An der Peripherie des nazifizierten deutschen Hochschulsystems. Zur Geschichte der Universität Basel 1933–1945 [1. ed.] 9783796545146, 9783796545405
440 73 5MB
German Pages 878 [881] Year 2022
Polecaj historie
Table of contents :
Inhalt
1 Einführung
1.1 Störung in der Universität
1.2 Basler Universitätsgeschichte 1933–1945 in bisheriger Darstellung
1.3 Beobachtungen an der Geschichte anderer Schweizer Universitäten
1.4 Wandel in den Ansätzen der deutschen Universitätshistoriographie
1.5 Basler Politik und die Modernisierung der Universitätin den 1930er Jahren
1.6 Ziele und Vorgehen
2 Die Basler Studenten und Deutschland
2.1 Einleitung
2.2 Immatrikulierte an der Universität Basel
2.3 Die Veränderungen an deutschen Universitätenund in besetzten Gebieten
2.4 Neutrale und unpolitische Basler Universität
2.5 Studentische Organisationen in Basel. Ein Überblick
2.5.1 Die Basler Studentenschaft
2.5.2 Verbindungen
2.5.3 Andere Organisationen
2.5.4 Jüdische Studierende
2.5.5 Ephemere politische Gruppen
2.5.6 Die linken deutschen Studierenden
2.5.7 Die Marxistische Studentengruppe
2.5.8 Die nationalsozialistische Deutsche Studentenschaft
2.6 Die Zofingia als Beispiel für die Evolution studentischerpolitischer Auffassungen
2.6.1 Die Rede von der «Krise»
2.6.2 Vom Einfluss der Fronten zur ‚geistigen Landesverteidigung‘
2.6.3 Die Zofinger Studenten in der ‚geistigen Landesverteidigung‘
2.6.4 Neutralität, Pragmatismus und Zensur
2.6.5 Die Gleichschaltung der deutschen Universitäten, die Juden und Emigranten, die deutsche Besatzungspolitik
2.7 Schlussfolgerungen
3 Basel und die deutschen Universitätsjubiläender 1930er Jahre
3.1 Einleitung
3.2 Basler Reaktionen auf die Einladungen zumHeidelberger Universitätsjubiläum 1936
3.3 Die Basler Absage an Heidelberg und die Grussadresse
3.4 Die Durchführung des Heidelberger Jubiläumsfestes
3.5 Basel und Heidelberg, eine Zwischenbilanz
3.6 Eine Wiederholung mit Variationen: Die Einladung nach Göttingen 1937
3.7 Intermezzo: Die Lausanner 400-Jahrfeier aus deutscher Sicht
3.8 Die Göttinger Feier
3.9 Die Schweizer in Göttingen
3.10 Schlussfolgerungen
4 Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegenden Nationalsozialismus
4.1 Einleitung
4.2 Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
4.2.1 Systematische Theologie und Dogmatik
4.2.2 Kirchengeschichte
4.2.3 Altes Testament
4.2.4 Neues Testament
4.2.5 Praktische Theologie
4.2.6 Sprachen
4.2.7 Missionswissenschaft
4.3 Theologische Argumente gegen den Nationalsozialismus
4.3.1 Das Erste Gebot und die falschen Götter
4.3.2 Die Sorge um die Kirche/die Gemeinde
4.3.3 Das Verhältnis zur Obrigkeit, das Wächteramt der Kirche,die ‚rechte Obrigkeit‘ und der legitime gewaltsame Widerstand
4.3.4 Der staatliche Totalitarismus
4.3.5 Christliche Anthropologie
4.3.6 Die apokalyptische Endzeiterwartung (Antichrist) und die Eschatologie
4.3.7 Christen und Juden: Auserwähltes Volk, die Gemeinde («Kirche»), die «Nächsten» und Formen des Antisemitismus
4.4 Der Einsatz für Verfolgte und Flüchtlinge
4.5 Fazit – Elemente der Abwehr des Nationalsozialismus unddie Flüchtlingsfrage in der Theologischen Fakultät
5 Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
5.1 Einleitung
5.2 Der Grundtenor in der Juristischen Fakultät
5.3 Einzelne Professoren
5.4 Deutsche Juristen in der Basler Fakultät
5.5 Fazit
5.6 Abweichung nach links: Arthur Baumgarten
5.7 Jacob Wackernagel – ein rechtsextremer Jurist?
Exkurs: Gustav Däniker, Jurist und Wehrwissenschaftler an der Universität Basel
6 Mediziner
6.1 Einleitung
6.2 Die Bedeutung Deutschlands für Ausbildung undwissenschaftliche Kommunikation
6.3 Überzeugte Nationalsozialisten als Mitglieder der Basler Medizinischen Fakultät
6.4 Deutsche Professoren als Opfer des Nationalsozialismus und die Basler Medizinische Fakultät
6.5 Jüdische Basler Professoren und jüdische Studierende aus Deutschland
7 Geisteswissenschaftler
7.1 Philosophen
7.1.1 Einleitung
7.1.2 Paul Häberlin
7.1.3 Herman Schmalenbach
7.1.4 Heinrich Barth
7.1.5 Ergebnisse
7.2 Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
7.2.1 Einleitung
7.2.2 Klassische Philologen, Althistoriker und Klassische Archäologen: Humanistische Altertumswissenschaften
7.2.2.1 Einleitung
7.2.2.2 Altertumswissenschaften in Deutschland nach 1918
7.2.2.3 Matthias Gelzer – ein Schweizer in Frankfurt
7.2.2.4 Peter von der Mühll
7.2.2.5 Karl Meuli
7.2.2.6 Harald Fuchs
7.2.2.7 Die Alte Geschichte – von Felix Stähelin zu Bernhard Wyss
7.2.2.8 Die Klassischen Archäologen – von Ernst Pfuhl zu Arnold von Salis und Karl Schefold
7.2.2.9 Sprachwissenschaft
7.2.2.10 Ergebnis: Humanismus als Grundlage für Resistenz
7.2.3 Germanisten und Germanen
7.2.3.1 Einleitung
7.2.3.2 Altgermanisten
7.2.3.3 Vertreter der Neueren deutschen Literatur
7.2.3.4 Ergebnisse
7.2.4 Romanisten
7.2.4.1 Einleitung
7.2.4.2 Die Vertretung des Italienischen: Arminio Janner, ein Tessiner Patriot
7.2.4.3 Spanisch: Lektorate, Ehrendozentur und ein Versuch, einen Franco-Gegner nach Basel zu holen
7.2.4.4 Albert Béguin – der Frankophile unter den Basler Professoren
7.2.4.4.1 Einleitung
7.2.4.4.2 Béguin und Deutschland
7.2.4.4.3 Béguin und Frankreich
7.2.4.4.4 Die Wahl zum Basler Professor
7.2.4.4.5 Albert Béguin in Basel
7.2.4.4.6 Ergebnis
7.2.4.5 Walther von Wartburg – ein germanophiler Romanist
7.2.4.5.1 Einleitung
7.2.4.5.2 Konstanten im Lebenslauf
7.2.4.5.3 Schweizer Germanophilie
7.2.4.5.4 Geschichtsbild
7.2.4.5.5 Volk, Rasse, Raum, «Lingua Tertii Imperii»
7.2.4.5.6 Publizieren in Deutschland
7.2.4.5.7 Patriotismus und das Bild der Schweiz
7.2.4.5.8 Von Wartburgs Agenda – Zwischenbilanz
7.2.4.5.9 Professor in Leipzig und Verhältnis zum Nationalsozialismus
7.2.4.5.10 Berufung nach Basel
7.2.4.5.11 Nach der Wahl
7.2.4.5.12 Ergebnis
7.2.5 Englische Sprache und Literatur
7.2.5.1 Henry Lüdeke, ein Deutschamerikaner in Basel
7.2.5.2 Privatdozenten und Lektoren
7.2.6 Die Slawistin: Elsa Mahler
7.2.7 Orientalisten
7.3 Kunsthistoriker – Joseph Gantner: Letzter universalerKunsthistoriker
7.3.1 Einleitung
7.3.2 Aspekte der Laufbahn
7.3.3 Die Basler Wahl
7.3.4 Konstanz und Wandel
7.3.5 Die Gegnerschaft zum Nationalsozialismus
7.3.6 Ergebnis
7.4 Musikwissenschaftler
7.5 Historiker – Werner Kaegi: Kampf des Humanistenund Kulturhistorikers gegen den Ungeist
7.5.1 Einleitung
7.5.2 Kaegis Bildungsgang
7.5.3 Weltanschauliche Position des jungen Kaegi
7.5.4 Kaegi in Basel: Erasmus, Burckhardt und Renaissance
7.5.5 Emil Dürr und Kaegis Habilitation
7.5.6 Zwischenbilanz
7.5.7 Wahl zum Professor in Basel
7.5.8 Der Weg zur Ablehnung des Nationalsozialismus
7.5.9 Das Erasmusjahr 1936
7.5.10 Engagements im Rahmen der Professur
7.5.11 Kaegis Beziehungen zu Deutschland 1933 bis 1945
7.5.12 Ergebnisse
7.6 Ethnologie
7.7 Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen –Edgar Salin, vom «Mephistopheles» zum konservativen Antifaschisten
7.7.1 Einleitung
7.7.2 Erwartungen bei der Berufung nach Basel
7.7.3 Grundlagen von Salins Nationalökonomie
7.7.4 Verhältnis zur Schweiz und zur Demokratie
7.7.5 Salin in der Basler Wirtschaft und Politik
7.7.6 Fortgesetztes Engagement in Deutschland
7.7.7 Resultate: Salin in Basel 1933–1945
8 Die Naturwissenschaftler
8.1 Mathematik
8.2 Physik
8.2.1 Überblick
8.2.2 Angewandte Physik
8.2.3 Von der Spektralphysik zur Kernphysik
8.2.4 Ein deutscher Patriot als Mathematischer Physiker in Basel
8.2.5 Ergebnis
8.3 Astronomie
8.4 Chemie und Pharmazie
8.4.1 Einleitung
8.4.2 Pharmazie
8.4.3 Die Organische Chemie: Farbstoffe
8.4.4 Physikalische Chemie
8.4.5 Anorganische Chemie
8.4.6 Ergebnisse
8.5 Geologie, Mineralogie und Paläontologie
8.6 Ein Bewunderer Hitlers lehrt Geographie: Fritz Jaeger
8.7 Botanik
8.8 Zoologie – Adolf Portmanns Abwehr des Nationalsozialismus
8.8.1 Einleitung
8.8.2 Grenzen der Entwicklungsidee
8.8.3 Bildungsvoraussetzungen
8.8.4 Die Wahl auf die Basler Professur
8.8.5 Öffentliche Interventionen, die politisch interpretiert werden können
8.8.5.1 Vorlesungen
8.8.5.2 Vorträge
8.8.5.3 Erinnerungen
8.8.6 Portmanns originäre Position
8.8.7 Ergebnisse
9 Einsichten
9.1 Einleitung
9.2 Vorgeschichten
9.3 Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus bis ca. 1935
9.4 Zuspitzung ab 1935, Konflikte und Helvetisierung
9.5 Neutralität und Krieg
9.6 Übergreifende Resultate
10 Bibliographie
10.1 Unpublizierte Dokumente
10.2 Literatur und publizierte Quellentexte
11 Verzeichnis der Abkürzungen
12 Personenregister
Citation preview
STUDIEN ZUR GESCHICHTE DER WISSENSCHAFTEN IN BASEL NEUE FOLGE 11
IM AUFTRAG DES REKTORS DER UNIVERSITÄT BASEL HERAUSGEGEBEN VON HANS-PETER MATHYS UND RUDOLF WACHTER
CHRISTIAN SIMON
AN DER PERIPHERIE DES NAZIFIZIERTEN DEUTSCHEN HOCHSCHULSYSTEMS ZUR GESCHICHTE DER UNIVERSITÄT BASEL 1933 – 1945
SCHWABE VERLAG
Publiziert mit freundlicher Unterstützung der Freiwilligen Akademischen Gesellschaft Basel sowie des Rektorats der Universität Basel Gedruckt mit Unterstützung der Berta Hess-Cohn Stiftung, Basel
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. © 2022 Schwabe Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel, Schweiz Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Das Werk einschliesslich seiner Teile darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in keiner Form reproduziert oder elektronisch verarbeitet, vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden. Korrektorat: Ricarda Berthold, Freiburg i. Br. Gestaltungskonzept: icona basel gmbH, Basel Cover: Kathrin Strohschnieder, Zunder & Stroh, Oldenburg Layout: icona basel gmbh, Basel Satz: 3w+p, Rimpar Druck: Hubert & Co., Göttingen Printed in Germany ISBN Printausgabe 978-3-7965-4514-6 ISBN eBook (PDF) 978-3-7965-4540-5 DOI 10.24894/978-3-7965-4540-5 Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche. Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt. [email protected] www.schwabe.ch
Inhalt 1
2
Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Störung in der Universität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Basler Universitätsgeschichte 1933–1945 in bisheriger Darstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Beobachtungen an der Geschichte anderer Schweizer Universitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Wandel in den Ansätzen der deutschen Universitätshistoriographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Basler Politik und die Modernisierung der Universität in den 1930er Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 Ziele und Vorgehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 13
Die Basler Studenten und Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Immatrikulierte an der Universität Basel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Die Veränderungen an deutschen Universitäten und in besetzten Gebieten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Neutrale und unpolitische Basler Universität . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Studentische Organisationen in Basel. Ein Überblick . . . . . . . . . 2.5.1 Die Basler Studentenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2 Verbindungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.3 Andere Organisationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.4 Jüdische Studierende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.5 Ephemere politische Gruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.6 Die linken deutschen Studierenden . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.7 Die Marxistische Studentengruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.8 Die nationalsozialistische Deutsche Studentenschaft . . . 2.6 Die Zofingia als Beispiel für die Evolution studentischer politischer Auffassungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 Die Rede von der «Krise» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 49 50
15 18 36 39 44
52 56 57 57 60 62 64 66 68 69 72 74 75
6
Inhalt
2.7 3
4
2.6.2 Vom Einfluss der Fronten zur ‚geistigen Landesverteidigung‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 2.6.3 Die Zofinger Studenten in der ‚geistigen Landesverteidigung‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 2.6.4 Neutralität, Pragmatismus und Zensur . . . . . . . . . . . . . . 89 2.6.5 Die Gleichschaltung der deutschen Universitäten, die Juden und Emigranten, die deutsche Besatzungspolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Schlussfolgerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Basel und die deutschen Universitätsjubiläen der 1930er Jahre . . . . . . 3.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Basler Reaktionen auf die Einladungen zum Heidelberger Universitätsjubiläum 1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Die Basler Absage an Heidelberg und die Grussadresse . . . . . . . 3.4 Die Durchführung des Heidelberger Jubiläumsfestes . . . . . . . . . 3.5 Basel und Heidelberg, eine Zwischenbilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 Eine Wiederholung mit Variationen: Die Einladung nach Göttingen 1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7 Intermezzo: Die Lausanner 400-Jahrfeier aus deutscher Sicht . . 3.8 Die Göttinger Feier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9 Die Schweizer in Göttingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.10 Schlussfolgerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät . . . . . . . . . . 4.2.1 Systematische Theologie und Dogmatik . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Kirchengeschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Altes Testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4 Neues Testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.5 Praktische Theologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.6 Sprachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.7 Missionswissenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Theologische Argumente gegen den Nationalsozialismus . . . . .
107 107 110 112 118 121 123 126 130 133 136 139 139 142 143 155 165 169 178 180 181 186
Inhalt
4.3.1 Das Erste Gebot und die falschen Götter . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Die Sorge um die Kirche/die Gemeinde . . . . . . . . . . . . . . 4.3.3 Das Verhältnis zur Obrigkeit, das Wächteramt der Kirche, die ‚rechte Obrigkeit‘ und der legitime gewaltsame Widerstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.4 Der staatliche Totalitarismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.5 Christliche Anthropologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.6 Die apokalyptische Endzeiterwartung (Antichrist) und die Eschatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.7 Christen und Juden: Auserwähltes Volk, die Gemeinde («Kirche»), die «Nächsten» und Formen des Antisemitismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Der Einsatz für Verfolgte und Flüchtlinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fazit – Elemente der Abwehr des Nationalsozialismus und die Flüchtlingsfrage in der Theologischen Fakultät . . . . . . . . . . .
188 189
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Der Grundtenor in der Juristischen Fakultät . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Einzelne Professoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 Deutsche Juristen in der Basler Fakultät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6 Abweichung nach links: Arthur Baumgarten . . . . . . . . . . . . . . . 5.7 Jacob Wackernagel – ein rechtsextremer Jurist? . . . . . . . . . . . . . Exkurs: Gustav Däniker, Jurist und Wehrwissenschaftler an der Universität Basel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211 211 211 213 217 220 220 233
Mediziner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Die Bedeutung Deutschlands für Ausbildung und wissenschaftliche Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 Überzeugte Nationalsozialisten als Mitglieder der Basler Medizinischen Fakultät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4 Deutsche Professoren als Opfer des Nationalsozialismus und die Basler Medizinische Fakultät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5 Jüdische Basler Professoren und jüdische Studierende aus Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259 259
4.4 4.5
5
6
7
190 193 194 196
197 203 206
244
260 276 284 291
8
Inhalt
7
Geisteswissenschaftler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1 Philosophen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.2 Paul Häberlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.3 Herman Schmalenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.4 Heinrich Barth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.5 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker . . . . . . . . . . . . . . 7.2.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.2 Klassische Philologen, Althistoriker und Klassische Archäologen: Humanistische Altertumswissenschaften . 7.2.2.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.2.2 Altertumswissenschaften in Deutschland nach 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.2.3 Matthias Gelzer – ein Schweizer in Frankfurt . 7.2.2.4 Peter von der Mühll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.2.5 Karl Meuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.2.6 Harald Fuchs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.2.7 Die Alte Geschichte – von Felix Stähelin zu Bernhard Wyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.2.8 Die Klassischen Archäologen – von Ernst Pfuhl zu Arnold von Salis und Karl Schefold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.2.9 Sprachwissenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.2.10 Ergebnis: Humanismus als Grundlage für Resistenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.3 Germanisten und Germanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.3.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.3.2 Altgermanisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.3.3 Vertreter der Neueren deutschen Literatur . . . . 7.2.3.4 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.4 Romanisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.4.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.4.2 Die Vertretung des Italienischen: Arminio Janner, ein Tessiner Patriot . . . . . . . . . . . . . . . . .
297 297 297 298 302 309 314 315 315 317 317 319 325 331 337 341 347
349 363 365 369 369 372 393 406 409 409 410
Inhalt
7.3
7.4 7.5
7.2.4.3 Spanisch: Lektorate, Ehrendozentur und ein Versuch, einen Franco-Gegner nach Basel zu holen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.4.4 Albert Béguin – der Frankophile unter den Basler Professoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.4.5 Walther von Wartburg – ein germanophiler Romanist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.5 Englische Sprache und Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.5.1 Henry Lüdeke, ein Deutschamerikaner in Basel 7.2.5.2 Privatdozenten und Lektoren . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.6 Die Slawistin: Elsa Mahler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.7 Orientalisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kunsthistoriker – Joseph Gantner: Letzter universaler Kunsthistoriker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.2 Aspekte der Laufbahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.3 Die Basler Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.4 Konstanz und Wandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.5 Die Gegnerschaft zum Nationalsozialismus . . . . . . . . . . . 7.3.6 Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Musikwissenschaftler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Historiker – Werner Kaegi: Kampf des Humanisten und Kulturhistorikers gegen den Ungeist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.2 Kaegis Bildungsgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.3 Weltanschauliche Position des jungen Kaegi . . . . . . . . . . 7.5.4 Kaegi in Basel: Erasmus, Burckhardt und Renaissance . 7.5.5 Emil Dürr und Kaegis Habilitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.6 Zwischenbilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.7 Wahl zum Professor in Basel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.8 Der Weg zur Ablehnung des Nationalsozialismus . . . . . 7.5.9 Das Erasmusjahr 1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.10 Engagements im Rahmen der Professur . . . . . . . . . . . . . . 7.5.11 Kaegis Beziehungen zu Deutschland 1933 bis 1945 . . . . 7.5.12 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
414 415 440 476 476 477 478 481 484 484 489 500 508 511 516 518 521 521 524 530 533 537 540 542 549 552 558 573 578
10
Inhalt
Ethnologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen – Edgar Salin, vom «Mephistopheles» zum konservativen Antifaschisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.7.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.7.2 Erwartungen bei der Berufung nach Basel . . . . . . . . . . . . 7.7.3 Grundlagen von Salins Nationalökonomie . . . . . . . . . . . 7.7.4 Verhältnis zur Schweiz und zur Demokratie . . . . . . . . . . 7.7.5 Salin in der Basler Wirtschaft und Politik . . . . . . . . . . . . 7.7.6 Fortgesetztes Engagement in Deutschland . . . . . . . . . . . . 7.7.7 Resultate: Salin in Basel 1933–1945 . . . . . . . . . . . . . . . . .
579
Die Naturwissenschaftler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1 Mathematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Physik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1 Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.2 Angewandte Physik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.3 Von der Spektralphysik zur Kernphysik . . . . . . . . . . . . . . 8.2.4 Ein deutscher Patriot als Mathematischer Physiker in Basel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.5 Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3 Astronomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4 Chemie und Pharmazie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4.2 Pharmazie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4.3 Die Organische Chemie: Farbstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4.4 Physikalische Chemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4.5 Anorganische Chemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4.6 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5 Geologie, Mineralogie und Paläontologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.6 Ein Bewunderer Hitlers lehrt Geographie: Fritz Jaeger . . . . . . . 8.7 Botanik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8 Zoologie – Adolf Portmanns Abwehr des Nationalsozialismus . 8.8.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8.2 Grenzen der Entwicklungsidee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
627 627 630 630 631 631
7.6 7.7
8
588 588 594 597 600 610 615 624
637 640 641 642 642 643 651 653 660 671 672 677 688 692 692 694
Inhalt
11
8.8.3 Bildungsvoraussetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8.4 Die Wahl auf die Basler Professur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8.5 Öffentliche Interventionen, die politisch interpretiert werden können . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8.5.1 Vorlesungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8.5.2 Vorträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8.5.3 Erinnerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8.6 Portmanns originäre Position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8.7 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
697 704
9
Einsichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Vorgeschichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3 Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus bis ca. 1935 . 9.4 Zuspitzung ab 1935, Konflikte und Helvetisierung . . . . . . . . . . . 9.5 Neutralität und Krieg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6 Übergreifende Resultate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
729 729 732 734 741 748 752
10
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 10.1 Unpublizierte Dokumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 10.2 Literatur und publizierte Quellentexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768
11
Verzeichnis der Abkürzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851
12
Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853
707 708 714 722 723 726
1 Einführung 1.1 Störung in der Universität Wie wirkte sich die Nähe zu Deutschland und zu den dortigen Umwälzungen auf die Universität Basel in den Jahren 1933 bis 1945 aus?1 Die Präsenz Deutscher an der Universität, aber auch die engen Beziehungen der Dozierenden und Studierenden mit Schweizer Herkunft zu Deutschland boten die Voraussetzung für einen intensiven Austausch, der diese Frage relevant macht. Das Verhältnis der Universität Basel zu den deutschen Hochschulen war sehr eng; es ist zu fragen, wie es sich unter dem Einfluss der Veränderungen in Deutschland wandelte. Zudem studierten seit dem Frühjahr 1933 akademische Flüchtlinge an der Basler Universität oder bewarben sich darum, hier zu lehren und zu forschen. A priori möchte man annehmen, dass die Universität damals ein Ort der wissenschaftlichen Beschäftigung auch mit der Gegenwart war – wie wurde der Nationalsozialismus verstanden und analysiert? Wer fand ihn attraktiv, wer lehnte ihn ab, aus welchen Ursachen und in welchen Aspekten? Einige Basler Skandale aus jener Zeit sind schon länger bekannt. So wurde die Affäre um den deutschen Pathologen Werner Gerlach,2 der 1936 wegen nationalsozialistischen Umtrieben als Basler Ordinarius hätte entlassen werden sollen, mehrfach dargestellt.3 Waren solche Vorkommnisse die Spitze eines Eisbergs und damit Hinweise auf eine im Verborgenen nazifizierte Universität oder handelte es sich um Einzelfälle? Was in diesem Buch unter ‚Universität‘ verstanden wird und inwiefern die Nazifizierung der deutschen Universitäten darin zu Störungen führte, soll eingangs skizziert werden. Universitäten waren im Untersuchungszeitraum Institutionen, die unter verschiedenen Aspekten behandelt werden können. Ein Aussenaspekt war die Relation zur lokalen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik (die ‚Akademie in der Polis‘ oder ‚in der Cité‘). Eine Universität der klassischen Moderne war eine staatlich geführte und in ihren Grundstrukturen auch staatlich (öffentlich) finanzierte Anstalt der höheren Bildung. Als solche diente sie der Berufsbefähigung für Kader in verschiedenen Sektoren der Wirtschaft und der öffentlichen Dienste: Gesundheitswesen, Schulwesen, Administration und Dienstleistungsbetriebe, Rechtspflege, produzierende und forschende Industrie, 1 2 3
Siehe die Pionierarbeit von Zwicker 1991. Die Lebensdaten zu den erwähnten Personen siehe im Register der Eigennamen am Schluss des Buches. Z. B. in: Tréfás 2009, 125 ff.; Stirnimann 1988, 176 ff.; Rintelen 1980, 319 f.; Trinkler 1973; Bonjour 1960, 590 f.
14
Einführung
Finanzwesen und Banken, protestantische Kirche, Journalismus usw. Unter diesem Aspekt wurde angenommen, dass die öffentlichen Gelder in der Universität gut investiert waren – die Überzeugung, dass entsprechende Funktionen auch erfüllt würden, bildete Vertrauenskapital, das ins Spiel gebracht werden musste, wenn die Volksvertreter den Ausgaben für die Universität mit einer gewissen Verlässlichkeit zustimmen sollten. Ferner wünschte ein Teil des Basler Publikums eine Universität mit kultureller Ausstrahlung und einer überregionalen Geltung, auf die es stolz sein konnte. Dies war eine republikanische Spielart des Mäzenatentums: Die geförderte öffentliche Institution sollte ihren Glanz zurückstrahlen auf den Mäzen und durch ihre Geltung seinen Ruhm mehren. Zeitgenössisch gesprochen war dies der ‚Ruf‘ oder das ‚Ansehen‘ der Institution. All das verlief nicht immer harmonisch, sondern gelegentlich im Konfliktmodus. Von innen gesehen stellte sich die Universität als soziale Struktur dar, die nach bestimmten Regeln funktionierte. Diese sollten eine Kooperation oder mindestens eine gegenseitige Duldung ganz unterschiedlicher Charaktere ermöglichen. Gemeinsam befolgte Regeln und respektierte Werte sowie Höflichkeit schufen dafür die Voraussetzung. Diese wurden durch Sozialisation in einem überregionalen Netz von Universitäten erworben, die im Verlauf der Ausbildung besucht wurden und denen sich die Professorenschaft lebenslang verbunden fühlte. Die ritualisierte Erinnerung an die Studentenzeit im Verbindungswesen und die Verwurzelung in jeweiligen Fachtraditionen, die durch wissenschaftliche Gesellschaften und Tagungen laufend aufgefrischt wurden, trugen in den Dimensionen ‚Fach‘ und ‚Universität‘ zur akademischen Kultur bei. Die Idee, die Universität sei eine Körperschaft, die nach eigenen Regeln lebe, Anspruch auf Respektierung einer ‚Autonomie‘ habe und in Verbindung mit anderen Universitäten (als Schwesterinstitutionen) existiere, verdeutlicht dies. Auch hier sollte nicht Harmonie erwartet werden, denn der Konfliktmodus war zeitweise geradezu vorherrschend. Der Innenaspekt in seiner Verschränkung mit den Schwesterinstitutionen (unter denen damals in erster Linie deutsche Hochschulen zu verstehen waren) hilft die Störung zu verstehen, die die Nazifizierung der deutschen ‚Schwestern‘ gerade im Aussenaspekt bewirkte. Wenn die akademische Korporation darauf insistierte, mit ihren nazifizierten ‚Schwestern‘ weiterhin vernetzt zu bleiben, während sich die Überzeugung in der lokalen Öffentlichkeit durchsetzte, das nazifizierte Deutschland stelle eine Bedrohung der eigenen Politik, Gesellschaft und Kultur dar, darf man wohl erwarten, dass der ‚Ruf‘ der lokalen Universität beschädigt zu werden drohte. Eine ‚nazifreundliche‘ Universität zu unterhalten war ein demokratisch-schweizerisches Gemeinwesen nicht bereit, denn eine solche konnte die Bildungserwartungen nicht mehr umfassend erfüllen. Somit fragte es sich, wie Universität und lokale politisch-kulturelle Stimmung in der Öffentlichkeit wieder ‚in Phase‘ gebracht werden konnten. Gemäss Verfassung war dies die Aufgabe der Regierung und ihrer Beratungsgremien. Nun standen die Regie-
Basler Universitätsgeschichte 1933–1945 in bisheriger Darstellung
15
rungsstellen damals in Basel ‚links‘, während die Universität ‚bürgerlich‘ aufgestellt war. Daraus resultierte ein Konfliktpotential: Eingriffe der Behörden in die Universität, um diese ‚in Phase‘ zur Öffentlichkeit zu bringen, konnten von ‚rechts‘ als Missachtung der ‚Autonomie‘ der Universität getadelt werden, und die bürgerliche Öffentlichkeit sah sich trotz ihrer Ablehnung des Nazismus zur Verteidigung der universitären Sonderstellung aufgerufen, ja sie verglich die politischen Eingriffe zur Erhaltung ihres ‚Rufes‘ mit der Gleichschaltung der deutschen Hochschulen. Die internen Störungen waren komplexer gelagert. Kollegialität war Voraussetzung für das geziemende Verhalten unter Professoren. Was aber war unter Kollegen zu tun, wenn einige davon sich nicht nur privat zum Nazismus bekannten, sondern sich auch aktiv in Gesellschaft und Politik in dieser Art betätigten? Solange die Betreffenden die akademischen Regeln befolgten (gute Lehrer, gute Forscher, gute Kollegen innerhalb der Universität zu sein), waren der Professorenschaft die Hände gebunden, zumal nach der vorherrschenden Überzeugung Politik von Wissenschaft streng zu trennen war. Und wie sollte sie handeln, wenn die in Deutschland gelegenen Teile des fachlichen Netzwerks als Elemente des nazistischen Bildungs- und Propagandasystems instrumentalisiert wurden? Wenn die befreundeten Herausgebergremien und Verlage von Zeitschriften, die Vorstände von Fachgesellschaften, in denen man Mitglied war, gleichgeschaltet wurden, wenn die Fachtagungen in Gegenwart von SA-Uniformierten stattfanden und von Parteigrössen eröffnet wurden, die eine politisierte (Un⌥)Wissenschaft einforderten? Boykott war in der akademischen Kultur nicht vorgesehen, denn Wissenschaft lebte von kollegialem Austausch, und diesen ermöglichten damals in den meisten Fächern nur deutsche Agenturen auf dem gebotenen Niveau. Basel war im Verhältnis dazu eine Peripherie, und die akademischen Regeln sprachen gegen eine Provinzialisierung durch Abnabelung von Deutschland. Hielt die Universität jedoch die herkömmlichen akademischen Beziehungen aufrecht, litt ihr ‚Ruf‘ in der eigenen ‚Cité‘ Schaden.
1.2 Basler Universitätsgeschichte 1933–1945 in bisheriger Darstellung Ausgangspunkt jeder Beschäftigung mit der Basler Universitätsgeschichte ist das umfangreiche Buch von Edgar Bonjour, das zum Jubiläum 1960 erschien. Bonjour war selbst seit seiner Wahl nach Basel 1935 ein profilierter Akteur in jener Epoche gewesen, und viele seiner Zeitgenossen waren 1960 noch im Amt. Er erwähnte darum herausragende Kollegen wie z. B. Karl Barth4 mit nur ganz wenigen Worten. Zudem hatte er die Tendenz, die Universität als eine harmonische Körperschaft darzustellen, die sich (wie der Autor selbst) in der ‚geistigen Lan4
Bonjour 1960, 508.
16
Einführung
desverteidigung‘5 für eine helvetische Abwehr des Nationalsozialismus einsetzte, für Verfolgte eintrat und die Jahre von 1933 bis 1945 insgesamt mit Anstand bewältigte. Auf einige wenige Erscheinungen, die nicht in dieses Bild passten, wies er in der Absicht hin, sie als Ausnahmen erscheinen zu lassen, um die ‚Immunität‘ oder ‚Resistenz‘6 der Universität gegen die totalitären Ideologien im Ganzen um so heller zu zeichnen. So erwähnte er einige Fälle von Basler Professoren, die wegen nationalsozialistischer Aktivitäten oder wegen öffentlich geäusserter nationalsozialistischer Gesinnung ihres Amtes enthoben wurden. Diese Behandlung erfuhr der bereits erwähnte Pathologe Gerlach, wobei Bonjour das Vorgehen der Regierung mit einem Wortbruch Gerlachs moralisch legitimierte.7 Die Fälle des Geographen Fritz Jaeger und des Mathematischen Physikers Wilhelm Matthies registrierte Bonjour.8 Seine Wortwahl (die bei Bonjour als sehr bewusst gepflegt verstanden werden darf) suggeriert, dass er hier von der Weisheit der Regierung nicht ganz überzeugt war.9 Auffällig ist ferner, dass er der Frage nach der Aufnahme von Flüchtlingen im Lehrkörper der Universität Basel auswich. So begründete er die Wahl von Karl Ludwig Schmidt auf den Lehrstuhl für Neues Testament (1935) damit, dass keine geeigneten Schweizer verfügbar waren – dabei schätzte Bonjour Schmidt ganz offensichtlich hoch und wusste, dass er Bonn 1933 gezwungenermassen verlassen hatte, weil man ihm dort «kein rückhaltloses Eintreten für den nationalsozialistischen Staat zutraute».10 Dass der Rechtsphilosoph Arthur Baumgarten 1933 aus Frankfurt am Main wegen seiner Opposition gegen die Nationalsozialisten nach Basel zurückkam, verzeichnete er ohne Hinweis auf den Grund.11 Die Ankunft des Berliner Juristen Hans Lewald 1935 berichtete er unkommentiert.12 Hans von Baeyer verlor in Heidelberg 1933 seine orthopädische Professur aus ‚rassischen‘ Gründen. Gegen Widerstände wählte ihn der Regierungsrat nach Basel, wo er jedoch keine Wirkungsstätte fand und schliesslich auf die Professur verzichtete. Dies stellte Bonjour als verpasste Gelegenheit dar, eine moderne Orthopädie in Basel zu etablieren, ohne auf die Benachteiligung von Baeyers in Deutschland einzugehen.13 Bonjour erwähnte auch 5 6
7 8 9 10 11 12 13
Mooser 1997. Ich verwende die Worte ‚Immunität‘ und ‚Resistenz‘ im Sinne von: Der Nationalsozialismus war für jemanden nicht attraktiv, und er widerstand einer Beeinflussung durch ideologische Momente dieser ‚Bewegung‘ aufgrund einer kritischen Haltung. ‚Widerstand‘ ist demgegenüber die Summe von konkreten Handlungen, die dem Nationalsozialismus aktiv entgegengestellt werden, von explizitem Widerspruch bis zur direkten Bekämpfung. Bonjour 1960, 590. Bonjour 1960, 743 zu Matthies, 762 zu Jaeger. Bonjour 1960, 787. Bonjour 1960, 513. Bonjour 1960, 568. Bonjour 1960, 565. Bonjour 1960, 603.
Basler Universitätsgeschichte 1933–1945 in bisheriger Darstellung
17
nicht, dass die Wahl gewisser Professoren aus Deutschland nach 1937 damit zusammenhing, dass diese ihre Stellen verloren hatten, weil sie mit «nichtarischen» Gattinnen verheiratet waren, wie diejenige des Germanisten Friedrich Ranke14 und des Pädiaters Ernst Freudenberg.15 Den 1940 gescheiterten Versuch, dem aus Wien geflohenen Hermann Franz Mark den Lehrstuhl für Anorganische Chemie zu übergeben, strich Bonjour aus der Chronologie.16 Aktionen für Hilfsbedürftige erwähnte Bonjour als caritative Akte, in denen die Universität oder die Studentenschaft als Handelnde auftraten. Die vorsichtige Resolution für die 1943 in Oslo von der deutschen Besatzungsmacht unterdrückten Studierenden und Lehrenden rühmte er als Bekundung des Mitgefühls. Aus der Rede des Rektors zu diesem Anlass zitierte er den Satz, dass Angriffe auf die geistige Freiheit und Menschenwürde in der Schweiz auf den «entschlossensten Widerstand» stossen würden – eine wichtige Formulierung, die aber in der publizierten Resolution nicht vorkam.17 Eindeutig ist, dass Bonjour den Nationalsozialismus dezidiert ablehnte.18 Darüber hinaus schätzte er den tatkräftigen Einsatz von Kollegen aufseiten des Widerstands, vor allem wenn er auf christliche Motive zurückging, sehr, wie seine ungewöhnliche Würdigung des Romanisten Albert Béguin zeigt.19 Ähnlich lobte er den Philosophen Herman Schmalenbach ausführlich: «In schwerer Zeit äusserer Bedrängnisse schloss dieser späte Vertreter des deutschen Humanismus keinen Kompromiss mit der totalitären, nationalsozialistischen Betrachtungsweise, sondern hielt den besten Überlieferungen des deutschen Geistes, einer freien Humanität, die Treue […].»20 Der historische Beitrag zum Universitätsjubiläum 1460–201021 widmete der Zeit von 1933 bis 1945 eine gewisse Aufmerksamkeit. Im Abschnitt über «Universität und Weltkriege» stand die Wahl von Edgar Bonjour und Werner Kaegi 1935 als Beispiel dafür im Mittelpunkt, dass damals nur noch Schweizer wählbar zu sein schienen. Über die Stichwortsuche gelangt man zu Informationen über Karl Barth. Man liest in einem Abschnitt über die Basler Nationalökonomen, dass Hans Ritschl «nicht ohne Sympathien für den Nationalsozialismus» gewesen sei, und in der Darstellung der Marxistischen Studentengruppe erfährt man auch von der Existenz der (nationalsozialistisch geführten) Deutschen Studentenschaft. In der Zusammenfassung der Rede, die der Rektor und Theologe Ernst 14 15 16 17 18 19 20 21
Bonjour 1960, 669. Bonjour 1960, 619. Bonjour 1960, 746 f. Vgl. Simon 2019. Bonjour 1960, 814. Bonjour 1984. Er hatte seine Studien in Berlin ergänzt, dessen kulturelles Milieu er gut kannte. Er verkehrte u. a. mit Ricarda Huch. Bonjour 1960, 675. Bonjour 1960, 714. 550 Jahre Universität Basel. unigeschichte.unibas.ch – das online-Projekt zu 550 Jahre Universität Basel. https://unigeschichte.unibas.ch/.
18
Einführung
Staehelin im Juni 1939 bei der Einweihung des neuen Kollegiengebäudes hielt, wurde erwähnt, dass er implizit wegen der Hitlerdiktatur eine an Gott gebundene Humanität als wesentliche Aufgabe der Basler Universität bestimmte.22 Die Konzeption dieses Internetauftritts, der vor allem schon bestehendes Wissen vermitteln sollte, wurde anscheinend von der Ansicht geleitet, die Universität Basel sei durch die Nazifizierung der deutschen Hochschulen nicht grundlegend erschüttert worden. Ähnlich suggerierte der Artikel über die Universität Basel im Historischen Lexikon der Schweiz von 2013, dass für diese Periode nicht mit besonders bemerkenswerten Ereignissen zu rechnen sei. Er enthielt jedoch den weiterführenden Hinweis auf die zum Teil bedeutenden Gelehrten, die zwischen 1933 und 1945 (sowie unmittelbar danach) für Basel gewonnen wurden.23 Die nützliche Übersicht von Stephan Schwarz über die nationalsozialistischen Professoren in der Schweiz verwies für die Geschichte Basels auf die Studie von Dávid Tréfás über die hiesigen Erfahrungen mit deutschen Dozenten im Längsschnitt.24 Das Studium der Basler Verhältnisse lohnt sich trotzdem für diejenigen, die ein Ärgernis in der Tatsache vermuten, dass diese Universität sich nicht (oder selten?) dezidiert zum Nationalsozialismus geäussert und dessen Opfer nicht energischer unterstützt habe.
1.3 Beobachtungen an der Geschichte anderer Schweizer Universitäten Bevor ich versuche, das bisher gezeichnete Bild zu verifizieren und zu erweitern, ist ein Blick darauf angebracht, was über die anderen Schweizer Universitäten aus der Zeit von 1933 bis 1945 bekannt ist. Schliesslich war Basel nicht nur ein Element im weiten Netz der deutschsprachigen Universitäten, sondern auch eine der Schweizer Hochschulen, deren Rektoren sich über gemeinsame Probleme austauschten und nach einer einheitlichen Haltung suchten. Die Darstellungen der Geschichte der übrigen Schweizer Hochschulen bilden einen ersten Leitfaden für die nachfolgenden Untersuchungen.
22
23 24
Stichwortsuche vom 14. 10. 2020 in: https://unigeschichte.unibas.ch/suche?tx_indexedsear ch_pi2%5Baction%5D=search&tx_indexedsearch_pi2%5Bcontroller%5D=Search&cHash=0 7a7970eed16826be82e89e873b0431f,. https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010971/2013-01-28/. Schwarz 2018; Tréfás 2009. Allgemeine Beobachtungen zur Geschichte der Interpretation des Nationalsozialismus in der Schweiz: Späti 2017.
Beobachtungen an der Geschichte anderer Schweizer Universitäten
19
a) Die Bindung an Deutschland Besonders für die Deutschschweizer Universitäten und für das zweisprachige Freiburg war die enge Bindung an den deutschen Wissenschaftsbetrieb offensichtlich. Für die französischsprachigen Schweizer Universitäten erschien diese nach dem Ersten Weltkrieg deshalb als weniger wirksam, weil die Darsteller nicht die Studienzeit der dortigen Professoren in Deutschland und nicht deren Integration in den deutschen fachwissenschaftlichen Betrieb herausarbeiteten, sondern die Nationalitäten der Professorenschaft zum Ausgangspunkt nahmen – nach diesem Kriterium zeigten sich die Institutionen des «enseignement supérieur» der Zwischenkriegszeit von Beginn an als sehr stark ‚helvetisiert‘, während sie gleichzeitig danach strebten, möglichst viele deutsche Studierende zu gewinnen, ungeachtet der politischen Veränderungen.25 Alle Westschweizer Universitäten hatten sich dem ‚deutschen Modell‘ der Universität verschrieben, einem weltweit bewunderten Ideal, das nach dem Ersten Weltkrieg auch ohne die Präsenz von Deutschen im Lehrkörper gelebt wurde. Merkmale dafür waren die Ablehnung einer Politisierung der Universität, der Wunsch nach einer Autonomie der Wissenschaft, die ‚neutrale‘ (nicht an eine Weltanschauung gebundene) Lehre und die Norm der rational-methodenbewussten, desinteressierten und voraussetzungslosen Forschung. Diese Ziele galten als Eigenheiten der ‚liberalen‘ Hochschule, wie sie im ausgehenden 19. Jahrhundert konstituiert worden war. Die Abhängigkeit von deutschen Universitäten zeigte sich allgemein darin, dass die Schweizer Hochschulen in Deutschland Anerkennung suchten. Diese wurde nach ihrer Überzeugung dadurch erwiesen, dass sie deutsche Professoren für ihren Lehrkörper zu gewinnen vermochten, dass einzelne Schweizer Hochschullehrer auch in Deutschland für Lehrstühle wählbar waren und dass es gelang, Studierende aus Deutschland anzuziehen, deren Semester (unter Umständen auch Prüfungen) an ihren deutschen Heimatuniversitäten angerechnet wurden.26 Die deutschfeindliche Haltung, die sich nach 1914 in der Westschweiz manifestierte,27 führte jedoch dazu, dass erst in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre wieder Studierende aus Deutschland an die dortigen Universitäten gelangten. Genf und Lausanne schufen vor allem in den Rechtswissenschaften die Voraussetzung dafür, indem sie Kurse in deutschem Recht anboten, die von deutschen Professoren in deutscher Sprache abgehalten wurden. Das Jahr 1933 bedeutete in dieser Beziehung keinen Einbruch, im Gegenteil blieb das Bestreben, möglichst viele deutsche Studierende anzuziehen, weiterhin ein Ziel. Die französischsprachigen Universitäten waren gegenüber nationalsozialistischen Umtrieben relativ tolerant, um diesen Zustrom nicht versiegen zu lassen. Von der Bestimmung, 25 26 27
Altermatt 2009, 37–39; Martin 1958, 114 f., 186. Bsp. Freiburg: Raab 1991, 300. Wisard 1998, 56.
20
Einführung
dass deutsche Studierende mindestens drei Semester im eigenen Land studiert haben mussten, bevor sie einen Auslandsaufenthalt beantragen konnten, erreichten Westschweizer Universitäten bei den deutschen Behörden für sich eine Ausnahme.28 Auch die in Deutschland seit 1936 verkürzte Ausbildungszeit wurde als gleichwertig mit dem bisherigen deutschen Bildungsgang akzeptiert.29 Die Westschweizer hofften, eine ‚unpolitische‘ oder ‚neutrale‘ Schweizer Universität könne die Präsenz deutscher Studierender auch nach 1933 fördern, ohne den akademischen Liberalismus zu verraten.30 Unterschiede zwischen den französischsprachigen und den deutschsprachigen Universitäten der Schweiz bestanden darin, dass erstere in der Zwischenkriegszeit weniger Wert auf die Anstellung deutscher Professoren legten, bei Ehrungen deutsche Kollegen berücksichtigten, die gerade keine Repräsentanten des NS-Regimes waren,31 und vor allem das Ziel der Gewinnung deutscher Studierender energisch weiterverfolgten. In den Fakultäten der deutschsprachigen Schweizer Universitäten blieb das Bestreben, deutsche Kollegen als die jeweils Besten ihres Faches zu rekrutieren, in der ganzen Periode deutlich ausgeprägt, wurde aber von ‚aussen‘ und von ‚oben‘, d. h. von den Kantonsregierungen, seit der Mitte der 1930er Jahre gebremst – darauf komme ich noch zurück. Vieles deutet darauf hin, dass die Schweizer Universitäten eine ‚Peripherie‘ zu den deutschen ‚Zentren‘ darstellten. Damit ist nicht eine einseitige, sklavische Abhängigkeit gemeint, vielmehr eine Art Beziehung, aus der beide Seiten einen Gewinn zogen, wenn dieser auch asymmetrisch verteilt war. Diese Abhängigkeit bedeutete zweierlei. (1) In Deutschland wurden die Normen gesetzt, nach denen sich auch die Schweizer Akademiker zu richten hatten, und die deutschen Zentren konnten (informell) darüber befinden, ob die Schweizer ‚Peripherie‘ im deutschen akademischen Sprachraum als gleichwertig akzeptiert zu werden verdiente. Zudem war es wichtig, dass die Schweizer Akademiker wenigstens einen Teil ihrer Bildung direkt in Deutschland bezogen. Die so entstandene Bindung wurde durch die Zugehörigkeit zu deutschen Fachvereinen und persönliche Beziehungen zu ehemaligen Studienkollegen und Lehrern perpetuiert. Von der ‚Peripherie‘ her erwünscht waren ‚Belohnungen‘ durch Einladungen zu Vorträgen, Herausgeberschaft wichtiger Zeitschriften, Akademiemitgliedschaften, Wissen-
28
29 30 31
Documents diplomatiques 1994, vol. 12, 1062–1064. Diese Ausnahme wurde von den deutschen Behörden im September 1938 zugestanden, aber dazu benutzt, überzeugte Nationalsozialisten für das Studium in der Schweiz zu rekrutieren. Martin 1958, 186. Wisard 1998, 357 f. Bei der Genfer 375-Jahrfeier (Juni 1934) wurden Ehrendoktorate erteilt. Der einzige Deutsche, der eine solche Ehrung erhielt, war Friedrich von Müller, Internist, einer der Begründer des modernen Klinikwesens, seit 1927 Präsident der Deutschen Akademie, 1934 zum Rücktritt gezwungen. Martin 1958, 152.
Beobachtungen an der Geschichte anderer Schweizer Universitäten
21
schaftspreise etc. im ‚reward system of science‘.32 (2) Nur in den ‚Zentren‘ waren auch materielle Voraussetzungen für ‚gute Wissenschaft‘ gegeben. Dies betraf (neben der personellen und apparativen Ausstattung) vor allem die Kommunikationsstrukturen der einzelnen Fächer. Allein die deutsche Verlagsindustrie hatte genügend Renommee und ausreichende Mittel, um die fachliche Kommunikation sicherzustellen. Darum waren die Akademiker an der ‚Peripherie‘ darauf angewiesen, in deutschen Verlagen zu publizieren und ihre Artikel in deutschen Fachzeitschriften unterzubringen.33 In den meisten Fächern war das Stellenangebot in Deutschland unvergleichlich viel grösser als in der Schweiz, sie verfügten über eigene Institute mit reichen Bibliotheksbeständen, Assistentenstellen und hatten Zugriff auf Fördermittel für die Forschung. Für einige Fächer (wie zum Beispiel für die Althistorie) gab es nur in Deutschland ‚ordentliche Professuren‘ oder Lehrstühle. Materielle Interessen (die Sicherung der fachlichen Arbeitsmöglichkeiten) und Karrieremöglichkeiten wiesen somit in dieselbe Richtung wie die Orientierung an den Normen ‚guter Wissenschaft‘ nach dem deutschen liberalen Modell. Ich werde untersuchen, welche Folgen die Nazifizierung der ‚Zentren‘ für dieses Abhängigkeitsverhältnis hatte. Einen Testfall stellen die Einladungen dar, die die Universität Heidelberg zu ihrem 1936 gefeierten Jubiläum an schweizerische Universitäten richtete. Die Reaktionen in der Schweiz zeigen den Stand des Bewusstseins, was die Nazifizierung der deutschen Hochschulen bedeutete, sie hingen aber auch damit zusammen, wie stark die eingeladenen Universitäten von den Kantonsregierungen als öffentliche Bildungsanstalten oder als autonome akademische Einrichtungen betrachtet wurden. Die Zürcher Ordinarien waren zum Beispiel ganz selbstverständlich der Meinung, ihr Rektor solle nach Heidelberg delegiert werden. Die Regierung stellte sich auf den Standpunkt, dass die Universität darüber selbst entscheiden könne.34 Im Juni 1936 akzeptierte die Universität Genf die Einladung nach Heidelberg in der Annahme, dass die Beziehungen zwischen den Universitäten frei von politischen Konjunktureinflüssen sein sollten. Der Rektor erklärte, dass der Entscheid über die Repräsentation der Universität nach aussen in den Bereich der Hochschulautonomie gehöre. Er besuchte jedoch nicht nur Heidelberg, sondern nahm auch an der 300-Jahrfeier der Universität Utrecht teil, womit er die politische Unabhängigkeit der Genfer Hochschule bezeugen wollte.35 In Lausanne zögerte die Commission universitaire, da sie wusste, dass die meisten englischen Universitäten die Einladung ablehnten. Doch Zürich, Bern und Genf hatten sich bereits auf eine Teilnahme festgelegt, und die Commission befürchtete, dass es im Falle einer Ablehnung die deutschen Studierenden nicht mehr nach Lausanne, 32 33 34 35
Vgl. Paul-Hus u. a. 2017. Zum Schweizer Verlagswesen und Buchhandel: Dahinden 1987. Stadler 1983a, 58. Martin 1958, 156.
22
Einführung
sondern vermehrt nach Genf ziehen würde. Die Universität machte jedoch deutlich, dass sie von den neuen Verhältnissen in Deutschland nicht restlos begeistert war, indem sie nicht den Rektor, sondern einen Stellvertreter delegierte.36 Es wird sich also lohnen zu untersuchen, wie in Basel mit der Einladung nach Heidelberg verfahren wurde. b) Die politische Stellung der Studierenden zum Nationalsozialismus An den meisten Schweizer Universitäten hatten schon vor 1933 politisch aktive Gruppen von Studierenden mit antiliberalen und antidemokratischen Positionen auf die «Krise» der Zeit reagiert. Nach 1935 schwenkten sie auf die Landesverteidigung ein und wollten während des Krieges Neutralität praktizieren. Gegen Kriegsende schlugen sie einen antikommunistischen Kurs ein. Was das für ihr Verhältnis zu Deutschland bedeutete, wird zu untersuchen sein. Peter Stadler hat am Beispiel der Universität Zürich festgestellt: «Die akademische Jugend begann um 1930 in zunehmendem Masse ‚rechts‘ zu denken.»37 Die Anfänge des deutschschweizerischen Frontismus waren eng mit der studentischen Bewegung in Zürich verbunden.38 Schon 1935/36 war jedoch ‚Neutralität‘ der Grundsatz der Zürcher Studierenden. Im Herbst 1938 war der Kleine Studentenrat deshalb nicht zu einer Stellungnahme gegen die Nazipogrome zu bewegen. Im «Zürcher Student» erschien bis 1945 nie ein Beitrag über den Antisemitismus.39 Wie an anderen Universitäten wurde im Organ der Berner Studentenschaft schon vor 1933 der Korporatismus40 als die Alternative zum Liberalismus gelobt. Hier wie anderswo gab es Auseinandersetzungen um die Zeitungen und Zeitschriften, die im Lesesaal aufliegen sollten; im Februar 1933 wurde gefordert, dass der «Völkische Beobachter» greifbar sein solle.41 Die Berner Hochschulgruppe der Nationalen Front nutzte die Präsenz von aus Deutschland geflohenen Studenten, um einen Protest gegen die zugewanderten Juden in der Medizinischen Fakultät zu inszenieren. Daraufhin beschlossen die Behörden einen Numerus Clausus.42 Der Führer dieser Gruppe, Ubald von Roll, denunzierte im November 1933 den Anatomen Hans Bluntschli bei der Erziehungsdirektion, weil er der
36 37 38 39 40 41 42
Wisard 1998, 220 f. Stadler 1983a, 47. Stadler 1983a, 48; Stadler 1983, 197. Stadler 1983, 198. Zur Bedeutung korporativer Ideen in der Schweiz: Tanner 2015, 221 ff. Totti o. J., 4 f., 8 f. Totti o. J., 38–42.
Beobachtungen an der Geschichte anderer Schweizer Universitäten
23
Liga für Menschenrechte angehöre und Freimaurer sei.43 Im Zusammenhang mit dem Berner Prozess um die Protokolle der Weisen von Zion erfüllte von Roll als Gauleiter der Nationalen Front Aufträge für den Erfurter «Weltdienst» und lieferte Informationen an die Stabsleitung der NSDAP in München.44 An der Generalversammlung der Berner Studentenschaft vom Februar 1936 erreichte die Hochschulgruppe der Nationalen Front die Annahme ihrer Resolution gegen den «Davosermord» (gemeint war die Ermordung Wilhelm Gustloffs, des Landesgruppenleiters der NSDAP-Auslandsorganisation in der Schweiz), wenn auch in abgemilderter Form.45 Der «Berner Student» liess einen Umschwung der Meinungen zugunsten vaterländischer, den Nationalsozialismus ablehnender Stimmen erst im Zusammenhang mit der ‚geistigen Landesverteidigung‘ 1937 (Hochschulwoche für geistige Wehrbereitschaft) erkennen.46 Besonders in Genf waren die Studierenden überzeugt, dass die Schweiz eine nationale Erneuerung brauche. Die Gruppe Les Équipes kritisierte an der Universität die «vaterlandslose», «neutrale» und rationale Wissenschaft nach dem Muster der Studenten- und Intellektuellenproteste in Frankreich.47 Sie verlangte seit 1933, dass die Universität zu moralischen und politischen Fragen Stellung beziehe und ihnen Richtlinien gebe. Die Professoren meinten wiederholt, dass dies die Preisgabe der Unabhängigkeit und Objektivität bedeute. William Rappard hielt zum Semesterbeginn im Herbst 1936 eine Rede über L’Université et les temps actuels. Er bestimmte gegen die Zeitströmungen die Universität als Ort der freien Forschung in der Anwendung strikter Methoden. Im Juni 1937 nutzte einer der beiden Studentensprecher am Dies academicus, der Theologe Alfred Werner, die Gelegenheit, um diesen Begriff von Universität anzugreifen. Der ihm zugrundeliegende Liberalismus sei bloss eine Ideologie, in deren Namen die Universität gegen andere Ideologien kämpfe. Man müsse Partei ergreifen; Toleranz sei legitim gegenüber Personen, aber nicht gegenüber Ideen, die entweder wahr oder falsch seien. Die Wissenschaft brauche ein Ziel, das über sie hinausweise auf die übernatürliche Ordnung, womit deutlich wurde, dass dieser Angriff, der in manchen Aspekten den damaligen Attacken der Nationalsozialisten gegen das Wissenschaftsverständnis liberaler Professoren glich, aus einer christlichen Überzeugung heraus geführt wurde.48 Wie an anderen Universitäten kam es auch in Genf zu Kontroversen um die Zeitungen und Zeitschriften, die im Lesesaal für die Stu-
43
44 45 46 47 48
Bluntschli, seit 1919 Professor für Anatomie und Entwicklungsgeschichte in Frankfurt, war im Oktober nach Bern gekommen, nachdem er Deutschland wegen regimekritischer Äusserungen hatte verlassen müssen. Totti o. J., 54. Totti o. J., 55–57. Totti o. J., 57 f. Totti o. J., 12. Marcacci 1987, 199. Martin 1958, 141 f., 156 f., 190 f.
24
Einführung
dierenden aufliegen sollten.49 Freiburger Beispiele zeigten, dass der rechte Flügel der Studenten noch 1940 lebendig war. Der Bund nationalsozialistischer Schweizerstudenten, vom deutschen Vizekonsul in Zürich unterstützt, stellte im Juni 1941 den Bundesparlamentariern ein Manifest zu, das von einem Freiburger Studenten unterzeichnet war. Verlangt wurde darin die Anpassung an das faschistisch beherrschte Europa, dann im Herbst die Aufgabe der Neutralität und die Unterzeichnung des Antikominternpakts.50 Es ist somit deutlich, dass die Studierenden eher zu rechten Positionen neigten, von der bestehenden Demokratie selten überzeugt und gegenüber dem Liberalismus auch in der Universität kritisch eingestellt waren. Die Voraussetzungen für eine frühe und grundsätzliche Ablehnung des Nationalsozialismus waren damit schlecht. Für Basel wird zu untersuchen sein, wie sich diese Tendenzen auswirkten und weshalb es nicht zu einer verbreiteten Bewunderung für die nationalsozialistische Herrschaft unter Studierenden kam. c) Die Deutschen Studentenschaften an Schweizer Universitäten Die Nationalsozialisten versuchten, die deutschen Studierenden an allen Schweizer Hochschulen zu erfassen und ihrer Kontrolle zu unterwerfen. Dazu wurden überall Deutsche Studentenschaften gegründet oder bestehende deutsche Landsmannschaften nazifiziert. Einige Universitäten lehnten es ab, diese Gruppierung als studentische Organisation anzuerkennen mit der Begründung, es handle sich um eine politische Vereinigung, die zudem nicht demokratisch verfasst sei. Andere anerkannten die Deutsche Studentenschaft weniger aus Sympathie als aufgrund der Überlegung, eine anerkannte Gruppe mit bekannten Mitgliedern liesse sich leichter kontrollieren, aber auch – im Einklang mit der Politik des Bundesrats – um das ‚Dritte Reich‘ nicht durch einen feindseligen Akt zu brüskieren. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement wusste, dass deutsche Studierende, die im Wintersemester 1933/34 an eine Auslandsuniversität gehen wollten, sich beim Auslandamt des NS-Studentenbunds zu melden hätten, «um in den Informationsdienst eingeschaltet zu werden» und im Ausland «aufklärend» über die deutschen Verhältnisse zu wirken.51 In Bern konstituierte sich im Juli 1933 ein entsprechender Verein deutscher Studenten. Das Rektorat stellte fest, dass Juden nicht explizit ausgeschlossen werden und sich diese Vereinigung nicht als politisch aktive nationalsozialistische Gruppe darstelle. Im November 1933 wurde die «Führertagung» der Deutschen Studentenschaft in Bern im Deutschen Heim abgehalten. Der dortige Germanist
49 50 51
Martin 1958, 144 zu 1934. Barthélemy 1991, 290; Raab 1991, 301. Totti o. J., 44–47.
Beobachtungen an der Geschichte anderer Schweizer Universitäten
25
Helmut de Boor sprach über «Die Aufgaben der deutschen Studenten im Ausland» und erklärte, er glaube «an die weltgeschichtliche und endgültige Bedeutung» der nationalsozialistischen «Wandlung», er ermahnte aber die deutschen Studenten, Geschichte und Tradition der Schweiz zu respektieren.52 In Genf wurden die deutschen Studenten in eine nationalsozialistische Organisation eingebunden, die das Hakenkreuz führte. Probleme ergaben sich daraus im Juni 1938, als sich die Deutsche Studentenschaft weigerte, weiterhin die Veranstaltungen des Lehrbeauftragten Louis Hamburger zu besuchen. Zwar erneuerte der Staatsrat den Lehrauftrag trotzdem, Hamburger fühlte sich jedoch zu wenig vor den Nationalsozialisten geschützt, verliess 1940 Genf und wanderte in die USA aus.53 Zu Beginn des Wintersemesters 1938/39 kritisierte Wolfgang Amadeus Liebeskind vor den deutschen Studierenden die Pervertierung des Rechts durch die Nationalsozialisten. Die organisierten Deutschen verliessen daraufhin den Saal. Die Universität weigerte sich, die Nationalsozialisten hinauszuwerfen, und berief sich auf die Tradition des «accueil» und auf ihre Interessen, die sie darin sah, eine möglichst grosse Anzahl deutscher Studierender zu behalten.54 Als zwei deutsche Genfer Studenten im April 1940 wegen Spionage verhaftet wurden, schloss das Unterrichtsdepartement der Kantonsregierung vorübergehend die Kurse für deutsche Rechtsstudenten.55 Im benachbarten Lausanne bildeten deutsche Studierende 1933 eine nationalsozialistische Vereinigung. Otto Riese, der einzige deutsche Professor in Lausanne, war ihr «Ehrenpräsident». Juden wurden nicht zugelassen. Die Commission universitaire hoffte, Otto Riese werde die Studenten mässigen, und akzeptierte unter dieser Voraussetzung die Statuten der Vereinigung.56 Als in Neuchâtel die deutschen Studierenden 1936 einen Verein zu gründen versuchten, verlangte das Rektorat die Abgabe einer Erklärung, dass sie sich unpolitisch verhielten.57 Während dieser Verein wahrscheinlich nie ins Leben trat, war in Freiburg die übliche Gründung einer Deutschen Studentenschaft im Sommer 1933 erfolgt. Der Senat blieb dauernd gespalten ob der Frage, wie damit umzugehen sei. Die konzilianten Professoren argumentierten mit der neuen Macht des Deutschen Reichs und mit dem Einfluss der Auslandsorganisation der NSDAP in der Schweiz.58 52 53
54 55 56 57 58
Totti o. J., 44–48. Ludwig (Louis) Hamburger hielt sich von 1940 bis 1968 in den USA auf und kehrte dann nach Tübingen zurück. Lehrbeauftragter in Genf war er von 1931 bis 1940. Es wurde überliefert, dass Hamburger durch die Deutsche Studentenschaft aus seiner Genfer Stelle vertrieben worden sei und deshalb nach den USA auswanderte. Grundmann/Riesenhuber 2007, 227; Fikentscher 1977, Bd. 5, 20 ff. Marcacci 1987, 195; Martin 1958, 143 f., 187. Martin 1958, 242. Wisard 1998, 217. Quadroni 2002, 317. Barthélemy 1991, 186, 188.
26
Einführung
Es wird interessant sein zu sehen, wie in Basel auf die Gründung einer nationalsozialistischen Studentenorganisation reagiert wurde. Vor allem Bern, aber auch Lausanne zeigte deutlich, wie sich Universitätsprofessoren dazu hergaben, dieser Organisation gewissermassen als Patenonkel beizustehen, innerhalb der Organisation für eine gewisse Mässigung zu wirken und nach aussen den Schein einer freundlich-friedlichen, landmannschaftlichen Studentenvereinigung zu wahren. Die Frage, die sich einer schweizerischen Universität stellte, betraf nicht nur die externe Beziehung zu Deutschland seit 1933, sondern berührte damit auch intern die Kollegialität unter Professoren. d) Nationalsozialistische deutsche Professoren an Schweizer Universitäten Einige patriotische deutsche Professoren an Schweizer Universitäten wollten nicht nur (wie gewisse ihrer Schweizer Kollegen) im ‚Dritten Reich‘ anfangs eine grosse Chance für Deutschland erkennen, sondern sich auch aktiv als Nationalsozialisten in der Schweiz betätigten. Damit stellten sie die lokalen Erziehungsbehörden vor Probleme, die die Universitäten selbst als weniger dringend wahrnahmen oder auf die sie keine Antwort wussten, weil das Verhältnis zu Fakultätskollegen tangiert war. Deutschschweizer Universitäten waren im Unterschied zu ihren westschweizerischen Schwesterinstitutionen im Ersten Weltkrieg nicht deutschfeindlich geworden. Bis über 1933 hinaus darf hier mit vielen Sympathien für das 1918 unterlegene ‚Reich‘ gerechnet werden. Diesem galten die in der Schweiz wirkenden nationalsozialistisch eingestellten deutschen Professoren als wertvoll, weil sie ‚Deutschtum‘ im Ausland kulturpolitisch repräsentierten, aber auch, weil sie über die Gesinnung ihrer Kollegen in der Schweiz Auskunft geben konnten. Wenn im Zeichen der Helvetisierung ein Schweizer Lehrstuhl, den ein deutscher Professor geräumt hatte, nicht wieder mit einem Deutschen besetzt wurde, befürchteten deutsche Stellen Nachteile. Also sollten die deutschen Lehrstuhlinhaber in der Schweiz ausharren und ihre Äusserungen nationalsozialistischer Gesinnung, wenn notwendig, mässigen.59 Die Universität Zürich hatte gleich 1933 ihren «Fall Freytag». Der 1911 berufene Logiker Willy Freytag bekannte sich seit Mai 1932 zum Nationalsozialismus und wurde Parteimitglied. In der Landesgruppe der NSDAP war er «Kreisleiter Mittelschweiz». Sein «Fall» erhielt dadurch zusätzliche Brisanz, dass er als Historiker der Pädagogik auch in der Lehrerausbildung tätig war. Die «Neue Zürcher Zeitung» befand zwar, Freytags politische Haltung und Tätigkeit sei dessen Privatsache, auf die die Universität nicht reagieren solle. Aber im Kantonsparlament wurde 1933 die Ansicht vertreten, dass allein schon die Zugehörigkeit zur NSDAP mit dem universitären Amt unvereinbar sei. Freytag legte zunächst 59
Schwarz 2018, 519.
Beobachtungen an der Geschichte anderer Schweizer Universitäten
27
sein Parteiamt nieder. Die Regierung wollte auf eine Entlassung verzichten, da sie Gegenmassnahmen gegen Schweizer Professoren in Deutschland befürchtete. Dies überzeugte vor dem Forum der Politik nicht, und Freytag wurde im Oktober 1933 entlassen.60 In Bern fielen der Theologe Wilhelm Michaelis und der Germanist Helmut de Boor als Nationalsozialisten im Lehrkörper auf. Beide unterhielten seit 1933 Beziehungen zur Deutschen Studentenschaft.61 Michaelis war bei einem Teil der Berner als ‚positiver‘ evangelischer Theologe hoch angesehen (die Fakultät stand mehrheitlich eher auf der Seite der ‚Freisinnigen‘ oder ‚Liberalen‘ im Kirchenvolk). Er verteidigte die Deutschen Christen, die «die politische Macht zu Hilfe gerufen» hätten, und rechtfertigte den Ausschluss von Christen jüdischer Herkunft. Im Grossen Rat wurde seine Entlassung gefordert.62 Der deutsche Gesandte Ernst von Weizsäcker intervenierte darauf bei der Kantonsregierung. Michaelis trat von seinen Funktionen in der Deutschen Kolonie in Bern zurück und konnte die Professur behalten.63 Anders erging es dort dem Sprachwissenschaftler Walter Porzig. 1935 kritisierte Grimm im bernischen Grossen Rat, dass er Leiter der NSDAP-Ortsgruppe Bern war. Michaelis und Porzig trieben die Nazifizierung der Deutschen Kolonie in Bern energisch voran. Die Berner Regierung verbot daraufhin ihren Staatsbeamten, ausländischen politischen Organisationen anzugehören. Da Porzig an seinen Verpflichtungen gegenüber dem ‚Reich‘ festhalten wollte, wurde er entlassen. Während die Berner Professoren sich beunruhigt darüber zeigten, dass ihre Rechtsstellung gegenüber der Regierung so schwach sei, dass sie leicht entlassen werden könnten,64 kam es zu einem ‚Lehrstuhltausch‘ zwischen dem Schweizer Albert Debrunner in Jena, der nach Bern wechselte, und Porzig, der Debrunners Amt in Deutschland übernahm. Fritz Zetsche (Chemiker) und Herbert Jancke (Psychologe) mussten 1936 die Universität verlassen.65 Bis 1945 bleiben konnte hingegen der Germanist Helmut de Boor, obschon seine nationalsozialistische Gesinnung 1935 der Erziehungsdirektion zur Kenntnis gebracht worden war. Nach der Ermordung von Gustloff 1936 trat er der NSDAP bei und schrieb Berichte über die Haltung von deutschen Kollegen in der Schweiz zum Nationalsozialismus. Im August 1945 stellte die Bundesanwaltschaft Antrag auf seine Ausweisung.66 In Freiburg musste der Physiologe Hubert Erhard 1937 demissionieren, der bis 1936 Stützpunktleiter der NSDAP in Freiburg gewesen war. Er verteidigte die deutsche Gesetzgebung zur Rassenhygiene und äusserte sich als Antisemit. Für die Deutsche Studentenschaft 60 61 62 63 64 65 66
Schwarz 2018, 504–508; Stadler 1983a, 50 ff. Totti o. J., 47 f. Totti o. J., 83 ff. Schwarz 2018, 514–515. Totti o. J., 87 f., 90, 93 f. Totti o. J., 95–100. Schwarz 2018, 511 ff.; Totti o. J., 100 f.; Im Hof 1984, 85.
28
Einführung
wirkte er als Vertrauensprofessor.67 Bevor der Schweizer Josef A. Kälin zu seinem Nachfolger gewählt wurde, setzte Erhard alles daran, einen Deutschen zu seinem Nachfolger zu machen.68 Der Kunsthistoriker Heribert Reiners geriet 1938 in Verdacht, Spionage für Deutschland zu betreiben, gewann aber den von ihm angestrengten Verleumdungsprozess gegen die Zeitungen, die dieses Gerücht verbreitet hatten. Erst 1945 wurde gegen ihn vorgegangen.69 Aus Genf liegen keine Berichte über Aktivitäten nationalsozialistischer deutscher Professoren vor. Aber wenigstens ein Mitglied des Genfer Lehrkörpers hatte keine Schwierigkeiten mit dem deutschen Regime: Im Februar 1939 erhielt Hermann Conrad, aus Lausanne kommend, in Genf einen Lehrauftrag für deutsches ziviles Verfahrensrecht und Wertpapierrecht. Am 1. November 1941 wurde er zum ordentlichen Professor an der Universität Marburg ernannt und übte daneben eine Lehrstuhlvertretung an der Universität Frankfurt am Main aus. 1942 wurde er kurzzeitig als Leiter der Wissenschaftlichen Abteilung an das Deutsche Institut in Paris abkommandiert.70 Schon im Fall von de Boor71 haben wir gesehen, dass im Rahmen der Säuberungen nach Kriegsende bekannte Nationalsozialisten ausgewiesen wurden. Die Zugehörigkeit zur Partei galt nun als hinreichender Grund.72 In Zürich betraf dies den Extraordinarius für Physiologische Chemie der Medizinischen Fakultät Bonifaz Flaschenträger (Parteimitglied auf eigenen Antrag seit 1939 – das Gerücht sagte, er sei für den Fall einer deutschen Besatzung als Rektor der Universität Zürich vorgesehen gewesen) und den Ordinarius für Bakteriologie und Serologie der Tierkrankheiten Leonhard Riedmüller.73 In Lausanne bekam der Jurist Otto Riese nach 1945 Probleme, weil er 1939 der NSDAP beigetreten war. Anscheinend erfüllte er Aufgaben für deutsche Stellen vor allem deshalb, weil er in Lausanne bleiben wollte. Er wurde von den Vorwürfen entlastet und wirkte bis zur Pensionierung unangefochten weiter in Lausanne.74 Anders erging es deutschen Professoren in Freiburg, als auch hier 1945 Säuberungen einsetzten. Im Juni entliess der Staatsrat den Kunsthistoriker Heribert Reiners und den Germanisten Richard Newald und verlangte beim Bund deren Ausweisung. Der Anatom Emil Tonutti, der 1941 als Privatdozent von Breslau nach Freiburg gekommen war, die dortige NS-Sportgruppe geleitet hatte und Arzt der Landesjugendführung der
67 68 69 70 71 72 73 74
Schwarz 2018, 509–511; Raab 1991, 301 f. Barthélemy 1991, 188. Raab 1991, 302. Martin 1958, 198. Im Hof 1984, 85. Schwarz 2018, 520. Stadler 1983a, 79; Stadler 1983, 363. Wisard 1998, 217, 343.
Beobachtungen an der Geschichte anderer Schweizer Universitäten
29
Reichsdeutschen Jugend in der Schweiz gewesen war, wurde im April 1946 ausgewiesen.75 e) Germanophile Schweizer Professoren Es gab auch Schweizer Professoren, die über 1933 hinaus Sympathien für Deutschland zeigten und das Hitler-Regime zur Gänze oder in einigen seiner Aspekte wertschätzten. Dies sorgte 1934 beim Berner Universitätsjubiläum für Misstöne, als die linke Presse berichtete, einige Professoren würden mit den totalitären Regimes liebäugeln.76 Zu diesen gehörte der Jurist Hans Fehr, der nach einer Karriere in Deutschland seit 1924 in Bern lehrte und in Schweizer germanophilen Kreisen verkehrte.77 Die Sympathien des Zürcher Germanisten Emil Ermatinger für die Deutschen Christen und den nationalsozialistischen Rassegedanken erregten in der ganzen Schweiz Aufsehen, als er im Herbst 1937 in Eisenach erklärte, er sehe seine Aufgabe darin, die Kluft zwischen Schweizern und Deutschen, die sich seit 1933 aufgetan habe, zu überbrücken. 1939 nannte er Hitler und das NS-Weltbild in einem Atemzug mit den grossen deutschen Dichtern. Kulturell bestimmte Deutschfreundlichkeit verband sich bei ihm mit politischer Zustimmung zu gewissen Aspekten der neuen deutschen Verhältnisse. Er hoffte, es möge «alles deutschsprechende Volk […] diesen neuen Deutschglauben teilen und sich durch den gemeinsamen Rassegedanken auch staatlich-völkisch zusammenfinden».78 An der ETH aktiv war der Kristallograph Ernst Brandenberger (Privatdozent). Er war 1936 bis 1939 Zürcher Gauleiter der Nationalen Front. Als deutschfreundlich galt dort auch der Privatdozent für Werkstoffkunde Hans Stäger; er brachte 1940 seinen Chef Fritz Fischer (Abteilung für industrielle Forschung) dazu, die Eingabe der 173 zu unterschreiben, die Anpassungen der Schweiz an das nationalsozialistische Deutschland forderte.79 In der französischsprachigen Schweiz fielen eher die Sympathisanten der Action Française und die Bewunderer von Mussolini im Lehrpersonal auf. In Neuchâtel wurde 1928 Eddy Bauer Geschichtsprofessor. Er verehrte Charles Maurras und gründete 1934 den Ordre National Neuchâtelois, der einen berufsständisch gegliederten Staat forderte.80 Aus den 1920er Jahren sind Sympathien 75 76 77 78
79 80
Schwarz 2018, 521; Barthélemy 1991, 204; Raab 1991, 304. Totti o. J., 24 f. Becker 1995, 21. Stadler 1983a, 71. Die Zeitschrift «Berner Student» kritisierte 1937 Emil Ermatinger, der vor den Deutschen Christen über den «Gottesglauben im Schrifttum der deutschen Schweiz» gesprochen hatte. Anstössig erschien die oben zitierte Passage, der zufolge Ermatinger eine Vereinigung der Deutschsprachigen in einem Staat wünschte. Totti o. J., 14. Gugerli u. a. 2005, 212 f. Scheurer 2002, 410 f.; Rebetez 2002, 102; Anonym 2005.
30
Einführung
für die Action Française auch aus Lausanne bekannt. In der Zeit, die uns hier interessiert, wirkte die 1926 gegründete Organisation Ordre et Tradition für Föderalismus, Demokratiekritik und Korporativstaat. Sie gründete 1933 die Ligue Vaudoise, die einen starken Einfluss auf die Studenten ausübte.81 Als die Universität zu ihrem Jubiläum 1936 Benito Mussolini den Ehrendoktortitel verlieh, bestritt ihre Leitung jegliche (partei⌥)politische Intention und bekannte sich zu den demokratischen und republikanischen Institutionen der Schweiz. Die Ehrung galt der gesellschaftlichen «rénovation», die der italienische Faschismus gebracht habe und die auch ausserhalb Italiens von grossem Interesse sei. Mussolini wurde als Bollwerk gegen Sozialismus und Kommunismus gesehen und ihm als Verdienst zugeschrieben, dass er die Interessenkämpfe der Parteien beendet und Italien geistig, ökonomisch und gesellschaftlich geeint habe. Den Faschismus als Überwinder der moralischen und wirtschaftlichen Krise wahrzunehmen, an der ganz Europa kranke, war damals typisch für die waadtländische Rechte.82 f) Die Universitäten unter der Kontrolle einer deutschfeindlichen Öffentlichkeit Das Bestreben der Schweizer Universitäten, zu ihren deutschen Schwesterinstitutionen und zu massgebenden deutschen Fachautoritäten nach 1933 weiterhin gute Beziehungen zu unterhalten, wurde in der Öffentlichkeit zunehmend als Deutschfreundlichkeit (Germanophilie) oder als Nachgiebigkeit gegenüber dem Nationalsozialismus (die Unterscheidung zwischen diesen beiden Tendenzen fiel mit der Zeit dahin) aufgefasst. Demzufolge beanspruchten Presse, politische Gruppierungen, Parlamente und Regierungen für sich ein Aufsichtsrecht über die Universitäten, um diese auf denjenigen Pfad zurückzuführen, der der deutschfeindlichen Öffentlichkeit als richtig galt. «Die Öffentlichkeit (Presse, Parteien) erhebt den Anspruch, dass die Prinzipien und Werte, die in der nationalen Politik zur Maxime geworden sind, auch an der Universität respektiert werden. Die Reaktionen der Öffentlichkeit auf die nationalsozialistischen Bekenntnisse und Umtriebe einzelner Dozenten bedeuteten eine Kontrollfunktion über die Universität.»83 Da diese öffentlich-staatliche Lehranstalten waren, schien diese Beaufsichtigung legitim zu sein. Die Regierungen sorgten im Einklang mit Akademikern, die der ‚geistigen Landesverteidigung‘84 anhingen, dafür, dass deutsche Wissenschaftler spätestens seit der zweiten Hälfte der 1930er Jahre auch in der 81 82 83 84
Wisard 1998, 183. Wisard 1998, 209 ff. Stadler 1983a, 107. Beginn der ‚geistigen Landesverteidigung‘: Gemeinsame Hochschulwoche ETH/Universität Zürich, Mai 1936. Philipp Etter sprach dort erstmals dieses Wort öffentlich aus. Gemeint war kulturelle Einkehr, Besinnung auf geistige Eigenwerte, geläuterte Selbsterhebung. Gugerli 2005, 211. Über die Idee kritisch: Tanner 2015, 234 ff. Vgl. Möckli 1973.
Beobachtungen an der Geschichte anderer Schweizer Universitäten
31
Deutschschweiz de facto kaum mehr auf einen Schweizer Lehrstuhl gewählt werden konnten. So wurde in Zürich der Philosoph Freytag erst von der Regierung entlassen, nachdem die Presse dies gefordert hatte.85 In Neuchâtel machte sich die Öffentlichkeit ein negatives Bild von der ‚rechtsextremen‘ Universität aufgrund der Sichtbarkeit einiger entsprechend orientierter Dozenten und wegen der Studentenverbindungen. Doch die Regierung versuchte mit ihrer Commission pour l’enseignement supérieur eine Entwicklung zu weit nach rechts zu verhindern.86 Bei der 1934 in Genf ausgebrochenen Schlägerei unter Studenten wegen der Verteilung eines pazifistischen Flugblattes war es die Presse, die den Vorfall zu einem kontrovers diskutierten Thema machte. Danach griff der Konflikt auf den Staatsrat über, dessen linke Mitglieder sich hinter die pazifistische Studentengruppe stellten, während der Chef der Erziehungsdirektion, der Bürgerliche Paul Lachenal, zusammen mit der Universität eine politisierende Darstellung zurückwies.87 In Lausanne stellte die Öffentlichkeit die Fortführung des Unterrichts in Rechtswissenschaft für deutsche Studierende im Krieg infrage.88 Weitere Beispiele, von denen jedes für sich im Detail wieder anders gelagert war, liessen sich anführen. Für Basel wird abzuklären sein, inwiefern sich die Universität mit einem ‚unpolitisch-neutralen‘ Kurs in Widerspruch zu Teilen der öffentlichen Meinung brachte und welche Reaktionen dies auf welcher Seite auslöste. Ein Dilemma zwischen der Verteidigung der akademischen Freiheit einerseits und der Wahrung des Ansehens der Universität in einer deutschfeindlichen Öffentlichkeit andererseits wäre eine fatale Entwicklung gewesen. g) Beschränkung auf schweizerische Bewerber für Professuren (Helvetisierung des Personals) In einigen Universitäten war es seit 1930, in anderen erst gegen Ende der 1930er Jahre unmöglich, Professoren weiterhin aus Deutschland zu rekrutieren. Diese Blockierung ist zu unterscheiden von den Überlegungen, die man sich um 1930 in der Deutschschweiz machte, wonach eine ‚ausgewogene‘ Verteilung der Stellen zwischen Schweizern und Deutschen wünschbar sei – hier spielten die Furcht vor ‚Überfremdung‘ und die in der Wirtschaftskrise populäre Parole ‚Schweizer zuerst‘ hinein. Welche Faktoren den Trend zur Helvetisierung des Universitätspersonals lostraten und welche ihn unterstützten, wird für Basel zu untersuchen sein. Die Geschichte anderer Schweizer Universitäten legt nahe, dass es nach 1933 politische Faktoren waren, die von aussen an die Hochschulen herantraten 85 86 87 88
Stadler 1983a, 50 ff. Rebetez 2002, 102. Martin 1958, 144. Wisard 1998, 348.
32
Einführung
und diese davon abhielten, im Einklang mit ihrer peripheren Stellung zu den deutschen Zentren weiterhin Personal aus jenem Land zu rekrutieren. In Bern begann die Helvetisierung schon 1931 mit dem Argument, dass schweizerische Arbeitsplätze für Schweizer reserviert seien und dass in den philosophisch-historischen Fächern auch ein ‚schweizerischer Geist‘ vorherrschen solle. Dieses Ziel verfolgte auch die Fakultät, als bei der Besetzung der Professur für Klassische Philologie 1931 Karl Eduard Tièche gewählt wurde. Dies galt nicht nur für Dozenten, sondern in besonderem Masse – wie auch in Zürich – für Assistenten in Medizin und Naturwissenschaften: Als der Berner Pharmakologieprofessor Emil Bürgi 1933 seinem Kollegen Siegfried Walter Loewe, der in Mannheim von den Nationalsozialisten entlassen worden war, einen Arbeitsplatz einräumen wollte (ohne Bezahlung), lehnte der Berner Regierungsrat ab. Nach 1933 waren Deutsche in Bern definitiv nicht mehr gefragt.89 In Zürich sorgte der Regierungsrat dafür, dass der Deutsche Eduard Spranger, obschon in vieler Beziehung anderer Ansicht als die Nationalsozialisten, von der Nachfolge des entlassenen Philosophen Freytag ausgeschlossen wurde. In der Philosophie sollte neben Eberhard Grisebach kein zweiter Deutscher lehren. Im Endergebnis berief Zürich an seine Universität zwischen 1939 und 1944 nur noch Schweizer (einschliesslich zwei Auslandschweizer, die zurückkehrten).90 Auch Freiburg, das seit der Gründung stark von deutschen und österreichischen Professoren abhing, verzichtete ab 1933 auf die Anstellung neuer deutscher Dozenten.91 Die ETH wollte zwar weiterhin deutsche Studenten rekrutieren, bevorzugte aber gleichzeitig schweizerische Professoren. Dieser Trend stammte aus dem 19. Jahrhundert und hatte sich in den 1920er Jahren noch beschleunigt, bis der Anteil ausländischer Dozenten nach dem Zweiten Weltkrieg einen Tiefpunkt erreichte. Die Ursache war hier der Wille, die nationale technische Hochschule auch im Lehrpersonal zu nationalisieren; die Abwehr der Deutschen, die verdächtigt wurden, für den Nationalsozialismus und ihr Land zu arbeiten, verstärkte eine schon bestehende Handlungsmaxime.92 In der Westschweiz gab es schon 1933 so gut wie keine deutschen Professoren.93
89 90 91 92 93
Totti o. J., 28 f., 33. Stadler 1983a, 52, 72. Schwarz 2018, 518. Gugerli 2005, 237 f. Liste der Ordinarien und Extraordinarien für Lausanne 1914–1945 als Bsp.: Wisard 1998, 459 ff. Die Liste nennt die Nationalität, die Studentenverbindung und, wo vorhanden, die politische Tendenz oder Parteizugehörigkeit.
Beobachtungen an der Geschichte anderer Schweizer Universitäten
33
h) Misstrauen und Ablehnung gegenüber Flüchtlingen resp. Juden als Dozenten Die bekannten Überfremdungsängste verbanden sich verstärkt mit antisemitischen Tendenzen, als ab 1933 in Deutschland gegen die Juden an den Hochschulen vorgegangen wurde. Es ist deshalb nicht zu erwarten, dass die aus ihren Stellen vertriebenen deutschen Dozenten oder die jüdischen Studierenden, die in die Schweiz flohen, mit offenen Armen empfangen wurden. Ob diese allgemeine Erwartung für Basel differenziert werden kann, werde ich aufzeigen müssen. In Zürich verhinderte das generelle Misstrauen gegen «Emigranten» 1933 bis 1939 jeden Versuch, jemanden aus dieser Kategorie in den Lehrkörper aufzunehmen. Den Plan, Gustav Radbruch in Zürich als Privatdozenten aufzunehmen, hintertrieben die Fakultät und die Fremdenpolizei. Von den wenigen jüdischen Dozenten, die an der Universität Zürich vor allem in den Naturwissenschaften und der Medizin tätig waren, wurde zwischen 1933 und 1944 kein einziger befördert.94 Die ETH lies einzelne jüdische Flüchtlinge als Dozenten zu, bevorzugte aber unter ihnen die Schweizerbürger. Nach Kriegsausbruch erschien Zürich auch für sie unsicher zu sein, und eine Emigration nach den USA setzte ein. Paul Bernays (vormals Extraordinarius in Göttingen) erhielt bei den Mathematikern sporadisch Lehraufträge: Er war Schweizerbürger, wurde 1939 habilitiert, aber erst 1945 zum Professor ad personam befördert. Der Schulratspräsident Arthur Rohn verzichtete mit Rücksicht auf den Antisemitismus unter Schweizer Industriellen auf eine Anstellung des überragenden Maschinenbauingenieurs und Betriebswirtschaftlers Georg Schlesinger, der 1934 an der TH Berlin entlassen und in «Schutzhaft» genommen worden war.95 Im Juni 1933 überlegten in Neuchâtel die Commission pour l’enseignement supérieur und das Département d’Instruction Publique, ob man nicht exilierte Juden aus Deutschland als Professoren anstellen könne. Die Fakultäten waren damit nicht einverstanden, und so unterblieb ein entsprechender Versuch.96 Freiburg wird als offener dargestellt. Dies mag damit zusammenhängen, dass die Katholiken ein deutliches Bild der negativen Seiten des Nationalsozialismus hatten. 1937 fand Friedrich Dessauer, vormals Professor in Frankfurt, in Freiburg als Ordinarius für Experimentalphysik Zuflucht. Er war Katholik und Zentrumspolitiker. Die deutsche Gesandtschaft in Bern hatte gegen seine Berufung protestiert. Dessauer blieb der einzige Deutsche, der zwischen 1932 und 1943 auf eine Freiburger Professur gewählt wurde. Nach dem ‚Anschluss‘ Österreichs wurde das Haupt der Wiener ethnologischen Schule, Wilhelm Schmidt, SVD, 1939 in Freiburg aufgenommen, wo er bis 1948 Professor für Ethnologie war.97 Lausanne hin94 95 96 97
Stadler 1983a, 52; Stadler 1983, 277. Gugerli 2005, 240–242. Rebetez 2002, 119 und Anm. 276. Raab 1991, 303; Barthélemy 1991, 188.
34
Einführung
gegen zeigte sich sehr zurückhaltend. Seit 1933 unterrichtete Edgar Goldschmid eine (!) Wochenstunde Medizingeschichte, und Cuno Chanan Lehrmann, der spätere Landesrabbiner von Luxemburg, gab ab 1934 einen Kurs über die jüdische Frage in der französischen Literatur. Beide hatten die schweizerische Nationalität und beide standen schon vor 1933 in Kontakt mit Lausanne oder Genf; sie erhielten Unterstützung durch Fakultätsmitglieder. Sie kosteten den Staat nichts. Dennoch protestierten verschiedene Mediziner gegen den Lehrauftrag von Goldschmid.98 i) Umgang mit Studierenden aus Deutschland 1933 Zürich, Bern und Basel waren Destinationen, die in Deutschland Studierende nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten zu erreichen suchten. Wie die Hochschulen und deren übergeordnete Behörden damit umgingen, ist eine wesentliche Frage im Verhältnis zu Deutschland nach 1933. Die Westschweizer Universitäten waren einerseits seltener Ziele der Flüchtlinge, andererseits galten dort über 1933 hinaus (oft entgegen den Ansichten in der öffentlichen Meinung) Ausländerstudierende wie früher als willkommene Verstärkung der Studierendenstatistik und als Anzeichen der internationalen Reputation der Universität. An der Universität Zürich wurden zu Beginn des Sommersemesters 1933 von 250 Flüchtlingsstudierenden nur 72 zur Immatrikulation zugelassen. Dabei versuchte man gezielt, die so genannten «Ostjuden» von der Universität fernzuhalten.99 Die ETH verfolgte hingegen eine Politik der Vermehrung des Anteils ausländischer Studierender. Trotz antisemitischer Vorbehalte konstatierte der Schulrat im Herbst 1933, dass eine «Überfüllung» «mit deutschen jüdischen Flüchtlingen» nicht stattgefunden habe. Dennoch wurde die ETH 1934 Zielscheibe einer Agitation der Frontisten. 1940 protestierten auch die Schweizer Studierenden der ETH, die der VSETH vertrat, gegen die angebliche Privilegierung der Fremden. Der Schulrat wollte die nationalsozialistische Verfolgung nicht dadurch unterstützen, dass er Flüchtlinge abwehrte. Empört äusserte er sich 1938, als das EJPD die Schweizer Konsulate anwies, Studenten die Einreiseerlaubnis in die Schweiz mit der Begründung zu verweigern, die ETH sei überfüllt. Flüchtlinge erhielten auch Studiendarlehen. Diese Offenheit war nicht nur humanitär motiviert: Ausländische Absolventen der ETH galten als Botschafter der Schweizer Exportwirtschaft in ihrer Heimat.100
98 99 100
Wisard 1998, 225. Stadler 1983a, 54. Gugerli 2005, 234–236.
Beobachtungen an der Geschichte anderer Schweizer Universitäten
35
k) Vorsichtige akademische Kritik an Deutschland – der Testfall «Oslo» Die Schweizer Hochschulen hielten sich vor allem während des Krieges mit offener Kritik an deutschen Verhältnissen und Vorgehensweisen zurück. Ein Grund dafür war das fortdauernde Bestreben, mit deutschen Kollegen Beziehungen zu pflegen, von ihnen Einladungen zu erhalten und im Rahmen des akademischen Austausches für sie solche auszusprechen. Ein anderer war die vom Bund verordnete, umfassende Art der Neutralität. Behörden massregelten Professoren, die sich nicht danach richteten. Die Wirkung dieser Vorgabe beurteilten schon die Zeitgenossen als einseitig, denn zu Beginn des Krieges schwiegen die Hochschulen zu den teilweise brutalen deutschen Massnahmen in den 1939 und 1940 besetzten Gebieten.101 Als sich um 1943 die Ansicht verbreitete, Deutschland stehe nun in der Defensive, stellte sich die Frage, ob die Hochschulen weiterhin an die immer noch geltende, umfassende Neutralität gebunden seien. Ein erster Testfall war der Beginn der «Endlösung» und die Schliessung der Schweizer Grenzen 1942, der allerdings zu Äusserungen Anlass gab, die im humanitären Bereich blieben und keine politische oder zwischenstaatliche Dimension annahmen – Hauptthema war das Verhalten der Schweizer Bundesbehörden. Ein zweiter Testfall war die Verhaftung und Deportation von Professoren und Studierenden der Universität Oslo im Herbst 1943. In den skandinavischen Ländern wurde trotz Rücksichtnahme auf die Macht der deutschen Waffen energisch protestiert, dieser Protest blieb nicht allein Sache von Studierenden oder einigen Professoren und zielte explizit auf deutsche offizielle Stellen ab. Manche protestantischen Theologen waren seit Beginn der nationalsozialistischen Diktatur Gegner des totalitären Staates. Daran änderte auch die Schweizer Zensur im Krieg wenig, wie das bekannte Beispiel von Karl Barth zeigte.102 In Zürich nutzte der Theologe Emil Brunner seine Position als Rektor, um den Totalitarismus allgemein anzugreifen, allerdings in einer Form, die die Neutralität nicht offen tangierte.103 Andere Zürcher Professoren hielten sich weniger zurück. Der Mikrobiologe Hermann Mooser wurde vom Regierungsrat gerügt, weil er die Diktatur Hitlers laut kritisiert hatte.104 Unter den Schweizer Protestveranstaltungen gegen das deutsche Vorgehen in Oslo nahmen die Zürcher Vorgänge vom 3. Dezember 1943 einen hervorragenden Platz ein, wiederum im Zusammenhang mit der Opposition von Brunner gegen die deutsche Diktatur.105 Andere Universitäten taten sich schwer mit der Einsicht, dass von ihnen eine Kundgebung erwartet wurde. Genf gab ein typisches Beispiel dafür ab, wie das Rektorat und der 101 102 103 104 105
Am Bsp. Leiden: Hirschfeld 1997. Tietz 2019, 303 ff.; Beintker/Link/Trowitzsch 2010; Busch 2008. Stadler 1983a, 74 f. Stadler 1983, 371. Stadler 1983a, 75.
36
Einführung
Senatsausschuss verhindern wollten, dass eine unkontrollierbare Manifestation entstünde. Man bewirkte damit das Gegenteil.106 Lausanne war in der Pflicht, das negative Image, das die Erteilung des Ehrendoktorats an Mussolini bewirkt hatte, zu korrigieren. Auf Initiative des Philosophen Henri-Louis Miéville erfolgte durch das vorsichtige Rektorat eine breite Konsultation, die zu einer Resolution der Commission universitaire führte, die jede direkte Verurteilung der deutschen Massnahmen in Norwegen vermied.107 Die schweizerische Universitätshistoriographie kennt bereits zahlreiche «Fälle», die die Vermutung nahelegen, dass diejenigen Schweizer Professoren, die trotz der veränderten Verhältnisse ihre Beziehungen zu Kollegen in Deutschland weiterführen wollten, durch das nationalsozialistische Regime gewissermassen in Geiselhaft genommen wurden: Was sie auch im Rahmen dieser meist in bester Absicht praktizierten Beziehungspflege taten, trug letztlich zur Stabilisierung der Herrschaft der Diktatur bei und konnte zugunsten des Regimes propagandistisch verwertet werden. Für die Untersuchung über Basel stellt sich die Aufgabe, die bereits bekannten Ereignisse daraufhin zu untersuchen, ob sie nur Ausnahmen einer relativ einheitlichen, nach aussen neutralen, im vertrauten Kreis jedoch gegenüber der deutschen Diktatur kritischen Haltung waren, oder ob die Universität Basel ein «Nazinest»108 gewesen sei. Vor allem sollten die Kontexte genauer untersucht werden unter der Frage, inwiefern die Konflikte als Teil des Verhältnisses der Basler Peripherie zu deutschen Zentren zu verstehen wären.
1.4 Wandel in den Ansätzen der deutschen Universitätshistoriographie Die deutsche Universitätshistoriographie109 war zu der Zeit, da in der Schweiz nach 1980 die neuen Universitätsgeschichten zu erscheinen begannen, in eine Phase der «Vergangenheitsbewältigung» eingetreten. Seit 1945 hatte die Feststellung von Karl Jaspers gegolten, «der Kern der Universität [habe] in der Vergangenheit standgehalten».110 War in den 1960er und 1970er Jahren Universitätsgeschichte ein Schauplatz politischer Auseinandersetzungen zwischen traditionsund institutionskritischen Reformern und Revolutionären auf der einen, Vertre106 107 108 109
110
Wisard 1998, 349 f.; Martin 1958, 216 f. Wisard 1998, 350–352. Dieser Vorwurf geht auf eine Äusserung von Juliette Ernst gegenüber Jean-Marie Flamand aus den 1980er Jahren zurück, zitiert bei Hilbold 2022, 198 f. Schwinges 2019; Grüttner 2019; Grüttner u. a. 2010; Scholtyseck/Studt 2008; McClelland 2005; Grüttner/Connelly 2003; vom Bruch/Kaderas 2002. Im Hinblick auf die Geisteswissenschaften der kurze Überblick über die Entwicklung der Forschung in: Bialas/Rabinbach 2007, xxii f. Zitiert nach Grüttner 2019, 87; Remy 2007, 37.
Wandel in den Ansätzen der deutschen Universitätshistoriographie
37
tern der «Ordinarienuniversität», die ihre eigenen Karrieren in der NS-Zeit begonnen hatten, auf der anderen Seite gewesen, folgte in den 1980er Jahren eine Aufarbeitung der Geschichte einzelner Universitäten und Disziplinen mit geschichtswissenschaftlichen Methoden. In den 1990er Jahren setzte, nicht zuletzt dank der Möglichkeit, vermehrt Dokumente aus Archiven heranzuziehen, und im Kontext eines Generationenwechsels eine kritische Beschäftigung auch im Rahmen von Hochschuljubiläen ein. Als die Fakten wissenschaftlich gesichert waren, stand das Ringen um die moralische Bewertung im Mittelpunkt der Diskussion. Nachdem die Historiographie früher betont hatte, dass die Universitäten durch den Nationalsozialismus «gleichgeschaltet», also von aussen und oben mit Terror und Drohungen unter ein einheitliches ideologisches und institutionelles Joch gezwungen worden seien, waren nun vorübergehend Vorstellungen wie eine «Verstrickung» eines grossen Teils der Universitätslehrer mit dem (der Universität an sich feindlich gesinnten) Regime verbreitet. Seither hat sich die Perspektive verschoben: Vieles erscheint nun als Nazifizierung, die von Universitätsangehörigen aus eigenem Antrieb (wenn auch aus verschiedensten Motiven) selbst befördert wurde («Selbstgleichschaltung»), was das mehrheitliche Ausbleiben eines Widerstands erklären hilft. Nationalistische und ‚völkische‘ Einstellungen, die weit hinter 1933 zurückreichten, ermöglichten teils eine Symbiose mit nationalsozialistischen Erwartungen an die Wissenschaft, teils wurden sie als ‚reaktionär‘ kritisiert. Umgekehrt schien der 1933 ausgelöste nationalistische Aufschwung eine Aufforderung an die Wissenschaftler zu enthalten, mit den neuen Machthabern für ein übergeordnetes Ziel zu kooperieren. Auf der Motivationsebene werden seither (in einer System- oder ökonomischen Perspektive) die Bestrebungen betont, die das Regime, das wissenschaftliches und technisches Wissen für seine Ziele benötigte, mit Wissenschaftlern und Technikern zu einer interessierten Zusammenarbeit vereinte, die zunehmend ihre Karriere unter den vom Nationalsozialismus geschaffenen Bedingungen aufbauten – nicht konfliktfrei, aber unter der Annahme, dass die Diktatur Ressourcen für die Forschung verfügbar machte, die man einwerben wollte, und dass die Wissenschaftler und Techniker für die Verfolgung der ideologischen Ziele des Regimes nützliche, ja unentbehrliche geistige Ressourcen bereithielten. Die Formulierung, Regime und Wissenschaft seien «Ressourcen füreinander» gewesen, wird, seitdem sie Mitchell Ash vor zwanzig Jahren lanciert hat,111 immer wieder anzitiert. Neben die Systembetrachtung trat das linguistische Interesse an der Rezeption von solchen Sprachelementen in den Wissenschaften, die auch in nationalsozialistischen Texten zu finden waren.112 Damit wurde die These verbunden, dass gegen Ende des ‚Dritten Reichs‘ ein wissenschaftlicher Diskurs in Deutschland fast nur noch innerhalb des gegebenen
111 112
Ash 2002. Bollenbeck 2007; Bollenbeck/Knobloch 2001.
38
Einführung
ideologischen Rahmens stattfand.113 Die neuere Universitätsgeschichte in Deutschland hat zu inzwischen konsensfähigen Ergebnissen geführt, von denen die weitere Forschung ausgeht und die sich in überschaubaren «Grundtatsachen» zusammenfassen lassen.114 Hinsichtlich der biographischen Informationen über einzelne Wissenschaftler bleibt aber der Streit darüber selten aus, ob die Protagonisten aus tiefer (patriotischer oder nationalsozialistischer) Überzeugung, aus Karriereinteressen und in der Aussicht auf Förderung ihrer (an sich nicht unbedingt regimebezogenen) Forschungsprogramme gehandelt hätten. Oder hatten sie zur Erhaltung der Institution Universität, in der Tradition ‚voraussetzungsloser‘ Wissenschaft und persönlicher Anständigkeit unter einem braunen Tarnmantel ‚weitergemacht‘? Verblieben sie im Land, weil sie aus ökonomischen und familiären Gründen keine Alternative hatten oder eine Emigration als Verrat an ehrbaren Grundsätzen ansahen? Die Konsequenzen einer Auswanderung waren schwerwiegend, zumal die Zielländer in der Regel nur geringe Bereitschaft zeigten, Fremde freundlich aufzunehmen. Die vom Nationalsozialismus ausgehende, existenzielle Gefährdung wurde oft lange unterschätzt oder als vorübergehend aufgefasst. Die ‚Normalität‘ der Wissenschaft unter der Diktatur, der Fortbestand ernsthafter Forschung, ja die Innovationsbereitschaft in «Gemeinschaftsforschung», «Volksgeschichte», Umweltforschung, Volksgesundheit, Archäologie, Biochemie und Kernforschung wurden seit 1990 oft herausgearbeitet. Eine vergleichend-relativierende Einschätzung wollte menschliche Integrität nicht am Massstab messen, den entschiedene Kritiker und Opfer des Systems gesetzt hatten. In diesem Sinne wurde das unbedingte Verurteilen im Licht des Exils eines Albert Einstein oder gar des Holocaust durch das Erklären von Verhaltensmustern und Optionen innerhalb der Systembedingungen ersetzt. Dies gilt teilweise auch für die Studien über die grossen Forschungsorganisationen und Förderagenturen sowie über Gruppen wie Techniker und Studierende. Die Schweizer Universitätsgeschichte wäre vor diesem Hintergrund neu zu durchforsten und zu ergänzen. Inzwischen sind auch die Aussenbeziehungen der deutschen Hochschulen 1933 bis 1945 in den Blick gekommen.115 Besonders für Basel als nächste Nachbaruniversität zu Deutschland wäre es wichtig, darüber mehr zu erfahren. Enttäuschend war aber bisher, dass die Beziehungen zur Schweiz nur am Rande berührt worden sind. Umgekehrt wurde festgehalten, dass viele Schweizer auch in der Periode, die hier interessiert, in Deutschland tätig gewesen sind116 – über sie ist mit wenigen Ausnahmen, die wir demzufolge nur schwer kontextualisieren können, viel zu wenig bekannt. Matthias Gelzer in Frankfurt, Arnold von Salis 113 114 115 116
Rebenich 2010, 16. Grüttner 2019, 91–102. Albrecht u. a. 2020; Björkman u. a. 2019. Hoffmann/Walker 2011.
Basler Politik und die Modernisierung der Universität in den 1930er Jahren
39
und Max Gutzwiller in Heidelberg, Walther von Wartburg in Leipzig und Werner Kuhn in Kiel werde ich erwähnen, weil sie aus Basler Sicht denkwürdig erscheinen. Auch hat sich, soweit ich sehe, bisher niemand die Mühe gemacht, die fortgesetzte Schweizer Präsenz in deutschen Fachgesellschaften, Forschungskooperationen und an deutschen wissenschaftlichen Kongressen im Zusammenhang zu rekonstruieren. Diese Lücken kann ich nicht füllen; denn dazu braucht es einen eigenen Anlauf.
1.5 Basler Politik und die Modernisierung der Universität in den 1930er Jahren Die 1930er Jahre waren in Basel politisch turbulent.117 Mit der Mehrheit der Linken im Parlament und der Regierung («Rotes Basel») bewahrheiteten sich 1935 die schlimmsten Befürchtungen, die die Bürgerlichen seit 1918 gehegt hatten – und doch blieb ein bürgerkriegsartiger Klassenkampf aus. Zwar opponierten die Bürgerlichen gegen die Ausgabenpolitik der Linken in der Krise, aber diese entspannte die soziale Lage. Ausserdem sorgte sie für eine Dynamik im Stadtbild durch neue Bauten, ebenso im Kulturleben z. B. durch das 1936 eröffnete, neue Kunstmuseum, und alte Wünsche der Universität nach besseren Lokalitäten und einem klareren Grundgesetz, das das revisionsbedürftige Gesetz von 1866 ablösen könnte, gingen in Erfüllung. Wenn auch die Zahl der Professuren erhöht wurde, blieb sie doch hinter den Anforderungen, die an eine moderne Hochschule gestellt wurden, zurück.118 Man könnte die Tatsache, dass die Universität im Januar 1937 ein neues Gesetz erhielt, mit einer allgemeinen Modernisierungstendenz in Zusammenhang bringen oder sie als Antwort auf die deutschen Verhältnisse seit 1933 deuten. Tatsächlich war die politische Debatte um das neue Gesetz in einzelnen Aspekten vom Basler Blick auf deutsche Vorgänge mitgeprägt. So wurde Wert darauf gelegt, dass die Universität politisch neutral bleiben solle, und es wurde explizit bestimmt, dass bei Wahlen in den Lehrkörper politische und weltanschauliche Positionen der Kandidaten nicht berücksichtigt werden dürfen – Edgar Bonjour nannte dies einen «Ausdruck der Zeitstimmung».119 Der Einbruch weltanschauli117
118
119
Basler Geschichte seit 1933 (in Auswahl): Stirnimann 2021; Moser/Heini 2020; Haumann u. a.2008; Kreis/von Wartburg 2000; Stirnimann 1992; Guth/Hunger 1989; Stirnimann 1988; Grieder 1957. Aufschlussreich für Politik und Gesellschaft: Degen 1986. Jüdische Flüchtlinge: Sibold 2010. Darstellung des Gesetzes: Bonjour 1960, 784 ff. (von ihm stammt auch die Bezeichnung «Grundgesetz»). Entstehungsgeschichte: «Das Universitätsgesetz von 1937» in: https://unige schichte.unibas.ch/aufbrueche-und-krisen/das-universitaetsgesetz-von-1937 (2010). Zwicker 1991. Bonjour 1960, 787.
40
Einführung
cher und politischer Bespitzelung in die Ernennung und Beförderung von Dozenten in Deutschland wurde in Basel mit der Erhaltung eines im liberalen Sinne unpolitischen Hochschulraums, mit der für Basel erstmaligen expliziten Bekräftigung der Lehr- und Forschungsfreiheit und mit Bestimmungen über den Abstand zwischen Staat und Hochschule beantwortet.120 «Es wurde […] damit ein Gegenakzent zum totalitären Staats- und Gesellschaftsverständnis nördlich und südlich der Schweiz gesetzt.»121 Dass allerdings vor wie nach Erlass des Gesetzes bei Berufungen weltanschaulich argumentiert wurde, ist evident: Ziel war hier die Vermeidung von Konflikten innerhalb der Universität und zwischen Universität und Öffentlichkeit, indem auf politisch profilierte Deutsche verzichtet wurde. Wo es unvermeidlich erschien, schritt man zu disziplinarischen Massnahmen.122 Modernisierung lässt sich anführen als Motor für die Erweiterung der Zahl der im Gesetz verankerten Lehrstühle, denn sie folgte der Ausdifferenzierung und Spezialisierung der Wissenschaftsfelder; sie antwortete auch auf die wachsende Zahl Studierender.123 Dies war mit Mehrkosten verbunden, die in der noch andauernden wirtschaftlichen Krise problematisch erschienen. Ich verstehe den Ausbau – zusammen mit den Neubauten der 1930er Jahre, von denen auch die Universität profitierte – als Teil des «deficit spending» im keynesianischen Sinne, das die Sozialdemokraten, zum Teil beraten durch den Ökonomen Edgar Salin, betrieben. Wenig Rücksicht wurde auf die in Deutschland erstarkte Nichtordinarienbewegung genommen; die Regenz (anderswo Senat genannt) bestand weiterhin aus den Inhabern der gesetzlich fixierten und der persönlichen Ordinariate, während Privatdozenten und Extraordinarien nur je einen Vertreter neu in die Regenz wählen durften. Studentische Mitsprache wurde nicht erwogen; nur die marxistische Studentengruppe meldete einen solchen Wunsch an.124
120 121 122 123
124
Votum des liberalen Paul Speiser für eine möglichst weitgehende Autonomie der Universität zur Abwehr einer «Gleichschaltung» nach deutschem Muster, in: Bonjour 1960, 786. https://unigeschichte.unibas.ch/aufbrueche-und-krisen/das-universitaetsgesetz-von-1937. § 12 war die Handhabe zur disziplinarischen Entlassung von Universitätslehrern wegen «mangelnder Eignung». Die Medizinische Fakultät erhielt neu 13 gesetzlich verankerte Professuren (1866: vier); die Philosophisch-Historische Fakultät 15 gesetzliche Professuren (die entsprechende Abteilung hatte vorher zwölf); die Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät wuchs nur um einen gesetzlichen Lehrstuhl (die entsprechende Abteilung hatte vorher zwölf Professuren). Theologen und Juristen erhielten keine zusätzlichen Professuren. Bonjour 1960, 791–793; Ratschlag 1935, 31. Tschudi berichtet, er selbst habe den Wunsch nach studentischer Mitsprache in der Vernehmlassung zum Gesetzesentwurf formuliert. Tschudi war bei den Marxistischen Studenten, wurde aber für 1935/36 mit Unterstützung der bürgerlichen «Zofingia» zum Präsidenten der Studentenschaft gewählt. Tschudi 1993, 40, 42.
Basler Politik und die Modernisierung der Universität in den 1930er Jahren
41
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts war nach einer Gesetzesreform für die Universität gerufen worden.125 Das Universitätsgesetz von 1866 war vor allem hinsichtlich der Kompetenzverteilung zwischen universitären und staatlichen Instanzen, aber auch hinsichtlich des Mitwirkungsrechts der Fakultäten in Personalfragen, unklar. Der erste Reformanlauf hatte nur die Bestimmungen zum Universitätsgut aus dem Universitätsgesetz ausgekoppelt. Die politische Arbeit an einer Gesetzesreform stockte danach, bis der sozialdemokratische Chef des Erziehungsdepartements, Fritz Hauser,126 das Dossier in die Hand nahm und einen Professor der Juristischen Fakultät, Erwin Ruck,127 mit einem Entwurf beauftragte.128 Am 21. März 1935 unterbreitete die Regierung dem Parlament ihren Gesetzesvorschlag.129 Die Debatte drehte sich um die sogenannte Universitätsautonomie130 und damit um die Rechtsnatur der Universität – sollte sie unter dem Gesichtswinkel einer aus der Tradition der mittelalterlichen Korporation gewachsenen Anstalt mit Sonderrechten betrachtet werden, oder war sie eine Anstalt innerhalb des staatlichen Erziehungswesens? Der linke Flügel der Regierung beantwortete die Frage eindeutig mit dem Charakter einer staatlichen Anstalt, über die die Administration, die Exekutive und letztlich das Parlament verfügten. Konservative Bürgerliche fürchteten die Öffnung einer Tür in Richtung einer linken Parteihochschule (was sie mit einer nationalsozialistischen Gleichschaltung in Parallele setzten) und betonten deshalb die Tradition der Sonderstellung, Selbstreglementierung und Unvergleichbarkeit mit den staatlichen Schulen.131 Schliesslich wurde 1936 der Kompromiss gefunden mit einer ausführlichen Auflistung der Kompetenzverteilung («Kompetenzenkatalog») zwischen den verschiedenen Organen und Instanzen einerseits und dem Erhalt der Theologischen Fakultät (trotz Trennung von Kirche und Staat, und mit der Bestimmung, die Fakultät habe nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu arbeiten) andererseits.132 Die Ver125 126 127
128
129 130 131 132
Bonjour 1960, 784, datiert den Ruf nach einer Totalrevision des Gesetzes von 1866 auf 1903. Stirnimann 2021. 1912 war der süddeutsche Demokrat und Tübinger Privatdozent Erwin Ruck, bekannt als Verwaltungs- und Kirchenrechtler, nach Basel berufen worden, wo er schliesslich eingebürgert und zu einer tragenden Gestalt der Fakultät wurde, in der er bis 1953 unterrichtete. Kunz 2011, 163–165, 256–258. Bonjour 1960, 784, unterstreicht die Rolle von Fritz Hauser als «unablässiger Mahner» und diejenige des Öffentlichrechtlers Erwin Ruck. Der Auftrag an Ruck ging offiziell von der Kuratel aus, er datiert vom 3. 6. 1929. Ruck lieferte seinen Entwurf am 14. 12. 1929 dem ED ab. Ratschlag 21. 3. 1935, No. 3491; Stirnimann 2021, 239–241. Ratschlag 21. 3. 1935 (No. 3491), darin wird (3–6) die Vorgeschichte seit 1905 rekapituliert. Begriffsklärung: Wisard 1998, 16–18. Bonjour 1960, 786. Erhalt der Theologischen Fakultät als Bestandteil der staatlichen Universität: siehe unten, Kapitel 4.1.
42
Einführung
mehrung der Lehrstühle war ein Schritt in eine willkommene Richtung, zumal der Regierungsrat das Recht erhielt, noch weitere Professuren zu schaffen als die, die im Text von 1937 aufgeführt worden waren. In der praktischen Umsetzung bewährte sich das Gesetz gut. Probleme machte zunächst vor allem die Bestimmung, wonach die Professoren mit siebzig Jahren zurücktreten mussten – einige sahen darin eine rückwirkende Bestimmung, die sie benachteiligte, und prozessierten. Das neue Kollegiengebäude von 1939133 ging auf Initiativen zurück, die noch hinter den Ersten Weltkrieg zurückreichten. Seit 1891 waren «unhaltbare Zustände» in der Alten Universität am Rheinsprung beklagt worden.134 Es dauerte Jahrzehnte, bis geklärt war, ob es ein Auditorienhaus oder ein Universalgebäude mit Vorlesungs-, Seminar- und Büroräumen bräuchte, wo das Gebäude zu stehen kommen sollte und anderes mehr, nicht zu vergessen die Kostenfrage, da auch die Museen nach neuen Räumen oder Häusern riefen und dafür in der städtischen Gesellschaft Unterstützung erhielten. Der Umbau des Museums an der Augustinergasse und der Neubau des Kunstmuseums wurden noch vor dem Universitätsneubau realisiert. Die Regierung entschied 1912, dass das Alte Zeughaus am Petersplatz der Universität weichen müsse135 – auch gemäss der räumlichen Logik, dass dort ein Hochschulzentrum aus Bernoullianum, Vesalianum, Botanischem Institut und Universitätsbibliothek im Entstehen war. Bei diesem Standortentscheid galt das Zeughaus noch als wertloses Gebäude. Dies änderte später, als der Heimatschutzgedanke Fuss gefasst hatte; nun galt manchen das Zeughaus als erhaltenswert, allenfalls umzunutzen für die Universität. Und im Zuge der vermehrten Besinnung auf Traditionen konnte das Haus am Rheinsprung, obschon in bedenklichem Zustand, als geistiges Zentrum eines ‚Quartier Latin‘ gesehen werden, gebildet aus dem Museum an der Augustinergasse, der Alten Universität, den Seminarhäusern am Stapfelberg und einigen Liegenschaften am Münsterplatz. Anstelle eines massvoll-zeitgemäss gestalteten Hauses, wie es das favorisierte Projekt von Roland Rohn vorsah, wünschten sich vor allem Professoren eine repräsentative Gestaltung. Edgar Salin sprach gegenüber Regierungsrat Hauser von Rohns Projekt als «diesem wirklich nicht schönen Bau».136 So zogen sich Wettbewerb und Planung lange hinaus, und es brauchte ein Referendum und eine Volksabstimmung im November 1936, bis der Weg frei war für das heute noch bestehende Haus am Petersplatz resp. Petersgraben.137 Zeittypisch war die 133 134 135 136 137
Stirnimann 2021, 242 247; Kreis 2010; Bühlmann 2010; Huber 2003; Huber 1991; Labhardt 1939; Roth 1939. Labhardt 1939, 41. Labhardt 1939, 51. 1914 erfolgte die Ausschreibung für den ersten Architekturwettbewerb, ebd. 55 f. Salin an Hauser, 25. 5. 1938, in: Nachlass Edgar Salin, NL 114, Fb 1236. Labhardt 1939, 85–87.
Basler Politik und die Modernisierung der Universität in den 1930er Jahren
43
Moderne, die dem Ideal des Neuen Bauens entfernt eine Reverenz erwies, aber im Unterschied zu den in ähnlichem Stil gehaltenen Bauten der totalitären Nachbarstaaten hatte das Basler Haus menschliche Dimensionen. Die Repräsentativität lehnte sich an die Formensprache an, die die chemische Industrie (namentlich Hoffmann-La Roche) gewählt hatte – kein Zufall, war der Architekt Roland Rohn doch ein Schüler des Roche-Hausarchitekten und ETH-Dozenten Otto Rudolf Salvisberg.138 Der Architekt sprach die Abwendung von deutschen Konzeptionen offen aus. Nicht Berliner oder Münchner Prachtentfaltung, die die Wichtigkeit der Wissenschaften in Stein fasste, war sein Vorbild, sondern er liess sich von seiner Auffassung des britischen College-Gedankens inspirieren,139 indem er ein in der Hauptsache zweigeschossiges Gebäude um einen Hof zog, so dass das Ganze an einen Kreuzgang erinnerte, der zum Verweilen und zum intellektuellen Austausch anregte. Eine gewisse Bescheidenheit gemäss dem baslerischen ‚mehr sein als scheinen‘ war unverkennbar, auch wenn das Innere, insbesondere die Räume für die universitären Gremien und die Professoren, gediegen in der Art der zeitgemässen industriellen Repräsentation ausgestattet war. Die Einweihungsfeier stand 1939 im Zeichen der nationalsozialistischen Bedrohung. In Reden wurden an die Universität Ansprüche gestellt, sie möchte für allgemeine Bildung, für die Vermittlung von Werten zur Abwehr der totalitären Ideologien sorgen und dafür auf weitere Spezialisierung und einen Rückzug auf ‚neutrale‘ Methodenschulung verzichten. Karl Barth begrüsste in seiner Predigt die Universität, die «in die Kirche kommt», und unterstrich die Notwendigkeit eines lebendigen christlichen Fundaments für die Hochschule. Regierungsrat Fritz Hauser provozierte die Festgemeinde dadurch, dass er bei der Schlüsselübergabe eine Hand in der Hosentasche liess, worauf ihn die konservative Presse mit Schmutz bewarf – dabei wäre ohne ihn nichts realisiert worden.140
138 139 140
Diethelm 2003. Rohn 1939, 93. Stirnimann 2021, 245 ff. Reden in: Basler Nachrichten, Sonderbeilage vom 9. und 12. 6. 1939. Die Rede des Rektors Ernst Staehelin (Theologe): Staehelin 1939a; ferner in: Roth 1939. Karl Barth hielt die Predigt zu diesem Anlass mit dem Titel «Der Grund unseres Bauens» über 1. Korinther 3, 11, 11. 6. 1939, Martinskirche Basel. Er schloss diese Predigt mit einer Fürbitte: «Wir bitten Dich [Gott] insbesondere für die Kirche, die in der Versuchung, in der Verfolgung und in der Unterdrückung steht, und für dein bedrängtes Volk Israel in aller Welt». Barth 1996, 162–172. Siehe auch die Dokumente, die in: https:// unigeschichte.unibas.ch/die-universitaet-jubiliert/die-eroeffnung-des-kollegienhauses-1939 greifbar sind.
44
Einführung
1.6 Ziele und Vorgehen Ich fokussiere im Unterschied zu strukturgeschichtlichen Arbeiten wie derjenigen von Wisard141 – die ich sehr schätze – auf einzelne Fakultäten, Disziplinen und Gestalten, um aus einer Nahsicht einen Eindruck davon zu gewinnen, wie diese mit den Zeitverhältnissen umgingen. Dazu ist ein Blick auf die Inhalte von Forschung und Lehre ebenso erforderlich wie die exemplarische Vertiefung in einige Lebensläufe. Konfliktlinien interessieren mich, die bei Lehrstuhlbesetzungen zum Vorschein kamen. Das Verhältnis zwischen Universität, Staat und Öffentlichkeit studiere ich punktuell an einzelnen Ereignissen. Mich beschäftigen hier weniger die materiellen Voraussetzungen: Ich werde keine Statistik der Universitätsfinanzierung, nur wenige Informationen (und keine neuen) über zahlenmässige Entwicklungen der Studierenden und Professoren oder der Räumlichkeiten anbieten.142 Nur marginal beleuchte ich die damalige Rolle der Universität für die Basler Wirtschaft, Technologie, Gesellschaft und Kultur. Keine Behandlung erfährt die «Nachkriegshilfe», obschon die Zeitgenossen darauf stolz waren – vielmehr möchte ich erfahren, wie unter den Bedingungen der Nachbarschaft zur Hitlerdiktatur und während des Krieges gehandelt worden ist. Ich wähle deshalb als Untertitel nicht «Geschichte der Universität 1933–1945», sondern verspreche nur Studien «zur Geschichte der Universität». Das Hauptthema ist die Beziehung zu den deutschen Hochschulen und zu den deutschen Kollegen, auf die die Basler persönlich (durch Freundschaften), strukturell (durch die wissenschaftlichen Kommunikationswege) und emotional (durch ihre sekundäre Sozialisation durch Bildungserlebnisse an deutschen Universitäten) eng bezogen waren. Gesucht werden Basler Zeugnisse der Wahrnehmung von Vorgängen in Deutschland, die Haltung zur Exklusion und Verfolgung Andersdenkender und ‚Andersrassischer‘, aber auch zu Veränderungen in der Wissenschaft (Inhalte, Methoden, Vokabular) und deren Formen der Kommunikation. Ich unterlasse es aber nicht, auf weniger zentrale Einsichten hinzuweisen, die die Basler Wissenschaftskultur und einzelne wissenschaftliche Leistungen in einem Zeitalter der Erneuerung des Wissens wie der Strukturen betreffen. Individuelles Erleben steht für mich oft im Vordergrund: Ich werde einzelne Beobachtungen und Ereignisse auf ihre Bedeutung für die Erkenntnis der Lage von Baslern im Beziehungsgeflecht untersuchen, das sie mit der (für sie meist hegemonialen) Universitätswelt des Nachbarlandes verband. Gewinnen möchte ich eine Vorstellung von der Bandbreite von Wahrnehmungen, Verhalten und Beurteilungen sowie Einblicke in die Bedingungen, die deren Muster ein Stück weit determinierten.
141 142
Wisard 1998. Ein Basler Modell für eine Universitätsgeschichte, die auf Strukturen und Tendenzen achtet, hat Kreis 1986 vorgestellt.
Ziele und Vorgehen
45
Das Vorgehen mag impressionistisch erscheinen – es gibt systematische Ansätze der Hochschulgeschichtsforschung, die ich verwende, wo sie mir hilfreich erscheinen (z. B. den Feldbegriff von Pierre Bourdieu oder funktionalistische Ansätze), aber ich habe nicht den Eindruck gewonnen, dass die Universitätshistoriographie über einen Satz von fest etablierten Theorien verfüge, deren Verwendung nicht nur obligatorisch wäre, sondern auch allein wissenschaftlichen Ertrag verspräche. Etabliert hat demgegenüber die deutsche Geschichtsschreibung bestimmte Narrative, die die Darstellungen prägen, ob sie von einem einzelnen Autor (wie in Frankfurt am Main)143 stammen oder als Kollektivwerke144 aufgezogen worden sind. Diese handeln von der erfolgreichen Nazifizierung (ob «Gleichschaltung» oder «Selbstmobilisierung») und ihren hochschulinternen wie -externen Akteuren, der ideologisch bestimmten Verschiebung des Fächerkanons, veränderten Finanzierungsmöglichkeiten, hochschul- und wissenschaftspolitischen Diskursen und der Exklusion missliebiger und verfolgter Gruppen und Individuen. Das Basler Narrativ kann sich dadurch informieren lassen; ich werde aber daraus nur zwei Motive ableiten: die Widerständigkeit – ich suche nach Antworten darauf, warum die Nazifizierung der Nachbar- und bisherigen Vorbilduniversitäten für Basel schlussendlich nicht attraktiv war, und weshalb eine unmittelbare öffentliche Distanzierung oder organisierte Proteste gegen das Geschehen in Deutschland ausblieben. Aktiver Widerstand ist für Basel ein wenig ergiebiges Thema, vielmehr frage ich nach Resistenz in dem Sinne, dass jemand den Nationalsozialismus als unattraktiv und nicht nachahmenswert wahrnahm. Mein Narrativ ist somit auf weite Strecken von einer manchmal unausgesprochenen und vielfach enttäuschten Erwartung geleitet: dass sich eine Schweizer Grenzuniversität zu einem Ort der aktiven Opposition gegen die Entwicklung ihrer deutschen Schwesterinstitutionen entwickelt hätte. Meine Studie ist keine Auftragsarbeit und dient keinen universitätspolitischen Zwecken, sondern folgt allein meiner Neugier. Die Forschungen zu dieser Studie erstreckten sich über mehr als fünfzehn Jahre, während derer nicht nur das Wissen wuchs, sondern sich auch die Absichten verschoben und klärten. Der grosse Umfang und die Vielfalt des vorhandenen Materials sind typisch für die Basler Quellenlage, so dass die Erwartung einer kompletten Erfassung und Auswertung unrealistisch wäre. Vollständig durchgearbeitet habe ich die Protokolle der Fakultäten, der Regenz und der übergeordneten Instanzen wie Kuratel und Erziehungsrat. In breiter Auswahl habe ich die Akten zu Personen und Instituten herangezogen, die oft auf beiden Stufen, der Universität und der staatlichen Verwaltung, zu greifen sind. In engerer Auswahl habe ich Professorennachlässe benutzt, die teils die Universitätsbibliothek, teils das Staatsarchiv Basel aufbewahren und erschliessen. Wichtig war für mich die 143 144
Hammerstein 2012; Hammerstein 2004. Becker 1998; John 1991.
46
Einführung
Gelegenheit, den Nachlass des Historikers Werner Kaegi in der Paul Sacher Stiftung benützen zu dürfen. Ergänzende Sondierungen nahm ich in Freiburg im Breisgau (Universitätsarchiv und Stadtarchiv) und in den Universitätsarchiven von Frankfurt am Main, Göttingen, Heidelberg und Leipzig vor. Für Einblicke in die Materialien in Berlin erhielt ich Unterstützung von David Hamann, für diejenigen in Zürich, Wien und Wroc aw vom Personal der jeweiligen Universitätsarchive. Ich wollte weitgehend alle Fächer wenigstens streifen, um mich zu vergewissern, dass ich auch neben den gewählten Schwerpunkten nicht an vielversprechenden Nachrichten über Beziehungen zu deutschen Kollegen und Institutionen vorbeigehe. Es ist offensichtlich, dass dieses Vorgehen zu einigen weniger befriedigenden Abschnitten geführt hat. Dabei habe ich darauf Wert gelegt, über die Geisteswissenschaften hinaus, deren Studium für meine Fragestellung an sich besonders nahelag,145 auch andere Wissenschaften gebührend zu berücksichtigen. Universität ist ohne die Studierenden nicht vorstellbar, darum habe ich mich mit deren Wertvorstellungen, Erwartungen und Ansichten über Deutschland befassen wollen. Dafür fand ich insbesondere in den Protokollen der Basler Sektion des Zofingervereins («Zofingia») nützliches Material, ergänzt durch eine Lektüre der Zeitschrift «Basler Studentenschaft». Die Arbeit an diesem Buch wurde von einer Reihe von Institutionen durch Informationen und Dienstleistungen unterstützt, für die ich dankbar bin: Die Archive der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Universität Wien, der Universität Wroc aw, der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel im Landesarchiv Schleswig-Holstein; die Universitätsarchive Freiburg i. Br., Göttingen, Heidelberg, Leipzig und das UZH Archiv Zürich, das Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich, die Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, das Firmenarchiv der Novartis International AG, die Gesellschaft Deutscher Chemiker, das Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, Bibliothek/Dokumentenarchiv des Museums der Kulturen Basel, die Paul Sacher Stiftung Basel, das Sächsische Staatsarchiv/Hauptstaatsarchiv Dresden, das Schweizerische Bundesarchiv in Bern, das Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt, das Stadtarchiv Freiburg i. Br. sowie die Universitätsbibliothek Basel (insbesondere deren Handschriftenabteilung). Verschiedene Persönlichkeiten haben meine Forschungen durch Aufmunterung, Kritik und Vermittlung von Informationen und Kontakten gefördert, für die ich herzlich danke, darunter Helmut Bräuer, Lucas Burkart, Michael Fahlbusch, Johannes Feichtinger, Florian Gelzer, David Hamann, Frank-Rutger Hausmann, Ilse Hilbold, Siegfried Hoyer, Joseph Jurt, Mario König, Georg Kreis, Fabian Link, Nikolaus Meier, Sonja Müller, Markus Ritter, Niklaus Röthlin, Stephan Schwarz, Roger A. Stamm, Charles Stirnimann, Doris Tranter, Jürgen von Ungern-Sternberg und Hermann Wichers. Den Herausgebern danke ich für die Aufnahme des Buches in die Reihe der «Studien zur Geschichte der Wissenschaften 145
Vgl. Bialas/Rabinbach 2007.
Ziele und Vorgehen
47
in Basel». Ricarda Berthold bin ich für das gründliche Lektorat und Ruth Vachek für die kompetente Betreuung von Seiten des Verlags dankbar. Für die finanzielle Unterstützung, die das Erscheinen des Buchs ermöglicht, danke ich der Freiwilligen Akademischen Gesellschaft Basel, dem Rektorat der Universität Basel und der Berta Hess-Cohn Stiftung.
2 Die Basler Studenten und Deutschland 2.1 Einleitung Ich möchte erfahren, wie sich Basler Studierende zu den Vorgängen und Verhältnissen in Deutschland 1933 bis 1945 verhielten und welche Vorstellung sie sich vom Nationalsozialismus machten. Gerne hätte ich auch gewusst, ob nach 1933 noch Basler Studierende nach Deutschland zur Ausbildung gingen, konnte aber keine Auskunftsquelle dafür finden. Für die Kapitelüberschrift wähle ich die maskuline Form, weil meine Hauptquelle, Akten und Berichte des Zofingervereins resp. der Zofingia, eine rein männliche Organisation war. Die Darstellung beginnt mit den entscheidenden Veränderungen der Studienbedingungen in Deutschland selbst und in Ländern, die im Verlauf der Zeit unter deutsche Kontrolle gerieten. Damit möchte ich einerseits einen Hintergrund skizzieren, vor dem die Studienverhältnisse in der Schweiz im Relief erscheinen, andererseits aber auch darauf hinweisen, was Basler Studierende bewegt und erregt haben könnte, wenn sie einen Blick über die Grenzen warfen. Nach einer kurzen Vorschau auf Besonderheiten des studentischen Verhaltens in der Schweiz in dieser Zeit stelle ich in einem Überblick die Organisationen vor, die an der Universität Basel damals tätig waren. Dies ist deshalb nützlich, weil unsere Quellen unmittelbar mit diesen Organisationen zusammenhängen. Danach wende ich mich im Hauptteil Texten zu, die im Schweizerischen Zofingerverein und in dessen Basler Sektion Zofingia entstanden sind. Hier komme ich einer eingehenden, kohärenten studentischen Diskussion am nächsten, auch wenn damit nur ein kleiner Ausschnitt aus der Studierendenschaft erfasst wird. Denn über die Einstellungen der Basler Studenten in den Jahren 1933 bis 1945 können wir uns kein unmittelbares Bild machen. Es gab keine lokale Studentenzeitschrift, die inhaltlich mit dem reichhaltigen «Zürcher Student» vergleichbar gewesen wäre. Das Basler «Mitteilungsblatt», später «Basler Studentenschaft» genannt, diente bis 1939 vor allem für technische Mitteilungen der als Zwangskörperschaft verfassten Studentenschaft und nahm erst danach einige inhaltliche Artikel auf, die offensichtlich nach dem Muster des Zofinger «Zentralblattes» aufgezogen wurden.146 Studierende äusserten sich selten als solche in der Öffentlichkeit, und es kam zu keinen umfangreichen Bewegungen, über die Dokumente angelegt wurden – mit Ausnahme der Kundgebung anlässlich der Ereignisse von Oslo 1943. Zu den bürgerlichen («nationalen», «vaterländischen») Studenten führt uns der Weg über die studentischen Verbindungen. Unter diesen 146
Lotz 1944.
50
Die Basler Studenten und Deutschland
ragt als relativ grosse Organisation mit deutlich über hundert Aktiven147 die erwähnte Basler Sektion des Zofingervereins heraus, die zudem durch ihr im Staatsarchiv Basel-Stadt (StABS) deponiertes Material gut dokumentiert ist. Auf der nationalen Ebene kann das «Zentralblatt» dieses Vereins herangezogen werden, das jedes akademische Jahr von einer anderen Sektion (die den Zentralausschuss stellte) redigiert wurde. Man muss sich allerdings bewusst sein, dass die Tätigkeiten von einem kleinen Kreis aktiver Männer organisiert und moderiert wurden. Die Themenwahl spiegelt nur deren Aufmerksamkeit und Anliegen wider. In den Kriegsjahren verhinderten Zensur und Selbstzensur offene Debatten über das Weltgeschehen, so dass ich nicht weiss, ob ich eine Oberfläche sehe, die mir nicht offenbart, was darunter ablief, oder ob ich die Texte als Spiegel einer für die Opfer des Zeitgeschehens wenig Empathie aufbringenden Studentenelite lesen soll. Da sich die jüdische Studentenorganisation Jordania 1933 auflöste,148 entgeht uns die Möglichkeit, auf diesem Weg Ansichten jüdischer Studenten in den entscheidenden Jahren zu erkennen. Allerdings spielten die Altherren der der Jordania vorausgehenden Nehardea im Basler öffentlichen und politischen Leben eine wichtige Rolle. Soweit die Fürsorge für nach Basel geflüchtete jüdische Studierende und die Auseinandersetzung um den Zionismus betroffen waren, sind die Verhältnisse von Noëmi Sibold149 gut erforscht worden. Andere studentische Kreise erfasse ich indirekt in Situationen, in denen akademische oder staatliche Behörden auf sie aufmerksam wurden, meist um sie zu disziplinieren. Dies gilt sowohl für die nationalsozialistische Organisation deutscher Studenten in Basel (schweizerische Nationalsozialisten oder Faschisten waren an der Universität kaum sichtbar organisiert), als auch für das linke Spektrum aus sozialistischen und sozialdemokratischen Flüchtlingen und den Basler pazifistischen und marxistischen Organisationen.
2.2 Immatrikulierte an der Universität Basel Ich präsentiere hier die Statistik der Immatrikulierten, nicht aber die Hörerzahlen – diese schwankten nur unwesentlich. Die Zahl der Immatrikulierten zeigt deutliche vorübergehende Zunahmen, die offensichtlich durch die Ankunft von Flüchtlingen bedingt waren und sich nach Fakultäten unterschieden. Bei den 147
148 149
Statistiken in: Zentralblatt. Zahlen der Aktiven für die Basler Sektion, z. B.: 1937: 107 (nationaler Gesamtverein 570). 1940: 127. 1942: 130. 1943: 133. 1944: 124. 1945: 126. Basel und die Waadt (Lausanne) hatten jeweils mit Abstand die grössten Sektionen, wobei die Waadt im Verlauf des Krieges Basel überflügelte. Mitteilung der ‚Ablegung der Farben‘ durch die Jordania an die Basler Zofinger, in: StABS PA 1132a, E 7-10 nn, Protokoll der Sektion Basel 1930–1935, 369, 8. 11. 1933. Sibold 2010. Basler Flüchtlingspolitik: Koller 2020; Wacker 1990.
Immatrikulierte an der Universität Basel
51
Theologen stiegen die Zahlen erst in den Jahren 1935 bis 1938 nach der Ankunft von Karl Barth an, sie sanken vorübergehend wieder, nachdem das Basler Studium in Deutschland nicht mehr angerechnet wurde. Die Naturwissenschaften waren anscheinend weniger von der Zuwanderung von Flüchtlingen betroffen, und in den Geistes- und Sozialwissenschaften blieb der entsprechende Anstieg in einem bescheidenen Rahmen. Die deutlichste Steigerung für die Jahre 1933 und 1934, die zudem klar vom langfristigen Trend abweicht, verzeichneten die Mediziner und die Juristen – beides Fakultäten, die einen Numerus clausus einführten. Die Gesamtzahlen zeigen eine relativ kleine Universität, die mit etwa 1’000 Studierenden in die 1930er Jahre eintrat und bei Kriegsende bei fast 2’000 Studierenden anlangte. Dieses Wachstum ergab sich nicht aus einem Zustrom aus dem Ausland, sondern es war schweizerischen Veränderungen zu verdanken. Meine Quelle ist das Statistische Jahrbuch des Kantons Basel-Stadt. Studierende der Universität Basel und Ausländeranteile, 1930 1945 Jahr
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945
Theologische Fakultät Schw. Ausl. % A. 28 28 25 32 27 60 73 73 99 81 100 117 88 92 97 108
27 24 30 28 29 36 37 49 57 14 11 9 7 9 7 6
49 46 55 47 52 38 34 40 37 15 10 7 7 9 7 5
Juristische Fakultät Schw. Ausl. % A. 109 122 115 138 162 162 171 190 195 204 241 259 276 287 301 292
16 13 15 65 41 28 24 24 17 10 13 15 10 19 15 16
13 10 12 32 20 15 12 11 8 5 5 5 3 6 5 5
Medizinische Fakultät Schw. Ausl. % A. 204 222 219 254 265 297 305 315 345 354 372 399 428 457 487 508
143 152 192 327 308 253 188 115 139 84 44 45 48 74 60 62
41 41 47 56 54 46 38 27 29 20 11 10 10 14 11 11
52 Jahr
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945
Die Basler Studenten und Deutschland Phil.-Hist. Fakultät Schw. Ausl. % A. 170 208 219 240 239 251 286 292 342 350 398 430 470 453 449 451
85 95 89 130 124 104 104 89 86 70 60 51 50 109 78 77
33 31 29 35 34 29 27 23 20 17 13 11 10 19 15 15
Phil.-Nat. Fakultät Schw. Ausl. % A. 193 200 220 233 237 239 242 267 275 296 318 333 364 369 381 417
72 73 82 71 60 58 52 54 57 49 41 42 37 58 54 51
27 27 27 23 20 20 18 17 17 14 11 11 9 14 12 11
Alle Fakultäten (davon Frauen) Schw. Ausl. % A. 704 (73) 780 (92) 798 (106) 897 (124) 930 (149) 1009 (164) 1077 (173) 1137 (193) 1256 (201) 1285 (204) 1429 (212) 1538 (221) 1626 (269) 1658 (269) 1715 (273) 1776 (264)
343 (44) 357 (44) 408 (52) 621 (100) 562 (101) 479 (89) 405 (74) 331 (67) 356 (69) 227 (45) 169 (46) 162 (33) 152 (38) 175 (38 214 (41) 212 (50)
33 (38) 31 (32) 34 (33) 41 (45) 38 (41) 32 (35) 27 (30) 23 (26) 22 (26) 15 (18) 11 (18) 10 (13) 9 (12) 10 (12) 11 (13) 11 (16)
Quelle: Statistisches Jahrbuch Schw. Schweizer resp. Schweizerinnen Ausl. Ausländer resp. Ausländerinnen % A. Prozentualer Anteil Ausländer resp. Ausländerinnen
2.3 Die Veränderungen an deutschen Universitäten und in besetzten Gebieten Bevor über die Schweizer Studierenden gesprochen wird, sollten wir uns vergegenwärtigen, was über das Schicksal der Studierenden im benachbarten Deutschland bekannt ist.150 Denn man darf annehmen, dass infolge der Gewohnheit bessersituierter Basler Studenten, einige Semester im deutschen Ausland zuzubringen, viele Kontakte zu deutschen Kommilitonen bestanden und die Basler dadurch Informationen aus erster Hand über die Nazifizierung der Universitäten besassen. Auch die aus Deutschland geflohenen Wissenschaftler haben die europäische Öffentlichkeit über die Gleichschaltung der deutschen Hochschulen gut informiert.151 Schon vor 1933 strebten nationalsozialistische Studierende oft erfolgreich danach, die gewählten Studentenschaften zu beherrschen. Zwar waren sie bei den 150 151
Gevers/Vos 2004, 287–291; Hammerstein 2004, 535–540. «Einleitung des Herausgebers – die Gleichschaltung der deutschen Hochschulen», in: Gumbel 1938, 9–28.
Die Veränderungen an deutschen Universitäten und in besetzten Gebieten
53
Universitätsleitungen als Unruhestifter nicht beliebt, aber selten wurde ein entscheidender Schlag gegen sie geführt, da sie als Vertreter nationalen Gedankenguts mit Sympathien rechnen konnten. Disziplinarmassnahmen gegen Gewalttäter aus den rechten Reihen blieben in der Regel milde.152 1933 gaben sich die nationalsozialistischen Studenten vorübergehend sehr radikal (und wurden von der mit ihnen sympathisierenden NS-Presse auch so dargestellt).153 Sie halfen jüdische und demokratische Professoren durch Vorlesungsboykotte aus ihren Stellungen zu verdrängen, organisierten die bekannten Bücherverbrennungen und etablierten den Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund (NSDStB) als Mitspracheinstanz bei der ideologischen Überwachung der Lehrenden und der Selektion von Kandidaten für Dozenturen und Professuren. Vor allem, wenn er mit dem zuständigen Gauleiter gute Beziehungen unterhielt, bewahrte der NSDStB diese Position über die ‚heisse Phase‘ von 1933/34 hinaus. Die traditionellen studentischen Verbindungen wurden 1935/36 als elitär und reaktionär verboten, aber nicht mit dauerhaftem Erfolg, da die Altherren nicht völlig übergangen werden konnten. Nachdem die inkohärente Hochschulpolitik des Regimes vergeblich versucht hatte, Studienanfänger in eigenen Häusern zu kasernieren, setzte sie durch, dass Lager für Sport und ideologische Schulung obligatorisch wurden und «Fachschaften» gegründet wurden, die jeweils ein Nationalsozialist leitete und in denen die Mitgliedschaft zwingend war. Weitere Verpflichtungen wie Arbeitsdienst schürten Missmut gegen fachfremde Betriebsamkeit. Die nationalsozialistischen Studentenfunktionäre hatten somit seit 1934 eine schwere Aufgabe.154 Nicht, dass die unbeliebten Massnahmen zum Gegenstand einer grundsätzlichen Regimekritik geworden wären – viele Aspekte des Nationalsozialismus wurden von Studierenden gebilligt, und die Bereitschaft, sich im Krieg für Deutschland zu engagieren, war gross. Die nationalsozialistische Indoktrination hatte eine Entpolitisierung zur Folge, aber kein Abrücken von der grundsätzlich ‚vaterländischen‘ und völkisch-antisemitischen Einstellung.155 Der Weg der deutschen Wirtschaft in den Krieg brachte es gegen Ende der 1930er Jahre mit sich, dass an Hochschulen ausgebildete Fachkräfte gesucht und darum ein gewisses studentisches Eigenleben wieder zunehmend toleriert wurde. Grundsätzliche Opposition blieb auf meist isolierte Gruppen beschränkt, die aus religiösen, ethischen, patriotischen oder sozialistischen Antrieben handelten und dabei ihr Leben riskierten. Diese Opposition ist nicht zu verwechseln mit einer kulturellen ‚Resistenz‘ von Schülern und Hochschülern beider Geschlechter, die sich in subkulturellen Formen wie besonderer Kleidung und Vorlieben für offizi-
152 153 154 155
Giles 1991, 45, 47. Giles 1991, 44. Grüttner 1995, 473; Giles 1991, 51. Grüttner 1995, 478, 480.
54
Die Basler Studenten und Deutschland
ell als ‚dekadent‘ eingestufte Musik manifestierte.156 Nachdem der Zugang für Frauen in den 1930er Jahren beschränkt worden war und die Universitäten durch Spardruck und Umwidmung von Ressourcen Studierende verloren hatten, wurde das Frauenstudium im Krieg zu einem verbreiteten Phänomen.157 Trotz anfänglicher Bekenntnisse führender Nationalsozialisten zu einer ‚Demokratisierung‘ der Bildungseliten durch eine Öffnung für Arbeiterkinder blieben die Kinder bürgerlicher Familien, die in der Lage waren, ihnen das Studium zu bezahlen, das vorherrschende gesellschaftliche Element unter den Studierenden. Wenn sie sich äusserlich anpassten (z. B. durch Eintritt in die NSDAP oder eine Unterorganisation der Partei), hatten sie nun bessere Karrierechancen als in der Weimarer Zeit.158 Demokratisch-republikanische Studierende, Marxisten, teilweise auch Sozialdemokraten wurden zusammen mit den Juden aus den Hochschulen vertrieben; diese Säuberung betraf ca. fünf Prozent des Bestandes, riss also relativ betrachtet geringere Lücken als die Säuberung unter den Lehrenden.159 Die Zahl der Studierenden sank jedoch beträchtlich (von 116’000 im Sommer 1933 auf 77’000 im Sommer 1935 und auf 58’000 im Winter 1938/39), und das Ansehen der Akademiker wurde von Nationalsozialisten durchgehend relativiert. Jüdische Studierende wurden seit Frühjahr 1933 drangsaliert und marginalisiert, zunächst etwa durch Testatbücher in gelber Farbe.160 Niedrige Kontingente (Judenanteile an der Studentenzahl) wurden definiert, die aber an einzelnen Universitäten gar nicht erreicht wurden. Neuimmatrikulationen von «Volljuden» wurden ab Herbst 1934 nicht mehr vollzogen.161 Nach dem Verbot der Zulassung zu Prüfungen erfolgte nach dem Pogrom von 1938 das generelle Studienverbot. Waren im Wintersemester 1932/33 4’400 Studenten Juden, gab es davon im Wintersemester 1933/34 noch 800 und 1938/39 keine mehr.162 Sogenannte «Mischlinge» konnten hingegen unter Umständen weiterstudieren. Von alledem erfahren wir in der Studentenpresse und in den Protokollen studentischer Verbindungen in Basel und der übrigen Schweiz wenig, wie ich noch zeigen werde. Das Studium der studentischen Presse und studentischer Organisationen in Basel wird uns ferner lehren, dass hier bis Kriegsende auch sehr wenig über die Vorgänge an Universitäten wahrgenommen wurde, die seit 1938 unter unmittelbaren nationalsozialistischen Druck gerieten, wie diejenigen in der Tschechoslowakei, dann in Polen, im Baltikum, in Dänemark, Norwegen, Bel156 157 158 159 160 161 162
Grüttner 1991, 201–236. Grüttner 1995, 477 f. Grüttner 1995, 477. Grüttner 1995, 476 f. Hausmann 2000, 47 Giles 1991, 48. Hausmann 2000, 47.
Die Veränderungen an deutschen Universitäten und in besetzten Gebieten
55
gien, Luxemburg, den Niederlanden und in Frankreich. Zur Repression gegen Universitäten, die von den Besatzern als Oppositionsherde identifiziert wurden, kamen die allgemeinen Übelstände wie Hungersnot hinzu, die auch Studierende und Lehrende betrafen. Darüber wurde in Basel in der Regel nicht vor 1944 informiert, geschweige denn diskutiert. Hingegen geriet China gelegentlich in den Blick, wo die Universitäten unter japanischen Übergriffen litten, und Griechenland, dem die Basler eine traditionelle philhellenische Aufmerksamkeit entgegenbrachten. Zu Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland öffnete sich 1943 kurzzeitig ein Fenster anlässlich der Protestaktionen gegen die deutschen Besatzer in Oslo, die Studierende und Lehrende verhafteten, misshandelten und deportierten. Über die Vorgänge in Strassburg hatte man in Basel eine gewisse Kenntnis; so wurde der Rektor zur Eröffnungsfeier der neuen «Reichsuniversität» 1941 offiziell eingeladen, und ein Basler Professor (Hans Ritschl, Nationalökonom) trat in den Lehrkörper dieser nationalsozialistischen Hochschule über.163 Eine Ausnahme von dem üblichen Schweigen machte der in Genf domizilierte Fonds européen de secours aux étudiants (FESE)164 mit seinen Bestrebungen, «kriegsnotleidenden» Studenten zu helfen. In Basel wurden dessen Aufrufe zu Spenden seit 1942 verbreitet und Geldsammlungen durchgeführt. Jüdische Studenten wurden in den Mitteilungen, die in Basel weitergegeben wurden, nicht ausdrücklich erwähnt. Seit 1940 interessierte sich die Basler Studentenschaft für die als internierte Soldaten in der Schweiz weilenden Studenten aus kriegführenden Ländern.165 Verdeckt blieben in Basel bis zum Eklat von Oslo 1943 Informationen über studentischen Widerstand und Untergrunduniversitäten in den nordischen Ländern. 1945 lancierten Professoren und Studierende gemeinsam eine «Nachkriegshilfe».166 Diese bestand vor allem aus einer Patenschaft für die Universität Utrecht, aus Büchersendungen, aus der Beherbergung von Studierenden und der finanziellen Hilfe für die Hospitalisierung kranker Studierender aus befreiten Ländern sowie einer Hilfe für Studierende aus der badischen Nachbarschaft. Sie war gewissermassen eine intensivierte Fortsetzung dessen, was seit 1942 die Unterstützung für den FESE etwa mit Patenschaften für hungernde Studierende in Belgien167 oder Griechenland bewirken sollte.168
163 164 165 166 167 168
Zürcher 2012 erwähnt diesen Wechsel nach Strassburg nicht. Fonds Européen de Secours aux Étudiants, domiziliert in Genf. Ein «Bulletin» wurde seit 1942 herausgegeben. Erste Erwähnung in Basler Studentenschaft WS 1940/41, H. 1, 10 f. Bonjour 1960, 823. Reimann WS 1942/43. Die «Basler Studentenschaft» berichtete ab WS 1944/45 (H. 2, Februar 1945) über die Leiden von Studierenden in Kriegsgefangenschaft und in Ländern unter deutscher Besatzung sowie über die Massnahmen der «Nachkriegshilfe».
56
Die Basler Studenten und Deutschland
2.4 Neutrale und unpolitische Basler Universität Unsere Quellen reflektieren den ‚offiziellen‘ Wissens- und Diskussionsstand universitärer und studentischer Gremien. Ich nehme an, dass man in Basel privat sehr viel mehr wusste und zum Teil auch mehr tat, als aus diesen Quellen ersichtlich ist. In den Institutionen – Studentenschaft, Studentenverbindungen, Fakultäten, Regenz und Rektorat – herrschte bis Kriegsende das Bestreben vor, «neutral» zu sprechen und «unpolitisch» zu bleiben. Dies hatte zur Folge, dass Taten und Täter nicht offen benannt wurden und kritische Informationen, woher sie auch kamen, als Propaganda abgetan werden konnten. Man sprach allgemein von «den kriegführenden Mächten» oder vom «Krieg», auch wenn im Sinne einer kodierten Sprache ganz eindeutig inhumane Massnahmen einer bestimmten (nämlich der deutschen) Seite gemeint waren. Die Neutralität hatte bis kurz vor Kriegsende die Funktion, die deutschen Stellen nicht zu reizen und damit zum Erhalt des 1940 erreichten Verhältnisses zum nördlichen Nachbarn beizutragen. In den Debatten unter Studierenden trat dies offen zutage, wie ich noch zeigen werde. Diese Zurückhaltung unterschied sich von der Haltung der liberalen und demokratischen Basler Presse, aber auch von der Position vieler Studierender vor 1940, die betont hatten, dass sich Neutralität nur auf das militärische Gebiet erstrecke und es keine «totale Neutralität» (in der Art einer Gesinnungsneutralität) geben dürfe.169 Die Forderung nach einer «unpolitischen» Universität hatte viele Aspekte. Sie diente zur Vermeidung inneruniversitär ausgetragener Kämpfe zwischen Frontisten und Linken, aber auch zur ruhigen Entwicklung individueller Standpunkte unter den jungen Akademikern, die nicht gezwungen werden wollten, schon ‚früh‘, vor dem Abschluss ihres Bildungsgangs, Partei zu ergreifen. Da allerdings das Feld des Unpolitischen so umschrieben war, dass dem «Vaterländischen» ein bedeutender Platz innerhalb dieses Unpolitischen eingeräumt wurde, ist es leicht erkennbar, dass dieses Feld einem «juste milieu» aus liberalkonservativen und gemässigten demokratischen Überzeugungen entsprach. In der Öffentlichkeit durfte sich die Studentenschaft als Zwangskörperschaft zwar nicht politisch engagieren, aber davon ausgenommen waren «nationale» Fragen. Solche Ausnahmen waren das Engagement für den militärischen Vorunterricht und der zusammen mit der Regenz organisierte Protest gegen das deutsche Vorgehen an der Universität Oslo vom 6. Dezember 1943, der auf einer von den Verbindungsstudenten vorgegebenen und der Universitätsleitung genehmen Linie lag (dazu unten mehr). Die Ausgrenzung des ‚Politischen‘ traf zunächst vor allem die Linke. Demokratiefeindliche und antiliberale Ideen galten bis zur zweiten Hälfte der 1930er Jahre noch als unpolitische Denkanstösse zur Überwindung der «Krise» in Poli169
Rothmann WS 1939/40.
Studentische Organisationen in Basel. Ein Überblick
57
tik, Kultur und Gesellschaft. Erst die in der ‚geistigen Landesverteidigung‘ vollzogene Identifikation des schweizerischen Frontismus170 und verwandter Gruppen mit einer nationalsozialistischen («ausländischen», «unschweizerischen») Infiltration führte zur Ausgrenzung auch der extremen Rechten aus dem Feld des Unpolitischen.
2.5 Studentische Organisationen in Basel. Ein Überblick 2.5.1 Die Basler Studentenschaft In Basel gab es von 1918 bis 1974 eine Vertretung der Studierenden, die als Zwangskörperschaft organisiert war.171 Alle Immatrikulierten zusammen bildeten diese Basler Studentenschaft, die als Gegenüber der Professorenschaft (d. h. Regenz und Rektorat) und der vorgesetzten Behörden fungierte. Sie wurde von den farbentragenden Verbindungen dominiert. Die Studentenschaft war Mitglied beim Verband der Schweizer Studentenschaften (VSS), dessen «zentralistische» Einstellung und grosszügiges Geldausgeben immer wieder die Basler Kritik herausforderten. Das Basler «Mitteilungsblatt» (bald «Basler Studentenschaft» genannt) lud zu den Generalversammlungen ein und berichtete nach Schluss der Versammlung über die Ergebnisse. Der Vorstand wurde von der Generalversammlung aufgrund eines Vorschlags gewählt, den der abtretende Vorstand im Einvernehmen mit den farbentragenden Verbindungen ausgehandelt hatte. Mit Hans-Peter Tschudi, dem späteren sozialdemokratischen Bundesrat, wurde 1935 erstmals ein «Wilder», ein nicht in einer Verbindung organisierter Student, Präsident der Studentenschaft – er bemühte sich allerdings selbst energisch um eine «unpolitische» Studentenschaft.172 Faktisch bestand die Hauptaufgabe des Vorstandes und seiner Kommissionen in der Führung des Zeitungslesesaals und der studentischen Leihbibliothek (wo über lange Zeit der Sozialist Fritz Belleville beschäftigt wurde),173 in der Vermittlung von Zimmern, in der Veranstaltung von Vorträgen und im Aushandeln von Rabatten im Buchhandel, im Stadttheater, in Restaurants und in Ladengeschäften. Ferner engagierte man sich in der Mensa sowie in Stipendienfragen. Sport war ein wichtiges Arbeitsfeld, aber auch die Organisation des Arbeitsdienstes der Studierenden in der «Anbauschlacht» und die
170 171 172
173
Schumacher 2019; Wolf 2006. Anonym 2010. Tschudi 1993, 40. Bericht über die Generalversammlung der Studentenschaft vom 26. 2. 1935 (Basler Studentenschaft SS 1935, H. 2, 1–4). Vgl. auch den Bericht über die Generalversammlung der Basler Studentenschaft vom 25. 2. 1936 (Basler Studentenschaft SS 1936, H. 1, 3–4). Erstmals erwähnt in Basler Studentenschaft WS 1941/42, H. 3.
58
Die Basler Studenten und Deutschland
Sammlungen für die Hilfsaktivitäten der internationalen Studentenhilfsorganisation FESE.174 Die Generalversammlungen verliefen mit Ausnahme der bewegten Jahre um 1933 und einiger angespannter Situationen in den 1940er Jahren ereignisarm. Kontroverse Debatten innerhalb der Studentenschaft wurden meist vom Vorstand als Versuch, «Politik» in die Zwangskörperschaft hineinzutragen, abgetan. An der Generalversammlung vom 2. März 1933 drückte der abtretende Präsident Böhringer seine Hoffnung aus, dass sich die Universität «von übler Parteipolitik» wie im Ausland fernhalten möge. Starker Applaus folgte seinen Worten.175 1943 gab die Trennung der Studentenschaft von ihrer Filmkommission zu reden. Formal wurde diese Trennung mit dem eigenmächtigen Vorgehen des Kommissionspräsidenten Peter Bächlin und seinem Finanzgebaren begründet; die Auseinandersetzung legte aber auch offen, dass der Kurs dieser Kommission zu weit nach links führte und mit der antikommunistischen Grundstimmung der Studentenschaft unvereinbar war. «Die Studentenschaft Basel kann sich mit solchen Tendenzen, welche geeignet sind, Zweifel an der Lebenskraft unserer schweizerischen Kultur wachzurufen, nicht solidarisch erklären.»176 Die «Politisierung» wurde abgelehnt, weil die Verbindungsstudenten, aber auch die Professoren in Basel keine parteipolitischen Vertretungen in der Studentenschaft haben wollten und schon gar keinen Einbruch der Politik von aussen, wofür die noch vor 1933 begonnene nationalsozialistische Herrschaft über die Studentenvertretungen an den Universitäten in Deutschland das negative Beispiel abgaben. Stellungnahmen der Studentenschaft kamen dennoch vor. So verzichtete sie einige Tage darauf, Zeitungen aus dem ‚Reich‘ in ihrem Lesesaal aufzulegen, aus Protest gegen die Verbote schweizerischer Zeitungen in Deutschland.177 Später hätte eine solche Massnahme allerdings als ‚unneutral‘ gegolten. Hinweise auf den Umgang mit nach Basel geflüchteten Studierenden aus Deutschland sind im Umfeld der Studentenschaft ausserordentlich selten – es scheint, dass das Thema bis Kriegsende gezielt vermieden worden ist. Eine Ausnahme bildete der Satz im Protokoll der Generalversammlung vom Februar 174
175 176
177
Die Kommission für Studentenhilfe sammelte für den FESE. Bei Bezahlung der Semestergebühren sollte jede(r) zusätzlich Fr. 2 dafür geben (Basler Studentenschaft SS 1943, H. 4, 121. Basler Studentenschaft SS 1933, H. 2, 6 f. Über die Streitigkeiten mit «Le Bon Film» 1943 ein kleines Dossier in: StABS UA V 32, 4 Studenten, Studentenschaft, Gemeinstudentische Einrichtungen, Studentenhilfe 1918– 1938–1944. Die Kontroverse ist ausführlich behandelt im Mitteilungsblatt, u. a. in Basler Studentenschaft WS 1938/39, H. 2, 4 f. Siehe den Tätigkeitsbericht des Vorstandes der Studentenschaft Basel für das Jahr 1940/41 (Basler Studentenschaft WS 1940/41, H. 2, 2– 7). Höfflin WS 1942/43. Das Zitat im Text stammt aus «Studentenschaft und ‚Le Bon Film‘» (Basler Studentenschaft SS 1943, H. 5, 149 f.). Basler Studentenschaft WS 1933/34, H. 1, 16, Dauer vom 10. bis 15. 11. 1933.
Studentische Organisationen in Basel. Ein Überblick
59
1934: «Ein jüdischer Kommilitone benützt die Gelegenheit, den Dank seiner Gesinnungsfreunde den Basler Studierenden auszusprechen für die Gastfreundschaft, die ihnen zuteil wird.»178 Die Studentenschaft setzte sich auch dafür ein, dass die «auswärtigen» Studierenden nicht mehr von der Fremdenpolizei gezwungen werden sollten, während der Sommerferien die Schweiz zu verlassen. Der Zwang zur Heimkehr in den Semesterferien stellte Studierende, die aus politischen oder ‚rassischen‘ Gründen aus ihrer Heimat geflohen waren, vor unlösbare Probleme, wenn sie es nicht vorzogen, in den Untergrund zu gehen.179 Die 1943 durchgeführte Büchersammlung sollte offensichtlich Basler Studierenden (nicht Flüchtlingen) helfen, die aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch wegen der allgemeinen Schwierigkeit, Lehrbücher zu beschaffen, in eine Notlage geraten waren.180 Die von der Studentenschaft organisierten Vorträge lassen sich aus der Chronik in den Basler Jahrbüchern und aus den Jahresberichten des Vorstandes im Mitteilungsblatt rekonstruieren. So war zum Beispiel am 8. Januar 1935 Emmanuel Mounier eingeladen, der über die «Révolution personnaliste et communautaire» sprach, am 18. November 1935 Robert Musil, und am 20. Januar 1939 Denis de Rougemont. Am 28. Oktober 1935 war Egon Freiherr von Eickstedt, ein deutscher Anthropologe und massgeblicher Vertreter der Rassentheorie im Nationalsozialismus, bei der Studentenschaft eingeladen. Solch eindeutige Veranstaltungen blieben aber selten, denn die Studentenschaft bot den Nationalsozialisten in der Regel keine Plattform, lud vielmehr auch Antifaschisten wie Carlo Sforza ein (9. Juni 1936).181 Ausgewogenheit und Neutralität des Programms war ein Ziel des Vorstandes, doch trafen seine Versuche, auch Marxisten (dissidente wie Karl Korsch und orthodoxe wie Karl August Wittfogel) zu Wort kommen zu lassen, auf wenig Gegenliebe bei den Studierenden.182 Dagegen stellte die marxistische Studentengruppe Auftritte von dem Nationalsozialismus nahestehenden Rednern an den Pranger.183 Die «Neutralität» des Programms wurde im Krieg
178 179 180 181 182
183
Basler Studentenschaft SS 1934, H. 2, 5–7. Siehe den Tätigkeitsbericht des Vorstandes der Studentenschaft Basel für das Jahr 1936/37 (Basler Studentenschaft WS 1936/37, H. 2, 3–8). Bonjour 1960, 813. StABS UA V 32, 4 Studenten, Studentenschaft, Gemeinstudentische Einrichtungen, Studentenhilfe 1918–1938–1944. Basler Studentenschaft SS 1936, H. 1, 4 f. Der Vortragsausschuss rechtfertigte sich wegen des politischen Profils der Eingeladenen (Basler Studentenschaft WS 1932/33, H. 2, 9–11). Die definitive Vortragsliste im Jahresbericht des Vortragsausschusses für 1932/33 (Basler Studentenschaft WS 1932/33, H. 3, 12 f). linke front Nr. 4/5 vom WS 1933/34 gegen «Edelfaschisten» wie Friedrich Sieburg, Robert Michels, Erwin Guido Kolbenheyer, Jules Romains (der in Frankreich den Faschismus als «Herrschaft der Intelligenz» propagiere) und den Germanisten Josef Nadler, der «Blut
60
Die Basler Studenten und Deutschland
von einzelnen Studenten eingefordert und von der Studentenschaft durchgehalten. Dazu ein Beispiel: Am 31. März 1944 wandte sich Hans R. Linder (später Feuilleton-Redaktor der «National-Zeitung») als zuständiges Vorstandsmitglied der Studentenschaft mit dem Plan der Vorträge für das Sommersemester an Rektor Carl Henschen. Er berichtete dem Rektor, dass Hans Spörri, Präsident der theologischen Fachschaft, zusammen mit der Studentenschaft eine Vortragsreihe über die «Rechtslage in Europa» durchführen wolle. «Ich habe nun eine solche Zusammenarbeit abgelehnt, da Herr Spörri nicht bestreiten konnte, dass es sich bei seinem Projekt unter anderem auch um eine Anprangerung ausländischer politischer Systeme handeln werde.» Eine politische Kundgebung unter der Flagge des Vortragsausschusses könne er nicht verantworten.184 Im Krieg wurden Schweizer Gastreferenten bevorzugt – ausgenommen davon waren einige deutsche Professoren, die als Kulturbotschafter mit Billigung des Regimes Vortragsreisen in der Schweiz abhielten. Zu ihnen gehörten der Physiker Werner Heisenberg und der Naturphilosoph Bernhard Bavink. Beim Vortrag des Letzteren in Basel wurde die politische Bedeutung solcher Vortragsreisen sichtbar, weil er mit den beginnenden Protesten gegen das Vorgehen gegen die Professoren und Studierenden von Oslo zusammenfiel und weil vor dem Kasino, wo Bavink sprach, antideutsche Handzettel verteilt wurden. Die Studentenschaft entschied daraufhin, gar keine deutschen Referenten mehr einzuladen und den bereits kontaktierten Mediziner Ferdinand Sauerbruch wieder auszuladen.185 2.5.2 Verbindungen Die farbentragenden Verbindungen hatten sich in einer Dachorganisation, dem Delegiertenconvent (D.C.), zusammengeschlossen, der öffentliche Manifestationen (Fackelzüge, Auftritte bei universitären Feiern, Begräbnissen etc., aber auch gemeinsame Feste und Bälle) koordinierte und den Wahlvorschlag für das Präsidium der Studentenschaft aushandelte. Eine Rolle spielte auch die Verteilung des Schadenersatzes unter den Verbindungen, der nach Gelagen («Commers») und Beschädigungen an privaten und öffentlichen Einrichtungen zu leisten war. Diese Verbindungen waren der sichtbarste Ausdruck studentischen Lebens an der Universität. Alle waren sie einer «vaterländischen» Einstellung verpflichtet, pflegten die im 19. Jahrhundert etablierte studentische Folklore und die Freundschaft un-
184 185
und Boden» als bestimmende Mächte des Lebens in die Geisteswissenschaften eingeführt habe. Dossier über «Vortragsausschuss 1931–1944», in: StABS UA V 32, 4 Studenten, Studentenschaft, Gemeinstudentische Einrichtungen, Studentenhilfe 1918–1938–1944. Jahresbericht des Vorstandes der Studentenschaft Basel für das Jahr 1943/44 (Basler Studentenschaft WS 1943/44, H. 3, 71–82).
Studentische Organisationen in Basel. Ein Überblick
61
ter Brüdern, aber auch die Beziehung zu ihren Altherren. Innerhalb dieses Rahmens gab es Unterschiede. Besonders die Abstinentenverbindung Rhenania beteiligte sich nicht am üblichen Bierkult, aber auch die Zofingia hatte de facto einen besonderen Status als Verbindung der Söhne der lokalen Bourgeoisie, die Wert auf eine Bildung legte, die neben kulturellen Themen auch politische und gesellschaftliche Fragen einschloss und manchmal Gelegenheit zur vorübergehenden Öffnung auf alternative (reformerische) Positionen gab. Der 1941 erfolgte Austritt der Zofinger aus dem D.C. war zwar durch eine Schlägerei mit Angehörigen anderer Verbindungen veranlasst, war aber doch auch symptomatisch für deren Position innerhalb der farbentragenden Verbindungen. Das Spektrum der Verbindungen blieb über die Zeit relativ stabil. Aus der jährlich in der Zeitschrift «Studentenschaft Basel» publizierten Liste lässt es sich rekonstruieren:186 Die Helvetia, eine Sektion der schweizerischen Studentenverbindung Helvetia, wurde seit Sommersemester 1935 im Verzeichnis der Verbindungen erwähnt. Die Rauracia war eine Sektion des Schweizerischen Studentenvereins (St.V.), die «im Sinne und Geiste der katholischen Kirche» wirken wollte; sie wurde während der ganzen Untersuchungsperiode aufgeführt. Die Rhenania, die Basler Sektion der schweizerischen akademischen Abstinentenverbindung Libertas, war ebenfalls während der ganzen Untersuchungsperiode präsent. Dasselbe gilt von der Alemannia, einer Sektion («Korporation» ab 1936) der Schweizerischen akademischen Turnerschaft. Keine nationale Anbindung hatte die Jurassia, die sich als politisch und religiös neutral verstand und während der ganzen Untersuchungsperiode aktiv war. Das Schwizerhüsli, eine Kartellverbindung des Falkensteinerbundes, existierte ebenfalls während der ganzen Untersuchungsperiode. Die Froburger bildeten eine weitere Sektion des St.V.; dementsprechend wirkten auch sie «im Sinn und Geist der katholischen Kirche». Ab Sommersemester 1940 wurde diese damals neue Gruppe aufgeführt.187 Zu diesen sieben Verbindungen kam die Zofingia, die Basler Sektion des Zofingervereins, hinzu, die bis zum 1. Juli 1941 zusammen mit den obengenannten den Delegiertenconvent bildete. Nur vorübergehend erwähnt wurden zwei weitere Verbindungen: Die jüdische akademische Verbindung Jordania fehlte in der Liste ab Sommersemester 1934 (siehe dazu weiter unten), dasselbe gilt für die Palatia mit den Zielen Turnen, Wandern, Freundschaft. Da die Verbindungen (und immer wieder auch der Vorstand der Studentenschaft) zu den «vaterländischen» Organisationen gehörten, die Sozialismus und 186
187
StABS UA V 32, 6 Studenten Studentenschaft Delegiertenconvent der farbentragenden Verbindungen (D.C.) 1922–1945–1949. Ich folge der 1944 im D.C. festgehaltenen Reihenfolge. Die Froburger waren eine Abspaltung der Rauracia, gegründet 1939 im Einvernehmen mit dem Zentralpräsidenten (C.P.) des Schweizerischen Studentenvereins (St.V.)
62
Die Basler Studenten und Deutschland
Kommunismus bekämpften, stellten sie sich anlässlich der Verurteilung des Genfer Sozialistenführers Léon Nicole zusammen mit andern sich als «tatbereit [!] und entschlossen» bezeichnenden Organisationen hinter die Forderung, Nicole müsse aus dem Nationalrat ausgeschlossen werden.188 Die Studentenschaft warb im Vorfeld der jeweiligen Abstimmungen für die Wehranleihe und den militärischen Vorunterricht.189 2.5.3 Andere Organisationen Neben diese Verbindungen traten Organisationen, die insofern vom Rektorat ‚anerkannt‘ waren, als sie dort ihre genehmigten Statuten und ihre Mitgliederlisten deponiert hatten, Aushänge am «schwarzen Brett» anschlagen durften und im Mitteilungsblatt «Basler Studentenschaft» aufgeführt wurden. Aus dem erwähnten Mitteilungsblatt ergibt sich folgende Liste: – Studentinnenvereinigung Basel (während der gesamten Untersuchungsperiode präsent), – Zirkel katholischer Studentinnen (während der gesamten Untersuchungsperiode präsent), – Renaissance Basel, Sammlung katholischer Akademiker und Künstler (während der gesamten Untersuchungsperiode präsent), – Neu ab SS 1938: Akademische Vinzenzkonferenz, gegründet 1931, pflegte die Caritas im Sinne von Frédéric Antoine Ozanam, – Neu ab SS 1938: Haus der katholischen Studenten, Petersgraben 13/Herbergsgasse 7, zu Beginn des WS 1937/38 eröffnet, – Neu ab SS 1939: Basler Studentenkreis, Präsident Adolphe Vaudaux (rer. pol.), Georges Gansser (iur.) und Bruno Thommen (med.). Ziele: Geistige und gesellschaftliche Tätigkeit, Kontakt mit Vertretern des kulturellen Lebens, Vortragsabende, – Neu ab SS 1941: Ladinia, eine Sektion der Zentralverbindung Ladinia an den schweizerischen Hochschulen, Organisation romanischer Studenten,
188
189
Basler Nachrichten vom 6. 6. 1933, Ausriss, in: Protokollbuch des Delegiertenconvents der Universität Basel, StABS UA V 32, 6 Studenten Studentenschaft Delegiertenconvent der farbentragenden Verbindungen (D.C.) 1922–1945–1949. Die anderen Organisationen, die den Text unterzeichneten, waren: der Bund für Volk und Heimat, die Korporationenverbände der Universitäten Bern, Freiburg und Zürich, die Eidgenössische Front, die Nationale Front, die Neue Schweiz, der Ostschweizer und der Zentralschweizerischer Kavallerieverein, die Schweizer Heimatwehr, die Schweizerische Offiziersgesellschaft, der Schweizerischer Unteroffiziersverband, der Schweizerische Vaterländische Verband und die Schweizerische Wehrvereinigung. Basler Studentenschaft (WS 1940/41, H. 2, 8–10).
Studentische Organisationen in Basel. Ein Überblick
63
– Christliche Studenten-Vereinigung Basel, evangelisch (während der gesamten Untersuchungsperiode präsent), – Akademischer Alpenklub Basel (bis SS 1941 präsent), – Neu ab SS 1934: Schweizerischer akademischer Skiclub (bis SS 1941 präsent), – Neu ab SS 1935: Europäische Studentengruppe an der Universität Basel, Kollektivmitglied der Europa-Union (ab SS 1937 nicht mehr präsent), – Basler Kammerorchester (bis SS 1940 als studentische Vereinigung erwähnt), – Akademisches Orchester Basel (während der gesamten Untersuchungsperiode präsent), – Orchestervereinigung (bis SS 1940 als studentische Vereinigung erwähnt), – Schweizerischer Klinikerverband, Sektion Basel (neuer Name ab SS 1934: Verbindung Schweizer Kliniker, Sektion Basel, während der gesamten Untersuchungsperiode erwähnt), – Schweizerische Zahnärztliche Klinikerschaft, Sektion Basel (während der gesamten Untersuchungsperiode präsent), – Neu ab SS 1945: Vorklinikerverband der Universität Basel, Vereinigung der Medizinstudenten der propädeutischen Semester, – Pharmazeuten-Verein (während der gesamten Untersuchungsperiode präsent), – Neu ab SS 1934: Verband schweizerischer Nationalökonomen an der Universität Basel (bis SS 1941 erwähnt), – Verein jüdischer Akademiker, «pflegt jüdische und allgemeine Kultur, veranstaltet Sprachkurse, Vortrags- und Diskussionsabende, sorgt für die physische Entwicklung seiner Mitglieder und vertritt deren akademische Interessen» (fehlt ab SS 1934), – Neu ab SS 1934: Arbeitsgemeinschaft der jüdischen Studentenschaft, «aus allen an der Basler Universität bestehenden jüdischen Studentenorganisationen» zusammengesetzt (fehlt ab SS 1937), – Gegenseitige Unterstützungskasse (ab 1936 Gegenseitiger Hilfsverband genannt) jüdischer Studierender Basel (bis SS 1940 erwähnt), – Neu ab SS 1935: Die Deutsche Studentengruppe (bis SS 1937 erwähnt). In dieser Aufstellung fallen die katholischen Vereine und Einrichtungen besonders auf, die zusätzlich zu den dem St.V. angehörenden Verbindungen auftraten. Schon länger existierten eine Organisation («Zirkel») der katholischen Studentinnen und die Renaissance, die katholische Intellektuelle und Künstler zusammenführen sollte.190 Mit der Eröffnung des katholischen Studentenhauses an der Her190
Baumer 1998.
64
Die Basler Studenten und Deutschland
bergsgasse verfügten diese Organisationen ab 1937 über einen starken Mittelpunkt. Mit der Ankunft von Hans Urs von Balthasar191 im Jahr 1940 erhielten die katholischen Studentinnen und Studenten in Basel eine herausragende Führergestalt, die sowohl in Literaturwissenschaft wie in Theologie äusserst beschlagen war und einen katholischen Reformkurs von internationalem Format repräsentierte.192 Die evangelischen Studenten hatten ihre Christliche Studenten-Vereinigung. Die jüdischen Studierenden, deren farbentragende Verbindung Jordania 1934 eingegangen war, verfügten über eine schwindende Zahl von Institutionen, von denen schliesslich die Gegenseitige Hilfskasse in der Liste übrigblieb – zu diesen unten mehr. Unmittelbar als weltanschauliche oder politische Vereinigung erkennbar war die studentische Organisation der Europa-Union.193 Über Fachverbände verfügten die Medizinstudenten der klinischen Semester, später auch diejenigen der vorklinischen Phase. Analog organisiert waren die Zahnärzte und die Pharmazeuten. Das bedeutet nicht, dass es keine anderen Fachschaften gab, nur waren diese in der Untersuchungsperiode nicht in derselben Weise konstituiert und wurden im Mitteilungsblatt der Studentenschaft nicht aufgeführt. 2.5.4 Jüdische Studierende Nur wenig von dem, was für meine Themenstellung relevant wäre, ist über die organisierten jüdischen Studenten in Erfahrung zu bringen. Interessant sind zunächst diejenigen, die bei der Zofingia Mitglieder waren oder als solche aufgenommen werden wollten. Hubert Bloch (später Leiter der Pharmaforschung bei Ciba und Gründungsdirektor des Friedrich Miescher-Instituts) ist ein Beispiel für einen Aktiven, der vor 1933 aufgenommen worden war und durch seine Beiträge zum Vereinsbetrieb angesehen, ja unentbehrlich war. So war er weitgehend integriert – drohte aber im Mai 1933 mit seinem Austritt, als die Diskussion über die
191 192
193
Conzemius 2011. 1930 wurde P. Rudolf von Moos von der Gesellschaft Jesu als Studentenseelsorger nach Basel entsandt; der offizielle Träger war wegen des Jesuitenverbots der Augustinusverein. Von Moos benutzte Räumlichkeiten am Blumenrain, bis der Augustinusverein 1937 das Burckhardt-Vicarino-Palais an der Herbergsgasse erwarb. «Das katholische Studentenhaus an der Herbergsgasse 7, 50 Jahre Katholisches Studentenhaus Basel», www.studenten haus.ch. Dieser Text übergeht die Tätigkeit des Nachfolgers von von Moos, Hans Urs von Balthasar, der später die Gesellschaft Jesu verliess. Europäische Bewegung in Basel: Kreis 2020, 41, mit weiterer Literatur. 1934 wurde in Basel die «Europa-Union – Schweizerische Bewegung für die Einigung Europas» als Alternative zur «Paneuropa-Bewegung» von Richard Coudenhove-Kalergi gegründet, die 1932 hier ihren dritten Kongress abgehalten hatte. Tanner 2015, 250.
Studentische Organisationen in Basel. Ein Überblick
65
Aufnahme weiterer jüdischer Studenten Anlass zu antisemitischen Kundgebungen gab.194 Ich komme darauf noch zurück. Drei jüdische Studentenorganisationen195 sind aktenkundig. Ihre Entstehung gehörte in den Zusammenhang der bewussten Öffnung der Universität Basel für internationale Studierende nach 1918. So wurde sie zu einem «Zentrum jüdischer Studierender», was bis etwa 1930 wenig Probleme verursachte. Doch die Parole «Überfremdung» und das Aufkommen der ‚Fronten‘ liessen in damaliger Wahrnehmung eine «Judenfrage» entstehen, woraus folgte, dass man die Universität nicht als «verjudet» erscheinen lassen wollte, d. h. sie sollte nicht zur Zielscheibe der Antisemiten werden.196 Die 1911 gegründete Nehardea bestand mehrheitlich aus Schweizern, sie trug Farben und war schlagend.197 Diese Verbindung scheint eine Art Kaderschmiede gewesen zu sein. Ein bekanntes Mitglied war Salomon Schönberg, Gerichtsmediziner, Fakultätsmitglied und Grossrat von 1924 bis 1944; weitere Prominente waren Edmond Wormser (Grossrat von 1912 bis 1924) und Franz Arnstein (1926 bis 1940 Grossrat der Radikaldemokraten). Die Aktiven hatten jedoch Mühe, Nachwuchs zu rekrutieren, worauf die Verbindung schon 1920 suspendiert wurde und nur noch als Altherrenverbindung weiterexistierte.198 Die Jordania, gegründet 1924, gehörte zu den farbentragenden Verbindungen, praktizierte zwar nicht das Duell, unterschied sich sonst aber nicht vom üblichen Verbindungswesen. Sie scheint vor allem ausländische Studierende vereinigt und den Zionistengruppen nahegestanden zu haben.199 1933 legte sie die Farben ab, wie sie dem Rektor und den anderen Verbindungen mitteilte – der Grund bleibt ungenannt. 1937 ‚suspendierten‘ die verbliebenen Mitglieder angesichts von Rekrutierungsschwierigkeiten. Die Jordanier unterstützten das jüdische Studentenheim an der Leimenstrasse, das von 1933 bis 1935 den ausländischen jüdischen Studenten einen Studienort bot, um den Lesesaal der Universitätsbibliothek zu entlasten und der Kritik, die Basler Studenten an der dortigen Präsenz der Juden übten, die Spitze zu nehmen.200 Parallel zur Jordania existierte ein Verein jüdischer Studierender, ebenfalls 1924 gegründet, der sich auch 1933 auflöste. Im Januar 1934 folgte danach ein Verein jüdischer Akademiker und schliesslich eine Arbeitsgemeinschaft der jüdischen Studentenschaft,201 194 195 196 197 198 199 200 201
StABS PA 1132a, E 7-10 nn, Protokolle der Sektion Basel 1930–1935, 260 (14. 11. 1932); 343 (17. 5. 1933); 388 (13. 12. 1933); 400 (22. 1. 1934). Entstehung jüdischer Studentenverbindungen in Deutschland und Österreich: Platzer 1988, 12–25. Sibold 2010, 244. Sibold 2010, 119 f.; Platzer 1988, 46. Sibold 2010, 209 f.; Platzer 1988, 62, 73. Zu Schönberg: siehe unten, Kapitel 6.5. Sibold 2010, 212–214; Platzer 1988, 46. StABS UA V 30a 13. Sibold 2010, 164, 232; Platzer 1988, 64, 75. Jüdische Presszentrale Nr. 784, 17, 23. 2. 1934, https://archive.org/stream/JdischePresszen traleZrichUndJdischesFamilienblattFrDieSchweiz/Jg.17Nr.07841934_djvu.txt.
66
Die Basler Studenten und Deutschland
die sich vor allem aus ehemaligen Jordaniern zusammensetzte und mit der Gegenseitigen Unterstützungskasse jüdischer Studierender verbunden war.202 Möglicherweise gehörte auch die Vereinigung amerikanischer Studierender in diesen Kontext, die 1934 entstand, da viele Amerikaner vorher in Deutschland studiert hatten, zum Teil deshalb, weil viele US-amerikanische Hochschulen einen Numerus clausus gegen jüdische Studienbewerber errichtet hatten. Für die Amerikaner in Basel soll es ein eigenes Stipendium gegeben haben.203 Es scheint, dass sich zunächst aufgrund der Idee, dass Juden in der Öffentlichkeit nicht allzu präsent sein sollten, um die Antisemiten nicht zu provozieren, die Vereinigungen zu einer diskreten Gemeinschaft zusammengefasst wurden, bis sie ganz von der Bildfläche verschwanden. Sichtbar blieb die Hilfskasse, die sich auf die sozialen Aufgaben konzentrierte, die seit 1933 immer wichtiger wurden. 2.5.5 Ephemere politische Gruppen Die pazifistischen und antifaschistischen Studenten und Studentinnen sind nur wegen der Repression ihrer Flugblattverteilung durch das Rektorat bekannt.204 Das Blatt wurde am 17. Dezember 1934 am Morgen vor der Gynäkologischen Klinik Labhardts und um 12 Uhr vor der Tür des Kollegiengebäudes (damals am Rheinsprung) verteilt. Es enthielt einen Protest gegen die Ausweisung von zwei ausländischen Studenten, die sich zum Antifaschismus bekannt hatten, durch den Bundesrat, eine Kritik an der Anerkennung der nationalsozialistisch geführten Deutschen Studentenschaft in Basel sowie gegen das Einreiseverbot für den Pazifisten und unabhängigen Kommunisten Henri Barbusse. Angegriffen wurde auch Labhardt, weil er in seiner Rektoratsrede205 den Krieg als Mittel der natürlichen Auslese unter den Menschen bezeichnet habe. Schliesslich wurde die Entfernung linker Zeitschriften aus dem Lesesaal der Studentenschaft206 kritisiert und für eine Versammlung mit Max Wullschleger (damals Kommunist) geworben. 202 203
204 205 206
Sibold 2010, 216. StABS UA V 30a 14. David Kaplan namens der American Students of the University of Basel, Anerkennungsgesuch an den Rektor. Statuten in Englisch, Liste der Mitglieder. Das Rektorat verlangte und erhielt eine deutsche Übersetzung der Statuten. Das Dossier endet damit. StABS UA V 30a, 2 Studenten: Vereinigung der Amerikanischen Studierenden 1934, 17. 1. 1934. StABS UA V 30a, 3 Studenten: Antifaschistische Studentengruppe 1934–1935. Labhardt 1935. Zum Kampf um die linken Zeitungen und Zeitschriften im Lesesaal der Studentenschaft siehe den Auszug aus dem Protokoll der Generalversammlung vom 27. 2. 1934 in Basler Studentenschaft (SS 1934, H. 2, 5–7). 80 Studierende beantragten die Entfernung folgender Zeitungen und Zeitschriften: «Basler Vorwärts», «Schaffhauser Arbeiterzeitung», «Weltbühne», «Information». Beschlossen wurde nur die Abschaffung des «Basler Vorwärts» mit 159 : 121 Stimmen. Die anderen Presseerzeugnisse wurden beibehalten (178 : 141 Stimmen).
Studentische Organisationen in Basel. Ein Überblick
67
Unterzeichnet war das Blatt mit «Jugendkomitee gegen Krieg und Faschismus, Antifaschistische Studentengruppe Basel», eine sonst nicht bekannte Gruppe. Interessant ist die Attacke gegen Labhardt, dem auch vorgeworfen wurde, er fördere als Abtreibungsgegner Mutterschaft und Ehe ähnlich, wie dies in Italien und Deutschland geschehe. Zudem hielt die Gruppe ihren Protest gegen die Deutsche Studentenschaft für legitim, da diese während der Vorlesungen Fotoaufnahmen von ihren politischen Gegnern mache. Labhardt fühlte sich missverstanden; er verurteile selbst den Krieg, was auch die Studierenden zugaben. Er berief sich auf einen Erlass vom 1. Oktober 1933, der politische Aktionen nicht nur innerhalb, sondern auch in unmittelbarer Nähe der Universität untersagte. Als Rektor führte Labhardt in eigener Sache zweimal eine Einvernahme mit der Medizinstudentin Ida Fleissig durch. Da sie die Namen der Mitglieder nicht nennen wollte, erhielt sie am 27. Dezember 1934 einen strengen Verweis der Disziplinarkommission. Ihr wurde vorgehalten, dass sie ein Stipendium bezog, was wohl als Druckmittel dienen sollte. Da eine angesehene Persönlichkeit, Dr. Walter Strub, Gewerbeinspektor seit 1910 (und seit 1924 bei der Kommunistischen Partei),207 sie schützte, wurde ihr Fall nicht weiterverfolgt. Vorher war jedoch der Gruppe verboten worden, den Saal des Steinenschulhauses für die angekündigte Veranstaltung mit Wullschleger zu benutzen. Am 30. Januar 1935, 12 Uhr, trat die Gruppe mit einem neuen Flugblatt in Erscheinung, verteilt von Hans Mislin.208 Neben einer erneuten Kritik an Labhardt enthielt das Blatt einen Hinweis auf den Weltstudentenkongress gegen Krieg und Faschismus und einen Aufruf zum Kampf gegen die neue Militärvorlage.209 Die Breitenwirkung scheint gering gewesen zu sein, und die bürgerliche Universität konnte mit dem Hinweis auf Moskau als Vorbild nichts anfangen. Von solchen linken Bewegungen glaubten die ‚vaterländischen‘ Studierenden und Professoren, dass sie verdeckt oder offen unter der Kontrolle der kommunistischen Partei stünden, die Parolen wie Frieden und Antifaschismus gepachtet zu haben schien.210 Auf der rechten Seite des Spektrums sind Versuche dokumentiert, an der Universität zuerst eine Hochschulgruppe der Nationalen Front,211 dann die Völkerbundsgegner und Germanophilen mit einer Studentengruppe des Volksbundes für die Unabhängigkeit der Schweiz zu etablieren. Die Anläufe führten jedoch bis 1934 zu keinem Ergebnis – sei es, dass sie eigentlich unnötig waren, weil ent207
208 209 210 211
Ammann 2012. Der Kommunist Strub war zugleich Grossrat und Präsident des Basler Arbeiterbundes. Strubs Nachfolger wurde der 25-jährige Sozialdemokrat Hans-Peter Tschudi. Zinkernagel 2020, 2658; Tschudi 1993, 52. Vermutlich der spätere Mainzer Zoologieprofessor, http://gutenberg-biographics.ub.unimainz.de/personen/register/eintrag/hans-mislin.html. StABS UA Q 2 Protokoll der Medizinischen Fakultät 1933–1945, 17. 12. 1934. StABS UA B 1 XIV Regenzprotokoll 1934–1959 («Acta et Decreta»), 23. 1. 1935. Internationale Dimension: Gevers/Vos 2004, 297 f. StABS UA V 30a, 18 Studenten: Nationale Front, Hochschulgruppe 1933.
68
Die Basler Studenten und Deutschland
sprechende Tendenzen in der ersten Hälfte der 1930er Jahre in den Verbindungen präsent waren, sei es, dass sie doch zu ‚politisch‘ waren, um in der ‚unpolitischen‘ Universität bestehen zu können.212 2.5.6 Die linken deutschen Studierenden Im Verborgenen wirkte eine Organisation oppositioneller deutscher Studierender.213 Über sie wissen wir fast nichts. Diese antifaschistischen deutschen Studentinnen und Studenten traten durch einen Nachrichtendienst hervor, der über Vorgänge in Deutschland informierte. Die hektographierten Blätter wiesen deutlich auf die Kriegsvorbereitungen der deutschen Regierung hin und beleuchteten die nationalsozialistische Studenten- und Hochschulpolitik kritisch. Deren Verbreitung suchte die Universität zu verhindern mit dem Argument, es handle sich um politische Propaganda, die Flüchtlingen verboten sei, und um einen Versuch einer Studentengruppe, Mitglieder einer anderen Gruppe (d. h. der nationalsozialistischen Deutschen Studenten) zu verpetzen. Im vierten Rundbrief vom Juni 1938 war wirklich eine Liste von (angeblichen oder wirklichen) deutschen Polizeispitzeln enthalten. Neben Mitgliedern der Deutschen Studentenschaft enthielt diese Liste auch den Namen des Theologieprofessors Adolf Köberle. Ein Theologiestudent, der eine Zuschrift der Gruppe erhalten hatte, protestierte am 5. März 1938 beim Rektor gegen die mangelnde Neutralität der Ausländer in ihren «Pamphleten der sog. Opposition der Deutschen Studentenschaft», die er für Machwerke eines «einzelnen politischen Geschäftemachers oder Spitzels» hielt.214 Es scheint, dass es der Gruppe gelang, eigene Mitglieder in die nationalsozialistische Deutsche Studentenschaft einzuschleusen. Sie versorgten die Basler Linkspresse mit Informationen, die der Aufdeckung der Aktivitäten der deutschen Nationalsozialisten in Basel dienten. Noch 1938 beklagte sie sich mit einem anonymen Schreiben beim Rektor über die Deutsche Studentenschaft. Rektor und Kuratel fanden, auf anonyme Zuschriften solle nicht geantwortet werden, die Deutsche Studentenschaft sei bereits nicht mehr existent und Politik an der Universität sei sowieso unerwünscht.215 Kurz vor Kriegsbeginn scheint sich die Gruppe aufgelöst zu haben – mit dem Verschwinden der nationalsozialistischen Deutschen Studenten fehlte ihr der unmittelbare Feind, den zu bekämpfen sie angetreten war. Hermann Wichers bringt diese oppositionelle Gruppe in Zusammenhang mit der Kommunistischen Partei Deutschlands und deren Bestrebungen ab 1937, 212 213 214 215
StABS UA V 30a, 25 Studenten: Volksbund, Hochschulgruppe 1933–1940. StABS UA V 30a, 19 Studenten: Opposition der Deutschen Studentenschaft 1937–1938, Rundbriefe und offene Briefe 1937/38, die auch an Basler Professoren verschickt wurden. Dr. A. Freudenberg Basel, Rheingasse 10, stud. theol., 5. 3. 1938, an den Rektor, in: ebd. StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 13, 1935–1941, 5. Sitzung vom 18. 3. 1938, 271.
Studentische Organisationen in Basel. Ein Überblick
69
die Deutschen im Ausland zu erreichen und unter den exilierten Kommunisten eine einheitliche Doktrin durchzusetzen. Dies war eine Aufgabe des Basler Medizinstudenten Rudolf Nobel, dem 1939 in Zürich der Prozess gemacht wurde.216 Auch Henriette (Henny) Schönstädt und Ernst Reifenberg sind hier zu erwähnen. Als Studierende der Medizin standen sie in Basel vor dem Examen, als sie in Zürich verurteilt wurden, weil sie im Auftrag der Deutschen Kommunistischen Partei die Basler Trotzkisten observierten. Vielleicht war die Basler Organisation mit der Gruppe in Freiburg i. Br. identisch, die sich dort 1938 zu Wort meldete mit Informationen über die Kriegsvorbereitung, den Landdienst, die Überwachung der Theologiestudenten, die Aktionen gegen Mitglieder der Bekennenden Kirche, die Ideologisierung des Richterstandes, die Bürokratie der Studentenführung und mit Hinweisen auf die Zustände in den Konzentrationslagern.217 2.5.7 Die Marxistische Studentengruppe218 Die Basler Marxisten waren gut vernehmlich, profilierten sich auch in Vorlesungsdiskussionen (mit Angriffen gegen Edgar Salin z. B.)219 und wurden einmal sogar von den Zofingern eingeladen. Die Gruppe Freibund, die seit 1926 bestand, hatte sich gegen 1930 dem Marxismus zugewandt. Im Herbst 1932 war Fritz Belleville als Student nach Basel gekommen und erteilte den interessierten Studierenden Unterricht in Marxismus.220 Ab 1933 nannte sich die Organisation Marxistische Studentengruppe Basel. Wegen der Machtübergabe an die National216
217 218 219
220
Wichers 1994, 198. Affäre um Rudolf Nobel, Ernst Reifenberg und Henny Schönstädt: StABS UA Q 2 Protokoll der Medizinischen Fakultät 1939–1942, 5. 7. 1939. Die Gruppe wurde vom Zürcher Obergericht wegen Missbrauch des Asylrechts durch politische Tätigkeiten verurteilt. Auf Antrag des Gynäkologen Alfred Labhardt wurde das Gesuch, das medizinische Schlussexamen noch ablegen zu dürfen, abgewiesen. Schönstädt, die sich nach Frankreich absetzte, heiratete den 1937 in Basel promovierten Kardiologen und Kommunisten Rudolf Zuckermann, https://historischesarchiv.dgk.org/files/2015/10/R.Z. Vortrag-5.10.2011.pdf. Huber 1991, 335 f. Studer 1994, 518. Giles 1991, 52. StABS UA V 30a, 17 Studenten Marxistische Studentengruppe 1930–1937. Das Nachstehende stammt, soweit nicht anders vermerkt, aus diesem Dossier. Edgar Salin (im Kolloquium über das Zeitungswesen) «bemüht sich uneigennützig, die faschistische Metaphysik in der Schweiz zu verbreiten. Klare historische Tatsachen gibt es nach seiner Ansicht nicht, Geschichte steckt voller ‚irrationaler Dunkelheiten‘». Diese umgeben bei Salin auch den Reichstagsbrand vom 27. Februar. Den Verdacht der Urheberschaft auf politische Gegner zu lenken, nenne Salin ein «legitimes Mittel der Geschichte». Salin betreibe eine «metaphysische Geschichtsverdunkelung». linke front Nr. 2, Juni 1933, in: ebd. Wichers 1994, 214. Aufschlussreich das Interview mit Fritz Belleville vom 29. 3. 1972, in: https://www.ifz-muenchen.de/archiv/zs/zs-3008.pdf. Nachlass im StABS als PA 959.
70
Die Basler Studenten und Deutschland
sozialisten konnte Belleville nicht mehr nach Frankfurt zurückkehren und blieb in Basel, schliesslich wurde er ausgebürgert. In der Schweiz blieb dem immatrikulierten Studenten die Internierung während des Krieges erspart, und eine politische Betätigung konnte ihm nie polizeilich nachgewiesen werden.221 Zur Gruppe stiessen weitere Deutsche, die ihre Heimat verlassen mussten, so Franz Jakubowsky und Felix Ippen. Alle drei erhielten zunächst eine gewöhnliche Basler Aufenthaltsbewilligung, was ihnen eine grössere Bewegungsfreiheit ermöglichte, als sie den Flüchtlingen zugestanden wurde. Unter den Schweizer Mitgliedern der Gruppe verdienen Max Bächlin, Martin Stohler, Marianne Wenk, ihr Bruder Willi Wenk und Fritz René Allemann, der sie präsidierte, Erwähnung. Auch der spätere Sozialdemokrat Hans-Peter Tschudi gehörte vorübergehend der Gruppe an.222 Sie veröffentlichte Schriften unter dem Titel «Der rote Student» und «linke front» (meist in radikaler Kleinschreibung). Die Regenz lehnte seit 1930 die Bemühungen der marxistischen Gruppe, sich als studentische Organisation anerkennen zu lassen, ab, angeblich weil sie dem Rektor kein Verzeichnis ihrer Mitglieder einreichte.223 Die ‚vaterländisch‘ ausgerichteten Verbindungen, aber auch verschiedene Professoren sahen in den Marxisten gerade diejenige Organisation, die ‚Politik‘ in die unpolitische Universität hineintragen wolle. Dabei bemühten sich diese um eine Interpretation der Vorgänge in Deutschland, beschafften und verteilten Informationen über die Umtriebe der von ihnen als Faschisten wahrgenommenen, aber auch der offen nationalsozialistischen Dozenten. Mit den nationalsozialistischen Deutschen Studenten stritten die Marxisten darum, dass im Lesesaal der Studentenschaft weiterhin kritische und linke Presseorgane aufliegen konnten. Offenbar spielten Mitglieder der Gruppe eine Rolle beim Zusammentragen von Informationen und bei der Agitation, die 1936 zum Fall des nationalsozialistischen Mediziners Werner Gerlach führte.224 Am 18. Februar 1938 luden sie Anna Siemsen (seit 1933 in der Schweiz) zu einem öffentlichen Vortrag über den spanischen Bürgerkrieg ein. Diese Organisation war kein Ableger der Kommunistischen Partei (dies war schon durch die trotzkistischen Neigungen der Gruppe um Belleville ausgeschlossen), sondern behielt ihre Unabhängigkeit als Linkssozialisten bis zu ihrer noch 221 222 223
224
Fiche Fritz Belleville der Politischen Abteilung, 3 Karten, in: StABS PD-REG 5a 3-7-2, Seiten 439 ff. Ich danke Hermann Wichers für die Übermittlung des Dokuments. Tschudi bestätigt aus der Erinnerung die Dominanz der trotzkistischen deutschen Studenten, die er als weltfremde Theoretiker bezeichnet. Tschudi 1993, 39. StABS Protokoll T 2 Kuratel, Nr. 13, 1935–1941, 2. Sitzung vom 18. 2. 1936, 50. StABS UA V 30a, 17 Studenten Marxistische Studentengruppe 1930–1937, 22. 11. 1930; 13. 2. 1931; 16. 3. 1931; 30. 5. 1933 (die Studentenschaft empfahl damals die Anerkennung); 24. 11. 1936. Fritz Hauser, Erziehungsdirektor, fragte beim Rektor Haab an, warum die Regenz noch nicht über das Anerkennungsgesuch der Gruppe von Mitte September 1936 entschieden habe – denn damals lag eine Mitgliederliste vom 6. 4. 1936 vor. Wichers 1994, 104. Gerlach: siehe unten, Kapitel 6.3.
Studentische Organisationen in Basel. Ein Überblick
71
vor dem Verbot kommunistischer Organisationen erfolgten Auflösung (1938).225 Die Gruppe pflegte die Analyse des Nationalsozialismus im Sinne der linken Faschismustheorien und grenzte sich von der Auffassung der KP ab, der zufolge die Sozialdemokraten ‚Sozialfaschisten‘ seien.226 Belleville argumentierte mit Trotzki gegen Stalin und Dimitroff, dass der Faschismus eine Bewegung des wegen der Krise verzweifelten Kleinbürgertums sei, die sich mit Worten gegen die Grossbourgeoisie und in ihren Handlungen gegen die organisierte Arbeiterklasse richte. In den Jahren 1929 bis 1933 forderte Trotzki die deutsche Kommunistische Partei dazu auf, die Gefahr des Faschismus ernst zu nehmen und mit der SPD eine gemeinsame Front gegen Hitler aufzubauen.227 Ein Beleg für die Rezeption dieser Ansätze ist ein Artikel von Fritz Allemann in der «linken front» Nr. 3 vom Juli 1933 unter dem Titel «Thesen über den Nationalsozialismus». Der Nationalsozialismus war für den Verfasser dieses Artikels die deutsche Erscheinungsform des Faschismus, eine politische Reaktion der Mittelschichten auf ihre soziale Deklassierung. Der deutsche Faschismus wurzle in der Katastrophe des verschuldeten, durch rationalisierte Grossunternehmen bedrohten Mittelstandes und in der veränderten gesellschaftlichen Stellung der Angestellten. Er organisiere die Deklassierten in einer Massenbewegung. Die Machtstellung der bourgeoisen Elemente im Nationalsozialismus führe dazu, dass das Bürgertum ihn als Instrument zur Zerschlagung der Arbeiterbewegung nutzen könne. Er besitze keine Theorie, sei irrationalistisch und anti-intellektuell. Seine emotionale Programmatik erleichtere es, die Interessengegensätze zwischen Mittelstand und Bourgeoisie zu verschleiern. Antisemitismus sei in Deutschland die spezifisch mittelständische Form des Antikapitalismus. Der gesteigerte Nationalismus entspreche einer neuen Stufe des Kapitalismus mit der Tendenz zu nationaler Autarkie und Staatsintervention. Die Wirtschaftspolitik des Nationalsozialismus sei unrealistisch und vorkapitalistisch; dennoch werde sie zu einer Stütze für das im Niedergang befindliche Grosskapital. Die Demokratie habe im tiefen Gegensatz zwischen den politisch-sozialen Fronten, die mit Absolutheitsanspruch aufträten, ihre Grundlage verloren. Der krisenhafte Kapitalismus könne keine Konzessionen mehr an die Arbeiter machen, während die faschistische Diktatur dem Kapitalismus zuarbeite, indem sie die Arbeiterklasse durch Terror entmachte. Sie laviere mit korporatistischen Ideen zwischen den Klassen, ohne die Grundlagen des kapitalistischen Systems anzutasten.
225 226
227
Wichers 2010. «Freundschaft. Monatsendschrift der Sozialistischen Jugend Basel. Herausgegeben von der Gruppe Karl Marx». Redaktor war Max Blum. Nr. vom 31. 10. 1937, in: Nachlass Fritz Belleville, StABS PA 959 C 4. Kunow 2009. https://www.wsws.org/de/articles/1999/09/trot-s29.html. https://de.wikipedia. org/wiki/Faschismustheorie#Trotzkis_Faschismustheorie.
72
Die Basler Studenten und Deutschland
Diese Analyse war geradezu ein Alleinstellungsmerkmal der marxistischen Gruppe unter den studentischen Organisationen. Im gleichen Heft sprach sich diese Gruppe auch für die Rechte der Flüchtlingsstudenten in der Schweiz aus («Zur Lage der ausländischen Studenten in der Schweiz»), ein Engagement, das in dieser Deutlichkeit in keiner anderen Studentenorganisation zu finden war. Eine sozialdemokratische Basler Studentenorganisation ist mir nicht begegnet. 2.5.8 Die nationalsozialistische Deutsche Studentenschaft Eine nationale (landsmannschaftliche) Organisation bildeten in den 1930er Jahren nur die deutschen Studenten. Diese erhielten die Anerkennung der Universität, mussten allerdings ihre Statuten anpassen. Über das merkwürdige Schicksal dieses Verbandes berichte ich an anderer Stelle ausführlicher (Kapitel 6.2 Medizin) und fasse mich deshalb hier kurz. Ihre Gründung erfolgte wie in anderen Schweizer Universitätsstädten228 gesteuert von Funktionären der NSDAP von Zürich aus und unter Aufsicht des übergeordneten Verbandes und eines lokalen «Vertrauensprofessors». Trotz vielfältiger Schwierigkeiten überlebte sie bis 1938. Diese Schwierigkeiten begannen schon im Sommer 1933, als die Presse berichtete, deutsche Studenten in der Schweiz würden verpflichtet, am deutschen Informationsdienst mitzuwirken und in der Schweiz über deutsche Verhältnisse ‚aufzuklären‘. Der Kuratel war von Anfang an klar, dass es sich um eine antisemitische NS-Organisation handelte, die sie nicht dulden wollte (die Gruppe war nur für «Arier» offen).229 Die universitären Stellen (Disziplinarkommission und Regenz) hingegen bevorzugten 1934 eine Strategie der Toleranz und Anerkennung unter der Bedingung einer (formalen) Demokratisierung (Absage an das Führerprinzip im Wortlaut der Statuten). Die Mehrheit der Regenz teilte das Argument, eine zugelassene, bekannte Organisation sei weniger gefährlich als eine im Verborgenen wirkende. Zudem war in Basel bekannt, dass die analogen Vereine in Zürich und Bern von ihren Universitäten anerkannt worden waren.230 1934 kam es zu einem ersten Eklat. Angehörige der Deutschen Studentenschaft versuchten, hitlerfeindliche Blätter aus dem Lesesaal der Studentenschaft zu entfernen. Der Fall gelangte bis zum Eidgenössischen Politischen Departement, das in Basel eine Untersuchung verlangte. Im Herbst 1934 stellte die Deutsche Studentengruppe innerhalb der Basler Studentenschaft den Antrag, «Die Freiheit» abzubestellen. Ein ähnlicher Vorstoss richtete sich im Februar 1935 ge-
228 229 230
Angaben in der Einleitung. StABS Protokoll T 2 Bd. 12, Kuratel der Universität 1930–1935, 332, 22. 8. 1933. StABS UA B 1 XIV Regenzprotokoll 1934–1959 («Acta et Decreta»), 4. 7. 1934.
Studentische Organisationen in Basel. Ein Überblick
73
gen das «Pariser Tagblatt». Diese Anträge wurden jeweils in der Abstimmung von der Studentenschaft abgelehnt. Damit nicht genug: Das Eidgenössische Politische Departement hatte im März 1935 erfahren, dass alle deutschen Studenten, die Auslandsemester absolvieren wollten, um Aufnahme im Kreis Ausland der Deutschen Studentenschaft ersuchen mussten. Damit hatte jeder deutsche Student in der Schweiz eine Verbindung zu einer Organisation der NSDAP. Das Politische Departement erliess daraufhin am 17. April 1935 die Weisung, deutsche Studierende in der Schweiz müssten sich schriftlich verpflichten, keine parteipolitische Propaganda zu betreiben. In der Basler Regenz erregte diese Mitteilung Aufsehen; die Anerkennung der Deutschen Studentenschaft hätte damit hinfällig werden können. Der «Vertrauensprofessor» Gerlach erklärte, ‚seine‘ Studenten hätten sich nie politisch betätigt,231 und mit der neuen Bestimmung werde keine Verbindung zur NSDAP hergestellt. Damit blieb es bei der Anerkennung.232 Doch das Basler Erziehungsdepartement war nicht einverstanden und verlangte von der Regenz, sie solle gründlich prüfen, ob die Anerkennung wirklich weiterhin gerechtfertigt sei. 1936 war bekannt geworden, dass der in Lörrach lebende Führer der Basler Deutschen Studenten in Frankreich (Elsass) der Spionage verdächtigt wurde.233 Der Rektor sah aber darin keine neue Sachlage; für das Vergehen ihres Führers könne die Studentengruppe nicht behaftet werden. Der Bescheid an das Departement war somit abschlägig: Die Anerkennung blieb bestehen. In der Argumentation der Basler Professoren erschien auch die Begründung, dass das deutsche Regime die schweizerischen Studentenverbindungen an deutschen Hochschulen nie behelligt habe, also müsse man Gegenrecht halten.234 Allerdings
231
232 233
234
Das Vorgehen wird illustriert durch ein Gesuch, das die Deutschen Studenten mit Unterstützung des Deutschen Konsulats am 6. 6. 1935 bei der Fremdenpolizei stellten. Der Dichter Börries Freiherr von Münchhausen erhielt die Erlaubnis, in Basel einen Vortrag über «Das Buch als Kulturträger» zu halten. Die Fremdenpolizei machte zur Auflage, dass der Anlass keinen «politischen Karakter» (sic) tragen dürfe. Er fand dann im Badischen Bahnhof statt, wo üblicherweise Veranstaltungen der Nationalsozialisten in Basel abgehalten wurden. StABS PD-REG 3a 21430 – freundlicher Hinweis von Hermann Wichers. Münchhausen galt im ‚Dritten Reich‘ als herausragender völkisch-nationaler Dichter, war Senator der Deutschen Akademie der Dichtung, einer der Redaktoren der Zeitschrift «Volk und Rasse» und darf als eine Art Botschafter der Kultur des ‚Dritten Reichs‘ angesehen werden. Mittenzwei 1997. Regenzprotokoll wie oben, 15. 5. 1935. StABS UA R 3a 3 Protokoll der Phil.-Hist. Abteilung der Phil. Fakultät 1930–1948, 90–94, 4. 5. 1935. Spionageaffäre Hans Kübler: StABS Protokoll T 2 Kuratel der Universität Bd. 13, 1935– 1941, 86, 8. 6. 1936. Die Fiche der Politischen Abteilung der Basler Polizei ist unergiebig, da sie keine Inhalte referiert: StABS PD-REG 5a 3-7-18, Seiten 2377 f. (freundliche Mitteilung von Hermann Wichers). Regenzprotokoll wie oben, 25. 11. 1936. StABS Protokoll Erziehungsrat, 6. 7. 1936, 2. 11. 1936.
74
Die Basler Studenten und Deutschland
manifestierte sich die Gruppe danach drei Semester lang nicht mehr beim Rektorat, und Schreiben an sie kamen seit 1937 als unzustellbar zurück.235
2.6 Die Zofingia als Beispiel für die Evolution studentischer politischer Auffassungen Im Folgenden berichte ich, was aus dem Studium der Protokolle der Basler Sektion des Schweizerischen Zofingervereins (Zofingia) und aus der Lektüre des Zofinger «Zentralblattes» zu erkennen ist. Die Ausbeute über das Bild, das sich Studenten von deutschen Verhältnissen machten, wie sie sich dazu stellten und welche Auffassungen des Nationalsozialismus sie hatten, ist allerdings dürftiger als erwartet. Entweder fand in diesem Rahmen keine eingehende Auseinandersetzung statt (was offenlässt, ob sie anderswo stattfand), oder eine Selbstzensur verhinderte eine ausführliche Berichterstattung. Letzteres ist für die Kriegszeit nicht unwahrscheinlich. Der Verein war zwar in den 1930er Jahren bestrebt, kontrovers zu diskutieren, auch um ein diszipliniertes Debattieren zu üben. Aber das Sektionspräsidium konnte nicht allzuoft Themen und Referenten traktandieren, die harte Auseinandersetzungen provozierten. Die Zofinger wollten zwar einen vaterländisch denkenden Freundschaftsverband bilden, in dem abweichende Ansichten zur Sprache kommen konnten, aber man wollte doch das Verbindende betonen. Dazu war ein fester Rahmen vorgegeben durch das bürgerliche Herkommen der Mitglieder, durch den Ausschluss sozialistischer und marxistischer Positionen236 und mit der Zeit auch durch die Abgrenzung gegen nationalsozialistisches Gedankengut und deren Träger, die als «unschweizerisch» galten.237 235 236
237
StABS UA V 30a 7. 1931 liessen sich die Basler Zofinger noch über die Position der Marxistischen Studentengruppe von Fritz Allemann orientieren und diskutierten mit ihm: StABS PA 1132a, E 710 nn Protokoll der Sektion Basel 1930–1935, 145 ff., 9. 12. 1931. Später wurde Marxismus dezidiert abgelehnt und als Vehikel sowjetischer Einflussnahme verurteilt; siehe auch unten, Anm. 298. Zur Sozialdemokratie wurde das Verhältnis differenzierter, nachdem Sozialpolitik als Instrument einer Förderung des inneren Zusammenhalts der Schweiz und damit der Verteidigung gegen ausländische Bedrohungen aufgefasst wurde. Vgl. Vortrag von Fritz Marbach (seit 1931 Professor für Nationalökonomie in Bern, 1931–1943 Nationalrat) über den ethischen Sozialismus vor der Basler Sektion der Zofingia, in: StABS PA 1132a, E 7-10 nn, Protokoll der Sektion Basel 1930–1935, 485, 23. 1. 1935. Ein Beispiel ist das Verfahren gegen zwei Zofinger in der Basler Sektion, die angeblich oder tatsächlich Sympathien mit dem nationalsozialistisch geführten Deutschland zeigten, im WS 1942/43. Heitz 1942/43, 280–282; und StABS PA 1132a, E 7-10 pp, Protokoll der Sektion Basel 1939–1943, 366, 9. 12. 1942. Der eine Beschuldigte war ein Auslandschweizer, der öfter seine Familie in Deutschland besuchte, dem jedoch keinerlei Sympathien mit dem Regime nachgewiesen werden konnten. Der andere war ein Basler, der vorübergehend zur Nationalen Sammlung gehört hatte und der aus Verärgerung über das ‚unneu-
Die Zofingia
75
Schliesslich brachte es die Fixierung auf national-schweizerische Gegenstände mit sich, dass der Blick nach draussen selten gewagt wurde und wenn schon, dann oft unter der Frage, was Schweizer für ihr Land von ausländischen Verhältnissen (im Positiven wie im Negativen) lernen könnten. Erst auf diesem Umweg lassen sich Positionsbezüge zu den deutschen Verhältnissen ab 1933 erschliessen. 2.6.1 Die Rede von der «Krise» In den Äusserungen über die Lage der jeweiligen Gegenwart bildete seit dem Ersten Weltkrieg das Krisenbewusstsein eine wichtige Konstante. Die Schweizer Gesellschaft, Wirtschaft und Politik hätten sich demnach in einer Sackgasse befunden, aus der die etablierten Entscheidungsträger in den Parteien, in den Unternehmen und im Bildungswesen keinen Ausweg fänden. Reformen seien dringend nötig, und diese sollten vor allem von der «jungen Generation» kommen. Die «allgemeine Vernichtung bisher gültiger Formen, die Inflation sämtlicher geistiger Werte» wurde konstatiert, darum sollten Zofinger «Ausschau halten nach einem neuen Ziele». Eine «Entwertung des liberalen Denkens» sei erfolgt. Dessen Dominante habe ‚Fortschritt‘ geheissen; sie müsse nun einer anderen Dominanten weichen. Der Liberalismus versage, weil er an den Egoismus und Individualismus appelliere.238 Die Basler Marxistische Studentengruppe analysierte diese Rede von der Krise auf ihre Weise. Sie kritisierte das Interesse, das die bürgerlichen Studenten bis Mitte der 1930er Jahre frontistischen Ansätzen entgegenbrachten, und glaubte, dass die «Krise» im Kern das Versagen des liberalen bürgerlichen Staates vor der Aufgabe bedeute, mit der Arbeiterbewegung resp. dem Marxismus fertig zu werden. «Die Hochschule ist der Sammelplatz der faschistischen Front geworden.»239
238
239
trale‘ Verhalten von Studenten, die das erfolgreiche Attentat auf Reinhard Heydrich (4. 6. 1942 in Prag) feierten, einen deutschen militärischen Sieg (Fall von Tobruk im Juni 1942) mit drei Kommilitonen hochleben liess. Dafür erhielt er einen Verweis. Das Basler Protokoll zeigte schon 1938 das Dilemma auf, dass die Zofinger eigentlich nur auf den Menschen sehen wollten, ihnen aber ein deutscher (ehemaliger?) Nationalsozialist nicht geheuer war. «Wir wollen aber unter uns reine Schweizer sein!» sagte ein Sektionsmitglied. Der betroffene Gesuchsteller wurde dann nicht aufgenommen. StABS PA 1132a, E 710 oo, 429, 30. 11. 1938. Barth 1932/33, Zit. 441. Auch Eröffnungsrede zum Semesterbeginn durch Dietrich Barth als Praeses, in: StABS PA 1132a, E 7-10 nn, Protokoll der Sektion Basel 1930–1935, 243 ff., 26. 10. 1932; also noch vor der Machtübergabe an die Nationalsozialisten. die linke front, organ der marxistischen studentengruppe basel, Nr. 1, 1933, in: Privatarchiv Fritz Belleville, StABS PA 959, C 4 Politisches: Marxistische Studentengruppe 1933– 1938.
76
Die Basler Studenten und Deutschland
Die Zofinger selbst prangerten jedoch Materialismus und Egoismus an, ebenso die fehlende Bereitschaft zu einem opferwilligen Patriotismus, unethisches Verhalten im Parlament ebenso wie in der Ökonomie, Gottvergessenheit, Vermischung von Wirtschaft und Politik (Emil Dürrs These von der «Verwirtschaftlichung» der Politik klang hier an),240 «Bonzenherrschaft» in den Parteiorganisationen, («faule») Kompromisse statt durchgreifende Veränderungen, Fehlen von «echter» Autorität und Bereitschaft zur Entscheidung. Marxismus war für die Zofinger nur eine verderbliche Zeiterscheinung unter andern. Die Studenten fühlten sich heimatlos in einer «liberalen» (Un⌥) Ordnung und einer «mechanistischen», egalitären und formalisierten Demokratie. Sie suchten «Gemeinschaft». Die Zofingia selbst befinde sich als «eines der ältesten Kinder des Liberalismus» auf der Bahn der Ziellosigkeit: Von den negativen Wirkungen des Liberalismus und Individualismus sahen sich die jungen Zofinger besonders betroffen, weil sie einerseits «das 19. Jahrhundert» verteufelten, andererseits aber genau wussten, dass ihr Verein damals Wesentliches zur Durchsetzung dieser Ideen in der Schweiz beigetragen hatte. Unter den Altherren gab es im Unterschied zu den Aktiven weiterhin vehemente Verteidiger des Liberalismus.241 Westschweizer Studenten242 riefen nach Föderalismus, Deutschschweizer immer wieder nach Reform oder Totalrevision der Bundesverfassung. Das bürgerliche Segment der Jugend, das uns in Basel begegnet, lehnte revolutionäre Schritte stets ab und setzte auf eine Reform, die innerhalb des gegebenen Rahmens des öffentlichen Rechts angestossen werden sollte. Eine «konservative Revolution» war hier kein Thema. Sprachlich unterschieden sich diese Krisen-Texte kaum von denen des Auslands.243 Besonders aus Frankreich sind die «Non-Konformisten» der Generation um 1930 bekannt, die den Geist ihrer eigenen Zeit radikal ablehnten. Sie prägten vor allem einen Teil der Selbstwahrnehmung der Westschweizer Studenten, aber auch die Basler scheinen davon berührt gewesen zu sein. Die Basler Romanistikprofessoren Marcel Raymond (in Basel von 1931 bis 1936) und nach ihm von
240 241
242 243
Dürr 1928. Dr. Oskar Lutz, A.-Z. (Lutz 1933/34, 332): Der Kampf gegen den Liberalismus sei eine «schwere Versündigung an der Geistesfreiheit und damit an den modernen Kulturanlagen». Er forderte nicht nur militärische, sondern schon jetzt auch ‚geistige Landesverteidigung‘. Zur Einstellung der Westschweizer: siehe Kapitel 1.3 b. Loubet del Bayle 1969, 301, bezeichnet als Haupttendenzen der um 1930 auftretenden «revolutionären» Bewegungen: 1. Ein Umsturz der Werte, ein Bruch mit den Grundlagen der aktuellen ‚Unordnung‘ sei erforderlich; 2. gegen den Materialismus müsse der Geist wieder zu seinem Recht kommen; 3. die schöpferische Freiheit des Menschen soll die Quelle der Revolution sein, nicht ein wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Determinismus; 4. die Revolution sei eine persönliche Bekehrung zu den proklamierten Werten, als Modell für einen neuen Menschen.
Die Zofingia
77
1937 bis 1946 Albert Béguin vertraten diese Gegenwartskritik ex cathedra.244 Dass hier auch die deutsche Kulturkritik einen grossen Einfluss auf die Jugend ausübte, liegt auf der Hand und könnte am Vortragsprogramm der Studentenschaft aufgezeigt werden. In der Sache gab es aber wesentliche Unterschiede zwischen der Haltung der Studierenden in der Schweiz und denen im Ausland, die einerseits darauf beruhten, dass der schweizerische Frontismus mit seiner oft national-helvetischen Rhetorik die Rede von der «Krise» beeinflusste. Andererseits fehlte in der Schweiz eine Tiefe der Krise, die mit der ausländischen Nachbarschaft vergleichbar gewesen wäre: Keine offenen Bürgerkriege, keine Staatsstreichversuche, ein Klassenkampf, der nach dem ‚Landesgeneralstreik‘ von 1918 etwas gemässigter geführt wurde. Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise von 1929 waren zwar auch hier einschneidend, führten aber doch keine revolutionäre Lage herbei. So war die Diagnose der «Krise» bei schweizerischen bürgerlichen Studenten wohl teilweise auf eine jugendliche Identitätssuche zurückzuführen. Sie fanden in der schweizerischen Realität keine ‚würdigen‘ Ideale und trachteten darum danach, diese Realität zu verändern. Ein Generationenkonflikt trat hinzu: Es war die Haltung einer Jugend, die sich von den liberalen Vätern und Grossvätern absetzen wollte. Die Rede von der «Krise» war eine Suche nach «Persönlichkeit» in der «Gemeinschaft» statt nach Individualität, nach einem festen Grund der eigenen geistigen Existenz. Auch deshalb begannen sich Protestanten für die katholische Kirche und den Reformkatholizismus245 zu interessieren, riefen nach einem «christlichen Staat»246 und betrachteten vorübergehend Gonzague de Reynold247 als geistigen
244 245 246
247
Jurt 2018. Katholische Reform in Frankreich um 1930: Loubet del Bayle 1969, 25. Siehe dazu die Artikel von dem damals in Basel studierenden Olof Gigon, z. B. Gigon 1933/34. Gigon vertrat seine Position auch in seinem Beitrag zur Zentraldiskussion vor der Basler Sektion, gefolgt von seinem Kommilitonen Andreas Preiswerk; vgl. «Bericht der Basler Sektion über das Sommersemester 1933» (Zentralblatt 1933/34, 56 f.). De Reynold 1935/36. Er empfahl António de Oliveira Salazar (Staatschef von Portugal) als Vorbild für einen ‚rechten Mann‘, der einen christlichen Ständestaat aufbaue. Die Jungen in der Schweiz sollten mit dem 19. Jahrhundert brechen. Am Zentralfest der Aktiven 1935 konnte de Reynold eine Ansprache halten, was der Zentralpräsident des Jahres 1934/ 35, Marc Chapuis (geb. 1913, Jurist), sehr begrüsste. Chapuis 1935/36. Seine eher zurückhaltend formulierte Rede («comprendre pour agir») ist in: Zentralblatt 1935/36, 228 f., greifbar. Der Genfer Marc Genevière protestierte danach gegen die Rolle von de Reynold als katholischer «conducteur spirituel» der Zofinger Protestanten. Genvière 1935/36. De Reynold war 1914 zum Ehrenzofinger ernannt worden. Roggen 2014, 60. De Reynolds These von der «démocratie historique» in der Schweiz, die nichts mit der abstrakten Demokratie der Französischen Revolution zu tun habe, beschäftigte die Zofinger schon in den 1920er Jahren. Kundert 1969, 109.
78
Die Basler Studenten und Deutschland
Führer auch der reformierten Jugend.248 Die mehrheitlich protestantischen Basler Zofinger luden den katholischen Studentenseelsorger und Theologen Hans Urs von Balthasar zu einem Referat ein;249 der Schweizerische Zofingerverein versuchte, an der katholischen Universität Freiburg im Üchtland eine Sektion zu gründen. Ein Blick auf die Erscheinung des «Personnalisme» in Literatur, Philosophie und Religion, der auch im «Zentralblatt» Spuren hinterliess,250 macht verständlich, dass es sich um eine prominente Erscheinung des Zeitgeistes handelte. Denis de Rougemont propagierte damals diese Suche251 und empfahl den «Personnalisme», wie er in der Zeitschrift «Esprit» entwickelt und vertreten wurde. Deren Redaktor Emmanuel Mounier wurde wie de Rougemont von der Basler Studentenschaft als Gastredner eingeladen. Der Berner Student Hans Haefliger formulierte im August 1934 von München aus: «Jeder neue Stil ist nachweisbar aus einem Mythos der Gemeinschaft heraus entstanden, wobei Mythos als gemeinsames, religiöses Empfinden und als Gefühl für das Irrationale verstanden sein will.» Das erste Ziel jeder Erneuerungsbewegung müsse «das Suchen nach einer Allgemeinseele […] und das Streben nach Gemeinschaft sein».252 Eine solche Suche lag auch der Wissenschaftskritik zugrunde, die der Zofinger Zentralpräsident Alfred Werner (Theologe, später Pfarrer in Genf und Redaktor der «Vie Protestante») als Studentensprecher am Genfer Dies Academicus vom 8. Juni 1937 vortrug. Die Verwandtschaft der Idee von Wissenschaft, die Werner vertrat, mit derjenigen der Nationalsozialisten, etwa repräsentiert durch den Reichserziehungsminister Bernhard Rust, war nur oberflächlich: Wissenschaft müsse sich dem Leben zuwenden, ‚positivistische‘ Objektivität und eine Berufung auf den Geist der freien Wissenschaft seien wertlose Überbleibsel des liberalen Zeitalters; nicht Zweifel, sondern sicheres Wissen und Urteilen sollten gelehrt werden, und die Universität müsse auf ein Aktionsprinzip ausgerichtet werden. In Genf lief das Argument darauf hinaus, dass sich der Rationalismus, 248
249 250
251
252
Es brauche eine grundsätzlich föderative Einstellung, diese allein rücke das Gesamtwohl in den Vordergrund. Das falle jedoch schwer, weil auch die Bürgerlichen Klassenkämpfe für notwendig hielten. Der bürgerliche Klassenkampf sei das Bindeglied der politischen Koalitionen auf nationaler Ebene, und nur die katholisch-konservative Partei verfolge eine wirklich grundsätzliche Politik. Die bürgerliche Front sei geistig steril. Barth 1932/33, 446 f. Heitz 1942/43, 280. Das Zentralblatt 1938/39 publizierte eine Werbung für den «Personnalisme» aus der Feder des Neuenburger Professors Émile-Albert Niklaus (Niklaus 1938/39). Der Pädagoge Niklaus war ein Freund von Emmanuel Mounier und gehörte zu den «Amis de l’Esprit», die die Zeitschrift unterstützten und sich regelmässig in Paris trafen. Rauch 1972, 198. Denis de Rougemont gründete 1932 in Frankreich die Zeitschrift «Hic et Nunc». Loubet del Bayle 1969, 26. Im selben Jahr gab er für die NRF die einschlägige thematische Nummer «Cahier de Revendications» heraus. Ebd., 170–178. Hans Haefliger, Bern (Haefliger 1934/35, Zit. 102).
Die Zofingia
79
der stolze Verstand, wieder in Bescheidenheit dem Gottesglauben unterwerfen solle.253 Nur die mit Zitaten aus Blaise Pascal und Jacques Bénigne Bossuet untermauerte Suche nach der «Vérité» (mit grossem Anfangsbuchstaben) sei eine genügend starke Antwort auf die Ideologien. Fände die Jugend die von ihr gesuchte starke Autorität nicht bei Gott, werde sie sie bei Männern suchen, «qui lui dicteront quelque certitude à grand tirage».254 2.6.2 Vom Einfluss der Fronten zur ‚geistigen Landesverteidigung‘ Neben diesen Konstanten zeigten sich auch Veränderungen. In einer ersten Phase bis 1933 gaben sich die Basler Zofinger in politischen Fragen betont zurückhaltend. Sie erklärten, sie seien jung, unerfahren und hätten noch viel zu lernen, bevor sie zu Vorgängen in der Gesellschaft Stellung beziehen könnten. Sie wünschten sich ein unpolitisches akademisches Umfeld, das ihnen gestatte, sich in Ruhe umzusehen.255 Auf den Genfer Zentralpräsidenten Marc Genevière (später Chefredaktor von «La Suisse») wirkte diese Basler Haltung, hinter der er eine widersprüchliche Vielfalt der Meinungen vermutete, negativ: Bâle semble vivre actuellement encore sous l’influence de quelques vieux burschen qui, sous prétexte de réalisme, (tentative louable par ailleurs) avaient joué de façon fort caustique et fort habile avec toutes les notions établies. […] En outre, l’Allemagne est proche, les esprits bâlois aiment les solutions absolues, violentes. […] Bâle compte donc des disciples de Hitler, de Dada aussi bien que de Staline ou de Karl Barth.256
Um 1933/34 wollten unter dem Einfluss der ‚Fronten‘ viele Studenten als «junge Generation» ihre (neo⌥) konservative, antiliberale und oft religiöse Kultur- und Gesellschaftskritik artikulieren. Dabei wurde die Inspiration durch Faschismus, Nationalsozialismus, Austrofaschismus und katholische Soziallehre evident, wobei früh erkannt wurde, dass davon auch Gefahren für die Schweiz ausgingen: «[…] bei unseren Nachbarn arbeiten sehr starke Gruppen daran, über einen Staat wie die Schweiz und über ihren nationalen Eigenwillen das völkische Ideal zu setzen. Gegner der Schweiz sind sie beide und gefährlich werden können sie
253 254 255
256
Damalige Wissenschaftskritik in Frankreich: Loubet del Bayle 1969, 24. Alfred Werner, P.C. (Werner 1936/37). Lokaler Genfer Kontext: siehe oben Kapitel 1.3.b. Antrittsrede des neuen Praeses Robert Jucker, in: StABS PA 1132a, E 7-10 nn Protokoll der Sektion Basel 1930–1935, 120 f., 4. 11. 1931. Ähnlich Festrede von Hanspeter Schmid am ‚Rütli‘, in: ebd., 128 ff., 13. 11. 1931; und nochmals ebd., 145 ff., 9. 12. 1931. Zentralblatt (1932/33, 110).
80
Die Basler Studenten und Deutschland
uns alle.»257 Im Januar 1933 fasste Max Burckhardt in der Basler Sektion das Programm der Neuen Front so zusammen: Sie stelle Aristokratie gegen «verknöcherte Demokratie», verlange den Ausschluss des Volkes von komplexen Entscheidungen, eine Stärkung des Bundespräsidenten und eine korporative Ordnung. Er empfahl «die Literatur der neuen Front zur Kritik», d. h. er fand sie anregend, aber nicht restlos überzeugend.258 Diese Haltung verhinderte nicht, dass man in Basel gerade Hitler «sittlichen Zorn[e] und den Eifer gegen Ehrlosigkeit und Verbrechertum, den er dem Volke einzugeben verstand», zutraute. «Er hat damit gegen den Marxismus die Kraft der moralischen Begriffe bewiesen und den Materialismus jedenfalls schwer getroffen.»259 Mit ähnlichen Worten würdigte von München aus der Berner Hans Haefliger den deutschen Diktator noch im August 1934: «Adolf Hitler hat durch seinen ehrlichen Zorn gegen Falschheit und Flachheit der allerdings durch den Weltkrieg erst restlos heraufbeschworenen Unkultur und durch seinen rücksichtslosen ‚Kampf der Unmoral‘ der nationalsozialistischen Revolution diese gewaltige Schlag- und Durchbruchskraft verschafft.»260 Eine Fraktion der Zofinger warb für das Ziel der ‚Fronten‘, die Eidgenossenschaft autoritär zu «erneuern». Moralische Aufrüstung sollte aus der Eidgenossenschaft eine solidarische Gemeinschaft machen, wobei auch die Demokratie radikal kritisiert wurde. Ein Westschweizer Autorentrio fand, es sei falsch, in der Schweiz ‚Vaterland‘ unmittelbar mit ‚Demokratie‘ zu identifizieren. Nationale Werte stünden im ersten Rang, die anderen Werte müssten sich unterordnen. Die Zofinger sollten dem Vaterland dienen, die Hilfe der Demokraten brauche es dazu nicht.261 Eine Genfer Gruppe von Altzofingern meinte, der Parlamentarismus führe via Etatismus in den Sozialismus. Sie erhoffte sich von einem christlichen Korporativstaat die Zähmung des Kapitalismus.262 Der Stände- oder Korporativstaat wurde 1934 auch zum Thema der Zentraldiskussion263 des Sommers. Der Zentralpräsident Otto Hänni (später Substitut des Bundesanwalts) stellte fest: «Die berufständische [sic] Bewegung hat unter den aktiven Zofingern aus257
258 259 260 261 262 263
Eine umfassende Staatsidee könne «nur aus der Ewigkeit des Glaubens an Gott» kommen. Das Gebot der Verantwortung hätten nur die Katholiken verstanden. Barth 1932/33, Zit. 443. StABS PA 1132a, E 7-10 nn Protokoll der Sektion Basel 1930–1935, 301 ff., 18. 1. 1933. Gigon 1933/34, Zit. 19. Haefliger 1934/35. Chapuis/Muret/Fankhauser 1933/34. Brun u. a. 1933/34. Es handle sich um Thesen, die während zweier Sondersitzungen der Altzofinger von Genf 1933 diskutiert worden seien. Die für ein Jahr leitende Sektion («Zentralsektion») schrieb für jedes Semester ein Thema vor, das von allen Sektionen jeweils separat und wenn möglich in Anwesenheit des Zentralpräsidenten diskutiert werden sollte. Im «Zentralblatt» erschien danach eine Synthese der Ergebnisse.
Die Zofingia
81
serordentlich viele Anhänger und Freunde gefunden.» Er schloss daraus auf die allgemeine Haltung der akademischen Jugend der Schweiz: Wirtschaft und Technik sollten durch vermehrte Organisation der gesamten Volkswirtschaft wieder Dienerinnen des Menschen werden. «Unser Ideal ist die initiative Persönlichkeit, die zwar auf eigenes Können und eigene Kraft baut, die sich aber auch ihrer Verantwortung den Berufsgenossen, den Mitbürgern, der Gemeinschaft gegenüber bewusst ist.» Der Klassenkampf müsse «in eine neue Gemeinschaft» überführt werden.264 Immerhin wurde in dieser Phase – angeregt durch das Thema der Zentraldiskussion des Sommers 1933: «Der politische Gegensatz zwischen Bürgertum und Sozialdemokratie in der Schweiz und unsere zofingerische Pflicht» – in Basel noch gefragt, ob die gesuchte moralische Erneuerung nicht auch vom Sozialismus oder Marxismus kommen könnte. Zeittypisch dominant war jedoch der Tenor von Olof Gigon (Privatdozent in Basel, 1939 Ordinarius für klassische Altertumswissenschaften in Freiburg i. Ü.), vorübergehend «geistiger Führer» der Basler Sektion:265 Der Rechtsstaat wolle das Weltbürgertum und führe in den Marxismus. Allein die Forderung nach einem Gemeinschaftsstaat ermögliche eine Überwindung des Gegensatzes Bürgertum-Sozialdemokratie. Nur Kultur und Christentum könnten diese Gemeinschaft begründen. In der Diskussion wurde erwogen, ob es nicht ein Vorzug des Frontismus sei, dass er «wahre Kritik» üben und «Autorität» schaffen wolle.266 Besonders der Nationalen Front galt vorübergehend die (durch christliche Überzeugungen eingeschränkte) Bewunderung einiger junger Zofinger. Dietrich Barth267 war überzeugt, der «Kampfbund der Neuen und der Nationalen Front» werfe sich «mit Grund […] zur Trägerin der schweizerischen Erneuerung auf. Einzig die Nationale Front bemüht sich um eine
264 265 266
267
Hänni 1934/35. So bezeichnet von Aktuar Kühner im Semesterbericht WS 33/34 der Basler Sektion (Zentralblatt 1933/34, 630 f.). Jucker 1933/34, mit Hinweis auf Voten von Peter Preiswerk und G. Viollier. Preiswerk vertrat dabei eine linke Position, derzufolge der Kampf für die sozialistische Wirtschaft die passende Antwort auf die Krisen des Kapitalismus sei, in: StABS PA 1132a, E 7-10 nn, Protokoll der Sektion Basel 1930–1935, 339 ff., 10. 5. 1933. Deutlich war aber die dezidierte Frontstellung gegen die Genfer Sozialisten um Léon Nicole. Siehe auch: «Bericht des Zentralpräsidenten über die Zentraldiskussion im Sommer 1933 in Basel» (Zentralblatt 1933/34, 223–225), und StABS PA 1132a, E 7-10 nn, Protokoll der Sektion Basel 1930– 1935, 369, 8. 11. 1933. Wie die Basler Studentenschaft lehnten die «Zofinger» jedoch eine Teilnahme an einer öffentlichen Protestkundgebung gegen Nicole ab, in: ebd. 377, 22. 11. 1933. Später Redaktor der «Luzerner Neuesten Nachrichten» und Zentralsekretär des Schweizerischen Zeitungsverlegerverbandes, verstorben 1961. Nachruf in den Basler Nachrichten (Anonym 1961); Barth u. a. 1935.
82
Die Basler Studenten und Deutschland
neue Staatsidee». Nationale Selbstbesinnung, dynamischer und bewusster Wille zur Gestaltung seien dort zu finden. Diese Unterordnung des Einzelnen unter die menschliche Gemeinschaft und das bewusste Zurückstellen des eigenen Vorteils hinter die Belange des Volkes – Gemeinnutz geht vor Eigennutz! – zeigt das Neue, Grosse der Nationalen Front, und des frontistischen Denkens grösste und entscheidende Schwäche ist begründet durch den gleichen Glauben an die Allgewalt und die Allwissenheit des Staates.
Die Distanzierung vom Frontismus erfolgte schliesslich deshalb, weil er sich immer noch zu sehr von einer liberal geprägten Staatsauffassung leiten lasse, den rassistischen Nationalsozialisten anhänge und im Grunde nur einen materiellen Aufschwung verspreche. Sie geschah im Namen der «christlichen Religion», die zwar keine vorbehaltlose Unterwerfung unter Staat und Bürokratie zulasse, aber nur auf dem rechten Flügel des Parteienspektrums positive Ansätze erkennen könne. […] für ihn [den Schweizer] ist es darum Pflicht, das nationalsozialistische, rassisch begründete Denken der Fronten aus der Schweiz zu verweisen, eine Aufgabe, die nur zu lösen ist mit einem festen Glauben an die moralische Erneuerung von Mensch und Volk durch die christliche Religion und mit einem ehrlichen und starken Willen zur politischen und sozialen Reform. […] Die Wurzeln und der ideologische Aufbau des Frontismus sind im Grunde allzu freisinnig bedingt, als dass sie die wahre Erneuerung zu bringen vermöchten, und die Kampfesweise des Nationalsozialismus ist zu stark auf das Wirtschaftliche eingestellt, um die Lehre von der Vorherrschaft des Materialismus von innen heraus überwinden zu können.268
In dieser Periode verabschiedete die Zofingia die Volkssouveränität und damit die Demokratie aus ihren Statuten. An deren Stelle trat ein Bekenntnis zur «Gemeinschaft» und zur Landesverteidigung.269 Andreas Preiswerk, ebenfalls ein Basler Aktiver, bezweifelte, dass den Fronten eine grosse Zukunft beschieden sei, denn sie predigten einen geschlossenen Nationalismus, der mit dem schweizerischen Föderalismus in Widerspruch stehe. Im gleichen Zug kritisierte er die «Schweizer Monatshefte», von ihm bezeichnet als die «revue du front national destinée surtout aux intellectuels», dafür, dass sie den germanischen Charakter der Deutschschweiz ungebührlich unterstrichen. 268 269
Barth 1933/34, Zit. 336 f., 342 f. «Revision der Zentralstatuten» (Zentralblatt 1933/34), separat paginiert am Ende des Jahrgangs. In der Fassung vom 15. 7. 1934 lautete Artikel 1 der Zentralstatuten neu: «Er [der Verein] bekennt sich zur Schweizerischen Eidgenossenschaft als einer geistigen Gemeinschaft und zur Notwendigkeit der schweizerischen Landesverteidigung». Der Zweckartikel von 1919 hatte die Volkssouveränität bejaht, die auf verfassungsmässigem Weg zum Ausdruck komme. Kundert 1969, 105, 113.
Die Zofingia
83
Den Nationalsozialismus lehnte er deutlich ab: Nach der Niederlage von 1918 habe Deutschland einen neuen Glauben gesucht. Dem Volkscharakter entsprechend bräuchte der Deutsche eine «Weltanschauung». Hitler verschaffe Arbeit und verspreche, Deutschlands Rang als Grossmacht zu retablieren, was nun viele beeindrucke, die ihn früher nicht ernst genommen hätten. Was dächten aber die zwei Millionen Menschen, die mutig genug waren, gegen Hitler zu stimmen, fragte sich Preiswerk. Hitler sei ein mythischer Heros, der die Masse durch seine Auftritte elektrisiere. Der deutsche Mythos trage die Zeichen eines barbarischen jungen Volkes, das die Schweizer nur schwer verstünden. Sich einem Mythos zu ergeben sei die allgemeine Tragik des 20. Jahrhunderts. Der Mensch ohne (christlichen) Glauben suche einen Lebenssinn im Primitivsten, das in ihm wirke: dem Charakter, der Sprache, dem Land. Die Deutschen schienen sich jetzt über alles Geistige hinwegzusetzen, weshalb der Deutschschweizer nun verpflichtet sei, sich für die deutsche Kultur einzusetzen.270 Im Rückblick aus dem Jahr 1944 konstatierte der Basler Liberale Rudolf Massini: Manche von uns haben in der Zeit des Aufstiegs des Nationalsozialismus mit einem gewissen Neid auf die deutsche Jugend geblickt. Wir sahen, wie dort der Geist einer ganzen Generation von der Begeisterung für ein hohes Ziel erfüllt war, und es war verständlich, wenn manch einer in Versuchung kam, sich davon mitreissen zu lassen. Die Ernüchterung kam zur rechten Zeit. Es haben alle gesehen, dass der Gegenstand der Begeisterung der deutschen Jugend nicht der richtige war.271
2.6.3 Die Zofinger Studenten in der ‚geistigen Landesverteidigung‘ Erkannt wurden nun negative Auswirkungen der nationalsozialistischen Diktatur auch auf die kulturelle Produktion: «Mittelmässigkeit» sei das Programm der neuesten deutschen Literatur.272 Faschistische und nationalsozialistische Ideen in der Schweiz zu «verwerten» galt bald (mit Ausnahme der Idee des Ständestaates) als überholt, da mit dem Volkscharakter der Schweizer und deren Tradition unvereinbar.273 Präzisiert wurde die Ablehnung des «Liberalismus»: Sie gelte dem «geistigen Liberalismus», der den Individualismus propagiere, die Moral ausklammere und die Bedeutung des Geistig-Religiösen verkleinere – aber der nationalistische Gesinnungsstaat der Diktaturen des 20. Jahrhunderts sei schlimmer. Auch der Begriff der «Gemeinschaft» erfuhr eine Klärung: die «totale Gemeinschaft» sei abzulehnen als eine Fälschung, die Freiheit und Geist leugne; die 270 271 272 273
Zentralblatt (1933/34, 385–399). Massini 1944/45. Stickelberger 1934/35. Schubiger 1934/35.
84
Die Basler Studenten und Deutschland
«wahre Gemeinschaft» entstehe aus freier Zustimmung.274 Am Zentralfest der Altzofinger von 1935 stellte der Historiker Werner Näf (seit 1925 Professor in Bern) in seiner Rede über «Humanitätsgedanken in der Demokratie» fest, dass der Nationalsozialismus den Humanitätsgedanken durch seine ausschliessliche Rassentheorie verdränge; der Glaube an die Humanität gehöre wesentlich zu Demokratie.275 Über die Rassenlehren orientierte der Ethnologe Felix Speiser (seit 1917 Extraordinarius in Basel) die Basler Zofinger. Er bestritt, dass «Arier» eine Rasse seien; nur die Bevölkerung Indiens könne wirklich als Arier bezeichnet werden. Die Juden seien keine Rasse, sondern «ein völkischer Typus» mit einem kulturell bedingten Habitus. Die Juden «sind ein Volk».276 Weitere Auffassungen der «Judenfrage» diskutieren wir später. Am Zentralfest der Aktiven von 1935 wurde über «Liberté et Démocratie» diskutiert. Der Basler Berichterstatter Ernst Kober (Jurist) erteilte dem Ständestaat nun eine Absage und forderte eine Transformation des Staates unter «gleichbleibender demokratischer Kontrolle».277 Ab Herbst 1935 galten die Fronten resp. die Befürworter einer «Erneuerung» manchen schon als eine Fraktion, die «die Geschäfte gewisser Nachbarn betreibt oder den föderalistischen Aufbau der Eidgenossenschaft untergräbt».278 Das Autoritätsthema wurde hingegen von Jahr zu Jahr weitergepflegt in Verbindung mit der Kritik an politischen Parteien und der fortgesetzten Hoffnung in eine Regierung «über den Parteien».279 Während die Kulturkritik und die Forderung nach Revision oder Reform von Gesellschaft und Staat aufrechterhalten blieben, nahm nach 1935 die Bereitschaft ab, im Ausland oder bei katholischen Theologen nach positiven Aspekten zu suchen, die übernommen werden könnten. Das heisst nicht, dass sie definitiv verschwunden wäre: Die «moderne und straffe Organisation» in den faschistischen Staaten blieb ein Gegenstand der Bewunderung; in der Schweizer Demokratie fehle eine autoritäre Führung.280 Aber es fand nun eine differenziertere Auseinandersetzung mit dem Frontismus statt, namentlich durch die Basler Aktiven, unterstützt durch den Zürcher Max Imboden, der die westschweizerischen Ligen kritisch beleuchtete. Während der Einfluss der Ligen und Fronten auf die Studierenden zurückging (er manifestierte sich aber 1940/41 nach der Niederlage
274 275 276
277 278 279 280
Gigon 1935/36. Von Greyerz 1935/36. «Ostjuden» betrachtete auch Speiser als «für unsere Begriffe unerfreulich». Der Vortrag fand den «dankbaren Beifall» der Basler Zofingersektion, in: StABS PA 1132a, E 7-10 nn, Protokoll der Sektion Basel 1930–1935, 459, 7. 11. 1934. Zentralblatt 1935/36, 223 f. Editorial des Redaktors Dietrich Barth, Basel, Herbst 1935 (Zentralblatt 1935/36, 6). Anonym 1938/39, 503; «Bâle» als Beispiel für diese Tendenz. Barth 1935/36, insbesondere 485 f.; Barth 1935/36a, hier forderte er eine Führung durch «Herren».
Die Zofingia
85
Frankreichs vorübergehend erneut),281 stieg das Ansehen, das Gottlieb Duttweiler mit seinem Landesring der Unabhängigen nun genoss.282 Zunehmend äusserten sich Stimmen wie diejenige von Max Fluri (Jurist), der im Herbst 1935 feststellte, die nationalsozialistischen Ideen seien eine Bedrohung für die Zofingia und ihre Ablehnung sei ein «Kampf um das Recht auf einen Lebensraum, in dem Geist und Seele sich nach inneren Gesetzen entfalten können». Er votierte für eine schweizerische historische «Kontinuität» und gegen Konzessionen an den Zeitgeist.283 Die Diskussion um den christlichen Staat wurde erweitert durch einen Blick auf den Kirchenkampf in Deutschland. Hitlers Bekenntnis zur «positiven Religion» erwies sich als Farce angesichts des rassistischen und nationalistischen Staatsmythos, der mit einer kosmopolitischen Religion wie dem Christentum unvereinbar sei.284 1938 wurden im «Zentralblatt» anonym die «Deutschen Christen» angegriffen: Arm in Arm zog die Landeskirche mit Hitler in das III. Reich. […] Man stand auf dem Boden des ‚positiven Christentums‘, bis die gläubigen Männer der Kirche erkannten, dass Hitlers Reich vom Christus-Reich sehr verschieden ist, und dass man zwei Herren nicht dienen kann, nicht totalitär dienen kann. Der andere Teil der Kirche marschierte unentwegt neben den braunen Bataillonen von einer Ungeheuerlichkeit zu anderen.
Aber auch die Bekennende Kirche wurde im Sinne von Karl Barth kritisiert: «Noch aber hat die Bekenntniskirche nicht den Mut, aus den Früchten des III. Reiches auf den Baum zu schliessen, der sie trug. […] Wie sie nicht den Mut hatte, am 30. Juni [1934] den Mörder dieses Tages einen Mörder zu nennen, und von ihm abzurücken, wie sie nicht den Mut hat, in ihren Kampfschriften die Verbeugung gegen Hitler fortzulassen […].»285 Die Eidgenossenschaft galt fortan als in ihrem Bestand bedroht, und den Ausweg aus der «Krise» sollte die Stärkung des «Kleinstaats» durch eine Besinnung auf seine eigenen Werte bringen: Die Zofinger übernahmen die ‚geistige Landesverteidigung‘ und bereiteten die Abschliessung gegenüber dem «Un281
282 283 284
285
Dies verdankt die «Zofingia» der Tatsache, dass 1940/41 Lausanne den Zentralvorstand stellte und dass dieser von Pierre Coigny, einem Mitglied der «Ligue Vaudoise», präsidiert wurde. Er liess in das Zentralblatt einen Propagandaaufruf der «Ligue» einrücken, was vor allem den Baslern sauer aufstiess: Anonym 1940/41. Krayer 1940/41 (kritisch). Bericht von Coigny über die Zentraldiskussion in Basel: Coigny 1940/41, 283, zu Basel. Diverse Artikel in der Mai/Juni-Nr. 1936 (Zentralblatt 1935/36, 490–521). StABS PA 1132a, E 7-10 oo, Protokoll der Sektion Basel 1935–1939, 38, 23. 10. 1935. Schapiro 1934/35, namentlich die Fussnote S. 208. Die Orientierung der Basler Sektion über den deutschen Kirchenkampf erfolgte 1934, blieb aber ohne Fortsetzung: StABS PA 1132a, E 7-10 nn, Protokoll der Sektion Basel 1930–1935, 402, 22. 2. 1934. Anonym 1937/38, Zit. 148 f.
86
Die Basler Studenten und Deutschland
schweizerischen» vor, wobei die Westschweizer immer wieder im Sinne ihrer Auffassung des Föderalismus unterstrichen, dass diese nationale Eigenart in der Verschiedenheit der Staaten bestehe, die sich zum Bund zusammengefunden hätten.286 Dennoch öffneten sich Sektionen auch in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre gelegentlich der nationalsozialistisch inspirierten Propaganda. Unkritisch hörten sich die Basler 1937 einen Vortrag des Aargauer Staatsarchivars Hektor Ammann an, der ihnen darlegte, wie sehr die Schweiz kulturell mit Deutschland verbunden sei (die Abschliessung von Deutschland bringe «kulturelle Inzucht») und wie gefährlich sich die «hartnäckige und unschweizerische Hetze gegen unseren nördlichen Nachbarn» auswirke, während Hitler niemals daran denke, die Selbstständigkeit der Schweiz infrage zu stellen. Wir müssten «manches übernehmen […] und uns anpassen», auch auf geistigem Gebiet.287 Auf nationaler Zofingerebene hingegen wurden «ausländische Einflüsse» nun konsequent als Gefahren benannt. Die «Influences politiques étrangères et nos moyens de défense» waren im Winter 1938/39 Thema der Zentraldiskussion. In Basel brachte diese allerdings wenig Ertrag ausser der Warnung, dass die NS-Politik irrational und deshalb unberechenbar sei; man dürfe sich nicht durch Friedenserklärungen Hitlers beruhigen lassen (wie sie Hektor Ammann zuletzt in Basel verkündet hatte). Man las dafür Alfred Rosenbergs Mythus des 20. Jahrhunderts, Adolf Hitlers Mein Kampf und die Analyse von Hermann Rauschning Die Revolution des Nihilismus. In diesem Licht erschien Deutschland nun als sehr bedrohlich. Der eine Basler Redner fand, die beste Abwehr des Einflusses sei die Verteidigung der Demokratie durch Vertrauen in die Regierung, durch Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Gewährung von Freiheiten. Der andere Redner analysierte den Nationalsozialismus als «revolutionären Dynamismus, Bewegung um der Bewegung willen», wofür er sich auf Ernst Jünger und Denis de Rougemont bezog. Man dürfe hinsichtlich der Schweizer Resistenz nicht allzu optimistisch sein, denn wenn schon Millionen Menschen dem Nationalsozialismus verfallen seien, «warum könnten dann nicht auch wir in diesen Zustand geraten».288 Die Bedrohung 286 287
288
Festrede von Marc Chapuis (Lausanne) am 115. Zentralfest vom Juli 1934 (Zentralblatt 1934/35, 307); dies ist der früheste Beleg, den ich gefunden habe. Fredenhagen 1937/38. Die zitierte Wortwahl ist diejenige des Berichterstatters. Vgl. Darstellung im Sektionsprotokoll: StABS PA 1132, E 7-10 oo, Protokoll der Sektion Basel 1935–1939, 263, 9. 6. 1937. Ammann rechtfertigte die Aufrüstung Deutschlands (als Voraussetzung für den wirtschaftlichen Aufschwung) und behauptete, in der Schweiz habe man weder den deutschen Antisemitismus noch den Kirchenkampf richtig verstanden. Protokoll des 119. Zentralfestes (Zweiter Teil), 2. Sitzung im Rathaus, Sonntag, 17. 7. 1938 (Zentralblatt 1938/39, 110–116). Claude-Antoine Hotz, C.P. (Hotz 1938/39; 1938/39a). StABS PA 1132a, E 7-10 oo, Protokoll der Sektion Basel 1935–1939, 485, 22. 2. 1939. Den ersten Hinweis darauf, dass die Ablehnung ‚unschweizerischer‘ Einflüsse aus dem Ausland ein Mittel zur Behauptung der politischen Unabhängigkeit sei, in der Rede von Hans
Die Zofingia
87
materialisierte sich seit 1935 in den deutschen Angriffen auf die Schweizer Presse. Ausgangspunkt war Hermann Görings Rede in Freiburg i. Br. am 10. Mai 1935, in der er die negative Beurteilung deutscher Verhältnisse durch Schweizer Journalisten verurteilte. Bereits jetzt begann innerhalb der Schweiz die Auseinandersetzung darüber, ob die Presse zu «Neutralität» anzuhalten sei oder ob sie durch ihre kritischen Berichte eine wichtige Aufgabe zu erfüllen habe.289 Als die Schweiz im Krieg die Zensur einführte, bekam diese Debatte eine neue Dimension, auf die ich zurückkommen werde. 1936 wurde die militärische Landesverteidigung für die aktiven Zofinger zu einem wichtigen Thema, dem die Nummer 6 des «Zentralblatts» (April) gewidmet wurde. Das Militär bilde den Schutzring, innerhalb dessen sich die «Erneuerung» vollziehen sollte. Die Argumentation war nicht militaristisch: Der Krieg sei ein Übel, aber leider stehe es nicht in der Macht der Menschen, ihn abzuschaffen. Einige Stimmen erhoben sich, die eine Verständigung mit der Sozialdemokratie verlangten; die bürgerlichen Parteien sollten mit ihr in Sachfragen kooperieren, um die Krise zu bekämpfen und die Schweiz «in der heutigen Weltlage» damit zu stärken.290 In der Zentraldiskussion vom Sommer 1936 herrschte aber nach wie vor eine Furcht vor dem «katastrophalen sozialistischen Staat», und der Gegensatz zwischen Bürgertum und Sozialismus sollte durch einen dritten Weg überwunden werden, der offensichtlich spirituell-religiös gemeint war.291 Die Ablehnung des Nationalsozialismus wurde ins Allgemeine ausgeweitet durch die Feststellung: «Gewisse Erscheinungen der Gegenwart zeigen uns die Gefahr, der wir alle zustreben, wenn wir uns lediglich vom Vital-Dynamischen mitreissen lassen, ohne zugleich die Verinnerlichung des Einzelmenschen zu suchen. Das heutige Deutschland ist der sichtbare Ausdruck dieser Gefährdung.» Man löse die Erstarrung, versinke aber in der Masse. «Der brutale Machtwille, getragen von einem blindlings folgsamen Kollektiv ersetzt eine grundlegende
289 290
291
Adolf Scherrer am Basler ‚Rütlikommers‘ vom 21. 11. 1934, in: StABS PA 1132a, E 710 nn, Protokoll der Sektion Basel 1930–1935, 470. Vgl. Siegrist 1938/39, der besonders die Quasi-Monopolstellung der «ganz einseitigen» deutschen Wochenschau in Zürcher Kinos konstatierte, aber meinte, der nüchterne Schweizer sei für Propaganda wenig anfällig. Er erkannte auch den propagandistischen Gehalt von Spielfilmen, die «Volks- und Rassebewusstein» fördern sollten. Dr. Georg Heinrich Thommen, A.-Z. (Thommen 1934/35) und Dr. Oskar Lutz, A.-Z. (Lutz 1934/35). Nur Zofinger Altherren äusserten sich damals. Lukas Burckhardt, A.-Z. (Burckhardt 1935/36), Basel. Vgl. auch den schon genannten Vortrag von Marbach, Bern, über den ethischen Sozialismus vor der Basler Sektion der Zofingia, in: StABS PA 1132a, E 7-10 nn, Protokoll der Sektion Basel 1930–1935, 485, 23. 1. 1935. «Bericht über die Zentraldiskussion, SS 1936» (Zentralblatt» 1935/36, 553–556). Olof Gigon (Gigon 1935/36a).
88
Die Basler Studenten und Deutschland
Neuordnung der Dinge.»292 Die jungen Franzosen, die im «Personnalisme» einen dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus suchten, kritisierten Faschismus und Nationalsozialismus in ähnlicher Weise: Diese wirkten an sich faszinierend, sie galten als gesund, lebendig, ideal, gross. Aber die faschistischen Doktrinen waren tyrannisch und totalitär, sie feierten Rasse, Nation, Staat, Macht, Disziplin der Masse und waren bloss pseudo-spirituell. So verkörperten sie die negativsten Aspekte der Gegenwart, statt diese zu überwinden. Hitler galt als ein «Demokrat», Materialist und Nationalist, sein Rassismus wurde als pseudowissenschaftlich durchschaut.293 Die Beschäftigung der Basler Zofinger mit dem Nationalsozialismus erlebte im Sommer 1936 einen Höhepunkt. Gerhard Ritter, Geschichtsprofessor in Freiburg i. Br., war damals Stellvertreter in der Vakanz, die durch den Tod der Basler Historiker Hermann Bächtold und Emil Dürr im Jahr 1934 eingetreten war, und nach Meinung der Fakultät der aussichtsreichste Kandidat für Bächtolds Nachfolge.294 Er erklärte den Basler Aktiven den Aufstieg des Nationalsozialismus aus der deutschen Geschichte, d. h. aus dem Umbruch, den der Erste Weltkrieg in die deutsche Politik gebracht hatte. Der Redner beurteilte den Nationalsozialismus nicht, er beschränkte sich darauf, sein Aufkommen als Folge des Kriegsendes 1918 und der anschliessenden Krisen und Kämpfe verständlich zu machen. Das Ende von ‚Weimar‘ sei dadurch verursacht gewesen, dass zuletzt mehrheitlich republikfeindliche Parteien den Reichstag dominiert hätten, die das «Bedürfnis nach Volksgemeinschaft und [den] Abscheu vor den republikanischen Misserfolgen» repräsentierten; daraus sei der «mystische Glauben an den neuen Führer» entstanden. Die Darstellung wirkt differenziert, aber Ritter setzte ein gefestigtes Bild deutscher Nationalgeschichte und Geopolitik in der «Mittellage» ohne feste Grenzen voraus: Es gebe in der deutschen Geschichte ein Übergewicht von «aussenpolitischen Problemen, vielen Krisen, ein Druck von aussen, der beständig auf Deutschland einwirkt», es sei «ein Staat mit offenen Grenzen», der jeweils «den Augenblick ergreifen» (d. h. zu seiner Verteidigung rechtzeitig Kriege führen) müsse.295 Der ‚Anschluss‘ Österreichs an das ‚Dritte Reich‘ 1938 wurde in der Schweiz mit dem Einmarsch der Franzosen in die Alte Eidgenossenschaft von 1798 verglichen und daraus geschlossen, dass Menschen, die sich als Knechte autoritärer Herrschaften fühlten (wie die Untertanen der Stadtkantone im 18. Jahrhundert, 292 293
294 295
Imboden 1935/36. Auch Denis de Rougemont sah bei den Faschisten Dynamik und Energie sowie Jugend. Stenger 2018; Loubet del Bayle 1969, 302–315. «Personnalisme»: Winock 1996; Loubet del Bayle 1969, 338 ff., 344 ff. Wichers 2013. Staehelin 1936/37. StABS PA 1132a, E 7-10 oo, Protokoll der Sektion Basel, 125, 24. 6. 1936. Vgl. die Bemerkungen zu Gerhard Ritter, unten, Kapitel 7.5.7.
Die Zofingia
89
wie die Österreicher unter der Dollfuss- und Schuschnigg-Diktatur), keinen Widerstand leisteten, während freie Bürger etwas zu verteidigen hätten. Voraussetzung der Freiheit, so die Wendung, die Paul R. Ackermann diesen Beispielen gab, sei auch soziale Gerechtigkeit – Sozialpolitik wurde zu einem Element der Landesverteidigung.296 Im Verlauf des Krieges wuchs deshalb das Interesse der aktiven Zofinger an der Sozialpolitik, wenn es auch hier liberale Stimmen gab, die vor der wachsenden Macht des Staates warnten. Die Zentraldiskussion für das Sommersemester 1942 suchte nach einem besonderen Weg des Kleinstaates und nach einem richtigen Verständnis von Demokratie im Unterschied zu den Grossstaaten (sprich Deutschland), die mit zentraler Autorität eine ‚Lösung‘ durchsetzten.297 Mit der Entwicklung des europäischen Kriegs zeichnete sich seit Herbst 1942 ab, dass die Sowjetunion die Schweizer Innenpolitik beeinflussen könnte und dass die Diskussion über den Sozialstaat im Sinne einer Abwehr kommunistischer Ideen geführt werden müsse.298 1943 verdichtete sich dieser Eindruck zur Gewissheit. Die bürgerliche Jugend wollte den Klassenkampf verhindern oder mildern, da sie befürchtete, dass nach Kriegsende der Burgfrieden zerbrechen und in eine revolutionäre Situation münden werde. Dem sei durch soziale Konzessionen vorzubeugen, die nun (auch) innerhalb der Zofingia debattiert wurden. Der fortgesetzte Ruf nach Verfassungsrevision gewann eine neue Bedeutung: Festigung der helvetischen Ordnung durch Einbezug der Arbeiterschaft als Voraussetzung dafür, auch nach Kriegsende «unschweizerische» (nun sozialistische) Lösungen abzuwehren. Der Kalte Krieg hat in der Schweiz noch vor der Invasion in der Normandie begonnen. 2.6.4 Neutralität, Pragmatismus und Zensur Seit Herbst 1939 häuften sich die Bekenntnisse zur Neutralität.299 In den ersten Kriegsjahren wurden Stellungnahmen zu kriegführenden Parteien vermieden, nachdem im Studienjahr 1939/40 noch berichtet worden war, dass die Briten im Juli 1939 erkannt hätten, dass man Hitler nicht zur Vernunft bringen könne. Ein 296 297 298
299
Ackermann 1937/38. Zentralausschuss 1941/42. Die Zentraldiskussion des Sommersemesters 1943 galt dem Thema «Wie können wir verhindern, dass die Entwicklung der sozialen Massnahmen das Verantwortungsgefühl des Individuums erstickt?» (Zentralblatt 1942/43, 253–256). Einführung durch den C.P. in das Thema der Zentraldiskussion (Zentralblatt 1943/44, 136–143). Zentraldiskussion in Basel «Wir sind auf dem Weg zur sozialen Demokratie» (ebd., 349 f.). Massini 1944/45a. Festrede des neuen Zentralpräsidenten Christian Müller am 126. Zentralfest vom 8. 7. 1945 (ebd., 532–535), nun offen antikommunistisch gegen «Wühler und extremistische Hetzer» sowie «üble Einflüsse von aussen». Jost 1939/40.
90
Die Basler Studenten und Deutschland
Jurist, der in Oxford und London ein Praktikum absolviert hatte, schrieb damals über die Engländer: «Ils ne perdirent leur confiance que lorsqu’ils comprirent que ces dirigeants [de Berlin] étaient aveugles, à moins qu’ils ne fussent fous.»300 Mit dem Zentralpräsidenten Pierre Coigny (Theologe, Mitglied der Ligue Vaudoise) kamen nach der Niederlage Frankreichs 1940 vorübergehend wieder die Ligen (und teilweise die Fronten) zum Zug, die den Ruf nach «Erneuerung» mit einer Absage an Parlament und Parteien verbanden. Der Untergang der französischen ‚Dritten Republik‘ wurde als Vorzeichen des bevorstehenden Endes auch der schweizerischen Demokratie gedeutet eine Auffassung, die die Deutschschweizer 1940 nicht teilten, da sie im französischen Parlamentarismus keine dem helvetischen System verwandte Verfassung erkannten.301 In der nunmehr beginnenden Phase schloss sich die Nation Schweiz in den Augen der Studenten noch stärker ab – ihre Sprache wurde offen helvetisch-nationalistisch. Der Versuch des Bundes nationalsozialistischer Schweizerstudenten, im Namen der Schweizer Studierenden vom Bundesrat zu verlangen, er solle sich aktiv an der «Neuordnung Europas» beteiligen, wurde als «fremdländische» Einflussnahme hart kritisiert.302 In Basel artikulierte sich ein «Pragmatismus» unter Studenten, die vorübergehend akzeptieren wollten, dass die bedrohte Schweiz mit Deutschland paktierte, um Arbeitsplätze zu sichern und Kohlelieferungen zu erhalten. Dies wurde später auch «Durchmausern» genannt und 1943 mit der inzwischen manchmal offen gezeigten Sympathie für die Westmächte kritisch konfrontiert.303 Dieser «Pragmatismus» blieb nicht unwidersprochen: Er entspringe 300 301
302 303
Gagnebin 1939/40. Protokoll des 121. Zentralfestes, 21. 7. 1940 in Zofingen (Zentralblatt 1939/40, 496–503). Pierre Coigny, Festrede (ebd., 496–499). Der Korporativstaat sei ein «Importartikel», hiess es in Basel im Februar 1941 an der Zentraldiskussion; man könne sich allenfalls eine Totalrevision der Bundesverfassung zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen in der Art, dass die Bundesräte durch eine Vermehrung der Kompetenzen und der Zahl der Departementssekretäre entlastet würden, in: StABS PA 1132a, E 7-10 pp, Protokoll der Sektion Basel 1939–1943, 189, 5. 2. 1941. Kritisch über die Basler: Coigny 1940/41. Ablehnende Antworten zur frontistischen Position von Coigny: Im Hof 1940/41 und 1940/41a. «Ligue Vaudoise – eine Feststellung der Zofingia Bern zum Artikel im Zentralblatt Nr. 3 in der Tribune libre» (ebd., 402). Entwurf des Basler Protests gegen die Darstellung des Zentralpräsidenten in: StABS PA 1132a, E 7-10 pp, Protokoll der Sektion Basel 1939–1943, 221 und 229, 21. 5. 1941. Auch: «Procès-verbal de la 122ème fête centrale les 20 et 21 juillet [1941]» (Zentralblatt 1940/41, 559–568). Egger 1940/41. Adolphe Vaudaux, cand. rer. pol. (Vorabdruck eines Artikels für die «Schweiz. Hochschulzeitung»): Vaudaux 1940/41. Ansprache von Gilgian Ryhiner am ‚Rütli‘ 1943, in: StABS PA 1132a, E 7-10 pp, Protokoll der Sektion Basel 1939–1943, Einlageblatt nach 470, Ende 1943. Er kritisierte die Bereitschaft, westliche «Tendenzstücke» im Theater zu beklatschen, nachdem man sich früher geduckt hatte. Bescheidenheit als Respekt vor dem Leiden der Kriegführenden sei angebracht.
Die Zofingia
91
der Bequemlichkeit und entspreche letztlich der nationalsozialistischen Lehre, Werte nur nach ihrem Nutzen für die Nation zu beurteilen.304 Wer ‚pragmatisch‘ dachte, war auch bereit, ein Stück weit auf Pressefreiheit zu verzichten und zu akzeptieren, dass in der Schweizer Öffentlichkeit über negative Seiten der nationalsozialistischen Herrschaft und Kriegführung geschwiegen wurde – zumal einige Studenten auch überzeugt waren, dass Verbrechen auf beiden Seiten begangen würden und dass der Begriff «Kriegsverbrechen» juristisch keinen Sinn mache.305 Das Thema ‚Pressefreiheit‘ beschäftigte die Zofinger während des Krieges stark. Da sie unter sich uneinig waren, traten sie sehr selten energisch für eine positive Rolle der freien Journalisten ein. Zensur wurde oft bejaht. Angriffe auf «Zeitungsschreiber», die die Kriegführenden kritisierten und damit die Schweiz in Gefahr brächten, waren nach dem Vorbild von Bundesrat Eduard von Steiger (selbst ein Altzofinger) häufig.306 Die faktische Integration der Schweiz in den deutschen Wirtschaftsraum, so wurde argumentiert, sei unvereinbar mit einer humanitären oder politischen Kritik an deutschen Zuständen, und zu dieser Integration gäbe es keine Alternative. Viele standen unter dem Eindruck der Ermahnungen von Steigers, der bei der Zofinger Rütlifeier 1941 gegen die «Intellektuellen» klagte, «die, obschon guten Willens, aus Unachtsamkeit, Unverstand, Geltungstrieb oder Ressentiments ihr Möglichstes tun, um im Schutz der schweizerischen Infanteriekanonen und Maschinengewehre durch Wort und Schrift das Ausland zu ärgern und die Schweiz ohne Nutzen erhöhten und unnötigen Gefahren auszusetzen».307 Daraufhin versuchte Jakob Frey aus Basel, eine Anleitung zu entwerfen, die zeigen sollte, in welcher Weise die Presse noch schreiben könne. Zwar dürften Glaubens- und Gewissensfreiheit nicht eingeschränkt werden. Dazu gehöre auch, «dass unsere Pfarrer und Ethiker uns Glaube und Wahrheit noch weiter verkünden dürfen» – eine Anspielung auf das Vorgehen der Zensur gegen Karl Barth.308 Aber die Journalisten sollten sich an bestimmte Regeln halten, die eine direkte Zustimmung für oder Kritik an einem bestimmten ausländischen Staat ausschlössen.309
304
305 306 307 308 309
Rotschy 1942/43. Basler Studenten hätten einen «besoin de bien-être d’une part, de conformisme traditionaliste d’autre part». Sie liebten die «science du compromis nécessaire qui nous valait chauffage et nourriture» (37). Er nannte es «ce discret, ce classique et distingué boitement sur lequel Karl Barth attira l’attention ce printemps» (38). Favre 1942/43. Von Rechenberg 1943/44. Sutermeister, C.A. 1939/40, 306. «Rede des Herrn Bundesrat von Steiger» (bei der Rütlifeier 1941) (Zentralblatt 1941/42, 11–17, Zit. 13). Barths Verhältnis zur Zensur: Tietz 2019, 303 ff. Frey 1941/42.
92
Die Basler Studenten und Deutschland
Radikale Basler Theologen im Gefolge von Karl Barth waren damit nicht einverstanden,310 auch wenn ihre Ansichten durchaus divergierten.311 Andreas Lindt, sonst als Neffe von Karl Barth ein dezidierter Kämpfer gegen alle Unwahrheit, stellte sich hinter von Steiger. Es gehe um die Wahrung der nationalen Einheit und die Bekämpfung der Unzufriedenheit im Volk; er warnte davor, auf die Propaganda der Westmächte hereinzufallen, die nach seinem Urteil nur für ihre imperialistischen Interessen kämpften. Sein Anliegen war, Solidarität mit den Völkern statt mit den Staaten zu üben.312 Christoph Barth (ein Sohn von Karl Barth) fand, Neutralität verbiete keineswegs die Solidarität mit den «unterdrückten Völkern». Man müsse die Überzeugung aussprechen können, dass das Recht des Menschen auf Freiheit «keine hergelaufene und darum verkäufliche Meinung ist, sondern dass es auf Wahrheit beruht». Wer «Liebe zum Vaterland» als Argument für eine Zensur anführe, vergesse, dass die Eidgenossenschaft auf dem «Gedanken offener und freimütiger Solidarität» beruhe.313 Karl Barth selbst las den «pragmatischen» Basler Zofingern im Wintersemester 1941/42 die Leviten, was diese gar nicht schätzen,314 aber seine Anhänger, die freundlicher auftraten als ihr Meister, konnten weiterhin darlegen, dass der Pakt mit Deutschland nicht impliziere, dass «die Wahrheit» verschwiegen werden müsse. Wenn die Frage nach dem «Sinn» des Krieges gestellt wurde, gerieten nur Deutschland und England in den Blick: Sei dieser Krieg ein Kampf zwischen Weltanschauungen (liberale Freiheit gegen autoritäre Totalität) – wobei den Studenten zwar der westliche Liberalismus weiterhin als überholt, aber der deutsche Totalitarismus als «unschweize310 311 312 313 314
Christoph Barth, A.-Z. (Barth 1941/42). Charles A. Egger, C.P. (Egger 1941/42). Thema war «Neutralität und öffentliche Meinung». In Basel gingen die Meinungen weit auseinander (ebd., 363). Lindt 1941/42. Barth 1941/42a. Ihm sekundierte (Friedrich?) Sebastian Barth 1941/42. Barths eher negative Ansichten über die Basler Studenten: Busch 1975, 280. StABS PA 1132a, E 7-10 pp, Protokoll der Sektion Basel 1939–1943, 296, 21. 1. 1942, erwähnt kurz die «uferlos und scharf geführte Diskussion», die auch die Pressefreiheit betroffen habe. Ryhiner 1941/42. Frey/Hagemann/Moppert 1941/42. Die Autoren beklagten Barths Ausdrücke wie «Metterniche, Vertreter des Ungeistes, Angehörige eines Greisenasyls, Verräter am Zofingerideal». Barth habe die Ehrenhaftigkeit der Andersdenkenden infrage gestellt. «Sie [Herr Prof. Barth] vertreten Positionen, die von grösster Bedeutung sind, die absolutistische und totalitäre Weise ihrer Verfechtung durch Sie und insbesondere durch Ihre Gefolgschaft hat aber sicherlich viel verheerenderen Einfluss als Ihre Ansichten an sich Gutes wirken könnten.» In der Politik (im Unterscheid zur Theologie) sei nicht nur das Wahre das Kriterium, sondern auch das «praktisch Zweckmässige». Die Schweiz lebe vom Kompromiss. Diese Ansicht teilten nicht alle Basler Zofinger; der Semesterbericht stellte eine Spaltung in zwei gegensätzliche Meinungsgruppen fest, die sich in der Diskussion über die Neutralitätspflicht der Presse manifestierten. Diese zeigte sich auch in der Basler Zentraldiskussion, in der die Position von Barth derjenigen des «ängstlichen Bern» gegenüberstand. StABS PA 1132a, E 7-10 pp, Protokoll der Sektion Basel, 299, 29. 1. 1942.
Die Zofingia
93
risch» galt – oder kämpften beide Seiten nur für ihre wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen? Manchmal war die Betrachtung der Weltlage ein Vorwand, um einmal mehr den Liberalismus für tot zu erklären und den in der Schweiz herrschenden Ungeist zu geisseln.315 Dennoch wurde ab 1943 die Sprache gegenüber den Nationalsozialisten auch in Zofinger Publikationen zeitweise offener. So schrieb Daniel Roth, Jurist aus Zürich, die Deutschen suchten ein «Austoben im Rausch», die «Verwirklichung eines in ihrer Einbildung lebenden Wunschtraums», sie wollten «sich hinopfern für einen Glauben». «Dazu kommt, dass ihnen nur wohl ist in der körperlichen Wärme der Tischrunde, im unbedingten Gehorsam der Marschkolonne, in der Horde, die nach einem Führer schreit.»316 Die Nationalsozialisten waren nun vollständig mit den «Deutschen» identifiziert worden. 2.6.5 Die Gleichschaltung der deutschen Universitäten, die Juden und Emigranten, die deutsche Besatzungspolitik Zu den Themen, die die Zofinger in Basel kaum und in ihrem «Zentralblatt» nur gelegentlich ansprachen, gehörten besonders die negativen Seiten der totalitären Diktaturen in den Nachbarstaaten und die Folgen der deutschen Besatzung.317 Das ist deshalb auffällig, weil Schweizer Elite-Studenten eigentlich darüber gut informiert sein konnten. Bis 1933 und vielleicht darüber hinaus studierten viele für eine gewisse Zeit in Deutschland, einige – je nach Fach und Neigung – auch in Italien, Österreich, Frankreich, Spanien, den Niederlanden oder England und stellten so Beziehungen zu Studenten dieser Länder her. Bis 1939 informierte die Schweizer Presse recht gut. Man stellt sich auch vor, es könnte eine grenzüberschreitende Solidarität z. B. zwischen den ‚farbentragenden‘ Verbindungen (die in Deutschland verboten wurden) gewirkt haben, trotz der jeweiligen nationalen Ausrichtung. Seit 1933 kamen Kommilitonen zunächst aus Deutschland, dann auch aus anderen Ländern als Flüchtlinge an Schweizer Hochschulen. Wer in der Zofingia hörte ihnen zu? Unter den 1940 in der Schweiz internierten ausländischen Offizieren und Soldaten waren viele Studenten. Von Genf aus unterhielt die Hilfsorganisation des internationalen Studentenverbandes FESE ein Informationsnetz und ein Hilfswerk für «kriegsnotleidende Studierende», über das während des Krieges, insbesondere ab 1942, Nachrichten in die Schweiz kamen. Auch im Fall der Verschleppung von Professoren und Studierenden der Universität Oslo im Herbst 1943 gingen die Ansichten unter den Zofingern auseinander – die einen verlangten eine koordinierte Erklärung aller Sektionen, die
315 316 317
Sutermeister 1939/40. Roth 1943/44, Zit. 405 f. Langewiesche 1997.
94
Die Basler Studenten und Deutschland
die «tiefe Missbilligung» der Zofinger ausdrücke, oder eine Demonstration vor dem deutschen Konsulat; andere fanden einen solchen Schritt nutzlos und verspätet, ja «schäbig» zu einem Zeitpunkt, da es den Deutschen «beginnt schlecht zu gehen». Den Hintergrund bildete in Basel aber die Ablehnung der Zofinger gegen vermeintlich oder wirklich linksstehende Studierende, die hinter einem «ungebührlichen Pamphlet» standen, mit dem eine offene und energische Sympathiekundgebung gefordert wurde. Zudem kritisierten die Verfasser die Basler Universitätsleitung für die ‚neutrale‘ Formulierung des von ihnen als «verschämt» bezeichneten Protests – aber implizit auch die Mehrheit der Studentenschaft, die am 6. Dezember 1943 eine entsprechende Resolution angenommen hatte (es handelte sich um einen Anlass der von den farbentragenden Verbindungen dominierten Studentenschaft mit Beteiligung der Universitätsleitung).318 Das Thema wurde im Delegiertenconvent der Basler Verbindungen und im Mitteilungsblatt der Studentenschaft diskutiert. «Dabei fühlte sie [die Studentenschaft] sich nicht befugt zu den Kriegsmassnahmen [sic] eines fremden Staates Stellung zu nehmen.» Im Einvernehmen mit der Regenz wurde deshalb in der Resolution darauf verzichtet, einem bestimmten Staat (Deutschland) eine Schuld zuzuweisen. Dieses «ungebührliche Pamphlet» war ein gedrucktes Blatt vom 17. Dezember 1943, das privat verschickt wurde. Das anonyme Schreiben erregte die Gemüter der Verbindungen und des Vorstands der Studentenschaft derart, dass sie nach der Politischen Polizei riefen: Die Verbindungen fanden, dass es «gegen unsere Neutralität verstösst». Die Mitteilung an die Polizei werde von Rektor Max Reinhard «befürwortet».319 Das «Pamphlet» ist das einzige uns bekannte Dokument, worin auf den studentischen Widerstand in München und die Hinrichtung der Mitglieder der Weissen Rose aufmerksam gemacht wurde – eine Nachricht, die die Bundesanwaltschaft unterdrücken wollte.320 Die offizielle Basler Resolution war in der Tat noch nach den Regeln der Neutralität formuliert, wie sie für die Pressezensur galten. Das Mitteilungsblatt «Basler Studentenschaft» hingegen dokumentierte eingehend die Protestaktionen in ganz Europa, offensichtlich um indirekt aufzuzeigen, dass die Basler Resolution mit ihrer ‚neutralen‘ Formulierung einen eher schwachen Eindruck hinterliess. In Heft 2 für das Wintersemester 1943/44 betonte Hans Winter (iur.) 318 319 320
Basler Jahrbuch, Chronik zum 6. 12. 1943. Redner waren Rektor Max Reinhard und Studentenschaftspräsident Aebi. StABS UA V 32, 6 Protokollbuch des Delegiertenconvents der Universität Basel, 20. 12. 1943, Präsident des D.C. Kurt Abt an die Politische Abteilung des Polizeidepartements. Stückelberger 1943/44. Die Resolution der Basler Studentenschaft gab «ihrem tiefen Schmerz Ausdruck […] über alle Unterdrückung der geistigen Freiheit und Menschenwürde, die dieser Krieg mit sich gebracht hat. Sie sprechen den Kollegen und Kommilitonen der Universität Oslo ihr herzliches Mitgefühl aus», in: StABS PA 1132a, E 7-10 pp, Protokoll der Sektion Basel 1939–1943, 471, 1. 12. 1943; und 491, 18. 12. 1943.
Die Zofingia
95
(S. 35–37) schon im Voraus, dass Schweden bei der Schliessung der Universität Oslo eine tapfere Haltung gezeigt habe, die die Welt bewundere. Er erinnerte an ähnliche Vorgänge 1938 in Prag, an den belgischen Universitäten 1940 oder an die Verfolgung polnischer Studenten und Akademiker – ein seltener Fall der Erwähnung dieser Vorgänge in Basler Studentenkreisen.321 Dahinter erkannte er die Absicht, «ein Volk oder einen Volksteil seiner Führer, seiner Intelligenz zu berauben, sie in ihrem geistigen Bestande zu treffen, ihnen ihre geistige Orientierung zu nehmen und ihr innerstes Widerstandszentrum zu brechen.» Der Verband der schwedischen Studenten bezeichne die Massnahmen gegen Oslo zu Recht als «ein[en] Schlag gegen die Universitäten überhaupt». Sogar im besetzten Dänemark habe es eine helle Empörung gegeben.322 Die Schweizerstudenten dürften darum nicht schweigen. Winter erwähnte die erste grössere Protestkundgebung in Zürich. In Basel waren – wie schon erwähnt – bisher bloss beim Vortrag von Bernhard Bavink (Bielefeld) Zettel verteilt worden. Von der Basler Protestversammlung erhoffte sich Winter im Voraus eine «weithin hörbare Antwort». In einer Nachschrift, verfasst nach dieser Veranstaltung, bedauerte Winter, dass es an der offiziellen Manifestation der Basler Universität nur zwei kurze offizielle Ansprachen und eine Abstimmung über die Resolution gegeben habe. «Und nun? […] standen wir nicht da wie die Krieger in Hodlers ‚Schwur‘, die Hand erhoben: Seht auch uns, nehmt unseren guten Willen für die Tat!? Es ist etwas seltsames um diese Kundgebungen. Sie haben immer etwas von jener unsterblichen Szene im ‚Tell‘, die ausmündet in das Versprechen: Wir wollen sein – So klangs auch nach: Jetzt gehe jeder seines Weges still –.» Tatsächlich mündete die Ansprache des Rektors zwar in die energische Feststellung, «wer sich anmassen sollte, in der Eidgenossenschaft die geistige Freiheit und Menschenwürde anzutasten, werde auf den entschlossensten Widerstand stossen», dieser Satz fehlte aber in der veröffentlichten Resolution.323 Der Medizinstudent Huldrych Koelbing (Ophthalmologe, ab 1971 Professor der Medizingeschichte in Zürich) zeichnete im Basler Studentenblatt einen Artikel über «Neutralität und Solidarität» (S. 37–39). Er stellte fest, dass einige Studenten die Sympathiekundgebung für unangebracht hielten. Über die Neutralität herrsche Unklarheit. Geschickt zitierte er dazu Bundesrat Giuseppe Motta: Die Neutralität des Staates dürfe nicht mit der Neutralität des einzelnen Individuums verwechselt werden. Objektive Kritik bleibe gestattet, nur freiwillige Zucht hinsichtlich der Art und Weise, seine Gedanken auszusprechen, würde die Neutralität gebieten. In den ersten Kriegsjahren, meinte Koelbing, liessen wir uns einschüchtern von den Propagandisten der «totalen Neutralität». Diese sei aber eine «Gewissenslosigkeit». Es treffe zu, dass man 1938/39 bei der Unterdrückung der 321 322 323
Vorgänge in deutsch besetzten Gebieten: Hammerstein 2004, 529–534. Stybe 1979, 202 ff. Die Worte des Rektors, zit. nach Bonjour 1960, 814.
96
Die Basler Studenten und Deutschland
Tschechen oder Polen geschwiegen habe. Dies sei aber kein Grund, heute (1943) nicht «für unsere Ideale und für unsere Kameraden, die für sie kämpfen, einzustehen». Darauf folgte eine Liste (S. 57–61) unter der Überschrift «Die Reaktionen auf die Verhaftung der Osloer Studenten – Aus Pressemitteilungen chronologisch zusammengestellt». Erwähnt wurden darin die Kundgebung und Resolution der Universität Bern vom 6. Dezember 1943. Im Unterschied zu Basel nannten die Berner die «deutschen Besatzungsbehörden» beim Namen. Zitiert wurde für den folgenden Tag die sozialdemokratische Fraktion der Bundesversammlung, die eine Interpellation von Walther Bringolf gegen die Pressezensur über die Studentenkundgebungen ankündigte. Der demokratische Baselbieter Nationalrat Kurt Leupin reichte eine Motion ein, die vom Bundesrat Schritte gegen die Massnahmen verlangte, die die Universität Oslo trafen. Diese Motion durfte dann nicht behandelt werden. In der Zusammenstellung erschien ferner die Forderung der schwedischen Studentenschaft vom 15. Dezember 1943, die kulturellen Beziehungen zu Deutschland abzubrechen. Auch im Jahresbericht des Vorstandes der Studentenschaft wurde eine lebhafte Diskussion in der Studentenschaft erwähnt. Wie Koelbing berichtet hatte, hielten einige sogar die zurückhaltende offizielle Resolution für neutralitätswidrig, während andere eine «polemische Auseinandersetzung mit dem jetzigen Weltgeschehen» anstrebten (dies bezog sich auf das sogenannte «Pamphlet»). «Es ging […] darum, bei dieser Gelegenheit uns selbst wieder einmal aufzurütteln, uns auf das besinnen zu lassen, was wir zu verteidigen haben.»324 Es ging also um die Schweizer Studenten («wir») und deren Befindlichkeit, weniger um den expliziten Ausdruck der Solidarität mit den unterdrückten Kommilitonen in den besetzen Ländern. Die Solidarität äusserte sich dann aber wortlos in einer Spendensammlung für den FESE. Vor Kriegsausbruch hatte es mehrere Versuche gegeben, die Lage der Studierenden in Deutschland unter dem NS-Regime zu erfassen und zu beurteilen. In diesen Darstellungen fehlte in auffälliger Weise jede Aufmerksamkeit für die Opfer des Nationalsozialismus. Als der Zürcher Student Ernst Gegenschatz (Klassischer Philologe und Philosoph) 1937 über die deutschen Universitätsverhältnisse berichtete, suchte er gezielt nach Normalität, ja nach einer Vorbildlichkeit deutscher Zustände unmittelbar vor dem Krieg. Er glaubte, das Regime sei auf die Universitäten angewiesen und müsse deshalb deren Traditionen ein Stück weit respektieren – eine für die Zeit der Kriegsvorbereitung und besonders für die Natur- und technischen Wissenschaften nicht falsche Feststellung. NS-Propaganda in der Lehre war nach seinen Beobachtungen weitgehend oberflächlich und aufgesetzt; in den ersten Vorlesungsstunden dominierte sie, machte dann 324
«Jahresbericht des Vorstandes der Studentenschaft Basel für das Jahr 1943/44» (Basler Studentenschaft WS 1943/44, H. 3, 71–82).
Die Zofingia
97
aber sachlich-kompetenten Ausführungen Platz. Desgleichen seien die Studenten im Grund von einem unzerstörbaren akademischen Geist («genius loci», nannte er dies) beherrscht, der auch diejenigen Studenten erfasse, die in der Öffentlichkeit als SA-Männer verschlossen und energisch auftraten, aber in Zivil mit Handschlag grüssten und sich den Kommilitonen privat öffneten. Er verkannte die symbolische Bedeutung von Inszenierungen wie einer Fichte-Feier nicht, in welcher die Professoren – gekennzeichnet als ‚Stand‘ durch die Talare – passiv zuhörten, während der Festredner in Parteiuniform sprach. Und er berichtete von SS-Studenten, die mit grossem Ernst danach trachteten, fachlich zu den Besten zu gehören. Die deutschen Studenten führten nach seiner Auffassung eine Doppelexistenz als eifrige Nationalsozialisten und als typische Studenten, wie sie sich der Verfasser wünschte. Dieses Wunschdenken folgte aus einer Kritik des Autors an den Zuständen in der Schweiz: Der akademische Dünkel und das Standesbewusstsein seien in Deutschland nun verpönt, Vorrechte wie verbilligte Kinoeintritte würden abgeschafft, jeder Student habe ein Ziel vor Augen, er bummle nicht, zeige keine «kleinbürgerliche Mentalität» und wirke nicht als «akademischer Spiesser», der «alles hemmt und in den Schmutz zieht». So sei ein neues «Einheitsgefühl» unter Studenten in Deutschland entstanden, das er in der Schweiz vermisste.325 Ein Berner Kommilitone berichtete ähnlich vor der Basler Sektion im Januar 1936, dass die deutschen Studentenverbindungen mit einem gewissen Recht von den Nationalsozialisten bekämpft würden, weil sie «den grossen Fehler gemacht haben, sich vom Volk abzuschliessen»; er riet der Zofingia, nicht in diesen Fehler zu verfallen.326 Im Sommer 1936 erhielt eine Delegation der Deutschen Studentenschaft Gelegenheit, sich der Basler Sektion des Zofingervereins vorzustellen. Dabei sprach der deutsche Funktionär Theodor Meier über den «Umbruch der Studentenschaft im Reich». Er warb für die «völkische Lebensganzheit», erklärte in Übereinstimmung mit dem Reichserziehungsminister Bernhard Rust, dass es keine «voraussetzungslose Wissenschaft» gebe und dass die deutschen Universitäten nun den «politischen Menschen» heranbildeten. Die wenigen protokollierten Voten aus der Diskussion zeigen, dass sich die Basler nicht überzeugen liessen: Man kritisierte die «Ausrichtung» der Studenten und konstatierte, dass allein schon eine grosse fachliche Leistung ein Dienst am Volk sei, «da braucht es keine Rassenkunde und keinen Arbeitsdienst». Der Student müsse die Freiheit haben, sich selbst ein Weltbild zu formen. Der Ruf nach einer ‚unpolitischen‘ Universität konnte unter diesen Umständen auch die Forderung bedeuten, von einer ideologischen Indoktrination verschont zu bleiben.327 325 326 327
Gegenschatz 1937/38. Referat von Albert Schubiger, 8. 1. 1936, in: StABS PA 1132a, E 7-10 oo, Protokoll der Sektion Basel 1935–1939, 58. StABS PA 1132a, E 7-10 oo, Protokoll der Sektion Basel 1935–1939, 120, 17. 6. 1936.
98
Die Basler Studenten und Deutschland
Erst im letzten Kriegsjahr erschienen im «Zentralblatt» einige Berichte über die Lage der Studenten in Deutschland und in den Niederlanden.328 Der Kontakt mit den in der Schweiz internierten polnischen Studenten wurde immerhin von Basel angeregt, es kam zu zwei (für die Basler eindrücklichen) Begegnungen, einem Gastreferat eines internierten Polen in Basel und einem Konzert zugunsten der Polen in der Aula, nachher nichts mehr – und dabei wurden nicht etwa die Zustände im ‚Generalgouvernement‘ angesprochen, sondern polnische Tapferkeit vor dem Feind und polnischer Nationalgeist gefeiert.329 Die Emigration in der Schweiz wurde meist negativ dargestellt. Sie sei «Partei», ihre künstlerischen Leistungen seien wertlos, schrieb das «Zentralblatt» 1934/35. Der Basler Theologiestudent Emmanuel Stickelberger meinte, die vorher gefeierten deutschen Autoren, die das ‚Reich‘ verlassen haben, «lagern sich jetzt in den Grenzländern um die Redaktionen der sogenannten Emigrantenzeitschriften herum». Alle seien von «Hass und Hetze gegen das heutige Deutschland» getrieben. Darunter leide die Kunst: Nur Zerstörung der Macht könne sich als Thema der Dichtung nicht auf Dauer bewähren.330 Offensichtlich waren «Emigranten» Hassobjekte. Die sogenannte «Judenfrage» kam in Basel mehrmals zur Sprache, führte zu antisemitischen Positionsbezügen und zu komplexen theologischen Konstruktionen, aber nie zu einer klaren und umfassenden Wahrnehmung der Lage der Juden in Deutschland und in den besetzten Gebieten.331 Nie erwähnt das Protokoll der Basler Zofinger ein Gespräch oder eine Information über die Ausschliessung jüdischer und demokratischer Studenten vom Studium in Deutschland. Dabei wurde vermieden, zur Kenntnis zu nehmen, dass man in Basel jüdische, aus Deutschland und den besetzten Ländern geflohene Kommilitonen hatte. Aber man verlangte in der Zofingia auch nicht offen Massnahmen gegen diese, während dem Rektorat und dem Erziehungsdepartement entsprechende Petitionen anderer Gruppierungen vorlagen. 328 329 330
331
Deléamont 1944/45. Der Autor verband mit der Darstellung der Ereignisse in den Niederlanden den Aufruf, am Wiederaufbau der dortigen Universitäten mitzuwirken. Heusler 1942/43; Gloor 1943/44 (Referat von Adam Kozlowski [sic] vor der Basler Zofingia). Stickelberger 1934/35, Zit. 409. Das Argument wiederholte Speck 1935/36. Fetscherin 1936/37 diskutierte das deutsche Theaterleben 1936 ambivalent: Er lobte das Interesse der deutschen Führung für das Theater, bedauerte aber, dass dadurch, dass «Unternehmer, Regisseure, Schauspieler und Publikum gewechselt» (sic) hätten, das deutsche Theaterwesen im Ausland in Misskredit gekommen sei und dass es nun an guten neuen Stücken fehle. Er erwähnte die Verstaatlichung vieler Bühnen zum Zweck der Kontrolle, lobte dann aber wieder, dass Gustaf Gründgens und andere von Hermann Göring zu «Staatsschauspielern» ernannt worden seien, und hoffte auf die «Keime einer anbrechenden Theaterblüte». Die dortigen Vorgänge im Überblick bei: Hammerstein 2004, 528–534.
Die Zofingia
99
Die erste Erwähnung in der Untersuchungsperiode fiel ins Wintersemester 1932/33, als einer der Zofinger Zirkel das «heute wieder besonders brennende Judenproblem» behandelte. Wie das geschah, steht nicht im Semesterbericht,332 wohl aber im Sektionsprotokoll. Hubert Bloch referierte, wie das Protokoll festhält, vom jüdischen Standpunkt aus und plädierte für die Assimilation. «Wenn die Juden so geworden sind, wie sie heute sind, dann [seien] vor allem die Christen selbst schuld», und es verwundere nicht, dass dies «bei einer widerstandsfähigen Rasse wie die Juden es sind, […] zu einem starken Rassenbewusstsein führen musste».333 In Zürich sprach Otto Brandenburger 1933 «Zur Judenfrage» und stellte einen «latenten Antisemitismus» in der Schweiz fest. «Beim Nichtjuden wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet, dass er ein anständiger Kerl sei; beim Juden verhält es sich umgekehrt.» Stereotype Wahrnehmungen «des Juden» erklärte er aus deren Verhalten, das eine Folge ihrer Lage sei: Im Geschäftlichen herrsche nicht Geldgier, sondern die Suche nach Besitz materieller Güter sei ein Ersatz für geringere gesellschaftliche Geltung. «Hierher gehört auch eine gewisse Überschätzung des Geistigen, die Bevorzugung der akademischen Berufe.» Juden gehörten zwar zwei Kulturen an, sie seien aber eng verbunden mit ihrem Heimatland und blieben es auch dann, wenn man sie als Parias behandle wie in Deutschland. Brandenburger votierte für eine Integration: Ziel sei die Einordnung des Juden als tätiges Element in das Staatsvolk, jedoch ohne dass er sein Eigenleben aufgeben müsse. In Deutschland hatte der Referent die Stossrichtung der antisemitischen Politik 1933 schon deutlich als «trockenen Pogrom» erkannt. «Die Ausmerzung der Juden aus der deutschen Volksgemeinschaft ist ein Teil des Programms der Bewegung, die 1920 aus kleinen Anfängen entstand und heute, unter Ausschluss jeder anderen Partei, am Ruder steht.» So deutliche Worte wurden später nicht mehr gedruckt.334 Zurück nach Basel! Im Sommersemester 1933 fand hier eine Auseinandersetzung um die Aufnahme eines jüdischen Studenten in die Zofingia statt. Vorgeschlagen wurde dabei ein Numerus clausus für jüdische Bewerber. Dies widerspreche den Zentralstatuten, und die «Stimmungsmache» mit den Ostjuden sei unzulässig, wurde entgegnet. Hubert Bloch protestierte gegen die Abweisung des jüdischen Bewerbers mit einer Austrittsdrohung. Schliesslich wurde der Bewerber nicht aufgenommen, und Bloch blieb Mitglied der Basler Sektion. Der Protokollführer bezeichnete den Vorgang als «die abermalige – augenblicklich endgültige 332 333
334
«Bericht der Basler über das WS 1932/33» (Zentralblatt 1932/33, 417 f.) StABS PA 1132a, E 7-10 nn Protokoll der Sektion Basel 1930–1935, 260, 14. 11. 1932. Formulierungen des Protokollführers, die nicht mit der Wortwahl Blochs übereinstimmen müssen. Es handelte sich um einen «Zirkel» mit 16 Teilnehmern, die zu einer «lebhaften Diskussion» beitrugen. Dr. Otto Brandenburger, A.-Z. (Brandenburger 1932/33). Der Referent sprach «als Jude und als Altzofinger».
100
Die Basler Studenten und Deutschland
Diskussion des Antisemitenproblems».335 Im Sommersemester 1939 wiederholten sich aber die Ereignisse; wieder wurde ein Hospitant, der um Aufnahme ersuchte und einen jüdisch klingenden Namen führte, nicht aufgenommen.336 Im Winter 1933/34 wandten sich die Basler Aktiven grundsätzlich der «Judenfrage» zu. In einem Zirkel wurde Martin Buber als «sehr bedeutender Philosoph» vorgestellt und gelobt, er sei «ein rechter Israelit, an dem kein Falsch» sei – mit ihm lasse sich diskutieren, weil er ein «klassischer» Jude sei, der religiös argumentiere. Das mache ihn interessant in einem Moment, da man sich angewöhnt habe, Fragen zum Judentum «rassisch» aufzufassen.337 Zu Beginn des Jahres 1939 reagierte ein Altzofinger (aber nie ein Aktiver) im «Zentralblatt» auf die ‚Reichskristallnacht‘, er zeigte sich zwar «erschüttert», aber nicht solidarisch. Werner Ganz (Winterthur) gab seiner Erschütterung Ausdruck, weil wir ganz genau wissen, dass es gar nicht mehr um das Judentum an sich geht, sondern um sein Geld und um die Befriedigung revolutionärer Tendenzen; erschüttert, weil der Verfolger sich ethische und moralische Werte zulegt, die er ohne Zweifel nicht mehr besitzt als der Verfolgte, erschüttert aber auch, weil wir fühlen, dass hier ein Grundsatz vernichtet wird, der mit zu den bedeutendsten Ergebnissen der Entwicklung des 19. Jahrhunderts gehört.338
In Basel war bei den Zofingern davon nichts zu hören. Aber am Anfang des Jahres 1939 kamen sie hier unter dem Stichwort der «Emigrantenfrage» auf ihr Verhältnis zu den Juden zurück. Urteile über jüdische und nicht-jüdische Flüchtlinge wurden kontrovers diskutiert, indem je ein Sektionsmitglied einen der bekannten Standpunkte vertrat. Der eine hielt den «Gewinn für den [deutschen] Staat durch die Austreibung schädlicher Elemente [für] grösser als de[n] Nutzen der kulturell hochstehenden Leute, die das Land verlassen». Der Schweiz brächten die Einwanderer einen geringen Nutzen. Die politischen Flüchtlinge hetzten gegen die ihnen «missliebigen» Länder, während die Schweizer zwar die jüdische Religion angriffen, aber einen geistigen und wirtschaftlichen «Kampf» führten. «Es wäre daher an der Zeit, die Juden auszutreiben bevor sie sich in schweizerischen Familien einnisten.» Der Vertreter der Gegenposition erinnerte daran, dass
335
336 337 338
StABS PA 1132a, E 7-10 nn, Protokoll der Sektion Basel 1930–1935, 343, 17. 5. 1933. Im zu publizierenden Semesterbericht solle die «Judenfrage» nicht erwähnt werden, weil sie einen Basler Zofinger ganz persönlich betreffe, ebd., 363, 5. 7. 1933. StABS PA 1132a, E 7-10 pp, Protokoll der Sektion Basel 1939–1943, 21, 24. 5. 1939. «Bericht über das WS 1933/34» der Sektion Basel (Zentralblatt 1933/34). Einzelheiten in: StABS PA 1132a, E 7-10 nn, Protokoll der Sektion Basel 1930–1935, 369, 8. 11. 1933. «Gegenwart und Zofingertum. Referat gehalten von Dr. Werner Ganz (Winterthur) an der Generalversammlung der Zürcher Altzofinger am Bächtoldstag 1939» (Zentralblatt 1938/39, 298–309).
Die Zofingia
101
es der «Völkische Beobachter» war, der in der Schweiz das Asylrecht und die Pressefreiheit aufzuheben verlangte. Die politische Opposition (der Flüchtlinge) «sollten wir als Demokraten achten», sie kämpfe gegen die Machthaber, nicht gegen den Staat oder das Volk. Gegen die Juden seien rassische Argumente obsolet, da sie «weitgehend mit unserer Rasse verwandt» seien. Die antisemitische Propaganda sei «die Eselsbrücke zur Gleichschaltung der Schweiz». In der Diskussion hatten es die aufgeklärten Stimmen schwer, sich Gehör zu verschaffen. Ein Votant wurde niedergeschrieen. Angehört und protokolliert wurden hingegen antisemitische Voten: Die Zahl der aufzunehmenden Juden solle durch den Schweizer Selbsterhaltungstrieb bestimmt werden. Politischer Realismus zeige uns, dass die Juden das Ziel hätten, die Schweiz «vollkommen antifaschistisch zu gestalten», sie wirkten schlimmer als die Nazispitzel und seien «hinauszuschmeissen». Man solle den Juden verbieten, sich in der Presse zu politischen Themen zu äussern. Immerhin wurde am Schluss der Debatte festgestellt, menschliche Prinzipien wie das Asylrecht gehörten zur Schweiz.339 Von «Erschütterung» war auch wenig zu spüren, als sich die Basler Sektion ein Referat von Pfarrer Frey anhörte. Der gedruckte Bericht für das Sommersemester 1940 meldete dazu wortkarg: «Die Judenfrage wurde von Pfr. Frey besprochen, der, von seinem Standpunkt als Pfarrer aus, in sehr realistischen Worten seinen Gedanken Ausdruck verlieh, doch war das ganze Problem in dieser Aufziehung für die Sektion nicht gut fassbar.»340 Das handschriftliche Protokoll hingegen lässt Elemente der Argumentation erkennen. In enger Anlehnung an das Neue Testament erklärte Frey den Sinn der Begriffe ‚Israel‘ und ‚Juden‘. ‚Israeliten‘ seien nach der Bibel Juden und ‚Heiden‘, die sich zu Christus bekennen, während die ‚Juden‘ nicht an Christus glauben. Gott habe die Juden als das geringste und schwächste unter den Völkern auserwählt, um damit den starken Völkern seine Macht zu zeigen, was den Neid anderer Völker erkläre. Zwar sei nach Frey «der Jude der typische Mensch, jeder erkennt in ihm ein Stück von sich selbst», er meinte aber zugleich, der Jude suche durch Geld und Geist zu triumphieren, um Christus auszustechen: «Der Jude als Begriff ist der Mensch, der nicht Vergebung findet durch Christus.»341 Die Nähe zur Theologie von Wilhelm Vischer342 war ebenso offensichtlich wie die Tatsache, dass manche Zuhörer dieser Lehre nicht folgen konnten und dass die Argumentation keine Sympathien für die in Deutschland Verfolgten zu wecken vermochte. Der Holocaust fand in den Zofinger Dokumenten nicht statt. Andreas Lindt protestierte zwar lebhaft im «Zentralblatt» gegen die Grenzschliessung im Au339 340 341 342
StABS PA 1132a, E 7-10 oo Protokoll der Sektion Basel, 469, 1. 2. 1939. «Rapports du semestre – Sektion Basel über das Sommersemester 1940» (Zentralblatt 1940/41, 41 f., Zit. 42). StABS PA 1132a, E 7-10 pp, Protokoll der Sektion Basel 1939–1943, 114, 29. 5. 1940. Dazu unten, Kapitel 4.3.7.
102
Die Basler Studenten und Deutschland
gust 1942,343 erwähnte aber mit keiner Silbe, dass sich diese auch gegen jüdische Flüchtlinge richtete. Im Grenzkanton Basel schweigt das Zofinger Sektionsprotokoll. Lindt bezeichnete die Massnahme vom 13. August 1942 als einen «Schandfleck in der Schweizergeschichte unserer Tage» und freute sich über die Empörung des Volkes gegen die Fremdenpolizei. Von Steigers bekannte Aussage, dass das «Boot voll» sei, fand er angesichts der Zahl von nur 9’600 Flüchtlingen in der Schweiz anstössig. Der Zustimmung der radikalen Theologen konnte er sich sicher sein, aber es gab Gegenstimmen. Diese warben für Vertrauen in die Bundesbehörden, das durch Appelle an Gefühle nicht untergraben werden dürfe; ausserdem handle es sich in Wirklichkeit um beinahe 100’000 Menschen, die als Flüchtlinge oder Internierte in der Schweiz lebten. Bemerkenswert ist, dass auch Lindt konzedierte, dass die Schweiz nicht «unbeschränkt» Flüchtling aufnehmen könne und dass es unter ihnen auch «unerwünschte Elemente» gebe.344 Im Sommersemester 1944 thematisierte die Basler Sektion nochmals das «Judenproblem», ausgehend von zwei Referaten von Studenten. Der eine stellte fest, dass dem jüdischen Volk die Lebensbedingungen entzogen würden, der andere hielt die Juden für eine Gefahr, sobald sie in einem Land in Massen aufträten, weil sie kein Nationalgefühl hätten, und er riet deshalb zur Schaffung eines Judenstaates in Palästina. Er erwähnte einerseits die sehr geringe Zahl der Juden in der Schweiz, verwies darauf, dass Rassenhass in der Schweiz verfassungswidrig sei, unterstrich aber andererseits, dass fünfzig Prozent der Warenhäuser in jüdischen Händen seien. «Verhalten wir uns abweisend gegen den Juden, der geschäftig, interessiert und aufdringlich gegen uns ist, anerkennen wir ihn, wenn er sich anständig und zurückhaltend zeigt.» In der anschliessenden Diskussion kam es zu rabiaten antisemitischen Ausfällen, die auch der gedruckte Semesterbericht im «Zentralblatt» nicht verschweigen wollte: «Aktive, nämlich Martin Christ und Matthias Stückelberger, sprachen über das Judenproblem. Die nachfolgende Diskussion erhielt ihr etwas spezielles Gepräge dadurch, dass zu gleicher Zeit ein jüdischer Hospitant unter uns weilte. Dass die Diskussion von allen Seiten mit dem nötigen Taktgefühl geführt wurde, wie es sich für einen Zofinger gebührt hätte, kann man nicht gerade behaupten.» So wurde die Feststellung, es gäbe in der Schweiz nur wenige Juden, dadurch ‚widerlegt‘, dass die Statistik nur nach Konfessionen, nicht nach Rassen geführt werde. Der typische Jude lasse andere für sich arbeiten. Die Antipathie sei schon von vornherein gegeben und komme spontan aus dem Inneren. «Sobald sich der Jude wieder sicher fühlt, wird er arro343
344
Der Bundesrat nahm in seinem Beschluss vom 4. 8. 1942, Zivilflüchtlinge konsequenter zurückzuweisen als bisher, explizit in Kauf, dass «den davon betroffenen Ausländern daraus ernsthafte Nachteile (Gefahren für Leib und Leben) erwachsen können». Conseil Fédéral, Décision présidentielle du 4 août 1942, Nr. 128, in: Documents diplomatiques suisses 14, 1997, Nr. 222, 720. Lindt 1941/42a; Paschoud 1942/43.
Schlussfolgerungen
103
gant.» Der Theologe Wilhelm Vischer ergriff in der Diskussion das Wort und stellte klar, dass die «Judenfrage» keine «Rassenfrage» sei, er hielt sie aber für eine Frage der Zahl. «In geringer Zahl sind die Juden ein notwendiger Bestandteil einer Nation», aber sie bildeten einen Fremdkörper. «Konsequenzen bei Übersättigung [seien] mannigfach und eine Gefahr für unser Land. Einzige Waffe: Christentum.»345 Zwar stammten manche der Basler Zofinger-Studenten aus Elternhäusern, die sich für Flüchtlinge einsetzten; wahrscheinlich begegneten sie Flüchtlingen auch zu Hause. Die «Hilfe für kriegsnotleidende Studenten», für die sich die Zofinger 1941/42 als Verein zu interessieren begannen, konzentrierte sich aber auf Studenten in besetzten Ländern und in Kriegsgefangenenlagern, nicht auf verfolgte jüdische Kommilitonen. Nach einer Vorstellung des Weltstudentenwerks und des Fonds européen de secours aux étudiants (FESE) im Zentralblatt 1941/ 42 folgten regelmässige Berichte und Aufrufe zu Bücher- und Geldspenden.346 Die Basler Studentenschaft sorgte dafür, dass diese Aufrufe Gehör fanden, so wurden zusammen mit den Semestergebühren regelmässig Beiträge für den FESE einbezahlt und einmal jährlich ein Kalender zugunsten der internationalen Studentenhilfe verkauft.347
2.7 Schlussfolgerungen Ein gewisses Schweigen über die Vorgänge in Deutschland und eine Vorliebe für schweizerische (und intern-zofingerische – über diese berichtete ich hier nicht) Themen lässt sich feststellen. Die hier betrachteten Studenten waren mit sich und ihrem unmittelbaren Umfeld beschäftigt und bezogen sehr oft Nachrichten über das, was anderen widerfuhr, auf sich selbst. Sie wollten daraus für sich etwas lernen. Empathie auszudrücken war nicht das Ziel der Dokumente, die sie hinterlassen haben. Die Wahrnehmung der Vorgänge in Deutschland blendete die Opfer der Nazifizierung der Universitäten und der Rassenpolitik fast immer aus, mit Ausnahme der unter Karl Barths Einfluss stehenden Theologen, die im Kirchenkampf gegen die deutsche Regierung Stellung bezogen. Die Opfer der Okkupation wurden anlässlich der Ereignisse von Oslo kurz angesprochen; mehr als nur vereinzelte Berichte darüber fanden sich erst gegen Kriegsende. Für den deutschen Widerstand wurde weder in den hier untersuchten Veröffentlichungen noch in den Protokollen von Versammlungen Sympathie bezeugt, ausgenommen 345
346 347
Gloor 1943/44. Details in: StABS PA 1132a, E 7-10 qq, Protokoll der Sektion Basel 1943– 1947, 76, 31. 5. 1944. Wiederum ist zu bemerken, dass die Wortwahl diejenige des Protokollanten ist. Zentralausschuss 1941/42a. Bsp. in: Basler Studentenschaft, SS 1943, H. 4, 121.
104
Die Basler Studenten und Deutschland
vom linken Rand her anlässlich der Kritik an der allzu zurückhaltenden Basler Protestaktion gegen das deutsche Vorgehen in Oslo. Auch die Résistance in Frankreich gelangte kaum in das Blickfeld – die Schüler von Alfred Béguin äusserten sich offensichtlich nicht in den Kreisen der hier betrachteten (mehrheitlich protestantischen) Verbindungsstudenten oder in der Studentenschaft. Vielleicht ergäbe sich ein anderer Befund, wenn die Aktivitäten im katholischen Studentenheim an der Herbergsgasse untersucht würden. Dass die linken Organisationen ein anderes Weltbild hatten als die Verbindungsstudenten, habe ich eingangs gezeigt. Mit der ‚geistigen Landesverteidigung‘ etablierte sich seit der zweiten Hälfte der 1930er Jahre im «Zentralblatt» des Zofingervereins die Vorstellung, dass der Nationalsozialismus «unschweizerisch» und für die Schweiz gefährlich sei. Der Wille, die Unabhängigkeit der Schweiz im Fall eines militärischen Angriffs zu verteidigen, kann als deutlich ausgesprochen gelten. In den ersten Kriegsjahren wurde der Umstand, dass die Schweiz wirtschaftlich in das von Deutschland kontrollierte ‚Neue Europa‘ eingebunden war, «pragmatisch» oder «realistisch» hingenommen und mit einer verschlüsselten Sprache bezeichnet, die Teil der weitgehenden Selbstzensur war, die man der Neutralität schuldig zu sein glaubte. Später wurde erkannt, dass der soziale Ausgleich ein wichtiger Faktor für die Bereitschaft zu einem schweizerischen Widerstand sei – gegen das nationalsozialistisch beherrschte Deutschland, aber immer mehr gegen die Sowjetunion. Die Sektion Basel begann dann, Nationalsozialisten von der Aufnahme auszuschliessen und Aktive, die sich offen für den Nationalsozialismus oder für Deutschlands Kriegführung einsetzten, zu massregeln.348 Einige versuchten sehr lange, Distanz zu den kriegführenden Seiten zu wahren aufgrund der Meinung, dass beide bloss ihre eigenen (materiellen) Interessen verteidigten, die die Schweizer nichts angingen. Solidarität mit den Opfern oder wenigstens Respekt vor ihren Leiden wurde verlangt, beschränkte sich aber hier auf «kriegsnotleidende» Studenten, was die jüdischen Opfer nicht explizit einschloss, und auf die Folgen der Bombardierung deutscher Städte durch die Alliierten (die Vernichtung der Buchindustrie in Leipzig349 wurde zum Beispiel eingehend kommentiert). Verschiedene Formen des Antisemitismus erscheinen als dominierende Haltung, auch wenn jemand sehr deutlich feststellen konnte, dieser sei die «Eselsbrücke», über welche die nationalsozialistische Gleichschaltung in die Schweiz gelange. Erst kurz vor Kriegsende wurden Informationen über die Lage von Studierenden in besetzten Gebieten breiter zur Kenntnis genommen, und unmittelbar nach Kriegsende begann die 348 349
Bsp.: StABS PA 1132a, E 7-10 pp, Sektion Basel der «Zofingia», Protokoll 1939–1943, 366, Sitzung vom 9. 12. 1942. Die Zerstörung der Verlage und Druckereien durch Bombenangriffe im Dezember 1943 und Februar 1944 wurde auch anderswo häufig erwähnt, vgl. Hilbold 2022, 175.
Schlussfolgerungen
105
«Nachkriegshilfe», die Studierende zusammen mit der Universitätsleitung organisierten. Bei diesem Ergebnis ist zu fragen, ob es nur einen Diskurs abbildet, der zu einem bestimmten Forum gehörte, und ob damit offenbleibt, ob nicht in anderen Kreisen anders gedacht und gesprochen wurde. Tatsächlich stellte sich der linke Diskurs anders dar, aber zur Zeit des Kommunistenverbots und im beginnenden Kalten Krieg war er in universitären Kreisen marginalisiert. In manchen Punkten anders orientierten sich die protestantischen Christen, die unter dem Einfluss von Karl Barth standen. Der Diskurs der engagierten akademischen Katholiken lässt sich annährend aus der weiter unten vorgestellten Untersuchung über Béguin erschliessen; ich weiss aber nicht, wie tief er in die Basler studentischen Kreise hineinwirkte. Da die katholischen Verbindungen in der Studentenschaft vertreten waren, sie aber auf dieser Ebene nicht mit alternativen Positionen in Erscheinung traten, vermute ich, dass sie sich mehrheitlich nicht vom «juste milieu» unterschieden. Dieses Fazit betrifft vor allem die bürgerlichen, in Verbindungen organisierten Studenten. Es unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was ich über Basler Professoren in Erfahrung bringen konnte, wie noch zu zeigen sein wird. Aber spezifisch für die Jugend war der Wille, eine grundsätzliche, ja radikale Antwort auf eine «Krise» der Kultur, der Gesellschaft, der Wissenschaft, der öffentlichen Ordnung zu finden. Dieser Wille war bis in die Mitte der 1930er Jahre präsent und äusserte sich im Namen der «jungen Generation» als Fundamentalkritik der auf dem «19. Jahrhundert» beruhenden, liberalen, demokratischen Ordnung in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Darin manifestierte sich der Zeitgeist von 1930, der meist nach rechts weit offenstand, gelegentlich aber (als Antikapitalismus) auch linke Elemente einschloss. Insofern war ein jugendlicher Aufbruch zu vernehmen, der sich vom üblichen Professorenliberalismus und -rationalismus unterschied (prominente Ausnahmen unter den Professoren waren z. B. die den französischen «Personnalisme» vertretenden Romanisten Reymond und Béguin sowie der den Sozialdemokraten nahestehende Zoologe Portmann). Gemeinsam war den bürgerlichen Studenten und ihren Professoren ein manchmal relativ gemässigter (d. h. nicht auf physische Vernichtung abzielender, aber tief verwurzelter und gelegentlich verbal rabiater) Antisemitismus, ihre fehlende Aufmerksamkeit für die Repression in Deutschland sowie in den besetzten Ländern. Beschönigen, verharmlosen, wegschauen, Normalität suchen und das ‚Positive‘ sehen wollen war ein weitverbreitetes Verhalten. Auffällig ist auch die Absenz von Zeichen empathischer Solidarität mit den Opfern des Nationalsozialismus, soweit sich dies auf institutioneller Ebene dokumentieren lässt. Humanitäre oder politische Proteste blieben in den Foren, die die ‚unpolitische Universität‘ bot, weitgehend aus – ausgenommen in Einzelfällen wie den Aktionen für die Universität Oslo, die trotz aller Begrenztheit um so heller leuchteten. Die «Emigration» blieb isoliert und wurde schlechtgeredet. Zunehmend aber wurde die Unter-
106
Die Basler Studenten und Deutschland
scheidung zwischen Nationalsozialisten und Deutschen aufgegeben, und wer schlecht über die Zustände in Deutschland dachte, schrieb dies pauschal einem deutschen Volkscharakter zu. Ein Ringen um ein analytisches Verständnis des Nationalsozialismus fand in Ansätzen statt, blieb aber gegenüber den oberflächlichen, ‚ausgewogenen‘ Wahrnehmungen (welche die Unterschiede zwischen kriegführenden Mächten einebnen wollten) marginal. Dass sich in Deutschland der Nationalsozialismus durchsetzte, wurde manchmal ‚erklärt‘, aber selten und spät beklagt. Die Basler Sektion des Zofingervereins hörte sich etwa – offenbar zustimmend – einen Vortrag von Gerhard Ritter an, der die Machtübergabe an Hitler aus der deutschen Geschichte mit ihrem ‚Primat der Aussenpolitik‘ heraus verständlich machte. Aktive Zofinger kritisierten die Friedensbeteuerungen von Hitler mit dem Hinweis auf die «Dynamik» der «Bewegung» und ihre «Unberechenbarkeit». Somit gab es Elemente einer Analyse und einer zum Teil kritischen Meinungsbildung, die aber mit dem Versuch der Linken, Nationalsozialismus und Faschismus theoretisch zu erfassen, nicht verglichen werden kann. Was mehrheitlich für eine gewisse Resistenz gegenüber dem Nationalsozialismus sorgte, war ein schweizerischer Patriotismus, der in der Zofingia liberalkonservativ eingefärbt war, und ein fundamentaler Gottesglaube. Auf diesen Grundlagen liess sich eine ‚geistige Landesverteidigung‘ konstruieren, die die Alterität der Schweiz begründete. Diese erfand einen schweizerischen Nationalismus, der sich gegen «Unschweizerisches» abschloss und anscheinend bruchlos in den Kalten Krieg hinüberführte.
3 Basel und die deutschen Universitätsjubiläen der 1930er Jahre 3.1 Einleitung Zufällig fielen zwei grosse Jubiläen bekannter deutscher Universitäten in unsere Beobachtungszeit. Zwar wurden noch viele andere Universitätsjubiläen im ‚Dritten Reich‘ veranstaltet, doch Heidelberg und Göttingen feierten mit dem grössten Aufwand.350 Es stellte sich somit die Frage, ob angesichts der Nazifizierung der Hochschulen ab 1933 einerseits offizielle Schweizer Delegationen, andererseits einzelne Schweizer Professoren oder Studierende an diesen Feiern in Deutschland teilnehmen konnten oder gar sollten. Universitätsjubiläen hatten Tradition. Vor 1933 waren sie relativ kleine Feiern von und für die Universitätsangehörigen, für die unmittelbare Trägerschaft und vor allem für die ehemaligen Studierenden gewesen. Sie dienten der Erhaltung, Bestätigung und Gewinnung von ‚Kredit‘:351 – von akademischem Kredit dadurch, dass die betreffende Universität zusätzliches Ansehen erlangte durch die Glückwunschadressen anderer Hochschulen, durch Besuche ehemaliger Schüler und von Rektoren anderer Universitäten, durch die in einer Festschrift enthaltene Botschaft, die ihre Traditionen bekräftigte und bestätigte, dass ihre wissenschaftliche Bedeutung in Lehre und Forschung gross sei;
350
351
Folgende Jubiläen wurden in der NS-Zeit gefeiert: Jena 1933, Leipzig 1934, Berlin 1935, Breslau 1936, Heidelberg 1936, Göttingen 1937, Köln 1938, Frankfurt 1939, Kiel 1940, München 1942, Erlangen 1943, Bonn 1943, Hamburg 1944, Königsberg 1944, Halle-Wittenberg 1944, Rostock 1944. Universitätsfeiern wurden erst unter dem Nationalsozialismus zu eigentlichen Massenveranstaltungen. Die erste dieser umfangreichen Art war Heidelberg 1936, wobei Göttingen und Heidelberg die grössten Universitätsfeiern im ‚Dritten Reich‘ überhaupt darstellten. Drüding 2014, 16, 117. Ich verwende «Kredit» in einem durch Pierre Bourdieus «Kapital»-Begriff angeregten Sinn, halte aber die von Bourdieu mit dem Kapitalbegriff untrennbar verbundene Feldvorstellung hier nicht für sinnvoll anwendbar. Basler Professoren hatten eine Vorstellung von der Autonomie des wissenschaftlichen Feldes, brachten sie jedoch im falschen Moment (Abwehr des Nationalsozialismus) und in einem ungeeigneten Zusammenhang (Kampf der Bürgerlichen gegen Sozialdemokraten und Kommunisten) zur Anwendung. In Basel war das wissenschaftliche Feld sehr eng mit der Gesellschaft verzahnt und durch die übergeordnete Administration des Kantons kontrolliert. Bourdieus Begriff: Jurt 2008, 70–90.
108
Basel und die deutschen Universitätsjubiläen der 1930er Jahre
– von gesellschaftlichem und politischem Kredit durch die Anerkennung in der Öffentlichkeit, durch die Bereitschaft von Honoratioren ausserakademischer Art, an den Feierlichkeiten teilzunehmen, durch das Presseecho; – von ökonomischem Kredit durch die Bestätigung der Bereitschaft privater, industrieller und öffentlicher Geldgeber und Mäzene, zur Finanzierung der Hochschule beizutragen, einzelne Institute und Professoren materiell zu unterstützen oder Sammlungen zu erweitern. Nach dem Regimewechsel von 1933 waren die deutschen Universitäten bestrebt, Kredit bei den neuen Machthabern zu erwerben, Beziehungen zu den verschiedenen Partei- und Staatsstellen herzustellen, zu konsolidieren und trotz der oft akademikerfeindlichen Aspekte352 der nationalsozialistischen Politik ihren Bestand abzusichern, die Weiterexistenz von Lehre und Forschung garantieren zu lassen oder gar sich demonstrativ auszurichten auf das, was das neue Regime zu fordern schien. Dadurch, so hätte ich erwartet, könnte die Absicherung der Kreditwürdigkeit gegenüber dem Ausland erschwert gewesen sein. Die Entlassung jüdischer und politisch nicht genehmer Professoren war nicht unbemerkt geblieben, obwohl sich auch im Ausland nur wenige Kollegen davon unmittelbar zu Protesten motivieren liessen. In den in Deutschland erscheinenden wissenschaftlichen Zeitschriften war der Wechsel in den Herausgebergremien offensichtlich, ebenso wie die Aufnahme von Artikeln, deren Sprache und Inhalt mit fachlichen Konventionen brachen und eindeutig nicht mehr rein wissenschaftlichen Zielen dienten. Letztlich aber galten auch in nazifizierten deutschen Hochschulen Akklamationen aus dem Ausland als wertvoll, wenn sie als innerhalb des ‚Dritten Reichs‘ verwertbarer Kredit eingesetzt werden konnten, zumal auch Vertreter des Regimes in den ersten Jahren der Diktatur darauf achteten, im Ausland eine ‚gute Presse‘ zu haben. Die Jubiläen in Heidelberg 1936 und in Göttingen 1937 fielen in die Zeit nach der Festigung der nationalsozialistischen Diktatur, nach den ersten Entlassungswellen, nach den Bücherverbrennungen, nach den ersten antisemitischen Massnahmen und nach dem sogenannten ‚Röhm-Putsch‘. Die Nazifizierung war weit fortgeschritten, auch wenn die Entlassung der «jüdisch versippten» Professoren noch bevorstand. Die nationalsozialistische Herrschaft bedeutete, dass die Universitäten ihre Jubiläen nur im Einverständnis mit Parteistellen (auch die zuständigen Ministerien in den Ländern und im ‚Reich‘ waren durch Parteileute kontrolliert), somit im Einklang mit den Erwartungen der «Propaganda» für das Regime und für die Ideen seiner Repräsentanten organisieren konnten, die in den Feierlichkeiten eine Plattform zur Darstellung ihrer Ziele suchten. In der Durchführung spielten deshalb Uniformträger und die NS-Nomenklatura eine beachtliche Rolle: Die Hakenkreuzfahne war allgegenwärtig, und die Veranstaltungen 352
Jung 2020; Scholtyseck/Studt 2008; Grüttner 2007.
Einleitung
109
waren mitgeprägt durch SA-Aufmärsche. Feierlichkeiten in Festhallen zeigten den regimetypischen Schmuck; ihre Liturgie war durchsetzt mit Sprechchören, und die wichtigsten Reden stammten von Parteileuten. Eine ständisch strukturierte, rassistisch und nationalistisch konzipierte ‚Masse‘ ersetzte die akademische Bürgerschaft. Statt der Farben der studentischen Verbindungen dominierten die Farben schwarz-weiss-rot, das Hakenkreuz und das Braun. Die Veranstalter wollten die Einbindung der Universität in ihre Vorstellung eines organisierten «Volksganzen» symbolisch und rhetorisch dartun. Dies galt nicht nur für die Institution Hochschule, deren Wert nun daran gemessen wurde, wie sie «Volk und Reich» diente, sondern auch für die Wissenschaft selbst. Akademische Freiheit in Deutschland bedeutete vor 1933, dass die Wissenschaft ihre Massstäbe in sich selbst suchte; den Studenten wurde beigebracht, dass Wissenschaft «voraussetzungslos» zu sein habe, wohlverstanden innerhalb eines sehr patriotischen und – wenigstens unter dem Kaiserreich – staatstragenden Rahmens.353 Nun vollzogen nicht nur Parteisprecher an Universitätsfeierlichkeiten, sondern auch einige akademische Redner den Abschied vom Professorenliberalismus und von der «reinen» oder «voraussetzungslosen Wissenschaft». Wissenschaft war nach diesen (in Gegenwart von Ausländern vorgetragenen) Parteikriterien nun nur noch dann kreditwürdig, wenn sie auf völkischer oder rassischer Grundlage aufbaute und für das Deutschland des ‚Dritten Reichs‘ Nutzen zu bringen versprach. Innerhalb dieser allgemeinen Umstände zeigten sich Unterschiede zwischen Heidelberg 1936 und Göttingen 1937. Der Faktor Zeit spielte dabei insofern hinein, als die Heidelberger Feier in einer ähnlichen Atmosphäre wie die Olympischen Spiele abgehalten wurde, d. h. eine deutsche ‚Normalität‘ und die Verlässlichkeit des angeblich friedliebenden Regimes demonstrieren sollte. So wollten die Heidelberger Veranstalter möglichst ‚die ganze Welt‘ bei sich zu Gast haben und ihr beweisen, dass die deutsche Wissenschaft auch unter diesem Regime florierte. Dass dieser Anspruch einer realen Grundlage entbehrte, erkannte man im Ausland vor allem am Kampf gegen die Kirche und in der Förderung einer Ideologie, die sichtbar als Religionsersatz diente, so dass die angelsächsischen Bischöfe eine wichtige Rolle in der Formulierung und Kommunikation der Kritik spielten. Hinzu kam die Überzeugung einiger nordamerikanischer und britischer Wissenschaftler, dass akademische Freiheit einen demokratischen Rahmen voraussetze. Die Göttinger Veranstaltung 1937 legte demgegenüber auf positive Reaktionen des Auslandes weniger Wert. Sie zielte zwar speziell darauf ab, Gastgeberin der angelsächsischen Welt zu sein (Göttingen hatte im Ancien Régime zum Kurfürstentum Hannover gehört, und das Haus Hannover hatte von 1714 bis 1901 die englischen Könige gestellt), musste aber damit scheitern. Denn 1937 war die Erfahrung mit der vorausgehenden Teilnahme am Heidelberger Anlass kritisch 353
Klassisch: Ringer 1969.
110
Basel und die deutschen Universitätsjubiläen der 1930er Jahre
aufgearbeitet worden, so dass gerade die angelsächsische Presse die Vorbereitungen unfreundlich begleitete. Vom amerikanischen Soziologen Edward Hartshorne lag eine Analyse des deutschen Hochschulwesens unter der nationalsozialistischen Diktatur vor, die deren ideologischen und symbolpolitischen Tendenzen als Angriff auf die Wissenschaft, die freie Meinungsäusserung und die Religion darlegte, ohne explizit auf die Universitätsjubiläen einzugehen.354 Gerade die Entlassung der zahlreichen und bedeutenden Naturwissenschaftler, die sich vor 1933 in Göttingen hatten entfalten können,355 hatte international Wellen geschlagen, vermutlich höhere, als die Nazifizierung der Universität Heidelberg. Einen gewissen Unterschied machte es auch, dass die Heidelberger Organisatoren Einladungen verschickt hatten, ohne das Festprogramm beizulegen, so dass die Besucher 1936 zunächst nicht genau wussten, was sie erwartete. Die Göttinger Veranstalter praktizierten 1937 eine zweistufige Einladung; sie erbaten zuerst (ohne Programm) eine Interessensbekundung der möglichen Gäste, und diese erhielten später eine Karte, die sie nun in Kenntnis des Programms als verbindliche Teilnahmebestätigung zurücksenden mussten. Doch auch wer das Göttinger Programm noch nicht kannte, mochte sich ausrechnen, dass es demjenigen von Heidelberg nicht unähnlich sein werde, auch hinsichtlich der im Festablauf geplanten Akklamationen für das Regime und der Integration rein nationalsozialistischer Festelemente.
3.2 Basler Reaktionen auf die Einladungen zum Heidelberger Universitätsjubiläum 1936 Ich gehe davon aus, dass die Folgen der Nazifizierung unter Schweizer Akademikern bekannt waren, als die Einladungen zu den deutschen Hochschulfeiern eintrafen. Dennoch herrschte die Überzeugung vor, dass solche Einladungen anzunehmen seien. Protokolle universitärer Gremien zeigen, was man sich im Kollektiv dachte und wie man zu handeln beschloss. 354
355
Die Feier zum dritten Jahrestag der Gründung des ‚Dritten Reichs‘ am 30. 1. 1936 an der Friedrich Wilhelms Universität Berlin war Anlass zu einer eingehenden Analyse. Hartshorne 1937, 145 ff. Der Autor typisierte auch die Haltungen der Professoren zur Diktatur und zu den Juden (159 ff.). Vgl. Strenge 2014, 283. Knoch 2013, 155 ff. Der Göttinger Physiker James Franck, Nobelpreisträger 1920, trat aus Protest am 17. 4. 1933 zurück und machte die Entlassungen international publik, obschon er als «Frontkämpfer» noch eine Weile hätte Professor bleiben können. In Göttingen wurden 52 habilitierte Wissenschaftler entlassen, mit einem überproportionalen Anteil in den Naturwissenschaften. Die Naturwissenschaften waren in Göttingen durch renommierte Forscher wie Richard Zsigmondy, Adolf Windaus und James Franck – alle Nobelpreisträger – vertreten gewesen. Die Rockefeller-Stiftung unterstützte in Göttingen Physik und Mathematik. Drüding 2014, 117 f.
Reaktionen auf die Einladungen zum Heidelberger Universitätsjubiläum
111
Beide Male, 1936 und 1937, beschlossen die Schweizer Universitäten, an den deutschen Jubiläen offiziell mit einer Delegation von jeder Universität teilzunehmen, koordiniert durch die schweizerische Rektorenkonferenz. Da es sich um Universitätsjubiläen handelte, wurde die ETH Zürich als Institution nicht eingeladen – das ist insofern auffällig, als jedenfalls in Göttingen verschiedene technische Hochschulen aus dem Ausland von den Organisatoren angefragt wurden und einige auch teilnahmen.356 In Basel gab es 1936 innerhalb der Professorenschaft keine Opposition gegen die Annahme der Heidelberger Einladung. Argumente für die Teilnahme setzten auf akademischer Seite die selbstverständliche Annahme einer Kontinuität voraus, die über den Einschnitt von 1933 hinausreiche. Man wollte glauben, dass weiterhin eine relativ autonome Sphäre der Wissenschaft in Deutschland existiere, die nicht vom Nationalsozialismus durchdrungen sei. Gegen das Argument, die Universitäten seien durch die Gleichschaltung weitgehend ins System des Nationalsozialismus integriert, wurde geltend gemacht, dass ein Fernbleiben der Basler diese Integration noch verstärken oder doch diejenigen Kräfte innerhalb der deutschen Universitäten, die gegen die Nazifizierung resistent waren, schwächen könnte. Betont wurde die «menschliche» Seite des akademischen Austauschs, die man nicht «politisiert» sehen wollte. Mit Blick auf den Konflikt, in dem sich Basel 1936 mit deutschen Stellen befand wegen des Versuchs, den nationalsozialistischen Anatomieprofessor Werner Gerlach aus dem Lehrkörper zu entfernen, mischte sich auch die Befürchtung in die Meinungsbildung, dass von deutscher Seite Repressalien drohten, die den wissenschaftlichen Betrieb und akademischen Austausch gefährden könnten. Basel war in den deutschsprachigen (deutschen) Hochschulraum integriert, so dass eine Ausgrenzung die Provinzialisierung bedeutet hätte.357 So wurde von Basler Professoren zu bedenken gegeben, dass manches Fach fast ausschliesslich auf die Kommunikationsplattformen deutscher wissenschaftlicher Zeitschriften und Verlage angewiesen sei.358 Die Basler Behörden (aber nicht die universitären Instanzen) hatten schon begonnen, eine Selbstausgrenzung zu betreiben, indem sie bei Professorenwahlen in ideologisch relevanten Fächern keine deutschen Kandidaten mehr berücksichtigen wollten. Umgekehrt verbot das Regime der Nachbaruniversität Freiburg i. Br., offiziell an der Basler Erasmus-Feier vom 24. Oktober 356
357 358
Prof. Jakob Ackeret, Aerodynamiker an der ETH, erhielt eine persönliche Einladung als ehemaliger Göttinger Assistent (1921–1927), die er mit dem unbestimmten Hinweis auf «familiäre Verhältnisse», die Terminschwierigkeiten verursachten, höflich ablehnte. Ackeret an Rektor Göttingen, 20. 3. 1937, in: UA Göttingen, unsignierter Bestand Jubiläum 1937. Tréfás 2009, 125 ff.; Stirnimann 1988, 176 ff. John Staehelin an Fritz Hauser, Ablehnung der Übernahme der Organisation einer Basler Gruppe des Vereins ‚Schweizerisches Hilfswerk für deutsche Gelehrte‘, 26. 9. 1933, in: StABS Erziehung X 48, Schweizerisches Hilfswerk für deutsche Gelehrte, 1933–1940.
112
Basel und die deutschen Universitätsjubiläen der 1930er Jahre
1936 teilzunehmen, und das traditionelle baslerisch-freiburgische Professorentreffen in Badenweiler fand damals wegen ‚Terminschwierigkeiten‘ nicht statt, weil die Basler an der Heidelberger Feier aufgrund eines Beschlusses der Regierung, den ich gleich erörtern werde, nicht erscheinen durften.359 Die deutsche Presse griff die Basler Behörden offen an. Die gewohnte Kooperation zwischen deutschen und Basler Professoren war infrage gestellt. Doch ich greife vor.
3.3 Die Basler Absage an Heidelberg und die Grussadresse Angesichts der Spannungen zwischen der Basler Regierung und dem nationalsozialistischen Deutschland ist es verständlich, dass die Basler Debatten um die Teilnahme an der Heidelberger Feier in der deutschen Nachbaruniversität Freiburg i. Br. eingehend beobachtet wurden.360 Das erste Dokument in dieser Freiburger Zusammenstellung war ein Aufruf der Europäischen Studentengruppe an der Universität Basel vom 3. Juni 1936. Als der Freiburger Rektor am 9. Juni 1936 davon Kenntnis erhielt, sandte er eine Abschrift an den Rektor der Universität Heidelberg, an das Kultusministerium in Karlsruhe und an den Rektor der Universität Basel. Entschieden wandte sich diese Studentengruppe gegen die Teilnahme schweizerischer Hochschulen an der Heidelberger Feier. Das nationalsozialistische Deutschland hat sich bewusst ausserhalb des europäischen Kulturkreises gestellt und gegen den übernationalen Charakter der Wissenschaft verstossen. Das nationalsozialistische Deutschland hat die besten Dozenten aus Gründen der Rasse von seinen Universitäten entfernt. Es hat das Rasseprinzip zur Staatsmaxime erhoben und es selbst für die Wissenschaft gültig erklärt. Eine Universität, die die Wissenschaft auf dem Rasseprinzip aufbaut, hat keinen Anspruch auf internationale Achtung. Nach den bisherigen Erfahrungen zu schliessen, werden die Heidelberger Festlichkeiten einzig dazu dienen, um Propaganda zu betreiben für die nationalsozialistischen Theorien, die in schroffem Gegensatz zur schweizerischen Staatsauffassung stehen und zum Gedanken der europäischen Kulturgemeinschaft. Die europäisch gesinnten Studenten sehen in einer geistigen Autarkie, wie sie heute
359
360
Häberlin/Binswanger 1997, 383 f. NSDAP Leitung der Auslands-Organisation/Kulturamt an das Reichserziehungsministerium,12. 10. 1936: Man könne nicht zwischen der Einstellung der Basler Regierung und der Universität unterscheiden. Der zwischenstaatliche Austausch dürfe nicht der Willkür der einen (Schweizer) Seite preisgegeben werden; die Würde des ‚Reichs‘ stehe auf dem Spiel. Freiburger Rektor Friedrich Metz an den Basler Rektor Haab, 24. 10. 1936. Metz an Kultusminister Wacker in Karlsruhe, 29. 10. 1936: «Bericht über die Säkularfeiern in Basel». Alles in: UA Freiburg i. Br. B0001 215 Generalien, Feierlichkeiten, Einladungen zu Versammlungen, Feierlichkeiten usw. 1936. UA Freiburg i. Br., B0001 132 1936 Universität Freiburg, Generalia, Feierlichkeiten, 550Jahrfeier der Universität Heidelberg. Die im Folgenden benutzten Dokumente entstammen, wo nicht anders vermerkt, diesem Bestand.
Die Basler Absage an Heidelberg und die Grussadresse
113
in Deutschland herrscht, vor allem auch grosse Gefahren für das Zusammenleben in Frieden der Völker.
Erhalten ist in Freiburg i. Br. auch ein Ausriss aus den «Basler Nachrichten» vom 4. Juni 1936 mit einem Bericht aus dem Grossen Rat (Ordentliche Sitzung vom Vormittag des 4. Juni). Das Blatt berichtete darin über die Interpellation des kommunistischen Gross- und Erziehungsrats Werner Meili-Hofstetter361 gegen die Teilnahme der Basler Universität an der Heidelberger Feier. Meili stellte richtig fest, dass die Regenz die Teilnahme beschlossen hatte (dies entnahm Meili der Frankfurter Zeitung!), und fragte: «Ist der Regierungsrat bereit, die Anmeldung in Heidelberg zurückzuziehen?» Denn Meili sah in der Heidelberger Feier eine «politische Grossveranstaltung zur Propagierung nationalsozialistischer Ideen». Die «Basler Nachrichten» vom 5. Juni 1936 kommentierten die Interpellation von Meili («Pressionsversuch der Kommunisten») mit einem Plädoyer für die Unabhängigkeit der Universität von Politik und Verwaltung. Jubiläumsbesuche zeugten, meinte die Redaktion der liberalkonservativen Zeitung, von geistiger Verbundenheit und internationaler Höflichkeit. Die unpolitischen Verbindungen zwischen den Hochschulen sollten erhalten bleiben. Auch die Berner Zeitung «Der Bund» vom 8. Juni 1936 («Die Hochschulfeier in Heidelberg») war der Meinung, die Konferenz der schweizerischen Hochschulrektoren solle sich nicht auf die Opposition von «Linkskreisen» einlassen, denn politische Gründe dürften nicht ausschlaggebend sein.362 Regierungsrat Fritz Hauser beantwortete die Interpellation Meili wie folgt: Die Basler Universität habe in Heidelberg zugesagt, ohne politische Erwägungen anzustellen. Inzwischen sei die «starke internationale Opposition» bekannt geworden, die von englischen Universitäten ausgehe. Auch könne man jetzt dem Programm entnehmen, dass es in Heidelberg um einen «staatspolitischen Akt» gehe. Die Universität halte trotzdem ihre Besuchsabsicht aufrecht, um unter den Schweizer Universitäten nicht allein dazustehen. Der Entscheid von Erziehungsrat und Regierungsrat stehe noch aus. Meili war
361
362
«Werner Meili-Hofstetter (21. 10. 1899–29. 4. 1967), verheiratet am 19. 9. 1924 in Basel mit Rosa Hofstetter (5. 8. 1907–30. 11. 2003). […] Werner Meili-Hofstetter wohnte seit 1923 in Basel. Seine Familie stammt aus Unterembrach (Zürich). Beruf: Hilfsarbeiter, später Inhaber eines Verlaggeschäftes.» StABS PD-REG 14a 8-6: Schweizerkontrolle, 1936–1974, Nr. 66947, nennt als Beruf Schreiner/Anschläger, Handlanger/Hilfsarbeiter und Inhaber eines Verlagsgeschäfts an der Untern Rebgasse 17. Freundliche Mitteilung vom 23. 8. 2018 von Christoph Manasse, StABS. Da er kein Intellektueller war, wurde Meili in hochschulpolitischen Fragen sehr wahrscheinlich von seinem Parteikollegen Dr. Walter Strub, Gewerbeinspektor, beraten (freundlicher Hinweis von Charles Stirnimann, 29. 12. 2020). Hinweise auf Stellungnahmen anderer Schweizer Universitäten zur Heidelberger Einladung: oben, Kapitel 1.3.a.
114
Basel und die deutschen Universitätsjubiläen der 1930er Jahre
mit dieser Antwort unzufrieden und forderte, dass Basel mit den englischen Universitäten «gemeinsame Sache» machen solle. Die (deutsche) «Freiburger Zeitung» berichtete am 16. Juni 1936, die Basler Regierung habe noch am 5. Juni beschlossen, die Universität müsse auf die Teilnahme an der Heidelberger Feier verzichten. Der Korrespondent wusste, dass der Beschluss dank der «sozialistischen» Mehrheit zustande gekommen sei, während ihn die bürgerliche Presse scharf kritisiere. Das gleichgeschaltete Freiburger Blatt konstatierte in Basel einen «kindisch anmutenden Hass gegen alles Deutsche» und drohte, der Entscheid könnte nachteilig für die wirtschaftspolitischen Verhandlungen zwischen Deutschland und der Schweiz sein; auch der Fremdenverkehr werde leiden. So viel erfahren wir über die Freiburger nationalsozialistische Perspektive. Tatsächlich hatte die Regenz der Basler Universität am 22. Januar 1936 «stillschweigend» beschlossen, die Einladung anzunehmen, und das Erziehungsdepartement hatte daraufhin einen Kredit für die Reise gewährt.363 Rektor Robert Haab sagte dann aber nicht gleich in Heidelberg zu, sondern wartete vorsichtig ab. Nach der Ermordung des NSDAP-Landesgruppenleiters Wilhelm Gustloff in Davos (4. Februar 1936) konsultierte er Kollegen an anderen Schweizer Universitäten und erfuhr, dass ausser Neuchâtel (das keine Einladung erhalten hatte) alle in Heidelberg vertreten sein wollten. Am 11. März 1936 brachte er die Sache wieder vor die Regenz: Es sei nun bekannt, dass englische Universitäten nicht an die 550-Jahrfeier von Heidelberg gehen würden, weshalb er auf den Basler Teilnahmebeschluss zurückkommen möchte. Er erwähnte auch den Fall des Schweizer Juristen Max Gutzwiller, der in Heidelberg Schwierigkeiten bekommen hatte (siehe unten). Da aber die meisten Schweizer Universitäten eine Delegation entsenden werden, soll Basel die Einladung annehmen. Die Altrektorenkonferenz erhielt von der Regenz die Vollmacht, über die Basler Teilnahme definitiv zu entscheiden, was sie im positiven Sinn auch tat. Danach nahm der Rektor die Einladung offiziell an. Regierungsrat Hauser warnte daraufhin den Rektor vor «innerpolitischen Schwierigkeiten», die sich daraus ergeben könnten; der Rektor fand aber, die Universität wolle bloss die wissenschaftlichen Beziehungen aufrechterhalten. Nun informierte Fritz Hauser am 16. März 1936 die Kuratel über den Beschluss der Regenz. Der Präsident der Kuratel, der radikal-demokratische Advokat Ernst (Alfred) Thalmann (bis 1935 Ständerat, damals noch Grossrat),364 konsultierte den Altphilologen Peter von der Mühll, der eine Basler Beteiligung wegen der engen Beziehungen zu Heidelberg für erforderlich hielt, eine Ansicht, die sich Thalmann zu eigen machte. Das Erziehungsdepartement fragte nun 363 364
Stirnimann 1988, 180 ff.; Stirnimann 2021, 234 ff. Gartmann/Pagotto 2012. Über diese wichtige Persönlichkeit gibt es nur Zeitungsnachrufe. Vgl. Schweizerisches Wirtschaftsarchiv, Biogr. Dossier Dr. Ernst Thalmann 1881–1938.
Die Basler Absage an Heidelberg und die Grussadresse
115
selbst in Bern und Zürich an, ob die dortigen Universitäten wirklich teilnehmen werden. Das Programm der Feier wurde Ende April bekannt. Als Hauser am 11. Mai 1936 die Kuratel über die Interpellation von Meili im Grossen Rat orientierte, nahm dies die Kuratel bloss zu Protokoll. Der Erziehungsrat befasste sich mit der Angelegenheit, bevor die Regierung auf Antrag des Erziehungsdepartements den definitiven Entscheid fällte. In der Sitzung dieses Rats vom 5. Juni 1936 begründete der Theologieprofessor (und Vertreter der Evangelischen Volkspartei) Ernst Staehelin die Teilnahme der Universität am Heidelberger Anlass: «Mit Rücksicht auf die Internationalität der Wissenschaft sollte man Beziehungen, die schon lange bestanden haben, nicht abbrechen.» Die Schweizer Universitäten sollten einheitlich auftreten. Ein «ungünstiger Eindruck» würde entstehen, wenn einzig Basel nicht teilnähme. «Um der Menschheitssache willen sollten wir die Beziehungen zwischen den Universitäten nicht abbrechen, solange es nicht absolut notwendig sei», wurde sein Votum protokolliert. Auch sprach er sich dagegen aus, den Fall Gutzwiller wieder ins Gespräch zu bringen, von dem er meinte, er liege schon sehr weit zurück. Tatsächlich war der Jurist Gutzwiller seit 1935 in Heidelberg am Unterrichten gehindert worden, und zum Zeitpunkt der dortigen Universitätsfeier war er beurlaubt; seine Entlassung erfolgte im Herbst 1936. Dies als «weit zurückliegend» zu bezeichnen, war eine Übertreibung. Staehelin erreichte damit nichts.365 Mit 4 : 2 Stimmen riet der Erziehungsrat davon ab, eine Delegation nach Heidelberg zu senden. Die Kuratel nahm dies am 8. Juni 1936 zum Anlass festzustellen, dass die Universität derart wichtige Fragen künftig nicht allein beschliessen dürfe. Der letztinstanzliche Entscheid lag nun beim Regierungsrat. Am 6. Juni hatte Hauser seinen Regierungskollegen ein Verbot der Basler Teilnahme beantragt; die Opposition vertrat in der Regierung der Liberalkonservative Carl Ludwig. Ein Entscheid fiel erst eine Woche später, da der sozialdemokratische Regierungsrat Fritz Brechbühl auf Reisen war. Hausers Antrag obsiegte knapp mit 4 : 3 Stimmen. Der Redaktor der «Basler Nachrichten», Albert Oeri, hatte am Vortag des Entscheids nochmals die Regierung beschworen, dem «kommunistischen Druck» nicht nachzugeben; ein Verbot («Kulturblamage für Basel») sei gleichbedeutend mit der politischen Einflussnahme auf die Universität, wie sie in Deutschland üblich geworden sei. Bürgerliche Stimmen stellten das Verbot der Teilnahme als politische Konzession der Sozialdemokraten an die Kommunisten hin und sahen darin eine Kompensation für die Niederlage der Kommunisten bei der Abstimmung über die Sparvorlage.366 Das Erziehungsdepartement sandte dem Rektor der Universität Heidelberg die Mitteilung, es habe der Universität die Teilnahme untersagt, während die Universität eine Glückwunschadresse dorthin schickte, auf die ich weiter unten eingehen werde.
365 366
StABS Protokoll S 4 Erziehungsrat, Bd. 23, 1934–1936, 5. 6. 1936. Stirnimann 1988, 181.
116
Basel und die deutschen Universitätsjubiläen der 1930er Jahre
Nachdem Ende Juni die Feierlichkeiten in Heidelberg stattgefunden hatten, stellte der Jurist Haab, der sich eingehend mit dem Universitätsrecht befasst hatte, in der Regenzsitzung vom 8. Juli 1936 fest, die Regierung habe tatsächlich das Oberaufsichtsrecht über die Universität; die Universität hätte nicht gegen den Willen der Regierung eine Delegation entsenden können. Eine Diskussion über diese Ausführungen wurde nicht protokolliert. Doch der renommierte Altgermanist Andreas Heusler trat nun ein Jahr früher als geplant von seiner Basler Professur zurück, um gegen Hausers Eingriff in die universitären Angelegenheiten zu protestieren.367 In Heidelberg waren schliesslich folgende Schweizer anwesend: Der Rektor der Universität Zürich Oskar Bürgi (Veterinärmediziner); aus Zürich kam auch der Geologe Paul Niggli, um einen Ehrendoktortitel zu empfangen.368 Die Universität Bern vertrat der Rechtshistoriker Hans Fehr (er war 1917–1924 Professor in Heidelberg gewesen);369 als Vertreter der Universität Lausanne reiste der Physiologe Alfred Fleisch nach Heidelberg; für die Universität Genf Rektor Albert Richard-Oltramare, Jurist; aus Genf hatte sich ferner der deutsche Jurist Hans Erich Kaden370 angemeldet, nahm dann aber nicht teil; die Universität Freiburg i. Ü. vertrat der Rektor Alfred Siegwart (Privatrechtler, er wohnte in Göttingen während der Feier bei Max Gutzwiller, der früher in Freiburg gelehrt hatte und kurz darauf wieder in den Freiburger Lehrkörper aufgenommen wurde).371 In der Tischordnung für den Festakt erschienen die Namen von zwei Basler Professoren: Fritz Jaeger, Geograph, und Siegfried Edlbacher, physiologischer Chemiker, der bis 1932 in Heidelberg gewirkt hatte.372 Sie fehlten jedoch in der Teilnehmerliste – vermutlich sagten sie ab, nachdem die Tischordnung schon erstellt war.373 Dafür erschien an den Heidelberger Feierlichkeiten ein anderer Schweizer: Max Gutzwiller, der katholische Jurist, der im Kreis um Marianne Weber, bei 367 368 369 370 371 372 373
Andreas Heusler an Eduard Hoffmann-Krayer, 20. 6. 1936, in: Zinkernagel 2020, 2679– 2681. Zu Heusler siehe unten, Kapitel 7.2.3.2. Leo 2010, 165. Hans Fehr war germanophil und für gewisse Aspekte des völkischen Denkens offen. Becker 1995, 21. Kaden (richtig Erich-Hans K.) lehrte in Genf von 1925 bis 1971 Deutsches Recht für die dortigen deutschen Studenten. Sturm 2007. Gutzwiller 1945. Entscheid in Freiburg, nach Heidelberg zu fahren: Altermatt/Späti 2009, 116 ff. Zur Person Edlbachers: https://www.leo-bw.de/web/guest/detail/-/Detail/details/PERSON/ kgl_biographien/12814419X/Edlbacher+Siegfried+Augustin+Johann. UA Heidelberg, Teilnehmer 550-Jahr-Feier, o. D. [1936], B-1812/31 (X, 2, Nr. 63), Zusagen Ausland. Generalia Feierlichkeiten 550-Jahrfeier, Ausländerliste Herr Fuhrmann, B1812/42 (X, 1, Nr. 114a), 10.6. (Neueste Liste Fest-Akte). Die Basler Kuratel hatte zu Protokoll genommen, dass Jaeger, Edlbacher und der Pharmazieprofessor Zörnig erklärten, an der Heidelberger Feier nicht teilnehmen zu können, in: StABS Basel, Protokoll T 2 Kuratel der Universität Nr. 13 1935–1941, 93, 8. Sitzung, 6. 7. 1936.
Die Basler Absage an Heidelberg und die Grussadresse
117
Heinrich Rickert und bei Hans Ritter von Baeyer, dem als jüdisch geltenden Professor für Orthopädie, verkehrte und seit 1926 Professor für Deutsches Privatrecht und Römisches Recht in Heidelberg war. Er war seit 1935 auf Betreiben der nationalsozialistischen Studentenschaft beurlaubt, da er keine Konzessionen an den Nationalsozialismus machen wollte. Nach Gutzwillers eigener Darstellung lehnte er die Nationalsozialisten wegen des tiefen intellektuellen Niveaus ab und weil Opportunisten und Streber die Stunde nutzten, um etwas für sich zu ergattern. Zudem stand er als Katholik in Opposition zum nationalsozialistischen Totalitätsanspruch. Gutzwillers Frau Gisela Strassmann war «nicht-arisch». Schon 1933 hatte Gutzwiller versucht, in der Türkei zu lehren, liess sich aber von den auch dort organisierten nationalsozialistischen Gruppen abschrecken. Der Heidelberger Rektor Wilhelm Groh374 schätzte Gutzwiller gegenüber dem Ministerium in Karlsruhe wie folgt ein: «Dem nationalsozialistischen Denken steht er infolge seiner schweizerischen Abstammung und seiner Verheiratung mit einer Jüdin besonders fremd gegenüber. Von der Studentenschaft wird er vielleicht noch nachdrücklicher abgelehnt als die beiden nichtarischen Professoren.» Im Herbst 1935 wurde Gutzwiller aufgefordert, einen wissenschaftlichen Urlaub zu beantragen, was er auch tat. Im Dezember 1935 verlangte Rektor Groh vom Karlsruher Ministerium, man solle Gutzwiller die Rückkehr in die Schweiz möglichst erleichtern, damit er seine Lehrtätigkeit in Heidelberg nach diesem Urlaub nicht wieder aufnehme. Die Reichsfluchtsteuer wurde ihm erlassen, es folgten weitere finanzielle Zugeständnisse, darunter eine Pension. Die Familie Gutzwiller blieb nach dem Urlaub in der Schweiz, er selbst kehrte zurück, war während der Feierlichkeiten in Heidelberg anwesend und verliess Deutschland im September 1936. In der Schweiz konnte er zunächst in St. Gallen an der Wirtschaftshochschule Kurse abhalten, bis in Freiburg/Schweiz das Ordinariat von Wilhelm Schönenberger frei wurde, und im Februar 1937 berief diese Universität Gutzwiller auf den Lehrstuhl, den er schon vor seinem Weggang nach Heidelberg bekleidet hatte, zurück.375 Interessant ist die Glückwunschadresse, die die Universität Basel offiziell der Universität Heidelberg zusandte. Mit dieser Adresse wollte die Universität einerseits zum Ausdruck bringen, dass sie nur wegen des regierungsrätlichen Teilnahmeverbots keine Delegation entsende. Mit der nachstehend zitierten Passage wurde aber Heidelberg andererseits auf die guten Traditionen verpflichtet, die durch die Nazifizierung gefährdet waren, und unterstrichen, dass die angesehene Universität nur bei deren Bewahrung den Deutschen und der Völkerwelt «Segen» bringe. Die in Heidelberg gefeierte ‚deutsche Revolution‘ von 1933 wurde bloss allgemein unter «Erschütterungen» rubriziert und betont neutral als ein 374 375
Leo 2010. Wubbe 2014; Gutzwiller 1978, 84–121, 206. Gutzwillers geistige Welt: Leo 2010, 124 ff.; Mussgnug 2006, 273 f.; Gutzwiller 1941, insbes. 85–89.
118
Basel und die deutschen Universitätsjubiläen der 1930er Jahre
«neue[r] Zeitraum» bezeichnet. Die Universität Basel gab damit zu verstehen, dass sie in Heidelberg die alte Stätte der freien, letztlich christlich fundierten Wissenschaft ehre, die Entwicklung seit 1933 aber mit Skepsis beobachte. Die Zeiten sind ernst. Da ist es unerlässlich, dass die Wissenschaft, durch die, wie es in der Stiftungsurkunde Ihrer Universität heisst, divini nominis fideique catholicae cultus protenditur, iusticia colitur tam publica quam privata, res geritur utiliter omnisque prosperitas humanae conditionis augetur, mit besonderer Treue ihres Führungsamtes walte. Darum ist es unser aufrichtigster Wunsch, dass es der Heidelberger Universität vergönnt sei, in den Erschütterungen unserer Zeit getreu der altehrwürdigen Bestimmung ihr Werk zu tun, die ewigen Wahrheiten, die dem Menschengeist gegeben und aufgegeben sind, zu erarbeiten, dem Recht und der Gerechtigkeit die Bahn zu bereiten, dem Wohle der Menschheit zu dienen. Möge die Feier, die Sie begehen, dazu beitragen, dass Ihre Universität in diesem Sinne in den neuen Zeitraum hineinschreiten darf zum Segen des deutschen Volkes und der ganzen Völkerwelt.376
Die Adressen von Genf, Lausanne, Neuchâtel und Zürich wiesen, wenn auch weniger ausführlich, in dieselbe Richtung. Bern betonte bloss die in der Vergangenheit engen persönlichen Beziehungen zwischen den Professoren der beiden Städte und erinnerte daran, wie sehr die Berner Studenten deutsche Kultur und deutsches Leben in Heidelberg geschätzt hätten.377
3.4 Die Durchführung des Heidelberger Jubiläumsfestes Der Verlauf der Heidelberger Feier liess an Deutlichkeit der nationalsozialistischen Botschaft, die damit gesendet werden sollte, nichts zu wünschen übrig. Er gab somit denjenigen Basler Politikern Recht, die dafür gesorgt hatten, dass die Universität nicht offiziell mit einer Delegation teilnehmen durfte. Die von Rektor Wilhelm Groh eingesetzten Vorbereitungsausschüsse gaben der Feier das Ziel vor, für die Wissenschaft im nationalsozialistischen Deutschland zu werben. Den Antrag der Universität, die Sache für «reichswichtig» erklären zu lassen, entschied Hitler im Januar 1936 positiv. Im Februar 1936 setzte 376
377
«Die Universität Basel der Ruprecht-Karl-Universität Heidelberg zur Feier ihres fünfhundertfünfzigjährigen Bestehens». Gedruckte Adresse Juni 1936, Unterschrift Rektor Haab, in: UA Heidelberg, B-1812/45, X,1, Nr. 37. Genf: UA Heidelberg, B-1812/62, X, 1 Nr. 54. Neuchâtel: UR 81, X, 1 Nr. 75. Lausanne: UR 14, X, 1 Nr. 67. Bern: UR 74, X, 1 Nr. 39: Nam magnus est numerus Helvetiorium imprimisque Bernensium qui cultus et animi educationem ei memori mente gratiam debitam persolvunt. In vestra urbe splendida ab historia ad missionem singularem destinata cultum Germanicum et vitae Germanicae relationem adamarunt et magni aestimaverunt. Zürich: B-1812/106, X, 1 Nr. 98.
Die Durchführung des Heidelberger Jubiläumsfestes
119
sich das Reichserziehungsministerium gegen Goebbels’ Idee, die Feier durch sein Propagandaministerium organisieren zu lassen, durch (Goebbels hatte in Heidelberg studiert). In der Diskussion um die offene Politisierung des Anlasses plädierte der badische Kultusminister Otto Wacker, seit 1925 Mitglied der NSDAP, für Zurückhaltung, da er ausländische Proteste fürchtete. Davon war dann während des Anlasses wenig zu merken. Bereits Anfang Februar 1936 lief in der «Times» eine Debatte über die Teilnahme der britischen Universitäten. Der Bischof von Durham, Herbert Hensley Henson, forderte mit dem Hinweis auf die Vertreibung der jüdischen Professoren aus den deutschen Hochschulen einen Boykott. Ab Mitte Februar trafen die Absagen aus Grossbritannien in Heidelberg ein. Nachdem auch Oxford und Cambridge abgesagt hatten, lud der Heidelberger Rektor mit Billigung des Reichserziehungsministeriums alle britischen Hochschulen wieder aus (29. Februar 1936). Die Niederländer boykottierten den Anlass geschlossen, viele Absagen kamen aus Frankreich, auch Kapstadt, Dublin und Oslo sagten ab, doch die Amerikaner nahmen überwiegend die Einladung an, zum Teil mit der Begründung, dass die Universität langfristig existiere, während die Hitlerdiktatur vorübergehe. Die Universitätsleitungen und die Studentenorganisationen der prestigeträchtigen Universitäten in den USA verfolgten meist eine Politik guter Beziehungen zu den deutschen Universitäten, die sie weiterhin als wissenschaftlich führend betrachteten, obschon sie den Eingriffen der Nationalsozialisten in die akademischen Freiheiten kritisch gegenüberstanden – soweit sie nicht in Hitler ein Bollwerk gegen Sozialismus und Judentum sahen. In der US-amerikanischen Öffentlichkeit wurde lebhaft dagegen protestiert, was jedoch bis 1938 und darüber hinaus die Universitäten kaum beeindruckte.378 Am Heidelberger Fest waren 31 Nationen vertreten, deren Flaggen als Auftakt von einer SS-Verfügungstruppe gehisst wurden unter Marschmusik und Gewehrpräsentation sowie mit einer Parade von NS-Verbänden. Danach begrüsste Rektor Groh die Gäste in der Aula. An der Heldengedenkfeier, die Teil des Programms war, waren SS und SA unübersehbar, und der Militärhistoriker Paul Schmitthenner (SS-Mann, damals als aktiver Nationalsozialist ohne Mitwirkung der Fakultät persönlicher Ordinarius geworden) hielt eine Ansprache, in der er den Mythos des 1918 «im Felde unbesiegten» Heeres aufleben liess und Hitler als «von Gott gesandt» darstellte. Am letzten Tag gab die Reichsregierung im Schloss einen Empfang mit drei NS-Ministern (Joseph Goebbels, Bernhard Rust, 378
Unter den Präsidenten der US-Universitäten herrschte die Meinung vor, ein Boykott sei kontraproduktiv. «Wenn wir zulassen würden, dass die unglückliche Entwicklung der letzten fünf Jahre jegliche Anerkennung des deutschen Volkes und des deutschen Geistes zunichte macht, so würden wir hiermit unsere geistige Freiheit tatsächlich aufgeben», Plett 2010, 76; Leo 2010, 150–182. Antisemitismus in den USA und Nahbeziehungen der Hochschulleitungen und Studenten zu Nationalsozialisten: Norwood 2009, 63 ff., 166.
120
Basel und die deutschen Universitätsjubiläen der 1930er Jahre
Franz Seldte); Hitler allerdings erschien nicht. Goebbels und Groh hielten Ansprachen. Rust rechtfertigte vor den ausländischen Gästen das harte Vorgehen gegen Juden und Andersdenkende als Selbstverteidigung und vertrat die These, Weltanschauung sei die Voraussetzung für Wissenschaft. Wacker unterstrich wie Rust den historischen Bruch von 1933 mit dem Liberalismus und dem Internationalismus.379 Danach erst durften die ausländischen Delegationen ihre Glückwünsche übermitteln und schienen so die vorausgehenden Ausführungen zu billigen. Die Schweizer mahnten die Respektierung der Unabhängigkeit der Schweiz vom ‚Reich‘ an. 43 ausländische Persönlichkeiten erhielten einen Ehrendoktortitel, darunter vier Italiener, sechs US-Amerikaner und der Zürcher Geologe und Mineraloge Niggli. Die Feier glich einer NSDAP-Parteiveranstaltung mit Fahneneinzügen und einschlägigem Saalschmuck, Musik aus Wagners Meistersingern und dem Horst-Wessel-Lied.380 Die Teilnehmer erhielten als Festgabe ein Buch mit einer kurzen historischen Darstellung und Texten zur Geschichte der Universität Heidelberg. Der Verfasser war der Papyrologe und Paläograph Karl Preisendanz, dessen Name allerdings in der Publikation nicht erscheint. 1934 war er, der im Mai 1933 der NSDAP beigetreten war, zum Direktor der Badischen Landesbibliothek ernannt worden als Nachfolger des aufgrund der nationalsozialistischen Rassengesetze entlassenen Ferdinand Rieser; dann, seit 1935, war er Leitender Bibliotheksdirektor an der Universitätsbibliothek Heidelberg. 1945 wurde er als Profiteur des Nationalsozialismus von den Amerikanern entlassen.381 Die Broschüre enthält nirgends ein Hakenkreuz oder auch nur das Akronym «NSDAP» oder verwandte Begriffe, auch den Namen «Hitler» sucht man vergeblich. Das Geschichtsbild ist deutsch-völkisch, antiwestlich, franzosenfeindlich und präsentistisch, der Stil ‚zeitgemäss‘, aber es gibt keinen offenen Antisemitismus, nur eine Anspielung auf die gescheiterte Berufung von Spinoza. Preisendanz beklagt, dass Heidelberg zwischen Ottheinrichs Universitätsreform und dem 30jährigen Krieg als Hochburg des Calvinismus einer «völligen Überfremdung» unterworfen und zum «Einfallstor westlichen Geistes in Deutschland» geworden sei. Mit der Neugründung nach der Franzosenzeit 1803 sei das Deutsche nun in vielen Fächern «endlich» Unterrichtssprache geworden, und die Universität habe seither ein «rückhaltloses Bekenntnis zum deutschen Volksgeist» abgelegt. Nach 1871 sei ein Niedergang eingetreten: «In politisch gesicherten Zeiten entzog sich die Wissenschaft ihrer völkischen Verpflichtung», sie sei in «Spezialisierung» versunken. In der Schlussbetrachtung lesen wir: Die Universität «weiss, dass sie das Vermächtnis, das ihr das Erbe einer 550jährigen wechselvollen Geschichte auferlegt, nur wahrnehmen kann, wenn sie in dem Boden, in dem Volke wurzelt, dessen Teil sie ist. Die 379 380 381
Elvert 2008, 7 f. Engehausen 2006, 130–139. https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Preisendanz.
Basel und Heidelberg, eine Zwischenbilanz
121
grösste Zeit ihrer Geschichte war die, in der Heidelberg zugleich am deutschesten war.»382 Frank Engehausen hat in der Geschichtskonstruktion der Festredner von 1936 eine fast grotesk anmutende «Generalverdammung der Entwicklung der Universität bis in ihre allerjüngste Vergangenheit» gesehen. So schrieb Rektor Groh, an sich sei Heidelberg die ‚jüngste‘ Universität, da sie die NS-Universitätsvorstellungen am gründlichsten verwirklicht habe.383 Oft dargestellt wurde der Vorgang, der ebenfalls ins Jahr 1936 gehört: Über dem Eingang der Neuen Universität prangte seit der Fertigstellung 1931 die Pallas Athene von Karl Albiker und die von Friedrich Gundolf vorgeschlagene Devise «Dem lebendigen Geist». 1936 wurde die Athene ersetzt durch einen Adler, und der Wahlspruch lautete neu «Dem deutschen Geist».384 Als Fazit darf gelten: «Statt 550 Jahren Heidelberger Universitätsgeschichte feierte man drei Jahre nationalsozialistischer Herrschaft.»385
3.5 Basel und Heidelberg, eine Zwischenbilanz So waren es 1936 in Basel die sozialdemokratisch geführten Departemente der Regierung, Politiker und ein Teil der Mitglieder der Kuratel, die die Einladung nach Heidelberg ablehnten. Dazu statuierten sie, dass die Universität als kantonale (staatliche) Bildungsanstalt in ihren Aussenkontakten nicht selbstständig handeln könne, sondern dem Entscheid der Regierung unterstellt sei – eine Auffassung, die einen sensiblen Punkt traf, glaubten doch die Professoren, die eine Teilnahme an den Heidelberger Feierlichkeiten befürworteten, dass es sich um eine rein akademische Freundschaftsbekundung handle, die die Politik der Regierung gar nicht tangiere. Die Basler Regierung begründete ihren Entscheid damit, dass es für die Stellung der Universität in der Basler Öffentlichkeit schädlich sei (kreditschädigend, könnte man sagen), wenn sie entgegen der in der Stadt verbreiteten feindlichen Einstellung zum Nationalsozialismus an einer nationalsozialistischen Feier (und die Behörden waren im Unterschied zu manchen Professoren überzeugt, dass es sich um eine solche handle) offiziell mitwirke. Das Erziehungsdepartement wollte auch deshalb verhindern, dass sich die Universität in der Basler Öffentlichkeit und Politik als ‚nazifreundlich‘ in Misskredit brächte, weil sein Vorsteher Fritz Hauser trotz finanzieller Knappheit mit dem neuen Universitätsgesetz auch einen Ausbau der Universität und für 1939 ein neues Kollegiengebäude realisieren wollte, wozu eine starke Unterstützung in der Öffentlichkeit unbedingt erforderlich war.386 382 383 384 385 386
[Preisendanz] 1936. Engehausen 2010, 118 f. Engehausen/Moritz 2010, 160 f. (Nr. 60). Leo 2010, 178. Siehe dazu oben, Anm. 133.
122
Basel und die deutschen Universitätsjubiläen der 1930er Jahre
Es ist im Gegensatz dazu auffällig, dass innerhalb der universitären Meinungsbildung ebenso wie in der liberalen Presse («Basler Nachrichten») weder der Aspekt des politisch/öffentlichen Kredits der Universität in Basel eine entscheidende Rolle spielte (vielmehr pochte man auf die Autonomie gegenüber der «Politik»), noch sich eine mehrheitsfähige Einsicht in die politische Instrumentalisierung der deutschen Hochschulen durch die Diktatur Bahn brach. Die Universität verteidigte grossmehrheitlich Traditionen, wie sie durch die Erlebnisse von Basler Studenten gefestigt worden waren, die vor 1933 (oder noch vor 1914) an deutschen Universitäten studiert und sich dort in Studentenverbindungen und fachbezogene Freundschaftskreise integriert hatten. Letztlich glaubte die Universität, durch ein ‚business as usual‘, ähnlich wie es viele Basler Wirtschaftsunternehmen damals pflegten, einen politikfreien Raum für Deutschland beschwören zu können, dessen Existenz durch den Totalitätsanspruch der nationalsozialistischen Ideologie jedoch unwahrscheinlich geworden war. Allerdings taten sich in der Schweiz viele schwer damit, die ganze Tragweite und die Energie, mit der der Totalitätsanspruch durchgesetzt wurde, zu erkennen. Nicht einmal die Vertreibung politisch und ‚rassisch‘ missliebiger Kollegen von deutschen Hochschulen fand in den akademischen Argumentationen eine angemessene Berücksichtigung – das Schicksal des in Heidelberg aus weltanschaulichen Gründen beurlaubten Schweizer Juristen Max Gutzwiller bewirkte wenig. Das Rektorat schickte der Universität Heidelberg eine feierliche Glückwunschadresse zum Jubiläum (dies war nicht ausdrücklich verboten worden) und machte in seiner Korrespondenz deutlich, dass man nur durch den Machtspruch der Regierung an der Teilnahme verhindert sei. Darin kann man den Versuch erkennen, die Universität selbst aus der Schusslinie der nationalsozialistischen Presse zu manövrieren, aber auch das Bestreben, aufzuzeigen, dass sich die Universität Basel an die Kriterien halten wollte, nach denen akademischer Kredit innerhalb des deutschsprachigen Hochschulraums bemessen wurde. Immerhin brachte sie ihre Distanz zur nationalsozialistischen Hochschulpolitik andeutungsweise zum Ausdruck. Der Ablauf der Feierlichkeiten in Heidelberg zeigte klar, dass die Universität dort nicht frei nach herkömmlichen akademischen Traditionen wirken konnte (noch wollte). Gefeiert wurde vor allem der Bruch mit den Traditionen der Zeit vor 1933. Die teilnehmenden ausländischen Universitätsvertreter hatten nachher den bestimmten Eindruck – so jedenfalls zeigte es die angelsächsische Presse in der Begründung des Fernbleibens von der nachfolgenden Göttinger Feier –, für eine Akklamation der akademischen Welt gegenüber der Diktatur missbraucht und funktionalisiert worden zu sein. So äusserte sich der Präsident der Johns Hopkins University in Baltimore, Isaiah Bowman, mit aller Deutlichkeit, als er die Einladung nach Göttingen ablehnte: Das Programm sei 1936 «at the last moment of the Heidelberg celebration» so gestaltet worden, dass «foreign participa-
Eine Wiederholung mit Variationen: Die Einladung nach Göttingen 1937
123
tion appear to approve, if not to celebrate, acts and practices which democratic countries universally condemn».387 Das sahen allerdings nicht alle Schweizer Delegierten so. Immerhin ist bemerkenswert, dass die meisten helvetischen Grussadressen wie diejenige aus Basel in sanfter, mehr oder minder verdeckter rhetorischer Form, der deutschen These widersprachen, dass die Heidelberger Traditionen durch einen radikalen Neuanfang überwunden werden müssten, der Volk und Rasse zum Ausgangspunkt nehme und das Existenzrecht der Universitäten von deren Nutzen für das Hitlerregime abhängig mache. Dass die Basler Grussadresse die Gründungsurkunde von Heidelberg, die eine Verpflichtung auf Christentum und Humanismus zum Ausdruck brachte, zitierte, kann auch als Anspielung auf den deutschen Kirchenkampf gelesen werden.
3.6 Eine Wiederholung mit Variationen: Die Einladung nach Göttingen 1937 Die Einladung zur 200-Jahrfeier der Universität Göttingen wurde in der Basler Regenz am 10. März 1937 von Rektor Fritz Mangold (Sozialreformer, Statistiker und ehemaliger unabhängiger Regierungsrat)388 zur Sprache gebracht. Er hatte sich vorher mit Regierungsrat Fritz Hauser unterhalten: Dieser lehnte eine offizielle Basler Teilnahme unter Hinweis auf die Heidelberger Feier von 1936 ab, aber einzelne Dozenten könnten privat hingehen. Der Gräzist Peter von der Mühll, der unter anderem in Göttingen studiert hatte, forderte eine offizielle Basler Teilnahme: Es gehe um eine universitäre Sache, in der die Politik nichts zu suchen habe. Die Universitäten von Lausanne, Genf, Neuchâtel und Zürich würden offiziell teilnehmen. Mangold war der Ansicht, die Göttinger Einladung sei viel weniger politisch gehalten als diejenige der Heidelberger Universität. Eine Ablehnung würde nach Ansicht des früheren Rektors Haab die Universität Basel in ihren internationalen Beziehungen schädigen. Mangold plante, mit einer Zusage zuzuwarten, bis er die Kuratel konsultiert habe; die Sache sollte jedenfalls nicht an die Presse gelangen. Der Antrag, eine offizielle Vertretung nach Göttingen zu entsenden, wurde daraufhin in der Regenz einstimmig bei zwei Enthaltungen (Harald Fuchs, Latinist, 1932 von Königsberg nach Basel gekommen, und Karl 387
388
Rektor an Reichserziehungsministerium via Kurator, Bericht: Anfrage des Herrn Ministers vom 19. 7. 1937, 16. 8. 1937, in: UA Göttingen, Kur. 0257 Ceremonialsachen Jubiläumskorrespondenz (1937) VIII. 47. II. V. 1/6. 37. Nachtrag zum Bericht vom 10. 8. 1937: Antwort der Johns Hopkins University in Baltimore vom 3. 5. 1937, in: ebd., W D 2068, Verhalten ausländischer Staaten, Universitäten und Persönlichkeiten zur 200-Jahrfeier der Universität Göttingen. Rektor Neumann bezeichnete diese Argumentation als «abseitig». Dettwiler 1988.
124
Basel und die deutschen Universitätsjubiläen der 1930er Jahre
Ludwig Schmidt, Theologe, 1933 von Bonn vertrieben und seit 1935 Ordinarius in Basel) angenommen. Am 1. April 1937 diskutierte die Kuratel das Begehren der Regenz, eine Delegation nach Göttingen abordnen zu dürfen. Regierungsrat Fritz Hauser opponierte dagegen. August Rüegg,389 Romanist und katholischer Politiker, meinte, in dieser nicht besonders wichtigen Frage (sic) würde er eine offizielle Basler Delegation zulassen. Auch Adolf Lukas Vischer, ein über deutsche Verhältnisse sehr gut informierter Geriater und wohl damals eines der einflussreichsten Mitglieder der Kuratel, beurteilte die Göttinger Einladung als weniger bedenklich im Vergleich zu derjenigen nach Heidelberg. Der Präsident der Kuratel wollte die wissenschaftlichen Beziehungen zu deutschen Universitäten nicht einfach abbrechen. Deshalb befürwortete er die Teilnahme an einem Jubiläum, da dies der Tradition entspreche. Die Rechtsprofessoren Robert Haab und Erwin Ruck widersprachen: es gehe hier um Politik. Der linke Sozialist Carl Miville sprach sich gegen einen Gang nach Göttingen aus. Der Antrag von Fritz Hauser, die Universität dürfe wie schon in Heidelberg nicht offiziell teilnehmen, setzte sich mit drei gegen zwei Stimmen durch. Die Kuratel informierte das Rektorat und die Regenz am 8. April darüber, dass die Regierung eine Beteiligung nicht gestatten werde. In der Regenz war am 28. April 1937390 umstritten, wie sie auf das Nein reagieren und was sie den Göttinger Kollegen offiziell schreiben solle. Rektor Mangold schlug vor, der Kuratel zu antworten, dass die Universität den Entscheid der Behörden zwar bedauere, sich ihm aber fügen werde. Die Ablehnung schädige jedoch die Universität in ihrem internationalen Verkehr. In der Diskussion stiessen zwei unterschiedliche Auffassungen von Theologen aufeinander. Der Kirchenhistoriker Ernst Staehelin befürwortete weiterhin die Annahme der Einladung als ein Bekenntnis zur internationalen Verbundenheit der Wissenschaft. Karl Barth hingegen beantragte, die Einladung zur Göttinger Universitätsfeier sei durch die Universität selbst klar abzulehnen. Die durch den Nationalsozialismus geschaffene Lage sei nicht vergleichbar mit derjenigen während des Krieges 1914–1918. Es gebe keinen Unterschied mehr zwischen einer Stellungnahme für eine deutsche Universität und einer solchen für den aktuellen deutschen Staat. Eine Teilnahme würde bedeuten, dem «verborgenen Deutschland», das das Regime ablehne, in den Rücken zu fallen. Der Historiker Werner Kaegi, wenig beeindruckt durch Barths Votum, schlug vor, dass die Regenz in aller Form festhalten solle, dass die Universität die Einladung hätte annehmen wollen, sich aber nun den Behörden fügen müsse. 389
390
August Rüegg, Lehrer am Humanistischen Gymnasium, sass von 1918 bis 1931 im Erziehungsrat und von 1929 bis 1944 in der Kuratel der Universität. Während des Ersten Weltkriegs präsidierte er die Neue Helvetische Gesellschaft und 1920 bis 1926 gehörte er als Vertreter der Katholischen Volkspartei dem Grossen Rat an. Grieder 1973, 180 f. StABS UA B 1 XIV Acta et Decreta 1934–1959 (Regenzprotokoll), Regenz 28. 4. 1937.
Eine Wiederholung mit Variationen: Die Einladung nach Göttingen 1937
125
Der Staatswissenschaftler Hans Ritschl (der schliesslich als einziger Basler Professor nach Göttingen reiste) verlangte noch deutlichere Worte, die zum Ausdruck brächten, dass die Regierung die Annahme der Einladung verbiete. Aber weder Kaegi noch der Gynäkologe Alfred Labhardt fanden es klug, die Differenz zwischen Universität und Regierung so stark zu betonen. Die mehrheitsfähige Lösung fanden schliesslich der Jurist August Simonius und Peter von der Mühll mit dem Vorschlag, die Regierung solle selbst die Absage formulieren und nach Göttingen absenden. Mit 19 : 7 Stimmen wurde dieser Vorschlag angenommen und bestimmt, dass die Universität im eigenen Namen schriftlich der Schwesteruniversität Göttingen ihre Glückwünsche übersenden werde. Beiläufig gab Rektor Mangold zu verstehen, dass die Professoren für den Besuch privater Veranstaltungen in Deutschland keine Erlaubnis benötigten. In diesem Sinne anerbot sich der Altgermanist Andreas Heusler, privat nach Göttingen zu reisen. Wieder untersagte also das Erziehungsdepartement die offizielle Teilnahme, wieder liess die Universität in der Korrespondenz mit Göttingen deutlich werden, dass man nur deshalb nicht komme, weil es die Regierung verboten habe. Und wieder sandte das Rektorat Glückwünsche der Universität Basel zum Jubiläum. Diese enthielten erneut eine rhetorische Formel, die als zurückhaltende Kritik an der neuen Ausrichtung der Universität Göttingen hätte gelesen werden können. Angesichts der vielen Absagen und einiger offen kritisch gehaltenen Reaktionen deutete der Göttinger Rektor Friedrich Neumann die Basler Grussadresse jedoch ins rein Positive um.391 Um so deutlicher wurde diesmal das Erziehungsdepartement. Von Regierungsrat Fritz Hauser persönlich unterschrieben erreichte Rektor Neumann ein zweiseitiges Schreiben aus Basel, das die nationalsozialistische Universitätspolitik frontal kritisierte. Hauser wies darauf hin, dass die überwiegende Mehrzahl der englischen Universitäten die Einladung abgelehnt habe. Er erklärte sich mit ihnen einig in der Auffassung, dass die Göttinger Feier zu einer «politischen Demonstration» werden müsse. Er erinnerte daran, dass in Göttingen viele Professoren «aus Gründen der Rasse und der freiheitlichen Welteinstellung» entlassen worden waren. Die Hauptaufgabe der deutschen Universitäten im ‚Dritten Reich‘ sei nun die «Unterbauung des gegenwärtigen Systems». Basel-Stadt habe schon 1936 ihrer Universität geboten, die Einladung nach Heidelberg abzulehnen. Würde sie jetzt nach Göttingen fahren, würde sie dadurch «das gegenseitige Vertrauen von Bürgerschaft und Lehrerschaft der Universität […] stören».392 391
392
Die Universität Basel habe eine «herausgehobene Glückwunschadresse» geschickt. Rektor Neumann an den Reichs- und preussischen Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung Berlin via Kurator, 10. 8. 1937, in: UA Göttingen, unsignierter Bestand Jubiläum 1937. Schreiben des ED Basel-Stadt vom 29. 6. 1937. Eine Abschrift wurde vier Wochen später an den Kurator der Universität Göttingen und an das Reichsministerium geschickt, 28. 7.
126
Basel und die deutschen Universitätsjubiläen der 1930er Jahre
3.7 Intermezzo: Die Lausanner 400-Jahrfeier aus deutscher Sicht Die 400-Jahrfeier der Lausanner Akademie wurde kurz vor der Göttinger Feier, in der ersten Juniwoche 1937, als Universitätsjubiläum begangen. Dieses Jubiläum erregte die besondere Aufmerksamkeit deutscher Stellen. Das Reichserziehungsministerium kümmerte sich eingehend um die Zusammensetzung der nationalen Delegation für diesen Anlass. Darüber sind wir durch Akten im Universitätsarchiv Freiburg i. Br. gut unterrichtet, weil sich diese «Grenzlanduniversität» der Pflege der Beziehungen zu den schweizerischen Nachbarn verschrieben hatte.393 Am 21. April 1937 genehmigte das Reichserziehungsministerium die Teilnahme des Freiburger Rektors Friedrich Metz394 und ernannte ihn zum «Führer» der deutschen Abordnung. Diese bestand aus Eduard Schwyzer (ursprünglich aus Zürich, Professor in Berlin), Friedrich Pietrusky (Professor in Bonn, am 12. Mai 1937 durch Rektor Karl Schmidt, Bonn, ersetzt), dem Theologen Otto Weber aus Göttingen, dem Chirurgen Hans von Haberer als Rektor in Köln, Ernst Krieck, damals noch Rektor in Heidelberg (dieser liess sich durch den Kunsthistoriker Hubert Schrade, in Heidelberg bekannt als aktiver Nationalsozialist, vertreten) und dem damals in Leipzig wirkenden Schweizer Romanisten Walther von Wartburg. Die deutsche Delegation sollte geschlossen auftreten. Das Auswärtige Amt hatte das Konsulat in Genf zu informieren, und Metz war angewiesen, dieses sogleich bei seinem Eintreffen in der Schweiz zu kontaktieren, «insbesondere wegen der Fassung Ihrer Reden». Auch die Auslandsorganisation des NSDAP-Kulturamts in Berlin erhielt amtlich Kenntnis von diesen Massnahmen. Daraufhin durfte Metz am 30. April 1937 die Einladung annehmen, die ihm der Lausanner Rektor zugeschickt hatte. Um sich über die dortigen Verhältnisse kundig zu machen, wandte sich Metz am 15. Mai an Otto Riese, der als einziger Deutscher in Lausanne lehrte,395 und bat ihn um Hinweise, wie er seine Rede formulieren solle. In seiner Antwort vom 19. Mai anerbot sich Riese, der deutschen Delegation «gern einige Studenten aus der hiesigen Hochschulgruppe der Deutschen Studentenschaft als Führer und Adjutanten zur Verfügung [zu] stellen» – Riese war ‚Vertrauensprofessor‘ der nationalsozialistischen Studentenorganisation in Lausanne. Damit war die deutsche Delegation einverstanden.
393 394 395
1937, in: UA Göttingen, Kur. 0257 Ceremonialsachen Jubiläumskorrespondenz (1937) VIII. 47. II. V. 1/6. 37. UA Freiburg i. Br., B0001, 133, 1937 Generalia, Feierlichkeiten, Jubiläen, Die 400-Jahrfeier der Universität Lausanne, 1937. Grün 2010. Siehe oben, Einführung.
Intermezzo: Die Lausanner 400-Jahrfeier aus deutscher Sicht
127
Riese wollte dafür sorgen, dass (von ihm für deutschfreundlich gehaltene) Schweizer bei der bevorstehenden Göttinger Feier geehrt würden: Er nannte den Juristen Philippe Meylan, den Internisten Louis Michaud, der vor dem Krieg in Kiel gewesen war und seine Ausbildung in Deutschland erhalten hatte, den Universitätskanzler und Altertumswissenschaftler Franck Olivier, der in Göttingen studiert hatte und kürzlich mit einem italienischen Orden geehrt worden war,396 den Historiker Charles Gilliard, der in Göttingen und München studiert hatte, und den Philosophen Arnold Reymond.397 Die Universität Lausanne lege grossen Wert auf gute Beziehungen zu den deutschen Universitäten, meinte Riese, sie habe auch in Heidelberg eine Glückwunschadresse überreicht und werde in Göttingen vertreten sein. Der Jurist Hans Lewald, der früher in Lausanne gewirkt hatte, dann eine Professur in Berlin erhalten hatte und 1935 nach Basel gekommen war, werde in Lausanne einen Ehrendoktortitel erhalten, berichtete Riese. Nun wurde die Lage etwas unangenehm für Metz, denn Henri Meylan, Dekan der Lausanner Theologen, meldete ihm am 19. Mai 1937, dass seine Universität bei ihrer Feier dem Berliner Theologen Alfred Bertholet den Ehrendoktortitel verleihen werde,398 und schlug vor, dass Bertholet, obschon Schweizer, als Mitglied der deutschen Delegation behandelt werden solle. Seinem Ärger über den Plan, den bei den Nationalsozialisten schlecht angeschriebenen Berliner Theologen mit Basler Wurzeln zum Ehrendoktor zu machen, gab er gegenüber Riese Ausdruck (24. Mai 1937). Gegen eine Ehrung für Walther von Wartburg in Lausanne war hingegen nichts einzuwenden (Metz an Generalkonsul Dr. Krauel in Genf, 2. Juni 1937). Am 6. Juni fand schliesslich die Feier in Lausanne statt.399 Unter den zahlreichen Ehrendoktoren waren auch die Theologen Ernst Staehelin (Basel) und – wie erwähnt – Alfred Bertholet (Berlin), der allerdings nicht in Lausanne erschien – sowie unter den Juristen Hans Lewald (Basel), während die Faculté des lettres Walther von Wartburg (Leipzig) ehrenhalber promovierte. Auch die Naturwissenschaftliche Fakultät ehrte einen bekannten Basler, nämlich den Chemiker Fritz Fichter, jedoch niemanden aus Deutschland. Die Zeremonie der Promotionen wurde unterbrochen durch Ansprachen. In diesem Rahmen konnte Metz 396
397
398 399
Franck Olivier, 1895 in Berlin in klassischer griechischer Philosophie promoviert, war Professeur ordinaire de langue et littérature latines (1917 bis 1939) an der Universität Lausanne, von der Regierung Mussolini zuerst zum Chevalier (1922), dann zum Commandeur (1932) de la Couronne d’Italie für seine Vergil-Studien ernannt. Abetel-Béguelin 2009. Ursprünglich Pfarrer, 1912 bis 1925 Philosophieprofessor an der Universität Neuchâtel, 1925 bis 1944 an der Universität Lausanne (1930 bis 1932 Rektor), Wissenschaftshistoriker. Meuwly 2010. Smend (2017). Tribune de Lausanne vom 6. 6. 1937, no. 156; und Gazette de Lausanne vom 7. 6. 1937, no. 157.
128
Basel und die deutschen Universitätsjubiläen der 1930er Jahre
als erster eine Rede halten, deren Inhalt ich weiter unten würdige. Nach ihm sprach der Romanist Hugh Fraser Stewart aus Cambridge im Namen der Demokratien von Grossbritannien und den USA, der Faschist Pietro de Francisci, Rechtshistoriker, damals Rektor in Rom (dieser erwähnte dankend, dass sein Staatschef Mussolini ebenfalls die Ehrendoktorwürde erhalte),400 der Ophthalmologe G. F. Rochat aus Groningen im Namen vieler ausländischer Universitäten, Sébastien Charléty, Recteur de l’Académie de Paris, namens der französischen Universitäten (er nannte die Schweiz «un asyle aux infortunés»). Johann Ulrich Duerst, Rektor der Universität Bern, sprach für die freie Forschung, Francesco Orestano von der königlich italienischen Akademie äusserte sich über die moralische Einheit der Menschheit. Gleich anschliessend schickte Metz (am 7. Juni 1937) seinen Vorschlag nach Göttingen, dass beim bevorstehenden dortigen Jubiläum die Lausanner Riese, Olivier und Michaud («dessen Beziehungen zum Deutschen Reich die allerengsten sind») geehrt werden sollten. Dort wurden jedoch überhaupt keine Schweizer berücksichtigt. In Lausanne überreichte Metz der Universität eine Urkunde mit Grüssen und Glückwünschen der «Universitäten des Deutschen Reiches». Dem Text zufolge sollte das gute Verhältnis zwischen den Universitäten der Schweiz und den reichsdeutschen Universitäten «noch weiter vertieft» werden durch freundnachbarliche Beziehungen. Gedankt wurde der Universität Lausanne «für die Betreuung so vieler Studierender aus dem Deutschen Reich, die hier ihre Ausbildung vervollkommnen konnten». In seiner kurzen Ansprache brachte Metz die «Gefühle guter Nachbarschaft und der Verbundenheit und vor allem Sympathie und Hochschätzung» zum Ausdruck. Namhafte Lausanner Professoren hätten in Deutschland studiert und dort auch als Dozenten gewirkt. Für die an von Wartburg, Bertholet und Lewald erteilten Auszeichnungen dankte er. «Freiburg im Breisgau ist aber auch durch seine geographische Lage in besonderem Masse berufen, die Brücke zur Schweiz zu schlagen. […] Wir wissen, dass sie [die Schweiz] ihre nationale Unabhängigkeit als ihr kostbarstes Gut betrachtet und immer bereit ist, es zu verteidigen. Wir sind untereinander verschieden in der politischen Staatszugehörigkeit und auch in der politischen Haltung, aber die Wissenschaft, der wir dienen, verbindet uns alle. […] Indem jeder auf seinem Platze, zunächst seinem Volke dient, glauben wir den besten Beitrag für die Kul-
400
Ideengeber für die Verleihung war der in Lausanne wirkende, ehemalige Pareto-Assistent Pasquale Boninsegni, dessen Vorschlag in den universitären Gremien von Arnold Reymond, Professor für Philosophie 1925 bis 1939 und Rektor 1931 bis 1932, Vorsitzender des Komitees für die 400-Jahrfeier der Universität, vertreten wurde. In der Presse gab es Kritik, aber die Universität liess sich nicht beirren. Am 8. 4. 1937 erfolgte die Zeremonie der Diplomübergabe im Palazzo Venezia; Boninsegni als ehemaliger Lehrer Mussolinis überreichte das Diplom. Wisard 1998, 209 ff.; Robert 1987.
Intermezzo: Die Lausanner 400-Jahrfeier aus deutscher Sicht
129
tur der Menschheit zu leisten.» Den Machtwechsel von 1933, das ‚Dritte Reich‘ oder den Nationalsozialismus erwähnte er nicht explizit. Am 9. Juni 1937 erstattete Metz Bericht an Staatsminister Wacker in Karlsruhe und nach Berlin. Er lobte den Lausanner Kanzler Olivier, der unverändert anhänglich ans Reich sei. Riese habe gute Arbeit geleistet. Die Delegation sei so geschickt zusammengesetzt gewesen, dass aus der Abwesenheit von Bertholet kein falscher Schluss gezogen werden konnte, «wie das versucht wurde».401 Dank ihrer Stellung im Alphabet («Allemagne») konnten die Deutschen zuerst sprechen. Die grosse französische Delegation (39 Personen) sei nicht mehr beachtet worden als die deutsche, und zwischen den bürgerlichen Westschweizer Regierungen und der französischen Regierung Léon Blum sei eine klare Differenz sichtbar geworden. Nur ein Zwischenfall sei zu vermerken: Auf der Reise nach Lausanne nahmen die Deutschen am 27. Mai 1937 in Basel an einer Exkursion des Geographischen Instituts (geführt durch den deutsch-schweizerischen Doppelbürger und Hitlerverehrer Fritz Jaeger) auf den «Aussichtsturm auf dem Bruderholz» teil. Bei diesem Anlass wurde am Privatauto von Christl Cranz, einer bekannten deutschen Skirennfahrerin, die bei Metz studierte,402 der Hakenkreuzwimpel entfernt. Die Feierlichkeiten in Lausanne standen bevor, ein sportlicher Wettkampf zwischen den Basler und Freiburger Studentenschaften und ein Besuch des Basler Geographischen Instituts in Freiburg zu einer gemeinsamen Exkursion in den Schwarzwald und nach Breisach waren geplant, deshalb sei davon abgesehen worden, Anzeige zu erstatten. Lausanne sei somit eine gute Gelegenheit für die deutsche Delegation gewesen, sich gegenüber den Schweizer Kollegen als rücksichtsvoll und freundnachbarschaftlich zu zeigen, meinte Metz. Bei den Schweizern habe er damit Erfolg gehabt. Lausanne bot auch den Schweizer Professoren eine Gelegenheit, ihren Auftritt in Göttingen für Ende Juni 1937 zu koordinieren. Man beschloss «einstimmig», dass der Rektor der Universität Bern «die offizielle Ansprache für die Schweiz bei der Göttinger 200-Jahrfeier […] übernehmen» werde.403 Der Berner 401
402
403
Dass Bertholet fehlte, sei seine eigene Schuld und diejenige der Lausanner gewesen. Friedrich Metz an Walther von Wartburg, 15. 6. 1937, in: UA Freiburg i. Br. B0001, 133, 1937 Generalia, Feierlichkeiten, Jubiläen. Die 400-Jahrfeier der Universität Lausanne, 1937. Die Siegerin bei den Olympischen Winterspielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen in der Alpinen Kombination studierte in Freiburg auch Geschichte bei Gerhard Ritter. Ritter 2006, 774 f. Rektor Neumann an Reichserziehungsministerium via Kurator, 10. 8. 1937, in: UA Göttingen, Kur. 0257 Ceremonialsachen Jubiläumskorrespondenz (1937) VIII. 47. II. V. 1/6. 37. Auch das Schreiben Duersts an Neumann, 7. 6. 1937, ist im UA Göttingen erhalten, in: unsignierter Bestand Jubiläum 1937. Duerst begründete seine Wahl zum Sprecher der Schweizer damit, dass eigentlich Basel diese Aufgabe hätte erfüllen sollen, da zwar Basel den Vorsitz der Rektorenkonferenz innehabe, aber nicht kommen werde. Im Brief fragte er, ob es passend sei, die religiösen Aspekte bei Haller zu erwähnen, da dies vielleicht «in
130
Basel und die deutschen Universitätsjubiläen der 1930er Jahre
Rektor und nun auch Führer der helvetischen Delegation für Göttingen, (Johann) Ulrich Duerst, seit 1911 Ordinarius für «Tierzucht, Hygiene, Beurteilungslehre und gerichtliche Tierheilkunde an der veterinär-medizinischen Fakultät der Universität Bern», war ein bekannter Agrarwissenschaftler und Zoologe, der sich als Vermittler zwischen deutscher und westeuropäischer Wissenschaft verstand.404 Duerst war dann tatsächlich der einzige Schweizer, der in Göttingen eine Rede hielt (am 27. Juni 1937). Man begab sich offensichtlich nach Göttingen in der Erwartung, dass dort ähnliche Töne wie von Metz in Lausanne zu vernehmen sein werden und dass sich die Göttinger Feier in einem an die akademische Tradition angelehnten Rahmen abspielen werde.
3.8 Die Göttinger Feier Für die Göttinger Festivitäten405 war die Kommunikation mit ausländischen Gästen zunächst politisch zurückhaltend gestaltet worden – die Basler hatten dies richtig bemerkt. Das Einladungsschreiben des Rektors vom Februar 1937 fügte sich in die akademische Tradition ein, kam ohne nationalsozialistische Symbole daher (eine historische Stadtansicht und die Jahreszahlen 1737–1937 waren auf dem vorderen Umschlag, das Universitätssiegel auf der Rückseite abgebildet) und entsprach rhetorisch weitgehend den traditionellen Erwartungen. Nur bei genauem Hinsehen hätte man den Passus erkennen können, der in kodierten Worten (die ich hervorhebe) die Universität auf ihre Aufgaben im ‚Dritten Reich‘ verpflichtete: Die Georg-August-Universität wird ihre 200-Jahrfeier vom 25. Juni bis 30. Juni dieses Jahres im Zusammenwirken mit dem Reichs- und Preussischen Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung festlich begehen. Sie will sich zugleich mit dieser Feier zu den Aufgaben bekennen, die ihr durch die lebendigen Kräfte der Gegenwart im Bereich der Forschung und Erziehung gestellt sind. So sollen diese Göttinger Universitätstage nicht nur an eine ehrenvolle Vergangenheit erinnern, sondern vor allem auch den Willen zu neuer Arbeit aufzeigen und stärken.
Die Einladung erging an über 300 Adressaten in 51 Ländern. Schliesslich meldeten sich 140 Personen aus 28 Ländern an, in der Mehrzahl Privatpersonen, die sich der Universität verbunden fühlten. Die renommiertesten angelsächsischen Universitäten, in deren Umfeld auch eine explizite politische Debatte über die
404 405
der heutigen Zeit Missfallen errege». In seiner Antwort vom 11. 6. 1937 gewährte ihm Neumann alle Freiheit, die Hallerbriefe zu erwähnen. Staffe 1950; Wyssmann 1946. Drüding 2014, 117–152. Detaillierte Rekonstruktion vor allem nach dem «Göttinger Tageblatt» bei: Ratzke 1988.
Die Göttinger Feier
131
Einladung erfolgt war, lehnten die Einladung ab. Um so willkommener war den Veranstaltern eine Adresse, die eine britische Gruppe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an die Universität richtete, die als deutschfreundlich bezeichnet werden kann. Die offiziellen Hochschuldelegationen kamen aus der Schweiz, aus nordischen Ländern, von wenig prominenten Hochschulen der USA und Grossbritanniens, von solchen aus Mittel-Osteuropa und aus Japan. Zu Propagandazwecken organisierte die Universität eine lange Serie von ausländischen Glückwunschansprachen, die jedoch nicht alle von offiziellen Sprechern eines Landes oder einer Hochschule gehalten wurden.406 Die Presse in Deutschland war angewiesen, nur über die angenommenen Einladungen zu berichten und die Ablehnungen zu verschweigen.407 Für das Jubiläum verfasste Götz von Selle eine Geschichte der Universität.408 Er gab die Universitätsmatrikel heraus, ein Projekt, das schon vor 1933 im Hinblick auf die 200-Jahrfeier begonnen worden war.409 Seine Universitätsgeschichte war betont traditionell gestaltet; der Buchschmuck beschränkte sich auf die Wiedergabe des Universitätssiegels. Der Text fokussiert auf Professoren und Berufungen, die in einem wenig gegliederten Narrativ chronologisch abgehandelt werden, sowie auf die Taten des Landesherrn und seines Kanzlers für den Ausbau der Universität. Antisemitisch ist eine Passage über die Juden, die im alten Göttingen den Studenten Darlehen 406
407 408
409
Liste der ausländischen Gäste, die am zweiten Festtag eine Ansprache halten sollten, hektographiert, in: UA Göttingen, unsignierter Bestand Jubiläum 1937 (Ortsnamen nach damaligem deutschem Usus): Ägypten (Rektor Essed Bey, Mohammedanische Universität Kairo), Belgien (Prof. Ganshof, Gent), Bulgarien (Prof. von Maneef, Sofia), Chile (Prof. Galvez, Santiago de Chile), Dänemark (Prof. Hörregaard, Kopenhagen), Finnland (Prof. Nevanlinna, Helsinki), Frankreich (Prof. Julia, Sorbonne und Académie des Sciences), Griechenland (Prof. Kougéas, Athen), Grossbritannien (Prof. Nuttall, Cambridge, und Superintendant Perkins, Sheffield), Holland (Prof. Snijder, Amsterdam), Island (Prof. Johanesson), Italien (Prof. Severi, Rom), Japan (Prof. Takenouchi, Tokio), Lettland (Prof. Straumanis, Riga, und Prof. Klumberg, Herder-Institut Riga), Norwegen (Prof. Seip, Oslo), Österreich (Prof. Hirsch, Wien, und Prof. Böck für die Technischen Hochschulen), Polen (Prof. Kleczkowski, Krakau), Portugal (Prof. Moncada, Coimbra), Rumänien (Prof. Puscariu, Klausenburg), Schweden (Prof. von Hofsten, Uppsala), Tschechoslowakei (Prof. Stark, Deutsche Universität Prag), Türkei (Prof. Mantar, Ankara), Ungarn (Prof. Rybar, Budapest), USA (Prof. Gauss, Moscow Idaho). Die Spanier konnten wegen des Bürgerkriegs nicht reisen. Drüding 2014, 129–131. Von Selle 1937. Götz von Selle war seit 1924 im Göttinger UA tätig und seit 1928 Bibliothekar an der dortigen Universitätsbibliothek. 1939 ging er nach Königsberg als Professor und stellvertretender Bibliotheksdirektor; nach dem Krieg war er, «reichlich belastet», wieder in Göttingen. Linnemann 2002, 21, 80 ff. Drüding 2014, 128, betont, dass das Projekt ‚Matrikeledition‘ eine neue Funktion erhalten hatte: Es diente jetzt der Ahnenforschung. Von Selle 1937a.
132
Basel und die deutschen Universitätsjubiläen der 1930er Jahre
gewährten und sie damit angeblich ausbeuteten. Erst spät kommt die Erzählung beim Weltkrieg an («Deutschlands Jugend [stand] unter den Waffen gegen eine Welt von Feinden»), dabei wird das Frauenstudium erwähnt und die Zahl der gefallenen Studenten und «Dozenten und Beamten der Universität» angegeben. Erwähnenswert für die Zeit von 1918 bis 1932 waren für Götz von Selle die Gründung der Deutschen Studentenschaft, die Mitwirkung von Studenten in den Freikorps und die Schaffung des Bundes zur Hebung des nationalen Gedankens. Den Schluss bildet die Darstellung der Hochschulwochen, mit denen die Universität über Göttingen hinaus wirken wollte, und die Unterstützung der Händelfestspiele durch den Universitätsbund.410 Die NSDAP wird mit keiner Silbe erwähnt; die Rhetorik bleibt national-konservativ mit einem gewissen ‚lebensphilosophischen‘ Einschlag. Da die Geschichte der Professuren nicht über 1914/18 hinausgeführt wird, kann sich der Autor auch über alle ausschweigen, die 1933 Opfer oder Täter der Gleichschaltung waren. Nur die letzte Doppelseite (334 f.) öffnet sich zögerlich der Gegenwart: Der Verfasser lobt einen «gesunden Pragmatismus» und «Optimismus», der die Universität angeblich charakterisiere; er kritisiert andeutungsweise die «individualistische Isolierung», die «atomistische Hoffnungslosigkeit» der Weimarer Zeit: «In dem Deutschland Adolf Hitlers glaubt niemand mehr an den Untergang des Abendlandes». Mit pragmatischem Optimismus gibt der Autor seiner «Zuversicht» Ausdruck, die Universität werde «ihr Geschick in eine Zukunft […] stellen, deren Grundlagen heute schon geschaffen sind und an deren Ausbau sie mit Notwendigkeit Anteil haben wird zu Nutz und Frommen des Dritten Reiches Deutscher Nation!»411 War dieses Buch über weite Strecken eine Übung in Zurückhaltung, so entsprach das Göttinger Festprogramm stark den nationalsozialistischen Erwartungen.412 In einer eigens errichteten, temporären Festhalle fanden zwei offizielle An-
410 411 412
Die bei Götz von Selle nur angedeuteten oder ganz übergangenen Ereignisse: Dahms 1999. Drüding 2014, 128. Gedrucktes Programm «Die festlichen Universitätstage», in: UA Göttingen, unsignierter Bestand Jubiläum 1937. Beginn Freitag, 25. 6. 1937, mit Eröffnung und Begrüssung der Gäste. Samstag, 26. 6. 1937, Feierstunde der Universität mit der Festrede von Reichsminister Rust, abends Empfang durch die Stadt und Aufmarsch der NSDAP sowie Heldenehrung durch die SA. Sonntag, 27. 6. 1937, Ehrenakt der Universität mit den Ansprachen der Gäste und den Ehrenpromotionen, gefolgt von den Deutschen Hochschulmeisterschaften, abends eine Aufführung von Händels «Scipio». Montag, 28. 6. 1937, Kundgebung der Studenten und Einweihung eines Hauses in einem Schulungslager, abends «Kameradschaftsabend» der Altstudenten und Studenten. Dienstag, 29. 6. 1937, Deutscher Hochschultag, Festsitzung der Altstudenten und eine Kundgebung der NSDAP zum Thema «Arbeiter und Student», danach festlicher Abend auf der Rohns. Den Abschluss bildeten am Mittwoch, 30. 6. 1937, Ausflüge in die Umgebung. Eine Analyse des Programms bei: Knoch 2013, 148.
Die Schweizer in Göttingen
133
lässe statt, an denen die NS-Auffassung von Wissenschaft propagiert wurde und ausgewählte ausländische Gäste Ehrendoktorate und Ehrenbürgerrechte der Göttinger Universität erhielten. Bei solchen Anlässen war den Göttinger Professoren der Talar vorgeschrieben,413 sie sollten als ‚ständische‘ Körperschaft erscheinen und sich dadurch zugleich abheben von und einfügen in die Repräsentationen anderer ‚Stände‘, die durch Militär- und Parteiuniformen gekennzeichnet waren. Eine grosse Anzahl von Industrie-, Gewerbe- und Bauernvertretern war eingeladen, um die Integration der Universität in das nationalsozialistische «Volksganze» zu verkörpern. Im Festprogramm waren zudem eigentlich nationalsozialistische Elemente untergebracht, die mit dem Ideal des ‚neuen Studenten‘ zusammenhingen: Kameradschaft, Sport und die Ehrung der Gefallenen waren hier die Stichworte. Eine NSDAP-Veranstaltung war dem Verhältnis zwischen Studenten und Arbeitern gewidmet. Die alten Verbindungen, die für viele frühere Studenten den Reiz Göttingens ausgemacht hatten, waren von der Bildfläche verschwunden, an ihre Stelle traten diejenigen, die das Festprogramm die «studentischen Kameradschaften» nannte.414 Das Hakenkreuz dominierte alle Veranstaltungen, auch wenn es auf dem gedruckten Festprogramm nicht vorkam.
3.9 Die Schweizer in Göttingen Die offiziellen Delegationsmitglieder waren Séverin («Severinus») Bays, durch den Senat seiner Universität abgeordnet, seit 1921 Professor der Mathematik und damals Dekan der Faculté des sciences (im Jahr 1937/38 dann Rektor) aus Freiburg/Schweiz, der im Sommer 1920 in Göttingen gewesen war, ein katholischkonservativer Politiker;415 Édouard Claparède, Pazifist und liberaler Protestant, 1908 bis 1940 Psychologieprofessor an der Universität Genf;416 Ulrich Duerst aus Bern; der Historiker Charles Gilliard aus Lausanne417 und der Mediziner Hans
413 414 415
416
417
Der Auftritt im Talar war die symbolische Bekräftigung des neuen «Herrschaftsarrangements und Gesellschaftsgebildes der nationalsozialistischen Zeit». Knoch 2013, 145. Die Korporationen waren aufgelöst und durften nicht in Erscheinung treten. Couleur war verboten, auch für die Alten Herren. Drüding 2014, 134. Ineichen 2002. Bays war vom Senat seiner Universität delegiert worden. Schreiben des Kanzlers der Universität Freiburg/Schweiz an den Göttinger Rektor, 21. 3. 1937, in: UA Göttingen, unsignierter Bestand Jubiläum 1937. Vidal 2009. Claparède hatte eine persönliche Einladung erhalten, die er im Gedenken an Herbart und Lotze sowie an Georg-Elias Müller positiv beantwortete. Claparède an Rektor Göttingen, 5. 3. 1937, in: UA Göttingen, unsignierter Bestand Jubiläum 1937. Die Universität, vertreten durch den Rektor William Rappard, bezeichnete im Schreiben an den Göttinger Rektor, 8. 3. 1937, Claparède als ihren offiziellen Vertreter. Charles Gilliard, Historiker, wurde von Rektor Émile Golay als offizieller Vertreter der Universität Lausanne bezeichnet, in einem recht trocken gehaltenen Schreiben an den
134
Basel und die deutschen Universitätsjubiläen der 1930er Jahre
von Meyenburg aus Zürich.418 Basel fehlte aus den bekannten Gründen; aber auch Neuchâtel419 war nicht vertreten. Kein Schweizer wurde mit einem Ehrendoktorat gewürdigt; die Diskussion, ob der Mineraloge und Geologe Paul Niggli420 infrage käme, weil er deutschen Gästen jeweils freundlich die Geologie der Alpen erklärte, ergab ein negatives Resultat, da seine politische Zuverlässigkeit nun fraglich erschien. Die Schweizer Delegation, geführt von Rektor Duerst aus Bern, umfasste auch ein selbsternanntes Mitglied aus Genf, das neben dem offiziellen Genfer Vertreter auftrat und sich durch besondere Deutschfreundlichkeit auszeichnete: Henri Mercier war in Göttingen von 1892 bis 1897 Lektor für französische Sprache und Literatur gewesen und fühlte sich seither Deutschland zu grossem Dank verpflichtet. Gewichtiger war die Nennung des einzigen Basler Professors auf der Gästeliste in Göttingen: Der ehemalige Göttinger Privatdozent Hans Ritschl, Staatswissenschaftler und Soziologe,421 der neben Edgar Salin die zweite Basler Professur für Nationalökonomie und Soziologie (mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft) bekleidete, wollte nach Göttingen fahren. Ritschl ist später dadurch aufgefallen, dass er sich 1942 von Basel an die deutsche Universität Strassburg berufen liess. Im März 1933 hatte er der Schwester des verstorbenen Basler Philosophen Karl Joël, Hedwig Joël, Vorwürfe wegen der jüdischen Kritik an der deutschen Regierung gemacht.422 Ritschl hatte schon am 12. Februar 1937 den Göttinger Rektor aus eigenem Antrieb darauf aufmerksam gemacht, dass nicht alle ehemaligen Göttinger Studenten, die nun in Basel lehrten, mit einer Einladung bedacht worden seien. Er wies auf Heinrich Alfred Schmid (Kunsthistoriker) und auf Herman Schmalenbach (Philosoph) hin, deren Privatadressen er mitteilte. Zudem schickte er die Personalliste aus dem Vorlesungsverzeichnis, auf der er «als Deutscher und alter Göttinger» weitere Namen markierte, die allerdings mit dem
418
419
420
421 422
Rektor Göttingen, 2. 3. 1937. Zur Person: Hubler 2005. Gilliard hatte vor 1914 in Göttingen und München studiert. Am 17. 3. 1937 hatte der Zürcher Rektor Oskar Bürgi (Veterinärmediziner) gemeldet, er delegiere den Altrektor Han(n)s (Walter) von Meyenburg, Ordinarius für pathologische Anatomie, an seiner Stelle nach Göttingen, in: UA Göttingen, unsignierter Bestand Jubiläum 1937. Dieser hatte vor 1912 in München, Kiel und Berlin studiert. Vizerektor Max Niedermann, Latinist und Sprachwissenschaftler, an Rektor Göttingen, Briefkopf Universität Neuchâtel, 4. 6. 1937, in: UA Göttingen, unsignierter Bestand Jubiläum 1937. Er sei durch eine Sitzung des Neuenburger Grossen Rats, dem er als Vertreter der Liberalen angehöre, an der Teilnahme verhindert. Niedermann hatte am 13. 3. 1937 zugesagt, mit Delegation durch den Rektor. Wachter 2009. Paul Niggli, Professor für Mineralogie und Petrographie an der ETH Zürich (1928 bis 1931 Rektor) und an der Universität Zürich (1940 bis 1942 Rektor). Neuenschwander 2009. Ritschl 2003. Hedwig Joël an Irma Zinkernagel, 31. 3. 1933, in: Zinkernagel 2020, 2146, Nr. 1973.
Die Schweizer in Göttingen
135
Nationalsozialismus nichts oder wenig gemein hatten: Adolf Köberle (Theologe, von einem Studium in Göttingen ist nichts bekannt), Werner Kaegi (auch dieser war nicht in Göttingen gewesen), Louis V. Furlan und Karl Schefold (auch dieser kein Göttinger). Im Postskriptum schrieb er: «Es ist wohl überflüssig, wenn ich daran erinnere, dass eine schematische Erledigung der Liste aus politischen Gründen nicht angeht.» «Dass das Verhalten des Theologieprofessors Karl Barth, der seinerzeit in Göttingen war, eine Einladung ausschliesst», war ihm selbstverständlich. «Ebenso dürfte eine Einladung von Professor Karl Ludwig Schmidt nicht in Frage kommen, von dem ich allerdings nicht weiss, ob er alter Göttinger ist.» Ein anderer Basler fällt in den Unterlagen zur Vorbereitung des Göttinger Ereignisse auf: Johannes Wendland, Theologieprofessor und 1893/94 kurzzeitig Student in Göttingen. Er sandte am 27. Februar 1937 eine Voranmeldung nach Göttingen, vermutlich aus der Nostalgie des Altherren heraus und ohne zur Kenntnis zu nehmen, was seither in Deutschland geschehen war.423 An der Feier war er dann nicht anwesend. Zusagen lagen zunächst auch vor vonseiten des Basler Studenten Dietrich Barth424 und vom berühmten Altgermanisten Andreas Heusler in Arlesheim – 1935 zum auswärtigen Mitglied der Göttinger Akademie der Wissenschaften gewählt425 – sowie vom Basler Kunsthistoriker Heinrich Alfred Schmid, seit 1919 korrespondierendes Mitglied der Göttinger Akademie der Wissenschaften. Heusler zog seine Zusage am 31. Mai 1937 zurück und berief sich auf sein «Fuszleiden» (sic). Max Pohlenz, seit 1916 Ordinarius für Klassische Philologie in Göttingen, der 1912 einen Ruf nach Basel abgelehnt hatte, schlug seinem Rektor vor, Peter von der Mühll und Jacob Wackernagel eine persönliche Einladung zu senden, weil sie als klassische Philologen in Göttingen studiert hatten.426 Peter von der Mühll schickte seine Absage am 31. März 1937, erinnerte sich dabei zwar kurz an die «unvergesslich schönen Semester», die er in Göttingen zugebracht hatte, bezeichnete sich jedoch als einen «sehr unfestlichen Menschen», der Feiern grundsätzlich meide. Wackernagel hatte schon am 19. Februar 1937 mitgeteilt, dass er nicht anwesend sein könne, betonte dabei seine «Anhänglichkeit» an Göttingen und wünschte, alle möglichen Dokumente zu er423 424
425
426
Siehe unten, Kapitel 4.2.1. Barth meldete sich mit einer Karte, 12. 3. 1937, in Göttingen an und versprach «nach Möglichkeit» die Teilnahme. Zu Dietrich Barth: siehe oben, Anm. 267; Barth stand damals dem Frontismus nahe. Szokody 2001, 266, 273, porträtiert Heusler als einen Antisemiten, der anfänglich Sympathien für das Hitlerregime hegte, weil es Deutschland internationale Geltung verschaffe. Die völkisch-rassische Ideologie des Nationalsozialismus lehnte er hingegen ab. Die Germanenverehrung im ‚Dritten Reich‘ tadelte er zunehmend, zuletzt öffentlich in: HZ 152, 1935, 546–552. Mehr zu Heusler: unten, Kapitel 7.2.3.2. Pohlenz an ungenannt, 30. 11. 1936, in: UA Göttingen, unsignierter Bestand Jubiläum 1937. Unte 2001.
136
Basel und die deutschen Universitätsjubiläen der 1930er Jahre
halten, die mit den Feierlichkeiten verbunden sein werden. Am 20. August 1937 bedankte er sich für die tatsächlich bei ihm eingetroffenen Schriften. Hermann Straub, Göttinger Klinikchef,427 bat den Rektor, eine persönliche Einladung an den Basler Internisten Rudolf Staehelin zu senden, der 1906 kurz in Göttingen gelehrt hatte.428 Staehelin, so heisst es in dieser Aufforderung, wolle einen Vorstoss gegen die Schwierigkeiten unternehmen, welche die Basler «sozial-demokratische Behörde» Professoren in den Weg stelle, die an «reichs-deutschen Feiern» teilnehmen wollten.429 Staehelin scheint in Basel jedoch nichts derartiges unternommen zu haben und fügte sich dem Teilnahmeverbot. Am 9. Mai 1937 meldete er sich beim Rektor in Göttingen mit der vagen Begründung ab, «verschiedene Ereignisse» stünden seinem Kommen im Weg. Dabei erinnerte er daran, dass er 1907 (genauer 1906/7) Privatdozent in Göttingen gewesen war und dort seine Ernennung zum Kgl. Preussischen Professor erhalten habe; deshalb fühle er sich «mit ganz besonderem Stolz als ihr [der Universität Göttingen] ehemaliges Mitglied». 1939 erstattete er allerdings für deutsche Stellen ein Gutachten über Gasverletzungen deutscher Soldaten, wofür er von der Kuratel kritisiert wurde, nachdem der Fall durch eine Interpellation im Basler Grossen Rat publik gemacht worden war.430 Auch der Basler Philosoph Paul Häberlin hatte als ehemaliger Göttinger Student eine persönliche Einladung erhalten, die er am 13. Mai 1937 «aus Gründen der Solidarität» ablehnte, da die Universität keine Erlaubnis habe, an der Feier teilzunehmen.
3.10 Schlussfolgerungen Die Basler Universität, wäre sie auf sich selbst gestellt gewesen, war nun als Institution offensichtlich kein Bollwerk gegen den Nationalsozialismus: Sie zeigte keine sichtbare Solidarität mit entlassenen Kollegen, erwähnte die Diskriminierung der Juden nicht, liess keine Sensibilität für die Verfolgung Andersdenkender, keine Wahrnehmung der verbrecherischen Aspekte des Regimes erkennen. Man nahm offensichtlich auch den Niedergang der Universitäten im ‚Dritten Reich‘ nicht zur Kenntnis431 und wollte freundnachbarliche Beziehungen zu Deutschland pflegen, wie sie der offiziellen Schweizer Aussenpolitik entsprachen. Es ist verständlich, dass auf dieser Seite der Trennlinie zwischen der freien Welt und der Hitler-Diktatur traditionelle Formen akademischer Kreditabsicherung immer 427 428 429 430 431
Beushausen 1998, 215 f. Catalogus Professorum Halensis, Art. «Hermann Straub». Steinke 2017. Straub, Direktor der Medizinischen Universität-Klinik Göttingen, an seinen Rektor, 1. 4. 1937. StABS Protokoll T 2 Kuratel der Universität Bd. 13, 1935–1941, 395, 10. Sitzung, 6. 11. 1939. Studentenzahlen in Göttingen: 1930: 3851, 1935: 2040, 1940: 1899. Drüding 2014, 297.
Schlussfolgerungen
137
noch eine Rolle spielten. Basler Professoren wollten in bester Absicht ihre Beziehungen zu Freunden und Bekannten in Deutschland weiterpflegen. Nostalgisch identifizierten sie mit den deutschen Universitäten Gemütlichkeit und Burschenherrlichkeit sowie die persönliche Nähe zu exzellenten Professoren. Manche hielten den menschlichen Aspekt der Beziehungen für eine Art Gegengift gegen die inszenierte nationalsozialistische Begeisterung und wollten die Position derjenigen deutschen Kollegen stärken, die am Ideal der ‚voraussetzungslosen‘ Wissenschaft festhielten. Scheinbar hatten diejenigen ein gewisses Recht für sich, die die Bedeutung der deutschen Kommunikationsnetze für ihre Wissenschaft unterstrichen. Basel war ein Element in der deutschsprachigen Universitätslandschaft, und ohne diese Zugehörigkeit war diese Universität helvetische Provinz. Aber Basler Politiker hatten die Zeichen der Zeit erkannt: Die Voraussetzungen für freundschaftliche Beziehungen und Beschaffung akademischen Kapitals aus deutschen Hochschulen waren durch den Nationalsozialismus pervertiert worden. Wer sich so verhielt, als ob diese Voraussetzungen auch nur teilweise noch intakt wären, förderte die Illusion der Normalität, die den deutschen Machthabern vorübergehend wichtig war, und machte sich damit zum Komplizen ihrer Machtausübung, eine Überzeugung, die Karl Barth in der Regenz vertrat. Der politisch-gesellschaftliche Kredit der Universität Basel innerhalb des demokratischen Umfeldes, das sie finanzierte, wurde durch Positionen, wie sie etwa Ernst Staehelin einnahm und wie sie ausserhalb der Universität durch bürgerliche Politiker unterstützt wurden, die prinzipiell gegen den sozialdemokratischen Chef des Erziehungsdepartements und die linke Presse Front machten, gefährdet. Politiker wie der radikaldemokratische Kuratelspräsident und frühere Ständerat Ernst (Alfred) Thalmann oder der Lehrer, Gewerkschafter und sozialdemokratische Regierungsrat Fritz Hauser erkannten dies, und linke Politiker und Publizisten wiesen deutlich darauf hin. Akademischen Kredit durch ‚business as usual‘ in der Beziehung zu deutschen Hochschulen weiterhin erhalten zu wollen und im Einklang mit der bürgerlichen Politik gegen ‚links‘ akademische Freiheit zu verteidigen, stand nun im Gegensatz zu den durch die politische Mehrheit und die Volksstimmung kontrollierten Quellen des lokalen gesellschaftlichen und ökonomischen Kredits der Universität und führte in eine moralische Sackgasse.
4 Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus 4.1 Einleitung Für die Geschichte der Lehrstühle in der evangelischen Basler Theologischen Fakultät, die zu den kleineren theologischen Fakultäten des deutschen Sprachraums gehörte (sieben Professuren), existiert als synthetischer Überblick nur das entsprechende Kapitel in der Geschichte der Universität Basel von Edgar Bonjour.432 Später erschienen Arbeiten über einzelne Basler Professoren, besonders materialreich diejenigen zu Karl Barth.433 Als wertvoll für unsere Studie erwies sich die Monographie über Karl Ludwig Schmidt,434 aber auch die kürzlich erschienene Sammlung von «Porträts» von Alttestamentlern von Rudolf Smend.435 Für die Stellungnahmen einzelner Professoren und Privatdozenten in der Auseinandersetzung der Reformierten mit der Flüchtlingspolitik der Eidgenossenschaft ist das Buch von Kocher436 unentbehrlich. Zur Vertiefung habe ich mich eingehender mit dem Kirchenhistoriker Ernst Staehelin befasst. Der Basler Lehrkörper437 hatte in den 1930er Jahren ein hohes Niveau. Unter den älteren Professoren, die dem Ideal ‚voraussetzungsloser Wissenschaft‘ nachlebten, wirkten Gelehrte von Rang, die meist von ihren Studien bei Adolf Harnack oder Otto Ritschl geprägt waren. Walter Baumgartners Forschungen zum Alten Testament, zum Hebräischen und Aramäischen, hatten beispielsweise eine internationale Ausstrahlung. Man sollte nicht ohne Weiteres die Massstäbe der Gruppe um Karl Barth übernehmen, für die liberale Kollegen als «harmlos» oder gar als «Nullen» galten.438 Die später hinzugekommenen Professoren, die von ihren Kollegen als «doktrinär gebundene» Theologen bezeichnet wurden, wollten das liberale ‚19. Jahrhundert‘ hinter sich lassen. Walther Eichrodt galt manchen als ein bedeutender Alttestamentler mit systematisch-dogmatischen Zielen. Mit Karl Ludwig Schmidt gewann Basel einen führenden deutschen Neutestamentler, und die ‚Akquisition‘ von Karl Barth brachte den wichtigsten Vertreter der dia432 433 434 435 436 437 438
Bonjour 1960, 502–538. Überblick in: Tietz 2019. Mühling 1997. Smend 2017a. Kocher 1996. Für die Persönlichkeiten, die ich vorstellen werde, siehe weiter unten, Kapitel 4.2. Eduard Thurneysen an Karl Barth, 7. 7. 1933, in: Barth/Thurneysen 2000, 448–453, und Eduard Thurneysen an Karl Barth, 14. 2. 1934, ebd., 595–601.
140
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
lektischen Theologie439 und Erneuerer der protestantischen Dogmatik seiner Generation440 nach Basel. Zu erwähnen ist auch der Elsässer Kirchenhistoriker Oscar Cullmann, der 1938 nach Basel gewählt wurde und zu einem international bedeutenden Theologen wurde. Die Basler Fakultät war in den Austausch von Dozenten und Studenten eingebunden, den die Zugehörigkeit zum deutschen Sprachraum mit sich brachte, bis die deutschen Machthaber 1938 die in Basel zugebrachten Studiensemester deutscher Studenten nicht mehr anerkannten, als Reaktion auf die Aktivitäten von Karl Barth.441 Bei der Rekrutierung von Dozenten aus Deutschland spielte es für die Fakultät nur eine geringe Rolle, welcher protestantischen Konfession oder Observanz sie angehörten. In den Kirchgemeinden wurde jedoch sehr wohl registriert, wer zu den ‚wirklichen Reformierten‘ gehörte und wer nicht. Vor allem der Gegensatz zwischen ‚liberalen‘ und ‚positiven‘ Theologen blieb dort lebendig, zumal die Pfarrerwahlen und die Synodalwahlen sich nach diesem Schema abspielten. Auch Presse und Öffentlichkeit teilten die Pfarrer diesen ‚Richtungen‘ zu. Nachdem die Universität in Deutschland verfolgte Theologen übernommen hatte, entstand in der Öffentlichkeit der Eindruck, die Fakultät werde durch «dialektische» Theologen, die sie den ‚Positiven‘ (später «neo-orthodox» genannt im Unterschied zum positiven Christentum des 19. Jahrhunderts) zurechnete, dominiert. Einige Theologen der Universität traten häufig öffentlich auf. Dies gilt besonders für Ernst Staehelin. Als Prediger und Redaktor des «Kirchenblattes für die reformierte Schweiz», aber auch als Grabredner und als Mitglied der Evangelischen Volkspartei (seit 1934 sass er für diese Partei im Erziehungsrat und konnte dort die Basler Bildungspolitik mitgestalten) sorgte er für Erbauung und Ermahnung; dabei vertrat er jeweils seine Auffassung, dass das Reich Gottes nahe sei und dass alle Lebensbereiche auf eine christliche Grundlage gestellt werden müssten.442 Neben Staehelin trat der Extraordinarius Adolf Köberle ebenfalls häufig in der Öffentlichkeit auf. Karl Barth war immer wieder auf Kirchenkanzeln zu hören. Die ‚Positiven‘ empfanden den Umstand, dass die Theologische Fakultät dank den Stimmen von ‚Heiden‘ und Katholiken als Bestandteil der Universität erhalten blieb, als bedenkliches Zeichen der Entchristlichung des öffentlichen Lebens. Der christlich-soziale Pfarrer der Arbeitergemeinde Matthäus, Rudolf Liechtenhan, analysierte den Entscheid des Parlaments in diesem Sinne in den Spalten des «Kirchenblattes für die evangelische Schweiz».443 In ähnlicher Weise 439 440 441 442 443
Begriff: Tietz 2019, 148 ff. Blaser 2015. Barths Kirchliche Dogmatik: Tietz 2019, 369 ff. Barth 2001, 129. Freyvogel 1941. Rudolf Liechtenhan über die Grossratsdebatte vom 12. 11. 1936: Liechtenhan 1936a.
Einleitung
141
reagierte Karl Barth auf seine ‚Heimholung‘ nach Basel: hominum confusione et dei providentia sei dies geschehen. In ihrem Bestreben, sich nicht politisch-weltanschaulich instrumentalisieren zu lassen, konnten die ‚positiven‘ und ‚dialektischen‘ Theologen nicht zugeben, dass die Erhaltung der Fakultät zeitgemässen Erwartungen zu verdanken war, die an diese adressiert wurden: die Stärkung der Abwehr des Nationalsozialismus. Der christlich-soziale Präsident der Kuratel, Max Gerwig, entwickelte eine entsprechende Position in seiner Rede zur Eröffnung des neuen Kollegiengebäudes im Juni 1939, in der er den Rückzug spezialisierter (moderner) Wissenschaft aus der Gesellschaft beklagte und ein Engagement der Hochschullehrer in der Lenkung der studentischen Jugend in Richtung einer antifaschistischen, ethisch-religiösen Grundeinstellung forderte.444 Diese Erwartung (oder externe Funktionszuschreibung) wurde nicht enttäuscht. Zwar gab es auch in der Basler Theologischen Fakultät wie in der Basler Mission, die bis zum Kriegsausbruch auf nationale und konservative deutsche Positionen Rücksicht zu nehmen hatte, Persönlichkeiten, die sich der Aufgabe verschrieben, gute Beziehungen zu den gleichgeschalteten deutschen Fakultäten zu unterhalten. Konservative Christen sahen in den Nationalsozialisten eine Kraft, die Europa vor einer bolschewistischen Revolution gerettet habe.445 Wie auch innerhalb der deutschen Bekennenden Kirche waren die Ansichten darüber, was man von Hitlers Diktatur zu halten habe, geteilt, wenn auch der Angriff der sog. Glaubensbewegung Deutsche Christen auf die protestantischen Kirchgemeinden446 verurteilt wurde – nicht ohne den Zusatz, wer den Nationalsozialismus verurteile, müsse stets auch die Verfolgung der Christen durch die Kommunisten anprangern, um glaubwürdig zu sein. Über die Natur der Theologischen Fakultät legten deren Mitglieder selbst Rechenschaft ab: Die anderen Fakultäten suchten eine (weltliche) Wahrheit, die Theologische Fakultät besitze die Wahrheit durch die Offenbarung und habe die Aufgabe, diese möglichst rein zu verkünden. Beide seien mit einem Geheimnis konfrontiert, das nach christlicher Auffassung letztlich in Gott ruhe. Der Kirchenhistoriker Ernst Staehelin sah im Verhältnis der Theologie zu den anderen Fakultäten keinen Gegensatz, da er glaubte, im kommenden Reich Gottes werde dieser hinfällig und alles Wissen finde sich in der einen Quelle zusammen, der es entstamme. Er erhoffte sich von der gleichberechtigten Präsenz der Theologie in der Universität eine fortschreitende Rechristianisierung der gesamten Universität im Zeichen ihres Wappens. Dieses stellte eine Hand dar, die aus einer Wolke heraus ein aufgeschlagenes Buch hielt mit den vier akademischen Tugenden: pie, iuste, sobrie, sapienter. Er verstand dieses Buch als die Offenbarung und darin 444 445 446
Basler Nachrichten, Sonderbeilage vom 9. und 12. 6. 1939. Zu den exemplarischen Positionen innerhalb der Basler Mission aufschlussreich: Quack 2016. Tietz 2019, 223; Meisiek 1993; Siegele-Wenschkewitz/Nicolaisen 1993.
142
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
den göttlichen Ursprung der Weisheiten, die alle Wissenschaften erstrebten und verkündeten.447 Zunächst möchte ich das ‚Personal‘ der Fakultät für die Zeit von 1933 bis 1945 im Zusammenhang Revue passieren lassen,448 um danach im Querschnitt nach Schwerpunkten vorzugehen und die in der Fakultät sichtbaren Positionen zu Themen wie der Aufmerksamkeit für das Vorgehen der Nationalsozialisten gegen die Bekennende Kirche, der Analyse der nationalsozialistischen Ideologie und der Bereitschaft, nicht nur «Judenchristen», sondern auch Juden zu verteidigen und nach Möglichkeit zu schützen, darzustellen.
4.2 Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät Ich orientiere mich bei der Präsentation des Lehrkörpers weitgehend an der Fächereinteilung, die in der Fakultät effektiv herrschte, und achte besonders auf (positive oder negative) Beziehungen zu Deutschland. In meiner Liste fehlt Paul Wernle, der schon 1927 aus gesundheitlichen Gründen aus der Lehre ausgeschieden war, aber noch bis 1936 im Frey-Grynaeischen Institut wohnte, wo er «Lektor» (Titel des Vorstehers) war und weiterhin Forschung betrieb. Wernle blieb wegen seiner Bedeutung als früherer Lehrer und als Vertrauensperson vieler Basler Theologen in der Fakultät präsent. Sein Nachfolger als Kirchenhistoriker, Ernst Staehelin, trat dann 1936 auch seine Stelle als Lektor an und bezog die Diensträume im Institut, die er bis 1980 bewohnte.449
447
448
449
Jan M. Lochman sah in der Nachfolge Staehelins in diesem Buch die Bibel. Lochman 2002, 17. Die vier Adverbien entsprechen den Devisen der vier alten Fakultäten (Theologie, Recht, Medizin, Philosophie). Staehelin 1933b. Die primären Angaben stammen, wo nicht anders vermerkt, aus Bonjour 1960 sowie aus einer Durchsicht der Basler Beamtenverzeichnisse (Verzeichnis der Behörden und Beamten des Kantons Basel-Stadt) für den interessierenden Zeitraum. Zudem habe ich die Angaben nach Möglichkeit anhand der Regierungsratsbeschlüsse sowie der vorbereitenden Entscheide (Kuratel, Erziehungsrat) für Wahlen, Ernennungen, Beförderungen, Entlassungen/Pensionierungen verifiziert. Paul Wernle wurde 1897 PD für Neues Testament an der Universität Basel, 1900 befördert zum Extraordinarius und ab 1905 ordentlicher Professor für neuere Kirchengeschichte, Dogmengeschichte, Geschichte des protestantischen Lehrbegriffs und Geschichte der protestantischen Theologie. Seit 1901 war er Lektor des Frey-Grynaeischen-Instituts. Kuhn 2016; Kuhn 2016a; Kuhn 1997. Vgl. unten das Kapitel 7.5.4 zu Werner Kaegi, der als Lehramtskandidat vorübergehend ein Zimmer im Frey-Grynaeum belegte.
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
143
4.2.1 Systematische Theologie und Dogmatik Unter den Systematikern ist zuerst Johannes Wendland zu erwähnen. Der Sohn eines Ostpreussen, der 1877 die Leitung der Berliner Mission übernommen hatte, absolvierte sein Studium in Halle, Berlin, Tübingen, Jena, Göttingen und besuchte anschliessend das Predigerseminar in Wittenberg. Nachdem er von 1901 bis 1905 Pfarrer in Görlitz gewesen war, wurde er 1905 in Basel als Nachfolger des nach Zürich abgewanderten, liberalen und deutschfreundlichen Adolf Bolliger450 zum ordentlichen Professor für Systematische Theologie gewählt, ein Amt, das er bis 1937 versah.451 Wendland zählte als Schüler von Ernst Troeltsch zu den Vertretern der liberalen Richtung, die ihre Prägung in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg empfangen hatten, er war jedoch kein aggressiver Propagandist dieser Orientierung wie Bolliger, sondern suchte eine Verbindung zwischen Theologie und Philosophie.452 Den deutschen Kollegen blieb er auch nach 1933 verbunden; noch 1937 und 1938 nahm er an den Professorentreffen Basel/Freiburg i. Br. teil, die inzwischen von den Nationalsozialisten weitgehend instrumentalisiert worden waren.453 Weder mit den Religiös-Sozialen noch mit den Anhängern von Karl Barth war er einverstanden, während Letztere ihn als Schleiermacherianer und Vertreter des von ihnen überwundenen ‚19. Jahrhunderts‘ apostrophierten.454 1937 erfolgte sein vorgezogener Rücktritt, worauf ihm noch ein Lehrauftrag bis zum 70. Altersjahr455 gewährt wurde. Den Lehrstuhl für Systematik übernahm damals Karl Barth (siehe unten). Als Wendlands Lehrauftrag 1941 auslief, verwendete der Staat die Mittel, die dadurch frei wurden, um die Situation von Fritz Lieb (zu Lieb ebenfalls unten mehr) zu verbessern.456 Damit ‚verloren‘ die Freisinnigen einen Lehrstuhl und einen Lehrauftrag an Theologen, die sie zu den ‚Positiven‘ resp. zu den Anhängern der dialektischen Theologie rechneten. Karl Barth war somit als Systematiker der Basler Nachfolger von Wendland. Er hatte sich während des Ersten Weltkrieges von seinen deutschen Lehrern (vor allem Wilhelm Herrmann und Adolf von Harnack) abgewandt, als er erkannte, dass sie nicht davor gefeit waren, sich unter die Patrioten zu begeben, die die deutsche Kriegsführung als eine Art von religiösem Kreuzzug verstanden.457 Nachdem er bei Hermann Kutter und Leonhard Ragaz nach Alternativen gesucht 450 451 452 453 454 455 456
457
Nöthiger-Strahm 2004. StABS UA AA2 Lektionskataloge/Vorlesungsverzeichnisse, Sommersemester 1942. Kuhn 2013. UA Freiburg i. Br. B1 317 Ohne Umschlagtitel, Inhalt Treffen Basel-Freiburg, ab 1924. Busch 1975, 281. StABS Protokoll Erziehungsrat 28. 6. 1937; Regierungsratsbeschluss vom 23. 6. 1937. Der Lehrauftrag hiess nun «Dogmatik und Theologiegeschichte» und umfasste vier Wochenstunden. Liebs Remuneration stieg dadurch von Fr. 3’000 auf Fr. 5’800. Regierungsratsbeschluss vom 9. 12. 1942, in: StABS Protokoll Erziehungsrat 8. 12. 1941. Tietz 2019, 89 ff.
144
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
und sich während seiner Zeit als Pfarrer in Safenwil (1911 bis 1921) für die Arbeiterbewegung engagiert hatte, entwickelte er noch in Safenwil im Austausch mit seinem Kollegen Eduard Thurneysen (unten mehr über ihn) seine Interpretation des Römerbriefs. Mit der radikalen Feststellung, dass es in der Theologie um Gott gehe und nicht um die Menschen und dass sich gegenüber den Menschen Gott zugleich offenbare und verhülle, denn er sei das «ganz Andere»,458 vollzog Barth sowohl den Bruch mit dem liberalen ‚19. Jahrhundert‘, dem er selbst als Student und junger Pfarrer angehört hatte,459 als auch mit den ReligiösSozialen und den christlichen Ethikern, für die der gläubige Mensch im Zentrum des Interesses verblieb.460 Ohne durch Habilitation für die akademische Laufbahn formal qualifiziert zu sein, wurde er nach Göttingen (1921 bis 1925) auf eine privat finanzierte Professur für Reformierte Systematische Theologie berufen461 und gelangte von dort über Münster (Dogmatik und Neutestamentliche Exegese, 1925 bis 1930)462 nach Bonn. Mit der Erteilung der Professur in Bonn, die vom damals einflussreichen Karl Ludwig Schmidt (siehe unten) stark gefördert wurde, begann 1930 der Höhepunkt von Barths Laufbahn in Deutschland.463 Früh erkannte er den unüberwindlichen Gegensatz zwischen dem Totalitätsanspruch des Nationalsozialismus und dem Christentum, wie er es vertrat. Kritische Äusserungen im privaten Kreis, die Weigerung, die Vorlesung (die er als eine Art Gottesdienst auffasste) mit dem Hitlergruss zu beginnen, und der Anspruch, den Beamteneid auf Hitler nur mit einem zunächst explizit gemachten, dann implizit gedachten Vorbehalt zu leisten, brachten ihn in Konflikt mit dem deutschen Regime. In zwei Instanzen wurde er deswegen verurteilt, in zweiter nur zu einer Geldbusse. Dies beeindruckte das Reichsministerium wenig; es versetzte ihn im Frühjahr 1935 definitiv in den Ruhestand.464 Schon 1933 war Barth mit seiner Schrift Theologische Existenz heute! hervorgetreten,465 die in der Auseinandersetzung zwischen den protestantischen Kirchgemeinden, die sich dem Nationalsozialismus widersetzten, und den sog. Deutschen Christen, die die Gemeinden auf Adolf Hitler ausrichten wollten, Stellung bezog. Barth war eine zentrale Gestalt im deutschen protestantischen Kirchenkampf und in der sich formierenden Bekennenden Kirche. In Barmen setzte er seine Version des Bekenntnisses mit geringen Konzessionen durch (Barmer Theologische Erklärung
458 459 460 461 462 463 464 465
Tietz 2019, 135. Tietz 2019, 60. Tietz 2019, 99 ff., 133 ff. Tietz 2019, 113 ff. Tietz 2019, 163 ff. Tietz 2019, 207 ff. Tietz 2019, 241 f., 259–269. Tietz 2019, 224 f.
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
145
1934). Zur weiteren Entwicklung der Bekennenden Kirche verhielt er sich oft sehr kritisch. Nach der Entlassung von der Bonner Professur466 fühlte er sich zwar weiterhin verpflichtet, in den deutschen Verhältnissen zu wirken, er sondierte aber schon anfangs 1934 wegen einer Stelle in Basel.467 Als Barth in Deutschland zum ersten Mal verhörte wurde, bemühten sich seine Bewunderer in Genf, für ihn eine Position am dortigen Ökumenischen Institut zu schaffen.468 Im November 1934 wurde das Disziplinarverfahren gegen Barth eröffnet und mit der sofortigen Suspendierung als Bonner Professor verbunden.469 Danach war am 1./2. Dezember 1934 in den «Basler Nachrichten» zu lesen, es wäre angezeigt, dass eine Schweizer Fakultät, wenn möglich die Basler, Barth aufnehmen würde.470 Im selben Monat forderten Basler Studenten ihren Rektor auf, dafür zu sorgen, dass Barth nach Basel komme. Vom Chef des Basler Erziehungsdepartements, Fritz Hauser, erhielt er eine Anfrage, ob er einen Ruf nach Basel annehmen würde. Ende 1934 wurde die Eventualität seiner Berufung nach Basel auch in der hiesigen Fakultät traktandiert.471 Der Regierungsrat ermächtigte am 22. Dezember 1934 das Erziehungsdepartement, Verhandlungen mit Barth aufzunehmen.472 Er zögerte zunächst: In Deutschland wollte er seine Mission weiterführen, und wenn er in die Schweiz müsste, zog er angeblich vorübergehend Genf vor, weil ihm in der Deutschschweiz der Einfluss der «natürlichen» Theologie und der liberalen Ethik von Emil Brunner473 zu stark schien – falls diese Erwägungen nicht die 466 467
468
469
470 471
472 473
Prolingheuer 1977. Eduard Thurneysen an Rudolf Pestalozzi, 31. 1. 1934, in: Barth/Thurneysen 2000, 582. Am 7. 3. 1934 hielt sich Barth anlässlich der Verheiratung seiner Tochter Franziska mit dem Kaufmann Max Zellweger, Sohn eines Seidenhändlers und später Vizedirektor in der Basler chemischen Industrie, in der Schweiz auf. Bei dieser Gelegenheit klärte er ernsthaft ab, ob er einen Basler Lehrstuhl erhalten könnte. Busch 1975, 273. Rudolf Pestalozzi hatte am 10. 9. 1934 an Charlotte von Kirschbaum geschrieben, dass für Barth in Genf eine Perspektive bestehe. Von Kirschbaum an Thurneysen, 4. 12. 1934, in: Barth/Thurneysen 2000, 781–783. Die Suspendierung erfolgte am 26. 11. 1934. Die Dienststrafkammer Köln sprach ihn am 20. 12. 1934 schuldig und beschloss, ihn aus dem Dienst zu entlassen. Am 14. 3. 1935 ging Barth in Berufung; am 14. 6. 1935 entschied das Preussische Oberverwaltungsgericht Berlin auf Gehaltskürzung für ein Jahr. Am 21. 6. 1935 versetzte ihn das Ministerium in den Ruhestand. Am 25. 6. 1935 wurde Barth Professor in Basel. Daten in: Barth/Bultmann 1971, 155. Thurneysen an Barth, 1. 12. 1934, in: Barth/Thurneysen 2000, 764–771. «Den Behörden soll die Freude der Fakultät über diesen Schritt und ihr Dank ausgesprochen werden.» StABS Protokoll der Theologischen Fakultät, 161, 12. Sitzung 20. 12. 1934 (Dekan Eberhard Vischer). StABS Protokoll S 4 Erziehungsrat, Bd. 23, 1934–1936, 14. 12. 1934. Ergebnis der Besprechung des ED mit Barth in Basel, 24. 12. 1934, Ermächtigung des ED zu Verhandlungen. Schoch 2012.
146
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
taktische Funktion hatten, in Basel Druck aufzusetzen.474 Zum Jahreswechsel entschied sich Barth im Prinzip für Basel: In Genf witterte er eine «internationalvölkerbündliche Vielgeschäftigkeit», Basel wäre näher bei Deutschland und würde ein ruhigeres Arbeiten an seiner Dogmatik ermöglichen.475 Er focht jedoch zunächst das erstinstanzliche Urteil an und war entschlossen, in Deutschland zu bleiben, bis das Revisionsverfahren am Berliner Oberverwaltungsgericht abgeschlossen sei. Den Basler Behörden erklärte er in diesem Sinn, dass er auf einen Ruf erst eintreten werde, nachdem das Urteil vorliege. Ab Januar 1935 bemühte sich das Predigerseminar Elberfeld in Barmen, für Barth eine Lösung zu finden, die ihn in Deutschland halten könnte.476 Seine deutschen Freunde versuchten, ihm mit der Gründung einer freien theologischen Fakultät eine Situation zu verschaffen, doch Barth begann daran zu zweifeln, dass sich die Bekennende Kirche konsequent und kompromisslos gegen die nationalsozialistische Diktatur positionieren werde. Barth erhielt auch ein Angebot aus St. Andrews, das er bald ablehnte, weil er fand, die dortigen Unterrichtsaufgaben würden ihn zu weit von seinem Ziel, die Dogmatik zu schreiben, abbringen. Barth war dann im März 1935 kurz in Basel und besprach sich mit Fritz Hauser; dieser war danach überzeugt, dass Barth nun bestimmt den Ruf nach Basel annehmen werde.477 In Basel begann sich vorübergehend eine Opposition gegen Barth zu regen: Gerhard Boerlin-Wackernagel, freisinnig und bekannter Germanophiler,478 ritt in den «Schweizer Monatsheften» eine Attacke gegen ihn.479 Im Mai bekundete die Fakultät ihr Einverständnis mit der Erteilung eines Lehrauftrags an Barth.480 Er hielt am 4. Juni 1935 einen Vortrag als Gast der Basler Studentenschaft. Am 14. Juni 1935 fand endlich die Revisionsverhandlung in Berlin statt. Erziehungsminister Rust verfügte am 22. Juni 1935 Barths Entlassung. Nun erfolgte unverzüglich der bereits vorbereitete Wechsel von Bonn nach Basel, zunächst auf eine persönliche Professur mit Lehrauftrag für Systematische Theologie und Homiletik.481 Diese versah er, bis mit dem vorgezogenen Rücktritt von Wendland 1937 474 475 476 477 478 479 480 481
Thurneysen an Barth, 17. 12. 1934 und 22. 12. 1934, in: Barth/Thurneysen 2000, 786–792. Barth an Thurneysen, 24./26. 12. 1934, in: Barth/Thurneysen 2000, 792–813. Bericht über die Reise Thurneysens mit Charlotte von Kirschbaum und Rudolf Pestalozzi nach Elberfeld. Thurneysen an Barth, 21. 1. 1935, in: Barth/Thurneysen 2000, 815–824. StABS Erziehungsrat Protokoll Bd. 23, 1934–1936, 8. 3. 1935. Ernst Staehelin kritisierte bei dieser Gelegenheit, dass seine Fakultät noch nicht begrüsst worden sei. Baumann o. J. Schweizer Monatshefte 14, 1934/35, 638 f. Boerlins Pseudonym war «Nemo». Thurneysen an Barth, 24. 5. 1935, in: Barth/Thurneysen 2000, 890–893. StABS Protokoll Kuratel 13. 5. 1935, 522. Formal datiert der Regierungsratsbeschluss erst vom 6. 9. 1935. Barth erhielt ein Salär von Fr. 18’000 pro Jahr, d. h. in der Höhe, die ihm Thurneysen für die Verhandlungen zu fordern geraten hatte. StABS Protokoll Erziehungsrat Bd. 23, 1934–1936, 14. 6. 1935; Regenzprotokoll 27. 11. 1935; Regierungsratsbeschluss 27. 6. 1935.
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
147
das gesetzliche Ordinariat für Systematische Theologie frei wurde. Per 1. April 1938 wechselte er auf diesen Lehrstuhl.482 Barths Berufung auf eine ad personam-Professur nach Basel 1935 war durch den Wunsch der Behörden und einiger Kollegen motiviert, aus der in Deutschland entstandenen Ausnahmesituation Gewinn zu ziehen. Seine Anstellung kann als gelungener Versuch in einer Reihe anderer Pläne, Exzellenz aus Deutschland zu importieren, gelten.483 Barth rechnete mit der helvetischen Enge: die beschränkte Auffassungsgabe der Schweizer für seine radikale Position, die kleine Universität,484 das Verbleiben liberaler Kollegen in der Fakultät, die Dominanz von ‚Heiden‘, Freidenkern und Agnostikern in der Basler Bildungspolitik, das Desinteresse vieler Schweizer evangelischer Gemeinden gegenüber dem Kampf zwischen Christ und Antichrist in Deutschland, die Lauheit im Glauben einer reformierten Kirche, die sich in die Gesellschaft und in den Staat einfügte. Barths theologisch begründete Radikalität im Positionsbezug gegen den Nationalsozialismus, der ihm politische Bedeutung zuwachsen liess, auch wenn die letztliche Begründung seiner Handlungen immer evangelisch und kirchlich war, machte Barth für die Schweizer Öffentlichkeit zu einer charismatischen Figur des Widerstands gegen die Diktatur in Deutschland, ein Bild, das sich weiter festigte durch die Versuche der Behörden (auch diejenige der Basler Kuratel 1942),485 ihn zu zensurieren und ihn daran zu hindern, die «integrale», auch die veröffentlich482 483
484
485
StABS Erziehungsrat Protokoll Bd. 24, 1936–1938, 31. 1. 1938; Protokoll Kuratel T 2 Kuratel der Universität, Bd. 13, 1935–1941, 255, 3. Sitzung 13. 1. 1938. Vergleichbar ist die Situation, die Basel dem aus Frankfurt zurückkehrenden Juristen Arthur Baumgarten bot (über ihn: Degen 2002), aber mit geringerer Besoldung für den Frankfurter. In andern Fällen wurde möglichst der Schein gewahrt, es handle sich um eine reguläre Berufung auf einen freigewordenen Lehrstuhl. So verstehe ich die Berufung von Hans Lewald (Jurist, Below 1985), so auch die Fälle von Friedrich Ranke (Germanist, Stolz 2010), Ernst Freudenberg (Kinderarzt, Bernhard 2001), Walther von Wartburg (Romanist, dazu unten, Kapitel 7.2.4.5) und eben auch denjenigen des grossen Bonner Neutestamentlers Karl Ludwig Schmidt (siehe unten in diesem Kapitel). «Das Auditorium ist freilich erheblich kleiner als in Bonn, und meine Landsleute, die Schweizer Studenten, sind kraft ihrer eigenen Zurückhaltung ein etwas härterer Arbeitsboden, als Sie einst waren […]. Um die Schweizer gruppieren sich übrigens in proportional nicht geringer Zahl auch allerlei in den Zungen des Ostens und Westens redende Ausländer, und ein Trüpplein Deutscher hat den Weg hierher bis jetzt auch noch regelmässig gefunden.» «An die ehemaligen Schüler in der Bekennenden Kirche in Deutschland», 10. 5. 1937, in: Barth 2001, 40–46. Barth wurde von der Kuratel auf Initiative von Regierungsrat Miville am 18. 8. 1942 dafür getadelt, dass er über Radio BBC Botschaften an die Norweger sende, allerdings nur mit einem Brief, während andere eine Verurteilung wegen Verstoss gegen das Dekret, das Staatsbeamten politische Äusserungen untersagte, verlangten. Tietz 2019, 312–314; Barth 2001, 328–337. StABS Protokoll T 2 Kuratel der Universität Bd. 14, 1941–1943, 136, 8. Sitzung, 6. 7. 1942.
148
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
te Gesinnung einschliessende «Neutralität» gegenüber dem mächtigen nördlichen Nachbarn offen zu kritisieren. Barth akzeptierte keine Gesinnungsneutralität,486 und er verstand die alliierten Mächte und Widerstand leistenden Völker als Kräfte, deren Kampf durch die Kirche zu unterstützen sei. Obschon vielfach nicht so gemeint, erscheint Barth als Reformator und Prophet,487 der von ihm als falsch erkannte Richtungen energisch verhindern wollte. Gegen die theologischen Kollegen, die immerhin seine Anstellung in Basel begrüsst hatten, äusserte er sich privat oft negativ, und zu Karl Ludwig Schmidt verhielt er sich zeitweise ambivalent, was jedoch auf Gegenseitigkeit beruhte.488 So trat Barth in der Auseinandersetzung um die Nachfolge Eberhard Vischers (zu ihm unten mehr) als treibende Kraft in der Verhinderung liberal gesinnter Kandidaten und als Befürworter eines Mitglieds der Bekennenden Kirche, von Campenhausen, auf. Auch in der Ablehnung der Philosophie seines Bruders Heiner Barth zeigte sich die Radikalität, mit der er das als Wahrheit Erkannte durchsetzen wollte. Die theologische Ablehnung einer auf die Anthropologie oder die Natur abzielenden Auffassung des evangelischen Glaubens motivierte die Härte, mit der er Andersdenkende bekämpfte.489 Seinen Zürcher Kollegen Emil Brunner bekämpfte er mit einer Vehemenz,490 die vergessen lässt, dass sich Brunner für die Flüchtlinge aller Herkunft einsetzte mit dem Argument, dass gerade der Flüchtling jeweils der «Nächste» sei, an dessen Behandlung der Christ gemessen werde. Auf der andern Seite konnte Barth grosszügig und weitsichtig handeln, so zum
486
487 488 489 490
«Wir haben drei Jahre lang nicht ernstlich hungern oder frieren müssen. Wir haben dabei zum Teil ganz gute Geschäfte gemacht […]. Was aber ist bei alledem aus unserer Seele geworden? Ist es nicht so, dass, was wir bisher für das beste Erbe unserer Väter und für die eigentliche Ehre unseres Volkes, Landes und Staates gehalten haben, durch die Art, wie wir uns in diesen Jahren zu helfen versucht haben, ein Loch bekommen hat, das, wenn überhaupt, dann für längste Zeit nicht mehr zu flicken sein wird? Wir haben uns die offizielle Unwahrheit ausgedacht und uns zu eigen gemacht, dass der heute die Welt bewegende Kampf um Recht oder Unrecht, Ordnung oder Anarchie uns auch innerlich nichts angehe […]. Wir haben ‚verdunkelt‘, d. h. wir haben uns gefügt; wir haben, wenn wir es je waren, aufgehört, ein scheinendes Licht inmitten der Völker zu sein.» Barth 1996, 438 f., 440 f. (Bettag 1942). Ott 2002, 11. Mühling 1997, 134 f. u. ö. Barth an Bultmann, 22.12. (er meint Januar) 1935, in: Barth/Bultmann 1971, 164 f., Nr. 90. Im Oktober 1934 verfasste Barth in Rom eine Streitschrift gegen Emil Brunner mit dem Titel «Nein!». Im Januar 1936 kam es zu einer Aussprache zwischen Barth und Brunner auf Schloss Auenstein, wo der offene Bruch vollzogen wurde. Tietz 2019, 243 f.; Busch 1975, 261, 289.
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
149
Beispiel in seiner Offenheit auch für linke Initiativen, die dem Ziel einer Regenerierung Deutschlands dienten.491 Fritz Lieb war als Dogmatiker (und Theologiehistoriker) 1924 in Basel habilitiert worden.492 Lieb gehörte wie viele seiner Altersgruppe zu den Idealzofingern, die über Probleme der Gesellschaft und des Friedens diskutierten und den intellektuellen Flügel der Organisation bildeten.493 Als Theologe war er Schüler von Leonhard Ragaz und Hermann Kutter.494 1923 erwarb er das theologische Lizentiat. 1915 war er der sozialdemokratischen Partei beigetreten und votierte dann dafür, dass sich diese der ‚Dritten Internationalen‘ anschliesse, weswegen er verdächtigt wurde, Kommunist zu sein. 1930 bis 1933 war Lieb Extraordinarius für Östliches Christentum an der Universität Bonn, wo er zum Umkreis von Karl Barth zählte und von Karl Ludwig Schmidt gefördert wurde.495 Im Herbst 1933 wurde er dort aus politischen Gründen entlassen.496 Darauf war er bis 1937 in Clamart bei Paris tätig, u. a. als Begründer der Freien Deutschen Akademie, in der Volksfrontbewegung und von 1929 bis 1936 als Mitherausgeber der Zeitschrift «Orient und Occident». In Paris verkehrte er unter russischen Emigranten, machte die Bekanntschaft von Walter Benjamin und befasste sich mit politischer Theologie oder Theologie der Politik.497 Nachdem die Verhältnisse in Paris für ihn zunehmend prekär geworden waren und sich seine finanziellen Mittel 491
492 493
494 495 496
497
Schon 1938 bestellte Barth die «Basler Nachrichten» ab mit der Begründung, die Hetze gegen Kommunisten und der Klassenkampf von rechts seien sinnlos geworden. Das Blatt sei die Zeitung der Baser Exportindustrie. Barth 2001, 111, 306. Barth traf sich mit Mitgliedern des Nationalkomitees Freies Deutschland am 10. 2. 1945 in Basel (bei dem sich übrigens auch Karl Ludwig Schmidt betätigte: Mühling 1997, 208 f.). Charlotte von Kirschbaum war in der Bewegung aktiv. Tietz 2019, 314 f.; Kocher 1996, 329. Karnetzky/Rese 1992; Kanyar Becker 2016. Lindt 1969. 1910 erschien die entscheidende Proklamation der Idealzofinger (Centralblatt 50, 1909/10, 423 ff.). Zu den Unterzeichnern gehörten aus Basel Ernst Staehelin (später Professor für Kirchengeschichte), Eduard Thurneysen (später Münsterpfarrer, Gefolgsmann von Karl Barth), Peter Thurneysen (Theologe), Heinrich Barth (Philosoph, Bruder von Karl Barth), Max Gerwig (Jurist, späterer Gerichtspräsident und Präsident der Kuratel, christlich-sozial), Carl Ludwig (Jurist, später Regierungsrat für die Liberalen), Karl Sartorius (später Herausgeber der «Basler Nachrichten»), Max Vischer (Jurist), Eugen Ludwig (Mediziner, später Anatomieprofessor, Bruder von Carl Ludwig). Mattmüller 1968, 433. Mühling 1997, 88. «Unser Fritzli» Lieb sei «auch den Weg alles Fleisches gegangen», er habe «das M[aul] bei allen Gelegenheiten zu weit aufgerissen, als dass sein Schicksal verwunderlich wäre». Barth an Thurneysen, 29. 11. 1933, in: Barth/Thurneysen 2000, 553–556. Taubes 2006, darin Elettra Stimilli, «Der Messianismus als politisches Problem», 131 ff.; Kambas 1983, 263–291. Für die Theologen (so auch für Alfred de Quervain) spielte Carl Schmitts Buch von 1922 eine wichtige Rolle: Politische Theologie, München/Leipzig 1922. Lieb, Benjamin und Carl Schmitt: Stimilli, ebendort 174 ff.
150
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
durch die Anschaffung von Büchern für seine grosse Fachbibliothek weitgehend erschöpft hatten, erneuerte er seine Basler Habilitation und wurde hier zu bescheidenen Konditionen 1937 Extraordinarius für Dogmatik und Theologiegeschichte.498 Mit Liebs Integration in die Basler Theologische Fakultät waren drei markante Gestalten der früheren Bonner Fakultät, Barth, Schmidt und eben Lieb, wieder in Basel vereint. Mit Abweichungen vertrat Lieb die dialektische Theologie von Karl Barth.499 Im Unterschied zu diesem war und blieb er in der demokratischen Linken parteipolitisch engagiert. Zusammen mit Eduard Behrens, dem 1935 aus Deutschland ausgewiesenen Korrespondenten der «National-Zeitung»,500 gründete er 1938 das antifaschistische Blatt «Schweizer Zeitung am Sonntag», das bereits ein Jahr später vom Bundesrat verboten wurde, weil es eine Belastung für die schweizerische Aussenpolitik sei. Inzwischen bekannte sich Lieb zu Barths Ansicht, dass der Nationalsozialismus auch mit Waffengewalt zu bekämpfen sei.501 1938 bis 1953 sass er für die Sozialdemokraten im Basler Grossen Rat, 1945 bis 1950 war er Vorsitzender der Gesellschaft Schweiz-Sowjetunion und Präsident der Bewegung gegen die atomare Aufrüstung.502 Ab Mitte der 1940er Jahre war Lieb zudem Ersatzrichter am Basler Appellationsgericht und Mitglied der Kommission des Humanistischen Gymnasiums sowie der Kuratel der Universität Basel. 1947/48 war er einer der Basler, die in Berlin (⌥Ost) universitäre Aufbauarbeit leisteten.503 Fritz Lieb attackierte offen den Nationalsozialismus als antichristliche, totalitäre Ideologie; er entwickelte eine eingehende Begründung dieser Opposition u. a. in einem predigtartigen Aufsatz, der als Kritik an Alfred Rosenbergs Mythus des 20. Jahrhunderts aufgezogen war. Diesen veröffentlichte er in der Sammelschrift deutscher Emigranten, die Emil Julius Gumbel504 1938 in Strassburg herausgab.505 Man erkennt darin einerseits die Nähe zu Barth, weil er den Totalitäts-
498
499 500 501 502 503 504 505
Die Karriere in Basel verlief zunächst wenig erfreulich: 1935 wurde ihm ein bezahlter Lehrauftrag noch verweigert. Den Titel Extraordinarius bekam er erst 1936, nachdem er sich wieder offiziell in Basel habilitiert hatte. 1937 wurde ihm endlich eine Besoldung gewährt. StABS Protokoll S 4 Erziehungsrat Bd. 23, 1934–1936, 20. 11. 1935; StABS Erziehungsrat Bd. 24, 1936–1938, 17. 2. 1936; Regierungsratsbeschluss vom 6. 3. 1936; Publikation des Entscheids durch Regierungsratsbeschluss vom 13. 6. 1936; StABS Erziehungsrat S 4 Bd. 24, 1936–1938, 22. 11. 1937; Regierungsratsbeschluss vom 11. 12. 1937; StABS Erziehungsrat S 4 Bd. 26, 1940–1942, 8. 12. 1941; Regierungsratsbeschluss 9. 12. 1942. Anonym 1962. Marti-Weissenbach 2002. Busch 1975, 117; Lieb 1939. Kanyar Becker 2016. Nipp o. J., Fritz Lieb; Buess 1985; Bibliographie Fritz Lieb: Gsell 2015. Leo 2010, 52 ff.; Brenner 2001; Wolgast/Kogelschatz 1993; Jansen 1981. Lieb 1938. Rosenbergs Buch Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelischgeistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit war schon 1930 erschienen. Liebs Kritik war nicht
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
151
anspruch der Nationalsozialisten sehr klar erfasste. Andererseits sieht man das Bedürfnis, die eigene Position nicht nur kirchlich, sondern auch politisch zu bekennen. Eine Besonderheit war bei Lieb sein enthusiastisches Interesse für die Kirchen des europäischen Ostens. Er war in der Basler Öffentlichkeit einer der entschiedensten Gegner des Nationalsozialismus.506 Sein Engagement in der Flüchtlingsfrage wäre noch zu untersuchen.507 Zu Barths grossem Ärger stellte ihm die Basler Regierung einen freisinnigen Systematiker zur Seite, wenn auch nur mit einem bescheidenen Pensum: Fritz Buri. Dieser erhielt 1939 in Basel einen Lehrauftrag für Systematische Theologie (zusätzlich zu seiner Stellung als Privatdozent in Bern), nachdem er erfolglos für die kirchengeschichtliche Professur von Eberhard Vischer kandidiert hatte, die schliesslich Cullmann erhielt. Seine Beauftragung geschah gegen den Willen der Fakultät und insbesondere unter Barths Protest. Fritz Buri war Pfarrer in Täuffelen, hatte 1934 in Bern promoviert und war 1935 dort für Systematische Theologie habilitiert worden.508 Seine zentrale Thematik war die neutestamentliche Eschatologie, deren Auffassung bei ihm auf Albert Schweitzer zurückging. Er rezipierte die These des Katholiken Hans Urs von Balthasar, dass auch Philosophie, Weltanschauungsdichtung und Soziallehren von eschatologischen Bedürfnissen geprägt seien. Die ersten christlichen Gemeinden hätten erwartet, dass ein «neuer Äon» real und unmittelbar hereinbreche, der für sie «in der Zeit» kommen sollte, nicht wie bei Barth oder Ragaz als etwas «überzeitlich Nahes».509 Die Fakultät wurde im Verfahren für die Nachfolge Eberhard Vischers im Sommer 1937 mit der Forderung konfrontiert, über Buri zu berichten.510 Für sie gingen die Überlegungen der Kuratelskommission in eine falsche (nämlich freisinnige)
506
507
508 509 510
die einzige von protestantischer Seite; ihr voraus ging z. B. Künneth 1935. Darin wurde jedoch der Antisemitismus gutgeheissen. Vgl. auch die Kritik von Heinrich Barth an Rosenberg, unten, Kapitel 7.4.1. Dies trug ihm eine Akte der Bundesanwaltschaft ein: E4320B 1974/47_41, Aktenzeichen C.03-133, E4320B#1974/47#179*. Aus einem Bericht der Bundesanwaltschaft über ein mit Max Lerch geführtes Telefongespräch erfährt man, dass Lieb 1939 Bundesrat Motta einen «Wegglibueb» nannte. 1943 habe ein russischer Agent, Yves Rameau, Verbindung mit Lieb gesucht. 1944 wurde Lieb Vorstandsmitglied der Gesellschaft Schweiz-Sowjetunion. Die Sozialdemokratische Partei Basel wisse, dass Lieb mit dem Kommunismus sympathisiere, er werde aber in der Partei als «absolut ungefährlich taxiert». Dabei geht aus den Akten hervor, dass er den Stalinismus ablehnte, aber das Jugoslawien Titos schätzte. In der Mustermesse sprachen über «Die Schweiz und die Zukunft der Flüchtlinge» Pfarrer F. Blum, Prof. Fritz Lieb, Nationalrat Albert Oeri, Pfr. Paul Vogt (Zürich), Dr. K. [Hans?] Zbinden (Bern). Basler Jahrbuch, Chronik zum 8. 9. 1944. Schulz/Sommer 2007; Balsiger 2003. Schulz/Sommer 2007, 23–25. StABS UA O 2b 1924–1946 Protokollbuch der Theologischen Fakultät seit 1924, 250, 13. Sitzung, 7. 7. 1937 (Dekan Eichrodt).
152
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
Richtung, weshalb sie nicht nur Buri ablehnte, sondern zusätzlich den Namen von Oscar Cullmann, Maître de conférence in Strasbourg, ins Spiel brachte. Gegen diesen gab es keine politischen Bedenken, er war zudem fachlich vorzüglich ausgewiesen. Damit war mit der Kandidatur Cullmanns ein Kompromiss angebahnt, der jedoch von der freisinnigen Seite nicht als solcher verstanden wurde. Im Januar 1938 entschied sich die Kuratel für den Deutschen von Campenhausen oder den Elsässer Cullmann und überliess die Wahl zwischen diesen beiden den vorgesetzten Behörden.511 Im Erziehungsrat erhielt Cullmann am 31. Januar 1938 fünf, von Campenhausen zwei Stimmen, bei einer Enthaltung. Die Mobilisierung der freisinnigen Pfarrer gegen diesen Vorentscheid änderte daran nichts. Am 30. April 1938 war Cullmann gewählt. Buris weitere Laufbahn an der Basler Universität verzögerte sich stark. Er schrieb Rezensionen für die «National-Zeitung», in denen er sich auch kritisch mit Barth auseinandersetzte. Anerkennung fand er in der International Association for Liberal Christianity and Religious Freedom.512 Im Krieg diente er als Feldprediger und leistete seinen Beitrag zur ‚geistigen Landesverteidigung‘.513 Buri hatte schon in seiner Berner Antrittsvorlesung die Theologie der Deutschen Christen mit eigenen theologischen und ethischen Argumenten abgelehnt, die sich stark von denen der Barthianer unterschieden.514 1948 wurde er in Basel in einem harten Wahlkampf, der die Positiven und die Freisinnigen polarisierte, zum Pfarrer von St. Alban-Breite gewählt.515 Erst 1951 erhielt er den Titel eines Extraordinarius.516 Nun orientierte er sich an Bultmann und Karl Jaspers.517 1957
511
512 513 514
515 516
517
Der Präsident der Kuratel begründete den Doppelvorschlag damit, dass man sich Mühe gegeben habe, einen «linkstheologisch gerichteten Vertreter» zu finden, aber es gebe keine geeigneten Kandidaten; also müsse die Verantwortung der Fakultät überlassen bleiben. Dieser Beschluss kam allerdings erst in der zweiten Sitzung, die die Kuratel dieser Sache widmete, zustande, in: StABS Protokoll T 2 Kuratel der Universität Bd. 13, 1935–1941, 251, 2. Sitzung, 6. 1. 1938; 255, 3. Sitzung 13. 1. 1938. Schulz/Sommer 2007, 32. Schulz/Sommer 2007, 39. Der Rassenwahn war für ihn der «Gipfel der Seinsverfallenheit». Aus dem Sein könne kein Sinn gewonnen werden. Das wahre Christentum hielt Buri für eine «Sinnreligion». Schulz/Sommer 2007, 29. Basler Nachrichten vom 19. 4. 1948; National-Zeitung vom 19. 4. 1948. National-Zeitung vom 24. 9. 1951. Kritisch über seine Antrittsvorlesung als Extraordinarius berichteten die «Basler Nachrichten». Er setze sich mit Bultmann auseinander, den er existentialistisch als Vertreter Heideggerscher Ideen verstehe, wolle den Mythos überwinden und kritisiere alle Offenbarungstheologie und solche, die vom historischen Jesus ausgehen wollten. «Theologie und Philosophie» (Basler Nachrichten vom 11. 2. 1952). Schulz/Sommer 2007, 33. Buri hatte schon im Winter 1944/45 in Basel eine Lehrveranstaltung über «Existenzphilosophie und Theologie» angekündigt. StABS UA AA2 Lektionskataloge/Vorlesungsverzeichnisse.
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
153
wurde er zum Münsterpfarrer gewählt, diesmal unbestritten,518 aber erst 1968 wurde er zum persönlichen Ordinarius befördert.519 Ganz anders als bei Buri verlief die Karriere von Alfred de Quervain, der sich 1930 in Basel für Dogmatik und Ethik habilitierte.520 1921/22 war er Mitarbeiter der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost gewesen, danach von 1923 bis 1926 Pfarrer der französisch (hugenottisch)-reformierten Gemeinde Frankfurt am Main, 1926 bis 1928 der reformierten Gemeinde Stuttgart und von 1928 bis 1931 der bernischen frankophonen Gemeinde La Neuveville. Er interessierte sich für die ethischen Voraussetzungen der Politik und orientierte sich dabei an Carl Schmitt und Gustav Radbruch. Als Privatdozent las er in Basel bis 1938 nur sporadisch.521 Denn nach dem Pfarramt in La Neuveville wirkte er wieder in Deutschland, wo er trotz seines Einsatzes für die Bekennende Kirche bis 1938 aushielt: 1931 bis 1938 war er Pfarrer der niederländisch-reformierten Gemeinde in Elberfeld und ab 1935 zugleich Dozent an der dortigen kirchlichen Hochschule. Als er 1938 in die Schweiz zurückkehrte, wurde er durch eine reguläre Wahl Pfarrer im damals bernischen Laufen (bis 1947). 1944 beförderten ihn die Basler Behörden zum Extraordinarius, während er zugleich Extraordinarius für Ethik in Bern wurde.522 In der Bundesstadt erhielt er schliesslich ein Ordinariat für Ethik, Soziologie, praktische Exegese und französische Theologie.523 De Quervain kreuzte immer wieder den Weg von Karl Barth, ohne dass es zu einem Vertrauensverhältnis gekommen wäre. Eduard Thurneysen erwähnte ihn als unsicheren und manchmal störenden Faktor in der Bekennenden Kirche und in Elberfeld. De Quervain nahm jedoch die Anhänger Barths als Gäste auf, wenn sie in Elberfeld waren, er setzte sich auch für eine Position Barths in Deutschland nach der Entlassung ein, aber nicht mit den Argumenten, die dessen Freunde gerne gehört hätten.524 Als Systematiker, Dogmatiker und Neutestamentler wirkte auch Adolf Köberle, der 1930 als Extraordinarius auf eine Basler Stiftungsprofessur (finanziert durch den Verein für christlich-theologische Wissenschaft) gewählt worden
518 519 520 521
522 523 524
National-Zeitung 24. 6. 1957. Umfassende Darstellung in: Schulz/Sommer 2007; Ott 1995 (Nachruf). Habilitationsvorlesung «Die theologischen Voraussetzungen der Politik» (Basler Chronik zum 6. 11. 1930). Einträge von de Quervain finden sich in den Basler Vorlesungsverzeichnissen ab Winter 1934/35 (vorher meist beurlaubt), die Themen waren z. B. «Glaube und Recht», «Das Recht nach reformierter Lehre», «Volk, Sitte, Recht», «Obrigkeit als theologisches Problem», «Der Staat als theologisches Problem». Regierungsratsbeschluss vom 12. 7. 1944. Kocher 2009. Ausführlich zur Ethik: Göllner 2005. Thurneysen an Barth, 21. 1. 1935, Bericht über die Reise Thurneysens nach Elberfeld mit Charlotte von Kirschbaum und Rudolf Pestalozzi, in: Barth/Thurneysen 2000, 816, 819.
154
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
war.525 Der bayrische Pfarrersohn diente 1916 bis 1918 als Soldat, danach studierte er Philosophie und Theologie in München, Erlangen und Tübingen. 1922 trat er in den Dienst der lutherischen Kirche in Bayern ein. 1926 wurde er Leiter des Evangelisch-lutherischen Missionsseminars in Leipzig, von wo aus er als Extraordinarius für Systematische Theologie nach Basel gewählt wurde. Zugleich wirkte er als Gastdozent auf St. Chrischona. Neben der Professur predigte er häufig und engagierte sich in der Volkshochschule und anderen Basler Vortragsreihen. 1939 wechselte er nach Tübingen als Ordinarius für Systematische Theologie, wo er seinem Lehrer Karl Heim nachfolgte.526 Es war eine in der Schweiz schwer verständliche Entscheidung, noch 1939 an eine gleichgeschaltete deutsche Universität überzutreten. Köberle repräsentierte eine Strömung im erneuerten süddeutschen Pietismus und befasste sich mit dem Erbe der schwäbischen Brüder. Zeitweise setzte er sich mit Rudolf Steiners Anthroposophie auseinander. Zu Barth und zu den Religiös-Sozialen hielt er Distanz, während ihm die Barthianer die Zustimmung zu Emil Brunners Ethik verübelten.527 Ethik gehörte auch zum Lehrangebot Köberles an der Universität Basel.528 Ernst Staehelin duzte sich mit Köberle; wenigstens nach dem Krieg scheinen die beiden gute Freunde gewesen zu sein.529 Köberle zählte sich selbst zu den Anhängern der Bekennenden Kirche und hielt Vorträge in Deutschland, so etwa 1938 in Hamburg. An den Basler-Freiburger Professorentreffen nahm Köberle 1930, 1933 und 1934 teil, danach nicht mehr.530 Er lobte zwar die Sozialpolitik des ‚Dritten Reichs‘ und gab sich als deutscher Patriot, der das Wiederaufstreben seines Vaterlandes begrüsste, aber er kritisierte die herr525 526 527
528 529 530
Kuhn 2010; Bautz 2005. StABS UA Stiftungsprofessuren VIII 11.2 n Adolf Köberle (1934–1941). Heim lehnte die Deutschen Christen ab, hielt sich aber von der Bekennenden Kirche fern, die ihm als ein Sammelbecken Unzufriedener vorkam. Meier 1996, 320. «[…] das ganz und gar unausstehliche Buch von unserem neuen Mann, von Köberle […].» Dies bezog sich auf Köberle 1929. Thurneysen an Barth, 20. 3. 1930, in: Barth/ Thurneysen 2000, 1–6. «Hast Du die Besprechung von Emils [Brunners] Ethik von [M.] Werner gesehen? Der Unselige, nach dem wahrhaft vernichtenden Lob von Köberle nun auch noch der Ruhm, man könne einen Offenbarungsglauben ablehnen und die darauf gebaute Ethik doch ganz gut heissen!» Barth an Thurneysen, 20. 2. 1933, ebd., 357–364. Vgl. Köberle 1933: «Nach unserer Meinung verkörpert dieses Werk [von Brunner] die ideale Dialektik, wie sie von einer wahrhaft protestantischen, evangelischen Ethik unter dem Vorzeichen von Kreuz und Auferstehung gefordert werden muss.» Diese Differenz verhinderte nicht, dass Barth und Köberle im Wintersemester 1936/37 eine gemeinsame Lehrveranstaltung über «Das apostolische Glaubensbekenntnis, nach lutherischer und reformierter Lehre» abhielten. StABS UA AA 2 Lektionskataloge/Vorlesungsverzeichnisse. StABS UA AA 2 Lektionskataloge/Vorlesungsverzeichnisse. Briefwechsel mit Adolf Köberle, in: Nachlass Ernst Staehelin NL 124, B 110. UA Freiburg i. Br., B0001 317 Ohne Umschlagtitel, Inhalt Treffen Basel-Freiburg, ab 1924.
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
155
schende Ideologie, wenn sie dem ‚Heidnischen‘ Vorschub leistete. Seine Berufung nach Tübingen gelang angeblich nur unter der Voraussetzung, dass zugleich ein «staatsloyaler» deutscher Lehrer gefunden würde, der an seiner Stelle in Basel wirken würde. Dies liess sich allerdings nicht verwirklichen; die Basler Position blieb vorerst unbesetzt.531 Belegt ist Köberles antisemitische Haltung, die nicht religiös, sondern rassistisch motiviert war. Der in Basel geschürte Verdacht, er habe sich in einer nationalsozialistischen Veranstaltung in Zürich einschlägig geäussert, lässt sich nicht erhärten, aber die Teilnahme ist unbestritten. Die bevorstehende Berufung an die Universität Tübingen erlaubte es damals den Basler Erziehungsbehörden, auf eine Untersuchung zu verzichten.532 Im Entnazifizierungsverfahren der Universitätsspruchkammer Tübingen wurde Köberle am 17. Juni 1949 als «nicht betroffen» von jedem Verdacht, Verbindungen mit dem Nationalsozialismus gepflegt zu haben, freigesprochen.533 4.2.2 Kirchengeschichte Eberhard Vischer war ordentlicher Professor für Kirchengeschichte und für Neues Testament. Sein Lehrstuhl hatte nichts mit dem kirchenhistorischen Lehrauftrag zu tun, den Ernst Staehelin innehatte, der seinerseits Nachfolger von Wernle war und sich auf die Geschichte seit der Reformation beschränken musste. Als Sohn des Historikers Wilhelm Vischer-Heussler534 und Schüler von Ritschl und Adolf von Harnack war Vischer zunächst ganz im 19. Jahrhundert verwurzelt, bewegte sich aber von jenem vermittelnden Liberalismus allmählich weg und auf eine ‚positive‘ Position zu. 1890 bis 1893 war er Pfarrer in Arosa und 1893 bis 1995 in Davos Dorf. 1898 wurde er in Basel Privatdozent, dann Extraordinarius, und 1907 stieg er zum Ordinarius auf, wobei er als Nachfolger von Franz Overbeck galt. Zusammen mit Paul Wernle dominierte er während des Ersten Weltkriegs und in den 1920er Jahren die Fakultät.535 Er bekleidete wichtige Ämter in der Kirche und in der Politik: Kurzfristig sass er im Grossen Rat (1923 bis 1926) und von 1904 bis 1946 in der Basler Kirchensynode. 1913 bis 1943 präsidierte er die theologische Konkordatsprüfungsbehörde, 1923 bis 1943 den protestantischkirchlichen Hilfsverein. 1918 bis 1935 war er Mitglied des Erziehungsrats. Dabei 531 532 533
534 535
StABS Erziehungsrat S 4 Bd. 26, 1940–1942, 28. 10. 1940. Tréfás 2009, 122–125. Landesarchiv Baden-Württemberg, https://www.landesarchiv-bw.de/, Staatsarchiv Sigmaringen, Staatskommissariat für die politische Säuberung, Findbuch Wü 13 T 2, Nr. 2655/ 320, Digitalisat des Entscheids. Janner 2013. Basel habe als «Harnackiden-Nest» gegolten; der Gegenstoss sei von Barth und Thurneysen 1919 gekommen. Bernoulli 1935.
156
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
war er offen für Neues und bewies soziales Engagement.536 Der Kirchenkampf in Deutschland interessierte ihn früh, er erfasste dessen Sinn aber zu Beginn nicht mit derselben Klarheit wie Karl Barth, vielmehr konstatierte er «mit Kummer und Sorge», wie die Deutschen Christen Hitler nachfolgten, betonte aber zugleich, dass die Kirche weder mit dem Staat um die Macht kämpfen noch ihre Hauptaufgabe darin sehen dürfe, «den Staat, ja eine bestimmte Partei im Staate zu stützen».537 Eindrücklich bleibt sein Engagement in der Flüchtlingsfrage. Vischer galt zusammen mit Ernst Staehelin als derjenige, der dafür gesorgt hat, dass der Bonner Karl Ludwig Schmidt in Basel einen Lehrstuhl bekam.538 1937 wurde er pensioniert, worauf der Streit um seine Nachfolge einsetzte, der mit der Berufung von Cullmann und der Erteilung eines Lehrauftrags an Buri endete.539 Die (christliche) Linke scheint Vischer bewundert zu haben, wie der Nachruf in der «AZ» zeigt: «Der Ehrendoktor der Universität Warschau hat in seiner weltweiten Offenheit für das Wertvolle in allen Völkern nicht nur gewusst, dass die Polen keine Untermenschen sind oder waren, sondern er war auch sehr früh im Bild über den Nationalsozialismus und hat die Kriegsjahre fern von jeder moralischen Neutralität verbracht.»540 Vischers Haltung scheint durch die grelle Beleuchtung, die die Anhänger Barths in ihrem Kampf gegen den Nationalsozialismus erhalten haben, überdeckt worden zu sein und verdient eine Würdigung, die ich an dieser Stelle nicht leisten kann. Der zweite Basler Kirchenhistoriker war Ernst Staehelin. Sein Standpunkt gestattet interessante Einblicke in eine Spielart des reformierten Verhältnisses zu den Ereignissen in den Jahren 1933 bis 1945. Während seine Schwester Ruth mit Fritz Lieb verheiratet war, heiratete er selbst 1921 Gertrud Kutter, eine Tochter von Hermann Kutter, von dem er wichtige Anregungen übernahm. Seine Karriere verlief gradlinig und brachte ihm viele teils kirchliche, teils politische Ämter ein. Staehelin hatte 1908 sein Studium in Basel begonnen und setzte es in Göttingen und Berlin fort. Nach einem Aufenthalt in Marburg habilitierte er sich 1916 in Basel. 1920 bis 1924 wirkte er als Pfarrer in Thalheim und Olten. 1924 erhielt er den Titel eines Extraordinarius, 1927 wurde er Nachfolger von Paul Wernle an der Basler Fakultät, wo er bis 1961 neuere Kirchen- und Dogmengeschichte lehrte. 1933, 1939 und 1960 war er Rektor. Von 1929 bis 1935 redigierte er das «Kirchenblatt für die reformierte Schweiz», und von 1936 bis 1980 war er Lektor des Frey-Grynaeums. 1933 bis 1947 sass er im Kirchenrat, 1934 bis 1946 im Erziehungsrat als faktischer Nachfolger für Eberhard Vischer, de jure aber als Nachfol536 537 538 539 540
Aerne 2013. Vischer 1933. Mühling 1997, 10. Vischer wurde per 15. 10. 1937 pensioniert. StABS Erziehungsrat, Protokoll 4. 8. 1937, Regierungsratsbeschluss vom 3. 8. 1937. Gerwig 1946.
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
157
ger des Kommunisten Franz Welti-Preiswerk.541 Seine historischen Arbeiten betrafen die Basler Reformation und die Geschichte der Deutschen Christentumsgesellschaft. Das Hauptwerk publizierte er nach dem Zweiten Weltkrieg; es bezog sich auf sein wichtigstes Anliegen, die Verkündigung des Reichs Gottes.542 1910 unterschrieb er das Manifest von sechzig aktiven Idealzofingern im «Centralblatt» des Zofingervereins. Er war auch beteiligt an der Zeitschrift «Aufbau», gegründet 1919 von Max Gerber und Max Gerwig.543 Der spätere Staehelin war Exponent von Hermann Bächtolds Evangelischer Volkspartei,544 die gemässigte soziale Anliegen mit einem Programm verband, das vor allem die Verchristlichung aller Lebensbereiche anstrebte. Staehelin vertrat eine Theologie der Erwartung des Reichs Gottes und galt kritischen Geistern als wenig origineller, dieselben Formeln («zerbrochene Schöpfung») wiederholender Redner und Prediger.545 Tatsächlich zeigen seine kleineren Arbeiten oft dasselbe Argumentationsschema: Nur wenn eine menschliche Aktion sich eng auf Jesus Christus und das Reich Gottes beziehe, könne sie bestehen. Dies exemplifizierte er an der Schweizer Geschichte, an Wirtschaftsthemen und an der Nutzung der Atomkraft.546 Er begrüsste die Wirtschaftsthesen der Weltkirchenkonferenz von Stockholm 1925, die vom internationalen Sozialwissenschaftlichen Institut in Genf weiterentwickelt wurden (später Forschungsabteilung des Ökumenischen Rates für Praktisches Christentum). Beeindruckt zeigte sich Staehelin von der 1937 abgehaltenen zweiten Weltkirchenkonferenz in Oxford. Das christliche Gewissen ertrage keine wirtschaftlich bedingten Klassenunterschiede.547 Seine eigenen liberalen Wurzeln liess er in der Behandlung des Verhältnisses zwischen Liberalismus und Theologie im 19. Jahrhundert erkennen: Manche Errungenschaften jenes Jahrhunderts fand er unverzichtbar und damit verteidigungswürdig unter der Voraussetzung, dass sie von einem christlichen Glauben getragen seien. Schliesslich war Staehelin relativ offen für den Katholizismus. Er hielt die Reformation zwar für ein Eingreifen Gottes in die Geschichte der Menschen, glaubte aber nicht, dass die Perpetuierung der Glaubensspaltung ein göttlicher Auftrag sei. Er hielt regelmässig eine Vorlesung über Niklaus von Flüe,548 in der er zeigte, wie eine Durchwirkung der Politik mit 541 542 543 544 545
546 547 548
Basler Jahrbuch, Chronik zum 8. 11. 1934. Kuhn 2012; vgl. Schmidt 1997, für meine Fragestellungen jedoch wenig ergiebig. Kunz 2011, 93; Busch 1975, 91; Lindt 1969. Ammann 1954. «[…] wie [der Leser] etwa einen Artikel von Ernst Staehelin über die zerstörte Schöpfung oder dergl. zur Kenntnis nimmt zwischen zwei Schlücken Kaffee». Barth über Ernst Staehelin 1932, in: Barth/Thurneysen 2000, 359. Staehelin 1946. Staehelin 1943. Vorlesung über Niklaus von Flüe, ohne Datum (basiert auf Robert Durrer, Nikolaus von Flüe, 1917–1921), in: Nachlass Ernst Staehelin NL 124, D 028.
158
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
christlichen Impulsen für das Vaterland heilsam sei. In diesem Sinne hielt er eine «Erneuerung» der Schweiz für notwendig, womit er sich in ambivalenter Weise eines Schlagworts der rechtsextremen Frontisten bediente. Er begrüsste explizit eine katholisch-konservative Politik, und in dieser Hinsicht interessierte er sich auch für Philipp Etter (1933 Autor von Die vaterländische Erneuerung und wir, Bundesrat 1934 bis 1959) und Gonzague de Reynold (1929 Autor von La démocratie et la Suisse, 1938 von Conscience de la Suisse). Beispiele für seine Haltung zum Liberalismus finden sich in seiner Rektoratsrede von 1933. Hier plädierte er einerseits dafür, dass der Liberalismus, «eine der gewaltigsten Bewegungen der Menschengeschichte», ein «erfrischender Sturmwind», in vielen Aspekten unverzichtbar gewesen sei, dass es aber unbedingt christliche Ergriffenheit brauche, um das Gute zu tun. Der Liberalismus habe gezeigt, dass die Kirche «aus unvollkommener Glaubenserkenntnis und aus Trägheit heraus an viel Unwahrheit, Ungerechtigkeit und Erstarrung innerhalb der schweizerischen Volksgemeinschaft mitschuldig war». Die Leistungen des Liberalismus bilanzierte Staehelin aus evangelischer Sicht wie folgt: Er zerstörte die Fiktion, dass das Staatsvolk identisch sei mit dem Kirchenvolk, denn der Glaube komme nur als Geschenk Gottes. Der Liberalismus habe Raum für die Humanität derer geschaffen, die dieses Geschenk nicht erhielten oder sich ihm verweigerten. Er wollte damit nicht sagen, dass «das jetzige Verhältnis, wo die schweizerische Volksgemeinschaft offiziell fast vollständig von der Einstellung der blossen Humanität beherrscht wird, das richtige ist. Es muss wohl um der letzten Wahrheiten willen, die uns gegeben sind, über kurz oder lang eine neue Lösung gesucht werden.» Den Ernst der Lage hatte er 1933 noch nicht begriffen. «Verschiedene grosse kulturelle und politische Programme ringen heute in leidenschaftlichem Kampfe miteinander. Alle [sic] enthalten ernste und tiefe Wahrheiten. Aber es sind doch immer, weil sie aus der Sphäre der zerbrochenen Schöpfung stammen, nur Teilwahrheiten voll mannigfacher Beschränktheit.»549 Mit der ‚geistigen Landesverteidigung‘ intensivierte er die Verteidigung liberaler Errungenschaften, hielt aber Aspekte der Volksherrschaft stets für problematisch und tendierte zu einer von der katholischen Soziallehre inspirierten Ständestaatsidee. Wie diejenigen, die die «Integration» eines Volkes durch die faschistische Staatsidee interessant fanden, glaubte Staehelin, dass die Werte des Rechtsstaats und andere abstrakte Grundsätze allein keinen lebendigen Patriotismus begründen könnten, der ein «Staatsvolk» zusammenzuhalten vermöge.550 Nur dass für ihn dieser Zusammenhalt aus dem christlichen Glauben kommen müsse und liberale Errungenschaften dabei
549 550
Staehelin 1934. Hier traf er sich mit dem Juristen Jacob Wackernagel (Wackernagel 1934), siehe unten, Kapitel 5.7.
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
159
nicht geopfert werden dürften.551 Noch 1939 plädierte Staehelin für diese «Erneuerung». «Letzte Grundlagen der Volksgemeinschaft» in der Schweiz könnten nur die christlichen sein, die von Gonzague de Reynold bis Hermann Bächtold angerufen worden seien.552 Staehelins «Erneuerung» war inspiriert durch einen antidemokratischen Zug: Das Vertrauen in eine Volksherrschaft fehlte ihm weitgehend. Damit lag er recht nahe bei der bürgerlichen bis rechtsliberalen Linie der «Basler Nachrichten». Regierungsrat Carl Ludwig, der sich im Übrigen auch als Christ für die Flüchtlingsfrage interessierte und zugleich gegen alles, was er als Vorboten eines kommunistischen Umsturzes deutete, energisch vorging, war nicht zufällig eine Referenz für ihn, und er hatte keine Berührungsängste mit dem teilweise frontistisch orientierten «Jungreformierten» Rudolf Grob.553 Es ging Staehelin in den 1930er Jahren noch nicht direkt um den Kampf gegen Faschismus und Nazismus, sondern diese wurden als Folgen der Gottverlassenheit und der darauf folgenden, allgemeinen Verwirrung, ja als (verständliche) Reaktion auf einen übertriebenen Liberalismus und eine säkularisierte Demokratie aufgefasst. 1941 sah er klarer, blieb aber dabei, dass eine Verchristlichung aller Verhältnisse das Ziel sei: […] in den beiden grossen diktatorischen Totalitätsstaaten […] wird mit einem Aufwand von ungeheurer Dynamik der Versuch gemacht, das europäische Abendland von Grund auf umzuprägen, das bewusst christliche Abendland der früheren Jahrhunderte und das noch bis zu einem gewissen Grade vom christlichen Erbe der Vergangenheit lebende Abendland der Gegenwart durch ein Abendland zu ersetzen, das auf vollständig neuen Grundlagen steht. Nicht nur werden die Kirchen radikal verfolgt oder einem allmählichen Erstickungstod überantwortet, sondern die vier Leitlinien, die für das ganze staatlich-kulturelle Sein des Abendlandes konstitutiv waren, und die in säkularisierter Form auch noch die Ideale des liberalistischen und sozialistischen Abendlandes sind, werden sozusagen in ihr Gegenteil verkehrt. [Die Ideale des Humanismus] müssen wieder an die grosse Quelle der Offenbarung Gottes in Jesus Christus angeschlossen werden und dort ihre Kraft, ihren Inhalt und ihre Orientierung erhalten.554 551 552 553 554
Staehelin 1933, 97. Staehelin 1939. Kocher 2020. Akademischer Vortrag, 25. 2. 1941, «Das christliche Abendland», Manuskript, nicht durchgeschrieben, viele Seiten enthalten blosse Zitate, in: Nachlass Ernst Staehelin NL 124, D 056. Die vier Leitideen: «1. Die Menschen- und Völkerwelt samt dem Staat und den Trägern der Staatsgewalt werden unter die Majestät Gottes gestellt und in ihre von Gott gesetzten Schranken verwiesen: homo es (Ambrosius an Theodosius). 2. Der Mensch wird zugleich in gewaltiger Weise erhoben und geadelt, und zwar jeder Mensch: Abbild Gottes, Christus als das neue Urbild des Menschen. Konstantin (gegen Brandmarkung). Ambrosius (gegen? in Beziehung auf das Blutbad von Thessaloniki). Christliche Humanität Vollendung der Humanitätsgedanken der Antike. 3. Die Menschen- und Völkerwelt
160
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
Staehelin sah sich offenbar als ein Vermittler, der jedes Thema einerseits auf eine menschliche Dimension zurückführte, es andererseits hinauftransformierte zur Frage nach dem kommenden Reich Gottes. So pflegte er Kontakte zu ausserkirchlichen Gemeinschaften und stellte diese seinen Studenten vor. Als Redaktor des «Kirchenblattes» äusserte er sich selten selbst und veröffentlichte lieber nur Dokumentationen zum deutschen Kirchenkampf. Bis 1938 nahm er an den Zusammenkünften der Professoren von Basel und Freiburg i. Br. teil; zuweilen war er der einzige Basler Theologe dort.555 Als Rektor wollte Staehelin in der RegenzDebatte vom Dezember 1933 über die Umtriebe der nationalsozialistischen Deutschen Studenten die Anerkennung der studentischen NS-Organisation grosszügig behandeln und sah (im Unterschied zum Historiker Emil Dürr, der eine demokratische innere Organisation für studentische Vereine forderte) keinen Diskussionsbedarf.556 1936 riet er in ähnlicher Weise im Erziehungsrat davon ab, gegen die Deutschen Studenten vorzugehen, als deren «Führer» Kübler der Spionage verdächtigt wurde. Im Fall des Anatomen Werner Gerlach, der sich zum Nationalsozialismus bekannte, hielt sich Staehelin ebenfalls auffällig zurück, allerdings unter Berufung auf den Rechtsstaat, der keine Gesinnungsdelikte kenne.557 Er befürwortete 1936/37 die offizielle Teilnahme der Universität Basel an den Jubiläumsfeiern der Universitäten Heidelberg und Göttingen. Seine Frau engagierte sich derweilen stark und unzweideutig in der Betreuung von Flüchtlingen. Das Frey-Grynaeische Institut bot dafür ausreichend Platz. Seine eigenen professoralen Interessen vernachlässigte er nicht, auch wenn er sie nicht durchsetzen konnte. In der Fakultätsdebatte um die Berufung von Karl Ludwig Schmidt versuchte er als Dekan, alle kirchenhistorischen Fächer in seiner eigenen Hand zu vereinigen. Der durch diese Intention direkt betroffene Vischer war damit keineswegs einverstanden, und so scheiterte Staehelins Versuch.558 Andererseits war er bereit, sich für Kollegen einzusetzen: Barths Professur in Basel befürwortete er. Als Schmidt Probleme mit der Aufenthaltsbewilli-
555 556
557 558
wird im Zeichen letzter metaphysischer Wahrheiten und Wirklichkeiten zu einer Einheit zusammengeschlossen. 4. Das staatlich-kulturell-soziale Leben erhält ein Telos von ungeheurer Tiefe und Sinnfülle: den Menschen in seiner letzten Bestimmung zu verwirklichen.» UA Freiburg i. Br., B0001 317 Ohne Umschlagtitel, Inhalt Treffen Basel-Freiburg, ab 1924. StABS Acta et Decreta Academiae Basiliensis 1922–1933 = UA (Bücher) B 1 XIII, Regenz 6. 12. 1933, 387. Man konnte auch den Standpunkt vertreten, die Universitätsbehörden und das ED Basel-Stadt könnten nichts tun, weil der Bundesrat keinen Anlass sah, einzugreifen. Sibold 2010, 44 f. StABS Protokoll S 4 Erziehungsrat Bd. 24, 1936–1938, 6. 7. 1936. StABS UA O 2b 1924–1946 Protokollbuch der Theologischen Fakultät 1924–1946, 169, 4. Sitzung, 29. 3. 1935. Karl Goetz: Ernst Staehelin an Fakultätskollegen, hektographiert, 26. 3. 1935, in: StABS UA VIII 5,3.
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
161
gung bekam, reiste Staehelin eigens deswegen nach Bern im Einverständnis mit Fritz Hauser, erreichte allerdings bei den Bundesbehörden nichts.559 Ein dritter Professor für Kirchengeschichte war wie Staehelin an der Ökumene interessiert, hatte aber sonst nur wenig mit ihm gemein: Oscar Cullmann, den ich bereits im Zusammenhang mit der Diskussion über Fritz Buri560 als Nachfolger von Eberhard Vischer erwähnt habe. Cullmann war der Sohn eines Strassburger lutherischen Lehrers. Bis 1925 absolvierte er das Theologiestudium an der protestantischen Theologischen Fakultät der Universität Strasbourg. Diese war die einzige französische Universität, die (zufolge der Sonderstellung des Elsass im französischen Staat nach 1918) die Trennung von Staat und Kirche nicht durchführte und zwei staatliche theologische Fakultäten hatte. 1925 studierte er in Paris an der École Pratique des Hautes Études und an der Sorbonne, während er als Lehrer an der École préparatoire de Théologie/École des Batignolles Paris arbeitete.561 1926 bis 1930 leitete er das Seminar am Thomasstift, das die protestantischen Studierenden der Theologie (Lutheraner und Calvinisten) in Strasbourg beherbergte. 1927 wurde er «Lecteur» an der Universität. 1928 veröffentlichte er «Les problèmes posés par la méthode exégétique de Karl Barth» und 1930 schloss er seine Thèse über Le problème littéraire et historique du roman pseudo-clémentin ab, die als wichtiger Beitrag zur Geschichte des Verhältnisses zwischen Juden und Christen gilt.562 1930 bis 1935 war er Maître de conférences am Lehrstuhl für Neues Testament, ab 1936 lehrte er «Histoire de l’Eglise primitive» im gleichen Rang am Lehrstuhl für Kirchengeschichte.563 La signification de la sainte-cène dans le christianisme primitif erschien 1936. Die Dozenten an der Universität Strasbourg waren in den späten 1930er Jahren zunehmend beunruhigt über die wachsenden Spannungen zwischen den politischen Lagern, aber vor allem über die internationale Situation, denn sie sahen einen deutschen Angriff auf das Elsass kommen. Cullmann gab jedoch das einzige bekannte Beispiel für einen Gelehrten in Strasbourg, der deswegen nicht auf eine Stelle im Innern Frankreichs wechselte, sondern nach Basel ging. Deutlich ist, dass Cullmann keinerlei Sympathien für den Nationalsozialismus hegte, aber in der deutschen Forschung ebenso heimisch war wie in der französischen Wissenschaft und Sprache.564
559 560 561 562 563 564
Briefwechsel zwischen Prorektor Ernst Staehelin und dem Vorsteher des ED Hauser, 9., 17., 22. 10. 1940, in: StABS UA VIII 5, 3 Karl-Ludwig Schmidt. Über Buri berichte ich unter ‚Systematische Theologie‘, Kapitel 4.2.1. Encrevé 1986, 978. Olivier-Utard 2015, 177. Das Werk wird auch zitiert als: Gnosticisme et judéo-christianisme d’après les pseudo-clémentines, ebd., 486. Olivier-Utard 2015, 172. Craig 1984, 323 ff., zu Cullmann: 325.
162
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
Die Möglichkeit, nach Basel zu wechseln, ergab sich für ihn erst im Verlauf des Verfahrens für die Nachfolge Vischer, denn die Basler Fakultät schaute zuerst nach Deutschland, wo sie einen Anhänger der Bekennenden Kirche zu finden hoffte, dessen Karriere durch die Nationalsozialisten behindert wurde. Während die Fakultät im Herbst 1937 Hans Erich Freiherrn von Campenhausen,565 den Patristik- und Lutherforscher Walther von Loewenich566 sowie den Augustin-Spezialisten und Archäologen Erich Dinkler567 – alle waren Deutsche mit einer Nähe zur Bekennenden Kirche – vorgeschlagen hatte, bevorzugten die Sachverständigen der Kuratel ihrerseits von Campenhausen, von Loewenich und Cullmann. Den Namen Cullmann hatte die Fakultät wie erwähnt selbst ins Spiel gebracht, als sie erkannte, dass der Regierung keiner der deutschen Kandidaten willkommen wäre und es nun primär darum gehe, die Berufung eines Schweizer Freisinnigen resp. Liberalen zu verhindern. Die Kuratel beurteilte den Balten von Campenhausen als ein eher «rechtsstehendes» Mitglied der Bekennenden Kirche. Der Kuratelspräsident konstatierte an der Universität eine Vorherrschaft der «Rechtstheologie», womit der Grosse Rat sicher nicht einverstanden sei, denn er wollte die Theologische Fakultät nicht beibehalten, um nur noch «rechte» Theologen zu haben.568 Nachdem die Kuratel im Januar 1938 die Wahl zwischen von Campenhausen oder Cullmann dem Erziehungsrat respektive dem Regierungsrat überlassen hatte,569 argumentierte Hauser am 31. Januar 1938 im Erziehungsrat gegen von Campenhausen; man dürfe deutsche Kandidaten «nicht ohne Not» berücksichtigen. Deshalb bevorzugte er den Elsässer (resp. Franzosen) Cullmann. Ernst Staehelin verteidigte von Campenhausen, dieser sei die bedeutendere Persönlichkeit; damit folgte er Karl Barth. In der Abstimmung erhielt Cullmann die Mehrheit. Anfangs März 1938 lief deswegen eine Kontroverse um die ‚Richtung‘ der 565
566
567
568 569
Hans Erich Freiherr von Campenhausen galt später als bedeutender evangelischer Kirchenhistoriker. Bis 1945 konnte er keinen Lehrstuhl erhalten. https://de.wikipedia.org/ wiki/Hans_von_Campenhausen. Von Loewenich hatte u. a. bei Barth studiert und arbeitete als Studienrat für evangelische Religion an der Lehrerinnenbildungsanstalt in Erlangen, da ihm die Nationalsozialisten eine akademische Karriere verwehrten. Loewenich 1979. Dinkler war Oberassistent in Marburg, Schüler von Walther Köhler und Hans von Soden. 1936 erhielt er einen Lehrauftrag in Marburg. Er gehörte zur Bekennenden Kirche. Merk 2000. StABS Protokoll T 2 Kuratel der Universität Bd. 13, 1935–1941, 231, 12. Sitzung, 15. 10. 1937. StABS Protokoll T 2 Kuratel der Universität Bd. 13, 1935–1941, 251, 2. Sitzung, 6. 1. 1938. Fritz Hauser empfahl Cullmann; der Kuratelspräsident Max Gerwig setzte sich mit dem Doppelvorschlag von Campenhausen und Cullmann «pari loco» durch mit der Begründung, man habe sich zwar bemüht, einen «linkstheologisch gerichteten Vertreter» zu finden, aber es gebe keine geeigneten Kandidaten; also müsse die Verantwortung der Fakultät überlassen bleiben. Dieser Vorschlag kam allerdings erst in der zweiten Sitzung, die die Kuratel dieser Sache widmete, zustande, in: Bd. 13, 255, 3. Sitzung, 13. 1. 1938.
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
163
Professorenkandidaten zwischen Karl Barth und dem liberalen Pfarrer Albert Wolfer in der «National-Zeitung».570 Der Regierungsrat wählte schliesslich Cullmann mit der bekannten, kleinen Konzession an die opponierenden freisinnigen Kirchenkreise, nämlich dem Lehrauftrag für Buri. 1938 bis 1972 war Cullmann Ordinarius für Alte Kirchengeschichte und Neues Testament an der Universität Basel. Er las hier nicht nur über das frühe Christentum, sondern auch über mittelalterliche Kirchengeschichte und – im zeitgeschichtlichen Kontext auffällig – über die Geschichte der Judenverfolgungen.571 In Strasbourg war er auf jeweils fünf Jahre beurlaubt («détaché»), hätte also wieder ins französische Universitätssystem zurückkehren können.572 1941 wurde er in Basel zudem Hausvater des Alumneums und betreute dort zusammen mit seiner Schwester Louise über zweihundert Studenten aus vielen Ländern, darunter auch Flüchtlinge.573 Mit der Basler Église française war er als Mitglied von deren Consistoire verbunden. Nach dem Krieg war er eine führende Persönlichkeit im Dialog mit der katholischen Kirche, 1965 Beobachter am Vatikanischen Konzil und Freund des Papstes Paul VI.574 In seinen Arbeiten am Neuen Testament liess er sich von der Formengeschichte von Bultmann (und von Karl Ludwig Schmidt) leiten, während er theologisch auf einem anderen Boden stand.575 Cullmann wurde vermutlich bei der Wahl nach Basel unterschätzt und nur als Kompromisskandidat gehandelt.576 Cullmanns Wahl war einerseits das Ergebnis des Eingreifens der Politik in die akademische Theologie (gegen die Dominanz der dialektischen Theologie und gegen deutsche Kandidaten), andererseits eine Folge davon, dass die Freisinnigen keine fachlich geeigneten Kandidaten präsentierten. In einer eigenen Kategorie lehrte und forschte Carl Albrecht Bernoulli. Er war auf seine Art gläubig, in manchen Aspekten theologisch liberal, aber durch seine intensive, persönliche und künstlerische Suche dem Liberalismus fremd und ambivalent, auch wenn er sich von rechtsextremen und völkischen Tendenzen distanzierte. Er war in einem ersten Anlauf von 1895 bis 1897 Privatdozent für Kirchengeschichte in Basel gewesen. Unter dem Pseudonym «Ernst Kilchner» publizierte er 1897 den Roman Lukas Heland. Seine Arbeit über Die wissenschaftliche und die kirchliche Methode in der Theologie (ebenfalls 1897) machte jede Aussicht auf eine Professur in einer damaligen theologischen Fakultät zunichte, 570 571 572 573 574 575 576
Kirchenblatt für die reformierte Schweiz, 10. 12. 1936, 396. G. W. (Wieser?) kommentiert den Artikel von Pfr. Wolfer im Protestantenblatt, Nr. 47. Barth 2001, 72–83. «Die Judenverfolgungen im Mittelalter», in: StABS UA AA2 Lektionskataloge/Vorlesungsverzeichnisse Wintersemester 1939/40. Olivier-Utard 2015, 388. Basler Nachrichten vom 13. 4. 1952. Reicke 1972; Wanner 1953; Basler Nachrichten vom 14. 12. 1965. Labhardt 1993. Brändle 2005.
164
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
da er eine Trennung zwischen Theologie und Wissenschaft propagierte. So gab er seine Venia Legendi auf und lebte von 1898 an als Dichter, Journalist und Publizist in Paris, London, Berlin und seit 1906 in Arlesheim. 1922 habilitierte er sich in Basel erneut, diesmal für Religionsgeschichte (Ryhinersches Lektorat, privat finanziert); 1926 beförderten ihn die Behörden zum Extraordinarius. Seine Studien über Overbeck und Nietzsche hatten zu seiner Zeit einen beachtlichen wissenschaftlichen Wert, ebenso wie seine Publikationen zu Johann Jakob Bachofen.577 Als Nietzsche-Forscher war er Schüler von Overbeck und führte einen langjährigen Rechtsstreit mit Elisabeth Förster-Nietzsche, der seine finanzielle Lage schwächte. Als «Religionsforscher» kritisierte er die völkische Bachofen-Renaissance in Deutschland (1924 Johann Jakob Bachofen und das Natursymbol ⇤ ein Würdignungsversuch).578 An der Universität war er immer weniger präsent, da sich sein Gesundheitszustand laufend verschlechterte. Seine Deutung von Jesus zeigte, dass es ihm um seelische Erlebnisse ging, um die «menschliche Empfänglichkeit für eine kosmische Kundgebung». Sein Umfeld bildeten Künstler, Schauspieler, Musiker und Dichter.579 Thematisch gehörte Bernoullis Werk580 in die Suche nach Neuem, Tiefem, Wesentlichem, Irrationalem aus dem Fin-de-Siècle, und seine Neugier galt alternativen religiösen Gedanken (Bô Yin Râ und Rudolf Maria Holzapfel).581 Insofern wollte auch Bernoulli das ‚19. Jahrhundert‘ überwinden.582 Zu Lebzeiten war er ein renommierter Schriftsteller, Dichter und Theaterautor, bekannt etwa durch seinen Tod zu Basel. In der völkischen Schweizer Literaturgeschichte von Josef Nadler583 wurde er zusammen mit Jakob Schaffner, einem seiner Freunde, als beachtenswerter Basler Autor genannt. Er war in vielem nach Deutschland orientiert, konservativ, antidemokratisch, oft rebellisch, aber ein idealistischer Schweizer Patriot und Verfasser von entsprechenden Festspielen sowie einer Nationalhymne. Die deutsch577 578 579 580
581 582 583
Peter 2009. «Carl Albrecht Bernoulli †» (NZZ vom 14. 2. 1937). Bernoulli 1987. Verzeichnis der Werke und Weg zum Nachlass in: NL 4 in der Handschriftenabteilung der Basler Universitätsbibliothek http://www.ub.unibas.ch/cmsdata/spezialkataloge/bla/ bernoulli_carl_albrecht.html. Findbuch http://www.ub.unibas.ch/digi/a100/kataloge/nach lassverzeichnisse/IBB_5_000006245_cat.pdf. Knuchel 1937 (nur mit «EFK» gezeichnet). Bô Yin Râ (Joseph Anton Schneiderfranken): www.bo-yin-ra.ch. Holzapfel: siehe das Kapitel über Portmann, unten. Vgl. auch Anonym 1937. Staehelin 1933a besprach Josef Nadlers Literaturgeschichte der deutschen Schweiz insgesamt lobend. Er vermisste zwar «klare Konkretheit», war aber begeistert von diesem Buch, das «einen überaus wertvollen uns innerlich ergreifenden und bereichernden Blick in die Geistesgeschichte unseres Volkes» vermittle. «Und es kann nur von Segen sein, wenn wir durch es neuen Zugang auch zu diesem Ringen unseres Volkes gewinnen». Dabei zitierte er die Passage, die Carl Albrecht Bernoulli zusammen mit Jakob Schaffner als grosse Basler Autoren rühmte.
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
165
freundliche «Neue Basler Zeitung» würdigte ihn als Visionär mit «mächtigen Ausbrüchen» und lobte den gewaltigen Ausdruck für die Vaterlandsliebe in seiner Schweizer Nationalhymne, «uns durchbraust ein Feuerbrand / Deine Ehre, Vaterland».584 4.2.3 Altes Testament Walter Baumgartner, ein Zürcher mit Glarner Wurzeln,585 war der Inhaber des gesetzlichen Lehrstuhls für Altes Testament in Basel. Er studierte Geschichte, klassische und altorientalische Philologie in Zürich (Doktorat 1912), bildete sich dann in Gießen und Marburg als Theologe aus (Habilitation 1916 bei Hermann Gunkel) und erwarb 1917 das Lizentiat in Theologie. In Gießen wurde er 1920 Extraordinarius und 1928 Ordinarius. Dort handelte er sich Probleme mit rechtsextremen Studenten ein, die in seiner Darstellung des Codex Hammurabi antimonarchische Anspielungen entdeckten.586 Als Schweizer Demokrat hatte er den Wunsch, auf einen Lehrstuhl in der Heimat zu wechseln, der 1929 in Erfüllung ging, als er in Basel Nachfolger von Bernhard Duhm587 für Altes Testament, allgemeine Religionsgeschichte und semitische Sprachen wurde. Diese Professur behielt er bis 1958.588 Baumgartner gehörte zu den liberalen Theologen des ‚19. Jahrhunderts‘. Als solcher nahm er an den Tagungen der «freigesinnten Theologen» teil. Statt zu eigentlich theologischen Themen publizierte er lieber zu Fragen der Komparatistik, zu hebräischer und aramäischer Philologie, zu Religionsgeschichte, aber auch über Sagen und Märchen. Regelmässig informierte er die Leser der «Neuen Zürcher Zeitung» über die Fortschritte seiner Wissenschaft. Das volkskundliche Interesse verband ihn mit Karl Meuli, den er zusammen mit dem Orientalisten Rudolf Tschudi zu einem regelmässigen Gedankenaustausch traf. «Sein Hauptwerk bilden die ersten beiden Bände des von Ludwig Köhler begründeten ‚Hebräischen und aramäischen Lexikons zum Alten Testament‘ […], zu dessen 2. Auflage er den aramäischen Teil (1953) und ein Supplement (1958) beigesteuert hat.»589 Baumgartners Überblick über die alttestamentliche und die orientalistische Forschung war umfassend, seine Gelehrsamkeit stupend. Als Lehrer war Baumgartner dementsprechend anspruchsvoll. Dieser «Histori584 585 586 587 588 589
Neue Basler Zeitung vom 15. 2. 1937. Felix Möschlin sprach in ähnlichem Sinn an der Gedenkfeier für Bernoulli im Stadttheater, National-Zeitung vom 19. 4. 1937. Smend 2017a, 708–728. Bremi 1957. Smend 2017a, 357–371. Duhm war am 1. 9. 1928 bei einem Verkehrsunfall verstorben. Baumgartners Nachlass liegt in der Universitätsbibliothek Basel, ist aber «unsigniert». Mathys 2004. Eine Bibliographie der Werke Baumgartners aus seiner Basler Zeit: https:// theologie.unibas.ch/fileadmin/user_upload/theologie/06_Fachbereiche/1_Theologische_ Fachbereiche/1_Altes_Testament/Baumgartner_biblio_semit_2.pdf.
166
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
ker, Ästhet und fromme Christ» war unzweifelhaft einer der hervorragenden Alttestamentler im deutschen Sprachraum.590 1941 setzte er sich in einem Zürcher Vortrag explizit mit Barths Auslegung des Alten Testaments auseinander. Er sah darin einen Übergriff der Dogmatik in die Exegese und mahnte eine strikte Orientierung an den Texten an. Barth folgerte daraus, dass Baumgartner eben kein Theologe sei, was aber eine gegenseitige Wertschätzung nicht verhinderte.591 Baumgartner lehnte Wilhelm Vischers von Barth inspirierte Exegesen rundweg als unwissenschaftlich ab und gab (zusammen mit Eichrodt) 1936 «starke Bedenken» gegen Vischers Habilitation in der Basler Fakultät (siehe unten) zu Protokoll. Baumgartner war bestimmt kein Freund des Nationalsozialismus. So organisierte er eine Unterstützungsaktion für Martin Rade (Marburg, linksliberaler Verteidiger der Weimarer Republik, Schwager und politischer Anhänger von Friedrich Naumann, «Kulturprotestant»), der – obschon bereits emeritiert – als Kritiker des Nationalsozialismus formell entlassen wurde und nur noch 45 Prozent seiner Pension erhielt.592 Dessen Sohn Gottfried emigrierte 1933 in die Schweiz und wurde Pfarrer in Chur. Neben Baumgartner unterrichtete Walther Eichrodt593 Altes Testament. War Baumgartner der philologisch-strenge Exegetiker mit liberalem Hintergrund, so lag Eichrodts Bedeutung darin, dass er eine antimoderne Dogmatik des Alten Testaments schrieb. Eichrodt habilitierte sich 1918 in Erlangen. 1922 bis 1934 lehrte er als Extraordinarius in Basel auf der zweiten «positiven» Stiftungsprofessur, bezahlt von der Karl Sarasin-Stiftung. 1934 wurde er zum Ordinarius befördert. Bis 1960/1961 war er in dieser Position Professor für Altes Testament und Religionsgeschichte. Er war im Sinne der ‚Positiven‘ in der Basler Missionsgesellschaft, in der Basler Synode, in der Christlichen Studentenvereinigung, im Vorstand der Elisabethen-Gemeinde und im Evangelisch-kirchlichen Verein präsent.594 1939 erhielt er das Basler Bürgerrecht, war also offensichtlich gut integriert. Im englischen Sprachraum gilt er als wichtiger Theologe, der mit der historistischen Auffassung des Alten Testaments gründlich aufräumte. Statt darin nach «Entwicklungen» zu suchen, fragte er nach Querverbindungen zwischen den Büchern und rekonstruierte eine Theologie der Beziehung zwischen Gott und Mensch als strukturierte und strukturierende Einheit, in deren Mittelpunkt der «Bund» Gottes mit Israel stand. So erscheint Eichrodt als eine Barth gewis590 591 592
593 594
Werk: Lessing 2004, 164–167. Smend 1996, 53–69. Thurneysen an Barth, 16. 3. 1934, in: Barth/Thurneysen 2000, 620–625, Rade und Baumgartner 622. Thurneysen betrachtete Baumgartner als einen der «Harmlosen». Kaiser 2014, 186 f. Willi 2004. Kapahu 2016, 367–386; Gottwald 1970, 23–62; Anonym 1950.
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
167
sermassen vergleichbare Gestalt für das Alte Testament, ein «Neo-Orthodoxer». Wie Barth insistierte er darauf, dass die Bibel keine vermenschlichende Auffassung zulasse. Wie dieser kritisierte er Aufklärung und ‚19. Jahrhundert‘.595 Seine Systematik der Theologie des Alten Testaments (erschienen 1933–1939) erlangte Weltgeltung.596 1934, aber nur in diesem Jahr, nahm Eichrodt am Professorentreffen Basel-Freiburg i. Br. in Badenweiler teil.597 Ich nehme an, dass er danach auf Distanz zu der nazifizierten Freiburger Universität ging. Über Aktivitäten zugunsten von Flüchtlingen und eine fundamentale Kritik des Nationalsozialismus ist mir nichts bekannt geworden. Zu den Basler Alttestamentlern gehörte auch der schon erwähnte Wilhelm (Helmi) Vischer.598 Vischer hatte sich in seiner Jugend für soziale Gerechtigkeit engagiert, dann mit Fritz Lieb die russischen Revolutionen mit grosser Anteilnahme verfolgt. Sein Studium führte ihn nach Lausanne, Basel und Marburg. Er heiratete Maria, eine Schwester von Ernst Staehelin. Die Begeisterung für das Alte Testament vermittelte ihm Albrecht Alt in Jerusalem 1924. 1927 begründete er in einem Vortrag in Zürich seine fortan feststehende Überzeugung, dass Christus durchgehend auch vom Alten Testament bezeugt werde, das als Ganzes Gottes Wort sei und nicht durch philologisch-historische Kritik oder liberale Umdeutung selektiv wahrgenommen werden dürfe. Das Alte Testament verstand er vom Neuen Testament her, «so wie es die urchristliche Gemeinde gelesen hat». Seine künstlerische Auffassungsgabe erlaubte ihm auch die Nachdichtung von Psalmen.599 Nach einer Zeit als Pfarrer in Tenniken (1918 bis 1928) wurde der Sohn des Basler liberalen Neutestamentlers Eberhard Vischer 1928 Dozent für Hebräisch, Bibelkunde und Altes Testament an der Theologischen Schule Bethel. Der ausserordentlich beliebte Dozent pflegte regelmässige Kontakte zu Barth, als der in Bonn lehrte. Barth war seit 1921 eine zentrale Gestalt für Vischers Theologie.600 Vischer hielt im Mai/Juni 1933 zum bald durch Ludwig Müller ersetzten Reichsbischof Friedrich von Bodelschwingh, der seit 1910 Leiter der Bodelschwinghschen Anstalten Bethel gewesen war. Dort wurde Vischer 1934 wegen seiner konsequenten Ablehnung des Nationalsozialismus, seiner christlich-sozialen Position und der Opposition gegen die antisemitische Theologie der Deutschen Christen zuerst von Studenten boykottiert, dann (am 20. Mai 1933) beurlaubt und 595
596 597 598 599 600
McKim 1998. Dass Eichrodt nicht zum Umfeld von Karl Barth gehörte, ist eindeutig. Thurneysen stellte sich vor, dass Wilhelm Vischer die Professur von Eichrodt übernehmen könnte. Thurneysen an Barth, 23. 5. 1935, in: Barth/Thurneysen 2000, 886–889. Die Encyclopedia Britannica enthält einen Artikel über ihn. UA Freiburg i. Br., B0001 317 Ohne Umschlagtitel, Inhalt Treffen Basel-Freiburg, ab 1924. Smend 2017a, 770–793. Pfr. G. Wieser (Wieser 1965). Thurneysen 1965.
168
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
schliesslich am 19. Mai 1934 entlassen. Es war ihm verboten zu predigen, Vorlesungen zu halten oder anderweitig in Deutschland öffentlich zu wirken.601 Vischer nutzte diese Zeit, um sein Hauptwerk zu beginnen: Das Christuszeugnis des Alten Testaments. Nachdem eine Berufung an die geplante Elberfelder Kirchliche Hochschule für reformatorische Theologie gescheitert war und sich Hoffnungen auf Lehrstühle in Zürich oder Basel zerschlagen hatten, versah er in Lugano eine Pfarrstelle, bis er 1936 in Basel als Nachfolger von Rudolf Handmann (siehe unten) Pfarrer zu St. Jakob wurde. Nach der Rückkehr nach Basel war Vischer der Begleiter von Barth bei dessen Ausritten.602 Vischer wurde 1940 zusammen mit Barth und anderen (darunter Fritz Lieb) Mitglied der am 7. September 1940 in Olten gegründeten Aktion nationaler Widerstand.603 Weil der «mitreissende Lehrer»604 in der Schweiz keine adäquate akademische Position fand, übernahm er 1947 durch Vermittlung Cullmanns eine Professur für Altes Testament an der protestantischen Fakultät in Montpellier.605 Vischer war Mitgründer des Schweizerischen Evangelischen Hilfswerks für die Bekennende Kirche in Deutschland.606 Vorübergehend war er Mitglied und ab 1937 auch Präsident des Vereins der Freunde Israels, ein Amt, das er «1938 aus Protest gegen eine feige und anpasserische Haltung nieder[legte], die ihm nicht genug für die Juden (und Karl Barth) einzustehen wagte».607 Barth war als Prediger für das Missionsfest eingeladen und dann wieder ‚ausgeladen‘ worden mit der Begründung, die deutschen Mitglieder der Mission könnten in ihrem Heimatland Nachteile erleiden, wenn sie an einer Basler Versammlung teilnähmen, an der Barth eine prominente Rolle spielte (siehe dazu unten zu Hartenstein). Wilhelm Vischer präsidierte auch die Schweizerische Zentralstelle für Flüchtlingshilfe von 1936 bis 1938.608 Er war seit Herbst 1938 Präsident der Subkommission für ‚Judenchristen‘ des schweizerischen Hilfswerks für die Bekennende Kirche.609 Dieses Hilfswerk brachte 1938 (noch vor der ‚Kristallnacht‘ verfasst) ein Memorandum mit dem Titel Das Heil kommt von den Juden heraus. Darin wurde die Frage der ‚Judenchristen‘ erstmals im Kontext «des Judenproblems» angesprochen. Das 601 602 603 604 605 606
607 608 609
Neue Basler Zeitung vom 15. 5. 1934. Busch 1975, 117, 284. Tietz 2019, 306; Tanner 2015, 261; Gautschi 1989, 347 ff.; Busch 1975, 321. Anonym 1955. Aerne 2014. Die dort behauptete «Ausweisung» aus Deutschland konnte ich nicht verifizieren. Siehe auch Seifert, https://personenlexikon.bl.ch/Wilhelm_Vischer. 1937 entstand das Bekenntnis-Pfarrer-Familien-Hilfswerk auf Initiative von Paul Vogt. Seit Frühjahr 1938 hiess die Organisation Schweizerisches evangelisches Hilfswerk für die Bekennende Kirche in Deutschland; es veranstaltete von 1938 bis 1942 jährliche Tagungen in Zürich-Wipkingen. Tietz 2019, 294 f. Willi 1985. Kocher 1996, 361. Kocher 1996, 112.
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
169
von Ernst Hurter, Karl Barth, Oskar Farner, Gottfried Ludwig und Wilhelm Vischer unterzeichnete Memorandum verfasste Vischer. Im Zeitkontext leistete es einen wesentlichen Beitrag zur Bewusstwerdung unter den Protestanten, dass das Schicksal der Juden sie etwas anging, auch wenn aus späterer Sicht die Verwurzelung in herkömmlichen christlichen Anschauungen offensichtlich und damit problematisch erscheint.610 Verglichen mit der auch in der Schweiz verbreiteten Ablehnung der ‚Judenchristen‘, die im Verdacht standen, nur wegen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Vorteile zum Christentum übergetreten zu sein,611 war Vischer progressiv. Erst recht fühlten sich viele Schweizer Christen für die Unterstützung derjenigen Juden, die nicht zum Christentum übergetreten waren, ‚nicht zuständig‘. Zusammen mit dem Gedanken, dass der Flüchtling (d. h. in vielen Fällen der Jude) der «Nächste» sei, dem zu helfen bedeute, Christus nachzufolgen, war Vischers theologische Begründung der Rolle des Judentums im Christentum ein Ausgangspunkt. 4.2.4 Neues Testament Als Neutestamentler lehrte auch Eberhard Vischer, wie wir schon gesehen haben. In diesem Abschnitt stelle ich jedoch diejenigen Professoren vor, die ausschliesslich oder hauptsächlich dieses Fach betreuten. Karl (Gerold) Goetz studierte in Basel, wo er sich der Zofingia anschloss, ab 1886 in Göttingen bei Albrecht Ritschl und Hermann Schultz, dann in Berlin und Marburg. Dort absolvierte er das theologische Lizentiat 1888 bei Adolf von Harnack, dem er sich stets verpflichtet fühlte. Von 1888 bis 1892 war er Pfarrer der deutschen evangelischen Gemeinde Smyrna, die er verliess, weil sich Probleme aus einer angeblich unpatriotischen Bemerkung anlässlich des Geburtstags des Kaisers ergaben. 1897 habilitierte er sich an der Universität Basel. Neben der Privatdozentur war er von 1898 bis 1903 Pfarrhelfer in Binningen. 1915 wurde er zum Extraordinarius befördert und 1917 als Nachfolger für den liberalen Paul Wilhelm Schmidt612 zum Ordinarius für Neues Testament gewählt. Diese Aufgabe erfüllte er bis 1935. 1918 bis 1942 war er Mitglied der Kirchensynode. Goetz lässt sich der liberalen, kritisch-historischen Richtung zuweisen. Er schrieb über Cyprian von Karthago, das Leben Jesu und das Abendmahl. Letzteres fasste er symbolisch auf (Jesus habe beim Abendmahl den Jüngern nur bildlich zu verstehen gegeben, seine Person sei deren geistige Speise) und er zweifelte daran, dass sich Jesus selbst als Messias bezeichnet habe.613 Er war bestrebt, den «historischen Christus» aus den Dokumenten herauszuschälen. In diesem Sinne 610 611 612 613
Kocher 1996, 113–116. Kocher 1996, 59. Wolfes 2007. Raith 2005.
170
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
lehrte er auch an der Volkshochschule. Dabei verstand er sich als aufrichtiger Christ und Kirchenmann,614 wie sein Nachfolger Karl Ludwig Schmidt bei der Abdankung bezeugte. Goetz sei kein christlich verbrämter Stoiker gewesen, sondern habe über eine gewisse Zuversicht für das verfügt, was man hoffe, und nicht gezweifelt an dem, was man nicht sehe.615 Diese sorgfältig gewählten und sicher ernstgemeinten Worte sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass Goetz bei seinem Tode 1944 als tief im ‚19. Jahrhundert‘ verwurzelter Liberaler galt, dessen Position schon bei seinem Rücktritt 1935 überholt gewesen sei. Der in Bonn 1933 aus politischen Gründen entlassene und in die Schweiz geflüchtete Karl Ludwig Schmidt616 wurde in Basel Nachfolger von Goetz. Goetz sass zusammen mit Eberhard Vischer in der Sachverständigenkommission der Kuratel für seine eigene Nachfolge, wie damals üblich. Diese Kommission hatte jedoch eine beschränkte Funktion, da das Erziehungsdepartement fest auf die Wahl von Schmidt zusteuerte und von der Regierung zu Verhandlungen mit ihm ermächtigt war, bevor die Sachverständigen überhaupt zusammentraten.617 Mit Schmidt kam ein führender Neutestamentler auf Goetzens Lehrstuhl, der sich für die deutsche Bekenntniskirche engagierte, gläubig auf dem Boden der Evangelien stand, eine positive Theologie mit klaren, bahnbrechenden philologischen Analysen und formengeschichtlichen Untersuchungen der Evangelien verband und trotz aller Differenzen im Glauben Karl Barth nahestand, den er 1930 selbst nach Bonn geholt hatte. Karl Ludwig Schmidt verbrachte seine Kindheit in Frankfurt am Main in einfachen Verhältnissen. Das Frankfurter Umfeld machte Schmidt immun gegen den Wilhelminismus und die Kriegsbegeisterung von 1914.618 Er begann 1909 mit dem Studium der klassischen Philologie, wechselte dann zur Theologie an den Universitäten Marburg und Berlin. 1910 lernte er dort bei Friedrich Delitzsch Syrisch und Aramäisch; dabei schloss er mit dem Basler Mitstudenten Ernst Staehelin Bekanntschaft.619 Bei Karl Holl entwickelte er seinen Ansatz zur Untersuchung der Evangelien. Von Holl war er vermutlich auch theologisch beeinflusst: Holl wandte sich vom liberalen Lutherbild ab und der Vorstellung eines von Gott entfremdeten Menschen zu, der der Gnade des Evangeliums bedürfe. Dies lässt sich in der Rezeption durch Schmidt als Bruch mit dem ‚19. Jahrhundert‘ verstehen. Trotzdem schätzte er Harnack sehr; er arbeitete als ‚Senior‘ in dessen Semi614 615 616 617
618 619
Anonym 1944. Basler Nachrichten vom 23. 5. 1944. Würdigung durch Oscar Cullmann 1956 (Cullmann 1966, 675–682). Kuratel an die für die Sachverständigenkommission vorgesehenen Herren, 6. 9. 1934, in: StABS UA VIII 5,3 Karl-Ludwig Schmidt. Die Kommission bestand aus Christian Buchmann als Präsident, Eberhard Vischer, Carl Götz und den Pfarrern Rudolf Handmann sowie Jakob Täschler. Mühling 1997, 8. Mühling 1997, 10.
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
171
nar. Sein wichtigster Lehrer und Freund wurde aber Adolf Deissmann, der ihn überzeugte, dass er die wissenschaftliche Laufbahn einschlagen sollte. 1913 legte Schmidt das Lizentiatsexamen ab mit einer Arbeit über das Johannesevangelium.620 Im Krieg wurde er 1915 schwer verwundet.621 1918 heiratete er Ursula von Wengern. Unter dem Einfluss seiner liberal denkenden Frau näherte sich Schmidt der DDP an, der er bis 1920 angehörte. Als Privatdozent verkehrte er im sozial interessierten Freundeskreis um Paul Tillich.622 Schmidt verteidigte die Weimarer Verfassung ab 1924 als Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. In der Weimarer Republik erkannte er die «rechte Obrigkeit», für die er als Christ und Bürger einstand.623 1918 hatte er sich mit der Arbeit Der Rahmen der Geschichte Jesu habilitiert, seinem wichtigsten Werk, das ihn zu einem Begründer der an «Formen» orientierten Analyse der Schriften des Neuen Testaments («Formengeschichte») machte.624 Dieser Ansatz verstand die Evangelien nicht als historiographische Dokumente, sondern als Anleitungen zur Verehrung von Jesus Christus. 1921 wurde er Ordinarius für Neues Testament an der Universität Gießen. Von diesem Jahr an beschäftigte er sich mit dem Werk von Karl Barth; daraus entstand zunächst eine Kooperation.625 1925 wechselte er nach Jena, und 1929 erhielt er einen Ruf nach Bonn. Er machte die Annahme des Rufs davon abhängig, dass auch Barth nach Bonn geholt werde. Er meinte, dass dann Friedrich Gogarten Nachfolger von Barth in Münster werden könne, da er diesen damals für förderungswürdig hielt. Schmidt war später wie Barth enttäuscht über den Weg, den Gogarten in den 1930er Jahren einschlug.626 Schmidt wirkte in Jena und in Bonn als ‚Fakultätspolitiker‘, der einen direkten Draht zum Ministerium pflegte und Personalentscheide beeinflusste.627 Als Mensch umgänglich und freundlich, war er als Verfasser von Buchbesprechungen gefürchtet. Mit den «Theologischen Blättern» schuf er sich eine eigene Plattform, auf der er über die Entwicklungen im Fach berichtete und richtete.628 Früh und konsequent bekämpfte er den Einfluss nationalistischer und nationalsozialistischer Kräfte an den deutschen Universitäten und vertrat die Ansicht, dass von Konservativen und Nationalsozialisten angegriffenen Kollegen, die den Krieg 620 621 622 623 624
625 626 627 628
Mühling 1997, 11–13. Mühling 1997, 15–18. Mühling 1997, 28. Mühling 1997, 31, 51. Mühling 1997, 21. Zum Diskussionsstand über die «Formengeschichte» in den 1920er Jahren siehe Cullmanns Aufsatz: «Die neueren Arbeiten zur Geschichte der Evangelientradition» (1925) (Cullmann 1966, 41–89). Mühling 1997, 48–50. Auch Barth wünschte sich 1930 Gogarten zu seinem Nachfolger in Münster, den er seit 1921 als einen Verbündeten ansah. Tietz 2019, 157 ff., 169, 247 f. Mühling 1997, 62–63. Mühling 1997, 34, 46, 99.
172
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
1914–18 nicht verherrlichten und für Frieden und Völkerverständigung eintraten, solidarisch geholfen werden müsse. So verteidigte er seit 1931 Günther Dehn, der 1928 die Dolchstosslegende und die Gleichsetzung des Todes fürs Vaterland mit Christi Opfertod öffentlich kritisiert hatte, gegen Denunziationen durch Nazistudenten.629 Dass ihm Barth in solchen Aktionen nicht bedingungslos folgte, schuf ein gewisses Misstrauen zwischen den beiden Theologen.630 Im Unterschied zu Barth übernahm Schmidt auch unmittelbare politische Verantwortung: Er liess sich im Februar 1933 auf der SPD-Liste für den Bonner Stadtrat aufstellen und wurde am 12. März 1933 gewählt. Am 24. April demissionierte er, nachdem die Nationalsozialisten den gewählten Oberbürgermeister abgesetzt hatten. Schmidt verliess die im Sommersemester 1933 bereits nazifizierte Bonner Fakultät auf dem Weg über ein Urlaubsgesuch. Dies genügte allerdings seinen Gegnern, namentlich den Studenten, nicht; sie verlangten, dass er sich in der Stadt Bonn nicht mehr blicken lasse. Auch die Rheinische Kirche strich ihn von der Liste der theologischen Examinatoren. Seine Entlassung als Professor wurde am 15. September 1933 vollzogen. Schmidt löste den Bonner Haushalt auf, seine Familie wurde verstreut in Deutschland untergebracht. Am 4. November 1933 verliess er allein das Land, um in Bern einen Vortrag zu halten. Danach kehrte er nicht mehr nach Deutschland zurück.631 Als die «Basler Nachrichten» am 25. September 1933 berichteten, dass Schmidt entlassen worden sei, verband die Zeitung damit ein grosses Lob für seine wissenschaftliche Leistung und vermutete, hinter seiner Entlassung stünden die Deutschen Christen.632 Schmidt suchte ab Jahresbeginn 1934 eine Anstellung in Basel. Am 10. Februar 1934 wies die Fakultät den Chef des Erziehungsdepartements, Fritz Hauser, offiziell auf Schmidt hin und schlug vor, die günstige Gelegenheit zu «benützen», um ihn für Basel zu gewinnen, zumal der Lehrstuhl für Neues Testament von Goetz nächstens neu zu besetzen sein werde. Die Fakultät beantragte zunächst einmal einen Lehrauftrag mit einer Remuneration, die zusammen mit der kleinen deutschen Pension (die für ihn aber von der Schweiz aus unerreichbar war) für das Leben mit seiner Familie in der Schweiz ausreichen sollte. Zugleich stellten Studenten der Fachschaft das Gesuch, Schmidt in Basel zu beschäftigen.633 Am 28. Mai 1934 empfahl der Erziehungsrat der Regierung, ihm einen Lehrauftrag für ein Jahr zu erteilen unter der Voraussetzung, dass die Freiwillige Akademische Gesellschaft diesen finanziere und der Lehrstuhlinhaber 629 630 631 632 633
Tietz 2019, 216 ff.; Mühling 1997, 99–103; Meier 1996, 12–16; Jansen 1981, 56–59. Barth an Thurneysen, 16. 10. 1933, in: Barth/Thurneysen 2000, 512–524. Mühling 1997, 145–164. Barth an Thurneysen, 12. 9. 1933, in: Barth/Thurneysen 2000, 500–503, relevante Passage: 501. Dekan der Theologischen Fakultät an Fritz Hauser, 10. 2. 1934, in: StABS UA VIII 5, 3 Karl-Ludwig Schmidt.
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
173
Goetz einverstanden sei.634 Im Juli war das Erziehungsdepartement bereit, den Lehrauftrag zu erteilen. Es wollte darüber hinaus sogleich für ihn eine Professorenstelle vorsehen, dazu müsse jedoch aus formalen Gründen eine Sachverständigenkommission der Kuratel eingesetzt werden, und die Fakultät müsse für diese einen Bericht über Schmidt verfassen.635 Nach der Sommerpause, im September 1934, wurde die Sachverständigenkommission aktiv. Deren Präsident, Christian Buchmann, forderte die Fakultät auf, in ihrem Bericht neben Schmidt noch andere deutsche Professoren zu berücksichtigen.636 Daraufhin berichtete die Fakultät Buchmann, dass der in Aussicht genommene Lehrauftrag für Schmidt überflüssig geworden sei, weil er im Toggenburg eine Anstellung gefunden habe.637 Danach ruhten die Geschäfte wieder bis Frühjahr 1935.638 Schmidt traute der Basler Fakultät nicht. So entstand die Situation, dass er die Vertretung (Verweserstelle) in einer Toggenburger Pfarrei annahm, während man ihm in Basel einen Lehrauftrag zuhalten wollte. Freunde Barths kritisierten, dass sich Schmidt allzu energisch selbst um eine neue Situation bemühe, er sei zu betriebsam, um in Basel wirklich Erfolg zu haben.639 Schweizer Theologen wussten, wer er war, und sie unterstützten ihn, wie man einen Flüchtling unterstützt: Er wurde in Pfarrhäusern als Gast aufgenommen. Am 11. Februar 1934 erhielt er die Ordination der basellandschaftlichen Kirche, was die Voraussetzung für die Übernahme eines Pfarramtes schuf.640 Im Mai 1934 zeitigte die Stellensuche einen ersten Erfolg: Die Gemeinde Zürich-Seebach stellte ihn auf vier Monate als Verweser an, eine schlecht bezahlte Aufgabe, in der sich aber Schmidt als Gemeindepfarrer und Prediger sehr gut bewährte. Anfang November 1934 trat er die erwähnte Verweserstelle in Lichtensteig (Toggenburg) auf ein Jahr an. Daneben arbeitete er wissenschaftlich weiter und behielt die Redaktion der «Theologischen Blätter» in seiner Hand, eine enorme Leistung.641
634 635 636 637 638 639 640
641
StABS Protokoll Erziehungsrat Bd. 23, 1934–1936, 28. 5. 1934. Hauser an Theologische Fakultät, 6. 7. 1934; Theologische Fakultät an Hauser 9. 7. 1934, in: StABS UA VIII 5, 3 Karl-Ludwig Schmidt. Chr. Buchmann (für die Expertenkommission) an die Fakultät, 22. 9. 1934, in: StABS UA VIII 5, 3 Karl-Ludwig Schmidt. Dekan der Theologischen Fakultät an Chr. Buchmann, 30. 10. 1934, in: StABS UA VIII 5, 3 Karl-Ludwig Schmidt. Ernst Thalmann (für die Kuratel) an Expertenkommission, 5. 3. 1935, in: StABS UA VIII 5, 3 Karl-Ludwig Schmidt. Thurneysen an Barth, 16. 3. 1934, in: Barth/Thurneysen 2000, 620–625. Thurneysen hatte im Februar 1934 Dehn und Schmidt zu Besuch, die Pfarrstellen in der Schweiz suchten, «während Nullen wie Wendland und Goetz ihnen bei uns die Plätze versperren». Für Schmidt sehe es nicht gut aus, es sei vielleicht zu viel für ihn versucht worden. Thurneysen an Barth, 14. 2. 1934, in: Barth/Thurneysen 2000, 595–601. Mühling 1997, 166–171.
174
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
Das Basler Erziehungsdepartement war entschlossen, Schmidt eine Professur zu verschaffen, allerdings nur im Rahmen einer verfügbaren Stelle, während die Fakultät bloss an einen Lehrauftrag gedacht hatte. Nun manifestierte sich Widerstand gegen den weitergehenden Plan des Departements. Goetz, dessen Stelle aufgrund seines Alters bald freiwerden und die Schmidt übernehmen sollte, weigerte sich, frühzeitig gegenüber dem Erziehungsdepartement ein bestimmtes Rücktrittsdatum zu nennen, und gab erst am 20. Februar 1935 seien Rücktritt auf den Anfang des Wintersemesters 1935/36 bekannt.642 Schmidts Gegner in der Fakultät (neben Goetz lässt sich Carl Albrecht Bernoulli diesen zuordnen) hatten dadurch Zeit gewonnen, um Argumente gegen ihn aufzubauen. Nicht nur deuteten sie unmissverständlich an, dass sie ihn für einen Intriganten hielten, den sie nicht zum Kollegen wünschten.643 Sie unterstrichen auch, dass inzwischen noch weitere deutsche Theologen entlassen worden seien oder von Entlassung bedroht würden, darunter angeblich Bultmann und Dibelius (diese waren gar nicht an einem Wechsel nach Basel interessiert), die sie lieber in der Fakultät begrüsst hätten.644 Am 5. April 1935 legte die Fakultät der Kuratelskommission ihr Gutachten vor. Es begann mit der negativen Beurteilung von möglichen Schweizer Kandidaten. Der Religiös-Soziale Rudolf Liechtenhan645 sei zu alt und bereits 1930 in Bern zwar auf den ersten Listenplatz gesetzt, aber von der Regierung aus politischen Gründen abgelehnt worden. Hugo (Helmut) Huber, Pfarrer in Leissigen und Privatdozent in Bern,646 komme wegen wissenschaftlicher und didaktischer Mängel nicht infrage. Die Mehrheit der Fakultät könne Schmidt wegen seiner «universi642
643
644
645 646
Hauser an Goetz, 18. 8. 1934; Goetz an Hauser, 22. 8. 1934, in: StABS Erziehung Y 7 Theologische Fakultät Professur und Lectorat für neutestamentliche Theologie 1816–1935. Protokoll Erziehungsrat, 3. 9. 1934. StABS UA O 2b 1924–1946 Protokollbuch der Theologischen Fakultät 1924–1946, Theologische Fakultät, 4. Sitzung, 9. 5. 1934. C. A. Bernoulli protestierte nachträglich gegen den Fakultätsbeschluss, dass Schmidt einen Lehrauftrag erhalten solle; er möchte ihn nur habilitieren lassen. Thurneysen an Barth, 20. 5. 1935, in: Barth/Thurneysen 2000, 883–886 (hier wurden die Vorbehalte gegen Schmidts fakultätstaktische Verhaltensweisen in Deutschland referiert, siehe auch Mühling 1997, 172). Die einen wünschten ihr Erstaunen über das Vorgehen der Regierung auszudrücken [d. h. sie waren nicht damit einverstanden, dass die Regierung dem ED freie Hand gegeben hatte für Verhandlungen mit Schmidt für die Übernahme eines Lehrstuhls], die andern wollten feststellen, dass die Fakultät nur einen Lehrauftrag für Schmidt beantragt hatte, keine Professur, allerdings in der Meinung, auf Dauer eine wertvolle Kraft für Basel zu sichern. Der Dekan erklärte, dass die Regierung Schmidt keinen Lehrauftrag erteilen werde im Fall, dass seine Berufung auf den neutestamentlichen Lehrstuhl nicht zustande käme. Der Gedanke einiger Fakultätsmitglieder, ganz darauf zu verzichten, den neutestamentlichen Lehrstuhl zu besetzen, fand keine Mehrheit. StABS UA O 2b 1924–1946 Protokollbuch der Theologischen Fakultät 1924–1946, Theologische Fakultät 14. 9. 1934. Über ihn unten mehr. https://www.literapedia-bern.ch/Huber,_Hugo_Helmut.
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
175
tätspolitischen Betätigung in Deutschland» nicht an erster Stelle vorschlagen. Martin (Franz) Dibelius (Heidelberg)647 wäre hingegen eine «ausserordentliche Bereicherung» für Basel. Von den Jüngeren komme am ehesten «noch» Heinrich Schlier (Marburg)648 in Betracht, aber die Fakultät trage Bedenken, einen jungen Deutschen zu berufen, der dann den Schweizern die akademische Laufbahn auf Jahrzehnte blockieren würde, weil er nicht mehr nach Deutschland zurückkehren könnte. Mit sechs Stimmen einigte sich die Fakultät auf folgenden Listenvorschlag: 1o loco Dibelius, 2o loco Schmidt, 3o loco Schlier. Eine Minderheit (zwei Stimmen) wollte 1o et pari loco Dibelius und Schmidt, 2o loco Schlier setzen.649 Ernst Staehelin, damals Dekan, hatte in seinem Entwurf des Gutachtens folgende Liste vorgeschlagen: 1o et pari loco Dibelius, Schlier, Schmidt. 2o et unico loco: Werner Georg Kümmel (Zürich). Entweder wollte er sich nicht eindeutig für Schmidt einsetzen, oder er hielt es taktisch für klüger, Schmidts Namen mit der Nennung von Dibelius und Schlier gewissermassen in Deckung zu halten in der Erwartung, dass die Kuratel dann Schmidt allein berücksichtigen werde.650 In der Kuratel wehte ein anderer Wind als in der Fakultät. Sie setzte Schmidt am 20. Mai 1935 auf den ersten Listenplatz. Schmidts grosse Leistungen wurden gewürdigt und darauf hingewiesen, dass er aus «ärmlichen Verhältnissen» stammte. Die «formengeschichtliche» Forschung habe Schmidt begründet; der von der Fakultät gelobte Dibelius habe sie nur weitergeführt. Die «Theologischen Blätter» seien eine der angesehensten Zeitschriften. Das Erziehungsdepartement fügte bei, Schmidt müsse der akademischen Forschung und Lehre erhalten bleiben, was nur durch eine Basler Berufung möglich sei, während Dibelius bis jetzt ungestört in Heidelberg weiterwirken könne. Schmidt passe zudem besser in die Schweizer und Basler Verhältnisse als der Norddeutsche Dibelius, und in Lichtensteig habe er sich als Pfarrer «glänzend» bewährt.651 Am 21. Juni erklärte sich der Erziehungsrat einstimmig für Schmidt. Das Erziehungsdepartement folgte in seinem Antrag an den Regierungsrat vom 2. Juli der Kuratel und dem Erziehungsrat, und die Regierung wählte ihn am 12. Juli 1935 zum Nachfolger von Goetz auf den gesetzlichen Neutestament-Lehrstuhl.652 Schmidts Verhandlungsposition war relativ schwach, was eine mittelmässige Besoldung von
647 648
649 650 651 652
Kümmel 1957. Schlier hatte die Erklärung deutscher Neutestamentler gegen die Einführung des Arierparagraphen in der Kirche («Neues Testament und Rassenfrage», 1933) unterzeichnet und verlor dann in Marburg seine Venia Legendi. Bendemann 2007. StABS UA VIII 5, 3 Karl Goetz; UA O 2b 1924–1946 Protokoll der Theologischen Fakultät 1924–1946, 4. Sitzung, 29. 3. 1935 (Dekan Staehelin). Dekan Staehelin an Fakultätskollegen, hektographiert, 26. 3. 1935, in: StABS UA VIII 5, 3 Karl Goetz. Bericht des ED an den Regierungsrat vom 2. 7. 1935, in: StABS UA VIII 5, 3 Karl Goetz. Mühling 1997, 171 ff., stellt den Vorgang aus Schmidts Perspektive dar.
176
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
Fr. 14’200 zur Folge hatte,653 deutlich unter derjenigen, die Barth erhielt. Ein späteres Gesuch um Erhöhung wurde wegen der Finanzlage des Kantons zunächst abgelehnt, dann aber rückwirkend auf den 1. Juli 1939 ein Lohn von 15’200 Franken bewilligt.654 Die Antrittsvorlesung hielt er am 2. Dezember 1936 zum aktuellen Thema «Das Gegenüber von Kirche und Staat in der Gemeinde des Neuen Testaments». Die Basler Professur gestattete es Schmidt, die Familie in die Schweiz nachkommen zu lassen, doch dann erkrankte seine Frau. Schmidt, der eine zahlreiche Kinderschar hatte, musste Geld aufnehmen. Er verlor auf den 1. Januar 1937 die Möglichkeit, durch einen deutschen Strohmann die «Theologischen Blätter» weiterzuführen.655 Aus Deutschland konnte er keine Mittel in die Schweiz transferieren. Da erkrankte er selbst; die fälschlich gestellte Diagnose führte zu einem schweren chirurgischen Eingriff, von dem er sich nur langsam erholte. Aus seiner Verwundung im Ersten Weltkrieg und den Folgen des Eingriffs in Basel ergaben sich in den 1940er Jahren unerträgliche Schmerzen, die er mit Medikamenten bekämpfte, von denen er abhängig wurde.656 Dass er gegen Karl Barths Wunsch, Hans Hellbardt in Basel promovieren zu lassen, opponierte,657 schwächte hier seine Position ebenso wie der Umstand, dass er eine Version von Barths Bonner Entlassung verbreitet hatte, die dem Barth-Kreis missfiel.658 Als die Gültigkeit seines deutschen Heimatscheins ablief, verlangten die Schweizer Behörden eine Erneuerung als Voraussetzung für seinen Aufenthalt in diesem Land. Auf Betreiben der Gestapo wurde das Dokument verzögert ausgestellt.659 1938 wurde ihm die 653 654 655 656 657
658 659
Beschluss des Regierungsrats 23. 7. 1935, Anstellung per 1. 10. 1935, in: StABS UA VIII 5, 3 Karl-Ludwig Schmidt. Beschluss des Regierungsrats 3. 10. 1939, in: StABS UA VIII 5, 3 Karl-Ludwig Schmidt. Hermann Strathmann führte danach die «Theologischen Blätter» ohne Schmidt weiter, der im März 1937 alle Rechte an seiner Zeitschrift verlor. Mühling 1997, 184. Mühling 1997, 198. Die Bonner Fakultät verweigerte Hans Hellbardt, der seit 1934 zur Bekennenden Kirche gehörte, im Februar 1936 den Grad eines theologischen Lizentiaten. Auf Rat von Karl Barth beantragte Hellbardt in Basel die Anerkennung seiner Dissertation. Schmidt sprach sich dagegen aus, da ihm philologischer Schlendrian und eine dogmatische Voreinstellung missfielen. Im Mai 1936 lehnte die Basler Fakultät (mit Ausnahme von Karl Barth) die Arbeit von Hellbardt ab. Ihm wurde zugestanden, eine neue Arbeit einzureichen und in Basel das Rigorosum abzulegen. Mit Ausnahme von Schmidt (und Barth) scheint die Fakultät vom Bestreben geleitet gewesen zu sein, sich nicht in den deutschen Kirchenkampf einzumischen. Mühling 1997, 179 f.; Faulenbach 1991, 401–429. Thurneysen an Barth, 1. 12. 1934, 783–786; Thurneysen an Barth, 4. 12. 1934, in: Barth/ Thurneysen 2002, 764–771. Rektor August Buxtorf an Fritz Hauser, 9. 9. 1940; ED an Rektor August Buxtorf, 9. 10. 1940; Prorektor Ernst Staehelin an Fritz Hauser, 17. 10. 1940; Fritz Hauser an Prorektor Ernst Staehelin, 22. 10. 1940. «Aufgrund von Erfahrungen ist man bei den kantonalen und namentlich bei schweizerischen Amtsstellen aus begreiflichen Gründen sehr zurückhal-
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
177
deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt.660 Die Schweizer Behörden behandelten ihn zusammen mit anderen deutschen Professoren in der Schweiz in der Frage des Aufenthaltsrechts so rücksichtslos wie jeden anderen Emigranten und erteilten ihm nur eine befristete Toleranzbewilligung. 1945 versuchte Schmidt nach Deutschland zurückzukehren, hatte aber keinen Erfolg. Dennoch nahm er 1949 die Staatsbürgerschaft der Bundesrepublik an.661 Ungeachtet aller Schwierigkeiten beteiligte er sich auch während des Krieges an der theologischen Diskussion über die Stellung der Christen zu den Juden – eine Weiterführung dieses Themas, das er bereits 1933 in einem Gespräch mit Martin Buber aufgegriffen hatte.662 Schmidt hatte im selben Jahr die Erklärung gegen den Arierparagraphen in der Kirche von Bultmann und anderen unterzeichnet. «Nach dem Neuen Testament ist die christliche Kirche eine Kirche aus ‚Juden und Heiden‘, die sich sichtbar in einer Gemeinde zusammenfinden.»663 In seinem Berner Vortrag von 1933 berührte er diese Frage ebenfalls.664 Im November 1942 hielt er in Wipkingen ein Referat über «Die Judenfrage im Lichte der Kapitel 9–11 des Römerbriefes».665 Zu den Neutestamentlern zählte auch der schon erwähnte Extraordinarius Rudolf Liechtenhan. Der Basler durchlief das Humanistische Gymnasium und die Basler Fakultät. 1910 bis 1936 war er als religiöser Sozialist Pfarrer in einer Arbeitergemeinde. In dieser Zeit habilitierte er sich 1921, wurde aber erst 1935 anlässlich der Berufung von Karl Schmidt zum Extraordinarius für Neues Testament befördert. Seine Schwester hatte 1901 den Basler Kirchenhistoriker Paul Wernle geheiratet.666 Liechtenhan wollte wie Leonhard Ragaz für das göttliche Recht der Unterdrückten eintreten, er war für Frieden und Abrüstung.667 Zudem
660 661 662 663 664 665 666 667
tend geworden.» Er soll sich mit der gegenwärtigen Lage abfinden, auch wenn sie «nicht gerade erfreulich» ist. Fritz Hauser an Karl Ludwig Schmidt, 18. 12. 1940, alles in: StABS UA VIII 5,3 Karl-Ludwig Schmidt. Das Kuratelsmitglied Adolf Lukas Vischer berichtete, dass ausländische Professoren immer wieder Schwierigkeiten mit der Regelung ihres Aufenthaltsverhältnisses hätten, er nannte als Bsp. Karl Ludwig Schmidt und den Pädiater Freudenberg, in: StABS Protokoll T 2 Kuratel der Universität Bd. 14, 1941–1943, 222, 5. Sitzung, 7. 6. 1943. Einbürgerungsgesuch Prof. Karl Ludwig Schmidt, in: StABS Protokoll T 2 Kuratel der Universität Bd. 13, 1935–1941, 368, 6. Sitzung, 2. 6. 1939. Mühling 1997, 244. Kuschel 2015. Abgedruckt im Kirchenblatt für die reformierte Schweiz, 5. 10. 1933, 319. «Aus dem Vortrag von Karl Ludwig Schmidt in Bern» (Kirchenblatt für die reformierte Schweiz 1933, 407). Mühling 1997, 199 f. Kuhn 1997, 139. Von Rudolf Liechtenhan stammt auch ein Beitrag zur Erasmus-Festschrift von 1936 über die Friedenshoffnungen: Liechtenhan 1936. Das Thema erschien auch in seinem Vorle-
178
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
engagierte er sich für Alkoholabhängige (Beratungsstelle für Alkoholkranke) und war Abstinent. Seine Aktivitäten bremsten offensichtlich seine akademische Laufbahn, zusammen mit seinen Hemmungen, öffentlich zu sprechen. Als Nachfolger für Goetz lehnte ihn die Fakultät 1935 dezidiert ab.668 Liechtenhans Spezialgebiet, das er auch in der universitären Lehre berücksichtigte, war die jüdische Apokalyptik.669 Karl Ludwig Schmidt scheint ihn sehr geschätzt zu haben. Er widmete ihm je einen Nachruf in der «National-Zeitung» und in der «Abend-Zeitung» (vormals «Arbeiterzeitung») vom 1. Dezember 1947. Nach Schmidt fühlte sich Liechtenhan durch die Bibel verpflichtet, «den von anderen aus allen möglichen Gründen gescheuten Schritt zu tun, in die Sozialdemokratische Partei einzutreten, der er seine ganzen Pfarrerjahre hindurch angehört hat». Er sei sich immer treu geblieben, «weil es ihm auf die Treue gegenüber der Sache des Evangeliums als einer sozialen Kraft angekommen ist» («Abend-Zeitung»). Liechtenhan habe die biblische Erkenntnis «in den Dienst des sozialen Volksfriedens und des internationalen Völkerfriedens» stellen wollen. Als Redaktor der «Neuen Wege» von 1906 bis 1912 war «Liechtenhan […] ein unbekümmert kämpfender Pazifist» mit einem nüchternen Sinn für Volksaufklärung. Bei Liechtenhans Abdankung sagte Schmidt, «humanistisch-christlicher Individualismus» habe den Verstorbenen beseelt, dabei sei bemerkenswert gewesen, «dass er ein Kämpfer werden wollte und es auch war». «Er darf als einer der führenden religiösen Sozialisten bezeichnet werden.»670 4.2.5 Praktische Theologie (Johann Jakob) Rudolf Handmann671 war von 1890 bis 1936 Pfarrer zu St. Jakob, seit 1896 Privatdozent, Präsident des Kirchenrats von 1918 bis 1933 und seit 1899 Extraordinarius für Praktische Theologie. Dieses Fach, das in der Ausbildung der angehenden Pfarrer selbstredend eine grosse Rolle spielte, war in Basel damals immer durch Nichtordinarien vertreten. Handmann gehörte der älteren,
668
669 670 671
sungsangebot: Winter 1941/42 «Evangelische Friedensbestrebungen». StABS UA AA2 Lektionskataloge/Vorlesungsverzeichnisse. Offizielles Gutachten der Fakultät zur Nachfolge Goetz, Fakultät an Sachverständigenkommission der Kuratel, 5. 4. 1935, in: StABS UA VIII 5, 3 Karl Goetz. Für die Kuratel war Bedingung für die Beförderung zum Extraordinarius, dass Liechtenhan nie zu Dienstverweigerung aufgerufen habe. StABS Protokoll T 2 Bd. 12, Kuratel der Universität 1930– 1935, 524, 6. Sitzung 20. 5. 1935, und 528, 7. Sitzung, 31. 5. 1935. Z. B. Sommer 1938, Sommer 1942, Sommer 1944, Sommer 1945 u. ö. StABS UA AA2 Lektionskataloge/Vorlesungen, Anonym 1947. Angaben zur Person in: Barth/Thurneysen 2000, 896.
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
179
liberalen Generation nicht nur dem Jahrgang nach an.672 Bei seinem 40-jährigen Jubiläum als Pfarrer zu St. Jakob hielt der Bankier Alfred Sarasin die Festansprache, als Kollege von der Münsterpfarrei sprach Pfarrer Täschler. Sie wiesen ihn den «kirchlich-fortschrittlichen» Kreisen zu und würdigten ihn als Absolventen des Humanistischen Gymnasiums, als aktives Mitglied der Schülerverbindung Pädagogia, als Verehrer von Jacob Burckhardt, als Italienreisenden und als Kunstfreund, der sich für die Klassik einsetzte und die modernen Richtungen verabscheute. Sein Studium hatte ihn nach Berlin und Göttingen geführt. Als Theologe war er Anhänger von Albrecht Ritschl und forschte zum Alten Testament unter Leitung von Duhm. Harnack hatte ihn in Marburg mit einer Arbeit über das Hebräerevangelium promoviert. Danach blieb er für seine ganze Wirkungszeit Pfarrer zu St. Jakob.673 1935 trat er von seinem Extraordinariat und bald danach vom Pfarramt zurück; sein Nachfolger auf der Kanzel von St. Jakob wurde Wilhelm Vischer. Julius Schweizer war an der Universität nach dem Rücktritt von Handmann zusammen mit Eduard Thurneysen für die praktische Seite der Basler Pfarrerausbildung verantwortlich. Er war seit 1924 Privatdozent an der Theologischen Fakultät, wurde aber erst 1941 zum Extraordinarius für Praktische Theologie befördert. Zu seinen Lehrgebieten gehörten Katechetik und Liturgik, auch unterrichtete er Schülerinnen und Schüler der Musikschule in Kirchenmusik. Er hatte in Lausanne, Basel und Strassburg studiert und war zunächst Sekretär der reformierten Synode von Elsass-Lothringen. Nach einer Zeit als Pfarrer in Niedererlinsbach wirkte er von 1937 bis 1964 als reformierter Pfarrer in Allschwil. Neben der Praktischen Theologie interessierte ihn die Kirchengeschichte. So publizierte er über das Basler Konzil, die Vorgeschichte der Universität und hielt Vorträge vor der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft. Im Zusammenhang mit der Liturgik stand seine oft zitierte Arbeit über Zwingli und das Abendmahl.674 Schliesslich befasste er sich mit der Entwicklung des religiösen Empfindens bei Jugendlichen.675 Eduard Thurneysen war zunächst von einer Begegnung mit Christoph Blumhardt beeinflusst. Ab 1907 studierte er in Basel bei Bernhard Duhm und Paul Wernle Theologie, dann in Marburg, wo er sich intensiv mit den Werken Ernst Troeltschs beschäftigte. In Zürich, wo er von 1911 bis 1913 als Sekretär des Christlichen Vereins Junger Männer arbeitete, befasste er sich mit den Lehren 672 673 674 675
StABS Erziehungsrat S 4 Bd. 21, 1931–1932, 22. 6. 1931. Artikel zum 75. Geburtstag und Nachrufe: National-Zeitung vom 8. 7. 1935 und 14. 5. 1940; Basler Nachrichten vom 14. 5. 1940 und 15. 5. 1940. Wanner 1968. Dieses Thema war Teil seines Lehrangebots an der Universität. «Die religiöse Entwicklung im Jugendalter». StABS UA AA 2 Lektionskataloge/Vorlesungsverzeichnisse für den Winter 1934/35.
180
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
von Hermann Kutter und hörte Vorlesungen bei Leonhard Ragaz. Auch Thurneysen gehörte vor dem Ersten Weltkrieg zu den Idealzofingern.676 Von 1913 bis 1920 war er Pfarrer in Leutwil und regelmässiger Gesprächspartner von Karl Barth. 1920 wechselte er nach St. Gallen-Bruggen. 1927 promovierte er in Basel, von diesem Jahr an bis 1959 war er Pfarrer am Basler Münster. Unterricht in Praktischer Theologie hielt er an der Universität Basel seit 1930 ab. 1941 wurde er zum Extraordinarius für Homiletik befördert.677 Thurneysen begleitete Barth nicht nur während der wichtigen Ausarbeitung des Römerbriefs, sondern auch in der Zeit, da Barth in Deutschland lehrte. Seine Korrespondenz mit Barth ist aufschlussreich für die Art dieser Begleitung, die in Bewunderung und Hilfe im Aufrechterhalten von Kontakten innerhalb vor allem des Basler Netzwerks des berühmten Theologen bestand. Die Briefe geben Einblicke in den Kreis der «dialektischen Theologen», der «Positiven» sowie in ihre Beziehungen zu den «Freisinnigen» und lassen erkennen, wo die Barth-Gruppe Freunde und Feinde sah. Thurneysen konnte sehr mutig für die Notwendigkeit, den Juden beizustehen, sprechen und schlug sich auf die Seite der radikalen Forderungen von Pfarrer Walter Lüthi (seit 1931 Pfarrer an Gemeindehaus Oekolampad) in dieser Sache.678 Bei Kriegsbeginn schrieb er: «Was kann Gott an einer Schweiz liegen, die, immer noch bewahrt vor dem Ärgsten, ihre Grenzen schliesst gegen die Not der Heimatlosen?»679 Derselbe Mann lobte dann das Buch von Friedrich Vöchting über den Krieg in der Ukraine, das linke Politiker wie Max Wullschleger 1943 als Dokument für die dem Nationalsozialismus freundlich gesinnte Haltung des Verfassers betrachteten: «Das Bild des Krieges, das hier vor einem ersteht, ist wohl immer noch ein sehr ernstes, erschreckendes, aber es birgt in sich so viel Züge menschlicher Verantwortlichkeit und Güte, dass man es nicht ungetröstet bei Seite legt, dass man den Glauben an den Menschen, insbesondere den deutschen Menschen und seine Geistigkeit neu bestärkt fühlt.»680 4.2.6 Sprachen Jakob Wirz erhielt 1932 das Lektorat für Hebräisch an der Basler Theologischen Fakultät. Von 1911 bis 1941 war er zudem Hausvater des Alumneums, eine Funktion, in der er von Oscar Cullmann und dessen Schwester Louise abgelöst wurde. Wirz galt als hervorragender Kenner des Alten Testaments, des Arabi676 677 678 679 680
Lindt 1969, 208. Kuhn 2012a; Bohren 1982. Bohren 1982, 170. Kocher 1996, 440. Thurneysen an Friedrich Vöchting, 5. 5. 1938, in: Nachlass Friedrich Vöchting, Archiv für Zeitgeschichte, ETH Zürich, 1.1, Korrespondenzen, Prozessakten, Presseartikel und Notizen, 1938–1940.
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
181
schen, des Aramäischen und der rabbinischen Gelehrsamkeit.681 Das Studium führte ihn von Basel nach Marburg. Ab 1897 wirkte er während 14 Jahren als Pfarrer in Benken. Am Humanistischen Gymnasium diente er als Religionslehrer, und von 1911 bis 1933 redigierte er das «Kirchenblatt für die reformierte Schweiz».682 Johann Jakob Stamm habilitierte sich 1941/42 an der Universität Basel für Altes Testament und orientalistische Hilfsdisziplinen. Sein Studium der Theologie und der altorientalischen Sprachen hatte er in Basel, Neuenburg und Marburg absolviert; in Leipzig studierte er Assyriologie. Dort promovierte er zum Dr. phil. im Jahr 1939. Seine bei Benno Landsberger683 geschriebene Dissertation über Die akkadische Namengebung (1939) wurde zum Standardwerk. Das Doktorat in Theologie folgte 1940 in Basel bei Walter Baumgartner mit einer begriffsgeschichtlichen Studie über Erlösen und Vergeben im Alten Testament. Als Nachfolger von Wirz wurde er Lektor für Hebräisch.684 1949 folgte er einem Ruf nach Bern, wo er zunächst Extraordinarius für Altes Testament und Religionsgeschichte wurde und von 1950 bis 1976 als Ordinarius für Altes Testament und altorientalische Sprachen tätig war.685 «Theologisch Karl Barth verpflichtet, engagierte sich Stamm auch für die evangelisch-reformierte Kirche Berns. Diese Tätigkeit fand ihren Niederschlag u. a. in populären Werken über den Dekalog und den Weltfrieden, von denen das erste auch von den Fachkollegen breit rezipiert wurde.»686 4.2.7 Missionswissenschaft Karl Hartenstein wurde 1926 von seiner Pfarrerstelle in Bad Urach nach Basel zum Direktor der Mission berufen und war damit auch Mitglied des Deutschen Evangelischen Missionsrats. Daneben war er Dozent für Religionswissenschaft und Missionskunde an der Universität. Hartenstein bereiste die Einsatzländer der Missionare und nahm an internationalen Konferenzen teil, darunter an der Weltmissionskonferenz von Madras 1938. Der Sohn eines Bankiers, der durch den Vater und einen Onkel mit der Basler Mission verbunden war, hatte am Ersten Weltkrieg als Artillerieoffizier teilgenommen. 1933 promovierte er in Tübingen mit der damals vielbeachteten Arbeit Die Mission als theologisches Problem: Beiträge zum grundsätzlichen Verständnis der Mission. Anlässlich der Trennung der 681 682 683 684 685 686
Anonym 1944a. Anonym 1944b. Landsberger war Jude, 1935 in Leipzig entlassen, nach Ankara berufen, dann 1948 nach Chicago. Er war der führende Assyriologe seiner Generation. Soden 1982. StABS Protokoll S 4 Bd. 26, 1940–1942, Erziehungsrat 3. 3. 1941. Kuhn 2011. Mathys 2013.
182
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
Basler Mission von den deutschen Funktionsträgern und der organisatorischen Ablösung von der deutschen Heimatgemeinde687 kehrte er 1939 als Bevollmächtigter der Basler Mission nach Deutschland zurück, wo er Mitglied der Bekennenden Kirche war.688 Er versuchte, von Stuttgart aus das Vermögen der Missionsgesellschaft zu sichern. «Ab 1941 wirkte er von Korntal aus als Prälat von Stuttgart und Stiftsprediger. Er setzte sich 1945 für das Zustandekommen des Stuttgarter Schuldbekenntnisses ein. 1948 lehnte er das Amt des Landesbischofs ab, wurde aber Mitglied des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland und nahm an internationalen Missionsveranstaltungen und 1948 an der Gründungsversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Amsterdam teil.»689 In der Basler Mission war er die überragende Persönlichkeit, theologisch wie intellektuell und organisatorisch. Als Prediger und Vortragsredner in Deutschland und der Schweiz wurde Hartenstein sehr geschätzt.690 Hartenstein fiel in Basel als deutscher Patriot auf, der Verständnis und manchmal auch Sympathie für Aspekte des Nationalsozialismus (wie anfänglich für die Aussenpolitik des ‚Dritten Reichs‘) zeigte. So sah er in der nationalsozialistischen «Revolution» den Beginn des Wiederaufstiegs Deutschlands und begrüsste die Bestrebungen zur Revision des Versailler Vertrags. Er setzte sich dafür ein, dass Missionare ihren Heimaturlaub in Deutschland verbrachten statt in der Schweiz, um die Verbundenheit mit dem «neuen Deutschland» zu fördern. Konfrontationen zwischen der Basler Mission und den deutschen Machthabern versuchte er zu verhindern und vertrat eine Linie der ‚Normalität‘ in den Beziehungen zu deutschen Instanzen.691 An seinem Beispiel lässt sich zeigen, wie nach 1933 die traditionell starke Präsenz von Deutschen zu Schwierigkeiten in der Basler Mission führte. Die Mission stand organisatorisch neben der Kirche, aber 687
688 689 690 691
Hartenstein wurde damals als Direktor nicht ersetzt. Die Gesamtleitung der Basler Mission fiel nun Alphons Koechlin zu (über ihn siehe unten); das Missionshaus und das China-Inspektorat leitete Heinrich Gelzer, bisher Rektor (Bruder des Althistorikers in Frankfurt, Mattias Gelzer). Quack 2016, 108 f. Bultmann 2017, 47. https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Hartenstein_(Theologe). Dilger 1966. Basler Nachrichten vom 3. 10. 1952. Thurneysen berichtet von einem «nicht ganz affektlosen Gespräch» mit Hartenstein, «der der ganzen Entwicklung irgendwie positiv eingestellt gegenübersteht». Hartenstein äusserte sich über die Unmöglichkeit des Versailler Vertrags, «die kommende Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit Polen, mit dem Osten überhaupt», er richtete Vorwürfe an die USA, wo man sich «wegen der Judengeschichte in Deutschland aufregt», während man dort die «Neger» lynche. Deutschland sei wehrlos inmitten hochgerüsteter Staaten. Diese Position schien Thurneysen nachvollziehbar zu sein, «[…] aber ich verstand nicht die Ideologie der nationalen Bewegung, auch nicht in der relativ einsichtigen und gedämpften Form, in der Hartenstein sie vertritt». Hartenstein und Thurneysen waren sich dann wieder in der Ablehnung der Gleichschaltung der Kirche einig. Thurneysen an Lollo von Kirschbaum, 12. 4. 1933, in: Barth/Thurneysen 2000, 385–388; Quack 2016, 92 ff.
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
183
durch die Pfarrer, die sie in Basel beschäftigte, durch ihre Präsenz innerhalb der Universität und durch die Verflechtung mit Teilen der Basler wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Elite war sie eng mit ihr verbunden. Unter diesen Umständen konnte sie sich bis zum Kriegsausbruch 1939 nicht klar vom ‚Dritten Reich‘ abgrenzen, dem manche ihrer Exponenten durch Patriotismus, Konservativismus (Hartenstein glaubte, Hitler habe Deutschland und Europa vor einer bolschewistischen Revolution bewahrt) und persönliche Beziehungen verbunden blieben oder zu bleiben trachteten. Der «Heimatinspektor» der Basler Mission für Deutschland war ab 1934 der NSDAP-Parteigenosse Gustav Hanich, den Hartenstein dem Komitee der Basler Mission als einen «Vollblut-Deutschen» vorstellte, der diejenige «bejahende Stellung zur nationalen Bewegung, die jetzt für den deutschen Heimatinspektor erforderlich ist», mitbringe.692 Solche Positionen waren, wie von Barth oft beklagt, mit der Zugehörigkeit zur Bekennenden Kirche durchaus vereinbar. Die führenden Basler Mitglieder der Mission duldeten positive Haltungen zum ‚Dritten Reich‘ und versuchten, im Interesse der Einheit der Mission Entscheidungen auszuweichen. So hatte Hartenstein freie Hand, innerhalb der Mission seine Ansicht zu verbreiten, dass die Machtübergabe an Hitler und die Errichtung der Diktatur ein willkommener Sieg über den Parlamentarismus und das Parteiwesen sei, dass sie Lebensraum im Osten eröffnen werde und einen Ständestaat herbeiführe. Differenzen zu den Nationalsozialisten ergaben sich jedoch rasch, da Hartenstein das Ziel der Deutschen Christen, die Mission der geplanten deutschen Nationalkirche einzuverleiben, deutlich ablehnte; er stellte sich ab 1934 auch offen gegen den Reichsbischof. Deshalb wollte Hartenstein 1934 die Mission in eine «Front» mit der Bekennenden Kirche stellen. Dadurch geriet er ins Visier der Deutschen Christen und 1937 auch der Gestapo, die ihn in Stuttgart verhörte. Politische Äusserungen von Hartenstein sind danach bis 1939 nicht mehr überliefert, aber er verlangte 1938 erfolgreich, dass Karl Barth nicht am Basler Missionsfest dieses Jahres auftreten dürfe. Schweizer Teilnehmer an der Ausbildung, die die Mission anbot, opponierten gegen den von manchen Seminarlehrern vertretenen Pietismus. Da Hartenstein hinter diesem Widerstand einen negativen Einfluss von Karl Barth vermutete, verbot er den Seminaristen den Besuch der «Offenen Abende» von Barth.693 Nach Hartensteins Übersiedlung nach Deutschland war Koechlin als neuer Leiter der Basler Mission bestrebt, ihn wie andere Deutsche konsequent aus der Basler Mission auszuschalten, um den ‚schweizerischen‘ Charakter der Mission zu unterstreichen, was angesichts der Weltlage geboten schien.694
692 693 694
Quack 2016, 94, Zit. aus: Komitee-Protokoll vom 22. 11. 1933. Quack 2016, 96–107. Quack 2016, 118 f.
184
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
Alphons Koechlin war von 1936 bis 1959 zugleich Präsident und operativer Leiter der Basler Mission. Auch an der Universität trat er die Nachfolge von Hartenstein mit dem Titel eines Ehrendozenten an. In dieser Funktion lehrte er über Fragen der Mission und später vor allem der Ökumene.695 Koechlins Laufbahn hatte 1910 bis 1921 als Pfarrer in Stein am Rhein begonnen. 1921 bis 1954 wirkte er als «Frühprediger» an St. Martin in Basel. In den Jahren von 1933 bis 1954 stand er dem Kirchenrat von Basel-Stadt vor, seit 1935 sass er im Vorstand des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, den er von 1941 bis 1954 präsidierte. In den 1920er Jahren begannen seine engen Beziehungen zur kirchlichökumenischen Bewegung. An allen grösseren Konferenzen zwischen 1925 und 1954 war er beteiligt und arbeitete am Aufbau des Ökumenischen Rates der Kirchen mit, dessen Zentral- und Exekutivausschuss er 1948 bis 1954 angehörte. Koechlin war auch Mitglied des Führungsgremiums des Weltverbandes der Christlichen Vereine Junger Männer. In den 1930er und 1940er Jahren pflegte er regelmässige Kontakte zum anglikanischen Bischof von Chichester, George Bell, und präsidierte von 1943 bis 1946 das Schweizerische kirchliche Hilfskomitee für evangelische Flüchtlinge.696 Im Oktober 1933 war Koechlin bereit, sich um die ‚Judenchristen‘ zu kümmern, die als evangelische Pfarrer in Deutschland in Schwierigkeiten gerieten. Als die Bekenntnis-Pfarrer-Familienhilfe, die im Mai 1937 in der Schweiz gegründet worden war, im Advent desselben Jahres ein Memorandum zum deutschen Kirchenkampf publizierte, worin das Vorgehen der Nazis als «Vernichtungskrieg gegen den inneren und äusseren Bestand der christlichen Kirche» bezeichnet wurde, unterstützte es Koechlin mit seiner Unterschrift. In einer Radiopredigt vom 2. Oktober 1938 lobte er allerdings die Erhaltung des Friedens durch die Münchner Konferenz. Aber er folgerte aus der Friedenshoffnung, die Schweiz müsse sich auf ihren Friedensauftrag besinnen, d. h. auch an die Flüchtlinge denken, die in der Schweiz «Schutz und Frieden» suchten. Der von Koechlin autorisierte Basler Kanzelaufruf mahnte, «dem Fremdling am Wegrand ohne Unterschied der Konfession, Nationalität oder Rasse» zu begegnen. Im Herbst 1938 war Koechlin an der Gründung des Schweizerischen Kirchlichen Hilfskomitees für evangelische Flüchtlinge beteiligt; er vertrat den Basler Kirchenrat, während Wilhelm Vischer für das Hilfswerk für die deutsche Bekennende Kirche mitwirkte und Rosie Preiswerk, Koechlins Sekretärin, die Basler Hilfsstelle für Flüchtlinge repräsentierte. Dieses Hilfskomitee wollte sich zunächst nicht um Juden und politische Flüchtlinge kümmern (für die man andere Organisationen für zuständig erachtete), sondern um evangelische ‚Judenchristen‘. Ab 1942 wurden dann die ungetauften Juden zunehmend berücksichtigt, und Koechlin warnte in diesem Jahr explizit davor, die Lage dieser Juden zugunsten der Judenmission auszunützen. 695 696
Linder 1966. StABS UA AA2 Lektionskataloge/Vorlesungsverzeichnisse. Kocher 2007.
Der Lehrkörper der Basler Theologischen Fakultät
185
Koechlins Stellung als eine der Schlüsselfiguren für die evangelische Kirche und deren Verhältnis zum Staat brachte es mit sich, dass er mit den Behörden über die Lage der Flüchtlinge in der Schweiz und die Auswirkungen der 1942 verfügten Grenzschliessung verhandelte. Nach der Schliessung der Schweizer Grenzen für Flüchtlinge im August 1942697 ersuchten viele Pfarrer Koechlin, beim Bundesrat vorstellig zu werden. Am 21. August 1942 besprach er sich mit Heinrich Rothmund (Chef der Eidgenössischen Fremdenpolizei), ohne etwas zu erreichen. Auf Initiative von Pfarrer Walter Lüthi schrieb Koechlin kurz darauf nochmals an Rothmund und nun auch an Bundesrat Eduard von Steiger. Vermutlich in Absprache mit Koechlin und auf Initiative des liberalen Journalisten und Grossrats Albert Oeri besuchten am 23. August 1942 Gertrud Kurz («Kreuzritter»-Flüchtlingshilfe) und Paul Dreyfus-de Gunzburg (Bankier) von Steiger. Als auch Koechlin am 29. August 1942 Bundesrat von Steiger persönlich traf, versprach dieser, der Bund werde eine Lösung suchen, die dem Anliegen der Kirchen Rechnung trage, ohne die Sicherheit des Landes zu gefährden. Der sonst sehr zurückhaltende Koechlin stellte nun am 31. August 1942 vor dem Basler Kirchenrat deutlich fest, dass die Grenzschliessung darauf hinauslaufe, dass die Schweiz sich einer «aktiven Teilnahme an dem deutschen Vorgehen schuldig» mache. Als die Basler Synode am 9. Juni 1943 eine Resolution von Samuel Dieterle (Pfarrer der Petersgemeinde) behandelte, der das «Wächteramt» der Kirche gegenüber der weltlichen Obrigkeit dadurch herausgefordert sah, dass die Zurückweisung von Flüchtlingen der Normalfall sei, widersetzte sich Koechlin dem Vorschlag von Walter Lüthi, das Votum von Dieterle im «Kirchenboten» zu veröffentlichen. Man habe ihm in Bern versichert, dass nur 19 Prozent der Flüchtlinge zurückgewiesen würden, und die Behörden seien keine Antisemiten.698 Zurückhaltend, diskret, ordnungsliebend, bürgerlich, allen radikalen Vorgehensweisen abhold, auf die Erhaltung von «Einheit» ausgerichtet, versuchte Koechlin das Vertrauen der Bürger in die Behörden zu festigen, setzte sich dann aber in Gesprächen und Mahnungen mit grossem Ernst für die Flüchtlinge ein. Dadurch erschien sein Verhalten zwar ambivalent, es ergab sich aber konsequent aus seiner vermittelnden, Extreme vermeidenden und gesellschaftliche Autoritäten stärkenden Intentionen. Eine umfassende Bilanzierung der Effekte seines Wirkens an prominenten Positionen steht noch aus.
697
698
Mächler 2019, 327 ff., stellt die Grenzsperre ausführlich dar, insistiert aber darauf, dass ihre Bedeutung übertrieben wurde: «Die Flüchtlinge kamen vorher, während und nach dieser ‚Sperre‘ – man hat immer mehr hereingelassen. Eine totale Sperre gab es nie.» (Zit. 329) In Deutschland war der Holocaust im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 1941 zu einem konkreten Programm geworden. Kershaw 1997, 202 ff. Kocher 1996, 57, 90, 102, 104, 123 ff., 210 f., 213 f., 219, 227, 232, 242 f. Der Protest gegen die Grenzschliessung war relativ erfolgreich, vgl. die Berechnungen, die Lambelet 2000, 6 ff., anstellt.
186
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
4.3 Theologische Argumente gegen den Nationalsozialismus Die Theologie bot Möglichkeiten, den Nationalsozialismus explizit zu reflektieren und Positionen aufzubauen, die solide Grundlagen für dessen Abwehr darstellten. Im Unterschied zu anderen akademischen Kontexten waren diese Grundlagen jedenfalls für die ‚dogmatisch gebundenen‘ Lehrer und Forscher der Fakultät integrierte Elemente ihrer Wissenschaft und nicht bloss Nebenerscheinungen der Haltung einer Elite, die sich durch bestimmte Aspekte der nationalsozialistischen Ideologeme abgestossen oder bedroht fühlte. Über die rein humanistische Abwehr in den Geisteswissenschaften hatten die Theologen eine eigene Meinung: Sie hielten sie für zu schwach fundiert. Die Annahme, dass jede Theologie zu einer kritischen Analyse des Nationalsozialismus führen müsste, wäre allerdings unbegründet. Bekannt ist Karl Barths Enttäuschung über vieles, was sich innerhalb der Bekennenden Kirche in Deutschland abspielte. Nationalistische (Wiederaufstieg Deutschlands) und konservative (Abwehr einer angeblich drohenden sozialistischen oder bolschewistischen Revolution) Einstellungen sowie das Bestreben, die Kirche als weltliche Institution durch Kompromisse mit dem Regime zu retten, erschwerten eine fundamentale Analyse und konsequente Abwehr. Auch ‚dogmatisch gebundene‘ Basler Theologen vertraten solche Positionen. Auf Hartensteins Wirken in der Mission habe ich hingewiesen, aber auch an genuin baslerischen Theologen lassen sich die Effekte einer konservativen (hier: liberalkonservativen) Einstellung illustrieren. Als Beispiel dient mir Ernst Staehelin. Er teilte die zeittypische Überzeugung, dass Demokratie und liberaler Staatsgedanke überholt seien und eine Alternative gefunden werden müsse, deren Umrisse sich im neukonservativen, demokratiekritischen Denken oder in der Phraseologie der ‚Erneuerer‘ von rechts abzeichneten. So fiel es ihm anfänglich schwer, die grundsätzlich verbrecherische Natur der deutschen Diktatur umfassend zu erkennen, auch wenn er Gewalt und Rassismus durchaus sah. Das Kriterium, dass nur eine öffentliche Ordnung gut sei, die auf christlichem Fundament aufgebaut sei, führte zu relativierenden Beurteilungen. Zudem scheint Staehelin wie viele nach rechts neigende Bürger gemeint zu haben, dass sich die Nationalsozialisten zähmen und in eine höhere Ordnung einbinden liessen, die gewisse liberale Züge bewahre, aber ‚Exzesse‘ wie säkularisierte Demokratie, freie kapitalistische Konkurrenz und unkontrollierte Ausbeutung der Arbeiter verbiete. 1933 deutete er die nationalsozialistische Diktatur im «Kirchenblatt» wie folgt: «Wer wagte schon über das, was in Deutschland geschieht, ein endgültiges Urteil zu haben? Wertvolles, Gesundes, aus viel Versumpfung Hinausführendes ist ohne Zweifel vermischt mit viel Wesen aus der Tiefe, mit Überhebung, Gewaltgeist, Vergötzung des Volkstums und der Rasse.» Die Kirche müsse das ‚Dritte Reich‘ in das Reich Gottes «hineinstellen», um es «dadurch in seinen Dämonien einzudämmen und zu läutern». «Auch unsere
Theologische Argumente gegen den Nationalsozialismus
187
liberale Demokratie ist mit all dem, was sich in ihr als schweizerisches Volksleben abspielt, ist im Licht von Karfreitag und Ostern etwas ganz und gar Fragwürdiges.» «Auch» die Schweiz müsse «erschüttert» werden, aber durch eine «Bewegung neuer Hingabe an den Herrn».699 Noch 1939 plädierte Staehelin für die «Erneuerung». Das Vertrauen in eine Volksherrschaft fehlte ihm weitgehend. So schrieb er 1941: «Die Betätigung der demokratischen Rechte geschieht aus viel Verantwortungslosigkeit, Oberflächlichkeit und menschlich-irrender Torheit heraus.» Der christliche Korporatismus interessierte ihn als Antwort auf die Gegenwartsfragen; er suchte eine Fundierung der «Volksgemeinschaft» in einer übergreifenden, von allen geteilten Idee, die die Menschen einige. Das liberale Erbe sollte dabei jedoch durchaus erhalten bleiben.700 Offenheit für vieles paarte sich mit einer unscharfen Wahrnehmung offensichtlichen Unrechts und einer wenig ausgeprägten Bereitschaft, deutlich zwischen dem Rechtsstaat und der Gewaltherrschaft zu unterscheiden – «im Lichte von Karfreitag und Ostern» konnte nur eine christlich fundierte Ordnung gut sein, und in Erwartung des Reichs Gottes war alles Elend auf dieser Welt relativ. Auffällig ist, dass sich Staehelins Name in den Akten des Hilfswerks für deutsche Gelehrte, das wegen der Anwendung nationalsozialistischer Grundsätze in Deutschland in Not geratene Hochschullehrer unterstützte und dessen Basler Zweig zuletzt von Karl Barth geleitet wurde, nicht findet.701 Vieles hatte sich Staehelin schon als Reaktion auf den ersten Weltkrieg zurechtgelegt. Er bewunderte den Aufbruch des Zusammengehörigkeitsgefühls bei den kriegführenden Nationen im August 1914 und bedauerte, dass in der neutralen Schweiz nichts Ähnliches geschah. Wenn die Kriegführenden glaubten, dass das Leben als solches keinen Wert habe, wenn es nicht dem Vaterland geopfert werden könne, so erführen die Neutralen, «dass zu leben, ohne für Gott zu leben, wertloser ist als gar nicht zu leben». Ohne göttliche Läuterung und Neugeburt werde die Schweiz untergehen. Die Erwartung eines glückseligen Zustandes ohne Krieg sei verfehlt. «[D]amit Erhebungen stattfinden können, muss Krieg und Verderben herrschen, damit die richtende Heiligkeit Gottes kund werde; liegt doch der Sinn der Geschichte gar nicht in einem glückseligen Endzustand, sondern darin, dass durch sie, durch ihre Stürme und Schrecknisse, immer aufs neue erdgeborene Menschen zu Gottesmenschen emporgebildet werden».702 1941 kritisierte er die Absicht, den Widerstand gegen den Nationalsozialismus im Namen des «Alten Europas», wie es Jacob Burckhardt repräsentiere, zu 699 700 701 702
Staehelin 1933c. Akademischer Vortrag, «Das christliche Abendland», 25. 2. 1941, Manuskript, nicht durchgeschrieben, in: Nachlass Ernst Staehelin NL 124, D 056 Sibold 2010, 241. StABS Erziehung X 48: Schweizerisches Hilfswerk für deutsche Gelehrte 1933–1937/40. Vgl. unten. Staehelin 1914.
188
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
führen. Das Alte Europa müsse «hineingehoben» werden «in die Welt des auferstandenen Christus». Dann erst werde Europa «stark genug sein, die Erneuerung, die aus satanischen Tiefen von unten her in Angriff genommen wird, siegreich zu überstehen». Wie Paulus in Athen gegen die Verehrung der antiken Gottheiten («Götzen») predigte, solle man jetzt nicht im (humanistischen) Götzendienst steckenbleiben, denn nur von Christus her sei anhaltender Widerstand möglich. Zwar verberge sich in den Statuen, die Paulus sah, «eine tiefe Sehnsucht nach dem Göttlichen». Paulus (und mit ihm Staehelin) hielt dieser Welt die «Königsherrschaft des auferstandenen Christus» entgegen, «eine neue Schöpfung». Humanität sei «unfruchtbare Zufriedenheit und Sattheit». Und schon 1941 dachte er an die Nachkriegszeit: Christen könnten vergeben, «weil ihnen selbst vergeben ist».703 Nur ein theologischer Ansatz, der mehrere Dimensionen in sich vereinigte und sich ebenso aufmerksam dem «Hier und Jetzt» zuwandte wie den biblischen Verheissungen für die Zukunft, konnte für die Abwehr des Nationalsozialismus genügend Energie freisetzen und die bürgerliche Neigung, im Nationalsozialismus «auch Gutes» zu finden, überwinden. Ich fasse die theologische Abwehr unter Rubriken, die untereinander verknüpft waren und die ich im Interesse der Klarheit der Darstellung nachstehend getrennt durchgehe, wobei ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben möchte. 4.3.1 Das Erste Gebot und die falschen Götter Ein starkes theologisches Argument gegen die Hitlerdiktatur enthielt das erste Gebot: «Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.» Es gab Anleitung, die pseudoreligiösen Aspekte im Nationalsozialismus zu entlarven und die Vergötterung des ‚Führers‘ abzulehnen. Diesen Ansatz konnte man auch ausserhalb der Theologie finden, besonders ausgeprägt bei der Analyse der Universitäten unter dem Nationalsozialismus durch den amerikanischen Soziologen Edward Hartshorne Jr.704 Er brachte eine gewisse religiöse Sensibilität mit, die ihm gestattete, die kultischen Inszenierungen nationalsozialistischer Feiern als Surrogate für christliche Riten und Liturgien zu erkennen. Wurde gar ein Mensch wie Hitler zum Gegenstand einer bedingungslosen Verehrung, begann der Tanz um das goldene Kalb. Karl Barth argumentierte damit in seiner Verteidigung während des Prozesses, der 1934/35 gegen ihn in Köln und Berlin in zwei Instanzen geführt wurde. Der Staatsanwalt behauptete zur Frage des Beamteneids auf Hitler, dass es im NS-Staat um die Verpflichtung auf eine lebendige Person 703
704
Staehelin 1941a. Staehelin bezieht sich in dieser Predigt auf das damals neue Buch von Alfred von Martin, Nietzsche und Burckhardt, München 1941, eine eindeutige Stellungnahme gegen das NS-Regime. Hartshorne 1937.
Theologische Argumente gegen den Nationalsozialismus
189
gehe. Reserven und Prüfungsvorbehalte gälten nicht, und der ‚Führer‘ handle sowieso nicht gegen Gottes Gebot. Barth versuchte in seiner Entgegnung klarzumachen, dass die Anerkennung der Kirche durch den Staat bedeute, dass dieser die Grenzen seiner Totalität anerkenne, zu seinem eigenen Besten. Barths Verurteilung würde bedeuten, dass Hitler ein inkarnierter Gott sei.705 1938 wandte sich Barth kategorisch gegen die von den Pfarrern in Deutschland verlangte Eidesleistung. Der Eid auf Hitler bringe nun ohne jeden Zweifel die Gleichschaltung der protestantischen Geistlichkeit mit den auf den ‚Führer‘ bereits eingeschworenen Beamten und Offizieren. Christen und insbesondere Diener am Wort Gottes könnten einen solchen Eid nicht leisten: «[Wer ihn leistet,] hat sich in aller Form in den Dienst eines fremden Gottes begeben.»706 Dem stand die Überzeugung konservativer Christen entgegen, dass Hitler Deutschland und Westeuropa vor einem kommunistischen Umsturz gerettet habe, dass es gut gewesen sei, die Demokratie abzuschaffen und die Linke zu liquidieren, dadurch die Klassengegensätze im Reich angeblich zu mildern sowie gegen den Versailler Vertrag vorzugehen. Für sie war jedenfalls zu Beginn der Diktatur das politische Geschehen eine Erfüllung langgehegter Wünsche, die als Eingreifen Gottes in die deutsche Geschichte gedeutet wurde. Hitler als «gottgesandt» zu bezeichnen, lag nahe. Wolle die Kirche mit der «Zeit» gehen, dürfe sie sich nicht in Opposition zum Regime begeben. 4.3.2 Die Sorge um die Kirche/die Gemeinde Die Kirche (als weltlich organisierte Institution) wurde oft mit der «Gemeinde» identifiziert, die in das Urchristentum zurückreiche und «von Gott» sei. Daraus ergaben sich zwei mögliche Richtungen für das Handeln. Die eine versuchte, deren Bestand möglichst zu erhalten, auch durch Konzessionen. Oft verband sich damit die Integration der Kirche in die bürgerliche Welt, d. h. auch ihre Verwendung für die Repräsentation bürgerlicher Ordnung in der Gesellschaft. Die andere Richtung betonte, dass die Kirche als Gemeinde nicht von dieser Welt sei und in einem klar definierbaren Verhältnis zur ‚weltlichen Obrigkeit‘ zu sehen sei. Zu dieser zweiten Richtung gehörten diejenigen Positionen, die sich den Übergriffen des Staates in die Kirche widersetzten, und aus dieser Haltung heraus formierte sich eine starke Abwehr gegen den Nationalsozialismus. Diese Abwehr konnte über die in Verfassungs- und Verwaltungsbegriffen definierte Grenzziehung zwischen Staat und Kirche hinaus auch zu einer Ablehnung des (selbstverständli-
705 706
Barth an Thurneysen, 24./26. 12. 1934, insbes. 799–801, in: Barth/Thurneysen 2000, Briefwechsel Bd. 3, 1930–1935, 792–813. Tietz 2019, 283 f. «An die Bekennende Kirche in Deutschland», 18. 5. 1938, in: Barth 2001, Offene Briefe 1935–1942, 84–92.
190
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
chen) Einbezugs der Kirche in Nationalismus und Rassismus oder gar ihrer Instrumentalisierung zur Unterstützung einer Ideologie vorstossen. In der Vorstellung der christlichen Gemeinde, identifiziert mit der evangelischen Kirche, war somit das Gebot angelegt, sie nicht für weltliche Zwecke zu instrumentalisieren und sie auch nicht menschlichen Zielen zu unterwerfen; sie und namentlich ihre Pfarrer sollten allein Gott dienen. Dieser Anspruch war nicht verhandelbar und verdichtete sich im bereits erwähnten Gebot, keine andern Götter neben (und schon gar nicht über) Gott zu haben. Karl Barth richtete an die Schweizer Pfarrer die Mahnung, dass es im Kirchenkampf in Deutschland nicht um «Missverständnisse» gehe, «sondern – zunächst von Seiten des nationalsozialistischen Staates – um einen kaum noch verhüllten, planmässig angesetzten und durchgeführten Vernichtungskrieg gegen den inneren und äusseren Bestand der christlichen Kirche». Die Stelle der Kirche respektive der Gemeinde nehme nun die NSDAP ein.707 Er sah den Nationalsozialismus als einen Todfeind des Christentums, der zu bekämpfen sei, auch mit den Gewaltmitteln einer ‚rechten‘ Obrigkeit, die er in der schweizerischen Demokratie erkennen wollte immer mit einer deutlichen Einsicht in deren Mängel. 4.3.3 Das Verhältnis zur Obrigkeit, das Wächteramt der Kirche, die ‚rechte Obrigkeit‘ und der legitime gewaltsame Widerstand Nicht von der Verteidigung der Gemeinde zu trennen war also die Frage der Grenze, die dem staatlichen Anspruch gezogen werden sollte, und was das rechte Verhältnis zu einem Staat sei, der diese Grenze nicht respektieren wollte. Nach Paulus sollten die Gebote der weltlichen Obrigkeit, also des Staats, auch für die Christen gelten, aber nach evangelischer Auffassung nur so weit, wie sie von einer ‚rechten‘ Obrigkeit ausgingen. Verlange die Obrigkeit die komplette Einfügung der Kirche in den Staat, sei Widerstand legitim, ja geboten. Ausserdem habe der Diener des Wortes Gottes die Möglichkeit, die weltliche Gewalt zu ermahnen, wenn sie auf dem Pfad der ‚unrechten‘ Obrigkeit wandle; die Kirche 707
«Memorandum an die Pfarrer der reformierten Kirchen der Schweiz», 24. 12. 1937 (die Autorschaft Barths blieb den Empfängern verborgen), in: Barth 2001, 52–64, Zit. 57. Barth erklärte auch in verschiedenen öffentlichen Vorträgen in Basel seine Sicht des deutschen Kirchenkampfes; über die Berichterstattung im «Kirchenblatt» und in den «Basler Nachrichten» ärgerte er sich oft. Vgl. Basler Jahrbuch, Chronik unter folgenden Daten: 31. 3. 1936 Anlass ungenannt: «Die Bekenntniskirche im heutigen Deutschland»; 3. 11. 1936 akademischer Vortrag: «Die Grundformen des theologischen Denkens»; 1. 12. 1936 Anlass ungenannt: «Die allgemeine kirchliche Bedeutung des deutschen Kirchenkampfes»; 23. 4. 1937 Vortragsabend der Metallarbeiter: «Der deutsche Kirchenkampf»; 16. 1. 1938 Anlass ungenannt: «Not und Verheissung des deutschen Kirchenkampfes»; 18. 12. 1938 öffentlich-populäre Vorträge: «Der Sinn des kirchlichen Fortschritts».
Theologische Argumente gegen den Nationalsozialismus
191
solle nicht schweigend dulden, sondern Unrecht und Ketzerei benennen: Dies wurde als das «Wächteramt» der Kirche gegenüber dem Staat verstanden. Am 30. Januar 1933 konnte Barth noch an Eduard Thurneysen über Adolf Hitler schreiben, er sei jetzt der Staatschef, «in dem wir nun fürs Erste die in ihrer Art gewiss auch von Gott gesetzte Obrigkeit zu verehren haben». Er machte bei öffentlichen Anlässen den Hitlergruss, aber nicht in seinen Lehrveranstaltungen, weil er diese als Gottesdienst auffasste. Er zeigte sich vorübergehend und taktisch auch bereit, den Eid auf Hitler abzulegen, sofern die Implikation akzeptiert würde (was eine Unmöglichkeit war), dass der Eid für den Christen nur insofern gelte, als sich der ‚Führer‘ als ‚rechte‘ Obrigkeit geriere.708 Interessant war dabei die Reaktion von Rudolf Bultmann. Er wies Barth darauf hin, dass ein solcher Vorbehalt den Eid hinfällig werden lasse und dass der Staat das nicht dulden könne. Zugleich aber differenzierte Bultmann: Ich kann die Sache nur so ansehen, dass der von Ihnen geforderte Vorbehalt allerdings für jeden Christen selbstverständlich ist, dass der Christ aber nicht den Staat auf diesen Vorbehalt verpflichten kann, sondern dass er im Konfliktfall auf sein unter diesem Vorbehalt übernommenes Amt verzichten muss. […] Sie können sich also denken, dass die Nachricht von Ihrem Verhalten für uns ein grosser Schrecken war, der auch durch Ihre Richtigstellung kaum vermindert wurde. Und je länger ich die Sache bedenke, desto mehr beklage ich Ihren Schritt […].709
1938 erwartete dann Barth, dass die deutschen protestantischen Pfarrer den von ihnen nun ebenfalls geforderten Eid auf Hitler verweigerten. Die Idee von 1934, den Eid mit einer «reservatio mentalis» zu verbinden, sei nun «objektiv hinfällig».710 Schon im Mai 1939, also noch vor Kriegsausbruch, stellte er für die Schweiz klar, dass der kommende Krieg nicht nur die Verteidigung der Neutralität verlange, sondern «die Verteidigung des rechten Staates (den wir uns in der Schweiz erhalten wollen) gegen dessen Umsturz, gegen die ‚Revolution des Nihilismus‘». «Dafür eintretend, kann man dem Tode und – was schlimmer ist, dem Tötenmüssen entgegensehen.»711 Gegenüber Ausländern, die in die Lage kommen konnten, für ihr Land, das gegen die Hitlerdiktatur kämpfen werde, ins Feld zu ziehen, hielt er pazifistische Predigten für verfehlt. Im November 1939 präzisierte er in diesem Zusammenhang: «Kein einzelner Staat ist ganz und gar ‚rechter‘ Staat, wie auch keiner (auch nicht Hitler-Deutschland) ein ganz und gar ‚unrechter‘ Staat.» «Man wird also den Staat nicht in globo, sondern auf seine einzelnen 708 709 710 711
Busch 1975, 270. Barth an Bultmann, Nr. 84, 27. 11. 1934; Bultmann an Barth, Nr. 85, 3. 12. 1934, in: Barth/ Bultmann 1971, 155, 156 f. «Brief an die Bekennende Kirche in Deutschland», 18. 5. 1938, in: Barth 2001, 84–92. Barth in der NZZ vom 3. 5. 1939, in: Barth 2001, 183.
192
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
konkreten Entscheidungen anzusehen und ihnen gegenüber sich zu fragen haben, ob er sich in ihnen als der (Röm. 13,1) von Gott eingesetzte (objektiv für die Freiheit des Wortes von der Rechtfertigung sorgende!) Staat bewährt und betätigt oder nicht.» «Selbstverständlich wäre eine Kirche, die sich zu einem Tempel der Demokratie machen lassen würde, ebenso schlimm, wie es die deutsche Kirche als Tempel der Volkstums- und Führerideologie weithin geworden ist.»712 Schon im Dezember 1934 hatte sich Barth zur Landesverteidigung bekannt. Die schweizerischen Antimilitaristen dürften auf keinen Fall mit seiner Unterstützung rechnen. Es brauche eine starke Armee, «die barbarische Einbrüche zu verhindern weiss».713 Barth wurde 1940 Gründungsmitglied des Bundes Nationaler Widerstand, zusammen mit Hans Hausamann, August Lindt, Hans Oprecht und anderen.714 Der Widerstand gegen die unrechte Obrigkeit gehe von der Gemeinde oder der Kirche aus und verteidige diese in ihrem richtigen Verhältnis zu Gott; er war damit nicht «politisch» motiviert, auch wenn er politische Dimensionen und Wirkungen annehmen konnte, vor allem aus der Perspektive derer, die die fundamentale christliche Motivation nicht sahen oder ihre Grundlagen nicht teilten.715 In diesen Zusammenhang gehörten Barths Fürbitten für Völker, die sich gegen Unterdrückung zur Wehr setzten. Er hätte 1938 auch einen bewaffneten Widerstand der Tschechen gegen Hitlers Ansprüche begrüsst: «Jeder tschechische Soldat, der dann streitet und leidet, wird es auch für uns – und, ich sage es heute ohne Vorbehalt: er wird es auch für die Kirche Jesu Christi tun, die in dem Dunstkreis der Hitler und Mussolini nur entweder der Lächerlichkeit oder der Ausrottung verfallen kann.»716 Die mehrheitlich patriotischen deutschen Theologen, auch solche, die Barth im Glauben nahestanden, verurteilten diese Worte.717 Für Barth waren Völker wie die Finnen Kräfte, deren Kampf durch die Kirche zu unterstützen sei. So betete er: «Wir bitten dich, dass […] aller Tyrannei und Unordnung gewehrt und allen unterdrückten Völkern und Personen zu ihrem Recht geholfen werde. Wir bitten dich für das Volk von Finnland in seiner grossen Gefahr.»718 Oder «[…] für die unterdrückten und bedrängten Völker, insbesondere
712
713 714 715 716 717 718
Mit diesen Argumenten riet er einem Pfarrer in Canada im November 1939 davon ab, «pazifistisch» zu predigen. Brief an Arthur C. Cochrane, 18. 11. 1939, in: Barth 2001, 187– 195, Zit. 194 f. Barth an Thurneysen, 24./26. 12. 1934, in: Barth/Thurneysen 2000, 792–813. Barth 2001, 252 f., 7. 9. 1940. Barths Überlegungen über den Rechtsstaat und die Demokratie: Tietz 2019, 292–294. Barth an Josef L. Hromádka, Prag, 19. 9. 1938, in: Barth 2001, 113–115. Kontexte und Wirkungen: Tietz 2019, 285–289 Barth 2001, 129. Predigt über Matthäus 21, 1–17, 10. 3. 1940, St. Jakobskirche Basel, in: Barth 1996, 182– 193, Zit. 193.
Theologische Argumente gegen den Nationalsozialismus
193
für das englische und griechische: dass ihnen der Mut und die Kraft zu gutem Widerstand erhalten bleibe».719 Barth war nie darauf aus, dem Kirchenvolk Respekt vor den Behörden einzureden. Im Basler Münster kritisierte er 1943 offen die Rede von Bundesrat Pilet-Golaz von 1940, indem er gezielt über denjenigen Text predigte, den der Bundesrat damals anzitiert hatte: «Es ist Wahrheit in Jesus: dass ihr – im Gegensatz zu eurem früheren Wandel – ablegen sollt den alten Menschen, der an der betrügerischen Begierde zugrunde geht, dagegen euch erneuert durch den Geist in eurem inneren Wesen und anzieht den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit» etc. (Epheser 4,21b–32). Bei der Lesung dieser Stelle gehe ihm «eine Rede durch den Kopf […], die wir vor einigen Jahren in gefährlicher Stunde von höchster Stelle unseres Landes haben hören müssen und in welcher von diesen Worten ein sehr bedauerlicher Gebrauch gemacht worden ist. Uns ist damals gesagt worden, dass wir als den neuen Menschen das anziehen sollen, was wir nach dem, was wir in unserem Text hören, gerade ablegen sollen als den alten Menschen. Nebenbei bemerkt: so geht es, wenn man mutwillig die Bibel zitiert […]. Wollte Gott, jene Rede könnte auch in der Schweizer Geschichte ganz und gar vergessen werden!»720 4.3.4 Der staatliche Totalitarismus Der totalitäre Staat kannte keine Grenze zwischen sich und der Kirche. Sein Verhältnis zu ihr war für die Zeitgenossen aufschlussreich, da es auf alle anderen Gebiete, einschliesslich des Rechts und der Selbstbestimmung des Individuums, ein Schlaglicht warf. Die unmittelbaren Kenner der deutschen Verhältnisse wie Barth, Schmidt, Lieb oder Vischer konnten dies leichter wahrnehmen als die Schweizer, die nur von Ferne oder gar mit partieller Sympathie beobachteten. Es erstaunt deshalb nicht, dass das Verhältnis zwischen Kirche und Staat vielfach auch Gegenstand der Lehre an der Universität Basel geworden ist.721 Barths Eidverweigerung war die Folge seiner Erkenntnis, dass Hitlers Staat kein Staat wie jeder andere war, sondern mit einem neuen totalitären Anspruch 719 720
721
Predigt über Psalm 46, 5–8, 3. 11. 1940, Safenwil, in: Barth 1996, 216–223, Zit. 223. Predigt vom 31. 10. 1943, Basler Münster, in: Barth 1996, 283–293. Barth äusserte sich schon fünf Tage nach der Rede kritisch in seinem Vortrag «Der Dienst der Kirche an der Heimat» (gedruckt 1940). Tietz 2019, 305. Bsp. aus StABS UA AA2 Lektionskataloge/Vorlesungsverzeichnisse: Sommer 1938 Fritz Lieb: «Theologiegeschichtliche Übungen: Das Verhältnis von Kirche und Staat» (wiederholt im Winter 1942/43); Sommer 1939 Karl Barth: «Systematisches Seminar: Der Staat als theologisches Problem»; Sommer 1939 Oscar Cullmann: «Kirche und Staat im ältesten Christentum»; Winter 1944/45 Alfred de Quervain: «Der Staat als theologisches Problem».
194
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
auftrat, dem der Bürger oder in diesem Fall der Beamte als Professor bedingungslos ausgeliefert war. Die Position Barths hatte den Vorteil, dass er den Totalitätsanspruch im Unterschied zu vielen Zeitgenossen beim Wort nehmen konnte und so einen Grundzug des Regimes und seiner Ideologie früh und klar erkannte, mit dem keine Kompromisse möglich waren. Dies wurde nicht nur von Basler Professorenkollegen, sondern auch von deutschen Pfarrern nicht immer verstanden, die den Totalitätsanspruch verharmlosten, sei es zum Zweck einer Deeskalierung und zur Rettung der Kirche als Institution, sei es weil sie glaubten, der Nationalsozialismus repräsentiere irgendwie die «Zukunft», der man sich anpassen müsse.722 Die Reaktionen auf die Einladungen zu deutschen Universitätsfeiern zeigten deutlich, wie wenig der Totalitarismus des NS-Staates in Basler Professorenkreisen begriffen worden war. Nur die antifaschistischen Politiker (darunter der Sozialdemokrat Fritz Hauser und der Freisinnige Ernst Thalmann) einerseits und Karl Barth andererseits erfassten ihn. Dessen Kollegen von der Universität vermochten ihm nicht zu folgen und wollten die Einladungen annehmen. Als Beispiel soll hier wieder Ernst Staehelin dienen. Er wollte zugunsten der zwischenmenschlichen Beziehungen den Kontakt mit Professoren in Deutschland möglichst lange aufrechterhalten, auch wenn er sich dafür an Veranstaltungen wiederfand, die der Propagierung des Nationalsozialismus dienten.723 Konsequent war, dass Staehelin bis zuletzt zu den Zusammenkünften der Professoren von Basel und Freiburg ging.724 Hellsichtig argumentierte Barth, dass infolge der Totalität des Parteistaates in Deutschland kein universitäres Leben mehr ausserhalb des Nationalsozialismus existierte, und dass eine Mitwirkung an einer deutschen Universitätsfeier immer bedeutete, dass man an einem nationalsozialistischen Akt teilnahm. Die Verläufe der Festlichkeiten sowohl in Heidelberg als auch in Göttingen gaben ihm Recht. 4.3.5 Christliche Anthropologie Die christliche Anthropologie verstand den Menschen als ein Wesen, das sich in seinen geistigen Aspekten, nicht in seinen fleischlichen, auf Gott beziehe. Die Würde des Menschen liege darin, dass er nach Gottes Bild geschaffen sei, und diese Eigenschaft als Geschöpf Gottes, das zu ihm beten dürfe, beziehe ihn (als Geistwesen) auf die Transzendenz. Alles Körperliche teile der Mensch mit dem Tier. Werde nun, wie es die nationalsozialistische Ideologie tue, der Mensch re722 723 724
Barth an Bultmann, 27. 2. 1934, in: Barth/Bultmann 1971, 144 ff., Nr. 78. StABS Protokoll S 4 Erziehungsrat Bd. 23, 1934–1936, 4. 5. 1936; StABS UA B 1 XIV Acta et Decreta 1934–1959 (Regenzprotokoll), 28. 4. 1937. UA Freiburg i. Br., B0001 317 Ohne Umschlagtitel, Inhalt Treffen Basel-Freiburg, ab 1924.
Theologische Argumente gegen den Nationalsozialismus
195
duziert auf seine Abstammung, auf Rasse und Körper, und werde er in diesen Aspekten zum Gegenstand einer Hochschätzung, verliere er seine Würde, und das Tierische in ihm gelte nun als das Wesentliche. Daraus folgte die Kritik an der Verherrlichung des deutschen Volkes in «gestählten» Körpern ebenso wie am Rassismus. Die «Selbstanbetung des deutschen Menschen», so erkannte Karl Barth, sollte im ‚Dritten Reich‘ den Glauben an Jesus ersetzen; die «Verherrlichung des deutschen Volkstums und die religiöse Ergebenheit gegenüber dem deutschen Führer» traten an die Stelle des Christentums.725 Deutlich fassbar wurde diese christlich-anthropologische Basis der Kritik am nationalsozialistischen Menschenbild bei Fritz Lieb. Ich paraphrasiere seine Ausführungen von 1938 im Zusammenhang, auch um zu zeigen, wie eng die Anthropologie mit verschiedenen Themen wie ‚Apokalypse‘ und ‚Antichrist‘ verflochten wurden. Lieb wählte als Ausgangspunkt die Offenbarung des Johannes 13: das Tier mit den zehn Hörnern. Er schrieb: «Wenn es je eine Pest gegeben hat, die die Menschheit mit Vernichtung bedrohte, so ist sie die nationalsozialistische Bewegung des Dritten Reiches.» Dann zog er über Alfred Rosenbergs Mythus des 20. Jahrhunderts (1930 publiziert) her. Dieser mache aus Pseudowissenschaft «eine furchtbare ideologische Waffe zur Eroberung Europas und zur Vernichtung aller geistigen Werte, die dieses Europa gross gemacht haben». Die Rasse war auch für Lieb das Tierische im Menschen. Die «völkische Pseudoreligion» sei «ein Produkt der Ausweglosigkeit und Lebensangst einer degenerierten Literatenschicht». Nietzsches «blonde Bestie» werde zum höchsten Wert verklärt. Rosenberg leugne zynisch die Gottebenbildlichkeit des Menschen. An die Stelle des «Wort-Anfangs» setzten die Nationalsozialisten einen «Blutanfang», den Gottmenschen Jesus ersetzten sie durch einen vergötterten Tiermenschen. So werde das Ziel der Menschheit ein Zurück in seine tierische Herkunft. Daraus folge die «totale Militarisierung». «Sadistische Grausamkeitsorgien in den Konzentrationslagern» seien die Folgen nihilistischer Menschenverachtung. Der Verlust der Geschichte verführe die Nationalsozialisten dazu, von einem «tausendjährigen Reich» zu sprechen. Die Eschatologie sei verlorengegangen und an deren Stelle trete die Selbstbehauptung des Blutes. Lieb verteidigte die Lehre der Erbsünde, die für ihn nicht primär mit Sexualität verknüpft war. «Das Volk, das Gott verloren hat und mit ihm seine eigene Humanität, d. h. selbst den ihm von Gott nach dem Sündenfall geschenkten und überlassenen ‚Acker‘, beginnt, durch die Wüste der Hoffnungslosigkeit, Angst und Verzweiflung gejagt, ermattet, wie seinerzeit das Volk Israel auf seinem Wüstenzuge, das goldene Kalb anzubeten.» Zum Schluss führte Lieb eine Stelle aus Wladimir Sergejewitsch Solowjow an: Das Antichristentum werde nicht als Unglaube oder Materialismus daherkommen, sondern als eine «religiöse Usurpation»; christusfeindliche Kräfte würden sich seines 725
«Memorandum an die Pfarrer der reformierten Kirchen der Schweiz», 24. 12. 1937, in: Barth 2001, 52–64, Zit. 57.
196
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
Namens bemächtigen. «Dieses Antichristentum nennt sich heute ‚positives Christentum‘ und sein Prophet heisst Alfred Rosenberg.»726 So verknüpfte Lieb das Bild vom aufkommenden Antichristen mit einer Kritik des Nationalsozialismus aus der Perspektive der christlichen Anthropologie. 4.3.6 Die apokalyptische Endzeiterwartung (Antichrist) und die Eschatologie Aus der Lektüre von Liebs Artikel ergibt sich bereits, dass die Epoche von 1933 bis 1945 von manchen Theologen real als Beginn einer Endzeit oder als die Endzeit selbst aufgefasst wurde. Nicht zufällig zitierte Lieb gleich eingangs die Offenbarung des Johannes. Der Antichrist war gekommen, es war eine verkehrte Welt mit verkehrten Begriffen und einem totalen Angriff auf die Kirche. Götzendienst hatte um sich gegriffen, und der Mensch begann, sich selbst an Gottes Stelle zu erheben. In dieser Zeit musste der Christ sich bewähren, radikal zu Gott halten, dem Evangelium gehorsam sein, seinen Glauben bekennen, ihn verbreiten und wo möglich auch andere bekehren. Es war eine derartige Haltung, die manche Theologen beflügelte. Durchaus glaubhaft ist, dass diese bereit gewesen wären, im Untergrund zu kämpfen und auch zu sterben, wie die christlichen Widerstandskämpfer z. B. in Frankreich. Zwar war auch die Erwartung des «kommenden Reiches Gottes» eschatologisch. «Arbeit am Reich Gottes» in der irdischen Welt galt als Aufgabe der Christen in der Endzeit, wie schon Albrecht Ritschl gelehrt hatte. Aber wie wir bei Staehelin gesehen haben, inspirierte die Erwartung in dieser Form eher eine vermittelnde Haltung, weil viele menschliche Werte sich vor der Frage relativierten, ob eine Position auf Gott baue oder nicht. Die Eschatologie verlor durch diese Akzentsetzung teilweise an radikalisierender Sprengkraft, die sie bei Lieb offensichtlich hatte. Politisch waren somit die Auswirkungen einer Endzeiterwartung verschieden. Aber in jedem Fall hatte der Grund der Taten und Worte nichts mit ‚Politik‘ zu tun – was wiederum unterschiedlich verstanden werden konnte, im Sinne einer vorsichtigen (‚unpolitischen‘) Zurückhaltung gegenüber dem ‚Dritten Reich‘ oder im Sinne einer kompromisslosen Gegnerschaft. So waren die Worte Barths zu verstehen, der – manchmal gegen Schmidt und Lieb – das Amt des Pfarrers wie dasjenige des Theologen als in seinem Wesen unpolitisch definierte: «Die politische Entscheidung als solche und für sich genommen ist nicht die christliche. Sie darf also in der kirchlichen Verkündigung keinen Augenblick so sichtbar werden, als ginge es um sie an sich und als solche, statt ganz allein um den konkreten Gehorsam gegen das Evangelium.»727 726 727
Lieb 1938, 90–110. Vgl. die Ausführungen von Heinrich Barth zur selben Thematik, unten, Kapitel 7.1.4. «An die ehemaligen Schüler in der Bekennenden Kirche in Deutschland», 10. 5. 1937, in: Barth 2001, 40–46, Zit. 43 f.
Theologische Argumente gegen den Nationalsozialismus
197
4.3.7 Christen und Juden: Auserwähltes Volk, die Gemeinde («Kirche»), die «Nächsten» und Formen des Antisemitismus Zunächst möchte ich die Ausführungen zum Thema ‚Christen und Juden‘ in die damalige Zeit hineinstellen. Wer die entsprechenden Zeugnisse liest, sollte sich vergegenwärtigen, dass gewisse Spielarten des Antisemitismus im bürgerlichen Deutschland wie in der bürgerlichen Schweiz allgegenwärtig waren. Der Unterschied zum Antisemitismus der Nationalsozialisten bestand ‚nur‘ darin, dass diese aktiv zunächst die soziale, kulturelle und wirtschaftliche, danach konkret die physische Liquidierung der Juden betrieben. Im üblichen reformierten Gemeindeleben, das von der Hegemonie des Bürgertums geprägt war und seiner Selbstdarstellung wie der Disziplinierung unterer Klassen diente, war Antisemitismus so geläufig wie in anderen Lebensbereichen. So dachten zwar auch Basler Liberale antisemitisch, aber sie deklarierten einen grossen Unterschied zwischen ihrer Haltung und dem Antisemitismus der Nationalsozialisten, den sie publizistisch bekämpften. Jacques Picard728 führte dafür den Begriff «verschweizerter Antisemitismus» ein. Man teilte die Vorstellung, Juden seien fremdartig hinsichtlich ihrer Kultur oder gar ihrer Biologie und sie strebten nach Weltherrschaft. Wegen der Bedrohung durch die Nationalsozialisten, mit denen man nicht verwechselt werden wollte, traten diese antisemitischen Elemente jedoch nur abgeschwächt und diskret auf. Aber auf ‚leise‘ Art sollte der jüdische Anteil der Bevölkerung auch ausserhalb von Deutschland klein gehalten werden. Die eigene Judenfeindlichkeit wurde oft verdeckt als Abwehr der angeblichen «Überfremdung» praktiziert, die dann in erster Linie die Juden traf. Hinzu kam das weitverbreitete Argument, der ‚leise‘ Antisemitismus (Karl Barth nannte ihn «bodenständig»)729 und die Massnahmen, mit denen die jüdische Präsenz in der Schweiz klein gehalten werden sollte, diene der Abwehr eines aggressiven Antisemitismus in der Schweiz und damit dem Schutz der Juden.730 Traditionelle theologische Gründe schienen in gängigen Auffassungen für den Antisemitismus zu sprechen. Die Juden hatten den Messias nicht als solchen erkannt, sie hatten ihn umbringen lassen. Die Synagoge war ‚blind‘, die Kirche triumphierend. Die Juden waren in alle Welt zerstreut, und in vielen Weltgegenden waren sie offener Verfolgung und Unterdrückung ausgesetzt – Strafe Gottes?731 So war es bemerkenswert, dass evangelische Theologen diese scheinbaren Selbstverständlichkeiten infrage stellten. Sie zogen sich damit nicht nur den Hass säkularisierter Antisemiten zu, sondern auch die Ablehnung von Teilen des Kirchenvolks. Dabei muss die Art, wie die Theologen damals ihre Fragen stellten, 728 729 730 731
Picard 1994. Tietz 2019, 296. Zu den verschiedenen Formen des Antisemitismus: Sibold 2010, 37 f., 52. Metzger 2017.
198
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
nicht als vorbildlich gelten, es genügt zu sehen, dass sie mutig gegen Zeitgeist und Tradition auftraten und dazu beitrugen, Diskriminierung, Verfolgung und Ermordung der Juden als unevangelisch, unchristlich zu erweisen. Karl Barth wurde schon vorgeworfen, dass er sich zu Beginn der Auseinandersetzung mit den Nationalsozialisten und den Deutschen Christen mehr auf die Verteidigung der Kirche gegen den Totalitarismus des NS-Staates konzentrierte, als sich der Juden anzunehmen.732 Dabei war es für ihn selbstverständlich und wichtig, dass Christus Jude war und die frühe Gemeinde aus Juden und Griechen zusammengesetzt war. Ein «Arierparagraph» hatte in der Kirche nichts zu suchen. Aber es wird angenommen, dass Barth, solange er sich in Deutschland noch eine Wirksamkeit versprach, aus taktischen Gründen keinen frontalen Angriff auf den Antisemitismus führen wollte. Nach Klaus Wengst hat Karl Barth das den Juden angetane Unrecht klar als solches wahrgenommen. Aber er habe sich dazu (in Deutschland) nicht öffentlich geäussert, obwohl er 1933 zweimal dringend darum gebeten worden war. Beide Male argumentierte er zunächst damit, dass eine solche Initiative aussichtslos sei und dass sie zur Folge haben könnte, dass seine Handlungsmöglichkeiten dadurch noch weiter beschränkt würden, denn man wisse, «wie unerbittlich die Nationalsozialisten […] gerade in der Judenfrage keine Konzession zu machen entschlossen sind». In der Barmer theologischen Erklärung kam das Thema ‚Juden‘ tatsächlich nicht vor; es wurde an den Bruderrat delegiert. Auch Karl Ludwig Schmidts Anregung an Barth von 1933 hatte damals keine unmittelbare Wirkung erzielt: «Im übrigen aber sollten wir Universitätsprofessoren uns aber allen Ernstes überlegen, ob wir uns nicht mit den jüdischen Kollegen, die nun als Juden abgesetzt werden, solidarisch erklären müssen.»733 Ab 1935 setzte sich Barth öffentlich für Flüchtlinge734 und spätestens ab 1938 für die verfolgten Juden ein.735 Wie schon erwähnt, präsidierte er die Basler Gruppe, die sich mit der Unterstützung von (meist jüdischen) Kollegen befasste, die Deutschland verlassen mussten. Am Schluss des Gottesdienstes nach der Feier zur Eröffnung des Basler Kollegiengebäudes 1939 sagte Barth in der Fürbitte: «Wir bitten Dich [Gott] insbesondere für die Kirche, die in der Versu732
733 734
735
Kritisch bis polemisch: Wengst 2014; Kalinna 2009; Kraft 1982. Mit grossem Verständnis für Barths Position: Busch 2005. Für die Zeit nach der Übersiedlung nach Basel: Tietz 2019, 255; Beintker/Link/Trowitzsch 2010. Wengst 2014, 16. Bsp. aus Basler Jahrbuch, Chronik zum 4. 12. 1935. Verschiedene Hilfswerke veranstalteten einen Vortragsabend zur Flüchtlingsnot, mit Pfr. Alphons Koechlin (Kirchenratspräsident), Regierungsrat Carl Ludwig, Hochkommissar für Flüchtlinge J. MacDonald, Dr. Hanna Eisler, Germaine Melon und Karl Barth. Einschlägig war Barths Rede an der Wipkinger Tagung von 1938 über «Die Kirche und die politische Frage von heute» mit der Aussage: «Antisemitismus ist Sünde gegen den Heiligen Geist. Denn Antisemitismus heisst Verwerfung der Gnade Gottes». Zitiert nach Tietz 2019, 295 f.
Theologische Argumente gegen den Nationalsozialismus
199
chung, in der Verfolgung und in der Unterdrückung steht, und für dein bedrängtes Volk Israel in aller Welt».736 1942 führte er Gespräche mit Rothmund und General Henri Guisan wegen der Grenzschliessung für Flüchtlinge. In einem Thesenpapier formulierte er im Oktober 1942: «Die Flüchtlinge gehen uns an […] nicht obwohl sie Juden, sondern gerade weil sie Juden und als solche des Heilands leibliche Brüder sind». Das war nach Barth der «christliche Grund» für die Flüchtlingshilfe. Als «schweizerischen Grund» führte er an: «Man wird aber noch nach Jahrhunderten davon reden, ob die Schweiz ihren Namen als die freie Schweiz in diesen Tagen bestätigt oder verleugnet hat.»737 Karl Ludwig Schmidt war ein Beispiel unter vielen, wie eine private antisemitische Haltung neben (für seine Zeit aufregenden) Argumenten für eine positive (wenn auch begrenzte) Bewertung des Judentums stand. 1936 beurteilte er z. B. seinen Kollegen Werner Georg Kümmel, von 1932 bis 1950 Neutestamentler in Zürich, von dem er erfahren hatte, dass er jüdische Vorfahren hatte, negativ nach dessen «jüdischer Abstammung».738 Im Januar 1933 hatte Schmidt jedoch geschrieben, die Diffamierung der Juden zeige, dass die Hitlerregierung unchristlich sei. Bultmann erklärte er, dass er und Barth der Meinung seien, man müsse aus der Kirche austreten, wenn diese die ‚Judenchristen‘ hintansetzen oder gar ausschliessen wolle. Schmidt respektierte Martin Buber und Hans Jonas. Am 14. Januar 1933 führte er ein öffentliches «Zwiegespräch» mit Buber. Darin setzte er den neutestamentlichen Begriff «Israel» mit der «Kirche» gleich und hielt daran fest, dass es Aufgabe der Christen sei, auch die Juden zu bekehren. Zudem setzte Schmidt voraus, dass zwar «rassische» Unterschiede zwischen Juden und anderen Menschen eine Tatsache seien, aber er beklagte, dass 1933 nur noch der «rassische» Aspekt im Vordergrund stehe. Das war sicher nicht ein Bruch mit der christlichen Tradition oder der gängigen pseudowissenschaftlichen Überzeugung,739 aber es galt in der damaligen Zeit als Provokation. Denn zu seiner Überraschung stand Schmidt damit ziemlich alleine da.740 Schmidt beteiligte sich dann an der Erklärung gegen den Arierparagraphen in der Kirche, die Bultmann und andere aufgesetzt hatten.741 In seinem Berner Vortrag von 1933 berührte Schmidt diese Frage ebenfalls: Nach einer langen Darstellung von Ergebnissen seiner philologischen Arbeit an den Evangelien des 736
737 738 739 740 741
Predigt «Der Grund unseres Bauens» über 1. Korinther 3, 11, 11. 6. 1939, Martinskirche Basel, in: Barth 1996, 162–172. Es war ein theologisches Problem, ob «Volk Israel» an dieser Stelle mit den Juden zu identifizieren sei, vgl. unten zur Diskussion über den Begriff «neues» oder «altes Israel». Wie Barth seine Thesen verwendet hat, ist unklar. Barth 2001, 356 f. Mühling 1997, 8. Kuschel 2015 betont, dass Schmidt als Amtsträger der evangelischen Kirche zu Buber sprach und deshalb die etablierten Positionen der christlichen Kirche vertrat. Mühling 1997, 134 f. Abgedruckt im Kirchenblatt für die reformierte Schweiz vom 5. 10. 1933, 319.
200
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
Matthäus, Lukas und Markus teilte er seinen Zuhörern mit, dass es keinen Autarkieanspruch der einzelnen Völker geben könne. Die Deutschen Christen bezeichnete er als «gefährliche» Häretiker. Er wiederholte schliesslich seine im Gespräch mit Martin Buber vertretene Ansicht, die «Judenfrage» sei kein «Rassenproblem», sondern «die Frage nach Israel».742 Eine der ersten Lehrveranstaltungen, die Schmidt in Basel abhielt, galt dem Thema «Judenchristentum und Heidenchristentum» (Sommer 1936). Im Sommer 1939 behandelte er «Israel und Judentum im Neuen Testament» (im Winter 1942/43 wiederholt als «Israel und Judentum im Neuen Bund. Exegetisch und dogmatisch»).743 Im November 1942 referierte Schmidt in Wipkingen über «Die Judenfrage im Lichte der Kapitel 9– 11 des Römerbriefes». Hier kritisierte er nun die Verwendung des Wortes «Jude» als «Rassenbezeichnung» radikaler. «Judentum» sei ein Begriff für ein verstocktes Verhalten, das alle, auch Christen, zeigen könnten. «Israel» bedeute die «geistlich-göttliche Erwählung eines Volkes» jenseits von Rasse oder Geschichte und unabhängig von biologisch oder kulturell erworbenen Eigenschaften. «Hebräer» sei demgegenüber die Bezeichnung eines Volkes oder einer «Rasse» auf der physischen Ebene. Und er stellte den Zionismus, für den er kein Verständnis hatte, auf eine Stufe mit den Deutschen Christen. Israels Erwählung sei zwar bleibend (d. h. Gott halte an seinem auserwählten Volk auch nach der Verkennung des wahren Messias fest), aber der neue Bund sei danach der wahre Bund, d. h. die christliche Kirche. Bemerkenswert ist dabei, dass Schmidt auch das «verstockte» (historisch-reale) Judentum als «Israel» betrachtete, nicht nur das sogenannte «geistige Israel». Die Antisemiten bezeichnete er als «Antijuden». Wer die antijüdische Haltung toleriere, missachte die «Dauerbedeutung des Judentums» und damit Gottes eigenen Ratschluss.744 Man sieht also, wie Schmidt auf einer sehr traditionsgebundenen und nach heutigen Begriffen teilweise antisemitischen Argumentationsschiene zum dezidierten Resultat gelangte, dass eine antijüdische Einstellung und Aktion mit dem Christentum schlicht unvereinbar seien. Wilhelm Vischer gilt als einer derjenigen, die sich aus biblischer Sicht besonders eingehend mit dem Verhältnis der Christen zu den Juden befasst haben. Seine Position verunmöglichte ein Verbleiben in Deutschland; und er meldete sich in der Schweiz mit seinen Überlegungen an prominenter Stelle nochmals zu Wort. In der Bibel, die für den «Entdeckungsreisenden»745 integral Gottes Wort darstelle, sah er eine zusammenhängende Botschaft, in deren Mittelpunkt die Erwartung des Messias und die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus stand. Die Geschichte der Juden (das Alte Testament) betrachtete er so als gleichwertig mit
742 743 744 745
Kirchenblatt für die reformierte Schweiz 1933, 407. StABS UA AA2 Lektionskataloge/Vorlesungsverzeichnisse. Mühling 1997, 199 f. Smend 2017a, 780.
Theologische Argumente gegen den Nationalsozialismus
201
dem Neuen Testament.746 Ausgehend von Barths Sätzen in Theologische Existenz heute! formulierte Vischer für Bethel im August 1933 zehn Thesen in einem Artikel über «Die Kirche und die Juden». Fünf davon galten den Juden innerhalb der Kirche, worin er Barth auslegte. Die übrigen fünf Thesen behandelten die Juden ausserhalb der Kirche. In ihnen erkannte er einen «heiligen Rest», der weder durch Assimilation noch durch zionistische Nationswerdung oder durch «pharaonische Massnahmen ausgerottet» werden könne; darin sah er den «character idelebilis des auserwählten Volkes».747 So griff er die ironische Formulierung aus seinem Vortrag vom 30. April 1933 auf: «Wenn die geistige Berührung mit Semitenstämmlingen zersetzend wirkt auf Deutsche, wie können dann die Bücher des Neuen Testaments noch die Heilige Schrift der Deutschen Christen sein?» Vischer zeigte sich hier als Erwählungstheologe, der an der «Politik Gottes» mit Israel interessiert war.748 Wie andere Exegeten las Vischer im Neuen Testament, dass die ersten christlichen Gemeinden aus Juden und «Griechen» zusammengesetzt waren, und dass Paulus keiner der beiden Gruppen einen Vorrang zugestanden hatte. Barth hatte in seiner Theologischen Existenz heute mit Blick auf die ‚Judenchristen‘ formuliert: «Die Gemeinschaft der zur Kirche Gehörigen wird nicht durch das Blut und also auch nicht durch die Rasse, sondern durch den heiligen Geist und durch die Taufe bestimmt.»749 Unter diesen Voraussetzungen betrachtete auch Vischer einen Ausschluss der Juden aus den christlichen Gemeinden oder aus dem Pfarramt, wie ihn die Deutschen Christen anstrebten, als ketzerisch. Während Vischer mit Schmidt überzeugt war, dass die Juden dadurch, dass sie in Jesus nicht den Messias erkannt hatten, ihre Auserwähltheit durch Gott nicht verloren hätten,750 so war er in den 1930er Jahren doch der Ansicht, dass die Juden schliesslich (aber erst am Ende der Tage) zu Christen werden würden. Bevor erkennbar wurde, dass die Nationalsozialisten ernsthaft die physische Vernichtung der Juden betrieben, sah er in der Geschichte der Vertreibung und Verfolgung der Juden einen Sinn, den er in seiner Basler Antrittsvorlesung vom 27. Januar 1937 über das Buch Esther zum Ausdruck brachte. Die «Judenfrage» sei eine «offene Wunde am Leibe der Menschheit, die sich erst dann ganz schliesst, wenn die Juden in völliger Umkehr glauben und bekennen, dass Gott Jesus, den sie den Heiden zur Kreuzigung übergeben haben, zum Christus und
746 747 748 749 750
Smend 2017a, 784 f. Zitiert nach Smend 2017a, 782. Smend 2017a, 783. Barth 2013, Vorträge und kleinere Arbeiten 1930–1933, 327, zitiert nach Smend 2017a, 782. 1942 stritt Vischer mit Barth und Thurneysen gegen Brunner und Zimmerli für die These, dass die Juden auch als Nicht-Christen von Gott bleibend erwählt seien. Smend 2017a, 789.
202
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
Herrn gemacht hat». Damit brachte er eine damals gängige theologische Überzeugung zum Ausdruck. Andererseits sagte Vischer sehr deutlich, dass es ohne Juden kein Christentum gebe und dass ein Christentum ohne das Alte Testament und damit ohne die Juden nicht zu haben sei. Er selbst sah in seinen Ausführungen überhaupt keine antisemitische Tendenz. «L’unité de deux Testaments […] stipule ‚la solidarité‘ des Chrétiens avec les Juifs dans la lecture de la Bible et, par cette lecture commune, elle leur atteste et les fait vivre leur solidarité existentielle.»751 Ähnliche Voraussetzungen finden sich in seiner Schrift Das Heil kommt von den Juden von 1938, die er für die Subkommission zur Hilfe für nichtarische Christen des Schweizerischen Hilfswerks für die Bekennende Kirche in Deutschland verfasste.752 Vischer betonte die Ausschaltung der Juden und ‚Judenchristen‘ aus dem wirtschaftlichen und sozialen Leben in Deutschland: ihnen bleibe dort nur das KZ oder die Auswanderung. Er beklagte ferner einen zunehmenden Antisemitismus unter Christen. Auch innerhalb der Kirche würden ‚Judenchristen‘ drangsaliert. Für Vischer ergab sich das «spezifisch Jüdische» aus der Erwählung der Juden als Volk Gottes, wie er schon 1933 ausgeführt hatte. Die Kirche war ein neues Israel, bestehend aus allen Völkern. Gott erhalte aber das alte Israel weiter «als Zeichen der Freiheit seiner Gnade». Das aber sei der Welt ein Ärgernis. Der Antisemitismus greife «direkter als jeder Menschenhass die Humanität an der Wurzel» an. Da Gott mit Israel barmherzig verfahre, verbietet sich den Menschen jeder Hass auf die Juden. Nur wer sich «in Solidarität mit den Juden […] schuldig am Tod Jesu» bekenne, habe Anteil an der Vergebung Jesu Christi. Vischer sah den «tiefsten Grund» für die Bewahrung des Judentums auch in dieser Schrift in der endzeitlichen Umkehr Israels zu Jesus Christus, diese werde die letzte erlösende Wendung der Weltgeschichte sein. Dies meinte er mit dem Wort «das Heil kommt von den Juden» (in Anlehnung an Johannes 4,22). Die Bedeutung der Judenmission relativierte er konsequent: Nach Römer 11,25 müsste zuerst die Masse der Heiden umkehren, und diese würden dann die Eifersucht Israels erregen. Juden könnten aber nicht eifersüchtig sein auf eine «Christenheit, die gar nicht christlich ist». Am Schluss forderte er die vollständige kirchliche Integration der ‚Judenchristen‘. Dieser Versuch wirkt heute zwiespältig, da er der Tradition verhaftet und einer bestimmten Auslegung der Schrift verpflichtet blieb. Die Juden betrachtete Vischer als die Mörder des Heilands, die Gott «dem Mutwillen und der Wut der Heiden» preisgegeben habe – auch wenn er die Auserwählung nicht widerrufen habe. Auch hier blieb die Position ambivalent, sie genügte aber wie bei Schmidt und Barth, um damals auf der einen Seite Widerspruch und Verärgerung zu pro-
751 752
Zit. nach Smend 2017a, 789 f. Smend 2017a, 789. Interpretation dieser Schrift u. a. bei: Kocher 1996, 114–116, 438.
Der Einsatz für Verfolgte und Flüchtlinge
203
vozieren und auf der andern Seite die Hilfe von Christen für Juden theologisch zu legitimieren.
4.4 Der Einsatz für Verfolgte und Flüchtlinge In der akademischen Welt zeigte sich das Engagement für Verfolgte und Flüchtlinge zunächst auf der Ebene individueller Kontakte. In Deutschland bedrohte Universitätslehrer wandten sich ab 1933 an ihnen bekannte Schweizer, um zu erfragen, ob es für sie in Basel oder anderswo die Möglichkeit gebe, durch Übernahme einer Lehrtätigkeit der deutschen Diktatur zu entkommen. In Konferenzen zwischen den relevanten Gremien einigte man sich im Mai 1933 auf eine Linie, die eher restriktiv zu nennen ist.753 Anfragen sollten gesammelt werden, eine Übersicht sei zu erstellen. Im Grundsatz galt die Maxime, dass die öffentlichen Basler Finanzen keine Hilfsaktionen gestatteten, dass aber bei hervorragenden Wissenschaftlern zu prüfen sei, ob für sie eine Ausnahme möglich wäre. Dabei gingen die Ansichten in den Fakultäten und diejenigen in der Kuratel und im Erziehungsdepartement auseinander. Die Fakultäten wollten einen Vorrang für ihren eigenen Schweizer Nachwuchs durchsetzen, ausgenommen Fälle, in denen ein einflussreiches Mitglied hervorragende deutsche Kandidaten favorisierte. Geholfen werden sollte deutschen Kollegen dann, wenn diese unbestritten exzellent waren und eine Professur auf regulärem Weg durch sie besetzt werden konnte. Ansonsten sollte sich die Hilfe darauf beschränken, den Verfolgten die Weiterreise zu ermöglichen. Nach 1936 kam erschwerend hinzu, dass nun auch die Politik, die zunächst etwas grosszügiger als die Universität helfen wollte, in ideologisch relevanten Fächern keine deutschen Bewerber mehr berücksichtigen mochte, seien sie nun oppositionell oder hitlerfreundlich. Denn die Kuratel befürchtete Komplikationen: Bekannte Regimekritiker liessen Probleme im diplomatischen Verhältnis zu Deutschland erwarten (und sorgten für Spannungen zwischen Basel und Bundesbern), Freunde des NS-Regimes wurden von der Basler Öffentlichkeit abgelehnt und schadeten so dem lokalen Ruf der Universität. Und man wollte Konflikte innerhalb der Universität zwischen Befürwortern und Gegnern des Nationalsozialismus vermeiden. Schliesslich spielte der «verschweizerte Antisemitismus» hinein: Man hatte nichts gegen die Juden, befürchtete aber, dass die Basler Universität für einen hohen Judenanteil bekannt werde – was angeblich den lokalen Antisemitismus fördern könnte.754 Hingegen wurde in Zürich eine Aktion aufgezogen, die verfolgten deutschen Kollegen (und damit mehrheitlich jüdischen Gelehrten) helfen sollte, allerdings 753 754
Sibold 2010, 242. Sibold 2010, 59, 229.
204
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
nicht durch Vermittlung von akademischen Positionen in der Schweiz, sondern nach dem auch für andere Flüchtlinge geltenden Grundsatz einer Unterstützung für einen vorübergehenden Aufenthalt in der Schweiz und einer Beihilfe zur Weiterreise. In der Basler Professorenschaft fand dieses Schweizerische Hilfswerk für deutsche Gelehrte wenig Anklang. Der Psychiater John Staehelin lehnte einen weitergehenden Einsatz für dieses Projekt mit der Begründung ab, dass ihm dies in der Basler Öffentlichkeit Feindschaften eintrüge und seine Beziehungen zu deutschen Verlagen und Zeitschriften beeinträchtigen könnte. Für bürgerliche Professoren war es ferner nachteilig, dass die Zürcher Aktion wesentlich von Hans Oprecht getragen wurde, der der sozialdemokratischen Partei angehörte, eine führende Rolle in der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes (VPOD) spielte und im Nationalrat sass.755 Zudem war Hans Mühlestein, für viele ein ‚rotes Tuch‘ und als Wissenschaftler in Basel verfemt, zu Beginn Sekretär der Organisation. Der Chef des Erziehungsdepartements, Fritz Hauser, Nationalrats-, Parteiund Gewerkschaftskollege von Oprecht, übernahm zunächst persönlich die Verantwortung für die Basler Organisation. Zu seiner Entlastung versuchte er mehrmals, einzelnen Professoren ins Gewissen zu reden, ohne Erfolg, bis ihm schliesslich 1935 Karl Barth zusagte.756 Über den genauen Umfang von Barths Tätigkeit sind wir nicht informiert, aber noch 1944 verdankte er eine Spende des Kunsthistorikers Joseph Gantner (Quittung in dessen Nachlass). Die Beziehungen zur Zürcher Zentrale von Oprecht, dem Barth nach Hausers Meinung Rechenschaft ablegen sollte, scheinen anfangs nicht sehr gut gewesen zu sein. 1937 vergass Oprecht sogar, Barth als Basler Delegierten an die Generalversammlung in Zürich einzuladen. Aber erhaltene Listen für 1937 zeigen, dass mehrere Persönlichkeiten Zuwendungen erhielten. Für Basel verbuchte Barth unter den Einnahmen den Reingewinn aus einem Vortrag, den er selbst gehalten hatte, mit Fr. 330, ferner den Zuschuss von der Zentrale in Zürich ebenfalls mit Fr. 330, sowie Spenden im Umfang von Fr. 160. Unter den Ausgaben verzeichnete Barth Beiträge an Dr. (Carl Hanns) Pollog (Verkehrsgeograph) 340 Franken, Dr. Bernfeld (der marxistische Psychoanalytiker und Jugendpsychologe Siegfried Bernfeld) 180 Franken, Dr. Emmerich 50 Franken, Dr. Berger 40 Franken, Dr. (August) Sänger (Saenger, Frankfurter Jurist) 150 Franken, Dr. May 25 Franken, Ing. Weyland 15 Franken, Hanns Knieling 40 Franken, die Allgemeine Flüchtlingsstelle 25 Franken, Hofheinz 40 Franken, Paul Hütt 30 Franken.757
755 756 757
Bürgi 2010. Busch 1975, 284. Sibold 2010, 241. StABS Erziehung X 48, Schweizerisches Hilfswerk für deutsche Gelehrte, 1933–1940. Einen eigentlichen Tätigkeitsbericht fand ich in den Unterlagen im Basler Staatsarchiv nicht.
Der Einsatz für Verfolgte und Flüchtlinge
205
Vor diesem Hintergrund nahm die Theologische Fakultät teilweise eine Ausnahmestellung ein. Bei ihr gab es zwar Kontroversen zwischen liberalen und ‚dogmatisch gebundenen‘ Fakultätsmitgliedern, die die Aufnahme von gefährdeten Kollegen verzögerten. Auch hier hatten deutsche Kandidaten nach 1936 keine Chancen mehr. Aber im Endergebnis wurden doch deutsche Regimekritiker und regimekritische Schweizer aus Deutschland nach Basel geholt in einem Umfang, der für die kleine Fakultät als beachtlich bezeichnet werden muss. Auch in der Aufnahme von Studierenden erschien die Basler Theologie als grosszügig, auch wenn Stimmen laut wurden, die darauf hinwiesen, dass ein Studium in Basel für Deutsche zu einer Sackgasse werden müsse, da die Kantonalkirchen immer weniger bereit seien, Deutsche zu ordinieren (die Ausnahme bildeten Regionen und Zeiträume, in denen ein Pfarrermangel herrschte), während ihnen in Deutschland ab 1938 die Basler Studiensemester nicht mehr angerechnet wurden und sie in von Deutschen Christen kontrollierten Fakultäten und Kirchen chancenlos dastanden. Die Betreuung weniger prominenter Flüchtlinge758 erfolgte in Basel zwar oft im Zusammenhang mit einer religiösen Überzeugung (oder einer Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft, dem Sozialismus oder Kommunismus), wobei christliche Organisationen die Juden bis etwa 1942 der jüdischen Gemeinde überliessen, eine ‚Arbeitsteilung‘, die angesichts der Grössenverhältnisse zuungunsten der Letzteren ausfiel.759 In den Organisationen, deren Tätigkeit Kocher für die Protestanten eingehend dargestellt hat, waren nicht die Theologieprofessoren die von aussen sichtbaren Kräfte, sondern meist Frauen. Gertrud Kurz, Georgine Gerhard oder Gertrud Staehelin-Kutter sind Beispiele für den grossen und wachsenden Einsatz, der geleistet wurde, nicht nur in der direkten Betreuung und im Versuch, in den Lagern auch im Ausland760 zu helfen und Menschen vor dort in die Schweiz zu holen, sondern auch durch Behördengänge, Vorträge und Gespräche.761 Immerhin haben Theologieprofessoren an der Gründung christlicher Hilfsorganisationen mitgewirkt, dafür Proklamationen an die Pfarrer und die Gemeinden verfasst und bei Behörden namentlich 1942 vorgesprochen. Die unmittelbare Hilfstätigkeit durch Aufnahme von Flüchtlingen im eigenen Haushalt oder deren Unterbringung in anderen Wohnungen ist sehr schwierig zu erfassen, da offensichtlich die Maxime galt, Gutes zu tun (eventuell auch ausserhalb der rechtlichen Normen) und darüber nicht zu sprechen. Nur wenige Persönlichkeiten sind als Helferinnen und Helfer öffentlich sichtbar geworden.
758 759 760 761
Koller 2018; Feldges 1989. Sibold 2010. Picard 1994, 396 ff. Waeber 2004.
206
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
Gertrud Staehelin-Kutter machte aus dem Frey-Grynaeischen Institut ein Zentrum der Flüchtlingshilfe.762 Ernst Staehelin selbst handelte vorsichtig und im Bestreben, Deutsche nicht zu verletzen und den Kontakt zu ihnen aufrechtzuhalten. Beispiele dafür haben wir gesehen.763 Er setzte sich aber auch persönlich für Flüchtlinge ein: so riet er 1941 dazu, dass der jüdische Gelehrte Joseph Prijs in Basel bleiben könne.764 Gertrud Staehelin-Kutter nahm im Frey-Grynaeum neben anderen Helfern den jüdischen Kaufmann Richard M. Wagner auf, der bis 1933 in Frankfurt am Main eine Grosshandelsfirma für Modewaren betrieben hatte. Dann floh er ins Elsass. Bei Kriegsausbruch wurde er dort als Deutscher interniert. Gertrud Kurz holte ihn aus dem Lager und verschaffte ihm eine Einreisegenehmigung für Basel. Im Februar 1942 kam er hier an und wurde «ehrenamtlicher» Mitarbeiter (den Flüchtlingen war Erwerbsarbeit untersagt) der Hilfsorganisation der «Kreuzritter» von Kurz und der Leonhardsgemeinde mit einer Adresse im Frey-Grynaeum, wo zwei Räume zur Verfügung standen, in denen vorübergehend auch weitere jüdische Hilfskräfte beschäftigt wurden. Wagner arbeitete für die überkonfessionelle Versorgung der Flüchtlinge mit Esswaren, Kleidung und Geld. Er engagierte sich besonders in den Bestrebungen, die in Frankreich Internierten süddeutschen Juden freizubekommen oder doch ihr Los zu lindern. Im Nachlass des Chemikers Tadeus Reichstein finden sich zahlreiche Hinweise auf Wagners Tätigkeit. Im Juni 1944 befassten sich Wagner und Reichstein zum Beispiel gemeinsam mit der Unterstützung für eine tschechisch-italienische Jüdin, die 1943 mit ihrem Sohn aus Italien in die Schweiz geflohen war.765
4.5 Fazit – Elemente der Abwehr des Nationalsozialismus und die Flüchtlingsfrage in der Theologischen Fakultät Trotz ihrer Kleinheit war die Basler Theologische Fakultät divers. Zwar vollzog sich ein Generationenwechsel in den 1930er Jahren, aber Liberale und Vertreter der voraussetzungslosen (nicht ‚doktrinär gebundenen‘) Wissenschaft wirkten in ihr weiter, darunter namentlich Baumgartner. Zwar hatte die Theologische Fakultät keine organisatorische Verbindung zur Kirche, aber ihre innere Bindung war stark: Die meisten Professoren traten auf Kirchenkanzeln als Prediger auf, sie 762 763 764 765
Vischer 1997, 7 f. Kocher 1996, 243. Siehe Kapitel 7.5.10, Intervention von 21. 12. 1941. Petry 2008; Kocher 1996, 121 u. ö. Friedrich David arbeitete bei der Evangelischen Flüchtlingshilfe (Frau Prof. Staehelin-Kutter) und wurde deshalb von der Internierung in einem Lager dispensiert. Belege für 1943, 1944–1945, in: Nachlass Tadeus Reichstein, StABS PA 979a E 2-2 4 Jüdische Flüchtlingshilfe 1943–1946. Reichstein an Wagner c/o Staehelin, Durchschlag, 7. 6. 1944; Wagner c/o Staehelin an Reichstein, 27. 6. 1944, ebd., B 3-3 3 Diverse Korrespondenz 1943–1947.
Fazit
207
veröffentlichen ihre Predigten und Erbauungsschriften, sie schrieben Artikel für die evangelische Presse und wirkten in kirchlichen Gremien. Die theologische Reflexion namentlich der Neutestamentler und der Systematiker drehte sich um den Begriff und die Rolle der Kirche. Die nach den verschiedenen ‚Richtungen‘ organisierten Gemeindepfarrer lobbyierten dafür, dass ihre jeweilige Orientierung innerhalb der Fakultät angemessen vertreten sei, ein Anspruch, der von den vorgesetzten staatlichen Behörden innerhalb gewisser Grenzen anerkannt wurde. Mit Ausnahmen verstanden sich so die Theologieprofessoren als für das Glaubensleben (mit⌥) verantwortliche Glieder der christlichen Gemeinde. Sie waren zwar Forscher im akademischen Sinne, aber zugleich sahen sie sich als Verkünder der Offenbarung, die für sie die Basis ihrer Wissenschaft war. Ein Teil der Professoren der Theologie bemühte sich darum, als Christen in ein positiveres Verhältnis zu den Juden zu gelangen, was zunächst für das Thema ‚Judenchristen‘, dann aber zunehmend, ab 1942 mit vitaler Bedeutung für die Rechtfertigung der Hilfe für die Juden überhaupt, relevant wurde. Prominente Basler Theologen erfüllten die Erwartung der antifaschistischen Politiker und Journalisten, mutige Worte gegen die Anpasserei und die sogenannte «integrale Neutralität» zu schreiben und zu sprechen. Sie wurden so Teil einer heterogenen Koalition, die die Resistenz gegen den Nationalsozialismus in der Basler Gesellschaft und Öffentlichkeit legitimierte, bestärkte und verkörperte. Die theologische Begründung der Resistenz gegen den Nationalsozialismus hatte ihren Anlass vor allem in der Verteidigung der Freiheit der Kirche in Deutschland gefunden, Gottes Wort zu verkünden, ohne vom NS-Staat kontrolliert oder gar vereinnahmt zu werden. Die Resistenz gegen den Antisemitismus ergab sich aus der Überzeugung, dass Gott an seinem Entschluss, die Juden als sein auserwähltes Volk zu behandeln, trotz deren Ablehnung des Messias festgehalten habe. Sie ergab sich ferner aus der Bedeutung, die dem Alten Testament für den christlichen Glauben zugesprochen wurde. Sie folgte auch aus den biblischen Informationen über die urchristlichen Gemeinden, die diese unmissverständlich als Verbände aus gleichberechtigten ‚Judenchristen‘ und ‚Griechen‘ erwies. Schliesslich galt der Flüchtling, ob Jude oder nicht, als der «Nächste», dem der Christ ohne Ansehen der Volkszugehörigkeit zu helfen hatte. In diesen Diskursen kam jedoch die Anschauung zum Vorschein, dass die Juden von Gott geprüft oder gestraft würden durch die Vertreibung in alle Welt hinaus und dass sie nirgends richtig sesshaft werden könnten. Manche Theologen glaubten an die Existenz eines eigenen jüdischen «Wesens» oder gar einer spezifischen jüdischen «Rasse» als biologisches Faktum. In dieser Haltung lagen Chancen und Risiken zugleich. Die Chancen lagen darin, dass Versuche, ein ‚arisches‘ oder ‚germanisches‘ Christentum zu konstruieren, radikal verworfen wurden. Juden wurden Gesprächspartner der Christen. Antisemitismus als ideologisch gerechtfertigte Vernichtung zunächst der bürgerlichen und wirtschaftlichen, danach der physischen Existenz der jüdischen «Ras-
208
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
se» liess sich so als grundsätzlich unchristlich brandmarken. Die Risiken waren ebenfalls evident: Die Judenmission war kaum angreifbar, es wurde allenfalls geraten, sich während der Judenverfolgung im deutschen Machtbereich damit zurückzuhalten.766 Es wurde weiterhin gelehrt, dass die Juden den Messias nicht erkannt, ja der Hinrichtung ausgeliefert hätten. ‚Judenchristen‘ wurden manchmal höher gewertet als die nicht bekehrten Juden. Antisemitismus im heutigen Wortsinn begründete etwa Wilhelm Vischer (in guter Absicht) theologisch; das auserwählte Volk trage besondere Kennzeichen, Juden seien anders als andere Menschen. Die Basler Theologische Fakultät fällt dadurch auf, dass sie ein Experimentierfeld für das Auffangen von in Deutschland verfolgten Wissenschaftlern (von Schweizern wie Barth, Lieb, Vischer, de Quervain, und von einem herausragenden Deutschen, Schmidt) abgab. Nicht dass alle Fakultätsmitglieder damit einverstanden gewesen wären, denn oft kam die Initiative von aussen, von Kuratelsmitgliedern, Politikern oder aus dem Erziehungsdepartement der Regierung. Bemerkenswert war der Versuch der Kuratel, Karl Jaspers nach Basel in die Theologische Fakultät zu holen, der hier kurz erwähnt werden soll. Nachdem er 1937 in Heidelberg wegen seiner jüdischen Frau entlassen worden war und 1938 Publikationsverbot erhalten hatte, wollte die Kuratel unter Führung des einflussreichen Mediziners Adolf Lukas Vischer ihn für Basel gewinnen, zunächst für Theologie, was nicht gelang. Die Philosophen (angeführt von Paul Häberlin) lehnten ihn kategorisch ab. Wie nach dem Krieg die Verbindung Buri-Jaspers zeigte, war der philosophische Glaube von Jaspers für liberale Theologen diskussionswürdig, nicht aber für positiv gläubige Protestanten.767 Spätere Versuche scheiterten an der Unmöglichkeit, die Ausreise von Jaspers zu bewirken, bis er schliesslich 1947 den Ruf nach Basel annahm. Selten wurde gegen die Aufnahme von in Deutschland Verfolgten offen opponiert (und wenn, dann fakultätsextern in der Presse), aber ein Verhalten wie dasjenige von Goetz oder von Bernoulli kann doch kaum anders gedeutet werden denn als symbolischen Widerstand gegen die von Bonn nach Basel geholten Theologen und deren Theologie. Auch fehlte das Argument nicht, dass der schweizerische Nachwuchs den Vorzug erhalten sollte. Schliesslich waren alle aus Bonn nach Basel Geretteten in irgendeiner Weise der dialektischen Theologie zugehörig, die der älteren Professorengeneration nicht einleuchtete und die von ‚fortschrittlichen‘ Politikern als ‚rechts‘ eingeordnet wurde. Dies verhinderte aber nicht, dass im Fall Barths die überragende Bedeutung seiner Person von vielen Fakultätsmitgliedern anerkannt, seine Ankunft in Basel begrüsst und ihm Platz geschaffen wurde, bis einer der gesetzlich definierten Lehrstühle durch einen altersbedingten Rücktritt frei war. Der Empfang, den die Fakultät Karl Ludwig 766 767
Kocher 1996, 438. StABS Protokoll T 2 Kuratel der Universität Bd. 13, 1935–1941, 248, 2. Sitzung, 6. 1. 1938.
Fazit
209
Schmidt und nachher Fritz Lieb und Wilhelm Vischer bereitete, sah dann anders aus. Inhaltlich gibt die Geschichte der Basler Theologie in den 1930er Jahren ein Beispiel ab für die grosse Rolle, die die Ablehnung oder Überwindung des ‚19. Jahrhunderts‘ in der Geistesgeschichte seit etwa 1910 spielte. Ähnliche Tendenzen zeigten etwa die Ökonomen, die Germanisten, die Kunsthistoriker, die Historiker, die Altertumswissenschaftler. Dieser ambivalente Wille, die Rationalität kleinzureden, liberale Grundwerte nur mit Vorbehalten anzuerkennen, der Demokratie zu misstrauen, sich von den universellen Menschenrechten abzugrenzen und eine ‚positivistische‘, rationale Auffassung der Ziele der Wissenschaft für überholt zu erklären, determinierte in weiten Bereichen die Verschiebung von liberaler Theologie hin zur ‚dogmatisch gebundenen‘ und dialektischen Theologie. Zugleich eröffnete die Absage, die die dialektischen Theologen der liberalen Theologie des ‚19. Jahrhunderts‘ durch die «strikte Trennung von Gott und Welt» erteilten, die Chance einer grösseren kritischen Distanz zu Politik und Gesellschaft.768 Mehr am Rande des Geschehens kamen auch neue Wertschätzungen des Pietismus unter süddeutschem Einfluss ins Bild. Dominiert wurde es aber von den Barthianern. Auch ein philologisch hervorragend geschulter Wissenschaftler wie Karl Ludwig Schmidt war letztlich von einem Glaubensprogramm getrieben, das von Jesus (und Paulus) her nein sagte zu einer Kirchenpolitik, die mit den weltlichen Mächten paktierte oder Kompromisse suchte. In dieser Generation ‚dogmatisch gebundener‘ Theologen fiel der einem vermittelnden ‚juste milieu‘ angehörende Kutter-Schwiegersohn Staehelin dadurch auf, dass er zwar forderte, Kirche und christliches Leben sollten sich wie alle anderen Lebensbereiche auf die Erwartung des kommenden Reichs Gottes ausrichten, aber daraus folgerte, dass die Theologie nicht in den Lauf der Zeit aktiv eingreifen und deshalb im ‚Dritten Reich‘ auf die Menschen und die scheinbar oder wirklich weiterexistierenden Traditionen und Institutionen sehen solle statt auf den Totalitarismus und die Verbrechen der Nationalsozialisten. Viele Theologen waren der Überzeugung, Parlamentarismus und Demokratie müssten ebenso wie Kapitalismus und Klassengesellschaft irgendwie überwunden werden. Einige wie Staehelin plädierten für eine «Erneuerung», ohne anfänglich zwischen den Ideologien gross unterscheiden zu wollen, oder sie sympathisierten zu Beginn mit dem ‚Dritten Reich‘, das angeblich einen Umsturz von links verhindert und (wie die Faschisten in Italien oder die Katholiken mit dem Ständestaat) die soziale Frage ‚gelöst‘ habe. Unterschiede und damit Misstrauen prägten deshalb die Beziehungen zwischen den einzelnen Theologen. Aufschlussreiche Dokumente dazu enthält der publizierte Briefwechsel von Eduard Thurneysen. Der Anspruch, den rechten Glauben zu haben oder anzustreben, hatte einen ausschliessenden Charakter und 768
Tietz 2019, 419.
210
Theologie in Basel – Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus
führte zur Betonung von Unterschieden, auch wenn Thurneysen oft als Mediator auftrat. An Feindbildern mangelte es wahrlich nicht. Die ältere Theologengeneration wurde als Nachhut des verpönten ‚19. Jahrhunderts‘ verachtet. Wo sie in der Krise der 1930er Jahre Gutes bewirken wollte, wie im Fall von Eberhard Vischer, wurde sie als «harmlos» qualifiziert. Von Hermann Kutter mochte man nichts mehr wissen, Leonhard Ragaz geriet an der Universität weitgehend aus dem Blick. Religiös-Soziale wurden bezichtigt, Politik in die christliche Gemeinde zu tragen und humanitär zu argumentieren, vom Menschen her, statt aus der Offenbarung heraus. Barths Zürcher Kollege Emil Brunner, immerhin einer, der wichtige Manifeste für die Aufnahme von Flüchtlingen unterzeichnete, wurde mit einem harten «Nein» ausgeschieden. Ein Häresieverdacht fiel auch auf Barths philosophischen Bruder Heinrich. Auch wenn die kirchlich Freisinnigen eine schlichte Blockpolitik betrieben und wie Wolfer einfach das Interesse ihrer ‚Richtung‘ geltend machten, so wird doch in Ansätzen verständlich, warum sie glaubten, sich zur Wehr setzen zu müssen. Nur die radikalen Anhänger Barths erkannten allerdings in der schweizerischen Demokratie den «rechten Staat», d. h. die «rechte Obrigkeit», der der Christ, wenn auch oft mahnend und kritisierend, diente und die notfalls mit Waffengewalt gegen die Diktatur verteidigt werden musste. Vor allem sie vermochten im Nationalsozialismus diejenige Macht zu erkennen, die es auf die Vernichtung der Kirche und die Durchsetzung eines antichristlichen Religionsersatzes mit den Instrumenten des totalitären Staates abgesehen hatte. Ihr zentrales Motiv war die Verteidigung ihrer Auffassung von Kirche in ihrem Verhältnis zum Staat.
5 Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat 5.1 Einleitung Im Unterschied zur Theologischen Fakultät, von der ich eine ausführlichere Darstellung geben wollte, da ich sie für einen zentralen Ort der Resistenz gegen den Nationalsozialismus in Basel halte, möchte ich mich für die Juristen kürzer fassen. Ich verkenne jedoch nicht, dass der Umstand, dass die Mehrheit der Angehörigen dieser Fakultät fest auf dem Boden des Rechtsstaats stand, über die Universität hinaus einen wichtigen Einfluss ausübte. Interessant sind auch die Abweichungen von dieser Linie, denn sie zeigen, wie wenig selbstverständlich damals die Orientierung der Mehrheit war. Ich bespreche zuerst die Basler Juristen, die sich dem liberalen und radikaldemokratischen politischen Spektrum zurechnen lassen, danach gehe ich auf je ein Beispiel ausführlicher ein, das eine Abweichung nach links respektive nach rechts zeigt.
5.2 Der Grundtenor in der Juristischen Fakultät Partei, Staat, Gerichte, Polizei und Angehörige der Juristischen Fakultäten, unterstützt durch die Akademie für Deutsches Recht, demontierten in Deutschland seit 1933 den Rechtsstaat.769 Wer erwartet, dass sich demgegenüber die Basler Juristische Fakultät in dieser Zeit als ein Ort erwiesen hätte, an dem die Werte von Recht und Gerechtigkeit hochgehalten wurden, wird im Allgemeinen nicht enttäuscht. Und wie so oft war der offizielle Betrieb der Fakultät keine geeignete Plattform für explizite Debatten über den Nationalsozialismus und was dagegen zu tun sei. Der Gedankenaustausch erfolgte privat, allenfalls zwischen den Zeilen der für uns greifbaren Arbeiten. Auch die Unterstützung für Flüchtlinge blieb eine private Angelegenheit, über die selten gesprochen und noch seltener geschrieben wurde. So war der liberale Jurist und Politiker Carl Ludwig, der noch während seiner Amtszeit als Regierungsrat Privatdozent und Extraordinarius wurde (1949 erhielt er eine persönliche Professur) ein vehementer Gegner der Kommunisten und Sozialisten. Zugleich vertrat er gegenüber frontistischen und nationalsozialistischen Manifestationen die rechtsstaatlichen Grundsätze: Schweizerisches und Basler Recht kannten keine Gesinnungsdelikte, also wurde den Anhängern dieser Richtungen Versammlungs- und Redefreiheit zugestanden, und eine Verfolgung war nur für den Fall denkbar, dass sie nachweislich
769
Ramm/Saar 2014; Wiener 2013; Göppinger 1990, 45–182.
212
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
eine Straftat begingen. Privat nahm er jedoch Anteil am Schicksal der Flüchtlinge aus Deutschland. Ludwig war in der Betreuung von Verfolgten und Vertriebenen aktiv und förderte die Tätigkeit von Gertrud Staehelin-Kutter im Frey-Grynaeischen Institut.770 Nach dem Krieg verfasste er den vielbeachteten «Bericht Ludwig» über die schweizerische Flüchtlingspolitik.771 Ähnlich war die Position des ebenfalls liberalen Regierungsrats und Juristen Adolf Im Hof,772 der die bürgerlichen Freiheiten auch im Fall von Menschen mit rechtsextremen Überzeugungen respektieren wollte. Er unterstützte privat Künstler, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden; seine Tochter Georgine war mit dem Basler Mittelalterhistoriker Wolfram von den Steinen, einem deutschen Anhänger Stefan Georges, verheiratet. Der Grundtenor der Fakultät war mit den in der Einleitung angedeuteten Ausnahmen liberal bis freisinnig. Hätte das Wort nicht allzu viele Bedeutungen, könnte man sie gelegentlich als ‚linksliberal‘ bezeichnen, im Unterschied zu jenen konservativen Liberalen, die die demokratischen Errungenschaften der Moderne ablehnten. In der Juristischen Fakultät stand die Ablehnung des ‚19. Jahrhunderts‘, die in anderen Fakultäten stark verbreitet war, nicht hoch im Kurs. Nach dem altersbedingten Ausscheiden des bedeutenden Handelsrechtlers Carl Wieland773 waren alle durch das Universitätsgesetz vorgesehenen Ordinariate von Angehörigen einer jüngeren Generation besetzt. Diese Professoren verteidigten Rationalität, Verfassung und Rechtsstaat, sie engagierten sich teilweise auch für das Arbeitsrecht, für Sozialrechte und kritisierten den Missbrauch der Normsetzung durch Exekutive und Administration, der in ihrem Verständnis seit dem ersten Weltkrieg und unter dem Eindruck der Wirtschaftskrise die Verfassung auszuhöhlen drohte.774 Im Staatsrecht äusserte sich die Überzeugung deutlich, dass staatliches Handeln in der Schweiz grundsätzlich durch das Volk zu legitimieren sei; der Volkswille, teilweise explizit mit Anlehnung an Rousseau formuliert,775 sei die Grundlage des Staatwesens in den Kantonen wie im Bund. Die Bundesverfassung von 1848 wurde vom Öffentlichrechtler Erwin Ruck als intelligenter und ausbaufähiger Kompromiss verstanden, der sich organisch weiterentwickle und keineswegs nach einer Totalrevision rufe, wie dies der rechte Flügel der Politik verlangte.776 Kritik wurde laut an der schleichenden, nicht auf die Ver770 771 772 773 774 775 776
Siehe das Kapitel über die Theologen, oben. Kunz 2011, 146; Staehelin 1987. Ludwig 1957: Die Flüchtlingspolitik der Schweiz in den Jahren 1933 bis 1955. Bericht an den Bundesrat zuhanden der eidgenössischen Räte. Schibler 2007. Bühler 2013. Ruck 1948, 90–92; Haab 1936. «Rousseaus Staatstheorie, aus schweizerischen Verhältnissen abgeleitet, wies den Weg» [zur Verfassung von 1848], Ruck 1925, 5. Dieselbe Feststellung in: Ruck 1933, 12. Vgl. Gutzwiller 1948, xii f.; Ruck 1933, 14: «politisch und staatsrechtlich ein hervorragendes Werk». Ruck 1925, 6.
Einzelne Professoren
213
fassung abstützbaren Ausdehnung der Kompetenzen des Bundes,777 aber kein Jurist rief in Basel eine ‚Krise der Demokratie‘ oder der Parlamentsarbeit aus.778 Alle waren sich darin einig, dass ihre Wissenschaft die Gesetzgebung vom Standpunkt der Grundideen des Rechts und der Gerechtigkeit aus zu begleiten, zu beraten und zu kritisieren habe. Deutlich abgelehnt wurde die Instrumentalisierung von Recht und Justiz zu politischen Zwecken. Desgleichen wurde die Überzeugung mehrheitlich geteilt, dass «der Staat nicht Selbstzweck werden darf und dass das Volk nicht um des Staates willen, sondern der Staat um des Volkes willen da ist».779
5.3 Einzelne Professoren Die Fakultät war zu klein, um mit ihren fünf gesetzlichen Lehrstühlen auch nur alle wichtigen Fächer in der Lehre vertreten zu können.780 Zudem legten die Juristen Wert auf die Verbindung zur Praxis. Beide Faktoren führten dazu, dass eine beachtliche Zahl von Privatdozenten zum Unterricht herangezogen wurde, die, falls sie eine zentrale Funktion im Unterricht erfüllten, rasch zu Extraordinarien und persönlichen Ordinarien befördert wurden. Zudem lasen die meisten Ordinarien nicht nur über die Themen, die zur Umschreibung ihres Lehrstuhles gehörten, sondern auch über entferntere Spezialgebiete. Der Vertreter des Römischen Rechts, August (getauft auf die französische Namensform «Auguste») Simonius-Bourcart (Professor in Basel seit 1918, Ordi-
777 778
779 780
Ruck 1925, 12 f. «Wir sehen, wie der solidarische Staatsgedanke im politischen Getriebe des Alltags oft in den Hintergrund gedrängt wird, wie infolge der durch den Weltkrieg geschaffenen Schwierigkeiten des Lebens der Materialismus und die Selbstsucht eine erhebliche Rolle spielen; wir sehen aber auch, dass das politisch erzogene Volk mit Ausnahme revolutionär eingestellter Kreise die Anerkennung des Mehrheitswillens als selbstverständlich betrachtet, dass es in schicksalsschweren Zeiten zum Aufgehen im Staate sich als fähig erwies, dass die politisch und geistig führende Schicht des Volkes vom Staat zwar Freiheit der Person und des Eigentums, des geistigen und wirtschaftlichen Lebens verlangt, daneben aber bewusst die selbstlose Mitarbeit, Ein- und Unterordnung vertritt. Diese Auffassung wird den Sieg behalten.» Ruck 1925, 18 f. Ablehnung des Sozialismus und Kommunismus und Erhaltung der «Staatsgesinnung und Staatstreue» im Volk: ebd., 34–36. Die Bundesversammlung habe es «verstanden, die anderwärts sich zeigenden Erscheinungen tiefgreifender Entartung und Unfähigkeit des ‚Parlamentarismus‘ im Wesentlichen zu vermeiden». Ruck 1933, 87. Ruck 1925, 36. Gesetzlich verankerte Lehrstühle gab es für Römisches Recht, Germanisches Recht, Privatrecht, Öffentliches Recht und Strafrecht. Ruck 1940, 5. Liste der Lehrgebiete im Basler Unterricht in 21 Positionen, ebd. 5 f.
214
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
narius von 1920 bis 1956),781 war zum Beispiel zugleich ein profunder Kenner des Wirtschaftsrechts und arbeitete als zweisprachig aufgewachsener Sohn von Fabrikanten auch rechtsvergleichend. Durch seine Verwandtschaft mit der Familie Veillon aus dem Waadtland war er auf die Westschweiz ausgerichtet und interessierte sich auch für Frankreich. In seiner Schulzeit besuchte er oft seinen Grossonkel Jacob Burckhardt. Als Studienfach wählte er Kunstgeschichte, bevor er zur Jurisprudenz wechselte, wobei er in die Zofingia eintrat; der Kunst blieb er als Präsident der Kunstkommission verbunden, wo er die Anschaffung moderner französischer Kunstwerke förderte und dem kommunistischen Museumsdirektor Georg Schmidt782 als verlässlicher Partner den Rücken stärkte. Im Militär führte er als Hauptmann im Ersten Weltkrieg eine Füsilierkompagnie. Im Zweiten Weltkrieg diente er als Chef der Polizeiabteilung des Basler Stadtkommandos. Der weitgereiste Student begeisterte sich in Leipzig bei Ludwig Mitteis für das Recht der alten Römer. Er glaubte, die römischen Patrizier seien vorbildliche Juristen gewesen, an denen man sich auch im 20. Jahrhundert orientieren könne. Innerhalb der Basler Fakultät kam Simonius eine besondere Position zu. Er repräsentierte bewusst einen ‚altbaslerischen‘ Typus des vornehmen Liberalen mit ausgesprochenem Sinn für Haltung und Zeremoniell, in vielem autoritär, aber gegenüber allen Menschen betont höflich und dort, wo er nicht auf feindselige Ablehnung stiess, freundlich-zuvorkommend, hilfsbereit und zuverlässig, so in seiner Tätigkeit am Appellationsgericht (1922 bis 1957). Obschon er stets an seinem Basler Lehrstuhl festhielt, war Simonius ein international vernetzter Jurist mit Beziehungen nach West- und Südeuropa. Auch die Studenten sollten fremde Länder erleben, meinte er, deshalb setzte er sich für die Schaffung der Maison Suisse in der Cité Internationale Universitaire in Paris ein. Von Deutschland hatte er schon vor 1914 Unheil erwartet. Die Existenz der nationalsozialistisch kontrollierten Deutschen Studentenschaft an der Universität Basel war ihm ein Dorn im Auge.783 Als Humanist trat er für die Freiheit des Individuums ein, auch des Unternehmers. Dahinter stand seine Ablehnung des Rechtspositivismus; jede Herrschaft von Menschen über Menschen war ihm suspekt, und er verteidigte die Menschenwürde bedingungslos. Gegenüber der Rede von der Zeitbedingtheit und damit der relativen Geltung der Menschenrechte war er kritisch eingestellt: Heute hätte man wahrscheinlich sogar mehr Anlass, die Freiheitsrechte hervorzuheben, als im ausgehenden 18. Jahrhundert. […] Die Erklärungen der Menschenrechte sind […] schon der Form nach nicht gänzlich zeitbedingt. Noch weniger aber ver-
781 782 783
Kunz 2011, 70, 264–267. Lesenswert: Zur Erinnerung 1957. Dettwiler 2018. StABS UA B 1 XIV Acta et Decreta 1934–1959 (Regenzprotokoll), 4. 7. 1934; 15. 5. 1935.
Einzelne Professoren
215
dienen die Gedanken, auf denen sie beruhen, den Vorwurf, nur den Bedürfnissen einer bestimmten Epoche gedient zu haben.784
Dass solche Feststellungen auch durch die gegenteilige Auffassung von Basler Fakultätsmitgliedern veranlasst waren, werden wir unten bei Jacob Wackernagel sehen. Das Privatrecht lag bis 1935 in den Händen des konservativen Carl Wieland. Er war insbesondere am Handelsrecht interessiert, wirkte als Experte an der Revision des Schweizerischen Obligationenrechts und gestaltete das Aktienrecht, das Gesellschaftsrecht sowie das Wechselrecht mit. Als er 1935 aus gesundheitlichen Gründen demissionierte, wechselte Robert Haab,785 der 1929 auf den Lehrstuhl für Germanisches Recht berufen worden war, auf den freigewordenen Privatrechtslehrstuhl. Als Nachfolger Wielands lehrte er neben dem Zivilgesetzbuch das Obligationenrecht, das Gesellschaftsrecht und bald auch das Schweizerische Seerecht, das seine eigene Schöpfung war. Gehörten Simonius und Wieland ins Lager der Liberalen, war Haab wie sein Vater Robert Haab-Landis, Bundesrat von 1918 bis 1929, vorher Generaldirektor der SBB, freisinnig. Der Zürcher Jurist war in Bern von Eugen Huber geprägt worden, bildete sich nach dem Studium als Gerichtsadjunkt, Bundesbeamter und Vorsteher des Eidgenössischen Grundbuchamtes praktisch weiter. Nachdem er sich 1921 in Bern habilitiert hatte, wurde er dort 1927 zum Extraordinarius befördert. 1929 nahm er den Ruf nach Basel an. Haab war ein wirtschaftsnaher Jurist nicht nur hinsichtlich seiner Lehre und Forschung, sondern auch dadurch, dass er für die Basler Handelskammer tätig war786 und dem kaufmännischen Leiter der Basler Chemiefirma J. R. Geigy AG, Carl Koechlin, nahestand. Er forderte auch die Entschuldung der Landwirtschaft in der Krise. Der patriotisch gesinnte Haab stand ganz auf dem Boden des Rechts- und Verfassungsstaates. Er verstand «das Recht [als] die von Gott den Menschen gegebene grundlegende, unentbehrliche, ordnende Macht».787 Während er sich vom Freiburger Rektor und völkischen Geographen Friedrich Metz vorübergehend hofieren liess, der in ihm einen potentiell wichtigen Verbindungsmann zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und der Schweiz sehen wollte, erkannte Haab (zusammen mit Ruck) klar, dass die deutschen Hochschulen nach 1933 Instrumente der nationalsozialistischen Politik geworden waren. In der Regenz hatte Haab jedoch noch für eine Teilnahme an der Göttinger Feier votiert mit der Begründung, eine Ablehnung würde die Universität Basel in ihren internationalen Beziehungen schädigen.788 Mit dem Deutschland der Zeit vor 784 785 786 787 788
Simonius 1948, 295. Kunz 2011, 92, 118 f., 204–206. Ansprachen 1944. Siehe auch Haab/Koechlin 1934. Koechlin 1944, 10. StABS UA B 1 XIV Acta et Decreta 1934–1959 (Regenzprotokoll), 10. 3. 1937; StABS Protokoll T 2 Kuratel der Universität Nr. 13, 1935–1941, 169, 4. Sitzung, 1. 4. 1937.
216
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
1914 war er aus Studienaufenthalten in München und Berlin vertraut. Simonius hat ihn aufrichtig geschätzt in seiner ebenso politischen wie juristischen Begabung und seinem Einsatz für die Freiheit der Wirtschaft.789 Zu diesem Einsatz gehörte auch die vehemente Kritik an den Verordnungen, die schon in Friedenszeiten zur Krisenbekämpfung erlassen worden waren; er sah darin die Gefahr, dass «das Recht der Krise zu einer Krise des Rechtes und des Rechtsempfindens des Volkes» führe. «Die Rechtswissenschaft bürdet sich sogar eine schwere Verantwortung auf, wenn sie schweigt, wo das Reden geboten ist.»790 1943 erlitt Haab einen Hirnschlag, an dessen Folgen er 1944 verstarb. Sein Nachfolger wurde der christlich-soziale Max Gerwig, als Sozialdemokrat seit 1919 Richter am Appellationsgericht, Präsident der Kuratel, seit 1936 Ehrendozent und seit 1938 Extraordinarius für Zivilprozessrecht. Strafrecht vertrat seit 1930 Oscar Adolf Germann. Der Sohn eines freisinnigen Thurgauer Juristen wurde von Bern wegberufen, blieb aber wie viele in Basel lehrende Juristen Berater von Bundesstellen (er hatte zuvor für das BIGA gearbeitet). Sein Lehrauftrag umfasste auch Schweizerisches und Internationales Arbeitsrecht, eine Kompetenz, die in der Krisenzeit sehr gefragt war.791 Sein Hauptwerk bildete der Kommentar für das Schweizerische Strafgesetzbuch (1942). Germann hatte in Deutschland studiert und war von Mitteis und Rudolph Sohm beeindruckt. In Wien verkehrte er mit Oskar Kokoschka und Adolf Loos. Ab 1917 ergänzte Germann seine juristische Ausbildung durch ein Philosophiestudium in Berlin. Sein Profil passte in das Basler Umfeld insofern gut, als er den rechtsstaatlichen Schutz vor ungerechter Strafe und eine humane Strafverfolgung forderte, aber auch mit seinem Postulat, dass das Recht letztlich dem Willen der ihm unterworfenen Bürger entsprechen sollte. Ein staatliches Monopol auf Rechtsetzung lehnte er ab. Eine Folge davon war seine Überzeugung, dass im Arbeitsrecht den Verbänden bei der Rechtsgestaltung eine aktive Rolle zukommen sollte. Germann war international vernetzt und beteiligte sich am Wiederaufbau juristischer Fakultäten nach Kriegsende 1945.792 789
790 791
792
Simonius 1944, 12 f. Freisinnige wie Ruck oder Haab machten zwar Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit geltend im Sinne einer Verpflichtung des Kapitals, zur allgemeinen Wohlfahrt beizutragen, Armut zu bekämpfen und den sozialen Frieden zu fördern. Ruck 1941, 233, verlangte aber Garantien gegen «Eigentumsbegrenzung», da er damit rechnete, «dass die kommende Zeit eine durch staatliche Wirtschaftsregelung erheblich beschränkte Wirtschaftsfreiheit» bringen werde. Die Freiheit des Eigentums war für ihn eine Voraussetzung für die Unabhängigkeit der Bürger in der Demokratie. Haab 1936, 17, 24. Germann wurde bekannt als Oberst im Generalstab, der sich im Krieg mit den Beziehungen zur französischen Armee und der Idee des «Réduit» befasste. Tschudi erwähnt den Sozialdemokraten Arnold Gysin als Spezialisten für Arbeitsrecht an der Universität Basel, der von 1924 bis 1934 PD war (später Grossrat in Luzern). Tschudi 1993, 34 f. Kunz 2011, 145 f., 200–204.
Deutsche Juristen in der Basler Fakultät
217
Die Ablehnung des Nationalsozialismus wurde nach Kriegsende deutlich aus seiner Äusserung, dass in Diktaturen die «Strafgewalt von Trägern der staatlichen Macht missbraucht [wurde] in einem Ausmass, dass für Millionen von Menschen die Freiheit ihr schutzlos preisgegeben war und für Hunderttausende die latent stets mehr oder weniger bestehende Gefahr der Willkür und des Machtmissbrauches zur harten Tatsache wurde».793 Willkür und Machtmissbrauch seien auch in Republiken, ja in «sehr fortschrittlichen Gemeinwesen», vorgekommen, in denen «ein Mann an der Spitze, der im Namen des Volkes über die Macht des Staates verfügt, für die persönliche Freiheit und die Menschenrechte der Staatsangehörigen schwere Gefahren» brachte. Garantien gegen Machtmissbrauch seien im «nationalsozialistischen Deutschen Reich […] mit offenem Hohn als Erbteil einer überwundenen Zeit abgeschafft» worden. Davon sei vor allem das Verfahren, weniger das materielle Recht betroffen gewesen. Demgegenüber lege das englische Recht mit guten Gründen das Schwergewicht auf verfahrensrechtliche Garantien.794
5.4 Deutsche Juristen in der Basler Fakultät Schweizer waren naturgemäss gefragt als Dozenten für schweizerisches Recht. Dies führte in Basel jedoch keineswegs zum Ausschluss von Ausländern. 1912 war der süddeutsche Demokrat und Tübinger Privatdozent Erwin Ruck795 nach Basel berufen worden, wo er schliesslich eingebürgert und zu einer tragenden Gestalt der Fakultät wurde. Er vertrat energisch die Grundsätze des freiheitlichen Rechtsstaates;796 als Spezialist des Völkerrechts arbeitete er an Grundsätzen für den Verkehr zwischen Staaten, die auf Ethik und Moral basieren sollten. Für die Nachkriegszeit hoffte er, «dass nicht Lüge, Gewalt und Terror den Sieg erringen werden, sondern Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit».797 Für die Basler Regierung war er der wichtigste Experte für die Ausarbeitung des neuen Universitätsgesetzes von 1937.798 Das massgebende Kompendium des schweizerischen Staatsrechtes für Studenten stammte aus seiner Feder. In den Kriegsjahren versah er, abweichend vom üblichen kollegialen Turnus, von 1940 bis 1945 dauernd das Dekanat seiner Fakultät. In dieser Zeit trat er für die Erhaltung des Rechtsstaates ein, der für ihn untrennbar mit dem Begriff der Freiheit verbunden war, sofern der
793 794 795 796 797 798
Germann 1948, 259. Germann 1948, 263 f. Kunz 2011, 163–165, 256–258. Tschudi 1993, 34; Ruck 1933; vgl. die Vorstudie in: Ruck 1925. Ruck 1946, 3, 5, 22 f. Vgl. Ruck 1930.
218
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
Rechtsstaat nicht rein formal konzipiert wurde. Freiheit bezog Ruck auf die «Persönlichkeit», im Unterschied zu Menschen, die in der «Masse» aufgingen.799 In die Juristische Fakultät berief die Basler Regierung 1935 auch einen der wenigen deutschen Professoren, die aus dem nationalsozialistisch beherrschten Deutschland nach Basel weggehen wollten und konnten: Hans Lewald.800 Dieser hatte zunächst als Rechtshistoriker über ägyptische Papyri gearbeitet (auch er gehörte zur Schule von Ludwig Mitteis) und war dann über Lausanne (1911), Frankfurt (1915), Köln (1920) und nochmals Frankfurt (1923) 1932 auf ein Berliner Ordinariat gelangt. Schon in Frankfurt hatte er sich als Pionier mit internationalem Privatrecht beschäftigt, aber auch das Vorgehen der nationalsozialistischen Studenten kritisiert.801 Als Berliner Ordinarius unterrichtete er neben jüdischen Kollegen, namentlich Ernst Rabel (Gründungsdirektor des Kaiser Wilhelm-Instituts für Ausländisches und Internationales Privatrecht, 1937 als Professor entlassen, 1939 nach Chicago ausgewandert)802 und Martin Wolff (1921 nach Berlin berufen und 1935 entlassen); dabei konnte er miterleben, wie gegen ‚nichtarische‘ und demokratische Juristen vorgegangen wurde.803 Lewald hatte dem Beirat des Kaiser Wilhelm-Instituts für Ausländisches und Internationales Privatrecht angehört, das Rabel leitete, und die Zeitschrift dieses Instituts mit herausgegeben.804 In den Berufungsverhandlungen für die Basler Position gab er zu verstehen, dass er mit dem nationalsozialistischen Regime nicht einig gehe und einen Ruf nach Basel bestimmt annehmen würde. Dieser Ruf befreite ihn aus einer nicht einfachen, wenn auch nicht unmittelbar bedrohlichen Situation.805 In Deutschland galt er als «arisch».806 Das Grossunternehmen, das seine Verwandten besassen, und das auf den Grossvater mütterlicherseits zurückgehende Finanzinstitut hätten im Fall einer Entlassung einen materiellen Rückhalt geboten. 799 800
801 802 803 804 805
806
Ruck 1948, 77 ff. Die bisher gründlichste Darstellung dessen, was wir über Lewald wissen, in: Breunung/ Walther 2012, 275–290, mit Verzeichnis der Schriften. Kunz 2011, 242–245. Flessner 1989. Hammerstein 2012, 166. Rabel hatte von 1906 bis 1910 Römisches Recht in Basel gelehrt. Kunz 2011, 248–256. Rabels Institut: Kunze 2004. Gleichschaltung der Juristischen Fakultät der Berliner Universität: von Lösch 1999. Lewald war Mitherausgeber der Zeitschrift des Instituts («Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht»). Kunze 2004, 92. Sein Bruder Walter (Rechtsanwalt in Berlin seit 1929, danach in Frankfurt a. M.) war mit einer als Jüdin geltenden Frau verheiratet. Er wurde im Krieg zum Arbeitseinsatz in der Organisation Todt zwangsverpflichtet, sie wurde nach Theresienstadt deportiert. Breunung/Walther 2012, 275. Familie: Below 1985. Ein Grossvater war der protestantische Theologieprofessor in Heidelberg, Ernst Anton Lewald. Drüll 1986, 163 f. Die Meinung, seine Vorfahren gehörten der jüdischen Familie David an und sein Urgrossvater sei ein hannoverscher Hofjude gewesen, ist offensichtlich falsch, wie von Lösch 1999, 387, bestätigt.
Deutsche Juristen in der Basler Fakultät
219
Seine Lehrveranstaltungen waren von den nationalsozialistischen Studenten nicht gestört worden, und er hatte sich nicht politisch exponiert, war vermutlich auch keiner dem Nationalsozialismus verbundenen Organisation beigetreten.807 Konflikte mit NS-Stellen sind aus den erhaltenen Dokumenten nicht ersichtlich. Vermutlich vertrat er privat einen liberal-konservativen Standpunkt; so befürwortete er 1944 eine Berufung von Matthias Gelzer aus Frankfurt nach Basel.808 Für seine Verhandlung über die Anstellungsbedingungen in Basel809 erhielt er 1935 die Ausreiseerlaubnis, und auf den ergangenen Ruf hin wurde er seinem Wunsch gemäss ohne Probleme aus dem preussischen Staatsdienst entlassen.810 Noch 1937 stand sein Name auf der Liste der Basler Professoren, die am Treffen mit deutschen Kollegen aus Freiburg i. Br. in Badenweiler teilnehmen sollten.811 Deutsche Stellen versuchten jedoch aus seinem Weggang Gewinn zu erzielen, indem sie ihn mit der Reichsfluchtsteuer belegten. In Basel war man überzeugt, dass diese (allerdings schon 1931 eingeführte) Abgabe nur offenen Kritikern des nationalsozialistischen Regimes abverlangt werde, nicht aber Befürwortern, von denen die Nationalsozialisten erwarteten, sie würden für die Diktatur im Ausland werben.812 Die schweizerische Intervention in Berlin scheint erfolgreich gewesen zu sein.813 In Basel enthielt sich Lewald offenbar einer aktiven Kritik an der in Deutschland
807
808 809
810
811 812
813
Fragebogen (um 1933), in: Archiv der Humboldt-Universität Berlin, B 01.10 NS-Dozentenbund, Bestand: NS-Doz. 2 – NS-Dozentenschaft der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin (Personalia), Sign.Nr.: ZD I 0630, Akte Lewald. Ich danke David Hamann, Berlin, für die Durchsicht der in Berlin vorhandenen Dokumente über Lewald. Protokoll Erziehungsrat (mit Zitaten aus den Verhandlungen der Kuratel) vom 6. 3. 1944. Basler Verfahren, in dem Lewald zunächst nur auf dem zweiten Platz stand, pari passu mit Hans Thieme (Breslau) und Max Gutzwiller (Heidelberg): Breunung/Walther 2012, 278. Den Ausschlag gab die Qualität der Lehre, der Eindruck der Persönlichkeit und die Bereitschaft Lewalds, einen Ruf nach Basel unbedingt anzunehmen. Von Lösch 1999, 387 f.; Breunung/Walther 2012, 278. Entlassungsurkunde vom 13. 8. 1935 in: Archiv der Humboldt-Universität Berlin, B 01.02 Universitätskurator, Bestand: UK Personalia – UK Personalakten bis 1945, Sign.Nr.: L 129a, Titel: Lewald, Hans, Bd. 2, Blatt 88 f. UA Freiburg i. Br. B0001 317, Ohne Umschlagtitel, Inhalt Treffen Basel-Freiburg, ab 1924, Basler Rektor Mangold an Friedrich Metz in Freiburg, 17. 6. 1937. StABS Protokoll T 2 Kuratel der Universität Bd. 13, 1935–1941, 5, 10. Sitzung, 9. 9. 1935. Die Schweizer Diplomatie werde den deutschen Stellen erklären, dass der «althergebrachte schweizerisch-deutsche Dozentenaustausch» geschädigt werde, wenn die Reichsfluchtsteuer so gehandhabt werde wie im Fall Lewald. «Wir setzen dabei voraus – die Gesandtschaft wird sich hierüber zu vergewissern haben –, dass gegen einen solchen Schritt keine Bedenken der politischen Opportunität bestehen, die etwa darin liegen könnten, dass sich Herr Professor Lewald politisch stark exponiert hätte.» StABS Protokoll S 4 Erziehungsrat Bd. 23, 1934–1936, Eintrag vom 26. 10. 1935 betr. Meldung des Eidgenössischen Politischen Departements vom 19. 10. 1935. Breunung/Walther 2012, 285.
220
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
herrschenden Diktatur, wurde hier gut integriert und las schliesslich neben internationalem Privatrecht über schweizerisches Recht, zum Beispiel «Schweizerisches Zivilgesetzbuch», aber auch «Obligationenrecht», was ihn in Konflikt mit August Simonius brachte. Basel hat er nicht wieder verlassen.
5.5 Fazit So erscheint die Basler Juristische Fakultät im Allgemeinen als ein Hort der Ideen von Recht und Gerechtigkeit, die nicht politischen Zwecken verfügbar gemacht werden sollten. Die hier wirkenden Professoren stellten damit unzeitgemäss-zeitgemäss der Versuchung durch Faschismus und Nationalsozialismus überzeitlich geltende Werte entgegen. Die Einheit und Geschlossenheit [des geistigen Rechtsbaues, den die wissenschaftliche Jurisprudenz errichtet] ruht in der Rechtsidee und im Rechtsideal, die den Inhalt der Rechtsvorschriften und deren Vollzug in Justiz und Verwaltung bestimmen. Hinter allem Recht steht als Rechtsidee die verbindliche Ordnung und Sicherung menschlichen Zusammenlebens.
Ziel des universitären Unterrichts war es, die Absolventen «hinaus[zu]schicken nicht bloss als Streiter für Recht und Gerechtigkeit, sondern auch als Träger der geistigen und sittlichen Werte im Leben von Volk und Staat». Die Fakultät wollte dazu beitragen, «dass Basel in der Schweiz und dass die Schweiz in der Welt sich als unüberwindliche Hochburgen des Rechtes und der Menschlichkeit bewähren».814 Dieses Postulat war eine Antwort auf den Nationalsozialismus im Sinne der ‚geistigen Landesverteidigung‘ aus der Position einer bürgerlichen Mitte heraus. Sie verteidigte die weltanschaulichen Grundlagen und Werte, die den aufgeschlossenen Liberalen und den Freisinnigen gemeinsam waren.
5.6 Abweichung nach links: Arthur Baumgarten Die zweite Basler Zeit (1933 bis 1947/49)815 des Strafrechtlers und Rechtsphilosophen Arthur Baumgarten interessiert mich hier wegen seiner Rolle als ‚linker Flügel‘ der Juristischen Fakultät. Ich sehe davon ab, Baumgartens Stellung in der
814 815
Ruck 1940, 18. Biographie: Kunz 2011, 176–183; Irrlitz 2008, 17 ff.; Gschwend 2006, 333 ff.; Klenner/ Oberkofler 2003, 36 ff. Den aktuellen Wissensstand (zusammen mit einer Bibliographie) stellen Breunung/Walther 2012, 65–80, zusammen. Basler Laufbahn: StABS UA IX 3, 3 Arthur Baumgarten.
Abweichung nach links: Arthur Baumgarten
221
Rechtswissenschaft der Nachkriegszeit und des Kalten Krieges einzubeziehen.816 Als Liberaler ging der junge Baumgarten zum wilhelminischen Geist und zum deutschen Patriotismus während des Ersten Weltkriegs auf Distanz. Wie viele andere wollte er sich vom ‚19. Jahrhundert‘ absetzen, bezog dafür aber einen republikanischen und demokratischen Standpunkt.817 Er bildete sich eine philosophische Position aus, die zu keiner der im frühen 20. Jahrhundert in Deutschland vorherrschenden Schulen passte. In Nordamerika, in England und vielleicht auch in Frankreich wäre seine empiristisch-sensualistische Philosophie jedoch nicht weiter aufgefallen. Vor allem während seiner Genfer Zeit (1909 bis 1920) vertiefte sich Baumgarten in die Philosophie der Aufklärung und eignete sich Rousseaus Überlegungen zur «volonté générale» an.818 In seiner ersten Basler Zeit (1923 bis 1929; von 1920 bis 1923 war er in Köln gewesen) lehrte Baumgarten Strafrecht und daneben Rechtsphilosophie.819 Wie für Mitglieder der Juristischen Fakultät üblich diente er auch als Richter am Straf- und am Appellationsgericht. Aus dieser Zeit datiert das Bild eines sehr belesenen, wortgewandten, geistig offenen und liebenswürdigen Menschen. Dass er 1929 schliesslich den Ruf nach Frankfurt am Main annahm,820 kann nicht verwundern; er passte damals sehr gut in das dortige ideelle Experimentierfeld. In Frankfurt begann er sich für Russland zu interessieren und erlernte die Sprache. In Diskussionen mit deutschen Linken lehnte er 1931 den Marxismus noch ab, der für ihn Kollektivismus und Geringschätzung der Rechte der Individuen bedeutete (Beleg ist ein Vortrag von 1931, der 1933 publiziert wurde).821 Die Erwähnung selbst ist aber ein Hinweis auf die intensive Beschäftigung mit
816
817 818 819
820
821
Kleibert 2010; Gschwend 2006. Dass Baumgarten in der DDR eine ‚humanistische‘ Variante des Sozialismus vertrat und seinen Schülern einen Freiraum für Diskussionen bot, ist unbestritten. Andere Aspekte verdienen eine Klärung, z. B. seine Propaganda für die Sowjetunion als Friedensmacht, sein Verhältnis zu den Machthabern in der UdSSR, seine Rolle als Jurist angesichts der Verfolgung von Oppositionellen und «Republikflüchtigen», die Position zum 17. Juni 1953, zum Ungarnaufstand etc. Irrlitz 2008, 288 ff. Baumgarten 1972, 3: «Zum Weg Arthur Baumgartens». Geschichte der juristischen Lehrstühle in Basel: Kunz 2011, 17. Baumgarten wurde 1923 Nachfolger von August Schoetensack, nachdem Wenzeslaus Graf Gleispach (Wien) wegen zu hoher Salärforderung nicht zu gewinnen war, ebd. 143. Man kann daraus ersehen, dass Baumgarten nicht gezielt als Linksliberaler nach Basel geholt wurde. Kunz 2011, 144. Basel versuchte damals, Baumgarten durch Lohnzulagen zu halten, die die Freiwillige Akademische Gesellschaft finanzierte. Baumgartens Nachfolger in Basel wurde Oscar Adolf Germann. Es handelte sich um Baumgartens Frankfurter Antrittsvorlesung vom Juni 1931. Paraphrase nach dem Manuskript in: Klenner/Oberkofler 2003, 18–20.
222
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
dem Thema.822 Von seinem eigenen Liberalismus ausgehend, der bis in die 1920er Jahre hinein kaum einen Begriff von der «sozialen Frage» hatte,823 entwickelte er eine Kritik des Kapitalismus, der mit seiner Tendenz zum Monopolkapital ausserhalb der Demokratie zu stehen schien.824 Zum Strafrecht meinte er, dass in manchen Fällen nicht der Täter zu bessern sei, sondern die Verhältnisse, in denen er gehandelt habe. Massstab für Baumgartens Kritik war der philosophische (pragmatisch-soziale) Eudämonismus:825 Die Gesellschaft bewegte sich nach seiner Überzeugung auf das grösstmögliche Glück für die grösstmögliche Zahl zu, aber Kapitalismus und Klassentrennung bremsten diese Entwicklung. Schon vor 1933 war Baumgarten überzeugt, dass die herrschende Wirtschaftsordnung geändert werden müsse, um den Menschen zu einem geordneten Leben in Wohlfahrt zu verhelfen. Die Industrialisierung ermögliche – vorausgesetzt, die kapitalistische Ordnung würde beseitigt – allen Menschen ein friedliches Zusammenleben in einer «Arbeitsgemeinschaft» von Freien und Gleichen, die genügend Musse hätten, um ihre Verhältnisse in demokratischer Weise selbst in die Hand zu nehmen.826 Unter Juristen wurde damals in Deutschland das Thema der «Integration» lebhaft erörtert. Rudolf Smend hatte 1928 ein Buch zu diesem Thema publiziert, das für die Weimarer Republik die Vorstellung entwickelte, die Glieder der modernen Massengesellschaft müssten durch besondere Massnahmen in den Staat integriert werden, ähnlich wie die Kirche mit Zeichen, Zeremonien und Ritualen eine Einheit unter den Gläubigen herstelle. Diese Überlegungen implizierten eine Skepsis gegen die parlamentarische Demokratie827 und setzten voraus, dass der Weimarer Verfassungsstaat nicht in der Lage sei, einen Patriotismus zu erzeugen, der die Bürger auf gemeinsame Werte und Ziele hin auszurichten vermöchte. 822
823 824 825 826
827
Klenner/Oberkofler 2003, 41, zitieren dazu aus Ein Leben in der Arbeiterbewegung. Gespräche von Wolfgang Abendroth, der als Student Baumgarten in Frankfurt erlebt hatte: Abendroth 1981. Die erste Erwähnung eines Klassengegensatzes in der Gesellschaft fand Irrlitz in einer Abhandlung von 1927. Irrlitz 2008, 117. Baumgarten hielt den Kapitalismus für in sich widersprüchlich und berief sich dafür auf Herbert George Wells. Irrlitz 2008, 158. Irrlitz 2008, 137. Am deutlichsten ausgesprochen in: Grundzüge der juristischen Methodenlehre, 1939, zitiert in: Baumgarten 1972, 223. 1938 hatte er noch vom Staat erwartet, dass er diese Gemeinschaft organisiere. Baumgarten in: Gumbel 1938, 155. Auch Baumgarten kritisierte die parlamentarische Demokratie als rein formal und stellte ihr die «volonté générale» entgegen, die seiner Idee der «Gemeinschaft» besser entsprach. Dies war eine der Denkfiguren, die ihn schliesslich zum Sozialismus führten, während er den demokratischen Rechtsstaat vorübergehend als Bollwerk gegen den Faschismus schätzte und in ihm den Freiraum sah, in dem sich fortschrittliche Ideen äussern konnten, bevor der Sozialismus real verwirklicht würde. Van Ooyen 2017, 228, 290 ff.; Stolleis 1999, 101–103, 107 f.
Abweichung nach links: Arthur Baumgarten
223
«Gemeinschaft» sei in der parlamentarischen Demokratie nicht möglich. Baumgarten hat demgegenüber die Integrationsidee auf Rousseaus «volonté générale» bezogen.828 Die umfassende Darstellung seiner Auffassung des Rechts, die Baumgarten in seinem Buch Der Weg des Menschen 1933 gab, zeigte den Wandel von der individualistischen Perspektive zum Blick auf die Gesellschaft, die Verantwortung für die sozialen Zustände trage, aus denen sich Verbrechen ergäben. Das Hauptthema aber war der Entwicklungsgedanke.829 Er hoffte auf eine höhere Zivilisationsstufe, eine Epoche des Gemeinsinns, der die Integration der Individuen bewirke. Kriminalpolitik sollte mit Sozialpolitik und entsprechenden Reformen verbunden werden, die auch das Wirtschaftsrecht beträfen.830 Anlässlich der Nazifizierung der Frankfurter Juristischen Fakultät entschloss sich Baumgarten, ohne selbst unmittelbar aus politischen oder ‚rassischen‘ Gründen bedroht zu sein, in die Schweiz ins Exil zu gehen. In seiner Studie über Paul Johann Anselm von Feuerbach hatte er allerdings den Nationalsozialismus im Frühling 1933 öffentlich abgelehnt.831 Er scheint er auch das Vorgehen gegen seine in Frankfurt zahlreichen jüdischen Kollegen missbilligt zu haben.832 Auf eigenen Antrag wurde er auf den 31. Oktober 1933 in Frankfurt entlassen. Auf das Wintersemester 1933/34 erhielt er auf Wunsch der Basler Juristischen Fakultät833 ein persönliches Ordinariat mit bezahltem Lehrauftrag. Sein früheres Basler Ordinariat für Strafrecht war 1930 mit Oscar Adolf Germann besetzt worden, so dass die persönliche Professur nun der Rechtsphilosophie galt. Das Erziehungsdepartement war über Baumgartens Rückkehr nach Basel erfreut, da «auf rechtsphilosophischem Gebiete so viel unerwünschte Importware aus dem Auslande zu uns dringt».834 Die Freude an Baumgartens Rückkehr hielt in Basel bis mindestens 1936 auch im Bürgertum an. In diesem Jahr erhielt er das Basler Bürgerrecht, unterstützt durch Referenzen, die in der ‚besseren Gesellschaft‘ Rang 828 829 830 831
832
833 834
Klenner/Oberkofler 2003, 206–229, zu Smend 218. So schon 1922, in: Baumgarten 1972, 34–109: «Neueste Richtungen der allgemeinen Philosophie und die Zukunftsaussichten der Rechtsphilosophie», insbes. 62 ff. Irrlitz 2008, 120–122. 1932 gehörte Baumgarten in Frankfurt zu denjenigen Professoren, die den Senat in seinem Vorgehen gegen die nationalsozialistischen Studenten unterstützten. Hammerstein 2012, 166. Er war als einer der Professoren bekannt, die das Weimarer ‚System‘ guthiessen und die Angriffe von Rechtsextremen verurteilten. Insofern gab es ein Potential der Bedrohung wegen seiner politischen Einstellung. Jüdische Frankfurter Rechtswissenschaftler: Epple u. a. 2016. «Sie [die «deutschen Rechtslehrer jüdischer Abkunft»] haben nicht spezifisch jüdischen Geist in die deutsche Rechtswissenschaft hineingetragen, sondern sich auf einem bestimmten Gebiet an der geistigen Bewegung des Volkes, unter dem sie lebten, so beteiligt, dass es dieses Volkes unwürdig wäre, wenn es sie nicht zu den Seinigen rechnen wollte.» Baumgarten in der National-Zeitung vom 10. 4. 1938, abgedruckt in: Baumgarten 1972, 213–216. StABS UA IX 3, 3, Arthur Baumgarten, 28. 9. 1933. Zitiert nach Kunz 2011, 145.
224
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
und Namen hatten.835 Die einzige Opposition gegen seine Rückkehr war aus politisch rechtsstehenden Kreisen (Bürger- und Gewerbepartei, «Neue Basler Zeitung») gekommen.836 Die Bedenken, die die Freiwillige Akademische Gesellschaft äusserte (sie trug jährlich Fr. 4’000 an Baumgartens Salär bei), bezogen sich auf das beschleunigte Verfahren, mit dem er nach Basel geholt wurde: Angesichts der Zustände in Deutschland schaffe es ein «gefährliches Präjudiz», der Betrag sei hoch und die Berufung so rasch erfolgt, dass eine gründliche Prüfung nicht möglich gewesen sei.837 Als Jurist war er unter den Basler Professoren zu Beginn angesehen, aber Paul Häberlin zweifelte an Baumgartens Kompetenz in seinem eigenen Fach, der Philosophie: Baumgarten sei von Frankfurt weggegangen, «weil er sich in seiner pazifistisch-übernationalen Einstellung bedrückt fühlte». «Persönlich ist er sehr nett und lebhaft, begeistert und überzeugt». Er habe einen guten Namen als Strafrechtler, wolle aber Philosoph sein, «und da kann ich nicht so mit». Er pflege einen «optimistischen Eudämonismus», sei Menschenfreund und hoffe auf Frieden, das genüge jedoch nicht für eine Philosophie. Er sei Ethiker im moralischen Sinn. «Aber ehrlich. Und ein guter Dialektiker und Darsteller.»838 In Basel entwickelte Baumgarten seine Kritik des Monopolkapitals und des liberalen Bürgertums weiter. Angesichts dessen, was er als Versagen, ja Kollusion des deutschen Bürgertums mit den Nationalsozialisten839 erlebt hatte, hielt er es nun für ausgeschlossen, dass der Liberalismus dem Nationalsozialismus entschiedenen Widerstand leiste. Der (deutsche) politische Liberalismus habe sich schon im ausgehenden 19. Jahrhundert von den Idealen der Aufklärung gelöst und darauf verzichtet, seine Postulate im Sinne einer Demokratisierung der Gesellschaft voranzutreiben. Die These, wonach der Faschismus und der Nationalsozialismus aus der bürgerlich-kapitalistischen Herrschaft hervorgingen und letztlich deren Erhaltung dienten, gewann für ihn an Plausibilität. Er durchlebte einen «Desillusionierungsprozess».840 Nicht nur in Hinblick auf die Analyse des Faschismus gewann der Marxismus für Baumgarten nun einen grossen Stellenwert.841 Er fasste Marx als Fortsetzer der radikalen Aufklärer und der Frühsozialisten auf, der dem (ursprünglich utopischen) Sozialismus eine wissenschaftliche Grundlage verlie835 836
837 838 839 840 841
Referenzen: August Simonius, der Fabrikant Alfred Weber-Stehlin und das Mitglied der Kuratel Adolf Lukas Vischer. Klenner/Oberkofler 2003, 43. Erklärung des Dekans der Juristischen Fakultät zu Händen des Präsidenten der Bürgerund Gewerbepartei, dem Rektorat zur Kenntnis gebracht am 16. 10. 1933: «Feststellungen zu einem Artikel der ‚Neuen Basler Zeitung‘: ‚Zurück in das humane Basel‘ vom Freitag 13. 10. 1933», in: StABS UA IX 3, 3, Arthur Baumgarten. ED an Rektorat und Fakultät, 30. 11. 1933, in: StABS UA IX 3, 3, Arthur Baumgarten. Häberlin an Binswanger, Basel, 9. 2. 1934, in: Häberlin/Binswanger 1997, 241. Irrlitz 2008, 38. Irrlitz 2008, 31. Baumgartens Marxismus-Rezeption: Irrlitz 2008, 30 ff. Grenzen dieser Rezeption: ebd., 33, 35, 357.
Abweichung nach links: Arthur Baumgarten
225
hen habe. Baumgarten hielt seinen eigenen Entwicklungsgedanken mit der Geschichtsphilosophie des Marxismus für verwandt, auch wenn er weiterhin ideelle und psychologische Faktoren geltend machte, die die Entwicklung (ohne strenge Dialektik) vorantrieben. Nach dem Sieg über den Faschismus müsste der Kapitalismus in eine «Arbeitsgemeinschaft» der arbeitenden Menschen überführt werden, die die Voraussetzung für den Völkerfrieden bringen sollte. Denn der Krieg, so hatte er schon über den ersten Weltkrieg geurteilt, sei ein Produkt des Kapitalismus, der gegen aussen auf koloniale Expansion angewiesen sei und der keine anderen Ideale mehr anbieten könne als den «siegreichen Krieg» (Erich Kaufmann 1911)842 – die alte Parole, die nun die Faschisten zu einem «Idol» stilisierten. Baumgarten präzisierte diese These in seinem Vortrag über «Völkerrecht und Weltkrise» von 1942.843 In dogmatischer Weise formulierte Baumgarten seine Analyse des Faschismus 1945. Mit diesem Begriff wollte er ein konkretes historisches Ereignis bezeichnen, keinen «politischen und geistesgeschichtlichen Allgemeinbegriff» konstruieren. Dieser habe die «ganze zivilisierte Welt» nach 1918 erfasst, «um dann nach einem beispiellos grauenvollen Krieg zusammenzubrechen». Sein «Lebenszentrum» war «das nationalsozialistische Deutschland». Zu den Entstehungsbedingungen des Nationalsozialismus zählte Baumgarten den «Monopolkapitalismus, der die Tendenz hat, mit der auf dem Gebiet der Wirtschaft herrschenden Oligarchie die rechtliche Verfassungsform durch Einführung eines autoritären Regimes in Einklang zu bringen», die Arbeitslosigkeit, den durch den Versailler Vertrag verstärkten Nationalismus, die verspätete Industrialisierung und die daraus folgende militaristische Expansionspolitik mit dem Verlangen nach Kolonien. Der Faschismus sei «eine Gegenrevolution gegen die sozialistische Revolution», er sollte «der fortschrittlichen Arbeiterschaft das Rückgrat brechen» und das sozialistische Russland «zerschmettern». Um überhaupt als Gegner des Sozialismus antreten zu können, musste der Faschismus eine «Weltanschauung» erhalten. Dazu wurde der militärische Machtstaat zu einem Idol erhoben als «Gegenwirkung» gegen die «sozialistische Idee». Die Integrationswirkung des Krieges sei für den Kapitalismus notwendig, da dieser nur Konkurrenz und Krisen anzubieten habe. Ein sehr erheblicher Teil des Bürgertums […] hat in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen dem Faschismus mitsamt seiner dreimal unseligen Weltanschauung eine Förderung angedeihen lassen, die ihn hart an den Rand der Weltherrschaft […] heranführte. Das war […] antisozialistische Politik. Dieser jeden Verantwortungsgefühls für das Schicksal der Menschheit entbehrenden Politik ist es zuzuschreiben, dass der Faschismus eine Erscheinung im Weltmassstab geworden ist.
842 843
Irrlitz 2008, 314 f. Wiederabgedruckt in Baumgarten 1972, 242.
226
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
Die Bereitschaft, die faschistische Politik zu unterstützen, erklärte Baumgarten psychologisch aus der «Angst vor dem Neuen», «ein Grausen vor dem Sprung in die Zukunft». Die Wendung im Kampf gegen den Faschismus sei Russland zu verdanken, das als «sozialistisches Land im Kriege gegen die Achsenmächte die schwersten Opfer zu bringen hatte. Und weil dem so ist, ist der Sieg über den Faschismus ein Sieg des Sozialismus.»844 Dass Sozialismus real möglich sei, glaubte er bei seiner Reise in die Sowjetunion 1935 erkannt zu haben. Alles gefiel ihm dort: Die Kollektivierung der Landwirtschaft, die Zusammenziehung der Arbeiterschaft in Fabriken mit zehntausenden von Arbeitsplätzen, Staudämme und Kraftwerke, neue Arbeitersiedlungen, ja auch Straflager und die bolschewistische Auffassung von Strafrecht hielt er für positiv,845 während er 1933 noch Bedenken angesichts der Diktatur, die aus der Oktoberrevolution hervorgegangen war, geäussert hatte.846 Die Nachrichten über die Hungersnot 1932/33 hielt er durch volle Regale in den Läden für widerlegt. «Von Elend der Bevölkerung ist nichts zu merken.» Die Verehrung des toten Lenin machte er sich zu eigen, schien aber vom Aufbau der Diktatur Stalins nichts zu bemerken.847 In Basel engagierte sich Baumgartens Frau, (Nina) Helene Baumgarten-von Salis-Soglio, Schwester des bekannten Historikers Jean Rudolf von Salis, stark in der Flüchtlingsarbeit. Sie wirkte in der Roten Hilfe und in der Basler Hilfsstelle für Flüchtlinge mit. Von 1938 bis 1945 leitete sie diese 1935 gegründete Organisation.848 Von Baumgarten selbst ist ein Engagement für den Frankfurter Rechtsprofessor August Saenger849 bekannt, den er als bürgerlich-liberalen Demokraten 844 845 846 847
848 849
«Der 8. Mai 1945», zuerst in Heft 4 des 1. Jahrgangs von «Sozialismus», wieder abgedruckt in Baumgarten 1972, 395–403. Koziolek 1985, 24–28. Irrlitz 2008, 195. Am 16. 8. 1935, während Baumgarten in Moskau war, erschienen in der deutschen Presse Berichte über die Ermordung des britischen Journalisten Gareth Jones in der Mongolei. Paul Scheffer schrieb für das «Berliner Tageblatt» einen Nachruf. Darin machte er Stalin für den Tod von Jones verantwortlich und stellte dar, wie die Sowjetunion trotz schlechter Ernten und Hungersnöten Getreide exportiere, um ihre Industrialisierung zu finanzieren. Scheffer war allerdings ein bekannter Antikommunist mit Beziehungen zu Goebbels. https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor. Irrlitz 2008, 39 f.; Klenner/Oberkofler 2003, 79. Das (unvollständige) Archiv der Basler Hilfsstelle für Flüchtlinge ist als PA 927 im StABS greifbar. Wichers 2015, 55–58. August Saenger (auch: Sänger), Extraordinarius in Frankfurt, Anwalt und Notar, verlor 1933 die Lehrbefugnis, emigrierte 1936 in die Schweiz und trat von hier aus im selben Jahr eine Professur für Versicherungsrecht in Kaunas (wo auch Baumgarten jeweils im Sommer lehrte) an. 1938 wanderte er in die USA aus. Kurzbiographien der Rechtsanwälte jüdischer Herkunft im Oberlandesgerichtsbezirk Frankfurt (Stand 23. 8. 2004), in: https:// www.yumpu.com/de/document/read/5016314/kurzbiographien-der-anwalte-judischer-her kunft.
Abweichung nach links: Arthur Baumgarten
227
zur Unterstützung durch das Schweizerische Hilfswerk für deutsche Gelehrte an Fritz Hauser empfahl.850 Ausserdem weiss man aus Polizeiberichten, dass er (seit 1937) Mitglied im Schweizerischen Hilfskomitee für notleidende Frauen und Kinder in Deutschland war.851 Baumgarten begegnete so politisch engagierten Arbeitern und kommunistischen Intellektuellen im Schweizer Exil. Seine Philosophie und die Ergebnisse seiner Marx-Lektüre verbreitete er nun in Volkshochschulkursen und in der Arbeiterbildung. Gegen Ende der 1930er Jahre gehörten zu Baumgartens Bekanntenkreis neben seinen Arbeiterschülern und dem Basler Goldschmied Hans Stebler852 intellektuelle Kommunisten wie die Brüder Hans (Architekt) und Georg Schmidt (Direktor des Kunstmuseums). Den Juristen blieb diese Entwicklung ihres Kollegen nicht verborgen. Seit Sommer 1934 las er über Völkerrecht (in Konkurrenz mit dem ganz anders orientierten Jacob Wackernagel [siehe unten] und dem Verteidiger des Rechtsstaates Erwin Ruck), seit Sommer 1936 über «Materialistische (marxistische) und idealistische Gesellschaftslehre», gefolgt vom Thema «Die Gesellschaftslehren der Gegenwart» (Winter 1937/38). Im darauffolgenden Wintersemester bot er eine Vorlesung über «Gesellschaftliches Denken im 19. Jh.» an, um im Sommersemester 1939 beim «Gesellschaftliche[n] Denken in der neuesten Zeit (von Marx bis zur Gegenwart)» anzukommen. Im Sommer 1941 wiederholte er dieses Lehrangebot unter dem Titel «Das gesellschaftliche Denken seit der Aufklärung» und vertiefte es im folgenden Semester als «Das gesellschaftliche Denken von Marx bis zur Gegenwart». Im Sommer 1944 nannte er diese Vorlesung «Geschichte der Gesellschafts- und Rechtsphilosophie seit Marx»; im darauffolgenden Sommer las er über «Idealistische und materialistische Gesellschaftslehre». Geschichte der sozialen Ideen konnten die Studierenden auch regelmässig beim Ökonomen Edgar Salin und (weniger oft) beim Soziologen Hans Ritschl hören, allerdings in ‚bürgerlicher‘ Auffassung. Nur in Baumgartens Vorlesung hörten die Studierenden eine positive Würdigung der Lehren von Marx, Engels und Lenin,853 und unter den Basler Professoren vertrat nur er eine marxistisch inspirierte Faschismusanalyse. 1939 brachte Baumgarten in Bern seine Grundzüge der juristischen
850
851
852 853
Baumgarten an Hauser, 13. 2. 1940, in: StABS Erziehung X 48, Schweizerisches Hilfswerk für deutsche Gelehrte, 1933–1940. August Saenger erschien schon 1933 in einer Liste deutscher Dozenten, die in Basel nach einer Beschäftigungsmöglichkeit gefragt hatten, Hauser an Kuratel, 20. 12. 1933, in: ebd. In dieser Liste standen u. a. auch die Namen von Gumbel, Schaxel und Radbruch. In Baumgartens Dossier, das Klenner/Oberkofler 2003 publizierten, betrifft der erste Eintrag (1. 9. 1937) dessen Mitgliedschaft im Schweizerischen Hilfskomitee für notleidende Frauen und Kinder in Deutschland. Irrlitz 2008, 39. Durchsicht der Vorlesungsverzeichnisse 1933–1945, in: StABS UA AA 2 Lektionskataloge, Vorlesungsverzeichnisse.
228
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
Methodenlehre854 heraus, worin er sein Interesse am Marxismus erstmals breit bekannte und das Recht zu gesellschaftlichen Bedingungen in Beziehung setzte. Die Macht des Grosskapitals sollte durch Sozialisierung gebrochen werden; das Recht galt als Instrument des revolutionären Wandels. Materialismus lehnte er in diesem Buch jedoch ab.855 Zustimmung erntete er damit wenig; Gustav Radbruch erinnerte ihn daran, dass der Rechtsstaat das entscheidende Korrektiv für den zunehmend «kollektivistischen» Staat sein müsse.856 Mit Vorbehalten lobte Michael Schabad das Werk in der freisinnigen «National-Zeitung» als Ansatz gegen die «drohende Barbarei».857 Im Februar 1939 musste Baumgarten seine Position vor der Fakultät erläutern. Er tat dies in einem Schreiben, das der Dekan verlas. Anlass zu diesem Vorgang waren Bedenken von Fakultätsmitgliedern gegen Baumgartens politische Haltung. Das Protokoll vermerkt enigmatisch, dass die Fakultät ihrerseits eine Stellungnahme verfasste, die eines ihrer Mitglieder dem zuständigen Regierungsrat Fritz Hauser vortragen sollte.858 In seinen akademischen Publikationen hatte Baumgarten bis 1939 wenig von seinem sozialistischen Engagement erkennen lassen. Im Basler Rektoratsprogramm veröffentlichte er eine Arbeit zum Thema «Wissenschaftssprache», ohne sich zum Sozialismus zu bekennen. Erwähnenswert ist die Tatsache, dass Baumgarten 1935 im Berner Prozess um die Protokolle der Weisen von Zion ein Gutachten abgab, worin er die «Protokolle» als Fälschung bezeichnete.859 In seinem Beitrag zu dem Buch, mit dem der Mathematiker Emil Julius Gumbel 1938 als Herausgeber die Leistungen emigrierter deutscher Wissenschaftler dokumentieren wollte,860 hatte er seine hauptsächlichen Anliegen vorgebracht: Die falsche Integration des Staatsvolkes durch den Krieg, die Spaltung der Gesellschaft durch den Kapitalismus, die Überwindung dieser Spaltung durch eine «staatlich organisierte Gemeinschaft» nach russischem Vorbild.861 Baumgarten kannte wenigstens einen der Mitautoren von 854 855 856
857 858 859 860 861
Irrlitz 2008, 40; Gschwend 2006, 345 ff., 353. Die als marxistisch geltenden Positionen, die in den Grundzügen zu finden sind, stellen Klenner/Oberkofler 2003, 28 f., zusammen. Baumgarten verteidigte damals den demokratischen Rechtsstaat, vgl.: «Die Krise des Rechtsstaates», unveröff. Vortrag in Zürich, Oktober 1942, abgedruckt in Baumgarten 1972, 247–259. Darin kritisierte er die marxistische These, derzufolge der demokratische Rechtsstaat bloss «ein Produkt des Klasseninteresses» sei. Bis zur Etablierung eines echten sozialistischen Staates müsse «aufs zäheste» an «unsern alten freiheitlichen Institutionen» festgehalten werden. Michael Schabad hatte 1916 in Zürich in Rechtswissenschaften und 1932 bei Karl Joël in Basel in Philosophie promoviert. Zeugin 1998. StABS UA P 4, Acta et decreta collegii jurisconsultorum / Protokoll der Juristischen Fakultät 1936–1944, 14. 2. 1939. Dekan war Jacob Wackernagel. Irrlitz 2008, 19. Prozess in Bern: Arber 2003, 16–18. Es gab auch in Basel einen Prozess, in dem Baumgarten jedoch nicht auftrat. Petry 2020, 76. Gumbel 1938, 141–155: «Psychologie des Staates». Zitiert nach: Gumbel 1938, 155.
Abweichung nach links: Arthur Baumgarten
229
seinem Besuch in Moskau 1935 her, nämlich Julius Schaxel;862 und er war nicht der einzige Basler Autor, denn neben ihm veröffentlichte auch der Theologe Fritz Lieb in diesem Band einen Artikel. Die öffentliche politische Wirksamkeit Baumgartens begann erst nach 1940. 1942 versuchte er eine Erklärung von Intellektuellen gegen die vom Bundesrat verordnete «integrale Neutralität» der Schweiz mit Unterschriften von Prominenten herauszubringen, die die Solidarität der Mehrheit der Schweizer mit den angelsächsischen Demokratien, der Sowjetunion und den unterdrückten Völkern proklamieren sollte.863 Sonst konzentrierte sich Baumgartens öffentlich sichtbare Tätigkeit auf Referate.864 In seinem Vortrag über «Völkerrecht und Weltkrise» vom 24. Juni 1942 hielt er fest, dass «auf dem Gebiet des Völkerrechts kein Kraut gewachsen [ist] gegen die aus der Struktur unserer monopolkapitalistischen Wirtschaft hervorgehende Kriegsgefahr. Will man sie beseitigen, bleibt nichts anderes übrig, als die Struktur unserer Wirtschaft tiefgreifend umzugestalten».865 Er referierte anlässlich der Feier zum Todestag von Karl Marx am 14. März 1943, veranstaltet vom Bildungsausschuss der Sozialistischen Partei Zürich (wiederholt in Basel am 23. März 1943 vor der Basler Kulturgemeinschaft)866 und engagierte sich in der Gesellschaft Schweiz-Sowjetunion. Als 1940 die Kommunistische Partei verboten wurde, gerieten Baumgartens Freunde in die Illegalität. Er führte die Arbeiterschulung weiter, hielt Vorträge und beteiligte sich am Aufbau der 1944 erfolgreichen Liste der Arbeit, aus der 862 863
864
865 866
Julius Christoph Schaxel, geb. 1887 in Augsburg, wurde im Oktober 1933 Professor an der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. Poppe/Weichelt 1985, 26; Gumbel 1938, 280. Irrlitz 2008, 40. Über Erfolg oder Misserfolg erfährt der Leser nur, dass Barth am 14. 11. 1942 seine Zusage zurückzog, in der Unterschriftenliste zu figurieren. Mit Barth und Robert Trösch (damals Schauspieler am Basler Theater, KPD-Mitglied) soll Baumgarten 1943 «eine Zelle der schweizerischen Gruppe ‚Freies Deutschland‘» gegründet haben. Haener 1989. Trösch ging wie Baumgarten nach Kriegsende in die SBZ/DDR. Diese Themenwahl ist bei Baumgarten nicht strategisch zu verstehen. Wichtige Thesen zum Völkerrecht, darunter diejenige über den Vorrang des Völkerrechts vor dem Landesrecht als Mittel zur Beendigung des Krieges oder das Plädoyer für eine Weltrechtsordnung und einen Weltstaat finden sich schon in: «Souveränität und Völkerrecht», 1931 (Baumgarten 1972, 123–167, insbes. 155 ff., 163); vgl. Jütersonke 2010, 87. Dort erkannte er auch die «Behebung der wirtschaftlichen Not» als eine Voraussetzung für den Frieden, 162. Baumgarten war ein grundsätzlicher Pazifist; seine Ablehnung des Krieges folgte nicht nur aus der Rezeption der marxistischen Lehren. «Der Krieg ist unsittlich, weil er die Menschen nicht anders zu vereinen weiss als durch den gemeinsamen Hass der einen gegen die andern und weil er der Zerstörung dient und nicht dem Aufbau.» Baumgarten 1972, 225: Grundzüge der juristischen Methodenlehre, 1939. «Völkerrecht und Weltkrise», 24. 6. 1942, veröff. in Die Friedenswarte 4/5, 1942, wiederabgedruckt in Baumgarten 1972, 234–246, Zit. 241. Klenner/Oberkofler 2003, 55. Die Referate und deren Veranstalter listet das Dossier Baumgarten der Bundespolizei auf, das ebd. 97 ff. abdruckt ist.
230
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
sich die Partei der Arbeit (PdA) konstituierte. ‚Richtige‘ Kommunisten bemerkten, dass er vor allem deshalb als Aushängeschild der Partei verwendet wurde, weil bis 1945 die Kommunistische Partei noch verboten war und man deshalb Persönlichkeiten ins Rampenlicht schickte, die nicht schon vor dem Parteiverbot als Vertreter der Kommunisten in der Öffentlichkeit präsent gewesen waren.867 Im Vorfeld der Wahlen vom März 1944 trat Baumgarten mehrfach als Versammlungsredner für die Liste der Arbeit auf. Er präsidierte die Versammlung, an der am 21. Mai 1944 die lokalen Parteien der Arbeit zu einer nationalen Föderation zusammentraten, und spielte eine besondere Rolle am ersten Parteitag der PdA im Zürcher Volkshaus im Oktober 1944. Nachdem er im Januar 1945 an der Leninfeier der Basler PdA gesprochen hatte,868 wurde er im Februar 1945 Präsident des Bildungs- und Schulungsausschusses der nationalen Organisation.869 Baumgarten redigierte die PdA-Zeitschrift «Sozialismus» und steuerte eigene Beiträge dazu bei.870 Zu seinem 60. Geburtstag wurde er von den Brüdern Hans und Georg Schmidt, von Hans Mühlestein und andern im Volkshaus in einer Grossveranstaltung gefeiert. Baumgarten selbst sprach von seinem Werdegang, seiner Kritik der «Vorkriegszeit» (vor 1914) als einer «im Tiefsten ungeistigen Zeit» und von Leonard Nelsons Ablehnung einer «Rechtswissenschaft ohne Recht».871 Nach einem Seitenhieb auf Max Weber referierte er seine Faschismusanalyse in einer auffallend ideengeschichtlich-idealistischen Beleuchtung. Er arbeite an einer Geschichte der abendländischen Philosophie,872 die noch «stark unter dem Einfluss des bürgerlich idealistischen Denkens» stehe. Den für ihn hohen Stellenwert der Frühsozialisten verschwieg er nicht. Der Ideologieansatz reduzierte sich bei ihm hier auf den «Dämon des Klasseninteresses», der das Bürgertum «gezwungen» habe, «den letzten Fragen des menschlichen Zusammenlebens auszuweichen» statt den Sozialismus zu verwirklichen.873 Von der PdA meinte er, sie betreibe den 867
868 869 870 871 872
873
Darstellung der Gründung der PdA bei: Hofer 1998. Dieser zählt Baumgarten und die Brüder Schmidt zu dieser Kategorie. Die PdA in der Gründungsphase war für Hofer eine Vereinigung von Linken aller Schattierungen, die sich vor allem für die Verhältnisse in der Schweiz interessierten und von Moskau organisatorisch und finanziell unabhängig sein wollten. Basler Stadtbuch, Chronik zum 21. 1. 1945. Klenner/Oberkofler 2003, 58 ff. Liste in Klenner/Oberkofler 2003, 235 f. Vgl. Baumgartens Auseinandersetzung mit Nelson, in: «Leonard Nelsons Rechtslehre und das Naturrecht der Aufklärung», 1925 (Baumgarten 1972, 110–122). Das umfangreiche Buch erschien unter dem Titel Die Geschichte der abendländischen Philosophie ⇤ eine Geschichte des geistigen Fortschritts der Menschheit im Selbstverlag 1945, gedruckt in Genf. Klenner/Oberkofler 2003, 45 f. Siehe den Basler Polizeibericht, ebd. 104–118. Es sprachen Georg Schmidt, Paul Vosseler, Carl Miville jun., Karl Haldimann und Hans Mühlestein. Oberrichter Max Wolff, Zürich, liess ein Glückwunschtelegramm verlesen. Ernst Bösiger, der mit Hans Schmidt das Vorwort zum Geburtstagsheft unterschrieb (im Namen des
Abweichung nach links: Arthur Baumgarten
231
Übergang der kapitalistischen Gesellschaft in die sozialistische Gemeinschaft nicht im leninistischen Sinne.874 Die Sowjetunion diene dabei jedoch als Leitstern. Stalin bezeichnete Baumgarten nun als grossen Marxisten und Staatsmann, den er in eine Linie mit Lenin stellte.875 Kurze Zeit war Baumgarten Mitglied des Erziehungsrats (im Juni 1944 rückte er als Nachfolger des ausscheidenden Dr. W. Widmer für die PdA nach) und hätte als solcher die Basler Erziehungspolitik mitgestalten können. Er beschränkte sich aber weitgehend darauf, die Anliegen des mit ihm befreundeten Psychiaters Heinrich Meng zu vertreten,876 der 1933 aus Frankfurt vertrieben worden war und versuchte, in Basel einen Lehrauftrag für Psychohygiene zu erhalten.877 Dass Baumgarten 1949 als Professor an die Humboldt-Universität nach Ostberlin zog,878 war nur konsequent. An der Basler Universität war er isoliert,879 von der politischen Polizei wurde er seit 1937 observiert;880 die Beobachtung intensivierte sich, als seine Tochter Elisabeth 1948 den deutschen Physiker Robert Rompe ehelichte, von dem man annahm, er arbeite für den sowjetischen Geheimdienst und betreibe Industriespionage.881 Mich beschäftigt hier Baumgartens Verhältnis zum Nationalsozialismus. Mit seiner Art der Faschismuskritik stand er innerhalb der Basler Professorenschaft
874 875 876
877 878 879 880 881
Bildungsausschusses der PdA Basel-Stadt), ist als Lehrer Dr. Ernst Bösiger-Ensner zu identifizieren, ebd. 126 f., 143. Bösiger gehörte zum Freundeskreis der Baumgartens. Zur Abschiedsfeier für das nach Berlin ausreisende Ehepaar Baumgarten in der Kunsthalle, 22. 3. 1949, waren eingeladen: Fritz Lieb, Heinrich Meng, Ernst Bösiger, Alfred Goepfert, Hans Schmidt, Kurt Berger, Hans Lewald, Josef Keller-Winkler, Margrith Strub-Saxer, Max Bächlin, Jean Moser, Daniel Hummel, Georges Ehret, Georg Schmidt, Helene Berger-Morgenstern, Elisabeth Schmidt-Imboden, Anna Keller-Winkler, Ernst Bösiger-Haldimann (nicht identisch mit Dr. Bösiger-Ensner). Der Polizeibericht spricht vom «Bösiger-Zirkel», PdA-Leuten und solchen von der Gesellschaft Schweiz-Sowjetunion. Ebd., 160 f. Publikation der PdA als Baumgarten 1944, wiederabgedruckt in Baumgarten 1972, 260–267. Baumgarten, «Referat an der öffentlichen Versammlung der Liste der Arbeit am 3. 3. 1944 in der Mustermesse Basel», abgedruckt bei Klenner/Oberkofler 2003, 201–205. Irrlitz 2008, 41–43. Baumgarten erreichte die Beförderung Mengs zum Extraordinarius mit Lehrauftrag auf sechs Jahre. Die Regierung beschloss entsprechend am 16. 11. 1945 und legte die Remuneration auf bescheidene Fr. 1’000 fest. StABS Protokoll Erziehungsrat 22. 9. 1944, 13. 11. 1944, 12. 2. 1945, 12. 3. 1945, 28. 5. 1945. Zu Meng siehe unten, Kapitel 6.4. Baumgartens Tätigkeit in der SBZ und der DDR: Kleibert 2010, 112–118, 184–190, 229, 251. Der Historiker Edgar Bonjour berichtet in seinen Erinnerungen, dass Baumgarten nicht mehr zu den Nachtessen unter Kollegen eingeladen wurde. Klenner/Oberkofler 2003, 36. Kunz 2011, 146. Klenner/Oberkofler 2003, 88.
232
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
allein da. Er folgte weder der Auffassung, Faschismus sei ein einfacher ‚Agent‘ des Kapitalismus, noch der These des «Sozialfaschismus», die in der Sozialdemokratie den entscheidenden Gegner sah. Die ideengeschichtliche Herleitung des Faschismus aus Militarismus und expansivem Nationalismus sowie der Ansatz der perversen «Integration» einer Nation durch das «Idol» des «siegreichen Kriegs» waren zentrale Elemente seiner Analysen. Baumgartens Erwartung, der Sozialismus bringe den Weltfrieden, hatte eine genuin humanistische Wurzel und war bei ihm nicht Anhängsel einer strategisch-politisch konzipierten kommunistischen Doktrin. Er erwartete von den Intellektuellen (vergeblich) kulturelle Beiträge zur Überwindung der Kulturkrise und rechnete mit einer durchgehenden, vom Historischen Materialismus recht weit entfernten Fortschrittsbewegung der Menschheit in der Geschichte. Psychologische Interessen klangen an, wenn er den Kampf gegen den Sozialismus mit der «Angst vor dem Neuen» erklärte. Thesen wie die von der «verspäteten Nation» (Plessner) führten zu einer Vorstellung von der in Italien und Deutschland verspäteten Industrialisierung als Voraussetzung für die Etablierung faschistischer Herrschaft. Marxistisch gefärbt war die zentrale Stellung, die er dem Klassengegensatz zusprach, und die Vorstellung, dass Liberalismus und Sozialismus die jeweils entsprechenden Ideen (aber nicht unbedingt «Ideologien» im vulgärmarxistischen Sinn) der beiden Klassen seien. Im Kapitalismus, insbesondere im «Monopolkapitalismus» sah er die Wurzel allen Übels: Er hintertreibe die Schaffung von «Gemeinschaft»,882 verhindere die Verwertung der Errungenschaften der Industrialisierung zum Wohle der grösstmöglichen Zahl von Individuen, führe notwendig zum Krieg und zeige Wohlwollen gegenüber dem Faschismus dort, wo dieser die Arbeiterbewegung zerschlage. Mit seiner Art des Pazifismus lieferte er sich der sowjetischen Propaganda aus, der zufolge allein die Diktatur Stalins den Weltfrieden verspreche. Obschon frei von Antisemitismus, hatte Baumgartens Faschismusanalyse kein Sensorium für den Holocaust. Baumgarten hatte diese Auffassung selbstständig aus der Lektüre der marxistischen und sozialistischen Klassiker vor dem Hintergrund seiner eigenen (bürgerlich-idealistisch-aufklärerischen) philosophischen Bestrebungen erarbeitet.883 Seine Rolle als Intellektueller in der kommunistischen Arbeiterbewegung 882
883
«Gemeinschaft» war für Baumgarten schon vor seinem Bekenntnis zum Marxismus ein zentrales Motiv. Als Jurist war er der Auffassung, dass das Recht aus «Gemeinschaftshandeln» folgen müsse. 1932 forderte er eine Lebensphilosophie, die die Menschheit als «Gemeinschaft» verstehe. «Gemeinschaftsarbeit» war hier schon Schlüsselwort; der Weg zum Begriff «Arbeitsgemeinschaft» war nicht weit. Der Wunsch nach «Gemeinschaft» hat Baumgartens Schritte in den Sozialismus beschleunigt. «Rechtsphilosophie und Praxis», unpubl. Vortrag, Juristische Gesellschaft Frankfurt a. M., 14. 11. 1932, abgedruckt in Baumgarten 1972, 168–181, insbes. 180 f. Überblick über Faschismustheorien: Woodley 2010; klassisch Saage 1997; Wippermann 1997. Faschismusthesen des Kommunismus bis 1935: Luks 1985.
Jacob Wackernagel – ein rechtsextremer Jurist?
233
war international gesehen kein Sonderweg – man denke an die Bedeutung der Intellektuellen in der Kommunistischen Partei Frankreichs.884 In den Schweizer Verhältnissen, aber auch bezogen auf die in der deutschen Rechtswissenschaft herrschenden Tendenzen war Baumgartens Weg allerdings einmalig für einen etablierten Professor.
5.7 Jacob Wackernagel – ein rechtsextremer Jurist? Wenn mit Arthur Baumgarten der ‚linke Flügel‘ der Basler Juristen identifiziert wurde, dann war Jacob Wackernagel auf dem ‚rechten Flügel‘ zu lokalisieren. Er studierte in Basel, Lausanne, Göttingen und Berlin. 1915 doktorierte er in Basel bei Andreas Heusler in Rechtsgeschichte. 1918 wurde er Privatdozent, 1924 Extraordinarius und 1934 Ordinarius885 mit einer persönlichen Professur.886 Ab 1937 leitete er zudem das Basler Institut für Internationales Recht und Internationale Beziehungen,887 dessen Gründung er selbst betrieben hatte. Wackernagel war Richter in Basel, Grossrichter bei der Armee, seit 1938 sass er im Grossen Rat für die Liberalen;888 1956 wurde er Rektor der Universität.889 884 885 886
887
888
889
Ory/Sirinelli 2002. StABS Protokoll S 4 Erziehungsrat, 30. 4. 1934; Regierungsratsbeschluss vom 15. 5. 1934. Wackernagel verlangte eine Lohnerhöhung und fand es ungerecht, dass Arthur Baumgarten Fr. 12’000 erhalte. Wackernagel hatte seit 1935 Fr. 7’000 bezogen, davon Fr. 1’000 zu Lasten der Freiwilligen Akademischen Gesellschaft (FAG). Wackernagel an Thalmann, Kuratelspräsident, 16. 11. 1937, in: StABS ED-Reg 1a 2. Universität Basel, Juristische Fakultät, Ordnung des Instituts für internationales Recht und internationale Beziehungen in Basel, durch den Erziehungsrat am 6. 9. 1937 genehmigt, in: StABS ED-Reg 1a 2. Das Institut sollte u. a. die Tätigkeit des Comité suisse de coordination des hautes études internationales unterstützen, ebd., Bericht (von Wackernagel) über das Institut, 29. 2. 1940, an ED. Seit 1936 war die Schweiz an der Conférence permanente des hautes études internationales beteiligt. Dem Comité de coordination gehörten August Simonius und Wackernagel an. Die Bibliothek wurde zusammengestückelt aus Beständen der Universitätsbibliothek und des Juristischen Seminars, ergänzt durch private Schenkungen. Am Institut hielt 1939/40 Hans Lewald Übungen in internationalem Recht ab, weil Wackernagel wegen Militärdienst oft abwesend war. Wackernagel betonte, dass es das einzige deutschsprachige Institut sei, das weiterhin mit Engländern und Franzosen kooperieren könne. Zur Finanzierung des Instituts in Verbindung mit Wackernagels Lohnforderungen auch: StABS UA P 4, Acta et decreta collegii jurisconsultorum/Protokoll der Juristischen Fakultät 1936–1944, 4. 3. 1938. Über seine Aktivitäten im Parlament wissen wir aus der «Chronik» in den Basler Jahrbüchern, dass er am 10. 11. 1938 über das prämierte Wandbild für das neue Kollegiengebäude der Universität interpellierte. Am 13. 4. 1939 lehnte der Grosse Rat seinen Anzug betr. Geheimhaltung der Unterschriften bei Initiative und Referendum ab. Am 16. 1. 1941 interpellierte er über Berufsunkosten und steuerpflichtiges Einkommen. Kunz 2011, 165–168; Wanner 1967.
234
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
Die Familie Wackernagel war 1835 durch die Berufung des Germanisten Wilhelm Wackernagel auf die Professur für deutsche Philologie in Basel heimisch geworden. Wilhelm Wackernagels Sohn war der berühmte Sprachforscher Jacob Wackernagel-Stehlin (Jacob I.), der von 1902 bis 1915 in Göttingen lehrte und danach in Basel eine Professur versah. Dessen jüngerer Bruder Rudolf war in Basel als Staatsarchivar eine prominente Gestalt.890 Seine Geschichte der Stadt Basel (erschienen in Basel von 1907 bis 1924) gilt bis heute als Klassiker. Er verfasste auch eine Geschichte des Elsass (Basel 1919), die im völkischen Kreis um das Alemannische Institut in Freiburg i. Br. (Friedrich Metz) sehr geschätzt wurde.891 Er hatte sieben Kinder; eines davon wurde Gattin des Juristen, Völkerbundkritikers und Heimatschützers Gerhard Boerlin, der 1913 das Haus «Vogelsang» an der Wenkenstrasse in Riehen errichten liess, wo sich die Verwandtschaft, die einen engen Zusammenhalt pflegte, oft traf.892 Jacob I. und Rudolf hegten wie Boerlin Sympathien für Deutschland im Ersten Weltkrieg und hofften nach 1918 auf den Wiederaufstieg der deutschen Nation. In den deutschen Verhältnissen nach 1933 versuchten sie, Positives zu erkennen, auch wenn sie mit Hitlers Politik nicht in jeder Hinsicht einig gingen und keine Annexion der Schweiz an das Reich wünschten.893 Jacob II., um den es hier geht, war der älteste Sohn aus der zweiten Ehe des Sprachgelehrten. Beide Söhne von Jacob Wackernagel I. hatten ausgeprägte historische Interessen. Hans Georg wurde Historiker, wirkte an der Universität als Privatdozent und später als Extraordinarius, gab die Basler Universitätsmatrikel heraus und machte sich einen Namen als historischer Volkskundler mit prägnanten Thesen zur mittelalterlichen Schweiz. Die Vorstellung einer alteidgenössischen Staatlichkeit trat bei Hans Georg Wackernagel zurück hinter dem Bild einer bündisch strukturierten (Un⌥)Ordnung (Knabenschaften), die mit dem Massstab der freisinnigen patriotischen Rationalität des 19. Jahrhunderts nicht zu erfassen war. Er publizierte anfänglich wie sein Bruder in den «Schweizer Monatsheften» und in der «Neuen Basler Zeitung», suchte aber nach dem Aufstieg des Nationalsozialismus zur Herrschaft in Deutschland andere Publikationsorte.894 Seine Studien 890 891
892 893 894
Janner 2012. Vom Alemannischen Institut veranlasster Neudruck, 1940. Friedrich Metz schenkte ein Exemplar dem nationalsozialistischen Bürgermeister von Freiburg i. Br., Kerber. «Bericht über das Alemannische Institut in Freiburg für das Jahr 1939/40» und Schreiben Metz an Kerber, 19. 9. 1940, in: Stadtarchiv Freiburg i. Br., C4/X/19/10, Kunst und Wissenschaft, Alemannisches Institut. Zimmerli 2009, 2, spricht von «fast sippenhafte[r] Kohäsion» der Familie Wackernagel. Vgl. Zimmerli 2009. M. Wackernagel 2013; Graf 2002. Veröffentlichung in den «Schweizer Monatsheften» 6, 1926/27. Tendenz dieser Zeitschrift: Baumann o. J. Der Name der Zeitschrift änderte im Verlauf der Zeit von «Schweizerische Monatshefte für Politik und Kultur» zu «Schweizer Monatshefte». Ich schreibe in der Regel «Schweizer Monatshefte». In der «Neuen Basler
Jacob Wackernagel – ein rechtsextremer Jurist?
235
über das Elsass ergaben sich aus seinem volkskundlichen Interesse.895 Er war zu kritisch, um ideologische Anregungen aus Deutschland unmittelbar zu übernehmen. Nicht Mythologien interessierten ihn, sondern Entdeckungen in den Texten, und diese sprachen von Freiheit. Aber er fand nichts dabei, in der deutschen völkischen Wissenschaft zu suchen, was sie an Brauchbarem für ihn zu bieten hatte.896 Sein Bruder Jacob Wackernagel II. spezialisierte sich zunächst auf mittelalterliche Rechtsgeschichte,897 begab sich dann aber in viele andere juristische Gebiete: Steuerrecht, internationales Recht, deutsche und schweizerische («Germanische») Verfassungsgeschichte, Staatsrecht, Völkerrecht und weitere Felder. Seine akademische Karriere war letztlich erfolgreich, wenn auch nicht frei von Schwierigkeiten. Dem Privatdozenten erteilte der Regierungsrat 1925 nur mit Bedenken einen Lehrauftrag; er sei kein guter Redner und habe einen «gewundenen Weg» hinter sich. Diese Bemerkungen gingen auf Carl Wieland (Professor für Handels- und Zivilrecht) zurück.898 Die Beförderung zum persönlichen Ordinarius wurde 1929 von der Kuratel zuerst abgelehnt: Er erfülle die Anforderungen nicht, seine wissenschaftliche Produktion (sic) sei «klein».899 1934 erhielt er eine persönliche Professur, wobei auch hier ein prominenter Fakultätskollege, Erwin
895
896
897
898 899
Zeitung» publizierte Hans Georg Wackernagel seinen Habilitationsvortrag «Das Ausscheiden der Kelten aus der Weltgeschichte» am 10. 9. 1932 und am 17. 9. 1932; danach schrieb er für die liberal-konservativen «Basler Nachrichten» (1934, 34), die freisinnige «National-Zeitung» (1936, 36, 37) und in Fachzeitschriften wie «SAVk» und «SVk». Bühler 1968. Hans Georg Wackernagel nahm 1936 an einer Tagung der Westdeutschen Forschungsgemeinschaft in Bad Freyersbach zur Geschichte des Elsass teil. Weitere Teilnehmer aus der Schweiz waren Arthur Frey (Wettingen), Bruno Meyer (Zürich) und Karl Schib (Schaffhausen). An anderen Tagungen derselben Organisation wirkte der Basler Staatsarchivar Paul Roth mit. Fahlbusch 1999a, 395. Fazit aus Einblicken in den wissenschaftlichen Nachlass, in: Nachlass Hans Georg Wackernagel-Riggenbach, StABS PA 82 N 2, 4, Notizen über «Bauerntum und Hirtentum», insbes. Vorlesung «Bauerntum und Hirtentum des Mittelalters»; 2, 47, Mappen und Zettel zu bestimmten Themen. Wackernagel 1923, 17–34, zeigt deutlich wirtschaftsgeschichtliche Interessen und eine klare Vorstellung von mittelalterlicher ländlicher Gesellschaft. Rechtsformen entstanden nach ihm aus wirtschaftlichen Verhältnissen, ähnliche Verhältnisse generierten ähnliche rechtliche Bestimmungen. Ebd., 9 f. Bühler 2013. StABS ED-Reg 1a 2, Regierungsratsbeschluss vom 26. 12. 1925. Kuratelspräsident Ernst Thalmann an die Juristische Fakultät, 8. 10. 1929, in: StABS EDReg 1a 2. Antrag der Juristischen Fakultät an die Kuratel vom 5. 6. 1929, in: UNI-REG 5d 2-1 (1) 385.
236
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
Ruck,900 Bedenken gegen Wackernagels damals neuestes Buch, Der Wert des Staates (datiert 1934, faktisch veröffentlicht im Herbst 1933; auf den Inhalt werde ich zurückkommen), anmeldete. Die Fakultät wollte ihn auf Rechtsgeschichte beschränken, weil Ruck selbst hauptsächlich das Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht behandelte. Wackernagel erhielt dann im Sommer 1938 offiziell den Auftrag, auch über Völkerrecht zu lesen, allerdings nur «im Einverständnis mit dem Inhaber des gesetzlichen Lehrstuhls für öffentliches Recht».901 Als Staatsrechtler interessierte er sich besonders für die Frage des Zusammenhalts («Integration») innerhalb einer Nation und der Bereitschaft der Angehörigen dieser Nation, sich den Forderungen, die der Staat an die Mitglieder stellte, nicht nur willig zu unterwerfen, sondern mit begeisterter Zustimmung den Führern zu folgen. Dabei konnte er sich an der in der Weimarer Republik breit geführten Diskussion orientieren, die sich namentlich auf das Buch von Rudolf Smend, Verfassung und Verfassungsrecht (1928), bezog.902 Als Spezialist des internationalen Rechts vertrat Wackernagel die in national-konservativen deutschen Kreisen beliebte These, dass sich im Verhältnis zwischen den Staaten ein gegenseitiger Respekt zu manifestieren habe, was in der konkreten Anwendung auf Deutschland bedeutete, die «Schmach» von Versailles durch das Einfordern dieses Respekts bei den Siegermächten von 1918 aussenpolitisch zu überwinden. Mit dem Nationalsozialismus erhielten beide Interessen Wackernagels, ‚Integration‘ und Aussenpolitik, eine neue Aktualität. Nachdem schon im italienischen Faschismus die Ausrichtung der Bevölkerung auf einen bestimmten Nationalismus durch Propaganda, Fahnen- und Führerkult wichtig geworden war, kam im Nationalsozialismus zusätzlich zum Propagandathema die aussenpolitische Selbstdarstellung des ‚Dritten Reichs‘ hinzu, das sich mit anderen Staaten auf Augenhöhe stellen wollte und grossen Wert darauf legte, in internationalen Beziehungen respektiert zu werden. Diese Gegenstände waren damit nicht von rein akademischem Interesse, sondern implizierten eine politische Anteilnahme am Zeitgeschehen. In seinen staatsrechtlichen Überlegungen versuchte Wackernagel, sowohl an gewissen Grundsätzen des Liberalismus festzuhalten als auch dem ‚19. Jahrhundert‘ eine Absage zu erteilen. Bezeichnend dafür ist sein Aufsatz über das Verhältnis der Persönlichkeitsrechte zum Recht des Staates. Umfassende Kenntnis sowohl der Tradition der Menschen- und Bürgerrechte als auch eines Staatsrech900
901 902
Kunz 2011, 256–258. Immerhin erschien das Buch in der Reihe «Basler Studien zur Rechtswissenschaft», hg. von Carl Wieland, Erwin Ruck, August Simonius, Robert Haab und Oskar A. Germann. Personalkarte für Dozenten. Regierungsratsbeschluss vom 5. 4. 1938, in: StABS UNI-REG 5d 2-1 (1) 385. Korrespondenz zwischen Wackernagel und «Rudolf Smed» (sic), Berlin, in: StABS PA 82 M2 111. Integrationslehre: Stolleis 1999.
Jacob Wackernagel – ein rechtsextremer Jurist?
237
tes, das alle Rechte des Bürgers nur aus dem Recht des Staates fliessen lassen wollte, stellte er hier in den Dienst der Aufgabe, Menschen- und Bürgerrechte in ihren Einzelbestimmungen als nie endgültig fixiert und letztlich historisch-soziologisch bedingt zu relativieren. Diese aus freiheitlicher Sicht ärgerliche Relativierung von Grundrechten verband er wiederum mit der liberalen Intention, das Recht des Individuums (sogenannte «subjektive öffentliche Rechte», die dem Individuum grundsätzlich gegenüber dem Staat in juristischem Sinne «Persönlichkeit» verleihen) im Verhältnis zum Staat als absolutes Recht zu erweisen, bis hin zur Anerkennung eines Widerstandsrechts gegen den Staat, das er anscheinend auch dem Widerstand von rechts, exemplifiziert im Hitlerputsch, zubilligte. Die einzelnen Bestimmungen der Menschen- und Bürgerrechte waren für Wackernagel demgegenüber wandelbare Regelungen, die das absolute und damit unveräusserliche Recht des Individuums gegenüber dem Staat auf «Persönlichkeit» jeweils zeit- und gesellschaftsbedingt konkretisierten.903 Diese Arbeit erschien in den politisch-kulturellen Blättern der «Schweizer(⌥ischen) Monatshefte», sollte also ein allgemein gebildetes Publikum erreichen, das im rechtsbürgerlichen Spektrum angesiedelt war – ein Hinweis auf die Ambivalenz des Wackernagelschen Programms zwischen Wissenschaftlichkeit und politischer Nutzbarkeit, zwischen Liberalismus und postliberalem Relativismus, zwischen der Auffassung der Rechtswissenschaft als Normwissenschaft und der Suche nach ‚Realismus‘. Zum Staatskult des Faschismus veröffentlichte Wackernagel sein bereits erwähntes Buch über den Wert des Staates.904 Das Manuskript lag 1933 vor, als über Wackernagels Beförderung zum Ordinarius diskutiert wurde. Aus der zeitlichen Distanz gesehen wirkt das Buch recht differenziert. Nur wenige Positionen wurden darin eindeutig bezogen, so die Absage an das ‚19. Jahrhundert‘ und an die rationalistische Staatsrechtswissenschaft. Staat sei nicht vernunftmässig konstruierbar, erst recht nicht im Geiste der Aufklärung als Instrument zur Befriedigung der Interessen der Bürger. Der Staat erscheint bei Wackernagel als Organismus und als Zielpunkt der Vergemeinschaftung der Individuen. Die Wissenschaft müsse ihre Ansätze dem Gegenstand entsprechend anpassen: Wackernagel empfahl einen methodischen Verzicht auf eine logisch streng geschlossene Gedankenentwicklung und befürwortete die Erfassung der Wirklichkeit durch Intuition und eine dem irrationalen Gehalt des Gegenstandes angepasste Perspektive (33, 266). Die Mechanismen der Integration stellte er an faschistischen und nationalsozialistischen Beispielen vor, ohne dass der Leser zwingend den Schluss ziehen musste, der Autor wolle ihm diese Diktaturen als Vorbilder empfehlen. Er blendete jedoch alle Gewalt aus, die diese Regimes gegen ihre Opposition anwandten. Diese Ausblendung gewann propagandistische Züge, wenn er paramilitärische 903 904
Wackernagel 1924. Das Interesse am Hitlerputsch zeigt sich in den Zusätzen zu seinem Handexemplar, das im Nachlass erhalten ist. Wackernagel 1934. Die Seitenzahlen referenziere ich im Text in Klammern.
238
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
Organisationen wie die SA lobte, weil sie angeblich «der grossen Zahl der in ihnen organisierten Volksgenossen Möglichkeiten zur Betätigung und Äusserung ihrer Staats- und Nationalgesinnung bieten und diese fortlaufend neu beleben und in die richtige Bahn lenken können» (216). Er sah nur positive Wirkungen auf die «geistige Desorientiertheit der heutigen Zeit»: Das Individuum suche sein «persönliches Dasein» an Berufsorganisationen, kirchliche Gemeinschaften, Bünde, Parteien anzubinden und es in diese einzuordnen. Der Staat müsse dieses «Einordnungsstreben» «sammeln und auffangen», um dem Einzelnen Gelegenheit zu verschaffen, sich als Teil eines «grösseren und wertvolleren Ganzen» zu fühlen. Faschismus und Nazismus sollten nach Wackernagel nach ihrer Leistung für die «Vergemeinschaftung der Staatsangehörigen zur Nation» gewürdigt werden (268). Den Kampf für die bürgerlichen Freiheiten im 19. Jahrhundert schätzte Wackernagel gering. Der «Geist» der Verfassung, der zum Ausdruck bringe, was die Menschen eine, galt ihm als wichtiger denn einzelne Verfassungsbestimmungen, die die Freiheit garantieren sollten (76, 194–198). Zeigte er Skepsis gegenüber der Demokratie, so teilte er den Eindruck vieler Zeitgenossen, dass eine rechtsstaatliche demokratische Republik («Gesetzesdemokratie» im Unterschied zur «Führerdemokratie», 227) wenig Anziehungskraft auf Menschen ausübe, die vom Staat eine Orientierung an Werten erwarteten, denen sie sich hingeben könnten. Die Staatsform der Demokratie diskutierte Wackernagel zwar nicht ganz ohne Sympathie, aber unter der Voraussetzung, dass sie nicht ein Wert an sich sei, sondern in ihrer Funktionserfüllung für den Staat gesehen werden sollte (227 ff.).905 Als Liberaler wollte Wackernagel nicht, dass das Individuum sich in einer als Masse gedachten Nation auflösen solle, sondern dass sein Dasein durch die eindeutige Orientierung einen neuen Inhalt erlange, der sein Ich stärke. Er bestritt, dass integrativer Nationalismus die Kriegsgefahr vermehre, denn eine starke Nation erfülle ihre Mitglieder mit Selbstsicherheit und dämpfe Aggressionen (269). Er verwahrte sich dagegen, einer Staatsvergötterung das Wort zu reden (267). Der starke Nationalstaat schränke Minderheiten zwar kulturell ein, grenze sie aber nicht aus (178). Die bei Volkstumspolitikern beliebte Vorstellung, dass der Nachbarstaat ein «Schutzherr» der entsprechenden nationalen Minderheit sein soll, überzeugte Wackernagel nicht (187). Mussolinis Italienisierungspolitik im Südtirol billigte Wackernagel anscheinend ohne völkische Vorbehalte, aber die Durchsetzung des Französischen im Elsass seit 1918 fand er übertrieben 905
In Wackernagel 1936, ergänzte er diese Betrachtung dadurch, dass er für eine Milizarmee, wie sie die Schweiz besass, eine integrative Kraft postulierte, die den Einzelnen mit dem Staat zu einer Identifikation führe. Nach seiner Ansicht litt die Weimarer Republik darunter, nur eine Berufsarmee gehabt und damit die Chance verpasst zu haben, die Deutschen durch die allgemeine Wehrpflicht an die Republik zu binden.
Jacob Wackernagel – ein rechtsextremer Jurist?
239
(182–186). Juden betrachtete er als «Gastvolk», sah von ihnen jedoch zunächst keine Gefahr für Gesellschaft oder Wirtschaft ausgehen. Mit Interesse las er jüdische Autoren und befasste sich als Rechtshistoriker mit jüdischen Traditionen (31).906 Den Ausschluss der Juden aus dem deutschen Staatsdienst verteidigte er jedoch: Dieser dürfe «keineswegs aus blossem Antisemitismus erklärt werden. Sondern der massgebliche Gedanke für eine solche Anordnung scheint doch wohl darin zu liegen, dass ein mit auf der Idee einer spezifisch germanisch-deutschen Nationalität aufgebauter Staat diese Idee nun auch in seinem Beamtenkörper grundsätzlich verwirklichen soll. Denn der Beamte ist, wie wir sahen, ein Repräsentant auch seines [des Staates] besonderen Wesens». Er zitierte zwar Hitlers Mein Kampf mehrfach, aber das Ziel der Judenvernichtung wurde ihm wie vielen anderen damals nicht bewusst (180). Die akademischen Urteile über Wackernagels Buch, die anlässlich seiner Beförderung zum Ordinarius in der Universität gefällt wurden, waren verhalten, wobei ihm jedoch zugestanden wurde, dass er sich an die Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens gehalten habe und man deshalb die Studie annehmen müsse, auch wenn man mit der impliziten Tendenz nicht einverstanden sei.907 In der liberal-konservativen Presse wurde das Buch jedoch sehr lobend besprochen.908 Ebenso lobend äusserte sich Gerhard Boerlin-Wackernagel, der in den Bezügen auf Bismarck und Hitler einen grossen Vorzug sah.909 Aus einer vergleichbaren Ecke kam die Zustimmung von Friedrich (Fritz) Vöchting-Oeri, der allerdings auf eine inhaltliche Auseinandersetzung verzichtete: Das Werk erfülle «in höchstem Grade ein Zeitbedürfnis».910 Ohne auf die Hitler-Zitate einzugehen, würdigte auch der liberale Regierungsrat Carl Ludwig-von Sprecher, damals Chef des Basler Justiz- und Polizeidepartements, das Buch positiv, allerdings mit einer gewissen Zurückhaltung. Er freute sich darüber, dass «blutleeren» Konstruktio906 907
908
909
910
Bsp. Wackernagel 1923, 10. Erwin Ruck distanzierte sich vorsichtig in seinem Gutachten an die Kuratel anlässlich der Beförderung Wackernagels zum persönlichen Ordinarius. Kunz 2011, 165–168. Ruck hat Wackernagel jedoch am 30. 12. 1933 privat ausdrücklich zum Buch «beglückwünscht», in: Nachlass Wackernagel, StABS PA 82 M2 98. «Der Wert des Staates», Zeitungsausriss, Quelle unbekannt, Autor «-r.», in: StABS EDReg 1a 2. Gelobt wurde die Behandlung der Staatsgesinnung und des Verhältnisses zwischen Staat und Individuum. Richtig wurde festgestellt, dass das Buch sich auf aktuelle deutsche Literatur beziehe (Jellinek, Smend, Kelsen). Gerhard Boerlin schreibt, er habe den «stattlichen Band» mit «Wohlgefallen in die Hand genommen» und sei sehr beruhigt darüber, dass sich das Werk nicht in Spekulation verliere. Es sei «ein Werk der Anschaulichkeit» gemäss der «Basler Schule» geworden, «weil ich sofort auf Namen wie Bismarck und Hitler stiess. Bei solchen Gewährsmännern[,] sagte ich mir[,] bleibt der Verfasser auf dem Boden des Wirklichen.» Boerlin an den «Lieben Jacob», 31. 12. 1933, in: StABS PA 82 M2 9. Vöchting an Wackernagel, 11. 1. 1934, in: StABS PA 82 M2 134, Korrespondenz mit Friedrich Vöchting.
240
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
nen «zu Leib» gerückt werde.911 Vorbehaltlose Anerkennung äusserte der Advokat Conrad Gelzer, der eine Besprechung des Werks für die «Schweizer Monatshefte» verfasste.912 Auch dem Berner germanophilen Rechtshistoriker Hans Fehr, der die Tendenz deutlich erkannte und schätzte, gefiel das Buch sehr gut: Ich begrüsse dieses Buch lebhaft. […] Über die fade u[nd] meist farblose Staatskonstruktion hinaus, führt die Studie mitten in das dynamische Wesen der Wirklichkeit hinein. Es ist noch freier als Smend u[nd] es bildet einen erfrischenden Gegensatz zur blutleeren Lehre von Kelsen […]. Alles kommt auf die Wahrheit hinaus, dass wir ein Gebilde, wie den Staat, mehr dynamisch betrachten u[nd] dennoch das notwendig Statische nicht übersehen.913
Die «Neue Basler Zeitung», das deutschfreundliche Organ der bürgerlichen und gewerblichen Rechten in Basel, druckte ausführliche Zitate aus dem Werk ab, wohl als Zeichen völligen Einverständnisses. Einleitend bemerkte das Blatt: «Die Aktualität solcher Untersuchungen beruht in der Erkenntnis vom Vorhandensein wesentlicher Elemente irrationalen Gehaltes in einer Zeit, die am allzu Rationalen zu veröden droht. Im Volk ist das Sehnen nach den grossen, menschlichen Werten des Staates wieder erwacht.»914 Der Privatgelehrte Eduard His, von 1921 bis 1948 Herausgeber der «Zeitschrift für Schweizerisches Recht», besprach das Buch ebenfalls zustimmend, wenn er auch Einwände gegen die Ausführlichkeit hatte, mit der Nebensächliches behandelt wurde.915 Erst nachträglich äusserte sich öffentlicher Widerspruch. Max Imboden stellte in seinem Nachruf auf Wackernagel von 1967, der sonst wohlwollend formuliert war, fest, der Autor habe in diesem Buch die Natur des modernen Staates völlig verkannt.916 911
912
913 914 915 916
Ludwig an Wackernagel, 25. 12. 1933, in: StABS PA 82 M2 78, Korrespondenz mit Carl Ludwig-von Sprecher. Ludwig besprach das Buch in der Zeitschrift für Schweizerisches Recht 54, 144 f., und lobte es vorbehaltlos; der Inhalt sei «lebendige Wirklichkeit». Gelzer war an einer inhaltlichen Auseinandersetzung interessiert; seine Zustimmung beruhte auf ähnlichen Orientierungen, wie sie Wackernagel favorisierte: «Ich hatte kürzlich den Schriftleiter der Schweiz. Monatshefte gesprochen und ihm von Deinem fabelhaften Buch etwas erwähnt. Er ersuchte mich um eine Besprechung.» Als Beispiel für die Bedeutung des Buches nannte er einen Aufsatz in: Die Tat, Februar (H. 11) 1934, in dem die Schule als entscheidender staatlicher Integrationsfaktor bezeichnet werde. In einem nationalsozialistischen totalen Staatswesen müsse «das ein Bau von totaler Integration sein». Vermeintlich nur juristische Begriffe rückten bei Wackernagel in ein neues Licht. Die Rezension erschien in den Schweizer Monatsheften unter dem Titel «Über das Wesen der Staatsgesinnung» (Gelzer 1933). Fehr an Wackernagel, Muri 14. 3. 1934, in: StABS PA 82 M2 22, Korrespondenz mit Hans Fehr. Neue Basler Zeitung Nr. 159, 11. 7. 1934. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 29, H. 3–4, 521 f. Imboden 1967. Eine Sammlung von Besprechungen des Buches in: Nachlass Wackernagel, StABS PA 82 M 3, 2.
Jacob Wackernagel – ein rechtsextremer Jurist?
241
1939 hatte Wackernagel Gelegenheit, sich zum Thema «Autarkie» zu äussern.917 Hier kam wieder sein Grundsatz zur Anwendung, Phänomene ‚realistisch‘ zu erfassen und wirtschaftliche Themen auch gesellschaftlich und politisch zu beleuchten (110). Damit polemisierte er gegen den Genfer Ökonomen und Juristen William Rappard, der erklärte, die Schweiz habe mit Autarkiepolitik nichts im Sinn (130). Indirekt zielte er auch auf die liberalen «Basler Nachrichten», deren Chefredaktor Albert Oeri ein Verfechter des Freihandels war.918 Für die Schweiz der 1930er Jahre konstatierte Wackernagel eindeutige Tendenzen zur wirtschaftlichen Abschliessung (131), die sich in einen globalen Trend zur Autarkiepolitik einfügten. Die Schlussfolgerung aus der weitgehend sachlichen Betrachtung lautete, dass in der Schweizer Wirtschaftspolitik noch für viele Jahre Autarkie und Welthandel nebeneinander bestehen werden. Wirtschaftspolitik solle nach ihrem Nutzen für die nationale Wohlfahrt und nicht nach doktrinären Kriterien beurteilt werden (164). Die Nation müsse auf einen Wirtschaftskrieg vorbereitet werden, was nur eine staatliche Lenkung zu leisten vermöge. Italien und Deutschland galten ihm als Beispiele dafür, dass eine kontrollierte Wirtschaft entgegen den Erwartungen der Liberalen nicht in den Ruin führe (106 f.). Nachteile aus dem Streben nach Autarkie entstünden nur dann, wenn die Führer der Wirtschaftspolitik falsch vorgingen. Auch die private Initiative könne in einer gelenkten Wirtschaft durchaus erhalten bleiben oder sogar durch den Staat gefördert werden, was das liberale System gerade nicht leiste (110). Einzelne Betrachtungen waren durchaus illiberal. So rechtfertigte er die Autarkiepolitik Italiens polemisch damit, dass dem Land nach den Sanktionen wegen des Abessinienkrieges nichts anderes übrigbliebe – die wahren Verfechter des Freihandels müssten demzufolge Gegner der Sanktionen des Völkerbundes sein (122). Wackernagel bewunderte mit Friedrich Vöchting die «Schlacht für das Korn in Italien» (122). In der Autarkie sah Wackernagel in Weiterführung seiner Argumentation von 1934 einen Ausdruck des politischen Strebens nach nationaler Macht: Autarkie sei ein Element des Nationalstolzes (126 f.). Schon 1937 hatte Wackernagel in einem Grundsatzbeitrag das Recht des Bundesrats begründet, in Notsituationen das Volk von der Mitwirkung an Beschlüssen auszuschliessen. Er ging («politisch», wie er sagte, also nicht als Jurist) dabei so weit, dass er diese Ausschliessung auch dann für geboten erklärte, wenn 917
918
Wackernagel 1939. Der Beitrag erschien in einem Band, den das schweizerische Komitee der 12. Session der Conférence permanente des hautes études internationales 1939 vorlegen wollte. Das Vorwort von August Simonius machte deutlich, dass sich das Komitee mit den Thesen Wackernagels keineswegs in Einklang befand: Die Schweiz könne keine Autarkiepolitik betreiben, da sie vom Aussenhandel abhänge. August Simonius, ebd., «Préface», 5 f. Fink 1971, 90.
242
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
die Demokratie durch andere Umstände als durch eine Gefährdung der staatlichen Existenz von aussen handlungsunfähig (das Volk «als Staatsorgan funktionsunfähig») würde. Diese Lage hielt er für gegeben, wenn dem Volk die Einsicht in die Bedeutung einer Vorlage fehle, wenn im Volk ein «Gemeinwille» (volonté générale) nicht erkennbar sei oder wenn der Abstimmungskampf so leidenschaftlich geführt zu werden drohe, dass dadurch «der demokratische Staat selber in seiner Existenz gefährdet» würde. Wackernagel wollte der Regierung auch in der Schweiz eine legitime diktatorische Führungsgewalt im weit gefassten Krisenfall zusprechen. Damit liess er ein freisinniges Verfassungsverständnis weit hinter sich.919 Was Jacob Wackernagel zum internationalen Recht beitragen wollte, ersehen wir aus dem «Sonderheft Ausland» der nationalsozialistischen «Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht» von 1935.920 Hier stammte der Abschnitt «Schweiz» von Wackernagel.921 Was wie eine Wiederaufnahme von Thesen aus seinem Buch von 1934 erschien, erhielt durch den Publikationsort eine neue Bedeutung. Nicht nur betonte Wackernagel im Verhältnis zwischen den Staaten das Recht auf gegenseitige Achtung so stark, dass Hitlers Forderung, andere Länder sollten Deutschland Respekt erweisen, legitimiert wurde. Wackernagel sprach jedem ‚richtigen‘ Staat (eine interessante implizite Unterscheidung zwischen wahrhaft souveränen Staaten und Gebilden, die es zu sein nur behaupteten) das «Grundrecht» zu, «Staat zu sein», und damit verband er die Vorstellung, dass jeder ‚richtige‘ Staat Ehre und Würde besitze, die aus seinem «wertbetonten Selbstbewusstsein» folge. Hierfür bezog er sich auch auf den Aufsatz über «Nationalsozialismus und Völkerrecht» von Carl Schmitt (1934).922 Wackernagel forderte, dass Beleidigungen von Staatsoberhäuptern, staatlichen Repräsentanten und Staatssymbolen härter geahndet werden sollten. Denn für die Tat von Individuen auf seinem Territorium sei der betreffende Staat völkerrechtlich verantwortlich, also müsse er eine Strafe verhängen. Angesichts der Spannungen, die zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland mit seiner gesteuerten Presse und den freien Schweizer Zeitungen herrschten, bedeuteten Wackernagels Ausführungen eine Parteinahme zugunsten deutscher Ansichten und ein Plädoyer für die Bestrafung derjenigen Schweizer, die Deutschland und dessen nationalsozialistischer Führung die geforderte Achtung versagten. Wackernagel schrieb auch offen, dass die Bedeutung des Völkerbunds überschätzt werde, denn das Völkerrecht war für Wackernagel immer Recht zwischen einzelnen souveränen Staa919 920
921 922
Wackernagel 1937. Die herrschende freisinnige Auffassung bei: Ruck 1933, 122–124. Diese «Akademie» war 1933 von Walter Frank zur Förderung einer nationalsozialistischen Rechtswissenschaft und zur Unterstützung von Gesetzgebungsprojekten in Deutschland gegründet worden. Anderson 1982; Pichinot 1981. Wackernagel 1935. Schmitt 1934. Vgl. Diner 1989.
Jacob Wackernagel – ein rechtsextremer Jurist?
243
ten – überstaatliche Organe brauchte es nicht. Subjekte des Völkerrechts konnten für ihn nur Staaten sein, während z. B. Arthur Baumgarten das Völkerrecht als Regelung der Beziehungen zwischen Völkern behandelte. Völker erschienen bei Wackernagel als Träger des Nationalgedankens, der ihnen Ehre und Würde verleihe, die im Staat verkörpert und damit auch vom Staat zu schützen seien. Dass er sich damit auf der Linie der nationalsozialistischen Vorstellungen von Aussenpolitik befand, bewies er mit seiner Rezension des Völkerrechts von Ernst Wolgast (Berlin 1934), die er 1936 veröffentlichte.923 Bis Kriegsbeginn hatte somit Wackernagel Positionen entwickelt, die deutsche Forderungen nach einer Unterdrückung schweizerischer Kritik am Nationalsozialismus legitimierten. Er hatte seine Staatsidee vom Liberalismus weg in Richtung eines starken, ‚integrierten‘, von einer Elite gegebenenfalls autoritär geführten Machtgebildes verlagert, das auf eine direkte Demokratie fallweise verzichten konnte. Er trat für eine ‚realistische‘ Einschätzung internationaler Beziehungen und eine Geringschätzung des Völkerbundes ein, rechtfertigte staatliche Autarkiepolitik und Wirtschaftslenkung, zudem blendete er die Gewalt, mit der sich die Diktaturen im Süden und Norden etabliert hatten und an der Macht hielten, aus. Zu beachten sind auch die Publikationsorte im rechtsbürgerlichen, völkerbundkritischen und nationalsozialistischen Umfeld. Gelobt wurde er von rechtsbürgerlichen und germanophilen Kreisen. Wie weit diese Position in Basel Anstoss erregte, lässt sich bis in den Beginn der 1940er Jahre nicht eindeutig festlegen, zumal in seinen differenzierten, breit informierten, intelligenten und manchmal gewundenen Argumentationen fast immer liberale Reste sichtbar waren – die offene, provokative Radikalität faschistischer Sprache war ihm fremd, und die bürgerliche Verwurzelung des gelehrten Juristen blieb stets erkennbar. Die Fakultät setzte sich solidarisch für Wackernagels Besoldungsforderungen bei den oberen Behörden ein und liess verlauten, dass sie auf seine geschichtlichen Lehrveranstaltungen und seine Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung angewiesen sei – was man allerdings auch als Versuch deuten kann, Wackernagel von Themen wie Völkerrecht und Staatsrecht fernzuhalten, in denen seine Haltung deutlicher zum Ausdruck kam und in denen er im Widerspruch zu Erwin Ruck stand.924 Dennoch las Wackernagel bis zum Winter 1939/ 1940 immer wieder auch über Völkerrecht und Verfassungsgeschichte (Letztere erlaubte Ausflüge in das Staatsrecht), während Ruck seinerseits seit Sommer 1937 über Völkerrecht lehrte, ein Gebiet, in dem auch Arthur Baumgarten mit Lehrveranstaltungen präsent war. Es sieht so aus, wie wenn im Basler Unterricht nebeneinander Ruck den freisinnigen Standpunkt, Baumgarten den linksliberalen 923 924
Wackernagel bezeichnete darin die Prinzipien der nationalsozialistischen Aussenpolitik als «richtig». Kunz 2011, 165 ff. Protokoll der Juristischen Fakultät 23. 10. 1937. Eine Verpflichtung auf Verfassungsgeschichte wurde nochmals am 4. 3. 1938 verlangt.
244
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
und bald sozialistischen, Wackernagel den jungkonservativen Ansatz in denselben Themenfeldern vertraten. 1939/40 wurde Wackernagel turnusgemäss zum Dekan der Fakultät gewählt. Die kollegiale Duldung, die das Zusammenleben in der Fakultät kennzeichnete, war intakt. Positionen, die im Krieg einen anderen Juristen, der als Wehrwissenschaftler an der Basler Universität dozierte, Oberst Gustav Däniker, zu Fall brachten, formulierte Jacob Wackernagel 1942 explizit. Somit ist ein Vergleich zwischen Jacob Wackernagel und Däniker sinnvoll. Beide wurden in den 1940er Jahren disziplinarisch bestraft. Die Vorwürfe lagen aber auf verschiedenen Ebenen: Der Berufsoffizier Däniker hatte nach einem Besuch in Berlin einen vertraulichen Bericht verfasst, der die deutsche Stärke unterstrich und eine Anpassung an die 1940 in Europa geschaffene Lage verlangte; dieser Bericht gelangte an die Öffentlichkeit und löste Empörung aus. Nach der militärischen Bestrafung wurde er in Basel seiner wehrwissenschaftlichen Dozentur (als Ehrendozent) enthoben. Die Vergehen, die dem Milizoffizier (Oberrichter, Oberstleutnant) Jacob Wackernagel zur Last gelegt wurden, gehörten in einen rein zivilen Kontext, doch fanden die Kritiker, dass Wackernagels Ansichten denen Dänikers ähnlich seien. Beide Disziplinarfälle waren juristisch problematisch, weil der Basler Rechtsstaat keine Gesinnungsdelikte kannte, und beiden konnte Propagandatätigkeit in der Vorlesung oder gar Landesverrat nicht nachgewiesen werden. Der Fall Wackernagel lag jedoch für die Juristen insofern einfacher, als hier Beziehungen zu Organisationen, deren Mitgliedschaft Staatsangestellten verboten war, nachgewiesen wurden. Exkurs: Gustav Däniker, Jurist und Wehrwissenschaftler an der Universität Basel Der Pfarrersohn Gustav Däniker925 doktorierte 1922 in Rechtswissenschaften, um für den Fall, dass seine militärische Laufbahn scheiterte, einen Brotberuf zu haben. Als Student schloss er sich dem Akademischen Harst an, einer Studentenverbindung, zu der er als Altherr auch später Beziehungen unterhielt.926 Seit 1920 kritisierte er den Völkerbund und wurde Mitglied des Volksbundes für die Unabhängigkeit der Schweiz. Sein wichtigstes Anliegen war die Kriegsbereitschaft der Schweizer Armee, der er als Instruktionsoffizier diente. 1934 bis 1938 lehrte er daneben an der ETH in Zürich. Soweit er militärwissenschaftliche Publikationen nicht in Fachorganen927 veröffentlichte, schrieb er für die von der Nationalen Front herausgegebene Zeitung «Schweizerische Unabhängigkeit», die «Schweizer Monatshefte»928 und die «Neue Basler Zeitung», gelegentlich auch in der «Neuen Zür-
925 926 927 928
Tanner 2015, 260; Senn 2005; Keller 1997; Gautschi 1989, 168 ff., 394 ff. Keller 1997, 51. Däniker bevorzugte die österreichische Revue: «Wehr und Waffen – Monatsschrift für den Soldaten von gestern, heute und morgen». Keller 1997, 141. Den «Schweizer Monatsheften» war Däniker so weit verbunden, dass er im Frühjahr 1941 der Herausgebergenossenschaft beitrat und mit Gerhard Boerlin und Hektor Ammann
Jacob Wackernagel – ein rechtsextremer Jurist?
245
cher Zeitung» und anderen Organen. Angeblich war sein einziges Kriterium für die Auswahl der Publikationsorgane deren positive Einstellung zu einer starken Armee,929 was sich aber durch seine Sympathie für die «Neue Basler Zeitung» und die «Monatshefte» auch als Affinität zu frontistischen und germanophilen, dem nationalsozialistisch geführten ‚Dritten Reich‘ eher freundlich gesinnten Positionen verstehen lässt.930 Seine Schriften wurden im ‚Reich‘ geschätzt und ab 1940 dort propagandistisch genutzt, während er selbst deutsches Propagandamaterial direkt oder über die diplomatische Vertretung in Zürich bezog und auswertete.931 Dass er im dortigen deutschen Konsulat regelmässiger Gast sei, dementierte er jedoch vehement.932 In der Debatte um die Armeereform 1938/39 propagierte er eine Professionalisierung der Armee mit einem «Friedensgeneral». Milizoffiziere und Politiker galten ihm als ahnungslose Laien, die die Armee schwächten.933 Die Berufsoffiziere stellte er sich als eine Elite von Technokraten des Krieges vor, die möglichst frei von einer demokratischen Kontrolle wirken sollten.934 Däniker hatte seine Vorurteile gegen Franzosen und Westschweizer in einem zweijährigen Studienaufenthalt an der École supérieure de guerre in Paris von 1929 bis 1931 vertieft. Er verehrte den General des Ersten Weltkrieges, Ulrich Wille senior.935 Dem Oberstkorpskommandanten Ulrich Wille junior war er nahe verbunden. Im August 1938 besuchte er im Rahmen einer zehntägigen Abkommandierung die deutsche Infanterieschule Döberitz bei Berlin, die ihn begeisterte. Im gleichen Jahr wurde er Kommandant der Schiessschule in Walenstadt, 1938 bis 1940 kommandierte er das Gebirgsinfanterie-Regiment 20, 1939 wurde er Oberst im Generalstab, 1940 Generalstabsoffizier im Armeestab; er stand ab 1940 auch den Zentralschulen II der Armee vor. Von den Offizieren verlangte er Gradlinigkeit, Treue, Ehre und Schneid; Besprechungen zwischen Offizieren sollten in der Hochsprache abgehalten werden. Von der Truppe forderte er «soldatische Haltung». Seine Massstäbe für richtiges Soldatentum entlieh er dabei der deutschen Tradition,936 ohne dass er sich zu ‚1933‘ je öffentlich geäussert hätte. Er war jedoch überzeugt, dass Deutschland die «Schmach» von 1918 auswetzen sollte. Wichtig war ihm, dass
929 930
931 932 933
934 935 936
über seine Wahl in den Vorstand korrespondierte. Dänikers Ärger über die sprachlichen Korrekturen, die Jan von Sprecher an seinem Beitrag über «Soldatische Führung» im Mai 1941 anbrachte, beendete dann dieses Verhältnis. 1940 hatte er es gegenüber Hans Oehler noch abgelehnt, für die «Nationalen Hefte» zu schreiben, da diese die «Monatshefte» konkurrenzierten. Keller 1997, 134 f. Keller 1997, 136. Die Auffassung, dass Däniker (gewissermassen passiv) die Aufmerksamkeit von Frontisten auf sich zog, wird durch die Feststellung korrigiert, dass er «Kontakten mit frontistischen Kreisen nicht abgeneigt» war. Keller 1997, 282 f., 397. Keller 1997, 144 f. Keller 1997, 265. Das von Däniker vertretene «totalitäre Führungsprinzip» für die Armee fiel im Parlament durch; nur der frontistische Nationalrat Robert Tobler verteidigte dort die Einführung eines obersten militärischen Armeechefs in Friedenszeiten. Keller 1997, 212. Keller 1997, 215. Keller 1997, 268 ff. Keller 1997, 273 ff.
246
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
die Schweizer Armee im Ausland, insbesondere in Deutschland, Respekt genoss – darin sah er seinen Beitrag zur Unabhängigkeit der Schweiz. Schon 1936 hatten Basler Studenten dem Rektor vorgeschlagen, an der Universität einen Unterricht in Militärfragen einzurichten. Nachdem Däniker am 2. April 1937 vor der Basler Sektion der Neuen Helvetischen Gesellschaft ein Referat zum Thema «Vor welche Probleme werden uns die ersten Tage eines Zukunftskrieges stellen?» gehalten hatte, forderten die farbentragenden (‚nationalen‘) Verbindungen von der Philosophischen Fakultät, einen Lehrauftrag für Militärwissenschaften einzurichten. 1938 empfahl die Kuratel der Regierung, einen solchen Unterricht zu schaffen. Die Offiziere in der Sachverständigenkommission der Kuratel (Oberstkorpskommandant Rudolf Miescher, liberaler alt-Regierungsrat, seit 1931 Berufsmilitär und Kommandant des 3. Armeekorps; Oberst Paul Ronus-von der Mühll, Notar, Grossrat, und Oberst Peter Schmid-Fehr, Notar, Militärrichter) schlugen geeignete Dozenten vor, darunter Eugen Bircher, Redaktor der «ASMZ», Divisionskommandant, 1926 bis 1939 Dozent an der ETH, Mitbegründer der Vaterländischen Verbände, Angehöriger der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei Aargau,937 ferner Edgar Schumacher, Instruktionsoffizier der Infanterie, ein Bewunderer von Ulrich Wille,938 und Däniker. Miescher scheint Däniker besonders nahe gestanden zu sein.939 Die Fakultät hatte Hans Georg Wackernagel (in seiner Eigenschaft als Militärhistoriker) vorgeschlagen. Man einigte sich auf Gustav Däniker, der als hervorragender Kenner strategischer und waffentechnischer Entwicklungen galt und zudem den Zivilisten in der Kommission, namentlich Adolf Lukas Vischer und Edgar Bonjour, einen sehr guten persönlichen Eindruck machte: ein noch junger Mann, gebildet, sprachgewandt, mit festen Ansichten, zuverlässig und kompetent, dabei ein ausgezeichneter Didaktiker und Vortragsredner.940 Dänikers Schriften waren schon vorher in den «Basler Nachrichten» und der «Neuen Zürcher Zeitung» hochgelobt worden, insbesondere sein Beitrag zur Festschrift für Ulrich Wille junior von 1937.941 Seine Haltung zur Demokratie, zu Deutschland, zu Franzosen und Westschweizern sowie seine Nähe zu Frontisten wurden nicht angesprochen. Man glaubte wohl, diese Haltung liesse sich scharf von der fachlichen und methodischen Kompetenz trennen. Diese Erwartung erfüllte Däniker insofern, als ihm nie nachgewiesen wurde, seine Studenten politisch indoktriniert zu haben. Die Regierung wählte Däniker aufs Wintersemester 1938/39 zum «Ehrendozenten» (d. h. Dozenten ohne Habilitation) mit einer Entschädigung von jährlich Fr. 2’000. Als der Entscheid für Däniker bereits gefallen war, veröffentlichte er unter vollem Namen einen Beitrag in der «Neuen Basler Zeitung».942 Die Gegner des Nationalsozialismus unter den Basler Liberalen fanden den Publikationsort sehr unpassend, zumal die frontistische Presse den Beitrag sofort nachdruckte. Ein Redaktor der «Basler Nachrichten», N. Bischoff, wies Däniker in einem privaten Schreiben darauf hin, dass sich die «Neue Basler Zeitung» ausserhalb des bürgerlichen politischen Kon937 938 939 940 941 942
Heller 2018. Müller-Grieshaber 2014. Keller 1997, 122. Keller 1997, 113 ff. Keller 1997, 175. Der inkriminierte Text behandelte «Das Erbe General Willes» und erschien am 9. 11. 1938, kurz nach Dänikers Wahl (5. 11. 1938). Später noch: Däniker 1939.
Jacob Wackernagel – ein rechtsextremer Jurist?
247
senses bewegte und ihre Redaktoren und Geldgeber im Verdacht standen, schlechte Patrioten zu sein. Statt sich die Warnung zu Herzen zu nehmen, erklärte Däniker, er gehe mit verschiedenen Positionen der Frontisten und dieser Zeitung, die Ende Dezember 1939 auf Initiative des Basler Stadtkommandos durch eine Verfügung des Armeestabes verboten wurde, einig.943 Däniker sah darin eine willkürliche Unterdrückung der freien Meinungsbildung, die in Deutschland einen negativen Eindruck hinterlasse.944 Die Basler Lehrtätigkeit verlief ohne Zwischenfälle, doch Däniker konnte wegen seiner dienstlichen Inanspruchnahme nur mit grossen Unterbrechungen lesen.945 Es ergaben sich auch keine Diskussionen daraus, dass Däniker 1939 die Wahl des «Französlings» Henri Guisan zum General kritisierte und ostentativ zur Gruppe um Ulrich Wille hielt.946 Eine Beteiligung an einer schweizerischen Widerstandsgruppe lehnte er 1940 ab mit der Bemerkung, man solle nicht den Widerstandswillen fördern, sondern die Lage dazu benützen, das «grosse Weltgeschehen zu begreifen», eine «Erneuerung von Grund auf» zu betreiben. Das «Museum aus dem 19. Jahrhundert»947 sei aufzugeben. Damit meinte er offensichtlich die Errungenschaften von 1848 wie direkte Demokratie, freie Presse und Volksheer.948 Unbeachtet blieb, dass Däniker 1940 die ‚Eingabe der 173‘ unterzeichnete,949 die Eingriffe in die demokratischen Freiheitsrechte forderte, um das Verhältnis der Schweiz zu Deutschland zu verbessern. Guisan hatte schon vorher vermutet, dass er zum Frontismus gehöre, und ihn 1940 in die Untersuchung gegen 120 politisch verdächtige Offiziere einbezogen. Er wurde jedoch freigesprochen in einer formlosen Art, die Däniker mit seiner «soldatischen Ehre» für unvereinbar hielt.950 Guisans Auftritt auf der Rütliwiese (25. Juli 1940) betrachtete Däniker als Provokation gegen Deutschland.951 Auch dass Däniker bei verschiedenen Gelegenheiten erklärte, er sei als Deutschschweizer «Deutscher»952 und verlange, dass die Schweiz sich nun kooperativ und konstruktiv ins «neue Europa»
943 944 945 946 947
948 949 950 951 952
Keller 1997, 117 f., ausführlich 291–294. Däniker interessierte sich hauptsächlich für die sog. Neutralität der Presse. Däniker an Johannes von Muralt (Kommandant der 5. Division), 15. 1. 1940, bei: Keller 1997, 293 f. Keller 1997, 120. Keller 1997, 270. Die uns bereits mehrfach begegnete Ablehnung des ‚19. Jahrhunderts‘ war auch ein zentraler Teil der Ideologie Dänikers. 1943 schrieb er in der «ASMZ»: «Der Nationalsozialismus und der ihm verwandte Faschismus strebten auf national-völkischer Grundlage eine organisch sich bildende Synthese der verschiedenen Probleme an, eine Ordnung der verworrenen Verhältnisse, welche vom ausgehenden 19. Jahrhundert als Erbe hinterlassen worden waren.» Zitiert nach Keller 1997, 266 f. Keller 1997, 251. Keller 1997, 295–299. Keller 1997, 311–317; Gautschi 1989, 171 ff. Keller 1997, 261. «Ich bin nicht ‚deutschfreundlich‘, sondern ‚deutsch‘.» Däniker an Georg Züblin, 20. 9. 1941, zitiert nach Keller 1997, 265 f.
248
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
(ein Code-Wort für die nationalsozialistische Ordnung953 in den seit 1940 besetzten oder sonstwie abhängig gewordenen Gebieten) einfüge, hatte in Basel keine unmittelbaren Folgen. Aber es ist anzunehmen, dass den Basler Gegnern des Nationalsozialismus klargeworden war, auf welcher Seite Däniker stand, auch wenn er die Wehrfähigkeit der Schweiz weiterhin zu stärken versprach. So vermutete Regierungsrat Fritz Hauser, Däniker betreibe in der Vorlesung nationalsozialistische Propaganda,954 doch die Untersuchung des Kuratelspräsidenten ergab nichts Greifbares. Es fehlte ein konkreter Anlass. Däniker und seine Freunde lieferten diese Gelegenheit 1941 selbst. Als er sich in Berlin für eine Besprechung mit dem Verlag E. S. Mittler & Sohn und zum Besuch von Einrichtungen der Wehrmacht (30. April bis 10. Mai 1941) aufhielt, führte er Gespräche, die ihn darin bestärkten, dass die Schweiz die Opposition gegen das ‚Dritte Reich‘ zum Schweigen bringen müsse. Die Widerstandsrhetorik (er verband sie mit den Namen Karl Barth und Oskar Frey) sollte aufhören, und die Schweiz habe sich im «neuen Europa […] entsprechend ein[zu]gliedern». Ein Verlust der nationalen Souveränität drohe gegenwärtig nicht, aber eine Schweiz, die als «Querschläger» in diesem Europa weiterleben wolle, würde auf die Dauer vom ‚Reich‘ nicht geduldet. Der gegenwärtige Krieg sei ein Weltanschauungskrieg, der zu einer «europäischen Einigung» hinführe und der aus dem Kontinent eine «Schicksalsgemeinschaft» machen werde. Dadurch, dass in der Schweiz keine freie Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zugelassen werde, entstehe in Deutschland der Eindruck, es gebe «Unterdrückte», denen das ‚Reich‘ zu Hilfe kommen müsse. Gewisse deutsche Forderungen sollten «wir […] gerne annehmen», andere müssten zurückgewiesen werden, nötigenfalls auch im Kampf, den die Schweiz ohne Rücksicht darauf, ob ein Erfolg wahrscheinlich sei, führen werde.955 Diese Einsicht hielt er in einer Denkschrift über Feststellungen und Eindrücke anlässlich eines Aufenthaltes in Deutschland956 fest, von der er eine begrenzte Anzahl Kopien anfertigte. Mit einem Begleitbrief, der die Denkschrift als «persönlich und geheim» deklarierte, schickte er den Text an Bundesrat Pilet-Golaz, Oberst Roger Masson (Chef des Nachrichtendienstes), Ulrich Wille, Eugen Bircher, Heinrich Frick und wenige andere. Die Reaktionen waren unverbindlich und für Däniker enttäuschend. Also erlaubte er seinem Freund Frick, einem weiteren Personenkreis Einblick in die Denkschrift zu gewähren, was dieser auch tat. Dadurch wurde jedoch die Verteilung der Schrift unkontrollierbar; deutsche diplomatische Stellen erhielten davon ebenso Kenntnis und machten davon Gebrauch wie die Gegner des Nationalsozialismus in der Schweiz. Freisinnige und jungliberale Kreise wurden besonders aktiv dank dem Einsatz von Ernst von Schenck und der Aktionsge-
953
954 955 956
Däniker vermied es bis 1943 konsequent, in seinen Äusserungen offen den Namen «Hitler» oder die Begriffe «Nationalsozialismus» oder «Drittes Reich» zu verwenden; er sprach nur von «Deutschland». Keller 1997, 266. StABS Protokoll T 2 Kuratel der Universität Bd. 13, 1935–1941, 482, 8. Sitzung, 25. 11. 1940. Keller 1997, 17–22. Text abgedruckt bei: Keller 1997, 405 ff.
Jacob Wackernagel – ein rechtsextremer Jurist?
249
meinschaft der jungen Generation. Die Schweiz (und nicht nur Basel) hatte einen «Fall Däniker».957 Basler Politiker und Basler Behörden wollten ihn als Dozenten rasch loswerden: Däniker war als Mitglied der Universität untragbar geworden. Die Politische Abteilung des Polizeidepartements Basel-Stadt informierte den Chef des Erziehungsdepartements Carl Miville (Nachfolger des verstorbenen Fritz Hauser) am 19. August 1941 über Dänikers «bedenkliche» Geisteshaltung und riet dazu, seine Lehrtätigkeit zu beenden. Am 27. August 1941 richtete die Aktionsgemeinschaft der Jungen Generation eine Eingabe an das Erziehungsdepartement, die in die gleiche Richtung wies. Einen Monat später beantragte die Kuratel dem Departement die vorsorgliche Amtsenthebung von Däniker, worauf der Regierungsrat am 30. Oktober 1941 einen entsprechenden Beschluss fasste. Die sofortige Entlassung wurde verfügt und ein Disziplinarverfahren angeordnet, aber faktisch aufgeschoben.958 Carl Miville informierte sich persönlich bei Bundesrat Kobelt über den Stand des Berner militärischen Verfahrens gegen Däniker, denn Basel wollte zuwarten, bis die militärische Hierarchie den ersten Schritt zu seiner Bestrafung unternehmen werde. Miville kommunizierte gegenüber der Universität und Däniker zuerst ungenügend. Darüber erregte sich Hans Georg Wackernagel, der sich deswegen am 19. November 1941 an Rektor Eugen Ludwig wandte. Dieser erhielt von Miville die Auskunft, Däniker sei suspendiert worden, um Unruhe unter den Studenten vorzubeugen, eine Antwort, die eine fatale Ähnlichkeit mit der Begründung von Vorgängen an deutschen Universitäten 1933 aufwies. Im Dezember schalteten sich auch Erwin Ruck, der immer für den Rechtsstaat eigentreten war und ein besonderes Sensorium für die Lehrfreiheit hatte, und Jacob Wackernagel ein.959 Inzwischen liess es die Zensur zu, dass Däniker seinen Aufsatz «Der europäische Stil der Kriegsführung» in der «Schweizerischen Monatsschrift für Offiziere aller Waffen» veröffentlichen konnte. Darin wurde die Überlegenheit deutscher Kriegskunst gepriesen und behauptet, der Russlandfeldzug verfolge ein «gesamtabendländisches Kriegsziel»; würde
957 958
959
Keller 1997, 23 f. Ernst von Schenck, «Aktion nationaler Widerstand» und «Informationen der Woche» (Keller 1997, 256). Im Vorlesungsverzeichnis wurde die Fiktion aufrechterhalten, Däniker sei noch im Amt. Werner Kaegi, zur fraglichen Zeit Dekan der Philosophisch-Historischen Fakultät, schrieb an Däniker am 30. 12. 1941 (Briefkonzept): «Ich habe nur gerüchtweise von den Gründen Ihres Nichtlesens gehört und kann darum als Dekan zu den Vorgängen die Sie zum zeitweiligen Verzicht [sic] auf Ihre Lehrtätigkeit veranlasst haben, in keiner Weise Stellung nehmen. Ich möchte Ihnen aber mein persönliches Bedauern über diese Unterbrechung zum Ausdruck bringen und Ihnen mitteilen, dass ich für das Vorlesungsverzeichnis des Sommersemesters vorläufig angeordnet habe, dass, falls Ihre Ankündigung nicht eingeht, der Vermerk gesetzt wird: ‚Wird eventuell später anzeigen‘.» Paul Sacher Stiftung Basel, Nachlass Werner Kaegi, WK 185. Keller 1997, 122. Auch gegenüber Werner Kaegi unterstrich Däniker, dass «Professor Wackernagel» «einigermassen auf dem Laufenden und vor allem auch darüber orientiert [ist], auf welche merkwürdige Weise mein akademischer Vortrag, der für diesen Winter vorgesehen war, hintertrieben wurde.» Däniker an Kaegi, 5. 1. 1942, in: Nachlass Werner Kaegi, WK 185.
250
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
Deutschland den Krieg nicht gewinnen, müsse mit kommunistischen Revolutionen in ganz Europa gerechnet werden.960 Der General hatte im Oktober 1941 auf Antrag von Oberauditor Jakob Eugster eine Disziplinarstrafe (zwei Wochen Festungshaft) und die Suspendierung wegen verletzter Amtspflichten verfügt. 1942 wurde Däniker als Instruktionsoffizier nicht wiedergewählt und schied so aus dem Bundesdienst aus. Ein militärgerichtliches Verfahren, wie er es gewünscht hätte, um sich umfassend verteidigen zu können, wurde ihm versagt. Danach kam er bei Oerlikon-Bührle als Waffenexperte unter.961 Diese Massnahmen des Bundes wurden der Basler Regierung jedoch erst im Mai 1942 offiziell bekanntgegeben, worauf im Juni endlich das kantonale Disziplinarverfahren anlief. Däniker liess sich von Jacob Wackernagel juristisch beraten.962 Die zuständige Kommission erkannte, dass es für die Suspendierung als Dozent in Basel keine solide rechtliche Grundlage gab. Schon der Erziehungsrat hatte eingesehen, dass sich Däniker als Universitätslehrer nichts habe zu Schulden kommen lassen.963 Die Disziplinarkommission war der Ansicht, dass die vorübergehende Einstellung der Lehrtätigkeit zwar als Notmassnahme in Kriegszeiten zulässig sei, dass aber eine definitive Entlassung nicht begründet werden könne. Däniker könnte mit einem Rekurs Erfolg haben, mit peinlichen Folgen für die Regierung. Der Regierungsrat beschloss trotzdem am 30. Oktober 1942 die definitive Entlassung. Wie vorauszusehen war, legte Däniker Rekurs ein, worauf das Appellationsgericht am 21. September 1943 urteilte, dass es keine Rechtsgrundlage gebe, um Däniker als Mitglied der Universität zu bestrafen. Dieses Urteil wurde erst am 11. Oktober 1944 den Behörden und der Öffentlichkeit mitgeteilt. Am 4. Dezember 1944 entliess der Regierungsrat Däniker definitiv auf der Grundlage von Paragraph 12 des Universitätsgesetzes (wegen fehlender Eignung), obschon Dänikers Verhalten als Dozent nie infrage gestellt worden war. Gegen diese Entlassung rekurrierte Däniker erneut, wurde aber diesmal vom Appellationsgericht am 25. Mai 1945 abgewiesen.964 Der politische Wille, die Freunde des nationalsozialistischen Deutschland an der Universität in Schranken zu weisen und an Däniker, der eine eher marginale Stellung einnahm, ein Exempel zu statuieren, war zwar stärker als
960
961 962
963
964
Keller 2009, 139 f. Bundesarchiv Bern, E4450 1000/864_178, Aktenzeichen B.231 Dossier E4450#1000/864#2310*, Entscheid vom August 1942 über den Wiederabdruck des Aufsatzes als Heft II der «Schriftenreihe der Studiengemeinschaft für europäische Fragen». Die Zensoren wollten an sich eine Veröffentlichung untersagen, aber die bereits 1941 erteilte Erlaubnis, den Aufsatz zu publizieren, präjudizierte die Freigabe. Keller 1997, 24 f. Ernst von Schenck suggerierte wegen der Nähe Wackernagels zur Organisation der deutschen Kulturpropaganda ‚Basler Pfalz‘ die Zugehörigkeit von Wackernagel und Däniker zum gleichen Umfeld. Kopie aus: Bulletin der Aktionsgemeinschaft der Jungen Generation, 16. 6. 1942, in: Bundesarchiv Bern, E27 1000/721_817, Mikrofilm Silber S_00115, Aktenzeichen 04.A.1.b.5.b.3.b. E27#1000/721#4787, Versetzung von Oberstlt. Wackernagel, Basel, zur Disposition wegen frontistischen Gesinnung, 1942. Streng vertrauliche Behandlung des Falles Oberst Däniker: StABS Protokoll S 4 Bd. 26, 1940–1942, 6. 10. 1941. In der folgenden Sitzung vom 14. 10. 1941 war eine Minderheit von zwei Ratsmitgliedern gegen die Suspendierung. Keller 1997, 122–131.
Jacob Wackernagel – ein rechtsextremer Jurist?
251
die Befürchtung, die Lehrfreiheit könnte durch eine so extensive Auslegung von Paragraph 12 des Universitätsgesetzes Schaden leiden. Die Langsamkeit, mit der in Basel gegen Däniker vorgegangen wurde, scheint aber darauf hinzudeuten, dass hier mit der Entlassung zugewartet wurde, bis restlos deutlich war, dass Deutschland den Krieg nicht gewinnen konnte.
Der ‚Fall‘ Wackernagel965 begann damit, dass er sich an der Gründung der kulturpolitischen deutschen Propagandaorganisation mit Namen ‚Basler Pfalz‘966 beteiligte, in der bekannte Frontisten, Angehörige der Eidgenössischen Sammlung (eine Nachfolgeorganisation der Nationalen Front, im Juni 1943 durch die Bundesbehörden definitiv verboten) und Bewunderer des Nationalsozialismus wie der ehemalige Seminardirektor Wilhelm Brenner sowie der Binninger Fabrikant Paul Ganzoni eine führende Rolle spielten. Diese Aktivitäten trugen Wackernagel eine Untersuchung durch seine militärischen Vorgesetzten und ein Disziplinarverfahren in seiner Eigenschaft als Basler Staatsangestellter ein. Wackernagel suchte angeblich nach Gelegenheiten für ein zwangsloses Treffen zwischen Schweizern und Deutschen. Im April 1942 wandte sich Brenner nach Rücksprache mit Wackernagel an Paul Zehntner mit der Idee, in Basel eine Kulturvereinigung zu gründen. Nach dem Zürcher Vorbild, das sich im Februar 1942 um den bekannten Frontisten Tobler mit Beteiligung von Paul Zehntner formiert hatte, wurde die Vereinigung vorerst «Gesellschaft zur Förderung kulturellen Lebens» genannt. Man organisierte im Mai 1942 einen ersten Vortragsabend in der Basler Schlüsselzunft zum Thema «Dichtung und Volkheit» mit Heinz Kindermann (Literaturwissenschaftler in Münster, bekannt für seine NSGesinnung). Wackernagel hatte eine Liste mit Adressen für Einladungen zu dieser Veranstaltung zusammengestellt, die er Brenner zuschickte, und er nahm an 965 966
Ich benütze, wo nicht anders vermerkt, das ausführliche Dossier «Disziplinar. Angelegenheit 1942–1944» in: StABS ED-Reg 1a 2. Die weitere Öffentlichkeit erfuhr von der Existenz der ‚Pfalz‘ im Oktober 1942 durch Zeitungsartikel und eine Interpellation im Grossen Rat. Die National-Zeitung Nr. 485, 19. 10. 1942, berichtete über die Einladung zum Beitritt; sie trage die Unterschriften von Dr. W. Brenner, Paul Ganzoni-Bidermann und Dr. Werner Peter-Deschwanden. Die Weltanschauung von Alt-Seminardirektor Brenner sei an «unschweizerischen Ideen orientiert», Ganzoni und Peter seien Mitglieder der frontistischen Eidgenössischen Sammlung. Der Regierungsrat habe sie als staatsfeindliche Organisation bezeichnet. Die ‚Pfalz‘ sei wie die Berner ‚Manesse‘ ein «getarnter Ableger der ‚Eidgenössischen Sammlung‘». Über die Interpellation im Grossen Rat berichteten die Basler Nachrichten am 23. 10. 1942. Zeitungsausrisse in: AFZ ETH Zürich, Nachlass Friedrich Vöchting 1.2 Korrespondenzen, Prozessakten, Presseartikel und Notizen, 1943. Begründung des Rekurses durch Paul Ganzoni gegen das Verbot der ‚Pfalz‘ ebd.: Paul Ganzoni, Durchschlag, 5. 11. 1943, an Bundesrat, Verwaltungsbeschwerde gegen die Auflösung der ‚Pfalz‘. Die Darstellung, die Ganzoni von den Tätigkeiten der ‚Pfalz‘ gab, deckte sich mit den Aussagen von Wackernagel: Die Organisation sei unpolitisch, es wurden Vorträge und ein Konzert veranstaltet.
252
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
der Veranstaltung teil. Er erschien auch am nachfolgenden Vortrag, der am 1. Juni 1942 im Stadtcasino stattfand. Dort sprach Heinrich Besseler, Musikwissenschaftler aus Heidelberg, aktives Mitglied der SA und der NSDAP, 1945 wegen seiner Aktivitäten 1933 bis 1945 entlassen. Bereits jetzt beantragte das Basler Polizeidepartement bei der Regierung, sie solle den Staatsangestellten verbieten, Mitglieder dieser Vereinigung zu werden. Als in der Wohnung von Paul Ganzoni in Binningen am 20. Juni 1942 diese Gesellschaft, nun mit dem Beinamen ‚Basler Pfalz‘, formell gegründet wurde, war Wackernagel wieder dabei. Wenig später spendete er Geld für Werner Peter-Deschwanden (der wegen rechtsextremer Aktivitäten in Schwierigkeiten geraten war), das nach Auffassung der Politischen Polizei für die Eidgenössische Sammlung bestimmt gewesen sei. Doch schon Mitte Juli erklärte Wackernagel gegenüber Brenner mündlich seinen Austritt aus der Basler Pfalz und begründete dies mit «Anfeindungen», worauf ihm Brenner schriftlich den Austritt bestätigte. Dies genügte ihm nicht; per Einschreiben verlangte er von Zehntner Ende Juli 1942 eine Bestätigung, dass er gar nie Mitglied der Basler Pfalz gewesen sei. Das war nicht hilfreich, da die Behörden die Frontisten, mit denen sich Wackernagel getroffen hatte, observierten und deshalb auch über seine Aktivitäten Bescheid wussten.967 Die Basler Pfalz existierte weiter. Im November 1942 organisierte sie im Stadtkasino einen Vortrag des Landschaftsplaners Alwin Seifert, den Hitler mit dem Professorentitel geehrt hatte und der seit 1940 den Titel «Reichslandschaftsanwalt» trug, (mit einer Einführung durch Ganzoni). Später im Jahr 1942 trat der in Deutschland erfolgreiche Schweizer Schriftsteller Alfred Huggenberger mit einer Lesung auf den Plan. Im Februar 1943 hätte der weltbekannte Naturwissenschaftler Adolf Butenandt über «Biochemische Probleme der Vererbungsforschung» bei der Basler Pfalz sprechen sollen, der Vortrag wurde jedoch abgesagt.968 Im selben Monat verbot der Regierungsrat den Basler Staatsangestellten, der Pfalz als Mitglieder anzugehören; sie galt fortan offiziell als staatsgefährlich. Im Juli 1943 trafen sich die Mitglieder noch zu einer Versammlung in der Holbeinstube unter dem Vorsitz von Ganzoni, und am 7. Oktober 1943 löste der Bund die Basler Pfalz auf, wobei finanzielle Unterlagen, Geld, Mitgliederlisten und andere Dokumente beschlagnahmt wurden. Wackernagel verstärkte die Aufmerksamkeit für seine Gesinnung dadurch selbst, dass er in der Festschrift zum nationalen Juristentag, den die Basler 1942 967
968
Fiche (drei Karten) ‚Jacob Wackernagel‘ der Politischen Abteilung, in: StABS PD-REG 5a 3-7-16, Seiten 8135–8140. Fiche (5 Karten) ‚Gesellschaft zur Förderung kulturellen Lebens Zürich, und Ges[ellschaft] zur Pflege kultureller Gemeinschaft ‚Basler Pfalz‘ / getarnte Nebenorganisation der Eidg. Sammlung‘, in: StABS PD-REG 5a 3-7-18, Seiten 4823–4831. Ich danke Hermann Wichers für die Übermittlung dieser Dokumente. Informationen zu diesem Archivbestand in: Wichers 2020. Vgl. dazu den Abschnitt über Adolf Portmann, unten, Kapitel 8.8.
Jacob Wackernagel – ein rechtsextremer Jurist?
253
ausrichteten, einen Beitrag zur Neutralität der Schweiz unterbringen wollte, den der Verleger als Aufforderung zur Anpassung an das nationalsozialistisch geführte Deutschland auffasste;969 von einer ‚zweiten Denkschrift Däniker‘ war die Rede. Eine Fotokopie des heute nicht mehr auffindbaren Beitrags legte die Politische Polizei zu ihren Akten. Wackernagel forderte darin anscheinend eine umfassende «Neutralität» auch der Presse und des Volkes, nicht nur des Staates; der Staat sei für die Meinungsäusserungen der Privaten mitverantwortlich. Im Aufsatz zitierte er (zustimmend?) eine Leipziger Dissertation, in der erklärt wurde, die Schweiz habe sich im Ersten Weltkrieg so unneutral verhalten, dass das Kaiserreich berechtigt gewesen wäre, ihr den Krieg zu erklären. Der mit Wackernagel verwandte und befreundete germanophile Gerichtspräsident Gerhard Boerlin bezeichnete ihn in diesem Zusammenhang als «beinahe ausgesprochene[n] Nazi».970 Mit seinen Auffassungen stellte sich Wackernagel ausserhalb des Konsenses der Basler Juristen, den der Herausgeber der Festschrift, Erwin Ruck, im Vorwort umschrieb.971 Die Akten der Militärjustiz972 zeigen die Verknüpfung des Falls Wackernagel mit dem Fall Däniker deutlich. Die Politische Abteilung des Basler Polizeidepartements informierte am 24. Juni 1942 den Armeeauditor Oberstbrigadier Eugster über Wackernagels Einstellung. Eugster legte das Basler Schreiben umgehend Bundesrat Kobelt vor. Die Basler stellten fest, dass «Herr Oberstleutnant Jakob Wackernagel, Grossrichter der 5. Division, der ‚Eidgenössischen Sammlung‘ derart nahe steht, dass die Frage der Vereinbarkeit mit seiner Stellung als Grossrichter u[nseres] E[rachtens] aufgeworfen werden müsste.» Wackernagel habe am 30. April 1942 dem Sekretariat der Eidgenössischen Sammlung eine Geldspende von Fr. 400 überweisen lassen.973 Er bediente sich dabei nach Auffassung der Po969
970 971 972
973
In der Kuratel wurden die Bedenken im Verlag Helbing & Lichtenhahn resp. beim Verleger Lichtenhahn persönlich lokalisiert. Aufgrund von Äusserungen des Chefs der Basler Pressekontrolle habe Wackernagel dann seinen Beitrag zurückgezogen – ein Fall von Vorzensur. StABS Protokoll T 2 Kuratel der Universität Bd. 14, 1941–1943, 167, 12. Sitzung, 16. 11. 1942. Der Sammelband erschien im September 1942 als Festgabe der Basler Juristenfakultät zum Schweizerischen Juristentag. Boerlin an seine Tochter Gertrud, 15. 12. 1942, in: Zimmerli 2009, 151 f. Festgabe der Basler Juristenfakultät 1942, «Vorwort». Bundesarchiv Bern, E27 1000/721_817, Mikrofilm Silber S_00115, Aktenzeichen 04.A.1. b.5.b.3.b. E27#1000/721#4787, Versetzung von Oberstlt. Wackernagel, Basel, zur Disposition wegen seiner frontistischen Gesinnung, 1942. In der Kuratel wurde dies zugunsten von Wackernagel so dargestellt, dass er Dr. Peter mit diesem Geld persönlich unterstützen wollte und es versehentlich bei der Eidgenössischen Sammlung als Spende verbucht worden sei. StABS Protokoll T 2 Kuratel der Universität Bd. 14, 1941–1943, 153, 10. Sitzung, 20. 8. 1942. Die Unterstützung durch Wackernagel erschien in den Materialien zum Bericht des Regierungsrats über Abwehr staatsfeindlicher Umtriebe in den Vorkriegs- und Kriegsjahren, in: StABS PD-REG 5a 8-1-2-3, 1945–1947, Polizeidepartement des Kantons Basel-Stadt, Polizei-Inspektorat, Spezialdienst: Bericht
254
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
litischen Polizei eines Mittelmannes, damit sein Name nicht in den Büchern der Sammlung erscheine. Nach Wackernagels Darstellung übergab er das Geld Werner Peter-Deschwanden, Syndikus des Verbandes der Basler chemischen Industrien und Hauptmann der Armee, einem alten Freund und Dienstkameraden; dieses sei nicht für die Eidgenössische Sammlung bestimmt gewesen. Wackernagel, so wusste die Politische Abteilung ferner, sei Mitglied der Freunde der Erneuerung, eine Gründung der Eidgenössischen Sammlung, die gestatten sollte, dass Leute, «die mit Rücksicht auf ihre Stellung offiziell nicht Mitglieder der ‚Eidgenössischen Sammlung’ werden können», sich dennoch (mit Spenden) engagieren könnten. Schliesslich wurde Wackernagels Rolle in der Gesellschaft zur Förderung kulturellen Lebens, resp. der Basler Pfalz erwähnt und diese als «eine Organisation von Mitgliedern der ‚Eidgenössischen Sammlung‘» dargestellt. Nachdem Eugster am 28. Juli 1942 Jacob Wackernagel angehört hatte, schickte dieser ihm ein Protestschreiben mit einer Kopie aus dem «Bulletin» der Aktionsgemeinschaft der jungen Generation. Dazu schrieb Wackernagel: «Meines Wissens ist auch Dr. Lützelschwab, Chef der politischen Abteilung des Polizeidepartements [Basel-Stadt] an dieser Aktionsgemeinschaft massgeblich beteiligt.» Die beigelegte Abschrift (Durchschlag) des «Bulletins» der Aktionsgemeinschaft vom 16. Juni 1942 enthielt einen Angriff auf Nationalrat Eugen Bircher und auf Oberst Schumacher, der in Dänikers Denkschrift bloss ein Zeichen von Verwirrung und fehlender Urteilskraft erkennen wollte (ein Argument, das wir auch im Fall Wackernagels antreffen werden). Die Aktionsgemeinschaft wertete Dänikers Denkschrift als «Faktum der ausgesprochenen Denunziation unseres politischen Wehrwillens an den Todfeind aller kleinen Randnationen durch die missbräuchliche Verwendung eines militärischen Geheimdokumentes». Der Autor (Ernst von Schenck) fuhr fort: «Anders wird wohl der Fall des Staatsrechtsprofessors und Grossrichters Oberst Jacob Wackernagel aus Basel liegen, der Gründungsmitglied der prodeutschen Kulturpropagandaorganisation Basler Pfalz ist und seltsamerweise Oberst Däniker in seinen Bemühungen, sich rehabilitieren zu lassen, rechtlich berät.» In der ersten Augusthälfte beklagte sich Wackernagel auch beim Dekan der Juristischen Fakultät, damals Robert Haab, über die gegen ihn gerichteten ‚Gerüchte‘.974 Die Politische Abteilung des Basler Polizeidepartements unterstützte inzwischen weiterhin das militärische Verfahren in Bern, indem Lützelschwab dem Armeeauditor am 16. August 1942 «persönlich und streng geheim» die Fotokopie
974
betr. Publikation der Namenslisten nationalsozialistischer und frontistischer Organisationen, 12: Finanzierung frontistischer Organisationen. Der Regierungsrat beschloss, im gedruckten Bericht keine Namen zu publizieren, und lehnte somit den Wunsch des Grossen Rats nach Transparenz ab. StABS UA P 4, Acta et decreta collegii jurisconsultorum / Protokoll der Juristischen Fakultät 1936–1944.
Jacob Wackernagel – ein rechtsextremer Jurist?
255
der Vernehmlassung zuschickte, die Wackernagel am 20. Juli 1942 eingereicht hatte. Zum Anklagepunkt der Mitgliedschaft in der Basler Pfalz präzisierte Wackernagel darin, Dr. Wilhelm Brenner-Reich habe ihm vorgeschlagen, sich an einem unpolitischen kulturellen Verein zu beteiligen. Er habe darauf die Statuten der Schweizerischen Gesellschaft zur Pflege der kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Italien mit den Statuten der Basler Pfalz verglichen. Die Pfalz, so Wackernagel, sei ein ideeller Verein im Sinne von Art. 60 ff. des Zivilgesetzbuches mit dem Zweck, wissenschaftliche, literarische und künstlerische Beziehungen besonders innerhalb des deutschen Sprachgebiets zu pflegen. Es bestehe kein Zusammenhang zwischen der Pfalz und der Gesellschaft zur Förderung kulturellen Lebens. Der Auditor erfuhr durch Lützelschwab, dass Wackernagel inzwischen aus der Liberalen Partei Basel-Stadt ausgetreten sei, und am 3. September 1942 meldete er auch Wackernagels Rücktritt als Grossrat, der am Vortag erfolgt war, nach Bern. Auch die Rückweisung von Wackernagels Beitrag zur Festschrift für den Schweizerischen Juristentag vom September 1942 berichtete Lützelschwab an Eugster am 4. November 1942. Der Erziehungsrat befasste sich am 26. Oktober 1942975 mit der Empfehlung der Kuratel,976 Wackernagel disziplinarisch (nur) einen scharfen Verweis zu erteilen. Der Chef des Erziehungsdepartements, der als Präsident des Erziehungsrats fungierte, Carl Miville, stellte sich auf den Standpunkt, dass es sich nicht bloss um ein Gesinnungsdelikt handle, sondern um die finanzielle Unterstützung einer verbotenen Organisation, der Eidgenössischen Sammlung. Die Kuratel hielt an ihrem Antrag, Wackernagel bloss eine scharfe Rüge zu erteilen und das Disziplinarverfahren einzustellen, fest. Die der Universität nahestehenden Mitglieder des Erziehungsrats und der liberale Jurist und Regierungsrat Adolf Im Hof unterstützten diesen Antrag mit dem Argument, dass die wissenschaftliche Überzeugung publizistisch frei vertreten werden dürfe (damit bezog er sich auf Wackernagels Artikel über die Neutralität). Die andern forderten, dass die Disziplinarkommission das Verfahren weiterführen solle. Mit Stichentscheid des Präsidenten beschloss der Erziehungsrat, der Regierung die Weiterführung des Disziplinarverfahrens zu empfehlen. Als Eugster am 20. Dezember 1942 Regierungsrat Carl Miville in Basel besuchte, erfuhr er, dass Wackernagel über Peter der Eidgenössischen Sammlung
975 976
StABS Protokoll S 4 Erziehungsrat Bd. 27, 1942–1944. Die Kuratel war grundsätzlich milde gestimmt; mehrere Mitglieder und der Chef des ED, Carl Miville, setzten sich dafür ein, dass Wackernagel nur einen Verweis erhalten solle. Zur Begründung sagte der Verleger Hagemann in der Kuratel, Wackernagel wisse nicht genau, was er tue, sei weltfremd und voller Minderwertigkeitsgefühl. Zudem verteidige er sich sehr ungeschickt. Kuratelspräsident Gerwig gab zu Protokoll, dass Wackernagel nach seiner Überzeugung «innerlich» nicht zu den Frontisten gehöre. Protokoll, 153, 10. Sitzung, 20. 8. 1942.
256
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
Geld hatte zukommen lassen, um die in Not geratenen Gesinnungsfreunde von Peter zu unterstützen und einen Beitrag zum Abbau des «Deutschenhasses» zu leisten. Die Basler Politische Polizei könne Wackernagels Mitgliedschaft bei den Freunden der Erneuerung nicht beweisen; nur die Geldspende war belegt. Den Beitritt zur (damals noch nicht verbotenen) Basler Pfalz habe Wackernagel zugegeben, er hatte sich auch an der Gründung beteiligt, die er für eine unpolitische Vereinigung gehalten habe. Es gebe keine Klagen über seine Lehre an der Universität. Es läge also nur ein Verstoss gegen das regierungsrätliche Verbot der Zugehörigkeit zu staatsgefährlichen Organisationen vor. Eugster selbst war überzeugt, dass Wackernagel keiner «verräterischer Handlungen verdächtig» sei. Die Unterstützung der Sammlung betrachtete er als eine blosse «Dummheit». Einen Verdacht auf landesverräterische Aktivitäten hielt auch Lützelschwab für unbegründet.977 Die Basler Regierung war nach dem Beschluss des Erziehungsrats zunächst untätig geblieben. Am 5. Januar 1943 riefen Basler Studenten deshalb zum Boykott von Wackernagels Lehrveranstaltungen per 11. Januar auf: Lieber Kommilitone, Sie besuchen das Kolleg bei Herrn Wackernagel. Finden Sie nicht auch, man sollte einen Schweizer Professor ruhig alleine lesen lassen, wenn er mit der Nationalen Front sympathisiert, diese sogar tatkräftig unterstützt, Festschriften verfasst, die wegen fremden Gesinnungsinhaltes zurückgewiesen werden müssen? Falls Ihnen bekannt ist, dass der betreffende Herr merkwürdig rasch aus dem Basler Grossen Rat ausgeschieden ist und von der liberalen Partei das consilium abeundi erhalten hat, werden Sie wahrscheinlich Steuerrecht oder gar Verfassungsgeschichte unserer Schweiz lieber anderswo lernen oder wenigsten warten, bis das Verfahren der Disziplinarkommission abgeschlossen ist.978
Die Basler Regierung beschloss daraufhin am 12. Januar 1943, das Disziplinarverfahren offiziell einzuleiten. Die Anklage lautete auf Unterstützung der Eidgenössischen Sammlung, Mitgliedschaft bei den Freunden der Erneuerung, einer Tarnorganisation der verbotenen Eidgenössischen Sammlung, sowie Beteiligung an der Gründung der Basler Pfalz. Das Erziehungsdepartement orientierte die Fakultät am 15. Januar 1943, dass Wackernagel für ein Jahr ab Ende Wintersemester 1942/43 ein Urlaubsgesuch gestellt habe.
977
978
Auditor Eugster an Bundesrat von Steiger, 29. 1. 1943; Lützelschwab, Politische Abteilung Basel-Stadt, an Bundesanwaltschaft, 26. 2. 1943, in: Bundesarchiv Bern, E4320B 1973/ 17_30, Aktenzeichen C.02-9260, E4320B#1973/17#433, Wackernagel Jakob Prof. «Die Basler Studentenschaft weiss, was sie will. Den Frontismus will sie nicht, und auch nichts Ähnliches.» Die Nation, Januar 1943, unter dem Titel «Basler Leckerli», Ausriss in: AFZ ETH Zürich, IB JUNA-Archiv / 512, Kontroversen um einzelne Personen, Presseartikel A–Z, 1938–1959.
Jacob Wackernagel – ein rechtsextremer Jurist?
257
Aufgrund des inzwischen abgeschlossenen Disziplinarverfahrens entschied die Regierung am 19. März 1943, Wackernagel während drei Monaten in Dienst und Besoldung einzustellen. Zudem bewilligte sie das mit Gesundheitsproblemen begründete Urlaubsgesuch von Wackernagel mit Reduktion des Gehalts um die Hälfte. Über die Beendigung des Urlaubs entschied sie am 25. Januar 1944 aufgrund eines medizinischen Gutachtens von John Staehelin,979 demzufolge Wackernagel per Wintersemester 1944/45 seine Tätigkeit wiederaufnehmen könne. Wackernagel verlangte, die volle Besoldung ab Juli 1944 wieder zu erhalten, was ihm zugestanden wurde.980 Dass Wackernagel in die Mühlen einer Untersuchung geriet, kam nicht überraschend. Er war von der Bundesanwaltschaft schon am 25. September 1939 fichiert worden, weil er nationalsozialistisches Propagandamaterial per Post empfangen hatte. Die Post beschlagnahmte solches auch am 30. September 1939 und informierte den Armeestab. Wackernagel wurde danach observiert. Am 21. Oktober 1939 meldete der Zürcher Nachrichtendient, dass Wackernagel Mitglied des Verwaltungsrats des Buchverlags Scientia A.G. Zürich sei. Der Dienst vermutete, dass sich der Verlag mit dem Vertrieb von deutscher Propaganda in der Schweiz befasse. Am 31. August 1940 wurde diese Verdachtsmeldung wiederholt, und am 21. April 1942 glaubte der Zürcher Nachrichtendienst zu wissen, dass Wackernagel für die Leitung der Gesellschaft zur Förderung kulturellen Lebens, die in Basel aufgezogen werden soll, vorgesehen sei. Damit war die Basler Pfalz gemeint.981 Die Folgen der Verurteilung von 1942 waren für Wackernagel einschneidend, aber vorübergehend. Immerhin hielt die Disziplinarkommission fest, dass er im Kolleg nie etwas «Unschweizerisches» geäussert habe. Der Arzt John Staehelin attestierte Wackernagel eine gewisse verminderte Zurechnungsfähigkeit. Schliesslich wurde Wackernagels Verhalten gegenüber den rechtsextremen Kreisen als grobfahrlässig beurteilt, aber nicht als gefährlich für die Existenz der Schweiz oder als landesverräterisch. Nach 1945 erfolgte an der Universität seine Reintegration: 1950 wurde er Dekan, 1956 Rektor. Bemerkenswert ist die Zurückhaltung, die sich Wackernagel später im Zitieren seines eigenen Buches von 1934 auferlegte. Obschon sich zum Beispiel sein Beitrag zur Festschrift für Carl Jacob Burckhardt von 1961 thematisch mit jenem Buch berührte, zitierte er darin
979 980
981
Der Psychiater John Staehelin war ein Studienfreund von Wackernagel; beide waren Mitglieder der Studentenverbindung «Zofingia». Zur Erinnerung 1969, 6. Regierungsratsbeschluss vom 25. 1. 1944. Regierungsrat Carl Miville an Regenz und Fakultät, 27. 1. 1944. John Staehelin bestätigte, dass Wackernagel vom medizinischen Standpunkt aus seinen «Habitualzustand» wieder erreicht habe. «K/G» an Kuratel, 27. 1. 1944, in: StABS ED-Reg 1a 2. Bundesarchiv Bern, E4320B 1973/17_30, Aktenzeichen C.02-9260, E4320B#1973/17#433, Wackernagel Jakob Prof.
258
Der Kampf der Juristen für den Rechtsstaat
zwar Michels, Kluckhohn und Smend, aber nicht seine eigene Arbeit.982 Die Nachrufe von 1967 erwähnten den hier untersuchten Fall und die Verurteilung nie. Nur Max Imboden deutete an, dass für Wackernagel «der Staat des 20. Jahrhunderts mit seinen ungeheuren Möglichkeiten wie auch seinen verschlingenden Abgründen etwas Fremdes bleiben musste» – eine verschlüsselte Absage an die im Wert des Staates von 1934 sichtbaren Tendenzen. Die Nekrologe betonten übereinstimmend, dass sich bei näherer Bekanntschaft hinter der Fassade («dem Schirm») eines charmanten, doch abwartenden Gesprächspartners eine empfindsame, gütige und aufopfernde Persönlichkeit offenbarte.983 Es sieht so aus, als ob die ‚oberen Behörden‘ an Wackernagels Beispiel die Grenzen aufzeigen wollten, die innerhalb der Universität für Germanophile gelten sollten. Die Fakultät hielt auf eine zurückhaltende Weise zu Wackernagel, während Max Gerwig, Duzfreund von Wackernagel,984 versuchte, die Disziplinaruntersuchung zu vermeiden und die Strafe auf einen Verweis zu reduzieren. Damit scheiterte er am Sozialisten Carl Miville, der im Erziehungsrat den Ausschlag für die weitere Verfolgung Wackernagels gab. Der Freund und Psychiater John Staehelin wählte eine Strategie der medizinischen Entlastung: Wackernagel habe aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur eine Vorliebe dafür, von gängigen, akzeptierten Wegen abzuweichen und sich in Grenzbereichen zum Verbotenen hin zu bewegen, deshalb habe er mit frontistischen Argumenten gespielt. Wollte Wackernagel Freiheit zurückgewinnen, indem er sich gerade in solche Diskursfelder begab, die die Gesinnungsdiktatur der ‚geistigen Landesverteidigung‘ dem Tabu unterworfen hatte? Juristen wie Fakultätskollegen und Regierungsrat Im Hof sahen diesen Aspekt des Falles. Allerdings wäre es problematisch, in Persönlichkeiten wie Wackernagel ernstzunehmende Kämpfer für Freiheiten zu suchen. Denn sie suchten die Freiheit gerade dadurch zu verteidigen, dass sie scheinbar oder wirklich Sympathien für die Feinde der Freiheit entwickelten.
982 983
984
Wackernagel 1961. Basler Nachrichten vom 19. 7. 1967, und National-Zeitung vom selben Tag, in: StABS UNI-REG 5d 2-1 (1) 385. Im Artikel zum 60. Geburtstag von Wackernagel, den die «National-Zeitung» am 1. 10. 1951 publizierte, reduzierte der Autor «C.G.» Wackernagels wissenschaftliche Leistung in auffälliger Weise ganz auf Rechtsgeschichte und Steuerrecht, während sein Kollege von den «Basler Nachrichten», «A.I.H.», das Buch von 1934 zwar erwähnte, aber feststellte, dass dessen «Bedeutung hier nicht klargelegt werden» könne. Zeitungsausschnitte ebd. Am 29. 12. 1949 bedankte sich Wackernagel bei Gerwig für dessen «lange Freundschaft», in: StABS PA 82 M2 35 Korrespondenz mit Max Gerwig.
6 Mediziner 6.1 Einleitung Die Untersuchung der Basler Medizinischen Fakultät erlaubt, das Verhältnis von Basler Wissenschaftlern zu Deutschland in den Jahren 1933 bis 1945 etwas eingehender zu diskutieren. In diesem Kapitel gebe ich einen breiten Überblick über die Fakultät, statt auf einzelne Persönlichkeiten zu fokussieren. Hierher gehört auch eine Darstellung der einzigen grösseren Affäre, die sich in Basel mit einem nationalsozialistischen deutschen Professor ereignete. Die Basler Medizinische Fakultät bestand vor dem Inkrafttreten des Universitätsgesetzes von 1937 aus nur acht gesetzlich verankerten Lehrstühlen. Diese waren 1933 wie folgt besetzt (Ausnahmen von Besetzungen mit Schweizern nenne ich in Klammern): Rudolf Staehelin für Innere Medizin, Alfred Labhardt für Gynäkologie, Robert Doerr für Hygiene (Österreicher), Eugen Ludwig für Anatomie, John Eugen Staehelin für Psychiatrie, Werner Gerlach für Pathologie (Deutscher), Fritz Verzár für Physiologie (Ungar). Vier persönliche Ordinariate mit Lehraufträgen sowie Extraordinarien erweiterten die Corona: Emil Wieland für Pädiatrie, Arthur Brückner für Ophthalmologie (Deutscher), Ernst Oppikofer für ORL (pensioniert 1940, Nachfolger wurde Erhard Lüscher aus Bern 1941), Siegfried Edlbacher für Physiologische Chemie (Österreicher), Alfred Gigon für die Medizinische Polyklinik. Dermatologie vertrat der Extraordinarius Wilhelm Lutz-Gutknecht, die Allgemeine Chirurgie Fritz Suter, die Gerichtsmedizin Salomon Schönberg, die Röntgenologie Max Lüdin, die Pharmakologie Hans Staub,985 die Soziale Hygiene Hans Hunziker (hauptamtlich Vorsteher des Basler Gesundheitsamts, verstorben 1941);986 hinzu kamen acht weitere Extraordinarien ohne Lehrauftrag und zwölf Privatdozenten.987 In der Zahnmedizin, deren Lehrer erst durch das Universitätsgesetz von 1937 als Medizinprofessoren anerkannt wurden – aber nur einer von ihnen durfte in der Medizinischen Fakultät Einsitz nehmen – wirkten Ernst Hockenjos, der sich 1916 in deutschen Kriegslazaretten in Kieferchirurgie weitergebildet hatte, Oskar Müller, Rudolf Schwarz, Max Spreng 985
986 987
Der Pharmakologe Staub, Privatdozent seit 1924, seit 1932 Vorsteher der Pharmakologischen Anstalt, war umstritten wegen seiner Neigung, sich drastisch gegenüber Patienten zu äussern. Dennoch wurde er 1944 Nachfolger von Rudolf Staehelin als Chef des Bürgerspitals (Ordinarius für Innere Medizin, Direktor der Medizinischen Universitätsklinik). Deutsche Kandidaten wurden damals gar nicht in Erwägung gezogen. Rintelen 1980, 184 f., 354–358; Bonjour 1960, 627. Rintelen 1980, 342. Rintelen 1980, 305 f. Das 1943 gegründete Tropeninstitut behandle ich hier nicht.
260
Mediziner
und Gottlieb Vest.988 Das am 8. März 1937 in Kraft getretene, neue Gesetz definierte nun dreizehn gesetzlich verankerte Lehrstühle; die neuen Ordinariate (vorher Extraordinariate oder persönliche Ordinariate) waren: Physiologische Chemie, Ophthalmologie, Dermatologie, ORL und Pädiatrie.989 Medizin, so ist aus den Forschungen über deutsche Verhältnisse bekannt, hatte in der Untersuchungsperiode eine besondere Affinität zu den mit der nationalsozialistischen Diktatur gegebenen, erweiterten oder neuen, unter Missachtung ethischer Grundsätze gewonnenen Möglichkeiten, medizinisch zu forschen und die mehr oder minder wissenschaftlichen Erkenntnisse auch in der Praxis auf den «Volkskörper» anzuwenden.990 Für eine Schweizer Fakultät resultieren daraus bestimmte Fragen: Gab es eine Beteiligung von Basler Medizinprofessoren an unethischen Vorgehensweisen in Deutschland, oder lassen sich Spuren von Kritik und Ablehnung solcher Praktiken in der Basler Fakultät feststellen? Konnten Basler Mediziner auf Finanzierungsmöglichkeiten zurückgreifen, wie sie typisch für das nationalsozialistische Deutschland waren? Es wird sich zeigen, dass die zur Beantwortung nötigen Informationen meistens nicht vorliegen oder akribisch in Nachlässen und Publikationen zusammengesucht werden müssten, was ich für diese Fakultät nicht leisten konnte. Möglich ist dagegen, die Beziehungen zu deutschen Fachgesellschaften und Publikationsmöglichkeiten in Stichproben offenzulegen und zu untersuchen, inwiefern Medizin in Basel eine ‚deutsche‘ Wissenschaft war. Hinweise kann ich auch auf den Umgang mit Flüchtlingen und auf die Rekrutierungspraxis für ausländische Bewerber geben.
6.2 Die Bedeutung Deutschlands für Ausbildung und wissenschaftliche Kommunikation Obschon die französische und manchmal auch die englische Medizin ins Blickfeld von Basler Medizinprofessoren gelangte (einige besuchten Pariser Spitäler zur Aus- oder Weiterbildung; britische Medizin war durch Gastvorträge in Basel und durch den Professorenaustausch mit England präsent), galt auch in diesem Fach, dass Deutschland die überragende Wissenschaftsnation war. Zudem stand Basel hinsichtlich der Lehrzeit und der Karrieren der schweizerischen Mediziner in einem so engen Verhältnis zu deutschen Universitäten und Kliniken, dass man seit dem späten 19. Jahrhundert von einer Integration zu sprechen versucht ist. Basler Medizinstudenten besuchten nach der Absolvierung der propädeutischen Semester in der Heimatstadt deutsche Universitäten und hospitierten oder assistierten an deutschen Kliniken. Auf diese Weise wurden sie in die Denkweisen 988 989 990
Bonjour 1960, 628. Professorenverzeichnisse in den Basler «Staatskalendern» 1933–1945. Rintelen 1980, 143. Forsbach 2006, 691–700.
Ausbildung und wissenschaftliche Kommunikation
261
deutscher Ärzte und in die im Nachhinein romantisch verklärte ‚Burschenherrlichkeit‘ einbezogen. Es kam umgekehrt auch vor, dass Deutsche als Assistenten oder Privatdozenten nach Basel kamen, namentlich wenn sie Schüler von Deutschen waren, die in Basel lehrten. In Kriegszeiten gehörte zur Aus- und Weiterbildung der Basler Ärzte vor allem in klinischen Fächern auch der Besuch deutscher Lazarette, so während des Ersten Weltkriegs und später während der drei schweizerischen Ärztemissionen an der deutschen Ostfront im Zweiten Weltkrieg. Dies konnte zwar aus rein medizinischem Interesse geschehen, fehlte doch in der Schweiz eine Möglichkeit, mit Katastrophen- und Kriegsmedizin unmittelbar Erfahrungen zu gewinnen. Unter Umständen bedeutete dies aber eine faktische Kooperation mit der deutschen Wehrmacht, was schon damals für Diskussionen sorgte. Die unter dem Zeichen des Roten Kreuzes stehenden Missionen wurden von Albert Oeri als «Hakenkreuz-Missionen» bezeichnet.991 Nach Deutschlandsemestern war die Mitgliedschaft in einer deutschen Fachgesellschaft selbstverständlich, woraus sich auch die regelmässige Teilnahme an deren Tagungen ergab, die gelegentlich auch in einer Schweizer Stadt abgehalten wurden. So begrüsste die Basler Fakultät 1934 den Plan der Deutschen Pharmakologischen Gesellschaft, ihre Jahrestagung hier abzuhalten. Andererseits hörte der Basler medizinische Pharmakologe Ernst Rothlin 1935 auf, in Deutschland zu veröffentlichen.992 Bis 1933 war es auch üblich, dass junge Schweizer Mediziner mit akademischen Ambitionen sich in Deutschland habilitierten oder dort eine Professur erlangten. Im Gegenzug war die Basler Fakultät bestrebt, von ihr als herausragend beurteilte deutsche Professoren in ihren Kreis zu berufen. Die ausländischen Professoren waren in der Basler Medizinischen Fakultät in der Minderheit – sie vertraten eher die theoretischen (Grundlagen⌥) Fächer, für die sich Schweizer weniger interessierten, wie Anatomie/Pathologie, Bakteriologie/Virologie, Physiologische Chemie, oder damals als Randfächer geltende Bereiche, für die es keine gesetzlich verankerten Ordinariate gab. Und die Rekrutierung von Ausländern erfolgte nicht ausschliesslich in Deutschland, sondern auch in mit der deutsch-
991 992
Widmer 2012, 122–124, Zit. Oeri: 124. Aschwanden 2020. StABS UA Q 2 Protokoll der Medizinischen Fakultät, 5. 3. 1934. Der Schwyzer Rothlin hatte sich als Schüler des Nobelpreisträgers Walter Rudolf Hess 1920 in Zürich habilitiert. 1922 holte ihn Arthur Stoll nach Basel in die Firma Ciba, wo er über Naturstoffe wie Herzglykoside und Mutterkornalkaloide sowie über Calcium arbeitete, später über Psychopharmaka. 1934 erhielt er den Titel eines Extraordinarius für Pharmakologie. Verheiratet war er seit 1926 mit Églantine Léonie Marie Wachs, der Tochter eines Kaufmanns bei I.G. Farben in Hoechst. Rintelen 1980, 163; Bickel 2005. Die heute «Deutsche Gesellschaft für experimentelle und klinische Pharmakologie und Toxikologie e. V. (DGPT)» genannte Organisation wurde 1920 gegründet. Am 17. 9. 1934 erfolgte an der Jahresversammlung in Göttingen die Nazifizierung. Starke 1998; Muscholl 1995.
262
Mediziner
sprachigen Hochschullandschaft verbundenen Ländern an der ‚Peripherie‘ wie Ungarn oder Österreich. Zu den Ungarn in Basel gehörte der Physiologe Fritz Verzár, der mit Unterstützung der chemisch-pharmazeutischen Industrie einen bedeutenden Forschungsbetrieb an seinem Institut unterhielt.993 Aus Ungarn stammte auch der Nachfolger des Österreichers Robert Doerr im Fach Hygiene, faktisch Bakteriologie und Virologie, Joseph Tomcsik. Doerr, seit 1919 in Basel Professor für Hygiene, vielleicht einer der bedeutendsten medizinischen Grundlagenforscher im damaligen Basel (unterstützt durch die Ciba und die Rockefeller Foundation), pflegte ein distanziertes Verhältnis zu Deutschland unter dem Nationalsozialismus: Eine Beteiligung an der Emil Behring-Feier in Marburg lehnte er trotz einer nachdrücklich formulierten Einladung 1940 ab.994 Ihm war auch klar, dass er, wäre er 1938 in Österreich gewesen oder hätte er 1922 eine Stelle in Deutschland innegehabt, «mit tödlicher Sicherheit» ein Opfer des nationalsozialistischen Regimes geworden wäre.995 Die Ungarn sorgten 1944 dafür, dass der nach damaligem Dafürhalten als Entdecker des DDT geltende Geigy-Chemiker Paul Läuger, der mit einer Ungarin liiert war, den Ehrendoktor der Medizinischen Fakultät erhielt.996 Mit Tomcsik wählte die Regierung während des Krieges 1943 erfolgreich einen Ausländer auf einen wichtigen Lehrstuhl. An sich hätte Adolf Lukas 993
994 995 996
Fritz Verzár war 1918 zum Professor für experimentelle Physiologie in Debrecen gewählt worden; er leitete auch das ungarische biologische Forschungsinstitut in Tihany. Nach seiner Berufung nach Basel im Jahre 1930 verbrachte er bis 1938 jeden Sommer in Ungarn. Sein Basler Institut wurde gefördert von der Rockefeller-Stiftung, der Freiwilligen Akademischen Gesellschaft und der Basler chemischen Industrie (Ciba). In Fragen wie innere Sekretion, Vitamine und Produkte der Nebennierenrinde kooperierte er mit Reichstein, Ru⌅i⇥ka und Karrer. Seine Bedeutung für die Ernährungsphysiologie kann kaum unterschätzt werden, so wurde er 1942 in das Weltgesundheitsamt des Völkerbunds und später in die WHO und FAO berufen. Der ungarische Patriot wurde erst 1950 eingebürgert (in Arlesheim). Mit Deutschland verband ihn die Herkunft seiner Mutter, aber wissenschaftlich war er nach England (Austauschprofessor in Oxford 1938) und Frankreich ausgerichtet, Länder, deren Sprachen er beherrschte. Nur 1937 nahm er einmal am Treffen der Basler und Freiburger Professoren teil. Ratmoko 2010, 196; Rintelen 1980, 324– 328; Nipp o. J., Fritz Verzár; Basler Nachrichten vom 17./18. 9. 1966 und 4. 9. 1976. Reichstein an Verzár, 6. 2. 1936, und Reichstein an Siegfried Edlbacher, 19. 2. 1936, in: Nachlass Tadeus Reichstein, StABS PA 979a, G 2 Poly 1930–1937. StABS UA Q 2 Protokoll der Medizinischen Fakultät, 16. 12. 1940. Berger 2009, 407. Er soll auch manchen Wissenschaftlern Geld für die Fahrt nach Übersee vorgestreckt haben. Berger 2010. Involviert waren ausser dem Rektor und Chirurgen Carl Henschen (Rintelen 1980, 214– 216, 376) die Ungarn Fritz Verzár und Joseph Tomcsik; der Fakultätsbeschluss war einstimmig. StABS UA Q 2 Protokoll der Medizinischen Fakultät 6. und 20. 11. 1944. Nachdem Paul Läuger bei Geigy entlassen worden war, galt Paul Müller als Entdecker des DDT und erhielt dafür den Nobelpreis. Simon 2002.
Ausbildung und wissenschaftliche Kommunikation
263
Vischer den Elsässer Charles Oberling vorgezogen, der von 1936 bis 1939 in Strasbourg Bakteriologie gelehrt und sich dann nach Paris zurückgezogen hatte. Von dort aus war er 1940 nach Teheran gegangen, dann mit einem RockefellerStipendium für die Jahre 1942 bis 1944 in die USA. Nachher kehrte er nach Teheran zurück. Seit 1948 arbeitete er in Frankreich für das CNRS, später erhielt er einen Lehrstuhl am Collège de France für «Médecine expérimentale». Die Basler Perspektive vermochte ihn nicht zu überzeugen. Mit Tomcsik, dem Direktor des staatlichen Hygiene-Instituts in Budapest,997 gewann Basel einen Immunologen, der über die Struktur von Antigenen an den Oberflächen von Bakterienzellen forschte und sich historisch mit Louis Pasteur beschäftigte. Mit der meist positiven Deutschlanderfahrung junger Schweizer vor 1933 verband sich je nach Autor bis in die Mitte der 1930er Jahre, manchmal bis in die 1940er Jahre hinein, die Gewohnheit, in den Zeitschriften dieser Fachgesellschaften zu veröffentlichen, die man als Mitglied ohnehin abonniert hatte. Ferner gehörte es dazu, die Lehr- und Handbücher des eigenen Faches aus Deutschland zu beziehen. Arrivierte Schweizer Professoren erschienen auch als Mitautoren von deutschen Gesamtdarstellungen ihres Fachgebietes und als Mitherausgeber von (nach 1933 gleichgeschalteten) Zeitschriften. Ophthalmologie eignet sich besonders als Untersuchungsfeld, weil diese Wissenschaft früh und intensiv an Vererbungsforschung interessiert war – Sammlungen von Augenpräparaten waren bei Vertretern dieses Gebiets beliebt.998 Ihre Fachzeitschriften und Tagungen enthielten dementsprechend viele Beiträge zur Eugenik und Vererbungslehre. In Deutschland waren Augendefekte meldepflichtig, um das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses durchsetzen zu können.999 Der in Basel von 1924 bis 1948 für Ophthalmologie zuständige Arthur Brückner1000 war vor seiner Wahl in Königsberg, Berlin und Jena tätig gewesen. Er interessierte sich allerdings für die Zytologie des Kammerwassers und die Dioptrik, d. h. für ganz andere Themen als die Vererbung und hielt sich von den Nationalsozialisten fern. Nach 1930 nahm er nicht mehr am Professorentreffen Basel-Freiburg teil, blieb aber Mitglied der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft wie 29 andere in der Schweiz lebende Spezialisten. Als der aus Deutschland emigrierte Verleger Karger die «Zeitschrift für Augenheilkunde» mit Band 96 (1938/39) nach Basel brachte und in «Ophthalmologica» umtaufte, übernahm Brückner zusammen mit Hendricus Jacobus Marie Weve (Utrecht) die Redaktion ohne die deutschen und österreichischen Kollegen.1001 Brückner und Weve waren vorher zusammen mit Carl Behr in Hamburg und Josef Meller 997 998 999 1000 1001
Rintelen 1980, 343–345; Haguenau 2003. Hesse 2001. Rohrbach 2007, 127 ff. Bonjour 1960, 616. Rohrbach 2007, 189 f.
264
Mediziner
in Wien für die Herausgabe verantwortlich gewesen. Als Gegenbeispiel kann der Zürcher Ophthalmologe Alfred Vogt gelten. Er war bis 1938 Mitherausgeber der «Zeitschrift für Augenheilkunde»; als diese mit Karger nach Basel und zu Brückner wechselte, wurde Vogt einer der Redaktoren der «Klinischen Monatsblätter für Augenheilkunde» beim Ferdinand Enke Verlag in Stuttgart. Dortiger Hauptredakteur war Rudolf Thiel in Frankfurt, der Aurel von Szily (in Münster 1935 als Jude entlassen, emigriert nach Ungarn 1939) ersetzte. Vogt war 1936 Ehrendoktor der Universität Heidelberg geworden und erhielt 1939 die Cothenius-Medaille der Leopoldina.1002 In Basel existierte übrigens unabhängig von Brückners Augenklinik ein ophthalmologisches Institut im Physikgebäude, das vom Extraordinarius Ernst Wöfflin geleitet wurde, einem jüngeren Bruder des Kunsthistorikers Heinrich Wölfflin, der Beziehungen zu vielen adligen Häuptern, unter anderen zum Hof des exilierten deutschen Kaisers Wilhelm II. in Doorn, unterhielt. Im Unterschied zu Brückner hielt Wölfflin Vorlesungen über «Vererbungslehre mit spezieller Berücksichtigung der Augenkrankheiten», so im Sommer 1939 und im Winter 1939/40.1003 Schweizer Professoren konnten durchaus den Nationalsozialismus ablehnen und dennoch als Mitautoren in Lehrbüchern und Gesamtdarstellungen auftreten, die in Deutschland herauskamen, zum Beispiel Siegfried Edlbacher, der noch 1940 sein Praktikum der physiologischen Chemie in Berlin bei de Gruyter verlegen liess. Sein erfolgreiches Lehrbuch für dieses Fach war 1937 im gleichen Verlag (allerdings in Leipzig statt in Berlin) erschienen. Auch veröffentlichte er verschiedene Aufsätze in deutschen Zeitschriften bis 1940. Edlbacher konnte jedoch keineswegs verdächtigt werden, Sympathien mit dem Nationalsozialismus zu hegen, so versuchte er die Berufung von österreichischen Hitler-Anhängern nach Basel zu verhindern. Aufschlussreich ist das Verhalten des Psychiaters John Eugen Staehelin gegenüber dem Schweizerischen Hilfswerk für deutsche Gelehrte, das 1933 geschaffen wurde, um Flüchtlinge aus Deutschland zu unterstützen. Staehelin hatte im Mai 1933 den Basler Aufruf zusammen mit Kollegen wie Emil Dürr (Historiker), Fritz Fichter (Chemiker), Eduard Hoffmann-Krayer (Volkskundler), Fritz Mangold (Statistiker) und Felix Stähelin (Althistoriker) unterzeichnet; es unterschrieben auch liberale Journalisten wie Albert Oeri, Eduard Fritz Knuchel, Otto Kleiber und der sozialdemokratische Chef des Erziehungsdepartements, Fritz Hauser. Im August/September sollte die Basler Ortsgruppe entstehen, wozu ein Gründungspräsident gesucht wurde. Staehelin weigerte sich, diese Rolle zu übernehmen. Er sei schon wegen seiner Unterschrift unter dem Aufruf von Studenten angegriffen worden. «Nicht gleichgültig» könnten ihm kritische «Äusserungen deutscher Universitätskreise » sein, die den Aufruf als «Affront gegen das moder1002 1003
Rohrbach 2007, 106; Gloor 2007. https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Wölfflin.
Ausbildung und wissenschaftliche Kommunikation
265
ne Deutschland empfunden» hätten. In deutschen Zeitungen sei sein Name in diesem Zusammenhang erwähnt worden. Da die deutschen Universitäten vollständig ‚gleichgeschaltet‘ sind, riskiere ich, dass die wissenschaftlichen Arbeiten unserer Basler psychiatrischen Klinik in den psychiatrischen Fachzeitschriften Deutschlands nicht mehr publiziert werden, wenn es in Deutschland bekannt wird, dass ich die Ortsgruppe Basel des Schutzverbandes präsidiere. Da aber in der Schweiz nur eine einzige selten erscheinende psychiatrische Zeitschrift herausgegeben wird, sind wir nach wie vor darauf angewiesen, den grössten Teil unserer Arbeiten in deutschen Zeitschiften zu veröffentlichen.1004
Er sei aber bereit, als gewöhnliches Kommissionsmitglied zu wirken, erklärte er gegenüber Fritz Hauser. Die Lösung kam dann von Karl Barth, der sich im November 1935 zur Übernahme des Präsidiums bereit erklärte. Man erkennt die starke Wirkung, die das Kommunikationsmonopol deutscher Verlage und Hochschulen auch auf gutwillige Schweizer ausübte. Der Gynäkologe Alfred Labhardt hatte Deutschlanderfahrung während des Studiums in Tübingen und einer Assistenz in Königsberg erworben, alles vor 1902.1005 Seine frühen Publikationen erschienen in Deutschland, spätere in der Schweiz. Eine Statistik zu erstellen erlaubt das Schriftenverzeichnis:1006 Labhardt publizierte 63 mal in der Schweiz, 28 mal in Deutschland, 4 mal in Frankreich. Von den 28 deutschen Veröffentlichungen sind nur sechs nach 1933 erschienen. Der Chirurg Carl Henschen wurde 1894 in Basel eingebürgert. Lange vor dem Ersten Weltkrieg hatte er in Kiel studiert, war danach 1908 bis 1910 in Tübingen, bis er über Zürich und St. Gallen 1926 nach Basel kam. Mindestens bis 1941 publizierte er in Deutschland; noch 1938 besuchte er einen Kongress für Unfallmedizin und Berufskrankheiten in Frankfurt am Main und referierte dort über Meniskusprobleme der Bodenleger. Im gleichen Jahr vertrat er Basel in Manchester als Austauschprofessor.1007 Ähnlich Hans Iselin-Haeger, der von 1906 bis 1921 Chef der Basler Chirurgischen Poliklinik, Dozent für Unfallchirurgie sowie Forscher zur Orthopädie war und 1937 zum Extraordinarius befördert wurde. Er erhielt den Hebelpreis für die Hilfe, die er als Unfallchirurg deutschen 1004
1005 1006
1007
«Baslerliste» zum Aufruf der Komitees, Zürich, im Mai 1933. Korrespondenz zwischen Fritz Hauser und Oprecht vom 22.8., 1.9., 21. 9. 1933. Hauser an Staehelin 21. 9. 1933. Ausführliche Antwort von Staehelin an Hauser, 26. 9. 1933, wie oben zitiert. Weitere Korrespondenz Hauser/Staehelin vom 5.3., 7.3., 9.7., 16. 7. 1935. Alles in: StABS Erziehung X 48 Schweizerisches Hilfswerk für deutsche Gelehrte 1933–1940. Rintelen 1980, 223–229. Labhardt engagierte sich gegen die Freigabe der Abtreibung und für Geburtenkontrolle. L. M. Walser, «Bibliographie der Veröffentlichungen von Prof. Dr. Alfred Labhardt, Basel», vermutlich aus der Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie 112, 1941, Typoscript, mit einem Nachtrag = Universitätsbibliothek Basel, Med. Conv. 222 Nr. 26. Rintelen 1980, 214–216, 376; Henschen 1938.
266
Mediziner
Kriegsverletzten geleistet hatte, und interessierte sich noch 1937 für das Professorentreffen Basel-Freiburg. Er publizierte nach dem Ersten Weltkrieg bald in der Schweiz bei Schwabe, bald in einem deutschen Verlag oder bei Springer Wien.1008 Nur in Deutschland bestand eine hochqualifizierte deutschsprachige ‚Industrie‘ für die wissenschaftliche Kommunikation in Medizin. Vom Dissertationsdruck über den Verlag von Fachzeitschriften und Fachinformationsmitteln bis zu grossen Handbuchreihen lief die wissenschaftliche Kommunikation in der Regel über deutsche Druck- und Verlagsunternehmen. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hatten die in der Schweiz domizilierten Verlage eher eine ergänzende oder dann lokale Bedeutung; ihre Produkte dienten der Kommunikation dort, wo landesspezifische Verhältnisse und Themen im Vordergrund standen – namentlich in den meist kurzen Beiträgen zur «Schweizerischen Medizinischen Wochenschrift» des Schwabe-Verlags (bis 1919 «Correspondenzblatt» genannt), oder in den «Verhandlungen» der national-schweizerischen Fachgesellschaften. Viele Fächer hatten so eine nationale neben einer international-deutschen Dimension. Dies änderte sich vor allem, als – wie schon erwähnt – Karger sich kurz vor dem Krieg mit seinem Verlag in Basel ansiedelte. Er nahm Zeitschriftentitel mit, die nun durch lateinische Namen internationalisiert und von Schweizern herausgegeben wurden. Das Studium der Haut- und Geschlechtskrankheiten hatte in Deutschland eine besondere politische Bedeutung als Fach, das für die Gesundheit des ‚Volkskörpers‘ einschlägig sein sollte. Für die Dermatologen habe ich die Schweizer Beteiligung an den Tagungen der deutschen Fachgesellschaft in den 1930er und frühen 1940er Jahren untersucht. Ein Autor der deutschen Dermatologenzeitschrift war der Basler Wilhelm Lutz-Gutknecht, der bis 1934 auch auf deren Titelblatt als Mitherausgeber genannt wurde, danach aber nicht mehr (die Reihe seiner Publikationen in Deutschland endete 1936). Wilhelm Lutz, der von 1922 bis 1956 in Basel als Professor wirkte, wurde 1922, von Bruno Bloch (Zürich) empfohlen, zum Extraordinarius gewählt und 1937 zum Ordinarius befördert.1009 Im Unterschied zu seinen Zürcher Kollegen Guido Miescher1010 und Walter Burckhardt sowie zu seinem Berner Kollegen Oskar Naegeli, welche die seit 1934 nazifizierte deutsche Fachkonferenz regelmässig nicht nur besuchten, sondern dort auch referierten (allerdings ohne Konzessionen an die Ideologie; die jüdische Schweizer Autorität Bruno Bloch zitierten sie regelmässig – Miescher war Blochs Assistent gewesen), erschien Lutz in diesem Zusammenhang nicht mehr, bis Karger seinen Verlag und damit auch die Zeitschrift nach Basel brachte. Lutz wurde 1939 Redaktor der nun «Dermatologica» genannten Zeitschrift, die er neutral führte und
1008 1009 1010
Bonjour 1960, 624. Rufli 2008, 28–35. Geiges 2008.
Ausbildung und wissenschaftliche Kommunikation
267
nach 1945 in den Dienst der Verständigung zwischen den vorher kriegführenden Nationen stellte.1011 Die «Verhandlungen der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft» (DDG) geben Einblicke in die Fachtagungen in Deutschland mit Schweizer Beteiligung. Der 17. Kongress wurde in Berlin vom 8. bis 10. Oktober 1934 abgehalten und bildete den Übergang von einer internationalen Tagung zu einer nazifizierten deutschen Veranstaltung. Das Publikationsorgan für die Tagungsberichte hiess «Archiv für Dermatologie und Syphilis begründet von H. Auspitz und F. J. Pick. Kongressorgan der Deutschen Gesellschaft, unter Mitwirkung von […] und in Gemeinschaft mit […] herausgegeben von J. Jadassohn Zürich, W. Frieboes Berlin, L. v. Zumbusch München. 172. Band». Unter den damaligen «Mitwirkenden» der Herausgeber stammten drei aus der Schweiz: Lutz aus Basel, Miescher aus Zürich und Winkler aus Luzern. Da keine Liste der Teilnehmer veröffentlicht wurde, sind nur die Referenten und Votanten in der Diskussion bekannt. Die Schweizer Beiträge präsentierten sich an dieser Tagung wie folgt: (16) In einer Aussprache findet sich ein Beitrag von Miescher, der über Studien seines Schülers Burckhardt zu berufsbedingten Ekzemen von Maurern berichtete und dabei auch auf Arbeiten von Bruno Bloch und Naegeli (Bern) verwies. Dieses Votum war völlig neutral-wissenschaftlich. (85) In einer anderen Aussprache meldete sich Naegeli mit einem Bericht über Salvarsanresistenz zu Wort. (134) In einer weiteren Aussprache teilte Naegeli seine Erfahrungen mit Fieberkuren unter Verwendung von «Impfmalaria» mit. (169) Schliesslich trat Naegeli wieder in einer Aussprache über Entzündungen der Prostata auf. Das Ziel war offensichtlich, die Forschungen in Zürich und Bern den Tagungsteilnehmern zur Kenntnis zu bringen. Das Umfeld aber charakterisierte die Eröffnung der Tagung, in der die Nazifizierung deutlich wurde. (3–6) Der Vorsitzende Karl Zieler (Würzburg)1012 wollte die Fachgesellschaft «fest einordnen […] in die Bedürfnisse des neuen nationalsozialistischen Staates, der sich auf Volk und Rasse gründet». Die Mitgliederversammlung habe den «Neuaufbau auf der Grundlage des Führergedankens» durch die Eingliederung in die Reichszentrale für Gesundheitsführung vollzogen. «Es liegt in der Natur der Sache, dass Neuordnungen gewisse Härten haben. Neue Zeiten verlangen neue Männer.» Die grosse Teilnehmerzahl schien zu beweisen, dass «wir auf dem rechten Weg sind». Er begrüsste namentlich viele Partei- und Behördenvertreter. Die Bedeutung der Geschlechtskrankheiten für die Volksgesundheit unterstrich er ebenso wie die Tatsache, dass der «Führer» 1011
1012
Anonym 1956; Wilhelm Lutz-Gutknecht, Professor Dr. med., 4. November 1888 bis 8. September 1958. Bestattungsfeier Donnerstag den 11. Sep. 1958 in der St. Leonhardskirche Basel, o. O., o. J. (Privatdruck). Karl Zieler war aktiver Nationalsozialist und Antisemit, 1936 Parteimitglied, vorher deutschnational. Scholz 1999, 127 f.
268
Mediziner
deren Entwicklung mit Sorge verfolge. Der neue Staat werde auf diesem Gebiet «noch wesentlich mehr und Gründlicheres erreichen». Der Arzt sei «Anwalt der Volksgesundheit». Dass Ausländer aus zehn Ländern gekommen seien, «das ist mir eine Bürgschaft, dass die deutsche Wissenschaft ihr altes Ansehen nicht verloren hat trotz aller Verleumdungen, mit denen gewisse ausländische Kreise und Zeitungen uns noch heute bedenken.» Alle sollten einstimmen in den Ruf «Der Führer unseres deutschen Volkes, unser Reichskanzler Adolf Hitler: Sieg Heil!» Danach sprach (6–8) Ernst Heinrich Brill (Rostock) als Vertreter des Reichsärzteführers Gerhard Wagner (8). Weitere Reden wurden nur kurz zusammengefasst; sie stammten vom Inspekteur des Heeres-Sanitätswesens Generaloberstabsarzt Prof. Anton Waldmann; von Ministerialrat Hans Bogusat namens des Reichsinnenministeriums; von Ministerialrat Bauer namens des Reichsarbeitsministeriums; von Ministerialrat Hesse namens des Preussischen Innenministeriums; von Curt Thomalla namens des Reichspropagandaministeriums (dessen Rede S. 8–11 ausführlich abgedruckt wurde). In den Ansprachen fehlte offener Antisemitismus, aber ansonsten war dies ein reiner NS-Kongress einer soeben gleichgeschalteten Gesellschaft. Die Berichte über die 18. Tagung, gehalten zu Stuttgart vom 18. bis 21. September 1937, erschienen 1938 wieder im «Archiv», nun herausgegeben von Leopold Arzt in Wien, Ernst Heinrich Brill in Rostock, Walther Frieboes in Berlin, Svend Lomholt in Kopenhagen, Guido Miescher in Zürich, Karl Zieler in Würzburg. Eine Liste von «Mitwirkenden» existierte nicht mehr, und damit wurde auch Lutz nicht mehr genannt. Wieder finden wir kein Teilnehmerverzeichnis, sondern nur die Namen der Vortragenden und Diskussionsteilnehmer. Aus der Schweiz stammte (8–35) der Vortrag von Guido Miescher über «Die Bedeutung der Testproben für die Haut». Der Referent gab einen rein wissenschaftlichen Überblick über den Stand der Forschung, zitierte viele jüdisch klingende Namen, auch wieder Bruno Bloch. Das Schlusswort der entsprechenden Sektion (65) hielt ebenfalls Miescher. Ein Referat hielt (79 f.) auch Walter Burckhardt; er sprach über «Wesen und Genese der Maurerekzeme». Auch in den Aussprachen waren die Zürcher präsent, wiederum mit rein fachlichen Argumenten (119 Miescher; 149 Burckhardt). Einen Eindruck vom Klima, in dem diese zweite nationalsozialistische Tagung der Gesellschaft abgehalten wurde, geben die Informationen über die «Eröffnungssitzung» (1–7). Zuerst ergriff Oberbürgermeister Dr. Karl Strölin das Wort, um ‚sein‘ Stuttgart als Tagungsort ins rechte Licht zu rücken. Es folgte die Ansprache von Zieler (2–7), der die Bemühungen Stuttgarts um das Auslandsdeutschtum und für Kliniken lobte, sich dann den ausländischen Gästen und Mitgliedern zuwandte und dabei das Fehlen von Harald Boas aus Kopenhagen und von Tommasini aus Italien bedauerte. «Wir freuen uns, dass trotz aller Hetze gegen das neue Deutschland die alten Freunde im weiteren Auslande uns fast restlos treu geblieben sind und eine ganze Reihe neuer Freunde in den letzten
Ausbildung und wissenschaftliche Kommunikation
269
Jahren sich unserer Gesellschaft angeschlossen hat.» Ihr zahlreiches Erscheinen bewies für ihn wieder die Wertschätzung der deutschen Wissenschaft im Ausland. Ein Wissenschaftler leiste Hervorragendes nur bei fester Verwurzelung in «seinem Volkstum». Zieler begründete den Sieg des Nationalsozialismus und erhoffte eine wirtschaftliche Sicherung und einen kulturellen Aufstieg des Volkes durch den Vierjahresplan. «Es wird immer mehr auch im Auslande anerkannt, dass die Bemühungen unseres Staates sich lohnen, bevölkerungspolitische, erbund rassenpflegerische Gesichtspunkte der Gesetzgebung zugrunde zu legen. Denn dieser Weg ist geeignet, die dem deutschen Volke drohenden Gefahren abzuwenden, einer Verschlechterung der Gesamterbmasse unseres Volkes in gesundheitlicher und rassischer Hinsicht entgegenzuwirken.» Am Schluss hiess es wieder «Unser Führer und Reichskanzler, Adolf Hitler, Sieg Heil!» Die 19. Tagung (als «erste grossdeutsche Tagung» deklariert) und Feier des 50jährigen Bestehens der Fachgesellschaft wurde in Breslau von 18. bis 21. August 1939 veranstaltet. Den Bericht gab nun (im Auftrag der Gesellschaft) Zieler als «Leiter der Tagung» allein heraus (wohl im Sinne des ‚Führerprinzips‘). Das Buch erschien weiterhin im Verlag von Julius Springer, Berlin (1940), als ein Band des «Archivs», nun herausgegeben von Brill (Rostock), Frieboes (Berlin) und Zieler (Würzburg). Der einzige Schweizer Beitrag (238–251) stammte von Guido Miescher aus Zürich, der über «Strahlenphysiologie der Haut» sprach. Sachlich knapp und präzise referierte er auf der Grundlage von eigener Forschung und zitierte Epstein, Lutz und andere. Er war völlig frei von Ideologien, behandelte aber mit rassistischem Unterton die Haut der «Neger», aber das war wohl zeittypisch. In der Festsitzung (1–12) ging es hoch her. Zieler begrüsste Partei, Staat, Wehrmacht, Heer, Marine und Luftwaffe, ferner Vertreter der Stadt Breslau und der Universität. Er deutete die Anwesenheit von Vertretern dieser Institutionen als Zeichen dafür, dass die «Ziele meiner [!] Gesellschaft […] vor allem auch in deren [der Krankheiten] Bekämpfung und Verhütung im Sinne nationalsozialistischer Gesundheitsführung» lägen. Er erwähnte die befreundeten Gesellschaften: Deutsche Gesellschaft für Lichtforschung, Italienische Dermatologische Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, Union contre le péril vénérien sowie Deutsche Lichttechnische Gesellschaft, und freute sich über die Aussicht, dass Danzig bald wieder dem «Reichsverband» angehöre. Grosse Erwartungen verband er auch mit der «Rückkehr» der deutschen Universität Prag in die Obhut des ‚Reichs‘. Die Einverleibung der Universitäten aus dem «Protektorat Böhmen und Mähren» werde hoffentlich «eine Zeit friedlicher und erfolgreicher Zusammenarbeit beider Völker» einleiten. Anschliessend unterstrich er die Anziehungskraft der DDG für Ausländer, denn ein Fünftel der Mitglieder arbeite in Ländern ausserhalb der «Reichsgrenzen». Sichtlich mit Blick auf die Ausländer betonte er den Friedenswillen des «Führers». Wieder kam es zu keinen antisemitischen Ausfällen, er verschwieg die Existenz von Juden ein-
270
Mediziner
fach. Glückwünsche zum Jubiläum der Gesellschaft überbrachten die Rumänische Dermatologische Gesellschaft, die Section of Dermatology and Syphilology der American Medical Association, und persönliche Glückwünsche trafen von André Desaux aus Paris, Franjo Kogoj aus Zagreb, Ede Neuber aus Budapest und Alexander Paldrock aus Dorpat ein. Die letzte Tagung vor Kriegsende wurde in den «Verhandlungen der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, 20. Tagung (‚Kriegstagung‘) gehalten zu Würzburg 28. bis 30. Oktober 1942», dokumentiert. Als Herausgeber zeichnete wieder Zieler als «Vorsitzender der Gesellschaft und Leiter der Tagung»; der Band erschien im Springer-Verlag Berlin (1943) wiederum als «Archiv», herausgegeben «in Gemeinschaft mit H[einrich] Gottron-Breslau, E[rich] SchmidtStuttgart, W[alther] Schultze-Gießen, A[lfred] Stühmer-Freiburg i. Br, J[osef] Vonkennel-Leipzig […], E. Brill-Rostock, W. Frieboes-Berlin und K. ZielerWürzburg (184. Band)». Wie die anderen Bände trug auch dieser nirgends ein Hakenkreuz oder ein anders nationalsozialistisches Zeichen auf dem Titelblatt. Die Begrüssung erfolgte diesmal durch den Gauleiter Dr. Otto Hellmuth aus Würzburg, Zieler war bloss «antwortend». Danach hielt der aus Lugano gebürtige Reichsgesundheitsführer Dr. Leonardo Conti seine Ansprache, und das Schlusswort sprach wieder Zieler. Er begrüsste speziell ausländische Ehrenmitglieder sowie Mitglieder aus Finnland, der Schweiz, Bulgarien, Holland und natürlich aus Italien. Er war in seiner Rhetorik auffällig gedämpft, musste sich aber auch deshalb kurz fassen, weil Conti ausschweifend lange gesprochen hatte. Es gab noch Schweizer Beiträge: (260) Max H. Welti aus Zürich beteiligte sich an einer Aussprache, berichtete Erfahrungen aus seiner Privatpraxis über Untersuchungen an Blutzucker und Calciumkonzentration und die Folgen der Kälteperiode im Winter 1941/42 (267). Walter Burckhardt aus Zürich war in den Diskussionen wieder präsent; er referierte über Neutralisationsversuche an Leichen, die bewiesen, dass die Haut Alkali neutralisiere. Schweizer nahmen somit bis zum Ende teil, d. h. die Züricher Schule, manchmal Oskar Naegeli aus Bern, aber keine Basler. Das Beispiel zeigt, dass es ergiebig wäre, für verschiedene Disziplinen die schweizerische Präsenz an deutschen Tagungen zu untersuchen. Offenbar haben Schweizer noch bis in den Krieg hinein solche Treffen besucht. Das nationalsozialistische Dekor, das ich hier nicht bis ins letzte Detail erwähnt habe, scheint sie nicht abgeschreckt zu haben – Dabeisein war wichtiger? Das Beispiel zeigt ferner, dass die Mitwirkung an solchen Anlässen keineswegs voraussetzte, dass die Schweizer Konzessionen an die nazifizierte Wissenschaft machen mussten. Hingegen wurde ihre Anwesenheit propagandistisch verwendet: Sie sollte beweisen, dass auch unter der NS-Diktatur Wissenschaft getrieben wurde, die im Ausland Respekt heischte und Teilnehmer von dort anzog. Es ist somit eine Illustration der These, dass diejenigen Schweizer, die dabeigewesen sind, damit den Propagandisten des Regimes einen Dienst erwiesen haben.
Ausbildung und wissenschaftliche Kommunikation
271
Die Auswirkungen von ‚1933‘ auf die Systeme von Austausch und Kommunikation mit Deutschland zu erfassen, ist nicht einfach. Spätestens als es sich abzeichnete, dass Deutschland den Krieg verlieren werde, wandte sich die Medizin in der Schweiz einer national-helvetischen und anti-nationalsozialistischen Selbstdarstellung zu, deren vaterländischer Landesverteidigungsdiskurs die früher selbstverständliche Nähe zu Deutschland verdeckte. Man möchte davon ausgehen, dass sich diese Nähe nicht nur fachlich manifestiert hatte. Die Medizinische Fakultät in Basel glich einem durch und durch bürgerlichen Haus, in dessen Räumen anfänglich meist keine Furcht vor dem nationalsozialistisch beherrschten Deutschland zu bemerken war. Als rein politisch gedeutete Veränderung im Nachbarland schien die Etablierung der Diktatur Hitlers die Wissenschaft nichts anzugehen. Die wenigen politischen Positionen, die von Fakultätsmitgliedern offen bezogen wurden, lagen im bürgerlichen ‚juste milieu‘ und reichten von den Freisinnigen (Radikal-Demokraten) bis zu den Liberalkonservativen. Dies erlaubte allerdings eine Aufgeschlossenheit gegenüber Flüchtlingen, wie wir sehen werden. Ideell teilten viele Basler Mediziner zunächst Weltanschauungen, die in Deutschland verbreitet waren und die dort in ein mehr oder weniger lockeres Verhältnis zum Nationalsozialismus traten. Dies galt zum Bespiel für die Dekadenzthese: Da in den industrialisierten Nationen des Nordens und Westens unter den Menschen keine Darwinsche Auslese der Tüchtigsten mehr stattfand, verschlechterte sich angeblich die Qualität des ‚Volkskörpers‘ laufend. Die Medizin sah sich im Rahmen der Eugenik aufgerufen, Gegenmassnahmen zu entwickeln und diese zur Implementierung vorzuschlagen. Ohne Anstoss zu erregen konnte unter Medizinern formuliert werden, dass gerade die Schwachen mehr Zuwendung erhielten als die Starken und Gesunden. Und sie könnten sich ungehindert fortpflanzen, ja vermehren: die Sozialstatistiken schienen zu beweisen, dass ‚Amoralische‘, Randständige, geistig Behinderte und wirtschaftlich wenig Erfolgreiche eine höhere Geburtenrate aufwiesen als die ‚wertvollen‘ Eliten. Solche Überlegungen konnten, mussten aber nicht rassistisch eingefärbt sein. Humangenetik, eine relativ neue Wissenschaft, war in diesem Zusammenhang besonders interessant, da sie durch statistisch-methodische Innovation Neuland erschloss. Angesprochen sah sich dabei die Psychiatrie, da sie im Unterschied zu anderen medizinischen Fächern, die durch die Verwissenschaftlichung ihrer biologisch-chemischen Grundlagen von einem robusten Fortschrittsgedanken getragen wurden, nur geringe Heilungserfolge aufwies. Die in der Basler Fakultät geschätzte psychiatrische Schule von Emil Kraepelin in München hatte deshalb das Programm entwickelt, Geistesstörungen zu verhindern statt, was wenig Erfolg versprach, solche zu heilen. Dazu führte sie den Nachweis, dass viele solcher Störungen erblich seien und die Vererbung nach bestimmten Regeln erfolge. Aus
272
Mediziner
diesem Ansatz, verbunden mit der Eugenik und der Degenerationslehre,1013 resultierte die Forderung, dass mit potentiellen und realen psychischen Krankheiten ‚Belastete‘ keine Nachkommen haben sollten, wenn möglich aus eigener Einsicht. Der Schweizer Hauptrepräsentant dieses Ansatzes war der aus St. Gallen stammende Ernst Rüdin, der 1925 in Basel Professor für Psychiatrie wurde.1014 Rüdin, dessen Überzeugungen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg wurzelten, war seit 1907 bei Emil Kraepelin in München tätig gewesen, der ihn 1909 auch habilitiert hatte. Da die Basler Fakultät von der Kraepelinschule beeindruckt war, freuten sich alle Basler Instanzen darüber, Rüdin zu gewinnen. Dieser blieb jedoch während seiner Basler Zeit Leiter der genealogischen Abteilung von Kraepelins Deutscher Forschungsanstalt für Psychiatrie, engagierte sich weiterhin in Deutschland für Erbbiologie und unternahm wenig, um die erhofften Reformen in der Basler Anstalt Friedmatt zu realisieren. Sein Entscheid für Basel war offensichtlich dadurch motiviert, dass er in München 1925 keine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten für seine Arbeit sah.1015 Dies änderte sich im Verlauf der zweiten Hälfte der 1920er Jahre, als die Münchner Forschungsanstalt grosszügig ausgebaut werden konnte. In München gewann sie Mäzene, verband sich mit der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und erhielt ein neuerbautes Institut. Da fortan die Basler Verhältnisse den Vergleich zu München nicht mehr aushielten,1016 verliess Rüdin mit seinen deutschen Mitarbeitenden die Rheinstadt im Herbst 1928 und wurde 1930 Nachfolger des verstorbenen Kraepelin. Während sein Standpunkt zur Rassenhygiene bis etwa 1930 noch insofern gemässigt war, als er die Sterilisation ‚Erbkranker‘ nur im äussersten Fall (bei mangelnder Einsicht) zwangsweise betrieben haben wollte,1017 näherte er sich der NSDAP an, die die Zwangssterilisationen nach dem Motto ‚Gemeinnutz geht vor Eigennutz‘ befürwortete, in der Hoffnung, dass die Rassenhygiene nun eine energische staatliche Förderung erfahre.1018 Er beriet die Ausarbeitung des «Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses» und beteiligte sich an einem Kommentarwerk zu diesem Ge-
1013
1014 1015 1016 1017 1018
Die Degenerationslehre finden wir bei Ernst Rüdin (Haenel 1982, 163) wie auch bei dessen Nachfolger John Eugen Staehelin (Staehelin 1948, 7–12). Eugenik in der Schweiz: Wecker 2013, 11; Ritter 2009; Ritter 2003; Schweizer 2002. Die Schweizer Eugeniker bildeten ein Netzwerk, das den Doyen Auguste Forel und die jüngeren Eugen Bleuler, Hans Wolfgang Maier, Ernst Rüdin und John Eugen Staehelin umfasste. Der Bezug auf Deutschland war nach 1934 rückläufig. Zusammenfassend: Tanner 2015, 241. Ritter 2009, 177 ff. Weber 1993, 135–141. Ritter/Roelcke 2005; Weber 1996; Weber 1993, 148–155. Weber 1993, 141; Haenel 1982, 164–166. Weber 1993, 180, 192.
Ausbildung und wissenschaftliche Kommunikation
273
setz.1019 1937 trat er der NSDAP bei. 1940 schreckte er allerdings vor der Tötung von Anstaltsinsassen zurück. Sein Name blieb mit der nationalsozialistischen ‚Erbbiologie‘ verbunden, und obschon ihn die Alliierten nach Kriegsende nur als «Mitläufer» einstuften, wurde ihm das Schweizerbürgerrecht aberkannt.1020 Reaktionen auf seine Auftritte in den 1930er Jahren in der Schweiz zeigen, dass seine NS-geprägte Auffassung der Rassenhygiene hier mehrheitlich abgelehnt wurde – der trennende Punkt war meist die Frage der Zwangssterilisation.1021 Nur Jakob Klaesi, Psychiater in Bern, ging mit Rüdin einig, weshalb dieser den Vorschlag lebhaft unterstützte, Klaesi 1944 die Ehrendoktorwürde der Universität Frankfurt am Main zu verleihen, zumal dieser ein aufrichtiger Verehrer Deutschlands sei.1022 Rüdin erklärte sich die geringe Zahl von Anhängern in der Schweiz mit der Präsenz von Juden und Emigranten in den dortigen Fachgremien.1023 Faktisch gingen die Schweizer Ärzte zu den deutschen Entwicklungen auf Distanz, weil sie Wert legten auf die Autonomie der behandelnden Ärzte gegenüber politischen und administrativen Übergriffen, aus einer Vorliebe für die individualisierte Beurteilung ihrer Fälle und aus Rücksicht auf die Prinzipien des Rechtsstaates, ohne dass die Grundgedanken der Eugenik in der Schweiz aufgegeben worden wären.1024 Die Fakultät wollte nach Rüdins Rückkehr nach München in Gestalt von Johannes Lange wieder einen Kraepelin-Schüler nach Basel holen. Lange leitete die Klinische Abteilung sowie das Klinische Archiv der Deutschen Forschungsanstalt und untersuchte die Vererbung der Veranlagung für Delinquenz. Die Münchner Studien basierten an sich auf soliden statistischen Grundlagen und bezweckten, Korrelationen zwischen Erbanlagen und Erkrankungen oder Delinquenz zu verifizieren. Staatliche eugenische Zwangsmassnahmen liessen sich damit nicht begründen – aber ideologisch vertrat Rüdin trotzdem diesen Standpunkt.1025 Die Basler Fakultät, beraten von Rüdin (der auch das Fakultätsgutachten entwarf), setzte ebenso wie der Erziehungsrat auf Lange, während die Kuratel auch John Eugen Staehelin interessant fand, der bei Eugen Bleuler im Burghölzli wirkte und sich durch ein besonderes Eingehen auf die Patienten auszeichnete – dabei allerdings wenig publizierte. Wer für Lange eintrat, und dazu gehörte zunächst auch der Erziehungsdirektor Fritz Hauser, wollte das wissenschaftliche Niveau der Fakultät durch die Wahl eines ausgewiesenen und fruchtbaren For1019
1020 1021 1022 1023 1024 1025
Den Kommentar verfassten Rüdin, Arthur Gütt und Falk Ruttke im März 1934; er wurde der führende Leitfaden für die «Erbgesundheitsgerichte», die am 25. 7. 1933 eingerichtet worden waren. Rohrbach 2007, 127 ff. Schwalbach 2000. Ritter 2009, 227 ff. Ritter 2009, 232 f.; Weber 1993, 231 f., 209; Rintelen 1980, 233–235. Ritter 2009, 169; Weber 1993, 230 ff. Eugenik sollte in der Schweiz ein Teil der Psychiatriereform sein. Ritter 2009, 156. Weber 1993, 146 ff.
274
Mediziner
schers heben. Wer für Staehelin eintrat, wollte einen Klinikchef, der die Friedmatt reorganisierte, das Personal förderte, sich um die Heilung der Patienten kümmerte und ein guter Arzt zu sein versprach. Schliesslich setzte sich in der Regierung im Januar 1929 mehrheitlich die Überzeugung durch, auf die Kraepelin-Schule zu verzichten und den Bleuler-Schüler aus Zürich zu wählen, der als Sohn eines Basler Seidenfabrikanten lokale Wurzeln hatte. Weltanschauliche Fragen wurden nicht protokolliert, doch die Fakultät konzedierte, dass die BleulerSchule dem «schweizerischen Empfinden» näherstehe als die Münchner.1026 Tatsächlich war der humanistisch gebildete, in der Studentenverbindung Zofingia zum sozialreformerischen Flügel zählende, abstinente und auf den evangelischen Glauben vertrauende Staehelin eine Persönlichkeit, die sich aus Menschenliebe im Dienst an den leidenden Geschöpfen Gottes für das Wohl der Patienten aufopferte. Dabei traute er niemandem etwas Böses zu – deshalb stand er in der Zeit seines Dekanats 1935/36 auch zum nationalsozialistischen Anatomen Gerlach (siehe unten).1027 Und als der bekannte Germanophile Gerhard Boerlin 1947 als Präsident der Inspektion des Humanistischen Gymnasiums abgesetzt wurde, trat Staehelin nicht nur dessen Nachfolge an, er gehörte auch zu den wenigen, die an einem Essen zu Ehren Boerlins teilnahmen, wo er ihn in einer Rede würdigte, die die Familie Boerlin sehr schätzte.1028 Staehelin war allerdings ein überzeugter Eugeniker, der die «Erbbiologie» Rüdins für die Psychiatrie für «überaus wertvoll»1029 hielt und deshalb zunächst einen Schüler Rüdins förderte, Carl Brugger.1030 Staehelin beriet die Ausarbeitung des kantonalen Einbürgerungsgesetzes von 1938 und erreichte, dass an körperlichen oder seelischen Krankheiten leidende Menschen, die ihre Krankheit auf ihren Nachwuchs übertragen könnten, nicht zur Einbürgerung zugelassen wurden.1031 Durch Brugger waren Rüdins Ansätze wieder in Basel präsent. In der Schweiz war er der radikalste Vertreter der Position, dass «Belastete» durch Heiratsverbote und Sterilisation an der Fortpflanzung gehindert werden sollten.1032 Er hatte bis 1929 in der Basler Friedmatt gewirkt und dann bis 1933 bei Rüdin in München gearbeitet, zeitweilig mit Mitteln aus der Rockefeller-Stiftung finan-
1026
1027 1028 1029 1030 1031 1032
Haenel 1982, 189; Rintelen 1980, 235 f., 394–402. Zeugnisse zu seiner Persönlichkeit in: Zur Erinnerung an Prof. Dr. med. John E. Staehelin 3. Juni 1891–16. Mai 1969, Privatdruck anlässlich der Trauerfeier. Unterlagen zur Berufung in: StABS ED-REG 5d 2-1 (1) 336; ferner in: ED-REG 1a 2 1762. StABS UA Q 2 Protokoll der Medizinischen Fakultät 1935–1937, 14. 12. 1936. Gerhard Boerlin an seine Tochter Gertrud, 23. 10. 1947, in: Zimmerli 2009, 174 f. John Staehelin 1933, 40. Ritter 2009, 175–191; Haenel 1982, 200 f.; Rintelen 1980, 400 f.; Basler Nachrichten vom 31. 3. 1944 (Nachruf). Ritter 2009, 193. Ritter 2009, 173–175.
Ausbildung und wissenschaftliche Kommunikation
275
ziert.1033 Nach der Rückkehr nach Basel fand er 1934 einen Broterwerb als Schularzt, wobei ihm diese Position Reihenuntersuchungen an Basler Hilfs- und Sonderschülern erlaubte.1034 Die Fakultät habilitierte ihn am 1. Juli 1935 auf Antrag von John Eugen Staehelin und Gustav Wolff.1035 Im selben Jahr beendete Hans Hunziker-Kramer seine im Wintersemester 1934 begonnene und im Sommersemester 1935 fortgesetzte Vorlesung «Grundzüge der Rassenhygiene».1036 Hinweise auf die Problematik der deutschen Gesetzgebung finden sich in den Fakultätsdiskussionen über Brugger nicht. 1938 konnte dieser mit seinen Stammbaumkarten in der psychiatrischen Poliklinik unterkommen («Genealogische Abteilung»); er las über «Psychiatrische Erblichkeitslehre», «Psychiatrische Eugenik (Rassenhygiene)», «Psychiatrische Zwillingsforschung» und «Psychose und Konstitution». Es fällt auf, dass Staehelin nie mit ihm zusammen eine Lehrveranstaltung abhielt, wohl aber mit anderen Psychiatern wie Benno Dukor und Hans Binder.1037 Ein Ausbau der psychiatrischen Genealogie fand in Basel nicht statt, und die Fakultät distanzierte sich von Rüdin und der nationalsozialistischen Eugenik, indem sie die Freiwilligkeit von Eingriffen wie Sterilisation unterstrich. Dies war ein für die Zeit nach 1935 symptomatischer Entscheid: Den eugenischen Geist und die erbbiologischen Methoden wollte man auch in Basel erhalten, aber die Ausprägung, die das Fach im deutschen ‚Massnahmenstaat‘ erhalten hatte, lehnte man im Sinne einer liberalen, rechtsstaatlichen Ordnung ab. Bruggers Plan, eine «Zentrale für Erb- und Konstitutionsbiologie» mit privater Unterstützung (Schweizerische Vereinigung für Anormale/pro infirmis) einzurichten, scheiterte an der Fakultät, die ihn zwar habilitiert hatte und in der psychiatrischen Poliklinik duldete, sein Fach als «Notwendigkeit» bezeichnete, ihm jedoch die Fähigkeit absprach, ein wissenschaftliches Zentrum zu leiten. Kuratelspräsident Max Gerwig wollte zudem in Basel kein «Tochterinstitut» von Rüdins Unternehmen in München dulden. Die Fakultät kleidete die Ablehnung in die Formulierung, ein für die Leitung geeigneter junger Schweizer müsste erst noch ausgebildet werden.1038 Somit war sie wieder auf der Basler Position des ‚juste milieu‘ angekommen und hatte eine Grundsatzdebatte vermieden.
1033 1034 1035 1036
1037
1038
Weber 1993, 172. Ritter 2009, 185 f. Ritter 2009, 188 f. Hunziker war Abstinent und kämpfte für obligatorische Impfungen in der Armee. Hauptamtlich war der Sanitätsoberst Vorsteher des Basler Gesundheitsamtes; verstorben 1941. Er dozierte ab 1936 nur noch über Militärhygiene und Gasschutz. Rintelen 1980, 342. Vorlesungsverzeichnisse Sommer 1936 ff. Dukors Position in der Frage des Eheverbots für Geisteskranke: Ritter/Imboden 2013, 35–37; Ritter 2009, 309; Wecker 2013, 174 f., 183; Ritter 2009, 277 ff. Binder leitete seit 1930 die Basler psychiatrische Poliklinik. StABS UA Q 2 Protokoll der Medizinischen Fakultät, 1. 7. 1935, 6. 3. 1939; StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 13, 1935–1941, 28.8. und 18. 12. 1939.
276
Mediziner
6.3 Überzeugte Nationalsozialisten als Mitglieder der Basler Medizinischen Fakultät Von 1933 bis etwa 1935 war in der Basler Fakultät wenig von einer Kritik an der Medizin in Deutschland zu sehen. Wohl konnten die Basler feststellen, wie gewisse Namen von den Titelblättern der deutschen Fachzeitschriften und Handbücher verschwanden. Sie konnten auch sehen, wie im Nachbarland Kollegen aus ihren Ämtern entfernt wurden und an den Fachtagungen zunächst noch geduldet waren, dann dort nicht mehr erschienen. Die Reaktionen waren individuell: Einige halfen solchen Kollegen, indem sie sie als Assistenten ohne Gehalt oder Hospitanten in ihren Kliniken beschäftigten,1039 oder sie schrieben Empfehlungsbriefe an Freunde in Westeuropa und streckten ihnen Geld vor, um zu emigrieren. Der zaghafte Versuch, 1933 zur Beteiligung an einer Aktion für aus Deutschland vertriebene Gelehrte aufzurufen, überzeugte nur wenige, wie wir an John Eugen Staehelins Beispiel gesehen haben. Ein Protest einer universitären Basler Instanz gegen die Säuberungen in Deutschland ist nicht bekannt geworden. Es wurde auch nicht danach gefragt, ob die deutschen Kollegen an ethisch bedenklichen Projekten beteiligt waren. Ein Beispiel bot Gerhard Rose, der in Deutschland Fleckfieberforschung betrieb und damit für die DDT-Anwendungsentwicklung in der Basler Industrie ein interessanter Partner war. Er war Assistent bei Doerr in Basel gewesen und 1925 ans Robert-Koch-Institut gegangen, wo er dann als NSDAPMitglied eine Karriere als Tropenmediziner und beratender Hygieniker des staatlichen Sanitätswesens aufbaute. Im KZ Buchenwald nutzte er die Gelegenheit zu Versuchen an Menschen.1040
1039
1040
Dieser Praxis begegnete die Regierung mit Misstrauen. Vorübergehende Anstellungen deutscher Assistenten bräuchten die Zustimmung des Regierungsrats, beschloss dieser, und legte dem ED nahe, dafür zu sorgen, dass die Befugnis der Professoren, Assistenten anzustellen, nicht zu einer «Überfremdung» führe. Regierungsratsbeschluss 12. 5. 1933, in: StABS UA Q 2 Protokoll der Medizinischen Fakultät, 29. 5. 1933. Der Beschluss ist ambivalent. Er konnte sich gegen die Praxis deutscher Professoren wenden, in erster Linie deutsche Assistenten anzustellen, oder gegen die Beschäftigung jüdischer Studenten bei Basler Professoren, die ihnen (und sich selbst) damit helfen wollten. Im Fall Gerlach (siehe Kapitel 6.3) erscheint der Beschluss im Licht einer Abwehr der Bildung «deutscher Schulen» durch Basler Ordinarien. Rose wurde von der Firma Geigy zu Vorträgen im Zusammenhang mit der Fleckfieberbekämpfung durch DDT eingeladen. «Gerhard Rose kehrte nach seiner Assistenzzeit bei Doerr 1925 ans Robert Koch-Institut zurück und durchlief als ehemaliges Freikorpsmitglied und frühes Mitglied der NSDAP eine steile Karriere in der Tropenmedizin und als beratender Hygieniker im Sanitätswesen des Dritten Reichs.» (https://unigeschichte.uni bas.ch/fakultaeten-und-faecher/medizinische-fakultaet/zur-geschichte-der-medizinischenfakultaet/das-fach-hygiene-in-basel); Wolters 2009; und der Wikipediaeintrag zu Gerhard Rose: https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Rose.
Überzeugte Nationalsozialisten in der Fakultät
277
Kollegen, die sich in Basel öffentlich zum Nationalsozialismus bekannten, waren persönlich geschätzte und fachlich angesehene Fakultätsmitglieder, wie Werner Gerlach und Rüdiger von Volkmann.1041 Nachdem deren Wirken 1936 zu einem politischen (aber nicht akademischen) Skandal geführt hatte, verteidigten Basler Mediziner diese in einer fachlichen und fakultären Solidarität als Opfer politischer Übergriffe auf die Universität. Auch gegen den Nationalsozialismus resistente Mediziner betrachteten den Anatomen Gerlach verharmlosend als «wilhelminischen Korpsbruder».1042 Dieser 1973 zum ersten Mal ausführlich dokumentierte ‚Fall Gerlach‘1043 verdient eine kurze Vergegenwärtigung der Ereignisse. Werner Gerlach trat 1930 die Basler Professur für Pathologie an, nachdem er von seinem Vorgänger Robert Rössle, der 1929 einen Ruf nach Berlin angenommen hatte, empfohlen worden war. Rössle hatte Gerlach als Prosektor nach Basel mitgebracht, dieser war aber 1928 nach Halle gegangen. Regierungsrat Hauser hatte Bedenken gezeigt, den ihm als rechtsextremen Deutschnationalen bekannten Pathologen Gerlach auf Rössles Basler Professur zu berufen, hatte dann aber der Kuratel und dem Erziehungsrat nachgegeben, die sich auf verschiedene Fakultätsmitglieder beriefen, die ihn als «taktvoll und wohlerzogen» schilderten. Mit Gerlach schien in Basel eine neue Ära des Faches anzubrechen: Er interessierte sich unter dem Einfluss seines Bruders, der in München Physik lehrte, für physikalisch-chemische Methoden und konnte die erforderlichen Mittel aus der Staatskasse, von der Freiwilligen Akademischen Gesellschaft und der Rockefeller-Stiftung erhalten so erwarb er einen modernen Spektrographen. Das Vesalianum wurde für ihn ausgebaut. Zu seiner Unterstützung stellte er einen Assistenten an und eine Chemikerin, beides Deutsche; auch seine Frau arbeitete im Institut mit. Als Lehrer beeindruckte er die Studierenden, und den Fakultätsmitgliedern war er ein liebenswürdiger Kollege, der zwar seinen Patriotismus offen zur Schau trug, was aber nicht weiter auffiel, da man dies für ein Zeichen von Ehrlichkeit hielt – zumal er auch zu Schweizern und Juden freundlich war.1044 Mit der Machtübergabe an Hitler wurde aus diesem Patriotismus ein Bekenntnis zum Nationalsozialismus. Gerlach trat wie der Prosektor der Anatomie, Rüdiger von Volkmann, dem Opferring der Basler Ortsgruppe der NSDAP bei. 1933 behauptet er, er habe eine Berufungszusage, dass er seine «deutsche Schule» in Basel weiterführen dürfe, d. h. Deutsche als Assistenten weiterbilden könne. Dabei wurde er von Schweizer Medizinstudenten dafür kritisiert, dass er Deutsche bevorzuge. Für die Basler Behörden kam das nicht infrage – man brauchte damals kein Anhänger der ‚Fronten‘ zu sein, um einen Vorrang der jun1041 1042 1043 1044
Rintelen 1980, 319 f. Ludwig 2005, 58. Trinkler 1973. Rintelen 1980, 172–177; Trinkler 1973, 76–79.
278
Mediziner
gen Schweizer in der Nachwuchsförderung zu fordern.1045 Gerlach war «Vertrauensprofessor» der deutschen Studentengruppe, die in Basel wie in anderen Schweizer Universitätsstädten von Zürich aus koordiniert und auf den Nationalsozialismus ausgerichtet geschaffen wurde. Er verteidigte diese Gruppierung in der Regenz, als liberale Professoren sie wegen des «Führerprinzips» in ihren Statuten angriffen. Er verteidigte sie nochmals, als bekannt wurde, dass deutsche Studenten nur nach einer Schulung in einem Lager in die Schweiz durften, sich dabei verpflichteten, für das ‚Dritte Reich‘ einzustehen und, wie vermutet wurde, andere deutsche Studierende und deutsche Professoren, die es nicht mit dem Nationalsozialismus hielten, zu denunzieren.1046 1935 beschwerte er sich beim Rektor des Mädchengymnasiums, wo eine seiner Töchter zur Schule ging, gegen eine Geldsammlung für Emigrantenkinder. Er erklärte, er wolle lieber «hungernden Rassegenossen» helfen als eine «Emigrantenclique» unterstützen. Einen Arzt am Augenspital, Dr. Hans Müller, Vorstandsmitglied der Deutschen Kolonie, setzte er unter Druck, als die Kolonie, die sich der Gleichschaltung durch das nationalsozialistische Konsulat zunächst widersetzte,1047 eine entsprechende Verlautbarung publizierte. Er drohte dem Arzt mit negativen Konsequenzen im Fall einer Rückkehr nach Deutschland. Als sich seine frühere Chemiker-Assistentin Käthe Kempter um ein deutsches Stipendium bewarb, schrieb er nach München, ihr Verhalten entspreche nicht dem, was «man» von einer Deutschen im Ausland erwarten dürfe, worauf sie nach eigener Aussage keine Aussichten mehr auf finanzielle Zuwendungen oder eine Anstellung in Deutschland habe. Es ging das Gerücht, er zwinge seinen Assistenten Willy Finkeldey, eine Funktion in einer nationalsozialistischen Organisation zu übernehmen, um seinen Patriotismus zu beweisen. Im Oktober 1935 fand in Überlingen ein Lager für deutsche Studierende statt, die in der Schweiz ein Semester absolvieren wollten. Gerlach trat als Instruktionsredner auf und erklärte den Lagerteilnehmern, was sie in der Schweiz tun und lassen sollten. Er referierte auch über Rassehygiene und erklärte, die Sterilisation sei ebenso wissenschaftlich-erbbiologisch begründet wie die deutschen Gesetze gegen die Juden. Gleichzeitig verkehrte Gerlach weiterhin überaus freundschaftlich mit seinen Schweizer Kollegen und Studenten und band vor allem seinen Prosektor, Andreas Werthemann, den liberalen Spross einer Basler Kaufmanns- und Unternehmerfamilie, an sich.1048
1045 1046 1047 1048
StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 12, 1930–1935, 26.6., 4.9., 13. 11. 1933. StABS UA B 1 XIV Acta et decreta (Protokoll der Regenz) 1934–1959, 15. 5. 1935. Heini 2020, 68. Trinkler 1973, 82–84. Zur Erinnerung an Andreas Werthemann-Dietschy, 12. Juli 1897– 13. August 1974, Basel o. J. (Privatdruck). Edgar Bonjour berichtet in seinen Erinnerungen (Bonjour 1984, 110), Werthemann sei ihm nahegestanden. Es entsteht das Bild eines gebildeten, musikalischen Humanisten und Liberalen. Positiv urteilt auch Rintelen 1980, 339.
Überzeugte Nationalsozialisten in der Fakultät
279
Auffällig wurde auch das Verhalten von Rüdiger von Volkmann, einem überzeugten Nationalsozialisten, der als fachlich kompetenter Prosektor für den Ordinarius der Anatomie, Eugen Ludwig, arbeitete. Dieser hält in seinen Memoiren fest, dass ihm Volkmann verdächtig vorkam: Er las nur deutsche Zeitungen, war der Sohn eines preussischen Offiziers und mit einer Enkelin von Ernst Häckel verheiratet, die «rabiat und altdeutsch» war. Trotz Ludwigs offensichtlich deutschfeindlicher Einstellung attestierte er ihm ein korrektes Verhalten gegenüber allen Studierenden, auch gegenüber den Juden. Er sei dem Institut dadurch nützlich gewesen, dass er die von seinem Onkel Heidenhain eingeführten Methoden praktizierte.1049 Deshalb beantragte Ludwig für ihn am Ende des Wintersemesters 1934/35 die Wiederwahl für eine weitere sechsjährige Amtsdauer als Prosektor, die der Erziehungsrat (unter der Bedingung, er möge sich jeder politischen Betätigung enthalten) und der Regierungsrat am 14. resp. am 25. Juni 1935 auch bewilligten. Im Herbst desselben Jahres setzte sich Ludwig dafür ein, dass von Volkmann mehr Lohn erhalte oder ihm ein Urlaub gewährt werde, weil er keine Devisen in die Schweiz bringen durfte und so über zu wenige Mittel verfügte.1050 Die Kuratel hatte dafür aber kein Verständnis und empfahl dem Erziehungsdepartement, dieses Gesuch abzulehnen. Basler Dozenten unterstanden wie andere Staatsangestellte aus fiskalischen Gründen einem Wohnsitzzwang im Kanton. Von Volkmann aber lebte in Lörrach, wo seine Kinder zur Schule gingen, und führte bloss zum Schein ein Domizil in einem Haus in Riehen. Der schon von Ludwig konstatierte Grund war angeblich rein ökonomisch: Wegen der deutschen Devisenbewirtschaftung konnte er die Erträge aus seinem in Deutschland liegenden Vermögen nicht in die Schweiz transferieren, die er brauchte, um sein bescheidenes Basler Einkommen aufzubessern.1051 Auf eine Untersuchung wurde verzichtet, da bekannt wurde, dass Volkmann einen Ruf an eine deutsche Hochschule erhalten werde. Er demissionierte kurzfristig per 30. September 1936.1052 Ludwig gibt an, dass von Volkmann seine Stelle in Jena, die diese rasche Kündigung ermöglichte, ihm zu verdanken habe: Er habe sich beim Reichsärzteführer (damals Gerhard Wagner) dafür eingesetzt, dass er eine Anstellung in Deutschland erhielt, nachdem Kuratelspräsident Ernst Thalmann energisch seinen Weggang gefordert hatte. Im weiteren Verlauf der Karriere gab sich von Volkmann als überzeugter Nationalsozialist, der zu jedem Opfer für die deutsche Sache bereit war. So verlor er einen Sohn bei einem Unfall in einer HJÜbung, ein anderer fiel im Krieg. Von Volkmann sah darin sinnvolle Opfer. Als Prorektor in Jena (ab 1942) verbreitete er Durchhalteparolen und bezeichnete nach dem Krieg die Deutschen als die wahren Winkelriede. 1945 wurde er entlas1049 1050 1051 1052
StABS Protokoll Erziehungsrat Bd. 23, 1934–1936, 14. 6. 1935. StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 13, 1935–1941, 9. 9. 1935. StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 13, 1935–1941, 16. 3. 1936. StABS UA Q2 Protokoll der Medizinischen Fakultät 1935–1937, 2. 11. 1936.
280
Mediziner
sen und eröffnete eine Praxis als Orthopäde, wobei er Beziehungen zur Universität Tübingen unterhielt.1053 Kritisch wurde unterdessen die Lage der Deutschen Studentenschaft an der Universität Basel. Ihr «Führer», ein in Lörrach domizilierter Chemiestudent, wurde von französischen Behörden im Elsass der Spionage für Deutschland verdächtigt. Dies machte das Gerücht plausibler, dass deutsche Nationalsozialisten in der Schweiz wie Gerlach oder von Volkmann eine ‚Fünfte Kolonne‘ bildeten, die nicht nur Landsleute drangsalierten, die sich Hitler nicht fügten, sondern auch Schweizer Verhältnisse ausspionierten und für einen ‚Tag X‘ bereitstanden. Sozialdemokratische und kommunistische Blätter schlugen Alarm, nachdem sie von Gerlachs Auftritt in Überlingen Kenntnis erhalten hatten. Hauser nahm die Presseartikel anfangs November 1935 zum Anlass, sich mit Gerlach zu besprechen; er schloss aus der Unterredung, Gerlach betreibe politische Propaganda und setze seine frühere Assistentin Kempter unter Druck, was auch dem Physiologischen Chemiker Edlbacher und dem Pharmakologen Rothlin an der Universität bekannt sei. Die Kuratelsmitglieder Vischer und Gerwig hielten aber zunächst zu Gerlach.1054 Der kommunistische Grossrat und Erziehungsrat Werner Meili lancierte am 12. Dezember 1935 eine Interpellation gegen Gerlach, wofür er Informationen verwendete, die ihm linke deutsche Studenten zugetragen hatten.1055 Die Basler Gegner des Nationalsozialismus, insbesondere der frühere Ständerat Ernst Thalmann und der Chef des Erziehungsdepartements Fritz Hauser, hielten Gerlach für nicht länger tragbar. Sie liessen sich dafür von den Vorgängen in Bern anregen, wo am 17. August 1935 der Regierungsrat Walter Porzig (Professor für Vergleichende Sprachwissenschaft und Klassische Philologie, Ortsgruppenleiter der NSDAP) seines Amtes enthoben wurde.1056 Bern liess danach die Zugehörigkeit seiner Staatsangestellten zu ausländischen politischen Organisationen untersuchen, was in Basel nachgeahmt wurde.1057 Hausers Unterredung mit Gerlach blieb jedoch vorerst ohne Konsequenzen.1058 Die Kuratel hatte sich am 18. November 1935, schon vor Meilis Interpellation, mehrheitlich zum Entschluss durchgerungen, gegen Gerlach eine Disziplinaruntersuchung wegen unerlaubter politischer Tätigkeit zu fordern. Sie gelangte damit am 23. Dezember 1935 offiziell an das Erziehungsdepartement. Der Regierungsrat beauftragte am 3. Januar 1936 die Disziplinarkommission mit der Untersuchung, die schleppend anlief – die Kommission ‚vergass‘, die Eröffnung 1053 1054 1055 1056 1057 1058
Ludwig 2005, 58 f. StABS Protokoll Kuratel T 2 Bd. 13, 1935–1941, 11. 11. 1935. Wichers 1994, 104. Schmitt 2001. Stirnimann 1988, 176 ff. Bericht Hauser an die Mitglieder der Kuratel in der Sitzung vom 9. 9. 1935, in: StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 13, 1935–1941.
Überzeugte Nationalsozialisten in der Fakultät
281
des Verfahrens Gerlach zu kommunizieren.1059 Ihre Verhandlungsführung unter dem Vorsitz von Rudolf Leupold kam dem Angeklagten weit entgegen: Zeugen wurden in Anwesenheit von Gerlach am 29. Februar und 3. März 1936 vernommen, und Gerlach selbst konnte sie dabei befragen. Am 27. April stellte die Disziplinarkommission fest, es gebe keine Grundlage für eine Bestrafung. Am 28. Mai entschied sich die Kuratel mit Stichentscheid des Präsidenten dafür, trotzdem der Regierung die Entlassung zu empfehlen. Gerwig war zunächst noch der Ansicht, es genüge, Gerlach die Demission energisch nahezulegen – eine Meinung, die auch Hauser damals teilte. Thalmann verlangte, Gerlach müsse entfernt werden analog zu Beispielen aus Zürich und Bern; er fügte zur Liste von Gerlachs Vergehen hinzu, dass dieser in einer Zeitschrift im Institut zum Namen eines Autors hinzugeschrieben habe: «Jude». Vischer zeigte sich unbeeindruckt und akzeptierte den Befund der Disziplinarkommission.1060 Am 6. Juli 1936 befand der Erziehungsrat jedoch mehrheitlich, eine Entlassung sei möglich. Für die Minderheit sprach der liberale Regierungsrat Im Hof: Den aus Deutschland berufenen Professoren seien nie besondere Auflagen gemacht worden, die ihre politische Tätigkeit betreffen. Damit unterstehen sie den gleichen Regeln wie die Schweizer, das heisst, ihre ausserdienstlichen Aktivitäten gehen den Staat nichts an. Die Vorwürfe gegen Gerlach seien angesichts dieses Umstandes zu wenig schwerwiegend, um eine Entlassung zu rechtfertigen, obschon er dessen Verhalten «unangenehm» und «unerfreulich» nannte. Dabei unterstrich Im Hof, dass er keine Sympathien für das nationalsozialistische «System» hege. Ähnlich votierte der Kirchenhistoriker Ernst Staehelin: Die Basler Behörden müssten auf dem Boden des Rechtsstaates bleiben. Hauser stellte dem entgegen, «es sei nicht mit unseren Auffassungen vereinbar, dass ein aktiver Nationalsozialist im Staatsdienste angestellt sei».1061 Die fristlose Entlassung wurde von der Regierung am 18. August 1936 entschädigungslos verfügt, gegen die Stimmen der bürgerlichen Ratsmitglieder, die es mit Regierungsrat Im Hof vorgezogen hätten, wenn Gerlach von sich aus den Rücktritt erklärt hätte. Gerlach legte sofort Rekurs ein. Das Eidgenössische Politische Departement schrieb der Basler Regierung am 31. August, die deutschen Stellen würden verlangen, dass die Entlassung zurückgenommen werde. Tatsächlich kam es zu einer deutschen Pressekampagne, und der Universität Freiburg i. Br. wurde parteiamtlich untersagt, eine offizielle Delegation an die Basler Erasmusfeier zu entsenden. Dabei spielte auch eine Rolle, dass die Basler Regierung ihrer Universität die Teilnahme an der Heidelberger Jubiläumsfeier untersagte.1062 1059 1060 1061 1062
StABS Protokoll Erziehungsrat Bd. 23, 1934–1936, 27. 2. 1936. StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 13, 1935–1941, 28. 5. 1936. StABS Protokoll Erziehungsrat Bd. 24, 1936–1938, 6. 7. 1936. Zur Erasmusfeier siehe unten, Kapitel 7.5.9. Zur Heidelberger Feier siehe oben, Kapitel 3.2 ff.
282
Mediziner
Zum ‚Fall Gerlach‘ hat die Fakultät vor der Entlassung nichts protokolliert. Anscheinend hielt sie diesen für eine politische Angelegenheit, die eine universitäre Instanz nichts angehe. Aber nach der Entlassung musste sie die Lage am Institut regeln. Zwar gab die Fakultät nicht nach, als Gerlach und von Volkmann verlangten, dass Gerlach das Institut interimistisch weiterführen könne, während sein Rekurs laufe. Sie schrieb aber den oberen Behörden, das Institut (nicht Gerlach) leide durch den Entlassungsentscheid schweren Schaden, den die Kuratel abwenden möge.1063 Andreas Werthemann übernahm die Stellvertretung für Gerlach im Institut. Noch bevor bekannt wurde, dass Gerlachs Rekurs Erfolg hatte, wählte die Fakultät den Dekan für 1937/38. Sie überging dabei Gerlach, der an der Reihe gewesen wäre, und übergab das Amt Fritz Verzár.1064 Rekursinstanz war das Appellationsgericht, präsidiert von August Simonius. Als Rechtsvertreter der Regierung wurde Ernst Thalmann bestimmt; Gerlach wurde verteidigt vom bekannten Germanophilen, Gerichtspräsident Boerlin. Er stellte den Entscheid der Regierung als Gesinnungsurteil dar und warf der Kuratel vor, sie wolle nicht wahrhaben, dass die deutsche Schweiz zum deutschen Kulturgebiet gehöre. Neue Tatsachen kamen im Rekursverfahren nicht auf den Tisch. Der liberale Rechtsgedanke setzte sich hier durch. Dem Rekurs wurde am 23. November 1936 entsprochen, womit der Entscheid des Regierungsrats aufgehoben war – allerdings ohne Entschädigung für Gerlach. Das Urteil galt in der Öffentlichkeit als unverständlich.1065 Gerlach erschien danach wieder im Institut und wurde von Werthemann in einer Weise begrüsst, die der Chef des Erziehungsdepartements als persönliche Beleidigung empfand. Werthemann, der mit Gerlach durch ein enges kollegiales Verhältnis verbunden war, scheint es damals für richtig gehalten zu haben, sich in akademischer Solidarität voll hinter den Nationalsozialisten zu stellen. In der Fakultät begrüsste ihn der Dekan John Eugen Staehelin sehr freundlich, er konnte aber gleichzeitig bekanntgeben, dass Gerlach bereits einen Ruf nach Jena erhalten habe, wozu er ihn beglückwünschte. Die Fakultät wählte ihn darauf in die Kommission, die den Vorschlag für die Wiederbesetzung seiner Professur ausarbeiten sollte.1066 Sein Nachfolger wurde dann 1937 Werthemann.1067 1063 1064 1065 1066 1067
StABS UA Q 2 Protokoll der Medizinischen Fakultät 1935–1937, 27. 8. 1936. StABS UA Q 2 Protokoll der Medizinischen Fakultät 1935–1937, 2. 11. 1936. Casanova 2015; Tréfás 2009, 103–128; Rintelen 1980, 313–316. StABS UA Q 2 Protokoll der Medizinischen Fakultät 1935–1937, 14. 12. 1936. StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 13, 1935–1941, 23.3. und 26. 4. 1937; StABS Protokoll Erziehungsrat Bd. 24, 1936–1938, 31. 5. 1937. Die Wahl wurde vom Regierungsrat am 25. 6. 1937 beschlossen, er folgte damit dem Vorschlag der Fakultät, der Kuratel und der Mehrheit des Erziehungsrats. Vorübergehend in Erwägung gezogen hatte die Kuratel Schürmann Berlin (der eine militärische Funktion erhielt, weswegen Ständerat Schöpfer den Baslern sehr von ihm abriet) sowie den Franzosen Oberling. Ausser von Carl Miville wurde Werthemann in Basel von breiten Kreisen empfohlen.
Überzeugte Nationalsozialisten in der Fakultät
283
Das deutsche Konsulat veranstaltete aus Anlass von Gerlachs Rekurserfolg am 11. Dezember 1936 im Badischen Bahnhof eine Feier mit 300 Teilnehmern, an der er ein Referat über die nationalsozialistische Erb- und Rassepolitik hielt.1068 Am 1. April 1937 verliess Gerlach Basel und übernahm in Jena das pathologische Ordinariat – gegen den Wunsch der dortigen Fakultät, aber auf Weisung des Reichserziehungsministeriums. Er übernahm die Stelle des als ‚jüdisch versippt‘ entlassenen Walther Berblinger,1069 der sich in die Schweiz begab, um von 1938 bis 1954 das Forschungsinstitut für Tuberkulose in Davos zu leiten.1070 Gerlach pflegte noch 1938 den Kontakt zu Basler Kollegen bei Besuchen in Lörrach.1071 Im gleichen Jahr wie Gerlach erhielt von Volkmann in Jena das Extraordinariat für Anatomie auf Betreiben des Gauleiters Fritz Sauckel, ebenfalls gegen den Willen der Fakultät. 1938 wurde er auf das anatomische Ordinariat befördert. Die Mediziner in Jena pflegten Kontakte zum KZ Buchenwald, das im Juli 1937 eröffnet wurde, und das Pathologische Institut von Gerlach nahm dort im Auftrag der SS Sektionen vor und entwarf dafür 1938 auch Richtlinien. Von Volkmann wurde im Sommer 1942 Prorektor der Universität Jena und behielt dieses Amt bis zum Ende des Wintersemesters 1944/45.1072 Gerlach jedoch tauschte bald seine akademische Position gegen eine diplomatische Laufbahn: Er war Konsul in Island, bis britische Truppen die Insel im April 1940 besetzten.1073 Als Gerlach im September 1943 die Trauung seiner Tochter Ingeborg mit Wolfgang H. A. Kittel bekanntgab, bezeichnete er sich als Generalkonsul, Leiter der Kulturpolitischen Abteilung an der deutschen Botschaft in Paris und SS-Brigadeführer im persönlichen Stab des Reichsführers SS.1074 Wie Hedwig Trinkler 1973 ermittelt hat, verhielten sich Gerlach und von Volkmann nach einem Schema, das für Repräsentanten der NSDAP im Ausland galt, indem sie ihre wahren Absichten «verschleierten» und sichtbare Aktivitäten vermieden, die sie mit schweizerischen oder Basler Gesetzen hätten in Konflikt bringen können. Sie zeigten sich vielmehr als anständige, die Normen bürgerlichen und akademischen Anstands weitgehend respektierende, gute Kollegen, Fachleute und Lehrer. Damit versuchten sie, Sympathie nicht nur für ihre Person zu wecken, sondern auch für das Regime, zu dem sie sich bekannten. Sie verkörperten damit die Botschaft, die Hitler selbst zur Zeit der Olympiade in Berlin und wieder in der Phase der Münchner Verhandlungen aussandte, dass Deutschland friedliche Absichten hege, mit den Nachbarn freundschaftlich verkehren wolle 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074
Die Freiheit vom 14. 12. 1936, in: StABS PD-Reg 3a 2484. Trinkler 1973, 85–89. Sziranyi u. a. 2019. Bericht von Meili, in: StABS Protokoll Erziehungsrat Bd. 24, 1936–1938, 30. 5. 1938. Zimmermann/Zimmermann 2005, 141, 151, 242. Trinkler 1973, 89 f. Karte in: StABS PD-Reg 3a 2484.
284
Mediziner
unter der Bedingung, mit seinen Ambitionen als gleichberechtigte Nation akzeptiert zu werden. Hinter dieser Fassade wurden Deutsche in der Schweiz beobachtet, abweichendes Verhalten nach Deutschland gemeldet und vielleicht – so vermuteten jedenfalls die Schweizer Gegner des Nationalsozialismus – auch Nachrichtendienst zum Nachteil der Schweiz betrieben.1075 Die involvierten Basler Stellen reagierten darauf sehr verschieden. Universitäre Instanzen orientierten sich an einem Verhaltensmuster, das von korporativer Solidarität und von rechtsstaatlichen Grundsätzen wie nulla poena sine lege diktiert war. Einen Einfluss hatte auch der Wunsch, Eingriffe der ‚Politik‘ in die Universität abzuwehren. Schliesslich meinten 1936 viele Professoren noch, dass die periphere Basler Universität trotz Nationalsozialismus bestrebt sein müsse, den Anschluss an das deutschsprachige Hochschulsystem und das mit ihm verbundene wissenschaftliche Kommunikationswesen zu behalten – eine Illusion, die der Verharmlosung der Hitler-Diktatur Vorschub leistete, indem Basler Akademiker mit inzwischen nationalsozialistisch geführten Hochschulen ‚rein wissenschaftliche‘ und ‚rein universitäre‘ Kontakte im Zeichen der Trennung von Wissenschaft und Politik weiterpflegten. Die Fortführung gewohnter Verhältnisse (business as usual) ersparte eine Umorientierung. Die verbrecherische und mörderische Seite des Nationalsozialismus blieb deshalb lange unberücksichtigt, und die Meinung, Schilderungen von Judenverfolgungen und von Zuständen in den KZs (wie in den Moorsoldaten) seien unglaubwürdig und übertrieben, hielt lange an.1076 Wer als Universitätsangehöriger so dachte und handelte, geriet jedoch zunehmend in Gegensatz zur öffentlichen Meinung und zum entscheidenden Kreis von Politikern, Journalisten, Administratoren und Honoratioren, die die Basler Bildungspolitik bestimmten. Durchaus vereinbar mit dieser akademischen Haltung war jedoch ein Kopfschütteln über den Nationalsozialismus als Ideologie, das bis zur Verachtung für die politischen Doktrinen gehen konnte, aber keinen aktiven Antifaschismus erzeugte, der die deutsche Wissenschaft nach 1933 und die Basler Partizipation darin als Teil des damaligen deutschen politischen Systems begriffen hätte.
6.4 Deutsche Professoren als Opfer des Nationalsozialismus und die Basler Medizinische Fakultät Die personalpolitische Hauptsorge der Fakultät, die auch zu einer diplomatischen Intervention des Eidgenössischen Politischen Departements führte, galt zunächst der Reziprozität in den Lehrstuhlbesetzungen zwischen deutschen Hochschulen und Schweizer Universitäten, weil offensichtlich Schweizer Kandidaten in 1075 1076
Trinkler 1973, 81, 87. Ludwig 2005, 59.
Deutsche Professoren als Opfer des Nationalsozialismus
285
Deutschland nach 1933 kaum mehr berücksichtigt wurden – während einige Schweizer Universitäten noch lange nach deutschen Fachkräften riefen. Nur ein einziger in Deutschland entlassener Mediziner erlangte nach 1933 einen Basler Lehrstuhl, und dies in einem regulären Berufungsverfahren: Ernst Freudenberg. In den offiziellen Unterlagen zu seiner Berufung finden sich keine Hinweise darauf, dass man ihn nach Basel holen wollte, um ihn aus der misslichen Lage zu befreien, die mit seiner Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand am 27. Juni 1937 eingetreten war. Argumentiert wird nur mit seiner überragenden, allgemein anerkannten Leistung als Pionier der Pädiatrie in Marburg. Der einzige ernsthaft erwogene Gegenkandidat war der Basler Adolf Hottinger, wissenschaftlich weniger profiliert, aber Schweizer und von deutschfeindlichen Anhängern unterstützt. (Hottinger wurde dann 1954 Freudenbergs Nachfolger.) Die Pädiatrie war in Basel bis 1937 nur durch ein Extraordinariat vertreten gewesen. Das Kinderspital leiteten Emil Wieland-Burckhardt und Ernst Hagenbach-Merian; es war eine lokal-baslerische Angelegenheit, für eine aufstrebende Disziplin und die wachsende Fallzahl unzureichend ausgestattet. Wieland und Hagenbach trieben den Plan eines Neubaus am Rhein voran, der erst 1939, zwei Jahre nach Wielands Emeritierung, fertig wurde. Die Fakultät schlug für Wielands Nachfolge an erster Stelle Eduard Glanzmann, Extraordinarius aus Bern, vor, der aber bei den Sachverständigen der Kuratel durchfiel,1077 und zusammen mit ihm auf dem ersten Platz Freudenberg. Auf den zweiten Listenplatz setzte sie Adolf Hottinger und auf den dritten Theo Baumann, beides Basler. Bald polarisierte sich die Debatte zwischen Vertretern einer schweizerisch-baslerischen Option und solchen, die sich an der wissenschaftlichen Überlegenheit des deutschen Bewerbers orientierten. Basler Ärzte und der Klinikerverband forderten die Wahl Hottingers, da der Leiter des Kinderspitals mit den Kindern Schweizerdeutsch sprechen müsse, aber auch deswegen, weil Schweizer Kandidaten in Deutschland nicht mehr berücksichtigt würden – werde kein Gegenrecht gehalten, kämen nur noch Schweizer infrage. Auch der Chef des Sanitätsdepartements Edwin Zweifel (Radikaldemokrat) wünschte sich eine Schweizer Lösung, trat aber nicht vorbehaltlos für Hottinger ein, dessen manchmal schroffes und sarkastisches Wesen ihm missfiel. Die Fakultät, Emil Wieland selbst, die Kuratel, die Mehrheit des Erziehungsrats und der Chef des Erziehungsdepartements Fritz Hauser (der ausdrücklich mit dieser Wahl das «Niveau» der Medizinischen Fakultät heben wollte) strebten die Wahl des wissenschaftlich besten Kandidaten an, und dieser war für sie Freudenberg. Sie setzen sich damit bei der Regierung durch, die am 8. April 1937 Freudenberg wählte.1078
1077 1078
StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 13, 1935–1941, 19. 1. 1938. Rintelen 1980, 406–414. StABS Protokoll S 4 Erziehungsrat Bd. 24, 1936–1938, 14. 2. 1938.
286
Mediziner
Freudenberg entstammte einer Unternehmerfamilie.1079 Mehrere Angehörige dieser Familie hatten jüdische Ehefrauen, so auch Ernst Freudenberg, dessen protestantische Gattin nach nationalsozialistischer Doktrin «nichtarisch» war. Den Nationalsozialismus bezeichnete der Demokrat Freudenberg als barbarisch.1080 Am 1. Mai 1933 verhinderte er die Hissung der Hakenkreuzfahne auf seinem Institutsgebäude in Marburg. Im selben Jahr versuchte man ihm unerlaubte Auslandsbeziehungen nachzuweisen. Später sprach er sich gegen die NS-Euthanasie aus. Aktiven Widerstand hat Freudenberg nicht geleistet, wohl aber klare Zeichen der Resistenz gesetzt.1081 Seit Juni 1937 befand er sich im erzwungenen Ruhestand und lebte von seinem Vermögen, bis er nach Basel gewählt wurde. An diesem Vermögen wollten allerdings deutsche Stellen Anteil erhalten, indem sie die Reichsfluchtsteuer auf Freudenberg anwandten und ihn bis zur Bezahlung an der Ausreise nach Basel hinderten. Freudenbergs Basler Tätigkeit war auch mit der Geschichte des Karger-Verlags verbunden: Freudenberg übernahm die Redaktion der wichtigsten Fachzeitschrift, des «Jahrbuchs für Kinderheilkunde», das Karger nach Basel mitbrachte und fortan als «Annales Paediatrici» veröffentlichte.1082 Einen glücklichen Ausgang hatte nach schwierigen Anfängen auch die Emigration von Gerhard Wolf-Heidegger nach Basel. Der in Trier geborene Sohn eines luxemburgischen Arztes war in Bonn einer der beiden Assistenten bei Johannes Sobotta gewesen. Während Sobotta nachweisen konnte, dass er «Arier» sei, waren seine beiden Assistenten Juden. Wolf-Heidegger war hochqualifiziert durch je einen Doktortitel in Naturwissenschaften (Berlin 1932) und in Medizin (1934). 1935 musste er Bonn verlassen und begab sich nach Basel. Ludwig macht ihn zu seinem (unbezahlten) Assistenten und verteidigte ihn gegen die Fremdenpolizei, die ihm Aufenthalt und Erwerbsarbeit verwehren wollte. Zunächst erhielt er Unterstützung durch die Ciba-Stiftung – ein Antrag Ludwigs bei der Rockefeller-Stiftung zur Finanzierung von Wolf-Heideggers Arbeit wurde abgelehnt. Als von Volkmann Basel verliess, konnte ihn Ludwig als Prosektor einstellen. In dieser Funktion sowie als Dozent wurde er sehr geschätzt – Ludwig sah in ihm ein Beispiel für den grossen Verlust, den Deutschland durch die nationalsozialistische Rassenpolitik erlitt. Die Beförderung zum Extraordinarius erfolgte 1942, und 1955 wurde Wolf-Heidegger Ludwigs Nachfolger.1083 1079
1080 1081 1082 1083
Scholtysek 2016. Eine Tochter Freudenbergs, Renate, war seit 1933 mit Hans Jakob von Baeyer, einem Sohn des Heidelberger Orthopäden Hans von Baeyer, verheiratet. Er arbeitete bis 1935 im Kaiser Wilhelm-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg, wechselte dann in die Privatwirtschaft zu Telefunken und kam 1945 in die Schweiz. Nach einer kurzen Tätigkeit für die BBC wanderte er 1951 nach Kanada aus. Rürup/Schüring 2008, 150 f. Buchs 1977, 68. Bernhard 2001. Buchs 1977, 69. Forsbach 2006, 78, 334, 361, 696; Ludwig 2005, 59; Rintelen 1980, 320 f.
Deutsche Professoren als Opfer des Nationalsozialismus
287
Im Kontrast dazu steht die Ablehnung, die der Vorschlag erfuhr, den Orthopäden Hans von Baeyer nach Basel zu holen.1084 Er war ein bekannter Fachmann für sein Gebiet, seit 1919 Ordinarius in Heidelberg und verbunden mit der Stiftung Orthopädische Klinik Schlierbach bei Heidelberg. Im kulturellen Leben Heidelbergs spielte er eine zentrale Rolle.1085 Am 1. März 1933 war er als «Nichtarier» entlassen worden, da die Grosseltern beiderseits jüdischer Herkunft waren. Seit Ende 1933 war dem Schweizerischen Hilfswerk für deutsche Gelehrte bekannt, dass er eine Aufgabe in der Schweiz suchte.1086 Kreise der Kuratel und der Regierung wollten mit ihm in Basel das Fach im grösseren Massstab verankern und setzten gegen den Willen der Fakultät am 1. April 1935 seine Wahl zum persönlichen Ordinarius mit Lehrauftrag für Orthopädiemechanik durch. Die Fakultät war der Ansicht, Orthopädie würde bereits gelehrt und deren weitergehende Verankerung habe keine Priorität. In der Kommission, die so argumentierte, sass auch Gerlach. Der Zentralvorstand der Verbindung Schweizer Ärzte lehnte von Baeyer als Ausländer ab.1087 Die Opposition der Fakultät bezeichnete das Kuratelsmitglied Adolf Lukas Vischer als «Animositäten» gegen die Person, August Rüegg vermutete dahinter «Antisemitismus», während Fritz Hauser «bestürzt» über die Argumentation der Fakultät war. Der Erziehungsrat teilte mehrheitlich Hausers Überzeugung, dass man von Baeyer «mit allen Mitteln» für Basel zu gewinnen suchen solle.1088 Ohne eine Basis in einer Klinik war Orthopädie nicht praktizierbar, aber kein Spital, das private St. Claraspital eingeschlossen, wollte von Baeyer einen Platz einräumen. In der Fakultät wurde herumgeboten, von Baeyer sei überheblich, undankbar und stelle unerfüllbare Forderungen. Die Unterredungen, die nach der Ernennung zum Professor mit von Baeyer geführt wurden, verärgerten schliesslich Fritz Hauser, und die Kuratel lehnte es mit drei zu zwei Stimmen ab, weiter mit ihm zu verhandeln.1089 Er verzichtete im Mai 1935 auf die Basler Professur und zog sich in seine private Praxis in Düsseldorf zurück, worauf der Regierungsrat den Lehrauftrag am 25. Juni 1935 wieder aufhob und auf von Baeyers Angebot, wenigstens einzelne Kurse in Basel abzuhalten, nicht eintrat.1090 1084
1085 1086
1087 1088 1089 1090
Bonjour 1960, 603, bedauert ausdrücklich, dass von Baeyer nicht für Basel gewonnen werden konnte; für ihn bedeutete dies einen Verzicht auf einen fälligen Ausbau der Orthopädie. Gutzwiller 1978, 100–102. Liste der hilfesuchenden Akademiker des ED vom 20. 12. 1933; Fritz Hauser an Kuratel, 20. 12. 1933, in: StABS Erziehung X 48; StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 12, 1930–1935, 29. 12. 1933. StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 12, 1930–1935, 27. 2. 1934. StABS Protokoll S 4 Erziehungsrat Bd. 23, 1934–1936, 28. 5. 1934, 2. 3. 1935. StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 12, 1930–1935, 6. 5. 1935. Rintelen 1980, 378; StABS UA Q 2 Protokoll der Medizinischen Fakultät, 29.1., 12.2., 5. 11. 1934; StABS Protokoll S 4 Erziehungsrat Bd. 23, 1934–1936, 14. 6. 1936.
288
Mediziner
Zögerlich verhielten sich die Basler Behörden und die Fakultät gegenüber Heinrich Mengs Wunsch, an der Universität zu lehren. Der Verehrer Sigmund Freuds hatte in Frankfurt zusammen mit Karl Landauer und in Verbindung mit dem Institut für Sozialforschung 1929 ein Institut für Psychoanalyse aufgebaut, das 1933 geschlossen wurde.1091 Meng begab sich Mitte 1933 nach Basel. Die Übersiedlung wurde durch Bekannte erleichtert, die zur Friedensbewegung, zu den Abstinenten, Reformpädagogen und Psychoanalytikern gehörten. Er besprach sich mit dem Vorsteher des Gesundheitsamtes, Hans Hunziker, mit dem er durch den Verein abstinenter Ärzte verbunden war, mit Fritz Hauser und mit dem Leiter der Basler Schulausstellung, Albert Gempeler. Fritz Mangold war bereit, ihm Volkshochschulkurse zuzuhalten. Nach zwei Monaten erhielt er eine Arbeitsbewilligung als Psychologe. Das Verständnis in Basel für seine Emigration war gering, wie er sich erinnerte: Warum sollte ein Nichtjude Deutschland nur wegen Hitler verlassen?1092 An der Universität hatte er mangels Habilitation wenig Chancen, zudem waren die Gegner der Psychoanalyse hier vorherrschend, wie auch sein Freund Hans Christoffel1093 erfahren hatte. Zu diesen Gegnern zählten u. a. der Leiter des Lehrerseminars Wilhelm Brenner, der Philosophieprofessor Paul Häberlin,1094 in gewisser Hinsicht auch der Psychiater John Eugen Staehelin. Da Meng C. G. Jung ablehnte und zu Freud hielt, waren auch die Jungianer gegen ihn. Dank der Förderung durch einflussreiche Kreise im Erziehungsrat und in der Kuratel wurde für ihn dennoch 1937 ein Lektorat für Psychohygiene geschaffen, zuerst für ein Jahr auf Probe, dann auf längere Sicht. Obschon der dafür von der Fakultät anberaumte Probevortrag angeblich etwas unbefriedigend ausfiel, sprang John Eugen Staehelin, der (im Unterschied zum ablehnenden Paul Häberlin von der Philosophischen Fakultät) schon die Niederlassung befürwortet hatte, über seinen Schatten und beantragte die Zulassung durch die Medizinische Fakultät, die mit Zweidrittelmehrheit angenommen wurde.1095 Sein privates Institut, das er 1943 mit einem Legat gründen konnte, gab ihm die Möglichkeit zu ausgedehnteren Arbeiten mit Psychiatern und Psychologen wie Hans Christoffel sowie (für die Tierpsychologie) Adolf Portmann. Auch Juristen (darunter Arthur Baumgarten, mit dem er ein Seminar über «Utopien» abhielt) und Theologen (Köberle, Thurneysen, Hendrik van Oyen) begannen sich für ihn zu interessieren; seinen Einladun-
1091 1092 1093 1094
1095
Plänkers u. a. 1996; Haenel 1982, 182–184; Meng 1971. Meng 1971, 84. Christoffel und Meng waren sich einig in der Ablehnung der nationalsozialistischen Medizin, die Christoffel als sadistisch bezeichnete. Kaiser 1982, 24, 34, 93, 193, 195, 198 f. Ludwig Binswanger an Paul Häberlin 1. 6. 1933, in: Häberlin/Binswanger 1997, 236; Kaiser 1982, 164, über die Gegner der Psychoanalyse in Basel, 195, über die Freudianer in der Schweiz. StABS UA Q 2, Protokoll der Medizinischen Fakultät 1935–1937, 11. 1. 1937.
Deutsche Professoren als Opfer des Nationalsozialismus
289
gen folgten Fritz Medicus (Zürich), Viktor von Weizsäcker (Heidelberg) und Heinrich Jacoby (Zürich). Einen bezahlten Lehrauftrag (im Unterschied zum Lektorat) an der Universität erhielt er erst 1945 zusammen mit dem Titel eines Extraordinarius, nachdem die Fakultät einen entsprechenden Antrag 1939 noch abgelehnt hatte auf der Basis von Gutachten, die Jakob Klaesi und Oscar Forel geschrieben hatten. Das Argument, die Psychohygiene werde bereits von den Psychiatern der Universität betrieben, entsprach nicht der Realität.1096 So gelangte über einen Flüchtling, der der Linken zuzurechnen war, der sich aber in Basel politisch sehr zurückhielt und von Sozialisten und Marxisten abgelehnt wurde (er wurde erst 1951 eingebürgert)1097, die Freudsche Psychoanalyse und die darauf basierende Psychohygiene in die Basler Fakultät. Nach Kriegsende erhielt er wie sein Freund Arthur Baumgarten ein Ordinariat in Berlin-Ost angeboten, das er aber ausschlug, weil ihm dort die Lehrfreiheit nicht garantiert schien. Meng verdankte seinen Verbleib in Basel zunächst nicht der Universität, sondern ausseruniversitären Kreisen. Basler Universitätskreise erreichten hingegen, dass C. G. Jung nach dem Ende seiner Lehrtätigkeit an der ETH Zürich nach Basel berufen wurde. Hier lehrte er allerdings nie, da er unter schweren gesundheitlichen Problemen litt und im Februar 1944 verunfallte.1098 Zudem hatte die Wahl eine politische Implikation: Sie bedeutete, dass seine Anhänger Jungs Verhalten gegenüber den Nationalsozialisten als ehrbar beurteilten, während Jungs Gegner ihm die antisemitische Abrechnung mit Freud 1933 in Frankfurt und die Kooperation mit Nationalsozialisten in Deutschland im Rahmen der Allgemeinen ärztlichen Gesellschaft für Psychotherapie1099 nicht verziehen. Dies war in 1096
1097
1098 1099
Rintelen 1980, 312 f., 402; Meng 1971, 86 ff. StABS Protokoll S 4 Erziehungsrat Bd. 24, 1936–1938, 20. 3. 1937, 11. 9. 1939; Bd. 27, 1942–1944, 8. 3. 1943, 5. 4. 1943 (Gründung des Seminars und Forderung nach einem Lehrauftrag), 22. 9. 1944, und Bd. 28, 1944– 1947, 13. 11. 1944, 12. 2. 1945, 12. 3. 1945 (Erteilung des Lehrauftrags für sechs Jahre, Honorar Fr. 1’000, nach energischen Mahnungen durch Baumgarten). StABS UA Q 2 Protokoll der Medizinischen Fakultät 11. 1. 1937. Meng bewarb sich seit 1942 um das Basler Bürgerrecht, hatte aber damit erst 1951 Erfolg. Für die ersten Nachkriegsjahre ist belegt, dass er als Kommunist galt, da das Ehepaar Meng mit dem Ehepaar Baumgarten verkehrte. 1949 wurde deswegen seine Post kontrolliert. Die Bundesanwaltschaft war Ende 1949 überzeugt, dass Meng «marxistisch-kommunistischen Ideologien huldigt», während sie von den US-Besatzungsbehörden erfahren haben wollte, dass Mengs Bruder Hermann in Stuttgart ein kommunistischer Agitator sei. Er hielt sich aber von der PdA fern, engagierte sich in der Friedensbewegung und später in der Bewegung gegen atomare Aufrüstung. StABS PD-REG 5a 3-1-2 Fiche Otto Heinrich Meng-Köhler. Bair 2004, 496. Typisch für diese radikale Ablehnung: Meng 1971, 51 f. Hier und im Protest der Studierenden zeigte sich eine relativ breite Kritik an Jungs Verhältnis zu den Nationalsozialisten (Lewin 2009, 36 f., 55, 147, 186 f., 211 ff., 215–217), deren Macht er unterschätzte (Bair 2004, 432–462).
290
Mediziner
Basel zu spüren, als die studentische Linke am 16. Februar 1944 gegen die Ernennung Jungs protestierte.1100 Die Berufung nach Basel ging auf eine Initiative von John Staehelin und vor allem von Adolf Lukas Vischer zurück, die ihm per Oktober 1943 ein persönliches Ordinariat mit einem Lehrauftrag für Medizinische Psychologie (mit besonderer Berücksichtigung der Psychotherapie) verschafften.1101 Nach Ansicht der Initianten betrieb Jung rein medizinische Psychologie, deshalb wurde die Philosophische Fakultät gar nicht gefragt.1102 Man darf vom wissenschaftlichen Format her Jung und Meng nicht miteinander vergleichen, aber dennoch feststellen, dass einflussreiche Mediziner lieber die Jungsche Psychologie an der Universität sahen als eine (linke) Psychologie nach Freud. In der Regel aber führte das Verhalten der Fakultät zur Ablehnung von hilfesuchenden Kollegen. Oft wurde argumentiert, dass Platz und Ressourcen für die Forschung der in Deutschland Verfolgten in Basel fehlten. Auch wurde genau geprüft, ob sich deren Spezialgebiet nach Meinung der Basler Mediziner sinnvoll in den vorhandenen Fächerkanon einfügen liess. Dazu erwähne ich drei Beispiele: Heinrich Poll war als Anatom auf erbbiologische Fragen spezialisiert und betrieb an seinem Hamburger Institut Zwillingsforschung, wobei er sich für Rassenhygiene einsetzte. Da er «Nichtarier» war, endete seine Laufbahn 1933 durch eine Denunziation. Im Ausland fand er keine Stelle, bis er 1939 von Lund (Schweden) ein Angebot erhielt. In diesem Jahr erlag er jedoch einem Herzinfarkt.1103 Poll besuchte 1935 seinen Basler Kollegen Eugen Ludwig und bat um einen Lehrauftrag für Vererbungslehre. Ludwig und Rudolf Staehelin «stell[t]en ihm die Schwierigkeiten vor». Sie beschlossen, ohne Konsultation der Fakultät Fritz Hauser Polls Bitte mit einer ablehnenden Empfehlung vorzulegen – Hauser war mit der Ablehnung einverstanden.1104 Das zweite Beispiel stammt vom Oktober 1938. Titus von Lanz war seit 1931 ausserplanmässiger Professor für Anatomie in München. Im Oktober 1938 verlor er seine Stelle, weil er mit einer «Nicht-Arierin» verheiratet war.1105 Nach der Entlassung schrieb er einen Bittbrief an Eugen Ludwig, der ihn als hochqualifiziert beurteilte, sich aber gerade deswegen nicht vorstellen konnte, ihn in Basel forschen zu sehen: Er hätte auf Jahre hinaus viel Platz und zahlreiche Leichen gebraucht. Fritz Hauser, dem Ludwig auch diesen Fall vorlegte, entscheid sich wiederum im Einvernehmen mit Ludwig gegen eine Geste zugunsten von von Lanz.1106 Das dritte Beispiel betrifft 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106
Häberlin/Binswanger 1997, 346 f. Haenel 1982, 178; StABS Protokoll S 4 Erziehungsrat Bd. 28, 1944–1947, 11. 10. 1943. Rintelen 1980, 313; Bonjour 1960, 607. Braund/Sutton 2008. Eugen Ludwig an Fritz Hauser, 29. 10. 1935, in: StABS Erziehung X 48 Schweizerisches Hilfswerk für deutsche Gelehrte 1933–1940. Lippert 1973. Ludwig an Hauser, 29. 10. 1938; Hauser an Ludwig, 15. 11. 1938, in: StABS Erziehung X 48 Schweizerisches Hilfswerk für deutsche Gelehrte 1933–1940.
Jüdische Basler Professoren und jüdische Studierende aus Deutschland
291
eine Dozentin aus Freiburg i. Br., die in Basel unterzukommen hoffte. Berta Ottenstein war als Privatdozentin das erste weibliche Fakultätsmitglied in Freiburg im Breisgau. Im Frühling 1933 suchte der dortige Ordinarius für Dermatologie Georg Alexander Rost bei seinem Basler Kollegen Lutz eine Lösung für die jüdische Dozentin. Lutz lehnte ab: Die Fremdenpolizei würde ihr keine Aufenthaltsbewilligung geben, in seiner kleinen Klinik sei keine Stelle frei und für Ottensteins biochemische Forschung gebe es in Basel kein Labor. Sie gelangte daraufhin über Budapest und Istanbul nach Harvard. 1942 und 1943 publizierte Lutz zusammen mit ihr je ein Sammelreferat – es scheint keine Verstimmung wegen der negativen Antwort gegeben zu haben;1107 das Muster der Ablehnung war jedoch typisch. Nach 1936 stand die Förderung von Schweizern im Vordergrund, zumal die Deutschen kein Gegenrecht mehr hielten, wie gesagt wurde.1108 Diese Tendenz herrschte auch bei den politischen Instanzen vor, da sie Konflikte zwischen antinationalsozialistischen Emigranten und regimetreuen deutschen Professoren in Basel verhindern wollten.
6.5 Jüdische Basler Professoren und jüdische Studierende aus Deutschland Eine besondere Beachtung verdienen die jüdischen Professoren, die schon vor 1933 nach Basel gewählt worden waren. Teils waren sie zunächst für die Verfolgungen in Deutschland nicht sensibilisiert, da sie keine jüdische Identität ausgebildet hatten. Teils hielten sie sich bedeckt, entsprechend der Parole, die auch die jüdischen Gemeinden in der Schweiz ausgegeben hatten, nicht aufzufallen, um dem Antisemitismus keine Angriffsfläche zu bieten. Einige waren voll in das Basler gesellschaftliche und politische Leben integriert, so der Gerichtsmediziner Salomon Schönberg,1109 der aus Galizien stammte, seine ganze Karriere in Basel durchlaufen hatte und dabei auch einer jüdischen Studentenverbindung, der Ne-
1107 1108
1109
Rufli 2008, 40. Als Beispiel wird oft auf den Fall von Theodor Naegeli verwiesen. Dieser arbeitete nach seinem Studium in Deutschland und in Zürich 1914 in deutschen Kriegslazaretten. Ab 1917 wirkte er in Bonn, wo er 1922 PD und 1925 Extraordinarius wurde. 1935 bemühte sich die Schweizer Gesandtschaft beim Reichserziehungsminister Rust darum, ihm ein Ordinariat zu verschaffen mit der Begründung, dass Deutschland für Schweizer eine Berufungssperre errichtet habe, während Schweizer Universitäten weiterhin Deutsche auf Professuren beriefen. Naegeli erhielt kein Ordinariat, obschon sein Name auf verschiedenen Berufungslisten erschien. Ab 1936 sass er in Bonn auf einer Oberarzt-Stelle fest, ab 1942 durfte er nicht mehr in die Schweiz reisen. Forsbach 2006, 397 ff. Rintelen 1980, 427–429.
292
Mediziner
hardea,1110 angehörte, die er als Altherr weiter pflegte. Schönberg war anfangs Präsident einer deutschen Fachgesellschaft; bis 1935 publizierte er auch noch in Deutschland. Mit der zunehmenden Verfolgung änderte sich das Verhalten jüdischer Professoren; ihre Herkunft gewann an Bedeutung. Man erkennt dies auch an der Festschrift der Basler jüdischen Gemeinde von 1955, in der der Autor Nordemann alle Basler Gelehrten aufführte, die als Juden zum wissenschaftlichen Ruhm Basels beigetragen hätten, darunter Karl Joël (Philosophie), Bruno Bloch (Dermatologie, später in Zürich), Julius Landmann (Nationalökonomie, später in Kiel), Robert Bing (Neurologie),1111 Salomon Schönberg, Alexander Ostrowski (Mathematik), Tadeus Reichstein (Pharmazie/Chemie), Alfred Bloch (Sprachwissenschaften), Benno Dukor (Psychiatrie), Erwin Berger (Mikrobiologie) – wenn auch mit Auslassungen (zum Beispiel Edgar Salin).1112 Vor dem Krieg wäre eine solche Darstellung schwer vorstellbar gewesen. Auch die Haltung der christlichen Basler Professoren änderte sich zum Teil, wenn sie zunächst auch nicht spezifisch den Juden galt. So wurden die Gäste bei der Trauerfeier für den Kliniker Rudolf Staehelin dazu aufgefordert, statt Blumen zu spenden, die Aktion für Emigrantenkinder zu unterstützen, in der die Gattin des Theologen Ernst Staehelin-Kutter aktiv war. Bemerkenswert ist auch, dass die Ehrendoktorwürde der Medizinischen Fakultät 1942 an Mathilde Paravicini für die Flüchtlingshilfe vergeben wurde.1113 Rudolf Staehelin war aber auch derjenige Vorsteher der Medizinischen Klinik gewesen, der im Oktober 1939, d. h. unmittelbar nach Kriegsbeginn, im Auftrag einer deutschen Stelle ein Gutachten über die Gasvergiftung deutscher Soldaten erstellt hatte, was für seine enge Bindung an die deutsche Wissenschaft und seine «politische Kurzsichtigkeit» sprach – die Kuratel tadelte diesen Vorgang.1114 Das war wohl ein Zeichen völliger Naivität, denn Staehelin galt als Schweizer Patriot, gläubiger Protestant, pflichtbewusst, hilfsbereit und musikalisch, mit Freunden in Schweden, Holland und Frankreich. Der Medizinhistoriker Rintelen sah darin ein Zeichen dafür, wie gross die Kluft zwischen der öffentlichen Ablehnung des nationalsozialistisch geführten Deutschland und der Haltung vieler Universitätsangehöriger war.1115 1110 1111 1112 1113
1114
1115
Sibold 2010, 209 f.; Platzer 1988, 62, 73. Georgi 1957. Nordemann 1955, 124, 129. Von den 14 Ehrendoktoraten der Basler Medizinischen Fakultät zwischen 1933 und 1945 gingen sechs an Manager der Basler chemischen Industrie, eines an die Zürcher Naturstoffchemiker Paul Karrer und Leopold Ru⌅i⇥ka. Rintelen 1980, 317 f. (Liste). Staehelin handelte im Einvernehmen mit dem Eidgenössischen Politischen Departement, aber ohne Rücksprache mit den Basler Behörden. StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 13, 1935–1941, 6. 11. 1939. Massini 1944. Nachrufe in den Basler Nachrichten vom 29./30. 3. 1943, und in der National-Zeitung vom 29./30. 3. 1944.
Jüdische Basler Professoren und jüdische Studierende aus Deutschland
293
Die Studenten sahen vieles ganz anders. Sie kamen in grösserer Zahl aus Deutschland und später aus Gebieten, die an Deutschland «angeschlossen» oder von deutschen Truppen besetzt worden waren, nach Basel, um hier ihr Medizinstudium fortzusetzen und abzuschliessen. Im Sommersemester 1933 hatte die Universität insgesamt 1192 Studierende (davon 150 Frauen), 379 Studierende waren Ausländer.1116 Im Winter 1933/34 waren es 1518 Studierende (davon 224 Frauen), darunter 621 Ausländer, was dem höchsten Stand an Ausländern vor Kriegsbeginn entsprach.1117 Auf die Medizinische Fakultät entfielen davon im Winter 1933/34 581 Studierende, davon 327 Ausländer. In der Statistik der Immatrikulationen zeigte sich im selben Semester deren Gewicht: 45 Schweizern standen 42 Deutsche, 51 US-Amerikaner, 24 Polen, total 178 ausländische Immatrikulationen gegenüber.1118 Zuerst fielen die amerikanischen Juden auf, die in Deutschland bis 1933 studiert hatten, einerseits wegen des Renommees der deutschen Wissenschaft, andererseits weil viele Medical Schools in den USA ihnen den Zugang erschwerten. Aus letzterem Grund waren einige schon vor 1933 in Basel präsent gewesen.1119 Danach folgten deutsche, nach 1938 auch österreichische, galizische, tschechoslowakische und baltische Studenten, die als Juden verfolgt wurden; es kamen aber auch Studenten, die aus politischen Gründen geflohen waren. Offiziell sah die Fakultät diesen Zustrom ohne nähere Qualifizierung als «Überfüllung» an, während der Mediziner in der Kuratel, Adolf Lukas Vischer, befürchtete, die «Ostjuden» würden das Niveau sinken lassen.1120 Antisemitische Äusserungen in offiziellen Dokumenten wurden vom Erziehungsdepartement, dem die Universität unterstellt war, unterbunden. Dekan Ludwig wusste der Fakultät am 24. April 1933 zu melden, dass ihn der israelitische Gemeindebund gebeten habe, nicht zu viele ausländische jüdische Studenten zuzulassen. In der Diskussion dieser Nachricht wurde eine Drosselung des Zustroms verlangt mit der Begründung, Schweizer Studierende sollten nicht benachteiligt werden.1121 Die gleiche Stimmung herrschte auch unter Assistenten vor: die Schweizer wollten nach Möglichkeit verhindern, dass ihnen Deutsche bevorzugt würden. Ein Beispiel ist Erwin Berger, der erste Assistent bei Robert Doerr am Hygieneinstitut. Schweizer Kollegen sorgten dafür, dass sein Einbürgerungsgesuch abgelehnt wurde, weil er Jude war. Frustriert verliess er 1934 das Institut, womit das Ziel vorerst erreicht war. Sein weiterer Weg führte ihn über das Blutspendezentrum des Bürgerspitals in die chemisch-pharmazeuti-
1116 1117 1118 1119 1120 1121
Rintelen 1980, 144. Rintelen 1980, 304 f. Rintelen 1980, 308. StABS UA Q 2 Protokoll der Medizinischen Fakultät, 1928–1933. Rintelen 1980, 308. Rintelen 1980, 309, 340–343.
294
Mediziner
sche Industrie. Erst 1949 holte ihn Freudenberg ans Kinderspital.1122 Besser erging es Hubert Bloch, der schon in Basel geboren war und hier die Schulen durchlief, der Zofingia angehörte, 1937 das Staatsexamen ablegte und danach bei Ciba angestellt und zugleich Assistent bei Doerr wurde. Bei diesem habilitierte sich der begabte Cellist und Freund des Chemikers Erlenmeyer 1942 für Mikrobiologie. Nach drei Jahren Zusammenarbeit mit Doerrs Nachfolger Tomcsik wurde er am TB-Institut der WHO in Kopenhagen beschäftigt, dann am Rockefeller-Institut in New York. Nach einer 1955 angetretenen Professur in Pittsburgh wurde er 1961 Forschungsleiter bei Ciba. Zuletzt war er Gründungsdirektor des Friedrich Miescher-Instituts in Basel.1123 Eine Umfrage ermittelte 1933 die Kapazitäten der medizinischen Institute, die dann an das Erziehungsdepartement gemeldet wurden.1124 Engpässe sah man in der Vorklinik und in der Anatomie, wo zu wenig Leichen verfügbar waren, aber auch in der Geburtshilfe. Fehlende ‚Materialien‘ seien die Hauptursache, nicht eigentlicher Platzmangel. Die Fakultät wollte zunächst den Schweizern den Vorrang lassen, danach wurden Ausländer berücksichtigt in der Reihenfolge der Anmeldung. So galt für das Wintersemester 1933/34, dass sich Schweizer bis zum 31. Oktober 1933 anmelden sollten, die Anmeldefrist für Ausländer begann dann am 1. November 1933. Dieser Entscheid diente auch dazu, eine Protestbewegung der Schweizer Studenten zurückzubinden, die ihre Interessen gegen die Ausländer verteidigen wollten.1125 Die Fakultät unterschied offiziell nur zwischen Schweizern, Amerikanern und anderen Ausländern. Anders verfuhr das Kontrollbüro, das dem Erziehungsdepartement die Summe der bis Mitte Mai 1933 gemeldeten «fremden jüdischen Studenten» bekanntgab. Im Juni folgte eine Konferenz des Erziehungsdepartements mit den interessierten Kreisen, nach der auf Wunsch der Medizinischen Fakultät ein Numerus clausus für ausländische Studierende bewilligt wurde. Für Schweizer und in der Schweiz niedergelassene Ausländer blieb der Zugang zum Medizinstudium frei, dabei wurde festgehalten: «Staatsangehörigkeit, Rasse und Religion werden bei den Entscheiden der Fakultät nicht in Betracht gezogen».1126 In den ersten Jahren des NS-Regimes gelangten viele fortgeschrittene deutsche Medizinstudenten mit einer fertigen Dissertation nach Basel, die als Juden in ihrem Lande ab dem 20. Oktober 1933 nicht mehr zum Examen zugelassen wurden und ab 1934 keine Dissertationen mehr einreichen durften. Wurde die wissenschaftliche Leistung in Basel als ausreichend beurteilt, konnten sie hier den
1122 1123 1124 1125 1126
Rintelen 1980, 309; Fischer u. a. 1994, 406. Rintelen 1980, 345. Anonym 1974. StABS UA Q 2 Protokoll der Medizinischen Fakultät 1928–1933, 24. 4. 1933. Rintelen 1980, 307. StABS UA Q 2 Protokoll der Medizinischen Fakultät, 14.4., 8.5., 29.5., 5. 7. 1933.
Jüdische Basler Professoren und jüdische Studierende aus Deutschland
295
Doktortitel erlangen, der für ihr weiteres Fortkommen notwendig war.1127 Denn eine Auswanderung nach den USA war ohne Doktortitel so gut wie unmöglich – und immer war an Weiterreise gedacht, da die Standesorganisationen in der Schweiz keinen Zustrom Fremder wünschten und ohne schweizerische Maturität kein Staatsexamen abgelegt werden konnte. 1934 und 1935 erfolgten zum Beispiel mehrere derartige Promotionen bei Lutz in Dermatologie in Basel von «Kollegen deutscher Herkunft». Lutz hat so gut geholfen, wie er im Rahmen seiner Möglichkeiten und seiner Vorstellungen konnte. Ein anekdotisches Beispiel aus dem Jahr 1934 wurde von Rudy Baer berichtet. Er hatte in Heidelberg eine Dissertation geschrieben, die er nicht mehr einreichen durfte. Deshalb fuhr er an einem Samstag mit der Bahn nach Basel und traf Lutz in der Klinik an; dieser rief Ernst Oppikofer (HNO) an. Die Dissertation wurde über Nacht gelesen und begutachtet; am Montag prüften Lutz und Oppikofer Baer, worauf er das Basler Doktordiplom erhielt.1128 Die Fakultät war allerdings der Ansicht, dass fehlende Dokumente über das vorausgehende Studium ein grosses Problem darstellten, und sie war bereit, Studenten, die ein Examen nicht bestanden, nach Hause zu schicken. Schlimmer noch war die Vereinbarung zwischen dem Erziehungsdepartement, der Eidgenössischen Fremdenpolizei und dem Rektorat über das Schicksal polnischer Medizinstudenten vom Juni 1939. Studierende höherer Semester mit vollständigen Papieren konnten ihren Aufenthalt verlängern, solange sie im Studium waren. Studienanfänger benötigten eine Bestätigung einer polnischen Behörde, dass sie jederzeit nach Polen zurückkehren konnten – Scheine von Konsulaten wurden ausdrücklich nicht akzeptiert. Wer sein Basler Studium unterbrochen hatte und es fortsetzen wollte, benötigte denselben Schein und musste einen neuen Antrag auf Zulassung zum Basler Studium vorlegen.1129 Interessant ist auch die Überlegung, die hinter den Bestimmungen über die Examensgebühren für mittellose jüdische Kandidaten stand. Es ging um fünf Studenten, die von der Dreyfus-Brodsky-Stiftung unterstützt wurden. Diese mussten die Examensgebühr bei der Anmeldung bezahlen, damit das Prinzip gewahrt wurde, aber sie erhielten nach der Prüfung das Geld vom Examinator persönlich wieder zurück.1130 Tatsächlich bedeutete die Zulassung ausländischer Studenten eine grosse Arbeitslast für das medizinische Dekanat, das dafür keine Ressourcen besass, so dass der Dekan mit Unterstützung einer Schreibkraft alle Fälle allein bearbeiten
1127
1128 1129 1130
Das medizinische Doktorat erlangten 1933 18 Schweizer und 18 Ausländer, 1934 11 Schweizer und 62 Ausländer; nach 1937 waren die Schweizer meist wieder in der Überzahl. Rintelen 1980, 308. Rufli 2008, 41. StABS UA Q 2 Protokoll der Medizinischen Fakultät, 19. 6. 1939. StABS UA Q 2 Protokoll der Medizinischen Fakultät, 11. 12. 1939.
296
Mediziner
musste. Diese Schreibkraft war eine Tochter von Regierungsrat Hauser.1131 Die Fakultät lebte in einem Bewusstsein der Sparsamkeit und Enge, das es ihr nahelegte, die lokalen Verhältnisse als überfordert zu betrachten und nur in beschränktem Mass Veränderungen zur Bewältigung der Situation zu organisieren. Hilfsbereitschaft blieb individuell und erreichte nie eine systemische Dimension, wie denn die Basler Medizin zwar auf Distanz zum rassistischen Missbrauch deutscher Medizin ging, diesen aber lange nicht anprangerte.
1131
Ludwig 2005, 59.
7 Geisteswissenschaftler 7.1 Philosophen 7.1.1 Einleitung Drei verschiedene Philosophien waren in Basel in den Jahren 1933 bis 1945 vor allem vertreten, die sich jeweils keiner anderswo etablierten Richtung zuweisen liessen. Paul Häberlin, der dominante Part, vertrat mit einem eigenen System eine Ethik und Pädagogik, die auch lebenspraktische Fragen berücksichtigte. Zudem beeinflusste er das Geschehen in der Lehrerausbildung. Eine überzeugte Gefolgschaft blieb ihm über den Tod hinaus treu. 2004 hat ihn eine führende Tageszeitung als den «vermutlich bedeutendsten schweizerischen Philosophen» bezeichnet.1132 Häberlin amtierte zunächst noch neben seinem Lehrer Karl Joël, der seit 1902 den allgemeinphilosophischen Lehrstuhl versah (1893 hier habilitiert, 1897 Extraordinarius),1133 und widmete sich einstweilen Teilbereichen des Faches wie vor allem der Pädagogik, Psychologie, Ethik und Anthropologie. Mit Joëls Rücktritt weitete Häberlin seine Vorlesungen auf das Gesamtgebiet der Philosophie aus. Den Joëlschen Lehrstuhl erhielt dann 1931 Herman [sic] Schmalenbach, aus Deutschland berufen, mit einer gewissen Neigung zu Stefan George und an Leibniz, an gesellschaftlichen Strukturen und an Grundfragen des Bewusstseins interessiert (er war bis 1950 im Amt). Im Vergleich zu seinem Schweizer Kollegen stand er weniger im Rampenlicht1134 – nicht dass er vergessen worden wäre, aber die Informationen über ihn sind schlechter zugänglich. Immerhin hatte er im Unterscheid zu Häberlin zwei Schüler, Michael Landmann und Hansjörg A. Salmony, die eine akademische Karriere durchliefen. Neben den beiden Ordinarien wirkte seit 1920 Heinrich Barth, christlicher Philosoph mit Interesse an Fragen der menschlichen Existenz, aber auch an Politik und sozialen Themen. Barth wurde 1942 persönlicher Ordinarius und 1950 Schmalenbachs Nachfolger. 1943 doktorierte der Psychologe Hans Kunz bei Häberlin; er wurde 1945 habilitiert und fällt damit für meine Studie ausser Betracht.1135 Hermann Gauss, der 1928 doktoriert hatte, 1929 Privatdozent geworden war, 1947 den Extraordinarientitel erhalten hatte und 1949 nach Bern berufen wurde, war in Basel mit einem Lehrauftrag für die Interpretation klassischer philosophischer Autoren 1132 1133 1134 1135
Anonym 2004 (Zit.); Häberlin/Binswanger 1997, Einleitung, 13–88. Vischer 2010, 8. Vischer 2010 erwähnt Schmalenbach nur im Vorbeigehen und widmet ihm keine biographische Notiz. Vischer 2010, 2 f.
298
Geisteswissenschaftler
ausgestattet.1136 Über ihn berichte ich hier nicht; auch nicht über Hermann Gschwind, der von 1920 bis 1945 Privatdozent für Pädagogik war. 7.1.2 Paul Häberlin Paul Häberlin1137 vertrat ein eigenes System, den «aprioristischen Seinsmonismus». Der Lehrersohn aus Kesswil und passionierte Jäger war auch Naturphilosoph. Zuerst betrieb er Theologie bis zur Ordination als Pfarrer, wandte sich dann aufgrund seiner Kantlektüre vom kirchlichen Glauben ab und studierte Philosophie, Naturwissenschaften und Psychologie. Nach der Promotion (1903) wurde er Lehrer in Basel, leitete von 1904 bis 1909 das Lehrerseminar in Kreuzlingen und heiratete die deutsche Malerin Paula Baruch. Mit dem Psychiater und Klinikleiter Ludwig Binswanger verband ihn eine lebenslange Freundschaft. 1908 habilitierte er sich in Basel, 1914 erlangte er eine Professur für Philosophie in Bern, von wo aus er 1922 nach Basel berufen wurde mit den Schwerpunkten «Pädagogik und allgemein philosophische Disziplinen». Hier lehrte er bis zu seinem Rücktritt 1944. Häberlin wolle Orientierungshilfen durch Belehrung und konkrete Anweisung für die Lebensführung anbieten. Als Pädagoge beschäftigte er sich in Bern wie in Basel mit ‚schwer erziehbaren‘ und psychisch gestörten Jugendlichen, die er in seinen Haushalt aufnahm. Er war überzeugt, dass Philosophie «wahre und daher für das Leben massgebende Einsicht zu gewinnen» erlaube.1138 In Philosophie, Psychologie und Pädagogik arbeitete er sein eigenes Gedankensystem aus, ohne explizit auf die Geschichte dieser Fächer Bezug zu nehmen, wie dies bei seinen Kollegen üblich war. Seine anfänglich kantianische Ethik wandelte sich um 1930 zu einer Forderung nach «Seinsfrömmigkeit», die mit der Suche nach einer Position der Mitte verbunden war: In der 1935 erschienenen Arbeit Wider den Ungeist prangerte er nicht den Ungeist des Nationalsozialismus an, sondern das, was bei Martin Heidegger (Freiburg i. Br.), mit dem sich Häberlin vorübergehend gut verstand, «Seinsvergessenheit» genannt wurde.1139 Häberlin war nie ein Existenzphilosoph; mit Karl Jaspers führte er eine Privatfehde und trug dazu bei, dass sich die Fakultät nicht darauf einlassen wollte, Jaspers nach Basel zu holen.1140 Dass dieser schliesslich gar sein Nachfolger wurde, war nicht in seinem Sinne. Obschon er das Argument gebrauchte, Jaspers habe in der Fakultät keinen 1136 1137 1138 1139 1140
Rogger Kappeler 2005. Kamm 1977/1981. Cesana 2011, 89. Kamm 1981, 151 f. StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 13, 1935–1941, 248, 2. Sitzung, 6. 1. 1938; 386, 8. Sitzung, 28. 8. 1939. August Rüegg erklärte, Jaspers würde nichts Neues bringen, da Häberlin schon dasselbe vortrage.
Philosophen
299
Platz, weil seine Wahl die Basler Nachwuchspolitik durchkreuzen würde, hatte er keinen Schüler, der für seine Nachfolge bereitstand. Sein Einfluss erstreckte sich auf das Lehrerseminar, wo er dem Frontisten Wilhelm Brenner, mit dem er befreundet war, 1925 den Direktorenposten zuhielt, um sich selbst im Bereich der Pädagogik zu entlasten. Weitere Instrumente seines Einflusses ausserhalb der Universität waren die Stiftung Lucerna1141 des liberalen Luzerner Bankiers Emil Sidler, die der Weiterbildung und später der ‚geistigen Landesverteidigung‘ gewidmet war, sowie das mit der Stiftung verbundene und von Häberlin geleitete Anthropologische Institut (gegründet 1930), das eine Auslese akademischer Nachwuchsleute heranziehen sollte. Mehr als seine eigene Philosophie wirkte seine Psychologie und Pädagogik auf die Zeitgenossen und damaligen Schüler.1142 Wichtig für seine Entwicklung waren die Studiensemester in Deutschland gewesen, namentlich in Göttingen; in Paderborn und Bremen arbeitete er eine Zeitlang als Hauslehrer, um das weitere Studium nach dem Abschluss in Theologie zu finanzieren. Eine klare Ablehnung undemokratischer Tendenzen in der Schweiz oder in Deutschland ist bei Häberlin nicht ersichtlich. Er hegte seit seiner Göttinger Zeit eine grosse Begeisterung für Deutschland, die von seiner Frau zunächst geteilt wurde. Häberlin bewunderte insbesondere die Jugendbewegung der 1920er Jahre und wurde Mitglied der Verbindung Germania. Was in Deutschland 1933 begann, schätzte er zunächst positiv als ‚Erneuerung‘ ein, wie er sie in nicht näher bestimmter Form auch für die Schweiz erhoffte – mir scheint, dass die Gegenwart von Frontisten in Häberlins Umfeld nicht zufällig war. Als es am 26. Oktober 1933 im Basler Grossen Rat zu einer Debatte über die Frontisten in der Lehrerschaft und unter anderen Staatsangestellten kam, wurde bemängelt, dass sich Häberlin in der Kommission für das Lehrerseminar hinter den frontistischen Seminardirekter Brenner stelle. Häberlin rechtfertigte sich damit, dass für Brenner die Gedanken- und Lehrfreiheit gelte.1143 In Häberlins Anthropologischem Institut arbeitete Alfred Zander, der sich als Journalist prominent auf der Seite der Fronten betätigte und eine Ausgabe der Protokolle der Weisen von Zion besorgte. 1934 trat Zander auf politischen Druck hin aus dem Institut aus. Seit diesem Jahr unterhielt er Kontakte zu Organen der NSDAP und war für Deutschland nachrichtendienstlich tätig, wofür er 1938 verurteilt wurde.
1141 1142
1143
Stiftung: Häberlin/Binswanger 1997, Einleitung, 54 f., 58 f.; Kamm 1981, 189 ff. Anonym 2004, wie oben. Im Internet erscheint der Text ohne Autorin; die Umschreibung ihrer Funktionen deutet auf Jeannine Luczak hin. Cesana 2011; Anonym 2010b. Mit abweichender Einordnung in die Philosophie seiner Zeit: Kuhn 1966. Bericht der Seminarkommission über politische Propaganda durch Seminardirektor Brenner, in: StABS Erziehungsrat Protokoll S 4, Bd. 22, 1932–1934, 18. 9. 1933. Zu Brenner: Häberlin/Binswanger 1997, Einleitung, 53 f.; Kamm 1981, 115.
300
Geisteswissenschaftler
Nach ausgestandener Strafe wurde er in Deutschland für den ‚Anschluss‘ der Schweiz aktiv.1144 Häberlin nahm regelmässig an den baslerisch-freiburgischen Professorentreffen in Badenweiler teil, auch und ohne Unterbruch in der Zeit des Nationalsozialismus bis 1938.1145 Während seines Rektorats 1935 hatte er eine solche Zusammenkunft turnusgemäss selbst zu organisieren und hielt dort eine Ansprache, mit der er Spannungen zwischen Schweizern und Deutschen lösen und versöhnlich-vermittelnd wirken wollte. Ihm war wichtig, dass man sich austauschte und erfuhr, dass alle Menschen seien; das Verbindende sah er in der Sorge um die Zukunft der Universität und der akademischen Bildung. Die «Bedrängnis des Geistes» sei universell, doch dürfe der Geist nicht als Widersacher des Lebens gelten.1146 In seiner Ansprache am Basler Dies academicus im Herbst 1935 kritisierte er den nationalsozialistischen Begriff von Wissenschaft und Bildung – es war ihm nun bewusst, dass die in Deutschland Herrschenden sich zum Ziel gesetzt hatten, Wissenschaft nur noch als Instrument patriotischer und parteigemässer Schulung und Ideologiebildung aufzufassen.1147 Häberlin protestierte im selben Jahr bei der Erziehungsdirektion gegen die Wahl von Werner Kaegi zum Geschichtsprofessor und hätte gern den renommierten Deutschen Gerhard Ritter auf dieser Professur gesehen. Kaegi hielt er für «physisch» unfähig, wie er darlegte. Anscheinend beklagte er die Lockerung der Kontakte der Basler Universität zu Deutschland, die sich durch die Abkehr vom deutschen Universitätssystem ergab, die die Basler Politik dekretierte. Um so mehr war ihm 1938 die Ankunft des Germanisten Friedrich Ranke in Basel willkommen, der wie er selbst eine emotionale Beziehung zu Göttingen pflegte.1148 Häberlins Verhalten gegenüber dem Nationalsozialismus wie gegenüber den schweizerischen Fronten war teilweise in seiner Philosophie begründet. Die Suche nach Mitte und Ausgleich legte ihm eine Rolle nahe, in der er um Verständnis für die in Deutschland herrschende Ideologie eintrat und in deren Anhängern vor allem die Mitmenschen erkennen wollte. In seiner «Seinsphilosophie» war es nicht leicht, Gegebenheiten wie den Nationalsozialismus radikal infrage zu stellen und anzugreifen. Einer ‚Erneuerung‘ wollte er sich nicht grundsätzlich entgegenstellen, da etwas Gutes daraus hätte resultieren können. Er deutete 1934 die «Krise» als Absterben, Aufbruch und Chancen für alte Ordnungen, äusserte sich versöhnlich-zweideutig zum Frontismus (den sein Freund, der Redaktor der «Basler 1144 1145 1146 1147 1148
Kamm 1981, 184–187. Alfred Zander war der Basler Ortsgruppenleiter der Nationalen Front. Heini 2019, 40. Vgl. Heini 2020, 218. UA Freiburg i. Br., B0001 317 Ohne Umschlagtitel, Inhalt Treffen Basel-Freiburg, ab 1924. Kamm 1981, 171. Kamm 1981, 173, 177. Kamm 1981, 236.
Philosophen
301
Nachrichten» Albert Oeri, publizistisch bekämpfte) und hoffte, dass sowohl die alten Fronten1149 wie die neuen Fronten «wirklich berufen» seien, «den Schweizergeist zu vertreten». Häberlins Philosophie verlangte die Unterstellung des Eigenwillens unter den Einheitswillen; damit war er wenig hellhörig für die Gefahren des Totalitarismus. Er sah aber die Gefahren für die Freiheit der Wissenschaft, die in einer einseitigen Hinwendung zur Praxis und in der Indienstnahme der Universitäten für eine Ideologie lagen. Angesichts seiner wichtigen Stellung innerhalb der Universität Basel erhielt Häberlin ab 1933 zahlreiche Hilfegesuche aus Deutschland. Allein für das Jahr 1933 erschienen in seiner Korrespondenz die folgenden Hilferufe: Ludwig Binswanger bat ihn um Unterstützung für den Frankfurter Analytiker Heinrich Meng (s. oben über die Mediziner). Theodor Litt ersuchte Häberlin, sich für Karl Mannheim (Emigration nach London) zu verwenden. Martin Heidegger bat um Hilfe für Paul Oskar Kristeller (ab 1934 in Italien im Exil), was Häberlin abschlägig beantwortete. Arthur Stein (damals Extraordinarius in Bern) setzte sich bei Häberlin für Richard Kroner, Philosoph in Kiel (1934 nach Frankfurt versetzt), ein, den er für den Zürcher Lehrstuhl empfahl. 1935 entfiel die Schonung für ehemalige Kriegsteilnehmer in Deutschland. Nun fragte Kurt Riezler (bis 1933 Kurator der Universität Frankfurt, ab 1938 in den USA) aus Italien bei Häberlin an, ob er in Basel einen Lehrauftrag erhalten könne. Karl Löwith (ab Herbst 1933 in Rom, später in Japan) wandte sich an Binswanger, der während eines LucernaKurses mit Häberlin über seinen ‚Fall‘ sprach. Dies führte zu einer Absage. Binswanger wollte sich 1938 bei Häberlin für Heinrich Robert Zimmer (1938 in Heidelberg entlassen, danach in Oxford und später in New York) einsetzen, jedoch ohne Erfolg. Einen der seltenen Erfolge zeigt das Dankschreiben von Albert Béguin (seit 1937 Professor in Basel) vom 22. Dezember 1939 für Häberlins Einsatz zugunsten einer Einreisebewilligung für den Germanisten Eduard Berend, der im KZ Sachsenhausen sass und danach ausgewiesen wurde. Häberlin verweigerte hingegen eine Hilfe für das philosophische Zeitschriftenprojekt von Fritz Heinemann (damals Emigrant in Paris) sowie für den früheren Herausgeber der «Kant-Studien»1150 und Geschäftsführer der Kant-Gesellschaft, Arthur Liebert (seit 1933 in Belgrad im Exil). Hingegen nahm Häberlin die Einladung an, in der inzwischen gleichgeschalteten deutschen Kant-Gesellschaft einen Posten im erweiterten Vorstand zu besetzen; während einer seiner früheren Berner Schüler, Hans Heyse, interimistisch die Kant-Gesellschaft im Sinne der Nationalsozialisten bis zu ihrer Schliessung 1937 leitete.1151
1149 1150 1151
Albert Oeris Kampfschrift gegen den Frontismus trug den Titel Alte Front, erschienen mit einem Geleitwort von Emil Dürr, Basel 1933. Leaman/Simon 1993, 3 ff. Häberlin/Binswanger 1997, Einleitung, 59 ff.
302
Geisteswissenschaftler
7.1.3 Herman Schmalenbach Herman Schmalenbach,1152 verheiratet mit Sala Müntz aus ⇧ód⌃ (aus polnischdeutscher jüdischer Familie)1153, war vor seiner Ankunft in Basel bekannt als philosophischer Soziologe, der sich mit Ferdinand Tönnies und Max Weber auseinandersetze und mit dem Begriff des «Bundes» eine besondere, dritte Art der Vergesellschaftung neben «Gesellschaft» und «Gemeinschaft» untersuchte, namentlich an Schülergruppen, aber auch angeregt von Stefan George. Schmalenbach hatte vor dem Ersten Weltkrieg für einige Jahre zum äusseren Kreis um George gehört (für diesen Kreis war der Begriff des «Bundes» ebenfalls sehr relevant, wenn auch in einem etwas anderen Sinne als in der Sozialwissenschaft).1154 In Berlin unterrichtete er an derselben Privatschule wie Robert Boehringer; während des Studiums in München traf er sich mit Friedrich Gundolf regelmässig, und in der sprachlichen Form seiner Dissertation von 1909 ist der Einfluss Georges mit Händen zu greifen. Auch in der Basler Zeit benutzte er die sich bietenden Gelegenheiten, Boehringer und Karl Wolfskehl zu sehen.1155 Er liebte Hölderlin, Goethe, Baudelaire und Rilke, hatte mit Martin Buber Bekanntschaft geschlossen,1156 war Lehrer an Reformschulen gewesen (Dürer-Schule in Hochwaldhausen und Odenwald-Schule in Ober-Hambach) und hatte in unterschiedlichen akademischen Positionen gewirkt. Promoviert hatte er 1910 bei Rudolf Eucken in Jena (eigentlich verstand er sich als Bewunderer Georg Simmels, der jedoch keine Dissertationen betreuen konnte);1157 die Habilitation erfolgte 1920 in Göttingen, nachdem er in München zum Verehrer Edmund Husserls geworden war. In Göttingen wurde er 1923 zum Extraordinarius befördert. Seit 1928 lehrte er zusätzlich an der Technischen Hochschule Hannover, bis er 1931 den Ruf nach Basel annahm (als Nachfolger von Karl Joël). Er konnte damals zwischen Prag, Kö1152
1153 1154
1155 1156
1157
Angehrn/Rother 2011 (in diesem Band wurde Schmalenbach nicht erwähnt); Zürcher 2010; Lüschen/Stone 1977, 3–5; Landmann 1950 und 1982; Salmony 1950/51; Ballmer (1950/51) 2006, 218 f. Es gibt keine umfassende Biographie von Schmalenbach, nur Nachrufe und Erinnerungen seines Schülers Michael Landmann. Vgl. Karafyllis 2015, 26. Karafyllis 2015, 591, Schmalenbachs Studienzeit 498 ff. Bruns 2008, 450, rechnet Schmalenbach zu den Urhebern eines Versuchs, den «Bund» liberal aufzufassen, im Unterschied zu autoritären Vorstellungen. Lüschen/Stone 1977, 17–42, untersuchen Schmalenbachs Beitrag zur Soziologie eingehend. Vgl. auch Landmann 1982, 82 f. Landmann 1982, 81 f., 84 f. Die Bekanntschaft hielt bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Buber wohnte bei Schmalenbach, wenn er sich in Basel aufhielt, ebenso vor dem Krieg die Malerin und George-Bewundererin Sabine Lepsius (1864–1942), die Schmalenbach von Berlin her kannte. Landmann 1982, 86. Lüschen/Stone 1977, 7 f., vertreten die These, dass Euckens damals hochgeschätzte Philosophie Schmalenbach auch inhaltlich prägte. Sie bestreiten aber nicht, dass Schmalenbach zu den unmittelbarsten Schülern Simmels gehörte.
Philosophen
303
nigsberg und Basel wählen. In der Biographie seines Freundes Willy Moog wird vermutet, dass er Basel wählte, weil seine Frau Jüdin war.1158 Über Schmalenbach berichtete anlässlich der Basler Kandidatur Ernst Gundolf an Julius Landmann, er gehöre zu den «besten Köpfen» unter den Hochschullehrern und verfüge über eine umfassende historisch-philosophische Bildung. Gundolf konnte mit Schmalenbachs Interesse an Tönnies und Max Weber hingegen wenig anfangen.1159 Die Basler Studenten hätten Heinrich Barth vorgezogen, während die Auswahlkommissionen Eberhard Grisebach (er ging 1931 nach Zürich) auf den ersten und Schmalenbach nur auf den zweiten Listenplatz setzten. Schmalenbachs künftiger Kollege Häberlin trat vehement für Grisebach ein.1160 Nicht überraschend votierte Regierungsrat Adolf Im Hof-Schoch, der auch von George beeinflusste Künstler förderte, für Schmalenbach, den er als Historiker der Philosophie einschätzte, während Adolf Lukas Vischer wie die Studenten Barth bevorzugte. Schmalenbach war ein ‚Grieche‘, der vom Christentum wenig hielt, was Häberlin ebenso wie den Barthianern missfallen mochte.1161 Im Erziehungsrat hatte Grisebach am 22. Juni 1931 die Mehrheit für sich. Da er den Ruf nach Basel ablehnte, kam Schmalenbach entsprechend dem Wunsch der Kuratel zum Zug.1162 In Basel war Schmalenbach – falls eine Zuordnung überhaupt sinnvoll war1163 – der Phänomenologie zuzurechnen; sein zentrales Thema war das Bewusstsein. Ausgangspunkte waren für ihn Leibniz und Kant. Das Basler Hauptwerk Geist und Sein (1939) zum Thema der Intentionalität gehört in die Phänomenologie des Bewusstseins und folgt Anregungen von Simmel und vor allem Husserl.1164 In den letzten Jahren arbeitete er an einem grossen Werk über «Die Welt des Menschen», das unvollendet blieb, wie der Nachlass erkennen lässt und Michael Landmann bezeugt hat. In den letzten zwölf Jahren vor seinem Tod liess seine Kraft zur Gestaltung von Texten nach, während er ein Meister des gesprochenen Wortes blieb.1165 Vielleicht reflektierte er in seinem Beitrag zur Festschrift 1158 1159 1160 1161 1162 1163
1164 1165
Karafyllis 2015, 25. Gundolf an Julius Landmann, 17. 6. 1931, in: Gundolf 2006, 284. Kamm 1981, 13 f. Landmann 1982, 83. StABS Protokoll S 4 Erziehungsrat Bd. 21, 1931–1932, 22.6., 17.8., 4.9., 19. 10. 1931. Lüschen/Stone 1977, 5 f., zeigen, wie schwer eine Zuordnung fällt; sie schwanken zwischen Lebensphilosophie, Pragmatismus (William James), Historismus, Idealismus (er verachtete Hegel nicht) und (vornehmlich) Phänomenologie. Immer wieder setzte er sich mit Kant auseinander, den er als religiösen Denker verstehen wollte (11); Leibniz war jedoch für ihn zentraler (13 f.). Deutlicher ist, was er ablehnte: Empirismus, Positivismus, Existentialismus, «Feuilletonphilosophie» (damit zielte er auf Graf Keyserling und Ernst Bloch). Eine Interpretation versuchen Lüschen/Stone 1977, 9 ff. Landmann 1982, 86 f.
304
Geisteswissenschaftler
für den Zürcher Kollegen Fritz Medicus auch seine eigene Einstellung über das Verhältnis des Philosophen zur Politik nach Kriegsausbruch: «Macht und Recht. Platons Absage an die Politik (zugleich zur Entstehungsgeschichte der Apologie und des Kriton)». Schmalenbach zeigte darin, dass sich Platon in seiner zweiten Lebenshälfte aus der Politik heraushielt, aber weiterhin über die Grundlagen des idealen Staates reflektierte. Seine zweite Reise nach Sizilien diente zwar der praktischen Politik; Platon arbeitete an Gesetzen, aber nur an Grundgesetzen, nicht an deren praktischer Umsetzung, die dem Staatsmann überlassen bleiben sollte. Denn dazu bräuchte er Macht, aber der Philosoph habe keine Macht und wolle keine haben. Der Gorgias, den Schmalenbach nur im Vorbeigehen erwähnte (der Aufsatz wirkt unfertig), enthalte Platons Auseinandersetzung mit dem Staat als Recht und dem Staat als Macht.1166 Schmalenbachs Aktivitäten beschränkten sich nicht auf Seminar, Hörsaal und Studierstube. Er hat auch am Radio Vorträge gehalten, unter anderem über Stefan George («Erinnerungen an George», 1. Oktober 1945). Weitere ausserfachliche Vorträge behandelten u. a. die Neutralität (1938 in Davos). Schmalenbachs Vortrag über «Neutralität» gibt einen Einblick in seine Überzeugung, dass Neutralität eines Menschen oder eines Staates keineswegs negativ zu werten sei.1167 Sie sei weder ‚Drückebergerei‘, noch dürften sich Neutrale darüber beklagen, «dass die Schicksalsmächte des Krieges an der Schweiz vorübergegangen seien» und dass ihr deshalb keine künstlerischen Höchstleistungen erreichbar seien (Blatt 1). Unbedingte Parteinahme, so erinnerte Schmalenbach seine Zuhörer, verlangten religiöse Gruppen, was sein erster Anlass war, den Nationalsozialismus (den er nie beim Namen nannte) als eine «sich selber als fast religiöse […] Macht» verstehende Partei zu bezeichnen (Blatt 2). Bevor er zur Neutralität gelangte, diskutierte er den «Kompromiss», der von der Jugend verachtet werde (Blatt 4 f.), denn für seine Philosophie war der Kompromiss «organische Weisheit und damit auch eine hohe Tugend». Als Liberaler hielt er die Existenz von Parteien für berechtigt und ihren Streit für sinnvoll: «Das Leben selbst steht niemals auf der Seite nur einer Partei» (Blatt 5). Neutralität bezog sich aber in der Vorkriegszeit weniger auf Parteien als auf die «Gegensätzlichkeiten der grossen politischen Weltmächte». Sich von ihren Kämpfen fernzuhalten sei der Kern des Neutralitätsprinzips. Wem es gelinge, sich in diesen Kämpfen neutral zu halten, «der kann für sich in Anspruch nehmen, die Stelle zu sein, wo in den Wirbeln wilder Dynamik das organische Leben vor allem seine Stätte bewahrt hat». Nur 1166
1167
«Natur und Geist» 1946, 183–209. Lüschen/Stone 1977, 15, sehen in diesem Beitrag Schmalenbachs eigene Absage an die Politik, erkennen aber auch, «that he did not make a single comment on those political events» (in Deutschland 1933–1945). «Die Jdee der Neutralität», Typoskript des Davoser Vortrags, ca. 1938, in: Nachlass Herman Schmalenbach NL 106 VII. 76.
Philosophen
305
kleine Länder seien dazu imstande, aber Neutralität «ist nichts Kleines». Sie sei die Idee des organischen Lebens (Blatt 6). Schmalenbach kannte aber noch eine zweite Argumentationslinie, die zur Hochschätzung der Neutralität führe. Um diese verständlich zu machen, sprach er über seine Einsichten zum Thema «Erkennen» (Blatt 8 f.). Das Verhalten des Neutralen sei «erkennendes […] zusehend abwartendes Verhalten». In der «Gesinnung des Erkennens» bedeute Neutralität den Versuch, reine Erkenntnis zu leben; die Neutralität erweise sich so als «das Prinzip des erkennenden, des philosophischen Lebensverhaltens». Damit war die Neutralität philosophisch doppelt gerechtfertigt. Noch zwei Fragen wollte Schmalenbach danach klären: die sogenannte «Gesinnungsneutralität», die damals aktuell diskutiert wurde, und die Möglichkeit oder Notwendigkeit, dass sich der Neutrale doch noch kämpfend einer Partei anschliesse. Die Forderung nach Gesinnungsneutralität kritisierte Schmalenbach offen und eingehend (Blätter 9–12). In Wahrheit verlangten die Parteien unter diesem Schlagwort nicht Neutralität, sondern Parteinahme. Der Neutrale dürfe eine Gesinnung haben und diese auch kundtun, wenn er erkenne, dass eine Partei mehr Recht habe als eine andere. «Dass die echte Neutralität verlange, dass man niemals und auch innerlich nicht Partei ergreifen dürfe, ist also ein falscher Anspruch. Zum Erkennen gehört auch das Erkennen von Wert, auch das von negativem Wert.» Eine solche Werterkenntnis darf mitgeteilt werden, aber dies solle zurückhaltend und nicht in der Art der Parteien (und ihrer Propaganda) geschehen. Es könne allerdings Situationen geben, wo das Werturteil darauf hinauslaufe, dass man sich an der «Vernichtung der Bestie» beteiligen soll. «Das Ethos» könne gebieten, selbst bei Gefahr eigenen Untergangs in den Kampf zu gehen. «Auch der möglichst weitgehend neutral Gesinnte kann in Situationen geraten, die ihm die Neutralität unmöglich machen.» (Blatt 12) Illegitimer Gewalt müsse man mit Gewaltmitteln entgegentreten dürfen. Der Neutrale müsse deshalb gerüstet, wachsam und entschlossen sein. Dies gelte auch für den neutralen Kleinstaat, obschon es «scheint», dass nur ein starker Staat imstande sei, jeden Angriff der «dynamischen Parteien» zurückzuweisen (Blatt 15). Die Vorlesungen galten einer umfassenden Geschichte der Philosophie von der Antike bis Kant und Fichte; deshalb erschien der ursprüngliche Metaphysiker vielen Studenten als Historiker der Philosophie, der diese nach Epochen, nicht nach Persönlichkeiten gliederte.1168 Zudem befasste er sich auch in der akademischen Lehre mit Gegenwartsfragen, so las er noch vor der Ankunft in Basel 1931 über die «Ideologien der grossen Parteien» und hielt dann in Basel eine Vorlesung über den «Geist unserer Zeit» (1935). Über Grundsätze der Logik, der So1168
Landmann 1982, 80.
306
Geisteswissenschaftler
ziologie und der Psychologie hat er in Basel vorgetragen, aber auch über Ästhetik und Philosophie der Kunst sowie Philosophie der Geschichte. Platon hat ihn mehrmals beschäftigt. Als Schüler Simmels lehrte er immer auch Soziologie.1169 Grenzen zwischen Disziplinen beachtete er kaum, er war weder Spezialist noch Schulhaupt. Es scheint, dass sich Schmalenbach als ein humanistischer deutscher Patriot verstand, für den Basel eine etwas kleine und altmodische deutsche Universität innerhalb einer Schweiz war, die er nicht immer leicht verständlich fand.1170 In der Frage der Nachfolge des Romanisten Marcel Raymond setzte er sich 1936 sehr für Ernst Robert Curtius ein und teilte die von Andreas Heusler vertretene Auffassung, dass Basel analog zu deutschen Universitäten eine Romanistik brauche, die aus deutscher Perspektive auf Frankreich blicke – was nicht notwendig eine feindliche Perspektive zu sein brauchte. Denn Schmalenbach liebte die französische Kultur und Sprache.1171 Sein Schüler Hansjörg Salmony (seit 1942 als Flüchtling in Basel Student) schilderte ihn als begeisternden Lehrer, der in seinem Philosophischen Kreis eine internationale Schülerschaft um sich versammelte und faszinierte. Spürbar war für die Studenten der Einfluss Georges als «Haltung», die aber auf Goethe und dahinter auf Platon verwies, meinte Salmony, dem bewusst war, wie sehr Schmalenbach im Deutschland der Epoche vor 1933 verwurzelt bleib. Die deutsche Entwicklung seit 1933 scheint ihm grosse persönliche Probleme verursacht zu haben, die ihn für Paul Häberlin und Heinrich Barth zu einem schwierigen Kollegen machten. Der junge Schmalenbach war noch mehr als in der Basler Zeit an Gegenwartsfragen und an sozialen Themen interessiert gewesen. Als Sozialethiker bezog er sich auf William James, publizierte in den «Sozialistischen Monatsheften» und gehörte in die Kreise der Reformbewegungen in Berlin. Als der Nationalsozialismus aufkam, zog er sich zurück und hinterliess keinen öffentlichen Kommentar zu den Vorgängen in Deutschland seit 1933. Begriffe, die ihm lieb waren wie «Gemeinschaft» und «Bund», wurden in die Ideologie der Nationalsozialisten absorbiert; Kollegen, die sich damit beschäftigt hatten, namentlich Hans
1169
1170
1171
Es fällt schwer, Schmalenbach rundheraus als Vertreter der «Soziologie» an der Universität Basel zu bezeichnen, wie dies Lüschen/Stone 1977 empfehlen. Ihnen folgt Zürcher 1995, 27, ohne die strategischen Ziele von Lüschen/Stone im US-amerikanischen Kontext der 1970er Jahre zu bedenken. Die Schweiz sei in der Aufklärung steckengeblieben, habe er gesagt. Landmann 1982, 81. Sein Humanismus war mit Auffassungen durchsetzt, die auf Stefan George zurückgingen. Landmann 1982, 85, gibt zu verstehen, dass sich Schmalenbach noch 1938 mit Wolfskehl als «die geistige Jugend der Nation» fühlte. Landmann 1982, 81.
Philosophen
307
Freyer, dem sich Schmalenbach im Grunde nahe fühlte,1172 kamen mit den Nationalsozialisten zurecht. Als deutscher Humanist und Soziologe hielt er nichts von ‚Volksgemeinschaft‘. Seine letzte in Deutschland veröffentlichte Publikation war ein Beitrag zur Festschrift für Tönnies (Leipzig 1936),1173 nachdem vorher noch sein Nachruf auf Karl Joël im «Morgen»1174 von 1934 erschienen war. Offensichtlich nahm Schmalenbach Studierende in Basel auf, die in Deutschland als Juden nicht abschliessen konnten1175 oder die nach einer Odyssee als Flüchtlinge hier ankamen.1176 Sein Bruder Eugen (Betriebswirtschaftler) hatte an der Universität Köln, wo er seit 1919 einen Lehrstuhl innehatte, Probleme mit den Nationalsozialisten, weil seine Ehefrau Marianne Sachs als Jüdin galt. Er liess sich deshalb von seinem Lehrstuhl 1933 emeritieren, blieb aber in Deutschland und überlebte das Kriegsende in einem Versteck. Wie Herman Schmalenbach die nationalsozialistische Herrschaft privat erlebte, müsste aus dem Nachlass in der Basler Universitätsbibliothek erschlossen werden, was bisher niemand getan hat. Dieser Nachlass enthält einen sehr umfangreichen Briefwechsel. Auffällig sind darin die vielen Briefe von Regierungsrat Fritz Hauser, möglicherweise aufschlussreich die Briefe der Tochter Cornélia und des Schwiegersohns Pierre Thévenaz (1948 bis 1955 Philosophieprofessor in Lausanne). Nicht überraschend sind die zahlreichen Korrespondenzen mit jüdischen Verwandten und Bekannten. Zu den Basler Bekannten und Kollegen, deren Namen im Briefwechsel er1172
1173
1174
1175
1176
Lüschen/Stone 1977, 14 f., datieren dem Umschwung auf die Philosophentagung von 1928, wo ein völkischer Begriff von «Gemeinschaft» befürwortet wurde, dem Schmalenbach fernstand. Landmann 1982, 80. Lüschen/Stone 1977, 44, qualifizieren diesen Beitrag als «very weak» und deuten ihn als Zeichen für Schmalenbachs Missfallen gegenüber der Entwicklung der deutschen Soziologie seit 1933. Schmalenbach 1934. «Der Morgen» war eine von Julius Goldstein herausgegebene Zweimonatsschrift, die von 1925 bis 1938 erschien, auch mit Untertitel «Monatsschrift der Juden in Deutschland». Joël erhielt ein israelitisches Begräbnis in Basel; nach dem Rabbiner sprach dort Schmalenbach, der eine enge Vertrautheit mit Joëls Philosophie bewies. Auffällig sind die Sätze (370): «Bis in seine letzten Tage trieb die Not der Zeit Hilfsbedürftige in sein Haus, und er half, wo er konnte, oder suchte Rat, wo Hilfe zu erlangen sei. Dass auch die konservativen Kreise der Stadt sich dem aus der Ferne gekommenen Juden öffneten, beruhte auf der genauesten Kenntnis des Mannes, der sich Jahrzehnte hindurch immer wieder bewährte. Das Festhalten am Judentum war Joël ebenso selbstverständlich, wie er trotz tiefster Verbundenheit mit Basel die schweizer [sic] Staatsangehörigkeit nicht erworben, die deutsche niemals aufgegeben hat.» Nicolai Hartmann (1931 bis 1945 Professor in Berlin) schickte jüdische Studenten zu Schmalenbach, die bei ihm in Deutschland nicht mehr doktorieren konnten. Landmann 1982, 80. Ein Bsp. war Hansjörg Salmony. Füzesi 2010. Siehe auch die Webseite von Tamara Albertini: https://www.hjsalmony.com/escaping-national-socialism.html, https://www.hjsalmony. com/life-as-a-refugee.html.
308
Geisteswissenschaftler
scheinen, gehören die Kunsthistoriker Heinrich Alfred Schmid (Schmid war wie Schmalenbach begeisterter Göttinger)1177 und Joseph Gantner; unter den Basler Korrespondenten erscheinen ferner der Germanist Walter Muschg und der Gräzist Peter von der Mühll. Hinzu kommen George-Anhänger und -Anhängerinnen wie der Klassische Archäologe Karl Schefold. Schülerbriefe stammen von Ernst von Schenck (Publizist, Assistent am Philosophischen Seminar), von Michael Landmann und vor allem von Salcia Landmann (Schriftstellerin, Doktorandin von Schmalenbach und Ehefrau von Michael Landmann), um Beispiele zu nennen. Heinrich Barth hielt die Trauerrede auf Schmalenbach (unveröffentlicht, im Nachlass Heinrich Barth), obschon Barth als Nichtordinarius vorübergehend Schwierigkeiten mit Schmalenbach erlebt hatte der Unfrieden im Philosophischen Seminar wurde oft beklagt.1178 Auswärtige Philosophenkollegen, mit denen er Kontakt hatte, waren Karl Löwith und Fritz Medicus (seit 1911 Professor an der ETH Zürich), aber auch Helmuth Plessner (seit 1934 in den Niederlanden im Exil). Persönliche Freundschaft mag die Ursache sein für den Briefwechsel mit Paul Rabbow (Altphilologe).1179 Zu Schmalenbachs Umfeld gehörten zahlreiche jüdischen Freunde, was ihm gegenüber den beiden anderen Basler Philosophen eine Sonderstellung und eine genaue Kenntnis der Vorgänge im ‚Dritten Reich‘ verschaffte. Unter Vorbehalt näherer Untersuchung könnte man Schmalenbach als linksliberal bezeichnen; dafür spricht auch, dass Ernst von Schenck von 1932 bis 1945 für ihn als Assistent arbeitete.1180 Edgar Bonjour hat ihn in seiner Universitätsgeschichte von 1960 mit Worten gewürdigt, die ihm sonst nur selten in die Feder flossen: In schwerer Zeit äusserer Bedrängnisse schloss dieser späte Vertreter des deutschen Humanismus keinen Kompromiss mit der totalitären, nationalistischen Betrachtungsweise, sondern hielt den besten Überlieferungen des deutschen Geistes, einer freien Humanität, die Treue – ein akademischer Gelehrter, der sich an keinem besonderen Ort beheimatet fühlte.1181 1177 1178 1179 1180
1181
Ritschl ging davon aus, dass diese beiden (wie er selbst) an der Göttinger Universitätsfeier teilnehmen wollten, vgl. oben Kapitel 3.8 f. Kamm 1981, 250. Findbuch: https://ub.unibas.ch/digi/a100/kataloge/nachlassverzeichnisse/IBB_5_000048679 _cat.pdf. Ernst von Schenck an Zinkernagel, 29. 3. 1932, in: Zinkernagel 2020, 2023–2025 Nr. 1861. Von Schenck an Zinkernagel, 12. 9. 1934, ebd. 2406, Kommentar zu Nr. 2177. Von Schenck war Präsident der Philosophischen Gesellschaft Basel und der Ortsgruppe Basel der Neuen Helvetischen Gesellschaft, er war zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus entschlossen (Mitbegründer der Aktion Nationaler Widerstand) und bestrebt, Sympathien mit den deutschen Verhältnissen unter Schweizer Eliten aufzudecken («Information der Woche», vgl. oben Exkurs zu Däniker in Kapitel 7.5). Bonjour 1960, 714.
Philosophen
309
7.1.4 Heinrich Barth Heinrich Barth1182 wurde als Sohn des Kirchenhistorikers Fritz Barth-Sartorius in Bern geboren, studierte zuerst dort, dann in Marburg bei den Neukantianern Hermann Cohen und Paul Natorp, die ihm wichtige Anregungen vermittelten. Promoviert wurde er 1913 wieder in Bern von Anna Tumarkin. 1918 trat er nach einem Aufenthalt in Berlin und nach verschiedenen Vikariaten in Basel eine Stelle als Lehrer an der Töchterschule an, 1920 erfolgte die Habilitation, 1928 die Beförderung zum Extraordinarius, aber erst 1942 das persönliche Ordinariat. Die Karriere war nicht frei von Enttäuschungen, so hatte er 1931 auch in der Regierung Befürworter, die ihn an Stelle von Grisebach oder Schmalenbach auf der freigewordenen Philosophieprofessur sehen wollten. Als Kompensation wurde sein Lehrauftrag damals erweitert und die Besoldung erhöht.1183 Barth begann als Neukantianer, entwickelte dann aber eine eigenständige, evangelisch fundierte Existenzphilosophie, die sich zu keiner Schule in Beziehung setzen lässt.1184 In der Lehre behandelte er eingehend die Geschichte der abendländischen Philosophie, abwechselnd mit Grundfragen wie Willensfreiheit, Erkenntnistheorie, Staatsphilosophie. Oft kam er auf Augustin und Thomas von Aquin zurück, und immer wieder auf Kant. Offen gegenwartsbezogene Themen wählte er für den akademischen Unterricht zwischen 1933 und 1945 nicht.1185 1947 begann das Hauptwerk Philosophie der Erscheinung publiziert zu werden. Husserls Phänomenologie, der das Thema zu ähneln scheint, lehnte er ab und durchforstete die ganze Philosophiegeschichte auf der Suche nach einem eigenständigen Ansatz. An Theologie blieb er interessiert, teilte aber nicht alle dogmatischen Überzeugungen seines Bruders Karl und wünschte sich einen Dialog zwischen Philosophie und Theologie als gleichberechtigten Partnerinnen.1186 Heinrich Barth gehörte vor dem Ersten Weltkrieg zu denjenigen in der Zofingia organisierten Studenten, die eine schweizerische Krise diagnostizierten und die seither eine moralische Erneuerung der Nation auf christlicher Basis forderten, die den Liberalismus des 19. Jahrhunderts überwinden sollte. In Fortsetzung dieser Ideen kritisierte er wieder in den 1930er und 1940er Jahren die bei Freisinnigen und Sozialdemokraten beliebten Konzepte der «Volksherrschaft» und der 1182
1183 1184 1185 1186
«Eine Biographie, die über die Auflistung dieser wenigen äusseren Lebensdaten hinausginge, steht leider noch immer aus.» Heinrich Barth-Gesellschaft, https://www.heinrichbarth.ch/leben.html; die Webseite datiert von 2019. Vgl. Barth 1965, 3 f. StABS Protokoll S 4, Erziehungsrat Bd. 21, 1931–1932, Sitzungen vom 4.9. und 11. 12. 1931. Graf/Hueck/Zeyer 2019; Graf 2011; Graf 2008. Leander 1982, Sektion «A» des Nachlasses. Vischer 2010, 12 f. Verhältnis zum Christentum: Graf/Schwaetzer 2010. Differenzen zwischen Heinrich Barth, dessen Bruder Karl und Thurneysen: z. B. Barth/Thurneysen 2000, 551 f., 558 f. (1933), und Busch 1975, 282.
310
Geisteswissenschaftler
«Volksvertretung» aus einer konservativ-liberalen, elitären, aber sozial verantwortlichen und freiheitlichen Position heraus. Er zeigte sich auch unzufrieden mit der Konzeption von demokratischer Politik als einem organisierten Wettstreit der (materiellen) Interessen, der von selbst die Wohlfahrt fördere. Über das «Böse» in der Welt hatte er schon vor 1933 öffentlich nachgedacht und der Nietzsche-Verehrung seine christlich motivierte Absage erteilt. Eine «Ideologie des Bösen» brauchte er nicht: «Ideologien […] durchziehen unser ganzes literarisches Bildungswesen. […] Es ist ein Übermass an Ideologie, wenn sich angeregte Jünglinge als ‚Brücke und Übergang zum Übermenschen‘ zu erkennen meinen.» Seine Position war pragmatisch («sehe jeder wie er’s treibe», zitierte er Goethe), das Böse gehöre in die «Welteinheit», und er wollte «Luzifer» nicht durch falsches Moralisieren verdunkelt sehen, sondern ihn als «Verkünder der nahenden Herrlichkeit der Morgensonne» wirken lassen, allerdings im Bewusstsein, dass sein Licht nur «geliehen» sei und schliesslich «erlöschen darf».1187 Barth setzte sich ausführlich und öffentlich mit Alfred Rosenbergs Mythus des 20. Jahrhunderts auseinander, jedoch erst 1937. Die erste Ausgabe dieses Buches war schon 1930 erschienen ich haben den Eindruck gewonnen, dass in Basel erst im Verlauf der 1930er Jahre verstanden wurde, dass es eine Schlüsselfunktion für die nationalsozialistische Weltanschauung hatte. Fritz Lieb folgte Heinrich Barth ein Jahr später mit seinem Beitrag über Rosenberg zur Sammelschrift deutscher Emigranten, die Emil Julius Gumbel1188 in Strassburg 1938 herausgab.1189 In Liebs Ansatz kommt sein Bedürfnis, die eigene Position nicht nur innerkirchlich, sondern auch parteipolitisch zu bekennen, zum Ausdruck. Diese Absicht fehlte in Barths Vortrag vor dem Positiven Gemeindeverein St. Elisabethen-Gundeldingen.1190 Barth fasste Rosenbergs Mythus als einen (Ersatz⌥)Glauben der Gottlosen auf, der auf die materielle Seite der menschlichen Existenz, die Rasse, abstelle und somit eigentlich den Menschen selbst zum Gott mache (darin war Lieb mit ihm einig) – wobei er zunächst keinen Anstoss an «Rasse und Blut» als «materiell gedachte Grundlage» nahm. Nur dass Rosenberg der Rasse auch «Seele» zuspreche und behaupte, jede Rasse habe eigene Werte der Seele und des Charakters (Blatt 10), war für Barth wirklich unzulässig. Die Rasse sei das «Goldene Kalb» der Nationalsozialisten. Anders als Lieb zeigte Barth für diesen ‚Tanz‘ der verzweifelten Deutschen ein gewisses Verständnis. Deren Not sei seit 1918 1187 1188 1189
1190
Barth 1931, 18, 20 f. Leo 2010, 52 ff.; Brenner 2001; Wolgast/Kogelschatz 1993. Lieb 1938. Rosenbergs Buch war schon 1930 erschienen. Liebs Kritik war nicht die einzige von protestantischer Seite; ihr voraus ging z. B. Künneth 1935. Darin wurde jedoch der Antisemitismus gutgeheissen. Vgl. meine Ausführungen im Kapitel über die Theologen, oben Kapitel 4.3.5. Heinrich Barth: «Der Mythus des 20. Jahrhunderts». Konzept eines Vortrags vor dem Positiven Gemeindeverein St. Elisabethen-Gundeldingen, 17. 1. 1937, Typoskript, in: Nachlass Heinrich Barth, NL 108, B 43.
Philosophen
311
(oder schon während des Krieges: «Erschütterungen des Krieges und der Nachkriegszeit», Blatt 7) so gross gewesen, dass sie – wenn sie nicht Christen waren – in ihrer Verlassenheit und Orientierungslosigkeit in der Bespiegelung ihres besseren (sic) Selbst einen Götzen schufen und anbeteten (Blatt 20). Zu den Merkmalen dieser «Not» rechnete Barth die Stärke der Sozialdemokratie in der Weimarer Republik, den Kommunismus und zugleich den entfesselten Kapitalismus, aber auch die «jüdische Frage», die «so oder so» gelöst werden müsse – was meinte er damit? In seinem Typoskript schrieb er skizzenhaft, die Deutschen seien ein Volk, dem jede zusammenfassende geistige Kraft abhanden gekommen ist, und das sich darum in zahllose Sonderinteressen und Sonderüberzeugungen verloren hat. Kein Zweifel, dass hier nicht nur Schreckgespenster gesehen wurden. Unmöglich, auf die Mentalität der Sozialdemokratie, also etwa auf den kollektiven Egoismus der Gewerkschaften, das Deutsche Reich zu gründen. Der Kommunismus in Wahrheit eine Gefahr; kein Land kann einen permanenten Revolutionsherd ertragen; so gut wie der Kapitalismus, sofern mit ihm der schrankenlose Individualismus des wirtschaftlichen Gebarens gemeint ist. Das Judentum, als Bestandteil des deutschen Volkes, sicher eine Frage die man nicht beiseite schieben kann, ob man sie so oder so löst. All diese Faktoren gesehen als Elemente der Zersetzung; und nirgends ein übergreifender, machtvoller Glaube, der ihr Halt geboten hätte (Blatt 21).
Den Schluss bildeten Andeutungen zur Schweiz, der bisher eine vergleichbare Not erspart geblieben sei, und das Glaubensbekenntnis, das seine Zuhörer bestimmt von ihm erwarteten: Uns Schweizern bleibt die Versuchung zu diesem Götzendienst erspart; nicht durch unser Verdienst! Andere Götzen sind uns nicht unbekannt. Wer weiss, wonach wir greifen, wenn wir einmal in ähnliche Notlage […] geraten! […] Wir sind in grosser Gefahr! Eine Bewährung in ihr gibt es nicht durch Vergottung des Menschen, sondern durch jenen andern Glauben dass Gott sich in Christus zum Menschen – zum gottfernen Menschen! – gefunden hat (Blatt 25).
Sein erstes Anliegen war in diesem Moment die Rettung des Seelenheils angesichts der Versuchungen, die die Not bereithielt, bei aller Aufklärung über den angeblichen «Mythus» und die Mechanismen, durch die seine Bilder eine mächtige Wirkung entfalteten. Diese Aufklärung leistete er auch – wenn auch mit einer nicht zurückgenommenen Bewunderung für Rosenbergs «Hauptwerk», das er als «ungemein reichhaltig und anregend» bezeichnete. Im Krieg engagierte sich Heinrich Barth in der Verteidigung der Demokratie durch eine explizite Kritik an faschistischen Ideen wie Ständestaat, autoritäre Staatsführung, Volksgemeinschaft und auf völkischer resp. ‚rassischer‘ Basis konzipierte nationale Einheit (Der Sinn der Demokratie), was ihn mit der Zensur in
312
Geisteswissenschaftler
Kontakt brachte.1191 Dabei entwickelte er eine christlich-konservative Idee der direkten Demokratie. Diese sollte auf der unmittelbaren Partizipation der Bürgerschaft beruhen, zum Majorzsystem zurückkehren, um herausragenden Persönlichkeiten statt Parteiinteressen Chancen in den Wahlen zuzugestehen, aber im Unterschied zu einer «Volksherrschaft» sollten höhere Interessen leitend sein, die nicht von «Volksvertretern», sondern von zwar demokratisch gewählten, aber vor allem ihrem Gewissen verantwortlichen Staatsmännern («Elite») repräsentiert würden. In solchen seit 1938 veröffentlichten Texten griff er deutsche Verhältnisse nicht explizit an (wohl seit Kriegsausbruch auch aus Rücksicht auf die Zensur), machte aber deutlich, wie er das Funktionieren einer inhumanen Ideologie in den Diktaturstaaten verstand und warum er sie verurteilte. Barth plädierte für einen christlichen Humanismus, der die Menschenrechte nicht aus dem Naturrecht herleitete, sondern daraus, dass die Menschen nach Gottes Ebenbild geschaffen worden seien. Er nutzte die Gelegenheit, 1938 einen Kongress über Rechtsphilosophie mit einem magistralen Gang durch die Geschichte des Rechtsdenkens einzuleiten. Dabei würdigte er zwar die deutsche romantische Lehre, die das Recht als Ausdruck des «Volksgeistes» verstand (Friedrich Carl von Savigny und Johann Jakob Bachofen erwähnte er namentlich), als «edle Geistigkeit». Aber er zeigte auch auf, welches Unheil deren neuere Ausprägung anrichte, die «minder geistvolle Ideologie des ,totalen Staates‘, dessen Substrat, das Volk, für diese naturalistische Mystik als die Einheit bluthafter Verbundenheit hingestellt wird».1192 Barth leistete seinen Beitrag zur ‚geistigen Landesverteidigung‘ spätestens seit 1940, nach der Niederlage Frankreichs und angesichts einer helvetischen Stimmungslage, der die Schweiz jedenfalls in ihrer herkömmlichen demokratischen Ordnung dem Untergang geweiht zu sein schien, vor der Neuen Helvetischen Gesellschaft, in der Presse und vor seiner Kirchgemeinde. Deutlich erteilte er den ‚Erneuerungsbewegungen‘, die nach dem Mai 1940 nochmals ihre Zeit gekommen glaubten, eine Absage. Die Rede von der ‚Neuordnung Europas‘ und das Ansinnen, die Schweiz an einem «weltgeschichtlichen ‚Umschwung‘» durch «Anpassung» oder «Gleichschaltung» teilhaben zu lassen, durchschaute er als nationalsozialistische Propaganda, die «weltgeschichtliche Betrachtungen» (die verkehrte Nutzung der Ideen Jacob Burckhardts nannte er nicht explizit, zitierte aber den Buchtitel) missbrauche. «Schweizerische Eigenart» zu betonen, erschien ihm eine unzulängliche Antwort. Denn diese sei voller Schwächen: Das helvetische öffentliche Leben sei auf «Mittelmässigkeit» ausgerichtet, es herrsche «feige Verlagerung der Verantwortung» und «Trägheit», der «Egoismus der wirtschaftlichen Sonderinteressen» dränge sich vor. Diese Fehler seien nicht den Institutionen, sondern den Men1191 1192
Barth 1941a. Bundesarchiv Bern, E10032 Abteilung Presse und Funkspruch, E4450#1000/ 864#1753*. Barth 1938, 442 f.
Philosophen
313
schen anzulasten. Der Zusammenhalt der «Gemeinschaft» könne auf die Dauer nicht durch rein weltliche Tugenden erhalten bleiben, denn solche seien kein Ersatz für «die Grundlage des christlichen Glaubens, auf der sich einst auch in der Schweiz das staatliche Leben aufgebaut hat». Der «Kleinstaat» habe keine Existenzberechtigung aus sich selbst, es sei denn er diene einer «geschichtlichen Mission». Diese wollte er auf der Basis einer richtig verstandenen Demokratie bestimmen. Ihre Verfassung beruhe auf einer «tief verwurzelten Humanität». Darum müsse die «Volksherrschaft» «auch schutz- und machtlosen Minderheiten ihre Fürsorge angedeihen» lassen. Die wahren «Volksvertreter» seien dem «Gesamtinteresse» verantwortlich. «Das schweizerische Staatswerk beruht […] nicht auf einer naturrechtlichen Konstruktion, vielmehr auf dem geschichtlichen Erbe, das uns anvertraut ist. Und wie denn geschichtliche Existenz im Horizonte des Ewigen existiert, so wird nur dann das Staatswerk gut vollbracht, wenn es auf Ewigkeit ausgerichtet ist.»1193 Als deutlich wurde, dass sich der Krieg zu Ende neigte, schrieb er für das breite Lesepublikum eine relativ umfangreiche Staatsphilosophie der Schweiz.1194 Er sah eine Nachkriegskrise voraus, in der um die Erhaltung des Lebensstandards gerungen werden müsse, und er bezweifelte, dass eine weltliche Ausrichtung auf das Gemeinwohl, wie er sie von den angelsächsischen Siegermächten in Vorwegnahme der UNO-Charta erwartete, einen «wirklichen Lebensinhalt» bieten könne; dies vermöge nur die «Christuswahrheit» als «Fundament unserer Eidgenossenschaft».1195 Die individuelle und politische Freiheit folgte für ihn aus dem Dienst an der «Gemeinschaft», die nach dem Vorbild der christlichen Gemeinden «transzendent» begründet sein solle. Im Rückgriff auf Augustin,1196 dem er auch eine eigene Schrift gewidmet hatte,1197 sah er den weltlichen Staat in einem Bezug auf den «Gottesstaat». Und in Erinnerung an den Bund der Eidgenossen (1291) plädierte er für einen ideologiefreien, pragmatischen Zusammenschluss zur Lösung gemeinsamer Aufgaben «im Namen Gottes» und ohne Staatsvergötzung. Schon 1938 hatte er in einem Vortrag vor der Basler Lehrerschaft den ‚Dritten Humanismus‘1198 angegriffen und mit ihm zugleich auch dem deutschen Idealismus von Schiller bis Humboldt eine Absage erteilt. Er sah darin eine Reduktion 1193
1194 1195 1196 1197 1198
Zitiert aus Barth 1941b. Die Argumentation ist ähnlich in: Barth 1941 (aber mit explizit theologischen Elementen wie «Volksherrschaft durch Gottesherrschaft», 22) und Barth 1941a (mit einer Diskussion des Souveränitätsbegriffs und einem Bekenntnis zur «demokratischen Humanität», die «heute durch ganze Fluten von Menschenverachtung hindurchgerettet werden» müsse, 30). Barth 1943. Barth 1943, 10 ff., 26 f. Barth 1943, 72 ff. Barth 1935. Vgl. dazu mein Kapitel über die Altertumswissenschaften, unten, 7.2.2.2.
314
Geisteswissenschaftler
der Bildung des Menschen auf ästhetische Prinzipien und einen Versuch, den Menschen «ideologisch» in «Totalität» zu erfassen. «Ein herrliches Phantom des Menschen, eine trügerische Geschlossenheit seines Bildes, ein Idol, das die Bildung in einem vollendeten Menschenbilde gefangennimmt!»1199 Den deutschen Bildungsbegriffen stellte er Johann Heinrich Pestalozzi mit seiner «unpathetischen, sachlichen Weisung»1200 gegenüber. In der säkularisierten Staatsschule gebe es nur das pragmatische Ziel, die Menschen zu einer Lebensführung und Berufsausübung zu befähigen, die dem jeweiligen Individuum entspräche. «Nicht zum Menschen, sondern zu seinem menschlichen Lebenswerke soll der werdende Mensch herangebildet werden.» Kein «Idol» dürfe Schulbildung leiten.1201 Auch vergass er nicht, eine «Besinnung» einzufordern «auf die unverrückbaren Voraussetzungen aller Bildung, die die Voraussetzungen des Lebens selber sind!»1202 – was er auch mit dem Begriff der «Transzendenz» verdeutlichte,1203 ohne diesen explizit zu erklären, denn dies tat er meist nur, wenn er in einem kirchlichen Kontext sprach. Man erkennt auch in dieser Diskussion, wie Barth für die Freiheit der Menschen, und hier für diejenige der Kinder, plädierte, die als Geschöpfe Gottes immer schon «Menschen» seien, eine Freiheit, die weder von den alten Griechen noch der französischen Revolution noch der deutschen idealistischen Philosophie herrühre, sondern aus dem Glauben komme.1204 7.1.5 Ergebnisse So zeigte sich in der Basler Philosophie von 1933 bis 1945 ein breites Spektrum von Haltungen. Am rechten Flügel stand Häberlin mit seiner Offenheit auch für die frontistische ‚Erneuerung‘ in der Schweiz und einer merkwürdigen Indifferenz gegenüber den Wirkungen des Nationalsozialismus in Deutschland – ausgenommen seine eindeutige Ablehnung der Nazifizierung der Wissenschaft. Er vertrat die in Basel nicht seltene Position, dass zwischen dem Nationalsozialismus und den freien schweizerischen Universitäten vermittelt werden müsse, wobei der menschliche Kontakt zwischen deutschen und schweizerischen Professoren nicht abreissen dürfe. Schmalenbach, der aufgrund seiner Jugend als Berliner Reformer, als humanistischer George-Anhänger und Leibnizianer, aber auch wegen seiner Nähe zum deutschen Judentum prädestiniert gewesen wäre, seine linksliberale Stimme zu erheben, verstummte leidend, zog sich oft in die reine Wissen1199 1200 1201 1202 1203 1204
Barth 1938a, 14–21. Barth 1938a, 21. Barth 1938a, 11. Barth 1938a, 26. Barth 1938a, 22. Barth 1965, 9–14: «Gedenkrede des Herrn Dr. Armin Wildermuth», Zit. 13 f., unter Verwendung der Terminologie, die Barths Schüler nach 1945 aufnahmen.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
315
schaft zurück und arbeitete über Grundlagen des Erkennens und des Seins. Sein öffentliches Engagement für ein richtiges Verständnis der Neutralität scheint eine Ausnahme gewesen zu sein. Barth hingegen war als religiöser und philosophischer Zeitgenosse kritisch aktiv und publizierte seine freiheitlichen Argumente gegen Bestandteile der nationalsozialistischen Ideologie, die als vermeintliche Beiträge zu einer ‚erneuerten‘ schweizerischen Staatsgesinnung angeboten wurden. Dabei vertrat er ähnliche Positionen wie die Basler Theologen, stand aber auch in einer Linie mit dem seit 1910 üblichen Krisendiskurs, indem er eine Revision der Grundlagen der Nation und ihrer politischen Ordnung aus dem christlichen Glauben forderte.
7.2 Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker 7.2.1 Einleitung Sprachen und Literaturen waren Fächer, denen für das Verhältnis zu den Nachbarstaaten und Nachbarkulturen eine grosse Bedeutung zukam. Dem romantischen Verständnis galten Sprache und Literatur als Zugangswege zum Wesen der Nationen. Die Art, wie ihre Bedeutung aufgefasst wurde, mochte sichtbar werden lassen, wie sehr sich die Basler Eliten identifizierten mit oder distanzierten von verschiedenen Völkern. Aus provinzieller Warte galten die Sprachen und Literaturen der Nachbarvölker als die zentralen kulturellen Erscheinungen, an denen der gebildete Schweizer teilhaben musste. Ungeachtet seiner geographischen Nähe zu Frankreich – das Elsass war für viele ein Teil des deutschen Sprachraums geblieben, trotz der Reintegration in den französischen Staat für die als kurz erlebte Phase von 1918 bis 1940 – schaute der Basler nach Deutschland, wo er studiert hatte, wo er Goethes Geist oder den neuesten Entwicklungen der Kunst seit den ersten Jahrzehnten des noch jungen 20. Jahrhunderts begegnet war. Griechisch und Latein hatte er während acht Jahren am Gymnasium getrieben, und wenn er kein Banause war und blieb, waren dies für ihn die Sprachen und Literaturen schlechthin, von denen ausgehend er sich anderen näherte. Die Bildung der Elite hatte ihr Fundament in diesem Unterricht erhalten, der von der deutschen Philologie geprägt war. Mächtig war der Effekt, den die Stellung von Sprachfächern an den höheren Schulen auf die Universität hatte. Die kulturelle Führung lag bei der Tradition des humanistischen Gymnasiums, und dort kam den Alten Sprachen der erste Rang zu, gefolgt vom Deutschen und Französischen. Der Humanist konnte sich das Italienische selbst beibringen, die Hochsprache durch die Lektüre, die Volkssprache durch seine sommerlichen Reisen nach Süden zu den antiken Stätten und den von Jacob Burckhardt beschriebenen Kunstwerken. Das Italienische war auch die Sprache der Musik, ein Grund mehr, es wichtig zu nehmen. Das Engli-
316
Geisteswissenschaftler
sche zu schätzen gelehrt hatten die deutschen Klassiker mit ihrer ShakespeareBegeisterung, und ein Segment der Basler Gesellschaft blickte deshalb so gern nach London wie ein anderes nach Paris. Daraus resultierte die Vertretung und Gewichtung der Sprachfächer an der Universität. Griechisch und Latein hatten je einen eigenen Lehrstuhl. Deutsch hatte deren zwei, einen für Sprache und ältere Literatur, den anderen für die neuere Literaturgeschichte. Auf ähnlichem Fuss stand seit den 1930er Jahren das Französische. Die Vertretung des Italienischen arbeitete sich mühsam von einer Sprachlehrerstelle zur eigenen Professur empor, und davon musste eine genügen. Nur eine Professur war auch dem Englischen zugedacht, doch diese war schon zu Beginn meiner Untersuchungsperiode voll ausgebildet. Russisch erhielt nach kleinen Anfängen mit einem Lektorat schliesslich ein Extraordinariat; das Fach umfasste eine Art Landeskunde, Sprache, Literatur und Volkskunde des Russischen. Manche anderen Sprachen erschienen bloss auf der Stufe eines Lektorats oder Lehrauftrags, mit einer Ausnahme: die orientalischen Sprachen verfügten über eine eigene Professur. Die Geschichte fast aller Sprachfächer ist für meine Frage nach den Beziehungen zu Deutschland in den Jahren von 1933 bis 1945 relevant, wenn auch in unterschiedlichem Mass. Ich illustriere dies hier nur mit einigen Hinweisen; weitere Dimensionen werden sich in den nachstehenden Sondierungen, die angesichts begrenzter Ressourcen nur zu einzelnen Personen oder Fächern unternommen werden können, zeigen. Die Alten Sprachen hatten, geschichtlich bedingt, eine untrennbare Verbindung zur deutschen Klassik, den deutschen Humanismen und der deutschen Klassischen Philologie. Aus der Geschichte des ‚Dritten Humanismus‘ ist bekannt, dass manche Erscheinungsformen des Humanismus zunächst keine Bollwerke gegen den Nationalsozialismus bildeten. Wie es um den in Basel gelebten Humanismus der Altertumswissenschaftler stand, lohnt somit eine Untersuchung. Im Fach Deutsch wurden vom germanischen Altertum bis zu den neuesten literarischen Werken die meisten Erscheinungen gelehrt, die auch für die deutsche Nationalkultur von entscheidender Bedeutung waren. Deren ideologische Verflechtungen sind offensichtlich, doch zeigten sie sich in gleicher Weise auch in der Basler Germanistik? Oder konnte diese ein Refugium sein für alles, was nach 1933 in Deutschland unter die Räder kam? Wie stand es um das Französische war es Gegenstand der Identifikation wie für viele Künstler, die regelmässig den direkten Zug nach Paris bestiegen, ein Quell der Bildung, oder dominierte eine deutsche Auffassung? Hatte die schweizerische Nationalperspektive auf der Grundlage der Mehrsprachigkeit einen Einfluss in Basel? War Italienisch aus nationalpolitischen Motiven als dritte Landessprache in Basel präsent oder eher weil Dante Bestandteil der allgemeinen Bildung der Elite war?
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
317
7.2.2 Klassische Philologen, Althistoriker und Klassische Archäologen: Humanistische Altertumswissenschaften 7.2.2.1 Einleitung Der Basler Humanismus begründete eine Distanz zum Nationalsozialismus, die tief empfunden wurde. Ich werde am Ende des Kapitels versuchen, den Geist dieses Humanismus oder den «humanistischen Widerstand»1205 auch in seiner Differenz zur deutschen Klassikverehrung zu charakterisieren, um seine Bedeutung für die ‚Resistenz‘ gegenüber der im nördlichen Nachbarland seit 1933 herrschenden Ideologie zu ermessen. Angesichts der dominanten Position der deutschen Klassischen Philologie und anderer deutscher Wissenschaften vom Altertum in der gelehrten Welt des 19. und des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts war es selbstverständlich, dass die Basler Gelehrten einen oft prägenden Teil ihrer Ausbildung in Deutschland erfuhren, sich dadurch in die deutsche wissenschaftliche Gemeinschaft integrierten und in deutschen Zeitschriften und Verlagen publizierten. Für den Basler Humanismus stellte das Humanistische Gymnasium einen für die Lehre fast noch wichtigeren Ort als die Universität dar, sowohl pädagogisch wegen der im Vergleich zum akademischen Fachstudium grösseren Reichweite als auch für die Rekrutierung des akademischen Unterrichtspersonals unter der Lehrerschaft. Das Griechische und das Lateinische nahmen als einzige altertumswissenschaftliche Schulfächer an der Universität eine dominierende Stellung ein. Die zunächst auffällige Verbindung von Griechischer Philologie mit Volkskunde, die Peter von der Mühlls Freund und Schüler Karl Meuli in Basel entwickelte, erscheint natürlich, wenn die Bedeutung des Erbes von Johann Jakob Bachofen berücksichtigt und der Stellenwert ethnologischer Erscheinungen für die Homerforschung, wie sie von der Mühll pflegte, in Rechnung gestellt wird. Der Stellenwert der Alten Geschichte war in Basel eher gering. Ihr Vertreter Felix Stähelin hatte einen schweren Stand neben den Geschichtsprofessoren, die sich als Universalhistoriker auch der Antike zuwandten und einem Obligatorium für Geschichtsstudenten, Stähelins Unterricht zu besuchen, abgeneigt waren. Allein schon der Umstand, dass die Alte Geschichte auf dieselben Texte, Corpora und Lexika angewiesen war, die die Klassischen Philologen benützten und die im Historischen Seminar fehlten, zwang den Fachvertreter zu einer engen Anlehnung an die Philologen.1206 Felix Stähelin war stark vom Erbe seines Grossonkels Jacob 1205 1206
Am Bsp. von Ludwig Curtius sprechen Chaniotis/Thaler 2006, 301, von «humanistischem Widerstand». Auf Initiative von Felix Stähelin, der sich von den «Universalhistorikern» am Historischen Seminar bedrängt sah und der zugleich auf die Bibliothek der Altphilologen angewiesen war, wurde 1934 das Seminar für Alte Geschichte geschaffen, was als Abtrennung dieses Faches von der Historie verstanden werden konnte. Königs 1988, 23–29.
318
Geisteswissenschaftler
Burckhardt geprägt, dessen Nachlass er erschloss, und damit von vornherein kritisch gegen den Einfluss einer von Friedrich Nietzsche herkommenden, deutschen Burckhardt-Interpretation eingestellt.1207 Marginal in institutioneller Hinsicht (obschon an sich in wissenschaftlicher Hinsicht fundamental) war die Lage der Allgemeinen, Vergleichenden oder Indogermanischen Sprachwissenschaft, nachdem die überragende Gestalt von Jacob Wackernagel abgetreten war. Die Klassischen Philologen hatten selbst Lehrstühle für ‚Sprache und Literatur‘ inne, so dass sie der Sprachwissenschaft eine propädeutische oder ergänzende Funktion zuwiesen, für die seit 19331208 ein nebenamtlicher Dozent, Johannes Lohmann, der jeweils aus Freiburg i. Br. anreiste, zu genügen schien. Zu einer definitiven Lösung kam es nicht.1209 Erst nach Lohmanns Versetzung von Freiburg an die Universität Rostock1210 lehrte mit Albert Debrunner ab Sommersemester 1940 ein Schweizer das Fach, der jedoch ähnlich wie Lohmann zur Hauptsache an einer anderen Universität, in seinem Fall in Bern, beschäftigt war. Wir sehen hier eine Folge der faktischen Grenzschliessung für die Personalrekrutierung in Basel. Basel war vorübergehend der Ort, an dem die umfassende Bibliographie der Altertumswissenschaften, die «Année philologique», zusammengestellt und redigiert wurde. Die Redaktorin Juliette Ernst liess sich im April 1940 von Frankreich herkommend hier nieder, um im Geist einer «humanistischen Resistenz» das Werk weiterzuführen. Ihren Lebensunterhalt finanzierte sie zunächst als Französischlehrerin am Mädchengymnasium, dann ab Herbst 1942 als Lektorin am Romanischen Seminar.1211 In einer gewissen Nähe zu den Altertumswissenschaften stand die Orientalistik, die in Basel von 1922 bis 1949 durch Rudolf Tschudi vertreten wurde.1212 Ihn verband eine Freundschaft mit Peter von der Mühll; beide Professoren reisten oft gemeinsam und in Begleitung von Karl Meuli den Sommer über nach Griechenland und in den Vorderen Orient. Die Archäologie war zwar mit Ernst Pfuhl in Basel durch einen angesehenen Forscher vertreten.1213 Die Philologen verfügten aber selbst über bedeutende Kenntnisse der antiken Kunst, so dass sie 1207 1208 1209 1210
1211 1212
1213
Protest gegen das von Edgar Salin verfasste «Rektoratsprogramm» über das Verhältnis zwischen Jacob Burckhardt und Friedrich Nietzsche in Kapitel 7.7.4, unten. StABS Erziehungsrat Protokoll S 4 Bd. 22, 1932–1934, 3.7., 9.10., 25. 10. 1933. StABS Erziehungsrat Protokoll S 4 Bd. 24, 1936–1938, 31. 5. 1937. portal.uni-freiburg.de/indogermanistik/seminar/historia.html. Lohmann wurde offiziell per Ende September 1940 von seiner Basler Lehrverpflichtung entbunden, und die Lohnzahlungen auf dieses Datum eingestellt. StABS Erziehungsrat Protokoll S 4 Bd. 25, 1938– 1940, 1. 5. 1940. Hilbold 2022, 171 ff, 191 f. Bigger 2015. Tschudi war ein Freund von Aby Warburg und Unterstützer von dessen Assistenten Saxl. Gertrud Bing an Werner Kaegi, 2.9.[1933?], in: Paul Sacher Stiftung, Nachlass Werner Kaegi, WK 178. Kaufmann-Heinimann 2012, 19.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
319
keine Notwendigkeit sahen, die Klassische Archäologie auszubauen, sie förderten jedoch die Anschaffung archäologischer Werke. Vor diesem Hintergrund war es bemerkenswert, dass sich in der Person von Karl Schefold ein deutscher ‚Emigrant‘ als Privatdozent für Archäologie habilitieren konnte. Nach Pfuhls Tod stieg er unter einer vom herausragenden Zürcher Lehrstuhlinhaber Arnold von Salis versehenen Fachvertretung langsam, aber stetig nicht nur zum Ordinarius auf (persönliches Ordinariat 1953, Lehrstuhl 1960), sondern etablierte eine eigene Schule mit zahlreichen Doktoranden. Schliesslich schuf er mit Unterstützung wirtschaftlich potenter Freunde ein Antikenmuseum, das internationales Aufsehen erregte. Die geforderte archäologische Ergänzung zur Philologie war nicht «antiquarisch» («realienkundlich») oder Ausgrabungstechnik, sondern eine Kunstgeschichte oder Kunstwissenschaft der Antike. Ich skizziere im Folgenden zunächst die Lage der Altertumswissenschaften im nördlichen Nachbarland als Folie für die Basler Verhältnisse und Entwicklungen. In diesem Rahmen werfe ich kurz einen Blick auf Matthias Gelzer, einen Basler, der in der deutschen Althistorie eine zentrale Stellung innehatte und nicht nach Basel zurückehrte. Schliesslich stelle ich die altertumswissenschaftlichen Basler Fächer im Hauptteil des Abschnitts dar mit dem Ziel, die Beziehungen ihrer Vertreter zu Deutschland in der Zeit zwischen 1933 bis 1945 soweit möglich zu klären. 7.2.2.2 Altertumswissenschaften in Deutschland nach 1918 Zwar äusserst vielfältig, weil durch starke Individualitäten getragen, war die Entwicklung der Grundpositionen in den deutschen Altertumswissenschaften seit 1918. Aber wie in vielen andern Fächern herrschte eine Abwehrhaltung gegenüber der Weimarer Republik vor. Zu den allgemeinen Vorbehalten gegen die neue Verfassung kam die Befürchtung, dass die Demokratie der zentralen Stellung der klassischen Bildung im Schulwesen den Garaus machen wolle. Dies motivierte viele Fachvertreter dazu, die Relevanz der Antike für ihre Gegenwart neu zu artikulieren. Dafür wurde die Wahrnehmung einer «Kulturkrise»,1214 verbunden mit dem Aufstieg der «Herrschaft der Massen» und des «Maschinellen» fundamental.1215 Zudem sollte das ‚19. Jahrhundert‘ wie in anderen Geisteswissenschaften so auch in den Altertumswissenschaften überwunden werden. Dazu schien eine Abkehr von der «Realienkunde» und von einem Präsentismus, der die Antike direkt vergegenwärtigen wollte, nötig zu sein. Indirekt sollte das Altertum für die Gegenwart relevant werden. Antike Staatsphilosophie und die Kenntnis der Geschichte der Polis wurden als Lehrmeisterinnen für die von Revolution 1214 1215
Ansätze für eine Bewältigung dieser «Krise»: Jansen 2018. Landfester 2017, 5; Landfester 1995, 13.
320
Geisteswissenschaftler
und Sozialismus bedrohte Gegenwart empfohlen. Im Zeichen der «Kulturkrise» suchte eine neue Wissenschaft nach «Ursprüngen» und «Wesen», die sie auch durch Intuition, «Schau», erahnen wollte.1216 Die Kritiker der Moderne wurden neu gelesen: Das Mutterrecht von Johann Jakob Bachofen, die Griechische Kulturgeschichte von Jacob Burckhardt und insbesondere eine bestimmte NietzscheRezeption,1217 die im Ersten Weltkrieg einsetzte, dienten zu einer Überwindung des «Positivismus», aber auch oft zur Widerlegung eines idealisierenden Bildes der Antike zugunsten einer manchmal offen antiklassischen Sicht insbesondere der Griechen. Das unmittelbar aus der Überlieferung und den Inschriften Greifbare sollte ergänzt werden durch Vorstellungen aus der Ethnologie, der Religionsgeschichte und einer neuen Idee von Kultur und Klassik, die die Antike auch im Rahmen der Fachwissenschaft zu einem Gegenstand des Bildungserlebnisses machte. Kaum im Widerspruch dazu standen Tendenzen, mit Dimensionen wie «Raum», «Volk», «Rasse» auch anonym wirkende Kräfte einzubeziehen; vorherrschend blieb aber die Beschäftigung mit den Grossen, deren Ideen und Taten. ‚Völkische‘ Ansätze konstruierten eine Verwandtschaft, Kontinuität oder gar Identität zwischen den alten Griechen und den Deutschen als «nordisch»,1218 und die Verschiedenheiten der griechischen «Stämme» wurden schliesslich als «rassische» Unterschiede gedeutet, wobei oft den Doriern oder Spartanern der Vorzug vor den Athenern oder den Ioniern gegeben wurde.1219 «Warnungen vor der Gefahr einer von völkischer Ideologie geprägten fachlichen Diskussion, wie sie der Kunsthistoriker Erwin Panofsky, wenn auch als einziger seiner Zunft, schon 1927 formuliert hatte, gab es auf Seiten der Klassischen Archäologie weder in der Weimarer Zeit noch nach 1933.»1220 In der Fachliteratur erschienen diese Tendenzen meistens gemässigt, während sie in der Kulturgeschichte für das Laienpublikum – und für die Ideologen des Nationalsozialismus – eine prominente Stelle einnahmen. Wissenschaftshistorisch gelten insbesondere die 1920er Jahre als eine Zeit des Aufbruchs.1221 Jüngere Wissenschaftler lösten sich von der Dominanz von Ulrich Wilamowitz-Moellendorff und Eduard Meyer im Zeichen der neuen Auffassungen, die zum intellektuellen Klima jener Jahre gehörten. Der Gesichtskreis erweiterte sich durch Blicke auf die Randregionen der klassischen Antike, auf die Spätantike und die Frühzeit der Wanderungen. Die einen entdeckten Mythen,
1216 1217 1218 1219
1220 1221
Landfester 1995, 18 f. Färber/Link 2019, 351. Borbein 1995, 239 f. Losemann 1998. Der Unterschied zwischen Dorern und Ioniern war schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts herausgearbeitet worden, wurde aber erst später ‚völkisch‘ aufgeladen. Brands 2012, 15. Marchand 2003, 129.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
321
Riten und Religionen und suchten das Irrational-Dunkel-Ursprüngliche in der Antike, die andern betonten (meist mit einer positiven Akzentuierung) das «Gebundensein» des «antiken Menschen» in Kult, Familie («Geschlecht», «Verwandtschaft», «Volk», «Rasse») und «Polis». Nun erhielten Ansätze wie diejenigen der Usener-Schule1222 der antiken Religionsgeschichte eine Chance zur Entfaltung. Die Religionsgeschichte tendierte dazu, im Sinn einer liberalen Theologie (und damit einer noch dem 19. Jahrhundert zugehörigen Strömung) das Christentum aus antiken Wurzeln heraus und in Kontinuität zum Hellenentum zu verstehen,1223 wodurch, beabsichtigt oder ungewollt, der fortwirkende jüdische Einfluss auf die frühen Christen schwächer gewichtet oder gar geleugnet wurde. Für die Historie standen weiterhin die grossen Staatsmänner im Mittelpunkt, die ‚Geschichte machten‘ oder das ‚Wesen‘ ihres Volkes verkörperten, auch vor dem Hintergrund der Hoffnung, dass eine starke Persönlichkeit in Deutschland Ordnung schaffen und den nationalen Wiederaufschwung bewerkstelligen werde. Das erwachte Interesse für Gesellschaft, Kultur und Geist ermöglichte es einigen Autoren wie Matthias Gelzer, ihre ‚grossen Männer‘ historisch in die Gegebenheiten («Strukturen») ihrer Epochen einzubetten. Die Klassische Archäologie wurde zur Kunstwissenschaft nach Anleitung von Heinrich Wölfflin oder im Sinne der Kunstbetrachtung, die sich nach Stefan George richtete. Die Ausgrabungen, die die Epigraphik und die Realienkunde bis in den Ersten Weltkrieg gefördert hatten, wurden zwar von der Weimarer Republik nach einer Phase des Geldmangels wieder recht grosszügig als Teil einer deutschen Kulturpolitik aufgenommen, für die Lehrstühle aber wurde immer mehr ein Profil gewünscht, in dessen Mittelpunkt die Deutung grosser Kunstwerke oder die Rekonstruktion von Stilentwicklungen stand. Die Klassische Philologie hingegen blieb «Philologie», das heisst das umfassende Wissen über Sprache, Literatur und Kultur, angewandt auf die Deutung einzelner klassischer Werke, die man als Kunstwerke dem Genuss ihrer ästhetischen Qualität erschliessen wollte, aber auch dezidiert eine Beschäftigung mit Überlieferungsfragen (Emendationen) und der Deutung einzelner Stellen. Ideengeschichte fand zunehmend ihren Platz in der Philologie, wurde aber von den Vertretern der Tradition nur dann geschätzt, wenn sie auf einer breiten Basis von Textgelehrsamkeit aufbaute. Werner Jaegers Begründung eines ‚Dritten Humanismus‘, der im Mittelpunkt des griechischen Wesens Bildung und Erziehung («Paideia») mit einem deutlichen Staatsbezug erkennen wollte, war eine Ausprägung des Bestrebens, die Antike relevant für die Gegenwart zu machen und aus dem ‚Positivismus‘ des 1222 1223
Hermann Usener. Schlesier 1995. Auch Werner Jaeger wollte die christliche Antike auf das klassische Griechentum zurückbeziehen, im Gegensatz zur damaligen Theologie. Stiewe 2011, 300 (altgriechische Philosophie als Präfiguration des christlichen Glaubens). Landfester 1995, 33. Zu den Basler Klassischen Philologen siehe unten, Kapitel 7.2.2.4 ff.
322
Geisteswissenschaftler
‚19. Jahrhunderts‘ zu retten.1224 Der ‚Dritte Humanismus‘ wollte zudem einen der Aufklärung oder der Humanität verpflichteten, politisch zurückhaltenden Humanismus ablösen und die zu bildenden Menschen als politisch Handelnde auf die Polis, identifiziert mit dem «Staat», beziehen, in den sie eingebunden seien, was nun positiv gewertet wurde.1225 Einige dieser Bestrebungen diskreditierten sich 1933 dadurch, dass sie versuchten, sich der nationalsozialistischen Kultur- und Bildungspolitik anzudienen, sei es aus Selbstüberschätzung, sei es im Kampf um die Erhaltung der Vorrangstellung des humanistischen Curriculums am Gymnasium. Auf die Dauer erwies sich jedoch die Archäologie im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der neuen Machthaber als erfolgreicher als die Klassische Philologie.1226 Tatsächlich liebte ein Teil der nationalsozialistischen Führungselite, allen voran Adolf Hitler, verschiedene Aspekte der klassischen Antike.1227 Manche Nationalsozialisten waren überzeugt von einer «Rassenverwandtschaft» zwischen Griechen und Deutschen,1228 sahen in den Spartanern Vorbilder und suchten bei Platon und im alten Rom eine unchristliche ‚Ethik‘, die Rücksichtslosigkeit gegen Schwache legitimieren sollte. «Humanismus statt Humanität» lautete das entsprechende Schlagwort.1229 Ahistorisch wurde die Alte Geschichte als Kapitel des ewigen Kampfes der «nordischen Rasse» mit «Fremdrassen» aufgefasst. Hitler hatte schon in Mein Kampf der römischen Geschichte die Rolle von überzeitlich gültigen Beispielen, aus denen die Gegenwart lernen sollte, und den Griechen ideale Schönheit zugesprochen. Bildung sollte nach ihm vor allem zur Aneignung von Idealen führen, wozu die Beschäftigung mit der Antike ein Instrument war.1230 Die NS-Presse feierte die «Führergrabung» in Olympia, und die Olympischen Spiele wurden als deutsche Idee propagiert. Horaz wurde als Dichter verstanden, der die eigene «Volksgruppe» und den «Führer» (Augustus) zu verehren gelehrt haben soll.1231 Gelehrte, die die Gunst der Stunde nutzen wollten, 1224
1225
1226 1227 1228 1229 1230 1231
Kritisch zu Werner Jaeger, Eduard Spranger und Stefan George resp. deren Anhänger: Schmidt 2017, 79 ff.; Stiewe 2011; Ugolini 2016, 261 ff.; Rebenich 2010, 16; Apel/Bittner 1994, 165; Losemann 1980, 16 f. Chapoutot 2008, 130 ff. In der Weimarer Republik strebten Jaeger und Spranger danach, aus Deutschland einen mächtigen Kulturstaat zu machen, wobei Kultur und Wissenschaft den Staat stützen sollten, der seinerseits Kultur und Wissenschaft schütze. In dieser Hinsicht wussten sie sich im Einklang mit dem preussischen Kultusminister Carl Heinrich Becker. Stiewe 2011, 211. Rösler 2017, 66 ff.; Brands 2012, 17; Stiewe 2011, 285 ff.; Klingemann in: Näf 2001, 192 f.; Wegeler 1996, 186; Landfester 1995, 40; Fuhrmann 1984. Färber/Link 2019, 9. Kurze und treffende Darstellung: Maissen 2000. Rösler 2017, 71 ff. Apel/Bittner 1994, 226. Apel/Bittner 1994, 221 f. Ideologieproduktion der Latinistik: Schmidt 1995, 180.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
323
konnten so in Versuchung geraten, dem nationalsozialistischen Ideologiebedarf eine wissenschaftliche Grundlage nachzuliefern (die die Nationalsozialisten allerdings kaum brauchten) oder doch – opportunistisch – eine Förderung durch Partei, SS oder Staat zu erlangen.1232 Für die Archäologie wurde festgestellt, dass sie «weltanschaulich relevante Positionen im Sinne des Systems» besetzen wollte, um gefördert zu werden. Ab 1936 zeichneten sich gewisse Erfolge dieser Strategie ab. Im April 1941 betonte der Erziehungsminister Bernhard Rust, dass das Reich nicht auf die Altertumswissenschaften verzichten könne; um eine führende Rolle im «neuen Europa» spielen zu können, erhielten sie Mittel.1233 Im deutschen Schulunterricht sollten die pseudowissenschaftlichen, die Antike rassistisch und bellizistisch umdeutenden Ansätze1234 durchgesetzt werden, ein Vorhaben, das aber teilweise am passiven Widerstand einer vor 1933 ausgebildeten Lehrerschaft scheiterte.1235 Die Reaktionen der Fachgelehrten auf den Nationalsozialismus gingen verschieden weit und ergaben sich aus verschiedenartigen Motiven.1236 Diese reichten vom Nachweis der angeblichen Relevanz altertumswissenschaftlichen Wissens für die Machthaber über Versuche, der neuen Herrschaftselite Kultur beizubringen, bis zur expliziten Verwendung nationalsozialistischer Interpretationsansätze. Es blieb aber, wie jedenfalls für die Alte Geschichte festgestellt wurde, eine gewisse ‚Resistenz‘ der etablierten akademischen Fachvertreter gegen das Ansinnen, Geschichte und «Leben» entsprechend den Erwartungen des Regimes unter Verzicht auf einen disziplinären Autonomieanspruch ideologisch unmittelbar zu verkoppeln. Zweckgerichteter Dilettantismus wurde in der Regel von den etablierten Professoren altertumswissenschaftlicher Fächer durchschaut und im privaten Kreis verabscheut. Die ‚Resistenz‘ äusserte sich aber in den Publikationen eher «leise».1237 In der Archäologie blieben «nennenswerte Vorbehalte gegen eine derartige Politisierung von Fachinhalten und ihre Ausrichtung auf originär nationalsozialistische Positionen, darunter eine Anpassung an dezidiert völkischrassische Tonlagen», aus.1238 Politisch affine Themen und Inhalte wurden nach 1232
1233 1234 1235 1236
1237 1238
Chapoutot 2008, 71 ff. (Apoll), 105 ff. («nordische» Griechen), 135 f. («antike» Legitimierung der Vernichtung «unwerten Lebens»), 144 ff., 266 ff. (Sparta als Vorbild), 161 f., 167 (Horaz und Augustus), 195 ff. (Olympia). Brands 2012, 12 ff. Thematische Beispiele dafür in: Apel/Bittner 1994, 266 ff. Apel/Bittner 1994, 227, 241 ff., 332 ff., 357 f. Dazu «Literaturbericht» von Näf 2001. Chaniotis/Thaler 2006, 391 f., halten die deutschen altertumswissenschaftlichen Fächer schon vor 1933 für ideologisiert; ihre Gegenwartsbezüge seien «Förderstrategien» (Strategien zur Erlangung von Fördermitteln) gewesen. Wolf 2001, 436. Humanismus und Nationalsozialismus konnten insofern miteinender inkompatibel sein, als die politische Ideologie keiner empirisch-wissenschaftlicher Beweise bedurfte und kul-
324
Geisteswissenschaftler
hohen fachlichen Standards aufgearbeitet. Es wird die These vertreten, dass auch auf diese Weise ein Beitrag zur Stabilisierung des Herrschaftssystems geleistet worden sei.1239 Stefan George hatte die Bedeutung der alten Griechen für die neue deutsche Elite, die er heranzubilden hoffte, unterstrichen, eine neue Spielart der Platonverehrung gefördert1240 und ein heroisches, antiliberales und antidemokratisches Bild der Antike durch seine Anhänger verbreitet.1241 Anregend wirkten die Impulse von George für Philologen und Religionshistoriker wie Karl Reinhardt oder (in extremerer Form) Walter Friedrich Otto, die schliesslich zu kritischer Distanz zum Nationalsozialismus gelangten. Aber auch der durch seine Zusammenarbeit mit dem SS-Ahnenerbe diskreditierte Althistoriker Franz Altheim stand unter diesem Einfluss.1242 Denn was für die Anhänger Georges in der Konfrontation mit dem Nationalsozialismus aus den Lehren des Meisters folgte, war nicht determiniert. Manche stellten den Geist und die Freiheit in den Mittelpunkt ihrer Auffassung, opferten sich im Widerstand und wurden dafür von andern als grosse Vorbilder gefeiert. Dies galt insbesondere für die Grafen Stauffenberg,1243 wie wir an zwei Basler Beispielen sehen können, nämlich am Ökonomen Edgar Salin (siehe weiter unten) und am Archäologen Karl Schefold. Die oft nur privat am Einzelschicksal bedauerte Ausschaltung der als Juden definierten Kollegen unterschied sich kaum wesentlich von entsprechenden Vorgängen in anderen Fächern.1244 Nur drei Fälle von öffentlichen Protesten etablierter deutscher Altertumswissenschaftler gegen antijüdische Massnahmen, die ‚nicht-arische‘ Kollegen betrafen, sind bisher erwähnt worden: Harald Fuchs, der nach seiner Ernennung in Basel 1933 keinen Lehrstuhl in Deutschland annehmen wollte (aber, wie wir sehen werden, dennoch zu Berufungsverhandlungen nach Berlin fuhr), der Versuch von Karl Reinhardt, im Mai 1933 seinen Frankfurter Lehrstuhl aufzugeben, und die Verweigerung des Eides auf Adolf Hitler durch Kurt von Fritz im Jahr 1934. Die übrigen Protestaktionen kamen von unmittelbar Betroffenen wie Eugen Täubler (Heidelberg), E. A. Stein (Berlin), Karl Lehmann-Hartleben (Münster) oder Hans Liebeschütz (Hamburg). Der Schweizer Willy Theiler (damals in Königsberg) organisierte eine Unterschriftensamm-
1239 1240 1241 1242 1243 1244
turelle Phänomene unmittelbar aus ‚rassischen‘ Voraussetzungen herleitete. Stiewe 2011, 296. Brands 2012, 21. Norton 2018; Rebenich 2008; Näf 1986, 88 f. Landfester 2017, 10 f., 16 ff. Zu Franz Altheim zuletzt: Hamway 2019. George-Anhänger in den Altertumswissenschaften: Färber/Link 2019, 352. Stiewe 2011, 303. Säuberungen und Zwangsversetzungen in den Altertumswissenschaften listen Färber/Link 2019, 346 f. auf. Wegeler 1996, 181 ff., 194.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
325
lung gegen die Entlassung von Paul Maas; Bruno Snell richtete eine Eingabe an das Ministerium, um die Entlassung von Kurt von Fritz zu verhindern, und unterstützte Verfolgte und Ausreisewillige.1245 Die gängige Erklärung für die Seltenheit von Protesten ist die Verbindung von politischer «Blindheit» mit wissenschaftlicher «Redlichkeit» bei den Altertumswissenschaftlern.1246 Von den achtzig Professoren und Privatdozenten der Klassischen Philologie, die 1932/33 in Deutschland lehrten, gingen 13 ins Exil.1247 Keiner davon konnte in Basel wirken, während der berühmte Latinist Eduard Norden sich nach 1938 in Zürich aufhielt wie auch Franz Stoessl, der von Wien an die Limmat geflüchtet war. Von den Archäologen begab sich Karl Schefold nach Basel (über ihn unten mehr), während Peter P. Kahane, der 1933 an das Deutsche Archäologische Institut in Athen gekommen war, 1937 in Basel zwar sein Doktorat machte, aber 1938 über Athen nach Palästina ausreiste und erst 1972 wieder nach Basel zurückkehrte.1248 7.2.2.3 Matthias Gelzer – ein Schweizer in Frankfurt Ein Basler, Matthias Gelzer, lehrte seine ganze Laufbahn über in Frankfurt am Main als angesehener Althistoriker. Er hielt dabei ständigen Kontakt mit Basler Verwandten und Freunden und wirkte an der Basler Bachofen-Ausgabe mit.1249 Als Spross einer konservativen Familie war er von Jacob Burckhardts Skepsis geprägt, schätzte die Demokratie gering, aber nicht – wie Burckhardt – den deutschen Machtstaat. Zu Deutschland verhielt er sich solidarisch, rechnete im Ersten Weltkrieg mit einem deutschen Erfolg und übernahm im letzten Kriegsjahr noch eine Professur an der Universität Strassburg. Nach dem Zusammenbruch der deutschen Herrschaft über das Elsass erhielt er eine Aufgabe an der jungen Universität Frankfurt, die – anders als ältere Universitäten und die damalige Basler Universität – der Alten Geschichte ein Ordinariat mit eigenem Institut (Seminar) zugestand.1250 Von dieser Position aus errichtete er einen respektierten Standort in der deutschen Althistorie. Gelzer wahrte kritische Distanz gegenüber den typischen Erscheinungen des Enthusiasmus der 1920er Jahre; er nutzte seine Rezensionen, um exzessive akademische Irrationalität zurechtzuweisen. Dabei 1245 1246 1247 1248
1249 1250
Wegeler 1996, 197–202. Wolf 2001, 437; Ludwig 1984. Vinzent 2001, 441 f. Wegeler 1996, 378, 383, 393. Kahane wurde in Basel durch das Schweizerische Hilfswerk für deutsche Gelehrte 1935/36 auf Empfehlung von Ernst Pfuhl unterstützt. Korrespondenz Oprecht, Hauser, Pfuhl, Oktober 1935, in: StABS Erziehung X 48, Schweizerisches Hilfswerk für deutsche Gelehrte, 1933–1940. Dazu Korrespondenz mit Matthias Gelzer Frankfurt, 1940, 1941, 1943, in: Nachlass Karl Meuli, NL 45, F 280, 1–18. Hammerstein 2012, 151; Rebenich 2010, 14 f.
326
Geisteswissenschaftler
kritisierte er Verehrer von Nietzsche, Spengler (und George) in der Altertumswissenschaft.1251 Er lehrte, dass die Antike grundsätzlich ‚anders‘ sei als die Gegenwart, teilte aber die Auffassung, dass aus der Alten Geschichte Einsichten für die Gegenwart zu gewinnen seien, wenn auch eher indirekt. Gelzer war wie die meisten seiner Kollegen ein Gegner der Weimarer Republik, von der er Bürokratismus und sozialistische Zwangsmassnahmen erwartete. 1926 betonte er die Vergleichbarkeit der Spätantike mit der staatlichen Organisation seiner Gegenwart in diesem Licht der Unfreiheit.1252 Gegen die Gleichschaltung der Universität Frankfurt 1933 hatte er wenig Einwände; die Universitätsgeschichte legt nahe, dass seine alte Gegnerschaft zu Kollegen, die konservative Überzeugungen nicht teilten, in Gelzers Augen solide wissenschaftliche Arbeit ebenso wie die Pflichten in Lehre und Selbstverwaltung verachteten und die er ironisch die «grossen Geister» nannte (gemeint war der Kreis um Kurt Riezler), sein Verhalten beeinflusste.1253 Deren Entlassung musste für ihn eine Erleichterung bedeuten. In der Umwälzung sah er anscheinend eine Chance für Deutschland, aussenpolitisch wieder Geltung zu erlangen, innenpolitisch Linke und Demokraten auszuschalten, auch wenn er in Hitler keineswegs den grossen Staatsmann sah und bald erkannte, dass die Nationalsozialisten die Gelzer nahestehenden Deutschnationalen beiseite schoben. Obschon von einer konservativen Gesinnung alter Manier, die den Nationalsozialisten oft als ‚reaktionär‘ verdächtig war,1254 wurde seine Stellung in Frankfurt und im Fach unter den neuen Herrschaftsbedingungen nicht geschwächt. Die weit hinter das Jahr 1933 zurückreichende, enge Freundschaft mit dem 1934 zum NS-Rektor erhobenen Walter Platzhoff ist eine mögliche Erklärung dafür. Die beiden Männer hatten dasselbe Ziel, seriöse Wissenschaft auch unter dem neuen Regime zu bewahren und durch geschickte Taktik den direkten Einfluss der Partei auf die Universität gering zu halten. Noch im Krieg beteiligte sich Gelzer an NS-Unternehmen, deren ideologische Zwecksetzung ihm nicht verborgen blieb. «Bei den Historikern mussten zumindest Gelzer im Seminar für Alte Geschichte und Platzhoff im Historischen Seminar zwar nicht als Parteimitglieder oder Nationalsozialisten, doch als einflussreiche, regimestützende Professoren gelten.»1255 In dieser Hinsicht wurde Gelzers Beitrag zum Sammelband Rom und Karthago schon mehrfach diskutiert.1256 Dieser Band bildete zusammen mit demjeni-
1251 1252 1253 1254 1255 1256
Stahlmann 1995, 320. Stahlmann 1995, 308 f., unter Verwendung von Gelzer 1927. Mons/Santner 2019, 122 f.; Hammerstein 2012, 166 f., 204, 281 f. Hammerstein 2012, 282. Hammerstein 2012, 361. Mons/Santner 2019, 127–132; Gelzer 1943, 178–202; das von mir konsultierte Exemplar schenkte Karl Schefold der Basler Bibliothek.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
327
gen über Das neue Bild der Antike von 1941 den von Helmut Berve1257 und Joseph Vogt1258 organisierten «Kriegseinsatz» der Altertumswissenschaften.1259 Das Thema war mehr als vorbelastet: In ‚völkischer‘ Auffassung bedeuteten die punischen Kriege eine Auseinandersetzung zwischen den «semitischen» Karthagern, die «Handelsgeist» repräsentierten, und den «arischen» oder «nordischen» Römern, der Verkörperung der «Tugend».1260 Die vom Herausgeber Joseph Vogt vorgegebene Fragestellung lautete: «[…] ist dieser folgenschwere Konflikt [zwischen Rom und Karthago] durch das Blutserbe der Völker bestimmt gewesen, durch die Tatsache also, dass dem wesentlich nordisch geprägten Rom die Welt Karthagos gegenüberstand, deren Fremdheit sich aus der rassischen Struktur des Puniertums ergibt?»1261 Die Frage nach der Rolle der «Rasse» in der Geschichte behandelte Vogt als einen neuen Ansatz mit unsicherem Erfolg, und er hielt (wie Gelzer) fest, dass es in der Antike keine Entsprechung zum ‚modernen‘ Rassenbegriff gab. Damit wurden die Leser darauf vorbereitet, dass die empirische Quellenforschung möglicherweise zum Schluss komme, dass der Ursprung des Konflikts zwischen Rom und Karthago nicht adäquat in einem Rassengegensatz gesucht werden könne – was Gelzer dann in seinem Aufsatz ausführte. Gelzers Beitrag zum «Kriegseinsatz der Geisteswissenschaften» war wohl typisch für sein Selbstverständnis innerhalb des damaligen deutschen Wissenschaftssystems. Er schien bereit, völkische Anregungen aufzugreifen, was wie ein Entgegenkommen gegenüber den neuen Verhältnissen aussah, prüfte dann aber deren Ertrag für die Wissenschaft kritisch. So kann er als Beispiel dafür dienen, dass die älteren Ordinarien in Deutschland mehrheitlich eine unmittelbare Ideologisierung ihres Faches ablehnten, dass es aber einen wissenschaftlichen Austausch nur noch innerhalb des ideologischen Raumes gab, den das Regime definierte.1262 Gelzer verstand die Darstellungen römischer «Tugenden» und karthagischer «Falschheit» in den Quellen mit seiner gewohnten Nüchternheit als Kriegspropaganda. Er nahm sich die Freiheit heraus, die völkischen Deutungen durch eine 1257 1258
1259 1260
1261 1262
Näf 1986, 146 ff. Königs 1995. «Ideologisch stand er schon früh dem Nationalsozialismus nahe, zumal Vogt aus seiner rassistischen, antisemitischen und anti-demokratischen Grundhaltung auch in der Weimarer Republik kaum einen Hehl gemacht hatte. 1933 trat er in die SA und den NS-Lehrerbund ein, 1937 folgte der Eintritt in die NSDAP und den NS-Dozentenbund. Später wurde er korrespondierendes Mitglied des 1941 gegründeten Instituts zur Erforschung der Judenfrage.» Näf 2001, 64. Losemann 2007, 227; Hausmann 1998; Losemann 1995, 101–105. Der Kampf zwischen Rom und Karthago wurde schon von Houston Stewart Chamberlain und nach ihm von Alfred Rosenberg als Rassenkonflikt gedeutet. Chapoutot 2008, 363 f. ‚Rassische‘ Ansätze in der Alten Geschichte: Näf 1986, 122 ff. Während des Ersten Weltkriegs waren die Punier mit den Engländern verglichen worden. Vogt 1943, 5–8: «Unsere Fragestellung». In Anlehnung an die These von Rebenich 2010, 16.
328
Geisteswissenschaftler
rationale, stark quellenbezogene Methode ohne Weiteres als Unsinn zu entlarven. Dabei half ihm auch das Credo, dass moderne Begrifflichkeit (wie «Rasse») in der Geschichte nichts erschliessen könne. Gleich in der ersten Fussnote setzte er ein Zeichen, indem er den inzwischen aus Deutschland geflüchteten Juden Richard Laqueur zitierte.1263 Statt mit Rasse argumentierte er – immer nah am Wortlaut der Quellen – mit landschaftlicher Herkunft («Gleichstämmigkeit»).1264 Dennoch prüfte er, inwiefern die ideologische Anregung, die Geschichte als Kämpfe zwischen «Rassen» zu verstehen, für die Alte Geschichte doch noch fruchtbar zu machen wäre. Denn auch hier suchte er nach anonymen Faktoren, die neben den Taten grosser Männer in der Geschichte wirksam waren. Sein Ergebnis war eindeutig: «Die römisch-karthagischen Kriege entwickelten sich aus rein machtpolitischen Gegensätzen». «Die Rasse der beiden Gegner spielte dabei nicht die geringste Rolle.» Hass und Verachtung des Feindes dürften nicht so verstanden werden, «als ob die Römer in den Karthagern vor allem die andere Rasse aus der bisherigen Machtstellung im Mittelmeerraum verdrängen wollten» [Hervorhebung Ch. Simon]. Aber er gab sich konzessionsbereit: «Ohne […] zu vergessen, dass die römische Politik in diesen Jahrzehnten überhaupt in brutaler Vernichtung der Gegner ihr Heil erblickte, wird man im Falle Karthagos doch als eine besondere Ursache anführen dürfen die Schwierigkeit, sich gegenseitig zu verstehen, und dafür die Erklärung finden in der rassischen Verschiedenheit.» Für diese Feststellung fehlte aber die Grundlage in den Quellen weitgehend; sie sieht wie ein Nachsatz aus, der dem Frieden zuliebe hinzugesetzt worden sein könnte.1265 Gelzers Beitrag illustriert eine Funktion, die der Band Rom und Karthago innerhalb der verschiedenen nationalsozialistischen Richtungen in der Historie erfüllen sollte. Das Unternehmen sollte ernstzunehmende Wissenschaft in einem nationalsozialistischen Rahmen präsentieren, in Konkurrenz zu ‚rein ideologischen’ Positionen, wie sie das SS-Ahnenerbe und vor allem die parteiamtlichen Verbände des Unterrichtspersonals vertraten, aber auch aus der Distanz zu unmittelbar rassistischen Ansätzen, für die der Name Fritz Schachermeyr stand.1266 1263 1264 1265 1266
Gelzer 1943, 178. Richard Laqueur war 1936 in Halle entlassen worden und 1939 in die USA emigriert. Gundel 1982. Gelzer 1943, 185 f. Gelzer 1943, 201 f. Rom und Karthago war somit ein Unternehmen der ‚gebildeten‘ Fraktion der Wissenschaft unter dem Hakenkreuz, die zeigen wollte, dass auch unter der Hitler-Diktatur die herkömmlichen Regeln solider Forschung respektiert wurden, im Unterschied zu den Aktivitäten der ‚gläubigen‘ Nationalsozialisten, die sich im NS-Dozentenbund zusammenfanden. Canfora 1995, 168 f. Berve anerkannte (im Unterschied zu Gelzer) grundsätzlich die Wirksamkeit von «Rasseinstinkt, Rassepolitik und Rassezersetzung» und verstand den Untergang der antiken Welt als eine Folge der «Zersetzung», aber er sah (ähnlich wie Gelzer, der Berve schätzte) Schwierigkeiten in der Anwendung des Rassebegriffs auf die
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
329
Nach aussen sollte erwiesen werden, dass im nationalsozialistischen Deutschland weiterhin seriöse Arbeit geleistet werde.1267 Die Bedeutung des Rassenansatzes sollte empirisch verifiziert werden durch gute Wissenschaft, die vor einem kritischen internationalen Fachpublikum bestehen konnte. Dass der Band ohne Hakenkreuze und andere Zeichen des Regimes in den Buchhandel kam, entsprach dieser Absicht.1268 In diesem Zusammenhang ist auch Gelzers Akademierede von 19381269 aufschlussreich. Die «umwälzenden Ereignisse der Gegenwart», so führte Gelzer aus, riefen «zur Beantwortung neuer Fragen» auf und würfen «neues Licht» auf «bisher unbeachtete Zusammenhänge und Hintergründe». Zur klassischen Quellenkritik müssten nun vermehrt Archäologie, Sprach- und Rasseforschung hinzutreten. Das bedeutete keine Unterwerfung unter die nationalsozialistische Ideologie, konnte aber als Anpassung, Konzession oder als nüchterne Reaktion eines rationalen Historikers auf die Zeitumstände (die er hier nicht wertete) verstanden werden. Nicht als Anbiederung an die Nationalsozialisten, sondern als sachliche Auseinandersetzung wurden Gelzers damalige Arbeiten in Basel gelesen, als 1943 darüber diskutiert wurde, ob Gelzer hierher berufen werden sollte. Der Fakultät galt er als «von Tagesmeinungen nicht beeinflusst», wobei sie gerade Rom und Karthago als Beweis dafür anführte, dass er «auch der modernen Rassenideologie gegenüber seine Unabhängigkeit bewahrt».1270 Dennoch scheiterten Basler Freunde Gelzers1271 mit ihren Versuchen, ihn hierher zu holen. Der erste Grund dafür lag im Vergleich zwischen den Frankfurter respektive den deutschen Verhältnissen in der Alten Geschichte und denen in der Schweiz und in Basel. Nur in Deutschland existierten althistorische Seminare mit einem regen Forschungsbetrieb, getragen von Assistenten und Doktoranden und geführt von Ordinarien. Wäre Gelzer nach Basel gekommen, wie schon 1931 in der Kuratel erwogen worden war,1272 so wäre er hier in eine äusserst bescheide-
1267 1268 1269 1270 1271
1272
Antike und distanzierte sich von Fritz Schachermeyrs Vereinfachungen. Losemann 2007, 227. Näf 1994; Näf 1986, 135 ff. Vogt 1943, 5–8. Diskussion, was zu Recht «nationalsozialistische Wissenschaft» heissen dürfe: Näf 2001, 69, und Klingemann 2001, 192. Jahrbuch der Preussischen Akademie der Wissenschaften 1939. Ich zitiere hier nach Rebenich 2001a, 214. Königs 2010, 35–37. Zitiert nach Königs 1988, 33. Zu den Freunden gehörte auch Peter von der Mühll. Karl Meuli, NL 45, F 280, 1–18, Korrespondenz mit Matthias Gelzer, Briefe von 1947. Eine wichtige Verbindungsperson nach Basel war sein Bruder Heiner Gelzer, der in der Basler Mission führende Positionen bekleidete. Quack 2016, 109. Königs 2010, 29 f.; Königs 1988, 19–21. Schon damals wusste die Basler Kuratel, dass Gelzer der Deutschnationalen Volkspartei angehörte; deshalb und weil er in Frankfurt in ei-
330
Geisteswissenschaftler
ne Stellung geraten. Der zweite Grund lag in der verschärften Wahrnehmung von Positionen innerhalb der deutschen Politik seit Beginn der ‚geistigen Landesverteidigung‘ in der Schweiz ab etwa 1936. Als 1943 die Fakultät und die Sachverständigenkommission der Kuratel Gelzer nach Basel zu holen versuchten, konnte man hier vermuten, dass er wie viele Auslandschweizer dem Krieg entfliehen wolle. Seine Basler Bekannten wussten, dass er in Frankfurt litt, durch persönlich-familiäre Verluste, aber auch unter dem Bombenkrieg und den Angriffen des Regimes gegen die Bekennende Kirche, in deren Frankfurter Gemeinde er eine prominente Rolle spielte. Die Schlussfolgerung war jedoch unzutreffend, dass er deswegen Deutschland verlassen wolle. Seine persönliche und akademische Verbundenheit mit Frankfurt war stark.1273 Offensichtlich war er entschlossen, seine Solidarität mit Deutschland auch im Weg in die Katastrophe aufrechtzuerhalten. Aufgrund seiner Mitwirkung in der Bekennenden Kirche versprach er sich möglicherweise einen Einfluss auf eine Rekonstruktion nach dem Krieg, die konservativ und religiös getragen wäre.1274 Zudem hatte sich in Basel die Lage des Faches gegenüber 1931 nur unwesentlich verbessert: Felix Stähelin, den es nun zu ersetzen galt, war zuletzt Inhaber des 1937 geschaffenen ‚gesetzlichen‘ Lehrstuhls geworden,1275 ohne dass das Fach eine wirkliche Autonomie erlangt hätte. Das Seminar, das auf sein Verlangen 1934 gegründet worden war, bestand aus einem Zimmer neben demjenigen der Klassischen Philologen und verfügte über keine eigenen Mittel. Auch wurden die Altertumswissenschaften in Basel von einer starken Persönlichkeit dominiert, nämlich vom Gräzisten Peter von der Mühll – die hiesige Lage des Faches war völlig unattraktiv, und ein Ruf nach Basel hätte allenfalls einem dezidierten und gefährdeten Gegner der Nationalsozialisten als Rettung erscheinen können. Hinzu kam hier ein ideologisches Umfeld, das nun nicht mehr nur dem Nationalsozialismus feindlich gesinnt, sondern allgemein deutschfeindlich geworden war. Germanophile Schweizer, die den deutschen Anspruch auf eine erneute Weltgeltung der Nation für gerechtfertigt hielten, waren in der Basler Gesellschaft inzwischen marginalisiert und fühlten sich als Opfer von Sozialdemokraten, Sozialisten aber auch von Radikaldemokraten. Als 1943 die Fakultät und die Sachverständigen der Kuratel vorschlugen, Gelzer nach Basel zu berufen, war bekannt, dass er im «deutschnationalen» Lager stand – eine so bezeichnete Haltung, d. h. antidemokratischer konservativer deutscher Patriotismus, hatte schon 1935 verhindert, dass ein fachlich hochangesehener Mann, der der Bekennenden Kirche angehörte, aber zweifellos ein deutscher Patriot war, wie
1273 1274 1275
ner gesicherten Position war, verzichtete die Kuratel in jener Epoche auf eine persönliche Kontaktnahme mit ihm. Freundliche Nachricht von Florian Gelzer an den Verfasser, 27. 6. 2018. Mons/Santner 2019, 119; s. auch die Korrespondenz mit Basler Bekannten und Verwandten. Königs 2010, 29.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
331
Gerhard Ritter, nach Basel gewählt werden konnte.1276 Obschon die Nachricht über Gelzers Zugehörigkeit zu den Deutschnationalen sowohl dementiert als auch deshalb für irrelevant erklärt wurde, weil an sich die private Gesinnung bei Professorenwahlen kein Kriterium sein durfte, schickten die vorgesetzten Behörden der Fakultät den Vorschlag, Gelzer zum Nachfolger von Felix Stähelin zu wählen, zur Wiedererwägung zurück. Erst 1945 äusserte sich die Fakultät wieder. Sie zog Gelzer nun nicht mehr in Erwägung; mit der Lehre in Alter Geschichte in Basel wurde der Gräzist, Generalstabsoffizier und Schüler von Peter von der Mühll, Bernhard Wyss, beauftragt.1277 7.2.2.4 Peter von der Mühll Eine Übersicht über die Basler Lehrstuhlinhaber in den Altertumswissenschaften muss seiner Bedeutung entsprechend mit dem Gräzisten Peter von der Mühll1278 beginnen, der altbaslerische Geldaristokratie mit deutscher Philologie der Zeit vor 1914 verband. Nachdem er sich gegen den Plan seiner Familie, ihn zum Bankier ausbilden zu lassen, durchgesetzt hatte, absolvierte er ab 1904 das übliche Studium eines Philologen der Wilamowitz-Schule. Für die Klassische Philologie hatte ihn Eduard Schwartz begeistert, bei dem er 1909 in Göttingen promovierte. Zu den breiten Kenntnissen alter Sprachen und ihrer Literaturen, der Kunst der Antike und der Alten Geschichte kam eine grosse Liebe zur Musik und eine erstaunliche Belesenheit in den Werken auch des 19. Jahrhunderts hinzu. Der Junggeselle pflegte Freundschaften intensiv – zum engeren Kreis gehörten Franz Dornseiff, Karl Meuli, der Architekt und Psychiater Walter Spiess und der Orientalist Rudolf Tschudi. Nach der Habilitation in Zürich (1913) wählte Basel 1917 von der Mühll als Griechischprofessor an die Universität.1279 Wie damals üblich wurde er zuerst Extraordinarius und erst nach einer Art Probezeit 1918 zum Ordinarius befördert.1280 Damit war er nun Nachfolger von Werner Jaeger. Er lehnte 1276
1277 1278 1279
1280
Vgl. die Argumente gegen Gerhard Ritter im Verfahren, das zur Ernennung von Werner Kaegi führte, bei Wichers 2013. Aufschlussreich ist die Diskussion in der Kuratel: StABS Protokoll T 2 Protokoll der Kuratel Bd. 15, 1944, 2, 1. Sitzung, 31. 1. 1944, und 6, 4. Sitzung, 26. 6. 1944, sowie die Auseinandersetzung im Erziehungsrat: Protokoll Erziehungsrat S 4 Bd. 27, 1942–1944, Eintrag vom 6. 3. 1944, sowie Protokoll Erziehungsrat S 4 Bd. 28, 1944–1947, Eintrag vom 22. 2. 1945. Nachweise siehe unten, Kapitel 7.2.2.7. Wyss 1976; Wehrli 1971; Schefold 1970. Hermann Diels (Berlin) an Prof. Herzog, 25. 2. 1914, in: StABS Erziehung CC 28a. Im Verfahren, das 1914 zur Wahl von Werner Jaeger nach Basel führte, stand Peter von der Mühll auf dem zweiten Listenplatz. StABS ED-REG 1a 1 1579. Wahl von der Mühlls 1916/17: Kuratel an ED 15. 1. 1917, ED an RR 26. 1. 1917, und daselbst: Dossier «Lehrstuhl für Gräzistik – Empfehlungen». Personalkarte der Universitätsverwaltung, in: StABS UNI-REG 5d 2 – 1 (1) 375.
332
Geisteswissenschaftler
1925 einen Ruf nach Berlin ab,1281 blieb bis 1952 im Basler Amt und lehrte danach bis kurz vor seinem Tod 1970 im kleinen Kreis ehemaliger Schüler weiter. In Basel entfaltete er seinen Humanismus, der mit Werner Jaegers ‚Drittem Humanismus‘ nichts zu tun hatte, sondern nach einer rechten Lebensführung trachtete. Diese war auf den Genuss des Schönen und Guten ausgerichtet, sie war aber auch inspiriert von einem Polis-Denken, das Dienst am städtischen Gemeinwesen und in diesem Sinne eine lokal- und national-patriotische Haltung forderte, aber auch untrennbar mit der Freude an individueller Freiheit verbunden war. Diszipliniert war dieses Lebensideal durch die strenge Schule philologischer Rationalität und ein pädagogisches Ethos, das Erziehung zur Suche nach Wahrheit und Unterwerfung unter die der Antike entlehnten Massstäbe des «Geziemenden» bedeutete, die in quasi-religiöser Deutung mit dem Christentum verglichen oder verbunden wurden.1282 Ein Bewunderer von der Mühlls brachte dies in einem Artikel zu seinem 60. Geburtstag am 1. August 1945 auf folgende Formeln («K.M.», sehr wahrscheinlich Karl Meuli): Wenn irgendwo, so haben wir bei von der Mühll das Ethos wissenschaftlicher Gesinnung als charakterbildende Macht erlebt. Hier kann einem klar werden, dass wahre Wissenschaft Auswirkung der höchsten menschlichen Tugend ist, der Gerechtigkeit: der verstehenden Gerechtigkeit gegenüber dem Wort, gegenüber dem geistigen Werk, der Persönlichkeit, dem Geist der Zeiten und der Völker, einer beseelten und liebenden Gerechtigkeit; aber auch der kritischen Gerechtigkeit, die die Nebel der Lüge zerreisst, die ordnet und wertet. […] Wir wissen wohl, wie bedrückend Gewalt und Ungerechtigkeit unserer traurigen Zeit auf ihm lasten; wir wissen aber auch, dass vielleicht noch nie so wie heute geistige Menschen, Menschen mit empfindlichstem Gerechtigkeits- und Wahrheitssinn, Idealisten nötig sind.1283
Von der Mühlls Themen waren zeitgemäss nach den Kriterien seiner Epoche. Er befasste sich intensiv mit den homerischen Epen, wenn auch seine Synthese aus der unitarischen und analytischen Richtung unzeitgemäss, weil originell war; er beschäftigte sich mit der künstlerischen Wirkung, die die Dichtung auf ihn ausübte (hier liess er sich von seinem «Sinn für dichterischen Wert» leiten, den er auch in der Homerforschung walten liess), und fühlte auf dieser Grundlage die Unterschiede zwischen einem ursprünglichen Epos und einer späteren Bearbei1281
1282
1283
Kuratel an ED 6. 7. 1925; Kuratelspräsident Koechlin an Mitglieder der Kuratel 16. 7. 1925; ED an Regierungsrat 31. 7. 1925, Regierungsratsbeschluss 4. 8. 1925, alles in: StABS EDREG 1a 1 1579. Von der Mühll forderte damals unter anderem, Karl Meuli müsse nach der Habilitation einen bezahlten Lehrauftrag erhalten. Vorträge von Peter von der Mühll lassen erkennen, dass er in der Antike «ursprüngliche Frömmigkeit» fand und die «im Diesseits begründete Menschenliebe Mark Aurels sittlich ebensohoch [sic] […] werten [wollte] wie die […] christliche Caritas», in: StABS EDREG 1a 1 1579, Dossier «Diverses». K.M. 1945.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
333
tung.1284 Traditionsbedingt war seine Vorliebe für Emendationen. Typisch für die damals neue Philologie war sein Interesse an den sagenhaften Elementen der ursprünglichen Dichtung. In diesem Sinne verband ihn eine Kollegialität mit Franz Dornseiff, den er 1920 in Basel habilitierte.1285 Sein Einsatz für die Ausgabe der Werke von Johann Jakob Bachofen ging weit über das hinaus, was aus den gedruckten Angaben ersichtlich ist. Zeitgemäss war an sich auch seine grosse Vorliebe für Pindar, doch scheint es, dass ihn mehr die Schwierigkeit der Sprache, die Originalität des Ausdrucks, die ethischen Elemente und die Bezüge zur Epik fachlich und ästhetisch ansprachen, weniger die von deutschen Kollegen darin gesuchten, Tyrannen und spartanisch-dorisches Wesen verherrlichenden Tendenzen.1286 Diogenes Laertius galt ein grosser Teil seiner Energie, wenn auch die angestrebte endgültige kritische Ausgabe nicht zustande kam. Ihm gelang eine Schulebildung in jedem Wortsinn. Die Ausbildung von Gymnasiallehrern und die massgebende Mitwirkung in der Aufsicht (Inspektion) des Humanistischen Gymnasiums machten ihn zum Vermittler und Hüter seines Humanismus. Philologie war für ihn eine Lebensform, die keiner Rechtfertigung bedurfte. «Er war überzeugt, dass die Griechen, im Besonderen die Athener, naturgemässer, sinnvoller und damit richtiger gelebt hätten als wir Heutigen; dass die Beschäftigung mit ihnen uns auf einzigartige Weise zur Bewältigung des Lebens zu helfen vermöge.»1287 Dabei war deutlich, dass er in Zeiten des Nationalsozialismus eine absolute Trennung von Politik und Wissenschaft anstrebte und dem politischen Totalitätsanspruch eine Autonomie des wissenschaftlich-universitären Feldes entgegenstellen wollte. Dies zeigte sich 1935, als er das Habilitationsgesuch von Adolf Grabowsky, dem 1933 entlassenen und in die Schweiz geflohenen Herausgeber der «Zeitschrift für Politik» und Dozent an der Deutschen Hochschule für Politik in 1284
1285 1286
1287
1938 veröffentlichte die Real-Enzyklopädie (Pauly-Wissowa) seinen umfangreichen Artikel «Odyssee», zitiert nach von der Mühll 1976, 29. Hier begründete er seine Unterscheidung zwischen drei Schichten in der Odyssee: einer Telemachie, einem Epos eines grossen Dichters («A») und einer Bearbeitung aus dem 6. Jahrhundert durch einen schwächeren Dichter, der aber eine gute Komposition des Stoffes fand («B»). Von der Mühll verstand diese Position als ‚analytisch‘ im Vergleich zu derjenigen der ‚Unitarier‘ (die nur einen Verfasser postulierten), wollte aber die Analyse auf das Wesentliche vereinfachen. Von der Mühll 1940, kürzer: von der Mühll 1940a; vgl. Wyss 1976, x. Rektorat an Kuratel, 16. 12. 1920, in: StABS Erziehung CC 28a. Die Antrittsvorlesung hielt Franz Dornseiff am 22. 2. 1921. Wyss 1976, xii; Schefold 1970; von der Mühll 1917/18 (= von der Mühll 1976, 189–193). Er suchte ein Verständnis der Dichtung zu gewinnen, die «die tiefsten Gedanken griechischer Ethik» zum Ausdruck bringe. Pindar-Bild in Deutschland: Losemann 1998, 125 ff. Wyss 1976, xvii f. Man darf auch an die Überzeugung der Stoiker denken, dass das Naturgemässe das Vernünftige, der göttlichen Ordnung der Welt Entsprechende sei. Auch die Pflichterfüllung gegenüber Freunden und der Gemeinschaft wäre in diesem Sinne naturgemäss.
334
Geisteswissenschaftler
Berlin, ablehnte: Unter den damaligen Umständen wollte er keine Habilitation im Fach Politik zulassen.1288 Kein Verständnis hatte er für die von Karl Barth vertretene Ansicht, dass eine Teilnahme von Basler Professoren an deutschen Universitätsfeierlichkeiten eine Unterstützung für das nationalsozialistische Regime bedeute. Wie die überwiegende Mehrheit der Regenz war er im Falle des Göttinger Universitätsjubiläums überzeugt, dass es sich (noch 1937) um einen universitären Anlass handle, bei dem die Politik nicht mitzureden habe.1289 Von der Mühll war gerne bereit, Begabungen zu fördern und zur Habilitation zu bringen, so dass in der nachfolgenden Generation kaum ein Professor der Altphilologie in der Schweiz nicht aus seiner Schule stammte.1290 Damals üblich war sein Bestreben, einen seiner eigenen Schüler zum Nachfolger zu machen. Dafür hatte er Bernhard Wyss ausersehen. Wyss war der Sohn des Vorstehers der aargauischen Erziehungsanstalt auf Schloss Biberstein, sein Schwiegervater der aargauische Jurist, Richter und Historiker Walther Merz. Nach der Promotion 1929 (Veröffentlichung der Dissertation 1935) bei von der Mühll mit einer vielbewunderten Edition der Antimachi Colophonii Reliquiae erhielt er zunächst eine Stelle als Lehrer am Humanistischen Gymnasium und wurde dann mit erst 27 Jahren Rektor dieser Schule. Die militärische Karriere im Generalstab und die Folgen eines Unfalls verzögerten den wissenschaftlichen Aufstieg bis zur Habilitation in Griechischer Philologie im Jahr 1943. Bei erster Gelegenheit wurde er mit einer Professur ausgestattet. Diese Gelegenheit bot sich angesichts der Unmöglichkeit, im Krieg einen namhaften Althistoriker wie Matthias Gelzer aus Deutschland als Nachfolger für Felix Stähelin zu gewinnen – so erhielt der Gräzist Wyss 1945 die althistorische Professur, bis von der Mühll 1952 selbst emeritiert wurde. Nun konnte Wyss den gräzistischen Lehrstuhl übernehmen, allerdings erst, nachdem Wolfgang Schadewaldt den Ruf nach Basel ausgeschlagen hatte.1291 Wyss’ einflussreiche Stellung im Basler Bildungswesen wurde verdeutlicht durch seine Ernennung zum Mitglied der Kuratel im Jahr 1955.1292 Ein anderer Basler Privatdozent der Griechischen Philologie war Olof Gigon, Sohn des Medizinprofessors Alfred Gigon, 1934 ebenfalls von Peter von der Mühll promoviert und 1937 habilitiert, über dessen philosophische und theologische Interessen seine Beiträge zum «Zentralblatt» der Zofinger Studentenverbin1288 1289 1290 1291
1292
Protokoll der Philologisch-Historische Abteilung der Philosophischen Fakultät, StABS UA R 3a, 3, 1930–1948, 4. 5. 1935. StABS UA B 1 XIV Acta et Decreta 1934–1959 (Regenzprotokoll), 28. 4. 1937. Wyss 1976, xv, zählt neun Schweizer Ordinarien der Klassischen Philologie, die bei von der Mühll doktoriert hatten. Regierungsratsbeschluss 29. 6. 1951, in: StABS UNI-REG 5d 2 – 1 (1) 375. Die Fakultät hätte Olof Gigon vorgezogen und zweifelte an der Verfügbarkeit (und Eignung für die Basler Stelle) von Schadewaldt. Gutachten 25. 6. 1950, ebd. Absage Schadewaldt, ED an Regierungsrat, 3. 10. 1951, in: StABS ED-REG 1a 1 1579. Alle Informationen aus: StABS UNI-REG 5d 2 – 1 (1) 408.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
335
dung Aufschluss geben (siehe Beitrag über die Studenten, oben). Als Gegner der Aufklärung und der liberalen Demokratie entwickelte er in seiner Jugend eine eigene Staatsphilosophie und rief zur Verchristlichung der öffentlichen Ordnung auf. Der Verehrer von Charles Péguy und Paul Claudel gehörte zum Freundeskreis des Ehepaars Werner und Adrienne Kaegi-von Speyr.1293 Aber nicht als Philosoph, sondern als Philologe erhielt er 1939 eine ordentliche Professur an der Universität in Freiburg im Üchtland. Für die Nachfolge von der Mühlls hatte er gegen Wyss keine Chancen. Der wichtigste Schüler von der Mühlls war jedoch ohne Zweifel sein Freund Karl Meuli, dem ich deshalb unten einen eigenen Abschnitt widme. Naturgemäss war von der Mühll in die deutsche Altertumswissenschaft integriert, auch institutionell. Er gehörte zu den Begründern und Herausgebern des Rezensionsjournals «Gnomon», das seit 1925 kritisch über Neuerscheinungen berichtete und dabei die fachlichen Standards guter Philologie hochhielt. In seiner Wohnung empfing er viele deutsche Kollegen, die auf der Reise nach oder von Italien in Basel einen Zwischenhalt einlegten. Aber nach 1934 trübte sich sein Verhältnis zu den Philologen in Deutschland. Die Besuche deutscher Kollegen in seiner Wohnung wurden seltener. «Die Verfinsterung der politischen Lage, dann der Zweite Weltkrieg liessen diese Beziehungen fast ganz abreissen; wohl kamen sie später allmählich wieder in Gang, doch im Vergleich mit den ‚goldenen Zwanzigerjahren‘ blieben sie spärlich.»1294 Aus dem Herausgebergremium des «Gnomon» schied er 1933 aus, als dieses ‚arisiert‘ wurde: Von den 17 Herausgebern blieben nach 1934 noch drei, darunter Matthias Gelzer (der von 1925 bis 1962 dabei war).1295 Das letzte Urlaubsgesuch für den Besuch der Philologenkongresse in Deutschland (Fachtagung der Klassischen Altertumswissenschaft) stellte er 1932.1296 Bis in die Kriegsjahre hinein publizierte von der Mühll jedoch in deutschen Zeitschriften, die ohne Alternative als die wesentlichen Kommunikationsforen des Faches galten («Philologus» 1934, 1938, 1940; «Gnomon» 1938; «Hermes» 1940; «Klio» 1942). Sobald jedoch ab 1944 – nicht zuletzt dank seiner eigenen Initiative – das «Museum Helveticum» verfügbar war, veröffentlichte er seine Aufsätze in der Schweiz.1297 Eines seiner Hauptwerke, der Artikel «Odyssee», erschien in der deutschen Realenzyklopädie. 1293 1294 1295
1296 1297
Briefwechsel mit Olof Gigon, in: Paul Sacher Stiftung, Nachlass Werner Kaegi, WK 196. Vgl. die Kapitel 7.2.4.4 und 7.5, unten. Wyss 1976, xvi. Säuberung der Herausgebergremien altertumswissenschaftlicher Zeitschriften: Wegeler 1996, 195, speziell zu «Gnomon» 308. Ferner, https://de.wikipedia.org/wiki/Gnomon_ (Zeitschrift). StABS ED-REG 1a 1 1579 Dossier «Besoldung, Anstellung», sowie Dossier «Beurlaubungen»; letztes Gesuch 6. 5. 1932 für Bad Naumburg. Schriftenverzeichnis in: von der Mühll 1976, 555–564. Das «Museum Helveticum» wurde von der ersten Nummer an (Januar 1944) bis Februar 1949 von Olof Gigon redigiert,
336
Geisteswissenschaftler
Den vorübergehenden Versuch Werner Jaegers, die deutsche Philologie dem Naziregime beliebt zu machen, missbilligte er, ohne daraus ein öffentliches Statement zu machen. Ein solches gab er hingegen ausführlich ab, als er 1942 Rektor wurde und die übliche Ansprache am Dies Academicus zu halten hatte.1298 Sein Bild der athenischen Demokratie gestaltete er bei dieser Gelegenheit so, dass alle Zuhörer merken mussten, dass er von dem sprach, was ihm an der Basler Demokratie wertvoll und deshalb gegen den Nationalsozialismus verteidigungswürdig erschien. Das Thema war nicht originell: Schon längst war es zur Darlegung der Nachteile der Demokratie für Deutschland genutzt worden, als Weg in die Anarchie, oder dann erschien, unter Absehen von den freiheitlichen Aspekten, Athen als Modell eines ‚starken Staates‘, der seine Bürger an sich band. Und Jacob Burckhardt hatte die athenische Demokratie als eine Hölle für die Rechte des Individuums und der wohlhabenden Eliten ausgemalt.1299 In den 1920er Jahren war in Deutschland eine neue Version der Demokratie-Darstellung hinzugekommen, die nun gerade diejenigen Aspekte positiv hervorhob, die in der liberalen und konservativen Kritik als besonders abscheulich gegolten hatten: Die Integration des Mannes mit Leib und Gut in den «Staat» oder die «Gemeinschaft» (deren Angehörige zudem «gleichen Stammes» sein sollten), nicht zuletzt unter dem Eindruck einer bestimmten Platon-Interpretation. All dies liess von der Mühll in seinem Lob der Demokratie (nach Solon) links liegen.1300 Seine Demokratie war eine naturgemässe Staatsform mit Redefreiheit, ohne Steuern, ohne Bürokratie, ohne professionelle Advokaten, nicht militaristisch, aber im Notfall durchaus bereit zur Verteidigung, ein Reich der Freiheit zur Entfaltung der besten Anlagen der Bürger, eine Schule der Eigenverantwortlichkeit und der Verpflichtung, zum Wohl des Ganzen freiwillig und aus Überzeugung beizutragen. Die Demokratie von der Mühlls war zudem eine Schule der Kultur, indem sie auch dem einfachen Mann den Zugang zu künstlerischen Höchstleistungen wie den Statuen und Bauwerken und vor allem zur Tragödie und Komödie eröffnete. Eliten und Volk standen nicht in einem unüberbrückbaren Gegensatz zueinander, und das Volk war keine unstrukturierte «Masse», deren «öffentliche Meinung» Minderheiten tyrannisiert hätte.1301 Gleichzeitig gab für
1298 1299 1300 1301
danach von Fritz Wehrli. Gemäss Verlagsvertrag von September 1943 bestand die Redaktionskommission aus Albert Debrunner, Olof Gigon, Ernst Howald, Victor Martin, Max Niedermann, Arnold von Salis, Denis van Berchem, Peter von der Mühll und Fritz Wehrli. Universitätsbibliothek Basel, Handschriften, Verlagsarchiv Schwabe, Inv.-Nr. 922, Museum Helveticum Korrespondenz. Von der Mühll 1976, 506–529: «Über das naturgemässe Leben der alten Athener», Rektoratsrede, 28. 11. 1942. Näf 1986, 61 ff., 106 f. Die Ablehnung eines Bezugs auf Platons Staat war in der Rektoratsrede offensichtlich, vgl. von der Mühll 1976, 507 f. Solons Staatsideal, von der Mühll 1976, 512 f.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
337
ihn die athenische Demokratie den Rahmen ab für die im Titel des Vortrags angesprochene «natürliche Lebensweise». Er sah seinen Ort dort, wo die «Natur» des Menschen sich entfalten konnte, in der Hingabe an Kunst, Kultur und Freundschaft, ohne Verachtung des «Biotischen», wie Wyss in seinem Nachruf betonte. Demokratie gestatte Freiheit und Lebensfreude; «Gebundenheit» und «Pflichten» seien zwar wirksam, ergäben sich aber ganz natürlich. Was auf der einen Seite eine klare Absage an den Staat des Faschismus und Nationalsozialismus war, bedeutete auf der anderen Seite auch eine konservativliberale Kritik an der realen Basler Demokratie zur Zeit der linken Mehrheit. Schulzwang, Steuern, Bürokratie, Staatssozialismus statt Fürsorge wirkten auf von der Mühll zwar ganz ähnlich, wie sie Jacob Burckhardt beunruhigt hatten, als Zeichen der Unfreiheit. Doch von Burckhardts Athen-Bild, «in dem der Einzelne dem Staat verknechtet erscheint», distanzierte er sich deutlich; nicht Knechtschaft, sondern Freiheit stand im Mittelpunkt seiner Auffassung.1302 Die Rede war ein Beispiel für eine freiheitlich-konservative Ablehnung der Systeme im Norden und Süden, von links wie von rechts, aber auch für eine liberal-konservative Distanz zur Moderne im Namen eines baslerischen Humanismus. Der Redner fühlte sich anders als die radikalen Kritiker der Moderne im demokratischen Kleinstaat Basel durchaus wohl, vorausgesetzt, er entwickle sich nicht in einem staatssozialistischen Sinne. 7.2.2.5 Karl Meuli Karl Meuli war einer der ersten Doktoranden bei von der Mühll gewesen (promoviert 1920), sein liebster Schüler sowohl hinsichtlich seiner thematischen Ausrichtung als auch in der engen Freundschaft, die die beiden Junggesellen verband.1303 Meuli, seit 1926 Privatdozent, war auch der bevorzugte Begleiter auf den Bildungsreisen, die von der Mühll unternahm. Im Unterschied zum jüngeren Schüler Bernhard Wyss wurde Meuli nicht Inhaber eines im Universitätsgesetz verankerten Lehrstuhls, sondern blieb auf eigenen Wunsch Gymnasiallehrer und (seit 1933)1304 nebenamtlicher Extraordinarius, bis er schliesslich 1942 zum persönlichen Ordinarius befördert wurde, aber stets unter Beibehaltung eines (reduzierten) Schulpensums.1305 Nachdem er 1927 einen Ruf nach Zürich abgelehnt 1302 1303
1304 1305
Von der Mühll 1976, 520. Grundlegend zur Biographie von Meuli: Bonjour 1994; Jung 1975; Wyss 1968. Ausser von der Mühll gehörten zu Meulis engstem Freundeskreis der Architekt und Psychologe Walter Spiess, der Musiker Werner Wehrli, der Anthroposoph Kurt Englert-Faye und der Mediävist und Volkskundler Hans Georg Wackernagel. Jung 1975, 1164. Antrag vom 7. 7. 1932, in: StABS UA XI 3, 3 110, Akten zur akademischen Laufbahn, in: StABS ED-REG 1a 2 1202. Die Basler Universitätsbibliothek hat einen umfangreichen Nachlass von Karl Meuli. Allein von der Korre-
338
Geisteswissenschaftler
hatte, blieb Meuli in Basel.1306 Seine persönliche Professur wurde seit 1942 von der Vischer-Heuslerschen Stiftung, die die Freiwillige Akademische Gesellschaft (FAG) verwaltete, finanziert. Dafür wurden Mittel verwendet, aus denen bis 1940 die Professur für Klassische Archäologie von Ernst Pfuhl (siehe unten) finanziert worden war. So erhielt er neben dem Gräzisten Peter von der Mühll und dem Latinisten Harald Fuchs die «dritte altphilologische Professur», was der Zweckbestimmung des Vischer-Heuslerschen Legats entsprach.1307 Meulis grosses Pensum umfasste nicht nur den altsprachlichen Unterricht an der Schule und die Griechischvorlesungen an der Universität, sondern auch das weite Feld der damaligen Volkskunde – obschon er sich immer als Philologe sah. Meuli lehnte es lange ab, die Volkskunde als akademisches Prüfungsfach zuzulassen.1308 Als Altphilologe beschränkte er sich nicht auf antike Religionsgeschichte (diese war allerdings sein Ausgangspunkt, wie das Arbeitsprogramm zeigt, das er 1932 dem Chef des Basler Erziehungsdepartements vorstellte),1309 oder auf die Suche nach Ursprüngen von Riten und Kulten der Griechen und ihrer Vorgänger, wie es die deutsche Usener-Schule meist tat, sondern er erfasste die Volkskunde auch der Schweiz und Deutschlands. Ausgangs- und Referenzpunkt war immer wieder seine Beschäftigung mit Johann Jakob Bachofen,1310 dessen Werke er mit Unterstützung von Kollegen herausgab. Wie Bachofen suchte er nach Spuren des «Altertums des Altertums», für die er das Brauchtum anderer Epochen
1306 1307
1308 1309
1310
spondenz sind 990 Briefe erhalten. Wichtige Korrespondenzpartner waren offensichtlich Karl Schefold, Bernhard Wyss, Wolfgang Keiper, Harald Fuchs und Andreas Alföldi. Ruf nach Zürich auf ein Extraordinariat mit einer Besoldung von Fr. 10’000, ED an Regierungsrat 14. 7. 1927, in: StABS ED-REG 1a 2 1202. Kuratel an Dekan Werner Kaegi, 5. 12. 1941; Rektor an FAG, 23. 4. 1942; Regierungsratsbeschluss 30. 4. 1942, in: StABS UNI-REG 5d 2 – 1 (1) 223. Meuli erhielt damit insgesamt eine Jahresbesoldung von Fr. 13’200. Meulis Nachfolger auf dieser Professur wurde Felix Heinimann. Fakultät (Dekan Bombach) an Kuratel, 14. 3. 1961, ebd. «Grenzgebiet»: ED an Regierungsrat 1. 4. 1942, in: StABS ED-REG 1a 2 1202. Zweckbestimmung der VischerHeuslerschen Stiftung (für einen Lehrer der Klassischen Philologie unter der Voraussetzung, dass ihm der Staat Titel und Rechte eines Ordinarius verleihe): Kuratel an Fakultät 5. 12. 1941, ebd. Der Name des Stifters erscheint auch in der Form «Vischer-Heussler». Meuli wurde schliesslich finanziell einem Ordinarius gleichgestellt. Regierungsratsbeschluss 9. 4. 1942, ebd. Jung 1975, 1171. Geschichte der Volkskunde in Basel: Burckhardt-Seebass 2010. Ausführlicher Werkplan zur Erschliessung von «religionsgeschichtlichem Neuland» im Rahmen des Urlaubsgesuchs für WS 1932/33, Meuli an Hauser, Vorsteher ED, 3. 3. 1932, in: StABS ED-REG 1a 2 1202, Dossier «Beurlaubungen, Entlastungen». Meuli ‚entdeckte‘ Bachofen als Student dank seinen Kontakten mit Anhängern von Stefan George und Ludwig Klages in München. Jung 1975, 1159. Er beschäftigte sich mit ihm aber erst eingehend, als ihn die Kommission der Universitätsbibliothek auf Betreiben von der Mühlls 1933 beauftragte, eine wissenschaftliche Edition herauszubringen. Jung 1975, 1168 f.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
339
und Landstriche zu kühnen, von Intuition geleiteten, aber von wissenschaftlicher Nüchternheit kontrollierten Vergleichen heranzog. Dabei wurden die Vorstellungen vom Tod und der Präsenz der Toten im Leben zu einer zentralen Thematik. Seine bekannteste These war, dass die Masken die wiederkehrenden Toten darstellten.1311 Zeitgemäss war seine Ansicht, dass das «Griechische» ein Erbe des «Nordischen» sei, aber er teilte nicht die von den Nationalsozialisten propagierte These, dass sich daraus eine ‚rassische‘ Affinität der Deutschen zu den alten Griechen ergebe.1312 Für von der Mühll, aber auch für andere Basler Philologen und Archäologen bedeutete Meulis Arbeit eine erwünschte, vielleicht notwendige Ergänzung zur philologischen Arbeit am Text, insbesondere an Homer. Meulis Studien gehörten insofern auch zur ‚Überwindung des 19. Jahrhunderts‘, als in seinem Bild des Menschen nicht die Rationalität dominierte, sondern «das Unverständige, Irrationale».1313 Sein Freund Walter Spiess (der ebenfalls eng mit von der Mühll verbunden war) hatte ihn 1924 auf Freuds Totem und Tabu aufmerksam gemacht. Meulis damals unveröffentlichte Habilitationsschrift von 1926 über den Agon war davon sichtbar geprägt.1314 Dennoch entfernte sich Meuli nie vollständig vom ‚19. Jahrhundert‘ – er hatte oft die Tendenz, das Irrationale in eine ferne, vorgriechische Vergangenheit zu verlegen und die Kultur seiner Gegenwart gegen Sittenzerfall und Verlust der Wertorientierung zu verteidigen. Der Pädagoge Meuli1315 war in manchen Aspekten humanistisch-antimodern im Sinne Burckhardts, er verachtete aber die Aufklärung nicht und hielt an einer Idee eines Fortschritts der Menschheit fest.1316 Sitten unterlagen bei ihm nicht der Evolution von einer «mentalité primitive» zum zivilisierten Menschen, sondern beruhten auf wahrer und tiefer Empfindung, die zum Menschsein gehörte.1317 Auffällig ist die Wirkung des Stils seiner Arbeiten auf die Zeitgenossen. Selten wurde die Schreibweise eines wissenschaftlichen Autors als «entzückend», «umfangreich, schwer gelehrt», «eindrucksvoll», «glänzend», ja «anmutig» gepriesen, wie dies bei Meulis Publikationen geschah. Sein Stil war Ausdruck der musischen Seite seiner vielfältigen Begabung, und die Reaktionen darauf entsprangen offensichtlich der tiefen Verehrung, die seine Persönlichkeit genoss.1318 Fernerstehende beschränkten sich darauf, die eigentümliche Verbindung von «Intuition und Umsicht» zu erwäh1311
1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318
Mezger 1992. Meuli publizierte seine These, wonach die Masken die Seelen Verstorbener seien, die zurückkehrten, um zu ‚heischen‘ und damit Sühne zu fordern, erstmals 1927 und hielt an ihr bis zum Ende fest. Burkert 1992, 173. Rassem 1992, 27. Henrichs 1992, 134 f., 139. Boerlin 1992. Henrichs 1992, 148 f. Burkert 1992, 180 f. Wyss 1968.
340
Geisteswissenschaftler
nen, um damit die «glückliche» Lösung der Spannung zwischen strenger Philologie und assoziativer ethnologischer Deutung zu bezeichnen, die für Meuli charakteristisch war.1319 Über die unmittelbaren eigenen Interessen hinaus betätigte sich Meuli als Organisator der schweizerischen Volkskundler, präsidierte deren Fachgesellschaft und vollzog deren Wendung vom Deutsch-Völkischen weg und hin zu einer Verschweizerung des Faches im Sinne der ‚geistigen Landesverteidigung‘, die er ohne die deutschen Kollegen zu brüskieren betrieb. Bei Meuli kam hinzu, dass er die angelsächsische Ethnologie rezipierte (namentlich die Oxford Ritualists),1320 aber auch die französische, soziologisch informierte Ethnologie. Das Germanische trat zurück hinter der von Wilamowitz so sehr verachteten Vergleichung verschiedener Kulturen1321 und der Suche nach Ursprüngen allgemein-menschlichen Verhaltens. Von der deutschen Volkskunde der nationalsozialistischen Zeit1322 wandte er sich mit Zurückhaltung ab – eine seiner wichtigeren Arbeiten zum Thema «Maske», die durchaus zur Hauptsache deutsche Materialien berücksichtigte, erschien als Artikel im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, wie er denn nach dem Vorbild von Eduard Hoffmann-Krayer und andern Baslern bis in die 1930er Jahre hinein mit der deutschen Volkskunde selbstverständlich verbunden blieb. Regelmässig besprach er in den 1930er Jahren Publikationen von deutschen Autoren im «Schweizer Archiv für Volkskunde» (SAVk), auch solche von Otto Höfler (dieser hatte in Basel bei Andreas Heusler studiert),1323 wobei er die Verwendung des Arier-Begriffs im Nationalsozialismus und die zugehörige Rassentheorie kritisierte.1324 Die volkskundliche Tagung vom 19. bis 21. September 1938, die der Verband deutscher Vereine für Volkskunde organisierte und die sowohl in Basel als auch in Freiburg im Breisgau abgehalten wurde, gab Anlass, über die Beziehungen zu deutschen Kollegen nachzudenken, da das nationalsozialistische Element inzwischen unübersehbar geworden war. In höflicher, aber unmissverständlicher Art erklärte Meuli als Basler Gastgeber, dass die Schweizer Wert darauf legten, unabhängig zu bleiben und als viersprachiges Land nicht nur nach Norden zu blicken, was ja nun die gemässigt auftretende Fraktion der deutschen Kulturpolitik, wie sie in Freiburg von John Meier (einem alten Freund von HoffmannKrayer) und Friedrich Metz repräsentiert war, keineswegs bestritt.1325 1941 nahm
1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325
Wehrli 1968. Most 1995, 99 f., formuliert, dass Anthropologie «Hausrecht» in der Altphilologie erhielt. Marchand 2003, 145. Dow/Lixfeld 1994. Zimmermann 1994. Liste von Meulis Publikationen in: Meuli 1975, 21–29. Vgl. Jung 1975, 1166. Zum Alemannischen Institut und zum Auftreten von Friedrich Metz in Lausanne siehe Kapitel 7.2.4.5.9 e, unten. Text der Ansprache von Meuli in: Meuli 1975, 541 f.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
341
Meuli eine Einladung zu einem Vortrag in Freiburg i. Br. an mit der Begründung, dieser werde von der Kunstwissenschaftlichen Gesellschaft veranstaltet, die «altmodisch unpolitisch» sei – mit Bewilligung des Erziehungsdepartements.1326 Offenbar versuchte auch Meuli, den Kontakt zu den von ihm als vernünftig wahrgenommenen deutschen Kollegen weiterzupflegen, auch wenn die Schweizer Volkskunde dank dem «Schweizer Archiv für Volkskunde» nicht auf deutsche Zeitschriften angewiesen war und sich das Fach hierzulande zunehmend ‚helvetisierte‘.1327 Ähnlich wie Peter von der Mühll schätzte er die alte athenische Demokratie hoch als Ausdruck von «glücklichen Zeiten», vor allem weil sie die Redefreiheit gestattete, die die «Rüge» in der Komödie möglich machte.1328 Mit einer solchen Einstellung war die Distanz zur Diktatur in Deutschland selbstverständlich. 1946 resümierte er in «Volkstumspflege und wissenschaftliche Volkskunde»: «Deutsche und Italiener haben in den letzten Jahren vor dem Krieg die Volkskunde vielfach mächtig gefördert, haben aber auch höchst unerfreuliche Erscheinungen hervorgebracht.»1329 Meuli war kein «Volkstumspfleger» und lehnte eine kulturpolitische Nutzanwendung der Volkskunde ab; die Vereinnahmung des Faches durch Faschismus und Nationalsozialismus kritisierte er auch aus diesem Grunde. In Meulis Selbstverständnis stand die Idee der reinen Wissenschaft im Mittelpunkt. Dies bedeutete für ihn einen Einsatz für bleibende Werte und eine nüchterne, theorieferne Darstellung der Wirklichkeit.1330 Dieser Wissenschaftsauffassung traute er auch, wie er in seinem Geburtstagsartikel für von der Mühll zeigte, eine eminente pädagogische Wirkung zu.1331 7.2.2.6 Harald Fuchs Waren die Gräzisten der Untersuchungszeit lokal rekrutiert worden, stammte der Latinist, der damals das Fach vertrat, aus einer anderen Sphäre. Harald Fuchs war der Sohn eines protestantischen hanseatischen Kaufmanns, in China geboren, aber in Hamburg aufgewachsen und ausgebildet. Fuchs gehörte zum Schülerkreis von Werner Jaeger. Dieser protegierte seine Laufbahn, betreute sein Doktorat zum Thema Augustin und der antike Friedensgedanke (1925), verschaffte ihm in Berlin dank einer Assistenz am Archäologischen Institut die Möglichkeit zur Habilitation (1928) und brachte den 29-jährigen dann rasch auf den Lehrstuhl in 1326 1327 1328 1329 1330 1331
Antrag Meuli 23. 10. 1941, Bewilligung 1. 11. 1941, in: StABS ED-REG 1a 2 1202, Dossier «Beurlaubungen, Entlastungen». Schmoll 2010, 104 f., 107 f., 108 f.; Frei 2010, 133, 136, 138, 140, 143. Gelzer 1992, 35. Henrichs 1992, 132. Jung 1975, 1167. Rassem 1992, 20 f.
342
Geisteswissenschaftler
Königsberg (1929).1332 Von dort wurde Fuchs 1932 als Nachfolger für den nur kurze Zeit in Basel wirkenden Kurt Latte auf das Ordinariat an der Rheinstadt geholt. Die Vertretung des Faches während der Vakanz hatten sich Eduard Fraenkel (damals in Freiburg i. Br.),1333 Karl Meuli, Peter von der Mühll und Bernhard Wyss geteilt.1334 Zwar stand Fuchs nur auf dem zweiten Listenplatz für die Nachfolge von Latte hinter Otto Regenbogen aus Heidelberg,1335 aber dieser liess sich überzeugen, dass sein Verbleiben in Deutschland für die Verteidigung der Vernunft gegen die aufziehende Barbarei («der Sache des Geistes in Deutschland» dienen war Regenbogens Formulierung) Ehrensache sei.1336 So kam Fuchs zum Zug, der schliesslich sehr gut in den Basler altphilologischen Humanismus passte, auch wenn er, wie sein Nachfolger Josef Delz festhielt, kein Einbürgerungsgesuch stellte und sein Deutsch mit hanseatischem Akzent weiterhin pflegte. Weder thematisch noch bildungspolitisch folgte Fuchs seinem Mentor Jaeger. Der vor allem auf die Hellenen bezogene ‚Dritte Humanismus‘ war nicht sein Anliegen, und bei aller Beherrschung der philologischen Methoden wandte sich Fuchs der damals aktuellen «Geistesgeschichte» zu, die die Wandlungen einer Idee und eines Begriffs im Verlauf der Zeit nachzeichnete. So befasste er sich vor 1332
1333
1334
1335 1336
Schmidt 1995, 176. Personalkarte der Universitätsverwaltung; Typoskript der Ansprache gehalten an der Trauerfeier für Harald Fuchs am 4. 11. 1985 von Josef Delz, in: StABS UNI-REG 5d 2 – 1 (1) 91. Hauptsächliche Akten zur Karriere in Basel in: StABS ED-REG 1a 4 342. Die Ansprache von Delz erschien auch als Nachruf in: «Gnomon», Delz 1988. Eduard Fraenkel war 1931 von Göttingen nach Freiburg berufen worden. Er wurde aus ‚rassischen‘ Gründen im Herbst 1933 «vorläufig» und im Frühjahr 1934 definitiv in den Ruhestand versetzt. Im Herbst 1934 emigrierte er nach England. Malitz 2006, 3, 8. ED an Kuratel, 3. 2. 1932; von der Mühll an Kuratelspräsident Thalmann, 8. 2. 1932; ED an Regierungsrat, 8. 2. 1932; Kuratel an ED, 16. 2. 1932; Regierungsratsbeschluss 29. 4. 1932; ED an Regierungsrat, 5. 7. 1932, in: StABS Erziehung CC 16. In Heidelberg galt Regenbogen als Gräzist; zu seinem Schicksal: Chaniotis/Thaler 2006, 393. Akten zur Berufung von Otto Regenbogen nach Basel: Gutachten der Fakultät für die Nachfolge Latte, 4. 7. 1931 (Regenbogen auf Platz 1, Fuchs auf Platz 2); Protokollkopie Expertenkommission Latein, 8. 7. 1931 (für Regenbogen); Rüegg als Präsident der Expertenkommission an Thalmann für Kuratel, 9. 7. 1931 (die Kommission der Kuratel bestand aus August Rüegg, Edgar Salin, Jakob Wackernagel, Kurt Latte, Peter von der Mühll): Sie schliesse sich dem Fakultätsgutachten an; Kuratel an ED, 10. 7. 1931, entsprechend; Regenbogen an Hauser, 19. 10. 1931 (Absage); in: StABS Erziehung CC 16. Regenbogen gehörte zum Umkreis des ‚Dritten Humanismus‘. Sein Ziel, die Sache des Geistes zu verteidigen, verfolgte er vorübergehend 1933 und 1934 mit der Behauptung, Thukydides als «Mischblut» aus «nordischem» und «attischem Stamm» habe den «totalen Staat, in dem jeder in der Volksgesamtheit gebunden schafft und lebt», gewollt. Im Namen des Deutschen Gymnasialvereins, dem er vorstand, erklärte er, der Humanismus sei bereit, dem neuen Deutschland zu dienen, zwar mit «Zucht, Mass und Haltung», aber auch mit «Freude an Kraft und Schönheit des Körpers». Zitiert nach: Stiewe 2011, 286.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
343
allem mit der spätantiken christlichen Literatur, namentlich mit Augustin.1337 Ideengeschichtlich profilierte er sich auch mit seiner Basler Antrittsvorlesung über den «geistigen Widerstand gegen Rom». Darin zeigte sich der Latinist nicht nur als profunder Kenner auch der Griechen, sondern behandelte eingehend jüdische Schriften, um schliesslich zum Verhältnis der Christen zu Rom zu gelangen. Einen unmittelbaren Bezug auf einen geistigen Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu sehen wäre nicht angebracht. Fuchs selbst berichtete, dass die Thematik aus einer Vorlesung erwachsen sei, die er 1931 in Königsberg gehalten hatte – offensichtlich ein Hinweis darauf, dass der Leser keine Anspielungen auf die Aktualität suchen solle.1338 In der Darstellung stand die Frage nach dem Erfolg des Christentums im römischen Reich, die übrigens auch von der Mühll beschäftigte, im Mittelpunkt. Auch wenn die Wortwahl gelegentlich zeittypisch war, fehlten offen antisemitische Züge weitgehend. Der Vergleich zwischen Juden und Christen war ihm ein Anliegen, und dabei hielt er das Judentum für unterlegen, auch wenn er die «seelische Widerstandskraft» der Juden mit Respekt erwähnte.1339 Er stellte klar, dass er vom «antike[n] Judentum» handle und somit keine Aussagen zur aktuellen ‚jüdischen Frage‘ mache. «Wenn die Juden, die früher in den Römern die treuen Beschützer aller Schwachen gesehen hatten, inzwischen zu Wortführern des östlichen Römerhasses geworden waren, so lag der Grund dafür in dem Missverhältnis zwischen der Empfindlichkeit, die ihnen selbst als Religions- und Volksgemeinschaft eigen war, und der Strenge der römischen Herrschaftsansprüche.» Die «Empfindlichkeit» der von ihm als «artbewusst» bezeichneten Juden1340 kommentierte er nicht weiter. Im Vergleich mit den Juden habe «das Christentum die Unbefangenheit besessen, über eine nicht minder hartnäckige Gegnerschaft [gegen Rom] hinweg sich dem Reiche fortschreitend zu nähern und es schliesslich geradezu als ein Mittel zur Verwirklichung der neuen Lehre in seiner geschichtlichen Notwendigkeit zu bejahen und zu rechtfertigen.» Eine positive Wertung des frühen Christentums war in der Darstellung unverkennbar.1341 Dass Fuchs selbst im Christentum verwurzelt war und der unter deutschen Spezialisten für die Spätantike verbreiteten Ansicht nahestand, dass das Christentum historisch in Kontinuität zum antiken Geist gesehen werden müsse, lässt sich erkennen. Die gleichzeitig in Basel lehrenden Theologen nahm er zur Kenntnis und zitierte sie auch, allerdings mit merklicher Distanz.1342 Der Vortrag wie 1337 1338 1339 1340 1341 1342
Einordnung von Fuchs in die damals in der Latinistik aufkommende geistesgeschichtliche Hermeneutik: Schmidt 1995, 158 f. Fuchs 1938, unpaginiertes Vorwort. Fuchs 1938, 67. Fuchs 1938, 62. Fuchs 1938, 19–21. Fuchs 1938, 58 f.
344
Geisteswissenschaftler
auch die sehr umfangreichen Anmerkungen wurzelten stark in Fuchs’ Kenntnis des Augustin. Fuchs erweist sich als Kenner der Bibelphilologie, der Offenbarung des Johannes und verwandter jüdischer und christlicher Texte. Deutsche Autoren der 1930er Jahre rezipierte und zitierte er zustimmend, auch wenn sie eindeutig im nationalsozialistischen Lager standen, wie Hans Oppermann (Fuchs erwähnte dessen Arbeit über die Bevölkerungspolitik des Augustus von 1936) und Wilhelm Weber (Princeps. Studien zur Geschichte des Augustus ebenfalls von 1936). Das Thema war hier in Fuchs’ Worten die «Sorglosigkeit in der Aufnahme von Neubürgern».1343 Dieselbe Skepsis gegen ‚Neubürger‘ zeigte allerdings auch von der Mühll 1942 in seiner Rektoratsrede; sie gehörte anscheinend zu einer konservativen Idee einer Bürgergemeinschaft, die nicht beliebig ausgedehnt werden könne. Der in seinen Forschungen besonders gründliche Fuchs publizierte relativ wenig, gab sein Bestes in der Lehre sowie in der Beratung seiner Doktoranden und verausgabte sich in der Beantwortung von Fragen hilfesuchender Kollegen, vor allem nach 1945. In diesem Zusammenhang publizierte er 1947 im «Museum Helveticum» einen sehr geschätzten Überblick über die Lage der Lateinischen Philologie.1344 Auch für die Basler Bachofen-Edition setzte er sich unermüdlich ein. Der Universität diente er selbstlos in zahlreichen Ämtern.1345 Thematisch war sein Unterricht einigen Hauptautoren des üblichen Kanons gewidmet: Cicero, Vergil, Ovid, Tacitus, Livius, Horaz, Plautus, Lukrez und die römische Elegie. Eine Besonderheit war die zweimal vorgetragene «Einführung in das Römische Recht für Philologen» und (allerdings nur einmal) eine Vorlesung über die «Religion der Römer».1346 Fuchs nahm während und nach der nationalsozialistischen Herrschaft keine Rufe nach Deutschland an und blieb in Basel. Zwar soll er wie viele andere national empfindende Deutsche Hitlers Versprechungen 1933 noch begrüsst haben,1347
1343 1344 1345 1346 1347
Fuchs 1938, 93. Fuchs 1947. Delz 1988. Liste der Lehrveranstaltungen vom WS 1937/38 bis WS 1944/45, in: StABS ED-REG 1a 4 342. Andreas Heusler zählte im Dezember 1933 Fuchs zum «rechten Flügel der Deutschen und unterstützte ihn (laut Mitteilung an [Wilhelm] Ranisch 16. 12. 1933) in seinen (damaligen) Sympathien für Hitler». Bandle 1989, 38. Fuchs sah wie der Orientalist Tschudi keinen Anlass, persönlich zu Kollegen auf Distanz zu gehen, die mit einzelnen Zielen des Nationalsozialismus sympathisierten. Die Witwe von Friedrich Vöchting, Louise Vöchting-Oeri, und deren Tochter behaupteten in einem Gespräch mit dem Vorsteher des Archivs für Zeitgeschichte am 20. 3. 1986, zu denjenigen Professoren, die gleicher oder ähnlicher Gesinnung wie Vöchting (d. h. regelmässige Kontakte zum Deutschen Konsulat, positive Einstellung zu Hitlers «Neuem Europa» etc.) gewesen seien, hätten ausser dem Ökonomen Hans Ritschl (der eine Professur an der Reichsuniversität Strassburg erhielt) auch der Germanist Friedrich Ranke (1938 aus Deutschland nach Basel gekommen, weil
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
345
konnte aber seit 1934 für den Nationalsozialismus kein Verständnis aufbringen,1348 wie er auch seinem Briefpartner Richard Harder (damals in Kiel) 1934 mitteilte.1349 Einen Ruf nach Kiel erhielt er 1935. Er reiste zwar zu Verhandlungen nach Berlin, lehnte danach aber ab, worauf Basel seine Besoldung um Fr. 1’000 auf Fr. 17’500 erhöhte.1350 Freiburg i. Br. hatte ihn 1934 in Erwägung gezogen, doch die ‚national‘ denkende (oder eher dem Nationalsozialismus zugeneigte) Fakultätskommission befand, dass eine Berufung Fuchs’ nach Freiburg bedeuten würde, dass der Lehrstuhl in Basel «der deutschen Wissenschaft verloren» gehe – Fuchs galt als «Aussenposten deutscher Wissenschaft» im damaligen Sinne; und der Berichterstatter der Freiburger Fakultät, der bekannte Klassische Archäologe Hans Dragendorff, argumentierte, dass Basel bei einem Weggang von Fuchs nicht wieder einen «Reichsdeutschen» als Latinisten wählen würde. Bei einem zweiten Anlauf in Freiburg 1935 standen der regimetreue Hans Oppermann auf dem ersten Platz der Liste, Fuchs immerhin noch auf dem zweiten und der wie Oppermann zum Nationalsozialismus neigende Hans Drexler auf dem dritten. Oppermann wurde gewählt.1351 Weitere Rufe ergingen an Fuchs nach Königsberg 1934 und nach Göttingen 1938.1352 1952 lehnte er einen Ruf nach Köln ab.1353 Fuchs wies diese deutschen Angebote immer vorsichtig von sich, liess aber privat erkennen, dass er «über den Verlauf der Ereignisse [in Deutschland] entsetzt» sei und er für einen Gelehrten seiner Art in Deutschland keine Zukunft sehe. Eine seelische Belastung war für ihn die Haltung seiner Freunde und Lehrer wie Werner Jaeger, wie er seinen Schülern in der Schweiz zu verstehen gab, aber er sprach selten darüber.1354 So reihte er sich nicht öffentlich unter die Regimekritiker im Ausland ein und blieb solidarisch mit der deutschen Nation. Fuchs begrüsste als Patriot die Reichsgründung von 1871 und damit die Existenz des Reichs ohne Vorbehalte. Innerhalb der Basler Universität verkehrte er mit deutschfreundlichen Kollegen wie dem Basler Hans Georg Wackernagel (Mediävist)1355 und dem
1348 1349 1350
1351 1352 1353 1354 1355
seine Frau ‚nicht-arisch‘ war), der Latinist Harald Fuchs und der Orientalist Tschudi gehört. Gespräch mit Frau Prof. Louise Vöchting-Oeri, 20. 3. 1986, in: AFZ ETH Zürich NL Friedrich Vöchting 6. 1. Wegeler 1996, 186, 197. Schott 2008, 422. Regierungsratsbeschluss 1. 4. 1935 auf Antrag ED vom 27. 3. 1935, in: StABS Erziehung CC 16. Fuchs an Hauser ED, 9. 3. 1935; ED an Regierungsrat, 27. 3. 1935, in: StABS EDREG 1a 4 342. Malitz 2006, 11–15, Zit. dort 11. Delz 1988. Dossier «Entlastungen», in: StABS ED-REG 1a 4 342. Delz 1988, aus persönlicher Erinnerung. StABS, Leichenreden, LA 1967 Dezember 23, Hans Georg Wackernagel-Riggenbach 24. Juli 1895 – 23. Dezember 1967, Innentitel: Zur Erinnerung an Hans Georg Wackernagel-Riggenbach Geboren am 24. Juli 1895 zu Basel Gestorben am 23. Dezember 1967 zu
346
Geisteswissenschaftler
Doppelbürger Friedrich Vöchting (Agrarhistoriker),1356 was allerdings auch als Teil der professoralen Kollegialität und Höflichkeit aufgefasst werden kann. Bis zum Schluss nahm er stets an den Professorentreffen Basel-Freiburg i. Br. teil.1357 Der «starke preussische Einschlag», den Friedrich Baethgen 1931 in einer persönlichen Auskunft über Harald Fuchs erwähnt hatte,1358 fand Ausdruck in Fuchs’ Reaktion auf Werner Kaegis Verteidigung des «Kleinstaates».1359 Fuchs schrieb am 23. Dezember 1938 an Kaegi: Gewiss leben wir in den Grossstaaten in einer härteren Zucht und in grösseren Gefahren, als sie im allgemeinen für die Kleinstaaten in Betracht kommen werden. Aber wer in diese Zucht und in diese Gefahren hineingeboren ist, weiss, dass sie vielfach auch geistige Kräfte zur Entfaltung bringen, die sich ohne sie kaum oder garnicht [sic] geregt hätten. Wenn man die Reichsgründung von 1871, wie es hier in der Schweiz so oft geschieht, als verhängnisvoll ansieht, so wäre es vielleicht gut, sich einmal vorzustellen, was denn ein Fortbestehen des deutschen Kleinstaatenwesens bedeutet haben würde. Vermutlich hätten die ungefährdeten und infolgedessen erschlafften kleinen Staaten nicht allzu viel an grossen geistigen Werten hervorgebracht und dem neuen technischen Zeitalter hätten doch auch sie unweigerlich ihre Opfer bringen müssen.
Die Besten des deutschen Volkes hätten den Grossstaat herbeigewünscht, unterstrich Fuchs.1360 Während des Krieges engagierte sich Fuchs in den Bestrebungen, für die Schweizer Schulen schweizerische Texteditionen («Editiones Helveticae») bereitzustellen; wie von der Mühll Homer edierte, steuerte Fuchs ein Bellum Galli-
1356
1357 1358
1359 1360
Riehen, Trauerfeier in der Dorfkirche zu Riehen am 28. Dezember 1967 [unpaginiert]. In den «Personalien» (von Wackernagel in Ich-Form verfasster Lebensrückblick) bezeichnet H. G. Wackernagel Harald Fuchs als treuen Freund. Gespräch mit Frau Prof. Louise Vöchting-Oeri, 20. 3. 1986, in: AFZ ETH Zürich, NL Friedrich Vöchting 6. 1. In einem Brief an den wegen nationalsozialistischer Betätigung angeklagten Vöchting gab Fuchs seiner Hoffnung Ausdruck, Vöchtings Verteidigung möge Erfolg haben, und lud ihn zu einem Treffen mit Ehefrauen ein. Fuchs an Vöchting, 4. 9. 1944, in: NL Vöchting 1. 3. Korrespondenzen, Prozessakten, Presseartikel und Notizen, 1944, Rekursakten. UA Freiburg i. Br., B0001 317 Ohne Umschlagtitel, Inhalt Treffen Basel-Freiburg, ab 1924. Fuchs’ Name erscheint von 1933 bis 1938 jährlich auf der Teilnehmerliste. Friedrich Baethgen an Edgar Salin, 14. 7. 1931, in: Nachlass Edgar Salin NL 114, Fa 340. Baethgen präzisierte in diesem Brief: «Er hat eine starke politische Ader, der Staat ist für ihn einer der Zentralpunkte seines Denkens. […] Andererseits ist er seiner ganzen Art nach viel zu diskret und zurückhaltend, als dass er die Schweizer Neutralität je irgendwie tangieren würde.» Kaegi 1938a. Fuchs an Kaegi, 23. 12. 1938, in: Paul Sacher Stiftung, Nachlass Werner Kaegi, WK 193.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
347
cum1361 und einen Tacitus1362 bei. Auch er publizierte in der seit 1944 verfügbaren Zeitschrift «Museum Helveticum» und übernahm die Korrektur einzelner Aufsätze für dieses Organ. Da für Philologen früher keine Alternative zu deutschen wissenschaftlichen Kommunikationswegen bestand, veröffentlichte er vor der Gründung des helvetischen Organs Beiträge in gleichgeschalteten und ‚arisierten‘ deutschen Verlagsprodukten. Fuchs reiste bis Kriegsausbruch weiterhin nach Deutschland (im August 1939 vertrat er die Universität Basel am VI. Internationalen Kongress für Archäologie in Berlin) und wurde im September 1939 in den deutschen Wehrdienst eingezogen, aber bald wieder nach Basel entlassen, da die in der Schweiz wirkenden Deutschen der Wehrpflicht nicht unterstanden.1363 7.2.2.7 Die Alte Geschichte – von Felix Stähelin zu Bernhard Wyss Felix Stähelin,1364 Grossneffe von Jacob Burckhardt, Extraordinarius seit 1917, war 1931 Ordinarius ad personam und durch das neue Universitätsgesetz von 1937 Inhaber eines gesetzlichen Lehrstuhls1365 geworden. Er hielt umfassende Vorlesungen zur Geschichte des Altertums einschliesslich des Vorderen Orients und Israels ab. Daneben und neben seinem Engagement an der Schule (Humanistisches Gymnasium, 1905 bis 1930) und in vielen Ämtern im lokalen und nationalen Fach- und Kulturleben sowie neben der eingehenden Beschäftigung mit der Geschichte der eigenen Familie fand er die Zeit, eine Reihe von Artikeln für die Realenzyklopädie von Pauly-Wissowa zu schreiben und für die Jacob Burckhardt-Ausgabe eine Griechische Kulturgeschichte (vier Bände, 1930/31) herauszubringen. Vor allem war er der profunde Kenner der Schweiz in römischer Zeit – immer wieder wurde betont, dass wenige Provinzen des Imperium Romanum eine Darstellung ihrer Geschichte von einer mit Stähelins Buch vergleichbaren Qualität besassen. Und selbstverständlich war Stähelin an Augusta Raurica sehr interessiert. Er beteiligte sich nicht an den Ausgrabungen – dies war das Territorium von Rudolf Laur-Belart,1366 der nach seiner Tätigkeit für Vindonissa haupt1361 1362 1363 1364
1365 1366
Fuchs 1944. Fuchs 1946/1949. Elsa Mahler (Russisch-Dozentin) an ED, 12. 9. 1939; ED an Rektorat, 16. 9. 1939; Rektorat an ED, 20. 9. 1939, in: StABS Erziehung CC 16. Königs 1988, 8–32. Schriftenverzeichnis (Abt) in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 42, 1943. Laur-Belart 1952. Würdigung durch: von Ungern-Sternberg 2010. StABS Protokoll S 4 Erziehungsrat Bd. 24, 1936–1938, 6. 9. 1937. Rudolf Laur-Belart wurde 1941 zum Extraordinarius mit einem Lehrauftrag von drei Wochenstunden für Ur- und Frühgeschichte mit besonderer Berücksichtigung der Schweiz befördert. Regierungsratsbeschluss 14. 1. 1941 aufgrund Antrag ED an Regierungsrat, 20. 12. 1940, in: StABS Erziehung CC 28c. Das Schweizerische Institut für Ur- und Frühgeschichte wurde 1941 in Basel gegründet und 1943 im Beisein von Bundesrat Philipp
348
Geisteswissenschaftler
beruflich am Basler Historischen Museum als Assistent wirkte. Stähelin rezipierte und interpretierte aber laufend die neuen Ergebnisse der Archäologen und wirkte seit 1913 zusammen mit Karl Stehlin als Delegierter der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft für Augusta Raurica.1367 Er erreichte 1934 von der Regierung die Schaffung eines eigenen Seminars für Alte Geschichte, allerdings «ohne Kostenfolge».1368 Es entstand in «Wohngemeinschaft» mit den Klassischen Philologen von der Mühll, Fuchs und Meuli.1369 Über Stähelins Verhältnis zur deutschen Wissenschaft wissen wir, dass er eine baslerische Interpretation der Ideen Jacob Burckhardts gegen deutsche, von Nietzsche inspirierte Deutungen energisch verteidigte: Mit Edgar Salins «Rektoratsprogramm» zum Thema Burckhardt und Nietzsche war er gar nicht einverstanden.1370 Gegen den Seminardirektor Wilhelm Brenner, der den ‚Fronten‘ nahestand, führte er eine Kontroverse.1371 Im Augustus-Jahr, das von faschistischer Seite weidlich ausgeschlachtet wurde, hielt er eine kritische Rede.1372 Als er sich nach seinem Rücktritt dafür einsetzte, Matthias Gelzer nach Basel zu holen, den die Linken wegen seiner Zugehörigkeit zur Deutschnationalen Volkspartei ablehnten, wurde seinem Votum besonderes Gewicht beigemessen, weil er als Gegner des Nationalsozialismus bekannt war.1373 Neben Gelzer erwähnte er auch Alfred Heuss, mit dem er in brieflichem Kontakt stand.1374 Stähelin gehörte zu den
1367 1368 1369 1370 1371 1372
1373 1374
Etter eingeweiht. Die Ur- und Frühgeschichte hatte u. a. die Funktion, das spezifisch ‚Schweizerische‘ auch für weit hinter die schriftlichen Dokumente zurückreichende Epochen nachzuweisen («prähistorische Urschweiz») und gehörte damit in die ‚geistige Landesverteidigung‘. Kreis 2000, 375 f. Königs 2010, 30 f., 33 f. StABS Protokoll S 4 Erziehungsrat Bd. 22, 1932–1934, 11. 12. 1933, 3. 1. 1934. Von Ungern-Sternberg 2010, 61 f. Siehe Kapitel 7.7.4, unten. Korrespondenzen, X: Kontroverse mit W. Brenner, in: Nachlass Felix Stähelin NL 72, Abt. VIII. Über Brenner neuerdings: Giudici/Ruoss 2018. «Kaiser Augustus von Felix Stähelin (Rede im Theater von Augst)», in den Basler Nachrichten 1938; und die Rede über dasselbe Thema in Windisch/Vindonissa, erschienen Brugg: Effingerhof, 1939. Die kritische Position zum Nationalsozialismus, die sich an Jacob Burckhardt orientierte und in der Augustus-Rede zum Ausdruck kam, erwähnt auch Laur-Belart 1952. Königs 1988, 33. Auch der konservative Schweizer Alfred Heuss wäre unter den damaligen politischen Umständen in Basel ein problematischer Kandidat gewesen. Obschon er schon 1934 eine klare und kritische Einsicht in das Funktionieren des nationalsozialistischen Herrschaftssystems hatte, sah er keine Möglichkeit, eine wissenschaftliche Laufbahn in Alter Geschichte anderswo als in Deutschland zu beginnen. Er war Schüler von Berve und trat 1937 der NSDAP bei, um eine Dozentur erlangen zu können. So wurde er 1938 Lehrstuhlvertreter in Königsberg. 1941 versetzte ihn das Ministerium nach Breslau, von wo aus er kurz vor Kriegsende nach Kiel wechselte. Er hatte (ähnlich wie Gelzer) zum Band Rom
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
349
Liberalkonservativen und verachtete ähnlich wie die Redaktion der «Basler Nachrichten» den Nationalsozialismus als humanismusfeindliche Barbarei. Jacob Burckhardts Ablehnung des (deutschen) Machtstaates hatte er rezipiert. Dafür spricht, dass er zusammen mit Albert Oeri (Chefredaktor dieser Tageszeitung) im Mai 1933 den Aufruf für das Schweizerische Hilfswerk für deutsche Gelehrte unterzeichnete1375 und dass er 1942 auch auf dem Prospekt des Vereins zur Unterstützung von Flüchtlingen in Frankreich erschien.1376 Er sah keine Probleme, sich auf Kollegen in Deutschland einzulassen, die zwar konservativ dachten, von denen er aber wusste, dass sie keine überzeugten Nationalsozialisten waren. Dies führte zur bereits erwähnten Basler Kontroverse um Matthias Gelzer. Um eine verlängerte Vakanz nach Stähelins altersbedingtem Rücktritt zu vermeiden, stimmte der Kuratelspräsident schliesslich der Lösung zu, die einen historisch versierten Altphilologen auf die althistorische Professur brachte. Bernhard Wyss wurde 1945 durch alle Instanzen als Nachfolger Stähelins akzeptiert. Obschon von Haus aus nicht als breit ausgewiesener Historiker bekannt, arbeitete sich Wyss in die Materien ein und bot eine gediegene Übersicht über die klassischen Epochen der Alten Geschichte im Unterricht.1377 Nur der Neuzeithistoriker Edgar Bonjour war damit unzufrieden und beklagte die Stellung der Alten Geschichte als «Magd der Philologie»,1378 während Wyss 1952 von der Mühlls Nachfolge als Ordinarius für Griechisch antrat. Damit konnten die Karten für die Basler Althistorie zu Beginn der 1950er Jahre neu gemischt werden, ein Vorgang, der ausserhalb unseres Gesichtskreises liegt.1379 7.2.2.8 Die Klassischen Archäologen – von Ernst Pfuhl zu Arnold von Salis und Karl Schefold Ernst Pfuhls1380 Ausbildungszeit lag noch ganz in der Epoche vor dem Ersten Weltkrieg. ‚Kaiser und Reich‘ machten es deutschen Archäologen damals möglich, grössere Grabungen durchzuführen und dabei wertvolle Erfahrungen zu
1375 1376 1377 1378 1379 1380
und Karthago einen betont sachbezogenen Aufsatz beigetragen («Die Gestaltung des römischen und des karthagischen Staates bis zum Pyrrhos-Krieg»), der frei von ideologischen Konzessionen war. Ruprecht 2015, 40; Rexroth 201; von Ungern-Sternberg 2010, 76; Rebenich 2000. StABS Erziehung X 48, Schweizerisches Hilfswerk für deutsche Gelehrte, 1933–1940. Prospekt in: StABS NL Reichstein, PA 979a E 2-3 2 Frankreich: Unterstützung von Einzelpersonen und Flüchtlingshilfe 1940–1945. Von Ungern-Sternberg 2010, 63. Königs 2010, 33; von Ungern-Sternberg 2010, 62. Ruprecht 2015; Königs 2010, 38 ff. Schefold 1943. Der Nachlass Pfuhl in der Basler Universitätsbibliothek enthält so gut wie keine Korrespondenz aus der Zeit nach 1931. Ich verzichte deshalb auf die Auswertung.
350
Geisteswissenschaftler
sammeln, die denjenigen ihrer Kollegen aus den alten Kolonialmächten ebenbürtig waren.1381 Pfuhl hatte sowohl einen kunstgeschichtlichen Ansatz als auch Erfahrung mit Grabungen und Bodenforschung. 1900 promovierte er in Berlin mit einer Arbeit über die Prozessionen in Athen. Als Gatte der Griechin Sophia Rhusopulos konnte er fliessend Neugriechisch. 1909 fand er den Weg von der 1905 angetretenen Göttinger Privatdozentur nach Basel,1382 wo er zwar ein an klassischer Kunst interessiertes Publikum vorfand, aber anfänglich eher bescheidene Bedingungen: Ein Extraordinariat, ab 1911 ein Ordinariat, das die VischerHeuslersche Stiftung finanzierte. Er versah diese Professur schrittweise mit einem Seminar und einer sehr gut ausgestatteten Bibliothek (der reichsten der Schweiz),1383 was zusammen mit der von ihm geförderten Sammlung von Gipsabgüssen einen ernsthaften Unterricht in Archäologie erlaubte. Der hervorragende Fachmann blieb hier, betreute nur wenige Doktoranden (darunter Flüchtlinge wie Peter Kahane) und hielt in der Forschung einen hohen Standard. Seine Studien namentlich zur griechischen Malerei (1923) waren für das Fach von grosser Bedeutung. Pfuhl wurde früh zu einem der besten Kenner der archaischen Keramik und vor allem der griechischen Grabreliefs, denen sein zweites Hauptwerk gewidmet war. Nach Lehrbüchern und Lexikonartikeln für die Realenzyklopädie wandte er sich der Betrachtung einzelner Plastiken zu. Die attische Kunst verstand er als geprägt von einem autonomen Stil, dessen Wandel sich aus ihr selbst ergab und nicht aus immer neuen ionischen Einflüssen. Die Basler Philologen respektierten Pfuhl, zumal er über die ganze Altertumswissenschaft Bescheid wusste und sich an Wilamowitz und Hermann Diels orientierte. Insbesondere mit dem Gräzisten Peter von der Mühll verband ihn eine herzliche Kollegialität, und dieser legte Wert darauf, dass seine eigenen Schüler bei Pfuhl studierten. An Pfuhl schätzte er dessen Sinn für «die jugendliche Klugheit des Griechentums» und bewunderte den «selten klugen Mann», aber auch seine Aufgeschlossenheit für menschliche, soziale und politische Fragen – über die sich Pfuhl nie öffentlich ausliess, da er der Ansicht war, dass die Wissenschaft den ganzen Einsatz fordere.1384 Wie Pfuhl auf den Nationalsozialismus reagierte, ist bisher nicht bekannt, aber Schefold deutete an, dass er mit einer Spartanerverehrung nichts anfangen konnte. Auch war Pfuhl nach 1930 nie wieder an einem der Professorentreffen zwischen Basel und Freiburg in Breisgau an-
1381
1382 1383 1384
Vigener 2012, 9 ff. Die von Borbein 1995, 206 f., beobachtete «unfreiwillige Pause» der Archäologie nach dem Ersten Weltkrieg relativiert sich durch die Feststellung von Vigener, die eine starke Förderung der Grabungen durch die Weimarer Republik erkennt. Berufungsakten in: StABS Erziehung CC 28a (u. a. Regierungsratsbeschluss 1. 2. 1911, Beförderung zum Ordinarius). Schefold 1970 bezeichnet dies dann als Leistung von Jacob Wackernagel und vor allem von Peter von der Mühll. Zitiert bei: Schefold 1943, 100.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
351
zutreffen.1385 Er war aber sofort bereit, zusammen mit von der Mühll Karl Schefold zu helfen, als dieser als Angestellter des Deutschen Archäologischen Instituts, verheiratet mit einer sog. «Halbjüdin», durch die nationalsozialistische ‚Rassenpolitik‘ zwischen Istanbul und Athen blockiert war. Sie eröffneten ihm die Möglichkeit zur Habilitation (1936) und zum Aufenthalt in Basel mitsamt seiner Familie. Karl Schefold1386 stammte aus Heilbronn und hatte in Stuttgart das Gymnasium absolviert. Er studierte unter anderem in Tübingen und in Heidelberg, wo er Friedrich Gundolf hörte.1387 Nach dem Doktorat, das südrussischen («Kertscher») Vasen gewidmet war, hielt er sich zuerst mit einem Stipendium, dann mit einer befristeten Assistentenstelle an den Deutschen Archäologischen Instituten von Rom und Athen auf. Ludwig Curtius, der schon seine Dissertation angeregt hatte, förderte ihn in Rom, während er in Athen von Ernst Buschor1388 fasziniert war und von Georg Karo1389 unterstützt wurde. Jeweils im Sommer konnte er seit 1932 an den Grabungen in Larisa am Hermos teilnehmen, die er schliesslich selbst leitete.1390 Die Möglichkeit, über Kertscher Vasen zu arbeiten, zu denen er 1936 publizierte, verdankte er den Kontakten des Deutschen Archäologischen Instituts zur Sowjetunion.1391 Schefold verkörperte die neue Tendenz der Archäologie der 1920er Jahre, die sich von der Realienkunde, Inventarisierung und Sachkulturforschung der vorausgehenden ‚positivistischen‘ Ära abwandte und eine Kunstgeschichte der 1385
1386
1387 1388 1389
1390 1391
Schefold 1943, 89. UA Freiburg i. Br. B0001 317 Ohne Umschlagtitel, Inhalt Treffen Basel-Freiburg, ab 1924, Teilnehmerliste vom 21. 6. 1930. Im Sommer 1939 fand in Berlin der Internationale Kongress für Archäologie statt. Das ausländische Interesse war zunächst dürftig, doch die Schweizer Delegation gehörte zu den grössten ausländischen Abordnungen nach denjenigen aus Italien, Frankreich, Grossbritannien, den Niederlanden, Russland, Jugoslawien, Bulgarien und Ungarn. Der Kongressbericht wurde anscheinend nicht veröffentlicht; Vigener 2012, 86 ff. Wer die Schweizer Teilnehmer waren, erfahren wir hier leider nicht. Als Quelle benutzt Vigener den Bericht über den Kongress vom 21. 9. 1939, in: DAI Archiv Zentrale 14-01 Kongress Ministerien AA. Verzar 2014, 18. Die Basler Universitätsbibliothek hat einen umfangreichen Nachlass von Schefold. Darin gibt es grössere Bestände von Briefen an Hans Möbius, Ernst Langlotz, Edgar Salin und Carl Jacob Burckhardt. Die Dokumente in: StABS UNI-REG 5d 2 1 (2) 120 und in: UA XI 3. 3 142 sind langfristig gesperrt und wurden deshalb nicht konsultiert. Schefold 2003, 25. Buschor widmete sein 1924 erschienenes Werk über Olympia Stefan George; seine nichtkonfessionelle Religiosität glich derjenigen von Schefold und Langlotz. Hofter 2012, 129 f. Zur Person: Vigener 2012, 75. Karo war der Erste Sekretär des Athener Deutschen Archäologischen Instituts und blieb bis 1939 in Athen, obschon das Institut ihm seit 1933 den Rücktritt aus ‚rassischen‘ Gründen nahegelegt hatte. Schefold 2003, 72. Kooperation zwischen dem Institut und der UdSSR: Vigener 2012, 37. Die letzte in diesem Rahmen erschienene Publikation war diejenige von Schefold 1936. Schefold 2003, 64.
352
Geisteswissenschaftler
Antike als «Geistesgeschichte» betrieb, aber zugleich an den Ausgrabungen interessiert blieb. Schefold wie Buschor insistierten darauf, dass jede grosse Kunst eine religiöse Bedeutung habe, die sich nicht der Religionsgeschichte (nach der Art von Usener – oder für Basel von Karl Meuli) erschliesse, sondern den richtig vorgebildeten Betrachter unmittelbar durch die Werke anspreche. Diese geistige Religiosität1392 manifestiere sich in einer historischen Abfolge, die sich in Perioden gliedern lasse. Schon angeblich «primitive» Keramik liess sich darin einordnen, aber sein Interesse galt neben Archaik und Klassik auch den Randregionen des klassischen Altertums, dem Hellenismus sowie dem Übergang in die frühe christliche Kunst. Die grosse Breite, der forschende Ernst und der Zugang zu entscheidenden Netzwerken im Fach, über die der dreissigjährige Schefold verfügte, hätten es ihm unter anderen Umständen leichtgemacht, bald nach der Habilitation einen Lehrstuhl zu übernehmen. Davon zeugt auch der Ruf an die Universität Ankara, den er schliesslich kurz vor Kriegsausbruch ablehnte.1393 In Basel verlief jedoch Schefolds Karriere in den dreissiger und vierziger Jahren etwas schleppend. Geldsorgen prägten das Leben des Paares mit seinen Söhnen, die besonders drückend wurden, als das Verbot, Devisen aus Deutschland auszuführen, die Unterstützungszahlungen der Eltern Schefold aus München verunmöglichten. Seine Kunstauffassung stand unter dem Einfluss einer Zugehörigkeit zur Jugendbewegung und deren Suche nach einer ideal-geistigen Welt, die sich nach 1918 noch intensivierte.1394 Ohne dass er dem «Meister» persönlich begegnet wäre, verehrte er Stefan George und verkehrte in den Kreisen von Friedrich Wolters und anderen Georgeanern, kultivierte den Umgang mit Dichtung intensiv und teilte die Erwartung, dass ein «Weisser Ritter» Deutschland aus der Misere von 1918 erlösen werde. In Heidelberg verband er sich mit Marianne von den Steinen, einer Tochter des Berliner Völkerkundlers und Museumsdirektors Karl von den Steinen. Sie gehörte der gleichen geistigen Welt an wie Karl Schefold und ihr eigener Bruder Wolfram, ein Doktorand von Friedrich Wolters, der in Basel 1928 habilitiert und 1938 Extraordinarius für mittelalterliche Quellenkunde wurde.1395 Auch fachlich hatte der George-Kreis einen direkten Einfluss auf Schefolds kunsthistorischen Ansatz. «Das Wirken des Geistes in der Gestalt» als Thema des Lebenswerks war von George und Goethe inspiriert.1396 Robert Boehringers 1392
1393 1394 1395 1396
Werke der geometrischen Epoche als «Symbole numinoser Erfahrung», etc.: Schefold 1995, 186 (Buschor als Beispiel), 187. Vgl. den Text von Schefold, der bei seiner Trauerfeier verlesen wurde, in: Schefold 1999, 11, zu «Olympia und Golgatha», «Gericht und Erlösung». Schefold 2003, 100. Rektor Ernst Staehelin an Hauser ED, 16. 10. 1939; Hauser ED an Rektor der Universität, 21. 11. 1939, in: StABS Erziehung CC 28c. Ursprünge seiner Geistigkeit: Schefold 2003, 18 ff. Schefold 2003, 41, 46 ff., ausführlich über seine Frau Marianne. Zu Wolfram von den Steinen: Keupp 2013. Schefold 1999, 10.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
353
Behandlung der antiken Porträtkunst im Sinne des Kreises1397 wurde für ihn vorbildlich.1398 Besonders beeindruckt war Schefold von den Grafen Alexander und Berthold Schenk von Stauffenberg, die für ihn den «wirklichen Adel» verkörperten, der Deutschland zu führen berufen wäre (ähnlich wie es Edgar Salin erwartete). Mit diesen verband ihn eine auf die Schulzeit zurückgehende Freundschaft; beide vermittelten ihm ihre eigene Auffassung von Georges Geist und Bedeutung, die für sie mit dem Nationalsozialismus unvereinbar war. Diese Ideologie griff entscheidend in das Leben des Paares Schefold-von den Steinen ein. Mariannes Mutter galt als jüdisch. Die für 1933 vorgesehene Heirat (in diesem Jahr trat Schefold eine Assistentenstelle in Athen an) konnte zunächst nicht stattfinden, wurde dann aber 1935 in Athen nachgeholt unter der Bedingung, dass Schefold im Ausland zu verbleiben habe. Nun war er ‚jüdisch versippt‘ und konnte nach Ablauf seiner Assistentenzeit keine neue akademische Anstellung in Deutschland oder bei einer deutschen Organisation finden – damit war auch die wissenschaftliche Laufbahn blockiert. Per 1. November 1935 schied Schefold aus dem Deutschen Archäologischen Institut aus.1399 Schon 1933 hatte er jedoch Besuch aus Basel erhalten: Peter von der Mühll war in Begleitung des Basler Orientalisten Rudolf Tschudi auf einer seiner Reisen nach Istanbul gelangt und hatte dort Schefold kennengelernt, der Funde aus Larisa auswertete.1400 Von der Mühll war von dem jungen Archäologen beeindruckt. Als nun Schefold nach Ablauf der Assistentenzeit ohne Berufsaussichten dastand, bot ihm von der Mühll, unterstützt von Pfuhl, an, ihn in Basel zu habilitieren. Das Ehepaar Schefold liess sich darauf in Basel nieder, und die Habilitation wurde 1936 vollzogen. Der Privatdozent hatte allerdings zunächst keine Einkommensquelle in Basel. Er lebte in der ersten Zeit von den Ersparnissen aus Athen und Zuwendungen seiner Eltern (sein Vater war Jurist im deutschen Staatsdienst, seit 1928 Reichsrichter in München).1401 Hinzu kamen nach und nach kleine Lehraufträge und Honorare für Artikel. Der von Schefold verehrte Pfuhl1402 reservierte den Unterricht in klassischer antiker Kunstgeschichte für sich, so dass Schefold über spätantike Kunst sowie über den Vorderen Orient lehrte. Als Pfuhl für das Wintersemester 1938/ 39 seine Lehrtätigkeit auf zwei Wochenstunden reduzierte, um mit seinem Buch über die ostgriechischen Grabreliefs voranzukommen, erhielt Schefold den Auftrag, ihn im Umfang von drei Semesterwochenstunden zu vertreten. Dies war ein
1397 1398 1399 1400 1401 1402
Boehringer 1935; Boehringer 1937. Robert Boehringer verwaltete den Nachlass von Stefan George. Leuenberger 2020; Schefold 2003, 64, 97; Schefold 1999, 13. Schefold 1999, 12. Vigener 2012, 74; Schefold 2003, 49, 75–77. Schefold 2003, 77. Schefold 2003, 57. Schefold 1943.
354
Geisteswissenschaftler
erster Schritt in Richtung einer bezahlten Stelle an der Basler Universität.1403 Daneben unterrichtete er an der Volkshochschule. Schefolds Freunde, die seinen Lehrauftrag auszuweiten vorschlugen, benutzten die dank Karl Barth wachsende Zahl von Theologiestudenten, um die Notwendigkeit zu begründen, Unterrichtsstunden in frühchristlicher Kunst bereitzustellen, die Schefold von Walter Baumgartner und Fritz Lieb zugehalten wurden. So kam er zu einem sechsjährigen Lehrauftrag «Kunst des alten Orients und der christlichen Antike» mit einer Renumeration von Fr. 3’000.1404 Unmittelbar vor Pfuhls Tod wurden Schefolds Bezüge an der Universität auf Fr. 5’000 (daran bezahlte die Freiwillige Akademische Gesellschaft Fr. 3’500) erhöht.1405 Nach Pfuhls Tod (1940) hielt er die noch vom Verstorbenen angekündigte Hauptvorlesung «Hochklassische Kunst der Griechen», aber die Fakultät legte Wert auf die Feststellung, dass dies die Wiederbesetzung von Pfuhls Professur nicht präjudiziere.1406 Immerhin wurde er 1943 mit dem Titel eines Extraordinarius ausgestattet. Eine gewisse Enttäuschung spricht aus seinen Memoiren: «Aber man war in der Schweiz doch so vorsichtig mit Emigranten, dass ich erst 1942 ausserordentlicher, 1953 ordentlicher Professor wurde.»1407 Seine Zugehörigkeit zum George-Kreis hatte für ihn in Basel Vor- wie Nachteile. Nachteilig war eine Tendenz in der Basler Personalpolitik, die Zahl der George-Anhänger im Staatsdienst eher klein zu halten. An der Universität wirkten bei Schefolds Ankunft in Basel zum Beispiel bereits Edgar Salin als Ordinarius für
1403
1404
1405
1406 1407
Ernst Pfuhl an Kuratel, 31. 3. 1938; Kuratel (Gerwig) an ED, 22. 4. 1938; Beschluss Erziehungsrat 2. 5. 1938; ED an Regierungsrat, 18. 5. 1938; Regierungsratsbeschluss entsprechend 24. 5. 1938, in: StABS Erziehung CC 28c. StABS Erziehungsrat Protokoll Bd. 24, 1936–1938, Einträge vom 2. 5. 1938 und 25. 5. 1938. Schefold 2003, 89. ED an Regierungsrat, 5. 6. 1939, Lehrauftrag basierend auf der Eingabe der Fakultät vom 6. 3. 1939, Regierungsratsbeschluss 19. 6. 1939 entsprechend, in: StABS Erziehung CC 28c. Die deutsche Devisenstelle bewilligte die Unterstützungen [durch die Eltern] nicht mehr, von denen er und seine Familie lebten. Er habe nur noch die Entschädigung für die Vertretung Pfuhl und Honorare der Volkshochschule. «Nach allgemeinem Urteil ist Herr Dr. Schefold ein so vorzüglicher, wissenschaftlich arbeitender und lebendig vortragender Dozent und ein so bescheidener und anständiger Mensch, dass man ihn mit gutem Gewissen nicht fallen lassen darf.» StABS Erziehungsrat Protokoll S 4 Bd. 25, 1938–1940, Eintrag vom 15. 5. 1939. Regierungsratsbeschluss vom 30. 3. 1940, aufgrund des Antrags ED, 21. 3. 1940. Zur Begründung führte das ED an: Studenten und Professoren schätzten Schefold sehr. Er habe die Berufung nach Ankara abgelehnt. Seine ökonomischen Verhältnisse seien ungünstig, die Ersparnisse bald aufgezehrt. Er habe zwei Kinder und ein Gehalt von nur Fr. 3’000, in: StABS Erziehung CC 28c. Dekanat (Edgar Bonjour) an ED, 20. 8. 1940, in: StABS ED-REG 1a 1 1249. Schefold 2003, 49.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
355
Nationalökonomie und der Mittelalterhistoriker Wolfram von den Steinen.1408 Die Versuche der George-Anhänger, im Verlauf der 1930er Jahre weitere solche wie z. B. Ernst Kantorowicz nach Basel berufen zu lassen, scheiterten. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass Schefold als deutscher Patriot galt, was in den 1940er Jahren in Basel problematisch war. Bei der Diskussion seiner Kandidatur für die Nachfolge Pfuhls in der Kuratel fielen deutliche Worte. August Rüegg erklärte: «Die Opposition gegen Schefold gründet sich weniger auf seine wissenschaftliche Leistung als auf seinen ‚Georgeanismus‘.» Der Museumsdirektor Georg Schmidt doppelte nach: «Ich bin froh, dass der ‚Georgeanismus‘ offen zur Sprache kommt, denn er ist bei Schefold hinter allem als letzter Massstab doch spürbar, und dessen müssen sich die Behörden bewusst sein.» Werner Kaegi war mit ihm einig: «Genetisch hat George bei Schefolds Berufung [gemeint war wohl: der Entscheid, sich der Wissenschaft zu widmen] gewiss keine Rolle gespielt, aber dogmatisch in seiner Wirkung ist es eben doch der Fall, und zwar zunehmend.»1409 Von Vorteil war die Zugehörigkeit zum Kreis allerdings in Teilen der Basler Gesellschaft. Robert Boehringer, dessen Arbeiten Schefold bewunderte, war hier nicht ohne Einfluss. Schefolds Schwager von den Steinen war mit Georgine Im Hof verheiratet, der Tochter des einflussreichen liberalen Regierungsrats Adolf Im Hof-Schoch, des stellvertretenden Vorstehers des Erziehungsdepartements und Mitglieds des Erziehungsrats. Zu den «guten Geistern», die ihn in Basel willkommen hiessen, zählte er auch den Lehrer der Alten Sprachen am Humanistischen Gymnasium Georg Peter Landmann, Sohn des Ökonomen Julius und der Philosophin Edith Landmann, die dem inneren George-Kreis angehörten.1410 Schefold fand auch Zugang zum Künstler Alexander Zschokke, der den Grabstein seiner Schwiegermutter gestaltete.1411 Nur Edgar Salin erwähnte er in seinem Lebensrückblick mit keinem Wort. Materielle wie geistige Hilfe erhielt er vom Numismatiker Herbert Cahn, einem Schüler von Ernst Langlotz (damals Frankfurt)1412 und Pfuhl, der die Münzhandlung der Familie 1933 von Frankfurt nach
1408
1409 1410 1411 1412
Bei Schefolds Ankunft in Basel war Wolfram von den Steinen (seit April 1932) PD mit einem dreistündigen Lehrauftrag «Lateinliteratur und die Quellenkunde des Mittelalters» und einem Einkommen von Fr. 4’500 jährlich. 1938 wurde er zum Extraordinarius mit einem Pensum von fünf Wochenstunden befördert und erhielt seither Fr. 6’000 pro Jahr. Daneben gab er Kurse an der Volkshochschule. ED an Regierungsrat, 28. 2. 1938, und Regierungsratsbeschluss 18. 3. 1938, in: StABS Erziehung CC 28c. Protokoll der Sitzung der Sachverständigen für die Nachfolge Ernst Pfuhl vom 24. 3. 1941, in: StABS ED-REG 1a 1 1249. Schefold 2003, 50, 81 f.; Anonym 2007. Schefold 1999, 10. Ernst Langlotz als Vertreter der «neuen Archäologie» zuletzt: Schneider 2019. Langlotz, ein Bewunderer von Stefan George, war Assistent bei Ludwig Curtius gewesen, spätestens
356
Geisteswissenschaftler
Basel verlegt hatte.1413 Von der Mühll war zwar wie die grosse Mehrheit der Fakultät der Ansicht, Schefold sei zu Beginn der 1940er Jahre noch nicht reif für eine Professur, er setzte sich aber dafür ein, dass seine fachlichen Leistungen respektiert wurden, und stimmte nicht in den Chor der George-Kritiker ein. Die Nachfolge von Pfuhl blieb Schefold verwehrt, und die Archäologie wurde in Basel ‚vertretungsweise‘ durch den in Zürich lehrenden Arnold von Salis versehen. Von Salis, ein Schwager des Basler Gräzisten Peter von der Mühll, geboren in Liestal und in Basel aufgewachsen, dort 1905 in Klassischer Philologie doktoriert, war von 1929 bis 1940 in Heidelberg als Nachfolger von Ludwig Curtius Ordinarius für Klassische Archäologie gewesen. Er stand dort einem sehr gut ausgestatteten Institut vor und galt als einer der hervorragenden Vertreter seines Faches. Er war kunsthistorisch orientiert mit einem ausgeprägten Interesse an der Geschichte des Formenwandels in Anlehnung an Heinrich Wölfflin. Über Konflikte mit dem 1933 eingerichteten, neuen Regime ist nichts bekannt geworden; zur Weimarer Zeit hatte er zur «nationalen Opposition» gehört (d. h. er lehnte die Weimarer Republik ab) und war damit einverstanden, dass Emil Julius Gumbel (dessen ‚Fall‘ in das Jahr 1932 gehört) die Lehrbefugnis entzogen wurde.1414 Er erlebte die Nazifizierung der altertumswissenschaftlichen Nachbarfächer mit, ohne dass seine Archäologie davon wesentlich betroffen worden wäre.1415 Er wurde Mitglied des NSDLV und des NSV, sein Assistent Rudolf Horn trat der SA und dem Kampfbund für Deutsche Kultur bei,1416 was man als übliche Konzessionen an das Regime betrachten kann, mit denen man sich Schwierigkeiten mit Parteileuten zu ersparen hoffte. Bei Kriegsbeginn entschloss sich von Salis jedoch, in die Schweiz zurückzukehren, wo bereits seine Kinder wohnten. Durch Vermittlung des Kunsthistorikers Heinrich Wölfflin wandte er sich an die Universität Zürich, wo er seine Absicht damit begründete, dass das Heidelberger Institut geschlossen und wissenschaftliche Arbeit sehr erschwert sei.1417 In Zürich war dank dem altersbedingten Rücktritt von Otto Waser nur ein Extraordinariat mit Lehrauftrag frei. Trotz der bescheidenen Konditionen nahm von Salis das Zürcher Angebot an – kurz bevor Pfuhl in Basel starb. Nun gleich nach Basel zu wechseln hätte als sehr
1413 1414 1415 1416 1417
seit der Habilitation (1925) geprägt durch Ernst Buschor, befreundet mit Ernst Kantorowicz, seit 1933 Professor in Frankfurt. Die Freundschaft Cahn/Schefold ging auf das Jahr 1935 zurück. Schefold 2003, 90. Cahn in: Schefold 1999, 31 f.; zu Cahn: Boehringer 2002. Leo 2010, 52–54; Brenner 2001. Chaniotis/Thaler 2006, 394, 397 f., 402, 405 f. Chaniotis/Thaler 2006, 407, 412. Im Wintersemester 1939/40 wurde Kohle gespart, die Verdunkelung eingeführt und 17 Institute geschlossen. Im Herbst 1940 wurde allerdings der Betrieb wieder aufgenommen. Chaniotis/Thaler 2006, 425 f.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
357
ungebührlich gegolten, obschon offensichtlich ist, dass von Salis liebend gern hierher gekommen wäre.1418 Die Zürcher Fakultät behandelte von Salis’ Wunsch nach Rückkehr in die Schweiz als regulären Berufungsvorgang. Sie diskutierte vier Kandidaten, nämlich Hansjörg Bloesch aus Bern, der gerade bei Ernst Buschor in München seine Dissertation abgegeben hatte, Paul Collart aus Genf/ Lausanne, den sie als Ausgräber charakterisierte, der zudem nicht in deutscher Sprache lehren könne, und Karl Schefold, den sie sehr lobte. Den ersten Platz aber räumte sie Arnold von Salis ein. Als eigentlicher Kunsthistoriker spreche er sowohl zu den Kunstforschern als auch zu den Altertumswissenschaftlern, er sei ein «gereifter Meister». Gegenüber den deutschen Stellen brauche er ein «Motiv», um von seiner dortigen Professur entlassen zu werden – ein Ruf nach Zürich wäre dafür passend. Von Salis aber erklärte sich mit dem Gehalt von Fr. 12’000 zufrieden, verzichtete auf Ruhegehalt und Eintritt in die Sozialversicherung, erhielt aber Titel und Rechte eines Ordinarius. So wählte ihn der Zürcher Regierungsrat am 18. April per 16. Oktober 1940. Er hatte damals noch die Aussicht, Erträge aus seinem in Deutschland angelegten Vermögen zu beziehen, was angesichts der Devisenbewirtschaftung als ausserordentliches Privileg erscheint.1419 Erst bei Kriegsende wurde offensichtlich, dass das Vermögen verloren war. Aber auch in Basel war kein gesetzlich verankerter Lehrstuhl für Klassische Archäologie zu vergeben. Die einzige international führende Kraft, die hätte berufen werden können, war von Salis, und dieser war soeben in Zürich verpflichtet worden. Einige deutsche Namen wurden von der Kommission der Basler Fakultät pro forma erwogen, aber es galt inzwischen als inopportun, einen Ruf nach Deutschland ergehen zu lassen. Die Schweizer Archäologen betrachtete die Fakultät als zu wenig qualifiziert (die Einschätzungen lauteten ähnlich wie in Zürich), und vor allem entsprachen sie nicht dem gewünschten Profil: Kunstgeschichte. So wäre an sich Schefold infrage gekommen, doch niemand in Basel wollte ihm eine volle Fachvertretung zugestehen, und es wurde an entscheidender Stelle der Argumentation festgehalten, er sei «deutscher Staatsangehöriger». Immerhin erschien sein Name in den Vorschlägen der Fakultät und der Kuratel auf dem zweiten Listenplatz (genau wie in Zürich), während auch hier auf dem ersten Platz Arnold von Salis stand, ein «Meister seines Faches», der «auf der Höhe
1418 1419
Ich danke dem UA Zürich für seine wertvollen Auskünfte. Die Basler Akten in: StABS UA XI 3. 3 140, und ED-REG 1a 1 1249. Protokoll und Beschluss des Regierungsrats vom 18. 4. 1940 (enthält auch einen Auszug aus dem Gutachten der Fakultät); Beschluss des Erziehungsrats vom 19. 11. 1940 (Bibliothek), in: UA Zürich, Dekanats- und Rektoratsakten AB.1.0839.
358
Geisteswissenschaftler
seines Schaffens» stehe. Die Fakultät argumentierte, dass nur mit von Salis das hohe Basler Niveau gewahrt werden könne.1420 Die als Provisorium deklarierte Lösung ging dahin, von Salis so lange als möglich in Basel zusätzlich zu seiner Zürcher Professur mit einem vierstündigen Lehrauftrag zu versehen und ihm die Fachvertretung zu übergeben. Zum Erstaunen der Basler bewilligte Zürich die Nebentätigkeit von von Salis zunächst nur für zwei Semester in der Annahme (der von Basel aus nicht widersprochen wurde), in dieser Zeit könne für Pfuhl ein geeigneter Nachfolger gefunden werden.1421 Faktisch war aber das Basler Provisorium von Dauer, weil sowohl die Basler Universität vom Prestige von Salis’ profitierte, als auch von Salis selbst auf den Zuverdienst angewiesen war. Als 60jähriger hielt er die Doppelbelastung noch aus, aber im Herbst 1947 waren seine Kräfte erschöpft, und er wurde in Basel zunächst dispensiert, bis er auf Ende Sommersemester 1948 vom Basler Lehrauftrag zurücktrat.1422 In Zürich erhielt er zudem kurz vor der Emeritierung noch das 1420
1421
1422
Der Antrag lautete auf ein Provisorium mit Arnold von Salis und eine Erweiterung von Schefolds Lehrauftrag mit dem Zweck, von Salis durch Lehrveranstaltungen über den Alten Orient, die kretisch-mykenische Kultur sowie die frühgriechische und altitalische Kunst zu entlasten. Bericht der Fakultät zur Nachfolge Pfuhl, 10. 1. 1941, in: StABS EDREG 1a 1 1249. Die Sachverständigen der Kuratel (zu ihnen gehörte von der Mühll) stimmten dem Fakultätsvorschlag unter der Voraussetzung zu, dass Schefold weiterhin in Basel wirke. Von Salis würde das «humanistische Studium in Basel» neben von der Mühll, Fuchs und Meuli ergänzen «und ihm die erste Stelle in der Schweiz und einen erhöhten Glanz im Ausland sichern». Nicht vergessen wurde der Hinweis, dass der Tod Pfuhls eine Gelegenheit sei, Meuli noch stärker vom Schuldienst zu entlasten. Bericht der Sachverständigen an die Kuratel, 31. 3. 1941, ebd. In der Kommission hatte sich von der Mühll für Schefold eingesetzt: «Da Dr. Schefold ohne die Möglichkeit, Prof. von Salis zu bekommen, nach meiner Auffassung durchaus befähigt gewesen wäre [das Fach allein zu vertreten], bin ich für Gewährung des Titels ao. Professor. Ich muss das deutlich sagen, trotzdem ich dem Gutachten zustimme.» Protokoll der Sitzung der Sachverständigen vom 24. 3. 1941, ebd. ED Basel an ED Zürich, 10. 4. 1941; von Salis an Regierungsrat K. Hafner und an den Dekan in Zürich, 15. 4. 1941, und Dekanat Zürich an ED Zürich, 19. 4. 1940. Der Zürcher Regierungsrat bewilligte die Basler Tätigkeit am 3. 5. 1941. UA Zürich AB.1.0839. Regierungsrat Im Hof, der Fritz Hauser als Departementsvorsteher vertrat, war anfangs April 1941 eigens zu seinem Zürcher Amtskollegen gereist, um die Anstellung von von Salis in Basel zu regeln. Die Zürcher, aber auch von Salis selbst, bezeichneten die Basler Anstellung damals als «interimistisch». Die Akten zur Basler Anstellung von von Salis in: StABS ED-REG 1a 1 1249. Erziehungsratsbeschluss vom 23. 6. 1947 (Dispensierung von Salis unter Belassung der Besoldung); Dekanat an Kuratel, 9. 7. 1947 (Protest der Fakultät gegen die Absicht der Kuratel, den Berner Privatdozenten Hansjörg Bloesch zum Nachfolger von von Salis zu ernennen); Kuratel an Dekanat, 15. 6. 1948; Dekanat an Kuratel, 2. 7. 1948 (Rücktritt von Salis und Überlegungen zur Nachfolge; Schefold wurde davon ausgeschlossen), in: StABS UA XI 3, 3 140.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
359
volle Ordinariengehalt, so dass er schliesslich das Basler ‚Provisorium‘ aufgab.1423 Er scheint auch in Zürich und Basel zum konservativen Lager gehört zu haben; auffällig ist, dass er in den «Schweizer Monatsheften» publizierte und dass auch ein Nachruf auf ihn in dieser Zeitschrift erschien.1424 Als er von der Nachfolge Pfuhl ausgeschlossen wurde, erhielt Karl Schefold einen erweiterten Lehrauftrag «Kunstgeschichte der (alten) Mittelmeervölker»,1425 während die freigewordenen Mittel der Vischer-Heuslerschen Stiftung Meuli zugute kamen. Schefold wurde dann 1943 auf Antrag der Fakultät, von Salis’ und der Kuratel mit dem Extraordinarientitel ausgestattet,1426 und im Herbst 1944 wurde ihm (zur Entlastung von von Salis) die Leitung des Archäologischen Seminars und der entsprechenden Übungen übertragen; von nun an erhielt er jährlich Fr. 8’000.1427 Solange aber von Salis in Basel tätig war, musste er dessen Lehrangebot «ergänzen». Erst 1953 wurde er zum Ordinarius befördert. Schefold hatte offensichtlich lange Zeit in der Rolle des jungen, nach Basel geretteten, dankbaren Schützlings zu verharren. Hinderlich war zudem sein Bekenntnis zu George. Schliesslich war Schefold Deutscher, und solche wurden nach etwa 1936 in Basel nach Möglichkeit von wichtigen Positionen ferngehalten. Explizit nahm die Kuratel an, dass Schefold nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft wieder nach Deutschland zurückkehren werde. In den Akten ist festgehalten, dass man seine Basler Situation bewusst nicht «festigen» wollte, um nach dem Rücktritt von Arnold von Salis freie Hand für eine anderweitige Vergabe der Professur zu behalten. Bis 1953 war die Familie Schefold auch nur mit einer Aufenthaltsbewilligung in Basel geduldet gewesen; nun endlich erhielt sie einen «Schweizer-
1423
1424
1425
1426 1427
Von Salis an Kuratelspräsident Hagemann, 27. 5. 1948; Regierungsratsbeschluss vom 4. 6. 1948 und ED Zürich an von Salis, 4. 6. 1948, in: UA Zürich AB.1.0839, und StABS EDREG 1a 1 1249. Das Gehalt stieg damit von Fr. 12’000 auf 16’000. Die Pensionierung («Entlassung») erfolgte per 15. 10. 1951 und sah ein Ruhegehalt von Fr. 9’600 vor. Schweizer Monatshefte 38, 1958, 432–437. Auch Schefold publizierte in den Monatsheften: «Akademische Verantwortung», in Nr. 26, 1946, 361–364, und im gleichen Heft: «Die Antwort des griechischen Geistes auf Alexander den Grossen». Regierungsratsbeschluss 16. 5. 1941, in: StABS UA XI 3, 3 140. StABS Erziehungsrat Protokoll S 4 Bd. 26, 1940–1942, Einträge vom 7.4., 12.5., 26. 6. 1941. Damit war nun eine Besoldung von Fr. 7’000 verbunden. StABS Erziehungsrat Protokoll S 4 Bd. 26, 1940–1942, Eintrag von 24. 8. 1942. Regierungsratsbeschluss vom 17. 10. 1944, in: StABS UA XI 3, 3 140. Kuratel an ED, 4. 7. 1944, in: StABS ED-REG 1a 1 1249. Von Salis selbst hatte beim Kuratelspräsidenten Gerwig angeregt, dass Schefold für ihn das Seminar führen solle, aber zugleich erklärt, dass er Hansjörg Bloesch (PD in Bern) für den besseren Archäologen halte. Gerwig erklärte dem ED, Schefold könnte nach Deutschland zurückkehren, wenn sich die Verhältnisse ändern. Darum soll seine Bindung an Basel nicht verstärkt werden. StABS Erziehungsrat Protokoll S 4 Bd. 27, 1942–1944, Eintrag vom 22. 9. 1944.
360
Geisteswissenschaftler
pass».1428 Er hatte aber inzwischen eine enge Verbindung mit geistig interessierten und zugleich vermögenden Persönlichkeiten hergestellt, die ihn förderten und ihm erlaubten, eine eigene archäologische Schule in Basel mit relativ zahlreichen Doktoraten aufzubauen – was Pfuhl nie gelungen war. Höhepunkt seiner Tätigkeit war die Gründung des Antikenmuseums 1961 (eröffnet 1966).1429 Schliesslich konnte Schefold nach dem Krieg auch eigene Grabungen im Ausland organisieren und leiten.1430 Nach schwierigen Anfängen erwies sich seine Archäologie in Basel somit als Erfolgsgeschichte. Seit seiner Ankunft in der Rheinstadt war Schefold hier einer der dezidierten Gegner des Nationalsozialismus. Dazu trugen auch seine Freundschaften zu Juden in Deutschland bei.1431 Schon beim Ausgang des Ersten Weltkrieges war er vom wilhelminischen Patriotismus enttäuscht, wandte sich deshalb der deutschen Jugendbewegung zu, las Hölderlin und fand bei George, was er suchte.1432 Vom Aufstieg der Nationalsozialisten 1932/33 war er nach eigener Aussage «überrascht». Er wusste, dass die Grafen Stauffenberg «das Gesindel» verachteten. Im Frühjahr 1933 hielt er sich nochmals in Deutschland auf, traf seine Verlobte Marianne von den Steinen in Weimar und erfuhr vom Reichstagsbrand. Langlotz erklärte die Sache als «nazistische Inszenierung». Er selbst erinnerte sich, dass er vor 1933 auf einen Erfolg des Kanzlers Brüning gehofft hatte, und dass er 1933 in der Erwartung nach Athen ging, «das geheime Deutschland, das wahre, werde siegen» – 1935 kam er zum Schluss, dass dies leider nicht eintraf.1433 Als Ausländer in der Schweiz, aber auch als Sohn und Schwiegersohn von weiterhin in Deutschland lebenden Personen hielt er sich mit öffentlichen Äusserungen zurück, damit er weiterhin nach Deutschland fahren konnte. Dies war nicht nur aus familiären Gründen erforderlich, sondern auch für die Weiterarbeit an der Veröffentlichung der Resultate seiner Grabungen in Larisa. Auch war es von Vorteil, sich in Basel nicht als «Emigrant» zu profilieren – so finden wir Schefolds Namen sowohl 1937 als auch 1938 auf der Liste derjenigen Basler Dozenten, die das
1428 1429 1430 1431
1432 1433
Schefold 2003, 120. Kaufmann-Heinimann 2012, 22. Schefold 1999, 14. Als Beispiel sei seine Freundschaft mit Paul Jacobsthal erwähnt, der zu den George-Bewunderern gehörte und aus ‚rassenpolitischen‘ Gründen 1935 in den Ruhestand versetzt wurde. Jagust 2012; Schefold 2003, 57. Schefold 2003, 30. Schefold 2003, 75; Schefold 1999, 13. Die im George-Kreis 1933 gehegten Erwartungen liefen anscheinend darauf hinaus, dass sich ein staatlicher Kollektivismus auf der Basis von Führer- und Gefolgschaftsverhältnissen sowie heroischer Gesinnung etabliere. Stiewe 2011, 274–276. Was Schefold selbst damals genau unter einem Sieg des geheimen Deutschland verstand, wissen wir nicht; jedenfalls gehörte er nicht zu denjenigen GeorgeVerehrern, die zu Hitler überliefen. Namen in: Stiewe 2011, 288.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
361
Treffen mit Freiburger Kollegen in Bad Bellingen besuchen wollten.1434 Er publizierte weiterhin in Deutschland, im «Gnomon», in «Die Antike» (bis 1943) und auch in der offiziösen kulturpolitischen Zeitschrift «Forschungen und Fortschritte» (1944).1435 Ferner arbeitete er bis 1943 noch in den Semesterferien in Rom im Deutschen Archäologischen Institut.1436 Auch für die Archäologie galt, dass es nach 1933 so gut wie keine Alternative zum wissenschaftlichen Kommunikationssystem gab, das deutsche Verlage und Fachgesellschaften aufgebaut hatten. Schefold bewunderte den Versuch der Hitler-Attentäter von 1944 (die Gruppe der Tyrannenmörder Harmodios und Aristogeiton hatte für ihn einen hohen Stellenwert im Sinne des «Geistes der Freiheit in Athen» und als Symbol der Hoffnung für die Emigranten)1437 und war tief beeindruckt von ihrem Opfertod. Offensichtlich war er – in dieser Hinsicht Edgar Salin vergleichbar – der Ansicht, das «geheime Deutschland» Georges sei berufen, die nationalsozialistische Diktatur doch noch zu überwinden und die Führung zu übernehmen. Die Etrusker waren an sich ein archäologisches Thema, das in der Zwischenkriegszeit beliebt war, für das es aber in Basel keinen Spezialisten gab. In Frankfurt hatte Hans Mühlestein, ein Schweizer Anhänger von Leonard Nelson,1438 1929 einen Lehrauftrag für dieses Gebiet erlangt. Er unterrichtete von 1930 bis 1932 an der Universität sowie im Bund für Volksbildung und bekannte sich spätestens am Ende dieser Periode zum Marxismus. Zwar begrüsste die dortige Fakultät seinen Unterricht nicht, aber das Ministerium (Carl Heinrich Becker) hielt seine Ideen für originell und passend als Ergänzung des archäologischen Lehrangebots. Mühlestein vertrat die umstrittene Idee, dass die Etrusker ein seefahrendes Volk gewesen seien, das in Italien angekommen und dort eine Art feudaler Herrschaft als Herrenvolk errichtet habe. Er orientierte sich an Oswald Spengler und ging von «völkerbiologischen Lebensgesetzen» aus.1439 Von 1925 bis 1928 hatte er intensiv über die Etrusker geforscht, unterstützt von Franz Oppenheimer, der seit 1919 in Frankfurt Professor war und 1933 über Palästina in die USA auswanderte. Oppenheimer ermöglichte ihm Forschungsreisen und die Immatrikulation in Frankfurt, ohne dass er dort einen Doktorvater gefunden hätte. Diese Rolle übernahm dann in Zürich der Archäologe Otto Waser. Die (bestandene) Lateinprüfung aus Mühlesteins 1911 gescheitertem Versuch, die 1434
1435 1436 1437 1438 1439
Schefold 2003, 98 f. UA Freiburg i. Br. B0001 317 Ohne Umschlagtitel, Inhalt Treffen Basel-Freiburg, ab 1924, Listen für 1937 und 1938. Er war dabei in guter Gesellschaft: Peter von der Mühll stand ebenso auf diesen Listen wie Harald Fuchs. Zu dieser Zeitschrift: Vigener 2012, 21 f., 62. Schefolds Publikationsorte ergeben sich aus: Schefold 2003, 215 ff. (Schriftenverzeichnis im Anhang), sowie Müller-Huber 1990. Schefold 2003, 101. Schefold 2003, 95 f. Meyer 2017, 46 ff. Steuernagel 2018, 237–255: «Ursprung und Originalität der Etrusker. Wiederaufnahme einer Diskussion».
362
Geisteswissenschaftler
Matura nachzuholen, sein Primarlehrerpatent und die in Zürich und Frankfurt absolvierten Semester dienten 1928 als Grundlagen für die Zulassung zum Zürcher Doktorat im Hauptfach Kunstgeschichte und in den Nebenfächern Deutsche Literatur und Schweizergeschichte.1440 Noch vor der Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur verliess Mühlestein im Herbst 1932 Frankfurt und suchte eine Aufgabe in der Schweiz.1441 Da er in Zürich bei Otto Waser doktoriert und in Frankfurt Lehrbeauftragter gewesen war, hoffte er auf eine Stelle im akademischen Unterricht. Nachdem er im Frühjahr 1933 eine kurze Zeitlang das Sekretariat des Hilfswerks für deutsche (emigrierte) Gelehrte in Zürich aufgebaut und dafür Unterschriften gesammelt hatte,1442 das dann vom VPOD-Gewerkschafter und Nationalrat Emil Oprecht als Verein übernommen wurde,1443 wandte er sich 1935 an Oprechts Parteifreund Fritz Hauser, Chef des Basler Erziehungsdepartements, mit der Bitte um eine bezahlte Beschäftigung in dessen Departement. Dieser fragte in der Basler Fakultät an, ob für Mühlestein ein Lehrauftrag infrage käme, was vom Althistoriker Felix Stähelin vehement verneint wurde: In Basel waren sich die Fachleute einig, dass Mühlestein völlig unwissenschaftlich arbeite («krasser Dilettant»).1444 Da Stähelin sich wunderte, wie Mühlestein überhaupt in Zürich hatte doktorieren können,1445 holte Hauser, der anscheinend hinter der Abwehrhaltung der Fakultät ein politisches Motiv vermutete (Mühlestein behauptete 1939, er habe keinen Zugang zu Schweizer Universitäten erhalten, weil er das Hilfswerk aufgezogen habe),1446 in Zürich bei Robert Faesi eine Auskunft über diese Promotion ein. Damit beging der den Fauxpas, Stähelins nur an ihn gerichtetes, vertrauliches Urteil nach Zürich weiterzuleiten und dort den Eindruck zu erwecken, die Basler würden die Kompetenz der Zürcher Fakultät in der Beurteilung einer wissenschaftlichen
1440 1441 1442 1443
1444
1445 1446
Meyer 2017, 75 ff. Entlassung 11. 11. 1932. Meyer 2017, 94 ff. Die Basler Unterschriften vom Mai 1933 in: StABS Erziehung X 48, Schweizerisches Hilfswerk für deutsche Gelehrte, 1933–1940. Meyer schreibt Mühlestein das Verdienst zu, das Hilfswerk gegründet und zusammen mit dem Basler Redaktor Oeri den Aufruf, der im Juni in der Presse erschien, verfasst sowie Unterschriften und Gelder gesammelt zu haben. Im August konstituierte Oprecht die Initiative als Verein und besorgte das Sekretariat mit VPOD-Mitteln, ohne für Mühlestein Verwendung zu haben. Meyer 2017, 132 ff. Ab November 1935 bemühten sich Karl Barth, Felix Stähelin und der Psychiater John Staehelin um die Schaffung einer Basler Ortsgruppe. Hauser an Oprecht, 18. 11. 1935, in: StABS Erziehung X 48, Schweizerisches Hilfswerk für deutsche Gelehrte, 1933–1940. Felix Stähelin vertraulich an Hauser, 26. 7. 1935, in: StABS Erziehung X 48, Schweizerisches Hilfswerk für deutsche Gelehrte, 1933–1940. Stähelin konzedierte, dass Mühlestein «ein Schriftsteller von Geist» sei, der bei einer Redaktion unterkommen könnte. Mühlesteins akademischer Bildungsgang: Meyer 2017, 16, 26 f., 30, 46. Meyer 2017, 146.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
363
Leistung in Zweifel ziehen.1447 Schliesslich blieb es dabei, dass für Mühlestein die akademischen Türen in der Schweiz verschlossen blieben, da er auch an der ETH keinen Erfolg hatte und sowohl vom Zürcher Althistoriker Ernst Meyer als auch vom Basler Archäologen Ernst Pfuhl negativ beurteilt wurde.1448 7.2.2.9 Sprachwissenschaft Bis zum Anfang der 1930er Jahre lagen in Basel die allgemeine Sprachwissenschaft und Sprachgeschichte («Indogermanistik») in den berühmten Händen von Jacob Wackernagel. Trotz der prominenten Stellung, die er innegehabt hatte, erhielt er keinen direkten Nachfolger, und im neuen Universitätsgesetz von 1937 war kein Lehrstuhl für sein Fach vorgesehen. Man behalf sich mit einem Dozenten aus dem deutschen Freiburg, der neben seiner dortigen Tätigkeit jeweils für einige Tage nach Basel kam, um hier zu unterrichten. Johannes Lohmann war in der Basler Fakultät angesehen und nicht betroffen von der wachsenden Abneigung gegen Deutsche. Da er der Fakultät nicht angehörte und nicht in Basel wohnte, war Harald Fuchs für die Geschäfte des Indogermanischen Seminars verantwortlich.1449 Lohmann verhielt sich in Basel unpolitisch, wofür er sich später in Deutschland rechtfertigen musste.1450 In Freiburg hatte Lohmann keine offensichtlichen Probleme mit den Nationalsozialisten und wurde schliesslich 1940 auf eine Professur (Extraordinariat) nach Rostock versetzt. 1943 kam er nach Freiburg zurück, ohne allerdings wieder in Basel zu wirken.1451 Edgar Salin versuchte 1938 seinen Freund, den Indologen Heinrich Zimmer aus Heidelberg, der dort wegen seiner jüdischen Frau (Tochter von Hugo von Hofmannsthal) entlassen worden war, anstelle von Lohmann in Basel Sprachwis1447
1448 1449 1450
1451
Robert Faesi an Hauser, 2. 8. 1935, in: StABS Erziehung X 48, Schweizerisches Hilfswerk für deutsche Gelehrte, 1933–1940. Faesi hielt Stähelins Urteil für zu scharf, war aber auch der Meinung, Mühlestein sei «mehr Anreger als Forscher» und dazu ein talentierter Dichter. Die Dissertation sei von Waser allein beurteilt worden; dieser habe sich sicher mit Gewissenhaftigkeit bemüht. Meyer 2017, 147 f. ED an Fuchs, 22. 2. 1938, in: StABS ED-REG 1a 4 342. Lohmann erklärte 1940 in Rostock, er habe sich in seiner Basler und Freiburger Zeit politisch zurückhalten müssen, teils wegen der Freiburger Politik der guten Nachbarschaft mit der Schweiz (offensichtlich eine Anspielung auf das Rektorat von Friedrich Metz), teils wegen dem ausdrücklichen Verbot der Basler Regierung für Universitätsangehörige, sich politisch zu äussern. Er versprach, sich nun in Rostock als ‚guter Staatsbürger‘ zu erweisen, 14. 11. 1940. http://cpr.uni-rostock.de/file/cpr_person_00002296/cpr_derivate_000059 69/lohmann_johannes_erklaerung.pdf. Ebd.; http://portal.uni-freiburg.de/indogermanistik/seminar/historia.html; http://cpr.unirostock.de/file/cpr_person_00002296/cpr_derivate_00005968/lohmann_johannes_beur teilung.pdf.
364
Geisteswissenschaftler
senschaft dozieren zu lassen. Er scheiterte am Widerstand der Fakultät, die Lohmann vorzog. Salin vermutete, dass die Klassischen Philologen Zimmer ablehnten, weil er über den engeren Fachkreis hinaus wirkte (wohl auch eine Anspielung auf Zimmers Beziehungen zu Carl Gustav Jung und zum Eranos-Kreis in Ascona), und dass die Behörden an Lohmann festhielten, weil er weniger Mittel benötige, als man für den international angesehenen Zimmer aufwenden müsste.1452 Typischerweise kam nun 1940 kein Deutscher mehr für die Nachfolge Lohmanns in Betracht. Und ähnlich wie kurz darauf in der Klassischen Archäologie wurde eine Lösung bevorzugt, die es einem herausragenden Schweizer Fachvertreter gestattete, neben dem Engagement an einer anderen helvetischen Universität das Fach auch in Basel zu vertreten. Der dafür auserwählte Schüler von Jacob Wackernagel, Albert Debrunner,1453 in Basel aufgewachsen, hatte in Deutschland Karriere gemacht und war nun (seit 1935) in Bern untergekommen. In Jena, wo er seit 1925 tätig gewesen war, geriet der christlich motivierte Gegner des Nationalsozialismus und Helfer Verfolgter mit der gleichgeschalteten Hochschulpolitik in Konflikt und wurde entlassen. Da in Bern gleichzeitig der Nationalsozialist Walter Porzig untragbar geworden war, konnte Debrunner dorthin wechseln, während Porzig nach Jena ging.1454 Von 1940 bis 1949 lehrte Debrunner neben der Berner Professur auch in Basel im Rahmen eines besoldeten Lehrauftrags von drei bis fünf Wochenstunden, während das Salär für seine Berner Anstellung entsprechend reduziert wurde.1455 Der Lehrauftrag wurde ihm auf Antrag der Fakultät erteilt, die mit dem Bedürfnis der Klassischen Philologen argumentierte.
1452
1453 1454 1455
ED Basel an Salin, jeweils gezeichnet von Hauser, später von Carl Miville, in: Nachlass Edgar Salin, NL 114, Fb 1236, Salin an Hauser, 25. 5. 1938, und Fa 2447–2453, einzelne Dokumente ohne spezifische Nummer, Bsp.: 21. 9. 1938 gez. W/H [Fritz Wenk Sekretär/ Fritz Hauser Departementsvorsteher]. Das ED fand Indologie interessant, aber nicht wirklich notwendig. Hauser äusserte sich in der Sitzung der Kuratel vom 29. 8. 1938 sehr ungehalten über den Antisemitismus, der bei der Diskussion in der Fakultät über Salins Vorschlag sichtbar geworden sei, auch hatte er Einwände gegen Lohmann vernommen, während die zentralen Gestalten der Kuratel, August Rüegg und Adolf Lukas Vischer, unterstützt vom Sozialisten Miville, an Lohmann festhielten. StABS Protokoll T 2 Kuratel der Universität Bd. 13 1935–1941, 282, 7. Sitzung, 1. 6. 1938, und 297, 9. Sitzung, 29. 8. 1938. Eine fachlich negative Beurteilung von Zimmers Stellung in der deutschen Wissenschaft vor seinem Exil: Marchand 2007, 303 («neoromantische Kunstgeschichte», «zu jung und zu marginal»). Maas 2018 und 2018a. Schütt 1996, 87. StABS Erziehungsrat Protokoll S 4 Bd. 26, 1940–1942, 27. 5. 1940 und 12. 9. 1940. Regierungsratsbeschluss vom 11. 10. 1940, gemäss Antrag ED an Regierungsrat, 26. 9. 1940, in: StABS Erziehung CC 28c.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
365
Danach erhielt der 1942 habilitierte Alfred Bloch einen Lehrauftrag und später eine Professur.1456 Der ausgezeichnete Gelehrte kümmerte sich neben seinen Forschungen eingehend um das Verständnis vor allem der Studierenden der Klassischen Philologie für die Welt der indogermanischen Sprachen und deren Geschichte, ohne dass es ihm gelungen wäre, eine eigene Schule zu bilden. 7.2.2.10 Ergebnis: Humanismus als Grundlage für Resistenz Als Ergebnis möchte ich festhalten, dass in Basel der Humanismus in verschiedenen Ausprägungen eine ausgesprochene Resistenz oder ‚Immunität‘ gegen nationalsozialistische Einflüsse begründete. Das Wort ‚Humanismus‘ hat zahlreiche verschiedene Bedeutungen angenommen, insbesondere seit der Auseinandersetzung mit den Diktaturen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Derjenige Humanismus, der uns in Basel begegnet, war keine Doktrin und keine Ersatzreligion (wie sie von christlicher Seite gerne kritisiert wurde),1457 er hatte auch keinen Bezug zu ‚neuen Humanismen‘ im Umkreis emanzipatorischer und antifaschistischer Philosophien wie des Marxismus.1458 Seine Beziehung zur Aufklärung blieb implizit, und er wurde aufgrund der eher konservativen Orientierung nicht mit den Errungenschaften der Revolution von 1789 in Verbindung gebracht. Auch ‚Humanismus‘ verstanden als historische Epoche, synonym mit ‚Renaissance‘, ein Begriff, der für Geschichtsforscher wie Werner Kaegi1459 eine Referenz darstellte («Althumanismus» im Gegensatz zum «Neuhumanismus» des frühen 19. Jahrhunderts),1460 wurde von den Basler Altertumswissenschaftlern nicht direkt als Basis einer Weltanschauung herangezogen. So waren sie auch wenig berührt vom Patriotismus der frühneuzeitlichen Humanisten, den Werner Kaegi gelegentlich als Rechtfertigung für seinen schweizerischen Nationalismus ins Feld führte.
1456 1457 1458
1459 1460
Würsch 2002. Baab 2013. «Der Ausdruck ‚Humanismus‘ bot um das Jahr 1945 in den deutschsprachigen Ländern einen bequemen Weg zur Bewältigung dessen, was man damals verharmlosend ‚die Niederlage des europäischen Menschen‘ nannte.» Cancik 2014, 59, zit. über die Humanismen nach 1945. ‚Humanismus‘ erschien als Begriff für Antifaschismus zuerst am Moskauer Ersten Allunionskongress der Sowjetschriftsteller 1934 in einer Rede von Johannes R. Becher und wurde am Ersten Internationalen Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur 1935 in Paris ausführlich als Element der literarischen Einheitsfront dargelegt, das den Brückenschlag zwischen den Kommunisten und ihren bürgerlichen ‚compagnons de route‘, die in klassischen Traditionen standen, bewirken sollte. Streim 2017, 195 f., 199; Baab 2013, 27. Kritik an diesen Auffassungen von ‚Humanismus‘: Kaegi 1959, 7 ff., mit Bezug auf den Band Grousset 1949. Kaegi hat diese Darlegungen Harald Fuchs gewidmet. Kaegi 1959. Cancik 2016a.
366
Geisteswissenschaftler
Da der Humanismus bei den Altertumswissenschaftlern eine gelebte Praxis war, fielen nur selten Äusserungen, die das Grundsätzliche berührten. So war sich Peter von der Mühll während des Krieges bewusst, dass «die Pflege des klassischen Altertums», die er hier mit einem wichtigen Aspekt des Humanismus gleichsetzte, sowohl an «die geistige Unabhängigkeit» als auch an «einen gewissen Wohlstand des Volkes gebunden» sei, und er hoffte anlässlich seines 25-jährigen Professorenjubiläums 1942: «Möge unserer Stadt und unserm Lande auch nach den furchtbaren Erlebnissen dieser Zeit beschieden sein geistig und materiell der Not Herr zu werden.»1461 Er anerkannte also, dass Humanismus sowohl von materiellen Existenzbedingungen abhängig war als auch einen Beitrag zur Bewahrung der Freiheit leisten konnte. In seiner Rektoratsrede von 1942 hatte er gefordert, die schweizerische Freiheit müsse durch das Wissen über das klassische Altertum informiert sein, «sind es doch die Griechen gewesen, die der Menschheit die Freiheit des Geistes und der Persönlichkeit gebracht haben».1462 Am ausführlichsten waren Karl Meulis Formulierungen zur humanistischen Pädagogik, die ihm ein Anliegen war und die er stets auch selbst am Gymnasium praktizieren wollte; man kann davon ausgehen, dass sie sich mit den Ansichten von der Mühlls deckten. Der Althistoriker Felix Stähelin nutzte 1938 seine Reden über Augustus für das auf Jacob Burckhardt abgestützte Bekenntnis, die antike Kultur sei der Grund und Boden, in dem die Schweizer aller Landesteile und -sprachen verwurzelt seien. Es wird überliefert, dass er «mit erhobener Stimme zum Rhein hinüber [d. h. zur schweizerisch-deutschen Grenze] rief: Dieses gemeinsamen Bodens wollen wir uns bewusst bleiben, jetzt mehr als je!»1463 Zwar hatten die Basler Humanisten in den 1920er Jahren wie ihre deutschen Kollegen ein Interesse an Ursprüngen, Riten und Mythen entwickelt (wofür in Basel Meuli und die Beschäftigung mit Bachofen stand), sich der archaischen Epoche zugewandt und im Umgang mit Kunstwerken keinen im einfachen Wortsinn rationalen Zugang praktiziert (z. B. Schefold). Aber sie waren einerseits als Skeptiker und scharfsinnige Philologen, als Mitglieder einer die individuellen Freiheiten liebenden kulturellen Elite, andererseits als Anhänger Georgescher Geistigkeit in der Art Stauffenbergscher Tatbereitschaft und schliesslich als Christen (Beispiele gaben etwa Fuchs, Debrunner) befähigt, die pseudokulturellen Bemühungen der Nationalsozialisten zu durchschauen. Auch wenn ihr Verhältnis zur modernen direkten oder parlamentarischen Demokratie nicht von Begeisterung geprägt war, waren sie doch Verteidiger der Freiheit zu denken, zu sprechen und zu leben, wie es ihrer eigenen Überzeugung entsprach. Sie waren Humanisten in dem Sinne, dass die Antike für sie auch die Funktion eines Ideals 1461 1462 1463
Von der Mühll an Miville, 8. 9. 1942, in: StABS ED-REG 1a 1 1579, Dossier «Diverses». Von der Mühll 1976, 506. Laur-Belart 1952, 8.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
367
hatte, das für ihre eigene Weltanschauung wegweisend war. Normative Geltung hatte die Antike für ihre Bildungsvorstellungen und ihre Pädagogik, weniger für ihre Forschungsarbeiten, die von einer kritischen Intention geleitet waren. Im Kern verwirklichte sich der Basler Humanismus der Philologen in deren wissenschaftlichen Praxis und in den präsumtiven Wirkungen auf den Geist und die ethische Haltung der Leser und Erforscher antiker Texte. Am Humanistischen Gymnasium1464 sollte diese Schulung, der sowohl disziplinierende wie befreiende Wirkung zugesprochen wurde, einen relativ weiten Kreis der Söhne der städtischen Eliten erreichen; einige von ihnen vertieften dann diese Bildung an der Universität in den Fächern, die dem klassischen Altertum gewidmet waren. Über die individuelle Bildung hinaus galt das klassische Altertum als «Grundlage der Kultur». Von vielen Angehörigen der Basler Eliten, Industriechemiker eingeschlossen, ist bezeugt, dass sie in der Freizeit oder spätestens wieder nach dem Rückzug aus der aktiven Geschäftstätigkeit allein oder in Gruppen antike Texte lasen. Man kann auch auf das Interesse am Sammeln von Antiken hinweisen oder auf das Echo, das seit den späten 1930er Jahren Aufführungen antiker Komödien oder Tragödien fanden. In diesem Sinne war der Basler Humanismus eine Spielart des «Bildungs»-Humanismus des frühen 19. Jahrhunderts, der in Überwindung des «Ancien Régime» eine befreiende Zielsetzung verfolgte und zugleich in Fortsetzung des Eudaimonismus der späten Aufklärung (für Basel ist an Isaak Iselin zu denken) das Pathos einer «Menschenbildung» mit sich führte.1465 Für Fachvertreter war die philologische Textkritik ein zentrales Moment für den Bildungseffekt ihrer Disziplinen. Wie Meuli formulierte, schärfte diese Arbeit den Sinn für Wahrheit und Gerechtigkeit, sowohl in der Abwehr des Falschen wie auch in der Anerkennung des Richtigen und Wahren. Über die Wirkungen der wissenschaftlichen Arbeit hinaus standen die Philologen unter dem Eindruck der Erwartungen, die Cicero mit der zu seiner Zeit «Rhetorik» genannten Bildung verbunden hatte.1466 Hier ging es um eine breite und vertiefte Aneignung des Wissens und der Einsichten griechischer und römischer Philosophie, Literatur und Kunst und letztlich um die Kenntnis des Menschen. Erworben wurde diese Bildung nicht nur durch Lektüre in Musse, sondern vor allem im Gespräch unter Freunden. Freundschaft1467 hatte (in Anlehnung an Cicero, De amicitia) die zentrale Aufgabe, Bildung mit verpflichtenden Beziehungen unter Männern zu unterbauen, und sie sollte sich in der politischen und gerichtlichen Praxis bewähren. So wird ersichtlich, wie eng sich ein Peter von der Mühll oder ein Karl Meuli 1464 1465 1466 1467
Karl Meulis Ideal war das Gegenteil der deutschen Schulpraxis, die Apel/Bittner 1994 darstellten. Herrmann 2016; Cancik 2014a. Cancik 2014a, zu Cicero 20–27; Maissen 2000a. Cancik 2016b.
368
Geisteswissenschaftler
an diesem antiken Muster orientierten, wenn sie Freundschaft feierten, das Gespräch pflegten, Wissenschaft mit Kunstsinn verbanden und auch die eigenen musischen Fähigkeiten zur Geltung brachten. Sie wollten in diesem Sinne Menschen sein und forderten dafür die Freiheit ‚von‘ äusseren Zwängen, Begrenzungen und staatlichen Auflagen als Voraussetzung ein, die sie dann wieder als Freiheit ‚zu‘ ihrer Bereitschaft verstanden, in die Gesellschaft der Stadt hineinzuwirken, darin ebenso wie in der akademischen Gemeinschaft Pflichten auf sich zu nehmen und zu dienen. Solchen Humanismus gab es in vielen Teilen der Welt. Es scheint aber, dass es einen Unterschied ausmachte, ob er in einem republikanischen Kontext gelebt wurde oder unter den Voraussetzungen eines Machtstaates und des mit ihm verbundenen, nachromantischen Nationalismus. Unter Letzteren war Humanismus, wie die Geschichte der deutschen Altertumswissenschaften zeigt, kein sicheres Bollwerk gegen Angriffe auf Freiheit und Humanität, vielmehr konnte er instrumentalisiert werden zur Legitimierung einer Unterwerfung des Individuums unter den (Macht⌥) Staat sowie für die Behauptung der Suprematie der eigenen «nordischen» Abstammung und der eigenen Nation. Widerständigkeit äusserte sich auf einer solchen humanistischen Grundlage selten offen. Gelebter Bildungshumanismus begründete hingegen den Rückzug in eine private Distanz zum Geschehen, nachdem deutlich geworden war, dass die anfangs gehegten nationalen Hoffnungen ein Trugbild waren, das den Blick auf die verbrecherische Natur der Diktatur verstellte.1468 Unter republikanischen Verhältnissen konnte die ciceronianische ‚Humanität‘ als Tugendpraxis in der aktiven ‚zivilgesellschaftlichen‘ Inanspruchnahme und Verteidigung von bürgerlicher Freiheit, aber auch in der Pflicht zur Mitwirkung und zum Dienst an der Gemeinde der Bürger und der Universitätsangehörigen gelebt werden. Diese Mitwirkung bedeutete dann Mitträgerschaft und Mitentscheidung innerhalb der faktischen Oligarchie, die die Republik führte. Humanismus, politisch gewandt, vertrug sich somit gut mit einem individualistischen Liberalismus. Kaum kompatibel war dieser republikanische Humanismus mit einer geschlossenen Machtstruktur, die nur Freiheit zur Unterwerfung zuliess, und mit der parlamentarischen Mehrheitsidee schloss er nur Frieden im Angesicht einer Bedrohung der individuellen Freiheit durch Diktaturen. Gerade aufgrund des elitären und individualistischen Zuges dieser in der Regel antimodernen Einstellung wurde die deutsche Diktatur als Massenherrschaft 1468
Stiewe 2011, 311, betont, dass der deutsche ‚Dritte Humanismus‘ sowohl historisch-retrospektiv im Idealismus und Neuhumanismus zu verorten als auch «durch Bereitstellung von Anknüpfungsmöglichkeiten für die nationalsozialistische Kultur- und Bildungspolitik» auf seine «nahe Zukunft» (d. h. auf das ‚Dritte Reich‘) gerichtet gewesen sei. Sie spricht von einem «Sonderweg» der deutschen Antikenrezeption «im europäischen Kontext».
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
369
abgelehnt. Der ideologische ‚Bricolage‘ des Nazismus wurde als Feind der Freiheit des gebildeten Individuums durchschaut. An antiker Rhetorik Geschulten fiel es leicht, leere Worthülsen wie pervertierten Sprachgebrauch zu entlarven. Die freiheitliche Grundeinstellung opponierte gegen den Anspruch totaler Unterwerfung. Die Durchdringung aller Lebensbereiche mit einer solchen Ideologie wurde als Angriff auf die wahre Bildung begriffen, auch wenn und gerade wenn sie sich mit antiken Versatzstücken drapierte. In dieser Hinsicht war der Basler Humanismus freiheitlich, zwar in ähnlichen Worten wie die deutsche Entsprechung auf die «Gemeinschaft» der «Polis» bezogen, aber mit einem deutlichen Akzent auf der freiwilligen Übernahme von Pflichten in einem republikanischen Kontext, der auf der Selbstbestimmung des gebildeten Individuums beruhte. Das Problem des Verhältnisses zwischen Gesellschaft/Gemeinschaft und Staat und einer nationalen oder gar völkischen Aufladung des Antikenbezugs, wie es sich in der deutschen Geschichte entwickelt hatte, stellte sich in der Basler Stadtrepublik nicht, und so war die Versuchung sehr gering, Humanismus einer bestimmten politischen Herrschaft anzudienen. 7.2.3 Germanisten und Germanen 7.2.3.1 Einleitung Germanistik ist von Haus aus eine ‚deutsche‘ Wissenschaft gewesen. So liegt es nahe, nach der Rolle dieser Fächergruppe für das Verhältnis der Basler Universität zu Deutschland zu fragen. Mit einer Übersicht möchte ich zeigen, dass das Fach in Basel kein Brückenkopf nationalsozialistischer Einflüsse1469 geworden ist, im Gegenteil. Zur Germanistik in der Schweiz existieren Studien, die auf die mehr politisch-ideologischen Beziehungen zur Wissenschaft in Deutschland eingehen. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen oft die beiden Zürcher Literaturhistoriker Robert Faesi und Emil Ermatinger; bekannt ist auch der Deutschschweizer Gottfried Bohnenblust, der in Genf dozierte. Eigentliche nationalsozialistische Aktivitäten gingen von Richard Newald in Freiburg im Üchtland und von Helmut de Boor in Bern aus, wie in der Einführung erwähnt worden ist. Von den Basler Professoren genossen Andreas Heusler und Walter Muschg bisher grössere Aufmerksamkeit, während Franz Zinkernagel zu den Vergessenen gehörte, was die umfangreiche Briefedition von Frank Hieronymus kürzlich geändert hat.1470. Der Altgermanist Friedrich Ranke wurde nach seinem Tod gewürdigt, sein Wirken in Deutschland vor der Wahl nach Basel scheint aber nicht untersucht worden zu sein. Bis in die Mitte der 1930er Jahre spielte die Nationalität der in der Schweiz lehrenden Germanisten eine geringe Rolle, und die Inte1469 1470
Germanistik in Deutschland 1933–1945: Sturm 1995; Dainat/Danneberg 2012. Zinkernagel 2020.
370
Geisteswissenschaftler
gration in deutsche Kollegenkreise war auch für Schweizer Fachvertreter selbstverständlich. Erst 1940 formierte sich ein schweizerischer Germanistenverband.1471 Die Basler Universität kannte im Untersuchungszeitraum die Trennung in zwei Teilfächer, die jeweils durch ein Ordinariat vertreten waren, neuere Literaturgeschichte einerseits, Sprache und ältere Literatur andererseits.1472 «Germanistik» umschloss auch die Kenntnis der (alten) Germanen, und bestimmend war die Überzeugung, dass das ursprünglich Germanische am ‚reinsten‘ aus der alten skandinavischen Sprache und Literatur erschlossen werden könne. So wurde erwartet, dass die akademischen Vertreter des Faches Deutsch auch über Nordistik lehrten. Ferner öffnete die Beschäftigung mit Sprache ein Fenster zu Dialektoder Mundart-Studien. Schliesslich war das Fach Volkskunde in Basel wie in Deutschland in der Germanistik verankert, nicht als Prüfungsgegenstand, aber als Forschungsgebiet jeweils eines Germanisten und als Thema einer «Volkskundliches Kränzchen» genannten Veranstaltung von Dozenten und Studierenden, die im Wintersemester Germanisten, Historiker und Altertumswissenschaftler zusammenführte. Die literaturgeschichtliche Lehre behandelte meist den Kanon klassischer Autoren und vermittelte bürgerliche Bildung sowie ästhetische Werte. Nach dem Ersten Weltkrieg verschob sich der Schwerpunkt der universitären Beschäftigung mit Literatur von Philologie zur «Geistesgeschichte», während weiterhin Texte durch wissenschaftliche Editionen gesichert und der Forschung verfügbar gemacht wurden. Die Professoren, die in den 1920er Jahren ausgebildet worden waren und im Verlauf der 1930er Jahre auf Lehrstühle kamen, suchten den historischen Zugang zu überwinden, um ein unmittelbares Verständnis für Dichtung und Dichter zu gewinnen. Nicht selten war der Professor selbst schriftstellerisch tätig. Aber nur in Ausnahmefällen wurden Autoren der neusten Tendenzen wie Symbolismus, Expressionismus, Neue Sachlichkeit ex cathedra vorgestellt. Das Fach war in Basel zur untersuchten Zeit jeweils von je einem Deutschen und einem Schweizer Professor vertreten: Zunächst bestand das Gespann aus dem Basler Altgermanisten und Volkskundler Eduard Hoffmann-Krayer und dem süddeutschen Literaturhistoriker Franz Zinkernagel (ab 1917 in Basel), dann lehrte von 1936 bis 1965 der Schweizer Walter Muschg Geschichte der Literatur neben dem 1938 aus Breslau rekrutierten deutschen Altgermanisten und Volkskundler Friedrich Ranke, der die Nachfolge des Baslers Eduard Hoffmann1471 1472
Caduff/Gamper 2001; Pestalozzi/Stingelin 1999; Schütt 1996. Akademische Gesellschaft schweizerischer Germanisten: Wehrli 1993, 411. Eine knappe Geschichte des Faches in Basel publizierte das StABS on-line: https://query. staatsarchiv.bs.ch/query/detail.aspx?ID=512958. Das Deutsche Seminar stellte seinerseits einen Überblick zur Verfügung: https://germanistik.philhist.unibas.ch/de/fachbereich/ geschichte/.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
371
Krayer angetreten hatte. Eine Sonderstellung nahm Andreas Heusler ein, der 1920 nach einer langen Wirkungsperiode in Berlin als Privatgelehrter zurückkehrte. Er unterrichtete bis 1936 an der Universität Basel im Rang eines Ordinarius und dozierte über Themen seiner Wahl, d. h. ausser seinem Spezialgebiet, der Nordistik, auch gelegentlich über deutsche Literatur vom Nibelungenlied bis Goethe. Sein Einfluss auf Berufungen, Habilitationen und akademische Prüfungen war beachtlich, weil sich sein hauptsächliches Beziehungsnetz weit über die Region hinaus spannte und er als führender Altgermanist seiner Zeit hohes Ansehen genoss. Ich werde zunächst die Altgermanisten behandeln und mich danach den Vertretern der Neueren deutschen Literatur zuwenden. Dabei werden die Ordinarien des Faches im Mittelpunkt stehen. Neben diesen lehrten mehrere Privatdozenten und Extraordinarien deutsche Sprache und Literatur. Diese zähle ich hier kurz auf, werde aber nicht weiter auf sie eingehen: – Wilhelm Bruckner, seit 1899 Privatdozent, von 1905 bis 1940 Extraordinarius für Ältere germanische Philologie, Spezialist für Schweizerische Ortsnamenkunde und Baseldeutsche Grammatik, von 1895 bis 1935 im Hauptamt Lehrer für Alte Sprachen, Deutsch und Geschichte am Humanistischen Gymnasium.1473 – Wilhelm Altwegg, von 1919 bis 1946 zuständig für deutsche Sprachkurse für fremdsprachige Studenten, seit 1930 Privatdozent für Deutsche Literatur, in den Jahren 1936 bis 1953 Extraordinarius mit einem Lehrauftrag für Deutsche Lyrik und Erzählung, spezialisiert auf Johann Peter Hebel, hauptberuflich von 1911 bis 1948 Lehrer am Humanistischen Gymnasium.1474 – Paul Geiger, habilitiert 1939, 1950 Extraordinarius, Germanist und Volkskundler, im Hauptamt von 1917 bis 1944 Lehrer am Humanistischen Gymnasium, wirkte vor allem als Volkskundler. – Ernst Merian-Genast, 1930 Privatdozent für Romanische (!) und vergleichende Sprachwissenschaft, 1938 Extraordinarius, von 1936 bis 1958 Inhaber eines Lehrauftrags für Vergleichende Literaturwissenschaft, Goethe-Spezialist und Herausgeber der Werke Goethes im Verlag Birkhäuser, forschte zum Vergleich deutscher und französischer Klassik, Übersetzer, seit 1924 Lehrer am Basler Mädchengymnasium.1475 – Emil Steiner, 1923 bis 1935 Privatdozent, Werke von ihm zur Mundartforschung und zur Deutschen Sprachwissenschaft sind von 1921 bis 1937 nachweisbar. Das Personendossier im Universitätsarchiv reicht von 1921 1473 1474 1475
Schläpfer 2004. Angaben nach: Bonjour 1960; und https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Altwegg. Anonym 1958: Nachruf. Merian-Genast war ein Sohn des Frankfurter Gymnasiallehrers Hans Merian-Genast, https://www.stroux.org/patriz_f/stMe_f/MeK_f.pdf.
372
Geisteswissenschaftler
bis 1941 und ist noch gesperrt. Edgar Bonjour hat ihn in seiner Universitätsgeschichte 1960 nicht erwähnt.1476 7.2.3.2 Altgermanisten Eduard Hoffmann-Krayer1477 war bei seiner Beförderung zum Ordinarius 1909 der erste Schweizer auf einem Basler Germanistik-Lehrstuhl (Extraordinarius seit 1900). Sowohl hinsichtlich Herkunft als auch Heirat gehörte er der lokalen Geldaristokratie an. Sein Studium führte ihn durch das deutsche Universitätswesen. Nach einer kurzen Wirkungszeit als Privatdozent und als Redaktor am Schweizer Idiotikon in Zürich (Habilitation 1891) richtete er sich an der Basler Universität im Jahr 1900 als Extraordinarius, 1909 als Ordinarius (Nachfolger von John Meier) ein, ohne diese wieder zu verlassen. Seine Wirkung als Forscher reichte jedoch weit über Basel hinaus, da er innerhalb der deutschen Volkskunde einen individualistischen und psychologischen Ansatz vertrat, der eine Alternative zur romantischen Volksgeistlehre und zu völkischen Ideen darstellte (Die Volkskunde als Wissenschaft, 1902).1478 Bis 1933 (und indirekt durch seine Schüler wie Paul Geiger und Hanns Bächtold1479 über dieses Datum hinaus) gestaltete er die deutsche Volkskunde mit, etwa durch Projekte wie das von Bächtold herausgegebene Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, für das nach aussen allerdings der Freiburger John Meier1480 sprach, der stets mit Basel in Verbindung blieb. Innerhalb der Vaterstadt baute er eine Bibliothek und Sammlung zur Volkskunde auf; er war mitverantwortlich für das Museum an der Augustinergasse und richtete dort zusammen mit Paul Sarasin, Fritz Sarasin und dem Arzt Leopold Rütimeyer eine volkskundliche Abteilung ein.1481 Diese sollte das Volksleben in Europa entlang der allgemeinen Aufgaben darstellen, die die Menschen zu lösen haben, wie Ernährung, Behausung, Transport, etc. Damit ist auch schon gesagt, dass wir 1476
1477 1478 1479 1480
1481
Entwurf für die Aufforderung der Fakultät an Emil Steiner, auf die Venia Legendi von 1923 freiwillig zu verzichten, Zinkernagel an Dekan Henry Lüdeke, 9. 11. 1934, in: Zinkernagel 2020, 2438 f., Nr. 2210. 1935 erklärte Steiner tatsächlich den Verzicht auf die Lehrbefugnis. Ich danke Hermann Wichers (StABS) für Recherchen in: StABS UA XI 4. 3c (Akten zum Doktorat vom 16. 3. 1918 resp. Promotion auf der Grundlage der gedruckten Dissertation vom 30. 4. 1921) und die Auskünfte vom 6. 5. 2020. Burckhardt-Seebass 2010; Lenzin 1996; Trümpy 1972. Burckhardt-Seebass 2010, 4. Liebl 2005; Hugger 2000. Der Volksliedforscher John Meier war 1899 nach Basel gewählt worden; er hatte 1900 für die Berufung von Hoffmann-Krayer nach Basel gesorgt. Burckhardt-Seebass 2010, 3; Holzapfel 1990. Burckhardt-Seebass 2010, 4, bezeichnet dies als eine «europäische vergleichend-ergologische Sammlung». Rolle Hoffmann-Krayers im Basler Museum an der Augustinergasse: Simon 2015, 214 f.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
373
zwar viel über den Volkskundler Hoffmann-Krayer wissen, aber nur wenig über den akademischen Germanisten, denn nach anfänglichen Publikationen zum Basler Dialekt und zur Geschichte der mittelalterlichen deutschen Literatur widmete er seine Zeit fast ausschliesslich der Volkskunde. An der Universität unterrichtete und prüfte er breit die üblichen Bereiche der Altgermanistik (mit weitgehender Ausnahme der Nordistik, die ab 1920 Andreas Heusler vertrat), ohne eine sichtbare Verbindung zwischen Forschung und Lehre zu praktizieren. Lebhafte Beziehungen zu Deutschland ergaben sich aus seiner Studentenzeit, aber besonders aus der Zusammenarbeit mit deutschen Volkskundlern. Besonders eng verbunden war er mit John Meier, der nach seinen Basler Jahren (1899 bis 1912) in Freiburg i. Br. Lehrte – daraus entstand eine regionale Fachverbindung, die sich nach aussen sichtbar bis 1938 (zwei Jahre nach Hoffmanns Tod) in gemeinsam abgehaltenen Tagungen manifestierte. Hoffmann-Krayer selbst zögerte aber seit 1933, in Deutschland Vorträge zu halten. Die schrittweise Nationalisierung der schweizerischen Volkskunde liess sie während des Krieges zu einer vaterländischen Wissenschaft werden. Während Hoffmann-Krayer zum Nationalsozialismus auf Distanz ging, suchte Meier Gelegenheiten, die deutschen Machthaber zu interessieren und an der Finanzierung seiner Projekte zu beteiligen.1482 Beide waren sich aber darin einig, dass die Volkskunde nicht Dilettanten überlassen werden sollte, die Wissenschaft mit einem nationalsozialistischen Glaubenssystem vermengen wollten.1483 Der aus einer Basler Gelehrten- und Politikerfamilie stammende Andreas Heusler1484 wuchs zwar in seiner Vaterstadt auf und erhielt hier wichtige Prägungen wie durch das Gymnasium und das Umfeld von Jacob Burckhardt. Er absolvierte aber den Hauptteil seines Studiums in Deutschland. Er doktorierte in Freiburg i. Br. 1887, habilitierte sich 1890 in Berlin, wo er als Extraordinarius von 1894 bis 1913 und dann als Ordinarius bis 1919 wirkte. Seit 1907 war er Mitglied der Preussischen Akademie der Wissenschaften. In der Berliner Zeit wurde er einer der führenden Nordisten seiner Generation. Da er stets betonte, dass die akademische Karriere für ihn keinen Wert an sich habe,1485 und weil er wirtschaftlich weitgehend unabhängig war, plante er schon früh, seine Stellung in Berlin aufzugeben. Aus Solidarität mit den Zuständen in Deutschland bei Kriegsende schob er die Verwirklichung seiner Wünsche bis 1919 hinaus, kehrte dann nach Basel zurück und liess sich ein Haus in Arlesheim errichten. Dort arbeitete er als Privatgelehrter bis zu seinem Tod 1940.1486 Er stand in regem Kontakt mit den deutschen und skandinavischen Kollegen und bereiste öfter 1482 1483 1484 1485 1486
Burckhardt-Seebass 2010, 5. Oesterle 1991, 153. Völker 1972. Beck 1989, 11. Wyss 2000.
374
Geisteswissenschaftler
Deutschland, auch in der Zeit nach 1933. Die reiche Korrespondenz mit einem seiner Jugendfreunde, Wilhelm Ranisch, ist für die Heusler-Forschung eine wichtige, in Auswahl publizierte Quelle.1487 Nach seiner Ankunft in Basel wurde Heusler von Professoren der Universität gebeten, sich an der Lehre zu beteiligen, ohne dem Zwang zu unterstehen, die Selbstverwaltung mitzutragen. Für seinen Unterricht im Umfang von meist vier Wochenstunden erhielt er eine bescheidene «Remuneration», aber auch Titel und Rechte eines Ordinarius.1488 Zum akademischen Freundeskreis gehörten ausser von der Mühll und dem Orientalisten Tschudi jeweils die Latinisten wie Günther Jachmann, Kurt Latte (den er besonders schätzte) und dessen Nachfolger Harald Fuchs. Mit den Professoren des Deutschen Seminars, Eduard HoffmannKrayer und Franz Zinkernagel, stand er in einem guten Verhältnis. Dies galt nicht nur für Friedrich Ranke, der sein Schüler aus der Berliner Zeit war und dessen Berufung nach Basel er empfohlen und vermittelt hatte, sondern schliesslich auch für Walter Muschg, dessen Kandidatur ihn zwar nicht völlig überzeugt hatte, den er jedoch nach seiner Antrittsvorlesung und aufgrund des persönlichen Kontaktes schätzen lernte.1489 Heusler beeinflusste Entscheide der Fakultät durch Gutachten und Mitwirkung in Berufungskommissionen. Insofern gestaltete er die Beziehungen der Universität zu Deutschland in den Jahren 1933 bis 1938 mit. Zuerst befasste er sich im Auftrag der Fakultät mit dem Wunsch von Werner Richter, in Basel eine akademische Beschäftigung zu finden.1490 Richter hatte als Literaturhistoriker an deutschen Universitäten gelehrt und war dann in das preussische Kultusministerium als Ministerialdirektor übergetreten. In dieser Funktion hatte er sich bei einigen Professoren unbeliebt gemacht. Seit 1932 gehörte er wieder zum Lehrkörper der Berliner Universität, bis er dort 1933 als Jude und Repräsentant des Weimarer «Systems» (d. h. als Mitarbeiter von Carl Heinrich Becker) entlassen wurde. Allerdings erhielt er eine Pension, von der er leben konnte. In Basel begann er ein Studium der Theologie, hoffte aber auf eine Dozentur für Germanistik, die er ohne Kostenfolge übernehmen wollte. Anfänglich konnte sich Heusler vorstellen, dass Richter, den er seit 1905 kannte und persönlich schätzte, in Basel Privatdozent würde, und schrieb die Abneigung seiner Kollegen gegen Richters Basler Vortrag deren Aversion gegen das ‚Norddeutsche‘ zu (1934).1491 Es gab jedoch Zweifel. Über die Frage, ob Richters Vorschlag, ihn nach Basel zu habilitieren und ihn hier gratis lesen zu lassen, vor 1487 1488 1489 1490 1491
Heusler 1989. Bandle 1989, 25 ff. Bandle 1989, 37. Von See 2005, 56 f.; Bandle 1989, 32. Werner Richter hatte im Dezember 1933 Heusler um Hilfe gebeten. Richter an Heusler, 18. 12. 1933, in: Zinkernagel 2020, 2626–2628. Heusler an Ranisch, 16. 4. 1934, in: Heusler 1989, 564–567, Nr. 174.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
375
die Fakultät zu bringen sei, berieten die vier Fachvertreter unter sich: der Extraordinarius Wilhelm Bruckner, der Altgermanist und Volkskundler Eduard Hoffmann-Krayer, der Literaturhistoriker Franz Zinkernagel und Heusler selbst. Hoffmann-Krayer hatte bereits Einwände, als er die Liste der Publikationen und der Vorlesungsthemen von Richter durchging – alles schien ihm zu breit angelegt für einen Basler Lehrauftrag.1492 Zinkernagel, obschon selbst auch nicht enthusiastisch, machte Richter (oder sich selbst) Hoffnungen: Richter werde ihn bald mit einer Vorlesung entlasten, schrieb er ihm. Ohne dass Richter davon erfahren sollte, «warnte» der Heidelberger Klassische Archäologe Arnold von Salis, ein Schwager des Basler Altphilologen Peter von der Mühll, die Basler davor, sich auf Richter einzulassen. Von der Mühll informierte vertraulich Hoffmann-Krayer, und dieser hinterbrachte die «Warnung» an Heusler.1493 Als Heusler seine Germanistenkollegen fragte, ob sie bereit wären, vor der Fakultät den Antrag zu stellen, meinten diese, nur Heusler käme dafür infrage. Dieser wollte aber nicht allein die Verantwortung dafür übernehmen. Nun holte er Auskünfte über Richter in Deutschland ein. Gerüchte, die auf Charakterdefizite hinwiesen, wollte niemand explizit bestätigen, aber Heusler sah es als erwiesen an, dass Richters Unterricht langweilig sei. Das letzte Element bildete Richters neueste Publikation, eine Untersuchung über den Lanzelet von Ulrich von Za(t)zikhoven. Ohne sich mit Heusler abzustimmen, schickte Zinkernagel lobende Worte an den Autor, die allerdings – sorgfältig verklausuliert – keine bedingungslose Zustimmung ausdrückten (das Thema sei unergiebig und die Durchführung philologisch korrekt, ein Eindruck, der in einem merkwürdigen Kontrast zu Richters hochfliegendem Basler Vortrag stand, wie auch Hoffmann-Krayer Heusler zu verstehen gab).1494 Gleichzeitig hoffte Zinkernagel jetzt, dass Richter nicht zur Habilitation zugelassen werde, damit der Weg frei werde für Richard Alewyn, dem er vorschlug, in Basel als Privatdozent mit Unterstützung der Rockefellerstiftung zu wirken, bis er Zinkernagels eigene Nachfolge antreten könne.1495 Heusler fand Richters Arbeit anfängerhaft (tatsächlich handelte es sich um die Publikation der Habilitationsschrift von 1913) und vermisste den grossen Stil, der ihm immer sehr wichtig war. 1492 1493 1494
1495
Hoffmann-Krayer an Zinkernagel und Wilhelm Bruckner, 19. 1. 1934, in: Zinkernagel 2020, 2643. Hoffmann-Krayer an Heusler, 31.5., 2. 6. 1934, und weitere Dokumente in: Zinkernagel 2020, 2649 ff. Zinkernagels «herzlichster Glückwunsch» galt der «Leistung als solcher», aber Richter könnte ihn ab Winter 1934/35 entlasten … Zinkernagel an Richter, 26. 5. 1934, in: Zinkernagel 2020, 2346 f., Nr. 2137. Das Werk sei philologisch-akribisch, was Richter nach dem Basler Vortrag nicht zuzutrauen gewesen sei, schrieb Hoffmann-Krayer an Heusler, 6. 5. 1934, ebd., 2649. Zinkernagel an Alewyn, 28. 3. 1934, in: Zinkernagel 2020, 2321–2324, Nr. 2116.
376
Geisteswissenschaftler
Richter erhielt von Heusler eine (allzu) eingehend begründete Absage,1496 und sein Anliegen kam nie vor die Fakultät. Richters Freunde vermuteten, Heuslers Antisemitismus habe den Ausschlag gegeben. Die Korrespondenzen geben jedoch keinen Anlass zu dieser Annahme – ausser dass Heusler damit argumentiert hatte, dass eine Habilitation Richters als Gefälligkeit gegenüber dem Chef des Erziehungsdepartements Fritz Hauser verstanden werden könnte, weil er die Beschäftigung von Dozenten an der Universität befürworte, die von den Nationalsozialisten entlassen worden seien. Unter diesen Entlassenen, so müsste man dies verstehen, waren viele Juden, und Regierungsrat Hauser sei – als dezidierter Gegner des Antisemitismus – ein Freund der Juden. Heusler hatte hinzugefügt, dass er erwarte, dass diese Haltung der Kantonsregierung sehr bald auf entschiedenen Widerstand im rechtsgerichteten Segment der Basler Öffentlichkeit stossen werde, wofür ihm ein Hetzartikel in der «Neuen Basler Zeitung» (die er gern las und der er Glauben schenkte) Beweis genug war.1497 Von da an verhinderte Heusler eine Anstellung Richters in Basel, auch als Richter Kandidat für den 1936 freigewordenen Lehrstuhl für Literaturgeschichte (Nachfolge Zinkernagel) wurde. Tatsächlich hatte Heusler gesagt, die Universität Basel habe nicht die Aufgabe, ein Auffangbecken für verfolgte Juden aus Deutschland zu werden, aber Begabungen, die der Universität nützlich sein könnten, seien aufzunehmen.1498 Diese Position entsprach jedoch weitgehend derjenigen der Universität und der vorgesetzten Behörden, wie sie offiziell formuliert wurde, während sich einzelne Bürger, vom Chef des Erziehungsdepartements Fritz Hauser bis zu manchen Professoren, für die in Deutschland Entlassenen und Verfolgten einsetzten. Richter wanderte 1939 nach den USA aus und kehrte 1948 wieder nach Deutschland zurück.1499 Zutreffend war der Kommentar von Zinkernagel, der jedoch kaum geeignet war, Richter zu besänftigen: «Auch haben Sie ja die Rechtfertigung für sich, dass es bisher [d. h. bis Juni 1934] noch keinem Opfer des deutschen Umsturzes tatsächlich gelungen ist, in den Basler Lehrkörper einzudringen (vom Falle Baumgarten vielleicht abgesehen, der aber nur
1496 1497
1498 1499
Heusler an Richter, 15. 6. 1934, in: Zinkernagel 2020, 2653–2556. Heusler hatte dies Richter gleich in seiner ersten Reaktion auf Richters Hilferuf mitgeteilt. Die Linksparteien seien in Basel gegenüber den in Deutschland Entlassenen jetzt noch freundlich gesinnt, aber ein Stimmungsumschwung werde kommen. Heusler an Richter, 20. 12. 1933, in: Zinkernagel 2020, 2633–2635. Ferner Ausriss aus der Neuen Basler Zeitung vom 18. 1. 1934 als Beilage zu Heuslers Durchschlag des Absagebriefes vom 15. 6. 1934, ebd., 2657–2660. Schütt 1996, 158; Bandle 1989, 32. Heusler an Zinkernagel, 7. 2. 1934, in: Zinkernagel 2020, 2302 f., Nr. 2102. Reinermann 2003.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
377
durch eine regelrechte Überrumpelung zustande kam, weswegen denn auch weidlich über ihn geschimpft wird).»1500 Heusler wirkte an der Suche nach einem Nachfolger für den Vertreter der Französischen Literaturwissenschaft, Marcel Raymond, mit. Hier vertrat er den in Deutschland verbreiteten Standpunkt, dass die akademische Romanistik aus einer deutschen Perspektive zu pflegen sei und nicht durch Romanen («Welsche») selbst. In der Sachverständigenkommission, die die Kuratel eingesetzt hatte, sah er sich mit diesem Votum zusammen mit dem Philosophen Herman Schmalenbach durch die von Schweizern gebildete Mehrheit isoliert. Heusler erkannte darin einen «Rückzug der Schweiz auf sich selber», womit er einen problematischen Zug der beginnenden ‚geistigen Landesverteidigung‘1501 und eine Politisierung der Wissenschaft benannte. Allerdings spielte hier Heuslers Ablehnung der «Welschen» hinein.1502 Diese Kommission verzichtete auf die Gelegenheit, den hervorragend qualifizierten deutschen Romanisten Ernst Robert Curtius für Basel zu gewinnen.1503 Für die Mehrheit war das Kriterium ausschlaggebend, dass Studierende und die interessierte Basler Öffentlichkeit aktuelle französische Literatur aus erster, mit den Autoren der Werke und der neuesten Forschungsrichtung (später als «Genfer Schule» bezeichnet) eng vertrauter Hand kennenlernen sollten; der Lehrauftrag resp. die Professur sollte echten französischen Geist in die Basler Universität bringen. Albert Béguin, der diesem Profil entsprach, enttäuschte diese Erwartungen dann nicht. Wie wir bereits wissen, entstand ein Konflikt zwischen der Regierung und der Universität ob der Frage, wie sich die Universität zur Einladung, an der Heidelberger Universitätsfeier 1936 mit einer offiziellen Delegation teilzunehmen, verhalten solle. Dieser Konflikt erstreckte sich auch auf die im folgenden Jahr eintreffende Einladung zur 200-Jahrfeier der Universität Göttingen.1504 Wie die überwiegende Mehrheit der Regenz vertrat Heusler die Auffassung, es handle sich um eine akademische Einladung zu einer akademischen Feier einer hochangesehenen Universität, deshalb sei es ein Gebot der universitären Höflichkeit, 1500 1501 1502 1503 1504
Zinkernagel an Richter 24. 6. 1934, in: Zinkernagel 2020, 2365 f., Nr. 2151. «Fall Baumgarten»: siehe oben, Kapitel Juristen. ‚Geistige Landesverteidigung‘ in der Germanistik: Wehrli 1993, 418. Von See 2005, 50; Bandle 1989, 38. Heusler hatte in Basel darauf hingewiesen, dass Ernst Robert Curtius für die Französischprofessur zu gewinnen wäre. Curtius 2015, 370. Vgl. Kapitel 7.2.4.4.4, unten. Heusler anerbot sich in der Regenz, privat nach Göttingen zu reisen. Tatsächlich meldete sich Heusler in Göttingen an (zusammen mit dem Kunsthistoriker Heinrich Alfred Schmid und dem frontistischen Basler Studenten Dietrich Barth). Heusler zog dann seine Anmeldung wieder zurück und machte sein «Fuszleiden» geltend. StABS UA B 1 XIV Acta et Decreta 1934–1959 (Regenzprotokoll): Regenz, 28. 4. 1937. Liste der Anmeldungen und Schreiben Heusler, 31. 5. 1937, in: UA Göttingen, unsignierter Bestand Jubiläum 1937.
378
Geisteswissenschaftler
eine Delegation zu entsenden. Die Regierung fasste diese Universitätsfeiern als nationalsozialistische Propagandaveranstaltungen auf und verbot der Universität die Teilnahme. In diesem Verbot sah Heusler zwar zusammen mit vielen anderen Professoren einen illegitimen Eingriff des Staates in die akademische Selbstbestimmung, er war aber der Einzige, der 1936 aus Protest seinen Rücktritt von seiner Basler Professur erklärte, die damit ein Jahr früher endete, als vorgesehen war.1505 Schliesslich war Heusler dafür verantwortlich, dass die Basler altgermanistische Professur nach Hoffmann-Krayer 1938 durch einen konservativ-patriotischen Deutschen besetzt wurde. Dagegen erhob sich allerdings kein Widerstand, da Friedrich Ranke als ausgewiesener, sachlich-seriöser Forscher für mittelalterliche deutsche und nordische Sprache und Literatur bekannt war, der auch hinsichtlich seines volkskundlichen Interesses in die Basler Lücke passte. Ranke war für Basel verfügbar geworden, weil er als Gatte einer ‚nichtarischen‘ Frau (Frieda Stein) 1937 in Breslau entlassen worden war. Im nachfolgenden Abschnitt werde ich zeigen, wie eng er in einem Teil seiner wissenschaftlichen Arbeit, aber auch in seinen ausgesprochen deutsch-vaterländischen Überzeugungen mit Heusler verbunden war.1506 Denn Heusler selbst vertrat in einer gelegentlich schroff-sarkastischen Art eine komplexe, aber eindeutige Position sowohl in seinem Fach als auch politisch gegenüber den Entwicklungen in Deutschland. Hinter seinen Forschungen stand ein kohärentes Programm zur Erkenntnis des Altgermanischen als Typus, nicht als Epoche.1507 Dies entsprach insofern einem deutschen ‚Mainstream‘, als er in den alten Germanen sowohl hinsichtlich ihrer Weltanschauung («Gesittung» oder «Kultur») als auch hinsichtlich des Schreibstils überzeitlich wirkende Vorbilder für eine Erneuerung der deutschen Kultur seiner Zeit fand – im Gegensatz zum Mittelalter, das für ihn eine Periode der Verchristlichung, der höfischen Verweichlichung, der ungezügelten Fantasie, der fränkisch-westlichen Einflüsse und der Zähmung des Mannes durch Staat und Gerichtswesen war.1508 Sein Ansatz lief darauf hinaus, «rein» Altgermanisches aus den Dichtungen der westlichen Nordländer des Mittelalters («Norrönen», Isländer, Norweger, Dänen) herauszuinterpretieren. Mit Übersetzungen für die «Sammlung Thule» wollte er das ger1505
1506 1507 1508
Bandle 1989, 31. Heusler erwähnte auch das 1937 erlassene Verbot, an der Göttinger Jubiläumsfeier teilzunehmen, und bezeichnete den Chef des Basler «Kultusministeriums», Fritz Hauser, als «Zwingherrchen, seines Zeichens Sozi». Heusler an Ranisch, 23. 7. 1937, in: Heusler 1989, 619–621, Nr. 191. «Es ist schon eine Sache, dass die Mehrheit unserer Regierung sozialistisch ist. Das Verbot im Juni, das Heidelberger Jubilaeum zu beschicken: das war doch böse – und hat meinen Abgang um ein Jährchen beschleunigt.» Heusler an Hermann Schneider, 22. 2. 1937, in: von See 2004, 91. Siehe dazu weiter unten den Abschnitt über Friedrich Ranke. Heuslers Ideen: Zernack 2005, 127 ff.; Beck 1989, 11 ff. Zernack 2005, 134 f.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
379
manische Wesen einem breiteren deutschen Publikum zugänglich machen und damit zur erhofften Erneuerung beitragen. Die nach Heusler darin enthaltenen Werte bezogen sich auf eine heroische «Herrenethik», die noch frei von christlichen Vorstellungen von Caritas und Hoffnung auf Belohnung guter Taten im Jenseits war und in Ehre, Ruhm, Ehrlichkeit, Selbstjustiz, freiwilliger Gefolgschaft gegenüber Höhergestellten, unverbrüchlicher Freundschaft, aber auch gnadenloser Rache ihre zentralen Werte sah.1509 Heusler selbst hatte sich gegen Ende der 1880er Jahre zwar vom Christentum losgesagt, suchte jedoch bei den alten Germanen keineswegs eine Ersatzreligion für seine eigene Zeit.1510 Stilistisch sah er in den frühen Zeugnissen echten Germanentums eine würdige, männliche Schlichtheit. Ausgehend von diesem Ideal sollte der gelehrte Stil der deutschen Akademiker überwunden werden als Ausweg aus der Kulturkrise, in der er Deutschland seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert gefangen sah.1511 Heuslers Intentionen gehörten in die Abwendung von der akademischen Kultur des ‚19. Jahrhunderts‘ und in die Suche nach Wesenheiten, die nicht ‚positivistisch‘ in ein chronologisches Schema einzupassen seien, sondern künstlerisch erfahren werden sollten. Zudem suchte er zeittypisch nach Ursprüngen der Individualität, Freiheit und Selbstbestimmung in einer Typologie von Kulturen nach dem Vorbild von Jacob Burckhardt, nur dass er diese nicht in der «Renaissance» fand, sondern im altgermanischen Wesen.1512 In an sich auffälligen, aber in der öffentlichen Rezeption seines Programms gern übersehenen Punkten unterschied sich Heuslers Position von der damaligen ‚Germanomanie‘. Ein wesentlicher Unterschied war der hohe Stellenwert individueller Freiheit in Heuslers Bild von der «germanischen Gesittung»: eine innerweltliche Ethik freier, pragmatisch-heroischer Individuen, die vor allem Herren über das eigene Schicksal sein wollten, aber aus freien Stücken Bindungen wie Freundschaft und Gefolgschaft eingingen. Sodann war Heusler kein Rassist in der Germanenfrage (wohl aber im Antisemitismus). ‚Seine‘ Deutschen waren seit dem Mittelalter ‚Mischwesen‘.1513 Die alten Germanen lebten nicht in den heutigen Deutschen weiter, sie sollten aber Vorbilder sein für eine neue deutsche Kultur, welche die Deutschen nicht «blutmässig» in sich selbst trügen.1514 Wie die meisten seiner gebildeten Zeitgenossen hat sich Heusler intensiv mit Nietzsche befasst.1515 Während er in der Kulturkritik oft mit ihm übereinstimmte, wich er in der Geschichte der Moral deutlich von ihm ab. Die «Herrenethik» sei 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515
Wyss 2000, 130, 137. Von Schnurbein 2005. Glauser/Zernack 2005, 14. Zernack 2005, 140–143. Von See 2005, 35. Beck 1989, 18, 23. Von See 2005, 39 f.; Beck 1989, 21.
380
Geisteswissenschaftler
nicht von «Bestien» getragen worden. Heuslers freie Germanen folgten dem Ideal der Selbstkontrolle. Sie seien zwar kriegerisch gewesen, aber sie hätten keine wilde Urhorde gebildet, die sich nach dem einfachen ‚Recht‘ des Stärkeren organisierte. Das «Raubtier» war nach Heusler eine spätere Erscheinung. Auch war er nicht primär daran interessiert, wie die Archäologen oder Ur- und Frühgeschichtler in den Germanen ein Volk der Frühzeit zu sehen, dessen Reste man dann durch Interpretation späterer kultureller Manifestationen ‚auszugraben‘ hätte. Vielmehr war für ihn das Germanische ein überzeitliches Ideal, das er zum Zweck der Wirkung auf die Gegenwart konstruierte. Mitgeprägt durch die wilhelminische Epoche, als Zeitgenosse des Ersten Weltkriegs, der Weimarer Republik und der nationalsozialistischen Machtübernahme solidarisierte sich Heusler engagiert mit dem Schicksal des Deutschen Reichs. Das Kriegsende von 1918 erlebte er als schmerzhafte und unverdiente Niederlage, und dementsprechend war für ihn die Weimarer Verfassung ein Oktroi der Siegermächte, der zusammen mit dem Völkerbund («Siegertrust»)1516 den deutschen Interessen zuwiderlief. Massstab für die Beurteilung deutscher Politik war für ihn der Wiederaufstieg der Nation zur Weltmacht, aber seit der Novemberrevolution auch zum Bollwerk gegen den Bolschewismus in Mitteleuropa. Zudem war er antifranzösisch, sowohl was die Schweiz betraf (er wollte die Ausweitung des Einflussbereichs der französischen Sprache bremsen, zusammen mit dem Deutschschweizer Sprachverein) als auch in der internationalen Politik. Entsprechend verbuchte er jede angebliche oder wirkliche Schwächung der französischen Position in Europa als Gewinn für Deutschland. Eine etwas weniger tiefsitzende Feindschaft brachte er England entgegen, das die koloniale Expansion Deutschlands hintertreibe. Italien als romanisches Land beurteilte Heusler ähnlich negativ wie Frankreich; an Mussolini («patentierts Grossmaul») liess er keinen guten Faden; den Überfall auf Abessinien kritisierte er als kostspieliges Manöver, das die materiellen Ressourcen Italiens erschöpfe. Wiederum aus einer Schweizer Perspektive misstraute er dem italienischen Irredentismus grundsätzlich. An der Wirksamkeit der Allianz zwischen Hitler und Mussolini zweifelte er und dachte, dass sich Hitler rasch wieder vom Feind aus der Zeit des Ersten Weltkriegs abwenden werde.1517 Hitlers Politik mass er dementsprechend am Kriterium der deutschen Stellung in Europa. Die nationalsozialistische ‚Erhebung‘ von 1933 begrüsste er als Versprechen der nationalen Erneuerung. Die Abstimmung über das Saarland war für ihn eine Bestätigung, dass Deutschland hinter Hitler stehe. Er hoffte auf eine rasche Annexion des Danziger Korridors, eine Entfremdung Polens von Frank1516
1517
Heusler an Zinkernagel, 29. 10. 1933, in: Zinkernagel 2020, 2265–2267, Nr. 2067. Den Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund quittierte Heusler in diesem Brief mit «Heil Hitler!» (2267). Vgl. u. a. Heusler an Hermann Schneider, 26. 5. 1936, in: von See 2004, 87.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
381
reich, erwartete die Eingliederung des Sudentenlandes und Österreichs in das ‚Reich‘. Ausdrücklich nahm er den Terror innerhalb Deutschlands für die ersten Jahre als ein Phänomen der Übergangszeit in Kauf, in der die aussenpolitischen Erfolge errungen werden sollten.1518 Die Fixierung auf die aussenpolitische Rolle der Nationalsozialisten für Deutschland entsprang seinem gewollten Realismus, der Heuslers Position unterschied von ‚geistigen‘ Deutungen, die die Hitler-Diktatur als «Sieg des Glaubens an die Idee» priesen.1519 Die innere Lage kannte er durch seine Korrespondenten und durch eigene Besuche recht genau. Dazu gehörten sein Auftritt an der Freiburger Hebel-Feier 1937, wo er die Hauptrede hielt,1520 und 1938 die Fahrt nach Freiburg i. Br. zur Entgegennahme des 1935 gestifteten Toepferschen Erwin-von Steinbach-Preises. Er erhielt auch den Lessing-Preis unter Würdigung seiner Verdienste um die «germanische Renaissance der Schweiz», die einem «gesamtdeutschen Interesse» entspreche. In Hamburg nahm er 1937 den Dietrich-EckartPreis entgegen, der «vor allem für literarisch-propagandistische Leistungen im Sinne der Idee des Nationalsozialismus gedacht» war.1521 Wer also Heusler als passives Opfer einer nationalsozialistischen «Vereinnahmung» seines Germanenbildes darstellt, tendiert dazu, seine Bereitschaft zu übersehen, sich diese Vereinnahmung gefallen zu lassen und die nationalsozialistischen Belohnungen für seine Beiträge zur Ideologie abzuholen.1522 Schon in der Anfangszeit der Hitler-Diktatur missfielen ihm innenpolitische Aspekte, namentlich der Kampf gegen die protestantische Kirche («die unselige kirchliche Politik»), der einen Keil zwischen die nazifizierten Christen in
1518 1519 1520 1521
1522
Heusler an Hermann Schneider, 22. 12. 1933, in: von See 2004, 73 f. Die letztere Formulierung stammt vom Zürcher Germanisten Ermatinger, zitiert nach Amrein 2001, 49. Heuslers Bewunderung für Hitlers Aussenpolitik: von See 2005, 55. Schütt 1996, 275. Erwin von Steinbach-Preis: Fahlbusch 1999a, 116 ff.; Leitgeb 1994, 189, 201 f. Der Preis belohnte die Förderung «alemannischen Volkstums» im Elsass, in der Schweiz und in Deutschland. Stifter war der Unternehmer Alfred Toepfer. Im Kuratorium dieser Stiftung sass seit 1937 Gerhard Boerlin, Basler Appellationsgerichtspräsident und Obmann der Schweizerischen Vereinigung für Heimatschutz, führend im Deutschschweizerischen Sprachverein und in der Redaktion der «Schweizer Monatshefte». Bandle 1989, 33. Der Zürcher Germanist Ermatinger hielt die Laudatio auf Heusler. Schütt 1996, 77. Attraktivität der «alemannischen» Veranstaltungen in Freiburg i. Br.: Schütt 1996, 76 f., 84. Über Ermatinger auch Amrein 2001, 46 ff. Szokody 2001, 263, 273, bringt die Tendenz von Klaus von See, Heusler scharf vom Nationalsozialismus abzugrenzen, zum Ausdruck. Sicher ist, dass Heusler trotz Nationalsozialismus an die ‚reine Wissenschaft‘ glaubte, diese noch lange an deutschen Hochschulen für realisiert hielt und dass er ‚völkische‘ Mythisierungen, die nach seinem Urteil keine wissenschaftliche Grundlage hatten, ablehnte.
382
Geisteswissenschaftler
Deutschland und die Protestanten im Ausland treibe.1523 Die negativen Wahrnehmungen traten bei ihm ab 1938 zunehmend in den Vordergrund;1524 er sah einen neuen Krieg kommen, den er nicht begrüsste. Während er allerdings die Zustimmung zu Hitlers äusserer Politik bis 1938 in seinen privaten Äusserungen ausdrücklich formulierte, äusserte er seine zunehmende Distanz eher verklausuliert – wobei zu bedenken ist, dass er aus Arlesheim nach Deutschland schrieb und mit Zensur und Nachteilen für die Empfänger rechnen musste, wenn er zu einer expliziten Kritik am Nationalsozialismus ansetzte. Er zählte sich nicht zu den «Rechtgläubigen» (d. h. zu den überzeugten Nationalsozialisten), vielmehr sah er im Nationalsozialismus in erster Linie ein Instrument der Wiedererlangung einer deutschen Machtposition. Den ‚Anschluss‘ Österreichs und die Zerstörung der Tschechoslowakei feierte er noch, aber die Novemberpogrome von 1938 und schliesslich die Annäherung zwischen Hitler und Stalin weckten seine Bedenken.1525 Antisemitismus war ein tragendes Element seiner Weltanschauung.1526 Juden betrachtete er als «Orientalen», als Fremde mit Gastrecht in Europa. Er forderte eine Reduktion ihrer Zahl, bezogen auf Deutschland, auf etwa 30’000 Individuen. Persönlich hatte er wie viele Antisemiten keine Berührungsängste mit Juden;1527 zu seinen besten Freunden aus der Studentenzeit gehörte zum Beispiel der Anglist Hans Hecht, ein glühender deutscher Patriot1528, und in Basel war einer seiner liebsten Zechkumpane Kurt Latte.1529 Er nahm die Massnahmen gegen die Juden in Deutschland seit 1933 durchaus wahr, registrierte Selbstmorde unter den Juden, allerdings in seiner emotionsarmen, durch die «Herrenethik» diktierten Art, die keine Ausdrücke für Mitleid kannte.1530 Anschauung gewann er aus erster Hand, denn allein zwischen April und Oktober 1933 war er sechsmal in Deutschland.1531 Hatte er 1936 und 1937 noch die Illusion, dass an deutschen
1523
1524 1525 1526 1527 1528
1529 1530 1531
Heusler an Ranisch 7. 10. 1934, in: Heusler 1989, 570–572, Nr. 176. Vgl. auch seine Klage über «die Abschnürung des reichsdeutschen Protestantismus von dem draussen», 10. 3. 1935, ebd., 572–578, Nr. 177. Bandle 1989, 39. Heusler an Hermann Schneider, 29. 10. 1939, in: von See 2004, 100. Von See 2005, 51 ff. Heusler an Ranisch, 6. 12. 1931, in: Heusler 1989, 537–540, Nr. 163. Der nationalpatriotisch eingestellte Hans Hecht lehrte von 1909 bis 1922 in Basel (unterbrochen durch seine Teilnahme am Krieg), danach bis 1935 in Göttingen, wo er als «Halbjude» entlassen wurde. Maas, 2018b. Basler Erfahrungen mit Hecht: Tréfás 2009, 119 ff. «Mein Schicksal heisst Deutschland, einerlei obs mir gut oder schlecht geht.» Hecht an Zinkernagel, 18. 4. 1933, in: Zinkernagel 2020, 2153–2155, Nr. 1980. Kurt Latte war von 1926 bis 1931 Latinist in Basel. Danach ging er nach Göttingen, wo er 1935 zwangsemeritiert wurde. Dörrie 1982. Heusler an Ranisch, 16. 4. 1934, in: Heusler 1989, 564–567, Nr. 174. Heusler an Zinkernagel, 29. 10. 1933, in: Zinkernagel 2020, 2265–2267, Nr. 2067.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
383
Universitäten freie Wissenschaft nach internationalen Massstäben getrieben werde, so war er doch aufmerksam für die zunehmende Beschränkung der wissenschaftlichen Freiheit im ‚Reich‘. Er tadelte schon 1935 deutsche Freunde, die als Pensionierte oder Emeritierte nur die Sonnenseite der inneren deutschen Verhältnisse seit 1933 sehen wollten.1532 Es war ihm auch klar, dass es in Deutschland keinen freien Zugang zu Informationen mehr gab; von den deutschen Zeitungen wusste er: «die bringen ja nichts – vollständiger Maulkorb».1533 Die Gefährdung Deutschlands aus Osten und Westen schien ihm aber noch bis 1938 die Diktatur mit allen negativen Wirkungen im Innern zu rechtfertigen. «Man darf da nicht zimperlich sein; man muss hohe Opfer bringen.»1534 Im Basler Kontext war Heusler ein germanophiler Freund der deutschen aussenpolitischen Macht-Wiedergewinnung, der zugleich den antifranzösischen Reflex vieler Deutschschweizer teilte, die mit dem Verhalten von «Welschen» zur Zeit des Ersten Weltkriegs begründet wurden. Auch lehnte er den Völkerbund (und erst recht die schweizerische Mitgliedschaft) entschieden ab und gehörte 1921 zu den Gründungsmitgliedern des Volksbundes für die Unabhängigkeit der Schweiz.1535 Er las mit Zustimmung die «Schweizer Monatshefte», die er als «unsere Gelben Hefte» bezeichnete1536 und deren weltpolitische Analysen er sein politisches «Orakel» nannte. Nur selten erwähnte er den Namen von Hektor Ammann, aber öfter denjenigen des Redaktors Zeugin (vermutlich Gottfried Zeugin, Jurist, geboren 1906, promoviert 1932). Unter den Tageszeitungen, deren Tendenz seine Zustimmung fand, ist die «Neue Basler Zeitung» zu erwähnen, die er offensichtlich regelmässig konsultierte, um sich über die Weltlage aus deutschfreundlicher Sicht zu informieren.1537 Dabei legte er, wie viele seiner Schweizer Gesinnungsgenossen, auf die staatliche Unabhängigkeit der Schweiz grossen Wert und kritisierte deutsche Kollegen, die den schweizerischen Verfassungspa-
1532
1533 1534
1535 1536 1537
«Die Stimmen meiner reichsdeutschen Freunde klingen mehr und mehr wie ein gedämpftes Stöhnen – das Stöhnen des Gefesselten. Unser Ausland erscheint ihnen wie ein Eldorado, wo man noch von Gedankenfreiheit weiss.» Heusler an Ranisch, 10. 3. 1935, in: Heusler 1989, 572–578, Nr. 177. Heusler an Ranisch, 26. 5. 1935, in: Heusler 1989, 579–583, Nr. 178. Heusler an Ranisch, 7. 7. 1935, in: Heusler 1989, 583–586, Nr. 179. Mit der deutschen Innenpolitik war er 1938 fertig: «Wir Nichtnazis können in dem Chor des Dritten Reichs nicht mehr mitsingen.» Heusler an Ranisch, 11. 3. 1938, ebd., 635–638, Nr. 196. Bekäme das «Reich» zehn Millionen Deutsche mehr, wäre das ein nicht zu verachtender «Machtzuwachs», urteilte er über die 1938 bevorstehenden Annexionen. Eine Distanzierung von der «so genannte[n] nazistische[n] Weltanschauung» am 26. 11. 1939, ebd., 662–665, Nr. 207. Bandle 1989, 39. Heusler an Ranisch, 7. 10. 1934, in: Heusler 1989, 570–572, Nr. 176. Das Blatt bezeichnete er gegenüber Hanisch am 23. 7. 1937 als «meine Zeitung», in: Heusler 1989, 619–621, Nr. 191. Zu diesem Presseorgan: Wichers 1993.
384
Geisteswissenschaftler
triotismus nicht verstünden.1538 Die Position, die er innerhalb der Schweiz bezog, war eine deutliche Option für den «rechten Flügel». Mit Blick auf die Bereitschaft, sich von Exponenten der nationalsozialistischen Kulturpolitik auszeichnen zu lassen, und auf die Anhänglichkeit an Kreise wie diejenigen der «Neuen Basler Zeitung» könnte man sagen, dass er sich gezielt in eine ‚Schmuddelecke‘ stellte, um seine völlige Unabhängigkeit als Autor und Künstler zu demonstrieren und die bürgerliche Gesellschaft, die sich seit 1935/36 zunehmend von dieser Ecke distanzierte, im Sinne des ‚épater les bourgeois‘ zu provozieren. Aber dadurch war er gesellschaftlich-akademisch keineswegs marginalisiert. Er war eingebunden in Freundschaftskreise unter den Professoren, einer der Wortführer in der Ablehnung der Politik des sozialdemokratischen Chefs des Erziehungsdepartements durch die Universität und in den Fällen, in denen seine Ansichten als sehr radikal angesehen werden konnten, gedeckt durch die Höflichkeit, Toleranz und Kollegialität, ja Freundschaft, die innerhalb der Fakultät den Umgang bestimmten. Die Basler Öffentlichkeit sah dies etwas anders, aber wenn er an der Fasnacht zur Zielscheibe wurde, dann war dies nach lokalem Empfinden eher eine respektlose Respektsbezeugung als eine Ausgrenzung. Da er 1940 verstarb, erlebte er die nach 1942 einsetzende Marginalisierung einer Basler Gruppe Germanophiler um Gerhard Boerlin1539 nicht mehr, die sehr wahrscheinlich dann auch ihn getroffen hätte. Friedrich Ranke1540 muss im Zusammenhang mit Andreas Heusler betrachtet werden.1541 Er war nicht, wie manchmal suggeriert wird, Heuslers Nachfolger in Basel, sondern er wurde 1938 auf den Lehrstuhl von Eduard Hoffmann-Krayer gewählt. 1911 in Strassburg habilitiert, lehrte Ranke als Privatdozent seit 1912 in Göttingen. 1917 wurde er nach einem Einsatz als Infanterist Extraordinarius in Göttingen, von wo ihn Königsberg 1921 auf ein Ordinariat berief. Seit 1930 war er Ordinarius in Breslau. Der deutsche Patriot im Sinne von 1914 folgte als Germanenforscher den Lehren von Andreas Heusler, aber als Literaturhistoriker des deutschen Mittelalters bewunderte er die poetische Kunst der Minnesänger sowie die höfischen Dichtung (für die Heusler wenig Verständnis aufbrachte) und als Volkskundler war er auf den Spuren von Friedrich von der Leyen1542 ein methodisch bewusster, rationaler Erforscher von Märchen und Sagen im Sinne der Erzählforschung. Diese manchmal widersprüchlichen Seiten behandle ich separat. Patriotisch äusserte sich Ranke meist in Beiträgen, die für die breitere Öffentlichkeit bestimmt waren, und darin oft zu Beginn oder zu Ende des Textes. Er 1538 1539 1540 1541 1542
Heusler an Ranisch, 10. 3. 1935, in: Heusler 1989, 572–578, Nr. 177. Gerhard Boerlin schrieb einen Nachruf auf Heusler in den von diesem geschätzten Schweizer Monatsheften 19, 1939/40. Stolz 2010; Freytag 2003; Rupp/Studer 1971, 7 ff. Roth 2001. Altwegg 1950, 196.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
385
unterstrich, dass die Kenntnis der alten Germanen für heutige Deutsche moralisch wertvoll sei und dass diese aus einer Beschäftigung etwa mit altisländischer Literatur (in Übersetzung) Gewinn ziehen könnten.1543 Er deutete auch an, dass ihn die nationale Erneuerung seit 1933 sehr erfreue und dass er glaube, die Rückbesinnung auf die Germanen leiste dazu einen Beitrag oder werde dadurch selbst wiederum gefördert.1544 Dieses Datum feierte er jedoch in keiner Publikation offen. Seine Begeisterung für Altgermanisches diente (wie dies Heusler gewünscht hatte) dem pädagogischen Zweck, nach 1918 die Erneuerung des deutschen Wesens voranzutreiben.1545 Dabei betonte er mit Heusler immer wieder, dass es keine direkte Deszendenz von den alten Germanen zu den aktuellen Deutschen gebe, schon gar nicht in der Art der ‚Rassenforschung‘ – die Deutschen galten auch ihm als «Mischvolk», das im Verlauf seiner Geschichte für Einflüsse von Nachbarvölkern offen gewesen sei und dadurch auch keinen Schaden erlitten habe. Die Skandinavier überlieferten Zeugnisse «germanischer Art», sie seien ein «Vetternvolk» der Deutschen, aber nicht in direkter Linie deren Vorfahren: Aus ihnen spreche «ein unserem eigenen verwandter, germanischer Geist».1546 «Noch heute aber und für alle Zeit vorbildlich ist der leidenschaftliche sittliche Wille, der in ihnen lebt.» «Der sittliche Idealismus, wie er der Grundzug der altgermanischen Sittlichkeit war, […] ist […] auch ein Stück von jenem deutschen Wesen, das wir als unser bestes Ahnenerbe und als unser tiefstes sittliches Verlangen in uns fühlen: Verwirklichung des inneren Gesetzes durch das Leben und die Tat.»1547 Die Beschäftigung mit den Germanen lasse erkennen, was «echt deutsch» sei, sie seien Vorbilder für einen deutschen Stil, eines Formwillens, der erst bei Klopstock und Goethe wieder zum Vorschein gekommen sei.1548 Die Themen «Stil» und «Form» hatte Ranke von Heusler übernommen, während der romantische Idealismus des Professorenpatriotismus in der Wortwahl nur bedingt Heuslers Streben nach Klarheit entsprach, aber der Intention nach die Rede von deutscher Krise und Reform aufgriff. Ranke hat sich wiederholt im Namen der Wissenschaft von ‚germanomanen‘ Exzessen wie die Propagierung einer heidnischen germanischen Religion oder von einfachen Rassentheorien distanziert. So griff er in einem Vortrag, den er 1928 veröffentlichte, die Edda-Gesellschaft frontal an, als sie eine neue Ausgabe ankündigte, die die «verborgene Weisheit unserer Ahnen aus absichtlicher 1543 1544
1545 1546 1547 1548
Bsp. Ranke 1928: «Die Edda und wir». Ranke 1936a, 161. Ranke sprach anlässlich des Breslauer Universitätsjubiläums, das im üblichen Stil die Demonstration des NS-Machtanspruchs in Universität, Wissenschaft und Forschung betrieb. Hauptredner war Reichserziehungsminister Rust. Kapferer 2001, 153 ff. Roth 2001, 284. Rupp/Studer (Ranke) 1971, 169. Ranke 1936a, 165. Ranke 1936a, 162 ff.
386
Geisteswissenschaftler
oder unabsichtlicher Verdunkelung […] befreien und das Geheimnis und die Weihe unserer Rasse von neuem […] offenbaren» sollte (Zitat aus einem Prospekt dieser Gesellschaft). Die Methode dieser Edition sei «über die Forderung wissenschaftlicher Objektivität grundsätzlich erhaben», wie er ironisch festhielt.1549 Nur bei wissenschaftlicher Betrachtung könne die Edda «wertvollste Erkenntnisse der geistigen Art unserer Vorfahren vermitteln».1550 Sie berichte «so gut wie nichts von dem eigentlich religiösen Sinn, von der Frömmigkeit unserer Vorfahren».1551 Ranke zeigte sich auch darin als Heusler-Schüler, dass er nicht nur eine vorbildliche germanische sprachliche und poetische Form, sondern auch ein germanisches Weltbild annahm, das in Spuren auch in späterer deutscher Dichtung (des Mittelalters) wiederzufinden sei, allerdings eingebettet in die jeweiligen zeittypischen (höfischen) Vorstellungen über Emotionen oder Jenseitshoffnungen. So zeigte er in seinem patriotisch beschwingten Beitrag zum Lexikon Die Grossen Deutschen über den (unbekannten) Dichter des Nibelungenliedes, wie in diesem grundsätzlich höfisch-ritterlichen und christlich geprägten Epos «Altgermanisches» hindurchscheine, das sich als Überreste früherer Dichtung darin entdecken lasse.1552 Als Erforscher von deutschen Märchen und Sagen war Ranke von Heusler unabhängig. Er wollte damit einen Beitrag zur Volkskunde leisten, d. h. zur Erkenntnis des Denkens und Lebens des deutschen Volkes seiner eigenen Zeit. Lebensnähe und Gegenwartsbezug entsprachen einer typischen Forderung der Epoche nach 1900. Märchen betrachtete er nicht als ‚uralt‘, und für Sagen versuchte er mit rationalen Methoden einen Ursprung in historischen Zeiten und psychologischen Mechanismen zu finden. 1928 formulierte er die Aufgaben des Sagenforschers so: «Er will die geistige Welt, die religiösen, mythischen, magischen, sittlichen, rechtlichen, naturgeschichtlichen und geschichtlichen Vorstellungen und Anschauungen kennenlernen, die in unserem Volke leben oder in denen unser Volk lebt […].»1553 Zwar diente für ihn diese Forschung der Erkenntnis ‚deutscher Art‘ und dem Verständnis für das einfache Volk in einer an die Romantik gemahnende Erwartung, dass wissenschaftliche Arbeit und Patriotismus mitein1549
1550 1551 1552 1553
Rudolf John Gorsleben war Übersetzer der «Edda» (1920), Gründer und «Kanzler» der Edda-Gesellschaft (1925), Runenforscher, Neuheide und Antisemit, https://de.wikipedia. org/wiki/Rudolf_John_Gorsleben. Rupp/Studer (Ranke) 1971, 143 f. Rupp/Studer (Ranke) 1971, 168. Ranke 1935a. Siehe auch z. B. Ranke 1937a. Ranke 1935, 87–112: «Vorchristliches und Christliches in den deutschen Volkssagen» (vorgetragen in Danzig und Breslau 1928), Zit. 87. Ranke 1936: «Die Grundsätze der Märchenforschung». Hierfür rechnete er mit starken Einflüssen anderer Kulturen auf die deutschen Märchen. Das sei eine «Überfremdung der deutschen Seele» gewesen, die der Kenner der altnordischen Dichtung, der daran arbeite, «die […] germanischen Werte wiederzuerwecken», bedaure, ebd., 299.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
387
ander eng verbunden seien.1554 Für die Sagen hatte er sich 1925, europäischer gestimmt und skeptischer als dann 1935, aber explizit gefragt, ob die Volkssagenforschung eine Antwort darauf geben könne, was «deutsch» sei, d. h. für «die Abgrenzung deutscher Sonderart gegen die Art fremden Volkstums oder gar der Sonderart deutscher Stämme und Landschaften gegeneinander». Er mahnte damals zur «Vorsicht» und vermutete, dass man in den Volkssagen vor allem das «allgemein Menschliche, vielleicht noch mit europäischer Sonderfärbung» sehe.1555 Dieser Ansatz stand für ihn schon vor 1914 fest.1556 Wo er glaubte, aus Sagenstoffen würden mythologische Gebilde konstruiert, die in weite Vorzeiten zurückreichen und germanisches Wesen offenbaren sollten, erhob er vor wie nach 1933 Einspruch ohne in Rechnung zu stellen, welchen Stellenwert derartige Pseudo-Wissenschaft für die politische Ideologie hatte.1557 Er verzichtete allerdings auf eine direkte Kritik der NS-Ideologie und zog es vor, falsche Tatsachenbehauptungen schlicht und gründlich zu widerlegen. Otto Höfler, bekannt durch sein Werk Kultische Geheimbünde der Germanen (Frankfurt 1934, ursprünglich eine in Wien 1931 eingereichte Habilitationsschrift), wurde so zum Gegenstand einer eingehenden und damit um so wirksameren Demontage.1558 Diese Beiträge zur Volkskunde zeigten Ranke als Skeptiker, misstrauisch gegen jeden Über1554
1555 1556
1557 1558
Ranke 1935, 7. Das Buch ist eine Sammlung von Aufsätzen, die bis 1928 erschienen waren; das Vorwort datiert vom September 1934 und nimmt offensichtlich Bezug auf die Erwartungen, die Ranke mit dem Ende der Weimarer Republik verband. Hitler hat er dabei nie erwähnt, auch nicht indirekt. Ranke 1935, 71–85: «Grundfragen der Volkssagenforschung» (vorgetragen in der Königlichen Deutschen Gesellschaft zu Königsberg 1925), Zit. 84. Ranke 1935, 27–37: «Sage und Erlebnis» (Antrittsvorlesung, Göttingen 1912). Zustimmend zitiert er auch den Franzosen Paul Sébillot, Le Folklore de France, daraus den Band Le peuple et l’histoire von 1907, ebd., 76 (Vortrag 1925). Bsp. Ranke 1935, 71–85: «Grundfragen der Volkssagenforschung» (Vortrag 1925), v. a. 79, mit einem Hinweis auf die Arbeiten von Richard Reitzenstein. Rupp/Studer (Ranke) 1971, 380-410: «Das Wilde Heer und die Kultbünde der Germanen. Eine Auseinandersetzung mit Otto Höfler». Zuerst erschienen in der Niederdeutschen Zeitschrift für Volkskunde und Blätter für niedersächsische Heimatpflege (18, 1940). Die Arbeit bezog sich auf Höflers Schrift in der Ausgabe von 1934 und wurde in Deutschland veröffentlicht, was auch zeigt, dass es dort kein Publikationsverbot für Ranke gab (alle in den Kleineren Schriften abgedruckten Aufsätze waren in Deutschland veröffentlicht worden) und dass Kritik an Höfler nicht als Akt eines politischen oder ideologischen Widerstands galt. Neben Sachkritik tritt hier die pragmatisch-psychologische Methode von Rankes Sagenforschung hervor, aber auch die Konzession an den Zeitgeist; so ist von germanischer «Urzeit» die Rede, ein Ausdruck, den er sonst kritisierte: Die Gesamtvorstellung des Wilden Heeres sei als Einheit zu betrachten, an die sich weitere Elemente angelagert hätten. Die Wurzeln reichten in germanische «Urzeit» zurück und seien deshalb für uns «nicht mehr erkennbar». Erkennbar seien bloss Anlässe, zu denen die Vorstellung wachgerufen worden sei, und diese entstammten «innerseelischen» Vorgängen. Rupp/Studer (Ranke) 1971, 408.
388
Geisteswissenschaftler
schwang und fern von völkisch aufgeladenen Deutungen, wenn auch immer sehr patriotisch gestimmt. Auch als Literaturhistoriker war Ranke von Heusler weitgehend unabhängig. Die Bezüge der mittelalterlichen Literatur auf das Christentum würdigte er im Gegensatz zu seinem Lehrer positiv, und er entwickelte ein genuines Interesse an der mittelalterlichen und spätmittelalterlichen Literatur.1559 Der deutschen mittelalterlichen Dichtung sprach er einen hohen künstlerischen Rang zu, auch wenn die Charakterisierung des Unterschieds zwischen «germanisch» und «mittelalterlich» in ähnlichen Kategorien wie bei Heusler geschah.1560 Bei Ranke trat auch seltener ein Bedauern über die Knechtschaft auf, die die mittelalterlichen Formen der Herrschaft durch ‚Staat‘ und Kirche über den freien Mann gebracht habe. Heusler folgte er hingegen recht eng in der Sprachlehre und Metrik des Altisländischen; sein Altnordisches Elementarbuch für die «Sammlung Göschen» von 1937 zitierte Heusler mit fünf Arbeiten (darunter dessen Altisländisches Elementarbuch in der Auflage von 1932) und verbreitete dieselben Einsichten sowie die gleiche wissenschaftlich-kritische Grundhaltung wie Heusler.1561 Die Suche nach einem Nachfolger für Eduard Hoffmann-Krayer in der Kommissionsarbeit1562 zog sich in Basel über ein Jahr hin. Der Vorschlag lautete schliesslich auf Hans Neumann1563 oder Kurt Wagner (damals in Gießen)1564, beides national orientierte Deutsche.1565 Andreas Heusler meldete daraufhin im Oktober 1937, dass Friedrich Ranke für Basel zur Verfügung stehe, und schrieb ein empfehlendes Gutachten über ihn.1566 Der Erziehungsrat schloss Neumann wegen mangelnder Lehrerfahrung aus, sodass noch Wagner und Ranke im Rennen ver1559 1560 1561
1562 1563
1564 1565
1566
Roth 2001, 289. Als Historiker der mittelalterlichen deutschen Literatur war Ranke eher ein Schüler von Gustav Roethe als von Heusler. Altwegg 1950, 195. Hinweis auf seine Kritik an der Ura-Linda-Chronik von Herman Wirth als «Geschichtsklitterung» bei: Rupp/Studer 1971, 9; Simon 2005. Rankes Veröffentlichung zum Thema datiert von 1933. Heinrich Himmler war ein Verfechter der Echtheit der gefälschten Chronik. Rankes Kritik am «Ura-Linda-Spuk» 1934: Kunicki 2002, 115. Die Spitze gegen den Breslauer Extraordinarius Steller, der an die Echtheit der Chronik glaubte, war offensichtlich, auch wenn Ranke nie Stellers Namen erwähnte. Roth 2001, 284 f. Neumann besuchte 1937 Andreas Heusler mehrmals, vgl. Heusler 1989, ix. Neumann war damals in Rumänien im Exil, da er als Enkel eines ‚Nichtariers‘ in Deutschland keine Stellenchancen hatte und auch die für 1934 vorgesehene Habilitation scheiterte. Stackmann 1999. Anonym 2021. Heusler berichtete Ranisch am 14. 12. 1937 über die Kommissionsarbeit: «Ungefähr pari loco stehen jetzt Kurt Wagner, Hans Neumann, Ranke.» Aus Menschenfreundlichkeit würde Heusler Neumann wählen, sonst «verräbelt» er in Rumänien, in: Heusler 1989, 627–631, Nr. 194. Heusler an Ranisch, 28. 1. 1938, in: Heusler 1989, 631–635, Nr. 195.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
389
blieben. Die Regierung verlangte Informationen über die politischen Einstellungen und beauftragte den Ersten Sekretär der Handelskammer, den Rechtshistoriker und liberal-konservativen Grossrat Hermann Henrici, der in der Kommission der Sachverständigen der Kuratel sass, mit Abklärungen. Die entscheidende Auskunftsperson war der Freiburger (ehemals Basler) Volkskundler John Meier. Er stufte Ranke als «gute zweite Klasse» ein, bezeichnete seine Entlassung in Breslau aber als einen Verlust für die deutsche Wissenschaft. Er werde sich, falls er nach Basel käme, politischer Auseinandersetzungen ganz enthalten.1567 Henrici empfahl deshalb Ranke. Wagner schilderte Meier aus süddeutscher Sicht als ‚preussisch-unangenehme‘ Persönlichkeit, die keinen Zugang zu Studierenden finden könne. Dennoch riet die Kuratel zunächst, Wagner zu wählen, weil dieser jünger als Ranke sei und sich deshalb in Basel leichter werde einleben können. Der Erziehungsrat empfahl aber der Regierung mit Stichentscheid des Präsidenten, d. h. des Chefs des Erziehungsdepartements, Ranke vorzuziehen, wobei die Hälfte der Erziehungsräte viel lieber einen Schweizer gesehen und notfalls den beiden Basler Extraordinarien Wilhelm Altwegg und Wilhelm Bruckner gemeinsam die Vertretung des Faches übertragen hätte. Diese aber wollten ihre Pensen an der Universität nicht ausweiten. So fiel die Wahl auf Ranke, dessen Persönlichkeit unbestritten von grosser Freundlichkeit war.1568 Diese Wahl ist dadurch bemerkenswert, dass die Stimmen, die sich seit Mitte der 1930er Jahre jeweils gegen die Berücksichtigung deutscher Kandidaturen für Basler Lehrstühle erhoben, hier nicht den Ausschlag gaben. Offensichtlich glaubte man, mit Ranke weder einen Nationalsozialisten noch einen prinzipiellen Regimegegner zu berufen. Auch wurde sein ausgeprägter Patriotismus nicht mit einem ‚deutschnationalen‘ Bild von Geschichte und Ansprüchen der deutschen Nation in Europa in Verbindung gebracht, wie dies in anderen Fällen geschehen war (Ritter) und später wieder geschah (Gelzer). Heusler notierte nach Rankes Ankunft in Basel mit Befriedigung, dass er sich hier gut einlebe und dass dessen (halb⌥)jüdische Ehefrau hier «aufblühen» könne.1569
1567
1568
1569
Roth 2001, 293, vermutet, dass Ranke auch in Basel den von den Nationalsozialisten eingeleiteten, angeblichen deutschen Aufschwung privat weiterhin positiv bewertete. Heusler über Ranke: «Er ist ein guter Patriot, trotz allem.» Heusler an Ranisch wie vorausgehende Anm. StABS Protokoll Kuratel T 2 Bd. 13, 1935–1941, 263, 5. Sitzung, 18. 3. 1938: Nachfolge von Eduard Hoffmann-Krayer. Kurt Wagner war als Nationalsozialist bekannt: https://de. wikipedia.org/wiki/Kurt_Wagner_(Germanist); er hatte 1933 die Mitgliedschaft des Kampfbundes für Deutsche Kultur, des NS-Lehrerbundes sowie der SA erworben. Der Entscheid für Ranke im Erziehungsrat: StABS Protokoll Erziehungsrat 2. 5. 1938, 30. 5. 1938, 24. 6. 1938. «Unter den jüdischen Gattinnen hier sind einige, die sich grollend in ihre 4 Wände bergen; andere, die ‚aufgehen wie die Küchlein‘ (offae) & die Schweiz ein Eldorado finden.»
390
Geisteswissenschaftler
Als Ranke 1930 nach Breslau gekommen war, das die zweitgrösste preussische Universität und damit eine der grössten deutschen Hochschulen beherbergte,1570 war dort die NSDAP mit vierzig Prozent der Wählerstimmen bereits die mächtigste Partei. Da die Universität als «stark verjudet» galt, wurde sie zur Zielscheibe antisemitischer Angriffe in der Presse und vonseiten der Studentenschaft.1571 Im Wintersemester 1932/33 begann die Agitation in der Universität. 1933 verloren 37 Breslauer Professoren ihre Stelle. Im Dezember 1933 installierte das preussische Ministerium den Völkerrechtler Gustav Walz, einen Parteigenossen (eingetreten 1931) und «verdienten Kämpfer»,1572 in Breslau, wo er das Rektorat übernahm – er wirkte als Rektor bis zum Herbst 1937, d. h. bis zu dem Zeitpunkt, da gegen seinen Rat Ranke entlassen wurde.1573 Walz wollte zusammen mit den Professoren der Breslauer Philosophischen Fakultät die etablierten fachlichen Standards aufrechterhalten. Ihre mehrheitlich sehr patriotisch-nationale Haltung, die Bereitschaft, wissenschaftliche Themen mit Bezug auf das ‚Leben‘ zu vermitteln und trotz der Grösse der Universität auf ihre Studierenden persönlich einzugehen, sicherte ein gutes Einvernehmen mit der von den Nationalsozialisten organisierten Studentenschaft. Nur unter den Nichtordinarien äusserten sich Ambitionen, die sich mit Parteistellen verbündeten. Der Volkskundler und Extraordinarius Walther Steller1574 fiel in dieser Beziehung besonders auf. Die ihm von der vorausgehenden Professorengeneration gemachten Versprechen1575 wurden nach 1930 nicht eingelöst, und Steller hatte zusammen mit Theodor Siebs (Siebs war der Lehrer des in Basel in Erwägung gezogenen Kurt Wagner gewesen) gegen die Berufung Rankes nach Breslau opponiert.1576 So wurde er zu einem Unruhefaktor im Deutschen Institut, das Ranke und der Professor für neuere Literatur, Paul Merker,1577 führten. Beide hielten wie Walz Stellers Volkskunde für unwissenschaftlich und waren nicht bereit, dafür eine universitäre Position zu schaffen. So profilierte sich Steller, der seit 1920 im schlesischen «Grenzkampf» engagiert war und 1933 der NSDAP beitrat, als Partei- und SAMann und suchte die Ordinarien zu diskreditieren.1578 Er hielt die Rede vor der Bücherverbrennung im Mai 1933. Andere Agitatoren wirkten unter den Theolo-
1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578
Heusler an Hermann Schneider über die Lage Rankes in Basel, 14. 6. 1939, in: von See 2004, 98. Kapferer 2001, 16. Kapferer 2001, 40, 44. Schmelz 2011; Hausmann 2002, 303 ff. Kapferer 2001, 60, 62, 77 f., 79. Zimmermann 1995, 242 ff. Kunicki 2002, 34 f., 57, 62 ff. Kunicki 2002, 37. Kunicki 2002, 51 ff. Da Merker sich im Unterschied zu Ranke nicht mit Volkskunde abgab, wurde er nicht Opfer der Angriffe von Steller. Kapferer 2001, 92 f., 113 f.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
391
gen1579 – von ihnen wurden die Germanisten jedoch nicht angegriffen. Obschon das «Ostprogramm» der Universität von 1933 eine Volkskundeprofessur vorsah, wurde diese 1937 zwar geschaffen, aber nicht mit Steller besetzt.1580 Er informierte sich bei der Hitlerjugend über Rankes Sohn und erfuhr, dass die Mutter Halbjüdin war. Auch brachte er vor, dass Ranke die Habilitation von Will-Erich Peuckert ermöglicht habe, der als ‚links‘ galt.1581 Diese Erkenntnisse gelangten 1934 an Parteistellen. Doch Ranke wurde als nationaler Erzieher von der nationalsozialistischen Studentenschaft sehr geschätzt.1582 Seine Professur konnte er deshalb behalten, bis die Gesetzgebung seine Versetzung in den Ruhestand wegen ‚jüdischer Versippung‘ erzwang. Am 29. September 1937 erliess das Ministerium die entsprechende Verfügung. Fakultät und Rektorat versuchten daraufhin am 15. Oktober 1937 resp. am 29. November 1937 (Empfehlung des Dekans Ludolf Malten) für Ranke eine Ausnahme zu erwirken. Als Argumente führten sie an, Ranke sei ein würdiger Vertreter eines grossen Namens, ein tapferer Kämpfer für Deutschland und ein durch und durch «deutscher Mann», der vom Halbjudentum seiner Frau nicht beeinflusst sei und keinen Kontakt zu den angeheirateten jüdischen Verwandten pflege. Im folgenden Jahr unterstützte auch der Oberpräsident und Gauleiter dieses Ausnahmegesuch – ohne jeden Erfolg. Wahrheitsgemäss wurde dabei von niemandem behauptet, Ranke sei ein überzeugter Nationalsozialist, nur sein «bester deutscher Typus», sein «wertvolles Blutserbe» und sein «ausgesprochen deutsch[es]» Denken und Fühlen wurden ins Feld geführt.1583 Peuckert kommentierte dies so: Breslau war ein grosser Trubel. R[anke] ist also wegen der Frau (sie ist 1/2 [jüdisch]) gefallen. Er bekam es gerad am Silberhochzeitstage auf den Tisch gelegt. Das grosse Kind hatte geglaubt, alle Schwierigkeiten seien überwunden, weil es den Bruder
1579 1580 1581 1582
1583
Kapferer 2001, 83 ff. Kunicki 2002, 33, 61. Kunicki 2002, 37, 58 ff. Peuckert verlor 1935 die Venia Legendi. Ranke war von sich aus in den Seminaren bestrebt, den Bezug zum ‚Leben‘ und zur ‚Gegenwart‘ herzustellen; er experimentierte auch mit interdisziplinären Lehrformen, was den Forderungen der NS-Studenten entsprach, ohne dass die Inhalte der nationalsozialistischen Ideologie voll entsprochen hätten. «Dieser betont nationalen Haltung verdankte Friedrich Ranke seine Beliebtheit bei der studentischen, national orientierten Jugend und konnte so die Gefahr einer nationalsozialistischen Gleichschaltung vermeiden.» Ranke suchte mit ihnen den «deutschen Menschen». Kunicki 2002, 94. Abschrift der Eingabe der Fakultät an den Minister vom 15. 10. 1937; Stellungnahme des Dekans zu Händen des Regierungspräsidenten vom 29. 11. 1937 mit handschriftlicher Empfehlung des Rektors; Stellungnahme des Oberpräsidenten und Gauleiters in Breslau an den Minister vom 2. 1. 1938, in: UA Wroc aw, Bestand Universität Breslau, Personalakt Friedrich Ranke S 220–385. Ich danke dem UA Wroc aw für die freundliche Überlassung einer Kopie der Dokumente.
392
Geisteswissenschaftler [Hermann Ranke, Ägyptologe in Heidelberg], der ihre Schwester [geheiratet] hat,1584 schon 6 Wochen vorher erwischte. Und jetzt denkt er, es seien Revisionsmöglichkeiten. Als ob man solche Dinge je revidierte.1585
So war er nun für Basel verfügbar, während Steller seine Karriere mit einem Lehrauftrag und ab 1940 mit dem Extraordinarientitel in Kiel fortsetzte.1586 Dabei war Friedrich Ranke in Breslau wie jemand aufgetreten, der die Hitlerdiktatur jedenfalls in den ersten Jahren als nationalen Aufschwung empfand, und er wollte mit der Germanenforschung und der älteren Literaturgeschichte, aber auch mit einer auf die Überwindung der Klassengegensätze zielenden Volkskunde dazu beitragen. Sein Name erschien in Hermann Aubins «Ostprogramm» für die Universität Breslau,1587 und Rankes Parole ‚Wissenschaft mit Lebensbezug‘ passte gut zu dieser Entwicklung. 1937 beteiligte er sich an der Breslauer «Jubiläumswoche» mit einem Vortrag über «Germanische Züge in der deutschen Dichtung des Mittelalters», dessen Text in eine NS-kontrollierte Publikation der Deutschen Studentenschaft aufgenommen wurde. Die Sprache war angepasst, aber die Grundlinien der herrschenden Ideologie, Antisemitismus und rassistische Geschichtsinterpretation, wurden offen negiert, und Hitler wurde nicht verherrlicht. Rankes Ansicht nach könne nur saubere, rationale wissenschaftliche Forschung dem nationalen Aufschwung dienen, nicht aber pseudowissenschaftliche Ideologiebildung.1588 Er war offensichtlich kein überzeugter Nationalsozialist, aber eine völkische Tendenz und deutscher Nationalismus waren tragende Elemente seiner Haltung.1589 Im Zeitkontext mussten einige Kernaussagen dieses Vortrags an der «Jubiläumswoche» fast schon oppositionell wirken, sie passten aber in den Stil des Deutschen Instituts, dessen Chefs sich nationalsozialistischer Mythenbildung nicht öffnen wollten, zum Ärger überzeugter Parteigenossen wie Steller. Als Basler Professor bot Ranke altisländische Privatissima, und die Volkskunde pflegte er im «Kränzchen» zusammen mit dem Altphilologen Karl Meuli, dem Historiker Hans Georg Wackernagel und dem Germanisten und Volkskundler Paul Geiger. Öffentliche Vorlesungen und Seminare hielt Ranke nur zur Sprachgeschichte und zur älteren deutschen Literatur ab. Für die linguistische Einführung ins Mittelhochdeutsche und alemannische Dialektologie entlasteten 1584 1585 1586 1587 1588 1589
Burkard 2003. Rankes älterer Bruder Hermann war mit der Künstlerin Marie Stein, einer Schwester von Friedrich Rankes Frau Frieda, verheiratet. Brief von Will-Erich Peuckert an Maria Hauptmann, Ende November 1937, zitiert bei: Kunicki 2002, 278. Zimmermann (1994a), zit. nach https://de.wikipedia.org/wiki/Walther_Steller. Zu Stellers wissenschaftlichen Arbeiten: Zimmermann 1995, 243 ff. Kapferer 2001, 113 f. Belege aus: Roth 2001, 279. Ranke 1937.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
393
ihn die nebenamtlichen Dozenten Wilhelm Bruckner und Wilhelm Altwegg. Ab 1939 war die Neukollationierung von Tristanhandschriften, der damals seine hauptsächliche Forschungsanstrengung galt, unmöglich. Ranke befasste sich nun mit dem Osterspiel aus Muri und mit Wolfram von Eschenbach. Das Spätwerk galt der spätmittelalterlichen Dichtung im Umkreis der deutschen Mystik. In der Lehre ging er nicht auf seine Forschungsthemen ein, er vermied jede blendende Formulierung und wollte alle Wege und Umwege der Erkenntnis darlegen. Dabei kümmerte er sich um die Studierenden persönlich und war bei ihnen geachtet und beliebt.1590 Bis 1943 veröffentlichte Ranke seine Forschungen in deutschen Zeitschriften, danach bis 1948 nur noch in der Schweiz.1591 7.2.3.3 Vertreter der Neueren deutschen Literatur Die Nachrichten zur Biographie von Franz Zinkernagel1592 sind spärlich. Er erscheint als vorbildlicher Familienvater, guter Freund seiner Kollegen und wohlwollender Betreuer seiner Studierenden. Eingehend studierte er Hebbel (ihm galt die Marburger Dissertation, die er 1904 bei Ernst Elster schrieb) und widmete sich dann (seit 1907) als Tübinger Privatdozent und Extraordinarius hauptsächlich Hölderlin. Seinen Lebensunterhalt verdiente er als Oberlehrer an der Tübinger Mädchenschule, der er vorübergehend auch als Rektor vorstand. 1917 wurde er nach Basel berufen. Der in Frankfurt aufgewachsene Zinkernagel pflegte enge Beziehungen zu Stefan Zweig, aber auch zum Nordisten Andreas Heusler, und er erwarb 1934 das Bürgerrecht von Riehen bei Basel, wo er seit 1920 wohnte. Die zeitgenössische deutsche Literatur verfolgte er aufmerksam, insbesondere Theaterschriftsteller wie Frank Wedekind interessierten ihn. Hölderlin musste im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert wiederentdeckt werden, wozu unter anderen Stefan George einen einflussreichen Beitrag leistete1593 – aber im Umkreis von Zinkernagel ist nie von George die Rede, wohl aber von einer Vorliebe für das Tragische in der deutschen Literatur. Mit Hölderlins Nachlass war er von Tübingen her unmittelbar vertraut und setzte sich zum Ziel, die Werke auf der Grundlage der Handschriften nach wissenschaftlichen Prinzipien herauszugeben. Bis 1926 erschienen die Textbände seiner Edition, stiessen allerdings wegen der Lesarten mehrfach auf Kritik der Fachwelt. 1590 1591 1592
1593
Rupp/Studer 1971, 10. Schriftenverzeichnis in: Altwegg 1950, 199 f. Anonymes Lebensbild, in: [Zinkernagel] 1935. Dieses Heft enthält die Würdigungen von Heusler, Franz Weiss für den Theaterverein (ehemaliger Schüler), Albert Bettex (Schüler) und Walther Allgöwer (doktorierte bei Zinkernagel über Hölderlin). Internationales Germanistenlexikon 1800–1950, Berlin 2003, 2104 f. Hieronymus in: Zinkernagel 2020, Ix ff., seinerseits auf diesem 1935 erschienenen Heft basierend. Aurnhammer 1987.
394
Geisteswissenschaftler
Zinkernagel wollte seinen wissenschaftlichen Apparat, der die Lesarten gerechtfertigt hätte, in einem Schlussband unterbringen. Diesen konnte er aber bis zu seinem Tod 1936 nicht drucken lassen, so dass sein Lebenswerk unvollendet und in seiner Bedeutung für das Editionswesen unterbewertet blieb.1594 An der Universität vertrat Zinkernagel die Neuere deutsche Literaturgeschichte mit einem «geistesgeschichtlichen» Profil, das Andreas Heusler aus seiner Perspektive auf die Formel «Gehalt statt Form» brachte.1595 Von Heusler unterschied ihn auch seine Haltung zu den Nationalsozialisten, die er kategorisch, wenn auch nicht plakativ, ablehnte. Schwerpunktthemen der Lehre waren Goethe, Hölderlin und Hebbel. In der Basler Gesellschaft war er als Freund des Stadttheaters bekannt. Gleich nach seiner Ankunft trat er in die Kommission ein, die das Theater damals leitete, und später, nach der Professionalisierung der Leitung, gehörte er zur Aufsicht über das Theater.1596 Der konservativ gesinnte Zinkernagel war mit Juden befreundet, deren 1933 eingetretene Lage sein Mitgefühl weckte. Unter seinen Freunden stand ihm der Ophthalmologe Josef Igersheimer aus Frankfurt sehr nahe; Zinkernagel korrespondierte mit Martin Buber, mit dessen Schwiegersohn Ludwig Strauss und mit Christiane Zimmer, der Tochter von Hugo von Hofmannsthal.1597 Sein Engagement für in Deutschland nach 1933 verfolgte Autoren wurde erst vor Kurzem knapp gewürdigt.1598 Bei Heuslers 70. Geburtstag distanzierte sich Zinkernagel in seinem Beitrag für die «Basler Nachrichten» von der Bewunderung des Jubilars für Hitler und dessen Sympathien für die Schweizer Völkerbundskritiker und Germanophilen: «Ein bewundernswert klar denkender Kopf, aber so unpolitisch, dass er dem kleinsten Schachzug eines Unaufrichtigen zum Opfer fällt. Abhold jedem kleinlichen Geschimpfe und Gestreite, aber leidenschaftlich hingerissen in die Sorge um die Zukunft deutscher Kultur.» Offensichtlich war mit dem «Unaufrichtigen» Hitler gemeint und mit der «deutschen Kultur» das ‚Reich‘.1599 Die Habilitation von Juden an der Basler Universität lehnte er allerdings mit der auch 1594
1595
1596 1597 1598 1599
Allgöwer in: [Zinkernagel] 1935, 18–20. Dokumente dazu in: Zinkernagel 2020, 2686– 2823: «Franz Zinkernagel und sein Kampf für den Lesartenapparat seiner Hölderlin-Ausgabe». Heusler deutete in seiner hochstilisierten Ansprache auf Zinkernagel an, dass er ihn nicht wirklich bedeutend fand, nur «gemütlich» und lieb, ein Süddeutscher, kein richtiger Germane, schwächlich. Die Spezialisierung auf Hölderlin, den Heusler den «kranken schwäbischen Dichterjüngling» nannte, trug wohl zu dieser Wahrnehmung bei. Heusler in: [Zinkernagel] 1935, 8–10. Vgl. Fritz Weiss in: [Zinkernagel] 1935, 11–13. Zinkernagel an Martin Buber, 30. 4. 1933; Christiane Zimmer an Zinkernagel, 30. 4. 1933, und andere mehr, in: Zinkernagel 2020, 2160 f., Nr. 1985 f. Steimer 2019, 13 ff. Zinkernagel 2020, 2561–2564, Nr. 2299 (Zit. 2564): «Prof. Dr. Andreas Heusler zum 70. Geburtstag». Beitrag für die Basler Nachrichten, erschienen am 11. 8. 1935.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
395
von Heusler geäusserten Begründung ab, deutsche Juden hätten nie eine Chance auf eine Dozentur in der Schweiz; die Attribute ‚deutsch‘ und ‚jüdisch‘ seien eine Quadratur der Hindernisse.1600 Zinkernagel ging (anders als Heusler) auf den Hilferuf von Richard Alewyn ein, der als Nachfolger Gundolfs in Heidelberg 1933 ohne Pension entlassen worden war.1601 Er wandte sich für ihn an das Schweizerische Hilfswerk für deutsche Gelehrte, das die Anfrage an die Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland und an das Comité international pour le placement des intellectuels émigrés in Genf weiterleitete. Alewyn stellte er in Aussicht, er könnte sich, falls die Habilitation von Werner Richter nicht zustande käme, in Basel habilitieren, von einem Rockefeller-Stipendium leben und sich dann für seine eigene Nachfolge bewerben. Das war wenig konkret. Hingegen lud er ihn zu einem Vortrag vor dem Theaterverein ein.1602 Im Dezember 1933 reiste Alewyn weiter an die Sorbonne, 1935 emigrierte er nach Österreich, wo er bis 1938 am HofmannsthalArchiv in Bad Aussee arbeiten konnte. 1938 begab er sich von dort via Ascona nach den USA, was dem patriotischen Mann, der deshalb in Basel hatte unterrichten wollen, weil er hier mit deutschem Boden und deutscher Luft in Verbindung zu bleiben hoffte,1603 widerstrebte.1604 Als Zinkernagels früherer Assistent Max Nussberger, ein Spezialist für Gottfried Keller und Conrad Ferdinand Meyer, der in Riga untergekommen war, 1939 nach Basel zurückzukommen wünschte, war sein Lehrer allerdings bereits verstorben, und in Basel wollte sich nun niemand für Nussberger verwenden. Vielmehr erinnerte man sich an eine Kon1600
1601 1602
1603 1604
Zinkernagel an Franz Schultz, 20. 5. 1933, in: Zinkernagel 2020, 2182 f., Nr. 2002. Hier referierte er offensichtlich die Ansicht von Andreas Heusler, da er dies als die Meinung von «Deutschfreunden» berichtete. Als «Ausländer» müsse er, Zinkernagel, sich mit seiner eigenen Ansicht zurückhalten. Auf die Lage von Alewyn wies ihn zuerst Fritz Lieb hin: Lieb an Zinkernagel, 5. 10. 1933, in: Zinkernagel 2020, 2241–2245, Nr. 2050. Hans Oprecht, Schweizerisches Hilfswerk, an Eduard Hoffmann-Krayer, 26. 10. 1933, in: Zinkernagel 2020, 2261, Nr. 2065. Bezeichnend Zinkernagels Anwort an Lieb, ebd. 2250– 2252, Nr. 2056, 12. 10. 1933: Es gebe dutzende gleichgelagerter Fälle. Ein starkes Entgegenkommen würde den Antisemitismus in der Schweiz schüren. Zudem vermutete Zinkernagel, Alewyn sei nicht nur wegen einer jüdischen Grossmutter, sondern auch wegen einer unvorsichtigen Äusserung entlassen worden. Zinkernagel an Wilhelm Pfeiffer-Belli, 19. 11. 1933, in: Zinkernagel 2020, 2273, Nr. 2074, fügte das Argument hinzu, man dürfe dem Schweizer Nachwuchs nicht den Weg verbauen, denn aufgenommene Ausländer hätten kaum Aussichten, «in absehbarer Zeit in ihr Vaterland zurückgerufen zu werden». Zinkernagel an Alewyn, 25. 11. 1933 (Einladung nach Basel für den Vortrag), ebd. 2274 f., Nr. 2076. Aber der Gedanke, dass Alewyn sein Nachfolger werden könnte, sei ihm «äusserst sympathisch», Zinkernagel an Alewyn, 28. 3. 1934, ebd. 2321–2324, Nr. 2116. Richard Alewyn an Zinkernagel, 15. 2. 1934, mit Rückschau auf den Basler Vortrag, der kein Erfolg gewesen sei, in: Zinkernagel 2020, 2308–2310, Nr. 2107. Schütt 1996, 158 f.
396
Geisteswissenschaftler
troverse um seine Habilitation. Da der Archäologe Karl Schefold einem Ruf nach Ankara nicht Folge leistete und somit weiterhin in Basel bezahlt wurde, waren keine Mittel für einen Lehrauftrag für Nussberger frei – ein Grund mehr, ihn nach Zürich zu verweisen.1605 Da Zinkernagel im Amt starb, konnte er die Wahl seines Nachfolgers nicht beeinflussen. Der fachlich hochqualifizierte, dem Nationalsozialismus jedoch nahestehende Richard Newald von der Universität Freiburg (Schweiz) sprang als Vertreter ein.1606 Zeitgemäss drehte sich die Nachfolgefrage darum, ob man ‚noch‘ Deutsche berücksichtigen könne, wobei wie oft ‚Emigranten‘ ebenso wie Freunde des Nationalsozialismus ausgeschlossen wurden. Die Fakultät nannte primo loco fünf (!) Kandidaten, wobei diese grosse Zahl schon zeigte, dass sie kaum in der Lage war, sich über die Auswahl konkret einig zu werden: Karl Viëtor (Hölderlin-Spezialist, damals in Gießen, 1937 unter Vorwegnahme der Zwangspensionierung nach Boston ausgewandert), Walther Rehm (Renaissance-Forscher und Burckhardt-Biograph, Freund des Basler Historikers Werner Kaegi, als Privatdozent in München wegen Kritik an der NS-Ideologie vorübergehend blockiert, ab 1937 in Gießen), Max Kommerell (damals Privatdozent in Frankfurt, von Stefan George geprägt) und die beiden Schweizer Wilhelm Altwegg und Walter Muschg. Die Kuratel wollte auf die deutschen Kandidaten nicht eintreten. Unter den Schweizern galt Altwegg als zu alt und kränklich. Deshalb schlug die Kuratel nur den 1898 geborenen Zürcher Walter Muschg vor, der auch den Chef des Erziehungsdepartements, Fritz Hauser, überzeugte. Es gab aber Einwände gegen seinen Charakter, die Regierungsrat Im Hof vor dem Erziehungsrat anführte. Dennoch wurde Muschg mit Mehrheitsentscheid gewählt.1607 Dass Walter Muschg1608 1936 Zinkernagels Nachfolger wurde, war in erster Linie dadurch bedingt, dass angesichts der damaligen kulturpolitischen Lage ein Schweizer die Neuere deutsche Literaturgeschichte vertreten sollte.1609 Da die un1605
1606 1607 1608
1609
Max Nussberger an Rektor Ernst Staehelin, 8. 10. 1939; Rektor Ernst Staehelin an Hauser, 11. 10. 1939; Hauser an Rektor der Universität, 21. 11. 1939, alles in: StABS Erziehung CC 28c, Philosophisch-Historische Fakultät, Einzelne Dozenten 1938–1954. Roloff 1999. StABS Protokoll Erziehungsrat 4. 12. 1935, 25. 3. 1936. Pestalozzi 2000, 199. StABS Protokoll Erziehungsrat 26. 6. 1936. Linsmayer 2010; Pestalozzi/Stingelin 1999; Glück/Nemec 1997; Schütt 1996, 45 ff. Die UB Basel bewahrt den Nachlass (NL 48), siehe https://ub.unibas.ch/digi/a100/kataloge/nach lassverzeichnisse/IBB_5_000010635_cat.pdf, der unter den gegebenen Umständen nicht benutzt werden konnte. Eine eigentliche Monographie zu Leben und Werk existiert nicht. «Schweizer & Reichsdeutsche kamen nahezu pari modo zur Betastung. Ich sage ‚nahezu‘, denn darauf mussten wir achten, ob einer kein Nazi sei. […] Immerhin, es kam zu keiner, auch nicht der leisesten Trübung über diese politischen Grenzfragen. Aber dann kamen die von aussen … Man hatte, Gott weiss warum, meinen dicken, meist im Spittel lagernden Nachbarn, lic. theol. Bernoulli, als Beirat zugezogen. Der tutete ins chauvinistische Horn, & da ich sanft replizierte, geriet er in Amoklauf & erliess mehrere hektographierte
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
397
einige Fakultät sich nicht zu einem klaren Vorschlag durchrang (sie war auch verstimmt angesichts der Erwartung der Regierung, dass nur ein Schweizer wählbar sei), führten die ‚oberen Behörden‘ die Entscheidung für Muschg herbei.1610 Er hatte in Zürich bei Emil Ermatinger studiert und lebte nach seiner Promotion über Kleists Penthesilea (1922) in Berlin1611 (und in Italien), wo er mit expressionistischen Dichtern verkehrte und selbst literarische Werke schrieb. 1928 habilitierte sich der frühere Nebenfachpsychologe mit der Arbeit Der dichterische Charakter. Eine Studie über Albrecht Schaeffers Helianth (veröffentlicht 1929). Die vielbeachtete Antrittsvorlesung als Zürcher Privatdozent galt dem Thema «Psychoanalyse und Literaturwissenschaft», eine Pionierleistung.1612 1935 veröffentlichte er eine Studie zur Mystik in der Schweiz. Dabei vertrat Muschg vor seiner Wahl nach Basel von Schweizer Patrioten als durchaus «deutsch» empfundene Ansätze (so Werner Kaegi).1613 Arnold Künzli zählte ihn zu den «konservativen Revolutionären».1614 Doch seine Position deckte sich nur teilweise mit den Frontisten, da er schon als Privatdozent eine Beurteilung von Dichtung nach deren Brauchbarkeit als Waffe im politischen Kampf ablehnte. Nach Muschg sollte die von vielen Angehörigen seiner Generation geforderte ‚Erneuerung‘ von der Kultur ausgehen, nicht vom Politischen. Sein Misstrauen gegen die etablierten Parteien und seine Hoffnung, die Schweiz könne sich moralisch erneuern, entsprach einer Grundstimmung unter jungen Akademikern – Muschg war eher ein konservativer Rebell als ein Revolutionär.1615 In den frühesten Publikationen äusserte sich diese Überzeugung: Das 19. Jahrhundert, die Entfernung vom bäuerlichen Ursprung der Schweiz, die Modernisierung durch Städtewachstum, Industrie und Freisinn bedeuten ihm «die Sphinx des ungeheuren Überganges […], den viele heute einen Niedergang nennen, weil er im tiefsten Grunde die Einleitung zu der Katastrophe war, von der wir heute heimgesucht sind. Aber diese Evolution steht tatsächlich jenseits aller Werturteile, denn sie ist eine Notwendigkeit gewesen, die
1610 1611 1612 1613
1614 1615
Schriftstücke wider mich.» Heusler an Hermann Schneider, 1. 3. 1936, in: von See 2004, 86. Kaegi an Carl Jacob Burckhardt, 24. 11. 1935, in: Nachlass Werner Kaegi, Paul Sacher Stiftung, WK 181. Kaegi war Mitglied der Berufungskommission. Muschg berichtete in «Wissen und Leben», später «Neue Schweizer Rundschau» genannt, über seine Erfahrungen in Berlin. Erschienen bei: Junker und Dünnhaupt, Berlin 1931. Siehe unten den Abschnitt über Kaegi, Anm. 2383. Das ‚Deutsche‘ an Muschg sieht Müller 2001, 120, in der gewissen Vergleichbarkeit mit Max Kommerell; der Kontext der Äusserung war der Entscheid, keine deutschen Bewerber für die Basler Stelle für neuere Literaturgeschichte zuzulassen. Zu Kommerell: Hammerstein 2012, 103, 108–111. Künzli 1999. Schütt 1996, 52. Der Umstand, dass Muschg gelegentlich in den «Schweizer Monatsheften» publizierte, ist für die Einschätzung seines politischen Standorts nicht von Belang, zumal er gleichzeitig in der «Tat» und in der «Neuen Schweizer Rundschau» schrieb.
398
Geisteswissenschaftler
uns als Tragik erscheinen mag.»1616 Somit wollte er nicht, wie die konservativen Revolutionäre, aktiv gegen die Moderne kämpfen, vielmehr betrachtete er sie als etwas Gegebenes, an dem der Dichter tragisch litt und das ihm die Möglichkeit eröffnete, sein Werk aus der Entfremdung zur eigenen Zeit heraus zu schaffen. An der Pflege der Beziehungen zur deutschen akademischen Welt unter dem Hakenkreuz, die führende Schweizer Germanisten praktizierten,1617 war Muschg nur gelegentlich beteiligt: Der damals nationalsozialistisch engagierte Jakob Schaffner vermittelte ihm eine Einladung nach Freiburg i. Br., dort an der alemannischen Tagung 1936 einen Festvortrag zu halten.1618 Auch bei Muschg vollzog sich die Einsicht in die wahre Natur des Nationalsozialismus in Etappen. 1934 konnte er noch behaupten, er habe «keine Beweise dafür, dass politische Gefangene [in Deutschland] misshandelt und gefoltert werden».1619 Er hatte aber schon im Juni 1933 den Aufruf des Schweizerischen Hilfswerks für deutsche Gelehrte unterzeichnet.1620 Nach 1934 publizierte er nur noch sporadisch in Deutschland.1621 Die akademische Karriere war für Muschg nicht selbstverständlich, da er nicht über die nötigen Mittel verfügte, um eine ‚brotlose‘ Privatdozentenzeit zu überstehen und zunächst wohl auch lieber als Dichter denn als Wissenschaftler gelebt hätte. Zuerst war er Lektor bei Orell Füssli, dann 1927/28 Redaktor der Monatsschrift «Annalen» (Horgen), in der er auch eigene Essais publizierte. Die Heirat in die Familie Zollikofer (der Schwiegervater war Chefarzt am Kantonsspital St. Gallen) entspannte die materielle Situation.1622 Muschgs Standpunkt zeichnete ihn dadurch vor anderen Germanisten aus, dass er sich für den deutschen Expressionismus begeisterte und die Aufgabe des Dichters als Verkünder tiefer Wahrnehmungen und Einsichten in den Mittelpunkt stellte. Aus der Perspektive der 1920er Jahre heraus gesehen ‚zeitgemäss‘ war seine Überzeugung, der ‚wahre‘ Dichter habe unbewusst einen Zugang zu den ursprünglichsten Vorstellungen und den elementarsten Befindlichkeiten des 1616 1617 1618 1619 1620 1621
1622
Muschg 1968, 25 (aus: «Zürcher Geist», Vortrag Genf 1925, publiziert 1926, in: Berner Geist, Zürcher Geist, Basler Geist). Schütt 1996, 74 ff. Schütt 1996, 76. Zitiert nach Schütt 1996, 155; der Satz bezog sich auf die Initiative (Unterschriftensammlung) gegen den NS-Terror von Rudolf Jakob Humm im März 1934. Schütt 1996, 156. In Deutschland publizierte er bis 1934, dann wieder 1936 (eine Buchbesprechung in der «Deutschen Literaturzeitung») und letztmals 1940 (im «Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts», Frankfurt): Auswertung der Bibliographie der Veröffentlichungen von Walter Muschg, in: Muschg 1969, 141 ff. Im Januar 1934 wollte er in der «Frankfurter Zeitung» den deutschen Lesern das jüngste Werk von Hans Henny Jahnn empfehlen. Muschg 1968, 145–154 (Frankfurter Zeitung vom 28. 1. 1934). Glück/Nemec 1997.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
399
Menschen. Nur als Individuum, das seiner Gegenwart entfremdet sei, schaffe der daran leidende Dichter sein einmaliges Werk. Die Neigung zu vielem, was mit der Vorsilbe «Ur-» verbunden war, und die gelegentliche Verwendung des Wortes «Blut» (was bei ihm ein kollektives Unbewusstes bezeichnete) machten ihn zu einem Vertreter des (ausserakademischen) Zeitgeistes. Muschg hatte sich um 1930 vorübergehend als Forscher profiliert, der die Tiefenpsychologie für die Literaturwissenschaft fruchtbar zu machen trachtete. Tatsächlich bewunderte er Freud, aber kaum dessen Epigonen, die nach seiner Auffassung als medizinischnaturwissenschaftlich geschulte Analytiker mit ihren schematischen Ansätzen in die Literaturwissenschaft «hineinpfuschten».1623 Letztlich habe Dilthey wertvollere Beiträge zur Psychologie des Dichters geleistet als die Analytiker,1624 und nur die Literaturwissenschaft besitze die «wirkliche Überlegenheit in der geistigen Vertrautheit mit der Dichtung».1625 Muschgs Beitrag zur ‚Überwindung des 19. Jahrhunderts‘1626 bestand somit in einer Hinwendung zum Irrationalen, Dunklen, in Seelentiefen Verborgenen, auch zur Mystik und durch einen Blick über die Disziplinengrenzen hinüber zu einem damals vielversprechenden Nachbarfach, der Psychologie. Besonders auffällig war seine 1931 veröffentlichte Gotthelf-Interpretation. Darin sah man eine doppelte Absage an das ‚19. Jahrhundert‘. Einmal – und daran hielt Muschg bis weit in die Nachkriegszeit fest – wollte er Gotthelf vor der Verniedlichung als ‚Heimatautor‘ retten, der ländlichbernische Gemütlichkeit und Emmentaler Volkscharaktere ausgemalt habe, dessen Romane von einer sich an Lokalkolorit labenden Lesergruppe zur Bestärkung ihres Heimatgefühls (das die ‚geistige Landesverteidigung‘ weiter geschürt hatte) ohne Anstrengung konsumiert werden könnten.1627 Zum andern entriss er durch seine Interpretation Gotthelf den liberalkonservativ eingestimmten Lesern, die ihn zusammen mit Jacob Burckhardt tendenziell auf die Kritik des modernen demokratischen Volksstaates reduzierten.1628 Dezidiert rückte er Gotthelf in die Nähe des Expressionismus, indem er in den Motiven und Stoffen das Unergründliche, die Tiefenschichten menschlicher Existenz Suchende und Andeutende fand. Im Buch über Gotthelf von 1931 zeigten sich Anleihen aus der völki1623
1624 1625 1626
1627 1628
Stingelin 1999, 18–30; Text der Rede in: Muschg 1968, 111–135 «Psychoanalyse und Literaturwissenschaft», Antrittsvorlesung Zürich 1929, publiziert bei Junker & Dünnhaupt Berlin 1930. «Schattenseiten» der Analytiker: Muschg 1968, 119 f., ähnlich 128 f. Muschg 1968, 131. Muschg 1968, 134. Edgar Salin erkannte diese Tendenz und bezeichnete Muschg, obschon er sonst nicht damit einverstanden war, dass nur noch Schweizer gewählt werden sollten, als einen «wirklich bedeutende[n] Anwärter». Salin an Werner Zimmer, 7. 12. 1935, in: Zinkernagel 2020, 2578–2581. Muschg 1968, 293–299: «Ehrfurcht vor dem Dichterwort ist nicht Wortklauberei» (Auszug aus: «Gotthelf im Radio», Bern 1954). Müller 2001.
400
Geisteswissenschaftler
schen (deutschen) Literaturkritik der 1920er Jahre, die die Verbindung des Werkes zu Herkommen und Räumen, zur kollektiven Psychologie, ja zu ‚Blut und Boden‘ erahnen wollte und den Autor als «Verherrlicher des Bauerntums» feierte.1629 In dieser Hinsicht bewegte sich Muschg in der Nähe zu Max Kommerell1630 und war damals ‚zeitgemäss‘ oder eben ‚deutsch‘. Muschgs Krisenbewusstsein verschärfte sich 1932 in der Auseinandersetzung mit der damaligen deutschen Literatur. Deutsche Dichtung treibe «im Getümmel des Untergangs mit». Die Erwartung, der «Grimmelshausen des Stellungskrieges» werde kommen, sei eine «Todsünde wider unser Schicksal». «Es gibt noch keine Sprache für das, was jetzt auf der Welt geschieht. Kein Genius wartet vor der Tür; vielleicht, dass einer sein Haupt verhüllt. Die Unbeirrbaren retten uns nicht, sondern die paar Gerechten in Sodom, die die Würde des Menschen tragen.»1631 Nach der Wahl nach Basel (1936) setzte Muschg mit seiner Antrittsvorlesung im Jahr 1937 ein Zeichen an die Adresse der Bewunderer völkischer Literaturdeutung.1632 Hier nahm er sich Josef Nadler vor, der seit 1911 eine kulturgeschichtlich-völkische («stammesgeschichtliche») Literaturinterpretation vertrat, die im Nationalsozialismus zustimmend rezipiert und wiederholt neu aufgelegt worden war.1633 Für diejenigen, die Muschg näher kannten, war dies nicht überraschend, da er schon in der Antrittsvorlesung als Zürcher Privatdozent Nadler (zusammen mit den Tiefenpsychologen) als Vertreter einer einseitig auf kollektive Vorbedingungen der Dichtung abstellende Tendenz kritisiert hatte.1634 Josef Nadler hatte 1932 noch eine Literaturgeschichte der Schweiz nachgeschoben, die Muschg allerdings nur am Rande erwähnte. In seiner von Andreas Heusler als «Demontage» begrüssten, programmatischen Basler Antrittsrede kritisierte Muschg zunächst Nadlers Ansätze eingehend als die Masse der Literaturproduktion in den Blick nehmende, dilettantisch-fehlerhafte Darstellung der Geschichte der deutschen Literatur. Diese Masse werde von Nadler auf einfache Charakteristiken reduziert, und diese wiederum mit Epochen, Landschaften und Volksgruppen in Verbindung gebracht. ‚Schrifttum‘ erscheine bei Nadler so als kollektiver Ausdruck des ‚Volkstums‘, und die Aufgabe der Literaturgeschichte sei angeblich erfüllt, wenn eine pauschalisierende Rückbindung der Schriften an das Völkische der deutschen «Stämme» hergestellt sei. Muschg als Autor des Gotthelf von 1931 1629 1630 1631 1632 1633
1634
Muschg 1931. So Linsmayer 2010. Muschg 1968, 139–144: «Dichtung des Schweigens», ursprünglich veröffentlicht in Die literarische Welt, Berlin, 28. 10. 1932. Schütt 1996, 104 f. Die Antrittsvorlesung war entscheidend für die Akzeptanz von Muschg in Basel. Heusler an Ranisch, 14. 12. 1937, in: Heusler 1989, 627–631, Nr. 194. Nadler war in der Schweiz schon vor seiner Literaturgeschichte der deutschen Schweiz (1932) bekannt, weil er von 1914 bis 1924 in Freiburg im Uechtland doziert hatte. Wehrli 1993, 411, 415. Muschg 1968, 131.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
401
distanzierte sich so weniger von Nadlers Annahme einer Wirkung kollektiver Kräfte in der Dichtung, vielmehr stellte er sich gegen deren Verortung im Völkisch-Massenhaften. Die relevanten überindividuellen Strukturen waren für Muschg das Unterbewusste und das Archaische, und diese äusserten sich in der Individualität des Dichters, nicht in einem Kollektiv.1635 Mit dieser Kritik war sich Muschg der Zustimmung derer sicher, die den Nationalsozialismus als kulturund geistfeindliche Massenbewegung ablehnten.1636 Mit diesem Vortrag bestritt Muschg seine frühere Nähe zu irrationalen Deutungen nicht.1637 Aber gegen die völkisch-kollektivistische Auffassung der Literaturwissenschaft wollte er ein Bild des Individuums, des «Dichters» herausarbeiten, der ahne, was den gewöhnlichen Menschen verborgen bleibe, und aus tiefem persönlichem Leiden heraus das Geahnte künstlerisch-individuell gestalte.1638 Damit bereitete Muschg seine wenig später klassisch gewordene Formel der «tragischen Literaturgeschichte» (sein Buch mit diesem Titel veröffentlichte er 1948) vor, die weder nazistisch noch rational aufklärerisch noch im humanistisch-klassisch-ästhetischen Sinn individualistisch-elitär war. Der Grund und das Ziel waren andere als bei den Humanisten: Nicht das gute Leben in Kunstgenuss und Gespräch, nicht das Klassische als feste Basis strebte er an; er blieb ‚bewegt‘, wie es die Expressionisten waren, suchend, leidend und mitleidend, ein lauter und kämpferischer Anwalt seiner grossen Dichter. Verbindend mit den Basler Humanisten wirkte allerdings die Ablehnung der Moderne, der Antiamerikanismus, der Kampf gegen Technisierung, gegen das Automobil, die Wochenendhäuschen, die Reklame, die Unterhaltungsindustrie, kurz der Kampf gegen den «Ungeist».1639 Diese Auffassung von Literatur und Literaturwissenschaft machte nur in seinem näheren Umkreis Schule, während seine oft polemischen Voten weit herum gehört wurden und in der Nachkriegszeit als Elemente des ‚Nonkonformismus‘ galten, der die konservativ-autoritären Seiten der Eidgenossenschaft zu überwinden trachtete. Damit und mit dem Einsatz für Dichter der 1920er Jahre, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfemt und nach 1945 in Vergessenheit zu geraten drohten, wurde er zum «Gewissen seiner Zeit».1640 1635 1636
1637
1638 1639 1640
Gamper 2001, 94; Muschg 1937. Pestalozzi 2000, 200, betont, dass Muschg seine Kritik an Nadler nicht «politisch» vorgetragen habe. Er stellte allerdings implizit klar, wie sich seine Auffassung von Dichtung von derjenigen faschistischer Interpreten unterschied. Pestalozzi/Stingelin 1999, 12 f. Vgl. z. B. Muschg 1968, 154–165: «Vom magischen Ursprung der Dichtung», erschienen in: Die literarische Welt, Berlin, 3. 3. 1933. Dort kritisierte er die akademische Erforschung der Mythen, Märchen und Sagen, wie sie z. B. in Breslau und ab 1938 in Basel Friedrich Ranke vertrat: «In der Forschung haben heute die Rationalisten gesiegt, die sich eine kollektive, in ihrem Wesen anonyme Dichtung nicht zu denken vermögen» (163). Muschg 1937, 23. «Ungeist»: Peter André Bloch im Vorwort zu Muschg 1968, 7. Wiesmann 1967.
402
Geisteswissenschaftler
In Basel stellte sich Muschg in die Reihe der antimodernen Kritiker der ‚reichsdeutschen‘ Gegenwart, ausgehend von Bachofen,1641 Burckhardt, Overbeck und dem frühen Nietzsche.1642 ‚Antimodern‘ soll nicht missverstanden werden: Muschg war wie andere Literaturwissenschaftler gegen die städtischindustrielle Massengesellschaft (die «gesellschaftliche Moderne»), aber er war unter Schweizer Germanisten wohl der einzige dezidierte ‚Modernist‘ mit seiner Wertschätzung des Expressionismus, der Neuen Sachlichkeit und der künstlerisch-individualistischen Moderne (die für ihn über den deutschen Rahmen hinausreichte).1643 Er förderte weiterhin Autoren des Expressionismus, mit Hans Henny Jahnn verband ihn eine Freundschaft,1644 Ernst Barlach und Alfred Döblin bewunderte er (während er weder von George noch von Thomas Mann, Hofmannsthal oder Rilke viel hielt) und warb um Verständnis für Kafka.1645 Als Förderer der Dichter im Exil war er allerdings der Meinung, sie sollten nicht als ‚Emigranten‘ Politik machen (wie die Gruppen in der Zürcher Theaterszene), sondern sich dem Werk widmen. Die ‚Erneuerung‘ der Schweiz erwartete er vom einheimischen ‚Schaffen‘.1646 Während des Krieges gab er im Schwabe-Verlag die «Schweizer Reihe» der «Sammlung Klosterberg» heraus, die von 1942 bis in die Nachkriegszeit national bedeutende Autoren bekannt machte, so neben Gotthelf Ueli Bräker, Heinrich Füssli, Pestalozzi, Bachofen, Gottfried Keller, Albert Steffen und Mystiker.1647 Den Texten stellte er Einleitungen voran, die teils eine eingehende Werkinterpretation boten (so zu Gotthelfs Schwarzer Spinne – Gotthelfs Erzählung fasste er frei von schweizerischem Nationalismus als Weltthema übernational und überzeitlich auf),1648 teils eine historische Darstellung der Kontexte enthielten, in die die Werke gehörten. Ein gutes Beispiel dafür war seine Präsen1641
1642 1643 1644 1645 1646 1647
1648
Muschg pflegte eine schwärmerische Bachofen-Rezeption, die an die ‚Konjunktur‘ des Basler Juristen im damaligen Deutschland gemahnt. Muschg 1968, 42, ursprünglich in: «Bachofens Sprachkunst», publiziert in den von Muschg redigierten Annalen, Zürich/ Horgen 1927. Sein Verhältnis zur Archäologie, insbesondere zu den Etruskern, illustriert der von faschistischen Sprachelementen durchzogene Artikel «Etruskische Totenstädte», ebenfalls in den Annalen von 1927, abgedruckt in: Muschg 1968, 53–61. Pestalozzi 2000, 202. Bucher 2001, 75 f.; Gamper 2001, 95. Muschgs Beziehung zu Hans Henny Jahnn und seine Bevorzugung des ‚schweizerischen Schaffens‘ in Zürich: Schütt 1996, 164, 166 f. Pestalozzi/Stingelin 1999, 17. Schütt 1996, 164 ff.; Kröger/Exinger 1998. Pestalozzi/Stingelin 1999, 14; Muschg 1969, 173 f. Muschg begann im November 1941, die helvetische Serie der «Reihe Klosterberg» herauszugeben; er korrespondierte dafür mit Konrad Farner, der beim Schwabe Verlag als Lektor angestellt war. Herausgeber der parallel erscheinenden europäischen Reihe war Hans-Urs von Balthasar. Universitätsbibliothek Basel, Handschriften, Verlagsarchiv Schwabe, Inv.-Nr. 1875 Sammlung Kosterberg Korrespondenz. Muschg 1968, 219–228 (1942).
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
403
tation der Briefe von Heinrich Füssli, die auch verdeutlichte, dass sich Muschgs Einsatz für die «Klosterberg»-Reihe nicht auf ‚geistige Landesverteidigung‘ reduzieren liess, sondern weiterhin Kritik und ‚Erneuerung‘ anstrebte.1649 Zwei Themen mussten hier auffallen. Muschg interessierte sich eingehend für den ‚GrebelHandel‘, der Zürich im ausgehenden Ancien Régime erschütterte und die patriotische Jugend der Repression durch die Obrigkeit auslieferte. Die Schüler von Bodmer und Breitinger interessierten Muschg als idealistische, moralische Staatsreformer, als (noch gescheiterte) ‚Erneuerer‘ einer «faul» gewordenen politischen Ordnung. Zudem porträtierte er Füssli als Beispiel für diejenigen Schweizer Künstler und Dichter, deren Leistungen erst viele Jahrzehnte nach ihrem Tod in der Schweiz rezipiert wurden, während sie zu ihren Lebzeiten nur im Ausland gewürdigt worden waren. Hierin äusserte sich Muschgs Unbehagen an der Schweiz, das sich gleichzeitig in seinem politischen Engagement während des Krieges zeigte. Er war nach dem ‚Anschluss‘ Österreichs1650 bereit, sich auch politisch zu engagieren, und wurde auf der Liste des Landesrings der Unabhängigen (LdU) in den Nationalrat gewählt. Der Landesring entsprach seiner Vorstellung von einer ‚Bewegung‘, die nicht als ‚Partei‘ Teil des anscheinend überholten Systems war. Die Schweiz war nach Muschg (ähnlich wie für den 1934 verstorbenen Basler Historiker Emil Dürr, den er zitierte) im Grunde ein Land von Bauern; das städtische Proletariat verstand er als eine bäuerliche Schicht, die von der Industrie in die Städte verpflanzt worden war. Mit Dürr war für Muschg Demokratie nur als ländliche Ordnung funktionsfähig. Zu Dürrs rechtsbürgerlicher Position stellte er sich allerdings dadurch in Gegensatz, dass er nicht nur die revolutionäre Rolle der Bauern in der Schweizer Geschichte unterstrich, sondern aus der These, die Proletarier seien im Grunde die Nachfahren dieser Bauern, folgerte, man müsse für die Integration der Sozialdemokratie in den Bundesstaat plädieren.1651 Muschgs Hochschätzung des Bäuerlichen war somit nicht restaurativ, aber konservativen Ursprungs.1652 Die kulturkritisch begründete «Rückbildung der Grossstadt» wurde dank Muschg ins Parteiprogramm des LdU eingeschrieben. Er wollte die Schweiz gegen «amerikanische» Einflüsse und gegen die Dominanz der 1649 1650
1651 1652
Muschg 1968, 238–259: «Heinrich Füssli, Briefe» (1942). Schütt 1996, 139, nimmt an, dass das Auftreten der Nationalsozialisten in Wien 1938 Muschg politisiert habe. Ein Blick in das Nachlassverzeichnis zeigt, dass es vor 1939 offenbar keine politischen Themen in seinen Manuskripten oder Publikationen gab. Konkrete politische Anliegen begannen sich 1939 öffentlich zu zeigen in einem Vortrag über Adalbert Stifter, worin er unterstrich, dass der Sudentendeutsche Stifter mit dem Witiko ein tschechisches Nationalepos verfasst habe. Muschg 1968, 171–189: «Die Landschaft Stifters», Vortrag vor dem PEN-Club in Basel, abgedruckt in den Basler Nachrichten vom 1. 4. 1939; der Hinweis auf Sudentendeutsche und Tschechen dort 171 und 187. Muschg 1968, 203: «Sterbendes Seldwyla», 9. 5. 1941. Muschg 1968, 198: «Sterbendes Seldwyla», 1. 4. 1941.
404
Geisteswissenschaftler
Technik1653 ‚erneuern‘ statt bloss die bestehende, freisinnig-selbstgerechte Schweiz zu verteidigen. Dafür stand die Artikelserie «Sterbendes Seldwyla», die er 1941 für «Die Tat» schrieb. «Seldwyla» symbolisierte eine kleinbürgerlich-satte Ordnung, die auf den Errungenschaften von 1848 ausruhte und sich, beherrscht von materiellen Interessen, durchwurstelte und darauf noch stolz war.1654 ‚Geistige Landesverteidigung‘ verachtete er, denn Politik sollte durch Moral ersetzt werden. Seine humanitären Überzeugungen äusserten sich in der Forderung, alle hätten Anrecht auf ein gutes und gerechtes Leben. Muschg formulierte in diesem Zusammenhang treffend, worin das kulturelle Problem der Deutschschweizer bestand, seit Deutschland unter nationalsozialistische Herrschaft geraten war. Vorher, in «Seldwyla», konnten sie es sich als provinzielle Peripherie des Zentrums Deutschland wohl sein lassen, denn als «Seldwyla» war die Schweiz auf eine «umfassende Kultur» bezogen, und die Freundschaft mit «mächtigen Nachbarn» war bereichernd gewesen, denn man holte sich bei ihnen, was einem gefiel, und liess den Rest auf sich beruhen. Die eigenen Leistungen zeigte man im Nachbarland vor, das sie honorierte. «Bis vor kurzem haben sich unsere Gelehrten, unsere Techniker, unsere Künstler und Schriftsteller im Ausland den Namen erworben, der ihnen dann auch daheim, meist verspätet und zögernd, zugestanden wurde.» Das sei nun vorbei, die Nachbarn «haben ihr Gesicht verändert». Nun müssten Schweizer die volle Verantwortung für sich selbst übernehmen. «Wir können keine Provinz, kein Hinterland mehr sein.» Als Antwort entwickelte er die seit den 1920er Jahren immer wieder gehörte Forderung nach ‚Erneuerung‘, diesmal mit der Idee: «Wir müssen selber eine Mitte werden, schöpferisch zu denken und zu handeln beginnen.» Die Schweiz brauche ein neues «geistiges Kraftzentrum», «die Geburt einer neuen Schweiz».1655 Von seinem Auftreten als Politiker im Nationalrat (1939 bis 1943) blieb in Erinnerung, dass er sich im Dezember 1940 zusammen mit Sozialdemokraten und Liberalen gegen die Ausweitung der Vollmachten des Bundesrats und gegen die Unterstellung von Anfragen, Motionen, Postulaten und Interpellationen unter eine Vorzensur wandte. 1941 äusserte er sich über das Wirtschaftsabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland und kritisierte die Angleichung der schweizerischen Ökonomie an die deutsche Kriegswirtschaft. In der Debatte über die Flüchtlingspolitik 1942 äusserte er sich gemässigt und verlangte, der Bundesrat müsse alles tun, um den Flüchtlingen die Weiterfahrt nach Frankreich oder 1653 1654
1655
Diese Stossrichtung entsprach auch derjenigen der Basler Humanisten; sie setzte sich in die Kulturkritik der Nachkriegszeit und der frühen 1960er Jahre hinein fort. Auszug aus der Serie von Beiträgen zu LdU-Zeitung «Die Tat» von 1941, in: Muschg 1968, 193–206, unter dem Titel «Sterbendes Seldwyla», Symbol ‚Seldwyla‘: 201 (9. 5. 1941). Muschg 1968, 206: «Sterbendes Seldwyla», 16. 5. 1941.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
405
Afrika zu ermöglichen, was immerhin implizierte, dass Flüchtlinge vorübergehend in der Schweiz aufzunehmen seien. Im gleichen Jahr sprach Muschg gegen die Ausbürgerung von Schweizer Landesverrätern, die im Ausland aktiv waren: Die Ausbürgerung sei «Ausdruck und Ausfluss des totalitären Denkens»,1656 ein faschistisches Machtinstrument; entsprechende Entscheide durch die Exekutive statt durch Gerichte bedeuteten die Ausschaltung des Rechtsstaates.1657 Zusammenfassend können wir festhalten, dass Muschgs Auffassung von Literaturgeschichte und Literaturkritik manchen in Deutschland wirkenden Tendenzen der 1920er Jahre entsprach; der Dichter galt ihm aber nicht als «Führer» nach Georges Bild, sondern als Dulder und Prophet, und Muschgs NietzscheLektüre war ganz offensichtlich die Basis seiner antimodernen Haltung. Dichtung musste für ihn ergreifend sein: Die Idee des Tragischen als Garantie des Echten hatte er schon sehr früh gefasst. Sein Thema war der Kampf gegen die Gebundenheit, denn das Gebundene ist unfrei und unecht, wer sich aber von Gebundenheit löst, begibt sich in eine Tragik. Darum lehnte er die klassenkämpferisch engagierte Literatur ab. Aufschlussreich für Muschgs Gegnerschaft zur Moderne war seine Studie über Bachofen, in der er seine Faszination durch Archäologie und Urgeschichte, Mythologie und Tiefendimensionen zum Ausdruck brachte. Ein Schweizer moralischer ‚Erneuerer‘ blieb er immer. Sein Idealismus definierte sich bäuerlich, antiamerikanisch, im Kampf gegen die «Verwirtschaftlichung» der Politik, gegen die Kulturindustrie, gegen Städtewachstum und Grossindustrie. Im Krieg trat er für den Rechtsstaat und die Verfassung ein und stellte sich gegen das Vollmachtenregime sowie gegen eine Nachahmung der politischen Ordnungen der Nachbarländer. Dieser Zug spricht klar gegen die These, dass er aus der konservativen Revolution, dem Frontismus, noch anderes mitgenommen hätte als bloss die Forderung, die Krise sei durch Idealismus und Moral zu überwinden. Mag er konservativ gewesen sein, reaktionär war er nicht, im öffentlichen Leben so wenig wie als Literaturkritiker, und als Rebell bekämpfte er Stillstand und Festhalten an Situationen, die früher einmal erträglich gewesen sein mochten, die zu seiner Zeit aber obsolet geworden waren. «Seldwyla» hiess seine Chiffre für die Kritik am Ausruhen auf dem freisinnigen Erfolg nach 1848 und für die Dialektik des Verhältnisses zwischen schweizerischer Peripherie und deutschen Zentren. Muschg blieb einerseits verankert im ‚19. Jahrhundert‘, denn er sah das ausgehende 18. Jahrhundert mit den Augen des Liberalen als «faul» und erneuerungsbedürftig an. Andererseits war er einer der Überwinder des ‚19. Jahrhunderts‘, indem er die angebliche innere Leere von Kultur und Lebensgefühl des späten 19. Jahrhunderts kritisierte. Zwar befasste er sich verständnisvoll, ja zustimmend mit Grillparzer und Stifter, er blieb jedoch nicht bei der Trauer über 1656 1657
Zitiert aus Muschg 1968, 212: Votum in Nationalrat gegen die Ausbürgerung, publiziert in: Der Aufbau 1./8. 10. 1943. Schütt 1996, 138 ff.
406
Geisteswissenschaftler
den Verlust der alten Ordnung stehen, denn dies verbot ihm schon seine Identifikation mit jugendlichen Aufklärern. Mit der Propagierung einer idealischen ‚Erneuerung‘ und der Kritik an der Modernisierung des öffentlichen und literarischen Lebens, mit der Gegnerschaft zu einer Literaturforschung, die typisierte, auf Werturteile verzichtete, die Produktion inventarisierte und zeitliche Abläufe historisierte, entsprach sein Programm dem Expressionismus und der Suche nach dem ‚Wesen‘. Weder auf der Grundlage dieser wissenschaftlichen Orientierung noch auf der Basis seiner rebellischen Sensibilität gegenüber öffentlichen Zuständen gab es für ihn eine Möglichkeit, am Nationalsozialismus etwas Positives zu finden. Doch wie die Mehrheit seiner Basler Kollegen sah er keinen Anlass, eine eingehende und explizit gemachte Kritik oder gar eine Theorie zur Erklärung des Nationalsozialismus zu entwickeln. Es blieb bei einer inneren Ablehnung, die sich auch auf schweizerische Versuche zur Angleichung oder ‚Anpassung‘ bezog, und einer aktiven Sympathie für die echten Dichter, die Opfer dieser Ideologie und dieses Systems geworden waren. 7.2.3.4 Ergebnisse Die Basler Germanistik war in das Zentrum der fachlichen Kommunikation integriert, das naturgemäss in Deutschland lag, doch habe ich keine Basler Beispiele dafür gefunden, dass dieser enge Bezug die Nazifizierung der deutschen Universitäten und Fachgesellschaften hier besonders lange überdauert hätte. Aber vertiefte Nachforschungen wären dazu nötig, etwa über die Basler Präsenz in deutschen Akademien, Fachvereinen und Herausgebergremien. Die personelle Helvetisierung der Neueren Literaturgeschichte erfolgte mit der Wahl von Walter Muschg. Dieser vertrat aber keinen Heimatstil, im Gegenteil wirkte er als der Helfer der von den Nationalsozialisten verfolgten, weil nicht konzessionsbereiten Dichter des Expressionismus und der Neuen Sachlichkeit. Er befasste sich zwar mit national-helvetischen Autoren wie Jeremias Gotthelf, Gottfried Keller und anderen mehr, stellte diese aber nicht in den Kontext einer vertraut-vaterländischen Kultur, sondern sah in ihnen Rebellen, Vergessene, Missverstandene, Leidende, Menschen ausserhalb der Norm mit Zugang zu tiefen Erfahrungen, ‚echte Dichter‘. Als Zeitgenosse war er ein idealistischer, in manchen Aspekten konservativer Erneuerer mit einer kritischen Haltung gegenüber einer autoritären staatlichen Ordnung; so missbilligte er die politische und wirtschaftliche Angleichung der offiziellen Schweiz an die Diktatur in Deutschland. Tatsache ist aber, dass er von Kuratel, Erziehungsrat und Regierung vor allem deshalb nach Basel gewählt wurde, weil er Schweizer war. Muschgs Vorgänger Franz Zinkernagel bot das Beispiel eines sich in Basel integrierenden Deutschen, der stets deutsche Themen bevorzugte, sich wegen seiner Hölderlinforschung immer wieder in Deutschland aufhielt, aber ein Herz für Verfolgte zeigte und diese
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
407
unterstützte. Mit Hölderlin und Hebbel interessierten auch ihn ‚schwierige‘, ‚tragische‘ Autoren, deren Werk sich auf keine Ideologie reduzieren liess; ähnliches galt von seinen Beziehungen zu Autoren seiner Gegenwart wie Stefan Zweig. In diesem Sinne wies sein Unterricht auf Muschg voraus, wenn er sich auch in wesentlichen Punkten keineswegs mit ihm vergleichen lässt: Muschgs enthusiasmierendes Auftreten als Dozent unterschied sich stark von der auf entsagungsvolle Editionsarbeit ausgerichteten Natur seines Vorgängers. Die Vertreter der ‚Älteren Abteilung‘ lagen anders. Eduard Hoffmann-Krayer habe ich nur gestreift, weil ich über seinen germanistischen Unterricht nichts Inhaltliches erfahren konnte. Aber so viel steht fest, dass er den Nationalsozialismus ablehnte und insbesondere die ideologische Vereinnahmung der Volkskunde beklagte. Volkskunde galt ihm als eine rationale Wissenschaft der ‚Ergologie‘, verankert in einer Wissenschaftsauffassung aus dem 19. Jahrhundert, die mit dem Aufschwung des völkischen Irrationalismus in Widerspruch stand. Andreas Heusler war seit 1920 ein prominentes und einflussreiches Element in der Basler Germanistik. Ob er auch auf eine breitere Gruppe von Studierenden Einfluss ausübte, ist angesichts der geringen Zahl, die er anzog, und seiner Abneigung, Doktoranden zu betreuen, zu bezweifeln. Heusler repräsentierte den im deutschen Kaiserreich sozialisierten, antimodernen Gelehrten, der die ‚Kulturkrise‘ überwinden wollte, indem er den Deutschen neue Bilder vor Augen stellte, nämlich seine Germanen, an denen sie sich stilistisch und moralisch reformieren sollten. Sein wissenschaftliches Ideal war antipositivistisch-künstlerisch, wenn auch durchaus nicht irrational. Durch die Identifikation mit Deutschland situierte er sich in der Schweiz auf dem ‚rechten Flügel‘, stand gegen die Weimarer Verfassung, äusserte sich antisemitisch, antifranzösisch1658 und zeigte öffentlich kaum Einwände gegen die an sich schiefe Rezeption seiner Themen durch die konservativen Revolutionäre, durch ‚Neuheiden‘ und ‚Germanomanen‘, von denen sich einige auch unter den Nationalsozialisten wiederfanden und dafür sorgten, dass er deswegen von regimenahen Gremien offiziell geehrt wurde. Privat allerdings verachtete er die Germanomanie, kritisierte und ironisierte die Vereinnahmung seiner Themen und Thesen in Deutschland nach 1933. Im schweizerischen politischen Koordinatensystem gab er seit 1920 ein Beispiel für die Germanophilie, die eine Revision der Versailler Verträge zugunsten Deutschlands forderte und zunächst (und bei Heusler bis 1938) die Nationalsozialisten an deren aussenpolitischen Erfolgen und der Abwehr der ‚bolschewistischen Gefahr‘ mass – und deshalb schätzte. Die Herrschaftsmethoden der Nationalsozialisten wurden in diesen Kreisen verharmlost, ignoriert oder – wie bei Heusler explizit – ‚heroisch‘ als vorübergehende Notwendigkeit legitimiert. In diesem Sinne hatte Heuslers Position Gemeinsamkeiten mit derjenigen von Auslandschweizern wie dem Roma1658
Vgl. das Gedicht «Sabotons» vom Frühjahr 1932, abgedruckt in: Zinkernagel 2020, 2005– 2007.
408
Geisteswissenschaftler
nisten Walther von Wartburg, der bis 1938 mit Überzeugung in Deutschland wirkte, oder mit Schweizern wie Hektor Ammann, die von der Schweiz aus für Verständnis für das nationalsozialistische ‚Dritte Reich‘ warben und an dessen Forschungsbetrieb partizipierten. Heusler hatte jedoch eine kritische Haltung gegenüber den inneren Zuständen in Deutschland, die ihn nach 1938 in seiner Korrespondenz dazu motivierte, sich von den «Rechtgläubigen» (überzeugten Nationalsozialisten) zu distanzieren. Zinkernagels Ansicht, Heusler sei politisch naiv gewesen, traf nicht das Wesen seiner Haltung und nicht die Schärfe seiner Wahrnehmung. Heusler wie mehr noch Friedrich Ranke, Hoffmann-Krayers Nachfolger als Basler Altgermanist, waren im Kern ihres fachlichen Programms rationale Wissenschaftler, die sich kritisch zur Mythenbildung stellten und ‚zunftmässig‘ korrektes Arbeiten im Fach einfordern. Dieser Teil ihrer Agenda koexistierte mit dem pädagogisch-nationalen Programm der ‚Erneuerung des Deutschtums‘. Die Suche nach dem Echt-Germanischen und die Propagierung eines Klassikerstatus für altnordische Texte bildeten die Zone, in der sich Ideologie und ‚reine Wissenschaft‘ berührten. Friedrich Ranke erscheint in diesem Licht nicht als das Opfer des Nationalsozialismus, das in die Schweiz gerettet wurde, sondern als überzeugter konservativer deutscher Patriot, der zwar gute Wissenschaft gegen ideologiegeleitete Stümperei verteidigte, sich an der Hitlerverehrung nicht beteilige, aber keinen offenen oppositionellen Ansatz gegen das Nazitum zeigte. Umgekehrt schätzten die ‚gemässigten‘ Nationalsozialisten seine vaterländische Pädagogik. Allein aufgrund des kontingenten Umstands, dass seine Ehefrau nach nationalsozialistischen Kriterien ‚halbjüdisch‘ war, verlor er seine Professur in Breslau. Der idealistische, heroische Patriotismus, den Ranke in Breslau gelehrt hatte, war nicht nationalsozialistisch, weil ihm Führerverehrung, Rassismus, Antisemitismus und eine Gegnerschaft zur liberal-rationalen Wissenschaftsvorstellung abging. Er passte aber in seinem Fall als Erziehungsprogramm auf die Bedürfnisse einer in den Nationalsozialismus eingebundenen Studentenschaft und einer Universität an der Grenze des ‚Deutschtums‘. In Basel angekommen, verzichtete Ranke darauf, dieses Programm öffentlich weiterzuverfolgen, und fügte sich als Universitätslehrer in die Basler Verhältnisse ein. Dies galt schliesslich auch für seine Forschungen: Nachdem er nicht mehr zu den Aufbewahrungsorten von Tristan-Handschriften reisen konnte, vertiefte er sich in das Mysterienspiel (Osterspiel) von Muri, während er mit der Sagenforschung aufgrund ihres rationalen Kerns einen Beitrag zur Volkskunde in Basel leistete. In der sichtbaren Basler Abwehrfront gegen den Nationalsozialismus finden wir somit unter den Germanisten den Basler Hoffmann-Krayer, den Süddeutschen Zinkernagel, der sich um das Riehener Bürgerrecht bewarb, und den Zürcher Muschg. Die Voraussetzungen ihrer Abwehr waren sehr verschieden, und keiner bekämpfte die Ideologie der Hitlerdiktatur mit wissenschaftlich ausgearbeiteter Analyse. Heusler gehörte dagegen in den germanophilen Kontext der
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
409
Gegner der Völkerbundes, der Feinde der «Welschen» (gegen Franzosen, Italiener und Westschweizer), zu den Lesern der «Neuen Basler Zeitung» und der politischen Analysen in den «Schweizer Monatsheften». 7.2.4 Romanisten 7.2.4.1 Einleitung Der bis 1939 aktive Inhaber der Basler Professur für Romanische Philologie Ernst Tappolet war sprachwissenschaftlich ausgerichtet. Der Zürcher Pfarrerssohn hatte in Marburg, Paris und Florenz studiert, absolvierte 1895 das Doktorat bei Heinrich Morf in Zürich und habilitierte sich 1902 an derselben Hochschule. Von 1895 bis 1904 unterrichtete er Französisch am Zürcher Gymnasium. 1905 wurde er nach Basel auf das romanistische Ordinariat berufen.1659 Er forschte über die Dialekte der französischen Schweiz und gründete mit Louis Gauchat und Jules Jeanjaquet 1899 das Glossaire des Patois de la Suisse romande. Im Zentrum von Tappolets Lehre stand neben der Dialektologie die Wortfeldforschung. Er war auch Methodiklehrer für die angehenden Lehrer für neue Sprachen1660 und Gründer der Romanistenvereinigung Gay Saber.1661 In der Sondierung zu Walther von Wartburg, der Tappolets Nachfolge antrat, werden wir sehen, dass Tappolet nicht nur diese Nachfolgeregelung vorbereitet hatte, sondern in ihm auch einen aufrechten Schweizer Patrioten erkannte. Als solchen betrachtete sich offensichtlich Tappolet selbst.1662 Von 1931 bis 1936 vertrat der Genfer Marcel Raymond in Basel die französische Literatur. Raymond erhielt dafür eine neu geschaffene Professur. Seine Wahl entsprach dem Basler Bedürfnis, der französischen Gegenwartsliteratur unmittelbar zu begegnen, vermittelt durch einen Dozenten französischer Muttersprache, der in dieser Literatur lebte. Franzosen waren wegen der Verschiedenheit der Universitätssysteme für Basel nicht zu gewinnen. Was mir an der Geschichte des Faches in Basel wesentlich erscheint, werde ich an Albert Béguin aufzeigen, der 1936, ebenfalls aus Genf kommend, Raymonds Nachfolge antrat. Für die Franzö1659 1660
1661
1662
Akten zu Tappolet in: StABS Erziehung CC 18 Philosophische Fakultät, Professur (Romanisch) 1839–1939. Nachfolger wurde Ernst Merian-Genast, Lehrer am Mädchengymnasium und Extraordinarius für Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität. Ernst Merian-Genast an ED, 22. 10. 1938 (Beförderung zum Extraordinarius), und ED an Regierungsrat, 13. 3. 1939 (Antrag für Remuneration), in: StABS Erziehung CC 28c Philosophisch-Historische Fakultät, einzelne Dozenten 1938–1953/54, Hubler 2019; Fryba 2013; Zur Erinnerung 1940; Ernst Tappolet 1940. «Ein verdienter Gelehrter wird gefeiert», Ausriss aus: Basler Nachrichten vom 3. 12. 1935, in: StABS Erziehung CC 18, Professur [Romanisch]). Siehe den Abschnitt über Walther von Wartburg, Kapitel 7.2.4.5, unten.
410
Geisteswissenschaftler
sische Sprachwissenschaft werde ich mich ausführlicher mit Walther von Wartburg beschäftigen. Er gab ein interessantes Beispiel für einen Auslandschweizer in Deutschland ab, der bei letzter Gelegenheit in die Schweiz zurückkehrte und hier freundlich aufgenommen wurde. Vergleichende Literaturwissenschaft resp. die Geschichte der literarischen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich unterrichtete von 1936 bis 1958 mit einem Lehrauftrag der aus Erfurt stammende Ernst Merian-Genast, Gymnasiallehrer und Goethe-Spezialist, der deswegen auch zu den Germanisten gerechnet werden könnte. Merian-Genast verstand sein Fach als Beitrag zur Völkerverständigung. Lektor für Französisch war bis Herbst 1942 Paul Roches, Französischlehrer am Mädchengymnasium,1663 und danach bis 1948 Juliette Ernst, ebenfalls (seit 1940) Lehrerin am Mädchengymnasium, bekannt als Redaktorin der internationalen Bibliographie der Altertumswissenschaften «L’Année philologique».1664 Ich behandle zuerst kursorisch die Vertretung des Italienischen und Spanischen, die in Basel anfänglich ein Randdasein fristeten. Danach wende ich mich ausführlicher der Französischen Literatur- und Sprachwissenschaft zu, die für das Thema ‚Universität Basel und Deutschland‘ aufschlussreiche Einsichten ermöglicht. 7.2.4.2 Die Vertretung des Italienischen: Arminio Janner, ein Tessiner Patriot Ernst Tappolet, der Ordinarius für Romanische Philologie, der vor allem Französisch lehrte, plädierte schon während des Ersten Weltkriegs dafür, in Basel eine Professur für Italienisch einzurichten. Dafür schien ihm Arminio Janner1665 geeignet, ein Walser aus Bosco Gurin. Janner hatte zwar Mathematik und Philosophie studiert (Doktorat im damals deutschen Strassburg 1912), was Basel aber nicht daran hinderte, ihn ab 1916 teilzeitlich als Italienischlektor zu beschäftigen, nachdem er 1915 wegen Differenzen mit der Leitung des Lehrerseminars in Locarno gekündigt hatte und verfügbar war.1666 Allerdings dauerte es bis 1931, bis Janner ein Extraordinariat mit besoldetem Lehrauftrag erhielt.1667 Als in Basel während 1663 1664 1665 1666
1667
Basler Stadtbuch, Chronik zum Juli 1957. Hilbold 2022, 192. https://de.wikipedia.org/wiki/Juliette_Ernst. Codiroli 2006. «Arminio Janner 1886–1949» 1950. Von Wartburg 1950, 3–9. StABS Erziehung CC 18d, Lektorat für Italienisch 1912–1936, hier auch Lebenslauf bis 1916. Schon 1916 wurde das Lektorat als Hauptaufgabe, der Unterricht an der Handelsschule als Ergänzung für die Komplettierung des Einkommens betrachtet. Bonjour 1960, 677. Bonjour legt Wert auf die Feststellung, dass dies «auf Betreiben» der Neuen Helvetischen Gesellschaft geschah – vermutlich hielt er diese Beförderung für einen politisch motivierten Entscheid. Janner gehörte schon zur Zeit des Ersten Weltkriegs
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
411
des Ersten Weltkriegs ein Extraordinariat für Italienisch geschaffen wurde, kam 1917/18 nicht Janner, sondern Ernst Walser zum Zug, der seit 1912 in Zürich habilitiert war. Er spezialisierte sich auf Humanismus und Renaissance. Erst als er 1929 unerwartet verstarb, stellte sich die Frage, was mit Arminio Janner geschehen solle. Die Etablierung als Extraordinarius verdankte er der Beharrlichkeit der Kuratel. Denn der Erziehungsrat leistete 1931 Widerstand gegen Janners Ernennung zum Professor für Italienisch mit der Begründung, ihm fehlten die akademischen Voraussetzungen: Janner hatte sich nie habilitiert; die Beförderung eines Lektors zum Extraordinarius war unüblich. Die Fakultät hatte Reto Bezzola aus Zürich auf den ersten Listenplatz gesetzt und sich auch deshalb mehrheitlich gegen Janner ausgesprochen, weil sie eine spätere Beförderung vom Extraordinarius zum ordentlichen Professor verhindern wollte. Opposition meldete auch Kurt Latte in der Sachverständigenkommission an. Er meinte, Janner sei bloss ein «gebildeter Italiener», der nicht mehr wisse, als in guten Tageszeitungen zu lesen sei; Bezzola sei ihm wissenschaftlich weit überlegen. Aber die Kuratel hielt an Janner fest, weil Bezzola als unattraktiver Dozent galt.1668 Nachdem sich die Kuratel durchgesetzt hatte und Janner gewählt war, gab ihm der Dekan bei seiner Einführung als Extraordinarius deutlich zu verstehen, dass die Fakultät seine Wahl nicht billige.1669 Neben dem Extraordinariat arbeitete er 1936 immer noch als Lehrer an der Handelsschule. Nun erst wurden die Stunden an der Handelsschule abgebaut und die Lehrverpflichtung an der Universität auf zehn Wochenstunden erhöht. Als Dante-Spezialist und Renaissance-Kenner (mehrere Aufsätze und sein letztes Werk galten Jacob Burckhardt) profilierte er sich in der Forschung, zudem äusserte er sich als Literaturkritiker zu neuen Werken der italienischen und der Tessiner Literatur. Besonders interessierten ihn Luigi Pirandello und Francesco Chiesa; Letzteren bekämpfte er politisch als Repräsentanten des faschistischen Italien.1670
1668
1669 1670
dem Zentralausschuss der Neuen Helvetischen Gesellschaft an. Rüegg erklärt selbst, dass er die Schaffung der Professur für Janner betrieben habe. Rüegg 1950, 17–20. StABS Protokoll T 2, Kuratel Bd. 12, 1930–1935, 86 resp. 113, 28.5./9. 7. 1931. Dossier zu den Nebengeräuschen bei Janners Professoralisierung, in: StABS UA XI 3, 3 Arminio Janner, 1930–1949. Der Widerstand kam von der Fakultät, die den Umfang des Lehrauftrags thematisch und stundenmässig klein halten wollte und statt des Extraordinariats eine Kombination aus vierstündigem Lektorat mit vierstündigem Lehrauftrag wünschte. Vgl. auch StABS ED-REG 1a 1 697 Prof. Dr. Arminio Janner, Lehrauftrag für Italienisch, Lektor für Italienisch, 1915–1949. Kuratel an ED, 4. 12. 1931, beklagte den «sterilen» Widerstand und die «ermüdende Streiterei» der Fakultät, in: StABS ED-REG 1a 1 697 Prof. Dr. Arminio Janner. Codiroli 1992, 51. StABS Protokoll T 2, Kuratel Bd. 13, 68, 1935–1941, 4. 5. 1936. StABS UA XI 3. 3.
412
Geisteswissenschaftler
Nach dem Krieg fand Walther von Wartburg anerkennende Worte für Janners Antifaschismus: «Während wir andern uns meist für unsere Person begnügten, diese unsere Zeit verpestenden Erscheinungen abzulehnen und im Übrigen still unseren Studien nachhingen, nahm es Janner auf sich, seine warnende Stimme zu erheben. Darum ging von ihm ein Strom der Reinigung aus, der nie versiegte.»1671 Bei der Gründung der Ortsgruppe Basel der Schweizerischen Gesellschaft zur Pflege der kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Italien gehörte Janner 1940 zum Vorstand.1672 Kulturpolitisch war er seit den 1920er Jahren aktiv, um die Position der ‚Helvetisten‘ im Tessin zu vertreten, die eine zu enge Anlehnung an Italien und die ‚Luganeser Gruppe‘ um den Italiener Giovan Battista Angioletti kritisierten. Janner fürchtete den italienischen Einfluss der ‚Irridenta‘, die die italienischsprachigen Teile der Schweiz an Italien anschliessen wollte, auch wenn er Angioletti als Schriftsteller schätzte und mit ihm korrespondierte.1673 Zur Abwehr dieser Tendenz, die auch Benito Mussolini von Zeit zu Zeit vertrat, redigierte Janner zusammen mit Guido Calgari (der als Herausgeber firmierte) eine von Pro Helvetia finanzierte kulturelle Zeitschrift, in der er für ein eidgenössisches, freisinniges, in die ‚geistige Landesverteidigung‘ einbezogenes Tessin eintrat: «Svizzera italiana».1674 Im faschistischen Italien war diese Zeitschrift verboten, und Calgari wie Janner durften nicht nach Italien einreisen.1675 Als Janner 1942 in der «Svizzera italiana» den Artikel «Ragioni di fede nell’ideale elvetico» veröffentlichte, protestierte der italienische Botschafter beim Bundesrat.1676 Zu Deutschland äusserte sich Janner (angesichts der Zensur) 1942 in dieser Zeitschrift etwas verschlüsselt. Er deutete an, dass England und Russland kaum zu überwindende Gegner seien. Er zweifelte an der Möglichkeit, dass Deutschland im Falle eines Sieges friedlich über Europa werde herrschen können, denn den Invasoren begegne ebenso wie den Kollaborateuren dauernder Hass. Offen erwähnte er auch die «Ausrottung» der Juden innerhalb des ‚Reichs‘ und fragte sich rhetorisch, ob Deutschland in Polen alle Polen, in Tschechien alle Tschechen, in Russland die Russen vernichten wolle. Was die Schweiz betraf, so gab er zu verstehen, dass die wirtschaftliche Kooperation mit Deutschland hier die bürgerlichen Freiheiten gefährden könnte. Bei aller relativen Vorsicht waren dies deutliche Worte.1677
1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677
Von Wartburg 1950, 8. «Jahresberichte» 1941–1991, in: StABS PA 1046a, D1 Schweizerische Gesellschaft zur Pflege der kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Italien, Ortsgruppe Basel. Codiroli 1992, 87–90. Calgari («La Redazione») 1941. Stäuble 2007, 476–484, hier 480; Romanisches Seminar 2020, Artikel «Italianità» und «Svizzera italiana (1941–1962)»; Codiroli 1992. Codiroli 1992, 80; Janner 1942, 333–361. Janner 1942, 355 f.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
413
Ebenso deutlich wurde in diesem Aufsatz Janners Bild von der deutschen Geschichte: Für ihn war Deutschland an sich ein Hort der Humanität, des Liberalismus, der Toleranz, ja der Brüderlichkeit. Für die deutsche Abneigung gegen England zeigte er Verständnis, denn die britische Kolonialherrschaft sei nur dadurch ‚gerechtfertigt‘, dass sie mit dem Erwerb von Kolonien früher als Deutschland hatte beginnen können. ‚Versailles‘ hielt Janner für einen Fehler: Mit der Erniedrigung Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg schufen die Sieger von 1918 eine Voraussetzung für den Aufstieg der Nationalsozialisten.1678 Dies entsprach offensichtlich den Wahrnehmungen eines Schweizers, der vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland studiert und das Gastland in dieser Zeit geschätzt hatte. Dass er den Nationalsozialismus aus seinen Vorbedingungen erklärte, implizierte jedoch keineswegs, dass er dafür auch Verständnis hatte. Den ‚helvetischen Geist‘ hielt Janner für ein Vorbild in Europa; die Bejahung des Kleinstaates verband ihn mit Fritz Ernst und Werner Kaegi, mit dem er sich duzte.1679 Janner hielt den Vertreter der Französischen Literaturgeschichte Albert Béguin zunächst für einen guten Dozenten. Er pflegte mit ihm in den 1930er Jahren einen engen Kontakt, der sich auf die gemeinsame Wertschätzung der Romantik bezog – schon mit Béguins Vorgänger Marcel Raymond hatte er sich angefreundet.1680 Als sich aber Béguin entschied, Basel nach Kriegsende den Rücken zu kehren, sah er darin einen Verrat an der Universität und vor allem am «esprit suisse». In den von Béguin redigierten «Cahiers du Rhône» fand Janner wenig ‚Schweizerisches‘. Fortan hielt er Béguin für einen französischen «Chauvinisten»; er schätzte wohl auch Béguins Übertritt zum Katholizismus nicht.1681 Mit dem Vorwurf, Béguin habe anfangs an Hitler geglaubt, überschritt er eine Grenze.1682 Janners vehemente Polemik traf sonst Ziele wie die Germanomanie in den Opern Richard Wagners, die Renaissance-Darstellung bei C. F. Meyer, den russischen Patriotismus, D’Annunzio, Léon Bloy und die Nationalsozialisten, wie August Rüegg in seinem Nachruf festhielt. «Den Hitlergeist erkannte und denunzierte er als einer der ersten in seiner Wagnerhaften Irrlichterei als eine Gefahr für Europa.»1683
1678 1679
1680 1681 1682 1683
Janner 1942, 358, 360. Bsp. Fritz Ernst an Werner Kaegi, 12. 9. 1938, in: Nachlass Werner Kaegi, WK 190. Janner korrespondierte in den 1930er Jahren oft mit Kaegi, während dieser ihm seinen Michelet und Deutschland schickte. Raymond 1970, 110. Von Wartburg 1950, 3–9, schildert Janners Weg vom Katholizismus zum Atheismus und zu einem nichtkirchlichen Christentum. Benninger 2001, 43, 77, 90. Die Reaktionen von Béguin in: Archives Albert Béguin, La Chaux-de-Fonds, AB/102/2157 f. (ältere Signatur 145), 19. 1. 1945, 21./22. 1. 1945. Rüegg 1949.
414
Geisteswissenschaftler
7.2.4.3 Spanisch: Lektorate, Ehrendozentur und ein Versuch, einen Franco-Gegner nach Basel zu holen Randständiger als das Italienische war an der Universität Basel das Spanische. Es war durch ein Lektorat vertreten, das Paul («Pablo») Merian 1925 bis 1938 versah.1684 Der Plan, in Basel während des spanischen Bürgerkriegs einen Franco-Gegner anzustellen, wurde nicht realisiert. Ernst Tappolet bemühte sich 1937 darum, den Historiker Américo Castro y Quesada für einen Lehrauftrag zu gewinnen. Castro war Professor in Madrid gewesen, 1931/32 Botschafter des republikanischen Spanien in Berlin und bis zum Bürgerkrieg 1936 wieder in Madrid, danach vorübergehend in Zürich, wo sein Sohn an der ETH studierte. Der im Basler Exil lebende deutsche Kunsthistoriker Werner Weisbach lud ihn zu sich ein und versprach, sich bei der Universität, offenbar über Tappolet, für ihn zu verwenden.1685 Tappolets Versuch scheiterte, als Castro einen Ruf nach Buenos Aires erhielt, wo man ihm anscheinend weiter entgegenkam als in Basel.1686 Schliesslich ging er jedoch in die Vereinigten Staaten ins Exil, wo er von 1940 bis 1953 in Princeton Literaturgeschichte lehrte.1687 Tappolets Vorschlag gelangte über die Kuratel1688 bis zum Erziehungsrat, der grundsätzlich damit einverstanden war, Castro einen Lehrauftrag für «Spanische Philologie» zu erteilen. Nur Regierungsrat Im Hof hatte Bedenken, man könne sich «derartige ausserordentliche Sachen» nicht leisten, während sich Regierungsrat Fritz Hauser und das sozialistische Ratsmitglied Carl Miville für den Franco-Gegner einsetzten.1689 August Rüegg, Mitglied der Kuratel, katholischer Bildungspolitiker und Mittelschullehrer, wurde 1943 Ehrendozent für Spanische und portugiesische Literatur, 1945 Extraordinarius mit einem Lehrauftrag für Südromanische Literaturen. Das Lehrangebot wurde nach Kriegsende ergänzt durch ein Lektorat für Joaquín González Muela, der in Madrid doktoriert hatte und später am Bryn Mawr College eine Professur für spanische Literatur bekleidete.1690
1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690
StABS Erziehung CC 18 f. Lektorat für Spanisch, Paul Merian. Weisbach 1956, 408. StABS UA R 3a, Protokoll der Philosophisch-Historischen Fakultät 1930–1948, 169, 28. 5. 1937. Armistead 1997. Befürwortendes Votum der Kuratel auf Antrag von August Rüegg, in: StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 13, 1935–1941, 160, 25. 2. 1937; 175, 1. 4. 1937. StABS Protokoll S 4 Erziehungsrat Bd. 24, 1936–1938, 26. 4. 1937. https://es.wikipedia.org/wiki/Joaquín_González_Muela.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
415
7.2.4.4 Albert Béguin – der Frankophile unter den Basler Professoren1691 7.2.4.4.1 Einleitung Der Literaturkritiker und Romanist Albert Béguin war einer der Basler Professoren, die konsequent gegen das nationalsozialistisch beherrschte Deutschland aktiv waren. Ihn als frankophil zu bezeichnen, mag für einen Romanisten trivial erscheinen, aber deutsche Beispiele von Romanisten und insbesondere der Fall des Schweizer Fachvertreters Walther von Wartburg zeigen, dass unter Romanisten im deutschen Sprachraum eine antifranzösische Haltung durchaus geläufig war – mindestens vertraten sie den Standpunkt, dass Romanistik aus einer deutschen Perspektive zu betreiben sei.1692 Albert Béguin war als Sohn eines Apothekers in La Chaux-de-Fonds aufgewachsen. Nach einer ausgeprägt laïzistischen1693 Erziehung wurde er zuerst zu einem Sympathisanten der sozialistischen und syndikalistischen Neuenburger Uhrenarbeiter. Als Linker begann er sein Studium 1919 in Genf.1694 Von dieser Orientierung wandte er sich ab in der Begegnung mit der aktuellen französischen Literatur und in den Diskussionen der Studentenvereinigung Société de Belles-Lettres. Diese Begegnung setzte sich in den Jahren fort, die er nach der Genfer Licence 1924 in Paris als Buch- und Antiquitätenhändler verbrachte. Sein Freund Marcel Raymond, der von 1926 bis 1929 Französischlektor in Leipzig gewesen war, legte ihm nahe, sich der Wissenschaft zu widmen. Dazu trat er 1929 die Stelle eines Lektors für Französisch an der Universität Halle an der Saale an.1695 Diese an deutschen Universitäten verbreitete Einrichtung sollte den Ordinarius des Faches entlasten, den deutschen Studenten Gelegenheit zu einer erweiterten Kenntnis Frankreichs geben und den Lektor selbst mit deutschen Verhältnissen vertraut und ihn eventuell zu einem Freund Deutschlands machen.1696 In Halle hatte Béguin bis zum Frühjahr 19341697 über neuere und aktuelle Literatur zu unterrichten, während der Lehrstuhlinhaber Karl Voretzsch1698 sich vor allem für ältere französische Literatur interessierte. Obschon Voretzsch jung-
1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698
Ich danke Joseph Jurt für eine ausführliche und hilfreiche Kommentierung. Hausmann 2000. Vgl. unten, Kapitel 7.2.4.5. Benninger 2001, 4. Grotzer 1977, 16–20. Albert Béguin und seine Frau Raymonde Vincent wohnten seit dem 29. 9. 1929 in Halle bei Peter Liebert. Benninger 2001, 9; Grotzer 1977, 43. Hausmann 2000, 152. Hausmann 2000, 153. Die oft kolportierte Nachricht, er sei 1934 aus Deutschland ‚vertrieben‘ worden, ist falsch; er verliess das Land aus freien Stücken. Grotzer 1977, 46 ff. http://www.catalogus-professorum-halensis.de/voretzschkarl.html. Voretzsch war Antisemit und lehnte als deutscher Nationalist das Frankreich der Moderne ab. Hausmann 2000, 12.
416
Geisteswissenschaftler
konservativen Ideen anhing und schliesslich den Nationalsozialismus begrüsste, schätzte er am andersdenkenden Béguin die Mischung aus klarem Positionsbezug bei gleichzeitiger Zurückhaltung und echter Suche nach einer inneren Wahrheit.1699 Aufgrund eigener Anschauung wurde Béguin in Halle zu einem überzeugten Gegner des Nationalsozialismus. Neben dem Lektorat schrieb Béguin an seiner Thèse: L’âme romantique et le rêve: essai sur le romantisme allemand et la poésie française. Darin unterstrich er die Bedeutung des rational nicht unmittelbar Fassbaren wie Träume und Visionen im schöpferischen Akt der Dichtung und des Romanschreibens.1700 Nach dem Aufenthalt in Deutschland trat Béguin eine Gymnasiallehrerstelle in Genf an. Neben dem Unterricht beendete er seine Thèse, die er Ende 1936 an der Universität Genf einreichte und im Februar 1937 vor einer Jury verteidigte, in der neben dem sozialdemokratischen Dekan André Oltramare die Professoren Bernard Bouvier, Gottfried Bohnenblust und sein Freund Marcel Raymond sassen.1701 Damit war er für eine Professur wählbar, denn das Genfer Doktorat galt als gleichwertig mit einer deutschen Habilitation. Nachdem er im selben Jahr als Nachfolger Raymonds auf die Basler Professur für Französische Literatur gewählt worden war, verbrachte Albert Béguin die Sommermonate im Berry, der Heimat seiner Frau Raymonde Vincent (Romanautorin),1702 wo das Paar in der Nähe von Saint-Maur ein Herrschaftshaus (Château de Laleuf) bewohnte. Der deutsche Überfall auf Frankreich bewegte ihn zutiefst. Frankreich war für ihn diejenige Nation, die eine Mission zur Erneuerung Europas zu erfüllen hatte, moralisch und kulturell, während er Deutschland als eine «kranke» Nation betrachtete. Vor Mai 1940 hatte er nicht daran gezweifelt, dass Frankreich einen Krieg gegen Deutschland gewinnen werde. Er fühlte sich denjenigen Schriftstellern verbunden, die, teils in der Nachfolge von Charles Péguy, aus persönlichem Leiden heraus mit bürgerlichen Werten des 19. Jahrhunderts gebrochen hatten, ohne auf Dauer bei der Linken unterzukommen. Sie suchten jenseits der ‚Dritten Republik‘ und ihres offiziellen Kultur- und Universitätsbetriebs als katholische Schriftsteller und Intellektuelle1703 etwas Wahrhaftiges, unmittelbar Menschliches und Transzendentes. Damit verband Albert Béguin einen französischen Patriotismus, der auf Land und Leute (vor allem in der Provinz) und deren katholischen Glauben abstellte. Die Ausrichtung auf die Person1704 und deren Erfahrungen, die Suche nach einem ‚dritten Weg‘ zwischen 1699 1700 1701
1702 1703 1704
Voretzsch an Tappolet, 31. 10. 1936, in: StABS ED-REG 1a 1 83. Calin 2007, 58 ff. Benninger 2001, 31. Spätestens seit 1931 bestand eine herzliche Beziehung zwischen dem Genfer Germanisten Bohnenblust und Béguin. Archives Albert Béguin AB 102–103, Korrespondenz ab 8. 5. 1931. Vincent 1982. Serry 2004. Der «Personnalisme», wie ihn Emmanuel Mounier vertrat, wollte die Fixierung des Individuums auf das eigene Ego überwinden und den Menschen im sozialen Kontext der Ge-
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
417
liberalem Individualismus und sozialistischem Kollektivismus sowie eine Sympathie für die Lage der einfachen Leute aus der Perspektive einer linkskatholischen Sozialpolitik verhinderten jede Annäherung an faschistische Positionen.1705 Seit Kriegsbeginn, aber mehr noch nach der Niederlage von 1940 war Béguin entschlossen, sich aktiv für die französische Nation einsetzen. Dazu wollte er in der Schweiz dafür sorgen, dass die Freunde Frankreichs fest mit einem Wiederaufleben des französischen Geistes nach dem Krieg rechneten. Seit 1940 war diese Mission auch in seinem Unterricht an der Universität Basel spürbar.1706 Béguin war bestrebt, französischen Autoren, insbesondere Katholiken, die sich gegen das nationalsozialistische Deutschland wandten und wegen des VichyRegimes und der deutschen Besatzung nicht frei publizieren konnten oder gar in deutscher Gefangenschaft lebten,1707 ein Forum zu bieten. Eine neue Zeitschrift und Serie sollten «Esprit» und «Les Temps nouveaux» ersetzen, nachdem deren Publikation verboten worden war. Emmanuel Mounier1708 hatte für «Esprit» in Vichy-Frankreich noch bis August 1941 Publikationserlaubnis, danach ging er in den Untergrund.1709 So gründete Béguin 1942 mit dem Neuenburger Verleger Hermann Hauser (Verlag «La Baconnière») die «Cahiers du Rhône». Da verschiedene der in den «Cahiers» publizierenden Schriftsteller und Dichter in der Résistance aktiv waren, hatte die Zeitschrift eine verdeckt politische Bedeutung, ohne eine eigentliche Untergrundzeitschrift zu sein.1710 Mit den «Cahiers» zeigte Béguin auch, dass er die Neutralität der offiziellen Schweiz nicht billigte: keine Politik ohne Moral. Zugleich unterstützte er indirekt die Résistance im Berry. Béguin und seine Frau liessen zu, dass ihr Haus im Sommer 1941 von den Compa-
1705 1706 1707
1708
1709
1710
meinschaft sehen. Der Gegensatz «individu»/«personne» stammt aus Charles Péguys Werken. Mounier 1949. Loubet del Bayle 2001. Grotzer 1977, 62–64. Cahiers du Rhône, Série bleue, Cahier no. VII: «Cahier des prisonniers», 1943. Die Idee des «Prisonniers»-Heftes stammte von Béguin. Die Europäische Studentenhilfe in Genf vermittelte die Kontakte zu den Schriftstellern und Dichtern in den Kriegsgefangenenlagern in Deutschland. Europäische Studentenhilfe, Generalsekretär André de Blonay, an Béguin, 21. 5. 1942, in: Archives AB 102-2530-1 ex G 55/4. Umfangreiche Vorarbeiten in: Archives AB, G55. Béguin kannte Emmanuel Mounier spätestens seit Ende 1933. Benninger 2001, 12 f. Die Zeitschrift «Esprit» war im Herbst 1932 entstanden. Béguins Freund Marcel Raymond kannte den Gründer Mounier ebenfalls persönlich und arbeitete selbst an der Zeitschrift mit. Raymond 1970, 101. Grotzer 1977, 70 f. Mounier hoffte wie viele andere, dass das Regime von Maréchal Pétain 1940/41 Einflussmöglichkeiten für seine Philosophie des «Personnalisme» biete. Deshalb liess er die Zeitschrift «Esprit» nach der Niederlage bis zu deren Verbot wieder aufleben und wirkte vorübergehend als Berater für die Organisation Jeune France sowie die Kaderschule von Uriage. Kessler 2001, 443 ff.; Bergès 1997, 63 ff.; Comte 1985. Benninger 2001, 65 f.
418
Geisteswissenschaftler
gnons de France genutzt wurde, was damit zusammenhing, dass bei den Compagnons Anhänger von Mouniers «Personnalisme» aktiv waren.1711 Das Ehepaar Béguin galt bei überzeugten Vichy-Anhängern als Sozialisten und Judenfreunde.1712 Während des Krieges begab sich Béguin wiederholt nach Lyon und ins Berry, traf sich mit katholischen Schriftstellern aus dem Widerstand und gewann Informationen über deren Lage sowie das Schicksal der Verlage. Unmittelbar nach der Befreiung bereiste er Savoyen und schrieb Texte über das Massaker von Vercors. Nach Kriegsende beteiligte sich Béguin persönlich an der nationalen Erneuerung Frankreichs, indem er 1946 seinen Basler Lehrstuhl verliess und unter schwierigen Bedingungen als freier Literaturkritiker in Paris lebte. 1951 übernahm er dort die Leitung der Zeitschrift «Esprit» als Nachfolger des 1950 verstorbenen Emmanuel Mounier. 7.2.4.4.2 Béguin und Deutschland Béguins Motive für den Widerstand gegen den Nationalsozialismus und die Vichy-Ideologie lagen in seinem persönlichen Verhältnis zu Deutschland, in seinem Erleben als französischsprachiger Schweizer in Halle und in der schrittweisen Entwicklung seiner Spiritualität. Im Studium in Genf und in der Zeit, die er anschliessend in Paris verbrachte, lernte er die universitäre Literaturwissenschaft kennen und kritisieren, die seit Ende des 19. Jahrhunderts das staatliche französische Hochschulsystem beherrschte. Sie hatte die als vorbildlich geltenden Ansätze deutscher wissenschaftlicher Philologie rezipiert und fügte sich in ein Programm der Disziplinierung des französischen Geistes durch methodische Strenge, Verzicht auf rhetorische Ausschmückung, Betonung der Rationalität, Nachprüfbarkeit und intersubjektiven Mitteilbarkeit in einer sachbezogenen, kritischen (im methodischen Sinne) Vorgehensweise ein, symbolisiert durch den Zettelkasten und gelehrte Artikel mit zahlreichen Nachweisen.1713 Stets hatten sich Literatur1711
1712
1713
Die Compagnons de France wurden damals vom Vichy-Régime finanziert, doch begannen sich 1941 einige Mitglieder im Verborgenen der Résistance zuzuwenden. Nord 2012; Kessler 2001, 437. Grotzer 1977, 69 f., 77. Béguins Verhältnis zum Vichy-Régime gestaltete sich differenziert. Im Sommer 1940 erwog er noch in der Diskussion mit Hans Urs von Balthasar, dass Vichy ein «schlechter Baum» sein könnte, der «gute Früchte tragen» würde. Raymonde Vincent, so berichtete Béguin, hielt die anfängliche Politik des Regimes für eine begrüssenswerte Rückkehr zu den Wurzeln des katholischen Frankreich. Béguin war verhalten positiv: «On ne peut rien en dire avant de voir les conséquences de cette politique; mais il n’est pas exclu qu’en dépit de tout elle aboutisse à une vraie renaissance profonde de la France.» Béguin an von Balthasar, 13. 7. 1940, in: Archives AB 102-40-5. Das Gleichnis vom Baum führte von Balthasar in seiner Antwort an Béguin vom 18. 7. 1940 an, ebd. Emmanuel Mounier dachte ähnlich. Comte 1985. Weisz 1983.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
419
schaffende und Literaturkritiker gegen diese Nouvelle Sorbonne abgesetzt1714 und ausserhalb der Universität eine kulturelle Gegenwelt gebildet, in der die ästhetische Innovation gepflegt wurde. Eine Möglichkeit zu akademischer Beschäftigung mit dieser Welt bestand angesichts der institutionellen Geschlossenheit des französischen Universitätssystems vor allem an frankophonen Universitäten ausserhalb des Landes, so namentlich in Genf.1715 Béguin lernte in der studentischen Diskussionsgruppe Belles-Lettres1716 und dann erst recht in Paris die neuen, auf die Jahrhundertwende zurückgehenden Strömungen der französischen Literatur schätzen. Einem Ansatz, mit dem ihre Unmittelbarkeit und Tiefe erfasst werden konnten, begegnete er in deutscher Literatur. Die Lektüre von Schriften aus der deutschen Romantik war für ihn ein Schlüsselerlebnis: Jean Paul, E. T. A. Hoffmann und Eduard Mörike. Besonders beeindruckten ihn die Träume in den Schriften von Jean Paul, die deutschen Autoren schon seit etwa 1900 als «Urmaterial der Dichtung» galten.1717 In der Pariser Zeit übersetzte er deutsche Romantiker ins Französische.1718 Zudem rezipierte er deutsche Literaturgeschichte und -theorie. Er fand darin Wege zur Annäherung an Dichtung durch das Eingehen auf den Geist der Autoren, antiphilologisch und antiliberal-antirationalistisch, durch eine einfühlende Interpretation auf der Basis der Introspektion in das Bewusstsein des Autors und in dessen eigene Mythologien. Béguin lehnte sich an Methoden zur Erforschung von Dichtung an, die er bei Friedrich Gundolf und bei Ernst Robert Curtius fand.1719 Die Lektüre von Dichtung wurde als intersubjektives Erlebnis verstanden, in dem das Erleben und Erleiden des Dichters auf der Suche nach einer Transzendenz nachvollzogen wurden. Der vier Jahre ältere Freund Marcel Raymond nannte dies «Morphologie des Geistes».1720 Béguin liebte weder das Deutschland der Aufklärung und der Klassik noch dasjenige des wissenschaftlichen Aufschwungs der Philologie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch den wilhelminischen Machtstaat. Er lehnte auch die 1714 1715 1716
1717
1718 1719 1720
Vgl. Raymond 1970, 47, 80; Mircea Martin in: Grotzer 1979, 173; Jurt 1973, 281. Unter diesen Bedingungen entstand die ‚École de Genève‘, siehe unten. Grotzer 1977, 20 f. Béguin begegnete dort u. a. Jules Romains, Jacques Rivière, Albert Thibaudet, Jean Cocteau, Paul Valéry. Béguin fuhr nach Paris, um Louis Aragon zu überzeugen, dass er vor den Belles-Lettres in Genf referieren solle. Der Ausdruck stammt von Stefan George, der in seiner Sammlung Deutsche Dichtung (Bd. 1, Berlin: von Holten 1900) viele Traumtexte vereinigte. Béguin zitierte nie George, aber man kann davon ausgehen, dass er ihm «l’essentiel de sa conception de Jean-Paul» verdankte. Bernard Böschenstein, in: Grotzer 1979, 87 f. In einer in Halle abgehaltenen Lehrveranstaltung bezeichnete Béguin George als «unchristlich». Archives AB/69 Albert Béguin professeur, Critiques, moralistes et mystiques de la France contemporaine. Bedeutung der deutschen Romantik für Béguin: Jurt 1973, 282 f. Benninger 2001, 9 f. Raymond 1970, 73–82; Jurt 1973, 286. Calin 2007, 65.
420
Geisteswissenschaftler
preussische Geschichtskonstruktion ab, die Friedrich II. mit den Befreiungskriegen, mit Bismarck und der Reichsgründung von 1870 verband und die durch den verlorenen Krieg 1918 erschüttert worden war. Darin unterschied sich Béguin von den Schweizer Germanophilen ebenso wie von demjenigen Deutschland, das sich während seines Aufenthaltes in Halle zwischen 1929 und 1934 zu formieren begann. Nach seiner Auffassung stand der deutsche Geist am Ende der 1920er Jahre in einer tiefen Krise. In Anlehnung an Jacques Rivière und Paul Natorp1721 diagnostizierte Béguin für die Deutschen eine innere Leere, die sich in unstetigem Wandel der Überzeugungen und einem Hang zu Betriebsamkeit und blinder Gefolgschaft im Kollektiv äusserte.1722 Béguins Verbindungsmann zur Librairie Stock, Maurice Delamain, machte ihn mit Hermann Graf Keyserling bekannt, mit dem Béguin danach eine umfangreiche Korrespondenz führte.1723 Er hielt ihn für einen grossen Kenner der deutschen Jugend. Ausgehend von deren Erwartungen beurteilte Béguin Elemente, die der Nationalsozialismus aufgriff, als positive Anzeichen eines geistigen Aufschwungs in Deutschland, den die Hitlerdiktatur dann allerdings durch ihre Geistfeindschaft verraten habe. Diese Bewunderung verkehrte sich ins Gegenteil, als sich Keyserling nach Hitlers Machtantritt bemühte, dem neuen Regime nicht negativ aufzufallen. Für Béguin wurde Keyserlings Verhalten damit zu einem Beispiel für die desolate geistige Lage Deutschlands unter der Diktatur.1724 Im Verlauf der Nazifizierung der Universität Halle, die er sehr kritisch beobachtete, legte er eine Sammlung von Flugblättern, Anschlägen und Pamphleten an. Auch soll er Mein Kampf gelesen haben.1725 Bedenklich fand er die Bereitschaft deutscher 1721
1722 1723
1724
1725
Rivière 1924, 157 ff., führte eine Auseinandersetzung mit Paul Natorp, «VolkstumDeutschtum», in: Deutscher Wille, des Kunstwarts 29. Jahr, zweites Novemberheft 1915, 125–133. Vgl. Liebold 2008. Benninger 2001, 10. Der Briefwechsel drehte sich in den Jahren 1930–1935 fast ausschliesslich um Details der Übersetzungen, die Béguin anfertigte. Zwischen Keyserlings Neujahrswünschen für 1936 resp. einem Schreiben von 1938 und dem Jahr 1946 klafft in der überlieferten Korrespondenz eine Lücke. Archives AB 102-454. Grotzer 1977, 49. Die Nachricht findet sich im Brief von Béguin an Marcel Raymond, 2. 9. 1933, in: Béguin/Raymond 1976, 116 f. Béguin 1933: «[…] sa connaissance des constantes de l’âme allemande lui donne l’espoir de voir se réaliser en un temps peut-être proche la conversion du régime nouveau à un système de large intégration, base d’une authentique création de valeurs: car c’est là ce que réclament les meilleurs d’entre les jeunes qui ont mis leur foi dans le Troisième Reich.» Ein Versuch von Keyserling, nachher mit Béguin wieder Kontakt zu knüpfen, blieb anscheinend folgenlos: «Les malentendus entre vous et moi sont bel et bien finis; Strich drunter, Schwamm drüber! Je serais très heureux de vous revoir à la première occasion et surtout aussi d’être présenté au génie que devrait être [?] votre femme.» Keyserling an «Cher Monsieur», 8. 3. 1938, in: Archives AB 102-2766 ex R70/14. Benninger 2001, 13.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
421
Kollegen, ihm gegenüber nun für das ‚Dritte Reich‘ einzustehen, nachdem sie vor 1933 noch Distanz zu Hitler gezeigt hatten. Er führte dies auf die erwähnte innere Haltlosigkeit der Deutschen zurück, die «terrible inconsistance personnelle».1726 Besonders interessierte ihn vorübergehend die Gleichschaltung der preussischen Landeskirche. Er schätzte Karl Barths fundamental-evangelische Antithesen zu den Deutschen Christen,1727 während ihm die Bekennende Kirche eine schwache Opposition zu sein schien.1728 An der Universität Halle registrierte er die Entlassung missliebiger und jüdischer Professoren, empörte sich über Martin Heideggers Freiburger Rektoratsrede «Die Selbstbehauptung der deutschen Universität» vom 27. Mai 1933 und empfand die Durchsetzung nationalsozialistischer Vorstellungen unter den Studierenden und den Zwang, an Lagerübungen teilzunehmen, als Militarisierung. Dabei teilte Béguin gewisse Auffassungen über die deutsche Universität, die deutsche Politik, Kultur und Gesellschaft, die die rechtsgerichtete Publizistik einschliesslich der Nationalsozialisten in Deutschland verbreiteten. Die Universität sei zersplittert in hochspezialisierte Einzelfächer, habe den Kontakt mit dem «Leben» verloren, biete den Studierenden wenig geistige Nahrung und spiele keine tragende Rolle in der Bildung der Nation. Im Gleichklang mit radikalen Konservativen und dem Geist der jungen Generation um 1930 verabscheute Béguin die Errungenschaften des ‚19. Jahrhunderts‘, d. h. Rationalismus, Säkularisierung, Modernisierung und die Idee des parlamentarischen Verfassungsstaates mit demokratischen Elementen, die den «Massen» einen Einfluss einräumten.1729 Deutschland fehle eine echte Elite mit geistiger Autorität. Die demokratischen Grundsätze, die am Ende des Ersten Weltkriegs von den Siegermächten verkündet worden waren, verurteilte Béguin.1730 Auch sah er anfangs in der nationalso1726 1727
1728
1729
1730
Grotzer 1977, 48. Einen entsprechenden Artikel schrieb Béguin in den Sommerferien 1933 nach der Lektüre von Dokumenten, die vor den Kirchenwahlen von 23. 7. 1933 erschienen. Das Manuskript schickte Béguin an Maurice Boucher von der «Revue d’Allemagne». Über diese Revue: Benninger 2001, 11 f. Grotzer 1977, 45 f. Die Dokumentation ist teilweise erhalten in: Archives AB, Allemagne A8 ex AB/ante A7/2-A8 alias AB102-2816. Peter Liebert stellte ihm im Sommer 1933 die theologische Position von Karl Barth dar. Liebert an Béguin, 11. 8. 1933, in: Archives AB 102-505-13. Liebert kommentierte auch den von Béguin zu diesem Thema verfassten Artikel: Liebert an Béguin, 9. 10. 1933, in: Archives AB 102-505-19. «Als demokratiegeübter Schweizer reagierte Béguin, wie die meisten seiner Landsleute auch, äusserst sensibel auf Gleichschaltung, Terror und Mangel an Zivilcourage», meint Hausmann 2008, zitiert nach Hausmann 2016. Ich bezweifle, dass Béguins Ablehnung des Nationalsozialismus aus einer wirklich demokratischen Gesinnung heraus erfolgte. In Béguin 1940a beschrieb er Deutschland als «un vague gouvernement des masses par les masses», zitiert nach Benninger 2001, 58. In einen Brief an Marcel Raymond vom 3. 12. 1939 hatte er im gleichen Sinn geschrieben: Nach dem Krieg werde man genug haben von der «autorité abusive des masses (dans tous les pays)», so dass man notwendigerweise
422
Geisteswissenschaftler
zialistischen ‚Revolution‘ einen Schritt zu einem Abbau der Klassenschranken und zu einer Reduktion des Standesdünkels, den deutsche Professoren zeigten.1731 Nach Béguins Beobachtungen weigerten sich diese, auf die Bedürfnisse der Jugend nach kollektivem Enthusiasmus (sic) einzugehen, und ignorierten die Ängste und die innere Revolte der Jugend. Dabei hätten die Professoren eine Führungsaufgabe erfüllen müssen, da sie die letzte noch existierende deutsche Elite nach dem Bedeutungsverlust von Adel und Offizieren darstellten.1732 Zwar wurde Béguins Erwartung, dass die Diktatur der Nationalsozialisten eine echte Revolution des Geistes bedeute, eine Gelegenheit «de faire l’Allemagne», rasch enttäuscht. Er blieb aber dabei, dass der Nationalsozialismus durch den 1918 importierten und kraftlosen Liberalismus verursacht worden sei, und bedauerte, dass Frankreich nur einen veralteten, offiziellen, liberalen Rationalismus anzubieten habe, der sich kaum von dem von Weimar unterscheide. Die Fähigkeit des Individuums, sich im Ganzen zu verlieren, könne an sich fruchtbar sein, sie trage jedoch das Risiko einer kollektiven Verrohung in sich. Ab Sommer 1933 zeigte er sich in der Korrespondenz als entschiedener Gegner des neuen Regimes, kritisierte dessen gewaltsame Methoden und bezeichnete Deutschland als «cet odieux pays»: «Vraiment, ici ce n’est plus tenable». Zudem konstatierte er, dass sich die deutschen Studierenden immer weniger für die Inhalte seines Unterrichts interessierten.1733 Öffentlich legte er seine Kritik (mit Ausnahme einer Darstellung des Kirchenkampfs im Sommer 1933) erst nach der Rückkehr aus Halle im Herbst 1934 dar.1734 Fortan fasste er das nationalsozialistische Deutschland als das Gegenteil all dessen auf, was er am Beispiel der deutschen Romantik und der einfühlend-evozierenden Literaturwissenschaft bewunderte. Später glaubte er jedoch auch in der Romantik die Symptome der deutschen «Krankheit» zu erkennen,1735 die er in eine Argumentationslinie verflocht, in der Luther,1736 der 30jährige Krieg, die deutsche Aufklärung, Goethe
1731 1732 1733 1734
1735 1736
etwas anderes erfinden werde als die Demokratie von 1918. Zur damals verbreiteten Kritik der Massenherrschaft klassisch: Ortega y Gasset 1929, noch im gleichen Jahr in deutscher Sprache als Aufstand der Massen veröffentlicht. Grotzer 1977, 48 f. Grotzer 1977, 46, 48. Grotzer 1977, 49; Béguin/Raymond 1976, 131–135, 3. 5. 1934. Die Artikelserie im Journal de Genève erschienen am 4.9., 8.9., 11.9., 13.9., 6.10. und 9. 10. 1934. Die Redaktion hielt die Darstellung für zu militant und lehnte es ab, weitere Beiträge von Béguin zu publizieren. Ackermann 1996, zitiert nach Benninger 2001, 14 f. Rückkehr nach Genf: Grotzer 1977, 46 ff., 51–53. In seiner späteren Kritik der deutschen Romantik sah er darin die Vorbereitung des Nationalismus und der Blut- und Boden-Lehre. Jean Starobinski, in: Grotzer 1979, 56. In der Vorlesung über «Idées politiques de la Renaissance» nannte er Luther einen Pessimisten, der den «pouvoir spirituel» der Institution Kirche zerstört und damit den «pouvoir temporel» gestärkt habe. Archives AB/95 Albert Béguin professeur, Idées politiques
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
423
und der Weg zur Reichsgründung von 1870/71 zu einem Bild vom Sonderweg der deutschen Geistesgeschichte verbunden wurden, das gewisse Ähnlichkeiten mit Helmuth Plessners «verspäteter Nation» aufwies. Es ist offensichtlich, dass Béguin solche Ideen bei den französischen ‚Germanisants‘ wie Edmond Vermeil aufgriff.1737 Nach dem Krieg lehnte er die deutsche Geistesgeschichte seit der Reformation dezidiert ab, nun einschliesslich der Romantik, die er pauschal als Folge der für ihn abartigen lutherischen Religiosität betrachtete.1738 Dass Béguin im Juni 1939 nochmals nach Deutschland zu einer Vortragstour zurückkehrte (es war sein erster Besuch seit 1934), bedeutet nicht, dass er von seiner Ablehnung des Nationalsozialismus abgerückt wäre. (Marcel Raymond allerdings weigerte sich zur gleichen Zeit, nach Deutschland zu fahren.)1739 Béguin nutzte die Einladung dazu, sich ein eigenes Bild vom Zustand deutschen Geistes und deutscher Seele nach sechs Jahren Hitlerdiktatur zu machen.1740 Er gewann den Eindruck, dass das Land durch die Umtriebe der Nationalsozialisten erschöpft und entnervt sei. Keiner seiner Gesprächspartner zeigte sich vom bevorstehenden Krieg begeistert. Béguin fiel das Wiederaufleben einer katholischen Spiritualität auf, das er daraus ersehen wollte, dass Schriften von Blaise Pascal (in Übersetzungen) in Deutschland nachgefragt wurden.1741 Er gewann die Überzeugung, dass der Zusammenstoss zwischen Frankreich und Deutschland, den er als möglicherweise «salutaire»1742 beinahe herbeisehnte, zwingend zu einer deut-
1737
1738 1739 1740
1741
1742
de la Renaissance, Résumé zu Erasmus und Luther. Von Balthasar hoffte vergeblich, von Béguin eine entsprechende Arbeit über Luther in seinem Johannesverlag veröffentlichen zu können. Von Balthasar an Béguin, 13. 3. 1949, in: Archives AB 102-40-15. Béguin zitierte Vermeil als grossen Kenner Deutschlands in seinen «Confessions d’un Germaniste», 1940. Denkbar ist auch eine Verbindung zu von Balthasars Arbeiten zur deutschen Geistesgeschichte, z. B. von Balthasar 1937/1939 (neue Aufl. 1969). Über Vermeil umfassend: Marmetschke 2008. Bernard Böschenstein, in: Grotzer 1979, 92 (bezogen auf das Jahr 1955). Hausmann 2000, 154. Grotzer 1977, 58, basierend auf einem Brief an Denis de Rougemont von 16. 8. 1939. Im Nachlass Blätter, auf denen Béguin die Reiseroute und die Namen der Gesprächspartner notiert hat (Freiburg i. Br., Leipzig, Berlin, Halle, Jena, Köln, Marburg, zurück nach Basel via Freiburg) – es bleibt allerdings offen, ob dies der Plan war oder der wirklichen Reise entsprach. Archives AB, Allemagne A20a. Benninger 2001, 46 f.: «Pascal et l’Allemagne» (Journal de Genève, 11. 9. 1939, 1–2). Der Artikel erschien auch in der Revue de Paris 47, Nr. 5, 1. 3. 1940, 131–143, erweitert um eine Darlegung der im französischen Katholizismus begründeten «force de la résistance». Benninger 2001, 47 f. Béguin an Raymond, 4. 10. 1939, in: Béguin/Raymond 1976, 175–178: Er hoffe, dass sich aus der «folie» «un monde moins inhabitable» ergeben werde. Er sah die grosse Gefahr, dass das Übel («le mal») siegen könnte. «Mais je ne crois pas aux catastrophes absolues, et j’ai l’impression que cette guerre peut [souligné] être salutaire.» Er biete die letzte Gelegenheit für die Franzosen «de reprendre par nécessité le sens de certaine grandeur».
424
Geisteswissenschaftler
schen Niederlage führen müsse,1743 und er machte sich eingehend Gedanken darüber, wie das unterlegene Deutschland zu «heilen» sei, so dass es schliesslich – unter Vermeidung der Fehler von 1918 – zu einem konstruktiv mitarbeitenden Glied in einem Konzert europäischer Nationen unter französischer Führung werden könnte. 7.2.4.4.3 Béguin und Frankreich Angesichts der Bedrohung, die vom Nationalsozialismus ausging, identifizierte sich Béguin mit einem starken französischen Patriotismus, für den er auch in der Schweiz warb, namentlich als Literaturkritiker und Herausgeber der «Cahiers du Rhône» ab 1942. Frankreich war für Béguin die Kulturnation schlechthin; von dort ging die Erneuerung der Literatur aus, die sein Freund Raymond 1933 umfassend in De Baudelaire au surréalisme dargestellt hatte. Béguin war nicht blind für negative Aspekte des französischen Geistes, aber er fühlte sich aufgerufen, für Frankreich mit der Feder zu kämpfen, und stellte darum kritischen Bemerkungen zurück hinter Aufrufen, die wie ein extremer und unreflektierter französischer Nationalismus aussahen. Dabei stellte er sich gerade nicht in die Tradition des Patriotismus der ‚Dritten Republik‘, der die Aufklärung, die Menschenrechte, die Demokratie, die Verbindung von ‚Science et République‘ und technische Errungenschaften in eine geschlossene, durch die angewandte Vernunft geleitete Fortschrittsbewegung zusammenfasste. Er hielt nichts (mehr) von Sozialismus und Kommunismus, die intellektuelle Disziplin und Geschlossenheit (d. h. Zensur) als Mittel zum Kampf gegen das System forderten: Vielfalt war für ihn ein hoher Wert. Nur vorübergehend von André Gide fasziniert, entwickelte er eine negative Haltung zu dessen Welt1744 und richtete sich ganz auf Péguy und dessen Nachfolger aus, deren spirituelle und rationalitätsferne Schöpfungen aus der Suche nach der «Inkarnation» der geistigen Welt im Weltlichen1745 ihn ansprachen. Dabei war, wie schon erwähnt, die Beschäftigung mit vorromantischer und romantischer Literatur ein Schlüssel zu einem damals neuen Verständnis des Poetischen.1746 Béguins Frankophilie bedeutete die Unterwerfung unter eine grössere Sache, an die er sich mit einem «Glauben» hingab. Dieser Glaube galt einer «France profonde», die Ausgangspunkt für eine moralische, kulturelle und politische Erneuerung Frankreichs und schliesslich Europas werden sollte, nicht im faschistischen Sinne von «Blut und Boden» und nicht unter Ausschliessung von als «fremd» deklarierten Elementen, sondern in Offenheit und Grosszügigkeit, dabei selbstbewusst als wahre Kulturnation. Den deutschen Überfall 1940 verstand Bé1743 1744 1745 1746
Benninger 2001, 44 f. Grotzer 1977, 23, 45. Jurt 1973, 283. Raymond/Poulet 1981, 2: Einführung von Pierre Grotzer.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
425
guin als vorübergehende Prüfung derjenigen Nation, der der Sieg letztlich gebührte. Wie bei vielen anderen, die als Ausländer Deutschland in den 1920er oder frühen 1930er Jahren entdeckten (ich denke an Delio Cantimori), wirkte der Glaube an eine nationale Sendung, der in Deutschland praktiziert wurde, inspirierend für die Ausbildung eines eigenen Patriotismus, der dann auf ganz anderen, ‚wahren‘, d. h. in Béguins Fall französischen, Werten aufbaute.1747 Damit verband sich eine Absage an die Intellektuellen, die durch eine humanistische ‚Internationale des Geistes‘ Europa auf eine neue kulturelle Grundlage stellen wollten. Béguin rechnete in diesem Sinn mit Thomas Mann ab: Dieser vertrete die Idee eines kosmopolitischen Europa mit grossen Hotels, Landsitzen, Kunststädten, Denkmälern und einer Vorstellung von Paris, wo die Sainte Chapelle und die Place du Tertre den gleichen Rang beanspruchten. Solche Eliten hätten keine Verbindung zum Volk, sie seien dekadent, entwurzelt und können keinen Glauben stiften.1748 In Frankreich, sah Béguin, war dieser nationale Glaube katholisch geprägt. Konsequent liess sich Béguin am 15. November 1940 in Basel katholisch taufen, allerdings nicht nur als Zeichen seiner Solidarität mit Frankreich, sondern vor allem weil er im Verlauf vieler Jahre und intensiver Studien zur Überzeugung gelangt war, dass er ganz persönlich eine Unterwerfung unter eine höhere Macht und deren verborgene Pläne mit den Menschen und mit Frankreich brauchte, die seiner Hingabe einen Sinn verlieh.1749 Die Taufe öffnete Béguin für Neues, auch Soziales, sie führte ihn nicht in eine konservative Abschliessung oder eine Unterwerfung unter die kirchliche Hierarchie.1750 Sein Katholizismus war die Grundlage seines antifaschistischen Humanismus, der auch den (getauften) Juden galt.1751 Im Vorfeld des deutschen Angriffs auf Frankreich wollte Béguin offen für Frankreich Partei ergreifen («collaborer»).1752 In diesem Sinne veröffentlichte er 1747 1748
1749
1750 1751 1752
Grotzer 1977, 59 f. Die zitierten Gedanken entwickelte Béguin anlässlich seiner Besprechung des Buchs von Renée Brand, Niemandsland. Publiziert in: Formes et couleurs 2/3, Lausanne 1940, als «Un roman de l’émigration». Notizen dazu in: Archives AB, B 196 Brand Renée. Auf die Kontroverse zwischen «Kosmopolitismus» (elitär) und «Internationalismus» (demokratisch) kann ich hier nicht eingehen. Von Haus aus war Béguin zunächst a-religiös, Grotzer 1977, 15 f. Die ersten Anzeichen für sein Interesse am Katholizismus lassen sich auf den Besuch einer Messe 1924 datieren. 1925 befasste er sich in Paris mit Religionsgeschichte; etwa in diese Zeit fiel seine Absage an den Sozialismus. Grotzer 1977, 27, 32, 34. Calin 2007, 63; Benninger 2001, 63; Grotzer 1977, 69; Archives AB, Dossier Religion R 37–40, 42–43/3. Calin 2007, 69. Gilbert Guisan in: Béguin/Raymond 1976, 12. «Il faudra bien que je trouve le moyen de collaborer […]». Er wolle schreiben, um Werte zu verteidigen, die im Fall einer französischen Niederlage verloren wären. Béguins Frau sei sehr patriotisch eingestellt und befürchte eine Invasion, sie wisse nichts über den Krieg 1914–1918 und sei deshalb enthusiastisch. Béguin an Raymond, 4. 10. 1939, ebd., 175–178.
426
Geisteswissenschaftler
«Pascal et l’Allemagne» in der «Revue de Paris», «Confessions d’un germaniste» in den «Cahiers du Sud»1753 und «L’Allemagne et la volonté de destruction» wieder in der «Revue de Paris». Stellvertretend für die oft wiederholte Argumentation sei der Inhalt der «Confessions d’un germaniste»1754 kurz skizziert: Der These von den ‚zwei Deutschland‘ widersprach er, denn er glaubte nicht daran, dass es eine wohlmeinende, aber unterdrückte Elite neben den Nationalsozialisten gebe. Nach Béguin waren es dieselben Deutschen, die Poesie, Musik und Philosophie geschaffen hatten, die nun auch entschlossen seien, die europäische Zivilisation zu zerstören. Dass Deutschland eine Gefahr darstelle, beruhe besonders auf der Reformation. Die deutsche «Krankheit» sei erkennbar am «flottement de la conscience nationale, qui ne cesse d’osciller entre l’attachement aux divers pays allemands, le rêve impérialiste du Reich qui les englobe, et enfin une sorte de patriotisme cosmopolite.» Die Unstetigkeit führe auf vereinfachende, elementare und brutale Werte, da das deutsche Individuum allzu «informe» sei, um konsistente Begriffe von Moral und Wahrheit zu entwickeln, auch könne es die Realität nicht als solche erkennen. Die deutschen Eliten hätten keinen Widerstand gegen den Nationalsozialismus versucht und sich dem Volk entfremdet; als eine spezialisierte Kaste handelten sie ausserhalb ihrer Studierstube verantwortungslos. Als Belgien schon gefallen, aber Frankreich noch nicht völlig besiegt war, veröffentlichte er im Juni 1940 in «L’Esprit» den Text «L’Allemagne et l’Europe». Er wollte Deutschland knebeln, um es von seinen «Dämonen» zu befreien, und schwelgte voreilig in Siegeseuphorie. Der Katholizismus verhalf ihm in diesem Zusammenhang zu ergänzenden Perspektiven: Die Nationalsozialisten (oder kurzum die Deutschen – auf die Unterscheidung legte er damals wenig Wert) waren für ihn gefährliche Neu-Heiden und vom Teufel («Démon») geritten.1755 Nach Juni 1940 äusserte sich Béguin nicht mehr zu Fragen der deutschen Literatur- und Geistesgeschichte;1756 die Abrechnung mit dem deutschen Geist nahm er erst 1944 wieder auf mit Publikationen über das Massaker von Vercors1757 und dann 1946 mit der Veröffentlichung von Faiblesse de l’Allemagne. Privat äusserte er sich differenzierter.1758 1753 1754 1755 1756 1757
1758
Die «Cahiers du Sud» wurden in Marseille verlegt; die Pariser Generalvertretung oblag José Corti, der mit Béguin eng verbunden war. Archives AB, A 16 Allemagne. Béguin 1940. Benninger 2001, 52–58; Hausmann 2000, 154; Grotzer 1977, 61 f.; Raymond 1970, 144 f. Benninger 2001, 67. Béguin war Mitglied einer Genfer Delegation, die den Vercors im Oktober 1944 besuchte. Sie war vom Bureau de Presse der Délégation du Gouvernement provisoire de la République française eingeladen worden. Jean-Marie Soutou an Béguin, 21. 9. 1944, in: Archives AB 102-2543 ex G 56–60/2. Die Delegation konstituierte sich dann als Groupe d’action pour les populations du Vercors und sammelte Mittel für die Bevölkerung. Béguin/Raymond 1976, 180–182, 185–187.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
427
7.2.4.4.4 Die Wahl zum Basler Professor Marcel Raymond, der in Basel seit Frühjahr 1931 Französische Literatur gelehrt hatte,1759 wurde 1935 als Nachfolger seines Lehrers Albert Thibaudet nach Genf berufen, wo er im Frühjahr 1936 zu unterrichten begann.1760 Im Basler Verfahren zur Bestimmung der Nachfolge wurde Albert Béguin von Raymond mit Nachdruck empfohlen, während Raymond selbst als sein eigener Stellvertreter1761 weiterhin in Basel präsent war. Die grundsätzliche Ausrichtung der Literaturbetrachtung von Raymond war mit derjenigen von Béguin eng verwandt (man spricht von der École de Genève).1762 In Basel wollten massgebende akademische und politische Kreise die von Raymond initiierte Tradition weiterführen: Repräsentation französischer Kultur und französischen Geistes durch eine Persönlichkeit, die in diese Welt hineingeboren war und sie kongenial gegenüber den Studierenden vertrat. Nicht nur die Fortführung dieser Konzeption sprach für Béguin. Obschon erst Mitte dreissig, wirkte er reif, nachdenklich, sensibel, an Fragen der Geistesgeschichte1763 orientiert, zurückhaltend und freundlich auch gegenüber Andersdenkenden, ein Kenner der damals aktuellen deutschen Romantikforschung und ein Vertreter der intuitiven, das Spirituelle betonenden Methoden der Interpretation. Bis 1939 engagierte er sich auch als ‚Germanisant‘ in der Verteidigung deutscher Kultur gegen die Nationalsozialisten wie gegen französische Kritiker.1764 Sehr wahrscheinlich durch Raymond koordiniert, bezeugten im Herbst 1936 mehrere Persönlichkeiten gegenüber Universität und Behörden in Basel, dass Albert Béguin eine aussergewöhnliche Begabung als Interpret von Poesie und Romanen besitze, dass er ein begnadeter Lehrer sei und in Halle de facto als Professor gewirkt habe. Ausserdem sei er in deutscher Literaturgeschichte ebenso bewandert wie in der französischen Gegenwartsliteratur. Zudem spreche und schreibe er perfekt Deutsch. Das beste Zeugnis dafür erteilte ihm Karl Voretzsch, der Ordinarius in Halle, dem Béguin als Lektor von 1929 bis 1934 unterstellt ge1759 1760 1761 1762 1763
1764
Béguin/Raymond 1976, 112 f. Raymond 1970, 118. Raymond 1970, 119; Grotzer 1977, 54. Jurt 2013. Diskussion um den Begriff in: Grotzer 1979, 256 f. Den Begriff «Geistesgeschichte» verwendete Marcel Raymond in seiner Korrespondenz mit Béguin im Jahr 1931. Raymond an Béguin, 26. 2. 1931, in: Béguin/Raymond 1976, 112 f. Apolitische Positionen vor 1940 zeigte Béguin in der Auseinandersetzung über die Ausrichtung der Zeitschrift «Présence» mit Gilbert Troillet zwischen 1933 und 1936, in seiner Mitarbeit an den «Schweizer Annalen» (Béguin war Redaktor des französischen Teils der Zeitschrift) 1935/36 und als Mitarbeiter der «Cahiers du Sud». Sein Eintreten für deutsche Kultur war verbunden mit einer geschärften Aufmerksamkeit für die innere Gewalt im ‚Dritten Reich‘ und die Kriegsvorbereitungen. Benninger 2001, 18–23.
428
Geisteswissenschaftler
wesen war.1765 Extrem lobend äusserte sich auch Gottfried Bohnenblust, der Genfer Germanist.1766 Bernard Bouvier, seit 1924 emeritierter Professor für Littérature française in Genf, schrieb über Béguin, er sei «parfaitement apte et excellemment préparé» und eigne sich besonders für eine Universität mit Studenten deutscher Muttersprache. Mit seiner Thèse sei er fast fertig. Er, Bouvier, habe jedes entstehende Kapitel durchgesehen und sei überzeugt, dass das Buch Platz finden werde unter «les tableaux français les plus pénétrants et les plus généreux du génie germanique».1767 An dieser Kampagne beteiligte sich der Dekan der Faculté des lettres, André Oltramare, der als Sozialdemokrat mit dem Basler Regierungsrat Hauser per Du war und 1924 bis 1927 das Genfer Erziehungsdepartement geführt hatte.1768 Zudem könnte Béguins Bekanntschaft mit Carl Jacob Burckhardt einen gewissen Einfluss gehabt haben.1769 Der Nachteil von Béguins Kandidatur bestand darin, dass er (nach den in Basel geltenden deutschen Massstäben) bisher nur den Status eines Assistenten (Lektors) und Gymnasiallehrers hatte. Äquivalent zur erforderlichen Habilitation wäre das Doktorat nach französischem Standard gewesen, das er bei Beginn des Basler Verfahrens noch nicht erworben hatte. Seine Thèse liess er vor der Soutenance drucken,1770 deshalb lag sie in Basel kurz vor Jahresende 1936 in Fahnen vor. Die Basler Fakultät hatte mit der Abfassung des von der Kuratel angeforderten Gutachtens seit Sommer 1936 zugewartet, bis der Text greifbar war!1771 Im Januar 1937 nahm die Genfer Fakultät die Thèse an, und die Soutenance fand im Februar statt. Da die Thèse vor allem der deutschen Romantik galt und ihren Verfasser mehr als Germanisten denn als Romanisten profilierte, publizierte Béguin kurz vor der Drucklegung der Thèse noch eine Studie über Gérard de Nerval.
1765
1766 1767 1768 1769
1770 1771
Voretzsch, 31. 10. 1936, an Tappolet, in: StABS ED-REG 1a 1 83 Prof. Dr. Albert Béguin (franz. Sprache und Literatur) 1937–1946. Wo nichts anderes vermerkt, stammen alle nachfolgenden Zitate aus diesem Dossier. Gottfried Bohnenblust an Raymond, 6. 11. 1936. Bernard Bouvier, professeur honoraire de l’Université de Genève, an ungenannt (vermutlich an Marcel Raymond), 19. 11. 1936. Oltramare, Doyen de la faculté des lettres, an Hauser, 8. 2. 1937. Über Oltramare: Bron 2009. Benninger 2001, 20. Béguin rezensierte den Richelieu von Burckhardt für die Schweizer Annalen (Heft 1, November 1935, 28–35). Die Besprechung gefiel Burckhardt ausserordentlich gut. Daraus ergab sich ein Gedankenaustausch ab Februar 1935. Im Sommer 1936 besprachen sich Béguin und Burckhardt über die Lage an der Universität Basel. Benninger 2001, 41; vgl. Raymond an Béguin, 1.12.193, in: Béguin/Raymond 1976, 148–150. Briefe von Burckhardt an Béguin, in: Archives AB 102-158. Dazu hatte ihm Bohnenblust geraten, um die Kandidatur in Basel zu fördern. Bohnenblust an Béguin, 25. 12. 1936, in: Archives AB 102-103-39. Universität Basel, Philologisch-Historische Abteilung der Philosophischen Fakultät, Herman Schmalenbach, Dekan, an Hauser, 19. 12. 1936.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
429
Zu Béguins Kandidatur gab es eine schwergewichtige Alternative. So versuchte der viel erfahrenere und hochangesehene Ernst Robert Curtius1772 die Basler Professur zu erlangen, um der nazifizierten Universität in Bonn den Rücken kehren zu können. Andreas Heusler1773 informierte seine Fakultätskollegen, dass Curtius «nicht abgeneigt» sei, Nachfolger von Marcel Raymond in Basel zu werden. So entstand die seltsame Situation, dass der 50-jährige Ordinarius Curtius Gegenkandidat zum 35-jährigen Doktoranden Béguin wurde. Curtius war, ähnlich wie Béguin,1774 ein Verfechter der intuitiven Interpretation. Er hatte ein lebhaftes Interesse für die französische Literatur des frühen 20. Jahrhunderts, deren Kenntnis er in Deutschland im Rahmen einer deutsch-französischen Verständigung vermitteln wollte. Persönliche Kontakte mit französischen Schriftstellern festigten diese Mittlerstellung. Zur Schweiz pflegte er ein enges Verhältnis als Sohn einer Berner Patrizierin aus der Hindelbank-Linie der Familie von Erlach und als Freund des Kulturjournalisten Max Rychner, der 1922 bis 1931 Redaktor von «Wissen und Leben» (ab 1926 «Neue Schweizer Rundschau» genannt) und anschliessend bis 1933 Feuilletonredaktor der «Kölnischen Zeitung» gewesen war. Von 1933 bis 1937 arbeitete er für die «NZZ» als Deutschlandkorrespondent in Köln, bis er als Leiter des Literaturteils des «Bund» nach Bern übersiedelte. Curtius bezeichnete den «alemannischen» Raum als seine eigentliche Heimat. Er verstand sich als unabhängiger Gelehrter, weltläufig, um ein Verständnis des französischen Geistes aus der Idee eines Volkscharakters heraus bemüht, aber doch fest verankert in einem nationalen deutschen Reichspatriotismus. Den Nationalsozialismus lehnte er als eine revolutionäre, geist- und kulturfeindliche, plebejische Massenbewegung ab. Seine Widerständigkeit demonstrierte er mit kleinen Gesten wie der unvollständigen Ausführung des Hitlergrusses oder dem Lesen westlicher Zeitungen in der Öffentlichkeit. Wann immer möglich hielt er sich in Luxemburg und in der Schweiz auf, freute sich aber 1940 darüber, dass das Elsass wieder zum ‚Reich‘ gehörte.1775 Nach 1933 begab er sich in eine ‚innere 1772 1773
1774 1775
Knappe Zusammenfassung in: Hausmann 2000, 125–129; Jurt 1995a, 1995b, 1997. Er bleibt in den Berufungsakten ohne Namensnennung. Es war Andreas Heusler gewesen, der von Curtius am 18. 6. 1936 ein Schreiben erhalten hatte, worin dieser zwar auf Anfrage geeignete deutsche Nachfolger für Raymond benannte (Auerbach und Schalk), aber zugleich deutlich machte, dass er gerne selbst die Position in Basel erhalten möchte. Hausmann 2015, 370. Den Brief hat Dröge 1995 zuerst veröffentlicht. Zu Heusler siehe oben, Kapitel 7.2.3.2. Vgl. die Würdigung Curtius’ durch Béguin 1956, zitiert bei Jurt 1995b, 168. Curtius an Heusler, 3. 7. 1937, in: Hausmann 2015, 370, über Kindheitserinnerungen an das «Dreieck Thann-Freiburg-Basel, das mir die eigentliche Heimat ist». «Das Elsass wird nun wohl wieder deutsch werden, und darüber wäre ich tief glücklich, denn damit wäre mir meine Heimat wiedergegeben. Die Sehnsucht nach den Vogesenwäldern hat mich seit 25 Jahren nie verlassen. Retournent francs en France dulce terre.» Curtius an Karl Vossler, 17. 6. 1940 (in: Nachlass Vossler), zitiert nach: Hausmann 2000, 521.
430
Geisteswissenschaftler
Emigration‘, indem er politisch instrumentalisierbare Themenstellungen vermied und sich mit mittellateinischer Literatur beschäftigte. Eine Minderheit in der Fakultät1776 und in der Sachverständigenkommission der Kuratel fand diese Kandidatur prüfenswert, hätte eine Berufung von Curtius doch den Glanz eines international angesehenen deutschen Professors in die Universität Basel gebracht. In der Fakultätskommission setzte sich der Philosoph Herman Schmalenbach für Curtius ein, während sich die übrigen Kommissionsmitglieder weigerten, über Curtius auch nur Bericht zu erstatten. Die Curtius favorisierende Minderheit war stark genug, um in das Fakultätsgutachten einen Passus von mehr als sechs Seiten über die Vorzüge von Curtius einzufügen. Darin wurde unterstrichen, dass er der Schweiz nahestehe. Er verfüge über «Internationalität» und Westorientierung, in seinem Elternhaus sei Französisch gesprochen worden, er sei ein erfahrener, grosser Gelehrter und feinsinniger Literaturkritiker, der mit französischen Schritstellern eng vertraut sei, eine lange Publikationsliste und umfangreiche Lehrerfahrung vorweisen könne.1777 Da anscheinend in der Fakultätsversammlung die Mehrheit die Curtius-Anhänger nicht brüskieren wollte, wurde kein ablehnender Beschluss gegen ihn herbeigeführt. Die Spannungen in der Fakultät äusserten sich im Schlusssatz ihres Antrags: «Ob die Berufung von Curtius nach Basel angängig erscheint, glaubt die Fakultätsabteilung1778 völlig den Behörden überlassen zu sollen. Falls dies verneint wird, bitten wir, dass an erster Stelle versucht werden möge, Herrn Albert Béguin für unsern Lehrauftrag zu gewinnen.»1779 Curtius’ Bewerbung stand in Basel unter einem schlechten Stern. Zunächst einmal hatte er sich gegenüber Heusler selbst als Kandidat vorgeschlagen, was immer ein ungeschickter Ausgangspunkt war. Durch die Wahl dieses Weges war die Kandidatur Curtius mit dem Odium der rechtsgerichteten Germanophilie, das Heusler anhing, verbunden. Deutscher konservativer Patriotismus stand in der Mitte der 1930er Jahren bei den der Basler Universität vorgesetzten Behörden keineswegs hoch im Kurs, wie das Beispiel der Wahl von Werner Kaegi als Historiker (der dem herausragenden deutschen Historiker Gerhard Ritter vorgezogen wurde) zeigte. Der Bezug auf einen «alemannischen» Raum, der die Grenzen 1776
1777
1778 1779
Die Diskussionen in der Fakultät wurden nicht protokolliert. Bekannt ist bloss die Zusammensetzung der Fakultätskommission: Dekan Herman Schmalenbach, Ernst Tappolet, Edgar Bonjour, Marcel Raymond, Arminio Janner, Gustav Binz, Andreas Heusler. StABS Protokoll der Philologisch-Historischen Abteilung der Philosophischen Fakultät R 3a, 3, 137, 16. 6. 1936, Trakt. 3. Argumentation von Herman Schmalenbach, Prodekan, gegenüber dem Präsidenten der Expertenkommission der Kuratel, Dr. August Rüegg, 30. 1. 1937: Gutachten der Fakultät, in: Universität Basel, Philologisch-Historische Abteilung der Philosophischen Fakultät. «Fakultätsabteilung» wurde geschrieben, weil bis zum Universitätsgesetz des Kantons Basel-Stadt vom 14. 1. 1937 die Philosophische Fakultät aus zwei Abteilungen bestand. Fakultätsgutachten vom 30. 1. 1937.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
431
zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz überschreiten sollte, kam bei einem Teil der Basler Öffentlichkeit nicht gut an, der dahinter einen deutschen Imperialismus fürchtete. Werner Kaegis Vortrag zur historischen Widerlegung dieser Rede von ‚Alemannien‘ spricht darüber Bände.1780 Obschon Curtius nicht zum direkten Umfeld von Stefan George gehörte und gelegentlich seine Distanz zum «Meister» betonte, fühlte er sich dem Dichter doch zeitlebens sehr verbunden.1781 Bewerbungen aus diesem Umfeld wurden in Basel von einer bestimmten Gruppe gefördert, die innerhalb (namentlich durch Edgar Salin) und ausserhalb der Universität Einfluss auszuüben versuchte. Ähnlich wie deutscher Patriotismus hatte die George-Gefolgschaft in der Mitte der 1930er Jahre bei universitären Bewerbungen einen negativen Effekt. Die entscheidende Instanz im Basler Berufungsverfahren war die Kuratel.1782 Der Präsident ihrer Expertenkommission, August Rüegg, betonte in der ersten Sitzung der Kommission (22. Juni 1936) den Vorentscheid der Kuratel, «die Wahl möge auf einen Gelehrten fallen, der die Geistigkeit der romanischen Kultur und Sprache auch durch seine Person repräsentiere». Herman Schmalenbach gab als Dekan zu bedenken: «Wenn die Fakultät auch in erster Linie Kandidaten französischer Geistigkeit ins Auge fasst, so darf sie letzten Endes die Tatsache nicht vollständig ignorieren, dass aus dem deutschen Sprachgebiet hervorragende Gelehrte bereit wären, nach Basel zu kommen».1783 Entscheidend für den Ausgang des Verfahrens war die zweite und letzte Sitzung der Expertenkommission der Kuratel, die erst im Februar 1937 stattfand, als Béguin gerade seinen Genfer Doktortitel erworben hatte. In dieser Sitzung trat Regierungsrat Fritz Hauser für Béguin ein, wollte ihn aber «in Anbetracht seiner Jugend zunächst als Extraordinarius» wählen, was er dann gegen den Willen des Kuratelspräsidenten und früheren Ständerats Ernst Thalmann1784 auch durchsetzte. (Erst 1939 wurde Béguin auf Antrag von Tappolet und im Umfeld der Berufung von Walther von Wartburg zum persönlichen Ordinarius befördert.) Danach wurde über Curtius diskutiert. Gemäss dem Protokoll wiederholte 1780 1781 1782
1783 1784
Brief an Heusler, 3. 7. 1937, in: Hausmann 2015, 370, Nr. 199; Kaegi 1942, 39–76. Todd 2005; Jurt 1995b, 164–166. Zusammensetzung der Experten- oder Sachverständigenkommission der Kuratel: Dr. August Rüegg, Gymnasiallehrer, Romanist, katholisch-konservative Volkspartei, Mitglied der Kuratel, als Präsident; Dr. Johannes Karcher, Arzt, Mitglied der Kuratel; Prof. Herman Schmalenbach, Philosoph, als Dekan der Philosophischen Fakultät; Prof. Ernst Tappolet, Romanist, als Fachvertreter; Prof. Edgar Bonjour, Historiker; Prof. Marcel Raymond, als Fachvertreter (Literaturwissenschaft) und abtretender Dozent; Dr. Max Meier, Rektor des Realgymnasiums Basel und Präsident der Seminarkommission (Lehrerseminar). Kuratel an die für die Expertenkommission designierten Herren, 8. 6. 1936. Expertenkommission Nachfolge Prof. Raymond, Protokoll der 1. Sitzung, 22. 6. 1936. Da Regierungsrat Hauser nicht anwesend war, wurde nichts beschlossen. Ernst Thalmann, Kuratel, an Hauser, 28. 4. 1937.
432
Geisteswissenschaftler
Schmalenbach, dass Curtius bereit sei, nach Basel zu kommen, und skizzierte die Bedeutung des Mannes. Nun meldete sich Johannes Karcher (im Elsass geborener Medizinhistoriker und Chefarzt am Diakonissenspital Riehen) zu Wort: Aus seinen persönlichen Beziehungen zur Familie Curtius wisse er, dass der Vater europäisches Format hatte und die Familie französisch sprach, doch das schweizerische Element sei mit der Zeit stark in den Hintergrund getreten. Schliesslich beurteilte Raymond die Französischkenntnisse von Curtius mit den Worten: «Il parle le français correctement, mais en cherchant ses mots.» Einstimmig wurde daraufhin beschlossen, den Behörden Béguin vorzuschlagen. «Der Antrag, es sei in einem Zusatz auf die Möglichkeit, Curtius zu gewinnen, hinzuweisen, wird mit 3 gegen 2 Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt.»1785 Dieser Zusatz fand sich dann trotzdem in den weiterführenden Anträgen. Ausserhalb des regulären Verfahrens sprachen weitere Faktoren gegen die Berücksichtigung eines Deutschen. 1936 hatte die Affäre Werner Gerlach1786 Basel erschüttert, während der sich die deutsche Presse drohend gegenüber Basel geäussert hatte. An der Basler Erasmusfeier desselben Jahres durfte deshalb keine offizielle deutsche Universitätsdelegation auftreten, und im selben Jahr hatten die vorgesetzten Behörden der Universität Basel untersagt, eine Delegation zum 550Jahr-Jubiläum der Universität Heidelberg zu entsenden. Regierungsrat Fritz Hauser, der neben dem Verfahren der Kuratel eigene Wege einschlug,1787 liess sich von Wilhelm Herzog schriftlich über Curtius informieren (durch Vermittlung von Carl Miville). Herzog war ein aus Deutschland geflohener jüdischer ehemaliger Kommunist, bekannt durch sein Buch über die Affäre Dreyfus,1788 der sich von 1933 bis 1939 in Basel aufhielt und als Kulturjournalist arbeitete.1789 Im Unterschied zum Gutachten der Fakultät, der Empfehlung der Kuratel und dem Bericht des Departements an die Regierung erwähnte er Curtius’ einzige politischaktuelle Schrift, Deutscher Geist in Gefahr von 1932 (Herzog datierte sie irrtümlich auf 1933). Die darin enthaltene nationalpatriotische Überzeugung stellte er ebenso genau dar wie die ablehnende Haltung von Curtius gegenüber den Nationalsozialisten. Herzogs Gesamturteil war positiv, er lieferte jedoch Regierungsrat 1785 1786 1787
1788 1789
Protokoll der 2. Sitzung der Expertenkommission, 8. 2. 1937. Tréfás 2009, 122. So hörte er Gerhard Hess, einen der jungen Schweizer in Deutschland, dessen universitäre Karriere im ‚Dritten Reich‘ aus politischen Gründen blockiert war, am 28. 12. 1936 persönlich an; Hess, Berlin-Schöneberg, an Herrn Regierungsrat [Hauser], 30. 12. 1936. Über Hess: Hausmann 2016b. Hess wechselte mit Béguin spätestens seit 1935 Briefe, in: Archives AB 102-2755 ex-R70/14, 19. 4. 1935 und 24. 5. 1937 (neue Signatur AB 102-409). Hess hatte den Roman Campagne von Raymonde Vincent ins Deutsche übersetzt (Vincent 1938: Stilles Land) und war 1939 wieder im Gespräch als Übersetzer ihres Romans Blanche; er hielt in Basel zu Beginn des Jahres 1940 einen Vortrag. Herzog 1932. Wichers 2007.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
433
Hauser eine Bestätigung für Curtius’ national-konservativen Standpunkt,1790 der damals eine Berufung nach Basel ausschloss: Er [Curtius] grenzt sich zwar scharf vom Nationalsozialismus, dem Mythos, den Blut-und-Boden-Theorien ab, um jedoch sein streng nationales Deutschtum oft unnötig stark zu betonen. Er hatte sich bis dahin – soweit ich sehen konnte – jeder politischen Äusserung oder gar Betätigung enthalten. Seine Abneigung dem revolutionären Nationalismus gegenüber, dessen Geistfeindschaft er kritisiert, mag ihm bei den regierenden Herren, soweit sie überhaupt davon erfahren haben, nicht nützlich gewesen [zu] sein. Wie überhaupt seine ‚westlichen‘ Anschauungen. […] Einen neuen Fall Gerlach wird man kaum fürchten müssen mit ihm zu erleben. Zweifellos wäre seine Berufung für die Universität ein Gewinn.1791
Die Kuratel erörterte in ihrem Schlussbericht und Antrag an das Erziehungsdepartement (vermutlich von Ernst Thalmann redigiert) ausführlich die Gründe, die gegen eine Berücksichtigung von Curtius sprachen: Es kann als sicher gelten, dass es sich bei Curtius um eine bedeutende und interessante Persönlichkeit handelt. Wir verweisen auf die Ausführungen des Fakultätsgutachtens. Für Basel möchten wir ihn solange nicht vorschlagen, als Persönlichkeiten aus dem französischen Kulturgebiet (französische Schweiz oder Frankreich) zur Verfügung stehen. […] Diese erfreuliche Entwicklung, die uns die Tätigkeit von Herrn Prof. Raymond gebracht hat, darf nicht dadurch unterbrochen werden, dass das Fach der französischen Literatur und Geistesgeschichte in deutsche Hände gelegt wird. In das letzte und innerste Empfinden eines Volkes wird sich ein Ausländer nie so einleben wie ein Volksangehöriger. Wenn Basel heute auf den französischen Lehrstuhl einen Deutschen berufen würde, so wäre das nicht weniger grotesk als wenn man den deutschen Lehrstuhl einem Franzosen anvertrauen würde. Diese Erwägungen waren so entscheidend, dass eine Bevorzugung Curtius’ vor Béguin gar nicht in Frage kommen kann.1792
Die Kuratel, und namentlich deren Präsident, argumentierten also primär auf der Ebene der Konzeption, die sich mit Raymond bewährt hatte und die vor allem 1790
1791
1792
Ob man in Basel wusste, dass Curtius bis 1933 ein Anhänger einer ‚konservativen Revolution‘ in Deutschland gewesen war, kann ich nicht feststellen. «Wie Sie, wie Hofmannsthal, habe ich lange an die kommende Restauration, d. h. conservative Revolution, geglaubt. Angesichts des Massenandrangs bildungsloser oder rebarbarisierter Schichten vermag ich das nicht mehr.» Curtius an Gerhard Masur, 3. 3. 1937, in: Hausmann 2015, 365 f., Nr. 197. Herzog an Hauser, 20. 3. 1937. Tatsächlich kann das Buch von Curtius als Kritik am Nationalsozialismus gelesen werden, die Grundlage der Kritik ist jedoch elitär-demokratiefeindlich und nationalistisch. Jurt 1995b, 175 f. Kuratel (Präsident Ernst Thalmann und Sekretär Fritz Wenk) an Hauser zu Händen Erziehungsrat, 8. 4. 1937.
434
Geisteswissenschaftler
mit Béguin weitergeführt werden sollte. Mit Ausnahme einer Tendenz in der Fakultät war dieses Konzept unbestritten und offensichtlich auch frei von parteipolitischen Aspekten. Es gelang den Befürwortern von Béguin, diesen weitgehend unwidersprochen als überragende positive Ausnahmeerscheinung darzustellen, die den Basler Erwartungen entspreche. Da es nicht primär darum ging, eine ‚Suissitude‘ zu stärken, sondern ein Fenster zum französischen Geist zu öffnen, kann man die Art, wie Béguin präsentiert wurde, kaum mit ‚geistiger Landesverteidigung‘ in Beziehung bringen. 7.2.4.4.5 Albert Béguin in Basel Als Professor erfüllte Béguin seine Unterrichtspflichten in einer Weise, die in Basel jedenfalls bis 1940 sehr geschätzt wurde, auch engagierte er sich als Dozent in den Volkshochschulkursen und sorgte dafür, dass bedeutende französische Schriftsteller zu Vorträgen nach Basel eingeladen wurden. Er pflegte einen engagierten, lebendigen Stil: «au sens où professer c’est faire professeur», notierte er sich zur Einleitung in seine Vorlesung über die «Idées politiques de la Renaissance». Der Ansatz war pointiert präsentistisch: «cours orienté vers nos préoccupations».1793 Er führte in den Haupt- und Übersichtsvorlesungen das Werk seines Vorgängers weiter mit dem Unterschied, dass er sich mehr Zeit liess für die Behandlung einzelner Epochen der Literaturgeschichte. Béguin sah jedoch in der Basler Professur nie ein erreichtes Lebensziel, sondern eher die Möglichkeit, seine eigenen Interessen mit dem Beruf besser zu vereinbaren, als dies in einer Position als Mittelschullehrer möglich war, und seine Mission zu erfüllen, für den französischen Geist durch die Vermittlung neuester Literatur aus einem bestimmten Ausschnitt zu wirken. In seinem Selbstbild war er ein engagierter Akteur in der kulturellen Erneuerung Frankreichs, in der kritischen Begleitung und Vermittlung der entsprechenden literarischen Produktion insbesondere von lebenden und verstorbenen katholischen Autoren wie Jules Supervielle, Emmanuel Mounier, Gérard de Nerval, Paul Claudel, Léon Bloy oder Georges Bernanos, stets in Erinnerung an Charles Péguy. Er verzichtete nie darauf, als Literaturkritiker direkt in Frankreich Einfluss zu nehmen, und es war deutlich, dass er in Basel nicht wirklich Fuss fassen wollte. Den Basler Geist tadelte er als materialistisch. Entsprechend spärlich sind die nachweisbaren Kontakte zu Basler Kollegen, wobei allerdings zu bedenken ist, dass bei räumlicher Nachbarschaft die Korrespondenz eine schlechte Auskunftsquelle ist. Vielleicht gehörte er zum Umfeld von Adolf Portmann, dessen Frau wie diejenige Béguins Französin war.1794 Sicher verkehrte
1793 1794
Archives AB/95 Albert Béguin professeur, Idées politiques de la Renaissance. Schon Raymond hatte mit Adolf Portmann und Arminio Janner verkehrt. Janner (siehe oben, Kapitel 7.2.4.2, und unten, Anm. 1804) hatte bereits mit Raymond Differenzen, weil
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
435
er in der Familie des Historikers Werner Kaegi.1795 Kaegis Frau Adrienne Kaegivon Speyr war im Neuenburger Jura aufgewachsen und beschäftigte sich wie Béguin intensiv mit Fragen der katholischen Glaubenslehre.1796 Im selben Haus wohnte der Seelsorger der katholischen Studenten, Hans Urs von Balthasar, selber ein Kenner der französischen Literatur,1797 der Béguin und Kaegi-von Speyr im Herbst 1940 durch Taufe der katholischen Kirche zuführte.1798 Das Verhältnis zu Werner Kaegi war distanziert, wohl weil dieser seinen religiösen Standort bei Erasmus von Rotterdam gefunden hatte, den Béguin in seinen Vorlesungen als «furchtsamen Katholiken»1799 verurteilte. Obschon sich Béguin 1933 intensiv für
1795
1796
1797
1798
1799
sich dieser an Benedetto Croce orientierte und mit den neuen Genfer Auffassungen über die Poesie wenig anfangen konnte. Raymond 1970, 110. Kaegi bezeichnete die Bekanntschaft mit Béguin im August 1937 noch als «flüchtig». Immerhin hatte das Ehepaar Kaegi bereits Béguin und dessen Frau kennengelernt. Kaegi an Béguin, 16. 8. 1937, in: Archives AB102-2159, ex-145. Woher die Bekanntschaft zwischen Adrienne Kaegi-von Speyr und Béguin datierte, bleibt mir unbekannt. Der erhaltene Briefwechsel beginnt erst am 14. 10. 1940; doch setzt er bereits eine nahe Bekanntschaft voraus. Adrienne Kaegi an Béguin, 14. 10. 1941, in: Archives AB 102-448-1. Conzemius 2011; Hallensleben/Vergauwen 2006. Von Balthasar hatte in Lyon die Kreise um Paul-Louis Landsberg, Reinhold Schneider, Alexander Marc, Emmanuel Mounier, Maurice de Gandillac und Étienne Borne kennengelernt. Benninger 2001, 41 f. Von Balthasar bewunderte Paul Claudel, was ihn gleichfalls mit Béguin verband. Grotzer 1977, 63. Der erhaltene Briefwechsel mit Béguin, in: Archives AB102-40, ab 3. 7. 1940, drehte sich zunächst um die deutsche Übersetzung des Seidenen Schuhs von Claudel, die von Balthasar 1939 herausbrachte (Claudel 1939). Von Balthasar kritisierte den Nationalsozialismus dezidiert, war aber persönlich nicht frei von antisemitischen Neigungen, so lehnte er als Herausgeber der «Europäischen Reihe» der «Reihe Klosterberg» 1947 eine von Hans Politzer herausgegebene Anthologie mit der Begründung ab, es seien «wirklich auch zu viel Juden darin»; Ezra Pound bezeichnete er bei dieser Gelegenheit als «ganz unangenehme[n] Bursche[n]» und wollte «aus ähnlichen Überlegungen» auch nichts von Karl Wolfskehl publizieren (was ihm Edgar Salin vorgeschlagen hatte). Von Balthasar an Schwabe Verlag, 28. 2. 1947, in: Verlagsarchiv Schwabe, Inv.-Nr. 1877. Grotzer 1977, 63 f. Die Taufe erfolgte am 20. 11. 1940. «Surtout ne vous inquiétez pas, – surtout pas de vous-mêmes et de vos dispositions (ou indispositions) pour la grâce. C’est Dieu qui agit et qui agira à présent et le moment viendra – tôt ou tard – infaillible, où la grâce sacrementelle pénètrera dans votre conscience et deviendra consciente elle-même, à la manière qui lui plaira. Il faut lui faire pleine confiance. Adhaerere, inhaerere, cohaerere!» Von Balthasar an Béguin, 8. 7. 1940, in: Archives AB 102-40-3. «Faiblesse: … d’être un chrétien timoré, peu actif». Notizen zu Erasmus, in: Archives AB/ 95 Albert Béguin professeur, Idées politiques de la Renaissance, 18. Von Balthasar urteilte ähnlich über Erasmus, jedoch mit dem Argument, «diese Art von Humanismus scheint mir heute gründlich überlebt», was auch eine Kritik an Huizinga und Kaegi war. Von Balthasar an Konrad Farner, 1. 11. 1941, in: Verlagsarchiv Schwabe, Inv.-Nr. 1875, Sammlung Klosterberg Korrespondenz.
436
Geisteswissenschaftler
Karl Barth interessiert hatte, dieser gleichzeitig mit Béguin in Basel wirkte und Hans Urs von Balthasar ein gemeinsamer Bekannter war, kam es zu keinen Kontakten zwischen Béguin und dem reformierten Theologen.1800 Zu Beginn der Basler Tätigkeit unterhielt Béguin wie sein Vorgänger gute Beziehungen zum Italianisten Arminio Janner. Das Verhältnis trübte sich 1945. Janner verbreitete vorzeitig die Nachricht vom bevorstehenden Weggang Béguins nach Paris und sah in Béguins verlängertem Parisaufenthalt eine Verletzung der Pflichten eines Basler Professors; zudem schrieb er einen Artikel für die «Basler Nachrichten», der Béguin sehr erregte.1801 Die Folge war ein erklärtes Ende der Freundschaft. Nach Béguins Umzug nach Paris war die offene Feindschaft unverkennbar. Janner warf ihm vor, sich anfänglich nicht genügend vom Nationalsozialismus abgegrenzt und dann gegen Kriegsende Sympathien für den Kommunismus entwickelt zu haben.1802 Zudem tadelte Janner an Béguin das, was er für französischen «Chauvinismus» hielt, und erklärte ihm, er sei ein schlechter Schweizer. Sehr wahrscheinlich hatte er auch kein Verständnis für Béguins Katholizismus.1803 Die «Cahiers du Rhône» seien «en effet plus une émanation de l’esprit français que de l’esprit suisse». Béguin stellte klar: «Je refuse l’étiquette de
1800
1801 1802
1803
Benninger 2001, 43 f. Unter Basler Kontakten nennt Benninger hier den Zoologen Adolf Portmann, den Theologen und Sozialdemokraten Fritz Lieb, den Germanisten Walter Muschg und den Romanisten Paul Zumthor, der ihn ab 1944 in der Lehre vertrat, aber bei der Wahl seines Nachfolgers nicht berücksichtigt wurde. Benninger 2001, 77. Basler Nachrichten vom 21. 7. 1946, 116, zitiert nach Benninger 2001, 90. Janner hatte auch wissenschaftliche Einwände gegen die Arbeiten Béguins. «Ha letto la mia ‚execuzione‘ della autorità e della teoria cara al nostro collega Béguin nell’ultimo numero di S.I. [«Svizzera italiana»]?» Janner an Gantner, 4. 1. 1945, in: Nachlass Gantner, NL 288, VI: 359: 250. Béguins Katholizismus ging auch anderen zu weit. So kritisierte im Juni 1942 Konrad Farner als Lektor beim Schwabe-Verlag deswegen Béguins Vorwort zu einem von ihm betreuten Band der «Reihe Klosterberg», der eine deutsche Übersetzung von Benjamin Constants Schrift Über die Gewalt enthielt. Nach Auffassung von Farner (die von Schwabe geteilt wurde) betonte Béguin die christliche Basis von Constants Denken zu stark. Farner meinte, Salin oder Kaegi hätten ein besseres Vorwort geschrieben. Der Herausgeber von Balthasar empörte sich über die «Art, wie [er] behandelt» werde. Die Schrift erschien dann 1942 im Verlag von Herbert Lang in Bern, hg. und übersetzt von Hans Zbinden. Von Balthasar an Farner, 19. 6. 1942; Farner an von Balthasar, 25.6., 22. 7. 1942, in: Verlagsarchiv Schwabe, Inv.-Nr. 1875, Sammlung Klosterberg Korrespondenz 1941– 1952. Janner griff 1945 den von Béguin geförderten Habilitationskandidaten Paul Zumthor in der Fakultät an: «Habilitation Zumthor: H. Janner ist bei aller Anerkennung der Habilitationsschrift der Ansicht, dass der Habilitand bei seiner ausgesprochen katholischen Stellungnahme eigentlich an eine katholische Universität gehöre.» StABS UA R 3a, 3 Protokoll der Philologisch-Historischen Abteilung der Philosophischen Fakultät, ab 1937 der Philosophisch-Historischen Fakultät, 1930–1948, 349.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
437
nationaliste français, de chauviniste (on dit ‚chauvin‘ en français), etc. J’ai toujours été et je reste hostile à tous les nationalismes».1804 Die frankophile Position von Béguin wurde spätestens bei Kriegsausbruch offensichtlich. Mit seinem Bekenntnis zum Katholizismus erregte er im protestantischen Basel Aufmerksamkeit. Schon im Vorfeld dieses Ereignisses bemerkten die Studierenden, dass er die französische Literatur von einem katholischen Standpunkt aus behandelte; von seiner Pascal-Vorlesung wurde gesagt, er lege die Schriften Pascals wie ein gläubiger Katholik aus. Unterrichtsthemen wählte er sichtlich nach deren Affinität zum katholischen Glauben aus (Péguy, Jeanne d’Arc). Seine Lehre diente offensichtlich der «défense de la pensée chrétienne et de la civilisation française»; Béguin spielte gegenüber den katholischen Studierenden die Rolle des «chef spirituel».1805 Albert Béguin engagierte sich während seiner Basler Zeit für verfolgte Kollegen in Deutschland und Frankreich. Einige einschlägige Fälle hat Benninger zusammengestellt.1806 Mit Eduard Berend, dem Berliner Spezialisten für JeanPaul,1807 stand Béguin seit seinem Lektorat in Halle in Kontakt.1808 Obwohl Berend Jude war, fürchtete er zunächst nichts: «Seien Sie herzlich begrüsst im neuen Deutschland, das am Ende doch das alte ist oder sein wird. Ich hatte fast schon gefürchtet, Sie kämen gar nicht wieder zurück», schrieb er Béguin.1809 Dann aber erfolgte die Gleichschaltung der 1925 gegründeten Jean Paul-Gesellschaft und ihrer Hefte. Im November 1933 musste Berend den Vorsitz der Ortsgruppe Berlin dieser Vereinigung abgeben, und sein Name durfte nicht mehr unter den Herausgebern der Zeitschrift erscheinen, wogegen Béguin brieflich bei der Gesellschaft protestierte.1810 Nach Béguins Weggang von Halle (1934) wurde der Kontakt lose; Briefe fehlen ganz für die Jahre 1937 und 1938. Berend hatte mit der preussischen Akademie bis Herbst 1938 einen Herausgebervertrag für die Werke von Jean Paul. Dieser wurde gekündigt und Berend im November 1938 verhaftet, nach Sachsenhausen verbracht und wieder freigelassen unter der Be1804
1805 1806 1807 1808
1809 1810
Maschinenschriftliche Konzepte von Briefen Béguins an Janner, 19./22. 1. 1945, und Antwort von Janner an Béguin, 21. 1. 1945, in: Archives AB/102/2157 f. ex-145 (neue Signatur AB 102-2157-145 und AB 102-2759_R70). Benninger 2001, 41; Grotzer 1977, 64. Benninger 2001, 69–71. Knickmann 2000. Die erhaltene Korrespondenz in: Archives AB 102-75-1. Zu Beginn des Jahres 1932 besuchte Béguin in Begleitung von Raymonde Vincent Berend in Berlin und hielt dort einen Vortrag. Berend an Béguin, 14. 9. 1932, in: Archives AB 102-75-41. Jean-Paul-Ausgabe: http://jean-paul.bbaw.de/ueberblick. Berend an Béguin, 17. 5. 1933, in: Archives AB 102-75-42. Die Korrespondenz der Jahre 1934 bis 1936 war rein fachlich. «Literaturportal Bayern, Institutionen», Jean-Paul-Gesellschaft, https://www.literaturpor tal-bayern.de/institutionen-startseite?task=lpbinstitution.default&gkd=2016615-1.
438
Geisteswissenschaftler
dingung, dass er Deutschland verlasse. Im Frühjahr 1939 wandte er sich deswegen an Béguin. Dieser bat Marcel Raymond am 14. März 1939 um Unterstützung für die Demarche bei der Fremdenpolizei, mit der Berend eine Aufenthaltsbewilligung bekommen sollte. Dieselbe Bitte richtete er auch an Victor Martin und an einen Genfer Anwalt. Man sieht, dass Béguin nicht Basler Beziehungen mobilisierte, sondern sich völlig auf seinen Genfer Kreis bezog. Am 13. Juli 1939 bestätigte Berend, dass er die Bewilligung für drei Jahre Aufenthalt in Genf erhalten habe, ging aber nur zögerlich an die Vorbereitung seiner Abreise.1811 Wesentlichen Anteil an der Übersiedlung nach Genf und der Finanzierung des dortigen Aufenthaltes hatte der Goethe-Forscher und Schriftsteller Heinrich Meyer (seit 1930 in den USA), da ursprünglich eine Weiterreise aus der Schweiz in die USA geplant war.1812 Berend blieb in Genf bis kurz vor seinem Tod, dann erst ging er nach Deutschland zurück, um seinen Nachlass der Jean Paul-Forschung zur Verfügung zu stellen. Der Pariser Verleger José Corti war mit Béguin eng verbunden. Dessen Sohn Dominique wurde am 2. Mai 1944 durch die Gestapo verschleppt. Corti hatte ein Mitglied der Résistance, François Le Lionnais, bei sich versteckt. Bei der Haussuchung bei Corti wurden dessen Frau und Sohn verhaftet, Corti selbst entkam. Ende Oktober 1944 und wieder im Februar 1945 bat Corti Béguin, beim Bund zu intervenieren, um den Aufenthaltsort seines Sohnes zu erfahren. Die Frau kam frei, während der Sohn in Deutschland verschollen ist. Schlechter dokumentiert ist der Fall des Sohns von Edmond Vermeil, Professor für Geschichte der deutschen Kultur in Paris und früher Kritiker des Nationalsozialismus, namens Guy (später Kinderarzt). Auch dieser wurde deportiert, und der Vater bat Béguin darum, dem Sohn Bücher und warme Kleider zu schicken. Der letzte bekannte Fall betraf den Surrealisten und Übersetzer Robert Valançay, Schüler von Maurice Boucher, der in Kontakt mit Paul Éluard stand. Er wurde von den Deutschen im Frühjahr 1941 verhaftet und im gleichen Jahr wieder freigelassen. Béguin schickte ihm deutsche Bücher, die er in Frankreich nicht finden konnte, für eine GrabbeÜbersetzung. Er kommentierte diese Übersetzung laufend während ihres Entstehens und schrieb dazu eine Einleitung. Als Mittelsmann für den Transport der Bücher und der Übersetzungsmanuskripte wirkte der Kunst- und Literaturkritiker Jean-Daniel Maublanc, der in Vichy wohnte. Er nahm bei der Rückfahrt Exemplare der «Cahiers du Rhône» mit, die er in Frankreich verbreitete. Um Béguins Engagement umfassend zu beurteilen, bräuchte man die Briefe, die er selbst geschrieben hat: Im Nachlass sind meist nur die empfangenen Briefe überliefert. Béguin selbst verlor gemäss Benninger Freunde und Bekannte in Konzentrationslagern, darunter Renée-Noëlle Guerpillon (Musikerin? Béguin 1811 1812
Grotzer 1977, 60. Der zugehörige Briefwechsel zwischen Béguin und Raymond (Berend an Béguin, 13. 7. 1939) in: Béguin/Raymond 1976, 177. Archives AB 192-75-81. Werner 2013.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
439
korrespondierte mit Michel Guerpillon), Roger Cazala, Maurice Renard (wenn meine Identifikation korrekt ist, starb er jedoch an den Folgen einer Operation, ist somit in dieser Liste wahrscheinlich fehl am Platz) und Dominique Corticchiato («écrivain mort pour la France», als solcher genannt im Panthéon, Übersetzer von Horace Walpole für José Corti). Schon 1942 schickte Béguin Marcel Raymond eine Liste mit Namen von Bekannten, die verfolgt wurden oder bereits tot waren: Emmanuel Mounier, inhaftiert in Lyon, dann interniert in Vals, nach Hungerstreik freigelassen; Jean Cayrol, inhaftiert in Fresnes, deportiert im März 1943 nach Mauthausen-Gusen, im März 1945 freigelassen; Georges Politzer, Gründer der «Pensée libre», mit den Mitbegründern Jacques Decour und Jacques Solomon am 30. Mai 1942 erschossen.1813 Deshalb beschäftigte er sich nach Kriegsende eingehend mit dem deutschen Lagersystem und trug dazu bei, das Massaker von Vercors publik zu machen.1814 7.2.4.4.6 Ergebnis Albert Béguin war als katholischer Humanist sowohl gegen Faschismus und Nationalsozialismus ‚resistent‘, als auch mit seiner Feder ein Kämpfer auf Seiten der französischen schriftstellerischen Résistance gegen die deutsche Invasion und das Vichy-Regime. In Basel vertrat er (auch im Unterricht) eine ausgeprägte Frankophilie aus der Überzeugung heraus, Frankreich sei dazu berufen, Europa zu einem neuen geistigen Aufschwung zu führen und dem «kranken» Deutschland den Weg zu weisen. Mit dieser Position der aktiven, im Katholizismus verwurzelten Solidarität mit einer westlichen Nation stand Béguin in der Basler Romanistik allein zwischen dem nach Deutschland orientierten Walther von Wartburg, der sich zu einem schweizerischen Patriotismus konservativer Art bekannte, und Arminio Janner, der als Tessiner Patriot die ‚geistige Landesverteidigung‘ in der Abwehr der italienischen Irridenta praktizierte, Bundesrat Motta bewunderte und eine vom Bund finanzierte Zeitschrift herausgab. Dabei war Béguins Auffassung von Roman und Dichtung sehr stark von der deutschen Romantik und der deutschen Bewegung gegen das ‚19. Jahrhundert‘ geprägt, was sie in gewissen Grenzen mit der Germanistik eines Muschg vergleichbar erscheinen lässt. In diesem Sinne wirkte durch Béguin ein ‚anderes Deutschland‘ auf dem Umweg über die französische Literaturgeschichte und -kritik zurück gegen das ‚neue Deutschland‘ des ‚Dritten Reichs‘ und nach anfänglichen Illusionen immer ausdrücklicher gegen den ‚französischen Staat‘ von ‚Vichy‘.
1813 1814
Béguin an Raymond, 26. 7. 1942, mit Kommentar von Gilbert Guisan, in: Béguin/Raymond 1976, 213 f. Béguin u. a. 1944.
440
Geisteswissenschaftler
7.2.4.5 Walther von Wartburg – ein germanophiler Romanist 7.2.4.5.1 Einleitung Walther von Wartburg,1815 der schon damals als einer der führenden Romanisten seiner Zeit galt, wurde auf den 1. Dezember 1939 an die Universität Basel berufen. An diesem Vorgang fällt auf, wie rasch er vollzogen wurde, dass dies einmütig geschah, und dass alle denkbaren Hindernisse wie von Zauberhand weggefegt wurden. Ausgangspunkt meines Interesses ist der Umstand, dass seit der Mitte der 1930er Jahre das baselstädtische Erziehungsdepartement und die Kuratel bei Neuanstellungen personell und zunehmend auch inhaltlich eine klare Abgrenzung vom nationalsozialistischen Deutschland verlangten. Nicht nur eine Berufung von Professoren aus Deutschland, die einer Nähe zum Nationalsozialismus verdächtigt wurden, war weitgehend unmöglich geworden, sondern auch nichtnationalsozialistische, jedoch national-konservative Deutsche galten diesen entscheidenden Stellen als weitgehend unerwünscht.1816 Nun war Walther von Wartburg zwar Schweizer, hatte aber ohne erkennbare Probleme von 1929 bis 1939 in einem national-deutschen Umfeld und seit 1933 unter der nationalsozialistischen Herrschaft an der gleichgeschalteten Universität Leipzig gewirkt. Wie ist vor diesem Hintergrund die Berufung Walther von Wartburgs kurz nach Kriegsausbruch zu beurteilen? Wurde damit ein gefährdeter Gegner des NS-Regimes in die Schweiz gerettet? Handelte es sich um die Rückwanderung eines Auslandschweizers im letzten Moment? Oder war es ein Akt des wissenschaftspolitischen Kalküls, einen berühmten Mann, der gerade für die Universität Basel verfügbar war, zur Förderung des internationalen Ansehens dieser Unterrichtsanstalt zu gewinnen?1817 Walther von Wartburg war ein Pionier der Sprachgeschichte und der Etymologie in einer für die Zwischenkriegszeit neuen Auffassung, die synchrone und diachrone Perspektiven, Lautgeschichte, historische Grammatik und Wortgeschichte sowie Daten aus der Historie miteinander verband. Seine Sprachgeschichte hatte den Anspruch, über die Fächergrenzen hinaus die allgemeine Geschichte zu belehren. In der Arbeit an seinem wichtigsten Vorhaben, dem Französischen Etymologischen Wörterbuch (FEW), zeigte er sich als äusserst konzentrierter, in die Breite und in die Tiefe zugleich vordringender Forscher, der über sehr lange Zeit hinweg an seinem Ziel festhielt und es unter Einsatz aller 1815 1816
1817
Obschon von Wartburg das «von» oft wegliess, wenn er Briefe unterzeichnete, halte ich durchgehend daran fest. Als Beispiel dienen die gescheiterten Bemühungen des bedeutenden, aber deutsch-konservativen Historikers Gerhard Ritter, von Freiburg i. Br. nach Basel zu wechseln: Wichers 2013; Matthiesen 1998, 79. Vgl. die Darstellung der Rolle von Werner Kaegi, weiter unten. Vgl. den Versuch der Basler Regierung, nach Kriegsende mit ähnlicher Zielsetzung Adolf Butenandt nach Basel zu holen. Simon 2009.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
441
erreichbaren Mittel zu einem vorläufigen Abschluss brachte. Er galt als Verkörperung eines Professorentypus, der dem Ideal der voraussetzungslosen Wissenschaft diente, asketisch lebte und jede freie Minute seinem grossen Ziel widmete. Zugleich war er ein erfolgreicher Mentor seiner zahlreichen Schüler. Als Freund der Schweizer Berge, liebend-gestrenger Vater von vier Kindern, heimatverbundener, ländlicher Solothurner, der seine Mundart pflegte, Verteidiger der regionalen Vielfalt und politischen Selbstbehauptung der Schweiz erschien er als idealer Patriot.1818 Ich stelle diesen Bildern den Versuch entgegen, aufzuzeigen, welche Konstanten die Agenda dieses Mannes prägten, wenn sie aus der Perspektive der Zeit um 1940 rekonstruiert werden. Dabei nehme ich an, dass zwar das FEW die meisten seiner Ressourcen beanspruchte, dass das Wörterbuch aber eine instrumentelle Funktion für eine übergreifende Aufgabe erfüllte, die sich von Wartburg bis in die 1940er Jahre und vielleicht noch darüber hinaus stellte. Diese Agenda hatte sowohl einen politischen als auch einen wissenschaftlichen Aspekt. Dafür beziehe ich mich hauptsächlich auf von Wartburgs Publikationen aus der Zeit von 1915 bis 1943, auf Interventionen und Synthesen. 7.2.4.5.2 Konstanten im Lebenslauf Die Suche nach Konstanten und die Annahme einer kohärenten Agenda können die Befürchtung wecken, ich würde Opfer der «biographischen Illusion».1819 Von Wartburgs äusserer Lebensgang war jedoch durch mehrere starke Reorientierungen gekennzeichnet. Wahrscheinlich wuchs das jüngste der zehn Kinder des Sekretärs des solothurnischen Departements des Innern zunächst im altkatholischen Glauben auf.1820 Der Jugendliche hing den Reformbewegungen der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg an und war bekennender Abstinent.1821 Durch seine Gattin Ida Boos (Heirat 1912) bewegte er sich später auf die Welt Rudolf Steiners zu, ohne (wie seine Frau) in ihr aufzugehen.1822 Nach dem internationalen Studium schien seine Karriere im Lehramt ihren Höhepunkt erreicht zu haben; die Position als Seminarlehrer in Wettingen und danach als Kantonsschulprofessor in Aarau hätte eine Endstation sein können. Neben der Tätigkeit an der Schule habilitierte sich der in Zürich Promovierte in Bern. Nach einem kurzen Jahr als Extraordinarius in Lausanne und Bern erlangte von Wartburg 1929 in Leipzig ein Ordinariat. Und als es so aussah, wie wenn er sich in Leipzig und Chicago, wo er 1818 1819 1820 1821 1822
Zum Gedenken 1972; Baldinger 1971. Bourdieu 1986. Zum Gedenken 1972, 4. Hausmann 2017, 14. Zum Gedenken 1971, 6, 8. In der Leipziger Personalakte steht «Christ, doch keiner Kirche angehörig». Karteikarte, in: UA Leipzig, PA 1029.
442
Geisteswissenschaftler
seit 1935 jährlich während eines Trimesters als Gast las, fest eingerichtet hätte, wechselte er Ende 1939 nach Basel, wo er den Rest Lebens verbrachte. Der geschworene Feind der Linken unterstützte nach 1945 den akademischen Wiederaufbau in Berlin-Ost gleichzeitig mit dem zum Kommunismus bekehrten Basler Juristen Arthur Baumgarten.1823 Diese Biographie verlief zwar innerhalb eines früh gewählten und kohärent bearbeiteten wissenschaftlichen Feldes, enthielt aber eine Vielfalt an Strategien und möglichen Wendungen, denen ich mit der Suche nach Konstanten nur teilweise gerecht werde. Was wäre gewesen, wenn er nach Kriegsbeginn in Deutschland geblieben wäre, wie zum Beispiel Matthias Gelzer in Frankfurt?1824 Oder wenn er den Ruf an die Universität Chicago angenommen hätte und nach Nordamerika ausgewandert wäre? Ich gehe davon aus, dass seine Überzeugungen spätestens zur Zeit des Ersten Weltkrieges gefestigt waren, dass er an ihnen festhielt und – abgesehen von geringen Korrekturen an seiner eigenen Wissenschaftssprache nach 1940 – keine Konzessionen machte. Seine wissenschaftlichen und politischen Intentionen verfolgte er transparent und gradlinig. Deshalb möchte ich sein Verhalten zwischen 1933 und der Wahl nach Basel nicht durch opportunistische Strategien erklären in dem Sinne, dass er sich der nazifizierten deutschen Universitätswelt nur angepasst hätte, um möglichst gute Bedingungen für die Erarbeitung und Veröffentlichung des FEW zu erhalten.1825 Das schliesst nicht aus, dass einige seiner Schüler so handelten, um in die wissenschaftliche Karriere unter den Bedingungen einsteigen zu können, die durch die Reichshabilitationsverordnung diktiert wurden.1826 Für von Wartburg selbst nehme ich blosse Akzentverschiebungen innerhalb eines gegebenen Satzes von Überzeugungen an.
1823 1824 1825
1826
Degen 2002. Gelzer 2011. So fasse ich die These von Hausmann 2017, 7, 12, auf, der von Wartburg als «naiv und ein Stückweit opportunistisch» darstellt und meint, er habe «nicht aus Überzeugung, sondern aus Loyalität» den Eid auf Hitler abgelegt, um «Wohlverhalten» zu demonstrieren mit dem Ziel, die Arbeit am FEW weiterzuführen. Von Hehl 2010, 227. Es geht um die Beurteilung der Zieldeklaration, die von Wartburgs Assistent Alwin Kuhn als Habilitationskandidat offiziell abgeben musste. Nach meiner Auffassung übertrug er dabei von Wartburgs Thesen über die Bedeutung der Germanen für das Französische von der Sprachgeschichte in die Literaturgeschichte, indem er behauptete, die Aufgabe der Romanistik im nationalsozialistischen Deutschland bestehe darin, «den starken germanischen Anteil, wie er sich in Charakter und Geisteshaltung der Helden der altfranzösischen […] Literatur ausprägt, in seinem weiteren Schicksal zu verfolgen». Diese Aussage stammt aus dem Dossier, das der SA-Mann Kuhn zur Anmeldung seiner Habilitationsabsicht 1934 zusammenstellte, in: UA Leipzig, PA 0667, Blatt 7 f. Die ausserwissenschaftlichen Habilitationsbedingungen im ‚Dritten Reich‘: Hausmann 2000, 48, 103.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
443
7.2.4.5.3 Schweizer Germanophilie Walther von Wartburg war germanophil. Nach seiner Auffassung gehörte er der deutschen Sprach- und Kultur-«Gemeinschaft» an. Er war Deutsch-Schweizer, fasste die Schweiz historisch als germanisch (alemannisch) geprägtes Land auf, das sich nach 1798 als vielsprachiger Staat konstituiert habe. Er glaubte, ein Deutsch-Schweizer könne nur durch die aktive Teilnahme am deutschen Geistesleben eine kulturelle Existenz führen. Jede Trübung des Verhältnisses zwischen Deutsch-Schweizern und dem deutschen ‚Reich‘ hielt er deshalb für schädlich. Einen Rückzug der Deutsch-Schweiz auf eine schweizerische Nationalkultur, die sich selbst genügte oder gar als romanisch-germanische Kulturfusion ein europäisches Vorbild sein sollte, betrachtete er als direkten Weg in die provinzielle Enge. Innerhalb des rein historisch-politisch konstituierten Gebildes ‚Schweiz‘ sah er eine konservativ-freiheitlich geprägte Koexistenz von vier «Völkern» (die Anerkennung der Rätoromanen war ein wichtiges Anliegen von Wartburgs),1827 von denen drei sprachlich-kulturell zu den jeweiligen grossen Nachbarvölkern gehörten und mit ihnen solidarisch waren. Germanophilie bedeutete im prägenden Kontext des Ersten Weltkriegs für von Wartburg, dass der Deutsch-Schweizer auf den Sieg Deutschlands hoffte. Die Koexistenz der Landesteile verstand er so, dass jedes Sprachvolk innerhalb der Schweiz hinter seinen festumrissenen Grenzen bleiben sollte und innerhalb seines «Raums» sein Eigenleben «rein», ohne Vermischungen, zu führen habe. Aus historischen und politischen Gründen sollte die Schweiz zwar ihre staatliche Unabhängigkeit von ihren Nachbarn behaupten; denn das politische Band mit Deutschland war schon im Schwabenkrieg (auch Schweizerkrieg genannt, 1499) zerrissen worden, während der französische Zentralismus und seit dem 19. Jahrhundert die französischen Vorstellungen von Freiheit und Demokratie (als «Parlamentarismus») mit den auch in der romanischen Schweiz geltenden Ideen angeblich unvereinbar waren.1828 Dieser Unabhängigkeitsanspruch musste aber, so 1827
1828
Viele kleine Schriften galten diesem Thema, so 1915 «Von unsern Rätoromanen» (NZZ), 1919 «Bergeller Mundart» (Bündnerisches Monatsblatt), 1920 «Der Kampf unserer Rätoromanen» (Aargauer Tagblatt), 1922 «Rätisches» (NZZ). Die Anerkennung des Rätoromanischen als Landessprache galt ihm als Vollendung der mehrsprachigen Schweiz. Er teilte dieses Interesse mit dem Zürcher Romanisten Jakob Jud, der sich bezüglich Deutschlands deutlich anders als von Wartburg orientierte. Liver 2013. In einem Brief vom 18. 11. 1915 behauptete von Wartburg, Freiheit sei in Frankreich bloss ein Schlagwort, das die «Gleichmacherei» verdecke. In Deutschland herrsche mehr Freiheit. Wahre Freiheit gäbe es in der Schweiz; sie bedeute die freie Entfaltung des Einzelnen und der einzelnen Landesteile in ihrer Vielfalt. Hausmann 2017, 16. In Deutschland war nach 1933 bei denjenigen Autoren, die nicht auf einer aggressiven nationalsozialistischen Linie lagen, der Unabhängigkeitsanspruch der Schweiz anerkannt. Als Beispiel wird Emil Meynen (Leiter der Geschäftsstelle der Volksdeutschen Forschungsgemeinschaften) ange-
444
Geisteswissenschaftler
dachten die Germanophilen, durch das enge Band immer wieder neu legitimiert werden, das die in ihrem Wesen germanische Schweiz mit dem ‚Reich‘ zusammenhielt, und durch die Nützlichkeit des demokratisch-föderalistischen Labors südlich des Rheins für die Kultur des Deutschen Reichs selbst. Für einen Romanisten mag diese Haltung auffällig erscheinen, doch von Wartburg betrieb seine Forschungen zur Geschichte der romanischen Völker und Sprachen ganz aus einer germanophilen Perspektive. 7.2.4.5.4 Geschichtsbild a. Deutsche Geschichte In der Geschichte der Deutschen sah er eine verzögerte Nationenbildung, verursacht durch den Entscheid der deutschen Stämme, das («römische») Kaisertum zu übernehmen und Deutschland «in den Dienst der Reichsidee» zu stellen.1829 So blieb Deutschland zersplittert und lange ohne Nationalbewusstsein. Erst die extremen Gefährdungen der Existenz, wie sie der 30jährige Krieg, die napoleonischen Kriege («Befreiungskriege») und schliesslich der verlorene Erste Weltkrieg mit sich brachten, weckten schrittweise das Nationalbewusstsein der Deutschen und ihr Verlangen nach politischer Einheit («volkliches Wollen»)1830 in der Auseinandersetzung mit dem Modell des westlichen Nachbarn. Luther brachte die sprachliche Einheit (während vorher entsprechend der Reichsidee das Lateinische dominiert habe), das 17. Jahrhundert die kulturelle Dämmerung, die Klassik und Romantik in Verbindung mit den Freiheitskriegen die Einheit im Geiste. Die politische Einheit sei jedoch durch die Reaktion (Metternich) und die Zweiteilung Deutschlands durch die Eigenexistenz Österreichs verzögert worden. Offensichtlich fasste von Wartburg den Kampf gegen die Weimarer Republik, die Bestrebungen zur Revision der Pariser Vorortverträge, den Beginn der Hitlerdiktatur und den ‚Anschluss‘ Österreichs als wichtige Schritte zur Vollendung des deutschen Nationalstaates auf. Für ihn gab es keine (oder im Vergleich zu den Vorgehensweisen der Westalliierten bloss eine geringe) deutsche «Kriegsschuld».
1829 1830
führt, der erkannte, dass das «Deutschtum in der Schweiz» – gemeint: die Deutschschweizer – «unerschütterlich auf der Grundlage des historischen Staatsgedankens der Schweiz» stehe, während die Schweiz völkisch und kulturell dem «deutschen Volksboden» zugehöre. Zitiert nach Fahlbusch 1999a, 681, Feststellungen von 1935 und 1938. Vgl. ebd., 399, entsprechende Diskussion an der Tagung der Westdeutschen Forschungsgemeinschaft 1939. Ähnlich die Äusserungen von Friedrich Metz (Freiburg i. Br.), z. B. am Lausanner Universitätsjubiläum, siehe oben, Kapitel 7.2.4.5.9 e. Von Wartburg 1943, 193. Von Wartburg 1943, 207.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
445
Nach seiner Auffassung wirkte die deutsche Sprache seit 1918 als derjenige Faktor, der die Deutschen über die in Versailles gezogenen Staatsgrenzen hinweg zusammenhielt. Dass Österreich bei Kriegsende die Vereinigung mit Deutschland untersagt wurde, galt ihm als «grosses Verbrechen».1831 Den 1938 vollzogenen ‚Anschluss‘ Österreichs begrüsste er dementsprechend als Notwendigkeit. Die Tschechoslowakei nahm er nicht als Opfer einer nationalsozialistischen Aggression wahr, sondern als Täterin, die das Deutschtum in ihren Grenzen unterdrückt habe und nun einer gerechten Strafe für «Übergriffe und Vergewaltigungen» zugeführt werde.1832 Und der Nationalsozialismus war in seiner Wahrnehmung eine zwar in einigen Aspekten unsympathische Erscheinung, die aber notwendig sei, um die Fehler von 1918 zu korrigieren, das deutsche Volk zu einen und den Bolschewismus zu bekämpfen. Noch über 1938 hinaus sah von Wartburg die starke, die Deutschen einigende Kraft der gemeinsamen Sprache am Werk: So würden Deutsche danach streben, aus dem Baltikum und aus dem Tirol abzuwandern, um sich in rein deutsche Siedlungsgebiete zu begeben.1833 b. Europäische Geschichte Germanophil war auch sein Bild von der Geschichte der Spätantike und des Frühmittelalters.1834 Die aktiven Kräfte, die massgebende Veränderungen bewirkten, identifizierte er mit den Germanen. Hauptsächlich germanischer Einfluss führte nach von Wartburg zur Sonderstellung des Französischen innerhalb der romanischen Sprachen. Mit dem germanischen (fränkischen) Einfluss in Synthese mit romanischem Wesen (gelegentlich erwähnte er auch «gallische» Faktoren, von «keltisch» sprach er fast nie) erklärte er die frühe Nationenbildung Frankreichs. Dabei betonte er stets, dass diese Wirkungen von einer Masseneinwanderung von Franken ausgingen, was er mit sprachgeschichtlichen Argumenten zu beweisen suchte, im Gegensatz zu der bei den Historikern geläufigen Annahme, nur eine kleine Elite hätte dies zusammen mit der Kirche bewirkt. Dass die Chro1831
1832
1833 1834
Von Wartburg erklärte in einem Brief an Hubschmied, 22. 11. 1935, dass er von einem französischen Diplomaten gehört habe, dass ein Anschluss Österreichs an Deutschland nicht im französischen Interesse läge. Diese Haltung sei für ihn «ein grösseres Verbrechen […], als alles was in der Schweiz Deutschland immer vorgeworfen wird, auch vorausgesetzt, dass alles wahr wäre. […] Wie soll Deutschland schliesslich nicht kriegerisch werden? Man zwingt es förmlich dazu, wieder selber für seine Bewegungsfreiheit zu sorgen.» Zitiert nach Hausmann 2017, 22. Von Wartburg 1943, 206–208, über die Tschechoslowakei 206. Derselbe Gedanke in: von Wartburg 1940. Der Untergang des tschechoslowakischen Staates sei verständlich; er habe aus Millionen widerstrebender Staatsbürger bestanden, die durch «Diktat zusammengestoppelt» worden seien. Von Wartburg 1943, 208. Link 2016, 516–520.
446
Geisteswissenschaftler
nistik ein anderes Bild zeichnete, irritierte ihn nicht: Die Fakten, die aus den Ortsnahmen und aus Lautverschiebungen sprachen, hielt er für sicherer als die «politisch» gefärbten Darstellungen der Chronisten. Insofern war von Wartburgs wissenschaftliches Selbstbild deutlich vom Faktenpositivismus des 19. Jahrhunderts und dem Willen zu einem Realismus geprägt. Zu den aktiven germanischen Kräften zählte er auch die Alemannen. Nach seinen Erkenntnissen waren und blieben diese dezidiert anti-römisch eingestellt (sie bewahrten «deutschen Charakter in völliger Reinheit»1835 ) und germanisierten das bereits romanisierte Elsass wieder komplett.1836 Auf die Festsetzung der Alemannen im später schweizerischen Mittelland und in gewissen Alpentälern (Goms, Walsersiedlungen) führte er auch den grundsätzlich germanischen Charakter der Schweiz und die geographische Isolierung der Rätoromanen von den romanischen Sprachgruppen im Westen zurück.1837 Ebenso erklärte er die Unfähigkeit der Schweizer, konsequente Grossmachtpolitik zu betreiben (gedacht war an die Vorstösse der Berner in die Freigrafschaft und der Zentralschweizer in die Poebene), mit dem alemannisch geprägten Volkscharakter.1838 7.2.4.5.5 Volk, Rasse, Raum, «Lingua Tertii Imperii» a. Volk und Raum Walther von Wartburg dachte und schrieb völkisch in der Art der rechten kulturellen Opposition zur wilhelminischen und zur Weimarer Zeit.1839 Er liess sich immer wieder von einem narrativen Automatismus tragen: Zwar erklärte er mehrfach, dass Sprache ein Ausdruck und ein Gefäss für Geistiges und Seelisches sowie als «Rede» ein Feld individueller Kreativität sei. In seinen sprachgeschichtlichen Überblicksdarstellungen verschob sich die Argumentation jedoch von Sprache zu Sprachgemeinschaft und von da zu Volk; aus der Geschichte der romanischen Sprachen wurde eine Entstehung der romanischen Völker. Anderswo 1835 1836 1837
1838 1839
Von Wartburg 1936. Von Wartburg 1939, 93. Die Betonung der Zugehörigkeit der (deutschen) Schweiz zum alemannischen Raum implizierte in den 1930er Jahren die Idee, die Schweiz gehöre eigentlich zu Süddeutschland, und weckte die Befürchtung, dahinter stehe eine Annexionsabsicht – was auch immer wissenschaftlich daran korrekt gewesen sein mochte. Quarthal 2007, 47. Theodor Mayer als Leiter des Alemannischen Instituts, Freiburg i. Br., verlangte aus diesen Gründen die Änderung des Namens der Institution in «Oberrheinisches Institut für geschichtliche Landeskunde», was am 8. 3. 1936 bewilligt wurde. Mayer an Reichs- und Preussisches Ministerium des Innern, 9. 1. 1936, in: Stadtarchiv Freiburg i. Br., C4/X/19/10. Fahlbusch 1999, 370 f. Von Wartburg 1939, 93. Link 2016a; Breuer 2008; Mohler 1950, 167.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
447
formulierte er explizit, dass Völker aus Sprachgemeinschaften entstehen; die beiden Begriffe wären demnach nicht synonym.1840 Zwar versuchte er an vielen Stellen seiner Werke klarzustellen, dass «Volk» in seinen Darstellungen nur «Sprachgemeinschaft» meine. Aber unter der Hand identifizierte er «Völker» mit «Stämmen», die als materielle (biologische) Träger der Sprache handelten, und umgekehrt interpretierte er sprachgeschichtliche Dokumente als Spuren der Aktivitäten dieser «Volksgemeinschaften», die dann nicht mehr blosse «Sprachgemeinschaften» waren.1841 Walther von Wartburg nannte sein Unterfangen gelegentlich «Volksgeschichte». Zugleich suchte er die Bewegung von Volk im Raum historisch zu erfassen. Damit begab er sich in ein Feld, das in den 1920er Jahren bei den Historikern zur Avantgarde gehörte.1842 Ob dies auch für die Sprachgeschichtler galt, bleibt offen; wenn ja, war er hier wohl ein Pionier. Vielleicht brachte ihn die Kooperation mit Theodor Frings1843 zu dieser Terminologie, aber denkbar ist auch, dass er sie bei den Historikern direkt ausborgte. Damit praktizierte von Wartburg eine bestimmte Strategie innerhalb der Sprachwissenschaft. Auf dem Weg zu einer dominanten Position in diesem Feld wählte er (aus Überzeugung, nicht taktisch) die Rolle des Neuerers, der allerdings nicht als radikaler Rebell auftrat, sondern zwei bereits anerkannte Ansätze, die diachrone und die synchrone Betrachtungsweise, vereinigte. Dabei versprach er, seine Art Sprachwissenschaft zu treiben sei ganzheitlich und habe fächerübergreifendes Potential, ja sie sei berufen, diese Wissenschaft ins Zentrum der Erforschung des Humanen schlechthin zu stellen.1844 Zugleich war sein Wissen ausserhalb des wissenschaftlichen Feldes für die völkischen Auffassungen nützlich, die von Sprachgrenzen und grossräumigen, anonymen Entwicklungen in der Geschichte fasziniert waren. Typischerweise wurde dabei die Eroberung von «Raum» für ein Volk thematisiert, das in zu engen Verhältnissen existierte. Es nehme nach dieser Vorstellung stets seine Kultur mit und präge damit den neu erschlossenen Raum. Dabei ging es von Wartburg wie den Volks- und Raumhistorikern weniger um die Leistung einzelner als um die Errungenschaften der Vielen. Diese bewegten sich 1840 1841 1842 1843
1844
Von Wartburg 1943, 189. Kritik dieser Begrifflichkeit: Ribi 1939, sowie Kaegi 1940 und 1942. Haar 2002; Flügel 2000; Schöttler 1999; Oberkrome 1993. Oberkrome 2003; König 2003, Bd. 1, 528–531. Theodor Frings sah in von Wartburg einen Bundesgenossen für volksgeschichtliche Ansätze. Er unterstützte deshalb von Wartburgs Berufung nach Leipzig energisch, vgl. UA Leipzig, PA 1029, Protokoll der Fakultätskommission 1928. Der Verzicht auf jede deutschnationale Rhetorik im Bericht dieser Kommission deutet darauf hin, dass es sich damals um eine methodologische, weniger um eine weltanschauliche Erwartung handelte. Ebd., Kommissionbericht vom 27. 10. 1928, Blatt 24, und Antrag der Fakultät an das Sächsische Ministerium für Volksbildung, Blätter 26 ff. Von Wartburg 1939a, 76.
448
Geisteswissenschaftler
durch den Raum als Masse, nur durch den Namen eines «Stammes» bezeichnet. Sie erschienen metaphorisch als Flüssigkeit, als Strom, der sich ergiesst, oder als Kraft, die einen «Druck» ausübt auf andere Völker. Diese Auffassung der Völkerwanderung war vorgeprägt. Trotzdem fällt auf, wie sehr er sich um die Inszenierung und Dramatisierung dieses Raumgeschehens bemühte und alles ins Grosse, Kontinentale wendete. b. Rasse In einem gewissen Sinne hing von Wartburg dem Rassengedanken an. Er konnte zwar deutlich erklären, dass das Adjektiv «germanisch» kultur- und sprachgeschichtlich etwas anderes bedeute als im Zusammenhang einer Rassengeschichte. Insofern waren die Völker, die sich in der Geschichte durch Europa bewegten, eben «Volksgemeinschaften» im Sinne von «Sprachgemeinschaften», die die Subjekte der «Volksgeschichte» waren, und nicht «rassisch» definierte Gruppen.1845 Immerhin sprach er ihnen konstante Eigenschaften zu: Der alemannische Stamm der Germanen war für ihn wie erwähnt grundsätzlich zur Bildung von «Staaten» unfähig und dem Romanischen feindlich gesinnt, im Gegensatz zu den Franken. Und er erklärte sehr deutlich, «Rasse» sei ein naturwissenschaftlicher Begriff. Das bedeutet einerseits, dass Rassen für ihn wissenschaftlich gesicherte Realitäten waren. Andererseits befreite ihn diese ‚Delegation‘ der Rasse an die Naturwissenschaften von rassistischen Argumentationen in seiner eigenen Wissenschaft zugunsten einer kulturgeschichtlichen Konzeption. Auch unterstrich er, dass es nie gelungen sei, Rasse und Sprache in ein unmittelbares kausales Verhältnis zueinander zu bringen.1846 Das ist bemerkenswert. Aber im gleichen Federzug suchte er wieder nach Wirkungen der Rasse auf die Sprache, indem er annahm, dass die Rasse zwar nicht die geistige Sphäre determiniere, wohl aber Einfluss auf das emotionale Leben und damit auf den sprachlichen Ausdruck in diesem Bereich ausübe. Deshalb konnten nach von Wartburg Angehörige beliebiger «Rassen» sich zwar fremde Sprachen aneignen und sich den entsprechenden Sprachvölkern «assimilieren», denn Sprachgemeinschaften seien offen für Menschen verschiedener «blutmässiger» Herkunft.1847 Aber im Gebrauch der Ausdrücke für Emotionen und «geistige Wertungen» sei Fremden eine völlige Assimilation nicht möglich, da diese mit dem Charakter des 1845
1846 1847
Relativ klar ausgeführt am Anfang in: von Wartburg 1939, v, 2–5. Im Haupttext erschien der Begriff «Volksgeschichte» nur einmal (102) und dort in einem Kontext, wo von «fränkischem Blut» geschrieben wurde, das «in grossen Mengen nach Nordgallien» einströmte. «Alle Versuche, Sprache und Rasse in ursächlichen Zusammenhang zu bringen, waren von vornherein zum Scheitern verurteilt.» Von Wartburg 1943, 188. Von Wartburg 1943, 188.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
449
Individuums zusammenhingen, der seinerseits «zum grossen Teil von seiner rassischen Herkunft bestimmt» sei, meinte er.1848 Die Bedeutungen von Rasse wie Kultur waren flexibel, und allgemein scheint in Deutschland tendenziell der während der frühen nationalsozialistischen Zeit dominierende Rassediskurs in der Wissenschaft gegen Ende der 1930er Jahre durch Kulturbegriffe abgelöst worden zu sein. Das bedeutete aber nicht in jedem Fall einen Wechsel der Überzeugungen, da die Begrifflichkeit mancher Autoren «opportunistisch» blieb.1849 c. Lingua Tertii Imperii Schliesslich zeigte von Wartburg dort, wo die erwähnten narrativen Automatismen seine Darstellungen prägten, charakteristische sprachliche Vorlieben. Seine Neigung zum Grossräumigen, Gewaltigen, Kraftvollen gab insbesondere Anlass zu einer schweizerischen Kritik (auf die ich noch zurückkomme) und erweckte den Verdacht, er bewundere diejenigen Völker, die in der Lage waren, grosse Räume zu besetzen und zu strukturieren. Wie oft plädierte er dafür, dass seine Anschauung durch die sprachgeschichtlichen Zeugnisse gedeckt sei und deshalb voraussetzungslose Wissenschaft repräsentiere – es sei der Leser, der die politischen Bezüge auf grossdeutsche Ideen und auf nationalsozialistisches Gedankengut in seine Texte hineintrage. Dennoch fielen Kraftausdrücke, Superlative, die Magie der grossen Zahl, Bilder, die aus der Hydraulik entlehnt waren, teleologische Argumente, der Appell an die «Vorsehung» und die «Aufgaben», die ein ungenanntes Subjekt den historischen Akteuren gestellt haben soll, auf. Das Eindringen, ja «Einströmen» der Franken in Nordgallien habe «gewaltige Folgen» gehabt und einen «ungeheuren Umwandlungsprozess» angestossen.1850 Historisches Geschehen bestehe aus «gewaltigen Ereignissen», das Römerreich unterliege der «Zersetzung», während die Germanen «kraftvoll eingreifen» und «mit germanischer Volkskraft gesättigt» gewesen seien; sie verfügten über «gewaltige Lebensfülle, mit der (sie) das damals alt gewordene Abendland erneuert haben».1851 Lokale Verschiebungen im Sprachgebrauch wurden aufgebauscht zu
1848 1849 1850 1851
Von Wartburg 1943, 184, Fussnote. Fahlbusch 1999, 797. Von Wartburg 1943, 38. Diese Wendungen finden sich in: von Wartburg 1936. Die völkische Terminologie trat zwar hier gegenüber den anderen Darstellungen zurück; schon im Titel standen statt (wie bei von Wartburg 1939) «Völkern» nun «Sprachräume»; für «Volk und Rasse» schrieb er hier «Sprach- und Kulturgemeinschaft». Die Thesen unterschieden sich jedoch nicht wesentlich. Durch weitgehende Sachlichkeit und fast völliges Fehlen dieser Volks-Rhetorik sticht aus dem von Wartburgschen Werk (ich beziehe mich auf das bei der Basler Beru-
450
Geisteswissenschaftler
«kämpferischem» Ringen um «Raum»; soziolinguistische Veränderungen deutete von Wartburg als das Ergebnis von «Kämpfen» zwischen sozialen Schichten.1852 Die Grammatik des Englischen rückte er wegen der Konjugation in die Nähe von «Negersprachen».1853 Man könnte diese Redeweisen mit Klemperer der «LTI», der «Lingua Tertii Imperii» zurechnen,1854 hätte ich nicht den Eindruck gewonnen, dass diese ‚Stilmittel‘ zu einem Repertoire gehörten, das sich von Wartburg schon lange vor 1933 angeeignet hatte. Ich könnte das als generationstypisch abtun, hätte ich nicht Einwände von Zeitgenossen gelesen, die diese automatischen Übergänge von Sprache zu Volk und zu «Stamm» kritisierten und denen die narrativen Automatismen zu denken gaben. Zum Zeitpunkt, da von Wartburg nach Basel gewählt wurde, konnte festgehalten werden, dass die Voraussetzung, dass Sprache auf Volk schliessen lasse, eine unbeweisbare Vorannahme sei.1855 Von Wartburg liess sich aber nicht belehren, sondern behauptete weiter mit Nachdruck, dass sprachgeschichtliche Fakten der Beweis dafür seien, dass die Germanen-Franken massenhaft in Nordfrankreich «eingeströmt» seien und nicht nur die romanische Sprache auf eine spezifische Art verändert, sondern dem französischen Charakter die Anlage zur Nationen- und Staatenbildung mitgegeben hätten. Dies lehrte er nicht nur in Deutschland, sondern noch 1943 in einem Vortrag vor der Basler Historischen und Antiquarischen Gesellschaft. 7.2.4.5.6 Publizieren in Deutschland Fachwissenschaftliche Veröffentlichungen in Deutschland herauszubringen, war für deutschsprachige Wissenschaftler die erste Wahl, besass doch das deutsche Verlagswesen eine herausragende Stellung. Von Wartburg bevorzugte aber bestimmte Publikationsorte für seine publizistischen Arbeiten. Schon seine zweite ausserwissenschaftliche Veröffentlichung, über die Schweizer «Kriegsziele» im Ersten Weltkrieg, brachte er 19171856 in der deutschen Zeitschrift «Die Tat» un-
1852 1853 1854
1855 1856
fung schon vorliegende oder kurz nachher noch erschienene Schrifttum) von Wartburg 1936a hervor. Diese grosse Arbeit ist in jedem Wortsinn unpolitisch. Von Wartburg 1943, 23. Von Wartburg 1943, 64. Er beobachtete die Neigung der ehemaligen Sklaven in Louisiana, im Französischen in der Art «toi aller» (statt «tu vas») zu konjugieren. Hausmann 2000, 525, ist «überrascht», dass sich von Wartburg der «nationalsozialistischen Terminologie und Metaphorik» bedient (vor allem in Entstehung der romanischen Völker) und diese auch in der Neuauflage 1951 nicht beseitigt habe. Siehe unten den Artikel in der NZZ und die Kritik, die Werner Kaegi an von Wartburgs Schriften übte. Oft wird als Jahr 1916 angegeben. Der Aufsatz wurde aber in Heft 10 des 8. Jahrgangs veröffentlicht (Seiten 883–891), und dieses Heft kam 1917 heraus. Von Wartburgs erste
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
451
ter. Von den 1920er Jahren bis in die 1940er Jahre publizierte er dann in den «Schweizer Monatsheften», dem Organ der Germanophilen und Gegner der Zugehörigkeit der Schweiz zum Völkerbund.1857 Sein Ziel war ein Werben um Verständnis für Deutschland in der Schweiz und für die Schweiz in Deutschland, verbunden mit einer abgekürzten Darstellung seiner sprach- und volksgeschichtlichen Einsichten unter starker Betonung der Kulturleistung der Germanen im frühen Mittelalter. Auch sein 1940 erschienenes Bekenntnis zum Schweizer Patriotismus veröffentlichten die «Monatshefte». Prononciert stellte er mindestens zweimal eine an Deutsche adressierte Erklärung zur Schweiz, die sowohl sprachlich ein Teil der deutschen Gemeinschaft sei als auch historisch und politisch eine staatliche Sonderstellung beanspruche, an den Schluss eines in Deutschland veröffentlichten Buches.1858 Von Wartburg hatte sich insbesondere mit dem Verlag Max Niemeyer in Halle verbunden, der nicht nur seine Monographien herausbrachte, sondern auch die «Zeitschrift für romanische Philologie». Als Herausgeber dieser wichtigsten deutschen romanistischen Zeitschrift seit 1935 war von Wartburg persönlich daran interessiert, qualitätsvolle Manuskripte nicht nur aus Deutschland zu erhalten. Den Ausschluss der deutschen Juden aus dem Verlags- und Zeitschriftenwesen nahm er zwar hin, aber er gestand ausländischen Juden Publikationsmöglichkeiten zu. Verlag und Redaktor wollten die «Zeitschrift für romanische Philologie» als wissenschaftlich hochstehendes Organ führen, in dem Arbeiten erscheinen konnten, die keinen Bezug zur herrschenden Ideologie aufwiesen. Von Wartburg sah darin eine verdienstvolle Aufgabe, die er für die deutschsprachige Romanistik zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft erfülle. Erreichbar war dieses Ziel allerdings nur mit Abstrichen und Konzessionen, und es durfte nicht offen verkündet werden. Kein Verständnis hatte von Wartburg für eine radikale Kritik an dieser Art seines Wirkens als Herausgeber und Redaktor, die von einer grundsätzlich antifaschistischen Warte aus vorgetragen wurde. In dieser Perspektive trug seine Zeitschrift dazu bei, dass das nationalsozialistische Deutschland nach aussen als ein Land erschien, das weiterhin hochstehende, reine Wissenschaft pflegte, und damit unterstützte von Wartburg eine Tendenz des Regimes, ‚Normalität‘ und ‚Salonfähigkeit‘ gegenüber dem Ausland zu demonstrieren. Dass er auch sonst dieser Tendenz aktiv zuarbeitete, ergibt sich aus seiner Korrespondenz und seinem Auftreten in Chicago.1859 Die Notwendigkeit der Gründung einer unabhängigen
1857 1858 1859
politische Veröffentlichung erschien in der «Kölner Zeitung» und behandelte die schweizerische Antwort auf den italienischen Irredentismus. Urner 1971. Von Wartburg 1943, 209. Auch schon in: von Wartburg 1939, als Schlussmotiv. Auf die einschlägigen Äusserungen von Wartburgs und die Auseinandersetzung zwischen Leo Spitzer und Walther von Wartburg gehe ich unten näher ein.
452
Geisteswissenschaftler
schweizerischen Romanistenzeitschrift «Vox Romanica», die Jakob Jud und Arnald Steiger angesichts der nationalsozialistischen Gleichschaltung betrieben (1936), sah von Wartburg nicht ein. An Niemeyer hielt er noch 1943 fest, als das Papier in Deutschland knapp und von schlechter Qualität war und ein kompetentes Lektorat nicht mehr bestand.1860 7.2.4.5.7 Patriotismus und das Bild der Schweiz Walther von Wartburg war ein rechtsfreisinniger Deutschschweizer Patriot: Patriot deswegen, weil er die Existenzberechtigung der Schweiz als eines viersprachigen, demokratischen Kleinstaats immer verteidigte und sich diesem (neben Deutschland) zugehörig und verpflichtet fühlte. Nie wollte er sein Schweizer Bürgerrecht aufgeben. In Leipzig erreichte er einen Ausnahmestatus, da er die deutsche Staatsbürgerschaft, die für beamtete Professoren an sich obligatorisch war, nicht annehmen musste. Von Wartburg sah die Schweiz in Gemeinden, Kantone und Sprachregionen gegliedert; insofern war er Föderalist. Freiheit und demokratische Selbstbestimmung bezog er auf diese kleinen Einheiten, aber auch auf das Individuum, nie aber auf eine soziale Gruppe. In der Schweiz stehe die «Idee der menschlichen Persönlichkeit» im Mittelpunkt; sie bilde eine Gemeinschaft ohne Zwang.1861 Die Schweiz sei keine Demokratie im «westlichen» Sinne, da das politische Leben nicht auf Parlamentarismus, Volksrepräsentation und einer von der Mehrheit der Volksvertretung abhängigen Regierung beruhe.1862 Die Freiheitsliebe, die er in alpinen Wanderungen auslebte, und die Neigung, sich dem einfachen Landvolk zugehörig zu fühlen, lassen auf seine freisinnige Grundhaltung schliessen. Nicht Arbeiter, sondern Bauern und Städter machten für ihn die Schweiz aus, entsprechend hasste er die Linken, und er gab auch zu verstehen, wie gering er die Pressefreiheit achtete.1863 Seine Verachtung galt ferner den «In-
1860 1861 1862
1863
Von Wartburg 1943. Von Wartburg 1940. Der anti-westliche Zug, der sich in von Wartburg 1917 gefunden hatte, erschien ungebrochen wieder in: von Wartburg 1940. Vgl. die Entgegensetzung der «naturnotwendig gewachsenen» Demokratie der Schweiz zu «der künstlichen und überstürzten Demokratie der Weimarer Verfassung» durch Emil Ermatinger 1937, zitiert in: Schütt 1996, 80, und die Auffasungen von Muschg, oben. In einem Brief vom 18. 11. 1915 bezeichnete er die Journalisten der sozialdemokratischen Zeitung «Tagwacht» als «Lausbuben» und forderte ein strenges Pressegesetz. Zitiert nach Hausmann 2017, 16. Von Wartburg 1917, 888, zitiert zustimmend Boos 1915 (Vorlesungen aus dem Wintersemester 1914/15), der als typischen Schweizer Fehler «das ekle Plebejertum» nannte, «das sich unter Missbrauch des Titels ‚demokratisch‘ bei uns breit macht».
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
453
tellektuellen» in der Schweiz, die sich für Völkerverständigung, Friedenssicherung und Internationalität einsetzten.1864 Deutschschweizer war er insofern, wie ich oben erwähnt habe, als er in der Zugehörigkeit zum deutschen «Stamm» eine kulturelle Lebensnotwendigkeit sah. Im Ersten Weltkrieg kritisierte er Spittelers Schweizer Standpunkt1865 nicht offen, verlangte aber das Recht, mit dem deutschen Reich zu sympathisieren und seinen Sieg herbeizuwünschen. Gleiches Recht konzedierte er den Schweizer Angehörigen des französischen «Volkes», aber nur unter der Voraussetzung, dass dessen pro-französische Haltung nicht zu publizistischen Angriffen auf Deutschland führte – solche aggressiven Ausfälle ebenso wie Spittelers Standpunkt würden die Deutsch-Schweizer von den Deutschen entfremden und umgekehrt.1866 Das gegenseitige Verständnis und der kulturelle Austausch zwischen den Staaten Schweiz und Deutschland galten ihm als Voraussetzung dafür, dass das ‚Reich‘ die staatliche Existenz der Schweiz anerkannte. Die «Blutsverwandtschaft unseres Staatslebens mit dem Deutschlands» zeige sich im Recht (keine Rezeption des Römischen Rechts), in der Mundart, im Föderalismus, im Fehlen eines Zentrums; die Schweiz schliesse direkt an «den mittelalterlichen Feudalstaat, jene rein germanische Form des Gemeinschaftslebens», an. An dieser 1917 in der deutschen Monatsschrift «Die Tat» veröffentlichten Position1867 hielt er auch in den 1930er Jahren fest, und sie war für ihn bis 1939 mit seinem Wirken als Schweizer im (inzwischen nationalsozialistisch beherrschten) ‚Reich‘ bestimmend. Von der gemässigten, von Annexionsideen (vorübergehend) Abstand nehmenden Position im Nationalsozialismus sah er sich darin bestärkt.1868 So war es kein Zufall, dass er wiederholt Aufsätze in derjenigen schweizerischen Zeitschrift veröffentlichte, die diese germanophile Stossrichtung besonders pflegte, den «Schweizer Monatsheften».
1864 1865 1866
1867
1868
Von Wartburg 1917, 883 f. Spitteler 1915. «Graben» zwischen der romanischen und der deutschen Schweiz im Ersten Weltkrieg: Mittler 2003. Von Wartburg zitiert zustimmend Paul Wernle, Gedanken eines Deutschschweizers, und warb ausführlich für seinen Schwager Boos. Die ängstlichen Versuche, den Graben zuzuschütten, «verstimme» die Reichsdeutschen. Von Wartburg 1917, 885. Von Wartburg 1917, 884 f. Ob zustimmend oder nicht, bleibt offen, aber wörtlich zitiert er dort, 888, Roman Boos, der den deutschen Überfall auf Belgien unter dem «Notstandsgesichtspunkt» betrachtet wissen wollte: Auch wenn Deutschland hier «gesündigt» habe, dürften sich die Deutschschweizer nicht «vor einer tiefen und wertvollen Gemeinschaft [mit Deutschland] drücken». Friedrich Metz als Leiter der deutschen Delegation bei der Lausanner Universitätsfeier 1937 «namens der Abordnung der Hochschulen des Deutschen Reiches» in Gegenwart von von Wartburg, der dieser deutschen Delegation angehörte. UA Freiburg i. Br. B0001, 133, 1937.
454
Geisteswissenschaftler
Die Rolle der Sprachgrenzen im schweizerischen ‚Sonderfall‘ bildete ein sehr auffälliges Motiv in seinem Bild der damaligen Schweiz. Nur bei Erhaltung der Verschiedenheit der Sprachgruppen sei eine gegenseitige Befruchtung und Ergänzung möglich, die die Schweiz lebensfähig erhalte. Alle Teile sollten sich an die grossen entsprechenden Nachbarnationen kulturell anlehnen und sich mit deren Geschicken solidarisch zeigen, sofern sie darob die gemeinsamen schweizerischen Interessen nicht verrieten und sich nicht gegenseitig schmähten. Als Voraussetzung für das friedliche Funktionieren dieser Beziehungen betrachtete von Wartburg den Umstand, dass sich die Territorien der jeweiligen Sprachgemeinschaften nicht veränderten. Damit stellte er sich in die Nähe der Heimatschützer und Sprachvereine, die eifersüchtig Bevölkerungsstatistiken analysierten, um festzustellen, ob sich etwa die Romanen im Jura oder in Biel zuungunsten der Germanen vermehrt und ausgedehnt hätten. Auch plädierte er für eine sprachliche ‚Reinheit‘ innerhalb der Sprachräume. Gerne berichtete er, dass er in seiner Kindheit im Solothurnischen fast nie Französisch sprechen gehört habe. Er lobte die Schweiz dafür, dass es keine sprachlichen Minderheiten gäbe, die im selben Territorium neben einer Sprachmehrheit lebten, so gäbe es keine Sprachkolonien und deshalb auch keinen Sprachenstreit in der Schweiz.1869 Sprachgrenzen waren auch das Thema, über das er noch 1940 in Deutschland referierte.1870 Auf diese Weise wurde Germanophilie mit schweizerischem Patriotismus nicht nur vereinbar, vielmehr deklarierte von Wartburg die Germanophilie geradezu als Voraussetzung für seine schweizerische Vaterlandsliebe. 7.2.4.5.8 Von Wartburgs Agenda – Zwischenbilanz Von Wartburg verfolgte offensichtlich eine kohärente Agenda. Für die Schweiz ging es ihm um die Erhaltung ihrer Selbstständigkeit. Die schweizerische «Volksgemeinschaft» beruhte auf historischen Erfahrungen («Schicksalsgemeinschaft»), nicht auf gemeinsamer Sprache; sie war neben der äusseren Unabhängigkeit durch innere Freiheit für die Entfaltung ihrer Elemente bis hinab zu den Individuen charakterisiert. Der kulturelle (aber gerade nicht staatliche) Zusammenhang mit den benachbarten grossen Sprachnationen war entscheidend, um der kulturellen Verarmung entgegenzuwirken und deren Sympathie für die Schweiz zu erhalten. Die Deutschschweizer sollten dabei für die deutsche Nation und den deutschen Staat weitgehendes Verständnis zeigen. Umgekehrt sollten Deutsch-
1869 1870
Von Wartburg 1940, 10. Einverständnis mit der Einladung von Wartburgs zu einem einstündigen, nichtöffentlichen Vortrag über romanisch-germanische Sprachgrenzen. Rektor der Universität Freiburg i. Br. an den Vorsteher des dortigen Romanischen Seminars, Friedrich, 23. 3. 1940, in: UA Freiburg i. Br., B0001, 319.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
455
schweizer dafür werben, dass Deutsche ihnen Sympathie und Achtung entgegenbrächten. Eine gewisse Art von ‚Demokratie‘ sei für die kleine Schweiz wichtig, nicht aber für grosse Nationen vorstellbar. In der Schweiz bedeute Demokratie föderalistisch-freiheitliche Selbstentfaltung von unten nach oben, nicht einen Parlamentarismus und schon gar nicht ein Regulativ zur Bewältigung von sozialen Konflikten. Hinsichtlich der Freiheit und des Föderalismus sei Deutschland der Schweiz am nächsten verwandt, während Frankreich und England von Wartburgs tiefes Misstrauen auf sich zogen. Er hatte keinen Bedarf für eine Identifikation des Romanischen mit Menschen- und Bürgerrechten oder kritischer Rationalität1871 – auch wenn er französischen Fachkollegen sehr freundlich begegnen konnte.1872 Wissenschaftlich hatte in dieser Agenda die Erhellung der Sprachgeschichte vor allem im Bereich der «Romania» Priorität. Diese Priorität lief auf eine «Volksgeschichte» oder besser «Völkergeschichte» hinaus, die nachzeichnen sollte, wie sich unter dem Einfluss der massenhaften Verschiebung von Völkern Sprachen wandelten und Sprachgrenzen verschoben. Innerhalb der grossen Bewegungen kam germanischen «Stämmen» eine Schlüsselrolle zu. In einer solchen Perspektive wird das FEW ein Mittel zum Zweck der Völkergeschichte, nicht umgekehrt, auch wenn ich nicht bestreiten will, dass die Hauptsorge und Hauptarbeit von Wartburgs immer diesem Grossprojekt galten. Schlüsselwerk für meine Betrachtungsweise ist das Buch über die Entstehung der romanischen Völker von 1939. Wie jede Perspektive verdeckt diese Betrachtungsweise andere Aspekte der Person. Zum Beispiel in den in Italien gehaltenen Vorträgen und in der Einführung in die Sprachwissenschaft von 1943 zeigte sich von Wartburg als Humanist. Die Sprachwissenschaft war in diesem Zusammenhang für ihn ein Schlüssel zum Verständnis des Menschen in seinen Dimensionen vom schöpferischen Geist bis zum Unterbewussten, von der Gemeinschaft, in die er hineinwächst und die ihn bestimmt, bis zur kreativen Freiheit des Ausdrucks in der individuellen Rede.1873
1871
1872
1873
Einschlägig ist hier seine Reaktion in der Kontroverse mit Leo Spitzer auf dessen Axiom, dass «ein wahrer Freund des Romanischen den neuen Idealen nicht erliegen» könne, siehe unten. In Frankreich erhielt er zwar nie eine staatliche Auszeichnung, war aber bei den meisten Fachkollegen hoch angesehen und persönlich beliebt. Dies zeigte die Reaktion auf die Denunziation von Wartburgs als Naziagent durch René Étiemble 1974, in: Revue de linguistique romane, Lieferungen 149–152. Von Wartburg 1943: Thema der «Strukturgeschichte der Sprache» sei «Sprache […] als Teil […] der gesamten menschlichen Existenz» (25); die Aufgabe des FEW sei es, «das Wesen des Sprachschatzes als [Element] der Gestaltung des Weltbildes einer Volksgemeinschaft […] zu erfassen» (161). Siehe auch von Wartburg 1939a, 76.
456
Geisteswissenschaftler
7.2.4.5.9 Professor in Leipzig und Verhältnis zum Nationalsozialismus a. Das Verhalten als Leipziger Professor Mit der Übersiedlung nach Leipzig eröffnete sich für von Wartburg 1929 die Chance, Unterstützung für seine Arbeiten am FEW zu erhalten; auch die Finanzierung von Publikationen liess sich vergleichsweise leicht arrangieren. Das galt allerdings nicht für die Jahre 1931 bis 1933. Wiederholt war er Opfer von Kürzungen, und immer wieder wandte er sich deswegen mit Beschwerden an das sächsische Ministerium für Volksbildung. 1932 wollte er die Schweizerische Gesandtschaft in Berlin dazu bewegen, für ihm beim Auswärtigen Amt zu intervenieren – was das Politische Departement in Bern unverhältnismässig fand.1874 Erst ab 1934 gelang es ihm, schrittweise sein Einkommen zu optimieren (das er nach eigener Aussage auch für die Finanzierung des FEW verwendete) und einen bezahlten Mitarbeiterstab aufzubauen. Die Ablehnung von Rufen nach Köln und Genf sowie eine Drohung mit der Rückkehr in die Schweiz nutzte er dafür nach den üblichen akademischen Regeln aus.1875 Solange die akademische Selbstverwaltung in Leipzig noch intakt war, nutzte von Wartburg seine Mitwirkung an Fakultätssitzungen und in Kommissionen dazu, einen eigenen Nachwuchs aufzubauen.1876 Unter der Weimarer Republik 1874
1875
1876
Von Wartburg an Sächsisches Ministerium für Volksbildung, undatiert, mit Bezug auf seine Eingabe vom 16. 11. 1931; dann an dasselbe, 18. 2. 1932. Von Wartburg an die Schweizerische Gesandtschaft in Berlin, 27. 2. 1932; Antworten derselben an von Wartburg, 8. 3. 1932, und 24. 3. 1932, in: Nachlass von Wartburg, IV:1. Tatsächlich waren alle Professoren in Sachsen Opfer einer Sparverordnung von 1931, die durch die Weltwirtschaftskrise veranlasst wurde. Die Konditionen, die in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre sehr gut geworden waren, verschlechterten sich zum Teil nur vorübergehend. Im ‚Dritten Reich‘ wurden die Sonderrechte der Professoren ab Mitte der 1930er Jahre abgebaut. Dietel 2015, 670 f., 679. 1929 versuchte die Universität Lausanne resp. der Kanton Waadt, ihn zurückzugewinnen: Doyen Arnold Reymond an von Wartburg, 10. 5. 1929. Ablehnung des Rufes nach Genf: Ministerialrat Ulrich an von Wartburg, 14. 7. 1932 und 4. 8. 1932. Rückkehr in die Schweiz: Von Wartburg an Ministerialrat Dr. Lange, 15. 1. 1934, mit Hinweis auf einen «Basler Kollegen, der in absehbarer Zeit sich emeritieren lassen will» und der ihn zum Nachfolger haben möchte; auch in Bern sei das Extraordinariat noch frei, das er bis 1929 innehatte. Ablehnung des Rufes nach Köln: Ministerium an von Wartburg, 20. 5. 1935; Rektor Krieger an von Wartburg, 31. 5. 1935, und Entscheide über Zusatzkredite vom 22.6. sowie 17. 9. 1935. Alles in: Nachlass von Wartburg, IV:1. Ferner der Kommentar von Ernst Robert Curtius, der in Köln eine Stellvertretung versah, in: Hausmann 2015, 327, Brief Nr. 173 an Walther von Wartburg, 1. 6. 1935. Als Beispiel sei von Wartburgs Förderung der Karriere des SA-Mannes Alwin Kuhn erwähnt, den er 1935 zum PD ernennen liess. Während von Wartburgs Gutachten über Kuhns Schrift noch rein wissenschaftlich dahergekommen war, bewegten sich seine Empfehlungen für die Habilitation und damit auch für die Person Kuhns entlang der Grenze
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
457
protestierte er noch gegen die weitgehende Toleranz, mit der der Senat den Umtrieben nationalsozialistischer Studenten in der Universität begegnete.1877 In der nazifizierten Universität hielt er sich bedeckt, und sein Name erschien mit einer Ausnahme in keiner akademischen Funktion.1878 Nach Möglichkeit lud er internationale Kollegen nach Leipzig zu Vorträgen ein, die der sächsische Staat über das Universitäts-Rentenamt finanzierte.1879 So hatte er in Leipzig eine Gruppe qualifizierter Mitarbeiter zur Hand und genoss die materielle Unterstützung des Staates und der DFG. Andere Finanzierungsquellen kann ich nicht feststellen. An der ‚Gemeinschaftsforschung‘ nahm er anscheinend nicht unmittelbar Anteil, obschon ihn Fahlbusch zu den Angehörigen der Westdeutschen Forschungsgemeinschaft rechnet.1880 Zudem wurden seine Auslandsreisen anstandslos bewilligt und finanziert. Abgesehen von Kritik an einigen «Übeln» (sein eigenes Wort)1881 teilte von Wartburg den Enthusiasmus der ersten Jahre der NS-Diktatur, die er als Ära der Befreiung von der Fessel von ‚Versailles‘, als Lösung der politischen Krisen der Weimarer Republik und vor allem als nationale Wiedergeburt des Deutschtums begrüsste. In privaten Briefen an Schweizer rechtfertigte er «Übel» wie die Existenz von Konzentrationslagern damit, dass sich Deutschland gegen die vom Bolschewismus ausgehende Gefahr mit harten Mitteln zur Wehr setzen müsse.1882 Gegen die Entfernung jüdischer Kollegen aus dem wissenschaftlichen Leben protestierte er nicht. Vielmehr übernahm er den Sitz eines solchen, Wilhelm Friedmann, im engeren Vorstand der Deutsch-Französischen Gesellschaft und versprach dem Ministerium, er werde dafür sorgen, dass «auch im erweiterten
1877 1878
1879 1880 1881 1882
zu eigentlichen nationalsozialistischen Äusserungen. UA Leipzig, PA 0667, Blätter 10 ff. und 19 ff. Zusammen mit Theodor Frings stellte er im Herbst 1932 kritische Fragen zur Haltung des Senats im Fall Kessler. Von Hehl 2010, 178–180. Protokoll der Philologisch-Historischen Abteilung der Philosophischen Fakultät und der Gesamtfakultät, 1920–1951. UA Leipzig Philosophischen Fakultät A3/30 Bd. 3 (UA Leipzig Filme 0030 und 0031). UA Leipzig, Film 985, Rentenamt, Nr. 1341. Als Bsp. Bewilligung Kosten Gastvortrag Marcel Raymond, Vortrag vorgesehen für den 18. 1. 1932, ebd., 28. 11. 1931, Blatt 28. Fahlbusch 1999, 349. Diese Einschätzung beruht nur darauf, dass von Wartburg an Tagungen anwesend war. Zitiert nach Hausmann 2017, 5. «Sicher sind die Konzentrationslager eine Einrichtung, die zu bedauern ist; aber es muss doch die Frage gestellt werden, ob ein Land, das Russland so nahe gerückt ist und in dem die Kommunistengefahr, wie ich mit eigenen Augen konstatieren konnte, so ungeheuer war, nicht eben andere Methoden anwenden muss als wer fern vom Schuss sitzt.» Von Wartburg an Hubschmied, 28. 12. 1935, zitiert nach Hausmann 2017, 22.
458
Geisteswissenschaftler
Vorstand keine Nichtarier sitzen».1883 Wilhelm Friedmann verliess Deutschland, lebte in Paris mit seiner Familie und arbeitete für Radio Française. Im Moment der Besetzung Südfrankreichs erhielt er die Erlaubnis, nach Amerika zu fahren, und versteckte sich an verschiedenen Orten in der Hoffnung, bald ein Schiff besteigen zu können. Als er seine Familie besuchen wollte, wurde er von der Gestapo gefasst und nahm Gift.1884 Ob von Wartburg wirklich einer der Mitautoren des Bekenntnisses deutscher Professoren zu Hitler an die Adresse der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft vom November 1933 gewesen ist, wie Heiber annimmt, lässt sich nicht beweisen. Im Gegensatz zu andern Professoren hat er das Dokument jedenfalls nicht unterschrieben.1885 b. Botschafter der Wissenschaft des nationalsozialistischen Deutschland Das sächsische Ministerium gewährte ihm nach der Ablehnung des Rufs nach Köln ab 1935 die Möglichkeit, jedes Jahr ein Trimester (oder Quartal nach europäischer Rechnung) in Chicago zu lehren. Treibende Kraft hinter den Einladungen nach Chicago war der deutschstämmige Professor William A. Nitze,1886 wobei 1883
1884 1885
1886
Zitiert nach Hausmann 2017, 6, aus Schreiben von Wartburgs an das sächsische Ministerium, 18. 11. 1933. Friedmann war auf Antrag von Wartburgs 1929 zum Extraordinarius befördert worden und unterrichtete Italienisch. UA Leipzig Film 0031 Protokoll Philologisch-Historische Abteilung der Fakultät Nr. 91, 1920–1932, Einträge vom 18. 12. 1929, 29. 1. 1930 und 3. 3. 1930. Sein Schicksal als Flüchtling: Hausmann 2000, 223, 232. Weitere antisemitische Äusserungen sind nicht bekannt geworden. In seiner in Deutschland verlegten Entstehung der romanischen Völker (von Wartburg 1939) zitiert er (ausländische) jüdische Autoren ohne Kennzeichnung, so z. B. Marc Bloch. Raymond 1970, 178. Marcel Raymond war mit Friedmann befreundet. Von Hehl 2010, 208. Unter den angeblichen Verfassern aus Leipzig befänden sich Theodor Frings (ein Freund von Wartburgs), Arthur Knick und Walther von Wartburg. Knick wurde Gau-Dozentenbundführer in Sachsen und Rektor. Ähnlich Hausmann 2017, 7. Die Vermutung geht auf Heiber 1992, 28, zurück. Von Wartburg widmete William Nitze sein 1939 erschienenes Buch über Die Entstehung der romanischen Völker «in freundschaftlicher Verbundenheit» (von Wartburg 1939, iii). Nitze bot ihm schon 1936 (von Hehl 2010, 250, datiert das Angebot auf 1937) eine Professur in Chicago an, die von Wartburg ablehnte. Gegenüber Ferdinand Brunot berichtete von Wartburg am 31. 12. 1936, er sei «trop vieux Européen pour pouvoir trouver une véritable nouvelle patrie spirituelle là-bas», zitiert nach Chambon u. a. 1979. Eine kurze Darstellung von Nitzes Karriere in: University of Chicago 2006. Ein negatives Bild des «Grossdeutschen» Nitze zeichnete René Étiemble 1974: «Allemand de souche et de cœur, gendre dʼun patron de la Hamburg Amerika Linie, et qui dès 1914–1918 avait clairement manifesté son pangermanisme. À lʼuniversité de Chicago, durant la période hitlérienne, les étudiants de lettres lʼappelaient ‚nasty Nazi Nitze‘, avec dʼheureuses paronomases qui exprimaient bien la vérité de lʼhomme.»
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
459
von Wartburg bei Erhalt der ersten Einladung 1934 behauptete, er kenne niemanden in Chicago und die Einladung sei spontan erfolgt. Man sollte dazu bedenken, dass im NS-Staat Auslandsreisen von Professoren von mehreren Instanzen bewilligt werden mussten, darunter in seinem Fall vom Sächsischen Ministerium für Volksbildung und vom Reichserziehungsministerium, je nachdem auch vom Auswärtigen Amt. Diese staatlichen Stellen waren gehalten, das Einverständnis von Parteistellen einzuholen. Es ging dabei auch um den Einsatz der knappen verfügbaren Devisen für solche Reisen und um die Optimierung der Chance, aktive Kulturpropaganda für NS-Deutschland zu betreiben.1887 Letzteres Argument brachte von Wartburg selbst vor. Gegenüber dem sächsischen Ministerium hatte er schon vor der Einladung nach den USA sein Konzept dargelegt, als in Deutschland wirkender Schweizerbürger ein Botschafter der Normalität unter der NS-Diktatur zu sein und sich nicht von westlichen Freunden vereinnahmen zu lassen.1888 Anlässlich der Einladung nach Chicago stellte er dem sächsischen Ministerium die Gefahr vor Augen, dass ein Franzose oder Belgier in Chicago lehren würde, falls er die Einladungen nicht annehmen dürfe: «Es hätte zweifellos grosse Nachteile, wenn man angesichts des vielerorts gesun-
1887
1888
Von Hehl (2010), 250, konstatiert die «relativ unbegrenzte Reisefreiheit» von Wartburgs in Leipzig. Einschlägige Parteidokumente fehlen zu von Wartburg. Eine Recherche, für die ich David Hamann (Berlin) danke, ergab: «In den Beständen des Berlin Document Centers taucht der Name Wartburg nicht auf, weder in den NSDAP-Karteien noch in einer anderen Sammlung.» «Die […] Akten zu Auslandsreisen deutscher Professoren im PA AA waren für den erwähnten Zeitraum nicht auffindbar. Die Akten zum Aktenzeichen ‚Reisen 3 Amerika I – Reisen deutscher Professoren ins Ausland‘, in welchem auch Dokumente betreffend Reisen nach Nordamerika abgelegt wurden, haben sich leider nicht erhalten. Zudem fehlen zeitgenössische Registraturhilfsmittel der Kulturabteilung für das Jahr 1938, somit konnte auch nicht nachgeprüft werden, ob überhaupt Dokumente betreffend der Reise Wartburgs nach Chicago 1938 eingegangen sind und ob sie evtuell unter einem anderen Aktenzeichen abgelegt wurden. Auch die deutsche Vertretung in Chicago hat in diesem Zusammenhang 1938 nicht an das Auswärtige Amt berichtet.» Bericht Hamann, 2. 11. 2017. «Ich erlaube mir, Ihnen noch einen Bericht über einen Vortrag beizulegen, den ich vor drei Jahren in Paris gehalten habe, damit Sie aus dem letzten Abschnitt entnehmen, dass ich bei allem Bemühen um gegenseitiges kulturelles Verständnis es doch immer im Ausland abgelehnt habe, die Grenzen zu verwischen und mich selber anzubiedern oder annektieren zu lassen. Meine Haltung in diesen Dingen ist völlig eindeutig. Ihre Wirksamkeit wird dadurch vermehrt, dass jedermann weiss, dass ich meine Staatsangehörigkeit beibehalten habe. Ich komme darauf zurück, weil Sie sagten, dass das bei der Aussetzung eines Reisezuschusses unter Umständen eine Rolle spielen möchte.» Von Wartburg an Ministerialrat Dr. Lange, 15. 1. 1934, in: Nachlass von Wartburg, IV, 1.
460
Geisteswissenschaftler
kenen Willens, Deutschland in der Welt zur Geltung kommen zu lassen, diese Einladung ausschlagen würde.»1889 Von Wartburg wurde so als internationaler Botschafter der wissenschaftlichen Exzellenz in Hitlerdeutschland und als unverdächtiger Werber um Verständnis für die deutsche Sache (im Verständnis des Nationalsozialismus) instrumentalisiert und instrumentalisierte sich selbst aus Überzeugung.1890 In die Darlegung der deutschen ‚Normalität‘ in Chicago band von Wartburg auch seine Leipziger wissenschaftlichen Mitarbeiter ein, die in seiner Vertretung und durch seine Vermittlung dort wirkten. So berichtete er über die Tätigkeit von Rudolf Hallig,1891 der von April bis Juni 1936 in Chicago war: Ich habe auch feststellen können, dass er es verstanden hat, in den vielen an einen Deutschen im Ausland herantretenden Diskussionen unaufdringlich, und doch mit grosser Bestimmtheit, den Standpunkt des heutigen Deutschen zu wahren, was ihm sehr viel Achtung eingetragen hat. Diese Haltung […] haben [sic] in den dortigen Universitätskreisen die Sympathien für Deutschland stark gefördert und haben vor allem auch mitgeholfen, die falschen Vorstellungen zu bekämpfen, die im Ausland, und besonders in Amerika, vielfach über die deutsche Universität und über die jüngere akademische Generation herrschen. Meine Beobachtungen sind mir auch vom deutschen Konsul in Chicago und Leiter der dortigen Ortsgruppe der N.S.D.A.P. Dr. Tannenberg vollauf bestätigt worden.1892
1889
1890
1891 1892
Von Wartburg an Sächsisches Ministerium für Volksbildung, 21. 7. 1934, in: UA Leipzig PA 1029, Blatt 48. Bewilligung der Reise und des Urlaubs im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt, Sächsisches Ministerium für Volksbildung an Philologisch-Historische Abteilung der Fakultät, 30. 7. 1934, ebd., Blatt 49. Von Hehl (2010), 250, bezeichnet von Wartburg als «Aushängeschild für die Internationalität der ‚Deutschen Wissenschaft‘, also ein propagandistischer Aktivposten», auch wenn er «keineswegs regimenah» gewesen sei. Bochmann 2009, 645–651, formuliert: Von Wartburg habe die «Normalität bzw. die hohe Qualität des Wissenschaftsbetriebs in Nazideutschland» repräsentiert. Hausmann 1994. Hallig war von 1931 bis 1945 Lektor und Assistent in Leipzig; er habilitierte sich erst 1948. Von Wartburg an Sächsisches Ministerium für Volksbildung, 1. 12. 1936, in: UA Leipzig Film 1312, Philosophische Fakultät B1/14: 39, Bd. 1, Romanisches Seminar 1931–1942, Blatt 41. Ernst August Wilhelm Tannenberg war bis 1936 stellvertretender Generalkonsul in Chicago. Kulturpolitik der Nationalsozialisten in den USA: Norwood 2009, der weder auf Nitze noch auf dessen Umfeld in Chicago eingeht.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
461
c. René Étiemble contra Walther von Wartburg In Chicago weckte sein Auftreten bei einem französischen Kollegen gar den bestimmten Verdacht, er sei ein Agent im Solde der Deutschen.1893 Dies gibt mir Veranlassung, sein Wirken in Chicago kurz zu beleuchten, soweit es die Quellen ermöglichen.1894 1974 attackierte René Étiemble den verstorbenen von Wartburg und löste dadurch Ehrenerklärungen seiner Bewunderer aus, die bisher als Hauptquellen für von Wartburgs Rolle in Chicago genutzt worden sind. Insgesamt waren Étiembles Vorwürfe übertrieben und wenig plausibel, aber im Einzelnen wurden sie nie wirklich nachgeprüft und lassen sich vielleicht auch nicht nachprüfen.1895 Dies gilt vor allem für den Vorwurf der Spionage. Problematisch war die Selbstbezeichnung von Étiemble als damaliger Repräsentant des Freien Frankreich,1896 da die von ihm geschilderten Ereignisse zeitlich vor dem Überfall auf Frankreich liegen müssten – als sich von Wartburg 1940, nun als Basler Professor, in Amerika aufhielt, war er kritisch zur deutschen Aggression eingestellt. Falsch ist Étiembles Behauptung, von Wartburgs Wirkungskreis sei München gewesen. Es stimmt auch nicht, dass Wartburg sich nach Kriegsausbruch nicht mehr getraut habe, nach den USA zu reisen, da er im Sommer 1940 nochmals in Chicago lehrte. Näher bei den Fakten, aber vermutlich verzerrt, könnten folgende Elemente der Schilderung sein: Von Wartburg versuchte überall, wo er tätig war, Personen zu engagieren, die für ihn Ausdrücke, Wendungen, Vokabeln und Lautformen romanischer Sprachen mit Interviews recherchierten. Da es in den USA und Canada frankophone Gruppen gab, ist es naheliegend, dass er auch dort so vorging. Es mag auch sein, dass einzelne Personen es ablehnten, für ihn zu arbeiten.1897 Eine enge Beziehung zwischen von Wartburg und Nitze liegt auf der Hand. Es ist auch durchaus wahrscheinlich, dass von Wartburg die Feststel1893
1894 1895 1896 1897
René Étiemble war von 1937 bis 1943 Dozent in Chicago und traf dort von Wartburg an. In einem Artikel in «Le Monde», 1974, erinnerte sich Étiemble, von Wartburg habe ihm gesagt «Hitler ne me refuse rien, […] tout l’argent que je désire, et tout le personnel». Von Wartburgs Bewunderer suchten die Vorwürfe zu entkräften, Hausmann 2017. Étiemble: Détrie 2002. Eine Darstellung von Étiembles Position in der Literaturwissenschaft: Marino 1982. Die Papiere von Nitze enthalten keine Korrespondenz mit von Wartburg, schreibt Hausmann 2017. Hausmann 1994. «[…] Nitze lui-même, qui haïssait en moi un membre de la France libre […]», Étiemble in Le Monde 1974. Yassu Gauclère, die Étiemble als Zeugin zitiert, hat mit ihm zusammen den Rimbaud, Gallimard 1936, geschrieben. http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/NRFEssais/Rimbaud. Sie verstarb 1961, konnte sich also nicht zu Étiembles Feststellung in «Le Monde» äussern. Korrekt ist, dass sie sich ab 1938 für eineinhalb Jahre in Mexiko und danach für mehrere Jahre in den USA aufhielt. Theoretisch könnte sie von Wartburg 1940 in den USA getroffen haben. http://www.babelio.com/auteur/Yassu-Gauclere/240492.
462
Geisteswissenschaftler
lung machte, dass ihm in Deutschland alle Wünsche erfüllt würden, die er für sein grosses Projekt äusserte. Ob er dabei sagte «Hitler ne me refuse rien», oder ob er präziser das sächsische Ministerium bezeichnete, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Die Ehrenerklärungen, die danach mehrere französische Forscher für Wartburg abgaben (gesammelt in der «Revue de linguistique romane» 1974), beruhten nicht auf der persönlichen Erfahrung in der Zeit vor 1939. Die Privatbriefe, die in diesem Zusammenhang der Strassburger Linguist Georges Straka1898 zitieren konnte, stammen erst aus der Zeit ab Sommer 1939. Die einleitend von Straka getroffene Feststellung, «Jamais W. von Wartburg n’a eu la moindre sympathie pour le nazisme»,1899 ist falsch, wie ich schon gezeigt habe und wofür ich noch weitere Belege anführen werde. d. Leo Spitzer contra Walther von Wartburg Die bisher interessanteste Quelle für von Wartburgs Aufenthalte in Chicago ist sein Briefwechsel mit Leo Spitzer. Er wird ergänzt durch Nachrichten über die Haltung von Wartburgs zu Spitzer aus der Redaktionsarbeit für die «Zeitschrift für romanische Philologie». Leo Spitzer,1900 bekannter Spezialist für Stilforschung und Italianist, hatte eine Professur in Köln innegehabt, die er als ‚Nichtarier‘ 1933 verlassen musste. Er war er ein kritischer Kopf, Kriegsgegner und in der Volksbildung engagiert. Auf dem Umweg über Istanbul erlangte er 1936 eine Position an der Johns Hopkins University in Baltimore.1901 Verschiedene Aufsätze konnte er als im Ausland lebender Jude in der «Zeitschrift für romanische Philologie», die von Wartburg seit 1935 leitete, unterbringen. Zum Ärger der in Deutschland verbliebenen Romanisten veröffentlichte die Zeitschrift «Mass und Wert», in Zürich herausgegeben von Thomas Mann und Konrad Falke, 1938 einen Beitrag von Spitzer über «Die romanistischen Zeitschriften im Deutschen Reich».1902 Darin beklagte er die «Nationalisierung der Wissenschaft», den «Abbau der wissenschaftlichen Solidarität» und die Entlassung namhafter Romanisten. Exilierte (das Wort «Emigranten» vermied er bewusst, denn es war negativ besetzt) könnten nicht mehr in deutschen Zeitschriften publizieren. Den einzelnen Zeitschriften erteilte er Tadel und manchmal auch Lob. Von Wartburg qualifizierte er als «vielseitig, gerecht und weitschauend», er habe der «Zeitschrift für romanische Philologie» zu einem bisher unerreichten
1898 1899 1900 1901 1902
Baldinger 1994. Straka 1974, 606. Hurch 2010; Hausmann 2000, 296 ff.; Hausmann 1993. Hausmann 2000, 315. Ausführlich referiert in Hausmann 2000, 369–377.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
463
Niveau verholfen. Lob erhielt auch Fritz Schalk, in Köln (indirekter) Nachfolger Spitzers,1903 der die «Romanischen Forschungen» emporgebracht habe. Schalk und von Wartburg tauschten sich über diese Kritik aus. Schalk beklagte, dass Spitzer «in vielfacher Hinsicht den Romanisten ihre Lage [in Deutschland] durch diese Veröffentlichung, deren Notwendigkeit ich sowenig begreife wie die in dieser Form unmögliche Protestkundgebung», erschwere. Denn bisher, so Schalks Argument, habe es keine explizite Weisung an die Redaktionen wissenschaftlicher Zeitschriften gegeben, Arbeiten von ‚Nichtariern‘ nicht mehr zu veröffentlichen; es habe nur eine «Empfehlung» gegeben, dies so zu tun, dass dadurch dem ‚Reich‘ kein aussenpolitischer Schaden entstehe.1904 Die Publikation in «Mass und Wert» könnte die deutschen Behörden also veranlassen, eine Weisung zu erlassen, die die Veröffentlichung von Artikeln jüdischer Autoren vollständig verböte. Tatsächlich sollte auf «Weisung von oben» eine Erwiderung an Spitzer formuliert und publiziert werden. Diese erschien jedoch nicht mehr wegen des ausbrechenden Krieges.1905 Kurz zuvor – von Wartburg lehrte gerade in Chicago – hatte dieser mit Spitzer zusammen ein Kolloquium in Baltimore veranstaltet, bei dem Spitzer einen positiven Eindruck von seinem Leipziger Kollegen gewann. Danach aber, Ende Januar 1938, schickte Spitzer das erwähnte Heft von «Mass und Wert» auch an von Wartburg. Es folgte ein brieflicher Schlagabtausch zwischen dem 1. und dem 14. Februar 1938. Von Wartburg eröffnete diesen mit der Feststellung, Spitzers Artikel sei «sehr bedauerlich», und korrigierte Spitzers Darstellung mit dem Nachweis angeblicher sachlicher Fehler. «Am meisten […] getroffen» fühlte sich von Wartburg von der Behauptung, Emigranten dürften in Deutschland nicht publizieren. Als Gegenbeweis führt er gerade die Aufsätze von Spitzer an, die in der «Zeitschrift für romanische Philologie» erschienen waren. Vor allem interessant ist jedoch die Befürchtung von Wartburgs, Spitzers Aufsatz in «Mass und Wert» sei «geeignet», «unrichtige Vorstellungen über Deutschland zu verbreiten». Von Wartburg konnte Spitzers Aussage nicht gelten lassen, wonach «ein wahrer Freund des Romanischen […] den neuen Idealen nicht erliegen» könne. Er schrieb dazu: «Selbstverständlich sind z. B. die Ideen Rosenbergs nicht die meinen, aber es hat daneben im Nationalsozialismus so viel Gutes und für das deutsche Volk Segensreiches, dass ein allgemeines Urteil einfach die Dinge verzerrt.»1906 Später wurde von Wartburg noch deutlicher: Der Aufsatz von Spitzer sei ein «Akt der Geringschätzung gegenüber der Linie, die Herr Niemeyer [der Verleger der Zeitschrift] und ich befolgen». Spitzer sei unfähig, «von [seiner] Basis aus [zu] verstehen, dass ich meiner Wirksamkeit in Deutschland treu bleibe». 1903 1904 1905 1906
Hausmann 2005; Hausmann 1997; Hausmann 1993, 359; Loos 1981. Fritz Schalk an von Wartburg, 15. 2. 1938, in: Nachlass von Wartburg, IV:2. Hausmann 2000, 373. Von Wartburg an Spitzer, Chicago, 1. 2. 1938, in: Nachlass von Wartburg, IV:2.
464
Geisteswissenschaftler
Er sah den Gegensatz zwischen sich und Spitzer letztlich darin, dass dieser nur über die Persönlichkeit, das hiess, über deren Verhältnis zum Nationalsozialismus urteile (von Wartburg nannte dies «subjektiv»), er selbst aber zudem die wissenschaftliche Leistung «objektiv» einbeziehe. «In der Gesamtökonomie des geistigen Lebens haben wohl beide [Positionen] ihre Funktion und ihre Bedeutung. Darum bin ich für leben und leben lassen.» Im Schlusssatz kündigte von Wartburg die weitere Zusammenarbeit auf. Spitzer, der sich selbst einen deutschen Patrioten nannte, der das «ewige Deutschland» in sich trage, konstatierte, dass er nirgends ausser in von Wartburgs Zeitschrift publizieren könne und dass viele in Deutschland verbliebene (jüdische) Kollegen nicht einmal mehr eine Bibliothek oder ein Institut betreten dürften. «Die Judenfrage von den übrigen Problemen zu trennen», wie es von Wartburg praktiziere, sein unzulässig. Wenn er selbst in von Wartburgs Zeitschrift noch publizieren dürfe, dann befürchte er, ein «Renommieremigrant in einer Renommierzeitschrift» zu sein. Spitzer erfasste genau die Instrumentalisierung, die von Wartburg als ‚Schweizer in Deutschland‘ anstrebte: Er trage zum falschen Eindruck einer Normalität bei, der die wahre Natur der Diktatur gegenüber dem Ausland verschleiere. Seine eigene Position erklärte Spitzer wie folgt: Die Romania ist eine Kultur- keine Rassengemeinschaft […], die humane Botschaft des römischen und christlichen Reiches hat nichts mit Walhalla und Hakenkreuz zu tun. Und so lange eine Fiber von mir lebendig ist, werde ich wie Ihr Kollege Borgese […], wie Croce, Salvemini und Benda behaupten, dass die Freiheit des Gedankens, Weltbürgertum, friedliche Kultur, ein absolutes moralisches Ideal und eine Verbindlichkeit gegenüber den Mächten dieser Welt den Lebensinhalt eines ‚clerc‘ bestimmen. Nein, Romanist kann kein Nationalsozialist sein.1907
e. Als Vertreter einer gleichgeschalteten deutschen Universität in Lausanne Als Mitglied der offiziellen deutschen, vom Freiburger Geographen und Rektor Friedrich Metz «geführten» Delegation nahm von Wartburg am Lausanner Universitätsjubiläum 19371908 teil. Er wurde in die Delegation aufgenommen, damit die deutsche Abordnung in der Schweiz einen positiven Eindruck hinterlasse. Die Mitwirkung von in Deutschland tätigen, im NS-Sinne «zuverlässigen» Schweizern war ebenso Teil dieser Strategie wie der Auftritt des Freiburger Geographen Metz als Repräsentant einer ‚vernünftigen‘, bei aller Betonung der «blutsmässigen» Verwandtschaft unter den «Alemannen» die Schweizer Souveränität re-
1907 1908
Von Wartburg an Spitzer, 24. 2. 1938; Spitzer an von Wartburg, 4. 2. 1938, ebd. Robert 1987. Siehe auch meine Darstellung der Jubiläen, oben, Kapiel 3.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
465
spektierenden NS-Wissenschaft.1909 Metz scheint sehr davon überzeugt gewesen zu sein, dass von Wartburg ideal in dieses Schema passe, denn schon 1936 hatte er versucht, ihn nach Freiburg i. Br. zu holen.1910 Die Rolle des «geborenen Schweizers» und Schweizerbürgers von Wartburg in der Delegation unterstrich Metz in seinem Schreiben an Otto Riese, den deutschen Juristen in Lausanne, vom 15. Mai 1937.1911 Von Wartburg, der bei der Lausanner Feier den Doktortitel ehrenhalber verliehen bekam, positionierte sich dabei deutlich als «Schweizer in Deutschland». f. Der Eid auf Adolf Hitler Schweizer in Deutschland zu sein war nicht frei von Problemen. Von Wartburg hatte bei seiner Berufung nach Leipzig 19291912 das Zugeständnis erhalten, die deutsche Staatsbürgerschaft nicht annehmen zu müssen. Dennoch leistete er damals den von den Beamten geforderten Eid auf die Republik. 1934 wurde von den Professoren ein Eid auf die Person Adolf Hitlers verlangt. Nachdem Wartburg zuerst gezögert hatte, diesen Eid abzulegen, und sich erneut auf seine Schweizer Nationalität berufen hatte,1913 wurde er vom Dekan und späteren Rektor, dem nationalsozialistisch orientierten Althistoriker Helmut Berve,1914 und vom sächsischen Oberregierungsrat Werner Studentkowski darüber aufgeklärt, dass dieser Eid eine harmlose Formalität im Zusammenhang mit seinem Beamtenstatus sei, weil ja der Eid auf die Weimarer Verfassung durch die nationalsozialistische ‚Revolution‘ obsolet geworden sei. Daraufhin wurde der Akt am 18. Dezember 1934 vollzogen.1915 Angesichts seines bekannten Eintretens für die deutsche Sache im Ausland schadete ihm dieses Zögern bei den Nationalsozialisten nicht, wie in den Akten explizit festgehalten wurde. Obschon von Wartburg versucht habe, für sich eine Ausnahme zu erwirken, trage der Dekan (Berve) «keine Bedenken» gegen eine Beurlaubung Wartburgs für die Reise nach Chicago, «zumal, wie die Fakultät 1909
1910 1911 1912 1913 1914 1915
Zusammensetzung der deutschen Delegation und Ernennung von Metz zum «Führer» dieser Abordnung. Reichsministerium an Friedrich Metz, Rektor Universität Freiburg i. Br., 21. 4. 1937. Änderungen an der Liste: Metz an Reichsministerium, 26. 5. 1937. Hausmann 2017, 7. UA Freiburg i. Br., B0001, 133, 1937. Bochmann 2009, 645–651. Von Wartburg an Dekan Berve, 5. 12. 1934, in: UA Leipzig, PA 1029, Blatt 55. Rebenich 2001. Hausmann 2017, 6, mit der Begründung, von Wartburg habe sich nicht exponieren wollen, Eidverweigerer seien in den Ruhestand versetzt und Hitler sei demokratisch gewählt worden. In den Quellen finde ich keine Anhaltspunkte für diese Interpretation. Von Wartburg an Ministerialrat Dr. von Seydewitz, 19. 11. 1924; von Wartburg an Dekan Berve, 5.12., 12. 12. 1934, in: Nachlass von Wartburg, IV:1.
466
Geisteswissenschaftler
schon einmal betont hat, Professor von Wartburg seit jeher für das Deutschtum im Auslande besonders eingetreten ist und auch für den neuen Staat nach besten Kräften wirkt».1916 g. Abwendung von der nationalsozialistischen Politik und Rückkehrwunsch Von Wartburg war dann doch einsichtig genug, die Kriegsvorbereitungen und den damit verbundenen, zunehmenden Druck des totalitären Staates auf die in Deutschland wirkenden Ausländer ab Ende 1938 zu erkennen. Im Herbst 1938 war er anscheinend Opfer einer Denunziation geworden. Zwar wurde diese im Detail nicht bekannte Sache nach langem Warten gütlich beigelegt mit der Erklärung, der Angriff sei nicht von der Partei ausgegangen, sondern von einer «örtlichen Einzelstelle». Aber er war nun gewarnt.1917 In den wenigen verfügbar gewordenen Privatbriefen, die zudem nicht hinter den Juli 1939 zurückreichen, zeigen von Wartburg und seine Frau eine grosse Enttäuschung, ja ein Entsetzen über das irrationale Verhalten Hitlers, der nach dem ‚Anschluss‘ Österreichs und nach ‚München‘ (Vorgänge, die von Wartburg positiv einschätzte) weiter auf den Krieg hinarbeitete, ohne von der Wehrmacht zurückgehalten zu werden. Am nun negativen Hitlerbild als «Dämon»1918 mag auch von Wartburgs Gattin mitgewirkt haben. So trug er sich nun mit dem Gedanken, das auf den Krieg zusteuernde Deutschland zu verlassen, da er sich ausrechnen konnte, wie schwierig es werden würde, die internationalen Kontakte in einem Krieg weiterzuführen, seine Forschungen zu finanzieren (Französisch wurde aufgrund von NS-Prioritäten zugunsten des Englischen abgebaut) und Mittel aus Deutschland in die Schweiz, wo seine Familie lebte, zu transferieren. Schliesslich wäre im Falle kriegerischer Handlungen in Deutschland auch sein Lebenswerk, die Fichen für das Wörterbuch, in Gefahr geraten. Im Entwurf seines Entlassungsgesuchs, das er an die sächsischen Behörden richtete, stellte er seine Isolierung in Deutschland in den Vordergrund und be-
1916 1917
1918
Dekan an Rektor, 10. 1. 1935, in: UA Leipzig PA 1029, Blatt 68. Regierungsdirektor Studentkowski, Leiter des Sächsischen Ministeriums für Volksbildung, an von Wartburg, 31. 3. 1939, mit Bezug auf eine Besprechung zwischen von Wartburg und ihm, 15. 11. 1938, und ein Schreiben des Gauamtsleiters Göpfert vom 21. 2. 1939. Anlass und Inhalt der Affäre bleiben bisher unbekannt. Belege in: Nachlass von Wartburg, IV:1. Das UA Leipzig besitzt dazu keine Dokumente; das Archiv der sächsischen Regierung in Dresden hat gar keine Akte über von Wartburg. Ida von Wartburg an Walther von Wartburg, 3. 8. 1939, zitiert nach: Straka 1974. Nach dem Einmarsch in die Niederlande nannte Walther von Wartburg Hitler einen «Besessenen» und fragte sich, warum die Wehrmacht solche Befehle ausführte. «Dass Deutschland so weit sinken konnte, ist nicht zum glauben», an seine Frau, Chicago, 10. 5. 1940, zitiert nach: Straka 1974.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
467
gründete sie mit zwei Faktoren: Auf dem Weg in den Krieg hätten sich die Deutschen zu einem «neuen totalitären deutschen Staat» zusammengefunden, so dass der Ausländer, auch wenn er mit den Deutschen sympathisiere, wegen der «wachsenden Geschlossenheit des deutschen Volkes» als «Aussenseiter» zunehmend aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen werde. Als Romanist werde er zudem durch die Hintansetzung des Französischen im Schulunterricht als Hochschullehrer weitgehend obsolet.1919 Der Besuch seiner Lehrveranstaltungen gehe zurück (was auch finanzielle Nachteile mit sich bringe), und es werde für ihn schwieriger, Nachwuchskräfte für seine Forschungen unter den Studierenden anzuwerben. So werde er isoliert als reiner Forscher mit einem zwar hervorragend eingespielten und gut finanzierten Team, das aber nicht mehr nachhaltig arbeiten könne, weil die Rekrutierungsbasis wegbreche.1920 Als die Wehrmacht in Hitlers Auftrag Polen überfiel, lehrte Wartburg in Chicago. Dort erhielt er bei diesem Anlass zum zweiten Mal das Angebot, eine Professur zu übernehmen. Dieses Mal lehnte er nicht sofort ab, sondern erbat Bedenkzeit bis zum Jahresende. Unterdessen sondierte er Wirkungsmöglichkeiten in der Schweiz, da er fürchtete, im Fall einer Ausweitung des Krieges nicht mehr zwischen den USA und der Heimat pendeln zu können. In Deutschland wollte er sein Engagement korrekt abschliessen und seine wissenschaftlichen Unterlagen vollständig herausholen.1921 Gegenüber der Universität Leipzig und dem Ministerium in Dresden erklärte er, er müsse als Schweizer Offizier in der Heimat dienen. Das war ein Vorwand, da, wie er selbst feststellte, für Schweizer Dienstpflichtige Urlaub für den Unterricht in fremden Staaten leicht zu erlangen war. Doch er befürchtete, im Kriegsfall in Deutschland interniert zu werden, wie sich aus der privaten Korrespondenz ergibt.1922
1919
1920 1921 1922
Tatsächlich versuchte das sächsische Ministerium, nach von Wartburgs Entlassung von den zwei Französischprofessuren die seine (Sprachwissenschaft) aufzuheben. Auf Weisung des Reichsministeriums und entsprechend dem Willen der Fakultät wurde dann darauf verzichtet. Leiter des Sächsischen Ministeriums für Volksbildung an Dekan, 12. 1. 1940, in: UA Leipzig Film 1312, B2/20: 02, 1841–1940 Professur für Romanische Philologie, Blatt 123. Ministerium für Volksbildung an Dekan, 21. 1. 1940, ebd., Blatt 127. Kurze Erwähnung des Sachverhalts bei von Hehl 2010, 221. Reduktion des Französischangebots im Schulwesen und Bedeutungsverlust des Fachs an Hochschulen: Hausmann 2000, 62 f. Entwurf des Schreibens an das sächsische Ministerium mit ausführlichen Argumenten für sein Entlassungsgesuch, in: Hausmann 2017, 11 f. Die Entlassung in Leipzig verlief reibungslos. UA Leipzig Film 1312, B2/20: 02 1841–1940 Professur für Romanische Philologie. Straka 1974. Studentkowski an von Wartburg, 25. 10. 1939, in: Nachlass von Wartburg IV:1. StABS ED-REG 1a, 1 1622.
468
Geisteswissenschaftler
7.2.4.5.10 Berufung nach Basel Die Basler Professorenschaft für Romanistik bestand damals aus Ernst Tappolet (Sprachwissenschaft), Albert Béguin (Französische Literaturwissenschaft) und Arminio Janner (Italienisch). Tappolet wäre im Herbst 1940 pensioniert worden. Er setzte sich lebhaft dafür ein, von Wartburg für seine Nachfolge zu gewinnen, vorausgesetzt, dass dadurch sein Pensionsanspruch nicht gekürzt würde – ein Problem, das sich von selbst löste, als Tappolet unerwartet im November 1939 verstarb.1923 Die Behörden waren der Ansicht, es böte sich die einmalige Chance, der Basler Romanistik durch die Berufung des Leipziger Professors einen internationalen Glanzpunkt aufzusetzen. Von Wartburg erschien im Oktober 1939 in Basel und legte dem Erziehungsdirektor persönlich seine Zwangslage dar, die auch Tappolet in seinem lobenden Gutachten im Namen der Fakultät1924 (Karl Jaberg, Bern,1925 schrieb das zweite, ausserfakultäre Gutachten) unterstrich. Sehr rasch1926 erhielt von Wartburg Gelegenheit, über eine Basler Position zu verhan1923
1924
1925 1926
StABS UA R 3a, 3 Protokoll der Philologisch-Historischen Abteilung der Philosophischen Fakultät, ab 1937 der Philosophisch-Historischen Fakultät, 1930–1948, 220–221, ausserordentliche Sitzung 11. 10. 1939. Die Fakultät beschloss, dass das ihr bereits vorliegende Gutachten von Tappolet als Fakultätsgutachten gelten solle. Gutachten Tappolet für die Fakultät, 10. 10. 1939, in: StABS ED-REG 1a, 1 1622. Unter «Zwangslage» verstand Tappolet, dass von Wartburg zwar einen bis 1. 1. 1940 geltenden Ruf nach Chicago erhalten, sich aber trotzdem in die Schweiz begeben hatte und dass nun wegen des Kriegsausbruchs nur noch italienische Schiffe nach Nordamerika fuhren. Wenn Italien in den Krieg einträte, fiele auch diese Möglichkeit weg, dorthin zurückzufahren. Ohne eine Anstellung in der Schweiz müsste von Wartburg somit weiterhin in Leipzig wirken. Liver 2015. Die Fakultät wurde aktiv, ohne die Einsetzung einer Sachverständigenkommission der Kuratel abzuwarten. Kuratelspräsident Max Gerwig hatte von sich aus, aber im Einvernehmen mit dem ED, dieses Vorgehen initiiert (Kuratel an Sachverständigenkommission, 13. 10. 1939). Am 13.10. setzte die Kuratel ihre Sachverständigenkommission ein. Vier Professoren der Fakultät waren darin vertreten (Mangold als Dekan; Tappolet, Béguin und Janner als Romanisten), Rektor Dr. Max Meier als Vertreter der pädagogischen Interessen der Mittelschulen, schliesslich Dr. G. Kluth. Am 20.10. tagten die Sachverständigen gemeinsam mit der Kuratel. Nur einen Tag später beantragte die Kuratel beim Chef des ED die Wahl von Wartburgs und die Behandlung dieses Vorschlags im Erziehungsrat. Vor diesen Aktivitäten hatte von Wartburg den Kuratelspräsidenten aufgesucht (Protokoll über die gemeinsame Sitzung der Kuratel und der Sachverständigenkommission für die Nachfolge von Prof. Tappolet, 20. 10. 1939, in: StABS ED-REG 1a, 1 1622). Am 31.10. ermächtigte der Regierungsrat das ED, mit von Wartburg in Verhandlungen zu treten, die am 2. 11. 1939 stattfanden. Am folgenden Tag wurden die Ergebnisse schriftlich festgehalten, und von Wartburg fuhr am 4.11. nach Leipzig, um seine Entlassung zu erreichen. Damit hatte er am 16.11. Erfolg und sagte in Basel definitiv zu, per 1.12. seine Professur anzutreten. StABS ED-REG 1a, 1 1622. ED Basel-Stadt an von Wartburg, 3. 11. 1939; von
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
469
deln: Das Angebot umfasste das höchste mögliche Basler Gehalt mit Zulage, Umzugsentschädigungen, Einkauf in die Pensionskasse zu Lasten der Universität, Mietzinszahlungen in Leipzig und einer weiten Umschreibung seines Lehrgebietes. Für 1940 wurde ihm Urlaub zugesichert, damit er nochmals (und letztmals) in Chicago lehren könne, was er dann auch vom April bis August 19401927 tat. Als weniger befriedigend stellte sich die Basler Bereitschaft heraus, das FEW zu finanzieren. Bereits die entsprechenden Passagen in der Berufungsvereinbarung waren eher unverbindlich formuliert gewesen («wohlwollende Prüfung begründeter Gesuche»),1928 und letztlich konnte von Wartburg den Apparat, der für die Fertigstellung des FEW erforderlich war, erst nach der Gründung des Nationalfonds wieder richtig in Gang bringen.1929 Auffällig sind Nebengeräusche, die die Basler Wahl begleiteten. Die offiziellen Basler Protokolle, meist unter Aufsicht des Departementschefs, Fritz Hauser, vom Sekretär des Erziehungsdepartements, Fritz Wenk (im Departement tätig von 1918 bis 1954, zugleich Sekretär des Erziehungsrats und der Kuratel sowie Mitglied des Grossen Rats) verfasst, enthalten die rhetorische Wendung, dass «gewisse Bedenken» vollkommen ausgeräumt worden seien. Aus Basler Sicht entsprach diese Rhetorik allerdings den Tatsachen. So war daran erinnert worden, dass von Wartburg es in Lausanne nur ein Jahr ausgehalten hatte, und man vermutete, er habe schon mit Leipzig verhandelt, als er in Lausanne zusagte. Dies wurde dann vonseiten der Universität Lausanne dementiert. Viel mehr Gewicht hatte die Frage, ob von Wartburg in Leipzig zum Nationalsozialisten geworden sei. Wie Tappolet in seinem Gutachten geschrieben hatte, zeigte sich von Wartburg im persönlichen Kontakt als «echter Schweizer» und freisinniger Patriot; Tappolet ging so weit, ihn auch äusserlich als ‚richtigen‘ Schweizer zu zeichnen.1930 Dies war nur glaubhaft, wenn von Wartburgs Schriften selektiv gelesen wurden. So überging das Gutachten der Fakultät von Wartburgs Begeisterung für die Rolle der Germanen in der französischen Geschichte mit lautem Schweigen. Doch Thematik und Stil einiger Arbeiten waren unübersehbar. Das Protokoll der Kuratelssitzung brachte die darauf bezogene Kritik mit dem Namen des Historikers Werner Kaegi in Verbindung, der zwar weder in der Kuratel noch in deren
1927 1928 1929 1930
Wartburg an Chef des ED Basel-Stadt, 7. 11. 1939; Bericht und Antrag des ED an den Regierungsrat, 23. 11. 1939, und Regierungsratsbeschluss 1. 12. 1939, in: StABS ED-REG 1a, 1 1622. Hausmann 2017, 9. In Basel wollte von Wartburg wie in Leipzig eine europäische Position mit einer solchen in Nordamerika «verbinden». Finanzierung des FEW in Basel: UNI-REG 2-1 (1) 379, und Nachlass von Wartburg, IV:3, sowie V:6,1. Das erste Gesuch nach der Gründung des Fonds ist im Nachlass von Wartburg, V:6,1, vorhanden (von Wartburg an Alexander von Muralt, 15. 10. 1952). «[…] ein Mann von typisch schweizerischem Gepräge im Aussehen und im Auftreten», Gutachten Tappolet für die Fakultät, 10. 10. 1939, in: StABS ED-REG 1a, 1 1622.
470
Geisteswissenschaftler
Sachverständigenkommission für die Berufung mitwirkte. Kaegi war aber als Freund und Übersetzer von Johan Huizinga gegen germanomane Ansätze stark sensibilisiert und berief sich zudem auf Jacob Burckhardt.1931 Im Protokoll wurde vermerkt, Kaegi hätte als Historiker Einwände gegen die Darstellung der fränkischen Invasion in Nordgallien vorgebracht und kritisiere die von Wartburgsche These, dass die Germanen einen entscheidenden Einfluss auf die französische Nationenbildung ausgeübt hätten.1932 Diese Einwände wurden mit der kodierten Wendung, «das neueste Buch über die Entstehung der romanischen Völker enthalte einige Stellen, die politisch sich Gedankengängen nähern, die uns fremd sind», zusammengefasst und damit entkräftet, dass diese Passagen «höchstenfalls eine gewisse Hochschätzung des Germanischen für die Entwicklung Europas [zum Ausdruck bringen], [diese] sind geschichtliche Werturteile für die Vergangenheit, nicht politische Werturteile für die Gegenwart». Das Buch sei als Ganzes «einwandfrei». Als Garanten für diese Einschätzung wurden Tappolet und Béguin angeführt.1933 In den Meldungen über von Wartburgs Wahl in der Basler Presse stand nichts über diese ausgeräumten Vorbehalte. 7.2.4.5.11 Nach der Wahl Von Wartburg hatte seine Einschätzung Hitlers (nicht aber diejenige des Nationalsozialismus und nicht seine eigenen Ideen über die Lage der deutschen Nation) in der ersten Jahreshälfte 1939 revidiert. Die Rolle als ‚Schweizer in Deutschland‘, wie er sie sich gewünscht hatte, war problematisch geworden, wie gezeigt worden ist. Wer jedoch erwartet hatte, dass von Wartburg in Basel auf seine germanischen Thesen verzichten würde, sah sich bald enttäuscht. Er verkehrte min1931 1932
1933
Chiantera-Stutte 2013/14. In Kaegis Exemplar der von Wartburgschen Entstehung der romanischen Völker (Paul Sacher Stiftung Basel) kommt die Ablehnung des nationalen Ansatzes in der Historiographie und die abweichende Einschätzung der Bedeutung der Germanen durch Kaegi in Randbemerkungen sehr deutlich zum Ausdruck. Ebenso erregten an den Nationalsozialismus erinnernde Wendungen seinen Zorn. Ferner Kaegi 1940 und Kaegi 1940a, 42: Die Ortsgruppe Basel der Neuen Helvetischen Gesellschaft hatte Kaegi im Frühling 1939 eingeladen, die Frage des Verhältnisses zwischen der Schweiz und den Alemannen zu beantworten – er war also gut vorbereitet. Siehe dazu unten, Kapitel 7.5.10. Kuratel (Max Gerwig) an den Vorsteher des ED zu Händen des Erziehungsrats, 21.10. 1939, in: StABS ED-REG 1a, 1 1622. Kaegi selbst hatte in der Fakultät seine Opposition gegen die Person, nicht aber gegen die Schrift, zurückgenommen: «Kaegi kann als Historiker die ‚Entstehung der romanischen Völker‘ nicht vorbehaltlos anerkennen, erklärt aber, dass die persönliche Bekanntschaft mit dem Verfasser seine Bedenken restlos zerstreut habe.» StABS UA R 3a, 3 Protokoll der Philologisch-Historischen Abteilung der Philosophischen Fakultät, ab 1937 der Philosophisch-Historischen Fakultät, 1930–1948, 220–221, ausserordentliche Sitzung, 11. 10. 1939.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
471
destens bis 1942 im Umfeld des deutschen Konsulats und der Basler Germanophilen, die hinter der Gründung der kulturpolitischen Gruppierung Basler Pfalz standen.1934 In seinem 1942 vor der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft gehaltenen Vortrag betonte er gemäss Pressebericht mit der bekannten Rhetorik und einer Spitze gegen die Historiker, die sich an die Chronistik klammerten, dass die Sprachgeschichte beweise, dass «die ungeheure Leistung der Franken, als einziges der germanischen Völker nach dem Untergang des römischen Reiches dem Abendland wieder eine politische Form gegeben und damit die Kontinuität seiner Kultur gewährleistet zu haben, das Ergebnis eines breiten Siedlungsstromes ist, der sich mit dem jugendlichen Chlodwig nach Nordgallien, in das Kernstück des nachmaligen Frankreich ergoss».1935 Auch in seiner 1943 in Halle/Saale erschienenen Einführung in die Sprachwissenschaft rückte er davon nicht ab; der Versuch, die Begriffe zu klären und Völker als Sprachgemeinschaften und Sprache als Kulturphänomen zu bestimmen, glückte nicht überzeugend. Die an sich vielversprechende Einleitung wurde vom nachfolgenden Inhalt oft wieder infrage gestellt.1936 Öffentlich sichtbare Probleme brachte ihm dies jedoch nur ganz am Anfang seiner Tätigkeit in Basel ein. Als er bereits einige Wochen hier gelehrt hatte, liessen sich die bei der Wahl ausgeräumten Nebengeräusche nochmals deutlich vernehmen. Denn auf die im Basler Verfahren wegretouchierten Bedenken gegen sein Geschichtsbild und seine Ausdrucksweise ging ein intelligenter Zeitungsbeitrag an herausragender Stelle ein: Die angesehene «Neue Zürcher Zeitung» publizierte zwischen Weihnachten 1939 und Neujahr 1940 eine Besprechung der Entstehung der romanischen Völker. Der vielseitige und kompetente Kulturjournalist Adolf Ribi, als Schüler von Charles Bally sprachwissenschaftlich kompetent, stellte nicht nur einzelne Ergebnisse von Wartburgs fachlich infrage, ihm missfiel auch der Denkstil, den er – ohne dies deutlich auszusprechen – als nationalsozialistisch empfand. Von «politisch verseuchter» Sprache und «irritierenden Formulierungen» berichtete er. Die Gleichsetzung von Volk mit «Rasse» lehnte Ribi als «materialistische Auffassung» ab. Ihm fiel auf, dass von Wartburg die Zugehörigkeit zu einem Volk mit der «Form der Gefühlsreaktion besonders 1934
1935 1936
Dem deutschen Konsul in Basel dankte er im November 1941 persönlich am Telefon für die Einladung zu einem Vortrag von Hans Friedrich Blunck, einem damals regimenahen Dichter, den das Konsulat organisierte. Im Mai 1942 empfahl Jacob Wackernagel dem Frontisten Wilhelm Brenner, von Wartburg eine Einladung zum Vortrag von Heinz Kindermann, dem NS-Germanisten in Münster, zu schicken. Fiche Walter von WartburgBoos, Daten aus der Abhörung des Telefons des Konsulats und der Postkontrolle von Wilhelm Brenner, in: StABS PD-REG 5a 3-1-2. Basler Nachrichten vom 24. 11. 1942, Ausriss in: StABS ED-Reg 1a, 1 1622. Von Wartburg 1943, unpag. Einleitung. Es ist denkbar, dass weite Teile des Haupttextes aus Vorlesungen stammten, die noch in Leipzig gehalten worden waren, ohne dass diese danach überarbeitet wurden.
472
Geisteswissenschaftler
gegenüber Artfremden» in Verbindung bringe (von Wartburgs eigene Worte). Die germanenzentrierte Argumentation entging ihm nicht. Er brandmarkte ferner die Tendenz, die Heimat der Indogermanen ins derzeitige Deutschland zu verlegen.1937 Es erinnert verräterisch an das überhebliche Wort von dem gewissen Wesen, an dem die Welt genesen soll, dass v. Wartburg den Satz wagt: ‚Wenn man die Dinge retrospektiv betrachtet, kann man den Eindruck bekommen, die Vorsehung habe, nachdem sie verschwenderisch die Mittelmeere mit indogermanischer Kraft überflutet hatte, hier (im heutigen Deutschland) eine letzte Quelle von unberührter und ungebrochener Volkskraft in Reserve behalten wollen, um damit im gegebenen Augenblick das in seinem Kreislauf erschöpfte Abendland zu erneuern‘.1938 Dergleichen und unnütz irritierende Formulierungen wie, Kelten hätten sich in Iberien eingenistet, während bei den Germanen vornehm von Landnahme und kulturschöpferischer Staatengründung die Rede ist, sind entschiedene Schönheitsfehler einer wissenschaftlichen Darstellung.
Ribi vermisste auch eine Erwähnung der von Jakob Jud herausgearbeiteten Bedeutung der Kirche bei der Germanisierung Nordfrankreichs (auch Kaegi hatte sich in seiner Kritik darauf bezogen). Von Wartburgs Erklärung der Entstehung des Französischen erweckte bei Ribi das «Gefühl», es würden «noch ungeklärte Vorgänge einseitig germanischem Blut und Wesen gutgeschrieben». Er stellte klar: «Sprachliche Argumente sagen a priori herzlich wenig über die Sprachträger aus.» Von Wartburgs Bemerkung, die Alemannen seien nicht fähig gewesen, «weitgesteckte politische Ziele mit einheitlichem Krafteinsatz zu verfolgen», gab Ribi Anlass zur spöttischen Bemerkung, der Autor habe «eine ausgesprochene Vorliebe für grossräumige Machtpolitik». Er verwahrte sich gegen die «Vergewaltigung anthropologischer, sprachlicher und historischer Tatsachen», die «alten Schweizer» in gleicher Weise pauschal als Alemannen zu bezeichnen.1939 Ribi hatte das Buch auf den nationalsozialistischen Kontext bezogen, wozu ihn der Verlagsort Halle/Saale und der Umstand, dass von Wartburg bis zum 30. November 1939 in Leipzig Professor gewesen war, berechtigte. Wer davon ausgeht, dass von Wartburg in einer Wissenschaftstradition stand, die von Strömungen der Zeit vor 1933, ja vor 1914 geprägt worden war, wird einige Passagen anders lesen. So war bei von Wartburg im besprochenen Werk «völkisch» das Adjektiv zu Volk, und Volk war bei ihm meistens eine «Sprachgemeinschaft», die
1937 1938
1939
Anspielung auf von Wartburg 1939, 16, 64. Das Zitat stammt aus von Wartburg 1939, 64. Ribi liess sich nicht davon beirren, dass von Wartburg diese Formulierung in indirekter Rede vortrug und sie als möglichen «Eindruck» bezeichnete, den man gewinnen «könnte». Die Distanzierung wirkte zwar nur schwach, aber sie war offensichtlich von ihm gewollt. Ribi 1939.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
473
keinen «rassischen Untergrund» benötige – Ausnahmen kamen allerdings vor, so sprach er von «fränkischem Blut», was zeigt, dass Ribi zu Recht die mangelnde Begriffsklärung tadelte. Von Wartburg plädierte auch nirgends offen dafür, Sprachgrenzen müssten zwingend zu Staatsgrenzen werden. In der Erwähnung des Elsass betonte er zwar, dass der Rhein keine wirkliche Grenze bilde und dass auf beiden Seiten deutsches Sprachgebiet sei, aber er unterliess es, daraus auf die Gegenwart bezogene Konsequenzen zu ziehen. Die Redaktion räumte von Wartburg das Recht zu einer Replik ein mit der Begründung, er habe «in Deutschland den alten Ruf der Schweizer Romanisten in Ansehen» gehalten. Diese Gelegenheit nutzte von Wartburg dazu, Ribi als einen voreingenommenen Leser abzukanzeln, der ideologische Fragen in einen wissenschaftlichen Text hineintrage, der doch nur Ergebnisse voraussetzungsloser Forschung darlege. Zudem bekannte sich von Wartburg erneut plakativ zu seinem Schweizertum und zu seinem Patriotismus, wozu er in extenso die entsprechenden Schlusssätze seines Buches zitierte.1940 7.2.4.5.12 Ergebnis Mit von Wartburg wurde tatsächlich kein Nationalsozialist nach Basel berufen, aber als deutschnational und germanophil durfte er wohl bezeichnet werden, und er hatte ausserhalb Deutschlands für Verständnis für den Nationalsozialismus geworben. Seine Interpretationsweise beruhte auf einer Mischung aus philologischem Positivismus, Kulturgeographie und der nicht problematisierten Annahme, dass man berechtigt sei, von Sprache auf Volk zu schliessen. Damit stand er allerdings keineswegs isoliert in der Wissenschaft seiner Zeit. Hinzu kam aber eine Neigung, deutschtümelnder Rhetorik freien Lauf zu lassen. Schwerer wiegt der Umstand, dass er national-deutsche Interessen zur Grundlage seiner Auffassung der Gegenwart machte: Er bewunderte anfangs Hitler als den «Führer», der die Einheit der deutschen Nation vollende, rechtfertigte harte Massnahmen gegen Andersdenkende und «Artfremde» als Abwehr des Bolschewismus in Selbstverteidigung der Deutschen und verstand die Tschechen nicht als Opfer deutscher Aggression, sondern als Täter, die ihre deutschen Minderheiten verfolgt hätten. Der ‚Anschluss‘ Österreichs war für ihn der Höhepunkt der deutschen Nationenbildung.1941 Manche Aspekte erinnern an gewisse Stellungnahmen von Andreas
1940
1941
Ausriss aus der NZZ ohne Datum, gestempelt 17. 1. 1940, in: StABS ED-REG 1a, 1 1622. Der Ausriss trägt auch die Visa aller Mitglieder der Kuratel, die ihn zwischen dem 19. und 24. 1. 1940 lasen. Darauf aufmerksam gemacht hatte das Kuratelsmitglied Adolf Lukas Vischer. Hausmann 2000, 162–165, rubriziert von Wartburg als «Beispiel von Ambivalenz» in der Haltung zum Nationalsozialismus.
474
Geisteswissenschaftler
Heusler zum Zeitgeschehen in Deutschland, nur dass Heusler von Basel aus urteilte, von Wartburg in Deutschland.1942 Diese Äusserungen folgten aus einem politischen Programm, das seit dem Ersten Weltkrieg darauf abzielte, die deutsche Schweiz und Deutschland in ein besonders enges Verhältnis zueinander zu bringen und je auf der einen Seite um Verständnis für die andere Seite zu werben. Darüber hinaus fühlte sich von Wartburg berufen, im Ausland, nicht nur in der Schweiz, zu demonstrieren, dass in Deutschland unter nationalsozialistischer Diktatur weiterhin seriöse Wissenschaft möglich sei. Die Unabhängigkeit der Schweiz war dabei eine absolute Voraussetzung, allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Schweiz ein positives Verhältnis zu Deutschland pflege. Andere Elemente waren jedoch immer auch präsent. So interessierte er sich in den 1920er Jahren für den gemässigten spanischen Republikaner und Rektor von Salamanca, Miguel de Unamuno, den er auch übersetzte.1943 Seine pädagogischen Beiträge berücksichtige ich hier nicht. Ein Vergleich mit Hektor Ammann ist aufschlussreich.1944 Von Wartburgs Einstellungen waren in vielen Punkten denen von Ammann ähnlich, insbesondere in der Einschätzung der Bedeutung eines guten Verhältnisses zwischen der Schweiz und Deutschland.1945 Ammann wurde jedoch von Schweizer Universitätspositionen ferngehalten und blieb auf das Aargauer Staatsarchiv beschränkt, nachdem unter anderen Ernst Gagliardi ihn als unerwünschten Germanophilen bezeichnet hatte, lange bevor er 1940 als einer der Verfasser der ‚Eingabe der 200‘1946 hervortrat. Er ging im aktiven Werben um Verständnis für Deutschland in der Schweiz sehr viel weiter als es von Wartburg je tat, und er nahm eine führende Rolle in der deutschen ‚Gemeinschaftsforschung‘ ein. Zudem pflegte er Verbindungen zu einem SS-Geheimdienstmann und wurde nach Kriegsende aus dem Aargauer Staatsdienst entlassen. Von Wartburg war an Treffen der Volksdeutschen Forschungsgemeinschaften interessiert,1947 in denen Ammann eine beherrschende Rolle spielte, aber ein konsequentes Engagement in diesem Umfeld ist bisher nicht bekannt geworden. Die für die nordgallisch-fränkischen Studien
1942 1943 1944 1945
1946 1947
Siehe oben zu Andreas Heusler im Abschnitt über die Germanisten. 1924 ein Beitrag über Unamuno in: Wissen und Leben. 1925 erschien von Wartburgs Übersetzung von Unamunos Abel Sanchez. Link 2019; Simon 1995. Ammanns Rolle in den Forschungsgemeinschaften: Quarthal 2007, 58; Fahlbusch 1999, 303–312 u. ö. Ammanns Position am Beispiel seines Auftritts an der Tagung der Westdeutschen Forschungsgemeinschaft in Badenweiler 1933: Fahlbusch 1999, 389. Siehe auch oben, Kapitel 2.6.3, Ammans Auftritt vor der «Zofingia» in Basel. Brassel-Moser 2010. Fahlbusch 1999, 349. An der Tagung der Westdeutschen Forschungsgemeinschaft in Bad Münster 1939 war von Wartburg als Referent vorgesehen mit dem Thema «Toponymische Glossen zur fränkischen Landnahme», meldete sich dann aber krank. Ebd. 399.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
475
einschlägigen nationalsozialistischen ‚Autoritäten‘ Franz Petri1948 und Franz Steinbach1949 zitierte er zwar, merkte aber an, sie seien über das Ziel, dem von Wartburg mit seiner These der fränkischen Masseneinwanderung grundsätzlich zustimmte, hinausgeschossen.1950 Immerhin trat er im Umfeld der süddeutschen Alemannenforschung auf, die in der Schweiz auf Misstrauen stiess, weil sie die Zugehörigkeit der Deutschschweiz zu Süddeutschland betonte und damit wie eine Anschlussvorbereitung wirkte. Im Unterschied zu Ammann, der intensiv publizistisch tätig war, verfasste von Wartburg nur wenige politische Texte. Er wollte die Meinung massgebender Kollegen durch persönliche Kontakte, durch seine eigene Existenz als ‚Schweizer in Deutschland‘ und durch die Redaktion seiner wissenschaftlichen Zeitschrift beeinflussen, ohne aktiv in nationalsozialistischen Organisationen oder Funktionen mitzuarbeiten. In diesem Sinne konnte er als ‚apolitisch‘ gelten. Wenn man bereit war, von Wartburgs Überzeugung, dass die Germanen das Abendland gerettet hätten, und seine Rechtfertigung deutscher Interessen und Aktionen auch in der Zeit des Nationalsozialismus als eine Idiosynkrasie eines ansonsten herausragenden Wissenschaftlers und zuverlässigen Schweizer Patrioten abzutun, die er schon vor 1933 ausgebildet hatte, liess er sich in die Kollegialität einer philosophischen Fakultät zur Zeit der ‚geistigen Landesverteidigung‘ integrieren. Die Basler Universität tolerierte damals neben von Wartburg Freunde des nationalsozialistischen Deutschland wie den Juristen Jakob Wackernagel-Sarasin,1951 den Ökonomen Friedrich Vöchting-Oeri1952 oder den Militärwissenschaftler Gustav Däniker.1953 Entscheidend war die Haltung der mehrheitlich linken Regierung und der antifaschistisch eingestellten Kuratel, und diese Instanzen wüschten, dass von Wartburg in den Lehrkörper der Basler Universität aufgenommen werde. Ihre Strategie der fachlichen Aufwertung der Fakultät gab den Ausschlag, und das patriotische Bekenntnis zur Unabhängigkeit der Schweiz liess Aspekte der politischen Orientierung vergessen. 1948 1949 1950
1951 1952
1953
Derks 2005. Tiedau 2008. Von Wartburg 1939, 117, konstatierte Übertreibungen, entschuldigte diese aber sogleich als «gerechtfertigte Reaktion gegen überkommene Anschauungen». Die Debatte ist differenziert zu betrachten, vgl. Hausmann 2000, 524. Siehe die Darstellung im Abschnitt über die Juristen, oben Kapitel 5.7. Über Friedrich Vöchting-Oeri sind mir bisher keine eingehenden Studien bekannt geworden. Eine kurze Erwähnung in: Moser/Heini 2020, 154–157: «In Ungnade gefallen» (Heini). Ferner http://www2.unil.ch/elitessuisses/index.php?page=detailPerso&idIdentite=80947. Nachlässe finden sich an verschiedenen Orten, so in Zürich, ETH Archiv für Zeitgeschichte https://www.afz.ethz.ch/bestaende/58bbe6dd4f154525a579a83524411373.pdf (mit biographischer Notiz), und in der Universitätsbibliothek Basel, http://www.ub.unibas.ch/ibb/api/ ubnachlass/personen.html. Siehe die Darstellung im Abschnitt über die Juristen, oben Kapitel 5.7, Exkurs.
476
Geisteswissenschaftler
7.2.5 Englische Sprache und Literatur 7.2.5.1 Henry Lüdeke, ein Deutschamerikaner in Basel Der in den USA geborene Henry Lüdeke erhielt seine literaturwissenschaftliche Ausbildung in Deutschland bei Julius Petersen, bei dem er 1915 in Frankfurt am Main promovierte. Als Lektor lernte er die Universitäten Bonn und Gießen kennen. Da er amerikanischer Staatsbürger war und trotz der Heirat mit einer Deutschen blieb, verliess er als ‚feindlicher Ausländer‘ beim Kriegseintritt der USA Deutschland und siedelte in die Schweiz über. Als Aushilfslehrer arbeitete er in Basel, Zürich, Frauenfeld und Glarisegg. 1919 wurde er Lehrer an der Kantonsschule Schaffhausen. Fünf Jahre später erhielt er die Professur für Englische Sprache und Literatur an der Handelshochschule St. Gallen. Dies bedeutete eine Festlegung auf Anglistik, nachdem er vorher gleichermassen Germanistik und Anglistik betrieben hatte. 1930 trat er die Nachfolge von Gustav Hübener in Basel an, während Hübener nach Bonn wechselte. Lüdeke blieb Basel bis zu seinem Rücktritt 1959 erhalten. Er liess sich nicht vereinnahmen, weder von schweizerischer noch von deutscher noch von amerikanischer Seite. Sein Hauptwerk war die Geschichte der amerikanischen Literatur (publiziert 1952), die wie seine anderen Arbeiten eine geistesgeschichtliche Ausrichtung zeigte. Lüdeke war fasziniert von den Dichtern als Individuen, die als Ausnahmemenschen eine Ausnahmeleistung erbrachten, und rekonstruierte ein greifbares Bild ihrer Welt. Für die nordamerikanische Literatur nahm er eine Dominanz puritanischer Einflüsse an. Neben der Frage nach den Wirkungen des Puritanismus befasste er sich mit dem Verhältnis der amerikanischen Autoren zu Europa und der ‚Frontier‘-Thematik. Als Wissenschaftsorganisator entwickelte er zusammen mit dem in Zürich lehrenden Bernhard Fehr die niederländische Fachzeitschrift «English Studies» seit 1936 zu einem angesehenen anglistischen Organ, das zugleich der schweizerischen Forschung und derjenigen anderer kleinerer Länder ausserhalb des deutschen Einflussbereichs diente.1954 Was er aber sonst zwischen 1933 und 1945 getan und gesagt hat, ist bisher nicht erforscht worden, obschon sich in der Basler Bibliothek ein Nachlass befindet.1955 Deutlich ist schon jetzt, dass seine Anglistik nichts mit der Entwicklung des Faches gemein hatte, die von 1933 bis 1945 in Deutschland ablief, wo britische Kultur und englischer Volkscharakter unter den Aspekten des Imperialismus und der angeblichen jüdischen Einflüsse in einer germanischen Perpektive mit dem Ziel dargestellt wurden, zusammen mit den neu eingerichteten Amerikastudien ideologische Bedürfnisse des Regimes zu bedienen.1956 Die ausseror1954 1955 1956
Engler 2008; Stamm 1966, 8–14; Zandvoort/Stamm 1949, 147–148. Nachlass NL 339, 1981 über Rudolf Stamm in die Bibliothek gelangt, 2021 leider immer noch unzugänglich. Hausmann 2007, 347–351.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
477
dentlich umfangreiche «Tabula gratulatoria» in der Festschrift von 1949 deutet darauf hin, dass Lüdeke ein weites Beziehungsnetz pflegte und über die Fachgrenzen hinaus beliebt war.1957 Er unterrichtete jedoch Englisch in Basel nicht allein. 7.2.5.2 Privatdozenten und Lektoren Bis 1935 las Gustav Binz regelmässig über Englische Philologie, aber auch über Bibliothekswissenschaft. Er hatte in Basel und Berlin Germanistik, Romanistik und Orientalistik studiert und sich 1893 in Basel für englische Philologie habilitiert. 1889 war er in den Basler Bibliotheksdienst eingetreten, dann leitete er von 1908 bis 1920 die Bibliothek in Mainz, wonach er von 1920 bis 1923 als Vizedirektor der Schweizerischen Landesbibliothek amtierte. 1923 wurde er als Oberbibliothekar nach Basel gewählt. Im selben Jahr erteilten ihm die Basler Behörden einen Lehrauftrag für Englische Philologie (und Bibliothekswissenschaft) sowie den Titel eines Ordinarius ad personam.1958 Eine weitere Persönlichkeit in der Basler Anglistik, die ich erwähnen möchte, war Karl Jost, der 1915 Privatdozent geworden war und von 1932 bis 1954 als Extraordinarius englische Grammatik und Altenglisch dozierte. 1960 verstarb er mit 78 Jahren. Über ihn lässt sich nur wenig in Erfahrung bringen, da er anscheinend weitgehend in Vergessenheit geriet, trotz der langen Wirkungszeit, seiner Forschungen z. B. über Wulfstan, der zahlreichen Buchbesprechungen aus seiner Feder und der Bedeutung seiner Lehrgegenstände, die die neuere Literaturgeschichte, die Lüdeke betrieb, ergänzten.1959 1934 doktorierte Rudolf Stamm bei Lüdeke. Er habilitierte sich hier 1938. Die weitere Laufbahn betraf die Zeit nach dem Krieg und liegt deshalb ausserhalb meines Gesichtskreises: 1948 wurde er zum Extraordinarius befördert, 1950 erhielt er die englische Professur an der Handelshochschule St. Gallen, 1956 eine Professur in Bern, von wo aus er 1959/60 als Nachfolger von Henry Lüdeke nach Basel berufen wurde. Das englische Drama war der Schwerpunkt seiner Arbeiten, womit er vorher die Amerikanistik von Lüdeke als Privatdozent und Extraordinarius gut ergänzt hatte.1960 Neben dem Ordinarius, dem Extraordinarius und den Privatdozenten kümmerten sich jeweils Lektoren um den Sprachunterricht für die Basler Studierenden. Der erste Englisch-Lektor, den ich nachweisen kann, war John Alexander 1957 1958 1959
1960
Zadvoort/Stamm 1949. https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Binz_(Philologe). Der wissenschaftliche NL befindet sich in der Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek Basel: Öffentliche Bibliothek der Universität Basel, Findbuch zu NL 189 (Karl Jost). Baertschi 2012a; Stamm 1991 (mit Schriftenverzeichnis).
478
Geisteswissenschaftler
West, im Personalverzeichnis erwähnt für das Jahr 1933. Er schrieb 1927 in den vom Germanisten Walter Muschg herausgegebenen «Annalen» über den Ulysses von James Joyce. Leonard Wilson Forster, MA Cambridge (UK), erhielt sein Doktorat in Basel 1938. Im Vorlesungsverzeichnis erschien er vom Wintersemester 1936/37 bis 1938 als Englischlektor. Analoge Positionen hatte er vorher in Leipzig (1934) und Königsberg (1935–1936) versehen. 1950 wurde er Professor für Deutsch am University College London und 1961 Schröder Professor of German in Cambridge. In Basel heiratete er 1938 Jeanne Marie Louise Billeter.1961 Lektor für Sprachkurse war während des Krieges Eudo Colecestra Mason (auch Colchester Mason genannt). Er war an sich Germanist mit einem Leipziger Doktorat über Rilke (1938) und wurde 1951 Professor für Deutsch an der University of Edinburgh.1962 Unvergessen ist der Unterricht in Phonetik, den Maria Schubiger, 1929 in Zürich doktoriert, 1986 84jährig verstorben, in Basel und Zürich von 1936 bis 1973 erteilte.1963 7.2.6 Die Slawistin: Elsa Mahler Elsa Mahler, Tochter eines Schweizer Kaufmanns in Moskau, Josef Mahler (verstorben 1893), und der Deutschbaltin Luisa Wilhelmine Sievers (verstorben 1904), hatte nach dem Besuch der Bestuzev-Hochschule in St. Petersburg in Berlin und München von 1909 bis 1913 (in ihrem Lebenslauf für die Habilitation gab sie die Jahre 1911 bis 1914 an) bei Otto Crusius und Friedrich Vollmer Klassische Philologie und Kunstgeschichte studiert. Bis zur Oktoberrevolution arbeitete sie als Geschichtslehrerin (im Lebenslauf erwähnt sie das Fach Latein) in Russland. 1919 bekam sie eine Stelle als Kustodin und Assistentin in der Altertumssammlung der Russländischen Akademie für Geschichte der materiellen Kultur in St. Petersburg. 1920 fuhr sie zur Weiterbildung in die Schweiz und immatrikulierte sich in Basel im Herbst dieses Jahres, um Klassische Archäologie bei Ernst Pfuhl zu studieren. Die sowjetischen Behörden verweigerten ihr die Rückkehr. Sie blieb in Basel, wo ihr Pfuhl und andere verschiedene Aufträge verschafften, mit denen sie den Lebensunterhalt bestreiten konnte. Im Frühjahr 1924 promovierte sie in Klassischer Archäologie und den Nebenfächern Griechisch und Latein mit einer Arbeit über Megarische Becher.1964 Inzwischen war ihr 1923 gegen den anfänglichen Widerstand der Kuratel ein Lektorat für Russisch übertragen worden. Die Fakultät hatte seit 1917 ein solches Lektorat gefordert und seit 1922 empfohlen, Elsa Mahler anzustellen. Nun 1961 1962 1963 1964
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Wilson_Forster. NL: Collection of Letters and Poems of Eudo Colecestra Mason, in: Edinburgh University Library Special Collections, https://archiveshub.jisc.ac.uk. James/Kettemann 1983, 302. Mahler 1924.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
479
bereitete sie eine Habilitation für «Slawistische Studien» vor. Da es in der Schweiz keine einschlägigen Bibliotheksbestände gab, arbeitete sie in den Semesterpausen in Prag, Paris und Berlin, bis sie im Herbst 1927 ihre Habilitationsschrift über die russische Totenklage einreichen konnte. Die Basler Fakultät habilitierte sie aufgrund eines Gutachtens von Professor Matija (Matväs) Murko von der Karls-Universität in Prag 1928. Bis 1939 gab es nur zwei Privatdozentinnen an der Universität Basel, Elsa Mahler und die Ökonomin Salomé Schneider (habilitiert 1929).1965 Elsa Mahler suchte in ihrer Arbeit nach dem Wesen der ursprünglichen Volkskultur (und damit des russischen Volkes) und widmete der Rolle der Frauen innerhalb dieser Kultur eine besondere Aufmerksamkeit.1966 Die Habilitationsschrift erschien 1935 in Leipzig im Verlag Otto Harrassowitz,1967 der die «Veröffentlichungen des Slavischen Instituts an der Friedrich Wilhelms Universität Berlin» publizierte (Mahlers Buch war Band 15 dieser Reihe). Der Herausgeber und Institutsleiter Max Vasmer war ein Russlanddeutscher, der sich 1909 in St. Petersburg habilitiert, ab 1912 an der Petersburger Frauenhochschule (an der Mahler studiert hatte) gewirkt hatte und über Saratow und Dorpat 1921 nach Leipzig und 1925 nach Berlin berufen worden war. Vasmer versuchte in den 1930er Jahren, dort eine wissenschaftliche Slawistik gegen die Erwartungen der Nationalsozialisten zu verteidigen, die germanische Einflüsse auf die Slaven in den Mittelpunkt stellen und die Slawistik in die ‚Ostforschung‘ einreihen wollten.1968 1936 erhielt Elsa Mahler in Basel einen vierstündigen Lehrauftrag, und 1938 wurde sie zur Extraordinaria befördert.1969 Die Fachbibliothek, die sie aufbaute, war zunächst Bestandteil des Indogermanischen Seminars, dem ihr Lehrauftrag angegliedert war; daraus wurde auf Antrag des verantwortlichen Professors Albert Debrunner 1942 die Russische Bibliothek als selbstständige Universitätsan-
1965 1966
1967
1968 1969
Tikhonov 2005, 103. (Katalog) Elsa Mahler 1882–1970, 5–24; Riggenbach 2010. https://de.wikipedia.org/wiki/ Elsa_Mahler. https://unigeschichte.unibas.ch/lokal-global/der-nationale-und-internationalekontext/wege-nach-basel/elsa-mahler-die-erste-professorin (2010). https://slavistik.philhist. unibas.ch/de/fachbereich/seminargeschichte/elsa-mahler/. Mahler 1935. Danach erschien noch: Mahler 1938 (fortan nur in der Schweiz publizierend). Der Vita Nova Verlag, in dem dieses Werk erschien, war 1934 vom deutschen Emigranten Rudolf Roessler gegründet worden, der Werke anderer Emigranten und solche aus dem Umkreis eines christlichen (katholischen: Paul Claudel, Jacques Maritain) Humanismus mit kritischer Tendenz gegenüber dem Nationalsozialismus veröffentlichte, darunter auch solche des Philosophen Nikolaj Berdjajew. Stourzh 2008, 32 f. Bott 2005, 284 ff. Kopie 29 im Ausstellungskatalog. Katalog, 31, zeigt, dass sie seit 1928 Fr. 3’000 als Lektorin und zusätzlich Fr. 3’000 als Unterstützung durch die FAG erhalten hatte – sie empfand dies als gering.
480
Geisteswissenschaftler
stalt.1970 1937 bis 1939 fuhr sie jedes Jahr nach Estland, um Volkslieder im Umland der altrussischen Stadt Pe⇥ory aufzuzeichnen. Die Sammlung von etwa 200 Liedern erschien 1951 im Bärenreiter-Verlag.1971 1944 war ihr Lehrbuch der russischen Sprache mit Übungs- und Lesestücken im Europa-Verlag Zürich erschienen, der auch die zweite, verbesserte Auflage nach dem Krieg herausbrachte.1972 Der Europa Verlag war 1933 von Emil Oprecht gegründet worden und galt als ‚Emigrantenverlag‘; Oprecht engagierte sich während des Krieges in der Hilfe für Verfolgte.1973 Studienreisen und Materialbeschaffung (darunter eine Dia-Sammlung und eigene Filmaufnahmen) finanzierte Mahler offenbar aus den Mitteln ihrer Besoldung als Lehrbeauftragte, was sie in wirtschaftliche Bedrängnis brachte. Von ihrem Einsatz für Verfolgte und Verarmte in der Zeit zwischen 1933 und 1945 erfahren wir, dass sie sich 1939 dafür einsetzte, dass die Manuskripte der Dichterin Marina Zvetajeva (Cvetaeva), die sie in Paris kennengelernt hatte, in die Basler Bibliothek gerettet wurden.1974 Ferner hielt sie während des Krieges Kontakt zu den sowjetischen Soldaten, die in der Schweiz interniert waren, und organisierte für diese eine Unterstützung durch wohlhabende Basler und Russlandschweizer. Dadurch geriet sie in Verdacht, für die Sowjetunion zu arbeiten, und wurde vom Spezialdienst des Basler Polizeiinspektorats 1943/44 überwacht.1975 Dieser Verdacht wurde dadurch genährt, dass sie zusammen mit Fritz Lieb1976 und Carl Miville seit 1944 für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen der Schweiz zur Sowjetunion warb, woraus ihre Tätigkeit in der Gesellschaft Schweiz-Sowjetunion1977 erwuchs. Auch die Wahl ihrer Verleger schien darauf hinzudeuten, dass sie sich in einem ‚linken‘ Umfeld bewegte. Ihre Vorstellung von der friedfertigen und brüderlichen Natur des russischen Volkes wurde vorübergehend als kommunistische Propaganda missverstanden, dabei handelte es sich um eine tiefe Identifikation mit der slawischen Seele unabhängig davon, wer
1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977
Katalog 32, 39 f. Katalog 51. Katalog 47. Aufsätze von Elsa Mahler in wissenschaftlichen Zeitschriften sind mir nicht begegnet. Vermutlich hat sie sich auf ihre Buchprojekte konzentriert. https://de.wikipedia.org/wiki/Europa_Verlag. Vgl. Salvisberg 2017. Katalog 36. Überwachung 1943 bis 1958: Bundesarchiv Bern, E4320B 1975/40_122, C.08.2248, E4320B#1975/40#740*. Die Basler Akte ab 1951, in: StABS PD-REG 5a 2 5314, zeigt, dass sie auch nach dem Krieg wiederholt verdächtigt wurde, kommunistische Propaganda zu betreiben. Diese zum Teil von einem blinden Kommunistenhass geprägten Denunziationen erwiesen sich als haltlos. Richtig stellt das Résumé über die Erhebungen von 1943/44, das am 3. 9. 1951 erstellt wurde, fest, dass Elsa Mahler keine Kommunistin, sondern eine Russlandfreundin sei. Die Fiche der Basler Politischen Abteilung in: StABS PD-REG 5a 3 1 1, beginnt 1944 und zeigt, dass sie bis zu ihren Tod 1970 observiert wurde. «Über das Verhältnis zwischen Mahler und Lieb wissen wir wenig.» Katalog 35. Tikhonov 2005, 112; Katalog 37 f.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
481
über Russland herrschte, während sie selbst mit den Bolschewiken nichts anfangen konnte. Allerdings schätzte sie es nicht, wenn Stalin mit Hitler gleichgesetzt wurde. 7.2.7 Orientalisten Rudolf Tschudi1978 vertrat in Basel im Rang eines Ordinarius die Orientalistik, das heisst namentlich Sprache und Kultur des Osmanischen Reichs. Dieses Fach galt nicht als marginal, zumal Tschudi mit wichtigen Fakultätsmitgliedern wie Peter von der Mühll eng befreundet war – seine Kenntnisse und Beziehungen zu führenden türkischen Persönlichkeiten waren für die Orientreisen der Altertumsforscher schon in praktischer Hinsicht unentbehrlich. Wie sich Tschudi von 1933 bis 1945 zu Deutschland und zum Nationalsozialismus verhielt,1979 konnte ich nicht klären, doch würde sich eine solche Untersuchung lohnen, weil er die erste Etappe seiner Laufbahn im imperialistischen und kolonialistischen Umfeld des Deutschen Reichs während des Ersten Weltkrieges absolviert hatte. Tschudi hatte in Basel (wo er als Klassischer Philologe begann und 1904 von Adam Mez für Arabisch und Persisch begeistert wurde), in Erlangen und in Tübingen studiert. In Erlangen doktorierte er 1910 bei Georg Jacob, dem Begründer der Turkologie in Deutschland. In dieser Zeit begann er im Osmanischen Reich Handschriften zu sammeln. Gleich anschliessend an das Doktorat wurde er Assistent von Carl Heinrich Becker, der seit 1908 den Lehrstuhl für Geschichte und Kultur des Vorderen Orients am Hamburger Kolonialinstitut1980 innehatte. Becker gab seiner Abteilung des Kolonialinstituts ein Profil, das die Beschäftigung mit Sprachen, Religionen, Kulturen, Geschichte und Gesellschaft zu einer Orientkunde verband. Tschudis Aufgabe bestand zuerst vor allem in der Durchführung von Kursen für Türkisch. 1911 begann er mit der Vorbereitung seiner Habilitation in Tübingen, wo er die Freundschaft Enno Littmanns gewann. Als Becker 1913 nach Bonn wechselte, wurde Tschudi, noch bevor er sich hatte habilitieren können, sein Nachfolger im Hamburger Institut als Leiter des Seminars für Geschichte und Kultur des Vorderen Orients, eine Funktion, die er bis Kriegsende behielt.1981 Seit 1913 war er Mitherausgeber der Reihe «Türkische Bibliothek», die Jacob gegründet hatte; seit 1914 gab er auch die Zeitschrift «Der Islam», die Becker geschaffen hatte, heraus. In Hamburg war Tschudi einer der Professoren, die die Lehre am Kolonialinstitut im Sinne von Becker weiterführten. Damit war er in den deutschen Kolonialimperialismus integriert, der aus einer wissenschaftlichen Haltung und Kenntnis heraus eine rationale Aneignung 1978 1979 1980 1981
Würsch 2019a; Bigger 2015; Meier 1962; Taeschner 1961. Orientalistik in Deutschland 1933–1945: Marchand 2007, 289–299. Ruppenthal 2007, 142–144, 233–235; Marchand 2007, 282. Köse 2016, 298.
482
Geisteswissenschaftler
der Welt betreiben wollte, teils unter Anwendung informeller, wirtschaftlicher, kultureller und diplomatischer Methoden, teils mit formeller Durchdringung afrikanischer und pazifischer Territorien als «Schutzmacht».1982 Tschudis Tätigkeit war Teil des informellen Imperialismus gegenüber dem Osmanischen Reich resp. der Türkei, deren Reformen in Rechtssystem und Hochschulwesen das Deutsche Reich ebenso unterstützte wie den Aufbau einer modernen Armee. Tschudis Position bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs hat Ali Sonay kürzlich anhand von dessen Vortrag «Der Islam und der Krieg» von 1914 untersucht.1983 In der Verbindung der Mittelmächte mit dem Osmanischen Reich sah Tschudi ein Bündnis mit einer «geistigen Weltmacht […], dem Islam». Er erkannte, dass die Besetzung von Teilen des Osmanischen Reichs durch westeuropäische Mächte und die Verbreitung gedruckter Schriften einen modernen «Panislamismus» provozierten: Dem als Sieg des Christentums gedeuteten Erfolg des Westens sollte ein erneuerter und vereinter Islam entgegengestellt werden. Tschudi fasste das deutsche Bündnis mit dem Osmanischen Reich als eine Chance für eine Koexistenz, ja Annäherung zwischen «Orient und Okzident» auf, allerdings unter Führung der europäischen Moderne. Einen offenen Konflikt zwischen Panislamismus und Christentum könnten seiner Meinung nach die Westmächte verursachen, nicht aber die Deutschen. So war er teilweise auch politisch-ideologisch in die deutsche Orientalistik eingebunden, urteilte aus der «orientalistischen» Position des überlegenen Abendländers1984 und erwartete seit 1914, dass das auch von Becker lebhaft begrüsste Bündnis mit der Türkei den deutschen Interessen diene.1985 Man erkennt, dass Tschudi keinen offensiven deutschen Imperialismus predigte, sondern eine freundliche, ‚desinteressierte‘ Annäherung im Sinn hatte, die dem Deutschen Reich informell nützen sollte. Deutsche Wissenschaft und deutsche kulturelle wie wirtschaftliche Beziehungen sollten dazu beitragen.1986 Tschudis Referat war Teil einer Reihe von Kriegsvorträgen der Hamburger Professoren. 1917, als der Hochschulbetrieb in Hamburg wegen des kriegsbedingten Mangels an Hörern stark eingeschränkt war, begab sich Tschudi zusammen mit Hamburger Kollegen nach Davos, um für «Kolonialdeutsche», die in der Schweiz interniert waren, Kurse abzuhalten, die von der deutschen Gesandtschaft in Bern aus betreut wurden. Daraus entstand 1918 vorübergehend eine entsprechende Institution in Brunnen, an der wiederum Tschudi dozierte.1987 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Hoffmann 1980, 126 ff. Sonay 2019, 55–66; Ruppenthal 2007, 251. Sonay 2019, 64, 66. Becker lobte nach 1918, dass Tschudi während des ganzen Krieges «treu» zur deutschen Sache gehalten habe, zitiert nach: Bolliger u. a. 2019, 75; Taeschner 1961. Bolliger u. a. 2019, 75. Hoffmann 1980, 147 ff.
Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
483
Als Tschudi 1919 in die Schweiz zurückkehrte, wurde er ausserordentlicher Professor für Orientalische Sprachen in Zürich. 1922 wählte ihn Basel zum Nachfolger für Friedrich Schulthess, der hier 1917 berufen worden war und 1919 das Orientalische Seminar gegründet hatte.1988 In Basel lehrte Tschudi bis zur Emeritierung im Jahre 1949 auf dem Ordinariat der «Orientalischen Philologie», eine Bezeichnung, die verdeutlichen sollte, dass auch die nichtsemitischen Sprachen des Vorderen Orients berücksichtigt wurden. Einen Ruf nach Göttingen lehnte er 1929 ab. Von Basel aus pflegte er intensiv den Kontakt zu seinen deutschen Lehrern und Kollegen, wovon die umfangreiche Korrespondenz zeugt. Für den Aufund Ausbau der Bibliothek und der Handschriftensammlung hilfreich war Tschudis Beziehung zu Hellmut Ritter (dem Bruder des Freiburger Historikers Gerhard Ritter), der 1919 sein Nachfolger in Hamburg geworden war, aber im Verlauf der 1920er Jahre wegen einer Affäre Deutschland verliess und sich seither in Istanbul aufhielt. Ritter besorgte ihm Bücher und Handschriften; er unterstützte seit 1934 auch die Arbeit von Tschudis Schüler Fritz Meier in den Bibliotheken Istanbuls.1989 Tschudi liess sich von einer persönlichen Neugier für die Sprachen, Geschichte und Religion des Osmanischen Reichs leiten, um den Islam mit Respekt als «geistige Macht» zu begreifen. Der türkischen Sprache, dem Derwischtum und der Geschichte des Osmanischen Reichs galt sein Interesse in Basel, aber durchaus auch den Ereignissen seiner Gegenwart; darüber hinaus setzte er sich für die Einrichtung eines Faches Ägyptologie in Basel ein. Die islamische Mystik faszinierte ihn am Ende mehr als die politische Deutung der aktuellen Weltlage. Wo stand Tschudi 1933? Das Hamburger Kolonialinstitut, an dem er die erste Phase seiner Laufbahn zugebracht hatte, war damals Teil einer mächtigen Vergangenheit der deutschen Wissenschafts-Aussenpolitik. Ich sehe Tschudi als Liberal-Konservativen und als Freund der Deutschen und ihrer Wissenschaft in der Art von 1914, aber nicht als Sympathisanten mit dem Nationalsozialismus. Die Niederlage des Reichs 1918 hatten Becker und Tschudi als «geistigen Untergang des ‚Deutschtums‘» gedeutet.1990 Die 1938 erfolgte Neugründung des Hamburger Kolonialinstituts hat ihn offensichtlich nicht bewegt.1991 Er unterstützte vielmehr notleidende Kollegen in Deutschland und wurde in der Nachkriegszeit zu einer Art Drehscheibe für den Austausch von Nachrichten und Liebesgaben für die Familien von deutschen Fachgenossen.1992 Auch jüdischen Studenten hat
1988 1989 1990 1991 1992
Würsch 2019, 33 ff. Bolliger u. a, 2019, 76, 98. Bolliger u. a. 2019, 76. Linne 2008, 54–56, 133 ff.; Hoffmann 1980, 150. Präsentation des NL in: https://ub-easyweb.ub.unibas.ch zum Fachgebiet Islamwissenschaften (tschudi-biografie.pdf). «Starke Bande verknüpften ihn mit deutschen Freunden,
484
Geisteswissenschaftler
er während des Krieges geholfen, wie das Beispiel von Ernst Ludwig Ehrlich zeigt.1993 Dass er fast nur in Deutschland publiziert hat, will nichts besagen, da es in der Schweiz kaum Verleger oder Drucker gab, die mit türkischen oder arabischen Textpassagen umgehen konnten. Zudem hat Tschudi 1934 bis 1941 fast nichts veröffentlicht, ausgenommen seinen Beitrag zu einem deutschen Projekt, der Propyläen Weltgeschichte (Teil Osmanische Geschichte bis zum Ausgang des 17. Jahrhunderts, erschienen in Berlin 1941).1994 Tschudis Schüler und Nachfolger Fritz Meier doktorierte bei ihm 1937. Seit 1935 wies ihm Tschudis Freund Hellmut Ritter in Istanbul nicht nur Wege zu Handschriften, sondern prägte ihm auch die Liebe zur philologischen Arbeit ein, nachdem er die islamische Mystik bereits bei Tschudi hatte studieren können.1995 Er wurde 1941 habilitiert (mit der Schrift Die schöne Mahsati), 1946 zum Extraordinarius befördert und verbrachte die Jahre 1946 bis 1948 in Alexandria, wo er als Maître de conférences Persisch unterrichtete. 1949 wurde er Nachfolger von Tschudi auf der Basler Professur.1996
7.3 Kunsthistoriker – Joseph Gantner: Letzter universaler Kunsthistoriker 7.3.1 Einleitung Meine Untersuchung über die Kunstgeschichte in Basel konzentriert sich auf Joseph Gantner. Darob soll nicht vergessen werden, dass andere dieses Fach früher als er und zum Teil neben ihm lehrten: Vor und neben Gantner standen vor allem Heinrich Alfred Schmid und Paul Ganz in vorderster Linie der Basler Kunstgeschichte, während Heinrich Wölfflin1997 einen dauernden Einfluss auf die Basler Kunstwissenschaft ausübte. Dies galt auch für die Wahl von Joseph Gantner im Jahr 1938.
1993
1994 1995
1996 1997
denen er in schwierigen Zeiten über die Grenzen hinweg seinen Beistand lieh.» Meier 1962, 140. Bomhoff 2015, 59. Ehrlich kam 1943 als Flüchtling nach Basel und studierte bei Walter Baumgartner Altes Testament sowie bei Tschudi Orientalistik. Letzterer hatte ihm geholfen, die Bewilligung der Fremdenpolizei für sein Studium zu erhalten. Meier gibt als Begründung für die geringe Zahl der Veröffentlichungen nur Tschudis Schreibhemmung an. Meier 1962, 139. «Meeting Ritter was decisive for Fritz Meier’s future academic career, because this renowned German Orientalist encouraged his high esteem of philology as the indispensable foundation for the study of other cultures, as well as his predilections for Islamic mysticism and Persian poetry.» Schubert 2002. Baumeister o. J.; Schubert 2019; Kieser 2008; Schubert 2002. Wölfflin 1982.
Kunsthistoriker
485
Schmid war ursprünglich Theologe (Studienabschluss 1886), doktorierte dann aber 1888 in München in Kunstgeschichte und habilitierte sich 1892 in Würzburg. 1896 hielt er sich in Berlin auf, wo er 1901 die Nachfolge von Wölfflin auf dem Extraordinariat für Kunstgeschichte antrat. Von 1904 bis 1912 lehrte er an der deutschen Universität in Prag, dann nahm er einen Ruf nach Göttingen an. Nach dieser Laufbahn in Deutschland wurde er 1919 nach Basel gewählt, wo er bis 1925 als Konservator der Basler Öffentlichen Kunstsammlung diente, dann wurde er Nachfolger des Universitätsprofessors Friedrich Rintelen. Nach seiner Emeritierung 1937 blieb er an der Universität präsent. Im Mittelpunkt seiner Forschungen standen Böcklin und Hans Holbein; an den Untersuchungen über Matthias Grünewald war er massgeblich beteiligt.1998 Paul Ganz erscheint im Vergleich zu Schmid als die dynamischere Person, auch hatte er eine helvetische Karriere durchlaufen (Studium der Kunstgeschichte in Zürich zwischen 1893 und 1897) und war auf die Kunst in der Schweiz ausgerichtet. Doktoriert hatte er beim Züricher Johann Rudolf Rahn über ein heraldisches Thema. 1899 holte ihn Rudolf Wackernagel für den Aufbau der Siegelsammlung ans Basler Staatsarchiv. Habilitiert wurde er 1901 in Basel, anschliessend war er (als Vorgänger von Schmid) von 1902 bis 1919 Konservator der Öffentlichen Kunstsammlung Basel. Von diesem Amt trat er wegen Differenzen über das Projekt des Museumsneubaus zurück und befasste sich danach mit Gutachten für Sammler. Als Ersteller von Inventaren und Spezialist für Kunstpflege verfügte er nun über weniger akademischen Kredit als die universitären Kunstwissenschaftler aus der Schule Wölfflin. Zudem gab er der Erhaltung der Kulturgüter Priorität vor der Auseinandersetzung mit neuen Kunsttendenzen. 1909 wurde er zum Extraordinarius befördert. Nach dem Rücktritt von der Konservatorenstelle widmete er sich vermehrt der Lehre, insbesondere an der Volkshochschule, wo seine Kurse beliebt waren. 1929 wurde er Ordinarius ad personam mit einem Lehrauftrag für Kunstgeschichte der Schweiz, was Heinrich Alfred Schmid
1998
Es gibt weder einen Eintrag im HLS noch in der Deutschen Biographie. Ausser dem Wikipedia-Artikel (https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Alfred_Schmid) können nur Nekrologe angeführt werden: Zur Erinnerung 1951. Nachlass Werner Kaegi, WK 231, Briefwechsel 1927/28. Schmid fühlte sich von Paul Ganz verfolgt (vgl. Berger 2016, 132). Schmid an Kaegi, 7. 8. 1935. Er war stolz auf seine Zeit an der deutschen Universität Prag, deren Umwandlung in eine tschechische Universität unter kommunistischem Vorzeichen er dann 1949 vehement kritisierte, nicht aber die dortigen Vorgänge zur Zeit des Nationalsozialismus. Er wollte 1936 nicht an der Gedenkschrift für Erasmus mitwirken, wenn Ganz auch daran beteiligt sei. Schmid an Kaegi, 12. 5. 1937, wegen der Aktivitäten von Ganz bei der Neubesetzung des Basler kunsthistorischen Lehrstuhls. Prag: Schmid an Kaegi, 24. 1. 1949, und Kaegis Konzept für eine Antwort vom 26. 1. 1949 (verschrieben zu «1948»). Alles in: Nachlass Werner Kaegi, WK 231.
486
Geisteswissenschaftler
sehr bedauerlich fand.1999 Das Archiv für Schweizerische Kunstgeschichte, das die Behörden 1932 von ihm als Schenkung entgegennahmen, beanspruchte ebenso wie seine umfangreiche Diasammlung in der Öffentlichen Kunstsammlung Platz. Auf eidgenössischer Ebene war er im Heimatschutz, in der Eidgenössischen Kunstkommission, seit 1933 in Pro Helvetia und in der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte präsent. Als Holbein-Forscher stand er in Konkurrenz zu Schmid.2000 Daniel Burckhardt-Werthemann wurde im Personalverzeichnis der Universitätslehrer bis 1945 als ausserordentlicher Professor der Phil. I-Fakultät (resp. Abteilung) geführt. Der Sohn des Bandfabrikanten Daniel Burckhardt-Thurneysen studierte Kunstgeschichte und Archäologie, spezialisierte sich für die Kunst des Spätmittelalters, promovierte in Strassburg und wurde vorübergehend Konservator der öffentlichen Kunstsammlung. Paul Ganz wurde 1901 sein Nachfolger, während Burckhardt das Präsidium der Kunstkommission und eine Professur an der Universität übernahm. Er gilt als Entdecker von Konrad Witz.2001 Neben kunstgeschichtlichen Arbeiten publizierte er zur Stadtgeschichte. Wilhelm Barth, der selber eine Ausbildung als Maler genossen hatte, organisierte als Konservator der Kunsthalle Basel (von 1909 bis 1934) Ausstellungen damaliger Gegenwartskunst. In der Periode von 1923 bis 1929 präsidierte er den Schweizerischen Kunstverein. Erst 1931 wurde er Extraordinarius für moderne Kunsterziehung. Da er 1934 verstarb, fällt er für meine Untersuchung nicht in Betracht.2002 An der Universität lehrende Kunsthistoriker arbeiteten zum Teil hauptberuflich an Museen: Der Ordinarius Friedrich Rintelen war 1925/26 kurzzeitig für die Öffentliche Kunstsammlung verantwortlich (als Nachfolger von Heinrich Alfred Schmid), dann trat 1927 Otto Fischer (1907 bei Wölfflin doktoriert) dieses Amt an und bekleidete es bis zu seinem gesundheitlich bedingten Rücktritt 1938, zugleich war er an der Universität Extraordinarius mit einem Lehrauftrag für Kunstgeschichte, spezialisiert für Ostasien. Unter Fischer wurde der Neubau des Kunstmuseums 1936 erstellt.2003 Fritz Gysin, Inhaber eines Lehrauftrags an der Universität, war von 1928 bis 1936 Konservator am Historischen Museum Basel und wechselte 1936 als Direktor an das Schweizerische Landesmuseum.2004 Hans 1999 2000 2001 2002 2003
2004
Schmid an Zinkernagel, 24. 1. 1931, in: Zinkernagel 2020, 1880 f., Nr. 1711. Schmid schrieb von einem Krieg zwischen den wahren Kunsthistorikern und Ganz. Berger 2016; Caviezel-Rüegg 2005; Kaufmann 1956. Burckhardt-Sarasin 1951. Lapaire 2002. Der Nachfolger Lucas Lichtenhan, Kurator der Kunsthalle von 1933 bis 1948, hatte anscheinend keine Beziehungen zur Universität. Tisa Francini 2020, 105. Meier 2011; Meier/Bühler 2003; Fischer 1936. Bereits Fischer förderte den Ankauf von zeitgenössischer deutscher Kunst (Kirchner), wurde aber von der Kunstkommission gebremst, die Basler und Schweizer Kunst stark gewichtete. Tisa Francini 2020, 104. Lanz 2006.
Kunsthistoriker
487
Reinhardt habilitierte sich 1932, wurde aber erst 1943 zum Extraordinarius für «Spezialgebiete der mittelalterlichen Kunst» befördert. Er war lange am Historischen Museum tätig. Keine Beziehung zur Universität hatte Fischers Nachfolger am Kunstmuseum, Georg Schmidt, der von 1939 bis 1961 der Kunstsammlung vorstand. Die Fakultät verhinderte die Erteilung eines Lehrauftrags, da Schmidt zwar doktoriert hatte (über die Geschichtsphilosophie von Johann Jakob Bachofen, 1929), aber, statt eine akademische Laufbahn einzuschlagen, als Assistent des Direktors des Gewerbemuseums Hermann Kienzle (im Amt von 1916 bis 1943) im Jahrzehnt von 1929 bis 1939 Ausstellungen organisierte und daneben von 1922 bis 1937 die Bibliothek des Basler Kunstvereins betreute. Es mag auch eine Rolle gespielt haben, dass sich Schmidt zum Sozialismus bekannte und eine soziologische Deutung der Kunstgeschichte anstrebte.2005 In Joseph Gantners Leben hat der Nationalsozialismus stark eingegriffen und bei aller Konstanz im Grundsätzlichen deutliche Wendungen im Thematischen und Situativen verursacht. Zudem wurde Gantner in einem Moment auf den Basler kunsthistorischen Lehrstuhl gewählt, in dem die Berufung eines Deutschen den administrativen und politischen Behörden geradezu unmöglich erschien. Das Basler Ordinariat für Kunstgeschichte, auf das Gantner 1938 gewählt wurde, genoss ein besonderes Ansehen, weil es in der Traditionslinie stand oder stehen sollte, die auf Jacob Burckhardt und Heinrich Wölfflin2006 zurückging. Stets waren Wölfflinschüler Basler Ordinarien für dieses Fach gewesen. Direkt oder indirekt zu dieser Schule gehörten auch manche Mitarbeiter des Kunstmuseums2007 und des Historischen Museums.2008 Die Ausnahme war der in Zürich ausgebildete Paul Ganz, der für Wölfflinschüler wenig Sympathie zeigte.2009 Man sollte jedoch die Bedeutung der Zugehörigkeit zu einer Schule nicht überschätzen: Der bei Wölfflin doktorierte Joseph Gantner fand als junger Assistent bei Ganz seine erste Anstellung. Die Fakultät hätte für die Wiederbesetzung von Schmids Lehrstuhl zwei Deutsche bevorzugt, Theodor Hetzer2010 und Ludwig Heinrich Heydenreich2011. August Rüegg,2012 Vorsitzender der Sachverständigenkommission der Kuratel, unterlief das Verfahren, indem er sich auf den Rat von Heinrich Wölfflin ver-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Dettwiler 2018. Schmidts Rolle beim Ankauf ‚entarteter Kunst‘ aus Deutschland für das Kunstmuseum: Kreis 1978. Burioni u. a. 2015; Meier 2010, 6. Geschichte des Kunstmuseums: Meier/Bühler 2003; Geelhaar 1992; Meier 1986. Zusammenfassend: Meier 2010. Geschichte des Historischen Museums: Gutmann 1994. Berger 2016; Verzar 2014, 8 f.; Meier 2010, 6. Gross 1972. Sorensen o. J. Hausmann 2016c.
488
Geisteswissenschaftler
liess,2013 der nachdrücklich Gantner empfahl. Dass ihn schliesslich die Behörden wählten, führte zu zweideutigen Kommentaren. Die freisinnige «National-Zeitung» betonte, dass früher einzig das wissenschaftliche Niveau für eine Professorenwahl den Ausschlag gegeben habe, doch nach den Ereignissen der vorausgehenden Wochen könne man es nicht mehr wagen, Männer ins Land zu holen, «die fremden Konsulaten unterstehen». Der Bericht schloss mit der Hoffnung, die Professur werde Gantner «die nötige geistige Vertiefung» noch erlauben.2014 Sogar bei der Begrüssung des Neugewählten in der Universität durch Rektor Fritz Mangold2015 fielen mehrdeutige Worte: «Die Behörden [also nicht die Fakultät] glauben, dass Sie, Herr Professor Gantner, im Stande seien, diesen Forderungen gerecht zu werden, und wir hoffen [die Fakultät war sich also dessen nicht sicher] alle, es möge Ihnen in reichem Masse gelingen.»2016 Gantner war einer der Professoren, die zwar schliesslich zu den Grossen des Faches gerechnet wurden, über die dann aber nie eine eingehende biographische Untersuchung unternommen wurde. Die Beschäftigung mit seiner Leistung wirkt jedoch in einzelnen Basler Lehrstühlen nach, und die Versuche, ihn historisch unter Heranziehung des Nachlasses einzuordnen, haben begonnen.2017 In den Studien über die Geschichte der deutschen Kunstgeschichte in der Zeit des Nationalsozialismus erscheint sein Name fast nie, nur seine Broschüre Revision der Kunstgeschichte von 1932 wird gelegentlich genannt.2018 Gantners Einstellungen in der Zeit vor seiner Wahl lassen sich aus den zahlreichen Beiträgen erschliessen, die er als Zürcher Privatdozent (Habilitation im Wintersemester 1926/27)2019 und von Herbst 1927 bis Ende 1932 als Dozent an der Frankfurter Kunstschule2020 zur Aufbesserung seines Einkommens für die Presse schrieb. Für die Biogra2013
2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020
Wölfflin hatte Rüegg schon am 14. 9. 1937 einen eindringlichen und langen Brief geschrieben. Am 5. 12. 1937 doppelte Wölfflin auf Bitten von Rüegg nach und charakterisierte nun ausschliesslich Gantner: Dieser sei der beste Schweizer PD. StABS ED-REG 1a 3 182, Philosophische Fakultät I 1981, Prof. Dr. Jos. Gantner Kunstgeschichte, Mappe «Diverse Gutachten, Berichte und Empfehlungen über Vorgeschlagene». «Joseph Gantner zum Ordinarius für Kunstgeschichte an der Basler Universität gewählt» (National-Zeitung 28. 3. 1938), in: StABS UNI-REG 5d 2-1 (1) 94 Joseph Gantner. Degen 2007. Konzept der Begrüssungsrede von Rektor Mangold, in: StABS UNI-REG 5d 2-1 (1) 94 Joseph Gantner. Verzar 2014, 24, 29, mit Hinweisen auf Beat Brenk und Gottfried Böhm. Halbertsma 1992, 96, referiert den Inhalt von Gantners Schrift, erkennt aber den Versuch einer Weiterentwicklung von Wölfflins Thesen nicht und übersieht die auf Jacob Burckhardt zurückgehenden Ansätze in der Darstellung der «Krise» des Faches und der Methodendiskussionen in der Kunstgeschichte. Dilly 1988, 18 f. Venia Docendi für das «Gesamtgebiet der Kunstgeschichte», Personalkarte für (Basler) Dozenten Nr. 4004, in: StABS UNI-REG 5d 2-1 (1) 94 Joseph Gantner. «Die ‚Kunstschule Frankfurt a. M.‘, an welcher ich von Herbst 1927 bis Herbst 1932 als Dozent gelehrt habe, besass als Rechtsnachfolgerin der alten Städel-Akademie für einen
Kunsthistoriker
489
phie wichtig war Gantners propagandistischer Einsatz für das Neue Bauen und die zeitgenössische Kunst als Redaktor von «Das Werk» in Zürich und ab 1927 von «Das Neue Frankfurt». Gantner wurde 1915 Schüler und Freund von Heinrich Wölfflin und blieb dies zeitlebens.2021 Er hielt dessen Einsichten jederzeit für grundlegend, auch wenn er für eine Erweiterung der Kunstgeschichte plädierte, aber immer ausgehend von dieser Basis und von den Ansätzen von Jacob Burckhardt für die Beschäftigung mit der autonom gedachten Kunst unter formalen Aspekten.2022 Er wollte eine reine Wissenschaft, die das Kunstwerk und den Künstler weitgehend von der Kulturgeschichte loslöste und das Werk als «Zweite Schöpfung» auf den Forscher wirken liess. Mit wenigen Ausnahmen blieben seine Auftritte vor Studierenden, Kollegen und in der Presse nach 1938 frei von allen Bezügen zu Zeitumständen. Die greifbaren Dokumente sind jedoch offensichtlich so ausgewählt, dass sie allein von seiner wissenschaftlichen Leistung künden, wobei vorausgesetzt wird, dass Wissenschaft ebenso wie Kunst mit Politik nicht zu vermengen sei. Kommt hinzu, dass über einen Einsatz für Verfolgte und Benachteiligte nach den Regeln baslerischer Ethik nicht gesprochen wird; die Aktion zählt, nicht die Worte. So ist nicht zu erfahren, was Gantner in dieser Hinsicht getan hat, und mein Bericht bleibt lückenhaft. 7.3.2 Aspekte der Laufbahn Gantner war der Sohn eines Angestellten aus Baden im Aargau. Am Gymnasium begegnete er dem Jacob Burckhardt-Schüler Otto Markwart, der die erste umfassende Biographie Burckhardts2023 zu schreiben unternommen hatte. Die Einführung in die Gedanken des Basler Historikers, die ihm dieser Geschichtslehrer vermittelte, hinterliess einen bleibenden Eindruck. Markwart wies den jungen Mann für das Studium der Kunstgeschichte zu seinem Freund aus der Basler Zeit, Heinrich Wölfflin. Die erste gedruckte Arbeit von Gantner war eine Besprechung der Vorträge von Burckhardt, die Emil Dürr für die Gesamtausgabe ediert hatte, in den «Münchner Neuesten Nachrichten» vom 21. Oktober 1918.2024
2021 2022 2023 2024
Teil ihrer Klassen den Charakter einer Hochschule.» Personalkarte für (Basler) Dozenten Nr. 4004, in: StABS UNI-REG 5d 2-1 (1) 94 Joseph Gantner. Ganter wurde nach Wölfflins Tod Verwalter von dessen wissenschaftlichem Nachlass und Herausgeber von Schriften und Briefen. Sitt 1990, 134 ff.; Gantner 1945. Gantners Auseinandersetzung mit Jacob Burckhardt in: Nachlass Gantner, NL 288, III: 1: 103a. Markwart 1920. Gantner 1979, 163–174: Bibliographie der wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Gantner besprach alle Bände dieser Gesamtausgabe, aber meines Wissens nie einen Band der Burckhardt-Biographie von Werner Kaegi.
490
Geisteswissenschaftler
Wölfflin war in Basel Burckhardts Nachfolger für den Unterricht in Kunstgeschichte gewesen. Er entwickelte zuerst in Berlin, dann in München aus Burckhardts Anregungen2025 ein begriffliches System der formalen Analyse von Kunstwerken, das er 1915 herausbrachte (Grundbegriffe).2026 Das Buch bot eine Alternative zur geistesgeschichtlichen oder kulturgeschichtlichen Arbeit an der Kunst. Gantner wurde in München Hörer, Schüler, schliesslich Freund und Vertreter der Ansätze Wölfflins. Zwar behandelte er als Student an der Universität klassische Themen,2027 aber in der Stadt nahm er begeistert die neue Kunst auf, die in den Münchner Galerien gezeigt wurde.2028 Wölfflins Formanalyse liess sich, so erkannte er, gut auf eine neuartige Kunst anwenden, die zunehmend die Form über den Inhalt stellte bis zur Abstraktion. 1979 erinnerte er sich, dass er «mit Leidenschaft» die Entwicklung der modernen Kunst verfolgte; alles Frühere «schien» infrage gestellt. Die Entwicklung der Kunst sei damals an ihren Ursprung zurückgekehrt.2029 Gantner fehlten die Mittel, um sich ausschliesslich auf die wissenschaftliche Laufbahn des Privatdozenten und danach eines Anwärters auf eine Professur vorzubereiten. So schrieb er für Zeitungen, zum Beispiel 1919 über die Münchner Räterepublik und die Stellung der Studenten zu ihr.2030 Später nannte er diese Epoche die «dunkle Zeit […] unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg».2031 Nach der Rückkehr aus Deutschland suchte er eine Stelle in der Schweiz. Zuerst stellte ihn in Basel Paul Ganz als Privatassistent für die Inventarisierung von Schweizer Kunstwerken an, dann bewarb er sich 1922 erfolgreich um die Redaktorenstelle für die Zeitschrift «Das Werk».2032 Dieses 1914 gegründete Organ des Bundes Schweizer Architekten (BSA) und des Schweizer Werkbunds (SWB)2033 hätte eigentlich einen Architekten oder angewandten Künstler gebraucht, nicht einen Kunsthistoriker. Da Gantner aus München eine Begeisterung für moderne Gestaltung mitbrachte, lebte er sich rasch ein und profilierte sich fortan als Verfechter des Neuen Bauens und der modernen Gestaltung, ohne die Beziehung zu Wölfflin zu verlieren: 1924 begab er sich als Begleiter seines Lehrers auf eine grosse Wanderung durch Italien, die Wölfflin bei der Entscheidung helfen sollte, München zu verlassen. Gantner war fasziniert von den Mög2025 2026 2027 2028 2029 2030
2031 2032 2033
Gantner 1948. Wölfflin 1915. Gantner 1919, ferner 1920; siehe auch 1979, 7. Sitt 1990, 139. Gantner 1979, 8. Josef (sic) Gantner: «Sturmtage in der Münchner Studentenschaft (von einem akademischen Augenzeugen)» (NZZ 8. 8. 1919 No. 1188, Erstes Mittagsblatt), in: Nachlass Gantner NL 288, 277, Zeitungsaufsätze 1927–1928. Gantner 1979, 7. Sitt 1990, 140. «100 Jahre werk», https://www.wbw.ch/de/mehr-werk/100-jahre-werk/.
Kunsthistoriker
491
lichkeiten einer Gestaltung ohne Ornament und wandte sich Themen der Stadtentwicklung und der Stadtplanung zu. Sein älterer Bruder Alfred, der als Architekt in Baden beispielhafte Werke des Neuen Bauens realisierte,2034 scheint dabei eine wichtige aber bisher ungeklärte Rolle gespielt zu haben. Bis in die 1940er Jahre hinein gestand Gantner in seinen Kunstanalysen der Architektur immer wieder einen grossen Platz zu.2035 Während der Zeit als Redaktor des «Werk» (1922 bis 1927) schrieb Joseph Gantner im Auftrag eines Verlags ein Buch über Die Schweizer Stadt.2036 Dieses erweiterte er zu einer Darstellung der europäischen Dimension der Formentwicklung von Städten und deren Typen, womit seine Beziehung zum Wiener Verlag Schroll begann.2037 Mit diesem Manuskript unternahm er 1927 einen vergeblichen Versuch, sich in Frankfurt als Privatdozent zu etablieren, nachdem Wölfflin, der seit 1924 in Zürich lehrte, dafür gesorgt hatte, dass Gantner sich im Wintersemester 1926 an der Universität der Limmatstadt habilitieren konnte.2038 Die Frankfurter Stadtregierung wollte eine rasche urbane Entwicklung herbeiführen, die den Familien der Arbeiter und Arbeitslosen Wohnraum ausserhalb des Stadtkerns bieten sollte. Dafür wirkte der Architekt Ernst May, seit 1925 Stadtbaurat, der eine Rationalisierung des Bauens und der Innenausstattung («Frankfurter Küche») betrieb und Vorstädte («Trabantenstädte») mit 12’000 Wohnungen aus standardisierten Blöcken errichten liess, deren Form rein aus der Funktion folgen und auf ökonomischen und soziologischen Analysen beruhen sollte. Dieses von kulturellen Aktionen flankierte Programm hiess «Das Neue Frankfurt».2039 Gleichzeitig lag die traditionsreiche private Städelsche Kunstschule darnieder; in der Inflation hatte sie ihre Mittel verloren, war von der Stadt übernommen worden und stellte schliesslich 1923 den Lehrbetrieb ein.2040 2034 2035 2036 2037 2038
2039
2040
Stadt Baden 2010, 65, 80. Hauptwerke sind das Schwimmbad und die ehemalige Schule des KV. Vgl. Gantner 1941. «Heinrich Wölfflin zum 70. Geburtstag» (NZZ vom 17. 6. 1934, Blatt 4, Erste Sonntagsausgabe Nr. 1088), in: Nachlass Gantner NL 288, Nr. 275 II. Gantner 1925. Gantner 1928. Die Nachricht über einen 1927 gescheiterten Habilitationsversuch stammt aus dem Fakultätsgutachten über die Nachfolge Schmid und passt dort in die negative Bewertung von Gantner, zitiert im Bericht des ED an den Regierungsrat 19. 2. 1938, in: StABS ED-REG 1a 3 182, Philosophische Fakultät I 1981 Joseph Gantner Kunstgeschichte, Mappe «Lehrstuhl für Kunstgeschichte Prof. Dr. Jos. Gantner, Wahl 1938». Im Personalfragebogen, den er am 30. 3. 1938 für das Basler ED ausfüllte, nannte er das Jahr 1926 als Datum für seine Zürcher Habilitation, ebd. Welzbacher 2016; Henderson 2013. Vgl. den Nachruf auf May von Helene Rahms in der FAZ vom 16. 9. 1970. Sie bezeichnete den Fabrikantensohn May als einen «sozialistisch orientierte[n] Praktiker» und konstatierte zugleich seine «Stilisierung ins Herrscherhafte». Nachlass Gantner NL 288 Nr. 357. Kolod 1982, 16 f.
492
Geisteswissenschaftler
Sie wurde mit der städtischen Kunstgewerbeschule zusammengeführt und sollte zu einer Kunstakademie entwickelt werden. In Vorbereitung dieses Schrittes hiess die künftige Akademie «Kunstschule» und führte neben kunstgewerblich-gestalterischen Klassen auch Bildungsgänge in freier Kunst. Max Beckmann war der Star dieser Abteilung. Ernst May beauftragte Fritz Wichert mit der Leitung der Kunstschule und deren Entwicklung zur Akademie. Der Wölfflin-Schüler Wichert hatte die Mannheimer Kunsthalle zum Erfolg geführt. Er erhoffte sich von der modernen Kunst und dem Neuen Bauen einen geistigen Aufbruch Deutschlands. Die freie Kunst betrachtete er als einen «Teilbereich dieses Gestaltungspanoramas».2041 Dieser Überzeugung war auch Gantner: Freie Kunst, Design und Industrie sollten zur Vermenschlichung der von der Massenproduktion dominierten Welt zusammenwirken. Dass dies ein bürgerliches Programm war, ist offensichtlich.2042 May war demgegenüber eher sozialreformerischen Ideen zugeneigt und suchte nach soziologisch und ökonomisch abgestützten Lösungen für die Arbeitslosigkeit und Armut. Durch die von May an die Kunstschule vergebenen Aufträge war diese in das «Neue Frankfurt» eingebunden, und die Klassen für Architektur und Innenarchitektur erhielten darin einen zentralen Platz.2043 Wichert strebte für die Kunstschule ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den idealistischen Stilreformern und den sozialistischen Revolutionären an.2044 Für den Ausbau zur Akademie verlangte Wichert von May einen Assistenten, der zugleich Kunstgeschichte dozieren sollte. Auf Anregung von Wölfflin bewarb sich Gantner, hatte allerdings als Ausländer zuerst mit Widerständen zu rechnen. Schliesslich war Gantner von 1927 bis 1932 Angestellter der Kunstschule. Die Umstände waren teils unerfreulich: Die Stadt Frankfurt scheiterte mit ihrem Plan einer Akademie am preussischen Handelsministerium, und zwischen Gantner und Wichert entstand 1929 ein schwerer Konflikt.2045 May sorgte dafür, dass Gantner blieb, und Wölfflin erläuterte ihm den psychologischen Hintergrund von Wicherts Reaktionen.2046 So war Gantner in Frankfurt einerseits Dozent an 2041 2042
2043 2044 2045
2046
Kolod 1982, 17. Wicherts Programm im Jahrbuch der Frankfurter Bürgerschaft 1926, 92 f. Bezeichnend sind Gantners kleine Artikel für die «NZZ» und die «Frankfurter Zeitung», gesammelt u. a. im Nachlass Gantner NL 288 Nr. 275 I Zeitungs- und Zeitschriften-Aufsätze 1931–1933. Beaucamp 1982, 75 f. Salden 1995; Beaucamp 1982, 79. Gantners Verhandlungen mit Wichert begannen im Februar 1926; im April 1927 sah es vorübergehend so aus, als ob er als Ausländer nicht zum Zug komme, bis dann im Mai 1927 der Entscheid für ihn fiel. Wölfflin riet Gantner, die Anstellung in Frankfurt anzunehmen. Briefe und Karten von Wölfflin an Gantner, 4. 2. 1926 bis 8. 5. 1927, in: Nachlass Heinrich Wölfflin NL 95, Abt. Nachtrag 1973, IX 1 k, Mappe IX 1 k 39–79, Briefe an Joseph Gantner 1924–1927. Kolod 1982, 19. Korrespondenz zwischen Wichert und Gantner, 28. 3. 1929 bis 30. 4. 1929, in: Nachlass Gantner NL 288, VI: 359: 588a Fritz Wichert. Wölfflin an Gantner, 16. 3.
Kunsthistoriker
493
der Kunstschule. Von Beginn seines Frankfurter Aufenthalts an wirkte Gantner andererseits als «Schriftleiter» der Zeitschrift «Das Neue Frankfurt», die May gemeinsam mit Wichert herausgab. Diese Zeitschrift diente als eine Art Sprachrohr der Stadtentwicklungspläne von May und zugleich der Tätigkeit der Kunstschule.2047 Allerdings verlor May in Frankfurt zunehmend seinen politischen Rückhalt und nahm 1930 einen Auftrag als «Brigadenführer» für den Bau von Arbeitersiedlungen in der UdSSR an.2048 Gantner blieb Dozent für Kunstgeschichte bis zum Ablauf seines Vertrags 1932 und Redaktor der Zeitschrift bis 1933. Aus der Frankfurter Monatsschrift machte Gantner ein Forum für Neues Bauen und Gestaltung mit einem europäischen Horizont (entsprechend lautete der Untertitel «Internationale Monatsschrift für die Probleme kultureller Neugestaltung»). Nachdem May 1930 in die Sowjetunion übersiedelt war, löste Gantner die Zeitschrift von der Bindung an die Stadtverwaltung und benannte sie ab April 1932 um zu «Die Neue Stadt».2049 Er organisierte Themenhefte, schrieb Buchund Ausstellungsbesprechungen und liess externe Mitarbeiter über kulturelle und architektonische Entwicklungen in anderen Städten und im Ausland berichten. Dem faschistischen Italien galt eine besondere Aufmerksamkeit, im Positiven (Pläne für Entwicklung und Neugründung von Siedlungen) wie im Negativen (Zerstörung historischer Substanz durch die Pläne für die Umgestaltung Roms).2050 Er verehrte Le Corbusier und propagierte dessen Ideen. Besonders en-
2047
2048
2049
2050
1929, in: Nachlass Heinrich Wölfflin NL 95, Abt. Nachtrag 1973, IX 1 k, Mappe IX 1 k 80–136 Briefe an Joseph Gantner 1927–1933, k 97. An der Bedeutung von Wicherts Leistungen zweifelte Gantner nie; er widmete ihm 1951 einen Nachruf (vgl. Gantner 1979, 163–174). Sitt 1990, 141. Ernst May an Gantner, 31. 8. 1927, sagte ihm die Schriftleitung von «Das Neue Frankfurt» zu (diese Zeitschrift bestand seit einem Jahr), nachdem Gantner ihm am 19. 6. 1927 seine Bedingungen (oder Wünsche) vorgelegt hatte, in: Nachlass Gantner NL 288, Nr. 357. Seit 1928 waren May und der Oberbürgermeister Ludwig Landmann (im Amt 1924 bis 1933) als Juden und Demokraten (Landmann gehörte der DDP an) Zielscheiben von Angriffen der rechten Parteien, während die «kapitalistische» Grundlage der Finanzierung des Neuen Frankfurt der Linken missfiel. Vgl. den gut informierten Wikipedia-Artikel (der die Mitwirkung Gantners nur am Rande erwähnt) https://de.wikipedia.org/wiki/Neu es_Frankfurt. In Das Neue Frankfurt (4, H. 9, September 1930, 197) verabschiedete Gantner die «Russlandfahrer». Ein Bericht über die Moskauer Architektenbrigaden von Ernst May, Hannes Meyer und Kurt Meyer findet sich in Die Neue Stadt (H. 10, Januar 1933). Die Neue Stadt (H. 1, April 1932, 1 f.). In seinem Editorial erklärte Gantner, dass das Neue Frankfurt (damit meinte er den von der Stadtverwaltung betriebenen Plan einer Erneuerung des Wohnungsbaus) «gefallen» sei, aber im Bund Neues Frankfurt weiterlebe. Die Zeitschrift sei jetzt unabhängig von der Stadtverwaltung. Negativ: «Städtebauliche Marginalien, Roma rinascente?» (NZZ vom 23. 7. 1931, Nr. 1410), in: Nachlass Gantner, NL 288, Nr. 275 I Zeitungs- und Zeitschriften-Aufsätze 1931–1933. Positiv dagegen: «Von der alten Sapienza zur neuen Città degli Studi in
494
Geisteswissenschaftler
gagierte sich Gantner für Le Corbusiers Projekt für den Völkerbundspalast in Genf.2051 In Italien wie in der Sowjetunion, aber auch in Genf bei der Debatte um die Gestaltung des Völkerbundspalasts wurde deutlich, dass sich die allgemeine Stimmung gegen das neue Bauen zu wenden begann. Mussolini wie Stalin verlangten repräsentative Fassaden.2052 Bilanz zog Gantner in einem Vortrag über «Die Kunst und der Staat» am 21. Januar 1936 in einem Staatsbürgerkurs in Zürich: «Im Bauwesen liebte der Staat von jeher und bis in unsere Zeit hinein die klassische Repräsentation, was heute gleichermassen die fascistischen Grossbauten in Rom, der Völkerbundspalast, der Moskauer Sowjetpalast und die Bauten am Königsplatz in München beweisen.»2053 In Deutschland forderten Konservative bürgerlichen wie rechtsradikalen Zuschnitts lange vor der Hitlerdiktatur ein Ende des «seelenlosen» Stils; Steildach wurde gegen Flachdach gesetzt. Seit 1931 bemühte sich Gantner aktiv, Frankfurt zu verlassen. Er bewarb sich um Stellen in anderen deutschen Städten,2054 dachte aber offensichtlich auch über eine Rückkehr in die Schweiz nach, weshalb er in seiner Publizistik schweizerischen Themen zunehmende Aufmerksamkeit zuwandte2055 und Referate in
2051
2052
2053 2054
2055
Rom» (Königsberger Hartungsche Zeitung vom 3. 4. 1933) und «Städtebau in Italien» (NZZ vom 28. 6. 1935, Blatt 8, Abendausgabe N. 1133), ebd. Dort behauptete er, in Italien würden die «Grundsätze des modernen Bauens sozusagen von Staates wegen sanktioniert». Vgl. aber Anm. 2052, unten. Gantners Berichte enthielten nie ein Wort über die faschistische Politik und Ideologie. Über und von Le Corbusier mehrere Beiträge in Das Neue Frankfurt, so 1928 und 1931 (H. 10, 171). In der Frankfurter Zeitung publizierte Gantner einen kritischen Artikel über «Wer baut den Völkerbundspalast?» vom 30. 9. 1927, in: Nachlass Gantner, NL 288, Nr. 277 Zeitungsaufsätze 1927–1928. Weitere Kritik an der Realisierung des Völkerbundspalasts durch Gantner auch in der Frankfurter Zeitung vom 31. 7. 1931, Nr. 564, ebd., Nr. 275 I Zeitungs- und Zeitschriften-Aufsätze 1931–1933. In einer Basler Autographensammlung ist ein Dankschreiben von Le Corbusier an Gantner für die Verteidigung seines Völkerbundspalastprojekts erhalten, in: UB Basel, Handschriftenabteilung, G V 1, 34 Autographensammlung: «Le Corbusier, le 15 mars 1928, à Monsieur Gantner Franckfort». Gantner beklagte 1931 die Unmöglichkeit, das Neue Bauen in Italien ernsthaft durchzusetzen. In Russland werde jedoch das Neue Bauen siegen: Gantner 1931. Aber 1932 wendete sich das Blatt in Moskau: Die Neue Stadt (H. 6/7, September/Oktober 1932, 148). Bericht in der NZZ (Datum nicht angegeben), in: Nachlass Gantner, NL 288, Nr. 263– 264 Vorträge III 1936–1942. In der Korrespondenz mit Wölfflin ist z. B. die Rede von einer misslungenen Bewerbung um eine Professur in Breslau und von einem Versuch, in Dresden unterzukommen. Nachlass Heinrich Wölfflin, NL 95, Abt. Nachtrag 1973, IX 1 k, Mappe IX 1 k 80–136, Briefe an Joseph Gantner von 1927–1933, k 106, 10. 2. 1931; k 115, 6. 12. 1931. Das Neue Frankfurt (1931 H. 3, März, 59; H. 4/5, April/Mai, 95; 1932 H. 1, April 1932, 13). Das H. 6/7, September/Oktober 1932, war ein Sonderheft «Bern».
Kunsthistoriker
495
der Schweiz hielt.2056 1931 verlobte er sich in Frankfurt mit der Fotografin Maria Dreyfus,2057 der Tochter des Professors für Psychiatrie an der Universität, Georg Ludwig Dreyfus,2058 und Enkelin eines Teilhabers des Frankfurter Bankhauses J. Dreyfus & Co. Gantner geriet als «Kulturbolschewist» in die Schusslinie nationalsozialistischer und deutschnationaler Publizistik noch bevor sein Frankfurter Vertrag Ende 1932 auslief. In diesem Jahr verbreitete Bettina Feistel-Rohmeder einen Artikel mit dem Titel «Moskauer Kunstgeschichte auch in Deutschland»; sie sah das «Reich des Satans in Menschengestalt» in der soziologischen Kunstanschauung, der sie Gantners Text Revision der Kunstgeschichte von 1932 zurechnete (dazu unten mehr).2059 Mit Paul Renner, der den neuen Stil gegen Antisemiten und Nationalsozialisten verteidigte, zeigte sich Gantner im selben Jahr solidarisch.2060 Die Redaktion der Märznummer der «Neuen Stadt», der letzten des Jahrgangs 1932/33, überliess Gantner dem Künstler und ehemaligen Testpiloten Robert Michel, der sie der Berliner Automobilausstellung widmete.2061 Die letzte Nummer überhaupt (sein Vorwort datierte Gantner auf Juni 1933, die Nummer wurde in Zürich vom exilierten Verleger Richard Weissbach herausgebracht) war ein Themenheft über Zürich.2062 Danach ging die Zeitschrift kom-
2056
2057
2058 2059 2060
2061
2062
Bspw. Zürcher Radiovorträge, 24./26. 3. 1932, über «Die Stadt der Gegenwart und die Stadt der Zukunft», zugehöriger Artikel in der Schweiz. Illustrierte Radio-Zeitung vom 28. 3. 1932 Nr. 12, mit Porträt Gantners von Maria Gantner-Dreyfus, in: Nachlass Gantner NL 288, 262 Vorträge II 1930–1935. https://www.geni.com/people/Maria-Gantner/6000000048700853056. Wölfflin bedankte sich für die Fotos der Braut in einem Brief an Gantner vom 29. 12. 1931, in: Nachlass Wölfflin, NL 95, k 116, Mappe IX 1 k 80–136, Briefe an Joseph Gantner 1927–1933. Die (zivile) Trauung fand im Februar 1932 statt: Gantner, Konzept eines Briefes an Wölfflin, 7. 2. 1932, k 120, in: Nachlass Wölfflin, NL 95, Abt. Nachtrag 1973, IX 1 k Mappe IX 1 k 80–136 Briefe an Joseph Gantner 1927–1933. Heuer/Wolf 1997, 66. Dilly 1988, 34 (publiziert in: Deutscher Kunstbericht 63, 1932). Besprechung von Paul Renner, Kulturbolschewismus? Die antisemitische Hetze gegen die moderne Kunst, Erlenbach-Zürich 1932 (NZZ vom 12. 6. 1932 Nr. 1091), in: Nachlass Gantner, NL 288, Nr. 275 I Zeitungs- und Zeitschriften-Aufsätze 1931–1933. Über den Künstler und Typographen Paul Renner, der 1933 von den Nationalsozialisten verhaftet und 1934 als Leiter der Münchner Typographenschule entlassen wurde: Chrambach 2003. Die Neue Stadt (H. 12, März 1933). Die Redaktion, für die noch Gantners Frankfurter Adresse angegeben war, wurde im Februar 1933 abgeschlossen. Michel war nicht unkritisch, so verwies er auf die Bedeutung, die die SA nun hatte. Hitlers Rede fand er hingegen lobenswert: «Jeder denkende Mensch muss anerkennen, dass die praktischen Vorschläge für das deutsche Verkehrswesen, die der Reichskanzler zu diesem Zeitpunkt bekannt gab, sachlich und überzeugend waren.» Gantner 1933/34, erschienen in «Heidelberg und Zürich».
496
Geisteswissenschaftler
mentarlos ein. Gantner war im April 19332063 in Zürich angekommen, wo sich der Schwiegervater mit einer privaten psychiatrischen Praxis niederliess.2064 Interessant sind die Schicksale von Gantners Freunden und Kollegen aus der Frankfurter Zeit, weil sie uns einen Eindruck davon vermitteln, was Gantner nach seiner Abreise aus Deutschland über das Vorgehen der Nationalsozialisten wissen konnte.2065 – Willi Baumeister war Leiter der Klasse für Gebrauchsgrafik, Typographie und Stoffdruck an der Kunstschule gewesen. Am 31. März 1933 wurde seine Professur an der Kunstgewerbeschule durch die Nationalsozialisten ‚eingespart‘, 1937 wurden Werke von ihm als «entartete Kunst» präsentiert, ab 1941 hatte er Ausstellungsverbot. Er arbeitete als Grafiker für eine Lackfabrik.2066 – Ferdinand Kramer, Architekt, wurde von den Nationalsozialisten als «entartet» bezeichnet und als Angestellter des Frankfurter Hochbauamts entlassen. Er arbeitete danach als selbstständiger Architekt in Frankfurt. Verheiratet war er mit Beate Feith. Eine von den Nationalsozialisten verlangte Scheidung lehnte er ab, und nach dem Ausschluss aus der Reichskammer der bildenden Künste und dem Arbeitsverbot 1937 folgte er ihr 1938 in die Emigration in die USA. Auf Einladung Horkheimers kehrte er 1952 nach Frankfurt zurück.2067 – Werner Nosbisch, Architekt, Oberbaurat, war Vorsitzender der Oktobergruppe, einer 1928 gegründeten lockeren Vereinigung von Architekten und Gestaltern des Neuen Frankfurt, und im «bund das neue frankfurt» aktiv. Er übernahm 1932 kommissarisch die Leitung der Baupolizei. Seit 1931 war er Mitglied der SPD gewesen. Am 1. April 1933 trat er in die NSDAP ein und wurde ein Jahr später Mitglied im Reichsbund der Deutschen Beamten und weiteren NS-Verbänden. 1935 verlor er dennoch die Leitung der Baupolizei wegen «politischer Unzuverlässigkeit», und 1944 wurde gegen ihn ein Parteigerichtsverfahren eröffnet.2068 – Martin Elsässer, Architekt, war von 1920 bis 1925 leitender Direktor der Kunstgewerbeschule in Köln gewesen, den späteren Kölner Werkschulen. 1925 berief ihn Ernst May als Leiter des Hochbauamtes nach Frankfurt. Bis 1932 arbeitete er am Projekt Neues Frankfurt, danach war er bis 1937 2063 2064
2065 2066 2067 2068
Sitt 1990, 142. Gantner verwendete gelegentlich Blätter aus dem Rezeptblock seines Schwiegervaters für Notizen, daraus ergibt sich dessen Adresse in Zürich: Dr. med. Georges L. Dreyfus, Nervenarzt FMH, Zürich, Tödistrasse 16. Bspw. in: NL 288, III: 1: 103a, Notizen «ZA 1937». Gleichschaltung der Kunstschule 1933: Bock 1982, 105–115. https://de.wikipedia.org/wiki/Willi_Baumeister. https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Kramer_(Architekt). Schilling 2021.
Kunsthistoriker
497
freier Architekt in München, von 1937 bis 1945 in Berlin. Im nationalsozialistisch beherrschten Deutschland erhielt er keine Aufträge, realisierte jedoch von München aus einige Projekte in der Türkei. Er verbrachte die Jahre des Zweiten Weltkriegs in «innerer Emigration» mit Studienreisen und utopischen Entwürfen.2069 – Max Cetto, Architekt, war Mitarbeiter von Ernst May im Siedlungsamt der Stadt Frankfurt gewesen. 1928 gründete er den Congrès International d’Architecture mit. Er verfasste den «Brief eines jungen deutschen Architekten an Dr. Goebbels», den Gantner in «Die Neue Stadt» im Mai 1933 (S. 26–28) publizierte. Daraus ergab sich ein Konflikt mit dem Regime, und Cetto zog sich auf private Aufträge zurück; so realisierte er 1936 und 1937 zusammen mit anderen die Heinkel-Werke Oranienburg. 1938 wanderte er in die USA aus und arbeitete in San Francisco mit Richard Neutra zusammen. Im Mai 1939 ging er nach Mexiko und nahm 1947 die dortige Staatsbürgerschaft an.2070 – Richard Döcker, Architekt, war 1926/27 Bauleiter für die Weissenhofsiedlung Stuttgart gewesen. 1932 verfasste er den Bebauungsplan für die Stuttgarter Kochenhofsiedlung. Von 1933 bis 1945 erhielt er keine öffentlichen Aufträge mehr und wurde als «Baubolschewist» bezeichnet. Von 1939 bis 1941 studierte er Biologie, und ab 1941 wurde er dienstverpflichtet beim Wiederaufbau in Saarbrücken.2071 Gantner war nach der Rückkehr in die Schweiz stellenlos und schlug Wölfflin vor, er könnte ergänzend zu den Vorlesungen, die dieser an der Universität Zürich hielt, Übungen veranstalten.2072 Dieser akzeptierte den Plan und sorgte dafür, dass sein Schüler wieder als Privatdozent von der Zürcher Fakultät aufgenommen wurde. So konnte Gantner von 1933 bis 1938 eine erfolgreiche Lehrtätigkeit entfalten, die zahlreiche Studierende und ein weiteres Publikum begeisterte. Vortragshonorare und Berichte für Zeitungen sollten ihn ernähren, bis er 1935 zusätzlich eine Hilfslehrerstelle an der Zürcher Töchterschule annahm. Daneben wollte er sich weiterhin wissenschaftlich profilieren, was er mit einem Verlagsauftrag zu kombinieren suchte, den sein Mentor Wölfflin begrüsste: Er verfasste eine Geschichte der Kunst in der Schweiz, von der er 1936 den ersten Band (bis zum 2069 2070 2071 2072
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Elsaesser. https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Cetto. https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_D%C3%B6cker; http://www.memotransfront.unisaarland.de/doecker.shtml. Die Debatte um Gantners Rolle an der Universität Zürich ab März 1933: Konzept Gantner für Antwort an Wölfflin 4. 3. 1933, in: Nachlass Wölfflin Mappe IX 1 k 132; Antwort Wölfflins 8. 3. 1933, ebd., k 133; Konzept Angebot Gantner an Wölfflin 19. 3. 1933, ebd., k 134. Alles in: Nachlass Wölfflin, Mappe XI 1 k 80–136 Briefe an Joseph Gantner 1927– 1933.
498
Geisteswissenschaftler
Ende der romanischen Epoche) herausbrachte und die er bewusst als Kunstgeschichte der Schweiz bezeichnete.2073 Die Zürcher Fakultät verhinderte eine Beförderung zum Extraordinarius.2074 Wölfflin hatte noch andere Schweizer Schüler, die eine Stelle suchten, darunter den etwas älteren Ulrich Christoffel, der vorübergehend als Konkurrent neben Gantner auftrat. Im Unterschied zu Gantner hatte Christoffel seine wissenschaftliche Profilierung als Kunsthistoriker konsequent vorangetrieben und galt als hochgebildeter und kultivierter Mann. Er lehnte aber die Demokratie ab und orientierte sich an der politischen Entwicklung in Deutschland. Zwar wurde er Kulturredaktor der «Neuen Zürcher Zeitung», aber seine Opposition gegen den Plan, Spitteler durch ein Denkmal zu ehren, führte zur Entlassung. Er wanderte nach München aus, wo er sich als Privatgelehrter und Kulturjournalist betätigte, völkische Ansätze in der Kunstgeschichte vertrat2075 und im (führenden, den Nationalsozialisten nahestehenden) Bruckmannverlag publizierte, ein Unternehmen, das auch Wölfflins Hauptwerk herausbrachte. Er blieb während des Krieges in München, verlor dort bei einem Bombenangriff Wohnung und wissenschaftliche Unterlagen und kam nach Kriegsende in die Schweiz zurück, wo er sich über die «gleichgeschaltete Demokratie» in der Schweiz beklagte und Gantner Vorwürfe machte, dass dieser seine Schriften nicht zitiere.2076 Ab 1933 widmete sich Gantner Schweizer Gegenständen, weil diese ohne aufwendige Auslandsreisen erreichbar waren.2077 Gelegentlich schienen vaterländische Argumente in seinen Artikeln durch; er engagierte sich für eine Modernisierung des schweizerischen Fachvereins und verlangte, dass sich dieser nicht auf Inventarisierung beschränke, sondern zu Synthesen ansetze, weil die Kenntnis der Kunst in der Schweiz ein Weg zum richtigen Verständnis der Schweizer Staatsauffassung sei.2078 Typisch für die Schweiz sei die Universalität ihrer Kunst. Es gebe keinen schweizerischen Stil, aber eine eigene Gesinnung: Man baue nach ausländischen Vorbildern und zeige doch «schweizerische Eigenart». In den wissenschaftlichen Arbeiten vermied er eine engagierte vaterländische Rhetorik und blieb Jacob Burckhardts Lehre treu, das Kunstwerk in den Mittelpunkt zu stellen 2073 2074
2075 2076 2077
2078
Gantner 1936. Vgl. dazu: Verzar 2014, 20, und Brenk 1988, 23. Durchschlag eines Briefes von Gantner an Arnald Steiger, 14. 6. 1944, in: Nachlass Gantner NL 288, VI: 359: 524. Gantner spielte darauf an, dass er früher verbittert gewesen sei «angesichts des empörenden Verhaltens der Clique, die ja bei Euch die Fakultät regiert». Christoffel 1940. Briefwechsel mit Ulrich Christoffel in: Nachlass Gantner, NL 288, VI: 359: 88. «Doch begann nun [1933] für mich eine stille Zeit der Besinnung und des Neuanfangs. Ich war so fest überzeugt davon, dass das Schicksal Europas nun eine tragische Wendung von unübersehbarer Dauer nehmen würde, dass ich mich entschloss, mir ein neues Thema zu stellen, das zur Not in meiner Heimat bewältigt werden konnte.» Sitt 1990, 142. «Eine ‚Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte‘» (NZZ vom 5. 3. 1934, Mittagsausgabe Nr. 385), in: Nachlass Gantner, NL 288, Nr. 275 II.
Kunsthistoriker
499
und die Kunst als autonome «Zweite Schöpfung» zu sehen, die nicht in den Dienst einer ideologischen Aufgabe gestellt werden könne. Zwar übernahm er von Wölfflin die Idee, dass in der Kunst etwas Regionales oder Nationales durchscheine, die aber schon Wölfflin vorsichtig als «Hilfskonstruktion» der Kunstgeschichte bezeichnet hatte.2079 Als 1931 Wölfflin das Wort «Rasse» gebrauchte, um einen Unterschied zwischen italienischer und nördlicher Kunst zu bezeichnen,2080 folgte ihm Gantner nicht. Er verwendete dafür den Begriff einer «biologischen» Grundlage,2081 die sich im schöpferischen Akt des Künstlers manifestiere. Dass es eine im völkischen Sinne deutsche oder schweizerische Kunst gebe, hat Gantner nicht behauptet, wohl aber eine Prägung des Künstlers (nicht des Werks). Gantner engagierte sich als Vortragsredner in der Schweiz gelegentlich weiterhin für die reinen Ideen des Neuen Bauens, aber thematisch stand er nun in der Geschichte der Kunstwerke und Bauten in der Schweiz. Einen besonderen Eindruck machte ihm die romanische Plastik, die er an den Kapitellen des Zürcher Grossmünsters2082 und an der Basler Galluspforte entdeckte. In Henri Focillon, seit 1933 Professeur d’esthétique an der Sorbonne,2083 begegnete er einem Erforscher der französischen Romanik, der formal analysierte und den Gantner deshalb als Vertreter Wölfflinscher Ideen begrüsste. Die 1936 erschienene Kunstgeschichte der Schweiz machte Gantner allerdings keineswegs ‚incontournable‘, wie er und Wölfflin gehofft hatten,2084 sie wurde als Kompilation verurteilt. Er musste zudem feststellen, dass die Wölfflinschule auch in der Schweiz kein verbrieftes Anrecht auf Lehrstühle hatte.2085 Bern wählte 1934 Hans Robert Hahnlo2079 2080 2081
2082 2083 2084 2085
Krüger Sasz 2008, 226 f. Halbertsma 1992, 108 f. Ob der Ausdruck «biologisch» dasjenige bedeuten sollte, was bei Wölfflin gelegentlich auch «Rasse» hiess, lasse ich hier offen. Gantner 1941, 105 und 110, meinte dann mit «biologischem Standort» den Bezug des Künstlers auf bestimmte Landschaften, Gebiete, Weltteile; im Akt der schöpferischen Realisierung des Werks löse sich dieses von den «biologischen» Voraussetzungen. Vgl. Dilly 1988, 13 f. Pinder nach 1933: Bohde 2008, 191 ff. Vgl. Sitt 1990, 143. Mazzocut-Mis 1998. Wölfflin an Gantner, 2. 8. 1933, in: Nachlass Wölfflin, NL 95, Abt. Nachtrag 1973, IX 1 k, Mappe IX 1 k 137–203, Briefe an Joseph Gantner 1933–1938, k 142. Über Gantners Anstellungshoffnungen informiert sein Briefwechsel mit Wölfflin: Nachlass Wölfflin, NL 95, Abt. Nachtrag 1973, IX 1 k, 137–203 Briefe an Joseph Gantner 1933–1938. Nachfolge Josef Zemp (Zürich-ETH): Kopie von Gantners Brief an Wölfflin vom 13. 5. 1934, ebd., k 154; vom 14. 5. 1934, ebd., k 155; Berufung von Linus Birchler (an die ETH Zürich): Briefe vom 4. 8. 1934, ebd., k 160; vom 1. 9. 1934, ebd., k 164; Ende der Aussichten auf eine Stelle in Deutschland: 22.6., ohne Jahr (1935), ebd., k 172; Versuch einer Bewerbung auf die Stelle des Direktors des Landesmuseums in Zürich: 7. 10. 1936, ebd., k 185; und dann 1937/38 das ungeduldige Warten auf die Basler Wahl, beginnend mit ebd., k 188 (ohne Ort und Datum).
500
Geisteswissenschaftler
ser; die Nachfolge von Josef Zemp an der ETH (Rücktritt ebenfalls 1934) übertrug der Schulrat, ohne auf Wölfflin zu hören, Linus Birchler. Eine Anstellung in Deutschland kam nicht mehr infrage, da dort zunehmend ein Bekenntnis zum Nationalsozialismus Voraussetzung für eine Anstellung wurde,2086 und Gantner war mit einer jüdischen Frau verheiratet. So blieb nur noch die Hoffnung auf Basel, wo nach Gantners Urteil «der wichtigste kunsthistorische Lehrstuhl unseres Landes»2087 existierte. Dort wurde Heinrich Alfred Schmid2088 zwar älter, isolierter durch seinen Konflikt mit Paul Ganz2089 und zunehmend leidend unter seiner Schwerhörigkeit, aber einen Rücktritt zögerte er möglichst lange hinaus.2090 7.3.3 Die Basler Wahl 1937 trat Heinrich Alfred Schmid zurück. Bei einem Treffen mit ihm spürte Gantner deutlich, dass Schmid ihn nicht favorisierte. Schmid war vielmehr der Ansicht, die Fakultät solle sich weiterhin in Deutschland nach Kandidaten umsehen.2091 Er war einer der wenigen Schweizer, die in der Kunstgeschichtlichen Sektion der 1925 gegründeten Deutschen Akademie mitwirkten, und daran hatte sich 1933 nichts geändert.2092 Im Basler Berufungsverfahren, das im Mai 1937 einsetzte und im März 1938 zum Abschluss kam,2093 favorisierte Schmid Theodor 2086
2087 2088 2089
2090 2091 2092
2093
Entwicklungen der Kunstgeschichte zwischen 1933 und 1945 in Deutschland: Heftrig u. a. 2008. Die von Gantner in der Nachfolge Wölfflins vertretene Formanalyse wurde in Deutschland am Ende der 1930er Jahre kritisiert als «begriffliches jüdisches Denken» (Pinder), sie übersehe «das Leben überhaupt» (Stange), zitiert nach Bohde 2008, 193. Sitt 1990, 143. Gantners Darstellung der Geschichte dieses Lehrstuhls: Gantner 1975. Schmidt 1951. Das HLS würdigt ihn nicht, deshalb greife ich auf https://de.wikipedia.org/ wiki/Heinrich_Alfred_Schmid zurück. Verzar 2014, 7 f., 9 f. StABS UA XI 2,17, 1934–1935. StABS Erziehung CC 1 G-i Philosophische Fakultät, darin Erziehung CC 1 h Kunsthistorisches Seminar, Archiv für Schweiz. Kunstgeschichte 1902– 1954. Gantner 1975, 23. Wölfflin an Gantner, in: Nachlass Wölfflin, NL 95, Abt. Nachtrag 1973, IX 1 k, Mappe IX 1 k 137–203 Briefe an Joseph Gantner 1933–1938, 21. 7. 1937, k 193; 8. 11. 1937, k 198. Mitglieder der 1925 gegründeten Abteilung für bildende Kunst waren um 1928 u. a. Adolph Goldschmidt, Hans Lehmann (Landesmuseum Zürich), Wilhelm Pinder und Heinrich Alfred Schmid (Basel). Wölfflin war in seiner Münchner Zeit Senator der Deutschen Akademie, aber nicht Mitglied dieser Abteilung. Bis 1933 kamen keine weiteren Schweizer hinzu, danach wurde nur noch 1935 Heribert Reiners (Freiburg Schweiz) aufgenommen. Die Akademie war «nationalkonservativ»; Warburg oder Panofsky waren nie Mitglieder. Im Verlauf der 1930er Jahre wurde die Institution propagandistisch instrumentalisiert. Fuhrmeister 2008, 316–319. Ich stütze mich auf die Protokolle der Sachverständigenkommission der Kuratel, in: StABS ED-REG 1a 3 182, Philosophische Fakultät I 1981, Joseph Gantner Kunstgeschichte, Mappe Lehrstuhl für Kunstgeschichte, Einsetzung einer Sachverständigenkommission,
Kunsthistoriker
501
Hetzer,2094 Schüler von Rintelen und nach dessen Tod Protegé von Wilhelm Pinder, seit 1923 Privatdozent in Leipzig, wo er 1929 Extraordinarius und 1935 Ordinarius wurde. Schmid würdigte Hetzer als Enkelschüler von Wölfflin und attestierte ihm echte Liebe zur Kunst, er sei ein begabter Erzieher und diszipliniert. Er versuchte den Eindruck zu widerlegen, dass Hetzers These, die italienische Kunst sei von deutschen Einflüssen geprägt, deutschtümelnd sei. Im Gutachten, das er über ihn abgab,2095 unterstrich er jedoch dessen Deutschtum und referierte den Stammbaum, wie wenn es für Basel wichtig gewesen wäre, einen wahrhaft «Deutschstämmigen» für die Professur zu gewinnen. Hetzer hatte dies nicht nötig, da er allgemein zu den interessanteren deutschen Kunsthistorikern gerechnet wurde.2096 Er war offensichtlich kein Nazi-Propagandist, relativ unabhängig, aber in seiner Karriere auf die Zustimmung von Parteistellen angewiesen, die er auch erhalten hatte. Er stand wohl Pinder nahe, der zwar Hitlers ‚nationale Revolution‘ begrüsste hatte, aber innerhalb des ‚Dritten Reichs‘ für die Wissenschaft gewisse Freiräume reklamierte.2097 Der einzige Einwand, der in Basel gegen ihn niedergeschrieben wurde, lag in der Frage, ob er den gut ausgestatteten Leipziger Lehrstuhl, den er erst 1935 erhalten hatte, gegen Basel einzutauschen bereit wäre. Die Fakultät hätte einen jüngeren Deutschen bevorzugt, dessen Unabhängigkeit von nationalsozialistischen Ideen viel deutlicher war: Ludwig Heinrich Heydenreich.2098 Er war Panofsky-Schüler und hielt auch nach dessen Entlassung und Emigration zu ihm. Er führte eine Arbeitsgruppe von Doktoranden in Hamburg, die unter Panofsky2099 zu studieren begonnen hatten und die er zum Doktorat bringen wollte. Allerdings wurde er vom interimistischen Seminarvorsteher
2094 2095
2096 2097 2098 2099
Protokoll, Rechnungstellung für Besuch von Vorgeschlagenen, Zirkulation von Büchern, Rückgabe, sowie auf die Berichte des ED, in: ebd., Mappe Lehrstuhl für Kunstgeschichte Prof. Dr. Jos. Gantner, Wahl 1938. Über die Diskussionen in der Fakultät habe ich keine Dokumente gefunden, nur das Fakultätsgutachten selbst (13. 7. 1937) liegt vor. Die Kommission der Fakultät bestand aus dem Dekan Harald Fuchs (Latinist), Ernst Pfuhl (Archäologe), Wilhelm Altwegg (Germanist), Heinrich A. Schmid (Kunsthistoriker, abtretend) und Werner Kaegi (Historiker). Paul Ganz (Kunsthistoriker, mit Schmid verfeindet) und Walter Muschg (Germanist) weigerten sich, dieser Kommission anzugehören. StABS UA R 3a, 3 Protokoll der Philologisch-Historischen Abteilung der Philosophischen Fakultät, ab 1937 der Philosophisch-Historischen Fakultät, 1930–1948, 164, Sitzung vom 7. 5. 1937, Traktandum 3. Gross 1972. Gutachten Heinrich Anton Schmid über Theodor Hetzer, undatiert, in: StABS ED-REG 1a 3 182, Philosophische Fakultät I 1981, Prof. Dr. Jos. Gantner Kunstgeschichte, Mappe Diverse Gutachten, Berichte und Empfehlungen über Vorgeschlagene. Voten in der Sachverständigenkommission der Kuratel über Hetzer, in: Protokoll der 3. Sitzung vom 28. 9. 1937. Pinder: Halbertsma 1992, und Dilly 1988, 46 f. Sorensen o. J. Nachruf in: Günther 1978. Dilly 1988, 12 f.
502
Geisteswissenschaftler
Werner Burmeister, Privatdozent wie er, aber von der nazifizierten Universitätsleitung eingesetzt, mit allen Mitteln in der Arbeit behindert.2100 1935 holte ihn Pinder als Assistent nach Berlin, bis er dann als Nachfolger eines anderen PinderAssistenten, Friedrich Kriegbaum, die Leitung des seit 1936 gleichgeschalteten und 1938 von Juden ‚gereinigten‘ Deutschen Instituts in Florenz übernahm.2101 Die Basler Fakultät war der Überzeugung, dass Heydenreich bereit wäre, nach Basel zu kommen. «Der nationalsozialistischen Partei gehört er nicht an». Heydenreich werde der Basler Fakultät von Ludwig Curtius (Rom) und von Erwin Panofsky selbst (Princeton) empfohlen; Letzterer bezeichne ihn als einen «Burckhardtianer». Das waren schwergewichtige Argumente. Mit einer abwertenden Charakterisierung aller denkbaren Schweizer Kandidaten legte die Fakultät nochmals ein Bekenntnis zur Integration der Universität Basel in das Hochschulsystem des ‚deutschen Sprachraums‘ ab und negierte die offensichtliche Verschränkung von Wissenschaft und Politik, die in den gleichgeschalteten deutschen Universitäten verlangt und teilweise praktiziert wurde. Vor allem mit Heydenreich schlug sie immerhin einen Bewerber vor, der nicht als Exponent einer nationalsozialistischen Wissenschaft gelten musste. Müsste es unbedingt ein Schweizer sein, dann wäre für die Fakultät Hans Reinhardt2102 die beste Wahl gewesen. «Dr. Gantner ist offenbar sehr von seiner jeweiligen Umgebung beeindruckt, deshalb die grossen prinzipiellen Schwankungen», erläuterte Dekan Harald Fuchs die Stellungnahme der Fakultät vor der Sachverständigenkommission der Kuratel. Im Fakultätsgutachten vom 13. Juli 1937 war über Gantner zu lesen, es habe ein «völliges Zerwürfnis mit der Schule» 2100
2101
2102
Dilly 1988, 68–73. Panofksy wurde 1933 entlassen und vorerst nicht ersetzt. Burmeister trug als Geschäftsführer SA-Uniform, diffamierte die Entlassenen und hatte nur wenig Zuhörer. Dilly/Wendland 1991, 614 f.; Badalin u. a. 2004/05. Caraffa/Goldhahn 2012, 93–110. «Kunsthistorisches Institut in Florenz – Geschichte», https://www.khi.fi.it/de/institut/geschichte.php. Das Basler Kunsthistorische Seminar bezahlte einen jährlichen Mitgliedbeitrag an das Deutsche Institut in Florenz. Regierungsrat Fritz Hauser wollte 1934 diesen Beitrag streichen, doch Heinrich Alfred Schmid protestierte dagegen mit dem Argument, die Eidgenossenschaft sehe keine derartigen Schritte vor, und der Schweizer Heinrich Bodmer habe nach 1918 dieses Institut durch eigene Spenden wiederhergestellt. Bodmer, 1922 bis 1933 Leiter des Instituts, war aber inzwischen gegen seinen Willen durch einen Deutschen ersetzt worden; er verlangte darauf selbst, dass die Schweizer keine Beiträge mehr bezahlen sollten. Hauser entschied, den Basler Beitrag zu kürzen. Gantner stellte 1938 fest, dass sowohl das Kunsthistorische Seminar als auch das Kunstmuseum Beiträge an das florentiner Institut bezahlten. Auf seinen Antrag hin stellte Hauser die Beitragszahlungen für das Seminar ein. H. A. Schmid an F. Hauser, 7. 2. 1934; Hauser an Schmid, 9. 3. 1934; Gantner an Hauser, 30. 7. 1938; Hauser an Gantner, 16. 8. 1938, in: StABS Erziehung CC 1 G-i Philosophische Fakultät, darin Erziehung CC 1 h Kunsthistorisches Seminar, Archiv für Schweiz. Kunstgeschichte 1902– 1954. Verzar 2014, 17 f.
Kunsthistoriker
503
in Frankfurt (de facto jedoch nur mit Fritz Wichert) bestanden. Seine Arbeiten zum Städtebau seien anregend, aber nicht mehr. Die Grundformen der europäischen Stadt seien in Frankfurt als Habilitationsschrift aufgrund von Gutachten von Rudolf Kautzsch (1915 bis 1930 Ordinarius für Kunstgeschichte in Frankfurt) und Hans Schrader (Professor für Archäologe in Frankfurt von 1914 bis 1931) abgelehnt worden. Während die Thesen in der Revision der Kunstgeschichte von 1932 stark vom Frankfurter Umfeld beeinflusst seien, sei seine Schweizer Kunstgeschichte von 1936 frei von aller Problemstellung (sic). Die Fakultät zitierte den Verriss des enttäuschten Peter Meyer im «Werk», der noch gar nicht gedruckt vorlag. Zwar sei er ein anregender Lehrer, aber nicht imstande, «als charakteristischer Forscher und sicher leitender Erzieher die Basler Tradition fruchtbar fortzuführen». Die Sachverständigenkommission der Kuratel schlug 1o loco Theodor Hetzer, 2o loco Heinrich L. Heydenreich vor. Falls die Behörden den schweizerischen Nachwuchs besonders berücksichtigen wollten, votierte die Kommission einstimmig (in Abwesenheit von Paul Ganz, der für Hahnloser eintrat) für Gantner und Gotthard Jedlicka (Zürich).2103 Allerdings hatte die Kommission der Kuratel manches am Fakultätsgutachten auszusetzen. So wurde gerügt, dass Meyers Rezension noch gar nicht publiziert sei. Und für diejenigen Kommissionsmitglieder, die nach Zürich gefahren waren, um eine Vorlesung von Jedlicka zu hören,2104 war klar, dass dieser von der Fakultät konsequent negativ gezeichnet worden war. Merkwürdig war auch das im Fakultätsgutachten angedeutete Argument, dass er kein echter Schweizer, sondern nur ein eingebürgerter Tscheche sei. Es scheint, dass eine Gruppe in der Fakultät versuchte, ihn mit dem Stereotyp des Geschäftemachers, Kunsthändlers und Lohnschreibers, der dem Geld nachjage, zu belegen. Hahnloser, immerhin vor Kurzem in Bern gewählt, wurde als ein Kunsthistoriker abqualifiziert, der sich nur mit schriftlichen Quellen über Kunst befasse und damit kein direktes Verhältnis zum Kunstwerk besässe. Unter den Universitätsangehörigen scherte in der Sachverständigenkommission der Kuratel nur Paul Ganz aus, der aber so offensichtlich für die Bedürfnisse seines eigenen, schweizergeschichtlichen Programms argumentierte, dass seine Stimme kaum Gehör fand. Immerhin erreichte er, dass in einer eigens dafür anberaumten Sitzung die Schweizer durchgespro2103
2104
Bericht des ED an den Regierungsrat, 19. 2. 1938, mit Antrag auf Ermächtigung zu Verhandlungen mit Gantner, in: StABS Erziehung CC 20b Philosophische Fakultät, Professur für Kunstgeschichte 1893–1938. Eine Delegation der Basler Sachverständigenkommission fuhr nach Zürich, um Gantner und Jedlicka zu hören, sowie nach Bern, um sich ein Bild von Hahnlosers Lehre zu machen. ED-REG 1a 3 182, Philosophische Fakultät I 1981 Joseph Gantner Kunstgeschichte, Mappe Lehrstuhl für Kunstgeschichte, Einsetzung einer Sachverständigenkommission, Protokoll, Rechnungstellung für Besuch von Vorgeschlagenen, Zirkulation von Büchern, Rückgabe.
504
Geisteswissenschaftler
chen wurden.2105 Eine gewisse Rolle spielte schliesslich ein Sondervotum des Privatdozenten Hans Reinhardt,2106 der aber selbst Kandidat war. Einige Votanten wollten auf ihn besonders Rücksicht nehmen und verhindern, einen Mann auf das Ordinariat zu berufen, der jünger wäre als er – was mit Heydenreich der Fall gewesen wäre. Gantner wusste, dass seine Kandidatur im Verlauf des Jahres 1937 nur geringe Chancen hatte, und Wölfflin vermochte ihn nicht zu trösten. Dieser brachte dann als erfahrener Taktiker im richtigen Moment seine Autorität zur Geltung und stellte schliesslich Gantner in den Vordergrund. Er hielt sich nicht damit auf, die Fakultät oder Schmid zu überzeugen, sondern korrespondierte mit dem Präsidenten der Sachverständigenkommission, August Rüegg, der sichtlich mit dem Kommissionsergebnis unzufrieden und deshalb recht glücklich war, dass er sich auf Wölfflins Autorität berufen konnte, um vor der Kuratel das Resultat der von ihm präsidierten Kommission infrage zu stellen. Wölfflin hatte von St. Moritz aus am 14. September 1937 vertraulich an Rüegg geschrieben, man dürfe die Schweizer nicht übergehen. In diesem Brief empfahl er noch sowohl Gantner als auch Christoffel. Es sei unrichtig, Gantner «rhetorische Suada» vorzuwerfen. Die Kunstgeschichte der Schweiz sei keine selbstgewählte Aufgabe gewesen, sondern «eine buchhändlerische Bestellung». Gantner verfüge über eine «ungewöhnliche literarische Beweglichkeit». «Der Tradition Jacob Burckhardts, in die er schon auf der Schule durch seinen Lehrer Markwart eingeführt worden war, fühlt er sich besonders verpflichtet». Christoffel sei vergleichsweise stiller und bedächtiger, «aber an Umfang der Kunstauffassung & an spezifisch humanistischer Kultur möchte er ihm überlegen sein». Eine «längere Dozentenpraxis» fehle ihm, auch gehe ihm diplomatisches Geschick ab, so dass er die in München angestrebte Habilitation nicht erreicht hatte. Am 5. Dezember 1937 doppelte Wölfflin auf Bitten von Rüegg nach und charakterisierte nun ausschliesslich Gantner: Dieser sei der beste Schweizer Privatdozent. «Zur Charakteristik Gantners gehört noch [sic] auch noch ein Hinweis auf deutlich sich bekundende organisatorische Triebe. In Zürich hat er, mehrfach gehemmt, nichts durchsetzen können. Ich bin aber überzeugt, dass diese aktive Ader in freien Verhältnissen sich für das allgemeine Kunstleben in glücklicher Weise bewähren würde.»2107
2105
2106 2107
Protokoll der 5. Sitzung der Sachverständigenkommission der Fakultät vom 1. 12. 1937, in: StABS ED-REG 1a 3 182, Philosophische Fakultät I 1981 Joseph Gantner Kunstgeschichte, Mappe Lehrstuhl für Kunstgeschichte, Einsetzung einer Sachverständigenkommission, Protokoll, Rechnungstellung für Besuch von Vorgeschlagenen, Zirkulation von Büchern, Rückgabe. Verzar 2014, 17 f. «Zu Ihrer Orientierung: ein vierseitiger Brief ist gestern an Rüegg abgegangen.» Wölfflin an Gantner, 6. 7. 1937, in: Nachlass Wölfflin, NL 95, Abt. Nachtrag 1973, IX 1 k, Mappe IX 1 k 137–203 Briefe an Joseph Gantner 1933–1938, k 200. Wölfflin an Rüegg, 14. 9.
Kunsthistoriker
505
Für die Kuratel selbst waren alle Überlegungen über Deutsche gegenstandslos. So erlangte Wölfflins Empfehlung für Gantner eine durchschlagende Wirkung; die Kuratel würdigte Gantner vor allem als «ausgezeichneten Dozenten», der «akademische Würde mit einer gewissen Eleganz» verbinde und in Zürich ausserordentlich viele Zuhörer habe. Er sei «von Jugend auf ein Verehrer Jacob Burckhardts gewesen» und würde sich gut in die Basler Tradition einfügen.2108 Da die Kuratel auch den Chef des Erziehungsdepartements, Fritz Hauser, überzeugte,2109 spielte es keine Rolle mehr, dass sich eine Minderheit des Erziehungsrats gegen Gantner stellte.2110 Nach fast einjährigem Verfahren war am 26. März 1938 Gantner gewählt,2111 wie es ihm Wölfflin vorausgesagt hatte. Der Stellenantritt wurde auf den 1. April 1938 festgesetzt.2112 Das Umfeld, in das Gantner als Kunsthistoriker eintrat, war nicht einfach. Schmid wirkte als Emeritus weiter bis zu seinem Tod 1951, Ganz führte ein eigenes Institut für Schweizer Kunstgeschichte neben dem von Gantner verantworteten Seminar.2113 Der Direktor des Kunstmuseums, Otto Fischer, ein bedeutender Spezialist für chinesische Kunst und Kultur, der sich auch wiederholt zu grossen Basler Themen geäussert hatte und (wie Wölfflin) mit dem Münchner Bruck-
2108
2109
2110
2111
2112
2113
1937, in: StABS ED-REG 1a 3 182, Philosophische Fakultät I 1981 Joseph Gantner Kunstgeschichte, Mappe Diverse Gutachten, Berichte und Empfehlungen über Vorgeschlagene. Kuratel an Hauser, 19. 1. 1938, in: StABS ED-REG 1a 3 182, Philosophische Fakultät I 1981, Joseph Gantner Kunstgeschichte, Mappe «Lehrstuhl für Kunstgeschichte Prof. Dr. Jos. Gantner, Wahl 1938». Die Kuratel empfahl mit 4 : 1 Stimmen und bei einer Enthaltung Gantner zur Wahl. StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 13, 1935–1941, 253, Sitzung vom 13. 1. 1938. Die Empfehlungsscheiben von sozialdemokratischen Parteigenossen für Jedlicka und für einen andern Zürcher Kandidaten machten keinen Eindruck auf Fritz Hauser. Entscheidend war offensichtlich Rüeggs persönliches Schreiben an Hauser, 5. 1. 1938: Er trat «mit Nachdruck» für Gantner ein im Vertrauen auf Wölfflin. Hetzer sei «ungeistig» und «interessiert». «Ich befürchte, wir bekämen einen zweiten Prof. Fischer. Falls Prof. Fischer [Otto Fischer, damals noch Leiter des Kunstmuseums, erkrankt] wirklich demissionieren sollte, hielte ich eine Berufung Heydenreichs auf diesen Posten für die beste Lösung. Heydenreich würde Gantner ganz nett ergänzen.» 2 Stimmen für Jedlicka, 2 Enthaltungen, 5 für Gantner. ED an Regierungsrat, Antrag auf Ermächtigung zu Verhandlungen mit Gantner, 19. 2. 1938, in: StABS Erziehung CC 20b Philosophische Fakultät, Professur für Kunstgeschichte 1893–1938. Bericht ED an Regierungsrat, 22. 3. 1938, und Regierungsratsbeschluss, 26. 3. 1938, in: StABS Erziehung CC 20b Philosophische Fakultät, Professur für Kunstgeschichte 1893– 1938. «Dass die Berufung zu Stande kam, ist natürlich auch für mich eine Freude, indem die Professur nun gewissermassen in der Familie bleibt.» Wölfflin an Gantner, 17. 3. 1938, in: Nachlass Wölfflin, NL 95, Abt. Nachtrag 1973, Mappe IX 1 k 137–203 Briefe an Joseph Gantner 1933–1938, IX 1 k, k 203. Gantner 1975.
506
Geisteswissenschaftler
mann-Verlag verbunden war,2114 war krank und auf dem Weg zur Erholung ins Tessin. Der Kenner der oberrheinischen Kathedralen Hans Reinhardt, Privatdozent an der Universität Basel und selbst Kandidat für die Nachfolge Schmid, wurde (erst) 1943 von der Regierung auf Initiative von Fakultät und Kuratel mit einer Beförderung zum Extraordinarius ‚getröstet‘,2115 bis er 1945 die Leitung des Historischen Museums übernahm. Gantner bewies grosses Geschick im Umgang mit diesen Männern und vermied Zusammenstösse. 1939 wurde Otto Fischer als Leiter des Kunstmuseums durch den Kommunisten Georg Schmidt, einen Sohn des Basler Geologieprofessors Carl Schmidt, ersetzt.2116 Gantner und Georg Schmidt kamen offensichtlich gut miteinander zurecht, auch wenn die Überlieferung sagt, Gantner hätte es nicht geschätzt, wenn seine Studenten Führungen und Vorträge von Schmidt besuchten. 1927 hatte Gantner Georg Schmidt als seinen Nachfolger in der Redaktion von «Das Werk» empfohlen, wenn auch ohne Erfolg.2117 Gantner hatte offensichtlich das Zeug dazu, einen Lehrstuhl nicht nur auszufüllen, sondern ihn zur Basis zu machen, vor der aus er eine vielbeachtete Wirksamkeit entfaltete. Diese erhielt nach dem Krieg eine internationale Dimension, als sich Gantner auch zu Grundfragen der Kunsttheorie und Ästhetik äusserte. Vorher hatte Gantner rasch das Basler Publikum für sich gewonnen, das seine brillanten und doch würdig-schweren rhetorischen Künste schätzte. Einer der Höhepunkte war die Gedenkrede auf den jüngeren Holbein im Jahr 1943 (ich 2114
2115
2116 2117
Fischer: Meier 2011; Meier 2010, 9. Münchner Verlag: Bechstedt u. a. 2008. Neben solchen von Otto Fischer brachte der Verlag auch Werke von Ulrich Christoffel heraus und besorgte die zahlreichen Auflagen von Wölfflins Grundbegriffen. Antrag auf Beförderung von Herrn PD H. Reinhardt zum Extraordinarius, begründet durch Gantner und von der Fakultät zu Händen der oberen Behörden angenommen, Sitzung vom 4. 12. 1942, in: StABS UA R 3a, 3 Protokoll der Philologisch-Historischen Abteilung der Philosophischen Fakultät, ab 1937 der Philosophisch-Historischen Fakultät, 1930–1948, 292 f. Am 14. 5. 1943 wurde Hans Reinhardt als Extraordinarius in die Fakultät eingeführt. Dettwiler 2011. Gantner an Hannes Meyer, 23. 8. 1927, in: Nachlass Gantner, NL 288, Nr. 357. 1943 verlangten hundert Studierende von der Basler Regierung, Georg Schmidt solle einen Lehrauftrag für Kunstwissenschaft an der Universität bekommen. Gantner, damals Dekan, bedauerte die Demarche der Studierenden und betonte zusammen mit Häberlin und Schmalenbach, dass diese keine schlechten Absichten verfolgten. Tatsache sei aber, dass Schmidts wissenschaftliche Legitimation bloss auf der Einleitung zu einem Buch über schweizerische Malerei von 1940 und auf einem mit Hans Mühlestein verfassten Werk über Hodler (1942) beruhe; Letzteres betrachte die Kunstkommission als «bedauerliche Veröffentlichung». StABS UA R 3a, 3 Protokoll der Philologisch-Historischen Abteilung der Philosophischen Fakultät, ab 1937 der Philosophisch-Historische Fakultät, 1930– 1948, 303 f., Protokoll vom 5. 3. 1943. Verzar 2014, 25, 28; Meier 2010, 10; Kreis 1990; Bessenich 1988.
Kunsthistoriker
507
komme darauf noch zurück). Sein wiederholtes Bekenntnis zu Jacob Burckhardt und sein ehrerbietiges Verhältnis zu Wölfflin kamen in Basel gut an. Das Kapital, das der Mäzen und Sammler Oskar Reinhart2118 schon Heinrich A. Schmid geschenkt hatte,2119 setzte Gantner für seine Zwecke klug ein. Für einen Kunsthistoriker in der damaligen Schweiz promovierte Gantner eine sehr grosse Zahl von Schülerinnen und Schülern.2120 Der Verlust, den Basel durch das politische Veto zur Wahl eines Deutschen erlitten hatte, war so zu verschmerzen, auch wenn Heydenreich mit seiner Nähe zu Panofsky und dem exilierten Warburg-Kreis eine interessante Wahl gewesen wäre.2121 Auch Hetzer wäre vermutlich kein Fehlgriff gewesen. Zwar fanden sich in seinen Schriften die üblichen völkischen Gedanken,2122 aber eine besondere Nähe zu Parteistellen ging ihm ab, und in der Wahl seiner Vorlesungsthemen zeigte sich eine europäische Weite und gelegentlich ein Interesse an der Architektur, aber kein politisch gefärbtes Insistieren auf dem ‚Deutschtum‘.2123 Als Erforscher der Farben war Hetzer zweifellos innovativ.2124 Auffällig ist, dass weder die Fakultät noch die Kuratel je in Betracht zogen, einen vom nationalsozialistischen Regime Verfolgten nach Basel zu holen. Die Distanz der Basler Kunsthistoriker zu den Emigranten, unter denen allein in Basel ein grosser Sammler, zwei bedeutende Kunsthistoriker und ein Kunstverleger weilten, nämlich Baron Robert von Hirsch (in Basel seit 1933),2125 Werner Weisbach (in Basel seit 1935),2126 Adolph Goldschmidt (seit 1939 in Basel)2127 und
2118 2119
2120 2121 2122
2123 2124 2125 2126 2127
Joelson-Strohbach 2013. Heinrich Alfred Schmid besuchte 1936 mit Studierenden Reinharts Sammlung, worauf dieser dem Basler Seminar Fr. 5’000 für die Beschaffung von Diapositiven schenkte. StABS Erziehung CC 1 G-i Philosophische Fakultät, darin Erziehung CC 1 h Kunsthistorisches Seminar, Archiv für Schweiz. Kunstgeschichte 1902–1954, Jahresbericht des Kunsthistorischen Seminars für 1936. Verzar 2014, 14 f. Caraffa 2012; Hausmann 2008, 16 f. Vgl. Hetzers einschlägige Publikationstitel: Hetzer 1935 («Dürers deutsche Form») und Hetzer 1935a («Die schöpferische Vereinigung von Antike und Norden in der Hochrenaissance»). Darauf wies Hermann Kienzle (Direktor der Gewerbeschule) in der 3. Sitzung der Basler Sachverständigenkommission, 28. 9. 1937, kritisch hin. Eine weitere Bemerkung bezog sich auf Hetzer 1929 (Das deutsche Element in der italienischen Malerei des 16. Jahrhunderts). Liste der Vorlesungen, in: Badalin u. a. 2004/05. Hetzer 1935b. Fillitz 2011. Wendland 1999, Bd. 2, 728–732; Weisbach 1956. Siehe Werner Kaegi, unten Kapitel 7.5.10. Meier 2007; Wendland 1999, Bd. 1, 211–218; Goldschmidt 1989.
508
Geisteswissenschaftler
Hermann Loeb (seit 1935 in Basel),2128 war Teil einer verbreiteten Erscheinung. Ich könnte auch Edgar Breitenbach erwähnen, der von 1933 bis 1934 als Hilfskraft bei Paul Ganz arbeitete.2129 Diese Distanz wurde schon als eine verpasste Gelegenheit beurteilt, aus der zunehmenden geistigen Isolierung der Schweizer Kunsthistoriker zwischen 1933 und 1945 auszubrechen.2130 Immerhin hatte Gantner vor seiner Wahl Vorträge von Weisbach besucht und sich 1934 mit dem entlassenen Paul Frankl in Basel getroffen;2131 er zitierte Ende 1938 demonstrativ Goldschmidt in seiner Basler Antrittsvorlesung.2132 Vertreter anderer Fächer pflegten Beziehungen zu den emigrierten Kunsthistorikern, so der Historiker Werner Kaegi zu Weisbach, den er bei der Niederlassung in Basel unterstützt hatte, und eine Gruppe von Nationalökonomen, die bei Robert von Hirsch verkehrten.2133 Es ist aber offensichtlich, dass die Flüchtlinge den jüngeren Schweizer Fachvertretern als Konkurrenten erschienen. So räsonierte der damals eine Stelle in der Schweiz suchende Gantner im April 1934 anlässlich der Entlassung von Frankl in Deutschland gegenüber Wölfflin: Und wie herzlich gerne würde ich ihm eine Position in der Schweiz gönnen – stünde ich nicht selbst wartend da, mit der Gewissheit, dass ich der akademischen Tätigkeit Adieu sagen muss, wenn es mir nicht gelingt, eine der frei werdenden Professuren zu erhalten. Wird nicht auch Panofsky sich auf jede Lücke stürzen? Und was soll denn zuletzt aus uns jüngern Schweizern werden? In einem Lande, das so wenig Freude an der Jugend hat?2134
7.3.4 Konstanz und Wandel Joseph Gantners Ansichten waren konstant und konsistent durch die Basis, die mit den Namen Jacob Burckhardt und Heinrich Wölfflin definiert war. Sie gab
2128
2129 2130 2131
2132 2133 2134
Hermann Loeb kam 1935 vom Prestel Verlag Frankfurt nach Basel und gründete hier den Phoebus Verlag resp. den Holbein Verlag. Seine Frau war die Kunsthistorikerin Anna Maria Cetto, mit deren Bruder Max Gantner in Frankfurt befreundet war und die ihrem Mann 1939 in die Schweiz folgte. Verzar 2014, 26. Loeb verlegte unter anderen Werke von Heinrich Alfred Schmid und Heydenreich. Wendland 1999, Bd. 1, 87 ff. Wendland 1999, Bd. 1, 68–70. Verzar 2014, 12–14. Wendland 1999, Bd. 1, 152–157. Gantner an Wölfflin, 3. 4. 1934; Kopie von Gantners Antwort, 4. 4. 1934, in: Nachlass Wölfflin, NL 95, Abt. Nachtrag 1973, IX 1 k Wölfflin an Gantner, Mappe IX 1 k 137–203 Briefe an Joseph Gantner 1933–1938, k 150 und k 151. Gantner 1939. Siehe unten über Werner Kaegi. Kopie von Gantners Antwort an Wölfflin, 4. 4. 1934, in: Nachlass Wölfflin, NL 95, Abt. Nachtrag 1973, k 151 IX 1 k in Mappe IX 1 k 137–203 Briefe an Joseph Gantner 1933– 1938.
Kunsthistoriker
509
ihm als Richtschnur die Fokussierung auf das Kunstwerk und die Vorstellung einer autonomen Kunst als «Zweiter Schöpfung» vor. Von Wölfflin übernahm er in erster Linie die formale Analyse des Kunstwerks und in zweiter Linie die Frage nach dem «biologischen Ort» des Künstlers. In diesen Hinsichten war Gantner geprägt von der zeittypischen Ablehnung des ‚19. Jahrhunderts‘, seiner beliebigfreien Verfügung über Stile der Vergangenheit (Historismus) und insbesondere des wissenschaftlichen «Positivismus».2135 Schon in der (ersten) Zürcher Antrittsvorlesung als Privatdozent hatte er im Namen der Jugend mit einem Jacob Burckhardt-Zitat das ‚19. Jahrhundert‘ für beendet erklärt: […] der Glaube der jungen Menschen von heute, dass unsere Künstler jetzt auf dem Punkte angelangt sind, wo sie die Bücher der Historie zuklappen müssen, und wo das Pensum der vergangenen Jahrhunderte, wie Burckhardt es nannte, aufgesagt, fertig zu Ende memoriert ist, diese neue Situation wird uns die Möglichkeit eines gerechten Urteils der Distanz geben über all das, wovon wir uns eben abgewandt haben.2136
Wirkliche «Wissenschaft» von der Kunst könne es auch deshalb nicht geben, weil kunsthistorische Erkenntnis ohne die «Einsicht in das künstlerische Erlebnis» nicht möglich sei. Dieses bedürfe des Miterlebens an der «eigenen lebendigen Kunst». Über Kunst könnten wir nur arbeiten, wenn wir selbst «erfüllt sind von dem einzigen Geschehen, das wir überhaupt als Totalität erleben können: der Gegenwart».2137 Konstant vertrat er die Vorstellung vom Künstler als schöpferisches Individuum, dessen Schöpferkraft nur psychologisch untersucht werden könne.2138 Aber der kreative Akt selbst liess sich nach Gantners Überzeugung ohne Rücksicht auf die Epoche kunsthistorisch erforschen, weshalb er sich zunehmend für die «Präfiguration» oder «das Bild des Herzens» interessierte, die resp. das sich in der Seele des Künstlers vorbereite, bevor das Werk geschaffen werde. Kunst war für Gantner immer etwas Ganzheitliches und Geistiges, das in einem autonomen Feld2139 ausserhalb von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft angesiedelt war. Kulturgeschichtliche, geistesgeschichtliche oder sozialwissenschaftliche Ansätze zur Deutung des Kunstwerks (im Unterschied zur Lage des Künstlers) interessierten
2135
2136 2137 2138 2139
Verzar 2014, 9, subsumiert sowohl die Forschungen von Paul Ganz wie diejenigen von Heinrich Alfred Schmid unter «Positivismus». Meier 2010, 6, nennt diese Ausrichtung «historisch-antiquarisch». Antrittsrede Zürich, 30. 4. 1927, über Semper und Le Corbusier, in: Gantner 1932, 64. Gantner 1932, 10, 31, 33. Verhältnis zwischen Psychologie und Kunstgeschichte: Gantner 1943, 99. Autonomie künstlerischer Felder: Jurt 1995; Bourdieu 1992. Gantner befasste sich weder mit der inneren Struktur eines solchen Feldes noch mit dessen Beziehungen zu anderen Feldern.
510
Geisteswissenschaftler
ihn deshalb kaum; aber für die Architektur konstruierte er die «Aufgabe» aus der sozioökonomischen Analyse der Bedürfnisse. An der Architektur interessierte ihn das Bauen der «Namenlosen», die die Dörfer und Städte gestaltet hätten. Zu allen Zeiten hätten die Wurzeln der Architektur in «den gesellschaftlichen Schichtungen, die bestimmte Bauaufgaben entstehen lassen, den wirtschaftlichen Verhältnissen, die die Realisierung ermöglicht, beschränkt oder verhindert haben, den weltanschaulichen Ideen schliesslich, die sich in der besonderen Art der Aufgabenstellung kundtun», gelegen. Dies fasste er unter den Oberbegriff der «soziologischen Kategorien».2140 Was den Zeitgenossen als «Anpassungen» (an den linken Zeitgeist) erschien, die die Basler Fakultät in ihrem Gutachten kritisierte, beruhte bei Gantner jeweils auf der konstanten Grundlage, die er in Burckhardt und Wölfflin fand, mochten sie auch noch so «kulturbolschewistisch» klingen. Diese Basis war plastisch genug, um Anwendungen auf modernste, abstrakte Kunst (an die Wölfflin nicht gedacht hatte, als er sein System von 1915 ausarbeitete) und auf Architektur (was schon bei Burckhardt angelegt war) zu erlauben. ‚Grundlage‘ bedeutete nicht ein Verbot, von dort aus konstruktiv weiterzudenken – dies war auch der Sinn der Kampfschrift von 1932, Revision der Kunstgeschichte, von der Wölfflin dachte, sie wäre besser ungeschrieben geblieben.2141 Das Kernthema dieser Schrift war bereits die «Präfiguration» des Werks in der Seele des Künstlers, die Gantner sein Leben lang beschäftigte.2142 Auf dieser Grundlage konnte Gantner auch auf Gestaltungen zugreifen, die nicht «reine» Kunst waren, sondern mit dem Prozess einer industriellen Herstellung und Vervielfachung verbunden waren. Dementsprechend handelte er auch als Propagandist der Form und Funktionalität des Neuen Bauens ‚unpolitisch‘. Dies erklärt die unterschiedslose Aufmerksamkeit für Neues Bauen, sei es im faschistischen Italien, sei es im kommunistischen Russland oder in linksliberalen Frankfurter Kreisen.2143 Die Zuschreibung von 2140
2141 2142 2143
Gantner 1932, 59 f. Ähnlich schon im Vortrag für den Bauwissenschaftlichen Fortbildungskurs Berlin bei der Hochbauabteilung des preussischen Finanzministeriums, 6. 10. 1930, über «Soziologie und Architektur»: Gantner verlangte dort die Berücksichtigung von soziologischen Grundtatsachen wie «die fortschreitende berufliche Differenzierung der Frauen zu wirtschaftlich selbständigen Individuen, die Verschiebung des soziologischen Aufbaus der Arbeiterklasse durch Verbürgerlichung und Proletarisierung, die Auflockerung des Familienverbandes infolge Übergangs familiärer Pflichten auf die Gesellschaft». Besprechung des Vortrags durch Dr. Lampmann im Zentralblatt der Bauverwaltung vom 22. 10. 1930, in: Nachlass Gantner, NL 288, Nr. 262 Vorträge II 1930–1935. Sitt 1990, 161. Verzar 2014, 15. Bezeichnend ist auch seine Erzählung, dass er während seines Studiensemesters in Rom im Winter 1919/20 Mussolini sprechen hörte und dabei «einen Redner mit einer grossartigen Rhetorik» erlebte; «da war Hitler später nichts dagegen». Über die Inhalte dieser Reden äusserte er sich nicht. Zitiert nach Sitt 1990, 137.
Kunsthistoriker
511
aussen zum «Kulturbolschewismus» hingegen war unmittelbar politisch motiviert und diente dazu, ihn zusammen mit der Crew von Ernst May in eine politisch definierte linke Ecke zu manövrieren. Gantner war wie Wichert kein Sozialrevolutionär, sondern ein Reformer, der eine geistige und ästhetische Wende anstrebte, die aber durchaus auch reale soziale Probleme lösen helfen sollte. Gantners Reorientierung nach 1933 liess die Begeisterung für die Reform etwas zurücktreten, aber er verleugnete sie nie. Hingegen erschloss er sich mit einem durch die moderne Kunst geschärften Blick die Formenwelt der Romanik,2144 die fortan zum grossen Repertoire seiner Lehr- und Forschungsgegenstände gehörte.2145 Romanische und moderne Kunst waren nach Gantner «monologisch»; der Künstler führe Zwiesprache mit sich selbst oder – im Fall der Romanik – mit Gott, aber nicht mit den Menschen unter Verwendung konventionell abgesicherter Formensprachen.2146 Gantners Konstanz war somit in den Grundlagen der formalen Analyse des Kunstwerks und der Ästhetik der «Präfiguration» verwurzelt. Von dieser ausgehend war und blieb er einer der letzten universalen Kunsthistoriker: «He remains one of the last great generalists in the area of Kunstwissenschaft dealing with a kind of Universalkunstgeschichte.»2147 7.3.5 Die Gegnerschaft zum Nationalsozialismus Gantner wurde aus mehreren Gründen zu einem Gegner des Nationalsozialismus. So hatte die Idee der «Zweiten Schöpfung» und der Autonomie der Kunst in einer Ideologie keinen Platz, die alles einem politischen Bekenntnis unterwerfen wollte. 1933 kamen mit der Rückkehr in die Schweiz drei Faktoren hinzu, die Gantners Ablehnung des Nationalsozialismus entschieden verstärkten. (1.) Seine Frankfurter Freunde wurden ins Exil getrieben oder erhielten Berufsverbot; er konnte ab 1933 die Radikalität des nationalsozialistischen Vorgehens an ihrer Lage direkt erkennen. (2.) Privat war die Familie seiner Frau wegen ihrer Zugehörigkeit zum Judentum unmittelbar betroffen, und Gantner verliess schon im Frühjahr 1933, bevor die Lage lebensbedrohlich wurde, zusammen mit seinen Schwiegereltern Frankfurt. Über das Schicksal der weiteren angeheirateten Verwandtschaft ist mir leider nichts bekannt geworden. (3.) Der dritte Faktor war Gantners Entschluss, sich in der ‚helvetischen Enge‘ einzurichten, über Gegen2144
2145 2146 2147
Die Nähe zwischen Romanik und Moderne, die Gantner konstatierte, erinnert Verzar 2014, 21, an Meyer Schapiro, vgl. Meyer Schapiro 1977. Die Idee war allerdings um 1930 verbreitet, vgl. Dilly 1988, 19. Gantner 1941, 11, 16. Gantner 1939. Ähnlich wieder in: Gantner 1941, 33, 49, «Zwiegespräch mit Gott» und «Gebetscharakter» der romanischen Kunst. Verzar 2014, 24.
512
Geisteswissenschaftler
stände in der Schweiz zu forschen und bei der Ausrichtung des schweizerischen Fachvereins mitzudiskutieren. Er entwickelte hier eine Position, die mit Vorbehalt der ‚geistigen Landesverteidigung‘ zugerechnet werden könnte. Die moderne Kunst und das Neue Bauen, die Gantner ein Anliegen waren, passten zwar in das Weltbild der ‚aufgeklärten‘, modernistischen Mitläufer der Nazis wie Pinder, aber nicht in das Schema Rosenbergs und ästhetisch rückwärtsgewandter Anhänger einer volkstümlichen ‚Gemütlichkeit‘. Gantner hatte seit 1932 öffentlich die Nationalsozialisten zu denjenigen Kräften gezählt, die bloss vorgaben, in Deutschland eine Sozialreform anzustreben, was er durch deren kulturpolitische Positionen widerlegt sah. «Wer heute noch so tut, als ob jedem ‚Volkgenossen‘ ein Haus im Stil der Gartenlaube versprochen werden könne, der begeht eine bedenkliche Demagogie. […] Wann endlich werden innerhalb der sog. proletarischen Parteien junge Menschen von Verantwortung aufstehen und diese Propheten darüber aufklären, wie es wirklich aussieht in der Welt?» Er durchschaute das angeblich ‚Soziale‘ im Programm als eine Verschleierung des Machtanspruchs. Aber dass ein ‚Drittes Reich‘ wirklich bevorstehe, bezweifelte er noch im November 1932. Im März 1933 verstand er die nationalsozialistische «Gewerbeverordnung» noch nicht als totalitären Ansatz zur Repression, sondern als «historische Romantik».2148 Es gab bei Gantner keine politische Analyse des Nationalsozialismus: Seine Ablehnung folgte aus der Kritik an Demagogie, aus sozialem Verantwortungssinn und dem Streben nach ästhetischer Aufrichtigkeit. Nach der Rückkehr in die Schweiz kamen dann weitere Elemente hinzu, die mit der Verteidigung einer schweizerischen Position von Mass und Mitte in Kultur und Staatsauffassung zusammenhingen, die ich in «Aspekte der Laufbahn» erwähnt habe. Schliesslich war in der Anhänglichkeit an Burckhardt und Wölfflin ein humanistischer Zug angelegt, der für Gantner verbindlich war. So schrieb er im September 1933 anlässlich der Besprechung der Jacob Burckhardt-Gesamtausgabe, er hoffe, dass bald auch eine Ausgabe der Briefe Burckhardts erscheinen werde: «Es müsste für die Schweiz eine Ehrensache sein, diese wissenschaftlich wie menschlich einzigartigen Zeugnisse eines ihrer humansten Geister gerade heute
2148
Die Neue Stadt (H. 6/7, September/Oktober 1932, 154), Kritik an der Schliessung des Bauhauses: «diejenigen Kreise, die eine Erneuerung aller öffentlichen Lebensformen auf sozialer Basis als Ziel proklamieren». In H. 9, 1932, 204, nannte er die Nazis «pseudoproletarisch». Der Anlass war wie selbstverständlich eine Schrift zur Architektur: Buchbesprechung von (Karl) Willy Straub, Die Architektur im Dritten Reich, Stuttgart 1932, unter dem Titel «Architektur» (NZZ vom 22. 11. 1932 Nr. 2176), in: Nachlass Gantner, NL 288, Nr. 275 I Zeitungs- und Zeitschriften-Aufsätze 1931–1933. «Gewerbeverordnung Wiederherstellung der Zünfte?» (NZZ vom 27. 3. 1933, Nr. 548), ebd.
Kunsthistoriker
513
herauszugeben, wo es gilt, die Ideologie dieser Humanität gegen eine ganze Welt zu behaupten.»2149 Das Pathos, mit dem er während des Krieges öffentlich auftrat, lag auf dieser Linie. In der Holbein-Rede von 1943 kam zudem das religiöse Moment neu zur Geltung, das sich bereits in der Betrachtung der romanischen Kunst manifestiert hatte. Gantner betonte bei Holbein den «tiefen religiösen Gedanken», der «im Gewande der profanen Erzählung […] sichtbar wird». Holbeins Totentänze erreichten einen «Höhepunkt […], dem nichts Früheres u[nd] nichts Späteres verglichen werden kann», notierte er in seinem Manuskript für den Radiovortrag über Holbein. Im Festvortrag verneigte er sich vor der Bedeutung Basels in der Geschichte der Kunst: Basel sei die einzige Stadt nördlich der Alpen, die mit der Idee des Klassischen so eng verbunden sei («die kostbarste Seite seines [Holbeins] Wesens seine klassische Haltung») – die Periode von 1430 bis 1530 sei ihr «grosses Zeitalter» gewesen, und auch die Erkenntnis des Klassischen sei von Basel ausgegangen, nämlich von Burckhardt und Wölfflin. Gantners Ode an das Klassische galt dem «heiss schlagenden Herz» und einer Kunst, die sich «wie leise vom Boden gelöst» habe. Denn die «Schöpferkraft» sei heimatlos geworden «im Interesse des Höheren, das er [der Künstler] erfüllt» (Vortragsmanuskript vom 30. August 1943). Die Faszination durch den Totentanz hatte vermutlich mit dem Kriegsgeschehen zu tun. In Basel wurde 1940 die Danse des Morts von Paul Claudel mit der Musik von Arthur Honegger uraufgeführt, bei welcher Gelegenheit Gantner nachher über den «Tod von Basel in der bildenden Kunst» sprach.2150 Gantner begab sich nach der Rückkehr in die Schweiz für einen Moment in die Nähe einer Indienstnahme der Kunstgeschichte für nationalpädagogische Zwecke. Diese wurde vor allem von Paul Ganz, dem Initianten der Kunstdenkmäler der Schweiz, vertreten («a truly nationalistic effort», meint Verzar), von dem sich Gantner jedoch durch die Forderung nach Synthesen statt Inventaren und die Ablehnung der Idee einer genuin nationalen «schweizerischen Kunst» absetzte.2151 Gantner vertrat an einem Staatsbürgerkurs im Jahr 1934 die These, man könne durch das Medium der Kunst «den Staat in voller Klarheit erkennen» (so zitiert im Bericht der Berner Zeitung «Der Bund»). «Die deutsche Schweiz ist niemals eine germanische Provinz gewesen und es wird seinen Sinn haben, dass sie es auch geistig nie wurde», soll Gantner nach dem «Tagblatt» damals formu2149 2150
2151
«Die Gesamtausgabe der Werke von Jacob Burckhardt» (Thurgauer Zeitung Nr. 212, Zweites Blatt, 9. 9. 1933), Kopie in: Nachlass Gantner, NL 288, III: 1: 103a. Gantners Äusserungen über Holbein 1943 sind ausführlich dokumentiert, sowohl für den Radiovortrag vom 31. 10. 1943 als auch für den Festvortrag vom 30. 10. 1943, in: Nachlass Gantner, NL 288, I: 4: 35 (2 Teile), und Ausriss aus einem ungenannten illustrierten Magazin vom 2. 3. 1940, in: Nachlass Gantner, NL 288, 279, Vorträge ab 1. 1. 1939. Verzar 2014, 9.
514
Geisteswissenschaftler
liert haben, und dieser Bericht fuhr fort: «Gantner sieht die Elemente einer einheimischen Tradition […,] in Merkmalen wie das Herausstellen eines volksmässig geprägten und kraftvollen Handelnden […]; in der bedächtigen Synthese auswärtig beheimateten Kunstgutes mit heimischen Ausdrucksformen; endlich in jener Unabhängigkeit vom Zeitstil Europas […].» Gantner wollte, sagte er selbst, auf dem Feld der Kunst einen «Schweizer Standpunkt» bestimmen.2152 Er verstand die Kenntnis der Kunst in der Schweiz als einen Weg, der zur richtigen Auffassung des schweizerischen Staates (und unausgesprochen zur Einsicht in die Unterschiede zu Deutschland) führe. Die Kunst in der Schweiz (und damit die Staatsauffassung) war zwar nach Gantner stets bedächtig entwickelt und langsam erprobt worden, aber sie war auch immer zugleich international, denn es gab nie einen «schweizerischen» Stil oder eine «schweizerische» Kunst. Gantner verstand sich als Vertreter der dreisprachigen Schweiz, eines «Mischvolkes»; innerhalb der Dreisprachigkeit zeige sich, «dass es nur eine Schöpferkraft gibt, und diese schafft über alle Grenzen hinweg die universale geistige Haltung der Schweiz».2153 Wissenschaftlich positionierte sich Gantner erkennbar ausserhalb der deutschen Schulen, die sich mehr oder minder unter nationalsozialistischer Herrschaft halten konnten. Auch stand er ausserhalb der Schulen, die die deutschen Emigranten in den angelsächsischen Ländern gründeten oder dorthin verpflanzten. Er blieb der formalen Analyse verpflichtet und stellte sich gegen eine geistesgeschichtliche oder ikonographische Auffassung des Faches. Kein deutscher Kunsthistoriker orientierte sich in den Jahren von 1933 bis 1945 so klar an Wölfflin, wie dies Gantner tat.2154 Interessant ist die vorsichtig-differenzierende Bemerkung über Pinder, den er vor 1933 für einen grossen Kunsthistoriker gehalten hatte, ein Urteil, das er im Grunde nicht revidierte. Aber er merkte beiläufig an, dass er Pinders Bekenntnis zu Hitler missbillige und dass er dessen neueren Tendenzen nicht zu folgen vermöge.2155 Pauschal verurteilte er (ohne Namensnen2152
2153
2154 2155
Die (zweite) Zürcher Antrittsvorlesung als Privatdozent galt dem Thema «Kunst und Kunstgeschichte in der Schweiz» (Der Kleine Bund, Bern, 2./9. 7. 1933). Dieselben Gedanken formulierte Gantner 1934 in einem Staatsbürgerkurs in Bern. Berichte darüber in Der Bund vom 28. 1. 1934, und im Berner Tagblatt vom 27. 1. 1934, beides in: Nachlass Gantner, NL 288, Nr. 262 Vorträge II 1930–1935. Vortrag an der Schulsynode des Kantons Zürich in Wetzikon am 21. 9. 1936, Bericht der Zeitung Der Freisinnige, Wetzikon, vom 21. 9. 1936, und der NZZ vom 22. 9. 1936. Ich zitiere aus Der Freisinnige. Beide in: Nachlass Gantner, NL 288, Nr. 263–264 Vorträge III 1936–1942. Heftrig u. a. 2008; Doll u. a. 2005; Halbertsma 1992; Dilly 1988. Gantner 1932, 20, 27 f., brachte grosse Bewunderung zum Ausdruck. Siehe aber Gantner 1940. Hier schrieb er, Pinder mache einen «merkwürdig schillernden Eindruck». «Er ist nach einem grossartigen Anfang in den wirklich bedeutenden und bleibenden Werken über die deutsche Plastik des Mittelalters dann in seinen reifen Jahren zu der bekannten
Kunsthistoriker
515
nung) die Unfreiheit, unter der in Deutschland Kunstgeschichte getrieben werde, und die Sprachregelungen, denen sie sich unterwerfe.2156 Zum 70. Geburtstag von Heinrich Wölfflin schrieb er andeutungsweise, die aktuelle Lage der Kunstgeschichte sei «verworren». «Auf den deutschen Universitäten droht auch das Fach der Kunstgeschichte vor den völkischen Ansprüchen zu versanden».2157 Zum 75. Geburtstag von Heinrich Wölfflin im Jahr 1939 bemerkte Gantner, dass sich die deutsche Kunstgeschichte weit von dessen Überzeugungen entfernt habe: Wölfflin repräsentiere das «geistige Deutschland von einst». «Die Kunstgeschichte, die heute von Trägern bedeutender Namen auf deutschen Kathedern gelehrt wird, […] ist […] von der Unbestechlichkeit seiner Analyse, von der europäischen Weite und Gesinnung seiner Lehre meilenfern. Wo die Kunst nur noch die Emanation völkischer Regungen und nicht mehr die freie Blüte des schöpferischen Geistes sein darf, da hat ihre Erkenntnis aus den Kräften der Form jeden Sinn und Wert verloren.»2158 Gantner scheint auch an keinen deutschen Kongressen zwischen 1933 und 1945 mitgewirkt zu haben, und er publizierte nicht in Deutschland, sondern in Wien – hielt aber an seinem Verleger fest, nachdem Österreich ans ‚Reich‘ ‚angeschlossen‘ worden war.2159 Persönliche Feindschaften pflegte er nicht; nach 1945 nahm er den Kontakt zur Wissenschaft in Deutschland wieder auf. Sein Interesse galt allerdings vor allem Heinrich Lützeler (Bonn), der in Deutschland 1940 Lehr- und 1942 Publikationsverbot erhalten hatte.2160 Man darf daraus schliessen, dass Gantner im Unterricht durch sein Vorbild wesentlich dazu beitrug, Studierende gegen allfällige nazistische Verlockungen zu immunisieren. Bemerkungen in den Vorlesungsvorbereitungen lassen erkennen,
2156
2157 2158
2159
2160
spekulativen Studie über das ‚Problem der Generation‘ (1926) weitergeschritten und hat schliesslich, nach dem Umsturz von 1933, mehr und mehr seine Arbeit und vor allem seine brillante Formulierungsgabe in den Dienst einer neuen ‚geschichtlichen Betrachtung‘ über ‚Wesen und Werden deutscher Formen‘ gestellt (seit 1935).» Zeitungsausriss in: Nachlass Gantner, NL 288, Nr. 279. Besprechung von Altdeutsche Meisterzeichnungen, Einführung und Auswahl von Edmund Schilling, Frankfurt: Prestel, 1934 (Der Bund Nr. 41, 25. 1. 1934), in: Nachlass Gantner, NL 288, Nr. 275 II. Gantner: «Heinrich Wölfflin zum 70. Geburtstag» (NZZ vom 17. 6. 1934, Blatt 4, Erste Sonntagsausgabe Nr. 1088), in: Nachlass Gantner, NL 288, Nr. 275 II. «Heinrich Wölfflin zum 75. Geburtstag am 21. Juni 1939 von Joseph Gantner» (Beilage Sonntagsblatt der Basler Nachrichten vom 18. 6. 1939 Nr. 25), in: Nachlass Wölfflin, NL 95, Abt. Nachtrag 1973, IX 1 k, Mappe IX 1 k 80–136 Briefe an Joseph Gantner 1927– 1933, k 119. Anton Schroll war ein angesehener Kunstverlag, der auch Georg Dehio verlegte; seit 1938 übernahm er allerdings auch Bücher mit der Redeweise von den «Marken» und «Gauen» im nationalsozialistisch-grossdeutschen Sinne in sein Programm auf. Verzar 2014, 23; Kroll 2008.
516
Geisteswissenschaftler
dass er dies im Sinne einer Totalitarismusthese tat: Totalitäre Regimes – er nannte Deutschland von 1933 bis 1945 und das stalinistische Russland – würden verlangen, dass sich der Künstler in den Dienst einer bestimmten politischen Sache stellen müsse, was als möglichen Stil nur den Realismus übriglasse. Diese Herrschaftsformen würden Baustile bevorzugen, die sich für Machtrepräsentation eigneten, was in der Architektur Historismus bedeute. Die Kunst aber verweigere sich dieser Indienstnahme und schaffe unter solchen Umständen ‚Unerwünschtes‘.2161 7.3.6 Ergebnis Gantners Wahl zum Kunstgeschichtsprofessor in Basel ist ein Beispiel für die ‚Helvetisierung‘ im Selektionsprozess unter dem Eindruck der bedrohlichen Haltung des nationalsozialistisch beherrschten Deutschland gegenüber der Schweiz, die in der Basler Politik seit 1936 empfunden wurde. Das universitäre Basel, das gleichzeitig in der Debatte über das Universitätsgesetz Autonomieforderungen vorbrachte, markierte deutlich, aber ohne Glauben an einen Erfolg, dass die ‚Verschweizerung‘ in eine kulturelle Isolierung führen könne und den Grundsatz, nur den wissenschaftlich herausragenden Kandidaten zu wählen, entwerte. Die Argumente für die Berücksichtigung von Schweizern in diesem Verfahren waren vor allem national und sozial defensiv: Jeder Deutsche, der 1937 oder 1938 nach Basel gewählt würde, müsste den Anordnungen des deutschen Konsulats folgen. Charles Woerler formulierte, Schweizer hätten keine Chancen in Deutschland, wenn sie sich nicht «geistig angeglichen haben». Man habe deshalb die Pflicht, den geeignetsten schweizerischen Anwärter zu finden und ihm die Möglichkeit zur Bewährung zu geben.2162 Kaum mehrheitsfähig war die von Paul Ganz vorgebrachte Forderung, ein Basler Professor müsse «unsere Art bejahen», weil in Basel künftig nur noch Schweizer studieren würden.2163
2161
2162 2163
«[Es zeigt sich] wieder einmal, dass K[unst] & Pol[itik] auf 2 g[e]tr[ennten] verschied[enen] Ebenen leben und arbeiten.» Solange nur die Nationalsozialisten die moderne Kunst ablehnten, sah Gantner darin eine «Möglichkeit der Parteinahme für best[immte] Politik», doch seit ihrer Diffamierung in der Sowjetunion sei klar: «Die polit[ischen] Herrschaften // Systeme //, die histor[ischen] Materialismus als einzige Grundlage kult[ureller] Äusserungen betrachten, lehnen jede K[unst] ab, die nach innen geht, infolgedessen abweicht vom Naturalismus. Gut, dass diese Präzisierungen erfolgt sind. Zeigen, dass mit diesen Stilen keine polit[ischen] Geschäfte zu machen.» «Moderne Kunst (Vorlesung) III», Winter 1948/49 Basel, Winter 1954/55 Basel, 11. Stunde, 24. 1. 1949, «Der deutsche Expressionismus», in: Nachlass Gantner, NL 288, Nr. 245. Protokoll der Sachverständigenkommission der Kuratel, Votum Charles Woerler, 7. 9. 1937. Protokoll der Sachverständigenkommission der Kuratel, Votum Paul Ganz, 28. 9. 1937.
Kunsthistoriker
517
Diese Wahl ist ferner ein Beispiel dafür, wie in dieser Situation ein altes Schulhaupt seinen eigenen Kandidaten zu ‚platzieren‘ vermochte, unter Einsatz einer geschickten Taktik, die seiner Intervention erst Autorität und Wirkung verlieh. Gantners eigene Entwicklung lässt den Einfluss erkennen, den die ‚helvetische Enge‘ auf die Themenwahl, aber weniger auf die Ansätze ausübte. Kunst in der Schweiz zu studieren implizierte, so lernen wir aus Gantners Verhalten, nicht, dass sich daraus eine nationalistische Blickverengung ergeben müsse. Zwar verfolgte auch Gantner in Zürich Ziele einer vaterländischen politischen Bildung, aber diese trübten seinen Blick für die Weltkunst und die Autonomie des künstlerischen Feldes keineswegs. Gantner dachte als Kunsthistoriker nicht politisch, gesellschaftlich oder national-helvetisch, sondern von der Überzeugung her, die Jacob Burckhardt mit dem vielzitierten Wort ausgedrückt hatte, dass die Kunst eine «Zweite Schöpfung» sei. Kunst wurde zwar durch Ideologien instrumentalisiert, doch gelang dies nach Gantners Urteil nur in bestimmten Stilen, nicht dort, wo sich der Künstler schöpferisch frei äusserte. Mochte für die Künstler jeweils ein «biologischer Ort» relevant sein, so war die Kunst selbst autonom. Gantner trat nicht als lautstarker, von einer bestimmten politischen Überzeugung geleiteter Kritiker des Nationalsozialismus auf, sondern bedeutete seinen Lesern mit leiseren Tönen, was er vom regimenahen kunsthistorischen Betrieb in Deutschland hielt. Die Ablehnung basierte auf humanistischen, ästhetischen Ansätzen und dem Blick eines Menschen, der Demagogie verabscheute und über soziales Verantwortungsbewusstsein verfügte. Über einen persönlichen Einsatz für in Deutschland Verfolgte konnte ich nichts erfahren, was jedoch angesichts der Tatsache, dass er der Schwiegersohn einer Frankfurter jüdischen Familie war, die sich teilweise in Zürich im Exil befand, keine negativen Schlussfolgerungen zulässt. Ob man den eigenständigen Weg, den Gantner als Schüler Wölfflins in Basel einschlug, als Provinzialisierung werten darf, möchte ich bezweifeln. Evident ist, dass er sich nicht an denjenigen Kunsthistorikern orientierte, die seit den 1960er Jahren retrospektiv als die bahnbrechenden, innovativen Gestalten in der Geschichte des Faches galten. Ansätze von Panofsky und Warburg griff er nicht auf, weil er als Wölfflinschüler davon nicht überzeugt war (ich spreche hier von der Zeit zwischen 1933 und 1945). Wölfflin folgte er nicht aus blinder Ergebenheit, sondern in wiederholter, grundsätzlicher Auseinandersetzung aus Einsicht und auch aus einer Freundschaft heraus. Wenn er auf Wirkung seiner Forschung Wert legte, so richtete er sich auf Europa aus, und später auch stark auf Asien, aber nicht primär auf den atlantischen, anglophonen Raum. Konstanz lag in seinem Interesse an der Form und seiner Aufmerksamkeit für den schöpferischen Akt im autonomen Feld der Kunst, das keine Nation kannte. Daran hielt er fest, ob er nun als Verteidiger einer als «kulturbolschewistisch» und danach als «entartet» verschrieenen Moderne wirkte, als Betrachter und Vermittler romanischer
518
Geisteswissenschaftler
Architektur und Plastik oder als humanistischer Redner an kulturellen Hauptund Staatsaktionen wie der Holbeinfeier in Basel.
7.4 Musikwissenschaftler «Auch heute, selbst im neuen Universitätsgesetz, ist die Musikwissenschaft noch nicht eines gesetzlichen Lehrstuhls gewürdigt.»2164 Karl Nef2165 war zunächst als Cellist am Konservatorium in Leipzig in Ausbildung, als Schüler von Hermann Kretzschmar (Leipzig) wurde er Musikhistoriker. Die Habilitation erlangte er 1900 in Basel, 1909 wurde er Extraordinarius und 1923 Ordinarius ad personam für Musikgeschichte. Nef lehrte bis zu seinem Tod 1935 in Basel. 1912 wurde ihm die Gründung eines Seminars zugestanden. Er war und blieb in der deutschen Musikwissenschaft der Zeit vor 1914 verwurzelt. Nach 1918 tat er viel dafür, die deutschen Kollegen wieder international ins Gespräch zu bringen, allerdings ohne deren übersteigerten Nationalismus zu schätzen.2166 Wohl war ja schon vor Nef an der Freiburger Universität in Peter Wagner eine erste musikwissenschaftliche Autorität tätig, aber Nef ist es gewesen, der mit vollem Bewusstsein von allem Anfang an das, was er in Deutschland gelernt hatte, auf die schweizerischen Verhältnisse anzuwenden, in sie einzubauen, mit schweizerischem Geist zu durchsetzen versuchte, und er ist auch über Wagner in seiner Auswirkung schon deswegen hinausgewachsen, weil er an keine konfessionellen Schranken gebunden war und seine wissenschaftliche Reichweite auf alle Gebiete sich erstreckte und zudem von stark nationalen Gesichtspunkten durchsetzt war.2167
In Basel und in der Schweiz leistete er Pionierarbeit für die Anerkennung der Beschäftigung mit Musik und ihrer Geschichte als einer akademischen Wissenschaft durch Erschliessungsarbeiten, Entdeckung von Handschriften und Komponisten, durch Beiträge zur historischen Aufführungspraxis und zur Geschichte der Musikinstrumente. Nef etablierte das Fach als historische Wissenschaft (Einführung in die Musikgeschichte, 1920).2168 Sein Lieblingsthema waren Beethovens Symphonien (Die neun Sinfonien Beethovens, Leipzig 1928). Daneben interessierte er sich für Bach und dessen Zeitgenossen sowie speziell für die Bedeutung des Cembalos. Er war aktiv im Auf- und Ausbau der Fachgesellschaft (Schweizerische Musikforschende Gesellschaft) und ihres Publikationsorgans; zudem schrieb 2164 2165
2166 2167 2168
Merian 1939, 87. https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Nef; Schrade 1960, 257–262, zitiert nach: https://musik wissenschaft.philhist.unibas.ch/de/fachbereich/portraet-mws/; Kirnbauer/Zimmermann 2000. Kirnbauer/Zimmermann 2000, 325. Merian 1939, 89. Merian 1939.
Musikwissenschaftler
519
er Musikkritiken für Zeitungen. Die Förderung von Nachwuchsleuten war ihm ein Anliegen, nicht im Sinne der Bildung einer Schule, die seine eigenen Vorhaben weiterführte, sondern in der Sicherung des mühsam errungenen Status des Faches in der schweizerischen akademischen Welt. Nef habilitierte zwei Musikwissenschaftler, die dann neben ihm lehrten. Wilhelm Merian, ursprünglich Altphilologe, war sein erster eigentlicher Schüler. 1921 habilitiert, wurde er 1930 Extraordinarius. Nefs Wissenschaftsstil hatte ihn stark geprägt. Er spezialisierte sich auf Instrumentalmusik des 16. Jahrhunderts, wurde der Biograph von Hermann Suter und Herausgeber der Werke von Ludwig Senfl. Erst 1935 erhielt er einen Lehrauftrag. Hauptberuflich war Merian seit 1920 Nefs Nachfolger als Musikkritiker bei den «Basler Nachrichten». 1924 organisierte er den ersten internationalen musikwissenschaftlichen Kongress nach dem Weltkrieg. Zwanzig Jahre lang war er Sekretär der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft. In zahlreichen Basler Institutionen war er präsent, doch die Beziehungen zu Deutschland blieben für ihn aktuell: Er war mit dem Musikwissenschaftler an der Universität Freiburg i. Br., Wilibald Gurlitt, befreundet, der 1937 wegen ‚jüdischer Versippung‘ entlassen wurde.2169 Der zweite Basler Musikwissenschaftler neben Nef war der hochbegabte Jacques Handschin, habilitiert 1924, 1930 zum Extraordinarius befördert. Er war zugleich Organist der Martinskirche (Schüler von Reger), betrieb Forschungen in einem sehr weiten Feld der Musikgeschichte, der Musikvölkerkunde und der Byzantinistik, vom Mittelalter bis Strawinsky. Der in Moskau geborene Handschin hatte zunächst in St. Petersburg eine Karriere begonnen, die er 1920 abbrach. Diese Laufbahn nahm er in Zürich als Organist an St. Peter wieder auf, dann habilitierte Nef den international ausgerichteten Mann in Basel. Handschin hatte bald eigene Schüler, seit 1933 auch solche, die als Verfolgte nach Basel gekommen waren, wie Manfred Bukofzer und Otto Johannes Gombosi.2170 Als 1935 ein Nachfolger für Nef gesucht wurde, fiel der Entscheid zwischen Merian und Handschin nicht schwer. Merian wurde mit der Leitung des Seminars abgefunden, während der brillante Handschin das persönliche Ordinariat von Nef erhielt. Mit einer Veranstaltungsreihe, für die er führende Musikwissenschaftler nach Basel zu Vorträgen einlud, gab er vielen hervorragenden Forschern, die in Deutschland verfolgt oder verfemt waren, Gelegenheit, ihre Thesen zur Diskussion zu stellen.2171 So wollte er nicht nur seine eigenen Studierenden intellektuell fördern, sondern auch zur lebhaften Basler Musikszene mit der 1933 2169 2170
2171
Anonym 1952. Boyden 1956; zu Handschin, Bukofzer und Gombosi: Zimmermann 2000, 128. Bukofzer und Gombosi gingen 1938 in die USA, nachdem ihnen Handschin erklärt hatte, dass die Lage für ihre Habilitation in Basel ungünstig sei. Handschins Russland-Bezug: Kniazeva 2011. Kirnbauer/Zimmermann 2000, 329.
520
Geisteswissenschaftler
gegründeten Schola Cantorum, dem Basler Kammerorchester und Paul Sacher beitragen. Dabei gab Handschin zu verstehen, dass es ihm nicht primär um die Hilfe für Verfolgte gehe, sondern um musikwissenschaftliche Exzellenz – die Wirkung war jedoch dieselbe.2172 Denn die schweizerische Wissenschaft kam ihm «blutleer» vor, aber auch aus menschlicher Sicht bedauerte er, dass in der Schweiz nicht mehr dafür getan werde, die Verfügbarkeit von Emigranten für den Wissenschaftsbetrieb genauer zu prüfen.2173 Seine manchmal provozierend zur Schau getragene elitäre Haltung verband er mit einer politischen Abgrenzung gegen links. Handschin lehnte schon vor 1933 ‚völkische‘ Ansätze in der deutschen Musikgeschichte ab, unterbrach aber das Gespräch mit dem Nationalsozialismus nahestehenden deutschen Fachvertretern wie Heinrich Besseler nicht.2174 Letztere Haltung teilte er mit der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft und der Redaktion der «Schweizerischen Musikzeitschrift».2175 An der Landesausstellung 1939 beteiligte sich Handschin zwar mit einem Beitrag über mittelalterliche Musik, doch hatte er kaum etwas mit den Intentionen der ‚geistigen Landesverteidigung‘ gemein.2176 So zeigt sich die Basler Musikwissenschaft, deren Geschichte ich hier leider nur streifen kann, einschlägig für mein Thema der akademischen Beziehung zu Deutschland.2177 Während der Pionier Nef in der deutschen Wissenschaft der Zeit vor 1914 verwurzelt war und blieb, war Handschin für vieles offen und machte sein Seminar in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre zu einer Drehscheibe der internationalen Musikforschung, was unter den gegebenen Umständen bedeutete, dass es zu einem Forum verfolgter und emigrierter Forscher wurde, ohne dass man Handschin selbst eine eindeutig politische Motivation unterstellen könnte. Als 1935 das Basler Ordinariat wiederzubesetzen war, kam in zeittypischer Weise kein Ausländer infrage, und einer der beiden Schüler des bisherigen Stelleninhabers erhielt die Stelle. Der Gewählte gehörte jedoch zur internationalen Elite seines Faches, so dass nicht von nationaler oder lokaler Beschränkung gesprochen werden kann. Noch wenig klar ist das Verhältnis dieser Musikwissenschaft zur Musikausübung in Basel. 1925 hatte Paul Sacher sein Studium in Basel begonnen (Musik2172 2173 2174
2175 2176 2177
Bockholdt 1966. Zimmermann 2000, 140. Zimmermann 2000, 127. Sie spricht von «kauziger Eigenständigkeit», die Handschin zu einer Stellungnahme gegen Besseler motivierte, mit dem er aber weiterhin korrespondierte. Zimmermann, 141, zeigt, dass die fortgesetzte Kommunikation oder Kooperation mit NS-nahen deutschen Musikologen Handschin den Ruf eintrugen, ein «Nazi» zu sein. Besseler: Lütteken 2000; Briefwechsel Besseler-Handschin im Mai 1937 über die Bedeutung der Rasse in der Musik und den Antisemitismus, ebd., 230–232. Walton 2000, 306 ff.; Kirnbauer/Zimmermann 2000, 321–346. «Schweizer Musikbuch», Zimmermann 2000, 138 f. Deutsche Musikwissenschaft der Zwischenkriegszeit: John 2000.
Historiker
521
wissenschaft bei Karl Nef und Jacques Handschin, Dirigieren bei Felix Weingartner). 1926 gründete er das Basler Kammerorchester (BKO), 1929 wurde er Vorstandsmitglied und Programmleiter der Ortsgruppe Basel der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik. Seit 1932 leitete er das von ihm mit August Wenzinger und Ina Lohr gegründete Lehr- und Forschungsinstitut für Alte Musik, die Schola Cantorum Basiliensis.2178 Bekannt ist nur, dass Handschin andere Vorstellungen über die Aufführung alter Musik hatte als Sacher.2179
7.5 Historiker – Werner Kaegi: Kampf des Humanisten und Kulturhistorikers gegen den Ungeist 7.5.1 Einleitung Ein ‚Paradigmenwechsel‘ oder eine ‚Disruption‘ erschütterte die Geschichtswissenschaft an der Basler Universität in der Mitte der 1930er Jahre und bestimmte deren Verhältnis zur Historie in Deutschland neu.2180 In der vorausgehenden Zeit vertraten das Fach hauptsächlich zwei Schweizer Professoren mit sehr unterschiedlichem Profil, die aber beide konservativ eingestellt und politisch engagiert waren: Der charismatische Hermann Bächtold mit seiner Evangelischen Volkspartei im Grossen Rat und als Redaktor der zugehörigen Zeitung, sowie Emil Dürr als liberaler Grossrat und Mitglied der Bürgerwehr, zwar ein Demokrat und bereit, demokratische Grundsätze gegen den Nationalsozialismus zu verteidigen, aber mit einer konservativen Auffassung der Demokratie, die nicht Volksherrschaft sei, sondern von einsichtigen Staatsmännern im Stil der Zeit vor 1848 geführt werden sollte. Plädierte Bächtold für eine christliche Grundlage der Politik ebenso wie der Universalgeschichte, beklagte Dürr den Einbruch wirtschaftlicher Interessen in die Parlamente. Wichtiger war aber, was mit dem Tod dieser beiden Historiker im Jahre 1934 verlorenging. Mit Bächtolds Hinschied endete eine starke Bindung an die deutsche Reichshistoriographie, die ‚1871‘ positiv wertete, den Kriegsausgang von 1918 nicht überwinden konnte und eine Revision der Pariser Vorortverträge zugunsten Deutschlands forderte. Diese nationalpolitisch-deutsch engagierte Historiographie behauptete nach Georg von Belows Vorbild, dass die parlamentarische Demokratie für das von Nachbarstaaten stets gefährdete Deutschland, dem wegen seiner geographischen Mittelposition eine Sonderstellung unter den europäischen Mächten zugesprochen wurde, nicht geeignet sei. 2178 2179 2180
https://www.paul-sacher-stiftung.ch/de/ueber-die-stiftung/paul-sacher.html. Zimmermann 2000. Kirnbauer 2008. Marchal 2013, 39–43; Wichers 2013. Das Fach Geschichte entwickelte sich damit in Basel im Gegensatz zur deutschen Geschichtswissenschaft der nationalsozialistischen Zeit, vgl. u. a. Oberkrome 2007; Schulze/Oexle 1999.
522
Geisteswissenschaftler
Mit Dürr verschwand ein neuer Blick auf die Schweizergeschichte, der (aus konservativer Warte) vermehrt strukturelle Wandlungen zum Verständnis historischer Prozesse heranzog.2181 Die beiden neuen Sterne am Basler Historikerhimmel, die im Zusammenhang mit diesem Wechsel aufgingen, dominierten eine Ära von 35 Jahren, die von den Zeitgenossen mit dem Kürzel ‚Kaegi-Bonjour‘ bezeichnet wurde. Edgar Bonjour wie Werner Kaegi trugen aus der Perspektive ihres Faches zur ‚geistigen Landesverteidigung‘ bei.2182 Dabei waren sie unter sich sehr verschieden, aber doch freundschaftlich verbunden; Kaegi betrachtete Bonjour gar als seine Stütze.2183 Bonjour war in der Öffentlichkeit auf die Dauer präsenter, er befasste sich mit neuerer und neuester Schweizergeschichte sowie mit ‚heissen‘ Themen wie ‚Neutralität‘. Dennoch trat er auch international in Erscheinung, so in vermittelnder Rolle am Internationalen Historikerkongress 1938 in Zürich.2184 Auch deshalb war er für Studierende zugänglicher als Kaegi, weil seine Themen meist mit der üblichen Kenntnis moderner Sprachen bearbeitet werden konnten, während Kaegis Humanismus zusätzlich eine solide Beherrschung der Alten Sprachen, des Italienischen und des Niederländischen voraussetzte. Bonjour war persönlich offener, wie auch zum Ende seines langen Lebens die Erinnerungen und die Freundesbriefe erkennen lassen.2185 Obschon über Bonjour (noch) keine umfassende biographische Studie vorliegt, habe ich mich entschlossen, vertiefend über Kaegi zu berichten, dessen Werdegang und Tätigkeiten für die hier interessierende Zeit besondere Aufmerksamkeit verdient. Die Dominanz von ‚Kaegi-Bonjour‘ bedeutete keineswegs, dass die beiden Ordinarien allein das Fach in Basel repräsentierten. Ihr Lehrangebot war in eine vielfältige historische Fauna eingebettet. Fritz Vischer-Ehinger wurde 1934 Extraordinarius für Neuere Schweizergeschichte. Mittelalterliche Geschichte lehrte neben Kaegi Wolfram von den Steinen, der seit 1929 Privatdozent in Basel war und 1938 zum Extraordinarius für Mittellateinische Literatur, Quellenkunde und allgemeine Geschichte des Mittelalters befördert wurde. Ebenfalls im Mittelalterfach bewegte sich Hans Georg Wackernagel, seit 1930 Privatdozent und ebenfalls 1938 zum Extraordinarius befördert, für Hilfswissenschaften und Volkskunde des Mittelalters; aber auch Albert Bruckner, habilitiert 1936, mit einer Spezialisierung in Paläographie, von 1933 bis 1941 am Staatsarchiv tätig, später Leiter der «Helvetia
2181 2182 2183 2184
2185
Simon 2013. Die innovativen Aspekte von Dürrs Geschichtswissenschaft waren für Aussenstehende erst posthum ersichtlich, siehe Dürr 1938. Kreis 2000, 369 f., 373 f. Kaegi an Bonjour, 8. 1. 1940, in: Bonjour 1987, 137. Stadler 1990. Gerhard Ritters Erinnerung an seinen Auftritt gegen das Luther gewidmete Referat von Otto Scheel: Ritter 2006, 787 f. (Ritter lokalisiert den Historikertag dort falsch in Basel statt in Zürich). Bonjour 1984 und 1987. Zur Person: Kreis 2004; Kreis 2002; Tanner 1991.
Historiker
523
Sacra». Für Verfassungsgeschichte habilitiert wurde 1936 Adolf Gasser, Geschichtslehrer und streitbarer radikaldemokratischer Verfechter der Gemeindefreiheit.2186 Staatsarchivar war von 1933 bis 1961 Paul Roth-Göhrig, der zwar nicht habilitiert war, aber für die Forschung in Basel u. a. mit der Arbeit an der Aktensammlung zur Geschichte der Basler Reformation eine Rolle spielte. Auf den Althistoriker Felix Stähelin habe ich schon im Abschnitt über die Altertumswissenschaften hingewiesen und dort auch den Ur- und Frühgeschichtler, Rudolf Laur-Belart, erwähnt, der als Extraordinarius seit 1941 der erste Vertreter dieses Faches in Basel war. Auch die Geschichtswissenschaft war in der Schweiz seit dem 19. Jahrhundert stark vom Umstand geprägt, dass die Fachausbildung in Deutschland erfolgte. Zwar gab es nationale Themen, etwa die Entstehung der Eidgenossenschaft und deren Auseinandersetzungen mit Habsburg, Burgund oder das Ausgreifen nach Süden. Das freisinnige Geschichtsbild,2187 das auf 1848 hin ausgerichtet war, hatte in der Generation Werner Kaegis bereits stark an Kredit verloren. Mit der Einführung in die fachspezifischen Methoden wurde während der Studiensemester im nördlichen Nachbarland meist auch der historische deutsche Bildungshorizont erworben. Dies bedeutete nicht zwingend, dass die Studierenden aus der Schweiz dort auch Einstellungen wie den Nationalliberalismus oder die Ablehnung von ‚westlichen‘ Auffassungen von Staat und Gesellschaft aus Deutschland übernahmen, obschon auch dies vorkam. Wichtiger war, dass Schweizer Historiker für den Rest ihrer Tätigkeit nach Deutschland blickten, deutsche Veröffentlichungen lasen, in deutschen Verlagen und Zeitschriften publizierten, in deutschen Burschenschaften und Fachgesellschaften Mitglieder waren und mit Deutschen korrespondierten, auch wenn es dank der Allgemeinen Geschichtforschenden Gesellschaft seit 1841 ein national-schweizerisches Forum mit eigenen Publikationen und (seit 1855) einer Zeitschrift gab. Nach 1933 wurde aus dem Deutschlandbezug ein Problem. Bächtold und Dürr verstarben beide 1934. Ihre Lehrstühle waren deshalb in der kritischen Zeit der entstehenden Distanz zum nationalsozialistischen deutschen Wissenschaftsbetrieb neu zu besetzen. Der Schweizer Kandidat Werner Kaegi erhielt den einen der beiden Lehrstühle. Der andere Lehrstuhl war kurz zuvor ebenfalls an einen Schweizer, Edgar Bonjour, gegangen. Bemerkenswert war, dass Kaegi in Konkurrenz zu einem der bedeutendsten deutschen Historiker jener Epoche, Gerhard Ritter, gewählt wurde, und zwar gegen den Willen der Fakultät. Werner Kaegi interessiert uns hier wegen dieser Berufung und wegen seiner Rolle in der ‚geistigen Landesverteidigung‘. Es war nicht selbstverständlich, dass er sich darin überhaupt engagierte. Als Historiker war er in Leipzig ausgebildet und von deutschen Bekannten an die Geschichte herangeführt worden. Von 2186 2187
Zimmermann 2002, 41 ff. Buchbinder 2002.
524
Geisteswissenschaftler
daher führte keine breite Strasse in ein historiographisches Engagement für die Bestimmung des ‚typisch Schweizerischen‘ und dessen Verteidigung gegen Nationalsozialistisches oder gar Deutsches. Sein eigentliches Thema wurde die Biographie Jacob Burckhardts, die erst ausserhalb des Zeitraums, der uns hier beschäftigt, ab 1948, im Druck erschien. Der Bezug der akademisch gebildeten Schweizer auf Deutschland war für ihn schon vor 1933 problematisch geworden. Die Verwendung des Konzeptes «Nation» in der Geschichte vor dem 19. Jahrhundert schien ihm unangebracht, und er griff die Vorstellung an, der Kleinstaat sei eine historische Marginalie. Eine umfassende Biographie, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, existiert nicht. Hingegen hat sich einer seiner Schüler, Manfred Welti, zum Ziel gesetzt, Kaegis Laufbahn aus dessen Psychologie heraus zu verstehen; dabei kommen interessante Informationen über den Menschen Werner Kaegi zum Vorschein. Verdienstvoll ist die biographische Skizze von René Teuteberg in Historische Meditationen III. Kaegis Beschäftigung mit dem Faschismus hat Patricia Chiantera-Stutte seit ihrer Dissertation studiert. Das biographische Quellenmaterial ist demgegenüber sehr reichhaltig und wird von der Paul Sacher-Stiftung in Basel verwahrt; zudem besitzt die Handschriftenabteilung der Basler Universitätsbibliothek den Nachlass des Kunsthistorikers Werner Weisbach, dessen Korrespondenz mit Werner Kaegi aufschlussreich ist. 7.5.2 Kaegis Bildungsgang Werner Kaegi (zunächst noch «Kägi» geschrieben)2188 wurde als drittes Kind des Landpfarrers (Gottfried) Paulus Kägi in Oetwil am See (Zürcher Oberland) 1901 geboren.2189 Sein Vater repräsentierte einen Typus des evangelischen Zürcher Pfarrers, der sowohl in der Fürsorge engagiert war als auch in der Bibelphilologie. Paulus Kägis erste und zweite Frau entstammten einer Familie von ländlichen Textilunternehmern. Werner war der Sohn der zweiten Frau, Ida Nussberger; seine Geschwister aus der ersten Ehe des Vaters waren Frieda und Paul. Frieda absolvierte eine Ausbildung in Psychologie ‚anormaler‘ Kinder und arbeitete in Heimen. Paul Kägi wurde ein Altphilologe, der sich im Gefolge von Hermann Kutter und Leonhard Ragaz zum religiösen Sozialismus bekannte,2190 als Sozialde2188
2189 2190
Werner Kägi veränderte für seine Person die Schreibung des Familiennamens um 1920. Welti 1993, 15, datiert den Wechsel der Schreibweise etwa auf 1922. Teuteberg, in: Kaegi 1994, 20, gibt das Datum 1924 an. Teuteberg, in: Kaegi 1994, 9–22. Paul Kägi verstand den Sozialismus als «sittliche Aufgabe» und wandte sich gegen den dogmatischen Marxismus der Kommunisten. Paul Kägi an Werner Kaegi, 16. 12. 1935, in: Paul Sacher-Stiftung Basel, Nachlass Werner Kaegi, WK (im Folgenden stets: «WK») 205.
Historiker
525
mokrat politische Ämter übernahm und zuerst in Neuhausen (SH), dann in Zürich in der staatlichen Fürsorge tätig wurde. Er untersuchte daneben die Entstehung des Historischen Materialismus2191 und war mit Regina Fuchsmann verheiratet, der Tochter baltisch-jüdischer Einwanderer, die sich für Flüchtlinge aus dem linken Flügel engagierte und während des Zweiten Weltkriegs durch die Aktion der Liebespakete für Lagerinsassen bekannt wurde.2192 Werners jüngere Schwester Gertrud (Fumasoli-Kägi) stand ihm am nächsten.2193 Er besuchte die lokale Primarschule und danach als externer Zögling ein Landerziehungsheim in Oetwil. Von seinem Grossvater Jakob Kägi (III.) lernte er zeichnen und aquarellieren; auf der Geige, die den jungen Kaegi überallhin begleitete, brachte er es früh zu einem beachtlichen Können. Für den Besuch des Gymnasiums (1916 bis 1919) wurde er bei Familien in der Stadt Zürich untergebracht. Das Literargymnasium schloss er als Primus seiner Klasse ab.2194 Dort begegnete er einem Geschichtslehrer, dem Literatur- und Kulturhistoriker Fritz Ernst, mit dem er für den Rest des Lebens freundschaftlich verbunden blieb.2195 Jugendbriefe geben darüber Aufschluss, dass der junge Werner in Kreisen alternativer und künstlerischer Reformer verkehrte.2196 Unter den Künstler-Bekanntschaften waren u. a. diejenigen mit Helen Dahm2197 und Aldo Patocchi beachtenswert.2198 Die schwierige Identitätsfindung des Jugendlichen beeinträchtigte das Studium, das er im Herbst 1919 an der Universität Zürich in Nationalökonomie, Geschichte und Psychologie aufnahm.2199 Er brach nach einem Semester seine akademische Bildung ab und suchte Rat bei Psychologen und Psychiatern (darunter Paul Häberlin2200 damals in Bern und Ludwig Binswanger in Kreuzlingen). Er hatte dabei das Glück, unter seinen Mitpatienten wichtigen Persönlichkeiten zu
2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198
2199 2200
«Erinnerung an meinen Bruder», in: Kaegi 1994, 279–295. Der Text entstand als Vorwort zu Kägi 1965. Die zugehörigen Briefe ab 1960 in: WK 205. Kaegi 1994, 289. Teuteberg, in: Kaegi 1994, 20. Welti 1993, 10 f.; Teuteberg, in: Kaegi 1994, 12. Welti 1993, 20 f.; Briefe von Fritz Ernst an Kaegi ab 1920, in: WK 190. Bspw. Katja (Käthe) Wulff an Kaegi, Postkarte, 21. 2. 1920, in: WK 242. Kaegi kannte Wulff von seinem Aufenthalt in Ascona her. Grossmann 1998. Die Korrespondenz mit Kaegi in: WK 185. Kaegi veröffentlichte 1930 einen Artikel über Dahm, um ihr zu mehr Bekanntheit zu verhelfen. Briefe von Patocchi an Kaegi seit 1929 in: WK 220; er gehörte zu Kaegis Duzfreunden, katholischer Künstler, Mitglied zahlreicher Kommissionen, auch der Stiftung «Pro Helvetia». Gilardi 1998. Teuteberg, in: Kaegi 1994, 13. Paul Häberlin an Kaegi, 9. 11. 1918, in: WK 198, diskutierte Möglichkeiten einer Behandlung für Kaegi, dafür empfahl er Dr. Rorschach in Herisau. Im Frühjahr 1919 behandelte Häberlin Kaegi. Briefe Häberlins vom 7.4., 17.4. und (zuletzt) 30. 6. 1919, in: WK 198.
526
Geisteswissenschaftler
begegnen.2201 So traf er in Kreuzlingen zufällig Aby Warburg,2202 der ihm einen starken und bleibenden Eindruck machte, wenn auch keine Beziehung zustande kam.2203 Sein späteres Interesse an der Bibliothek Warburg, die er in die Schweiz retten wollte,2204 war eine direkte Folge dieser kurzen Begegnung.2205 Kaegis Beziehung zu dieser Bibliothek begann mit einer Besprechung von Publikationen des Instituts in der «Neuen Zürcher Zeitung» 1931. Kaegis Bemühungen, die Bibliothek, die er selbst nie betreten hatte, in die Schweiz zu holen, hatten keinen Erfolg; im Herbst 1933 war der Entscheid für London gefallen.2206 In der Aussenstelle der Kreuzlinger Klinik in Ascona, in der sich Kaegi im Sommer 1920 während mehrerer Monate aufhielt und wohin er später oft zurückkehrte, fand er Anschluss an den Dichter Bruno Goetz,2207 den Schriftsteller Werner Graf von der Schulenburg und deren Frauen. Bruno Goetz war dem deutschen Expressionismus verpflichtet; er lenkte Kaegis Aufmerksamkeit auf die Geschichte Italiens, auf die Romantik und auf E. T. A. Hoffmann.2208 Auch von der Schulenburg wies ihn auf Italien, auf das Thema ‚Renaissance‘ und auf Jacob Burckhardt hin,2209 über den er eine Biographie schreiben wollte. 2201 2202 2203
2204 2205 2206
2207
2208 2209
Welti 1993, 27 ff.; Welti 2015, 20 (zu Häberlin). Schwester Frieda an Bruder Werner, 3. 11. 1918, in: WK 205. Binswanger 2005, zitiert nach https://de.wikipedia.org/wiki/Aby_Warburg. Königseder 1995. «Halte Fühlung mit ihm [Aby Warburg]. Er hat die Finger überall drin.» Von der Schulenburg an Kaegi, 15. 5. 1928, in: WK 232. Warburg starb am 26. 10. 1929. Warburg sei «kein Nährsalz, sondern ein Ätzmittel, ein Sprengstoff» gewesen. Kaegi an Walther Rehm, 17. 9. 1933, in: WK 224. Gedacht war an eine Unterbringung der Bibliothek in Basel oder Zürich. Ernst Howald an Kaegi, 10. 7. 1933, in: WK 200. Welti 1993, 44. Kaegi veröffentlichte in der «NZZ» ein ‚Porträt‘ Warburgs (auch in: Neue Schweizer Rundschau 1, 1933/34, 283, zitiert nach Teuteberg, in: Kaegi 1994, 21). Briefe von Gertrud Bing aus Hamburg und London an Kaegi, 2.9., 23.9., 20. 11. 1933; zusammenfassender Rückblick im Brief vom 21.8.[1934?], in: WK 178. Dazu Werner Weisbach an Kaegi, 23. 11. 1933: «Dass die Bibliothek unseres Freundes nun in London gelandet ist, werden Sie wohl schon gehört haben […]. Basilea hat also aus Ihrem Artikel – trotz der ‚Nützlichkeit‘ für Sie selbst – keine praktischen Konsequenzen gezogen.» In: WK 241. Die Londoner Lösung befriedigte Weisbach. Weisbach an Kaegi, 22. 8. 1933, in: WK 241. Mit Goetz hatte Kaegi schon vor dem Aufenthalt in Ascona korrespondiert (Kaegi an Goetz, 15. 1. 1919, in: WK 196). Aufschlussreich zu Kaegis erstem Aufenthalt in Ascona das Gruppenfoto der Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in Binswangers ‚Casa Günzel‘, reproduziert (mit Datum «1919», es müsste 1920 sein) in: Glauser 2008, 184 f. Kaegi an Rehm, 20. 10. 1936, in: WK 224. Korrespondenz Goetz/Kaegi in: WK 196. Welti 1993, 33. Von der Schulenburg plante angeblich eine Gesamtausgabe von Burckhardts Werken und eine Biographie. Von der Schulenburg an Kaegi, 3. 11. 1924, 20. 1. 1925. Vermutlich gab von der Schulenburg das Vorhaben wieder auf; von der Schulenburg an Kaegi, 19. 3. 1925, in: WK 232.
Historiker
527
Statt nach dem Aufenthalt in Ascona das Studium in Zürich fortzusetzen, reiste Kaegi im Herbst 1920 nach Florenz.2210 Sein Ziel war anfangs, sich Eindrücke von Kunstwerken und Bauten in Italien zu verschaffen, die Geschichte der Renaissance kennenzulernen und sich selbst als Bildhauer und Maler zu versuchen.2211 Dennoch schrieb er sich schliesslich an der Universität ein (dies war Bedingung für den Zugang zu den Bibliotheksbeständen) und hörte dort Geschichtsvorlesungen. Die Florentiner Erfahrungen bestärkten ihn auch in seiner Ablehnung des Sozialismus.2212 Chiantera-Stutte erwähnt namentlich Gaetano Salvemini als Lehrer Kaegis, den späteren Gegner des Faschismus, über den Kaegi in seinem Beitrag über den «Romantischen Faschismus» für die «Basler Nachrichten» vom 1. Mai 1927 berichtete. In Florenz begegnete er auch Federico Chabod und Ernesto Sestan.2213 Zum Zweck der Vermittlung zwischen Italien und Deutschland gründete von der Schulenburg eine Zeitschrift mit dem Titel «Italien». Diese wurde von 1928 bis 1930 von der faschistischen Regierung über den Generalkonsul Tamaro in Hamburg finanziert.2214 Von der Schulenburg forderte Kaegi auf, Artikel für diese Zeitschrift zu schreiben. Das Interesse galt dabei nicht nur der Renaissance, sondern auch den aktuellen politischen Vorgängen. Von der Schulenburg und Kaegi waren vom Faschismus fasziniert; Ersterer im direkten Kontakt mit dem Regime (er war von Mussolini empfangen worden), Letzterer eher aus der Distanz des Italienreisenden, des Lesers von Verlautbarungen, Gesetzesentwürfen und von biographischen Materialien über Benito Mussolini. Da Kaegi seit 1924 während der Semester in Basel wohnte und studierte (ich komme darauf zurück), schrieb er auch für die «Basler Nachrichten» über das gegenwärtige Italien.2215 Es scheint, dass er vorübergehend mit dem Gedanken spielte, eine Biographie Mussolinis zu verfassen. Von der Schulenburg empfahl ihm, diese Schrift unter einem Pseudonym herauszubringen:
2210 2211 2212 2213
2214
2215
Regina, Peter und Paul Kägi-Fuchsmann an Kaegi, 5. 11. 1920, in: WK 205. Von der Schulenburg, Postkarte, an Kaegi, 27. 10. 1920, in: WK 232. Kaegi an Goetz, 6. 11. 1920, in: WK 196. Chiantera-Stutte 2013/14, 8 f.; Welti 1993, 42, meint, Kaegi habe während diesem Florenzaufenthalt keine Studienfreundschaften geschlossen und sich auch kaum um den Lehrbetrieb der Universität gekümmert. Knigge 2016, 5–8. Von der Schulenburg an Kaegi, 5. 3. 1927; Lisel von der Schulenburg an Kaegi, 26. 9. 1927. Ende der Finanzierung durch italienische Stellen: Von der Schulenburg an Kaegi, 1. 3. 1930, in: WK 232. Dieses Ende hatte Kaegi vorausgesehen: «Ob im heutigen Deutschland eine Zeitschrift auf die Dauer von Faschismus oder Renaissancebegeisterung leben kann, scheint mir fraglich.» Kaegi an Rehm, 15. 12. 1929, in: WK 224. Die «Basler Nachrichten» berichteten in den 1920er Jahren oft positiv über die Diktatur Mussolinis in Italien; bspw. 1926 und 1928, in: Gerster 1980, 102 f., 106.
528
Geisteswissenschaftler Ich würde die Arbeit vom point de vue psycologique schreiben: in das lederne Zeitalter der müden Demokratie kommt noch einmal ein Individuum, von dem sich feststellen wird, ob es Napoleon I oder III ist. Aber: Es ist ein Individuum. Und wie dieses Individuum sich auseinander zu setzen sucht mit der Frage Demokratie, das ist nicht nur interessant, sondern auch grossartig. So kannst Du eigentlich nicht fehl greifen. Die Historie wird Dir in der nächsten Zeit weitere Hinweise geben: es kommt sich was. […] Persönlich bist Du, mit Tamaros Empfehlung absolut sicher. Für den Mob bleibst Du Herr Ignotus. Deshalb also keine Sorge. Bleibt das System, dann bist Du bald der Mann; fällt es, so bist Du sein erster Historiker. Ich rate zu. […] Werde nicht Schulmeister in Basel. Ex meridie lux.2216
Bei diesen Arbeiten kam es zu einem Zwischenfall, aus dem Kaegi eine wichtige Lehre zog. Da er für seine Artikel offizielles und offiziöses Material brauchte, hatte er sich in Basel an den dortigen Generalkonsul gewandt. Commendatore Tamburini fiel auf, dass Kaegis Artikel in der Deutschschweiz und in Deutschland ein positives Interesse für den Faschismus zu erwecken vermochten, und er hielt ihn für einen «sicheren» Autor.2217 1927 erhielt Kaegi vom Generalkonsulat zu Weihnachten einen goldenen Füllfederhalter geschenkt. Zugleich versuchte der Generalkonsul, bei den «Basler Nachrichten» die Veröffentlichung eines Aufsatzes von Kaegi über die faschistische Kolonialpolitik zu beschleunigen.2218 Von der Schulenburg war sich der Gefahr, die sich hier abzeichnete, sogleich bewusst, er riet Kaegi, das Geschenk umgehend zurückzugeben, und diktierte ihm ein ausführliches Konzept für einen Brief an den Generalkonsul.2219 Am 22. Juni 1929 teilte Kaegi dem Chefredaktor Oeri mit, dass er keine weiteren Artikel über «faschistische Angelegenheiten» mehr verfassen werde, denn das Publikum verkenne seine «informatorische Absicht».2220 Über diesen Vorgang berichtete er auch Emil
2216 2217
2218
2219
2220
Von der Schulenburg an Kaegi, 2. 6. 1928, in: WK 232. Der italienische Generalkonsul in Basel soll Kaegi «das geplante Gesetz» [über die Einrichtung des italienischen Parlaments] liefern. Dieser habe «Dich als ‚sicheren‘ Autor benannt, […] gratulor». Von der Schulenburg an Kaegi, 11. 12. 1927, in: WK 232. «Ha telefonato col Dr. Oeri il quale mi ha assicurato che il suo articolo sulla espansione coloniale italiana è già impaginato e lo trova molto interessante. D’accordo col Dr. Oeri Le mando anche altro materiale ‚La morale del Fascismo‘ un eccellente articolo di F. Ercole.» Generalkonsul A. Tamburini an Kaegi, 30. 11. 1927, und wieder 29. 12. 1927, in: WK 236. «Der Brief von Tamburini ist wirklich für ein Kalbsfell berechnet. Eine Frechheit! Du musst jetzt deutlich werden, sonst kannst Du in Teufels Küche kommen. Der B[rie]f T[amburini]’s ist eine Aufforderung zum Landesverrat. […] Du könntest auch die Goldfeder zurücksenden und schreiben: ‚Ich bin nicht gewohnt mit Gold zu schreiben; ich ziehe Stahl vor.‘» Von der Schulenburg an Kaegi, 1. 1. 1928, in: WK 232. Welti 1993, 115. «Ich glaubte, der faschistischen Entwicklung gegenüber jenes Mass von Sympathie aufbringen zu müssen, ohne das eine historische Erscheinung nie aus ihrem eigenen inneren Antrieben zu erfassen ist. Diese erkenntnismässige Einstellung wird zu
Historiker
529
Dürr, der ihm Unterstützung zusagte, falls er diese für seine wissenschaftliche Laufbahn in Basel bräuchte.2221 Kaegi lernte daraus, dass politischer Journalismus risikoreich war, und zu von der Schulenburg ging er künftig auf Distanz.2222 Nach dem Florentiner Aufenthalt war Kaegi entschlossen, in Deutschland ein Geschichtsstudium mit Schwerpunkt Renaissance zu absolvieren. Dafür wählte er 1921 Leipzig, wo der Burckhardt-Kenner Walter Goetz (keine Verbindung zu Bruno Goetz) über die Geschichte der italienischen Renaissance las und Erich Brandenburg eine solide Kenntnis historischer Methoden und der deutschen Geschichte zur Zeit von Humanismus und Reformation vermittelte.2223 Kaegi wurde neben anderen Studenten in Brandenburgs Haushalt aufgenommen, wo er durch Musik und Gespräche ein nahes Verhältnis zu seinem Lehrer und zu dessen Frau Johanna Brandenburg-Schumacher gewann.2224 Er schloss sich offensichtlich nicht einer Studentenverbindung2225 an, sondern befreundete sich mit Söhnen und Töchtern von Leipziger Professoren. Die Semesterferien verbrachte er im Elternhaus in Oetwil und in Ascona. Mit einer Dissertation über die Beziehung zwischen Ulrich Hutten und Erasmus von Rotterdam schloss er 1924 das Studium in Leipzig ab. Das Thema war klug gewählt, weil sich damals weite Kreise dafür interessierten und es kontrovers diskutierten. Brandenburg öffnete seinem Schüler die von ihm herausgegebene «Historische Vierteljahrsschrift».2226 Durch das Studium gewann Kaegi nicht nur den Zugang zur deutschen historischen Wissenschaft, es vermittelte ihm auch erste Distanzerlebnisse. So reflektierte er im Rückblick 1929 darüber, dass der Schweizer Gelehrte (oder Student) in einem merkwürdigen Verhältnis zu Deutschland stehe. Denn einerseits sei er kulturell von Deutschland abhängig und Deutschland zugehörig, anderer-
2221
2222 2223 2224 2225
2226
unrecht von manchen Lesern als eine politische Absicht aufgefasst.» Briefkonzept von Kaegi an Oeri, 22. 7. 1927, in: WK 219. «Ich habe mit Interesse Kenntnis genommen von Ihrem Brief an T[amburini]. Ich werde gerne, wo es angebracht ist, im allgemeinsten Sinne vom Inhalt Gebrauch machen, d. h. Ihre geistige und moralische Unabhängigkeit gegenüber dem Fascismus, wo dies überhaupt nötig sein sollte, unterstreichen.» Dürr an Kaegi, 11. 8. 1929, in: WK 187. Huizinga an Kaegi, 18. 9. 1929, in: Huizinga 1990, Nr. 821, 268 f. Die Korrespondenz von der Schulenburg/Kaegi hat im Nachlass eine Lücke von 1932 bis 1956, in: WK 232. Teuteberg, in: Kaegi 1994, 14. Welti 1993, 54 ff., unter starker Betonung der Beziehung zwischen Johanna Brandenburg und Werner Kaegi. Vgl. z. B. den Brief vom 30. 9. 1922, in: WK 180. In der Basler Zeit gehörte er, nach Vorbild seines Vaters, anscheinend der Verbindung «Schwizerhüsli» an (zum Vater: Teuteberg, in: Kaegi 1994, 10). Kaegi wohnte als Professor und «Ehrenphilister» dem Weihnachtskommers dieser Verbindung bei; seine Frau steuerte jeweils ein Geschenk für die Kinderbescherung bei. Schwizerhüsli Basel an Kaegi, 11. 12. 1937, 21. 12. 1959, 10. 12. 1965, in: WK 233. Welti 1993, 51. ‚Hutten und Erasmus‘ auch: Kaegi an Huizinga, 7. 3. 1930, und Huizinga an Kaegi, 9. 3. 1930, in: Huizinga 1990, Nr. 846, 292; Nr. 847, 293.
530
Geisteswissenschaftler
seits aber lebe er in einer nichtdeutschen Welt. So beobachtete er, dass manche Schweizer in dieser Lage entweder zu Sonderlingen geworden seien oder dann zu Verfechtern einer sehr engen Bindung ans Deutsche Reich. Über Jacob Burckhardt wusste er, dass er anfänglich den Schweizern beibringen wollte, dass sie (kulturell) «Deutsche» seien, dass er aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Bildung eines deutschen Nationalstaates und dessen Machtentfaltung immer kritischer kommentierte. Am Ende seiner eigenen Zürcher Gymnasialzeit hatte Kaegi die hitzigen Diskussionen zwischen den Deutschfreunden und den Ententefreunden erlebt und Spittelers Gedanken über Unsern Schweizer Standpunkt gelesen. Ein Zeugnis dieser Beschäftigung mit der Bedeutung Deutschlands für die Schweizer Kultur findet sich im Briefwechsel mit Huizinga vom Jahr 1929. Kaegi meinte, dass es eine schweizerische Kultur eigentlich nie recht gegeben hat[,] weil auch keine eigene Kultursprache da ist und weil darum die Dissonanz zwischen dem differenzierteren Geistesleben, das seine Zentren ausserhalb des Landes hat und haben muss, und der elementaren politischen und sozialen Absonderung und Eigenheit eine besonders grelle ist. Der Schweizer, der geistige Bindungen [an Deutschland] anerkennt, wird zunächst unfehlbar ein schlechter Schweizer, weil er nach dem Zentrum der nationalen Kultur hintendiert, der er sprachlich zugehört. (Denn ‚Heimatkultur‘ bleibt bei uns immer künstlich und meist minderwertig.) Wenn dies aber eine ganze Schicht tut, so wird das eigene Land dieser Kräfte beraubt, sein politisches und soziales Leben bleibt in primitiven Formen stecken[,] die eigentlich bloss einer geistigen Unterschicht entsprechen. […] Jene wenigen aber, die sich abgewendet haben, fühlen sich innerhalb der entsprechenden fremden Nationalkulturen trotz der sprachlichen Bindung im Grunde auch nicht zu Hause, weil sie in mancher Beziehung ganz andere, eben schweizerische Elementarbegriffe in sich tragen. Sie kehren dann (äusserlich oder innerlich) zurück, und bilden eine sehr zahlreiche Schicht von Sonderlingen und Eigenbrödlern [sic], in denen oft ein hohes Mass von persönlicher Kultur steht [steckt?], die aber unfruchtbar bleibt[,] weil sie keinen sozialen Untergrund und keine Gemeinschaft in ihrer eigenen Sphäre besitzt. Der Krieg [1914–1918] hat eigentlich diese Dinge bei uns nun erst recht akut werden lassen[,] und es ist nun die sehr schöne aber nicht leichte Aufgabe unserer Generation[,] hier eine Lösung zu finden, ohne in einen verwaschenen Kosmopolitismus zu verfallen.2227
7.5.3 Weltanschauliche Position des jungen Kaegi Weltanschaulich scheint Werner Kaegi in den 1920er Jahren weitgehend von gängigen deutschen Positionen inspiriert gewesen zu sein. Die Weimarer Demo2227
Kaegi an Huizinga, 29. 10. 1929, in: Huizinga 1990, Nr. 827, 274 f. Siehe auch Kaegi an Huizinga, 6. 11. 1929, ebd., Nr. 829, 276 f. Er illustrierte das Gesagte an Jacob Burckhardt und Conrad Ferdinand Meyer.
Historiker
531
kratie sagte ihm so wenig zu wie die italienische parlamentarische Monarchie aus der Zeit vor 1922 (Regierung Giolitti).2228 Während er am Elend der Massen mitleiden konnte und Fürsorge wichtig fand, verurteilte er revolutionäre Bestrebungen von Links und verspottete Menschen, die das Heil in Moskau suchten.2229 Der Faschismus faszinierte ihn als Experiment, aus dem eine gangbare Alternative zur Demokratie hervorgehen könnte; er verstand ihn als Verbindung von Syndikalismus mit Nationalismus unter einer intelligenten, mächtigen Führung, die Ordnung garantierte.2230 Kaegi verkehrte auch in Basel mit Persönlichkeiten, die sich für den italienischen Faschismus interessierten, so mit Friedrich Vöchting, einem angeheirateten Vetter von Carl Jacob Burckhardt, der über das Verhältnis zwischen Norden und Süden in der italienischen Wirtschaftsentwicklung forschte und später als Bewunderer des nationalsozialistisch beherrschten Deutschland galt.2231 Gegenüber seinem deutschen Freund Walther Rehm gab er sich fasziniert vom Ende der Welt des 19. Jahrhunderts und den durch deren Untergang geschaffenen Realitäten. Er hielt nicht mit franzosenfeindlichen Äusserungen zurück und gab seiner Hoffnung Ausdruck, Konflikte zwischen den Siegermächten von 1918 eröffneten für Deutschland einen neuen aussenpolitischen Spielraum. Diese Position erlaubte ihm 1930 zu erkennen, wie das Bild Jacob Burckhardts durch die Bewunderung der Basler Liberalen verfälscht worden sei.2232 Aber die 2228 2229
2230
2231
2232
Die Ablehnung der Giolitti-Regierung als korrupt teilte Kaegi mit vielen anderen Beobachtern. Chiantera-Stutte 2013/14, 11. «Am letzten Sonntag war Alby Platten hier. Sie geht zu ihrem Bruder nach Moskau und gründet ein Kinderheim. Vielleicht bin ich mal um ihre Protektion froh.» Kaegi an Regina Kägi-Fuchsmann, 6. 10. 1928, mit Bezug auf die «Sündflut» und die 1789 eingerichtete «Nivellierungsmaschine», in: WK 207. Angesichts der ausgesprochenen Theoriefeindlichkeit von Kaegi möchte ich darin keine «Faschismustheorie» suchen, wie dies Chiantera-Stutte 2013/14 tut. Zutreffend sind ihre Hinweise auf das Interesse, das Kaegi der Sozialpolitik des Faschismus zuwandte. Chiantera-Stutte 2013/14, 16. Siehe auch Spindler 1976, 227, 276–285. Friedrich Vöchting: NL im Archiv für Zeitgeschichte, ETH Zürich, https://www.afz.ethz. ch/bestaende/58bbe6dd4f154525a579a83524411373.pdf. Vöchting an Kaegi, 2. 6. 1928, in: WK 239. Vöchting lieh Kaegi Literatur über den Faschismus. Die späteren Kontakte betrafen Materialien über Jacob Burckhardt, zu denen Vöchting durch seine Frau, geb. Oeri, Zugang hatte, sowie Arbeiten, die ihm Kaegi regelmässig zuschickte; alles in: WK 239. Dass Vöchting an der Universität Basel Unterrichtsverbot erhielt, kam in der überlieferten Korrespondenz nicht zur Sprache. Kaegi an Rehm, Briefe 1931, z. B. Kaegi an Rehm, 29. 10. 1931, in: WK 224. «In Basel gilt er [Jacob Burckhardt] nicht nur als der Stadtheilige, sondern auch als der Spezialheilige der liberalen Partei. Scheint mir doch etwas brenzlich. In meiner Einleitung [zur Ausgabe von Burckhardts ‚Kultur der Renaissance in Italien‘] versuchte ich gelegentlich das Gegenteil anzudeuten. […] Die liberale Freude über den modernen Menschen und das Individuum kam dann erst durch Interpretation dazu, freilich durch eine naheliegende Interpretation. Was bei Burckhardt liberal war und der liberalen Interpretation entgegenkam,
532
Geisteswissenschaftler
Protektion dieser Liberalen brauchte er in der Schweiz, denn ihnen verdankte er «so ziemlich alles».2233 Die Opfer des faschistischen Systems interessierten ihn zunächst nicht, auch erkannte er die totalitären Tendenzen kaum. Ordnung war nach seiner Auffassung Voraussetzung dafür, dass der kultivierte Einzelne sich humanistisch bilden und die Kultur florieren konnte.2234 Methodisch wollte er eine historistische EinfühIung in faschistische Grössen pflegen, die er «Sympathie» nannte. Diese ist nicht zu verwechseln mit einer vollen Zustimmung zur faschistischen Politik, sondern als Versuch zu betrachten, diese zu ‚verstehen‘ aus der Psychologie der Massen («Glauben») und der Geistesgeschichte der Eliten.2235 Ob die Verwandtschaften, die zwischen Kaegis Darstellung und den Analysen des mit ihm bekannten Delio Cantimori auf einem gegenseitigen Austausch beruhten, kann ich nicht feststellen.2236 In der Schweiz hegte er allerdings bis 1933 mit Vorbehalten unmittelbare politische Sympathien für die ‚Fronten‘ als Kräfte der Erneuerung, während er das, was er politisch im Zürcher Oberland erlebte, als «Kuhdemokratie»2237 bezeichnete. Damit bewegte er sich auf einer ideologischen Strasse, auf der viele Gebildete seiner Generation wandelten. Demokratie unterschied er vom krisenhaften Parlamentarismus. Aber sie war erneuerungsbedürftig aus christlichen, ethischen, historischen Wurzeln heraus.2238 1930 meinte er von den Schweizern:
2233
2234
2235 2236 2237 2238
scheint mir eher sein Tribut an die Zeit, ein oft ganz unbewusster, den er nicht geleistet hätte, wenn er etwas anderes für möglich gehalten hätte. Im Herzen war er antiliberal, konservativ aus Pessimismus und ohne Glauben an eine Zukunft, im Bewusstsein des Untergangs.» Kaegi an Rehm, 29. 1. 1930, ebd. Kaegi an Rehm, undatiert, vermutlich zum Jahreswechsel 1929/30, in: WK 224. Der reife Kaegi machte seinen Frieden mit den Liberalen und wählte stehts die Liste der Basler liberaldemokratischen Partei. Liberal-demokratische Bürgerpartei Basel-Stadt, an Kaegi, 24. 10. 1961, in: WK 213. Das Verhältnis war jedoch nicht harmonisch. Robert Labhardt an Kaegi, 2. 11. 1943; Kaegi an Labhardt, 3. 11. 1943, und 3. 1. 1944, in: WK 211. Einstellung der bürgerlichen Schweiz zum frühen Faschismus: Spindler 1976, 153. Die bürgerliche Presse betrachtete bis zur Weltwirtschaftskrise den ‚Fascismus‘ als Ausdruck des ‚élan vital‘ und sah darin keine ernsthafte Bedrohung. Chiantera-Stutte 2013/14, 11, 30. Chiantera-Stutte 2013/14, 22 und 32, mit Hinweis auf die Politica von Cantimori. Kaegi an Bruno Goetz, 29. 9. 1920, in: WK 196. Vgl. die Debatten in der Neuen Helvetischen Gesellschaft der 1920er Jahre mit starker Beteiligung Emil Dürrs, die Spindler 1976, 169–173, darstellt. 1924 erklärte Dürr, Parlamentarismus dürfe nicht mit Demokratie verwechselt werden. Die Schweiz habe den Parlamentarismus in den 1860er und 1870er Jahren «überwunden», zitiert nach Spindler 1976, 160. Die Zugehörigkeit von Kaegi zur Neuen Helvetischen Gesellschaft ergibt sich indirekt aus Eduard Vischer an Kaegi, 8./9. 7. 1939, in: WK 239; die beiden Historiker trafen sich an der Delegiertenversammlung der Gesellschaft. In Kaegis Nachlass gibt es
Historiker
533
«Als geistige Nation existieren wir so gut wie gar nicht, es sei denn auf der Ebene wirtschaftlicher und wohlfahrtsmässiger Solidarität. Das andere ist die Ausnahme.»2239 Solche Positionsbezüge waren zeitgleich mit seinen ersten Begegnungen mit Männern, die dezidiert und mit guten Gründen derartige Gedanken und Entwicklungen bekämpften: Johan Huizinga und Werner Weisbach. Diesen gegenüber gab er sich als junger Humanist, der den Geist gegen die rechtsextremen Kräfte verteidigen wolle. Hier vollzog er einen Übergang voller Ambivalenzen. Die Abkehr von rechten Orientierungen kam spät im Verlauf des Jahres 1933. Er betrieb fortan die Verteidigung von Geist, Demokratie und Kleinstaat in einem liberal-konservativen Sinn. Für die Schweiz sah er voraus, man werde sich «in der Enge einrichten müssen».2240 7.5.4 Kaegi in Basel: Erasmus, Burckhardt und Renaissance Vorher aber verfolgen wir seinen Weg von Deutschland zurück in die Schweiz und nach Basel. Nach dem Doktorat wollte er zur Existenzsicherung ein schweizerisches Oberlehrerpatent erwerben. Als Schulfächer wählte er Deutsch und Italienisch neben Geschichte. Zu einem finanziell tragbaren Aufenthalt in einer Schweizer Universitätsstadt verhalf ihm eine Tante, Maria Nussberger. Diese hatte den Basler Kirchengeschichtler Paul Wernle geheiratet, den damals schon leidenden Verfasser der Geschichte des Schweizer Protestantismus im 18. Jahrhundert.2241 In Wernles Haushalt lebten zur Unterstützung seiner Forschungen und zu seiner Pflege immer wieder Studenten. Kaegi erhielt von seiner Tante diese Aufgabe.2242 So wohnte er ab Herbst 1924 während der Semester am Oberen Heuberg in Basel.2243 Hier studierte er Deutsch vor allem bei Franz Zinkernagel, Geschichte bei Hermann Bächtold und Emil Dürr sowie Italienisch bei Ernst Walser.2244 Bei Walser fand er Anschluss an einen Freundeskreis und verband sich persönlich eng mit ihm und dessen Frau Marguerite Walser-Escher. Walser forschte über die italienische Renaissance und scheint Kaegi die Aussicht auf eine
2239 2240 2241 2242 2243 2244
jedoch keine Dokumente der Gesellschaft aus der Zeit vor 1957, WK 219. Chiantera-Stutte 2013/14, 32. Kaegi an Rehm, 29. 1. 1930, in: WK 224. Welti 1993, 157. Kaegi an Weisbach, 24. 3. 1933, in: WK 241. Wernle 1923/25. Maria Wernle-Nussberger an «Ida», 25. 5. 1924, in: WK 219. Teuteberg, in: Kaegi 1994, 14; Welti 1993, 23 f. Briefe von Paul und Maria Wernle-Nussberger an Kaegi, 1924–1947, in: WK 219. Biographie von Ernst Walser: Zur Erinnerung an Prof. Dr. Ernst Walser 11. April 1878 – 29. Juni 1929, Exemplar in: WK 240, mit einem Beitrag von Kaegi («W.K.»). Walser wurde 1918 Extraordinarius in Basel und 1926 zum Professor ad personam befördert, er war Mitbegründer und zeitweise Leiter der Volkshochschule.
534
Geisteswissenschaftler
Habilitation eröffnet zu haben. Das Lehramtsstudium zog sich in die Länge (das Examen absolvierte Kaegi im März 1926, darauf folgte ein Vikariat an der Töchterschule bis 1927)2245 wegen zwei Umständen, die Kaegis Leben langfristig prägten. Der eine bezog sich auf das Thema Erasmus, der andere auf Jacob Burckhardt. Edward Bok hatte ein Lebensbild des Erasmus von Johan Huizinga bestellt und 1924 auf englisch herausgebracht.2246 Der Basler Verleger Karl Schwabe, der schon Boks Selbstbiographie herausgebracht hatte, wollte seit 1923 dieses Werk in deutscher Übersetzung publizieren (es gab damals keine deutsche Gesamtdarstellung von Erasmus’ Leben) und daraus ein gediegenes Verlagsprojekt machen. Huizinga war einverstanden, auch wenn die ‚Aufwertung‘ durch Illustrationen nicht ganz nach seinem Geschmack war.2247 Bei der Wahl des Übersetzers meldete der Verleger Bedenken gegen den in Holland lebenden deutschen Slawisten Bernd Dietrich von Arnim an, den Huizinga vorgeschlagen hatte. Kaegi konnte zwar noch kein Holländisch, hatte sich aber einen guten deutschen Stil erworben, der Huizingas Vorstellungen entgegenkam. Ein Probeabschnitt gefiel dem Autor, und Kaegi bekam 1925 den mit einem willkommenen Honorar verbundenen Auftrag.2248 Er lieferte innert weniger Monate2249 eine Übersetzung ab, die Huizingas Erwartungen übertraf und den Lehramtskandidaten Kaegi in ein nahes Verhältnis zu einem Historiker brachte, der damals als einer der Grössten seines Faches galt.2250 Ende 1926 wurde die Beziehung zwischen Huizinga und Kaegi öffentlich sichtbar, als Letzterer Huizingas Schweizer Vortragsreihe organisierte.2251 Kaegi wurde schliesslich Huizingas ‚Vertreter‘ in der deutschsprachigen
2245 2246 2247 2248
2249 2250 2251
Teuteberg, in: Kaegi 1994, 14, datiert das Examen auf März 1926. Es befähigte ihn zum Unterricht in Geschichte, Italienisch und Deutsch. Welti 1993, 61 f. Huizinga 1924. Huizinga an Schwabe, ab 9. 8. 1924, in: Huizinga 1990, 526 ff., Briefe Nr. 547, 563, 569. Originale in: Verlagsarchiv Schwabe, Inv.-Nr. 705, Huizinga Erasmus 1924–1988. Von der Schulenburg bot Kaegi Beratung für die Verlagsverhandlungen an. Von der Schulenburg an Kaegi, 19. 3. 1925, in: WK 232. Der Verlagsvertrag datiert vom 23. 5. 1925; Kaegi erhielt ein Honorar von Fr. 1’500. Verlag Schwabe an Kaegi, 23. 5. 1925, in: WK 233. Von Arnim war ein deutscher Doktorand in Slawistik an der Universität Leiden, mit einer Holländerin verheiratet. Am 23. 2. 1925 hatte Huizinga Werner Kaegi als Übersetzer aufgrund einer Probe vorgezogen mit dem Argument, er schreibe besser lesbar und sei fähig, feine Nuancen wiederzugeben, was von Arnim mit seiner «steifen» Art nicht schaffe. Verlagsarchiv Schwabe, Inv.-Nr. 705, Huizinga Erasmus 1924–1988, Huizinga an Schwabe. Nach Teuteberg, in: Kaegi 1994, 15, dauerte die Arbeit an der Übersetzung neun Monate (1925). Welti 1993, 66 ff. Kaegis Übersetzung lag 1925 fertig vor; gedruckt wurde sie erst 1928. Welti 1993, 121. Kaegi an Huizinga, Anfrage im Namen der Basler Studentenschaft für einen Vortrag in Basel, 20. 4. 1926, in: Huizinga 1990, Nr. 638, 81 f. Huizinga an Kaegi, 4. 12. 1926, Nr. 684,
Historiker
535
Welt: Wenn immer möglich übersetzte er dessen Werke ins Deutsche und vermittelte zwischen Huizinga und verschiedenen Verlagen. Diese Vermittlungstätigkeit wurde besonders wichtig nach 1933, als deutsche Verleger Gefahr liefen, Schwierigkeiten mit dem herrschenden Regime zu bekommen, wenn sie den Holländer ins Programm aufnahmen; aber auch Schweizer Verlagshäuser hielten sich mit Blick auf ihre Chancen und Risiken auf dem von Joseph Goebbels kontrollierten deutschen Buchmarkt zurück.2252 Kaegis Übersetzung von Huizingas Im Schatten von Morgen erschien deshalb 1935 in Bern.2253 Die deutsche Ausgabe des Erasmusbuchs von Huizinga wurde erst 1928 fertig2254 und bescherte dem Verleger wie dem Übersetzer viel Ärger. Verzögerungen folgten aus der Zusammenarbeit mit dem Basler Kunsthistoriker Heinrich Alfred Schmid, später aus Versehen der Druckerei und nachträglichen Sonderwünschen des Verlegers. Huizinga fürchtete, dass das Manuskript beim Erscheinen veraltet sei, da er annahm, dass der Herausgeber der Erasmuskorrespondenz, Percy Stafford Allen, noch vorher eine eigene Darstellung des Lebens des Erasmus herausbringen könnte. Als der Band im Druck vorlag, lobte Huizinga am 7. August 1928 Kaegis Vorwort und dankte ihm für die Übersetzung und andere Mühen. «Mögen unsere persönliche und wissenschaftliche Beziehungen [sic] mit dieser Ausgabe nicht enden.»2255 Nachdem Kaegi bereits in der Dissertation Erasmus (und Hutten) behandelt hatte, avancierte er nun zu einem bekannten jungen Vertreter seines Faches. Er förderte diesen Ruf, indem er in Zeitungen und Zeitschriften über Erasmus und Huizinga publizierte und Neuerscheinungen vorstellte. Er schickte Sonderabzüge an Freunde und Bekannte in der Schweiz, in Italien und Deutschland. Aus den eintreffenden Reaktionen entwickelte er nach Möglichkeit einen Briefwechsel, der zu seiner Bekanntheit und Wertschätzung weiter beitrug. Den Anstoss zur Beschäftigung mit Jacob Burckhardt hatte von der Schulenburg gegeben, falls Kaegi nicht bereits am Zürcher Literargymnasium nachdrücklich auf Burckhardt hingewiesen worden war. Felix Stähelin und Emil Dürr trieben drei Projekte voran: Eine Ausgabe seiner Werke, eine Sammlung seiner Briefe und eine Biographie. Sie hatten sich dafür mit dem Erben des Nachlasses
2252
2253 2254
2255
131 f. Thema war «Renaissance und Realismus»; der Vortrag wurde für den 13. 12. 1926 geplant. Huizinga 1990, passim, ab 1928. Die erste Zusammenarbeit dieser Art nach der Übersetzung des Erasmusbuches betraf den Artikel: «Das Problem der Renaissance», der in von der Schulenburgs Zeitschrift «Italien. Monatsschrift für Kultur, Kunst und Literatur», in drei Fortsetzungen erschien (Bd. 1, 1928). Huizinga an Kaegi, 9. 1. 1928, Nr. 743, 188 f. Kaegis Übersetzungen von Huizingas Arbeiten, Liste, in: Kaegi 1994, 23. Kaegis Vorbemerkung zur Übersetzung von 1928, in: Huizinga 1936. «Diese ErasmusPublikation ist auf alle Fälle das infernalste Abenteuer meines Lebens.» Karl Schwabe an Kaegi, 16. 6. 1928, in: WK 233. Huizinga an Kaegi, 7. 8. 1928, in: Huizinga 1990, Nr. 786, 234.
536
Geisteswissenschaftler
von Burckhardt, Albert Oeri, zusammengetan. Die Biographie zu schreiben hatte Dürr selbst in Aussicht gestellt, auch wenn er neben der Professur und neben seiner politischen Tätigkeit kaum die nötige Zeit dafür fand. Die Verantwortung für die einzelnen Bände der Werkausgabe wurde unter diesen und weiteren Männern aufgeteilt. Einer von ihnen, Hans Trog, Kunsthistoriker und seit 1901 Feuilleton-Redaktor der «NZZ», verstarb unerwartet am 10. Juli 1928.2256 So kam Kaegi zum (honorierten) Auftrag, relativ rasch Burckhardts Kultur der Renaissance in Italien herauszugeben.2257 Er löste diese Aufgabe sehr gut, schrieb eine vielbeachtete Einleitung über die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Werks und schaffte es, noch kurz vor Drucklegung ein von Burckhardt annotiertes Exemplar in Italien aufzufinden und auszuwerten.2258 Damit war er 1930 vom Burckhardt-Bewunderer zum Burckhardt-Spezialisten aufgestiegen. Darüber vergass er nicht, Huizinga an seinen Burckhardt-Studien zu interessieren und ihm Material zuzusenden.2259 Kaegi gehörte zu denjenigen, die der Ansicht waren, Jacob Burckhardt sei eine Art Prophet gewesen, der den Zerfall der liberalen Welt und das Aufkommen populistischer, geistfeindlicher Diktaturen vorausgesagt habe. So äusserte er sich 1933 gegenüber Huizinga: «Mir ist zuweilen erbärmlich zu Mute und der Gedanke, dass Jacob Burckhardt das alles vorausgesehen hat, tröstet mich wenig.»2260 Eine weitere Gelegenheit, sich für die Wissenschaft als Herausgeber nützlich zu machen, ergab sich 1929 beim Tod von Ernst Walser. Er hatte Kaegi als Repräsentant einer freieren, unvoreingenommenen Weltsicht und als unorthodoxer Katholik in seinen Bann gezogen. Zusammen mit der Witwe Marguerite WalserEscher gab er dessen nachgelassene kleine Schriften und Vorträge heraus. Auch hier brillierte er mit einer umfangreichen Einleitung, die ihn als hervorragenden Kenner der Renaissanceforschung profilierte.2261
2256 2257
2258
2259 2260 2261
Schaad 2012; Teuteberg, in: Kaegi 1994, 16. Oeri, Felix Stähelin und Dürr «denken an Sie für die Kultur der Renaissance». Kaegi befand sich in Paris und sollte den Druck von dort aus leiten. Dürr an Kaegi, 19. 9. 1928. Die Deutsche Verlagsanstalt (DVA) biete Kaegi einen Vertrag für die Edition der Kultur der Renaissance in Italien an, den Kaegi ohne Änderungen annehmen solle. Briefe Dürrs an Kaegi, ab 12. 9. 1928, in: WK 187. Korrespondenz mit der DVA in: WK 186. Von der Schulenburg kommentierte: «Das geschieht Dir recht. O homo sapiens, Du wirst Koebis Erbe!» Von der Schulenburg an Kaegi, 28. 9. 1928, in: WK 232. Das Handexemplar war im Besitz der Familie Valbusa. Spindler 1976, 224. «[Arminio] Janner [Professor für Italienisch in Basel] meinte, man brauche bloss Mussolini sanft zu treten, so schenke er den Band.» Marguerite Walser-Escher an Kaegi, 28. 4. 1929, in: WK 240. Nachdem das Exemplar in Basel angekommen war, wurde es von Marguerite Walser-Escher für Kaegi fotografiert. Briefwechsel Walser-Escher/Kaegi 1929, in: WK 240. Kaegi an Huizinga, 8. 5. 1929, in: Huizinga 1990, Nr. 809, 256 f. Kaegi an Huizinga, 26. 4. 1933, in: Huizinga 1990, Nr. 1003, 442 ff. Welti 1993, 77 ff.; Walser 1932.
Historiker
537
Zwar konnte Kaegi inzwischen das Examen für das höhere Lehramt ablegen. Bewerbungen für Gymnasialstellen in verschiedenen Schweizer Städten und bei einer Auslandschweizerschule führten zu keinem Erfolg, wahrscheinlich auch deshalb, weil Kaegi sich im Verlauf der 1920er Jahre entschlossen hatte, die akademische Laufbahn anzustreben und diesem Ziel andere Tätigkeiten unterzuordnen. Nur den Kulturjournalismus hielt er daneben noch für eine würdige Beschäftigung. Ermahnungen seines Halbbruders Paul Kägi, nicht länger den Eltern zur Last zu fallen,2262 quittierte er mit einer energischen Verteidigung seiner Auffassung, einer wissenschaftlichen Berufung folgen zu müssen.2263 Spätestens 1928 sprach er sich ein kulturpolitisches Programm zu, das darauf hinauslief, dass er die «Pflicht» habe, einen individualistischen Humanismus der Gebildeten zu pflegen, zu verbreiten und zu verteidigen. Während Bruno Goetz und Werner von der Schulenburg einen allgemeinen Einfluss auf die Konzeption dieser «Pflicht» ausgeübt hatten, bestärkte ihn die zufällige Begegnung von 1931 mit dem herausragenden Berliner Kunsthistoriker Werner Weisbach darin. Dieser formulierte in einem sehr persönlich gehaltenen Brief an Kaegi nochmals 1933 ein solches Programm (das auch sein eigenes Anliegen war), das zu realisieren er Kaegi förmlich auftrug.2264 7.5.5 Emil Dürr und Kaegis Habilitation Der Weg in die akademische Laufbahn führte zwingend über die Habilitation, und diese setzte ein ‚Opus magnum‘ voraus und eine Fakultät, die dieses Opus als Habilitationsschrift annahm und mit dem Bewerber ein Kolloquium durchführte. Kaegi tat sich schwer mit der Abfassung eines passenden Buches. Ernst Walser scheint ihn 1926 auf Chateaubriand und die französische Romantik aufmerksam gemacht und ihn damit ins französische 19. Jahrhundert verwiesen zu haben.2265 2262
2263
2264
2265
Paul Kägi an Werner Kaegi, 22. 2. 1931, in: WK 205. Kaegi replizierte am 3. 3. 1931 mit der Feststellung, diese Ermahnung sei eine «Störung […] in meiner Arbeit und meiner Gesundheit». Der Vorwurf, den Eltern zur Last zu fallen, war nicht ganz unbegründet. Die Mutter besorgte bis 1935 noch regelmässig Kaegis Wäsche. Kaegi an die Eltern, im Juli 1930. Briefe der Mutter 1935. Alles in: WK 207. «Sie entsinnen sich, dass ich Ihnen schon vor Monaten, als die nationalistische Krise bei uns eintrat, schrieb, dass die Schweiz nun die Aufgabe haben wird, humanistisches Kulturgut weiter zu pflegen, das in Deutschland mit Füssen getreten wird.» Weisbach (Paris) an Kaegi, 30. 9. 1933, in: WK 241. Kaegis Professur sah Weisbach dann mit einer humanistischen und kulturpolitischen Aufgabe dieser Art ausgestattet. Weisbach (Berlin) an Kaegi, 25. 6. 1935, ebd. Welti 1993, 95, 141, 146, berichtet, Kaegi habe sich 1927 eine Gesamtausgabe von Chateaubriand gekauft, die er gelesen und kommentiert habe. Der Wechsel zum Thema ‚Michelet‘ sei 1928 erfolgt.
538
Geisteswissenschaftler
Der Plan, die französische Historiographie des 19. Jahrhunderts insgesamt zum Thema zu machen, scheiterte an der Breite des Vorhabens. So wählte Kaegi den Geschichtsschreiber Jules Michelet als Thema und entwickelte wiederum ein zu gross angelegtes Konzept. Immerhin nahm er in Oetwil das gesamte veröffentlichte Werk von Michelet durch. Schwieriger war die Arbeit an den Quellen in Paris. Seine schwache Gesundheit hinderte ihn daran, dort genügend Zeit zuzubringen, und gegen die Stadt entwickelte er eine Abneigung.2266 Die Arbeit am Michelet wurde konkurrenziert durch die Herausgabe der kleinen Schriften von Ernst Walser, dann durch zahlreiche Buchbesprechungen, die er laufend übernahm, denn Kaegi lebte von seinen journalistischen Arbeiten, Übersetzungs- und Herausgeberhonoraren sowie von Stipendien.2267 Mehrfach klagte er Huizinga sein Leid mit der Habilitationsschrift.2268 Von verschiedener Seite wurde er zur Eile gemahnt.2269 Er reichte jedoch der Fakultät erst im Herbst 1933 hundert Seiten ein: Er hatte nur die Einleitung und das Unterthema «Michelet und Deutschland» ausgeführt. Walsers Witwe versicherte ihm jedoch unter Berufung auf ungenannte Gewährsleute aus der Fakultät, dass er sich damit ohne Probleme werde habilitieren können.2270 Unterdessen hatte er in Emil Dürr einen Betreuer für das Habilitationsverfahren gefunden. Er bestätigte ihm, dass das vorhandene Manuskript Michelet und Deutschland für eine Habilitation ausreiche und dass es keinerlei politische Bedenken gegen Kaegi gebe.2271 Dürrs Bericht («Referat») über die Arbeit fiel lo2266
2267
2268
2269
2270 2271
«Und wie bin ich froh, dass Paris dich garnicht zieht. Paris kostet immer Kräfte. Es ist ein ewiger Vampyr. Dass Michelet dich packt, freut mich sehr.» Von der Schulenburg an Kaegi, 13. 3. 1928, in: WK 232. Bspw. St. Albanstift, Verwaltung, Peter Sarasin, an Kaegi, 24. 9. 1931, in: WK 227. Die Kommission des St. Albanstifts beschloss, Kaegi «noch» ein Stipendium von Fr. 1’000 zu bewilligen. Damit sollte es ihm möglich werden, wieder nach Paris zu gehen. Kaegi an Huizinga, 15. 5. 1928, in: Huizinga 1990, Nr. 773, 223. Kaegi hatte den Parisaufenthalt aus gesundheitlichen Gründen unterbrochen. Er wollte ihn im Herbst 1928 fortsetzen, war aber erst im Frühjahr 1929 wieder dort, ebd., 8. 5. 1929, Nr. 809, 256 f. Ein weiterer Aufenthaltsversuch schlug 1930 fehl. Kaegi an Huizinga, 31. 1. 1930, Nr. 841, 288. Diskussion mit Huizinga über den «Renaissancemenschen»: Huizinga an Kaegi, 18. 5. 1928; Kaegi an Huizinga, 27. 8. 1928, in: Huizinga 1990, Nr. 775, 224; Nr. 791, 238 f. Auch Marguerite Walser-Escher redete ihm zu: «Ich glaube auch, dass Sie in die Universitätscarrière gehören u[nd] so oder so dazu kommen werden. Ich sprach just mit Herrn Dürr darüber; er sagte auch er hätte Sie gern in Basel, obschon die nächste Zeit die Historiker zahlreich sein werden.» Marguerite Walser-Escher an Kaegi, 6. 5. 1929, in: WK 240. Marguerite Walser-Escher an Kaegi, 14. 11. 1933, in: WK 240. Dürr mahnte Kaegi zur Eile und wünschte die Abgabe der Habilitationsschrift vor Ende 1933. Dürr an Kaegi, 28. 9. 1933, in: WK 187. Das Kapitel über «Michelet und Deutschland» sei ausreichend, Themen für das Kolloquium wurden erörtert, und: «Ich habe keinerlei Bedenken irgendwelcher politischer Art, nach keiner Seite hin.» Dürr an Kaegi, 4. 10. 1933, ebd.
Historiker
539
bend aus. Ausser dem Manuskript über Michelet fanden auch die Buchbesprechungen die Zustimmung des Professors: «darüber hinaus fallen auf: die gute, ja ausgezeichnete Form, die hohe Bildung und Selbständigkeit des Verfassers und die Beschränkung der besprochenen Werke auf ein paar bestimmte Themata, die sich einer grossen Einheit unterordnen.» Das Werk als Ganzes sei von einer «gewissen Einseitigkeit; denn es äussert sich vorwiegend geistesgeschichtlich, aber in wahrhaft gross gezogener Spannung. […] Auch tritt die im e[ngeren] S[inn] politische Note stark zurück, wie wohl sie, wie mir mündliche Aussprachen immer eindrücklich bewiesen haben, für Vergangenheit und Gegenwart recht deutlich und verständnisvoll vorhanden ist.»2272 Dürr empfahl ohne Vorbehalte, Kaegi zum Kolloquium zuzulassen, doch der Kandidat war vom Vorwurf der «Einseitigkeit» so beeindruckt, dass er beschloss, besonders viel politische Geschichte zu betreiben, um sich Respekt zu verschaffen.2273 Er hatte Mühe, das Spiel Dürrs zu durchschauen, das darin bestand, dass er Kaegi sehr wohlwollend vorstellte, aber, um glaubwürdig zu loben, einen negativen Zug erwähnen musste. Kaegis Spezialisierung fand zuletzt auch Eingang in die Bezeichnung der Venia Docendi, die ihm «unter besonderer Berücksichtigung der Kulturgeschichte» erteilt wurde. Kaegi bewunderte Dürr aufrichtig, weniger für die wissenschaftlichen Leistungen als für den unermüdlichen Einsatz in der Politik. Dies brachte er im Nekrolog auf den 1934 verstorbenen Dürr zum Ausdruck, worin er ihn als echte Führernatur und «Zunftmeister» porträtierte, der seine «Genossen» für einen Feldzug begeistere (man fühlt sich bei der Lektüre des Nachrufs an Mussolini erinnert). Kaegi orakelte auch über Pläne, die Dürr für den Fall einer linken Herrschaft in Basel gehegt haben soll.2274 Das bevorstehende Kolloquium beunruhigte Kaegi besonders. Nachdem das Ereignis glücklich vorüber war, empfand er das lebhafte Bedürfnis, sich darüber seinen Korrespondenzpartnern mitzuteilen. Dabei stilisierte er sich selbst als mu2272 2273 2274
«Zum Habilitationsgesuch von Dr. Werner Kägi [sic], Referat von Prof. Dr. E. Dürr», 17. 1. 1934, in: WK 8. Kaegi an Walther Rehm, 2. 3. 1934, in: WK 224. Teuteberg, in: Kaegi 1994, 15. Der Nachruf erschien in der «Neuen Schweizer Rundschau»: Kaegi 1933/34. Kaegi war sich bewusst, dass seine Äusserungen über Dürr unklar waren. «Zum Teil ist sein Leben der letzten Monate so eng mit den politischen Verschiebungen in Basel und der Gesamtschweiz verbunden gewesen, dass ich in einem Nachruf, der im Aprilheft der NSR erscheinen wird, nur andeutungsweise und sehr unklar davon sprechen darf.» Kaegi an Rehm, 2. 3. 1934, in: WK 224. Christoph Steding, der Dürr in Basel besucht hatte, meinte zu Kaegi, Dürr sei eine «urwüchsige Erscheinung», die mit «wurmstichigen» Altliberalen wie Albert Oeri wenig gemein habe. «Ich war ja immer der Meinung, dass D[ürr] im falschen [liberalkonservativen] Lager stand u[nd] ich wartete neugierig darauf, wie er mit den Ereignissen der nächsten Zeit fertig werden würde, die für die Eidgenossen ja nicht ganz einfach zu verdauen sein werden.» Steding an Kaegi, 10. 2. 1934 (oder 16. 2. 1934?), vgl. 2./3. 7. 1933, in: WK 235.
540
Geisteswissenschaftler
tigen Pionier der Kulturgeschichte, der mit dem Unverstand der politischen Historiker konfrontiert gewesen sei. So schrieb er von Hermann Bächtold, er sei von Georg von Below in Freiburg abhängig und noch ganz von Heinrich von Treitschke geprägt (Letzteres galt auch von Paul Wernle).2275 Die Distanz zu Schweizern, die sich ganz einer national-deutschen Auffassung von Geschichte verschrieben hatten, kam hier deutlich zum Vorschein. 7.5.6 Zwischenbilanz Ich kann an dieser Stelle eine Zwischenbilanz ziehen. Der junge Kaegi war in vielen Hinsichten ein Kind seiner Zeit. Rechtsbürgerlich, gegen die Errungenschaften des 19. Jahrhunderts wie Grundrechte, Verfassung, Aufklärung oder gar Sozialismus skeptisch eingestellt, ablehnend gegenüber dem parlamentarischen Republikanismus der Nachbarländer und innerhalb der Schweiz einer von denen, die sich etwas von einer radikalen ‚Erneuerung‘ erhofften, die die ‚Fronten‘ zu bewirken versprachen2276 und die er vorübergehend als eine Art ‚reinigendes Gewitter‘ verstand.2277 Sein Bezugsrahmen war zunächst weitgehend die deutsche Kultur- und Geistesgeschichte, nicht im Sinne Karl Lamprechts, sondern als individuelle, unmittelbare Begegnung des kultivierten Menschen mit den Quellen aus der Vergangenheit, die von grossen Männern und vor allem grossen Gedanken 2275
2276
2277
Welti 1993, 156. «Die Erzählung Ihres Kolloquiums, wonach auch Sie ein Opfer, glücklicherweise nur ein mittelbares, der Basler Verbrecher geworden sind, hat mich nachträglich recht amüsiert. Zum Erfolg dieser seltsamen Prüfung gratuliere ich Ihnen noch bestens […].» Eduard Fueter jun. an Kaegi, 3. 2. 1934, in: WK 193. In diesem Sinne fasse ich auch Kaegis Interesse am Schriftsteller Max Eduard Liehburg auf, das er mit dem katholischen Basler Bildungspolitiker und Danteforscher August Rüegg teilte. Das Bindeglied war die konservative Auffassung der Gesellschaft, die in einer scheinbar dynamischen Erneuerungsrhetorik enthalten war. In WK 226 ist ein undatiertes Manuskript von August Rüegg für die «Neue Schweizer Rundschau» erhalten, worin er den neuen Geist lobt, der in Max Eduard Liehburgs Das neue Weltbild von 1933 repräsentiert sei. Kaegi war mit Liehburg per Du. Liehburg an Kaegi, 15.2. und 19. 3. 1934, in: WK 213. Lie(h)burg alias Max Meier galt den Behörden als «eifriger Frontist»; Hinweis vom 3. 1. 1944 auf ein nicht erhaltenes Dossier in der Fiche «Gesellschaft zur Pflege kultureller Gemeinschaft / Basler Pfalz» der Politischen Abteilung der Basler Polizei, in: StABS PDREG 5a 3-7-18, vierte Karte, Seite 4830 (freundliche Mitteilung von Hermann Wichers). «[…] die Suggestionskraft der deutschen Bewegung hat nicht verfehlt, auch diesmal ihre Wirkung bei uns zu zeigen. Und was besonders mehrwürdig ist: sogar die Welschschweizer würden nicht ungern mitmachen, da die Affäre vom letzten November in Genf [Nicole] sie begreiflicherweise furibund gemacht hat. Ich bin nicht ganz unglücklich über alles was geschieht. Denn trotzdem sie die Gesamtsituation nicht zu unseren Gunsten verändert hat, sehe ich doch die tiefe Notwendigkeit des Vorgangs und hoffe sogar auf einige gute Resultate.» Kaegi an Rehm, 9. 5. 1933, in: WK 224. «Mir ist ganz wohl bei diesem pfiffigen Wind.» Kaegi an Rehm, 17. 9. 1933, ebd.
Historiker
541
berichteten. Innerhalb dieses deutsch bestimmten Rahmens war die Italienbegeisterung ein wichtiges Element, die sich zunächst auf Baudenkmäler, Werke der Kunst, Ideen der Renaissance und vorübergehend auf die manchen faszinierende Person Benito Mussolinis2278 bezog. Schon vor dem Auftrag, Burckhardts Kulturgeschichte der Renaissance in Italien herauszugeben, war der Basler Historiker für ihn eine Referenzgrösse geworden. Kaegi hatte sich der Aufgabe verschrieben, die humanistische Kultur des gebildeten Individuums zu verteidigen gegen die Angriffe, die er in Massenbewegungen, Demokratie, Industrie und Sozialismus sah. Er war in einer gewissen Weise jungkonservativ und antimodern. Er unterschied sich aber in einigen Punkten vom Mainstream seiner Generation. So bewunderte er nicht Nietzsche, sondern Burckhardt (was dies damals bedeutete, liesse sich am Nietzsche-Burckhardt-Buch von Edgar Salin verdeutlichen).2279 In Burckhardt sah er einen Kritiker des Liberalismus und vor allem den Warner vor den perversen Wirkungen der Moderne auf die Kultur. Untypisch war allerdings, dass er auch Burckhardts negative Einschätzung des modernen Staates übernahm2280 und mit diesem die Macht des Kollektivs über das Individuum an sich für gefährlich hielt. Dies brachte ihn einerseits in einen tendenziellen Gegensatz zu den liberalen Burckhardt-Bewunderern in Basel, andererseits immunisierte es ihn auf die Dauer gegen die schwärmerischen, bündischen und irrationalen Tendenzen der Jungkonservativen. Wie seine Umgebung notierte, hatte er einen «scharfen Verstand», den er auch nutzte. Dies machte ihn ironisch, aber auch pessimistisch, was ihm den Zugang zu älteren Männern, die aus eigener Erfahrung zu einer negativen Einschätzung der aktuellen Tendenzen neigten, erleichterte. Huizinga und Weisbach erschienen in diesem Licht als Fortsetzer einer Skepsis, die er aus der Burckhardt-Lektüre kannte, obschon Weisbach als Weimarer Demokrat politisch weit links von Kaegi stand. Zudem zeigte sich schon vor 1933 bei ihm ein ‚schweizerischer Standpunkt‘, von dem aus er deutsche Selbstverständlichkeiten infrage stellte und zu Schweizern, die ganz den ‚deutschen Standpunkt‘ vertraten, ein kritisch-distanziertes Verhältnis pflegte. Schliesslich hatte sich Kaegi bis zur Habilitation eine gewaltige Menge an Stoff aus den Originaltexten angeeignet. Zudem hatte er sich durch fleissiges Versenden von Sonderdrucken und die Pflege der daran anschliessenden Korrespondenz in wissenschaftliche Netzwerke eingebracht. Dabei verstand er es, durch richtige Wortwahl und feine Stilisierung den Ton zu treffen, der dem Empfänger
2278 2279 2280
Eine Wertschätzung der Person Mussolinis war verbreitet. Spindler 1976, 224, erwähnt explizit Kaegi als Beispiel. Abschnitt über Edgar Salin, unten. Die Basler, die vor ihm über Jacob Burckhardt arbeiteten, etwa Hermann Bächtold und Emil Dürr, konnten mit Burckhardts Staatsferne wenig anfangen, vgl. Simon 2013.
542
Geisteswissenschaftler
bedeutete, dass er verstanden wurde und dass Kaegi dieses Verstehen auch sehr wichtig nahm. 7.5.7 Wahl zum Professor in Basel Die Zeit nach der Habilitation erlebte Werner Kaegi als eine krisenhafte Phase. Die unbezahlte Privatdozentur hinderte ihn daran, in grösserem Umfang weiterhin kulturjournalistisch tätig zu sein und damit ein Einkommen zu generieren. Er fürchtete die Konkurrenz durch andere frisch habilitierte Dozenten. Nach dem Tod von Adolf Baumgartner im Dezember 1930 waren die Lehrstühle neu verteilt worden, und weder Hermann Bächtold (geboren 1882) noch Emil Dürr (geboren 1883) waren in einem Alter, das einen baldigen Rücktritt erwarten liess. Aussichten auf einen Ruf an eine andere Universität hatte Kaegi nicht, da er sich nicht durch gewichtige eigene Arbeiten profiliert hatte. Unmittelbar nach der Habilitation konnte er als Buch nur die Dissertation vorzeigen; das Manuskript über Michelet und Deutschland war dünn und wurde erst 1936 publiziert. Seine Leistungen bestanden in kulturjournalistischen Zeitungs- und Zeitschriftenaufsätzen sowie in etwas, was man als Dienst an der Wissenschaft, aber nicht als originäre Leistung verstand: Übersetzungen, Einleitungen, Editionen. Die von ihm bevorzugte Kulturgeschichte war vielleicht ein Schlüssel für die Zukunft der Historie, aber innerhalb des von den Ordinarien dominierten Fachbetriebs damals marginal.2281 Da geschah das Unerwartete: 1934 starben beide Basler Geschichtsprofessoren, zuerst Dürr am 12. Februar an den Folgen eines Unfalls, dann Bächtold am 4. Juni durch Überarbeitung und Krankheit. Anfänglich glaubte Kaegi, selbst keine Chancen auf einen dieser Lehrstühle zu haben. Seinen Mentoren eröffnete er, dass er höchstens darauf hoffe, ein bezahltes Extraordinariat zu erlangen. Dieselbe Haltung vertrat er auch gegenüber Freunden sie war also nicht taktisch gemeint.2282 Nach Dürrs Tod übernahm er vorerst nur die unbezahlte Pflicht und Ehre, dessen Plan einer Burckhardt-Biographie zu verwirklichen.2283 Ob er mit 2281
2282 2283
Diskussion zwischen Huizinga und Kaegi von 1932, die an die Debatten unter Literaturhistorikern über die Bedeutung von Träumen, Tiefenpsychologie und Archetypen für die Erfassung kultureller Leistungen erinnert (Muschgs Auseinandersetzung damit ist exemplarisch, siehe oben über Muschg, Kapitel 7.2.3.3). Kaegi an Huizinga, 30. 7. 1932, in: Huizinga 1990, Nr. 936, 378 f. Kaegi an Rehm, 26. 7. 1935, in: WK 224, im Rückblick auf die Vorgänge, die zu seiner Wahl geführt hatten. «Die Burckhardterbschaft Dürrs habe ich schweren Herzens aber schliesslich mit Ergebung ins Schicksal übernommen und fünf Jahre Schonfrist verlangt.» Kaegi an Rehm, 20. 9. 1934, in: WK 224. «Sie [Fueter] waren auch der erste, der mir von dem neuen Burckhardtauftrag Bestimmtes schrieb. Ich habe nach einigen Zögern zugesagt, denke
Historiker
543
den neu zu wählenden Ordinarien des Faches ein gutes Verhältnis herzustellen vermochte, war nicht vorauszusehen.2284 Inzwischen waren die Stellvertreter für die Vakanzen bestimmt worden. Die eine Vertretung versah Ernst Gagliardi (seit 1919 Ordinarius an der Universität Zürich). Der andere Vertreter war der Ordinarius aus Freiburg i. Br. Gerhard Ritter, der fachlich ein hohes Ansehen genoss. Während Gagliardi nur vorübergehend mit dem Gedanken spielte, in Basel eine grössere Aufgabe zu übernehmen und sich schliesslich auf die Rolle eines Beraters zurückzog, hoffte Ritter ernsthaft darauf, nach Basel wechseln zu können. Er sah darin zwei mögliche Vorteile. Da die Nationalsozialisten immer mehr als Feinde der protestantischen Kirche, in der er stark engagiert war, auftraten, und da er aus konservativ-preussischer und ethischer Sicht mit der Hitlerschen Spielart des deutschen Nationalismus2285 nicht einverstanden war, wünschte er, vom Basler Boden aus den Einfluss in Deutschland ausüben zu können, der ihm unter direkter Kontrolle innerhalb einer gleichgeschalteten Universität versagt war. Den zweiten Vorteil, den er aus seiner Sicht der Dinge schon aus der Stellvertretung zog, sah er darin, dass er in der Schweiz für eine in seinen Augen richtigere Auffassung der deutschen Geschichte werben und in diesem Sinne das Werk von Bächtold fortführen könne, indem er die Basler Studierenden an «das Verständnis deutschen Schicksals und deutscher Mentalität» heranführte, wie er Hermann Oncken am 2. Januar 1935 erklärte.2286 Er war deshalb nicht Kaegis Wunschkandidat, aber er erwartete, falls es zu dessen Wahl käme, von ihm korrekt behandelt zu werden, denn an Ritters fachlicher Kompetenz und ethischer Integrität zweifelte er nicht. Nachdem die Wahl für die eine Professur auf Edgar Bonjour aus Bern gefallen war, rechnete Kaegi nach aller bisheriger akademischer Erfahrung damit, dass für die andere Stelle nur ein deutscher Bewerber infrage käme.
2284 2285
2286
aber in den nächsten Wochen [?] nichts zu überstürzen. Ob diese Biographie jetzt oder in zehn Jahren erscheint, ist nicht entscheidend. Das einzige, was man mit Recht verlangen darf, ist, dass sie gut sei und dazu braucht es Ausreifen und Zeit. In diesem Sinne hat man mir den Auftrag erteilt und ich bin dankbar für das Verständnis, das man dabei bewies.» Kaegi an Eduard Fueter jun., 13. 7. 1934, in: WK 181. Kaegi an Huizinga, 31. 8. 1934, in: Huizinga 1991, Nr. 1092, 35. «Ich habe versucht, ihnen [den Studenten] klar zu machen, dass es einen lärmenden und einen echten Patriotismus gibt […].» Ritter 2006, 771 (Text von 1962, bezogen auf den Nationalsozialismus). Intentionen von Gerhard Ritter: Wichers 2013, 141–143. Vgl. auch Ritter 2006, 771 (Text von 1962): «[…] meine Lehrtätigkeit war ja keine ausschliesslich positivistisch-historische, sondern hatte immer einen politisch-erzieherischen Hintergrund.» Die Studenten nannte er «meine[r] Gefolgschaft», ebd. und 773. Die «Baseler Studenten» bezeichnete er als «harmlos», weil sie (im Unterschied zu den deutschen Studenten) nicht begriffen, dass die Freiheitsideen in der Zeit von Humboldt und Stein «eine hochaktuelle Sache» gewesen seien. Ritter 2006, 777, mit Bezug auf Ritters Vertretung in Basel 1934/35.
544
Geisteswissenschaftler
Offen ablehnend reagierte er auf die Möglichkeit, dass ein Anhänger Stefan Georges nach Basel berufen werden könnte. Er bezog sich damit auf die Bemühungen, Ernst Kantorowicz nach Basel zu holen. Seine Abneigung gegen die von ihm so genannten «Georginen» teilte Kaegi mit Weisbach.2287 Entgegen seiner sonstigen Zurückhaltung zeigte er offene Schadenfreude, als diese Bemühungen scheiterten. Doch Kaegi konnte differenzieren, wenn es um Individuen ging, mit denen er persönlich konfrontiert wurde. Für den George-Anhänger Wolfram von den Steinen setzte er sich später ein, als er sah, dass dieser auf Dauer nicht von seinem bescheidenen Einkommen leben konnte, und als er dem Dichter Karl Wolfskehl begegnete, der auf dem Weg in sein neuseeländisches Exil in Basel Station machte, war er voller Bewunderung.2288 Dass schliesslich Kaegi auf den zweiten Basler Lehrstuhl gewählt wurde, war die Folge eines komplexen Vorgangs, den Hermann Wichers vor einigen Jahren genau untersucht hat,2289 so dass ich mich hier darauf beschränken kann, einige Aspekte hervorzuheben. Der Zürcher Beitrag zu Kaegis Wahl stammte von Ernst Gagliardi. Nachdem er es aufgegeben hatte, sich selbst als Kandidaten anzubieten, empfahl er den Baslern, Kaegi zu wählen.2290 Wichtiger war aber die Genfer Intervention. Carl Jacob Burckhardt galt vielen als der überragende Schweizer Kandidat, der der Geschichtswissenschaft in Basel zu neuem Glanz verhelfen könnte. Er war wohl der einzige Schweizer Bewerber, der ein ausreichend gewichtiges Opus vorzulegen 2287
2288
2289 2290
Weisbach schrieb kritisch über den «Georginen-Kreis», in den er «tiefe Einblicke» gehabt habe; der «Meister» sei ihm unsympathisch gewesen. Weisbach an Kaegi, 25. 6. 1935, in: WK 241. In Kaegis persönlichem Umfeld gehörte der Romanist Johannes («Jean») Oeschger durch seine Freundschaften mit Robert Boehringer, Edith Landmann und Hans Urs von Balthasar indirekt zum George-Kreis; auch von Balthasar war vorübergehend vom Kreis fasziniert. Aurnhammer 2012, 1125. Oeschger und Kaegi waren spätestens seit 1933 miteinander bekannt. Oeschger an Kaegi, 5. 9. 1933, in: WK 220 (der Brief erinnert auch im Schriftbild an die Aesthetik, die der Kreis liebte). «Übrigens haben ich kürzlich hier [Kaegi schrieb in Oetwil, er meinte wohl Basel] Karl Wolfskehl kennen gelernt, einen sehr starken Eindruck gehabt als von jemandem, der von der Hybris Georgiana vulgaris weit entfernt ist, in dem die ganze Menschlichkeit einer grossen – wenn auch im tiefsten verwundeten – Natur spielt.» Kaegi an Carl Jacob Burckhardt, 13. 8. 1934, in: WK 181. Wichers 2013. «Ich habe es Herrn Regierungsrat Hauser, wie den Herren der Fakultät deutlich gesagt, dass Ihre Übergehung vollkommen unverständlich wäre, u[nd] ich freute mich, dass diese Argumente nicht vergeblich bleiben. Was sollen wir mit preussischem Nationalismus, womöglich noch semitischer Variante [Anspielung auf Kantorowicz], bei uns anfangen?» Gagliardi an Kaegi, 18. 8. 1936, in: WK 194. «Oftmals habe ich gewünscht, Ihre Berufung wäre schon erfolgt. Prof. Gagliardi und ich haben oft darüber gesprochen; Prof. G[agliardi] hat Sie bei der Regierung aufs wärmste empfohlen.» Eduard Fueter jun. an Kaegi, 14. 2. 1935, in: WK 193.
Historiker
545
hatte (1935 war der erste Teil seines Richelieu erschienen) und bereits Professuren bekleidete, nämlich an der Universität Zürich und am Institut Universitaire de Hautes Études Internationales in Genf. Auch Kaegi hätte es begrüsst, wenn Carl Jacob Burckhardt eine der beiden vakanten Stellen erhalten hätte.2291 Burckhardts Absage2292 eröffnete ihm die Möglichkeit, nun selbst auf das Verfahren Einfluss zu nehmen. Er lud Kaegi, mit dem er spätestens seit Januar 1934 sehr wohlwollend korrespondierte,2293 zu sich nach Genf ein. «Es ist möglich, dass wir uns verstehen werden», bedeutete er ihm. Wie meistens in der persönlichen Begegnung überzeugte Kaegi seinen Gesprächspartner, während er selbst zurückhaltend blieb und seinen Wunsch äusserte, erst einmal als Extraordinarius mit beschränktem Lehrauftrag (allerdings bei ausreichender Bezahlung) Erfahrung zu sammeln.2294 Burckhardt unternahm mit ihm Autotouren durch die savoyische Nachbarschaft Genfs und beherbergte ihn in seiner Villa. Während Kaegi reich an Eindrücken und bestärkt in seiner Ablehnung des Sozialismus nach Hause fuhr, empfahl Burckhardt den massgebenden Basler Stellen Kaegi auf die Professorenstelle zu wählen, die er selbst abgelehnt hatte.2295 Die Fakultät, die nach der Maxime, dass der Bestausgewiesene die Stelle erhalten müsse, nun auf Gerhard Ritter setzte, war nicht erfreut über diesen
2291
2292 2293
2294
2295
«Was ich sagen möchte ist dies: nach meinem Eindruck von der Lage hier, wäre es nicht nur bedenklich, sondern ein ganz kapitales Unglück, wenn C[arl] B[urckhardt] den Ruf nicht annehmen würde.» Kaegi ging es darum, die Berufung eines Deutschen zu verhindern: «Es ist gar nicht abzusehen, wie schief die Situation im Falle seiner Ablehnung herauskäme. Ich fürchte dass man trotz allem dann einen Blitzschwaben berufen und auf lange Zeit hinaus vieles verderben würde.» Kaegi an Eduard Fueter jun., 13. 7. 1934, in: WK 181. Die Gründe fasst Welti 1993, 165, kurz zusammen. «Jede Zeile die Sie schreiben bedeutet viel für mich, ist es doch das erste Mal, dass mir ein produktiver Schweizer entgegentritt dessen geistiges Klima mir wohltut obwohl er ein Zeitgenosse ist. Fritz Ernst, Sie kennen meine Verehrung für ihn, gehört für mich mehr dem 19. Jahrhundert an. […] Ich würde mich überaus freuen wenn wir hie und da Zeit zu geistigem Austausch fänden. Ich zähle auf Ihren Besuch im Frühjahr.» Carl Jacob Burckhardt an seinen «Lieben Freund» Kaegi, 1. 1. 1934, in: WK 181. «Eine bescheidene Stellung mit einiger Bewegungsfreiheit wäre sicher für die Förderung derjenigen Art Leistung, die mir wertvoll scheint, am bekömmlichsten.» Kaegi an Burckhardt, 25. 7. 1934, in: WK 181. Burckhardt an Kaegi, 19. 7. 1934, in: WK 181. Eduard Fueter jun. verdeutlichte Kaegi Burckhardts Gründe für die Ablehnung und ermutigte ihn, die Einladung nach Genf anzunehmen. Fueter an Kaegi, 21. 7. 1934, in: WK 193. «Ich [Burckhardt] habe im Sommer mit Hauser, kurz vor meiner Abreise mit Oeri eingehend Ihren Lehrauftrag besprochen und habe sehr betont, dass Ihr Verbleiben für die Universität ein seltener Glücksfall wäre; ich sprach von einem wenig belasteten Ordinariat oder einem gut besoldeten Extraordinariat; Oeri war sehr positiv, Hauser hat man gewisse schematische Vorstellungen beigebracht.» Burckhardt an Kaegi, 28.12.[1934?], in: WK 181.
546
Geisteswissenschaftler
Schachzug. Aber auf der politischen Ebene von Kuratel, Erziehungsrat und Regierung setzte sich nach kurzem Zögern die Überzeugung durch, dass angesichts der Bedrohung der Schweiz durch Deutschland die Besetzung beider Geschichtslehrstühle durch Schweizer gerechtfertigt sei, zumal Ritters Patriotismus nicht in die beginnende schweizerische ‚geistige Landesverteidigung‘ passte. Der Versuch des Erziehungsdepartements, Einsparungen zu erzielen, indem Kaegi nur ein Extraordinariat, Bonjour aber das volle Ordinariat zugesprochen werden sollte, ging vorüber, und Kaegi erhielt die zweite historische Professur ohne Einschränkungen. Ritter fühlte sich davon schwer getroffen.2296 Die Fakultät war damit konfrontiert, dass sich Juden und Gegner des Nationalsozialismus aus Deutschland für einen Lehrstuhl interessierten. Wichers nennt Richard Salomon (Osteuropäisches Seminar in Hamburg, 1934 entlassen, ab 1936 in den USA) und Hedwig Hintze (PD in Berlin, spezialisiert in französischer Geschichte, persönlich bekannt mit Edgar Bonjour, 1933 entlassen, in Paris bis 1935, 1939 emigriert in die Niederlande); Letzterer erteilte Lüdeke rasch eine Absage. Im Bericht der Fakultät an die Expertenkommission der Kuratel vom 30. November 1934 war Kaegi bereits auffällig positiv gewürdigt worden, auch wenn seine Befürworter in der Minderheit blieben.2297 Der emeritierte Historiker Rudolf Thommen hatte am 20. September 1934 beim Dekan Henry Lüdeke dagegen protestiert, dass überhaupt noch Deutsche in Betracht gezogen würden.2298 Günstig für Kaegi war die Zusammensetzung der Expertenkommission der Kuratel, die von Ernst Thalmann präsidiert wurde.2299 Thalmann sprach sich gleich bei Beginn der Kommissionsarbeit am 5. März 1934 gegen die Berücksichtigung deutscher Kandidaten aus, da er fürchtete, diese würden sich pro oder contra Nationalsozialismus engagieren, während der religiös-soziale Jurist Max Gerwig
2296
2297 2298 2299
Eine negative Haltung gegenüber Ritter hatte auch Huizinga gezeigt. Den Vortrag, den Ritter 1933 in Warschau gehalten hatte und der nach Auffassung Ritters für eine Verständigung unter den Völkern werben sollte, hielt Huizinga für einen Ausdruck der «politischen Amoralität», wie er zum Entsetzen Ritters in Im Schatten von Morgen auch schrieb. Ritter hatte von der «sittliche[n] Autonomie des staatlichen Handelns» gesprochen. Ritter an Huizinga mit ausführlicher Verteidigung, 15. 2. 1936, in: Huizinga 1991, Nr. 1192, 115 f. In der Replik doppelte Huizinga mit einer Kritik an Ritters abfälligen Aussagen über den Kleinstaat nach. Huizinga an Ritter, 22. 2. 1936, ebd., Nr. 1194, 118 f. Kaegi hatte Huizinga 1934 berichtet, man diskutiere in Basel darüber, «wie weit er [Ritter] ein typischer Vertreter des deutschen Geistes sei». Später kam es zu einer brieflichen Auseinandersetzung zwischen Kaegi und Ritter wegen Kaegis Behauptung (in Michelet und Deutschland), das Fehlverhalten des preussischen Militärs in Frankreich habe Tradition. Teuteberg, in: Kaegi 1994, 28. StABS ED-REG 1a 2. Wichers 2013, 201. Wichers 2013, 103.
Historiker
547
hoffte, einen Deutschen zu gewinnen, der über den Parteien in Deutschland stünde. Am 10. Mai 1935 fand die entscheidende Sitzung der Kuratelskommission statt. Wichers vermutet, dass sich diejenigen Mitglieder, die nicht der Fakultät angehörten, vorher auf Kaegi geeinigt hatten. Die übrigen plädierten weiterhin für Ritter. August Rüegg und Max Gerwig kritisierten, dass die deutschen Universitäten das Fach Geschichte für die Ziele des Nationalsozialismus instrumentalisierten; Ritter sei zwar kein Anhänger dieser Ideologie, aber er stehe «fest auf dem Boden des nationalen Mythos». Oeri unterstrich, dass alle Deutschen, die in die Schweiz kämen, sich verpflichten müssten, für das Regime zu arbeiten. In der Abstimmung erhielten in einem ersten Durchgang Ritter und Kaegi gleich viele Stimmen, worauf sich jemand in der Schlussabstimmung der Stimme enthielt, so dass Kaegi zur Wahl vorgeschlagen wurde. Die Kuratel folgte am 20. Mai 1935 dem Antrag ihrer Kommission. Namhafte Fakultätsmitglieder waren über den Entscheid, Kaegi zu wählen, entrüstet. Paul Häberlin, der Kaegi von früheren Kontakten kannte,2300 sprach als Rektor beim Departementschef Hauser vor und gab zu bedenken, dass Kaegi «physisch» der Professur nicht gewachsen sei. Auch Lüdeke, Felix Stähelin, Rudolf Tschudi und Edgar Salin beschwerten sich bei Hauser. Kaegi wurde trotz dieser Proteste am 28. Juni 1935 vom Regierungsrat gewählt.2301 Die Fakultät war sich bewusst, dass die Wahl von Bonjour und Kaegi einen grundsätzlichen Kurswechsel in der Basler Geschichtswissenschaft bedeutete, herbeigeführt von ‚aussen‘, von den politischen Behörden. Kurz zuvor, im Mai 1935, war eine sozialdemokratische Regierungsratsmehrheit gewählt worden, und der Fall der Entführung Berthold Jacobs durch Wesemann, aber auch Görings Rede in Freiburg hatte deutschfeindliche Emotionen geschürt.2302 Solche Animositäten hatte Kaegi selbst seit Herbst 1931 beobachtet.2303 Er konstatierte ferner im Herbst 1933, dass Deutsche einem seiner Vorträge fern blieben. Zudem erwähnt er damals die Basler Grossratssitzung zum Thema «Frontismus», in der Erziehungsdirektor Hauser den rechtsextremen Seminardirektor Wilhelm Brenner und den ihn anscheinend protegierenden Philosophen Paul Häberlin kritisierte. In Basel entwickelte sich eine Polarisierung im Verhältnis zu Deutschland.2304 2300
2301 2302 2303 2304
Briefe von 1919. Kaegi sandte Häberlin 1928 die deutsche Übersetzung von Huizingas Erasmusbuch und 1932 die gesammelten Schriften von Walser zu. Häberlin an Kaegi, 19. 9. 1928; 19. 10. 1932, in: WK 198. Nach Kaegis Wahl zum Ordinarius wurden die Briefkontakte spärlich, da Häberlin bis 1954 im gleichen Haus wie Kaegi wohnte, Häberlin an Kaegi, 7. 7. 1954; auch Freiwillige Akademische Gesellschaft an Kaegi, 17. 6. 1954, in: WK 192. Wichers 2013, 139. Wichers 2013, 140. Kaegi an Rehm, 29. 11. 1931, in: WK 224. Fritz Ernst an Kaegi, 10. 10. 1931, in: WK 190. Kaegi an Rehm, 26. 10. 1933, in: WK 224.
548
Geisteswissenschaftler
Kaegi selbst zweifelte, ob er der Arbeitslast gewachsen sein würde. Er nahm die Wahl an, da die Aussicht, vom Katheder aus und mit dem Prestige einer Professur für seine Anliegen zu werben, die Bedenken überwog. Gegenüber Huizinga erklärte er: «Ich konnte mich als einziger vorgeschlagener Schweizer der Wahl nicht entziehen.»2305 Andererseits war er durch eine Liebesbeziehung mit Emil Dürrs Witwe, Adrienne von Speyr, verbunden, die nach dem Zeugnis der Dokumente tief empfunden war2306 und nichts von einem universitätspolitischen Staatsakt an sich trug.2307 Die kommende Ehe sei «wie eine Festung, in der man gedeckt ist», schrieb er Carl Jacob Burckhardt.2308 Allerdings spielten gewisse Bequemlichkeitsüberlegungen zusätzlich eine Rolle, war doch die künftige Frau als Erbin Dürrs im Besitz einer grossen Bibliothek, die die Bestände von mehreren Generationen Basler Gelehrter vereinigte, und sie bewohnte eine geräumige Professorenwohnung in bester Lage: Münsterplatz 4. Mit dieser Wahl wurde der noch weitgehend von kleindeutsch-preussischen Vorbildern abhängige, protestantisch geprägte Betrieb der politischen Geschichte abgelöst durch eine für Basel neue Orientierung. Trotz der hier verbreiteten Verehrung für Jacob Burckhardt war dessen Befürchtung, dass der Geist durch den modernen Nationalstaat überrannt werde, und dessen Feststellung, dass die Macht an sich böse sei, von den Historikern, die über ihn publizierten, nicht wirklich beim Wort genommen worden. Mit Kaegi änderte sich dies. Als Dozent, Forscher und Publizist verfolgte er sein Programm, Individualismus und Humanismus kultur- und geistesgeschichtlich zu verteidigen. Held der Reformationszeit war für ihn weder Luther noch Zwingli noch Calvin,2309 sondern Erasmus. Das 19. Jahrhundert sah er im Spiegel Burckhardts, was eine kleindeutsch-preussische Perspektive radikal ausschloss. Während sich Dürr und Bächtold in die politische Arena gestürzt hatten, verschrieb sich der neue Geschichtsprofessor einer Mission, die mit einem unmittelbaren Engagement in der Parteipolitik nicht vereinbar war. Allerdings herrschte bei Kaegi Kontinuität in dem, was die Historiographiegeschichte später als ‚Historismus‘ bezeichnete, wenn er auch kriegeri2305 2306 2307
2308 2309
Kaegi an Huizinga, 28. 6. 1935, in: Huizinga 1991, Nr. 1142, 74. Briefe an Kaegi in: WK 204; erstes Dokument vom 26. 8. 1934. Anzeige der Verlobung und Mitteilung, dass er die Wahl für die Professur angenommen habe. Kaegi an Huizinga, 28. 6. 1935, in: Huizinga 1991, Nr. 1142, 74. Teuteberg, in: Kaegi 1994, 18, mit Angaben zur Person von Adrienne von Speyr. Ihre Biographie: Privatdruck Adrienne Kaegi-von Speyr 1902–1967, in: WK 220, Papiere Johannes Oeschger. Der schöne und sachliche Text ist von Hans Urs von Balthasar verfasst und von Kaegi handschriftlich mit «und WK.» unterschrieben. Kaegi an Burckhardt, 9. 10. 1935, in: WK 181. Kaegi war mit dem Vorschlag konfrontiert, für Walther Köhler an einer Calvin-Ausgabe mitzuarbeiten (Köhler an Kaegi, Postkarte, 1. 9. 1926, in: WK 209), was er dann aber auf Rat von der Schulenburgs nicht tat. Von der Schulenburg an Kaegi, 15. 9. 1926, in: WK 232.
Historiker
549
sche und diplomatische Handlungen in der Geschichte zugunsten des «Geistes» in den Hintergrund verbannte. 7.5.8 Der Weg zur Ablehnung des Nationalsozialismus Kaegis Agenda hatte ursprünglich wenig zu tun mit der Abwehr faschistischer und nationalsozialistischer Ideen; vielmehr war sie gut vereinbar mit einem Zweifel an verfassungsmässiger Demokratie und im jugendlichen Anfang antibürgerlich in der Ablehnung der evangelischen Kultur des Elternhauses. Wie die Briefe an seinen deutschen Freund Rehm zeigen, fehlte vor Ende 1933 ein bestimmter Ernst in der Ablehnung der Diktaturen. Im Mai 1933 wollte er noch gegenüber Huizinga geltend machen, dass er dem schweizerischen Frontismus ein «relatives Recht […] in manchen Punkten anerkennen» wolle.2310 Es ging ihm zunächst mehr um sich selbst, um seine Freiheit und sein eigenes Lebensziel.2311 Gegenüber seiner Schwägerin Regina Kägi-Fuchsmann hatte er sich mit der manchmal übertreibenden Schärfe seiner Jugendbriefe 1928 geäussert, er wolle der Vertreter einer Kulturtradition sein, die er verteidige gegen alle «nationalen Imperialismen, Kapitalmächte, Herrschaftswille, ‚unterdrückte‘ Schichten, technische Gewalten». Seit 1789 herrsche eine «Nivellierungsmanie». «Die Sündflut wird noch viel länger werden als sie schon ist, ich kauf mir einen Regenmantel. Basta, basta!»2312 Der 19322313 beginnende Austausch mit Werner Weisbach war für Kaegi lehrreich. An den Nachrichten, die er von ihm erhielt, erkannte er, dass mit dem Ende der von Kaegi mit Misstrauen betrachteten Republik ein Tor für Kräfte geöffnet wurde, von denen Kaegi anscheinend erst jetzt zur Kenntnis nahm, dass sie in jeder Beziehung geistfeindlich arbeiteten. Weisbach hatte im Februar 1933 erwartet, dass deutsche Professoren die Nationalsozialisten energisch bekämpfen würden, und er wünschte, dass sich Kaegi bei der «NZZ» dafür einsetze, dass solche Proteste von aussen Unterstützung finden.2314 Im April 1933 informierte Weisbach Kaegi über den «Rückfall ins Mittelalter mit Inquisition, Ketzerverfolgungen, Index librorum prohibitorum»; er wusste bereits, dass er keine Vorlesun2310 2311
2312 2313 2314
Kaegi an Huizinga, 7. 5. 1933, in: Huizinga 1990, Nr. 1008, 447 f. Werner Kaegi berichtete seinem Bruder Paul Kägi, dass er den Auftrag erhalten habe, Burckhardts Kultur der Renaissance in Italien herauszugeben, und betonte dabei, dass dies den Eintritt in die «noble Gesellschaft» der Wölfflin, Dürr, Felix Stähelin und Oeri bedeute. Der Aufstiegsaspekt erscheint hier vorübergehend wichtiger als der Dienst am «Geist». Kaegi an Paul Kägi, ohne Datum, ca. 1928, in: WK 205. Kaegi an Regina Kägi-Fuchsmann, 6. 10. 1928, in: WK 207. Die in WK 241 erhaltenen Briefe von Werner Weisbach an Kaegi setzen am 10. 7. 1932 ein. Weisbach an Kaegi, 10. 2. 1933, in: WK 241.
550
Geisteswissenschaftler
gen mehr werde halten können.2315 Im September 1933 erfuhr Kaegi von Weisbach, der von Paris aus ohne Furcht vor der deutschen Zensur schreiben konnte, dass das Ziel der Nationalsozialisten «eine völlige Vernichtung der nichtarischen Intelligenz» sei, wofür Massnahmen unter der Hand getroffen würden, «damit die Öffentlichkeit im Unklaren gehalten wird und nichts von dem wahren Sachverhalt ins Ausland dringt».2316 Dass nicht nur der Geist in Gefahr war, sondern auch Leib und Leben von Opponenten und ‚Andersartigen‘, sah wohl auch Weisbach vor seinem Entschluss, 1935 in die Schweiz zu emigrieren, nicht deutlich. Aber bei Kaegi war die Abkehr von der jungkonservativen Illusion und ebenso vom Glauben an die Standfestigkeit des deutschen Professorenliberalismus vollzogen.2317 Dazu trug 1933 auch Johan Huizinga bei, dessen pessimistische Zeitkritik Kaegi in seinem Briefwechsel mitverfolgen konnte. Huizinga wies zusammen mit Weisbach Kaegi den Weg in die Opposition zum Nationalsozialismus. So schrieb Kaegi im März 1933 Huizinga über seine Reaktion auf den Wahlsieg der Nationalsozialisten: Seit dem deutschen Umschwung fühlen wir uns hier [in der Schweiz] derart in die Enge gepresst, wie es während des Krieges [1914–1918] kaum schlimmer war, – sodass man derartige tiefere Atemzüge, wie sie Ihre Schriften boten, sehr nötig hat. […] Ich erlebe zum ersten Mal ein grosses politisches Ereignis, das mir gänzlich wider den Strich geht und bei dem ein ganzer Porzellanschrank von Illusionen zerbricht. Ich hatte zum mindesten erwartet, dass man sich wehren würde. Aber dass eine Welt über Nacht ins Moor versinkt, von der man angenommen hatte, sie stehe wenn nicht auf Felsen, so doch auf tragfähigem Grund, ist eine fatale Überraschung. Ich bin zu lange nicht mehr in Deutschland gewesen.2318
1933 schaltete sich Kaegi publizistisch ein, als es an der Universität Leiden zu einem Eklat zwischen nationalsozialistischen deutschen Studenten und dem Rektorat gekommen war, das Huizinga damals turnusmässig versah. Bei einem internationalen Studententreffen, das unter dem Patronat des Rektors veranstaltet wurde, fielen die deutschen Studenten dadurch auf, dass sie geschlossen als eine von Staat oder Partei mandatierte Delegation auftraten. Nun erfuhr der Senat der Universität, dass der ‚Führer‘ der deutschen Delegation, Johann von Leers, Verfasser eines antisemitischen Pamphlets war, das angebliche jüdische Ritualmorde als Tatsache hinstellte und «deutsche Mütter» vor den Juden warnte. Der Senat befand, dass die Autorschaft einer solchen Schrift mit dem Namen der Wissenschaft unvereinbar sei, und gab von Leers den Rat, das Treffen zu verlassen. Dar2315 2316 2317 2318
Weisbach (Florenz) an Kaegi, 4. 4. 1933, in: WK 241. Weisbach (Paris) an Kaegi, 30. 9. 1933, in: WK 241. Nachruf Kaegis auf Werner Weisbach, in: Kaegi 1994, 155–161 (ursprünglich in den Basler Nachrichten vom 11./12. 4. 1953). Kaegi an Huizinga, 25. 3. 1933, in: Huizinga 1990, Nr. 991, 428 f.
Historiker
551
aufhin zog die gesamte deutsche Delegation vorzeitig ab. Für den Senat hatte auftragsgemäss Johan Huizinga als Rektor gesprochen. In der deutschen Presse erschienen danach Berichte, die ihn persönlich attackierten und eine verfälschte Darstellung der Vorgänge in Leiden vermittelten.2319 Kaegi nutzte seine Verbindungen zur Redaktion der «Neuen Zürcher Zeitung», um eine mit Huizinga abgesprochene Richtigstellung zu publizieren, die anschliessend breit gestreut wurde. Zwar zögerte die Redaktion die Veröffentlichung hinaus («Ich fürchte aus politischen Gründen. Die N.Z.Z. ist uns allen zuweilen unerträglich vorsichtig», kommentierte Kaegi) und druckte schliesslich noch eine Entgegnung von Johann von Leers (mit Replik von Huizinga) ab.2320 Kaegi machte sich für den deutschen Sprachraum zum Helfer des Verteidigers akademischer Freiheit und Wahrheitswillens.2321 Er war sich mit Huizinga einig, dass das Auftreten der deutschen Protagonisten in dieser Affäre ein Angriff auf die abendländische Kultur und die Freiheit der Universitäten war, und dass die Gegenaktion weniger eine Kritik am Nationalsozialismus und mehr eine solche an den geistfeindlichen Erscheinungen der Massenherrschaft überhaupt sei.2322 Als Vertreter von Huizingas Autoreninteressen im deutschsprachigen Raum hatte Kaegi Gelegenheit, das Funktionieren von Zensur und Selbstzensur im Publikationswesen kennenzulernen. Huizinga wollte einen Aufsatz über «Die Mittlerstellung» der Niederlande im deutschen Teubner Verlag herausbringen; als Lektor wirkte dort Hajo Holborn. Holborn griff «auf eigene Verantwortung» (so Holborn) wegen «der heutigen Situation in Deutschland» in den Text ein. Er ersetzte die Passage «mit Einsteins Werk und Person» durch «mit deutschen Gelehrten». Die jüngsten Äusserungen von Einstein hätten es auch seinen Freunden in Deutschland «schwer gemacht, für ihn einzutreten», rechtfertigte sich Holborn gegenüber Huizinga dabei emigrierte dieser selbst 1934 in die USA.2323 Dann erschien die folgende Erklärung auf Seite 228 im Band 148 der «Historischen Zeitschrift» von 1933: 2319 2320
2321 2322
2323
Siehe dazu den Briefwechsel zwischen Huizinga und Kaegi ab 23. 4. 1933, in: Huizinga 1990, ab Nr. 1001, 440 f. Kaegi an Huizinga, 17. 5. 1933, in: Huizinga 1990, Nr. 1015, 454 f.; Huizinga an Kaegi, 21. 5. 1933, ebd., Nr. 1017, 455 f.; Huizinga an Kaegi, 29. 5. 1933, ebd., Nr. 1022, 459; Kaegi an Huizinga, 13. 6. 1933 (eher 12. 6. 1933), ebd., Nr. 1029, 462 f.; Hans Barth an Kaegi, 22. 5. 1933, in: WK 174. Kaegi war der Vermittler zwischen Huizinga und der Redaktion der «NZZ» für die Replik, die Huizinga nach der Gegendarstellung von Leers zustand; Barth arbeitete als Redaktor für diese Zeitung. Kaegi an Rehm, 9. 5. 1933, in: WK 224. Krumm 2011, 201–210, stellt die Affäre ausführlich dar (unter Einschluss der Auswirkungen auf die «Historische Zeitschrift») und referiert die These von Huizingas damals sehr allgemeinen Auffassung von der Bedrohung der abendländischen Kultur (statt einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus). Hajo Holborn an Huizinga, 25. 3. 1933, in: Huizinga 1990, Nr. 990, 427 f.
552
Geisteswissenschaftler Der Aufsatz von Herrn Prof. Dr. Huizinga, derzeitigen Rektors der Universität Leyden, war wie fast das ganze übrige Heft bereits ausgedruckt, als die Redaktion der H. Z. die amtliche Mitteilung von dem von ihm veranlassten Vorfall in der Leydener Universität erhielt. Die Redaktion erklärt, dass sie den Aufsatz nicht zum Abdruck gebracht haben würde, wenn sie von diesem Vorfall rechtzeitig Kenntnis gehabt hätte. Die Schriftleitung.2324
Mit dem Ausdruck «amtliche Mitteilung» wollte die Redaktion wahrscheinlich verschlüsselt darauf hinweisen, dass diese Erklärung nicht völlig ihrer eigenen Überzeugung entsprach. Kaegi bemerkte dazu: «Man lebt wieder in Kriegszeiten, nur dass der Hexenhammer des Nationalismus inzwischen gehörig ausgebaut worden ist.»2325 Vielleicht war dies der Grund dafür, dass er nach der offensichtlich gewordenen Gleichschaltung der «Historischen Zeitschrift» 1935 mit dem Gedanken spielte, eine neue historische Zeitschrift zu gründen, die der wissenschaftlichen Forschung und der Wahrheit gewidmet wäre.2326 7.5.9 Das Erasmusjahr 1936 1936 wurde das Erasmusjahr gefeiert. Rotterdam, der Geburtsort, und Basel, der Sterbeort des Humanisten standen dabei im Mittelpunkt der Ereignisse. Die Aktivitäten in Basel begannen mit der «Gedächtnisfeier anlässlich des 400. Todestages des Erasmus von Rotterdam» am Montag, 6. Juli 1936, die als privater Anlass im Sterbehaus des Erasmus veranstaltet wurde, in dem der Drucker Froben gewirkt hatte und das nun als Geschäftssitz des Antiquars und Verlegers Paul Braus-Riggenbach diente. Da die Universität am Todestag selbst nicht feiern wollte, weil er mit dem Semesterschluss zusammenfiel, hatte Braus-Riggenbach freie Bahn. In die Werbung für diesen Anlass bezog er die Stadt Freiburg i. Br. 2324
2325 2326
Kaegi an Huizinga, 26. 4. 1933, in: Huizinga 1990, Nr. 1003, 442 ff. Interessant ist das offensichtlich verschlüsselte Schreiben der Redaktion der «Historischen Zeitschrift» an Huizinga, 27. 6. 1933, ebd., Nr. 1041, 476, unterschrieben von Friedrich Meinecke und Albert Brackmann. Der Vorfall betreffe die «nationale Ehre und Würde» und sei deshalb im Sinne der «amtlichen» (!) Darstellung behandelt worden. Man bedauere, dass dies gerade Huizinga gegenüber geschah, nachdem die Zeitschrift selbst ihn um den Aufsatz gebeten hatte. Man werde in Zukunft die Erfüllung der Pflichten als Deutsche mit der «Wahrung der reinen Wissenschaft vereinigen». Huizinga antwortete mit grosser Bestimmtheit: Er lege Wert darauf, dass auch aus juristischer Sicht das Unrecht auf deutscher Seite liege. Es sei zu beanstanden, dass eine Regierung eine Delegation zu einer Konferenz der ISS schicke und danach den Vorgängen eine diplomatische Bedeutung beimesse. «Ganz abgesehen davon hat eine Universität, deren Wesen die Freiheit ist, in Sachen ihrer Ehre und Würde andere Massstäbe anzulegen als diejenige welche den Verkehr der Staaten regeln.» 30. 6. 1933, ebd., Nr. 1042, 476 f. Kaegi an Huizinga, 26. 4. 1933, in: Huizinga 1990, Nr. 1003, 442 ff. Fueter an Kaegi, 9. 8. 1935, in: WK 193.
Historiker
553
ein,2327 wohin sich Erasmus geflüchtet hatte, als die Basler Reformation heftigere Formen annahm. Tatsächlich erschienen Persönlichkeiten aus Deutschland und der Schweiz zu dieser Feier, die als voller Erfolg geschildert wurde. Für den Festvortrag hatte Braus-Riggenbach einen der führenden Reformationshistoriker gewonnen, Walther Köhler, der von 1909 bis 1929 in Zürich gelehrt hatte und dann nach Heidelberg übergesiedelt war.2328 Köhler hielt ein wissenschaftlich hochstehendes Referat über «Die Religion des Erasmus von Rotterdam» ohne jegliche Anspielung auf die Gegenwart und frei von allen nationalsozialistischen Einflüssen.2329 Kaegi trat dabei nicht in Erscheinung, obschon er seit 1925 mit Köhler in Kontakt stand.2330 An der offiziellen Feier in Rotterdam am 10./11. Juli 1936 nahm Werner Kaegi als Vertreter der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft in Begleitung des Delegierten der Universität Basel, des Kirchenhistorikers Ernst Staehelin, teil. In seinem kurzen Bericht bezeichnete Staehelin die Feier als «eine glückliche Mischung von wissenschaftlicher Tagung und Jubiläumsfeier». Er erwähnte nur seine eigene kurze Ansprache in der Hauptsitzung; Kaegi scheint sich nicht zu Wort gemeldet zu haben. Die «Basler Nachrichten» stellten zu diesem Anlass einen deutlichen Aktualitätsbezug her: «In unserer den Erasmusideen so feindlichen Zeit ist es gut, dass gerade die Schweiz und die Niederlande berufen sind, das Werk des Humanisten zu würdigen, Länder, die in der allgemeinen Strömung des emotionalen Denkens, des fanatischen Nationalismus und der Vergötzung des Staates oft als Inseln des kritischen Widerstandes erscheinen.»2331 Etwa gleich-
2327
2328 2329
2330 2331
Braus-Riggenbach, Buchhandlung & Antiquariat, Basel, an Rektor Friedrich Metz, 20. 6. 1936, in: UA Freiburg i. Br., B0001 215 Generalien, Feierlichkeiten, Einladungen zu Versammlungen, Feierlichkeiten usw. Er dankt für die Mitteilung vom 29.5., dass auch in Freiburg eine Erasmusfeier abgehalten werde. In der Anlage findet sich die Einladung zur Feier, die Braus-Riggenbach in Basel organisierte. Am 27. 6. 1936 lehnte Metz die Einladung ab und schickte Hans Dragendorff (Klassischer Archäologe) als seinen Vertreter. Bächtold 2008. Programm in: StABS Feste F 5e Erasmusfeiern 1936. Bericht in den Basler Nachrichten vom 7. 7. 1936, 2. Beilage zu Nr. 184, sowie in der National-Zeitung Nr. 308, 7. 7. 1936, ebd. Köhlers Ansprache wurde von Braus-Riggenbach als Sonderabdruck verteilt: «Erasus von Rotterdam als religiöse Persönlichkeit». Eine Kurzfassung publizierte Köhler in der NZZ vom 12. 7. 1936, Erste Sonntagsausgabe, Blatt 8 f., Nr. 1202, als «W. K-r.» unter dem Titel: «Philosophie Christi». Köhler hatte den Eindruck, dass Huizinga die theologischen Aspekte im Werk des Erasmus zu wenig würdige: «Schade, dass Huizinga die theologischen Zusammenhänge nicht recht liegen, denn Erasmus ist nun doch einmal primo loco Theologe.» Köhler an Kaegi, 23. 8. 1936, in: WK 209. Briefwechsel in: WK 209. Ernst Staehelin, 14. 7. 1936, an Vorsteher ED zu Händen Regierungsrat, in: StABS Feste F 5e Erasmusfeiern 1936. Bericht der Basler Nachrichten vom 15. 7. 1936: «Rotterdam feiert Erasmus», ebd.
554
Geisteswissenschaftler
zeitig mit der Rotterdamer Feier hielt Kaegi einen Vortrag am Basler Radio.2332 Kaegi nannte Erasmus «für unsere Zeit» einen «beneideten Unzeitgemässen, [einen] glücklichen Besitzer einer Position, die kaum einer unsrer Zeitgenossen mehr sein eigen nennt: eine innige und selbstverständliche geistige Verbundenheit mit allen Teilen und Nationen unsres Kontinents, eine persönliche Bildung, die allen europäischen Ländern irgend etwas zu danken hatte und die auf alle befruchtend und spendend zurückwirkte.» Er schloss mit dem Worten: «Je kräftiger die Wirklichkeit den Forderungen des Geistes widerspricht, um so gewaltiger leuchtet ihre Wahrheit.» Nicht ausgesprochen hat er die Bedeutung, die Erasmus für seine persönliche Religiosität hatte. Als Gegner aller verfestigten Glaubenssysteme fühlte er sich der «Tertia Ecclesia» des Erasmus zugehörig.2333 Kaegis Beitrag zur Basler akademischen Erasmusfeier vom 24. Oktober 19362334 bestand darin, Huizinga für die Gedenkrede zu gewinnen2335 und ihn während des Basler Besuchs zu betreuen.2336 An dieser Feier nahmen Vertreter der Basler Regierung und des Bürgerrats, der Regierung von Basellandschaft, die der Universität vorgesetzten Basler Behörden, die Gezantschap der Nederlanden, Bern, und der niederländische Konsul in Basel sowie ein Vertreter der Gemeente Rotterdam teil. Der ebenfalls eingeladene schweizerische Bundesrat sagte wegen Überlastung ab. Ferner beteiligten sich Delegationen von Geschichtsvereinen, darunter Hektor Ammann für die Historische Gesellschaft des Kantons Aargau. Aus der deutschen Nachbarschaft nahmen Theodor Mayer für die Badische Historische Kommission und Josef Rest, Direktor der Universitätsbibliothek Freiburg i. Br., teil. Fritz Kraus war als Journalist für die «Frankfurter Zeitung» an
2332
2333
2334 2335 2336
«Erasmus von Rotterdam», in: Kaegi 1942, 77–88. Ich arbeite mit dieser Fassung. Die Radioansprache datiert vom 11. 7. 1936; der Abdruck in den Basler Nachrichten vom 25. 10. 1936 erschien also erst zur akademischen Feier im Münster zu Beginn des Wintersemesters. Schon der junge Kaegi hatte Religionen als konfessionelle Systeme abgelehnt. Kaegi an seine Schwester Frieda, 14. 2. 1928, in: WK 205. Kaegi hielt die «philosophia Christi» des Erasmus für eine ihm angemessene theologische Position. Er schätzte Karl Barth schon gering, bevor dieser in Basel ankam: «Anscheinend bekommen wir nun Karl Barth in die theologische Fakultät gesetzt kraft politischem Machtspruch. Die Theologen selbst sind wenig entzückt.» Kaegi an Rehm, Ende Dezember 1934, in: WK 224. Obwohl der Sohn eines protestantischen Landpfarrers sich gern mit Katholiken unterhielt und seine Gattin 1940 zum katholischen Glauben übertrat, ist Kaegi nie Mitglied der katholischen Kirche geworden, weil er an der «Tertia Ecclesia» des Erasmus festhielt. Welti 2015, 14. Kaegi an Rehm, 20. 10. 1936, in: WK 224. Huizinga an Kaegi, 15. 3. 1935, in: Huizinga 1991, Nr. 1129, 65 f. «Historische Säkularfeiern in Basel» (NZZ vom 26. 10. 1936, Blatt 6). Huizinga besuchte Kaegi im Haus Münsterplatz 4, Huizinga an Kaegi, 6. 11. 1936, in: Huizinga 1991, Nr. 1236, 154 f.
Historiker
555
diesem Anlass präsent.2337 Die einzige ausländische Universität, die der Basler Rektor eingeladen hatte, war Freiburg i. Br. Wegen der Affäre um die Entlassung des Anatomen Werner Gerlach verbot das Ministerium dem Freiburger Rektor Friedrich Metz im letzten Moment, als universitärer Amtsträger in Basel zu erscheinen.2338 Huizinga enttäuschte die Erwartungen, die üblicherweise an Festvorträge gerichtet wurden, und sprach eher kritisch über Erasmus.2339 Er tat dies wohl deshalb, weil er die Unabhängigkeit der Wissenschaft von Tageserwartungen unterstreichen wollte, aber auch, um die wenig anziehenden Aspekte der Person des Erasmus abzulösen von der überragenden geistigen Bedeutung seines Wirkens.2340 Huizinga gab zu verstehen, dass die Gegenwart von einer fatalen Unordnung geprägt sei, für die der Geist des Erasmus heilsame Wirkungen haben könnte. Einen offenen Gegenwartsbezug herzustellen blieb der «Arbeiter-Zeitung» vorbehalten, die schrieb: «So wurde Erasmus der Stammvater eines geistigen 2337 2338
2339
2340
Programm, Korrespondenzen, Einladungsliste und Presseberichte in: StABS Feste F 5e Erasmusfeiern 1936. Eine offizielle Vertretung der Universität Freiburg i. Br. sei «unbedingt geboten». Gute Beziehungen zu Basel seien wichtig, sie konnten auch durch den Fall Gerlach nicht getrübt werden. «Dieser Fall fällt in keiner Weise der Universität Basel und dessen Rektor, sondern lediglich der sozialistischen Regierung von Basel zur Last.» Friedrich Metz an Reichs-Erziehungsministerium, 29. 9. 1936. Am 12. 10. 1936 nannte die Leitung der NSDAP-Auslands-Organisation, Kulturamt, als Begründung dafür, dass Metz nicht nach Basel fahren dürfe, folgende Brüskierungen des ‚Dritten Reichs‘: Im Frühjahr 1934 wurde Dr. Emil Niemann aus politischen Gründen aus dem Berner Staatsdienst entlassen; im November 1935 wurde Adolf Schuhmacher aus dem Basler Staatsdienst entlassen («Regierungsbaumeister»); im August 1935 wurde Prof. Walter Porzig aus dem Berner Hochschuldienst entlassen; im Oktober 1936 wurde Prof. Fritz Zetsche aus dem Berner Staatsdienst entlassen; vor Kurzem wurde in Basel Werner Gerlach fristlos und entschädigungslos entlassen und Prof. Michaelis in Bern von der üblichen Wiederwahl ausgeschlossen. Der Basler Affront gegen Heidelberg habe auch Schweizer empört, zum Beweis werden die «Schweizer Monatshefte» zitiert. Was die Basler Erasmus- und Zentenarfeier der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft betreffe, so sei Wölfflin (Hauptredner der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft) «ein aufrechter Deutschenfreund», aber Huizinga (Hauptreferent der Erasmusfeier) «ein Mann, der in seinen Veröffentlichungen eine ausgesprochene Verständnislosigkeit für die Vorgänge im Dritten Reich an den Tag gelegt und uns damit nur geschadet hat». Am 21. 10. 1936 dankte Metz noch dem Basler Rektor Haab für die Einladung. Am 24. 10. 1936 schickte Metz aber auftragsgemäss seine Absage an Haab. Alles in: UA Freiburg i. Br., B0001 215 Generalien, Feierlichkeiten, Einladungen zu Versammlungen, Feierlichkeiten usw. 1936. Kritik von Max Gerwig an der Festrede von Huizinga, die er mit dem Beitrag von Kaegi im Sonntagsblatt der Basler Nachrichten vom 25. 10. 1936 verglich: Kaegis Text sei eine «Erholung» nach der Ansprache von Huzinga gewesen, weil Kaegi das «Positive» in den Vordergrund gestellt habe. Max Gerwig an Kaegi, 25. 10. 1936, in: WK 195. «Historische Säkularfeiern in Basel» (NZZ vom 26. 10. 1936, Blatt 6).
556
Geisteswissenschaftler
Adelsgeschlechts, der legitime Vorfahr jener unerbittlichen grossen Welt- und Zeitkritiker von Voltaire über Lichtenberg, Marx, Nietzsche, Kierkegaard bis zu Karl Kraus.»2341 Der Sonntag nach der Erasmusfeier galt dem 100jährigen Bestehen der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft in Basel. Den Festvortrag in der Martinskirche hielt Heinrich Wölfflin über seinen Lehrer Jacob Burckhardt als Kunstforscher. Während Kaegi hier nicht öffentlich in Erscheinung trat,2342 hatte er einen wesentlichen Anteil an der Gedenkschrift zum Thema «Erasmus», die die Gesellschaft herausbrachte.2343 Er beriet auf Bitten ihres Vorstehers, Eduard His,2344 die Redaktion bei der Wahl der Persönlichkeiten, die für Beiträge angefragt wurden. Die Aufsätze von Gertrud Jung, Delio Cantimori, Benedetto Croce und von Johan Huizinga schlug Kaegi vor und vermittelte den Kontakt zu den Autoren. Er selbst publizierte in der Gedenkschrift eine Untersuchung über das Nachleben des Erasmus im 18. Jahrhundert. Auch Walther Köhler hätte gern einen Aufsatz für die Gedenkschrift geschrieben, wurde aber nicht berücksichtigt.2345 Der Herausgeber His situierte den Band mit vorsichtigen Worten in der Aktualität: Die Gedenkschrift sollte künden von «erasmischer Lebensauffassung in einer Zeit, die an Milde, an Toleranz und an Achtung vor der geistigen Persönlichkeit wahrlich keinen Überfluss hat!»2346 Delio Cantimoris Name erschien hier2347 zum ersten Mal im Umfeld Kaegis. Seit 1927 publizierte er zu Renaissancethemen. Mehrere Aufenthalte führten ihn 2341
2342 2343 2344
2345 2346 2347
«Erasmus – Der Weltruhm eines Unbekannten», Teile II bis IV (Arbeiter-Zeitung vom 24. 10. 1936). Als Autor zeichnete ein «F.». Eine Materialsammlung zu diesem Ereignis befindet sich in: StABS, PA 88a, Archiv der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel, E 4 Zentenarfeier und Erasmusfeier 1936. Sonntagsblatt der Basler Nachrichten Nr. 43, 25. 10. 1936. Gedenkschrift 1936. His an Kaegi, Aufforderung zur Mitarbeit bei der Vorbereitung der Gedenkschrift, 11. 1. 1935. His an Kaegi, dankt Kaegi für die Bereitschaft zur Mitarbeit, 27. 5. 1935. Am 17. 12. 1935 wurde Kaegi gebeten, Vorstandsmitglied der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft zu werden. 1942 war Kaegi Vorsteher der Gesellschaft, His an Kaegi, 20. 8. 1942. Alles in: WK 199. «An die Raumnot glaube ich nicht recht, aber es widerstrebt mir nach der Ursache zu forschen.» Köhler an Kaegi, 31. 8. 1936, in: WK 209. Eduard His, «Geleitwort», in: Gedenkschrift 1936, 9–10. His an Kaegi, 4. 5. 1936, in: WK 199. Gedenkschrift 1936, 98–112: «Note su Erasmo e la vita morale e religiosa italiana nel secolo XVI» (Delio Cantimori). Ebenfalls aus dem Jahr 1936 ist der Gruss datiert, den Cantimori über Karl Löwith aus Rom an Kaegi mit dem Wunsch übermittelte, Kaegi in Basel zu besuchen. Löwith an Kaegi, 4. 7. 1936, in: WK 213. Kaegis Bekanntschaft mit Cantimori scheint von einem Besuch des Italieners in Basel 1935 zu datieren; der Briefwechsel (in: WK 183) beginnt in diesem Jahr. Spätestens ab 1940 war die Korrespondenz unter der Zensur geschrieben und beschränkte sich auf einen rein wissenschaftlichen Austausch.
Historiker
557
in die Schweiz, wo er zu Beginn der 1930er Jahre auch Vorlesungen an der Basler Theologischen Fakultät hörte. Huizingas Beitrag war deutlich zeitkritisch inspiriert; er verwahrte sich gegen Fragestellungen wie die, ob Erasmus als ‚Deutscher‘ gelten könne, und diskutierte den «Nationalismus» der Humanisten.2348 «In notwendigem Widerspruch gegen den extremen Nationalismus, dessen giftige Früchte wir heute ernten, regt sich unter Zahllosen in der ganzen Welt wieder der Geist, der sie, ohne Abfall vom eigenen Volkstum und Vaterland, mit Erasmus reden lässt: Cives inter se sunt ac symmystae, quicunque studiis iisdem initiati sunt.»2349 Neben Huizinga war die internationale Erasmusforschung durch Helen Mary Allen vertreten, deren verstorbener Gatte Percy Stafford Allen die Erasmus-Korrespondenz herausgegeben hatte, an der sie wesentlich Anteil hatte. Die Universität Basel verlieh ihr deshalb bei ihrer Erasmusfeier den Ehrendoktortitel. In der Gedenkschrift erschien ein Ausschnitt aus einer biographischen Arbeit ihres verstorbenen Mannes über Erasmus.2350 Mit einem Beitrag aus Deutschland setzten die Herausgeber indirekt ein Zeichen gegen die nationalsozialistische Hochschulpolitik. Dieser stammte von Rudolf Pfeiffer, einem bekannten Klassischen Philologen, mit einer Jüdin verheiratet, der dann die Jahre 1938 bis 1951 im Exil in Oxford verbrachte.2351 Die Basler Beiträge repräsentierten die Vielfalt der Bestrebungen unter dem Dach der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft. Die schon bekannten Forschungen über das angebliche Grab und Skelett des Erasmus2352 und die ikonographischen Arbeiten über die Erasmus-Porträts von Holbein wurden präsentiert. Übersetzungsarbeiten erschienen als Kostproben der lokalen gelehrten Arbeit.2353 Der Basler Theologe Ernst Staehelin nahm die Erasmus-Gedenkfeier zum Anlass, festzustellen, dass die Glaubensspaltung nicht von Gott gewollt sei und die Kirchen den Auftrag hätten, sich gegenseitig anzunähern.2354 Kaegis eigene Arbeit, die er vorher mit Huizinga thematisch und inhalt2348 2349 2350 2351 2352
2353 2354
Gedenkschrift 1936, 34–49: «Erasmus über Vaterland und Nationen» (Johan Huizinga). Gedenkschrift 1936, 34–49: «Erasmus über Vaterland und Nationen» (Johan Huizinga), Zit. 49. Gedenkschrift 1939, 25–33: «The Young Erasmus» (Percy Stafford Allen†). Gedenkschrift 1936, 50–68: «Die Wandlungen der ‚Antibarbari‘» (Rudolf Pfeiffer). Über diesen Vorgang hatte Huizinga schon 1928 gemischte Gefühle gehegt, während Kaegi sich anfangs interessiert zeigte. «Es verstösst gegen Klios Spielregel, wenn man in dieser Weise hinter die Kulissen guckt.» Huizinga an Kaegi, 8. 7. 1928, in: Huizinga 1990, Nr. 780, 230. Später ironisierte er die Schwierigkeiten bei der Zuordnung des Schädels durch die Vermutung, Erasmus könnte zwei Köpfe gehabt haben. Huizinga an Kaegi, 29. 7. 1928, ebd., Nr. 784, 232 f. Gedenkschrift 1936, 11–24: «Beatus Rhenanus: Leben und Werke des Erasmus» (Alfred Hartmann), deutsche Übersetzung mit Auslassungen. Gedenkschrift 1936, 166–182: «Erasmus und Ökolampad in ihrem Ringen um die Kirche Jesu Christi» (Ernst Staehelin). Siehe auch Gedenkschrift 1936, 144–165: «Die politische Hoffnung des Erasmus und ihr Zusammenbruch» (Rudolf Liechtenhan). Diskutiert wurden hier die Friedensschriften.
558
Geisteswissenschaftler
lich abgesprochen hatte, brillierte durch Stil und vielfältigen Inhalt. Den Schluss seiner Abhandlung bildete ein Goethezitat: «Es scheine, als ob das Gute nur das Werk der einzelnen Menschen seie». Offene Aktualitätsbezüge fehlten, aber Kaegi stellte fest: «Der Bildungsgedanke der deutschen Klassik geht in seiner geistesgeschichtlichen Aszendenz auf Erasmus, nicht auf Luther zurück.»2355 Das konnte als Standortbestimmung gegen deutsche Kollegen verstanden werden. 7.5.10 Engagements im Rahmen der Professur Als Professor warb Kaegi in der Öffentlichkeit im Sinne seiner Mission. Die wichtigsten Interventionen publizierte er 1942 unter dem Titel Historische Meditationen; ein weiterer Band folgte wenige Jahre später. Der Umstand, dass seine Studien zur Renaissance und zur Historiographie des 19. Jahrhunderts in der gleichen Sammlung erschienen wie Vorträge und Aufsätze, denen die zeitbezogene Wirkungsabsicht unmittelbar eingeschrieben waren, lässt sich wohl damit erklären, dass er die wissenschaftliche Seriosität auch seiner politischen Interventionen im Vordergrund sah. Oft richtete er sich dabei gegen manchmal als ‚deutsch‘ verstandene, aber vor allem dem engen Bezug auf Staat und Politik verpflichtete Auffassungen von Geschichtswissenschaft und Geschichtsschreibung. Die Stellung der an die Universitäten und öffentlichen Forschungsinstitute gebundenen Geschichtswissenschaft im Staat des 19. Jahrhunderts ist nirgends eine absolut freie, sondern eine in den verschiedenen Regierungsformen etwas variierende, aber in den Grundzügen ähnlich gebundene gewesen. Durch die Abhängigkeit der sich entwickelnden Forschungsmethoden von staatlichen Bibliotheken, Instituten und Subventionen, mit der Gründung und inneren Vereinheitlichung der Nationalstaaten, mit der Ausdehnung des Kompetenzbereiches der Kultusministerien, mit der Unterstellung einer immer grösseren Zahl von Universitäten und Lehrstühlen unter dieselbe politische Aufsicht ist mit dem zunehmenden Interesse des modernen Grossstaates für die Wissenschaften diese Bindung der Geschichtsforschung an den Staat eine immer engere geworden. […] Und in der Schweiz selbst gehört es zu den fruchtbarsten Erkenntnissen der jüngsten Forschung, dass das Bild der schweizerischen Vergangenheit mehr als ein halbes Jahrhundert lang mit den befangenen Augen der Sieger von 1847 gesehen worden ist.2356 Neben den akademischen Lehrstühlen und Anstalten haben in allen europäischen Ländern damals kirchliche und private, von Korporationen und von Einzelnen 2355 2356
Gedenkschrift 1936, 205–227: «Erasmus im achtzehnten Jahrhundert» (Werner Kaegi). Kaegi 1946, 121–171: «Geschichtswissenschaft und Staat in der Zeit Rankes», 169 f. Ich verstehe Kaegis Argument als Kritik an der staatsfinanzierten und -geleiteten Geschichtswissenschaft (namentlich deutscher Art), während Kreis 2000, 372, darin eine nachsichtige, «grosszügige Einschätzung» der Problematik der verwischten Grenzen zwischen politischer Publizistik und Historiographie erkennt.
Historiker
559
getragene historische Forschungen das freie Wort genossen und die enger an den Staat gebundene Wissenschaft zu Rede und Antwort gestellt. Der Gerichtsort für die Bildung historischer Erkenntnis ist damals wie immer nicht das staatliche Forschungsinstitut, sondern der verantwortliche Geist des einzelnen Gelehrten gewesen.2357
Der Individualismus der Kaegischen Wissenschaft lehnte auch fast alle Kollektivsubjekte als treibende Kräfte in der Geschichte ab, ebenso Versuche, hinter den Intentionen der Handelnden Ideologien am Werk zu sehen. Mit Soziologie konnte er nichts anfangen, wie seine Auseinandersetzung mit Alfred von Martin (Soziologie der Renaissance) zeigte.2358 Der wirkliche Historiker hatte nach Kaegi Liebe zum Detail, war von Neugier geleitet, stets offen für Überraschungen, und suchte nach Fakten statt nach grossen Konstruktionen. Anekdotisch-aufschlussreich war die Differenz mit Adolf Grabowsky, der Kaegis Vortrag über «Nationale und universelle Denkformen im deutschen Humanismus des 16. Jahrhunderts» mit dem Hinweis kommentierte, dass die allgemeinen Formulierungen z. B. bei Grotius Ausflüsse einer bürgerlich-antifeudalen Ideologie seien.2359 Kaegis Kritik an einer Nationalisierung der Geschichte war bei Kaegi durch Jacob Burckhardt inspiriert. Die Nation als ein in der Geschichte handelndes Subjekt lehnte Kaegi grundsätzlich ab; desgleichen die übliche Unterscheidung zwischen einer romantisch-positiven Nationsidee, in der die Nationen als Schwestern und nicht als Konkurrentinnen erscheinen, die gemeinsam Freiheit anstrebten, und einem aggressiven Nationalismus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.2360 Kaegi zeigte nicht nur die negativen Auswirkungen nationalistischer Interpretationen auf die Erkenntnismöglichkeiten in der Geschichtswissenschaft auf. Im Zentrum seiner Ausführungen stand auch der Nachweis, dass «Nation» ein Konstrukt sei, das erst im 19. Jahrhundert geschaffen wurde, und als ‚Historist‘ protestierte er dagegen, eine solche Vorstellung zum Schlüssel für das Verständnis vorausgehender Epochen zu machen. Mit Blick auf die Geschichte Europas wollte er deshalb beweisen, dass «der Staat» älter sei als die Rede von der Nation, dass dieser den fruchtbaren, stabilen Zusammenhang des Lebens garantiert hatte und damit über Jahrhunderte die Bezugsgrösse für Gefühle von Einheit
2357 2358 2359
2360
Kaegi 1946, 121–171: «Geschichtswissenschaft und Staat in der Zeit Rankes», Zit. 171. Kaegi an Weisbach, 2. 7. 1932, in Nachlass Werner Weisbach, NL 91, A III c 249. Kaegi an Weisbach, 1. 8. 1932, ebd., A III c 250. Adolf Grabowsky an Kaegi, 4. 2. 1936, in: WK 197. Grabowsky hatte sich 1934 in Arlesheim niedergelassen, wo er ein eigenes Institut, das ‚Weltpolitische Archiv‘, mit Unterstützung der Rockefeller-Stiftung führte. Er gilt als nationalkonservativer Geopolitiker. https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Grabowsky. Chiantera-Stutte 2007, 236; Kaegi 1940. «Reichsdeutsche» Antwort auf Kaegis Nationalismuskritik: Kreis 2000, 368, Anm. 12.
560
Geisteswissenschaftler
und Identität gewesen sei.2361 Die alte Eidgenossenschaft war für ihn eine Verkörperung dieser Rolle des Staatlichen.2362 Dass er nicht den modernen Machtstaat meinte, sondern eine sehr alte Ordnung, zeigte er eingehend in seinen Forschungen über den Kleinstaat.2363 Die Widerlegung der Vorstellung, nur der grosse Machtstaat könne die Kultur schützen und dem Geist Anregung und Betätigungsraum gewähren, war ihm ein wichtiges Anliegen. An Kaegis jugendliche Neigungen zur Kritik am Parlamentarismus und am Versailler Vertragswerk erinnert die Passage, in der er ‚Versailles‘ mit dem Wiener Kongress verglich, um die negativen Wirkungen einer auf der Idee des Nationalstaates gegründeten Ordnung Europas (wie 1918) zu illustrieren. «Nirgends ist es möglich gewesen, einen jener in Versailles dekretierten Nationalstaaten ohne schwere Reibungen, ohne harte Vergewaltigung von Minoritäten zu errichten und aufrechtzuerhalten. […] Die Jugend des gegenwärtigen Europa hat nach all dem unverkennbare Lust, als einzig natürliche Grundlage der Staaten die Gewalt aufzufassen.»2364 Der Kleinstaat gewinne, was er an Macht gegenüber den zentralisierten Grossstaaten verliere, an Werten wie Menschlichkeit, Kultur und ‚echter‘ Politik. Kultur ergebe sich aus Freiheit und Spontaneität.2365 Die Tradition der kleindeutschen Historiographie des 19. Jahrhunderts lehnte Kaegi dezidiert ab, indem er Droysens Thesen auf die Formel reduzierte: Die Macht sei das Wesentliche im Leben des Staates, und Recht und Kultur bräuchten den Schutz einer starken Monarchie.2366 In den 1930er Jahren implizierte Kaegis Argumentation die Verteidigung aktueller Kleinstaaten wie der Niederlande oder der Schweiz gegen das ‚Dritte Reich‘. Diese Stossrichtung legte Kaegi offen, indem er gegen aktuelle Schweizer Auffassungen polemisierte. Der Schweizer erhalte von drei Seiten Geschichtsbilder angeboten, «in denen der Begriff der nationalen Kulturgemeinschaft dominiert». Der Schweizer sehe somit seinen Staat als «Zusammenschluss von drei oder vier Fragmenten nationaler Minorität». Die Bestimmung der Stellung der Schweiz in Europa müsse jedoch von «ihrer wirklichen Vergangenheit» ausgehen, d. h. vom Bund kleinräumiger Gemeinwesen, der sich hier (und in Holland) erhalten habe.2367 Die Gegenposition war an der Universität Basel durchaus ver2361 2362 2363
2364 2365 2366 2367
Kaegi 1938, 7. Chiantera-Stutte 2007, 234 ff. Chiantera-Stutte 2007, 231, et passim; Kaegi 1938. Kaegis Korrespondenten Delio Cantimori und Federico Chabod begannen erst nach Kriegsende, sich mit dem Kleinstaat zu beschäftigen; dazu lasen sie Jacob Burckhardt und Kaegi. Chabod rezensierte 1948 die Historischen Meditationen von Kaegi, in Rivista Storica Italiana» (Chabod 1948). Cantimori gab 1960 eine italienische Übersetzung der Meditationen heraus (Bari: Laterza). Chiantera-Stutte 2007, 230. Kaegi 1938, 34. Kaegi 1938, 45–51. Kaegi 1938, 32 f. Kaegi 1938, 8.
Historiker
561
treten. Kaegis Kollege Harald Fuchs kommentierte die erste Fassung von Kaegis Aufsatz über den Kleinstaat 1938 wie folgt: «Gewiss leben wir in den Grossstaaten in einer härteren Zucht und in grösseren Gefahren, als sie im allgemeinen für die Kleinstaaten in Betracht kommen werden. Aber wer in diese Zucht und in diese Gefahren hineingeboren ist, weiss, dass sie vielfach auch geistige Kräfte zur Entfaltung bringen, die sich ohne sie kaum oder garnicht geregt hätten.»2368 Auf den Kleinstaat kam Werner Kaegi 1942 in einem Vortrag in Aarau am 21. September zurück. Die Klage gegen die deutsche Kleinstaaterei sei unberechtigt gewesen, da gerade die deutschen Kleinstaaten die Voraussetzung für die Reformation, für den preussischen Staat, für Weimar und die Klassik gewesen seien. Nur dürfe man in den deutschen Kleinstaaten keine «echten Kleinstaaten» sehen: Kaegi verstand sie als Staaten der Fürsten, die keine Verbindung zum Bürgertum hatten. Darum habe niemand ihren Untergang bedauert. Das Wesen des echten Kleinstaates bestehe in Bürgernähe und Bürgerbeteiligung. «Die Urzellen menschlicher Gemeinschaft, in denen der Einzelne aufwächst, Vertrauen erwirbt und Opfer bringt, die Familie und die Gemeinde, seine Landschaft und seine Stadt, sie sind nicht nur die Lebensorgane einer kleinstaatlichen Ordnung, sie sind auch die Urzellen, aus denen der Grossstaat langsam wächst und bei deren Verwelken er krank wird und stirbt.» Kaegi bekannte sich als Redner schliesslich zur Verteidigung einer Schweizer Eigenart, die er politisch-verfassungsmässig in einer konservativen Auffassung der direkten Demokratie gegründet sah, als Wertegemeinschaft, die von der Familie ausgehe und sich in der Gemeinde manifestiere. Vor Studenten gab er sich als Moralprediger, der in einer Rückkehr zum Glauben die Voraussetzung für einen starken Zusammenhalt der Schweiz suchte.2369 Offen führte Kaegi seinen Angriff gegen die Vorstellung, die Zugehörigkeit zum «alemannischen Stamm» beiderseits des Rheins stelle eine Verbindung her, die stärker sei als die Trennung durch eine Staatsgrenze. Die Ortsgruppe Basel der Neuen Helvetischen Gesellschaft hörte im Frühling 1939 einen Vortrag von ihm zu diesem Thema, dessen erste Fassung er in der «Neuen Schweizer Rundschau» vom April 1940 veröffentlichte.2370 Dabei ist es evident, dass er die Bedeu2368 2369
2370
Harald Fuchs an Kaegi, 23. 12. 1938, in: WK 193. Zu Fuchs: Dill 2008, und die Ausführungen über die Basler Altertumswissenschaftler, oben Kapitel 7.2.2.6. Kaegi 1946, 43–80: «Über den Kleinstaat in der älteren Geschichte Europas». Kaegis moralische Perspektive hatte einen religiösen Hintergrund. Kaegi schickte Edgar Bonjour folgendes Zitat aus Vinet zum Thema Neutralität: «Plus que jamais je suis convaincu que le véritable palladium de la Suisse, ce n’est pas sa neutralité, mais sa moralité. La première dépend de la seconde. Sans moralité, c’est-à-dire sans religion, nous ne sommes plus qu’une grande voie militaire ouverte aux nations.» Kaegi an Bonjour, 17. 1. 1944, zitiert nach Bonjour 1987, 139. Ich benütze die Publikation Kaegi 1942, 39–76: «Die Rheingrenze in der Geschichte Alemanniens».
562
Geisteswissenschaftler
tung der Grenze übertrieben gezeichnet hat, denn Gewässer trennen nicht nur, sie verbinden tatsächlich auch. Mein Interesse richtet sich jedoch auf die Rhetorik, die er einsetzte, um seiner Absicht wissenschaftlich Nachdruck zu verleihen. Den aktuellen Anlass verschwieg er in der Darstellung nicht: «Bald in einwandfreier wissenschaftlicher Fassung, bald in grober, populärer Aktualisierung wird der Deutschschweizer immer wieder an jene Bande der Stammesgemeinschaft erinnert, die einst Schwaben und Schweizer im alemannischen Kreis zur Einheit verbunden hätten.»2371 Er grenzte die historische Bedeutung dieses alemannischen Stammes zeitlich und geographisch möglichst eng ein, um die Verwendung des Wortes «alemannisch», wie sie in der Bezeichnung etwa des in Freiburg i. Br. domizilierten Alemannischen Instituts Verwendung fand, als mythologisch zu erweisen. Kaegi unterschied zwischen der Wortverwendung in der Sprachgeschichte und derjenigen in der historischen Erforschung des Frühmittelalters. In der Sprachgeschichte sah er die Wirkung von Jacob Grimms Anschauung, der von der «Dialektgemeinschaft auf die Volksgemeinschaft» schloss, indem er Volk als «Inbegriff von Menschen, welche dieselbe Sprache reden», definierte (1846). «Die Macht der schweizerischen Einheit, gewoben aus Gegenwartswillen und Erinnerung», sei stärker als «alles neu belebte, aber rein historisch bleibende Bewusstsein einer einstigen Verbundenheit aller Alemannen».2372 Kaegi verlangte eine strenge Trennung zwischen Kultur und Sprache.2373 Die Tendenz, aus der Verbreitung «alemannischer» Dialekte eine grenzüberschreitende Zusammengehörigkeit abzuleiten, nannte Kaegi in seiner privaten Korrespondenz «imperialteutonisch». Der Aufsatz über die Rheingrenze war ein gelehrter ‚Tour de force‘. Seine Belesenheit und Quellenkenntnis traten hier in den Dienst einer vaterländischen Besinnung auf Schweizerisches und entbehrte der Feinheiten, die sonst seine Prosa charakterisierten. Auch die Versuche, Weltoffenheit trotz nationalem Selbstbezug zu retten, wirkten in patriotischer Rhetorik aufgesetzt.2374 Was Werner Kaegi unter Humanismus verstand, hat er 1958 noch einmal in einem Vortrag prägnant zusammengefasst, der ihm in Basel grosse Sympathien eintrug.2375 Zu diesen Äusserungen sah er sich dadurch veranlasst, dass die Linksintellektuellen dem Faschismus einen «neuen Humanismus» entgegenstellten, der demokratisch, sozial und entweder religiös oder marxistisch fundiert sein sollte.2376 Dem hielt er den wahren, konservativen Humanismus entgegen, der auf
2371 2372 2373 2374 2375
2376
Kaegi 1942, 41. Kaegi 1942, 44. Kaegi 1942, 58. Kaegi 1942, 75 f. Kaegi 1994, 237–264: «Humanismus der Gegenwart» (Vortrag an der Jahresversammlung Schweizerischer Gymnasiallehrerverein vom 27. 9. 1958 in Basel, bei Artemis Zürich 1959 mit dem Untertitel «Eine Rede» gedruckt). Grousset 1949.
Historiker
563
der Beschäftigung mit den (griechischen und lateinischen) Originaltexten vom Altertum bis zur Renaissance aufbaute und damit antimoderne Werte verband: «Stabilitas loci», Stille, Langsamkeit, Individualismus, liberaler Konservativismus. Voraussetzung sei das Studium «in seinem vollen Umfang der modernen sowohl wie der antiken Überlieferung als eines Ganzen. Denn nur in dieser Vollständigkeit hat es Weltgehalt.» Es brauche zur Bildung eine gewisse «Enge» oder Nähe zwischen Schülern und Lehrern. Universitäten dürften nicht ins «Monströse» wachsen. Lärm und Technik seien störend. «Die Stille [ist] eine Urbedingung des schöpferischen Lebens.» Die Stille gebe es zwar auf dem Land, aber eine solche Situation stehe für die Wissenschaft im Widerspruch zum «humanistischen Sinn». Denn Bildungsstätten seien «Teile des öffentlichen Lebens, unlöslich an die Städte und an den Standort der Bibliotheken gebunden».2377 Wenig ‚Stille‘ empfand Kaegi bei seinen Tätigkeiten in der akademischen Selbstverwaltung. Schon bald nach seiner Wahl zum Ordinarius wurde er Mitglied der Fakultätskommission für die Nachfolge des Germanisten Franz Zinkernagel, bei dem Kaegi selbst unzufriedener Student gewesen war. Zinkernagel war 1935 verstorben. Die Fakultät scheute eine interne Auseinandersetzung, die zu einem profilierten Resultat geführt hätte. So vergab sie sich die Chance, ihren Anspruch auf Autonomie in Personalfragen auch einzulösen. Die entscheidenden Diskussionen fanden deshalb in der Kuratel und bei den politischen Behörden statt. Kaegi sah dies klar und bezeichnete die Fakultätskommission als den «Rat der Ratlosen».2378 Er mischte sich ein, korrespondierte mit verschiedenen Germanisten, machte seinem Freund Rehm in München deutlich, dass für ihn nichts zu gewinnen sei,2379 und versuchte zusammen mit Carl Jacob Burckhardt, seinen 2377
2378 2379
Kaegi 1994, 258 f. Gleich nach seinem Einzug im Haus Münsterplatz 4 hatte sich Kaegi bei seinem Freund Walther Rehm beklagt, er habe Mühe, sich an das Stadtleben zu gewöhnen. In Binningen (und in Oetwil) lebte er auf dem Land. Schon Jacob Burckhardts Blick auf Basel sei durch die chemische Industrie getrübt gewesen, die nach Schwefelsäure rieche. Kaegi an Rehm, 20. 10. 1936, in: WK 224. Vgl. auch Kaegis Klagen bei der Freiwilligen Akademischen Gesellschaft über das Haus Münsterplatz 4, das er bewohnte und das der FAG gehörte: «Bericht über die Wohnverhältnisse im Hause Münsterplatz 4/5 bis 1954», in: WK 192. Kaegi an Carl Jacob Burckhardt, 24. 11. 1935, in: WK 181. Kaegi referierte in der Fakultätskommission über die Kandidatur Rehms mit dem Erfolg, dass die Fakultät für ihn einen Listenplatz vorsah. Kaegi an Rehm, 4. 2. 1936, in: WK 224. «Mir hängt die Geschichte zum Hals heraus, umso mehr als ich weder für Sie, noch für meine Schweizer Freunde [Fritz Ernst] etwas Gutes voraussehe. Die Alternative scheint im Augenblick doch am ehesten auf Muschg oder Kommerell zu stehen. Sie [Rehm] scheint man als zu baslerisch zu empfinden. Man brauche keine Eulen nach Athen zu tragen, und was ähnlicher Komplimente mehr sind. Mir ist die Sache fatal und bedenklich.» Kaegi an Rehm, 20. 10. 1936, in: WK 224. Rehm beklagte sich lebhaft darüber, dass man in Basel «nicht mehr mit seinem Humanismus ankommt». Rehm an Kaegi, 24. 5. 1936, in: WK 224.
564
Geisteswissenschaftler
Zürcher Freund Fritz Ernst in eine gute Ausgangslage zu manövrieren.2380 Wie bei seiner eigenen Wahl waren die politischen Behörden entschlossen, keine Deutschen mehr nach Basel auf weltanschaulich-kulturell sensible Stellen zu berufen. «Diese Stimmung ist übrigens nicht allein von Deutschen im Reich sondern auch, und vielleicht noch mehr, von solchen ausserhalb des Reichs provoziert.»2381 So fielen interessante Namen wie Richard Alewyn, der Kaegi im Umfeld des Verfahrens besuchte2382 und den er zusammen mit einem weiteren deutschen Kandidaten, Max Kommerell, als einen von den «Georginischen» bezeichnete, aus der Debatte heraus. Walter Muschg, an den schliesslich der Ruf erging, war nicht nach Kaegis Geschmack: Zwar war er Schweizer, aber nach Kaegis Ansicht durch seine völkisch-pathetische, irrationale Sprache und an Nietzsche gemahnende Auffassung des Dichterischen disqualifiziert. Kaegi bezeichnete ihn pointiert als einen «teutonischen» Kandidaten.2383 Kaegi war auch in die Neubesetzung des kunsthistorischen Lehrstuhls 1937 involviert, die zur Wahl von Joseph Gantner führte. Werner Weisbach unterstützte ihn dabei mit Auskünften über verschiedene Kandidaten.2384 Die Diskussion drehte sich vor allem um den Zürcher Gotthard Jedlicka, für den sich Heinrich Alfred Schmid einsetzte.2385 Später
2380 2381
2382
2383
2384 2385
Welti 1993, 22. Kaegi an Carl Jacob Burckhardt, 24. 11. 1935; Burckhardt an Kaegi, 4. 12. 1935, in: WK 181. Kaegi an Rehm, 4. 2. 1936, in: WK 224. Mit den «Deutschen ausserhalb des Reichs» waren vermutlich die Basler Professoren deutscher Herkunft gemeint, die hier durch übertriebene Zeichen ihrer Anhänglichkeit an das ‚Dritte Reich‘ auffielen. Vgl. meine Abschnitte über die Mediziner, oben, Kapitel 6.3, und über die Naturwissenschaftler, unten, Kapitel 8.2.4 und 8.6. Auf Empfehlung von Heinrich Zimmer (Heidelberg) war Alewyn bei Burckhardt gewesen. Dieser hatte von ihm einen positiven Eindruck. «Zum ‚Kreis‘ [um Stefan George] steht er mit voller Freiheit.» Kaegi solle ihn empfangen, er sei ab Montag in Basel. Burckhardt an Kaegi, ohne Angabe von Monat oder Jahr, an einem 15., in: WK 181. «Ich selbst sah in den letzten Wochen diese Lösung [Muschg] kommen. Auf Seiten der Behörden ist der von Anfang an gegebene Standpunkt, wenn immer möglich einen Schweizer zu wählen, fest geblieben und ausschlaggebend gewesen. […] Muschg wird zweifellos ausserordentlich anregend wirken. Seiner Grundeinstellung nach halte ich ihn für teutonischer als die meisten vorgeschlagenen Deutschen, dies natürlich nicht in einem politischen, sondern in einem romantisch-kulturgegnerischen Sinn. On verra.» Kaegi an Rehm, 4. 6. 1936, in: WK 224. Siehe auch die Briefe, mit denen Kaegi Burckhardt über den Verlauf des Verfahrens unterrichtete, 24. 11. 1935, 25. 2. 1936, in: WK 181. Weisbach an Kaegi, 13. 6. 1937, in: WK 241. «Die Korrekturbogen des neuen Werkes von Jedlicka versprechen allerdings sehr viel. Die Furcht vor dem Journalistentum hat ja ihre zweifellose Berechtigung, aber wenn der Journalist das Künstlerische in der Kunst ernster nimmt als der Gelehrte der über alle Weiten der Wissenschaft verfügt, dann muss man den realen Grund der Panik doch etwas nachprüfen. Unter den Vorlesungen, die ich letzte Woche gehört [habe], gefäl[lt] mir die von J[edlicka] am besten.» Heinrich Alfred Schmid an Kaegi, 18. 11. 1937, in: WK 231. «Ich
Historiker
565
hielt sich Kaegi nach Möglichkeit aus den Fakultätsgeschäften heraus, um sich in Ruhe seinen Forschungen zuwenden zu können. In seinen Freundschaften und in seiner praktischen Hilfsbereitschaft zeigte sich Kaegi weitgehend frei vom zeittypischen Antisemitismus. Allerdings verwendete er gelegentlich Redensarten, mit denen er denjenigen Aspekten des damals üblichen bürgerlichen Antisemitismus Tribut zollte, mit denen man den Anschein vermeiden wollte, ein ‚Judenfreund‘ zu sein. «Auch ich löcke gern gegen den semitischen Stachel», schrieb er in dieser Manier in einem Brief, um dann fortzufahren, dass er es im Falle herausragender gelehrter Persönlichkeiten nicht als gerechtfertigt empfand, zu fragen, ob sie Juden seien oder nicht.2386 Kaegi war schon als Gymnasiast in Zürich in einem Umfeld sozialisiert worden, zu dem ganz selbstverständlich Menschen gehörten, die dann 1933 als Juden definiert wurden. Dazu zählten Verwandte und Bekannte seiner Schwägerin, aber später auch Leipziger Studienfreunde wie z. B. Georg (Georges) Guggenheim-Strauss aus Zürich, der sich aktiv für die Juden während der NS-Zeit einsetzte und als Mäzen und Kunstsammler bekannt wurde.2387 Die antisemitischen Formeln haben anscheinend den Charakter einer ritualisierten captatio benevolentiae gegenüber Briefpartnern, von denen er annahm, dass sie selbst antisemitische Überzeugungen hegten. So hielt er für berichtenswert, dass sich ein Theologe mit einem «sehr judenfreundlichen» Vortrag habilitiert habe. Bei diesem Anlass liess er sich jedoch vom Bibliotheksdirektor und Anglisten Gustav Binz überzeugen, dass ein holländischer Jude, Joseph Prijs, der die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hatte, nun wieder Niederländer werden wolle und Hilfe benötige. Prijs hatte seit 1927 in München einen Lehrauftrag für Wissenschaft und Judentum an der Universität innegehabt und bei der dortigen Israelitischen Kulturgemeinde auch als Rabbiner gewirkt.2388 Für die Frage der Staatsbürgerschaft wandte sich Kaegi
2386
2387
2388
war noch bei Gagliardi, der mir sehr beruhigende Erklärungen abgab. Die Art, wie J[edlicka] Kolleg liest, hat mir sehr gefallen.» Schmid an Kaegi, 2. 12. 1937, ebd. «Aber Leute wie Weisbach und Cassirer, dessen ‚Platonismus in England‘ ich kürzlich besprach, leisten nun einmal so Vorzügliches, dass ich da eben nur mit der aufrichtigsten Ehrerbietung antworten kann und die speziell jüdischen Antriebe zwar als Motive immer wieder bemerke, aber in ihrer Wirkung als durchaus geläutert anerkennen muss.» Kaegi an Rehm, 20. 8. 1932, in: WK 224. Guggenheim an Kaegi, 15. 12. 1922 und 20. 8. 1964, in: WK 197. Zur Person siehe Notiz zum Nachlass im Archiv für Zeitgeschichte ETH Zürich, http://onlinearchives.ethz.ch/ detail.aspx?guid=abd843ced8924182b098fca35f0e31d5. Kaegi kannte von Zürich her auch Guggenheims Bruder Paul, der die akademische Laufbahn eingeschlagen hatte. Dieser war wiederum bekannt mit Kaegis Jugendfreundin Ira. Paul Guggenheim an Kaegi, zwei Briefe von 1919, in: WK 197. Dr. Joseph Prijs war als Sohn des jüdisch-niederländischen Gelehrten Barend Prijs in Würzburg geboren. 1921 erhielt er eine Anstellung an der Israelitischen Kultusgemeinde München als Rabbiner und Religionslehrer, die er bis 1933 behielt; danach emigrierte er
566
Geisteswissenschaftler
dann wirklich an Huizinga, der Abklärungen vornahm. Kaegi schilderte ihm in typischer Manier das Auftreten von Prijs, der ihn danach aufgesucht hatte, als «nicht übermässig sympathisch, aber auch nicht gerade widerwärtig». Als er 1940/41 Schwierigkeiten mit der Fremdenpolizei bekam, weil sein deutscher Heimatschein abgelaufen war, sandte der Theologe Ernst Staehelin deswegen Schriften von Prijs an Kaegi, «damit Sie sich einen Eindruck von dem Manne verschaffen könnten».2389 Kaegi sah keine Chance, für Prijs eine Aufenthaltsbewilligung zu erwirken, da er ein Einkommen benötigte und Familie hatte.2390 Dennoch fand sich eine Lösung, und Prijs blieb bis zu seinem Tode 1956 in Basel. Kaegis Beziehung zu Werner Weisbach ist ein Beispiel seiner Hilfsbereitschaft gegenüber Juden, das wir im Detail verfolgen können. 1931 hatte Kaegi bei einem Spaziergang in Castagnola zufällig Werner Weisbach kennengelernt.2391 Dieser war um eine Generation älter als Kaegi und wirkte als berühmter Kunsthistoriker an der Universität Berlin. Als begüterter Mann verfügte er über eine eigene Kunstsammlung und ein grosses Haus, das eigens für seine Zwecke erbaut worden war. Allerdings litt er seelisch schwer an zwei gescheiterten Ehen, war gesundheitlich angeschlagen und fühlte sich trotz seiner Mitwirkung am Berliner Professorenkränzchen (Mittwochsklub) einsam. In Kaegi fand er einen jungen Mann, der sich stark in ihn einzufühlen vermochte. Daraus entwickelte sich eine Korrespondenz, die Wissenschaftliches und Privates gleichermassen intensiv behandelte. Kaegi erhielt im Gegenzug moralische Unterstützung bei der Überwindung seiner Selbstzweifel und Ratschläge für seine wissenschaftliche Karriere. Weisbach bestärkte ihn auch in der Notwendigkeit, einen eigenen, an Jacob Burckhardt orientierten Weg zu gehen. Während Kaegi noch Hoffnungen in die ‚Erneuerung‘ der Politik durch rechtsextreme Kräfte in Deutschland und der Schweiz setzte, machte ihm Weisbach 1932 klar, dass die «Nationalisten» (so bezeichnete er damals die Nationalsozialisten) Feinde des Geistes seien und dass ihr Aufstieg eine grosse Gefahr für jede Kultur und die Freiheit individueller Betätigung bedeute. 1933 erhielt Kaegi dank dieser Korrespondenz Informationen aus erster Hand, was die Nazifizierung in Berlin bedeutete. 1935 entschloss sich Weisbach zur Emigration nach Basel. Die Stadt kannte er schon von seiner Dissertation über Jacob Burckhardt her. Er beschaffte sich eine Einladung nach Basel, nicht zu Kaegi, der als Privatdozent während des Semesters noch in einer Junggesellenwohnung in Binningen hauste und die Semesterpausen im Eltern-
2389 2390 2391
in die Schweiz, wo er im Jahre 1956 verstarb. Biographische Datenbank jüdisches Unterfranken, IdNr. 28353, https://www.historisches-unterfranken.uni-wuerzburg.de/juf/Daten bank/detailsinclude.php?global=reset. Ernst Staehelin an Kaegi, 21. 12. 1941, in: WK 234. Kaegi an Huizinga, 3. 2. 1937, in: Huizinga 1991, Nr. 1247, 165 f. Huizinga an Kaegi, 10. 2. 1937, ebd., Nr. 1249, 167. Kaegi an Rehm, 29. 10. 1931, in: WK 224.
Historiker
567
haus in Oetwil verbrachte, sondern zu einem ihm bekannten Bankier. Kaegi setzte sich bei der Fremdenpolizei dafür ein, dass Weisbach die Aufenthaltserlaubnis erhielt. Er hatte für ihn das Schreiben entworfen, mit dem er die Bewilligung beantragte, und er hatte dazu im eigenen Namen ein Begleitschreiben verfasst, das die Bedeutung Weisbachs als Wissenschaftler unterstrich und aufzeigte, wie Basel aus seiner Ankunft Gewinn ziehen konnte. Nach eigener Darstellung hielt Kaegi die Erteilung der Aufenthaltsbewilligung für einen Erfolg, den er unter grossen Schwierigkeiten errang.2392 Man soll diesen Einsatz allerdings nicht würdigen, ohne zur Kenntnis zu nehmen, dass Kaegi jedenfalls im April 1933 noch der Ansicht gewesen war, die Schweiz und insbesondere deren Universitäten seien gar nicht in der Lage, Flüchtlinge aufzunehmen. «Dabei sind wir Schweizer noch gezwungen, uns gegen die Flüchtlinge zu wehren, da wir ohnehin mehr als genug Fremde im Land haben und unsre wenigen öffentlichen Stellen nicht diesen Einwanderern überlassen können, so sehr sie unsern Universitäten Ehre machen könnten.» So hatte er sich gegenüber Huizinga geäussert, als er von der Absetzung Weisbachs in Berlin und vom Schicksal Ernst Cassirers erfahren hatte.2393 Als Weisbach in Basel ankam, bestand Kaegis Rolle darin, ihn zu betreuen, ihn vor Vereinsamung zu schützen und ihn mit den massgebenden Persönlichkeiten, soweit er sie nicht schon selbst kannte, in Verbindung zu bringen. Mehrfach wurde Weisbach ins Haus Münsterplatz 4 eingeladen, was er offensichtlich schätzte. Durch Geschenke zeigte er sich dafür erkenntlich.2394 Während Kaegi in Weisbach einen bedeutenden Mann verehrte, dem wegen seiner jüdischen Herkunft in Deutschland Unrecht geschah, zeigen andere Beispiele, dass er sich auch für Studierende einsetzte, deren wissenschaftliche Leistung ihn kaum überzeugte. Von dieser Art war Kaegis Engagement für den rumänischen Studenten Menachem Beir Safran (geboren 1913). Dieser entstammte einer Rabbinerfamilie aus Ploie⌥ti.2395 Wien war in der Zwischenkriegszeit das Zentrum der osteuropäischen Intelligenz, und so schickte die Familie Safran den Sohn dorthin, um eine Ausbildung an der Israelitisch-Theologischen Lehranstalt und ein Studium der Geschichte an der Universität Wien zu absolvieren. Als 2392
2393 2394
2395
Kaegi an Huizinga, 3. 2. 1937, in: Huizinga 1991, Nr. 1247, 165 f. Konzept eines Schreibens von Kaegi an die Fremdenpolizei Basel-Stadt, 14. 10. 1935; Kopie des Gesuchs von Weisbach um Aufenthaltsbewilligung, 14. 10. 1935 (unter Verwendung von Kaegis Vorarbeit); befürwortende Erklärung von Kaegi zum Gesuch Weisbachs vom 14. 10. 1935. Die kantonale Fremdenpolizei sicherte am 18. 10. 1935 die Aufenthaltsbewilligung zur Wohnsitznahme in Basel zu. Alles in: WK 241. Kaegi an Huizinga, 26. 4. 1933, in: Huizinga 1990, Nr. 1003, 442 ff. Weisbach an Kaegi, 31. 12. 1938, in: WK 241. Weisbach schenkte Kaegi aus Anlass des Überfalls auf Polen eine polnische Münze aus dem «Schatzkästlein» seines Vaters, 30. 12. 1939, in: WK 241. Her⌥covici 2010. Lebenslauf von Safran für die Dissertation, Safran an Kaegi, 3. 12. 1939, in: WK 226.
568
Geisteswissenschaftler
1938 der ‚Anschluss‘ Österreichs an das ‚Dritte Reich‘ erfolgte, wurde Safrans Doktorvater Martin Winkler2396 ‚beurlaubt‘; eine Fortführung des Studiums war nicht möglich. Kaegi setzte sich im Juni 1938 dafür ein, dass Safran in Basel studieren und promovieren konnte.2397 Im November 1939 war Safran bereits wieder in Rumänien. Zwar entsprach das Manuskript der Dissertation von Safran nicht Kaegis Anforderungen,2398 aber er suchte den Kontakt mit Safrans Doktorvater. Winkler hatte sich in Berlin mit seiner umfangreichen Privatbibliothek niedergelassen, wo ihn Kaegis Brief erreichte. Nach anfänglichem Zögern verfasste er für die Basler Fakultät ein Gutachten über die Dissertation seines ehemaligen Wiener Schülers, die er mit der Note «gut» bewertete.2399 Kaegis Urteil entsprach eher einem «knapp genügend», denn er hielt die Arbeit über die Herzegowina für eine reine Kompilation.2400 In seiner Heimat übernahm Safran die schwere Aufgabe eines Rabbiners unter dem Terror der Eisernen Garde und der deutschen Besatzung.2401 Er versuchte der Basler Fakultät klar zu machen, dass er dafür einen Doktortitel brauchte, den er ja an sich erworben hatte, den er aber nach Basler Reglement erst führen durfte, nachdem die Dissertation gedruckt und die Pflichtexemplare bei der Universitätsbibliothek eingetroffen waren. Mit Geld, das ihm Kaegi schickte, konnte er diese Auflagen erfüllen.2402 Als Oberrabbiner überlebte er die Inhaftierung in einem KZ, wurde unter kommunistischer Herrschaft nochmals unterdrückt und reiste 1957 nach Israel aus.2403 Als Dekan war Kaegi mit dem Fall von Renate Sommerfeld befasst, die nach Abschluss ihres Basler Studiums zu Beginn des Jahres 1941 die Übersiedung in die USA vorbereitete. Unter dem Namen Renée Brand (Pseudonym Yolan Mervelt) war sie eine bekannte Persönlichkeit. Die Schriftstellerin und Psychologin floh 1933 zuerst nach Frankreich und 1934 nach Basel. Hier studierte sie seit 1936 Germanistik und schrieb die Erzählung Kleine Hand in meiner Hand, wohin
2396 2397 2398 2399 2400 2401
2402 2403
Martin Winkler war von seinem Königsberger Extraordinariat 1934 vertrieben worden und erhielt 1935 eine Professur in Wien. Winkelbauer 2018, 202. Undatiertes Konzept von Kaegi, vermutlich Juni 1939, in: WK 226. Das Material für die Dissertation wird im StABS als PA 571 aufbewahrt. Martin Winkler an Kaegi, Wien 17. 5. 1939 und Berlin 14. 7. 1939, in: WK 242. Entwurf Kaegis zu seinem Gutachten; darin stellte er fest, er übernehme das Referat nur notgedrungen, in: WK 226. «On November 10 of that year [1940], a group of approximately 30 Jews was imprisoned, with the charge that they joined a Communist meeting. They were tortured in jail for more than two weeks. On the night of the 27/28 of November, 11 of them were taken out to be murdered, including Rabbi Friedman. That night, the chief rabbi of the city, Rabbi Dr. Menachem Safran was also arrested. He was saved at the last minute, after being tortured with terrible afflictions, thanks only to special intervention.» Pinkas Hakehillot 2006, Article «Ploiesti, Romania», translated by Jerrold Landau, 221 f. Safran an Kaegi, 1. 11. 1939; 13. 11. 1939; 3. 12. 1939; 26. 2. 1940; 28. 8. 1940, in: WK 226. Safran an Kaegi, 10. 4. 1946, und weitere Briefe, meist zum Neuen Jahr, in: WK 226.
Historiker
569
gehen wir? sowie das 1940 erschienenen Werk Niemandsland, das die Lage der Flüchtlinge an der Grenze behandelte (von der Schweizer Zensur verboten). Tatsächlich erreichte sie 1941 die USA, wo sie Niemandsland in englischer Sprache als Short Days Ago veröffentlichte. 1943 promovierte sie an der Stanford University, ab 1944 lebte sie in Los Angeles, erwarb die Mitgliedschaft des C. G. JungInstituts und praktizierte dann in San Francisco.2404 Kaegis Unterstützung bestand in der Hilfe bei der Beschaffung eines Leumundszeugnisses und einer Bescheinigung über das Basler Studium. Sie dankte ihm für seine «ausserordentliche Liebenswürdigkeit».2405 Ein ähnliches, aber viel schlechter dokumentiertes Schicksal scheint hinter der Anfrage von Ilse Kahn aus Frankfurt am Main zu stehen, die im Mai 1939 als frühere Schülerin von Kaegi mit ihm über die Chance korrespondierte, für die geplante Ausreise aus Deutschland nach den USA ein Visum für die Durchreise durch die Schweiz zu erhalten.2406 Der katholische Stadtpfarrer von Donaueschingen, Heinrich (Karl Joseph) Feuerstein, war in Basel als Erforscher der Kunst von Martin Schongauer und als Vorsteher der Fürstlich Fürstenbergischen Kunstsammlungen bekannt. Er gehörte zur katholischen Opposition gegen die Nationalsozialisten und kritisierte von der Kanzel aus das Euthanasieprogramm T4. Zu Weihnachten 1941 erwähnte er das Martyrium der verfolgten Priester und Laien; auf Neujahr 1942 verurteilte er den Krieg. Nachdem er schon länger von der Gestapo beobachtet worden war, wurde er am 7. Februar 1942 verhaftet und nach einem Aufenthalt im Gefängnis von Konstanz am 5. Juni 1942 nach Dachau deportiert, wo er im Juli 1942 umkam. Kaegi gehörte zusammen mit dem Basler Denkmalpfleger Rudolf Riggenbach zu einer Gruppe von Schweizern, die sich für Feuersteins Freilassung einsetzten. Sie wurden beim deutschen Gesandten Otto Köcher vorstellig und glaubten, bei der eidgenössischen Fremdenpolizei schliesslich eine Einreiseerlaubnis erwirkt zu haben, als sie die Mitteilung vom Tod Feuersteins erreichte.2407 2404 2405 2406
2407
Wall 2004, 52–54. Renate Sommerfeld an Kaegi, 30. 1. 1941; 7. 2. 1941; 8. 3. 1941; 17. 3. 1941, in: WK 228. Ilse Kahn, Frankfurt/Main, an Kaegi, 1. 5. 1939, in: WK 208. Sie konnte in Deutschland noch die Dissertation drucken lassen. Die amerikanische Botschaft lasse sie auf ein Visum warten. Die Briefe enden hier. Müller 1961. Durchschlag eines Briefentwurfs vom 25. 6. 1942 an Dr. Otto Köcher, Deutscher Gesandter, Bern, in: WK 186. Im Unterschriftenfeld von der Hand Kaegis: «fest:» «H. A. Schmid, Dr. Köpen v. Kupferstichkabinett, Dir. Künzel [?] v. d. Gewerbeschule, Dr. Riggenbach. [mit Fragezeichen:] Dr. Ed. Preiswerk, Prof. Zemp, Dr. Poenhel [?], Dr. Meier-Rahm, Prof. Wölfflin.» Kaegi notierte sich dazu: «Rothmund Dr. sondieren, fragen, wie er sich zur Frage der Einreise stellen würde, für den Fall, dass er freigelassen würde. Verhaftet, weil sie vermuten, [dass] er Sammelstelle für katholische Opposition ist. Stadtpfarrer in Donaueschingen ca. 65 Jahre alt. Dr. Riggenbach: die katholischen Kreise würden sicher für ihn aufkommen. Logis bei Dr. Riggenbach bis Ende des Krieges. Als kathol.
570
Geisteswissenschaftler
Vom Anlass her gehörte auch Kaegis Einsatz für die Sängerin und Pianistin Annette Brun noch in die Kriegszeit, auch wenn der Konflikt erst ab Mai 1945 ausgetragen wurde. Brun, populär geworden in der Titelrolle der «Gilberte de Courgenay» des Volksstücks von Hans Haug und Rudolf Bolo Maeglin, weigerte sich, zusammen mit der Altistin Elsa Cavelti auf der Bühne des Basler Stadttheaters aufzutreten. Cavelti, die die Existenz von Vernichtungslagern in Deutschland leugnete, hatte von 1936 bis zur Schliessung der deutschen Bühnen 1944 in Deutschland gearbeitet und war für die Saison 1944/45 in Basel engagiert worden. Brun sollte wegen Vertragsbruch entlassen werden. Kaegis Einsatz für Annette Brun hatte auch eine Spitze gegen den sozialistischen Regierungsrat Carl Miville, der die politische Dimension (Brun als gute Schweizerin gegen Cavelti, die im nationalsozialistischen Deutschland Karriere gemacht hatte) nicht berücksichtigte. Die Proteste, an denen sich Kaegi beteiligte, bewirkten, dass sie als Gast für die Spielzeit 1945/46 vorübergehend wiedereingestellt wurde. 1947 begab sie sich nach Israel.2408 Kaegi unterhielt Beziehungen zu den italienischen Gelehrten, die er jeweils auffrischte, wenn er das Land besuchte. Die Verfolgung der italienischen Juden nach Abschluss des Paktes zwischen Mussolini und Hitler erscheint nicht in den von mir eingesehenen Dokumenten des Nachlasses. Vielmehr war Kaegi beteiligt an Einladungen von Italienern, Faschisten oder nicht, durch die schweizerischen Organisationen zur Pflege der Beziehungen zwischen der Schweiz und Italien. Die Zürcher Organisation stand im Ruf, dem faschistischen Regime nahezustehen, während der Basler Ableger der Gesellschaft davon wenig erkennen liess. Ein vehementer Gegner der faschistischen Tessinpolitik (Irridenta) wie der Italianist an der Basler Universität, Arminio Janner, einer der Duzfreunde von Kaegi,2409 sass im Basler Vorstand.2410 Es war hier bekannt, dass seit etwa 1939 Lehrund Publikationsverbote gegen die akademischen Gegner der Faschisten ausge-
2408 2409 2410
Geistlicher keine Anstellung möglich.» Rudolf Riggenbach an Kaegi, 8. 9. 1942. Alles in: WK 225. Annette Brun, Zürich, an Kaegi, 5. 7. 1945, in: WK 180. Blubacher 2005. Korrespondenz in: WK 203, fast immer undatiert. Kaegis Darstellung, die Gesellschaft zur Pflege kultureller und wirtschaftlicher Beziehungen mit Italien habe den Zweck gehabt, hervorragende Männer «unabhängig vom Wohlwollen der damaligen italienischen Behörden» einladen zu können, traf für die Basler Ortsgruppe zu. Einaudi 1967, 13. In der Basler Gesellschaft wurde Kaegi 1949 Vorstandsmitglied (Dr. A. Gansser an Kaegi, 28. 11. 1949, in: WK 233; Jahresbericht der Gruppe Basel vom 3. 1. 1950). In den Jahren zuvor gab es nur einen Kontakt: Er betraf die gemeinsame Organisation von althistorischen Vorträgen von Prof. Giorgio Pasquali (Florenz) in Zürich und Basel. Reto R. Bezzola an Kaegi, 2. 12. 1939, in: WK 233. Siehe auch Rudolf Speich an Kaegi, 5. 12. 1939, in: WK 228. Der Vortrag von Pasquali fand in Basel am 17. 1. 1940 statt; er sprach über «Rom und die Griechen vor Pyrrhus» (Basler Stadtbuch, Chronik vom 17. 1. 1940).
Historiker
571
sprochen wurden. Gefährlich wurde die Lage vor allem nach dem Zusammenbruch des Badoglio-Regimes. Zu Kaegis italienischen Bekannten gehörte Delio Cantimori. Dieser hatte 1933 – als italienischer Faschist – den Nationalsozialismus kritisiert, den er als konfuse und irrationale Bewegung einschätzte; zugleich zeigte er Sympathien für die ‚Linke‘ im Nationalsozialismus und den Nationalbolschewismus. Nach 1938 verstand er sich als Kommunist, ohne entsprechende öffentliche Bekenntnisse abzugeben oder sich in Aktivitäten einzulassen. Er verfolgte seine Karriere innerhalb des faschistischen Bildungssystems weiter und unterrichtete ab 1940 an der Scuola Normale in Pisa, immer im Gefolge von Giovanni Gentile.2411 Der Umstand, dass Cantimori während des Krieges zu Vorträgen in die Schweiz eingeladen wurde2412 und dass Kaegi die Übersetzung von dessen Hauptwerk Eretici italiani del Cinquecento (das italienische Original war 1939 erschienen) begann, deutet darauf hin, dass er sich für dessen Schicksal ebenso wie für dessen Forschungen interessierte.2413 Cantimoris Häretiker waren hochgebildete Anhänger reformatorischer Glaubensrichtungen, für die sie ins Exil gingen – für Kaegi offensichtlich ein wichtiger Anstoss, da in dieser Zugehensweise einerseits geistesgeschichtlich über einen Aspekt der Reformation geforscht wurde, der nicht (wie Luther, Zwingli oder Calvin) staatsbezogen war, und andererseits Kaegis Beschäftigung mit der Frage der Toleranz, die er selbst an Sebastian Castellio untersuchte, Anregungen erfuhr.2414 Luigi Einaudi war als liberaler Ökonom und Politiker gegen Ende der dreissiger Jahre mit dem Mussolini-Regime in Konflikt geraten. Unter dem BadoglioRegime wurde er zum Rektor der Universität Turin ernannt, was als antifaschistische Massnahme galt und ihn nach der Übernahme der Macht in Norditalien durch die Deutschen und die italienischen Faschisten in Gefahr brachte.2415 Der 69-jährige floh Ende September 1943 mit seiner Frau von Turin nach Martigny. Nach einem Aufenthalt in Lausanne bezog er am 18. Oktober 1943 in Basel ein
2411 2412
2413
2414 2415
Pertici 1997. Unter Mitwirkung der Gesellschaft Schweiz-Italien wurde Cantimori per Mai 1942 in die Schweiz eingeladen. Gansser an Kaegi, 7. 4. 1942, in: WK 195. Eidg. Fremdenpolizei Bern an Kaegi, 13. 2. 1942, in: WK 188. Vom Lehn 2012, 187, bezeichnet Cantimori als «Vorzeigewissenschaftler der kommunistischen Partei», berichtet aber zugleich, dass auch Gerhard Ritter mit ihm enge Kontakte pflegte. Für die Übersetzung war zunächst Georgine Oeri vorgesehen, bis sich Kaegi 1942 entschloss, diese Arbeit gegen ein Honorar von Fr. 2’000 zu übernehmen. Der Verleger Benno Schwabe hatte zunächst abgelehnt, eine deutsche Fassung von Cantimoris Eretici herauszubringen, überwand seine finanziellen Bedenken dann allerdings. Benno Schwabe an Kaegi, Basel, 29. 12. 1941 und 11. 6. 1942, in: WK 233. Charakterisierung des Gegenstands ‚Häretiker‘ bei Cantimori: Seidel Menchi 2013, 25. Einaudi 1997, xix.
572
Geisteswissenschaftler
Appartement bei entfernten Verwandten.2416 Den aus Deutschland emigrierten Juristen Hans Lewald traf er in Basel, ferner August Simonius und den Leiter der Basler Sektion der Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen zu Italien, den Chemiker August Gansser-Burckhardt.2417 Kaegi versprach im Bedarfsfall materielle Hilfe,2418 Janner honorierte Artikel für die von ihm mitherausgegebene «Svizzera Italiana»2419 und Fritz Mangold schickte ihm hundert Franken aus dem Fonds zur Unterstützung ausländischer Gelehrter.2420 Zudem bezahlten die «Basler Nachrichten» Honorare für Artikel von Einaudi; vom «Schweizerischen Beobachter» erhielt er Geld für seinen Artikel «Tagebuch einer Flucht aus Italien».2421 Der Basler Regierungsrat Carl Ludwig lud ihn zum Essen ein.2422 Er wurde in Basler Familien ‚herumgereicht‘ und wunderte sich dabei über den zur Schau getragenen Reichtum der Professoren.2423 Das Verhältnis zu Kaegi scheint nach Einaudis Tagebuch zu schliessen nicht besonders eng gewesen zu sein.2424 Einige Professoren der Basler Universität setzten sich dafür ein, dass er einen Lehrauftrag erhalten sollte, unter ihnen Kaegi, Janner und die Ökonomen Luigi (Louis) Vladimir Furlan, Edgar Salin und Valentin Fritz Wagner. Aus dem Lehrauftrag an der Basler Universität wurde nichts – der Antrag der Universität lautete nur auf «einige Vorlesungen», und der Basler Regierungsrat verschleppte 2416
2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423
2424
Marguerite Kirchhofer, Schwägerin des Sohnes Mario, Witwe von Mario Michels, Pianistin. Einaudi 1997, xxii, 22. Einaudi 1967, 34, bezeichnet Kirchhofer als eine «Dame, […] die mit einem Bruder unserer Schwiegertochter verheiratet gewesen war; sie war Witwe geworden und lebte allein in Basel». Einaudi 1997, 57, Eintrag vom 10. 12. 1943. Einaudi 1997, 40, Eintrag vom 9. 11. 1943. «Kaegi, Signora Simonius (a Margherita), Wagner […] offrono aiuto, se necessario.» Einaudi 1997, 52, Eintrag vom 30. 11. 1943. Einaudi 1997, 51, Eintrag vom 27. 11. 1943. Einaudi 1997, 51 Eintrag vom 24. 11. 1943. Chefredaktor des Schweizerischen Beobachters war Max Adolf Ras. Einaudi 1997, 100, Eintrag vom 10. 3. 1944. Einaudi 1997, 196, Eintrag vom 31. 10. 1944, zu seinem Besuch bei Walther von Wartburg, damals Dekan. Wir erfahren hier, dass sich von Wartburg in Basel nicht wohlfühlte; die Kultur kam ihm oberflächlich vor, und die Basler interessierten sich kaum für das Italienische. Einaudi frühstückte mit von Wartburg im Restaurant «Batterie» auf dem Bruderholz. Eintrag vom 16. 11. 1944, ebd. 207. Einladung bei Kaegi und Frau am 5. 3. 1944. Bericht darüber erst im Eintrag vom 8. 3. 1944 (Tee bei Salin). Einaudi beschreibt das Haus mit 17 Zimmern, die Aussicht auf den Rhein, den Garten und die Terrasse. Über Kaegi notiert er nur: «Sopra deve [del «piano nobile»] star lui con i suoi libri, pare 10’000. Poi si sa che la signora (un donnone grosso, il doppio di lui) è un medico assai bravo, vedova del predecessore nella cattedra di storia di K[aegi] (e si dice scherzosamente che K[aegi] ereditò moglie, cattedra, figli e biblioteca), predecessore a sua volta vedovo con due figli, ora grandi. Ne parla come di suoi ragazzi, fu a Torino, Firenze ecc. e Roma. Anch’esse all’Albergo Città. Bei libri, antichi basilesi; ed altri. Tutto il Marin Sanudo.»
Historiker
573
das Gesuch bis nach Kriegsende.2425 Immerhin konnte Einaudi einige Gastvorträge halten. Genf bot ihm schliesslich vom April bis Oktober 1944 die erhofften Möglichkeiten. William Rappard verschaffte ihm ein Stipendium der RockefellerStiftung, er unterrichtete an der Universität, gab Kurse für internierte Militärpersonen und fand dort eine Gruppe junger Italiener vor, die seine Lehre schätzten und es ihm ermöglichten, sein Wissen für die Zeit nach Kriegsende weiterzugeben. Kaegis Einschätzung, die Basler hätten Einaudi «aus der Einsamkeit seines Exils» befreit, müsste angesichts der Bedeutung der Genfer Zeit relativiert werden.2426 Lange nach Kriegende brachte Kaegi Einaudis Witwe dazu, ihre Erzählung des Exils in deutscher Übersetzung in Basel zu publizieren, und im von Kaegi verfassten Begleittext kam zum Ausdruck, wie hoch Kaegi die Ehre schätzte, den Mann, der 1945 zunächst die italienische Währung sanierte, dann Mitglied der Konstituanten, Mitglied der Regierung und schliesslich Staatspräsident wurde, in Basel mitbetreut zu haben.2427 Bereits erwähnt habe ich die Verdienste, die sich Kaegi um Johan Huizinga erwarb. Auch während des Krieges tat Kaegi insofern viel für ihn, als er dessen Publikationsprojekte weiterhin betreute. Der Kontakt riss allerdings während Huizingas Geiselhaft2428 ab; wobei Carl Jacob Burckhardt bei den Besatzungsbehörden für Huizinga intervenierte und Kaegi darüber unterrichtete.2429 Nachher hatte Huizinga nur noch zweimal mit Kaegi Kontakt.2430 7.5.11 Kaegis Beziehungen zu Deutschland 1933 bis 1945 Kaegis Präsenz in Deutschland war zwischen 1933 und 1945 gering. Christoph Steding, der das Verhältnis der «germanischen Randstaaten» zur Reichsgrün2425 2426 2427 2428
2429 2430
Einaudi 1967, 13. Einaudi 1967, 13. Einaudi 1967, 11–18: «Zum Geleit» (Werner Kaegi). Dazu der mit Vorsicht zu lesende Bericht von Heinrich Ritter von Srbik an Kaegi, 20. 3. 1948, in: WK 230. Von Srbik behauptet dort, er habe Huizinga bei einem seiner (von Srbiks) Vorträge in den Niederlanden gesprochen, und Huizinga habe ihm aufgetragen, Seyß-Inquart zu erklären, dass die holländischen Universitäten und er selbst «zum äussersten Widerstand entschlossen» seien. Daraufhin wurde Huizinga in ein Geisellager überführt. Von Srbik wollte dagegen Protest eingelegt haben. «[…] ich weiss es, dass meine Intervention bei Seyss-Inquart die Entscheidung für Huizingas Entlassung aus dem Lager herbeigeführt hat». Carl Jacob Burckhardt an Kaegi, 23. 10. 1942, in: WK 181. Leiden unter deutscher Besatzung: Hirschfeld 1997. Huizinga an Kaegi, 31. 1. 1942, in: Huizinga 1991, Nr. 1454, 333 (letzter Brief vor der Inhaftierung); Huizinga an Kaegi, 20. 4. 1943, ebd., Nr. 1506, 392. «Die allgemeine Lage hier ist eigentlich fürchterlich, wenn es uns auch persönlich gut geht.» Huizinga an Kaegi, 21. 1. 1944, ebd., Nr. 1522, 405 f.
574
Geisteswissenschaftler
dung 1870/71 erforschen wollte, warf ihm vor, er mache einen Bogen um das Land, seit Hitler regiere.2431 Tatsächlich nahm Kaegi nicht an den Dozententreffen der Freiburger und Basler Universitätslehrer in Badenweiler teil und hielt auch keine Vorträge in Deutschland. Schon 1935 bemerkte Kaegi: «Bei mir selber ist die Stimmung so weit gediehen, dass mir eine Reise nach Deutschland immer unmöglicher erscheint. Ich muss diese Freude wohl denjenigen überlassen, die hier nicht öffentlich zu reden haben. Ein Freund von mir schlug kürzlich die Möglichkeit der Übersiedelung vom Tessin nach Basel, die mit grossen finanziellen Vorteilen verbunden gewesen wäre[,] aus, weil ihm Basel zu exponiert schien.»2432 Publizistisch hielt er eine (schwache) Verbindung zu deutschen Zeitschriften und Verlagen aufrecht unter der Voraussetzung, dass diese nicht markant den Nationalsozialismus propagierten. So schrieb er 1935 eine Buchbesprechung für die «Frankfurter Zeitung»2433 und lud diese Zeitung auch ein, über die Basler Erasmusfeiern zu berichten. Empört war er, als die «Vossische Zeitung» ohne sein Einverständnis eine Arbeit von ihm nachdruckte.2434 Mit der Deutschen Verlagsanstalt hielt Kaegi Verbindung und bezog von ihr Honorare, weil sie an der Jacob Burckhardt-Ausgabe beteiligt war, für die Kaegi die Kultur der Renaissance in Italien herausgegeben hatte.2435 Für seine eigenen Publikationen hielt er sich an schweizerische Verlage, namentlich an Wachsmuth und Fretz in Zürich und Schwabe in Basel. Doch auch Schweizer Verlage pflegten nach 1933 weiter Kon2431
2432 2433 2434
2435
Steding sah eine «Gefahr» der «Verbaslerung» der europäischen (deutschen) Kultur. Chiantera-Stutte 2007, 233, mit Bezug auf Steding 1938. Kaegi hatte Steding 1932 kennengelernt. Steding leide an «dieser merkwürdigen deutschen Reichstheologie», berichtete Kaegi damals an Huizinga, 13. 10. 1932, in: Huizinga 1990, Nr. 946, 386 f. Steding besuchte auch Huizinga, der sich mit ihm nicht verstand; Steding an Kaegi, 2./3. 7. 1933, in: WK 235. Kaegi an Rehm, 26. 7. 1935, in: WK 244. WK 192. Zur Verteidigung seiner Interessen wurde Kaegi 1934 Mitglied des Schweizerischen Schriftstellervereins. Schweiz. Schriftstellerverein an Kaegi, 12. und 19. 1. 1934, in: WK 233. Da Honorare aus dem deutschen Machtbereich über die Clearingstelle abzurechnen waren, gestattet die Korrespondenz einen gewissen Einblick in Kaegis Bezüge aus Deutschland und den deutsch besetzten Ländern. Dies betraf den Pantheon Verlag in Amsterdam (für Übersetzungen, Briefwechsel mit der Verrechnungsstelle vom 4. 11. 1942, in: WK 233), den S. Fischer Verlag Berlin (Honorar für einen Beitrag zur «Neuen Rundschau», ebd. 19. 11. 1941) und die Deutsche Verlagsanstalt in Stuttgart (ebd. 27. 8. 1942 und 24. 3. 1944). Auch die Korrespondenz mit dem S. Fischer Verlag 1941: Einen Aufsatz über Basel in den 1860er und 1870er Jahren für die «Neue Rundschau» zu schreiben, lehnte Kaegi ab, aber er sandte dem Verlag einen Aufsatz über den jungen Michelet, für den er das erwähnte Honorar erhielt, S. Fischer Verlang (Hans Paeschke) an Kaegi, 3.5., 26.5., 24.7., 15.9., 15. 10. 1941, in: WK 191.
Historiker
575
takt zu Deutschland, waren dort durch Partner vertreten und suchten sich im deutschen Buchmarkt zu halten. Einblicke in Kaegis Verhalten gegenüber deutschen Verlagsunternehmen erlaubt die Anfrage vom 16. Januar 1935, den Artikel «Jacob Burckhardt» für die Neue Deutsche Biographie (ein Projekt des Propyläen-Verlags) zu verfassen.2436 Gemäss Prospekt diente die Biographie dem Ziel, «eine deutsche Geschichte in Charakterbildern» vorzulegen. Hier war Kaegi zunächst durchaus gewillt, seine Deutung des Verhältnisses, das Burckhardt zu Deutschland entwickelt hatte, prägnant mitzuteilen. Am 21. Januar 1935 verpflichtete er sich vertraglich zur Lieferung des Artikels gegen 200 Mark Honorar und skizzierte für sich die Grundzüge seines Beitrags.2437 Als ihm jedoch bewusst wurde, dass der Verlag das Projekt zeitgemäss-nationalistisch aufzäumte und «deutsch» in einem imperialen Sinn verstand, zog er sich zurück. Zur Begründung schrieb er an den Verlag: «Eben bemerke ich, dass nach dem mir kürzlich zugesandten Prospekt der neue Haupttitel der ‚Neuen Deutschen Biographie‘ offenbar lauten soll: ‚Die grossen Deutschen‘. Sollte diese Annahme richtig sein, so würde ich meinen Beitrag über Jacob Burckhardt leider nicht abliefern können.» «Deutsch» als Adjektiv zu «Biographie» sei unproblematisch, aber das Substantiv «Deutsche» impliziere etwas, was er nicht mittragen wolle. Für ein sauberes deutsches Sprachempfinden, auf das auch wir Deutschschweizer Anspruch erheben, sind Gottfried Keller, C. F. Meyer, Böcklin, Gotthelf, Pestalozzi keine Deutschen, sondern Schweizer. […] Was Burckhardt betrifft, so repräsentiert er geradezu die entscheidende Wendung, die Scheidung des kulturell-Deutschen vom politisch-national-Deutschen, der fortan allein diesen Namen trägt. Diese Wendung vorzustellen wäre mir eine wahrhafte Freude gewesen. Je mehr sich Deutschland seit 1848 politisierte u[nd] nationalisierte, umso mehr zerstörte es die kulturelle Gemeinschaft mit der Schweiz, umso mehr distanzierte sich Jacob Burckhardt von Deutschland, in dem Masse, dass er einem Freunde, der Bismarck besuchen ging, die Freundschaft kündigte. […] Burckhardt hat als Warner u[nd] Prophet mit heimlicher Liebe leidenschaftlich am deutschen Schicksal Anteil genommen. In einer Neuen Deutschen Biographie hat er also mit Recht seinen Platz. Ein Deutscher aber ist Burckhardt nicht gewesen. Und ich könnte es meinen Landsleuten gegenüber nicht verantworten, ihn unter dieses Licht des Obertitels, das die wahre kulturelle Situation mehr
2436
2437
Gedruckte Einladung zur Mitarbeit vom 16. 1. 1935, unterzeichnet von Wilhelm von Scholz und Willy Andreas, in: WK 219. Den Auftrag hatte Felix Stähelin vermittelt. Zu Willy Andreas: Remy 2007, 28 f. Notizen von Kaegis Hand auf den leeren Seiten des Prospekts/der Einladung zur Mitarbeit vom 16. 1. 1935.
576
Geisteswissenschaftler verschleiert als beleuchtet, stellen zu lassen. Auch dem guten Namen Burckhardts bin ich diesen Verzicht schuldig.2438
Der Verlag annullierte darauf am 5. August 1935 die Vereinbarung vom Januar ohne ein Wort des Bedauerns.2439 Erst für die Neue Deutsche Biographie der Nachkriegszeit schrieb Kaegi den Artikel über Jacob Burckhardt ohne Zögern.2440 Während des Krieges versuchten deutsche Verlage, über schweizerische Autoren aus der Isolation auszubrechen. Einer davon war Koehler & Amelang in Leipzig. Dass dieser 1941 Kaegi um Manuskripte bat und hoffte, dessen Burckhardt-Biographie verlegen zu können, hatte einen persönlichen Hintergrund: Der Verlagsleiter Hellmut Köster hatte mit Kaegi in Leipzig studiert. Diese Bemühungen erstreckten sich bis 1943, ohne Erfolg für das Leipziger Unternehmen.2441 Weiterhin pflegte er aber, soweit es Zensur und Kriegsumstände erlaubten, Briefkontakte zu ausgewählten deutschen Freunden, unabhängig davon, ob diese anfänglich eine gewisse Begeisterung für die ‚nationale Revolution‘ zu erkennen gegeben hatten. Viele dieser Kontakte waren ephemer und zeigten Kaegis Distanz zu damaligen deutschen Ansichten. Dazu gehörte etwa der Briefwechsel mit dem Gundolf-Schüler Horst Rüdiger, der 1937 endete. Rüdigers Thema, der (neue, ‚Dritte‘) Humanismus in Deutschland im Vergleich zu angrenzenden Ländern, hätte Kaegi an sich interessiert. Aber Rüdiger hatte ein Kapitel über «Humboldt und George» vorgesehen, was Kaegi nicht schätzte, und der Autor verstand nicht, warum Werner Jaeger in der Schweiz nach Kaegis Auffassung keine Rezeption erfahren haben sollte (im Hinblick auf die Basler Klassischen Philologen täuschte sich Kaegi nicht).2442 Zudem wollte Rüdiger bei Jacob Burckhardt eine Affinität für die «lateinische Kulturrasse» erkennen, die es in Deutschland nicht gegeben habe. Hinter diese Bemerkung setzte Kaegi ein Ausrufezeichen, gefolgt von einem Fragezeichen, und die Korrespondenz war beendet.2443 Zu Kaegis Briefkontakten gehörte auch Gerhard Ritter in Freiburg. 1938 hatte er ihm vorgeschlagen, Beiträge für das «Archiv für Reformationsgeschichte» zu schreiben (offensichtlich vergeblich), und 1940 bat er Kaegi um einen Aufsatz für die Festschrift Walther Köhler. Das Interesse war aufseiten Ritters 2438 2439 2440
2441 2442 2443
Undatiertes Konzept Kaegis für seinen Absagebrief an den Propyläen-Verlag, in: WK 219. Propyläen-Verlag an Kaegi, 16.1., 21.4., 2.5., 5. 8. 1935, alles in: WK 222. Graf Stoltenberg, Schriftleiter der NDB, an Kaegi, Anfrage, 14. 5. 1952. Ders., Dank für die Annahme des Auftrags, 17. 10. 1952. Ders., Dank für die Ablieferung des Artikels, 29. 4. 1953, alles in: WK 219. Verlag Koehler & Amelang, Leipzig, Hellmut Köster, 27. 11. 1941; 21. 1. 1942; 30. 1. 1943. Alles in: WK 209. Siehe zur Ablehnung von Werner Jaegers ‚Drittem Humanismus‘ in Basel Kapitel 7.2.2.4. Horst Rüdiger an Kaegi, 27. 3. 1933; 1.7., 26. 7. 1937, in: WK 226. Rüdiger lebte meistens in Italien als Schriftsteller, Übersetzer und seit 1938 auch als Lektor an italienischen Universitäten. Gossens 2003.
Historiker
577
grösser als bei Kaegi; Ritter brauchte Kontakte, um der Isolation zu entgehen.2444 Kaegi schickte ihm darauf einige seiner Publikationen. 1946 war Ritter dann bei Kaegi zu Gast,2445 und 1948 beteiligte sich Kaegi an der Festschrift für Ritter, was dieser verdankte.2446 Begonnen hatte der Austausch unter einem schlechten Stern: Ritter war überzeugt gewesen, den Basler Lehrstuhl zu erhalten, auf den Kaegi gewählt wurde. Danach versuchte Kaegi, mit Ritter in ein Verhältnis zu gelangen, indem er sich betont als Freund Deutschlands darstellte: Ich denke mit grosser Dankbarkeit an die Zeit meines Studiums in Leipzig und an meine deutschen Reisen, und ich sehe mit grossem Schmerz meine Beziehungen zu Deutschland auf ein Minimum zusammenschmelzen. Sollte meine Ernennung diese Distanzierung noch verstärken, so würde das die Freude an meiner kommenden Tätigkeit wesentlich beeinträchtigen. Die stärkste Bestätigung schweizerisch-deutscher Zusammenarbeit wäre es zweifellos gewesen, wenn Sie an meiner Stelle gewählt worden wären.2447
Ein echtes Anliegen vermischte sich hier mit nicht sehr geschickter Diplomatie. Gewissermassen als Antwort darauf kritisierte Ritter lebhaft Kaegis preussenfeindliche Rhetorik in dessen Michelet.2448 Herzlich-freundschaftlich blieb der Briefwechsel zwischen Kaegi und Walther Rehm, zuletzt Professor für Neuere deutsche Literaturgeschichte in Freiburg, der 1929 mit einer Frage zu Kaegis Ausgabe der Kultur der Renaissance in Italien begonnen hatte2449 und erst mit Rehms Tod endete. Erhalten sind die Briefe von beiden Seiten, während wir sonst meist nur diejenigen haben, die an Kaegi geschickt wurden.2450 Der Briefwechsel weitete sich auf alle möglichen Fragen des Gelehrtenlebens und, wenigsten für die beginnenden 1930er Jahre, auf politische Themen aus. Der Austausch während des Krieges bezog sich oft nur auf Leseeindrücke; anderes unterblieb vermutlich wegen der Zensur. 1942 druckte die «Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde» mit Kaegis Unterstützung einen Aufsatz von Rehm.2451 Welche Art von Bemerkungen unter der Zensur möglich waren, zeigte der Brief vom 12. Januar 1941: Rehm hatte in Berlin am Winckelmannfest den Festvortrag gehalten über Winckelmann und Lessing; dar-
2444 2445 2446 2447 2448 2449
2450 2451
Ritter an Kaegi, 10. 5. 1938; 3. 7. 1940, in: WK 225. Briefe Ritters an Kaegi, 1942 bis 1946, in: WK 225. Ritter an Kaegi, 31. 5. 1948, in: WK 225. Kaegi an Ritter, 30. 6. 1935, in: WK 225. Ritter an Kaegi, 20. 8. 1936, in: WK 225. Kaegi an Rehm, 19. 11. 1929 und 29. 1. 1930, in: WK 224. Als Gegenleistung für den Einblick in Kaegis Einleitung zu Burckhardts Kultur der Renaissance in Italien kommentierte Rehm Kaegis Text. WK 224. Brief vom 31. 12. 1941; Rehm an Kaegi, 15. 8. 1942, in: WK 224.
578
Geisteswissenschaftler
über berichtete er, «etwas anstrengend war das alles, nicht der Vortrag, sondern das Drum und Dran».2452 Nach dem deutschen Zusammenbruch war Kaegi wieder indirekt präsent durch «Liebesgaben», von denen liberale Kollegen wie Friedrich Meinecke,2453 aber auch betont national ausgerichtete Historiker wie Rudolf Kötzschke2454 profitierten. Zudem beteiligte er sich an der Lieferung von Büchern für den Wiederaufbau zerstörter Universitätsbibliotheken, allerdings mit einer Vorliebe für die Niederlande (dies erklärt sich teils aus Kaegis Verbindungen zu Holland, teils aus dem Umstand, dass sich die Universität Basel besonders um den Wiederaufbau in Utrecht kümmerte).2455 Wenn ich richtig orientiert bin, galt auch seine erste Auslandsreise nach Kriegsende den Niederlanden und nicht Deutschland. Kaegi war einer der Initianten der Schweizerischen Vereinigung akademische Nachkriegshilfe. Hans Rudolf Schinz, Mediziner in Zürich, schrieb dazu an Kaegi, sicher in dessen Sinn: «Die von Ihnen geplante Gründung begrüsse ich sehr. Wir müssen so rasch als möglich aus unserer Isolierung herauskommen und müssen dafür Sorge tragen, dass aus den dünnen Fäden, welche während der Kriegsjahre noch bestanden haben, wieder solide Stricke werden zu Nutz und Frommen aller Gutmeinenden.»2456 7.5.12 Ergebnisse Werner Kaegi verwirklichte in seiner Professur ein Programm der Verteidigung des freien, lebendigen, individualistischen, humanistischen Geistes gegen den Nationalsozialismus. Der junge Kaegi war nicht gegen die Anfänge von Faschismus und Frontismus immun gewesen. Er blieb lange fokussiert auf eine Gefahr von Links. Dann aber wandte er sich nach einer ambivalenten Übergangsphase gegen das nationalsozialistische System des direkten und indirekten Zwangs zur Heuchelei, Lüge, Pseudowissenschaft und der unmittelbaren Bedrohung der Träger des Geistes. Er tat dies im Einklang mit der Formulierung von Werner Weisbach,
2452 2453
2454 2455
2456
Alles aus: WK 224. Kaegi korrespondierte seit 1938 gelegentlich mit Meinecke. Am 23. 12. 1944 schickte Meinecke Kaegi drei seiner Werke und bat ihn, als Gegenleistung etwas mit einer Schweizer Bank zu regeln. Die Korrespondenz über die Liebesgabenpakete: 17.1., 3.5., 27.5., 28. 8. 1947, alles in: WK 216. Meinecke war Rezensent des ersten Bandes von Kaegis Burckhardt-Biographie. Rudolf Kötzschke an Kaegi, 30. 8. 1947, in: WK 209. Kaegi beteiligte sich auch an der Polenhilfe mit einer Büchergabe. Er wirkte an der Bücherauswahl für den Wiederaufbau der Universitätsbibliothek von Utrecht mit. In: WK 233 die entsprechenden Briefwechsel. Prof. Dr. H. R. Schinz, Dekanat Medizinische Fakultät Zürich, an Kaegi, 1. 10. 1945, in: WK 231.
Ethnologie
579
der der Schweiz eine besondere Aufgabe in einer von den Diktaturen dominierten europäischen Welt zuwies, die von einem Schweizer Standpunkt und von der Kulturgeschichte in der Nachfolge Burckhardts und Huizingas zu erfüllen sei. Andere bestärkten ihn darin.2457 Hinzu kam eine überkonfessionell-religiös fundierte konservative Ethik, von der er ein wenig Ordnung im Weltchaos erhoffte.2458 Das Mittel in Kaegis Kampf gegen den Ungeist war die fachlich strenge, tiefe und breite Gelehrsamkeit, gewonnen durch die unmittelbare Auseinandersetzung mit den Originaltexten, verbunden mit einem Darstellungsstil, der Humanismus demonstrierte und dabei gelegentlich die Schärfe der Verurteilung durchblicken liess. Insbesondere machte er als Universitätslehrer und Publizist seine Hörer, Schüler und Leser immun gegen den Nationalsozialismus, indem er ihnen intellektuelle Werkzeuge in die Hand gab, mit denen sie Geschichtsfälschung, irrationales Geschwätz und Pseudosynthesen auf der Grundlage pauschaler fixer Ideen zu demontieren vermochten. Kaegi sah in der persönlichen Begegnung den Menschen und beurteilte ihn nach Integrität, aber auch nach Intelligenz und Bildungsstand, teilweise nach der Nützlichkeit seines möglichen Beitrags zu einem von Kaegis Projekten, aber nicht nach der Zugehörigkeit zu Partei oder Ideologie. Deshalb fanden sich in seinem Beziehungsnetz Menschen, die ein linkes oder rechtes, faschistisches oder dem Nationalsozialismus zeitweise nahestehendes Profil hatten, wie auch verfolgte Juden, Katholiken wie Protestanten, und vor allem solche, die dem humanistischen Geist gegen alle feindlichen Kräfte einen Platz in der europäischen Welt erhalten wollten.
7.6 Ethnologie Ethnologie gehörte erst seit Ende der 1930er Jahre und auf Wunsch von Felix Speiser zur Philosophisch-Historischen Fakultät. Speiser war der einzige Fachvertreter an der Universität im Professorenrang.2459 Die Ethnologie war in Basel in allererster Linie am Museum an der Augustinergasse zu Hause, wo Paul und Fritz Sarasin das Fach souverän vertraten,2460 und Speiser wurde am Ende seiner Laufbahn Leiter des dort angesiedelten Völkerkundemuseums. Der 1914 habilitierte 2457
2458
2459 2460
«In der erbarmungslosen Zerstörung unendlicher Werte, der wir beiwohnen, ist mir der Anblick des unwiderstehlichen Aufbaus Ihres Lebenswerks ein tiefer Trost.» Fritz Ernst an Kaegi, 1. 12. 1933, in: WK 190. Kaegi 1946, «Zwischen gestern und morgen» (Ansprache auf einer Tagung katholischer Studentenschaften der Schweiz im Juni 1945 in Solothurn), 205, 216; vgl. Spindler 1976, 169. Baertschi 2012; Riese 2010. Simon 2015.
580
Geisteswissenschaftler
Speiser war zwar der erste, aber nicht der einzige akademisch-universitäre Ethnologe in Basel. Nach Speiser war der Forschungsreisende Paul Wirz 1928 für Völkerkunde habilitiert worden, der allerdings lieber auf Expeditionen war, als dass er an der Universität unterrichtete. 1944 erfolgte die Habilitation von Speisers späterem Nachfolger in der Leitung des Völkerkundemuseums, Alfred Bühler, der 1950 den Lehrauftrag für Ethnologie an der Universität erhielt. Der Ethnologe2461 Felix Speiser2462 interessiert mich hier unter der Frage nach dem Verhältnis zu Deutschland und zu deutscher Wissenschaft. Für die 1930er Jahre sind die Materialien aus dem Museum der Kulturen und die Korrespondenz im Familienarchiv Speiser wenig aufschlussreich. Für die Zeit des Zweiten Weltkriegs hingegen ist die Quellenlage besser, auch wenn nicht ersichtlich ist, aus welchen konkreten Gründen Speiser damals seine deutschen Kollegen pauschal als Nationalsozialisten bezeichnete und deshalb ablehnte. Niemand (mit Ausnahme von Gosden und Knowles, die sich auf eine Andeutung beschränkten)2463 hat sich bisher damit befasst, wie sich Speisers Verhältnis zu deutschen Kollegen, Zeitschriften, Kongressen, Fachgesellschaften zwischen 1933 und 1945 wandelte. Felix Speiser war ein Sohn des liberal-konservativen Richters, Regierungsrats, Nationalrats, Professors und Obligationenrechtlers Paul Speiser-Sarasin. Damit passte er ins Bild der schweizerischen Ethnologie, die weitgehend von Angehörigen der gesellschaftlichen Eliten praktiziert wurde, im Unterschied zu anderen Ländern, in denen das Fach ein Vehikel gesellschaftlichen Aufstiegs sein konnte.2464 Zu Beginn absolvierte er ein Chemiestudium (Doktorat 1904) und arbeitete nach einer Weiterbildung am Pharmazeutischen Institut in Berlin und einem Praktikum in Färbereitechnik in Leeds für die chemische Industrie, zuletzt in der Aussenstelle der Firma Johann Rudolf Geigy AG in New York. Dort faszinierte ihn die Ethnologie so sehr, dass er beschloss, sich ganz dieser Wissenschaft zuzuwenden. Bei den Hopi sammelte er seine ersten Erfahrungen in der ethnologischen Feldarbeit. Unter der Führung seines Onkels Paul Sarasin und dessen Freundes und Grossvetters Fritz Sarasin, der bedeutenden Entdeckungsreisenden und Museumsleute in Basel, erfolgte Speisers Einstieg in die Völkerkunde.2465 Die Sarasin, aber auch Speisers amerikanische Bekannte lenkten ihn auf die deutsche
2461
2462 2463 2464 2465
Ich verwende hier den Begriff ‚Ethnologie‘ synonym mit ‚Völkerkunde‘. ‚Volkskunde‘ (‚Folklore‘), in letzter Zeit oft auch als ‚Europäische Ethnologie‘ bezeichnet, ist hier nicht der Gegenstand. Felix Speiser-Merian: Autobiographischer Text, 1948, in: StABS PA 1245a F 3 (1) 3. Gosden/Knowles 2001. Reubi 2011, 9. Kaufmann 2000, 204. Bedeutung der Sarasin für Speisers ethnologischen Anfänge: Reubi 2011, 261 f., 423.
Ethnologie
581
Ethnologie,2466 die seit den 1880er Jahren in Berlin in Blüte stand und durch die Erlangung von deutschen «Schutzgebieten» in Übersee (Kolonien) eine neue Dimension erhalten hatte. Er absolvierte in Berlin bei Felix von Luschan 1907/08 eine Fachausbildung. Anschliessend unternahm er von 1910 bis 1912 eine Forschungsreise nach den Neuen Hebriden (Vanuatu), auf eigene Faust und mit eigenen Mitteln, aber beraten durch die Berliner Fachleute und versehen mit Aufträgen der Sarasin.2467 Auffällig ist, dass er sich damit nicht in ein Territorium begab, das unter deutscher «Schutzherrschaft» stand, sondern benachbarte, britisch kontrollierte Inseln besuchte.2468 Dank der Ausbildung in Berlin war er zunächst mit der deutschen ethnologischen Forschung verbunden, sowohl persönlich als auch hinsichtlich der Methoden und Zielvorstellungen, in der die Einflüsse von Adolf Bastian und Rudolf Virchow weiterwirkten. Speiser vollzog jedoch die «konservative Revolution» in der deutschen Völkerkunde nach 1900 nicht mit, sondern entwickelte sich selbstständig, ausgehend von der von den Begründern des Faches vorgegebenen Linie – mit Ausnahme seiner Absage an den Entwicklungsgedanken, der das 19. Jahrhundert (und die Grossvettern Sarasin) beherrscht hatte, und im Einklang mit dem für die deutsche Wissenschaft zentralen «Kultur»-Begriff.2469 Methodisch unterschieden sich Speisers Arbeiten somit deutlich von denen der Sarasin. An Speisers Texten fällt auf, dass sie äusserst ambitioniert daherkamen; als Bücher innerhalb von Büchern kann man einige Artikel charakterisieren.2470 Er betrachtete sich trotz seiner Habilitation als Gentleman- oder Laienvölkerkundler. Die scheinbar eindeutige Zugehörigkeit zu deutschen Traditionen ist vor allem für Historiker der Ethnologie evident, die von der angelsächsischen Tradition der teilnehmenden Beobachtung und der Soziologie ‚primitiver‘ Gesellschaften herkommen, während Speiser seine eigenen Wege suchte, die ihm den Respekt auch der angelsächsischen Ethnologen seiner Zeit eintrugen und ihn schliesslich zu konzeptionellen Arbeiten über eine ‚Kulturgeschichte‘ der Südsee führten. Zwar hielt er sich an die von den Berlinern und den Sarasin entwickelten Praktiken der Feldarbeit und sammelte deshalb auch Objekte, die den Interessen der 2466 2467 2468 2469 2470
Deutscher Hintergrund der Grossvettern Paul und Fritz Sarasin: Reubi 2011, 57 ff. Deutsche Völkerkunde: Gingrich 2005. Kaufmann 2000, 205. Verhältnis der deutschen Völkerkunde zu den Kolonien des Kaiserreichs: Gingrich 2005, 98 f. Reubi 2011, 260 ff.; Adam 1950, 66; Meuli 1950, 2 f. Wandel in der deutschen Völkerkunde: Gingrich 2005, 92. Speiser 1919, mit einer noch weitgehend immanenten Kritik an den evolutionistischen Ansätzen der Sarasin in der Kulturforschung. Vgl. Speiser 1928/1929, wiederum in einer Festschrift für Fritz Sarasin. Die ethnologischen Leistungen von Speiser erörtert: Reubi 2011, 423–433, im Überblick.
582
Geisteswissenschaftler
Berliner Schule entsprachen, wie Schädel und Skelette (von ihm im Museum in Basel deponiert),2471 und er legte eine Sammlung von Artefakten an, die dem täglichen Leben und den Kulten angehörten. Geleitet wurde er dabei von der in Berlin wie bei den Sarasin herrschenden Vorstellung, dass die Feldarbeit dazu dienen sollte, Zeugnisse einer untergehenden Kultur zu retten («‚salvage‘ anthropology»).2472 Physisch-anthropologische Fragen verschwanden nicht einfach aus Speisers Agenda, aber ihr Gewicht verringerte sich mit der Zeit, und Speisers Ansätze wurden kritischer. Noch 1946 äusserte er sich zur «Pygmäenfrage»;2473 vor dem Krieg hatte er sich zuletzt 1935 in der «Zeitschrift für Rassenkunde» damit befasst. Diese Zeitschrift wurde damals von Egon Freiherr von Eickstedt herausgegeben, einem Vertreter der Rassentheorie im Nationalsozialismus. Es sollte aber bedacht werden, dass die Wahl der Zeitschrift nicht in jedem Fall einem Bekenntnis zu deren Tendenz entsprach. So publizierte Speiser auch in «Anthropos», dem Organ des Kreises um Pater Wilhelm Schmidt (nach dem ‚Anschluss‘ Österreichs nach Freiburg/Schweiz übergesiedelt), den er gar nicht schätzte. Speiser erklärte in seinem «Versuch einer Siedlungsgeschichte der Südsee» von 1946, dass die kleinwüchsigen Völker der Region weder eine eigene «Rasse» seien noch eine eigene Kultur hätten, mit der Intention, die Vorstellung von einer ethnischen Einheit der «Melanesier» definitiv zu widerlegen.2474 Speisers Interesse für «Bevölkerungselemente» und deren Wanderungen als Beiträge zur «Kulturgeschichte» belegen implizit seine Distanz zur ‚Rassenforschung‘ des Nationalsozialismus.2475 Eine direkte Auseinandersetzung mit den ideologischen Aspekten dieser Forschung findet sich jedoch im publizierten Werk von Speiser nicht. Eigene Vorlieben liessen ihn nach Schönheit in den Objekten suchen und diese als Werke der Kunst auffassen.2476 Seine Kulturgeschichte entsprach nicht der naturwissenschaftlich dominierten Idee einer Evolution der menschlichen Kulturleistungen von ‚primitiv‘ zu ‚entwickelt‘ und eines engen Zusammenhangs zwischen Kultur und Ethnie. Nach der Forschungs- und Sammelreise zu den Neuen Hebriden kehrte Felix Speiser nach Basel zurück. Hier nahm ihn Fritz Sarasin 1912 als Betreuer der «Abteilung Polynesien» in die Kommission auf,2477 die ehrenamtlich die wissenschaftliche Arbeit für das Museum an der Augustinergasse besorgte, und 1914 waren die Naturwissenschaftler der Basler Philosophischen Fakultät bereit, Spei2471 2472 2473 2474 2475 2476
2477
Meuli 1950, 4. Kaufmann 2000, 207 f. Meuli 1950, Schriftenverzeichnis, dort Nr. 59. Adam 1950, 67–69. Speiser 1938. Speisers Beziehung zur Kunst (er war seit 1927 auch Mitglied der Kommission des Kunstmuseums): Kaufmann 2000, 214; Meuli 1950, 8 f. Speiser 1941 zeigt seine Vertrautheit mit Kunsttheorien und der modernen Kunst des Expressionismus. Speiser 1943, 273.
Ethnologie
583
ser als Privatdozenten an der Universität zuzulassen. Fritz Sarasin begrüsste diesen Schritt als eine Massnahme, die die Aufmerksamkeit für die Völkerkunde in Basel steigern sollte, während Speiser selbst wenig akademischen Ehrgeiz zeigte (die «Einpassung in das ganze Getriebe academischer Hierarchie und Laufbahn» lag ihm nicht)2478 und sich zeitlebens mit der Vorbereitung seiner Vorlesungen schwer tat.2479 1917 wurde er (ohne Gehalt) zum Extraordinarius befördert, wie dies für angesehene Privatdozenten üblich war.2480 Im selben Jahr heiratete er Elise (Elisabeth Marie Rosalie) Merian. Im Krieg war er Offizier gewesen und hatte als Mitglied einer Rotkreuz-Delegation in Marokko ein Lager für deutsche und in Deutschland ein Lager für französische Kriegsgefangene besucht.2481 Speiser gehörte wie viele seiner Standesgenossen und Universitätskollegen zum rechten Flügel des politischen Spektrums, ohne selbst Politik machen zu wollen;2482 er beteiligte sich vorübergehend an der Bürgerwehr, hielt Völkerbund und Versailler Vertrag (wie später die UNO) für verfehlt und war überzeugt, dass sich Europa aus der Weltgeschichte verabschieden werde, wenn es weiterhin für Frieden und Gewaltlosigkeit eintrete, während «gesunde» Nationen mit Gewalt imperialistische Ziele verfolgten.2483 Er vertrat noch in den 1930er Jahren den ständischen Anspruch, dass Wissenschaft nicht durch bezahlte ‚Proletarier‘,2484 sondern durch berufene, ‚freiwillige‘ Persön2478 2479 2480 2481 2482
2483
2484
Felix Speiser-Merian: Autobiographischer Text 1948, 6, in: StABS PA 1245a F 3 (1) 3. Speisers Habilitation in Basel mit Unterstützung von Fritz Sarasin: Reubi 2011, 262–265. Reubi 2011, 271. Meuli 1950, Schriftenverzeichnis Nr. 8 und 9, Berichte publiziert Genf 1916. «Les premiers éthnographes suisses – comme du reste la majeure partie de leurs successeurs loin dans le 20e siècle – penchent lourdement à droite de l’échiquier politique. Rarement revendiquée de manière explicite, leur orientation n’est jamais consacrée par un engagement.» Reubi 2011, 72, 73 zeigt mit Beispiel von britischen und deutschen Ethnologen, dass ausserhalb der Schweiz auch andere politische Orientierungen im Fach vertreten waren; 229, Speisers Mitgliedschaft in der Bürgerwehr. «Politisch habe ich mich nie betätigt – meine Mitarbeit bei der Bürgerwehr war ein Seitensprung, bei welchem ich erkannt habe, dass mein so gar nicht berechnendes Gemüt mich in keiner Weise zum Politiker fähig machte.» Felix Speiser-Merian: Autobiographischer Text 1948, 6, in: StABS PA 1245a F 3 (1) 3. Speiser 1932, anlässlich der Intervention des Völkerbunds im Konflikt zwischen Japan und China. Dieser kurze Artikel zeigt den Autor als Verächter des Parlamentarismus, des Pazifismus und als ‚Realisten‘ der Machtpolitik, mit der sich Nationen Raum in der Welt schaffen. Meuli 1950, 11, verdanke ich den Hinweis auf Speisers Autorschaft; der Artikel ist nur mit dem Kürzel «-sr.» gezeichnet. Mit «dem bis anhin ängstlich gewahrten Prinzip völlig ehrenamtlicher Betreuung» sei 1931 «gebrochen» worden. Speiser 1943, 276. Speisers Aversion gegen die Präsenz besoldeter ‚Proleten‘ in der Ethnologie: Reubi 2011, 146–149, 276; genannt werden Eugen Paravicini (der nicht zur angesehenen Basler Familie Paravicini gehörte) und Paul Wirz, während Alfred Bühler, der seit 1933 der Kommission des Museums angehörte, nicht in
584
Geisteswissenschaftler
lichkeiten aus der gesellschaftlichen Elite betrieben werden sollte, die damit der Vaterstadt ein Opfer brachten. Er begriff aber sehr wohl, dass die bezahlten Arbeiter ihn von der wachsenden administrativen Arbeit entlasteten. Nach einer in der Einschätzung von Speiser misslungenen Expedition nach Brasilien, die er 1924 auf Anregung seines deutschen Freundes Theodor KochGrünberg2485 unternommen hatte,2486 reiste er 1929/30 nochmals auf eigene Kosten und «privat»2487 – begleitet vom Zoologen Heini Hediger nach der Südsee. Diesmal besuchte er eine ganze Reihe von Inseln (wie Bougainville, nördliche Salomonen, Bismarck-Archipel, Neu-Britannien) und einen Teil von Neuguinea (Tal des Sepik), um durch eine breite Perspektive kulturellen Verbindungen auf die Spur zu kommen und die Geschichte der Region zu rekonstruieren. Verschiedenes war an dieser Expedition neu gegenüber derjenigen nach den Neuen Hebriden. Die deutsche Dominanz in der Ethnologie war gebrochen, einerseits wegen der vorübergehenden Ausschaltung deutscher Gelehrter aus internationalen Gesellschaften und Kongressen durch den Weltkrieg und seine Folgen,2488 andererseits durch die wirtschaftliche Lage Deutschlands nach 1918. Angelsächsische Forschung hatte an Terrain gewonnen, während Deutschland im Krieg seine «Schutzgebiete» ab 1914 faktisch, dann durch die Pariser Vorortverträge auch rechtlich verloren hatte. Der Einstieg in Speisers Untersuchungsgebiete erfolgte nun über Australien.2489 Ferner war Speisers materielle Lage nicht mehr dieselbe.
2485 2486 2487
2488 2489
die Kategorie der ‚Proleten‘ fiel, obschon er aus einer bescheidenen Eisenbahnerfamilie stammte und als Primarlehrer begonnen hatte. Paul Wirz (PD 1928): Reubi 2011, 278 ff.; Alfred Bühler (PD 1944, 1950 Leiter des Basler Völkerkundemuseums): Reubi 2011, 282 ff. Reubi 2011, 383, 430 f. Koch galt als der beste deutsche Südamerikanist seiner Generation: Gingrich 2005, 99. Meuli 1950, 6 f.; Reubi 2011, 431, sieht in dieser Expedition einen Beleg dafür, wie tief Speiser in der deutschen Ethnologie verankert war. Speiser legte Wert darauf, diese Reise als «privat» zu deklarieren im Unterschied zu den im Museumsauftrag (und teilweise mit kommerziellen Absichten) unternommenen Reisen von Eugen Paravicini (Salomonen) und Alfred Bühler (Neu Irland und Admiralitätsinseln sowie später Timor). Speiser 1943, 276; Gosden/Knowles 2001, 107. Finanzierung der Expedition von 1929: Reubi 2011, 385 f. Reubi 2011, 298 f. Verhältnis zwischen Speiser und Alfred Radcliffe-Brown in Sidney 1929: Reubi 2011, 520. Radcliffe-Brown stand weder politisch noch wissenschaftlich im gleichen Lager wie Speiser: Er verehrte Peter Kropotkin, kritisierte die Kolonialherrschaft und bevorzugte einen soziologischen Ansatz in der Völkerkunde. Barth 2005, 1–57: «Britain and Commonwealth» (Fredrik Barth), hier 26 f. Gosden/Knowles 2001, 101, 107, zeigen, dass Speiser trotz der veränderten kolonialen Herrschaft sich auf die Reste deutscher Kolonisten in Rabaul bezog. Sie weisen seinen «intellectual background» insgesamt der «German school of anthropology» zu, ebd., 102. Angesichts der Vielfalt deutscher Ansätze (Gingrich 2005, 116 u. ö.; Fischer 1990, 16 f.) wirkt dies pauschal.
Ethnologie
585
Mit der deutschen Hyperinflation und danach dem Börsenkrach von 1929 hatte er Vermögenswerte verloren. Die Reise war ein finanzielles Wagnis, das er mit der Hoffnung verband, dass die Behörden ihm in Basel eine besoldete Stelle an der Universität schaffen würden. Die 1929/30 angelegte Sammlung verkaufte er zum Teil dem Museum, um seine finanzielle Lage etwas aufzubessern.2490 Zwar hatte er inzwischen einen besoldeten Lehrauftrag, der jedoch – wie üblich – schlecht bezahlt war. Dabei war er nun zunehmend vom Einkommen abhängig, das mit der Lehrtätigkeit verbunden war.2491 Die schrittweise Erhöhung der Entschädigung blieb unbefriedigend – immerhin war Speiser pensionsberechtigt.2492 Als Fritz Sarasin 1942 starb, konnte Speiser die Leitung der völkerkundlichen Sammlung des Museums übernehmen. Nun war er (mit über 60 Jahren) frei,2493 seine Vorstellung von einer Kulturgeschichte der melanesischen Inseln zu verfolgen, losgelöst von den Entwicklungsvorstellungen von Fritz und Paul Sarasin, aber ebenso von deutschen Kulturkreislehren.2494 Entsprechend seiner Funktion im Museum war er seit seiner Rückkehr aus der Südsee in der Basler Öffentlichkeit mit Vorträgen präsent. Diese betrafen Themen wie «Die Furcht in Melanesien (1931), «Ethnographische Probleme in der Südsee (1931), «Über den Sepik und seine Bewohner» (1932), «Die Grundlagen der Moral bei den Na-
2490
2491
2492
2493
2494
Das Museum kaufte den Hauptteil der Sammlung für Fr. 25’000 an; der Rest wurde auf Fr. 30’000 geschätzt. Das Museum bot Speiser an, den Verkauf dieses Rests gegen eine Kommission zu fördern. Gosden/Knowles 2001, 123. Felix Speiser (aus Bestand Dr. Ruth Speiser): Briefe, Postkarten, Gedichte 1927–1944. Typoscript, Dezember 1944, «Geht an Salome & Felix und kann bei Gelegenheit auch den andern Kindern mitgeteilt werden». In: StABS PA 1245a, F 5 (1) 1. Speiser unterrichtete von 1914 bis 1923 ohne Besoldung an der Universität Basel. 1923 verlangte er zum ersten Mal eine Entschädigung für seinen Unterricht. Mit Einverständnis der Kuratel erhielt er eine Remuneration von Fr. 2’000. Speisers Gesuch um Erhöhung von 1927 wurde nicht stattgegeben. 1931 bewilligte ihm die Regierung eine Erhöhung auf Fr. 6’000 mit der Verpflichtung, vier Wochenstunden zu lesen, was ihn frustrierte. 1932 konzedierte die Regierung schliesslich eine Remuneration von Fr. 9’000, was ihn bis 1943 zufriedenstellte. Reubi 2011, 273–277. 1943 wurde die Erhöhung auf Fr. 12’000 beschlossen. Regierungsratsbeschluss, 21. 7. 1931, in: StABS Erziehungsrat Protokoll S 4 Bd. 21, 1931–1932, 22. 7. 1931. StABS Erziehungsrat Protokoll S 4 Bd. 27, 1942–1944, 20. 12. 1943. Die Befreiung drückte sich auch in seiner kritischen Schilderung des Sarasinschen Regiments im Museum aus. Speiser 1943, 278 f. Die Literatur zitiert diese Passage dankbar: Reubi 2011, 133. Adam 1950, 67–69. Speisers Ansätze sind noch am ehesten mit denen von Richard Thurnwald (Ordinarius in Berlin 1933 bis 1945) über Austausch und Verteilung zwischen interdependenten Regionen vergleichbar. Nicht zu vergessen sind die Kontakte zur angelsächsischen Forschung. Gingrich 2005, 105 ff.
586
Geisteswissenschaftler
turvölkern» (1934), «Besitz und Geld bei den Naturvölkern» (1936), «Kunststile in Melanesien» (1938), «Schmuck und Kleidung des Menschen» (1940).2495 Speiser hatte bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs weiterhin in deutschen Zeitschriften (beliebt war bei ihm die renommierte Berliner «Zeitschrift für Ethnologie»)2496 und Verlagen publiziert, die ihm als massgebende Fachorgane seit der Epoche vor 1914 vertraut waren. Allerdings war er publizistisch ab 1913 schon gelegentlich im englischen Sprachraum präsent.2497 Seine Referenzliteratur war durchwegs international, wie z. B. die Bibliographie zu seinem langen Artikel über Kunststile von 1937 zeigt.2498 Schrittweise trat in seinen Aufsätzen das Interesse an «Kulturkomplexen» und an «Stilgeschichte» der Kunst hervor.2499 Spätestens seit 1933 war er überzeugt, dass ‚Rasse‘ und Kultur nicht zwingend zusammenhingen.2500 Seine Entwicklung verlief damit entgegengesetzt zu den deutschen Bestrebungen, unter nationalsozialistischer Herrschaft physische Anthropologie und Völkerkunde wieder näher zusammenzuführen.2501 Zudem publizierte er nun weitgehend lokal in den «Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel» (in der die Basler Ethnologen ein Forum besassen, auch wenn ihre Beiträge im Vergleich zu den naturkundlichen Artikeln wenig zahlreich waren)2502 und national im «Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft für Anthropologie und Ethnologie». Mit seinen kulturgeschichtlichen Studien fand er international zunehmend Beachtung und Anschluss an britische For-
2495
2496
2497 2498 2499
2500
2501 2502
Nach Basler Jahrbuch, Chronik (entsprechende Jahre). Das Thema ‚Moral‘ war für Speiser wichtig vor dem Hintergrund seiner christlichen Erziehung; er wollte zeigen, dass es auch ausserhalb des Christentums moralisches Verhalten geben konnte. Organ der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, die seit 1870 existierte und bei der Fritz und Paul Sarasin Mitglieder waren. Gosden/Knowles 2001, 103. Deutsche Völkerkunde zur Zeit des Nationalsozialismus: Gingrich 2005, 111 ff. Vgl. Adam 1950. Speiser 1937, 368 f. Speiser 1937 (umfangreicher, grundlegender Aufsatz). Speiser 1941, und öfter, vgl. Adam 1950, 70 f. Kaufmann bezeichnet Speisers Übergang als «Paradigmenwechsel». Er datiert ihn auf die Phase von 1914 bis 1919 und bringt ihn mit der Expedition nach den Neuen Hebriden in Zusammenhang. Konzept «Kulturkomplex»: Kaufmann 2000, 220 f.; auch dafür hat Kaufmann eine frühe Datierung vorgeschlagen (1915, 1919). Kaufmann 2000, 214, 224, vermutet mit Recht, dass Speisers Distanznahme zu rassistischen Ansätzen nicht auf einer konsequenten Analyse der physischen Anthropologie beruhte. Sein Interesse an den ‚Rassen‘ in Melanesien schwand wohl angesichts der in seiner eigenen Arbeit erlebten Unmöglichkeit, ‚Rassen‘ mit Kulturen empirisch überzeugend zu verknüpfen. Gingrich 2005, 114. Reubi 2011, 89.
Ethnologie
587
schungen. 1932 wurde er Honorary Fellow of the Royal Anthropological Institute, und er erhielt 1934 eine Einladung nach England als Gastreferent.2503 In Deutschland konnte er die für viele Fachbereiche übliche ‚Gleichschaltung‘ beobachten, aber auch Opportunismus und Anbiederung an die Machthaber. Führende Fachvertreter versuchten ab 1933, das (an sich bescheidene) Interesse der Nationalsozialisten an der Völkerkunde zu wecken. In den Fachgesellschaften wurde das ‚Führerprinzip‘ praktiziert und zunächst die Neuaufnahme jüdischer Mitglieder untersagt, schliesslich die Mitgliedschaft von Juden ganz verboten. Der auch im Ausland angesehene Richard Thurnwald wandte sich den Nationalsozialisten zu und förderte entsprechenden Nachwuchs wie Wilhelm Emil Mühlmann. Aus ‚rassischen‘ und politischen Gründen wurde eine relativ grosse Zahl von Völkerkundlern entlassen; viele davon gingen in die Emigration.2504 Leonhard Adams Lehrbuch der Völkerkunde erschien 1937 unter dem Namen von Konrad Theodor Preuss. All das konnte Speiser nicht verborgen bleiben, als er 1938 in Kopenhagen am internationalen Anthropologen- und Ethnologenkongress mit einem Referat teilnahm: Die deutsche Delegation bestand aus Eugen Fischer, Otmar von Verschuer, Josef Mengele vonseiten der Anthropologen, Thurnwald und Hermann Baumann vonseiten der Völkerkunde.2505 Spätestens seit 1942 äusserte er sich dezidiert ablehnend über die völkische deutsche ethnologische Forschung.2506 Während des Krieges solidarisierte er sich mit der britischen Kriegsführung, nicht ohne den Beitrag der USA zu registrieren und gegen Kriegsende auch das russische Engagement zu loben – bei allem Misstrauen, das er Stalin entgegenbrachte. Einladungen nach Deutschland lehnte er ab und betrachtete seine Kollegen in jenem Land nun pauschal als Nationalsozialisten, mit denen er nichts mehr zu tun haben wollte.
2503 2504
2505 2506
Kaufmann 2000, 222. 1934 sprach Speiser vor dem Royal Anthropological Institute in London. Gosden/Knowles 2001, 124. Liste bei: Fischer 1990, 195 f. Nach Fischers Zählung waren 1933 in Deutschland 78 Personen in der Völkerkunde wissenschaftlich tätig; mindestens 30 davon wurden «benachteiligt, verfolgt oder emigrierten». In Österreich zählt Fischer 1938 15 Angehörige des Faches, von denen acht den Angriffen der Nationalsozialisten ausgesetzt waren. Fischer 1990, 175. Gingrich 2005, 113 ff.; Fischer 1990, 30 f., 150 ff. Kopenhagen: Gingrich 2005, 128 f. Gosden/Knowles 2001, 125. Deutliche Worte fand Speiser in seinen Briefen an Beatrice Blackwood (Knowles 2000, 252 ff.; Gosden/Knowles 2001, 139 ff.), siehe die folgende Anm. Reubi 2011, 517, druckt das interessante Urteil Speisers über Blackwood von 1930 ab, das den Unterschied zwischen Speisers Feldmethoden (Sammeln von Dokumenten materieller Kultur durch kurze Besuche an mehreren Orten) und den damals modernen, als wirklich wissenschaftlich geltenden Forschungen Blackwoods, die während längerer Zeit am selben Ort blieb, die Sprache lernte und sich in die untersuchte Gesellschaft einbrachte, sichtbar macht. Das Sarasinsche Familienarchiv in: StABS PA 212(a) T2, XXXIV, enthält den Briefwechsel Speiser/Fritz Sarasin aus der Zeit von 1929/30.
588
Geisteswissenschaftler They were all Nazis and ACTIV [sic] Nazis – as all the rest of the german university-men. I will not have anything to do with them, unless he can prove, that he always was against the system. But no-one of them can proove [sic] that. Therefore we are rather isolated and we must look for England. […] For the rest, I really do not regret, that the german Universities will for generations be abolished. THEY breeded that mentality, which led to Hitler and the war: they were all empoisoned by Bismarck, Nietzsche and Treitschke (what names barbarious !!!) and they educated their students in that mentality. I noticed that already in the last war, but really I could not believe, that the mental insanity could lead that far.2507
So ergab sich eine Emanzipation von der deutschen Ethnologie. Eine mehr als symbolische Bedeutung kam dem Wechsel von einer naturwissenschaftlichen zu einer humanwissenschaftlichen Umgebung zu, als er 1938/1939 in die Philosophisch-Historische Fakultät wechselte,2508 wo er inzwischen als Kulturwissenschaftler am richtigen Ort war – nicht ohne Nebengeräusche, denn Speiser fehlten die akademischen ‚Credits‘ für seine neue Fakultätszugehörigkeit (er hatte als Schüler das Humanistische Gymnasium verlassen müssen und konnte ‚nur‘ einen Abschluss der Oberen Realschule vorweisen). Seit dem Fakultätswechsel konnte er auch häufiger Dissertationen betreuen, die dem Studium der materiellen Kultur der Südsee galten. Sein früher Tod verhinderte, dass seine Kritik an der deutschen Völkerkunde sichtbar in seiner Publizistik zur Geltung kommen konnte. Sie scheint aber unter Fachkollegen bekannt gewesen zu sein, sonst hätte der Emigrant Leonhard Adam (1939 nach Grossbritannien ausgewandert und von dort als feindlicher Ausländer nach Australien deportiert, wo er seit 1942 in Melbourne als Dozent arbeiten konnte) nicht Speiser einen ausführlichen Nachruf gewidmet.
7.7 Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen – Edgar Salin, vom «Mephistopheles» zum konservativen Antifaschisten 7.7.1 Einleitung Die Fächerzuordnung der Basler Dozenten ist zwischen Volkswirtschaft, Nationalökonomie, Staatswissenschaft und Soziologie wegen der wechselnden Begrifflichkeit nicht immer evident. Spezifisch baslerisch war der Umstand, dass die Wissenschaften von der Gesellschaft, ihrer Wirtschaft, der Statistik, auch der Finanzwissenschaft innerhalb der Philosophischen, später der Philosophisch-Histo2507
2508
Speiser an Beatrice Blackwood, Oxford, 8. Mai 1945, in: Pitt Rivers Museum Archive, Blackwood Papers, Box 4, Envelope S, No. 62. Dort weitere Briefe aus Kriegs- und Nachkriegszeit. Ich danke Christopher Morton für die Übermittlung von Kopien. Reubi 2011, 287 f., 291 ff.
Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen
589
rischen Fakultät verblieben. Andere Universitäten ordneten sie den Juristen zu oder bildeten eine eigene Staatswissenschaftliche Fakultät oder Abteilung. Eine Ausdifferenzierung dieser Richtungen erschien zwar auch in Basel zunächst als wahrscheinlich,2509 und es gab Ökonomen, Soziologen und Statistiker, aber nie einen spezifischen Lehrauftrag oder Lehrstuhl eigens für die Soziologie (ausgenommen vorübergehend für Stephan Bauer).2510 Kontroversen zwischen Bürgertum und universitärer Wissenschaft um die Soziologie gab es in Basel nicht, angegriffen wurde dafür Julius Landmanns Nationalökonomie, weil ihm eine Besteuerung des Kapitals notwendig erschien. Nach dem Weggang des überragenden Julius Landmann dominierte seit seiner Ankunft 1928 Edgar Salin die Basler Nationalökonomie, sowohl akademisch als auch durch seine Politikberatung, die in die Krisenzeit hineinpasste, weil sie staatliche Eingriffe in Wirtschaft und Gesellschaft notwendig fand. Salin war gerade derjenige, der aus seiner von Stefan George geprägten Wissenschaftsauffassung heraus eine Ausdifferenzierung der Fächer verhinderte. ‚Nationalökonomie‘ verstand er als eine ganzheitliche Betrachtung von Staat, Volk, Wirtschaft und Gesellschaft. Er war kompetent genug, um zu beweisen, dass diese Ganzheit aus seiner Person heraus erfolgreich praktiziert werden konnte, und als Inhaber des gesetzlich definierten Lehrstuhls war er einflussreich genug, um das zu verhindern, was er als Zersplitterung des Wissens durch Spezialisierung empfand. Gegen die Etablierung der Soziologie als eigenes Fach trug er aufgrund seiner Erfahrungen in Heidelberg Bedenken, wo er bei Eberhard Gothein einem Kulturoptimismus begegnet war, den er mit der Bezeichnung ‚Soziologie‘ verband und für grundfalsch hielt.2511 Bevor ich näher auf Edgar Salin eingehe, erwähne ich kurz die anderen Ökonomen, Staatswissenschaftler und Soziologen in Basel. Der Max Weber-Schüler Robert Michels2512 war in Deutschland aus politischen Gründen in seiner Karriere behindert worden und hatte sich vor dem Ersten Weltkrieg nach Italien gewandt, wo er die Staatsbürgerschaft annahm und habilitiert wurde. Ohne Begeisterung war er 1914 nach Basel gekommen. Hier befasste er sich weiterhin mit italienischer Politik und wurde schliesslich bekennender Faschist und Parteimitglied. 1926 ging er nach Rom, 1928 wechselte er an die faschistische Eliteuniversität in Perugia, behielt aber Kontakte nach Basel, die vor allem über Edgar Salin liefen, der ihn auch öfter in Italien besuchte.2513 Michels hatte Basel verlassen, bevor der
2509 2510 2511 2512 2513
Zürcher 1995, 12, 22. Zürcher 1995, 23. Zürcher 1995, 29 f. Über Edgar Salin berichte ich weiter unten ausführlich. Lengwiler 2010, 7. Nachlass Salin, Fa 6241 bis 6269. Das Vortragsthema für einen Besuch von Michels in Basel lautete, wie Michels am 10. 3. 1933 (Fa 6263) mitteilte, «Über das Criterium der
590
Geisteswissenschaftler
Faschismus von der linken Presse und den linken Studenten offen angegriffen wurde.2514 Hans Ritschl erhielt als Nachfolger von Michels 1926 die Professur für Nationalökonomie und Soziologie (mit einem Schwerpunkt auf Finanzwissenschaft). 1942 folgte er einem Ruf nach der ‚Reichsuniversität‘ Strassburg, und in Basel trat an seine Stelle Valentin Fritz Wagner. Hans Ritschl war konservativ orientiert und wie Salin überzeugt, dass (jedenfalls für Deutschland) eine gemischte Wirtschaftsform das Richtige sei, die Staat und Privatwirtschaft in ein geordnetes Verhältnis brächte, um einen exzessiven Kapitalismus zu verhindern und die Integration der Nation zu stärken. Valentin Fritz Wagner, 1931 als Schüler von Julius Landmann habilitiert, war anfänglich in seiner Laufbahn durch Krankheit behindert. Vor der Übernahme der Professur leitete er das Wirtschaftsarchiv und redigierte die «Schweizerische Zeitschrift für Statistik und Volkswirtschaft». Er hielt nichts von Salins George-Bewunderung und deutschem Patriotismus, tadelte dessen relative Offenheit für linke Studenten und fühlte national-schweizerisch; auch Ritschls Interesse an Soziologie teilte er nicht. Der Wechsel von Ritschl zu Wagner war symptomatisch für die Unmöglichkeit, während des Krieges einen ausländischen Kandidaten zu berücksichtigen. Fritz Mangold, ehemaliger parteiloser Regierungsrat, wurde 1921 Extraordinarius und 1928 Ordinarius für Statistik2515 sowie Leiter des Wirtschaftsarchivs. Er war ein praxisorientierter Statistiker mit Interesse für Demographie und Sozialstatistik, der sich für eine Sozialreform engagierte. 1941 trat er zurück. Hinter Salin und Ritschl stand Mangold als sozial engagierter Spezialist und mit den Basler Verhältnissen eng verflochtener ehemaliger Politiker wissenschaftlich in der zweiten Reihe. Zu den Spezialisten gehörte auch der frühere Mitarbeiter von Vilfredo Pareto, Louis Vladimir Furlan, Chefredaktor des Wirtschaftsteils der «Basler Nachrichten», 1914 Privatdozent für Nationalökonomie und Statistik, 1931 Extraordinarius für Versicherungsökonomie und mathematische Nationalökonomie. Der bedeutende Statistiker erhielt 1947 ein persönliches Ordinariat.2516 Die Privatdozentin Salomé Schneider lehrte von 1929 bis 1946 Finanzwissenschaft. Theodor Brogle, der Rektor der Handelsschule, wurde 1932 Extraordinarius für Betriebswirtschaftslehre und 1951 zum Ordinarius befördert. Ab 1938 leitete er die Mustermesse Basel. Der Agronom Friedrich Christian Vöchting-Oeri habilitierte sich 1929 und wurde 1937 zum Extraordinarius befördert. Er war auf die Agrargeschichte und -politik in Italien spezialisiert, inbesondere auf das
2514 2515 2516
Jugendlichkeit der Völker», «das ‚sans épater le bourgeois bâlois‘ (was ich nicht nötig hätte)» behandelt werden sollte. Zürcher 1995, 24 f., 163 ff., 182 f. Degen 2007; Zürcher 1995, 26. Mornati 2003.
Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen
591
Nord-Süd-Gefälle.2517 Hans Wolfram Graf Finck von Finckenstein wurde 1939 für Praktische Volkswirtschaftslehre habilitiert, nachdem er 1933 in Basel bei Salin promoviert hatte. Sein Schwerpunkt waren die preussischen Agrarverhältnisse. Nachstehend unternehme ich eine Sondierung am Beispiel der zentralen Gestalt der Basler Nationalökonomie, Edgar Salin, um die doppelte Bindung eines patriotischen deutschen Professors an Deutschland und an die Basler Demokratie näher zu untersuchen. Edgar Salin war ein Beispiel für einen Basler Professor, der ein rechtsgerichteter Deutscher war, wobei bis ca. 1945 am ehesten das Etikett «jungkonservativ» auf ihn zutraf, der für den Nationalsozialismus keine Sympathien entwickelte. Er vertrat Ansätze, die eine direkte Beziehung zur Praxis in Politik und Wirtschaft wünschenswert erscheinen liessen. Über die Vorgänge in Deutschland in den Jahren 1933 bis 1945 war er ausnehmend gut informiert. Ich habe keine Spur einer Beteiligung an der ‚geistigen Landesverteidigung‘ in der Schweiz gefunden. Salin wirkte erzieherisch nach dem Vorbild Stefan Georges, d. h. er wollte aus der Position einer elitären Bildung heraus Distanzerlebnisse schaffen, die seine Studierenden Abstand nehmen liessen zur eigenen Zeit und zu einfachen «Glaubensformen», die er auf das 19. Jahrhundert zurückzuführen liebte, wie Freisinn, Liberalismus und Demokratie. Seine Rolle in Basel bis 1945 blieb damit ambivalent; aber gerade dadurch leistete er im lokalen Rahmen seinen eigenständigen Beitrag zur Widerständigkeit gegen die anfangs scheinbar glänzenden Aspekte der nationalsozialistischen Diktatur. Einige Daten zum Lebenslauf seien vorausgeschickt.2518 Edgar Salin wurde 1892 in Frankfurt in einer wohlhabenden jüdischen Familie geboren. Von der Vaterseite her waren es Fabrikanten, von der Mutterseite her Bankiers, die dem Herkommen ihr Gepräge vermittelten. Sein Grossonkel Jakob Schiff, Inhaber einer Bank in New York, ermöglichte Edgar Salin nach dem Abitur eine Reise in die USA. Gemeinsam studierten sie die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Entwicklung von Alaska. Salin absolvierte von 1910 bis 1914 ein Studium in Heidelberg, München und Berlin. Dabei lernte er in München den Dichter Karl Wolfskehl kennen, der ihn mit Friedrich Gundolf zusammenbrachte.2519 In Heidelberg 2517
2518
2519
Vöchting wurde 1944 als Extraordinarius entlassen, nachdem Max Wullschleger 1943 im Grossen Rat auf dessen angebliche «nationalsozialistische Kriegspropaganda» (das Buch über den Krieg in der Ukraine behandelte den Ersten Weltkrieg) und die Mitgliedschaft in der deutschen kulturpolitischen Organisation ‚Basler Pfalz‘ hingewiesen hatte. Moser/ Heini 2020, 154–157: «In Ungnade gefallen» (Alexandra Heini). Siehe zur ersten Information die Publikationen von Föllmi 1999 sowie von Lengwiler 2010 und https://unigeschichte.unibas.ch/fakultaeten-und-faecher/wirtschaftswiss-fakultaet/ edgar-salin, 2010, ohne Verfasserangabe. Zu George: Lerner 2017. Salins Studium in Heidelberg und der Zugang zum GeorgeKreis: Schönhärl 2009, 71 ff. Sie erinnert daran, dass Alfred Weber Salins wissenschaftli-
592
Geisteswissenschaftler
fand er 1913 Zugang zu Stefan George, dessen Gedichte er schon als Schüler gelesen hatte, und verkehrte im George zugewandten Kreis der Professorengattin Marie Luise Gothein.2520 1914 doktorierte Salin bei Alfred Weber über die wirtschaftliche Entwicklung von Alaska. Im Sommer dieses Jahres meldete er sich als Kriegsfreiwilliger. Nach einer schweren Verwundung wirkte er 1918 für ein Jahr als Referent in der deutschen Gesandtschaft in Bern, wo er Nachrichten über extremistische Bewegungen auswertete.2521 1919 kehrte er als Assistent von Eberhard Gothein nach Heidelberg zurück; 1920 habilitierte er sich dort mit seinem Buch über Platon und die griechische Utopie. Vier Jahre später wurde er an derselben Universität als Extraordinarius Inhaber der Eberhard Gothein-Gedächtnisprofessur.2522 Für den Sommer 1927 folgte er einer Einladung an das Institut für Weltwirtschaft in Kiel, von wo aus er nach Basel als Nachfolger für Julius Landmann gewählt wurde, der seinerseits in Kiel blieb. Er war mit Landmann schon vor dem Ersten Weltkrieg durch die gemeinsame Zugehörigkeit zum George-Kreis bekannt.2523 Salin vertrat teilweise ähnlich wie sein Doktorvater Alfred Weber eine stark auf Philosophie, Kultur und Nation bezogene, umfassende Auffassung von Nationalökonomie. Er förderte die Erforschung und Publikation des Werkes von Friedrich List2524 und sah darin eine Möglichkeit, die Bedeutung des Staates in der Wirtschaft richtig zu bestimmen und von dieser Position aus beratend in die Politik der Weimarer Republik einzugreifen. Er betrieb 1924 zusammen mit Arthur Spiethoff, Hans Luther, Erwin von Beckerath und Bernhard Harms (dem ersten Leiter des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, bis 1933 im Amt) die Gründung der Friedrich List-Gesellschaft. Die politischen Auffassungen des jungen Salin waren durch die mehrfache Entfremdung gegenüber der wilhelminischen Zeit und der Weimarer Republik charakterisiert. Diese resultierte aus der Kulturkritik Stefan Georges, aus dem Kriegserlebnis sowie aus der radikalen Ablehnung des Versailler Vertrags und der Republik als Staatsform für Deutschland. Salin suchte seine Ideale einerseits in der Vergangenheit, namentlich bei Platon und in der Georgeschen ‚Ahnenreihe‘ von grossen Männern bis Goethe, Hölderlin und Nietzsche, andererseits in der
2520 2521 2522 2523 2524
cher Mentor gewesen ist und dass dieser in einem Gegensatz zum Kreis um George und Gothein stand. Schefold 2013, 211–214. Schönhärl 2009, 74. Schönhärl 2009, 77. Föllmi 1999, 3. Salin wertete den damals wenig beachteten List «zu einem der wichtigsten Vertreter der deutschen Volkswirtschaftslehre» auf. Er sah in List eine legitimierende Figur für seine eigenen Ideen. List habe eine «wertende Nationalökonomie» gewollt mit politischer Zielsetzung (wie Salin selbst). Schönhärl 2009, 237–240.
Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen
593
Zukunft, von der Georges Dichtung sprach. Die Gruppe um George war für Salins Heidelberger Bildungsgang entscheidend, auch wenn er seit 1921 nicht mehr zum inneren Kreis zählte und von George nicht mehr empfangen worden ist.2525 Zu Beginn aber widerfuhr Salin die grosse Ehre, von George eine neue Art, seinen Namen auszusprechen, zu empfangen.2526 Ohne Bezug auf George sind Salins Agenda für Deutschland und sein Begriff des «Staatlichen» kaum verständlich. Salin war kein aktiver bewaffneter Kämpfer in den deutschen Bürgerkriegen wie der George persönlich näherstehende Ernst Kantorowicz, aber in seinem Denken und Schreiben zunächst kaum weniger radikal. Dabei unterschied sich sein Auftreten je nach Situation: Als Georgeaner kritisierte Salin in hohem Ton möglichst grundsätzlich und oft aggressiv die wirtschaftliche und politische Lage Deutschlands seit dem 19. Jahrhundert und insbesondere seit 1918, während er als Mitglied des List-Kreises pragmatisch über praktische wirtschafts- und sozialpolitische Möglichkeiten zur Verbesserung dieser Lage nachdachte. Die Grundlagen seiner Äusserungen waren jedoch in beiden Rollen dieselben.2527 Vor der Berufung nach Basel machte er sich mit seiner Geschichte der Volkswirtschaftslehre von 1923 weithin bekannt.2528 Salin wandte sich darin gegen die Vorherrschaft der Historischen Schule der deutschen Nationalökonomie und gegen das Fortschrittsdenken der wilhelminischen Zeit. Bei den alten Griechen fand er ein kohärentes «Denkbild», in das sich die Wirtschaft als Teil des gesellschaftlichen Lebens einfügte. Die jeweils zeitspezifische Verschränkung von Politik und Wirtschaft prägte nach seiner Auffassung das ökonomische Denken. Dieses erwuchs nicht unmittelbar aus den ökonomischen Gegebenheiten im Sinne eines ‚Überbaus‘, sondern war nach Salin das Werk grosser Männer.2529 Seine polemische Darlegung der volkswirtschaftlichen Lehren in zeitlicher Abfolge von der Antike bis in die Gegenwart machte deutlich, wie sehr Salin die Ideen des 2525
2526
2527
2528 2529
Kersten 2015, 117. Schon während des Ersten Weltkriegs äusserte sich George abfällig über Salin. Schönhärl 2009, 73. Salin versuchte, sich im Kreis hervorzutun. «Dieses SichHervortun hat George keineswegs immer gefallen. George schätzte an Salin, dass er reiche Kenntnisse über die Antike besass, aber Prunken mit den Inhalten des Schulsacks war eigentlich nicht willkommen.» Schefold 2013, 214. «Wir selbst [Salin] erfuhren die kleine und doch so wesentliche Änderung, dass der Meister den Nachnamen, der bis anhin französisch gesprochen wurde, deutsch aussprach – mit dem Ton auf der zweiten Silbe.» Darin sah er eine «Sendung und Segen». Salin 1948a, 241. Bspw.: Tagung der List Gesellschaft 1931; Riese 1992, 7. Salins pragmatische Reflexionen über Mittel zur Bekämpfung der Effekte der Wirtschaftskrise waren selbst wieder theoretisch fundiert, wenn auch nicht in Georgescher Theorie, so doch in Währungstheorie. In diesem (und wohl nur in diesem) Sinne könne Salin auch schon 1931 als «Liberaler» bezeichnet werden, meint Riese 1992, 10. Einordnung dieser Schrift in die Krise der deutschen Nationalökonomie: Schönhärl 2009, 49 ff. und 139 ff. Schefold 2013, 217.
594
Geisteswissenschaftler
‚19. Jahrhunderts‘, einschliesslich des Kathedersozialismus, der Historischen Schule und des Wirtschaftsliberalismus, für überholt hielt. Zugleich wollte er die Vorteile eines historischen, philosophisch informierten, wertenden Ansatzes in der Ökonomie aufzeigen. Diesen Profilierungs- und Selbstverständigungstext hat Salin später mehrfach weiter ausgebaut.2530 7.7.2 Erwartungen bei der Berufung nach Basel Die schwierigen Anfänge der Nationalökonomie in Basel seit 1855 hat Martin Lengwiler erläutert.2531 Seit 1909 hatte die Universität zwei nationalökonomische Professuren, von denen eine mit dem Internationalen Arbeitsamt verbunden war, die andere, die vor allem durch eine dem Schweizerischen Bankverein nahestehende Stiftung finanziert wurde, mit den Interessen der Basler Wirtschaftskreise. Die erstgenannte Professur versah seit 1899 Stephan Bauer, die zweite war seit Sommer 1910 mit Julius Landmann besetzt.2532 Dieser hatte wie Bauer für das Arbeitsamt gewirkt; dann aber war er in leitender Funktion bei der Schweizerischen Nationalbank tätig geworden. Auf Bauers Professur wurde 1913 Robert Michels berufen. 1921 entstand eine dritte Professur in Basel, die für Statistik bestimmt war und mit Fritz Mangold besetzt wurde. Die Nachfolge von Michels, die Hans Ritschl antrat, wurde bereits von Salin beeinflusst,2533 der in der Expertenkommission der Kuratel sass. Diese Kommission schlug nach fünf Sitzungen unico loco Hans Ritschl für die Professur vor.2534 Ritschl empfahl sich selbst als Kenner des «alemannischen Volkscharakters» und wohnte während der Berufungsverhandlungen mit dem Erziehungsdepartement bei Salin.2535 Julius Landmann bewegte sich in Basel zunächst auf schwierigem akademischem Terrain, konfrontiert mit widersprüchlichen Erwartungen an ein Fach, das an der Universität nicht konsolidiert war.2536 Bald jedoch war seine hohe Kompetenz voll anerkannt, aber persönlich wurde er nach Ende des Ersten Weltkrieges zur Zielscheibe von Bank- und Investorenkreisen. Landmann und vor allem seine 2530 2531 2532 2533
2534
2535 2536
Föllmi 1999, 2. Lengwiler 2010, 2 ff. Heroisierende Darstellung von Leben und Leistungen Landmanns: Salin 1933. Vgl. Schönhärl 2009, 83–93 und 371. Salin empfahl für die Nachfolge von Michels in Basel folgende Namen: Ritschl, Gehlhoff und Bousquet; er betonte, dass er Ritschl für den besten Kandidaten halte. Salin an Erwin von Beckerath, 5. 4. 1928, in: Nachlass Salin, Fb 157. Bericht der Expertenkommission für die Neubesetzung des gesetzlichen Lehrstuhls ‚für Nationalökonomie und Statistik‘, gez. Chr. Buchmann (Präsident der Expertenkommission), 18. 6. 1928, in: Nachlass Salin, Beilage zu Fa 7576–7579. Ritschl an Salin, 11. 4. 1928 («Volkscharakter»), in: Nachlass Salin, Fa 7578, und Ritschl an Salin, 4. 8. 1928 (Gastrecht), in: Nachlass Salin Fa 7585. Anfänge der Nationalökonomie in Basel: Lengwiler 2010, 2 f.
Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen
595
Frau Edith2537 waren überzeugte Anhänger von Stefan George.2538 Die enge Beziehung zu George mochte dazu beigetragen haben, dass er zunehmend «staatlich» argumentierte. Er beschädigte seine Beziehungen zu den Bankkreisen dadurch dauerhaft, dass er eine Stempelsteuer befürwortete und das «arbeitslose Renteneinkommen» verachtete. Damit verlor er an Rückhalt im liberalen Bankmilieu. Weitere Gegnerschaft verschaffte ihm seine Art, «die Armseligen wie Gewürm zu zertreten». Die Unterlegenen «erwiderten ihm mit Verleumdung und Geifer, schmähten seine jüdische Geburt oder seine deutsche Geistigkeit, seine überlegene Haltung oder seine diktatorische Art».2539 Auch an der Universität hatte er nun einen schweren Stand. «Fakultät und Universität liessen es ihn jahrelang entgelten, dass er ohne ihre Zustimmung gewählt und berufen war von den Behörden, welche die Bedeutung des seltenen Mannes erkannten und die Gewalt seiner Person wichtiger nahmen als die ungewöhnliche und unregelmässige Vorbildung.»2540 Er wechselte deshalb auf das Wintersemester 1926/27 nach Kiel. Bei seinem Weggang von Basel empfahl Landmann, Salin zu wählen, den er als Gegner des reinen Wirtschaftsliberalismus kannte, aber auch als Bewunderer von George schätzte. Landmann provozierte in Kiel durch sein Lob für den Abbé Galiani (eine Gestalt, die für den Georgeaner durch Nietzsches Worte über ihn geadelt war)2541 und die Kritik aller staatlichen Wirtschaftsprogramme. Die deutsche Regierung empfing ihn zu seiner grossen Enttäuschung nicht als Berater.2542 Am Institut für Seeverkehr und Weltwirtschaft fühlte er sich unglücklich, fand so wenig Rückhalt wie zuvor in der Schweiz und überforderte sich selbst durch übertriebene Vorbereitungsarbeiten für seine Vorlesungen. 1931 beging er Suizid.2543 Basel suchte nach Landmanns Weggang einen Ökonomen, der sich mit Bank und Finanz befasste, sich auf Schweizer Fragen einlassen wollte und eine gewisse geistige und formale Brillanz mitbrachte, um das Fach attraktiv zu machen. Zwar entsprach der von Landmann vorgeschlagene Salin in gewissen Teilen dem Anforderungsprofil, aber mit seinem Namen verbanden sich noch ganz andere Aspekte, die in Basel Bedenken erweckten. Er trat als bekennender Georgeaner auf, wobei die sich auf den Dichter Berufenden als eine ‚Seilschaft‘ erschienen, die sich gegenseitig Stellen zuhielt.2544 In Deutschland hatte er als 2537
2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544
Edith Landmann verfasste eine Erkenntnislehre in enger Anlehnung an Stefan George. Schönhärl 2009, 28 ff. Bedeutung von Landmanns Erkenntnistheorie für die «Anschauliche Theorie» Salins: Schefold 1992, 318. Salin 1933, 16. Salin 1933, 8. Salin 1933, 5. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, § 26, nach: http://www.thenietzschechannel.com/ works-pub/bge/bge2.htm. Salin 1933, 11–13. Salin 1933, 14. Salin 1948a.
596
Geisteswissenschaftler
Gelehrtenpolitiker Stellung gegen die Regierungen der Weimarer Republik bezogen, die er für unfähig hielt, eine Katastrophe abzuwenden. Als einer der Gründer der List-Gesellschaft trat er für eine aktive Rolle des Staates in der Wirtschaft ein. Auch besass er offensichtlich eine hohe Meinung von sich selbst, die er nicht verbarg. Dies alles sprach ebenso wie die Befürchtung, dass er sich nach der Wahl nicht auf das Feld der Nationalökonomie beschränken werde, gegen ihn. In der Expertenkommission der Kuratel hatte der Historiker Hermann Bächtold zuerst nur konzediert, dass Salin ein «ganz besonderer Mensch», der «der grössere Geist» sei im Vergleich mit dem von Bächtold favorisierten Sven Helander (damals in Kiel). Landmann argumentierte ausführlich zugunsten von Salin. Der sozialdemokratische Regierungsrat Fritz Hauser2545 stimmte ihm zu, denn er wünsche sich für die Universität «eine erste Persönlichkeit». Die Einwände, die Max Gerwig gegen Salins Persönlichkeit vorbrachte, fanden keine Mehrheit. Bächtold gab schliesslich seinen Widerstand auf, weil Helander «langweilig» sei, worauf der Vorschlag, Salin zu wählen, die Oberhand gewann.2546 Da seine literarischen Interessen auf dem Lehrstuhl unerwünscht waren, wurde der Lehrauftrag eng gefasst, um solche Eskapaden auszuschliessen, aber die Distanz zum Liberalismus scheint man nicht für anstössig gehalten zu haben. Dass ein deutscher Hochschullehrer nicht loyal zu seiner Regierung stand, war nicht aussergewöhnlich und für Basel kein Problem. Salin entwickelte in Basel ein breites Unterrichtsprogramm zu Soziologie und Ökonomie im Sinne der List-Anhänger. Auch ergriff er schon 1929 die Möglichkeit, in der Basler Sozialpolitik praktisch mitzuwirken, und wurde Präsident des kantonalen Einigungsamts als Nachfolger des verstorbenen Obristen Dr. Carl Bohny.2547 Hier hatte er Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeiterorganisationen zu schlichten und über die Einhaltung von Gesamtarbeitsverträgen zu wachen.2548 Salin glänzte mit geistiger und rhetorischer Überlegenheit, grosser fachlicher Breite, profunder kultureller Bildung sowie den Kenntnissen, die er seiner Herkunft aus Industriellen- und Bankkreisen verdankte.
2545 2546 2547
2548
Spuhler 2006. Protokoll der 2. Sitzung der Expertenkommission, 21. 6. 1927, in: StABS ED-REG 1a 2 1545 Dossier Salin. Salin übernahm das Amt auf Bitten des Vorstehers des Departements des Innern, des Sozialdemokraten Gustav Wenk. Departement des Innern an Salin, 10. 6. 1929, in: Nachlass Salin, Fa 1766. Er tat dies nicht ohne Zögern und gab Wenk zu bedenken, dass er nicht Schweizer sei und Basler Mundart zwar verstehe, aber nicht sprechen könne. Salin an Wenk, 13. 6. 1929, in: Nachlass Salin Fb 3055. Wenk, der mit Salin oft uneinig war, hat seine Arbeit am Einigungsamt geschätzt und seinen Rücktritt ehrlich bedauert. Wenk an Salin, 7. 1. 1939, in: Nachlass Salin Fa 1770. Zu Wenk: Spuhler 2015. Lengwiler 2010, 8–10.
Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen
597
7.7.3 Grundlagen von Salins Nationalökonomie Salins bevorzugte Themen waren in der Periode von 1918 bis 1939 «die sich auflösende Weltwirtschaft und das Problem der Arbeitslosigkeit»; dazu gehörten Gegenstände wie die Europäische Währungsunion, der internationale Zahlungsausgleich, der Goldstandard und die Parität der nationalen Währungen.2549 Ergänzend wären seine Interessen an Konzentrationsprozessen und Standortfragen zu nennen.2550 Diese Themen waren mehrheitlich mit dem Versuch, als Berater2551 für Regierungen zu wirken, verbunden. Als Präsident des Basler staatlichen Einigungsamtes interessierte er sich für Massnahmen zur Schaffung von klassenübergreifender Solidarität in der Gesellschaft (Integration), woraus der Plan für den Arbeitsrappen resultierte.2552 Er lehnte die Moderne grundsätzlich ab, hielt die Verselbstständigung der Wirtschaft gegenüber Staat und Gesellschaft für ein Übel und kritisierte die Verwissenschaftlichung der Welt im liberalen 19. Jahrhundert. Damit verband er eine moralische Abrechnung mit dem beginnenden 20. Jahrhundert und den ‚Roaring Twenties‘ als «Tanz ums Goldene Kalb». Die Krisen der Epoche von 1918 bis 1932 verstand er als Durchgangszeit zu einem besseren Deutschland, das ihn Stefan George zu erhoffen gelehrt hatte. Platon, Goethe und Nietzsche waren seine Ausgangspunkte für die Suche nach einer Wissenschaft, die über faktenbezogene Korrektheit und methodisch gesicherte Objektivität hinausstrebe. Seine Habilitationsschrift über Platon und die griechische Utopie von 19212553 enthielt in diesem Sinne eine breite Wissenschaftskritik,2554 ebenso wie die Schriften, die er 1932 in Staat und Wissenschaft zusammenfasste. Es liegt nicht im Wesen der Wissenschaft, wohl aber in ihrer besondern ‚modernen‘ Art und Richtung, in ihrer Rückführung alles Lebendigen auf ursächlich oder zweckhaft Bestimmtes, auf Zahlen- und Mengenverhältnisse, auf entleerte Begriffe und entseelte Bilder begründet, dass von dieser tiefsten Weltsicht des klassischen Alters nur wenige Aussenseiter, nur die grossen Kämpfer gegen die Verödung und die Verflachung des Lebens bestimmt und bereichert wurden. ‚Die früheren Jahrhunderte‘, war eine andere Warnung Goethes erklungen, ‚hatten ihre Ideen in Anschauung und Phantasie; unseres bringt sie in Begriffe. Dort war die Produktionskraft grösser, heute die Zerstörungskraft oder die Scheidekunst.‘ Aber es wurde weiter ‚geschieden‘, weiter ‚begriffen‘ – ja, in der Ausscheidung der Werte, der ‚Wertfreiheit‘, das eigent2549 2550 2551 2552 2553 2554
Föllmi 1999, 7. Schefold 1992, 305. Salins Beratertätigkeit in Deutschland: Schönhärl 2009, 272 ff. Schönhärl 2013; Schönhärl 2009, 277–284. Salin las Platons Schrift nicht als «Utopie» im modernen Sinne, sondern als Dokument dessen, was Platon wirklich für den griechischen Staat gewollt habe. Salin 1921. Salin 1921, v. Er war offensichtlich bestrebt, eine Wissenschaftsauffassung zu entwickeln, die George akzeptieren konnte. Böschenstein u. a. 2005.
598
Geisteswissenschaftler liche Wesen der nun im doppelten Sinn wertlosen Wissenschaft gesehen. […] Der armseligste Stümper des in frevelnder Vermessenheit sich blähenden neunzehnten Jahrhunderts wusste es besser: der Mensch, die Krone der Schöpfung, hatte alle Welträtsel gelöst.2555
Friedrich Nietzsche und Stefan George hatten ihm die Bedeutung der «Seher» und «Täter» (im Unterschied zu den Wissenschaftlern) gezeigt. Die Antwort auf diese Schicksalsfrage [ob der wirtschaftliche Untergang komme oder der Hochkapitalismus weiterbestehe] kann weder durch Überlegung noch durch Erfahrung gefunden werden, die Zukunft durchdringt nur der Seher und bezwingt nur der Täter […]. An der Erkenntnis der Nöte und Greuel stählt sich der Wille, der sie überwindet.2556 […] Adel der Seele, sittliche Hoheit und geistige Würde bewähren im Wachsen der Gefahr ihre Kraft und Härte und jenseits des noch so bitteren Einzelschicksals liegt Trost in dem Wissen, dass das Leben eines Volkes über mögliche Zusammenbrüche der Wirtschaft hinaus durch tiefere Mächte bestimmt und beschirmt ist.2557
Nicht alles sei möglich für den Staatsmann, denn der Stoff, den er formen soll, habe wegen der im 19. Jahrhundert begangenen Fehler bestimmte Eigenschaften, die er nicht ändern könne. Darum und nur darum ist politische und wirtschaftliche Theorie – Theorie im tiefsten, griechischen Sinn des Wortes – auch heute möglich, nötig und sinnvoll. Sie hat die schöne Aufgabe, die Kräfte von Volk und Staat und die Schätze von Mensch und Boden zu weisen, welche sich für neuen Aufbau dem Handelnden bieten, und sie hat die bittere Pflicht, ihm die starren, schwer übersteigbaren Schranken zu zeigen, welche der Aberwitz eines Jahrhunderts auf der übervölkerten Erde aufgerichtet hat. […] Nachdem er [der «Fachmann»] mit Fug als Heilbringer verspielt hat, bleibt ihm noch eine kurze Weile das Amt des Deuters und des Beraters, – des Helfers bei der doppelten Aufgabe, deren ganze Schwere Nietzsche betont und deren volle Lösung er doch den Deutschen zugetraut hat: den männlichen und kriegerischen Tugenden nicht abzuschwören und doch einen Rest von Klarheit, Trockenheit und Kälte des Geistes übrig zu behalten. […] Eine einzige Voraussetzung der Wesenserkenntnis hat immer bestanden und wird immer bestehen, – man mag sie als offenen Sinn oder unbestechliches Auge, als echtes Gemüt oder natürliche Ehrfurcht bezeichnen und meint doch immer das Gleiche: die Gesundheit der Triebe, die Ursprünglichkeit der Sinne, kurz eine ungebrochene Natur und die menschliche Rundheit des Erkennenden. […] Eben darum führt in der wirklichen Erkenntnis etwa des Kapitalismus oder des Sozialismus, ja ‚der‘ Wirtschaft oft ein einziger Ausspruch von Nietzsche,
2555 2556 2557
Salin 1932, 9 f. Salin 1932, 10. Salin 1932, 140.
Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen
599
ein einziger Satz von Burckhardt weiter als ganze, noch so klug ausgesonnene und noch so sorgsam durchdachte Systeme der reinsten Gelehrten.2558
Wirtschaftsgeschichte interessierte ihn nicht in der Art der Historischen Schule der Nationalökonomie, sondern in der Absicht, die eigene Überzeugung deutlicher hervortreten zu lassen. Eine Nähe zu Harms’ weltwirtschaftlichem Institut in Kiel blieb offensichtlich, zusammen mit der Propagierung der Erinnerung an Friedrich List.2559 Seine grundsätzlichen Überzeugungen vom Wesen des Staates und dessen Verhältnis zu Wirtschaft und Gesellschaft bestimmten seine Ansätze auch in der Basler Praxis stärker als die lokalen Gegebenheiten. Mit der Auflösung des liberal-demokratischen Wirtschaftsstaates, mit der Rückkehr der Wirtschaft in ihre Mittel- und Dienststellung ist nicht nur die Voraussetzung für eine Rückbildung ‚der‘ Wirtschaft zur Mannigfaltigkeit der wirtschaftlichen Tätigkeiten und Berufe mit ihrem besonderen Leistungsstolz und ihrer besonderen Berufsehre geschaffen, sondern auch das Erlöschen der Aufklärungs- und GeldrechnungsKrankheit wirksam gefördert. […] Darum erhält die Frage nach dem Verhältnis der Wirtschaft zum Staat ihre gültige, in die Zukunft weisende und die Zukunft bestimmende Antwort letztlich nicht von der Wirtschaft aus, – nicht von der Wirtschaft in ihrer gegenwärtigen noch in irgendeiner möglichen Form, – sondern allein vom Staat aus, vom Staat nicht in seiner heutigen, sondern in seiner wahren Gestalt.2560
Seine Verwendung des vieldeutigen Georgeschen Schlüsselworts «Staat» (respektive «staatlich») verunmöglicht letztlich jede eindeutige Festlegung der Aussagen Salins auf eine bestimmte Realität, die im Zeitpunkt des Erscheinens dieser Schrift (1932) mit dem Staat als Diktatur identifiziert werden konnte (oder musste). «Erst in der Wiedereinfügung der Wirtschaft in den Staat, in der Wiederanerkennung des Vorrangs des Staates liegt die Gewähr für einen dauerhafteren Bau der wirtschaftlichen und der staatlichen Ordnung.»2561 «Ordnung» war ein weiteres Schlüsselwort für das jungkonservative Denken des frühen Salin. Öffentliche Ordnung konnte er sich damals nicht als Ergebnis von zivilgesellschaftlichen Aushandlungen, sondern nur als durch eine Autorität gesetzt vorstellen. Wie von der Basler Expertenkommission erwartet, gelang es ihm, Schweizer Studierende zu begeistern; die grosse Zahl von Dissertationen zu Basler und Schweizer Themen spricht dafür. Mit seinen Vorlesungen gewann er auch Menschen für sich, die von einer humanistischen Bildung herkommend zu den Staatswissenschaften vordrangen. Salins Professur war attraktiv für Studierende, die seine Provokationen als Anregungen verstanden, sich auf Unbekanntes einzu2558 2559 2560 2561
Salin 1932, 189–191. Salin 1932, 195. Salin 1932, 196 f. Salin 1932, 199.
600
Geisteswissenschaftler
lassen. Aufseiten der Frontisten äusserte sich keine Begeisterung für Salin; anscheinend verhinderte sowohl die Komplexität seiner gedanklichen Welt wie vor allem der Umstand, dass er zu den sogenannten ‚Nichtariern‘ gehörte, eine Vereinnahmung durch die extreme Rechte. Linke und demokratische Zuhörer und Leser erkannten allerdings Salins Nähe zum radikalen deutschen Konservativismus der Zeit nach 1918 durchaus. 7.7.4 Verhältnis zur Schweiz und zur Demokratie Vor seiner Wahl nach Basel könnte Salin eine bestimmte Meinung von der Schweiz durch seine Tätigkeit für die deutsche Gesandtschaft in Bern 1918 gewonnen haben; auch wurde darauf hingewiesen, dass seine erste Frau aus deutschem Grafengeschlecht in der Schweiz aufgewachsen sei. Die Gräfin Antonie Charlotte Trützschler von Falkenstein hatte einen Bruder, der in Genf am deutschen Konsulat arbeitete. Dieser Ehe entstammten eine Tochter und ein Sohn. Nach der Scheidung 1938 heiratete er 1949 die 25 Jahre jüngere Isolde Maria Baur aus Mannheim.2562 Sein Korrespondenznetzwerk bestätigt, dass er stets nach Deutschland schaute. Für Salins Entscheid, den Ruf nach Basel anzunehmen, scheint die Chance eine Rolle gespielt zu haben, einen Beobachtungsposten zu gewinnen, der ihm Sicherheit2563 und kreativen Abstand bei gleichzeitiger Möglichkeit bot, in Deutschland präsent zu bleiben. Zudem gab es in Basel GeorgeVerehrer, und der Weg nach Heidelberg war nicht allzu weit. Seine Geringschätzung für die deutsche Republik war nicht zwingend auf die Schweiz übertragbar. Aber der Basler Professor trat in die kritischen 1930er Jahre ein als ein pathetischer Grabredner nicht nur der Demokratie, sondern auch der Aufklärung und des Liberalismus. Er sah sich inmitten einer grossen Krise, in der die Moderne untergehen werde. Aus deren Zerstörung werde eine bessere Ordnung heraufziehen, in der die Massen dazu bestimmt sein würden, «dem formenden Geist den formbaren Stoff» zu bieten. Salins Freiheitsbegriff war damals unvereinbar mit den Ideen, auf denen die schweizerische Demokratie seit 1848 beruhte. Mit Bezug auf Platons Politeia erklärte er: In einer Zeit, da das Bild des wahren Staates erst den Wenigsten wieder sichtbar wurde, doch die sogenannte Wirklichkeit des gegenwärtigen Staates in ihrem gespenstischen Wesen für die Meisten ihre Kraft und Verbindlichkeit verlor, birgt der unverrückte Blick auf Werk und Lehre der grossen Vordern die einzige Gewähr, dass eigenes Trachten, Handeln und Werten von den ewigen Ordnungen und Gesetzen 2562 2563
Schönhärl 2009, 79 f.; Föllmi 1999, 2. Ich denke hier an die materielle Sicherheit des Ordinariats. In Heidelberg hatte er die Gothein-Gedächtnisprofessur inne, die von einer nicht sehr reich ausgestatteten Stiftung getragen wurde. In Kiel war er nur als Gast auf Zeit eingeladen gewesen.
Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen
601
nicht in zu grosse Ferne abirrt. Indem wir daher die Betrachtung der heutigen staatlichen Lage [Deutschlands, gemeint ist die Weimarer Republik] mit einer Erinnerung an das grösste Staatsbild der Vorzeit [Platons Politeia] beginnen, wird das erhabene Mass errichtet, vor dem jeder echte Staat und jede gültige Staatslehre sich bewährt, und wird zugleich der Blick geschärft für die Erkenntnis der heillosen Dürftigkeit all dessen, was sich Politik der jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart nennt, und fast all dessen, was sich mit Umkehr der Vorzeichen als Politik der Zukunft empfiehlt und anpreist.2564
Die von Demokraten und Liberalen gemeinte Freiheit ist nicht wie aller lebenskräftige, schöpferische und gestaltende Freiheitssinn der Geschichte verwurzelt in Gefühl und Bewusstsein der menschlichen und völkischen Würde, sie ist keine Freiheit zur Gefolgschaft, keine Freiheit, die sich frei zu eigen gibt, sondern sie ist geboren aus dem Hass gegen Macht und Grösse und sie meint bloss Befreiung von allen zufälligen Bildungen der Zeit. Daher ist sie vereinbar mit der grössten Unfreiheit, die sich ersinnen lässt, mit der Anerkennung der Herrschaft der Masse, deren Willen durch Abstimmung angeblich ermittelt und deren wahre Ansicht und Absicht in der Entscheidung der Mehrheit ausgedrückt und erkannt wird. Diesen mystischen Glauben an die Weisheit der Überzahl, den zuerst Rousseau in dunklen Worten verkündete, hat mehr als ein ganzes Jahrhundert ihm nachgebetet.2565 […Es] bleibt […] die ehrenvolle Bestimmung und unentbehrliche Leistung der unteren, der tragenden Schichten, der natürlichen Wurzel und Grundlage jeden Staates, das pflanzenhafte Wachstum nicht abreissen, nicht schädigen zu lassen und dem formenden Geist den formbaren Stoff, dem zeugenden Schöpfer den fruchtbaren Schoss zu bieten.
Eine zentrale Bedeutung komme deshalb dem «Bauerntum» zu. Die Notlage der Landwirtschaft, «dieser nur wirtschaftlich gesehene und benannte Sachverhalt, bedeutete nicht nur die Entvölkerung des Landes und eine Abwanderung in die Städte, sondern vor allem einen Raubbau an den besten, noch heil gebliebenen Wurzeln, Säften und Trieben des Volkes».2566 Die Volkheit hat Gespür und Trieb, nicht Bewusstsein und Willen. Im Volke kann es kreissen und gären, aber das Volk schafft weder Bau noch Ordnung. Wie für alle
2564 2565 2566
Salin 1932, 141 f. Salin 1932, 151. Salin 1932, 160 f. Über diese Gedanken gab es einen kurzen Austausch zwischen Salin und dem Schweizer Bauernführer Ernst Laur. Laur an Salin, 4. 8. 1932, in: Nachlass Salin, Fa 5774. «Verehrter Herr Kollege! Nun habe ich den grösseren Teil Ihres Buches ‚Wirtschaft & Staat‘ gelesen. Wieder ist es mir deutlich bewusst geworden, wie nahe wir uns stehen in der Beurteilung des öffentlichen Lebens, der Wirtschaft & des Staates.» Laur an Salin, 17. 1. 1933, in: Nachlass Salin Fa 5779. Kontext von Salins agrarpolitischen Interessen: Oberkrome 2013.
602
Geisteswissenschaftler noch naturverwachsenen Menschen, so galten und gelten daher für das wahre Volk in trächtigem Schlummer und in wachem Tun als Norm und Sitte und Traum der Sehnsucht kein erklügeltes Recht und keine erlogene Gleichheit, sondern die in ihrer schlichten Grösse einfachsten und darum für das menschliche und staatliche Dasein unentbehrlichsten Tugenden und Ziele: Kraft und Mut, Ehre und Würde, Ordnung und Friede.2567
Antidemokratismus sei ebenso ein Kind der Aufklärung wie die Demokratie selbst: Falsch sei deshalb die deutsche Hoffnung, dass jede Verfassung gut sei, wenn sie nur nicht demokratisch sei.2568 Dies unterschied Salin von den Faschisten. Er suchte mit George zwar eine neue, autoritäre Ordnung, die sich aber grundsätzlich den aus dem verhassten 19. Jahrhundert stammenden Kategorien wie Links und Rechts, Demokratisch und Antidemokratisch entzog. Für verfehlt hielt Salin auch den Schluss, die Konservativen müssten selbst eine Revolution herbeiführen und unmittelbar eine neue Staatsform einrichten. (Zu Salins Wahrnehmung des Nationalsozialismus siehe unten.) Er empfahl, der Krise ihren Lauf zu lassen und den Sinn einer «Orgie der Vernichtung» darin zu suchen, dass aus ihr das neue «Reich» hervorgehen könnte, für welches Stefan George seine Schüler vorbereite.2569 Die Schweiz nahm er jedoch von diesem erschreckend düsteren Bild aus. «Von den alten Demokratien hat nur die kleine Schweiz es weitgehend verstanden, den einstigen Vorteil der volksstaatlichen Verfassung: die innere und äussere Beteiligung des Bürgers an seinem Staat am Leben zu erhalten.»2570 So fand er die Schweizer Demokratie als Experimentierfeld interessant, während er weiterhin am Schicksal Deutschlands lebhaft Anteil nahm. Von Landmann konnte er wissen, dass er einen Rückhalt in der Gesellschaft brauchte, um hier in der «alten Demokratie» praktisch tätig sein zu können, und dass ein Fremder leicht diese Unterstützung verspielen konnte. In der Abscheu vor der Moderne fühlte er sich von Jacob Burckhardt und damit auch von Basel getragen und der «volksstaatlichen Verfassung» hatte er seine Huldigung entgegengebracht. Aber die Wirkung seines Bekenntnisses von 1932 auf schweizerische Leser und Hörer unterschätzte er. So kritisierten Studenten in seinem Kolloquium im Winter 1932/33 solche Auffassungen. Faschismus war für sie nicht eine Staatsform, die im 19. Jahrhundert wurzelte, sondern eine aktuelle Weltanschauung, gegen die man kämpfen musste. Wenn wir dem Basler «Vorwärts» Glauben schenken dürfen, war der Anlass gering, und die Reaktion Salins auf ein abfälliges Votum über Mussolini
2567 2568 2569 2570
Salin 1932, 164–166. Salin 1932, 167 f. Salin 1932, 173. Salin 1932, 159.
Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen
603
für die Teilnehmenden des Kolloquiums exzessiv. Die Zuschrift des von Salin abgekanzelten Studenten publizierte der Basler «Vorwärts» am 9. Februar 1933: Doch kaum geendet, springt der Herr Professor wutschnaubend vor die Versammlung, rot im Gesicht; vor Wut schnaubend kanzelt er den Verblüfften [ab] ob seiner ‚unsachlichen, unreifen Art‘, über einen Gott wie Mussolini so zu sprechen. [Tatsächlich hatte sich Salin noch 1930 begeistert über Mussolini geäussert.]2571 ‚Wir sind hier an einem Ort, wo wissenschaftlicher Ton herrschen soll!‘ […] Wie ein jähzorniger Junge raffte Professor Salin seine Blätter zusammen und verliess das Auditorium.
Der Student deutete die Szene so, dass Salin als Faschist und Hitleranhänger eine Kritik an Mussolini nicht dulden wolle: «Wer weiss, vielleicht hat Adolf Hitler seinen treuen Gefolgsmann, den Reparationssachverständigen Salin, geistig befruchtet? Oder ist ihm Basel mit [s]einen sehr annehmbaren Professorengehältern doch noch lieber?» Das war unfair, denn einerseits konnte man sich fragen, weshalb der Zwischenfall an die Öffentlichkeit getragen werden musste, und andererseits sollte man Salin zugute halten, dass er sich wirklich über politische Polemik in akademischer Debatte aufregte und nicht Mussolini verteidigen wollte. Aus der Tatsache, dass Salin Argumente gegen die Reparationen publiziert hatte, durfte nicht gefolgert werden, dass er ein Hitleranhänger sei. Der Text traf aber eine Stimmung, die sich offensichtlich an Salins jungkonservativem deutschem Patriotismus und an seiner Ablehnung der freiheitlichen Ideen des 19. Jahrhunderts entzündet hatte. In saloppem Sprachgebrauch war Salin damit als faschistoid denunziert. Journalisten lasen inzwischen sein Buch Wirtschaft und Staat. Johann Baptist Rusch2572 gab in der «National-Zeitung» eine Zusammenfassung der dritten Schrift in diesem Band. Er kritisierte die pauschale Verwerfung der Demokratie und konstatierte falsche Gleichsetzungen bei Salin: Liberalismus sei nicht Demokratie und Materialismus nicht Individualismus. Schliesslich wurde auch Rusch polemisch: «Wenn man selbst in Götterlehren personifizierter Staatsgewalten macht, sollte man zurückhaltend darin sein, in andersgerichteten Staatsauffassun2571 2572
Schönhärl 2009, 268, mit Hinweis auf Salin, Die deutschen Tribute, 1930, 41 f. 1932 war diese Begeisterung allerdings verflogen. Schönhärl 2009, 271. Johann Baptist Rusch: Stäuble 1954; Scherrer 2009; ferner Spindler 1976, 184 ff. Ruschs «Schweiz. Rep. Blätter» waren das Organ einer 1919 gegründeten Vereinigung Schweizerischer Republikaner. Rusch war ein unabhängiger Katholik. Ab 1921 verfasste er auch die Leitartikel der Samstagsausgabe der «National-Zeitung». «Fascismus» bedeutete für Rusch zuerst eine Sache Italiens, die die Schweiz wenig anging. Positiv bewertete er die Überwindung des Bolschewismus und den Korporativstaat. Ab 1925 berichtete er jedoch über die konsequente Verfolgung aller «Nichtfascisten» und erkannte in Mussolini nun den Schauspieler. Schon im Herbst 1927 vermutete Rusch, Mussolini ziele auf einen Krieg ab. Dann wurde Rusch antisemitisch und identifizierte den «Fascismus» mit dem Zionismus (!).
604
Geisteswissenschaftler
gen Pseudoreligionen zu sehen.» Für Rusch war die Vernunft des Menschen eine Gabe des Heiligen Geistes. Den Schluss bildete eine offene Aufforderung an Basel, Salin abzuschaffen: «Das Mass der Selbstachtung liegt in dem, was man sich gefallen lässt» (9. April 1933). Am 20. April 1933 erschien auf der Frontseite des «Landschäftler» ohne Verfasserangabe über mehrere Spalten ein mit Feind im Land! betitelter Artikel. Es habe sich der «Feind auf unbewachten Pfaden längst ins Land geschlichen». Es folgte ein Porträt von Salin, das gleichzeitig den Anhänger Georges und den Juden zeichnete sowie noch den Teufel dazu malte: «Er kommt daher in einem Aufzug, als hätte er eben in der Rolle des Mephisto in Gounods Oper ‚Margarethe‘ aufzutreten. Einen wallenden schwarzen Mantel hat er geheimnisvoll um sich geschlagen, und aus dem Mantel guckt ein Kopf mit arabischem Profil.»2573 Er lehre «Demokratieverachtung» und «Cäsarenwahnsinn». Dabei sollte die Hochschule «den Geist der schweizerischen Demokratie in den künftigen Führern unseres Volkes […] vertiefen». Salin erziehe «fascistische Geistessklaven» (das war offensichtlich eine Schlussfolgerung aus dem studentischen Text im «Vorwärts»). Es folgten einschlägige Zitate aus Wirtschaft und Staat. Der Autor schloss daraus, dass Salin sich nicht «weiter von einer Demokratie ernähren» lassen sollte. Nicht vergessen wurde der Hinweis, dass er in Deutschland als ‚Nichtarier‘ gar nicht mehr lehren könnte. Verbunden wurde dies mit einem Seitenhieb auf den sozialdemokratischen Erziehungsdirektor, der Salin toleriere: Die Demokratie dürfe nicht «ihre eigenen Mörder bezahlen». Salin kommentierte diese Vorgänge in der ersten Stunde des Kollegs «Einführung in die Volkswirtschaftslehre» vom 25. April 1933. Zu seiner Absicherung liess er seine Worte mitstenographieren. Wenn in der Oeffentlichkeit immer nur Rusche das Wort erhalten, verliert man allmählich die Lust, über die amtliche Verpflichtung hinaus etwas zu lehren […]. Es wird einem die Luft genommen, in der alle geistige Gestaltung wächst und gedeiht, wenn die Zahl derer immer geringer wird, die zu einer freien und unvoreingenommenen Aufnahme bereit sind. […] [Das Folgende ist unterstrichen und bildet den Schluss]: Irren Sie sich nicht, wenn solche Denunzianten meinen, einem vorwerfen zu können, dass man nicht Basler ist. Es gibt auch einen Stolz dessen, der nicht Basler ist, und der trotzdem und vielleicht verstärkt, gern und freiwillig, sich in die Tradition hineinstellt, die geistige Tradition, die an einem Orte und an einer Universität geschaffen ist. Ich bin hierher gegangen, und habe es damals ausgesprochen: mit dem Bewusstsein, an die Stätte zu kommen, an der einmal Nietzsche, an der Jakob [sic] Burckhardt gelehrt hat, und mit Entschlossenheit, nach besten Kräften in die2573
Das war nicht einmalig. Max Gerwig hatte sich in den Verhandlungen der Expertenkommission für Salins Berufung 1927 schon ähnlich geäussert: Er trug Bedenken angesichts von «subjektiven Meinungsäusserungen», «wegwerfender Kritik» und «allzu ausgeprägtem Selbstwertgefühl»; Salin trete auf «im Priestermantel der Georgiasten». Protokoll der Expertenkommission, 29. 1. 1927, in: StABS ED-REG 1a 2 1545 Dossier Salin.
Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen
605
sem besten Geiste hier zu sein und zu lehren. Ich gebe diesen Geist nicht preis, und wer Wert darauf legt, dass ein solches Geistiges hier noch wächst und gedeiht, der tut gut daran, abzurücken von denen, die am Werk sind ihn zu zerstören, auch wenn sie sich darauf berufen, Schweizer Demokraten zu sein. Ich sage dies mit besonderem Nachdruck in einer Zeit, die so gefährdet und so gefährlich ist wie die heutige für allen Geist. Vom lebendigen Geist hat das 19. Jahrhundert schon sehr wenig übrig gelassen, es hat ihn erstickt in einem Wust von Büchern, Paragraphen, Museen und dergl[eichen] mehr. Das 20. Jahrhundert tut ein Uebriges und wird noch mehr tun, um ihn zu verpönen. Es hat eine Zeit gegeben, vor fast schon 11/2 Jahrtausenden, da sind Kriegsstürme über Europa gegangen, und da haben die Klöster das Ihre getan um wenigstens einiges vom antiken Gut in eine andere Zeit hinüber zu retten. Die Zeit ist nicht mehr fern, wo es keine wichtigere Aufgabe geben wird als dass noch irgendwo in Europa eine Stätte besteht, die so Bewahrerin des Lebendigsten bleibt. Dann sollte es ehrenvoll sein, bis zum letzten Augenblick hier die Freiheit des lebendigen Geistes in Europa zu erhalten, und nicht um einer Idee, eines Ideals oder eines Idols willen eine der letzten Zufluchtsstätten zu zerstören.2574
Am 5. Januar 1934 griff die «Nation» das Thema auf mit einem Beitrag von Felix Schweizer (offensichtlich ein Pseudonym) über «Professoren und Demokratie».2575 Auch hier wurde der «Fall» Salin in den Kontext der Abwehr deutscher Professoren gestellt, die nationalsozialistisches Gedankengut in der Schweiz verbreiteten. Der Bestand unserer Demokratie hängt nicht davon ab, ob ihr ein deutscher Professor mosaischen Glaubens eine Leichenrede hält oder nicht. […] Indessen haben wir viel zu wenig Lehrstühle in der Schweiz als dass wir auch nur einen davon einem Professor abtreten dürfen, der sich darauf mit einer Weisheit produziert, die dem dritten Reich wahrhaftig zur Zierde gereichen würde […]. Wir brauchen auf unseren Lehrstühlen in erster Linie Führer, die die heranwachsenden Geschlechter bei aller wissenschaftlichen Strenge zu aktiven Gliedern unserer Volksgemeinschaft [gesperrt] zu gestalten wissen.
Demgegenüber verteidigte die «Arbeiter-Zeitung» am 17. Januar 1934 Salin gegen solche Angriffe. An der Universität lasse Salin «in loyalster Weise jeden noch so entgegengesetzten Standpunkt gelten […], wenn er in begründeter Weise und in den Formen, die eine geistige Auseinandersetzung nun einmal verlangt, vorgetragen wird.» Und markig schloss dieser Artikel: «Die organisierte Arbeiterschaft und ihre studierenden Genossen an den Hochschulen werden jedoch dieses Treiben – bei aller prinzipiellen Ablehnung der in dem Salin’schen Buche geäusser-
2574 2575
«Kolleg gehalten am 25. April 1933 (Stenogramm-Uebertragung)», in: Nachlass Salin, B 373. Schweizer 1934.
606
Geisteswissenschaftler
ten Gedanken – in keiner Weise mitmachen.»2576 Offensichtlich betrachteten die Basler Sozialdemokraten Salin als einen Bundesgenossen, was auch im Vertrauen zum Ausdruck kam, das Fritz Hauser ihm entgegenbrachte (siehe unten). Salin erwies sich jedoch in dieser Lage als hochfahrend, elitär, autoritär, als Verteidiger des ‚lebendigen Geistes‘ und dessen letzter Bastion in der Nietzsche- und Burckhardt-Stadt. «Er geriet [damit] in eine mehrdeutige Lage.»2577 In der Basler Universität war er in Kommissionen und Ämtern sehr präsent.2578 In den Staatswissenschaften hatte er sich zu Beginn seiner Basler Zeit erfolgreich für Ritschl eingesetzt, dessen «Geistesadel» und deutscher Patriotismus ihn beeindruckten. Trotz grosser psychologischer Unterschiede hatten Salin und Ritschl gemeinsame Vorstellungen von der Rolle des Staates in der Wirtschaft. Zudem war Ritschl sein Leben lang ein Gegner der Republik; er hielt noch nach 1945 daran fest, dass für Deutschland nach 1918 eine konstitutionelle Monarchie das Richtige gewesen wäre. Während sich jedoch Salin auf Experimente mit der Basler Demokratie einliess, blieb Ritschl zurückgezogen und pflegte eine nationale Pflichtethik.2579 1935 stellte Salin ein Gesuch um Aufnahme in das Basler Bürgerrecht. Daraus wurde eine lange Affäre, die Salin als beleidigend erlebte. Die lokalen Behörden befürworteten mehrfach seine Einbürgerung; die von Heinrich Rothmund geleitete Polizeiabteilung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements lehnte sie jedoch immer wieder ab oder schob die Entscheidung hinaus. Interessant ist das Schreiben von Fritz Mangold, der 1935 bei Rothmund die Wiedererwägung beantragte. Daraus ergeben sich nicht nur Einblicke in die antisemitische Stimmungslage, sondern auch solche in Nachwirkungen der erwähnten Kontroverse von 1933/34. Mangold «wüsste nichts gegen eine Einbürgerung Prof. Salins vorzubringen; es sei denn, dass grundsätzlich kein, aber auch gar kein Jude mehr, in unser Bürgerrecht aufgenommen würde.» Bekannt sei, dass Studenten «irrtümliche Behauptungen» verbreitet hätten. «Es wäre etwas sehr Seltsames, wenn sich ergäbe, dass der vom Regierungsrat ernannte Präsident des Einigungsamtes des Schwei2576
2577 2578
2579
Die «Arbeiter-Zeitung» hielt treu zu Salin. So gratulierte sie ihm in Nr. 36, 12. 2. 1951, zum 60. Geburtstag mit den Worten: «Salin ist ein unbestechlich treuer Freund der Arbeiterbewegung, weil er weiss, dass ihr Hineinwachsen in die Verantwortung für das gesamte Volk die Aufgabe unserer Zeit ist.» Ausschnitt in: StABS UNI-REG 5d 2-1 (1). Schefold 2013, 219, mit Bezug auf Salins Schriften vor 1933. Salin bedauerte, dass man in der Nachfolge Bächtold oder Dürr nicht «neuen Glanz» gesucht habe. Damit meinte er den Umstand, dass die Kandidatur von Ernst Kantorowicz keine Chance hatte. Burkart 2015, 194. Kantorowicz liebte Salin allerdings gar nicht. Schönhärl 2009, 126. Wahlen für die beiden Basler Historiker-Lehrstühle 1934: Wichers 2013. Ritschl an Salin, 10. 2. 1973, in: Nachlass Salin, Fa 7595a, und Ritschl an Salin, 10. 6. 1973, ebd., Fa 7595b.
Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen
607
zer Bürgerrechts nicht würdig wäre.» Salin habe sich in Basel «angewöhnt, wie wenige unserer fremden Professoren». Salins Frau (Gräfin Trützschler von Falkenstein) sei «zum guten Teil in der Schweiz aufgewachsen», sie spreche «unsere Mundart». «Der bekannte J[ohann] B[aptist] Rusch hat ihn einmal in der National-Zeitung angegriffen, zu Unrecht, und als damals einer der Studierenden mit vollem Namen sich für Prof. Salin wehren wollte, nahm die Redaktion seine Einwendungen nicht auf. Salin ist nicht Fascist und nicht Nationalsozialist […,] er ist auch weder Sozialist, noch Kommunist, sondern parteilos.» Salin sei ein Freund Landmanns gewesen. Dieser sei bereits wenige Jahre nach seiner Einreise in die Schweiz in Basel eingebürgert worden. «Er stammte aus Galizien, war ein Ostjude, und doch hat er unserm Lande ausserordentlich wertvolle Dienste geleistet; als rechte Hand Hirters, als Generalsekretär der Nationalbank, als Experte des Finanzdepartements (wenigstens unter Herrn Bundesrat Motta) und vor allem des Volkswirtschaftsdepartements. Salin könnte uns dieselben Dienste leisten. […] Ich selbst liebe die Einbürgerung von Nichtariern nicht, aber man hat von Fall zu Fall zu entscheiden.»2580 1940 erhielt Salin den Bescheid von Rothmund, seine Dienststelle sei wegen der Mobilmachung überlastet, man könne «Ihre Einbürgerungsangelegenheit zurzeit nicht weiterbehandeln». «Ausnahmsweise» sei er bereit, «Ihnen und ihren Kindern schweizerische Ausländerpässe zu verabfolgen».2581 Die Folge war, dass Salin im Jahre 1943 nur eine Toleranzverfügung erhielt, weil die deutschen Behörden ihm als Juden den Heimatschein nicht verlängerten2582 – im Unterschied zu seiner inzwischen geschiedenen Ehefrau, die als deutsche ‚Arierin‘ die volle Niederlassung erhielt und behielt. Salin empfand das als Unrecht: «Das heisst: meine Stellung als Basler Beamter reicht bei mir nicht mehr aus, dagegen Nazipapiere sind eine bessere Unterlage!» protestierte er beim Regierungsrat Carl Ludwig.2583 Noch 1950 hatte Salin bloss einen Reisepass für Ausländer. Bevor ich Salins Rolle in der Basler Wirtschafts- und Sozialpolitik kurz erörtere, möchte ich ein weiteres Moment der Fremdheit zwischen Salin und Basel ansprechen. Es hing mit dem Thema Nietzsche und Burckhardt zusammen. Die Universität Basel veröffentlichte damals ein Universitätsprogramm, eine offizielle Schrift, die im Turnus von jeweils einem Professor einer wechselnden Fakultät im 2580
2581 2582
2583
Mangold an Heinrich Rothmund, Abteilungschef der Polizeiabteilung des EJPD Bern, 15. 10. 1935, in: Nachlass Salin, Fa 5994–6000, Beilage. Salin wurde auch vom Erziehungsdirektor Hauser unterstützt, der sich direkt an Bundesrat Baumann (EJPD) wandte und um wohlwollende Erledigung des Gesuchs bat. Hauser an Baumann, 7. 5. 1938, in: StABS ED-REG 1a 2 1545 Dossier Salin. EJPD Polizeiabteilung, Rothmund an Salin, 20. 5. 1940, in: Nachlass Salin, Fa 7129. Schreiben von Salins Anwälten Löw/Würz/Meerwein an die kantonale Fremdenpolizei, 28. 1. 1943, und an Erziehungsdirektor Carl Miville, 1. 2. 1943, in: StABS ED-REG 1a 2 1545 Dossier Salin. Salins deutscher Heimatschein war am 12. 7. 1942 abgelaufen. Salin an Ludwig, 18. 12. 1944, in: Nachlass Salin, Fb 1831. Zu Ludwig: Wichers 2017.
608
Geisteswissenschaftler
Namen der Universität verfasst wurde. Über Thema und Verfasser wurde abgestimmt.2584 Was sich die Kollegen dabei dachten, Salin das Thema Friedrich Nietzsche und Jacob (er schrieb stets «Jakob») Burckhardt zu überlassen, ist unbekannt. Immerhin hatte Salin darüber einen Volkshochschulkurs veranstaltet, so dass es nicht unmöglich gewesen wäre, Kenntnis von der damit verbundenen Tendenz zu erlangen. Jedenfalls wurde daraus ein aufschlussreiches Buch – aufschlussreich für Salin und für die Grenzen seiner Integration, die er wohl bewusst gezogen hat.2585 Salin wollte den Gegensatz zwischen den zwei Männern so konstruieren, dass er Burckhardt zur Folie, Nietzsche zur Lichtgestalt machte. Nietzsche erschien als Seher und Prophet, Burckhardt nur als ein Bürger. Masken trugen nach Salin beide, aber diejenige Burckhardts sei leblos gewesen. Burckhardt wurde als schweizerisch-baslerisch-eng, Nietzsche als deutsch gesehen. Salin hatte eine Vorliebe für ‚Ahnenreihen‘ (auch «Kirchenväter» genannt2586 ), die von Platon zu Dante zu Michelangelo zu Goethe, Hölderlin, Nietzsche und Stefan George reichten. Unverzeihlich für den Platon-Bewunderter Salin war deshalb «die Art, wie [Burckhardt] den Platon schulmeistert».2587 Salin porträtierte sich anscheinend selbst in der Nietzsche-Nachfolge als tragischer Maskenträger, der «Dionysos in die Augen gesehen»2588 hatte, Grosses, Einsames wollte inmitten einer Schar von verständnislosen Provinzlern. Salin stellte zwar Burckhardts Problemstellungen und Leistungen durchaus mit positiven Zügen dar, denn auch Burckhardt hatte den «dürren Fortschrittsglauben» und den «nationalistischen Wahn» kritisiert.2589 Salin war bestrebt, Nietzsche vor dem Fehlurteil, er gehöre zu den Wegbereitern des Nationalsozialismus, zu retten und stellte ihn gemeinsam mit Burckhardt als radikalen Kritiker der Moderne, insbesondere des modernen Deutschland von 1871, vor. Doch Nietzsche sei überlegen gewesen, weil er seine Kritik radikal, mit Einsatz der ganzen Existenz, übte und damit in Salins Auffassung Burckhardt als mutlos und selbstbezogen entlarvte. Burckhardt such-
2584 2585 2586 2587
2588 2589
Rektor Fritz Mangold offiziell an Salin, 16. 3. 1937, in: Nachlass Salin, Fa 5997. Der Themenvorschlag war am 10. 3. 1937 angenommen worden. Salin 1938. Andere sprechen von «Johannes-Funktion», da diese Gestalten auf George hinweisen sollten wie Johannes auf Christus. Schönhärl 2009, 231. Salin 1938, 98. Schon in: Salin 1921, 270, lässt sich die folgende Fussnote zu Burckhardt finden: «Vgl. aus neuerer Zeit selbst Burckhardt, dessen ganze Stellung zu Platon freilich merkwürdig negativ, fast hämisch ist: vor aller fordernden Grösse (ausser vor Platon zum Beispiel vor Michelangelo und Napoleon) verschliesst der dem Absoluten feindliche Historiker den Blick. Vgl. Griechische Kulturgeschichte, 3. Aufl., passim, u. a. I, 198 ff., 285 f., 357 f.» Salin 1938, 201. Salin 1938, 62 f.
Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen
609
te nach Salin Weisheit, Nietzsche aber war der «tatendurstige Merker»2590 : «[…] denn wo dem Historiker [Burckhardt] als Ziel das Weise-Sein vorschwebt, da setzt der Philosoph [Nietzsche] den Willen und die Tat.»2591 Salin erkannte zwar Burckhardts Ironie und verstand deren Funktionen recht genau, aber er bewertete sie negativ.2592 Der Basler hatte angeblich «die geheime Angst vor allem Titanischen», darum konnte er «Michel Angelo» nicht voll würdigen, und darum sei er «blind» für Dante gewesen. «Nun gehört es wirklich zu Burckhardts Wesen: auf den innersten Geist der Menschen und Zeiten zu lauschen und ihre innersten Kräfte aufzuspüren, aber sofort auszuweichen, wenn die eigene Selbstbehauptung in Frage gestellt ist, wenn von einem überragend Grossen letzte Hingabe, bedingungslose Nachfolge verlangt wird.»2593 Trotz einer tendenziell negativen Charakterisierung gewann Salin Erkenntnisse über Burckhardt, die als tragfähig gelten können. Er formulierte deutlich, dass Burckhardt nicht in die Ahnenreihe einer Bindestrich-Historie namens «Kulturgeschichte» gehörte.2594 Die Bedeutung der Bilder und damit der Augen bei Burckhardt hat Salin gesehen. Geschichte war für Burckhardt «Poesie im grössten Massstab».2595 Interessant waren auch Salins Ergebnisse zur Frage nach Burckhardts Verhältnis zum Christentum. Im Vergleich zu Nietzsche, der mit «unzerreissbaren Ketten» mit dem Christentum verbunden blieb (gerade im Ver-
2590 2591 2592 2593
2594 2595
Salin 1938, 115. Salin 1938, 30. Salin 1938, 27 (Zit.), 55, 79. Salin 1938, 45. Carl Jacob Burckhardt wusste (allerdings viel später) Salin über Burckhardt und Bachofen zu berichten: «Merkwürdig, Ihre Erkenntnis von J[acob] B[urckhardt]s Zurückschaudern vor jeder Erscheinungsform letzthiniger Grösse. Dies entspricht dem Empfinden, das unser Grossvetter J[ohann] J[akob] Bachofen ihm gegenüber hegte, ihm war der Pfarrersohn vom Münsterplatz unangenehm, er hat ihn ‚einen redegewandten Aestheten‘ genannt. J. J. Bachofen war der moralistische (nicht der moralische!) der rationale Zug in Burckhardt fatal. Auf der anderen Seite aber ertrug er jede Form von deutscher Exuberanz sehr schlecht. Als Nietzsche einmal in sein Haus kam, sich ans Klavier setzte und, wie berichtet wird, über eine Stunde mit viel Pedal Wagner spielte, beschloss Bachofen ihn nie wiederzusehen. Welch merkwürdige Zeitgenossen in dieser damals so kleinen Stadt (seither meinten so viele meiner Mitbürger, es genüge ‚merkwürdiggspässig‘ zu sein.) […] Ich glaube, dass J. B. immer nach Verhaltenheit strebte, der Begriff der Grösse fehlte ihm nicht, aber er anerkannte ihn nur innerhalb jener Selbstkontrolle, die wir heute der Atomkraft auferlegen möchten. Ist das nicht auch sehr linksrheinischfranzösisch? Mir ist immer der Ausspruch Bouchardons so bezeichnend, der, als man ihm Homer zu lesen gab, ausrief: ‚je ne saurais admirer ces hommes audessus de la mesure humaine‘. Darin liegt der Schlüssel zu allem Französischen.» Burckhardt an Salin, 12. 2. 1959, in: Nachlass Salin, Fa 1295. Publiziert in: Burckhardt 2015. Salin 1938, 44. Salin 1938, 28.
610
Geisteswissenschaftler
such der Überwindung), wirkte Burckhardt auf Salin frei in Religionsdingen.2596 Aber Nietzsche war sein Held. Nietzsche galt jedoch damals in Basel als Vordenker des nationalsozialistischen Übermenschen. Innerhalb der Universität regte sich nach der Veröffentlichung Unmut. Der Fakultätskollege Felix Stähelin, Professor für Alte Geschichte und Grossneffe Jacob Burckhardts, liess in der Regenz seinen Protest zu Protokoll geben. Die Schrift von Salin habe die Erwartungen enttäuscht. «Als Ergebnis wissenschaftlicher Forschung durfte sie unter dem Patronat unserer Universität nicht erscheinen.» Denn Burckhardt und Nietzsche würden mit «ungleichen Massstäben gemessen». Nietzsches Verfall in Wahnsinn werde zu einer «Entrückung in den Götterhimmel» umgedeutet, während Burckhardt als «verkauzter Sonderling behandelt» werde. «Ganz einseitig wird das Prädikat des göttlichen Geistes dem einen zu ungunsten des andern in Form einer Apotheose zuerteilt; es werden in einer Art, wie ich sagen möchte, theologischer Orthodoxie Werturteile aufgestellt, die sich nicht vertragen mit vorurteilsloser Sachlichkeit und unparteiischer Gründlichkeit.»2597 Angesichts der Kleinheit der Basler Verhältnisse, in denen vieles nur mündlich ausgetauscht wurde, vermute ich, dass auch andere schlecht darüber sprachen. Jedenfalls erschien in der frontistischen Presse die Bemerkung, Salin mache aus Burckhardt einen Heiden, was dort allerdings dem Zweck diente, Salin als destruktiven Juden zu apostrophieren.2598 7.7.5 Salin in der Basler Wirtschaft und Politik Salin benutzte die Basler Situation als Experimentierfeld für seinen an Friedrich List geschulten Ansatz der Wirtschaftspolitik und der Sozialpolitik im Kleinen. Der Umstand, dass er mit Basler Gepflogenheiten anfangs wenig vertraut war, bot ihm Vor- und Nachteile. Ein Vorteil bestand darin, dass er wirklich unabhängig war und demzufolge gut zwischen streitenden Parteien vermitteln konnte. Nachteilig war die Gefahr, dass sein Auftreten missverstanden wurde und ihm auf die Dauer daraus (ungerechtfertigte) Kritik erwachsen musste. Auch begab er sich auf das politische Parkett eines demokratischen Kleinstaates im Klassenkampf, an dessen Regeln er sich nicht gebunden fühlte, was auch aufseiten der Politik für Unmut sorgen konnte. Schliesslich war in der «Mitte», in der er für das durch den «Staat» (in seinem respektive Georges Verständnis) gedeckte Vorgehen Platz suchte, in der Basler Politik nur schwer ein Ort zu finden, war doch dieser Staat weder eine Obrigkeit noch ein ideales Gemeinwesen, sondern eine 2596 2597
2598
Salin 1938, 181 f. Schreiben des Rektors Ernst Staehelin an Salin, 20. 1. 1939, in: Nachlass Salin, Fa 9514, und Abschrift der Protokollnotiz von Felix Stähelin vom 18. 1. 1939 als Beilage zu Nachlass Salin, Fa 9513–9517. Meier 1981, 98.
Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen
611
Agentur einer fliessenden und konfliktreichen politischen Basis. Die Regierungsräte, die seine hauptsächlichen Partner waren, Fritz Hausers Klassenkamerad aus der Oberen Realschule Gustav Wenk für das Innere, Carl Ludwig für die Finanzen, Adolf Im Hof für die Justiz und Fritz Hauser für die Erziehung, waren keine unabhängigen «Führer», sondern blieben an das parteipolitische Getriebe2599 und die Wählergunst gebundene Politiker, Taktiker und Administratoren. Dass Salin trotzdem einen grossen Erfolg mit dem von ihm initiierten «Arbeitsrappen»2600 erzielte und dass er in zahlreichen Verfahren der Einigungsstelle zu Vermittlungen kam, die ihm den Respekt beider Seiten verschafften, ist offenkundig. Erfolg aber rief wiederum Kritiker auf den Plan, die nicht an sozialer Vermittlung und Minderung der Arbeitslosigkeit, schon gar nicht an einer Stärkung der Rolle des Staates im Wirtschaftsleben interessiert waren, sondern politisch von Konflikten lebten und den Klassenkampf intensivieren wollten. So wurde er in kleinliche Auseinandersetzungen hineingezogen bis hin zur Verdächtigung, im Amt Verschwendung betrieben, Parteien in Schlichtungsverhandlungen durch Bestechung zum Einlenken bewogen und privat Steuern hinterzogen zu haben. Diese Elemente gehörten zur Agitation der Rechten, die dem Kapital in der Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften völlig freie Hand bewahren und den Staat nur als Garanten der öffentlichen Ordnung dulden wollten. Die äusserste Linke sah in Salins Wirken richtig den Versuch, dem Staat einen starken Einfluss als Moderator des Verhältnisses zwischen Kapital und Arbeit zu verschaffen, und falsch die Tendenz, einen faschistischen Korporativstaat errichten zu wollen, der die Gewerkschaften ausgeschaltet hätte. Schliesslich stand auch Salins Expertise quer zu liberalen und konservativen Versuchen, der Wirtschaftskrise durch eine strikte Politik der Austerität zu begegnen. Im Hintergrund der Angriffe standen Antisemitismus, die unversöhnliche Klassenkampfposition eines Teils der Basler Liberalen (lokalisiert in der Handelskammer) und die entsprechende Gegenposition der radikalen Linken. 1938 sollte er durch ein politisches Manöver der Liberalen aus dem Einigungsamt verdrängt werden. Salin selbst vermutete auch, dass diese Aktion dazu diene, seine seit 1935 hängige Einbürgerung zu hintertreiben.2601 Dabei lancierte der Erste Sekretär der Handelskammer, Hermann Henrici-Müller,2602 den Vorwurf der Steuerhinterziehung.2603 Die Finanz2599 2600 2601 2602 2603
Stirnimann 1989 und 1992; Burckhardt 1984. Stirnimann 2021, 196 ff. Salin an Hauser, 12. 12. 1938, in: Nachlass Salin, Fb 1237. Von Hermann Henrici besitzt die UB Basel einen kleinen Nachlass: NL 180, den ich jedoch nicht eingesehen habe. Briefe an Regierungsrat Carl Ludwig, 12. 11. 1938, in: Nachlass Salin, Fb 1819. Henrici verlangte im Grossen Rat die Prüfung der Bezüge der Mitglieder des Einigungsamtes. Stellungnahme von Salin zum Bericht der Finanzkontrolle, 26. 11. 1938, ebd., Fb 1821. Salin wollte die Ämter niederlegen, da niemand in der Liberalen Partei sich von den von Henrici vorgebrachten Anwürfen distanzierte, 19. 12. 1938, ebd., Fb 1824. Jemand (aus dem De-
612
Geisteswissenschaftler
kontrolle sprach Salin von diesem Vorwurf frei, aber Salin hatte genug von der Basler Parteipolitik, obschon sich nicht nur Fritz Hauser, sondern auch Gustav Wenk, der kein Freund des Arbeitsrappens war, hinter ihn stellte.2604 Enttäuscht war Salin auch vom liberalen Regierungsrat Carl Ludwig, vom dem er vergeblich erwartete, dass er die Grossräte «seiner» Partei, die – wie Salin es nannte – eine «Sudelpolitik» betrieben, zurückgebunden hätte.2605 Die Auseinandersetzung flammte 1941 erneut auf, als Henrici diesmal die Ausgaben des Arbeitsbeschaffungsrats, dem Salin ebenfalls angehörte, angriff.2606 Die Spielregeln der kleinen politischen Arena liessen keine Gelehrtenpolitik (in der Art einer rein wissenschaftlich fundierten Politikberatung durch Professoren)2607 zu, sondern forderten den Positionsbezug innerhalb des parteipolitischen Feldes und verlangten dort im Rahmen von Bündnissen Loyalität. Der Erziehungsdirektor Fritz Hauser vertraute Salin in der Art eines politischen Männerbündnisses, für das das Ehrenwort, die ungeschriebene Pflicht und absolute Verlässlichkeit galten. «Hochverehrter Herr Prof., Heute ist es mir ein besonderes Bedürfnis, Ihnen für Ihre Treue und Ihre Hilfe ganz besonders zu danken. Ich werde Ihnen das nie vergessen; es gibt mir Mut zu neuer Arbeit. Ihr F. Hauser». So war der Tenor 1931 zu Beginn der Zusammenarbeit.2608 Salin lieferte dem sozialdemokratischen Politiker mehrere, meist informelle wirtschafts- und sozialpolitische Gutachten zu dessen persönlicher Orientierung.2609 1934 verlangte Hauser von Salin eine kritische Durchsicht des Entwurfs für ein eidgenössisches Bankengesetz.2610 Salin, der sich nicht als politisch gebundener Gefolgsmann sah, verstand das Verhältnis zu Hauser anders. Missverständnisse waren deshalb unaus-
2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610
partement Ludwigs?) hatte Henrici Salins Steuererklärung oder den Bericht Ludwigs über Salin an den Regierungsrat Henrici zugespielt. Briefe Salins an Regierungsrat Gustav Wenk, 13.12., 17. 12. 1938 und 6. 1. 1939, in: Nachlass Salin, Fb 3059–3062. Salin an Ludwig, 1.4. und 24. 4. 1939, in: Nachlass Salin, Fb 1826 f. Salin an Ludwig, 7. 7. 1941, in: Nachlass Salin, Fb 1830. Schmidt/Rüsen 1986. Karte von Hauser aus dem Nationalrat in Bern an Salin, 21. 3. 1931, in: Nachlass Salin, Fa 3858. Genereller Dank für solche Gutachten ohne nähere Spezifizierung, Hauser an Salin, 2. 7. 1931, in: Nachlass Salin, Fa 3859. Hauser in Rigi-Kaltbad auf Briefpapier des Nationalrats an Salin, 20. 8. 1934, in: Nachlass Salin, Fa 3872. Auch der freisinnige Basler Ständerat Ernst Thalmann war in die Diskussionen über das Bankengesetz involviert; 1934 übergab er alle seine Akten zu diesem Thema dem von Salin geleiteten Staatswissenschaftlichen Seminar der Universität. Briefe Salin an Thalmann, 1932, in: Nachlass Salin, Fb 2892–2893. Salin verfasste auch für Thalmanns Anwaltskanzlei ein Gutachten zum Prozess ‚Publicitas (Annoncenagentur) gegen Basler Nachrichten‘: Dank Thalmanns an Salin, 1937. Briefe Thalmann an Salin, in: Nachlass Salin, Fa 9772–9780.
Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen
613
weichlich. So tadelte Hauser Salin dafür, dass er die Intrigen der Liberalen gegen seine Person nicht aushielt. Auch missfiel ihm, dass Salin ihn in einzelnen Fragen nicht konsultierte, dafür aber Informationen, die Hauser für vertraulich hielt, an Dritte weitergab. Ob absichtlich oder nicht, Ihre Demission in diesem Augenblick bedeutet eine Fahnenflucht aus einer Verantwortung heraus, der Sie sich ja doch nicht entziehen können, denn am Anleiten und auch an seiner Form waren Sie mitbeteiligt. Ich hatte mich immer für Sie eingesetzt, aus ehrlicher Überzeugung und in Anerkennung Ihrer grossen Leistung und Aufopferung und nun lassen Sie mich im Stich, denn anders kann ich es nicht auffassen [ ] wenn jemand Anlass hätte, sich bei Seite zu stellen, umsomehr als meine Abwesenheit mir beim Anleiten auch noch formell Recht gäbe, so wäre ich es. Und ich tue es doch nicht, nun erst recht nicht. Und bei dieser Gelegenheit muss ich Ihnen noch etwas anderes sagen. Ich hatte auf Ihren Rat Herrn V[alentin] Wagner gebeten mir zu helfen bei der II. Finanzvorlage. Ich bin sehr glücklich darüber, denn ich muss anerkennen, dass V. Wagner seine Arbeit vorzüglich gemacht hat. Aber es war sicher nicht notwendig, dass Sie Herrn Bohny darüber orientierten und mich damit der grossen Gefahr öffentlicher Polemik über den sachlichen Inhalt der Vorlage hinaus aussetzten.2611
Dennoch erwartete Hauser weiterhin Ideenskizzen von Salin, nun für seine geplante Kritik an der Position seines liberalen Regierungskollegen Carl Ludwig zum Basler Staatsbudget. Nächsten Donnerstag ist Budgetberatung. Ich möchte gern für ein paar allg[emeine] Bemerkungen gerüstet sein. Ludwig hat zwar erklärt, dass, seit er andere Staatsrechn[ungen] genauer anzusehen habe (sic!) er unsere Vermögenslage günstiger ansehe; aber er wird doch müden2612. Jede Baumassnahme bekämpft er nun. Ich teile seine prinzipielle Auffassung nicht, dass in der jetzigen Zeit ein Budget ausgeglichen sein soll. Das ist naiv. Würden Sie mir darüber ein paar Worte schreiben; Sie kennen ja unser Budget und unsere Rechnung. Ihr ergebener F. Hauser.2613
Hausers Erwartung, dass Salin wie ein mannhafter Politiker in den Stürmen der Auseinandersetzungen aufrecht zu stehen und sich an Hauser als seinen Partner zu halten hätte, kam 1939 noch einmal deutlich zum Ausdruck. Wer sein Gemeinwesen wirklich liebt, zieht sich nicht wegen eines persönlichen Grolls in den Schmollwinkel zurück, ganz abgesehen davon dass ich bei Ihrer mir immer erwiderten freundschaftlichen Gesinnung mir gegenüber ich [sic] erwartet 2611 2612 2613
Hauser an Salin, 1. 1. 1937, in: Nachlass Salin, Fa 3878. «Müden»: Dialektwort für Einwände erheben, opponieren, nörgeln. Hauser an Salin, 2. 2. 1939, in: Nachlass Salin, Fa 3882. Das ‚Deficit Spending‘, das dem Sozialdemokraten Hauser wie dem politischen Ökonomen Salin als Mittel der Wahl galt, verweist auf das Verhältnis Salins zu Keynes, dazu: Riese 1992, 11–15.
614
Geisteswissenschaftler hätte, dass Sie mir und nicht Ludwig, der ja unsere Sanierung sabotiert Ihren Plan mitgeteilt hätten. Das ändert aber an meiner steten treuen Gesinnung nichts. Ihr F. Hauser.2614
Salin selbst hat im Rückblick seine Erfahrungen mit der Basler Politik positiv gewürdigt und darin eine Gelegenheit gesehen, sich mit der lebendigen Demokratie vertraut zu machen.2615 Es blieben aber Divergenzen, die teils mit seiner fortwährenden Bewunderung für Stefan George und seinem deutschen Patriotismus zusammenhingen, teils mit seiner Bereitschaft, auch Studenten, die links von der Sozialdemokratie standen, ein Dissertationsthema zuzuteilen. Überdeutlich formulierte dies der kranke Valentin Fritz Wagner, der ihm kurz vor seinem Tod schwere Vorwürfe machte: Kaum sei der Krieg zu Ende gegangen, vergleiche Salin Stefan George wieder mit Christus – dies bezog sich auf Salins Buch Um Stefan George. Deutschland, das auserwählte Volk, hat zwar Europa nicht einer neuen Blüte entgegengeführt, sondern Europa ruiniert. Aber jetzt ist Sovjetrussland die neue Hoffnung, wo man lateinisch parliert, und die preussische Macht, wenigstens stellvertretend, ihre Auferstehung feiert. Ein Gespräch, wie dasjenige über Russland, offenbart mir den Abgrund, der zwischen uns besteht. Diese Tendenz, die schon früher unsere berufliche Arbeit erschwerte, nämlich das übergrosse Verständnis, das Sie kommunistischen Studenten entgegenbrachten, ist heute in Ihren Seminarien lebendig, und Sie akzeptierten Dissertationen, die dann aus naheliegenden Gründen nicht gedruckt wurden.2616
Wagner scheute sich nicht, Salin auch öffentlich als «ein[en] deutschtümelnde[n], nationalistische[n] und romantische[n] Vertreter der anschaulichen Theoretiker» zu bezeichnen.2617 Wagner war Julius Landmann als Assistent nach Kiel gefolgt. 1937 wurde er Privatdozent in Basel und Leiter des Wirtschaftsarchivs. Seit 1941 bekleidete er das früher von Salin versehene Amt des Vorsitzenden des Einigungsamtes, und im folgenden Jahr erhielt er den Titel eines Ordinarius. Wissenschaftliche Bedeutung erlangte er als Geldtheoretiker.2618 Sein Nachlass harrt in der Universitätsbibliothek der wissenschaftlichen Auswertung. Die Ablehnung von Salins quasi-religiösen Apotheosen grosser Männer begegnet auch bei einem anderen Korrespondenzpartner: dem Marxisten Konrad 2614 2615
2616 2617 2618
Dokumente aus dem ED, in: Nachlass Salin, Fa 2447–2453 (nicht einzeln numeriert), darunter Karte Hausers an Salin, 5. 5. 1939. 1962 bilanzierte er in Salin 1962, dass er dabei die Bedeutung des Kompromisses in der Politik habe schätzen gelernt; im kleinen Rahmen sei direkte Demokratie mit entsprechender Führerauslese möglich. Schönhärl 2013, 60 f.; Schönhärl 2009, 277 ff. Wagner an Salin, 27. 7. 1956, in: Nachlass Salin, Fa 10096. Wagner 1959, 42. Maeder 2012.
Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen
615
Farner,2619 gegen den sich offensichtlich Wagners Bemerkung über kommunistische Studierende richtete. Farner, Student an der Universität Basel und seit 1936 Mitglied der Trotzkistengruppe um Fritz Belleville,2620 hatte, als er von 1941 bis 1943 Lektor beim Basler Schwabe-Verlag war,2621 ein Platon-Manuskript von Salin zum Druck vorzubereiten (Von Mensch und Staat: Apologie, Kriton, Phaidon. Platon; übertragen und eingeleitet von Edgar Salin). Er weigerte sich, Salins Einleitung durchgehen zu lassen: «Der Ton, der mich wie eine nebulose Verschleierungsmaschine einhüllt», missfiel ihm, er wollte nichts wissen von einem quasireligiösen Mysterium um Platon und Sokrates. Für Farner waren sie «klare, rationale, sogar kühle, ja ‚heilig-nüchterne‘ Denker gewesen». «Und warum diese Hölderlin-Stelle? Warum die nach meinem Dafürhalten nicht haltbare These, dass die grosse Kunst immer nur am Rande des Abgrundes gedeiht?» Farner wollte als zuständiger Verlagslektor für die Europäische Reihe der «Edition Klosterberg» keine Kompromisse eingehen.2622 «Ich bin der Überzeugung, dass ein Irenäus des 20. Jahrhunderts weder an Ihrem Augustin-Buch noch an Ihrem ‚Burckhardt und Nietzsche‘ noch an Ihrer Einleitung zu den drei Platonischen Dialogen Freude gehabt hätte.»2623 Die Bände kamen dann doch 1945 bei Schwabe heraus; Farner aber fand sich beim Birkhäuser Verlag wieder.2624 7.7.6 Fortgesetztes Engagement in Deutschland 1932 lehnte Salin die nationalsozialistische ‚Revolution‘ eindeutig ab. Anlass waren vermutlich die Massendemonstrationen der NSDAP in Berlin und die Absetzung der preussischen Regierung. «Auch ich bin ganz benommen von den Berliner Vorgängen. Mein Eindruck ist: mit solchen Mitteln verwandelt man die politische Revolution, die unvermeidlich war, und heilsam werden konnte, in
2619 2620
2621
2622 2623 2624
Bürgi 2004. Fichen der Politischen Abteilung der Basler Polizei über Farner, in: StABS PD-REG 5a 31-2. Dieser wurde 1941 wegen angeblicher kommunistischer Betätigung verhaftet und 1942 mangels Beweisen freigesprochen. Nachlass Farner: https://www.zb.uzh.ch/Medien/spezialsammlungen/handschriften/nach laesse/farnerkonrad.pdf. Farner arbeitete für Schwabe von 1941 bis 1943. 1944 war er für den Verlag Birkhäuser tägig. Von Farner gibt es Unterlagen zu seinem Basler Studium. Eine erste Dissertation («Die geistige Entwicklung des Bürgertums», 1941) wurde abgelehnt, die Arbeit über Augustin angenommen. Farner, Schwabe Verlag, an Salin, 11. 10. 1943, in: Nachlass Salin, Fa 2633. Farner an Salin, 22. 10. 1943, in: Nachlass Salin, Fa 2633a. Oberkofler 2015. Herausgeber der «Europäischen Reihe» war bis 1952 Hans-Urs von Balthasar, der sich im Oktober 1941 dazu bereit erklärt und im November 1941 einen entsprechenden Vertrag mit dem Verleger Benno Schwabe abgeschlossen hatte. Verlagsarchiv Schwabe, Inv.Nr. 1875 Sammlung Klosterberg Korrespondenz 1941–1952.
616
Geisteswissenschaftler
eine soziale Revolution von kaum vorstellbarem Grausen.»2625 Gegen die autoritären Regierungen am Ende der Weimarer Republik hatte er eingewendet, dass sie beratungsresistent seien und das Land wirtschaftlich und sozial in die falsche Richtung steuerten, womit sie ihre einzige Legitimität, die Autorität, verspielten.2626 Eine Zeitlang galten ihm die Nationalsozialisten demgegenüber als die willkommene destruktive Kraft, die die letzte Krise des Weimarer Regimes herbeiführen könnte, aus der heraus dann ein neues Reich im Georgeschen Sinne hervorgehen sollte. In der Literatur wird von «temporären Sympathien für die nationalsozialistische Bewegung» gesprochen.2627 Diese bezogen sich nicht auf Hitlers Person, der das Gegenteil dessen darstellte, was sich Salin unter einem «Führer» vorstellte.2628 1930 hatte er Benito Mussolini seine Wertschätzung entgegengebracht,2629 die 1932 wieder in Skepsis umgeschlagen war. Eine soziale Revolution (wie er sie von den Nationalsozialisten befürchtete) sei in Deutschland zu verhindern, meinte er 1933, während er eine politische Revolution etwa durch eine Präsidialdiktatur in konservativem Sinne, die sich von den Bestimmungen der Versailler Verträge löse, die demokratisch-parlamentarischen Elemente der Verfassung zerstöre und eine nationale Erneuerung bewirke, an sich begrüsste sofern deren Führung die dazu erforderliche Autorität aufbrächte. Unter diesen Bedingungen hätte ihn auch Gewalt nicht abgeschreckt. Nun enttäuschte ihn die NS-Diktatur rasch.2630 Aus eigener Anschauung sah er, dass diese Herrschaft den «lebendigen Geist» zerstören wollte, aber er glaubte noch am Jahreswechsel 1933/34, dass sie nur von kurzer Dauer sein werde. Die gegenteilige Einsicht entwickelte sich wohl 1934/35: So durfte sein Name nicht mehr auf den Publikationen der List-Gesellschaft erscheinen, und kritische Bekannte (auch ‚Arier‘) wurden aus dem Amt gedrängt oder nicht zu einem solchen zugelassen. 1935 liquidierte sich die List-Gesellschaft selbst, um einer Gleichschaltung zu entgehen.2631 2625
2626 2627 2628 2629 2630 2631
Salin an von Beckerath, 3. 6. 1932, in: Nachlass Salin, Fb 208. Das war Salins Antwort auf die Bemerkung von Beckeraths (von Beckerath an den «Lieben Salin», 1. 6. 1932 , in: Nachlass Salin, Fa 547): «In Berlin treibt man fürchterliche Dinge. Ist das das Ende?» Derart klare politische Aussagen sind in den konsultierten Briefen sehr selten. Im gleichen Sinne: «Wenn der jetzige Kurs scheitert, so wird die Folge sein, dass man an Stelle einer politischen Revolution, die unvermeidlich war, in eine soziale Revolution hineintreibt, die schlimmste Formen annehmen würde.» Salin an Friedrich Baethgen, 31. 8. 1932, in: Nachlass Salin, Fb 114. Salin an Baethgen, 2. 11. 1932, in: Nachlass Salin, Fb 115. Schönhärl 2009, 79. Schönhärl 2009, 270. Salin 1930, 50. Dazu Schönhärl 2009a, 178. Schönhärl 2009, 276, datiert die wachsende Distanz Salins zum Nationalsozialismus auf Mitte 1933. Schönhärl 2009, 276.
Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen
617
Mit Bernhard Harms stand er in regem Austausch. Harms hatte dezidierte Ansichten, die ihn trotz seiner ausgeprägt nationalen Einstellung sehr bald in Konflikt mit gewissen Nationalsozialisten brachten. Er gab die Leitung seines Instituts ab, trat eine Weltreise an, kehrte dann aber nach Berlin zurück, wo er eine akademische Stellung erhielt.2632 Weiterhin trug er Verantwortung für die ListAusgabe und die zugehörige Schriftenreihe. Interessant ist die Auseinandersetzung zwischen Salin und Harms im Sommer 1934 über die Schrift von HansPeter Olshausen, Friedrich List und der Deutsche Handels- und Gewerbsverein, erschienen bei Fischer in Jena 1935 als Heft 6 der «List-Studien». Harms äusserte sich wie immer temperamentvoll, als er an Salin schrieb: Wichtiger als das alles aber ist, dass Olshausen List sozusagen als einen der berühmten ‚Ahnherren‘ (Sie wissen was ich meine!2633 ) der nationalsozialistischen Partei bezeichnet. Das ist schlechthin unhistorisch und wird von keinem geschichtskundigen Nationalsozialisten gebilligt werden. […] Das Bestreben des Autors, List nicht aus seiner Zeit, sondern aus der Gegenwart verständlich zu machen und ihn für die Gegenwart zu nutzen, hat ihn zu unerlaubten historisch-perspektivischen Verzeichnungen geführt. Dass dies alles unter Ihrem Protektorat geschehen ist und mit unter Ihrem Namen in die Welt gehen soll, erschüttert mich, offen gesagt, aufs tiefste. ‚Denn der Mensch, der zur schwankenden Zeit auch schwankend gesinnt ist …‘ Ich für meine Person mache das nicht mit und bitte Sie daher, unter den Herausgebern von Heft 6 der List-Studien meinen Namen zu streichen.2634
Salin verteidigte Olshausen und sich selbst ebenso energisch: «Offenbar sehen Sie doch schon darin, dass List mit vollem Recht als Deutscher herausgestellt wird […], einen Versuch, List zum Nationalsozialisten zu stempeln».2635 In der Einleitung wurden daraufhin Retouchen vorgenommen, und Harms akzeptierte dann, als Mitherausgeber genannt zu werden. Salin glaubte, einen Trennstrich zwischen seinen eigenen nationalen Überzeugungen und deren Verwendung in der Naziideologie ziehen zu können. Harms dagegen verteidigte die Grundsätze fachwissenschaftlicher Geschichtsforschung und -darstellung und unterstellte den Nationalsozialisten (naiv oder taktisch?), sie würden diese respektieren wollen.
2632
2633 2634 2635
Harms an Werner Richter (damals als Basler Theologiestudent wohnhaft in Grenzach), 1. 8. 1937, in: Nachlass Salin, Beilage zu Fa 3578. Harms rechtfertigte sich hier gegenüber Richter dafür, dass er in Deutschland blieb. Geistige ‚Ahnherren‘ spielten im Denken Georges und seiner Anhänger eine grosse Rolle. Harms, List-Gesellschaft, an Salin, 26. 7. 1934, in: Nachlass Salin, Fa 3539. Harms, List-Gesellschaft, an Salin, 3. 8. 1934, in: Nachlass Salin, Fa 3543 (das Argument wird so im Brief von Harms zitiert).
618
Geisteswissenschaftler
Ein Zeitschriftenprojekt war Salin um 1932 bis 1934 ein Anliegen; er wollte darin den in seinen Augen richtigen Staatsbegriff propagieren.2636 Noch nach der Machtübergabe an die Nazis am 30. Januar 1933 gingen Verlagsverhandlungen weiter, denn Salin hoffte, dass gerade nach den Märzwahlen eine solche Zeitschrift sinnvoll sein werde. Friedrich Baethgen und Hans Rothfels waren als Herausgeber vorgesehen, Heinz Zimmermann2637 sollte die Redaktion besorgen. Salin wollte dafür denselben Interessentenkreis gewinnen, der die List-Publikationen abnahm.2638 Darauf, dass die Hitlerregierung für den Staatsbegriff der George-Anhänger keine Verwendung hatte, war er offensichtlich nicht vorbereitet. Zusammen mit der List-Gesellschaft und teilweise in Überschneidung mit dieser waren Angehörige des George-Kreises für Salin wichtige Verbindungspersonen nach Deutschland. Zudem war Salins Weltbild in den 1930er und 1940er Jahren kaum zu verstehen ohne seine Bindung an die Vorstellungen von Stil, Staat, Deutschtum und deutscher Geschichte sowie Wissenschaft,2639 die von George und seinem Kreis gepflegt worden sind. Salin hörte nicht auf, um George zu werben, Verbindungen zu anderen George-Verehrern intensiv zu pflegen und sich als Teil eines Netzwerks zu verstehen, innerhalb dessen man sich auch berufliche Situationen zu verschaffen suchte. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete Salin an einem Buch, dass seine Zugehörigkeit zum Kreis darlegen sollte; es erschien 1948 unter dem Titel Um Stefan George. Auch wenn Salins Darstellung ausgewählter Gestalten aus dem George-Kreis ein idealisierendes Bild vermittelt und auch wenn sie seine eigene Stellung im Kreis in problematischer Weise überzeichnet,2640 bleibt das Buch eine wichtige Quelle für Salins Auffassungen dessen, was sein eigenes Verständnis der jüngeren deutschen Geschichte bestimmte. Viele Elemente sind bereits bekannt aus dem Sammelband über Staat und Wirtschaft von 1932. Das George-Werk belegt, welche dieser Elemente Salins Auseinandersetzung mit Deutschland unter der nationalsozialistischen Diktatur überdauert hatten, und beantwortet die von Valentin Wagner gestellte Frage, was 2636
2637
2638 2639
2640
Salin an Baethgen, 29. 11. 1932, in: Nachlass Salin, Fb 119. Baethgen an Salin, 9. 2. 1933, ebd., Fa 348. Man hoffte auf die Realisierung einer neuen Zeitschrift, die den von Salin und Baethgen gemeinsam vertretenen Staatsbegriff propagieren sollte. Salin bemühte sich darum, seinem früheren Studenten Zimmermann eine Position zu verschaffen, bevor dieser emigrierte. Es war Salin, der Zimmermann für den George-Kreis angeworben hatte. Zimmermann gehörte zum inneren Kreis; der Meister hatte ihn dadurch ausgezeichnet, dass er dem blonden Jüngling ein Gedicht widmete. Eschenbach 2011, 128; Schönhärl 2009, 75. Salin an Baethgen, 16. 2. 1933, in: Nachlass Salin, Fb 122. Nur Salin hat das George-Wort überliefert: «Von mir aus führt kein Weg zur Wissenschaft». Für George war Wissenschaft eine der Stufen der Erkenntnis unter der Bedingung, dass sie nicht philologisch, sondern in einer «lebendigen» Form getrieben würde. Schönhärl 2009, 11. Salins Selbststilisierung als George Nahestehender: Schönhärl 2009, 81 f.
Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen
619
Salin aus der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur «gelernt» habe. Im Grunde tatsächlich wenig: Situationsbedingt neu war die Tendenz, die Georgeschen Hoffnungen auf ein neues Reich auf die Nachkriegszeit von 1945 zu beziehen. Ansonsten teilte er ungebrochen die Verachtung für die Weimarer Republik und die Politiker, die den Versailler Frieden unterzeichnet hatten.2641 «Der Weg der Ehre» für Deutschland wäre nach seiner Hoffnung ein Weg zu George gewesen.2642 Politischen «Patriotismus» der deklamatorischen Art lehnte er zugunsten eines elitären Konzepts der inneren Vorbereitung einer kulturellen Elite auf die Erneuerung ab.2643 Es ging Salin darum, das «aufbauend Vaterländische im Sinn des Meisters mit unmissverständlicher Schärfe abzugrenzen […] gegen den zerstörenden Patriotismus aller engstirnigen Nationalismen».2644 Das Thema Rassismus war damals neu bei Salin, aber seine Erwähnung diente vor allem dazu, George vom Vorwurf des Antisemitismus zu reinigen. «Schon Wolters hat festgestellt, dass wie die Jugendbewegung von den Triebwellen getragen wurde, ‚die von den Mahn- und Fluchreden Nietzsches und der Dichtung Georges durch das deutsche Geistesleben fluteten‘, so auch in den sogenannten Rassebewegungen nach dem Krieg [1914–1918] mancherlei missverstandener Georgianismus spukhaft beteiligt war.»2645 1948 stellte er fest, dass niemand nach 1918 erwartet hätte, dass das deutsche Volk «nichts Besseres zu tun wisse, als sich frei in Unehre und Schande zu stürzen».2646 Diese Feststellung gehörte in den von ihm geschätzten Zusammenhang zwischen nationaler Ehre, soldatischer Haltung und adligem Vorbild. Seine Antwort auf die ‚deutsche Katastrophe‘ war dadurch bestimmt, denn deutscher Adel spielte für Salin eine wichtige Rolle.2647 Er verehrte die adligen Helden des Widerstands gegen Hitler, die zudem noch von George beeinflusst waren, insbesondere die Grafen Stauffenberg, die er nach 1945 feierte. Zuvor aber muss die Beziehung zu Marion Dönhoff, Tochter des Grafen Dönhoff auf Friedrichstein bei Löwenhagen in Ostpreussen, erwähnt werden.2648 Sie hatte bei ihm doktoriert und damit Salins Interesse für ostpreussische Wirtschaftsverhältnisse befriedigen
2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647
2648
Salin 1948a, 208. Vgl. Salin 1932, 167. Salin 1948a, 207 f. Salin 1948a, 246. Salin 1948a, 206, ähnlich 273. Salin 1948a, 254. Salin 1948a, 207, Fussnote. «Führer» könnten nach Salin nur Menschen aus dem «alten agraren Adel oder dem städtischen Patriziat» sein; edle Geburt sei entscheidend. Steigt der Führer aus der Masse auf, bedeute das Niedergang. Schönhärl 2009, 267. Vencato 2009. Programm der Basler Ausstellung: «Die Neubegründung der Toleranz. Marion Dönhoff, die Universität Basel und Europa, 18. 11. 2009 – 20. 11. 2009 Basel», in: H-Soz-Kult, 4. 11. 2009, www.hsozkult.de/event/id/termine-12621.
620
Geisteswissenschaftler
geholfen.2649 Der Briefwechsel begann 1931.2650 Darin kommt klar zum Ausdruck, dass Marion Dönhoff die Diktaturen in Italien und Deutschland, die letztlich zum Krieg trieben, ablehnte. Aus der Beobachtung des Mussolini-Regimes zog sie wichtige Schlüsse auch für Deutschland. So schrieb sie 1935 aus England an Salin: «They are bound irgendwann einmal disastro zu erleiden wenn erst einmal alles gründlich verfahren und ruiniert ist kann nur der ‚ehrenvolle‘ Tod auf dem Schlachtfeld – auch wenn es nur gegen barfüssige Abessinier geht – helfen.»2651 Salin war über den Widerstand in Deutschland gut informiert. Bei Kriegsende setzte er sich dafür ein, dass dieser in seiner nationalen Bedeutung gewürdigt und der Adel dabei in den Mittelpunkt gestellt werde. Er hat unter anderem in den «Schweizer Annalen» 1945, Heft 2, «die Aufmerksamkeit auf die aktive Gegenwehr von Deutschen aller Schichten und Parteien gegen die deutschen Machthaber» gelenkt. In den «Schweizer Annalen» 1946/47, Heft 12, hat er «die These von der deutschen Kollektivschuld auf ihr richtiges Mass zurückzuführen versucht». Tatsache war nach Salin, «dass vermutlich keine 10 Prozent des Volkes überzeugte Parteianhänger und keine 5 Prozent gewissenlose Verbrecher gewesen sind».2652 Den Widerstand nannte er «Gegenrevolution»; denn den Nazis sprach er weiterhin einen «revolutionären» Charakter zu. Er suchte nach Erklärungen für den relativ wenig ausgeprägten und schwach organisierten Widerstand: Zwar hätte die Reichswehr das Regime stürzen können, aber der Eid der Wehrmacht auf Hitler von 1934 habe es den Offizieren erlaubt, sich hinter dem Gehorsam zu verstecken. Im sogenannten Röhmputsch waren auch «namhafte Vertreter des Heeres, der Politik, des Adels» liquidiert worden. Von Papen lieh dennoch weiter seine «treuen Dienste» «den Verbrechern». «Kein Angehöriger des Adels fühlte sich zur Rache veranlasst». Die «Notwendigkeit einer radikalen geistigen Umkehr» habe zuerst einmal erkannt werden müssen. Entscheidend war nach Salin das Auftreten von Graf Peter Yorck, für ihn «der Träger bester preussischer Tradition, der Erbe Dilthey’schen Humanismus».2653 Hier sieht man zwei Vorlieben Salins: Die Fokussierung auf den Adel als Träger der «Gegenrevolution» und die Betonung der «geistigen Umkehr» als Voraussetzung für einen Widerstand. Ersteres war eine Grundidee Salins, der noch im Deutschland des 20. Jahrhunderts den Adel als Gruppe hochschätzte, die zu besonders selbstlosem Einsatz für Ideale fähig gewesen sei. Letzteres hing mit seiner Auffassung der Lehren von Stefan George zusammen, der die geistige Erneuerung zur Voraussetzung der politischen Erneuerung Deutschlands erklärt 2649 2650 2651 2652 2653
Dönhoff 1935: Entstehung und Bewirtschaftung eines ostdeutschen Großbetriebes. Die Friedrichstein-Güter von der Ordenszeit bis zur Bauernbefreiung. Erhalten sind die Briefe von Dönhoff an Salin in: Nachlass Salin, Fa 2000 ff. Dönhoff aus Oxford an Salin, 9. 6. 1935, in: Nachlass Salin, Fa 2025. Salin 1948, 2. Salin 1948, 3–5.
Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen
621
hatte. Salin bezeichnete die Gruppe um Goerdeler als «restaurativ», er sah sie gehemmt durch die Befürchtung, eine Tat würde eine neue Dolchstosslegende entstehen lassen. Der linke Widerstand hatte das Unglück, dass sein möglicher Führer Carlo Mierendorff bei einem Bombenangriff umkam. Die Rechte war geschwächt durch die im Januar 1944 erfolgte Verhaftung von Graf Helmuth von Moltke. Dadurch erhielten nach Salin die «Aktivisten» die Oberhand, die den Umsturzplan der jüngeren Offiziere, unter ihnen der Vetter Yorcks, Claus Schenk Graf von Stauffenberg, akzeptierten. Stauffenberg war für Salin ein «wahrer Revolutionär».2654 Die Opfer seien 1944 «um der deutschen Ehre und Würde willen in diesen Kampf gezogen und in den Tod gegangen». «Fromme Sitte und die heilige Ehre» hätten diese geleitet. «Und durch alle geschichtliche Schuld hindurch, die der deutsche Adel in der Zeit Bismarcks und Wilhelms II. und noch in den Anfängen der Nazis auf sich lud, strahlt sühnend das Opfer derer, die ihre Mörder als die ‚Grafenclique‘ zu verfemen suchten».2655 Zur Frage nach Salins Beziehungen zu Deutschland nach 1933 gehört auch eine Abklärung, wie Salin deutschen Kollegen geholfen hat, die der nationalsozialistischen Herrschaft entkommen wollten. Davon habe ich nur wenige Spuren gefunden, was aber andere Formen der Hilfsbereitschaft keinesfalls ausschliesst. Einige Aktionen bestanden in Gutachten über Personen, die in Basel eine Stellung suchten. So beurteilte er für Fritz Hauser im Dezember 1933 Robert Wilbrandt, Ordinarius in Tübingen, 1929 nach Dresden berufen, wo er über Sozialpolitik und Konsumvereinsbewegung arbeitete. Wilbrandt war schon in der Weimarer Republik Zielscheibe von Angriffen gewesen, weil er der Sozialdemokratie nahestand und scheinbar in den Krawall anlässlich des Vortrags von Emil Julius Gumbel 1924 verwickelt war.2656 1933 wurde er entlassen und schlug sich als freier Schriftsteller durch. Salin attestierte ihm «echte Volksverbundenheit» und «tiefes, soziales Verständnis», er sei ein «durchaus lauterer Mensch», aber gehöre «kaum zu den stärksten Begabungen der Generation zwischen 55 und 65». Die Zurückhaltung war spürbar. Wilbrandt, empfahl Salin, solle sich in Grenzach oder Lörrach niederlassen und dort seine deutsche Pension beziehen; ein Basler Lehrauftrag über Genossenschaftswesen könnte dann das Einkommen ergänzen. Den Einsatz von Basler Staatsmitteln schloss Salin angesichts der «Finanzklemme» aus; vielmehr solle der Konsumverein (VSK) dafür aufkommen. Salin versprach noch Harms zu fragen, den er in Basel erwartete; davon fehlt aber in den Unterlagen die weitere Spur.2657 So erstaunt es nicht, dass aus diesem Plan nichts wurde. 1934 beurteilte Salin den Goethe-Forscher Friedrich Muckle (an sich ein Nationalökonom, 1926 bis 1933 Privatdozent an der Handelshochschule Mann2654 2655 2656 2657
Salin 1948, 11. Salin 1948, 13 f. Jansen 1981. Salin an Hauser, 4. 12. 1933, in: Nachlass Salin, Fb 1228.
622
Geisteswissenschaftler
heim, Spezialist für Saint-Simon und Mitarbeiter von Kurt Eisner). Salin wies auf das als gross und interessant bezeichnete Werk Muckles über den Geist der jüdischen Kultur und das Abendland hin und attestierte dem Autor «grosse[n] geschichtliche[n] Takt». Auch Muckles Buch über Nietzsche sei «eine selbständige und bedeutende Leistung», betone jedoch zu sehr die «Dekadenz» bei Nietzsche. Sein Goethebuch sei das beste seit Gundolf. Dieser grosse Geist solle nach Kräften unterstützt werden. Die Volkshochschule könne ihn vielleicht gebrauchen. Salin rechnete vor, Muckle könnte seinen Besitz in Binau verkaufen und in Basel etwas erwerben, er bräuchte dann dazu einen Lehrauftrag als eine Art von Zuschuss.2658 1935/36 unterstützte er Fritz Cronheim, einen Schüler von Friedrich Wolters. Dieser zählte zum George-Kreis und versuchte sich zunächst als Pädagoge mit eigenen Schulprojekten in Deutschland und in der Schweiz (Glarisegg bei Steckborn). Danach konnte er sich in England einen Namen als Kunsthistoriker machen. Salin hat nach eigener Aussage einen Onkel in London beim Home Office zugunsten von Cronheim intervenieren lassen.2659 1938 schlug er Hauser vor, dem ihm persönlich bekannten Indologen und George-Verehrer Heinrich Zimmer2660 aus Heidelberg in Basel einen Lehrauftrag zu verschaffen. Salin argumentierte, in Basel bräuchte die indogermanische Sprachwissenschaft nach dem Tod Jakob Wackernagels eine definitive Lösung. «Nun ist in Heidelberg Prof. Dr. Zimmer entlassen worden, da seine Frau, eine Tochter des Dichters Hugo v[on] Hofmannsthal, nicht ganz arisch ist. Zimmer ist wohl derjenige Indologe und Sanskritist des Kontinents, dessen Name international am bekanntesten ist.» Er entfalte eine breite Wirkung über die Kreise der Fachleute hinaus in ganz Heidelberg. Die (Basler) Philologen seien ihm deswegen ungünstig gesinnt und gäben Johannes Friedrich Lohmann (aus Freiburg, in Basel lehrend bis 1939)2661 den Vorzug. «Wenn Zimmer Fr. 6’000.– erhielte, würde er sofort kommen und alle anglo-amerikanischen Möglichkeiten in den Wind schlagen.»2662 Unter Berufung auf das abschlägige Gutachten der Fakultät lehnte Hauser in einem offiziellen Schreiben an Salin mit Kopie an die Kuratel den Plan ab. «Im Falle des Herrn Prof. Zimmer dagegen würde es sich lediglich um eine Hilfsaktion handeln, denn es wird wohl nicht bestritten werden, dass eine Professur für Indologie wohl etwas recht Interessantes wäre, aber durchaus nichts Nötiges ist.»2663
2658 2659 2660 2661 2662 2663
Salin an Hauser, 21. 9. 1934, in: Nachlass Salin, Fb 1231. Muckle emigrierte 1937 in die Schweiz. Salin an Cronheim, 13. 7. 1936, in: Nachlass Salin, Fb 602. Weber 2011, 131 ff. http://portal.uni-freiburg.de/indogermanistik/seminar/historia.html. Salin an Hauser, 25. 5. 1938, in: Nachlass Salin, Fb 1236. ED an Salin, 21. 9. 1938, in: Nachlass Salin, Fa 2447.
Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen
623
Schliesslich möchte ich kurz Artur Sommer als Beispiel für einen ehemaligen Salin-Schüler aus Heidelberg, George-Verehrer und von der Nazi-Diktatur Verfolgten erwähnen, der selbstlos und ohne Pathos Sand ins Getriebe der Judenvernichtung streute und Menschen rettete. Von ihm hatte Salin Ende Juli 1942 Informationen über die Vernichtungslager zugespielt erhalten.2664 Nach Kriegsende 1918 hatte Sommer in Freiburg und Heidelberg bei Heidegger, Alfred Weber, Karl Jaspers und Edgar Salin studiert. Die Promotion erfolgte 1924 bei Alfred Weber über List. Sommer entdeckte in Paris das Manuskript der wichtigen Schrift von Friedrich List Nationales System der politischen Ökonomie, deren Herausgabe Sommer bis 1934 beschäftigte2665 und ihn zu einem wichtigen Mitglied der List-Gesellschaft machte. Von 1927 bis 1931 war er in Gießen Privatdozent, danach konnte er mit Rockefeller-Mitteln in England forschen und dort ein Manuskript über die Geschichte der Wirtschaft und der politischen Ökonomie des frühen 19. Jahrhunderts abschliessen. Bei seiner Rückkehr nach Deutschland 1934 hatte er in Gießen Aussicht auf eine Professur. Zuvor hatte er sich allerdings mit der SA angelegt, was zur Folge hatte, dass er bei seiner Ankunft in Deutschland verhaftet und in das KZ Osthofen gesteckt wurde. Bei dieser Gelegenheit ‚verschwand‘ sein Koffer mit dem Manuskript über Englands Wirtschaftsgeschichte. Dank der Fürsprache von Freunden wurde er rasch wieder entlassen, kam aber nicht mehr für eine Tätigkeit an einer deutschen Hochschule infrage. Nachdem ihn auch die List-Gesellschaft nicht weiterbeschäftigen konnte, fand er auf Umwegen über den Archivdienst 1938 eine Anstellung als Berufsoffizier im Stab für Wehrwirtschaft beim Oberkommando der Wehrmacht in Berlin. Dort war er als Mitglied der Handelsdelegation des Auswärtigen Amtes mit Diplomatenstatus an wirtschaftlichen Verhandlungen mit Partnerstaaten Deutschlands beteiligt. Diese Situation, die Solidarität unter Offizieren und der diplomatische Status erlaubten es ihm, sich für die Auswanderung von Juden, aber auch die Organisation der Flucht über die Grenze einzusetzen.2666 Auch konnte er konkrete Angaben über die Planung des Holocaust sammeln. Erst nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler 1944 geriet er ernsthaft in Gefahr, entdeckt zu werden, und entzog sich den Nachforschungen durch Einsätze an der Ostfront. Die Ad2664
2665 2666
Artur Sommer an Salin, Briefe 1925 bis 1965, in: Nachlass Salin, Fa 9024–9260. Dort als Beilage auch der Artikel einer ungenannten (Heidelberger) Zeitung von 11./12. 7. 1959: «Professor in dieser Zeit – Meine geistige Heimat ist Heidelberg. Zum 70. Geburtstag von Prof. Sommer am 14. Juli», mit Angaben zur Biographie. Nachricht über die Vernichtungslager: Haas 1997, 183 f. Sommer ersuchte Salin, Briten und Amerikaner zu informieren (nicht Schweizer Behörden, dafür die Jüdische Nachrichtenagentur Juna in Zürich resp. deren Leiter Benjamin Sagalowitz). List 1930. Sommers schlichte und ergreifende Darstellung seiner Leistungen für verfolgte Menschen in Berlin: Sommer an Salin, 21. 6. 1964 und 10. 2. 1964, in: Nachlass Salin, Fa 9127 und Fa 9130. Ein Beispiel in: Raulff 2009, 316, Anm. 124.
624
Geisteswissenschaftler
ministration der Sowjetischen Besatzungszone wollte ihn für Ämter gewinnen, was er aber ablehnte.2667 Die Rückkehr nach Heidelberg verlief mühsam. Er habilitierte sich dort 1948 neu für einen schlecht bezahlten Lehrauftrag, bis er 1959 als von den Nazis entlassener ehemaliger Gießener Professor reguläre Bezüge erhielt. Akademisch war Sommer erfolgreich, aber materiell meist in prekärer Lage. Er ist ein Beispiel für die Informationsquellen, die Salin zur Verfügung standen, wobei stets zu berücksichtigen ist, dass Vieles mündlich bei Besuchen in Basel ausgetauscht worden ist, das sich nicht in der (zensurierten) Korrespondenz niederschlug. Salin nutzte die erhaltenen Informationen insbesondere 1942, um mithilfe von Chaim Pozner (Haim Pazner), der bei ihm doktoriert hatte, britische und amerikanische Stellen auf den anlaufenden Holocaust aufmerksam zu machen. Ein Bericht von Sommer spielte dabei eine herausragende Rolle.2668 Salin war somit dauernd in Deutschland präsent, persönlich, soweit es die dortigen Verhältnisse erlaubten, sonst durch Korrespondenz und durch seine Rolle als Gastgeber in seiner Basler Wohnung. Im Verlauf der nationalsozialistischen Diktatur entwickelte er Aktivitäten zur Rettung der Juden, nachdem er zu Beginn der 1930er Jahre das Thema Antisemitismus eher vernachlässigt hatte. Dass er neben diesem Engagement noch in Basel als Dozent und als wirtschaftspolitischer Experte an der Universität und in der Stadt die oben dargestellte Präsenz wahrnehmen konnte, spricht für seine überragende Arbeitskraft und Selbstorganisation. 7.7.7 Resultate: Salin in Basel 1933–1945 Die Wahl Salins war mit beträchtlichen Unsicherheiten hinsichtlich seiner Wirkung in Basel befrachtet gewesen. Lange Zeit zeigten sich drei verschiedene Gesichter des Professors, die für Aussenstehende schwer in Einklang zu bringen waren. Auf der einen Seite war Salin ein elitärer, oft hochfahrender Vertreter des «lebendigen Geistes» im Sinne Stefan Georges, der in provokanter Weise Grundwerte, die in der schweizerischen Öffentlichkeit einen hohen Stellenwert hatten, von einem jungkonservativen Standpunkt aus infrage stellte. In seinen hauptsächlich für deutsche Kreise bestimmten Schriften vertrat er demokratiefeindliche Ansichten, hoffte ostentativ auf den Zusammenbruch der Weimarer Republik und eine nationale Erneuerung Deutschlands. Mit Friedrich List vertrat er gegen die Liberalen eine politische Ökonomie, in der dem Staat eine herausragende Funktion in der Wirtschaft und in den Klassenbeziehungen zugedacht war. Die von ihm propagierte «anschauliche Theorie» konnte als Versuch erscheinen, Anregungen von Stefan George in die Wissenschaft zu übertragen. Auf der andern 2667 2668
Sommer an Salin, 10.8./25. 9. 1947, in: Nachlass Salin, Fa 9176. Schönhärl 2009, 79; Penkower 1988, 60 ff.
Volkswirtschaftler, Nationalökonomen und Soziologen
625
Seite stürzte er sich seit 1929 in die Basler Wirtschafts- und Sozialpolitik, kooperierte mit vor allem sozialdemokratischen Regierungsräten, begründete ein ‚Deficit Spending‘ in der kantonalen Finanzpolitik, schlichtete Arbeitskonflikte und verschaffte der Idee des Gesamtarbeitsvertrags verstärkte Geltung. Mit dem Arbeitsrappen griff er aktiv in den politischen Kampf ein und schuf eine Institution, die positive Wirkungen für Basel hatte. Die dritte Seite wurde in seiner Lehre an der Universität sichtbar. So lange Diskussionen innerhalb des akademischen Rahmens verblieben, war er ein Lehrer, der vor allem anregen, Fragen auf das Grundsätzliche herabführen und eine selbstständige Entfaltung der geistigen Kräfte in den Studierenden fördern wollte. Er empfing auch dissidente Studierende und ermöglichte ihnen einen akademischen Abschluss, mehr noch, er war auch ihnen ein fordernder Gesprächspartner. In diesem von ihm geschaffenen, anregenden Klima erwuchs ihm eine dankbare Schülerschaft, die seinen Ruhm und seine Auffassung von politischer Ökonomie aus der Universität hinaustrug. In den brennenden Fragen der Zeit manövrierte er sich zunächst mit der Tendenz, alles auf Grundfragen zurückzuführen, die sich an Platon, Augustin, Dante, Goethe oder Nietzsche (und dahinter Stefan George) abhandeln liessen, und bei jeder Gelegenheit dem ‚19. Jahrhundert‘ eine laute Absage zu erteilen, in eine schwer vermittelbare Position. Dadurch und aufgrund des üblichen Antisemitismus wurde seine Einbürgerung trotz des Basler Engagements lange hintertrieben. Im politischen Kampf wurde er zur Zielscheibe gehässiger Angriffe, unter denen diejenigen, die von der Handelskammer und Teilen der liberalen Partei ausgingen, besonders auffielen. Wenigstens auf akademischem Terrain gewann er aber schliesslich jene souveräne Autorität, die es ihm gestattete, die gesuchte Erziehungsaufgabe erfolgreich wahrzunehmen. Salin leistete keine direkten Beiträge zur ‚geistigen Landesverteidigung‘, soweit ich sehen konnte. Eine unmittelbare Frontstellung gegen den Nationalsozialismus war bis 1932 auch nicht seine Sache, da er auf den Untergang der Republik hoffte, den diese Partei offensichtlich beschleunigte. Seine Einstellung wandelte und festigte sich aber schrittweise zu einer grundsätzlichen Ablehnung. Abseits der Öffentlichkeit, durch den Empfang von Besuchern, durch Gespräche, durch Briefwechsel und durch die Weitergabe von Nachrichten wurde Salins Wohnung zu einem Ort des (deutschen) Widerstandes. Basel profitierte davon, dass sein Experiment mit dem Arbeitsrappen und den Gesamtarbeitsverträgen die erwünschte gesellschaftliche Integrationsleistung erbrachte. Damit trug er zum sozialen Frieden und der politischen Verständigung, die in den Burgfrieden der Kriegszeit hinüberleitete, bei; er stärkte so die lokale Demokratie, führte sie aus verfestigten Frontstellungen heraus und machte sie als Basis für die Abwehr des Nationalsozialismus gangbar. In der Lehre förderte er Fairness in kontroversen Diskussionen und zeigte durch Rückgriffe auf Grundsätze und Geschichte Auswege aus antagonistischen Positionen. Sein kultureller Hintergrund setzte Massstäbe und machte deutlich, welche Verluste drohten, falls eine nationalsozia-
626
Geisteswissenschaftler
listische Weltanschauung sich durchsetzte. In diesem Sinne leistete Salin mindestens so viel für die Immunisierung Basels gegen deren Einflüsse wie solche, die sich offen und direkt der ‚geistigen Landesverteidigung‘ verschrieben.
8 Die Naturwissenschaftler 8.1 Mathematik Alexander Ostrowski, wohl der bedeutendste Mathematiker an dieser Hochschule in der Untersuchungszeit, wirkte von 1927 bis 1958 in Basel. Er stammte aus Kiew und besuchte eine Handelsschule; dort wurde sein mathematisches Talent entdeckt. Mit 15 Jahren kam er ins Seminar des Mathematikers an der Universität Kiew, Dmitry Alexandrowitsch Grave, während er daneben die Handelsschule abschloss. Grave schickte ihn danach zu Kurt Hensel in Marburg. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde Ostrowski interniert. Nach Kriegsende war er in Göttingen Assistent bei Felix Klein; 1920 doktorierte er bei David Hilbert und Edmund Landau. Danach trat Ostrowski eine Assistentenstelle bei Erich Hecke in Hamburg an, wo er sich 1922 habilitierte. 1923 wechselte er zurück nach Göttingen. 1925/26 hielt er sich mit einem Rockefeller-Stipendium in Oxford, Cambridge und Edinburgh auf. Kurz nach der Rückkehr nach Göttingen wählte ihn Basel 1927 zum Professor. An dieser Stellung hielt er fest und erwarb 1950 das Basler Bürgerrecht. Ostrowski legte Wert darauf, wissenschaftliche Verdienste ohne Rücksicht auf Ideologien oder Herkunft anzuerkennen. Deshalb lud er 1949 Ludwig Bieberbach (von 1921 bis 1945 Professor in Berlin) nach Basel ein, der als Vertreter einer «Deutschen Mathematik» und wegen seiner Nazi-Vergangenheit entlassen worden war. Er sorgte auch dafür, dass Bieberbachs Basler Ergebnisse im Birkhäuser-Verlag publiziert wurden.2669 1935 hatte sich Ostrowski gegen eine Wiederbeschäftigung des Mathematikers Hans Mohrmann in Basel ausgesprochen. 1919 bis 1927 war dieser Professor in Basel, 1927 bis 1931 an der TH Darmstadt und 1931 bis 1934 in Gießen gewesen. Nachdem er dort entlassen worden war, suchte er wieder nach Basel zu kommen. Die Fakultät opponierte mit dem Argument, sie sehe keinen Bedarf. Das Erziehungsdepartement hielt ihn für homosexuell; er sei kein politischer Flüchtling und verdiene keine Unterstützung. Im Unterschied zur Ablehnung von Mohrmann setzte sich Ostrowski seit 1933 für Alexander Weinstein ein, auf dessen Lage ihn Rolin-Louis Wavre in Genf aufmerksam gemacht hatte. Der Schweizer Weinstein war in Breslau als Lehrbeauftragter aus ‚rassischen‘ Gründen entlassen worden. Die Basler Mathematiker empfahlen ihn für eine Assistenz, aber die Kuratel und das Erziehungsdepartement waren der Meinung, es bestehe kein wirkliches Bedürfnis und die Finanzlage sei zu angespannt. Die Fakultät nahm im Herbst 1934 einen neuen 2669
Gautschi 2010, 1–7; Eichler 1988, 295–298.
628
Die Naturwissenschaftler
Anlauf, indem sie ein Extraordinariat für Weinstein in Mathematischer Physik beantragte, doch trug sie diesen Wunsch eher halbherzig vor, da Ostrowski lieber Edmund Landau (Göttingen) in Basel gesehen hätte. Dieser hätte ohne Kostenfolge unterrichtet, so dass neben Landau noch Weinstein hätte gefördert werden können. Als Weinstein sich bereits in London mit einem Stipendium des Academic Assistance Council aufhielt, legte die Basler Fakultät im Juni 1935 ihren Bericht vor, worin sie negativ über Weinstein urteilte. Das Basler mathematische Lehrangebot sei bereits vielfältig, während Weinstein trotz seines Alters von 37 Jahren erst Privatdozent sei. Gutachten über ihn wurden bei Wilhelm Blaschke in Hamburg (einem NSDAP-Parteimitglied) und bei Ludwig Bieberbach in Berlin (einem engagierten Nationalsozialisten) eingeholt; beide behaupteten, Weinstein gebe sich als Opfer der Verfolgung aus, während er unbehelligt bei seinen Schwiegereltern in Genf wohne und nicht viel leiste. Der Zürcher Mathematiker (Karl) Rudolf Fueter nannte Weinstein einen «Fremdkörper». Von Weinstein riet die Fakultät nun «entscheiden ab». Inzwischen wandte sich Weinstein besorgt an Hauser; sein britisches Stipendium laufe im Juli 1935 ab, würde aber verlängert, wenn er einen Arbeitsplatz an einer Schweizer Hochschule nachweisen könne. Das Hilfswerk für deutsche Gelehrte würde ihn unterstützen, wenn er einen Lehrauftrag in Basel bekäme. Die Kuratel schloss sich aber der ablehnenden Meinung der Fakultät an. Nun erklärte Ostrowski, er sei von der Fakultätsmehrheit, die sich vom Mathematischen Physiker Matthies (einem deutschen Patrioten mit NS-Sympathien), vom Astronomen Niethammer sowie von den Mathematikern Spiess und Buchner beeinflussen lasse, übergangen worden. Kuratel und Erziehungsdepartement gingen auf sein Sondervotum nicht ein und blieben bei ihrer ablehnenden Haltung.2670 Weinstein aber absolvierte in Paris ein französisches Doctorat und floh 1940 nach Nordamerika.2671 Unter Ostrowski doktorierten lokale Studenten wie Fritz Blumer (1938) oder Eduard Batschelet (1944); daneben fallen auf: 1934 Leo Leib Krüger aus Riga; 1936 Theodor Samuel Motzkin aus Berlin, Sohn des Zionisten Leo Motzkin, der aus Russland nach Berlin gekommen war; 1938 Caleb Gattegno aus Alexandria in Ägypten, der sich später auf die Psychologie des Lernens spezialisierte.2672 Ostrowskis Publikationsliste2673 zeigt, dass nach 1933 die deutschen Publikationsorte immer seltener wurden und an deren Stelle französische, schweizerische («Commentarii Mathematici Helvetici», gegründet 1928), russische, skandinavische und britische Periodika traten. 2670
2671 2672 2673
Korrespondenzen zwischen Fakultät, Kuratel, Ostrowski, Weinstein, Thalmann und Hauser, in: StABS Erziehung X 48, Schweizerisches Hilfswerk für deutsche Gelehrte, 1933– 1940. O’Connor/Robertson o. J. Gautschi 2010, 15 ff. Eichler 1988.
Mathematik
629
Ich möchte also annehmen, dass Ostrowskis Seminar ein Zufluchtsort für von den Nationalsozialisten verfolgte Mathematiker war und dass er selbst die in Deutschland herrschende Ideologie ablehnte. Die Einladung für Bieberbach gehörte anscheinend in die Bestrebungen verschiedener Basler Professoren, ihren deutschen Kollegen nach Kriegsende Arbeitsmöglichkeiten zu bieten und ihnen den Wiedereinstieg in die internationale Fachgemeinschaft zu erleichtern, erklärt sich aber auch aus einer rein fachlichen Hochschätzung und dem demonstrativen Bestreben, Mathematik frei von ideologischen, nationalen und ‚rassischen‘ Aspekten zu betreiben. Wie im Fakultätsbericht über Weinstein erwähnt wurde, waren in Basel neben Ostrowski mehrere andere Mathematiker an der Universität aktiv, die ein breites Themenfeld abdeckten. Zu ihnen gehörte Otto Spiess,2674 seit 1904 Privatdozent, 1908 zum Extraordinarius befördert, dann von 1938 bis 1944 neben Ostrowski Ordinarius als Inhaber des zweiten Lehrstuhls für Mathematik. Der durch seine «unschulmässigen» Vorlesungen beliebte Dozent forschte über Bernoulli und Euler; er initiierte 1935 die grosse Bernoulli-Edition. Zu seinem Nachfolger gewählt wurde 1944 Andreas Speiser, den die Presse als einen der «massgebenden Mathematiker der Jetztzeit überhaupt» begrüsste.2675 Als das neue Universitätsgesetz 1937 ein zweites gesetzlich verankertes Mathematikordinariat schuf, wurde dessen Besetzung Gegenstand einer Kontroverse. Die Kuratel wollte Otto Spiess mit der neuen Professur betrauen, womit Ostrowski nicht einverstanden war, denn Spiess fehle die für einen Lehrstuhlinhaber nötige Energie. Die Fakultät fand diese Haltung für Spiess kränkend, weshalb sie seine Ernennung beantragte, worauf der Regierungsrat im Juli 1938 Spiess wählte, während der Vertreter der Mathematischen Physik Matthies es ablehnte, diesen Lehrstuhl zu übernehmen.2676 Andreas Speiser war ein Bruder des Ethnologen Felix Speiser. In Göttingen als Schüler Minkowskis doktoriert, kurz vor dem Krieg in Strassburg habilitiert, bot er ein Beispiel für eine vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland begonnene Karriere. Ab 1917 lehrte er als ausserordentlicher Professor und ab 1919 als ordentlicher Professor an der Universität Zürich. Er war Generalredaktor der Euler-Kommission, Herausgeber von Leonhard Eulers Opera Omnia sowie der Werke von Johann Heinrich Lambert, publizierte 1937 einen Parmenideskommentar und 1949 einen Kommentar zu Goethes Farbenlehre. Seine Hauptarbeit galt den Schriften Eulers.2677 Paul Buchner war seit 1924 Privatdozent und wurde 1934 zum Extraordinarius befördert. Im Hauptberuf war er seit der Gründung der Schule im Jahr 1929/ 2674 2675 2676 2677
Neuenschwander 2013; Basler Nachrichten vom 13. 3. 1944 und National-Zeitung vom 13. 6. 1944 (Zitat im Text stammt von hier). Anonym 1944. StABS Protokoll Erziehungsrat Bd. 24, 1936–1938, 30. 5. 1938. Stammbach 2010; Wanner 1970.
630
Die Naturwissenschaftler
30 Rektor des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasiums. An der Universität lehrte er Darstellende Geometrie, Infinitesimalrechnung (für Chemiker und Naturwissenschaftler) und Zahlentheorie.2678 Ernst Zwinggi, ab 1956 Generaldirektor der Basler Versicherungs-Gesellschaft, wirkte als Extraordinarius für Versicherungsmathematik;2679 dasselbe Fach vertrat der Direktor der Basler Lebensversicherungsgesellschaft, Hermann Renfer, als Privatdozent. Erwähnenswert ist schliesslich der Statistiker Ewald Bodewig, den ich unter den (Mathematischen) Physikern erwähnen werde.
8.2 Physik 8.2.1 Überblick Die Universität Basel verfügte 1933 über drei Physikprofessuren. Das gesetzlich verankerte Ordinariat versah August Hagenbach bis 1942. Sein Nachfolger wurde Paul Huber, während der Extraordinarius Max Wehrli die von Hagenbach gepflegte Spektroskopie weiterführte. Die zweite Professur (für Mathematische Physik) besetzte Wilhelm Matthies, der 1944 entlassen wurde. Die Nachfolge trat 1945 Markus Fierz an. Die dritte Professur war ein Extraordinariat für Angewandte Physik, in dem sich Wissenschaft und Technik begegneten; es war mit Hans Zickendraht besetzt. Ein weiterer Extraordinarius war der eigenwillige Ludwig Zehnder. In Würzburg und München war er Mitarbeiter von Wilhelm Röntgen gewesen, mit dem er befreundet blieb. Nachdem er als Ingenieur gearbeitet hatte, wechselte er in die akademische Laufbahn und habilitierte sich bei Eduard Hagenbach-Bischoff (dem Vater und Vorgänger von August Hagenbach) im Jahr 1890. Anschliessend wirkte er als Extraordinarius in Freiburg i. Br. 1904 wurde er Physiklehrer an der Lehranstalt für höhere Postbeamte in Berlin. Bei Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 wechselte er in die Röntgenabteilung am Kantonsspital Zürich. Vor dem Ersten Weltkrieg war er ein führender Fachmann für elektromagnetische Wellen und Hochfrequenztechnik mit einer starken Bindung an die deutsche Wissenschaft gewesen. Als Extraordinarius in Basel (1919 bis 1945) widersetzte er sich der Relativitätstheorie und der Quantenmechanik und vertrat eine
2678 2679
Nachruf in: Basler Zeitung vom 19. 12. 1978. Ernst Zwinggi hatte in Bern Mathematik studiert (Doktorat 1929) und wurde 1932 Mitarbeiter der «Basler Lebensversicherunggesellschaft». 1938 habilitierte er sich in Basel und wurde 1944 zum Extraordinarius und Leiter der Versicherungstechnischen Abteilung des Mathematischen Instituts der Universität befördert. In die Direktion des Unternehmens stieg er 1946 auf. Anonym 1965a; Anonym 1971; Wanner 1971.
Physik
631
eigene Theorie, die er auch populärwissenschaftlich verbreitete. An der Universität hielt er noch als Neunzigjähriger eine zweistündige Vorlesung.2680 8.2.2 Angewandte Physik Hans (Heinrich) Zickendraht, ein Schüler von Eduard Hagenbach-Bischoff, wurde 1909 Privatdozent in Basel. Von 1912 bis 1914 lehrte er Physik an der Höheren Chemieschule in Mülhausen, ging 1915 nach Basel als Extraordinarius mit einer eigenen Abteilung für Angewandte Physik und wurde 1935 zum persönlichen Ordinarius befördert. Er blieb bis 1951. Anknüpfend an HagenbachBischoffs Interesse für Telegraphie befasste sich Zickendraht seit 1913 mit Wellenlehre, drahtloser Telegraphie und praktischen Sendeversuchen. 1917/18 entwickelte er in Zusammenarbeit mit der Basler Glühlampenfabrik Elektronenröhren und konstruierte eine transportable Sendeanlage für das Militär. Seit 1923 hatte das Bernoullianum dank ihm einen Radiosender, der die Mustermesse bediente, um das neue Medium zu fördern. 1929 war Zickendraht Gastprofessor am King’s College London. Seine grosse Vielseitigkeit zeigte sich ausserhalb der Radiotechnik in Beiträgen zur Aviatik, Akustik (er war auch Lehrer für dieses Fach am Konservatorium) und Farbenlehre. Seinen Zeitgenossen blieb er in Erinnerung als Redner an den populären Vorträgen im Bernoullianum, durch seine Kurse an der Volkshochschule, als Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft in Basel sowie als Lehrer am Humanistischen Gymnasium. Wer ihn als Radiopionier, als Filmer und wegen seiner Aufnahmen auf dem Grammophon würdigt, wird ihm nicht völlig gerecht, weil bei ihm «nicht die Technik, die Physik […] das erste Wort» hatte.2681 8.2.3 Von der Spektralphysik zur Kernphysik Das bis 1937 einzige gesetzlich verankerte Physikordinariat (Experimentalphysik) hatte 1906 August Hagenbach von seinem Vater Eduard Hagenbach-Bischoff übernommen. Nach fünf Semestern in Basel hatte er in Leipzig beim Vorgänger seines Vaters, Gustav Heinrich Wiedemann, studiert und 1894 doktoriert. Anschliessend wurde er Assistent von Heinrich Kayser in Bonn, wo er sich 1898 habilitierte. Dort entwickelte er zehn Jahre lang die damals neue Spektroskopie unter Verwendung von Beugungsgittern (Rowlandsche Gitter), die Kayser pro2680 2681
Dessauer 1949. Anonym 1949. Studer 2014; Mohr 2010, 5. Die Basler Universitätsbibliothek hat Zickendrahts Nachlass, den ich hier nicht berücksichtige. Nekrolog: Baldinger 1956, mit Schriftenverzeichnis. Nachruf auch in den Basler Nachrichten vom 5. 6. 1956. Zitat aus: Basler Nachrichten vom 27./28. 12. 1941: «Zum 60. Geburtstag von Prof. Dr. Hans Zickendraht».
632
Die Naturwissenschaftler
pagierte, und wandte sie auf einfache Moleküle an. Mit dem Atlas der Emissionsspektren der meisten Elemente von 1905, den er zusammen mit Heinrich Konen publizierte, stelle er der Physik ein vielbeachtetes und -benutztes Nachschlagewerk zur Verfügung. Nach einem kurzen Zwischenspiel an einer deutschen technischen Hochschule wechselte er 1906 auf die Basler Professur. Diese Wahl galt nicht einfach dem Sohn eines einflussreichen Vaters, sondern dem ausgewiesenen Spezialisten in einem innovativen und wenigstens bis zum Ende der 1920er Jahre attraktiven Forschungsfeld. Basel war das erste Institut in der Schweiz, das mit Rowlandschen Gittern arbeitete und sich damit in die ‚Front‘ der physikalischen Forschung jener Zeit stellte. Als Wissenschaftsorganisator gelang es Hagenbach, 1926 ein neues Physikgebäude zu erhalten, das er zusammen mit seinem Assistenten Alfred Krethlow2682 grosszügig konzipierte. Er stand der Inspektion des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasiums vor und sass in der Basler Elektrizitätskommission. Oft war er in der Reihe der populären Vorträge zu hören, die sein Vater begründet hatte. Er war mindestens bis 1929 Mitglied des Vorstands der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und wurde noch zur Vorstandssitzung vom 2. März 1938 in Berlin-Dahlem als Stellvertreter für Erwin Lohr eingeladen. Näheres weiss man über seine Rolle in dieser deutschen Fachgesellschaft bisher nicht. Bekannt ist hingegen seine Aktivität in der Naturforschenden Gesellschaft in Basel, in der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft (Vizepräsident des Zentralvorstandes 1935–1940) und in der Schweizerischen Physikalischen Gesellschaft (Präsident 1917, Delegierter im Senat der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 1922–1932). Als einer der Gründer der «Helvetica Physica Acta» und Redaktionspräsident dieser Zeitschrift publizierte er sehr gern in diesem nationalen Fachorgan, soweit er nicht für die «Verhandlungen» anderer Fachgesellschaften schrieb. In dieser Beleuchtung erscheint die Experimentalphysik als eine ‚helvetisierte‘ Wissenschaft, die nicht unbedingt auf deutsche Kommunikationswege angewiesen war. Deutlich ist, dass Hagenbach bei seinem Rücktritt 1942 wünschte, dass die optische Spektroskopie weitergeführt würde. Er sah darin einen Zugang zur Erkenntnis des Baus namentlich von Molekülen und war theoretisch durchaus an den Fortschritten der Quantentheorie und der Wellenmechanik interessiert.2683 Hagenbach wurde von Max Wehrli unterstützt, einem Absolventen der Universität Zürich, der im Sommersemester 1916 das Physikstudium aufgenommen hatte, mit einer Unterbrechung von 1916 bis 1919. 1922 hatte er dort dokto-
2682 2683
Krethlow wurde später Mitarbeiter der Kriegstechnischen Abteilung des EMD und Sekretär der Studienkommission für Atomenergie. Wildi 2002, 35. Mohr 2010, 4 f.; Wieland 1966; Wieland 1957; Huber 1955; Miescher 1955. StABS Erziehung CC 24 Philosophische Fakultät, Professur Physik 1853–1955. Aus dem Nachlass, in: StABS PA 838a Familienarchiv Hagenbach, wurden L 40 (1) und M 11 (1) konsultiert.
Physik
633
riert.2684 Viele Jahre lang war er Erster Assistent, unterbrochen durch einen einjährigen Studienaufenthalt bei Robert Andrews Millikan (Nobelpreis 1923) in Pasadena. 1928 habilitiert, erhielt er in Basel 1934 den Extraordinarientitel. Seit 1933 führte er, oft zusammen mit Ernst Miescher, innovative Untersuchungen an Molekülspektren durch, die der Konstitutionsaufklärung dienten und die chemische Industrie interessierten. Beim Rücktritt Hagenbachs 1942 wurde Wehrli zum (persönlichen) Ordinarius mit Lehrauftrag befördert.2685 Seither leitete er die neugeschaffene Abteilung Spektralphysik, während das gesetzliche Ordinariat mit der Wahl von Paul Huber für Kernphysik umgewidmet wurde.2686 Nach dem frühen Tod von Wehrli (1944) führte Ernst Miescher diese Gruppe weiter und spezialisierte sich auf die Spektren des Stickoxids. Miescher, von 1929 bis 1942 Assistent bei Hagenbach, hatte sich 1935 in Basel habilitiert und war hier 1941 zum Extraordinarius befördert worden.2687 Seit dem Winter 1934/35 wurden in Basel Lehrveranstaltungen zur Quantenmechanik angeboten. Wilhelm Matthies las über Quantentheorie, der Chemiker Hans Erlenmeyer führte ein Seminar über «moderne Fragen aus dem Gebiete der Atom- und Molekülstruktur» zusammen mit Max Wehrli (ohne Wehrli wiederholt im Sommer 1940) durch. Wehrli dozierte im Sommer 1936 über «Methoden zur Erforschung des Atombaus» (im Sommer 1937 und im Sommer 1939 wiederholt). Im Winter 1937/38 trat Ernst Miescher mit einer Veranstaltung über «Radioaktivität und Physik des Atomkerns» auf den Plan.2688 Das Interesse war da, aber es fehlten ein Kristallisationspunkt und eine Aufwertung des Themas durch eine entsprechende Anstellung. Seit 1938 hatten die Physikprofessoren von der Regierung einen Ausbau des Lehrangebots in theoretischer Physik gefordert – was Matthies (der einzige
2684 2685
2686 2687 2688
Ich verwende die Angaben nach: Matrikeledition der Universität Zürich (www.matrikel. uzh.ch). Es scheint Kreise gegeben zu haben, die Max Wehrli zu Hagenbachs Nachfolger gewählt sehen wollten. Während der Kernphysiker Paul Huber zuerst ein Probesemester absolvieren musste (siehe unten), begrüssten die Basler Nachrichten am 15. 6. 1942 in Wehrli den «neuen Ordinarius». Bei seinem Tod im September 1944 wurde Wehrlis Lehrauftrag in ähnlicher Weise als «Lehrstuhl» bezeichnet (Basler Nachrichten, 2. 9. 1944). Wehrli war in der Basler Gesellschaft als humanistisch gebildeter Mann angesehen, der sich auch politisch betätigte, allerdings nicht bei den Liberalen, sondern bei den Radikaldemokraten, deren Programm dem Politikverständnis des Thurgauers eher entsprach. Abgesehen vom Wunsch, mit der Kernphysik einen aktuellen Schwerpunkt zu setzen, waren Wehrlis gesundheitliche Probleme der Grund dafür, dass er nicht für die Nachfolge von Hagenbach infrage kam. Nachruf auf Werli in den Basler Nachrichten am 2. 9. 1944. Mohr 2010, 5. Csobádi 2008. Angaben in: Basler Vorlesungsverzeichnisse der entsprechenden Semester.
634
Die Naturwissenschaftler
Deutsche in diesem Umfeld) leistete, erschien ungenügend.2689 Hagenbach und Matthies verhandelten im April 1939 mit dem Zürcher Markus Fierz, dem sie eine Assistentenstelle, verbunden mit einem Lehrauftrag zudachten. Im Juni wurde Fierz, der seit 1938/39 Privatdozent in Zürich war, nach Basel umhabilitiert, wo er im Winter 1939/40 zu unterrichten begann. Der Lehrauftrag wurde am 30. Januar 1940 von der Regierung bewilligt. Fierz wurde (noch) verpflichtet, den Spektralphysikern beratend zuzuarbeiten.2690 Fakultät und Kuratel hatten damals vorgeschlagen, ihn mit «ergänzenden Vorlesungen zur theoretischen Physik unter besonderer Berücksichtigung der modernen Atom- und Quanten-Physik» zu beauftragen.2691 Erst im Juni 1943 erhielt Fierz den von ihm gewünschten Extraordinarientitel und eine Lohnzulage zu Lasten der Freiwilligen Akademischen Gesellschaft, um zu verhindern, dass er nach Zürich abwandere.2692 Als Matthies im September 1944 in den Ruhestand trat, war Markus Fierz der gegebene Kandidat. Immerhin wurde erörtert, ob man an eine deutsche Grösse wie Werner Heisenberg denken solle, aber das schien unrealistisch, da man in Basel wusste, dass Heisenberg nach dem Krieg die Kaiser Wilhelm-Gesellschaft weiterführen wolle. So wurde Fierz aufgrund eines regulären Berufungsverfahrens2693 zum 1. April 1945 Inhaber des gesetzlichen Ordinariats für Theoretische Physik. Die Basler Physik war damit vollständig in schweizerischen Händen. Fierz war der Sohn des Chemikers Hans Eduard Fierz, der nach einer Zeit bei der Basler Firma J. R. Geigy AG 1917 Professor an der ETH geworden war. Markus Fierz hatte 1931 in Göttingen sein Physikstudium begonnen und war 1933 nach Zürich zurückgekehrt, wo er 1936 beim Theoretischen Physiker Gregor Wentzel promovierte. Bei einem Sommerkurs, den Werner Heisenberg in Leipzig veranstaltete, erhielt er 1936 Gelegenheit, in Kopenhagen an einer Konferenz teilzunehmen und Niels Bohr kennenzulernen. Danach wurde er noch im 2689 2690 2691
2692 2693
Das Folgende basiert auf: StABS ED-REG 1a 1 367, Prof. Dr. Markus Fierz, Theoretische Physik 1945–1959. Die Physikprofessoren Matthies und Hagenbach an Regierungsrat Hauser, 21. 11. 1939, ebd. Die Finanzierung wurde dadurch erleichtert, dass Matthies darauf verzichtet hatte, das durch das Universitätsgesetz 1937 neu geschaffene ‚gesetzliche‘ Orinariat zu übernehmen. Bericht der Kuratel an das Erziehungsdepartement, 3. 1. 1940, ebd. Erziehungsdepartement an Regierungsrat, 15. 6. 1943, ebd. Das Gutachten der Fakultät, 15. 11. 1944, stellte Fierz auf die erste, Felix Bloch (Stanford) auf die zweite Stelle. In der Sitzung der Sachverständigenkommission der Kuratel, 27. 11. 1944, wurde entschieden, nur Schweizer zu berücksichtigen (wofür auch die Ansicht von Paul Scherrer in der Diskussion angeführt wurde). Blochs Arbeiten zur Wellenmechanik wurden als «zeitbedingt» abgetan, während der Physiker Huber sich mit dem Mathematiker Speiser einig war, dass die Zusammenarbeit mit Fierz, dem umfassende Bildung und ein «grossartiges Gedächtnis» attestiert wurden, sehr gut sei. Protokoll der Sitzung, ebd. Die Kuratel machte sich dieses Ergebnis zu eigen und drängte zur Eile, da Fierz in Zürich Aussicht auf einen Lehrstuhl hatte. Kuratel an Erziehungsdepartement, 11. 12. 1944, ebd.
Physik
635
selben Jahr auf Empfehlung Heisenbergs Assistent bei Wolfgang Pauli in Zürich. Dort habilitierte er sich mit einer Arbeit über das Spin-Statistik-Theorem für freie Felder. Fierz’ Laufbahn scheint somit auf die engen Beziehungen hinzudeuten, die zwischen der Schweizer (Zürcher) und der deutschen Physik vor dem Zweiten Weltkrieg bestanden. Doch Fierz kehrte bald nach der Machtübergabe an Hitler nach Zürich zurück, nach eigener Aussage aus Abneigung gegen die Nationalsozialisten. 1980 erinnerte er sich, wie die Studenten 1933 den jüdischen Professoren die Scheiben einschlugen, für ihn offensichtlich der Anlass, Göttingen zu verlassen. Fierz erhielt immer wieder Angebote aus Zürich, die die Basler Behörden mit der Gewährung von Urlaub und Gehaltserhöhungen abzuwehren versuchten. Im Herbst 1959 wurde er schliesslich zum Nachfolger von Pauli gewählt, eine Position, die er auf April 1960 antrat. Paul Huber,2694 der Nachfolger Hagenbachs auf dem Lehrstuhl für Experimentalphysik und Anstaltsvorsteher, hatte bei Paul Scherrer an der ETH 1937 doktoriert und versah nach der Habilitation einen Lehrauftrag am Technikum Winterthur. Seine Wahl nach Basel bedeutete nicht nur die Verlagerung des Basler Schwerpunkts auf die experimentelle Kernphysik, sondern auch den Einstieg eines katholischen ETH-Absolventen in die Basler Naturwissenschaften. Dieser Schritt in eine neue Richtung wurde nicht ohne Bedenken getan: Hagenbach hätte seinen Mitarbeiter Miescher vorgezogen und gab zu bedenken, dass die Kernphysik sehr grosse Ausgaben nach sich ziehen müsse. Da Wehrli bei schwacher Gesundheit war, kam er als Ordinarius nicht infrage. Regierungsrat Im Hof machte sich diese Befürchtungen zu eigen, während der Erziehungsdirektor Miville die übliche linke Position vertrat, dass das neue Gebiet für die Industrie interessant sei und somit indirekt zur Prosperität der Basler Wirtschaft und zur Erhaltung von Arbeitsplätzen beitrage. Auf Betreiben des Erziehungsrats beschloss die Regierung am 14. April 1942, Huber zunächst nur für ein Semester auf Probe anzustellen. Der Zoologe und Dekan Adolf Portmann besuchte während der Probezeit Vorlesungen und das Institut, um sich ein Urteil über Huber zu bilden,2695 während die Zeitungen bereits die Beförderung von Wehrli zum (persönlichen) Ordinarius (mit einem Lehrauftrag für Spektralphysik) meldeten. Huber, der bei Scherrer über Neutronenstrahlen2696 gearbeitet hatte, errichtete in Basel nach seiner Wahl (12. Juni 1942) trotz der Kriegsbedingungen ein (kleines) Zentrum der Kernforschung auf internationalem Stand. Gleich im ersten Jahr seiner Basler Tätigkeit wurde mit dem Bau eines Beschleunigers begon2694 2695 2696
Baumgartner 1972; Baumgartner 1971. StABS UNI-REG 5d 2-1 (1) 145. StABS Protokoll Erziehungsrat S 4 Bd. 26, 1940–1942, 25. 3. 1942, 30. 3. 1942. Neutronenphysik zur Zeit von Hubers Anfängen: Huber 1960, 76 f.; daraus ergibt sich, dass Huber die Themenstellung von Scherrer von der ETH nach Basel mitnahm. An der ETH begann die Kernforschung unter Scherrer 1935 durch Kessar D. Alexopoulos, dessen Untersuchungen Huber, Staub und Baldinger weiterführten, ebd. Wäffler 1992.
636
Die Naturwissenschaftler
nen. Die Neutronen waren erst 1932/34 entdeckt worden (Chadwick; Oliphant, Harteck und Rutherford); den ersten Beschleuniger hatten Cockcroft und Walton 1932 gebaut. 1935 wurde dieses Design an der ETH unter Paul Scherrer durch Alexopoulos kopiert und 1937 durch Baldinger, Huber und Staub verbessert.2697 Für die apparative Ausstattung waren Ideen von Greinacher in Bern wegweisend. Deutsche Kontakte wurden in diesem Zusammenhang nie erwähnt. Anders verhält es sich mit den Arbeiten an der ETH zum Beta-Zerfall; hierfür kamen die Anregungen aus Italien von Enrico Fermi, die Markus Fierz zu einer Theorie ausbaute (publiziert in der deutschen «Zeitschrift für Physik» 1937, in der auch Fermi seine Entdeckungen 1934 veröffentlicht hatte). 1937 hatte Scherrer in Heidelberg das Kaiser Wilhelm-Institut besucht und einen elektrostatischen Bandgenerator von Bothe und Gentner gesehen, der ihn zu einer ähnlichen Konstruktion in Zürich anregte. Damit konnten photonukleare Prozesse studiert werden, die das Arbeitsgebiet von Otto Huber (später Professor in Freiburg/ Schweiz) bildeten. Die ETH besass erst 1944 ein Zyklotron, mit dem Fermis Beta-Experimente nachgeprüft werden konnten.2698 1937 veröffentlichte die Scherrer-Gruppe in «Nature» einen Aufsatz über ihre Studien an Neutronen und behauptete, Alpha-Teilchen gefunden zu haben – in Wirklichkeit hatte sie eine Kernspaltung beobachtet, ohne dies zu erkennen.2699 Die Möglichkeit einer atomaren Kettenreaktion war seit 1939 bekannt; an der ETH befasste sich Helmut Bradt (ein aus Deutschland emigrierter Student)2700 im Juli 1939 mit der Zählung der Neutronen, die pro gespaltenen Urankern freiwerden.2701 Einen sehr engen Bezug der Zürcher Studien zu den Basler Forschungen scheint es nach 1942 nicht gegeben zu haben, aber für Basel wie Zürich gilt, dass die Grundlagenforschung, die in den kriegführenden Staaten beeinträchtigt war, sich in der Schweiz frei entfalten und man den Rückstand in der Ausrüstung aufholen konnte, so dass in den ersten Nachkriegsjahren hier ein Vorsprung vor anderen Ländern bestand.2702 Während Zürich die Verbindung zu den deutschen Arbeiten von Heisenberg im Krieg aufrechterhielt, ist über die Basler in dieser Hinsicht bisher nichts bekannt geworden. In der Basler Kernforschung waren neben Paul Huber auch die Chemiker Hans Erlenmeyer und Werner Kuhn involviert, die über Isotopentrennung und mit Massenspektrometern experimentierten.2703
2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703
Gugelot 1960, 110 ff. Bleuler/Stellen 1960; Boehm 1960. Aemmer u. a. 1992, 32. Gasser 2020. Aemmer u. a. 1992, 32 ff. Wäffler 1992, 173. Aemmer u. a. 1992, 30, 44, 118.
Physik
637
Huber propagierte in Basel die Nutzung der Kernenergie in zahlreichen öffentlichen Auftritten2704 und bot geschickt aufgebaute Experimentalvorlesungen für ein breites Publikum. Es scheint, dass er erst nach dem Krieg zu einer zentralen Gestalt in schweizerischen Fachgesellschaften, beim Nationalfonds und in der Kommission für Atomwirtschaft wurde. Auch in die Nachkriegszeit gehörte das Knüpfen von Beziehungen zur internationalen Kernforschung. 1949 brachte Huber den ersten internationalen Kongress über Atomphysik nach Basel, und 1951 reiste er in die USA. Bis 1948 publizierte er nur in deutscher Sprache und fast nur in den «Helvetica Physica Acta». Diese Vorlieben behielt er bis zu seinem Ende. Elektronik wurde für die Analyse der Daten aus der Kernphysik immer wichtiger; dafür gewann Basel 1945 Ernst Baldinger-Müller von der ETH, der Huber ideenreich unterstützte.2705 Baldinger hatte in Basel die Obere Realschule absolviert und dann Elektrotechnik an der ETH studiert (Diplom 1935). Anschliessend arbeitete er als Assistent am Physikalischen Institut von Paul Scherrer und doktorierte bei diesem 1938. Nach einer Tätigkeit am Institut für Technische Physik der ETH, wo er die Elektronik für das Projektionsverfahren Eidophor entwickelte, holte ihn sein Freund Paul Huber 1945 nach Basel. Hier habilitierte er sich 1946; 1948 wurde er zum Extraordinarius befördert und 1952 zum persönlichen Ordinarius. Seit 1959 war er Vorsteher des neugeschaffenen Instituts für Angewandte Physik.2706 Auch Baldinger publizierte meist in den «Helvetica Physica Acta». 8.2.4 Ein deutscher Patriot als Mathematischer Physiker in Basel Mathematische Physik existierte in Basel als selbstständiges Fach seit 1889; erster Dozent war Karl von der Mühll.2707 Wilhelm Matthies war 1913 aus Münster als Nachfolger von Karl von der Mühll mit Unterstützung der Freiwilligen Akademischen Gesellschaft nach Basel gewählt worden. Er las über die damals aktuellen Themen wie Thermodynamik, hatte aber fast kein Lehrangebot zu den neuesten Entwicklungen wie Quantenphysik. Als das Universitätsgesetz von 1937 einen zweiten im Gesetz verankerten Physiklehrstuhl geschaffen hatte, war die Kuratel gegen eine Beförderung von Matthies auf die neue Professur, die Fakultät dafür. Auch im Erziehungsrat war die Sache umstritten. Schliesslich wurde, wenn auch
2704 2705 2706 2707
Anonym 2010. Mohr 2010, 6. Nachrufe: Iris Zschokke-Gränacher 1971; Meyer 1971; Basler Nachrichten vom 11. 12. 1970; siehe auch National-Zeitung vom 27. 7. 1948. Mohr 2010, 4.
638
Die Naturwissenschaftler
ohne Begeisterung, der Lehrstuhl Wilhelm Matthies angeboten, und er schlug ihn aus.2708 Matthies vertrat deutsche nationalistische Überzeugungen in Zusammenkünften von Basler Dozenten (entsprechende Konflikte wurden 1935 berichtet; ich komme darauf zurück) und bezeichnete andere deutsche Mitglieder des Basler Lehrkörpers, wenn sie sich nicht auf die von ihm bevorzugte Linie begaben, als schlechte Patrioten. Deshalb befürchteten diese, Matthies würde sie in Deutschland ‚anschwärzen‘. 1939 wurde erstmals eine Untersuchung über seine politische Einstellung durchgeführt. Er war Mitglied einer NS-Organisation für Veteranen des Ersten Weltkriegs und gehörte später der Basler Pfalz an, in der die Mitgliedschaft für Basler Kantonsbeamte verboten war. Matthies fühlte sich als unschuldiges Opfer von Intrigen und bestritt nationalsozialistische Aktivitäten. Weil er wissenschaftlich und pädagogisch seit den 1920er Jahren angeblich kaum mehr etwas geleistet hatte, kam es den Behörden gelegen, dass er nationalsozialistischer Umtriebe verdächtigt wurde. 1941 beklagte sich Matthies über «beschämende Verletzungen und offene und versteckte Unfreundlichkeiten», die er und seine Familie in den letzten Jahren erlitten hätten, ohne diese zu präzisieren.2709 Im Dezember 1943 (nach der offensichtlichen Kriegswende) wollte ihn die Kuratel im Einverständnis mit der Fakultät vorzeitig pensionieren mit der Begründung, er sei dienstunfähig, und mit dem Ziel, den Platz für Fierz freizumachen,2710 was einige juristische Abklärungen erforderte. Diese besorgte Regierungsrat Im Hof persönlich und kam im April 1944 zum Schluss, dass für die Feststellung der Dienstunfähigkeit ein Gutachten des Amtsarztes erforderlich sei – was Matthies verhindern wollte und deshalb seinen freiwilligen Rücktritt anbot. Der Regierungsrat entschied, Matthies auf den 30. September 1944 aus dem Dienst zu entlassen und ihm eine Pension zu gewähren.2711 Politische Gründe kamen damals in der Begründung nicht vor; Recherchen der Politischen Polizei hatten nach Einschätzung der Kuratel nichts Konkretes zutage gefördert.2712 Doch 1945 sollte er durch den Bundesrat auf Antrag der Basler Behörden aus der Schweiz ausgewiesen werden: Er sei Mitglied der Nationalsozialistischen Kriegerkameradschaft und der Basler Pfalz gewesen, hiess es zur Begründung. Er habe eine fanatische nationalsozialistische Gesinnung bekundet, regelmässig die Veranstaltungen der «reichsdeutschen Gemeinschaft» besucht und sei spionagever2708
2709 2710 2711 2712
StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 13, 1935–1941, 264, 18. März 1938: zweiter gesetzlicher Lehrstuhl Physik. StABS Protokoll S 4 Erziehungsrat Bd. 24, 1936–1938, 30. 5. 1938; Bd. 25, 1938–1940, 17. 10. 1938, 19. 11. 1938. Matthies an den Dekan, 18. 12. 1941, in: StABS UA XI A 3, 2 Wilhelm Matthies. StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 14, 1941–1943, 247, 13. 9. 1943: Angelegenheit Prof. W. Matthies. Matthies war bereit, per Wintersemester 1943/44 zurückzutreten. Regierungsratsbeschluss, 18. 7. 1944. StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 14, 222, 1941–1943, 7. Juni 1943: Angelegenheit Prof. W. Matthies. StABS Protokoll S 4 Erziehungsrat Bd. 27, 1942–1944, 20. 12. 1943, 6. 3. 1944.
Physik
639
dächtig. Auf einen Rekurs von Matthies hin wurde dieser Entscheid 1946 zurückgenommen und in eine blosse Androhung der Ausweisung umgewandelt.2713 Der Konflikt mit Matthies von 1935 betraf Konrad Ewald Bodewig, der 1931 in Bonn über Thomas von Aquins Verhältnis zur Mathematik doktoriert hatte. Bodewig war ein Gegner der deutschen Erbgesetze und suchte statistisch zu beweisen, dass Zwangssterilisierungen nutzlos seien.2714 Er habilitierte sich 1935 in Basel.2715 Seinen Habilitationsvortrag hielt er am 20. Februar 1936 über «Biologische Massenerscheinungen in mathematischer Beleuchtung» (Chronik im «Basler Jahrbuch»). Bodewigs entsprechender Aufsatz wurde 1937 in der «Neuen Schweizer Rundschau» und in den britischen «Annals of Eugenics» publiziert, da er in Deutschland nicht veröffentlichen durfte.2716 Im Basler Vorlesungsverzeichnis2717 erschien er von 1935 bis zum Wintersemester 1938/39 mit Lehrveranstaltungen zu Differential- und Integralrechnung sowie zu Mathematischer Statistik. Für 1939 beantragte er einen Urlaub, während ihm die Basler Behörden die Aufenthaltserlaubnis per Ende 1938 entzogen hatten mit der Begründung, er sei ein Querulant. Die Kuratel wollte ihm die Lehrerlaubnis entziehen lassen.2718 Bodewig wurde ein bekannter Spezialist für höhere Algebra und hielt sich später in den Niederlanden auf.2719 Matthies hatte 1935 bei einem Beisammensein von Dozenten eine politische Behauptung aufgestellt, der Bodewig widersprach. Matthies insistierte; er sei ganz genau orientiert, und bemerkte: «Es ist doch traurig, dass ein Deutscher in der 2713
2714 2715 2716 2717 2718
2719
Liste der seit Kriegsende aus- oder weggewiesenen deutschen Reichsangehörigen, 22. 2. 1947, 34. Weggewiesen werden sollte «Matthies-Ter Horst Wilhelm, geb. 1881, Universitätsprof.». Das Verzeichnis der dem Bund zur Ausweisung beantragten Deutschen präzisiert, dass der Antrag zur bundesrätlichen Wegweisung von Basel ausging (Antrag 3. 5. 1945, Verfügung 29. 5. 1945) und dass ein Wiedererwägungsgesuch eingegangen sei, in: StABS PD-REG 5a 8-1-2-3, 1945–1947, Materialien zum Bericht des Regierungsrats über Abwehr staatsfeindlicher Umtriebe in den Vorkriegs- und Kriegsjahren sowie die Säuberungsaktion nach Kriegsschluss vom 4. Juli 1946; von 1945 bis 1947. Porter 2018, 317. 8. Sitzung der Kuratel, 4. 9. 1934, 450: Zustimmung zum Antrag der Regenz auf Habilitation. Quelle für das «Memorandum on Dr. Bodewig’s Paper»: https://onlinelibrary.wiley.com/ doi/pdf/10.1111/j.1469-1809.1933.tb02100.x. StABS UA AA 2 Lektionskataloge, Vorlesungsverzeichnisse. StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 12, 1930–1935, 542, 1. 7. 1935: Beschwerde Dr. Bodewig gegen Prof. Matthies. StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 13, 1935–1941, 329, 9. 1. 1939: Dr. E .Bodewig, Entzug der Venia Legendi. Bodewig reichte 1959/60 beim Landgericht Baden-Württemberg Klage gegen das Land Baden-Württemberg ein und verlangte Wiedergutmachung (Entschädigung für Schäden an Eigentum, Vermögen und im beruflichen Fortkommen). Landesarchiv Baden-Württemberg, Abteilung Staatsarchiv Freiburg, F 166/3 Landgericht Freiburg. Bodewig lebte damals in Den Haag.
640
Die Naturwissenschaftler
Schweiz so gegen sein Vaterland redet. Auch ein Herr der Bibliothek hat sich bei mir beklagt, dass Herr Bodewig solche Reden gegen sein Vaterland führt.» Bodewig betrachtete dies als Verleumdung und kündigte an, vor Gericht zu gehen. Adolf Portmann, damals Dekan, wollte verhindern, dass Ehrenstreitigkeiten unter Dozenten aus der Universität hinausgetragen würden, und brachte die Angelegenheit vor den Rektor Paul Häberlin. Dieser vermittelte zunächst erfolgreich, indem er Matthies erklären liess, er habe mit seiner Äusserung Bodewig nicht einen Mangel an vaterländischer Gesinnung vorwerfen wollen, und es wurde festgehalten, dass weder Matthies noch sonst jemand einen Bericht nach Deutschland geschickt habe. Bodewig sollte aufgrund dieser Erklärung seine gerichtliche Klage gegen Matthies zurückziehen.2720 8.2.5 Ergebnis Die Geschichte der Physik in Basel erlaubte somit auf den entscheidenden Lehrstühlen mit Ausnahme von Matthies keine Aufschlüsse über ein besonders enges Verhältnis der Professoren zu Deutschland in der Untersuchungsperiode, obschon zuvor ein Studium der Physik in Deutschland wenigstens während einiger Semester üblich gewesen war. Das Fach war nach 1933 bereits zu sehr internationalisiert, um noch einseitig in Deutschland den Mittelpunkt dieser Wissenschaft zu sehen, aber selbstverständlich war es für Schweizer Physiker weiterhin nützlich, Beziehungen zu einer deutschen Koryphäe wie Werner Heisenberg zu pflegen. Am Beispiel Fierz sieht man, wie der Weg zu den Grössen des Faches jenseits der deutschen Grenzen über Heisenberg nach Kopenhagen führen konnte. Deutsche Fachzeitschriften blieben wichtig, aber (ähnlich wie in der Chemie, siehe unten) Durchbrüche wurden als Artikel in «Nature» publik gemacht. Das Engagement in den schweizerischen lokalen und nationalen Fachgesellschaften führte dazu, dass deren «Verhandlungen» und vor allem die 1928 gegründeten «Helvetica Physica Acta» zu einem zentralen Medium der Fachkommunikation wurden. Auf deutsche Periodika waren Schweizer Physiker somit nicht (mehr) angewiesen. Das Fach erscheint damit einerseits als wirklich internationalisiert (d. h. nicht mehr primär auf Deutschland ausgerichtet), zugleich aber personell und hinsichtlich der Kommunikationskanäle helvetisiert. Dass mit Wilhelm Matthies gerade ein Physiker ein Beispiel für einen deutschen Patrioten abgab, der sich von den Nationalsozialisten nicht fernhielt, ist für das Fach insgesamt nicht aussagekräftig.
2720
Bodewig an Fakultät, 23. 5. 1935; Adolf Portmann Dekan an PD Dr. R. Bodewig, 23. 5. 1935; Notiz von Paul Häberlin, Rektor, 4. 7. 1935, in: StABS UA XI A 3, 2 Wilhelm Matthies.
Astronomie
641
8.3 Astronomie Ein kurzer Blick auf die Dozenten der Astronomie lässt vermuten, dass sich das Fach wenig für eine exemplarische Untersuchung über die Beziehungen zu Deutschland 1933 bis 1945 eignet. Beide Basler Astronomen waren in schweizerische Projekte eingebunden und veröffentlichten ihre Beiträge hauptsächlich in nationalen Fachzeitschriften. Die Professur war seit 1918 mit Theodor Niethammer besetzt. Der Sohn süddeutscher Eltern wuchs in Basel auf, besuchte das Humanistische Gymnasium und studierte an der Universität Basel. Zur Weiterbildung ging er an die ETH Zürich und an das Geodätische Institut Potsdam. 1904 promovierte er in Basel mit einer Dissertation über die Relative Bestimmung der Schwerkraft im Nikolaital. Darin wertete er Messungen aus, die er seit 1899 für die Schweizerische Geodätische Kommission vorgenommen hatte. Dieser Kommission gehörte er bis zu seinem Tod an. Sein Ziel war eine vollständige Schwerekarte der Schweizer Alpen. In der Basler Professur berücksichtigte er die Astronomie stärker und forschte zu Fragen der Genauigkeit von Beobachtungen, deren Ergebnisse erst 1947 in seinem Buch Die genauen Methoden der astronomisch-geographischen Ortsbestimmung erschienen. Zwar erreichte er, dass die Astronomie ein eigenes, neues Institut oberhalb des Margarethenparks erhielt (1928/29), in dessen Untergeschoss er einen Seismographen aufbaute, aber der von ihm geplante, grosse Spiegel wurde wegen des Zweiten Weltkriegs nicht realisiert; die Sternwarte behielt den alten Refraktor aus dem Bernoullianum.2721 Die Publikationsorte seiner Arbeiten waren grossmehrheitlich schweizerisch. Als Lektor für Astronomie war (Johannes) Martin Knapp angestellt. Astronomie hatte er in Basel und in Göttingen studiert, dann war er nach einem Zwischenspiel als Mitarbeiter der Heidelberger Sternwarte als Mathematiker für die Schweizerische Geodätische Kommission tätig, bevor er das Lektorat an der Universität Basel übernahm. Der von Italien begeisterte Knapp lebte vor allem als Privatgelehrter und Wissenschaftsjournalist. Für die «Basler Nachrichten» schrieb er regelmässig über Himmelsereignisse und verband den Blick zum Nachthimmel mit kulturgeschichtlichen Informationen; zu Beginn war er auch Musikkritiker. Als Historiker beschäftigte ihn die Astronomie der Babylonier, Symbolik und Kalenderfragen; als Mathematiker interessierten ihn die Beziehungen zwischen Zahlen und Musik. Freundlich stellte die «National-Zeitung» fest, dass der siebzigjährige Knapp sich von der «Landstrasse der offiziellen Wissenschaft» weit entfernt habe.2722
2721 2722
Fülscher 1999; Anonym 1947a; Anonym 1946. Birkhäuser 1997; Anonym 1946a.
642
Die Naturwissenschaftler
8.4 Chemie und Pharmazie2723 8.4.1 Einleitung Die Chemieprofessuren entwickelten sich in Basel entlang der üblichen akademischen Konfliktlinien: Hausberufungen oder Präferenzen für internationale Grössen (namentlich aus Deutschland) sowie innerwissenschaftliche oder ausserwissenschaftliche Kriterien der Wahl. Ähnliches galt für die Pharmazie, die hier zu den Naturwissenschaften gerechnet und in der Untersuchungszeit eng mit der Chemie verbunden wurde. Auf die Privatdozenten gehe ich in der Regel aus Mangel an Ressourcen nicht ein. Zeitspezifisch war die Diskussion um die «Emigranten» (Flüchtlinge),2724 rassistische Vorurteile und kriegsbedingte Einschränkungen. Ich beobachte in diesem Kapitel das Geschehen in vier Instituten: in der Organisch-Chemischen Anstalt, in der Anorganisch-Chemischen Anstalt und in der Physikalisch-Chemischen Anstalt, zudem – wie erwähnt – untersuche ich die Vorgänge in der Pharmazie.2725 Chemie wurde allerdings auch ausserhalb dieser naturwissenschaftlichen Anstalten getrieben. So gab es in der Medizinischen Fakultät Institute, die mit chemischen Methoden arbeiteten, ohne dass ich sie hier berücksichtigen werde. In der zweiten Hälfte der 1930er Jahre konnten die Weichen für die Chemie in Basel neu gestellt werden, weil damals sowohl die Chemiker als auch der Pharmazeut die Altersgrenze erreichten. Wie von anderen Fächern her bereits bekannt, war es in dieser Phase unwahrscheinlich, dass deutsche Bewerber berücksichtigt wurden, woraus sich neue Rahmenbedingungen ergaben. So waren entweder nur noch schweizerische Kandidaten denkbar, oder Auslandschweizer wurden zurückgeholt, oder man versuchte, aus der politischen und ‚rassischen‘ Verfolgung deutscher und österreichischer Gelehrter Nutzen zu ziehen, um bedrohte Fachvertreter für Basel zu gewinnen.
2723 2724
2725
Eine frühere Fassung dieses Kapitels erschien als Aufsatz in der «Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde», Simon 2019. Emigration von Chemikern in die Schweiz: Deichmann 2001, 118 ff., 131. Unter den Zielländern der Emigration für ‚rassisch‘ Verfolge stand die Schweiz im sechsten Rang mit nur sechs Emigranten. Grossbritannien stand an der Spitze mit 35, gefolgt von den USA mit 19 Fällen. Deichmann 2001, 133 ff., zählt in der Rubrik der aus politischen Gründen Verfolgten 18 Fälle, von denen zehn emigrierten (darunter auch solche, die schon 1932 Deutschland verlassen hatten, wie für Basel Hermann O. L. Fischer und Erich Eugen F. Baer, siehe unten, und solche wie Werner Kuhn, der erst 1939 nach Basel kam). Ferner gingen aus dieser Kategorie in die Schweiz: Alfred Winterstein (1933, Basel) und RobertKarl Wizinger-Aust (1938, Zürich, später in Basel). Constable 1999; Simon 2011 zu den Bauten.
Chemie und Pharmazie
643
8.4.2 Pharmazie Als die akademische Apothekerausbildung an der Universität Basel 1916 eingeführt wurde, war das hiesige pharmazeutische Universitätsinstitut in der Forschung über synthetische Medikamente noch nicht aktiv. Der Fachvertreter Heinrich Zörnig (Ordinarius in Basel von 1916 bis 1937),2726 der selbst eine Apothekerlehre gemacht und eine Offizin geführt hatte, und der Extraordinarius Josef Anton Häfliger (Besitzer der St. Johann-Apotheke, von 1932 bis 1942 Extraordinarius für Galenik und Pharmaziegeschichte),2727 waren in den Apothekerstand eingebunden und an Botanik (Zörnig) und der Geschichte der traditionellen Heilmittel (Häfliger) interessiert. Doch bereits in den 1920er Jahren wurde diese Art der Pharmazie durch die Pharmazeutische Chemie ergänzt. Der Davoser Paul Casparis wirkte in Basel seit 1927 für dieses Fach, bis er im November 1932 nach Bern als Ordinarius für Pharmakognosie, Pharmazeutische Chemie und Arzneiformenlehre gewählt wurde.2728 Da traf es sich gut, dass der Kohlenwasserstoffchemiker Hermann O. L. Fischer (Sohn des deutschen Nobelpreisträgers Emil Fischer)2729 Berlin verlassen wollte, weil ihm die Perspektive eines geistfeindlichen Regimes in Deutschland grosse Bedenken erweckte. Auf Einladung des Basler Ordinarius für Organische Chemie, Hans Rupe,2730 wandte sich Fischer schon im Mai 1932 der Universität Basel zu, deren Philosophische Fakultät ihn im Juni 1932 anstandslos umhabilitierte.2731 Fischer hielt je eine Vorlesung für die Pharmazeuten und für die Chemiker an den entsprechenden Instituten ab. Am 12. Juni 1934 wurde der Privatdozent auf Antrag der Ordinarien für Organische Chemie und für Pharmazie mit dem Titel eines Extraordinarius ausgestattet.2732 Er brachte einen eigenen Assis2726 2727 2728 2729
2730 2731
2732
Ledermann 2015. Ledermann 2006. Ledermann 2009. Stanley/Hassid 1969; Sowden 1962. Alle Angaben, soweit nicht anders nachgewiesen, zur Situation von Fischer in Basel aus: StABS ED-REG 1a 1 373 Prof. Dr. Herm. Fischer Phil. II (Chemie). K. Wd. 1960. Die Naturwissenschaftliche Abteilung der Philosophischen Fakuktät meldete der Kuratel am 4. 11. 1932, Casparis sei nach Bern berufen worden, und bei diesem Anlass habe «der neue Privatdozent für Chemie, Herr Dr. Herm. Fischer, eine einstündige Vorlesung ‚Pharmakochemie III‘» übernommen. Die Überlassung von Räumen für Fischer bei den Pharmazeuten am Totengässlein sei, so insistierte Zörnig, nur ein «Provisorium». ED-REG 1a 1 373 Prof. Dr. Herm. Fischer Phil. II (Chemie). Naturwissenschaftliche Abteilung der Fakultät an Kuratelspräsident (Ernst Thalmann), 16. 3. 1934. Fischer habe bereits 27 Doktoranden angeleitet. In der Basler Zeit seien zwei Veröffentlichungen erschienen, und Fischer habe zwei Einladungen an das Kaiser Wilhelm-Institut für medizinische Forschung erhalten. Er habe sieben Referate an schweizerischen und deutschen Versammlungen gehalten. Seine Spezialvorlesungen seien gut be-
644
Die Naturwissenschaftler
tenten aus Berlin mit, Erich (Eugen F.) Baer,2733 und er unterrichtete ohne Gehalt oder Entschädigung, da er von eigenen Mitteln leben konnte. Seine humanistische Bildung und sein liebenswürdiges Wesen verschafften ihm in Basel rasch viele Freunde; zudem war anerkannt, dass er zu den Besten seines Faches zählte. Er baute eigene Forschungsgruppen auf und betreute in Basel zahlreiche Dissertationen. Zwar waren die Verhältnisse hier zu eng, um ihn auf Dauer zu befriedigen, aber Fakultät, Kuratel und Erziehungsdepartement wollten ihn in Basel halten, bis ihm eines der chemischen Ordinariate hätte zugesprochen werden können Ende der 1930er Jahre erreichten beide Ordinarien der Chemie die Altersgrenze. Im Dezember 1936 erhielt Fischer eine Einladung der Universität Toronto, zunächst für Gastvorlesungen und einen Besuch im Institut von Sir Frederick Banting.2734 Dafür gewährte ihm Basel einen Urlaub.2735 Als er nach drei Monaten zurückkehrte, brachte er ein Angebot für die Übernahme einer Professur mit, wollte aber die Beziehungen zur Basler Universität nicht abbrechen und sich die Option für eine hiesige ordentliche Professur offenhalten. So liess sich Fischer auf unbestimmte Zeit beurlauben und ging mit den Assistenten Erich Baer und Jean Manfred Grosheintz nach Toronto.2736 Der Chef des Erziehungsdepartements, Fritz Hauser, und der Präsident der Kuratel, Ernst Thalmann, hatten Fischer de facto die Nachfolge des Apothekers Zörnig angeboten.2737 Fischer entschied sich jedoch ‚vorläufig‘ für Toronto, da das dortige Angebot sehr gute Forschungsmöglichkeiten einschloss. Er würde in Basel eine Professur für Chemie annehmen, in Pharmazie seien die Möglichkeiten zu begrenzt. «Da ich für das demnächst freiwerdende Ordinariat für Organische Chemie aus Gründen der persönlichen Rücksichtnahme auf Herrn Professor Ruggli nicht in Frage zu kommen glaubte, waren Sie [Fritz Hauser in der Unterredung vom Vortag] so freundlich, mich für eine später freiwerdende chemische Professur in Aussicht zu nehmen.» Fischer wollte den «Konnex mit der Universität Basel» behalten.2738 Die Fakultät fand sich zunächst damit ab, auch weil Fischer noch Prüfungen abnehmen sollte. Sie opponierte erst 1943, als alle Professuren neu besetzt waren,
2733 2734 2735 2736 2737 2738
sucht, und die Studenten fänden ihn «sehr anregend». ED-REG 1a 1 373 Prof. Dr. Herm. Fischer Phil. II (Chemie). Deichmann 2001, 133. Institutsleiter Frederick G. Banting an Fischer, 16. 12. 1936, bestätigt durch den Präsidenten der Universität Toronto Henry John Cody am 22. 12. 1936. Gesuch Fischer an die Kuratel, 10. 1. 1937, um Urlaub bis zum Schluss des Wintersemesters, bewilligt durch ED am 22. 1. 1937. Stortz 2012, 229. Die Lebensdaten von Grosheintz sind nicht eruierbar. ED an Fischer, 25. 1. 1937. Fischer an Hauser, 21. 4. 1937. Am 29. 4. 1937 äusserte sich die Kuratel zustimmend. Die Fakultät war einverstanden, worauf der Erziehungsrat am 31. 5. 1937 einer mehrjährigen Beurlaubung zustimmte. Ebd.
Chemie und Pharmazie
645
eine neue Habilitation bevorstand und sie nun nicht mehr wünschte, dass Fischer zurückkehre. Doch auch dann noch teilte das Basler Erziehungsdepartement im Einverständnis mit der Kuratel Fischer offiziell mit, dass die Streichung seines Namens aus der Liste der Angehörigen des Basler Lehrkörpers nicht so zu verstehen sei, dass er nun unerwünscht sei.2739 Fischer machte in Nordamerika eine glänzende Karriere, die ihn von Toronto nach Berkeley führte (dort lehrte er von 1948 bis 1960 und war Chairman of the Department of Biochemistry von 1953 bis 1956). Stanley und Hassid berichten, dass Fischer Europa verliess, weil er den Krieg kommen sah und vermeiden wollte, dass seine Söhne ein Aufgebot für die deutsche Wehrmacht erhielten. Basel lag zu nahe an der deutschen Grenze.2740 Das Verhalten von Regierung und Kuratel gegenüber Fischer lässt eine Strategie erkennen, die innerhalb des Beobachtungszeitraums zweimal, mit Tadeus Reichstein und Werner Kuhn,2741 zu einem Erfolg führte: neben die lokalen Fachvertreter international angesehene, zur Spitzengruppe ihres Faches gehörende Wissenschaftler nach Basel zu ziehen, die wegen der direkten oder indirekten Auswirkungen der nationalsozialistischen Diktatur auf den akademischen Stellenmarkt für Basel zu gewinnen waren oder es zu sein schienen. Nach der Pensionierung Zörnigs verschob sich der Schwerpunkt des Pharmazeutischen Instituts von einer Apothekenwissenschaft zu einer Ausrichtung auf die Chemie lebenswichtiger Naturstoffe, auf deren Synthese und damit auf die Forschung über mögliche Arzneimittel für die chemische Industrie. Dies geschah durch die Wahl des in Zürich als Extraordinarius lehrenden und forschenden Tadeus Reichstein (Nobelpreis 1950)2742 per 1938 auf das pharmazeutische Ordinariat. In der Pharmazie wurde damit ein radikaler Wechsel vollzogen. Für die Entwicklung von Arzneimitteln kooperierte die Basler chemische Industrie in der Zwischenkriegszeit gern mit der ETH Zürich und der dortigen Universität. An der Universität Zürich war seit 1918 Paul Karrer tätig (Nobelpreis 1937)2743 und an der ETH seit 1918 resp. 1923 Leopold Ru⌅i⇥ka (Nobelpreis 1939),2744 Naturstoffchemiker von Weltrang, die selbstverständlich mit der Indus-
2739
2740 2741 2742 2743 2744
Abschrift Schreiben von Paul Ruggli, Vorsteher der Anstalt für Organische Chemie, an den Dekan Erlenmeyer, 4. 5. 1943. Dekan Erlenmeyer an Kuratelspräsident Max Gerwig, 29. 5. 1943. Gerwig an ED, 19. 6. 1943. Carl Miville, Vorsteher ED, an Fischer, 24. 6. 1943, informierte Fischer wie beschlossen und unterstrich, dass nur äussere Gründe die Veranlassung für diese Statusänderung seien. StABS ED-REG 1a 1 373 Prof. Dr. Herm. Fischer Phil. II (Chemie). Stanley/Hassid 1969, 96 f. Kuhn 1984; Thürkauf 1965; Prijs 1983 f. Ich werde auf diese Beispiele unten zurückkommen. Bickel 2010. Hansen 2018. Buchs 2010; Simon 2005.
646
Die Naturwissenschaftler
trie Partnerschaften eingingen.2745 Sehr erfolgreich mit Industriekooperationen war in Zürich auch Tadeus Reichstein, der im ETH-Labor von Ru⌅i⇥ka 1930 als Privatdozent, dann ab 1937 als Extraordinarius eigenständigen Forschungen nachging, die in der Schweiz von Haco (Gottlieb Lüscher,2746 namentlich Vitaminfragen)2747 und in den Niederlanden von Organon (Saal und Mau van Zwanenberg, Hormonforschung)2748 finanziert wurden. Die einträgliche Arbeit an Vitaminen führte zu einer Verbindung mit dem Basler Pharma-Unternehmen Hoffmann-La Roche (Roche).2749 Diejenigen Projekte von Reichstein, die Roche interessierten, konnten konfliktfrei neben den Forschungen des mit der Ciba vertraglich verbundenen Hormonspezialisten Ru⌅i⇥ka durchgeführt werden. Aber aus Reichsteins Forschungen über die Produkte der Nebennierenrinde, die Organon seit 1934 förderte,2750 resultierten Spannungen. Ru⌅i⇥ka liess in seinem Labor, dessen Ausbau weitgehend von Ciba finanziert wurde,2751 einen Chemiker arbeiten, der mit der niederländischen Konkurrenz liiert war. Hinter diesem Konkurrenzverhältnis hatte zwar keine Absicht gestanden, da man annahm, die in ihrer chemischen Struktur noch unbekannten Produkte des Cortex (Nebennierenrinde) gehörten zu einer anderen Verbindungsklasse als die Sexualhormone, denen die Aufmerksamkeit Ru⌅i⇥kas und das Interesse der Ciba galten. Reichsteins Untersuchungen zeigten aber, dass diese Annahme falsch war.2752 Die Intervention der Ciba stand im Zusammenhang mit der Herausbildung des Hormonkar-
2745 2746 2747 2748 2749 2750
2751
2752
Kooperation der chemischen Industrie mit externen wissenschaftlichen Mitarbeitern: Bürgi 2011, 64–69. Ratmoko 2010, 170, 185, 190 f. (Leopold Ru⌅i⇥ka). Zürcher 2008. Kooperation Lüscher/Reichstein: König 2016, 131 f.; Bächi 2007, 21 ff. Reichsteins Leistungen in der Synthese von Vitamin C: Bächi 2007, 18 ff. Ratmoko 2010, 171 ff.; Tausk 1984. Landoldt 2002; Vetter 1953. 1934 wurde die Kooperation zwischen Organon und Reichstein auf dem Gebiet «Cortin» beschlossen. Im Herbst 1936 fand Reichstein «Corticosteron». Reichstein vermutete, dass es sich um ein Steroid handle. Am 28. 11. 1936 sandten Reichstein und andere eine Mitteilung an die Kgl. Niederländische Akademie, in der der Name «Corticosteron» erstmals publiziert wurde. Den Durchbruch bedeutete die Synthese von «Desoxycorticosteron» durch Reichstein und Marguerite Steiger an der ETH Zürich. Organon konnte alle Erfindungen von Reichstein, die unter den Vertrag fielen, patentieren, was die Position des Unternehmens gegenüber der Konkurrenz im Hormongeschäft, namentlich Schering und Ciba, stärkte. Tausk 1984, 67 f., 165. Ru⌅i⇥ka erhielt von der Ciba jährlich Fr. 12’000 und eine Umsatzbeteiligung an seinen Erfindungen. Die Firma finanzierte an der ETH das Mikrolabor und verschiedene Mitarbeiter; sie nahm in Basel die physiologisch-biologischen Studien an den Substanzen vor, die das Team von Ru⌅i⇥ka zusandte. Bürgi 2011, 69; Ratmoko 2010, 191–196. Interview mit dem Center for History of Chemistry (Transcript) 1985–1987, 12, in: Nachlass Reichstein, StABS PA 979a, B 2-3 9.
Chemie und Pharmazie
647
tells,2753 in deren ersten Phase Ciba und Schering einerseits, Organon zusammen mit Chimio und Boehringer Mannheim andererseits zwei antagonistische Blöcke bildeten. Unmittelbarer Auslöser des Entscheids, dass Reichstein das ETH-Institut verlassen müsse, war der Ärger Ru⌅i⇥kas über Mau van Swanenberg, von dem er sich bei einem Treffen des Hormonkartells in Berlin 1937 beleidigt fühlte. Er verlangte vom Niederländer Unternehmer eine Satisfaktion, andernfalls wollte er Reichstein nicht mehr bei sich dulden.2754 So wurde der international bekannte und gut vernetzte Reichstein wissenschaftlich ‚heimatlos‘. Eine Karriere als Chemieprofessor schien aussichtslos, da er als Jude in Deutschland nicht infrage gekommen wäre (zudem hatte er von Kindheit her eine Abneigung gegen Deutsche).2755 Der akademische Stellenmarkt in der Schweiz war klein und bot deshalb zu selten eine Chance, während in Westeuropa und den USA bereits herausragende Wissenschaftler, die Deutschland verlassen hatten, auf Stellensuche waren. An das Daniel Sieff-Institut in Rehovot (Palästina) wollte Reichstein aus Rücksicht auf seine niederländische Ehefrau nicht übersiedeln.2756 Später deutete er an, dass er 1937 der Ansicht gewesen sei, dass er als «polnischer Jude» nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz unter den gegebenen Umständen keine Stellenchancen habe.2757 In den Dokumenten von 1937 wurde jedoch jedes offen antisemitische Argument vermieden; den ‚Hinauswurf‘ aus der ETH verursachten unmittelbar die Erregung von Ru⌅i⇥ka und mittelbar der Einfluss der Ciba2758 – Antisemitismus gab 2753
2754
2755
2756 2757
2758
Geschichte des Hormonkartells: Ratmoko 2010, sie klammert jedoch die Corticosteroide aus und geht deshalb nicht auf Reichsteins Rolle für die Industrie ein. Geschichte des Cortison: Haller 2012; Tausk 1984, 88 ff., bleibt eine lohnende Lektüre. Briefdokumente zum Abgang von Zürich in: StABS PA 979a Nachlass Reichstein, G2 1 Poly 1929–1937. Das Drängen der Ciba, Reichstein die Kooperation mit Organon zu untersagen oder ihn aus dem Labor zu werfen, erklärte sich Reichstein damals als Manöver der Ciba in einer bestimmten Phase der Kartellverhandlungen im Hormonbereich. Reichstein an Laqueur, 6. 3. 1937. Reichstein war in Jena zwei Jahre in die Schule gegangen, bevor er seinen in die Schweiz eingewanderten Eltern nach Zürich folgte. Noch 1985 erinnerte er sich an die dortige «kind of military attitude». Interview mit dem Center for History of Chemistry (Transcript) 1985–1987, 1, in: Nachlass Reichstein, StABS PA 979a, B 2-3 9. Deichmann 2001, 162. Reichstein an Chaim Weizmann, 1. 12. 1935, in: Nachlass Reichstein, StABS PA 979a, G2 2 Poly 1930–1937. Vgl. dazu die Lage von Moses Goldberg, Assistent von Leopold Ru⌅i⇥ka an der ETH in Zürich, und die Behauptung, in der Chemie seien «zuviele Ostjuden anwesend», bei: Bürgi 2011, 82. Reichsteins Situation wird von Bürgi nicht angesprochen. Dagegen referiert Bächi 2007, 203, aus Reichsteins Curriculum Vitae von 1993: «During the years around 1938 no other Swiss University would have had the courage to nominate a Polish Jew, as I was, for a chair.» «Reichsteins Wegzug von der ETH stand nicht direkt mit antisemitischen Tendenzen in Zusammenhang.» Bächi 2007, 201. Auch in der Selbstdarstellung von 1985 begründete
648
Die Naturwissenschaftler
es jedoch in Zürich sehr wohl, wie ein Blick in die Presse zeigt, die die ETHStellen für ‚richtige‘ Schweizer reservieren wollte. Reichstein war mit seinen vier Brüdern 1915 in Zürich eingebürgert worden, hatte an der Zürcher Industrieschule seine Maturität erworben, an der ETH studiert und hauptsächlich mit Schweizer Industriellen kooperiert. Verheiratet war er mit Henriette Louise Quarles van Ufford,2759 der Tochter eines niederländischen Adligen englischer Herkunft, der als Marineoffizier in den Kolonien gedient hatte und in Aufsichtsräten von Chemiefirmen sass.2760 In der zunehmend xenophoben und judenfeindlichen Atmosphäre der 1930er Jahre galt Reichstein als ‚Papierschweizer‘ und fühlte sich spätestens 1942 auch in der Schweiz latent bedroht.2761 Den altersbedingten Rücktritt des Pharmazeuten Heinrich Zörnig verstanden die Basler Behörden als Gelegenheit, das Fach gründlich zu modernisieren. Gegen den starken Widerstand der Apothekerschaft setzten sie auf einen Pharmazeutischen Chemiker. Ausländische Kandidaturen scheiterten daran, dass die Behörden politische Konflikte mit Deutschen oder Österreichern fürchteten.2762 Unter den Schweizern, die nicht schon fest auf einem Lehrstuhl sassen, kam eigentlich nur Reichstein infrage. So liess ihn die Basler Kuratel durch ein Mitglied ihrer Sachverständigenkommission – Roche-Direktor Barell – anfragen, ob er Interesse hätte, nach Basel zu kommen, allerdings mit der Bemerkung, dass die Verhältnisse am Basler Institut im Vergleich mit der ETH sehr bescheiden sei-
2759
2760
2761
2762
Reichstein seinen Weggang von Zürich nicht mit Antisemitismus: Interview mit dem Center for History of Chemistry (Transcript) 1985–1987, 12, in: StABS Nachlass Reichstein PA 979a, B 2-3 9. Sowohl Emil Barell, der ihn im Auftrag der Kuratelskommission fragte, ob er nach Basel kommen würde, als auch Regierungsrat Fritz Hauser, der die Anstellung in Basel bewerkstelligte, waren dezidierte Gegner des Antisemitismus. Bächi 2007, 42. Reichsteins Mutter Gustawa führte seit 1918/19 eine Pension, nachdem die Einkünfte ihres Ehemanns Isidor aus Russland wegen Krieg und Revolution weggefallen waren. Reichstein erwähnt die Pension in seinen Lebenserinnerungen. Interview mit dem Center for History of Chemistry (Transcript) 1985–1987, 4, in: StABS Nachlass Reichstein PA 979a, B 2-3 9. Siehe auch: http://www.ticinarte.ch/index.php/epper-mischa. html, konsultiert am 3. 12. 2028, im Moment in Überarbeitung, und https://gw.geneanet. org/edriessen?lang=en&iz=2&p=gerard+charles&n=quarles+van+ufford. Lebenslauf des Schwiegervaters, Junker Gérard Charles Quarles van Ufford: http://res ources.huygens.knaw.nl/retroboeken/persoonlijkheden/#source=1&page=1188&view= imagePane. Briefwechsel mit dem Chemieprofessor Hans Eduard Fierz-David 1934, der verdächtigt worden war, den mit «F.» gezeichneten Artikel in der Zeitung «Die Front» gegen die Juden an der ETH geschrieben zu haben. Fierz an Reichstein, 12. 9. 1934, und Reichstein an Fierz, 29. 9. 1934, in: Nachlass Reichstein, StABS PA 979a, G2 2 Poly 1930–1937. Ferner Polizeibericht von März 1942 über Reichsteins Intervention an einem Vortrag zur Frage der Rechtsstellung der Juden in Staaten mit antisemitischer Legislation. Bächi 2007, 204 f.; Picard 1994, 204. Wichers 2013, 105.
Chemie und Pharmazie
649
en.2763 Reichstein sagte zu, das Basler Institut wurde für ihn umgestaltet, und Basel erhielt so durch eine Auswärtsberufung de facto neben dem Farbstoffspezialisten Paul Ruggli einen zweiten Professor der Organischen Chemie (zur Geschichte dieses Faches siehe unten). Reichstein war in der Vorkriegs- und Kriegszeit einer der Basler Ordinarien, die Flüchtlingen halfen und die demokratische Ordnung in der Schweiz verteidigten. Er unterstützte zahlreiche Personen aus den Einkünften, die aus seinen Patenten und Industrieverträgen reichlich flossen.2764 Diese Hilfe galt einerseits der Betreuung von Strafgefangenen in Basel durch Frau Dr. Hedwig Boye.2765 Andererseits schickte er deutschen Juden, die in Südfrankreich in Lagern interniert waren, Lebensmittel und Geld;2766 in gleicher Weise unterstützte er eine Bekannte, die 1943 mit ihrem Sohn aus Italien in die Schweiz geflohen war.2767 Zudem förderte er den Bildhauer und Maler Hans Josephsohn (seit 1938 als Flüchtling in der Schweiz) in Zürich.2768 Manche dieser Personen kannte er entweder von sei-
2763 2764 2765
2766
2767
2768
Bächi 2007, 202 f. Bächi 2007, 204. Reichstein war spätestens seit 1943 Mitglied und Geldgeber eines Komitees zur Förderung der Arbeit von Hedwig Boye mit Strafgefangenen in Basel (später Erziehungsberaterin in Schaffhausen). StABS Nachlass Reichstein, PA 979a, B 3-3 4, Beruflich-finanzielle Unterstützung diverser Personen («Dr. H. Boyne») 1943–1976 (der Name von Hedwig Boye ist im Inventar falsch geschrieben). Nachlass Reichstein, StABS PA 979a, B 3-3 2, Darlehen, Kautionen etc. A–Z 1943 bis (ca.) 1991. Im selben Bestand, Dokumente über die Unterstützung eines entfernten Verwandten, Alfred Reichstein, der nach São Paulo geflohen war, in: Nachlass Reichstein, PA 979a, B 3-1 1, Private Briefe, Fotos, Texte etc. (sehr heterogen) 1918–1994, Materialien zu den Zuständen in den Lagern von Gurs und Rivesaltes und zu Reichsteins Mitwirkung an Aktionen zum Loskauf von Juden über die «Austauschliste» für die Emigration nach Palästina. 1944 versuchte er, Dr. S. Kober zu helfen, der für Organon gearbeitet hatte und dessen Familie nach Theresienstadt deportiert worden war. Dem Redaktor der «Basler Nachrichten» dankte er 1944 für einen mutigen Artikel über die Fremdenpolizei. Ebd., E 2-3 2, Frankreich, Unterstützung von Einzelpersonen und Flüchtlingshilfe 1940–1945, über Hilfen, die er nach Perpignan, Les Milles, Gurs, Noé, Thuir schickte. Oft diente das Office Paléstinien in Genf als Vermittlungsstelle. Diese Aktivitäten begannen spätestens 1941. Lager in Frankreich: Picard 1994, 396 ff.; Feigenwinter 1991. Hilfe für Wilhemina Schmolkowá Casella und deren Sohn Sacha im Oktober 1943, in: Nachlass Reichstein, StABS PA 979a, B 3-3 3, Diverse Korrespondenz 1943–1947. Weitere Dokumente sind verstreut in: E 2-2 4, Jüdische Flüchtlingshilfe 1943–1946, und E 2-2 2, Jüdische Hilfsorganisationen 1943–1950. Vorgänge an der schweizerisch-italienischen Grenze: Mächler 2019, 382 ff.; die Lager in diesem Zusammenhang: Broggini 1999. Flüchtlingshilfe allgemein zuletzt: Koller 2018, 26–90; und speziell für Basel: Sibold 2010; Haumann/Petry/Richers 2008. Nachlass Reichstein StABS PA 979a, E 2-3 1, Prof. Weizmann London 1939–1943 (im Inventar ist der Titel der Serie unzutreffend). Nachlass Reichstein StABS PA 979a, B 3-3
650
Die Naturwissenschaftler
ner Kooperation mit Organon in den Niederlanden oder von der Pension her, die seine Mutter Gustawa seit 1918/19 in Zürich führte. Ab 1933 beherbergte sie vor allem Flüchtlinge.2769 Seit 1942 unterstützte Reichstein die Basler Flüchtlingshilfe, ab 1943 die Flüchtlingsaktion des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes, Lokalkomitee Basel, und im Herbst 1943 wurde er von der Israelitischen Gemeinde Basel als Gemeindemitglied angeworben.2770 Arbeitslosen Forschern gab er im Rahmen des Möglichen einen Laborplatz und Fr. 200 pro Monat. Einige Flüchtlinge beschäftigte er mit Geldern aus der Industrie.2771 Wissenschaftlich ging Reichstein in den Jahren 1933 bis 1945 zu den Deutschen auf Distanz.2772 Zwar blieb er auf die wichtigen Handbücher und Zeitschriften abonniert, die die Deutsche Chemische Gesellschaft (DChG) herausgab, und blieb zu diesem Zweck «ausserordentliches» Mitglied der DChG von 1928 bis 1945.2773 Sein Beispiel illustriert die internationale Bedeutung dieser Gesellschaft und zugleich den wirtschaftlichen Stellenwert, den die auswärtigen Mitglieder während der Herrschaft der Nationalsozialisten für die DChG hatten. Während in Deutschland die jüdischen Mitglieder zunehmend ausgeschaltet wurden, was Reichstein nicht verborgen blieb, wurden die entsprechenden Ausländer als Devisenbringer nicht behelligt.2774 Interessant ist, dass die DChG glaubte, die Basler
2769 2770 2771
2772
2773 2774
2, Darlehen, Kautionen etc. A–Z 1943 (ca.) – 1991, Dokumente zur Unterstützung von Hans Josephsohn. Zu Josephson: Oberli 2012. Broda 2013. Nachlass Reichstein, StABS PA 979a, E 2-2 1, Israelitische Gemeinschaft und Flüchtlingshilfe 1942–1991. Kontext: Sibold 2010, 177, 304. Dr. Jean Press, Nyon VD, 1940 Assistent bei Kurt H. Meyer in Genf, wurde nach Beendigung der Arbeiten bei Reichstein 1941 von Ciba auf dessen Empfehlung übernommen. Er sollte nach Summit (US-Filiale von Ciba) gehen, war aber noch im Januar 1942 bei Ciba Basel. Dr. D. A. Prins, Holländer, 1939 an der ETH diplomiert, arbeitete bei Reichstein über Desoxyzucker, privat von Reichstein bezahlt und zusätzlich seit Herbst 1941 mit einem Stipendium von Ciba ausgestattet. Reichstein erklärte dem Arbeitsamt am 1. 12. 1943, dass Prins keinem Schweizer Arbeit wegnehme, er forsche ohne «industrielle Ziele». Auch Prins wollte 1941 nach den USA ausreisen, doch Ciba war nicht breit, ihn in Summit anzustellen. Nachlass Reichstein, StABS PA 979a, H 2-5 2, Mitarbeiter und Angestellte A– Z 1940–1944. Schon in der Vitamin C-Arbeit zogen weder Reichstein noch Lüscher deutsche Partnerfirmen in Betracht, hingegen suchten sie Beziehungen zu Organon, Glaxo Laboratories sowie Parke Davis. Bächi 2007, 29. Aber Reichsteins Vitamin C-Partnerfirma Roche bearbeitete den deutschen Markt intensiv, so dass Reichsteins Einkünfte zum Teil indirekt aus Lieferungen von Roche an die deutsche Wehrmacht resultierten. Bächi 2007, 57, 71 ff. Nachlass Reichstein, StABS PA 979a, F 2-1 1, Deutsche Chemische Gesellschaft 1928– 1948 (Akademie-Verlag Berlin). Maier 2015, 621 f. 40 Prozent der 4’000 Mitglieder der DChG waren 1932 Ausländer. Deichmann 2006, 459, ‚Arisierung‘ der Gesellschaft, ebd., 468 ff. Sichtbar war das ‚Verschwinden‘ der jüdischen Herausgeber auf den Titelseiten der «Berichte» der Deutschen
Chemie und Pharmazie
651
Chemieprofessoren kämen im Unterschied zu anderen Schweizer Chemikern nicht dafür infrage, nationalsozialistisches Propagandamaterial zu erhalten.2775 Reichstein veröffentlichte zwischen 1933 und 1945 mit geringen Ausnahmen nicht in Deutschland, sondern in den «Helvetica Chimica Acta» und in «Nature».2776 Seit Januar 1939 war er zudem Mitglied der American Chemical Society.2777 8.4.3 Die Organische Chemie: Farbstoffe Hans Rupe hatte sich als Schüler von Adolf von Baeyer (Nobelpreis 1905) 1895 in Basel habilitiert. 1907 heiratete der schon 1884 in Basel eingebürgerte Westfale eine Tochter des einflussreichen, auch politisch aktiven Basler Physikprofessors Eduard Hagenbach-Bischoff.2778 Diese Verbindung weist ebenso wie seine Begeisterung für den Schweizer Alpen-Club2779 auf seine Zugehörigkeit zum engeren Kreis der lokal dominierenden wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Elite hin. Seine Leidenschaft für die Musik erleichterte zusätzlich die Integration in die Basler Gesellschaft.2780 1912 trat er die Nachfolge des herausragenden Farbstoff-
2775
2776
2777 2778 2779 2780
Chemischen Gesellschaft und aus dem Team der Redakteure des ‚Beilstein‘ (Handbuch der Organischen Chemie), ebd., 470–472. Die Gesellschaft entschied, bei den deutschen Juden sei das «Verschwinden» aus der Gesellschaft «anzustreben», ebd., 474. Der Generalsekretär der DChG, Rudolf Weidenhagen, erstellte eine Liste «der neutralausländischen Professoren […], die Mitglieder unserer Gesellschaft sind», und ersuchte die Vorstandsmitglieder, ihnen persönlich bekannten Professoren aus dieser Liste Publikationen des Gaupropagandaamtes Berlin in neutralen Umschlägen zuzustellen (Schreiben vom 15. 11. 1939, zitiert nach: Maier 2015, 504). Die Basler Vertreter der Chemie und Pharmazie fehlten in dieser Liste ganz. Ich danke der Gesellschaft Deutscher Chemiker Frankfurt a. M. (Frau Christane Dörr) für die Übermittlung einer Kopie des Dokuments (E-Mail, 12. 2. 2018). Bächi 2007, Bibliographie. Nachlass Reichstein, StABS PA 979a, L 1-1 1, Diverse Publikationen 1934–1941. Ausser in den «Helvetica Chimica Acta», der «Schweiz. Apothekerzeitung» und in «Nature» publizierte er in: «Archives internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie» (Belgien/Holland). In Deutschland erschienen von ihm nur Beiträge im Sammelband Ergebnisse der Vitamin- und Hormonforschung, hg. von Edward Mellanby und Leopold Ru⌅i⇥ka, die von der Akademischen Verlagsgesellschaft Leipzig 1936–1938 publiziert wurden (Mitarbeit auf Einladung durch Ru⌅i⇥ka vom 19. 11. 1936); ferner Beiträge zum Abderhaldenschen Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden mit dem Titel: «Die Hormone der Nebennierenrinde», im Verlag Urban & Schwarzenberg, Berlin und Wien (Honorarzusprache vom 18. 11. 1938). StABS Nachlass Reichstein, PA 979a F 2-1 2, American Chemical Society Washington 1939–1961. Zu Hagenbach-Bischoff: Simon 2011; Huber 2011. Suter-Christoffel 1951. Anonym 1951.
652
Die Naturwissenschaftler
chemikers Rudolf Nietzki2781 auf dem Basler Lehrstuhl für Organische Chemie an. Als Mitredaktor der «Helvetica Chimica Acta» war er eine respektierte Persönlichkeit seines Faches. Entsprechend seiner Generationszugehörigkeit pflegte er enge Beziehungen zur deutschen Wissenschaft, was sich 1932 auch in seiner Aufnahme in die Akademie Leopoldina niederschlug.2782 1937 wurde er emeritiert. Unter Rupe arbeitete seit 1919 Paul Ruggli als Leiter des von der Firma Sandoz gestifteten Färberei- und Textildrucklaboratoriums der Universität. Der Schüler ausgezeichneter Chemiker wie Richard Willstätter (damals Zürich, Nobelpreis 1915)2783 und Johannes Thiele (Strassburg)2784 erhielt in Basel 1922 den Extraordinarientitel und 1935 eine Professur ad personam. In einer typischen Hausberufung wurde Ruggli 1936/37 zum Nachfolger seines Chefs Rupe gewählt und lehrte bis zu seinem Tod 1945 die Organische Chemie mit den Schwerpunkten ‚synthetische Farbstoffe‘ und ‚substantive Färbung‘. In diesem Verfahren setzte die Fakultät im Juni 1937 Tadeus Reichstein auf Platz drei mit der Bemerkung, er trage «die Prägung der Meisterschaft, eines weitblickenden Forschers». Weshalb Ruggli den ersten Platz erhielt, wurde nicht explizit begründet. Vermutlich wollte die Fakultät von Anfang an den Farbstoffspezialisten zum Ordinarius befördern.2785 Ruggli galt als ausgewiesener Fachmann der Färbereichemie und konnte als kluger Experimentator, Kenner der Azofarbstoffe und Erforscher der heterozyklischen Verbindungen für die Basler chemische Industrie gut qualifizierte Farbenchemiker heranbilden, wirkte aber als Dozent wenig inspirierend, wenn man ihn mit internationalen Grössen verglich. Er war breit vernetzt, orientierte sich nach England, wo er 1931 im Rahmen des Professorenaustausches in Oxford weilte, und war an internationalen Kongressen der Chemiker-Koloristen präsent. Seine pianistische Begabung verschaffte ihm zudem innerhalb der städtischen Gesellschaft Ansehen.2786 Erst nach Kriegsende wurde der Lehrstuhl für Organische Chemie verdoppelt. Für die Farbstoffsparte (und damit als eigentlichen Nachfolger des verstorbenen Ruggli) wurde der aus politischen Gründen in Bonn 1938 entlassene und 2781 2782 2783 2784 2785
2786
Kurz 2010. Wichers 2010; Prijs 1983d. Hansen 2014. https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Thiele_(Chemiker). Philosophische Fakultät (Dekan Zickendraht) an Kuratel, 25. 6. 1937: Vorschläge für die Besetzung des Lehrstuhls für Organische Chemie, in: StABS Erziehung CC 23. Die Sachverständigenkommission der Kuratel bestand aus: Carl Miville Präsident, Dr. Emil Barell, Dr. Gadient Engi, Prof. Fritz Fichter, Dr. Hartmann Koechlin, Dr. W. Meile-Welti, Prof. Hans Rupe, Prof. Arthur Stoll, Prof. Hans Zickendraht Dekan. Kuratelspräsident Ernst Thalmann und Sekretär Fritz Wenk an diverse Herren, 30. 4. 1937. Die chemische Industrie war hier wie auch in den anderen Kommissionen für die Besetzung chemischer Lehrstühle durch führende Persönlichkeiten von Roche, Ciba, Geigy und Sandoz vertreten. Wichers 2010; Tamm 2005a; Prijs 1983; Rupe 1945; Rupe 1946, mit Publikationsliste.
Chemie und Pharmazie
653
an der Universität Zürich bei Paul Karrer wirkende Robert (Karl) Wizinger (Extraordinarius in Zürich 1943) gewonnen,2787 und für die immer mehr im Vordergrund stehende Chemie der biologisch wirksamen Substanzen übernahm Tadeus Reichstein 1948 vertretungsweise zunächst zusätzlich zur Pharmazie den zweiten Lehrstuhl für Organischen Chemie, auf den er dann 1952 definitiv wechselte. Beide erhielten eigene Gebäude, aber der Unterschied in der Gewichtung zeigte sich schon darin, dass Wizinger 1948 ein bestehendes, vergleichsweise bescheidenes Institut an der Sankt-Johann-Vorstadt bezog, worin vor dem Krieg ein kleiner Pharmabetrieb Opiate hergestellt hatte,2788 während Reichstein, Nobelpreisträger von 1950, einen grosszügigen Neubau erhielt (eröffnet 1953), der auf seine eigenen wissenschaftlichen Anforderungen zugeschnitten war.2789 8.4.4 Physikalische Chemie Die Physikalische Chemie vertrat in Basel August Leonhard Bernoulli. Bis 1912 hatte er die ersten Schritte der Karriere, die bei Wilhelm Conrad Röntgen begonnen hatte, in Deutschland absolviert. In diesem Jahr holte ihn seine Vaterstadt auf die Kahlbaumsche2790 Professur für Physikalische Chemie zurück; 1919 wurde er zum Ordinarius befördert. Im 1926 bezogenen neuen Institut für Physik erhielt er einen eigenen Trakt für sein Fach.2791 Seine vielseitige Tätigkeit war für die Chemiker besonders wegen der reaktionskinetischen Studien interessant.2792 Nachdem er in finanzielle Schwierigkeiten geraten war, schied er im Februar 1939 aus dem Leben.2793 Ein idealer Kandidat für seine Nachfolge wurde rasch gefunden: Der Schweizer Werner Kuhn2794 wirkte als international bekannter Physikalischer Chemiker an der Universität Kiel, die inzwischen zu einer exemplarischen natio-
2787
2788 2789 2790
2791 2792 2793 2794
Maier 2015, 270. Wizinger war PD in Bonn gewesen, wo er 1934 eine Professur erhielt. Prijs 1983a. Wizinger galt den Nationalsozialisten als «weltanschaulich nicht mehr tragbar», weil Katholik («ultramontan»). Deichmann 2001, 135. König 2016, 124; Kreis 2016, 300. Das bemerkenswerte Gebäude wurde 2016 zum Abriss freigegeben. Rudin 2016. Die Physikalische Chemie wurde in Basel durch Georg Kahlbaum eingeführt, der seine Tätigkeit weitgehend selbst finanzierte. Nach seinem Tod garantierte eine nach ihm benannte Stiftung die Weiterexistenz des Faches. Tamm 2006; Prijs 1983e. «Die Physikalische Chemie erhält ein eigenes Institut», Prijs 1983b. Hagenbach 1940, 413 f. Akten zur Abwicklung der von Bernoulli angehäuften Schulden in: StABS Erziehung CC 23, März und April 1939. Kuhn 1984; Prijs 1982 f; Thürkauf 1965.
654
Die Naturwissenschaftler
nalsozialistischen Hochschule geworden war.2795 Kuhn hatte die ETH besucht und von 1924 bis 1926 mit einem Rockefeller-Stipendium in Kopenhagen mit Niels Bohr zusammengearbeitet. Dort heiratete er eine Dänin. Nach der Habilitation an der Universität Zürich wirkte er in Heidelberg bei Karl Freudenberg, unterbrochen durch Aufenthalte bei Ernest Rutherford in Cambridge. 1930 bis 1936 war Kuhn Extraordinarius und Abteilungsleiter an der Technischen Hochschule Karlsruhe. Dort befasste er sich vor allem mit Makromolekülen, einem Thema, das nach der Veröffentlichung der Theorien von Hermann Staudinger kontrovers behandelt wurde.2796 1936 erhielt er das Ordinariat in Kiel, wo er über Isotopentrennung forschte. Mit der nationalsozialistischen Führung der Universität Kiel war er unzufrieden; vielleicht sah er auch, dass das ‚Dritte Reich‘ auf einen Krieg zusteuerte. Die Anzahl Studierender nahm in Kiel laufend ab, und die Universität wäre geschlossen worden, hätte nicht die Medizinische Fakultät eine Bedeutung als Ausbildungsstätte behalten.2797 Nach 1937 versuchte er, von Kiel wegzukommen.2798 «Werner Kuhn litt in diesen Jahren sehr unter dem politischen Druck und half, wo er konnte, seinen vom Nationalsozialismus bedrängten Bekannten. Als Ausländer und Nichtmitglied der Partei wurde es für ihn sehr schwierig. Es war deshalb für ihn und seine Frau eine Befreiung, als er 1939 einem Ruf auf das Ordinariat für Physikalische Chemie der Universität Basel folgen konnte.»2799 Leider erlaubt das im (wissenschaftlichen) Nachlass erhaltene Material nicht, diese Aussage zu konkretisieren. Kuhn gab sich in Deutschland als zuverlässiger Beamter des nationalsozialistisch geführten Staates, unterschrieb offizielle Briefe innerhalb des Reichs wie üblich mit «Heil Hitler!» und war schweizerisch-deutscher Doppelbürger, der, wie ihn das schweizerische Konsulat in Hamburg informierte, im 2795
2796
2797 2798 2799
Geschichte der Universität Kiel im Nationalsozialismus: Cornelißen/Mish 2009, allerdings ohne Informationen zur Physikalischen Chemie. Auch die von Prahl 1995/2007 herausgegebenen Bände erwähnen weder das Fach noch Kuhn. Werner Kuhn war der Ansicht, «dass die von Staudinger vertretene Vorstellung, dass Moleküle wie Kautschuk oder Zellulose in Lösung langgestreckte starre Fäden seien, durch die von Staudinger selbst veröffentlichten Experimente ausgeschlossen würden. Das musste zu Schwierigkeiten führen, die noch Jahre später beim 60. Geburtstag von Staudinger ihren dichterischen Ausdruck (‚die Kuhn’schen Knäuel sind uns hier ein Greuel‘) fanden.» Kuhn 1984, 209. Die Zahl der Studierenden sank von 2763 im Winter 1932/33 auf 784 im Sommersemester 1939, als Kuhn die Universität verliess. Prahl 1995, 38 f. Deichmann 2001, 135, unter Hinweis auf Morris 1986. Kuhn 1984, 207. Ähnlich Prijs 1982 f: «Hier [in Kiel] half er nach Möglichkeit seinen aus rassischen und politischen Gründen verfolgten Bekannten», und Thürkauf 1965, 190: «Werner Kuhn hat während der Zeit, da er an deutschen Hochschulen wirkte, den vom Nationalsozialismus und den Nürnberger Gesetzen bedrohten Kollegen in seiner stillen, aber bestimmten Art viel geholfen. Seine vornehme Zurückhaltung hat kaum jemanden etwas davon erfahren lassen.»
Chemie und Pharmazie
655
Kriegsfall bei einem Aufenthalt auf Reichsboden ein Aufgebot der Wehrmacht erhalten könnte.2800 Anscheinend versuchte er, in Deutschland nicht aufzufallen, um sich seine dortige Stellung nicht beeinträchtigen zu lassen, während er sich im Verkehr mit Bekannten und Freunden von nationalsozialistischen Doktrinen unbeeinflusst zeigte. Im Mai 1933 (d. h. nach den von den Nationalsozialisten gewonnen ‚Wahlen‘ vom März 1933 und dem ‚Judenboykott‘ vom 1. April 1933) wurde er in Karlsruhe denunziert und seine Vorlesung boykottiert. Nun liess er sich vom «Obmann» der Nationalsozialistischen Betriebsorganisation der Technischen Hochschule bescheinigen, dass er zuverlässig zur «nationalen Regierung» stehe. Kuhn war beschuldigt worden, ein Freund der Juden zu sein, denn er war vom jüdischen Vorsteher des Instituts, Georg Bredig (der auf Herbst 1933 entlassen wurde)2801 1929 nach Karlsruhe geholt worden, und die überwiegende Mehrzahl seiner Mitarbeiter waren Juden, von denen ihn mindestens mit Rudolf Bloch2802 eine Freundschaft verband. Auch habe er die Regierung Hitler wegen den judenfeindlichen Massnahmen kritisiert; er wollte das Plakat «Wider den undeutschen Geist» im Institut entfernen, weil sich Bredig darüber aufregte. Er arbeite in Deutschland nur des Geldes wegen, nicht weil er «das deutsche Wesen» schätzte, wurde ihm vorgeworfen. Als die Strassen an Hitlers Geburtstag beflaggt waren, habe er seiner dänischen Frau gesagt, dies geschehe wegen irgendeines Feuerwehrfestes. Er habe versucht, einem jüdischen Studenten illegal in der Schweiz zu einer Stelle zu verhelfen2803 und unterhalte Beziehungen zu Marxisten. Schliesslich soll er gesagt haben, wenn man wüsste, wie er wirklich denke, befände er sich schon längst auf dem Heuberg – dort war das erste badische Konzentrationslager eingerichtet worden.2804 Kuhn wollte offensichtlich seine Stelle als Abteilungsleiter behalten. In seinem Bekenntnis zur «nationalen Regierung» Adolf Hitlers stand, man müsse ihr 2800
2801
2802 2803
2804
Schweizerisches Konsulat Hamburg, Dr. Henri Dumont, an Kuhn, 2. 7. 1937, in: Nachlass Werner Kuhn, NL 298, A III 27,4. Soweit nicht anders nachgewiesen, stammen alle Informationen aus: Nachlass Werner Kuhn, NL 298. Entlassungen in Karlsruhe: Seidl 2009. Bredig war in der Weimarer Zeit für seine liberale und pazifistische Einstellung bekannt; auch kritisierte er die Nationalsozialisten. Kuhn widmete Bredig eine (späte) Würdigung: Kuhn 1962. Siehe auch: Nationalsozialismus in Karlsruhe (ns in ka), https://ns-in-ka.de/personen/bredig-prof-georg/. Bloch rettete sich vorerst 1935 zu Aussig, später nach Palästina. Nachlass Werner Kuhn, Korrespondenz mit Rudolf Bloch, A II 30. Kuhn rechtfertigte seine Bemühungen um den Studenten Lehmann gegenüber dem Schweizer Konsul in Mannheim so: «Es kann natürlich keine Rede davon sein, dass die Schweiz alle Juden aufnimmt, die zur Zeit gerne Deutschland verlassen würden; andererseits hatte ich doch gegen einen mehrjährigen Mitarbeiter [Lehmann] gewisse Verpflichtungen.» Kienle 1998.
656
Die Naturwissenschaftler
dafür dankbar sein, dass sie «ein kommunistisches Chaos» verhindere. Antisemitische Massnahmen seien teilweise berechtigt, da die Juden unter sich ‚Seilschaften‘ bilden würden,2805 und wenn er sich gelegentlich kritisch über Exzesse geäussert habe, so nur deshalb, weil er vermeiden wollte, dass das Regime im Ausland einen schlechten Eindruck mache. Die jüdischen Mitarbeiter habe er nicht «gesucht», sondern er habe sie als reguläre Studierende, die alle Bedingungen erfüllten, nicht abweisen können. Auch habe er die deutsche Wirtschaft seit seiner Ernennung in Karlsruhe 1929 dadurch unterstützt, dass er Gegenstände des persönlichen Bedarfs immer in Deutschland, nicht in der Schweiz eingekauft habe.2806 Gegen den Denunzianten2807 wollte er mit Unterstützung eines Heidelberger Anwalts vorgehen und suchte Rat beim schweizerischen Honorarkonsul in Mannheim, Max A. Kunz, dem wir weiter unten wieder begegnen werden.2808 Die Hochschule massregelte zwar den Denunzianten dadurch, dass sein Habilitationsverfahren hinausgeschoben wurde. Kuhn nahm aber an, die Denunziation
2805
2806
2807
2808
«[…] dass die Juden einen Teil der gegen sie ergriffenen Massnahmen selbst verschuldet haben, indem sie an vielen Stellen eine starke Protektionswirtschaft unter sich betrieben haben, welche abgeschafft werden müsste». Kuhns eigene Darstellung seiner Argumentation. Der Minister des Kultus, des Unterrichts und der Justiz, Abteilung Kultus und Unterricht, «Im Auftrag gez. Fehrle», betr. «Wiederherstellung des Berufsbeamtentums», Karlsruhe, 19. 7. 1933, «An den Senat der technischen Hochschule Karlsruhe. Im Hinblick auf die inzwischen getroffenen Feststellungen und die von a .o. Professor Dr. Werner Kuhn abgegebene Erklärung und Versicherung positiver Mitarbeit am Aufbau der nationalen Regierung kommen weitere Massnahmen gemäss § 4 des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 nicht in Betracht. Hiervon wolle dem Genannten Eröffnung gemacht werden.» In: Nachlass Werner Kuhn, NL 298, G 8a. «Diese Erhebungen ergeben, dass die Anschuldigungen durch gewisse Missverständnisse entstanden sind und die Einstellung des Herrn Professor Kuhn gegenüber der nationalen Regierung als einwandfrei zu bezeichnen ist.» Abschrift einer «Erklärung» des NSBO-Obmanns Dr. E. Gerisch, 26. 10. 1933, ebd. Günther Briegleb promovierte 1929 in Kiel, war dann Assistent in Karlsruhe, wurde dort 1936 habilitiert und gelangte nach Würzburg, wo er bis 1945 Extraordinarius war. Bis 1951 durfte er nur in der Privatindustrie wirken. Kurzbiographie und Publikationen von Briegleb, Universität Hamburg, https://www.chemie.uni-hamburg.de/institute/pc/publika tionen/db/briegleb.html. Kuhn an Direktor Dr. Kunz, Konsul, Schweiz. Konsulat, Mannheim, vertraulich, 6. 7. 1933, in: Nachlass Werner Kuhn, NL 298, G 8a. Dr. Max A. Kunz war Direktor bei IG Farben Ludwigshafen und von 1926 bis 1939 Schweizerischer Honorarkonsul in Mannheim, Spezialist für Küpenfarbstoffe, während des Krieges in der Schweiz Stellvertreter des Chefs der Sektion Chemie und Pharmazeutika im Kriegs-, Industrie- und Arbeitsamt. https://www.swissinfo.ch/ger/historisches-tondokument_konsul-max-kunz-ueber-die-aus landschweizer-jugend/42291892; http://dodis.ch/P20430.
Chemie und Pharmazie
657
habe seine Aussichten zerstört, Nachfolger von Bredig zu werden.2809 1934 wurde der fachlich durchaus kompetente (Johannes) Ludwig Ebert Nachfolger des entlassenen Bredig; derselbe Ebert wurde 1940 auf den durch die Vertreibung von Hermann F. Mark 1938 freigewordenen Wiener Lehrstuhl (siehe unten) versetzt, auf den sich auch Kuhn Hoffnungen gemacht hatte.2810 Den Wechsel auf das Ordinariat in Kiel (1936) fasste Kuhn als Erfüllung eines «Auftrags»2811 auf (das Ministerium hatte ihn dorthin versetzt), während seine Freunde und Bekannten in gewohnter akademischer Manier von «Ruf» oder «Berufung» schrieben. Empfohlen hatte ihn Ludwig Ebert mit rein fachlichen Argumenten, aus denen eine Hochachtung vor Kuhns Leistungen sprach, aber auch mit dem vielleicht nur taktisch gemeinten Schlusssatz: «Kuhn lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Seine Frau ist Dänin. Beide gehören zu den wenigen Ausländern, die ein wirklich nahes Verhältnis und eine durchaus bejahende Einstellung zu deutscher Kultur und deutschem Leben gewonnen haben.» Von einer Begeisterung für die «Regierung» oder für Hitler ist hier jedoch auch nicht andeutungsweise die Rede.2812 Von Kiel aus begann Kuhn nach Alternativen zu suchen. Eine Sondierung aus Leipzig2813 lehnte er ab. 1938 glaubte er, auf drei Stellen Aussicht zu haben. In Bern war Volkmar Kohlschütter2814 verstorben, der dort die Anorganische Chemie vertreten hatte.2815 An der ETH Zürich wollte er unterkommen, ohne ein Ordinariat anzustreben. Für die Optimierung seiner Chancen setzte er sich mit dem Sekretär des Auslandschweizerwerks der Neuen Helvetischen Gesellschaft in Verbindung,2816 der sich beim Berner Erziehungsdirektor und beim Präsidenten des Schweizerischen Schulrats, Arthur Rohn, der die ETH führte, für Kuhn verwendete. Der einflussreiche Zürcher ETH-Physiker Paul Scherrer wurde von Kuhn in seine Schweizer Stellensuche einbezogen; dieser sprach auch mit Gadient Engi, Direktor der Ciba, um abzuklären, ob es in der Industrie eine Stelle für ihn ge-
2809 2810 2811 2812
2813 2814 2815
2816
Alle Informationen, soweit nicht anders bezeichnet, aus: Nachlass Werner Kuhn NL 298, G 8a. Nach Maier 2015, schrieb Ebert 1946, nie Parteigenosse gewesen zu sein. Konopik 1959. Lebenslauf, Kiel 1938, in: Nachlass Werner Kuhn NL 298, G 13. Gutachten von Ludwig Ebert über Kuhn für die Professur in Kiel, Karlsruhe, 25. 5. 1936, Abschrift, in: UA Kiel (= Landesarchiv Schleswig-Holstein, Abt. 47), 1590, Akten betr. Anträge auf Errichtung neuer Professuren/Wiederbesetzung von Professuren, März–August 1936, Titel III, Abschnitt A, Nr. 5, Bd. IV, 257. Karl Friedrich Bonhoeffer an Kuhn, 15. 1. 1937, und ablehnende Antwort Kuhns vom 19. 1. 1937; in: Nachlass Werner Kuhn NL 298, A II 80, 2, 4. Giovanoli 2007. «Es liegt klar, dass ich für die Übernahme dieses Instituts zuständig wäre.» Kuhn an Dr. W. Imhoof, Auslandschweizerwerk Bern, 20. 9. 1938, in: Nachlass Werner Kuhn NL 298, A III 11, 2. Kontakte von September bis November 1938, in: Nachlass Werner Kuhn NL 298, A III 11.
658
Die Naturwissenschaftler
be.2817 Die Interventionen wurden jedoch meist an untere Stellen weitergeleitet, wo sie auf Ablehnung trafen. Bei der Stellensuche in der Schweiz half Kuhns Bruder in Solothurn mit. Sein Vater, der pensionierte Pfarrer von Zumikon, versuchte insbesondere bei der ETH, seinen Einfluss geltend zu machen und den Sohn als Chemiker zu profilieren, der sich für praktische Anwendungen und Techniken interessiere.2818 Er erreichte damit immerhin, dass der Schulratspräsident Arthur Rohn Werner Kuhn einmal empfing.2819 Im Herbst 1932 hatte Hermann F. Mark in Anbetracht der kommenden nationalsozialistischen Herrschaft seine Stelle bei der I.G. Farbenindustrie in Deutschland verlassen und seither als Ordinarius das Erste Chemische Institut der Universität Wien geleitet, das dank seinen Verbindungen zum früheren Arbeitgeber und zu österreichischen Unternehmern stark ausgebaut wurde. Er konnte eine Gruppe junger Chemiker beschäftigen, die als Juden in Wien marginalisiert waren und sich besonders für neue Richtungen in der Wissenschaft interessierten.2820 Dass dies in der antisemitischen Wiener Atmosphäre2821 möglich war, verdankte Mark seinem älteren Kollegen am benachbarten Zweiten Chemischen Institut,2822 Ernst Späth.2823 Als Österreich 1938 an das ‚Dritte Reich‘ angeschlossen wurde, floh Mark über die Schweiz und Grossbritannien nach Kanada. Dadurch wurde die Wiener Professur frei. Späth fragte Kuhn im Auftrag der neuen Herren in Wien an, ob er Marks Nachfolge antreten möchte. Kuhn sagte zu, lieferte Antworten auf Fragen über seine Person und Parteizugehörigkeit2824 und wurde mit Zustimmung des Vertreters des NS-Dozentenbunds von den Wiener Stellen zusammen mit dem Deutschen Carl Wilhelm Wagner (Mitglied der SA 2817
2818
2819
2820 2821 2822 2823 2824
Korrespondenz zwischen 26. 7. 1938 und 19. 11. 1938, in: Nachlass Werner Kuhn NL 298, Korrespondenz mit Paul Scherrer, A II 135. Scherrer wusste von Kuhns Kandidatur in Wien und in Bern. Kuhn an seinen Vater Gottfried Kuhn, 18. 4. 1938, Darstellung seines praxisorientierten Profils zur Verwendung im Kontakt mit der ETH resp. dem Schulrat, in: Nachlass Werner Kuhn NL 298, Korrespondenz mit dem Vater, A II 75, 1. Einladung zu «der von Ihnen gewünschten Besprechung» auf 15. 7. 1938, Arthur Rohn an Kuhn, 11. 7. 1938, in: Nachlass Werner Kuhn NL 298, A II 133, 1. Die Absage folgte sogleich: Rohn an Kuhn, p. adr. Herrn a.Pfarrer Dr. Gottfried Kuhn, Zumikon, 18. 7. 1938, ebd., A II 133, 2. Rolle marginalisierter Juden in der Forschungsgruppe Marks: Feichtinger 2017. Ich danke Johannes Feichtinger für seine wertvollen Hinweise. Antisemitismus an der Wiener Universität: Bauer 2016; Taschwer 2016, 240, insbes. Mark und Ernst Späth. Deichmann 2001, 182 f.; Priesner 1980, 77. Soukup 2005. Korrespondenz mit E. Späth, 18. 7. 1938 bis 31. 10. 1938, in: Nachlass Werner Kuhn NL 298, A II 115. Kuhn erklärte, er sei «Mitglied von NS-Volkswohlfahrt und Reichsluftschutzbund. In bin Schweizer Staatsangehöriger und als Beamter gleichzeitig deutscher Staatsangehöriger».
Chemie und Pharmazie
659
seit 1933) primo et pari loco dem Reichsministerium in Berlin vorgeschlagen. Dieses verhandelte lange und erfolglos mit Wagner, aber nicht mit Kuhn.2825 Erst zwei Jahre später wurde die Wiener Nachfolge geregelt und Ebert aus Karlsruhe gewählt. Während die Entscheide in Bern und in Wien hängig waren, boten zwei Basler Physikprofessoren Kuhn informell die Nachfolge von August L. Bernoulli an (Gesprächseinladung vom 23. Februar 1939).2826 Die Kandidatur wurde dann dem Präsidenten der Sachverständigenkommission der Kuratel, dem Geriater Adolf Lukas Vischer-von Bonstetten,2827 vorgelegt.2828 Dieser sorgte zusammen mit dem Basler Erziehungsdirektor Fritz Hauser dafür, dass Kuhn sehr rasch die Stelle zugesprochen erhielt. Die Nachfolge Bernoullis in Basel war für ihn die geeignete Position, und für Basel war er der geeignete Physikalische Chemiker von internationalem Ansehen und mit einer aktuellen Agenda (neben Polymeren u. a. die Isotopentrennung, die für die Atomforschung wichtig war). Die Wahl vollzog sich problemlos, nachdem sich Kuhn dem Basler Publikum am 16. März 1939 mit einem Vortrag vor der Chemischen Gesellschaft vorgestellt hatte. «Prof. Kuhn wirkt in seinem Auftreten sehr sympathisch. Trotz seiner langjährigen Landesabwesenheit ist er in seinem ganzen Wesen ein einfacher Schweizer geblieben.» Am 29. März 1939 kam Kuhn zu Verhandlungen mit dem Basler Erziehungsdepartement nach Bern (vermutlich weil der Basler Erziehungsdirektor Fritz Hauser sich in Bern als Nationalrat aufhielt). Am 25. April 1939 teilte Kuhn mit, dass ihn das Reichsministerium sofort ziehen lasse und dass alle Steuer- und Devisenfragen in Deutschland geregelt seien. Dabei betonte er, wie freundlich ihn die deutschen Stellen behandelt hätten.2829 Dies und das Fehlen einer Personalak-
2825 2826
2827 2828
2829
Akten Nachfolge Mark, in: Archiv der Universität Wien, PH S 34.39: Dekanat der Philosophischen Fakultät, 1937/38 ff., 995. Max Wehrli, Physikalische Anstalt der Universität Basel, an Kuhn, 23. 2. 1939, in: Nachlass Werner Kuhn NL 298, A III 56, 1. An der Besprechung solle auch der Ordinarius, Physikprofessor August Hagenbach (Institutsvorsteher seit 1906) teilnehmen. Die Basler Chemiker waren zunächst nicht involviert. Bonjour 1974. Erster erhaltener Brief von Vischer an Kuhn 23. 2. 1939, in: Nachlass Werner Kuhn NL 298, A III 55, 1. Kuhn werde an erster Stelle für die Nachfolge Bernoulli genannt. Vischer wusste, dass Bern Anstrengungen unternahm, Kuhn als Nachfolger für Kohlschütter zu gewinnen. Bericht der Sachverständigen an die Kuratel wegen Nachfolge Bernoulli, 17. 3. 1939, in: StABS Erziehung CC 23. Mitglieder der Kommission waren Emil Barell (Roche), Gadient Engi (Ciba), Fritz Fichter (abtretender Ordinarius für Anorganische Chemie), Fritz Hagemann (Advokat, Verleger der «National-Zeitung»), August Hagenbach (Professor für Physik), Hartmann Koechlin (Geigy), Tadeus Reichstein (Professor für Pharmazie), Paul Ruggli (Professor für Organische Chemie), Arthur Stoll (Sandoz), Adolf Lukas Vischer als Präsident. Diese Kommission trat am 19. 1. 1939 zum ersten Mal zusammen. Erkundi-
660
Die Naturwissenschaftler
te im Universitätsarchiv Kiel lässt sich zum reibungslosen Weggang des Romanisten Walther von Wartburg aus Leipzig im selben Jahr in Parallele setzen.2830 Die deutsche Hochschulpolitik war damals offenbar nicht daran interessiert, ausländische Professoren am Wegzug zu hindern. Am 28. April 1939 war Kuhn durch den Regierungsrat gewählt, und ab 1. Mai 1939 wirkte er bereits in Basel, wo er blieb: 1942 lehnte er einen Ruf nach Zürich ab.2831 8.4.5 Anorganische Chemie Inzwischen erreichte der Vertreter der Anorganischen Chemie, Fritz Fichter, mit siebzig Jahren das Pensionierungsalter. Der Sohn eines Basler Seidenbandfabrikanten hatte in Strassburg Chemie studiert und ab 1896 in Basel die akademische Laufbahn beschritten. 1904 heiratete er eine Tochter des Historikers August Christoph Bernoulli, des Vaters des Physikalischen Chemikers August Leonhard Bernoulli. Nach der 1897 mit Unterstützung von Jules Piccard in Basel erfolgten Habilitation wurde er zunächst Extraordinarius. Seit 1911 war er Ordinarius für Anorganische Chemie, von 1918 bis 1948 redigierte er die von ihm mitbegründeten «Helvetica Chimica Acta». Nach anorganisch-präparativen Arbeiten spezialisierte er sich auf Arbeiten über die Elektrochemie, die mit zahlreichen Ehrungen bedacht wurden.2832 Wie damals üblich wirkte Fichter in der Fakultäts- und in der Kuratelskommission an der Suche nach seinem Nachfolger mit. Im Einklang mit der Fakultät, aber gegen die Präferenzen der Kuratel, optierte er für eine schweizerische Lösung und war der Ansicht, dass sein als Privatdozent und Extraordinarius bewährter Assistent Hans Erlenmeyer2833 zu seinem Nachfolger berufen werden müsse. Dies wäre eine Hausberufung in Analogie zur Nachfolge von Rupe geworden, die Ruggli kurz zuvor angetreten hatte. Erlenmeyer war in seiner Jugend
2830 2831 2832 2833
gungen über Kuhn wurden eingezogen bei Alfred Gigon, Rudolf Staehelin und Alexander von Muralt. Vgl. die Ausführungen zu Walther von Wartburg, oben Kapitel 7.2.4.5.9 f. Leopold Ru⌅i⇥ka an Kuhn, 2. 6. 1942, in: Nachlass Werner Kuhn NL 298, A II 103, 1. StABS UNI-REG 5d 2-1 (1) 176. Tamm 2005; Erlenmeyer 1961. Erlenmeyer 1953, mit Publikationsverzeichnis. Prijs 1983c; Schüpbach-Guggenbühl 2004 (Ich danke Samuel Schüpbach für ergänzende Angaben); Bloch 1969.
Chemie und Pharmazie
661
Sportler gewesen,2834 verfolgte äusserst vielseitige Interessen2835 und betreute seine Studenten besonders eingehend. Mit der Basler chemischen Industrie verbanden ihn verschiedene Kontakte. Daneben interessierte er sich für Philosophie und Kulturgeschichte und war mit dem Basler Kreis um den Dichter Karl Wolfskehl und andere von Stefan George geprägte Persönlichkeiten verbunden. Er war zu einer Zeit im Elsass geboren worden, als dieses als ‚Reichsland‘ zu Deutschland gehörte. Deshalb besass er die deutsche Staatsbürgerschaft. Aus Abneigung gegen den Nationalsozialismus beantragte er am 3. März 1933 die Aufnahme ins Basler Bürgerrecht, die ihm 1934 gewährt wurde. Die Fakultät würdigte in ihrem Gutachten vom 10. Februar 1939 für Fichters Nachfolge2836 nur schweizerische Chemiker ernsthaft und empfahl unter diesen in erster Linie Hans Erlenmeyer zur Wahl; in zweiter Linie ex aequo einerseits Robert Flatt (jr.), Privatdozent an der Universität Basel und Lehrer an der École supérieure de Chimie Mulhouse, Analytischer Chemiker, spezialisiert auf Uranverbindungen, Schüler von Treadwell in Zürich. Andererseits setzte sie ebenfalls auf den zweiten Platz Hermann Mohler, Schüler von August L. Bernoulli, Zürcher Stadtchemiker, 1936/37 habilitiert in Basel (später Professor in Zürich), der damals über chemische Kampfstoffe arbeitete, und schliesslich Gerold Schwarzenbach, der damals das Praktikum bei Paul Karrer an der Universität Zürich leitete und mit einem Rockefeller-Stipendium in den USA gewesen war.2837 Unter den Schweizern im Ausland nannte die Fakultät nur Werner Kuhn: «Er hat den sehnlichen Wunsch, nach der Schweiz zurückzukehren». Er sei aber Physikochemiker und komme deshalb für die Anorganische Chemie nicht in Betracht. Ferner zählte die Fakultät eine Reihe von Ausländern auf, ohne sie ernsthaft in Erwägung zu ziehen, darunter nur einen Flüchtling, Fritz Feigl in Brüssel, der früher in Wien gewirkt hatte. Der Kuratel gab die Fakultät zu bedenken, dass der Schwerpunkt der Forschung in den angelsächsischen Ländern liege – es war das erste Mal, dass nicht grundsätzlich nur auf deutsche Fachleute verwiesen wurde. Der Unterricht sei jedoch in Basel in deutscher Sprache zu halten, so dass die Angelsachsen nicht infrage kämen. «Auf die möglichen politischen Schwierigkeiten, welche bei Berufung von Ausländern auftreten können, 2834
2835
2836 2837
«Mächtiger Boxer, keiner tats ihm gleich / gefürchtet in Helvetien und deutschem Reich / Knapp konnt er sich vom Berufssport trennen / als die Manager ihm nachtun stellen / Sichrer Schütze, nie verfehlend Ziel und Beute / grosser Helfer für bedrängte Leute / Mächtger Lehrer, Stuf und Stuf erklimmend /» etc. Beitrag von A. Marxer (Ciba-Mitarbeiter), in: Festschrift 1960, Universitätsbibliothek Basel, Handschriften, Mscr. L IV 13. Zu diesen Interessen gehörten auch Themen aus der Biochemie; seine Zusammenarbeit mit dem Pharmazeutischen Chemiker Hermann O. L. Fischer und den Physiologen Verzár wurde explizit erwähnt. Anonym 1941. Philosophisch Naturwissenschaftliche Fakultät Gutachten, 10. 2. 1939, in: StABS Erziehung CC 23. Hansen 2012.
662
Die Naturwissenschaftler
brauchen wir die hohen Behörden nicht aufmerksam zu machen», schrieb die Fakultät in ihrem Gutachten.2838 Die Mitglieder der Sachverständigenkommission der Kuratel waren damit nicht einverstanden. Deren Präsident, Adolf Lukas Vischer, hörte sich den aussichtsreichsten externen Schweizer Kandidaten, Gerold Schwarzenbach in Zürich, an und fand im Einklang mit Mitgliedern seiner Kommission, dass er nicht hinter Erlenmeyer zurückgestellt werden sollte.2839 Die Kommissionsmitglieder holten zudem umfassende Auskünfte bei bekannten internationalen Chemikern ein, aus denen sich ergab, dass die konsultierten Persönlichkeiten keinen Schweizer für besonders geeignet oder gar für herausragend hielten. Die Kommission erstellte daraus eine alternative Liste aus zehn Namen, die sie der Fakultät zur Kommentierung vorlegte. Die Fakultät bemerkte in dieser Liste zahlreiche «Emigranten» – anscheinend war sie grundsätzlich gegen diese eingestellt.2840 Sie bemerkte ausserdem, dass die meisten hier genannten Chemiker von ihr nicht als klassische Anorganiker identifizieren wurden. Denn die Fakultät hielt an der 1911 beim Rücktritt von Nietzki etablierten Facheinteilung in Organische Chemie (Ruggli und Reichstein), Anorganische Chemie (diese war zu besetzen) und Physikalische Chemie (Werner Kuhn) fest. Denkbar gewesen wären nach dem Urteil der Fakultät für Basel Anton Eduard van Arkel, Georg von Hevesy, Gustav Franz Hüttig und Fritz A. Paneth, unter denen van Arkel und von Hevesy hervorträten, aber eine Berufung von von Hevesy wäre ein Affront für Kuhn, da er auf verwandten Gebieten forsche. Die ausländischen Gutachten seien zudem von schlechter Qualität, da aus der Ferne geschrieben.2841 Die zweite Liste der Fakultät lautete folglich so: 1o loco Erlenmeyer, 2o loco Schwarzenbach, 3o loco Mohler. Erlenmeyer sei älter und habe mehr veröffentlicht als Schwarzenbach. In der Sachverständigenkommission überzeugten die Industriechemiker (Hartmann Koechlin von Geigy,2842 Emil Barell von Roche, Gadient Engi von Ci2838 2839 2840
2841
2842
Philosophisch Naturwissenschaftliche Fakultät, Gutachten, 10. 2. 1939, in: StABS Erziehung CC 23. Diese Einschätzung war berechtigt, vgl. Hansen 2012. Philosophisch Naturwissenschaftliche Fakultät, Zweites Gutachten [der Fakultät] über die Neubesetzung der Professur für Anorganische Chemie, 26. 4. 1939, in: StABS Erziehung CC 23. Fichter hatte in seiner Rektoratsrede 1933 (Fichter 1933) das Verhältnis zwischen Anorganischer und Organischer Chemie diskutiert und festgestellt, dass die Fächerteilung entlang dieser Grenze für die Forschung sinnlos sei, wohl aber für die Lehre eine praktische Notwendigkeit darstelle. Die Nachteile der Trennung müssten aufgehoben werden durch ein gutes persönliches Verhältnis zwischen den beiden Fachvertretern. Diese Position vertrat er nun offensichtlich in der Frage seiner Nachfolge. Gloor 1963; Fischer 1962. Hartmann Koechlin gehörte der Kuratel als reguläres Mitglied von 1941 bis 1962 an. Kreis 2016, 305.
Chemie und Pharmazie
663
ba, Arthur Stoll von Sandoz2843 ) den Präsidenten Vischer, dass die von der Fakultät verteidigte Facheinteilung durch die neueren Entwicklungen der Chemie obsolet geworden sei. Deshalb ging diese Kommission nicht auf das Argument der Fakultät ein, die Ausländerliste enthalte kaum einen ‚echten‘ Anorganiker. Auch die nicht weiter begründete Abneigung gegen «Emigranten» teilte dieses Gremium nicht. Es erwog erneut bekannte Namen wie Georg von Hevesy (ehemals Freiburg, dort ersetzt durch Walter Noddack), Fritz Paneth (ehemals Königsberg, dort ersetzt durch R. Schwarz), Franz Simon (ehemals TH Breslau, dort ersetzt durch R. Suhrmann)2844 und vor allem Hermann F. Mark.2845 Die Überlegungen der Schachverständigen lösten energische Interventionen für Erlenmeyer aus. Diese argumentierten nicht nur mit seiner Stellung in Lehre und Forschung, sondern auch mit seiner Persönlichkeit. Der Zoologe Adolf Portmann2846 erinnerte daran, dass Erlenmeyer aus Überzeugung zugunsten des Basler Bürgerrechts auf die deutsche Staatsbürgerschaft verzichtet habe. Er befasse sich auch mit kulturhistorischen Fragen. «Freie geistige Weite» und «wahrhaft demokratische Gesinnung» besitze Erlenmeyer, und die Persönlichkeit sei im Unterricht an einer kleinen Universität entscheidend.2847 Zuvor hatte Portmann dem Präsidenten der Sachverständigenkommission erklärt, «es erscheint mir angesichts der vielen geistigen Probleme, die heute dem Hochschullehrer ausser seinen Fachfragen entgegentreten, von grösstem Wert, dass die allgemeine geistige Orientierung eine weite sei und das zentrale Interesse am eigenen Fach durch geistige weitere Betätigung ergänzt werde».2848 Auch andere sahen in der Nachfolge Fichter eine ausgezeichnete Gelegenheit, einen echten Demokraten und kulturell hochstehenden Gebildeten unter die Basler Naturwissenschaftler zu berufen, der die ‚geistige Landesverteidigung‘ mittrug. So beschwor der Gerichtspräsident Hans Oettinger, den Erlenmeyer bereits bei seiner Einbürgerung 1933/34 als Referenz angegeben hatte, Fritz Hauser, Erlenmeyer zu berücksichtigen. Er […] ist jetzt als Basler ein leidenschaftlicher Demokrat, der weder im Stillen noch unter Menschen irgendwelche Konzessionen an totalitäre Weltanschauungen machte und macht […]. Er hat über sein Fachgebiet hinaus lebendige Interessen an ge-
2843 2844
2845 2846 2847 2848
Degen 2013; Dettwiler 2011. Deichmann 2001, 77, zu von Hevesy auch 120, 145 («einer der bedeutendsten Physikochemiker in Deutschland», er verliess Freiburg, bevor er dazu gezwungen wurde, und folgte 1935 einer Einladung von Niels Bohr nach Kopenhagen). Zu Paneth und Simon auch Deichmann 2001, 122. Simon wurde in England zu einem bedeutenden Tieftemperaturforscher, Berater von Churchill und als «Sir Francis» geadelt, ebd., 195. Biographie von Mark: Mark 1993. Zusammenfassend (zugleich Quelle für den englischen Wikipedia-Artikel): Ginsberg 2003. Wichers 2011. Vgl. auch das Kapitel über Portmann, unten. Portmann an Hauser, 13. 5. 1939, in: StABS Erziehung CC 23. Portmann an Vischer, 5. 3. 1939, in: StABS Erziehung CC 23. Vgl. auch Portmann 1967.
664
Die Naturwissenschaftler schichtlichen und kulturgeschichtlichen Vorgängen, an philosophischen Bestrebungen das Lebendige aus der Erfahrung heraus zu erfassen und zu deuten, und an psychologischen Bestrebungen die Wirklichkeiten des Einzelmenschen wahr zu schauen und daraus die nötigen Schlüsse zu ziehen.2849
Dies war eine Anspielung darauf, dass Erlenmeyer dem George-Kreis nahestand. Dies bestätigt die Korrespondenz von Wolfskehl, aber auch die Liste der Persönlichkeiten, die Erlenmeyer in seinem Einbürgerungsgesuch als Referenzen angegeben hatte. Neben dem Vorsteher des Anorganisch-chemischen Instituts, in dem er tätig war und der ihn in Basel habilitiert hatte, Fritz Fichter, und dem Leiter der pharmazeutischen Forschung bei Ciba, Max Hartmann-Stehelin, Mitglied der Kunstkommission der öffentlichen Kunstsammlung,2850 war die Nennung von Hans Oettinger-Burckhardt bemerkenswert. Dieser Jurist hatte während seines Studiums in Heidelberg durch seinen Vetter Friedrich Gundolf diejenigen kennengelernt, «die höchste geistige Schau gewonnen haben». Der «hochfliegende Geist», Dichter, Korrespondenzpartner von Wolfskehl und Gustav Radbruch sowie Verehrer Beethovens, musste dann aus materiellen Gründen 1915 in den Basler Staatsdienst eintreten.2851 1923 bis 1932 war er erster Staatsanwalt, dann Strafgerichtspräsident. Als Mitglied der radikaldemokratischen Partei war er «von einer hohen freiheitlichen und freisinnigen Weltanschauung».2852 Seine Frau Gertrud Burckhardt war wie diejenige von Erlenmeyer Künstlerin. Einen weiteren, den Künstlern nahestehenden Juristen gab Erlenmeyer als Referenz für seine Einbürgerung an, Fritz Jenny-Glaettli. Der Advokat war Sekretär des Schweizerischen Bühnenkünstlerverbandes sowie des Schweizerischen Chorsänger- und Ballettkünstlerverbandes, Ehrenpräsident der Genossenschaft des deutschschweizerischen, deutschen und österreichischen Theaterpersonals sowie langjähriger Präsident des Basler Theatervereins.2853 Einblicke in Erlenmeyers Welt erlaubt die Durchsicht der (ungedruckten) Festschrift, die ihm Freunde 1960 widmeten, sowie die zugehörigen Gratulationsbriefe. Auffällig sind darin Beiträge von Archäologen, von denen einer dem George-Kreis zuzurechnen ist. Viele Gratulanten bezeugten die Seelenführerschaft von Erlenmeyer gegenüber ausgewählten Studenten, lobten die Verbindung von Tradition mit Fortschritt,2854 von chemischem Fachwissen mit universaler europäischer Bildung, und unterstrichen Erlenmeyers Beziehung zum Griechentum und zu Hölderlin als «huma2849 2850 2851 2852 2853 2854
Hans Oettinger an Hauser, 7. 5. 1939, in: StABS Erziehung CC 23. Weibel 2003. Basler Nachrichten vom 19./20. 11. 1949. National-Zeitung vom 19. 11. 1949. Basler Nachrichten vom 20. 4. 1964. «Denn nur in der Synthese der Tradition und des Fortschritts / findet der Mensch seinen Weg zur rechten und kritischen Weltschau». Anonym, Gedicht, in: Festschrift 1960, Universitätsbibliothek Basel, Handschriften, Mscr L IV 13.
Chemie und Pharmazie
665
nistisch-klassische Synthese von Aletheia und Kalokagathia»2855 sowie sein Bestreben zur «Erhaltung höchster menschlicher Güter, Wahrheit und Dienst».2856 Das waren aber nun fachfremde Argumente, die für die Naturwissenschaften bereits einen sehr geringen Stellenwert in Berufungen hatten. Kuratel und Regierung suchten einen Chemiker von grossem Format wie Reichstein und Kuhn zu gewinnen, der zudem die Universität für die chemische Industrie in Basel wertvoll zu machen vermochte. Und falls man doch ausserwissenschaftliche Kriterien zuliess, so war Hermann F. Mark 1939 ein Flüchtling, der sich inzwischen in prekärer Situation in Kanada aufhielt. Wie erwähnt war er seit 1932 als Ordinarius an der Universität Wien erfolgreich gewesen.2857 Als Mark 1937 einen Vertreter der kanadischen Papierindustrie in Dresden traf, der ihm eine interessante Aufgabe anbot, sagte er nur zu, das betreffende Unternehmen später einmal zu besuchen und zu beraten.2858 Beim ‚Anschluss‘ Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland wurde Mark, der zum Freundeskreis von Engelbert Dollfuss gehört hatte (der ‚Austrofaschist‘ Dollfuss hatte in einem von Mark geführten Regiment Kriegsdienst geleistet),2859 vorübergehend verhaftet. Mark verliess danach Wien, traf die Zürcher Chemieprofessoren und kam nach kurzem Aufenthalt in England im Herbst 1938 bei der Canadian International Pulp and Paper Company unter, mit der er seit 1937 in Kontakt gestanden hatte. Britische Stellen hatten vergeblich um ihn geworben.2860 Als «Halbjude» wurde er nach seiner Flucht offiziell in Wien entlassen. Der mit einer Genferin verheiratete Paneth wurde in Basel offensichtlich kurz erwogen, er berichtete jedoch Vischer, dass er die britische Staatsbürgerschaft beantragt habe und es deshalb unklug wäre, nun gleich wieder Durham zu verlassen.2861 Für die Kuratelskommission besuchten Vischer und Tadeus Reichstein Anfang November 1939 Zürich, um sich ein Bild von Schwarzenbach zu machen und Zürcher Auskunftspersonen anzuhören. Sie trafen Albert FreyWyssling (Pflanzenphysiologe an der ETH) und Gerold Schwarzenbach selbst. Man sprach mit Paul Karrer, der Schwarzenbach empfahl. Leopold Ru⌅i⇥ka stellte Schwarzenbach über Erlenmeyer, auch Studenten der ETH und Ru⌅i⇥kas ‚rechte Hand‘, Moses Wolf Goldberg (emigriert 1942 nach den USA), wussten nur Positives über Schwarzenbach, aber wenn man einen Star suche, solle man Mark wählen. Der Anorganiker an der ETH, William Dupré Treadwell, empfahl 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861
Beitrag von Silvio Fallab und Mitarbeitenden, in: Festschrift 1960. Beitrag von Rolf Meier, Basel, in: Festschrift 1960. Mark 1993, 83 f. Finanzierung von Marks Forschungen in Wien, ebd., 65 f.; Forschungsprogramm, ebd., 68 ff. (vgl. Feichtinger 2017, 12 f.); Unterrichtsprogramm, ebd., 72 ff. https://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Francis_Mark. Mark 1993, 65. In Marks Autobiographie von 1993 wird diese Episode ausgelassen. Siehe die Ergebnisse von Feichtinger 2017, 16 ff. Fritz Adolf Paneth an Vischer, 25. 6. 1939, in: StBAS Erziehung CC 23.
666
Die Naturwissenschaftler
Erlenmeyer oder Schwarzenbach. Für Mark wären die Basler Verhältnisse zu klein, gab er zu bedenken.2862 Gegen Mark, den die Sachverständigen der Kuratel nun ernsthaft in Erwägung zogen, intrigierten in Basel Werner Kuhn und der emeritierte Hans Rupe, indem sie ein negatives Bild seines Charakters zeichneten. Diese Aspekte von Marks Persönlichkeit bezeugten der ehemalige Schweizer Konsul in Mannheim, Max A. Kunz,2863 seit Kurzem wieder in der Schweiz, und der berühmte Erforscher der Makromoleküle, Hermann Staudinger,2864 seit 1926 Professor in Freiburg i. Br. Max Kunz war bei BASF Ludwigshafen (die nach der Fusion zur I.G. Farben gehörte) in der Forschung tätig gewesen, wo Mark von 1926 (seit 1927 mit eigener Arbeitsgruppe) bis zur bevorstehenden Machtübergabe an Hitler stellvertretender Forschungsleiter gewesen war.2865 Er berichtete von sehr unerfreulichen Erfahrungen mit Mark, den er als einen Menschen schilderte, auf den angeblich alle Klischees des Juden zutreffen sollten, wenn er auch explizit antisemitische Äusserungen vermied. Mark sei eigentlich Physiker, eine Berufung als Chemiker wäre unverständlich und nur mit «einflussreichen persönlichen Beziehungen» zu erklären. Auch die chemische Industrie hätte keinen Gewinn von seinen Impulsen. «Wir sollten Ausländern nur dann vor inländischen Anwärtern den Vorzug geben, wenn ihre Berufung für unser Land und dessen Wissenschaft und Wirtschaft eine beneidenswerte Acquisition bedeutet».2866 Dass Marks wissenschaftliches Format international als sehr gross galt, wie die britischen Bestrebungen, ihn 1938 aus dem deutsch beherrschten Wien zu retten und seine Kompetenzen für den eigenen Wissenschaftsbetrieb und die eigene Industrie zu nutzen, zeigten, beeindruckte Kunz nicht. Vielmehr scheint er es für einen Beweis für Marks Undankbarkeit angesehen zu haben, dass dieser seine englischen Förderer zuerst zugunsten des kanadischen Unternehmens sitzen liess, um dann Ende 1939 nach einjähriger Tätigkeit in der Industrie wieder eine akademische Position in England oder Indien anzustreben. Die Basler Industrie würde keine Vorteile aus einer Tätigkeit von Mark in Basel ziehen. Kunz hatte insofern Recht, 2862
2863 2864 2865 2866
Bericht Vischer und Reichstein über ihren Besuch in Zürich, 7. 11. 1939, in: StABS Erziehung CC 23. Auch in: Nachlass Reichstein, StABS PA 979a, H 1-3 1, Nachfolge Fritz Fichter (Lehrstuhl für Anorganische Chemie) 1939–1940 (nur offizielle Protokolle der Sachverständigen). In der Fakultät hatte Reichstein nur zögerlich der primo-loco-Platzierung von Erlenmeyer zugestimmt; sein Kandidat wäre Fritz Feigl (damals Gent) gewesen. Durchschlag an Ruggli, 25. 10. 1939. Reichstein wollte v. a. verhindern, dass Kuhn übergangen werde. https://www.swissinfo.ch/ger/historisches-tondokument_konsul-max-kunz-ueber-die-aus landschweizer-jugend/42291892. http://dodis.ch/P20430. Hansen 2012a. https://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Francis_Mark. Mark verliess die IG Farben 1932. Deichmann 2001, 182 f.; Priesner 1980, 77. Max A. Kunz an Kuhn, 4. 1. 1940, in: StABS Erziehung CC 23.
Chemie und Pharmazie
667
als das einzige grosse Basler Unternehmen, das sich damals eingehender mit Kunststoffen befasste, Ciba, nicht mit Mark kooperierte, sondern mit der Freiburger Staudinger-Schule und Forschern in Firmen wie Henkel. Der zuständige Forschungsleiter bei Ciba, Anton Alfons Gams, arbeitete ohne Verbindungen zu Mark über Melaminharze,2867 er zitierte ihn auch in seinen Publikationen nicht.2868 Am 6. Januar 1940 besuchte Max Kunz Werner Kuhn und legte ihm die negativen Seiten von Mark mündlich dar, worauf sich Kuhn bei Regierungsrat Fritz Hauser darüber beschwerte, dass die Expertenkommission der Kuratel nicht bereit sei, ihn anzuhören.2869 Kunz gewann auch Paul Karrer dafür, in Basel bei Fritz Hauser gegen Mark zu intervenieren.2870 Kuhn hätte kurz zuvor keine Bedenken gehabt, den Lehrstuhl, von dem Mark 1938 in Wien vertrieben worden war, selbst einzunehmen.2871 Staudinger, der Mark als «gewandten Journalisten» qualifizierte, meinte, dieser sei kein Anorganiker, sondern ein Physikalischer Chemiker, der Werner Kuhn konkurrenzieren würde.2872 Der Freiburger Professor erfuhr aus dem inzwischen unter nationalsozialistischer Herrschaft stehenden Wien den sogenannten ‚wahren Grund‘, weshalb Mark Österreich 1938 fluchtartig verlassen hatte. Er habe nämlich die Behörden falsch über seine jüdische Abstammung informiert; er habe angegeben, ein Vierteljude zu sein, doch die Behörden hätten ihm nachgewiesen, dass er ein Halbjude sei, der aus dem «Ghetto bei Pressburg» stamme. Staudinger fügte hinzu, dass kein ehrlicher Wissenschaftler, der 1938 entlassen wurde, schlecht behandelt worden sei; alle hätten ihre volle Pension erhalten. Staudingers Schlussfolgerung, die er Hans Rupe mitteile, lautete: Es ist mir unverständlich, dass von deutscher Seite H[ermann] M[ark] so unterstützt wird, denn er hat oft mit Undank in unfairer Weise seinen Freunden geschadet. Man kann mit recht annehmen, dass er in Basel sich so benehmen wird, wie er es bei der I.G. und in Wien gemacht hat, nämlich aus persönlichen und finanziellen Gründen eine Sonderstellung gegenüber seinen Kollegen mit allen Mitteln anstreben 2867 2868
2869 2870 2871
2872
Seymour 1989, 88. Kaiser 1991; vgl. auch Gams/Widmer/Fisch 1941; zur Person von Gams: Vollenweider 1955. Die Ciba unternahm seit 1921 Versuche mit Kunststoffen (Aminoplasten); 1924 gründete sie eine Kunststoffabteilung unter der Leitung von Gams. Dieser war der Schwiegervater von Eduard Preiswerk, der als Erfinder des erfolgreichen Epoxyharz-Produkts ‚Araldit‘ gilt. Moser 2016. Kuhn an Hauser, 7. 1. 1940, in: StABS Erziehung CC 23. Paul Karrer an Hauser, 8. 1. 1940, in: StABS Erziehung CC 23. Konsul Kunz habe ihm erklärt, warum Mark nicht infrage komme. Hauser solle sich bei Kunz erkundigen. Kuhns Beiträge zur Polymerchemie: Deichmann 2001, 149. Mark selbst bot an, Kuhn in Basel die theoretische Chemie ganz zu überlassen und sich auf praktische Fragen zu konzentrieren, die für die Industrie interessant sein könnten. Mark an Vischer, 26. 2. 1940, in: StABS Erziehung CC 23. Staudinger an Rupe, 27. 11. 1939, in: StABS Erziehung CC 23.
668
Die Naturwissenschaftler wird. Wenn auch sein Äusseres die Abstammung nicht verrät, so zeigt seine innere Haltung die Abstammung aus dem Osten.2873
Das war ein interessanter Einblick in Staudingers Gedankenwelt. Dabei hatte Staudinger eine grosse Autorität, die nicht nur auf seinen fachlichen Leistungen und seiner früheren Stellung an der ETH beruhte, sondern auch auf dem Mut, mit dem er nach dem Ersten Weltkrieg die deutsche Lage als wirkliche Niederlage eingeschätzt und der ‚Dolchstosslegende‘ eine Abfuhr erteilt hatte. Deswegen war er vom Freiburger Rektor und Philosophen Martin Heidegger 1933 hart angegriffen worden.2874 In der Folge zeigte er jedoch betont sein Einverständnis mit dem Nationalsozialismus. Zudem war Staudinger gegen alle Kollegen aufgebracht, die seine Theorie der Makromoleküle nicht voll akzeptierten, darunter Hermann Mark.2875 Rupe und Kuhn konnten das alles wissen, dennoch gaben sie die Auskunft von Staudinger als wahre und aufschlussreiche Information weiter. Werner Kuhn machte sich zum Sprecher dieser ‚Enthüllungen‘ und liess sich, auch nachdem der Entscheid bereits für Mark gefallen war, von der Fakultät bestätigen, dass das Einholen dieser ‚Informationen‘ ganz in deren Sinn gewesen sei.2876 Die Fakultät beauftragte daraufhin ihren Dekan Reichstein, deswegen beim Regierungsrat vorstellig zu werden. Fritz Hauser liess sich nicht davon beeindrucken und tadelte Reichstein schriftlich dafür, dass er noch nach dem Entscheid der Kuratel und des Erziehungsdepartements versuchte, Mark aus dem Rennen zu werfen. Eine solche Intervention sei unzulässig, zumal es sich um «die Besetzung eines unserer wichtigsten Lehrstühle handelt und die Chemische Industrie, auf die wir angewiesen sind, den Vorschlag warm unterstützt».2877 In ihrer Sitzung vom 1. Dezember 1939 hatten sich nämlich die Sachverständigen der Kuratel auf Mark geeinigt. Am 7. Dezember fragte Vischer Mark an, ob er einen Basler Ruf annehmen würde, was dieser am 26. Dezember 1939 telegrafisch bejahte. Ende des Jahres 1939 war die Basler Anfrage für Hermann F. Mark interessant, da er die Aufgaben, die ihm die kanadische Papierindustrie gestellt hatte, als gelöst betrachtete und nun wieder eine akademische Position anstrebte.2878 Mit Brief vom 28. Dezember erklärte er deshalb, er würde den Lehr2873 2874 2875 2876 2877
2878
Ausführlich referiert von Rupe an Vischer, 25. 1. 1940, in: StABS Erziehung CC 23. Deichmann 2001, 395 ff.; Krüll 1978, 228 f. Teltschik 1992, 84–87; Priesner 1980. Zur Kontroverse um die Makromoleküle resp. Polymere auch: Deichmann 2001, 149 f., 255. Kuhns Beiträge zur Polymerchemie: Deichmann 2001, 149. Hauser an Dekan Reichstein, 8. 3. 1940. Antwort ebd.; Reichstein persönlich und handschriftlich an Hauser, 10. 3. 1940, in: StABS Erziehung CC 23. Reichstein möchte die Angelegenheit mit der Verlesung von Hausers Antwort in der Fakultät als erledigt betrachten. Stellensuche von Mark am Jahreswechsel 1939/1940 in den USA, Indien und England: Feichtinger 2017, 19 f.
Chemie und Pharmazie
669
stuhl per Wintersemester 1940/41 annehmen und möchte Schweizerbürger werden, da er wegen des ‚Anschlusses‘ Österreichs Deutscher geworden war, sich aber im Gegensatz zur gegenwärtigen Regierungsweise in Deutschland befinde. Am 30. Dezember 1939 beantragte die Kuratel offiziell beim Erziehungsdepartement, Mark zu wählen mit der Begründung, «ein qualifizierter schweizerischer Kandidat» sei «nicht vorhanden».2879 Auch der Erziehungsrat empfahl die Wahl Marks. Am 5. Februar 1940 eröffnete Hauser die schriftlichen Berufungsverhandlungen. Dabei einigten sich Regierungsrat Hauser und Hermann Mark am 5. April 1940 auf die Konditionen seiner Ernennung in Basel, und der Regierungsrat wählte ihn am 16. April 1940 regulär zum neuen Basler Ordinarius mit Stellenantritt auf Herbst 1940.2880 Mark kündigte dementsprechend seine Anstellung in Kanada. Sein Wunsch, einen Schweizer Pass zu erhalten, wurde jedoch vom EJPD abgelehnt.2881 Als die Wehrmacht am 10. Mai 1940 in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden einfiel und am 14. Juni in Paris einmarschierte, wurde es für einen Flüchtling mit einem deutschen Pass aussichtslos, nach Europa zu gelangen und legal in die Schweiz einzureisen.2882 Mark sass nach einer Vortragstournee in New York fest.2883 Hauser glaubte, dass Mark seine Basler Wahl nicht ernst nehme. In diesem Verdacht fühlte er sich bestärkt, als in «Science» die Nachricht erschien, Mark sei Professor am Polytechnic Institute of Brooklyn geworden. Dies wurde anfangs September 1940 in Basel bekannt.2884 Hauser war empört. In ausführlichen Briefen2885 erklärte Mark ihm seine Lage: Die «Professur» am Polytechnikum sei nur ein Notbehelf. Ein Manager der Chemiefirma Du Pont, der im Hochschulrat des Polytechnikums in Brooklyn2886 sass, hatte Mark 2879 2880 2881 2882 2883 2884
2885
2886
Kuratel an ED, 30. 12. 1939, in: StABS Erziehung CC 23. Beschluss des Erziehungsrats, 18. 10. 1939, mit dem Zusatz, Kuhn solle soweit erforderlich Hans Erlenmeyer zu den Arbeiten hinzuziehen, in: StABS UNI-REG 5d 2-1 (1) 176. Polizeiabtteilung des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements an Basler ED, 11. 5. 1940, in: StABS Erziehung CC 23. «Forsee serious difficulties letter on way.» Telegramm Mark an ED, 1. 6. 1940. Mark an Hauser, datiert aus New York, 2. 6. 1940. Zum Institut: Furukawa 1997, 557. M. Reinhard, Stellvertreter des Dekans der Fakultät, an ED-Sekretär Fritz Wenk, 14. 9. 1940. In der Nachricht hiess es, dass Mark «Professor für organische Chemie» am Polytechnischen Institut Brooklyn geworden sei. Dies erschien auch deshalb ärgerlich, weil Mark in Basel eine Anorganische Professur angenommen hatte. Schreiben vom 18. 7. 1940 mit Gesuch um Urlaub für ein Jahr in Basel von Oktober 1940 bis September 1941, worin er seine «Gastprofessur» am Brooklyn College erwähnte. Im Brief vom 20. 9. 1940 schrieb er, er fürchte, dass sich die Schweiz der «deutschen Kulturund Erziehungspolitik» angleichen könnte, dann würde er wegen 25 Prozent jüdischer Abstammung gleich wieder entlassen werden. In den USA habe er nur eine «fast unbezahlte einjährige Gastprofessur» und sonst nichts. Er stelle es aber Basel anheim, «eine andersartige Lösung in der Besetzungsfrage ins Auge zu fassen». Furukawa 1997, 557.
670
Die Naturwissenschaftler
dort eine Anstellung als «adjunct professor» für vorerst ein Jahr verschafft.2887 Die Stelle war mit einem Beratungsauftrag für das Chemieunternehmen Du Pont verbunden (was Mark gegenüber Hauser nicht erwähnte).2888 Dieses war einer der bedeutendsten Kunden für den Celluloserohstoff, den das kanadische Unternehmen, für das Mark tätig gewesen war, verkaufte. Als deutlich wurde, dass der Krieg sich ausweitete und länger dauern werde, erklärte sich Mark am 20. September 1940 damit einverstanden, dass die Basler die Professur anderweitig besetzen könnten. Die Kuratel beschloss daraufhin, offiziell noch einige Monate zuzuwarten.2889 Als am 4. Dezember 1940 in Basel die Sachverständigenkommission wieder zusammentrat, entschied sie, dass nur noch ein Schweizer infrage komme, und dieser Schweizer war Erlenmeyer. Mark aber erhielt von Fritz Hauser noch am 12. Dezember 1940 die Versicherung, dass er per 30. April 1941 in Basel willkommen sei. Doch am 4. Februar 1941 verzichtete Mark offiziell auf den Lehrstuhl. Die Kuratel sprach sich nun definitiv für Erlenmeyer aus. «Über seinen Unterricht hörte man in den letzten Semestern auch recht günstige Urteile, sodass zu hoffen ist, dass sich ein voller Lehrerfolg noch einstellen wird.»2890 So wählte ihn der Regierungsrat am 18. April 1941 zum Nachfolger von Fichter. Mark hingegen erhielt ein eigenes Polymerinstitut am Polytechnic Institute of Brooklyn und wurde als «Herman Francis Mark» US-amerikanischer Bürger. Er gehörte zu den Begründern der erfolgreichen Polymerchemie in den USA, repräsentierte und propagierte das Fach weltweit.2891 Das Zwischenspiel mit Hermann Franz Mark hinterliess in Basel anscheinend kaum Spuren. Die Universitätsgeschichte2892 weiss nichts von ihm. Hinter der Annahme, die Industrie würde von Marks Tätigkeit in Basel profitieren, stand eine politische Idee, nicht ein vitales Interesse der Industrie selbst, denn diese konnte Wissen dort erwerben, wo sie es in relevanter Thematik vorfand.2893
2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893
Mark 1993, 88, 91. Deichmann 2001, 184. Kuratel an ED, 24. 10. 1940. Sachverständigenkommission Nachfolge Fichter an den Präsidenten der Kuratel, 12. 3. 1941, in: StABS Erziehung CC 23. Geschichte der Polymerchemie mit Schwerpunkt USA: Furukawa 1998; Morris 1986. Bonjour 1960, 747 und 764, behauptet gar, dass Erlenmeyer 1947 Fichters Nachfolge als Ordinarius angetreten habe. Die Interventionen der Industrievertreter in den Berufungsverfahren wurden anscheinend nicht durch eine firmeninterne Strategiediskussion vorbereitet, sondern als Privatsache der entsprechenden Persönlichkeiten behandelt. In den Unternehmensarchiven finden sich keine Spuren solcher Diskussionen. Ich danke den Archiven von Novartis und Roche für ihre Hilfe bei der Suche nach einschlägigen Dokumenten.
Chemie und Pharmazie
671
Der Durchbruch der Ciba mit Kunstharzen erfolgte erst nach der gescheiterten Berufung von Mark nach Basel und gelang ohne sein Zutun.2894 8.4.6 Ergebnisse Die Basler Behörden versuchten, aus der durch die Judenverfolgung im ‚Dritten Reich‘ und den bevorstehenden Krieg geschaffenen Lage Gewinn zu ziehen und die Chemie an der Universität, die für die lokale Industrie relevant war, durch die Wahl herausragender internationaler Chemiker aufzuwerten. Entgegen der in der Fakultät vorherrschenden Meinung, es seien Schweizer zu bevorzugen, interessierten sich die Kuratel und der Erziehungsdirektor für die Chance, rückkehrwillige Auslandschweizer und vom Nationalsozialismus verfolgte Ausländer von hohem wissenschaftlichem Prestige für Basel zu gewinnen. Im Fall Kuhn gelang dies, weil er als Auslandschweizer regulär in die Schweiz übersiedeln konnte, weil er mit seinem fachlichen Profil in eine Lücke passte und weil er ‚arisch‘ war. Im Fall Mark misslang dies. Der Entscheid fiel zu spät; der Frage des Reisepasses wurde zunächst zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Mit den Dimensionen, die mit der Berufung eines aus dem deutschen Machtbereich geflohenen ‚Stars‘ aus Übersee verbunden waren, konnten die Basler Behörden letztlich nicht umgehen. Mit Reichstein war eine verwandte Bestrebung insofern einfacher zu realisieren, als dieser als jüdischer Schweizer in der Schweiz durch die nationalsozialistische Rassenpolitik in seiner Karriere blockiert und deshalb für Basel verfügbar war. Es bleibt aber bemerkenswert, dass die damals so genannten ‚oberen Behörden‘ die Tendenz der abtretenden Ordinarien, Hausberufungen für ihre Schüler durchzusetzen, und der Fakultät, ihnen dabei nicht zu widersprechen, infrage stellten. Auch etablierte Grenzziehungen zwischen Teilfächern waren für die Behörden nicht Tabu. Ohne die Vokabel ‚Innovation‘ zu verwenden, gewichteten sie das Interesse der chemischen Industrie an herausragenden Entdeckern und Neuerern stark. ‚Geistige Landesverteidigung‘ war ein relevantes Kriterium in Fächern, deren Lehre der politischen Bildung zudienten, nicht aber in Naturwissenschaften. Wenn schliesslich doch Erlenmeyer dank einer Hausberufung Professor wurde, dann war das kaum ideologischen Überlegungen zu verdanken, sondern der inzwischen weitgehenden, kriegsbedingten Abschliessung der akademischen Schweiz vom internationalen Umfeld – und dem Umstand, dass er für das Amt durchaus qualifiziert war. Die Administration von Regierungsrat Fritz Hauser verstand es, im Zusammenspiel mit den dem Nationalsozialismus entschieden feindlich gesinnten An-
2894
Preiswerk 1965, 11. Er zitiert den Beitrag von Kurt H. Meyer zur mit Hermann F. Mark zusammen herausgegebenen Serie «Hochpolymere Chemie». Preiswerk war bei Meyer in Genf 1940/41 Assistent gewesen.
672
Die Naturwissenschaftler
gehörigen von Universität und Öffentlichkeit offen antisemitische Urteile zu unterdrücken. Die meist nur unterschwellige Präsenz des Antisemitismus in universitären Kreisen war jedoch unübersehbar. Dieser manifestierte sich verdeckt, im Fall Reichsteins als Opposition einer beruflichen Standesvertretung, bei der Diskussion möglicher Kandidaten aus dem Ausland in der Fakultät durch eine negative Beurteilung von «Emigranten», im Fall von Mark als ‚Warnung‘ vor dem angeblich exzessiven Ehrgeiz eines Bewerbers, für die man einen wissenschaftlich hochqualifizierten Gewährsmann aus dem Ausland mobilisierte. Dieses Vorgehen verband sich mit einer akademischen Intrige gegen wissenschaftliche Gegner und mögliche Konkurrenten, die den antisemitischen Kern der Wahrnehmung überlagerte. In Erinnerung bleiben wird die Befürchtung von Hermann Mark, dass sich die Schweiz der «deutschen Kultur- und Erziehungspolitik» angleichen könnte, wie er sich ausdrückte, und dass er dann wegen seiner 25-prozentigen jüdischen Abstammung gleich wieder entlassen würde.
8.5 Geologie, Mineralogie und Paläontologie In der nachfolgenden kleinen Skizze behandle ich die Erdwissenschaften ohne die Geographie. Ihr widme ich später ein separates Kapitel. Für Geologie, Mineralogie, Paläontologie und verwandte Wissenschaften2895 suche ich nach Beziehungen zu Deutschland, die weitere Einblicke in die durch den Nationalsozialismus veränderten Verhältnisse gestatten könnten. Das Ordinariat für Mineralogie und Petrographie hatte Max Reinhard von 1923 bis 1952 inne. Der gebürtige Berner wandte sich dem Studium der Erdwissenschaften an den Universitäten Bern, Genf und Zürich zu, von wo aus er 1904 auf eine Assistentenstelle in Bukarest gelangte. 1906 erwarb er während eines Urlaubs von seiner Stelle in Rumänien an der ETH Zürich den Doktortitel. In Bukarest habilitierte er sich 1910. Hauptthema seiner Forschungen waren bis zu diesem Zeitpunkt die Karpaten gewesen. 1911 bis 1915 war er im Auftrag der Standard Oil Company als Praktischer Geologe in Sumatra, Java, Borneo, Kolumbien sowie in Venezuela tätig. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz im Jahre 1916 erhielt Reinhard eine Stelle am Laboratoire minéralogie der Universität Genf, wo 1920 seine Beförderung zum ausserordentlichen Professor erfolgte. Seit 1919 arbeitete er in der Schweizerischen Geologischen Kommission mit. 1923 wurde Max Reinhard als Nachfolger von Carl Schmidt zum Ordinarius für Mineralogie und Petrographie an der Universität Basel gewählt, und im folgenden Jahr gründete er die Schweizerische Mineralogische und Petrographische Gesellschaft. Das Mineralogische Institut in Basel baute er zu einem Zentrum der Feldspatoptik aus, das bis 1933 von internationalen Gästen und Studierenden rege besucht 2895
Simon 2009a, 75–86.
Geologie, Mineralogie und Paläontologie
673
wurde: Neben Deutschen waren Rumänen, Skandinavier, Briten, Inder, Japaner und Chinesen dort zu Gast. Eine besondere Beziehung pflegte Reinhard zum wissenschaftlichen Leiter des deutschen Optikunternehmens Leitz/Wetzlar, Max Berek. 1930 war er Austauschprofessor an der Universität Durham. Die Arbeit an geologischen Karten liess seit 1931 wenig Zeit für eigene wissenschaftliche Publikationen, dafür brachte er 18 Doktoranden zur Promotion. Reinhard war eine international ausgerichtete Persönlichkeit, die sechs europäische Sprachen beherrschte, mit einer Vorliebe für die romanischen Sprachen (Französisch, Rumänisch, Italienisch); seine liebsten Freunde waren Genfer. Seine Publikationen erschienen nach 1933 häufig in schweizerischen Fachzeitschriften («Eclogae Geologicae Helveticae», «Schweizerische mineralogisch-petrographische Mitteilungen»), nie in Deutschland.2896 Geologie wurde in Basel in der Untersuchungszeit bis 1944 von August Buxtorf-Burckhardt gelehrt. Er doktorierte 1900 hier bei Carl Schmidt, nachdem er in Grenoble, Göttingen und Basel studiert hatte. 1901 diente er als Erdöl-Geologe in Indonesien und unternahm Reisen nach Burma, Indien und Ägypten. 1907 wurde er in Basel habilitiert, danach 1914 zum Extraordinarius befördert. Nachdem er 1921 einen Ruf nach München abgelehnt hatte, wurde er als Ordinarius in Basel Inhaber der damals neugeschaffenen Professur für Geologie und Paläontologie. 1926 bis 1953 präsidierte er die Geologische Kommission der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft. Einen Namen machte er sich 1907 mit seiner Hypothese über den Ursprung der Faltung des Juras. Schwerpunkte seiner Arbeiten waren die Geologie der Zentralschweiz sowie des Tessins, daneben war er anerkannter Experte in angewandter Geologie, unter anderem im Tunnelbau.2897 Vor dem Ersten Weltkrieg war er dem Oberrheinischen geologischen Verein beigetreten und hatte oft in Deutschland publiziert, so in der «Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft» 1908, in den «Berichten über die Versammlungen des Oberrheinischen geologischen Vereins» 1909 und einem Organ der Grossherzoglich-Badischen geologischen Landesanstalt 1912. Nach 1914 kann ich nur noch schweizerische Veröffentlichungsorte nachweisen – seine Arbeiten erschienen gelegentlich in den «Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel», manchmal in denen der «Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft», und meistens in den «Eclogae Geologicae Helvetica». Auch Buxtorfs Nachfolger Louis Vonderschmitt, der 1921 bei Buxtorf doktoriert hatte, publizierte fast ausschliesslich in den «Eclogae». Extraordinarius für Mineralogie und Petrographie war Heinrich Preiswerk. Nach seinem Studium in Basel (Mittellehrerexamen für Naturkunde) und Heidelberg am damals renommierten Institut von Rosenbusch promovierte er 1901 in Basel bei Carl Schmidt, danach nahmen ihn Victor Goldschmidt und Harry 2896 2897
https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Reinhard; Wenk 1975. Weidmann 2003; Vonderschmitt 1969.
674
Die Naturwissenschaftler
Rosenbusch in Heidelberg als ihren Assistenten auf. 1903 war er zurück bei Carl Schmidt in Basel, der ihn 1904 habilitierte. 1912 erhielt er den Titel eines Extraordinarius und 1920 einen Lehrauftrag, zudem war er Vorsteher des Gesteinsanalytischen Labors. Für die Geologische Kommission untersuchte er die Lepontinischen Alpen und erstellte wichtige Karten: Während dreissig Jahren bearbeitete er jeden Sommer die Geologie des Sopraceneri. Daneben verfasste er geologische Expertisen zu Erzlagerstätten und Erdölvorkommen. 1933 trat er aus Gesundheitsgründen zurück. Die deutsche Entwicklung seit 1933 bedauerte er lebhaft.2898 Ein Schüler von Preiswerk, der vorübergehend auch in Innsbruck studiert hatte, war Eduard Wenk, der 1934 bei Max Reinhard doktorierte. Anschliessend bildete er sich bei Helge Backlund in Uppsala 1934/35 weiter. Nach der Teilnahme an der Grönland-Expedition von Lauge Koch war er von 1936 bis 1939 Erdölgeologe in Borneo für Shell, worauf er für die Geologische Abteilung dieser Firma in Den Haag arbeitete. Beim Einmarsch der deutschen Truppen in die Niederlande ging er zurück in die Schweiz, wo er für die Geologische Kommission tätig wurde und bei Paul Niggli an der ETH Zürich assistierte. Nach der Habilitation in Basel (1943) trat er hier 1952 die Nachfolge von Max Reinhard als Ordinarius und Leiter des Mineralogisch-Petrographischen Instituts an.2899 Auch seine Publikationsliste zeigt keine Affinität zu Deutschland, vieles publizierte er national. Joos Cadisch2900 vertrat in Basel vorübergehend die regionale Geologie. Seit 1927 war er in Basel Privatdozent (vorher 1925 an der ETH in Zürich habilitiert), wohin es ihn als Adjunkt der Geologischen Kommission, von Zürich herkommend, verschlagen hatte. 1935 wurde er Extraordinarius, nachdem er im Jahr zuvor seine Geologie der Schweizer Alpen geschrieben hatte. Während der Dreissigerjahre war er ein international gefragter Experte für Geologie. Er befasste sich mit der Beurteilung von Lagerstätten, veröffentlichte zahlreiche Arbeiten über Mineral- und Thermalquellen und wurde 1941 stellvertretender Chef des Bergbaubureaus in Bern, das zum Eidgenössischen Kriegs-Industrie- und Arbeitsamt gehörte. 1943 wurde er in Bern auf das Ordinariat seines Lehrers Arbenz berufen.2901 In den 1930er Jahren veröffentlichte er gelegentlich Arbeiten in deutschen Zeitschriften wie der «Geologischen Rundschau» (seit 1930 war er für eine deutsche Bergbaugesellschaft tätig), in österreichischen wie der «Zeitschrift für Gletscherkunde», einmal im faschistischen Italien (Padua), sonst immer in schweizerischen Organen. Walter Hotz machte 1905 an der Basler Universität das Mittellehrerexamen. Danach war er Assistent beim Geologen Carl Schmidt. Dieser schlug ihm vor, die Magnetiterz-Lagerstätten in Siebenbürgen zu studieren. 1908 wurde Hotz mit 2898 2899 2900 2901
Reinhard 1940; Buxtorf 1940. Trommsdorff 2002; Wanner 1969. Anonym 1965. Matter 2005; Nabholz 1977.
Geologie, Mineralogie und Paläontologie
675
diesen Studien promoviert, worauf er sich an der Berliner Bergakademie weiterbildete. Ab 1909 befasste er sich mit der Petroleumgeologie. Er führte Expertisen im Elsass, in den Karpaten, in Spanien, Marokko und Ägypten aus; von 1910 bis 1919 arbeitete er in Indonesien, später besuchte er Südamerika. 1922 kehrte er nach Basel zurück, von wo aus er weiterhin als Experte tätig war und sich 1926 für Mineralogie habilitierte. Kurz vor dem Krieg wurde er Geschäftsführer der Zentralstelle für Kohleeinfuhr beim Bund, dann Sektionschef im Kriegs-Industrie- und Arbeitsamt. Wegen der grossen beruflichen Belastung gab er die Privatdozentur in Basel auf. Entsprechend wenig veröffentlichte er in den 1930er Jahren, darunter namentlich das Blatt Saint-Maurice des Geologischen Atlasses der Schweiz.2902 Der in Basel geborene und aufgewachsene Vulkanologe Alfred Rittmann promovierte 1922 in Genf bei Louis Claude Duparc über platinführende Gesteine im Ural. 1926 bis 1934 war er Mitarbeiter von Immanuel Friedlaender an dessen Institut für Vulkanologie in Neapel, kehrte dann in die Schweiz zurück und war von 1935 bis 1941 als Privatdozent an der Universität Basel tätig. Ab 1941 hielt er sich erneut in Italien auf (1942 Anstellung am Istituto della Ricostruzione Industriale in Rom) und führte im Auftrag des italienischen Staates geologische Untersuchungen in der Umgebung von Neapel, in der Toscana und in Albanien durch. Nach Kriegsende lehrte er zehn Jahre lang in Ägypten, bis er 1956 Professor am Istituto della Vulcanologia in Catania wurde. Internationale Anerkennung blieb nicht aus, während er den Kontakt zu Basler Freunden nicht abreissen liess.2903 Rolf Rutsch, Kustos am Naturhistorischen Museum seit 1927, war von 1935 bis 1940 Basler Privatdozent aufgrund seiner Arbeit über Die Gastropoden aus dem Neogen der Punta Gavilán in Nord-Venezuela, danach habilitierte er sich nach Bern um. Seit 1933 arbeitete er für die Geologische Kommission der Naturforschenden Gesellschaft über die Geologie der Umgebung von Bern.2904 Petrographie lehrte in Basel als Privatdozent Peter Bearth, der nach einem hiesigen Studium 1931 mit einer Arbeit zur Geochemie den Doktorgrad erwarb. 1933 hielt er sich kurz in Göttingen auf. Ab 1935 war der gelernte Maschinenschlosser und Alpinist Gymnasiallehrer für Physik und Chemie am Mädchengymnasium und daneben von 1928 bis 1940 Assistent an der Mineralogisch-Petrographischen Anstalt für Gesteinsanalysen. Die Habilitation erfolgte 1938, aber erst 1945 erhielt er einen Lehrauftrag, den er ab 1952 neben seinem Schulpensum als ausserordentlicher Professor für Petrographie versah. Seine Publikationen veröffentlichte er fast ausschliesslich in den «Schweizerischen mineralogisch-petro-
2902 2903 2904
Reinhard 1959. Dietrich 2010; Anonym 1963. Hedeberg 1977; Thalmann 1976.
676
Die Naturwissenschaftler
graphischen Mitteilungen»; die wichtigsten Leistungen waren Beiträge zum Geologischen Atlas der Schweiz.2905 Manfred Reichel war der grosse Basler Spezialist der Mikropaläontologie. Er besuchte 1916 bis 1918 die École des Beaux-Arts in Genf, wo er Zeichenunterricht nahm, und studierte danach Zoologie an der Universität Neuchâtel (Lizentiat 1922). 1926 doktorierte er dort bei Otto Fuhrmann in Zoologie. Von 1928 an war er Assistent am Institut für Geologie und Paläontologie der Universität Basel, wo ihn August Tobler auf die Mikropaläontologie der Foraminiferen aufmerksam machte. Hier wurde er 1933 habilitiert und lehrte fortan über die Paläontologie der Wirbellosen. Seit 1935 hielt er Kurse in Mikropaläontologie ab, die eine überregionale Ausstrahlung erlangten. 1940 wurde er zum Extraordinarius und 1955 zum persönlichen Ordinarius für Paläontologie befördert.2906 Er publizierte mit Vorliebe in französischer Sprache und mit einer Ausnahme immer in schweizerischen Fachzeitschriften wie in den «Abhandlungen der schweizerischen paläontologischen Gesellschaft», den «Verhandlungen der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft» und in den «Eclogae Geologicae Helveticae». Nur einmal erschien eine Arbeit von ihm in Deutschland; diese war in den Sammelbänden enthalten, die die Ergebnisse der niederländischen Karakorum-Expedition von 1922 bis 1930 präsentierten und bei Brockhaus in Leipzig von 1935 bis 1938 verlegt wurden.2907 Die schweizerischen Erdwissenschaftler waren somit sichtlich nicht auf das deutsche wissenschaftliche Kommunikationssystem angewiesen, sondern teils in einem national-schweizerischen Kontext aufgehoben, teils durch ihre Expertentätigkeit und ihre Forschungen im Ausland weitgehend internationalisiert. Reinhard und Reichel waren zudem auf den romanischen Sprachraum ausgerichtet. Schweizerische Unternehmen standen bereit, um Kartenwerke in hoher Qualität herzustellen, so dass die Problematik, die sich in anderen Fächern aufgrund der Nazifizierung von deutschen Zeitschriften, Fachgesellschaften, Druckereien und Verlagen manifestierte, hier nicht aufscheint. Man hat den Eindruck, dass die Helvetisierung dieser Wissenschaften bereits nach dem Ersten Weltkrieg erfolgt war, soweit ihre Vertreter nicht von vornherein aufgrund ihrer Laufbahn westlich-international ausgerichtet waren.
2905
2906 2907
Trommsdorff 2020; Streckeisen/Meyer 1990; Laubscher 1990; Artikel über Bearth im Basler Volksblatt am 30. 3. 1968, in den Basler Nachrichten und der National-Zeitung am 9. und 10. 9. 1952. Schaer 2010; Luterbacher 1986. Visser/Visser-Hooft 1935/1938.
Geographie
677
8.6 Ein Bewunderer Hitlers lehrt Geographie: Fritz Jaeger Der Deutsche Gustav Braun machte noch vor dem Ersten Weltkrieg den vielversprechenden Anfang mit dem damals neuen Fach Geographie in Basel. Ihn interessierten Eiszeiten und norddeutsche Formationen. Braun war vor der Berufung nach Basel Abteilungsvorstand am Institut für Meereskunde und Privatdozent an der Universität Berlin gewesen. Er stand nur an dritter Stelle auf der Liste der Sachverständigenkommission der Basler Kuratel vom 7. November 1911; den ersten Platz hatte Fritz Jaeger, Extraordinarius in Berlin, erhalten;2908 Norbert Krebs, Realschulprofessor und Privatdozent in Wien, stand auf dem zweiten Platz. Jaeger betrachtete die Basler Kommission als jemanden, der die Methoden sowohl in «altem Kulturland» als auch «in der Wildnis» (gemeint waren Expeditionen nach den deutschen Kolonien in Afrika) beherrsche. Mit ihm verhandelte der Privatgelehrte und Forschungsreisende Paul Sarasin. Der Kandidat machte auf Sarasin einen guten Eindruck, erklärte sich bereit, auch über Handelsgeographie zu lesen, forderte aber ein Gehalt von Fr. 6’000 und die Aussicht, rasch zum Ordinarius befördert zu werden. Nachdem Jaeger abgesagt hatte, erging der Ruf an Braun, der ihn annahm. Am 2. März 1912 wählte ihn der Regierungsrat zum Inhaber der ausserordentlichen Professur, am 5. April 1913 erfolgte seine Beförderung zum Ordinarius, und am 20. Juni 1917 beschloss die Regierung, die Geographie mit einem gesetzlich verankerten Lehrstuhl auszustatten. Doch Braun erklärte am 3. September 1917, er habe einen Ruf nach Greifswald angenommen, und empfahl als seinen Stellvertreter Paul Vosseler.2909 Der Basellandschäftler Vosseler hatte 1915 das Oberlehrerpatent erworben und 1917 bei Braun mit einer Arbeit über die Morphologie des Aargauer Juras doktoriert. Habilitiert hat er sich erst unter Brauns Nachfolger Hugo Hassinger 1926. Ab 1930 war er Lehrbeauftragter, und 1936 wurde er Extraordinarius. Hauptberuflich war er Lehrer am Basler Realgymnasium. Er befasste sich in seinen Forschungen vor allem mit der Geographie der Schweiz; in der Lehre an der Universität mit Europa. Vosselers Tätigkeit sicherte über Jahrzehnte eine Kontinuität in der Basler Geographie.2910 Brauns Nachfolger wurde Hugo Hassinger (vorher Mittelschullehrer und seit 1914 Privatdozent in Wien), der der Kulturgeographie näherstand als sein Vorgänger. Er interessierte sich für die Donauländer und Tschechien. An erster Stelle in der Liste der Expertenkommission der Kuratel war zunächst nicht Hassinger, sondern Walter E. Behrmann genannt worden (1912/13 Mitglied der «Expedition des Reichskolonialamtes, der Königlichen Museen und der Deutschen Kolonialgesellschaft zur Erforschung des Kaiserin-Augustaflusses in Kaiser-Wil2908 2909 2910
Über ihn unten ausführlich. Schreiben und Konzepte von 1911 in: Erziehung CC 26a. Nipp o. J., Paul Vosseler. Siehe auch: Wichers 2015a. Nachlass Paul Vosseler NL 328 in der Universitätsbibliothek Basel (von mir nicht benutzt).
678
Die Naturwissenschaftler
helms-Land» und daher Kenner von Neuguinea, Privatdozent in Berlin seit 1914).2911 Im Erziehungsrat fiel die Kandidatur von Behrmann durch, weil er weniger Lehrerfahrung habe und keine Aussicht bestehe, den guten Forscher für längere Zeit in Basel zu halten. Die Kandidatur des einzigen in Betracht gezogenen Schweizers, Fritz Nussbaum (Privatdozent an der Universität Bern und Lehrer am Unterseminar Hofwil),2912 war aussichtslos, da er sich angeblich nur für die Lehrerausbildung eigne (Nussbaum wurde dennoch 1944 Ordinarius in Bern) und nationale Gesichtspunkte auch im Erziehungsrat keine Chance hatten, wenn das ausländische Bewerberfeld als so viel besser galt. Mit drei gegen zwei Stimmen entschied sich der Erziehungsrat für Hassinger, während drei weitere Erziehungsräte der Sitzung fernblieben. So wählte der Regierungsrat auf Antrag von Mangold am 12. April 1918 Hassinger zum Basler Geographieprofessor, wiederum mit dem Extraordinarientitel und der Aussicht auf Beförderung zum Ordinarius, die dann am 10. Februar 1920 erfolgte. Hassinger erhielt mehrere Rufe nach auswärts (1920 Innsbruck, 1922 Frankfurt am Main, 1927 Graz und Freiburg i. Br.), die er zunächst zur Verbesserung seiner Ausstattung in Basel verwendete. Die Bleibeverhandlungen, die er 1927 mit Regierungsrat Hauser führte, enttäuschten ihn, und so teilte er ihm am 19. Mai dieses Jahres mit, dass er nach Freiburg i. Br. gehe.2913 Hassinger profilierte sich darauf in Freiburg und ab 1931 in Wien als ‚völkischer‘ Geograph, der nach 1933 auch Gutachten für die Umsiedlung der Südtiroler für die SS redigierte, aber nie in die NSDAP eintrat.2914 Mit dem ihnen schon bekannten Fritz Jaeger glaubten die Basler Behörden danach einen guten Fang zu tun.2915 Im ersten Anlauf (Berichtsentwurf vom 24. August 1927) setzte die Kommission der Kuratel Jaeger zwar bloss auf den zweiten Platz. Platz eins belegten ex aequo der Zürcher Pflanzengeograph, Sohn eines Winterthurer Lehrers polnischer Herkunft, Heinrich Brockmann-Jerosch, Privatdozent in Zürich,2916 und Johann Sölch, seit 1920 Professor für Physische 2911
2912 2913 2914 2915
2916
Leibniz-Institut für Länderkunde, Archiv für Geographie, Findbuch Walter Behrmann, https://leibniz-ifl.de/fileadmin/Redaktion/Bibliothek_Archiv/Archiv_Findbücher_PDF/ Behrmann.pdf. Balmer 2010. Alles nach Schreiben und Konzepte von 1911, in: Erziehung CC 26a. Haar/Fahlbusch/Iggers 2005; Fahlbusch 1999; Wien Geschichte Wiki: «Hugo Hassinger». Troll 1974. Umfangreicher Aktenbestand v. a. in: StABS UA XI A 3, 2 Fritz Jaeger, und in der ehemaligen Registratur des ED (Erziehung CC 26a, Philosophische Fakultät, Professur Geographie, sowie ED-REG 1a, 1 Dossier Prof. Dr. Fritz Jaeger 1928–1948). Einzelne Schreiben und Berichte sind überliefert mit Absender Polizeidepartement Basel-Stadt, Politische Abteilung, in: StABS ED-REG 1a, 1. Siegrist 1989, 311–319, hat schon vor 35 Jahren (seine Arbeit stammt aus dem Jahr 1985) den «Fall Jaeger» aufgrund der Basler Akten in: StABS ED-REG 1 a 1 dargestellt. Ziegenspeck 1955. In der Expertenkommission der Kuratel wurde Brockmann als origineller, aber nicht solider Aussenseiter gesehen, dem die zünftigen Geographen vorwarfen,
Geographie
679
Geographie in Innsbruck.2917 Jaeger wurde eingehend gewürdigt. Er sei als Professor für Kolonialgeographie durch den Verlust der deutschen Kolonien («Schutzgebiete») «wurzellos geworden», als Forscher sei er zwar «grundgediegen», habe aber «nicht genügend Temperament». Im Charakter sei er zurückhaltend, nüchtern, «unbedingt lauter und anständig», aber «etwas philiströs». Die Kuratel wies daraufhin diese Liste ihrer Expertenkommission zurück offensichtlich gab es grosse Widerstände gegen Brockmann. In einer neuen Würdigung Jaegers wurde festgestellt, durch ärztliche Behandlung habe sich dessen «Nervenschwäche» deutlich gebessert, wodurch auch sein Vortrag interessanter geworden sei. Die Kommission setzte Jaeger nun auf Platz eins, nachdem Fritz Sarasin und Regierungsrat Fritz Hauser auf Anraten von Hermann Bächtold seine Vorlesungen in Berlin besucht hatten, und teilte Sölch (den Hassinger gerne als seinen Nachfolger gesehen hätte) und Brockmann ex aequo den zweiten Platz zu. Am 24. März 1928 erhielt Jaeger die Basler Professur mit einem Gehalt von Fr. 15’0002918 und führte sich bald mit einer Antrittsvorlesung über «Geographische Probleme in Afrika» ein.2919 Jaeger hatte sein Profil innerhalb der deutschen Kolonialgeographie2920 erworben. 1903/04 sammelte er als Begleiter von Carl Uhlig Erfahrungen in der Ostafrikanischen Expedition der Otto-Winter-Stiftung nach Deutsch-Ostafrika, dann erforschte er als Expeditionsleiter 1906/07 im Auftrag des Reichskolonialamtes nochmals Ostafrika. 1909 wurde Jaeger Privatdozent und erhielt 1911 das Extraordinariat für Koloniale Geographie an der Universität Berlin, das der Verleger, Forschungsreisende und Kolonialpolitiker Hans Meyer gestiftet hatte. Kurz vor Kriegsbeginn begab er sich im Auftrag des Reichskolonialamtes auf seine dritte afrikanische Forschungsreise, diesmal nach Deutsch-Südwestafrika. Britische Truppen hielten ihn dann von 1915 bis 1919 dort fest. Diese Zeit nutzte er, um reiches Material für eine Landeskunde von Südwestafrika zu sammeln.2921
2917 2918
2919
2920 2921
er sei nur ein Pfanzengeograph, dessen Klimatologie negativ beurteilt worden sei. Die polnische Herkunft wurde ihm zum Vorwurf gemacht, er dränge sich vor und mische sich in andere Fächer ein. Debatte in der Kuratel und in deren Expertenkommission, in: StABS ED-REG 1a, 1 Prof. Dr. Fritz Jaeger 1928–1948, Dossier Berufung 1928. Wien Geschichte Wiki: «Johann Sölch». Diese und weitere Angaben aus: StABS Erziehung CC 26a: Philosophische Fakultät, Professur Geographie, 1911–1929–1934. Berufungsakten in: StABS ED-REG 1a, 1 Dossier Prof. Dr. Fritz Jaeger 1928–1948. Vorlesung gehalten am 13. 5. 1928, in: StABS ED-REG 1a, 1 Dossier Prof. Dr. Fritz Jaeger 1928–1948. Die bei Troll 1969, 23, genannte «Antrittsvorlesung» von 1929 über «Probleme klimatischer Grenzen in Afrika» scheint einen anderen Anlass gehabt zu haben – oder zitiert Troll eine gedruckte Fassung mit geänderter Überschrift? Kolonialgeographie vor 1914: Gräbel 2015, zu Jaeger 51 f.; Débarre/Ginsburger 2014. Troll 1974; Troll 1969, 9 ff. ausführlich.
680
Die Naturwissenschaftler
Forschungen in Physischer Geographie und die Kartierung von afrikanischen Regionen verband er nach seiner Rückkehr nach Europa mit einem breiten Lehrangebot, das sich durch praktische Übungen und Exkursionen auszeichnete. In Berlin musste er sich nach dem Krieg zusätzlich zur Kolonialgeographie mit dem «Auslanddeutschtum» befassen, da die Finanzierung seiner Professur nach dem Verlust der «Schutzgebiete» und wegen der Inflation an die Berücksichtigung dieses Themas gebunden wurde.2922 Zu diesem Zweck studierte er auch die deutsch-polnische Grenze und die deutschen Minderheiten in Rumänien und der Tschechoslowakei. In welchem Geiste er dies tat, wurde bisher nicht untersucht. Es steht aber fest, dass Jaeger ein deutscher Patriot war, der seine Grundeinstellung in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gefestigt hatte. Seine Arbeiten, die ihn zunächst zu einem der führenden deutschen Afrika-Geographen gemacht hatten,2923 dann zunehmend auf Grundsatzfragen der Physischen Geographie bezogen waren und schliesslich auch von der Basler Freiwilligen Akademischen Gesellschaft gefördert wurden,2924 galten nach den Massstäben der deutschen Fachkollegen über 1945 hinaus als wertvoll. In die schweizerische Geographie, die sich in den 1930er Jahren zunehmend mit Beiträgen zur ‚geistigen Landesverteidigung‘ profilierte und durch Persönlichkeiten wie Fritz Nussbaum (Bern, stark patriotisch ausgerichtet)2925 oder in einer jüngeren Generation durch Ernst Winkler (Zürich, erst 1945 habilitiert, mit engen Beziehungen zur deutschen Geographie)2926 geprägt war,2927 integrierte sich Jaeger kaum. Seine Forschungen richteten sich nur dann auf die Schweiz, wenn er mit Studenten exemplarische Studien an Schweizer Landschaften unternahm, er förderte aber Schweizer Schüler wie Hans Annaheim, den er 1944 habilitier-
2922 2923 2924
2925 2926
2927
Troll 1969, 18. Siegrist 1989, 312. Antrag ED an Regierungsrat, 5. 10. 1934; Antrag Jaeger auf Finanzierung einer Studienreise nach Nordafrika, am 9. 10. 1934 durch den Regierungsrat bewilligt, mit einer Unterstützung der FAG von Fr. 3’000 und einem Staatsbeitrag von Fr. 1’000, in: StABS Erziehung CC 26a, Philosophische Fakultät, Professur Geographie, 1911–1929–1934. Akten der Kuratel und des ED zu diesem Gesuch in: StABS ED-REG 1a, 1 Dossier Prof. Dr. Fritz Jaeger 1928–1948, Urlaubsgesuche. Ergebnisse publiziert unter dem Titel «Trockengrenzen in Algerien» (Jaeger 1936). Ein direkter Zusammenhang mit einem Plan zur Errichtung eines nationalsozialistischen Kolonialreichs ist nicht erkennbar, vielmehr handelt es sich um einen Teil von Jaegers Studien über Klimaveränderungen, Trockengebiete und deren Grenzen. Troll 1969, 20 ff., 25, 27. Balmer 2010. Bridel 2015; Siegrist 1989, 292. Winkler war einer der wenigen Schweizer Geographen, die (in Auseinandersetzung mit deutschen Fachkollegen) theoretische Interessen zeigten. Siegrist 1989, 326, u. ö. Siegrist 1989, passim. Schweizer Geographen setzten sich mehrheitlich von der Vorstellung einer grenzüberschreitenden deutschen Nation kritisch ab. Siegrist 1989, 291 ff.
Geographie
681
te.2928 Dagegen unterhielt er enge Kontakte zu deutschen Fachverbänden und Kollegen wie z. B. zu Friedrich Metz in Freiburg i. Br., der regelmässig Geographen und Historiker in der Schweiz besuchte, auf Einladung durch Jaeger auch in Basel referierte und seinerseits Besuche von Jaeger in Freiburg empfing.2929 Seine wissenschaftlichen Beziehungen galten mit Ausnahme seiner Beiträge zu internationalen Kongressen (1933 Geologenkongress in Washington und 1938 Geographenkongress in Amsterdam) und der Präsentation von Exkursionsresultaten zur Schweizer Geographie deutschen und österreichischen Organisationen. Ich halte die Ausrichtung nach Deutschland nicht für extrem – sie entspricht dem, was von einem deutschen Professor in der Schweiz zu erwarten war, sie zeigt aber auch, dass er keineswegs auf Distanz zum Nationalsozialismus ging.2930 Jaeger gehörte wie sein Vorgänger Hassinger zu den deutsch-nationalen Geographen, im politischen Urteil primär auf die Wiedererlangung einer deutschen Weltgeltung als Kompensation für die 1918 erlittene ‚Schmach‘ ausgerichtet. Er setzte den Umstand, dass er einen schweizerischen und einen deutschen Pass hatte (sein Vater Hans Jaeger stammte aus Brugg im Kanton Aargau und arbeitete in Offenbach am Main in einer chemischen Fabrik als Kaufmann, eingebürgert in Deutschland 1893),2931 gezielt ein, um bald als Schweizer eine Politik der kulturellen Verständigung zwischen der Schweiz und dem nationalsozialis2928 2929 2930
2931
Troll 1969, 31. Zu Annaheim siehe unten. Siegrist 1989, 298–301. Bezeichnend sind Jaegers Urlaubsgesuche für wissenschaftliche Treffen zwischen 1928 und 1936, in: StABS ED-REG 1a, 1 Dossier Prof. Dr. Fritz Jaeger 1928–1948. Diese betreffen 1928 die Berliner Gesellschaft für Erdkunde, 1929 den Deutschen Geographentag in Magdeburg, 1931 den Deutschen Geographentag in Danzig, 1933 den Deutschen Geographentag in Wien, 1934 den Deutschen Geographentag in Bad Nauheim und 1936 den Verein für Geographie und Statistik in Frankfurt a. M. Den Deutschen Geographentag 1936 in Jena besuchte er ohne Urlaubsantrag, ebenso den Oberdeutschen Geographentag auf der Insel Reichenau, 3.–8. 10. 1938. Dort war die Veranstaltung deutlich nationalsozialistisch ausgerichtet. Troll 1969, 31. Jaeger arbeitete im Krieg auch für die Westdeutsche Forschungsgemeinschaft in einer Kommission mit, die sich mit der Ostwanderung der Niederländer im Kontext eines SS-Programms befasste, zusammen mit Hans Oehler (Zürich). Fahlbusch 2003, 595. Jaegers Veröffentlichungen erschienen von 1933 bis 1945 in Deutschland, aber mit einigen Ausnahmen: 1933 «Report über den 16. Internationalen Geologenkongress Washington», 1934 und 1935 «Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft» (dort auch die ersten Ergebnisse aus Algerien, spätere Publikationen dazu wieder in Deutschland), 1936 Beitrag in «Schweizer Geograph», 1937 Beitrag in «Mélanges É.-F. Gautier» (Tours), 1938 «Compte-rendus» des Kongresses in Amsterdam (Thema «Siedlungsmöglichkeiten der weissen Rasse in den Tropen»), in «Journal of Geomorphology», «Mitteilungen der Geographisch-Ethnologischen Gesellschaft Basel», 1941 und 1944 wieder Beiträge in «Schweizer Geograph», 1945 ein Beitrag in «Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel». Troll 1969, 7.
682
Die Naturwissenschaftler
tisch beherrschten Deutschland zu betreiben (Indizien dafür waren u. a. sein öffentliches Lob für die politische Linie der «Neuen Basler Zeitung», bei der einer seiner Studenten namens Krüger tätig war und die ihm als einziges objektiv berichtendes Schweizer Blatt galt), und bald als «Auslanddeutscher» innerhalb von deutschen Organisationen aufzutreten. Jaeger hielt einmal schriftlich fest, dass er sich als Doppelbürger nach beiden Seiten verpflichtet fühle. Mehrfach geriet er in den Verdacht, in der Schweiz für das nationalsozialistisch geführte Deutschland zu arbeiten. Zum einen besuchten seine Söhne deutsche Schulen in der Grenzstadt Lörrach, der ältere seit 1934 und ohne die erforderliche Bewilligung des Basler Erziehungsdepartements.2932 Er fiel auch wegen Äusserungen auf, die er nach 1933 auf Exkursionen in Deutschland und in den Niederlanden machte: In Tübingen besuchte Jaeger bei einer Reise des Basler Instituts 1934 eine Parteiveranstaltung und erhob sich zum «Heil-Hitler»-Ruf, 1938 nach dem ‚Anschluss‘ Österreichs vertrat Jaeger gegenüber niederländischen Gastgebern die deutsche Position. Schliesslich kam es zu einem Konflikt mit dem Geographen und Journalisten Carl Hanns Pollog2933 im Jahre 1935. Der Streit mit Pollog trug zum Teil groteske Züge. Pollog war seit Sommer 1930 in Basel und wollte eine Assistentenstelle bei Jaeger erhalten, der sie ihm mit der Begründung verweigerte, er stelle nur Schweizer an. Die Kuratel sah den Ursprung des Konflikts darin, dass Jaeger der deutschen ‚Geopolitik‘ anhing, d. h. mit Karl Haushofer, den Pollog kritisierte, einig ging. Jaeger behauptete, Pollog sei im Institut unangenehm aufgefallen durch seine wiederholten Versuche, Kollegen und Studenten um Geld ‚anzupumpen‘, und seine Art, sich im Institut wie ein dort Angestellter aufzuführen, obschon er nur geduldeter Gast war.2934 Pollog 2932
2933
2934
Jaeger hatte 1928 die Erlaubnis bekommen, seinen ältesten Sohn Hermann, geb. 1921, während des Schuljahres 1928/29 zu Hause zu unterrichten. Für den anschliessenden Schulbesuch in Lörrach hatte er keine Bewilligung. Akten des ED dazu, August bis Dezember 1934, in: StABS ED-REG 1a, 1. Vgl. Troll 1969, 32 f. Pollog kam mit seiner Mutter aus Deutschland (Geburtsort Breslau), hielt sich seit 1934 in Basel auf, bekam am 4. 7. 1935 die Niederlassungsbewilligung und wurde 1952 eingebürgert (ich danke Christoph Manasse, Staatsarchiv Basel-Stadt, für seine Recherche in PD-REG 14a 12-4: Bürgerkontrolle (1920–1974), Nr. 93491, PD-REG 14a 9-7: Niederlassungskontrolle Ausländer (1936–1974), Nr. 19751, und Datenmarkt BS). Im Basler Adressbuch erschien er 1939 zum ersten Mal (als Schriftsteller). In den Akten zum Streit von 1935 wurde Burgfelden als Wohnort bezeichnet. Eine Biographie existiert nicht. Akten zur Streitsache Pollog-Jaeger in: StABS ED-REG 1a, 1, aus dem Jahr 1935. Anlass bot die Anordnung von Jaeger, dass Dr. Carl Hanns Pollog die Geographische Anstalt nicht mehr betreten dürfe. Pollog vermutete, er sei von NS-Agenten bespitzelt worden. Er erstatte deshalb Anzeige bei der Polizei. Daraufhin refüsierte der deutsche «Geographische Anzeiger» ein Manuskript von Pollog angeblich aus politischen Gründen. Pollog informierte dann Regierungsrat Hauser. Er publizierte 1935 tatsächlich nicht in Deutschland, sondern in den schwedischen «Geografiska Annaler», während er vorher meist in Deutschland veröffentlicht hatte. Seine Behauptung, er habe in Deutschland gleichzeitig
Geographie
683
war überzeugt, dass er von der deutschen Geheimpolizei bespitzelt werde, und vermutete, dass Jaeger seinen Einfluss im Verband deutscher Hochschullehrer der Geographie gegen ihn verwende. Jaeger beteilige sich in Deutschland als «Auslanddeutscher» freiwillig an der nationalsozialistisch ausgerichteten Wissenschaft. Während die Basler Behörden daraus keine grosse Sache machen wollten, war der damalige Kuratelspräsident Ernst A. Thalmann immerhin irritiert über die Briefe, die der Professor an Pollog geschrieben hatte, und hätte sich gewünscht, Jaeger würde nach Deutschland wegberufen. Insbesondere die Ausführungen von Jaeger über die mit dem Doppelbürgerstatus angeblich verbundenen Verpflichtungen gegenüber deutschen Stellen betrachtete Thalmann als beunruhigend.2935 Jaegers Engagement unter deutschen Geographen lässt sich mit den Berichten über die Deutschen Geographentage teilweise verifizieren. In der Untersuchungsperiode hat er 1934 am Treffen in Bad Nauheim und 1936 in Jena teilgenommen; weitere solche Tage fanden erst nach Kriegsende wieder statt. Beide hatten den üblichen Zuschnitt von wissenschaftlichen Kongressen unter der nationalsozialistischen Herrschaft, mit Telegrammen an Hitler und Bekenntnissen zur Nützlichkeit der Geographie für Volk, Nation und Staat. 1934 hatte Jaeger keine offizielle Funktion an der Tagung. Hingegen gehörte Carl Troll, damals Berliner Extraordinarius und späterer Biograph Jaegers, zu diesem Zeitpunkt dem Zentralausschuss an. Troll war als Nachfolger von Jaeger seit 1930 Professor für Kolonial- und Überseegeographie in Berlin2936 und erhielt 1938 den Lehrstuhl für Geographie an der Universität Bonn. Am Geographentag von 1936 referierte Troll prominent über «Kolonialgeographische Forschung und das deutsche Kolonialproblem» mit sprachlichen Konzessionen an den nationalsozialistischen Geist und einem warmen Plädoyer für ein neues deutsches Kolonialreich.2937 Jaeger selbst wurde 1934 in den Zentralausschuss gewählt. Er war der einzige Schweizer, der in der publizierten Tagungsdokumentation mit Namen erwähnt wurde. An zwei Diskussionen beteiligte er sich mit sachbezogenen Voten, aber nicht an Argumentationen, die die Geographie auf das neue Regime auszurichten trachteten.2938 An der Tagung von 1936 war Jaeger wiederum der einzige mit einer Schweizer Adresse. Unter den Mitgliedern des Zentralausschusses figurierte er
2935
2936 2937 2938
mit dem Konflikt mit Jaeger Publikationsverbot erhalten, ist plausibel. Pollog trat mit Arbeiten zur Verkehrsgeographie (Flugwesen) hervor. Geopolitik: Sprengel 1996, dieser zitiert Pollog beiläufig (103) mit einer Arbeit von 1925. Thalmann im Namen der Kuratel an Hauser, 14. 10. 1935, in: StABS ED-REG 1a, 1. Ausführliche Exzerpte aus der Korrespondenz zwischen Pollog und Jaeger und aus den Vernehmungen Jaegers: Siegrist 1989, 312–319. Troll 1969, 7. Troll 1937. Verhandlungen 1935, 16, 64, 133.
684
Die Naturwissenschaftler
nun an erster Stelle nach dem Vorsitzenden Ludwig Mecking (Hamburg). In dieser Funktion hatte er eine Sitzung zu präsidieren, die sich mit Thüringen befasste. Ein eigenes Referat hielt er nicht, auch ist keine Diskussionsbeteiligung vermerkt worden – was aber wenig bedeutet, da in diesem Jahr oft keine Debatten protokolliert wurden.2939 Sollte sich Jaeger also, wie Pollog behauptete, in vorderster Linie der nationalsozialistischen Geographie betätigt haben, so liefern die Geographentage zwar konkrete Anhaltspunkte für seine institutionelle und organisatorische Einbindung, sind aber unergiebig für Feststellungen über Jaegers inhaltliches und thematisches Engagement. Der Verdacht, Jaeger spioniere für Deutschland, wurde in Basel durch praktische Übungen geschürt, die er 1939 mit Studierenden an der Grenze zu Deutschland durchführte.2940 Vermutungen über geheimdienstliche Aktivitäten hingen damit zusammen, dass er als Geograph über eine Kartensammlung verfügte, die in Kriegszeiten als potentielle Waffe galt. Das Stadtkommando hatte angeordnet, dass Karten unter Verschluss zu halten seien, was Jaeger nicht befolgte. Immerhin gab er 1946 zu, dass um 1940 ein Vertreter einer deutschen Amtsstelle zu ihm gekommen sei und Kartenmaterial verlangt habe, was er allerdings abgelehnt habe.2941 Sein Institut war im Bernoullianum untergebracht, wo der Physiker Zickendraht eine Radiostation betrieb, von der geglaubt wurde, dass sie im Fall eines deutschen Überfalls eine besondere Bedeutung erhalten könnte. Ausgerechnet Jaeger soll 1940 die Luftschutzorganisation der Universität geleitet haben, hiess es – was Jaeger bestritt, er sei nur Hausluftschutzwart in seinem Privathaus gewesen. In Riehen verkehrte Jaeger zusammen mit dem Volkswirtschaftsprofessor Hans Ritschl, der wie er 1928 nach Basel berufen worden war, aber 1942 von Basel nach Strassburg wechselte,2942 im Zirkel des deutschfreundlichen Appellationsgerichtspräsidenten Gerhard Boerlin-Wackernagel. Für 1938 wurde bezeugt, dass er als Gast am Montagskränzchen des Volksbundes für die Unabhängigkeit der Schweiz in der Holbeinstube anwesend gewesen sei (was er bestritt). Im selben Jahr gaben Jaegers Söhne die schweizerische Staatsbürgerschaft auf, was dem Riehener Gemeindepräsidenten und dem Basler Regierungsrat Fritz Hauser merkwürdig vorkam; Jaeger meinte aber, dies sei der freie Entschluss seiner Söhne, den er nicht zu verantworten habe.2943 Die Studierenden und die Riehener
2939 2940 2941
2942 2943
Verhandlungen 1937, 5, 7, 27. Troll 1969, 31, zu den «geographischen Arbeitsgemeinschaften im Gelände». Bericht der Politischen Abteilung des Polizeidepartements Basel, 15. 5. 1940, über die Vernehmung von Greti Hadorn-Diez, Assistentin von Jaeger. Protokoll über die Einvernahme des Herrn Prof. Dr. Fritz Jaeger, 10. 5. 1946, 15.00 Uhr, in: StABS ED-REG 1a, 1. Zum Schicksal der Akten der Basler Politischen Polizei: Wichers 2020. Schäfer 1999, 110. Jaeger an Hauser, 17. 1. 1939, in: StABS ED-REG 1a, 1.
Geographie
685
Nachbarn wussten, dass Jaeger gerne Hitlerreden hörte, die im deutschen Radio übertragen wurden. Er war überzeugt, dass Hitler Deutschland zu neuer Grösse führen werde, und er attestierte dem Diktator noch nach Kriegsende, er habe das Land vor einer kommunistischen Revolution bewahrt. In den Vorlesungen äusserte er sich zunächst nicht aggressiv-pronationalsozialistisch und kommentierte auch schweizerische Verhältnisse nicht direkt, aber den Studierenden war dennoch aufgrund vieler Formulierungen Jaegers klar, dass er eine nationalsozialistische Gesinnung hatte und dass er die ‚Bewegung‘ in Vorlesungen und Übungen positiv darstellte.2944 1943 beklagte sich die Studentenschaft beim Rektor über Jaeger, der die Industriearbeiterschaft als von «Rassen- und Volksfremdlingen» geführt darstelle und die nationalsozialistische deutsche Arbeitsorganisation als vorbildlich bezeichne. Der Rektor wollte darauf nicht eintreten und verwies die Studierenden an die Kuratel, die nichts unternahm.2945 Den Verdachtsmomenten wurde vom Erziehungsdepartement weder unter Fritz Hauser noch unter dessen Nachfolger Carl Miville energisch nachgegangen. Die Politische Abteilung des Polizeidepartementes suchte 1940 in Jaegers Publikationen nach Hinweisen auf seine Gesinnung, nachdem er im Herbst 1939 nationalsozialistisches Propagandamaterial zugestellt bekommen hatte.2946 Nach kolportierten Äusserungen von 1939 und 1940 hielt er die Schweiz für einen England ergebenen Staat; ein eventueller deutscher Einfall in die Schweiz rechtfertige für Basel keine Evakuierung, da nach drei Tagen wieder Normalität einkehren
2944
2945
2946
Aussage von Max Gschwend, Lehrer für Geographie und Naturkunde, seit 1947 Leiter der Aktion Bauernhausforschung in der Schweiz, der 1940–1945 bei Jaeger studiert hatte und von 1941 bis 1943 sein Assistent gewesen war, 12. 1. 1948, in: StABS ED-REG 1a, 1. Gschwend berichtete auch, dass Jaeger die Schuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bei England und Amerika sah und dass er die Deutschschweiz «kulturell und geistig» als Deutschland zugehörig betrachtete. Jaegers Vorlesungsmanuskript «Die Erde als Lebensraum des Menschen» von 1943 wurde für das Verfahren zur Amtsenthebung ausgewertet; Siegrist 1989, 315–317. Jaeger identifizierte sich mit Schlagwörtern wie «Volksgemeinschaft», hielt die NSDAP für eine sozial wirkende Bewegung, zählte einen Teil der Schweiz zum «deutschen Volksboden», unterstellte den «Juden Amerikas und Englands» das Ziel, «das deutsche Volk zu vernichten», hoffte auf «Deutschlands Sieg über Sowjetrussland», der Europa vor dem «Schreckgespenst des Bolschewismus bewahren» werde, etc. Diese kulturgeographische Vorlesung hatte er seit seinem Amtsantritt in Basel mehrmals gehalten. Troll 1969, 28–30 zu den fachlichen Intentionen Jaegers. Briefwechsel zwischen André Meyer, cand. Phil. II Zürich, Hugo Aebi, Präsident der Basler Studentenschaft, und dem Basler Rektorat, Mai und Juli 1943, in: StABS UA XI A 3, 2, Fritz Jaeger. Die Bundesanwaltschaft hatte am 29. 9. 1939 das Basler Polizeidepartement darauf aufmerksam gemacht, dass Jaeger nationalsozialistisches Propagandamaterial empfangen habe. Im Herbst des folgenden Jahres beschaffte die Polizei Schriften von Jaeger bei dessen Assistentin Greti Hadorn-Diez. Akten dazu in: StABS ED-REG 1a, 1.
686
Die Naturwissenschaftler
würde. Widerstand wäre zwecklos.2947 Daraufhin überging ihn die PhilosophischNaturwissenschaftliche Fakultät, als 1942/43 der Turnus an ihm gewesen wäre, Dekan zu werden.2948 Eine nach Basler oder Bundesgesetzen strafbare Handlung schien lange nicht vorzuliegen, und die Gesinnung war im Rechtsstaat nicht juristisch relevant. Zudem achteten die Bundesbehörden in Bern darauf, dass der nördliche Nachbarstaat nicht durch Massnahmen gegen seine Bürger in der Schweiz gereizt werde, was auch die Bereitschaft der Basler Behörden, vor 1943 oder vor 1945 gegen Freunde des Nationalsozialismus vorzugehen, verminderte. Dies änderte sich 1946, als die Kuratel entdeckte, dass Jaeger 1943 Mitglied der Vortragsgesellschaft Basler Pfalz geworden und geblieben war. Den Basler Staatsangestellten war diese Mitgliedschaft explizit verboten worden, da die Organisation, die vorgeblich nur gute kulturelle Beziehungen zwischen der Schweiz und Deutschland pflegen wollte, den Behörden als getarnte Fortführung einer anderen verbotenen Organisation, der Eidgenössischen Sammlung, galt. Nun lag ein Verstoss vor, der geahndet werden konnte.2949 Auf dieser Grundlage beschloss der Regierungsrat schliesslich am 21. Oktober 1947, Jaeger aus disziplinarischen Gründen zu entlassen. Als er während des Disziplinarverfahrens von den Basler Behörden 1946 einvernommen wurde, gab er ein zusammenhängendes politisches Statement ab: Den Ruf nach Basel habe er angenommen, weil er befürchtete, in Deutschland als Bürgerlicher von den Bolschewisten umgebracht zu werden. Dank Hitler seien Deutschland und Europa von einer kommunistischen Diktatur verschont geblieben. Den ‚Anschluss‘ Österreichs ans ‚Reich‘ begrüsse er als einen Akt der Selbstbestimmung der Österreicher. Seine Zustimmung fand auch die «Zusammenarbeit» der europäischen Staaten im ‚Neuen Europa‘, welche Hitler nach Jaegers Meinung herbeiführen wollte, um die Kriege und die Gefahr des Bolschewismus auf Dauer zu bannen.2950 Jaeger hielt seine nationalsozialistische Weltsicht für die Wahrheit, die er nicht verleugnen wolle. Ob er aus Naivität, mangelndem politi2947
2948 2949
2950
Eine dieser Aussagen stammte von Jaegers Frau, die im September 1939 zu Greti Hadorn gesagt haben soll, die Mobilisation der Schweizer Armee sei überflüssig. Greti Hadorn bestätigte, dass ihr Jaeger anlässlich des deutschen Einfalls in Norwegen versprach, eine Besetzung der Schweiz durch deutsche Truppen würde reibungslos ablaufen. Politische Abteilung des Polizeidepartements, Bericht, 15. 5. 1940, in: StABS ED-REG 1a, 1. Einvernahme von Prof. Louis Vonderschmidt, 8. 1. 1948, in: StABS ED-REG 1a, 1. Jaeger an ED bescheinigt unterschriftlich, den Regierungsratsbeschluss vom 6. 12. 1938 betr. Unvereinbarkeit des öffentlichen Dienstes mit der Zugehörigkeit zu kommunistischen und anderen staatsfeindlichen Organisationen empfangen und vom Inhalt desselben Kenntnis genommen zu haben, vorgedrucktes Formular, 20. 12. 1938, in: StABS EDREG 1a, 1 Dossier Prof. Dr. Fritz Jaeger 1928–1948. Dass die ‚Pfalz‘ unter diese Kategorie fiel, war den Staatsangestellten schriftlich eröffnet worden. Berichtigungen zum Protokoll vom 10. 5. 1946, in: StABS ED-REG 1a, 1.
Geographie
687
schem Durchblick, fehlgeleitetem Patriotismus oder tieferen psychologischen Gründen so dachte und sich so verhielt, bleibt offen.2951 Bemerkenswert sind vielmehr die Reaktionen des universitären, administrativen und politischen Umfelds. Dass nicht jedem Gerücht nachgegangen wurde, dass die Darstellung von Jaegers Tendenzen durch eine schwierige Persönlichkeit wie Pollog nicht zum Nennwert genommen wurde, dass eine rechtliche Handhabe zunächst fehlte, all dies sind hinreichende Erklärungen für die Passivität des Umfeldes und der Vorgesetzten. Auffällig ist nur, wie gross im Basler Universitätsbereich die Toleranz gegenüber einem überzeugten, unbelehrbaren Hitleranhänger war, der ungehindert (wenn auch meist mit relativer Zurückhaltung) seine Ansichten vor Studierenden vertreten konnte. Immerhin war er als Dekan nicht erwünscht. Wer sich für Geographie interessierte, musste bei Jaeger studieren und abschliessen, da er der einzige Ordinarius des Faches war. Im umfangreichen Untersuchungsdossier fehlte aber jeder Hinweis darauf, dass er, wie vor ihm Gerlach, Studierende im Sinne des Nationalsozialismus persönlich beeinflusst hätte. Insofern war er vergleichsweise harmlos. Geographie bot in Deutschland ein Beispiel für die Vorbereitung einschlägiger ideologischer Elemente auf ‚1933‘ und dann für die Verflechtung eines wissenschaftlichen Feldes mit den Nationalsozialisten durch Selbstmobilisation.2952 Hans Dietrich Schultz hat dies differenziert am Beispiel von Albrecht Penck aufgezeigt.2953 Schultz analysierte die Vorstellungswelt einer Wissenschaftlergeneration, die noch vor 1914 fachlich wie politisch sozialisiert worden war und selbstverständlich ‚national‘ dachte. Deshalb verstand sie auch ihre Wissenschaft als direkten oder indirekten Beitrag zur Förderung nationaler Ziele. Geographie war, obschon institutionell den Naturwissenschaften zugehörig, kein Fach, in dem Ergebnisse reiner Wissenschaft gegen Ideologien abgeschottet war. Wer einen deutschen Fachvertreter mit einem solchen Profil auf eine Schweizer Professur wählte, musste in Kauf nehmen, dass er dieser Vorstellungswelt anhing. Daraus ergaben sich bis 1933 keine Probleme. Dass Jaeger nicht primär über und für die Schweiz arbeitete, erleichterte einerseits eine gewisse Toleranz ihm gegenüber, schaltete ihn andererseits aus der Diskussion über eine ideologische Indienstnah2951
2952 2953
Carl Troll warb stets um Verständnis für den «naiven» Jaeger, in: Troll 1974, und schon im Nekrolog in den Erlanger Geographische Arbeiten, H. 24, 1969. Bereits zu Jaegers Lebzeiten betrachteten ihn einige als «gutgläubig», «persönlich treu und aufopfernd», subjektiv ein Freund der Schweiz, der aber auf die Nationalsozialisten hereingefallen sei. Schreiben des Ehemanns von Jaegers früherer Sekretärin Greti Hadorn an das ED, 14. 1. 1948, sowie die Einvernahme vom 8. 1. 1948 mit Hans Schaub, Schüler von Jaeger in den Jahren 1932–1937, damals Lehrer am Realgymnasium, später Direktor des Naturhistorischen Museums; dieser Sozialdemokrat bezeichnete ihn als naiv und unfähig, politisch zu denken, in: StABS ED-REG 1a, 1. Vgl. dazu die frühe Intervention von Rössler 1987. Schultz 2018.
688
Die Naturwissenschaftler
me der Geographie für einen schweizerischen Nationalismus aus.2954 Die neue Qualität einer totalen Weltanschauung und ihres Anspruchs, auch die Wissenschaft als Kampfinstrument in ihren Dienst zu nehmen, die sich nach 1933 in Deutschland durchsetzte, verlieh dem Professorenpatriotismus mancher Deutschen eine neue Dimension, falls sie diesem Quantensprung im Verhältnis zwischen Wissenschaft und Nation nicht kritisch begegneten. Jaeger war nicht von dieser Art. Er konnte im Nationalsozialismus nur das ‚Positive‘ sehen und daran ‚glauben‘. Jaeger war er kein aktiver NS-Propagandist, er organisierte keine NS-Gruppen und wir lesen nichts über enge Beziehungen zum Deutschen Konsulat und den von dort gesteuerten Aktivitäten der deutschen Nationalsozialisten in Basel. Die durch den bevorstehenden Krieg geschaffenen neuen Situationen und der Angriff auf Belgien, Frankreich und die Niederlande vom Mai 1940 waren Anlässe für eine Furcht vor der möglichen Zugehörigkeit Jaegers zu einer 5. Kolonne, die den deutschen Einmarsch vorbereiten oder erleichtern könnte. Die nachträglich erkannte Zugehörigkeit zur Basler Pfalz lieferte mit beachtlicher Verzögerung den Grund zur Abrechnung mit einem unverbesserlichen Nationalsozialisten. Aber diese Abrechnung war ohne Rücksicht auf den Rechtsstaat unternommen worden: Jaeger rekurrierte und konnte einen Teil seines Pensionsanspruchs retten. Das Ergebnis war wie so oft eine (hier nachträgliche, da der Lehrstuhl ja während der NS-Zeit nicht vakant wurde) ‚Helvetisierung‘ des Faches. Paul Vosseler und Hans Annaheim übernahmen nach Jaegers Absetzung das Institut: Annaheim erhielt einen Lehrauftrag 1947, während Vosseler zum interimistischen Leiter des Geographischen Instituts erhoben wurde, ein Zustand, der von 1947 bis 1961 dauerte.2955
8.7 Botanik Die dominierende Gestalt der Basler Botanik war in meiner Untersuchungsperiode Gustav Senn-Bernoulli. Er stammte aus einer Familie von Basler Seidenbandunternehmern. Nach Absolvierung des Humanistischen Gymnasiums studierte er in Neuchâtel bei Fritz Tripet und in Basel. 1898 doktorierte er über Algen bei Georg Albrecht Klebs, der von 1887 bis 1898 in Basel wirkte. Im Zusammenhang mit Algen stand auch Senns Beitrag über Flagellaten zum Handbuch Die Natürlichen Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen und wichtigeren Arten, insbesondere den Nutzpflanzen von Adolf Engler und Karl Prantl. Zur Weiterbildung begab sich Senn an deutsche Universitäten. In Halle besuchte er Klebs, der ihn zum Studium der Chromatophoren und deren Bewegungen im Licht angeregt hatte, 2954 2955
Siegrist 1989. Nipp o. J., Paul Vosseler.
Botanik
689
und in Kiel das Botanische Institut von Johannes Reinke, einem Algenspezialisten mit einer kritischen Haltung gegenüber den Darwinisten. Namentlich in Leipzig bei Wilhelm Pfeffer (dieser war 1877/78 in Basel Professor gewesen) wandte sich Senn dem Thema zu, das den Gegenstand seines ersten Hauptwerks Die Gestaltsund Lageveränderung der Pflanzen-Chromatophoren, Leipzig 1908, bildete. In Neapel lernte er Meeresorganismen kennen. Nach einer Exkursion auf Korsika als Begleiter von Martin Rikli im Jahr 1900 habilitierte sich Senn 1901 in Basel; 1908 wurde er zum Extraordinarius befördert. In dieser Zeit unternahm er eine Studienreise nach Java, Ceylon und der Malakka-Halbinsel (1910/11). Als 1912 ein nur kurze Zeit in Basel wirkender deutscher Botaniker, Alfred Fischer, die Universität verliess, erhielt Senn den Basler Lehrstuhl. Trotz bedeutenden wissenschaftlichen Leistungen stand die Botanik mit ihren wenigen Hauptfachstudenten in Basel im Schatten der Geologen und der Zoologen. Senn war als Lehrer nicht sehr beliebt, da er strenge Sachlichkeit verlangte in einer Zeit, da die Studierenden Orientierung verlangten und grosse Zusammenhänge erfahren wollten. Ab 1918 befasste er sich mit der Physiologie der Alpenpflanzen, doch seit etwa 1920 galt Senns Interesse dem griechischen Botaniker Theophrast von Eresos. In sorgfältiger, philologischer und naturwissenschaftlicher Arbeit emendierte und kommentierte er Theophrast, ohne allerdings vor seinem Tod zu einer Edition und Übersetzung des Gesamttextes zu gelangen. Senn kommandierte ein Basler Bataillon und war von 1919 bis 1927 Basler Platzkommandant, d. h. auch in der Phase grosser Streikbewegungen. Neben ausgeprägten militärwissenschaftlichen Interessen und der Förderung des Hochschulsports zeigte er soziale Aufgeschlossenheit und beteiligte sich am Aufbau der Volkshochschule. Ernst Staehelin hob bei der Abdankung seine «Menschenliebe» hervor und – was sonst selten geschah – würdigte seinen Einsatz für zahlreiche Flüchtlinge.2956 Daneben war er in verschiedenen lokalen und nationalen Fachgesellschaften der Naturwissenschaften tätig; die Schweizerische Botanische Gesellschaft präsidierte er von 1921 bis 1924, die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft von 1935 bis 1940. Als Mitbegründer der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften war er von 1921 bis 1935 deren Präsident. Die vor dem Ersten Weltkrieg enge Beziehung zur deutschen Botanik scheint sich nachher gelöst zu haben zugunsten einer international weiter ausgreifenden Orientierung, die auch die Arbeit an Theophrast betraf. Senn publizierte hauptsächlich in den «Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft», in deren Basler Schwesterreihe, in den «Berichten der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft» – ausgenommen seine Nachrufe auf Hermann Christ, die in Deutschland und England erschienen. Die Arbeit an Theophrast war faktisch eine Weiterführung der Studien von Sir William Thisel2956
Staehelin 1945.
690
Die Naturwissenschaftler
ton-Dyer und trug ihm eine Einladung nach Edinburgh und den Respekt der britischen Forscher ein, den der Nachruf auf ihn in «Nature» von 1945 dokumentiert. 1924/25 war er Gastprofessor in Cambridge gewesen.2957 Als Extraordinarius wirkte Otto Schüepp am Botanischen Institut. Der Thurgauer studierte 1906 bis 1909 an der ETH. Dann wurde er dort Assistent beim Pflanzengeographen Carl Schröter, bei dem er 1911 doktorierte. Anschliessend war er bis 1918 Assistent am Pflanzenphysiologischen Institut der Universität München. Danach assistierte er bei Gustav Senn, zugleich habilitierte er sich 1918 hier. Ab 1920 lehrte er im Hauptberuf Mathematik und Naturwissenschaften am Basler Missionsseminar und zeitweise an der Freien Evangelischen Schule. 1928 erfolgte die Beförderung zum ausserordentlichen Professor, der er bis zu seiner Emeritierung 1958 blieb. Seit 1929 hatte er einen Lehrauftrag für Morphologie und Entwicklungsgeschichte der Pflanzen, der sich im Wesentlichen an die Lehramtskandidaten und Nebenfachbotaniker richtete. Seine Forschungen galten der Entwicklungsmorphologie und dem Widerspruch zwischen christlicher Schöpfungslehre und Naturwissenschaft.2958 Wie Senn war Wilhelm Vischer in der Algenforschung aktiv, allerdings nach einem längeren Aufenthalt in den Tropen. Er hatte in Basel als Medizinstudent begonnen und sich dann in Genf unter dem Einfluss des dortigen Botanikprofessors Robert Chodat der Botanik zugewandt. Das Doktorat absolvierte er 1914 in München bei Karl von Goebel, einem Morphologen, der Java, Ceylon, Venezuela und Britisch-Guyana bereist hatte. Im Jahr der Promotion begab sich Vischer zusammen mit Chodat nach Paraguay. Von 1919 bis 1923 untersuchte Vischer Möglichkeiten zur Optimierung der Kautschuk-Gewinnung in Buitenzorg. Er verband damit eine Expedition nach Ostjava und Bali. 1924 war er zurück in Basel und habilitierte sich hier. Zwei Jahre später erhielt er auf Antrag von Senn den Lehrauftrag für «Systematische und pharmazeutische Botanik und Pflanzengeographie»; 1928 den Titel eines Extraordinarius. Seine Hauptvorlesung galt der Pflanzengeographie. Der humanistische Idealist, ‚Zofinger‘, aktiver Alpinist im SAC und energischer Kämpfer für den Naturschutz stand unter den nächsten Kollegen als unbequemer Kämpfer für strikte Moralität isoliert da. Die internationale Fachwelt schätzte jedoch den Algenforscher, und die Studierenden waren von seinen Exkursionen angetan, die immer auch kulturhistorische Aspekte einschlossen. Vischer war begeisterter Offizier (Oberleutnant) in beiden Weltkriegen. Er gehörte von 1923 bis zu seinem Tod der Kommission des Nationalparks an. In seinem 1946 in Basel erschienen Buch Naturschutz in der Schweiz plädierte er für die Rücksichtnahme auf die natürliche Umwelt, nachdem er von 1927 bis 1939 die Naturschutzkommission der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft präsidiert hatte. Er stand der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft vor 2957 2958
Nachruf auf Gustav Senn, in: Anonym 1945/46; Geiger (⌥Huber) 1945. Nipp o. J., Otto Schüepp; Wichers 2011a; Nachruf in der Basler Zeitung am 23. 2. 1981.
Botanik
691
und war Mitbegründer der Basler Botanischen Gesellschaft. Vischer engagierte sich während der 1930er und 1940er Jahre für Flüchtlinge (vor allem Studierende und Fachkollegen) und leitete von 1937 bis 1938 die Schweizerische Zentralstelle für Flüchtlingshilfe.2959 1938 stiess der Elsässer Emil Heitz-Staehelin2960 zu den Basler Botanikern. Auf ein in München, dann in Strassburg angefangenes Biologiestudium folgte der deutsche Militärdienst im Ersten Weltkrieg. 1919 nahm er das Studium in Basel auf und doktorierte 1921 in Heidelberg. Nach Aufenthalten an mehreren deutschen Instituten holte ihn Hans Winkler 1926 von Greifswald an das Institut für Allgemeine Botanik in Hamburg. Er wurde dort im selben Jahr Privatdozent und 1932 ausserordentlicher Professor mit einer Spezialisierung in Zytogenetik. Nachdem er 1933 das Bekenntnis der deutschen Professoren zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat unterschrieben hatte, merkte er bald, dass er unter nationalsozialistischem Regime in Schwierigkeiten geraten musste, weil sein Grossvater mütterlicherseits, ein protestantischer Pfarrer, nach nationalsozialistischer Definition Jude gewesen war. Bereits 1933 suchte der freisinnige Solothurner Ständerat Robert Schöpfer für ihn eine Stelle in Basel (dem Herkunftsort von Heitz’ Frau), aber die Kuratel verhielt sich ablehnend. Als Heitz im Frühjahr 1936 in Basel erneut sondieren liess, ob er an der Universität unterkommen könne, stellte Gustav Senn ausdrücklich fest, es bestehe kein sachlich begründeter Bedarf für einen Heitzschen Lehrauftrag; dementsprechend verhielten sich auch die Kuratel, die eine «reine charitative Unternehmung» vermeiden wollte, und Regierungsrat Hauser ablehnend. Damit war der Weg zu einem bezahlten Lehrauftrag verbaut. Adolf Portmann, der mit Heitz befreundet war, erklärte gegenüber Hauser, es würden sich private Mittel finden lassen, um ihn zu finanzieren.2961 1937 wurde Heitz schliesslich wegen ‚nichtarischer Abstammung‘ in Hamburg entlassen. Trotz ihrer ausgesprochenen Zurückhaltung stimmte die Basler Fakultät 1938 einer Umhabilitation hierher zu, worauf Heitz weiter den Titel eines Extraordinarius führen konnte – unter der Bedingung, dass sich für den Staat daraus keine Auslagen ergäben.2962 1947 wurde er in Basel eingebürgert, konnte einige Monate in Columbia an der University of Missouri unterrichten, lebte danach aber wieder bis 1955 in Basel. In diesem Jahr wurde er wissenschaftliches Mitglied am Max-
2959 2960 2961
2962
Wichers 2013a; Rütimeyer 1962; Nekrolog in den Basler Nachrichten am 3. 6. 1960; Anonym 1950. Zoller 2011. https://de.wikipedia.org/wiki/Emil_Heitz_(Botaniker). Zur wissenschaftlichen Bedeutung zuletzt Berger 2019, vorher ausführlich Passarge 1979. StABS Protokoll T 2 Kuratel Bd. 12, 1930–1935, 393, 1. Sitzung, 5. 2. 1934. Nr. 13, 1935– 1941, 68, 4. Sitzung, 4. 5. 1936; 97, 8. Sitzung, 6. 7. 1936; 185, 5. Sitzung, 26. 4. 1937; 243, 1. Sitzung, 3. 1. 1938. StABS Protokoll S 4 Erziehungsrat Bd. 24, 1936–1938, 31. 1. 1938.
692
Die Naturwissenschaftler
Planck-Institut für Biologie in Tübingen und Honorarprofessor für Zytologie an der dortigen Universität. Max Geiger-Huber2963 war ein Schüler von Senn, der sich wie sein Lehrer der Pflanzenphysiologie zugewandt hatte. 1927 promovierte er mit einer experimentellen Arbeit zum Stoffwechsel von Aspidistra. 1929 bis 1931 war Geiger Rockefeller Fellow in Utrecht bei Frits Went, einem der führenden Spezialisten für Pflanzenhormone. Nach der Rückkehr wurde er Assistent bei Senn und habilitierte sich 1934. 1939 erfolgte die Beförderung zum Extraordinarius. Kurz vor Kriegsausbruch war er Gast bei Runar Collander in Helsinki, der über Permeabilität und Osmose forschte, wodurch seine enge Beziehung zu den finnischen Botanikern begründet wurde. Nach dem Tod von Senn wurde Geiger 1945 dessen Nachfolger auf dem Basler Lehrstuhl (emeritiert 1971). 1936 hat er einmal in den «Jahrbüchern für wissenschaftliche Botanik», Leipzig, publiziert, zusammen mit seinem Basler Kollegen Ernst Burlet, sonst fast immer in den Periodika lokaler Fachgesellschaften und in den «Proceedings of Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam» (1930, offensichtlich die Ergebnisse der Arbeit bei Frits Went). Die Botanik bietet uns somit Beispiele für Forscher, die vor 1914 eng auf die deutsche Wissenschaft bezogen waren, sich danach jedoch einerseits in schweizerischen Publikationsstrukturen, andererseits in westeuropäisch-internationalen resp. finnischen Fachkreisen und Journalen bewegten. Nach 1933 blieb nur Heitz in einer deutschen Situation, die zu verlassen ihm schwergemacht wurde, bis er 1937 wegen eines jüdischen Vorfahren in die Heimat seiner Frau, nach Basel, übersiedelte, wo er offensichtlich nicht willkommen war. Die relativ grosse Zahl der Dozenten, die trotz der wenigen Studenten neben dem Ordinarius Senn Botanik lehrten, war die Grundlage für eine Argumentation, die darauf hinauslief, dass kein Bedarf für die akademische Tätigkeit von Flüchtlingen aus Deutschland bestehe.
8.8 Zoologie – Adolf Portmanns Abwehr des Nationalsozialismus 8.8.1 Einleitung Die Basler Zoologie stand in einer grossen Tradition, die auf Ludwig Rütimeyer zurückging, der zu den bedeutenden Erforschern der Entwicklungsgeschichte der Arten gehörte. Sein Lehrstuhl ging 1893 an Fritz Zschokke, der als Erster ein eigentliches Zoologisches Institut in der Alten Universität aufbaute.2964 Nach sei-
2963 2964
Zoller 1978; Anonym 1945. Simon 2015, 40–70.
Zoologie
693
nem Rücktritt wählte der Regierungsrat 1931 Adolf Portmann, dem ich nachstehend eine ausführliche Darstellung widme.2965 Neben dem Lehrstuhl von Portmann hatte Eduard Handschin seit 1925 einen Lehrauftrag für Systematische Zoologie, Parasitologie und Hydrobiologie, der 1927 in ein Extraordinariat umgewandelt wurde. Ab 1942 war Handschin ordentlicher Professor ad personam für Entomologie. 1927 hatte er als Gastdozent die Universität Cambridge besucht, anschliessend führte er 1928 Forschungen an der Experimentalstation Harpenden (England) durch. Handschin beschäftigte sich von 1930 bis 1932 mit der Untersuchung und Bekämpfung der Büffelfliege in Indonesien und Australien. Von 1932 bis 1959 war er für das Naturhistorische Museum Basel tätig, zunächst in der Museumskommission, die er ab 1946 präsidierte, dann von 1956 an als Museumsdirektor.2966 Ein Freund Portmanns, Rudolf Geigy, wurde 1938 ausserordentlicher Professor für Experimentelle Embryologie und Genetik. Geigy leitete ab 1943 das Schweizerische Tropeninstitut, erhielt aber erst 1953 ein Ordinariat an der Universität.2967 Heini Hediger promovierte 1932 bei Adolf Portmann und habilitierte sich 1935. Nach einer Tätigkeit am Basler Naturhistorischen Museum war er von 1938 bis 1943 Zoodirektor in Bern, von 1944 bis 1953 in Basel und von 1954 bis 1973 in Zürich. Von 1942 bis 1953 lehrte er daneben als ausserordentlicher Professor an der Universität Basel. In den folgenden 26 Jahren war er Titularprofessor für Tierpsychologie an der Universität Zürich.2968 1942 habilitierte sich Hans Mislin in Basel für Zoologie mit einer Studie über Chiroptera. Seit 1937 war er Assistent gewesen, bis 1946 diente er als Oberassistent, während er zwischenzeitlich den Extraordinarientitel erhalten hatte. 1945 gründete er die interdisziplinäre Zeitschrift «Experientia Monatsschrift für das gesamte Gebiet der Naturwissenschaft» im Basler Birkhäuser-Verlag, die die deutsche, bei Springer erschienene Zeitschrift «Die Naturwissenschaften» ablösen sollte, denn das ehemals renommierte Springersche Verlagsprodukt war ‚arisiert‘ worden und erschien 1945 nicht mehr. Später wurde Mislin Zoologieprofessor in Mainz.2969 (Karl) Adolf Portmann2970 war einer von denjenigen Basler Professoren, die auf eine oft diskrete, aber immer bestimmte Art Konzessionen an den nationalso-
2965 2966 2967 2968 2969 2970
Ich danke Roger Alfred Stamm für die Erlaubnis, den Nachlass von Alfred Portmann zu benützen, sowie für seine Einführung. Simon 2009a, 145–154; Keiser 1966. Freyvogel 2006. König 2011. Von Hahn/Jenkins 1994; «Verzeichnis der Professorinnen und Professoren der Universität Mainz 1477–1973». Lebensdaten in: Ritter 2015, 48 f.; Stamm/Fioroni 1984, 88 f.
694
Die Naturwissenschaftler
zialistischen Zeitgeist und Einfluss entschieden ablehnten. Dies tat er nicht nur aufgrund einer politischen und familiären Prägung seiner Sensibilität, sondern vor allem aufgrund seiner Wissenschaftsauffassung als Biologe. Portmanns Biologie und deren hauptsächliche Agenda sind, wie Markus Ritter gezeigt hat, um 1940/41 fertig angelegt gewesen. Deren Erarbeitung fiel in die 1920er und 1930er Jahre. Sie erfolgte somit gleichzeitig mit dem Aufstieg der faschistischen und nationalsozialistischen Ideologien.2971 Ich möchte zeigen, wie Portmann zur Abwehr nationalsozialistischen Gedankenguts an der Universität Basel und darüber hinaus beitrug und welche wissenschaftlichen Überlegungen ihn dabei leiteten. Nach einer Einführung in Portmanns Bildungsgang und Karriere betrachte ich seine Auseinandersetzung mit den Ideologien der Zeit. Man mag einwenden, dass die nachstehend diskutierten Momente fast alle rein innerwissenschaftlich seien, war es doch gerade ein Anliegen Portmanns, die Grenzen zwischen wissenschaftlichen und ausserwissenschaftlichen Aussagen klar zu ziehen. Doch die Wissenschaft im Nationalsozialismus kannte keine Trennung von Wissenschaft und Politik; sie sollte selbst politisch werden und Politik mit wissenschaftlich klingenden Schlagworten begründen. Wenn also Portmann Ergebnisse der Wissenschaft darlegte, war dies unter den damaligen Umständen auch ein politisches Handeln, das darauf abzielte, die Indienstnahme der Wissenschaft und die negativen Folgen der Pseudowissenschaft anzuprangern und über die Denkfiguren der Ideologen aufzuklären. Ich benütze hier seine Vorlesungen und Vorträge aus der Zeit vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs und stütze ich mich insbesondere auf Dokumente aus seinem reichen Nachlass. Da er seine Vorlesungen und viele seiner Vorträge nicht wörtlich ausarbeitete, bestehen diese Texte meist aus Notizen und Stichwortsammlungen. Diese hat er offensichtlich erweitert und mehrfach benutzt, so dass es schwierig ist, sie exakt einem bestimmten Jahr zuzuordnen. Markus Ritter hat Hinweise zur Datierung gegeben, denen ich gerne folge.2972 8.8.2 Grenzen der Entwicklungsidee Die politische Verwendung von Themen aus dem Werk Charles Darwins, wie sie im deutschen Kulturkampf des 19. Jahrhunderts und in der Nachfolge Ernst Haeckels üblich war, hielt Portmann schon früh für problematisch. Er hinterfragte den Umgang mit dem Motiv der Entwicklung des Lebens und die Wirkungen der Erkenntnisse Darwins intensiv. Portmanns Auseinandersetzung mit den biologischen Entwicklungslehren, die sich in die Basler Tradition einfügte, betrachte
2971 2972
Ritter 2000, 208. Ritter 2000.
Zoologie
695
ich als grundlegend für das Verständnis seiner Position in den 1930er und 1940er Jahren, so dass ich sie an den Anfang der Ausführungen stelle. Als Hypothesen, die begrenzte, aber doch wichtige Einsichten eröffneten, würdigte er die Leistungen Darwins. Dennoch verlangte er eine präzise Bestimmung der Grenzen, innerhalb derer Darwins Auffassung ertragreich sein könne. Sein Studium der Schriften von Jean-Baptiste Lamarck2973 in den drei Jahren, die er am Laboratoire Arago in Banyuls-sur-Mer verbrachte, und seine Hochachtung für den südfranzösischen Entomologen Jean-Henri Fabre,2974 der nicht nur den Darwinismus,2975 sondern auch Darwins eigene Formulierungen ablehnte, ist dafür aufschlussreich. Innerhalb der Biologie hasste er zunächst alles Dogmatische und die ‚einfachen‘ Erklärungen für reduziert wahrgenommene Phänomene. «Portmann lehnte die reduktionistische Doktrin ab, die in der Auflösung aller biologischen Fakten in chemische und physikalische Vorgänge das eigentliche Ziel der Forschung sieht. Auch konnte er nicht akzeptieren, dass die ‚synthetische Evolutionstheorie‘ als umfassende integrative Konzeption die Entstehung aller biologischen Fakten im Prinzip solle erklären können.»2976 Vor dem Munot-Verein in Schaffhausen sprach er am 21. November 1928 über «Neue Forschungen zum Problem der Menschwerdung». Er kritisierte damals wie später die Auffassung, Darwin habe dieses Problem gelöst. Eine Vorliebe zeigte er für Louis Bolk, der den Menschen als Affen gesehen hatte, der im embryonalen Zustand verharre.2977 Dieser Vortrag stand am Anfang des Wegs, der Portmann in den 1940er Jahren zu der Einsicht führte, dass der Mensch die abschliessende embryonale Entwicklung ausserhalb des Uterus, das heisst innerhalb der menschlichen Gesellschaft, gewissermassen nachhole.2978 Seine Auffassung, was Biologie leisten sollte, war nicht nur von der Lektüre geformt worden. Nie verlor er die primäre Freude an den Sinneseindrücken, die
2973 2974 2975
2976 2977
2978
In der Krise der Evolutionslehre ist Portmann nicht der einzige gewesen, der auf Lamarck zurückgriff: Ritter 2000, 216. Illies 1976, 45. Im Tagebuch notierte er an Weihnachten 1918, er habe Fabres Schriften bekommen. Tagebuch Portmann 1915–1920, in: Nachlass Schachtel 108, NO-DSK 615. Ich bezeichne hier als ‚Darwinismus‘ die Rezeption von Darwins Theorien in Gestalt von vereinfachten Dogmen, die schon im 19. Jahrhundert zu Kampfmitteln in Ideologie und Politik geworden sind. Portmann selbst verwendete manchmal ‚Darwinismus‘ im Sinne von ‚Darwins wissenschaftlichen Hypothesen‘ und bezeichnete das Wiederaufleben dieser Ansätze nach 1910 (im Lichte der Entdeckung Mendels und der Mutationen aus der Drosophila-Forschung) als ‚Neodarwinismus‘. Portmann 1974, 30 f. Stamm/Fioroni 1984, 99. Ritter 2000, 215, unter Verwendung des Vortragsmanuskripts von Portmann aus dem Jahre 1928. Zur Bedeutung von Louis Bolk für Portmann: Wahlert 1972, 21 f. Bolk im Kontext der deutschen Anthropologie (Gehlen): Rehberg 2007, 190 f. Auf die Bedeutung Arnold Gehlens für Portmann gehe ich hier nicht ein. Nachlass Schachtel 3, NO-DSK 0039.
696
Die Naturwissenschaftler
die Beobachtung der Natur gewährte. So interessierten ihn nicht nur die Embryologie, das Nervensystem, das Gehirn oder der Flug der Vögel. Er konnte seine Augen nicht vor dem Eindruck verschliessen, den die Musterung und Färbung der Tiere auf ihn machten. Die Gestalten waren nicht bloss Trägerinnen einer Funktion; Mutation und Selektion konnten ihre Veränderungen verständlich machen, aber nicht ihren Ursprung, ihren Sinn und Wert erschliessen.2979 In seinem 1939 gehaltenen Vortrag «Von erloschenen Vogelgeschlechtern» kommentierte er das Aussterben von Arten wie folgt (ich zitiere aus seinen Notizen): Vernichtung von Geschlechtern, Gestalten. Nicht Töten des Individuums, sondern Ausrottung einer Gestalt, einer Rasse oder Art ist die schwere Angelegenheit. Teile des Geschaffenen, aus der gleichen [gestrichen: tiefsten] Herkunft wie wir – wir kommen heute zur Einsicht, dass wir kein Recht haben, solche Geschöpfe als Geschlechter zu vernichten. […] Die Dinge hängen tiefer zusammen, als Viele denken, denn das Problem, um das es geht, ist das vom inneren Wert des Lebens und aller Gestalten, in denen dies Leben erscheint. Und dies ist eine jener Fragen, von deren Beantwortung alles abhängt – auch unser eigenes Schicksal. Innere Besinnung, Wandlung.2980
Er konnte auch nicht davon absehen, dass das Verhalten2981 der Tiere nicht restlos durch ein einfaches Schema von Aktion und Reaktion zu erklären war. Lebewesen hatten für Portmann Innerlichkeit.2982 Verhalten und Innerlichkeit wurden für ihn allerdings erst nach 1945 zentrale Gegenstände seiner Publikationen. Zuerst setzte er sich hauptsächlich mit der Entwicklung der Individuen (Ontogenese) auseinander, wobei er seit dem letzten Drittel der 1930er Jahre ver2979
2980
2981 2982
Stamm 2002, 62 ff.; Stamm/Fioroni 1984, 104 f.; Illies 1976, 160. Portmann verfolgte die Gestaltphilosophie schon in den 1930er Jahren. Er kannte Buytendijk und Plessner und wechselte Briefe mit Hans André. Eine «organische Stilkunde» entwickelte er aber erst nach der Begegnung mit dem Eranos-Kreis 1946. Ilies 1976, 166. Die Veröffentlichungen zur Tiergestaltlehre reichen von 1948 (Die Tiergestalt) bis 1960 (Neue Wege der Biologie). Illies 1976, 180. Portmann hatte in der «Schweizerischen Lehrerzeitung» allerdings schon 1943 (Nr. 88, 833–836) über die Tiergestalt zu berichten begonnen. Eine eingehende Auseinandersetzung mit Portmanns Lehre von der Tiergestalt: Ritter 2000, 228 ff. Vortrag vor der Ornithologischen Gesellschaft, 2. 9. 1939, in: Nachlass, Schachtel 003, NO-DSK 0033, betitelt «Von erloschenen Vogelgeschlechtern». Manuskript, teils ausformuliert, teils in Stichworten. Portmanns Verhaltensforschung: Stamm/Fioroni 1984, 105 ff. Stamm 2002, 62–64; Stamm 1999. Stamm betont, dass für Portmann diese Begriffe rein deskriptiv zu verstehen seien. Sie ergaben sich nicht aus der naturphilosophischen Spekulation. Boletzky 2006, 14, weiss, dass Portmann die Vorstellung von einer Innerlichkeit der Lebewesen schon 1920 aus Roux 1915 schöpfte. Portmann unterstrich in seinem Exemplar folgenden Satz: «Die Naturforscher haben die unendlich schwierige Aufgabe, die ganze Harmonie des Lebensgeschehens und die Selbstregulationen ‚möglichst weit‘ ohne zwecktätige ‚gestaltende‘ Seele zu erklären.»
Zoologie
697
mehrt auch die Primaten und den Menschen in seine Überlegungen einbezog. Was er zur Abwehr nationalsozialistischen Denkens und Sprechens beitrug, entstammte dieser Aufmerksamkeit für Evolution, Entwicklung und Darwinismus und damit auch für Anthropologie. Das wissenschaftliche Grundproblem sah er darin, dass verschiedene Fächer mit verschiedenen Begriffsvarianten von «Entwicklung» arbeiteten, die dann zwischen Naturforschung einerseits und Geschichte andererseits vermengt werden: Die «Einsicht in diese Doppelnatur d[es] Entw[icklungs]begriffs macht aufgeschlossener für Urteile der Grossen des 19. Jahrh[underts]: Joh[annes] Müller[,] A[lexander] v[on] Humboldt [und] J[acob] Burckhardt.»2983 Dank dem selbstgewählten pädagogischen Auftrag, immer auch die Grenzen des noch nicht Gewussten («Rätsel»), dann des Wissbaren überhaupt aufzuzeigen und damit Raum für das «offenbare Geheimnis» des Lebens zu gewinnen,2984 war er nicht nur immun gegen zeitgeistige Strömungen, sondern auch auf die Verteidigung einer human-rationalen Position vorbereitet. 8.8.3 Bildungsvoraussetzungen In Portmanns Bildung kann man zwei Schichten unterscheiden. Die erste Schicht gehörte zur Arbeiterbewegung. Die Familie2985 und deren Umfeld waren – ausser einer Anhänglichkeit der Frauen an die katholische (die frühverstorbene Tante Anna Portmann, deren Kind zusammen mit den kleinen Portmann aufgezogen wurde) und an die evangelische Konfession (Portmanns Mutter)2986 – vom Kampf für soziale Gerechtigkeit und die Rechte der Gewerkschaften geprägt. So erinnerte Portmann in der Einführung zu einer Vortragsreihe der Volkshochschule am 14. Mai 1943 (zwei Wochen nach der ersten öffentlichen Maifeier, die 2983 2984
2985 2986
Vortragsmanuskript über Beziehungen zwischen Anthropologie und Zoologie, Thun, 22. 3. 1943, in: Nachlass Schachtel 28, NO-DSK 0991. Portmann bekannte sich zu Goethe und übernahm das Wort von der Natur als einem «offenbaren Geheimnis». Sie gebe immer etwas preis, was unsere Erkenntnis eine Stufe weiterbringe, und dazu brauche es neben Anschauung strenge wissenschaftliche Forschung. Vor Denken, Fühlen und Wollen komme das Wahrnehmen. Stamm 2002, 70. Markó/Meier/Neff 1998. Illies 1976, 37. Sowohl der Vater wie der Bruder Hans arbeiteten bei den Basler Verkehrsbetrieben und waren demzufolge im Verband des Personals der öffentlichen Dienste VPOD (der 1930 bis 1941 von Regierungsrat Fritz Hauser präsidiert wurde) organisiert. Die linke Familientradition ging auf den Grossvater Karl Adolf zurück, der in einer Lörracher Textildruckerei arbeitete und wegen seiner Überzeugung Deutschland verlassen musste. Markó/Meier/Neff 1998, 77–79, 95 f. Otto Studer: «Familien Portmann von Escholzmatt», SA aus: Natur- und heimatkundliche Forschungen aus dem Entlebuch, ohne Datum, Portmann gewidmet vom Verfasser, 30. 5. 1969, in: Nachlass Portmann, Schachtel 57, NO-DSK 0467. Ritter 2015, 51, glaubt, die «antifaschistische Gesinnung war somit gesetzt» aufgrund der Familientradition.
698
Die Naturwissenschaftler
in Basel in Kriegszeiten wieder stattfand) eindringlich daran, dass «Verbesserungen in grosser Zahl / Hygien[ische] Bedingungen / Versicherung der Arbeitenden / Reduktion der Kinderarbeit / Reduktion der Arbeitszeit / Alles das im Kampf errungen [worden ist] durch den aufkommenden Sozialismus».2987 Der Grossvater Karl Adolf I., der Vater Karl Adolf II., der mit Adolf Portmann gleichaltrige Cousin Otto und der jüngere Bruder Hans (Johann Rudolf) waren aktive Sozialisten und Gewerkschafter.2988 Über sie kannte er auch Mitglieder der Basler politischen Szene persönlich.2989 Der jugendliche Portmann verstand sich als Produkt einer sozialistischen Erziehung, deren Wirkungen er allerdings unter dem Einfluss von Rudolf Maria Holzapfels Panideal ablehnte (dazu unten mehr).2990 Er litt unter dem Widerspruch zwischen seinen spontanen Neigungen zu linken Positionen und dem Idealismus, den er sich selbst verordnet hatte. Einen Anlass zu diesen widersprüchlichen Empfindungen bot ihm der landesweite Generalstreik («Landesstreik») im Herbst 1918. Im Rückblick bekannte er sich 1974 zwar vorbehaltlos zu seiner sozialistisch geprägten politisch-sozialen Sensibilität. Im Generalstreik sei er «auf der linken Seite der Politik [gestanden], der ich tief verbunden blieb». «Dass der geistige Sumpf des Faschismus in Italien und die braune Flut in Deutschland meine ursprünglichste innere Ausrichtung noch stärkte, wird nicht erstaunen.» Er sei nie politisch indifferent gewesen und seinem jüngeren Bruder (Hans) nahegestanden, der «zeitlebens ein tätiger Politiker im sozialistischen Feld geblieben ist».2991 In seinem Tagebuch hatte er aber am 9. November 1918 in durchwegs bürgerlicher Diktion notiert, in der Stadt sei der Generalstreik «entfesselt» worden, «Bürger gegen Bürger» seien aufgeboten. In Deutschland sei «die Revolution im Wachsen». Er verglich die Lage mit dem Zusammenbruch 2987 2988
2989 2990
2991
Einführung am 14. 5. 1943 zum Volkshochschulkurs «Naturgeschichte der Gross-Stadt», in: Nachlass Schachtel 28, NO-DSK 0988. Höhepunkt der beruflichen Laufbahn war die Position als Chef der kaufmännischen Abteilung der Basler Verkehrsbetriebe; pensioniert wurde er 1956. 1921 war er Mitglied der Sozialdemokratischen Partei geworden, 1929 Mitglied des VPOD, von 1941 bis 1944 sass er im Grossrat. Wie der Vater engagierte er sich im Arbeitersport, seit 1943 war er ausserdem Revisor der Volksdruckerei. Markó/Meier/Neff 1998, 95; Illies 1976, 34. Undatierter Zeitungsausriss «Hans Portmann-Sacher gestorben», in: Nachlass Portmann Schachtel 108, ohne NO-DSK-Nr. Illies 1976, 115. Eine wissenschaftlich-kritische Würdigung der Bedeutung Rudolf Maria Holzapfels fehlt leider. Eine Einführung in die Hauptwerke von Holzapfel: Burri 1985. Illies 1976, 96, stellt den Einfluss, den Holzapfel auf Portmann ausübte, wohl zu schwach dar. Richtig ist, dass der erwachsene Portmann Holzapfel selektiv rezipierte und die sektenartigen Tendenzen in dessen Umfeld nicht mitmachte. Illies 1976, 97. Zudem arbeitete vorübergehend Holzapfels Tochter Monika (Lienhard 2007) als Zoologin mit Portmann zusammen. Stamm/ Fioroni 1984, 107. Portmann 1974, 219.
Zoologie
699
des Römischen Reichs: Barbaren sah er von allen Seiten einbrechen, Hippo wurde belagert und Augustin lag dort im Sterben (Portmann hatte gerade Louis Bertrands Darstellung des Lebens Augustins2992 gelesen). «Da steigen mir Dämonen des Verderbens [wie] die Revolutionsgelüste herauf, die selbstischen Wünsche, eine Rolle zu spielen, mehr wie wirre Träume, aber sie sind doch da, diese niederen Gelüste, diese Träume von Umsturz, Gewalt und brutaler Volksherrschaft. Das sind die Geburten der sozialistischen Erziehung, die jetzt an meiner Entwicklung wie Bleigewichte hängen.»2993 Mit Sympathie für die Linke hatte er an einer Versammlung teilgenommen, die den Anschluss der Studenten an die Bürgerwehr ablehnte und die Forderungen des Oltener Streikkomitees guthiess. Diese Forderungen wirkten, meinte der «Jungsozialist»2994 Portmann, durch ihre «Selbstverständlichkeit», sie bedeuteten «den Weg des Fortschritts und des Verstehens».2995 Kurz darauf bereute er erneut seine Sympathien und stellte fest, dass sie mit Holzapfels Panideal nicht vereinbar seien.2996 Im Februar 1919 liess er sich von einem Vortrag des damaligen Ministerpräsidenten der bayerischen Republik, Kurt Eisner, begeistern.2997 Im Basler Generalstreik vom Sommer 1919, so berichtete er seinem Biographen Illies, sei er auf der «Aufrührerseite»2998 gestanden. Dem jugendlichen Anhänger des Panideals bereiteten diese Regungen erneut schwere Gewissensbisse. So notierte er im Tagebuch: Wieder kommen sie herauf, aus den Tiefen des Gemüts, die Plagegeister einer 20jährigen Erziehung, Umgebung, Gewöhnung, wie seinerzeit beim Landesstreik. Und wenn ich durch die Stadt gehe, so reizt mich alles, Stahlhelme, Maschinengewehre krampfen meine Hände zur Faust, feige, ekle Bürger zwingen meine Stirn in Zornesfalten und die niederen Machtgelüste machen sich breit. […] Wir sind noch alle Sklaven, die einen ihrer Partei, die andern ihres Mammons, ich meiner Vergangenheit.2999
2992 2993 2994 2995 2996
2997 2998 2999
Bertrand 1913. Tagebuch von 1915 bis 1920, in: Nachlass Schachtel 108, NO-DSK 615. Stirnimann 2021, 107. Tagebuch von 1915 bis 1920, in: Nachlass Schachtel 108, NO-DSK 615, Eintrag vom 11. 11. 1918. Tagebucheintrag, 19. 11. 1918: Die Ruhe sei zurückgekehrt. Er wünsche eine «gesetzliche Umwandlung», denn nur so könne sich das Panideal entfalten. Entgegen seinen Absichten empfand Portmann «durch die Gemeinheiten beider Parteien und der Presse» einen Hass «gegen alle Ungerechtigkeiten unserer Gesellschaft und die Verständnislosigkeit so vieler, die sich ‚Geistige‘ nennen». Er liess sich zu «Sympathien hinreissen», die er jetzt «verwerfen muss». Illies 1976, 48. Illies 1976, 49. Tagebucheintrag, 2. 8. 1919.
700
Die Naturwissenschaftler
Er bewegte sich aber weiterhin sozial im linken Umfeld: Bis 1933 absolvierte Portmann die obligatorischen Schiessübungen in der Schützengesellschaft Arbeiterbund Basel.3000 Diese «sozialistische Erziehung» und deren Weiterwirken bildeten somit die erste Schicht. Die zweite Schicht formierte sich in der Oberen Realschule, in die er am 21. April 1912 eintrat und an der er am 30. November 19163001 die Maturitätsprüfung ablegte, um sich dann im Herbst 1916 an der Universität Basel zu immatrikulieren.3002 Die Obere Realschule war eine bürgerlich-idealistische staatliche Bildungsanstalt, die ihm als erstem und damals einzigem Mitglied der Familie den Zugang zu einer andern Welt eröffnete – ausgenommen die altgriechischen Klassiker des humanistischen Curriculums, die er sich später selbst aneignete. Portmann wollte schreiben können wie Goethe, kaufte sich am 26. Februar 1916 trotz extremer Sparsamkeit Goethes Werke, besuchte trotz grosser finanzieller Engpässe das Theater, das Kino und – soweit möglich kostenlos – Kunstausstellungen. Seine ausgeprägte zeichnerische Begabung und sein offenes Auge für Form und Farbe in der Natur liessen den Wunsch wachsen, Künstler zu werden. Aber neben Shakespeare, Goethe, Lessing, Schiller, G. B. Shaw, Tolstoi, Ibsen, Gerhart Hauptmann, Spitteler, und neben einer ersten Begegnung mit modernen Kunstrichtungen und Kunsttheorie stand die Beschäftigung mit Biologie in einer vorerst auf Ernst Haeckels Ideen beruhenden Auffassung.3003 Das Bedürfnis nach Idealen führte ihn zu Viten katholischer Heiliger wie Augustin, Franziskus und auch einmal Savonarola.3004 Beim Wandervogel ging er gelegentlich mit, aber sein engerer Kreis wurde mit dem Beginn des Studiums an der Universität Basel die (Akademische) Freischar, die von einer besseren Welt träumte.3005 Den zünden3000 3001
3002 3003
3004
3005
Einträge in Portmanns Schiessbüchlein, in: Nachlass Schachtel 108, NO-DSK 621. Obere Realschule zu Basel, Abgangs-Zeugnis für Portmann; Fleissnoten alle 6 (beste Note), Leistungen alle 6, ausser Physik, Chemie, Technisches Zeichnen: 5, in: Nachlass Schachtel 108, NO-DSK 0618. Portmann Collegienbuch Universität Basel, Immatrikulation 23. 10. 1916, letzter Eintrag Wintersemester 1920/21, in: Nachlass Schachtel 108, NO-DSK 617. Der Wunsch, Zoologe zu werden, «kam als etwas ganz Selbstverständliches», ohne dass er sich in den Schuljahren darüber Gedanken gemacht hätte. «Zurückblickend finde ich keine zweifelnden Stunden, keine grüblerischen Momente der Wahl, als ich im Ersten Weltkrieg Zoologie zu studieren begann.» Etwas anders gestimmt ist das Tagebuch von 1915 bis 1920, in: Nachlass Schachtel 108, NO-DSK 615. Illies 1976, 43, verweist auf den Einfluss Wilhelm Bölsches. Das Tagebuch bestätigt diesen Einfluss; er las am 13. 5. 1916 den Stammbaum der Tiere von Bölsche (ein Kosmos-Bändchen, Bölsche 1904/05). Einträge vom 3., 4. und 5. 11. 1918, unter dem Einfluss von Holzapfel geschrieben, Tagebuch von 1915 bis 1920, in: Nachlass Schachtel 108, NO-DSK 615. Weihnachten 1918 erhielt er das Werk des liberalen Protestanten Paul Sabatier, Vie de saint François d’Assise (Sabatier 1894). Eintritt in die Freischar bei Studienbeginn, in: Tagebuch von 1915 bis 1920, Eintrag 12. 12. 1916, in: Nachlass Schachtel 108, NO-DSK 615.
Zoologie
701
den Funken in dieser jugendlichen Suche hatte schliesslich die Freundschaft mit einem nachträglich in die Klasse aufgenommenen Schüler, Franz Senglet, beigetragen.3006 Dieser lieh Portmann das Panideal3007 von Rudolf Maria Holzapfel und arbeitete mit ihm das Buch durch. Die damit verbundenen Erlebnisse muss Portmann für so wichtig erachtet haben, dass er sein Tagebuch aus jener Zeit aufbewahrte.3008 In den 1920er Jahren verfolgte er aufmerksam alle Werbungsaktionen für das Panideal,3009 ohne sich öffentlich stärker zu engagieren als durch eine kleine Schilderung seines eigenen ‚Bekehrungserlebnisses‘ in der Zeitschrift der Akademischen Freischar.3010 Holzapfels Wirkung auf Portmann hielt ein Leben lang an, noch verstärkt durch das Buch Welterlebnis, das Holzapfel 1928 veröffentlichte. Diese Lehren bedeuteten für den jungen Mann zunächst eine Ethik3011 als Leitschnur für das eigene Verhalten und Empfinden, deren Vervollkommnung schliesslich aufzeigen sollte, «wie der einzelne und die Menschheit einem harmonischeren Schicksal
3006
3007
3008
3009
3010
3011
Briefe von Portmann an Franz Senglet, in: Nachlass Portmann Schachtel 101, NO-DSK 459. Die Freundschaft begann im Herbst 1915, als Senglet (geb. 1893) in Portmanns Oberrealschulklasse eintrat, und endete mit Senglets frühem Tod 1920. Tagebuch von 1915 bis 1920, in: Nachlass Schachtel 108, NO-DSK 615. Holzapfels Panideal erschien in Leipzig 1901 in erster Auflage. Der junge Portmann kann nur diese Ausgabe gekannt haben. Wenn Illies 1976, 96, Portmann so zitiert (nach 1974, 220): Die zweite [sic] Auflage des Panideal und das Welterleben «förderten früh [sic] meine Einsicht in die Bedeutung des Gleichgewichts von rationalem und irrationalem Erleben. Beide Werke rüsteten mich mit heilsamer Skepsis gegenüber gar manchen geistigen Strömungen jener zwanziger Jahre aus und regten zugleich zu fruchtbarer Exkursion in philosophische Bereiche an», dann ist damit eine spätere Phase der Auseinandersetzung mit Holzapfel gemeint. Die zweite Fassung des Panideal erschien erst 1923 in Jena, das Welterlebnis in Jena 1928. Portmann schrieb meistens «Welterleben» statt «Welterlebnis». Tagebuch Portmann von 1915 bis 1920, Eintrag 15. 10. 1917, in: Nachlass Schachtel 108, NO-DSK 615. Er liess eine Seite leer, «um zu zeigen, dass ein neuer Abschnitt beginnt, ein wirklich neuer, der ausgezeichnet sein wird durch die Wirkung des ‚Panideal‘ von Holzapfel». Die Hinweise auf die Propaganda für das Panideal reichen bis 1924. Nachlass Portmann, Schachtel 101, NO-DSK 459, und Schachtel 61, NO-DSK 232, für den Zeitraum von 1917 bis 1924. Portmann, «Mein Weg zum Panideal. Ein Brief», in: «Holzapfels Panideal. Ein Weg der Erneuerung, Zweite Folge», Bern: Haupt, 1918, = SA aus: Neue Fahrten, Zürich, Nr. 4/5 1918, 51–55, in: Nachlass Portmann, Schachtel 105, NO-DSK 1176. Die «Neuen Fahrten» waren das gemeinsame Organ des Schweizerischen Altwandervogels und der Akademischen Freischar. Nachlass Schachtel 61, NO-DSK 232. Portmanns Bemerkungen zu diesem Aufsatz im Tagebuch von 1915 bis 1920, Einträge 15. 10. 1917, 11. 12. 1917 und 16. 12. 1918, in: Nachlass Schachtel 108, NO-DSK 615. Burri 1985, 6–9.
702
Die Naturwissenschaftler
entgegengeführt werden könnten».3012 Altruistische Neigungen sollten das Streben nach Vorteilen für die eigene Gruppe unterdrücken. Holzapfels Kritik traf sowohl die «nivellierende Altruismusmoral» als auch die reine «Gruppenmoral». Portmanns Holzapfel-Aneignung führte deshalb zu dem erwähnten Gewissenskonflikt mit den Geboten des Sozialismus.3013 Der Sozialismus habe nur das Ziel, etwas zu erhalten und zu verteidigen, aber nicht etwas zu entwickeln.3014 Portmann gewöhnte sich schliesslich an, in allen Konflikten eine übergeordnete Position zu suchen und von dort aus zu urteilen, aber weiterhin geleitet von einem ausgeprägten Empfinden für Gerechtigkeit und von ernsthafter Wahrheitssuche. Ausser diesen ethischen Maximen bot ihm Holzapfel eine Bestätigung seines Gefühls, dass die Natur grösser, weiter und tiefer sein müsse als alles, was rationale Naturwissenschaft zu erkennen vermöge. Er folgte Holzapfel nicht in jeden Winkel von dessen Gedankengebäude, das letztlich die Stiftung einer neuen Religion bezweckte,3015 denn Portmann brauchte für sich keine Dogmen.3016 Dennoch hing er ihm so weit an, dass er 1928 seiner britischen Freundin Anna Bidder (Anna McClean Bidder) auf die Frage nach seinem Glauben mit Holzapfel antwortete, eine reichere und schönere Welt könne in unseren einsamen und stillen Stunden erahnt werden. Sie stehe nicht im Widerspruch zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die aus derselben Wurzel stammten, aber diese weite Welt könnte bevölkert sein von höheren Wesen, die durch ihre Gegenwart in uns den Wunsch nach Vervollkommnung und «émulation d’une grandeur qui dépasse ce que les joies scientifiques peuvent donner» weckten. Die Möglichkeit der Existenz dieser Wesen sei wissenschaftlich gesichert.3017 Das Welterlebnis bestärkte den inzwischen Habilitierten darin, dass die weiteren Wege des Verstehens, die sich neben und hinter der wissenschaftlichen Rationalität auftaten, einen Zugang zu Einsichten eröffneten, die ihre eigene Art der Sicherheit und Gewissheit besässen. Holzapfel lehrte, der Drang nach Vergegenwärtigung «höheren Lebens» sei 3012 3013 3014
3015 3016 3017
Burri 1985, 4. Burri 1985, 6–11. Portmann, «Anmerkungen zum Panideal nach den Besprechungen mit Dr. Wladimir Astrow, Oktober 1917 bis März 1918», in: Nachlass Schachtel 105, NO-DSK 1071. Astrow hatte vorübergehend für Portmann und Senglet die Funktion eines persönlichen Seelenführers; das Zusammentreffen mit den Berner Holzapfel-Anhängern wie Hans Zbinden löste dann diese Beziehung auf zugunsten einer eigenständigen Beschäftigung mit dem Panideal. Ziel des «Welterlebnisses» sei eine «den Erkenntnissen der Naturwissenschaft Rechnung tragende religiöse Neuorientierung». Burri 1985, 4. Illies 1976, 99. Portmann an Anna Bidder, 1. 11. 1928, in: Nachlass Schachtel 124, NO-DSK 1059. Illies 1976, 236 f., zitiert aus einem Interview, das Portmann 1975 für eine Radiosendung gegeben hatte, Portmann wisse, «dass es im Kosmos Dinge gibt, über die ich wissenschaftlich nichts aussagen kann».
Zoologie
703
vertrauenswürdig, da diese Vorstellung im allgemeinen «Funktionszusammenhang der Natur» stehe. Es gebe keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen «wissenschaftlicher und religiöser Orientierung». «Wahrheit» habe in beiden dieselbe Wurzel und gehe vom Wahrscheinlichen aus. Die Seele trage selbst «Züge der weltgestaltenden Kräfte» in sich, der Repräsentationsvorgang sei somit von diesen mitgeprägt. Darum könne die Vorstellung ausserirdischer Gestalten auch menschenähnliche Züge tragen.3018 1944 schrieb Portmann entsprechend, die «klaren Gestalten, die um uns leben, [seien] Zeugen der Gestaltungen, welche grösser sind als das auf Erden Sichtbare».3019 Aus dem Welterlebnis kopierte er unter anderen folgende Passagen (undatiert): Neben der Aufnahme orientalischer Schöpfung und anderer Kunsteindrücke sollten die ernüchterten Menschen der Neuzeit der Versenkung in die unabsehbare Welt der Naturformen einen grossen Teil ihrer Liebe und Selbsterziehung widmen. […] Wie das Fernrohr, so wird auch das Mikroskop zum heiligsten Rüstzeug der panidealistischen Religion gehören.3020
Diese Thesen machten ihn für eine ganzheitliche Perspektive offen, in der er die Zukunft der Biologie sah. «Formenfülle» hinnehmen wollte er, und darum beschäftigte er sich mit Gestalt und Verhalten. Portmann war überzeugt, dass es echtes Erkennen durch reine Anschauung gebe.3021 Natürlich sprach auch der Darwinismus Verhalten und Gestalt eine Funktion im «Lebenskampf» zu. Aber die bekannten Selektions- und Mutationswirkungen erklärten nicht die jeweilige Besonderheit und alle gestaltlichen Details. Auch wenn alle genetischen und selektiven Faktoren bekannt wären, bliebe das «Geheimnis des Lebens» bestehen. Konkrete Forschung könne nur isolierte Aspekte untersuchen, sie bleibe hinter der umfassenderen Aufgabe der Wissenschaft zurück. Nur der Mensch sei in der Lage, sich selbst von innen und von aussen zu betrachten, bei allen andern Lebewesen kennen wir nur das Äussere, das heisst Gestalt und Verhalten. «Das Prinzip des Lebens» sei nicht durchschaubar, da wir wissenschaftlich nicht sagen können, wozu der Organismus da sei.3022
3018 3019 3020 3021 3022
Burri 1985, 14–16. Zitiert nach Müller 1988, 135, aus Biologische Fragmente 1944. Exzerpte Portmanns aus Holzapfel, Welterlebnis, Bd. 2, 31 f., in: Nachlass Schachtel 24, NO-DSK 0137. Stamm 2002, 68 f. Stamm/Fioroni 1984, 107–110.
704
Die Naturwissenschaftler
8.8.4 Die Wahl auf die Basler Professur Die Wahl Portmanns zum Nachfolger des Basler Zoologieprofessors Friedrich Zschokke im Jahr 1931 war «heftig umstritten».3023 Die Fakultät hätte eine ältere Persönlichkeit mit einer reichen Publikationsliste vorgezogen, getreu dem akademischen Motto, immer nur den Besten zu berufen. Hier handelte es sich jedoch um eine Hausberufung – Portmann hatte seit 19153024 zuerst als Schüler, dann als Student und Doktorand, schliesslich als Privatdozent im Basler Institut für Zschokke gearbeitet und war seit 1928 dessen Stellvertreter. Portmanns Veröffentlichungen qualifizierten ihn kaum für eine volle Professur, und in seinem Schriftenverzeichnis klaffte zwischen Doktorat (1921) und Habilitation (1926) eine Lücke,3025 die der für ihn eingenommene sozialdemokratische Erziehungsdirektor Fritz Hauser damit entschuldigte, dass Portmann in bescheidenen finanziellen Umständen lebte und seine Erfolge «unter den allerschwierigsten äusseren Verhältnissen erzielt» habe.3026 Portmann selbst erkannte im Rückblick: «Ich kümmerte mich viel zu wenig darum, wie man eigentlich in das akademische Leben einsteigt und dort vorwärtskommt. Das erfordert Beziehungen, Publikationen, was alles ich damals arg vernachlässigte.»3027 Zudem bewegte er sich thematisch auf einer Linie der Ontogenese, Embryologie und Physiologie, die nicht als bahnbrechend gelten konnte und, soweit ich dies beurteilen kann, wenig wirklich neue Ansätze bot. Die von der Kuratel eingesetzte Expertenkommission, die vom Mediziner Johannes Karcher präsidiert wurde und in die auch die im Naturhistorischen Museum basierten Fachleute Fritz Sarasin und Hans Georg Stehlin berufen worden waren, stellte nicht Portmann auf den ersten Listenplatz, sondern Jean Strohl, Ordinarius für Physiologische Zoologie in Zürich.3028 Portmann stand immerhin auf dem dritten Platz.3029
3023
3024
3025
3026 3027 3028 3029
Antrag der Kuratel an das ED zur Beförderung Portmanns vom Extraordinarius zum Ordinarius, 16. 3. 1933, Rückblick auf die Berufung 1931, in: StABS ED-REG 1a, 2 Philosophische Fakultät II, Prof. Dr. Adolf Portmann, Zoologie. Illies 1976, 46. Der Eintrag in das Tagebuch 24. 12. 1915 erwähnt erstmals die Arbeit in der Basler Zoologischen Anstalt. Er bekam dafür Fr. 50, was ihn, wie er schrieb, für den Alkoholgestank entschädige. Immer am Mittwoch und Donnerstag sollte er im Institut wirken. Tagebuch von 1915 bis 1920, in: Nachlass Schachtel 108, NO-DSK 615. Die ersten wissenschaftlichen Publikationen verteilten sich wie folgt auf der Zeitachse: 1921 eine (Dissertation), dann erst wieder 1925 eine; ab 1926 etwas höhere Frequenz: 1926 sechs, 1927 drei, 1928 eine, 1929 zwei, 1930 drei. Ich zähle dabei die populärwissenschaftlichen Schriften nicht, die besonders von 1927 bis 1930 zahlreich waren. Flubacher 2007, 21. Portmann 1974, 113. Fischer 1943. Zusammensetzung der Expertenkommission: Flubacher 2007, 5.
Zoologie
705
Zschokke sprach sich in der Expertenkommission wiederholt gegen Strohl aus, kritisierte aber zunächst an Portmann die fehlende Bescheidenheit und charakterisierte seine Arbeiten als erste Anfänge.3030 Sein Favorit wäre Adolf Naef gewesen (zu ihm unten mehr). In dieser Art votierte er in drei Sitzungen der Expertenkommission (7. Januar, 7. Februar und 10. März 1931). Aber am 15. März 1931 empfahl er in einem persönlichen Brief an den Kuratelspräsidenten Portmann «warm» für seine Nachfolge. Entweder war die vorherige Kritik an Portmann blosse Taktik, wie Flubacher vermutet, oder es ging ihm am Schluss vor allem darum, Strohl zu verhindern, der nun primo loco stand. Auch Regierungsrat Hauser gab sich zunächst kritisch und beklagte in der dritten Sitzung der Expertenkommission (10. März 1931) Portmanns fehlende «männliche Festigkeit», zudem sei er «noch zu unselbständig». Für den Mediziner Eugen Ludwig waren Portmanns Publikationen nur vorläufige Mitteilungen. Stehlin nannte Portmann unreif, und als «nicht immer ganz zuverlässig» und unausgereift bezeichnete ihn der Dekan Wilhelm Matthies. Johannes Karcher schliesslich votierte in einem persönlichen Schreiben an die Kuratel vom 7. Mai 1931 für Portmann. Die Kuratel folgte ihrer Expertenkommission nicht und favorisierte in ihrem Antrag an das Erziehungsdepartement vom 10. Juni 1931 Portmann.3031 Der Erziehungsrat fand diesen Antrag «eigenartig» und wollte ihn an die Kuratel zurückgeben, verzichtete aber darauf, weil die Wahl eines Nachfolgers für Zschokke als dringlich galt. Das Gremium erklärte sich mit vier Stimmen (eine Gegenstimme, zwei Enthaltungen) für den von der Expertenkommission vorgeschlagenen Jean Strohl. Eingehend gewürdigt wurde im Berufungsverfahren neben Strohl Ernst Gustav Gotthelf Marcus aus Berlin, der dann 1935 wegen seiner jüdischen Herkunft Deutschland verliess und nach Brasilien auswanderte.3032 Als Forscher und Lehrer genoss Marcus in Basel hohes Ansehen, doch wurde befürchtet, dass er eine Basler Professur nur als Sprungbrett benützen könnte, um in Deutschland weiter Karriere zu machen (das war 1931). Wohl um den Abstand zu Portmann, 3030
3031
3032
Portmann verhielt sich manchmal rebellisch gegenüber Zschokkes eher konservativer Biologie. Portmann 1974, 22. Aus diesem Grund begab er sich nach der Promotion nach Genf zu Émile Guyénot, der eine neue Biologie lehrte. Protokoll der Expertenkommission, 7.1., 7.2. und 10. 3. 1931; Bericht der Expertenkommission an die Kuratel, 18. 4. 1931, sowie anschliessende Korrespondenzen, in: StABS EDREG 1a, 2 Philosophische Fakultät II, Prof. Dr. Adolf Portmann Zoologie. Da die Fakultät (resp. deren Naturwissenschaftliche Abteilung – sie erhielt erst mit dem Universitätsgesetz von 1937 Fakultätsrang) die Schaffung eines zweiten Lehrstuhls für Zoologie abgelehnt hatte, erhielt das Kriterium, dass der Nachfolger Zschokkes Generalist sein müsse, viel Gewicht. Flubacher 2007, 6, nach: StABS Protokoll T 2 Kuratel, Bd. 12, Beschluss vom 28. 5. 1931. https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Gustav_Gotthelf_Marcus.
706
Die Naturwissenschaftler
der auf den dritten Platz gesetzt wurde, zu verdeutlichen, wurden secundo loco neben Marcus zwei Schweizer gesetzt. Dabei handelt es sich um den MolluskenSpezialisten Adolf Naef, der in Zürich ausgebildet worden war und damals in Ägypten wirkte.3033 Wegen Bedenken gegen seinen Charakter stellte ihn die Expertenkommission hinter Strohl. Der dritte secundo-loco-Kandidat war der Vererbungsforscher Jakob Seiler, Herausgeber des Zoologischen Taschenbuchs, Extraordinarius in München, der bereits in Berlin und Bonn als Lehrstuhlkandidat erwogen worden war. Seiler wirkte dann von 1933 bis 1957 an der ETH und gilt als bedeutender Forscher.3034 Die Kuratelskommission hatte den Eindruck, Seiler sei zu spezialisiert, um den einzigen Lehrstuhl für Zoologie in Basel einzunehmen, für den es einen Generalisten brauche.3035 Nun war der Regierungsrat am Zug: Mit fünf gegen zwei Stimmen lehnte er es ab, mit Strohl in Verhandlungen zu treten. Damit ging das Geschäft zurück an den Erziehungsrat. Dieser hielt mit vier Stimmen an Strohl fest, konzedierte allerdings, dass er einen Entscheid für Portmann dulden könne, sofern die Regierung dafür die volle Verantwortung trüge. Kurz vor Beginn des Wintersemesters 1931/ 32 wählte eine knappe Mehrheit von vier Mitgliedern des Regierungsrats Portmann zum Zoologieprofessor, allerdings nur als Extraordinarius. Hauser war inzwischen zum Schluss gekommen, dass gegen Portmann intrigiert werde und die fachlichen und charakterlichen Einwände bloss vorgeschoben seien. Für ihn war letztlich Portmanns «Lehrbefähigung» entscheidend. Dabei dachte er auch an die Rolle der Zoologie in der Ausbildung der Naturkundelehrer.3036 Portmann verfügte über eine breite wissenschaftliche Bildung, die einen Gegenpol zu der damals beklagten Spezialisierung und «Modefächern» wie Genetik bildete. Da Basel nur einen Lehrstuhl hatte (die Schaffung eines zweiten wurde von der Fakultät als Aufsplitterung abgelehnt), der zudem der Grundausbildung der Mediziner und den angehenden Naturkundelehrern zu dienen hatte, war dies ein Vorteil. Portmann hatte Zschokke während der Jahre von 1928 bis 1931 mit grossem Erfolg vertreten. Doch seine Breite und Unabhängigkeit von etablierten Schulen konnte auch als Unberechenbarkeit verstanden werden.3037 Die Fakultät fühlte sich übergangen, weil Zschokkes Stellvertretung 1928 von Kuratel und Erziehungsdepartement an Portmann vergeben worden war, ohne die Fakultät in die Entscheidfindung einzubeziehen.3038 Portmann hatte sich ferner als Vortrags3033
3034 3035 3036 3037 3038
Portmann war mit Adolf Naef persönlich bekannt. 1974 erinnerte er sich an den bedeutenden Spezialisten für Tintenfische und stellte fest, dass die Beziehung auch nach Portmanns Wahl «ungetrübt» geblieben sei. Boletzky 1997a, 123. Baertschi 2010. Flubacher 2007, 9–11. Flubacher 2007, 22. Bedeutung der Lehrerausbildung in der Berufung Portmanns: ebd., 26 f. Flubacher 2007, 17 f.; Illies 1976, 100 ff. Flubacher 2007, 6.
Zoologie
707
redner für ein weiteres Publikum und mit Interesse an philosophischen Fragen3039 profiliert. In ihm konnte man eine Option für die Zukunft sehen. Nach meiner Ansicht gab diese Sicht der Dinge bei Kuratel und Kantonsregierung den Ausschlag,3040 auch wenn nicht zu verkennen ist, dass die zentrale Position seiner Verwandten in den Basler gewerkschaftlichen und sozialdemokratischen Kreisen bei Regierungsrat Hauser eine gewisse Rolle spielte. Diese machte jedoch offensichtlich auf die rein bürgerliche Fakultät einen bedenklichen Eindruck,3041 während die bürgerliche Presse die Berücksichtigung einer jungen lokalen Kraft gut fand und Portmanns Kenntnisse gerade der französischen Wissenschaft schätzte.3042 Die Skepsis gegen Portmann äusserte sich aber darin, dass ihm unter Rückgriff auf eine frühere Praxis bei Berufungen erst nach einer Phase der Bewährung 1933 das volle Ordinariat übergeben wurde.3043 Man muss berücksichtigen, dass angesichts der angespannten Finanzlage auch das Kriterium, wieviel ein neuer Zoologieprofessor kosten würde, für den jungen Portmann sprach.3044 8.8.5 Öffentliche Interventionen, die politisch interpretiert werden können In manchen öffentlichen Auftritten seit 1933 zeigte Portmann seine kritische Distanz zu nationalsozialistischen Ideen. Er wollte damit die Zuhörer über die Zusammenhänge zwischen falscher Wissenschaft und falscher Politik aufklären. Während des Krieges bekannte er sich zu freiheitlichen Vorstellungen der Organisation von Staat und Gesellschaft und stimmte damit von links her in Themen der ‚geistigen Landesverteidigung‘ ein. Wenn wir vom Vortrag über Erbbiologie absehen dürfen, den er im September 1933 hielt, bezog er seit 1938 in der Öffent-
3039 3040 3041
3042
3043
3044
Portmann an Paul Häberlin, Basel, 23. 11. 1929, und Portmann an Häberlins Witwe, Basel, 8. 10. 1960, in: Nachlass Portmann, Schachtel 57, NO-DSK 0393. Illies 1976, 106. Flubacher 2007, 21. Portmann selbst berichtete, sein Eintritt in die Fakultät habe «alte Spannungen neu» belebt, denn die Fakultät sei eine «geschlossene bürgerliche Gruppe» gewesen, die dem neuen Zoologen als Sozialisten mit Misstrauen begegnete. Portmann 1974, 219. Flubacher 2007, 20. Die Basler Nachrichten vom 5. 9. 1931 berichten äusserst lobend über die Wahl Portmanns: Er habe eine enge Beziehung zu Frankreich, sei eine einheimische Kraft, halte hervorragende Vorlesungen, habe bereits einen eigenen Schülerkreis und engagiere sich in der Volkshochschule. Zeitungsausschnitt in: StABS ED-RED 1a, 2, Philosophischen Fakultät II, Prof. Dr. Adolf Portmann Zoologie. Illies 1976, 137, erwähnt eine Kreditkürzung um zehn Prozent gegenüber der ZschokkeZeit. Diese erfolgte allerdings querbeet aus Anlass der schlechten Lage der Kantonsfinanzen. Flubacher 2007, 21, 23. Dieses Argument erschien explizit im Antrag der Kuratel an das ED, 10. 6. 1931.
708
Die Naturwissenschaftler
lichkeit direkt Position gegen den Nationalsozialismus.3045 In den nachstehenden Abschnitten stelle ich Beispiele für solche Interventionen zusammen und gliedere sie nach den Medien, in denen sie sichtbar wurden. 8.8.5.1 Vorlesungen Beginnen wir mit seinen Vorlesungen; die öffentlichen Vorträge untersuche ich später. Dafür gibt es nur Serien von Notizen, von denen man nicht auf Anhieb wissen kann, aus welcher Zeit sie stammen und wann sie verwendet wurden. Er hielt jeweils zwei Hauptvorlesungen, im Sommer diejenige über Allgemeine Zoologie und im Winter jene über Vergleichende Anatomie (Morphologie) der Wirbeltiere, deren zahlreiches Publikum die Mediziner waren.3046 Hinzu kamen am Samstag Spezialvorlesungen zu Themen seiner eigenen Forschungen, und schliesslich bot er zwei Formen von Praktika und Exkursionen an. In der Wintervorlesung ergaben sich viele Gelegenheiten, auf Evolution und Entwicklung einzugehen3047 und dabei den Darwinismus kritisch zu behandeln.3048 Die Geschichte der Forschung und der Theorien, über die er seit den 1920er Jahren Material zusammentrug, gestattete Portmann, verständlich zu machen, dass wissenschaftliches Wissen nicht abgeschlossen sei und somit nicht als Grundlage von Dogmen tauge.3049 Er hatte dafür die klassischen Kritiker des Darwinismus und Vertreter alternativer Ideen zu Darwin durchgearbeitet und war dabei auf die Bedeutung Ludwig Rütimeyers3050 aufmerksam geworden.3051 Die Samstagsvorlesung «Biologische Probleme einer Lehre vom Menschen» nutzte er besonders 1940/41 für zeitbezogene Aufklärung. Ritter stellt fest, dass «der aktuelle politische Bezug an manchen Stellen kaum verborgen» war. Einleitend sprach Portmann den «Zel-
3045
3046
3047 3048 3049 3050 3051
Die ersten Hinweise auf offen politische Reflexionen in Privatbriefen finden wir in Portmanns Brief an Anna Bidder, 28. 10. 1938, in: Nachlass Schachtel 124, NO-DSK 1059. Vortrag von 1933: siehe unten. Stamm 2002, 57 ff.; Illies 1976, 137. Überblick über die Leistungen in Morphologie und Embryologie bei: Fioroni, in: Stamm/Fioroni 1984, 89–99, und kürzer in: Stamm 2002, 60 ff. Portmann 1974, 7, bezeichnete sich selbst als jemanden, der sein Forscherleben der Morphologie gewidmet habe. Stamm 2002, 58. Stamm/Fioroni 1984, 109. Stamm 2002, 59. Simon 2015. Die undatierten Vorbereitungsarbeiten für die Vorlesung über Naturforscher (Naturphilosophen) zeigen breit angelegte Lektüre über Entwicklungslehren des 19. Jahrhunderts, in: Nachlass Schachtel 24, NO-DSK 0139. Vgl. zum späteren Verhältnis Portmanns zu Rütimeyer: Portmann 1965.
Zoologie
709
lenstaat» und die «Abstammungslehre» «als einen Teil der Bestialisierung des Menschenbildes» an.3052 Ein undatiertes Fragment zur Abstammungslehre ist aufschlussreich für Portmanns Verhältnis zu historischen Kontexten, in denen die Lehre Darwins zu einem Dogma geworden war, das auch politischen Zwecken zu dienen hatte. Portmann arbeitete mit der Vorstellung, dass verschiedene Landstriche mit verschiedenen Denkstilen korrelierten, womit er einen Unterschied zwischen Deutschen und Schweizern zu erfassen meinte. So skizzierte er eine politische Anthropologie der Schweizer. Das Fragment beginnt mit der These, dass der Mensch des Nordens (das hiess wohl: der Deutsche) den Darwinismus als Weltanschauung (statt als wissenschaftliche Hypothese) geschaffen habe, und dass diese Weltanschauung in Bismarcks Kulturkampf politische Funktionen erhielt. Jeder explizite Hinweis auf den Nationalsozialismus fehlt im Fragment, aber der Kontext der Jahre von etwa 1938 bis 1945 ist mit den Hinweisen auf Isolation (der Schweiz) und auf Hass (gegen Deutsche) deutlich angesprochen. Damit kontrastierte er das Verhältnis der Schweizer und besonders der Basler zu Darwin. Rütimeyers Arbeiten stellte er als Höhepunkte der Schweizer Darwinrezeption vor und legte dessen Warnungen vor dem (ideologischen) Darwinismus breit dar. Rütimeyers Zurückhaltung gegenüber der Ausdehnung und den Verallgemeinerungen der Abstammungslehre muss ganz besonders hervorgehoben werden, da doch seine vergleichenden Untersuchungen, vor allem die Huftierstudien, mit zu den wichtigen Zeugnissen der Lehre gehören. In seinem Lebensrückblick hebt er selber nochmals 1894/95 die ‚eingeborene oder ererbte Pietät auch in wissenschaftlichen Dingen hervor, die später in ihm noch durch das Vorbild Peter Merians gestärkt worden sei‘. […] Es ist kein Zufall, dass der einzige bedeutende Lehrer, der damals in unserem Lande militanten, extremen Darwinismus verkündete[,] ein ehemaliger Deutscher war: Carl Vogt, der Affen-Vogt, seit [Lücke] in Genf wirkend.
Den Unterschied zwischen Carl Vogt einerseits und den Schweizern Wilhelm His, Ludwig Rütimeyer, Oswald Heer, Carl Wilhelm Nägeli und Rudolf Albert Koelliker anderseits unterstrich Portmann. Wir heben diese Zurückhaltung der Besten hervor! … Es handelt sich für uns darum, die Stimmung an den Stätten der wahren Forschung zu ermitteln; wir suchen sie zu finden im Geiste der Besten, die in jener Zeit schweizerischen Geist in der Naturforschung darstellen.
Diese Zurückhaltung bedeutete damals keine grundsätzliche Gegnerschaft zu deutschem Wesen, denn viele der «Besten» wirkten selbst in Deutschland.
3052
Zitiert aus Ritter 2000, 237, nach der Vorlesungsnachschrift von Ernst Suter. Ritter 2000, 210 und 237 ff.
710
Die Naturwissenschaftler Viel mehr dürfte der Grund zu dieser Haltung in der besonderen Artung des schweizerischen Geistes zu suchen sein, der in Grenzlage sich geformt hat, auf der eigenartigen Scheide zwischen germanischem [sic] und romanischer Lebensart, zwischen nördlichen und südlichen Daseinsformen und Erlebnisweise. Es muss wohl kaum gesagt werden, dass hier von Formen geistigen Lebens gesprochen wird ohne jeden Versuch, diesem Geiste eine besondere somatische [d. h. rassische] Grundlage zu bieten, ihn etwa als das besondere Erbe der Pfahlbauer an unseren Alpenseen zu erklären! Wir sind noch viel zu fern von einer wissenschaftlichen Erfassung der Grundlagen von gruppentypischer Geistesart. […] Ich möchte – wenn es schon darum geht, die Grundlagen unserer Eigenart zu erfassen – zuerst die Wirkung aller dieser Faktoren der geistigen Situation, dieser eigenartigen Eintracht von Grenzstämmen voll würdigen, sie erscheinen mir fassbarer als die Annahme irgend einer heimlichen somatisch bedingten Übereinstimmung. Das klare, ruhige Bild sachlichen Abwägens, das die Haltung der Schweizer Biologen angesichts der wilden Meinungskämpfe um den Darwinismus in Deutschland bietet, ist mehr als zufälliges Übereinstimmen, es ist Ausdruck einer aus tieferen Gründen stammenden Geisteshaltung des Ausgleichs.3053
Für eine Vorlesung bestimmte Notizen zur Entwicklung des Darwinismus in Deutschland enthält auch ein anderer, undatierter Teil des Nachlasses, den ich hier zur Ergänzung zitiere. Portmann suchte nach einer Verbindung zwischen Kulturgeschichte und Wissenschaftsgeschichte mit ihren politischen Wirkungen. Damit entfernte er sich meilenweit vom üblichen deutschen Selbstverständnis nicht nur der 1930er und 1940er Jahre, sondern schon der wilhelminischen Epoche. Die hauptsächliche Quelle war offensichtlich Helmuth Plessner,3054 dessen 3053
3054
Ich zitiere aus den Seiten 21 bis 27 der Notizen, in: Nachlass Schachtel 32, NO-DSK 0995. Es könnte sich teilweise um die Vorarbeiten für den 1928 in Basel gehaltenen Vortrag über Abstammungsprobleme handeln, von dem Rudolf Geigy in seinem Brief an Portmann, 22. 12. 1928, in: Nachlass Schachtel 115, NO-DSK 0809, berichtet: «Stehlin & Sarasin, als letzte Säulen einer grossen Vergangenheit, solle[n] ja einen besonderen Discussionsdrang verspürt haben!» Gemeint sind Hans Georg Stehlin, Leiter des Naturhistorischen Museums, und Fritz Sarasin, Leiter des Völkerkundemuseums, vgl. Simon 2009a. Illies datiert in seiner Bibliographie Portmannscher Schriften einen entsprechenden Aufsatz Portmanns in der «NZZ» schon auf 3. 7. 1927 («Aktuelle Probleme der Abstammungslehre»). In den ersten Jahren nach 1928 erschien kein Beitrag Portmanns zu dieser Thematik im Druck. Viele Andeutungen in den Notizen sind auf die Zeit unmittelbar vor und während dem Zweiten Weltkrieg bezogen. Falls er von Helmuth Plessner Die verspätete Nation gelesen hat: Die Erstausgabe erschien 1935 unter dem Titel: Das Schicksal des deutschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche. Portmann selbst nannte jedoch in seinem Lebensrückblick (Portmann 1974, 220) von Plessner nur Die Stufen des Organischen und der Mensch, Einleitung in die philosophische Anthropologie von 1928, da hier neben Max Scheler eine Wurzel seiner anthropologischen Betrachtungen zu finden war. Ich nehme an, dass Portmann die französische Perspektive auf die deutsche Geschichte gut kannte und dank seiner Frau teilweise davon
Zoologie
711
Namen er erwähnte, doch entsprechen Portmanns Auffassungen auch weitgehend denen der französischen Germanisten seiner Zeit. Lutherischer Geist ist formendes Prinzip deutscher Kultur geworden. […] Darwinismus, organ[ische] Schöpfungsgeschichte viel bedeutsamer f[ür] deu[tsche] als für andere Staaten. Machtstaat ohne humanist[isches] Rechtfertigungsbedürfnis (z. B. Gegensatz zu England, das stets hum[anistische] Prinzipien als seine Staatsmaxime gleichlaufend bewertet hat). Deutschland wurde ‚eine Verbindung von Preussentum u[nd] Amerikanismus‘. Idee des Volkes ist sehr deutsche Schöpfung (Herder), eine Annahme eines organ[ischen] Grundes für polit[ische] Formen. (Gegensatz zu Staat, Nation, Commonwealth)[.] Die ‚gemüthafte‘ Tiefe des Volks steht [?] gegen die rationale Sphäre der Rechtsideen. Bild des Organismus ist in ‚Volk‘. Herder sucht damit zwischen Mensch und Menschheit das natürliche Zwischenglied[,] das er nicht in Staat, Nation sehen konnte. Vom ‚Volkstum‘ aus wirkt jede Verfassung als zufällig, nebensächlich. Fichte betonte, dass Deutsche ein ‚Urvolk‘ mit gewachsener Sprache sei[e]n, nicht latinisiert auf ein[em] andern Grundbau (Affektgeladene Ansichten!) […]. Im Wort Kultur liegt die Tiefe der Weltfrömmigkeit, die aus d[em] Verhältnis d[es] Luthertums zu weltlicher Arbeit und Beruf stammt. / Darwin in D[eutschland]. Aus Darwins Angaben machen deutsche Gelehrte ein romantisches Weltbild der natürl[ichen] Entw[icklung] in Natur, Geschichte u[nd] Gesellschaft. Deutsche haben Instinkt der Traditionslosigkeit[,] die das Niedagewesene, Ungeheure, die grenzenlose Zukunft liebt. Bedeutung v[on] Musik = Philosophie als Ausdruck v[on] Unsagbarem od[er] Suchen nach Unsagbarem. Nicht die Vokalmusik Italiens sondern die freie Tonschöpfung. / Plessner / Vorliebe massgeb[ender] Schichten für best[immte] Geschichtsbilder ‚erschütternde Ansprechbarkeit für Ideen‘. Weder Überschätzung noch Bagatellisierung von geistigen Wirkungen sollte Ziel sein.
Portmanns Kritik des politischen Missbrauchs und das Studium der Bedeutungsverschiebungen von wissenschaftlichen Theorien konnte sich ebenso gegen die Verwendung des Darwinismus durch die bürgerlichen antiklerikalen Bewegungen des 19. Jahrhunderts und die Arbeiterbewegung richten wie gegen die rassistischen Vorstellungen und das Dogma vom Überlebenskampf im Sozialdarwinismus, die in den Nationalsozialismus mündeten. Spezifischer wurde seine Kritik, als er begann, den Menschen in der Vorlesung über Wirbeltiere systematisch zu berücksichtigen, d. h. ab etwa 1936.3055 Die
3055
geprägt war. Vgl. meine Darstellung von Albert Béguins Auffassung des Luthertums und die Hinwesie auf die Germanistik in Frankreich, oben, Kapitel 7.2.4.4.2. Stamm/Fioroni 1984, 100 f. Es handelte sich um die Vorbereitung der Vorlesung für den Winter 1936/37. In der Schlussstunde dieser Vorlesung gab er 1937 einen Ausblick auf die Stellung des Menschen; bei dieser Gelegenheit wurde ihm die «menschliche Trias» (Stehen, Sprechen, Denken) und deren Ontogenese bewusst. Diese Lektion wurde zum Beginn «einer neuen Arbeit in Jahren grosser Sorge, im Schatten der Kriegsdrohung und des
712
Die Naturwissenschaftler
Vorarbeiten zeigten ihm das Ungenügen eines «isolierten zoologischen Denkens». Haeckels biogenetisches Grundgesetz verführe die Zoologen und Mediziner zur Annahme, der menschliche Embryo vollziehe die Entwicklung vom Affen zum Menschen, einseitig fokussiert auf die Gemeinsamkeiten von Mensch und Affe. Als hilfreich galt ihm, wie wir gesehen haben, schon 1928 nur Louis Bolk, der den erwachsenen Menschen durch Retardation und Fötalisation geprägt sah. Bolk fokussierte aber den Organismus, nicht die Umweltbeziehungen. In der älteren Literatur fand Portmann die Hinweise auf besondere Muster der Längenund Gewichtszunahme, die nur beim Menschen festgestellt worden waren: Das erste Lebensjahr folge beim Menschen fötalen Wachstumsgesetzen. Die frühen fachwissenschaftlichen Publikationen seiner für die Vorlesungen entwickelten Einsichten erschienen 1941 in der «Schweizerischen Medizinischen Wochenschrift» (umfassend) und in der «Revue Suisse de Zoologie» (speziell zu den Tragzeiten der Primaten). Im selben Jahr teilte er seine Entdeckung der Freundin Anna Bidder mit.3056 1942 referierte er darüber in Bern vor Studenten3057 und nannte den «notwendigen Kontakt mit dem Reichtum der Welt» einschliesslich der «Sozialwelt» entscheidend für die Entwicklung des neugeborenen Menschen. Drei Merkmale kennzeichneten die menschliche Entwicklung: «weltoffenes Verhalten, die Sprache und die aufrechte Haltung». Erster Höhepunkt dieser Reihe von Veröffentlichungen waren die Biologischen Fragmente zu einer Lehre vom Menschen von 1944.3058 Der Plan, gestützt auf wissenschaftliche Daten aufzuzeigen, was für den Zoologen des 20. Jahrhunderts den Menschen vom Tier unterschied, öffnete eine weite Tür zur grundlegenden Kritik nationalsozialistischer Ideen, denn die NS-Anthropologie forcierte das angeblich «Natürliche» im Menschen, seine Zugehörigkeit zu einer Rasse,3059 seinen Bedarf an Lebensraum, seine vermeintlich notwendige Gewaltanwendung in der Eroberung von Nahrung und Boden und der Verteidigung des reinen Blutes, d. h. seine «Bestialität». Von da aus ergab sich eine interfakultäre Brücke,
3056 3057
3058 3059
Zweiten Weltkriegs», die 1942 mit dem Vortrag über den Grundriss der neuen Anthropologie vor Berner Studenten öffentlich zu werden begann. Portmann 1974, 82–86. Portmann an Anna Bidder, 9. 11. 1941, in: Nachlass Portmann, Schachtel 124, NO-DSK 1059. «Die Biologie und das neue Menschenbild. Schriftenreihe der Studentenschaft der Universität Bern», 1942 Bd. 2, sowie im gleichen Jahr «Die Biologie und das neue Menschenbild», in: Der Kleine Bund 23, Nr. 17. 1944 sprach Portmann im Basler Radio über den Ursprung des Menschen. Boletzky 1997, 117. Portmanns Rassebegriff wäre noch genauer zu klären. Sein undatierter Vortrag über ‚Rasse‘ legt die Vermutung nahe, dass er die Existenz von ‚Menschenrassen‘ für vertretbar hielt, aber unterstrich, dass Menschen ihre ‚Rassen‘ selbst schufen, indem sie sich für die Trennung entschieden; die Alternative sei die Vermischung in der Vielfalt. Nachlass Schachtel 4, NO-DSK 053.
Zoologie
713
über die Portmann selbst zwar nicht schritt, aber die für den Überblick über die Basler Abwehr des Nazismus doch wichtig ist, nämlich zu den Basler Theologen. Diese kontrastierten die Verherrlichung des Tierischen im Menschen (etwa durch Rosenbergs Mythus des 20. Jahrhunderts) mit der christlichen Lehre von der Menschwerdung Gottes, so nachzulesen bei Fritz Lieb und beim christlichen Philosophen Heinrich Barth.3060 Portmanns Biologie wurde dadurch humanistisch, ohne unmittelbar in Idealismus überzugehen. Besondere Aufmerksamkeit widmete er oft den Vorstellungen vom Urmenschen.3061 Auch hier kritisierte er Legenden. Über den Urmenschen könnten wir nur das wissen, was die Skelettreste der physischen Anthropologie preisgeben, seinen Charakter kennen wir nicht. Portmann wusste hingegen, dass der Mensch Anlagen zum Guten und zum Bösen, zum Frieden und zur extremen Brutalität in sich trug; nichts davon liess sich auf ein positives oder negatives Bild eines Urmenschen zurückverfolgen. Zudem kritisierte er die Übertragung evolutionärer Vorstellungen auf die Geschichte des menschlichen Geistes und der menschlichen Seele scharf. Damit stellt er sich in Opposition zur Kulturgeschichte, wie sie eine Generation vorher die Grossvettern Sarasin ganz selbstverständlich gepflogen hatten.3062 Eine Vorlesung zum Thema skizzierte er am 17. Januar 1942 – dies ist für uns die älteste datierte Fassung seiner Gedanken. Die Überschrift lautet «Vom Bild des Frühmenschen»: Der Versuch der Naturforschung, aus den Zeugnissen des Geistwirkens (Werkzeugen etc.) eine geistige Entwicklung des Menschentypus selbst abzuleiten, beruht auf einem folgenschweren Irrtum: einer Verwechslung zwischen den geistigen Anlagen des Menschen (für deren Wandlung kein Beweis besteht) und dem Inhalt des Geistschaffens, welcher auf den verschiedensten Gebieten die Erscheinung der Entwicklung, beruhend auf der Möglichkeit d[er] Tradition, bietet. Die Anlagen selber sind heute – auch bei somatisch relativ ähnlichen Menschengruppen in den Einzelwesen sehr verschieden so verschieden oft als die sog. Rassenunterschiede Wir müssen eine entsprechende Variation auch in früheren Menschengruppen annehmen. Die gleichen geistigen Anlagen werden zu verschiedenen Zeiten sehr abweichende Geistwerke erzeugen, weil die Einflüsse, die von Beginn ihrer Entfaltung an zur Geltung 3060 3061
3062
Vgl. oben die Abschnitte zur Theologie und zur Philosophie. Portmann 1974, 98 ff., ausführlich, wenn auch ohne Hinweise auf bestimmte Zeitpunkte in seinem Schaffen, über seine Ergebnisse zur Geschichte der Darstellung von Menschenaffen und Urmenschen. Illies 1976, 213 ff., deutet an, dass Portmann erst spät über die Problematik der Vorstellungen vom Urmenschen publizierte. Er verweist dafür auf: Vom Urmenschenmythos zur Theorie der Menschwerdung, 1972. Die Notizen zu diesem Thema im Nachlass datiere ich jedoch viel früher und nehme an, dass es lange Gegenstand von Vorlesungsstunden gewesen ist, bevor er dazu etwas im Druck veröffentlichte. Dies entspricht Portmanns Vorgehensweise, die Fioroni in: Stamm/Fioroni 1984, 98, kurz beschreibt. Simon 2015.
714
Die Naturwissenschaftler kommen, zu jeder Zeit von allen andern verschieden sind. Die einseit[ige] Bevorzugung einer bestimmten, vorwiegend auf techn[ische] Intelligenz gerichteten Geistesarbeit in der jüngsten Gegenwart hat den Blick von der Tatsache abgelenkt, dass sich die geistigen Anlagen ebensosehr auf Willensstrebungen, als auf Empfindungsweise, auch Phantasietätigkeit wie auf logische Fähigkeiten und techn[isches] Denken beziehen. Wer das Bild des Frühmenschen sucht, wird sich diese Tatsachen stets vor Augen halten!3063 […] ich denke, es ist aus [sic] allen bisherigen Erörterungen bereits angedeutet, dass das Ursprungsproblem den Bereich rein wissenschaftlichen Erkennens überschreitet. Der Ursprung ist Geheimnis […]. Da es [«das vielversprechende Bild des reifenden Menschen»] das Typische im Anlagenreichtum des Menschen heraushebt, so lenkt dieses Bild unsern Blick auch auf eine der schwersten und dringendsten Forderungen unserer eigenen Zeit: den Blick zu richten auf die harmonische und umfassende, die verschiedenen Anlagen fördernde Bildung des Menschen.3064
Man erkennt hier bis in die Wortwahl hinein den Stellenwert der Holzapfelschen Ideen von der harmonischen Entfaltung der Anlagen des Individuums und der Menschheit. Bemerkenswert ist, wie Portmann von der naturwissenschaftlichen Anthropologie ausgehend zu einer deontologischen Aussage gelangte. 8.8.5.2 Vorträge Ich wende mich jetzt den Vorträgen zu, die Portmann ausserhalb des Universitätsunterrichts hielt. Wieder stütze ich mich hauptsächlich auf Vorbereitungsnotizen. Schon im September 1933 erklärte er vor der Frauenzentrale, was man mit Sicherheit über Erbvorgänge wisse. Der allgemeine Zeitbezug ist ebenso unverkennbar wie Portmanns Anliegen, wahre Wissenschaft von Wissenschaftsaberglauben zu unterscheiden. Die Klärung des wissenschaftlich Sagbaren war für Portmann ein wichtiger Beitrag zur Immunisierung gegen die NS-Ideologie. «Man kann in diesem Vortragstext ein erstaunlich frühes Beispiel ideologiekritischer Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Biologie erkennen.»3065 Portmann notierte sich: Angesichts der Rolle, welche von manchen politischen Strömungen etwa den Rasseproblemen und der Erbbiologie zugewiesen wird, ist solche abwägende Skepsis [Portmann will «streng […] sondern was wirklich den wissenschaftlichen Arbeiten entnommen werden darf – von all dem, was der Wunsch und die geistigen Modelaunen
3063 3064 3065
Vorlesung Anthropologie, in: Nachlass Schachtel 32, NO-DSK 0996S, 15 f. «Zusammenfassung!». Vorlesung Anthropologie, in: Nachlass Schachtel 32, NO-DSK 0996S, 18 f. Ritter 2000, 220.
Zoologie
715
des Tages aus der Forschung gewaltsam herauspressen»] ein doppeltes Gebot der Stunde.
Trotz grosser Erfolge der Forschung müsse Zurückhaltung geübt werden. Denn die Ergebnisse moderner Erbforschung beruhten auf Experimenten an Pflanzen und Tieren. Sie hätten ganz bestimmte Voraussetzungen: «Reines Ausgangsmaterial von Rassen, deren konstantes Erbverhalten durch lange Kontrolle gesichert war». «Die Rassen werden so gewählt, dass die Nachkommenschaft zahlenmässig so gross ist, um nach den Gesetzen der Statistik verarbeitet zu werden.» Im menschlichen Sozialleben seien alle diese Voraussetzungen nicht erfüllt: «1. Rassenmischung unlösbar komplex, 2. Inzucht durch ethische Gesetze verhindert, 3. Nachkommenzahl stets zu gering.» Stammbaumforschung sei nur aufschlussreich bei auffälligen körperlichen Missbildungen. Die Vererbung geistiger Fähigkeiten sei extrem schwer zu erforschen, und deren Merkmale seien nicht eindeutig definierbar. Beim Menschen werde mit den Worten «Erbwissenschaft und Erbmerkmal» oft «folgenschwerer Missbrauch» getrieben. Bei Verbrechern hält es Portmann für eine «leichtfertige Annahme», dass ihre Tat durch erbliche Anlagen bedingt sei. Das sogenannte Erbliche sei veränderlich durch Erziehung, Milieu und Pflege. Pseudowissenschaftliche Auffassungen dürften uns nicht davon abhalten, alle Mittel von Pflege und Erziehung zu versuchen, «wo es sich um menschliches Sozialleben handelt». Dann erklärte er zur Inzucht und zur «Rassenmischung», dass eine vorurteilsfreie Forschung darüber noch «fast völlig» fehle. Den Schluss bildete die Ermahnung, ein korrektes Verständnis der wissenschaftlichen Forschung zu pflegen. Mit Empfehlungen gegen Inzucht und Rassenmischung begebe sich die Naturforschung in das Feld menschlicher Wertungen, die ihr fremd seien. «Die Naturwissenschaft darf nicht mit der durch sie ermöglichten Technik identifiziert werden, wie das gern geschieht. Und ihre Leistungen dürfen nicht nach den Anwendungsmöglichkeiten gemessen werden.» Die Bedeutung der Erbforschung liege vielmehr in deren Erkenntniswert. Sicheres Wissen ersetze Aberglauben, dumpfes Ahnen und Nichtwissen. Dieses Wissen dürfe nicht prahlerisch daherkommen, sondern nur «mit Ehrfurcht [vor] dem Geheimnisvollen der Lebensvorgänge». Die Wissenschaft entzaubere die Natur keineswegs, sondern «zeig[t] das tiefere Wunder der Naturvorgänge nur umso eindringlicher». Dass die Vererbungsgesetze für alle drei Reiche (Pflanzen, Tiere, Menschen) gleich sind, bestärke den Eindruck, dass «alle Lebewesen eine grosse Einheit bilden und zeige uns Menschen, dass auch wir nur ein Teil der grossen Kräfte sind, welche an der Entfaltung des Lebens arbeiten».3066
3066
Manuskript eines Vortrags vor der Frauenzentrale über Ergebnisse der Erbforschung, 26. 9. 1933, in: Nachlass Schachtel 3, NO-DSK 0038.
716
Die Naturwissenschaftler
Nach Kriegsbeginn sprach er vor Berner Studenten (1942) und dann vor Angehörigen der Studentenverbindung Zofingia (1943) über seine anthropologischen Erkenntnisse, die er nun als «basal» bezeichnete im Unterschied zu einer «terminalen» Anthropologie. Mit «basal» meinte er diejenigen Lehren, die sich in wissenschaftlicher Systematik aussagen lassen und die Basis für eine Wissenschaft vom Menschen abgeben. Unter «terminal» verstand er eher zielgerichtete religiöse, ethische und ästhetische Lehren vom Menschen, die nicht in der gleichen Strenge gälten wie die ersteren. «Hierzu zählten neben den religiösen auch philosophische Entwürfe von Menschenbildern […]».3067 In der Kriegszeit spitzte Portmann die Auseinandersetzung noch deutlicher auf die nationalsozialistischen Ideen vom Menschen zu. Zu diesem Zweck befasste er sich mit den Vorstellungen vom «Urmenschen» (darüber habe ich schon berichtet), mit der Idee, die politisch-gesellschaftliche Ordnung sei ein «Organismus» oder solle wie ein solcher funktionieren, und mit der These, dass das Verhalten der Menschen untereinander «biologisch» (rassisch/völkisch) determiniert sei. Für ihn handelte es sich in Politik und Gesellschaft um «geistige Entscheidungen» im Rahmen einer «terminalen» Anthropologie. Die wissenschaftliche Biologie könne per se nicht Anleitung geben zur richtigen Entscheidung, aber sie könne und müsse über den pseudowissenschaftlichen Charakter entsprechender Ideologeme aufklären. Über diese Themen publizierte Portmann umfassend 1946.3068 Dabei hatte er selbst während des Krieges in die ethische (terminale) Anthropologie übergegriffen. Als Bürger und Demokrat trug Portmann auch seine eigenen «geistigen Entscheidungen» vor und warb für diese unter der Jugend. Zusätzlich zu einer Darlegung dessen, was der Mensch nach seinen biologischen Erkenntnissen nicht sein könne, erörterte er nun, was im Humanen sein solle. Diese Ausführungen schlossen während des Krieges ein offenes Bekenntnis zur Demokratie ein. Dabei distanzierte er sich schon vor, aber erst recht bei Kriegsende von Revanchegelüsten im Namen der angeblich Gerechten. Diktatur, Terror und Krieg offenbarten, zu welchen Untaten der Mensch fähig sei, aber ohne den Willen zur Versöhnung und zum Aufbau könne es kein menschliches Zusammenleben geben. Das Referat vor der Zofingia vom 16. Juni 1943 war überschrieben mit «Zwielicht der Entwicklungsidee». Hier wiederholte er seine kritischen Überlegungen zur politischen Instrumentalisierung des Entwicklungsgedankens. Er unterschied wieder zwischen zwei Entwicklungsbegriffen, einem naturwissenschaftlichen und einem historischen, und warnte vor den Folgen, die ihre Vermischung habe. Erneut wies er darauf hin, dass die kulturgeschichtliche Evolution keines-
3067 3068
Müller 1988, 113. Portmann 1946: Natur und Kultur im Sozialleben. Vgl. dazu: Markó/Meier/Neff 1998, 89.
Zoologie
717
wegs die Fortsetzung der «organischen», naturwissenschaftlich untersuchten Entwicklung des Menschen sei.3069 Im gleichen Jahr 1943 sprach er über «Die Moralkrise und die Biologie».3070 In seinen Vorbereitungen finden sich dazu folgende Überlegungen: Nach einem geplanten Hinweis auf «Lektüre von wenigen Beispielen: Humm – Ortega y Gasset – Gantner» stellte er fest: Die Biologie habe zwar Segen gebracht, zum Beispiel in Gestalt neuer Heilmittel. Sie habe aber auch «Schlagworte» geschaffen, nämlich die «Waffen, die zum Guten wie zum Bösen dienen mussten». Der ‚Daseinskampf‘ erscheine in der Reihe der Schlagworte als schöpferisches Prinzip: Das ‚Überleben der Tüchtigsten‘ bilde scheinbar die Grundlage der Entwicklung. Der Staat werde als Organismus oder als wertbestimmende Instanz dargestellt (hier verwies er auf «Ernst Jünger im ‚Arbeiter‘»);3071 Rasse und ihr Erbgut gälten als «letzter Wert und letzte Gewissheit: Recht ist, was meinem Volke nützt». «Vermengung aller biolog[ischen] Kampfparolen in den Begriffen der Herrenrasse, des Führungsvolkes, des Lebensraumes, der jungen und alten Völker» – das waren damals sehr aktualitätsbezogene Stichworte. Mit der Biologie sei «ein neues Bild vom Menschen» auf den Plan getreten, das im Gegensatz zum alten Bild stehe, das für «weite Kreise des Abendlandes» selbstverständlich gewesen sei und auf der Bibel beruhte, mit griechischem Denken verschmolzen gewesen sei und einen von Gott erschaffenen Menschen gezeigt habe. Der Unterschied zwischen Mensch und Tier sei in diesem Bild nur graduell, Vernunft und Verstand seien eine blosse Steigerung der tierischen Psyche in Gestalt der technischen Intelligenz. Geist [erscheint in diesem Bild] als ein Instrument der vitalen Triebe: Geistwerke [sind] ideolog[ische] Verbrämung, Überbau[,] Sublimierung – Verstand als ‚Instinkt der höchsten Lebenserhaltung‘ (Marx, Nietzsche, Freud Entlarvung des Geistigen). Betonung des unbewussten Lebens (seit Romantik – Nietzsche – Freud). Historische Entwickl[ung] oft als eine Fortsetzung der organ[ischen] Entwicklung aufgefasst.
Diese Vorstellungen seien für viele Zeitgenossen eine «nicht mehr diskutierte Selbstverständlichkeit» geworden. Beide Bilder, das alte und das neue, existierten nebeneinander und durcheinander. Resultat: Weithin Zerfall alter Glaubensformen – vielfach Bewahrung von Formen ohne Inhalt, weithin Lauheit. Lockerung aller Autorität in Staat und Familie, wilder Individualismus, egoist[ische] Genusssucht. Abwertung des Geistigen gegen ma-
3069 3070 3071
Ritter 2000, 218 f. Ritter 2000, 213 f. Vorlesung Anthropologie, in: Nachlass Schachtel 29, NO-DSK 0311. Hier Ausriss aus einem Artikel von H. A. Wyss, «Ernst Jünger – Bildner der Wirklichkeit» (Schweizer Monatshefte, Oktober 1943).
718
Die Naturwissenschaftler ter[ielle] Güter. Schwinden des Verantwortungsgefühls, der Rechtsideen im Leben des Einzelnen, in der Familie, im Staate. Erinnern an Rechtszerfall im Kriege. Krisenrecht a[ls] Rechtskrise. Hinweis auf Zahl der Scheidungen.
Richtig verstandene Biologie könne durch «neu zu förderndes Bewusstsein von der Besonderheit der geistigen Sphäre des menschlichen Lebens u[nd] von der Eigenart ihrer Gesetze!» Auswege aus der Krise weisen. Daran schloss sich eine staatsbürgerliche Ermahnung an: Hinweis darauf, wie sehr gerade wir Schweizer stetsfort Grund haben, uns auf die wahrhaft menschl[ichen] Grundlagen des Staatslebens zu besinnen. Wie sehr wir Gegensatz des Totalitären, Kontrast zum ‚Überorganismus‘ sind, gegen jeden Versuch biologischer Begründung! […] Stärkung des Willens, der Verantwortungsgefühle, der Selbsterziehung und der Sozialerziehung (nicht Dressur, wie sie der totalit[äre] Staat üben muss).
Ein pathetischer Ausblick auf die Biologie der Zukunft, an der Portmann arbeitete, beschloss die Ausführungen: In kommenden Tagen wird der Biologe mit grosser Zurückhaltung von den Problemen des Ursprungs sprechen. Aus seinen Darstellungen wird uns ein Menschenbild anschauen, in dessen ganzer Erscheinung, in dessen Blick uns das grosse Geheimnis seines Wesens begegnet und uns erschüttern wird in der Ahnung der kosmischen Ferne und Grösse dieses Geheimnisses.3072
Vor der Studentenverbindung Rhenania hatte er schon am 13. Januar 1943 mit aktuellen Bezügen ausgeführt, warum es falsch sei, den Staat in biologischen Begriffen verstehen zu wollen. Aufklärungsabsicht und ‚geistige Landesverteidigung‘ griffen beinahe exemplarisch ineinander; das Verhältnis zwischen naturwissenschaftlicher Grundlage und staatspolitischem Anliegen wurde dabei offensichtlich. Ich zitiere deshalb nochmals ausführlich aus Portmanns Notizen: «Staat wird heute in einem besond[eren] Masse betont und oft geradezu als das grössere Ganze bezeichnet, dem das Indiv[iduum] sich restlos einzuordnen habe.» Der Mensch werde heute vor allem «von der Vitalsphäre aus gewertet»,3073 der Geist sei somatisch bedingt, heisst es, «Somatisches als Rasse festgelegt», die Lebensform sei angeblich letztlich von biologisch fassbaren Gesetzmässigkeiten bestimmt. Dadurch werde das Individuum extrem abgewertet, «Hochwertung
3072 3073
«Referat 1943», in: Nachlass Schachtel 32, NO-DSK 0994. Auch nach dem Ende der faschistischen resp. nationalsozialistischen Diktaturen hielt er daran fest, dass der biologistische Argumentationsstil in Wertdiskussionen vorherrsche. So schloss er seine Rektoratsrede mit dem Appell: Wir «müssen den Mut finden, unsere Entscheidungen im Reich der Werte zu suchen und die Parolen für die Führung des Daseins nicht aus dem Felde des Vitalen zu holen». Portmann 1948, 24.
Zoologie
719
des Kollektiven und damit auch des Staates, Kollektiv gilt als Bezugssystem für viele Biologen». «Gemeinnutz geht vor Eigennutz; Recht ist, was meinem Volke nützt; Das Volk dauert, das Indiv[iduum] vergeht. So dröhnt es auf uns ein.» «Fascismus» und «Bolschewismus» verstünden den Staat als Organismus, da sie selbst totalitäre Staaten seien. «Wir haben sie [die totalitäre Auffassung] ernst zu nehmen[,] selbst wenn wir sie als irrig erweisen[,] da sie auch uns alle beeinflusst, da wir die Notwendigkeiten der Kriegszeit nur sinnvoll überwinden, wenn wir dieser Beeinflussung nicht erliegen, sondern sie klar erkennen.» Der Vergleich zwischen dem Staat der Menschen und den Staaten der Tiere zeige: Wir finden bei uns keine der Grundlagen d[er] Tierstaaten: 1. Keine Abstammung von 1 Muttertier oder Elternpaar, also echte Blutsverwandtschaft = Familienstaat 2. Keine völlige Dominierung erbfester Instinkte 3. Keine morphol[ogisch] u[nd] psychisch festgelegten Kastenunterschiede.
Die Vorstellung vom Menschen als einer Zelle des Staates sei zirkulär: zuerst würden Zellen wie Menschen abgebildet, danach erkläre man, die Menschen müssten wie Zellen sein.3074 Erblehre. Erbbedingte Grundlagen des geistigen Lebens sehr umstritten sicher nur vage Anlagen der vitalen Grundlagen d[er] Psyche. Rolle der Tradition in der Kontinuität des Geisteslebens, der Kultursphäre wird ungenügend taxiert, von Biologen oft vernachlässigt. Was man heute als von ‚Blut und Boden‘ stammend bezeichnet, ist genau so unbekannt, so schwer zu fassen, wie was [wenn] man etwas als Geschenk des Himmels bezeichnet. Vermischen von Volk und Staat – da wo die beiden nicht identisch [sind], wurde auch eine zusätzliche Ansicht erfunden: 1 [sic] Volk von Vielen ist ‚Staatsvolk‘. Vermischen Volk und Rasse. Rasse als biolog[isches] Fundament organ[ische] Grundlage des Staates, resp. Staatsvolkes. Dieses Bedürfnis nach Zurückführung eines Anspruches auf ‚natürliche‘ Grundlagen ist Hauptantrieb zur Biologisierung des Staates. Rasse auf Blut u[nd] Boden zurückgeführt, Ursache aller geistigen Sonderart.
3074
Ähnlich sagte er in seiner Einführung in den Volkshochschulkurs «Naturgeschichte der Gross-Stadt», 14. 5. 1943 (in: Nachlass Schachtel 28, NO-DSK 0988), über die Gefahren, die mit dem falschen Bild des Zellenstaates verbunden seien: «Diese Auffassung erlaubt denen, die über die Macht verfügen, jeden Eingriff in die Sphäre der persönlichen Freiheit […]. Und dies nicht unter der Notlage eines Krieges, sondern als allgemeingültige Staatsauffassung: Sterilisierung, Humane Tötung, Deportation oder Haft für Gesinnungsgegner.» Der «Biologe muss betonen: elementare Gleichheit der Menschen (nicht faktische Identität) / Freiheit der geistigen Entscheidung (trotz Notwendigkeit des Zus[ammen] lebens) / Wert der Person, des Einzelnen. Auf dieser Basis: Sonderfall der menschlichen Gemeinschaft».
720
Die Naturwissenschaftler
Am Staat ist in Wahrheit alles «menschlich»: – «Das Kommunikationsmittel der Sprache und Schrift – Die Mittel der Kontinuität: Überlieferung statt Vererbung – Die Geschichtlichkeit des Staates».
Jacob Burckhardt lehre:3075 Nur der Menschenstaat ist eine Gesellschaft, d. h. eine irgendwie freie, auf bewusster Gegenseitigkeit beruhende Vereinigung […]. Nicht Staat: Gesellschaft verwirklicht das Sittliche […]. Die Rassenlehren: sie haben in Deutschland zuerst als Grundlage für Ansprüche gedient, […] nachher wurde sie preisgegeben zugunsten neuer Ideen als Grundlagen: Lebensraum statt ‚Staat‘, Europa (ein rein geistiger Begriff). Rascher Verbrauch der Schlagworte. Vorsicht beim Nachbeten!! […] In Notzeiten gleicht der Staat ganz besonders als Ganzes einem streng gefügten ‚Organismus‘[,] aber wir wollen hoffen und darüber wachen, dass diese Not zur Organisation nicht eine falsche Lehre vom ‚natürlichen Organismus‘ des Staates schaffe. Demokratie ruht auf dem Wert der menschl[ichen] Person als einem obersten Prinzip. Person: entscheidungsfreies Indiv[iduum]. Das ist nicht schrankenloser Individualismus. Diese Person ist natürliches Sozialwesen, damit naturgegeben Leben in Gesellschaft [gestrichen: Gemeinschaft]. Die Form der Gesellschaft ist nicht naturgegeben, sondern in freier geistiger Entscheidung gewonnene Gestaltung.
In der Gefahr betone man die frei gewählte Staatsform als Wert. Gerade die akademische Elite müsse sich «heute in unserer von Gefahren umtobten Heimat ganz besonders auf die Werte besinnen, welche der grössten Opfer würdig sind».3076 Weitere Vortragsvorbereitungen aus demselben Jahr 1943 variieren und präzisieren seine öffentlichen Beiträge zur kritischen Diskussion der Bilder vom Urmenschen und der nationalsozialistischen Staatsideologien. Hier stelle ich nur die Schlussfolgerungen vor, die Portmann aus seinen Überlegungen zu den zwei Menschenbildern für den Vortrag vor der Naturforschenden Gesellschaft am
3075
3076
Wie und wann Jacob Burckhardt für Portmann wichtig wurde, müsste Gegenstand einer eigenen Untersuchung sein. Aus den im Nachlass enthaltenen Notizen gewinne ich den Eindruck, dass anfänglich nicht die Lektüre aus erster Hand, sondern Karl Löwith den Zugang eröffnete, sowohl mit Von Hegel bis Nietzsche, 1941, (daraus exzerpierte Portmann einen Vergleich zwischen Goethe, Hegel und Burckhardt) als auch mit Löwiths Jacob Burckhardt, Der Mensch inmitten der Geschichte, Luzern 1936. Notizen zu einer Vorlesung über Naturforscher (Naturphilosophen), in: Nachlass Schachtel 024, NO-DSK 0139. Das jüngste dort angeführte Dokument stammt von 1941, was die Datierung der Notizen erlauben könnte. «Ist der Staat ein biologisches Phänomen?» Vortrag vor der Rhenania, 13. 1. 1943, in: Nachlass Schachtel 28, NO-DSK 0990. Vgl. Ritter 2000, 222–225.
Zoologie
721
22. März 1943 in Thun zog. Dabei handelt es sich um ausformulierte Sätze, die in einem Typoskript festgehalten sind. Es ist nicht vermessen, zu behaupten, dass dem heutigen Weltkonflikte im Abendlande mindestens zwei Auffassungen vom Menschen zugrunde liegen, von denen die eine mit grosser Werbekraft behauptet, die biologische zu sein und aus diesem Umstand ihre Bedeutung für die Zukunft ableitet. Diese Situation verpflichtet den Biologen zu strenger Rechenschaft darüber, ob er alle die weiten Folgerungen, die aus biologischen Forschungen oft gezogen werden, auch wirklich mitverantworten kann. Die heutigen Betrachtungen über zoologische Probleme der Anthropologie wollen zu solcher Rechenschaft anregen.
Wer den Ursprung der Sprache bei Affen studieren wolle, handle sich unüberwindliche Schwierigkeiten ein. Viel zu sehr sind gerade im Grenzgebiete, wo sich Zoologie und Anthropologie in der Erforschung des Menschen begegnen, die Ideen der Evolution zu nicht mehr diskutierten Selbstverständlichkeiten geworden. Welch eine seltsame Auffassung von Wissenschaft spricht aus dem Worte des Rassenforschers von Eickstedt, der 1932 sagt: die Zeit ist vorbei, wo der Ursprung des Menschengeschlechtes zu den grossen Problemen der Forschung gehörte. Ist doch dieses Problem noch immer vor uns im tiefen Dunkel und in unzugänglicher Ferne.3077
Den Höhepunkt dieser öffentlich vorgetragenen Analysen bildete seine Rektoratsrede im Jahr 1947.3078 Nachdem er einleitend festgestellt hatte, dass Wissenschaft immer irgendwie «verwertet» werde, kam er direkt auf die soeben überstandene Zeit des Nationalsozialismus zu sprechen. Diese stellte er unmittelbar in eine Perspektive zum politischen Missbrauch biologischer Theorien, der schon im 19. Jahrhundert begonnen habe, insbesondere in Deutschland. «Aber noch nie hat man Argumente des Forschens zur Rechtfertigung von so Entsetzlichem verwendet, wie während der letzten Jahrzehnte, wo in manchen Ländern unter der Herrschaft der Schlechtesten die Lebensforschung für politische Abenteuer ausgebeutet worden sind [sic].» Er konstatierte eine «rauschhafte Überbewertung des Lebens schlechthin». «Bedenkliche Anfänge» datierte er auf die Zeit nach 1870. Der Missbrauch der Biologie in Deutschland «begann mit der völligen Entstellung der Abstam3077
3078
«Beziehungen von Anthropologie und Zoologie», in: Nachlass Schachtel 28, NO-DSK 0991. Der Vortrag wurde an der Tagung der Naturforschenden Gesellschaft in Thun, 22. 3. 1943, gehalten. Ritter 2000, 210. Ritter 2000, 225, wichtig dort 225–227, auch Ritters Hinweis auf Portmann, Natur und Kultur im Sozialleben. Ein Beitrag der Lebensforschung zu aktuellen Fragen, Basel 1946; diese Publikation beruht auf Radiovorträgen von 1945, wobei das Vorwort den Zeitbezug explizit herstellt.
722
Die Naturwissenschaftler
mungslehren». Eine «vulgarisierte Lehre vom Daseinskampf» gewann Oberhand. Wilhelm His kritisierte schon 1874, dass die Abstammungslehre «ein geschlossenes dogmatisches System» geworden sei. Bei Ludwig Rütimeyer sah Portmann «steigende[n] Unmut». Rütimeyers Nachruf auf Darwin von 1882 war ein «mahnendes Wort», auf das nur wenige hörten. Gerade in Deutschland hatte dies unabsehbare Folgen. Die höheren Tierformen (insbesondere die Primaten) erschienen fälschlich als unmittelbare Nachbarn des Menschen, dies bedeute eine Verkürzung des Menschenbildes. Demgegenüber erkenne die Biologie (Portmanns) heute den weiten Abstand zwischen Tieren und Mensch.3079 8.8.5.3 Erinnerungen Wenden wir uns zum Schluss dem zu, was aus Portmanns Erinnerungen bekannt ist. Das ist herzlich wenig. Die geringe Zahl von rückblickenden Äusserungen erklärt sich mit Portmanns Abneigung, sich selbst als einen Mann darzustellen, der schon immer gewusst habe, was Recht und Unrecht sei, der zurückblicke statt vorwärts in die Zukunft der Nachkriegszeit. Diese allgemeine Zurückhaltung legte Portmann ab, als er ohne Nennung von Namen und Daten in den 1970er Jahren seinem Biographen Illies berichtete, dass er an einer Aktion beteiligt gewesen sei, die den Vortrag eines deutschen Nobelpreisträgers in Basel verhindern sollte.3080 Leicht lässt sich erraten, dass damit die Vortragsreise von Adolf Butenandt durch die Schweiz gemeint war. Verschiedene wichtige Schweizer Wissenschaftler, darunter Leopold Ru⌅i⇥ka, der 1939 den Nobelpreis mit Butenandt zu teilen hatte, organisierten den Boykott der Vorträge überregional. Wie sich Portmann richtig erinnerte, wurde der Basler Vortrag abgesagt.3081 Portmann berichtete Illies, dass er mit einer Gruppe Gleichgesinnter entschlossen gewesen sei, den Vortrag, falls er denn hätte stattfinden sollen, notfalls durch direkte Aktion zu verhindern. Portmann möchte uns also darauf hinweisen, dass er nicht nur mit Worten gehandelt hätte, sondern auch mit Taten, wenn das erforderlich geworden wäre.
3079 3080 3081
Portmann 1948, 3–5. Illies 1976, 116. Butenandt und Basel: Simon 2009. Butenandts Basler Vortrag wurde von der deutschfreundlichen kulturpolitischen Vereinigung ‚Basler Pfalz‘ für Februar 1943 organisiert, die ihn dann von sich aus wieder absagte. Diese Organisation war damals noch nicht verboten; erst die Mitgliedschaft von Staatsangestellten (darunter Universitätslehrern) wurde am 12. 2. 1943 durch Regierungsratsbeschluss untersagt. Der Bund löste dann die ‚Basler Pfalz‘ im Oktober 1943 auf.
Zoologie
723
8.8.6 Portmanns originäre Position Die relative Abgrenzung von politischen Ideenfamilien bei gleichzeitiger Verwandtschaft mit ihnen charakterisiert Portmanns Position. Mit Gewerkschaftern und Sozialdemokraten verband ihn die Sensibilität für Unrecht und Ungleichheit sowie die Bereitschaft, notfalls auch zu handeln. Was ihn davon trennte, war einmal die Überzeugung, dass sich ein intensives Forscher- und Dozentenleben nicht mit aktiver Politik vereinbaren lasse, sodann der Holzapfelsche Idealismus, der ihm verbot, für die Interessen einer einzelnen Klasse einzutreten. Mit den Christlichsozialen verband ihn die Erkenntnis, dass das Menschliche im Menschen das Wesentliche sei, nicht das, was der Zoologe (und Ideologe) an Tierischem in ihm zu sehen glaubte. Getrennt war Portmann jedoch von ihnen durch das Fehlen eines biblischen Offenbarungsglaubens und der Bereitschaft, aus einem solchen Glaubensgrund heraus gegen den Nazismus zu predigen. Portmann war nicht irreligiös, lehnte aber konfessionelle Dogmen ab und bekannte sich nach seinem Kirchenaustritt 1926 nie zu einer christlichen Lehre, weil ihn daran die vermeintliche «Informiertheit» der Gläubigen störte.3082 Wenn er vom «Geheimnis» sprach, sollte die Wortwahl nicht den Eindruck erwecken, dieses «Geheimnis» stehe für einen konfessionell definierbaren Gott. Liberalkonservative wie der «Basler Nachrichten»-Redaktor Albert Oeri spielten eine grosse Rolle in der lokalen und nationalen, ja europäischen Abwehr des Nationalsozialismus.3083 Durch den humanistischen Grund dieser Haltung, den Bezug auf Jacob Burckhardts Denken über den Staat, aber auch durch ein waches und vor allem kritisches Interesse an den Tagesnachrichten stand Portmann dieser Tendenz nahe. Die Liberalkonservativen hatten jedoch bis zum kriegsbedingten (relativen) Burgfrieden aktiv den Klassenkampf gegen links geschürt und galten als Sprachrohr der Basler Geldelite. Zwar war Portmann über Mäzene, die ihn unterstützt hatten,3084 und durch seinen Freund Rudolf Geigy3085 mit dieser Elite verbunden, auch publizierte er selbst in den «Basler Nachrichten», aber seine stete Suche nach einer übergeordneten Position, der Verzicht auf Parteipolitik und die Prägung durch den sozialistischen Vater und gewerkschaftlich aktive Verwandte verhinderten, dass er diesem Lager zugerechnet werden konnte. Seine Position ebenso wie die Begründungen dieser Position waren durchaus eigenständig-individuell. 3082 3083 3084
3085
Illies 1976, 236 f. Teuteberg u. a. 2002. Illies 1976, 75. Der mysteriöse «Basler Industrielle» wird auf seinen eigenen Wunsch nirgends mit Namen genannt. Fioroni 1997, 37. Seine Schecks finanzierten Portmanns Aufenthalt in Banyuls-sur-Mer von 1924 bis 1927. Siehe auch die Andeutung in: Portmann 1974, 16. Briefe von Rudolf Geigy an Portmann, in: Nachlass Portmann, Schachtel 115, NO-DSK 0809. Portmann war z. B. Trauzeuge bei Geigys Vermählung, Brief vom 17. 1. 1928.
724
Die Naturwissenschaftler
Der Blick nach Westen unterschied Portmann von sehr vielen anderen Basler Professoren. Zwar war auch Portmann mit Begeisterung durch Deutschland gewandert; an deutschen Universitäten hatte er kurz studiert. Er hatte wissenschaftliche, philosophische und literarische deutsche Autoren gelesen, blieb aber irgendwie unberührt von der besonderen Welt der wilhelminischen und Weimarer Professorenkaste.3086 Seine deutschen Wanderungen3087 verliefen zum Teil ausserhalb eines akademischen Curriculums und dienten der Selbstfindung, dem Abschluss der Jugendzeit, der Hermann Hesse-Lektüre3088 und dem Ausstieg aus der Phase, in der er sich selbst als Künstler sah. Die universitären Studien in München (bei Richard Hertwig, Siegfried Mollier und Heinrich Wölfflin)3089 und Berlin (bei Oskar Hertwig)3090 erfolgten nach den entscheidenden Prägungen als Biologe und dienten eher der Erweiterung seiner wissenschaftlichen Basis als deren Fundierung. Einen vergleichbaren Stellenwert hatte die Studienzeit in Paris bei Marcel Prenant.3091 Die Tätigkeit in den Marinelaboratorien von Helgoland,3092 Roscoff,3093 Villefranche und vor allem Banyuls-sur-Mer förderte Portmanns eigene Beobachtungsgabe, und er folgte dort eigenen Plänen. Die Frage, wessen Schüler Portmann gewesen sei, ist schwierig zu beantworten, da er vieles an vielen Orten aufgriff, aber letztlich immer seinen eigenen Weg fand. Die Weiterbildung nach Abschluss der Studien in Basel und Genf war nach Portmanns eigener Einschätzung «ziemlicher Wildwuchs».3094 Muss sie aber doch eine bün3086 3087 3088 3089
3090 3091
3092 3093 3094
Hübinger 2006; Faulenbach 1980; Ringer 1969. Illies 1976, 55 ff., 65 ff. Illies 1976, 64, 98. Portmanns Rolle in der Herman-Hesse-Stiftung: ebd., 109. Illies 1976, 60 ff. Kollegienbuch für Herrn Dr. Adolf Portmann Studierenden der Philosophischen Fakultät, 2. Sekt., Ludwig-Maximilians-Universität München, Sommersemester 1922 (nur dieses), in: Nachlass Schachtel 108, NO-DSK 616. Er hörte bei Otto Frank «Experimentalphysiologie», bei Wilhelm Goetsch «Probleme des biologischen Individuumsbegriffs», bei Fritz Lenz «Menschliche Erblichkeits- und Rassenlehre», bei Siegfried Mollier «Entwicklungsgeschichte der Wirbeltiere», bei Ludwig Neumeyer «Anatomie am Lebenden und ihre Anwendung in der bildenden Kunst» und bei Wilhelm Specht «Pathologische Psychologie I». Illies 1976, 71. Illies 1976, 73; Dorst 1997, 22, identifiziert den Mann, bei dem Portmann vorübergehend in Paris studierte, mit (Eugène) Marcel Prenant. Dieser war bis 1928 «chef de travaux à la Station biologique de Roscoff. Il devient alors maître de conférences à la faculté des sciences de Paris», also jemand, der Portmann auf Roscoff vorbereiten konnte – und Portmann begab sich von Paris aus wirklich dorthin. Ausserdem war Marcel Prenant Kommunist, https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Prenant. Der Vater Auguste Prenant war Professor an der Faculté de médecine für Histologie, http://www.professeurs-medecinenancy.fr/Prenant_A.htm. Illies 1976, 67 f., 73. Illies 1976, 74. Portmann 1974, 15.
Zoologie
725
dige Antwort finden, so lautet diese: Fritz Zschokke in Basel. Zschokke selbst blickte nach Westen, er war der erste Basler Austauschprofessor in Oxford. Der Blick nach Westen war schliesslich besonders determiniert durch die lange Zeit, die Portmann in der Vorbereitung auf die (Basler) Habilitation und danach in Banyuls verbrachte. War ihm das Französische schon wichtig anlässlich der kurzen Assistenzzeit, die er in Genf bei André und Guyénot verbracht hatte,3095 wurde ihm Südfrankreich zu einer zweiten Heimat – das demokratische Frankreich der ‚Dritten Republik‘. Seit jener Zeit sollten «französische Sprache und Kultur […] zur Grundlage im privaten Bereich werden».3096 In Banyuls lernte er 19273097 auch die 1928 geschiedene Frau seines Kollegen André Migot3098 kennen, Geneviève (Ginette) Devillers, die 1931 seine Gattin wurde.3099 Von ihr wird berichtet, dass sie grosses politisches Interesse zeigte und mit Portmann die Entwicklungen in Frankreich (und später Deutschland) intensiv diskutierte. Spuren politischer Diskussionen enthält die Korrespondenz Portmanns mit Anna Bidder. Auch hierin zeigte sich die Westorientierung. Ihr schrieb er am 28. Oktober 1938: Vous pensez que toutes les menaces de guerre ici, aux frontières allemandes ont pris des proportions graves et que Ginette a souffert beaucoup de cette tension. Elle souffre presque plus encore de la défaite réelle des pays démocratiques et de la perspective sinistre de tous les ‚arrangements‘ dictés par les plus brutaux. Je voudrais tant que toutes les grandes démocraties commenceraient à reconnaître qu’il y a actuellement tout à perdre, tout ce que nous avons cru acquis comme bien spirituel.3100
Und am 30. September 1939, Portmann leistete nun Militärdienst als Korporal bei einer Munitionskolonne, schrieb er ihr: «Je ressens plus que beaucoup d’autres, parce que par tous mes liens de sentiments je participe à la souffrance de Ginette qui voit son pays en guerre – de l’autre côté je connais tellement bien une Allemagne qui n’est pas celle du gouvernement actuel.» Ginette und er litten unter dem Klima der Neutralität – verstanden als einziger Wunsch, verschont zu bleiben –, das dem Land aufgezwungen werde. Dem Individuum sei es nicht möglich, neutral zu bleiben: «On ne peut pas être neutre dans une telle lutte.» «Au moment d’une aggression, je serai parmi les combat3095 3096 3097
3098
3099 3100
Illies 1976, 56. Boletzky 2006, 15. Die Datierung ergibt sich aus Briefen von Geigy an Portmann aus der ersten Jahreshälfte 1927, worin die «Freundin» erwähnt wird. Briefe Geigy an Portmann, in: Nachlass Portmann, Schachtel 115, NO-DSK 0809. Boletzky 2006, 15, erwähnt die Freundschaft Portmanns mit dem «vielseitig interessierten» André Migot, der mit ihm auch das Hinterland von Banyuls durchwanderte. Aus der wissenschaftlichen Zusammenarbeit folgten zwei gemeinsame Publikationen. Illies 1976, 106; Markó/Meier/Neff 1998, 94. Portmann an Bidder, 28. 10. 1938, in: Nachlass Schachtel 124, NO-DSK 1059.
726
Die Naturwissenschaftler
tants, car une vie sans liberté d’esprit n’en est pas une.»3101 Am 18. Mai 1940 klang es dann so: «Si on vit, comme nous autres, à une demi-heure de la frontière de l’Allemagne, on sait ce qui nous menace de toute une race transformée en démons de la destruction. C’est terrible. Nous sommes prêts en Suisse au dernier sacrifice pour avoir plus tard le droit de vivre selon nos propres idées.»3102 Insgesamt kann man sich schwer vorstellen, dass sich Portmann die Grundüberzeugungen konservativer deutscher Kollegen zu eigen gemacht hätte, auch wenn er deutsche Philosophen gründlich studierte, Goethe las und sich an ein anderes Deutschland als dasjenige Hitlers erinnern konnte. Erst nach Kriegsende kam es zu engeren persönlichen Kontakten mit Vertretern des geistigen Deutschland, so Martin Heidegger und vor allem mit dem Heidegger nahestehenden Wolfgang Szilasi,3103 und nicht zu vergessen im Eranos-Kreis im Tessin, worin Portmann eine immer zentralere Rolle spielte, bis er selbst den Kreis steuerte.3104 Dies liegt jedoch ausserhalb der hier interessierenden Epoche. 8.8.7 Ergebnisse Portmann war nicht nur ‚immun‘ gegen nationalsozialistische Gedanken, er war auch geradezu prädestiniert, diese durch Aufklärung aktiv zu bekämpfen. Portmanns Wissenschaft war unter den gegebenen Zeitumständen eine Art politischer Handlung. Er hat diese Wirkung nicht gesucht, vielmehr forderte er konsequent eine Trennung der Wissenschaft von politischen Schlagworten und entwickelte Analysen der ‚Verwertung‘ wissenschaftlichen und pseudowissenschaftlichen Wissens in der Öffentlichkeit. Portmann praktizierte eine eigene, nichtmarxistische «Ideologiekritik»3105 der Instrumentalisierung von Wissenschaft, die im Kampf gegen den Nazismus gute Dienste leistete. Sein Fach war dafür zentral, weil Biologismen in den politischen Ideologien seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert eine zunehmende Rolle spielten und dann für das national3101 3102 3103
3104
3105
Ebd. Portmann an Bidder, aus dem Militärdienst, 18. 5. 1940. Szilasi bewegte sich von 1919 bis 1933 im Umkreis von Edmund Husserl und Martin Heidegger; er emigrierte 1933 in die Schweiz, wo er bis zu seinem Lebensende blieb. In Freiburg wirkte er ab 1947 vorübergehend an der Stelle des suspendierten Heidegger. https:// de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Szilasi. Zusammenarbeit zwischen Portmann und Szilasi, die hauptsächlich in die Zeit nach Kriegsende fällt: Müller 1988, 19 ff.; Portmanns Beziehungen zu Freiburg i. Br.: Ritter 2000, 245 ff. Olga Fröbe versuchte schon während des Krieges, Portmann für den Eranos-Kreis zu gewinnen, dieser lehte jedoch ab, da er sich durch die Verbindung von Lehre, Forschung, Institutsverwaltung und Militärdienst überlastet fühlte. 1946 übernahm er im Kreis ein erstes Referat. Portmann 1974, 223. Ritter 2015, 56, bezeichnet die Biologischen Fragmente zur Lehre vom Menschen (1944) als den «zentralen Textbestand der Ideologie-Kritik» Portmanns.
Zoologie
727
sozialistische Verständnis von Mensch und Gesellschaft grundlegend wurden. Zudem hatte Portmann eine Kunst der Kommunikation entwickelt, die in zeittypischem Pathos ganz verschiedene Zuhörer- und Leserschaften zu begeistern vermochte. Portmann war ein eigenständiger Mensch, mutig und zurückhaltend zugleich, auf allgemeine Begriffe rekurrierend und trotzdem ein authentischer Vertreter einer klaren Überzeugung. Er hatte aus der Krise der Entwicklungsbiologie und den Ansprüchen des Neodarwinismus der 1920er Jahre heraus zur Geschichte der biologischen Grundbegriffe gefunden und damit ein Rüstzeug bereit, das die Grenzen des wissenschaftlich Sag- und Vertretbaren klar zu bestimmen erlaubte. Seine eigenständige neue Biologie, deren Umrisse in den 1930er Jahren rechtzeitig zur Abwehr nazistischer Biologismen entstanden, war human und kritisch zugleich. Zu den Voraussetzungen, unter denen sowohl Portmanns wissenschaftliche Biologie als auch seine Grundeinstellung zum Menschen, zur Gesellschaft, zur Natur und zur Welt im Ganzen sich ausbilden konnten, habe ich die selektive Rezeption der Ideen von Holzapfel gezählt. Ich hätte auch stärker auf Goethes Naturvorstellung hinweisen können. Diese Voraussetzungen lagen im idealischen, antimaterialistischen, den Menschen und die Wissenschaft als klein im grossen Kosmos reflektierenden Denken, mit Ehrfurcht vor dem Leben, das mit dem «offenbaren Geheimnis» enger verbunden sei, als die rational-empirische Wissenschaft wissen könne, und das immer schon vor jeder Erkenntnis existiere. Portmann wollte Anschauung, Wahrnehmung, ganzheitliches Sehen fördern, das sich der Vielfalt, dem Reichtum, der Fülle, dem Überraschenden in der Natur öffne. Hinzu kam Portmanns demokratische Orientierung, sein Wunsch nach Selbstbestimmung und Freiheit. Diese Haltung war nicht individualistisch im Sinne einer Zentrierung auf die eigene Person oder liberalistisch im Sinne einer Auflösung der Gesellschaft in Individuen, sondern freiheitlich in der Ablehnung eines vom Staat oder einer übermächtigen Organisation ausgehenden Kollektivzwangs im Handeln und Denken. Ohne das Wort zu gebrauchen, forderte er das Zusammenwirken der Individuen in einer Zivilgesellschaft und lehnte die Idee und Realisierung einer völkisch-rassisch («somatisch» schrieb er meistens) determinierten «Gemeinschaft» ab. Die harmonischen sozialen Beziehungen, die er sich im Ganzen der Gesellschaft wünschte, fanden die Leser seiner anthropologischen Arbeiten in der Kind-Eltern-Beziehung wieder, die nach Portmann im ersten Lebensjahr des Menschen für dessen Menschwerdung erforderlich waren. Illies hat Portmann als «Homo Politicus» bezeichnet. Portmann wollte keine Politik für eine Partei oder eine Klasse machen, wohl aber sich an seinem Ort dafür einsetzen, dass die Zivilgesellschaft die nationalsozialistische Zeit, die schweizerischen Notverordnungen und die Zensur überstehen könne. Als Demokrat verteidigte er nicht die Freiheitsansprüche einer akademischen Elite, sondern die Gesellschaft der Bürger mit ihren sozialen Errungenschaften. Als Lehrer und Kommunikator wollte er wissenschaftliche Zoologie, Biologie, Anthropologie,
728
Die Naturwissenschaftler
aber auch die kritischen Überlegungen, die der Freiheit Raum gaben, anderen so mitteilen, dass sie in seinem Sinne die Welt anschauen und in ihr handeln sollten. In damaligen Begriffen tat er dies nicht schulmässig und erwartete keine Gefolgschaft, sondern Zuhörer, die so selbstständig dachten und handelten wie er. «Portmanns Wissenschaft war herrschaftsfrei.»3106
3106
Ritter 2015, 57.
9 Einsichten 9.1 Einleitung Die hauptsächlichen Ergebnisse der Untersuchung über das Verhältnis der Universität Basel zu Deutschland in den Jahren 1933 bis 1945 stelle ich in zwei Dimensionen dar. Die eine Dimension, die auch den Leitfaden für die Darstellung abgibt, ist die Entwicklung in der Zeit, die einerseits durch die Evolution der Zustände in Deutschland bestimmt war, andererseits durch die politisch-kulturellen Veränderungen in Basel und die damit verbundenen Reaktionen auf diese Zustände. Die andere Dimension ergibt sich aus den Beziehungen zwischen den ‚Feldern‘ (nach Pierre Bourdieu), die sich in meinen Sondierungen abgezeichnet haben, ohne dass sie voneinander scharf getrennt waren: Dem akademisch-universitären Feld, dem politisch-administrativen Feld sowie dem Feld der ‚Öffentlichkeit‘. Ich setze dieses Wort in Anführungszeichen, weil wir nur die publizierte ‚Öffentlichkeit‘ der Presse kennen sowie die Äusserungen von Organisationen und von Volksvertretern im Parlament. Die Beziehungen zwischen der Universität Basel und den deutschen Universitäten verstehe ich als ‚Zentrum-Peripherie‘-Verhältnis, als Beziehung einer ‚Provinz‘ auf die deutschen ‚Zentren‘ – im Plural, denn die Vielfalt des deutschen Universitätswesens war an sich ein herausragendes Merkmal seiner Stärke, wenn sie auch durch die Nazifizierung zunehmend reduziert wurde. Offensichtlich war dieses Verhältnis nicht einseitig: Auch an der ‚Peripherie‘ wurde gute wissenschaftliche Arbeit geleistet, und die ‚Zentren‘ zogen Gewinn aus der Existenz der Peripherie, da sie ihren Einflussbereich vergrösserte, die Möglichkeit, Schüler zu platzieren, erweiterte und den Ruhm der bedeutenden ‚zentralen‘ Wissenschaftler mehrte. Die Abhängigkeit der ‚Peripherie‘ von den ‚Zentren‘ war dadurch determiniert, dass diese die fachliche Kommunikation durch Zeitschriften, Publikationsreihen, Fachgesellschaften und Kongresse beherrschten und im ‚reward system‘ die herausragenden Anerkennungszeichen zuteilten. Ganz elementar zeigte sich die Abhängigkeit zudem in den Ausbildungsgängen. Zwar besuchten auch deutsche Studierende die Schweizer Hochschulen und deutsche Fachleute zogen Berufungen an Schweizer Hochschulen in Betracht, aber Schweizer, die eine wissenschaftliche Laufbahn anstrebten, waren geradezu verpflichtet, bei deutschen Meistern ihres Faches in die Lehre zu gehen. Die Asymmetrie der Beziehung zwischen ‚Peripherie‘ und ‚Zentren‘ kam im einseitigen Bestreben der Schweizer zum Ausdruck, ihre Hochschulen, Studiengänge und Professorenstellen von den deutschen ‚Zentren‘ als gleichwertig anerkannt zu sehen.
730
Einsichten
Manche Naturwissenschaften verfügten in der Schweiz vor 1933 über eigene Zeitschriften und Tagungen, die mit starken Fachgesellschaften (namentlich der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft und mit regionalen Fachgesellschaften) verbunden waren und internationales Ansehen genossen, wie zum Beispiel die «Helvetica Chimica Acta». Zu den Voraussetzungen gehörte, dass das entsprechende Fach in der Schweiz von hervorragenden Forschern mit weltweitem Renommee vertreten war, die hier ihre Ergebnisse veröffentlichten, und dass der Resonanzraum dafür in ihren Disziplinen wirklich eine globale Dimension hatte. Gegen Ende der 1930er Jahre wurde die Kommunikation in den Naturwissenschaften und in verschiedenen Fächern der Medizin durch die Zeitschriften weiter von Deutschland losgelöst, die der Karger Verlag nach Basel transferierte und mithilfe von Schweizer Professoren internationalisierte. Hinsichtlich der fachlichen und kollegialen Kommunikation war die Existenz als ‚Peripherie‘ in solchen Fällen deutlich weniger ausgeprägt als in anderen Disziplinengruppen. Basler Professoren zeigten in ihren Kontakten zu den seit 1933 umgestalteten deutschen Verhältnissen ein Verhaltensmuster, das schon für andere Länder an der ‚Peripherie‘ des deutschen Hochschulsystems beschrieben worden ist: Man verhielt sich gegenüber deutschen Kollegen und Institutionen so, wie wenn sich durch die Nazifizierung nichts Wesentliches verändert hätte, in der Art einer (gespielten oder erhofften, in Nischen teilweise real weiterexistierenden) ‚Normalität‘. In Wahrnehmung und Strategie der ‚Peripherie‘ gegenüber den ‚Zentren‘ der Wissenschaft, die dem nationalsozialistischen Herrschaftsanspruch unterworfenen waren, erschien die Situation insbesondere durch Kooperationen und kommunikative Partizipation als ‚normalisiert‘, weshalb vorgeschlagen wurde, dieses Phänomen als «normalization» zu bezeichnen. Es stellte sich damit jedoch die Frage, wo legitime wissenschaftliche Kooperation endete und eine (vor allem von der Öffentlichkeit der ‚Peripherie’) als illegitim beurteilte ‚Kollaboration‘ überging3107 – zumal die Nationalsozialisten bis 1938 darauf erpicht waren, sich von ausländischen Wissenschaftlern darin bestätigt zu sehen, dass ihre Herrschaft die Weltgeltung deutscher Wissenschaft keineswegs beeinträchtige. Es sollte ferner bedacht werden, dass die offizielle Aussenpolitik der Schweiz zum nationalsozialistisch beherrschten Deutschland freundschaftliche, d. h. mehr als nur korrekte, Beziehungen unterhalten wollte. Die ‚Normalization‘ der Wissenschaftsbeziehungen war vor diesem Hintergrund eine weniger auffällige Haltung als eine kritische Distanznahme. Schliesslich ist es angebracht, zwischen zwei Betrachtungsebenen zu unterscheiden. (1) Die eine ist funktional-systemisch. Hierher gehörte der Aspekt der Integration der Basler Universität in das deutsche Hochschulsystem mit allen Folgen, die die von Deutschland seit 1933 ausgehende Nazifizierung hatte. Hierher gehörte auch die in einzelnen Disziplinen gegebene, mittelfristig in vielen Fä3107
Björkman/Lundell/Widmalm 2019a.
Einleitung
731
chern alternativlose Notwendigkeit einer Partizipation an der von deutschen Verlagen und Organisationen dominierten Wissenschaftskommunikation. Hierher gehörte ausserdem die Eigenheit des sozialen Systems ‚Wissenschaft‘, als Komplement zur Konkurrenz zwischen den Forschern eine herzliche Kollegialität zu pflegen, die ein akademisches Zusammenleben in den Fakultäten und Instituten ermöglichte, sei es auf der Basis einer bewusst gelebten Freundschaft oder auf derjenigen einer formalisierten Respektierung der Freiheit des andern, die seine privaten, weltanschaulichen oder politischen Vorstellungen aussen vor liess, was von Ferne wie eine überraschend weitgehende Toleranz auch gegenüber extremen Positionen aussieht. Zu dieser Betrachtungsweise gehört die Annahme, dass ein (nach den Massstäben des frühen 20. Jahrhunderts ‚bürgerlicher‘) Liberalismus Voraussetzung für das gute Funktionieren von Wissenschaft sei. Zeitbedingt sah sich diese Bürgerlichkeit seit 1918 primär von links her bedroht, was sie gegen rechts hin offener machte. Nicht zu vergessen ist die weitgehende Abhängigkeit des damaligen Systems ‚Wissenschaft‘ von der öffentlichen Finanzierung und der Führung durch eine politisch-administrative Instanz (hier die Kantonsregierung und die von ihr eingesetzten Gremien). Aus ihr ergaben sich materielle Bedingungen, die – wiederum zeitbedingt, denn man befand sich in einem Krisenmodus – vor allem zu einer engen Begrenzung der Möglichkeiten führten. Ausnahmen gab es nur infolge eines starken privatwirtschaftlichen Interesses an einer bestimmten Fachrichtung (wie zum Beispiel in der pharmazeutischen Chemie) und infolge eines sozialdemokratischen ‚deficit spending‘ zur Krisenbekämpfung. Die politische Führung, zusammen mit der Aufsicht durch eine kritische Öffentlichkeit (materialisiert in Presse und Parlament), definierte der Wissenschaft einen Handlungsraum nach den Kriterien ihres eigenen, politischen ‚Feldes‘. Dieser Raum war in Basel zunehmend antinationalsozialistisch und fremdenfeindlich (antideutsch) bestimmt. Davon unterscheide ich (2) die Betrachtungsebene der individuellen Wahrnehmungen, Einstellungen und Handlungsorientierungen. Auf dieser Ebene manifestierte sich ein breites Spektrum, das gerade von solchen privaten weltanschaulichen Vorstellungen bestimmt war, die in der akademischen Interaktion nicht explizit angesprochen wurden. Auf dieser Ebene ist eine ethische Bewertung der konkreten Handlungen möglich. Dabei zeigten sich in Basel mehrheitlich widerständige Positionen gegen den Nationalsozialismus: Theologen verteidigten die Freiheit der Kirche und standen für die Pflicht des Christen ein, dem Nächsten zu helfen. Juristen plädierten mit wenigen Ausnahmen für den demokratischen Rechtsstaat. Humanisten hielten die geistige Freiheit des Individuums für unverzichtbar. Anhänger von Stefan George und deutsche Patrioten erkannten (teilweise erst mit der Zeit) im Nationalsozialismus das Gegenteil dessen, was sie für den Wiederaufstieg Deutschlands erhofft hatten. Methodisch bewusste, solide wissenschaftliche Arbeiter durchschauten und verachteten die Ideologisierung deutscher (pseudo⌥)wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Basler Naturwis-
732
Einsichten
senschaftler liessen ihre Kommunikation vermehrt über nationale und lokale Medien und Vereine laufen, mieden die deutschen Kanäle und hielten immer seltener Vorträge an deutschen Veranstaltungen. Wer wissenschaftlich informiert bleiben wollte, musste deutsche Publikationen aber auch während der nationalsozialistischen Diktatur zur Kenntnis nehmen. Während auf der systemischen Ebene Hilfe für Kollegen aus Deutschland durch die offizielle Sparsamkeit und damit die Knappheit öffentlicher Ressourcen eng begrenzt war, zeigte sich privat eine oft grosszügige Bereitschaft, deutschen Akademikern in Not zu helfen, ungeachtet ihrer ‚rassischen‘ Zugehörigkeit. Im Folgenden skizziere ich grob die Dynamik im Verhältnis der Basler Universität zu Deutschland nach Phasen.
9.2 Vorgeschichten Dem Umstand, dass das universitäre ‚Feld‘ in Basel im 19. Jahrhundert als ‚Peripherie‘ des deutschen Hochschulsystems konstituiert worden war, verdankte die Universität ihr Entrinnen aus der bescheidenen Rolle einer lokalen Bürgerakademie. Diese Integration als ‚Peripherie‘ zeigte sich in der Aufnahme deutscher Studenten in Basel, in der Bedeutung der Universität für die Karrieren deutscher Privatdozenten und Professoren, aber auch in den Laufbahnen einiger Basler in Deutschland, und vor allem darin, dass Basler Studenten wenn immer möglich nach einigen in der Heimatstadt absolvierten Semestern an deutsche Hochschulen gingen und von dort prägende Eindrücke mit nach Hause brachten, durch die sie sich langfristig mit Deutschland verbunden fühlten. Diese Universität war jedoch mehr als blosse ‚Peripherie‘ im (externen) Verhältnis zum deutschen Hochschulsystem, vielmehr erfüllte sie zentrale Funktionen innerhalb des eigenen, regionalen Ausbildungssystems für eine ganze Reihe von Berufen und war insofern auch eine Bürgerakademie: Notare und Advokaten, Pfarrer, Ärzte, Lehrer, leitende Angestellte der Industrie, Beamte im höheren Staatsdienst usw. wurden hier ausgebildet. Aus der Perspektive des lokalen politischen Feldes und der Öffentlichkeit war die Universität Basel für das eigene Ausbildungswesen somit ‚zentral‘. Daraus resultierten Erwartungen an die Universität, die neben der Qualifikation im Fachlichen auch die Bildung von Bürgern eines demokratischen Staatswesens betrafen. Diese Doppelfunktion wurde durch die im politischen Feld als negativ, ja bedrohlich verstandene Nazifizierung der auswärtigen ‚Zentren‘, auf die sich das Basler akademische Feld weiterhin im Sinne der «normalization» bezog, seit Mitte der 1930er Jahre zu einem Problem. Die ‚periphere‘ Situation gegenüber den deutschen ‚Zentren‘ implizierte (als Möglichkeit, nicht als Determinante) insbesondere nach 1918 oft auch einen solidarischen Blick auf die jüngste deutsche Geschichte. Wer als Deutschschweizer auf einen deutschen Sieg im Ersten Weltkrieg gehofft hatte, empfand wie seine
Vorgeschichten
733
deutschen Kollegen ‚1918‘ als unverdiente Erniedrigung einer Kulturnation und hoffte, dass sich die Bestimmungen von ‚Versailles‘ nachbessern oder aufheben liessen, arbeitete gegen die Verurteilung des nördlichen Nachbarn als am und im Krieg ‚schuldige‘ Nation und befürwortete eine rasche Rückkehr deutscher Professoren in den Kreis der internationalen Wissenschaftsorganisationen. Dazu gehörte auch die Bereitschaft, das deutsche Selbstbild als eine Nation in der ‚Mitte‘ Europas mit offenen Grenzen und als Bollwerk gegen Einflüsse aus dem Osten wie aus dem Westen zu übernehmen. Diese Neigung wurde dadurch verstärkt, dass der schweizerische Landesgeneralstreik von 1918 und die nachfolgenden sozialen Bewegungen gleich wie die deutsche Revolution als Teil eines weltweiten Versuchs aufgefasst wurden, die Herrschaft des Bolschewismus zu errichten. Insbesondere Professoren gehörten auch in Basel dem rechten Flügel des Bürgertums an, der sich aktiv gegen die Linke verteidigen wollte. Das Basler akademische ‚Feld‘ war zunächst ähnlich wie das politische gegenüber einer Integration der Juden offen. Von der Einbürgerung bis zur Übernahme von Professuren, staatlichen Ämtern und politischen Aufgaben schien hier bis um 1930 vieles möglich zu sein. Prominent war zum Beispiel die Stellung des Philosophieprofessors Karl Joël, des Ökonomen Julius Landmann, des Gerichtsmediziners Salomon Schönberg, der auch im Grossen Rat sass. Andere Juden, die an der Universität in der Studentenverbindung Nehardea angefangen hatten und danach als Advokaten und Politiker namentlich in der radikaldemokratischen (freisinnigen) Partei integriert waren, gehörten der Elite in der Politik wie in den liberalen Berufen an, wie die Karriere des Politikers Franz Arnstein zeigte. Das Verhältnis der Deutschschweizer zu Deutschland hatte sich während des Ersten Weltkrieges in Basel wie auch anderswo in der Schweiz geklärt. Der ‚Graben‘ zwischen Westschweizern und Deutschschweizern bot dazu den Anlass. Seither existierte eine Gruppe von dezidierten Germanophilen, die sich mit deutscher Aussenpolitik identifizierten, eine Revision der Pariser Vorortverträge befürworteten und in der Schweizer Innenpolitik gegen den Beitritt zum Völkerbund und für die Fixierung der Grenzen zwischen deutschem und französischem Sprachgebiet wirkten. In der Basler Professorenschaft war diese Gruppe (mit sehr prominenten Ausnahmen) wenig wirksam, aber in der gebildeten Öffentlichkeit (etwa durch das Magazin «Schweizer Monatshefte») und im politischen Feld (z. B. durch die «Neue Basler Zeitung») präsent. Unter den Studierenden wurde vorübergehend ein Ableger der Germanophilen tätig, dieser scheint aber im Unterschied zu Bewegungen wie der Europa-Union wenig Zulauf erhalten zu haben. Die rechte Grundhaltung der Studentenschaft harmonierte in Basel trotz des Generationenunterschieds mit derjenigen der Professorenschaft weitgehend konfliktfrei; ihre Linke hatte dagegen einen schweren Stand. Die Neue Helvetische Gesellschaft bildete im zweiten und dritten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts im akademischen wie vor allem im politischen Feld eine wichtige Diskussionsplatt-
734
Einsichten
form für eine ‚nationale Erneuerung‘ der Schweiz und später, im Verlauf der 1930er Jahre, für die Bewusstwerdung der Gefahr, die vom Nationalsozialismus ausging. Eine ähnliche Bedeutung erlangten die Debatten innerhalb des studentischen Zofingervereins, dessen Reformfraktion, die «Idealzofinger», nach dem Eintritt in die Verantwortung im politischen und akademischen ‚Feld‘ ein eigenes Profil zeigte, während die jungen «Aktiven» um 1930 für neokonservative Ideen offen waren. Durch die Präsenz der Zofingia in manchen Fakultäten der Universität wie durch ihre engen Verbindungen zu den «Altherren» in öffentlichen Funktionen war sie unmittelbar für die Universitätsgeschichte relevant.
9.3 Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus bis ca. 1935 Ein neuer politischer Faktor zeigte sich schon vor der Machtübergabe an den Nationalsozialismus in Gestalt des italienischen Faschismus. Die Basler Öffentlichkeit verhielt sich dazu wohlwollend-tolerant und mit Vorbehalten interessiert. Beachtenswert erschien vor allem, dass es Mussolini angeblich gelang, die Arbeiter für den Nationalismus zu gewinnen und so die ‚Integration‘ herzustellen, die die Krise des parlamentarischen Systems zu lösen versprach, indem sich das Volk mit dem Staat, das Proletariat mit der Nation identifizierte. Zugleich erwies sich der faschistische Staat als autoritär, stellte sich ‚über‘ die divergierenden politischen und wirtschaftlichen Interessengruppen und bannte gewaltsam die revolutionäre Gefahr, die das Bürgertum von links her fürchtete. Das Regime erschien jung, tatkräftig, von einer dynamischen Persönlichkeit geführt und damit fähig, das als ‚verknöchert‘ geltende System zu überwinden. Dazu propagierte es Ideale, die Gegenstand eines ‚Glaubens‘ sein sollten. Im Basler politischen Feld und in der Öffentlichkeit erhielt der Faschismus eine grössere Aufmerksamkeit als im akademischen Feld, wo nur vereinzelt Juristen wie Jacob Wackernagel das Thema der Staatsbejahung im Sinne von Rudolf Smends «Integrationslehre» aufgriffen, an italienischen und deutschen Beispielen illustrierten und staatsrechtlich interpretierten. Mit Friedrich Vöchting befasste sich zudem ein Ökonom mit der faschistischen Agrarpolitik angesichts der Kluft zwischen Norden und Süden in Italien. In einem Segment des politischen Felds, das dank einigen politisch auf der Linken engagierten Studierenden ins akademische Feld hinüberreichte, formierte sich als Reaktion auf die Mussolini-Diktatur und auf die eher wohlwollende Einstellung der bürgerlichen Öffentlichkeit ein Antifaschismus, der mit marxistischen Analysen trotzkistischer Observanz arbeitete. Diese Gruppe trat seit etwa 1930 innerhalb der Universität lautstark auf und suchte ihre Professoren in Diskussionen zu verwickeln. Sie wollten verhindern, dass Demokratie und Sozialismus in der akademischen Lehre zu beliebigen Objekten der Hinterfragung durch eine Wissenschaft von Staat und Gesellschaft wurden, die sich völlig vorausset-
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus bis ca. 1935
735
zungslos gab, aber offensichtlich an Tendenzen gebunden war, die eher dem rechten Spektrum zugehörten, wie dies exemplarisch bei Edgar Salin beobachtet wurde. Zusammen mit den Sozialisten und Sozialdemokraten im politischen Feld und dank ihrem Zugang zur Presse waren diese Studierenden einflussreich genug, um die Vorstellung zu erwecken, dass ein Bekenntnis zu Mussolini beim Einstieg in eine akademische Karriere zu Problemen führen könnte, wie Werner Kaegis Befürchtungen am Beginn seiner Basler Karriere zeigten. Später trug diese Gruppe dazu bei, die Tätigkeiten nationalsozialistischer Professoren an der Universität zum öffentlich debattierten Skandal zu machen. Breiter vertreten war der schweizerische Frontismus unter den Studierenden. Im Unterschied etwa zu Zürich oder Bern stellten aber Basler Studierende so gut wie keine prominenten Repräsentanten dieser Tendenz im politischen Feld. Mit dem Direktor des Lehrerseminars Wilhelm Brenner sass aber am Rande der Basler Professorenschaft ein Anhänger der Fronten in einer wichtigen Stellung im Bildungswesen, und mit ihm und dem Institut des Philosophen Paul Häberlin verbundene Studenten wirkten auch in den Redaktionen einschlägiger Presseorgane. Dass es in Basel nicht zur Formierung einer studentischen Gruppierung der Frontisten kam, erkläre ich damit, dass in den etablierten Studentenverbindungen entsprechendes Gedankengut gut vertreten war und diskutiert wurde, so dass die Thematik bereits besetzt und die Rekrutierungsbasis für neue, spezifisch frontistische Gruppierungen zu schmal war. Ähnliches galt für die Gegner des Völkerbundes. Nicht zu vergessen ist ferner, dass ein Grossteil der Studierenden immer wieder – im Einklang mit den Professoren – eine politikfreie (‚unpolitische‘) Universität verlangte. Direkte Ableger von Gruppierungen aus dem politischen Feld hatten angesichts dieser konstanten Betonung einer Grenze zwischen Politik und Universität im akademischen Feld einen schweren Stand. Mit der Übergabe der Macht in Deutschland an Hitler 1933 zeigten sich Probleme der engen Anbindung des Basler universitären Felds als ‚Peripherie‘ an das deutsche Hochschulwesen. Diese Anbindung führte zum vorübergehenden Versuch einer Nazifizierung der Basler Universität, soweit dies ausserhalb Deutschlands möglich zu sein schien. Sie betraf zunächst nur die Deutschen an der Universität. Die Studierenden sollten ‚erfasst‘ werden durch eine nationalsozialistisch geführte, von Zürich aus koordinierte Aktion, die zur Bildung einer Deutschen Studentenschaft führte. Diese sollte die Gesamtheit der in Basel Studierenden mit deutscher Staatszugehörigkeit vereinen und sie als Aussenposten der nazifizierten Heimat profilieren. Die Nazifizierung der deutschen Professoren und Universitätsangestellten in Basel betrieb der Pathologe Werner Gerlach, der Mitarbeitende verpflichten wollte, in NS-Organisationen tätig zu werden und an der Übernahme der deutschen Kolonie durch die Nationalsozialisten mitzuwirken. Gerlach war auch in der Schulung deutscher Studierender, die Semester in der Schweiz absolvieren wollten, engagiert. Weniger systematisch, eher als Individuum und ohne Engagement im Sinne einer aktiven, sichtbaren und zielgerichte-
736
Einsichten
ten Betätigung, aber mit Begeisterung vertraten andere deutsche Professoren in Basel den Standpunkt, dass Hitler Deutschland zu neuer Grösse führen werde und dass die Deutschen deshalb auch im Ausland geschlossen hinter ihm stehen sollten. Ich habe dies an den Beispielen des Geographen Fritz Jaeger und des Mathematischen Physikers Wilhelm Matthies gezeigt, die sich gegenüber Kollegen und Privatdozenten als nationalsozialistisch gewendete deutsche Patrioten verhielten, sich aber im Unterricht in Basel zurückhielten. Diese neue Art des deutschen Patriotismus beeindruckte auch schweizerische Germanophile, innerhalb der Universität am offensichtlichsten Andreas Heusler, der bis 1938 explizit in Hitler einen Faktor begrüsste, der die erhoffte Revision des Kriegsausgangs von 1918 und damit den Wiederaufschwung der deutschen Nation herbeiführen könne. Zugleich wurde Hitler verbreitet als erfolgversprechender Verhinderer einer sozialistischen Revolution und einer Ausbreitung des Bolschewismus in Mitteleuropa gesehen. Im Basler akademischen ‚Feld‘ selbst änderte sich 1933 zunächst wenig – die Nationalsozialisten und deren Freunde in der Dozentenschaft respektierten innerhalb der Universität die kollegialen, feldspezifischen Umgangsformen und blieben deshalb akademisch integriert; aus der Basler ‚Peripherie‘ ging man weiterhin nach Deutschland zum Studium, zu Vorträgen, zu Kongressen, und die deutsche Verlagsindustrie blieb das zentrale Element in der wissenschaftlichen Kommunikation. Dass die Anbindung der ‚Peripherie‘ aber auch schwächer wurde, ja die Distanz zu den ‚Zentren‘ wuchs, zeigte sich in je unterschiedlicher Weise und mit unterschiedlichem Gewicht in vier Aspekten. (1.) Die linken Studierenden übertrugen ihre Kritik am Faschismus nun auf den Nationalsozialismus, während die Linke im politischen ‚Feld‘ die Frontisten als potenzielle Agenten des Nationalsozialismus energisch angriff – die Angriffe galten vor allem den Staatsangestellten, die einen Einfluss auf die Jugend hatten, also namentlich Lehrkräften. (2.) Die Massnahmen gegen die Juden in Deutschland erschienen manchen als zu weitgehend (insbesondere auf der individuellen Ebene, wenn sie Freunde betrafen), auch wenn im Prinzip oft wenig Einwände dagegen laut wurden, dass das neue Regime den Einfluss der Juden in der Wissenschaft, in den freien Berufen und im Wirtschaftsleben zurückdrängte. (3.) Der Versuch, die protestantischen Kirchen in Deutschland zu nazifizieren und den Widerstand der Katholiken zu brechen, führte zu Konflikten, in die auch Basler Professoren in Deutschland involviert waren, mit Auswirkungen auf ihre Heimatstadt. (4.) Und es kamen gleich 1933 Studierende und Lehrkräfte aus dem deutschen universitären ‚Feld‘ in Basel an oder ersuchten von Deutschland aus in Basel um Hilfe, die Opfer der Massnahmen gegen Juden, andere Minderheiten und Demokraten geworden waren. 1. Es waren vor allem die linken Studierenden, die die Kritik am Nationalsozialismus offen und systematisch innerhalb des Basler universitären ‚Feldes‘ vorbrachten. Eine Ausnahme unter den Professoren war der Jurist und Philosoph
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus bis ca. 1935
737
Arthur Baumgarten, der sich vom liberalen Kritiker der bürgerlichen Toleranz gegenüber dem Rechtsradikalismus zu einem Weggenossen der Kommunisten wandelte. In der Theologischen Fakultät war die Ablehnung häufig und wurde eingehend begründet, aber sie hatte nach meinem Verständnis ihre Wurzeln im deutschen Kirchenkampf, weshalb ich weiter unten darauf eingehe. Ich hätte erwartet, dass sich auch andere Professoren als die Theologen mit der Frage beschäftigt hätten, was der Nationalsozialismus seinem Wesen nach sei und weshalb er abgelehnt werden müsse. Tatsächlich gibt es Spuren von solcher Beschäftigung. Der Zoologe Adolf Portmann verwendete teilweise Helmuth Plessners Argumente in den Vorbereitungsarbeiten für seine Vorlesungen; zu vermuten sind bei ihm auch Einflüsse des französischen Deutschlandbildes. Vor allem kritisierte er den Biologismus der Nationalsozialisten mit fachlichen Argumenten. Edgar Salin befasste sich als deutscher Patriot mit dem Machtanspruch der Nationalsozialisten, beobachtete deren Vorgehen in Berlin schon vor 1933 und befürchtete, sie entfesselten eine soziale Revolution. Doch erhoffte er zunächst eine Zuspitzung der Krise in Deutschland in der Annahme, dass auf ihrem Höhepunkt eine Lösung gefunden würde, die dem «geheimen Deutschland» von Stefan George eine Chance böte. Ähnlich erwartete Karl Schefold einen Übergang der Herrschaft an das «geheime Deutschland», doch beide wurden enttäuscht. Philosophische (d. h. nicht auf theologischer oder kulturkritischer Grundlage formulierte) Kritik des Nationalsozialismus kam wie schon erwähnt von marxistischer Seite. Die Basler Marxistischen Studenten übernahmen und propagierten die Theorie, dass der Nationalsozialismus eine kleinbürgerliche Ideologie von depossedierten Angehörigen des Mittelstands sei. Im Nationalsozialismus an der Macht sahen diese Studierenden ein Instrument der Zerstörung der Organisationen des Proletariats im Interesse des Kapitals. Sie zogen aus ihrer Theorie die Konsequenz, dass eine Volksfront, die Intellektuelle, Sozialdemokraten, Gewerkschafter und Kommunisten zum Kampf vereine, zur Abwehr notwendig sei. Der zweite explizite Ansatz kam aus dem bürgerlichen Idealismus. Ausgehend von einer westeuropäisch-atlantischen freiheitlichen Philosophie hatte Arthur Baumgarten gehofft, das aufgeklärte Bürgertum würde seine Freiheit gegen die Nationalsozialisten verteidigen. Da es dies mehrheitlich nicht tat, kam er zur Überzeugung, dass das Bürgertum zu keiner Tat mehr fähig sei. So suchte er weiter links nach einer verlässlichen Kraft, die sich dem Nationalsozialismus entgegenstellen könne, und er fand sie in einer (idealistischen) Lektüre von Marx und dessen Nachfolgern. Er verklärte die Sowjetunion zu der Welt des Guten, die den Kampf führen werde. Nur bei Baumgarten hörten die Studierenden eine sympathisierende Darlegung des Marxismus, und nur Baumgarten schritt auch zur Tat, indem er (als ‚compagnon de route‘) sich am Aufbau der Partei der Arbeit beteiligte und deren Programm teilweise ausformulierte und propagierte. Die verbreitete, meist nicht explizit begründete und theorieferne Abgrenzung der Basler Professoren vom Nationalsozialismus war kulturkritisch motiviert: Sie sahen in Hitlers ‚Be-
738
Einsichten
wegung‘ einen Angriff auf die Freiheit des abendländischen Geistes. Wo sie zur expliziten Kritik nationalsozialistisch inspirierter Wissenschaft ansetzten, wie ich dies am Beispiel Werner Kaegis gezeigt habe, legten sie offen, wie Nationalismus, völkisches Denken und die Verbindung von Macht und Wissenschaft zu einer Pervertierung der Letzteren führten, wobei ihnen der Nationalsozialismus als Resultat einer deutschen Fehlentwicklung galt. 2. Die Radikalität und Gewaltsamkeit der Judenverfolgungen in Deutschland wurde gerne übersehen und nicht (oder erst sehr spät) als systematische Drangsalierung mit dem Ziel der Vernichtung zunächst der wirtschaftlichen und intellektuellen Lebensgrundlage, dann des Lebens überhaupt erkannt. Die Ansicht war verbreitet, dass es ‚zu viele‘ Juden gebe. Wenn Andreas Heusler schrieb, er habe persönlich nichts gegen Juden, und wenn es in Deutschland nur deren 30’000 gäbe, wäre er ihr Freund, bewegte er sich (wenn auch mit zugespitzten Ausdrücken) auf der Linie des ‚üblichen‘ Antisemitismus. Dieser identifizierte fälschlicherweise den nationalsozialistischen Antisemitismus mit seinen eigenen Ansichten. Einigen wenigen Schweizer Beobachtern wurde zwar im April 1933 deutlich, dass diese Identifikation falsch war, als die jüdischen Geschäfte boykottiert wurden. Die dennoch verbreitete Ansicht, dass der Nationalsozialismus einen ‚gewöhnlichen‘ Antisemitismus praktiziere, der als deutsch-internes Systemelement die Basler nur dann etwas angehe, wenn eigene Freunde und Kollegen betroffen seien, war funktional, denn sie verlangte kein Umdenken und Neulernen, sie deckte sich mit der mangelnden Vorstellungskraft und der biedermännischen Devise, es gebe nichts Neues unter der Sonne zu sehen. Erst mit den Rassegesetzen von 1937 und dem inszenierten Pogrom von 1938 sahen nun einige weitere, dass die Existenzgrundlage der deutschen Juden ernsthaft zerstört wurde. Bereitwillig wurde bis 1942 geglaubt, das Regime wolle Juden ‚nur‘ aus dem Land vertreiben oder – nachdem die Deportationen als Tatsache erwiesen waren – sie würden zur Urbarmachung ‚leerer‘ Gebiete in den Osten verschoben.3108 Es brauchte verlässliche Nachrichten über die intensivierte Verfolgung und über die ersten Anzeichen der noch kaum vorstellbaren ‚Endlösung‘ 1942/43, bis universitäre Kreise in der Schweiz erwachten, nun zusammen mit kirchlichen Gruppen, die die vorübergehend proklamierte Grenzschliessung kritisierten. Öffentliche Kritik am Antisemitismus hatte vorher wie nachher einen schweren Stand, und sie wurde, wie sich an den engagierten Theologen zeigen lässt, auch oft nur innerhalb eines bestimmten Denkrahmens vorgetragen – womit der Mut nicht verkannt werden sollte, den auch dies brauchte. Anders verhielt es sich mit dem dezidierten Kampf gegen antisemitische Äusserungen, der von Regierungsrat 3108
Der Bundesrat war sich bewusst, dass den zurückgewiesenen Flüchtlingen «Gefahren für Leib und Leben» drohten, als er am 4. 8. 1942 beschloss, die Rückweisung konsequenter zu handhaben. Conseil Fédéral, Décision présidentielle du 4 août 1942, Nr. 128, in: Documents diplomatiques suisses 14, 1997, Nr. 222, 720.
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus bis ca. 1935
739
Fritz Hauser und einigen anderen vom politischen ‚Feld‘ aus geführt wurde. Dieser entzog der stillschweigenden Legitimität ‚selbstverständlicher‘ Judenfeindschaft zwar nicht den Boden, aber die Möglichkeit, sich in staatlichen Dokumenten auszudrücken. In der offiziellen Sprachregelung kannte die Universität Basel nur Schweizer und Ausländer, aber keine ‚Arier‘ und ‚Nichtarier‘. 3. Der Wellenschlag des deutschen Kirchenkampfs erreichte am Basler Ufer vor allem diejenigen Theologen und kirchlichen Kreise, die dem bibelzentrierten Christentum anhingen und in der Religion etwas grundsätzlich anderes als eine Schwester der Vernunft im Stil des Liberalismus des 19. Jahrhunderts sahen. Führend waren in dieser Hinsicht in Basel die ‚dialektischen Theologen‘ im Umkreis Karl Barths. Sie konnten einen klaren Begriff von der Natur des Nationalsozialismus gewinnen, weil sie den christlichen Kirchen eine transzendentale Verankerung zusprachen und deshalb die Angriffe auf die Freiheit der Kirche und der Kirchenmänner vor allem im Licht der paulinischen Lehre von der Kirche in ihrem Verhältnis zur weltlichen Herrschaft (sowie der Apokalypse) deuteten. Der Nationalsozialismus war eine Irrlehre, ein Tanz ums Goldene Kalb unter Erhebung des germanischen Leibes und des Diktators zu falschen Göttern; er wurde so zur beginnenden Herrschaft des Antichristen. War diese Sicht wohl bei Barth schon 1933/34 angelegt, so fand ich eine publizistische Verbreitung bei anderen wie Fritz Lieb oder Heinrich Barth erst nach der Mitte der 1930er Jahre. Sehr häufig riefen gerade Studierende schon vor 1933 nach einer durchgehenden Verchristlichung des öffentlichen Lebens als Antwort auf die moralische ‚Krise‘ der Politik und Kultur und als Weg zur ‚nationalen Erneuerung‘ der Schweiz. Insofern hatten theologische Postulate eine Bedeutung, die über religiöse und kirchliche Kreise hinaus ins politische ‚Feld‘ wirkte und dazu beitrug, dass die Theologie als universitäres Fach mit Unterstützung ‚Ungläubiger‘ gegen alle Kritik in Basel erhalten blieb. 4. Die Universität äusserte ihre Befürchtungen gegen Flüchtlingsstudenten und -studentinnen in verschiedenen Stellungnahmen, sie leistete aber für sie, was sie subjektiv tun zu können glaubte. Die Flüchtlinge gerieten in eine schweizerische ideologische Landschaft, die durch einen starken Überfremdungsdiskurs geprägt war. Dabei sah die Universität in der Fremdenpolizei eine Agentur, die die ausländischen Studierenden drangsalierte, und diese wiederum sah im Bund einen Akteur, der restriktives Verhalten forderte und alles vermeiden wollte, was die Machthaber in Deutschland irritieren könnte. In der ersten Phase, um die es hier geht, fiel die Diskrepanz zwischen Worten und Taten auf: Immer wieder wurde geschrieben, man stecke tief in einer Krise, habe selbst zu wenig Mittel, müsse sparen und habe deshalb keine Möglichkeit zu helfen, obschon sich viele persönlich für Flüchtlinge einsetzten. Offensichtlich stand dahinter der Versuch der Universität, gegenüber dem Staat und der Politik kohärent aufzutreten. Wenn die eigenen materiellen Forderungen der Universität unerfüllt blieben, wollte man nicht gleichzeitig grosszügig Fremde aufnehmen, denn das hätte den An-
740
Einsichten
schein erweckt, dass die eigene Not nicht so schlimm sei. Zwei Fakultäten verlangten und erreichten einen Numerus clausus, und die Bevorzugung der Schweizer Studierenden war die anerkannte Maxime. In einer Universität, in der die Professoren meist Wert auf ein gutes Einvernehmen mit den Studentenverbindungen legten (und umgekehrt), sollte verhindert werden, dass es zu lauten Protesten gegen die Zulassung von fremden Studierenden kam, die Praktikumsplätze belegten, die engen Vorlesungsräume am Rheinsprung füllten, sich im Lesesaal der Bibliothek breitmachten (da sie nicht wie die Basler zu Hause arbeiten konnten) und mit der Erfahrung und Geschicklichkeit Benachteiligter die wichtigsten Bücher zuerst ausliehen. Ressentiments gerade gegen jüdische (insbesondere «ostjüdische») Flüchtlinge waren unter Basler Studierenden verbreitet. In der Professorenschaft wurde zudem befürchtet, dass politisch bewusste Studierende, die nach Basel flüchteten, sich hier politisch betätigen könnten. Die Gratwanderung gelang insofern, als keine breiten und anhaltenden Konflikte zwischen fremden und Basler Studierenden ausbrachen, die aktenkundig geworden wären, und auch keine zwischen Studierenden und der Universitätsleitung. Den Preis bezahlten aber diejenigen fremden Studierenden, die wegen fehlenden Papieren nicht zugelassen wurden oder von denen die Fremdenpolizei verlangte, dass sie sich in der Semesterpause in ihre Heimat (oder in die Illegalität) begeben sollten. In Einzelfällen konnten die Bemühungen von Basler Professoren zugunsten von Flüchtlingsstudenten sehr weit gehen. Zurückhaltend gaben sie sich vor allem dann, wenn sie glaubten, diese Studierenden würden später in der Schweiz eine Stelle suchen und den Arbeitsmarkt belasten oder – da sie als Ausländer die Voraussetzungen für die Zulassung zu reglementierten Berufen nicht erfüllten in der Armut des ‚akademischen Proletariats‘ versinken. Aus ähnlichen Gründen verhielten sie sich meist ablehnend, wenn Flüchtlinge sich habilitieren wollten. Wenn Dozenten und Professoren aus Deutschland um Hilfe riefen, wurden ihnen oft Mittel zur Weiterreise zur Verfügung gestellt oder sie erhielten Empfehlungen an ausländische (nichtdeutsche) Universitäten. Dazu existierte eine Unterstützungsorganisation, die in Basel vom Erziehungsdepartement gefördert wurde. Mit wenigen Ausnahmen wiesen die Fakultäten die Aufnahme solcher Kollegen in den Lehrkörper meist mit der Begründung ab, für ihr Spezialfach bestehe in Basel grundsätzlich kein Bedarf, es werde bereits von einem Basler vertreten, oder ein Basler Nachwuchsmann stehe schon bereit, die Aufgabe zu übernehmen. Versuche, Flüchtlingen bezahlte Lehraufträge zuzuhalten, wie sie manchmal das Erziehungsdepartement unternahm, scheiterten auf diese Weise am Widerstand der betreffenden Fakultäten. Gelegentlich wurde konzediert, dass ihnen die Volkshochschule einen honorierten Kurs überlassen könne. Innerhalb des universitären ‚Feldes‘ galt das Unpolitische als Tugend, und der kollegiale Konsens hatte Priorität. Die ‚Peripherie‘, die keine Alternative zu ihren deutschen ‚Zentren‘ kannte, wirkte in dieser Lage gelähmt. Private (ausserhalb des ‚Feldes‘ geübte) Menschlichkeit liess allerdings jenseits der offiziellen Äusserungen und des
Zuspitzung ab 1935, Konflikte und Helvetisierung
741
schweizerischen ‚kleinen‘ Antisemitismus eine Hilfsbereitschaft zu, die den Individuen galt, wenn diese auch in den ersten Jahren sehr oft geprägt war von der Vorstellung, die Fremden seien nur auf Durchreise. Im Verhältnis zwischen dem universitären und dem politischen ‚Feld‘ (ausgenommen die sozialdemokratischen Regierungsmitglieder) herrschte bis zur Mitte der 1930er Jahre unter Professoren die Überzeugung vor, es gehe noch immer hauptsächlich darum, die Linke von Entscheidungspositionen fernzuhalten, während man gegenüber Rechtsextremen Toleranz zeigte, sofern sie bestimmte Regeln zu respektieren versprachen. Die beginnende Bewusstwerdung der Differenz zum Nationalsozialismus und die Wahrnehmung seiner Auswirkungen auf das deutsche wissenschaftliche ‚Feld‘ standen noch eine Weile im Schatten dieser Überzeugung. Dabei hatte die Universität mit Fritz Hauser als Chef des Erziehungsdepartements seit 1919 einen ‚Sozi‘ als Vorgesetzten, den man verdächtigte, die Universität wie einen einfachen staatlichen Schulbetrieb zu behandeln.3109 Die negative Einstellung der liberalkonservativen Universitätsangehörigen äusserte sich privat und mündlich deutlich; im Schriftverkehr hielt man sich eher zurück. Mit der linken Mehrheit in der Kantonsregierung öffnete sich nun in der folgenden Periode (ab 1935) die Kluft zwischen Universität und politischem ‚Feld‘ deutlich sichtbar; einerseits, weil es Anlässe zu offenen Konflikten gab (wie diejenigen um die Beteiligung an deutschen Universitätsfeiern), andererseits, weil sich im politischen ‚Feld‘ eine überparteiliche Koalition zur Abwehr des Nationalsozialismus bildete, die auch Konsequenzen innerhalb der Universität forderte.
9.4 Zuspitzung ab 1935, Konflikte und Helvetisierung Nach 1935 wurde zuerst im politischen ‚Feld‘ offensichtlich, dass ein friedliches Nebeneinander zwischen Basel und dem nationalsozialistischen Deutschland nicht einfach zu haben war. Dazu trugen die deutschen Nationalsozialisten an der Basler Universität ihren Teil bei. Sie forderten Respekt vor dem wiedererstarkenden Deutschland in Basler Schulen. Der Versuch der Behörden, Werner Gerlach disziplinarisch von der Universität zu entfernen, führte zu einer Kampagne in der deutschen Presse, die einschüchtern sollte. Dem Freiburger Rektor wurde verboten, als offizieller Universitätsvertreter an Basler akademischen Feiern teilzunehmen. Die Regenz erfuhr, dass deutsche Studenten, die an Schweizer Universitäten studieren wollten, dies nur mit Erlaubnis von Parteistellen tun durften und verpflichtet wurden, Dienste für diese zu leisten. Die Behörden schlossen daraus, dass, wenn immer möglich, keine Deutschen mehr für Basler Lehrstühle in Be3109
Tatsächlich hatte Fritz Hauser öffentlich über die Konzentration bestimmter Fakultäten in wenigen Hochschulen nachgedacht und damit das Modell der Volluniversität angesichts der Kleinheit schweizerischer Verhältnisse infrage gestellt. Hauser in: Huber/Hauser 1931, 30 f., 39 (freundlicher Hinweis von Charles Stirnimann).
742
Einsichten
tracht gezogen werden sollten, erst recht nicht in Fächern, von denen sie die Erfüllung eines politischen Bildungsauftrags erwarteten.3110 Während im politischen Feld ein Prozess einsetzte, der zu einer Frontstellung zunächst gegen die Nationalsozialisten und schliesslich die Deutschen überhaupt führte, die auch den in nationalen (nicht-nationalsozialistischen) Kreisen üblichen deutschen Patriotismus zu einem Ausschliessungsgrund machte, versuchte das universitäre ‚Feld‘, seine Autonomie zu verteidigen, indem es sich weiterhin für ‚unpolitisch‘ erklärte. Dazu hatte es einen aktuellen Anlass, der keinen direkten Bezug zu den Vorgängen in Deutschland und unter Deutschen in Basel hatte: die Debatten über das neue, 1937 eingeführte Universitätsgesetz. Es definierte klar die Grenze zwischen den Befugnissen der universitären und denen der staatlichen Instanzen und regelte eindeutig den Instanzenzug. In Absetzung von der Nazifizierung der Hochschulen im Nachbarland wurde statuiert, dass bei Professorenwahlen nur die fachliche Kompetenz relevant sein sollte: Die ‚unpolitische‘ Universität wurde im Grundsatz zur Geltung gebracht. Gegen offensichtliche Anzeichen des Gegenteils nahm man innerhalb des universitären ‚Feldes‘ mit überwiegender Mehrheit weiterhin an, dass die deutschen Universitäten auch unter nationalsozialistischer Herrschaft im Kern unpolitisch, rein wissenschaftlich und der voraussetzungslosen Forschung gewidmet geblieben seien. Vorausgesetzt wurde, dass der Geist, den die Schweizer als Studierende an deutschen Hochschulen und als Kollegen deutscher Professoren vor 1933 (viele noch vor 1914) bewundert hatten, unveränderbar sei. Diese Position verstärkten mehrere Faktoren. So galt der Aufbau der antinazistischen Front im politischen ‚Feld‘ als ein Akt der sozialistisch dominierten Basler Regierung (was nicht zutraf; dafür war eine breite Koalition verantwortlich, die ihren Schwerpunkt in der Neuen Helvetischen Gesellschaft hatte) und das Bestreben, das universitäre ‚Feld‘ in diese Front zu integrieren, als Angriff auf die Autonomie. Das ‚periphere‘ Basler universitäre ‚Feld‘ blieb trotz der sichtbaren ‚Gleichschaltung‘ von deutschen Fachgesellschaften und Zeitschriftenredaktionen daran interessiert, diese weiterhin als Plattformen des Austausches zu nutzen. Deutschland blieb der entscheidende Resonanzraum der Basler Wissenschaft, der auch fachliche Anerkennung und Prestige (Ehrendoktorate, Akademiemitgliedschaften 3110
Im November 1938 erhielt diese Furcht neue Nahrung, als die NZZ am 22. 11. 1938 berichtete, dass am Anschlagbrett der Berliner Universität «besonders einsatzbereite» Studierende für einen Aufenthalt in der Schweiz gesucht und ihnen Fördermittel in Aussicht gestellt würden. Der diplomatische Vertreter der Schweiz in Berlin, Minister Hans Frölicher, fand es in einem Schreiben an Bundesrat Motta «ganz natürlich», dass gerade bewährte Nationalsozialisten zum Studium in die Schweiz geschickt würden, zumal kurz vorher die Westschweizer Universitäten nach deutschen Studierenden gerufen hatten (Letzteres entsprach den Tatsachen). Der Text des Aushangs an der Berliner Universität sei «kaum zu beanstanden», urteilte er. Documents diplomatiques 1994, vol. 12, 1062– 1064.
Zuspitzung ab 1935, Konflikte und Helvetisierung
743
usw.) zuteilen konnte. Davon wichen nur Angehörige von Fächern ab, die bereits deutlich internationalisiert (d. h. auf ‚Zentren‘ ausserhalb des deutschen Machtbereichs bezogen) waren oder über starke nationale Kommunikationskanäle verfügten wie manche Naturwissenschaften. Auch zeigte sich, dass dem Basler universitären ‚Feld‘ eine gewisse Trägheit innewohnte, die zusammen mit dem Primat der Kollegialität in den Fakultäten und in der Regenz dazu führte, dass universitäre Gremien keine geeigneten Foren für Diskussionen und Entscheidungen über die Gefahr sein konnten, die vom Nationalsozialismus für die selbstbestimmte Wissenschaft ausging. Es scheint, dass um die Mitte der 1930er Jahre weiterhin die Abgrenzung von der Politik der sozialdemokratischen Erziehungsdirektion wichtiger war als der Kampf gegen die Auswirkungen des Nationalsozialismus im akademischen Feld. Zwar waren die Nationalsozialisten offensichtlich bestrebt, in ihrem eigenen Interesse bis etwa 1938 ‚Normalität‘ vorzutäuschen und ausländische Gäste als Zeugen der trotz (oder angeblich wegen) der nationalsozialistischen Diktatur fortdauernden Exzellenz deutscher Wissenschaft zu instrumentalisieren. Aber auf internationalen Kongressen traten Parteigrössen wie der Erziehungsminister Bernhard Rust auf und proklamierten das Ende der voraussetzungslosen Wissenschaft zugunsten einer durchgehenden Politisierung. SA-Aufmärsche, Sprechchöre und Fahnenmeere verdeutlichten bei solchen Anlässen die Integration der Wissenschaftler als Angehörige eines durch eine eigene Tracht gekennzeichneten ‚Standes‘ in die uniformierte NS-Herrschaft. Doch in Basel überzeugte das Argument mehrheitlich nicht, dass die fortgesetzte Fixierung der ‚Peripherie‘ auf die deutschen ‚Zentren‘ und dementsprechend die Weiterführung der freundschaftlichen Beziehungen zu deutschen Universitäten und Fachorganisationen dem Nationalsozialismus nütze. Denn es war ein politisches Argument, dessen Radikalität die Weiterexistenz der ‚Peripherie‘ in der bisherigen Art infrage stellte und das zudem die Auffassung gegen sich hatte, dass eine fortgesetzte Kontaktpflege die Lage der in ihrer Freiheit beschnittenen, vom Nationalsozialismus nicht ergriffenen deutschen Professoren erleichtern würde. Zwar setzte sich die Basler Regierung durch und verbot die offizielle Teilnahme der Universität an den Jubiläen der Universitäten Heidelberg und Göttingen. Aber viele Professoren publizierten weiterhin in deutschen Zeitschriften und Verlagen und besuchten Fachtagungen. In dieser Hinsicht zeigten sich allerdings unterschiedliche Verhaltensweisen. Einige Professoren veröffentlichten immer seltener Beiträge in deutschen Organen, bis sie schliesslich nur noch schweizerische (lokale und nationale) bedienten oder sich neue helvetische Organe schufen wie z. B. 1943/44 das «Museum Helveticum» für die Altertumswissenschaften. Auch konnten sich Naturwissenschaftler und Mediziner der ehemals deutschen Fachorgane bedienen, die Heinz Karger mit seinem Verlag 1937 nach Basel gebracht und internationalisiert hatte. Sie blieben aber Mitglieder deutscher Fachgesellschaften, wenn sich damit der Zugang zu wichtigen Informationen und der
744
Einsichten
verbilligte Erwerb von Handbüchern verbanden. Es bestand allerdings die Tendenz, sich aus der Leitung von deutschen Fachgesellschaften zurückzuziehen. Der Tagungsbesuch in Deutschland setzte sich in einzelnen Fällen bis 1942 fort, doch habe ich dafür vor allem Belege aus Zürcher Verhältnissen. Die Basler Anti-NS-Koalition, in der die «neuhelvetischen» Tendenzen (von Edgar Bonjour so genannt nach dem Einfluss der Neuen Helvetischen Gesellschaft) dominierten, war primär im politischen ‚Feld‘ verankert. Private Verbindungen von Professoren mit dieser Koalition zeigen sich in einzelnen Fällen darin, dass man auf den Besuch der baslerisch-freiburgischen Professorentreffen in Badenweiler verzichtete (Adolf Portmann zum Beispiel war nie dort) und in Berufungsfragen ausserwissenschaftliche Argumente wie das Bedürfnis, im Lehrkörper überzeugte Demokraten und Humanisten zu haben, vorbrachte. Und es gab Grenzgänger zwischen den ‚Feldern‘, die als Mitglieder der Kuratel oder des Erziehungsrats dem politischen Feld zuarbeiteten und zugleich als Angehörige von Fakultäten dem universitären Feld angehörten. Doch mein Gesamteindruck geht dahin, dass diese Koalition primär in Politik, Publizistik und Öffentlichkeit verankert war und nicht in der im ‚Unpolitischen‘ verharrenden Universität. Wobei ich gerne zugebe, dass unter gewissen Umständen das ‚Unpolitische‘ auch eine Abwehr gegen die Nazifizierung sein konnte, denn in Basel war bekannt, welche Rolle nationalsozialistisch politisierte Studierende und entsprechend organisierte Mitglieder des Lehrkörpers an den deutschen Universitäten gegen Ende der 1920er Jahre gespielt hatten und nach 1933 noch spielten. Eine weitere Veränderung im Verhältnis der Basler ‚Peripherie‘ zu den deutschen ‚Zentren‘ ergab sich 1937 aus der Entlassung von Professoren in Deutschland, die mit jüdischen Frauen verheiratet waren. Der Pogrom von 1938 («Reichskristallnacht») bestärkte allgemein den Eindruck, dass sich die antijüdische Politik in Deutschland nicht auf eine relative Zurückdrängung der Juden aus Schlüsselpositionen in Wirtschaft und Wissenschaft beschränkte, sondern dass die Entrechtung konsequent realisiert wurde, unter Bedrohung von Leib und Leben, auch wenn man sich den ‚Holocaust‘ nicht vorstellen konnte. Zugleich hörten in Basel die Nazifizierungsbestrebungen im universitären ‚Feld‘ auf. Mit Ausnahme von ganz unbelehrbaren Individuen (zu denen einige deutsche Professoren gehörten, nicht aber Andreas Heusler und auch nicht die Schweizer Wissenschaftler in Deutschland, von denen nun einige das Land verlassen wollten) war auch die Begeisterung für Adolf Hitler vorbei. Die Organisation der Deutschen Studenten verschwand 1938 von der Basler Bildfläche. Wer dem Nationalsozialismus weiterhin Positives abzugewinnen vermochte, wurde zunehmend isoliert und äusserte sich nur noch im privaten Kreis. Dort wirkte allerdings der Gedanke weiter, dass das ‚Dritte Reich‘, wenn es denn nicht restlos als vorbildlich gelten könne, so doch ein die Geschicke der Schweiz mächtig bestimmender Faktor sei, dem man respektvoll begegnen und dem eine ‚Anpassung‘ entgegengebracht werden sollte, zumal eine deutschschweizerische kulturelle
Zuspitzung ab 1935, Konflikte und Helvetisierung
745
Existenz ohne engen Bezug auf Deutschland undenkbar wäre. Man kann diese Einstellung als verdeckte pro-nazistische Haltung denunzieren, oder sie als (inzwischen teilweise im Widerspruch zur Realität stehende) trotzige Weiterführung der Anhänglichkeit an Deutschland auffassen. Beide Aspekte verflochten sich untrennbar miteinander in den Organisationen der deutschen Kulturpolitik in der Schweiz mit schweizerischem Mitgliederbestand. Die erste Welle von ‚rassisch‘ und politisch bedingten Entlassungen an deutschen Universitäten (1933/34) hatte nur wenige Auswirkungen auf die Basler Stellenbesetzungen im universitären ‚Feld‘ gehabt. Diese Wirkungen standen damals noch weitgehend im Zeichen der Doktrin, dass Entlassene, die Deutschland verliessen, in der Schweiz nur Durchreisende sein sollten, denen man die Weiterreise durch persönliche Hilfe erleichtern wollte. Wie erwähnt wurde der Wunsch der Flüchtlinge, in Basel einen Lehrauftrag oder gar eine Professur zu erlangen, von den Fakultäten fast immer abgewiesen. Kuratel und Erziehungsdepartement waren schon seit 1933 offener; sie wollten im Interesse einer Erneuerung der Wissenschaft und der Hebung der Qualität gewisser Fakultäten und Fächer versuchen, aus der Verfügbarkeit ausgewiesener deutscher Fachleute für Basel Gewinn zu schlagen. Bleiben konnten Flüchtlinge, die grosse eigene Ressourcen mitbrachten, die sie materiell unabhängig machten, aber die Universität als Institution ergriff die Chance selten, sie einzubinden (eine Ausnahme war die vorübergehende Integration des Berliner Biochemikers Hermann O. L. Fischer in die Universität, der aber schon vor 1933 hier angekommen war), sondern überliess es einzelnen ihrer Professoren, Kontakte zu pflegen, und den privaten Vereinigungen wie der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft, ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, zu einem Basler Publikum zu sprechen (als Beispiele erwähnte ich die Kunsthistoriker, die Basel als Exil wählten). Allenfalls konnte die Volkshochschule einen bezahlten Kurs in ihr Programm aufnehmen. Einige weniger Bemittelte konnten sich privat so lange durchschlagen, bis sie ein Verhältnis zur Universität herstellen konnten, wie etwa der Psychiater Heinrich Meng. Etwas anders sah die Lage der 1937 wegen ‚jüdischer Versippung‘ entlassenen deutschen Professoren aus. Hier wurde eine Ausnahme gemacht vom Prinzip, nach 1935 keine Deutschen mehr an der Universität anzustellen. So konnte allenfalls ein Deutscher berücksichtigt werden, wenn er weder als dezidierter Nationalsozialist noch als aktiver, ausgesprochener Gegner des Regimes profiliert war. Zur Vermeidung aller denkbaren Probleme wurden dafür regelrechte Berufungsverfahren durchgeführt, in denen die entlassenen Deutschen einfache Kandidaten unter anderen Kandidaten waren oder zu sein schienen. Erst nach eingehenden Debatten und wenn sie gewichtige akademische und wissenschaftspolitische Fürsprecher in Basel hatten, wurden sie auf eine Professur gewählt. So verfuhr man mit einem Juristen, einem Pädiater und einem Altgermanisten. Für die erfolgreiche Anstellung eines aus Deutschland geflohenen Juden auf einer Basler Professur gab es jedoch bis 1945 kein Beispiel.
746
Einsichten
Eine Erwähnung verdienen die Auslandschweizer, die sich entschlossen, Deutschland angesichts der Radikalisierung des Nationalsozialismus nach 1936 und des seit 1938 offensichtlich drohenden Krieges zu verlassen, ohne dass sie als Opponenten des Regimes bekannt geworden wären. Anders lag der Fall bei den Schweizer Theologen in Deutschland, die schon früh mit Nationalsozialisten in Konflikt geraten waren und deshalb nicht in Deutschland bleiben konnten. Zu ihnen gehörte prominent Karl Barth, für den angesichts der Bedeutung, die ihm seine Anhänger als einem neuen Reformator zusprachen, in Basel eine Sonderlösung gefunden wurde. Nachträglich wurde Barth dann auf eine reguläre Professur ‚verschoben‘, womit wieder die fakultäre ‚Normalität‘ hergestellt war. Wilhelm Vischer oder auch politisch Radikalere wie Fritz Lieb hatten es schwerer, in der Heimat unterzukommen. Der Jurist Max Gutzwiller, der seiner Herkunft nach mit der Basler Region verbunden war, fand Unterstützung katholischer Hochschulkreise, um auf einem Umweg über St. Gallen von Heidelberg nach Freiburg/Schweiz zurückzukehren, ohne dass Basel betroffen wurde. Für weitere wissenschaftlich herausragende heimkehrwillige Auslandschweizer, die in Basel unterkamen, habe ich die Beispiele des Physikochemikers Werner Kuhn (Kiel) und des Romanisten Walther von Wartburg (Leipzig) diskutiert. In beiden Fällen war entscheidend, dass sich starke Kräfte innerhalb der betroffenen Fakultäten für sie einsetzten, während im wissenschaftlichen wie im politischen ‚Feld‘ Konsens darüber herrschte, dass sie in eine (grosse und gerade freigewordene) Lücke passten, fachlich als überragend galten und es überflüssig machten, einen Deutschen zu wählen. Letzteres traf auch auf den Heidelberger Archäologen Arnold von Salis zu, der zwar eine Professur in Zürich erhielt, aber zugleich in Basel wirkte. Der Antisemitismus war in Basel eine weiterhin meist im Verborgenen wirkende Kraft. Bei der Aufnahme von aus Deutschland geflüchteten Studierenden – wenn ich von der Bedeutung absehen dürfte, die dem Vorhandensein ausreichender Dokumente wie Ausweise, Testatbücher, Diplome, als Kriterium für die Zulassung zum Studium zukam und wenn ich die Abneigung gegen «Ostjuden» vernachlässigen könnte – wurde innerhalb der Universität keine offene Diskriminierung praktiziert. Sie wurden einfach unter Ausländern rubriziert. Anders die Polizeistellen, die 1933 Auskunft verlangten, wer von den neu Aufgenommenen Jude sei – allerdings nur einmal. Anders auch die Kuratel, die verhindern wollte, dass das öffentliche Ansehen der Universität darunter leide, dass sie ‚verjudet‘ würde. Der Diskurs erscheint auch dadurch schief, dass immer wieder argumentiert wurde, man dürfe Juden nicht fördern, um dem Antisemitismus nicht Nahrung zu verschaffen. Eine kodierte Sprache kam zur Anwendung: ‚Ausländische‘ Studierende kann oft als Synonym für ‚Juden‘ gelesen werden. Wenn es um Lehraufträge oder Professorenwahlen ging, zeigte sich in der Darstellung der Persönlichkeitsmerkmale der für die Fakultäten unerwünschten Kandidaten oft eine Wortwahl, die mit den Stereotypen verwandt war, mit denen Juden gezeichnet
Zuspitzung ab 1935, Konflikte und Helvetisierung
747
wurden. Die Anstellung des «Halb-» oder «Vierteljuden» Hermann Franz Mark scheiterte; obschon von der Regierung gewählt, kam er nie nach Basel. Anders behandelt wurden Schweizer mit jüdischen Wurzeln, jedenfalls vom Erziehungsdepartement, das lebhaft über den Antisemitismus in den Diskussionen der Fakultäten klagte. Der prominenteste Vorgang dieser Art war die Berufung von Tadeus Reichstein auf den Pharmazie-Lehrstuhl. Bezeichnend für die akademische Grundstimmung waren die Ausfälle gegen Juden in Debatten der studentischen Organisationen. Hausers Kampf gegen den Antisemitismus erscheint vor diesem Hintergrund in umso hellerem Licht. Die ‚geistige Landesverteidigung‘, die Helvetisierung verschiedener Disziplinen und der neue (deutschfeindliche) Nationalismus in Politik und Wissenschaft kennzeichneten die Phase nach 1935 in Basel. Die negativen Auswirkungen der Nationalisierung mancher Wissenschaften im (deutschen) Imperialismus des späten 19. Jahrhunderts und im Ersten Weltkrieg waren zwar in der Schweiz sehr wohl bekannt – die Geschichtswissenschaft bot dafür ein Beispiel. Da man in einer ‚peripheren‘ Stellung zu Deutschland gefangen war, fiel es allerding manchen schwer, gerade die deutschen Kollegen dafür zu kritisieren. Eine schweizerische Nationalisierung der Wissenschaft erschien jedoch angesichts der Bedrohung, die vom Nationalsozialismus ausging, ab 1935 zunehmend legitim zu sein. Personell äusserte sich diese Tendenz zuerst in der Zielsetzung, nur Schweizer als Assistenten anzustellen, was zugleich einer Forderung der Frontisten entsprach, sich aber auch sonst mit einem politischen (nicht-akademischen) Konsens deckte, den Arbeitsmarkt für Einheimische zu reservieren. Nur waren die Konditionen so schlecht, dass (ausser Wohlhabenden, die darin den Einstieg in die akademische Laufbahn suchten) nur anspruchslose Ausländer und Flüchtlinge zu gewinnen waren, wie am Beispiel der ETH deutlich wurde. Auch ausländische Professoren waren gehalten, Schweizer als Mitarbeitende und Nachwuchsleute heranzuziehen und nicht eine «deutsche Schule» zu gründen oder zu erhalten. Gegen Ende der 1930er Jahre kam vor allem bei Auslandschweizern, die zurückkehren wollten, das Kriterium zur Anwendung, ob sie «echte Schweizer» geblieben seien. Inhaltlich waren zuerst ideologisch relevante Wissenschaften von der helvetischen Nationalisierung betroffen. In Basel manifestierte sich dies am deutlichsten und zuerst in der Geschichte, für die in der Mitte der 1930er Jahren gleich zwei Schweizer auf Lehrstühle gehoben wurden, die helvetisch-national dachten, teilweise auch so publizierten und entsprechend in der Öffentlichkeit auftraten. Zur vor allem von der Politik vertretenen Doktrin, dass in allen Disziplinen kein Deutscher mehr für eine Basler Professur berücksichtigt werden dürfe, verhielten sich die Fakultäten fallweise verschieden. Manchmal stellten sie sich gegen ausländische Kandidaten, wenn diese von der Regierung bevorzugt zu werden schienen (namentlich, wenn es sich um Flüchtlinge handelte oder wenn ein abtretender Ordinarius einen eigenen Schweizer Schüler als Nachfolger ‚aufgebaut‘ hatte). Dann aber wünschten sie wieder deutsche Kandidaten gewählt zu
748
Einsichten
sehen, die nach herkömmlicher akademischer und ‚unpolitischer‘ Auffassung als die Besten ihres Faches galten, und bezeichneten die Schweizer als zu wenig qualifiziert. Helvetisierung war nicht pauschal mit wissenschaftlicher Mittelmässigkeit verbunden, hatte aber manchmal (auch in Naturwissenschaften) den Effekt, dass an einem Lehrstuhl eigenwillige Ansätze gepflegt wurden, die zwar wissenschaftlichen Respekt genossen, aber nach 1945 nicht mehr an die internationale Fachdiskussion ‚anschlussfähig‘ waren. Man kann sich fragen, ob die Helvetisierung die einzige mögliche Antwort auf die Nazifizierung der ‚Zentren‘, auf die Basel sich bezog, gewesen ist. Die hiesigen Fakultäten erklärten wiederholt, dass der Unterricht in deutscher Sprache zu erteilen war und dass deshalb eine Berufung von Fremden nur aus Deutschland, Österreich und stark deutsch geprägten Ländern wie z. B. damals Ungarn möglich sei. Im Nachhinein ist es schwer zu beurteilen, wie stichhaltig dieses Argument war. Ein Vergleich mit anderen Ländern ist wenig sinnvoll. Zwar waren die Wissenschaften auch in vielen nicht-deutschsprachigen Ländern auf deutsche ‚Zentren‘ bezogen gewesen. Eine Orientierung nach Deutschland gab es auch dort über 1933 hinaus, verbunden mit derselben Strategie der so genannten «normalization» der Kooperation mit nationalsozialistischer deutscher Wissenschaft, die an Schweizer Hochschulen gepflegt wurde. Aber, um ein Beispiel zu nennen, in Schweden fiel es den Medizinern leichter, sich auf die angelsächsische Welt umzuorientieren, und trotz Neutralität äusserte sich dort die Kritik am Umgang, den deutsche Stellen mit Akademikern in besetzen Ländern pflegten, viel lauter als etwa in der Schweiz.
9.5 Neutralität und Krieg Im Unterschied zum Ersten Weltkrieg ist kein deutscher Professor aus Basel bekannt, der sich 1939 zum Einsatz in einer deutschen Einheit gemeldet hätte. Vielmehr waren die deutschen Stellen der Ansicht, dass ihre in der Schweiz als Professoren tätigen Landsleute dort weiterwirken sollten. Auch Schweizer Professoren in Deutschland, die als Staatsangestellte zusätzlich das deutsche Bürgerrecht besassen, mussten auf keiner Seite Dienst leisten. Die ‚periphere‘ Stellung der Universität Basel zur deutschen Wissenschaft hätte manchen Basler verleiten können, sich in informeller oder publizistischer Form am deutschen Kriegseinsatz zu beteiligen. In den hier herangezogenen Dokumenten kommt nur ein Fall einer indirekten Beteiligung vor: Der Mediziner Rudolf Staehelin, der schon vorher als begeisterter Göttinger aufgefallen war und der Leopoldina angehörte (auch wenn er sich als guter Schweizer verstand), erstellte kurz nach Kriegsbeginn ein Gutachten über Gasverletzungen an deutschen Soldaten im Auftrag einer deutschen Stelle. Dies wurde von den Basler Behörden als unzulässig gerügt, worauf keine weiteren solchen Fälle aktenkundig wurden. Ausländern war eine
Neutralität und Krieg
749
Tätigkeit für ihr Heimatland an der Universität verboten worden – spektakuläre Verstösse gegen dieses Verbot wurden mir nicht bekannt. Schwieriger zu beurteilen waren Fälle, in denen eine nunmehr problematische ‚Gesinnung‘ zum Vorschein kam. Der Bund forderte von den Schweizern im Krieg eine ‚integrale‘ Neutralität, das heisst auch eine Neutralität der öffentlich geäusserten Einstellung. Zensur unterstützte diese Erwartung nachdrücklich. Wie Studenten kurz vor Kriegsausbruch noch festhielten, war dies im Völkerrecht nicht vorgesehen und bedeutete einen Eingriff in die Bürgerrechte. Verstösse von Basler Universitätsangehörigen gegen diese Weisung wurden nach meiner Kenntnis fast nur im Falle zu weitgehender Sympathie mit Deutschland geahndet – mit der gewichtigen Ausnahme von Karl Barth, der in Radiobeiträgen und in der Fürbitte am Ende seiner Predigten keinen Zweifel daran liess, auf welcher Seite er das Recht sah. Bei den deutschfreundlichen Äusserungen im Basler universitären ‚Feld‘ handelte es sich im hier untersuchten Material um Darstellungen der überlegenen deutschen Wehrmacht, der Notwendigkeit einer ‚Anpassung‘ und um mehr oder weniger wissenschaftliche, positive Darstellungen des ‚Neuen Europa‘ unter deutscher Vorherrschaft nach 1940, die nahelegten, dass sich die neutrale Schweiz darin ‚einfügen‘ sollte – was sie ja faktisch bereits tat, indem Industrie und Banken deutsche Kunden bedienten, wie jedenfalls unter Studenten offen beklagt wurde. Die neue Lage ab 1940 konnte ich anhand von Dokumenten zur Geschichte der studentischen Organisationen etwas näher ansehen. Es zeigte sich einerseits ein recht grosses Misstrauen gegen die Alliierten, deren Propaganda mit dem Argument der Verteidigung von Freiheit und Demokratie kaum in der Lage sei, die Verfolgung handfester materieller Interessen zu verdecken. An sich wünschten sich die Studenten und wohl auch die meisten andern Universitätsangehörigen eine freie Schweiz, unabhängig von Deutschland und ohne weitgehende Konzessionen an den Nationalsozialismus. Dementsprechend war die Bereitschaft, Militärdienst zu leisten, an sich nicht infrage gestellt. Ein Malaise verband sich aber mit der Integration in das deutsche Wirtschaftssystem, das nicht nur wegen der Zensur nicht offen diskutiert werden konnte, sondern auch deswegen, weil keine Alternative gefunden wurde. ‚Ehrlichkeit‘ war eine Maxime der Aktivdienstgeneration unter den Studierenden, und man sollte in diesem Licht diejenigen nicht zu schnell verurteilen, denen sogar die laue Basler Kundgebung der Solidarität mit den Studierenden und Professoren von Oslo zu weit ging. Zu Recht fragten sie, wieso keine Kundgebungen veranstaltet worden waren, als das Kriegsglück noch auf deutscher Seite stand, denn es hätte damals genügend Anlässe gegeben, Solidarität mit tschechischen, polnischen, niederländischen, belgischen und anderen Akademikern zu zeigen. Offene Parteinahme für die Alliierten war im universitären Feld selten, auch wenn vermutlich die Mehrheit hoffte, dass der Krieg nicht mit einem überwältigenden deutschen Sieg ende. Die starke Identifikation mit Frankreich, die der
750
Einsichten
Französischprofessor Albert Béguin vorlebte, blieb marginal und galt bei Kriegsende als ‚unschweizerisch‘, wie es Arminio Janner drastisch formulierte. Dennoch hegten Professoren Sympathien für das republikanische Frankreich, die mit einer Französin liiert oder für ihre Ausbildung längere Zeit in Frankreich gelebt hatten, wie Adolf Portmann. Russland interessierte vor allem die Kommunisten, die Mitglieder der Gesellschaft Schweiz-Sowjetunion und ihnen nahestehende Professoren wie den Juristen Baumgarten. England galt als materialistisch, und die USA erschienen vor 1944 sehr selten im Blickfeld der hier betrachteten Zeitgenossen. Im Jahr 1942 manifestierten vor allem die Theologen gegen die Grenzschliessung im Moment der Deportationen nach dem Osten, doch taten sie das anscheinend eher im Einklang mit dem ‚Wächteramt‘ der Kirche gegenüber der weltlichen Obrigkeit als von einem universitären Standpunkt aus. Am Beispiel Reichsteins liess sich zeigen, dass sich nun auch Schweizer Juden in privilegierten Positionen bedroht fühlten und den Eindruck hatten, dass schweizerische Behörden vielleicht nicht bereit wären, ihnen gleiche Rechte und gleichen Schutz wie den ‚arischen‘ Eidgenossen zu gewähren. Immerhin hielten die juristischen Professoren der Basler Universität an der Verteidigung des Rechtsstaates unmissverständlich fest. Für die Rettung von Juden setzte sich nicht die Universität offiziell ein, sondern einzelne ihrer Angehörigen, und insbesondere deren Gattinnen wurden aktiv. Während des Krieges wurde die deutsche Kulturpolitik im neutralen Ausland fortgesetzt, ja teilweise intensiviert. Die Wissenschaft sei in einem neutralen Land wie der Schweiz oder Schweden per se ‚neutral‘ und stehe deshalb offen für alle Einflüsse, die unvoreingenommen geprüft und unabhängig davon, ob sie aus einer Diktatur stammten, begrüsst werden, wenn sie fachlich interessant seien. So liess sich ‚beweisen‘, dass auch unter den Bedingungen, die in Deutschland während des Krieges herrschten, bedeutende wissenschaftliche Leistungen erbracht werden. Auf der einen Seite wurden dazu Vortragstourneen von deutschen Berühmtheiten aus Wissenschaft, Kunst und Kultur organisiert, die mit Erlaubnis und im Auftrag deutscher Stellen in den wichtigeren Städten der Schweiz auftraten. Diese Auftritte blieben auch in Basel bei den Gegnern des Nationalsozialismus nicht unbemerkt. Als der deutsche Naturphilosoph Bernhard Bavink im Stadtcasino sprach, wurden Handzettel verteilt, die auf das Vorgehen der deutschen Besatzer gegen die Universität Oslo aufmerksam machten. Die ‚Verschwörung‘ zur Verhinderung des Auftritts von Adolf Butenandt in Basel, von der Portmann später berichtete, war Teil des Boykotts, den in Zürich Leopold Ru⌅i⇥ka und andere organisiert hatten. Vor Kriegsbeginn hatten deutsche ‚Kulturträger‘, deren Tätigkeit dem nationalsozialistischen Regime genehm war, keine Schwierigkeiten gehabt, sich von Basler Organisationen wie zum Beispiel der Studentenschaft zu Veranstaltungen einladen zu lassen. Deutsche Kulturpolitik während des Krieges hiess, dass regionale und lokale schweizerische Organisationen
Neutralität und Krieg
751
geschaffen wurden, die – formal nicht an die Aktivitäten der deutschen Konsulate, Kolonien und Auslandsorganisationen der Partei gebunden – Plattformen für die Beschäftigung mit deutscher Kultur bilden und schweizerischen wie deutschen Freunden dieser Kultur Treffpunkte anbieten sollten. Das klang unverfänglich, schliesslich war die Deutschschweiz tatsächlich ein Teil der deutschsprachigen Kulturwelt, und die analoge Organisation der Freunde italienischer Kultur war wenigstens in Basel keineswegs darauf festgelegt, Propaganda für den italienischen Faschismus zu machen. Die deutsche Kulturorganisation mit der Bezeichnung ‚Basler Pfalz‘ hingegen hatte ein besonderes Profil. Hinter ihr standen schweizerische rechtsextreme Kreise, verbunden mit Germanophilen, die während des Krieges bedauerten, nicht offen mit Deutschland sympathisieren zu können, und vor allem, was in Bern auffiel, personell liiert mit Anhängern der Eidgenössischen Sammlung, die als staatsgefährliche Organisation verboten worden war. Die Angehörigen der Universität, die sich bei der Basler Pfalz einschrieben, begaben sich somit in eine merkwürdige Gesellschaft, auch wenn sie mit Blick auf die Statuten der Pfalz beteuerten, nur an guten kulturellen Beziehungen zu Deutschland interessiert zu sein und damit auch dem Interesse der deutschschweizerischen Kultur zu dienen. Es liegt in der Natur der Sache, dass man nicht sicher wissen kann, wer aus naiver Fortführung der Germanophilie der Zeit vor dem Krieg, ja vor 1933, teilnahm und wer gezielt einer nationalsozialistischen Tarnorganisation beitreten wollte. Das vom Regierungsrat ausgesprochene Verbot für die Staatsangestellten (und damit für die Universitätsdozenten), Mitglieder zu sein, gab ihm eine Handhabe, mehr oder weniger verborgene Anhänger des Nationalsozialismus, die sich durch ihre Mitgliedschaft enttarnten, zu verfolgen. Das Verbot ergänzte damit die als stumpf empfundene Waffe des Disziplinarrechts, das keine Verurteilung wegen Gesinnung zuliess, wohl aber Massnahmen gegen solche forderte, die expliziten Verboten zuwiderhandelten. Die wenigen Deutschlandfreunde in der Universität, die in diese Falle tappten, lassen keine verlässlichen Rückschlüsse darauf zu, wie verbreitet die Bewunderung des Nationalsozialismus in der Hochschule nach 1939 war, und die juristisch gefasste Situation von Anklage und Verteidigung eignete sich nicht, uns differenziertere Aufschlüsse über Motive zu gewähren. Dass es jedoch auch nach 1939, nach 1940 und noch nach der Kriegswende von 1943 Professoren an der Basler Universität gab, die Hitlers angebliches Programm bewunderten und nicht bloss aus Nationalgefühl heraus einen Sieg deutscher Waffen herbeiwünschten, ist an zwei bereits in früheren Perioden aufgefallenen Beispielen aus der Naturwissenschaftlichen Fakultät bekannt. Matthies und Jaeger bildeten aber damals mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht die Spitze eines Eisbergs. Hingegen gab es einen germanophilen Kreis in Riehen aus juristischen Amtsträgern und Universitätsangehörigen, der seine Marginalisierung nach 1943 schmerzhaft erlebte und sich als Opfer eines Stimmungsumschwungs, ja einer Gesinnungsdiktatur verstand, die keine freie Meinungsäusserung mehr zulasse.
752
Einsichten
Offensichtlich ist, dass in der Kuratel eine Gruppe aktiv war, die derartige Tendenzen seit Mitte der 1930er Jahre und erst recht nach Kriegsbeginn konsequent verfolgen wollte und auf Gelegenheiten wartete, die ihr dazu eine Handhabe böten. Ihren Antrieb fand sie in der Überzeugung, dass die Universität einen Erziehungsauftrag zu erfüllen habe, indem sie junge Menschen gegen die Verführung durch inhumane Weltanschauungen immunisiere. Die Verteidigung des Rechtsstaates, die sich vor Kriegsbeginn oft zugunsten der Meinungsfreiheit von Nationalsozialisten ausgewirkt hatte, interessierte sie dabei weniger. Aber die Basler Gerichte hielten an rechtsstaatlichen Grundsätzen auch gegenüber den Germanophilen weitgehend fest. Der Kalte Krieg erfasste die Universität noch vor 1945. Erkennbar wurde dies an studentischen Positionen. Während die einen sich ein friedliches Nachkriegseuropa mit einem neuen Völkerbund wünschten, der die Menschenrechte verteidige und auch einen auf marxistischer Grundlage gelebten Humanismus mit sozialstaatlichen Tendenzen einschliesse, sahen andere das Vordringen der Roten Armee in Mitteleuropa als Gefahr für Freiheit, Selbstbestimmung und Eigentum. Die ‚unpolitische‘ patriotische Universität grenzte sich erneut gegen links ab, wie dies die Basler Studentenschaft, der alle eingeschriebenen Studierenden angehörten und die meistens von den Verbindungen dominiert wurde, schon relativ früh durch die Trennung von ihrer Filmkommission (Le Bon Film) gezeigt hatte. Die Professorenschaft blieb im Vergleich dazu am Kriegsende duldsam gegenüber der humanitären Linken und den Linksliberalen, die sich in der Gesellschaft Schweiz-Sowjetunion und anderen Organisationen zusammenfanden.
9.6 Übergreifende Resultate Nachdem ich die Ergebnisse in einem an der Chronologie ausgerichteten Narrativ dargestellt habe, suche ich nun zunächst nach Erklärungen dafür, warum die Universität Basel keine dezidierten Stellungnahmen gegen den Nationalsozialismus abgegeben hat. Der einzige öffentliche Positionsbezug der Universität während des Krieges bezog sich auf die Geschehnisse an der Universität Oslo 1943; diese war trotz der Kriegswende noch ganz nach dem Muster der Selbstzensur redigiert und nannte die Täter nicht beim Namen. Weder vorher noch nachher liess die Universität offiziell etwas verlauten. Eine naheliegende Erklärung, die sich mit Einschränkungen auch auf das Ausbleiben eines tätigen Widerstands der deutschen Universitäten gegen ihre Nazifizierung anwenden lässt, suche ich in der Funktionsweise der Fakultäten und der Regenz. Mir geht es dabei um die Rekonstruktion von Regeln, die das meistens friedliche Zusammenleben zwischen als Forscher untereinander kon-
Übergreifende Resultate
753
kurrierenden Wissenschaftlern ermöglichten, und nicht um die Suche nach Schuld an einem Versagen der Institution. Es gab nur ganz bestimmte Themen, die in diesen Gremien angesprochen werden konnten, etwa Fragen zu Prüfungen, Entscheide über Stipendien; doch schon die Vorbereitung eines Gutachtens zu einer Berufung geschah in einem kleinen Kreis, der dann sein Ergebnis zur Berücksichtigung allfälliger weiterer Interessen dem Plenum vorlegte. Entscheide in solchen Fragen wurden wenn möglich konsensual gefällt, und man versuchte stets zu vermeiden, dass eine Minderheitsmeinung formuliert wurde, die sich dann nach aussen zur Geltung bringen wollte. Empfindlichkeiten einzelner Fächer oder Persönlichkeiten wurden oft vorwegnehmend berücksichtigt. Zwar gab es längere Rededuelle, und einzelne Mitglieder des Gremiums waren dafür bekannt, Probleme zu suchen statt Lösungen. Doch insgesamt ging die Rücksichtnahme auf allfällige Einwände sehr weit. Einzelne Mitglieder der Gremien hatten eine faktische Machtposition, bereiteten Geschäfte mit Gleichgesinnten, aber auch mit Andersdenkenden vor und versuchten dann, den Konsens in ihrem Sinne zu steuern. Die Konfliktvermeidung (die natürlich nicht immer gelang) basierte auf einem kleinsten gemeinsamen Nenner, auf Geduld im Anhören von Reden und im gegenseitigen Entgegenkommen, besonders unter den Einflussreichen. Stellte einer die Interessen seines Kollegen nicht infrage, konnte er erwarten, dass auch der Kollege Rücksicht auf seine Interessen nahm. Themen, die sich so nicht behandeln liessen, wurden möglichst vermieden. So war auch die Teilnahme an den deutschen Universitätsjubiläen behandelt worden. Mit Ausnahme erfahrener Opfer des Nationalsozialismus wie Karl Barth war der Konsens gegeben, dass man nach Tradition verfahren solle. Diese verlangte die gegenseitige Ehrerbietung der Universitäten, also musste man teilnehmen. Man sah hier keinen Anlass zu einer Grundsatzdebatte über das Verhältnis der ‚Peripherie‘ zu den deutschen ‚Zentren‘ oder über die Natur des Nationalsozialismus. Als die Regierung aus Rücksicht auf die Strömungen im politischen ‚Feld‘ anders entscheid, war der Missmut gross, zumal an anderen Schweizer Universitäten die Teilnahme an akademischen Feiern im Ausland als rein universitäre Sache galt, in die sich die Regierung nicht einzumischen hatte. Aber die Basler Professoren gehorchten, weil sie die Unterordnung der Universität unter den Staat akzeptierten, soweit dieser die Verantwortung trug, was gleichfalls der Tradition entsprach. Nur Andreas Heusler protestierte aus seiner Position der Unabhängigkeit heraus und legte seine Professur vorzeitig nieder. Der Gehorsam gegenüber dem Staat, den die andern zeigten, verbunden mit der Unmöglichkeit von Grundsatzdebatten über ausseruniversitäre Fragen lässt sich mit allen Vorbehalten vergleichen mit dem Verhalten deutscher universitärer Gremien gegenüber ihren nationalsozialistischen Ministerien. Durch das formale Recht gedeckte staatliche Erlasse wurden respektiert und gingen den durch die akademische Tradition gegebenen Regeln letztlich vor. Meine erste These lautet also, dass universitäre Gremien gar nicht fähig waren, politische oder weltan-
754
Einsichten
schauliche Verantwortung für sich selbst zu übernehmen in Themenbereichen, die über den traditionellen Rahmen hinausgingen. Denn dafür gab es keine Spielregeln. Spielregeln waren aber wichtig, um die stark divergierenden Interessen von Persönlichkeiten und Disziplinen zusammenzuhalten. Traditionen, notfalls ad hoc erfundene Traditionen (ich denke an die Einführung des Talars in den 1930er Jahren – wie die meisten Schweizer Professoren waren die Basler vorher auch bei feierlichen Gelegenheiten als bürgerliche Mitglieder der formal egalitären Zivilgesellschaft im schwarzen Anzug aufgetreten), Rituale (wie die Doktorpromotionen mit dem Schwur in Gegenwart des Rektorenszepters, die Einführung der Neulinge in die Fakultät oder die Einleitung der Voten unter Verwendung der korrekten lateinischen Titulatur) und Symbole bewirkten die Integration derer, die zum Kreis gehörten, und den Ausschluss derer, die sich nicht an die akademischen Spielregeln halten wollten. Im akademischen Feld waren solche Faktoren wichtige Regulative, die Eintritt ins ‚Feld‘, Karriere, Aufstieg oder Ausschluss und die Macht der führenden Gestalten sicherten. Die zweite These geht somit dahin, dass die akademische Integration ein mühsam errungenes Ergebnis war, das nicht durch das Aufgreifen unpassender Themen gefährdet werden durfte. Die Vorstellung von der ‚unpolitischen‘ Universität stand damit in einem direkten Zusammenhang. Politik hatte in der Universität ein korrosives Potential, das ‚draussen‘ bleiben sollte. Dabei war offensichtlich, dass das ‚Unpolitische‘ der Universität sehr politisch sein konnte. So trug die idealistische Überzeugung vom ‚unpolitischen‘ Wesen der Universität dazu bei, dass für die in Deutschland sozialisierten Basler Professoren die rasche und tiefgreifende Gleichschaltung der Universitäten durch den Nationalsozialismus akademisch nicht thematisierbar war und deshalb möglichst ‚übersehen‘ wurde. Mit dem Willen zum ‚Unpolitischen‘ verband sich ein Negativbild des politischen ‚Feldes‘, das zwar die Kredite für die Universität bewilligen sowie bauliche Erweiterungen beschliessen und finanzieren, aber nicht in die Interna der Universität eingreifen sollte. Umgekehrt erschien vom politischen ‚Feld‘ aus gesehen die Universität manchmal als verantwortungslos und unfähig, ihr eigenes Wohl zu erkennen. Sollte dies wie eine strikte Grenzziehung zwischen den ‚Feldern‘ aussehen, so möchte ich daran erinnern, wie stark die Universität im Basler politischen und öffentlichen ‚Feld‘ präsent war. Die Behauptung der ‚Feldgrenze‘ hatte eine situative gruppenideologische Funktion und war vor dem Hintergrund der Debatten um ein neues Universitätsgesetz und dessen Umsetzung in die politisch-administrative Praxis zu verstehen. Und die ‚voraussetzungslose‘ (weltanschaulich ungebundene) Wissenschaft, eine Errungenschaft des liberalen, seit dem ‚Fin de siècle‘ verpönten ‚19. Jahrhunderts‘, war auf ein politikfreies, eigenes ‚Feld‘ für ihre Tätigkeit angewiesen. Schliesslich schienen die Ereignisse der 1920er und 1930er Jahre in Deutschland das ‚Unpolitische‘ als wichtige Verteidigungslinie gegenüber Jugend-
Übergreifende Resultate
755
lichen zu erweisen, denen die Voraussetzungslosigkeit nichts, die radikale politische Tat oder Theorie sehr viel bedeutete. Dies traf in Basel nun vor allem die linken Studierenden, während das Beispiel der NS-Studierenden, die die deutschen Universitäten seit den ausgehenden 1920er Jahren zu beherrschen versuchten, zwar bekannt und gefürchtet war, aber hier keine Konsequenzen hatte. Die dritte These lautet also, dass die Betonung des ‚Unpolitischen‘ und die Wahrung der ‚Feldgrenze‘ zu Politik und Öffentlichkeit für die Forderung nach universitärer Autonomie funktional war, dass sie aber in der Perspektive des politischen ‚Feldes‘ solche Eingriffe in die Universität legitim erscheinen liess, die darauf abzielten, das Ansehen der Universität in der Öffentlichkeit und damit die Bereitschaft des Grossen Rats zur Finanzierung der Hochschule zu wahren. Vorübergehend schien die akademische Autonomie in einen Widerspruch zur Verteidigung der bürgerlichen Freiheit gegen den Nationalsozialismus zu geraten, die im politischen ‚Feld‘ angestrebt wurde. So wurde von ‚aussen‘, vom politischen Feld aus, der Universität eine Distanznahme zum nazifizierten deutschen Hochschulwesen auferlegt, um sie ‚in Phase‘ mit der öffentlichen Meinung zu bringen. Solche Eingriffe dienten aus der Sicht des ‚Politischen‘ aber auch dazu, die Universität erneuerungsfähig zu erhalten, indem gelegentlich nicht der Schüler des abtretenden Ordinarius gewählt wurde oder der nach herkömmlichen akademischen Kriterien hochverdiente, beste (deutsche) Fachmann, sondern eine andersgeartete Persönlichkeit, die in der betreffenden Fakultät nicht mehrheitsfähig gewesen wäre. Eine bedeutende Rolle spielte die – angeblich oder wirklich – alternativlose Gefangenschaft der Basler Universität in der Position der ‚Peripherie‘ gegenüber dem deutschen Universitätssystem. Solange dieses zentrale System vielfältig, individualistisch, rationalistisch und selbstbestimmt war, konnten die methodisch hochstehende, thematisch umfassende ‚voraussetzungslose Wissenschaft‘ und der deutsche Professorenliberalismus ein Vorbild für die Schweizer sein. Dass dieser Liberalismus national war, galt seit dem 19. Jahrhundert als üblich und konnte in einer gelehrten Welt gelebt werden, in der die Nationalismen im mehr oder minder friedlichen Wettbewerb miteinander zu stehen schienen. Mit der Nazifizierung entfielen wichtige Voraussetzungen für einen positiven Bezug der Schweizer ‚Peripherie‘ auf die deutschen Universitäten, weil nach dem Willen der nationalsozialistischen Bildungspolitiker Wissenschaft nicht länger voraussetzungslos sein durfte, wollte sie Relevanz für die ‚Volksgemeinschaft‘ zur Legitimierung ihres Daseins beanspruchen. Rationalität sollte der rechten Gesinnung weichen, und die (liberale) nationale Erziehungsmission sollte einer Politisierung im Sinne des Regimes dienen. Vielfalt verlor in Deutschland an Wert zugunsten einer Unterwerfung unter das Reichsministerium und der Ausrichtung auf ein vorgegebenes Ziel und einen erwarteten Diskurs. Die Gefangenschaft der Basler ‚Peripherie‘ war jedoch relativ, denn eine Nazifizierung fand hier nicht statt; Freiheiten, Vielfalt und Individualismus blieben erhalten. Dennoch war sie für viele Disziplinen existentiell, weil die ‚Zentren‘ ein faktisches Monopol auf unentbehrliche Funk-
756
Einsichten
tionen in vielen Wissenschaften innehatten. Was die ‚Peripherie‘ an Verlagen, Zeitschriften, Vereinen, Tagungen und Preisen vorzuweisen hatte, konnte mit Ausnahme gewisser Naturwissenschaften nur eine sekundäre Geltung im Verhältnis zu den entsprechenden Leistungen der ‚Zentren‘ beanspruchen. Auf alternative ‚Zentren‘ wollten und konnten sich die deutschsprachigen ‚peripheren‘ Wissenschaftlergemeinschaften nicht innert kurzer Zeit neu ausrichten. Die reine Wissenschaft galt als ewig; die deutsche Diktatur hätte rasch wieder verschwinden können. Und vor allem in den Geisteswissenschaften galt (abgesehen von der Geschlossenheit vieler nationaler Universitätssysteme) die Kulturbarriere gegenüber anderen ‚Zentren‘ als unüberwindlich: Frankreich hatte (im Vergleich zum 19. Jahrhundert) keinen grossen Stellenwert mehr, zumal die für Basel massgebenden deutschen ‚Zentren‘ über Generationen gelehrt hatten, das Land im Westen zu verachten. Angelsächsische und skandinavische Wissenschaftswelten waren eigentlich nur für Naturwissenschaftler zugänglich, allenfalls noch für Anglisten und für Altertumswissenschaftler. Während die Forschung mit dieser Welt interagierte, verhinderte die in deutscher Sprache zu haltende Lehre die Rekrutierung von Dozenten aus diesem Raum. Ich möchte in zweiter Linie Thesen zu den Faktoren formulieren, die die Stärken und Schwächen der Basler Resistenz und der Abwehrbereitschaft gegen den Nationalsozialismus und dessen Wirkungen in der deutschen Wissenschaft beeinflussten. Schwächen zeigten sich deutlich, bei Studierenden wie bei Professoren. Die ‚unpolitische‘ Universität war in der Regel system- und kulturbedingt nicht zur politischen Analyse ihres Umfeldes geneigt. Sie hatte aber potentiell die Stärke, das ‚Politische‘ von sich fernzuhalten und damit auch den Nationalsozialismus, soweit er als eine Politik erkannt wurde, die über private Weltanschauung oder Gesinnung hinausging. Die ‚Peripherie‘ musste lernen (oder durch Eingriffe aus dem politischen ‚Feld‘ zur Einsicht gebracht werden), was der nationalsozialistische Totalitätsanspruch im wissenschaftlichen Feld bedeutete, um zu einer begründeten Ablehnung vorzustossen. Da diese Totalität aber wegen der unauffälligen, aber doch für ihre Basler Freunde erkennbaren Resistenz deutscher Kollegen manchmal fiktiv bleib, sah sich die ‚Peripherie‘ ermutigt, den Kontakt mit den ‚Zentren‘ zu halten und wegzuschauen, wenn Funktionsträger der Partei prominent an Tagungen auftraten. Selten erkannt wurde allerdings (obwohl in vielen Ansprachen an Kongressen in Deutschland eindeutig artikuliert), dass die Präsenz von ausländischen Studierenden und Professoren im nazifizierten ‚Zentrum‘, die sich nicht zum Nazismus bekannten, Teil eines Kalküls war, das darauf hinauslief, gerade in dieser Präsenz den Beweis für eine Akzeptanz oder gar zustimmende Mitwirkung ‚Neutraler‘ innerhalb oder am Rande des NS-Systems zu sehen und daraus propagandistisch Gewinn zu schlagen. Eine bewusste Resistenz gegen schleichende Einflüsse von älteren, allgemein antirationalistischen Strömungen auf die Wissenschaft, die der Nationalsozialismus sich zu eigen gemacht hatte, war in Basel eher wenig sichtbar. Als ‚Periphe-
Übergreifende Resultate
757
rie‘ hatten Schweizer Wissenschaftler seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ähnliche geistige und fachliche Veränderungen vollzogen wie ihre deutschen Lehrer und Kollegen. Skepsis gegenüber der Demokratie, die Absage an die Werte, die mit dem Schlagwort ‚19. Jahrhundert‘ assoziiert wurden, die methodische Lockerung der Bindung an Rationalität, intersubjektive Mitteilbarkeit und Nachprüfbarkeit wissenschaftlicher Aussagen teilte die ‚Peripherie‘ mit den ‚Zentren‘. Die krisenbedingte Integrationsproblematik der Weimarer Republik erschien ebenso übertragbar auf die Demokratie der ‚Peripherie‘ wie die Erwartung eines Umsturzversuchs von links. Die Befürchtung einer bevorstehenden Revolution begründete eine Toleranz altliberaler wie rechtsbürgerlicher Haltungen gegenüber der extremen Rechten, die in der Professorenschaft der ‚Peripherie‘ verbreitet waren. Stärken zeigten sich aber am Beispiel der Juristen der ‚Peripherie‘. Mehrheitlich waren sie als Berater der Gesetzgebung und als Richter, aber auch durch gemischte Karrieren, die ein Pendeln zwischen exekutiven und judikativen Aufgaben einerseits, universitären Aufgaben andererseits zuliessen, in den bürgerlichdemokratischen Rechtsstaat des Kantons wie des Bundes eingebunden. Der katholische Widerstand gegen den Nationalsozialismus fand in der ‚Peripherie‘ eine Sympathie, die ich jedoch an einer protestantisch ausgerichteten Universität nicht eingehend studieren konnte. Der protestantische Widerstand schuf sich in der Theologischen Fakultät in Basel eine Zitadelle, die vor allem von der dialektischen Theologie der Barthianer besetzt war und von der aus ein fundamentaler Widerstand gegen den Totalitarismus, die nazistische Anthropologie und zum Teil auch gegen den Antisemitismus begründet und gelehrt wurde. Die Zensur, die auch in der ‚Peripherie‘ dagegen mobilisiert wurde, vermochte diese Tendenz nicht zu bändigen. Zu den die Resistenz stärkenden Faktoren gehörte in Basel der Umstand, dass hier eine Universität nach ‚deutschem Modell‘ fortexistierte, die zwar bis 1933, wie oben erwähnt, die weltanschaulichen und wissenschaftlichen Tendenzen der ‚Zentren‘ ein Stück weit mitgemacht hatte, in der aber die eigentliche Nazifizierung keinen Erfolg hatte. So konnte sie ein Ort werden, der den Willen zur individuellen geistigen Freiheit und Unabhängigkeit als akademische Tugend bewahrte. Der Humanismus war ein Teil dieses Willens, ob in der Art der George-Anhänger, im klassischen Humanismus der Griechenverehrung oder in Ansätzen zu einem neuen Humanismus, wie sie sich nach 1945 deutlicher manifestierten. Reste von Aufklärung und Rationalismus überlebten und milderten durch den Effekt der provinziellen Mässigung und Verspätung die Folgen der ‚Absage an das 19. Jahrhundert‘. Zusammen mit dem Faktum, dass hier vaterländische Wissenschaft an ein demokratisches Vaterland gebunden blieb, konnten diese Reste zu Ausgangspunkten für ein Erlebnis von Distanz, Differenz und schliesslich zu Resistenz werden. Zwar betrachteten auch in der Schweiz Akademiker die
758
Einsichten
reale Demokratie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als ausgesprochen krisenhaft. Falls diese sich dennoch zur Demokratie bekannten, konstruierten sie eine ideale Demokratie aus vorrevolutionärer und vormoderner Zeit. Wesentlich war, dass das politische Umfeld der Wissenschaft in der Schweiz keine Unterwerfung unter den Machtstaat forderte, der im Gegenzug Wissenschaft und Kultur schützen sollte, wie dies der deutsche Professorenliberalismus lehrte (oder es die schweizerische Kritik daran verstand). Unterstrichen wurde diese Differenz durch die Abhängigkeit von einem politischen ‚Feld‘, das nicht bereit war, für eine Universität Ressourcen freizumachen, die sich nach dem nationalsozialistisch beherrschten deutschen Hochschulwesen ausrichtete. Das Basler wissenschaftliche ‚Feld‘ war nicht abgeschottet gegenüber Öffentlichkeit und politischem ‚Feld‘, daher konnten ‚neuhelvetische‘ Einflüsse hineinwirken und die Einsicht vermitteln, dass der Nationalsozialismus eine Gefahr auch für die Wissenschaft sei. Ein Faktor, dessen Bedeutung ich nicht unmittelbar erfassen kann, lag in der Unabhängigkeit von der Forschungsfinanzierung durch nationalsozialistische Stellen. In den deutschen Hochschulen entstand eine vor allem für randständige Fächer und für Nichtordinarien attraktive Möglichkeit, eine ‚Gemeinschaftsforschung‘ finanziert zu bekommen. Zudem verband sich dort immer mehr der Zugang zu bedeutenden Ressourcen, wie sie Kaiser Wilhelm-Institute und angeblich oder wirklich kriegsrelevante Forschung zur Verfügung hatten, aber auch zu DFG-Mitteln, mit einem (manchmal nur gespielten) Bekenntnis zur nationalsozialistischen Ideologie. Die Dozentenlager und die ‚charakterliche‘ Eignungsprüfung von Habilitationskandidaten richteten zudem den deutschen Nachwuchs nolens volens auf das Regime aus oder bewirkten Konzessionen. Die Basler ‚Peripherie‘ hatte dazu keinen Zugang und verfügte auch über keine analogen Strukturen und Prozesse. Insofern blieb sie vergleichsweise arm und ‚rückständig‘, aber eben auch frei. Bei deutschen Professoren (ob sie in Deutschland oder in der Schweiz wirkten) und bei Schweizer Germanophilen spielte die Wahrnehmung einer nationalen Krise, auf die die Nationalsozialisten eine Antwort zu haben behaupteten, eine grosse Rolle für ihre Bereitschaft, die Nazifizierung zu dulden oder sich daran aktiv zu beteiligen. Im Vergleich zur deutschen Notlage seit 1918 war die Krise in Basel, auch wenn sie lautstark beklagt wurde, jedoch vergleichsweise mild. Zumal hier ein ‚imperialer Komplex‘ wegen des verlorenen oder verstümmelten ‚Reichs‘ ganz fehlte, da der Basler ‚Imperialismus‘ gewohnt war, informell aufzutreten und den Ausgang des Krieges 1918 nur dann als schmerzlich erlebt hatte, wenn er (auch finanziell) voll auf die deutsche Karte gesetzt hatte. Demokratie und Wirtschaft entwickelten sich in der schweizerischen Krise weiter, wenn auch konflikthaft. Höhere öffentliche Bildungsinstitutionen wurden zwar knapp gehalten, manchmal sogar gegenüber Volksschulen, Museums- oder Infrastrukturprojekten benachteiligt, aber nicht völlig vernachlässigt – das Universitätsgesetz von
Übergreifende Resultate
759
1937 und das neue Kollegiengebäude von 1939 hatten auch die symbolische Funktion, die Bereitschaft des Staates zu demonstrieren, diese öffentliche Bildungsanstalt zu fördern. Insgesamt wurden die 1930er Jahre und dann insbesondere die Kriegszeit zu einer Phase der relativen Prosperität, die sich auch in der wachsenden Zahl von Schweizer Studierenden niederschlug. Die Bereitschaft, Opfern des Nationalsozialismus innerhalb derjenigen Grenzen zu helfen, die die Selbstwahrnehmung als strukturschwache und unterfinanzierte Bildungsanstalt der Hilfsbereitschaft zog, gehörte zur Haltung einer diskreten Resistenz. Dass aktive Opposition von der Universität als Institution nicht ausging und vielleicht auch nicht erwartet werden konnte, habe ich bereits zu erklären versucht. Sichtbare Helden der meist verbalen Opposition gegen den Nationalsozialismus in Basel waren vor allem Politiker, Journalisten, Pfarrer (die Theologen opponierten mehr als Kirchleute denn als Universitätsvertreter, vermute ich), während Basler Studierende (ich meine die Studierendenpopulation mit lokalen oder regional-helvetischen Wurzeln) und Professoren mehr im Stillen resistent waren, soweit sie sich nicht dem Wegsehen, Verharmlosen und einer mangelnden Vorstellungskraft hinsichtlich der Totalität und Radikalität des nazistischen Programms hingaben und damit indirekt der deutschen Diktatur zudienten.3111 Die Basler Universitätsgeschichte von 1933 bis 1945 ist in einem gewissen Sinne unspektakulär verlaufen. Einerseits blieben grössere Skandale aus, andererseits ist auch nicht von auffälligen oppositionellen Aktionen gegen den Nationalsozialismus zu berichten. Trotz dieses Mangels an spektakulären Ereignissen hat sich das Studium der Basler Universitätsgeschichte als lohnend erwiesen. Es hat ermöglicht, Erklärungen dafür zu diskutieren, warum die Vorteile eines demokratischen und freiheitlichen Umfeldes von dieser Universität nicht verstärkt genutzt wurden, um die Nazifizierung der deutschen Hochschulen öffentlich anzuprangern und ihre stillschweigende Akzeptanz im Ausland zu unterminieren. Die Alltäglichkeit der meist friedlich-freundlichen Koexistenz, manchmal auch Kooperation, zwischen einer freiheitlichen ‚Peripherie‘ und den deutschen ‚Zentren‘, die sich den Geboten der verbrecherischen Diktatur unterwarfen und dadurch ihre Freiheit und ihr Ansehen verloren, war vielleicht das wirklich Spektakuläre dieser Basler Geschichte. Viele Studien über die Zeit von 1933 bis 1945 sind in der Absicht unternommen worden, die Handlungen der damals Verantwortlichen im Sinne einer ‚Aufarbeitung der Vergangenheit‘ zu beurteilen. Dafür ist die Ethik besser gerüstet als die Historiographie. Im Licht des Holocaust war einzig die radikale Haltung mit expliziter Stellungnahme, die mit dem Gang ins Exil verbunden war, wie sie ei3111
«Wer ist an Hitler und Mussolini schuld? Die unzähligen damals Unbeteiligten sind es, die damals vorläufig Abwartenden und Zuschauenden.» So Karl Barth in: «Die geistigen Voraussetzungen für den Neuaufbau in der Nachkriegszeit», zitiert nach Tietz 2019, 320.
760
Einsichten
nem Albert Einstein zugeschrieben wird, ethisch richtig. Gemessen an diesem Massstab trugen alle anderen Haltungen und Verhaltensweisen dazu bei, die Herrschaft von Verbrechern zu etablieren, zu stabilisieren und zu verlängern. Wird dieser Massstab relativiert, treten letztlich Argumentationsweisen hervor, die bereits unmittelbar nach Kriegsende in der Entnazifizierung und in den Taktiken des damaligen ‚Weisswaschens‘ zur Legitimierung des ‚Weitermachens‘ hervorgetreten sind. Historiographie kann sich allerdings in Verbindung mit der Ethik zur Vertreterin der Anklage machen, wie es in der Schweiz zuletzt die Bergier-Kommission («Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg», 1996 bis 2002) tat. Zunächst jedoch stellt sich der Historiographie die Aufgabe zu erklären. Sie geht von der Frage aus, warum nach bürgerlichen Massstäben anständige, gutwillige und in ihrem Fach zuweilen herausragende Fachleute mit hoher Intelligenz mit Institutionen und Menschen kooperierten, die innerhalb des Netzwerks dieser verbrecherischen Herrschaft Funktionen erfüllten. Die Antworten, die sie geben kann, stehen zur Ethik in einem Spannungsverhältnis, das lehrreich ist. Die Art, wie die Basler akademischen Akteure ihre eigene Lage wahrnahmen, wie sie die Vorgänge im ‚Reich‘ rezipierten, und die Motive von Opportunität, aber auch solche der Menschlichkeit, ergeben Erklärungsmuster, die sich einfügen lassen in Ansätze wie ‚Peripherie und Zentren‘ oder ‚Normalization‘. Die Spannweite von verbreiteten Verhaltensweisen, die von latentem Einverständnis mit einzelnen Aspekten der Diktatur über Wegschauen, ‚business as usual‘, dem Wahrnehmen von scheinbaren Chancen, der formalen Trennung zwischen ‚Politik‘ und ‚Wissenschaft‘ bis zu individuellen Anzeichen von Anstand, Einsicht und Hilfsbereitschaft gegenüber den Opfern reichte, bleibt im Angesicht des Verbrechens ethisch ungenügend, aber im Rahmen dessen, was die Geschichtswissenschaft beizutragen vermag, erklärbar.
10 Bibliographie 10.1 Unpublizierte Dokumente Archiv der Humboldt-Universität Berlin B 01.02 Universitätskurator, Bestand: UK Personalia UK Personalakten bis 1945, Sign. Nr. L 129a. B 01.10 NS-Dozentenbund, Bestand: NS-Doz 2 NS-Dozentenschaft der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin (Personalia), Sign. Nr. ZD I 0630. Archiv der Universität Wien PH S 34.39: Dekanat der Philosophischen Fakultät, 1937/38 ff. Archiv der Universität Wroclaw Bestand Universität Breslau S 220–385 Akte Friedrich Ranke. Archiv für Zeitgeschichte, ETH Zürich IB JUNA-Archiv / 512, Kontroversen um einzelne Personen, Presseartikel A-Z, 1938–1959. Nachlass Friedrich Vöchting 1.1 Korrespondenzen, Prozessakten, Presseartikel und Notizen, 1938–1940. 1.2 Korrespondenzen, Prozessakten, Presseartikel und Notizen, 1943. Nachlass Gustav Däniker, online-Verzeichnis: http://onlinearchives.ethz.ch/md/ 37a1b131b81e408f8f812c0eeca560ae. Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds Archives (Fonds) Albert Béguin. Bundesarchiv Bern E27#1000/721#4787 Versetzung von Oberstlt. Wackernagel, Basel, zur Disposition wegen seiner frontistischen Gesinnung, 1942 (Dossier). E4320B 1974/47_41, Aktenzeichen C.03–133, E4320B#1974/47#179* Akte Fritz Lieb. E4320B#1973/17#433 Akte Jacob Wackernagel. E4450#B.231 Einzelne Werke 1939–1945, auch als E4450#1000/864#1532* Barth, Karl: Im Namen Gottes des Allmächtigen … 1751*, und weitere bis 1760*. E4450#1000/864#2310* Däniker, Gustav: Der europäische Stil in der Kriegsführung. E4450#1000/864#1753* Barth, Heinrich: Der Sinn der Demokratie. Der Schweizer und sein Staat.
762
Bibliographie
Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, Archiv S / 1.753 Band 1. Organisation des gesamten künstlerischen und kunstgewerblichen Unterrichts i. sp. Lehrer. Direktor. 1921 1927. S / 1.753 Band 2. Kunstgewerbeschule. Lehrpersonal. Sept. 1927–1929. S / 1.753 Band 3. Kunstgewerbeschule. Lehrpersonal. 1930 [–1931]. Magistratsakten 2.453. Städelschule. Verwaltungspersonal. Akten Nr. 6681, 1930 1935. Magistratsakten 8.109. Akten Nr. 6355. Band 1, 1933 1939. Magistratsakten 8.379. Personalakte 1.631. Wichert, Fritz, Prof., geb. 22. 8. 1878. Landesarchiv Baden-Württemberg Staatsarchiv Sigmaringen, Staatskommissariat für die politische Säuberung, Findbuch Wü 13 T 2, Nr. 2655/320 Digitalisat des Entscheids der universitären Spruchkammer über Adolf Köberle, https://www.landesarchiv-bw.de/. Landesarchiv Schleswig-Holstein Abt. 47, Universitätsarchiv Kiel, Nr. 1590, Akten betreffend Anträge auf Errichtung neuer Professuren / Wiederbesetzung von Professuren, März – August 1936, Titel III, Abschnitt A, Nr. 5, Band IV, 257. Paul Sacher Stiftung Basel Bibliothek PSS A 1643 Exemplar von Von Wartburg 1939 aus der Bibliothek von Werner Kaegi. WK Nachlass Werner Kaegi. Pitt Rivers Museum/Archive Oxford Blackwood Papers, Box 4, Envelope S, No. 52–88. Staatsarchiv Basel-Stadt (StABS) Bürgerrecht H 1, 72, Fall 301 (Hans Erlenmeyer) = Bürgeraufnahmen 1934 No. 205–306. ED-REG 1, 259–0 Kunsthistorisches Seminar, Allgemeines. ED-REG 1a 1 83 Albert Béguin. ED-REG 1a 1 367 Markus Fierz. ED-REG 1a 1 373 Hermann Fischer. ED-REG 1a 1 692 Fritz Jaeger. ED-REG 1a 1 697 Arminio Janner. ED-REG 1a 1 1249 Arnold von Salis. ED-REG 1a 1 1579 Peter von der Mühll. ED-REG 1a 1 1622 Walther von Wartburg. ED-REG 1a 2 176 Edgar Bonjour.
Unpublizierte Dokumente
763
ED-REG 1a 2 1202 Karl Meuli. ED-REG 1a 2 1402 Adolf Portmann. ED-REG 1a 2 1545 Edgar Salin. ED-REG 1a 2 1913 Hans Georg Wackernagel. ED-REG 1a 2 1914 Jakob [sic] Wackernagel (Jur.). ED-REG 1a 3 182 Joseph Gantner. ED-REG 1a 4 342 Harald Fuchs. Erziehung CC 1 G-i Philosophische Fakultät, h Kunsthistorisches Seminar, Archiv für Schweiz. Kunstgeschichte. Erziehung CC 16 Professur (Lateinisch) für Klassische Philologie. Erziehung CC 18 Professur (Romanisch). Erziehung CC 18d Lektorat für Italienisch. Erziehung CC 18 f Lektorat für Spanisch. Erziehung CC 20 Professur für Geschichte. Erziehung CC 20b Professur für Kunstgeschichte. Erziehung CC 23 Professur Chemie I. Erziehung CC 24 Professur Physik. Erziehung CC 26a Professur Geographie. Erziehung CC 28a Philologisch-Historische Abteilung, einzelne Dozenten. Erziehung CC 28c Philosophisch-Historische Fakultät, einzelne Dozenten. Erziehung X 48 Schweizerisches Hilfswerk für deutsche Gelehrte. Erziehung Y 7 Professur und Lektorat für Neutestamentliche Theologie. Feste F 5e Erasmusfeiern 1936. PA 82 Familienarchiv Wackernagel M Nachlass Jacob Wackernagel M2 35 Korrespondenz mit Max Gerwig. N Nachlass Hans Georg Wackernagel-Riggenbach. PA 88a Archiv der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel E 4 Zentenarfeier und Erasmusfeier 1936. PA 838a Familienarchiv Hagenbach L 40 (1) Aulavortrag von August Hagenbach, 10. Dezember 1935. M 11 (1) Nachlass August Hagenbach, Korrespondenz mit der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.
764
Bibliographie PA 959 C 4 Privatarchiv Fritz Belleville Politisches: Marxistische Studentengruppe 1933–1938. PA 979a Nachlass Tadeus Reichstein. PA 1046a D1 Schweizerische Gesellschaft zur Pflege der kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Italien, Ortsgruppe Basel Jahresberichte 1941–1991. PA 1132a Archiv der Sektion Basel des Zofingervereins E 7–10 nn, Protokoll der Sektion Basel 1930–1935. E 7–10 oo, Protokoll der Sektion Basel 1935–1939. E 7–10 pp, Protokoll der Sektion Basel 1939–1943. PA 1245a Archiv Dr. iur. Ruth Speiser F 3 (1) 3 Felix Speiser-Merian: Autobiographischer Text 1948. F 5 (1) 1 Felix Speiser-Merian: Briefe, Postkarten, Gedichte 1927–1944. PD-REG 3a Polizeidepartement 1: Personen- und Sachdossiers der Fremdenpolizei (1912–1998), 21430. PD-REG 5a 2 5314, 1951–1958, Dossier Elsa Mahler des Spezialdienstes des Basler Polizei-Inspektorats. PD-REG 5a 3–1–2, Fichen zu Konrad Farner. PD-REG 5a 3–1–2, Fichen zu Elsa Mahler. PD-REG 5a 3–1–2, Fichen zu Heinrich Meng. PD-REG 5a 3–7–16, Fichen zu Jakob Wackernagel. PD-REG 5a 3–7–18, Fiche zur Deutschen Studentengruppe. PD-REG 5a 8–1–2–3, 1945–1947 Materialien zum Bericht des Regierungsrates über Abwehr staatsfeindlicher Umtriebe in den Vorkriegs- und Kriegsjahren sowie die Säuberungsaktion nach Kriegsschluss vom 4. Juli 1946. Polizeidepartement des Kantons Basel-Stadt, Polizei-Inspektorat, Spezialdienst: Bericht betr. Publikation der Namenslisten nationalsozialistischer und frontistischer Organisationen. Protokolle S 4 Erziehungsrat Band 21, 1931–1932. Band 22, 1932–1934. Band 23, 1934–1936. Band 24, 1936–1938. Band 25, 1938–1940.
Unpublizierte Dokumente
765
Band 26, 1940–1942. Band 27, 1942–1944. Band 28, 1944–1947. Protokolle T 2 Kuratel der Universität Band 12, 1930–1935. Band 13, 1935–1941. Band 14, 1941–1943. Sammlung biographischer Zeitungsausschnitte. UA AA 2 Lektionskataloge Vorlesungsverzeichnisse. UA Bücher B 1 XIII Acta et Decreta Academiae Basiliensis 1922–1933 (Protokolle der Regenz). UA Bücher B 1 XIV Acta et Decreta 1934–1959 (Protokolle der Regenz). UA Bücher O 2b Protokollbuch der Theologischen Fakultät 1924–1946. UA Bücher P 4 Acta et Decreta Collegii Jurisconsultorum (Protokoll der Juristischen Fakultät) 1936–1944. UA Bücher Q 2 Protokoll der Medizinischen Fakultät 1933–1945. UA Bücher R 3a, 3 Protokoll der Philologisch-Historischen Abteilung der Philosophischen Fakultät, ab 1937 der Philosophisch-Historischen Fakultät, 1930–1948. UA V 30a 2 Studenten: Vereinigung der Amerikanischen Studierenden 1934. UA V 30a 3 Studenten: Antifaschistische Studentengruppe 1934–1935. UA V 30a 7 Studenten: Deutsche Studentenschaft. UA V 30a 13 Studenten: Jordania. UA V 30a 14 Studenten: Verein jüdischer Studierender. UA V 30a 17 Studenten: Marxistische Studentengruppe 1930–1937. UA V 30a 18 Studenten: Nationale Front Hochschulgruppe 1933. UA V 30a 19 Studenten: Opposition der Deutschen Studentenschaft 1937–1938. UA V 30a 25 Studenten: Volksbund, Hochschulgruppe 1933–1940. UA V 32 4 Studenten: Studentenschaft, Gemeinstudentische Einrichtungen, Studentenhilfe. UA V 32 6 Studenten: Delegiertenconvent der farbentragenden Verbindungen (D.C.) 1922–1945–1949. Protokollbuch des Delegiertenconvents der Universität Basel. UA VIII 5, 3 Karl Goetz.
766
Bibliographie UA VIII 5, 3 Karl-Ludwig Schmidt. UA VIII 11, 2 n Stiftungsprofessuren: Adolf Köberle. UA IX 3, 3 1 Arthur Baumgarten. UA XI 2, 17 Kunsthistorisches Seminar 1910–1943. UA XI 3, 3 15 Albert Béguin. UA XI 3, 3 82 Arminio Janner. UA XI 3, 3 110 Karl Meuli. UA XI 3, 3 140 Arnold von Salis. UA XI A 3, 2 Fritz Jaeger. UA XI A 3, 2 Wilhelm Matthies. UNI-REG 4a 133 Kunsthistorisches Seminar 1946–1977. UNI-REG 5d 2–1 (1) 91 Harald Fuchs. UNI-REG 5d 2–1 (1) 94 Joseph Gantner. UNI-REG 5d 2–1 (1) 145 Paul Huber. UNI-REG 5d 2–1 (1) 176 Werner Kuhn. UNI-REG 5d 2–1 (1) 223 Karl Meuli. UNI-REG 5d 2–1 (1) 299 Edgar Salin. UNI-REG 5d 2–1 (1) 375 Peter von der Mühll. UNI-REG 5d 2–1 (1) 379 Walther von Wartburg. UNI-REG 5d 2–1 (1) 385 Jacob Wackernagel (Jur.). UNI-REG 5d 2–1 (1) 408 Bernhard Wyss.
Stadtarchiv Freiburg i. Br. C4/X/19/10, Kunst und Wissenschaft, Alemannisches Institut. Universitätsarchiv Freiburg i. Br. B0001 132, 1936 Generalia, Feierlichkeiten, 550-Jahrfeier der Universität Heidelberg. B0001 133, 1937 Generalia, Feierlichkeiten, Jubiläen, 400-Jahrfeier der Universität Lausanne. B0001 215, 1936 Generalia, Feierlichkeiten, Einladungen zu Versammlungen, Feierlichkeiten usw. B0001 317, Ohne Umschlagtitel, Inhalt: Treffen der Professoren Basel-Freiburg, ab 1924. Universitätsarchiv Göttingen Kur. 0257 Ceremonialsachen Jubiläumskorrespondenz (1937) VIII. 47. II. V. 1/6. 37.
Unpublizierte Dokumente
767
Unsignierter Bestand Jubiläum 1937. Universitätsarchiv Heidelberg B-1812/31, X, 2 Nr. 63. B-1812/42, X, 1 Nr. 114a. B-1812/45, X, 1, Nr. 37. B-1812/62, X, 1, Nr. 54. B-1812/106, X, 1, Nr. 98. UR 14, X, 1, Nr. 67. UR 74, X, 1, Nr. 39. UR 81, X, 1, Nr. 75. Universitätsarchiv Leipzig PA 0667 Alwin Kuhn. PA 1029 Walther von Wartburg. PA-SG 0444 Walther von Wartburg. Phil. Fak. A 03/30 Bd. 3. Phil. Fak. B 02/20:02 (Film 1312). Phil. Fak. B 02/20a. RA 1341 Rentenamt Rechnungsangelegenheiten des Seminars für Ro[manische] Sprachen und Literatur. Universitätsarchiv Zürich Dekanats- und Rektoratsakten AB.1.0839. Universitätsbibliothek Basel, Handschriften G V 1, 34 Autographensammlung. Mscr. L IV 13 Beilagen, Festschrift Hans Erlenmeyer zum 60. Geburtstag 1960. Nachlass Walther von Wartburg, Akzess-Nummer 04/02H, IV:1; IV:2; IV:3; V:6,1. NL 45 Nachlass Karl Meuli. NL 48 Nachlass Walter Muschg Findbuch zum Nachlass Walter Muschg gescannt im Dezember 2008, https:// ub.unibas.ch/digi/a100/kataloge/nachlassverzeichnisse/IBB_5_000010635_cat.pdf. NL 55 Nachlass Ernst Pfuhl. NL 72 Nachlass Felix Stähelin. NL 91 Nachlass Werner Weisbach. NL 95 Nachlass Heinrich Wölfflin.
768
Bibliographie NL 106 Nachlass Herman Schmalenbach. NL 108 Nachlass Heinrich Barth, B 43. NL 110 Nachlass Carl Jacob Burckhardt. NL 114 Nachlass Edgar Salin. NL 119 Nachlass Paul Häberlin. NL 124 Nachlass Ernst Staehelin. NL 288 Nachlass Joseph Gantner. NL 298 Nachlass Werner Kuhn. NL 320 Nachlass Karl Schefold. NL 345 Nachlass Adolf Portmann. Ohne Signatur Archiv des Schwabe-Verlags Basel.
10.2 Literatur und publizierte Quellentexte 550 Jahre Universität Basel (2010): unigeschichte.unibas.ch – das online-Projekt zu 550 Jahre Universität Basel, https://unigeschichte.unibas.ch/. Abendroth, Wolfgang (1981): Ein Leben in der Arbeiterbewegung. Gespräche, aufgezeichnet von Barbara Dietrich und Joachim Perels, Frankfurt a. M.: edition suhrkamp. Abetel-Béguelin, Fabienne (2009): Franck Olivier, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/text es/f/F42643.php. Ackermann, Bruno (1996): «Albert Béguin face à la montée des périls. Premières impressions de l’Allemagne 1930–1934», in: Alain Clavien/Bertrand Müller, Le goût de l’histoire des idées et des hommes, Lausanne: l’Aire, 153–182. Ackermann, Paul R. (1936/37): «Soziale Gerechtigkeit», in: Zentralblatt, 435–437. Adam, Leonhard (1950): «In Memoriam Felix Speiser», in: Oceania 21, No. 1, 66–72. Aemmer, Fritz u. a. (1992): Geschichte der Kerntechnik in der Schweiz. Die ersten 30 Jahre 1939–1969, hg. von der Schweizerischen Gesellschaft für Kernfachleute, o. O.: Olynthus. Aerne, Peter (2013): Eberhard Vischer, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D10894.php. Aerne, Peter (2014): Wilhelm Vischer, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D10896.php. Affolter, Claudio (1996): Neues Bauen im Kanton Aargau, 1920–1940, hg. vom Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Verein Sektion Aargau, Baden: Lars Müller. Albrecht, Andrea/Lutz Danneberg/Ralf Klausnitzer/Kristina Mateescu (Hg.) (2020): ‚Zwischenvölkische Aussprache‘. Internationaler Austausch in wissenschaftlichen Zeitschriften 1933–1945, Berlin/Boston: de Gruyter Oldenbourg.
Literatur und publizierte Quellentexte
769
Albrecht, Andrea/Ralf Klausnitzer (2020): «‚Trotz mancher Schwierigkeiten‘. Zu den Auslandsreisen deutscher Geisteswissenschaftler zwischen 1933 und 1945», in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 43, 48–73. Alemannisches Institut Freiburg i. Br. e. V. (Hg.) (2006): Das Alemannische Institut. 75 Jahre grenzüberschreitende Kommunikation und Forschung (1931–2006), Freiburg/München: Karl Alber. Altermatt, Urs (Hg.) (1993): Den Riesenkampf mit dieser Zeit wagen … Schweizerischer Studentenverein 1841–1991, Luzern: Maihof. Altermatt, Urs (2009): Die Universität Freiburg auf der Suche nach Identität. Essays zur Kultur- und Sozialgeschichte der Universität Freiburg im 19. und 20. Jahrhundert, Freiburg i. Ü.: Academic Press Fribourg/Paulusverlag Freiburg Schweiz. Altermatt, Urs/Christina Späti (2009): Die zweisprachige Universität Freiburg. Geschichte, Konzepte und Umsetzung der Zweisprachigkeit 1889–2006, Freiburg i. Ü.: Academic Press Fribourg. Altwegg, Wilhelm (1950): «Zum Hinschied von Friedrich Ranke», SA aus: Schweizerisches Archiv für Volkskunde 46, H. 3–4, 195–202. Amelung, Peter (1976): Albert Béguin 1901–1957. Ein Schriftsteller im Zeitgeschehen. Ausstellung in der Württembergischen Landesbibliothek, Stuttgart: Württembergische Landesbibliothek. Ammann, Max (1954): Die ‚Evangelische Politik‘ des Basler Historikers Hermann Bächtold (1882–1934), Affoltern a. A.: Weiss. Ammann, Ruth (2012): Walter Strub, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/028320/ 2012-07-02/. Amrein, Ursula (2001): «Diskurs der Mitte. Antimoderne Dichtungstheorien in der Schweizer Germanistik vor und nach 1945», in: Caduff/Gamper 2001, 43–64. Anderson, Dennis Le Roy (1982): The Academy for German Law, 1933–1944, Ann Arbor, Michigan: Dissertation. Angehrn, Emil/Wolfgang Rother (Hg.) (2011): Philosophie in Basel. Prominente Denker des 19. und 20. Jahrhunderts, Basel: Schwabe. Anonym (o. J.): «Elsa Mahler: Die erste Professorin der Universität Basel und Gründerin des Slavischen Seminars», verfügbar unter: https://slavistik.philhist.unibas.ch/de/fach bereich/seminargeschichte/elsa-mahler/. Anonym (1937): «Die Bestattung von Professor C. A. Bernoulli», in: Basler Nachrichten vom 16. 2. 1937. Anonym (1937/38): «Voraussetzungen des deutschen Kirchenkampfes», in: Zentralblatt, 143–149. Anonym (1938/39): «Rapport sur la discussion centrale du semestre d’été 1939: ‚Conditions de l’autorité de l’Etat‘», in: Zentralblatt, 502–506. Anonym (1940/41): «Les étudiants de la Ligue Vaudoise: La Ligue Vaudoise aux étudiants, aux gymnasiens et aux normaliens», in: Zentralblatt, 187–191. Anonym (1941): «Die Neubesetzung des Lehrstuhls für anorganische Chemie», in: Basler Nachrichten, 19. April 1941. Anonym (1944): «Zum Tode von Professor Karl Goetz», in: Basler Nachrichten vom 22. Mai 1944.
770
Bibliographie
Anonym (1944a): «Pfarrer Dr. Jakob Wirz †», in: National-Zeitung vom 25. Januar 1944. Anynom (1944b): «† Pfarrer D. Jakob Wirz», in: Basler Nachrichten vom 24. Januar 1944. Anonym (1944c): «Der neue Ordinarius für Mathematik an der Basler Universität» (Andreas Speiser), in: Basler Nachrichten vom 13. 6. 1944. Anonym (1945): «Der neue Ordinarius für Botanik», in: National-Zeitung, 18. Juli 1945. Anonym (1945/46): «Nachruf auf Gustav Senn», in: Basler Studentenschaft WS 1945/46, H. 1, Oktober 1945, 1 f. Anonym (1946): «Prof. Dr. Th. Niethammer 70 Jahre alt», in: Basler Nachrichten vom 1. April 1946. Anonym (1946a): «Martin Knapp zum 70. Geburtstag», in: National-Zeitung vom 22. Mai 1946. Anonym (1947): «Die Abdankungsfeier für Prof. Dr. Rudolf Liechtenhan», in: Basler Nachrichten vom 2. Dezember 1947. Anonym (1947a): «Professor Dr. Th. Niethammer †», in: National-Zeitung vom 30. Juli 1947. Anonym (1949): «Zum Tode von Prof. Ludwig Zehnder», in: Basler Nachrichten vom 26./ 27. März 1949. Anonym (1950): «Prof. Wilhelm Vischer zum sechzigsten Geburtstag», in: Basler Nachrichten vom 4. Januar 1950. Anonym (1950a): «Professor Walther Eichrodt zum 60. Geburtstag», in: Basler Nachrichten vom 31. Juli 1950. Anonym (1951): «Abschied von Professor Dr. Hans Rupe», in: National-Zeitung vom 16. Januar 1951. Anonym (1952): «Abschied von Professor Dr. Wilhelm Merian», in: Basler Nachrichten vom 19. November 1952. Anonym (1955): «Professor Dr. Wilhelm Vischer zum 60. Geburtstag», in: Basler Nachrichten vom 1. Mai 1955. Anonym (1956): «Zum Rücktritt von Prof. Dr. W. Lutz», in: National-Zeitung vom 2. 10. 1956. Anonym (1958): «Nachruf auf Ernst Merian-Genast», in: Sprachspiegel 14, September/ Oktober 1958, Nr. 5, 129 f. Anonym (1960): «Zum Tode von Professor Hermann O. L. Fischer», in: Basler Nachrichten vom 17. März 1960. Anonym (1961): «Nachruf auf Dietrich Barth», in: Basler Nachrichten vom 21. August 1961. Anonym (1962) «Prof. Dr. Fritz Lieb zum 70. Geburtstag», in: National-Zeitung vom 10. Juni 1962. Anonym (1963): «Einem Auslandbasler zum siebzigsten Geburtstag», in: Basler Nachrichten vom 22. März 1963. Anonym (1965): «Professor Dr. Joos Cadisch zum 70. Geburtstag», in: Basler Nachrichten vom 1. September 1965. Anonym (1965a): «Professor Ernst Zwinggi 60jährig», in: Basler Nachrichten vom 21./ 22. August 1965.
Literatur und publizierte Quellentexte
771
Anonym (1971): «Prof. Dr. Ernst Zwinggi zum Gedenken», in: National-Zeitung vom 14. Juli 1971. Anonym (1974): «Nachruf auf Hubert Bloch», in: Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, Wissenschaftlicher und administrativer Teil 154, 237. Anonym (1984): «Die Geschichte der studentischen Organisationen», in: Scandola 1984, 441–494. Anonym (2004): «Das grosse Ja», in: NZZ vom 11. September 2004, verfügbar unter: https://www.nzz.ch/article9TPKC-1.305397. Anonym (La rédaction) (2005): Eddy Bauer, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/ 031456/2005-11-15/. Anonym (2007): Art. Landmann, Georg Peter Wolfgang, in: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 15, hg. von Archiv Bibliographica Judaica, München: Saur, 76–81. Anonym (2010): «Die Anfänge der Basler Studentenschaft», in: unigeschichte.unibas.ch – das online-Projekt zu 550 Jahre Universität Basel, https://unigeschichte.unibas.ch/ akteure/studentenschaft/die-anfaenge-der-basler-studentenschaft. Anonym (2010a): «Die Beteiligung der Universität Basel am Schweizer Atomprogramm», in: unigeschichte.unibas.ch – das online-Projekt zu 550 Jahre Universität Basel, https://unigeschichte.unibas.ch/fileadmin/user_upload/pdf/Atomreaktor_in_Basel_ Final.pdf. Anonym (2010b): «Paul Häberlin (1878–1960)», in: unigeschichte.unibas.ch – das onlineProjekt zu 550 Jahre Universität Basel, https://unigeschichte.unibas.ch/fakultaetenund-faecher/philhist-fakultaet/philosophie/paul-haeberlin. Anonym (2021): «Kurt Fritz Konrad Wagner», in: Hessische Biografie, https://www.lagishessen.de/pnd/117102997. Ansprachen (1944) gehalten an der Trauerfeier für Professor Dr. iur. Robert Haab geboren den 1. Mai 1893 gestorben den 28. Januar 1944 am Montag, den 31. Januar 1944 in der Martinskirche zu Basel und am Dienstag, den 1. Februar 1944 in der Kapelle des Friedhofes Manegg zu Zürich, Privatdruck o. O., o. J. Apel, Hans Jürgen/Stefan Bittner (1994): Humanistische Schulbildung 1890–1945. Anspruch und Wirklichkeit der altertumskundlichen Unterrichtsfächer. Köln u. a.: Böhlau Verlag. Arber, Catherine (2003): «Frontismus und Nationalsozialismus in der Stadt Bern. Viel Lärm, aber wenig Erfolg», in: Berner Zeitschrift für Geschichte 65, 1/3, 2–62, verfügbar unter: http://www.bezg.ch/img/publikation/03_1/arber.pdf. Armistead, Samuel G. (1997): «Américo Castro in the United States (1937–1969)», in: Hispania 80, 271–274. Aschwanden, Erich (2020): «Ab an die Ostfront: Schweizer Ärzte pflegen Hitlers verwundete Soldaten», in: NZZ vom 11. Februar 2020, verfügbar unter: https://www.nzz.ch/ schweiz/schweizer-aerzte-pflegten-an-der-ostfront-hitlers-verwundete-soldaten-ld. 1537012?reduced=true. Ash, Mitchell G. (2002): «Wissenschaft und Politik als Ressourcen für einander», in: Rüdiger vom Bruch (Hg.), Wissenschaften und Wissenschaftspolitik – Bestandaufnahmen zu Formationen, Brüchen und Kontinuitäten im Deutschland des 20. Jahrhunderts. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 32–51.
772
Bibliographie
Aurnhammer, Achim (1987): «Stefan George und Hölderlin», in: Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte 81, 81–99. Aurnhammer, Achim u. a. (Hg.) (2015): Stefan George und sein Kreis, ein Handbuch. Berlin: de Gruyter (1. Aufl. 2012). Baab, Florian (2013): Was ist Humanismus? Geschichte des Begriffes, Gegenkonzepte, säkulare Humanismen heute. Regensburg: Friedrich Pustet. Badalin, Klaudija u. a. (2004/5): «Kunstgeschichte im Nationalsozialismus 1933–1946», in: Karlsruher Institut für Technologie. Eine Dokumentation zur Lehr- und Forschungstätigkeit an kunstgeschichtlichen Universitätsinstituten in Deutschland in den Jahren 1933 bis 1945. Zusammengestellt im WS 2000/01 von Klaudija Badalin, Sibel Cakmakoglu, Oya Dobruca, Sandra Eberle, Gabriele Frank, Yuriko Ono, Claudia Schuler, Xudong Wu und Magdalena Zak, bearbeitet und ergänzt von Felix Fischborn, Christian Gräf, Ingo Harter, Julia Junkert und Simone Schweers im SS 2004 und WS 2004/05 unter der Leitung von Martin Papenbrock. Ehemals verfügbar unter: http://kg.ikb.kit.edu/263.php, konsultiert am 14. November 2017. Bader, Karl Siegfried (1983): «Unterricht und Dozenten [der Rechtswissenschaft]», in: Stadler 1983, 275–280. Bächi, Beat (2005): «‚Rein schweizerisches‘ Vitamin C aus Basel. Zur Kulturgeschichte einer soziotechnischen Innovation», in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 105, 79–113. Bächi, Beat (2007): Künstliches Vitamin C. Roche und die Politik eines chemischen Körpers (1933–1954). Zürich: Diss. ETH Zürich. Bächi, Beat (2007a): Tadeus Reichstein, in: Deutsche Biographische Enzyklopädie (2., überarbeitete und erweiterte Ausgabe), hg. v. Rudolf Vierhaus, Bd. 8. München: Saur, 270. Bächtold, Hans Ulrich (2008): Walther Köhler, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/ d/D27078.php. Baertschi, Christian (2010): Jakob Seiler, in HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D44459.php. Baertschi, Christian (2012): Felix Speiser, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D28945.php. Baertschi, Christian (2012a): Rudolf Stamm, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 042220/2012-02-27/. Bair, Deirdre (2004): Jung, a Biography. London: Littler, Brown. Baldinger, Ernst (1956): «Nekrolog Hans Zickendraht», in: Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel 67, 595–599. Baldinger, Kurt (Hg.) (1971): Walther von Wartburg 1888–1971. Beiträge zu Leben und Werk, nebst einem vollständigen Schriftenverzeichnis. Tübingen: Niemeyer. Baldinger, Kurt (1994): «Georges Straka», in: Zeitschrift für romanische Philologie 110, 803–810. Balmer, Heinz (2010): Fritz Nussbaum, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/032093/ 2010-09-14/. Ballmer, Karl (2006): Ehrung des Philosophen Herman Schmalenbach (1950/51). Siegen/ Sancey Le Grand: Edition LGC.
Literatur und publizierte Quellentexte
773
Balsiger, Max Ulrich (2003): Fritz Buri, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D10558.php. Balthasar, Hans Urs von (1998): Apokalypse der deutschen Seele. Studien zu einer Lehre von letzten Haltungen. Einsiedeln: Johannes Verlag. Bandle, Oskar (1989): «Andreas Heusler und die Universität Basel», in: Heusler 1989, 25– 39. Barth, Christoph (1941/42): «Noch einmal: Unsere Pflicht», in: Zentralblatt, 203–208. Barth, Christoph (1941/42a): «Dem Vaterland zuliebe?», in: Zentralblatt, 573–575. Barth, Dietrich (1932/33): «Macht mir den rechten Flügel stark! Eine ketzerische Interpretation der Devise Patria», in: Zentralblatt, 440–448. Barth, Dietrich (1935/36): «Auf dem Weg zur schweizerischen Erneuerung», in: Zentralblatt, 484–488. Barth, Dietrich (1935/36a): «Das Zentralblatt als Zofingerspiegel», Zentralblatt, 700–703. Barth, Dietrich (1940): Die protestantisch-konservative Partei in Genf in den Jahren 1838 bis 1846. Basel: Helbing & Lichtenhahn. Barth, Dietrich/Max Burckhardt/Olof Gigon (Bearb.) (1935): Der Schweizerische Zofingerverein 1819–1935. Basel: Helbing & Lichtenhahn. Barth, Fredrik/Andre Gingrich/Robert Parkin/Sydel Silverman (2005): One Discipline, Four Ways. British, German, French, and American Anthropology. Chicago/London: University of Chicago Press. Barth, Heinrich (1931): Das Problem des Bösen. Akademischer Vortrag. Basel: Helbing & Lichtenhahn. Barth, Heinrich (1935): Die Freiheit der Entscheidung im Denken Augustins. Basel: Helbing & Lichtenhahn. Barth, Heinrich (1938): «Menschenrechte im Lichte der Geistesgeschichte. Vortrag gehalten in der Philosophischen Gesellschaft in Zürich, als historische Einleitung zu einer Folge von Vorträgen über Rechtsphilosophie», in: Philosophia 3, 419–443. Barth, Heinrich (1938a): Zur Neubesinnung über Ziele, Grundlagen und Möglichkeiten unserer Schulbildung. Vortrag gehalten an der Jahresversammlung der Staatlichen Schulsynode des Kantons Basel-Stadt am 3. Dezember 1937. Basel: Helbing & Lichtenhahn. Barth, Heinrich (1941): Volksherrschaft und Gottesherrschaft. Vortrag gehalten im Positiven Gemeindeverein St. Elisabethen-Gundeldingen am 19. Januar 1941 (Kriegszeit und Gotteswort 20). Basel: Verlag Evangelische Buchhandlung. Barth, Heinrich (1941a): Der Sinn der Demokratie. Vortrag. Basel: Helbing & Lichtenhahn. Barth, Heinrich (1941b): Der Schweizer und sein Staat. Vortrag gehalten in der Ortsgruppe Basel der Neuen Helvetischen Gesellschaft am 21. November 1940. Basel: Helbing & Lichtenhahn. Barth, Heinrich (1943): Grundlagen der Gemeinschaft. Fragen und Antworten eines Schweizers. Winterthur: Verlag der Buchdruckerei Winterthur AG. Barth, Heinrich (1965): Heinrich Barth Professor der Philosophie in Basel, 3. Februar 1890 bis 22. Mai 1965 (Privatdruck).
774
Bibliographie
Barth, Karl (1996): Predigten 1935–1952, hg. von Hartmut Spieker und Hinrich Stoevesandt. Zürich: Theologischer Verlag (Gesamtausgabe I. Predigten). Barth, Karl (2001): Offene Briefe 1935–1942, hg. von Dieter Koch. Zürich: Theologischer Verlag (Gesamtausgabe V. Briefe). Barth, Karl/Rudolf Bultmann (1971): Briefwechsel, hg. von Bernd Jaspert. Zürich: Theologischer Verlag. Barth, Karl/Eduard Thurneysen (2000): Briefwechsel, Bd. 3, 1930–1935, einschliesslich des Briefwechsels zwischen Charlotte von Kirschbaum und Eduard Thurneysen, hg. von Caren Algner. Zürich: Theologischer Verlag (Gesamtausgabe V. Briefe). Barth, Sebastian (Friedrich?) (1941/42): «Demokratie und Flüchtlingsfrage», in: Zenralblatt, 664–666. Barthélemy, Dominique, OP (1991): «Les rhythmes d’un développement», in: Ruffieux 1991, 141–230. Basler Studentenschaft. Mitteilungsblatt der Basler Studentenschaft, 1932–1947. Bauer, Kurt (2016): «Schlagring Nr. 1. Antisemitische Gewalt an der Universität Wien von den 1870er- bis in die 1930er-Jahre», in: Regina Fritz/Grzegorz Rossolinski-Liebe/ Jana Starek (Hg.): Alma Mater Antisemitica. Akademisches Milieu, Juden und Antisemitismus an den Universitäten Europas zwischen 1918 und 1939, Wien: new academic press, 137–160. Baumann, Sarah (o. J.): Schweizer Monatshefte. Collaborateurs, in: Dictionnaire des revues culturelles suisses, ehemals verfügbar unter: http://www.unifr.ch/grhic/revues/ index.php, konsultiert am 8. August 2018, Neubearbeitung geplant: http://revuescul turelles.ch/fiches/revue/. Baumeister, Miriam (o .J.): Fritz Brechbühl, in: Personenlexikon des Kantons Basel-Landschaft, https://personenlexikon.bl.ch/Fritz_Brechb%C3%BChl. Baumeister, Miriam (o .J.): Fritz Meier, in: Personenlexikon des Kantons Basel-Landschaft, https://personenlexikon.bl.ch/Fritz_Meier. Baumeister, Miriam (o. J.): Hans Annaheim, in: Personenlexikon des Kantons Basel-Landschaft, https://personenlexikon.bl.ch/Hans_Annaheim. Baumer, Christoph (1998): Die ‚Renaissance‘. Verband Schweizerischer Katholischer Akademiker-Gesellschaften 1904–1996. Freiburg i. Ü.: Universitäts-Verlag. Baumgarten, Arthur (1944): Professor Dr. Arthur Baumgarten zu seinem 60. Geburtstag. Basel: Friedrich Reinhardt AG (PdA Schriftenreihe Nr. 1, hg. vom Bildungsausschuss der Partei der Arbeit Basel-Stadt). Baumgarten, Arthur (1972): Rechtsphilosophie auf dem Wege. Vorträge und Aufsätze aus fünf Jahrzehnten, hg. von Helene Baumgarten, Gerd Irrlitz und Hermann Klenner. Glashütten am Taunus: Detlev Auvermann (Lizenzausgabe Akademie-Verlag Berlin). Baumgartner, Eugen (1971): «Paul Huber 1910–1971», in: Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, Wissenschaftlicher und administrativer Teil, 151, 237–247. Baumgartner, Eugen (1972): «Prof. Dr. sc. nat. Paul Huber (1. Oktober 1910 bis 5. Februar 1971)», in: Basler Stadtbuch 1972, 89–92.
Literatur und publizierte Quellentexte
775
Bautz, Friedrich Wilhelm (2005): Adolf Köberle, in: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon 24, 953–963. Beaucamp, Eduard (1982): «Die Frankfurter Kunstschule in den zwanziger Jahren», in: Verein 1982, 63–82. Becherer, Alfred (1945): «Gustav Senn 1875–1945», in: Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 125, 374–380. Bechstedt, Anne/Anja Deutsch/Daniela Stöppel (2008): Der Verlag F. Bruckmann im Nationalsozialismus, in: Heftrig u. a. 2008, 280–311. Beck, Heinrich (1989): «Andreas Heusler und die Erforschung des germanischen Altertums», in: Heusler 1989, 9-24. Becker, Hans-Jürgen (1995): «Neuheidentum und Rechtsgeschichte», in: Joachim Rückert/Dietmar Willoweit (Hg.): Die deutsche Rechtsgeschichte in der NS-Zeit. Ihre Vorgeschichte und ihre Nachwirkungen, Tübingen: Mohr, 7–30. Becker, Heinrich u. a. (Hg.) (1998): Die Universität Göttingen unter dem Nationalsozialismus. München: Saur. Béguin, Albert (1933): «Keyserling et la jeunesse allemande», in: Présence 1, o. S. Béguin, Albert (1940): «Confessions d’un germaniste», in: Cahiers du Sud. Poésie, critique, philosophie 27, avril 1940, 251–257. Béguin, Albert (1940a): «L’Allemagne et l’Europe», in: Esprit, juin 1940, 241–251. Béguin, Albert (1946): Faiblesse de l’Allemagne. Paris: José Corti. Béguin, Albert (1973): Création et destinée. Essais de critique littéraire; choix de textes et notes par Pierre Grotzer. Paris: du Seuil. Béguin, Albert u. a. (1944): Le livre noir du Vercors. Précédé d’un poème de Pierre Emmanuel. Neuchâtel: Ides et Calendes. Béguin, Albert/Marcel Raymond (1976): Lettres 1920–1957. Choix, présentation et notes de Gilbert Guisan. Lausanne/Paris: La Bibliothèque des Arts. Beintker, Michael/Christian Link/Michael Trowitzsch (Hg.) (2010): Karl Barth im europäischen Zeitgeschehen (1935–1950). Widerstand – Bewährung – Orientierung. Beiträge zum Internationalen Symposion vom 1. bis 4. Mai 2008 in der Johannes a Lasco Bibliothek Emden. Zürich: Theologischer Verlag. Below, Karl-Heinz (1985): Hans Lewald, in: Neue Deutsche Biographie 14, 411 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118572407.html#ndbcontent. Bendemann, Reinhard von (2007): Heinrich Schlier, in: Neue Deutsche Biographie 23, 88 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118608231.html#ndb content. Benninger, Marc Albert (2001): Béguin et l’Allemagne. Un germaniste suisse confronté au nazisme (1935–1950). Fribourg: Mémoire de licence, Faculté des Lettres, Université de Fribourg (unveröff.). Berger, Frédéric (2019): «Emil Heitz, a True Epigenetics Pioneer», in: Nature Reviews Molecular Cell Biology 20, 572. Berger, Sandra (2016): Paul Ganz und die Kunst der Schweiz. Eine Biografie. Bielefeld: transcript. Berger, Silvia (2009): Bakterien in Krieg und Frieden. Eine Geschichte der medizinischen Bakteriologie in Deutschland 1890–1933. Göttingen: Wallstein.
776
Bibliographie
Berger, Silvia (2010): ‚Sie hätten in ein grosses Institut hineingehört‘ – Robert Doerr und der Boom der Basler Hygiene, verfügbar unter: https://unigeschichte.unibas.ch/filead min/user_upload/pdf/Berger_DoerrBaslerHygiene.pdf. Bergès, Michel (1997): Vichy contre Mounier. Les non-conformistes face aux années 40. Paris: Economica. Bernhard, Michael (2001): Der Pädiater Ernst Freudenberg 1884–1967. Marburg: Tectum. Bernoulli, Carl Albrecht (1935): «Zum siebzigsten Geburtstag von Prof. theol. Eberhard Vischer», in: National-Zeitung vom 27. Mai 1935. Bernoulli, Eva (1987): Erinnerungen an meinen Vater Carl Albrecht Bernoulli 1868–1937. Basel: Gute Schriften. Bertrand, Louis (1913): Saint Augustin, Paris: Fayard. Bessenich, Wolfgang (1988): «Im Einzelfall das Generelle sehen. Zum Tode des Kunsthistorikers Joseph Gantner», in: Basler Zeitung vom 11. April 1988. Beushausen, Ulrich u. a. (1998): «Die Medizinische Fakultät im Dritten Reich», in: Heinrich Becker/Hans-Joachim Dahms/Cornelia Wegeler (Hg.): Die Universität Göttingen unter dem Nationalsozialismus, 2. Aufl., München: Saur, 183–285. Bialas, Wolfgang/Anson Rabinbach (Hg.) (2007): Nazi Germany and the Humanities. Oxford: Oneworld. Bickel, Marcel H. (2005): Ernst Rothlin, in: Neue Deutsche Biographie 22, 126, verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd128045949.html#ndbcontent. Bickel, Marcel H. (2010): Tadeusz Reichstein, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D14611.php. Bigger, Andreas (2015): Rudolf Tschudi, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/044649/ 2015-11-18/. Binswanger, Ludwig (2005): Aby Warburg. La guarigione infinita. Storia clinica di Aby Warburg. A cura di Davide Stimilli. Vicenza: Neri Pozza. Birkhäuser, Kaspar (Bearb.) (1997): Das Personenlexikon des Kantons Basel-Landschaft. Liestal: Verlag des Kantons Basel-Landschaft, verfügbar unter: https://personenlexi kon.bl.ch/. Björkman, Maria/Patrik Lundell/Sven Widmalm (Hg.) (2019): Intellectual Collaboration with the Third Reich. Treason or Reason? London/New York: Routledge. Björkman, Maria/Patrik Lundell/Sven Widmalm (2019a): «Collaboration and Normalization», in: Björkman/Lundell/Widmalm 2019, 1–20. Blasberg, Cornelia (Hg.) (1988): Karl Wolfskehls Briefwechsel aus Neuseeland 1938–1948, mit einem Vorwort von Paul Hoffmann. Darmstadt: Luchterhand Literaturverlag. Blasberg, Cornelia (Hg.) (1993): Karl Wolfskehls Briefwechsel aus Italien 1933–1938. Hamburg: Luchterhand Literaturverlag. Blaser, Klauspeter (2002): Karl Barth, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D10517. php. Blaser, Klauspeter (2015): Dialektische Theologie, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/text es/d/D11428.php. Bleuler, E./R. M. Stellen (1960): «Kernspektrometrie», in: H. Frauenfelder/O. Huber/P. Stähelin (Hg.): Beiträge zur Entwicklung der Physik. Festgabe zum 70. Geburtstag von Professor Paul Scherrer, 3. Februar 1960. Basel/Stuttgart: Birkhäuser, 138–146.
Literatur und publizierte Quellentexte
777
Bloch, Hubert (1969): «Prof. Dr. phil. Hans Erlenmeyer 1900–1967», in: Basler Stadtbuch 1969, 37–40. Blubacher, Thomas (2005): Annette Brun, in: Andreas Kotte (Hg.): Theaterlexikon der Schweiz, Bd. 1. Zürich: Chronos, 278 f. Bochmann, Klaus (2009): «Romanistik, von den Anfängen bis 1945», in: Ulrich von Hehl/ Uwe John/Manfred Rudersdorf (Hg.): Geschichte der Universität Leipzig 1409– 2009, Bd. 4: Fakultäten, Institute, Zentrale Einrichtungen, 1. Halbband. Leipzig: Universitätsverlag, 632–651. Bock, Günter (1982): «Die Städelschule im Dritten Reich», in: Verein 1982, 102–115. Bockholdt, Rudolf (1966): Jacques Handschin, in: Neue Deutsche Biographie 7 (1966), 611 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd11896979X.html#ndb content. Boehm, F. (1960): «Der Betazerfall», in: H. Frauenfelder/O. Huber/P. Stähelin (Hg.): Beiträge zur Entwicklung der Physik. Festgabe zum 70. Geburtstag von Professor Paul Scherrer, 3. Februar 1960. Basel/Stuttgart: Birkhäuser, 126–137. Boehringer, Christoph (2002): «Herbert A. Cahn, Frankfurt am Main 28. Januar 1915 bis 4. April 2002 Basel», in: Commission Internationale de Numismatique, Compte rendu 49, 119–126. Boehringer, Robert (1935): Das Antlitz des Genius: Platon. Breslau: Hirt. Boehringer, Robert (1937): Das Antlitz des Genius: Homer. Breslau: Hirt. Bölsche, Wilhelm (1904/1905): Stammbaum der Tiere. Stuttgart: Franckh. Boerlin, Paul H. (1992): «Meuli als Lehrer. Erinnerungen eines ehemaligen Schülers des Humanistischen Gymnasiums», in: Graf 1992, 203–215. Böschenstein, Bernhard/Jürgen Egyptien/Bertram Schefold/Wolfgang Graf Vitzthum (Hg.) (2005): Wissenschaftler im George-Kreis. Die Welt des Dichters und der Beruf der Wissenschaft. Berlin/New York: de Gruyter. Bohde, Daniela (2008): «Kulturhistorische und ikonographische Ansätze in der Kunstgeschichte im Nationalsozialismus», in: Heftrig u. a. 2008, 189–204. Bohren, Rudolf (1982): Prophetie und Seelsorge: Eduard Thurneysen. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener. Boletzky, Sigurd von (1997): «Die Vielfalt lebender Formen und die Suche nach dem ‚natürlichen System‘», in: Anita Brinckmann-Voss/Pio Fioroni/Sigurd von Boletzky: Adolf Portmanns frühe Studien mariner Lebenwesen, Basel: Schwabe, 117–121. Boletzky, Sigurd von (1997a): «Portmanns meeresbiologische Arbeit nach 1950», in: Anita Brinckmann-Voss/Pio Fioroni/Sigurd von Boletzky: Adolf Portmanns frühe Studien mariner Lebenwesen, Basel: Schwabe, 123–125. Boletzky, Sigurd von (2006): «Adolf Portmann 1897–1982», in: Adolf Portmann, Lebensforschung und Tiergestalt. Ausgewählte Texte, hg. von David G. Senn. Basel: Schwabe, 11–20. Bollenbeck, Georg (2007): «The Humanities in Germany after 1933. Semantic Transformations and the Nazification of the Disciplines», in: Bialas/Rabinbach 2007, 1–20. Bollenbeck, Georg/Clemens Knobloch (Hg.) (2001): Semantischer Umbau der Geisteswissenschaften nach 1933 und 1945. Heidelberg: Winter.
778
Bibliographie
Bolliger, Claudia (2019): «Rudolf Tschudi und sein wissenschaftliches Netzwerk im Spiegel ausgewählter Briefe», in: Bolliger/Würsch 2019, 67–99. Bolliger, Claudia/Renate Würsch (Hg.) (2019): Blick auf den Orient. Vom Orientalischen Seminar zum Seminar für Nahoststudien der Universität Basel (1919–2019). Basel: Schwabe. Bomhoff, Hartmut (2015): Ernst Ludwig Ehrlich – prägende Jahre. Eine Biographie. Berlin/München/Boston: de Gruyter. Bonjour, Edgar (1960): Die Universität Basel von den Anfängen bis zur Gegenwart 1460– 1960. Basel: Helbing & Lichtenhahn. Bonjour, Edgar (1974): «Adolf Lukas Vischer 1884–1974», in: Basler Stadtbuch 1974, 242–246. Bonjour, Edgar (1984): Erinnerungen. Basel/Frankfurt: Helbing & Lichtenhahn. Bonjour, Edgar (1987): Freundesbriefe. Basel/Frankfurt: Helbing & Lichtenhahn. Bonjour, Edgar (1994): Karl Meuli, in: Neue Deutsche Biographie 17, 264 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118581635.html#ndbcontent. Boos, Roman (1915): Der europäische Krieg und unser Schweizer Krieg, Zürich: SDV. Borbein, Adolf H. (1995): «Die Klassik-Diskussion in der Klassischen Archäologie», in: Flashar 1995, 205–245. Bott, Marie-Luise (2005): «‚Deutsche Slavistik‘ in Berlin? Zum Slavischen Institut der Friedrich Wilhelms Universität 1933–1945», in: Rüdiger vom Bruch (Hg.): Die Berliner Universität in der NS-Zeit, Bd. 2: Fachbereiche und Fakultäten (unter Mitarbeit von Rebecca Schaarschmidt). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 277–298. Bourdieu, Pierre (1986): «Lʼillusion biographique», in: Actes de la recherche en sciences sociales 62, no. 1, 69–72. Bourdieu, Pierre (1992): Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire. Paris: du Seuil. Boyden, David D. (1956): «In Memoriam Manfred F. Bukofzer (1910–1955)», in: The Musical Quarterly 42, No. 3, 291–301. Brändle, Rudolf (2005): Oscar Cullmann, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D10572.php. Brandenburger, Otto (1932/33): «Zur Judenfrage», in: Zentralblatt, 546–557. Brands, Gunnar (2012): «Archäologen und die deutsche Vergangenheit», in: Brands/ Maischberger 2012, 1–34. Brands, Gunnar/Martin Maischberger (Hg.) (2012): Lebensbilder. Klassische Archäologen und der Nationalsozialismus, Bd. 1. Rahden: Leidorf. Brassel-Moser, Ruedi (2010): Eingabe der Zweihundert, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/ articles/017341/2010-05-07/. Brassel-Moser, Ruedi (2013): Volksbund für die Unabhängigkeit der Schweiz, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D45630.php. Braund, James/Douglas G. Sutton (2008): «The Case of Heinrich Wilhelm Poll (1877– 1939). A German-Jewish Geneticist, Eugenicist, Twin Researcher, and Victim of the Nazis», in: Journal of the History of Biology 41, 1–35. Bremi, Willy (1957): «Prof. Walter Baumgartner zum 70. Geburtstag», in: National-Zeitung vom 23./24. November 1957.
Literatur und publizierte Quellentexte
779
Brenk, Beat (1988): «Joseph Gantner zum Gedenken», in: uninova 50, 23. Brenner, Arthur D. (2001): Emil J. Gumbel, Weimar German Pacifist and Professor. Boston: Brill. Breuer, Stefan (2008): Die Völkischen in Deutschland. Kaiserreich und Weimarer Republik. Darmstadt: WBG. Breunung, Leonie/Manfred Walther (2012): Die Emigration deutschsprachiger Rechtswissenschaftler ab 1933. Ein bio-bibliographisches Handbuch, Bd. 1: Westeuropäische Staaten, Türkei, Palästina/Israel, lateinamerikanische Staaten, Südafrikanische Union. Berlin/Boston: de Gruyter. Bridel, Laurent (2015): Ernst Winkler, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/031713/ 2015-01-13/. Broda, May B. (2013): «East European Migration to Switzerland and the Formation of ‚New Women‘», in: Tamar Lewinsky/Sandrine Mayoraz (Hg.): East European Jews in Switzerland. Berlin: de Gruyter, 149–177. Broggini, Renata (1999): La frontiera della speranza. Gli ebrei dall’Italia verso la Svizzera, 1943–1945. Milano: A. Mondadori. Brogiato, Heinz Peter (2005): «Geschichte der deutschen Geographie im 19. und 20. Jahrhundert. Forschungsstand und methodische Ansätze», in: Winfried Schenk/Konrad Schliephake (Hg.): Allgemeine Geographie (Perthes Geographie-Kolleg). Gotha: Klett-Perthes, 41–81. Bron, Marie (2009): André Oltramare, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D6463. php. Bruch, Rüdiger vom/Brigitte Kaderas (Hg.) (2002): Wissenschaften und Wissenschaftspolitik. Bestandsaufnahme zu Formationen, Brüchen und Kontinuitäten im Deutschland des 20. Jahrhunderts. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. Brun, J. W./Dr. R. Colomb/A. Guillermet/J. Lescaze/Marcel Reymond/P. Robert (1933/34): «Zofingue et les problèmes de l’heure présente», in: Zentralblatt, 493–499. Bruns, Claudia (2008): Politik des Eros. Der Männerbund in Wissenschaft, Politik und Jugendkultur (1880–1934). Köln: Böhlau. Buchbinder, Sascha (2002): Der Wille zur Geschichte. Schweizergeschichte um 1900 – die Werke von Wilhelm Oechsli, Johannes Dierauer und Karl Dändliker. Zürich: Chronos. Bucher, André (2001): «Zur Rezeption der klassischen Moderne in der Schweizer Germanistik. Untersuchungen zu Ermatinger, Faesi, Muschg und Staiger», in: Caduff/Gamper 2001, 65–83. Buchs, Armand (2010): Leopold Ru⌅i⇥ka, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D28926.php. Buchs, Samuel (1977): «Ernst Freudenberg 1884–1967, Professor der Kinderheilkunde», in: Ingeborg Schnack (Hg.): Marburger Gelehrte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Marburg: Elwert, 64–74. Bühler, Theodor (1968): «Verzeichnis der Schriften von Hans Georg Wackernagel», in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 68, 237–245. Bühler, Theodor (2013): Carl Wieland, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D15840.php.
780
Bibliographie
Bühlmann, Lea (2010): Konstruktionen. Die Entstehung des neuen Kollegienhauses der Universität Basel auf dem Petersplatz 1860 bis 1939. Verfügbar unter: https://unige schichte.unibas.ch/fileadmin/user_upload/pdf/Buehlmann_Konstruktionen.pdf. Bürgi, Markus (2004): Konrad Farner, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D22745.php. Bürgi, Markus (2010): Hans Oprecht, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D6464. php. Bürgi, Michael (2011): Pharmaforschung im 20. Jahrhundert. Arbeit an der Grenze zwischen Hochschule und Industrie. Zürich: Chronos. Buess, Eduard (1985): Fritz Lieb, in: Neue Deutsche Biographie 14, 472 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118971662.html#ndbcontent. Bultmann, Rudolf (2017): Briefwechsel mit Götz Harbsmeier und Ernst Wolf 1933–1976, hg. von Werner Zager. Tübingen: Mohr Siebeck. Burckhardt, Carl Jacob (2015): Briefe 1908–1974. Frankfurt a. M.: Fischer. Burckhardt, Lukas (1935/36): «Die schweizerische Sozialdemokratie der Gegenwart», in: Zentralblatt, 490–495. Burckhardt, Lukas u. a. (Hg.) (1984): Das politische System Basel-Stadt. Geschichte, Strukturen, Institutionen, Politikbereiche. Basel/Frankfurt a. M.: Helbing & Lichtenhahn. Burckhardt-Sarasin, Carl (1951): «Daniel Burckhardt-Werthemann als Persönlichkeit», in: Basler Jahrbuch 1951, 68–74. Burckhardt-Seebass, Christine (2010): Zur Geschichte der Volkskunde (Kulturwissenschaft und Europäischen Ethnologie) an der Basler Universität. Verfügbar unter: https://unigeschichte.unibas.ch/fileadmin/user_upload/pdf/Burckhardt-8Seebass_Volks kunde.pdf. Burioni, Matteo/Burcu Dogramaci/Ulrich Pfisterer (Hg.) (2015): Kunstgeschichten 1915. 100 Jahre Heinrich Wölfflin: Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Passau: Dietmar Klinger. Burkard, Günter (2003): Hermann Ranke, in: Neue Deutsche Biographie 21, 144 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd116329092.html#ndbcontent. Burkart, Lucas (2015): «‚Ein vortrefflicher Fischzug‘ als Beinahe-Geschichte. Ernst Kantorowicz und die deutschsprachige Geschichtswissenschaft in der Zwischen- und Nachkriegszeit», in: Lucas Burkart/Joachim Kersten/Ulrich Raulff/Hartwig von Bernstorff/Achatz von Müller (Hg.): Mythen, Körper, Bilder. Ernst Kantorowicz zwischen Historismus, Emigration und Erneuerung der Geisteswissenschaften. Göttingen: Wallstein, 189–218. Burkert, Walter (1992): «Opfer als Tötungsritual. Eine Konstante der menschlichen Kulturgeschichte?» in: Graf 1992, 169–189. Burri, Otto (1985): Rudolf Maria Holzapfel (1874–1930): Hauptwerke. Eine Einführung und Übersicht als Studienhilfe. Aarau u. a.: Sauerländer. Busch, Eberhard (1975): Karl Barths Lebenslauf. Nach seinen Briefen und autobiographischen Texten. München: Chr. Kaiser. Busch, Eberhard (2005): «Barth und die Juden», in: Michael Beintker u. a. (Hg.): Karl Barth in Deutschland (1921–1935). Aufbruch – Klärung – Widerstand. Beiträge
Literatur und publizierte Quellentexte
781
zum Internationalen Symposion vom 1. bis 4. Mai 2003 in der Johannes a Lasco Bibliothek Emden. Zürich: Theologischer Verlag, 445–456. Busch, Eberhard (2008): Die Akte Karl Barth. Zensur und Überwachung im Namen der Schweizer Neutralität 1938–1945. Zürich: Theologischer Verlag. Buxtorf, August (1940): «Nekrolog Heinrich Preiswerk», in: Basler Nachrichten vom 26. März 1940. Caduff, Corina/Michael Gamper (Hg.) (2001): Schreiben gegen die Moderne. Beiträge zu einer kritischen Fachgeschichte der Germanistik in der Schweiz. Zürich: Chronos. Calderari, Lara (2009): Aldo Patocchi, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I22562. php. Calgari, Guido («La Redazione») (1941): «Giustificazione», in: Svizzera italiana 1, No. 1, 1–3. Calin, William (2007): Twentieth-Century Humanist Critics. From Spitzer to Frye. Toronto/Buffalo/London: University of Toronto Press. Cancik, Hubert/Hildegard Cancik-Lindemaier (2014): Humanismus – ein offenes System. Beiträge zur Humanistik, hg. und mit einem Vorwort versehen von Horst Groschopp. Aschaffenburg: Alibri Verlag. Cancik, Hubert (2014): «Antike Menschenbilder im humanistischen Diskurs», in: Cancik/ Cancik-Lindemaier 2014, 49–65. Cancik, Hubert (2014a): Humanismus als offenes System, in: Cancik/Cancik-Lindemaier 2014, 15–34. Cancik, Hubert/Horst Groschopp/Frieder Otto Wolf (Hg.) (2016): Humanismus. Grundbegriffe. Berlin/Boston: de Gruyter. Cancik, Hubert (2016a): «Humanismus», in: Cancik/Groschopp/Wolf 2016, 9–15. Cancik, Hubert (2016b): «Freundschaft», in: Cancik/Groschopp/Wolf 2016, 169–175. Canfora, Luciano (1995): Politische Philologie. Altertumswissenschaften und moderne Staatsideologien. Stuttgart: Klett-Cotta. Cantimori, Delio (1936): «Note su Erasmo e la vita morale e religiosa italiana nel secolo XVI», in: Gedenkschrift 1936, 98–112. Caraffa, Costanza/Almut Goldhahn (2012): «Zwischen ‚Kunstschutz‘ und Kulturpropaganda. Ludwig Heinrich Heydenreich und das Kunsthistorische Institut in Florenz 1943–1945», in: Christian Fuhrmeister/Johannes Griebel/Stephan Klingen/Ralf Peters (Hg.): Kunsthistoriker im Krieg. Deutscher Militärischer Kunstschutz in Italien 1943–1945. Köln: Böhlau, 93–110. Casanova, Mauro (2015): Der Fall Werner Gerlach. Schweizer Reaktionen auf einen nationalsozialistischen Professor in den Jahren 1935–1936. Basel: Seminararbeit Universität Basel, Departement Geschichte (unveröff.). Catalogus Professorum Halensis: Hermann Straub, http://www.catalogus-professorumhalensis.de/straubhermann.html. Caviezel-Rüegg, Zita (2005): Paul Ganz, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D27720.php. Cesana, Andreas (2011): «Paul Häberlin. Der Anspruch des Denkens», in: Angehrn/Rother 2011, 87–105.
782
Bibliographie
Cetta, Toni (2015): Wilhelm Röpke, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D44478. php. Chabod, Federico (1948): Rezension Werner Kaegi, «Historische Meditationen», in: Rivista Storica Italiana 60, 143. Chambon, Jean-Pierre/Claude Choley/Pierre Swiggers (1979): «Autour de l’histoire du français. Échanges épistolaires entre Walther von Wartburg et Ferdinand Brunot», in: Revue de linguistique romane 61, H. 241/242, 79–86. Chaniotis, Angelos/Ulrich Thaler (2006): «Altertumswissenschaften», in: Wolfgang U. Eckart u. a. (Hg.): Die Universität Heidelberg im Nationalsozialismus. Heidelberg: Springer, 391–434. Chapoutot, Johann (2008): Le national-socialisme et l’Antiquité. Paris: PUF. Chapuis, Marc (1935/36): «Rapport du Président central sur l’année 1934–35», in: Zentralblatt, 209–217. Chapuis, Marc/Philibert Muret/René Fankhauser (1933/34): «La Démocratie contre la Patrie», in: Zentralblatt, 194–199 Chiantera-Stutte, Patricia (2007): «Nazione e piccolo stato nella conflagrazione europea. Note sulle ‚Historische Meditationen‘ di Werner Kaegi», in: Storiografia 11, 229– 254. Chiantera-Stutte, Patricia (2013/14): «Psychologie des geistigen Faschismus. Die Kritik und die Interpretation Werner Kaegis», in: Historische Mitteilungen 26, 4–70. Chrambach, Eva (2003): Paul Renner, in: Neue Deutsche Biographie 21, 434–436, verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/gnd118744542.html#ndbcontent. Christoffel, Ulrich (1940): Deutsche Innerlichkeit. München: Piper. Claudel, Paul (1939): Der seidene Schuh oder Das Schlimmste trifft nicht immer zu. Übertragung und Nachwort von Hans Urs von Balthasar. Salzburg: O. Müller. Codiroli, Pierre (1992): Tra fascio e balestra. Un’acerba contesa culturale (1941–1945). Locarno: Dadò. Codiroli, Pierre (2006): Arminio Janner, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D10157.php. Coigny, Pierre (1940/41): «Discussion centrale du semestre d’hiver 1940/41. Rapport du président central», in: Zentralblatt, 280–284. Comte, Bernard (1985): «Emmanuel Mounier devant Vichy et la révolution nationale en 1940–41. L’histoire réinterprétée», in: Revue d’histoire de l’Église de France 71, No. 187, 253–279. Conrads, Norbert (Hg.) (2004): Die tolerierte Universität. 300 Jahre Universität Breslau 1701 bis 2002. Katalogbuch zur Ausstellung ‚Die tolerierte Universität‘. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. Constable, Edwin C. (1999): «Chemistry at the University of Basel. Historical Landmarks», in: Chimia 53, 185–186. Conzemius, Victor (2011): Hans Urs von Balthasar, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/ textes/d/D9716.php. Cornelißen, Christoph (2001): Gerhard Ritter. Geschichtswissenschaft und Politik im 20. Jahrhundert. Düsseldorf: Droste.
Literatur und publizierte Quellentexte
783
Cornelißen, Christoph/Carsten Mish (Hg.) (2009): Wissenschaft an der Grenze. Die Universität Kiel im Nationalsozialismus (Mitteilungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte 86). Essen: Klartext. Craig, John E. (1984): Scholarship and Nation Building. The Universities of Strasbourg and Alsatian Society 1870–1939. Chicago/London: University of Chicago Press. Csobádi, Susanne (2008): Ernst Miescher, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 043527/2008-09-16/. Cullmann, Oscar (1966): «Karl Ludwig Schmidt 1891–1956», in: Oscar Cullmann, Vorträge und Aufsätze 1925–1962, hg. von Karlfried Fröhlich. Tübingen/Zürich: Mohr/ Zwingli Verlag, 675–682. Cullmann, Oscar (1966a): «Autobiographische Skizze», in: Oscar Cullmann, Vorträge und Aufsätze 1925–1962, hg. von Karlfried Fröhlich. Tübingen/Zürich: Mohr/Zwingli Verlag, 683–687. Curtius, Ernst Robert (2015): Briefe aus einem halben Jahrhundert. Eine Auswahl, hg. und kommentiert von Frank-Rutger Hausmann. Baden-Baden: Valentin Koerner. Curtius, Ernst Robert/Max Rychner (2015): Freundesbriefe 1922–1955. In Zusammenarbeit mit Claudia Mertz-Rychner hg. und kommentiert von Frank-Rutger Hausmann. Frankfurt/Main: Vittorio Klostermann. Däniker, Gustav (1939): «Der Feldzug in Polen», in: Neue Basler Zeitung vom 18. November 1939. Dahinden, Martin (1987): Das Schweizerbuch im Zeitalter von Nationalsozialismus und Geistiger Landesverteidigung. Bern: Lang. Dahms, Hans-Joachim (1999): «Die Universität Göttingen 1918–1989. Vom ‚Goldenen Zeitalter‘ der Zwanziger Jahre bis zur ‚Verwaltung des Mangels‘ in der Gegenwart», in: Rudolf von Thadden/Günter J. Trittel (Hg.): Göttingen – Geschichte einer Universitätsstadt, Bd. 3: Von der preussischen Mittelstadt zur südniedersächsischen Grossstadt 1866–1989. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 395–456. Dainat, Holger/Lutz Danneberg (2012): Literaturwissenschaft und Nationalsozialismus. Tübingen: Niemeyer. Das Neue Frankfurt, 2. bis 7. Jahrgang, 1928–1933/34. Débarre, Ségolène/Nicolas Ginsburger (2014): «Geographie der Kolonien, Kolonialgeographie? Théorisation et objectifs de la géographie coloniale dans les leçons inaugurales de Fritz Jaeger (1911) et Hans Meyer (1915)», in: Revue Germanique Internationale 20, 167–186. Degen, Bernard (1986): Das Basel der andern. Geschichte der Basler Gewerkschaftsbewegung. Basel: Z-Verlag. Degen, Bernard (2002): Arthur Baumgarten, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D27959.php. Degen, Bernard (2007): Fritz Mangold, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D5955. php. Degen, Bernard (2013): Arthur Stoll, in: Neue Deutsche Biographie 25, 410–412, verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118618571.html#ndbcontent. Deichmann, Ute (2001): Flüchten, Mitmachen, Vergessen. Chemiker und Biochemiker in der NS-Zeit. Weinheim: Wiley-VCH.
784
Bibliographie
Deichmann, Ute (2006): «‚Dem Duce, dem Tenno und unserem Führer ein dreifaches Sieg Heil‘. Die Deutsche Chemische Gesellschaft und der Verein deutscher Chemiker in der NS-Zeit», in: Dieter Hoffmann/Mark Walker (Hg.): Physiker zwischen Autonomie und Anpassung. Weinheim: Wiley-VCH, 459–498. Deléamont, Pierre (1944/45: «Le sort des universités hollandaises», in: Zentralblatt, 217– 221. Delz, Josef (1988): «Harald Fuchs †», in: Gnomon 60, 80–82. Derks, Hans (2005): «German Westforschung, 1918 to the Present. The Case of Franz Petri 1903–1993», in: Ingo Haar/Michael Fahlbusch (Hg.): German Scholars and Ethnic Cleansing, 1919–1945. New York/Oxford: Berghahn, 175–199. Dessauer, Friedrich (1949): «Ludwig Zehnder 1854–1949», in: Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 129, 413–417. Détrie, Muriel (2002): «Étiemble, ‚citoyen de la planète‘», in: Revue de littérature comparée 1, No. 301, 97–101, verfügbar unter: www.cairn.info/revue-de-litterature-compa ree-2002-1-page-97.htm. Dettwiler, Walter (1988): Fritz Mangold, die politische Laufbahn. Basel: Lizentiatsarbeit Univ. Basel, Historisches Seminar (unveröff.). Dettwiler, Walter (2011): Arthur Stoll, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D28955.php. Dettwiler, Walter (2018): Georg Schmidt, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D27103.php. Dietel, Beatrix (2015): Die Universität Leipzig in der Weimarer Republik. Eine Untersuchung zur sächsischen Hochschulpolitik. Leipzig: Universitätsverlag. Diethelm, Alois (2003): Roland Rohn 1905–1971, hg. von Alexander L. Bieri. Zürich: gta. Dietrich, Volker (2010): Alfred Rittmann, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 048534/2010-03-22/. Dilger, Alfred (1966): Karl Hartenstein, in: Neue Deutsche Biographie 7, 710 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118546163.html#ndbcontent. Dill, Ueli (2008): Harald Fuchs, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D43465.php. Dilly, Heinrich (1988): Deutsche Kunsthistoriker 1933–1945. München/Berlin: Deutscher Kunstverlag. Dilly, Heinrich/Ulrike Wendland (1991): «‚Hitler ist mein bester Freund …‘ Das Kunsthistorische Seminar der Hamburger Universität», in: Eckart Krause u. a. (Hg.): Hochschulalltag im ‚Dritten Reich‘. Die Hamburger Universität 1933–1945, Teil II. Berlin/ Hamburg: Reimer, 607–624. Diner, Dan (1989): «Rassistisches Völkerrecht. Elemente einer nationalsozialistischen Weltordnung», in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 37, H. 1, 23–56. Documents diplomatiques suisses 1848–1945 (1994): Vol. 12 (1937–1938), préparé sous la direction d’Oscar Gauye (†), par Gabriel Imboden et Daniel Bourgeois. Bern: Benteli. Documents diplomatiques suisses 1848–1945 (1997): Vol. 14 (1941–1943), préparé par Antoine Fleury, Mauro Cerutti et Marc Perrenoud. Bern: Benteli.
Literatur und publizierte Quellentexte
785
Dönhoff, Marion (1935): Entstehung und Bewirtschaftung eines ostdeutschen Grossbetriebes. Die Friedrichstein-Güter von der Ordenszeit bis zur Bauernbefreiung, Dissertation, Basel. Dörrie, Heinrich (1982): Kurt Latte, in: Neue Deutsche Biographie 13, 685 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd116862971.html#ndbcontent. Doll, Nikola/Christian Fuhrmeister/Michael H. Sprenger (Hg.) (2005): Kunstgeschichte im Nationalsozialismus. Beiträge zur Geschichte einer Wissenschaft zwischen 1930 und 1950. Begleitband zur Wanderausstellung ‚Kunstgeschichte im Nationalsozialismus‘. Weimar: Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften. Dorst, Jean (1997): «Adolf Portmann en France», in: uninova 79/80, 22–23. Dow, James R./Hannjost Lixfeld (Hg.) (1994): The Nazification of an Academic Discipline. Folklore in the Third Reich. Bloomington: Indiana University Press. Dröge, Christoph (1995): «Ernst Robert Curtius, lettre à Andreas Heusler (18 juin 1936)», in: Ernst Robert Curtius et l’idée de l’Europe. Actes du colloque de Mulhouse et Thann des 29, 30 et 31 janvier 1992, organisé par Jeanne Bem et André Guyaux. Paris: Honoré Champion, 393 f. Drüding, Markus (2014): Akademische Jubelfeiern. Eine geschichtskulturelle Analyse der Universitätsjubiläen in Göttingen, Leipzig, Münster und Rostock (1919–1969). Münster: Lit. Drüll, Dagmar (1986): Heidelberger Gelehrtenlexikon 1803–1932. Berlin u. a.: Springer. Dürr, Emil (1928): Neuzeitliche Wandlungen in der schweizerischen Politik. Eine historisch-politische Betrachtung über die Verwirtschaftlichung der politischen Motive und Parteien. Basel: Helbing & Lichtenhahn. Dürr, Emil (1938): «Vorgeschichte der helvetischen Revolution», in: Hans Nabholz/Leonhard von Muralt/Richard Feller/Edgar Bonjour: Geschichte der Schweiz, Bd. 2: Vom siebenzehnten bis ins zwanzigste Jahrhundert. Zürich: Schulthess, 267–312. Egger, Charles A. (1940/41): «Discours de fête», in: Zentralblatt, 560–564. Egger, Charles A. (1941/42): «Bericht über die Centraldiskussion im Winter 1941/42», in: Zentralblatt, 358–366. Ehinger, Paul (2014): «Karl Barth – inmitten heftiger Konflikte», in: Zofingia. Zofingue. Die Idee. Das Feuer. Der Freundeskreis. Amitiés à travers les temps, hg. vom Schweizerischen Zofingerverein und Schweizerischen Altzofingerverein. Zofingen: Schweizerischer Zofingerverein, 72 f. Eichler, Martin (1988): «Alexander Ostrowski. Über sein Leben und Werk», in: Acta Arithmetica 51, 295–309. Einaudi, Ida (1967): Luigi Einaudi flieht in die Schweiz. Blätter der Erinnerung, hg. von der Schweizerischen Gesellschaft zur Pflege der kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Italien in Basel. Deutsche Übertragung Giuseppe Zamboni, Vorwort Werner Kaegi. Basel/Stuttgart: Schwabe. Einaudi, Luigi (1997): Diario dell’esilio 1943–1944, a cura di Paolo Soddu, prefazione a cura di Alessandro Galante Garrone. Torino: Einaudi. Elvert, Jürgen (2008): «Einige einführende Überlegungen zum Projekt ‚Kulturwissenschaften und Nationalsozialismus‘», in: Jürgen Elvert/Jürgen Nielsen-Sikora (Hg.): Kulturwissenschaften und Nationalsozialismus. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 7–18.
786
Bibliographie
Emmanuel, Pierre (2005): Lettres à Albert Béguin. Correspondance 1941–1952, établie et annotée par Aude Préta-de Beaufort. Lausanne: L’Age d’homme. Encrevé, André (1986): Protestants français au milieu du 19e siècle. Les réformes de 1848 à 1870. Genève: Labor et Fides. Engehausen, Frank (2006): «Akademische Feiern an der nationalsozialistischen Universität», in: Wolfgang U. Eckart/Volker Sellin/Eike Wolgast (Hg.): Die Universität Heidelberg im Nationalsozialismus. Heidelberg: Springer, 123–146. Engehausen, Frank (2010): «Vier Jahrhunderte akademische Festkultur. Vergleichende Bemerkungen zu den Heidelberger Universitätsjubiläen», in: Engehausen/Moritz 2010, 109–119. Engehausen, Frank/Werner Moritz (Hg.) (2010): Die Jubiläen der Universität Heidelberg 1587–1986. Begleitband zur Ausstellung im Universitätsmuseum Heidelberg 19. Oktober 2010 bis 19. März 2011. Katalogteil. Heidelberg: Verlag Regionalkultur. Engler, Balz (2008): Henry Lüdeke, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/044825/ 2008-07-16/. Epple, Moritz/Johannes Fried/Raphael Gross/Janus Gudian (Hg.) (2016): ‚Politisierung der Wissenschaft‘. Jüdische Wissenschaftler und ihre Gegner an der Universität Frankfurt am Main vor und nach 1933. Göttingen: Wallstein. Erlenmeyer, Hans (1953): «Fritz Fichter 1869–1952», in: Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, Teilbd. 3: Nekrologe verstorbener Mitglieder, 308–322. Erlenmeyer, Hans (1961): Fritz Fichter, in: Neue Deutsche Biographie 5, 126, verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd116489499.html#ndbcontent. Eschenbach, Gunilla (2011): Imitatio im George-Kreis. Berlin/New York: de Gruyter. Étiemble, René (1974): Von Wartburg et la France, in: Le Monde vom 23. September 1974. Färber, Roland/Fabian Link (Hg.) (2019): Die Altertumswissenschaften an der Universität Frankfurt 1914–1950. Studien und Dokumente. Basel: Schwabe. Färber, Roland/Fabian Link (2019a): «Einleitung. Die Altertumswissenschaften an der Universität Frankfurt im NS-Regime als Forschungsgegenstand», in: Färber/Link 2019, 7–24. Fahlbusch, Michael (1989): «Die Geographie in Münster von 1920 bis 1945», in: Michael Fahlbusch/Mechtild Rössler/Dominik Siegrist (Hrsg.): Geographie und Nationalsozialismus. Drei Fallstudien zur Institution Geographie im Deutschen Reich und der Schweiz (urbs et regio 51), 153–273. Fahlbusch, Michael (1994): «Deutschtum im Ausland. Zur Volks- und Kulturbodentheorie in der Weimarer Republik», in: Manfred Büttner (Hg.): Miteinander, Nebeneinander, Gegeneinander. Bochum: Brockmeyer, 213–231. Fahlbusch, Michael (1999): Die verlorene Ehre der deutschen Geographie. eMail an HSoz-u-Kult vom 7. Oktober 1999, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/beitrag/ essays/geograph.htm. Fahlbusch, Michael (1999a): Wissenschaft im Dienst der nationalsozialistischen Politik? Die ‚Volksdeutschen Forschungsgemeinschaften‘ von 1931 bis 1945. Baden-Baden: Nomos.
Literatur und publizierte Quellentexte
787
Fahlbusch, Michael (2003): Deutschtumspolitik und Westdeutsche Forschungsgemeinschaft, in: Burkhard Dietz/Helmut Gabel/Ulrich Tiedau (Hg.): Griff nach dem Westen. Münster/New York: Waxmann, 569–647. Faulenbach, Bernd (1980): Ideologie des deutschen Weges. Die deutsche Geschichte in der Historiographie zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus. München: Beck. Faulenbach, Heiner (1991): «Die kirchenpolitische Bestrafung des BK-Theologen Hans Hellbardt», in: Heiner Faulenbach (Hg.): Standfester Glaube. Festgaben zum 65. Geburtstag von Johann Friedrich Gerhard Goeters (Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte 100). Köln/Pulheim, 401–429. Favre, Manuel (1942/43): «Dogmatisme … et pragmatisme», in: Zentralblatt, 219–224. Feichtinger, Johannes (2017): Die Wiener Schule der Hochpolymerforschung in England und Amerika. Emigration, Wissenschaftswandel und Innovation. Wien: ÖAW, IKT Working Papers (Version September 2017), verfügbar unter: http://epub.oeaw.ac.at/ 0xc1aa5576_0x00371231.pdf. Feigenwinter, Daniela (1991): Hilfeleistungen der Juden in der Schweiz für Gurs. Basel: Lizentiatsarbeit, Phil.-Hist. Fakultät der Universität (unveröff.). Feldges, Benedikt (1989): «Basler Flüchtlingspolitik von 1933 bis 1945. Im Spannungsfeld zwischen nationalsozialistischer Politik und eidgenössischen Vorschriften», in: Guth/ Hunger 1989, 74–85. Festgabe (1942) der Basler Juristenfakultät zum Schweizerischen Juristentag September 1942. Basel: Helbing & Lichtenhahn. Festschrift Arthur Baumgarten (1964), überreicht von der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin (Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe XIII, H. I). Festschrift Hans Lewald (1953) bei Vollendung des 40. Amtsjahres als ordentlicher Professor im Oktober 1953 überreicht von seinen Freunden und Kollegen. Basel: Helbing & Lichtenhahn. Fetscherin, Hans (1936/37): «Bild des deutschen Theaterlebens», in: Zentralblatt, 396– 400. Fichter, Friedrich (1933): Das Verhältnis der anorganischen zur organischen Chemie. Rektoratsrede. Basel: Helbing & Lichtenhahn (Basler Universitätsreden 4). Fikentscher, Wolfgang (1977): Methoden des Rechts, Bd. 5. Tübingen: Mohr. Fillitz, Hermann (2011): Robert von Hirsch, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D30215.php. Fink, Udo (1971): Albert Oeri als Publizist und Politiker zwischen den beiden Weltkriegen. Ein Beitrag zur Schweizergeschichte der Neuesten Zeit. Zürich: Diss. Zürich. Fioroni, Pio (1997): «Die Entwicklung der Vorderkiemenschnecken», in: uninova 79/80, Mai 1997, 35–37. Fischer, H. (1943): «Jean Strohl 1886–1942», in: Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 123, 319–326. Fischer, H. (1945): «Gustav Senn», in: Gesnerus 2, 169–172. Fischer, Hans (1990): Völkerkunde im Nationalsozialismus. Aspekte der Anpassung, Affinität und Behauptung einer wissenschaftlichen Disziplin. Berlin/Hamburg: Dietrich Reimer.
788
Bibliographie
Fischer, M. (1962): «Hartmann Koechlin-Ryhiner 1893–1962», in: Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, Wissenschaftlicher und administrativer Teil 142, 213–218. Fischer, Otto (1936): «Geschichte der Öffentlichen Kunstsammlung», in: Festschrift zur Eröffnung des Kunstmuseums Basel. Basel: Birkhäuser, 7–118. Fischer, Wolfram u. a. (Hg.) (1994): Exodus von Wissenschaften aus Berlin. Fragestellungen, Ergebnisse, Desiderate. Entwicklungen vor und nach 1933. Berlin/New York: de Gruyter Fisher, Charles H. (1989): «Emil Fischer Pioneer in Monomer and Polymer Science», in: Raymond B. Seymour (Hg.): Pioneers in Polymer Science. Dordrecht u. a.: Kluwer Academic Publishers, 63–80. Flashar, Hellmut (Hg.) (1995): Altertumswissenschaft in den 1920er Jahren. Neue Fragen und Impulse. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. Flessner, Axel (1989): «Hans Lewald (1883–1963)», in: Bernhard Diestelkamp/Michael Stolleis (Hg.): Juristen an der Universität Frankfurt am Main. Baden-Baden: Nomos, 128–135. Flöter, Jonas u. a. (Hg.) (2015): Karl Lamprecht (1856–1915), Durchbruch in der Geschichtswissenschaft. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag. Flory-Fischer, Hilde (1986): Otto Fischer. Ein Kunsthistoriker des zwanzigsten Jahrhunderts, Reutlingen 1886 – Basel 1948, hg. von der Stadt Reutlingen. Reutlingen: Reutlinger Geschichtsverein. Flubacher, Silvia (2007): Die Berufung Adolf Portmanns auf den Lehrstuhl für Zoologie in Basel 1931. Basel: Seminararbeit, Historisches Seminar der Universität (unveröff.). Flügel, Axel (2000): «Ambivalente Innovation. Anmerkungen zur Volksgeschichte», in: Geschichte und Gesellschaft 26, H. 4, 653–671. Föllmi, Anton (1999): Aus dem Leben und Denken des Basler Sozialwissenschafters Edgar Salin (1892–1974). Vortrag im Rahmen des Forums für Wort und Musik im Refektorium Kleines Klingental, Unterer Rheinweg 26, 4058 Basel am Mittwoch, 26. Mai 1999, 18.15–19.45 Uhr. Basel: Schweizerische Nationalbank. Forsbach, Ralf (2006): Die medizinische Fakultät der Universität Bonn im Dritten Reich. München: Oldenbourg. Fredenhagen, Hermann (1937/38): «Semesterberichte Sommer 1937, Basel», in: Zentralblatt, 169–172. Frei, Alban (2010): «Ein ‚Dokument des geistigen Selbstbehauptungswillens der Schweiz‘. Der Atlas der Schweizerischen Volkskunde und die Nationalisierung der Volkskunde in der Schweiz», in: Schürch/Eggmann/Risi 2010, 133–145. Frey, Jakob (1941/42): «Neutralität und freie Meinungsäusserung», in: Zentralblatt, 123– 130. Frey, Jakob/Max Hagemann/Andreas Moppert (1941/42): «Offener Brief an Herrn Prof. Karl Barth», in: Zentralblatt, 266–268. Freytag, Hartmut (2003): Friedrich Ranke, in: Internationales Germanistenlexikon 1800– 1950, Bd. 3: R–Z, hg. von Christoph König unter Mitarbeit von Birgit Wägenbaur u. a., Berlin/New York: de Gruyter, 1460–1462.
Literatur und publizierte Quellentexte
789
Freyvogel, Hans Ludwig (1931–1941): «Basler Chronik», in: Basler Jahrbuch, konsultiert für die Jahrgänge 1931–1941. Freyvogel, Hans Ludwig (1941): «Basler Chronik vom 1. 10. 1939 bis 30. 9. 1940», in: Basler Jahrbuch, 210–242. Freyvogel, Thierry A. (2006): Rudolf Geigy, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 044781/2006-11-23/. Fryba, Anne-Marguerite (2013): Ernst Tappolet, in: Neue Deutsche Biographie 25, 789, verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118801333.html#ndbcon tent. Fuchs, Harald (1938): Der geistige Widerstand gegen Rom in der antiken Welt. Berlin: de Gruyter. Fuchs, Harald (Hg.) (1944), C. Julius Caesar: Commentarii belli Gallici. Frauenfeld: Huber. Fuchs, Harald (Hg.) (1946/1949): P. Cornelius Tacitus: Annalium ab excessu divi Augusti quae supersunt, 2 Bde. Frauenfeld: Huber. Fuchs, Harald (1947): «Rückschau und Ausblick im Arbeitsbereich der Lateinischen Philologie», in: Museum Helveticum 4, 147–198. Fülscher, Peter (1999): Theodor Niethammer, in: Neue Deutsche Biographie 19, 247 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd102010498.html#ndbcon tent. Füssli, Johann Heinrich (1942): Briefe, hg. von Walter Muschg, mit einer Wiedergabe der Füssli-Büste von Tobias Sergel und drei Zeichnungen Füsslis. Basel: Schwabe. Füzesi, Nicolas (2010): Hansjörg Salmony, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 047726/2010-02-01/. Fuhrmann, Manfred (1984): «Die humanistische Bildungstradition im Dritten Reich», in: Humanistische Bildung 8, 139–161. Fuhrmeister, Christian (2008): «Die Sektion Bildende Kunst der Deutschen Akademie 1925–1945. Ein Desiderat der Fachgeschichte», in: Heftrig u. a. 2008, 312–334. Furukawa, Yasu (1997): «Polymer Chemistry», in: John Krige/Dominique Pestre (Hg.): Science in the Twentieth Century. London: Harwood, 547–563. Furukawa, Yasu (1998): Inventing Polymer Science. Staudinger, Carothers, and the Emergence of Marcromolecular Chemistry. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Gagnebin, Bernard (1939/40): «Réflexions sur l’Angleterre et les Anglais», in: Zentralblatt, 11–18. Gamper, Michael (2001): «‚Er schreibt für das Volk, nicht für die Masse‘. Die Ablehnung der gesellschaftlichen Moderne in der Schweizer Germanistik – Konzepte und Konsequenzen», in: Caduff/Gamper 2001, 85–110. Gams, Anton Alfons/G. Widmer/W. Fisch (1941): «Über Melamin-Formaldehyd-Kondensationsprodukte», in: Helvetica Chimica Acta 24, Fasciculus extraordinarius Gaudentio Engi sexagesimum natalem agenti dicatus, 302E 319E. Gams-Meng, Anton Alfons 1884–1955. Trauerfeier in der Kirche St. Matthäus in Basel am 1. November 1955. Ansprache gehalten von Kirchenratspräsident Herrn Pfarrer Ru-
790
Bibliographie
dolf Vollenweider. Lieder gesungen durch den Basler Männerchor unter Leitung von Dirigent Walther Aeschbacher. Privatdruck o. O. Gantner, Joseph (1919): «Zum Schema der Sixtinischen Decke Michelangelos», in: Monatshefte für Kunstwissenschaft 12, 1–9. Gantner, Joseph (1920): Michelangelo, die Beurteilung seiner Kunst von Leonardo bis Goethe. Beiträge zu einer Ideengeschichte der Kunsthistoriographie. München: Diss. München. Gantner, Joseph (1925): Die Schweizer Stadt. München: R. Piper. Gantner, Joseph (1928): Grundformen der europäischen Stadt. Versuch eines historischen Aufbaues in Genealogien. Wien: Anton Schroll. Gantner, Joseph (1931): «Die Situation», in: Das Neue Frankfurt, H. 6, Juni 1931, 97–99. Gantner, Joseph (1932): Revision der Kunstgeschichte. Prolegomena zu einer Kunstgeschichte aus dem Geiste der Gegenwart. Anhang: Semper und Le Corbusier. Eine Rede. Wien: Anton Schroll. Gantner, Joseph (1933/34): «Zum neuen Jahrgang», in: Die Neue Stadt, eine Monatsschrift, 5. Jahrgang, 1. Heft. Gantner, Joseph (1936): Kunstgeschichte der Schweiz. Erster Band: Von den helvetischrömischen Anfängen bis zum Ende des romanischen Stiles. Frauenfeld/Leipzig: Huber. Gantner, Joseph (1939): «Das Bild des Menschen in der romanischen Kunst. Antrittsvorlesung an der Universität Basel, den 7. November 1938», in: Sonntagsblatt der Basler Nachrichten vom 1. Januar 1939, Nr. 1, 33. Jahrgang, 1–4. Gantner, Joseph (1940): «Um einige kunsthistorische Bücher», in: Literaturblatt der Basler Nachrichten, Beilage zu Nr. 287, 18. Oktober 1940. Gantner, Joseph (1941): Romanische Plastik. Inhalt und Form in der Kunst des 11. und 12. Jahrhunderts. Wien: Anton Schroll. Gantner, Joseph (1943): «Die Genesis der Gotik», in: Jahrbuch des Vereins Schweizer Gymnasiallehrer 70, Aarau, 98–103. Gantner, Joseph (1945): «Nachruf auf Heinrich Wölfflin, gesprochen in der Sitzung der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft Basel vom 29. Oktober 1945», SA aus: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 44, 7–10. Gantner, Joseph (Hg.) (1948): Jacob Burckhardt und Heinrich Wölfflin. Briefwechsel und andere Dokumente ihrer Begegnung, 1882–1897. Basel: Schwabe. Gantner, Joseph (1975): «Der Unterricht in Kunstgeschichte an der Universität Basel 1844–1938», SA aus: Kunstwissenschaft an Schweizer Hochschulen 1 (Jahrbuch 1972/73 des Schweizerischen Instituts für Kunstwissenschaft), Zürich (Beiträge zur Geschichte der Kunstwissenschaft in der Schweiz 3), 9–32. Gantner, Joseph (1979): ‚Das Bild des Herzens‘. Über Vollendung und Un-Vollendung in der Kunst. Reden und Aufsätze. Berlin: Gebr. Mann-Verlag. Gantner, Joseph (1990): «Erinnerungen», in: Martina Sitt (Hg.): Kunsthistoriker in eigener Sache. Zehn autobiographische Skizzen. Berlin: Reimer, 132–166. Gartmann, Seraina/Jan Pagotto-Uebelhart (2012): Ernst-Alfred Thalmann, in: HLS, http:// www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D6706.php.
Literatur und publizierte Quellentexte
791
Gasser, Michael (2020): «Zum Beispiel Helmut Bradt – Möglichkeiten und Grenzen von Einsteins humanitärer Hilfe», in: https://blogs.ethz.ch/digital-collections/2020/08/07/ zum-beispiel-helmut-bradt-moeglichkeiten-und-grenzen-von-einsteins-humanitaererhilfe/. Gautschi, Walter (2010): «Alexander M. Ostrowski (1893–1986). His Life, Work, and Students», SA aus: Bruno Colbois/Christine Riedtmann/Viktor Schroeder (Hg.): Schweizerische mathematische Gesellschaft 1910–2010. Zürich: European Mathematical Society Publishing House, 257–278. Gautschi, Willi (1989): General Henri Guisan. Die schweizerische Armeeführung im Zweiten Weltkrieg. Zürich: Neue Zürcher Zeitung. Gedenkschrift (1936) zum 400. Todestage des Erasmus von Rotterdam, hg. von der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel. Basel: Braus-Riggenbach. Geelhaar, Christian: (1992): Kunstmuseum Basel. Die Geschichte der Gemäldesammlung und eine Auswahl von 250 Meisterwerken. Basel: Verein der Freunde des Kunstmuseums Basel. Gegenschatz, Ernst (1937/38): «Vom deutschen Studenten», in: Zentralblatt, 36–41. Geiger (⌥Huber), Max (1945): «Gustav Senn 1875–1945», in: Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschat in Basel 56, vii–xv. Geiger, Paul (1947): «Eduard Hoffmann-Krayer 1864–1936», in: Basler Jahrbuch, 97– 105. Geiges, Michael L. (2008): Guido Miescher, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 014552/2008-11-13/. Gelzer, Conrad (1934): «Über das Wesen der Staatsgesinnung», in: Schweizer Monatshefte 13, März 1934, 620–624. Gelzer, Matthias (1927): «Altertumswissenschaft und Spätantike», in: HZ 135, 173–187. Gelzer, Matthias (1943): «Der Rassengegensatz als geschichtlicher Faktor beim Ausbruch der römisch-karthagischen Kriege», in: Joseph Vogt (Hg.): Rom und Karthago. Ein Gemeinschaftswerk. Leipzig: Koehler & Amelang, 178–202. Gelzer, Thomas (1992): «Die Alte Komödie in Athen und die Basler Fastnacht», in: Graf 1992, 29–61. Gelzer, Urs (2011): Matthias Gelzer, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D27058. php. Genevière, Marc (1935/36): «Offener Brief an Dietrich Barth, 25. 11. 1935», in: Zentralblatt, 293–295. Georgi, Felix (1957): Robert Bing 1878–1956. Zürich: Orell Füssli. Gerhard, Anselm (Hg.) (2000): Musikwissenschaft – eine verspätete Disziplin? Die akademische Musikforschung zwischen Fortschrittsglauben und Modernitätsverweigerung. Stuttgart/Weimar: Metzler. Germann, Oscar A. (1948): «Schutz der persönlichen Freiheit im Strafrecht», in: Die Freiheit des Bürgers im Schweizerischen Recht. Festgabe zur Hundertjahrfeier der Bundesverfassung, hg. von den Juristischen Fakultäten der schweizerischen Universitäten. Zürich: Polygraphischer Verlag, 257–270.
792
Bibliographie
Gerster, Willi (1980): Die Basler Arbeiterbewegung zur Zeit der Totalkonfrontation zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten (1927–1932). Von der Einheitsfrontpolitik zur Sozialfaschismustheorie. Zürich: Rotpunktverlag. Gervais, Gilbert (1965): Die Geschichte der Rauracia von ihren Anfängen bis zum hundertsten Jubiläum. Basel: Cratander. Gerwig, Max (1946): «Zur Erinnerung an Eberhard Vischer», in: Abend-Zeitung vom 4. Februar 1946. Gevers, Lieve/Louis Vos (2004): «Studentische Bewegungen», in: Walter Rüegg (Hg.): Geschichte der Universität in Europa, Bd. 3: Vom 19. Jahrhundert zum Zweiten Weltkrieg (1800–1945). München: Beck, 227–299. Gigon, Olof (1933/34): «Über die Grundlagen des christlichen Staates», in: Zentralblatt, 19–27. Gigon, Olof (1935/36): «41 Sätze über den Staat», in: Zentralblatt, 8–38. Gigon, Olof (1935/36a): «Bericht über die Centraldiskussion des Sommersemesters 1936», in: Zentralblatt, 678–684. Gilardi, Anastasia (1998): Aldo Patocchi, in: SIKART Lexikon zur Kunst in der Schweiz, http://www.sikart.ch/KuenstlerInnen.aspx?id=4001204. Giles, Geoffrey J. (1991): «‚Die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen‘. Die Studenten als Verfechter einer völkischen Universität?», in: Eckhard John u. a. (Hg.): Die Freiburger Universität in der Zeit des Nationalsozialismus. Freiburg: Plötz, 43–56. Gingrich, Andre (2005): «The German-Speaking Countries. Ruptures, Schools, and Nontraditions. Reassessing the History of Sociocultural Anthropology in Germany», in: Barth u. a. 2005, 59–153. Ginsberg, Judah (2003 ): Herman Mark and the Polymer Research Institute. National Historic Chemical Landmark dedicated on September 3, 2003, verfügbar unter: http://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/landmarks/polymerrese archinstitute.html. Giovanoli, Rudolf (2007): Volkmar Kohlschütter, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/text es/d/D45053.php?topdf=1. Giudici, Anja/Thomas Ruoss (2018): «Zwischen Pädagogik und Revolution. Pädagogische Vorstellungen und Praktiken des schweizerischen Frontismus der 1930er Jahre», in: Flavian Imlig/Lukas Lehmann/Karin Manz (Hg.): Schule und Reform. Veränderungsabsichten, Wandel und Folgeprobleme. Wiesbaden: Springer, 117–134. Glauser, Friedrich (2008): ‚Man kann sehr schön mit Dir schweigen‘. Briefe an Elisabeth von Ruckteschell und die Asconeser Freunde, 1919–1932, hg. von Bernhard Echte. Wädenswil: Nimbus. Glauser, Jürg/Julia Zernack (Hg.) (2005): Germanentum im Fin de siècle. Wissenschaftsgeschichtliche Studien zum Werk Andreas Heuslers. Basel: Schwabe. Gloor, Balder P. (2007): «Alfred Vogt (1879–1943)», in: 100 Jahre SOG und die Entwicklung der Schweizer Augenheilkunde, hg. von der Schweizerischen Ophthalmologischen Gesellschaft. Horw: Target Media, 91–101. Gloor, Paul (1963): «Dr. Dr. h. c. Hartmann Koechlin-Ryhiner (1893–1962)», in: Basler Stadtbuch 1963, 71–77.
Literatur und publizierte Quellentexte
793
Gloor, Pierre (1943/44): «Semesterberichte – Sommersemester 1944. Sektion Basel», in: Zentralblatt, 575 f. Glück, Alfons/Friedrich Nemec (1997): Walter Muschg, in: Neue Deutsche Biographie 18, 624 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd119361108.html#ndb content. Göllner, Werner (2005): «Alfred De Quervain (1896–1968)», in: Wolfgang Lienemann/ Frank Mathwig (Hg.): Schweizer Ethiker im 20. Jahrhundert – Der Beitrag theologischer Denker. Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 105–132. Göppinger, Horst (1990): Juristen jüdischer Abstammung im ‚Dritten Reich‘. Entrechtung und Verfolgung. 2. Aufl. München: Beck. Goldschmidt, Adolph (1989): Lebenserinnerungen, hg. von Marie Roosen-Runge-Mollwo. Berlin: Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft. Gosden, Chris/Chantal Knowles (2001): Collecting Colonialism. Material Culture and Colonial Change. Oxford/New York: Berg. Gossens, Peter (2003): Horst Rüdiger, in: Internationales Germanistenlexikon 1800–1950, hg. und eingel. von Christoph König, bearb. von Birgit Wägenbaur, Bd. 3. Berlin/ New York: de Gruyter, 1538–1540. Gottwald, N. K. (1970/1972): «W. Eichrodt, Theology of the Old Testament», in: R. B. Laurin (Hg.): Contemporary Old Testament Theologians. Valley Forge, PA: Judson/ London: Marshall, Morgan and Scott, 23–62. Gräbel, Carsten (2015): Die Erforschung der Kolonien. Expeditionen und koloniale Wissenskultur deutscher Geographen, 1884–1919. Bielefeld: transcript. Graf, Christian (2008): Ursprung und Krisis. Heinrich Barths existential-gnoseologischer Grundansatz in seiner Herausbildung und im Kontext neuerer Debatten (Schwabe Philosophica XII). Basel: Schwabe. Graf, Christian (2011): «Heinrich Barth – Wirklichkeit und Transzendenz», in: Angehrn/ Rother 2011, 125–138. Graf, Christian/Johanna Hueck/Kirstin Zeyer (Hg.) (2019): Philosophische Systematik an ihren Grenzen. Heinrich Barths ‚transzendental begründete‘ Existenzphilosophie. Regensburg: S. Roderer. Graf, Christian/Harald Schwaetzer (Hg.) (2010): Existentielle Wahrheit. Heinrich Barths Philosophie im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft, Kunst und christlichem Glauben. Regensburg: S. Roderer. Graf, Fritz (Hg.) (1992): Klassische Antike und neue Wege der Kulturwissenschaften. Symposium Karl Meuli (Basel, 11.–13. September 1991). Basel: Verlag der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde. Graf, Fritz (2002): «Von Knaben und Kämpfern. Hans Georg Wackernagel und die Ritenforschung», in: Wider das ‚finstere Mittelalter‘. Festschrift für Werner Meyer zum 65. Geburtstag. Basel: Schweizerischer Burgenverein, 237–243. Grassi, Giorgio (Hg.) (1984): Das neue Frankfurt 1926–1931. Bari: Dedalo Libri. Greyerz, Otto von (1935/36): «Vom Altzofinger Centralfest 1935», in: Zentralblatt, 53–58. Grieder, Fritz (1942–1946): «Basler Chronik», in: Basler Jahrbuch, konsultiert für die Jahrgänge 1942 bis 1946.
794
Bibliographie
Grieder, Fritz (1957): Basel im Zweiten Weltkrieg 1939–1945. Basel: Helbing & Lichtenhahn. Grieder, Fritz (1973): «Biographische Abrisse», in: Basler Stadtbuch 1973, 179–181. Gross, Werner (1972): Theodor Hetzer, in: Neue Deutsche Biographie 9, 36 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/gnd118774328.html#ndbcontent. Grossmann, Elisabeth (1998): Helen Dahm, in: SIKART Lexikon zur Kunst in der Schweiz, http://www.sikart.ch/kuenstlerinnen.aspx?id=4000039. Grotzer, Béatrice (1975): Les archives Albert Béguin. Inventaire établi en collaboration avec Pierre Grotzer. Neuchâtel: La Baconnière. Grotzer, Pierre (1967): Les écrits d’Albert Béguin. Essai de bibliographie. Neuchâtel: La Baconnière. Grotzer, Pierre (1973): Les écrits d’Albert Béguin. Essai de bibliographie, supplément I. Neuchâtel: La Baconnière. Grotzer, Pierre (1977): Existence et destinée d’Albert Béguin. Neuchâtel: La Baconnière. Grotzer, Pierre (Hg.) (1979): Albert Béguin et Marcel Raymond. Colloque de Cartigny. Sous la direction de Georges Poulet, Jean Rousset, Jean Starobinski, Pierre Grotzer. Textes réunis et publiés par les soins de Pierre Grotzer, avec une bibliographie des écrits de Marcel Raymond. Paris: José Corti. Grousset, René (1949): Pour un nouvel humanisme. Textes des conférences et des entretiens organisés par les quatrièmes Rencontres internationales de Genève, 1949. Neuchâtel: La Baconnière. Grün, Bernd (2010): Der Rektor als Führer? Die Universität Freiburg i. Br. von 1933 bis 1945. München: Karl Alber. Grüttner, Michael (1991): «‚Ein stetes Sorgenkind für Partei und Staat‘. Die Studentenschaft 1930–1945», in: Eckart Krause/Ludwig Huber/Holger Fischer (Hg.): Hochschulalltag im ‚Dritten Reich‘. Die Hamburger Universität 1933–1945, Teil I. Berlin/ Hamburg: Dietrich Reimer, 201–236. Grüttner, Michael (1995): Studenten im Dritten Reich. Paderborn: Schöningh. Grüttner, Michael (2007): «Hochschulpolitik zwischen Gau und Reich», in: Jürgen John/ Horst Möller/Thomas Schaarschmidt (Hg.): Die NS-Gaue. Regionale Mittelinstanzen im zentralistischen ‚Führerstaat‘. München: Oldenbourg, 177–193. Grüttner, Michael (2019): «Universitäten in der nationalsozialistischen Diktatur – Stand der Forschung», in: Livia Prüll/Christian George/Frank Hüther (Hg.): Universitätsgeschichte schreiben. Inhalte – Methoden – Fallbeispiele. Göttingen: V&R unipress/ Mainz University Press, 85–110. Grüttner, Michael/John Connelly (Hg.) (2003): Zwischen Autonomie und Anpassung. Universitäten in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Paderborn: Schöningh. Grüttner, Michael u. a. (Hg.) (2010): Gebrochene Wissenschaftskulturen. Universität und Politik im 20. Jahrhundert. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. Grumann, Jürgen (1982): «Geschichte der Satzung», in: Verein 1982, 172–187. Grundmann, Stefan/Karl Riesenhuber (Hg.) (2007): Deutschsprachige Zivilrechtslehrer des 20. Jahrhunderts in Berichten ihrer Schüler, Bd. 1. Berlin: de Gruyter.
Literatur und publizierte Quellentexte
795
Gschwend, Lukas (2006): «Vom Liberalismus zum Marxismus oder die Suche nach dem richtigen Recht. Gedanken zum 40. Todestag Arthur Baumgartens (1884–1966)», in: Jahrbuch der Juristischen Zeitgeschichte 8, 332–358. Gsell, Yael Naomi Berit (2015): Fritz Liebs politisches Wirken zwischen 1933 und 1945. Basel: Seminararbeit, Departement Geschichte, 13. Februar 2015 (unveröff.). Günther, H. (1978): «Ludwig H. Heydenreich, 1903–1978», in: Die Weltkunst 48 H. 19, 2078, verfügbar unter: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/1325/1/Guenther_ Ludwig_H_Heydenreich_Nachruf_1978.pdf. Gugelot, P. C. (1960): «Beschleuniger», in: H. Frauenfelder/O. Huber/P. Stähelin (Hg.): Beiträge zur Entwicklung der Physik. Festgabe zum 70. Geburtstag von Professor Paul Scherrer, 3. Februar 1960. Basel/Stuttgart: Birkhäuser, 110–125. Gugerli, David/Patrick Kupper/Daniel Speich (2005): Die Zukunftsmaschine. Konjunkturen der ETH Zürich 1855–2005. Zürich: Chronos. Gumbel, Emil Julius (Hg.) (1938): Freie Wissenschaft. Ein Sammelbuch aus der deutschen Emigration. Strasbourg: Sebastian Brant Verlag. Gundel, Hans Georg (1982), Richard Laqueur, in: Neue Deutsche Biographie 13, 634–635, verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd119071304.html#ndbcon tent. Gundolf, Ernst (2006): Werke. Aufsätze, Briefe, Gedichte, Zeichnungen und Bilder, hg. von Jürgen Egyptien. Amsterdam: Castrum Peregrini Presse. Guth, Nadia/Bettina Hunger (Hg.) (1989): Réduit Basel 39–45. Katalog zur Ausstellung ‚Réduit Basel 39–45‘ des Historischen Museums Basel in der Stückfärberei, Kleinhüningen, 4. November 1989 bis 28. Januar 1990. Basel: Reinhardt. Gutmann, Veronika/Lukas Hartmann/Burkard von Roda (1994): Historisches Museum Basel in der Barfüsserkirche 1894–1994. Rückblicke in die Museumsgeschichte. Basel: Historisches Museum. Gutzwiller, Max (1941): Das Büchlein der Einsichten. Freiburg i. Ü.: Privatdruck. Gutzwiller, Max (1945): Alfred Siegwart 1885–1944 zum Gedächtnis (Freiburger Universitätsreden NF 6). Freiburg: Universitätsbuchhandlung. Gutzwiller, Max (1948): «Vorwort», in: Die Freiheit des Bürgers im Schweizerischen Recht. Festgabe zur Hundertjahrfeier der Bundesverfassung, hg. von den Juristischen Fakultäten der schweizerischen Universitäten. Zürich: Polygraphischer Verlag, ix– xv. Gutzwiller, Max (1978): Siebzig Jahre Jurisprudenz. Erinnerungen eines Neunzigjährigen. Basel: Helbing & Lichtenhahn. Haab, Robert (1936): Krisenrecht. Rektoratsrede gehalten am 20. November 1936 (Basler Universitätsreden 8). Basel: Helbing & Lichtenhahn. Haab, Robert/Carl Koechlin (1934): Zur wirtschaftlichen Krisis. Zwei Vorträge, hg. von der Basler Handelskammer. Basel: Helbing & Lichtenhahn. Haar, Ingo (2002): Historiker im Nationalsozialismus. Deutsche Geschichtswissenschaft und der ‚Volkstumskampf‘ im Osten. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. Haar, Ingo/Michael Fahlbusch/Georg Iggers (Hg.) (2005): German Scholars and Ethnic Cleansing, 1919–1945. New York: Berghahn.
796
Bibliographie
Haas, Alois M. u. a. (1998): Mission et méditation. Hans Urs von Balthasar. Symposium à l’occasion du 90e anniversaire de sa naissance, Fribourg, 27–29 septembre 1995. Saint-Maurice: Ed. Saint-Augustin. Haas, Gaston (1997): ‚Wenn man gewusst hätte, was sich drüben im Reich abspielte …‘ 1941–1943. Was man in der Schweiz von der Judenvernichtung wusste, 2. Aufl. Basel/Frankfurt a. M.: Helbing & Lichtenhahn. Häberlin, Paul/Ludwig Binswanger (1997): Briefwechsel 1908–1960. Im Auftrag der Paul Häberlin-Gesellschaft hg. und kommentiert von Jeannine Luczak. Basel: Schwabe. Haefliger, Hans (1934/35): «Staat und Kirche in der Erneuerung», in: Zentralblatt, 94– 102. Haenel, Thomas (1982): Zur Geschichte der Psychiatrie. Gedanken zur allgemeinen und Basler Psychiatriegeschichte. Basel/Stuttgart: Birkhäuser. Haener, Ruth (1989): «Selbstdarstellung Basels im Zauber des Theaters», in: Guth/Hunger 1989, 124–127. Hänni, Otto (1934/35): «Berufsständische Ordnung. Schlusswort zur Zentraldiskussion des SS 1934», in: Zentralblatt, 52–56. Hagenbach, August (1940): «August Leonhard Bernoulli 1879–1939», in: Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 120, 413 f. Haguenau, Françoise (2003): «Charles Oberling (1895–1960). A Herald of Modern Oncology», in: International Journal of Surgical Pathology 11, H. 2, 109–115. Hahn, H. P. von/J. M. Jenkins (1994): «Hans Mislin and Experientia», in: Experientia 50, 321–323. Halbertsma, Marlite (1992): Wilhelm Pinder und die deutsche Kunstgeschichte. Worms: Wernersche Verlagsgesellschaft [Deutsche Ausgabe des niederländischen Originals von 1985]. Hallensleben, Barbara/Guido Vergauwen (Hg.) (2006): Letzte Haltungen. Hans Urs von Balthasars ‚Apokalypse der deutschen Seele‘ neu gelesen. Fribourg: Academic Press. Haller, Lea (2012): Cortison. Geschichte eines Hormons, 1900–1950. Zürich: Chronos. Hammerstein, Notker (2004): «Universitäten und Kriege im 20. Jahrhundert», in: Walter Rüegg (Hg.): Geschichte der Universität in Europa, Bd. 3: Vom 19. Jahrhundert zum Zweiten Weltkrieg (1800–1945). München: Beck, 515–545. Hammerstein, Notker (2012): Die Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Bd. 1: Von der Stiftungsuniversität zur staatlichen Hochschule 1914–1950. Göttingen: Wallstein. Hamway, Charlotte (2019): «Zwischen Forschungsdrang und Finanzierungszwang. Franz Altheim», in: Färber/Link 2019, 137–152. Hansen, Hans-Jürgen (2012): Gerold Schwarzenbach, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/ textes/d/D31668.php. Hansen, Hans-Jürgen (2012a): Hermann Staudinger, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/ textes/d/D44507.php. Hansen, Hans-Jürgen (2014): Richard Willstätter, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/text es/d/D31712.php. Hansen, Hans-Jürgen (2018): Paul Karrer, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D28863.php.
Literatur und publizierte Quellentexte
797
Hartshorne, Edward Yarnall Jr. (1937): The German Universities and National Socialism. London: Allen & Unwin. Haumann, Heiko/Erik Petry/Julia Richers (Hg.) (2008): Orte der Erinnerung. Menschen und Schauplätze in der Grenzregion Basel 1933–1945. Basel: Christoph Merian. Hausmann, Frank Rutger (1993): «Ernst Robert Curtius et Leo Spitzer. Deux romanistes face à la prise de pouvoir par les nationaux-socialistes», in: Hans-Manfred Bock/ Reinhart Meyer-Kalkus/Michel Trebitsch (Hg.): Entre Locarno et Vichy. Les relations culturelles franco-allemandes dans les années 1930. Paris: CNRS Editions, 343– 362. Hausmann, Frank Rutger (1994): «Von Leipzig über Chicago und Basel nach Berlin. Ein Schweizer Gelehrtenschicksal. Vier Briefe von Walther von Wartburg an Rudolf Hallig», in: Richard Baum u. a. (Hg.): Lingua et traditio. Geschichte der Sprachwissenschaft und der neueren Philologien. Festschrift für Hans Helmut Christmann zum 65. Geburtstag. Tübingen: Gunter Narr, 609–616. Hausmann, Frank-Rutger (1997): «Fritz Schalk und die Romanistik in Köln von 1945 bis 1980», in: Petra Boden/Rainer Rosenberg (Hg.): Deutsche Literaturwissenschaft 1945–1965. Fallstudien zu Institutionen, Diskursen, Personen. Berlin: AkademieVerlag, 35–60. Hausmann, Frank-Rutger (1998): ‚Deutsche Geisteswissenschaft‘ im Zweiten Weltkrieg. Die ‚Aktion Ritterbusch‘ (1940–1945). Dresden: Dresden University Press. Hausmann, Frank-Rutger (2000): ‚Vom Strudel der Ereignisse verschlungen‘. Deutsche Romanistik im ‚Dritten Reich‘. Frankfurt a. M.: Klostermann. Hausmann, Frank-Rutger (2002): ‚Auch im Krieg schweigen die Musen nicht‘. Die Deutschen Wissenschaftlichen Institute im Zweiten Weltkrieg, 2. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Hausmann, Frank-Rutger (2005): Fritz Schalk, in: Neue Deutsche Biographie 22, 551, verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/gnd118606379.html#ndbcontent. Hausmann, Frank-Rutger (2007): «English and Romance Studies in Germany’s Third Reich», in: Bialas/Rabinbach 2007, 341–364. Hausmann, Frank-Rutger (2008): «Wozu Fachgeschichte der Geisteswissenschaften im ‚Dritten Reich‘», in: Heftrig u .a. 2008, 3–24. Hausmann, Frank-Rutger (Hg.) (2015): Ernst Robert Curtius – Briefe aus einem halben Jahrhundert. Eine Auswahl. Baden-Baden: Valentin Koerner. Hausmann, Frank-Rutger (2016): Albert Béguin, in: Romanistenlexikon, http://lexikon. romanischestudien.de/index.php?title=B%C3%A9guin,_Albert. Hausmann, Frank-Rutger (2016a): Marcel Raymond, in: Romanistenlexikon, http://lexi kon.romanischestudien.de/index.php?title=Raymond,_Marcel. Hausmann, Frank-Rutger (2016b): Gerhard Hess, in: Romanistenlexikon, http://lexikon. romanischestudien.de/index.php?title=Hess,_Gerhard. Hausmann, Frank-Rutger (2016c): Joseph August Rüegg, in: Romanistenlexikon, http:// lexikon.romanischestudien.de/index.php?title=R%C3%BCegg,_Joseph_August. Hausmann, Frank-Rutger (Hg.) (2017): «Die politische Auseinandersetzung zwischen W. v. Wartburg und Johann Ulrich Hubschmied», zusammengestellt von Johannes
798
Bibliographie
Hubschmid, hg., eingeleitet und angemerkt von F.-R. Hausmann, in: Zeitschrift für romanische Philologie 133, No. 1, 1–29. Hedeberg, Hollis D. (1977): «Memorial to Rolf F. Rutsch 1902–1975», in: Geological Society of America, 1–7, https://www.geosociety.org//documents/gsa/memorials/v07/ Rutsch-RF.pdf. Hedinger, Christoph (1983): «Die Pathologischen Institute», in: Stadler 1983, 368–373. Heftrig, Ruth (2005): «Neues Bauen als deutscher ‚Nationalstil‘? Modernerezeption im ‚Dritten Reich‘ am Beispiel des Prozesses gegen Hans Weigert», in: Doll u. a. 2005, 119–137. Heftrig, Ruth/Olaf Peters/Barbara Schellewald (Hg.) (2008): Kunstgeschichte im ‚Dritten Reich‘. Theorien, Methoden, Praktiken. Berlin: Akademie-Verlag. Heftrig, Ruth/Olaf Peters/Barbara Schellewald (2008a): «Kunstgeschichte im ‚Dritten Reich‘. Einleitende Bemerkungen», in: Heftrig u. a. 2008, ix–xvi. Hehl, Ulrich von (2010): «In den Umbrüchen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Universität Leipzig vom Vorabend des Ersten bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, 1909–1945», in: Ulrich von Hehl/Günther Heydemann/Klaus Fitschen/Franz König (Hg.): Geschichte der Universität Leipzig 1409–2009, Bd. 3: Das zwanzigste Jahrhundert 1909–2009. Leipzig: Universitätsverlag, 15–329. Heiber, Helmut (1992): Universität unterm Hakenkreuz. Die Kapitulation der Hohen Schulen. Das Jahr 1933 und seine Themen, Bd. 1. München: Saur. Heini, Alexandra (2019): «‚Wir werden nicht ruhen, bis das Hakenkreuz über der Kuppel des Bundeshauses flattert!‘ Der Basler Nationalsozialist Ernst Leonhardt gegen den Schweizer Staat», in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 119, 35– 57. Heini, Alexandra (2020): «Nationalsozialisten und Kommunisten in Basel», in: Moser/ Heini 2020, 67–73. Heinimann, Felix (1945): Nomos und Physis. Herkunft und Bedeutung einer Antithese im griechischen Denken des 5. Jahrhunderts. Basel: Reinhardt. Heitz, Fritz (1942/43): «Rapport du semestre d’hiver 1942/43, Sektion Basel», in: Zentralblatt, 280–282. Heller, Daniel (2018): Eugen Bircher, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D5018. php. Henderson, Susan R. (2013): Building Culture. Ernst May and the New Frankfurt am Main Initiative, 1926–1931. New York: Peter Lang. Henrichs, Albert (1992): «Gott, Mensch, Tier. Antike Daseinsstruktur und religiöses Verhalten im Denken Karl Meulis», in: Graf 1992, 129–167. Henschen, Carl (1938): Der spontane Riss der Kniegelenksmenisken als Berufskrankheit der Bodenleger. Degeneration übernutzter Gewebe als Folge quantenphysikalischer Kernalterationen. Leipzig: Thieme. Herrmann, Ulrich (2016): «Bildung», in: Cancik/Groschopp/Wolf 2016, 141–149. Her⌥covici, Lucian-Zeev (2010): afran Family, in: The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, New York, http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Safran_Fami ly.
Literatur und publizierte Quellentexte
799
Herzog, Wilhelm (1932): Der Kampf einer Republik. Die Affäre Dreyfus. Dokumente und Tatsachen. Zürich: Europa-Verlag. Hesse, Hans (2001): Augen aus Auschwitz. Ein Lehrstück über nationalsozialistischen Rassenwahn und medizinische Forschungen. Der Fall Dr. Karin Magnussen. Essen: Klartext. Hetzer, Theodor (1929): Das deutsche Element in der italienischen Malerei des 16. Jahrhunderts. Berlin: Deutscher Kunstverlag. Hetzer, Theodor (1935): «Dürers deutsche Form», in: Rasse 2, H. 4, 134–148. Hetzer, Theodor (1935a): «Die schöpferische Vereinigung von Antike und Norden in der Hochrenaissance», in: Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung 11, 292–305. Hetzer, Theodor (1935b): Tizian, Geschichte seiner Farbe, Frankfurt a. M.: Klostermann. Heuer, Renate/Siegbert Wolf (Hg.) (1997): Die Juden der Frankfurter Universität. Frankfurt a. M.: Campus. Heusler, Andreas (1989): Andreas Heusler an Wilhelm Ranisch. Briefe aus den Jahren 1890–1940, in Zusammenarbeit mit Oskar Bandle hg. von Klaus Düwel und Heinrich Beck, mit einem Geleitwort von Hans Neumann. Basel/Frankfurt a. M.: Helbing & Lichtenhahn. Heusler, Karl (1942/43): «Die Zusammenkunft der Sektion Basel mit den polnischen internierten Studenten in Herisau», in: Zentralblatt, 474 f. Hilbold, Ilse (2022): Écrire Juliette Ernst. Bibliographie et sciences de l’Antiquité au XXe siècle. Basel: Schwabe. Hille, Nicola (2008): «‚Deutsche Kunstgeschichte‘ an einer ‚deutschen Universität‘. Die Reichsuniversität Strassburg als nationalsozialistische Frontuniversität und Hubert Schrades dortiger Karriereweg», in: Heftrig u. a. 2008, 87–102. Hirschfeld, Gerhard (1997): «Die Universität Leiden unter dem Nationalsozialismus», in: Geschichte und Gesellschaft 23, H. 4, 560–591. Histoire de l’Université de Neuchâtel, Bd. 3 (2002): L’Université, de sa fondation en 1909 au début des années soixante. Neuchâtel: Université de Neuchâtel/Editions Gilles Attinger. Höfflin, Georg (1942/43): «Jahresbericht des Vorstandes der Studentenschaft Basel für das Jahr 1942/43», in: Basler Studentenschaft, WS, H. 3, 71–79. Hofer, Hansjörg (1998): Völker, hört die Signale … Erinnerungen eines Basler Kommunisten. Basel: Pharos. Hoffmann, Dieter/Mark Walker (Hg.) (2011): ‚Fremde‘ Wissenschaftler im Dritten Reich. Die Debye-Affäre im Kontext. Göttingen: Wallstein. Hoffmann, Walter K. H. (1980): Vom Kolonialexperten zum Experten der Entwicklungszusammenarbeit. Acht Fallstudien zur Geschichte der Ausbildung von Fachkräften für Übersee in Deutschland und in der Schweiz. Saarbrücken/Fort Lauderdale: Breitenbach. Hofter, Mathias René (2012): «Ernst Buschor (1886–1961)», in: Brands 2012, 129–140. Holzapfel, Otto (1990): John Meier, in: Neue Deutsche Biographie 16, 643 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118732609.html#ndbcontent. Holzer, Vincent (2012): Hans Urs von Balthasar, 1905–1988. Paris: Les Éditions du Cerf.
800
Bibliographie
Hotz, Claude-Antoine, C.P. (1938/39): «Die politischen Einflüsse aus dem Ausland und unsere Abwehrmittel», in: Zentralblatt, 187–189. Hotz, Claude-Antoine, C.P. (1938/39a): «Rapport sur la discussion centrale de semestre d’hiver 1938/1939. Les influences politiques étrangères et nos moyens de défense», in: Zentralblatt, 281–288. Huber, Dorothee (2003): Das Kollegienhaus der Universität Basel, 2. Aufl. Bern: Gesellschaft für schweizerische Kunstgeschichte. Huber, Dorothee u. a. (Hg.) (1991): 50 Jahre Kollegienhaus der Universität Basel. Vorträge gehalten am 10. Juni 1989. Basel: Helbing & Lichtenhahn. Huber, Georg Leo/Karl Menzi (1959): Herkunft und Gestalt der Industriellen Chemie in Basel, hg. von der CIBA aus Anlass ihres 75jährigen Bestehens als Aktiengesellschaft. Olten/Lausanne: Urs Graf-Verlag. Huber, Katharina (2011): Eduard Hagenbach-Bischoff, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss. ch/textes/d/D14801.php. Huber, Max/Fritz Hauser (1931): Die schweizerische Schule. Referate von Prof. Dr. Max Huber und Regierungsrat Dr. F. Hauser gehalten am Schweizerischen Lehrertag in Basel, Juli 1931 (Kleine Schriften des Schweizerischen Lehrervereins 9). Huber, Paul (1955): «August Hagenbach-Aman 1871–1955», in: Verhandungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel 66, No. 1, 195–203. Huber, Paul (1960): «Neutronenphysik», in: H. Frauenfelder/O. Huber/P. Stähelin (Hg.): Beiträge zur Entwicklung der Physik. Festgabe zum 70. Geburtstag von Professor Paul Scherrer, 3. Februar 1960. Basel/Stuttgart: Birkhäuser, 75–82. Huber, Peter (1991): «Schweizer Spanienkämpfer in den Fängen des NKWD», in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 41, 335–353. Hublard, Marie-Jeanne (1957): «Albert Béguin à Bâle. Essais et témoignages. Albert Béguin. Étapes d’une pensée. Rencontres avec Albert Béguin», in: Les Cahiers du Rhône, Série blanche 96, XXX, décembre 1957. Neuchâtel: La Baconnière, 185–212. Hubler, Lucienne (2005): Charles Gilliard, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/ F31576.php. Hubler, Lucienne (2019): Ernst Tappolet, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 049667/2019-11-07/. Hübinger, Gangolf (2006): Gelehrte, Politik und Öffentlichkeit. Eine Intellektuellengeschichte. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. Hugger, Paul (2000): Hanns Bächtold-Stäubli, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 011486/2000-04-28/. Huizinga, Johan (1924): Erasmus, with an Introduction by the Editor (the translation from the Dutch manuscript has been made by Mr. F. Hopman of Leyden), New York/London: Charles Scribner. Huizinga, Johan (1936): Erasmus. Deutsch von Werner Kaegi. Basel: Schwabe [Neuausgabe anlässlich des 400. Todestags von Erasmus, im Vorwort als «kleine Ausgabe» bezeichnet.] Huizinga, Johan (1989–1991): Briefwisseling 1894–1945, 3 Bde., hg. von Léon Hanssen/ Wessel E. Krull/Anton von der Lem. Utrecht/Antwerpen/Veen: Tjeenk Willink.
Literatur und publizierte Quellentexte
801
Humbel, René/Jeremias H. R. Kägi/Huldrych M. Koelbing (1983): «Biochemie», in: Stadler 1983, 363–365. Hurch, Bernhard (2010): Leo Spitzer, in: Neue Deutsche Biographie 24, 722–724, verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/gnd118752138.html#ndbcontent. Illies, Joachim (1976): Das Geheimnis des Lebendigen. Leben und Werk des Biologen Adolf Portmann. München: Kindler. Im Hof, Ulrich (1940/41): «Semesterbericht der Sektion Basel vom Winter 1940/41», in: Zentralblatt, 297–299. Im Hof, Ulrich (1940/41a): «Die Sektion Basel an den C.P.», in: Zentralblatt, 400–402. Im Hof, Ulrich (1984): «Hohe Schule – Akademie – Universität. 1528 – 1805 – 1834 – 1984», in: Scandola 1984, 25–127. Imboden, Max (1935/36): «Was bedeutet der heutige Konflikt zwischen der alten und der jungen Generation?», in: Zentralblatt, 704–721. Imboden, Max (1967): «Professor Jacob Wackernagel zum Gedenken», in: National-Zeitung vom 19. Juli 1967. Ineichen, Robert (2002): Séverin Bays, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D41115.php. Irrlitz, Gerd (2008): Rechtsordnung und Ethik der Solidarität. Der Strafrechtler und Philosoph Arthur Baumgarten (Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Sonderband 22). Berlin: Akademie Verlag. Jaeger, Fritz (1936): Trockengrenzen in Algerien (Ergänzungsheft zu Petermanns Geographischen Mitteilungen 223). Gotha: J. Perthes. Jagust, Frederick (2012): «Paul Jacobsthal (1880–1957)», in: Brands 2012, 65–74. James, Alan/Bernhard Kettemann (Hg.) (1983): Dialect Phonology and Foreign Language Acquisition. Tübingen: Gunter Narr. Janner, Arminio (1942): «Ragioni di fede nell’ideale elvetico», in: Svizzera italiana 2, No. 8/9, 15. August 1942, 333–361. Janner, Arminio (1950): Arminio Janner 1886–1949. Gedenkworte seiner Freunde und Schüler. Basel: Zbinden. Janner, Sara (2012): Rudolf Wackernagel, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D27122.php. Janner, Sara (2013): Wilhelm Vischer-Heussler, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/ d/D14818.php. Jansen, Christian (1981): Der ‚Fall Gumbel‘ und die Heidelberger Universität 1924–32. Heidelberg; digitale Ausgabe, erstellt von Gabriele Dörflinger, Universitätsbibliothek Heidelberg 2012, http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/13154/1/jansen.pdf. Jansen, Christian (2018): «Krise und Verunsicherung in den deutschen Geisteswissenschaften durch Niederlage, Revolution und moderne Massengesellschaft», in: Steuernagel 2018, 17–27. Jaquier, Claire (2002): Albert Béguin, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D16022. php. J. J. (1940): «Ernst Tappolet 1870–1939», in: Vox romanica 5, 332–334. Joelson-Strohbach, Harry (2013): Oskar Reinhart, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/text es/d/D27755.php.
802
Bibliographie
John, Eckhard (2000): «‚Deutsche Musikwissenschaft‘. Musikforschung im ‚Dritten Reich‘», in: Gerhard 2000, 257–279. John, Eckhard u. a. (Hg.) (1991): Die Freiburger Universität in der Zeit des Nationalsozialismus. Freiburg i. Br.: Ploetz. Jost, W. (1939/40): «Semesterbericht Basel», in: Zentralblatt, 274–276. Jucker, Benedict (1933/34): «Bericht über das Sommersemester 1933 in Basel», in: Zentralblatt, 56 f. Jütersonke, Oliver (2010): Morgenthau, Law and Realism. Cambridge UK: University Press. Jung, Franz (1975): «Biographisches Nachwort», in: Karl Meuli, Gesammelte Schriften, Bd. 2, hg. von Thomas Gelzer. Basel: Schwabe, 1153–1209. Jung, Michael (2020): Literaturübersicht Hochschulen im Nationalsozialismus (Stand November 2020), https://www.uni-hannover.de/fileadmin/luh/content/webredaktion/uni versitaet/geschichte/literaturuebersicht.pdf. Jurt, Joseph (1973): «Das kritische Denken Albert Béguins», in: Schweizer Rundschau, Juli/August, 281–287. Jurt, Joseph (1995): Das literarische Feld. Das Konzept Pierre Bourdieus in Theorie und Praxis. Darmstadt: WBG. Jurt, Joseph (1995a): «Ernst Robert Curtius and the Position of the Intellectual in German Society», in: Journal of European Studies 25, 1–16. Jurt, Joseph (1995b): «Ernst Robert Curtius et le champ universitaire allemand», in: Centre d’études et de recherches allemandes et autrichiennes contemporaines, Chroniques allemandes 4, 155–176. Jurt, Joseph (1997): «Seinsgebundenheit des Denkens oder Kontinuität des Zeitlosen? Zu einer Untersuchung von Dirk Hoeges über die Curtius-Mannheim-Debatte», in: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 234, 55–65. Jurt, Joseph (2008): Bourdieu. Stuttgart: Reclam. Jurt, Joseph (2013): Genfer Schule, in: Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe, hg. von Ansgar Nünning, 5. Aufl. Stuttgart/Weimar: Metzler, 266 f. Jurt, Joseph (2018): «Die Anregungen der deutschen Geistesgeschichte für die École de Genève im Kontext der romanistischen Fachgeschichte», in: Wolfgang Asholt (Hg.): Engagement und Diversität. Frank-Rutger Hausmann zum 75. Geburtstag (Romanische Studien, Beiheft 4). München: AVM.edition, 266–283. K. M. (1945): «Professor Peter von der Mühll zum 60. Geburtstag, 1. August 1945», in: Basler Nachrichten vom 31. Juli 1945. K. Wd. (1960): «Zum Tode von Professor Hermann O. L. Fischer», in: Basler Nachrichten vom 17. März 1960. Kägi, Paul (1965): Genesis des historischen Materialismus. Wien u. a.: Europa-Verlag. Kaegi, Werner (1933/34): «Nachruf auf Prof. E. Dürr», in: Neue Schweizer Rundschau 1, 723. Kaegi, Werner (1938): «Der Typus des Kleinstaates im europäischen Denken», zuerst in: Neue Schweizer Rundschau, September bis November 1938, später in: Kaegi 1942, 249–314.
Literatur und publizierte Quellentexte
803
Kaegi, Werner (1940): «Die Entstehung der Nationen», SA aus: Neue Schweizer Rundschau, November 1940. Kaegi, Werner (1940a): «Die Rheingrenze in der Geschichte Alemanniens, Vortrag vor der Ortsgruppe Basel der Neuen Helvetischen Gesellschaft im Frühling 1939», zuerst in: Neue Schweizer Rundschau, April 1940, später in: Kaegi 1942, 39–76. Kaegi, Werner (1942): Historische Meditationen I. Zürich: Fretz & Wasmuth. Kaegi, Werner (1946): Historische Meditationen II. Zürich: Fretz & Wasmuth. Kaegi, Werner (1959): Humanismus der Gegenwart. Eine Rede. Zürich: Artemis Verlag. Kaegi, Werner (1994): Historische Meditationen III, eingeleitet und hg. von René Teuteberg. Basel: Schwabe. Kaiser, Thomas O. H. (2014): Eleutheria, Profile der Freiheit. Norderstedt: Books on Demand. Kaiser, Willi (1982): Leben und Werk des Basler Psychiaters und Psychoanalytikers Hans Christoffel (1888–1959). Zürich: Juris. Kaiser, Wolfgang (1991): «Ein Streifzug durch die Geschichte der Kunststoffe. Auf der Suche nach Schweizer Spuren», in: Ferrum: Nachrichten aus der Eisenbibliothek, Stiftung der Georg Fischer AG 63, 40–45, verfügbar unter: https://www.e-periodica.ch/ digbib/view?pid=fer-002:1991:63::99#44. Kalinna, Hermann E. J. (2009): War Karl Barth ‚politisch einzigartig wach‘? Über Versagen politischer Urteilskraft. Berlin: Lit. Kambas, Chrysoulla (1983): «Fritz Lieb – Walter Benjamin – Karl Barth», in: Jacob Taubes (Hg.): Der Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen (Religionstheorie und politische Theologie 1). München: W. Fink, F. Schöningh, 263–291. Kamm, Peter (1977/1981): Paul Häberlin Leben und Werk, Bd. 1: Die Lehr- und Wanderjahre (1878–1922); Bd. 2: Die Meisterzeit (1922–1960). Zürich: Schweizer Spiegel. Kanyar Becker, Helena (2016): Fritz Lieb, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D10735.php. Kapahu, William K. K. (2016): «Walther Eichrodt, His Times and His Theology», in: Stanley Porter/Sean A. Adams (Hg.): Pillars in the History of Biblical Interpretation, Bd. 1: Prevailing Methods Before 1980, Hamilton: Mac Master Divinity Press, 367– 386. Kapferer, Norbert (2001): Die Nazifizierung der Philosophie an der Universität Breslau 1933–1945. Münster: Lit. Karafyllis, Nicole Christine (2015): Willy Moog (1888–1935), ein Philosophenleben. Freiburg/München: Karl Alber. Karnetzki, Manfred/Karl-Johann Rese (Hg.) (1992): Fritz Lieb – ein europäischer Christ und Sozialist. Eine Dokumentation der Evangelischen Akademie Berlin im Evangelischen Bildungswerk. Berlin: Evangelische Akademie. [Katalog] Elsa Mahler 1882–1970 (2011): Die erste Professorin der Universität Basel und ihre slavistisch-volkskundlichen Sammlungen. Ausstellung in der Universitätsbibliothek Basel vom 17.9. bis 24. 11. 2011. Ausstellungstexte und Photographien. Kuratierung durch den Fachbereich Osteuropa der Universität Basel. Basel: Universitätsbibliothek [zitiert als «Katalog»]
804
Bibliographie
Kaufmann-Heinimann, Annemarie (2012): Geschichte der Klassischen Archäologie an der Universität Basel, in: Knochen, Scherben und Skulpturen. 100 Jahre Archäologie an der Universität Basel, 11–24, verfügbar unter: https://klassarch.philhist.unibas.ch/ fileadmin/user_upload/klassarch/Fachbereich/Geschichte/Geschichte_KlassArch.pdf. Kaufmann, Christian (2000): «Felix Speiser’s Fletched Arrow. A Paradigm Shift from Physical Anthropology to Art Styles», in: Michael O’Hanlon/Robert L. Welsch (Hg.): Hunting the Gatherers. Ethnographic Collectors, Agents and Agency in Melanesia, 1870s–1930s. New York/Oxford: Berghahn Books, 203–226. Kaufmann, Rudolf (1956): «Paul Ganz (1872–1954)», in: Basler Jahrbuch, 72–85. Keiser, Fred (1966): Eduard Handschin, in: Neue Deutsche Biographie 7, 611, verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd134120302.html#ndbcontent. Keller, Franziska (1997): Oberst Gustav Däniker. Aufstieg und Fall eines Schweizer Berufsoffiziers. Zürich: Thesis. Keller, Stefan A. (2009): Im Gebiet des Unneutralen. Schweizerische Buchzensur im Zweiten Weltkrieg zwischen Nationalsozialismus und Geistiger Landesverteidigung. Zürich: Chronos. Kershaw, Ian (1997): Qu’est-ce que le nazisme? Problèmes et perspectives d’interprétation. Paris: Gallimard. Kersten, Joachim (2015): «In vino dignitas. Der Chevalier und die Comtesse», in: Lucas Burkart/Joachim Kersten/Ulrich Raulff/Hartwig von Bernstorff/Achatz von Müller (Hg.): Mythen, Körper, Bilder. Ernst Kantorowicz zwischen Historismus, Emigration und Erneuerung der Geisteswissenschaften. Göttingen: Wallstein, 103–123. Kessler, Nicolas (2001): Histoire politique de la Jeune Droite (1929–1942). Une révolution conservatrice à la française. Paris: L’Harmattan. Keupp, Jan (2013): Wolfram von den Steinen, in: Neue Deutsche Biographie 25, 176 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd117252077.html#ndbcon tent. Kienle, Markus (1998): Das Konzentrationslager Heuberg bei Stetten am kalten Markt (K & O Wissenschaft 1). Ulm u. a.: Klemm & Oelschläger. https://de.wikipedia.org/wiki/ Lager_Heuberg#Konzentrationslager_Heuberg. Kieser, Hans-Lukas (2008): Fritz Meier, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/044646/ 2008-10-22/. King, Colin Guthrie/Roberto Lo Presti (Hg.) (2017): Werner Jaeger. Wissenschaft, Bildung, Politik. Berlin/Boston: de Gruyter. Kirnbauer, Martin (2008): «‚Tout le monde connaît la Schola‘ – eine Spurensuche zur Vorgeschichte der Schola Cantorum Basiliensis», in: Basler Jahrbuch für Historische Musikpraxis 32, 145–157. Kirnbauer, Martin/Heidy Zimmermann (2000): Wissenschaft in ‚keimfreier Umgebung‘? Musikforschung in Basel 1900–1960, in: Gerhard 2000, 321–346. Kleibert, Kristin (2010): Die Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin im Umbruch. Die Jahre 1948 bis 1951 (Berliner Juristische Universitätsschriften – Grundlagen des Rechts 50). Berlin: BWV.
Literatur und publizierte Quellentexte
805
Klenner, Hermann/Gerhard Oberkofler (2003): Arthur Baumgarten (1884–1966), Rechtsphilosoph und Kommunist. Daten und Dokumente zu seiner Entwicklung. Innsbruck u. a.: StudienVerlag. Klingemann, Carsten (2001): «Eine vergleichende Betrachtung der NS-Wissenschaftspolitik gegenüber Altertums- und Sozialwissenschaften», in: Näf 2001, 181–202. Kniazeva, Janna (Hg.) (2011): Jacques Handschin in Russland. Basel: Schwabe. Knickmann, Hanne (2000): «Eduard Berend (1883–1973)», in: Christoph König/HansHarald Müller/Werner Röcke (Hg.): Wissenschaftsgeschichte der Germanistik in Porträts. Berlin/New York: de Gruyter, 176–179. Knigge, Jobst C. (2016): Werner Graf von der Schulenburg – Kulturvermittler zwischen Italien und Deutschland. Berlin: Humboldt-Universität, verfügbar unter: http://dx. doi.org/10.18452/13657; https://edoc.hu-berlin.de/citations/bibtex/18452-14309.bib. Knoch, Habbo (2013): «Wissenschaft und Führerprinzip. Das Jubiläum der Georgia Augusta von 1937», in: Gerd Lüer/Horst Kern (Hg.): Tradition – Autonomie – Innovation. Göttinger Debatten zu universitären Standortbestimmungen. Göttingen: Wallstein, 145–170. Knowles, Chantal (2000): «Reverse Trajectories. Beatrice Blackwood as Collector and Anthropologist», in: Michael O’Hanlon/Robert L. Welsch (Hg.): Hunting the Gatherers. Ethnographic Collectors, Agents and Agency in Melanesia, 1870s–1930s. New York/Oxford: Berghahn Books, 251–271. Knuchel, E.F. (1937): «Nun tut sich dem Deuter und Streiter der dunkle Schoss der geliebten Muttererde auf». Nachruf, in: Basler Nachrichten vom 15. Februar 1937. Kocher, Hermann (1996): ‚Rationierte Menschlichkeit‘. Schweizerischer Protestantismus im Spannungsfeld von Flüchtlingsnot und öffentlicher Flüchtlingspolitik der Schweiz 1933–1948. Zürich: Chronos. Kocher, Hermann (2020): Rudolf Grob, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D10642.php. Kocher, Hermann (2007): Alphons Koechlin, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D9862.php. Kocher, Hermann (2009): Alfred de Quervain, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/ d/D10791.php. Köberle, Adolf (1929): Rechtfertigung und Heiligung, Leipzig (Diss.). Köberle, Adolf (1933): «Zu Emil Brunners Ethik», in: Kirchenblatt für die reformierte Schweiz, 8–12. Koechlin, Alphons (1944): Ansprachen gehalten an der Trauerfeier für Professor Dr. iur. Robert Haab, geboren den 1. Mai 1893, gestorben den 28. Januar 1944, am Montag, den 31. Januar 1944 in der Martinskirche zu Basel und am Dienstag, den 1. Februar 1944 in der Kapelle des Friedhofes Manegg zu Zürich (Privatdruck). König, Barbara (2011): Heini Hediger, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/032084/ 2011-01-06/. König, Christoph (2003): Theodor Frings, in: Internationales Germanistenlexikon 1800– 1950, Bd. 1. Berlin/New York: de Gruyter, 528–531. König, Christoph/Hans-Harald Müller/Werner Röcke (Hg.) (2000): Wissenschaftsgeschichte der Germanistik in Porträts. Berlin/New York: de Gruyter.
806
Bibliographie
König, Mario (2016): Besichtigung einer Weltindustrie – 1859–2016 (Chemie und Pharma in Basel, Bd. 1, hg. von Georg Kreis und Beat von Wartburg). Basel: Christoph Merian. Königs, Diemuth (1988): Die Entwicklung des Fachs ‚Alte Geschichte‘ an der Universität Basel im 20. Jahrhundert. Basel: Lizentiatsarbeit, Seminar für Alte Geschichte der Universität (unveröff.). Königs, Diemuth (1995): Joseph Vogt. Ein Althistoriker in der Weimarer Republik und im Dritten Reich. Basel: Helbing & Lichtenhahn. Königs, Diemuth (2010): «Die Entwicklung des Faches ‚Alte Geschichte‘ an der Universität Basel im 20. Jahrhundert», in: Leonhard Burckhardt (Hg.): Das Seminar für alte Geschichte in Basel 1934–2007. Basel: Selbstverlag, 21-51 [Wiederabdruck aus: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 90, 1990, 193–228]. Königseder, Karl (1995): «Aby Warburg im Bellevue», in: Robert Galitz/Brita Reimers (Hg.): Aby M. Warburg, ‚Ekstatische Nymphe … trauernder Flussgott‘, Portrait eines Gelehrten (Schriftenreihe der Hamburgischen Kulturstiftung 2). Hamburg: Dölling und Galitz, 74–103. Köse, Yavuz (Hg.) (2016): Osmanen in Hamburg. Eine Beziehungsgeschichte zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Hamburg: Hamburg University Press. Koller, Guido (2018): Fluchtort Schweiz. Schweizerische Flüchtlingspolitik (1933–1945) und ihre Nachgeschichte. Stuttgart: Kohlhammer. Koller, Guido (2020): «Humaner als Bern? Basel und die Flüchtlinge – eine Nachgeschichte», in: Moser/Heini 2020, 49–57. Kolod, Michael (1982): «Städelschule – Skizze ihrer Geschichte», in: Verein 1982, 4–25. Konopik, Nelly (1959): Ludwig Ebert, in: Neue Deutsche Biographie 4, 258, verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd116332409.html#ndbcontent. Koziolek, Helmut (1985): «Arthur Baumgarten – Freund des neuen Russland. Fazit einer Reise in die Sowjetunion 1935», in: Poppe/Weichelt 1985, 24–28. Kraft, Dieter (1982): «Israel in der Theologie Karl Barths», in: Weißenseer Blätter 3, 9–21. Krayer, Paul (1949/41): «Hütet Euch am Morgarten. Nachträgliche Gedanken zur Zentraldiskussion», in: Zentralblatt, 268–274 Kreis, Georg (1978): «‚Entartete Kunst‘ in Basel. Eine Chronik ausserordentlicher Ankäufe im Jahre 1939», in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 78, 163– 189. Kreis, Georg (1986): Die Universität Basel 1960–1985. Basel: Schwabe. Kreis, Georg (1990): ‚Entartete Kunst‘ für Basel – die Herausforderung von 1939. Basel: Wiese Verlag. Kreis, Georg (2000): «Geschichte zwischen Wissenschaft und Politik. Zum Engagement der Schweizer Historiker 1933–1945», in: Revue d’Allemagne et des Pays de langue allemande 32, 365–378. Kreis, Georg (2002): «Edgar Bonjour und seine Zeit», in: Georg Kreis (Hg.): Zeitbedingtheit – Zeitbeständigkeit. Professoren-Persönlichkeiten der Universität Basel. Basel: Schwabe, 27–44. Kreis, Georg (2004): Edgar Bonjour, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/027020/ 2004-06-07/.
Literatur und publizierte Quellentexte
807
Kreis, Georg (2010): Orte des Wissens. Die Entwicklung der Universität Basel entlang ihrer Bauten. Basel: Christoph Merian. Kreis, Georg (2016): «Vergabungswesen, Sponsoring und Mäzenatentum. Förderung von der Kultur über den Sport bis zur Politik», in: Georg Kreis/Beat von Wartburg (Hg.): Wechselwirkungen einer Beziehung – Aspekte und Materialien (Chemie und Pharma in Basel, Bd. 2). Basel: Christoph Merian, 296–309. Kreis, Georg (2020): «Basel in seiner doppelten Einbettung», in: Moser/Heini 2020, 41– 46. Kreis, Georg/Beat von Wartburg (Hg.) (2000): Basel – Geschichte einer städtischen Gesellschaft. Basel: Christoph Merian. Kro� ger, Ute/Peter Exinger (1998): ‚In welchen Zeiten leben wir!‘ Das Schauspielhaus Zürich 1938–1998. Zürich: Limmat. Kroll, Frank-Lothar (2008): Intellektueller Widerstand im Dritten Reich. Heinrich Lützeler und der Nationalsozialismus. Berlin: Duncker & Humblot. Krüger Sasz, Susen (2008): «‚Nordische Kunst‘. Die Bedeutung des Begriffes während des Nationalsozialismus», in: Heftrig u. a. 2008, 224–244. Krüll, Claudia (1978): «Hermann Staudinger. Das Zeitalter der Kunststoffe», in: Kurt Fassmann u. a. (Hg.): Die Grossen der Weltgeschichte, Bd. 11: Einstein bis King. Zürich: Kindler, 222–241. Krumm, Christian (2011): Johan Huizinga, Deutschland und die Deutschen. Begegnung und Auseinandersetzung mit dem Nachbarn. Münster: Waxmann. Kühsel, Thorsten (2008): «Der ‚Preussische Stil‘ – Arthur Moeller van den Brucks Stilkonstruktion. Anmerkungen zu deren Rolle in der Kunstpolitik und der Kunstgeschichte zwischen 1916 und 1945», in: Heftrig u. a. 2008, 205–223. Kümmel, Werner Georg (1957): Martin Dibelius, in: Neue Deutsche Biographie 3, 632, verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118671820.html#ndbcon tent. Künneth, Walter (1935): Antwort auf den Mythus. Die Entscheidung zwischen dem nordischen Mythus und dem biblischen Christus. Berlin: Wichern. Künzli, Arnold (1999): «Ursprung ist das Ziel», in: Pestalozzi/Stingelin 1999, 45–55. Kuhn, Hans (1984): «Leben und Werk von Werner Kuhn 1899–1963», in: Chimia 38, No. 6, 191–211. Kuhn, Helmut (1966): Paul Häberlin, in: Neue Deutsche Biographie 7, 421 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118700030.html#ndbcontent. Kuhn, Thomas K. (1997): «Theologisch-historische Leidenschaften. Paul Wernle (1872– 1939). Eine biographische Skizze», in: Andreas Urs Sommer (Hg.): Im Spannungsfeld von Gott und Welt. Beiträge zur Geschichte und Gegenwart des Frey-Grynaeischen Instituts in Basel 1747–1997. Basel: Schwabe, 135–158. Kuhn, Thomas K. (2010): Adolf Köberle, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D10709.php. Kuhn, Thomas K. (2011): Johann Jakob Stamm, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/ d/D10854.php. Kuhn, Thomas K. (2012): Ernst Staehelin, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D10851.php.
808
Bibliographie
Kuhn, Thomas K. (2012a): Eduard Thurneysen, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/ d/D10875.php. Kuhn, Thomas K. (2013): Johannes Wendland, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/ d/D10907.php. Kuhn, Thomas K. (2016): Paul Wernle, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D10912.php. Kuhn, Thomas K. (Hg.) (2016a): Paul Wernle und Eduard Thurneysen. Briefwechsel 1909–1934. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. Kuhn, Werner (1962): «Georg Bredig», in: Chemische Berichte 95, xlvii–lxiii. Kuhr, Olaf (2010): Johannes Oekolampad, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D10779.php. Kundert, Werner, unter Mitarbeit von Ulrich Im Hof (1969): «Geschichte des Schweizerischen Zofingervereins im Überblick dargestellt», in: Der Schweizerische Zofingerverein 1819–1969. Eine Darstellung hg. vom Schweizerischen Zofingerverein und vom Schweizerischen Altzofingerverein. Bern: K. J. Wyss Erben, 13–133. Kunicki, Wojciech (2002): Germanistik in Breslau 1918–1945. Dresden: Thelem. Kunow, Fabian (2009): «Trotzkis Perspektive auf den Faschismus», in: Antifa Infoblatt 84, H. 3, 38–41, verfügbar unter: http://faschismustheorie.de/wp-content/uploads/2011/ 08/aib84-38-41.pdf. Kunsthistorisches Institut in Florenz – Geschichte, https://www.khi.fi.it/de/institut/ geschichte.php. Kunz, Roland (2011): Geschichte der Basler Juristischen Fakultät 1835–2010. Basel: Schwabe. Kunze, Rolf-Ulrich (2004): Ernst Rabel und das Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht 1926–1945. Göttingen: Wallstein. Kurz, Martin (2010): Rudolf Nietzki, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D45058. php. Kuschel, Karl-Josef (2015): Martin Buber – seine Herausforderung an das Christentum. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. Labhardt, Alfred (1935): Die natürliche Rolle der Frau im Menschheitsproblem und ihre Beeinflussung durch die Kultur. Rektoratsrede, gehalten am 16. November 1934. Basel: Helbing & Lichtenhahn. Labhardt, Alfred (1939): «Geschichte der Kollegiengebäude der Universität Basel 1460– 1936. Im Auftrage der Regenz der Universität verfasst», in: Festschrift der Universität Basel zur Einweihung des neuen Kollegienhauses am 10. Juni 1939. Basel: BrausRiggenbach, 4–91. Labhardt, Alfred (1993): «Die Glaubenskrise betrifft heute sämtliche Kirchen. Interview mit Oscar Cullmann», in: Basler Zeitung vom 2. April 1993. Lambelet, Jean-Christian (2000): Evaluation critique du Rapport Bergier ‚La Suisse et les réfugiés à l’époque du national-socialisme‘ et nouvelle analyse de la question (Cahiers de recherches économiques 2000.04). Lausanne: École des HEC/DEEP. Landfester, Manfred (1995): «Die Naumburger Tagung ‚Das Problem des Klassischen und die Antike‘ (1930). Der Klassikbegriff Werner Jaegers. Seine Voraussetzung und seine Wirkung», in: Flashar 1995, 11–40.
Literatur und publizierte Quellentexte
809
Landfester, Manfred (2017): «Werner Jaegers Konzepte von Wissenschaft und Bildung als Ausdruck des Zeitgeistes», in: King/Presti 2017, 5–50. Landmann, Michael (1950): «Herman Schmalenbach 1885–1950», in: Studia Philosophica 10, 1–4. Landmann, Michael (1982): «Hermann Schmalenbach 1885–1950», in: Michael Landmann, Figuren um Stefan George. Zehn Porträts, Amsterdam: Castrum Peregrini Presse, 80–87. Landoldt, Niklaus (2002): Emil Barell, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D29883.php. Langewiesche, Dieter (Hg.) (1997): Universitäten im nationalsozialistisch beherrschten Europa (Geschichte und Gesellschaft 23.4). Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht. Lanz, Hanspeter (2006): Fritz Gysin, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/030214/ 2006-03-16/. Lapaire, Claude (2002): Wilhelm Barth, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/027689/ 2002-01-11/. Laubscher, Hans (1990): «Nachruf Peter Bearth», in: uni nova vom 27. Februar 1990. Laur-Belart, Rudolf (1952): «Worte der Erinnerung an Prof. Dr. Felix Stähelin (1873– 1952)», in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 51, 5–8. Lausberg, Heinrich (1957): Ernst Robert Curtius, in: Neue Deutsche Biographie 3, 447 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118523058.html#ndbcon tent. Leaman, George/Gerd Simon (1993): Die Kant-Studien im Dritten Reich. Korrigierte Fassung, https://homepages.uni-tuebingen.de//gerd.simon/ks.pdf. Leander, Harriet (1982): Verzeichnis des Nachlasses von Heinrich Barth auf der Universitätsbibliothek Basel. Basel: Diplomarbeit (unveröff.). Ledermann, François (2006): Josef Anton Häfliger, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/text es/d/D43660.php. Ledermann, François (2009): Paul Casparis, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D43655.php. Ledermann, François (2015): Heinrich Zörnig, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/ d/D43667.php. Lehn, Marcel vom (2012): Westdeutsche und italienische Historiker als Intellektuelle? Ihr Umgang mit Nationalsozialismus und Faschismus in den Massenmedien (1943/45– 1960). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Leibniz-Institut für Länderkunde, Archiv für Geographie: Findbuch Walter Behrmann, https://leibniz-ifl.de/fileadmin/Redaktion/Bibliothek_Archiv/Archiv_Findbücher_PDF/ Behrmann.pdf. Leitgeb, Hanna (1994): Der ausgezeichnete Autor. Städtische Literaturpreise und Kulturpolitik in Deutschland 1926–1971. Berlin/New York: de Gruyter. Lengwiler, Martin (2010): «Der lange Schatten der Historischen Schule. Die Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel», verfügbar unter: https://uni geschichte.unibas.ch/fileadmin/user_upload/pdf/Lengwiler_Entwicklung_Wirtschafts wissenschaften.pdf.
810
Bibliographie
Lenzin, Danièle (1996): ‚Foklore vivat, crescat, floreat.‘ Über die Anfänge der wissenschaftlichen Volkskunde in der Schweiz. Zürich: Volkskundliches Seminar der Universität. Leo, Paul Christopher (2010): Wilhelm Groh, erster Rektor der Ruperto-Carolina in der NS-Zeit. Hamburg: Kovac. Lerner, Robert E. (2017): Ernst Kantorowicz. A Life. Princeton/Oxford: Princeton University Press. Lessing, Eckhard (2004): Geschichte der deutschsprachigen evangelischen Theologie von Albrecht Ritschl bis zur Gegenwart, Bd. 2: 1918-1945. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Leuenberger, Martin (2020): Robert Boehringer, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 029884/2020-01-09/. Lewin, Nicholas Adam (2009): Jung on War, Politics and Nazi Germany. Exploring the Theory of Archetypes and the Collective Unconscious. London: Karnac. Lieb, Fritz (1938): «Der ‚Mythos‘ des nationalsozialistischen Nihilismus», in: Emil Julius Gumbel (Hg.): Freie Wissenschaft. Ein Sammelbuch aus der deutschen Emigration. Strasbourg: Sebastian Brant Verlag, 90–110. Lieb, Fritz (1939): «Warum wir schiessen müssen! Offener Brief an Ragaz», in: Schweizer Zeitung am Sonntag. Demokratie im Angriff, vom 26. August 1939. Liebl, Elsbeth (2005): Paul Geiger, in HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/042248/200508-18/. Liebold, Sebastian (2008): Starkes Frankreich, instabiles Deutschland. Kulturstudien von Curtius/Bergstraesser und Vermeil zwischen Versailler Frieden und Berliner Notverordnungen. Berlin: Lit. Liechtenhan, Rudolf (1936): «Die politische Hoffnung des Erasmus und ihr Zusammenbruch», in: Gedenkschrift zum 400. Todestage des Erasmus von Rotterdam, hg. von der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel. Basel: Braus-Riggenbach, 144–165. Liechtenhan, Rudolf (1936a): «Vom Kampf um die theologische Fakultät Basel», in: Kirchenblatt für die reformierte Schweiz vom 10. Dezember 1936, 388–390. Lienhard, Luc (2007): Monika Meyer-Holzapfel, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/ d/D28881.php. Linder, Rudolf (1966): «Pfarrer Alphons Koechlin-Thurneysen (1885–1965)», in: Basler Stadtbuch 1966, 26–33. Lindt, Andreas (1941/42): «‚Anpassung‘ und Neutralitätspolitik», in: Zentralblatt, 282– 289. Lindt, Andreas (1941/42a): «Zofingia und die Flüchtlingsfrage», in: Zentralblatt, 659–663. Lindt, Andreas (1969): «Zofingerideale, christliches Bewusstsein und reformierte Theologie 1819–1918», in: Der Schweizerische Zofingerverein 1819–1969. Eine Darstellung, hg. vom Schweizerischen Zofingerverein und vom Schweizerischen Altzofingerverein. Bern: K. J. Wyss Erben, 194–212. Link, Fabian (2016): «Gegenwarten des Mittelalters vom späten 18. bis ins 20. Jahrhundert. Politisierung, Populärkultur und die Kulturwissenschaften», in: GWU 67, 509– 522.
Literatur und publizierte Quellentexte
811
Link, Fabian (2016a): «PEUPLE (Volk) et RACE (Rasse)», in: Olivier Christin (Hg.), Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines, Bd. 2. Paris: Éditions Métailié, 71–85. Link, Fabian (2019): «Hektor Ammann’s völkisch Idea of Medieval Economics and the Place of Switzerland in Nazi-dominated Europe», in: Björkman u. a. 2019, 134–149. Linne, Karsten (2008): Deutschland jenseits des Aequators? Die NS-Kolonialplanungen für Afrika. Berlin: Ch. Links. Linnemann, Kai Arne (2002): Das Erbe der Ostforschung. Zur Rolle Göttingens in der Geschichtswissenschaft der Nachkriegszeit. Marburg: Tectum. Linsmayer, Charles (2010): Walter Muschg, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 006446/2010-09-02/. Lippert, Herbert (1973): «Titus W.-H. Ritter von Lanz, 1897–1967», in: Acta Anatomica 84, 465–474. List, Friedrich (1930): Das nationale System der politischen Ökonomie: Ausgabe letzter Hand, vermehrt um einen Anhang, hg. von Artur Sommer (Schriften, Reden, Briefe, Bd. 6). Berlin: Reimar Hobbing. Liver, Ricarda (2013): Jakob Jud, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D42192.php. Liver, Ricarda (2015): Karl Jaberg, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D42191. php. Lochman, Jan M. (2002): «Theology and Cultural Contexts», in: Frank D. Macchia/Paul S. Chung (Hg.): Theology between East and West. A Radical Heritage. Eugene OR: Cascade Books, 5–21. Lösch, Anna Maria Gräfin von (1999): Der nackte Geist. Die Juristische Fakultät der Berliner Universität im Umbruch 1933. Tübingen: Mohr Siebeck. Löwe, Matthias/Gregor Streim (Hg.) (2017): ‚Humanismus‘ in der Krise. Debatten und Diskurse zwischen Weimarer Republik und geteiltem Deutschland. Berlin/Boston: de Gruyter. Loewenich, Walther von (1979): Erlebte Theologie. Begegnungen, Erfahrungen, Erwägungen. München: Claudius-Verlag. Loos, Erich (1981): «Fritz Schalk zum Gedenken», in: Iberoromania 14, 143–145. Losemann, Volker (1980): «Programme deutscher Althistoriker in der ‚Machtergreifungsphase‘», in: Losemann 2017, 16 f. Losemann, Volker (1995): «Die Altertumswissenschaften in der Zeit des Nationalsozialismus», in: Losemann 2017, 101–105. Losemann, Volker (1998): «Die Dorier im Deutschland der dreissiger und vierziger Jahre», in: Losemann 2017, 107–136. Losemann, Volker (2007): «Classics in the Second World War», in: Losemann 2017, 213– 236. Losemann, Volker (2017): Klio und die Nationalsozialisten. Gesammelte Schriften zur Wissenschafts- und Rezeptionsgeschichte von Volker Losemann, hg. von Claudia Deglau, Patrick Reinhard und Kai Ruffing. Wiesbaden: Harrassowitz. Lotz, Ernst Felix (1944): «Das ‚Mitteilungsblatt‘ der Basler Studentenschaft 1918-1943», in: Basler Studentenschaft, SS, H. 5, 194–200.
812
Bibliographie
Loubet del Bayle, Jean-Louis (1969): Les non-conformistes des années 30. Une tentative de renouvellement de la pensée politique française. Toulouse: Thèse doctorat en droit (1968). Paris: du Seuil. Luck, Rätus (2010): Max Rychner, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D12242. php. Ludwig, Carl (1957): Die Flüchtlingspolitik der Schweiz in den Jahren 1933 bis 1955. Bericht an den Bundesrat zuhanden der eidgenössischen Räte, Bern. Ludwig, Eugen (2005): Memoiren (Erzählte Erfahrung. Alumni der Medizinischen Fakultät Basel, Bd. 1, hg. von Michael J. Mihatsch und René Fröscher). Basel: Privatdruck. Ludwig, Walther (1984): «Amtsenthebung und Emigration klassischer Philologen», in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 7, 161–178. Lüschen, Günther/Gregory P. Stone (Hg.) (1977): Herman Schmalenbach on Society and Experience. Chicago/London: University of Chicago Press. Lütteken, Laurenz (2000): «Das Musikwerk im Spannungsfeld von ‚Ausdruck‘ und ‚Erleben‘. Heinrich Besselers musikhistoriographischer Ansatz», in: Gerhard 2000, 213– 232. Luks, Leonid (1985): Entstehung der kommunistischen Faschismustheorie. Die Auseinandersetzung der Komintern mit Faschismus und Nationalsozialismus 1921–1935. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt. Luterbacher, H. P. (1986): «Manfred Reichel», in: Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles 109, 175–178. Lutz, Oskar (1933/34): «Freiheitliche Weltanschauung», in: Zentralblatt, 328–332. Lutz, Oskar (1934/35): «Zur Beschimpfung der Schweizerpresse durch Göring – eine Entgegnung», in: Zentralblatt, 554–556. Maas, Utz (2018): Verfolgung und Auswanderung deutschsprachiger Sprachforscher 1933–1945. Tübingen: Stauffenburg. Maas, Utz (2018a): Debrunner, Albert, in: Verfolgung und Auswanderung deutschsprachiger Sprachforscher 1933–1945, verfügbar unter: https://zflprojekte.de/sprachfor scher-im-exil/index.php/catalog/d/178-debrunner-albert/. Maas, Utz (2018b): Hecht, Hans, in: Verfolgung und Auswanderung deutschsprachiger Sprachforscher 1933–1945, verfügbar unter: https://zflprojekte.de/sprachforscher-imexil/index.php/module-styles/h/247-hecht-hans. Mächler, Joseph (2019): Wie sich die Schweiz rettete. Grundlagenbuch zur Geschichte der Schweiz im Zweiten Weltkrieg, 2. Aufl. Zollikofen: Pro Libertate. Maeder, Pascal (2012): Valentin F. Wagner, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D29921.php. Mahler, Elsa (1924): Die megarischen Becher. Basel: Diss. (masch.). Mahler, Elsa (1935): Die russische Totenklage. Ihre rituelle und dichterische Bedeutung, mit besonderer Berücksichtigung des grossrussischen Nordens. Leipzig: Harrassowitz. Mahler, Elsa (1938): Michail Nesterow. Ein Maler des gläubigen Russlands. Luzern: Vita Nova.
Literatur und publizierte Quellentexte
813
Maier, Helmut (2015): Chemiker im ‚Dritten Reich‘. Die Deutsche Chemische Gesellschaft und der Verein Deutscher Chemiker im NS-Herrschaftsapparat. Im Auftrag der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Weinheim: Wiley-VCH. Maissen, Thomas (2000): «Irrwege des antiken Erbes», in: Surbeck/Billerbeck 2000, 30– 33. Maissen, Thomas (2000a): «Sind Humanisten gute Menschen?» in: Surbeck/Billerbeck 2000, 78–81. Malitz, Jürgen (2006): «Klassische Philologie», in: Eckhard Wirbelauer (Hg.): Die Freiburger Philosophische Fakultät 1920–1960. Mitglieder – Strukturen – Vernetzungen. Freiburg/München: Karl Alber, 303–364. [Ich zitiere nach der erweiterten Fassung, die im Internet greifbar und die von 1 bis 71 paginiert ist: http://archiv.ub.uni-heidel berg.de/propylaeumdok/volltexte/2010/584]. Marcacci, Marco (1987): Histoire de l’Université de Genève 1559–1986. Genève: Université de Genève. Marchal, Guy P. (2013): «Kleine Geschichte des Historischen Seminars der Universität Basel», in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 113, 11–52. Marchand, Suzanne (2003): «From Liberalism to Neoromanticism. Albrecht Dietrich, Richard Reitzenstein, and the Religious Turn in Fin-de-siècle German Classical Studies», in: Ingo Gildenhard/Martin Rühl (Hg.): Out of Arcadia. Classics and Politics in Germany in the Age of Burckhardt, Nietzsche and Wilamowitz. London: Institute of Classical Studies, School of Advanced Study, University of London, 129–160. Marchand, Suzanne (2007): «Nazism, Orientalism and Humanism», in: Bialas/Rabinbach 2007, 267–305. Marino, Adrian (1982): Étiemble ou le comparatisme militant. Paris: Gallimard. Mark, Herman (1993): «From Small Organic Molecules to Large. A Century of Progress», in: Jeffrey Seeman (Hg.): Profiles, Pathways, and Dreams. Autobiographies of Eminent Chemists. Washington D.C.: American Chemical Society. Markó, Magdolna/Victor G. Meier/Magdalena Neff (1998): «Adolf Portmann 1897–1982. Ein Beitrag zum Leben und Wirken des Schweizer Zoologen und Anthropologen aus genealogischer Sicht», in: Familienforschung Schweiz, Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Familienforschung 1998, 71–102. Markwart, Otto (1920): Jacob Burckhardt. Persönlichkeit und Leben, Bd. 1: Persönlichkeit und Jugendjahre. Basel: Schwabe. Marmetschke, Katja (2008): Feindbeobachtung und Verständigung. Der Germanist Edmond Vermeil (1878–1964) in den deutsch-französischen Beziehungen. Köln/Weimar/Wien: Böhlau. Marti-Weissenbach, Karin (2002): Eduard Behrens, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/ textes/d/D28183.php. Martin, Paul-Edmond (1958): Histoire de l’Université de Genève. L’Université de 1914 à 1956. Genève: Georg. Mason, Eudo (o. J.): Collection of Letters and Poems of Eudo Colecestra Mason in Edinburgh University Library Special Collections. https://archiveshub.jisc.ac.uk. Massini, Rudolf (1944): «Prof. Rudolf Staehelin-Kracht 28. August 1875 bis 26. März 1943», in: Basler Jahrbuch 1944, 7–12.
814
Bibliographie
Massini, Rudolf (1944/45): «Wir und die Politik», in: Zentralblatt, 196–199. Massini, Rudolf (1944/45a): «Das soziale Problem in der Demokratie», in: Zentralblatt, 85 f. Mathys, Hans-Peter (2004): Walter Baumgartner, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/text es/d/D10521.php. Mathys, Hans-Peter (2013): Johann Jakob Stamm, in: Neue Deutsche Biographie 25, 47, verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118616676.html#ndbcon tent. Matter, Albert (2005): Joos Cadisch, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/043931/ 2005-02-15/. Matthiesen, Michael (1998): Verlorene Identität. Der Historiker Arnold Berney und seine Freiburger Kollegen 1923–1938. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. Mattmüller, Markus (1968): Leonhard Ragaz und der religiöse Sozialismus. Eine Biographie, Bd. 2: Die Zeit des ersten Weltkriegs und der Revolutionen. Zürich: EVZ-Verlag. Mazzocut-Mis, Maddalena (1998): Forma come destino. Henri Focillon e il pensiero morfologico nell’estetica francese della prima metà del Novecento. Firenze: Alinea. McClelland, Charles (2005): «Modern German Universities and their Historians since the Fall of the Wall», in: Journal of Modern History 77, No. 1, 138–159. McKim, Donald K. (Hg.) (1998): Walter Eichrodt, in: Historical Handbook of Major Biblical Interpreters, Downers Grove Ill.: InterVarsity Press, 482–487. Meier, Fritz (1962): «Rudolf Tschudi (1884–1960)», in: Der Islam 38, 138–141. Meier, Kurt (1996): Die Theologischen Fakultäten im Dritten Reich. Berlin: de Gruyter. Meier, Nikolaus (1981): «Zu Jacob Burckhardt und Friedrich Nietzsche. Ein Stück spekulativer Quellenkritik», in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 81, 97–117. Meier, Nikolaus (1986): Die Stadt Basel den Werken der Kunst. Konzepte und Entwürfe für das Kunstmuseum Basel 1906–1932. Basel: Kunstmuseum. Meier, Nikolaus (2007): «Adolph Goldschmidt im Basler Exil. Ein Stück tragischer Wissenschaftsgeschichte», in: Gunnar Brands/Heinrich Dilly (Hg.): Adolph Goldschmidt (1863–1944). Normal Art History im 20. Jahrhundert. Weimar: VDG Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, 247–273. Meier, Nikolaus (2010): «Die Öffentliche Kunstsammlung. Vom Sammlerkabinett der Amerbach zum Flagschiff der Stadtwerbung», verfügbar unter: https://unigeschichte. unibas.ch/fileadmin/user_upload/pdf/Meier_Kunstmuseum.pdf. Meier, Nikolaus (2011): «Ars una. Der Kunsthistoriker Otto Fischer (1886–1948)», SA aus: Reutlinger Geschichtesblätter, N.F. 50, 147–208. Meier, Nikolaus/Martin Bühler (2003): Kunstmuseum Basel – Die Architektur. Basel: Christoph Merian. Meisiek, Cornelius Heinrich (1993): Evangelisches Theologiestudium im Dritten Reich. Frankfurt u. a.: Lang. Meng, Heinrich (1971): Leben als Begegnung. Stuttgart: Hippokrates-Verlag. Merian, Wilhelm (1939): Karl Nef und die Entstehung der Musikwissenschaft in Basel, in: Basler Jahrbuch 1939, 72–93.
Literatur und publizierte Quellentexte
815
Merk, Otto (2000): Erich Dinkler, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon 17, 263–275. Mesmer, Beatrix (1984): «Die Berner und ihre Universität», in: Scandola 1984, 131–168. Metzger-Buddenberg, Ingrid (1984): Verzeichnis des schriftlichen Nachlasses von Edgar Salin 1892–1974. Basel: Öffentliche Bibliothek der Universität. Metzger, Thomas (2017): Antisemitismus im Deutschschweizer Protestantismus 1870 bis 1950. Berlin: Metropol. Meuli, Karl (1950): «Felix Speiser (20. Oktober 1880 – 19. September 1949)», SA aus: Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel 61, 1–12. Meuli, Karl (1975): Gesammelte Schriften, hg. von Thomas Gelzer. Basel/Stuttgart: Schwabe. Meuwly, Olivier (2010): Arnold Reymond, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D41420.php. Meyer, Helmut (2017): Hans Mühlestein (1887–1969). Leben und Werk eines Aussenseiters. Zürich: Chronos. Meyer, Klaus P. (1971): «Prof. Dr. Ernst Baldinger (1911–1970)», in: Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik 22, i–viii. Mezger, Werner (1992): «Karl Meuli und die Erforschung des Maskenwesens in Mitteleuropa aus heutiger Sicht», in: Graf 1992, 65–91. Miescher, Ernst (1955): «August Hagenbach 1871–1955», in: Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 135, 346–351. Mittenzwei, Werner (1997): Börries Freiherr von Münchhausen, in: Neue Deutsche Biographie 18, 525–527, verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/ pnd118785273.html#ndbcontent. Mittler, Max (2003): Der Weg zum Ersten Weltkrieg. Wie neutral war die Schweiz? Kleinstaat und europäischer Imperialismus. Zürich: Neue Zürcher Zeitung. Möckli, Werner (1973): Schweizergeist – Landigeist? Das schweizerische Selbstverständnis beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Zürich: Schulthess. Mohler, Armin (1950): Die konservative Revolution in Deutschland 1918–1932. Stuttgart: Friedrich Vorwerk. Mohr, Anna (2010): «Geschichte des Departements Physik», verfügbar unter: https://uni geschichte.unibas.ch/fileadmin/user_upload/pdf/Mohr_GeschichtePhysik.pdf. Mohr, Christoph/Michael Müller (1973): Funktionalität und Moderne. Das Neue Frankfurt und seine Bauten 1925–1933. Köln: Edition Fricke im Rudolf Müller Verlag. Mons, Theresa/Carina Santner (2019): «Matthias Gelzer – Universitätspolitik und Althistorie im ‚Dritten Reich‘», in: Färber/Link 2019, 111–136. Mooser, Josef (1997): «Die ‚Geistige Landesverteidigung‘ in den 1930er Jahren. Profile und Kontexte eines vielschichtigen Phänomens der schweizerischen politischen Kultur in der Zwischenkriegszeit», in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 47, 685–708. Mornati, Fiorenzo (2003): Louis Vladimir Furlan, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/artic les/047512/2003-05-07/. Morris, Peter J. T. (1986): Polymer Pioneers. A Popular History of the Science and Technology of Large Molecules. Philadelphia: Center for the History of Chemistry.
816
Bibliographie
Moser, Patrick B. (2016): «Araldit», in: Georg Kreis/Beat von Wartburg (Hg.): Wechselwirkungen einer Beziehung – Aspekte und Materialien (Chemie und Pharma in Basel, Bd. 2). Basel: Christoph Merian, 158–161. Moser, Patrick/Alexandra Heini (Hg.) (2020): Grenzfälle. Basel 1933–1945. Basel: Christoph Merian. Most, Glenn W. (1995): «Polemos panton pater. Die Vorsokratiker in der Forschung der zwanziger Jahre», in: Flashar 1995, 87–114. Mounier, Emmanuel (1949): Le Personnalisme (Que sais-je?). Paris: P.U.F. Mühling, Andreas (1997): Karl Ludwig Schmidt. ‚Und Wissenschaft ist Leben‘. Berlin/New York: de Gruyter. Mühll, Peter von der (1917/18): «Wieder zu Pindar», in: Rheinisches Museum 72, 307– 310. Mühll, Peter von der (1940): Odyssee, in: Realenzyklopädie Supplement 7, 696–768. Mühll, Peter von der (1940a): «Die Dichter der Odyssee», Vortrag vom 24. 2. 1940, in: 68. Jahrbuch des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer, Aarau, 80–103. Mühll, Peter von der (1976): Ausgewählte kleine Schriften, hg. von Bernhard Wyss. Basel: Friedrich Reinhardt. Müller, Dominik (2001): «Walter Muschgs ‚echter‘ Gotthelf», in: Caduff/Gamper 2001, 111–132. Müller, Helmut (1988): Philosophische Grundlagen der Anthropologie Adolf Portmanns. Weinheim: VCH. Müller, Wolfgang (1961): Heinrich Feurstein, in: Neue Deutsche Biographie 5 (1961), 116 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd116484640. html#ndbcontent. Müller-Grieshaber, Peter (2014): Edgar Schumacher, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/ textes/d/D12270.php. Müller-Huber, Brigitte (Red.) (1990): Karl Schefold Bibliographie 1930–1990 mit zusammenfassenden Kommentaren des Autors. Basel: Antikenmuseum und Sammlung Ludwig. Münzel, Uli (1981): «Badener Künstler seit 1800», in: Badener Neujahrsblätter 56, 49–62. Muschg, Walter (1931): Gotthelf. Die Geheimnisse des Erzählers. München: C. H. Beck. Muschg, Walter (1933): «Dichtung als archaisches Erbe», in: Imago 19, 99–112. Muschg, Walter (1937): «Josef Nadlers deutsche Literaturgeschichte. Basler Antrittsvorlesung vom 25. November 1937», SA aus: Basler Nachrichten Nr. 359, 31. Dezember 1937. Muschg, Walter (1968): Pamphlet und Bekenntnis. Aufsätze und Reden, hg. von Peter André Bloch in Zusammenarbeit mit Elli Muschg-Zollikofer. Olten/Freiburg i. Br.: Walter-Verlag. Muschg, Walter (1969): Die dichterische Phantasie. Einführung in eine Poetik. Bern/München: Francke. Muscholl, E. (1995): «Gründungsgeschichte und die ersten 25 Jahre der Deutschen Pharmakologischen Gesellschaft», in: DGPT Mitteilungen 16, 29–33.
Literatur und publizierte Quellentexte
817
Mussgnug, Dorothee (2006): «Die Juristische Fakultät», in: Wolfgang U. Eckart/Volker Sellin/Eike Wolgast (Hg.): Die Universität Heidelberg im Nationalsozialismus. Heidelberg: Springer Medizin, 261–318. Nabholz, Walter (1977): «Joos Cadisch †», in: Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 157, Teil 1, 394. Näf, Beat (1986): Von Perikles zu Hitler? Die athenische Demokratie und die deutsche Althistorie bis 1945. Bern: Lang. Näf, Beat (1994): «Der Althistoriker Fritz Schachermeyr und seine Geschichtsauffassung im wissenschaftsgeschichtlichen Rückblick», in: Storia della storiografia 26, 83–100. Näf, Beat (Hg.) (2001): Antike und Altertumswissenschaft in der Zeit von Faschismus und Nationalsozialismus. Mandelbachtal: Edition Cicero. Nationalsozialismus in Karlsruhe (2018): Prof. Georg Bredig, https://ns-in-ka.de/personen/ bredig-prof-georg/. Natur und Geist (1946): Fritz Medicus zum siebzigsten Geburtstag, 23. April 1946, mit Portraitskizze von Cuno Amiet. Erlenbach-Zürich: Eugen Rentsch. Neuenschwander, Erwin (2009): Paul Niggli, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D28898.php. Neuenschwander, Erwin (2013): Otto Spiess, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 043136/2013-01-08/. Niklaus, Émile-Albert (1938/39): «Du pain sur la planche», in: Zentralblatt, 485–491. Nipp, Manuela (o. J.): Fritz Lieb, in: Personenlexikon des Kantons Basel-Landschaft, https://personenlexikon.bl.ch/Fritz_Lieb. Nipp, Manuela (o. J.): Otto Schüepp, in: Personenlexikon des Kantons Basel-Landschaft, https://personenlexikon.bl.ch/Otto_Sch%C3%BCepp. Nipp, Manuela (o. J.): Fritz Verzár, in: Personenlexikon des Kantons Basel-Landschaft, https://personenlexikon.bl.ch/Fritz_Verzar. Nipp, Manuela (o. J.): Paul Vosseler, in: Personenlexikon des Kantons Basel-Landschaft, https://personenlexikon.bl.ch/Paul_Vosseler. Nöthiger-Strahm, Christine (2004): Adolf Bolliger, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/text es/d/D10549.php. Nord, Philip (2012): «Vichy et ses survivances. Les Compagnons de France», in: Revue d’histoire moderne et contemporaine 59, H. 4, 125–163. Nordemann, Theodor (ca. 1955): Zur Geschichte der Juden in Basel. Jubiläumsschrift der Israelitischen Gemeinde Basel aus Anlass des 150jährigen Bestehens, 5565–5715/ 1805–1955. o. O.: Buchdruckerei Brin AG. Norton, Robert E. (2018): «Platon im George-Kreis», in: Steuernagel 2018, 191–204. Norwood, Stephen H. (2009): The Third Reich in the Ivory Tower. Complicity and Conflict on American Campuses. Cambridge u. a.: Cambridge University Press. Oberkofler, Gerhard (2001): Leopold Ru⌅i⇥ka (1887–1976), Schweizer Chemiker und Humanist aus Altösterreich. Innsbruck: Studien Verlag. Oberkofler, Gerhard (2015): Konrad Farner. Vom Denken und Handeln des Schweizer Marxisten. Innsbruck: Studien Verlag.
818
Bibliographie
Oberkrome, Willi (1993): Volksgeschichte. Methodische Innovation und völkische Ideologisierung in der deutschen Geschichtswissenschaft 1918–1945. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. Oberkrome, Willi (2003): «Entwicklungen und Varianten der deutschen Volksgeschichte 1900–1960», in: Manfred Hettling (Hg.): Volksgeschichten im Europa der Zwischenkriegszeit. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 65–95. Oberkrome, Willi (2007): «German Historical Scholarship under National Socialism», in: Bialas/Rabinbach 2007, 207–237. Oberkrome, Willi (2013): «Siedlung und Landvolk. Die agrarpolitischen Annäherungen zwischen Edgar Salin und der ‚Sering-Schule‘», in: Karin Wilhelm/Kerstin Gust (Hg.): Neue Städte für einen neuen Staat. Die städtebauliche Erfindung des modernen Israel und der Wiederaufbau in der BRD. Eine Annäherung. Bielefeld: transcript, 237–251. Oberli, Matthias (2012): Hans Josephsohn, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D48552.php. O’Connor, J. J./E. F. Robertson (2021): Alexander Weinstein, in: MacTutor History of Mathematics Archive, University of St. Andrews, https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/ Biographies/Weinstein/. Oesterle, Anka (1991): «Letzte Autonomieversuche. Der Volkskundler John Meier. Strategie und Taktik des Verbandes deutscher Vereine für Volkskunde 1933–1945», in: Eckhard John/Bernd Martin/Marc Mück/Hugo Ott (Hg.): Die Freiburger Universität in der Zeit des Nationalsozialismus. Freiburg/Würzburg: Plötz, 151–162. Olivier-Utard, Françoise (2015): Une université idéale? Histoire de l’Université de Strasbourg de 1919 à 1939. Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg. Ooyen, Robert Chr. van (2017): Hans Kelsen und die offene Gesellschaft, 2. Aufl. Wiesbaden: Springer VS. Ortega y Gasset, José (1929): La rebelión de las masas. Madrid: Revista de Occidente. Ory, Pascal/Jean-François Sirinelli (2002): Les intellectuels en France de l’affaire Dreyfus à nos jours, 3. Aufl. Paris: Armand Colin. Ott, Heinrich (1962): «Professor Dr. Fritz Lieb zum 70. Geburtstag», in: National-Zeitung vom 10. Juni 1962. Ott, Heinrich (1995): «Prof. Dr. theol. Fritz Buri», in: uni nova 73. Ott, Heinrich (2002): «Der bleibende Gewinn der Theologie Karl Barths», in: Georg Kreis (Hg.): Zeitbedingtheit – Zeitbeständigkeit. Professoren-Persönlichkeiten der Universität Basel. Basel: Schwabe, 10–24. Paschoud, J.-F. (1942/43): «Zofingue et le problème des réfugiés», in: Zentralblatt, 132– 136. Passarge, Eberhard (1979): «Emil Heitz and the Concept of Heterochromatin. Longitudinal Chromosome Differentiation was Recognized Fifty Years ago», in: American Journal of Human Genetics 31 H. 2, 106–115. Paul-Hus, Adèle/Nadine Desrochers/Sarah de Rijcke/Alexander D. Rushforth (2017): «The Reward System of Science», in: Aslib Journal of Information Management 69, H. 5, 478–485.
Literatur und publizierte Quellentexte
819
Pedroni, Matteo (2015): Walther von Wartburg, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 042195/2015-01-11/. Penkower, Monty Noam (1988): The Jews Were Expendable. Free World Diplomacy and the Holocaust. Detroit: Wayne State University Press. Pertici, Roberto (1997): «Mazzinianesimo, fascismo, comunismo. L’itinerario politico di Delio Cantimori (1919–1943)», in: Cromohs 2, 1–128. Pestalozzi, Karl (1996): «Walter Muschg und die schweizerische Germanistik in Kriegsund Nachkriegszeit», in: Wilfried Barner/Christoph König (Hg.): Zeitenwechsel. Germanistische Literaturwissenschaft vor und nach 1945. Frankfurt a. M.: Fischer, 282–300. Pestalozzi, Karl (2000): «Walter Muschg (1898–1965)», in: König/Müller/Röcke 2000, 199–210. Pestalozzi, Karl/Martin Stingelin (Hg.) (1999): Walter Muschg (1898–1965). Gedenkreden zum 100. Geburtstag gehalten an der Feier in der Alten Aula am 20. Mai 1998 (Basler Universitätsreden 96). Basel: Schwabe. Peter, Niklaus (2009): Carl Albrecht Bernoulli, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/ d/D10533.php. Peterson, Paul Silas (2015): The Early Hans Urs von Balthasar. Historical Contexts and Intellectual Formation. Berlin: de Gruyter. Petry, Erik (2008): «Richard M. Wagner und das Ehepaar Staehelin. Einsatz für die Nächsten», in: Haumann/Petry/Richers 2008, 103–107. Petry, Erik (2020): «Die Israelitische Gemeinde Basel im Kampf gegen den Antisemitismus», in: Moser/Heini 2020, 75–81. Picard, Jacques (1994): Die Schweiz und die Juden 1933–1945. Schweizerischer Antisemitismus, jüdische Abwehr und internationale Migrations- und Flüchtlingspolitik. Zürich: Chronos. Pichinot, Hans-Rainer (1981): Die Akademie für Deutsches Recht. Aufbau und Entwicklung einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft des Dritten Reichs. Kiel: Diss. Pinkas Hakehillot (2006): ‚Ploiești, Romania‘, in: Encyclopedia of Jewish Communities, Romania, Bd. 1, 218–224, verfügbar unter: http://www.jewishgen.org/Yizkor/pinkas_ romania/rom1_00218.html. Plänkers, Tomas/Michael Laier/Hans-Heinrich Otto/Hans-Joachim Rothe/Helmut Siefert (Hg.) (1996): Psychoanalyse in Frankfurt am Main. Zerstörte Anfänge. Wiederannäherung. Entwicklungen. Tübingen: Edition Diskord. Platzer, Peter (1988): Jüdische Verbindungen in der Schweiz (Studentica Helvetica, Documenta et Commentarrii 4). Bern: Schweizerische Vereinigung für Studentengeschichte. Plessner, Helmuth (1935): Das Schicksal deutschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche. Zürich/Leipzig: Max Niehans. Plett, Ella (2010): «Die 550-Jahrfeier 1936. Jubiläum unter nationalsozialistischer Diktatur», in: Frank Engehausen/Werner Moritz (Hg.): Die Jubiläen der Universität Heidelberg 1587–1986. Begleitband zur Ausstellung im Universitätsmuseum Heidelberg 19. Oktober 2010 bis 19. März 2011. Heidelberg: Verlag Regionalkultur, 65–77.
820
Bibliographie
Poppe, Eberhard/Wolfgang Weichelt (Hg.) (1985): Arthur Baumgarten zum 100. Geburtstag (Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften der DDR – Gesellschaftswissenschaften, Jg. 1984, Nr. 15/G). Porter, Theodore M. (2018): Genetics in the Madhouse. Princeton/Oxford: Princeton University Press. Portmann, Adolf (1946): Natur und Kultur im Sozialleben. Ein Beitrag der Lebensforschung zu aktuellen Fragen. Basel: Reinhardt. Portmann, Adolf (1948): Von der Idee des Humanen in der gegenwärtigen Biologie. Rektoratsrede, gehalten am 33. November 1947 (Basler Universitätsreden 22). Basel: Helbing & Lichtenhahn. Portmann, Adolf (1965): «Die Frühzeit des Darwinismus im Werk Ludwig Rütimeyers», in: Basler Stadtbuch 1965, 164–188. Portmann, Adolf (1967): «Abschied von Professor Hans Erlenmeyer», in: National-Zeitung vom 4. Juni 1967. Portmann, Adolf (1974): An den Grenzen des Wissens. Vom Beitrag der Biologie zu einem neuen Weltbild. Wien/Düsseldorf: Econ. Prahl, Hans-Werner (1995/2007): Uni-Formierung des Geistes. Universität Kiel im Nationalsozialismus, 2 Bde. (Veröff. des Beirats für Geschichte der Arbeiterbewegung und Demokratie in Schleswig-Holstein/Gesellschaft für Politik und Bildung SchleswigHolstein e. V. 16.). Kiel: Schmidt und Klaunig. Preisendanz, Karl (1936): ‚Sit willekomen, Her Gast‘. Festgabe der Universität Heidelberg für die Gäste ihrer 550-Jahrfeier 1936. Heidelberg: Braus. Preiswerk, Eduard (1965): «Zwanzig Jahre Araldit-Funktionserfindung. Die Bindefunktion der Äthoxylin- (Epoxy⌥) Harze», SA aus: technica 4/5. Priesner, Claus (1980): H. Staudinger, H. Mark und K. H. Meyer. Thesen zur Grösse und Struktur der Makromoleküle. Ursachen und Hintergründe eines akademischen Disputes. Weinheim/Deerfield Beach, Florida/Basel: Verlag Chemie. Prijs, Bernhard (1982): Werner Kuhn 1899–1963, in: Neue Deutsche Biographie 13, 268 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd137804008. html#ndbcontent. Prijs, Bernhard (1983), «P. Ruggli, Meister der chemischen Experimentierkunst», in: Bernhard Prijs: Chymia Basiliensis. Episoden aus der Basler Chemiegeschichte. Basel: Karger, 105–106. Prijs, Bernhard (1983a): «Das neue Institut für Farbenchemie; R. Wizinger», in: Bernhard Prijs: Chymia Basiliensis, Episoden aus der Basler Chemiegeschichte. Basel: Karger, 111–112. Prijs, Bernhard (1983b):« Die Physikalische Chemie erhält ein eigenes Institut», in: Bernhard Prijs: Chymia Basiliensis. Episoden aus der Basler Chemiegeschichte. Basel: Karger, 103–104. Prijs, Bernhard (1983c): «H. Erlenmeyer: Metallionen und Biologie, chemische Systematik», in: Bernhard Prijs: Chymia Basiliensis. Episoden aus der Basler Chemiegeschichte. Basel: Karger, 115.
Literatur und publizierte Quellentexte
821
Prijs, Bernhard (1983d): «H. Rupe: Optische Aktivität, Rotationsdispersion», in: Bernhard Prijs: Chymia Basiliensis. Episoden aus der Basler Chemiegeschichte. Basel: Karger, 97–98. Prijs, Bernhard (1983e): «Professor für Physikalische Chemie auf eigene Kosten», in: Bernhard Prijs: Chymia Basiliensis. Episoden aus der Basler Chemiegeschichte. Basel: Karger, 89–90. Prijs, Bernhard (1983 f): «W. Kuhn, ein bedeutender, vielseitiger Physikochemiker», in: Bernhard Prijs: Chymia Basiliensis. Episoden aus der Basler Chemiegeschichte. Basel: Karger, 109–110. Prolingheuer, Hans (1977): Der Fall Karl Barth, 1934–1935. Chronographie einer Vertreibung. Neukirchen: Neukirchener. Quack, Jürgen (2016): «Zur Geschichte der Basler Mission – Deutscher Zweig», in: Blätter für württembergische Kirchengeschichte 116, 71–158. Quadroni, Dominique (2002): «Les étudiants – les aspects sociaux», in: Histoire 2002, 299–334. Quarthal, Franz (2007): «Das Alemannische Institut von seiner Gründung bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges», in: Das Alemannische Institut. 75 Jahre grenzüberschreitende Kommunikation und Forschung (1931–2006), hg. vom Alemannischen Institut Freiburg i. Br. e. V. Freiburg/München: Karl Alber, 47–96. Raab, Heribert (1991): «Öffnung auf die Welt – Die deutschsprachigen Länder», in: Ruffieux 1991, 278–307. Raith, Michael (2005): Karl Goetz, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D10638. php. Ramm, Thilo/Stefan Chr. Saar (Hg.) (2014): Nationalsozialismus und Recht. Erste Babelsberger Gespräche. Baden-Baden: Nomos. Ranke, Friedrich (1928): «Die Edda und wir», in: Rupp/Studer 1971, 143–170. Ranke, Friedrich (1935): Volkssagenforschung. Vorträge und Aufsätze. Breslau: Maruschke & Berendt. Ranke, Friedrich (1935a): «Der Dichter des Nibelungenliedes um 1200», in: Willy Andreas/Wilhelm Scholz (Hg.): Die Grossen Deutschen. Neue Deutsche Biographie. Berlin: Propyläen, 168–181. Ranke, Friedrich (1936): «Märchenforschung. Ein Literaturbericht», SA aus: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 14, H. 2, 246–304. Ranke, Friedrich (1936a): «Die sittlichen Ideale der alten Germanen», in: Monatsblätter der städtischen Büchereien [Umschlagtitel: «Blätter der städtischen Volksbüchereien Breslau»] 8. Februar 1936, 161–167. Ranke, Friedrich (1937): «Germanische Züge in der deutschen Dichtung des Mittelalters. Auszug aus dem Vortrag in der Jubiläumswoche», in: Nachrichten aus dem Deutschen Institut der Universität Breslau, hg. von der Germanistischen Fachabteilung der Studentenschaft an der Universität Breslau, 10. H., Februar 1937, 1–8. Ranke, Friedrich (1937a): Altnordisches Elementarbuch. Schrifttum, Sprache, Texte mit Übersetzung und Wörterbuch (Sammlung Göschen). Berlin/Leipzig: de Gruyter. Rassem, Mohammed (1992): «Meulis Konzeption der Kulturwissenschaft», in: Graf 1992, 15–28.
822
Bibliographie
Ratmoko, Christina (2010): Damit die Chemie stimmt. Die Anfänge der industriellen Herstellung von weiblichen und männlichen Sexualhormonen 1914–1938. Zürich: Chronos. Ratschlag und Entwurf zu einem Universitätsgesetz des Kantons Basel-Stadt, dem Grossen Rate des Kantons Basel-Stadt vorgelegt am 21. März 1935 (Ratschlag No. 3491). Ratzke, Erwin (1988): Hakenkreuz und Talar. Das 200jährige Jubiläum der Georg-AugustUniversität Göttingen im Jahre 1937, in: Göttinger Jahrbuch 36, 231–248. Rauch, R. William Jr. (1972): Politics and Belief in Contemporary France. Emmanuel Mounier and Christian Democracy, 1932–1950. The Hague: Martinus Nijhoff. Raulff, Ulrich (2009): Kreis ohne Meister. Stefan Georges Nachleben. München: Beck. Raymond, Marcel (1970): Le sel et la cendre. Récit. Lausanne: L’Aire/Coopérative Rencontre. Raymond, Marcel/Georges Poulet (1981): Correspondance 1950–1977. Choix et présentation par Pierre Grotzer. Paris: Librairie José Corti. Rebenich, Stefan (2000): «Alfred Heuss. Ansichten seines Lebenswerkes. Mit einem Anhang: Alfred Heuss im Dritten Reich», in: HZ 271, 661–673. Rebenich, Stefan (2001): «Alte Geschichte in Demokratie und Diktatur. Der Fall Helmut Berve», in: Chiron 31, 457–496. Rebenich, Stefan (2001a): «Zwischen Anpassung und Widerstand? Die Berliner Akademie der Wissenschaften von 1933–1945», in: Näf 2001, 203–229. Rebenich, Stefan (2008): «‚Dass ein Strahl von Hellas auf euch fiel‘. Platon im Georgekreis», in: George Jahrbuch 7, 115–141. Rebenich, Stefan (2010): «Institutionalisierung der Alten Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Wissenschaftshistorische Überlegungen zur Entwicklung des Faches», in: Leonhard Burckhardt (Hg.): Das Seminar für alte Geschichte in Basel 1934–2007. Basel: Selbstverlag, 5–20. Rebetez, Jean-Claude (2002): «Les autorités politiques et l’Université», in: Histoire 2002, 7–121. Rechenberg, Hans-Kaspar von (1943/44): «Zur Frage der ‚Kriegsverbrechen‘», in: Zentralblatt, 250–254. Rehberg, Karl-Siegbert (2007): «‚Images of Mankind‘ and the Notion of Order in Philosophical Anthropology and National Socialism. Arnold Gehlen», in: Bialas/Rabinbach 2007, 178–206. Reicke, Bo (1972): «Professor Oscar Cullmann zum 70. Geburtstag», in: National-Zeitung vom 24. Februar 1972. Reimann, Hans (WS 1942/43): «Belgische Studenten hungern», in: Basler Studentenschaft, H. 1, 15–17. Reinermann, Lothar (2003): Werner Richter, in: Neue Deutsche Biographie 21, 539 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd132563894.html#ndbcontent. Reinhard, Max (1940): «Heinrich Preiswerk, 1876–1940», in: Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilungen 20, H. 1, 1–7. Reinhard, Max (1959): «Walter Hotz 1884–1958», in: Verhandlungen der Naturforschenen Gesellschaft in Basel 69, 169–173.
Literatur und publizierte Quellentexte
823
Remy, Steven P. (2007): «‚We Are no Longer the University of the Liberal Age‘. The Humanities and National Socialism at Heidelberg», in: Bialas/Rabinbach 2007, 21–49. Reubi, Serge (2011): Gentlemen, prolétaires et primitifs. Institutionnalisation, pratiques de collection et choix muséographiques dans l’éthnographie suisse, 1880–1950. Bern: Peter Lang. Rexroth, Frank (2013): «Geschichte schreiben im Zeitalter der Extreme. Die Göttinger Historiker Percy Ernst Schramm, Hermann Heimpel und Alfred Heuss», in: Christian Starck/Kurt Schönhammer (Hg.): Die Geschichte der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Berlin u. a.: de Gruyter, 265–299. Reynold, Gonzague de (1935/36): «Lettre au secrétariat général. Toussaint 1935», in: Zentralblatt, 39–43. Ribi, Adolf (1939): «Die Entstehung der romanischen Völker», in: NZZ Nr. 2200, Morgenausgabe, 28. Dezember, Bl. 1; Nr. 2206, 29. Dezember 1939, Bl. 2. Riese, Berthold (2010): Felix Speiser, in: Neue Deutsche Biographie 24, 653 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/sfz123278.html#ndbcontent. Riese, Hajo (1992): «Edgar Salin und das Ende der liberalen Wirtschaftsverfassung der Weimarer Republik. Überlegungen zu seinem 100. Geburtstag am 10. 2. 1992», in: List Forum für Wirtschafts- und Finanzpolitik 18, 7–18. Riggenbach, Heinrich (2010): «Elsa Mahler – die erste Professorin der Universität Basel», verfügbar unter: https://unigeschichte.unibas.ch/fileadmin/user_upload/pdf/Riggen bach_Elsa_Mahler.pdf. Ringer, Fritz Franz Klaus (1969): The Decline of the German Mandarins. The German Academic Community, 1890–1933. Cambridge MA: Harvard UP. Rintelen, Friedrich (1980): Geschichte der Medizinischen Fakultät in Basel 1900–1945. Basel/Stuttgart: Schwabe. Ritschl, Albrecht (2003): Hans Ritschl, in: Neue Deutsche Biographie 21, 650 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118788949.html#ndbcontent. Ritter, Gerhard (2006): «Die Universität Freiburg im Hitlerreich. Persönliche Eindrücke und Erfahrungen», in: Eckhard Wirbelauer (Hg.): Die Freiburger Philosophische Fakultät 1920–1960. Freiburg/München: Karl Alber, 769–802. Ritter, Hans-Jakob (2003): «Die Institutionalisierung der Vererbungsforschung in Basel. Formierung und Institutionalisierung einer wissenschaftlich fundierten Eugenik in Basel zwischen 1925 und 1944», in: Claudia Honegger/Brigitte Liebig/Regina Wecker (Hg.): Wissen, Gender, Professionalisierung. Zürich: Chronos, 41–63. Ritter, Hans-Jakob (2009): Psychiatrie und Eugenik. Zur Ausprägung eugenischer Denkund Handlungsmuster in der schweizerischen Psychiatrie, 1850–1950. Zürich: Chronos. Ritter, Hans Jakob/Gabriela Imboden (2013): «‚Hat die Eröffnung, dass er civilrechtlich nicht ehefähig ist, relativ ruhig aufgenommen‘. Zur Praxis der psychiatrischen Ehefähigkeitsbeurteilung», in: Wecker 2013, 23–47. Ritter, Hans Jakob/Volker Roelcke (2005): «Psychiatric Genetics in Munich and Basel between 1925 and 1945. Programs, Practices, Cooperative Arrangements», in: Osiris 2nd series 20, Politics and Science in Wartime. Comparative International Perspectives on the Kaiser Wilhelm Institute, 263–288.
824
Bibliographie
Ritter, Markus (2000): «Die Biologie Adolf Portmanns im zeitgeschichtlichen Kontext», in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 100, 207–254. Ritter, Markus (2015): «Adolf Portmann (1897–1982), Leben und Werk des grossen Basler Biologen», in: Verein pro Klingentalmuseum, Vorträge 2015 des Forums Wort und Musik und Jahresbericht 2015 (o. O., o. J.), 46–57. Rivière, Jacques (1924): L’Allemand. Souvenirs et réflexions d’un prisonnier de guerre. 8. Aufl. Paris: Gallimard (Nouvelle Revue Française). Robert, Olivier (1987): Matériaux pour servir à l’histoire du doctorat h.c. décerné à Benito Mussolini en 1937, recueillis, édités et annotés par Olivier Robert (Études et documents pour servir à l’histoire de Lausanne XXVI). Lausanne: Université de Lausanne. Rösler, Wolfgang (2017): «Werner Jaeger und der Nationalsozialismus», in: King/Presti 2017, 51–82. Rössler, Mechtild (1987): «‚Blut und Boden – Volk und Raum‘. Thesen zur Geographie im Nationalsozialismus», in: Jürgen Friedrichs (Hg.): 23. Deutscher Soziologentag 1986, Sektions- und Ad-hoc-Gruppen. Opladen: Westdeutscher Verlag, 741–744, verfügbar unter: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-149999. Rössler, Mechtild (1989): «Die Geographie an der Universität Freiburg 1933–1945. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte des Faches im Dritten Reich», in: Michael Fahlbusch/Mechtild Rössler/Dominik Siegrist (Hrsg.): Geographie und Nationalsozialismus. Drei Fallstudien zur Institution Geographie im Deutschen Reich und der Schweiz (urbs et regio 51), 77–151. Roggen, Roland (Red.) (2014): Zofingia/Zofingue. Die Idee, das Feuer, der Freundeskreis. Zofingen: Schweizerischer Zofingerverein und Schweizerischer Altzofingerverein. Rogger Kappeler, Franziska (2005): Hermann Gauss, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/ articles/047707/2005-08-12/. Rohn, Roland (1939): «Das neue Kollegienhaus», in: Geschichte der Kollegiengebäude der Universität Basel 1460–1936. Im Auftrage der Regenz der Universität verfasst (Festschrift der Universität Basel zur Einweihung des neuen Kollegienhauses am 10. Juni 1939). Basel: Braus-Riggenbach, 93–97. Rohrbach, Jens Martin (2007): Augenheilkunde im Nationalsozialismus. Stuttgart/New York: Schattauer. Roloff, Hans-Gert (1999): Richard Newald, in: Neue Deutsche Biographie 19, 193 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd116990910.html#ndbcontent. Romanisches Seminar der Universität Zürich (2020): La Gita a Chiasso, Artikel Italianità und Svizzera italiana (1941–1962), verfügbar unter: www.rose.uzh.ch/static/gita chiasso. Roth, Daniel (1943/44): «Eidgenössische Verpflichtung», in: Zentralblatt, 404–408. Roth, Detlef (2001): «Kontinuität und Diskontinuität in der Altgermanistik der dreissiger und vierziger Jahre am Beispiel Friedrich Rankes», in: Caduff/Gamper 2001, 277– 297. Roth, Paul (Hg.) (1939): Festbericht über die Einweihung des neuen Kollegienhauses der Universität Basel. Basel: Helbing & Lichtenhahn.
Literatur und publizierte Quellentexte
825
Rothmann, Erwin Hans (WS 1939/40): «Unsere Neutralität!», in: Basler Studentenschaft, H. 1, 9–11. Rothschild, Miriam (1999): «Tadeus Reichstein (20 July 1897 – 1 August 1996)», in: Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 45, 449–467. Rotschy, Marc-Henri (1942/43): «Un Zofingien genevois à Bâle», in: Zentralblatt, 35–39. Roux, Wilhelm (1915): «Das Wesen des Lebens», in: Die Kultur der Gegenwart, 3. Teil: Mathematik, Naturwissenschaften, Medizin, 4. Abt. Organische Naturwissenschaften, 1. Bd.: Allgemeine Biologie. Leipzig/Berlin: Teubner, 173–187. Ruch, Alexander (1985): Festschrift zur 100-Jahr-Feier der Alt-Rauracia Basel 1884–1984. Basel: Alt-Rauracia. Ruck, Erwin (1925): Verfassungsrecht und Verfassungsleben in der Schweiz. Berlin: Carl Heymanns Verlag (SA aus: Zeitschrift für Politik 14, H. 4). Ruck, Erwin (1930): Die Rechtsstellung der Basler Universität (Basler Universitätsreden 1). Basel: Helbing & Lichtenhahn. Ruck, Erwin (1933): Schweizerisches Staatsecht. Zürich: Polytechnischer Verlag. Ruck, Erwin (1940): «Die Juristische Fakultät», in: Die Juristische Fakultät und der Beruf des Juristen. Referate von Dr. Erwin Ruck und Dr. Fritz Goetzinger, Professoren der Rechte an der Universität Basel. Basel: Helbing & Lichtenhahn, 3–18. Ruck, Erwin (1941): «Eigentumsgarantie und Volkswirtschaft», in: Schweizerische Wirtschaftsfragen. Festgabe für Fritz Mangold, hg. von der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik und Volkswirtschaft. Basel: Helbing & Lichtenhahn, 217–233. Ruck, Erwin (1946): Grundsätze im Völkerrecht. Rektoratsprogramm der Universität Basel für das Jahr 1946. Basel: Friedrich Reinhardt. Ruck, Erwin (1948): «Freiheit und Rechtsstaat», in: Die Freiheit des Bürgers im Schweizerischen Recht. Festgabe zur Hundertjahrfeier der Bundesverfassung, hg. von den Juristischen Fakultäten der schweizerischen Universitäten. Zürich: Polygraphischer Verlag, 75–98. Rudin, Patrick (2016): «Das Chemie-Institut der Uni Basel darf abgerissen werden», in: bz Basel vom 15. Dezember 2016. Rüegg, August (1949): «Zum Tode von Professor Arminio Janner», in: Basler Nachrichten vom 12. Juli 1949. Rüegg, August (1950): «Erinnerungen eines alten Freundes und Kollegen», in: Janner 1950, 17–20. Rüegg, August (1964): Vom Geist der Polis. Basler Lebensbilder (Basler Schriften 11). Basel: Pharos. Rürup, Reinhard/Michael Schüring (Hg.) (2008): Schicksale und Karrieren. Gedenkbuch für die von den Nationalsozialisten aus der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft vertriebenen Forscherinnen und Forscher. Göttingen: Wallstein. Rütimeyer, Wilhelm (1962): «Prof. Dr. Wilhelm Vischer (1890–1960)», in: Basler Stadtbuch 1962, 264–272. Ruffieux, Roland (Hg.) (1991): Histoire de l’Université de Fribourg Suisse 1889–1989, éd. par une commission de professeurs présidée par Roland Ruffieux et par le Rectorat de l’Université, Vol. 1: Fondation et développement. Fribourg: Editions universitaires Fribourg Suisse.
826
Bibliographie
Rufli, Theo (2008): Die Geschichte der Dermatologen und der Dermatologie an der Universität Basel 1460–1913. Die Geschichte der Dermatologischen Universitätsklinik Basel 1914–2005. Basel: Schwabe. Rupe, Hans (1945): «Paul Ruggli», in: Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 125, 373–375. Rupe, Hans (1946): «Paul Ruggli, 1884–1945», in: Helvetica Chimica Acta 29, 96–111. Rupp, Heinz/Eduard Studer (Hg.) (1971): Friedrich Ranke. Kleinere Schriften. Bern/München: Francke. Ruppenthal, Jens (2007): Kolonialismus als ‚Wissenschaft und Technik‘. Das Hamburgische Kolonialinstitut 1908 bis 1919. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. Ruprecht, Seraina (2015): «Andreas Alföldi und die Alte Geschichte in der Schweiz», in: James H. Richardson/Federico Santangelo (Hg.): Andreas Alföldi in the Twenty-First Century. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 37–64. Rusterholz, Peter/Andreas Solbach (Hg.) (2007): Schweizer Literaturgeschichte. Stuttgart/ Weimar: J. B. Metzler. Ryhiner, Gilgian (1941/42): «Semesterbericht Sektion Basel», in: Zentralblatt, 471 f. Saage, Richard (1997): Faschismustheorien. Baden-Baden: Nomos. Sabatier, Paul (1894): Vie de saint François d’Assise. Paris: Fischbacher. Salden, Hubert (Hg.) (1995): Die Städelschule Frankfurt am Main von 1817 bis 1995. Mainz: Hermann Schmidt. Salin, Edgar (1921): Platon und die griechische Utopie. München/Leipzig: Duncker und Humblot. Salin, Edgar (1930): Die deutschen Tribute. Zwölf Reden. Berlin: Reimar Hobbing. Salin, Edgar (1932): Wirtschaft und Staat. Drei Schriften zur Weltlage. Berlin: Reimar Hobbing. Salin, Edgar (1933): Julius Landmann. Rede, gehalten bei der Gedenkfeier der Philosophischen Fakultät der Universität Basel am 14. Dezember 1931. Tübingen. Salin, Edgar (1938): Jakob [sic] Burckhardt und Nietzsche. Rektoratsprogramm der Universität Basel für das Jahr 1937. Basel: Verlag der Universitätsbibliothek. Salin, Edgar (1948): «Die Tragödie der deutschen Gegenrevolution. Bemerkungen über den Quellenwert der bisherigen Widerstandsliteratur», SA aus: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 3, 1–14. Salin, Edgar (1948a): Um Stefan George. Godesberg: Helmut Küpper vormals Georg Bondi. Salin, Edgar (1962): «Lebendige Demokratie. Der Basler Arbeitsrappen von 1936», in: Theodor Eschenburg (Hg.): Festgabe für Carlo Schmid zum 65. Geburtstag. Tübingen: J. C. B.Mohr, 153–170. Salmony, Hansjörg (1950): «Prof. Dr. Herman Schmalenbach zum Gedächtnis», in: Basler Studentenschaft 32, 28-30. Salvisberg, Stefanie (2016): «Universität im Zugzwang. Die Berufungspolitik der Universität Bern 1933–1945». Referat im Panel Forschungen, Karrieren, Netzwerke. Der Nationalsozialismus und die Arbeit der Wissenschaften in der Schweiz, 4. Schweizerische Geschichtstage 2016, verfügbar unter: http://2016.geschichtstage.ch/referat/87/ universitaet-im-zugzwang-die-berufungspolitik-der-universitaet-bern-19331945.
Literatur und publizierte Quellentexte
827
Salvisberg, Stefanie (2017): «Veröffentlichungen von Schweizer Verlagen in der Schweiz (1919–1949)», in: Olivier Dard/Michel Grunewald/Reiner Marcowitz/Uwe Puschner (Hg.): Confrontations au national-socialisme en Europe francophone et germanopohone / Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus im deutsch- und französischsprachigen Europa (1919–1949), vol. 1: Introduction générale – savoirs et opinions publiques / Bd. 1: Allgemeine historische und methodische Grundlagen. Bruxelles: Peter Lang, 373–382. Scandola, Pietro (Red.) (1984): Hochschulgeschichte Berns 1528–1984. Bern: Universität Bern. Schaad, Gabrielle (2012): Hans Trog, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D27777. php. Schäfer, Herwig (1999): Juristische Lehre und Forschung an der Reichsuniversität Strassburg 1941–1944. Tübingen: Mohr Siebeck. Schaer, Jean-Paul (2010): Manfred Reichel, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 044407/2010-08-26/. Schapiro, Max (1934/35): «Est-il possible que l’Etat soit chrétien?», in: Zentralblatt, 203– 208. Schapiro, Meyer (1977): Romanesque Art. Selected Papers. New York: George Braziller. Schefold, Bertram (1992): «Nationalökonomie als Geisteswissenschaft. Edgar Salins Konzept einer Anschaulichen Theorie», in: List Forum für Wirtschafts- und Finanzpolitik 18, 303–324. Schefold, Bertram (2013): «Edgar Salins Konzeption des modernen Kapitalismus. Von Marx, Sombart und Weber zu einer europäischen Perspektive für die Globalisierung», in: Karin Wilhelm/Kerstin Gust (Hg.): Neue Städte für einen neuen Staat. Die städtebauliche Erfindung des modernen Israel und der Wiederaufbau in der BRD. Eine Annäherung. Bielefeld: transcript, 209–227. Schefold, Karl (1943): «Ernst Pfuhl», SA aus: Basler Jahrbuch 1943, 84–100. Schefold, Karl (1970): «Professor Peter von der Mühll zum Gedenken», in: Basler Nachrichten vom 16. Oktober 1970. Schefold, Karl (1995): «Neue Wege der Klassischen Archäologie nach dem Ersten Weltkrieg», in: Flashar 1995, 183–203. Schefold, Karl (1999): Karl Schefold-von den Steinen, 26. Januar 1905 – 16. April 1999. Trauerfeier am 23. April 1999 in der Peterskirche zu Basel unter Leitung und mit Predigt von Pfarrer Dr. Franz Christ (Privatdruck). Schefold, Karl (2003): Die Dichtung als Führerin zur klassischen Kunst. Erinnerungen eines Archäologen. Aus dem Nachlass hg. von Martha Rohde-Liegle in Verbindung mit Dian, Reimar und Bertram Schefold. Hamburg: Kovac. Scherrer, Adrian (2009): Johann Baptist Rusch, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/ d/D25359.php Scheurer, Rémy (2002): «L’histoire», in: Histoire 2002, 407–417. Schibler, Thomas (2007): Adolf Im Hof, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D5957.php. Schilling, Jörg (2021): Werner Nosbisch, in: Frankfurter Personenlexikon, https://frank furter-personenlexikon.de/node/9681.
828
Bibliographie
Schläpfer, Robert (2004): Wilhelm Bruckner, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 011645/2004-06-08/. Schlesier, Renate (1995): «‚Arbeiter in Useners Weinberg‘ – Anthropologie und antike Religionsgeschichte in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg», in: Flashar 1995, 329–380. Schlottmann, Antje/Jeannine Wintzer (2019): Weltbildwechsel. Ideengeschichten geographischen Denkens und Handelns. Bern: Haupt/utb. Schmalenbach, Herman (1934): «Karl Joël», in: Der Morgen. Monatsschrift der Juden in Deutschland 10, H. 8, 366–370, verfügbar unter: http://sammlungen.ub.uni-frank furt.de/cm/periodical/titleinfo/2904387. Schmelz, Christoph (2011): Der Völkerrechtler Gustav Adolf Walz. Eine Wissenschaftskarriere im ‚Dritten Reich‘. Berlin: Logos. Schmidt, Ernst A. (2017): «Humanistische und antihumanistische Kritik an Werner Jaegers neuem Humanismus», in: Matthias Löwe/Gregor Streim (Hg.): ‚Humanismus‘ in der Krise. Debatten und Diskurse zwischen Weimarer Republik und geteiltem Deutschland. Berlin/Boston: de Gruyter, 79–96. Schmidt, Georg (1951): «Nachruf auf Heinrich Alfred Schmid», in: Das Werk 38, 85 f. Schmidt, Gustav/Jörn Rüsen (Hg.) (1986): Gelehrtenpolitik und politische Kultur in Deutschland 1830–1930. Referate und Diskussionsbeiträge. Bochum: Brockmeyer. Schmidt, Martin Anton (1997): «Ein ökumenischer Theologe. Ernst Staehelin (1889– 1980)», in: Andreas Urs Sommer (Hg.): Im Spannungsfeld von Gott und Welt. Beiträge zur Geschichte und Gegenwart des Frey-Grynaeischen Instituts in Basel 1747– 1997. Basel: Schwabe, 159–169. Schmidt, Peter Lebrecht (1995): «Zwischen Anpassungsdruck und Autonomiestreben. Die deutsche Latinistik vom Beginn bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts», in: Flashar 1995, 115–182. Schmitt, Carl (1934): Nationalsozialismus und Völkerrecht (Schriften der Deutschen Hochschule für Politik I, Idee und Gestalt des Nationalsozialismus 9). Berlin: Junker und Dünnhaupt. Schmitt, Rüdiger (2001): Walter Porzig, in: Neue Deutsche Biographie 20, 645 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118741551.html#ndbcontent. Schmoll, Friedemann (2010): «Verbandlungen. Basel und die schweizerisch-deutschen Wissenschaftsbeziehungen in der Volkskunde», in: Schürch/Eggmann/Risi 2010, 99– 110. Schneider, Tamara (2019):« Ernst Langlotz. Klassische Archäologie in Frankfurt während des NS-Regimes», in: Färber/Link 2019, 255–270. Schnurbein, Stefanie von (2005): «Nordisten und Nordglaube. Wechselwirkungen zwischen akademischen und religiösen Konzepten von germanischer Religion», in: Glauser/Zernack 2005, 309–325: Schoch, Max (2012): Emil Brunner, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D10450. php. Schönhärl, Korinna (2009): Wissen und Visionen. Theorie und Politik der Ökonomen im Stefan George-Kreis. Berlin: Akademie-Verlag.
Literatur und publizierte Quellentexte
829
Schönhärl, Korinna (2009a): «Die Nationalökonomen im George-Kreis und ihre Vorstellungen von Wirtschaft und Staat», in: Roman Köster/Werner Plumpe/Bertram Schefold/Korinna Schönhärl (Hg.): Das Ideal des schönen Lebens und die Wirklichkeit der Weimarer Republik. Vorstellungen von Staat und Gemeinschaft im GeorgeKreis. Berlin: Akademie Verlag, 173–194. Schönhärl, Korinna (2013): «‚Urbanität‘ in Zeiten der Krise. Der Basler Arbeitsrappen», in: Karin Wilhelm/Kerstin Gust (Hg.): Neue Städte für einen neuen Staat. Die städtebauliche Erfindung des modernen Israel und der Wiederaufbau in der BRD. Eine Annäherung. Bielefeld: transcript, 46–63. Schöttler, Peter (Hg.) (1999): Geschichtsschreibung als Legitimationswissenschaft 1918– 1945. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Scholtyseck, Joachim (2016): Freudenberg. Ein Familienunternehmen in Kaiserreich, Demokratie und Diktatur. München: Beck. Scholtyseck, Joachim/Christoph Studt (Hg.) (2008): Universitäten und Studenten im Dritten Reich. Bejahung, Anpassung, Widerstand. XIX. Königswinterer Tagung vom 17.– 19. Februar 2006. Berlin/Münster: Lit. Scholz, Albrecht (1999): Geschichte der Dermatologie in Deutschland. Berlin: Springer. Schott, Gerhard (2008): «Richard Harder, Klassischer Philologe, erster Interpret der Flugblätter der ‚Weissen Rose‘, und das ‚Institut für Indogermanische Geistesgeschichte‘», in: Elisabeth Kraus (Hg.): Die Universität München im Dritten Reich. Aufsätze, Teil II. München: Herbert Utz, 413–500. Schrade, Leo (1960): «Musikwissenschaft», in: Lehre und Forschung an der Universität Basel zur Zeit der Feier ihres Fünfhundertjährigen Bestehens, dargestellt von Dozenten der Universität Basel. Basel: Birkhäuser. Schröder, Rainer (2010): «Die Geschichte der Juristischen Fakultät zwischen 1810 und 1945», in: Stefan Grundmann u. a. (Hg.): Festschrift 200 Jahre Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Berlin/ New York: de Gruyter, 5–113. Schubert, Gudrun (2002): Fritz Meier, in: Encyclopedia Iranica, http://www.iranicaonline. org/articles/meier-fritz-1. Schubert, Gudrun (2019): «Fritz Meier – Professor für Islamwissenschaft 1949–1982», in: Bolliger/Würsch 2019, 101–109. Schubiger, Albert (1934/35): «Dr. Erich Oberli: Die Verwertung faschistischer Ideen in Staat und Wirtschaft (Paul Haupt Bern/Leipzig)», Buchbesprechung, in: Zentralblatt, 360–363. Schüpbach-Guggenbühl, Samuel (2004): Hans Erlenmeyer, in: HLS, http://www.hls-dhsdss.ch/textes/d/D45048.php. Schürch, Franziska/Sabine Eggmann/Marius Risi (Hg.) (2010): Vereintes Wissen. Die Volkskunde und ihre gesellschaftliche Verankerung. Basel/Münster: SGV/Waxmann. Schütt, Julian (1996): Germanistik und Politik. Schweizer Literaturwissenschaft in der Zeit des Nationalsozialismus. Zürich: Chronos. Schultz, H. D. (2018): «Albrecht Penck – Vorbereiter und Wegbereiter der NS-Lebensraumpolitik?», in: E&G Quaternary Science Journal 66, 115–129, verfügbar unter: https://doi.org/10.5194/egqsj-66-115-2018.
830
Bibliographie
Schulz, Peter/Andreas Urs Sommer (2007): Fritz Buri – sein Weg. Leben, Denken, Glauben. Göttingen/Freiburg: V&R unipress/Academic Press Fribourg. Schulze, Winfried/Otto Gerhard Oexle (Hg.) (1999): Deutsche Historiker im Nationalsozialismus. Frankfurt a. M.: Fischer. Schumacher, Yves (2019): Nazis! Fascistes! Fascisti! Faschismus in der Schweiz 1918– 1945. Zürich: Orell Füssli. Schwalbach, Nicole (2000): ‚Es ist jetzt noch Zeit, die Trennlinie zwischen Schweizern und Verrätern zu ziehen‘. Die Ausbürgerung des Psychiaters Ernst Rüdin vor dem Hintergrund der Schweiz am Ende des Zweiten Weltkriegs. Basel: Lizentiatsarbeit Historisches Seminar (unveröff.). Schwarz, Stephan (2018): «Nationalsozialistische Dozenten an Schweizer Universitäten (1933–1945)», in: SZG 68, H. 3, 502–525. Schweizer, Felix (1934): «Professoren und Demokratie. Nach dem Zürcher ein Basler Fall», in: Die Nation. Unabhängige Zeitung für Demokratie und Volksgemeinschaft, 2. Jahrgang Nr. 1, Zürich, 5. Januar 1934, 3. Schweizer, Magdalena (2002): Die psychiatrische Eugenik in Deutschland und in der Schweiz zur Zeit des Nationalsozialismus. Ein Beitrag zur geschichtlichen Aufarbeitung mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Schweiz. Bern: Lang. Schweizerischer Zofingerverein: Zentralblatt (Centralblatt), 1932–1946. Schwinges, Rainer Christoph (2019): «Universitätsgeschichte. Bemerkungen zu Stand und Tendenzen der Forschung (vornehmlich im deutschsprachigen Raum)», in: Livia Prüll/Christian George/Frank Hüther (Hg.): Universitätsgeschichte schreiben. Inhalte – Methoden – Fallbeispiele. Göttingen: V&R unipress/Mainz University Press, 25–45. See, Klaus von (2004): «Hermann Schneider und der Nationalsozialismus. Mit einem Anhang: ‚Ich bin kein freier Mensch mehr …‘. Hermann Schneider im Briefwechsel mit Andreas Heusler 1920–1939», in: von See/Zernack 2004, 9–106. See, Klaus von (2005): «‚Mich hat der gelehrte Beruf nur mässig beglückt‘ – Andreas Heusler als Wissenschaftler und Zeitzeuge», in Glauser/Zernack 2005, 21–61. See, Klaus von/Julia Zernack (2004): Germanistik und Politik in der Zeit des Nationalsozialismus. Zwei Fallstudien: Hermann Schneider und Gustav Neckel. Heidelberg: Universitätsverlag Winter. Seidel Menchi, Silvana (2013): «Häretiker im Italien des 16. Jahrhunderts», in: Uwe Israel/ Michael Matheus (Hg.): Protestanten zwischen Venedig und Rom in der Frühen Neuzeit. Berlin: Akademie Verlag, 25–39. Seidl, Tobias (2009): «Personelle Säuberungen an der Technischen Hochschule Karlsruhe 1933–1937», in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 157 (N.F. 118), 429– 492. Selle, Götz von (1937): Die Georg-August-Universität zu Göttingen 1737–1937. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Selle, Götz von (Hg.) (1937a): Die Matrikel der Georg-August-Universität zu Göttingen, Bd. 1: 1734–1837. Text- und Hilfsband. Hildesheim: August Lax.
Literatur und publizierte Quellentexte
831
Senn, Hans (2005): Gustav Däniker, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D23463. php. Serry, Hervé (2004): Naissance de l’intellectuel catholique. Paris: La Découverte. Seymour, Raymond B. (1989): «The Development of Thermosets by Lee Baekeland and Other Early 20th Century Chemists», in: R. B. Seymour (Hg.): Pioneers in Polymer Science. Dordrecht u. a.: Kluwer Academic Publishers, 81–92. Sibold, Noëmi (2010): Bewegte Zeiten. Zur Geschichte der Juden in Basel von den 1930er Jahren bis in die 1950er Jahre. Zürich: Chronos. Siegele-Wenschkewitz, Leonore/Carsten Nicolaisen (Hg.) (1993): Theologische Fakultäten im Nationalsozialismus. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Siegrist, Dominik (1989): «Heimat – Landschaft – Nation. Ein Beitrag zur Geschichte der Schweizer Geographie während des deutschen Faschismus», in: Michael Fahlbusch/ Mechtild Rössler/Dominik Siegrist (Hrsg.): Geographie und Nationalsozialismus. Drei Fallstudien zur Institution Geographie im Deutschen Reich und der Schweiz (urbs et regio 51), 275–423. Siegrist, Kurt (1938/39): «Der deutsche Film von heute», in: Zentralblatt, 86–91. Simon, Christian (1995): «Hektor Ammann – Neutralität, Germanophilie, Geschichte», in: Aram Mattioli (Hg.): Intellektuelle von rechts. Ideologie und Politik in der Schweiz 1918–1939. Zürich: Orell Füssli, 29–53. Simon, Christian (2002): «Belohnte Industrieforschung. Der Nobelpreis für Physiologie/ Medizin 1948», in: Mitteilungsblatt Gesellschaft Deutscher Chemiker, Fachgruppe Geschichte der Chemie 16, 134–150. Simon, Christian (2005): «Vier ‚gewöhnliche‘ und ein aussergewöhnlicher Chemiker. Mikrohistorie einer Abteilung der ETH Zürich 1933–1945», in: Mitteilungsblatt Gesellschaft Deutscher Chemiker, Fachgruppe Geschichte der Chemie 18, 117–147. Simon, Christian (2009): «Adolf Butenandt für Basel? Geschichte einer gescheiterten Berufung 1946–1949», in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 109, 9–52. Simon, Christian (2009a): Natur-Geschichte. Das Naturhistorische Museum Basel im 19. und 20. Jahrhundert. Basel: Christoph Merian. Simon, Christian (2010): «Naturwissenschaften in Basel im 19. und 20. Jahrhundert. Die Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität», verfügbar unter: https://unigeschichte.unibas.ch/fileadmin/user_upload/pdf/CSimon_Naturwissenschaft enBasel.pdf. Simon, Christian (2011): «‚Anstalt für Physik, Chemie und Astronomie‘. Die ersten Jahrzehnte des Bernoullianums», in: Dorothee Huber/Christian Simon/Willem B. Stern: Das Bernoullianum – Haus der Wissenschaften für Basel (Neujahrsblatt der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige 190). Basel: Schwabe, 9–53. Simon, Christian (2013): «Zwischen Historismus und Geistiger Landesverteidigung. Geschichtswissenschaft an der Universität Basel im frühen 20. Jahrhundert», in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 113, 53–100. Simon, Christian (2015): Reisen, Sammeln und Forschen. Die Basler Naturhistoriker Paul und Fritz Sarasin. Basel: Schwabe.
832
Bibliographie
Simon, Christian (2019): «Zeittypische Bedingungen am akademischen Stellenmarkt für die Universität Basel 1937–1941. Das Beispiel der chemischen Fächer», in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 119, 9–34. Simon, Gerd unter Mitwirkung von Dagny Guhr und Ulrich Schermaul (2005): Chronologie zur Ura-Linda-Chronik, Letztfassung Oktober 2005, verfügbar unter: https:// homepages.uni-tuebingen.de//gerd.simon/ULChr.pdf. Simonius, August (1944): Ansprachen gehalten an der Trauerfeier für Professor Dr. iur. Robert Haab, geboren den 1. Mai 1893, gestorben den 28. Januar 1944 am Montag, den 31. Januar 1944 in der Martinskirche zu Basel und am Dienstag, den 1. Februar 1944 in der Kapelle des Friedhofes Manegg zu Zürich (Privatdruck). Simonius, August (1948): «Die Persönlichkeitsrechte des Privatrechts in ihrem Verhältnis zu den öffentlichen Freiheitsrechten», in: Die Freiheit des Bürgers im schweizerischen Recht. Festgabe zur Hundertjahrfeier der Bundesverfassung, hg. von den Juristischen Fakultäten der schweizerischen Universitäten. Zürich: Polygraphischer Verlag, 281–296. Sitt, Martina (Hg.) (1990): Kunsthistoriker in eigener Sache. Zehn autobiographische Skizzen. Berlin: Reimer. Smend, Rudolf (1996): «Der Exeget und der Dogmatiker – anhand des Briefwechsels zwischen W. Baumgartner und K. Barth», in: Michael Trowitzsch (Hg.): Karl Barths Schriftauslegung. Tübingen: Mohr, 53–69. Smend, Rudolf (2017): «Alfred Bertholet (1868–1951)», in: Smend 2017a, 525–542. Smend, Rudolf (2017a): Kritiker und Exegeten. Porträtskizzen zu vier Jahrhunderten alttestamentlicher Wissenschaft. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Soden, Wolfram von (1982): Benno Landsberger, in: Neue Deutsche Biographie 13, 516 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd116681888.html#ndbcon tent. Sommer, Andreas Urs (Hg.) (1997): Im Spannungsfeld von Gott und Welt. Beiträge zur Geschichte und Gegenwart des Frey-Grynaeischen Instituts in Basel 1747–1997. Basel: Schwabe. Sonay, Ali (2019): «Basler Islamwissenschaftler zur ‚Orientalischen Frage‘ und zum zeitgenössischen Islam zwischen 1896 und 1922», in: Bolliger/Würsch 2019, 55–66. Sorensen, Lee (o. J.): Ludwig Heydenreich, in: Dictionary of Art Historians. A Biographical Dictionary of Historic Scholars, Museum Professionals and Academic Historians of Art, https://arthistorians.info/heydenreichl. Soukup, Rudolf Werner (2005): Ernst Späth, in: Österreichisches Biographisches Lexikon, 1815–1950, Bd. 12 (Lfg. 58), 444, verfügbar unter: www.biographien.ac.at/oebl/oebl_ S/Spaeth_Ernst_1886_1946.xml. Sowden, John C. (1962): «Hermann Otto Laurenz Fischer», in: Advances in Carbohydrate Chemistry 17, 1–14. Späti, Christina (2017): «Historiografie des Nationalsozialismus in der Schweiz – punktuell, aber bedeutsam», in: Olivier Dard/Michel Grunewald/Reiner Marcowitz/Uwe Puschner (Hg.): Confrontations au national-socialisme en Europe francophone et germanophone / Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus im deutschund französischsprachigen Europa (1919–1949), vol. 1: Introduction générale – sa-
Literatur und publizierte Quellentexte
833
voirs et opinions publiques / Bd. 1: Allgemeine historische und methodische Grundlagen. Bruxelles: Peter Lang, 63–83. Speck, E. E. (1935/36): «‚Literarische Autarkie‘ in der Schweiz?», in: Zentralblatt, 613– 615. Speiser, Felix (1919): «Kultur-Komplexe in den Neuen Hebriden, Neu-Caledonien und den Sta-Cruz-Inseln», in: Beiträge zur Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte Herrn Dr. Fritz Sarasin zum 60. Geburtstage, 3. Dezember 1919, gewidmet. Genf: A. Kündig, 140–247. Speiser, Felix (1928–1929): «Über Initiationen in Australien und Neu-Guinea», in: Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel 40.2, 56–258. Speiser, Felix (1932): «Europas Selbstmord», in: Schweizer Monatshefte. Zeitschrift für Politik, Wirtschaft, Kultur 12, 39–41. Speiser, Felix (1937): «Über Kunststile in Melanesien», SA aus: Zeitschrift für Ethnologie 68, 304–369. Speiser, Felix (1938): «Melanesien und Indonesien», SA aus: Zeitschrift für Ethnologie 70, 463–481. Speiser, Felix (1941): Führer durch das Museum für Völkerkunde Basel. Kunststile in der Südsee. Basel: Krebs. Speiser, Felix (1943): «Geschichte des Museums für Völkerkunde in Basel 1893 bis 1942», SA aus: Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel 54, 265–280. Speiser, Felix (1943a): «Dr. Fritz Sarasin 1859–1942», in: Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel 54, 222–264. Spindler, Katharina (1976): Die Schweiz und der italienische Faschismus (1922–1930). Der Verlauf der diplomatischen Beziehungen und die Beurteilung durch das Bürgertum. Basel/Stuttgart: Helbing & Lichtenhahn. Spitteler, Carl (1915): Unser Schweizer Standpunkt. Zürich: Rascher. Sprengel, Rainer (1996): Kritik der Geopolitik. Ein deutscher Diskurs 1914–1944. Berlin: Akademie-Verlag. Spuhler, Gregor (2006): Fritz Hauser, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D4521. php. Spuhler, Gregor (2015): Gustav Wenk, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D5960. php. Stackmann, Karl (1999): Hans Neumann, in: Neue Deutsche Biographie 19, 151 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd116960116.html#ndbcontent. Stadler, Peter (Red.) (1983): Die Universität Zürich 1933–1983. Festschrift zur 150-JahrFeier der Universität Zürich, hg. vom Rektorat der Universität Zürich. Zürich: Universität Zürich. Stadler, Peter (1983a): «Die Jahre 1919 bis 1957», in: Stadler 1983, 25–180. Stadler, Peter (1990): «Im Schatten der Kriegsgefahr. Der internationale Historikerkongress in Zürich 1938», in: Schweizer Monatshefte 70, H. 6, 483–495. Stadt Baden (2010): Verzeichnis der Baudenkmäler, verfügbar unter: https://www.baden. ch/public/upload/assets/4488/1_20131108_Baudenkmaeler.pdf. Staehelin, Andreas (1987): Carl Ludwig, in: Neue Deutsche Biographie 15, 430 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd137877137.html#ndbcontent.
834
Bibliographie
Staehelin, Ernst (1914): Die Bedeutung des gegenwärtigen Zeitpunktes für unsere Schweiz. Der Gebirgs-Sanitäts-Kompagnie VI/3 gewidmet. Basel: Helbing & Lichtenhahn. Staehelin, Ernst (1933): «Die wahre Volksbewegung», in: Kirchenblatt für die refomierte Schweiz vom 6. April 1933, 97. Staehelin, Ernst (1933a): «Josef Nadlers Literaturgeschichte der deutschen Schweiz», in: Kirchenblatt für die reformierte Schweiz vom 4. Mai 1933, 136–141. Staehelin, Ernst (1933b): «Wesen und Aufgabe der theologischen Fakultät (Schluss)», in: Kirchenblatt für die reformierte Schweiz vom 23. März 1933, 85–89. Staehelin, Ernst (1933c): «Die wahre Volksbewegung», in: Kirchenblatt für die reformierte Schweiz vom 6. April 1933, 97. Staehelin, Ernst (1934): Liberalismus und Evangelium. Die Stellung des schweizerischen Protestantismus zum Aufbruch des Liberalismus in der Regenerationszeit. Rektoratsrede gehalten am 17. November 1933 (Basler Universitätsreden 5). Basel: Helbing & Lichtenhahn. Staehelin, Ernst (1935): «Warum schweigt die Kirche?», in: Kirchenblatt für die refomierte Schweiz vom 10. Januar 1935, 2–3. Staehelin, Ernst (1936): «Erasmus und Ökolampad in ihrem Ringen um die Kirche Jesu Christi», in: Gedenkschrift zum 400. Todestage des Erasmus von Rotterdam, hg. von der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel. Basel: Braus-Riggenbach, 166–182. Staehelin, Ernst (1939): Vom Ringen um die christliche Grundlage der schweizerischen Eidgenossenschaft seit der Geltung der Bundesverfassung von 1874. Rektoratsrede gehalten am 17. November 1939 (Basler Universitätsreden 10). Basel: Helbing & Lichtenhahn. Staehelin, Ernst (1939a): «Rede beim Festakt zur Einweihung des neuen Kollegienhauses», in: Schweizerische Hochschulzeitung, H. 3, 171 ff. Staehelin, Ernst (1941): Der Ruf Gottes an das Schweizer Volk in Vergangenheit und Gegenwart. Überlingen am Untersee: Schweizerische Traktat-Missions-Gesellschaft. Staehelin, Ernst (1941a): Christus und Europa. Predigt über Apostelgeschichte 17, 16–34, gehalten am 20. April 1941 im Münster zu Basel. Basel: Heinrich Majer. Staehelin, Ernst (1943): «Evangelische Theologie und Wirtschaftsgestaltung», in: Wissenschaft und Wirtschaft. Eine Aufsatzreihe, hg. von der Direktion der Schweizer Mustermesse Basel. Basel: Helbing & Lichtenhahn, 9–13. Staehelin, Ernst (1945): «Abschied von Prof. Gustav Senn», in: Basler Nachrichten vom 13. Juli 1945. Staehelin, Ernst (1946): Die Atomenergie im Lichte des Wortes Gottes. Predigt, gehalten durch den Sender von Beromünster am 18. August 1946. Basel: Basler Missionsbuchhandlung. Stähelin, Felix (1956): Reden und Vorträge, hg. von Wilhelm Abt. Basel: Schwabe. Staehelin, Hans Rudolf (1936/37): «Nouvelles des Sections. Rapport du Semestre d’été 1936. Bâle», in: Zentralblatt, 153–155. Staehelin, John E. (1933): Kantonale Heil- und Pflegeanstalt Friedmatt Basel. Zürich: Eckhardt & Pesch.
Literatur und publizierte Quellentexte
835
Staehelin, John E. (1948): Gegenwartskrise und Psychiatrie. Rektoratsrede gehalten am 26. November 1948 (Basler Universitätsreden 25). Basel. Helbing & Lichtenhahn. Stäuble, Antonio (2007): «Literatur in der italienischen Schweiz», in: Rusterholz/Solbach 2007, 476–484). Stäuble, Eduard (1954): «Johann Baptist Rusch, Bad Ragaz», in: Appenzellische Jahrbücher 82, 76–80, verfügbar unter: http://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=ajb001:1954:82::229. Staffe, A. (1950): «Ulrich Duerst †», in: Schweizer Archiv für Tierheilkunde 92, 669–673. Stahlmann, Ines (1995): «‚Nebelschwaden eines geschichtswidrigen Mystizismus‘? Deutungen der römischen Geschichte in den zwanziger Jahren», in: Flashar 1995, 303– 328. Stamm, Roger Alfred (1999): «L’intériorité, dimension fondamentale de la vie», in: Revue européenne des sciences sociales 37, No. 115 (Animalité et humanité autour d’Adolf Portmann: XVe colloque annuel du Groupe d’Etude ‚Pratiques Sociales et Théories‘), 55–73. Stamm, Roger Alfred (2002): «Adolf Portmann, akademischer Lehrer und Forscher», in: Georg Kreis (Hg.): Zeitbedingtheit – Zeitbeständigkeit. Professoren-Persönlichkeiten der Universität Basel. Basel: Schwabe, 56–73. Stamm, Roger Alfred/Pio Fioroni (1984): «Adolf Portmann, ein Rückblick auf seine Forschungen», in: Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel 94, 87– 120. Stamm, Rudolf (1966): «Zum Andenken an Professor Henry Lüdeke 1889–1962», in: Jahrbuch für Amerikastudien 11, 8–14. Stamm, Rudolf (1991): Spiegelungen. Späte Essays. Tübingen: Francke. Stammbach, Urs (2010): Andreas Speiser, in: Neue Deutsche Biographie 24, 654, verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118616021.html#ndbcontent. Stanley, Wendell M./William Zev Hassid (1969): Hermann Otto Laurenz Fischer. A Biographical Memoir. Washington: National Academy of Sciences, verfügbar unter: http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/fischer-her mann.pdf. Starke, Klaus (1998): «A History of Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology», in: Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology 358, 1–109. Statistisches Jahrbuch des Kantons Basel-Stadt, 1933–1946. Steding, Christoph (1938): Das Reich und die Krankheit der europäischen Kultur. Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt. Steimer, Hans Gerhard (Hg.) (2019): Friedrich Hölderlin. Kritisch-historische Ausg. von Franz Zinkernagel 1914–1926. Werkteil Gedichte, Lesarten und Erläuterungen. Göttingen: Wallstein. Steinke, Hubert (2017): Rudolf Staehelin (Nr. 19), in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/text es/d/D14649.php. Stenger, Nicolas (2018): «Une religion de substitution: l’analyse du national-socialisme par Denis de Rougemenont», in: Michel Grunewald/Olivier Dard/Uwe Puschner (Hg.): Confrontations au national-socialisme en Europe francophone et germanophone / Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus im deutsch- und fran-
836
Bibliographie
zösischsprachigen Europa (1919–1949), vol. 2: Les libéraux, modérés et européistes / Bd. 2: Die Liberalen, ‚Modérés‘ und Proeuropäer. Bruxelles: Peter Lang, 115–128. Steuernagel, Dirk (Hg.) (2018): Altertumswissenschaften in Deutschland und in Italien. Zeit des Umbruchs (1870–1940). Regensburg: Schnell und Steiner. Stickelberger, Emmanuel (1934/35): «Mittelmässigkeit als Programm. Bemerkungen zur neuesten deutschen Literatur», in: Zentralblatt, 405–416. Stiewe, Barbara (2011): Der ‚Dritte Humanismus‘. Aspekte deutscher Griechenrezeption vom George-Kreis bis zu Nationalsozialismus. Berlin/New York: de Gruyter. Stingelin, Martin (1999): «Walter Muschg und Sigmund Freud», in: Pestalozzi/Stingelin 1999, 18–30. Stirnimann, Charles (1988): Die ersten Jahre des ‚Roten Basel‘ 1935–1938. Zielsetzungen und Handlungsspielräume sozialdemokratischer Regierungspolitik im Spannungsfeld von bürgerlicher Opposition und linker Kritik. Basel: Reinhardt. Stirnimann, Charles (1992): Der Weg in die Nachkriegszeit 1943–1948. Ein Beitrag zur politischen Sozialgeschichte des ‚Roten Basel‘. Basel: Reinhardt. Stirnimann, Charles (2021): Baumeister des Roten Basel. Fritz Hauser (1884–1941) in seiner Zeit. Mitarbeit Monika Schib Stirnimann. Basel: Christoph Merian Verlag. Stokes, Donald E. (1997): Pasteur’s Quadrant. Basic Science and Technological Innovation. Washington D.C.: Brookings Institution Press. Stolleis, Michael (1999): Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Bd. 3: Staatsund Verwaltungsrechtswissenschaft in Republik und Diktatur 1914–1945. München: Beck. Stolz, Michael (2010): Friedrich Ranke, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D11642.php. Stortz, Paul (2012): «Refugee Professors and the University of Toronto during the Second World War», in: Paul Stortz/E. Lisa Panayotidis (Hg.): Cultures, Communities, and Conflict. Histories of Canadian Universities and War. Toronto: University of Toronto Press, 227–252. Stourzh, Gerhard (2008): «Herbert Stourzh als politischer Schriftsteller», in: Herbert Stourzh, Gegen den Strom. Ausgewählte Schriften gegen Rassismus, Faschismus und Nationalsozialismus 1924–1938, Wien/Köln/Weimar: Böhlau, 11–39. Straka, Georges (1974): «Hommage à la mémoire de W. v. Wartburg. Extraits de la correspondance entre Walther von Wartburg et Mme von Wartburg en 1939 et 1940», in: Revue de linguistique romane 38, 149/152, 610–616. Streckeisen, Albert/Jürg Meyer (1990): «Peter Bearth, 1902–1989», in: Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilungen 70, H. 3, 449–453. Streim, Gregor (2017): «‚Grosse Ahnen‘ und ‚erbärmliche Erben‘. Die Begründung des ‚sozialistischen Humanismus‘ in den literarisch-politischen Debatten des Exils», in: Matthias Löwe/Gregor Streim (Hg.): ‚Humanismus’ in der Krise. Debatten und Diskurse zwischen Weimarer Republik und geteiltem Deutschland. Berlin/Boston: de Gruyter, 193–214. Strenge, Irene (2014): «Vom Protest der hundert juristischen Fakultäten», in: Thilo Ramm/Stefan Chr. Saar (Hg.): Nationalsozialismus und Recht. Erste Babelsberger Gespräche. Baden-Baden: Nomos, 272–291.
Literatur und publizierte Quellentexte
837
Studer, Brigitte (1994): Un parti sous influence. Le Parti communiste suisse, une section du Komintern 1931–1939. Lausanne: L’Age d’Homme. Studer, Samuel (2014): Hans Zickendraht, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 049728/2014-02-13/. Stückelberger, Matthias (1943/44): «Semesterberichte W.S. 1943/44 Sektion Basel», in: Zentralblatt, 413 f. Sturm, Fritz (2007): Erich-Hans Kaden, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D48546.php. Sturm, Peter (1995): Literaturwissenschaft im Dritten Reich. Germanistische Wissenschaftsformationen und politisches System. Wien: Edition Praesens. Stybe, Svend Erik (1979): Copenhagen University. 500 Years of Science and Scholarship. Copenhagen: The Royal Danish Ministry of Foreign Affairs. Surbeck, Rolf/Ewald Billerbeck (Red.) (2000): Humanismus. 56 Annäherungen an einen lebendigen Begriff. Basel: GS-Verlag. Suter-Christoffel, R. (1951): «Hans Rupe», in: Jahresbericht der Sektion Basel S.A.C., 89. Vereinsjahr, 3–6. Sutermeister, C. A. (1939/40): «Brief aus dem Aktivdienst», in: Zentralblatt, 301–307. Sziranyi, Janina/Stephanie Kaiser/Mathias Schmidt/Dominik Gross (2019): «‚Jüdisch versippt‘ and ‚materialistic‘. The Marginalization of Walther E. Berblinger (1882–1966) in the Third Reich», in: Pathology – Research and Practice 215.5, 995–1002, verfügbar unter: https://doi.org/10.1016/j.prp.2019.02.006. Szokody, Oliver (2001): «Isländischer Bauer oder ekstatischer Krieger? Zur Verknüpfung von Ideologie und Germanenbild am Beispiel von Andreas Heusler», in: Caduff/ Gamper 2001, 263–276. Taeschner, Franz (1961): «Rudolf Tschudi (1884–1960)», in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 111 (NF 36), 4–5. Tamm, Christoph (2005): Friedrich Fichter, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D44499.php. Tamm, Christoph (2005a): Paul Ruggli, in: Neue Deutsche Biographie 22, 239 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd116702214.html#ndbcontent. Tamm, Christoph (2006): Georg Kahlbaum, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D32032.php. Tanner, Jakob (1991): «Edgar Bonjour (1898–1991)», in: Basler Stadtbuch 1991, 249 f. Tanner, Jakob (2015): Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert. München: Beck. Taschwer, Klaus (2016): «Geheimsache Bärenhöhle. Wie eine antisemitische Professorenclique nach 1918 an der Universität Wien jüdische Forscherinnen und Forscher vertrieb», in: Regina Fritz/Grzegorz Rossolinski-Liebe/Jana Starek (Hg.): Alma Mater Antisemitica. Akademisches Milieu, Juden und Antisemitismus an den Universitäten Europas zwischen 1918 und 1939. Wien: new academic press, 221–242. Taubes, Jacob (2006): Der Messianismus als politisches Problem. Briefe von Jacob Taubes an Gershom Scholem und andere Materialien, hg. von Elettra Stimilli. Würzburg: Königshausen & Neumann. Tausk, Marius (1984): Organon. The Story of an Unusual Pharmaceutical Enterprise. Oss: AKZO PHARMA.
838
Bibliographie
Teissier, Pierre (2006): «Le laboratoire de Robert Collongues (1950–2000). Une école de recherche aux débuts de la chimie du solide», in: L’Actualité Chimique, Société chimique de France 50–59, verfügbar unter: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs01070277/document. Teltschik, Walter (1992): Geschichte der deutschen Grosschemie. Entwicklung und Einfluss in Staat und Gesellschaft. Weinheim u. a.: VCH. Teuteberg, René/Raymond Petignat/Dorothea Roth/Rudolf Suter (2002): Albert Oeri 1875 bis 1950. Journalist und Politiker aus Berufung. Basel: GS-Verlag. Thalmann, H. (1976): «Rolf F. Rutsch 1902–1975», in: Bulletin der Vereinigung Schweiz. Petroleum-Geologen und -Ingenieure (102), 27–28. Thommen, Georg Heinrich (1934/35): «Ist Görings jüngster Hieb gegen die Schweizerpresse wirklich völlig unberechtigt?», in: Zentralblatt, 500–503. Thompson, D’Arcy W. (1945): «Dr. Gustav Senn (Obituary)», in: Nature 3958, 8. September 1945, 289. Thürkauf, Max (1965): «Werner Kuhn-Laursen (1899–1963)», in: Basler Stadtbuch 1965, 189–192. Thurneysen, Eduard (1965): «Professor Wilhelm Vischer zum 70. Geburtstag», in: Basler Nachrichten vom 29. 4. 1965. Tiedau, Ulrich (2008): Franz Steinbach, in: Handbuch der völkischen Wissenschaften. Personen - Institutionen – Forschungsprogramme – Stiftungen, hg. von Ingo Haar und Michael Fahlbusch. München: Saur, 661–666. Tietz, Christiane (2019): Karl Barth. Ein Leben im Widerspruch, 2. Aufl. München: Beck. Tikhonov, Natalia (2005): «Das weibliche Gesicht einer ‚wissenschaftlichen und friedlichen Invasion‘. Die ausländischen Professorinnen an den Schweizer Universitäten vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1939», in: Jahrbuch für Europäische Geschichte 6, 99–116. Tisa Francini, Esther (2020): «Auseinandersetzungen um Kunst in Basel 1933–1945», in: Moser/Heini 2020, 101–109. Todd, Jeffrey D. (2005): «Die Stimme, die nie verklingt. Ernst Robert Curtius’ abgebrochenes und fortwährendes Verhältnis zum George-Kreis», in: Bernhard Böschenstein u. a. (Hg.): Wissenschaftler im George-Kreis. Berlin: de Gruyter, 195–208. Totti, Armida Luciana (o. J.): Die Universität Bern 1930–1940. Unter besonderer Berücksichtigung der philosophisch-historischen Fakultät. Bern: Lizentiatsarbeit (unveröff.). Tréfás, Dávid (2009): «Deutsche Professoren in der Schweiz – Fallbeispiele aus der Geschichte der Universität Basel im 19. und 20. Jahrhundert», in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 109, 103–128. Trinkler, Hedwig (1973): Aus der Geschichte der Pathologie und ihrer Anstalt in Basel (151. Neujahrsblatt der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige). Basel: Helbing und Lichtenhahn. Tripet, Arnaud (2012): Marcel Raymond, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D16158.php. Troll, Carl (1937): «Kolonialgeographische Forschung und das deutsche Kolonialproblem», in: Albrecht Haushofer (Hg.): Verhandlungen und Wissenschaftliche Ab-
Literatur und publizierte Quellentexte
839
handlungen des 26. Deutschen Geographentages zu Jena 9. bis 12. Oktober 1936. Breslau: Ferdinand Hirt, 119–138. Troll, Carl (1969): «Fritz Jaeger, ein Forscherleben», in: Erlanger Geographische Arbeiten 24, 7–50. Troll, Carl (1974): Fritz Jaeger, in: Neue Deutsche Biographie 10, 276, verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118711296.html#ndbcontent. Trommsdorff, Volker (2002): «In Memoriam Eduard Wenk (4. 11. 1907–19. 10. 2001)», in: Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilungen 82, No. 1, 130– 136. Trommsdorff, Volkmar (2020): Peter Bearth, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 043928/2020-04-23/. Trümpy, Hans (1972): Eduard Hoffmann-Krayer, in: Neue Deutsche Biographie 9, 394 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118774689.html#ndbcon tent. Tschudi, Hans-Peter (1993): Im Dienste des Sozialstaates. Politische Erinnerungen. Basel/ Berlin: Reinhardt. Ugolini, Gherardo (2016): «Jaeger e il Terzo umanesimo», in: Diego Lanza/Gherardo Ugolini (Hg.): Storia della filologia classica. Rom: Carocci, 249–276. Ungern-Sternberg, Jürgen von (2010): «Zur Geschichte der Alten Geschichte an der Universität Basel», in: Leonhard Burckhardt (Hg.): Das Seminar für alte Geschichte in Basel 1934–2007. Basel: Selbstverlag, 53–90. Universität Greifswald im Nationalsozialismus (o. J.): Gustav Braun, https://ns-zeit.unigreifswald.de/projekt/personen/braun-gustav/. Universitätsbibliothek Basel (o. J.): Präsentation des Nachlasses von Rudolf Tschudi. https://ub-easyweb.ub.unibas.ch/fileadmin/user_upload/universitaetsbibliothek/Univer sitaetsbibliothek/3_Fachgebiete/Gesellschaftswissenschaften/Islamwissenschaften/tschu di-biografie.pdf. University of Chicago Library (2006): Guide to the William A. Nitze Papers 1903–1937. https://www.lib.uchicago.edu/e/scrc/findingaids/view.php?eadid=ICU.SPCL.NITZE WA. Unte, Wolfhart (2001): Max Pohlenz, in: Neue Deutsche Biographie 20, 588 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd116260912.html#ndbcontent. Urner, Klaus (1971): «Die Gründung der Schweizerischen Monatshefte für Politik und Kultur», in: Schweizer Monatshefte 50, 1064–1078. v. S. [Ernst von Schenck?] (1942): «Probleme der fränkischen Besiedelung Galliens [Bericht über einen Vortrag von Walther von Wartburg vor der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft]», in: Basler Nachrichten vom 24. November 1942. Vaudaux, Adolphe (1941/42): «6. Kolonne», in: Basler Studentenschaft, WS, H. 1, 9–14. Vencato, Marco (2009): «Marion Dönhoff, die Universität Basel und Europa. Sonderausstellung im Museum Kleines Klingental 20.11.–13. 12. 2009. Vernissage-Ansprache des Ausstellungskurators», in: Jahresbericht Stiftung pro Klingentalmuseum Basel, 50–55.
840
Bibliographie
Verein Freunde der Städelschule e. V. Frankfurt (Hg.) (1982): Städelschule Frankfurt am Main. Aus der Geschichte einer deutschen Kunsthochschule. Frankfurt a. M.: Waldemar Kramer. Verhandlungen (1935): Verhandlungen und Wissenschaftliche Abhandlungen des 25. Deutschen Geographentages zu Bad Nauheim, 22. bis 24. Mai 1934, hg. von Albrecht Haushofer. Breslau: Ferdiand Hirt. Verhandlungen (1937): Verhandlungen und Wissenschaftliche Abhandlungen des 26. Deutschen Geographentages zu Jena, 9. bis 12. Oktober 1936, hg. von Albrecht Haushofer. Breslau: Ferdinand Hirt. Verzar, Christine B. (2014): «After Burckhardt and Wölfflin; was there a Basel School of Art History?», in: Journal of Art Historiography, 11 Dezember 2014, 1–31, verfügbar unter: https://arthistoriography.files.wordpress.com/2014/11/verzar.pdf (danach zitiert). Verzeichnis der Behörden und Beamten des Kantons Basel-Stadt, verschiedene Jahrgänge. Staatsarchiv Basel-Stadt, Bibliothek H 52. Verzeichnis der Professorinnen und Professoren der Universität Mainz 1477–1973, http:// gutenberg-biographics.ub.uni-mainz.de/personen/register/eintrag/hans-mislin.html. Vetter, Rudolf C. (1953): «Emil Christoph Barell 1874–1953», in: Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 133, Teilbd. 3, Nekrologe verstorbener Mitglieder, 299–302. Vidal, Fernando (2009): Édouard Claparède, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D9013.php. Vigener, Marie (2012): ‚Ein wichtiger kulturpolitischer Faktor‘. Das Deutsche Archäologische Institut zwischen Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit, 1918–1954. Rahden: Leidorf. Vincent, Raymonde (1938): Stilles Land. Übersetzung von Gerhard Hess. Berlin: Kiepenheuer. Vincent, Raymonde (1982): Le temps d’apprendre à vivre. Paris: Julliard. Vinzent, Markus (2001): «Bio-graphie und Historio-graphie», in: Näf 2001, 439–460. Vischer, Benedict (2010): «Die Geschichte der Philosophie an der Universität Basel», verfügbar unter: https://unigeschichte.unibas.ch/fileadmin/user_upload/pdf/Vischer_Phi losophie.pdf. Vischer, Eberhard (1933): «Kirche und Staat», in: Kirchenblatt für die reformierte Schweiz vom 16. November 1933, 354–362. Vischer, Frank (1997): «Vorwort des Präsidenten des Kuratoriums der Frey-Grynaeischen Stiftung», in: Sommer 1997, 7 f. Visser, Ph. L./Jenny Visser-Hooft (Hg.) (1935/1938): Wissenschaftliche Ergebnisse der niederländischen Expedition in den Karakorum und die angrenzenden Gebiete in den Jahren 1922, 1925 und 1929/30. Leipzig: Brockhaus. Völker, Paul Gerhard (1972): Andreas Heusler, in: Neue Deutsche Biographie 9, 49–52, verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118704370.html#ndbcon tent. Vogt, Joseph (Hg.) (1943): Rom und Karthago. Ein Gemeinschaftswerk. Leipzig: Koehler & Amelang.
Literatur und publizierte Quellentexte
841
Vollenweider, Rudolf (1955): Anton Alfons Gams-Meng, 1884–1955. Trauerfeier in der Kirche St. Matthäus in Basel am 1. November 1955. Ansprache gehalten von Kirchenratspräsident Herrn Pfarrer Rudolf Vollenweider. Lieder gesungen durch den Basler Männerchor unter Leitung von Dirigent Walther Aeschbacher. Privatdruck o. O. Vonderschmitt, Louis (1969): «August Buxtorf», in: Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 149, 263–265. Wachter, Rudolf (2009): Max Niedermann, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D43448.php. Wacker, Jean-Claude (1990): Humaner als Bern! Schweizer und Basler Asylpraxis gegenüber den jüdischen Flüchtlingen von 1933 bis 1943 im Vergleich. Basel: Lizentiatsarbeit Historisches Seminar (unveröff.). Wackernagel, Hans Georg (1926): «Das Volkstum als staatsbildende Kraft. Eine Untersuchung über den Ursprung der alten Eidgenossenschaft», in: Schweizerische Monatshefte 4, H. 2, 88–100. Wackernagel, Hans Georg (1959): Altes Volkstum in der Schweiz. Gesammelte Schriften zur historischen Volkskunde. Basel: Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde. Wackernagel, Jacob (1923): Die Viehverstellung. Eine Sonderbildung der spätmittelalterlichen Gesellschaft, dargestellt auf Grund italienischer, französischer und deutscher Quellen. Weimar: Böhlau. Wackernagel, Jacob (1924): «Staat und Persönlichkeit. Eine Studie über das absolute Element in den subjektiven öffentlichen Rechten», in: Schweizerische Monatshefte 3, H. 10, 487–501. Wackernagel, Jacob (1934): Der Wert des Staates. Untersuchungen über das Wesen der Staatsgesinnung. Basel: Helbing. Wackernagel, Jacob (1935): «Über das Recht auf Achtung im Völkerrecht», in: Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht, Sonderheft ‚Ausland‘, November 1935, 54–57. Wackernagel, Jacob (1936): «Armee und Staat», in: Mitteilungen der Offiziersgesellschaft Basel-Stadt 4, 4. Januar 1936, 35–37. Wackernagel, Jacob (1937): «Zur Lehre vom Staatsnotstand», in: Zeitschrift für Schweizerisches Recht NF 56, H. 2, 169–201. Wackernagel, Jacob (1939): «La Suisse et l’autracie», in: Charles Burky/Jean de la Harpe/ Jacob Wackernagel: La Suisse et l’autarcie, préface de August Simonius (Comité suisse de coordination des hautes études internationales, Conférence permanente des hautes études internationales – Les politiques économiques et la paix). Neuchâtel/ Paris: P. Attinger, 93–164. Wackernagel, Jacob (1961): «Staatsgesinnung», in: Hermann Rinn (Hg.): Dauer im Wandel, Festschrift zum 70. Geburtstag von Carl J. Burckhardt. München: Callwey, 439– 449. Wackernagel, Marianne (2013): Hans Georg Wackernagel, in: HLS, http://www.hls-dhsdss.ch/textes/d/D27121.php. Waeber, Aurel (2004): Georgine Gerhard (1886–1971) und ihre Aktivitäten in Flüchtlingshilfe, Frauenbewegung und Sozialpolitik. Eine Basler Biographie. Basel: Lizentiatsarbeit, Historisches Seminar (unveröff.).
842
Bibliographie
Wäffler, Hermann (1992): «Kernphysik an der ETH Zürich zu Zeiten Paul Scherrers», in: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 137, H. 3, 143–176. Wagner, Valentin F. (1959): «Die Armut des Historizismus. Theorie und Geschichte», in: Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 95, Teil I, 21–46. Wahlert, Gerd von (1972): Adolf Portmann – Versuch einer Würdigung. Basel: Reinhardt. Wall, Renate (2004): Lexikon deutschsprachiger Schriftstellerinnen im Exil 1933–1945. Gießen: Haland & Wirth. Walser, Ernst (1932): Gesammelte Studien zur Geistesgeschichte der Renaissance mit einer Einführung von Werner Kaegi. Basel: Schwabe. Walton, Chris (2000): «Heil Dir, Helvetia! Anmerkungen zur Musikpublizistik eines ‚neutralen‘ Landes, in: Gerhard 2000, 306 ff. Wanner, Gustaf Adolf (1953): «Oscar Cullmann – trait d’union entre l’Université de Bâle et la Sorbonne», in: Nouveau Courrier Romand, 18. Dezember 1953. Wanner, Gustaf Adolf (1967): «Professor Jacob Wackernagel zum Gedenken», in: Basler Nachrichten vom 19. Juli 1967. Wanner, Gustav Adolf (1968): «Professor Julius Schweizer zum 70. Geburtstag», in: Basler Nachrichten vom 15. Oktober 1968. Wanner, Gustav Adolf (1969): «Prof. Eduard Wenk zum Rektor designiert», in: Basler Nachrichten vom 29. Mai 1969. Wanner, Gustav Adolf (1970): «Professor Andreas Speiser zum Gedenken», in: Basler Nachrichten vom 13. 10. 1970. Wanner, Gustav Adolf (1971): «Professor Ernst Zwinggi gestorben», in: Basler Nachrichten vom 14. 7. 1971. Wartburg, Walther von (1917): «Schweizer Kriegsziele», in: Die Tat. Monatsschrift für die Zukunft deutscher Kultur 8, H. 10, 883–891. Wartburg, Walther von (1924): «Sprachgeschichte und Kulturgeschichte», in: Schweizer Monatshefte für Politik und Kultur 3, H. 2, 552–564. Wartburg, Walther von (1930): «Der Einfluss der germanischen Sprachen auf den romanischen Wortschatz», in: Archiv für Kulturgeschichte 20, 309–325. Wartburg, Walther von (1936): «Die Entstehung der romanischen Sprachräume», in: Schweizer Monatshefte 16, H. 1, 1–15. Wartburg, Walther von (1936a): «Die Ausgliederung der romanischen Sprachräume», in: Zeitschrift für romanische Philologie 56, 1–48. Wartburg, Walther von (1939): Die Entstehung der romanischen Völker. Halle (Saale): Max Niemeyer. Wartburg, Walther von (1939a): La posizione della lingua italiana. Firenze: Sansoni. Bibliotheca del Leonardo XIII [gedruckt 1940]. Wartburg, Walther von (1940): «Entstehung und Wesen der mehrsprachigen Schweiz», in: Schweizer Monatshefte 20, H. 1, 8–17. Wartburg, Walther von (1941): «Die Eigenart des französischen Sprachbaus und ihre historische Grundlage. Antrittsvorlesung», in: Sonntagsblatt der Basler Nachrichten vom 26. Januar 1941, 35. Jahrgang, Nr. 4, 13–16. Wartburg, Walther von (1943): Einführung in Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft. Halle (Saale): Max Niemeyer.
Literatur und publizierte Quellentexte
843
Wartburg, Walther von (1950): «Arminio Janner», in: Janner 1950, 3–9. Weber, Christian (2011): Max Kommerell, eine intellektuelle Biographie. Berlin/New York: de Gruyter. Weber, Kathrin (2005): Fritz Ebi, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D5963.php. Weber, Matthias M. (1993): Ernst Rüdin. Eine kritische Biographie. Berlin u. a.: Springer. Weber, Matthias M. (1996): «Harnack-Prinzip oder Führerprinzip? Erbbiologie unter Ernst Rüdin an der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie in München», in: Bernhard vom Brocke/H. Laitko (Hg.): Die Kaiser Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft und ihre Institute. Studien zu ihrer Geschichte. Das Harnack-Prinzip. Berlin: de Gruyter, 409–422. Weber-Hug, Christine (1983): «Die Studentenschaft 1933–1983», in: Stadler 1983, 195– 235. Wecker, Regina/Sabine Braunschweig/Gabriela Imboden u. a., unter Mitarbeit von Bernhard Küchenhoff (2013): Eugenik und Sexualität. Die Regulierung reproduktiven Verhaltens in der Schweiz 1900–1960. Zürich: Chronos. Wegeler, Cornelia (1996): ‚… wir sagen ab der internationalen Gelehrtenrepublik‘. Altertumswissenschaft und Nationalsozialismus. Das Göttinger Institut für Altertumskunde 1921–1962. Wien/Köln/Weimar: Böhlau. Wehr, Gerhard (o. J.): Adolf Köberle (Biographien – Dokumentation. Anthroposophie im 20. Jahrhundert). Dornach: Forschungsstelle Kulturimpuls, verfügbar unter: http:// biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=1096. Wehrli, Fritz (1968): «Karl Meuli †», in: NZZ vom 10. Mai 1968. Wehrli, Fritz (1971): «Nachruf auf Peter von der Mühll», in: Gnomon 43, 427–429. Wehrli, Fritz (1971a): «Peter von der Mühll 1885–1970», in: Museum Helveticum 28, H. 1, o. S., verfügbar unter: https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=mhl-001:1971: 28::312. Wehrli, Max (1993): «Germanistik in der Schweiz 1933–1945», in: Jahrbuch der Deutschen Schiller-Gesellschaft 37, 409–422. Weibel, Andrea (2003): Max Hartmann-Stehelin, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/text es/d/D46793.php. Weidmann, Marc (2003): August Buxtorf, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 028795/2003-03-17/. Weisbach, Werner (1956): Geist und Gewalt. Nach der Handschrift hg. und mit einem Personenverzeichnis versehen von Ludwig Schudt. Wien/München: Anton Schroll & Co. Weisz, George (1983): The Emergence of Modern Universities in France, 1863–1914. Princeton: Princeton University Press. Welti, Manfred (1993): Ohne Frauen geht es nicht. Werner Kaegi (1901–1979). Basel: Selbstverlag des Autors. Welti, Manfred (2015): Werner Kaegi (1901–1979) zum Zweiten. Allschwil/Basel: Selbstverlag des Autors. Welzbacher, Christian (2016): Das Neue Frankfurt. Planen und Bauen für die Metropole der Moderne. Fotos von Andreas Muhs. Berlin/München: Deutscher Kunstverlag.
844
Bibliographie
Wendland, Ulrike (1999): Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Kunsthistoriker im Exil. Leben und Werk der unter dem Nationalsozialismus verfolgten und vertriebenen Wissenschaftler. München: Saur. Wengst, Klaus (2014): «Auf die Bibel gehört – und die Juden übersehen. Die Barmer Theologische Erklärung und die Bibel.» Bonner Schlosskirchenvortrag 20. Oktober 2014, ehemals verfügbar unter: http://www.bonn-evangelisch.de/Downloads/2014_ 10_20_Klaus_Wengst_Barmen.pdf, konsultiert am 26. Mai 2018. Wenk, Eduard (1975): «Prof. Max Reinhard 1882–1974», in: Schweizerische mineralogisch-petrographische Mitteilungen 55, 157–162. Werner, Alfred (1936/37): «Libéralisme et Vérité. Discours pronocé le 8 juin 1937, en l’Aula de l’Université de Genève, à l’occasion du ‚Dies academicus‘», in: Zentralblatt 643–658. Werner, Meike G. (Hg.) (2013): Eduard Berend und Heinrich Meyer. Briefwechsel 1938– 1972 (Marbacher Schriften 10). Göttingen: Wallstein. Wernle, Paul (1923/25): Der schweizerische Protestantismus im 18. Jahrhundert. Tübingen: Mohr. Werthemann, Andreas (1963): «Über 100 Jahre Pathologie in Basel», in: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Pathologie 47, 1–11. Wichers, Hermann (1993): «Die ‚Neue Basler Zeitung‘ 1935 bis 1940 und ihre Entwicklung vom rechtskonservativen Parteiblatt zum frontistischen Organ. Ein Fallbeispiel deutscher Einflussnahme, frontistischer Aktivitäten und schweizerischer Pressezensur», in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 93, 155–173. Wichers, Hermann (1994): Im Kampf gegen Hitler. Deutsche Sozialisten im Schweizer Exil 1933–1940. Zürich: Chronos. Wichers, Hermann (2007): Wilhelm Herzog, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D27983.php. Wichers, Hermann (2010): «Die Marxistische Studentengruppe in den 1930er Jahren», verfügbar unter: https://unigeschichte.unibas.ch/fileadmin/user_upload/pdf/Wichers_ Marxistische_Studentengruppe.pdf. Wichers, Hermann (2010a): Gustav Senn, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 045453/2010-12-06/. Wichers, Hermann (2010b): Hans Rupe, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D45061.php. Wichers, Hermann (2010c): Paul Ruggli, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D45062.php. Wichers, Hermann (2011): Adolf Portmann, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D28915.php. Wichers, Hermann (2011a): Otto Schüepp, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 045452/2011-08-19/. Wichers, Hermann (2013): «Geschichte im Zeichen der Geistigen Landesverteidigung. Die Besetzung der Basler Historischen Lehrstühle 1935», in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 113, 101–145. Wichers, Hermann (2013a): Wilhelm Vischer, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 028970/2013-07-31/.
Literatur und publizierte Quellentexte
845
Wichers, Hermann (2015): «Hans Eckert. Flüchtlingshilfe, Exil, Widerstand und Nachrichtendienst 1935-1945», in: May B. Broda/Ueli Mäder/Simon Mugier (Hg.): Geheimdienste Netzwerke und Macht. Im Gedenken an Hans Eckert, Basler Advokat, Flüchtlingshelfer, Nachrichtenmann 1912 2011. Basel: edition gesowip, 55 67. Wichers, Hermann (2015a): Paul Vosseler, in: HLS, www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D44531. php. Wichers, Hermann (2017): Carl Ludwig, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D5961.php. Wichers, Hermann (2020): «Die Staatsschutzakten in Basel», in: Moser/Heini 2020, 27– 33. Widmer, Paul (2012): Minister Hans Frölicher. Der umstrittene Schweizer Diplomat. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung. Wieland, Karl (1957): «Prof. August Hagenbach-Aman (1871–1955)», in: Basler Jahrbuch 1957, 74–79. Wieland, Karl (1966): August Hagenbach, in: Neue Deutsche Biographie 7, 485, verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/sfz25320.html#ndbcontent. Wien Geschichte Wiki: Hugo Hassinger, https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Hugo_Has singer. Wien Geschichte Wiki: Johann Sölch, https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Johann_Sölch. Wiener, Christina (2013): Kieler Fakultät und ‚Kieler Schule‘. Die Rechtslehrer an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät zu Kiel in der Zeit des Nationalsozialismus und ihrer Entnazifizierung. Baden-Baden: Nomos. Wieser, G. (1965): «Wilhelm Vischer zum 70. Geburtstag», in: National-Zeitung vom 29. April 1965. Wiesmann, Louis (1967): «Ein Literaturwissenschaftler als Gewissen seiner Zeit. Zum Tod von Prof. Dr. Walter Muschg (1898–1965)», in: Basler Stadtbuch 1967, 140–147. Wikipedia: Wilhelm Altwegg, https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Altwegg. Wikipedia: Willi Baumeister, https://de.wikipedia.org/wiki/Willi_Baumeister. Wikipedia: Gustav Binz (Philologe), https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Binz_(Philo loge). Wikipedia: Max Cetto, https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Cetto. Wikipedia: Richard Döcker, https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_D%C3%B6cker. Wikipedia: Martin Elsässer, https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Elsaesser. Wikipedia: Hans Friedrich Albrecht Erlenmeyer, https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Erlen meyer. Wikipedia: Juliette Ernst, https://de.wikipedia.org/wiki/Juliette_Ernst. Wikipedia: Europa Verlag, https://de.wikipedia.org/wiki/Europa_Verlag. Wikipedia: Leonard Wilson Forster, https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Wilson_Forst er. Wikipedia: Gnomon, https://de.wikipedia.org/wiki/Gnomon_(Zeitschrift). Wikipedia: Joaquín González Muela, https://es.wikipedia.org/wiki/Joaquín_González_Mue la. Wikipedia: Adolf Grabowsky, https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Grabowsky. Wikipedia: Rudolf John Grosleben, https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_John_Gorsleben.
846
Bibliographie
Wikipedia: Emil Heitz, https://de.wikipedia.org/wiki/Emil_Heitz_(Botaniker). Wikipedia: Ferdinand Kramer, https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Kramer_(Archi tekt). Wikipedia: Elsa Mahler, https://de.wikipedia.org/wiki/Elsa_Mahler. Wikipedia: Ernst Marcus, https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Gustav_Gotthelf_Marcus. Wikipedia: Herman Francis Mark, https://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Francis_Mark. Wikipedia: Karl Nef, https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Nef. Wikipedia: Neues Frankfurt, https://de.wikipedia.org/wiki/Neues_Frankfurt. Wikipedia: Willliam A. Nitze, https://de.wikipedia.org/wiki/William_A._Nitze. Wikipedia: Marcel Prenant, https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Prenant. Wikipedia: Max Reinhard, https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Reinhard. Wikipedia: Heinrich Alfred Schmid, https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Alfred_ Schmid. Wikipedia: Walther Steller, https://de.wikipedia.org/wiki/Walther_Steller. Wikipedia: Wilhelm Szilasi, https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Szilasi Wikipedia: Johannes Thiele, https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Thiele_(Chemiker). Wikipedia: Kurt Wagner, https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Wagner_(Germanist). Wikipedia: Aby Warburg, https://de.wikipedia.org/wiki/Aby_Warburg. Wildi, Tobias (2002): Der Traum vom eigenen Reaktor. Die schweizerische Atomtechnologieentwicklung 1945–1969. Zürich: Chronos. Willi, Thomas (1985): «Wilhelm Vischer zum 90. Geburtstag», in: Basler Volksblatt vom 30. April 1985. Willi, Thomas (2004): Walther Eichrodt, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D10587.php. Winkelbauer, Thomas (2018): Das Fach Geschichte an der Universität Wien. Von den Anfängen um 1500 bis etwa 1975. Göttingen: V&R unipress/Vienna University Press. Winock, Michel (1996): ‚Esprit‘. Des intellectuels dans la cité (1930–1950) (édition revue et augmentée; première édition = Histoire politique de la revue ‚Esprit‘ [1930–1959], 1975). Paris: Seuil. Wippermann, Wolfgang (1997): Faschismustheorien. Die Entwicklung der Diskussion von den Anfängen bis heute. Darmstadt: Primus. Wisard, François (1998): L’université vaudoise d’une guerre à l’autre. Politique, finances, refuge. Lausanne: Payot. Wölfflin, Heinrich (1915): Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das Problem der Stilentwickelung in der neueren Kunst. München: Bruckmann. Wölfflin, Heinrich (1982): Autobiographie, Tagebücher und Briefe, hg. von Joseph Gantner. Basel/Stuttgart: Schwabe. Wolf, Ursula (2001): «Rezensionen in der Historischen Zeitschrift, im Gnomon und in der American Historical Review von 1930–1943/44», in: Näf 2001, 419–438. Wolf, Walter (2006): Frontenbewegung, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D17405.php. Wolfes, Matthias (2007): Paul Wilhelm Schmidt, in: Neue Deutsche Biographie 23, 212 f., verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd117515450.html#ndbcon tent.
Literatur und publizierte Quellentexte
847
Wolgast, Eike/Hartmut Kogelschatz (Hg.) (1993): Emil Julius Gumbel, 1891–1966. Akademische Gedenkfeier anlässlich seines 100. Geburtstags (Heidelberger Universitätsreden 2). Heidelberg: C. F. Müller. Wolters, Christine (2009): «Humanexperimente und Hohlglasbehälter aus Überzeugung. Gerhard Rose – Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts», in: Frank Werner (Hg.): Schaumburger Nationalsozialisten. Täter, Komplizen, Profiteure. Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte, 407–444. Woodley, Daniel (2010): Fascism and Political Theory. Critical Perspectives on Fascist Ideology. London: Routledge. Wubbe, Felix (2014): Max Gutzwiller, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D42809. php. Würsch, Renate (2002): Alfred Bloch, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/043713/ 2002-11-07/. Würsch, Renate (2019): «Basel und das Studium des Orients – von den Anfängen bis 1919», in: Bolliger/ Würsch 2019, 23–39. Würsch, Renate (2019a): «Rudolf Tschudi und sein wissenschaftliches Netzwerk im Spiegel ausgewählter Briefe», in: Bolliger/Würsch 2019, 67–72. Wyss, Bernhard (1968): «Gedenkworte, gesprochen an der Trauerfeier [für Karl Meuli] am 5. Mai 1968», in: Schweizer Volkskunde 58, H. 4/5, 53–57. Wyss, Bernhard (1976): «Vorwort des Herausgebers», in: Von der Mühll 1976, vii–xxi. Wyss, Ulrich (2000): «Andreas Heusler (1865–1941)», in: König/Müller/Röcke 2000, 128–140. Wyssmann, E. (1946): «Prof. Dr. J. U. Duerst zum 70. Geburtstag», in: Schweizer Archiv für Tierheilkunde 88, 429–432. Zandvoort, R. W./Rudolf Stamm (1949): «To Prof. Dr. Henry Lüdeke on his Sixtieth Birthday October 10, 1949», in: English Studies. A Journal of English Letters and Philology 30, No. 5, October 1949. Amsterdam/Bern/Copenhagen: Swets & Zeitlinger/ Francke/Munksgaard [Umschlagtitel: Lüdeke Anniversary Number 1889–1949], 147–148. Zelger, Franz L. E. J./Alexander Ruch (1985): Festschrift zur 100-Jahr-Feier der Alt-Rauracia Basel 1884–1984. Basel: Alt-Rauracia Basel. Zentralausschuss (1941/42): «Richtlinien für die Zentraldiskussion des Sommers 1942. Die Möglichkeiten des Kleinstaates in der modernen sozialen Revolution», in: Zentralblatt, 451–453. Zentralausschuss (1941/42a): «Hilfe für kriegsnotleidende Studenten», in: Zentralblatt, 454 f. Zernack, Julia (2005): «Altertum und Mittelalter bei Andreas Heusler», in: Glauser/Zernack 2005, 120–145. Zeugin, Bettina (1998): «Utopie und Wirklichkeit. Michael Schabad und der Revisionismus in der Schweiz», in: Heiko Haumann (Hg.): Der Traum von Israel. Ursprünge des modernen Zionismus. Weinheim: Beltz Athenäum, 301–318. Ziegenspeck, Hermann (1955): Heinrich Brockmann-Jerosch, in: Neue Deutsche Biographie 2, 628, verfügbar unter: https://www.deutsche-biographie.de/pnd102001685. html#ndbcontent.
848
Bibliographie
Zimmerli, Christoph (Hg.) (2009): Porträt einer Basler Ehe. Aus dem Briefwechsel von Gerhard und Mathilde Boerlin-Wackernagel 1905–1954 (unveröff., 2009 vom StABS als Fotokopie erworbenes Typoskript). Zimmermann, Adrian (2002): Freiheit und Genossenschaft. Geschichtsschreibung im Zeichen der Geistigen Landesverteidigung. Bern: Lizentiatsarbeit, Historisches Institut (unveröff.). Zimmermann, Harm-Peer (1994): «Männerbund und Totenkult. Methodologische und ideologische Grundlinien der Volks- und Altertumskunde Otto Höflers 1933–1945», in: Kieler Blätter zur Volkskunde 26, 5–27. Zimmermann, Harm-Peer (1994a): «Walther Steller in Breslau (1920–1937)», in: Volkskunde und Frisistik im Zeichen des Nationalsozialismus, Nordfriesisches Jahrbuch, N. F. 30, 41–54. Zimmermann, Harm-Peer (1995): «Vom Schlaf der Vernunft. Deutsche Volkskunde an der Kieler Universität 1933 bis 1945», in: Hans-Werner Prahl (Hg.): Uni-Formierung des Geistes. Universität Kiel im Nationalsozialismus, Bd. 1. Kiel: Malik Regional Verlag, 171–274. Zimmermann, Heidy (2000): «Musikforschung unter neutralem Regime. Die Schweizer Situation in den 20er bis 40er Jahren», in: Isolde von Foerster/Christoph Hust/Christoph-Hellmut Mahling (Hg.): Musikforschung, Faschismus, Nationalsozialismus. Mainz: Are Musik Verlag, 121–141. Zimmermann, Susanne/Thomas Zimmermann (2005): «Die Medizinische Fakultät der Universität Jena im ‚Dritten Reich‘», in: Uwe Hossfeld/Jürgen John/Oliver Lemuth/ Rüdiger Stutz (Hg.): ‚Im Dienst an Volk und Vaterland‘. Die Jenaer Universität in der NS-Zeit. Köln u. a.: Böhlau, 127–164. Zinkernagel, Franz (1935): Prof. Dr. Franz Zinkernagel 10. März 1878 – 3. November 1935. Riehen: Buchdruckerei Riehen/A. Schudel. Zinkernagel, Franz (2020): Briefe und Schriften aus dem Nachlass, hg. und kommentiert von Frank Hieronymus. Basel: Schwabe. Zoller, Heinrich (1977): «Professor Dr. Max Geiger-Huber zum Gedenken», in: Bauhinia 6, 9–11. Zoller, Heinrich (1978): «Nachruf auf Max Geiger-Huber», in: uni nova 13, Juni 1978. Zoller, Heinrich (2011): Emil Heitz, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/045440/ 2011-01-06/. Zschokke-Gränacher, Iris (1971): «Nachruf», in: Helvetica Physica Acta 44, 297. Zürcher, Christoph (2008): Gottlieb Lüscher, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D29681.php. Zürcher, Markus (1995): Unterbrochene Tradition. Die Anfänge der Soziologie in der Schweiz. Zürich: Chronos. Zürcher, Markus (2010): Herman Schmalenbach, in: HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/artic les/044333/2010-09-02/. Zürcher, Markus (2012): Hans Ritschl, in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/ D44332.php. Zum Gedenken an Walther von Wartburg-Boos (1972): Ansprachen an der Trauerfeier am 19. August 1971 in Basel. Privatdruck.
Literatur und publizierte Quellentexte
849
Zur Erinnerung (1940) an Herrn Professor Ernst Tappolet (⌥Schlup) 1870–1939. Basel: Zbinden & Hübin. Zur Erinnerung (1951) an Prof. Dr. Heinrich Alfred Schmid, geboren am 19. Juli 1863, gestorben am 1. April 1951. Bern: Haupt. Zur Erinnerung (1957) an Professor Dr. iur. Auguste Simonius-Burcart 1885–1957. Privatdruck. Zur Erinnerung (1967) an Hans Georg Wackernagel-Riggenbach, geboren am 24. Juli 1895 zu Basel, gestorben am 23. Dezember 1967 zu Riehen. Trauerfeier in der Dorfkirche zu Riehen am 28. Dezember 1967. Privatdruck. Zur Erinnerung (1969) an Prof. Dr. med. John E[ugen] Staehelin-Iselin, 3. Juni 1891 – 16. Mai 1969. Trauerfeier in der Martinskirche am 20. Mai 1969. Privatdruck. Zwicker, Josef (1991): «Zur Universitätsgeschichte in den 1930er Jahren», in: Huber 1991, 10–19.
11 Verzeichnis der Abkürzungen Abt. Anm. ASMZ Ausg. A.-Z. a. M. BBC BBC Bd. Bsp. bspw. C.A. C.P. D.C. DChG DDP DDR DFG d. h. Diss. DVA ebd. ED Eidg. EJPD ETH FAG Fak. FAZ FEW Fr. gez. H. Hg. hg. Hist. HLS HZ i. Br. i. Ü. KP
Abteilung Anmerkung Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift Ausgabe Altzofinger am Main British Broadcasting Corporation Brown, Boveri & Cie. Band Beispiel(e) beispielsweise Zentralaktuar Zentralpräsident Delegiertenkonvent Deutsche Chemische Gesellschaft Deutsche Demokratische Partei Deutsche Demokratische Republik Deutsche Forschungsgemeinschaft das heisst Dissertation Deutsche Verlagsanstalt ebenda Erziehungsdepartement Eidgenössisch Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Freiwillige Akademische Gesellschaft Fakultät Frankfurter Allgemeine Zeitung Französisches Etymologisches Wörterbuch Franken gezeichnet Heft Herausgeber, Herausgerberinnen herausgegeben Historisch Historisches Lexikon der Schweiz Historische Zeitschrift im Breisgau im Üchtland Kommunistische Partei
852 m. NL No. Nr. NRF NS NZZ P. PA P.C. PD PdA Phil. Red. SA SAC SBZ SPD SS StABS St.V. SVD u. a. u. ö. vgl. UA UB VSETH WS z. B.
Verzeichnis der Abkürzungen mit Nachlass Nummer Nummer Nouvelle Revue française Nationalsozialismus, nationalsozialistisch Neue Zürcher Zeitung Pater Privatarchiv Président central Privatdozent Partei der Arbeit Philosophisch, philologisch Redaktion Sonderabdruck Schweizer Alpen-Club Sowjetische Besatzungszone Sozialdemokratische Partei Deutschlands Sommersemester Staatsarchiv Basel-Stadt Schweizerischer Studentenverein Societas Verbi Divini unter anderem, und andere und öfter vergleiche Universitätsarchiv Universitätsbibliothek Verband der Studierenden an der ETH Zürich Wintersemester zum Beispiel
12 Personenregister Abendroth, Wolfgang (1906–1985) 222 A Ackeret, Jakob (1898–1981) 111 A Adam, Leonhard (1891–1960) 587 f. Aebi, Hugo (1921–1983) 685 A Albiker, Karl (1878–1961) 121 Alewyn, Richard (1902–1979) 375, 395, 395 A, 564 Alexopoulos, Kessar Demosthenes (1909– 2010) 636 Allemann, Fritz René (1910–1996) 70 f., 74 A Allen, Helen Mary (1872–1952) 557 Allen, Percy Stafford (1869–1933) 535, 557 Alt, Albrecht (1883–1956) 167 Altheim, Franz (1898–1976) 324 Altwegg, Wilhelm (1883–1971) 371, 389, 393, 396, 501 A Ammann, Hektor (1894–1967) 86, 86 A, 244 A, 383, 408, 474 f., 554 André, Émile (1870–1946) 725 André, Hans (1891–1966) 696 A Andreas, Willy (1884–1967) 575 A Angioletti, Giovan Battista (1896–1961) 412 Annaheim, Hans (1903–1978) 680 f., 688 Antimachus Colophonius 334 Aragon, Louis (1897–1982) 419 A Arkel, Anton Eduard van (1893–1976) 662 Arnim, Bernd Dietrich von (1899–1946) 534 Arnstein, Franz (1882–1940) 65, 733 Arzt, Leopold (1883–1955) 268 Astrow, Wladimir (1885–1944) 702 A Aubin, Hermann (1885–1969) 392
Augustinus (354–430) 309, 341, 343 f., 615, 625, 699 f. Augustus (63 v. Chr.–14 n. Chr.) 322, 348 Auspitz, Carl Heinrich (1835–1886) 267 Bach, Johann Sebastian (1685–1750) 518 Bachofen, Johann Jakob (1815–1887) 164, 312, 320, 333, 338, 344, 366, 402, 405, 487, 609 A Backlund, Helge Götrik (1878–1958) 674 Bächlin, Max (1910–2001) 70, 231 A Bächlin, Peter (1917–1998) 58 Bächtold, Hanns (1886–1941) 372 Bächtold, Hermann (1882–1934) 88, 157, 521, 523, 533, 542 f., 548, 596, 606 A, 679 Baer, Erich Eugen F. (1901–1975) 642 A, 644 Baer, Rudy 295 Baethgen, Friedrich (1890–1972) 346, 618 Baeyer, Adolf von (1835–1917) 651 Baeyer, Hans von (1875–1941) 16, 117, 287 Baldinger (⌥Müller), Ernst (1911–1970) 636 f. Bally, Charles (1865–1947) 471 Balthasar, Hans Urs von (1905–1988) 64, 64 A, 78, 151, 418 A, 423 A, 435 f., 544 A Banting, Frederick G. (1891–1941) 644 Barbusse, Henri (1873–1935) 66 Barell, Emil (1874–1953) 648, 662 Barlach, Ernst (1870–1938) 402 Barth, Christoph (1917–1986) 92 Barth, Dietrich (1909–1961) 81, 135
854
Personenregister
Barth (⌥Sartorius), Fritz (1856–1912) 309 Barth, Heinrich (1890–1965) 148, 149 A, 210, 297, 303, 306, 308–315, 739 Barth, Karl (1886–1968) 15, 17, 35, 43, 43 A, 51, 79, 85, 91 f., 103, 124, 135, 139–141, 143–150, 152–154, 156, 160, 162 f., 166–172, 176, 180 f., 183, 186–199, 201 f., 204, 208, 210, 229 A, 248, 265, 309, 334, 354, 421, 436, 554 A, 739, 746, 749, 753 Barth, Wilhelm (1869–1934) 486 Bastian, Adolf (1826–1905) 581 Batschelet, Eduard (1914–1979) 628 Baudelaire, Charles-Pierre (1821–1867) 302 Bauer, Eddy (1902–1972) 29 Bauer, Michael Josef (1886–1959) 268 Bauer, Stephan (1865–1934) 589, 594 Baumann, Hermann (1912–1972) 587 Baumann, Theo 285 Baumeister, Willi (1889–1955) 496 Baumgarten, Arthur (1884–1966) 16, 147 A, 220–233, 243, 288 f., 442, 737 Baumgarten (⌥von Salis-Soglio), Helene (Nina) (1897–1975) 226 Baumgartner, Adolf (1855–1930) 542 Baumgartner, Walter (1887–1970) 139, 165 f., 181, 354 Bavink, Bernhard (1879–1947) 60, 95, 750 Bays, Séverin (1885–1972) 133 Bearth, Peter (1902–1989) 675, 676 Becher, Johannes R. (1891–1958) 365 A Becker, Carl Heinrich (1876–1933) 361, 374, 481 f. Beckerath, Erwin von (1889–1964) 592, 616 A Beckmann, Max (1884–1950) 492 Beethoven, Ludwig van (1770–1827) 518, 664 Béguin, Albert (1901–1957) 17, 77, 104, 301, 377, 409, 413, 415–439, 468, 470, 750
Behr, Carl (1874–1943) 263 Behrens, Eduard (1884–1944) 150 Behrmann, Walter E. (1882–1955) 677 f. Bell, George K. A. (1883–1958) 184 Belleville, Fritz (1903–1994) 57, 69–71, 615 Below, Georg von (1858–1927) 521 Benda, Julien (1867–1956) 464 Benjamin, Walter (1892–1940) 149 Berblinger, Walther (1882–1966) 283 Berchem, Denis van (1908–1994) 336 A Berek, Max (1886–1949) 673 Berend, Eduard (1883–1973) 301, 437 f. Berger, Erwin (1898–1975) 292, 293 Berger (⌥Morgenstern), Helene 231 A Berger, Kurt (1904–2008) 231 A Bernanos, Georges (1888–1948) 434 Bernays, Paul (1888–1977) 33 Bernfeld, Siegfried (1892–1953) 204 A Bernoulli (Mathematiker-Familie) 629 Bernoulli, August Leonhard (1879– 1939) 653, 659, 661 Bernoulli, Carl Albrecht (1868–1937) 163–165, 174, 208 Bertholet, Alfred (1868–1951) 127–129 Bertrand, Louis (1866–1941) 699 Berve, Helmut (1896–1979) 327, 328 A, 465 Besseler, Heinrich (1900–1969) 252, 520 Bezzola, Reto (1898–1983) 411 Bidder, Anna McClean (1903–2001) 702, 725 Bieberbach, Ludwig (1886–1982) 627– 629 Binder, Hans (1899–1989) 275 Bing, Gertrud (1892–1964) 526 A Bing, Robert (1878–1956) 292 Binswanger, Ludwig (1881–1966) 298, 301, 525 Binz, Gustav (1865–1951) 477, 565 Bircher, Eugen (1882–1956) 246, 248, 254 Birchler, Linus (1893–1967) 500
Personenregister Bischoff, Nikolas Carl Guntram (1893– 1962) 246 Bismarck, Otto von (1815–1898) 239, 420 Blackwood, Beatrice (1889–1975) 587 A f. Blaschke, Wilhelm (1885–1962) 628 Bleuler, Eugen (1857–1939) 272 A Bloch, Alfred (1915–1983) 292, 365 Bloch, Bruno (1878–1933) 266–268, 292 Bloch, Hubert (1913–1974) 64, 99, 294 Bloch, (Moshe) Rudolf (1902–1985) 655 Bloesch, Hansjörg (1912–1992) 357 Bloy, Léon (1846–1917) 413, 434 Blum, Franz Christoph (1901–1969) 151 A Blum, Léon (1872–1950) 129 Blum, Max 71 Blumer, Fritz (1904–1988) 628 Blumhardt, Christoph 179 Blunck, Hans Friedrich (1888–1961) 471 A Bluntschli, Hans (1877–1962) 22, 23 A Bô Yin Râ (Joseph Anton Schneiderfranken) (1876–1943) 164 Boas, Harald (1882–1961) 268 Bodelschwingh, Friedrich von (1877– 1946) 167 Bodewig, Konrad Ewald (1901–) 630, 639 f. Bodmer, Heinrich (1885–1950) 403, 502 A Böck, Friedrich (1876–1958) 131 A Böcklin, Arnold (1827–1901) 485, 575 Böhringer, Peter Hans (1909–1976) 58 Boehringer, Robert (1884–1974) 302, 352, 353, 355, 544 A Bölsche, Wilhelm (1861–1939) 700 A Boerlin (⌥Wackernagel), Gerhard (1873– 1954) 146, 234, 239, 239 A, 253, 274, 282, 381 A, 384, 684 Bösiger (⌥Ensner), Ernst 230 A f. Bösiger (⌥Haldimann), Ernst 231 A Bogusat, Hans 268
855
Bohnenblust, Gottfried (1883–1960) 369, 416, 428 Bohny, Carl (1856–1928) 596, 613 Bohr, Niels (1885–1962) 634, 654 Bok, Edward (1863–1930) 534 Bolk, Louis (1866–1930) 695 Bolliger, Adolf (1854–1931) 143 Boninsegni, Pasquale (1869–1939) 128 A Bonjour, Edgar (1898–1991) 15–17, 39, 139, 246, 308, 349, 522 f., 543, 546 f., 744 Boor, Helmut de (1891–1976) 25, 27 f., 369 Boos, Roman (1889–1952) 453 A Borgese, Giuseppe Antonio (1882–1952) 464 Bossuet, Jacques Bénigne (1627–1704) 79 Bothe, Walther Wilhelm Georg (1891– 1957) 636 Bouchardon, Edme (1698–1762) 609 A Boucher, Maurice (1885–1977) 438 Bourdieu, Pierre (1930–2002) 45, 107 Bouvier, Bernard (1861–1941) 416, 428 Bowman, Isaiah (1878–1950) 122 Boye, Hedwig 649 Brackmann, Albert (1871–1952) 552 A Bradt, Helmut (1917–1950) 636 Bräker, Ulrich (1735–1798) 402 Brand, Renée (1900 od. 1902–1980) 425 A, 568 f. Brandenberger, Ernst (1906–1966) 29 Brandenburg, Erich (1868–1946) 529 Brandenburg (⌥Schumacher), Johanna 529 Brandenburger, Otto 99 Braun, Gustav (1881–1940) 677 Braus (⌥Riggenbach), Paul (1880–1950) 552, 553 A Brechbühl, Fritz (1897–1963) 115 Bredig, Georg (1868–1944) 655, 657 Breitenbach, Edgar (1903–1977) 508
856
Personenregister
Breitinger, Johann Jakob (1701–1776) 403 Brenner (⌥Reich), Wilhelm (1875–1960) 251 f., 255, 288, 299, 348, 471 A, 547, 735 Briegleb, Günther (1905–1991) 656 A Bringolf, Walther (1895–1981) 96 Brill, Ernst-Heinrich (1892–1945) 268– 270 Brockmann (⌥Jerosch), Heinrich (1879– 1939) 678 f. Brogle, Theodor (1893–1959) 590 Bruckner, Albert (1904–1985) 522 Bruckner, Wilhelm (1870–1952) 371, 375, 389, 393 Brückner, Arthur (1877–1959) 259, 263 f. Brüning, Heinrich (1885–1970) 360 Brugger, Carl (1903–1944) 274 f. Brun, Annette (1910–) 570 Brunner, Emil (1889–1966) 35, 145, 148, 148 A, 154, 154 A, 201 A, 210 Brunot, Ferdinand (1860–1938) 458 A Buber, Martin (1878–1965) 100, 199 f., 302, 394 Buchmann (⌥Schardt), Christian (1858– 1935) 173 Buchner, Paul (1892–1978) 628–630 Bühler, Alfred (1900–1981) 580, 584 A Bürgi, Emil (1872–1947) 32 Bürgi, Oskar (1873–1952) 116 Bukofzer, Manfred (1910–1955) 519 Bultmann, Rudolf (1884–1976) 152, 152 A, 163, 174, 177, 191, 199 Burckhard, Carl Jacob (1891–1974) 257, 428, 531, 544 f., 548, 563, 573, 609 A Burckhardt (⌥Thurneysen), Daniel (1832– 1894) 486 Burckhardt (⌥Werthemann), Daniel (1865–1949) 486 Burckhardt, Jacob (1818–1897) 179, 212, 315, 318, 320, 325, 336 f., 339, 347 f., 366, 373, 379, 399, 402, 411, 470, 487, 489, 498, 504 f., 507–510, 512, 517,
524, 526, 530 f., 534–536, 541 f., 548, 556, 559, 574–576, 579, 604, 606– 610, 615, 697, 720, 720 A, 723 Burckhardt, Max (1910–1993) 80 Burckhardt, Walter (1905–1971) 266– 268, 270 Buri, Fritz (1907–1995) 151–153, 156, 161, 163, 208 Burlet, Ernst (–1951) 692 Burmeister, Werner (1895–1945) 502 Buschor, Ernst (1886–1961) 351, 351 A, 357 Butenandt, Adolf (1903–1995) 252, 722, 750, Buxtorf (⌥Burckhardt), August (1877– 1969) 673 Buytendijk, Frederik Jacobus Johannes (1887–1974) 696 A Cadisch, Joos (1895–1977) 674 Caesar, Gaius Iulius (100–44 v. Chr.) 346 Cahn, Herbert (1915–2002) 355 Calgari, Guido (1905–1969) 412 Calvin, Jean (1509–1564) 548, 571 Campenhausen, Hans Erich Freiherr von (1903–1989) 148, 152, 162 Cantimori, Delio (1904–1966) 425, 532, 556, 560, 571 Casparis, Paul (1889–1964) 643 Cassirer, Ernst (1874–1945) 567 Castellio, Sebastian (1515–1563) 571 Castro y Quesada, Américo (1885–1972) 414 Cavelti, Elsa (1907–2001) 570 Cayrol, Jean (1911–2005) 439 Cazala, Roger (1904–1944) 439 Cetto, Anna Maria (1898–1991) 508 A Cetto, Max (1903–1980) 497, 508 A Chabod, Federico (1901–1960) 527, 560 A Chadwick, James (1891–1974) 636 Chamberlain, Houston Stewart (1855– 1927) 327 A Chapuis, Marc (1913–) 77 A
Personenregister Charléty, Sébastien (1867–1945) 128 Chateaubriand, François-René Vicomte de (1768–1848) 537 Chiesa, Francesco (1871–1973) 411 Chlodwig (466–511) 471 Chodat, Robert (1865–1934) 690 Christ, Hermann (1833–1933) 689 Christ, Martin 102 Christoffel, Hans (1888–1959) 288 Christoffel, Ulrich (1891–1975) 498, 504 Cicero, Marcus Tullius (106–43 v. Chr.) 344, 367 Claparède, Edouard (1873–1940) 133, 133 A Claudel, Paul (1868–1955) 335, 434, 513 Cockcroft, John Douglas (1897–1967) 636 Cocteau, Jean (1889–1963) 419 A Cohen, Hermann (1842–1918) 309 Coigny, Pierre (1919–2007) 85 A, 90 Collander, Runar (1894–1973) 692 Collart, Paul (1902–1981) 357 Conrad, Hermann (1904–1972) 28 Conti, Leonardo (1900–1945) 270 Corti, Dominique (1925–1944) 438 Corti, José (1895–1984) 438 f. Corticchiato, Dominique 439 Coudenhove-Kalergi, Richard von (1894– 1972) 64 A Cranz, Christl (1914–2004) 129 Croce, Benedetto (1866–1952) 464, 556 Cronheim, Fritz (1901–1974) 622 Crusius, Otto (1857–1918) 478 Cullmann, Louise (1899–1994) 163, 180 Cullmann, Oscar (1902–1999) 140, 151 f., 156, 161–163, 168, 180 Curtius, Ernst Robert (1886–1956) 306, 377, 419, 429–433 Curtius, Ludwig (1874–1954) 351, 356, 502 D’Annunzio, Gabriele (1863–1938) 413 D’Arc, Jeanne (1412–1431) 437
857
Däniker, Gustav (1896–1947) 244–251, 254, 475 Dahm, Helen (1878–1968) 525 Dante Alighieri (1265–1321) 316, 411, 608 f., 625 Darwin, Charles (1809–1882) 694 f., 708 f., 711, 722 David, Friedrich 206 A Debrunner, Albert (1884–1958) 27, 318, 336 A, 364, 366, 479 Decour, Jacques (1910–1942) 439 Dehn, Günther (1882–1970) 172, 173 A Deissmann, Adolf (1866–1937) 171 Delamain, Maurice (1883–1974) 420 Delitzsch, Friedrich (1850–1922) 170 Delz, Josef (1922–2005) 342 Desaux, André (1922–2003?) 270 Dessauer, Friedrich (1881–1963) 33 Dibelius, Martin Franz (1883–1947) 174 f. Diels, Hermann (1848–1922) 350 Dieterle, Samuel (1882–1950) 185 Dilthey Wilhelm (1833–1911) 399 Dimitroff, Georgi (1882–1949) 71 Dinkler, Erich (1909–1981) 162 Diogenes Laertius 333 Döblin, Alfred (1878–1957) 402 Döcker, Richard (1894–1968) 497 Dönhoff, Marion Gräfin (1909–2002) 619 f. Doerr, Robert (1871–1952) 259, 262, 276, 293 Dollfuss, Engelbert (1892–1934) 89, 665 Dornseiff, Franz (1888–1960) 331, 333 Dragendorff, Hans (1870–1941) 345, 553 A Drexler, Hans (1895–1984) 345 Dreyfus, Georg Ludwig (1879–1957) 495 Dreyfus (⌥de Gunzburg), Paul (1895– 1967) 185 Droysen, Johann Gustav (1808–1884) 560
858
Personenregister
Dürr, Emil (1883–1934) 76, 88, 160, 264, 403, 521–523, 529, 532 A, 533, 535 f., 538 f., 542, 548, 606 A Duerst, Johann Ulrich (1876–1950) 128, 129 A, 130, 133 f. Duhm, Bernhard (1847–1928) 165, 179 Dukor, Benno (1897–1980) 275, 292 Duparc, Louis Claude (1866–1932) 675 Duttweiler, Gottlieb (1888–1962) 85
Ernst, Juliette (1900–2001) 36 A, 318, 410 Étiemble, René (1909–2002) 458 A, 461 Etter, Philipp (1891–1977) 30 A, 158, 348 A Eucken, Rudolf (1846–1926) 302 Eugster, Jakob (1882–1967) 250, 253– 256 Euler, Leonhard (1707–1783) 629
Ebert, Johannes Ludwig (1894–1956) 657, 659 Edlbacher, Siegfried (1886–1946) 116, 116 A, 259, 264, 280 Ehret, Georg(es) (1913–1993) 231 A Ehrlich, Ernst Ludwig (1921–2007) 484 Eichrodt, Walther (1890–1978) 139, 166 f. Eickstedt, Egon Freiherr von (1892– 1965) 59, 582, 721 Einaudi, Luigi (1874–1961) 571–573 Einstein, Albert (1879–1955) 38, 551 Eisler, Hanna 198 A Eisner, Kurt (1867–1919) 622, 699 Elsässer, Martin (1884–1957) 496 Elster, Ernst (1860–1940) 393 Éluard, Paul (1895–1952) 438 Emmerich, Kurt Julius (? 1903–) 204 A Engels, Friedrich (1820–1895) 227 Engi, Gadient (1881–1945) 657, 662 Engler, Adolf (1844–1930) 688 Englert-Faye, Kurt (Curt) (1899–1945) 337 A Erasmus, Desiderius von Rotterdam (ca. 1466–1536) 423 A, 435, 529, 534 f., 548, 552–558, 574 Erhard, Hubert (1883–1959) 27 f. Erlenmeyer, Hans (1900–1967) 294, 633, 636, 660–664, 666, 670 f. Ermatinger, Emil (1873–1953) 29, 29 A, 369, 381 A, 397, 452 A Ernst, Fritz (1889–1958) 413, 525, 545 A, 563 A, 564
Fabre, Jean-Henry (1823–1915) 695 Faesi, Robert (1883–1972) 362, 369 Falke, Konrad (1880–1942) 462 Farner, Konrad (1903–1974) 402 A, 436 A, 615 Farner, Oskar (1884–1958) 169 Fehr, Bernhard (1876–1938) 476 Fehr, Hans (1874–1961) 29, 116, 240 Feigl, Fritz (1891–1971) 661 Feistel (⌥Rohmeder), Bettina (1873– 1953) 495 Feith, Beate (1905–1997) 496 Fermi, Enrico (1901–1954) 636 Feuerbach, Paul Johann Anselm Ritter von (1755–1833) 223 Feuerstein, Heinrich Karl Joseph (1877– 1942) 569 Fichte, Johann Gottlieb (1762–1814) 305 Fichter, Fritz (1869–1952) 127, 264, 660, 662 A, 664, 670 Fierz (⌥David), Hans Eduard (1882– 1953) 634, 648 A Fierz, Markus (1912–2006) 630, 634, 635, 636, 640 Finck von Finckenstein, Graf Hans Wolfram (1891–1962) 591 Finkeldey, Willy (Wilhelm) (1897–) 278 Fischer, Alfred (1858–1913) 689 Fischer, Emil (1852–1919) 643 Fischer, Eugen (1874–1967) 587 Fischer, Fritz (1898–1947) 29 Fischer, Hermann O. L. (1888–1960) 643–645, 661 A, 745 Fischer, Otto (1886–1948) 486 f., 505 f.
Personenregister Flaschenträger, Bonifaz (1894–1957) 28 Flatt, Robert (1897–) 661 Fleisch, Alfred (1892–1973) 116 Fleissig, Ida (1913–1999) 67 Flüe, Niklaus von (1417–1487) 157 A Fluri, Max (1914–) 85 Focillon, Henri (1881–1943) 499 Förster (⌥Nietzsche), Elisabeth (1846– 1935) 164 Forel, Auguste (1848–1931) 272 A Forel, Oscar (1891–1982) 289 Forster, Leonard Wilson (1913–1997) 478 Fraenkel, Eduard (1888–1970) 342, 342 A Francisci, Pietro de (1883–1971) 128 Franck, James (1882–1964) 110 A Frank, Walter (1900–1945) 242 A Frankl, Paul (1878–1962) 508 Franziskus von Assisi (1181–1226) 700 Freud, Sigmund (1856–1939) 288, 289, 339, 717 Freudenberg, Ernst (1884–1967) 17, 147 A, 285 f., 294 Freudenberg, Karl (1886–1983) 654 Frey (⌥Wyssling), Albert (1900–1988) 665 Frey, Arthur (1897–1955) 235 A Frey, Jakob 91 Frey, Oskar (1893–1945) 248 Frey, Paul (? 1910–1995) 101 Freyer, Hans (1887–1969) 307 Freytag, Willy (1873–1944) 26 f., 31 f. Frick, Heinrich (1892–1981) 248 Frieboes, Walter (1880–1945) 267–270 Friedlaender, Immanuel (1871–1948) 675 Friedmann, Wilhelm (1884–1942) 457 f. Friedrich II. (1712–1786) 420 Frings, Theodor (1886–1968) 447, 447 A Fritz, Kurt von (1900–1985) 324 f. Fröbe, Olga (1881–1962) 726 A Frölicher, Hans (1887–1961) 742 A
859
Fuchs, Harald (1900–1985) 123, 324, 338, 341–348, 363, 366, 374, 502, 561 Füssli, Heinrich (1741–1825) 402 f. Fueter, Eduard (1908–1970) 545 A Fueter, Karl Rudolf (1880–1950) 628 Fuhrmann, Otto (1871–1945) 676 Fumasoli (⌥Kägi), Gertrud 525 Furlan, Louis (Luigi) Vladimir (1886– 1955) 135, 572, 590 Gagliardi, Ernst (1882–1940) 474, 543 f. Galiani, Abbé Ferdinando (1728–1787) 595 Gálvez Bravo, Alfredo 131 A Gams (⌥Meng), Anton Alfons (1884– 1955) 667 Ganshof, François Louis (1895–1980) 131 A Gansser (⌥Burckhardt), August (1876– 1960) 572 Gansser, Georg(es) 62 Gantner, Alfred (1890–1933) 491 Gantner, Joseph (1896–1988) 204, 308, 484–518, 564, 717 Gantner (⌥Dreyfus), Maria (1907–2005) 495 Ganz, Paul (1872–1954) 484–487, 490, 500, 503, 505, 508, 513, 516 Ganz, Werner 100 Ganzoni, Paul 251 f. Gasser, Adolf (1903–1985) 523 Gattegno, Caleb (1911–1988) 628 Gauchat, Louis (1866–1942) 409 Gauclère, Yassu (1907–1961) 461 A Gauss (Nachfahre von Carl Friedrich Gauss) 131 A Gauss, Hermann (1902–1966) 297 Gegenschatz, Ernst (1914–1998) 96 Geiger (⌥Huber), Max (1903–1977) 692 Geiger, Paul (1887–1952) 371 f., 392 Geigy, Rudolf (1902–1995) 693, 723 Gelzer, Conrad (1898–1974) 240, 240 A Gelzer, Heinrich (Heiner) (1888–1963) 182 A, 329 A
860
Personenregister
Gelzer, Matthias (1886–1974) 38, 219, 321, 325–331, 334 f., 348 f., 389, 442 Gempeler, Albert (1884–1952) 288 Genevière, Marc (1911–) 77 A, 79 Gentile, Giovanni (1875–1944) 571 Gentner, Wolfgang (1906–1980) 636 George, Stefan (1868–1933) 212, 297, 302–304, 306, 314, 321, 324, 326, 338 A, 351 A, 352–355, 360 f., 366, 393, 396, 402, 405, 419 A, 431, 544, 564 A, 589, 591–593, 595, 597–599, 604, 608, 614, 618–620, 622–625, 661, 664, 731 Gerber, Max (1887–1949) 157 Gerhard, Georgine (1886–1971) 205 Gerlach, Werner (1891–1963) 13, 16, 70, 73, 111, 160, 259, 274, 277–283, 432, 555, 687, 735, 741 Germann, Oscar Adolf (1889–1979) 216 f., 221 A, 223 Gerwig, Max (1889–1965) 140, 149 A, 162 A, 157, 216, 255 A, 258, 275, 280, 468 A, 546 f., 555 A, 596, 604 A Gide, André (1869–1951) 424 Gigon, Alfred (1883–1975) 259, 334 Gigon, Olof (1912–1998) 77 A, 81, 334, 336 A Gilliard, Charles (1879–1944) 127, 133, 133 A Glanzmann, Eduard (1887–1959) 285 Gleispach, Wenzeslaus Graf (1876– 1944) 221 A Goebbels, Joseph (1897–1945) 119 f., 497, 535 Goebel, Karl von (1855–1932) 690 Goepfert, Alfred 231 A Göpfert, Arthur Hugo (1902–1986) 466 A Göring, Hermann (1893–1946) 87, 98 A, 547 Goethe, Johann Wolfgang von (1749– 1832) 302, 306, 315, 352, 385, 394, 422, 592, 597, 608, 622, 625, 629, 700, 720 A, 727
Goetz, Bruno (1885–1954) 526, 537 Goetz, Karl Gerold (1865–1944) 169 f., 173 f., 208 Goetz, Walter (1867–1958) 529 Gogarten, Friedrich (1887–1967) 171 Goldberg, Moses Wolf (1905–1964) 647 A, 665 Goldschmid, Edgar (1881–1957) 34 Goldschmidt, Adolph (1863–1944) 500 A, 508 Goldschmidt, Victor (1853–1933) 673 Gombosi, Otto Johannes (1902–1955) 519 González Muela, Joaquín (1915–2002) 414 Gorsleben, Rudolf John (1883–1930) 386 A Gothein, Eberhard (1853–1923) 589, 592 Gothein, Marie Luise (1863–1931) 592 Gotthelf, Jeremias (1797–1854) 399, 402, 406, 575 Gottron, Heinrich (1890–1974) 270 Gounod, Charles (1818–1893) 604 Grabowsky, Adolf (1880–1969) 333, 559 Grave, Dmitry Alexandrowitsch (1863– 1939) 627 Grebel, Felix (1714–1787) 403 Greinacher, Heinrich (1880–1974) 636 Grimm, Jacob (1785–1863) 562 Grimm, Robert (1881–1958) 27 Grisebach, Eberhard (1880–1945) 32, 303, 309 Grob, Rudolf (1890–1982) 159 Groh, Wilhelm (1890–1964) 117–121 Grosheintz, Jean Manfred (1910–) 644 Gründgens, Gustaf (1899–1963) 98 A Grünewald, Matthias (ca. 1480– ca. 1530) 485 Gschwend, Max (1916–2015) 685 A Gschwind, Hermann (1878–1970) 298 Guerpillon, Michel 439 Guerpillon, Renée-Noëlle 439 Guggenheim (⌥Strauss), Georg (Georges) (1897–1987) 565
Personenregister Guggenheim, Paul (1899–1977) 565 A Guisan, Henri (1874–1960) 199, 247 Gumbel, Emil Julius (1891–1966) 150, 228, 310, 356, 621 Gundolf, Ernst (1881–1945) 303 Gundolf, Friedrich (1880–1931) 121, 302, 351, 395, 419, 591 Gunkel, Hermann (1862–1932) 165 Gurlitt, Wilibald (1891–1963) 519 Gustloff, Wilhelm (1895–1936) 23, 27, 114 Gutzwiller (⌥Strassmann), Gisela (1896– 1942) 117 Gutzwiller, Max (1889–1989) 39, 114– 117, 122, 219 A, 746 Guyénot, Émile (1885–1963) 725 Gysin, Arnold (1897–1980) 216 A Gysin, Fritz (1895–1984) 486 Haab (⌥Landis), Robert (1865–1939) 215 Haab, Robert (1893–1944) 70 A, 114, 116, 118 A, 123 f., 215 f. Haberer, Hans von (1875–1958) 126 Hadorn, Greti 686 A, 687 A Häberlin, Paul (1878–1960) 136, 208, 224, 288, 297, 298–301, 303, 306, 314, 525, 547, 640, 735 Häberlin (⌥Baruch), Paula (1882–1968) 298 Haeckel, Ernst (1834–1919) 694, 700 Haefliger, Hans (1912–1953) 78, 80 Häfliger, Josef Anton (1873–1954) 643 Hänni, Otto (1911–) 80 Hagemann, Fritz (1915–1970) 255 A, 659 A Hagenbach, August (1871–1955) 630– 635 Hagenbach (⌥Bischoff), Eduard (1833– 1910) 630 f. Hagenbach (⌥Merian), Ernst (1875– 1946) 285 Hahnloser, Hans Robert (1899–1974) 499, 503 Haldimann, Karl 230 A
861
Hallig, Rudolf (1902–1964) 460 Hamburger, Ludwig (Louis) (1901– 1970) 25, 25 A Handmann, (Johann Jakob) Rudolf (1862–1940) 168, 178 f. Handschin, Eduard (1894–1962) 693 Handschin, Jacques (1886–1955) 519– 521 Hanich, Gustav (1898–1942) 183 Harder, Richard (1896–1957) 345 Harms, Bernhard (1876–1939) 592, 599, 617, 621 Harnack, Adolf von (1851–1930) 143, 139, 155, 170, 179 Harteck, Paul (1902–1985) 636 Hartenstein, Karl (1894–1952) 181–183, 186 Hartmann (⌥Stehelin), Max (1884–1952) 664 Hartmann, Nicolai (1882–1950) 307 A Hartshorne, Edward Jr. (1912–1946) 110 A, 188 Hassinger, Hugo (1877–1952) 677–679, 681 Haug, Hans (1900–1967) 570 Hauptmann, Gerhart (1862–1946) 700 Hausamann, Hans (1897–1974) 192 Hauser, Fritz (1884–1941) 41–43, 70 A, 113–115, 121, 123–125, 137, 145 f., 162, 172, 194, 204, 227 f., 248, 264 f., 273, 280 f., 285, 287 f., 290, 307, 362, 376, 378 A, 396, 414, 428, 431 f., 469, 502 A, 505, 544 A, 547, 596, 606, 611–614, 621, 628, 644, 648 A, 659, 671, 667–670, 678 f., 684 f., 691, 697 A, 704–706, 739, 741, 747 Hauser, Hermann (1902–1980) 417 Haushofer, Karl (1869–1946) 682 Hebbel, Christian Friedrich (1813–1863) 393 f., 407 Hecht, Hans (1876–1946) 382 Hecke, Erich (1887–1947) 627 Hediger, Heini (1908–1992) 584, 693 Heer, Oswald (1809–1883) 709
862
Personenregister
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770– 1831) 720 A Heidegger, Martin (1889–1976) 298, 301, 421, 623, 668, 726 Heim, Karl (1874–1958) 154 Heinemann, Fritz (1889–1970) 301 Heinimann, Felix (1915–2006) 338 A Heisenberg, Werner (1901–1976) 60, 634, 640 Heitz (⌥Staehelin), Emil (1892–1965) 691 f. Helander, Sven (1889–1970) 596 Hellbardt, Hans (1910–1944) 176, 176 A Hellmuth, Otto (1896–1968) 270 Henrici (⌥Müller), Hermann (1889– 1941) 389, 611 Henschen, Carl (1877–1957) 60, 262 A, 265 Hensel, Kurt (1861–1941) 627 Henson, Herbert Henry (1863–1947) 119 Herder, Johann Gottfried (1744–1803) 711 Herrmann, Wilhelm (1846–1922) 143 Hertwig, Oskar (1849–1922) 724 Hertwig, Richard (1850–1937) 724 Herzog, Wilhelm (1884–1960) 432 Hess, Gerhard (1907–1983) 432 A Hesse, Hermann (1877–1962) 724 Hesse, Hermann (1882–1953) 268 Hetzer, Theodor (1890–1946) 487, 501, 503, 507 Heusler, Andreas (Jurist, 1834–1921) 233 Heusler, Andreas (Altgermanist, 1865– 1940) 116, 125, 135, 135 A, 306, 340, 369, 371, 373–386, 388 f., 393 f., 400, 407 f., 429 f., 474, 736, 738, 744, 753 Heuss, Alfred (1909–1995) 348 Hevesy, Georg(e) von (de) (1885–1966) 662 f. Heydenreich, Ludwig Heinrich (1903– 1978) 487, 501–504, 508 A
Heydrich, Reinhard (1904–1942) 75 A Heyse, Hans (1891–1976) 301 Hilbert, David (1862–1943) 627 Himmler, Heinrich (1900–1945) 388 A Hintze, Hedwig (1884–1942) 546 Hirsch, Hans (1878–1940) 131 A Hirsch, Robert Baron von (1883–1977) 507 f. Hirter, Johann Daniel (1855–1926) 607 His, Eduard (1886–1948) 240, 556 His, Wilhelm (1831–1904) 709, 722 Hitler, Adolf (1889–1945) 29, 35, 71, 79 f., 83, 85 f., 88 f., 106, 118 f., 132, 141, 144, 156, 183, 188 f., 191–193, 234, 239, 242, 252, 271, 277, 283, 288, 322, 344, 380–382, 392, 394, 413, 420, 458, 462, 465 f., 470, 473, 481, 495 A, 501, 514, 570, 574, 603, 616, 620, 623, 655, 666, 683, 685 f., 691, 726, 735–737, 744, 751 Hockenjos, Ernst (1872–1949) 259 Hodler, Ferdinand (1853–1918) 506 A Höfler, Otto (1901–1987) 340, 387 Hölderlin, Friedrich (1770–1843) 302, 360, 393 f., 396, 407, 592, 608 Hörregaard 31 A Hoffmann (⌥Krayer), Eduard (1864– 1936) 264, 340, 370–375, 378, 384, 388, 407 Hoffmann, E. T. A. (Ernst Theodor Wilhelm) (1776–1822) 419, 526 Hofheinz, Oskar (? 1873–1946) 204 Hofmannsthal, Hugo von (1874–1929) 402, 622 Hofsten, Nils von (1881–1967) 131 A Holbein, Hans (1497–1543) 485, 506, 513, 557 Holborn, Hajo (1902–1969) 551 Holl, Karl (1866–1926) 170 Holzapfel, Rudolf Maria (1874–1930) 164, 698 f., 701–703, 714, 727 Homer 332 f., 339, 346, 609 A Honegger, Arthur (1892–1955) 513 Horaz (65–8 v. Chr.) 322, 344
Personenregister Horkheimer, Max (1895–1973) 496 Horn, Rudolf (1903–1984) 356 Hottinger, Adolf (1897–1975) 285 Hotz, Walter (1884–1958) 674 f. Howald, Ernst (1887–1967) 336 A Huber, Eugen (1849–1923) 215 Huber, Hugo (Helmut) (1901–1983) 174 Huber, Otto (1916–2008) 636 Huber, Paul (1910–1971) 630, 633, 635– 637 Huch, Ricarda (1864–1947) 17 A Hübener, Gustav (1889–1940) 476 Hütt, Paul 204 A Hüttig, Gustav Franz (1890–1957) 662 Huggenberger, Alfred (1867–1960) 252 Huizinga, Johan (1872–1945) 470, 530, 533–536, 538, 541, 546 A, 548–552, 554–557, 567, 573, 573 A, 579 Humboldt, Alexander von (1769–1859) 697 Humboldt, Wilhelm von (1767–1835) 313 Humm, Rudolf Jakob (1895–1977) 398 A, 717 Hummel, Daniel (? 1895–1982) 231 A Hunziker (⌥Kramer), Hans (1878–1941) 259, 275, 288 Hurter, Ernst (1900–1953) 169 Husserl, Edmund (1859–1938) 302 f., 309 Hutten, Ulrich von (1488–1523) 529, 535 Ibsen, Henrik (1828–1906) 700 Igersheimer, Josef (1879–1965) 394 Im Hof (⌥Schoch), Adolf (1876–1952) 212, 255, 281, 303, 355, 396, 414, 611, 635, 638 Imboden, Max (1915–1969) 84, 240, 258 Ippen, Felix (1911–1937) 70 Iselin (⌥Haeger), Hans (1878–1953) 265 f. Iselin, Isaak (1728–1782) 367
863
Jachmann, Günther (1887–1979) 374 Jacob, Berthold (1898–1944) 547 Jacob, Georg (1862–1937) 481 Jacobsthal, Paul (1880–1957) 360 A Jacoby, Heinrich (1889–1964) 289 Jadassohn, Josef (1863–1936) 267 Jaeger, Fritz (1881–1966) 16, 116, 116 A, 129, 677–688, 736, 751 Jaeger, Hans (1848–1923) 681 Jaeger, Werner (1888–1961) 321 f., 331 f., 336, 341, 345, 576 Jahnn, Hans Henny (1894–1959) 398 A, 402 Jakubowsky, Franz (1912–1970) 70 James, William (1842–1910) 306 Jancke, Herbert (1898–1993) 27 Janner, Arminio (1886–1949) 410–413, 436, 439, 468, 570, 572, 750 Jaspers, Karl (1883–1969) 36, 152, 208, 298, 623 Jeanjaquet, Jules (1867–1950) 409 Jedlicka, Gotthard (1899–1965) 503, 505 A, 564 Jenny (⌥Glaettli), Fritz (1882–1964) 664 Joël, Hedwig (1868–1949) 134 Joël, Karl (1864–1934) 134, 292, 297, 302, 307, 733 Jóhanesson, Alexander (1888–1965) 131 A Jonas, Hans (1903–1993) 199 Jones, Gareth (1905–1935) 226 A Josephsohn, Hans (1920–2012) 650 A Jost, Karl (1882–1960) 477 Joyce, James (1882–1941) 478 Jud, Jacob (1882–1952) 443 A, 452, 472 Jünger, Ernst (1895–1998) 86, 717 Julia, Gaston (1893–1978) 131 A Jung, Carl Gustav (1875–1961) 288–290, 364 Jung, Gertrud (1894–1962) 556 Kaden, Hans-Erich (1898–1973) 116 Kaegi (⌥von Speyr), Adrienne (1902– 1967) 335, 435, 548
864
Personenregister
Kägi, Frieda 524 Kägi, Gottfried Paulus (1863–1938) 524 Kägi (⌥Nussberger), Ida 524 Kägi, Jakob 525 Kägi, Paul 524, 537 Kägi (⌥Fuchsmann), Regina (1889– 1972) 525, 549 Kaegi, Werner (1901–1979) 17, 46, 124 f., 135, 249 A, 300, 335, 346, 355, 365, 396, 413, 430 f., 435, 450 A, 469 f., 472, 508, 522–579, 738 Kälin, Josef A. (1903–1965) 28 Kafka, Franz (1883–1924) 402 Kahane, Peter P. (1904–1974) 325, 350 Kahlbaum, Georg (1853–1905) 653 A Kahn, Ilse 569 Kant, Immanuel (1724–1804) 303, 305, 309 Kantorowicz, Ernst (1895–1963) 544, 606 A Kaplan, David 66 A Karcher, Johannes (1872–1958) 432, 704 f. Karger, Heinz (1895–1959) 263 f., 266, 286, 743 Karo, Georg (1872–1963) 351 Karrer, Paul (1889–1971) 262 A, 645, 653, 661, 665, 667 Kaufmann, Erich (1880–1972) 225 Kautzsch, Rudolf (1868–1945) 503 Kayser, Heinrich (1853–1940) 631 Keller, Gottfried (1819–1890) 395, 402, 406, 575 Keller (⌥Winkler), Anna 231 A Keller (⌥Winkler), Josef 231 A Kempter, Käthe 278, 280 Keyserling, Hermann Graf (1880–1946) 420 Kienzle, Hermann (1876–1946) 487, 507 A Kierkegaard, Sören (1813–1855) 556 Kindermann, Heinz (1894–1985) 251, 471 A
Kirchhofer, Marguerite (1898–1992) 571 A Kirschbaum, Charlotte von (1899–1975) 149 A Kittel, Wolfgang H. A. 283 Klaesi, Jakob (1883–1980) 273, 289 Klages, Ludwig (1872–1956) 338 A Klebs, Georg Albrecht (1857–1918) 688 Kleczkowski, Adam Marian (1883–1949) 131 A Kleiber, Otto (1883–1969) 264 Klein, Felix (1849–1925) 627 Kleist, Heinrich von (1777–1811) 397 Klemperer, Victor (1881–1960) 450 Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724– 1803) 385 Kluckhohn, Paul (1886–1957) 258 Klumberg, Wilhelm (1886–1942) 131 A Knapp, Johannes Martin (1876–1948) 641 Knieling, Hanns 204 A Knuchel, Eduard Fritz (1891–1966) 264 Kobelt, Karl (1891–1968) 249, 253 Kober, Ernst (1916–1990) 84 Koch, Lauge (1892–1964) 674 Koch (⌥Grünberg), Theodor (1872– 1924) 584 Köberle, Adolf (1898–1990) 68, 135, 140, 153–155, 288 Köcher, Otto (1884–1945) 569 Koechlin, Alphons (1885–1965) 182 A, 183–185, 198 A Koechlin, Carl (1889–1969) 215 Koechlin, Hartmann (1893–1962) 662 Köhler, Ludwig (1880–1956) 165 Köhler, Walther (1870–1946) 553, 556, 576 Koelbing, Huldrych (1923–2007) 95 f. Koelliker, Rudolf Albert (1817–1905) 709 Köster, Hellmut (1898–1963) 576 Kötzschke, Rudolf (1867–1949) 578 Kogoj, Franjo (1894–1983) 270 Kohlschütter, Volkmar (1874–1938) 657
Personenregister Kokoschka, Oskar (1886–1980) 216 Kolbenheyer, Erwin Guido (1878–1962) 59 A Kommerell, Max (1902–1944) 396, 397 A, 400, 564 Konen, Heinrich (1874–1948) 632 Korsch, Karl (1886–1961) 59 Kougeas, Sokratis (1876–1966) 131 A Kraepelin, Emil (1856–1926) 271 f. Kramer, Ferdinand (1898–1985) 496 Krauel, Wolfgang (1888–1977) 127 Kraus, Fritz (1903–1960) 554 Kraus, Karl (1874–1936) 556 Krebs, Norbert (1876–1947) 677 Krethlow, Alfred (1897–1978) 632 Kretzschmar, Hermann (1848–1924) 518 Krieck, Ernst (1882–1947) 126 Kriegbaum, Friedrich (1901–1943) 502 Kristeller, Paul Oskar (1905–1999) 301 Kroner, Richard (1884–1974) 301 Kropotkin, Peter (1842–1921) 584 A Krüger, Leo Leib (1903–) 628 Kübler, Hans 73 A, 160 Kümmel, Werner Georg (1905–1995) 175, 199 Kuhn, Alwin (1902–1968) 442 A, 456 A Kuhn, Gottfried (1867–1941) 658 A Kuhn, Werner (1899–1963) 39, 636, 645, 653–662, 665–668, 671, 746 Kunz, Hans (1904–1982) 297 Kunz, Max A. (1876–1960) 656, 656 A, 666 f. Kurz, Gertrud (1890–1972) 185, 205, 206 Kutter, Hermann (1863–1931) 143, 149, 156, 180, 210, 524 Labhardt, Alfred (1874–1949) 66 f., 69 A, 125, 259, 265 Lachenal, Paul (1884–1955) 31 Läuger, Paul (1896–1959) 262 Lamarck, Jean-Baptiste (1744–1829) 695
865
Lambert, Johann Heinrich (1728–1777) 629 Lamprecht, Karl (1856–1915) 540 Landau, Edmund (1877–1938) 627 f. Landauer, Karl (1887–1945) 288 Landmann, Edith (1877–1951) 544 A, 595 Landmann, Georg Peter (1905–1994) 355 Landmann, Julius (1877–1931) 292, 303, 589, 592, 594–596, 607, 733 Landmann, Ludwig (1868–1945) 493 A Landmann, Michael (1913–1984) 297, 308 Landmann, Salcia (1911–2002) 308 Landsberger, Benno (1890–1968) 181, 181 A Lange, Johannes (1891–1938) 273 Langlotz, Ernst (1895–1978) 355, 360 Lanz, Titus von (1897–1967) 290 Laqueur, Richard (1881–1959) 328 Latte, Kurt (1891–1964) 342, 374, 382, 411 Laur, Ernst (1871–1964) 601 A Laur (⌥Belart), Rudolf (1898–1972) 347, 347 A, 523 Le Corbusier (1887–1965) 493 f. Le Lionnais, François (1901–1984) 438 Leers, Johann von (1902–1965) 550 f. Lehmann, Hans (1861–1946) 500 A Lehmann (⌥Hartleben), Karl (1894– 1944) 324 Lehrmann, Cuno Chanan (1905–1977) 34 Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646–1716) 297, 303 Lenin, Wladimir Iljitsch (1870–1924) 227, 230 f. Lepsius, Sabine (1864–1942) 302 A Lerch, Max 151 A Lessing, Gotthold Ephraim (1729–1781) 700 Leupin, Kurt (1907–1986) 96 Leupold, Rudolf (1913–1986) 281
866
Personenregister
Lewald, Ernst Anton (1790–1848) 218 A Lewald, Hans (1883–1963) 16, 127 f., 147 A, 218–220, 231 A, 233 A, 572 Lewald, Walter (1887–1986) 218 A Leyen, Friedrich von der (1873–1966) 384 Lichtenberg, Georg Christoph (1742– 1799) 556 Lichtenhahn, Hans (1875–1951) 253 A Lichtenhan, Lucas (1898–1969) 486 A Lieb, Fritz (1892–1970) 143, 149–151, 156, 168, 193, 195 f., 208 f., 229, 231 A, 310, 354, 480, 739, 746 Liebert, Arthur (1878–1946) 301 Liebert, Peter 421 A Liebeschütz, Hans (1893–1978) 324 Liebeskind, Wolfgang Amadeus (1902– 1983) 25 Liechtenhan, Rudolf (1875–1947) 140, 174, 177 f. Liehburg, Max Eduard (1899–1962) 540 A Linder, Hans R. (1921–2017) 60 Lindt, Andreas (1920–1985) 92, 101 f. Lindt, August (1905–2000) 192 List, Friedrich (1789–1846) 592, 610, 617, 623 Litt, Theodor (1880–1962) 301 Littmann, Enno (1875–1958) 481 Livius, Titus (ca. 59 v. Chr.–ca. 17 n. Chr.) 344 Loeb, Hermann (1897–1963) 508 Loewe, Siegfried Walter (1884–1963) 32 Loewenich, Walther von (1903–1992) 162 Löwith, Karl (1897–1973) 301, 308, 556 A, 720 A Lohmann, Johannes Friedrich (1895– 1983) 318, 363 f., 622 Lohr, Erwin (1880–1951) 632 Lohr, Ina (1903–1983) 521 Lomholt, Svend (1888–1949) 268 Loos, Adolf (1870–1933) 216
Ludwig (⌥von Sprecher), Carl (1889– 1967) 115, 149 A, 159, 198 A, 211 f., 239, 572, 607, 611–614 Ludwig, Eugen (1887–1971) 149 A, 249, 259, 279, 286, 290, 293, 705 Ludwig, Gottfried (1889–1970) 169 Lüdeke, Henry (1889–1962) 476 f., 546 f. Lüdin, Max (1883–1960) 259 Lüscher, Erhard (1894–1979) 259 Lüscher, Gottlieb (1897–1984) 646, 650 A Lüthi, Walter (1901–1982) 180, 185 Lützeler, Heinrich (1902–1988) 515 Lützelschwab, Wilhelm (1905–1981) 254–256 Lukrez (ca. 99–ca.53 v. Chr.) 344 Luschan, Felix von (1854–1924) 581 Luther, Hans (1879–1962) 592 Luther, Martin (1483–1546) 423 A, 522 A, 571 Lutz (⌥Gutknecht), Wilhelm (1888– 1958) 259, 266–268, 291, 295 Maas, Paul (1880–1964) 325 MacDonald, James Grover (1886–1964) 198 A Maeglin, Rudolf Bolo (1898–1973) 570 Mahler, Elsa (1882–1970) 478–481 Mahler, Josef 478 Maier, Hans Wolfgang (1882–1945) 272 A Malten, Ludolf (1879–1969) 391 Maneef, von 131 A Mangold, Fritz (1871–1944) 123–125, 264, 288, 488, 572, 590, 594, 606, 678 Mann, Thomas (1875–1955) 402, 425, 462 Mannheim, Karl (1893–1947) 301 Mantar 131 A Marbach, Fritz (1892–1974) 74 A, 87 A Marcus, Ernst Gustav Gotthelf (1893– 1968) 705 Mark, Hermann Franz (1895–1992) 17, 657 f., 663, 665–672, 747
Personenregister Markwart, Otto (1861–1919) 489, 504 Martin, Alfred von (1882–1979) 559 Martin, Victor (1886–1964) 336 A Marx, Karl (1818–1883) 224, 227, 229, 556, 717, 737 Mason, Eudo Colecestra (1901–1969) 478 Massini, Rudolf (1880–1954) 83 Masson, Roger (1894–1967) 248 Matthies (⌥Ter Horst), Wilhelm (1881– 1961) 16, 628–630, 633 f., 637–640, 705, 736, 751 Maublanc, Jean-Daniel (1892–1965) 438 Maurras, Charles (1868–1952) 29 May, Ernst (1886–1970) 204 A, 491– 493, 496 f., 511 Mayer, Theodor (1883–1972) 446 A, 554 Mecking, Ludwig (1879–1952) 684 Medicus, Fritz (1876–1956) 289, 304, 308 Meier, Fritz (1912–1998) 483 f. Meier, John (1864–1953) 340, 372 f., 389 Meier, Theodor 97 Meili (⌥Hofstetter), Werner (1899–1967) 113, 115, 280 Meinecke, Friedrich (1862–1954) 552 A, 578 Meller, Josef (1874–1968) 263 Melon, Germaine (1903–) 198 A Meng, Heinrich (1887–1972) 231, 231 A, 288–290, 301, 745 Mengele, Josef (1911–1979) 587 Mercier, Henri (1867–1949) 134 Merian (⌥Genast), Ernst (1894–1958) 371, 409 A, 410 Merian, Paul (1885–1966) 414 Merian, Peter (1795–1883) 709 Merian, Wilhelm (1889–1952) 519 Merker, Paul (1894–1969) 390 Merz, Walther (1868–1938) 334 Metternich, Klemens Wenzel Fürst (1773– 1859) 444
867
Metz, Friedrich (1890–1969) 112 A, 126–130, 215, 234, 234 A, 444 A, 453 A, 464 f., 555, 681 Meuli, Karl (1891–1968) 165, 317 f., 331 f., 335, 337–342, 348, 352, 359, 366 f., 392 Meyenburg, Han(n)s (Walter) von (1887– 1971) 134, 134 A Meyer, Bruno (1911–1991) 235 A Meyer, Conrad Ferdinand (1825–1898) 395, 413, 575 Meyer, Eduard (1855–1930) 320 Meyer, Ernst (1898–1975) 363 Meyer, Hans (1858–1929) 679 Meyer, Heinrich (1904–1977) 438 Meyer, Kurt H. (1883–1952) 650 A Meyer, Peter (1894–1984) 503 Meylan, Henri (1900–1978) 127 Meylan, Philippe (1893–1972) 127 Meynen, Emil (1902–1994) 443 A Mez, Adam (1869–1917) 481 Michaelis, Wilhelm (1896–1965) 27, 555 A Michaud, Louis (1880–1956) 127 f. Michel, Robert (1897–1983) 495 Michelangelo (1475 1564) 608 f. Michelet, Jules (1798–1874) 538 f., 542, 577 Michels, Robert (1876–1936) 59 A, 258, 589 f., 594 Mierendorff, Carlo (1897–1943) 621 Miescher, Ernst (1905–1990) 633, 635 Miescher, Guido (1887–1961) 266–269 Miescher, Rudolf (1880–1945) 246 Miéville, Henri-Louis (1877–1963) 36 Migot, André (1892–1967) 725 Millikan, Robert Andrews (1868 1953) 633 Minkowski, Hermann (1864–1909) 629 Mislin, Hans (1907–1993) 67, 693 Mitteis, Ludwig (1859–1921) 214, 216, 218
868
Personenregister
Miville, Carl (senior) (1891–1981) 124, 147 A, 249, 255, 258, 414, 432, 480, 570, 635, 685 Miville, Carl (junior) (1921–2021) 230 A Mörike, Eduard (1804–1875) 419 Mohler, Hermann (1900–1989) 661 f. Mohrmann, Hans (1881–1941) 627 Mollier, Siegfried (1866–1954) 724 Moltke, Helmuth Graf von (1907–1945) 621 Moncada, Luís Cabral de (1888–1974) 131 A Moog, Willy (1888–1935) 303 Moos, Rudolf von (1884–1957) 64 A Mooser, Hermann (1891–1971) 35 Morf, Heinrich (1854–1921) 409 Moser, Jean (1906–1994) 231 A Motta, Giuseppe (1871–1940) 95, 439, 607 Motzkin, Leo (1867–1933) 628 Motzkin, Theodor Samuel (1908–1970) 628 Mounier, Emmanuel (1905–1950) 59, 78, 416 A, 417 f., 434, 439 Muckle, Friedrich (1883–1942) 621 f. Mühlestein, Hans (1887–1969) 204, 230, 230 A, 361–363, 506 A Mühll, Karl von der (1841–1912) 637 Mühll, Peter von der (1885–1970) 114, 123, 125, 135, 308, 317 f., 329 A, 330–339, 341–344, 348–350, 353, 356, 358 A, 366 f., 374 f. Mühlmann, Wilhelm Emil (1904–1988) 587 Müller, Friedrich von (1858–1941) 20 A Müller, Hans (Karl) (1899–1977) 278 Müller, Johannes (1752–1809) 697 Müller, Ludwig (1883–1945) 167 Müller, Oskar (1887–1956) 259 Müller, Paul (Hermann) (1899–1965) 262 A Münchhausen, Börries Freiherr von (1874–1945) 73 A
Muralt, Alexander von (1903–1990) 660 A Murko, Matija/Matväs (1861–1952) 479 Muschg, Walter (1898–1965) 308, 369 f., 374, 396–406, 408, 439, 478, 564 Musil, Robert (1880–1942) 59 Mussolini, Benito (1883–1945) 29 f., 36, 128, 128 A, 192, 380, 494, 527, 539, 570, 602 f., 616, 620, 734 Nadler, Josef (1884–1963) 59 A, 164 A, 400, 401 A Naef, Adolf (1883–1949) 705 f. Näf, Werner (1894–1959) 84 Nägeli, Carl Wilhelm von (1817–1891) 709 Naegeli, Oskar (1885–1959) 266 f., 270 Naegeli, Theodor (1886–1971) 291 A Natorp, Paul (1854–1924) 309, 420 Naumann, Friedrich (1860–1919) 166 Nef, Karl (1873–1935) 518–521 Nelson, Leonhard (1882–1927) 230 Nerval, Gérard de (1808–1855) 428, 434 Neuber, Ede (1882–1946) 270 Neumann, Friedrich (1889–1978) 125 Neumann, Hans (1903–1990) 388 Neutra, Richard (1892–1970) 497 Nevanlinna, Rolf (1895–1980) 131 A Newald, Richard (1894–1954) 28, 369, 396 Nicole, Léon (1887–1965) 62, 81 A Niedermann, Max (1874–1954) 134, 336 A Niemann, Emil 555 A Niemeyer, Max (1883–1964) 451 f., 463 Niethammer, Theodor (1876–1947) 628, 641 Nietzki, Rudolf (1847–1917) 652, 662 Nietzsche, Friedrich (1844–1900) 164, 318, 320, 326, 348, 379, 402, 405, 541, 556, 564, 592, 595, 597 f., 604, 606– 610, 615, 622, 625, 717 Niggli, Paul (1888–1953) 116, 120, 134, 674
Personenregister Niklaus, Émile-Albert 78 A Nitze, William A. (1876–1957) 458, 461 Nobel, Rudolf 69 Noddack, Walter (1893–1960) 663 Norden, Eduard (1868–1941) 325 Nosbisch, Werner (1887–1974) 496 Nussbaum, Fritz (1879–1966) 678, 680 Nussberger, Maria (1868–1948) 533 Nussberger, Max (1879–1943) 395 f. Nuttall, George Henry Falkiner (? 1862– 1937) 131 A Oberling, Charles (1895–1960) 263 Oehler, Hans (1888–1967) 245 A, 681 A Oeri, Albert (1875–1950) 115, 151 A, 185, 241, 261, 264, 301, 349, 362 A, 536, 539 A, 547, 723 Oeschger, Johannes (1904–1978) 544 A Oettinger (⌥Burckhardt), Gertrud (1890– 1974) 664 Oettinger (⌥Burckhardt), Hans (1883– 1949) 663 f. Oliphant, Mark (1901–2000) 636 Olivier, Franck (1869–1964) 127–129 Olshausen, Hans-Peter (1899–1965) 617 Oltramare, André (1884–1947) 416, 428 Oncken, Hermann (1869–1945) 543 Oppenheimer, Franz (1864–1943) 361 Oppermann, Hans (1895–1982) 344 f. Oppikofer, Ernst (1874–1951) 259, 295 Oprecht, Emil (1895–1952) 362, 480 Oprecht, Hans (1894–1978) 192, 204 Orestano, Francesco (1873–1945) 128 Ortega y Gasset, José (1883–1955) 717 Ostrowski, Alexander (1893–1986) 292, 627–629 Ottenstein, Berta (1891–1956) 291 Ottheinrich (1502–1559) 120 Otto, Walter Friedrich (1874–1958) 324 Overbeck, Franz (1837–1905) 155, 164, 402 Ovid (43 v. Chr.–17.n. Chr.) 344 Oyen, Hendrik van (1898–1980) 288
869
Ozanam, Frédéric Antoine (1813–1853) 62 Paeschke, Hans (1911–1991) 574 A Paldrock, Alexander (1871–1944) 270 Paneth, Fritz A. (1887–1958) 662 f., 665 Panofsky, Erwin (1892–1968) 320, 501 f., 508, 517 Paravicini, Eugen (1889–1945) 584 A Paravicini, Mathilde (1875–1954) 292 Parmenides (ca. 520/515–ca. 460/455 v. Chr.) 629 Pascal, Blaise (1623–1662) 79, 423, 437 Pasquali, Giorgio (1885–1952) 570 A Pasteur, Louis (1822–1895) 263 Patocchi, Aldo (1907–1986) 525 Paul VI. (1897–1978) 163 Paul, Jean (1763–1825) 419, 437 Pauli, Wolfgang (1900–1958) 635 Péguy, Charles (1873–1914) 335, 416, 424, 434, 437 Penck, Albrecht (1858–1945) 687 Perkins 131 A Pestalozzi, Johann Heinrich (1746– 1827) 314, 402, 575 Peter (⌥Deschwanden), Werner 251 A, 252, 254–256 Petersen, Julius (1878–1941) 476 Petri, Franz (1903–1993) 475 Peuckert, Will-Erich (1895–1969) 391 Pfeffer, Wilhelm (1845–1920) 689 Pfeiffer, Rudolf (1889–1979) 557 Pfuhl, Ernst (1876–1940) 318 f., 325 A, 338, 349–351, 353–356, 358–360, 363, 478 Pfuhl (⌥Rhusopulos), Sophia (1865– 1952) 350 Piccard, Jules (1840–1933) 660 Pick, Filipp Josef (1834–1910) 267 Pietrusky, Friedrich (1893–1971) 126 Pilet (⌥Golaz), Marcel (1889–1958) 193, 248 Pinder, Wilhelm (1878–1947) 500 A, 501 f., 512, 514
870
Personenregister
Pirandello, Luigi (1867–1936) 411 Platon (428/427–348/347 v. Chr.) 304, 306, 324, 336, 592, 597, 600 f., 608, 615, 625 Platzhoff, Walter (1881–1969) 326 Plautus, Titus Maccius (ca. 254–ca. 184 v. Chr.) 344 Plessner, Helmut (1892–1985) 232, 308, 423, 696 A, 710 f., 737 Pohlenz, Max (1872–1962) 135 Politzer, Georges (1903–1942) 439 Poll, Heinrich (1877–1939) 290 Pollog, Carl Hanns (1899–1975) 204 A, 682–684, 687 Portmann, Adolf (1897–1982) 288, 434, 635, 640, 663, 691–728, 737, 744, 750 Portmann, Anna (1874–1900) 697 Portmann (⌥Devillers), Geneviève (1893– 1981) 725 Portmann, Hans (1900–1967) 697 A, 698 Portmann, Karl Adolf (1869–1934) 697 A, 698 Porzig, Walter (1895–1961) 27, 280, 364, 555 A Pozner, Chaim (Pazner, Haim) (1899– 1981) 624 Prantl, Karl (1849–1893) 688 Preisendanz, Karl (1883–1968) 120 Preiswerk, Andreas (1910–1936) 82 Preiswerk, Eduard (1912–1983) 667 A Preiswerk, Heinrich (1876–1940) 673 f. Preiswerk, Peter 81 A Preiswerk, Rosie 184 Prenant, Marcel (1893–1983) 724 Press, Jean 650 A Preuss, Theodor (1869–1938) 587 Prijs, Joseph (1889–1956) 565 f. Prins, D. A. 650 A Pușcariu, Sextil (1877–1948) 131 A Quarles van Ufford, Gérard Charles (1865–1952) 648 A
Quervain, Alfred de (1896–1968) 153, 208 Rabbow, Paul (1867–1956) 308 Rabel, Ernst (1874–1955) 218 Radbruch, Gustav (1878–1949) 33, 153, 228, 664 Radcliffe-Brown, Alfred (1881–1955) 584 A Rade, Gottfried (1891–1987) 166 Rade, Martin (1857–1940) 166 Ragaz, Leonhard (1868–1945) 143, 149, 177, 180, 210, 524 Rahn, Johann Rudolf (1841–1912) 485 Rameau, Yves (Zweig, Ewald) 151 A Ranisch, Wilhelm (1865–1945) 374 Ranke (⌥Stein), Frieda 378 Ranke, Friedrich (1882–1950) 17, 147 A, 300, 344 A, 369 f., 374, 378, 384–393, 401 A, 408 Ranke, Hermann (1878–1953) 392 Rappard, William (1883–1958) 23, 133 A, 241, 573 Rauschning, Hermann (1887–1982) 86 Raymond, Marcel (1897–1981) 76, 306, 377, 409, 413, 415 f., 419, 423 f., 427, 429, 432 f., 438 f. Regenbogen, Otto (1891–1966) 342, 342 A Reger, Max (1873–1916) 519 Rehm, Walther (1901–1963) 396, 531, 563, 577 Reichel, Manfred (1896–1984) 676 Reichstein, Alfred(o) (1902–) 649 A Reichstein, Gustawa (1875–1964) 648 A, 650 Reichstein (⌥Quarles van Ufford), Henriette Louise (1898–1993) 648 Reichstein, Tadeus (1897–1996) 206, 262 A, 292, 645–653, 662, 665, 668, 671 f., 747, 750 Reifenberg, Ernst 69 Reiners, Heribert (1884–1960) 28, 500 A
Personenregister Reinhard, Max (1882–1974) 94, 672– 674 Reinhardt, Hans (1902–1984) 487, 502, 504, 506 Reinhardt, Karl (1886–1958) 324 Reinhart, Oskar (1885–1965) 507 Reinke, Johannes (1849–1931) 689 Renard, Maurice (1875–1939?) 439 Renfer, Hermann (1874–1956) 630 Renner, Paul (1878–1956) 495 Rest, Josef (1884–1961) 554 Reymond, Arnold (1874–1958) 127, 128 A Reynold, Gonzague de (1880–1970) 77, 77 A, 158 Ribi, Adolf (1902–1988) 471–473 Richard (⌥Oltramare), Albert (1883– 1939) 116 Richelieu, Armand-Jean du Plessis Duc de (1585–1642) 544 Richter, Werner (1887–1960) 374–376, 395, 617 A Rickert, Heinrich (1863–1936) 117 Riedmüller, Leonhard (1898–1976) 28 Riese, Otto (1894–1977) 25, 28, 126– 128, 465 Rieser, Ferdinand (1886–1947) 120 Riezler, Kurt (1882–1955) 301, 326 Riggenbach, Rudolf (1882–1961) 569 Rikli, Martin (1868–1951) 689 Rilke, Rainer Maria (1875–1926) 302, 402, 478 Rintelen, Friedrich (1881–1926) 485 f., 501 Ritschl, Albrecht (1822–1889) 155, 179, 196 Ritschl, Hans (1897–1993) 17, 55, 125, 134, 227, 344 A, 590, 594, 606, 684 Ritschl, Otto (1860–1944) 139 Ritter, Gerhard (1888–1967) 88, 129 A, 300, 331 A, 389, 430, 522 A, 523, 543, 543 A, 545–547, 571 A, 576 f. Ritter, Hellmut (1892–1971) 483 f. Rittmann, Alfred (1893–1980) 675
871
Rivière, Jacques (1886–1925) 419 A, 420 Rochat, G. F. (1878?–1965) 128 Roches (⌥Schwab), Paul (1872–1957) 410 Rössle, Robert (1876–1956) 277 Roessler, Rudolf (1897–1958) 479 A Rohn, Arthur (1878–1956) 33, 657 f. Rohn, Roland (1905–1971) 42 f. Roll, Ubald von (1908–1976) 22 f. Romains, Jules (1885–1972) 59 A, 419 A Rompe (⌥Baumgarten), Elisabeth (1922– 1992) 231 Rompe, Robert (1905–1993) 231 Ronus (⌥von der Mühll), Paul (1883– 1941) 246 Rose, Gerhard (1896–1992) 276, 276 A Rosenberg, Alfred (1892–1946) 86, 150, 150 A, 195 f., 310 f., 327 A, 512, 713 Rosenbusch, Harry (1836–1914) 674 Rost, Georg Alexander (1877–1970) 291 Roth, Daniel 93 Rothfels, Hans (1891–1976) 618 Roth (⌥Göhrig), Paul (1897–1961) 235 A, 523 Rothlin (⌥Wachs), Églantine Léonie Marie 261 A Rothlin, Ernst (1888–1972) 261, 261 A, 280 Rothmund, Heinrich (1888–1961) 185, 199, 606 f. Rougemont, Denis de (1906–1985) 59, 78, 78 A, 86, 88 A Rousseau, Jean-Jacques (1712–1778) 221 Ruck, Erwin (1882–1972) 41, 41 A, 124, 215, 217 f., 227, 235 f., 239 A, 243, 249, 253 Rüdiger, Horst (1908–1984) 576 Rüdin, Ernst (1874–1952) 272–275 Rüegg, August (1882–1972) 124, 124 A, 355, 413 f., 431, 487, 504, 505 A, 540 A, 547 Rütimeyer, Leopold (1856–1932) 372 Rütimeyer, Ludwig (1825–1895) 692, 708 f., 722
872
Personenregister
Ruggli, Paul (1884–1945) 644, 652, 660, 662 Rupe, Hans (1866–1951) 643, 651 f., 660, 666–668 Rusch, Johann Baptist (1886–1954) 603 f., 607 Rust, Bernhard (1883–1945) 78, 97, 119 f., 132 A, 146, 323, 743 Rutherford, Ernest (1871–1937) 636, 654 Rutsch, Rolf (1902–1975) 675 Ru⌅i⇥ka, Leopold (1887–1976) 262 A, 645–647, 665, 722, 750 Rybar, István (1886–1971) 131 A Rychner, Max (1897–1965) 429 Sabatier, Paul (1858–1928) 700 A Sacher, Paul (1906–1999) 520 Saenger, August (1884–1950) 204 A, 226, 226 A afran, Menachem Beir (1913–) 567 f. Salazar, António de Oliveira (1889– 1970) 77 A Salin (⌥Trützschler), Antonie Charlotte Gräfin von Falkenstein (1903– 1987) 600, 607 Salin, Edgar (1892–1974) 40, 42, 69, 69 A, 134, 227, 292, 324, 348, 353– 355, 361, 363, 431, 541, 547, 572, 588–626, 735, 737 Salin (⌥Baur), Isolde Maria (1915–) 600 Salis, Arnold von (1881–1958) 38, 319, 336 A, 356–359, 375, 746 Salis, Jean-Rudolf von (1901–1996) 226 Salmony, Hansjörg A. (1920–1991) 297, 306 Salomon, Richard (1884–1966) 546 Salvemini, Gaetano (1873–1957) 464, 527 Salvisberg, Otto Rudolf (1882–1940) 43 Sarasin, Alfred (1865–1953) 179 Sarasin, Fritz (1859–1942) 372, 579– 583, 585, 679, 704, 710 A, 713 Sarasin, Paul (1856–1929) 372, 579–582, 677, 713
Sartorius, Karl (1890–1965) 149 A Sauckel, Fritz (1894–1946) 283 Sauerbruch, Ferdinand (1875–1951) 60 Savigny, Friedrich Carl von (1779–1861) 312 Savonarola, Girolamo (1452–1498) 700 Schabad, Michael (1894–1960) 228, 228 A Schachermeyr, Fritz (1895–1987) 328 Schadewaldt, Wolfgang (1900–1974) 334 Schaeffer, Albrecht (1885–1950) 397 Schaffner, Jakob (1875–1944) 164, 164 A, 398 Schalk, Fritz (1902–1980) 463 Schapiro, Meyer (1904–1996) 511 A Schaub, Hans (1913–1994) 687 A Schaxel, Julius Christoph (1887–1943) 229, 229 A Scheel, Otto (1876–1954) 522 A Scheffer, Paul (1883–1963) 226 A Schefold, Karl (1905–1999) 135, 308, 319, 324 f., 351–361, 366, 396, 737 Schefold (⌥von den Steinen), Marianne (1906–1997) 352 f., 360 Scheler, Max (1874–1928) 710 A Schenck, Ernst von (1903–1973) 248, 250 A, 254, 308 Scherrer, Hans Adolf 87 A Scherrer, Paul (1890–1969) 635–637, 658 A Schib, Karl (1898–1984) 235 A Schiff, Jakob (Heinrich) (1847–1920) 591 Schiller, Friedrich von (1759–1805) 313, 700 Schinz, Hans Rudolf (1891–1966) 578 Schlesinger, Georg (1874–1949) 33 Schlier, Heinrich (1900–1978) 175, 175 A Schmalenbach, Cornélia 307 Schmalenbach, Eugen (1873–1955) 307 Schmalenbach, Herman (1885–1950) 17, 134, 297, 302–309, 314, 377, 430– 432
Personenregister Schmalenbach (⌥Müntz), Sala (1886– 1942) 302 Schmid, Heinrich Alfred (1863–1951) 134 f., 308, 484–486, 500 f., 505, 507, 508 A, 535, 564 Schmid (⌥Fehr), Peter (1879–1939) 246 Schmidt, Carl (1862–1923) 506, 672– 674 Schmidt (⌥Imboden), Elisabeth (1900– 1986) 231 A Schmidt, Erich (1888–1967) 270 Schmidt, Georg (1896–1965) 227, 230, 231 A, 355, 487, 506 Schmidt, Hans (1893–1972) 227, 230, 231 A Schmidt, Karl (1899–1980) 126 Schmidt, Karl Ludwig (1891–1956) 16, 124, 135, 139, 144, 147 A, 148–150, 156, 160, 163, 170–178, 193, 196– 200, 202, 208 f. Schmidt (⌥von Wengern), Ursula 171 Schmidt, Wilhelm (1868–1954) 33, 582 Schmitt, Carl (1888–1985) 149 A, 153, 242 Schmitthenner, Paul (1884–1963) 119 Schmolkowá Casella, Wilhemina 649 A Schneider, Salomé (1887–1949) 479, 590 Schönberg, Salomon (1879–1958) 65, 259, 291 f., 733 Schönenberger, Wilhelm (1898–1985) 117 Schönstädt, Henriette (Henny) (1910– 1987) 69 Schöpfer, Robert (1869–1941) 691 Schoetensack, August (1880–1957) 221 A Scholz, Wilhelm von (1874–1969) 575 A Schongauer, Martin (ca. 1450–1491) 569 Schrade, Hubert (1900–1964) 126 Schrader, Hans (1869–1948) 503 Schröter, Carl (1855–1939) 690 Schubiger, Maria (–1986) 478 Schüepp, Otto (1888–1981) 690 Schuhmacher, Adolf (1896–1978) 555 A
873
Schulenburg, Werner Graf von der (1875– 1944) 526–528, 535–537 Schulthess, Friedrich (1868–1922) 483 Schultz, Hermann (1836–1903) 169 Schultze, Walther (1893–1970) 270 Schumacher, Edgar (1897–1967) 246, 254 Schuschnigg, Kurt (1897–1977) 89 Schwabe, Benno (1884–1950) 615 A Schwabe, Karl (1869–1938) 534 Schwartz, Eduard (1858–1940) 331 Schwarz, Robert (1887–1963) 663 Schwarz, Rudolf (1881–1954) 259 Schwarzenbach, Gerold (1904–1978) 662, 665 f. Schweitzer, Albert (1875–1965) 151 Schweizer, Felix 605 Schweizer, Julius (1898–1986) 179 Schwyzer, Eduard (1874–1943) 126 Seifert, Alwin (1890–1972) 252 Seiler, Jakob (1886–1970) 706 Seip, Didrik Arup (1884–1963) 131 A Seldte, Franz (1882–1947) 120 Selle, Götz von (1893–1956) 131 f. Senfl, Ludwig (–1543) 519 Senglet, Franz (1893–1920) 701 Senn (⌥Bernoulli), Gustav (1875–1945) 688–692 Sestan, Ernesto (1898–1986) 527 Severi, Francesco (1879–1961) 131 A Seyß-Inquart, Arthur (1892–1946) 573 A Sforza, Carlo (1872–1952) 59 Shakespeare, William (1564–1616) 700 Shaw, George Bernard (1856–1950) 700 Sidler, Emil (1844–1928) 299 Siebs, Theodor (1862–1941) 390 Sieburg, Friedrich (1893–1964) 59 A Siegwart, Alfred (1885–1944) 116 Siemsen, Anna (1882–1951) 70 Sievers, Luisa Wilhelmine (–1904) 478 Simmel, Georg (1858–1918) 302, 303, 306
874
Personenregister
Simon, Franz (Francis Eugen) (1893– 1956) 663 Simonius (⌥Bourcart), August(e) (1885– 1957) 125, 213–216, 224 A, 233 A, 241 A, 282, 572 Smend, Rudolf (1882–1975) 222, 236, 258, 734 Snell, Bruno (1896–1986) 325 Snijder, Geerto (1896–1992) 131 A Sobotta, Johannes (1869–1945) 286 Sölch, Johann (1883–1951) 678 f. Sohm, Rudolph (1841–1917) 216 Solomon, Jacques (1908–1942) 439 Solon (630–560 v. Chr.) 336 Solowjow, Wladimir Sergejewitsch (1853– 1900) 195 Sommer, Artur (1889–1965) 623 f. Sommerfeld, Renate (siehe Brand, Renée) Späth, Ernst (1886–1946) 658 Speiser, Andreas (1885–1970) 629 Speiser (⌥Merian), Elise 583 Speiser, Felix (1880–1949) 84, 84 A, 579–588, 629 Speiser (⌥Sarasin), Paul (1846–1935) 40 A, 580 Spengler, Oswald (1880–1936) 326, 361 Spiess, Otto (1878–1966) 628 f. Spiess, Walter (1888–1949) 331, 337 A, 339 Spiethoff, Arthur (1873–1957) 592 Spinoza, Baruch de (1632–1677) 120 Spitteler, Carl (1845–1924) 498, 530, 700 Spitzer, Leo (1887–1960) 462–464 Spörri, Hans 60 Spranger, Eduard (1882–1963) 32 Spreng, Max (1894–1965) 259 Srbik, Heinrich Ritter von (1878–1951) 573 A Stadler, Peter (1925–2012) 22 Stäger, Hans (1896–) 29 Staehelin, Ernst (1889–1980) 18, 43 A, 95, 115, 124, 127, 137, 139–142, 149 A, 154–162, 170, 175, 186–188,
194, 196, 206, 209, 281, 553, 557, 566, 689 Stähelin, Felix (1873–1952) 264, 317 f., 330, 334, 347–349, 362, 366, 523, 535, 547, 575 A, 610 Staehelin (⌥Kutter), Gertrud (1901– 1980) 156, 160, 205 f., 212, 292 Staehelin, John Eugen (1891–1969) 111 A, 204, 257–259, 264 f., 272–275, 282, 288, 290 Staehelin, Rudolf (1875–1943) 136, 259 f., 292, 748 Stalin, Josef (1879–1953) 71, 79, 226, 231 f., 382, 481, 494 Stamm, Johann Jakob (1910–1993) 181 Stamm, Rudolf (1909–1991) 476 A, 477 Stark, Michael (1877–1953) 131 A Staub, Hans (Physiker, 1908–1980) 636 Staub, Hans (Pharmakologe/Internist, 1890–1967) 259 Staudinger, Hermann (1881–1965) 654, 666–668 Stauffenberg, Alexander Schenk Graf von (1905–1964) 353, 360 f., 619 Stauffenberg, Berthold Schenk Graf von (1904–1944) 324, 353, 360 f., 366, 619 Stauffenberg, Claus Schenk Graf von (1907–1944) 324, 366, 619, 621 Stebler, Hans (1924–1994) 227 Steding, Christoph (1903–1938) 539 A, 573, 574 A Steffen, Albert (1884–1963) 402 Stehlin, Hans Georg (1870–1941) 704 f., 710 A Stehlin, Karl (1859–1934) 348 Steiger, Arnald (1896–1963) 452, 498 A Steiger, Eduard von (1881–1962) 91, 102, 185 Steiger, Marguerite (1909–1990) 646 A Stein, Arthur (1888–1978) 301 Stein, E. A. 324 Stein, Marie (1873–1964) 392 Steinbach, Franz (1895–1964) 475
Personenregister Steinen, von den (⌥Im Hof), Georgine (1917–2020) 212, 355 Steinen, Karl von den (1855–1929) 352 Steinen, Wolfram von den (1892–1967) 212, 352, 355, 355 A, 522, 544 Steiner, Emil (1888–) 371, 372 A Steiner, Rudolf (1861–1925) 154 Steller, Walther (1895–1971) 388 A, 390 f. Steward, Hugh Fraser (1863–1948) 128 Stickelberger, Emmanuel 98 Stoessl, Franz (1910–1987) 325 Stohler, Martin (1914–1966) 70 Stoll, Arthur (1887–1971) 261 A, 663 Straub, Hermann (1882–1938) 136 Straumanis, M. 131 A Strauss, Ludwig (1892–1953) 394 Strawinsky, Igor (1882–1971) 519 Strölin, Karl (1890–1963) 268 Strohl, Jean (1886–1942) 704–706 Strub (⌥Saxer), Margrith (1886–1970) 231 A Strub, Walter (1882–1938) 67, 67 A Studentkowski, Werner (1903–1951) 465, 466 A Stückelberger, Matthias 102 Stühmer, Alfred (1885–1957) 270 Suhrmann, Rudolf (1895–1971) 663 Supervielle, Jules (1884–1960) 434 Suter, Fritz (1870–1961) 259 Suter, Hermann (1870–1926) 519 Szilasi, Wolfgang (1889–1966) 726 Szily, Aurel von (1880–1945) 264 Tacitus, Publius Cornelius (ca. 58–120) 344, 347 Täschler, Jakob (1863–1936) 179 Täubler, Eugen (1879–1953) 324 Takenoutchi 131 A Tamburini 528 Tannenberg, Ernst August Wilhelm (1895–1983) 460, 460 A Tappolet, Ernst (1870–1939) 409 f., 414, 431, 468, 470
875
Thalmann, Ernst Alfred (1881–1938) 114, 137, 194, 279, 280–282, 431, 433, 546, 644, 683 Theiler, Willy (1899–1977) 324 Theophrast (ca. 371–287 v. Chr.) 689 Thévenaz, Pierre (1913–1955) 307 Thibaudet, Albert (1874–1936) 419 A, 427 Thiel, Rudolf (1894–1967) 264 Thiele, Johannes (1865–1918) 652 Thieme, Hans (1906–2000) 219 A Thiselton-Dyer, William (1843–1928) 688 f. Thomalla, Curt (1890–1939) 268 Thomas von Aquin (1225–1274) 309, 639 Thommen, Bruno 62 Thommen, Georg Heinrich (1908–1956) 87 Thommen, Rudolf (1860–1950) 546 Thukydides 342 A Thurneysen, Eduard (1888–1974) 144, 149 A, 153, 173 A, 179 f., 191, 201 A, 209, 288 Thurneysen, Peter (1891–1964) 149 A Thurnwald, Richard (1869–1954) 585 A, 587 Tièche, Karl Eduard (1877–1962) 32 Tillich, Paul (1886–1965) 171 Tobler, August (1872–1929) 676 Tobler, Robert (1901–1962) 251 Tönnies, Ferdinand (1855–1936) 302 f., 307 Toepfer, Alfred (1894–1993) 381 A Tolstoi, Leo N. (1828–1910) 700 Tomcsik, Joseph (1898–1964) 262 f., 294 Tonutti, Emil (1909–1987) 28 Treadwell, William Dupré (1885–1959) 661, 665 Treitschke, Heinrich von (1834–1896) 540 Tripet, Fritz (1843–1907) 688 Troeltsch, Ernst (1865–1923) 143, 179 Trösch, Robert (1911–1986) 229 A
876
Personenregister
Trog, Hans (1864–1928) 536 Troll, Carl (1899–1975) 683, 687 A Trotzki, Leo (1879–1940) 71 Tschudi, Hans-Peter (1913–2002) 40 A, 57, 67 A, 70 Tschudi, Rudolf (1884–1960) 165, 318, 331, 344 A, 353, 374, 481–484, 547 Tumarkin, Anna (1875–1951) 309 Uhlig, Carl (1872–1938) 679 Unamuno, Miguel de (1864–1936) 474 Usener, Hermann (1834–1905) 321, 338, 352 Valançay, Robert (1903–1985) 438 Valéry, Paul (1871–1945) 419 A Vasmer, Max (1886–1962) 479 Vaudaux, Adolphe (1917–2001) 62 Vergil (70–19 v. Chr.) 344 Vermeil, Edmond (1878–1964) 423, 438 Vermeil, Guy (1917–2005) 438 Verschuer, Otmar von (1896–1969) 587 Verzár, Fritz (1886–1979) 259, 262, 262 A, 282, 661 A Vest (⌥Buri), Gottlieb (1887–1977) 260 Viëtor, Karl (1892–1951) 396 Vincent, Raymonde (1908–1985) 415 A, 416, 432 A Vinet, Alexandre (1797–1847) 561 A Virchow, Rudolf (1821–1902) 581 Vischer (⌥von Bonstetten), Adolf Lukas (1884–1974) 124, 208, 224 A, 246, 262 f., 280 f., 287, 290, 293, 303, 659, 662 f., 665, 668 Vischer, Eberhard (1865–1946) 148, 151, 155 f., 160 f., 167, 169 f., 210 Vischer (⌥Ehinger), Fritz (1875–1938) 522 Vischer (⌥Staehelin), Maria (1897–1975) 167 Vischer (⌥von Planta), Max (1888–1975) 149 A Vischer (⌥Heussler), Wilhelm (1833– 1886) 155
Vischer, Willhelm (Botaniker, 1890– 1960) 690 f. Vischer, Wilhelm (Helmi) (Theologe, 1895–1988) 101, 103, 166–169, 179, 193, 200–202, 208 f. Vöchting (⌥Oeri), Friedrich Christian (1884–1969) 180, 239, 241, 344 A, 346, 346 A, 475, 531, 590, 734 Vogt, Alfred (1879–1943) 264 Vogt, Carl (1817–1895) 709 Vogt, Joseph (1895–1986) 327 Vogt, Paul (1900–1984) 151 A, 168 A Volkmann, Rüdiger von (1894–1990) 277, 279 f., 282 f., 286 Vollmer, Friedrich (1867–1923) 478 Voltaire (François-Marie Arouet) (1694– 1778) 556 Vonderschmitt, Louis (1897–1978) 673 Vonkennel, Josef (1897–1963) 270 Voretzsch, Karl (1867–1947) 415, 427 Vosseler, Paul (1890–1979) 230 A, 677 Wacker, Otto (1899–1940) 119, 129 Wackernagel (⌥Riggenbach), Hans Georg (1895–1967) 234 f., 246, 249, 337 A, 345, 392, 522 Wackernagel (⌥Stehlin), Jacob (1853– 1938) 135, 234, 318, 363, 622 Wackernagel (⌥Sarasin), Jacob (1891– 1967) 158 A, 227, 233–244, 249– 258, 471 A Wackernagel, Rudolf (1855–1925) 234, 485 Wackernagel, Wilhelm (1806–1869) 234 Wagner, Carl Wilhelm (1901–1977) 658 Wagner, Gerhard (1888–1939) 268 Wagner, Kurt (1890–1973) 388–390 Wagner, Richard (1813–1883) 120, 413, 609 A Wagner, Richard M. (1893–1986) 206 Wagner, Valentin Fritz (1895–1959) 572, 590, 613–615, 618 Waldmann, Anton (1878–1941) 268 Walpole, Horace (1717–1797) 439
Personenregister Walser, Ernst (1878–1929) 411, 533, 536 f. Walser (⌥Escher), Marguerite 533, 538 A Walton, Ernest (1903–1995) 636 Walz, Gustav Adolf (1897–1948) 390 Warburg, Aby (1866–1929) 507, 517, 526 Wartburg, von (⌥Boos), Ida (1887–1963) 441, 466 A Wartburg, Walther von (1888–1971) 39, 126–128, 147 A, 408–410, 412, 415, 431, 439–475, 572 A, 660, 746 Waser, Otto (1870–1952) 356, 361 f. Wavre, Rolin-Louis (1896–1949) 627 Weber, Alfred (1868–1958) 592, 623 Weber (⌥Stehlin), Alfred (1884–1973) 224 A Weber, Marianne (1870–1954) 116 Weber, Max (1864–1920) 230, 302 f., 589 Weber, Otto (1902–1966) 126 Weber, Wilhelm (1882–1948) 344 Wedekind, Frank (1864–1918) 393 Wehrli, Fritz (1902–1987) 336 A Wehrli, Max (1896–1944) 630, 632 f., 635 Wehrli, Werner (1892–1944) 337 A Weidenhagen, Rudolf (1900–1979) 651 A Weingartner, Felix (1863–1942) 521 Weinstein, Alexander (1897–1979) 627 f. Weisbach, Werner (1873–1953) 414, 507 f., 533, 537, 541, 544 A, 549 f., 564, 566 f., 578 Weissbach, Richard (1882–1950) 495 Weizmann, Chaim (1874–1952) 647 A Weizsäcker, Ernst von (1882–1951) 27 Weizsäcker, Viktor von (1886–1957) 289 Wells, Herbert George (1866–1946) 222 A Welti (⌥Preiswerk), Franz (1879–1934) 157 Welti, Max H. 270
877
Wendland, Johannes (1871–1947) 135, 143, 146 Wenk, Eduard (1907–2001) 674 Wenk, Fritz (1888–1954) 469 Wenk, Gustav (1884–1956) 596 A, 611 f. Wenk, Marianne 70 Wenk, Willi (1914–1994) 70 Went, Frits (1863–1935) 692 Wentzel, Gregor (1898–1978) 634 Wenzinger, August (1905–1996) 521 Werner, Alfred (1914–2005) 23, 78 Wernle, Paul (1872–1939) 142, 155 f., 179, 453 A, 533, 540 Werthemann, Andreas (1897–1974) 278, 282 Wesemann, Hans (1895–1971) 547 West, John Alexander 477 f. Weve, Hendricus Jacobus Marie (1888– 1962) 263 Weyland 204 Wichert, Fritz (1878–1951) 492 f., 503, 511 Widmer, Walter (1903–1965) 231 Wiedemann, Gustav Heinrich (1826– 1899) 631 Wieland, Carl (1864–1936) 212, 215, 235 Wieland (⌥Burckhardt), Emil (1867– 1947) 259, 285 Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich von (1848–1931) 320, 350 Wilbrandt, Robert (1875–1954) 621 Wilhelm II. (1859–1941) 264 Wille, Ulrich (senior) (1848–1925) 245 Wille, Ulrich (junior) (1877–1959) 245– 248 Willstätter, Richard (1872–1942) 652 Windaus, Adolf (1876–1959) 110 A Winkler, Ernst (1907–1987) 680 Winkler, Hans (1877–1945) 691 Winkler, Martin (1893–1982) 568 Winkler, Max (1875–1952) 267 Winter, Hans 94 Wirth, Hermann (1885–1981) 388 A
878
Personenregister
Wirz, Jakob (1870–1944) 180, 181 Wirz, Paul (1892–1955) 580 Wittfogel, Karl August (1896–1988) 59 Witz, Konrad (–1445) 486 Wizinger, Robert Karl (1896–1973) 653 Wölfflin, Ernst (1873–1960) 264 Wölfflin, Heinrich (1864–1945) 264, 321, 356, 484–487, 489 f., 492, 497– 501, 504 f., 507–510, 512, 514 f., 517, 556, 724 Woerler, Charles (1896–1988) 516 Wolf-Heidegger, Gerhard (1910–1986) 286 Wolfer, Albert (1889–1967) 163, 210 Wolff, Gustav (1865–1941) 275 Wolff, Martin (1872–1953) 218 Wolff, Max Gustav Heinrich (1893– 1965) 230 A Wolfram von Eschenbach 393 Wolfskehl, Karl (1869–1948) 302, 544, 591, 661, 664 Wolgast, Ernst (1888–1959) 243 Wolters, Friedrich (1876–1930) 352, 619, 622 Wormser, Edmond (1873–1924) 65 Wullschleger, Max (1910–2004) 66 f., 180 Wyss, Bernhard (1905–1986) 331, 334, 337, 342, 349 Yorck von Wartenburg, Peter Graf (1904– 1944) 620 Zander, Alfred (1905–1997) 299 Zbinden, Hans (1893–1971) 151 A
Zehnder, Ludwig (1854–1949) 630 Zehntner, Paul 251 Zellweger, Max (1903–2003) 145 A Zemp, Josef (1869–1942) 500 Zetsche, Fritz (1892–1945) 27, 555 A Zeugin, Gottfried 383 Zickendraht, Hans Heinrich (1881– 1956) 630 f., 684 Zieler, Karl (1874–1945) 267–270 Zimmer (⌥von Hofmannsthal), Christiane (1902–1987) 394 Zimmer, Heinrich Robert (1890–1943) 301, 363 f., 564 A, 622 Zimmerli, Walther (1907–1983) 201 A Zimmermann, Heinz 618 Zinkernagel, Franz (1878–1935) 369 f., 374–376, 393–396, 406–408, 533 Zörnig, Heinrich (1866–1942) 116 A, 643–645, 648 Zschokke, Alexander (1894–1981) 355 Zschokke, Friedrich (1860–1936) 692, 704–706, 725 Zsigmondy, Richard (1865–1929) 110 A Zuckermann, Rudolf (1910–1995) 69 A Zumbusch, Leo von (1874–1940) 267 Zumthor, Paul (1915–1995) 436 A Zvetajeva, Marina (1892–1941) 480 Zwanenberg, Mau van (1896–1942) 646 f. Zwanenberg, Saal van (1889–1974) 646 Zweifel, Edwin (1897–1964) 285 Zweig, Stefan (1881–1942) 393 Zwinggi, Ernst (1905–1971) 630 Zwingli, Huldrych (1481–1531) 548, 571
Das Signet des Schwabe Verlags ist die Druckermarke der 1488 in Basel gegründeten Offizin Petri, des Ursprungs des heutigen Verlagshauses. Das Signet verweist auf die Anfänge des Buchdrucks und stammt aus dem Umkreis von Hans Holbein. Es illustriert die Bibelstelle Jeremia 23,29: «Ist mein Wort nicht wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeisst?»
STUDIEN ZUR GESCHICHTE DER WISSENSCHAFTEN IN BASEL NEUE FOLGE
11
Das Verhalten der Basler Universitätsangehörigen reichte in der Zeit von 1933 bis 1945 von freundlichen Kontakten mit deutschen Institutionen über eine formale Trennung zwischen ‹Politik› und ‹Wissenschaft› bis zu Hilfsbereitschaft gegenüber Opfern des Nationalsozialismus. Diese Beziehungen zu den deutschen Hochschulen und Kollegen stehen im Zentrum des Bandes. Untersucht werden Basler Zeugnisse der Wahrnehmung von Vorgängen in Deutschland, von Exklusion und Verfolgung Andersdenkender und ‹Andersrassischer›, aber auch von Veränderungen in der Wissenschaft. Im Blick stehen einzelne Fakultäten und Disziplinen genauso wie Forschung und Lehre sowie – exemplarisch – einige Lebensläufe und Konflikte bei Lehrstuhlbesetzungen. Das persönliche, strukturelle und emotionale Beziehungsgeflecht, das die Basler mit der Universitätswelt des Nachbarlandes verband, wird dabei erstmals in seiner ganzen Breite sichtbar. Christian Simon lehrte als Extraordinarius an der Universität Basel Geschichte der Wissenschaften und der Technik sowie Umweltgeschichte. Er publizierte zur Geschichte der Geschichtsschreibung, der chemisch-pharmazeutischen Industrie, der Biologie und der Universität Basel.
Schwabe Verlag www.schwabe.ch



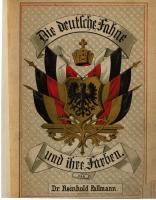



![Urkundliche Geschichte des Ursprungs der deutschen Hanse [2]](https://dokumen.pub/img/200x200/urkundliche-geschichte-des-ursprungs-der-deutschen-hanse-2.jpg)
![Urkundliche Geschichte des Ursprungs der deutschen Hanse [1]](https://dokumen.pub/img/200x200/urkundliche-geschichte-des-ursprungs-der-deutschen-hanse-1.jpg)

![An der Peripherie des nazifizierten deutschen Hochschulsystems. Zur Geschichte der Universität Basel 1933–1945 [1. ed.]
9783796545146, 9783796545405](https://dokumen.pub/img/200x200/an-der-peripherie-des-nazifizierten-deutschen-hochschulsystems-zur-geschichte-der-universitt-basel-19331945-1nbsped-9783796545146-9783796545405.jpg)