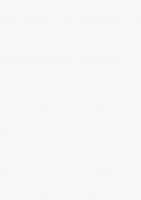Ambivalente Orte der Erinnerung an deutschen Hochschulen 3515115730, 9783515115735
Die Beiträge dieses Bandes gehen auf die Spezifika akademisch-universitärer Erinnerungsorte ein: Vor dem Hintergrund der
105 65 8MB
German Pages [318] Year 2016
Polecaj historie
Table of contents :
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
Joachim Bauer, Stefan Gerber, Jürgen John, Gottfried Meinhold – Ambivalente universitäre Erinnerungsorte
Klaus Dicke – Akademische Erinnerungskultur
ERINNERUNG IM RAUM
Rainer Nicolaysen – Ort universitären Erinnerns – das Hauptgebäude der
Universität Hamburg
Joachim Bauer – Das Universitätshauptgebäude in Jena
Gottfried Meinhold – Die Jenaer Universitätsaula als ambivalenter Raum
Jens Blecher – Die Geschichte der Leipziger Universitätskirche St. Pauli
und die Diskussionen um einen Wiederaufbau
Stefan Gerber – Landmarken im Erinnerungsraum.
Jenaer akademisch-universitäre Gedenktafeln im Vergleich
ERINNERUNG, SPRACHE UND PERSON
Jürgen John – „Nutzlose Symbolpolitik?“
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namens debatten in Deutschland.
Eine typologische Übersicht mit Fallbeispielen
Heinz Elmar Tenorth – Humboldt-Mythen und Universitätsgeschichten.
Die Historiographie der „Universität zu Berlin“
und die Identitätskonstruktion der deutschen Universität
Wolfgang Müller – Universitäre Erinnerungs- und Festkultur am Beispiel
einer besonderen Nachkriegsgründung – Die Universität des Saarlandes
Rainer Möhler – Zweierlei Erinnerung an einem „Historischen Ort“ –
das bedrückende Erbe der „Reichsuniversität Straßburg“
und die „Université de Strasbourg“ 1945 bis heute
Ulrich Knefelkamp – Die alte Frankfurter Universität und
die Europa-Universität – Erinnerung als ein Versuch zur Identitätsbildung
Eva-Marie Felschow – Der Umgang mit NS-De-Promotionen.
Das Beispiel Gießen
AUTORENVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
PERSONENREGISTER
Citation preview
Ambivalente Orte der Erinnerung an deutschen Hochschulen Herausgegeben von Joachim Bauer, Stefan Gerber, Jürgen John und Gottfried Meinhold Geschichte Franz Steiner Verlag
Quellen und Beiträge zur Geschichte der Universität Jena - 13
Joachim Bauer / Stefan Gerber / Jürgen John / Gottfried Meinhold (Hg.) Ambivalente Orte der Erinnerung an deutschen Hochschulen
quellen und beiträge zur geschichte der universität jena Herausgegeben von Joachim Bauer, Stefan Gerber, Jürgen John und Helmut G. Walther band 13
Ambivalente Orte der Erinnerung an deutschen Hochschulen Herausgegeben von Joachim Bauer, Stefan Gerber, Jürgen John und Gottfried Meinhold Redaktion: Christian Faludi
Franz Steiner Verlag
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Fritz Thyssen Stiftung Umschlagabbildung: Senat der Universität Jena 1912 (Universitätsarchiv Jena)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar. Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. © Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016 Druck: Offsetdruck Bokor, Bad Tölz Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier. Printed in Germany. ISBN 978-3-515-11573-5 (Print) ISBN 978-3-515-11577-3 (E-Book)
I N H A LTSVER Z EICH N IS vorwort
7
Joachim Bauer, Stefan Gerber, Jürgen John, Gottfried Meinhold – Ambivalente universitäre Erinnerungsorte
11
Klaus Dicke – Akademische Erinnerungskultur
21
er innerung im raum Rainer Nicolaysen – Ort universitären Erinnerns – das Hauptgebäude der Universität Hamburg
35
Joachim Bauer – Das Universitätshauptgebäude in Jena
51
Gottfried Meinhold – Die Jenaer Universitätsaula als ambivalenter Raum
71
Jens Blecher – Die Geschichte der Leipziger Universitätskirche St. Pauli und die Diskussionen um einen Wiederaufbau
89
Stefan Gerber – Landmarken im Erinnerungsraum. Jenaer akademisch-universitäre Gedenktafeln im Vergleich
111
er innerung, sprache und person Jürgen John – „Nutzlose Symbolpolitik?“ Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland. Eine typologische Übersicht mit Fallbeispielen
139
Heinz Elmar Tenorth – Humboldt-Mythen und Universitätsgeschichten. Die Historiographie der „Universität zu Berlin“ und die Identitätskonstruktion der deutschen Universität
195
Wolfgang Müller – Universitäre Erinnerungs- und Festkultur am Beispiel einer besonderen Nachkriegsgründung – Die Universität des Saarlandes
231
Rainer Möhler – Zweierlei Erinnerung an einem „Historischen Ort“ – das bedrückende Erbe der „Reichsuniversität Straßburg“ und die „Université de Strasbourg“ 1945 bis heute
255
6
Inhaltsverzeichnis
Ulrich Knefelkamp – Die alte Frankfurter Universität und die Europa-Universität – Erinnerung als ein Versuch zur Identitätsbildung
281
Eva-Marie Felschow – Der Umgang mit NS-De-Promotionen. Das Beispiel Gießen
293
autorenverzeichnis abkürzungsverzeichnis personenregister
305 306 308
VORWORT Die Beiträge des vorliegenden Sammelbandes gehen in ihrer Mehrzahl auf die Referate eines Workshops zurück, der von den Herausgebern vom 26. bis zum 28. März 2014 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena veranstaltet wurde. Sie werden ergänzt durch Texte, die in anderem Zusammenhang entstanden sind, aber zentral zum Themen- und Diskussionsfeld der Tagung und des Tagungsbandes gehören: Den Aufsatz von Rainer Möhler zum erinnerungskulturellen und geschichtspolitischen Umgang mit dem Erbe der deutschen Reichsuniversität Straßburg und der evakuierten französischen Université de Strasbourg nach dem Zweiten Weltkrieg, sowie den zu Beginn des Tagungsbandes abgedruckten Beitrag von Klaus Dicke zu akademischen Erinnerungskulturen, der nicht zuletzt aus der Praxis des langjährigen Jenaer Universitätsrektors und Hochschulpolitikers gespeist wird. Ausgangspunkt des Workshops, der 2014 Historiker, Universitätsarchivare und Germanisten zusammenführte, waren Diskussionen um geplante Erinnerungstafeln in der Jenaer Universitätsaula. Diesen Konflikt – dem sich der Beitrag von Gottfried Meinhold ausführlich aus der Perspektive des Akteurs und des reflektierenden Wissenschaftlers gleichermaßen zuwendet – in seinen historiographischen wie geschichtspolitischen Kontext zu stellen und das mit theoretischen und methodischen Überlegungen zu „ambivalenten universitären Erinnerungsorten“ zu verbinden, war das Anliegen eines Konzeptpapiers, das die Veranstalter und Herausgeber des vorliegenden Sammelbandes im Vorfeld der Tagung erstellt haben. Es wurde den Referenten bzw. den Beiträgern vor der Tagung zur Verfügung gestellt, um gemeinsame Fragehorizonte thematisch unterschiedlich ausgerichteter Beiträge zu ermöglichen und die Diskussion während der Tagung konzentriert und produktiv zu gestalten. Die in diesem Papier formulierten Perspektiven und Prämissen haben sich als so grundlegend für die Betrachtung des Feldes ambivalenter universitärer Erinnerungsorte erwiesen, dass die Herausgeber beschlossen haben, es diesem Band anstelle einer thematischen Einleitung voranzustellen, die das hier bereits Ausgesagte nur variiert hätte. Die Beiträge und die lebhaften Debatten der Tagung haben sich durchweg auf dieses Exposé bezogen, das deshalb hier in der Fassung von 2014 veröffentlicht wird – ohne es inhaltlich auszubauen und um unterdes erschienene Titel zu ergänzen. Diese sind in den einzelnen Beiträgen ausgewiesen Wer nach den Grundfragen und dem verbindenden Ansatz dieses Bandes fragt, sollte also zunächst dieses einführende Exposé zur Kenntnis nehmen. Komprimiert und thesenhaft werden hier vor dem Hintergrund der neueren Gedächtnis- und Erinnerungsforschung das zugrundeliegende Verständnis der verwendeten Signalbegriffe „Erinnerungsorte“ und „Ambivalenz“ erläutert, die Spezifika akademisch-universitärer Erinnerungsorte benannt und die Ziele der Tagung formuliert, die auch die Orientierungen des vorliegenden Tagungsbandes umschreiben. Zwei große Problembereiche strukturieren den Band. „Erinnerung im Raum“ wendet sich der räumlichen Dimension des Erinnerns zu, die mit einer im zurückliegenden Jahrzehnt erneuerten geschichtswissenschaftlichen Aufmerksamkeit für die – vieldeutige und historisch belastete – „Raum“-Kategorie, dem „spatial turn“, auch in der Geschichte von Erinnerungskulturen und Geschichtspolitik stärker als bisher in den Fokus gerückt ist. So versammelt dieser erste Abschnitt zunächst Beiträge, die „Orte“ in der grundlegenden erinnerungsgeschichtlichen Dichotomie von Topographie
8
Vorwort
und sinndeutender Konstruktion sind: Rainer Nicolaysen wendet sich dem 1911 eingeweihten Hauptgebäude der (erst 1919) begründeten Universität Hamburg zu, Joachim Bauer stellt dem das neue Universitätshauptgebäude in Jena gegenüber, das 1908 seiner Bestimmung übergeben wurde – Gebäude mit, wie Nicolaysen schreibt, „hohem Symbolwert“, die begehbarer Ort und Raum sind aber zugleich auch erinnerungskulturelle Topoi und Erinnerungsräume darstellen. Gottfried Meinhold vertieft diesen Blick für Jena mit seinem bereits erwähnten Beitrag zur Jenaer Universitätsaula, der mit den Vorschlägen für Gedenktafeln in diesem Raum vor allem die sprachliche Gestalt des akademischen Erinnerns diskutiert. Jens Blecher wendet sich in historischer Perspektive und mit aktuellen Fragen nach Hochschulmarketing und -entwicklung der langwierigen und heftigen Diskussion um den Wiederaufbau der 1968 gesprengten Universitätskirche St. Pauli in Leipzig zu, einem prominenten und vielschichtig codierten „Erinnerungsort“ der Leipziger Universität. Stefan Gerber nimmt stärker auf die Raum-Kategorie als erinnerungsgeschichtliches Konzept Bezug und stellt das Ensemble der ab 1858 angebrachten akademisch-universitären Gedenktafeln in Jena, im Vergleich vor allem mit Göttingen und Marburg, als besonderen Erinnerungsraum, als „Gedächtnislandschaft“ kleinerer und mittlerer Traditionsuniversitätsstädte vor. Der zweite Abschnitt ist mit „Erinnerung, Sprache und Person“ überschrieben und umfasst Beiträge, die aus verschiedenen Zugangsrichtungen das Problem universitärer Identitätskonstruktionen und Geschichtspolitiken umkreisen. Dass solche Identitätskonstrukte sprachlich, rhetorisch wie onomastisch produzierte und repräsentierte Phänomene sind, machen vor allem die beiden ersten Beiträge dieses Abschnittes von Jürgen John und Heinz-Elmar Tenorth plastisch: John beschäftigt sich in einem zeitlich und räumlich weit greifenden Beitrag mit den Namensgebungen und -debatten deutscher Universitäten im 20. Jahrhundert und macht so auf einen bislang wenig erschlossenen Forschungszugang aufmerksam. Tenorth thematisiert die Historiographie der Berliner Universität von 1810 als paradigmatischen – weil mit dem Humboldt-Mythos auch über den topografischen Ort hinaus traditionsbildenden – Fall von Identitätskonstruktionen deutscher Universitäten. Die Studien von Wolfgang Müller und Ulrich Knefelkamp nehmen die ganze Breite der kommunikativen, inszenatorischen und medialen Formen in den Blick, mit denen Universitäten prekäre Identitäten zu schaffen und zu vermitteln versuchen: Müller untersucht die 1948 eröffnete Universität des Saarlandes in ihrer Spannung zwischen französischer Gründung, deutscher Universitätstradition und europäischem Anspruch; Knefelkamp analysiert die Neugründung der „Europa-Universität“ Viadrina in Frankfurt an der Oder und ihre ambivalenten Versuche, eine angestrebte europäische Brückenfunktion an der deutsch-polnischen Grenze mit dem Traditionsanspruch der deutschen Universität zu verbinden, der sich in Frankfurt/Oder nur auf die 1811 aufgelöste bzw. nach Breslau verlegte Universität von 1506 beziehen kann. Rainer Möhler und Eva-Marie Felschow nähern sich dem erinnerungskulturellen Umgang mit der Universität im Nationalsozialismus auf unterschiedlichen Wegen: Möhler, wie bereits angedeutet, mit einem vergleichenden Blick auf französische und deutsche Verdrängungen und Opfererzählungen der Straßburger Universitäten; Felschow mit einer aufschlussreichen Darstellung des Umgangs der Universität Gießen
9
Vorwort
mit den Depromotionen in der NS-Zeit, der 2008 mit der Einweihung einer Gedenktafel einen – durchaus modellbildenden – Abschluss gefunden hat. Der mit dem konzeptionellen Eingangsexposé korrespondierende Beitrag von Klaus Dicke fragt – ausgehend vom Typus der „Traditionsuniversität“ – vor allem nach aktuellen Entwicklungen und Zukunftsperspektiven universitärer Geschichtspolitik und Geschichtsschreibung und stellt dabei das Fallbeispiel Jena in den Mittelpunkt. Das ist vor allem deshalb bedeutsam, weil Tagung und Sammelband sich ausdrücklich nicht nur als Foren detaillierter retrospektiver Analysen und entsprechender Kritik affirmativer Narrative und Identitätskonstrukte verstehen, sondern – so formuliert es das Konzeptpapier – auch „nach der ‚positiven Erinnerung‘“ fragen wollen: „Nicht im Sinne neuer ‚Meistererzählungen‘, sondern im Sinne historisch und aktuell verantwortbarer Strategien universitären Erinnerns und Gedenkens.“ Der Tagungsband ist so zugleich eine Aufforderung an die Historiker und Archivare von Universitäten und Hochschulen, ihre Kompetenz in den öffentlichen Debatten um universitäre Erinnerungskultur und Geschichtspolitik mit Nachdruck in die Waagschale zu werfen: Informationen und Sachargumente liefernd, wo die Diskussionen in Emotionen, Vorurteilen oder Halbwissen zu versinken drohen; insistierend, wo „verdrängte Fragen“ aus falsch verstandener korporativer Solidarität oder kommunikativen Ängsten heraus nicht gestellt werden sollen; aber auch begrenzend und widerstehend, wo der Furor einer sich als „Aufarbeitung“ gerierenden Geschichtspolitik spürbar wird, der von der ahistorischen Utopie ambivalenzfreier Erinnerungsorte und historischer Räume angetrieben wird, sich Differenzierungen verweigert und letztlich nichts als eine „Entsorgung“ von Vergangenheiten anstrebt. Universitätsgeschichte – und dies machen die Beiträge des vorliegenden Bandes eindrücklich deutlich – ist in dieser Sichtweise keine aus der institutionellen Dynamik der universitären Körperschaft resultierte Selbstbespieglung, sondern integraler Bestandteil des an der Universität betriebenen Forschens in allen Disziplinen selbst: Indem es immer wieder – und für mache Fachkulturen wohl auch unbequem – auf die sozialen, politischen und kulturellen „Fabrikationsumstände“ wissenschaftlicher Erkenntnisse, auf die Volatilität und Ambivalenz universitärer Erinnerungen und Identitäten verweist, hilft es, jene Reflexivität zu schaffen und zu erhalten, ohne die es keine Wissenschaft gibt. Die Beiträge des vorliegenden Bandes weisen zum Teil eine unterschiedliche Gestaltung auf. Insbesondere bieten einige umfängliche Quellenanhänge oder beziehen Bildmaterial breit in die Argumentation ein, während andere darauf verzichten. Hier wurde bewusst keine Vereinheitlichung vorgenommen, spiegeln sich darin doch sowohl verschiedenartige methodische Herangehensweisen als auch die Entstehungsgeschichte des Bandes. Abschließend soll an erster Stelle der Fritz Thyssen-Stiftung für Wissenschaftsförderung gedankt werden, die sowohl die Durchführung der Tagung als auch die Drucklegung dieses Bandes durch großzügige Förderung ermöglicht hat. Auch der Universitätsleitung der Friedrich-Schiller-Universität Jena sei für ihre finanzielle Unterstützung gedankt. Ein ebenso herzlicher Dank gilt Herrn Christian Faludi für die Redaktionsarbeiten, Patrick Martin für den Satz und schließlich dem Franz Steiner Verlag, der auch diesen Band der „Quellen und Beiträge zur Geschichte der Universität Jena“ in bewährter Weise betreut hat. Jena, Juni 2016
Die Herausgeber
A M BI VA L E N T E U N I V ERSI TÄ R E ER I N N ERU NGSORT E Joachim Bauer, Stefan Gerber, Jürgen John, Gottfried Meinhold I. „Erinnerung“ – heißt es – sei ein Brückenschlag aus der Gegenwart in die Vergangenheit. Erinnerungsvorgänge sagen meist mehr über die sich Erinnernden aus als über das Erinnerte. Sie offenbaren die Selbstbilder, Wahrnehmungs-, Denk- und Deutungsmuster der Beteiligten. Erinnerung ist für Einzelpersonen wie für Gesellschaften lebensnotwendig. So heilsam mitunter das Vergessen sein kann, so unabdingbar ist das Erinnern. Erinnern und Vergessen sind gleichsam zwei Seiten des selben Phänomens. Gemeinschaften brauchen kollektives Gedächtnis, mahnendes Erinnern und ehrendes Gedenken. Erinnerung lebt von dem Bedürfnis, sich mit der „Vergangenheit, die nicht vergehen will“ auseinanderzusetzen, sich mit ihr zu identifizieren oder sich von ihr zu distanzieren, ihr Sinn und Symbolgehalt zu unterlegen. Traditionen werden erfunden, gepflegt, von Generation zu Generation weitergegeben, um das korporative Selbstbild zu stärken und sich eine historisch geprägte „kollektive Identität“ zuzuschreiben. „Erinnerte Geschichte“ ist „gedeutete Geschichte“. Geschichte wird durch Erinnerung lebendig gehalten, für aktuelle Zwecke inszeniert, symbolisiert, oft mystifiziert oder für die „kritische Aufklärung“ genutzt. Die politische Kultur und die Öffentlichkeit aufgeklärter Demokratien brauchen die kritische Erinnerung. Erinnerungsvorgänge finden privat, oder öffentlich statt, unbewusst oder wohl überlegt. Letzteres vor allem dann, wenn gezielt Geschichtspolitik im öffentlichen Raum betrieben und Geschichte für den „Kampf um die Deutungshoheit“ instrumentalisiert wird. II. Erinnerungsvorgänge haben ihre eigene Geschichte. Was einst aus einer bestimmten Gegenwart in eine damals zurückliegende Vergangenheit wies, ist seitdem selbst Geschichte geworden. Die „Geschichte der Erinnerung“ stellt einen eigenen – zunehmend prominenten – Forschungsgegenstand dar, den die Erinnerungs- und Gedächtnisforschung mit den Methoden historisch-kritischer Deutungs-, Diskurs- und Inszenierungsanalysen untersucht. Das hat zu einer ganzen Flut einschlägiger Publikationen und Theorieansätze geführt.1 Dieser im engeren Sinne geschichts-, im weiteren Sinne 1
Als Beispiele: Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München 2007; Aleida Assmann/Dietrich Harth (Hg.): Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung, Frankfurt a.M. 1991; Hanno Loewy, Bernhard Moltmann (Hg.): Erlebnis – Gedächtnis – Sinn. Authentische und konstruierte Erinnerung, Frankfurt, New York 1996; Winfried Speitkamp (Hg.): Denkmalssturz. Zur Konfliktgeschichte politischer Symbolik, Göttingen 1997; Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, München 2006; Ulrich Borsdorf, Heinrich Theodor Grütter (Hg.): Orte der Erinnerung. Denkmal, Gedenkstätte, Museum, Frankfurt, New York 1999; Harald Weinrich: Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens, München 2000; Harald Welzer
12
Joachim Bauer, Stefan Gerber, Jürgen John, Gottfried Meinhold
kulturwissenschaftliche Trend erfasst die europäische2 und nationale3 wie auch die regionale und lokale Ebene. Er ist bereits lexikalisch erschlossen worden,4 aber auch – nicht zuletzt wegen seiner normativen und inflationären Tendenzen – in die Kritik geraten.5 Über die „Gedächtniskonjunktur“6 wird ebenso heftig diskutiert wie über die „Zukunft der Erinnerung“.7 Doch gibt es weder ein „Ende der Geschichte“ noch der Erinnerung. Das kollektive Gedächtnis schwindet nicht; es bleibt und wächst. Die erinnerungskulturellen Prozesse und Probleme gewinnen an Dynamik und Dramatik. Vor allem dann, wenn sie sich auf markante, als Chiffre fest im kollektiven Gedächtnis verankerte Geschichtskonstellationen beziehen – namentlich auf das nun vergangene „kurze 20. Jahrhundert der Extreme“. Die mahnende Erinnerung an das terroristische, kriegsgerichtete und genozidale NS-System, an seine Taten, Täter und Opfer, an den Vernichtungskrieg und an den Völkermord an den europäischen Juden bildet einer Grundkonstante des kollektiven Gedächtnisses und der politischen Kultur der Bundesrepublik.8 Der 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkrieges – der „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ – wirft bereits jetzt seine Schatten voraus. Er wird weit über die damals beteiligten Nationen hinaus das kollektive Gedächtnis Europas beschäftigen – und damit der Europäischen Union, die ja gerade den Friedensnobelpreis erhalten hat. Zum „positiven Gedächtnis“ und dem Stolz auf die eigene Geschichte treten in einer so dimensionierten Erinnerungskultur das „negative Gedächtnis“9 und die Bereitschaft, sich auch unbequemen und sperrigen Vergangenheiten zu stellen.10
2 3 4 5
6 7 8 9 10
(Hg.): Das soziale Gedächtnis. Geschichte, Erinnerung, Tradierung, Hamburg 2001; Gerald Echterhoff, Martin Saur (Hg.): Kontexte und Kulturen des Erinnerns. Maurice Halbwachs und das Paradigma des kollektiven Gedächtnisses, Konstanz 2002; Heinrich August Winkler (Hg.): Griff nach der Deutungsmacht. Zur Geschichte der Geschichtspolitik in Deutschland, Göttingen 2004, Hinzuweisen ist auf den Gießener Sonderforschungsbereich „Erinnerungskulturen“ (1996–2008). Helmut König, Julia Schmidt, Manfred Sicking (Hg.): Europas Gedächtnis, Bielefeld 2008. Etienne Francois, Hagen Schulze (Hg.): Deutsche Erinnerungsorte, 3 Bände, München 2001; als deutsche Auswahl vom französischen Vorbild der „lieux de mémoire“ vgl. Pierre Nora (Hg.): Erinnerungsorte Frankreichs, München 2005. Nicolas Pethes, Jens Ruchatz (Hg.): Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Lexikon, Reinbek bei Hamburg 2001. Als Beispiele: Winfried Speitkamp: Alles, was man erinnern muß. Anmerkungen zu den „Deutschen Erinnerungsorten“, in: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 52 (2002), S. 225–242; Norbert Frei: Rezension zu Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, München 2006, in: Die Zeitliteratur (9/2006), S. 56. Pierre Nora: Gedächtniskonjunktur, in: Transit 22 (2001/02), S. 18–31. Zukunft der Erinnerung = Aus Politik und Zeitgeschichte (25–26/2010). Stellvertretend sei hier auf die grundlegenden Arbeiten von Aleida Assmann und Norbert Frei verwiesen. Reinhart Koselleck: Formen und Traditionen des negativen Gedächtnisses, in: Volkhard Knigge, Norbert Frei (Hg.): Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord, München 2002, S. 21–32. Klaus Ahlheim, Bardo Heger: Die unbequeme Vergangenheit. NS-Vergangenheit, Holocaust und die Schwierigkeiten des Erinnern, Schwalbau i. Ts. 2002; Jürgen John: „Regionales Gedächtnis“ und „negatives Erinnern“ oder: Wie geht man mit „sperrigen Vergangenheiten“ um?, in: Ulrike Kaiser, Justus H. Ulbricht (Hg.): Sperrige Vergangenheiten. Aspekte regionaler Erinnerungskultur im 20. Jahrhundert, Leuchtenburg bei Kahla 2009, S. 11–44.
Ambivalente universitäre Erinnerungsorte
13
III. Die Erinnerungs- und Gedächtnisforschung hat zahlreiche analytisch taugliche Begriffe in die Debatte gebracht, sei es – wie die Begriffe „kollektives“, „kommunikatives“ und „kulturelles Gedächtnis“ – auf einer Metaebene, sei es – wie den Begriff „Erinnerungsort“11 – auf einer eher pragmatischen, vielfältig anwendbaren Ebene. „Erinnerungsräume“, „Erinnerungsorte“ und „Erinnerungslandschaften“ sind, gerade wegen ihrer geistig-topographischen Doppeldeutigkeit – als Chiffren im kollektiven Gedächtnis und auf der geistigen Landkarte von Gruppen, Institutionen, Nationen und supranationalen Gebilden einerseits, als Stätten und Räume erinnerungskultureller Vorgänge andererseits – besonders beliebte Begriffe.12 In dieser Doppeldeutigkeit liegt die Gefahr des inflationär-beliebigen Gebrauchs wie die Chance, beide Aspekte begrifflich-analytisch zusammenzuführen. Erinnerungsorte und Erinnerungsstätten – Denkmäler, Gedenkstätten, Museen, Originalschauplätze erinnerungsrelevanter historischer Vorgänge – sind offen für unterschiedliche Zwecke, Deutungs- und Analyseansätze. Sie können affirmativen oder kritischen Charakter tragen; sie können als Weihestätten und Erinnerungstempel mystifizierter Geschichte fungieren oder der kritischen Aufklärung dienen. „Erinnerungsorte“ können missbraucht und im normativ-kanonbildenden Sinne instrumentalisiert, aber auch genutzt werden, um die innere Ambivalenz von Erinnerungsvorgängen zu erfassen. Der Begriff der „ambivalenten“, „ambiguen“, „binomischen“ oder „bipolaren Erinnerungsorte“ kommt dem besonders nahe. IV. Im Gefolge bewegter oder gewalttätiger Geschichtsverläufe kam es häufig zur räumlichen Koinzidenz höchst gegensätzlicher, das kollektive Gedächtnis entsprechend strukturierender Ereignisse. Rühmliches und Glanzvolles stand und steht so geistigtopographisch dicht neben Schändlichem und Grauenvollem. Oft sind symbolisch aufgeladene und inszenierte Stätten später wieder geschichtspolitisch instrumentalisiert und symbolisch umgedeutet worden. Der Proklamation des Deutschen Kaiserreiches 1871 im Spiegelsaal von Versailles als Triumph des deutschen Siegers und als Demütigung Frankreichs folgte 1919 an gleicher Stätte der Versailler Friedensvertrag als Demütigung Deutschlands und als Triumph Frankreichs. Eine ähnliche räumlich-symbolische Koinzidenz bot der Waggon im Wald von Compiègne mit den Waffenstillstandsabkommen von 1918 und 1940. Sinnbilder räumlich-geistiger Koinzidenz von Kultur und Barbarei sind die bipolaren Chiffren „Krakau-Auschwitz“ und „Weimar-Buchenwald“. Und zwar nicht nur wegen der räumlich noch einigermaßen distanzierten Kontraste, sondern auch wegen der nationalsozialistischen Barbarei an den Kulturstätten Krakau und Weimar selber. Die Erinnerung und symbolische Deutung solcher Vorgänge und Konstellationen verdichten ihre Kontrastwirkung. 11 12
Constanze Carcenac-Lecomte: Was ist ein deutscher Erinnerungsort?, in: Deutsche Erinnerungslandschaften Rudelsburg-Saaleck Kyffhäuser, Halle 2004, S. 35–49. Vgl. Aleida Assmann: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München 1999.
14
Joachim Bauer, Stefan Gerber, Jürgen John, Gottfried Meinhold
V. Ambivalenz und Kontraste prägen auch die universitäre Erinnerungskultur. Universitäten sind Symbolstätten der „universitas litterarum“ und Musterstätten der Traditionspflege. Das hängt auch mit ihrem Charakter als „Institutionen der Ungleichzeitigkeit“ zusammen, in denen bestimmte gesellschaftliche Praktiken oder Lebensformen als Residuen weiterbestehen, weil sie innerhalb des korporativen Rahmens der Universität oder Hochschule ihre funktionelle Logik bewahren. Vor allem gilt das für die „Traditionsuniversitäten“ mit ihren mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Wurzeln. Die mit der neuidealistischen „Idee der Universität“ und dem „Mythos Humboldt“ verbundene „deutsche Universität“ ist zu einem markanten „nationalen Erinnerungsort“ im skizzierten Doppelsinne geworden.13 Die korporative Erinnerungskultur der Universitäten wird überwiegend von den Professoren getragen. Die nur zeitweise an den Universitäten weilenden Studenten sind lediglich indirekt, als Festkulisse oder Mitakteure akademischer Rituale beteiligt. Oder sie haben eigene studentische – freie wie korporative, meist universitätsübergreifende – Erinnerungskulturen entwickelt. Im 19. Jahrhundert und zuvor waren sie dagegen oft erinnerungskulturelle Konkurrenten der Professoren. In der Regel dominiert in der universitären Erinnerungskultur das „positive Gedächtnis“. Die Geschichte universitärer Selbstbilder, Jubiläums- und Erinnerungskultur zeigt überwiegend affirmative Züge mit dem Bestreben, das akademische Selbstbewusstsein zu stärken, die „corporate identity“ zu festigen und für ein gutes öffentliches Image zu sorgen.14 Sperriges, Schmerzliches und Peinliches wird gern mit dem Ziel einer beschönigten und „bereinigten“ Hochglanzgeschichte ausgeblendet. „Eine Universität“ – so ein bissiges Urteil – „ist eine Institution, die beinahe alles unter 13
14
Mitchell G. Ash (Hg.): Mythos Humboldt. Vergangenheit und Zukunft der deutschen Universitäten, Wien, Köln, Weimar 1999; Sylvia Paletschek: Die Erfindung der Humboldt-Universität. Die Konstruktion der deutschen Universitätsidee in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in: Historische Anthropologie 10 (2002), S. 183–205; Ulrich Sieg: Humboldts Erbe. Eine Einleitung, in: ders., Dietrich Korsch (Hg.): Die Idee der Universität heute, München 2005, S. 9–24; Rüdiger vom Bruch: „Universität“ – ein „deutscher Erinnerungsort“? in: Jürgen John, Justus H. Ulbricht (Hg.): Jena. Ein nationaler Erinnerungsort? Köln, Weimar, Wien 2007, S. 93–99. Winfried Müller: Erinnern an die Gründung. Universitätsjubiläen, Universitätsgeschichte und die Entstehung der Jubiläumskultur in der frühen Neuzeit, in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 21 (1998), S. 79–102; ders. (Hg.): Das historische Jubiläum. Genese, Ordnungsleistung und Inszenierungsgeschichte eines institutionellen Mechanismus, Münster 2004; Paul Münch (Hg.): Jubiläum, Jubiläum… Zur Geschichte öffentlicher und privater Erinnerung, Essen 2005, S. 29–44; Thomas P. Becker: Jubiläen als Orte universitärer Selbstdarstellung. Entwicklungslinien des Universitätsjubiläums von der Reformationszeit bis zur Weimarer Republik, in: Rainer Christoph Schwinges (Hg.): Universität im öffentlichen Raum, Basel 2008, S. 77–107; für Jena: Joachim Bauer: Universitätsgeschichte und Mythos. Erinnerung, Selbstvergewisserung und Selbstverständnis Jenaer Akademiker 1548 – 1858, Stuttgart 2012; Dieter Langewiesche: Selbstbilder der deutschen Universität in Rektoratsreden. Jena – spätes 19. Jahrhundert bis 1948, in: John/Ulbricht: Jena, S. 219–243; Antje Halle: Vom Forum für Ersatzpolitik zur Werbeveranstaltung. Die Jenaer Universitätsjubiläen 1858 und 1908, ebd., S. 283–295; für Jubiläen unter diktatorischen Bedingungen: Stefan Gerber: Universitäre Jubiläumsinszenierungen im Diktaturvergleich, ebd., S. 299–322.
Ambivalente universitäre Erinnerungsorte
15
der Sonne systematisch erforscht – nur sich selbst nicht“; jedenfalls soweit es um die Schattenseiten ihrer Geschichte gehe.15 Die finden sich in allen Geschichtsepochen, vor allem aber im „20. Jahrhundert der Extreme“. Das betrifft in besonderem Maße die NS-Vergangenheit der Universitäten – im ostdeutschen Falle zudem ihre DDR-Vergangenheit. Es gilt aber auch für die Weimarer Zeit, in der die deutschen Universitäten alles andere als Horte der Demokratie darstellten. Das wird in universitären Selbstbildern gern ausgeblendet oder mit dem Deutungsmuster „Krise“ überdeckt, die das „akademische Deutschland“ in Distanz zur ersten deutschen Demokratie gebracht habe.16 Die universitären Mitwirkungs- und Selbstmobilisierungspotenziale der NS-Zeit sind nach 1945 mit dem Narrativ vom „Diktat der Politik über die Wissenschaft“ und mit den Mythen vom „rein gebliebenen Geist“ oder von den „im Kern gesunden“ Hochschulen verdeckt worden.17 Zwei Aspekte wären hier noch hinzuzufügen: Zum einen die Frage nach den „Täter“- und „Opfer“Perspektiven18 und wo die Universitäten in diesem Spannungsfeld zu verorten sind. Zum anderen die Frage nach dem Umgang mit traumatischen Erlebnissen, z. B. Kriegserfahrung und Totengedenken.19 VI. Der affirmative Grundzug universitärer Selbstbilder und Erinnerungskultur steht freilich in Widerspruch zum gesellschaftlichen Bedürfnis einer demokratischen, pluralen und sensiblen Öffentlichkeit nach umfassender Kenntnis, kritischer Aufklärung und erinnerungskultureller Transparenz. Selektives, allein auf „Angenehmes“ gerichtetes Erinnern bietet auf Dauer keine tragfähige Grundlage für ein „reines Gewissen“ und für ein wirklich fundiertes korporatives Gedächtnis. Als Kerninstitutionen der modernen Wissensgesellschaft und ihres Wissenschaftssystems stehen die 15 16
17
18 19
Wolfgang Nitsch, Uta Gerhardt, Claus Offe, Ulrich K. Preuß: Hochschule in der Demokratie, Berlin (West) 1965, S. 1 (als Zitat eines amerikanischen Autors). Moritz Föllmer, Rüdiger Graf (Hg.): Die „Krise“ der Weimarer Republik. Zur Kritik eines Deutungsmusters, Frankfurt a.M. 2005; Jürgen John: „Not deutscher Wissenschaft“? Hochschulwandel, Universitätsidee und akademischer Krisendiskurs in der Weimarer Republik, in: Michael Grüttner u.a. (Hg.): Gebrochene Wissenschaftskulturen. Universität und Politik im 20. Jahrhundert, Göttingen 2010, S. 107–140. Mitchell G. Ash: Wissenschaft und Politik als Ressourcen für einander, in: Rüdiger vom Bruch, Brigitte Kaderas (Hg.): Wissenschaften und Wissenschaftspolitik. Bestandsaufnahmen zu Formationen, Brüchen und Kontinuitäten im Deutschland des 20. Jahrhunderts, Wiesbaden 2002, S. 32–51; Axel Schildt: Im Kern gesund? Die deutschen Hochschulen 1945, in: Helmut König, Wolfgang Kuhlmann, Klaus Schwabe (Hg.): Vertuschte Vergangenheit. Der Fall Schwerte und die NS-Vergangenheit der deutschen Hochschulen, München 1997, S. 223–240; Jürgen John: Der Mythos vom „rein gebliebenen Geist“. Denkmuster und Strategien des intellektuellen Neubeginns 1945, in: Uwe Hoßfeld u. a. (Hg.): Hochschule im Sozialismus. Studien zur Geschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena (1945–1990), Köln, Weimar, Wien 2007, Bd. 1, S. 19–70. Vgl. William John Niven (ed.): Germans as victims. Remembering the Past in Contemporary Germany, New York u. a. 2006. Marcus Müggenburg: Gefallenengedenken an den mitteldeutschen Universitäten Halle, Jena und Leipzig. Eine vergleichende Studie zu Tradition, Wandel und Umbruch des akademischen Kriegstotengedenkens zwischen 1871 und 1945 (Exposé 2012).
16
Joachim Bauer, Stefan Gerber, Jürgen John, Gottfried Meinhold
Universitäten besonders in der Pflicht, den Ballast affirmativ-selektiver Erinnerung zu überwinden und neue erinnerungskulturelle Wege einzuschlagen. Das ist auch ein wissenschaftskulturelles Problem. Geisteswissenschaften sind eher bereit, sich den erinnerungskulturellen Herausforderungen zu stellen, als Naturwissenschaftler, Techniker und Mediziner. Seit geraumer Zeit zeichnet sich ein Gegentrend nach dem Motto ab – salopp formuliert: „Besser endlich reinen Tisch machen als die Dinge länger unter den Teppich zu kehren“. Bei den Universitäten, die in den letzten Jahren ihre Gründungsjubiläen feierten und aus diesem Anlass neue, empirisch erweiterte Universitätsgeschichten veröffentlichten,20 hat sich das bereits deutlich gezeigt. Die Frage bleibt freilich offen, ob und wann sich das vom „kommunikativen“ ins „kulturelle Gedächtnis“ überträgt. So unterschiedlich die neuen universitätsgeschichtlichen Darstellungen im Einzelnen sein mögen – die Bereitschaft, sich auch den Schattenseiten der eigenen Geschichte zu stellen und die hemmenden Narrative zu überwinden, ist erkennbar gewachsen. Aus den dargelegten Gründen bezieht sich das vor allem auf das kontrastreiche 20. Jahrhundert und, abgeschwächt, auch auf das „lange“ 19. Jahrhundert. Gegen die erinnerungskulturelle Wucht dieses Jahrhunderts und vor allem der NS-Zeit verblasst das allzu wohlfeile Argument, was denn solch kurze Zeiträume gegen die jahrhundertelange glanzvolle Geschichte deutscher Universitäten zählten, auf die man sich doch hauptsächlich konzentrieren solle.
20 Dirk Alvermann, Karl-Heinz Spieß (Hg.): Universität und Gesellschaft. Festschrift zur 550-Jahrfeier der Universität Greifswald, Bd. 1: Die Geschichte der Fakultäten im 19. und 20. Jahrhundert; Bd. 2: Stadt – Region – Staat, Rostock 2006; Traditionen – Brüche – Wandlungen. Die Universität Jena 1850–1995, hg. von der Senatskommission zur Aufarbeitung der Jenaer Universitätsgeschichte im 20. Jahrhundert, Köln, Weimar, Wien 2009; Rüdiger vom Bruch, Heinz-Elmar Tenorth (Hg.): Geschichte der Universität Unter den Linden 1810–2010. Biographie einer Institution, Bd. 1: 1810–1918, Berlin 2012; Heinz-Elmar Tenorth, Michael Grüttner (Hg.): Geschichte der Universität Unter den Linden 1810–2010. Biographie einer Institution, Bd. 2: Die Berliner Universität zwischen den Weltkriegen 1918–1945, Berlin 2012; Konrad H. Jarausch, Matthias Middell, Annette Vogt (Hg.): Geschichte der Universität Unter den Linden 1810–2010. Biographie einer Institution, Bd. 3: Sozialistisches Experiment und Erneuerung in der Demokratie – die Humboldt-Universität zu Berlin 1945–2010, Berlin 2012; Heinz-Elmar Tenorth (Hg.): Geschichte der Universität Unter den Linden 1810–2010. Praxis ihrer Disziplinen. Bd. 4: Genese der Disziplinen. Die Konstitution der Universität, Berlin 2010; Heinz-Elmar Tenorth (Hg.): Geschichte der Universität Unter den Linden 1810–2010. Praxis ihrer Disziplinen. Bd. 5: Transformation der Wissensordnung, Berlin 2010; Heinz-Elmar Tenorth (Hg.): Geschichte der Universität Unter den Linden 1810–2010. Praxis ihrer Disziplinen. Bd. 6: Selbstbehauptung einer Vision, Berlin 2010; Franz Häuser (Hg.): Geschichte der Universität Leipzig 1409–2009, Bd. 1: Spätes Mittelalter und frühe Neuzeit 1409–1830/31, Leipzig 2011; Franz Häuser (Hg.): Geschichte der Universität Leipzig 1409–2009, Bd. 2: Das 19. Jahrhundert 1830/31–1909, Leipzig 2011; Franz Häuser (Hg.): Geschichte der Universität Leipzig 1409–2009, Bd. 3: Das 20. Jahrhundert 1909–2009, Leipzig 2011; Franz Häuser, Ulrich von Hehl, Uwe John, Manfred Rudersdorf (Hg.): Geschichte der Universität Leipzig 1409–2009, Bd. 4: Fakultäten, Institute und Zentrale Einrichtungen, Leipzig 2011; Franz Häuser, Michaela Marek, Thomas Topfstedt (Hg.): Geschichte der Universität Leipzig 1409–2009, Bd. 5: Geschichte der Leipziger Universitätsbauten im urbanen Kontext, Leipzig 2011.
Ambivalente universitäre Erinnerungsorte
17
VII. Alle Universitäten verfügen über entsprechend paradigmatische „Erinnerungsfälle“, Erinnerungsstätten und – im weitesten Sinne – Erinnerungsorte. Alle Universitäten haben in dieser oder jener Weise die damit verbundenen Problemlagen zu spüren bekommen. Und sie haben dabei ihre – positiven wie negativen – Erfahrungen gesammelt, die es ratsam erscheinen lassen, sie zum Gegenstand eines vergleichend angelegten Workshops zu Problemen universitärer Erinnerungskultur zu machen. Dabei können auch die mit der kritischen Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit21 gemachten Erfahrungen vergleichend genutzt und geprüft werden; ebenso die Erfahrungen im Umgang mit widersprüchlichen Persönlichkeiten von Rang. In Jena haben in den letzten Jahren mehrere öffentliche Debatten gezeigt, wie eng gerade im Wirken markanter Wissenschaftler wie dem Pädiater Jussuf Ibrahim (1999/2000) und dem Pädagogen Peter Petersen (2009/10) Licht und Schatten beieinander lagen und wie schwierig es ist, einen angemessenen erinnerungskulturellen Umgang damit zu finden.22 Mit den Ibrahim- und Petersen-Debatten hat sich das Problem keineswegs erledigt. Im Gegenteil. Es sind mehr Fragen offen geblieben als gelöst worden. Und es sind zahlreiche weitere Fälle erinnerungskulturell zu klären, wie schon ein Blick auf die Internet-Ehrenliste Jenaer Wissenschaftler zeigt. Der prominente Physiker Abraham Esau ist dafür nur ein Beispiel. Öffentliche Debatten können sehr heilsam sein. Der heftige Streit um die Jenaer Rektorenbildnisse (1997/98) hat bei dem Entschluss Pate gestanden, eine Senatskommission zur Aufarbeitung der Jenaer Universitätsgeschichte des 20. Jahrhunderts zu bilden und ein umfassendes Forschungsprogramm zu initiieren. Die Diskussionen und Publikationen zur Vergabe der Universitätsnamen „Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald“, „Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg“ und „Friedrich-Schiller-Universität Jena“ 1933/3423 haben sensibilisierend gewirkt. Die bereits erwähnte geplante Studie 21
Vergangenheitsklärung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Beiträge zur Tagung „Unrecht und Aufarbeitung“ am 19. und 20.6.1991, bearb. v. Hans Richard Böttcher, Leipzig 1994; Tobias Kaiser, Heinz Mestrup (Hg.): Politische Verfolgung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena von 1945 bis 1989, Berlin 2012; Studentischer Widerstand an der Universität Leipzig 1945–1955, 2Beucha 1998; Jens Blecher, Gerald Wiemers (Hg.), Studentischer Widerstand an den mitteldeutschen Universitäten 1945 bis 1955. Von der Universität in den GULAG. Studentenschicksale in sowjetischen Straflagern 1945 bis 1955, 3. überarb. u. erw. Aufl., Leipzig 2006; Sybille Gerstengabe, Horst Henning (Hg.), Opposition, Widerstand, Verfolgung an der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg 1945–1961. Eine Dokumentation, Leipzig 2010. 22 Marco Schrul, Jens Thomas: Kollektiver Gedächtnisverlust: Die Ibrahim-Debatte 1999/2000, in: Uwe Hoßfeld, Jürgen John, Oliver Lemuth, Rüdiger Stutz (Hg.): „Kämpferische Wissenschaft“. Studien zur Universität Jena im Nationalsozialismus, Köln, Weimar, Wien 2003, S. 1065–1098; Peter Fauser, Jürgen John, Rüdiger Stutz (Hg.): Peter Petersen und die Jenaplan-Pädagogik. Historische und aktuelle Perspektiven, Stuttgart 2012. 23 Dirk Alvermann: Zwischen Pranger und Breitem Stein. Die Namensgebung der Universität Greifswald und die aktuelle Diskussion, in: Hefte der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft e.V. 8 (2003), S. 23–39; Jürgen John: „Lutherjahr“ und „nationale Erhebung“. Die Namensgebung „Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg“ 1933 und ihre Kontexte, in: Hallische Beiträge zur Zeitgeschichte 19 (1/2010), S. 87–118; ders.: Namenswechsel – Wendezeiten? Die Jenaer Universitätsnamen 1921/1934 und ihre Kontexte, in: Helmut G. Walther (Hg.): Wendepunkte in
18
Joachim Bauer, Stefan Gerber, Jürgen John, Gottfried Meinhold
zum Kriegstotengedenken 1871 bis 1945 an den Universitäten Halle, Jena und Leipzig wird weitere Aufschlüsse erbringen. Doch klafft immer noch eine Schere zwischen dem durch neue Forschungen und Publikationen erheblich gewachsenen Forschungs- und Kenntnisstand einer- und entsprechender öffentlicher Präsentation andererseits.24 VIII. Einen besonders aufschlussreichen Erinnerungsfall bietet die Jenaer Universitätsaula mit zwei Antrittsvorlesungen, die auf Problemlagen der Weimarer Zeit und zugleich zeichenhaft in die Zeit der NS-Herrschaft verwiesen – und die somit beispielhaft für die räumlich-zeitliche Koinzidenz erinnerungskultureller Kontraste stehen. Am 28. Juni 1924 hielt hier der jüdische Mediziner Emil Klein, der 1923 vom damaligen sozialdemokratischen Thüringer Volksbildungsminister Max Greil gegen unterschiedlich motivierte universitäre Widerstände zum Professor für Naturheillehre berufen worden war, seine Antrittsvorlesung; 1933 wurde er als Jude aus der Universität vertrieben und 1943 nach Theresienstadt deportiert. An gleicher Stätte hielt am 15. November 1930 der vom Thüringer NS-Volksbildungsminister Wilhelm Frick gegen den Widerstand der universitären Gremien zum Professor für Sozialanthropologie berufene Rasse-Schriftsteller Hans F. K. Günther im Beisein Hitlers und Görings seine Antrittsvorlesung. Dieser Vorgang war Bestandteil eines ganzen Bündels von Maßnahmen, mit denen die Nationalsozialisten in Koalition mit rechtskonservativen Parteien 1930/31 die „legale Machtergreifung“ auf regionaler Probebühne testeten und damit reichsweites Aufsehen erregten. Wie zuvor schon in Leipzig wurde so das Fach „Rassenkunde“ universitär etabliert. Der Kontrastfall bietet beste Möglichkeiten kritischer Erinnerung und die Chance, die Aula im Universitätshauptgebäude als Gedächtnisort zu nutzen.25 Eine entsprechende Initiative (Gottfried Meinhold) hat freilich nicht nur Beifall ausgelöst, sondern auch den heftigen Widerspruch derjenigen, die meinen, eine Universitätsaula sei ein akademischer Weiheort mit besonderer Aura und dürfe deshalb nicht erinnerungskulturell befrachtet und belastet werden. Das Ergebnis dieser Diskussion ist noch offen, obwohl 2012 eine Gedenktafel für Emil Klein an einem anderen Universitätsgebäude angebracht worden ist.
viereinhalb Jahrhunderten Jenaer Universitätsgeschichte, Jena 2010, S. 87–138; Margit Hartleb: Die Namensgebung „Friedrich-Schiller-Universität“ 1934, in: Joachim Bauer, Klaus Dicke, Stefan Matuschek (Hg.): Patron Schiller. Friedrich Schiller und die Universität Jena, Jena 2009, S. 63–76. 24 Vgl. z.B. Rüdiger Hachtmann: Für die Jahre des „Dritten Reichs“ vorbildlich ausgeleuchtet: Neuerscheinungen zur Geschichte der Universität Jena, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 14 (2011), S. 245–251; kritisch dagegen: Daniel Hechler, Pierre Pasternack: Best Practise und Worst Case? Der Umgang mit der Hochschulzeitgeschichte an der Universität Jena und der Humboldt-Universität: ein exemplarischer Vergleich, in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 34 (2011), S. 329–345. 25 Vgl. auch Rainer Nicolaysen (Hg.): Das Hauptgebäude der Universität Hamburg als Gedächtnisort. Mit sieben Portraits in der NS-Zeit vertriebener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Hamburg 2011.
Ambivalente universitäre Erinnerungsorte
19
IX. Ein von interessierten Universitäten und Universitätsarchiven ausgerichteter, möglichst interdisziplinär angelegter Workshop böte gute Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und zur vergleichenden Debatte über die Chancen, Möglichkeiten, Probleme, Fallen und Gefahren ambivalenter universitärer Erinnerungsorte. Die rezeptive Wirkung bipolarer „Erinnerungsorte“ und die nötige Zusammenschau der Widersprüche und oft extremen Kontraste können das kritische erinnerungskulturelle Bewusstsein öffnen, erweitern und schärfen. Sie können so eine wissensfundierte Möglichkeit kritischen Reflektierens schaffen, die nötige erinnerungskulturelle Empathie stimulieren und eine rezeptive Kompetenz erzeugen, die für den kritischen Zeitgenossen und seine Souveränität unverzichtbar ist. Auf diese Weise könnte ein Zuwachs an Differenzierungsfähigkeit des Urteilsvermögens und des geduldigen Abwägens erreicht werden – und damit auch ein Zuwachs an geistig-kreativer Dynamik. Dabei müssen auch die vielfältigen „Modalitäten der Erinnerung“ mit all ihren praktischen Konsequenzen berücksichtigt werden. Eine solche Debatte sollte möglichst aus der Perspektive verschiedener Fachdisziplinen – Geschichte, Philosophie, Psychologie, Soziologie, Kunst- und Literaturwissenschaft wie auch anderer Fachdisziplinen der „universitas litterarum“ – erfolgen. Dabei sollte der Blick auf die Elemente universitärer Traditionsbildung und Erinnerungskultur seit der Frühen Neuzeit und dem 19. Jahrhundert sowie auf ihre Umformung und Neucodierung bzw. Revision oder Zurückweisung im 20./21. Jahrhundert mit einer kritischen Reflexion lokal-hochschulbezogener, vor allem aber auch disziplinspezifischer Erinnerungskulturen und -orte bis in die Gegenwart zusammengeführt werden. Die wissenschaftliche Grundlegung und Diskussion kritischdiskursiver Kompetenz im Umgang mit universitären „Erinnerungsorten“, wie sie der Workshop anstrebt, „dekonstruiert“ so nicht nur, sondern stellt auch die Frage nach der „positiven Erinnerung“ – nicht im Sinne neuer „Meistererzählungen“, sondern im Sinne historisch und aktuell verantwortbarer Strategien universitären Erinnerns und Gedenkens.
A K A DE M ISCH E ER I N N ERU NGSK U LT U R 1 Klaus Dicke „Akademiker wie Akademien haben die liebenswürdige Eigenschaft, sich selber historisch zu nehmen“ – so begann der damalige Bundespräsident Theodor Heuss im Jahr 1951 seine Festansprache zum 200. Jubiläum der Göttinger Akademie.2 Wer wollte angesichts voluminöser, oft mehrbändiger Jubiläumsschriften bezweifeln, dass dies auch für Universitäten gilt und auch heute noch so ist, ja sogar auf der Welle einer medial vermittelten allgemeinen Erinnerungskultur immense Ausweitungen erfahren hat: Kaum ein memorabiles Datum wird ausgelassen, ohne durch Ausstellungen, wissenschafts- oder institutionengeschichtliche Darstellungen oder mindestens einen Festakt mit historischem Festvortrag gewürdigt zu werden. Und ich gestehe gerne, dies als Rektor an der eigenen Universität gefördert zu haben, wenn auch gelegentlich mit der mir eigenen rheinischen Ironie begleitet, etwa in dem vom Erinnerungsstress durch Selbstironie entlastenden Spruch „Ich gedenke, also bin ich“ oder meinem leider ungehört verhallten Vorschlag, den seit 20 Jahren unveränderten Eingangsstempel für die Rektoratspost zu seinem runden Geburtstag mit einer Festschrift zu ehren. Was ist – so will ich im Folgenden fragen – aus der „liebenswürdigen Eigenschaft“ von Universitäten, sich selber historisch zu nehmen, geworden? Warum diese Eigenschaft, wie artikuliert sie sich heute, und wie hat sie sich verändert? Gibt es eine spezifisch universitäre Erinnerungskultur, und wenn ja, was zeichnet sie aus? Diese Fragen möchte ich in vier Schritten angehen: Zunächst sind einige kurze Überlegungen darüber anzustellen, warum die Pflege der eigenen Memoria ein Kennzeichen deutscher und europäischer Universitäten ist und sogar in Gestalt der sogenannten „Traditionsuniversitäten“ einen eigenen Typus ausgebildet hat (I.). Danach werde ich auf jüngere Entwicklungen eingehen, welche die Erinnerungskultur an Universitäten heute prägen (II.), um im dritten Abschnitt am Beispiel der Aufarbeitung der DDR-Zeit in Mitteldeutschland den „state of the art“ zu diskutieren (III.). Den Schluss bildet dann ein Vorschlag für eine mögliche auf Mitteldeutschland bezogene Agenda, um Universitäten professionell als Erinnerungsorte zu gestalten (IV.). M E MOR I A LK U LT U R U N D „T R A DI T IONSU N I V E RSI TÄT “ „Dreyhundert Jahre steht er nun, unser schwäbischer Musensitz! Manch großer Mann, auf den Schwaben stolz seyn kann, zierte ihn seit dieser Zeit – manch anderer Große ging aus ihm hervor […] – manch entfernte Gegend wurde von der Fackel der Wahrheit erleuchtet! Viel, sehr viel Wichtiges muss sich also bei der Feyer seines 1 2
Es handelt sich bei diesem Text um die überarbeitete Fassung meines Vortrages anlässlich der Tagung „Erinnerungskultur im Wandel“ der Fachgruppe 8 im Verband deutscher Archivarinnen und Archivare in Weimar am 17.3.2016. Theodor Heuss: Göttinger Akademie. Anlässlich der 200-Jahr-Feier der Akademie der Wissenschaften am 10. November 1951, in: ders.: Würdigungen, Reden, Aufsätze und Briefe aus den Jahren 1949–1955, hg. von Hans Bott, Tübingen 1955, S. 167.
22
Klaus Dicke
dritten Jahrhunderts sagen lassen“. Mit diesem Zitat Christoph Friedrich Daniel Schuberts aus seiner Würdigung der 300 Jahre werdenden Universität Tübingen aus dem Jahr 1777 beginnt Walter Jens seine Tübinger Universitätsgeschichte, die er 1977 anlässlich ihres 500. Jubiläums auf Anregung von Kanzler und Präsident schrieb.3 Sie trägt den Titel „Eine deutsche Universität. 500 Jahre Tübinger Gelehrtenrepublik“, und im Prolog heißt es: „Eine Geschichte, prall von Dramatik und Kraft, durch Blütezeiten, Katastrophen und jähe Umschwünge akzentuiert. Welttheater, Tragödie und Komödie, auf kleinstem Raum“.4 Für ein breites Publikum war diese im Stil eines roman vrai geschriebene Darstellung gedacht; dem Fachpublikum hatte die Universität, besorgt vom landeskundlichen Institut, eine dreibändige Festschrift vorgelegt: Universitätsgeschichte, v. a. Tübinger Wissenschaftsgeschichte sowie Dokumente und Bilder.5 Den Produktionen und Blüten des Tübinger Jubiläumsjahres 1977 lassen sich verschiedene Hinweise darauf entnehmen, warum Universitäten sich historisch geben. Da ist der Stolz auf die lange Kontinuität des Musensitzes, der Pflege dessen, was als „artes liberales“ in der Universitätsgeschichte begann und in Gestalt eines allegorischen Wandgemäldes des Weimarer Künstlers Ludwig von Hofmann den Jenaer Senatssaal noch heute ziert.6 Die Wissenschaft feiert sich hier als Konglomerat von Synapsen zu den hohen Sphären der Künste, eine Transzendenz eigener Art, die noch heute in der häufigen Nachfrage der Medien nach professoraler Fachauskunft, welche die Aura des Guten, Wahren und Schönen ausstrahlt, nachklingt. Und sie paart sich mit dem Stolz auf Beständigkeit: Drei, vier, fünf Jahrhunderte haben einen Wissensthesaurus geschaffen, der nicht nur allen Zeitläufen zum Trotz wuchs, sondern das besondere Prädikat „altehrwürdig“ ebenso verdient wie die Sammlungen, Kunstwerke und bibliophilen Pretiosen der Universität.7 Da ist zweitens der Stolz auf die Großen, die „Celebrities“, die der Universität angehörten oder aus ihr hervorgingen, die strahlendes Licht auf ihre Alma Mater werfen und die Korporation leuchten lassen. Da sind Entdeckungen von und Segnungen für entlegene Gegenden, die eine besondere Weltverantwortung und zugleich Utilität der Universität repräsentieren. Die „gesellschaftliche Relevanz“ der Wissenschaft ist keineswegs eine jüngere Erfindung. Die Utilität der Wissenschaft stand nicht nur Pate bei der Gründung von Akademien und „Landesuniversitäten“, sondern gehört heute noch zu den wichtigsten Registern des Werbens um Finanzen. Und da ist ferner die pralle Dynamik und Kraft im Auf und Ab der Geschicke, die Universität als Abbild des Kosmos, der Welt auf kleinem Raum. 3 4 5
6 7
Walter Jens: Eine deutsche Universität. 500 Jahre Tübinger Gelehrtenrepublik, München 1977, S. 9. Ebd. Hanns-Martin Decker-Hauff u. a. (Hg.): Beiträge zur Geschichte der Universität Tübingen 1477–1977, Tübingen 1977; Johannes Neumann (Hg.): Wissenschaft an der Universität heute, Tübingen 1977; Hanns-Martin Decker-Hauff, Wilfried Setzler (Hg.): Die Universität Tübingen von 1477 bis 1977 in Bildern und Dokumenten, Tübingen 1977. Ludwig von Hofmann: Die neun Musen, 1909, in: Anka Zinserling: Das Universitätshauptgebäude, in: Franz-Joachim Verspohl, Rudolf Zießler (Hg.): Jenaer Universitätsbauten, Gera 1995, S. 27f. Einen guten Einblick bietet die Leipziger Jubiläumsschrift 600 Jahre Universität Leipzig. Aus Tradition Grenzen überschreiten, hg. von der Universität Leipzig, Leipzig 2009.
Akademische Erinnerungskultur
23
Und da ist schließlich auch sie, die Idee der Universität, der Gelehrtenrepublik, jener selbstbewussten Korporation, die ihre Angelegenheiten selbst steuert und sich weniger vom Willen, sehr wohl aber leider von der Schatulle der Fürsten und Regenten abhängig sieht, jene Idee der Universität, die zuerst und vor allem bei allem Jubel über die goldene Vergangenheit zu Klagen darüber führt, dass die Gegenwart an ihr gemessen faul oder doch im Niedergang ist. All dies sind aus der Memoria gespeiste Topoi, aus denen sich die Identität einer Universität als Universität formt. Sie repräsentieren identitätsstiftende Sinngehalte, und ihre Projektionsfläche sind Gründungsmythen, historische Gebäude, Berühmtheiten unter den Lehrenden und Absolventen, bahnbrechende Entdeckungen und wissenschaftliche Leistungen sowie Festriten.8 Anlässlich des 450. Jubiläums der Universität Jena wurde ein Bildband erstellt, der die Gründungsurkunden, Hauptgebäude, herausragenden Wissenschaftler und Leistungen der in der sogenannten Coimbra-Gruppe versammelten europäischen Traditionsuniversitäten dokumentiert – ein Kompendium der Erinnerungskultur europäischer Universitäten.9 Nun lassen sich mindestens zwei strukturelle Gründe dafür benennen, warum Universitäten in besonderer Weise einer Erinnerungskultur bedürfen. Erstens sind Universitäten „ad infinitum“ angelegte Korporationen, wie es ausdrücklich in der Gründungsurkunde der Universität Groningen10 heißt, die jedoch in sehr kurzen Zyklen ihr Personal auswechseln. Das gilt für Studierende, aber ebenso auch für die ja doch wanderlustige Gruppe der Professoren. Die Identität einer Korporation lebt jedoch davon, dass die ihr Angehörigen sich die Authentizität und Aura ihres Wirkungsortes zu eigen machen, ja einverleiben und dass neu hinzu Kommende sich rasch dem „genius loci“ anverwandeln können. Nicht umsonst wird dieser in Grußworten und in den meist in eigenen Publikationsreihen veröffentlichten „Universitätsreden“ wieder und wieder beschworen. Denn was eignet sich mehr zur korporativen Selbstinszenierung über rasche Generationenfolgen hinweg als die historischen Lichtblicke der Korporation, die im Siegel und Logo repräsentiert, durch Denkmale oder auch Tafeln an Häusern in der Stadt erfahrbar gemacht, für jede Generation bei jedem sich bietenden Anlass neu aufbereitet und in oft fachspezifischen Legenden und Anekdoten tradiert werden? Welcher Tübinger Student der Geisteswissenschaften etwa kennt nicht die Geschichte der beiden Treppenaufgänge zur Alten Burse, für Platoniker die eine, für Aristoteliker die andere? Ein zweiter struktureller Grund für die besondere Angewiesenheit von Universitäten auf eine lebendige Erinnerungskultur ist wissenschaftsimmanent. Er liegt darin, dass das Geschäft der Universität, die Wissenschaft, ein auf Fachhistorie angewiesenes evolutives Geschehen ist. Wissenschaft arbeitet sich an den Größen des Fachs ab, sonnt sich auch gelegentlich in ihrem Ruhm, und hält deshalb die Kenntnis 8 9 10
Vgl. Rüdiger vom Bruch: „Universität“ – ein „deutscher Erinnerungsort“?, in: Jürgen John, Justus H. Ulbricht (Hg.): Ein nationaler Erinnerungsort, Köln, Weimar, Wien 2007, S. 93–99. Vgl. auch Klaus Dicke (Hg.): Symbole der Erinnerung. Insignien der Universität, Jena 2008. Jürgen Hendrich, Klaus Dicke (Hg.): The European Storehouse of Knowledge, Jena 2008; vgl. auch Jos. M.M. Hermans, Marc Nelissen (Hg.): Charters of Foundation and Early Documents of the Universities of the Coimbra Group, Leuven 2005. Hermans, Nelissen: Storehouse (2008), S. 55f.
24
Klaus Dicke
über deren Leben und Wirken wach. Wer etwa über die praktische Umsetzung der Wolffschen Schulphilosophie Mitte des 18. Jahrhunderts forscht, kommt um Halle, aber auch um Darjes in Jena und Frankfurt/Oder nicht herum. Mit dieser, Stoff für immer neue Festvorträge oder Dissertationen bietenden, wissenschaftsimmanenten Memorialkultur gewinnt die Sache nun aber einen neuen interessanten Aspekt: Galileis Beobachtungen konnten nicht wahr sein, weil Aristoteles anderes lehrte. Luther und Hobbes etwa eint das Bemühen, den aristotelischen und thomistischen Ballast in den zeitgenössischen Wissenschaften über Bord zu werfen. Pufendorf wechselte von Leipzig nach Jena, weil er dem Dschungel scholastischer Deduktionen entfliehen und sich auf den moderneren Weg der Wissenschaft more geometrico, wie ihn Weigel in Jena vertrat, begeben wollte. Mit diesen Beispielen rücken zwei Dinge in den Blick: Erstens kann universitäre Memorialkultur nicht von Wissenschaftsgeschichte getrennt betrieben werden; sie sind Zwillinge mit allerdings je sehr eigener Biographie. Und zweitens ist universitäre Memorialkultur Deutungskampf. Beide Aspekte: die untrennbare Verbindung von akademischer Erinnerungskultur und Wissenschaftsgeschichte und ihr Charakter als Deutungskampf prägen die jüngere Reflexion über universitäre Erinnerungskultur, wie man v. a. der Habilitationsschrift von Joachim Bauer11 entnehmen kann. Diesen jüngeren Entwicklungen wende ich mich nunmehr zu. U N I V E RSI TÄT U N D ER I N N E RU NGSK U LT U R – J Ü NGER E E N T W ICK LU NGE N Seit den achtziger und neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wird die Erinnerungskultur in Deutschland reflexiv und erfährt einen erheblichen Schub in der akademischen Bearbeitung. „Geschichte, Erinnerung, Gedächtnis, Identität und Kultur werden zu Leitbegriffen, vor allem auch in Kombination miteinander“.12 Die Rezeption französischer Autoren, v. a. Halbwachs, und namentlich Arbeiten von Aleida und Jan Assmann etablieren nahezu einen eigenen Forschungszweig der historischen Wissenschaften.13 Hinzu trat ein kaum zu sättigender Bedarf an akademischem Futter für den medialen Memorialkalender. Mit der Etablierung des Begriffs „Erinnerungskultur“ erfuhr die Sache eine nachhaltige Professionalisierung. Davon konnte auch die universitäre Erinnerungskultur nicht unberührt bleiben. Die übliche Festschriften-Panegyrik geriet unter Beschuss eines Verständnisses von Erinnerungskultur, das sich auch für dunkle Seiten der Geschichte öffnete, auch beschönigende und verschleiernde Momente der Gedächtniskultur thematisierte und sich hieraus edukatorische Gegenwartsimpulse versprach. Erinnerungskultur wurde zu einem Lernprogramm in Sachen demokratischer Gegenwartsgestaltung. Zugleich erfuhr die Erinnerungskultur eine insgesamt höchst produktive Pluralisierung. Das betrifft zunächst die Methoden: Neben die klassische Archivarbeit, bei der die nun zugänglichen Universitätsarchive Mitteldeutschlands mit ihren z. T. 11 12 13
Joachim Bauer: Universitätsgeschichte und Mythos. Erinnerung, Selbstvergewisserung und Selbstverständnis Jenaer Akademiker 1548–1858, Stuttgart 2012. Auch zum Folgenden Bauer: Mythos (2014), S. 31. Vgl. auch Klaus Dicke: Eine ganz neue Erinnerungskultur. Wer hat die Deutungshoheit über die Vergangenheit? (im Druck). Hierzu die Einleitung zum vorliegenden Band.
Akademische Erinnerungskultur
25
lückenlosen Beständen überraschend viel an neuem Stoff boten,14 traten Methoden der „Oral History“, professionelle und multimedial inszenierte Ausstellungsprojekte, erinnerungspolitisch motivierte Veranstaltungsreihen wie die „Belter Dialoge“ in Leipzig und innovative Darstellungen universitätshistorischer Dispute15 sowie jüngst auch eine bemerkenswerte literarische Bearbeitung der Lebenswissenschaften in den Bahnen des Faust-Stoffes.16 All dies beflügelte und beflügelt, Gelegenheiten zur Memoria zu suchen und sie professionell zu bearbeiten. Ausschlaggebend für die akademische Erinnerungskultur wurden die Verbindung von Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, die z. B. erinnerungskulturelle Bemühungen auf Fach- und Fakultätsebene anregte, sowie die historiographische Methode der Kontextualisierung. Unter dieser methodischen Vorgabe wurde Universitätsgeschichte gesellschaftlich und politisch eingebettet und in ihrer Verflechtung mit der politischen, wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Geschichte betrachtet.17 Genau damit aber geriet die herkömmliche akademische Erinnerungskultur unter Stress. Denn nun galt es auch, diverse unschöne Erinnerungen aufzuarbeiten, wobei die Initiative nicht immer von den Universitäten selbst ausging, in jedem Fall aber von erheblicher öffentlicher Aufmerksamkeit und oft auch internen Debatten begleitet wurde. Ich will einige Fälle benennen: Schon unmittelbar nach der deutschen Vereinigung setzten in Leipzig, Chemnitz und Jena heftige, z. T. bis heute anhaltende Debatten darüber ein, wie mit MarxDenkmalen umzugehen sei.18 Sind sie bloße Ikonen der SED-Herrschaft, Dokumente einer nun einmal real existierenden Vergangenheit, die Chemnitz und die Leipziger Universität mit Marxens Namen und Jena mit seiner Promotion in absentia verbunden hatte, oder sind sie nach einer gewissen Schamfrist wieder als Denkmal eines ohne Zweifel großen deutschen Denkers salonfähig geworden? Der Bilderstreit als Bestandteil des Deutungskampfes ist Bestandteil der Erinnerungskultur seit Menschengedenken. Wer will hier mit welchen Gründen entscheiden? In den z. T. emotional hoch aufgeladenen Debatten offenbarten sich die mit Betroffenheiten unterschiedlichster Art gegebenen Probleme des zeitgeschichtlichen Umgangs mit autoritären Regimen ein ums andere Mal. Es ist ein Verdienst einer kürzlich erschienenen Darstellung der Jenaer Umbruchzeit 1989 bis 1992 aus der Feder des damaligen
14 15 16 17 18
So etwa Rektoratsreden; dazu Dieter Langewiesche: Selbstbilder der deutschen Universität in Rektoratsreden. Jena – spätestes 19. Jahrhundert bis 1948, in: John, Ulbricht: Erinnerungsort (2007), S. 212–243. Etwa die literarische Rekonstruktion von Matthias Steinbach: Der Fall Hodler. Krieg um ein Gemälde 1914–1919, Berlin 2014. Thea Dorn: Die Unglückseligen. Roman, 3München 2016. Vgl. die Rezension von Rüdiger Hachtmann: Für die Jahre des „Dritten Reichs“ vorbildlich ausgeleuchtet: Neuerscheinungen zur Geschichte der Universität Jena, in: JbUG 14 (2011), S. 245–251, hier S. 251. Tobias Kaiser, „Die Universität Jena kann Karl Marx als einen der ihrigen bezeichnen“. Eine Ikone der Arbeiterbewegung in der Erinnerungskultur der Salana nach 1945, in; John, Ulbricht: Erinnerungsort (2007), 323–339; Gottfried Meinhold: Der besondere Fall Jena. Die Universität im Umbruch 1989 und 1991, Stuttgart 2014; Ingrid Bodsch u. a. (Hg.): Dr. Karl Marx. Vom Studium zur Promotion – Bonn, Berlin, Jena, Bonn 2012.
26
Klaus Dicke
Prorektors Gottfried Meinhold,19 die schwierigen Folgen autoritärer Herrschaft für die universitäre Erinnerungskultur sensibel reflektiert zu haben. Ein zweiter Fall: Als Prorektor sah ich mich 1999 plötzlich mit der Zuständigkeit für die Klärung der Frage konfrontiert, wie der in Jena hoch geachtete Kinderarzt Prof. Dr. Jussuf Ibrahim angesichts sich verdichtender Hinweise auf seine Verstrickung in das Euthanasieprogramm des Nationalsozialismus in der Memoria der Universität, und auch die Stadt war wegen eines Straßennamens involviert, zu behandeln sei.20 Hier konnten Nachforschungen Evidenzen erbringen, die zu Entscheidungen zwangen, aber die emotional hoch aufgeladene Begleitmusik des ganzen Verfahrens – hier prallten dankbare Patientenerinnerungen, auch Mythisierungen einerseits und beharrliches Bohren einer Political Correctness andererseits in einer Flut von Leserbriefen aufeinander – hat doch die Frage nach der Gerechtigkeit des Umgangs mit seiner Person und den Umständen seines Handelns nicht wirklich in voller Eindeutigkeit beantworten können. Fragen blieben. Auch im Prozess der Klärung der NS-Verstrickungen des „Jenaplan“-Pädagogen Peter Petersen wurde die Notwendigkeit eines sensiblen Umgangs mit Ambivalenzen in der Erinnerungskultur ausdrücklich thematisiert.21 Ich nenne den Fall der Aberkennung der Ehrendoktorwürde für Konrad Lorenz durch die Universität Konstanz, nachdem seine Verstrickungen in das NS-System bekannt wurden.22 In Oxford wurde v. a. von studentischer Seite massiv der Sturz eines Denkmals von Cecil Rhodes betrieben, und das Denkmal des Diamantenbarons und Kolonialpremiers der Kapkolonie ist wohl deshalb nicht gefallen, weil dies der Universität Oxford erhebliche finanzielle Verluste eingebracht hätte.23 Die in der NSZeit erfolgte Namensgebung der Universitäten Halle, Jena und Greifswald24 ist u. a. deshalb ins Gerede gekommen, weil Greifswalder Studierende den Namensgeber 19 Meinhold: Fall (2014). 20 Bericht der Kommission der Friedrich-Schiller-Universität Jena zur Untersuchung der Beteiligung Prof. Dr. Jussuf Ibrahims an der Vernichtung „lebensunwerten Lebens“ während der NS-Zeit, Jena 2000; Marco Schrul, Jens Thomas: Kollektiver Gedächtnisverlust: Die IbrahimDebatte 1999/2000, in: Uwe Hoßfeld u. a. (Hg.): „Kämpferische Wissenschaft“. Studien zur Universität Jena im Nationalsozialismus, Köln, Weimar, Wien 2003, S. 1065–1098; Eggert Beleites (Hg.): Menschliche Verantwortung gestern und heute. Beiträge und Reflexionen zum nationalsozialistischen Euthanasie-Geschehen in Thüringen und zur aktuellen Sterbedebatte, Jena 2008. 21 Peter Fauser, Jürgen John, Rüdiger Stutz (Hg.): Peter Petersen und die Jenaplan-Pädagogik. Historische und aktuelle Perspektiven, Stuttgart 2012; vgl. auch mein Grußwort zur Eröffnung des der Veröffentlichung zugrunde liegenden Symposiums in: Klaus Dicke: Heilige, PetawattLaser, Festakte und Forschungsmagnetresonanztomographen, Neustatt/Aisch 2015, S. 320f. 22 Titelentzug. Konrad Lorenz verliert Ehrendoktor, in: FAZ v. 19.12.2015; Patrick Bahners: Erschlichene Sauberkeit. Universitätscharakterkunde: Zum Fall Konrad Lorenz, in: FAZ v. 21.12.2015. 23 Gina Thomas: Tyrannei des Biedersinns, in: FAZ v. 16.1.2016; Spendenausfall. Oxforder Rhodes-Statue bleibt, in: FAZ v. 30.1.2016; Gina Thomas: Sie wollen mit geballten Fäusten die Geschichte tilgen, in: FAZ v. 11.3.2016. 24 Jürgen John: „Lutherjahr“ und „nationale Erhebung“. Die Namensgebung „Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg“ 1933 und ihre Kontexte, in: Hallesche Beiträge zur Zeitgeschichte 19 (2010), S. 87–118.
Akademische Erinnerungskultur
27
Ernst Moritz Arndt als unwürdige Referenz ihrer Universität in einer demokratischen Gesellschaft ansahen. Der Präsident der Musikhochschule Weimar sieht sich dem Dauerbeschuss einer Privatperson ausgesetzt, die auf die Rehabilitierung eines zu SED-Zeiten seiner Ansicht nach ungerecht behandelten Absolventen zielt und aus diesem Fall eine Fundamentalkritik an der Aufarbeitung der SED-Zeit durch die Hochschule ableitet.25 Viele weitere Fälle wären zu nennen, in denen die Erinnerungskultur einer Universität gefordert oder auch von einem dominant gewordenen Verständnis von Erinnerungskultur herausgefordert ist.26 In all solchen Fällen kann ich aus meiner Erfahrung zwei Ratschläge geben: Erstens sollte die Universität selbst proaktiv nach Fällen von demokratisch nicht zu verantwortenden Verstrickungen forschen und sie aufarbeiten, in die Archive gehen und Klartext reden. Und zweitens sollte sie die Aufarbeitung den dazu qualifizierten Professionen überlassen, mit Geduld und manchmal auch dickem Fell gegenüber Anstürmen Betroffener wie von Anwälten der Political Correctness, und dabei auch den Blick darauf nicht scheuen, wie andernorts solche Themen behandelt werden. Bei der Bearbeitung der Entziehung der Doktorgrade während der NS-Zeit hat sich die FSU Jena sehr genau das Vorbild der Universität Gießen27 angeschaut. Dabei sind zugleich die beiden wichtigsten Momente der jüngeren Entwicklung universitärer Erinnerungskultur angesprochen: ihre Professionalisierung einerseits und die Möglichkeit der Orientierung an Referenzprojekten andererseits. Ich bitte um Verständnis, dass ich dies am Beispiel des Jenaer Projekts „Universitätsgeschichte“ angesichts ihres 450. Jubiläums im Hinblick auf einige Details näher erläutere. Dabei ist von einer Reihe begünstigender Voraussetzungen auszugehen, die der Universität im Vorfeld ihres 450. Jubiläums zur Verfügung standen. Zu nennen ist vor allem das von einem universitätshistorisch interessierten und professionellen Personal betreute Universitätsarchiv, dessen Bestände nahezu lückenlos bis in die Anfänge zurückreichen. Zweitens ist auf den Sonderforschungsbereich „Weimar-Jena um 1800“ zu verweisen, der in einer Vielfalt methodischer und disziplinärer Zugriffe das geistige Geschehen in der Universität und im Austausch mit ihrer Umwelt erforschte und der nicht zuletzt durch die Kooperation mit der Klassik-Stiftung Weimar ein außerordentlich differenziertes Bild der Wissenschaften und der Korporation Universität gerade in den Austauschbeziehungen zu ihrem Wirkungsfeld zeichnete. Zudem ging aus dem SFB eine große Zahl wissenschaftshistorisch geschulter Nachwuchswissenschaftler hervor. Drittens wies die Universität Jena seit 1990 eine ungewöhnlich hohe Dichte von Gedenkanlässen auf, die bei einem gewachsenen Traditionsbewusstsein in Universität und – das muss betont werden – der Stadt Jena öffentliches Interesse 25 Christoph Stölzl: Diplomurkunde für Wallmann mit Note „Gut“, in: Thüringische Landeszeitung v. 18.2.2016. 26 So hat die Max-Planck-Gesellschaft 1997 eine unabhängige Historikerkommission mit der Bearbeitung der Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus beauftragt. Das Projekt wurde bis 2007 mit zahlreichen Publikationen durchgeführt. 27 Eva-Marie Felschow: Der Umgang mit NS-Depromotionen. Das Beispiel Gießen; in diesem Band.
28
Klaus Dicke
begründete. Viertens hat die Universität nicht nur die Wende aus sich selbst heraus vollzogen, sondern früh mit der Aufarbeitung der SED-Vergangenheit begonnen. Beides wurde nicht zuletzt auch durch den Rückgriff auf Narrative einer freien und sich in immer neuen Aufbrüchen selbst erneuernden Universität geistig unterfüttert. Die Umgestaltung nach 1990 hat ein eigenes erinnerungskulturelles Narrativ erzeugt, das durch die Inszenierung eines Wartburgtreffens 1990 und die Gründung des „Collegium Europaeum Jenense“ markante Konturen gewann.28 Diese Traditionslinie wäre eine eigene Darstellung wert. Und schließlich trägt die Tatsache, dass sich in Jena innerhalb und außerhalb der Universität Initiativgruppen wie die am 17. Juni 1995 eingerichtete „Geschichtswerkstatt Jena e.V.“ oder das bereits 1992 gegründete „Matthias-Domaschk-Archiv“ zusammengefunden haben, deren Tätigkeit erheblich zur Pluralisierung der lokalen und regionalen Erinnerungskultur beiträgt. Vor diesem Hintergrund hat der Senat 1998 beschlossen, eine Senatskommission mit der kritischen Aufarbeitung der Universitätsgeschichte im 20. Jahrhundert zu betrauen. Die Kommission und die mit ihr kooperierenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben bis heute mehrere Regalmeter an Publikationen erstellt, aus denen ein Band zur Geschichte der Universität im Nationalsozialismus,29 zwei Bände zur „Hochschule im Sozialismus“,30 eine Gesamtdarstellung der Universitätsgeschichte 1850 bis 199531 sowie jüngst die Habilitationsschrift von Joachim Bauer über die „imagined university“ 1548–185032 herausragen. Wenn Bauer am Schluss seiner Arbeit festhält, dass „es keinen Stillstand in der Gedächtnisgeschichte gibt“,33 dann reflektiert er damit auch eine der wichtigsten Folgen dieser Arbeiten: Die Erforschung universitärer Erinnerungskultur hat sich vom Anlass des Jubiläums gelöst und wird von einer beachtlichen Zahl einschlägig geschulter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in immer wieder neuen Fragestellungen vorangetrieben34 und hat nicht zuletzt zu einer starken Kooperation der Archive und ihrer Vernetzung im Universitätsbund Halle-Jena-Leipzig und auch darüber hinaus geführt. 28 Meinhold: Fall (2014); Michael Ploenus: Ankunft im vereinten Deutschland. Die Universität Jena zwischen 1989 und 1995, in: Traditionen, Brüche, Wandlungen. Die Universität Jena 1850 bis 1995, hg. von der Senatskommission zur Aufarbeitung der Jenaer Universitätsgeschichte im 20. Jahrhundert, Köln, Weimar, Wien 2009, S. 842–877, hier S. 842ff. Ulrich Zwiener (Hg.): Ein demokratisches Deutschland für Europa – Wartburgtreffen 1990, Jena 1990. 29 Hoßfeld u. a.: „Wissenschaft“ (2003); ders. u. a. (Hg.): „Im Dienst an Volk und Vaterland“. Die Jenaer Universität in der NS-Zeit (Sonderauflage für die Landeszentrale für Politische Bildung Thüringen), Köln 2005. 30 Uwe Hoßfeld, Tobias Kaiser, Heinz Mestrup (Hg.): Hochschule im Sozialismus. Studien zur Geschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena (1945–1990), 2 Bde., Köln, Weimar, Wien 2007. 31 Senatskommission: Traditionen (2009). 32 Bauer: Mythos (2014). 33 Ebd., S. 484. 34 Aus der Fülle der Beispiele Jürgen John: „Nutzlose Symbolpolitik“? Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland. Eine typologische Übersicht mit Fallbeispielen; im diesem Band; Joachim Bauer, Jens Blecher (Hg.): Der „akademische“ Schumann und die Jenaer Promotion von 1840, Leipzig 2010.
Akademische Erinnerungskultur
29
DI E AU FA R BEI T U NG DER U N I V ERSI TÄTSGE SCH ICH T E U N T E R DE R SED -H E R RSCH A F T In welcher Methodenpluralität und Vielfalt der Fragestellungen die Forschungen zur Universitätsgeschichte heute zur akademischen Erinnerungskultur beitragen, möchte ich im folgenden Abschnitt in einer überblicksartigen Durchsicht der Jenaer Arbeiten zur Universitätsgeschichte der DDR-Zeit zeigen. Angesichts der Fülle des vorliegenden Materials wäre allein eine Ergebnissicherung ein Forschungsprojekt, das mehrere Monate in Anspruch nehmen dürfte. Es lohnt sich jedoch, die Schwerpunkte der Forschungsfragen zu systematisieren, um den Stand der Forschung festzuhalten, dann aber auch auf Desiderate hinzuweisen. Bereits früh stand die Aufmerksamkeit für die Opfer des SED-Regimes und für Oppositionsbewegungen im Vordergrund. Bereits 1994 wurde ein Erinnerungsband veröffentlicht, der auf ein Symposium des Jahres 1992 zurückging. Ziel der zahlreichen Darstellungen überwiegend von Zeitzeugen und des Dokumentenanhangs war es, „vergangenes Unrecht öffentlich zu machen“ und „Berichte von Zeitzeugen über Formen und Folgen des Aufbegehrens für die geistige Situation der Gegenwart zu nutzen“.35 Weitere Beiträge, z. T. von Betroffenen, folgten z. B. zum Eisenberger Kreis, zur Opposition in Jena in den fünfziger und sechziger sowie in den siebziger und achtziger Jahren, oder zu Einzelschicksalen wie exemplarisch zu Hans Leisegang, Lutz Rathenow oder Jürgen Fuchs.36 Erinnerungskulturellen Niederschlag fand dies etwa in der Benennung des zum modernen Hörsaal umgestalteten ehemaligen großen Schwurgerichtssaals des Oberlandesgerichts Jena in „Matthias-Domaschk-Hörsaal“. Über ähnliche erinnerungskulturelle Entwicklungen an der Universität Leipzig hat Jens Blecher 2012 berichtet.37 Ein zweiter umfangreicher Themenkomplex betrifft die Disziplin- und Fachgeschichte. Ihm ist das Gros der Beiträge im zweiten Band „Hochschule im Sozialismus“ sowie umfangreiche Kapitel zu den Fakultäten und später Sektionen im Band „Traditionen, Brüche, Wandlungen“ gewidmet. Hervorzuheben ist eine monographische Darstellung des Jenaer Instituts Marxismus-Leninismus 1945–1990.38 Hier sind zwei Ergebnisse bemerkenswert: zum einen die politische Ausrichtung der DDR-Hochschulpolitik auf Ausbildung, vor allem im naturwissenschaftlich-technischen Bereich und die damit einhergehende Betonung der Lehre, die durchaus Ausstrahlungen bis heute hat, und zum andern die massive Förderung technologieorientierter Forschung 35 36
37 38
So das Vorwort von Ernst Schmutzer in: Vergangenheitsklärung an der Friedrich-SchillerUniversität Jena. Beiträge zur Tagung „Unrecht und Aufarbeitung“ am 19. und 20.6.1992, hg. vom Rektor der Friedrich-Schiller-Universität, Leipzig 1994, S. 9. Zusammenfassend Tobias Kaiser, Heinz Mestrup: Opposition und Widerstand an der Universität Jena von 1945 bis 1989. Bestandsaufnahme der bisherigen Forschung und Versuch eines Gesamtüberblicks, in: dies. (Hg.): Politische Verfolgung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena von 1945 bis 1989. Wissenschaftliche Studien und persönliche Reflexionen zur Vergangenheitsklärung, Berlin 2012, S. 19–62. Jens Blecher: Studenten in Gewissensnot. Zum Stand der zeitgeschichtlichen Erinnerungskultur an der Universität Leipzig, in: Kaiser, Mestrup: Verfolgung (2012), S. 98–112. Michael Ploenus: „…so wichtig wie das tägliche Brot“. Das Jenaer Institut für MarxismusLeninismus 1945–1990, Köln, Weimar, Wien 2007.
30
Klaus Dicke
besonders im letzten Jahrzehnt der DDR. Von methodischem Interesse ist der Fokus auf die Ressourcenausstattung einzelner Fächer im Band „Traditionen, Brüche, Wandlungen“. Für Arbeiten in einzelnen Fächern und Disziplinen selbst wäre eine bibliographische Zusammenstellung hilfreich, auch um nach wie vor bestehende Lücken zu identifizieren. Ein dritter, überwiegend strukturhistorisch bearbeiteter Themenkomplex betrifft die Einbettung der Universität in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Hier stehen zum einen der „sozialistische Umbau“ der Universität vor und nach der dritten Hochschulreform, die Tätigkeit der SED-Parteiorganisation an der Universität, der Einfluss des MfS, aber auch die Einbeziehung der Universität in kommunale Aufgabenerledigung im Zentrum. Zum anderen wird der Tradition Jenas entsprechend der Kooperation Universität – Industrie, nicht nur, aber vor allem mit dem Carl-Zeiss-Kombinat breiter Raum gewidmet. Aber auch Fragen wie die Auswirkung des Mauerbaus auf die Universität oder die Gleichstellungspolitik werden behandelt. Viertens sind sowohl struktur- als auch sozialhistorische Beiträge zur Geschichte der Studierenden und des studentischen Milieus in Jena zu nennen. Beachtenswerte Ergebnisse sind das breitgefächerte Angebot an kulturellen Zirkeln und Studentenclubs und die Jenaer Besonderheit eines „Kulturpraktikums“ im ersten Semester.39 Die Urteile über die politische Einstellung der Studierenden weisen zwar einerseits auf Jena als „Zentrum studentischer Dissidenz“ und auf einen „durchgreifende[n] Mentalitätswandel“ in der letzten Dekade der DDR hin,40 halten aber andererseits fest, dass „[d]ie Masse der Studenten […] vor dem Herbst 1989 keine öffentlichkeitswirksame Contraposition gegenüber der DDR“ bezog.41 Ein im Auftrag des Studierendenrates erstellter Sammelband42 behandelt nur die beiden letzten Jahre der DDR, ein entsprechender Band für die DDR-Zeit insgesamt ist studentischer Initiative anzuempfehlen. Nicht unterschlagen werden dürfen fünftens kulturhistorische Zugriffe auf das Universitätsleben von 1949–1989. Schiller- und Luther-Gedenkfeiern oder die Ehrenpromotion Thomas Manns bieten weit über die Universität hinausreichende Einblicke auch in die Memorialkultur der DDR,43 ein nur wenig bearbeitetes Forschungsgebiet. Insgesamt tragen die Beiträge in nicht unerheblichem Umfang auch zur zeitgeschichtlichen DDR-Forschung bei. Sie sind ihrerseits in Beziehung zu setzen zu vergleichbaren Arbeiten anderer Universitäten – ein Vergleich der Jenaer Arbeiten mit denen der Humboldt-Universität aus jüngerer Zeit44 liegt vor – sowie zu übergreifenden Darstellungen in den genannten Themenfeldern. Die Kooperation der mitteldeutschen Universitätsarchive nährt die Hoffnung auf verstärkte vergleichende Forschungen, insbesondere auch was verschiedene Formen, v. a. auch Präsentationsformen der Senatskommission: Traditionen (2009), S. 826. Hachtmann: Neuerscheinungen (2011), S. 250; Senatskommission: Traditionen (2009), S. 837. Ebd., S. 837. Robert Gramsch, Tobias Kaiser (Hg.): Engagement und Ernüchterung Jenaer Studenten 1988 bis 1995, Jena 2009. 43 Als Beispiel Julia Roßberg: Der ‚geteilte‘ Schiller. Die Schiller-Feiern 1955 und 1959 in beiden deutschen Staaten, Weimar 2009. 44 Daniel Hechler, Peer Pasternack: Best Practice und Worst Case? Der Umgang mit der Hochschulzeitgeschichte an der Universität Jena und der Humboldt-Universität: ein exemplarischer Vergleich, in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 34 (2011), 329–345.
39 40 41 42
Akademische Erinnerungskultur
31
akademischen Erinnerungskultur angeht. Ausstellungen, wie sie für die DDR-Zeit etwa die Universität Leipzig erstellt hat,45 oder Internetpräsentationen sind dabei in die Betrachtung einzubeziehen. U N I V E RSI TÄT A L S ER I N N ERU NGSORT – EI N E MÖ GLICH E AGE N DA Damit leite ich zu einigen abschließenden Bemerkungen zu einer möglichen Agenda der universitären Erinnerungskultur v. a. mit Blick auf die mitteldeutschen Universitäten über. In der universitätshistorischen Forschung wird man hinter den erreichten Methodenpluralismus, die Verschränkung von Ereignis- und Strukturgeschichte mit Wissenschaftsgeschichte sowie ihre Kontextualisierung nicht zurückgehen können. Eine kritische Sichtung der Publikationen der letzten 25 Jahre kann das eine oder andere Defizit ans Licht bringen, doch vor allem ist die Zeit für vergleichende Untersuchungen reif. Ich könnte es mir reizvoll vorstellen, auf einem Workshop im Blick auf das Reformationsjubiläum 2017 einmal die erinnerungskulturellen Bemühungen der drei im Universitätsbund verbundenen mitteldeutschen Universitäten bei den Reformationsjubiläen 1917 und 1967 sowie im „Lutherjahr“ 1983 vergleichend zu untersuchen und die Ergebnisse ggf. in einer gemeinsamen Ausstellung zu präsentieren. Auch die historischen Tiefenschichten der Beziehungen der drei Universitäten untereinander sind sicher nicht hinreichend erforscht. Insgesamt ist die Universitätsgeschichte jedoch deutlich aus dem Schattendasein eines hilfreichen Beiwerks herausgetreten. Es wäre wünschenswert, dass sie mit diesem Selbstbewusstsein auch größeren Verbundprojekten über die notwendigen Digitalisierungsprojekte hinaus näher tritt. Doch macht Forschung allein noch keine Erinnerungskultur aus. Als wesentlicher Bestandteil muss die mit modernsten technischen Mitteln arbeitende Präsentation hinzutreten. Ich hatte als Rektor das Vergnügen, an zahlreichen Ausstellungseröffnungen mitzuwirken, und Ausstellungen, zumal wenn sie auf multimediale Präsentationstechniken zurückgreifen, sind das vielleicht probateste Mittel der Präsentation. Wenn ich nur einige der vergangenen Ausstellungen Revue passieren lasse – Rektorenbilder, Robert Schumann, Franz Liszt, die Promotion von Marx, Schiller in Jena, Pilzforschung oder Ernst Abbe oder auch die Weimarer Ausstellung zu Goethes Wahlverwandtschaften – drängen sich zwei Erfolgsbedingungen förmlich auf: Erstens ein Sichtbarmachen des ja nie auf die Universität als Korporation allein bezogenen Operationsfeldes des Ausstellungsthemas, und zweitens die Kooperation mit geeigneten Partnern aus dem universitären und außeruniversitären Umfeld. Diese beiden Aspekte scheinen mir schon deshalb bedeutsam, weil Universitäten in steigendem Umfang auf Unterstützung ihrer Umwelt angewiesen sind. Wir haben in Deutschland im Unterschied zu den USA eine gesellschaftsoffene Universitätslandschaft. So hat das die Universität als in sich geschlossenen Lebensraum repräsentierende literarische Genre des Campusromans in Deutschland anders als in den USA nicht Fuß fassen können. Andererseits haben aber Universitätsbauten in Deutschland eine städtebauliche Note, wie man an den jüngeren Universitätsbauten in Leipzig 45
Blecher: Studenten (2012).
32
Klaus Dicke
einschließlich der Debatten um die Universitätskirche, aber auch an der Öffnung des Jenaer Aula-Foyers zur Stadt hin ablesen kann.46 Die Öffnung der Universität zur Gesellschaft hin gerade an Universitätsbauten sinnlich erfahrbar zu gestalten, ist ein unschätzbarer Beitrag zur universitären Memorialkultur. Dazu gehört auch ein moderne technische Möglichkeiten nutzendes, publikumsfreundliches Informationssystem, das einen raschen Blick auf das Geschehen hinter den Mauern einschließlich seiner historischen Genese ermöglicht. Eine Plakette „Goethe war hier“ reicht definitiv nicht mehr, es sei denn, sie weist einen Code auf, mit dem man entsprechende Informationen auf sein Smartphone laden kann. Und schließlich möchte ich die drei Archive des Universitätsbundes ermutigen, den kooperativen Blick nach vorn dergestalt zu wagen, dass sie einmal im Semester einen gemeinsamen offenen Workshop veranstalten, der regelmäßig drei Tagesordnungspunkte abarbeitet: Erstens eine Dreijahresvorschau auf anstehende Erinnerungsdaten, zweitens einen kurzen Bericht über neue Entwicklungen in ihrer jeweiligen Erinnerungskultur und drittens ein in Kurzbeiträgen verhandeltes gemeinsam interessierendes Thema. Das Thüringer Netzwerk Reformationsforschung hat unter Beweis gestellt, wie ergiebig ein solches Format sein kann. „Liebenswürdig“ hatte Theodor Heuss die Eigenart von Akademien genannt, sich historisch zu geben. Dank einer forcierten universitätshistorischen Professionalisierung hat die akademische Erinnerungskultur einen Status erreicht, der im Konzert geisteswissenschaftlicher Forschung Respekt verdient. Die Themen werden ihr schon deshalb nicht ausgehen, weil jede Generation von Universitätsangehörigen ihr eigenes Narrativ von der Bedeutung ihrer Alma Mater entwickeln muss und will, weil wachsame Erinnerungsprofis den Gedenkkalender zu nutzen wissen und weil aus der Gesellschaft heraus immer wieder neue Anfragen an das Gedächtnis der Universität gestellt werden, wie jüngst im Fall der Medikamententests in DDR-Zeiten. Ob die Art, wie sich Universitäten heute „historisch geben“, liebenswürdig ist, lasse ich einmal dahingestellt. Sie ist auf jeden Fall professionell, und das heißt auch: sie ist von der Liebe ihrer Protagonisten zu ihrem Gegenstand getragen. Diese zu bewahren und zu würdigen, dürfte das Interesse jeder Universität sein.
46 Dazu Klaus Dicke: Repräsentation und Integration der Universitäten im Vergleich zwischen Deutschland und den USA, in: Bildung und Erziehung 65 (2/2012), S. 139–152.
ER I N N ERU NG I M R AU M
Abb. 1 Das Hauptgebäude der „Hamburgischen Universität“ in den 1920er Jahren
Abb. 2 Das Hauptgebäude der Universität Hamburg heute
ORT U N I V ERSI TÄ R E N ER I N N ER NS – DAS H AU P TGEBÄU DE DER U N I V ERSI TÄT H A M BU RG Rainer Nicolaysen Das Hauptgebäude der Universität Hamburg verfügt über einen hohen Symbolwert, es ist älter als die Universität selbst und deren bauliche Keimzelle, es galt nach Gründung der Universität 1919 jahrzehntelang, etwa auf Ansichtskarten, schlicht als „die Universität“, es liegt an exponiertem Ort, citynah, gegenüber dem DammtorBahnhof, heute mit ICE-Anschluss, es findet sich auf etlichen Buchumschlägen und in zahlreichen Zeitungsartikeln. Denn fast immer, wenn eine Meldung zur Universität Hamburg illustriert werden soll, wird das Hauptgebäude gezeigt – und dies bisweilen auch, wenn es um Universitäten im Allgemeinen geht, steht das Gebäude doch wie wenige andere in Deutschland auf den ersten Blick für „Universität“. Zuletzt wurde es als Ikone1 und als Gedächtnisort2 bezeichnet, anlässlich seines 100-jährigen Bestehens fand im Mai 2011 ein Festakt statt,3 und auch wenn das Präsidium bald darauf, im Sommer 2012, aus dem repräsentativen Gebäude auszog, um die gesamte Verwaltung in einem abseits vom Campus gelegenen, angemieteten Zweckbau zusammenzuführen, bleibt der markante Kuppelbau doch weiterhin das Hauptgebäude der Universität Hamburg. Eröffnet wurde das Gebäude im Mai 1911, als sein Stifter, der Hamburger Kaufmann und Bürgerschaftsabgeordnete Edmund Siemers, den modernen Stahlbetonbau als „Vorlesungsgebäude“ dem Senat der Freien und Hansestadt Hamburg übergab.4 Gezielt unterstützte Siemers mit seiner Schenkung die hartnäckigen Bemühungen Werner von Melles um Errichtung einer Universität.5 Von Melle, seit 1891 als Senats1
2 3
4
5
Eckart Krause: Gebäude – Institution – Ikone. Anmerkungen zu 85 Jahren Geschichte und Symbolik des Universitätsgebäudes, in: Jürgen Lüthje, Hans-Edmund Siemers (Hg.): Das Vorlesungsgebäude in Hamburg 1911–2004. Festschrift aus Anlass der Neugestaltung des Hauptgebäudes der Universität Hamburg, o.O. o.J. [Hamburg 2004], S. 32–47. Rainer Nicolaysen (Hg.): Das Hauptgebäude der Universität Hamburg als Gedächtnisort. Mit sieben Porträts in der NS-Zeit vertriebener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Hamburg 2011. Rainer Nicolaysen (Red.): 100 Jahre Hauptgebäude der Universität Hamburg. Reden der Festveranstaltung am 13. Mai 2011 und anlässlich der Benennung der Hörsäle H und K im Hauptgebäude der Universität nach dem Sozialökonomen Eduard Heimann (1889–1967) und dem Juristen Albrecht Mendelssohn Bartholdy (1874–1936) (=Hamburger Universitätsreden N.F., Bd. 18), Hamburg 2012. Zur Geschichte des Gebäudes: Eckart Krause: Auf von Melles Wiese. Universität zwischen Aufklärung und Barbarei. Annäherungen an ein Gebäude und seinen „Standort“, in: Jürgen Lüthje (Hg.): Universität im Herzen der Stadt. Eine Festschrift für Dr. Hannelore und Prof. Dr. Helmut Greve, Hamburg 2002, S. 34–69; ders.: Gebäude – Institution – Ikone (2004); ders.: Der Forschung, der Lehre, der Bildung. Facetten eines Jubiläums: Hundert Jahre Hauptgebäude der Universität. In: Nicolaysen (Hg.): Gedächtnisort (2011), S. 25–55. Zur Vorgeschichte der spät gegründeten Hamburger Universität: Jürgen Bolland: Die Gründung der „Hamburgischen Universität“, in: Universität Hamburg 1919–1969 [=Festschrift zum 50. Gründungstag der Universität Hamburg], o. O. o. J. [Hamburg 1970], S. 17–105; Rainer
36
Rainer Nicolaysen
syndikus, seit 1900 als Senator in Hamburg für das Unterrichtswesen zuständig, verstand die Universitätsgründung in der zweitgrößten Stadt Deutschlands als seine Lebensaufgabe, stieß damit aber bis zum Ende des Kaiserreichs in der nach ungleichem Zensuswahlrecht gewählten Bürgerschaft, dem Parlament der Stadtrepublik, auf mehrheitliche Abwehr. Das Vorlesungsgebäude mit seinen damals zwölf Hörsälen für 3.000 Hörerinnen und Hörer diente zunächst zwei Vorläufern der Universität, dem 1895 reorganisierten Allgemeinen Vorlesungswesen und dem 1908 etablierten Kolonialinstitut, als zentraler Veranstaltungsort. Auf den Stifter Siemers gehen der von ihm durchgesetzte zentrale Standort des Gebäudes auf der Moorweide zurück wie auch das Motto über dem Haupteingang: jenes „DER FORSCHUNG – DER LEHRE – DER BILDUNG“, das 1911 in Stein gemeißelt wurde und knapp hundert Jahre später, im Oktober 2010, Teil des Hamburger Universitätslogos geworden ist.6 Neuere Forschungen haben im Übrigen ergeben, dass das großzügige Geschenk an die Stadt in einem etwas anderen Licht als bisher gesehen werden muss, denn Siemers, selbst Mitglied der Finanzdeputation der Bürgerschaft, war 1905 wegen spekulativer Bereicherung ins Gerede gekommen; seine Aufsehen erregende Schenkung sollte in dieser Situation offenbar auch für positive Schlagzeilen sorgen.7 Als die „Hamburgische Universität“8 dann im Mai 1919 als erste demokratische Universitätsgründung in Deutschland eröffnet wurde,9 konnte sie nicht nur auf etlichen bereits bestehenden wissenschaftlichen Einrichtungen aufbauen, sie besaß also auch
6 7 8
9
Nicolaysen: Wissenschaft ohne Zentrum. Über das Ende des Akademischen Gymnasiums 1883 und den schwierigen Weg zur Gründung einer Universität 1919, in: Dirk Brietzke, Franklin Kopitzsch, Rainer Nicolaysen (Hg.): Das Akademische Gymnasium. Bildung und Wissenschaft in Hamburg 1613–1883 (=Hamburger Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte, Bd. 23), Berlin, Hamburg 2013, S. 213–235. Zu dieser Trias auch: Heinz-Elmar Tenorth: Universität in der Stadt – Wissenschaft für die Gesellschaft, in: Nicolaysen: Hauptgebäude (2012), S. 19–43. Johannes Gerhardt: Edmund Siemers – Unternehmer und Stifter (=Mäzene für Wissenschaft, Bd. 16), Hamburg 2014, S. 70–77, 138–161. In den knapp hundert Jahren ihrer Existenz hat die Universität drei Namen getragen: Der ihr bei Gründung verliehene Titel „Hamburgische Universität“ sollte mehr als den Standort, nämlich zudem eine – freilich unterschiedlich interpretierte – spezifische Ausprägung der neuen Einrichtung anzeigen. Ihr zweiter, ideologisch aufgeladener Name „Hansische Universität“, den sie auf Geheiß ihres nationalsozialistischen Rektors, des „Kolonialhistorikers“ Adolf Rein, seit Oktober 1935 trug, steht für die fundamentale Wandlung der Institution in der NS-Zeit, für eine Universität, die als Stätte freier Wissenschaft schon 1933 zu existieren aufgehört hatte. Ihren heutigen Namen erhielt die Hochschule, als sie im November 1945 von der britischen Besatzungsmacht wieder eröffnet wurde: schon angesichts der personellen Kontinuität im Lehrkörper keineswegs eine „Stunde Null“, aber doch ein von vielen empfundener Neuanfang, der in der nüchternen Bezeichnung „Universität Hamburg“ zum Ausdruck kommen sollte; als Überblick zur Hamburger Universitätsgeschichte: Rainer Nicolaysen: „Frei soll die Lehre sein und frei das Lernen“. Zur Geschichte der Universität Hamburg, Hamburg 2008. Zur Weimarer Zeit: Rainer Nicolaysen: Glanzvoll und gefährdet. Über die Hamburger Universität in der Weimarer Republik, in: Andocken. Hamburgs Kulturgeschichte 1848 bis 1933, hg. von Dirk Hempel und Ingrid Schröder unter Mitarbeit von Norbert Fischer, Anna-Maria Götz, Johanna Meyer-Lenz, Mirko Nottscheid, Myriam Richter und Bastian Weeke (=Beiträge zur Hamburgischen Geschichte, Bd. 4), Hamburg 2012, S. 114–131.
Ort universitären Erinnerns – das Hauptgebäude der Universität Hamburg
37
schon ein Hauptgebäude. In der mit knapp hundert Jahren recht kurzen, gleichwohl wechselvollen Geschichte der Hamburger Universität war das Hauptgebäude stets ihr Zentrum: von Funktion und Symbolwert her von besonderer Bedeutung für die Universität und über sie hinaus. Entsprechend steht es heute im Mittelpunkt auch der sichtbaren Auseinandersetzung der Universität Hamburg mit ihrer eigenen Geschichte – insbesondere durch das 2011 abgeschlossene Programm zur Benennung seiner heute noch sieben Hörsäle nach im „Dritten Reich“ vertriebenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern10 sowie durch die im April 2010 verlegten, von Mitgliedern der Universität durch Patenschaften finanzierten „Stolpersteine“ vor dem Hauptgebäude an der Edmund-Siemers-Allee.11 Begonnen wurden die Benennungen im Mai 1999, als zum 80. Universitätsgeburtstag der größte Hörsaal im Hauptgebäude den Namen Ernst-Cassirer-Hörsaal erhielt.12 Nach den Worten des damaligen Universitätspräsidenten Jürgen Lüthje sollte die Namensgebung „als Teil einer lebendigen universitären Erinnerungskultur“ verstanden werden.13 Es gehe darum, „die Erinnerung an unsere schwierige Tradition wach zu halten und die Vergangenheit der Universität mit all ihren Brüchen zu vergegenwärtigen“. Dies solle „nicht aufdringlich, aber sichtbar“ geschehen, „nicht inflationär, sondern sparsam ausgewählt“.14 Die Benennung des Hörsaals A nach dem Philosophen Ernst Cassirer, der selbst bis zu seiner Vertreibung 1933 im Hauptgebäude Vorlesungen gehalten hatte, wurde im Rahmen einer akademischen Gedenkfeier am 11. Mai 1999 vollzogen. Die gehaltenen Reden erschienen in der Reihe „Hamburger Universitätsreden“ als Band 1 der Neuen Folge. An den Türen des Hörsaals wurde der neue Name in goldenen Lettern sichtbar; drei Tafeln zur Erläuterung im Hörsaal stellen den Namensgeber seither in Bild und Text vor. Ebenso wurde später bei der Benennung der anderen Hörsäle verfahren. Diesem universitären Gedenken seit den 1990er Jahren war im Jahrzehnt zuvor die Erforschung der Hamburger Universitätsgeschichte in der NS-Zeit vorausgegangen. Das 1983 begonnene interdisziplinäre Forschungsprojekt zum „Hochschulalltag im ‚Dritten Reich‘“ mündete 1991 in das gleichnamige dreibändige Werk15 sowie die im selben Jahr gezeigte Ausstellung „ENGE ZEIT“, die erstmals systematisch den „Spuren Vertriebener und Verfolgter der Hamburger Universität“ nachging.16 Als 10 11 12 13 14 15 16
Nicolaysen: Gedächtnisort (2011). Rainer Nicolaysen: Alltägliches Erinnern. 10 Stolpersteine vor dem Hauptgebäude, in: UHH Hochschulmagazin, Ausgabe 2, Mai 2010, S. 10–13. Zum Gedenken an Ernst Cassirer (1874–1945). Ansprachen auf der Akademischen Gedenkfeier am 11. Mai 1999 (=Hamburger Universitätsreden N.F., Bd. 1), Hamburg 1999. Jürgen Lüthje: Verneigung vor Ernst Cassirer. Rede aus Anlaß der Benennung des Hörsaals A im Hauptgebäude der Universität Hamburg in Ernst Cassirer-Hörsaal am 11. Mai 1999, in: Ebd., S. 10–15, hier S. 12. Ebd., S. 11f. Eckart Krause, Ludwig Huber, Holger Fischer (Hg.): Hochschulalltag im „Dritten Reich“. Die Hamburger Universität 1933–1945. 3 Teile (=Hamburger Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte, Bd. 3), Berlin, Hamburg 1991. Angela Bottin unter Mitarbeit von Rainer Nicolaysen: ENGE ZEIT. Spuren Vertriebener und Verfolgter der Hamburger Universität (=Hamburger Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte, Bd. 11), Berlin, Hamburg 1992 [zuerst Ausstellungskatalog, Hamburg 1991].
38
Rainer Nicolaysen
Eckart Krause, der Koordinator des „Hochschulalltag“-Projekts, in einem Aufsatz 1997 „den langen Weg der Universität Hamburg zu ihrer Geschichte im ‚Dritten Reich‘“ nachzeichnete, konnte er betonen, „die“ Universität Hamburg zeige sich inzwischen „auch der unbequemen Wahrheit verpflichtet“.17 Weitere Detailuntersuchungen standen damals und stehen in verringertem Maße heute noch aus, auch biographische Studien zu Hamburger Gelehrten. Selbst Ernst Cassirer wurde erst mit erheblicher Verzögerung (wieder)entdeckt.18 Die Universität Hamburg trug zu dieser internationalen „Cassirer-Renaissance“ nicht unerheblich bei: Im Jahre 1995 veranstaltete sie eine Ringvorlesung zum 50. Todestag ihres ehemaligen Rektors;19 1996 wurde die Einrichtung einer jährlichen Ernst-CassirerGastprofessur beschlossen, die 1998 erstmals besetzt wurde; im selben Jahr vor allem begann in der Ernst-Cassirer-Arbeitsstelle der Universität Hamburg die Arbeit an der „Hamburger Ausgabe“ aller seiner zu Lebzeiten veröffentlichten Werke. Diszipliniert vorangetrieben, konnte sie 2009 in 25 Bänden und einem Registerband abgeschlossen werden.20 Die Benennung des Hörsaals A im Hauptgebäude der Universität Hamburg nach Ernst Cassirer lag 1999 also nahe: Cassirer, einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, hatte einen maßgeblichen Teil seines Werkes in den Hamburger Jahren seit 1919 verfasst, die mit seiner Vertreibung als Jude im Jahre 1933 abrupt beendet wurden. Die Universität Hamburg ehrte mit der Benennung mithin einen ihrer größten Denker; sie übernahm zugleich Verantwortung dafür, dass seine Ausgrenzung und Entlassung – wie die anderer in der NS-Zeit vertriebener Gelehrter – und damit auch das Versagen der Universität und vieler ihrer Angehöriger dauerhaft im Gedächtnis bleiben.21
17
Eckart Krause: Auch der unbequemen Wahrheit verpflichtet. Der lange Weg der Universität Hamburg zu ihrer Geschichte im „Dritten Reich“, in: Peter Reichel (Hg.): Das Gedächtnis der Stadt. Hamburg im Umgang mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit (=Schriftenreihe der Hamburger Kulturstiftung, Bd. 6), Hamburg 1997, S. 187–217. 18 Zur Biographie: Thomas Meyer: Ernst Cassirer (Hamburger Köpfe), Hamburg 2006; Birgit Recki: Eine Philosophie der Freiheit – Ernst Cassirer in Hamburg, in: Nicolaysen (Hg.): Gedächtnisort (2011), S. 57–80. 19 Dorothea Frede/Reinold Schmücker (Hg.): Ernst Cassirers Werk und Wirkung. Kultur und Philosophie, Darmstadt 1997. 20 Ernst Cassirer: Gesammelte Werke. Hamburger Ausgabe in 25 Bänden und einem Registerband, hg. von Birgit Recki, Hamburg 1998–2009. 21 Im März 1995 hatte der grüne Bürgerschaftsabgeordnete Willfried Maier in einem Brief an Universitätspräsident Jürgen Lüthje sogar vorgeschlagen, die Universität nach Ernst Cassirer zu benennen. Berechtigte Bedenken, der Name „Ernst-Cassirer-Universität“ könnte als wohlfeiler Wiedergutmachungsversuch Nachgeborener und allzu starke Vereinnahmung des Philosophen verstanden werden, führten dazu, die Idee bald wieder fallenzulassen. Eine solche Namensgebung hätte wohl auch einen im Ganzen von einer Institution kaum einlösbaren Anspruch formuliert. Die Edition von Cassirers Werken in einer Hamburger Ausgabe und die Benennung des größten Hörsaals im Hauptgebäude der Universität erwiesen sich dann als angemessenere Würdigung. Vgl. „Zur Besinnung auf die Bedeutung von Ernst Cassirer“. Als Namensgeber für die Universität?, in: uni hh. Berichte und Meinungen aus der Universität Hamburg 26 (3/1995), S. 4; Korrespondenz zum Vorgang in der Universität Hamburg, Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte.
Ort universitären Erinnerns – das Hauptgebäude der Universität Hamburg
Abb. 3 Ernst Cassirer (1874 – 1945)
39
Abb. 4 Ernst-Cassirer-Hörsaal heute
Die erste Benennung eines Hörsaals fiel nicht nur generell in die Zeit eines deutschlandweit expandierenden Gedenk- und Erinnerungsdiskurses, sie ist auch ganz konkret im Kontext der Erweiterung und Renovierung des Hauptgebäudes zu sehen. Neben der Errichtung der Flügelbauten, die 1994 anlässlich des 75. Jahrestages der Universitätsgründung gestiftet worden waren22 und 1998 (West-Flügel) bzw. 2002 (Ost-Flügel) fertig gestellt wurden, begann auch die grundsätzliche Sanierung des Hauptgebäudes. Nachdem die Renovierung des Ernst-Cassirer-Hörsaals im Herbst 2000 abgeschlossen war, wurde 2002 eine mit Sonderinvestitions- und Stiftungsmitteln stufenweise durchgeführte Neugestaltung des Gebäudes in Angriff genommen, in deren Rahmen bis Ende 2007 alle Hörsäle renoviert und modernisiert waren, womit nicht zuletzt ein würdiges Ambiente für die Namensgebungen geschaffen wurde.23 Noch im Jahr der Benennung des Hörsaals A nach Ernst Cassirer wurde der zweitgrößte Hörsaal B im November 1999 nach Agathe Lasch benannt, die 1923 erste Hamburger Professorin und zugleich erste Germanistik-Professorin in Deutschland geworden war.24 Die Benennung der drei mittleren Hörsäle C, M und J folgte in den 22 Die Stiftung geht auf das Bauunternehmer-Ehepaar Helmut und Hannelore Greve zurück. 23 Zur Neugestaltung: Lüthje, Siemers: Vorlesungsgebäude (2004); sowie im größeren Kontext: Michael Holtmann unter Mitarbeit von Eckart Krause: Die Universität Hamburg in ihrer Stadt. Bauten, Orte und Visionen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Hamburg 2009. 24 Zum Gedenken an Agathe Lasch (1879–1942?). Reden aus Anlass der Benennung des Hörsaals B
40
Rainer Nicolaysen
Jahren 2000, 2005 und 2006 – nach dem Kunsthistoriker Erwin Panofsky,25 dem Mathematiker Emil Artin26 und der Juristin Magdalene Schoch.27 Die zwischenzeitliche Pause von fünf Jahren war dem Abwarten der jeweiligen Renovierungsarbeiten und deren Finanzierung geschuldet. Eine erneute Pause trat mit dem Amtsantritt der Stuttgarter Professorin für Raumtransporttechnologie Monika Auweter-Kurtz als Präsidentin der Universität Hamburg im November 2006 ein, als Pläne zur Verlagerung der Universität auf den Kleinen Grasbrook im Hafen die Zukunft des Hauptgebäudes überhaupt in Frage stellten. Die schon mit den Fakultäten vereinbarte Benennung der noch verbliebenen kleineren Hörsäle H und K nach dem Sozialökonomen Eduard Heimann28 sowie dem Völkerrechtler Albrecht Mendelssohn Bartholdy29 ließ so lange auf sich warten, dass Studierende im Juni 2009 eine eigene kleine Benennungsfeier durchführten – mit provisorischen Namensschildern und gehaltvollen Vorträgen zu beiden Namensgebern. Das studentische Engagement wurde vom damaligen Vizepräsidenten Holger Fischer in einem kurzen Schlusswort ausdrücklich gelobt, die offizielle Benennungsfeier angekündigt. Durchgeführt wurde sie zwei Jahre später, am 13. Mai 2011, im Rahmen der Festveranstaltung „100 Jahre Hauptgebäude“30 – nun unter der Ägide des seit März 2010 amtierenden Präsidenten Dieter Lenzen, der sich für einen „Weg der bekennenden Erinnerung“ ausgesprochen hat.31
25
26
27
28 29
30 31
im Hauptgebäude der Universität Hamburg in Agathe-Lasch-Hörsaal am 4. November 1999 (=Hamburger Universitätsreden N.F., Bd. 2), Hamburg 2002; zur Biographie: Christine M. Kaiser: Agathe Lasch. Erste Germanistikprofessorin Deutschlands (=Jüdische Miniaturen, Bd. 63), Teetz, Berlin 2007; Ingrid Schröder: „…den sprachlichen Beobachtungen geschichtliche Darstellung geben“ – die Germanistikprofessorin Agathe Lasch, in: Nicolaysen (Hg.): Gedächtnisort (2011), S. 81–111. Eckart Krause, Rainer Nicolaysen (Hg.): Zum Gedenken an Erwin Panofsky (1892–1968). Reden aus Anlass der Benennung des Hörsaals C im Hauptgebäude der Universität Hamburg in ErwinPanofsky-Hörsaal am 20. Juni 2000 (=Hamburger Universitätsreden N.F., Bd. 17), Hamburg 2009; zur Biographie: Rainer Donandt: Erwin Panofsky – Ikonologe und Anwalt der Vernunft, in: Nicolaysen: Gedächtnisort (2011), S. 113–140. Zum Gedenken an Emil Artin (1898–1962). Reden aus Anlass der Benennung des Hörsaals M im Hauptgebäude der Universität Hamburg in Emil Artin-Hörsaal (=Hamburger Universitätsreden N.F., Bd. 9), Hamburg 2006; zur Biographie: Karin Reich: Emil Artin – Mathematiker von Weltruf, in: Nicolaysen: Gedächtnisort (2011), S. 141–170. Eckart Krause, Rainer Nicolaysen (Hg.): Zum Gedenken an Magdalene Schoch (1897–1987). Reden aus Anlass der Benennung des Hörsaals J im Hauptgebäude der Universität Hamburg in Magdalene-Schoch-Hörsaal am 15. Juni 2006 (=Hamburger Universitätsreden N.F., Bd. 16), Hamburg 2008; zur Biographie: Rainer Nicolaysen: Für Recht und Gerechtigkeit. Über das couragierte Leben der Juristin Magdalene Schoch (1897–1987), in: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 92 (2006), S. 113–143; ders.: Konsequent widerstanden – die Juristin Magdalene Schoch, in: Nicolaysen: Gedächtnisort (2011), S. 171–198. Zur Biographie: Heinz Rieter: Eduard Heimann – Sozialökonom und religiöser Sozialist, in: Nicolaysen: Gedächtnisort (2011), S. 229–259. Rainer Nicolaysen: Albrecht Mendelssohn Bartholdy (1874–1936). Jurist – Friedensforscher – Künstler, in: Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 75 (1/2011), S. 1–31; ders.: Verfechter der Verständigung – der Jurist und Friedensforscher Albrecht Mendelssohn Bartholdy, in: Nicolaysen: Gedächtnisort (2011), S. 199–227. Nicolaysen: 100 Jahre Hauptgebäude (2012). Rede des Präsidenten der Universität Hamburg, Prof. Dr. Dieter Lenzen, anlässlich der Verlegung der Stolpersteine am 22.4.2010 vor dem Hauptgebäude der Universität Hamburg (online
Ort universitären Erinnerns – das Hauptgebäude der Universität Hamburg
41
Abb. 5 Erläuterungstafeln im Agathe-Lasch-Hörsaal
Als das Benennungsprogramm 1999 begonnen wurde, gab es kein Konzept, das sieben Namensgeberinnen und Namensgeber bereits festgelegt hätte.32 Neben der eigenen Schlüssigkeit jeder einzelnen nach und nach erfolgten Benennung lassen sich dennoch auch übergeordnete Faktoren für die jeweilige Entscheidung ausmachen – wie die Berücksichtigung von drei der früher vier Fakultäten: Ernst Cassirer, Agathe Lasch und Erwin Panofsky gehörten der Philosophischen, Emil Artin der MathematischNaturwissenschaftlichen, Magdalene Schoch, Albrecht Mendelssohn Bartholdy und Eduard Heimann der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät an. Unberücksichtigt blieb einzig die Medizinische Fakultät, die im Stadtteil Eppendorf über eine eigene topographische Identität verfügt. Fünf der sieben Vertriebenen wurden 1933/34 als – nach NS-Terminologie – „Nichtarier“ entlassen: Cassirer, Lasch, Panofsky, Mendelssohn Bartholdy und Heimann,
32
verfügbar unter: http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/pr/reden/2010–04–22.pdf; zuletzt abgerufen am 10.3.2016). Einen Einblick in den Entscheidungsprozess der Hörsaalbenennungen gibt Eckart Krause: Dokumentation: Zur Entstehung der Namensgebung des Magdalene-Schoch-Hörsaals, in: Krause, Nicolaysen: Schoch (2008), S. 81–91.
42
Rainer Nicolaysen
Letzterer zudem als Sozialdemokrat.33 Artins Entlassung folgte 1937 wegen seiner „halbjüdischen“ Ehefrau. Im selben Jahr kündigte Magdalene Schoch ihre Stelle, weil sie nicht bereit war, sich den geforderten Alltagsanpassungen zu beugen. Ein weites Spektrum zeigen auch die sieben Lebenswege nach der Vertreibung: Agathe Lasch gelang als einziger die betriebene Emigration nicht, sie wurde 1942 deportiert und ermordet; Mendelssohn Bartholdy und Cassirer starben im britischen bzw. schließlich US-amerikanischen Exil; Artin und, als Emeritus, Heimann zählten nach 1945 zu den wenigen Remigranten der Hamburger Universität; Schoch und Panofsky lehnten eine Rückkehr ausdrücklich ab.34 Die Auswahl der sieben von der Hamburger Universität in der NS-Zeit vertriebenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die Benennung der Hörsäle ist jeweils in mehrfacher Hinsicht, auch hinsichtlich ihrer Werke, wohlbegründet. Aber auch andere Gelehrte wären für eine Namensgebung in Betracht gekommen, und nicht zu Unrecht wird mancher etwa einen Otto-Stern- oder einen William-Stern-Hörsaal im Hauptgebäude vermissen. Beider wird andernorts im universitären Alltag gedacht, weiteren NS-Verfolgten wie dem Germanisten und Nestor der Exilforschung Walter A. Berendsohn ebenfalls.35 All diese gerade in den letzten Jahren vermehrten Bemühungen um eine „Erinnerungsarbeit“ werfen nicht nur bezogen auf die Universität Hamburg die Frage ihrer Angemessenheit auf. Steckt nicht immer auch ein Stück Anmaßung und Vereinnahmung in der Entscheidung, einen Ort nach einer verstorbenen Person zu benennen? Wäre diese Form – nicht selten unpassend als „Zurückholung“ der Ausgegrenzten und Vertriebenen bezeichnet – überhaupt im Sinne der Namensgeber gewesen? Derlei Zweifel können nicht ausgeräumt, durch Stimmen Angehöriger aber vielleicht relativiert werden. Nach seinem Besuch in Hamburg im Jahre 2005 dankte aus Massachusetts Richard Panofsky dafür, dass der Name seines berühmten Großvaters, der sich außerstande gesehen hatte, sein „Paradise lost“ nach 1945 auch nur einmal noch zu betreten, durch die Hörsaalbenennung an seiner alten Wirkungsstätte präsent sei.36 Ähnlich äußerte sich Magdalene Schochs Neffe und Patensohn, der in Arlington/ Virginia lebende Jazzmusiker Lennie Cujé, als er im Rahmen der Benennungsfeier im Juni 2006 über seine Tante berichtete.37 Die Benennungen sind keine temporären Erscheinungen, sondern bewusste und sichtbare Festlegungen durch die Institution, eine Verpflichtung nicht nur zum 33
34 35 36 37
Zur Entlassungswelle 1933: Rainer Nicolaysen: Das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933 und seine Umsetzung an der Hamburger Universität, in: ders. (Hg.): Auch an der Universität – Über den Beginn von Entrechtung und Vertreibung vor 80 Jahren. Reden der zentralen Gedenkveranstaltung der Universität Hamburg im Rahmen der Reihe „Hamburg erinnert sich 2013“ am 8. April 2013 (=Hamburger Universitätsreden N. F., Bd. 19), Hamburg 2014, S. 27–51. Rainer Nicolaysen: Die Frage der Rückkehr. Zur Remigration Hamburger Hochschullehrer nach 1945, in: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 94 (2008), S. 117–152. Rainer Nicolaysen: Einleitung, in: ders.: Gedächtnisort (2011), S. 9–24, hier S. 16–18. Richard Panofsky an Eckart Krause, 5.7.2005, Universität Hamburg, Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte. Lennie Cujé: Dankesworte. In: Krause, Nicolaysen: Schoch (2008), S. 63–65.
Ort universitären Erinnerns – das Hauptgebäude der Universität Hamburg
Abb. 6 Tür zum Magdalene-Schoch-Hörsaal
Abb. 7 Magdalene Schoch (1897 – 1987), vor der Emigration 1937
43
44
Rainer Nicolaysen
Gedenken, sondern auch zum weiteren kritischen Umgang der Universität mit der eigenen Vergangenheit. Die Wahrnehmung von Namen, Fotos und Erläuterungen in den Hörsälen sickern in den universitären Alltag ein, und wer dieser Zeichen einmal gewahr wurde, wird sie stets wieder sehen. So etwa lautete die Aussage von Studierenden des Hauptseminars „90 Jahre Universität Hamburg“ im Sommersemester 2009, die einen historischen Campus-Rundgang erarbeiteten und ihre Universität seither anders wahrnehmen als zuvor. Erstaunt über die vielen Spuren Hamburger Universitätsgeschichte, entdeckten sie unterschiedliche Formen öffentlichen Erinnerns: von Namensgebungen über Gedenkplatten, Büsten und Stolpersteinen bis hin zu Wandmalerei und Bodenmosaik – besonders verdichtet durch die topographische Einbettung der Universität Hamburg in das ehemalige jüdische Grindelviertel und dessen Gedenkorte.38 Seit 2010 erinnern zudem erst zehn, inzwischen elf „Stolpersteine“ vor dem Hauptgebäude an NS-Opfer der Hamburger Universität: an vier Gelehrte, die in verzweifelter Lage nur noch die Möglichkeit des Suizids sahen: an die Pädagogin und Psychologin Martha Muchow, die Juristen Kurt Perels und Gerhard Lassar sowie den Dermatologen Ernst Delbanco; an drei Opfer des Holocaust: neben Agathe Lasch an die Arabistin Hedwig Klein und den Musikwissenschaftler Raphael Broches; und an die vier studentischen Toten der „Hamburger Weißen Rose“ Hans Leipelt, Margaretha Rothe, Friedrich Geussenhainer und Reinhold Meyer.39 Mit den Hörsaalbenennungen und den „Stolpersteinen“ weist das UniversitätsHauptgebäude heute eine besondere Verdichtung von Erinnerungsformen auf, und das Gebäude selbst ist ein Erinnerungsort, denn seit Gründung der Universität ist es Bühne für viele Ereignisse gewesen. Im Hörsaal A, dem heutigen Ernst-Cassirer-Hörsaal, hielt Albert Einstein im Juli 1920 seinen Vortrag „Grundlagen der Relativitätstheorie“;40 im Juli 1930 fand hier die einzige Verfassungsfeier der Hamburger Universität in der Weimarer Republik statt, die der 1929/30 amtierende Rektor Cassirer gegen große Widerstände von Lehrenden und Studierenden durchgesetzt hatte,41 und eben hier trat Thomas Mann im Juni 1953 erstmals nach seiner Emigration wieder in Norddeutschland auf, als er seine berühmte „Ansprache vor Hamburger Studenten“ hielt und aus dem Felix-Krull-Fragment las.42 Im selben Hörsaal hatten in den 1920er 38
Der Geschichte auf der Spur. Ein Rundgang zur Geschichte der Universität Hamburg und zum ehemaligen jüdischen Viertel am Grindel in zwölf Stationen. Zusammengestellt von Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Hauptseminars „90 Jahre Universität Hamburg“. Redaktion: Rainer Nicolaysen und Eckart Krause, Hamburg 2009. 39 Nicolaysen: Erinnern (2010). 40 Karin Reich: Einsteins Vortrag über Relativitätstheorie an der Universität Hamburg am 17.7.1920. Vorgeschichte, Folgen, in: Mitteilungen der Mathematischen Gesellschaft in Hamburg 19 (2000), S. 51–68; vgl. dazu auch Cassirers Auseinandersetzung mit dem Thema, zum Teil im Austausch mit Einstein: Ernst Cassirer: Zur Einstein’schen Relativitätstheorie. Erkenntnistheoretische Betrachtungen, Berlin 1921 (jetzt als Bd. 10 der Gesammelten Werke, Hamburg 2001). 41 Rainer Nicolaysen: Plädoyer eines Demokraten. Ernst Cassirer und die Hamburgische Universität 1919 bis 1933, in: Philosophie und Gestalt der Europäischen Universität. Akten der Internationalen Fachtagung Budapest, vom 6. bis 9. November 2003, hg. von István M. Fehér und Peter L. Oesterreich (=Schellingiana, Bd. 18), Stuttgart, Bad Cannstatt 2008, S. 285–328. 42 Rainer Nicolaysen: Auf schmalem Grat. Thomas Manns Hamburg-Besuch im Juni 1953, in: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 101 (2015), S. 115–161.
Ort universitären Erinnerns – das Hauptgebäude der Universität Hamburg
Abb. 8 Selbstgleichschaltung der Hamburger Universität im Hörsaal A des Hauptgebäudes (1. Mai 1933)
45
Abb. 9 „Stolpersteine“ vor dem Hauptgebäude der Universität (22. April 2010)
Jahren die rückwärtsgewandten Reichsgründungsfeiern stattgefunden,43 hier hatte sich die Hamburgische Universität in einem Festakt am 1. Mai 1933 emphatisch zu Adolf Hitler als ihrem „Führer“ bekannt, hier wurden später gemeinschaftlich die HitlerReden im Radio angehört, hier wurde Reichserziehungsminister Rust empfangen.44 Wie der Ort selbst lässt sich auch die „Erinnerungskultur“ der Hamburger Universität durch Ambivalenzen kennzeichnen, was insbesondere dann deutlich wird, wenn man sich inzwischen verschwundene oder veränderte „Erinnerungsorte“ vergegenwärtigt. So stand östlich vor dem Hauptgebäude jahrzehntelang das Denkmal des Afrikaforschers und „Kolonialhelden“ Hermann von Wissmann.45 Von 1909 bis 1918 hatte es in Daressalam in der einstigen Kolonie Deutsch-Ostafrika gestanden; nach dem „Verlust“ der deutschen Kolonien durch den Versailler Vertrag wurde es im November 1922 mit großem Zeremoniell am Hauptgebäude der Hamburgischen 43
Anton F. Guhl: Die Reichsgründungsfeiern der Hamburgischen Universität in der Weimarer Republik. Zum Problem des 18. Januar und dem gescheiterten Versuch, ihn republikanisch umzudeuten, in: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 96 (2010), S. 71–100. 44 Rainer Nicolaysen: Geistige Elite im Dienste des „Führers“. Die Universität zwischen Selbstgleichschaltung und Selbstbehauptung, in: Hamburg im „Dritten Reich“, hg. von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, Göttingen 2005, S. 336–356. 45 Joachim Zeller: „Deutschlands größter Afrikaner“. Zur Geschichte der Denkmäler für Hermann von Wißmann, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 44 (1996), S. 1089–1111; ders.: Monumente für den Kolonialismus. Kolonialdenkmäler in Hamburg, in: Heiko Möhle (Hg.): Branntwein, Bibeln und Bananen. Der deutsche Kolonialismus in Afrika – eine Spurensuche, Hamburg 1999, S. 131–136; ders.: Kolonialdenkmäler und Geschichtsbewußtsein. Eine Untersuchung der kolonialdeutschen Erinnerungskultur, Frankfurt a. M. 2000; Krause: Aufklärung (2002), S. 64–68.
46
Rainer Nicolaysen
Universität eingeweiht.46 Passend erschien dieser Ort insofern, als in dem Gebäude bis 1919 das Kolonialinstitut beheimatet gewesen war,47 und noch im Hochschulgesetz von 1921 war der Universität die Aufgabe zugewiesen worden, „besonders für die Förderung der Auslands- und Kolonialkunde zu sorgen“.48 Das „Koloniale“ in dieser Formulierung hatte unverdrossen – drei Jahre nach dem Weltkrieg – die Deutsche Demokratische Partei durchgesetzt, da selbst die Liberalen sich nicht „zu dem Glauben entschließen“ konnten (und wollten), „daß wir auf ewig ein Reich ohne Kolonien sein werden“.49
Abb. 10 Kolonialrevisionistische Feier am Wissmann-Denkmal (um 1923)
46 Neben Berlin war Hamburg das wichtigste Zentrum des deutschen Kolonialismus. Die (post) koloniale Geschichte der Stadt wird jetzt in der 2014 durch Senatsbeschluss an der Universität Hamburg errichteten Forschungsstelle „Hamburgs (post-)koloniales Erbe/Hamburg und die frühe Globalisierung“ systematisch erforscht, womit die wissenschaftliche Grundlage auch für ein stadtweites Erinnerungskonzept zur Kolonialgeschichte erarbeitet werden soll. 47 Jens Ruppenthal: Kolonialismus als „Wissenschaft und Technik“. Das Hamburgische Kolonialinstitut 1908 bis 1919 (=Historische Mitteilungen, Beihefte, Bd. 66), Stuttgart 2007; ders.: Das Hamburgische Kolonialinstitut und die Kolonialwissenschaften, in: Jürgen Zimmerer (Hg.): Kein Platz an der Sonne. Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte, Frankfurt a. M./ New York 2013, S. 257–269. 48 Hochschulgesetz vom 4.2.1921, in: Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1921, S. 65–76, hier S. 66. 49 So formulierte es der DDP-Abgeordnete Curt Platen in: Vierte Sitzung der Bürgerschaft, 14.1.1919, Stenographische Berichte über die Sitzungen der Bürgerschaft zu Hamburg im Jahre 1921, Hamburg o. J., S. 105–140, hier S. 121f. Im Entwurf des bürgerschaftlichen Universitätsausschusses hatte es noch „Förderung der Auslandstudien“ geheißen.
Ort universitären Erinnerns – das Hauptgebäude der Universität Hamburg
47
Der Kolonialbewegung diente das Wissmann-Denkmal als Mahnmal und Versammlungsort; in kurzer Zeit entwickelte es sich zu einer „der wichtigsten Kultstätten“ in Deutschland, an der „der organisierte Kolonialrevisionismus zusammenkam, um den Kolonialgedanken öffentlichkeitswirksam zu pflegen“.50 In der NS-Zeit blieb es Anlaufpunkt für Gedenkfeiern und wurde 1935 durch das Standbild des „deutschen Kamerunhelden“ Hans Dominik auf der gegenüberliegenden westlichen Seite des Hauptgebäudes noch ergänzt. Als 1942 das Wissmann-Denkmal zur Verstärkung der Metallreserve eingeschmolzen werden sollte, wusste der amtierende Rektor, der Pharmakologe Eduard Keeser, dies mit dem Hinweis auf die politische Bedeutung der „Weihestätte“ zu verhindern.51 Erst ein Luftangriff am 14. April 1945 stürzte Wissmann schließlich vom Sockel. In der Nachkriegszeit wurde die Chance, sich des Wissmann-Denkmals zu entledigen, nicht genutzt, stattdessen wurde die Statue restauriert und im Jahre 1949 wieder aufgestellt – ein restaurativer Akt in der frühen Bundesrepublik. Erst die Studentenbewegung holte Wissmann endgültig vom Sockel; in seinem Roman „Heißer Sommer“ hat Uwe Timm diesen Denkmalsturz literarisch verarbeitet.52 Nachdem zwei Versuche im August und September 1967 noch vergeblich gewesen waren, gelang die studentische Aktion am 31. Oktober 1968 – jetzt getragen vom einmütigen Beschluss des Studentenparlaments.53 An eine Wiederaufstellung dachte danach offenbar niemand mehr. Die Statuen von Wissmann und Dominik, Repräsentanten einer deutschen Kolonialvergangenheit und -sehnsucht, wurden in einem Kellerraum der Bergedorfer Sternwarte eingelagert. In kritischer Absicht hervorgeholt wurde das Wissmann-Denkmal 1986 für die Ausstellung „Männersache“ des Museumspädagogischen Dienstes Hamburg sowie noch einmal 2004/2005, als die finnische Interventionskünstlerin HMJokinen es im Rahmen des Projekts „Afrika-Hamburg“ vierzehn Monate lang an den St. Pauli-Landungsbrücken präsentierte, um zur Diskussion über koloniale Vergangenheiten anzuregen; begleitet von Veranstaltungen, Kunstperformances und Schulaktionen wurde eine offene Webseite geschaltet, auf der Diskussionsbeiträge eingetragen werden konnten.54
50 51 52 53 54
Zeller: „Deutschlands größter Afrikaner“ (1996), S. 1100. Ebd., S. 1103f. Uwe Timm: Heißer Sommer, München, Gütersloh, Wien 1974, zweiter Teil, Kapitel drei. Zeller: „Deutschlands größter Afrikaner“ (1996), S. 1106f. Gordon Uhlmann: Das Hamburger Wissmann-Denkmal. Von der kolonialen Weihestätte zum postkolonialen Debatten-Mahnmal, in: Ulrich von der Heyden, Joachim Zeller (Hg.): Kolonialismus hierzulande. Eine Spurensuche in Deutschland, Erfurt 2007, S. 281–285.
48
Rainer Nicolaysen
Abb. 11 Das Wissmann-Denkmal beim Sturzversuch am 8. August 1967
Abb. 12 „Entsorgung“ des Wissmann-Denkmals im Keller der Hamburger Sternwarte
So berechtigt die Entfernung des Wissmann-Denkmals im Oktober 1968 gewesen war, so unangemessen war ein anderer erinnerungspolitischer Eingriff von Studierenden im Mai 1977. Bei einem „Go-in“, an dem im Anschluss an eine studentische Vollversammlung im Auditorium maximum etwa 1.500 Personen teilnahmen, wurde die Bronzebüste Werner von Melles aus dem Foyer des Hauptgebäudes entwendet. Anschließend zertrümmerten Mitglieder der Sozialistischen Studentengruppe (SSG) – der Studentengruppe des Kommunistischen Bundes Westdeutschland (KBW) – die 1924 von Friedrich Wield geschaffene Büste des „Inaugurator universitatis“, für sie ein „Imperialistenidol“, und versteigerten die Einzelteile für den „bewaffneten Befreiungskampf des Zimbabweschen Volkes“.55 Dass sie damit das Werk eines Künstlers zerstörten, der sich im „Dritten Reich“ wegen der Behinderung seiner Arbeit das Leben genommen hatte,56 spielte bei diesem Aktionismus keine Rolle. Nachdem sich im Hamburger Rathaus ein allerdings nicht fertig bearbeitetes Zweitstück der Büste gefunden hatte, gelang es durch einen Spendenaufruf des Präsidiums einen Nachguss zu finanzieren, der seither im Foyer des Hauptgebäudes aufgestellt ist.57 55
Joachim Buttler: Von Melles Auge. Ein Denkmalsturm an der Hamburger Universität, in: Martin Warnke (Hg.): Politische Kunst. Gebärden und Gebahren, Berlin 2004, S. 121–135; zu Werner von Melle als Reaktion auf die Zerstörung seiner Büste: Gerhard Ahrens: Werner von Melle und die Hamburgische Universität, in: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 66 (1980), S. 63–93. 56 Bildhauer Wield 1880–1940. Ein Gedenkbuch. Hg. von Hugo Sieker. Mit einem Geleitwort von Erich Lüth (=Veröffentlichung der Lichtwark-Stiftung Hamburg, Bd. 14), Hamburg 1975. 57 An alle Mitglieder der Universität Hamburg: Aufruf zu einer Spendenaktion, in: uni hh. Berichte und Meinungen aus der Universität Hamburg 8 (3/1977), S. 26; Aufruf wiederholt ebd. (4/1977), S. 28.
Ort universitären Erinnerns – das Hauptgebäude der Universität Hamburg
49
Abb. 13 Nachguss der Bronzebüste Werner von Melles (1979) im Foyer des Hauptgebäudes
Ein dritter Fall studentischer Intervention ist wiederum anders gelagert und betrifft die Büste des Meteorologen Albert Wigand. Im Schulterschluss mit den nationalsozialistischen Studenten hatte Wigand als Rektor des Amtsjahres 1931/32 für einen radikalen Rechtsruck der Hamburgischen Universität gesorgt.58 Nachdem er im Dezember 1932 fünfzigjährig gestorben war, spendete die Studentenvertretung der Universität die Wigand-Büste zur erwähnten Feierstunde am 1. Mai 1933, in der sich die Universität selbst gleichschaltete. Die Büste trug damals eine Widmungsplakette mit der Aufschrift „Ihrem Führer und Rektor – Die Hamburger Studentenschaft“.59 Das Überleben der Wigand-Büste bis heute ist auf eine Entscheidung der DekaneKonferenz im Januar 1968 zurückzuführen. Sie verfügte deren sichernde Einlagerung in der Hochschule für Bildende Künste. Die Wiederaufstellung erfolgte 1981. Noch Anfang 2007 war sie in einer der Nischen im Foyer des Hauptgebäudes aufgestellt – ihr gegenüber die Büste des Anglisten Emil Wolff, der 1945 erster Nachkriegsrektor der Universität geworden war. Die Gegenüberstellung eines Wegbereiters des Nationalsozialismus und eines oppositionell Gesinnten hätte erinnerungspolitisch durchaus Sinn ergeben, wäre diese Konstellation durch eine Erläuterung kenntlich gemacht worden. Da dies jedoch über viele Jahre hinweg unterblieb, rissen schließlich 58 59
Barbara Vogel: Anpassung und Widerstand. Das Verhältnis Hamburger Hochschullehrer zum Staat 1919 bis 1945, in: Krause, Huber, Fischer: Hochschulalltag (1991), T. 1, S. 3–83, hier S. 39–41. Dazu die zeitgenössische Presseberichterstattung, z. B.: „Ihrem Führer und Rektor die Hamburger Studentenschaft“, in: Hamburger Nachrichten v. 26.4.1933; Prof. Wigand zum Gedächtnis. Enthüllung einer Büste am 1. Mai, in: Hamburgischer Correspondent vom 25.4.1933.
50
Rainer Nicolaysen
Studierende die Büste mit Hilfe eines Seils aus ihrer Verankerung und hängten sie mit der Forderung der Einschmelzung an die Tür der Universitätspräsidentin.60 Nach einer Restaurierung wurde die Büste versehentlich wieder aufgestellt und kurz darauf ein weiteres Mal demontiert. Seither gehört sie zur Realia-Sammlung der Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte. Bei den historischen Campus-Rundgängen lässt sich in der verwaisten Nische im Foyer nur noch haptisch erkunden, dass hier einmal eine Büste verankert war, und erklären, dass nicht nur das Sichtbare, sondern auch das nicht mehr Sichtbare Quellenwert besitzen kann. Die hier genannten Beispiele zeigen einige Facetten des Umgangs mit dem ambivalenten Erinnerungsort „Hauptgebäude der Universität Hamburg“. Neben den in den letzten Jahren ebenso behutsam wie konsequent etablierten Elementen, den Hörsaalbenennungen und den „Stolpersteinen“, und neben den ausstehenden Gestaltungen, insbesondere im Foyer, gibt es im Ensemble Hauptgebäude auch ungeplante, aber nicht zufällige Konstellationen einer sich verdichtenden städtischen Erinnerungskultur: An der Ostseite des Hauptgebäudes erinnert das 1984 dorthin versetzte Denkmal Johann Georg Büschs an einen tätigen Aufklärer des 18. Jahrhunderts, Professor am Akademischen Gymnasium und Begründer des Allgemeinen Vorlesungswesens, beides Vorläufer der Universität; westlich des Hauptgebäudes verweist das 1983 errichtete Mahnmal am erst 1989 so benannten Platz der Jüdischen Deportierten darauf, dass hier, in aller Öffentlichkeit und in unmittelbarer Nähe zur Universität, von Oktober bis Dezember 1941 die vier ersten und größten Deportationen Hamburger Juden in die Vernichtung begonnen haben. Treffend ist das Hauptgebäude daher als ein historisch aufgeladener Ort im Spannungsfeld von Aufklärung und Barbarei charakterisiert worden61 – eine Ambivalenz, die unaufhebbar bleibt.
60 Studenten zerstören Rektorenbüste, in: Hamburger Abendblatt v. 31.1.2007; Bela Rogalla: Wigand muss weg! Reaktionen auf den Sturz der Büste des NS-nahen Rektors Wigand, in: hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 03–04/07, S. 20. 61 Krause: Aufklärung (2002).
DAS U N I V ERSI TÄTSH AU P TGEBÄU DE I N J E NA Joachim Bauer Ohne Zweifel gibt es auch innerhalb einer Universität Erinnerungsorte. Die sogenannten „Universitätshauptgebäude“ gehören durch ihre exponierte Funktion und Lage dazu. Mit dem schrittweisen Übergang zur modernen Universität im 19. Jahrhundert wurden die räumlichen Anforderungen größer. Aus Orten, an denen sich das akademische Corps zu ritualisierten feierlichen Anlässen (u. a. den Universitätskirchen) versammelte und aus im städtischen Weichbild dezentral angesiedelten Lehrräumen erwuchsen Schritt für Schritt neue innovative Gebäudekomplexe: moderne Institute, Sammlungsräume, Kliniken, Laboratorien und auch das Erscheinungsbild der modernen Universität nun prägende Zentralgebäude.1 Die Professorenschaft, staatliche Erhalter und Ministerialbeamte sowie mit der Planung beauftragte Architekten versuchten die traditionelle Aura der „deutschen Universität“ und das gewachsene Bedürfnis nach modernen Lehrräumen gleichermaßen
Abb. 1 Collegium Jenense (um 1770)
Abb. 2 Aula im Collegium Jenense (1848)
zu integrieren. Noch heute spricht man von „der Universität“, wenn es um einem solchen Zentralbau aus dem 19. bzw. frühen 20. Jahrhundert geht und unterscheidet diese „Bauten der Moderne“ auch sprachlich von ihren älteren Vorläufern. So gibt es z. B. in Wien, Tübingen und in Heidelberg die „Alte Universität“. In Leipzig wurde gleich zweimal im Verlaufe des 19. Jahrhunderts eine „neue“ Universität gebaut, 1836 das Augusteum und 1897 das Albertinum. In dieses Ensemble integrierte man in Leipzig den Zentralort der vormodernen Universität, die Paulinerkirche, mit neu gestalteter Fassade, zugleich aber auch eine neue säkulare Aula.2 Als die Universitäten „Staatsanstalten“ geworden waren, trennte man den zu ihrer mittelalterlichfrühneuzeitlichen Tradition und immer noch zu ihrem Selbstverständnis gehörenden, sakralen Raum vom modernen, säkularen auch im Gebäudeensemble endgültig ab. 1 2
Zu den Hauptgebäuden vgl. u. a. Sabine Marschall: Das Hauptgebäude der deutschen Universität und technischen Hochschule im 19. Jahrhundert (Univ. Diss.), Tübingen 1992. Vgl. Renate Drucker: Die Universitätsbauten 1650–1945, in: Heinz Füßler (Hg.): Leipziger Universitätsbauten Leipzig 1961, S.192–197, 203; Robert Bruck: Arwed Roßbach und seine Bauten, Berlin 1904, S. 66–74.
52
Joachim Bauer
In Jena finden wir eine ähnliche Situation im Collegium Jenense, dem alten Dominikanerkloster und Gründungsort der Hohen Schule 1548. Auch hier gab es im 19. Jahrhundert die Collegien- oder Paulinerkirche und schon eine säkulare Aula in der u. a. 1836 die vom Jenaer Professor Lorenz Oken gegründete „Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte“3 und 1848 die deutschen Hochschullehrer4 tagten. Eine erste „neue Universität“ entstand in Jena nach Ankauf und Umbau der „Wucherei“ am heutigen Fürstengraben 23. Erst als diese Gebäude in den 1880er Jahren keine Erweiterungen mehr zuließen, setzte sich unter maßgeblicher Beteiligung von Ernst Abbe der Gedanke zum Bau eines neuen zentralen „Kollegiengebäudes“ durch. Dieses – in kritischer Stimmung vom Meininger Herzog Georg II. als „Universitätspalast“ bezeichnete – Bauwerk wurde nach Abriss des alten Jenaer Schlosses, auf genau dessen Grund, nach Entwürfen von Theodor Fischer neu errichtet und 1908 eingeweiht. Im Raumprogramm war gefordert worden, dass das Gebäude neben Senats-, Fakultäts- sowie Verwaltungsräumen siebzehn Auditorien, Räume für Sammlungen, Bibliotheken sowie Museen und vor allem eine Aula beherbergen müsse.5 Fischer verwirklichte sein Konzept nicht nur indem er das Haus in das vorgefundene naturräumliche und städtebauliche Umfeld als Quasiersatz für das abgerissene Schloss einzupassen verstand. Er integrierte auch historische Sachzeugen aus dem Vorgängerbau und beim Abriss des Schlosses geborgene historische Baumaterialien in den Neubau und initiierte damit einen Erinnerungspfad. Vor allem in den zwei Innenhöfen des Komplexes wurden diese Erinnerungselemente sichtbar eingebracht, so u. a. eine Inschrift aus dem 16. Jahrhundert und ein nach historischen Motiven neu angefertigtes Relief (Arno Zauche), das an die Gründung der Hohen Schule, den Stifter Johann Friedrich I. und die Dynastie erinnern sollte. Dem Jenaer Gebäude kam und kommt, wie wohl allen Zentralbauten dieser Zeit, nicht nur eine große Bedeutung zu, weil sie den Ansprüchen von Forschung und Lehre auf modernem Niveau gerecht wurden. Sie sind ebenso Orte des Gedächtnisses geworden und selbst mit Erinnerungen behaftet – um mit den Worten von Aleida Assmann zu sprechen.6 3
4
5
6
Vgl. Georg Uschmann: Jena 1836 - Die 14. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte, in: Nova Acta Leopoldina. Abhandlungen der deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, NF 171, Bd. 29 (1964), S. 163–178; Amtlicher Bericht über die Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte zu Jena im September 1836 von den Geschäftsführern bei derselben D.DG. Kieser und D.J.C. Zenker, Weimar 1837. Vgl. Geschichte der Universität Jena 1548/58–1958. Festgabe zum vierhundertjährigen Universitätsjubiläum, Bd. 1, Jena 1958, S. 384f.; Frank Wogawa: Universität und Revolution. Jena und die „hochschulpolitischen“ Reformbestrebungen 1848, in: Hans-Werner Hahn, Werner Greiling (Hg.): Die Revolution von 1848/49 in Thüringen. Aktionsräume, Handlungsebenen, Wirkungen, Rudolstadt, Jena 1998, S. 445–474. Zum Universitätshauptgebäude vgl. Anka Zinserling: Die neue Universität in Jena (Dipl.-Arbeit, Ms.), Halle 1984; dies.: Der Jenaer Schloßkomplex – Vorgänger des Universitätshauptgebäudes, in: Reichtümer und Raritäten. Denkmale, Sammlungen, Akten und Handschriften (=Jenaer Reden und Schriften 1990), Jena 1990, S. 31–42; dies: Das Universitätshauptgebäude, in: FranzJoachim Verspohl, Rudolf Zießler (Hg.): Jenaer Universitätsbauten (=Minerva, Bd. 1), Gera 1995, S. 26–32; Gustav Keyssner: Das Gebäude der Universität in Jena, Leipzig o. D. [1911]; Max Osborn: Die neue Universität zu Jena. Erbaut von Theodor Fischer, Jena 1908. Alaida Assmann: Erinnerungsräume, München 1999, S. 158.
Das Universitätshauptgebäude in Jena
Abb. 3 Entwurfszeichnung des Hauptgebäudes von Theodor Fischer
Abb. 4 Luftbild Universitätshauptgebäude
53
54
Joachim Bauer
Abb. 5 Relief von Arno Zauche
Abb. 6 Historische Inschrift
An dieser Stelle soll nun anhand ausgewählter Beispiele auf die Ausgestaltung einzelner Gebäudeteile, vor allem der Aula, eingegangen und die Erinnerungspfade und die beteiligten Erinnerungsgemeinschaften sichtbar gemacht werden. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die sich entfaltende Dynamik bei der Weitergabe von kulturellen Gedächtnisinhalten bzw. ihrer generations- und kontextbezogenen Überformung innerhalb der Korporation gelegt. Schon für die Planungen des Architekten Theodor Fischer war vorgegeben, dass die Aula von einem Wandbild, das den Stifter der Hohen Schule, Johann Friedrich I. von Sachsen zeigt, dominiert wird. Das Bild gehört nicht zu den künstlerisch wertvollsten Gestaltungselementen und ist nicht zu vergleichen mit Ludwig von Hofmanns Wandbild „Die neun Musen“ (1909) und Auguste Rodins Minerva-Büste, beide präsentiert im Senatssaal des Hauptgebäudes, oder gar mit Ferdinand Hodlers „Auszug der Studenten“ („Auszug deutscher Studenten in den Freiheitskrieg von 1813“, 1908/09).7 Das dynastische Gedenkbild wurde von Prinz Ernst von Sachsen Meiningen, einem Nachfahren aus dem Hause Sachsen-Meiningen geschaffen und der Universität geschenkt.8 Solche, das Werk der Dynastie herausstellende Gedächtnisgaben der Erhalter hatten Tradition, denkt man nur an die Jubelgeschenke von 1858: so die Rektorkette und das Historienbild von James Marshall, das die damalige Universitätsleitung symbolträchtig im Ornat und mit den Insignien der Hochschule 7
8
Zur künstlerischen Ausstattung des Hauptgebäudes und die zeitgenössischen Hintergründe vgl. Volker Wahl: Jena als Kunststadt 1900–1933, Leipzig 1988; Günter Steiger: „Fall Hodler“, Jena 1914–1919. Der Kampf um ein Gemälde (=Jenaer Reden und Schriften 1970), Jena 1970; Franz-Joachim Verspohl: „Gebannt, fast erschrocken bleiben wir vor dem Hodler-bilde stehen“. Ferdinand Hodlers „Der Auszug der deutschen Studenten in den Freiheitskrieg von 1813, in: Jenaer Universitätsreden. Bd. 2. Philosophische Fakultät. Antrittsvorlesungen I, Jena 1997, S. 217–261. Johann Friedrich zu Pferde, FSU, Kustodie, InvNr. M 128. Zu einer zeitnahen Auflistung der im Hauptgebäude versammelten Kunst nach 1908 vgl. Keyssner, Gebäude (1911), S. 65.
Das Universitätshauptgebäude in Jena
55
zeigt.9 Im Hintergrund des Bildes, auf der Spitze des Pulverturms, ist eine schwarzrot-goldene Fahne zu sehen. Die Einbringung dieses Details in das von Großherzogin Sophie der Universität gestiftete Bild wird heute selbst von Historikern nicht mehr wahrgenommen, obwohl doch das Schicksal des späteren „Nationalsymbols“, dessen Geschichte eng mit dem Wirken der Jenaer Akademiker verbunden ist, durchaus ein öffentlichkeitswirksames Thema im vergangenen Jahrzehnt war.
Abb. 7 Entwurfszeichnung der Aula von Theodor Fischer
Abb. 8 Gemälde Johann Friedrich I. von Prinz Ernst von Sachsen-Meiningen
Vervollständigt wurde das Aula-Ensemble auf der Westwand durch die Porträts der Erhalter, des Weimarer Großherzogs sowie der Herzöge von Meiningen, Altenburg und Coburg-Gotha.10 Diese Bilder zielen grundlegend auf eine öffentliche Präsentation des Verdienstes der Erhalter um die Förderung von Wissenschaften und Künsten und um ihre Universität. Der Anspruch wurde schon im 16. Jahrhundert, im Collegium Jenense, durch das kurfürstliche Wappen am Treppenturm begründet und umgesetzt.11 9
10
11
Vgl. Barbara Oehme: Die goldene Amtskette des Rektors, in: Reichtümer und Raritäten. Denkmale, Sammlungen, Akten und Handschriften (=Jenaer Reden und Schriften 1), Jena 1990, S. 87–94; Klaus Dicke (Hg.): Symbole der Erinnerung. Insignien der Universität (Texte zum Jenaer Universitätsjubiläum 2), Jena 2008; Joachim Bauer: „Rektor und Dekane im Jubiläumsjahr 1858“. James Marshall und sein Jenaer Universitätsgemälde, in: Die große Stadt. Das kulturhistorische Magazin von Weimar-Jena, 1/1 (2008), S. 53–58. Die Ölgemälde von Wilhelm Ernst, Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, ausgeführt von Hans Olde (1908), in: Barbara Oehme: Jenaer Professoren im Bildnis. Gemälde aus 425 Jahren Universitätsgeschichte (1548/58–1983), Jena 1983, Katalog Nr. 249; Ernst II., Herzog von Sachsen-Altenburg, ausgeführt von Hans Olde (1908), in: ebd., Katalog Nr. 43; Georg II., Herzog von Sachsen-Meiningen, ausgeführt von Hans Olde (1908), in: ebd., Katalog Nr. 66; Karl Eduard, Herzog von Sachsen Coburg-Gotha, ausgeführt von Emanuel Grosser (1908), in: ebd., Katalog Nr. 140. Vgl. Dagmar Blaha, Joachim Bauer: Das Ernestinische Wappen im Collegium Jenense, in: Dicke: Symbole (2008), S. 9–12.
56
Joachim Bauer
Abb. 9 Rektorenkette, gestiftet von den Erhaltern anläßlich des Universitätsjubiläums (1858)
Abb. 10 Jubiläumsbild von James Marshall (1859)
Das Universitätshauptgebäude in Jena
57
Die neue Aula trug damit unübersehbar Züge einer dynastischen Ruhmeshalle. Das Hauptgebäude symbolisiert die moderne Universität, zugleich blieb es aber Nachfolgebau des abgerissenen Jenaer Schlosses. Der gestiftete Baugrund war ein fast symbolisches Geschenk der ernestinischen Erhalter an die Korporation. Wenn Orten tatsächlich Gedächtnis anhaftet, dann ist es hier spürbar, an jener Stelle, wo im 18. Jahrhundert die herzoglich-wissenschaftlichen Sammlungen und Bibliotheksbestände Platz gefunden hatten und Goethe und Herzog Carl August um 1800 ihre Vorstellungen von einer modernen Universität und den dazugehörigen wissenschaftlichen Anstalten sichtbar werden ließen. Welchen zentralen Platz Schlüsselsituationen aus der Geschichte der Jenaer Salana im Erinnerungsdepot der Korporation und der Erhalter um 1900 einnahmen, belegen fünf Historiengemälde. Allesamt waren sie Geschenke ehemaliger Jenenser Studenten und zur öffentlichen Präsentation in einem der Gänge im Hauptgebäude vorgesehen.12 Das Vorhaben sei, so ist in den Akten zu lesen, als „Jubiläumsstiftung in der Öffentlichkeit bekannt gemacht worden“, worauf Spenden in Höhe von rund 20.000 Mark eingingen.13 Auf gut 20 Metern Wandfläche waren nun in programmatischer Absicht ausgewählte Meilensteine universitären Selbstverständnisses zu betrachten: 1 Johann Friedrich I. empfängt bei seiner Rückkehr aus kaiserlicher Gefangenschaft Abgeordnete der Universität am Fürstenbrunnen,14 2 der Universalgelehrte Weigel dargestellt an seinem Observatorium im Collegienhof,15 3 Friedrich Schiller auf dem Weg zu seiner Antrittsvorlesung 1789,16 4 Bismarck bei einem Besuch auf dem Jenaer Markt 189217 – ein Bild, das besonderen Zuspruch erhielt,18 5 und ein Bild vom Jenaer Schloss.19 Es zeigt Goethe und Carl August vor dem Schloss im freundschaftlichen Gespräch, die Gebrüder Humboldt und der Jenaer Mineraloge Johann Georg Lenz verlassen gerade die hier befindlichen Sammlungen. Das Ereignis spiegelt die Situation 1796/97 wieder. Die Erinnerungsgemeinschaften „Universität“ und „Erhalter“ konnten und wollten sich noch um 1900 sehr wohl auf die Erfolgsgeschichte der „klassischen Universität“ beziehen. Die Erinnerung an diese Konstellation aus „klassischer“ Zeit 12 13 14 15 16 17 18 19
Keyssner: Gebäude (1911), S. 65 verweist auf den Gang zwischen Aula und dem kleinem Innenhof im Erdgeschoß, im Schreiben des Stifterkuratoriums war der „nordöstliche Korridor über der Wandelhalle“ vorgesehen. Vgl. UAJ, C 1659, Bl. 183v. Vgl. UAJ, C 1659, Bl. 183–184, n.p., 13.7.1908. Ölgemälde von Otto Ubbelohde: Begrüßung Johann Friedrichs I. am Fürstenbrunnen, 1913, FSU, Kustodie, InvNr. M 83. Ölgemälde von Ernst Liebermann: Weigel auf dem Dach seines Haus, 1908, FSU, Kustodie InvNr. M 81. Ölgemälde von Erich Kuithan: Schiller auf dem Weg zur Antrittsvorlesung, 1909/10, FSU, Kustodie, Inv.-Nr. M 80. Ölgemälde von Hans W. Schmidt: Bismarck auf dem Jenaer Marktplatz 1892, 1913, FSU, Kustodie, Inv.-Nr. M 85. Vgl. UAJ, C 1659 Bl. 183v. Ölgemälde von Hans W. Schmidt: Goethe und Carl August, 1908, FSU, Kustodie, InvNr. M 13.
58
Joachim Bauer
Abb. 11 Die Universitätsaula nach ihrer Eröffnung (1908)
Abb. 12 Goethe und Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach vor dem Jenaer Schloß, Hans W. Schmidt (1908)
wurde u. a. durch den Einbau des auf dem Bild zu sehenden Schlossportals als Eingang zu einem der Sammlungsräume (2. Obergeschoß) des neuen Gebäudes unterstrichen. Damit sollte, wie in zeitgenössischen Publikationen zu lesen ist, dem Willen der Bauherren folgend, der „genius huius loci“ an nachfolgende Generationen übergeben werden. Schmidts Gemälde vom Schloss wurde in DDR-Zeiten sogar neben dem alten Schlossportal im Obergeschoß des Hauptgebäudes platziert.20 Die Historien20 Auf diesen Kontext hat bereits Günter Steiger aufmerksam gemacht – freilich mit anderen Schlüssen. Vgl. Günter Steiger: „Ich würde doch nach Jena gehen“, Weimar 31989, S. 110f. Zur Ausgestaltung und zum Raumkonzept vgl. Keyssner: Gebäude (1911), a.a.O.
Das Universitätshauptgebäude in Jena
59
bilder durchwanderten allesamt im 20. Jahrhundert das Gebäude und sind heute, wohl ohne die Erinnerung an vorangegangene Gedächtnisprogramme fortzusetzen, auf unterschiedliche Plätze verteilt. Doch auch das „Vergessen“ ist Bestandteil der Erinnerungskultur. Das bereits erwähnte, fast hausväterlich anmutende Verhältnis der Erhalter zu ihrer akademischen Korporation, tritt uns auf einem Foto aus dem Jahre 1908 entgegen. Es wurde anlässlich der Jubelfeier zum 350. Jahrestag der Universitätsgründung angefertigt. Die klar gegliederte Anordnung zeigt, dass sich Erhalter und akademisches Corps gegenüber sitzen und es einen aufeinander ausgerichteten Blick-Dialog zwischen Fürsten und dem großen akademischen Senat gibt. Das ist die Perspektive im Kaiserreich 1908. Am Beginn des Ersten Weltkriegs kam es jedoch zu einem schwerwiegenden Konflikt um das Bildprogramm im Hauptgebäude. Er entzündet sich an Ferdinand Hodlers Gemälde „Auszug der deutschen (oder Jenenser) Studenten in die Freiheitskriege von 1813“. Es symbolisiert einen zentralen Gedächtnisinhalt der sich nach 1800 formenden, modernen und zunehmend national verstehenden Jenaer Universität. Am 14. November 1909 hatte die „Gesellschaft der Kunstfreunde von Jena und Weimar“ der Universität das gestiftete Bild zur bildkünstlerischen Ausstattung des neuen Hauptgebäudes übergeben. Konzipiert war es für die südliche Wandfläche auf einem der Flure im Ostflügel des 1. Obergeschosses.
Abb. 14 Gemälde von Ferdinand Hodler an seinem ursprünglichen Standort
Abb. 13
Portal aus dem alten Jenaer Schloss
Zur „Gesellschaft der Kunstfreunde“ gehörten Vertreter des öffentlichen Lebens ebenso wie Universitätsangehörige. In der Literatur ist darauf verwiesen worden, dass es nicht unbedingt das Anliegen des Architekten war, Wandbilder und Rundplastiken
60
Joachim Bauer
außerhalb der Aula, auch nicht in deren Vorraum, in den Bau einzubringen. Dies sei „eher dem Zufall überlassen“ worden und die spätere breite Ausstattung des Gebäudes ein Resultat der zahlreichen Stiftung von Kunstwerken gewesen.21 Das kann man auch anders sehen, denn für unseren Zusammenhang ist es wesentlich, dass es ein breites und über die Universität hinausreichendes Stifterbedürfnis gab, Symbole kollektiver Erinnerung in unterschiedlicher Form an den neu entstehenden Erinnerungsort anzulagern. Das Auszugsmotiv des Hodler-Bildes gehörte in jedem Fall zu den „Meistererzählungen“ korporativen Gedächtnisses. Indem das Gemälde an den Sieg der Verbündeten über Napoleon im Jahre 1813 erinnerte, bot es das Gegenstück zum Trauma der preußischen Niederlage bei Jena im Jahre 1806, an die kurz zuvor, im Jahre 1906, anlässlich der Säkularfeiern mit Denkmalssetzungen und Publikationen erinnert worden war. Wenngleich Hodlers Gemälde das „negativ“ belastete Erinnern an 1806 nicht aufheben konnte, lieferte sein Erinnerungsmotto, „Auszug“ der (Jenaer) „Freiwilligen“ (Akademiker/ Studenten) „1813“, gleich in mehrfacher Hinsicht und gruppenübergreifend „positiven“ Erinnerungsstoff. Genau dieser Umstand empfahl es in idealer Weise über das gesamte 20. Jahrhundert dem kollektiven und kulturellen Gedächtnis zur Übernahme an. Das hatten schon die Auftraggeber erkannt: „Man glaubt damit die nationale Idee der Erhebung über die unglückliche Niederlage bei der Schlacht von Jena zum Ausdruck zu bringen“.22 Sicher gab es bereits zeitgenössische Einwände, die einen geschlossenen Auszug der Jenaer Studenten historisch kritisch hinterfragten, wie z. B. vorgetragen vom nationalliberalen Jenaer Sprachwissenschaftler Berthold Delbrück im Frühjahr 1908. Dies sei bekannt, so der antwortende Universitätskurator. Doch gehe es nach Meinung des amtierenden Prorektors vielmehr darum, „die Idee zum Ausdruck zu bringen, von der zur Zeit der Freiheitskriege die akademische Jugend Deutschlands erfüllt gewesen ist“.23 Dennoch brach im März 1909 eine offene Fehde aus, bei der Hodler und sein Werk massiv angegriffen wurden. Aufgebrachte Studenten drohten dem Bild mit Zerstörung. Aufklärung von Seiten der Kunstfreunde und schließlich eine Sicherheitsverglasung sollten Bedrohungen abwenden. Eine grundlegend neue Situation ergab sich, als Hodler im September 1914 den Protest Schweizer Künstler gegen die Beschießung der Kathedrale von Reims durch deutsche Artillerie unterschrieb.24 Fortan war das Bild dem Angriff nationalistischer Propaganda ausgesetzt und wurde – als Ergebnis eines ausgehandelten Kompromisses – durch einen Bretterverschlag der Öffentlichkeit entzogen. Der Direktor des Geographischen Instituts, Gustav von Zahn, präsentierte während des Krieges auf der Verschalung kartographisch den Frontverlauf. Ernst Haeckel, der sich gegen die Vernichtung des Bildes wandte, dafür aber für einen Verkauf plädierte, warf Hodler in einem Brief vom 14. Oktober 1914 – das Datum ist mit Blick auf die Schlacht bei Jena 1806 wohl nicht zufällig gewählt – vor, dass jener „durch diese gehässige und verleumderische Erklärung nicht nur unser nationales Ehrgefühl auf das Tiefste verletzt [...], sondern sich selbst ins Gesicht geschlagen“ habe. Denn Hodler habe „in völliger Entstellung der bekannten Tatsachen – diesen in 21 22 23 24
Vgl. u.a. Wahl: Kunststadt (1988), S. 107, 117. UAJ, C 1568, Bl. 54f. Vgl. Wahl: Kunststadt (1988), S. 115f.; Zitat UAJ, C 1569, Bl. 55. Zu den Vorgängen vgl. Steiger: Hodler (1970), S. 26f.; Wahl: Kunststadt (1988), S. 126–129.
Das Universitätshauptgebäude in Jena
Abb. 15 Die Aula zu ihrer Einweihung im Beisein der regierenden Herzöge
Abb. 16 Die Aula zur Schillerfeier 1934 unter Beteiligung des NS-Volksbildungsministers Fritz Wächtler
61
62
Joachim Bauer
Abb. 17 Abbebüste von Hildebrand
Abb. 18
Minerva von Rodin
Abb. 19 Gürtelbinder von Molitor
Abb. 20 Fichtebüste von Kampf
Das Universitätshauptgebäude in Jena
63
Notwehr uns aufgedrungenen Befreiungskrieg [1. WK, d. Verf.] als ein barbarisches Attentat gegen die menschliche Kultur“ verurteilt, was ebenso von dessen „geringen Urteilskraft“, wie von seiner „deutschfeindlichen Gesinnung“ zeuge.25 Nur am Rande sei hier mit Blick auf unser Thema „Ambivalente Orte der Erinnerung“ angemerkt, dass heute in der Aula der Universität nur wenige Meter Haeckels Portrait von Hodlers Gemälde trennen – so verschlungen können Gedächtnispfade sein. Durch eine Aktion der sogenannten „Jugendbewußten“ unter der „Freideutschen Jugend“ wurde das Hodler-Bild im April 1919 wieder öffentlich zugänglich gemacht, blieb dennoch auch in der Weimarer Republik nicht unumstritten.26 Wie sah nun die Erinnerungskonstellation 30 Jahre später, also nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, aus? Die Aula wurde 1937 durch den Einzug eines Zwischengeschosses ihrer sakralen Aura beraubt. Auch hatte sich die oben beschriebene räumliche Anordnung der Festkorona zu akademischen Festakten in einem Detail geändert, wie auf einem Foto, angefertigt anlässlich der Schillerfeier 1934, ersichtlich wird. Die fürstlichen Sessel waren nun entfallen, dafür saßen die Repräsentanten des NS-Gaus Thüringen – und nicht die Prorektoren – mit dem Rektor in der ersten Reihe des Gestühls, einer Umklammerung gleich, und dokumentierten damit das neue Verständnis von Staat und Universität. Mit diesen Veränderungen ging eine Debatte um die künftige Innengestaltung der Aula einher. Das Hodler-Bild war immer noch am ursprünglichen Platz im Flur des Ostflügels hinter Glas verblieben. Zwischen 1935 und 1937 lassen sich aber mehrere Vorstöße beim Thüringischen Minister für Volksbildung nachweisen, die eine Restaurierung des Bildes als dringend darstellten. Das Vorhaben wurde jedoch aus Kostengründen nicht umgesetzt.27 Ein Schreiben des damaligen Rektors, des Deutschchristen Wolf Meyer-Erlach, an den Minister vom 20. Oktober 1937 thematisierte erneut die künstlerische Ausschmückung der Aula. Unter Bezug auf die Vorschläge des Kunsthistorikers Hans Rose28 habe sich der Senat mit der Materie beschäftigt. Anwesend waren als Vertreter der Fakultäten u. a. Gerhard von Rad, Vertreter der Bekennenden Kirche, der sich öffentlich gegen den Antisemitismus wandte, der Mediziner und spätere Nachkriegsrektor Joseph Hämel, der Leiter der NS-Dozentenschaft Heinrich Jörg, ein Vertreter des NS-Studentenführers sowie die Kunstwissenschaftler Hans Rose und Walter Hahland. Der Senat hatte folgenden Vorschlag erarbeitet: Das Reiterbildnis des Stifters sollte am alten Platz verbleiben. 25 Ediert bei Steiger: Hodler (1970), S. 77, vgl. auch S. 28f. 26 Der Jenaer Museumsdirektor und Kunsthistoriker Paul Weber brachte noch 1929 schriftlich zum Ausdruck, dass das Bild zwar von großem künstlerischem Wert sei, dass man in Jena aber immer noch den Mangel zu empfinden glaube, dass der Künstler das „Bild ohne Betonung des Geistes, in dem der Auszug 1813 geschah“ gemalt habe. Zitiert nach Wahl: Kunststadt (1988), S. 129. 27 Vgl. UAJ, C 92, Bl. 103–109. 28 Rose wurde wenige Wochen später, im November 1937 nach einer Denunzierung wegen „Verstoßes gegen §175 StGB“ von den Nazis in Untersuchungshaft genommen, später aus dem Dienst entlassen und 1938 zu einer 15monatigen Haft verurteilt. Zur Biographie Roses vgl. Christian Fuhrmeister: Hans Rose. Eine biographische Skizze, in: Pablo Schneider, Philipp Zitzelsperger (Hg.): Bernini in Paris. Das Tagebuch des Paul Freart de Chantelou über den Aufenthalt Gianlorenzo Berninis am Hof Ludwigs XIV., Berlin 206, S. 434–455.
64
Joachim Bauer
Das Hodlerbild,29 „über dessen ungenügende Anbringung im Flur des Ostflügels von jeher und mit Recht geklagt wurde“, sollte an der bislang von den fürstlichen Erhaltern dominierten Westwand der Aula angebracht werden. Rechts und links wolle man die Fichte-Büste,30 die Abbe-Büste31 und die Minerva von Rodin32 platzieren. An der Westwand sollte unter der Empore zudem „die von der Jenaer Studentenschaft zum Neubau geschenkte Jünglingsbüste von Molitor33 zur Aufstellung gelangen“. Weiter heißt es: So „wären die kostbarsten Kunstgegenstände und Erinnerungsstücke der Universität in der Aula wie in einer Ehrenhalle vereinigt. Der Porträtkopf des Führers soll wie bisher die Mittelachse beherrschen“. Und für die vier Erhalterbilder müssten „würdigere Plätze im Universitätsgebäude“ bestimmt werden.34 Am 8. Januar 1938 folgte die Antwort der Landesregierung, vermittelt durch den Leiter der Ministerialdienststelle Friedrich Stier. Den Antrag auf Anbringung des Hodlergemäldes in der Aula könne man aus konservatorischen Gründen nicht umsetzen. Auch sei es „bewußt für die jetzige Stelle komponiert worden“. Auf die ebenso wichtige Frage, ob die fürstlichen Erhalterbilder wieder an ihre angestammten Plätze verbracht werden sollten, antwortete Stier unmissverständlich: „Der Herr Ministerpräsident hat sich gegen eine solche Maßnahme entschieden und ersucht, diese Bilder an anderen geeigneten Stellen des Universitätsgebäudes aufzuhängen“.35 Das Blatt hatte sich gewendet, Hodlers Bild und damit auch seine Interpretation des Themas waren vollständig rehabilitiert und aufgewertet, seine Unterschrift unter das Protestschreiben von 1914 blieb unerwähnt. Dafür brach die NS-Führung nun mit dem Konzept der „dynastischen Ruhmeshalle“. Dass auch Rodins Minerva – zumindest aus der Sicht des Senats und des amtierenden NS-Rektors – ihren Platz in der Aula finden sollte, erscheint aus heutiger Sicht eher unerwartet. Bemerkenswert ist auch, dass diese NS-Konzeptionen in der durchaus gut aufbereiteten Jenaer Universitätsgeschichte bislang kein Thema waren. Welche Fehldeutungen ein Erinnerungsstück bei der Übergabe von einer Generation zur anderen erfahren kann, vor allem dann, wenn unmittelbarer politischer Wille die Oberhand gewinnt, zeigt das Beispiel der im Umfeld des Gefallenendenkmals im großen Innenhof aufgestellten Jünglingsbüste von Marta Bergemann-Könitzer.36 In einem Schreiben des Volksbildungsministeriums aus dem Jahre 1938 wird die Universität aufgefordert, diese von der Künstlerin „geschenkte Büste Horst Wessels“ würdiger zu präsentieren.37 Ein halbes Jahr später antwortete Rektor Abraham Esau, 29 Ferdinand Hodler, Auszuge der Jenaer Studenten in den Befreiungskrieg, FSU Jena, Kustodie, Inv.Nr. M 124. 30 Büste von Arthur Kampf, o. D., Granit, FSU, Kustodie, InvNr. P 1, H:50 cm, 1919 Geschenk des Künstlers an die Universität. 31 Büste von Adolf von Hildebrand, 1910, FSU, Kustodie, InvNr. P 17, H: 100 cm. 32 Aguste Rodin, Minerva,1905, Geschenk des Künstlers an die Universität, FSU, Kustodie, InvNr. P 15, H:57 cm. 33 Skulptur Gürtelbinder von Marthieu Molitor, 1905, FSU, Kustodie, InvNr. P 30, o. M. 34 UAJ, C 92, Bl. 113. 35 UAJ, C 92, Bl. 114. 36 Martha Bergemann-Könitzer, Alexander Osborne, Bronze-Büste, 1922, o. M., FSU, Kustodie, InvNr. P 32. 37 Vgl. UAJ, C 92, Bl. 115.
Das Universitätshauptgebäude in Jena
65
Abb. 21 Jüngling von Bergemann-Könitzer/ Osborne
dass man dem Wunsch gern folge, nur handle es sich keinesfalls um das Konterfei Wessels. Die freie Erfindung eines „Heldenporträts“ war eben nicht möglich. Ein kurzer Ausblick in die Zeit nach 1945 soll den Aufriss beschließen. Das vom Meininger Herzog gemalte Historienbild des Stifters der Universität entsprach seit den ausgehenden 1940er Jahren nicht mehr dem Traditionsverständnis der in Gründung befindlichen DDR38 und musste nun endgültig dem Hodler-Bild weichen. 1948 wurde dessen Wiederanbringung auf Antrag des Rektors Friedrich Zucker von der Sowjetischen Besatzungsmacht genehmigt. Zuckers Nachfolger, der Botaniker Otto Schwarz, 1918 selbst Angehöriger eines Soldatenrats, später KPD-Mitglied und seit 1946 Mitglied der SED, widmete diesem neuen Gestaltungskonzept besondere Aufmerksamkeit. Er gab 1969 zu Protokoll, dass unter seinem Rektorat Hodlers „Bild jenen Ehrenplatz im architektonischen Zentrum des Hauptgebäudes“ erhalten habe, „der ihm von der alten bürgerlichen Universität bis 1945 verweigert worden war. Für mich persönlich bedeutete das Anbringen des Bildes in der Aula ein besonderes Erlebnis, hatte ich doch 1919 als junger Student zu den ‚Befreiern‘ des Gemäldes gehört, dem ich nun als Rektor zum zweiten Male gegenübertrat“.39 38
39
Zur kontroversen Debatte um das Traditionsverständnis an der Jenaer Universität vgl. Joachim Bauer: Jubelschrift und Selbstvergewisserung. Traditionssuche an der Friedrich-SchillerUniversität Jena nach 1945, in: Werner Greiling, Hans-Werner Hahn (Hg.): Tradition und Umbruch. Geschichte zwischen Wissenschaft, Kultur und Politik, Rudolstadt 2002, S. 235–249, insb. S. 246–249. Erinnerungen des Rektors Otto Schwarz, in: „Fall Hodler“. Jena 1914–1919. Der Kampf um ein Gemälde (=Jenaer Reden und Schriften 1970), Jena 1970, S. 151.
66
Abb. 22 Die Aula vor 1949
Abb. 23 Die umgestaltete Aula
Joachim Bauer
Das Universitätshauptgebäude in Jena
Abb. 24
Günter Dührkop, Bildnis von Otto Schwarz (1970)
Abb. 25 Rektor Günther Drefahl, Bildnis von Heinz Wagner (1973)
67
68
Joachim Bauer
Schwarz thematisierte angesichts der Folgen des Zweiten Weltkrieges auch die komplizierte Entscheidungsfindung und die Debatte um Hodlers Bild. Das Wissen darum, dass die Universität beim Übergang ins bürgerliche Zeitalter nach 1800 auf „antiabsolutistischen“ und „demokratischen“ Positionen gestanden habe, sei um 1950 nicht mehr vorauszusetzen gewesen. Deshalb ging es um die Frage, ob das Gemälde überhaupt wieder sichtbar ins Gebäude gebracht werden könne. Das Für und Wider habe man im Kreise von SED-Funktionären intensiv diskutiert. Zweifelsohne seien auch Bedenken geäußert worden, da man befürchtete, dass einerseits die „Antifaschisten“ ebenso wie die „Sowjetischen Freunde“ es als „nationalistische Demonstration“ deuten, andererseits die „ewig Gestrigen“ den „patriotischen Gehalt des Bildes“ für ihre Propaganda nutzen konnten. Beachtung mussten auch jene finden, so Schwarz, die ihrer Rolle als „Verführte“ und „Soldaten Hitlers“ mit „tiefer Scham und Erbitterung“ gedachten und sich „provoziert fühlen müßten“. Befragungen unter den Universitätsangehörigen hätten ergeben, dass der Streit um das Bild im Ersten Weltkrieg kaum noch bekannt war und „nur wenige das Bild selber kannten“. Man kam daher zum Schluss – und hier kreuzen sich auffällig Geschichtspolitik und Erinnerungskultur –, dass durch öffentliche Präsentation am zentralen Ort „Aula“, das Bild der „Universität und überhaupt allen Bürgern“ vorzustellen sei, damit „sie sich mit diesem großen Denkmal des Befreiungskampfes unseres Volkes vertraut machten“. Aus dem Jahre 1969 rückblickend urteilte Schwarz, dass es schon damals, kurz nach Gründung der DDR, angesichts der immer sichtbarer werdenden „Restaurierung des deutschen Imperialismus“ darum gegangen sei, sich mit der Notwendigkeit einer militärischen Verteidigung auseinanderzusetzen.40 Das Bild ziert noch heute unsere Aula und ist weit über die Grenzen hinaus bekannt. Doch wie Diskussionen in den letzten zwei Jahrzehnten in und um die Aula zeigen, sind die ihm anlastenden Erinnerungen und Deutungsmuster stets ambivalent geblieben. Anlässlich einer 1994 gehaltenen Antrittsvorlesung, die sich mit dem Bild beschäftigte, formulierte der Dekan ohne näheren Bezug auf die Jenaer Bildgeschichte provozierend: „Was hier gezeigt wird: der Aufbruch junger Männer in ein Geschehen, das einen Freiheitskrieg zu nennen einem, hundertachtzig Jahre deutscher Geschichte später, nicht mehr so recht gelingen will, – ist es das, was in einer Universitätsaula jungen Leuten vorgerückt werden sollte?“41 Den Westflügel der Aula, wo einst die Erhalter-Porträts hingen, zierten in der DDR die Rektoren der Nachkriegszeit.42 Nach der Rekonstruktion des Gebäudes Anfang der 1990er Jahre wurde auch diese Traditionslinie durchbrochen. Der hilflos anmutende Versuch, nun die Aula – sieht man einmal von Hodlers Gemälde ab – ohne Erinnerungsstücke an das 20. Jahrhundert auskommen zu lassen, wirft freilich Fragen auf. 40 Vgl. ebd., S. 150–153. Die hier von Schwarz offenbarte Sicht wird durch ein Gemälde von Günter Dührkop, das Schwarz vor dem Hodlerbild darstellt, noch einmal unterstrichen. Vgl. FSU Jena, Kustodie, Depositum. 41 Einführung des Dekans Gottfried Willems, in: Jenaer Universitätsreden. Philosophische Fakultät. Antrittsvorlesungen I, Jena 1997, S. 220. 42 So die Bildnisse von Günther Drefahl, Oehme, Jenaer Professoren, Nr. 38; Franz Bolck, ebd., Nr. 10; Otto Schwarz, ebd., Nr. 210.
Das Universitätshauptgebäude in Jena
69
Unter der Überschrift „Von Schröter bis Haeckel“ hatte man ein neues Bildprogramm entworfen und umgesetzt. Man sprach nun von „neuer Professorengalerie“, deren „Doppelhängung“ die Würde des Raumes unterstreiche. Dass sich ein solches Vorgehen rächen musste, bestätigt der wenige Jahre später, quasi vor den Türen der Aula entbrannte sogenannte „Jenaer Bilderstreit“, bei dem es um das Malen und öffentliche Präsentieren von Universitätsrektoren aus der Zeit zwischen 1933 und 1989 ging und bei dem die „Täter“- und „Opfer“- Debatte mit voller Wucht die akademischen Erinnerungsgemeinschaften traf. Im Kern flammte eine Kontroverse um „Kunstwerk“, „Tradition“ und „Vergangenheitsbewältigung“ auf. Die heftig entbrannte Diskussion traf direkt ins Zentrum der Selbstwahrnehmung und des Selbstverständnisses der Universität. Eine im kulturellen Gedächtnis vergangener Generationen fest verhaftete „Tradition“ – das Porträtieren und öffentliche Präsentieren von Rektoren und Professoren – wurde auf dem Hintergrund der Geschichte des 20. Jahrhunderts auf den Prüfstand gestellt. Angesichts neu geschaffener Porträts von Rektoren der NS-Zeit sowie der DDR- und Nachwende-Zeit musste geklärt werden, was künftig dem weiteren Verwahren als würdig übergeben werden könnte und was dem „bildlichen“ Vergessen anheim gelegt werden müsse. Die noch überwiegend in der Sphäre des kommunikativen Gedächtnisses präsenten und porträtierten Personen und die mit ihnen verbundenen Ereignisse, um die sich die öffentliche Diskussion rankte, mussten zwangsläufig eine Kontroverse unter den beteiligten Generationen, mit ihren unterschiedlichen Erlebnis- und Erfahrungsräumen, auslösen. Prägend wirkte der Umstand, dass sich die Salana in den 1990er Jahren in weiten Bereichen noch in einer personellen und geistigen Umstrukturierung befand und ein über Jahre geformtes und angenommenes Selbstbild innerhalb der akademischen Erinnerungsgemeinschaft nicht mehr bzw. noch nicht wieder existierte. Die Debatte offenbart im Sinne der Gedächtnistheorien eine noch nicht ausgehandelte bzw. ausgeformte kollektive Erinnerung im Bereich der neuesten Geschichte der Universität und der Gesellschaft im vereinigten Deutschland überhaupt. Sie dauert noch an.43 Es bleibt festzuhalten: Im Unterschied zur alten Universität im Collegium Jenense verfügt die „neue Universität“ in ihrem Hauptgebäude auch 100 Jahre nach Einweihung über kein stabiles Erinnerungsprogramm. Die in der frühneuzeitlichen 43
Zu den kontroversen Standpunkten vgl. Gottfried Meinhold: Der besondere Fall Jena. Die Universität im Umbruch 1989–1991 (=Quellen und Beiträge zur Geschichte der Universität Jena 11), Stuttgart 2014, S. 250–260; Verena Krieger: Von der Repräsentation des Amtsträgers zur Reflexion der Bildgattung, der Medien und der Geschichte. Jenaer Rektorenbildnisse im 20. und 21. Jahrhundert, in: Babett Forster, Birgitt Hellmann (Hg.): Kluge Köpfe – Beredte Bilder. Gelehrtenbildnisse aus 450 Jahren Universitätsgeschichte Jena, Jena 2015, S. 51–75, insb. S. 60– 66; Frank Christiansen: Braune Schatten auf dem Campus. Ein Bild spaltet die Universität, in: Die Welt v. 15.1.1998; Ron Winkler: Wie frei darf Kunst sein? Resümee der Debatte um die neuen Rektorporträts, in: Akrützel, 112. Ausgabe, 8. Jg., 17.12.1997; Jürgen Fuchs: Magnifizenzen und Verbrecher, in: ebd.; Edda Lahmann: Vom Schwarz zum Licht. Ein Versuch über die Ästhetik der Rektorenporträts, in: ebd.; ,;Latenter Bocksgesang. Die Debatte um die Rektorenporträts nimmt seltsame Formen an – und beginnt teilweise zu nerven, in: Akrützel, 113. Ausgabe, 8. Jg., 15.1.1998; Horst Blau: Nun macht die Malerin von ihrem Ausstellungsrecht Gebrauch. Der Streit um die Rektorenportraits geht weiter, in: Gerbergasse 16 (2/1998). Zur Dokumentation: Franz-Joachim Verspohl, Michael Platen (Hg.): Anke Doberauer. Acht Magnifizenzen, Jena 1997; Alma Mater Jenensis, Universitätszeitung Jg. 8 (11/29.4.1997), Jg. 9 (6/18.12.1997).
70
Joachim Bauer
Gesellschaft fest etablierte alte ernestinische Korporation konnte offensichtlich durch ihre gesellschaftliche Sonderstellung – Goethe sprach 1817 von deren Unsterblichkeit – 44 kollektive Erinnerungen über längere Zeiträume noch konservieren. Der zur Staatsanstalt gewandelten und in die gesellschaftlichen Umbrüche des 20. Jahrhunderts fest integrierten, modernen Universität sollte dies nicht mehr und wird es vielleicht nie wieder gelingen.
44 Vgl. Goethe an Voigt v. 10.4.1817, in: Hans Tümmler (Hg.): Goethes Briefwechsel mit Christian Gottlob Voigt, Weimar 1962, S. 279f.
DI E J E NA ER U N I V ERSI TÄTSAU LA A L S A M BI VA L E N T ER R AU M Gottfried Meinhold Die bitteren Erfahrungen des 20. Jahrhunderts haben Menschen Erinnerungen zugemutet – biographische, familiäre, politische –, die sehr häufig über die humanen Fassbarkeitsgrenzen und Erträglichkeitsgrenzen hinausgingen. Und es gab posttraumatische Dauerkonfrontationen mit dem Unfassbaren, die erklären, dass für viele, vermutlich eine große Mehrzahl, der Wille zu vergessen den Willen, sich zu erinnern, alsbald übertraf. (So ähnlich wie bei der beschwiegenen HolocaustErinnerung in jüdischen Familien Israels.) Abgesehen von der Pathologie der Spätfolgen im Sinne posttraumatischer Belastung und der damit verbundenen psychosomatischen Symptomatologie, gibt es als generelle nichtpathologische Selbstschutzaktion eine Vermeidungsstrategie, die die Abwehr belastender Erinnerung stimuliert oder eben das Erinnern höchstens in einer Form gestattet, die affektive Neutralität zulässt, oder nur flüchtig und undeutlich ist. Verklammert zu sein mit der Erinnerung, natürliches Vergessen, befriedetes Vergessen zu blockieren, ist als „false memory“, falsches Erinnern, wie wir wissen, ein persistierender pathogener Faktor. (Auch verkapselte Erinnerung i. S. von Freuds Verdrängung gehört hierzu.) Das ist bekanntlich ein heikles Terrain, und man sollte zunächst verständnisvoll sein, wenn sich jemand gegen die störende Aufforderung, sich zu erinnern, zur Wehr setzt wie zum Beispiel die meisten Tschechen und Slowaken, wenn man sie an 1968–69 erinnert. (Zuweilen ist ja sogar vom Erinnerungsterror die Rede.) Aber es gibt andererseits die historisch und ethisch begründbare Erinnerungspflicht. Darum geht es im Fall der Jenaer Universitätsaula, wie ich dann zeigen will. Dennoch: Es bestehen zwischen Sicherinnernmüssen und Sicherinnernwollen oder Sicherinnernkönnen Diskrepanzen, die manchmal – wie soll man sagen – paradoxieträchtig sind. Um den Fall der Jenaer Aula gibt es eine Kontroverse zwischen den Verfechtern einer Form des Gedenkens im Raum selbst einerseits und andererseits der Vermeidung, der Abwehr beschämender Erinnerungstexte. Dieser Raum, so die Gegner u. a., sollte „erinnerungsfrei“ bleiben, als ob es darum ginge, dem Nachteil der Historie im Sinne Nietzsches zu entgehen. (Erinnerungsfrei war die Jenaer Aula – mit Hodlers Bild „Auszug der Jenaer Studenten...“ und zuvor mit dem Universitätsgründer Johann Friedrich hoch zu Ross – niemals.) Zugegeben, die Ambivalenz eines festlichen Raumes – und zwar im Sinne der Einheit von locus amoenus, anmutiger, gefälliger Ort, hier metaphorisch: Ort des Glanzes und Ruhmes der Wissenschaft sowie locus infamis oder terribilis als Ort, an dem sich Schmachvolles und Schändliches ereignet haben – ist mühevoll zu ertragen, insbesondere, wenn die polaren Ereignisse Extrempunkte einer Skala markieren, an deren einem Ende sich Heilung und menschliche Gesundheit befinden, am anderen Ende aber Mord und genozidale Massenvernichtung. Wie kann man der Ambiguität gewachsen sein, sie ertragen – ohne sie eben zu meiden?
72
Gottfried Meinhold
Eine kleine Abschweifung zu ambivalenten Orten besonderer Tragweite mit zwei historischen Beispielen: Es existieren sicher sehr viele konkrete, „historisch“ aufgeladene Räume, die ihre Bedeutung aus historisch hochrelevanten Ereignissen erhielten und danach mit dem Verweis auf sie existierten. Auf deren Polarität wurde zuweilen sogar politisch symbolschaffend hingearbeitet. Hier die zwei Beispiele. Das erste: Den Spiegelsaal von Versailles, eine Kultstätte der Grande Nation, wählte Deutschland, Sieger des „siebziger Krieges“, zur Demütigung Frankreichs als Ort des Triumphes zur Proklamation des deutschen Kaiserreiches. In demselben Saal fand nach der Niederlage des Kaiserreiches 1918 im Jahre 1919 die Unterzeichnung des Friedensvertrages mit dem Deutschen Reich statt, ein Augenblick der deutschen Schmach und (auch) französischer Revanche. Ein Chiasmus von Schmach und Triumph bei zwei Kontrahenten in jeweils umgekehrter Konstellation. Einen in etwa vergleichbaren deutsch französischen Chiasmus hat man – zweitens – mit dem ehemaligen Verhandlungswaggon der Waffenstillstände von 1918 und 1941 im Wald von Compiègne vor sich, der später als Kriegsbeute Hitlers aus Berlin nach Thüringen gebracht wurde und in Crawinkel und Gotha unterging. In der Jenaer Universitätsaula nun gibt es zwei Ereignisse, die sozusagen paradigmatisch und pars pro toto mit besonderer Deutlichkeit und Nachdrücklichkeit auf eine der großen katastrophalen Konstellationen des 20. Jahrhunderts verweisen, nämlich auf die genozidalen Exzesse des nationalsozialistischen Deutschlands. Es handelt sich um zwei Antrittsvorlesungen aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Antrittsvorlesungen sind bekanntlich im universitären Leben als festliche Ereignisse intendiert. Dass die beiden Antrittsvorlesungen, von denen jetzt die Rede sein soll, ausnahmsweise in der Aula stattfanden und nicht, wie sonst üblich, in dem damaligen Hörsaal 1 (jetzt 24), dem größten im Hauptgebäude, lag jeweils an der großen Zahl der Hörer. Beide Vorlesungen waren nicht nur akademische, sondern öffentliche Ereignisse. Man musste jeweils in die Aula „umziehen“, damit niemand vor der Tür blieb. Die erste der beiden Antrittsvorlesungen, gehalten am 28. Juni 1924, war die des ordentlichen Professors für Naturheillehre Dr. med. Emil Klein, der als Jude 1933 aus der Universität vertrieben und 1942 zusammen mit seiner Frau nach Theresienstadt deportiert wurde. Die zweite Antrittsvorlesung fand reichlich sechs Jahre später, 1930, statt, nämlich die Antrittsvorlesung des „Rassentheoretikers“ Dr. phil. Hans F. K. Günther, die er vor einem Auditorium mit lauthals triumphierenden Nationalsozialisten im Beisein Hitlers hielt. Im ersten Fall, bei Emil Klein, geht es um ein wissenschaftsgeschichtlich durchaus belangvolles Ereignis, nämlich die Präsentation des zweiten Lehrstuhlinhabers für Naturheillehre an einer deutschen Universität. Da erfüllte die Aula die Funktion als locus amoenus der Wissenschaft, mit einem Augenblick des Glanzes im wissenschaftlichen Leben, nicht nur dieser Universität, sondern eines Wissenschaftszweiges, der gewissermaßen mit diesem Geschehen im Kreis der Universitas litterarum seine große Aufmerksamkeit erregende Etablierung erfuhr. (Nähere Umstände der Berufung Emil Kleins darzulegen, muss ich mir ersparen, will aber die Gegenwehr der allopathischen schulmedizinischen Zunft wenigstens erwähnen, ebenso den Druck seitens der Landesregierung, des sozialdemokratischen Ministers Max Greil zumal.
Die Jenaer Universitätsaula als ambivalenter Raum
73
Er hatte der Universität und der Medizinischen Fakultät nahegelegt, einen Lehrstuhl für Naturheilkunde zu akzeptieren, was wiederum eine in die Öffentlichkeit getragene Forderung der naturheilkundlichen Fachverbände in Thüringen gewesen war. Siehe Dok. 2.) Die sechs Jahre später in demselben Raum, in der Aula, stattfindende spektakuläre Antrittsvorlesung des „Rassentheoretikers“ Hans Günther und zwar mit Hitler und neben ihm Hermann Göring und der nationalsozialistische thüringische Innen- und Volksbildungsminister Wilhelm Frick in der ersten Reihe, umgeben von nationalsozialistischer Jubelturbulenz, darf als ein wichtiger Schritt der Nazis bei der Etablierung der Rassenideologie in Deutschland und einer der frühen Schritte beurteilt werden, die in die Richtung des Holocaust führen. (Von Günther stammt die besondere Idolisierung der nordischen Rasse, deren Hochschätzung allerdings bereits aus dem 19. Jahrhundert stammt, durch Joseph Arthur de Gobineau (1816–1882) ins Leben gerufen und von Houston Stewart Chamberlain (1855–1927) bestärkt. Siehe auch Dok. 1.) Die Aula also – ich wiederhole es – in der Einheit von locus amoenus und locus infamis, allein schon durch diesen Fall ein Ort mit einer hochgradigen, das heißt weitreichenden Ambivalenz, die eine fatale Epoche von extremer Diskrepanz überspannt. Für die Nachfahren eine belastende, beschämende, schmerzliche Erinnerung, weil auch sie sich der Haftung nicht entziehen können, unabhängig von Zeit und Ort und jenseits aller Verjährung. Als ambivalentes Gesamtphänomen ein Fall größtmöglicher Ambiguität, ich bin versucht zu sagen: einer Makro-Ambivalenz. Der Verweis auf einen furchtbaren geschichtlichen Zusammenhang mit den Genoziden Nazideutschlands nötigt zu einer nachdrücklichen Reflexion darüber, ob nicht eine solche universitätsgeschichtliche Konstellation dazu verpflichtet, sie im kulturellen Bewusstsein, im kollektiven Gedächtnis zu erhalten, für die Erinnerung an sie vor Ort zu sorgen – eben trotz oder gerade wegen einer gar nicht so schwachen Gegenwehr bei dem Versuch, dem zu entsprechen. Ob das geschehen sollte, kann wohl hier nicht die Frage sein. Allenfalls die Art und Weise, wie es bewerkstelligt werden könnte, ruft weitere Fragen hervor. Die Sachverhalte fordern eine Schriftlösung, denn es sind einige genaue historische Informationen, am besten in Sätzen formuliert, zu präsentieren. Beide Ereignisse sollten nebeneinander gestellt werden, somit gewissermaßen aneinander gekoppelt. Auf den daraus entstehenden Effekt komme ich später zurück. Betrachten wir zunächst einmal verschiedene Möglichkeiten. Hält man sich die sparsamstmögliche Information zu diesen beiden Ereignissen einmal visuell parallelistisch gruppiert vor Augen, dann könnte sich in mittelachsensymmetrischer Form etwa die folgende einigermaßen rasch überblickbare (in Zeilenschritten gut lesbare) Textkonfiguration anbieten, die freilich erst einmal die minimale Textmenge liefert:
74
Gottfried Meinhold
I N DI E SE R AU L A
hielt Dr. med. Emil Klein 1923 – 1933 Professor für Naturheillehre in Jena am 28. Juni 1924 seine Antrittsvorlesung über Ärztliche Kunst – ärztliche Wissenschaft. Wegen ihrer jüdischen Herkunft wurden er und seine Frau 1942 in das KZ Theresienstadt deportiert.
hielt Dr. phil. Hans F. K. Günther 1930 – 1935 Professor für Sozialanthropologie in Jena am 15. November 1930 im Beisein von Adolf Hitler seine Antrittsvorlesung über Ursachen des Rassenwandels der Bevölkerung Deutschlands seit der Völkerwanderungszeit.
Beide Texte könnte man auch unter das gemeinsame Dach eines Schriftbalkens („In dieser Aula“) und nebeneinander stellen. Bei diesen Minimalinformationen fehlt aber doch zu viel Wesentliches: bei Günther seine Bedeutung für die Nationalsozialisten als Fanal und die Vorgeschichte der Berufung mit dem Druck des nationalsozialistischen thüringischen Innen- und Volksbildungsministers Frick auf die Universität, Günther in der MathematischNaturwissenschaftlichen Fakultät auf einem eigens eingerichteten Lehrstuhl für Sozialanthropologie zu platzieren. Es fehlen die anderen prominenten Nazi-Teilnehmer neben Hitler, eben Göring und Frick. Und es fehlt der Hinweis darauf, dass Günther bei der Entnazifizierung als Mitläufer davonkam und als freier Schriftsteller 1968 in der Bundesrepublik starb. Bei Emil Klein bleibt unerwähnt, dass seine Frau 1944 in Theresienstadt – wie es auf dem Grabstein steht – ermordet wurde. Und es steht nichts darüber da, dass Klein Theresienstadt überlebte, nach seiner Rückkehr unter bescheidensten Umständen in Weimar bis zu seinem Tod 1950 lebte und auf dem Erfurter jüdischen Friedhof begraben liegt. Durch einige dieser Fakten komplettiert, würden sich die verlängerten Texte folgendermaßen ausnehmen:
Die Jenaer Universitätsaula als ambivalenter Raum
75
I N DI E SE R AU L A
hielt Dr. med. Emil Klein 1923 – 1933 Professor für Naturheillehre in Jena am 28. Juni 1924
hielt Dr. phil. Hans F. K. Günther 1930 – 1935 Professor für Sozialanthropologie in Jena am 15. November 1930 im Beisein von Adolf Hitler
seine Antrittsvorlesung über Ärztliche Kunst – ärztliche Wissenschaft.
seine Antrittsvorlesung über Ursachen des Rassenwandels der Bevölkerung Deutschlands seit der Völkerwanderungszeit.
Die Berufung erfolgte 1923 durch den sozialdemokratischen Minister Max Greil. Wegen ihrer jüdischen Herkunft wurden er und seine Frau 1942 in das KZ Theresienstadt deportiert.
Die Berufung erfolgte 1930 durch den nationalsozialistischen Minister Wilhelm Frick. „Rasse-Günther“ konnte bis 1945 universitär wirken und danach als minderbelastet seinen Lebensabend in Freiburg/Br. verbringen.
Diese Textmenge ist für rascheres, beiläufiges Lesen, mit dem man rechnen muss, zu groß. Durch die Verlängerung des Textes wird in Kauf genommen, dass er nicht mehr auch im langsamen Vorbeigehen oder bei flüchtigem Stehenbleiben, en passant bis zum Schluss zur Kenntnis genommen wird; man muss beide Texte wirklich gründlich lesen, den von Klein zuerst und bis zum Schluss, den von Günther, der doch wohl anschließend rezipiert wird, zumindest bis zu der Stelle, wo der Name „Hitler“ fällt. Denn erst an diesem Punkt wird dem Leser klar, dass es sich um mehr handelt als das Gedenken an einen jüdischen Professor, der für den Weg in die Vernichtung vorgesehen war. (Kleins Abtransport von Theresienstadt nach Auschwitz war geplant, es kam aber nicht mehr dazu.) An diesem Punkt bildet sich eine Konklusion von besonderer Wichtigkeit: aus dem zeitgeschichtlichen Gesamtzusammenhang, wie knapp der auch angedeutet wird, treten die ganze Tragweite und die geschichtliche Kohärenz beider Geschehnisse erst in Erscheinung: ein schlagartiges Einleuchten, wie ein blitzartiges mit Erschrecken durchsetztes Erstaunen. Aber dieser Einsichtsblitz bei dem Namen „Hitler“ findet im Gesamttextablauf doch ziemlich spät statt. Die Nennung von Hitler sollte eher erfolgen. Das historisch Eminente und stark Signalisiernde, Hitler, wird als Rezeptionsreiz möglichst weit nach vorn gestellt, als ein Signal eben, das auf
76
Gottfried Meinhold
die Gesamtbedeutung dieses Nebeneinanders von Klein und Günther schlagartig hinweist, somit also den großen geschichtlichen Bogen bildet. Der Name Hitler muss eine zeitige Orientierungsreaktion auslösen, ein konzentriertes Aufmerken, das ein Weiterlesen auf dem höchstmöglichen Aktivationsniveau bis zum Schluss stimuliert. Die Information zum friedlichen, straffreien Lebensende Günthers wird – trotz ihrer Interessantheit – um der Verknappung willen weggelassen. Der Vorname Hitlers stellt eine ungewollte Nähe her, die wir scheuen, deshalb wird er weggelassen. Der Text für Günther würde nunmehr so lauten:
I N DI E SE R AU L A
hielt im Beisein von Hitler Dr. phil. Hans F. K. Günther 1930–1935 Professor für Sozialanthropologie in Jena am 15. November 1930 seine Antrittsvorlesung über Ursachen des Rassenwandels der Bevölkerung Deutschlands seit der Völkerwanderungszeit. Die Berufung erfolgte 1930 durch den nationalsozialistischen Minister Wilhelm Frick. Der „Rasse-Günther“ wirkte bis 1945 universitär.
Eine weitere Inschrift-Version, bei der die beiden Texte nebeneinander stehen, mit einer Art Überdachung durch die Ortsangabe „In dieser Aula“ zur Verdeutlichung der Gemeinsamkeit des Raumes, ein Schriftbalken mit größeren Lettern, Versalien oder Kapitälchen, wäre vielleicht noch besser geeignet, auf die historische Kohärenz der beiden Ereignisse im selben Raum hinzuweisen. Sie bietet den Vorteil der parallelen Nachbarschaft. Auch lässt sich durch Linksbündigkeit bei Klein und Rechtsbündigkeit bei Günther eine besser akzentuierte Distanz, die Kluft, zwischen beiden herstellen:
Die Jenaer Universitätsaula als ambivalenter Raum
77
I N DI E SE R AU L A
hielt Dr. med. Emil Klein 1923 – 1933 Professor für Naturheillehre in Jena am 28. Juni 1924 seine Antrittsvorlesung über Ärztliche Kunst – ärztliche Wissenschaft. Die Berufung erfolgte 1923 durch den sozialdemokratischen Minister Max Greil. Wegen ihrer jüdischen Herkunft wurden er und seine Frau 1942 in das KZ Theresienstadt deportiert.
hielt im Besein von Hitler Dr. phil. Hans F. K. Günther 1933 – 1935 Professor für Sozialanthropologie in Jena am 5. November 1930 seine Antrittsvorlesung über Ursachen des Rassenwandels der Bevölkerung Deutschlands seit der Völkerwanderungszeit. Die Berufung erfolgte 1930 durch den nationalsozialistischen Minister Wilhelm Frick. Der „Rasse-Günther“ wirkte bis 1945 an Universitäten.
Wollte man um der Kürze, also um des verringerten Lesezeitaufwandes willen die Information zur Berufung – bei Günther durch Frick – einsparen, dann würde man sich das Manko einhandeln, dass die für die Günther-Berufung spezifische nationalsozialistische Motivation zur Etablierung dieses Lehrstuhls keine Erwähnung mehr findet. Das geht nicht. Immerhin war es die Aktion eines ersten nationalsozialistischen Ministers in einem deutschen Landesparlament (1930!), und ausgerechnet in Thüringen. Beide – Emil Klein und „Rasse-Günther“ – sind als Personen Teil eines Gesamtgeschehens, eines historischen Makrogeschehens, in dem beide, der Täter – der Schreibtischtäter, Rassentheoretiker – und das Opfer – der jüdische Arzt und Hochschullehrer – auf verhängnisvolle Weise im ungeheuerlichen Makrogeschehen eines genozidalen Verbrechens koexistieren. Dass sie übrigens beide über zwei Jahre (1930–1933) Kollegen unter dem Dach dieser Universität waren, verleiht der Konstellation eine besonders makabre Note. Was wir soeben mit den Texten ausprobiert haben, bedarf eines linguistischen Seitenblicks: Denn wie hier zwei Kurztexte gewissermaßen als Makrozeichen zusammengestellt werden zu einem Gesamttext, das hat semantische Konsequenzen. Zunächst einmal wurden zwei zeitlich getrennte Geschehnisse zusammengerückt, sozusagen per Text miteinander verkoppelt. Die Kupplung ist zunächst der gemeinsame Raum „Aula“, das Ereignis „Antrittsvorlesung“, was die Personalie „Professorenstatus“ impliziert. (Das Aneinanderkuppeln geschieht kognitiv-semantisch in ähnlicher Weise
78
Gottfried Meinhold
wie bei der Bildung von Metaphern mit den zwei Elementen Bildgeber/Bildempfänger oder source/target oder wie immer.) Beide Geschehnisse um die Namen Klein und Günther bilden ein einheitliches Zeichen, ein Makrozeichen in der Form zweier aufeinander bezogener Texte, das – mit starkem Verweis – sich auf ein historisches Makrogeschehen bezieht, und zwar auf ein immenses Geschehen von eigentlich unvorstellbarer Leid-Trächtigkeit und Entsetzlichkeit, das als totum weder fassbar noch erträglich ist, nur als pars (pro toto) freilich für dieses große Ganze einer Kriegs- und Genozid-Totalität steht. (Es ist die Grundsituation des sprachlichen Zeichens: „Etwas steht für etwas [anderes].“) Analog zum kognitiven Geschehen einer Metaphorierung ereignet sich hier, was bei der konzeptuellen Metapher passiert: Das Evozieren eines großen assoziativen Umfeldes, in diesem besonderen Fall des größtmöglichen, immensen Umfeldes eines martialischen Geschehens auf dem Wege zum „totalen“ Krieg. (Bei einer konzeptuellen Metapher wie „die Gesellschaft als Garten“ lässt sich mit der Vorstellung von Unkrautbeseitigung und Schädlingsbekämpfung jegliche Grässlichkeit assoziieren.) Der Besucher der Aula, der durch diesen Text dazu veranlasst wird, der Facetten ihrer Geschichte und ihrer zeitgeschichtlichen Verquickung gewahr zu werden, sollte also durch die Dimension der assoziativen Erinnerungsfracht zu jenem Aufmerken veranlasst werden, das einer nachhaltigen Reflexionsbereitschaft dienlich ist. Damit verbundene psychische Konditionen, die aus dem Ertragen weitreichender Ambivalenzen wie dieser zu gewinnen wären, könnten einer bis ins Alltagsleben hinein wirkenden Toleranz der Ambiguität zugute kommen, die in der interpersonellen Kommunikation nicht nur bei diplomatischen Aktionen von größtem Nutzen ist. Dies aber nur als Nebenbemerkung. Ebenso wichtig oder wichtiger erscheint mir die Erprobung von Formen, die die Spannweite ganzer Zeitalter in Erinnerung zu halten lehren und unbefriedetem Vergessen samt seiner pathogenen Nachwirkung vorbeugen. Eine Zumutung zweifellos, aber – das wäre die Absicht – eine produktive. Es bietet sich also eine Gelegenheit, an zwei punktuellen Ereignissen von nur kurzer, etwa einstündiger Dauer, auf der Zeitachse eines Jahrhunderts oder Jahrtausends nur blitzartige Momente, Zeitpunkte eben und pars pro toto gewissermaßen, in der Spannweite eines ganzen Jahrhunderts, Genese und Wirkung politischer Wahnhaftigkeit in ihrer vollen Tragweite zu vergegenwärtigen, und zwar in einer Form, die die Erinnerung akzeptabel macht und einen Beitrag leistet, unbefriedetem Vergessen vorzubeugen. Letztlich gilt es, den Ort dieser Geschehnisse, die Aula, als das kenntlich zu machen, was er (spätestens) seit dem 15. November 1930 in aller Deutlichkeit auch ist, nämlich locus infamis, ein fataler Ort, ein Ort der Schande. Diese Doppelung – von historiogenem Glanz und Elend – hat der in diesem Raum Agierende, sei es nun rezeptiv oder produktiv, als ein den Raum Erlebender zu erkennen, zu ertragen, zu bewahren. Er wird vielleicht angestoßen, analoge Konstellationen der kommunistischen Diktatur, die hier keine Erwähnung fanden, zu ergänzen, etwa neben der Tatsache, dass bis 1948 Hans Leisegang in diesem Raum seine kritischen Philosophievorlesungen hielt, die seine Entfernung von der Universität zur Folge hatten, und dass sich die kommunistische Diktatur in der Aula in zahllosen Veranstaltungen selbst feierte oder Studenten in ihrem Sinne – z. B. in Vorlesungen der so genannte Roten Woche, die teilweise hier stattfanden – indoktrinierte, oder dass am 26. Januar 1966 eine Vollversammlung der
Die Jenaer Universitätsaula als ambivalenter Raum
79
Germanisten in der Aula stattfand, in der es um eine Zustimmung zu Wolf Biermanns Verurteilung im Zuge des berüchtigten 11. Plenums des Zentralkomitees der SED ging und um die Begründung der Resultate dieses Plenums. Und in derselben Aula fand 1991 die feierliche Aufnahme des Dichters Reiner Kunze, dessen Ausbürgerung aus der DDR 1977 erfolgt war, als Ehrenmitglied des Collegium Europaeum Jenense statt. Tempora mutantur – was für ein Glück bisweilen! Nun ja, in doloribus dixi – et gratias ago! Vielen Dank! DOK U M E N TAT ION 1 Dok. 1
[2008] 4. Zusammenfassung
Unter dem Einfluss einer Vielzahl rassistischer und nordisch-rassistischer Geschichtsinterpreten, Gelehrter und Anthropologen, völkischer Deuter und radikaler Antisemiten sowie sozialdarwinistischen, biologistischen und eugenischen Gedankenguts – die Hans F. K. Günther entscheidend prägenden [Georges Vacher de] Lapouge, [Houston Stewart] Chamberlain, [Herman] Lundborg, [Arthur de] Gobineau, [Paul Max Harry] Langhans, [Fritz] Lenz, [Alfred] Ploetz wurden mit ihrem Werk vorgestellt – entwickelte Günther seine an der „nordischen“ Rasse als Zielbild ausgerichtete politische Rassenlehre, ein umfassendes ideologisches Konstrukt der rassistischen Durchdringung und Erfassung von Mensch, Kultur, Gesellschaft und Staat. Günther legte eine in sich geschlossene rassistische Lehre vor, die aber nicht nur dem nordischen Gedanken in allen seinen Facetten wie dargestellt verpflichtet war, sondern auch maßgeblichst einem verheerenden Programm von Zucht, Auslese und „Ausmerze“ ihm „wert“ oder „unwert“ erscheinender Menschen und Bevölkerungsteile. Hinzu trat ein radikaler, rassistisch orientierter Antisemitismus, der auf die vollständige Entrechtung und „Entfernung“ der Juden aus dem deutschen Volk gerichtet war sowie die Propagierung einer machtvollen, rassistisch-expansiven, auf die Werte von „Blut und Boden“ gegründeten Politik der Eroberung und Dezimierung der als „minderwertig“ betrachteten Völker im europäischen Osten. Mit der Betonung der angeblichen Überlegenheit der „höherwertigen“ nordischen Rasse gegenüber allen anderen Rassen und den Juden, dem rassisch konstruierten Feind und Gegenbild, der vehementen Agitation gegen die „Verderblichkeit“ der Rassenmischung, der Berufung auf die „Reinerhaltung“ der Rasse als „Lebensgesetzlichkeit“ in direkter Verbindung mit einem menschenzüchterischen Konzept der „Aufartung“ sowie dem Zuchtziel einer „reinen“ nordischen Rasse wurde Günthers Rassenideologie eine der wesentlichsten, wenn nicht die wichtigste pseudowissenschaftliche Grundlage des biologistisch-rassistischen Nationalsozialismus, seine Schriften ermöglichten die rassistische Fundierung und politische Legitimation des nationalsozialistischen Staates. Günthers Rassenlehre regte nicht nur die fatale 1
Die Dokumentation erfolgt ohne die jeweiligen Fußnoten; kleinere Korrekturen wurden stillschweigend vorgenommen.
80
Gottfried Meinhold
rassenhygienische und antisemitische Gesetzgebung des NS-Staates maßgeblich mit an – Günthers persönlicher Beitrag etwa beim Zustandekommen des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ im Juli 1933 liegt dokumentiert vor –, sein Denken befruchtete zudem auch eine Vielzahl weiterer rassistischer Ideologen und führende nationalsozialistische Politiker wie den Reichsbauernführer Darré und Reichsführer-SS Himmler sowie ebenso in hohem Maße das gesamte nationalsozialistische Universum aus Schönheit, Gesundheit, Rasse und Herrschaft, Führertum, Auslese, Zucht, Entartung, Körperkult, „arteigener“ Kunst und Religion, Erziehung am Ideal des „heroischen“ und „ganzheitlichen“ Menschenbildes, zu dessen Untermauerung selbst die klassischen Denker der Antike von ihm herangezogen und mißbraucht wurden, wie am Beispiel seiner Platonrezeption deutlich wurde. Hans F. K. Günther, der zu den führenden rassistischen Intellektuellen des nationalsozialistischen Staates gehörte und wie an zahlreichen Beispielen gezeigt bereits seit den frühen 1920er Jahren fest im dichten mitteldeutschen völkischen Netzwerk um Schultze-Naumburg und Gerstenhauer verankert war sowie durch seinen Münchener Verleger Lehmann auch über gute Kontakte in die bayerische rechtsradikale Szene und ihr rassenhygienisches universitäres Umfeld verfügte, war somit letztlich mitverantwortlich für die historisch beispiellose eliminatorische Rassenpolitik des Nationalsozialismus und den Züchtungswahn eines „neuen“ nordischen Menschen, für die er mit seinem Werk die Grundlagen lieferte [...]. Verantwortung getragen für die menschenverachtenden Konsequenzen seiner rassistischen Doktrin oder gar Schuld dafür bekannt hat er nie, ganz im Gegenteil. Es blieb letztlich der Geschichte vorbehalten, über ihn zu richten. Quelle: Peter Schwandt: Hans F. K. Günther. Porträt, Entwicklung und Wirken des rassistischnordischen Denkens, Saarbrücken 2008, S. 142ff.
Dok. 2
[2012] 5.2.1 Die Berufung an die Universität Jena
Für die Berufung von Klein war letztlich, trotz der ihm bekannten ablehnenden Haltung der Medizinischen Fakultät, der Thüringer Volksbildungsminister Max Greil von der USPD/SPD verantwortlich. Seine Entscheidung rechtfertigte er damit, „[...] daß die Naturheilkunde [...] das Vertrauen der Arbeiter und Bürgerkreise [...]“ besitzt und dass „[...] die freie Forschung [...] gefördert werden [...]“ müsse. Am 13. Juni 1923 wurde der Medizinischen Fakultät mitgeteilt, dass der Volksbildungsminister sich entschlossen hatte, mit Emil Klein wegen des neu zu errichtenden Lehrstuhls für physikalischdiätetische Therapie (Naturheilkunde) in verbindliche Verhandlungen zu treten. Die Fakultät erklärte daraufhin: „Das Ministerium hat sich dadurch offensichtlich in schärfsten Gegensatz zur Medizinischen Fakultät gestellt.“ Ihre ablehnende Haltung begründeten die Mitglieder des Lehrkörpers unter anderem damit: „[...] wenn die Studierenden der Medizin, die als Lernende noch gar kein eignes Urteil haben können, von einem einseitig eingeschworenen Professor der Naturheilkunde an alledem irre
Die Jenaer Universitätsaula als ambivalenter Raum
81
gemacht werden, was von ihren übrigen Lehrern gelehrt und vor ihren Augen ständig angewandt wird. [...] Auch die großzügigen Regierungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Volksseuchen, Pocken und Geschlechtskrankheiten, Tuberkulose u. A. (sic!) könnte durch eine von der Universität Jena ausgehende Gegenagitation auf das Empfindlichste behindert werden. [...] Es ist daher unausbleiblich, dass durch die Berufung von Herrn Prof. Klein ein dauernder, unerspriesslicher und für die Einheitlichkeit des Unterrichts höchst schädlicher Kampf entfacht wird.“ [...] Obwohl Klein die ablehnende Haltung der Fakultät genau kannte, nahm er den Ruf an die Universität Jena an. Er wurde am 01. November 1923 zum planmäßigen außerordentlichen Professor und gleichzeitig persönlichen ordentlichen Professor an der Universität Jena ernannt, und erhielt den von ihm gewünschten, eher an technischen Behandlungsverfahren orientierten Lehrauftrag für „Klinische Pathologie und Therapie“. Die Medizinische Fakultät fühlte sich dadurch noch stärker provoziert und forderte umgehend, die aus ihrer Sicht irreführende Bezeichnung in [...] „Naturheilkunde“ umzubenennen. [...] In naturheilkundlichen, aber auch medizinischen Fachzeitschriften und besonders in der lokalen Tagespresse wurde der Hergang um die Lehrstuhlbesetzung eifrig [...] kommentiert, sowie häufig etwas überhöht von einem „Kampf“ gesprochen. In der Lokalpresse wurde die Berufung von Klein durchweg begrüßt und den Argumenten der Medizinischen Fakultät wenig Verständnis entgegengebracht. Als Reaktion auf diese Angriffe [...] verfasste die Medizinische Fakultät am 12. Oktober 1923 eine Gegendarstellung, die an die lokale Tagespresse, an verschiedene Fachzeitschriften und an andere Medizinische Fakultäten in ganz Deutschland versandt wurde. Auch eine daraufhin die Medizinische Fakultät unterstützende Stellungnahme des Verbandes der Deutschen Hochschulen vom 12. Januar 1924 erbrachte nicht den gewünschten Erfolg. [...] Am 14. März 1924 gab Prof. Klein offiziell die Aufnahme seiner Dienstgeschäfte bekannt. Durch die massiven Proteste und Drohungen initiiert, erfolgte die Umbenennung des Lehrauftrags. Am 15. Mai 1924 teilte das Thüringer Ministerium für Volksbildung der Medizinischen Fakultät mit, dass der Lehrauftrag die Bezeichnung „Naturheillehre und Naturheilverfahren“ erhalten habe. Damit hob er sich, wie von der Fakultät gewünscht, eindeutig von den anderen klinischen Fächern der Schulmedizin ab. Inwieweit Prof. Klein mit dieser Entscheidung einverstanden war, bleibt unklar. Am 16. Mai 1924 konnte dann die Einführung von Klein in den großen Senat erfolgen. [S. 34f.] 5.3.1 Die Universitätsklinik für Naturheilkunde unter Leitung von Klein Kleins Amtsantritt in Jena erregt große Aufmerksamkeit: „[...] bei der Antrittsvorlesung von Klein war das Auditorium so überfüllt, daß die Aula geöffnet werden musste, diese konnte aber auch kaum die Zuhörerschaft aufnehmen [...]“. Die Antrittsvorlesung wurde am Sonnabend, dem 28. Juni 1924 zum Thema: „Ärztliche Kunst – ärztliche Wissenschaft“ gehalten. Neben dem Vorhaben, seine theoretischen Überlegungen wissenschaftlich zu beweisen, wollte er mit seiner Lehre und Krankenbehandlung eine neue Generation von naturheilkundlich orientierten Ärzten heranbilden. Der Anfang
82
Gottfried Meinhold
in Jena war für Klein relativ schwer, das Versprechen, ihm ein eigenes klinisches Institut zu geben oder die Universitätspoliklinik zur Klinik umzubauen, wurde nicht erfüllt. Er musste sich vielmehr um zahlreiche Dinge selbst kümmern. Ein wichtiges Problem war am Anfang zum Beispiel die „Brotfrage“, da es sich als schwierig erwies, geeignetes reines Vollkornbrot in Jena zu besorgen. Insgesamt war der Anfang durch sehr einfache Bedingungen geprägt. Doch trotz aller Widrigkeiten eröffnete die Poliklinik im März 1924 und man behandelte dort bis zum August 1925 bereits über 2000 Patienten. Innerhalb der nächsten acht Jahre wurden schließlich in der Klinik fast 10000 Patienten poliklinisch und über 1000 stationär betreut. Quelle: Michael Baer: Prof. Dr. Emil Klein (1873–1950) und die Naturheilkunde an der Universität Jena. Med. Diss. Jena 2012, S. 31ff.
Dok. 3
9. Juni 2011
Frank Döbert: Erinnern ohne Erinnerung? Das ist das Thema einer Veranstaltung der Universität Jena zur Gedenkkultur [...] Jena. Zum Thema referiert zunächst Volkhard Knigge, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Im Anschluss an den Vortrag findet eine Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Klaus Dicke, Rektor, Prof. Dr. Eberhard Eichenhofer, Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Prof. Dr. Volkhard Knigge, und Prof. Dr. Heinrich Sauer, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, statt. Es moderiert Prof. Dr. Stephan Lessenich, Dekan der Fakultät für Sozial- und Verhaltenwissenschaften. [...] Die Universität hat [...] nicht nur die Baustelle „Petersen“, sondern noch etliche andere. So gab es nicht ursächlich wegen Petersen Veranlassung, erinnerungskulturelle Fragen zu diskutieren. Vielmehr ist es die schon weit gediehene Überlegung, zweier Personen der Universität – dem jüdischen, nach Theresienstadt deportierten Prof. Emil Klein und als Antipoden Prof. Hans F. K. Günther, dem Rassevordenker der Nazis – in einer Gegenüberstellung zu gedenken. [...] Quelle: Ostthüringer Zeitung vom 9. Juni 2011.
Die Jenaer Universitätsaula als ambivalenter Raum
Dok. 4
83 17. März 2016
Erinnern ohne Erinnerung? Podiumsgespräch über Erinnerungskultur an der FSU, am 9. Juni 2011, 17.00 Uhr, in der Aula Eröffnung: Rektor Prof. Dr. Klaus Dicke über das Aula-Projekt eines geeigneten Gedenkens an die Antrittsvorlesungen von Prof. Dr. Emil Klein 1924 und Hans F. K. Günther 1930. Einführung: Halbstündiger Vortrag von Prof. Dr. Volkhard Knigge über Grundsätzliches der Erinnerungskultur, ohne konkreten Bezug auf das aktuelle Projekt. Teilnehmer auf dem Podium mit ihren Statements 1. Klaus Dicke mit einem nachdrücklichen Plädoyer für das Erinnerungsprojekt, in der Aula in geeigneter Weise an die Ereignisse der beiden Antrittsvorlesungen zu erinnern. 2. Prof. Dr. Heinrich Sauer, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie formuliert, für die Medizinische Fakultät sprechend, seine Ablehnung des Projektes, ohne besondere Argumente geltend zu machen, und weist auch auf seinen Verzicht auf Argumente hin. 3. Prof. Dr. Eberhard Eichenhofer, Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, plädiert für die Aula als erinnerungsfreien Raum und begründet seine Ablehnung des Projekts auch mit Hinweisen auf nähere Umstände der umstrittenen Berufung von Emil Klein als Ordinarius für Naturheillehre im Jahr 1923, mit der nachdrücklichen Empfehlung des damaligen thüringischen Volksbildungsministers Max Greil. 4. Prof. Dr. Volkhard Knigge lobt das Projekt und bekundet seine ausdrückliche Sympathie dafür. 5. Als Moderator: Prof. Dr. Stephan Lessenich, Dekan der Fakultät für Sozialund Verhaltenswissenschaften Im Gespräch mit dem Publikum offenbart der Historiker Prof. Dr. Georg Schmidt seine Skepsis gegenüber dem Projekt und plädiert für dessen Ablehnung. Prof. Dr. Helmut G. Walther gibt dagegen zu bedenken, dass die Universitätsaula im Jenaer Universitätsleben während des Verlaufs der letzten 20 Jahre einen deutlichen Funktionswandel erfahren hat, der vielen jüngeren Universitätsmitgliedern und Neuberufenen vielleicht gar nicht vor Augen steht. Erst seit der Wende ist die Aula zum ständigen Ort von festlichen Veranstaltungen der Fakultäten, aber auch zu fakultätsübergreifenden und gesamtuniversitären feierlichen Treffen mutiert, wobei insbesondere an die neue hier verortete Tradition der Antritts- und Abschiedsvorlesungen, Ehrenpromotionen, Gedenkfeiern und kulturellen Veranstaltungen des CEJ zu erinnern ist. Das stellt gerade gegenüber der überwiegenden pragmatischen Nutzung der Aula durch die Universität noch zur Zeit der Weimarer Republik, im Dritten Reich und in der DDR eine deutliche Aufwertung
84
Gottfried Meinhold
dar. Dies darf freilich nicht zum Vergessen oder gar Verdrängen vorhergehender Ereignisse führen, die an diesem Ort stattfanden, die ihn im Langzeitgedächtnis durchaus zu keinem locus amoenus machen. Es waren zudem für die Ortswahl der Aula die bloße Raumnot dafür verantwortlich, also aus Not geborene Sonderfälle, dass die Antrittsvorlesungen von Emil Klein und F. K. Günther hier stattfanden. Schon die Möblierung des Saals wies mit seinem dominierenden Senatschorgestühl auf die andersartige „normale“ Nutzung. Nicht zu vergessen ist, dass die bis heute gültige architektonische Gestaltung der Halle mit der Einbeziehung eines Obergeschosses das Erbe eines Umbaus zugunsten des Rasseforschungsinstituts von Rektor Astel ist und damit ständig Zeugnis der nationalsozialistischen Umfunktionierung der Jenaer Universität bietet. Es steht der Universität gut an, dieser Ambivalenz der Aula Rechnung zu tragen und sich zu ihrer ungeteilten Geschichte zu bekennen. Die Denkmalpflege ist inzwischen schon lange von einer puristischen Renovierung als Wiederherstellung der „Reinheit“ eines ursprünglichen Zustands abgekommen. Erinnerung ist keine Verunreinigung der Aula als Ort wissenschaftlicher Weihehandlungen und Festlichkeiten. Sie „erinnerungsfrei“ zu erhalten ist einfach ein Unding und meint doch im Klartext „entpolitisieren“, was in keiner Weise das Anliegen der Erinnerung an die beiden Antrittsvorlesungen trifft: Auch Hodlers Gemälde an der Stirnseite anstelle des früheren martialischen Hanfrieds zu Pferde, die Gelehrtenporträts an der rechten Wand und schon die Erinnerungsbüste an Ernst Abbe fordern ja auf, sich an die wechselvolle Jenaer Universitätsgeschichte zu erinnern. Prof. Dr. Rolf Gröschner artikuliert seine persönliche Ablehnung des Erinnerungsprojektes zugleich mit der Ablehnung durch mindestens die Hälfte der Hochschullehrer der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Er habe sie persönlich zu ihrer Meinung über das Aulaprojekt befragt. Quelle: Erinnerungsprotokoll zum Podiumsgespräch vom 9. Juni 2011 angefertigt von Gottfried Meinhold und Helmut G. Walther am 17. März 2016.
Dok. 5
22. Mai 2007
Prof. em. Dr. Gottfried Meinhold Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir möchten die Gelegenheit nutzen, hier am Grab von Emil Klein dieses bedeutenden Arztes des 20. Jahrhunderts zu gedenken, der ein wunderbares Beispiel unermüdlicher Bemühung um die Fundamente ärztlicher Existenz und ärztlichen Wirkens gab, und dies in dürftiger, später sogar düsterer, entsetzlicher Zeit. Von 1923–1933 hatte Emil Klein den ersten Lehrstuhl für Naturheillehre und Naturheilverfahren an einer deutschen Universität, an der Universität Jena, inne. Er war ein kundiger Mediziner, gewiss, aber im Ringen um seine Bestimmung strebte er über die herkömmliche Wissenschaft seiner Zeit und seines Faches hinaus. Zudem schloss Heilkunde – dies der Gedanke seiner Antrittsvorlesung – für ihn Heilkunst ein: Das
Die Jenaer Universitätsaula als ambivalenter Raum
85
zu wissen und in solcher Überzeugung zu leben und zu handeln, setzt einmal voraus, was Schiller den philosophischen Kopf im Unterschied zum Brotgelehrten nannte, also den mit menschheitlichem Anspruch denkenden Menschen, zum anderen aber noch mehr: nämlich den Arzt als einen Menschen mit intensiver Empathie und Intuition. Emil Kleins geistige Ambition griff über den medizinischen Wissensstand hinaus, sein kritischer Geist litt unter den Defiziten des medizinischen Denkens seiner Zeit im Rahmen einer mehr und mehr messenden, zählenden Wissenschaft mit der Fokussierung auf die Krankheit und ihre Symptomatologie. Kleins Erkenntnis-Brennpunkt war die Genesung, unter Berufung auf die Lebenskraft, auf das Kräftepotenzial der Selbstheilung, aus dem vollen Wissen um das Wesen und die Besonderheit des einzelnen Menschen. Ärztliches Wissen wird mit Lebensweisheit angereichert. Solch kraftvoller Zugriff erinnert an große Arztgestalten der Geschichte: Galen oder Paracelsus. Kleins reiches Bekenntnisbuch mit dem Titel Naturheilverfahren bezeugt noch mehr: die Courage des Enthusiasten und die Zuwendung des Menschenfreundes, des Philanthropen, verbunden mit der geistigen Schwungkraft und Sprachmächtigkeit des Dichters, der seinen Werdegang in Leben und Denken in einem von Zuversicht, aber auch von kritischer Selbstbehauptung getragenen literarisch-wissenschaftlichen Selbstzeugnis öffentlich macht, mit Esprit geschrieben, bisweilen auch provokant polemisch: eine essayistische Meditation über die ärztliche Gesinnung und Bestimmung, ansteckend in ihrer Lebhaftigkeit. Man glaubt, beim Lesen Emil Klein zu hören, man spürt sein Temperament und die Kraft, aus der er seine Unerschütterlichkeit speist. Dieses Buch „Naturheilverfahren“, ein wahres Lebens-Werk, mutet an wie eine rhapsodische Textsinfonie, zugleich aphoristisch, es legt Zeugnis ab von der Ebenbürtigkeit gedanklich-rationaler und emotionaler Kräfte in der Mentalität des Arztes. Als begnadetem Praktiker war es ihm zwar um die Genesung des einzelnen Menschen zu tun, aber dahinter mochte ein tiefes Ahnen um die Heilungsbedürftigkeit der Menschheit überhaupt gestanden haben, des Verhängnisses eingedenk, dem der Mensch in einer mehr und mehr von ihm selbst radikal denaturierten künstlichen Umwelt mit all ihren pathogenen toxischen Einflüssen ausgeliefert ist. Kleins therapeutisches Prinzip, Allgemeinbehandlung sei anstelle alleiniger Lokalbehandlung vonnöten, oder: statt der Fixierung auf die Krankheit sei die Gesamtheit des kranken Menschen in Betracht zu ziehen, war durchaus angetan, eine Mehrheit der medizinischen Fachwelt zu provozieren. Aber er war ein Kämpfer, mit Worten und Taten, mit der glücklichen Hand des erfolgreichen Heilers, der kreativste Schüler seines väterlichen Lehrers Ernst Schweninger, der als Bismarcks Leibarzt schon zu Lebzeiten eine Legende war, ein unbändiger, unbeirrbarer, nicht zu entmutigender Geist, zugleich ein prägender Lehrer, der bedeutende Schüler in die Welt entließ. Emil Kleins philanthropische Hingabe hatte sich in einer Zeit zu bewähren, deren Not, zumal in Deutschland, mit der Jahrzehntwende zu den dreißiger Jahren eskalierte: Sein großer Plan eines Klinikbaus in Jena scheiterte, nachdem schon die Ausschachtungsarbeiten begonnen hatten, und zwar in dem Augenblick, als im Jahr 1930 die Nazis in der thüringischen Landesregierung mitwirkten und als es ihnen gelang, an der Jenaer Universität Prof. Günther, den Rasse-Günther, als ersten Rassentheoretiker überhaupt an einer deutschen Universität zu etablieren. 1930 hielt Günther im Beisein Hitlers und Görings in der Jenaer Aula seine Antrittsvorlesung,
86
Gottfried Meinhold
begrüßt vom Triumphgeschrei der Nazis, die die Aula in jener Stunde zum Locus infamis und höllischen Ort degradierten, frühe Station auf einem Weg, der direkt zur Wannseekonferenz 1942 und zur „Endlösung“ der Vernichtung jüdischer Menschen, dem Holocaust, führte. Nur reichlich sechs Jahre zuvor, am 28. Juni 1924, hatte Emil Klein zu Beginn seiner Antrittsvorlesung in ebendiesem Raum unter dem Thema Ärztliche Kunst – ärztliche Wissenschaft einleitend in bewegenden Worten von der Ehrfurcht gesprochen, die er an dieser Stätte vor der Größe des deutschen Geistes empfand. Von der Seele und Sehnsucht des Arztes sprach er schließlich, von ärztlicher Kunst und ärztlicher Wissenschaft als den „zwei eng zusammengehörende[n] Anteile[n] des geistigen Arztwesens“ – so seine Worte. 1933 beendete das Naziregime wenige Wochen nach der Machtergreifung in Deutschland die Tätigkeit des jüdischen Professors Emil Klein an der Universität Jena. Es gelang ihm, noch einige Jahre als Arzt in Jena zu praktizieren. Seine Kinder, zwei Söhne und eine Tochter, verließen Deutschland rechtzeitig und entgingen der Vernichtung. Er und seine Frau blieben und erlitten 1942 die Deportation in das Konzentrationslager Theresienstadt. Antonie Klein-Salomon, genannt Toni, überlebte nicht. Sie musste unter den mörderischen Lebensbedingungen von Ghetto und KZ das Leben lassen. Ihr zum Gedenken ließ Emil Klein auf dem Grabstein die folgenden Zeilen anbringen: „Sie war in der Liebe rein / in der Gefahr erhaben / im Schmerz heiter / in Schicksalsschlägen unerschrocken“. Emil Klein kehrte 1945 nach Jena zurück, mittellos und ohne Einkünfte. Ein Ruhegehalt wurde ihm jahrelang versagt, er musste – horribile dictu – die Landesregierung um Unterstützung bitten und verschuldete sich; später erhielt er einen geringfügigen monatlichen Geldbetrag. 1947 trat er im Wintersemester noch einmal mit einem medizinischen Kolleg über Naturheillehre in Erscheinung. In Weimar, wo er die letzten Lebensjahre verbrachte, starb er im St. Elisabeth-Heim der Grauen Schwestern am 21. Mai 1950 – gestern vor 57 Jahren – wenige Wochen nach der Vollendung des 77. Lebensjahres. Am 7. März 1873 hatte Emil Kleins Lebensbogen in Reichenberg in Böhmen seinen Anfang genommen. Sohn eines jüdischen Unternehmers war er Abiturient und Student in Prag, wählte nach seiner Promotion – 1898 in Prag – Berlin als Ort seines beruflichen Wirkens, dort von 1907 an als leitender Arzt der Poliklinik für physikalisch-diätetische Therapie – bis sich für den fünfzigjährigen exzellenten Praktiker die Universität Jena als akademische Wirkungsstätte und Kampfplatz für die Anliegen seines Faches öffnete. Trotz seiner legendären ärztlichen Tätigkeit hatte er sich in Jena nie ganz heimisch gefühlt, war dort stets ein Gast geblieben, im wöchentlichen Hin und Her zwischen Jena und Berlin, wo die Familie lebte – erst zuallerletzt, freilich mehr notgedrungen, im Thüringischen ansässig, wurde er schließlich in thüringischer Erde, an diesem Platz, am 25. Mai 1950 zur letzten Ruhe gebettet.
Die Jenaer Universitätsaula als ambivalenter Raum
87
Prof. Dr. Christine Uhlemann, Klinik für Innere Medizin II der FSU, Jena, Kompetenzzentrum Naturheilverfahren Sehr verehrte Damen, geehrte Herren, als Vertreterin der Naturheilkunde an der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist es mir eine besondere Ehre und innere Verpflichtung, heute ein paar Worte zum Gedenken an Professor Emil Klein, den ersten Lehrstuhlinhaber für Naturheilkunde in Deutschland, zu seiner Sicht auf die Medizin per se, seinem medizinischen Wirken und seinen Visionen, anlässlich der Einweihung des neuen Grabsteines zu sprechen. 1924 wurde er auf politischen Druck von Laienverbänden und Krankenkassen zum Professor berufen und 1933 vom Nazi-Regime und durch Protestschreiben der Medizinischen Fakultät entlassen. Ich sehe mich in der Phalanx seines Tuns an der Universität Jena, wo er auch ein Opfer eines ignoranten, universitären Hochmutes gegenüber der Naturheilkunde gewesen ist. (Zitat: „Durch die Anerkennung der einseitigen Naturheilkunde verleugne sich Fakultät“.) Dabei muss man sein Tun kennen, um ihn auch als Vertreter der Naturheilkunde an der Universität zu verstehen. Es kam ihm freilich auf die ganzheitliche Betrachtungsweise und Behandlungsweise seiner kranken Patienten an, aber sein Credo war, diese ganzheitliche Medizin auch wissenschaftlich zu messen, zu bewerten und damit zu belegen. Und genau diese Intention, die natürlichen Heilweisen integrativ mit der sogenannten Schulmedizin anzuwenden, ist mein Anspruch an der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena, somit bin ich quasi seine fachliche Enkelin und stolz, heute hier diese Worte sagen zu dürfen. Ich versuche, dieses Vermächtnis nach bestem Wissen und Gewissen zu bewahren und aufbauend auf seinen Lehren in Erweiterung der gewonnenen Erkenntnisse zur Wirkungsweise klassischer Naturheilverfahren in der studentischen Ausbildung, in der medizinischen Forschung und in der Patientenbetreuung anzuwenden. Der Unterschied zwischen Professor Klein und mir besteht darin, dass die meisten der heutigen Hochschulvertreter einer klassischen Naturheilkunde als integrativem Partner der sogenannten Schulmedizin aufgeschlossen gegenüberstehen. Beispielhaft sind an der Universität Jena die seit 2003 existierende naturheilkundliche Ambulanz in der Onkologie sowie das 2005 von mir gegründete Kompetenzzentrum Naturheilverfahren zu nennen, beides unter der Direktorenschaft von Professor Höffken, dem Ärztlichen Direktor des Klinikums, der die Naturheilkunde am Universitätsklinikum seit Jahren fördert und fordert. Dabei ist Jena wie kein anderer Ort berufen, Gedanken zur Ganzheit wieder aufzugreifen. In Hufeland kulminierte in dieser Stadt noch einmal die ausklingende Naturphilosophie. Jena war Zentrum und Höhepunkt der romantischen Medizin. Später haben Klein und Grober, in zwar unglücklicher persönlicher Verstrickung, die Naturheilkunde zu einer überzeugenden Physiotherapie geführt. Die Fachvertreter, die das medizinische Denken und Handeln von Professor Klein begriffen hatten, zollten ihm Respekt und Achtung, teilweise auch Bewunderung. Für die Patienten war er segensreich. Quelle: Reden anlässlich der Einweihung des neuen Grabsteines für Prof. Dr. Emil Klein auf dem jüdischen Friedhof in Erfurt am 22. Mai 2007, abgedruckt im Ärzteblatt für Thüringen 7–8 (2007), S. 446ff.
88 Dok. 6
Gottfried Meinhold
25. Juli 2014
Auf dem Workshop „ambivalente Orte der Erinnerung an deutschen Universitäten“ wurde am 28. März 2014 auch das Projekt einer geeigneten Erinnerung an die Antrittsvorlesungen von Emil Klein und Hans F. K. Günther in der Jenaer Universitätsaula vorgestellt, das in der Diskussion des hierzu gehaltenen Vortrages ausdrücklich gutgeheißen und in der vorgestellten Form zur Umsetzung empfohlen wurde. Beschlussvorschlag: Der Senat spricht sich dafür aus, den vorgeschlagenen Text (Anlage) in der Aula zu präsentieren. Der Rektor wird gebeten, einen Umsetzungsvorschlag zu erarbeiten. [Anmerkung: Dem Senat lag der Text der hier angeführten zweispaltigen Version vor. Vom Senat wurde angeregt, den Vornamen der Frau von Emil Klein (Antonie oder Toni) im Text zu nennen. Bei dem Hans F. K. Günther betreffenden Text erfolgte der Vorschlag einer Veränderung der Formulierung des letzten Satzes. Bei dem zur Realisierung nach diesen Senatsvorschlägen ergänzten, veränderten Text wurde der letzte Satz getilgt.] Quelle: Vorlage für Senat [der Friedrich-Schiller-Universität] am 25. Juli 2014, TOP 18.
DI E GE SCH ICH T E DER L EI P Z IGER U N I V ERSI TÄTSK I RCH E ST. PAU LI U N D DI E DISKUSSION EN U M EI N E N W I EDER AU F BAU 1 Jens Blecher DI E U N I V E RSI TÄT U N D DI E K I RCH E In der universitätsgeschichtlichen Literatur herrscht ein reger Diskurs, ob die mittelalterlichen Hochschulen einer kirchlichen, einer klerikalen oder vielmehr der weltlichen Sphäre zurechnen sind.2 Alle Vertreter der unterschiedlichen Betrachtungsweisen können durchaus fundierte Argumente für ihre jeweiligen Thesen vorbringen. Über den akademischen Diskurs hinaus hat der moderne Verfassungsstaat mit seinen rechtlichen Normierungen der letzten 200 Jahre oft genug Rücksicht auf die Korporationsprivilegien der Universität Leipzig genommen. Damit ist der gegenwärtige Streit um die Leipziger Universitätskirche auch ein Auslegungsstreit um das traditionell geprägte Selbstbild der Universität, dessen stadtbürgerlicher Außenwahrnehmung und um die politische Deutung des Verhältnisses von Staat und Kirche. Im Falle der Leipziger Hochschulgründung durchdringen sich diese drei Sphären von Anfang an fast unentwirrbar. Schon seit den 1380er Jahren hatte es in Prag immer wieder Streit zwischen Magistergruppen und dann gar zwischen den Universitätsnationen gegeben. Insbesondere der Nationenstreit wurde durch die städtische Bürgerschaft als Nationalitätenstreit emotional verstärkt und schließlich durch kirchen- und reichspolitische Interessen bis zur gewalttätigen Eskalation getrieben. Mit der durch ehemals Prager Hochschullehrer betriebenen Neugründung einer Universität in Leipzig, gelang der einen Konfliktpartei ein Neuanfang ohne Streit. Der Papst gestand der neuen Universität das Lehrrecht zu sowie alle anderen Korporationsrechte, wie sie an älteren Universitäten üblich waren. Die sächsischen Landesherren stifteten zwei Kollegien (zur räumlichen Unterbringung wie zur materiellen Versorgung von Dozenten und Studenten), und der Leipziger Rat stellte eine Immobilie zur Verfügung.3 Schließlich brachten die Prager Exilanten nahezu selbstverständlich die 1 2
3
Für diesen Artikel hat der Autor, der zugleich Direktor des Universitätsarchivs Leipzig ist, ausschließlich öffentliche Quellen genutzt. Alle inneruniversitären Archivunterlagen zu dem Thema sind mit einer 30-jährigen Sperrfrist noch bis mindestens ins Jahr 2020 für eine allgemeine Benutzung gesperrt. Siehe u. a.: Georg Kaufmann: Geschichte der deutschen Universitäten, Band I, Vorgeschichte, Graz 1958; Band II, Entstehung und Entwicklung der deutschen Universitäten bis zum Ausgang des Mittelalters, Graz 1958. Photomechanischer Nachdruck der Ausgabe Stuttgart 1888/1896; Friedrich Paulsen: Die Gründung der deutschen Universitäten im Mittelalter, in: Historische Zeitschrift (45) 1881, S. 251–311; Otto Gerhard Oexle Gerhard: Alteuropäische Voraussetzungen des Bildungsbürgertums, in: Werner Conz, Jürgen Kocka (Hg.): Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert. Teil 1, Bildungssystem und Professionalisierung im internationalen Vergleich, Stuttgart 1992, S. 29ff. Enno Bünz: Gründung und Entfaltung. Die spätmittelalterliche Universität Leipzig 1409–1539, in: Geschichte der Universität Leipzig 1409–2009. Gesamtausgabe in fünf Bänden, Band 1, Leipzig 2010, S. 21–330, hier S. 67.
90
Jens Blecher
mit ihren kirchlichen Ämtern verbundenen, zumeist personenbezogenen Präbenden in die neue Hochschule ein. Die neue Leipziger universitas hatte daher von Anfang einen Wesenskern, der, wie bei all ihren europäischen Schwestern auch, sowohl aus eher weltlichen, aus eher kirchlichen und aus Mischelementen bestand. Die Nähe zur Kirche hatte schon einen ganz praktischen Grund. Aus der reichen Großstadt Prag kommend, wo seit 1344 der eindrucksvolle Veitsdom auf der Prager Burg langsam empor wuchs, fanden die Universitätsgründer die schmucklose, um 1231 errichtete Kirche des Dominikanerklosters in Leipzig wohl nur wenig anziehend. Die kopfstarke Gruppe der Magister und Scholaren benötigte und bevorzugte die Versammlungsplätze von größeren Innenstadtkirchen.4 Die Gründung der Universität fand am 2. Dezember 1409 im Refektorium des Thomasklosters statt und dieser Raum diente noch über 100 Jahre hinweg als Universitätsaula. Erst um 1537 fanden die ersten Universitätsversammlungen im Großen Kolleg, einem universitätseigenen Gebäude, statt. Der alltägliche Vorlesungsbetrieb in der mittelalterlich engen wie kleinteiligen Stadt war jedoch von bescheidenen Raumverhältnissen geprägt, immer wieder klagten die Akademiker über den desolaten Zustand von Gebäuden und den hohen finanziellen Aufwand zu ihrer Erhaltung. Doch plötzlich bot die Reformation und die vom Landesherrn in Aussicht gestellte Übertragung des Dominikanerklosters an die Universität eine phänomenale Chance, diesen Zuständen dauerhaft zu entkommen. Mit ihrem tatkräftigen Rektor Caspar Borner nutzte die Universität diese Gelegenheit und verfolgte dieses Ziel auch weiter, als sie mit dem Rat der Stadt in heftigen Streit über die Zueignung des Klosterbesitzes geriet. Am 22. April 1544 wurde die Urkunde mit dem Besitztitel durch den sächsischen Landesherrn ausgestellt. Die Universität übernahm die Gebäude, die in den letzten Jahren verlassen gelegen und geplündert worden waren, zunächst mit erheblichem Bauaufwand. Bisher hatte die Universität allenfalls über Streubesitz innerhalb der Stadtmauern verfügt – nun entstand ein geschlossenes Universitätsareal, ein lateinisches Quartier, das sogar noch zahlreiche Annehmlichkeiten bot. Neben dem für damalige Verhältnisse riesigen Bibliothekssaal, zwei Versammlungssälen (einem Sommer- und einem Winterrefektorium) vermittelt eine kurze Aufzählung der noch wichtigeren Wirtschaftsgebäude eine Vorstellung von der faktisch neu fundierten Universität: Klostergarten mit Krankenstube, Apothekergewölbe, Destillierhaus, Brauhaus, Schneiderei, Schusterei, Schweine-, Rinder- und Pferdeställe, Malzhaus, Backstube, Weinkeller, Bad, Küchentrakt. Die ganze Anlage mit Versammlungsräumen und Wirtschaftseinrichtungen konnte nahezu unverändert für den Universitätsbetrieb genutzt werden – die PaulinerKirche verlor mit der Auflösung des Klosters ihre eigentliche Gemeinde und die sakrale Funktion. Der umbaute Raum diente weiterhin als geschlossener Andachtsund Begräbnisraum, wurde aber vorwiegend für akademische Rituale, die festlichen Promotionszeremonien der Fakultäten, genutzt. Erst im 18. Jahrhundert deutete sich ein Wandel in der Benutzung des Kirchengebäudes an. Indem die Universität sich nach und nach von den letzten konfessionellen Schranken löste, entwickelte sie sich allmählich von einer geistlichen hin zu einer geistigen, von Staatsinteressen geprägten Institution. 4
Zum Ende des Wintersemesters 1409/1410 war die Zahl der Universitätsangehörigen auf rund 350 Personen angestiegen.
Die Geschichte der Leipziger Universitätskirche St. Pauli
91
Die feierliche Zeremonie der höchsten, der Theologischen Fakultät, in der dem Kandidaten der Doktorhut übergeben wurde, fand bis zur Reformation in der Nikolaikirche und danach bis 1768 in der Paulinerkirche statt.5 Wegen der hohen Kosten für die Promovenden, die ja meist aus der sächsischen Landeskirche stammten, suchte das Dresdner Oberkonsistorium immer wieder den Aufwand zu reduzieren. 1734 fand der Promotionsakt erstmals in einem Hörsaal statt – was die Kosten erheblich senkte.6 Neben den Gebühren in harter Münze war hier noch der obligatorische Doktorschmaus vom Kandidaten zu bezahlen, der sich im 18. Jahrhundert bei den Theologen bis hin zu einer exorbitanten Summe von über 1000 Talern belaufen konnte.7 Bei den Juristen wurde seit der Reformation bis zum Jahre 1752 eine gleichermaßen anspruchsvolle Zeremonie in der Paulinerkirche gefeiert.8 Zum Promotionsritus gehörten die Übergabe zweier Bücher (ein offenes und ein geschlossenes Buch), des Doktorringes, des Doktorhutes und der Doktorkuss.9 Nach der Einweihung der neuen Fakultätsgebäude wurden die Promotionen seit 1779 im Petrinum gefeiert.10 Für die Mediziner und die Philosophische Fakultät lassen sich ähnliche Entwicklungen nachweisen. Universitäre Festakte wurden aber weiterhin in der Paulinerkiche begangen und ganz natürlich zur Entfaltung weltlichen Pomps genutzt. Nach der Erlaubnis zur Abhaltung von akademischen Gottesdiensten seit 1710 bestallte die Universität einen eigenen Universitätsmusikdirektor, der diese Zeremonien zu begleiten hatte. Dem Musikleben der Universität verhalf Johann Sebastian Bach zu ungeahntem Ruf, der von 1723 bis 1725 zahlreiche Werke im Auftrag der Universität komponierte und in der Paulinerkirche auch selbst aufführte. In der Universitätskirche verkehrten die gelehrten Korporationen mit dem Stadtrat zeremoniell auf Augenhöhe, wenn es darum ging, mit öffentlichen Festakten Regierungsantritte oder Professorenjubiläen bzw. 5 6 7
8
9
10
Carl Christian Carus Gretschel: Die Universität Leipzig in der Vergangenheit und Gegenwart, Dresden 1830, S. 115. Otto Kirn: Die Leipziger Theologische Fakultät in fünf Jahrhunderten, in: Festschrift zur Feier des 500-jährigen Bestehens der Universität Leipzig, Bd. 1, Leipzig 1909, S. 159. Dort auch Angaben zu den Kosten für den Doktorschmaus einzelner Promotionen im 18. Jahrhundert. Vgl. ausführlich dazu: Georg Erler: Leipziger Magisterschmäuse im 16., 17. und 18. Jahrhundert, Leipzig 1905, S. 43–158, 206; Festschrift 1909, Band 1, S. 128: bringt die Aufstellung eines Doktorschmauses von 1666 – damals hatten sich vier Doktoranden zusammengeschlossen, um die Kosten für das Mahl und die Geschenke in Höhe von 633 Talern aufbringen zu können. Die Gebühren dagegen beliefen sich auf moderate 64 Taler pro Person. Gretschel: Universität (1830) S. 125. Bei Friedberg findet sich in einer Fußnote der Hinweis, dass der eigentliche Promotionsritus mit den „üblichen Formen“ bereits im 17. Jahrhundert zum Erliegen gekommen wäre. Vielleicht hat sich hier allerdings nur ein Druckfehler eingeschlichen, denn bis zur Einweihung des neuen Petrinums 1779 erwähnt er immer wieder „sollemne Promotionen“ (Festschrift (2/1909), S. 8.). Emil Friedberg: Die Leipziger Juristenfakultät, ihre Doktoren und ihr Heim, Leipzig 1909, in: Festschrift (2/1909), S. 9: „Auch pflegte der junge Doktor mit Gepränge einen Umritt zu halten und einen Tanz zu geben, was, obgleich es nach Ausspruch der Fakultät ‚geschicht frauen und iungkfrauen zu ehrenn’ von Herzog Georg 1522 verboten wird.“ Festschrift (2/1909), S. 8. Bei Friedberg findet sich in einer Fußnote der Hinweis, dass der eigentliche Promotionsritus mit den „üblichen Formen“ bereits im 17. Jahrhundert zum Erliegen gekommen wäre. Vielleicht hat sich hier allerdings nur ein Druckfehler eingeschlichen, denn bis zur Einweihung des neuen Petrinums 1779 erwähnt er immer wieder „sollemne Promotionen“.
92
Jens Blecher
Geburtstage oder Sterbefälle im Herrscherhaus oder von Universitätsangehörigen zu begehen. Selbst nach der Reformation wurde die Kirche weiter als Begräbnisstätte genutzt – nach seinem frühen Tod wurde dort u. a. der Reform-Rektor Caspar Borner (1492–1547) begraben. Seine letzte Ruhestätte fand dort ebenfalls der weithin bekannte Jurist Benedikt Carpzov (1595–1666). Die folgenden Jahrhunderte überdauerte die Universitätskirche weitgehend unbeschadet. Nach den Bombennächten von 1943 und 1944 stand die Universitätskirche unzerstört in einer Trümmerlandschaft. Direkt neben und in der Kirche hatte auch das Universitätsarchiv die Brandbomben überstanden. Zunächst hatte sich die Sanierung des seit 1943 teilzerstörten Universitätsareals am Augustusplatz über lange Jahre hingezogen. Für Baumaßnahmen, bis auf minimale Erhaltungsmaßnahmen, waren an den Zentralgebäuden der Universität keine Kapazitäten eingeplant.
Abb. 1 Augustusplatz mit Universitätshauptgebäude und Universitätskirche (um 1920)
Um 1950 war die Studentenzahl wieder auf dem Vorkriegsniveau, doch mehr als einen Notbetrieb und halbzerstörte Gebäude hatte die Universität nicht zu bieten. Im Vorfeld des Jubiläums von 1959 verlangte die Hochschulleitung dringend nach einer baulichen Lösung der unbefriedigenden Verhältnisse. Spätestens nach dem Universitätsjubiläum entwickelte sich auf politischer Ebene, vom Politbüro über die Bezirks- bis hinab zur Stadtleitung der SED, der Entschluss, das Areal am Karl-Marx-Platz vollständig zu beräumen und einen sozialistisch determinierten Neubau zu errichten. Alle traditionsbezogenen und kunsthistorischen Aspekte wurden beiseite gewischt und die neue Architektur am Karl-Marx-Platz als Kulisse für Aufmärsche und Großdemonstrationen geplant. Auch hier standen sich allerdings politische Ansprüche und bauwirtschaftliche Realität gegenüber – eine anfangs noch erwogene Verschiebung der Universitätskirche war schwierig und der geplante Universitätsneubau hätte einen erheblichen Teil der sächsischen Baubetriebe
Die Geschichte der Leipziger Universitätskirche St. Pauli
93
über Jahre hinweg gebunden. Dennoch kam es im Dezember 1967 zu einem Architektenwettbewerb, der im Ausschreibungstext einen Neubau favorisierte, ohne die Universitätskirche zu erwähnen. In der Bevölkerung, in der Sächsischen Landeskirche und innerhalb der Universität – nicht nur innerhalb der Theologischen Fakultät – häuften sich die Befürchtungen um einen Kirchenabriss. Ende März 1968 lagen die Pläne der Architektenbüros vor – nur eine Variante sah noch eine Integration der Kirche in den neuen Baukörper vor. Am 7. Mai 1968 wurde über die Planungsvorschläge im Politbüro der SED beraten. Einen Sieger im Wettbewerb gab es nicht, aber in der abschließenden Kombination zweier Planungsvarianten war ein Erhalt der historischen Bausubstanz nicht mehr vorgesehen. Nur einige repräsentative Kunstgegenstände sollten geborgen werden – soweit die Entnahmearbeiten den Abriss nicht beeinträchtigten. Am 16. Mai wurde die Leipziger Stadtverordnetenversammlung über die Planungen informiert. Einen Tag später fanden Sondersitzungen der Theologischen Fakultät und des Akademischen Senates statt – der Dekan der Theologen, Ernst-Heinz Amberg, vertrat dort standhaft die Meinung seiner Fakultät, dass ein Abriss nicht in Frage komme. Auch der Ägyptologe und Vizepräsident der Sächsischen Akademie, Siegfried Morenz, engagierte sich öffentlich gegen die Kirchensprengung. Schriftlich protestierte der auch in Jena gut bekannte Historiker Max Steinmetz gegen die geplante Kirchensprengung. Am 23. Mai 1968 jedoch billigte die Stadtverordnetenversammlung im Neuen Rathaus den Abriss – mit lediglich einer Gegenstimme, und selbst dieser eine Protest wurzelte in einer kalkulierten Aktion des Staatsicherheitsdienstes. Am selben Tag fanden mittags bzw. abends die letzten evangelischen / katholischen Gottesdienste statt. Danach wurde die Kirche verschlossen und gegen 22.00 Uhr begannen die Steinmetze bereits mit den ersten Abbrucharbeiten. Unter chaotischen Verhältnissen, während riesige Lafettenbohrmaschinen Sprenglöcher meißelten, versuchten Denkmalpfleger und Archivare am 24. Mai die Bergungslisten abzugleichen. Weder Lagerplatz noch Personal oder Transportkapazität stand für die Bergung zur Verfügung – die Orgel konnte nur knapp, bevor die Sprengladungen scharf gemacht wurden, noch geborgen werden. Nicht alle Begräbnisstätten konnten geräumt werden, auch eine Entwidmung der Kirche fand nicht mehr statt. Auf dem Augustusplatz kam es am 28. Mai zu Tumulten, mehrere Dutzend Menschen wurden verhaftet, Polizisten drängten die schweigende Menge unter Einsatz von Hunden und Gummiknüppeln ab. Für den 30. Mai 1968 wurde in der Leipziger Volkszeitung die Sprengung öffentlich angekündigt und tatsächlich umgesetzt. Kurz vor 10 Uhr kam eine gewaltige Staubwolke aus dem Gebäude, die westliche Giebelwand sackte in sich zusammen, der Kirchturm stürzte in südlicher Richtung ein und nach einer kaum wahrnehmbaren Verzögerung fiel auch die östliche Giebelwand um.
94
Jens Blecher
Abb. 2 - 4 Steinmetz-Protestbrief (1968)
Die Geschichte der Leipziger Universitätskirche St. Pauli
95
DI E DE BAT T E N U M N EU BAU ODE R W I E DER AU F BAU DE R U N I V ERSI TÄTSK I RCH E NACH DER F R I E DLICH E N R EVOLU T ION Mit der Kirchensprengung von 1968 wurde zugleich ein Nullpunkt in der historischen Vergangenheitsbewertung erreicht. Zwischen den beiden Jubiläen von 1959 und 1984 hatte die Karl-Marx-Universität Leipzig nicht nur ihre historische Bausubstanz verloren, auch die Wissenschaftsstrukturen waren von der DDR mit der dritten Hochschulreform grundlegend geändert worden. Die Fakultäten und akademischen Wahlämter verschwanden, die Studiengänge wurden neu geordnet, zeitlich wie inhaltlich gestrafft und sämtliche historischen Bezüge verschwanden aus dem Alltag der Hochschulen. Unter diesen Vorzeichen gewann der achtlose Umgang mit Traditionen und Geschichte, verkörpert durch die rabiate Zertrümmerung einer filigranen Architektur mit vielen religiösen Bezügen, einen zusätzlichen Symbolwert. Was bedeutete diese Kirche am Augustusplatz für die Universität Leipzig? War sie tatsächlich nur ein Gebäude, das der neuen Zeit im Wege stand? In der DDR konnte eine solche Debatte nicht öffentlich ausgetragen werden. Das historisch unerwünschte Gedenken wurde aus dem Kanon der offiziellen Erinnerungen komplett ausgeblendet. Die mutige Protestaktion11 einzelner Studenten zum Bachwettbewerb 1968 fand keine Nachahmer, die gesprengte Universitätskirche blieb den nachfolgenden Studentengenerationen, sofern sie nicht aus Leipzig stammten, unerklärt und mehrheitlich wohl sogar völlig unbekannt.12 Den aufmerksamen Beobachter erinnerten im Innenhof steinerne Begräbnistafeln und eine große Glocke an die frühere sakrale Funktion des gesamten Areals – wobei das letztere Relikt von den meist jungen Leuten wohl eher mit einer Schulglocke auf dem Pausenhof assoziiert wurde. Der demokratische Aufbruch in der DDR vollzog sich zu wesentlichen Teilen im Herbst 1989 in Leipzig, hier nahmen die ersten großen Demonstrationen mit den Forderungen nach Redefreiheit, Pressefreiheit und Reisefreiheit ihren Anfang. Besonders am 7. und 9. Oktober 1989 standen sich Demonstranten und sozialistische Ordnungsmacht unsicher gegenüber, jederzeit hätte ein Schuss fallen können. Die Stimmung war enorm angespannt, das ganze Land hielt den Atem an. Im Laufe des Oktobers, schließlich mit dem 9. November war klar, dass dieser Erneuerungsprozess nicht mehr zu stoppen war. Mit dem großen Wahlkampfauftritt von Helmut Kohl am 15. März 1990 bewegte sich der politische Zug in Richtung auf die deutsche Einheit. Ironischerweise spielten sich alle diese Ereignisse unmittelbar neben oder vor dem historischen Standort der Universitätskirche ab. Der Einsatz von Wasserwerfern 11 12
Klaus Fitschen: Wissenschaft im Dienste des Sozialismus, in: Geschichte der Universität Leipzig 1409–2009, Gesamtausgabe in fünf Bänden, Bd. 3, Leipzig, S. 571–782, hier S. 738. So wurde zum Universitätsjubiläum 1984 auf allen bildlichen Darstellungen die Universitätskirche ausgeblendet. Am Augustusplatz waren eher geisteswissenschaftliche Studiengänge angesiedelt. Die Gebäude und Hörsäle der Medizin, der Veterinärmediziner und der meisten Naturwissenschaften lagen außerhalb des Leipziger Stadtringes. Die Theologie konnte keine Räume im neuerbauten Hauptgebäude beziehen, stattdessen bekam sie 1972 einen singulären Standort am Zoo, fernab der übrigen Wissenschaften.
96
Jens Blecher
und martialisch aufgerüsteter Volkspolizei gegen das eigene Volk fand in der Grimmaischen Straße, am Ausgang zum Augustusplatz statt. Eine große Litfaßsäule vor der Karl-Marx-Universität bot den DDR-Bürgern die erste Möglichkeit zur freien Meinungsäußerung. Von der Oper aus, hatte Walter Ulbricht angeblich die Sprengung der Universitätskirche verlangt, genau dort forderten im Frühjahr 1990 begeisterte Demonstranten vom Bundeskanzler die schnellstmögliche Wiedervereinigung. Nach der staatlichen Wiedervereinigung und der geordneten Übernahme rechtsstaatlicher Strukturen geriet das Thema Unrechtsbewältigung und Vergangenheitsaufarbeitung recht bald in den politischen Fokus: Vor allem interessierte zunächst die Frage nach persönlicher Schuld in der Diktatur und individueller Sühne. Daneben forderte das marode Stadtbild von Leipzig einen sorgsamen Umgang mit der gerade noch eben erhaltenen historischen Substanz. Doch scheinbar völlig überraschend und wie aus dem Nichts heraus, beschäftigten sich viele lokalstolze Leipziger mit dem äußerlich intakten Augustusplatz, einem der einstmals schönsten Plätze Europas. Das fehlende historische Gesicht der Universität und die brutale Vernichtung von wertvoller Bausubstanz durch die SED verlangten ihrer Meinung nach Aufarbeitung und Bewertung. Im Januar 1992 formierte sich mit dem Paulinerverein13 eine Initiativgruppe, zum Wiederaufbau von Universitätskirche und dem Universitätshauptgebäude Augusteum. Zugleich gab es ernsten Widerspruch dagegen, auch aus kirchlichen Kreisen. Der ehemalige Leipziger Studentenpfarrer und Zwickauer Superintendent Dietrich Mendt äußerte sich im April 1992 öffentlich ablehnend dazu: „Frage: Jüngst hat sich eine Initiative zum Wiederaufbau der Universitätskirche gegründet. Treten Sie auch dafür ein? Dietrich Mendt: Nein, ich bin dagegen. Eine Gedenktafel sollte still an die Willkür von damals erinnern.“14 Wenig später wurde die Frage nach einem Wiederaufbau von Reinhard Bohse, einem Bürgerrechtler des Herbstes 1989, beim ersten Leipziger Montagsgespräch öffentlich wiederholt. Die emotionale Sprengkraft dieser Frage schlug große Wellen, und wieder schien ein Intellektueller, der Schriftsteller Erich Loest, die rationale und richtige Antwort parat zu haben: „Wenn unsere Enkel einmal viel Geld haben, können die vielleicht ernsthaft darüber nachdenken.“15 Kurz darauf meldete sich Günther Fritzsch, einer der Studenten, die 1968 zum Internationalen Bachwettbewerb ein Plakat16 mit der Forderung nach Wiederaufbau der Universitätskirche entrollt hatten, öffentlich zu den damaligen Ereignissen und stellte eine gedruckte Publikation vor. Nun verknüpfte sich das Thema als eine Art positives Erinnerungsmoment mit der mutigen Courage einzelner Studenten, die 1968 mit einer Zeitsteuerung das Plakat enthüllt und damit für die DDR einen internationalen Eklat ausgelöst hatten. Die 13 14 15 16
Zur Geschichte des am 15. Januar 1991 Paulinerverein siehe Martin Helmstedt, Ulrich Stötzner: Vernichtet, vergraben, neu erstanden: Die Universitätskirche St. Pauli zu Leipzig, Leipzig 2015. „War die Uni-Kirche nicht zu retten?“ Interview von Thomas Mayer, in: LVZ (Leipziger Volkszeitung) v. 29.4.1992. Bericht von Thomas Mayer über das erste Reizthema der „Montagsgespräche“, in: LVZ v. 6.5.1992 Günter Fritzsch: Gesicht zur Wand. Willkür und Erpressung hinter Mielkes Mauern, Leipzig 1993. Bereits 1990 erschien von Harald Fritzsch: Flucht aus Leipzig – Eine Protestaktion und ihre Folgen, München 1990.
Die Geschichte der Leipziger Universitätskirche St. Pauli
97
gelungene Protestaktion war ein doppelter Schlag gegen den ungeliebten Staat: Weder wurde das Vorhaben von Spitzeln verraten, noch konnten die Beteiligten später von der Staatsicherheit verhaftet werden. Einer der Beteiligten, Harald Fritzsch, damals Doktorand am Institut für Biophysik, floh kurze Zeit später bei einer ebenso spektakulären Aktion mit einem Faltboot über das Schwarze Meer in den Westen. Im Mai 1993 wurde am Hauptgebäude der Universität eine steinerne Erinnerungstafel enthüllt, die sowohl an den kulturlosen Frevel der SED wie an den fehlenden persönlichen Mut von Stadtverordneten und Akademikern erinnerte. Vonseiten der Universität äußerte sich dabei der Rektor und Hoffnungsträger der Universitätserneuerung, Cornelius Weiss wiederum skeptisch gegenüber einem Nachbau: „Ich bin gegen den Wiederaufbau der Universitätskirche. Das wäre eine historische Lüge, ein Potemkinsches Dorf. […] Wir plädieren für einen Mehrzweckbau mit sakralem Charakter, in dem auch die Aula ihren Standort haben soll.“17 Damit war das Thema scheinbar aufgearbeitet und mit einem abschließenden Diktum belegt. In den nächsten Jahren blieb es still um die Universitätskirche: doch an der Theologischen Fakultät war auf Anregung von Günther Wartenberg bereits seit 1990 eine Dissertation in Arbeit, die erstmals in Form einer wissenschaftlichen Untersuchung die Geschichte der Universitätskirche beleuchtete. Besonders nachhaltig wirkte, dass Christian Winter darin die politischen Ereignisse um die gewollte Zerstörung der historischen Universitätsgebäude detailreich, faktenkundig und für ein breiteres Publikum erstmalig nachlesbar, schilderte.18 Mit der Drucklegung der Arbeit im Jahre 1998 entstand für die nach 1968 geborene Generation ein facettenreiches Stimmungsbild, das das nachwirkende Gefühl der Ohnmacht gegenüber diesem Akt sozialistischer Kulturbarbarei vermitteln konnte. Zur Erinnerung an den Sprengungstag vor 30 Jahren organisierte die Universitätskustodie im Mai 1998 eine Ausstellung der vor der Sprengung geborgenen Kunstschätze. Die berührende Nähe der geretteten Kunstwerke sorgte wohl für die große Emphase der Redner. Cornelius Weiss sprach in seiner sehr bewegenden Rede von der notwendigen Trauerarbeit, während der Universitätskustos Rainer Behrends den Bogen schon weiter spannte und für die historischen Kunstwerke einen neuen Raum erhoffte, eine „ […] Aula ebenso wie einen Festsaal, eine Universitätskirche und ein Memorial, in dem die lange Geschichte erlebbar und lebendig wird.“19 Mit einer Kunstinstallation im öffentlichen Raum platzierte Axel Guhlmann in konfrontativer Nähe zum Marx-Relief,20 das seit 1974 über dem Haupteingang der Universität thronte, eine provozierende Erinnerung an die gesprengte Giebelstruktur der Paulinerkirche. Diese Trias aus nüchterner wissenschaftlicher Untersuchung, emotionaler kunsthistorischer Erinnerung und medienträchtiger künstlerischer Provokation, sorgte für eine neuerliche politische Debatte und einen sich von nun an verschärfenden Meinungsstreit. Die Streitgründe bezogen sich weniger auf den Umgang mit den historischen Erinnerungen, sondern vielmehr auf die notwendige und angemessene 17 18
LVZ v. 24.5.1993. Christian Winter:: Gewalt gegen Geschichte: Der Weg zur Sprengung der Universitätskirche Leipzig, Leipzig 1998. 19 LVZ v. 09.6.1997. 20 Siehe dazu Jutta Schrödl, Wolfgang Unger: Installation Paulinerkirche 1998, Leipzig 1998.
98
Jens Blecher
Form der Aufarbeitung. Die öffentliche Verurteilung der Kirchensprengung als politischer und barbarischer Willkürakt ist seit 1990 bis heute ziemlich einhellig. Es gab daher keinen Streit zwischen politischen Parteien, die Altkader der SED und die Leipziger Linke bezogen öffentlich kaum Positionen in den folgenden Jahren. Als polarisierende Meinungsführer fanden sich vielmehr die prominenten Studenten der Protestaktion von 1968, der Paulinerverein und viele ältere Leipziger auf der einen Seite, während ihren Plänen Universität und Landeskirche ablehnend gegenüberstanden. In den folgenden Jahren sorgte der Streit um die besseren Argumente auch für ein eskalierendes Ringen um die öffentliche Meinungsführerschaft und damit um die Beeinflussung der Landesregierung, des potentiellen Geldgebers und Bauherrn. Denn bis zum Jahre 2009, dem 600jährigen Jubiläum der Universität Leipzig, sollte die Universität nach dem Willen der Landesregierung einen Neubau mit Aula erhalten. Mit dem alleinigen Verweis auf rationale Argumente, den hohen Kosten jeglicher Umbauwünsche oder eines Wiederaufbaus, geriet die Universität offenkundig schnell in die Defensive. Besonders die international erfolgreiche Spendenkampagne zum Wiederaufbau der Frauenkirche in Dresden zeigte die finanzielle Möglichkeit solcher Rekonstruktionen. Wegen der zahlreichen Spenden kamen die seit 1996 begonnenen Bauarbeiten an der Frauenkirche sogar schneller voran als gedacht. Als die Universität im Dezember 1999 den Rückbau der Guhlmann-Installation vor ihrem Hauptgebäude forderte, während das Marx-Relief allein aus finanziellen Gründen erhalten bleiben sollte, führte das zu einem Verständnisproblem in der Öffentlichkeit. Rektor Volker Bigl hatte kurz vor Weihnachten öffentlich erklärt: „Die Plastik [gemeint ist das Marx-Relief] allein wird uns wieder deutlich unsere Geschichte vor Augen führen. Der Abbau würde eine Million Mark kosten. Das ist in Anbetracht der ohnehin geplanten Neugestaltung des Gebäudes nicht zu vertreten.“ In der öffentlichen Wahrnehmung schien es nun so, dass mit der Kunstinstallation die Kirche wieder symbolisch abgerissen würde, während die Universität an Karl Marx festhielte.21 Die Universität hatte inzwischen einen internen Arbeitskreis ins Leben gerufen, um vor allem die funktionalen Planungen in Bezug auf einen universitären Neubau weiter zu entwickeln. Dem konnte dann ein architektonischer Wettbewerb folgen, wobei aus Sicht der Universität das multifunktionale Aula-Gebäude die Erinnerung an die Paulinerkirche und das Klosterareal aufnehmen sollte.22 Im Rückblick ist bemerkenswert, dass der damalige Vorsitzende des Paulinervereins, Martin Helmstedt, keine Zweifel hinsichtlich der benötigten Funktionsausstattung seitens der Universität äußerte. Sein Nachfolger im Vereinsvorsitz, der emeritierte Medizinprofessor Wolfram Behrendt, hielt im Oktober 2000 bereits den Plan eines Kirchenwiederaufbaus für unrealistisch. „Sie sind gegen den originalen Wiederaufbau? Ja. Ich will den Schulterschluss mit der Universität und befürworte die Pläne für eine ‚Paulineraula‘, die mit möglichst vielen architektonischen Zitaten an das Original erinnern soll. Dafür werde ich überall werben.“23 21
LVZ v. 18./19. Dezember 1999. Die „Installation Paulinerkirche“ blieb noch bis Januar 2006 vor dem Hauptgebäude der Universität stehen (LVZ v. 25. Januar 2006). 22 LVZ v. 14.1.2000. 23 LVZ v. 20.10.2000.
Die Geschichte der Leipziger Universitätskirche St. Pauli
99
Die beiden konträren Standpunkte schienen auf einen tragfähigen Kompromiss zuzulaufen, als die Universität plötzlich im April 2001 mit drastischen Vorwürfen konfrontiert wurde. „Die Universität darf sich nicht auf der von der SED geschaffenen Baufreiheit durch rein profane Nutzbauten zum Ulbricht’schen Sprengungsgewinnler machen.“24 Die Brüder Dietrich und Eckhard Koch, die ebenfalls an der Protestaktion beim Bachwettbewerb von 1968 beteiligt gewesen waren,25 verlangten, an der ursprünglichen Idee des Wiederaufbaus weiter festzuhalten.26 Rektor Bigl monierte vor allem den provokanten Ton der Festschrift, die der Universität eine immer noch existierende ideologische Nähe zur früheren Karl-Marx-Universität unterstellte und alle Demokratisierungsbemühungen ignorierte. Der Geschäftsführer des Paulinervereins, Otto Künemann, begrüßte im Gegensatz zur Universität das Grundanliegen der Denkschrift und forderte, etwas maßvoller im Ton „[…] eine größtmögliche Ähnlichkeit des zu errichtenden Aulagebäudes mit der früheren Kirche […]“.27 Diese Meinungsäußerung kam zu einem besonderen Zeitpunkt. Die Universität war gerade dabei, die Ausschreibungen fertigzustellen, um noch vor der Sommerpause einen zweiteiligen Architektenwettbewerb starten zu können. Damit sollte ein ganzes Bündel von Baumaßnahmen umgesetzt werden: „Neubau der Mensa als Anschluss ans Hörsaalgebäude, Abriss der alten Mensa, Neubau Institutsgebäude für Wirtschaftswissenschaften, Errichtung der Aula an historischer Stelle mit großem Hörsaal einschließlich einer Ladenzone (privater Investor), Sanierung des verbliebenen Teils des Hauptgebäudes (Sitz der Fakultät Mathematik/ Informatik) sowie von Hörsaal- und Seminargebäude.“28 Der Paulinerverein plante zeitgleich für den universitären Neubau eine Stiftungsgründung, die mit 25.000 DM privatem Anfangskapital von öffentlich-rechtlichen Partnern größere Summen für die neue Universitätsaula einwerben wollte. Während der Rektor sich für den Neubau eine Rekonstruktion der historischen Fassade vorstellen konnte, so zeichneten sich neue Streitpunkte im Detail schon deutlich ab: Sollte der Pauliner-Altar von der Thomaskirche in den Universitätsneubau versetzt werden und was sollte mit dem Marx-Relief geschehen? Im Juli 2001, kurz vor der Ausschreibung des Architektenwettbewerbs, meldeten sich zahlreiche prominente Befürworter des Wiederaufbaus in einem öffentlichen Aufruf zur Wort. Rektor Bigl verschärfte den nun aufkommenden polemischen Ton, als er die tatsächliche Beteiligung einiger Prominenter in Frage zog und seinen Austritt aus dem Paulinerverein in Aussicht stellte. Weiter folgten seitens der Universität einige Vorwürfe an die Pauliner: sie hätten sich bisher zu wenig in die Debatte eingebracht, die Vorplanungen für den Architektenwettbewerb seien abgeschlossen, der von Bund und Freistaat Sachsen gemeinsam finanzierte Hochschulbau habe eine endliche Rahmenhöhe mit gut 180 Millionen DM.29 24 LVZ v. 11.4.2001. 25 Dietrich Koch: Das Verhör. Zerstörung und Widerstand, Dresden 2000. 26 Dietrich Koch, Eckhard Koch: Denkschrift für den Wiederaufbau der Leipziger Universitätskirche St. Pauli, Dresden 2001. 27 LVZ v. 11.4.2001. 28 LVZ v. 30.5.2001. 29 LVZ v. 13.7.2001.
100
Jens Blecher
Spätestens an dieser Stelle, so scheint es im Nachgang, entwickelte sich aus der Debatte um die angemessene Form der Erinnerung an die gesprengte Universitätskirche ein polemischer Streit, der von allen Kombattanten zunehmend über öffentliche Medien ausgetragen wurde. Der im Urlaub weilende Vorsitzende des Paulinervereins erklärte gegenüber der Presse, über diese Vereinsaktivitäten nicht informiert gewesen zu sein und stellte sein Wahlamt in Frage. Erstmals regte sich nun das Interesse der Parteipolitiker an dem Thema, zunächst vonseiten der PDS, die sich mit Vorwürfen und Schuldzuweisungen gegenüber der CDU zu Wort meldete. Im Dezember 2001, kurz vor Weihnachten sollten die Architekturentwürfe begutachtet werden, folgte ein weiterer medialer Paukenschlag. Auf Initiative von Günter Blobel (1999 Nobelpreisträger für Medizin und Mitglied des Paulinervereins), unterschrieben 26 weitere Nobelpreisträger eine Forderung zum Wiederaufbau der Universitätskirche.30 Erst im Januar 2002 äußerte sich die Universität zu der prominenten Forderung nach Wiederaufbau – und zwar ablehnend. Rektor Bigl, im Interview gegenüber der Presse leicht verärgert, wiederholte nochmals die vorgebrachten Argumente, fügte jedoch einen interessanten erinnerungsgeschichtlichen Aspekt hinzu. „Ich verstehe sehr wohl, dass man den Wiederaufbau fordern kann. Ich bin jedoch nach über 30 Jahren für eine differenzierte Sicht und glaube, dass wir, wenn wir alles wieder so herstellen, wie es gewesen ist, kein Zeichen des Erinnerns, sondern des Vergessens setzen.“31 Obwohl das Thema nun mittlerweile viele Menschen beschäftigte, sollten die Entwürfe für den universitären Neubau erst im Mai öffentlich vorgestellt werden. Wie heftig die emotionalen Turbulenzen inzwischen waren, zeigte eine Veranstaltung des mit über 300 Personen sehr mitgliederstarken Paulinervereins. Eigentlich als Festveranstaltung aus Anlass des zehnjährigen Bestehens gedacht, uferte die Debatte immer mehr aus, speziell der Vereinsvorstand Behrendt wurde wegen seiner Abkehr vom Wiederaufbau heftig angefeindet, er weigerte sich aber vehement, freiwillig zurückzutreten.32 Im Bericht über die vorgezogene Neuwahl des Vereinsvorstandes im März 2002 stellte sich dann aber heraus, dass Behrendt, ebenso wie vor ihm Rektor Bigl, inzwischen aus dem Paulinerverein ausgetreten war. Als neuer Vereinsvorstand wurde der persönlich nicht anwesende Nobelpreisträger Günther Blobel gewählt. So standen sich in Fragen des Universitätsneubaus und eines Kirchenwiederaufbaus nun zwei Mediziner mit konträren Positionen gegenüber.33 Als nächstes Problem stellte sich die tatsächliche Bauausführung am Augustusplatz heraus. Die Mitte Mai 2002 öffentlich präsentierten Architekturentwürfe waren schon seitens der Jury nicht mit einem ersten Preis honoriert worden. Der dritte Preis sah eine Freifläche als Erinnerungsort für die gesprengte Paulinerkirche vor, während der zweite Preis eher Vorstellungen modernistischer Funktionskubatur folgte. Eine Leipzigerin brachte ihre Enttäuschung über den ausstehenden großen Entwurf mit 30 31 32 33
LVZ v. 19.12.2001. LVZ v. 12.1.2002. LVZ v. 17.1.2002. LVZ v. 4.3.2002.
Die Geschichte der Leipziger Universitätskirche St. Pauli
101
deutlichen Worten zum Ausdruck „Ich weiß, dass die Architekten bauen wollen. Aber ein bisschen mehr als nur Klötzchen hinsetzen, das hätte ich ihnen schon zugetraut.“34 Aus Sicht des Paulinervereins war nur einer der fünften Preise akzeptabel (der fünfte Preis wurde an drei verschiedene Architektenentwürfe ausgereicht), der als Einziger eine erkennbare Kirchengestaltung enthielt. Mit seiner Äußerung über Bauvorgaben seitens der Universität, die zu viele Vorgaben zum integrierenden Erhalt der bestehenden Gebäude in den Neubau gemacht hätte, äußerte sich Wolfgang Tiefensee in Richtung Öffentlichkeit zum mangelnden Ergebnis des kostenintensiven Architekturwettbewerbes. Einem Kirchenbau stand der Oberbürgermeister kritisch gegenüber, ohne ihn gänzlich ausschließen zu wollen. Er forderte allerdings eine moderne Architektursprache zum Gedenken, um „[...] an diese Kirche und wohlgemerkt an den kommunistischen Akt kultureller Barbarei zu erinnern.“35 Der neue Vereinschef der Pauliner, Blobel, hielt sich mit seiner Meinung über die kleinkarierten und halbherzigen Planungen kaum zurück. In der Hoffnung, dass der „misslungene“ Wettbewerb ein deutliches Signal in Richtung Wiederaufbau setzen würde, stiftete er zugleich 30.000 Euro für die Öffentlichkeitsarbeit des Paulinervereins.36 In der Öffentlichkeit begann nun der Blick über den Leipziger Stadtrand hinaus zu schweifen. Offenbar waren die Pläne für den Wiederaufbau der kriegszerstörten Dresdner Frauenkirche auch mit emotionalen Ressentiments konfrontiert worden. Doch in Dresden ebenso wie bei dem Berliner Wiederaufbauprojekt, dem Berliner Stadtschloss, war die umliegende historische Architektur noch weitgehend intakt. Der Leipziger Kunsthistoriker Thomas Topfstedt37 lehnte im direkten Vergleich mit diesen Projekten einen Wiederaufbau ab. Auch Elisabeth Hütter,38 die sich intensiv mit der Paulinerkirche beschäftigte hatte, stand einer historischen Kopie ablehnend gegenüber. „Was soll denn eigentlich aufgebaut werden? Die Paulinerkirche war doch, ich sage das ohne jede Abwertung, ein Konglomerat verschiedener Bauepochen. Etwa die Rippen im Gewölbe ganz andere als die im Chor, der Aufgang zur ProfessorenEmpore stammte aus dem Barock und die Fassade vom Ende des 19. Jahrhunderts. Ein originaler Wiederaufbau wäre meiner Meinung nach intellektuell nicht redlich.“39 Im August 2002 fand in der Alten Nikolaischule eine Debatte um die Architekturentwürfe statt, wobei die Mehrheit der Anwesenden dank der guten Präsentation des zweitplatzierten Architektenbüros und durch die deutlichen Worte seitens des Baubürgermeisters, Engelbert Lütke-Daldrup, den gewünschten Funktionsneubau der Universität begrüßte.40 34 35 36 37
LVZ v. 24.5.2002. LVZ v. 25.5.2002. LVZ v. 30.5.2002. Topfstedt: „Mir geht es um eine Memorial-Funktion und nicht um eine Kopie“, in: LVZ v. 6./7.7.2002. 38 Elisabeth Hütter: Die Pauliner-Universitätskirche zu Leipzig. Geschichte und Bedeutung, hg. v. Landesamt für Denkmalpflege Sachsen und der Universität Leipzig, Weimar 1993 (als Dissertation 1961 in Leipzig angenommen). 39 LVZ v. 6./7.7.2002. 40 LVZ v. 7.8.2002.
102
Jens Blecher
Parallel dazu hatten sich tiefgreifende Veränderungen in der sächsischen Landespolitik ereignet. Nach dem Rücktritt des langjährigen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf übernahm im April 2002 der bisherige Finanzminister Georg Milbradt dessen Verantwortung. Bei der folgenden Neubesetzung der Kabinettsposten wurde der Wissenschaftsminister Hans Joachim Meyer nicht mehr berücksichtigt. Anfang Mai 2002 übernahm der frühere Kultusminister Matthias Rößler nun das Wissenschafts- und Kunstministerium. Im Nachklang auf diesen Amtswechsel bekennt Meyer sich in seiner Autobiographie zur Erinnerungsfunktion der gesprengten Universitätskirche, die aber gerade wegen der historischen Erinnerung nicht zu einem bloßen Wiederaufbau geraten dürfe.41 Bei seinem Amtsnachfolger sieht Meyer indes mehr politische Beweggründe walten, da der Leipziger CDU-Stadtverband sehr unzufrieden mit dem Ausgang des Architektenwettbewerbs gewesen sei und der neue Minister diesen Meinungen in der eigenen Partei nachging. Im November 2002 trifft sich der neue Minister Rößler in Dresden erstmals mit allen Beteiligten – dem Rektor, dem Oberbürgermeister und dem Paulinerverein –, um über den Universitätsneubau zu reden. Offenbar ist der finale Ausgang des Bauvorhabens aber immer noch ungewiss, denn Rektor Bigl will nach dem Gespräch „Druck ausüben“, „[…] damit die Staatsregierung über den bis 2009 zu verwirklichenden Bau rasch entscheidet.“ In die gleiche Richtung zielten eine, fast einmütige Stellungnahme des Akademischen Senates der Universität Leipzig, die sich an Ministerpräsident Milbradt richtete, und eine Erklärung des Oberbürgermeisters Tiefensee.42 Für den Januar 2003 wurde nun von allen Seiten eine Entscheidung der Landesregierung erwartet: sollte der zweitplatzierte Architektenentwurf nun realisiert werden? Im Januar 2003 sorgt aber zunächst der Paulinervorsitzende für Schlagzeilen. Blobel, seit 2001 Mitglied der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften, konnte innerhalb des Vatikans neue Interessenten für einen Kirchenneubau in Leipzig gewinnen. Bis zu einem Drittel der Baukosten könnte das katholische Bistum in Meißen beisteuern, erklärte Blobel gegenüber der Presse.43 Am 27. Januar meldete sich Rektor Bigl überraschend mit einer Rücktrittsdrohung zu Wort, offenbar schien es ihm möglich, dass in der Landesregierung ein Stimmungsumschwung zum bisherigen Baukonzept der Universität eintreten könnte. Bigl sah den Architektenwettbewerb ursächlich mit dem Vorrecht des Grundstückseigentümers in allen Baufragen verknüpft – und das Grundstück sei nun mal im Besitz der Universität Leipzig. Über die Zuordnung des jahrhundertealten Stiftungs- und Korporationsvermögens hatte es nach juristischen Auseinandersetzungen zwischen Universität und Freistaat Sachsen im Jahre 2000 einen außergerichtlichen Vergleich gegeben.44 Das im Zuge der Reformation 1543 von Herzog Moritz der Universität 41
Hans Joachim Meyer: In keiner Schublade. Erfahrungen im geteilten und vereinten Deutschland, Freiburg i. B. 2015, S. 612. 42 LVZ v. 15.11.2002. 43 Im Mai 2015 wurde ein katholischer Kirchenneubau in Leipzig fertiggestellt und offiziell geweiht. Die Baukosten lagen nach Medieninformationen bei rund 15 Millionen Euro. 44 Am 17.12.1996 hatte die sächsische Regierung ein Immobiliengeschäft mit der Depfa-Bank beschlossen. Dabei tauschte sie das Universitäts-Hochhaus am Augustusplatz gegen ein Gerichtsgebäude. Die Universität Leipzig beschritt dagegen den Klageweg bis zum Bundesverwaltungsgericht.
Die Geschichte der Leipziger Universitätskirche St. Pauli
103
übereignete Dominikanerkloster wurde vom Freistaat als Körperschaftsvermögen der Universität anerkannt. So lange die Universität die darauf befindlichen Gebäude für Lehre und Forschung nutzt, übernimmt der Freistaat den Bauunterhalt. Tatsächlich berichtete die Presse einen Tag später, dass die Landesregierung in ihrer Kabinettssitzung vom 28. Januar 2003 eine Empfehlung für den Wiederaufbau der Universitätskirche ausgesprochen hatte.45 Nach der Sondersitzung des akademischen Senates am 30. Januar 2003 erklärte der Rektor seinen Rücktritt aus dem Amt. Das Verhalten der Landesregierung, die die Universität wie eine nachgeschaltete Behörde behandelt habe, sei für ihn nicht hinnehmbar. Nach Jahren der politischen Indoktrinierung sei das Selbstverwaltungsrecht ein wichtiges Fundament der Universität, Bigl erklärte wörtlich gegenüber der Presse: „Dieses Recht steht im Zentrum unseres Selbstbewusstseins.“46 Mit dem Rücktritt bewirkte Bigl zugleich eine enorme mediale und natürlich politische Wahrnehmung des Streitfalles. Die nationale Presse, vom Neuen Deutschland, über die Süddeutsche Zeitung, bis hin zur Welt und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung berichteten über die Auseinandersetzung. Das Plenum der Hochschulrektorenkonferenz stellte sich öffentlich hinter die Universität Leipzig und forderte die Landesregierung zum Einlenken auf.47 Die Landesregierung, so schien es jedenfalls öffentlich, hatte diese Eskalation nicht gewollt. Der sächsische Ministerpräsident Georg Milbradt und sein Fachminister Matthias Rößler bedauerten den Rücktritt. Rößler erklärte: „Der Rücktritt tut mir leid. Wir sind bemüht, so schnell wie möglich mit allen Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen.“48 Der Oberbürgermeister Wolfgang Tiefensee (SPD) nutzte die Gelegenheit, um von einer „Brüskierung“ der Universität seitens einiger „Strippenzieher“ in der CDUgeführten Landesregierung zu sprechen. Andererseits blickte er jedoch weit nach vorn und mahnte den rechtzeitigen Fertigstellungstermin zum Universitätsjubiläum im Jahre 2009 an. In der Sache kritisierte er dann die Universität, deren Festhalten am alten Hauptgebäude zu wenig Veränderungsspielraum für die Architekten geboten hätte. Tiefensee brachte den Plan einer neuen begrenzten Ausschreibung ins Spiel, die nur zwei Optionen hätte: zeitgemäßes Erinnern oder originalgetreuer Wiederaufbau der Kirche. Seine Sicht auf die Dinge brachte er deutlich zum Ausdruck: „Ich spreche mich dafür aus, dass Geschichte nicht zurückzuspulen ist, dass die Wunde sichtbar bleiben muss. Der Augustusplatz hat sein Gesicht komplett verändert. Eine Kirche ohne Augusteum bleibt ein Torso und würde eher eingezwängt zwischen Neubauten.“49 Mit den mahnenden Worten an alle Konfliktparteien, dass ohne die Universität nicht gebaut werden könne, aber dass die Universität auf den Rückhalt der Stadt 45
http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen_Entscheidung_fuer_Wiederaufbau_der_Leipziger_Uni-Kirche_12827.html; zuletzt abgerufen am 10.3.2016. 46 LVZ v. 31.1.2003. 47 Online abrufbar unter http://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/ hrk-plenum-unterstuetzt-die-universitaet-leipzig-in-sachen-uni-kirche–706/; zuletzt abgerufen am 10.3.2016. 48 LVZ v. 31.1.2003. 49 LVZ v. 5.2.2003.
104
Jens Blecher
angewiesen sei, bot sich Tiefensee als Moderator des politischen Streits an. Bereits Mitte Februar gab es einen Kompromissvorschlag, der vom Minister Rößler, vom Oberbürgermeister Tiefensee und vom Prorektor Franz Häuser seitens der Universität ausgehandelt wurde. Statt eines Kirchenwiederaufbaus einigten sich die Beteiligten in einem gut dreistündigen Gespräch auf einen modernen Erinnerungsbau, der für die Universität sowohl Kirche wie Aula sein sollte.50 Im Zeitungsinterview erklärte Prorektor Häuser über das Gespräch, „Rößler definiere die geistige Mitte als ‚Universitätskirche/Aula‘, die Uni plädiere mehr für ‚Aula/Universitätskirche‘. Dieses Bauwerk entgegen dem bisherigen Projekt deutlicher als Kirche zu profilieren, dem werde sich die Uni nicht verschließen.“51 Auch vonseiten des Paulinervereins waren plötzlich moderatere Töne zu hören, es musste sich ein erstaunlicher interner Meinungsumschwung vollzogen haben, den auch der 2002 zurückgetretene ehemalige Vereinsvorsitzende Behrendt kaum fassen konnte. In einem Interview äußerte sich Blobel zur geänderten Begriffsbestimmung eines originalen Wiederaufbaus: „Was heißt original? Die neogotische Ausmalung etwa wollten wir doch nie haben; so wie manch andere nicht gelungene Zutaten aus verschiedenen Epochen, die die Kirche im Laufe der Jahrhunderte veränderten.“52 Ein Vierteljahr später hatte sich die Lage schon wieder verändert, offenbar waren alle weiteren Details nach dem Gespräch bei Minister Rößler wieder strittig geworden. Der Ministerentwurf für einen zweiten Architektenentwurf sah einen Neubau mit historischen Kubatur und Kirche vor, während die Universität eher an einen Umbau der Fassade gedacht hatte. Der neue Rektor Franz Häuser erklärte dazu im Mai 2003 öffentlich, dass die Universität dazu ihre Zustimmung nicht geben würde.53 Der historische Grundriss in der alten Kubatur, einschließlich der Gewölbe und Säulen waren indes für den Paulinerverein unverzichtbar.54 Die neuerlichen Diskrepanzen wurden deutlich sichtbar beim Gedenken an den 35. Jahrestag der Sprengung der Paulinerkirche am 30. Mai 2003. Der Paulinerverein begeht am Augustusplatz eine Gedenkfeier ohne den Oberbürgermeister, während die Universität eine morgendliche Andacht in der Nikolaikirche hält.55 Nachdem sich Land, Universität und Stadt im Juli 2003 auf die Wettbewerbsmodalitäten verständigt hatten, startete im August 2003 die zweite Ausschreibungsrunde für einen Architektenwettbewerb, der nun eine Varianz von der zeitgemäßen Neuinterpretation bis hin zur Anlehnung an das historische Original zuließ.56 Die Frage nach dem erinnernden Umgang mit der eigenen Universitätsgeschichte führte zu einer zeitaktuellen Publikation von Leipziger Akademikern. Nachdem im April und Mai 2003 öffentliche Debatten zum Rücktritt von Rektor Bigl und zur Ausgestaltung des Universitätsneubaus stattfanden, erschien ein weiterführender Sammlungsband von Universitätsprofessoren im Dezember 2003. Die Herausgeber 50 51 52 53 54 55 56
LVZ v. 19.2.2003. LVZ v. 20.2.2003. 52 Interview mit Thomas Mayer, in: LVZ v. 23.4.2003. LVZ v. 30.5.2003. LVZ v. 30.5.2003. LVZ v. 31.5./1.6.2003. LVZ v. 24.8.2003.
Die Geschichte der Leipziger Universitätskirche St. Pauli
105
Charlotte Schubert (Dekanin und ab November 2003 Prorektorin), Matthias Middell und Pirmin Stekeler-Weithofer lieferten zunächst eine Chronologie der universitären Stellungnahmen und Positionen vom Frühjahr 2003 mit einer wissenschaftlichen Schau auf Tradition und Erinnerungskultur. Insbesondere mit der Arbeit von Pierre Nora zu den französischen Erinnerungsorten sei die „Parallelexistenz von Geschichte und Erinnerung“ postuliert worden.57 Allerdings stellte sich den Historikern in Leipzig wohl spätestens seit dem Herbst 1989 die Frage, ob eine politisierte Geschichtswissenschaft überhaupt in der Lage ist, das breite und meist aus persönlichen Bildern gespeiste Erinnerungsbild eines Volkes zu leiten oder im Gegenzug: ob überhaupt nur eine sich politisierende Historikerzunft dazu imstande ist? Daraus leiten sich weitere Problemstellungen einer universitären Erinnerungsbildung ab, die sich aus einer jahrgangsweise wechselnden Studentengeneration ergeben. Wie wird Erinnerung fernab der historischen Wissenschaft gebildet und verfestigt? Gehört das durch Schule und Medien transportierte, oft vereinfachte Geschichtsbild auch zum sicheren Erinnerungswissen? Wo liegen die Speicher der Erinnerung und wie können sie unverändert gesichert und dennoch weit offen gehalten werden? Hartmut Zwahr geht als Zeitzeuge und Historiker diesen Fragen nach und versucht, in seinem Beitrag mit fünf Thesen eine generationenübergreifende Sicht auf die an den Universitäten zu pflegende Erinnerungskultur zu eröffnen. „Welche Erinnerung brauchen wir? […] Erstens. Erinnerung schafft eine neue Wirklichkeit. Zweitens. Erinnerung erfordert Wissen über den Erinnerungsgegenstand. Drittens. Dieses Tatsachenwissen strukturiert die Erinnerung wesentlich. Tatsachen setzen einen Rahmen; sie beeinflussen die Dominanz von Erinnerungsinhalten, kurz, Tatsachen sind eine tragende Struktur der Erinnerungskultur. Viertens. Die Erinnerungskultur enthält stets starke Gegenwartsbestandteile. Erinnerte Vergangenheit ist aufgeladen mit Gegenwart. Diese Bestandteile sind in meinem Verständnis Hinzufügungen, Zusatz, eine Art Ferment. Es ist in jedem Fall zu fragen, ob und wie diese Hinzufügungen mit den Tatsachen korrespondieren. Fünftens. Erinnerung ist ein Konstrukt. Es wird von einem Erinnerungsgegenstand in der Regel verschiedene Konstrukte, also Erinnerungsvarianten geben. Erinnerungskultur ist das Ganze.“ 58 Der Historiker Markus Lorenz wendet sich in seinen Erörterungen vor allem den bindenden Kräften der emotionalen Erinnerung zu und fordert eine lebendige Erinnerungskultur: eine universitäre Tradition, die sich auch auf emotionale Bindungen in der Verknüpfung von Orten und Ereignissen stützen muss.59 Rektor Häuser ver57
Matthias Middell, Charlotte Schubert, Pirmin Stekeler-Weithofer: Erinnerungsort Leipziger Universitätskirche. Eine Debatte, Leipzig 2003, S. 26. In deutscher Übersetzung erschien das Werk des französischen Historikers Nora erst 2005. Pierre Nora: Erinnerungsorte Frankreichs, München 2005. 58 Hartmut Zwahr: Erinnern fordert Wissen, in: Middell u. a.: Erinnerungsort (2003), S. 55–68 hier S. 55. 59 Markus Lorenz: Funktion – Emotion – Tradition. Thesen zur Erinnerungskultur, in: Middell u. a.: Erinnerungsort (2003), S. 73–76 hier S. 75.
106
Jens Blecher
wies in seinem Beitrag besonders auf die Aula als geistigen Begegnungsort für die vielfältige und dezentrale Hochschule nach innen und als Austauschort in Richtung Mittel- und Osteuropa. Ein aufgenötigtes geistliches Zentrum werde dagegen eher eine Entfremdung von der eigenen Geschichte bewirken.60 Die Universität hatte sich mit den Debatten und mit dem im Sammelband enthaltenen Gedanken nun wichtige Leitlinien für den zweiten Architektenwettbewerb parat gelegt. Nach der ersten Jurysitzung mit Staatsminister Rößler, Oberbürgermeister Tiefensee und Rektor Häuser am 14. Januar 2004 bleiben vier Entwürfe im Rennen, zu denen auch der Umbauplan des Büros Behet und Bondzio zählte.61 In den folgenden Tagen interviewte Thomas Mayer von der Leipziger Volkszeitung die beteiligten Architekten und dabei stellte sich als rasche Vermutung heraus, dass es wohl keinen Wiederaufbau der Kirche geben würde.62 Zwei Wochen später wurden vonseiten des Paulinervereins Details aus der Jurysitzung an die Öffentlichkeit gegeben, da keiner der Entwürfe Verbesserungen zum ersten Ausschreibungsergebnis bringe. Lediglich der Niederländer Erick van Egeraat berücksichtige architektonisch angemessen die zerstörte Kirche.63 Nach und nach wurden so einzelne Entwürfe in der Öffentlichkeit bekannt. Das Stadtpublikum reagierte mit Unverständnis, nicht nur wegen der bisherigen Geheimhaltung sondern auch in Bezug auf die kubistische und rein funktionale Architektur. Als der Paulinerverein die Idee eines Bürgerentscheides ins Spiel brachte, drohte dem Wettbewerbsverlauf und dem weiteren Bauplan das Aus.64 Doch erst nach der zweiten Jurysitzung am 24. März 2004 wurden alle 14 Vorschläge (inklusive der vier weiterqualifizierten Entwürfe) öffentlich ausgestellt. Der Zuschlag war da schon an den Entwurf des Büros Erick Van Egeraat gegangen – und plötzlich zeigten sich alle Beteiligten (bis auf den Studentenrat) mit diesem Konzept einverstanden. In der Presse erklärte der Niederländer dazu: „Der Bau ist eine Verschmelzung von Moderne und Tradition. Er soll aber keine Kopie der alten Kirche sein.“ 65 Mit dem modernen, traditionsbezogenen Architekturentwurf war dieser seit fast zehn Jahren immer heftiger tobende Streit um den Erinnerungsort Paulinerkirche nun prinzipiell gelöst. In den folgenden Jahren verursachten der Baufortschritt und die dabei zu klärenden Detailfragen aber weitere Auseinandersetzungen. Heftiger Streit tobte schon bald um den Einbau einer Glaswand zwischen Aula und Andachtsraum und um den Wegfall von drei Säulenpaaren im Innenraum. Nun gab es auch erstmals einen von außen wahrnehmbaren Konflikt innerhalb der Universität, da sich sowohl Theologen (Professor Rüdiger Lux, Professor Martin Petzoldt) wie später der Universitätsmusikdirektor David Timm offen gegen die Glaswand aussprachen.66 60 Franz Häuser: Das geistig-geistliche Zentrum der Universität am Augustusplatz, in: Middell u. a.: Erinnerungsort (2003), S. 125–127 hier S. 126. 61 LVZ v. 14.1.2004. 62 LVZ v. 17./18.1.2004. 63 LVZ v. 5.2.2004. 64 LVZ v. 26.2.2004. 65 LVZ v. 25.3.2004. 66 LVZ v. 21.12.2006 und Sonderveröffentlichung der Universität Leipzig in der LVZ v. 18.10.2008.
Die Geschichte der Leipziger Universitätskirche St. Pauli
107
Selbst die Bezeichnung für das neu errichtete Gebäude war strittig. In dem sogenannten Harms-Kompromiss, der von der Generalbundesanwältin Monika Harms zwischen den Konfliktparteien vermittelt wurde, einigte man sich im Dezember 2008 nur mühsam. Die Universität, der Freistaat, die evangelische Landeskirche und die Stadt vereinbarten den offiziellen Namen „Paulinum Aula und Universitätskirche St. Pauli.“ Schon 2005, nach den ersten Innenraumentwürfen Erick Van Egeraat wurde öffentlich hinterfragt, wo die aus der Paulinerkirche geborgene Kanzel untergebracht werden sollte.67 Im Zuge des Baufortschrittes wurde dieses Problem verdrängt, doch nach heftigen verbalen Attacken gegen die Universität wurde schließlich im Jahre 2013 eine Kanzelkommission (bestehend aus Vertretern der Universität Leipzig, der evangelischen Landeskirche und des Freistaates Sachsen) gegründet, die das Problem bis Ende 2016 lösen soll.68 Im gleichen Jahr verabschiedete der Akademische Senat der Universität Leipzig die zukünftigen „Nutzungsgrundsätze für Paulinum und Augusteum“. Demnach soll der, vom Steuerzahler mit mehr als 100 Millionen69 finanzierte Erinnerungsort, „[…] vier Lebenswirklichkeiten zur Darstellung bringen […] – von akademischer und bürgerlicher Kultur, insbesondere Musik und Kunst, wie sie durch die Universitätsmusik, durch die Kunstschätze, aber auch durch akademische Feiern repräsentiert wird, – von wissenschaftlicher Bildung und Ausbildung mit einer Ausstrahlung weit über die Stadt Leipzig und das Land Sachsen hinaus, – von religiösem Leben, das in der Gestalt der Universitätsgottesdienste zum Ausdruck kommt, bei dem aber auch die Interessen und Perspektiven anderer Religionsgemeinschaften angemessen zur Geltung kommen müssen, – von gesellschaftlichem Leben, das einerseits immer wieder Gegenstand universitärer Theoriebildung und akademischer Diskurse war, das zugleich selbst auf die Universität fördernd bzw. behindernd einwirkte – bis hin zur Zerstörung ihres Herzstücks selbst.“70 Die gesamte online abrufbare Textfassung enthält 1303 Wörter: die Begriffe „Geschichte“ und „Tradition“ sind einmal bzw. zweimal im Text zu finden. Die semantische Geschichtsreduktion scheint folgerichtig, denn mit dem Baufortschritt des 67 LVZ v. 15.7.2005. 68 Im Februar 2015 verabschiedete die Kommission eine mehrheitliche Empfehlung, die Kanzel unter bestimmten Voraussetzungen (Beurteilung des Raumklimas) im Neubau aufzustellen, stellte aber klar, dass die alleinige Entscheidungskompetenz dazu bei der Universität liegt. Pressemeldung der Universität Leipzig, online unter http://www.zv.uni-leipzig.de/service/ presse/nachrichten.html?ifab_modus=detail&ifab_id=5899; zuletzt abgerufen am 10.3.2016. Allein schon die Interpretation der Empfehlung sorgte für neuen Streit. Als Zwischenschritt plante die Universität eine erste Teilrestaurierung des Kanzelkorbes und dessen fünfjährige Aufstellung im Museum für Musikinstrumente. Im März 2015 protestierten die Landeskirche sowie die ehemaligen/amtierenden Universitätsprediger gegen eine rein museale Nutzung. http:// www.evlks.de/doc/22_3_2014_Erklaerung_Kanzel_Lpz.pdf; zuletzt abgerufen am 10.3.2016. 69 LVZ v. 14.8.2012. 70 Nutzungsgrundsätze für Paulinum und Augusteum. Beschlossen vom Senat am 10.09.2013, vom Rektorat am 22.08.2013 und 24.10.2013. Online abrufbar unter https://www.zv.uni-leipzig. de/fileadmin/user_upload/UniStadt/allgemein/pdf/Baugeschehen/Nutzungsgrundsaetze_Paulinum_final.pdf; zuletzt abgerufen am 10.3.2016.
108
Jens Blecher
„Herzstückes“ entsteht zunächst erst einmal ein Neubau: Ein teurer Baukomplex mit komplizierter technischer Infrastruktur, der zwischen dem Abriss des DDRHauptgebäudes 2006 und der aktuell für 2016/2017 prognostizierten Einweihung völlig neu errichtet wurde. Es ist derzeit noch ein Ort ohne eigene Geschichte, ohne eigene Wurzeln in die Vergangenheit. Dank der bereits integrierten künstlerischen Artefakte aus der Universitätsgeschichte lässt sich im Gebäudeinnern immerhin ein Abglanz des historischen Ortes erkennen. Doch mit der Einweihung des kompletten Areals stellt sich für die Universität die Frage, wie über die wissenschaftlichen Fachdisziplinen hinaus ein universitärer Ort des Erinnerns und der Reflexion geschaffen werden kann. Die Karls-Universität in Prag, ebenso wie die Universität Leipzig über lange Jahrzehnte hinweg von politisch-ideologischen Vorgaben geprägt, hat dazu einen Teil des mittelalterlichen Karolinums zu einem Museum umgewandelt.71 Viel eindrücklicher wird die Verbindung zur eigenen Geschichte in Prag, wenn nach feierlichen Graduierungen der Fakultäten die jungen Absolventen der Karls-Universität ebenso freiwillig wie selbstverständlich Blumen am Denkmal von Jan Hus ablegen72 oder sich von ihren Angehörigen davor fotografieren lassen. Ein solches Verhalten setzt zumindest ein grundlegendes Gemeinschaftsgefühl, ebenso wie ein generationenübergreifendes Traditionsbewusstsein voraus. Diese Bedeutung der eigenen Geschichte stärker herauszustellen und sich den historischen Stärken und Schwächen zu widmen, empfiehlt eine von der Stadt für die Universität Leipzig erstellte Untersuchung zum Universitätsimage.73 Die 2008 vorgelegte, auf statistischen Erhebungen basierende Darstellung, verwendet auf 112 Berichtsseiten allein 59-mal das Wort Tradition. Neben der Auswertung einer auf regionale Bindungen zur Bevölkerung, auf Bekanntheit bei bundesweiten Multiplikatoren74 und auf Interesse bei Unternehmen ausgerichteten statistischen Untersuchung, stellten die Statistiker darin folgende Frage: Wenn Sie einmal ganz allgemein an die Universität Leipzig denken, was fällt Ihnen spontan dazu ein? Die Antwort ist eindeutig: „Fast die Hälfte der Multiplikatoren, mehr als jeder dritte Unternehmer, mehr als jeder vierte Universitätsbeschäftigte und fast jeder fünfte befragte Bürger besinnt sich des hohen Stellenwertes der Geschichte. Die Aussagen, die in dieser Rubrik gesammelt wurden, unterstützen die Bedeutung und weisen auf die Universitätstradition hin: ‚traditionsreiche Uni in einer lebendigen Stadt; berühmte 71 72 73
74
Josef Petráˇn: Karolinum, Charles University in Prague 2010, S. 119. Ebd., S. 97. Das Denkmal selbst entstammt der kommunistischen Ära und wurde 1957 von Karel Lidický geschaffen. Leipziger Statistik und Stadtforschung. Das Image der Universität Leipzig – Ergebnisse von Erhebungen 2007, hg. v. der Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen, Leipzig 2008. Online abrufbar unter http:// www.leipzig.de/ fileadmin/ mediendatenbank/ leipzig-de/ Stadt/ 02.1_ Dez1_Allgemeine_Verwaltung/ 12_Statistik_und_Wahlen/ Stadtforschung/ UniUmfrage2007. pdf; zuletzt abgerufen am 10.3.2016. Befragt wurden Vertreter aus 114 Institutionen aus der Verwaltung (Referats-/Abteilungsleiter von Wissenschafts- und Forschungsministerien; Landräte; Bürgermeister), aus der Politik (Sprecher der Ausschüsse für Wissenschaft/Bildung/Hochschule in den Landtagen; Parteivorstände; sächsische Landtagsabgeordnete) sowie aus den Medien (Chefredakteure, Redaktionsleiter, Programmdirektoren). Stadt Leipzig: Image (2008), S. IV.
Die Geschichte der Leipziger Universitätskirche St. Pauli
109
Studierende und Lehrende; Karl-Marx-Universität; altehrwürdig; Uni im Wandel; 600-jähriges Bestehen der Universität; Abriss des Augusteums und Sprengung der Paulinerkirche; Freude über den neuen Campus; Streit ums Karl-Marx-Relief; Alma Mater – wissenschaftliche Heimstatt; ehemaliges Zentrum der Philologien; mit der Stadt verbunden; Universität mit Tradition; Umbrüche Herbst 1989.‘“75 Die Universität hat diesen Ansatz nicht weiter verfolgt. Nach dem Jubiläum von 2009 ist die Universitätsgeschichte wieder zur Angelegenheit von einzelnen Fachgelehrten geworden. Allein schon die besondere historische Beziehung zwischen den Universitäten in Prag und Leipzig ist in der heutigen Öffentlichkeit kaum noch präsent. Obwohl es sich mit der Leipziger Universitätsgründung durch Prager Magister und Scholaren von 1409 um ein europäisches Alleinstellungsmerkmal handelt, zudem noch um eine der seltenen akademischen Eigengründungen, ist diese historische Beziehung in einem vereinten Europa fast in Vergessenheit geraten. Mit der rein nüchternen und sachbezogenen Fokussierung der Universitäten auf quantifizierbare und evaluierbare Wissenschaftskriterien, auf Positionsverbesserungen in Rankings, besteht die Gefahr, dass der seit 600 Jahren existierende akademische Bildungskern der Universität sich vereinzelt und verblasst: denn wissenschaftliche Erfolge sind immer das Resultat individueller Forschungsleistungen, kaum aber dem Wirken der Universität zuzurechnen. Nach einer jahrzehntelangen Debatte um die Paulinerkirche steht die Universität Leipzig mit der baulichen Vollendung der Hauptgebäude scheinbar wieder vor derselben Frage wie im Jahr 2003: Wie kann die universitas lipsiensis das Zusammenspiel aus Geschichte, Erinnerung und Tradition lebendig halten und für die eigene Zukunft fruchtbar gestalten?
Abb. 5 Festakt zum Universitätsjubiläum 2009 in der Baustelle des Neuen Paulinums (Foto Volkmar Heinz) 75
Stadt Leipzig: Image (2008), S. 96.
LA N DM A R K E N I M ER I N N ERU NGSR AU M Jenaer akademisch-universitäre Gedenktafeln im Vergleich Stefan Gerber Gedenktafeln stellen als Medium des kollektiven Gedächtnisses1 einen Doppelfall dar: Sie sind zweifelsohne ein Individualdenkmal, wie es bis ins 18. Jahrhundert – sieht man von den Sonderfällen bürgerlicher Epitaphe und Grabdenkmäler ab – zumeist fürstlichen Personen vorbehalten blieb und mit dem Aufstieg besonders der Bildungsbürger, aber auch des wirtschaftenden Bürgertums von diesen Schichten für sich erschlossen wurde.2 Das gilt ungeachtet der Tatsache, dass das monarchische Individualdenkmal in Deutschland mindestens bis 1918 ein relevantes Medium blieb und bis heute, auch über die ehemaligen Residenzstädte hinaus, seinen Platz im öffentlichen Raum zumeist behauptet, oder – man denke an das „Deutsche Eck“ in Koblenz –3 sogar wiedergewonnen hat. Bezeichnenderweise setzten die revolutionären Bilderstürme des „langen“ 19. und des kurzen 20. Jahrhunderts zumeist an den monarchischen bzw. herrschaftlichen Individual- und Persönlichkeitsdenkmälern an, bevor sie ihre ikonoklastischen Exzesse auch auf andere Symbole der gestürzten Herrschaft ausdehnten:4 Fast scheint es, als ob hier im politischen Bereich nachgebildet und 1
2
3
4
Die Begriffsverwendung folgt hier Astrid Erll: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung, Stuttgart, Weimar 2005, die dafür plädiert (S. 6), zunächst von einem weiten „Oberbegriff“ des „kollektiven Gedächtnisses“ „für all jene Vorgänge organischer, medialer und institutioneller Art“ auszugehen, „denen Bedeutung bei der wechselseitigen Beeinflussung von Vergangenem und Gegenwärtigem in soziokulturellen Kontexten zukommt.“ Davon ausgehend können dann Phänomene einzelner „Erinnerungskulturen“ erfasst werden, deren Pluralität und Heterogenität im Gießener DFG-Sonderforschungsbereich „Erinnerungskulturen“, in dem auch Erll geforscht hat, im Mittelpunkt stand. Vgl. auch Günter Oesterle (Hg.): Erinnerung, Gedächtnis, Wissen. Studien zur kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung, Göttingen 2005. Vgl. dazu v. a. Charlotte Tacke: Denkmal im sozialen Raum. Nationale Denkmale in Deutschland und Frankreich im 19. Jahrhundert, Göttingen 1995. Vgl. im Zusammenhang mit dem konkreten Beispiel der Gedenktafel, auch die Erwägungen in: Marita Metz-Becker: Erinnerungskultur. Zur kulturellen Konstruktion von Geschichtsbildern am Beispiel der Gedenktafeln alter Universitätsstädte, in: Olaf Bockhorn, Gunter Dimt, Edith Hörander (Hg.): Urbane Welten. Referate der Österreichischen Volkskundetagung 1998 in Linz, Wien 1999, S. 319–336, insb. S. 319–321. Zum Gesamtzusammenhang vgl. Jürgen Trimborn: Der Traum vom Kaiserdenkmal. Zur Problematik der Wiedererrichteten Preußendenkmäler in Köln und Koblenz, in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 200 (1997), S. 179–197; Marco Zerwas: Lernort „Deutsches Eck“. Zur Variabilität geschichtskultureller Deutungsmuster, Berlin 2015 Grundlegend die Beiträge in: Winfried Speitkamp: Denkmalsturz. Zur Konfliktgeschichte politischer Symbolik, Göttingen 1997. In der zeitgeschichtlichen Forschung haben in den letzten beiden Jahrzehnten natürlich vor allem politische „Bilderstürme“ ist Ost- und Mitteleuropa nach 1989/90 Beachtung gefunden. Vgl. dazu knapp zusammenfassend: Rudolf Jaworski: Denkmalstreit und Denkmalsturz im östlichen Europa – eine Problemskizze, in: Rudolf Jaworski, Peter Stachel (Hg.): Die Besetzung des öffentlichen Raumes. Politische Plätze, Denkmäler und Straßennamen im europäischen Vergleich, Berlin 2007, S. 175–190. – Zu einen spezifisch politischen Denkmalssturz der nachkommunistischen Ära an der Universität Jena vgl. Dokumente zur Erinnerung an den
112
Stefan Gerber
nachempfunden wird, was die Bilderökonomie der orthodoxen und der katholischen Liturgie ebenso festhält, wie die antike Ikonodulie: Das im Bild der Dargestellte im buchstäblichen Sinne selbst verehrt, aber auch selbst geschmäht oder vernichtet wird.5 Freilich waren nicht Konflikt, Konfrontation und Denkmalsturz sondern Anverwandlung und Synthese der „Normalfall“ des Übergangs von einer monarchisch-adlig geprägten zur „bürgerlichen“ und späterhin zur zivilgesellschaftlichen Denkmalskultur. Gerade Jena und die thüringische Kleinstaatenwelt boten im 19. Jahrhundert prominente Beispiele der Transformierung dynastischer Memoria in eine dezidiert bürgerliche Erinnerungskultur: Das zum Universitätsjubiläum 1858 auf dem Jenaer Marktplatz errichtete Denkmal für den Universitätsgründer Kurfürst Johann Friedrich I. von Sachsen präsentierte den Monarchen nicht im Sinne der dynastischen Erinnerung der Ernestiner, sondern als „liberalen“ Volksfreund, der den Kampf für Gewissensfreiheit mit dem Bestreben verbunden habe, der aus kirchlicher Bevormundung reformatorisch herausgelösten Wissenschaft in Jena eine Heimstatt zu geben. Noch stärker als bei Johann Friedrich I. ließen sich in der Erinnerung an Herzog Ernst den Frommen, die 1904 in der Errichtung eines bürgerschaftlichen Denkmals vor der Stadtseite des Gothaer Schlosses Friedenstein kulminierte, Frömmigkeit und Kirchenpolitik, Landesausbau-Maßnahmen in Wirtschaft und Bildungswesen sowie eine Inszenierung als sorgender Landes- und Familienvater in einen (bildungs-)bürgerlichen Werthorizont überführen und damit zugleich das aktuelle Ideal einer „bürgerlichen“ Monarchie beschwören. Ähnlich wie Johann Friedrich, dessen reformatorisches „Märtyrertum“ ihm im nationalliberalen Geschichtsbild des 19. Jahrhunderts gesamtnationale Bedeutung zuwies, konnte zudem auch Ernst der Fromme über den regionalen Rahmen hinausgehoben und so Instrument einer Zusammenschau von dynastischer Geschichtspolitik und bürgerlicher Geschichtsaneignung im 19. Jahrhundert werden.6 Universitätsstädte7 mussten im Zuge
5
6
7
Jenaer Denkmalsturz 1991/92 anläßlich des 175. Geburtstages von Karl Marx am 5. Mai 1993, hg. v. Jenaer Forum für Bildung und Wissenschaft, Jena 1993 (aus der Perspektive einer damaligen PDS nahe stehenden Organisation); Tobias Kaiser: „Die Universität kann Marx als einen der ihrigen bezeichnen“. Eine Ikone der Arbeiterbewegung in der Erinnerungskultur der Salana nach 1945, in: Jürgen John, Justus H. Ulbricht (Hg.): Jena. Ein nationaler Erinnerungsort, Köln, Weimar, Wien 2007, S. 323–339, insb. S. 335–339. Umfassend quellengestützt dokumentiert ist der Jena-Bezug von Karl Marx jetzt in: Ingrid Bodsch (Hg.): Dr. Karl Marx. Vom Studium zur Promotion - Bonn, Berlin, Jena. Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung des StadtMuseum Bonn in Kooperation mit dem Archiv der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Bonn 2012, insb. die Beiträge von Joachim Bauer, Thomas Pester, Margit Hartleb und Rita Seifert, S. 47–140. Vgl. dazu Hans Belting: Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München 52000; Hans Feld: Der Ikonoklasmus des Westens, Leiden u. a. 1990. Zum revolutionären Ursprung für das neuzeitliche Europa vgl. auch Bronislaw Baczko: Vandalismus, in: François Furet, Mona Ozouf (Hg.): Kritisches Wörterbuch der Französischen Revolution, Bd. 2: Institutionen und Neuerungen, Ideen, Deutungen und Darstellungen, Frankfurt a. M. 1996, S. 1354–1368. Vgl. dazu Stefan Gerber: Ahne, Volksfreund und Nationalheld. Kurfürst Johann Friedrich I. von Sachsen im „langen“ 19. Jahrhundert, in: Volker Leppin, Georg Schmidt, Sabine Wefers (Hg.): Johann Friedrich I. – der lutherische Kurfürst, Gütersloh 2006, S. 381–413; ders.: Ernestinische Geschichtspolitik im 19. Jahrhundert, in: Hans-Werner Hahn, Georg Schmidt, Siegrid Westphal: Die Welt der Ernestiner. Ein Lesebuch, Köln, Weimar, Wien 2016, S. 318–323. Zu allgemeinen Erwägungen zu diesem Stadttypus und seiner Konkretisierung für Jena vgl. Katja Deinhardt: Stapelstadt des Wissens. Jena als Universitätsstadt zwischen 1770 und 1830, Köln, Weimar, Wien 2007.
Landmarken im Erinnerungsraum. Jenaer Gedenktafeln im Vergleich
113
dieser bildungsbürgerlichen Aneignung des Persönlichkeitsdenkmals als Medium des Gedächtnisses und der daraus hervorgehenden Erinnerungskulturen ein bevorzugter Verbreitungsraum solcher Denkmäler, z. B. des Spezialfalls der Gedenktafel sein – es wird im Folgenden darauf zurück zu kommen sein, verbunden mit der Frage, ob dieser Befund nach dem Typus der betreffenden Universitätsstädte zu differenzieren ist. Um zunächst bei einer Einordnung der modernen Gedenktafel in eine Typologie von Medien des Gedächtnisses zu bleiben: Die Gedenktafel ist nicht nur Individual-, sie ist (nicht zuletzt in Universitätsstädten) auch Gruppendenkmal, indem sie die erinnerten Personen in einen gemeinsamen Sinnzusammenhang stellt: Dieser kann, wenn man z. B. die Gedenktafel-„Parcours“ alter Universitätsstädte abschreitet, bisweilen relativ arbiträr erscheinen. Die dort Erwähnten, so suggerieren die Tafeln, stehen – und hätten sie, wie manche der in Jena mit einer Gedenktafel Bedachten, auch nur wenige Tage, oder gar nur eine Nacht am Ort verbracht – in einer verbindenden Beziehung zu dem städtischen Raum, in dem ihre Namen und ihre Kurzbiographien sichtbar gemacht werden. Der spatiale Aspekt des von Gedenktafeln geschaffenen „Gedächtnisraumes“ auch und besonders in Universitätsstädten wird besonders deutlich, wenn man sich vor Augen hält, dass diese Gedächtnistopographie nur dann ihre volle Wirkung entfaltet, wenn der Betrachter sie teilweise oder – was wohl nur idealtypisch gedacht werden kann – ganz abschreitet, sich also auch individuell den städtischen Raum auf einer erinnerungskulturell vorstrukturierten Route erschließt und aneignet. Verglichen mit anderen, expressiveren, ja aggressiven Aneignungen des urbanen Raumes durch vor allem gemeinschaftliche Bewegung in Prozessionen, Umzügen, Demonstrationen, aber auch in der Gegenüberstellung zu ähnlich erinnerungskulturell vorstrukturierten Bewegungen im urbanen Raum wie Stadtführungen, Gedenkgängen, „Kulturlehrpfaden“ u. ä. stellen die durch Gedenktafeln strukturierte urbane Gedächtnistopographie und ihr Nachvollzug sicher eine vergleichsweise diskrete, aber doch wohl kaum minder nachhaltige Aneignung und erinnerungskulturelle Aufladung des Stadtraumes dar. Das verbindet die Gedenktafeln im Übrigen mit einem anderen universitär-akademischen Denkmalensemble Jenas, der Abfolge der Büsten und Gedenksteine für Professoren und (im Falle Fritz Reuters) Studenten am Fürstengraben: Auch die Jenaer „via triumphalis“ muss abgeschritten werden und macht den Spaziergänger in diesem Akt zu einem Bestandteil der akademischstädtischen Erinnerungsinszenierung.8 Die Tatsache, dass wir einen Ort, das Dorf oder die Stadt in der wir geboren, aufgewachsen, oder (ganz und teilweise) zu dem geworden sind, als den wir uns definieren, „mit anderen Augen sehen“, als andere, verweist darauf, dass diese Strukturierung des Raumes durch Sinnbezüge oft eine ganz individuelle, persönliche, fast intime sein kann. Selbst der Staatsrechtler und Schriftsteller Bernhard Schlink beschreibt in seinem in mancherlei Hinsicht zweifelhaften Essay „Heimat als Utopie“ die Orte der Kindheit als „unverrückbare“ Orte im topographischen Sinne.9 Daneben 8 9
Vgl. dazu: Michael Maurer: Aufbau einer Denkmallandschaft. Die Jenaer „via triumphalis“ am Fürstengraben, in: John, Ulbricht: Jena (2007), S. 245–257. Vgl. Bernhard Schlink: Heimat als Utopie, Frankfurt a. M. 2000. Freilich reflektiert Schlinks „Entortung“ der Heimat nicht, dass die kulturwissenschaftliche und volkskundliche Forschung
114
Stefan Gerber
aber steht die öffentliche, gemeinschaftliche und konkurrierende Strukturierung von Gedächtnis- und Erinnerungsräumen, die oftmals durch Landmarken im engeren Sinne, durch prominente, weniger diskrete Medien erreicht wird, als es die Gedenktafeln sind. Der Jena-Weimarer Schauspieler und Regisseur Otto Devrient etwa verortete sich selbst in einem solchen über die Natur gelegten, mit den geschichtlichen wie aktuellpolitischen Sinnbezügen einer historischen Teleologie gefülltem Erinnerungsraum, als er 1882 durch Jenaer Gymnasiasten am Tatzend sein Stück „Kaiser Rotbart“ aufgeführt sah, das er 1871 zur Feier des Sieges über Frankreich gedichtet hatte. Devrient schrieb: „In einem Steinbruch auf der Höhe des Forstberges die Scenerie, aus dem Bruchfelsen zum Innern des Kyffhäuser gestaltet, unter freiem Himmel, den Blick zur Linken auf den Napoleonstein, das Denkmal der deutschen Erniedrigung, zur Rechten auf den Forstturm, das Kriegerdenkmal der deutschen Erhebung im Siebzigerkriege, die Zuschauer im Halbkreis des Steinbruchs gelagert, so stellten Schüler des Gymnasiums die Rollen dar, während andere im Wald verborgen die vaterländischen Lieder sangen.“10 Unverkennbar also, sind Gedenktafeln, und ganz besonders die absichtsvoll und inhaltlich miteinander verknüpften akademisch-universitären Gedenktafeln an den Häuserfassaden alter Universitätsstädte, erinnerungskulturelle Aneignungen des urbanen Raumes.11 Sie „besetzen“ – ähnlich wie andere Denkmäler – den öffentlichen Raum im doppelten Sinn dieses Wortes: Topographisch, indem sie eine konkret lokalisierbare „Stelle“ einnehmen, von der sie nur durch einen mehr oder minder spektakulären Entfernungsakt wieder gelöst werden können; semantisch, indem sie durch ihr schieres Vorhandensein innerhalb der Universitätsstadt einen „Gedächtnisraum“ konstituieren, also „auf Räume bezogene Erinnerungsinhalte“ oder „sich in geografisch oder soziokulturell abgegrenzten Räumen bewegende Erinnerungskollektive“ erzeugen.12 Man könnte – so man den Begriff der „Landschaft“ auch auf den urbanen Raum beziehen will – im Blick auf diese Netze von Gedenktafeln, wie wir sie in mehreren traditionellen deutschen Universitätsstädten (besonders
10 11
12
schon seit Ende der 1970er Jahre einen differenzierten Heimat-Begriff entwickelt hat, der den topographischen Aspekt als einen unter anderen in das „Heimat“-Konzept einbezieht. Grundlegend: Hermann Bausinger: Heimat und Identität, in: Konrad Köstlin, Hermann Bausinger (Hg.): Heimat und Identität. Probleme regionaler Kultur. 22. Deutscher Volkskunde-Kongress in Kiel vom 16. bis 21. Juni 1979, Neumünster 1980, S. 9–24. Vgl. zum Überblick auch: Andrea Lobensommer: Die Suche nach „Heimat“. Heimatkonzeptionsversuche in Prosatexten zwischen 1989 und 2001, Frankfurt a. M. 2010. So zit. in: Gustav Richter: Das Jenaer Lutherfestspiel. Ein Rechenschaftsbericht im Auftrage des Vorstandes des Lutherfestspielvereins zu Jena, Jena 1889, S. 3. Die Begriffe der „Aneignung“ oder „Besetzung“ von Stadträumen sind sowohl historisch als auch sozial-, kultur- und siedlungsgeographisch in Gebrauch; vgl. etwa: Jaworski, Stachel: Besetzung (2007); Malte Bergmann, Bastian Lange (Hg.): Eigensinnige Geografien. Städtische Raumaneignungen als Ausdruck gesellschaftlicher Teilhabe, Wiesbaden 2011. Janina Fuge, Rainer Hering, Harald Schmid: Einleitung, in: dies.: Gedächtnisräume. Geschichtsbilder und Erinnerungskulturen in Norddeutschland, Göttingen 2014, S. 9–13, hier S. 9. – Den gegenwärtigen Stand der geschichtswissenschaftlichen Diskussion um Gedächtnis und Erinnerung fasst in einem kulturwissenschaftlichen Kontext konzis zusammen: Harald Welzer: Gedächtnis und Erinnerung, in: Friedrich Jaeger, Jörn Rüsen: Handbuch der Kulturwissenschaften, Bd. 3: Themen und Tendenzen, Stuttgart, Weimar 2004, S. 155–174.
Landmarken im Erinnerungsraum. Jenaer Gedenktafeln im Vergleich
Abb. 1 Gedenktafel zur Erinnerung an die Gründung der Burschenschaft im Juni 1815 an der „Grünen Tanne“ in Wenigenjena (1890)
115
Abb. 2 Gedenktafel zur Erinnerung an den Aufenthalt Martin Luthers im Gasthof „Schwarzer Bär“ in Jena 1522 (1858)
ausgeprägt in Jena) vorfinden, auch von „Gedächtnis“- oder „Erinnerungslandschaften“ sprechen.13 Sie sind, wie Aleida Assmann schreibt, insofern „auratische Orte“, als der Betrachter, Gedenkende oder kulturgeschichtlich interessierte Spaziergänger hier „einen unmittelbaren Kontakt mit der Vergangenheit sucht. Die Magie, die den Erinnerungsorten zugeschrieben wird, erklärt sich aus ihrem Status als Kontaktzone.“14 Auch wenn der Anspruch – wir werden noch darauf zurückkommen – oftmals eine Fiktion darstellt bzw. auf vielen Gedenktafeln nicht erhoben wird, ist deshalb dennoch das Wort „Hier“, mit dem der Text zahlreicher Gedenktafeln beginnt, entscheidend: „Hier wurde geboren“, „hier lebte“, „hier schrieb“, „hier komponierte“, „hier starb“, 13
Auch dies ein in der historisch-kulturwissenschaftlichen Gedächtnis-, Erinnerungs- und Gedenkforschung inzwischen viel verwendeter Terminus; vgl. grundlegend Aleida Assmann: Erinnerungsorte und Gedächtnislandschaften, in: Hanno Loewy, Bernhard Moltmann (Hg.): Erlebnis – Gedächtnis – Sinn. Authentische und konstruierte Erinnerung, Frankfurt a. M./ New York 1996, S. 13–29. Für konkrete Beispiele im mitteldeutschen Raum vgl. Deutsche Erinnerungslandschaften. Rudelsburg-Saaleck, Kyffhäuser, hg. v. Landesheimatbund Sachsen-Anhalt und vom Heimatbund Thüringen, Halle 2004; sowie die Bände der Reihe „Deutsche Erinnerungslandschaften“: „Rotes Mansfeld“ – „Grünes Herz“. Protokollband der wissenschaftlichen Tagungen vom 18. bis 20. Juni 2004 in Lutherstadt Eisleben und 10. bis 12. Juni 2005 in Arnstadt, hg. v. Landesheimatbund Sachsen-Anhalt und vom Heimatbund Thüringen, Halle 2005; Konrad Breitenborn, Justus H. Ulbricht: Jena und Auerstedt. Ereignis und Erinnerung in europäischer, nationaler und regionaler Perspektive, Dößel 2006; Elisabeth von Thüringen – Geschichte und Mythos, hg. v. Landesheimatbund Sachsen-Anhalt, Heimatbund Thüringen und der Katholischen Akademie des Bistums Magdeburg, Halle 2008. – Zur Verbindung von „Raum“-Kategorie, Region und „Erinnerungslandschaft“ am mitteldeutschen Beispiel vgl. die Publikationen aus dem Projekt „Deutschlands Mitte“ der Friedrich-Schiller-Universität Jena, der Bauhaus Universität Weimar und der Klassik Stiftung Weimar; zusammenfassend z. B. Jürgen John: „Deutsche Mitte“ – „Europas Mitte“. Zur Verschränkung der „Mitteldeutschland“- und „Mitteleuropa“-Diskurse, in: Detlef Altenburg, Lothar Ehrlich, Jürgen John (Hg.): Im Herzen Europas. Nationale Identitäten und Erinnerungskulturen, Köln, Weimar, Wien 2008, S. 11–80. 14 Aleida Assmann: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München 1999, S. 337.
116
Stefan Gerber
„hier wurde gegründet“ soll jene Aura des Authentischen erzeugen, die „das Ferne in bedrängende Nähe“ rücken15 und die Erwartung erzeugen bzw. stärken kann, im Anschauen der Lebens-Orte einer Person etwas von ihr selbst, ihrer Existenzform und ihrer historischen Empirie zu verstehen (Abb. 1 und 2). Freilich – darauf weist Assmann unter Bezug auf Walter Benjamin hin – kann auch der gegenteilige Effekt eintreten, und der Gedächtnisort als ein Ort wahrgenommen werden, „an dem die unnahbare Ferne und Entzogenheit der Vergangenheit sinnlich wahrgenommen werden kann.“16 Für den Gedächtnisort Gedenktafel gilt dies dann, wenn das Gebäude, an dem sie angebracht ist, in seinem aktuellen Zustand keine Authentizität vermittelt, sondern den tiefgreifenden Wandel der Stadtarchitektur seit der Lebensphase des Erinnerten augenfällig macht; wenn die Gedenktafel auf ein Wohn- oder Funktionsgebäude verweist, das – sei es durch Abriss, sei es durch den alliierten Bombenkrieg gegen die Wohnbebauung der deutschen Innenstädte während des Zweiten Weltkrieges – nicht mehr vorhanden ist, oder wenn die Gedenktafel – beschädigt, unvollständig, kaum noch lesbar – schon in ihrer Materialität auf das Schwinden des Gedächtnisses verweist.17 Gerade in den Städten, die besonders stark vom Bombenkrieg betroffen waren, erscheint der mit der Zerstörung der Gebäude verbundene Verlust der Gedenktafeln wie ein verstärkendes Symbol der Beschädigung des kollektiven Gedächtnisses, das mit dem Verlust der von ihnen bezeichneten authentisch-auratischen Orte verbunden ist. Für Kiel z. B., das im Zweiten Weltkrieg zu 80 Prozent zerstört wurde, verweist der regionale Geschichtsforscher Gerd Stolz in seiner Bestandsaufnahme der Erinnerungstafeln der schleswig-holsteinischen Universitäts- und Landeshauptstadt auf das Fehlen der „authentischen Örtlichkeiten“ als Kernproblem eines Erinnerns, das auf „Rudimente“ angewiesen ist, so dass der Eindruck entsteht, die Stadt sei „ein weithin geschichtsloses Gemeinwesen.“18 Allerdings – doch das wäre an anderer Stelle zu erörtern – ist gerade die Anmutung der „Geschichtslosigkeit“, die der Wiederaufbaus der zerstörten deutschen Städte während der 1950er und 1960er Jahre und die dabei geübte äußerste Zurückhaltung in der Rekonstruktion verlorener öffentlicher Erinnerungszeichen vielfach erzeugt haben, selbst ein aussagekräftiges erinnerungsgeschichtliches Faktum. Eng mit dem erinnerungsgeschichtlich aufschlussreichen Eindruck einer intendierten, oder doch zumindest erwünschten Gesichts- und „Geschichtslosigkeit“ von Nachkriegsstadtbildern, die zu architektonischen Ausdrücken des „kollektiven Beschweigens“ oder des ostentativen „Überbauens“ der jüngsten Vergangenheit wurden, ist für die öffentlichen Gedenktafeln im urbanen Raum auch das „negative Gedächtnis“: Der Schriftsteller und Lyriker Harald Gerlach stellte 1998 den Führer durch die Heidelberger Gedenktafellandschaft, den der Journalist und Publizist Jürgen von Esenwein zusammengestellt hatte, programmatisch (und nicht ohne 15 16 17
Ebd. Ebd., S. 338. Auf die „Aura des Authentischen“ als konstitutives Merkmal der Gedächtnisräume und die Abfolge der „auratischen Authentizitätsstufen“ vom „Objekt“, zum „Ort“ und schließlich zur „Region“ verweist: Martin Sabrow: Der Raum der Erinnerung, in: Fuge u. a.: Gedächtnisräume (2014), S. 17–32, insb. S. 24–31. 18 Gerd Stolz: Menschen und Ereignisse – Gedenktafeln in Kiel, Husum 2001, S. 9.
Landmarken im Erinnerungsraum. Jenaer Gedenktafeln im Vergleich
117
Pathos) unter das Hebbel-Zitat „Da bluten wir und fühlen keine Wunden“ – „Heidelbergs lückenhaftes Gedächtnis“, so Gerlach, werde gerade in den nicht angebrachten Gedenktafeln sichtbar: „Wer in einer lauen Sommernacht durch Heidelberg geht, läuft nicht nur Gefahr sein Herz zu verlieren, sondern der muß auch darauf gefaßt sein, daß das unerträgliche Schweigen der Unerwähnten, Vergessenen ihn an alle unsere Unbeholfenheiten im Umgang mit Geistes- und Kulturgeschichte schmerzlich gemahnt.“19 Sowohl die Nichtbeachtung, das Vergessen oder gar die „damnatio memoriae“ als auch das positive Erinnern auf Gedenktafeln folgt, das liegt auf der Hand, politischen und gesellschaftlichen Setzungen. Sie können Ausdruck „verordneten“ Erinnerns oder auch sozialer und kultureller Übereinkünfte sein. In Jena haben hier besonders die Jahrzehnte der DDR noch heute sichtbare Gedenktafel-Spuren hinterlassen – allerdings weniger im Ensemble der traditionellen universitär-akademischen Gedenktafeln, als durch Stücke, die sich in Gestaltung und Platzierung von diesem Medium abheben. Besonders im Zuge der seit Beginn der 1970er Jahre geführten Debatte um „Erbe“ und „Tradition“20 erfolgte über Gedenktafeln eine „Eingemeindung“ „progressiver“ akademisch-„bürgerlicher“ Traditionen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Erinnerungsbestand der „sozialistischen Universität“. Das zeigte sich z. B. bei der 1975 an der Ostmauer des historischen Johannisfriedhofes angebrachten Gedenktafel für den radikaldemokratischen Jenaer Burschenschafter und Progressstudenten Ferdinand Lange, der während der Reichsintervention in Thüringen im Oktober 1848 im Zuge des Vorgehens gegen den Jenaer Demokratischen Verein verhaftet worden und Anfang 1849 an den Folgen der Haft gestorben war. Die Initiative zur Anbringung der aufwändigen Gedenktafel ging von dem Historiker Siegfried Schmidt aus21, der in der Jenaer Forschung zur Geschichte der „bürgerlichen Parteien“ und – zwischen 1970 und 1976 – der „nichtproletarischen demokratischen Kräfte in Deutschland“ für das frühe 19. Jahrhundert bzw. die Zeit bis 1917 zuständig war und mit zahlreichen Arbeiten zu Linksliberalismus und Demokratie besonders in der Revolution von 1848/49 hervortrat.22 Die Gedenktafel, und auch die von Schmidt 1983 in Verbindung 19
Zur Gesamtproblematik vgl. Harald Weinrich: Lethe. Kinst und Kritik des Vergessens, München 3 2000. Knapp zusammenfassend: Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, München 2006, S. 104–108. 20 Vgl. dazu knapp Ulrich Neuhäußer-Wespy: Erbe und Tradition in der DDR. Zum gewandelten Geschichtsbild der SED, in: Alexander Fischer, Günther Heydemann (Hg.): Geschichtswissenschaft in der DDR, Bd. 1: Historische Entwicklung, Theoriediskussion und Geschichtsdidaktik, Berlin 1988, S. 129–153. 21 Vgl. „Die Studenten gehören zu den positiven Seiten meiner Erinnerung“. Prof. Dr. Peter Schäfer, Historiker, geb. 1931, in: Matthias Steinbach (Hg.): Universitätserfahrung Ost. DDRHochschullehrer im Gespräch, Jena, Quedlinburg 2005, S. 161–193, hier S. 182. 22 Vgl. Hans-Werner Hahn, Tobias Kaiser: Die Arbeitsgruppe zur Geschichte der bürgerlichen Parteien 1962–1990 – ein geisteswissenschaftliches Großprojekt, in: Uwe Hoßfeld, Tobias Kaiser, Heinz Mestrup (Hg.): Hochschule im Sozialismus. Studien zur Geschichte der Friedrich-SchillerUniversität Jena (1945–1990), Bd. 2, Köln, Weimar, Wien 2007, S. 1686–1714. Zu Schmidts Publikationen vgl. Bibliographie der wissenschaftlichen Veröffentlichungen von Siegfried Schmidt, in: Siegfried Schmidt: Die Entwicklung der politischen Opposition im Königreich Sachsen zwischen 1830 und 1848, hg. v. Werner Greiling, Dresden 2005, S. 141–149. – Den Platz, der Lange in der universitären Erinnerungskultur zugewiesen wurde, zeigt auch die Behandlung
118
Stefan Gerber
mit Günter Steiger und Ludwig Elm, Professor für „wissenschaftlichen Sozialismus“, veröffentlichte Jenaer Universitätsgeschichte feierte den 22jährig gestorbenen Sohn eines Jenaer Theologieprofessors als „Märtyrer“.23 In einem ähnlichen Kontext standen die langwierigen, 1984 schließlich von Erfolg gekrönten Bemühungen des Historikers und Kustos Günter Steiger um Gedenktafeln für den slowakischen Dichter, Philologen und Theologen Ján Kollár, der 1817–1819 in Jena studiert, im Oktober 1817 am Wartburgfest teilgenommen24 und in der thüringischen Universitätsstadt seine national-liberalen, panslawischen politischen Überzeugungen entwickelt hatte.25 Gelegentlich werden Gedenktafeln selbst zum Medium des Austrages von Deutungs- und Erinnerungskonflikten: Wenn sie in ihrer Aufschrift signalisieren, dass eine erinnerungskulturelle Übereinkunft nicht besteht, dass es gespaltene und konkurrierende Erinnerungskonzepte für die erinnerte Person oder das erinnerte Ereignis gibt, entsteht eine ambivalente, für die Paradoxien öffentlichen Erinnerns durchaus kennzeichnende Situation: Während die Gedenktafel durch ihr bloßes Vorhandensein und ihre Materialität den Willen zur Erinnerung dokumentiert, konterkariert die Beschriftung diese Erinnerung, indem sie vermittelt, dass das Erinnerte besser diskreter behandelt oder vergessen werden sollte. Ein charakteristisches Beispiel dafür ist die Tübinger Gedenktafel für den Theologen David Friedrich Strauß, der als radikaler philologischer Kritiker der neutestamentlichen Überlieferung und schließlich des Christentums insgesamt zur Identifikationsfigur des Linkshegelianismus wurde. Erst zu seinem 100. Todestag 1974 erhielt Strauß – immerhin einer der bekanntesten Theologen und Publizisten des 19. Jahrhunderts – eine von den Repetenten gestiftete Gedenktafel in der illustren „Plaketten“-Galerie auf der Altane des berühmten Tübinger Stifts, das für ihn als Studenten und Repetenten die prägendste Bildungserfahrung gewesen war, bis er es 1835, nachdem der erste Band seines „Lebens Jesu, kritisch betrachtet“ erschienen war, verlassen musste. Die Tafel trägt, neben den Lebensdaten, die für ein Gedächtnismedium bemerkenswerte, allen theologischen Parteien einen Anknüpfungspunkt bietende und zugleich alle gegensätzlichen Erinnerungsweisen andeutende Aufschrift: „Verfasser des ‚Leben Jesu‘, Ärgernis und Anstoss für Theologie und Kirche“.26 Neben die Vorentscheidung aufgrund (geschichts)politischer Prämissen oder wissenschaftlicher Positionen tritt – ganz besonders natürlich bei akademischuniversitären Gedenktafeln – auch die soziale, hier: bildungsbürgerliche Distinktion.
23 24 25
26
in: Günter Steiger: „Ich würde doch nach Jena gehen“. Geschichte und Geschichten, Bilder, Denkmale und Dokumente aus vier Jahrhunderten Universität Jena, Weimar 41989, S. 155f. Vgl. Bild XX; Siegfried Schmidt (Hg.): Alma Mater Jenensis. Geschichte der Universität Jena, Weimar 1983, S. 202. Vgl. Joachim Bauer, Marga Steiger: Die Wartburgfestteilnehmer von 1817, in: Einst und Jetzt 53 (2008), S. 149–183, hier S. 159. Nachdem 1983 eine Gedenktafel am Pfarrhaus in Jena-Altlobeda angebracht worden war, wo Kollár eine Liebesbeziehung mit der Pfarrerstochter Friederike Schmidt angeknüpft und den Pfarrer vertreten hatte, erfolgte 1984 die Errichtung eines Gedenksteins mit zwei Tafeln. Zum Vorgang vgl. UAJ, AKG 92. Vgl. außerdem: Steiger: „Ich würde doch nach Jena gehen“, S. 157–162; ders.: Urburschenschaft und Wartburgfest. Aufbruch nach Deutschland, Leipzig, Jena, Berlin 21991, S. 102f. Vgl. http://www.evstift.de/index.php?id=33; zuletzt abgerufen am 1.3.2016.
Landmarken im Erinnerungsraum. Jenaer Gedenktafeln im Vergleich
119
Die auf den Gedenktafeln Erinnerten waren, abgesehen von kanonisierten Dichtern, in den ersten Phasen der Strukturierung des universitätsstädtischen Erinnerungsraumes durch Gedenktafeln seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zumeist Professoren. Das lag auch daran, dass das über die Gedenktafeln geknüpfte Erinnerungsnetz in den Augen seiner zumeist selbst professoralen Konstrukteure in erster Linie an die universitäre Korporation gebunden war: Es sollte ihre Erinnerung im urbanen Raum manifestieren, den Erinnerungsbedürfnissen einer Korporation genügen, deren Kern und eigentliche Glieder in der Perspektive des 19. Jahrhunderts die Ordinarien waren. Das Selbstbild der Universität hegemonial zu formulieren, die universitäre Eigengeschichte zu strukturieren, erinnerungskulturell zu verfestigen und geschichtspolitisch durchzusetzen, war diesen Ordinarien selbstverständlich. Universitäre Erinnerungskultur war nicht Ergebnis einer diskursiven Einigung zwischen verschiedenen „Gruppen“, sondern zunächst Instrument korporativer Selbstvergewisserung, das auf einer Selektion aus dem kollektiven Gedächtnis der Universität beruhte. Nichtordinarien und Studenten konnten hier nur eine Nebenrolle einnehmen; nichtakademische Bürger oder Frauen hatten nur in seltenen Ausnahmefällen einen Platz. Eine studentische Ausnahme bildet z. B. der als Jenaer Original geltende „ewige Student“ (eingeschrieben 1827–1873) Friedrich Wilhelm Demelius, für den schon vor 1928 eine Tafel angebracht und 1979, zuletzt 2011 erneuert wurde. (Abb. 3) Dass viele der Gedenktafelwürdigen Akademiker zugleich „nationale“ Bedeutung besaßen und damit den Ort der Universität in der zu schaffenden Nationalkultur markieren konnten, kam den Intentionen zusätzlich entgegen.
Abb. 3 Gedenktafel für Friedrich Wilhelm Demelius, Jena, Ballhausgasse 6 (erneuert 2011)
Grundsätzlich lässt sich also festhalten, dass moderne Gedenktafeln im öffentlichen Raum, und besonders an der straßenseitigen Fassade von Häusern, sowie ganz besonders akademisch-universitäre Gedenktafeln als bildungsbürgerliche Individualdenkmäler, Instrumente und Ausdruck bürgerlicher Selbstdefinition über Bildung, Leistung oder auch Besitz seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, korporativer Selbstbeschreibung, und als Gemeinschaftsdenkmäler eine Struktur der erinnerungskulturellen Gestaltung und Aneignung von urbanen Räumen sind. Auch wenn sie aufgrund ihrer zumeist nüchternen Ästhetik und ihrer geringen Größe nicht die gleiche Expressivität
120
Stefan Gerber
aufweisen wie andere Denkmäler, etwa Büsten, Statuen, Stelen oder Türme,27 sind doch auch sie „Landmarken“, konstitutive Elemente und zugleich Orientierungspunkte in Erinnerungsräumen. Diese unspektakuläre Form, das vermutet die Volkskundlerin Marita Metz-Becker wohl zutreffend, ist der Grund für eine nur äußerst eingeschränkte Aufmerksamkeit der historischen, ethnologischen und kunsthistorischen Forschung für das Medium der Gedenktafeln.28 In dieser sehr schmalen Forschung zu modernen Gedenktafeln, die sich jenseits heimatkundlich-lokalgeschichtlicher Darstellungen mit deskriptiver, oftmals touristischer Ausrichtung (Gedenktafel-Führer) im Grunde auf die Beiträge Marita Metz-Beckers reduzieren lässt,29 ist der angedeutete Doppelcharakter der Tafeln skizziert, aber kaum erinnerungsgeschichtlich durchdekliniert worden. Deshalb sollen im Folgenden zumindest einige Anhaltspunkte für eine solche systematischere Durchmusterung gegeben werden, die sich vor allem auf die Universitätsstadt Jena beziehen; dabei werden Göttingen und Marburg immer wieder vergleichend herangezogen. Dass Jena einen prominenten Platz einnimmt, liegt vor allem daran, dass die thüringische Universitätsstadt nach allen bislang bekannten Bestandaufnahmen wohl tatsächlich die mit deutlichem Abstand ausgedehnteste akademisch-universitäre Gedenktafellandschaft besitzt. Jena ist deshalb auch der Ort, über den am häufigsten, zuletzt in einer Publikation zur Bestandsaufnahme und lokalgeschichtlichen Verortung 1989/90,30 Betrachtungen zu den Gedenktafeln angestellt wurden, die Ansatzpunkte für prinzipiellere Überlegungen zu diesem Medium des Gedächtnisses bieten können. Schon 1858, zum 300. Universitätsjubiläum – auf das gleich ausführlicher zurückzukommen sein wird – wurden in Jena 205 solcher Gedenktafeln angebracht.31 Im Vorfeld des Universitätsjubiläums 1908 erfolgte dann eine erste Revision und Erneuerung durch eine Kommission unter Leitung des stadt- und regionalgeschichtlich aktiven Realschulprofessors Ernst Piltz.32 Auch der Kunsthistoriker Paul Weber, der seit Ende 1900 Extraordinarius der Kunstgeschichte an der Universität war, das 1901 eröffnete Jenaer Stadtmuseum aufbaute und bis zu seinem Tode 1930 leitete, kümmerte sich in Zusammenarbeit mit dem Stadtbaumamt um die Erneuerung, Ergänzung und Neuanbringung von Gedenktafeln.33 Ende 1927 bildete die Universität einen neuen Gedenktafelausschuss unter dem Vorsitz des pensionierten Universitätskurators 27 Vgl. zu dem prominentesten Beispiel solcher erinnerungskultureller „Landmarken“ für Thüringen: Katrin Wenzel: Bismarcktürme und Bismarcksäulen in Thüringen. Zur politischen Topographie einer Erinnerungslandschaft, in: Werner Greiling, Hans-Werner Hahn (Hg.): Bismarck in Thüringen. Politik und Erinnerungskultur in kleinstaatlicher Perspektive, Rudolstadt 2003, S. 157–176. 28 Vgl. Metz-Becker: Erinnerungskultur (1999), S. 321. 29 Vgl. ebd.; teilweise textgleich, nur stärker im Kontext der „Inszenierung von Stadtbildern“: Marita Metz-Becker: Zum kulturellen Gedächtnis deutscher Universitätsstädte, in: Brigitta Schmidt-Lauber: Mittelstadt. Urbanes Leben jenseits der Metropole, Frankfurt a. M./New York 2010, S.105–120. 30 Vgl. Wilfried Haun, Detlef Ignasiak, Barbara Oehme, Ilse Traeger: Gedenktafeln. Kulturgeschichte an Jenas Häusern, Jena 1990. 31 Vgl. O. A. [Hermann Schaeffer]: Zu den Gedenktafeln, Jena 1858, S. 7–23. 32 Vgl. UAJ, BA 1790, Bl. 3r–8r, Bericht von Max Vollert an den Senat v. 20.7.1929. 33 UAJ, BA 1790, Bl. 2r, Anlage zur Abschrift aus dem Senatsprotokoll v. 8.12.1927.
Landmarken im Erinnerungsraum. Jenaer Gedenktafeln im Vergleich
121
Max Vollert, dem neben Weber noch der Direktor der Universitätsbibliothek Theodor Lockemann, später der Historiker Stephan Stoy und (als neuer Vorsitzender ab 1930) sein Fachkollege Georg Mentz angehörten; der Germanist Albert Leitzmann lehnte die Wahl in den Ausschuss ab.34 Auch dieser Ausschuss setzte sich zum Ziel, beschädigte Gedenktafeln zu erneuern, den Bestand kritisch zu durchforsten und vor allem weiter auszubauen. Für diese Ausdehnung des urbanen Gedächtnisraumes der Gedenktafeln wollte die Kommune, die bisher die Aktivitäten Paul Webers finanziert hatte, nun kein Geld mehr geben, sodass die Gedenktafeln vollends zum universitären Projekt wurden: Für neue Tafeln stellten die fünf Fakultäten insgesamt 850 Mark zu Verfügung; den Löwenanteil steuerte – wie so oft bei universitären Aufgaben in Jena – mit 1.000 Mark die Carl-Zeiß-Stiftung bei. Damit konnte der Ausschuss das Gedenktafelensemble beträchtlich ausbauen, denn eine Bilanz von 1929 wies aus, dass 239 Tafeln vorhanden waren, der Bestand mithin seit Mai 1928 um 88 Tafeln gewachsen war.35 Dabei waren nicht nur Professoren und andere universitär-akademischen Protagonisten der jüngeren Vergangenheit hinzugefügt worden, sondern auch Persönlichkeiten des 18. und 19. Jahrhunderts, für die es bisher – wie z. B. für den Anatomen Emil Huschke – noch keine Gedenktafel gegeben hatte.36 Der bereits erwähnte Friedrich Thieme, der 1933 die letzte Bestandaufnahme vor dem Zweiten Weltkrieg vornahm, registrierte dann 287 Gedenktafeln. Auch der Küster an der Jenaer Stadtkirche, Karl Rudolph, legte in diesen Jahren ein Verzeichnis an.37 Den Krieg mit seinen Bombenschäden in der Innenstadt überlebten nach der Zählung des langjährigen Jenaer Universitätsarchivars Otto Köhler 94 Tafeln; 1987 waren nach einer Bestandaufnahme der neugebildeten Jenaer Arbeitsgruppe „Gedenktafeln“ im Kulturbund der DDR unter der Ägide von Wilfried Haun 192 Tafeln vorhanden, bis Ende 1989 wurden weitere 54 angebracht.38 Aktiv bei der Erhaltung und Weiterentwicklung des Gedenktafelnetzes war neben dem Kulturbund, der bereits in den 1950er Jahren beschädigte bzw. verblasste Tafeln aufgefrischt hatte, in den 1970er Jahren vor allem der Jenaer Historiker und Bibliothekar Günter Steiger, der 1971 die Leitung der Kustodie der Friedrich-Schiller-Universität Jena übernahm, die als zentrale kustodische Einrichtung an den Universitäten der DDR damals ohne Vorbild war.39 Auf Steigers Betreiben wurde an der Universität 1971 eine „Arbeitsgruppe historischer Besitz der Friedrich-Schiller-Universität Jena“ gebildet, der neben dem bereits erwähnten Universitätsarchivar Otto Köhler unter anderen auch der Kustos des Phyletischen Museums, Dietrich von Knorre, der Direktor des Ernst-Haeckel-Hauses, Prof. Georg Uschmann und der Archäologe und Kunsthistoriker Prof. Gerhard Zinserling angehörten.40 Neben dem ausgedehnten Bereich der historischen Universitätsgebäude, der Sammlungen und eines immer 34 35 36 37 38 39 40
Vgl. ebd., Bl. 1v–2r und Abschrift aus dem Senatsprotokoll v. 30.4.1930, ebd., n.p. Vgl. ebd., Bl. 9r–17v, Liste der vorhandenen Tafeln. Vgl. ebd., Bl. 18r–26r, Liste der seit 1928 neu angebrachten Tafeln. Vgl. Haun u. a.: Gedenktafeln (1990), S. 10. Ebd., S. 10, 13. Ebd., S. 10f. Vgl. die Einladungsschreiben von Prorektor Heinz Keßler an die bestätigten Mitglieder der Arbeitsgruppe v. 2.6.1971, UAJ, AKG 55, n.p..
122
Stefan Gerber
wieder projektierten (aber nie realisierbaren Universitätsmuseums) betrachtete die Gruppe auch die universitären Denkmäler, als deren integralen Bestandteil sie das Jenaer Gedenktafelensemble ansah, als ihr Arbeitsgebiet.41 Steiger, der spiritus rector der Arbeitsgruppe, nahm, was den Zustand der Jenaer Denkmäler anging, in den 1970er Jahren universitätsintern kein Blatt vor den Mund: In einer Arbeitsvorlage, die er im Herbst 1976 für eine Dienstbesprechung des Rektors zum „Kunst- und Kulturerbe“ der Jenaer Universität erstellte, vermerkte der Kustos: „Es müßte ein gemeinsames Anliegen von Universität, Stadt und Zeiß-Stiftung sein, die gegenwärtig durchweg stark verwahrlosten öffentlichen Denkmäler und historischen Architekturmonumente Jenas sorgfältig zu pflegen und zu restaurieren. […] Die bisherigen Arbeiten der vergangenen Jahrzehnte haben sich im allgemeinen darauf beschränkt, das im Verfall begriffene einigermaßen zu sichern.“42 Im Vorfeld der Gründung der Arbeitsgruppe von 1971 hatte Universitätsarchivar Otto Köhler eine Liste der aktuell vorhandenen Gedenktafeln erstellt, die vervollständigt werden und als Grundlage einer umfassenden, systematischen Revision und Erneuerung dienen sollte. Alle Mitglieder der Arbeitsgruppe sollten nicht nur an einer Vervollständigung dieser Aufstellung mitwirken und Vorschläge für neue Tafeln machen, sondern den vorhandenen Bestand auch unter der Maßgabe durchmustern, welche Tafeln eventuell entfernt werden könnten oder müssten. Anders als Ende der 1920er Jahre hatte die Stadt Jena Steiger nun zugesagt, die neuen Schilder bzw. die Instandsetzung älterer zu finanzieren. Das Projekt war zunächst auf zwei Jahre angelegt und weitreichend: Alle Tafeln sollten renoviert bzw. ausgetauscht werden.43 Steiger dachte zuerst an Schamott-Tafeln, kam dann aber auf die traditionellen Emaille-Tafeln zurück.44 Bis Ende der 1970er Jahre wurden so deutlich mehr als 100 neue Gedenktafeln angefertigt.45 Die Anbringung und der Erhalt verliefen jedoch weitaus schleppender, als Steiger geplant und gehofft hatte. Zudem bestand das Problem der Verluste, das das Jenaer Gedenktafelensemble von Beginn begleitet hatte, fort: Im Januar 1982 z. B. übersandte der seit 1979 als Leiter einer eigenständigen „Arbeitsstelle Kulturgeschichte“ amtierende Steiger der Kustodie der Universität die drei „von uns kurz vor dem Wegwerfen ‚geretteten‘ Gedenktafeln“ für den Kurator Max Vollert, Ernst Haeckel und den Indogermanisten Eduard Sievers von gerade renovierten Häusern in der Neugasse. Steiger drängte, die Tafeln so schnell wie möglich – in jedem Fall solange die Bauarbeiter noch da seien – neu anbringen zu lassen, was ein Schlaglicht auf die beim Gedenktafel-Projekt in der DDR erschwerend hinzutretenden Engpässe bei Material und Arbeitskräften wirft.46 Bezeichnend für die daraus hervorgehenden Mühen, aber auch für das bis ins Private reichende Engagement Steigers für die Gedenktafeln ist ein Vorgang von Beginn der 1980er Jahre: Schon im Sommer 1981 wies er in einem Brief an Kustos Horst Hölzel darauf hin, dass die Gedenktafel für den Kotzebue-Attentäter Karl Ludwig Sand in 41
Vgl. die Tagesordnung v. 24.6.1971 und das Protokoll der Gründungssitzung der Arbeitsgruppe am 6.7.1971 v. 16.7.1971, UAJ, AKG 55, n.p. 42 UAJ, AKG 55, n.p., Vorlage für die Dienstbesprechung des Rektors v. 23.11.1976. 43 Vgl. UAJ, AKG 55, n.p., Protokoll der Arbeitsgruppensitzung am 6.7.1971 v. 16.71971. 44 Vgl. Haun u. a.: Gedenktafeln (1990), S. 11. 45 Ebd., S. 11f. 46 UAJ, AKG 4, n.p., Schreiben von Günter Steiger an Barbara Oehme v. 26.1.1982.
Landmarken im Erinnerungsraum. Jenaer Gedenktafeln im Vergleich
123
der Jenaer Oberlauengasse schon seit längerem erneuert werden solle.47 Ein Jahr lang bewegte sich – obgleich Steiger meinte, es müsse schon eine früher angefertigte Tafel vorhanden sein – nichts, bis er im Juli 1982 zur Tat schritt und im September an den Rat der Stadt berichtete: „Am 30. Juli 1982 haben wir durch einen Mitarbeiter der Universität nach Feierabend am Haus Oberlauengasse Nr. 11 die völlig verrottete alte Gedenktafel durch eine neue emaillierte Tafel für Carl Ludwig Sand ersetzen lassen.“ Steiger hatte schließlich die 20 Mark für das Anbringen aus eigener Tasche bezahlt.48 Auch heute ist die Lage in Jena zwiespältig: Einerseits konnten, vor allem durch die Bemühungen des Jenaer Universitätsarchivs, mit Unterstützung der „Gesellschaft der Freunde und Förderer der Friedrich-Schiller-Universität Jena“ und verschiedener lokaler und regionaler Stiftungen, in den letzten Jahren eine ganze Reihe von neuen Tafeln angebracht werden. Dass dies häufig – wenn auch glücklicherweise nicht ausschließlich – an Gebäuden der Universität geschah, verweist auf das Weiterbestehen des Problems, das Günter Steiger 1982 im Falle der Tafeln von Vollert, Haeckel und Sievers beklagte und das schon bei der Bestandaufnahme in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre konstatiert worden war:49 Baumaßnahmen an privaten Gebäuden führen durch Unachtsamkeit oder Desinteresse oft zum Verlust von Gedenktafeln, Hauseigentümer zögern oder weigern sich, Tafeln nach Fassadensanierungen wieder anbringen zu lassen. Der Journalist, Historien- und Kriminalschriftsteller Friedrich Thieme bemerkte bereits 1933 mit bedauernder Ironie, „Unkenntnis, Unachtsamkeit, zum Teil wohl auch Pietätlosigkeit und die überhandnehmende geschäftliche Sitte, die Hausfronten praktischer mit Kathreiner-, Maggi-, Insektenpulver- und anderen Tafeln zu bespicken“ machten dem Jenaer Gedenktafel-Ensemble schwer zu schaffen.50 Heute werden selbst Denkmalschutzbedenken geltend gemacht, weil die Gedenktafel nicht als Teil eines universitätsstädtischen Gedächtnisraumes, sondern als solitärhalbprivates Erinnerungszeichen wahrgenommen wird, dem nicht der Charakter eines „Kulturdenkmals“ zukommt. Ein Blick in die Entwicklung des durch die Gedenktafeln hergestellten universitären und städtischen Gedächtnisraumes macht indes deutlich, dass das Jenaer Gedenktafelensemble durchaus als Element eines „kennzeichnenden Straßen-, Platz- und Ortsbildes“ gelten kann.51 Anknüpfend an die oben skizzierten Überlegungen zu den differenzierten Funktionsweisen verschiedener Gedenktafeln innerhalb der durch sie formierten Gedächtnislandschaften, lassen sich in Jena heute vier Gruppen von Tafeln unterscheiden, die oft (Abb. 4, 5, 6, 7 und 8) in charakteristischen Tafel-Gruppen an den Fassaden angebracht sind.
47 48 49 50 51
Vgl. ebd., n.p., Schreiben von Günter Steiger an Horst Hölzel v. 24.7.1981. Ebd., n.p., Schreiben von Günter Steiger an den Rat der Stadt Jena, Abteilung Kultur v. 2.9.1982. Vgl. UAJ, BA 1790, Bl. 1r, Schreiben des Universitätsamtmannes an den Senat v. 15.11.1927. Friedrich Thieme: Jenas Gedenktafeln, Jena 1934 (Sonderdruck aus: Altes und Neues aus der Heimat, Beilage zum Jenaer Volksblatt, 1933), S. 1. So eine der Definitionen für „Kulturdenkmale“ in § 4, Absatz 2 und 4 des „Thüringer Gesetzes zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale“ v. 14.4.2004, in: Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen 10 (2004), 29.4.2004, S. 465–472, hier S. 466.
124
Stefan Gerber
Abb. 5 Gedenktafel für Carl Friedrich Ernst Frommann, Majorflügel des Frommannschen Anwesens, Fürstengraben 18 (erneuert 1999)
Abb. 4 Gedenktafeln am Haus der Sängerschaft St. Pauli zu Jena, Jenergasse 14
Abb. 6 Gedenktafeln am „Major-Flügel“ des Frommannschen Anwesens, Fürstengraben 18
Landmarken im Erinnerungsraum. Jenaer Gedenktafeln im Vergleich
Abb. 7 Gedenktafeln am Haus Neugasse 23
Abb. 8 Gedenktafeln am Collegium Jenense, Kollegiengasse
125
126
Stefan Gerber
Bereits verwiesen wurde an den Beispielen der Burschenschaftsgründung und Luthers auf die Tafeln, die direkt auf die Aura der Authentizität des bezeichneten Ortes setzen können. (Vgl. Abb. 1 und 2). Häufig anzutreffen ist zweitens der nur mittelbare, nicht auf die direkte Wohnstätte, sondern auf das Wirken der betreffenden Personen in Jena abzielende Rekurs. Das gilt z. B. für die Gedenktafeln, die Ende 2013 an den Rosensälen angebracht wurden, die im 19. Jahrhundert Schauplatz der akademischen Konzerte waren: Hier wird nun u. a. an Max Reger, der 1915/16 in Jena lebte und u. a. Leiter diese Konzerte war, und an die Pianistin Clara Schumann erinnert, die 1836 und 1840 Konzerte in den Rosensälen gab (Abb. 9, 10 und 11).
Abb. 10 Gedenktafel für Max Reger an den Rosensälen, Fürstengraben 27 (2013)
Abb. 9 Gedenktafeln an den Rosensälen, Fürstengraben 27
Abb. 11
Gedenktafel für Clara Schumann an den Rosensälen, Fürstengraben 27 (2013)
Eine dritte Gruppe bilden Tafeln, die auf eine nicht mehr existierende Lokalität (zumeist ein zerstörtes oder abgerissenes Gebäude) verweisen, das mit dem Jenaer Lebensabschnitt des auf der Tafel Erinnerten in Zusammenhang stand. So rekurriert die 2007 an einem neu errichten Haus in der Jenaer Rathausgasse angebrachte Gedenktafel für den Historiker Johann Gustav Droysen, der 1851 – 1859 in Jena lehrte, explizit auf das bis zur Zerstörung 1945 ungefähr an dieser Stelle befindliche Gebäude, eine der Jenaer Wohnungen Droysens (Abb. 12).
Landmarken im Erinnerungsraum. Jenaer Gedenktafeln im Vergleich
127
Abb. 12 Gedenktafel für Johann Gustav Droysen, Rathausgasse 1 (2007)
Viertens schließlich sind Tafeln zu nennen, die den tradierten personenbezogenen Rahmen des Jenaer Gedenktafelensembles durchbrechen: Sei es um diesen zu ergänzen, sei es um ihn zu ironisieren, die erinnerungskulturelle Absicht zu konterkarieren oder Manifestationen von Eigengeschichten im städtischen Raum zu platzieren. So wurde an einem ehemaligen Gebäude des Zeiss-Hauptwerkes („Bau 13a“), das heute Bestandteil eines neugestalten innerstädtischen Universitätscampus ist, 2013 durch die Fakultät für Mathematik und Informatik eine Gedenktafel für die 1954/55 bei Zeiss konstruierte „Optische Rechenmaschine“ OPREMA angebracht, die der erste Rechenautomat der DDR war und als einer der ersten deutschen Computer gelten kann (Abb. 13). In den Bereich polemisch präsentierter Eigengeschichten und des Versuchs, der städtischen Öffentlichkeit umstrittene Selbstdeutungen augenfällig zu machen, fällt eine Tafel am Haus Johannisstraße 14, dem Sitz der von der evangelischlutherischen Kirchengemeinde Jena als „offene Jugendarbeit“ betriebenen „Jungen Gemeinde Stadtmitte“: Stadtjugendpfarrer Lothar König, gegen den mehrfach wegen Drogenhandels (1996) und des Verdachts auf schweren Landfriedensbruch, Nötigung, Beihilfe zum Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchte Strafvereitelung ermittelt wurde (2011 und erneut seit 2015) erinnert dort in einer privaten, in der Gestaltung aber den universitären Gedenktafeln angeglichenen Tafel, an die – rechtstaatlich nicht zu beanstandende – Einziehung seines VW-Busses als Tatwerkzeug im Zuge der Ermittlungen von 2011, die 2014 zur Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage von 3.000 Euro für den Geistlichen führten (Abb. 14).
Abb. 13
Gedenktafel „Oprema“, Ernst-AbbePlatz (2013)
Abb. 14 Tafel am Haus der „Jungen Gemeinde Statdtmitte“, Johannisstraße 14
128
Stefan Gerber
Insgesamt sind nach den Erhebungen der bereits erwähnten Projektgruppe des Kulturbundes zwischen 1858 und 1989 520 Gedenktafeln in Jena angebracht gewesen, auf denen an 458 Personen erinnert worden ist.52 Die Universitätsstadt an der Saale weist damit eine einmalige Dichte an akademisch-universitären Gedenktafeln auf. Was Jena – und Göttingen, auf das gleich noch zu sprechen zu kommen sein wird – hier von anderen, auch alten Universitätsstädten, unterscheidet, ist allerdings nicht die Zahl der Gedenktafeln an städtischen Häuserfassaden. In Heidelberg, dem bereits erwähnten Kiel oder der traditionsreichen Montanuniversitätsstadt Freiberg z. B., deren Gedenktafellandschaften in den letzten Jahren Gegenstand von Bestandaufnahmen und Analysen geworden sind, erfolgte die Anbringung der Tafeln unsystematisch, in den verschiedensten äußeren Gestaltungsformen, durch unterschiedliche Akteure und in vergleichsweise beschränkter Anzahl.53 In Jena, Göttingen und – mit Abstrichen – auch in Marburg dagegen, waren und sind die Gedenktafeln ein erinnerungskulturelles „Projekt“, das Universität und Stadt mehr oder minder intensiv gemeinsam betreiben, das von einem einheitlichen Gestaltungswillen getragen ist und, wie der Leiter des Göttinger Stadtarchivs, Ernst Böhme treffend anmerkt, „als Denkmal besonderer Art“ begriffen wird: Es ist nicht an Einzellokalitäten gebunden, sondern macht das gesamte Stadtgebiet zu seinen „Ort“, „und es ist nicht statisch, sondern es lebt gleichsam, wächst und verändert sich.“54 Das Göttinger Gedenktafel-Projekt ist mit dem Jenaer unmittelbar verknüpft, denn Georg Merkel, der als Göttinger Oberbürgermeister zwischen 1870 und 1893 die infrastrukturelle Entwicklung der neupreußischen Universitätsstadt maßgeblich prägte, brachte den Plan dazu von einem Besuch in Jena mit.55 Seine Initiative vom Januar 1874 führte, zunächst in enger Kooperation zwischen dem Denkmälerausschuss der Universität und der Göttinger Stadtverwaltung bzw. später dem Stadtarchiv, zwischen 1874 und dem gegenwärtigen Zeitpunkt zur Anbringung von insgesamt 320 Gedenktafeln,56 von denen sich heute noch ca. 200 an Göttinger Hausfassaden befinden. Von Beginn an gelang in Göttingen die – auch im Vergleich zu Jena – stärkste „Institutionalisierung“ des „Gesamtdenkmals“: Stadtarchiv und Denkmalsbeauftragter der Universität57 entscheiden nach klaren Richtlinien, die ein ähnliches Bild wie in Jena bieten: Neben berühmtgewordenen Wissenschaftlern und Studenten der Universität und städtischen Persönlichkeiten können auch „Kandidaten“ eine Tafel erhalten, deren allgemeine politische oder kulturelle Berühmtheit ihren Aufenthalt in Göttingen bemerkenswert erscheinen lässt, ohne dass eine spezifische, dauerhafte Bindung zur Universitätsstadt besteht. Göttingen begann darüber hinaus 52 53 54 55 56 57
Vgl. Haun u. a.: Gedenktafeln (1990), S. 12. Vgl. dazu; Jürgen von Essenwein, Michael Utz: Folg’ ich meinem Genius; Stolz, Menschen und Ereignisse; Werner Lauterbach, Freiberg. Gedenktafeln bewahren Erinnerungen, Erfurt 2007. – In Heidelberg führt das Stadtarchiv eine ständig aktualisierte Liste der Gedenktafeln. Walter Nissen, Christina Prauss, Siegfried Schütz: Göttinger Gedenktafeln. Ein biografischer Wegweiser, Göttingen 2002, S. 7. Vgl. ebd., S. 5. Ebd., S. 5, 8; Metz-Becker: Erinnerungskultur (1999), S. 321. Eine Funktion, die oft Göttinger Mediävisten bzw. Frühneuzeit- und Landeshistoriker wie 1988–1998 Hartmut Boockmann, 1998–2006 Ernst Schubert und seit 2006 Peter Aufgebauer wahrnahmen.
Landmarken im Erinnerungsraum. Jenaer Gedenktafeln im Vergleich
129
schon früh mit der Bestandsaufnahme, Erklärung und touristischen „Vermarktung“ des Gedenktafelensembles: Beginnend mit einer Publikation des preußischen Offiziers Gustav von Kortzfleisch 1905 erschienen bis in die unmittelbare Gegenwart immer wieder Führer zu den Göttinger Gedenktafeln, vor allem von den langjährigen Stadtarchivaren und Stadthistorikern Walter Nissen und Helga-Maria Kühn.58 Auch in Marburg, wo zu Beginn der 1920er Jahre nur 20 Tafeln vorhanden waren und inzwischen ca. 100 angebracht sind, war die Verschränkung von akademischer mit städtischer Geschichtspolitik und touristischen Interessen kennzeichnend: Die Installierung der Gedenktafeln, die zum 350. Jubiläum von 1877 auf Beschluss des Jubiläumsausschusses begann und vom Direktor der Universitätsbibliothek, dem Altphilologen Carl Julius Cäsar geleitet wurde,59 wurde im weiteren 19. Jahrhundert von dem 1868 gegründeten Marburger „Verschönerungsverein“ und der Kommune betrieben.60 Fragen wir nach diesen gedächtnis- und erinnerungstheoretischen sowie ereignisgeschichtlichen Kontextualisierungen noch einmal systematisch-erinnerungsgeschichtlich danach, wo universitär-akademische Gedenktafeln angebracht wurden – d. h. in welchen Typen von Universitätsstädten verstärkt und wo dort im Stadtraum – und wann die Tafeln vermehrt installiert wurden bzw., was die „Initialzündung“ für die Gedenktafelprojekte war. Unübersehbar ist, dass vor allem kleinere und mittlere deutsche Universitätsstädte Verbreitungsgebiet der akademischen Gedenktafeln sind. Der Befund, dass dies auf die 1905 von Adolf von Harnack ausgemachte Transformation der deutschen Universität zum „Großbetrieb der Wissenschaft“ seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zurückzuführen ist,61 überrascht nicht. Die Finanzierungskrisen, in die kleinere und mittlere Universitäten im Zuge des damit verbundenen Ausbaus von Kliniken und naturwissenschaftlicher Großforschung und durch die Konkurrenz außeruniversitärer Forschungseinrichtungen im späten 19. Jahrhundert gerieten,62 waren auch Krisen 58
59 60 61 62
Vgl. O. A. [Gustav von Kortzfleisch]: Biographischer Führer durch Göttingens Gedenktafeln. Mit einem Anhange über sonstige Ehrungen hervorragender Männer durch Denkmäler, Strassenbenennungen usw., Göttingen 1905; Walter Nissen: Göttinger Gedenktafeln. Ein biographischer Wegweiser, Göttingen 1962 (ergänzte Neuaufl. Göttingen 1975); Helga-Maria Kühn: „…Stille Anrede…“. Göttinger Gedenktafeln 1874–1989, in: 100 Jahre Göttingen und sein Museum. Texte und Materialien zur Ausstellung im Städtischen Museum und im Alten Rathaus, 1. Oktober 1989 - 7. Januar 1990, Göttingen 1989, S. 225–238; Nissen u. a.: Gedenktafeln (2002); Siegfried Schütz, Walter Nissen: Göttinger Gedenktafeln. Ein biographischer Wegweiser, Göttingen 2015. (Auch nach Nissens Tod 1993 wurde die im Kernbestand von ihm erarbeitete Gedenktafelpublikation unter seinem Namen weitergeführt). Vgl. Friedrich Dickmann: Der russische Aufklärer Michail Vasilevič Lomonosov und die Universitätskirche, in: http://universitaetskirche.de/streifzug-durch-die-geschichte; zuletzt abgerufen am 1.3.2016. Vgl. Metz-Becker: Erinnerungskultur (1999), S. 326. Vgl. Adolf von Harnack: Vom Großbetrieb der Wissenschaft, in: Preußische Jahrbücher 119 (1905), S. 193–201. Zur Finanzlage der Universität Jena in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vgl. Stefan Gerber: Die Universität Jena 1850–1918, in: Traditionen – Brüche – Wandlungen. Die Universität Jena 1850–1995, hg. v. der Senatskommission zur Aufarbeitung der Jenaer Universitätsgeschichte im 20. Jahrhundert, Köln, Weimar, Wien 2009, S. 23–253, hier S. 65–102; ders.: Universitätsverwaltung
130
Stefan Gerber
von Selbstverständnis und Selbstdefinition. War die Institution der Universität als ganze, also auch die drei größten deutschen Universitäten des Kaiserreichs in Berlin, München und Leipzig von dieser Identitätskrise berührt, so traf sie doch die Klein- und Mitteluniversitäten mit besonderer Wucht. Die Kollision, die noch in unseren Tagen unübersehbar im Hintergrund von Exzellenzinitiativen und Leuchtturmprofessuren steht, war auch schon ein Problem des ausgehenden 19. Jahrhunderts: Der tradierte Anspruch des deutschen Universitätssystems, an allen seinen Standorten prinzipiell gleichwertige Studienabschlüsse zu bieten und daher zumindest in seinen Grundzügen auch ein ähnliches universitäres und wissenschaftliches Angebot vorzuhalten, traf auf die Tendenz von Finanz- und Investitionsströmen, an verdichtete, numerisch und ökonomisch besonders konzentrierte Standorte, in urbane Zentren zu fließen, wo wirtschaftlicher Dynamik auch soziale Modernität zu entsprechen schien. In der Krise, und vor allem dem geschärften und äußerst sensiblen Krisenbewusstsein der kleineren und mittleren Universitätsstädte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts schwang auch die Einsicht der sich formierenden Soziologie mit, dass in den Großstädten (und damit auch an großen bzw. großstädtischen Universitäten) der Druck urbanen Lebens eine neuartige, zunehmend an Einfluss gewinnende Intellektualität erzeugte – Georg Simmel skizzierte dies 1903 in seinem berühmtgewordenen Essay „Die Großstädte und das Geistesleben.“63 Hinzu trat der Eindruck, dass die Finanzierungskrise die kleinen und mittleren Universitäten wissenschaftlich, und damit auch in der Konkurrenz um die Studentenströme mehr und mehr zurücktreten lasse, ja zukunftslos mache. Max Weber konstatierte in seinem Vortrag „Wissenschaft als Beruf“ 1919, dass „unsere Universitäten, zumal die kleinen, untereinander in einer Frequenzkonkurrenz lächerlichster Art sich befinden. Die Hausagrarier der Universitätsstädte feiern den tausendsten Studenten durch eine Festlichkeit, den zweitausendsten aber am liebsten durch einen Fackelzug.“64 Die Gliedstaaten des Kaiserreichs, die kleinere und mittlere Universitäten unterhielten, auch das Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach und die übrigen sächsischen Herzogtümer, reagierten auf diese Infragestellung mit bedeutenden finanziellen Leistungen, die – auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass kleinere Staaten des Kaiserreichs eine Reihe von Staatsaufgaben nicht zu erfüllen hatten, die größeren Bundesstaaten wie Preußen, Bayern, Sachsen oder Württemberg oblagen – beträchtliche Anteile ihrer Staatsausgaben ausmachten. Gerade für Jena kann sicher zugespitzt formuliert werden, dass der deutsche Kleinstaat hier in der Phase seiner Auflösung neben seinen Dysfunktionalitäten noch einmal seine leistungsfähige, leistungsbereite Seite zeigte – auch wenn eine solide Finanzausstattung oft nur durch Hilfe von außen möglich wurde, wie sie der Universität Jena seit den 1880er Jahren zunehmend durch die Zuwendungen der Carl-Zeiß-Stiftung zukam. Aber die „Schlacht“ musste nicht nur auf dem Feld der Finanzierung, sie musste auch im Bereich der Identitätsstiftung, des Gedächtnisses, der Erinnerungskultur und Wissenschaftsorganisation im 19. Jahrhundert. Der Jenaer Pädagoge und Universitätskurator Moritz Seebeck, Köln, Weimar, Wien 2004, S. 555–595. 63 Vgl. Georg Simmel: Die Großstädte und das Geistesleben, in: ders.: Das Individuum und die Freiheit. Essais, Berlin 1984, S. 192–204 (zuerst 1903). 64 Vgl. Max Weber: Wissenschaft als Beruf, in: ders.: Schriften zur Wissenschaftslehre, hg. und eingeleitet von Michael Sukale, Stuttgart 1991, S. 237–273, hier S. 242.
Landmarken im Erinnerungsraum. Jenaer Gedenktafeln im Vergleich
131
und der Geschichtspolitik geschlagen werden. Die systematisch betriebenen akademischen Gedenktafelprojekte gehören unverkennbar in den Zusammenhang der Krisenbewältigungsstrategien, die kleinere und mittlere Universitäten seit der Mitte des 19. Jahrhunderts auf diesem Gebiet entwickelten. Es ging um die nach außen apologetische und nach innen integrierend-stabilisierende Strukturierung universitärer Eigengeschichte, die auf viele seit der Frühen Neuzeit entwickelte Topoi zurückgreifen konnte, wie sie sich in Jena in den „Archetypen der Erinnerung“, dem Universitätsgründer Kurfürst Johann Friedrich I. von Sachsen und Friedrich Schiller manifestierten:65 Bei aller „Kleinheit“ ein „sicherer Hafen“, ein „Asyl“ der freien Wissenschaft und dadurch, verbunden mit ungeschmälerter korporativer Verfasstheit und der Stabilität akademisch-studentischer Sitte und Tradition, ein Prototyp der „deutschen Universität“ zu sein.66 Deutsche „Klassik“ und Idealismus wurden in dieses Konzept vollständig integriert: Als die Jenaer Universität 1908 ihr 350. Gründungsjubiläum beging, eröffnete der amtierende Prorektor, der Sprachwissenschaftler Berthold Delbrück, seine Jubiläumsansprache mit den Worten: „Unter den vielen Vorzügen, welche man mit Recht, wie wir hoffen, der Universität Jena nachrühmt, ist einer, den uns keine Verschiedenheit der Meinungen rauben kann, die Tatsache nämlich, daß Schiller unser Kollege und Goethe unser Minister gewesen ist“.67 Das war einerseits defensiv, indem es die Verbindung der Salana mit der Klassik als historisches „Proprium“, als einen ererbten Besitz in den Mittelpunkt rückte, der Jena trotz aller Verwerfungen der Gegenwart nicht mehr genommen werden könne und den „Geist“ dieser Universität jenseits ihrer konkreten Leistung und Stellung im deutschen Universitätssystem präge und heraushebe. Zugleich aber ging es in die Offensive, indem es implizit darauf verwies, dass es gerade die „kleine Universität“ und der „kleine Staat“ gewesen waren, wo die um 1900 noch immer als normsetzend akzeptierten „Heroen“ der bürgerlichen Nationalkultur ihren Entfaltungsraum gefunden hatten. Die Schaffung, Erhaltung und Entwicklung einer von Gedenktafeln strukturierten, universitären Gedächtnislandschaft, die besondere Rücksicht auf die Universitätsstadt als Schiller- und Goethe-Ort und als Zentrum des nachkantischen Idealismus nahm, musste hier zentral sein. Hinzu trat eine weitere Strategie kleiner und mittlerer Universitätsstädte des späten 19. Jahrhunderts, „Kleinheit“ zum Vorteil zu machen: ihre Selbst- und Fremdromantisierung; für die Gegenwart sprechen die Volkskundler Karl Braun und Claus-Marco Dieterich kritisch von einer „Folklorisierung“.68 In der touristischen und fremdenverkehrswirtschaftlichen Selbstdarstellung, aber auch in der ganzen Breite populärer Belletristik und Publizistik avancierten die kleinen und mittleren 65 Grundlegend dazu: Joachim Bauer: Universitätsgeschichte und Mythos. Erinnerung, Selbstvergewisserung und Selbstverständnis Jenaer Akademiker 1548–1858, Stuttgart 2012. Zu den „Archetypen“ vgl. dort besonders S. 447–481. 66 Zum Topos der „Liberalität“ im 19. Jahrhundert vgl. auch Gerber: Universitätsverwaltung (2004), S. 403–422. 67 350jähriges Jubiläum der Universität Jena. 31. Juli und 1. August 1908 [Festreden], Jena 1908, S. 8. 68 Karl Braun, Claus-Marco Dieterich: Die Kleinstädte und das Geistesleben. Zur ethnografischen Erkundung der Universitäts-Stadt, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 11 (2008), S. 243–250, hier S. 244f.
132
Stefan Gerber
Universitätsstädte, parallel zu ihrer soziologischen Abwertung, zu Sehnsuchtsorten der Urbanitätsskepsis, die die europäischen Industrialisierungsprozesse überall, keineswegs nur in Deutschland, begleitet hat. Erst in dieser Zeit der Industrialisierung, erst seit den 1840er und 1850er Jahren treten die vorher dominierenden Klagen über das Unkomfortable, Abgeschiedene, Modernisierungsbedürftige der kleinen Universitäten hinter das Bild zurück, dass Ortsnamen wie „Heidelberg“ oder auch „Jena“ z. T. bis in die Gegenwart zu Chiffren der Distanzierung von industriegesellschaftlicher Moderne und großbetrieblicher Wissenschaft gemacht hat – selbst wenn diese Chiffrierung, wie besonders eklatant im Falle Jenas, auf der Ausblendung einer industriell geprägten Teilidentität beruhte, die dem urbanen Raum mehr und mehr ihren Stempel aufdrückte. Auch für diese Romantisierung mussten Gedenktafeln, die auf die Verdichtung akademischen und studentischen Lebens im „Bethlehem unter den Universitäten“ (Johann Gustav Droysen über Jena)69 oder dem „Weltdorf“ (Camilla Jellinek, Ehefrau des Staatsrechtlers Georg Jellinek über Heidelberg)70 hinwiesen, eine herausragende Rolle spielen. In Jena ordnete sich die Gedenktafelinitiative vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen in die erinnerungskulturellen und geschichtspolitischen Strategien des 300. Universitätsjubiläums ein: Auf politischer Ebene hatte sich Jena im Jahrzehnt nach der Revolution von 1848/49 unter Federführung des 1851 installierten Kurators Moritz Seebeck angesichts der preußischen Reaktionspolitik teilweise durchaus erfolgreich als universitär-wissenschaftliches Zentrum des gemäßigten Liberalismus zu profilieren versucht. Nun, da sich mit der „Neuen Ära“ in Preußen die Grenzen dieses Konzepts der Existenzsicherung abzuzeichnen begannen, diente die bei den Jubiläumsfeiern massiv inszenierte Überformung der Jenaer Universitätsgeschichte und der Gründergestalt Johann Friedrichs unter den Schlagworten „Liberalität“ und „Geistesfreiheit“ der Stabilisierung und Kanonisierung des prekär gewordenen Selbstund Fremdbildes. Diese erinnerungskulturelle und geschichtspolitische Herausforderung war auch der Gedenktafel-Kommission bewusst, die sich an der Universität Jena im Vorfeld des Jubiläums bildete und die aus dem Mathematiker und Physiker Hermann Schaeffer, dem Altphilologen und Direktor der Universitätsbibliothek Karl Wilhelm Göttling und dem Theologen Karl Albrecht Vogel von Frommannshausen bestand.71 Federführend war Schaeffer, der, weniger als forschender Wissenschaftler hervortretend, ein Hochschulpädagoge und Wissenschaftsvermittler von großer 69 Brief von Johann Gustav Droysen an Eduard Simson, Jena, v. 10.7.1852, in: Johann Gustav Droysen: Briefwechsel, hg. von Rudolf Hübner, 2. Bd.: 1851–1884, Leipzig, Berlin 1929, S. 117f., hier S. 118. 70 Vgl. Camilla Jellinek: Georg Jellinek. Ein Lebensbild, entworfen von seiner Witwe Camilla Jellinek, in: Georg Jellinek: Ausgewählte Reden und Schriften, 1. Bd., Berlin 1911, S. 5*–140*, hier S. 85*. Vgl. zum Gesamtzusammenhang auch die Beiträge in Hubert Treiber, Karol Sauerland (Hg.): Heidelberg im Schnittpunkt intellektueller Kreise. Zur Topographie der „geistigen Geselligkeit“ eines „Weltdorfes“: 1850–1950, Opladen 1995; insb. Karol Sauerland: Heidelberg als intellektuelles Zentrum, S. 12–30. 71 Zum Hergang des Jenaer Gedenktafelprojektes vgl. [Schaeffer:] Gedenktafeln (1858); Thieme: Gedenktafeln (1934); Haun u. a.: Gedenktafeln (1990), Bauer: Universitätsgeschichte (2012), S. 439–444.
Landmarken im Erinnerungsraum. Jenaer Gedenktafeln im Vergleich
Abb. 15
133
Gedenktafel für Hermann Schaeffer, Markt 10 (1988)
Abb. 16 „Lehren war seine Lust, Volkswohlfahrt seine Wonne“ – Denkmal für Hermann Schaeffer vor den Rosensälen, Fürstengraben 27 (1901)
Wirkung war.72 In engem Kontakt mit Jenaer „Unternehmerprofessoren“ wie Friedrich Gottlob Schulze, an dessen landwirtschaftlicher Lehranstalt er Lehrer für Geodäsie und Mechanik gewesen war oder dem Pädagogen Karl Volkmar Stoy, an dessen privater Knabenschule er unterrichtete, stand Schaeffer für die Tradition sozialreformerisch orientierter, kommunal wirksamer wissenschaftlicher Praxis im Umfeld der Jenaer Universität.73 Er engagierte sich in der gewerblichen Bildung und wirkte an Wilhelm Reins Jenaer „Ferienkursen“ vor allem zur Lehrerweiterbildung mit. Eine Grundlage dieses naturwissenschaftspädagogischen Volksbildungsansatzes war Schaeffers von ihm selbst so bezeichnete „Armenphysik“, der mit einfachen Mitteln bewerkstelligte Bau von physikalischen Apparaten, Versuchsanlagen und Modellen. 72
73
Zu Schaeffer vgl. Fritz Chemnitius: Geschichte der naturwissenschaftlichen und mathematischen Studien an der Universität Jena von ihrer Gründung bis zur Gegenwart, in: Altes und Neues aus der Heimat (Beilage zum Jenaer Volksblatt), Anhang II, Jena 1934, S. 1–35, hier S. 20f.; Otto Capeller: Persönliche Erinnerungen an Hermann Schaeffer. Für seine Freunde niedergeschrieben, Jena 1918; Gerber: Universität (2009), S. 156. Zum Gesamtzusammenhang vgl. Matthias Steinbach: Ökonomisten, Philantrophen, Humanitäre. Professorensozialismus in der akademischen Provinz, Berlin 2008.
134
Stefan Gerber
Dieser praxeologisch-didaktische Zug Schaeffers bestimmte zweifellos auch sein Engagement für das Gedenktafel-Projekt mit, das, wie er schrieb, „ein Stammbuch der edelsten Deutschen in dieser Herberge der freien und ernsten Wissenschaft darstellen“ sollte.74 Den erinnerungsgeschichtlichen Kern der Initiative hat man indes in der Spannung von kommunikativem und kulturellem Gedächtnis zu sehen, wie Jan Assmann es bestimmt hat, in der Spannung also, zwischen dem individuellen, zeitgenössischen und noch alltagsbestimmt-ungeformtem Gedächtnis, das an Zeitzeugen und an wenige Generationen geknüpft ist und dem objektivierten, in Erinnerungskulturen umgeformten und damit an spezifische Überlieferungsmedien und -träger gebundenen Gedächtnis.75 Schaeffer setzte in Jena zunächst insofern beim kommunikativen Gedächtnis an, als er die Authentizität der auratischen Orte, aus denen sich die durch Gedenktafeln strukturierte urbane Gedächtnislandschaft formen sollte, durch individuell-biographische Erinnerungen und durch Artefakte sichern wollte. Die Gedenktafeln sollten nach Möglichkeit an den Wohnhäusern der erinnerten Personen angebracht werden, woraus sich der angestrengte und letztlich unvermeidlich scheiternde Versuch ergab, das „floating gap“ zwischen kommunikativem und kulturellem Gedächtnis zu schließen. Zugleich kann man den gedächtnis- und erinnerungsgeschichtlich aufschlussreichen Bericht Schaeffers über die Prämissen des Jenaer Gedenktafelkomitees von 1858 auch als ein Mosaiksteinchen zu der von Friedrich Nietzsche so harsch kritisierten antiquarisch orientierten Geschichtsversessenheit des 19. Jahrhunderts lesen:76 Es sei, so Schaeffer, im Vorfeld der Gedenktafelanbringung „freilich die Absicht“ gewesen, „die Wohnstätten der Berühmten zu treffen und es wurden zur Auffindung derselben die umfassendsten Nachforschungen gehalten. Die noch vorhandene Tradition, die biographische Litteratur, die Zinsbücher auf hiesigem Rathhause wurden zu Rathe gezogen. Briefliche Erkundigungen wurden von allen Seiten eingezogen. Endlich wurden Hausbücher, Fensterscheiben, Fenstergewände, Tische, Thüren nach Namen untersucht. Wir sind dabei in der zuvorkommendsten Weise von den Bürgern Jena’s unterstützt und es ist uns z. B. sogar eine Wetterfahne zur Entzifferung von allerlei Inschriften hinterlassen worden. Aber die Ausbeute war gering. Die Tradition ist bei dem schnellen Wechsel der Studenten und Docenten und bei dem natürlich noch viel schnelleren Wechsel der Studenten sehr unsicher und lückenhaft. […] Die brieflich Befragten waren meist rathlos oder konnten uns doch oft die Lage der fraglichen Häuser aus der Erinnerung nicht mehr beschreiben.“ Außerdem habe sich beim Absuchen der Jenaer Fenster, Türen und Möbel nach möglicherweise eingekratzten Namenszügen gezeigt, „daß gerade die später berühmt Gewordenen in der Regel sich selbst zu verewigen unterlassen“ hätten.77 Angesichts dieser Eindrücke Schaeffers erscheint selbst Jan Assmanns Veranschlagung des kommunikativen Gedächtnisses auf 80 – 100 Jahre – die sich freilich an stark 74 75 76 77
[Schaeffer:] Gedenktafeln (1858), S. 3. Vgl. dazu grundlegend: Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München 1992; Aleida Assmann: Vier Formen des Gedächtnisses, in: Erwägen, Wissen, Ethik 13 (2002), S. 183–190. Vgl. Friedrich Nietzsche: Unzeitgemäße Betrachtungen. Zweites Stück. Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, in: Friedrich Nietzsche, Werke I, hg. v. Karl Schlechta, Frankfurt a. M., Berlin, Wien 1972, S. 209–285. [Schaeffer:] Gedenktafeln (1858), S. 4f.
Landmarken im Erinnerungsraum. Jenaer Gedenktafeln im Vergleich
135
identitätsbildenden Einschnitten, nicht am Alltag orientiert – als sehr optimistisch, denn bei dem 1858er Versuch, authentische Standorte der Gedenktafeln zu bestimmen, handelte es in Jena oft um Personen der Zeit um 1800, die zu diesem Zeitpunkt ungefähr 60 Jahre zurücklag – das war auch der Zeitraum für die „noch lebendige Erinnerung“, den Schaeffer 1858 annahm.78 Schnell gestand man das Scheitern implizit dadurch ein, dass man schon bei der ersten Anbringung von Gedenktafeln das Prinzip der topographischen Authentizität völlig aufgab, und den vielen Tafeln, für deren Persönlichkeiten kein Ort im topographischen Sinne mehr gefunden werden konnte, einen Platz in der imaginären, aber nicht minder aussagekräftigen Topographie des Erinnerns zuwies: Alle Bürger, die bereit waren, eine oder mehrere Tafeln an ihrem Haus anzubringen, konnten sie erhalten, auch wenn der Bedachte sich am Anbringungsort physisch mit recht großer Wahrscheinlichkeit nicht aufgehalten hatte.79 Dennoch blieb das kommunikative Gedächtnis stets attraktiv für die Betreiber der Gedenktafelprojekte, wenn sie den memorialen, traditionsbildenden Charakter dieser Gedächtnislandschaft nicht hinreichend reflektierten. Der bereits zitierte Bericht des universitären Gedenktafelausschusses der späten 1920er Jahre an den Senat zeigte das in einer wohl unbewusst aporetischen Formulierung: Man sei, so der ehemalige Kurator Vollert, seit 1927 bei der Erneuerung von Gedenktafeln „von dem Gesichtspunkte ausgegangen, daß Schilder nicht erneuert wurden, wenn der Träger des Namens aus dem Gedächtnis der Gegenwart gänzlich entschwunden war.“80 Natürlich aber kann eine erinnerungskulturelle Strukturierung des urbanen Raumes nicht – und das war weder in Jena noch in Göttingen oder Marburg der Fall – an die Inhalte des kommunikativen Gedächtnisses geknüpft oder mit dem durchschnittlichen Kenntnisstand zur Universitätsgeschichte verbunden werden. Sollte dies geschehen, müssten die Tafeln gleichsam mit dem „floating gap“ mitwandern, also beständig entfernt und durch neue ersetzt werden. Anders als Schaeffer, Göttling und Vogel, denen 1858 bei aller Bindung an das kommunikative Gedächtnis doch deutlich war, dass sie an der Jenaer korporativ-universitätsstädtischen Erinnerungskultur arbeiteten, verweist die Bemerkung von 1929 auf ein weniger differenziertes Selbstbild der Akteure: Vollert scheint tatsächlich gemeint zu haben, die Gedenktafeln seien nur „Merkzeichen“, „Gedächtnisstützen“ zur Repetition des Vorhandenen. Das aber trifft nicht zu: In der Hauptsache tragen die Gedenktafeln in Jena, Göttingen oder Marburg keinen Verweischarakter, sondern kreieren eine Gedächtnislandschaft, die beim Betrachter eine erinnerungskulturelle „mental map“ des universitätsstädtischen Raumes erst entstehen lässt – sie sind ein Medium des kulturellen Gedächtnisses. Auch insgesamt war das Jenaer Universitätsjubiläum von 1858 – neben der universitätspolitischen Strategie, die der Jubiläumsinszenierung zugrunde lag – stark vom Verhältnis zwischen kommunikativem und kulturellem Gedächtnis geprägt – die Gedenktafeln waren hier kennzeichnend und die Suche nach authentischen Orten symptomatisch. Denn für das neben Reformation, Klassik und Idealismus letzte zentrale Element der liberal-nationalen Jenaer Selbstdefinition im „langen“ 19. Jahrhundert, die Zeit der, wie man zeitgenössisch sagte, „deutschen Erhebung“, der frühnationalen 78 Ebd., S. 4. 79 Ebd., S. 5. 80 UAJ, BA 1790, Bl. 6r, Bericht von Max Vollert an den Senat v. 20.7.1929.
136
Stefan Gerber
Formierungsphase unter antinapoleonischem Vorzeichen und der Burschenschaftsgründung von 1815 schlug nun, in der Mitte des Jahrhunderts, unübersehbar die Stunde des Austritts aus dem kommunikativen Gedächtnis: Die Erlebnisgeneration von 1815 war 1858 in aller Regel in der Mitte des sechsten Lebensjahrzehnts – nach dem Maßstäben der Mitte des 19. Jahrhunderts also alt. Sieben Jahre später, beim Burschenschaftsjubiläum von 1865, sollte sich noch deutlicher zeigen, dass sich die Reihen der ersten und zweiten Burschenschaftsgeneration lichteten. Die Feierlichkeiten von 1858 (und auch die vorausgegangene, an der Eröffnung der „Hohen Schule“ 1548 orientierte Säkularfeier von 1848 sowie das Jubiläum von 1865) dienten somit unübersehbar dem Versuch, der schwindenden Authentizität eine tradierbare Form zu geben; sie gewissermaßen „5 vor 12“ kontrolliert, strukturiert, gesteuert in Formen des kulturellen Gedächtnisses zu überführen, die es nicht alle neu zu „erfinden“, aber doch den spezifischen Verhältnissen und Bedürfnissen der Jenaer Universität anzupassen galt: Alte und neue Medien, korporative und nationale Symbole, wurden, wie Joachim Bauer gezeigt hat, breit und facettenreich eingesetzt.81 Die Gedenktafeln als weitreichendstes, weil auf Entwicklung angelegtes, Projekt, das Johann-Friedrich-Denkmal auf dem Markt, das Jubelalbum der akademischen Senatsmitglieder, die Rektorkette von 1858 und die vielfältigen literarisch-publizistischen „Festgaben“ ordnen sich in diesen Zusammenhang ein. Fasst man die hier zusammengetragenen knappen Beobachtungen zu akademischen Gedenktafeln als „Landmarken im Erinnerungsraum“ kurz zusammen, zeigen sie sich als spezifisches Gedächtnismedium kleiner und mittlerer deutscher Universitätsstädte des 19. Jahrhunderts – auch wenn sich in größeren Universitätsstädten natürlich ebenfalls Gedenktafeln finden. Die Konsequenz aber, mit der der begrenzte urbane Raum kleinerer Universitätsstädte wie Jena, Göttingen oder Marburg durch eine Vielzahl von Gedenktafeln zum universitären Erinnerungsraum strukturiert und als solcher erlebbar, begehbar gemacht wurde, verweist auf die bedeutsame Funktion der Tafeln im Spannungsverhältnis von kommunikativem und kulturellem Gedächtnis, sowie für die ideelle Krisenbewältigung und erinnerungskulturelle Behauptung akademischer Relevanz in der jeweiligen Gegenwart. Diese Funktion – mit dieser These soll die vorliegende Skizze schließen – erfüllen die Gedenktafeln, auch wenn sie es unter den Bedingungen aktueller Medienvielfalt ungleich schwerer haben als im 19. Jahrhundert, im Grunde auch jetzt noch. Für kleinere und mittlere Universitätsstandorte ist die Strukturierung und Präsentation der Eigengeschichte, die sich in der Spannung zwischen dem Zusammentragen symbolischen Kapitals und „universitärer Folklore“ vollzieht, nicht nur prominentes Element akademischer Selbstdefinition: Sie ist vor allem auch wesentlicher Bestandteil einer (in ihrer Reichweite und ihren Erfolgsaussichten mehr als zweifelhaften) Vermarktungsstrategie, die dem Studienanfänger und dem noch heißer begehrten Masterstudenten plausibel machen will, warum es attraktiver sein kann, in Jena, Göttingen oder Marburg zu studieren, als in Berlin, München oder Köln.82 An dieser Gedächtnislandschaft wird – ungeachtet der Schwierigkeiten ihrer Erhaltung und Entwicklung in Jena – weitergearbeitet. 81 Vgl. Bauer: Universitätsgeschichte (2012), S. 395–445. 82 Kritisch zu solchen Strategien jüngst: Stefan Gerber: Wie schreibt man zeitgemäße Universitätsgeschichte? in: NTM. Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin 22 (2014), S. 277–286.
ER I N N ERU NG, SPR ACH E U N D PERSON
„ N U T Z LOSE SY M BOLP OLI T I K“? U N I V ERSI TÄ R E NA M E N, NA M E NSV ERGA BE N U N D NA M E NSDEBAT T E N I N DEU TSCH LA N D Eine typologische Übersicht mit Fallbeispielen Jürgen John Fallbeispiele: Goethe-Universität Frankfurt Thüringische Landesuniversität Jena Universität Halle-Wittenberg Hansische Universität Hamburg Arndt-, Luther- und Schiller-Universitäten Greifswald, Halle, Jena Liebig-Universität Gießen Von der Königsberger Albertus- zur Kaliningrader Kant-Universität Humboldt-Universität zu Berlin Marx-Universität Leipzig
S. 154 S. 155 S. 155 S. 158 S. 159 S. 167 S. 169 S. 169 S. 171
Pieck-Universität Rostock Gutenberg-Universität Mainz Universität des Saarlandes Freie Universität Berlin Otto-Friedrich-Universität Bamberg Heine-Universität Düsseldorf Ossietzky-Universität Oldenburg Lessing- oder Leibniz-Universität Hannover Wilhelms-Universität Münster Arndt-Universität Greifswald
S. 172 S. 181 S. 181 S. 182 S. 183 S. 185 S. 186 S. 188 S. 189 S. 192
GRU N DF R AGE N Der Beitrag verweist auf ein Gebiet ambivalenter universitärer Erinnerungskultur, das am deutschen Beispiel noch nicht systematisch untersucht und dargestellt worden ist.1 Universitätsnamen sind weder bloße Etikette noch Zufallsprodukte. Sie werden bewusst gewählt, verliehen, abgelegt, gewechselt – oder gemieden. Universitätsnamen sind symbolischer Ausdruck universitärer Identitäts- und Traditionssuche im gesellschaftlichen Raum. Meist kommen sie aus den Universitäten selber. Nur selten werden sie ihnen von außen aufgenötigt. Namensvergaben erfolgen in der Regel auf universitäre Initiativen durch staatliche – früher dynastische – Hoheitsakte. Völlig politikfern oder politikfrei sind sie nie gewesen. Die Geschichte deutscher Universitätsnamen hängt von jeher eng mit dem Verhältnis von „Hochschule und Staat“ zusammen. Im Kern war sie keine Geschichte universitären Eigensinns oder des Widerstandes gegen Staatsgewalt, sondern der Interaktion beider Seiten. Das entspricht auch dem überwiegenden Selbstverständnis deutscher Universitäten. Mit wenigen Ausnahmen trug es eher staatsnahe als staatsferne Züge. Nur in der Weimarer Zeit richteten universitäre Eliten die „Idee der Universität“ dezidiert gegen den seit 1918/19 republikanisch-demokratischen Staat. Namensvergaben sind im Regelfall eine Angelegenheit des universitären Establishments, der Professorenschaft und akademischer Gremien in Interaktion mit zuständigen politischen Bürokratien. Die nur zeitweilig an den Universitäten Studierenden 1
Als Vorüberlegungen vgl. die entsprechenden Abschnitte der in den Anm. 63 u. 65 genannten Studien des Vf. über die Universitätsnamen von Jena und Halle.
140
Jürgen John
waren bei Namensvergaben lange Zeit eher Festkulisse denn eigenständige Akteure. Sie sind erst seit den 1960er Jahren stärker selbst aktiv geworden. Zunächst vor allem im „1968er“-Kontext, als sich die studentische Protestbewegung gegen die Rituale der „Ordinarien-Universitäten“ wandte und an einigen Universitäten (Frankfurt am Main, Gießen) alternative Namen proklamierte. Später im studentischen Einsatz für neue Universitätsnamen – oder deren Abwehr. Doch haben sich bis heute nur Minderheiten der Studierenden so oder so in der Namensfrage engagiert. In der Zeit deutscher Zweistaatlichkeit konnten sich studentischer Eigensinn und studentische Selbständigkeit ohnehin nur auf westdeutscher Seite öffentlich artikulieren. Auf ostdeutscher Seite traten Studierende nur einmal bei der Vergabe eines Universitätsnamens („KarlMarx-Universität“ Leipzig) in Aktion – aber nicht aus eigenem Antrieb, sondern nur vorgeschoben im Auftrag außeruniversitärer politischer Instanzen. In der Weimarer Zeit interessierte sich die gegen das „System von Weimar“ politisierte Studentenschaft kaum für die Namensfrage. Das gilt auch für den radikal „völkischen“ studentischen Aktionismus zu Beginn des NS-Regimes. Namensvergaben tragen kollektiv-emphatischen Charakter. Die Wahl und die Vergabe von Namen sind herausragende, gleichsam konstitutive Akte. Man gibt sich zwar keine Verfassung, wählt aber einen Namen, der für etwas steht, was der universitären Gemeinschaft wichtig ist oder von dem man annimmt, dass er dafür stehe. Namen sagen nichts über das Profil und die Leistungskraft von Universitäten aus, aber viel über das an ihnen geläufige Traditions- und Identitätsdenken. Man bekennt sich aus Traditionsgründen zum gewählten Namen oder um auf diese Weise seiner Zugehörigkeit zur korporativen Gemeinschaft der Universität Ausdruck zu verleihen. Die Namensträger – korporative Instanzen wie Universitätsangehörige – sehen sich vom Universitätsnamen repräsentiert. Sie machen sich ein „Bild“ von ihm und von dem, wofür er symbolisch steht, projizieren eigene Ansichten und Absichten auf den Namen. Keineswegs sind Universitätsangehörige zu solchem Namensbekenntnis verpflichtet. Sie können sich ihm entziehen, können sich gleichgültig verhalten oder das, was der gewählte Name symbolisiert bzw. symbolisieren soll, ablehnen. Aber auch im Negativen gewinnt die Namensfrage oft kollektiv-emphatische Züge. Vor allem dann, wenn Universitätsnamen grundsätzlich in Frage gestellt oder alternative Namen und damit andere „Bekenntnisse“ ins Spiel gebracht werden. Das Spektrum „bekennender“ Universitätsnamen reicht weit. Es schließt ehrende und programmatisch-verpflichtende Namen ebenso ein wie bloße Staats-, Träger-, Funktions-, Orts- und Landschaftsbezüge. Mit personenbezogenen Namen erhalten Universitäten Namenspatrone. Bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein handelte es sich durchweg um Namenspatrone aus dem Kreis fürstlicher bzw. königlicher „Gründer“, „Stifter“ oder „Erhalter“. Seit der Prager Universitätsgründung 1348 war es im vielstaatlichen „Heiligen Römischen Reich deutscher Nation“ mit seinen zahlreichen Dynastien üblich, Universitäten nach ihren landesherrlichen Gründern oder Erhaltern zu benennen. Damit bekannten sich die Universitäten im obrigkeitsstaatlichen Sinne zu den jeweiligen Landesherren und Dynastien als Garanten höherer Bildung. Davon hoben sich nur einige landesherrliche Universitäten ohne Namenspatron (Rostock, Greifswald, Leipzig, Jena) und die städtischen Universitäten (Köln, Erfurt) ab. Doppelnamen mit zwei Namenspatronen wie „Ruprecht-Karls-Universität“ (Heidelberg),
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
141
„Eberhard-Karls-Universität“ (Tübingen), „Ludwig-Maximilians-Universität“ (München) „Friedrich-Alexander-Universität“ (Erlangen), „Julius-Maximilians-Universität“ (Würzburg) oder „Otto-Friedrich-Universität“ (Bamberg) verweisen auf Stifter und spätere Erhalter bzw. Umgründer. Bürgerliche Namenspatrone – zunächst nur Repräsentanten der deutschen Kulturnation, später auch bekannte Wissenschaftler – wurden erst seit den 1930er Jahren für die universitäre Namenskultur Deutschlands „salonfähig“. Bis dahin war sie ausschließlich monarchisch ausgerichtet. In der Regel sind die Namenspatrone beiden Typs unstrittig. Mit wenigen Ausnahmen tragen die betreffenden Universitäten diese Namen noch heute. An die monarchischen Namen hat man sich gewöhnt, ohne weiter über sie nachzudenken. Sie stehen für die jeweiligen Gründungstraditionen und sind zum Symbol universitären Entwicklungserfolgs geworden. Diese Namen haben sich längst von den Obrigkeitsstaaten und von den Personen gelöst, die sie einst würdigen und ehren sollten. Der breiten Öffentlichkeit erschließt sich ihr Erinnerungs- und Symbolgehalt kaum noch. Auf die allgemein bekannten Namen des bürgerlich-nationalkulturellen Typs sind die Trägeruniversitäten normalerweise selbst dann stolz, wenn sie in problematischen Zusammenhängen vergeben wurden oder erst in heftigen Namensdebatten erstritten werden mussten. Bis heute haben Universitäten keine weiblichen, sondern nur männliche Namenspatrone. Das ist bezeichnend. Denn es spiegelt die Probleme einer maskulin ausgerichteten universitären Selbstbild- und Erinnerungskultur wider. Die meisten Namenspatrone wurden nicht der jeweiligen Gegenwart, sondern der universitären Vergangenheit entnommen. Von den monarchischen Gründer- und Stifternamen abgesehen, sind ausgesprochen „politische Namen“ oder Politiker als Namenspatrone bis heute selten und kaum dauerhaft geblieben. Universitätsnamen wirken umso „zeitloser“ und widerspruchsfreier, je länger sie getragen werden. Sie sind wie selbstverständlich „im Gebrauch“, ohne viel Nachdenken auszulösen. Kritische Nachfragen werden gern mit dem Argument abgewiesen, man wolle am althergebrachten Namen festhalten; er habe sich nun einmal eingebürgert. Der zunehmende Gebrauch von Kürzeln wie „WWU“ (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), „LMU“ (Ludwig-Maximilians-Universität München), „MLU“ (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) oder „FSU“ (Friedrich-SchillerUniversität Jena) deutet auf diesen Trend ebenso hin wie die offiziell als Markenzeichen gewählten Kurzformen „Leibniz“- (Hannover) oder „Goethe-Universität“ (Frankfurt am Main) anstelle jeweils umständlicherer Varianten mit allen Vornamen. Beides – der Gebrauch von Kürzeln wie die Suche nach griffigen Markenzeichen – sind freilich auch Ausdruck allgemeiner Trends in der Verwaltungssprache und des Bemühens der Universitäten, sich in einer globalisierten Marktwelt neu zu verorten. Das zeigt auch der Gebrauch von Kürzeln ohne identitätspolitischen Traditionshintergrund wie „UL“ (Universität Leipzig). Namen und Namensvergaben gehören zu der in diesem Band erörterten Kategorie „ambivalenter universitärer Erinnerungsorte“.2 Sie stellen keine Erinnerungsstätten 2
Vgl. das einleitende Exposé und die dort angegebene Literatur; bei Literaturhinweisen wird in diesem Beitrag aus Platzgründen weitgehend auf die Angabe von Reihentiteln verzichtet – außer wenn sie zum Verständnis unverzichtbar sind.
142
Jürgen John
und Gedächtnisorte im topographischen Sinne dar;3 wohl aber erinnerungskulturelle Chiffren auf der geistigen Landkarte einer im deutschen Falle mit dem „Mythos Humboldt“ und der neuidealistischen „Idee der Universität“ verbundenen, überwiegend föderal geprägten Universitätslandschaft.4 Ihre Ambivalenzen zeigen sich in unterschiedlichem Grade. Sie können im Namen selbst liegen. Vor allem dann, wenn der gewählte Namenspatron fragwürdig und umstritten ist. Das ist bei bekannten Namen aus dem Kanon der Kulturnation selten der Fall. Der Streit um den Greifswalder Namen „Ernst-Moritz-Arndt-Universität“ stellt da einen Ausnahme- und Grenzfall dar. Anders sieht es bei Namen aus, die für eine alternative Erinnerungskultur jenseits des geläufigen Kanons stehen. Denn die mussten – wie die Namen „Heinrich-HeineUniversität“ (Düsseldorf) und „Carl von Ossietzky-Universität“ (Oldenburg) – erst gegen verbreitete Widerstände erstritten und durchgesetzt werden. Die Ambivalenz monarchischer Namenspatrone liegt eher im Anachronismus von Namen, die in modernen demokratischen Gesellschaften wie „aus der Zeit gefallen“ wirken. Die Persönlichkeit und die historische Rolle ihrer „Namensspender“ spielen dabei meist keine Rolle mehr. Oder nur dann, wenn sie – wie im Falle des auf den letzten deutschen Kaiser Wilhelm II. bezogenen Namens „Wilhelms-Universität“ (Münster) – besonders umstritten sind. Bei Namensvergaben, kontroversen Namensdebatten oder Umbenennungen treten die Ambivalenzen besonders deutlich zutage. Die institutionellen und diskursiven Abläufe solcher Vorgänge bieten fruchtbare Untersuchungsfelder für die kritischhistorische Analyse. Sie ist hier dicht an jenen Bereichen „unbequemer“ und „sperriger“ universitärer Vergangenheit,5 die oft verstörend wirken und einer wohlfeilen universitären Traditions- und Imagepflege im Wege stehen. Auf den ersten Blick wirkt die universitäre Namensgeschichte eher harmlos und randständig. Sie scheint fern der Kernbereiche universitärer Problemgeschichte zu liegen. Bei genauerem Hinsehen stellt sich das aber anders dar. Dann wird bei dem hier behandelten Thema rasch deutlich, dass der kritische Umgang mit der eigenen Geschichte viel stärker auf sicheres Wissen angewiesen ist als die affirmative Pflege der „großen, erhebenden und 3 4
5
Vgl. die Beiträge von Joachim Bauer und Rainer Nicolaysen in diesem Band sowie ders.: (Hg.): Das Hauptgebäude der Universität Hamburg als Gedächtnisort. Mit sieben Porträts in der NSZeit vertriebener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Hamburg 2011. Vgl. den Beitrag von Heinz-Elmar Tenorth in diesem Band sowie Rüdiger vom Bruch: „Universität“ – ein „deutscher Erinnerungsort“?, in: Jürgen John/Justus H. Ulbricht (Hg.): Jena. Ein nationaler Erinnerungsort?, Köln, Weimar, Wien 2007, S. 93–99; Mitchell G. Ash (Hg.): Mythos Humboldt. Vergangenheit und Zukunft der deutschen Universitäten, Wien, Köln, Weimar 1999; Sylvia Paletschek: Die Erfindung der Humboldt-Universität. Die Konstruktion der deutschen Universitätsidee in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in: Historische Anthropologie 10 (2002), S. 183–205; Ulrich Sieg: Humboldts Erbe, in: Ders., Dietrich Korsch (Hg.): Die Idee der Universität heute, München 2005, S. 9–24 sowie zum Bildungsföderalismus Jürgen John: „Bildungseinheit“ und „Bildungsföderalismus – Von Weimar bis Berlin, in: Peter Fauser u. a. (Hg.): Pädagogische Reform. Anspruch – Geschichte – Aktualität, Seelze 2013, S. 112–148. Klaus Ahlheim, Bardo Heger: Die unbequeme Vergangenheit. NS-Vergangenheit, Holocaust und die Schwierigkeiten des Erinnerns, Schwalbau/Ts. 2002; Jürgen John: „Regionales Gedächtnis“ und „negatives Erinnern“ oder: Wie geht man mit „sperrigen Vergangenheiten“ um?, in: Ulrike Kaiser, Justus H. Ulbricht: Sperrige Vergangenheiten. Aspekte regionaler Erinnerungskultur im 20. Jahrhundert, Leuchtenburg bei Kahla 2009, S. 11–44.
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
143
kraftspendenden“ Universitätstraditionen.6 Die zeigt meist große Bereitschaft, sich phantasiereich und oft faktenfern bequeme Geschichtstraditionen zurecht zu deuten, aber wenig Neigung, sich auch dem unangenehmen „negativen Gedächtnis“7 zu öffnen. Umso entschiedener reklamiert sie für sich, „Ausdruck geschichtsbewußten Denkens“ in einer Zeit angeblicher „Geschichtslosigkeit des Denkens“ zu sein.8 Oft werden die Ambivalenzen universitärer Namensgeschichte durch die scheinbare oder tatsächliche Kollektivität entsprechender Vorgänge – vom kollektiven Begehren von Namen bis zur kollektiv inszenierten Namensvergabe – überdeckt. Doch gehört es zu den Tücken vermeintlich „kollektiver Identität“,9 dass diese Zuschreibung nicht nur andere aus der jeweiligen Zuschreibungs- und Deutungsgemeinschaft ausgrenzt, sondern auch innere Widersprüche nur überdeckt oder kaschiert. Korporative Gemeinschaft bedeutet keineswegs unbedingte Homogenität der Ansichten und Deutungen. Auch in der Namensfrage haben sich der Streit und die „Wertekollisionen“ der Fakultäten und Wissenschaftskulturen10 stets mit dem Kampf um die Deutungshoheit überschnitten. Im typologisierenden Überblick lassen sich die Ambivalenzen universitärer Namensgeschichte freilich nur andeuten und erahnen. Umso wichtiger sind Fallstudien und Tiefenanalysen. Sie können auf ähnliche Ansätze aus den Bereichen außeruniversitärer Erinnerungskultur zurückgreifen. Seit geraumer Zeit häufen sich lokale Debatten um ambivalente und „belastete“ Institutions-, Straßen- und Platznamen, die Grundfragen ehrenden Gedenkens und kritischen Erinnerns wie institutioneller oder kommunaler Geschichts- und Identitätspolitik aufwarfen.11 Ihre Analysen bieten 6 7 8 9 10
11
So der Historiker Friedrich Schneider in einem Schreiben zur Universitätsgeschichte v. 28.1.1952 an den Jenaer Rektor (Universitätsarchiv Jena, Best. BB, Nr. 73, n. f.). Reinhart Koselleck: Formen und Traditionen des negativen Gedächtnisses, in: Volkhard Knigge, Norbert Frei (Hg.): Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord, München 2002, S. 21–32. So der Präsident der Universität Bamberg Siegfried Oppolzer in seinem Vortrag zur Begründung der auf den Namen der 1803 aufgelösten Universität zurückgreifenden Namensgebung „OttoFriedrich-Universität“ 1988 (vgl. Anm. 209). Lutz Niethammer: Kollektive Identität. Heimliche Quellen einer unheimlichen Konjunktur, Reinbek bei Hamburg 2000. Gangolf Hübinger: Wertkollisionen im frühen 20. Jahrhundert. Die Kompetenz der Geisteswissenschaften zur Deutung sozialer Wirklichkeit, in: Rüdiger vom Bruch, Brigitte Kaderas (Hg.): Wissenschaftskulturen und Wissenschaftspolitik. Bestandsaufnahmen zu Formationen, Brüchen und Kontinuitäten im Deutschland des 20. Jahrhunderts, Stuttgart 2002, S. 75–83. Als paradigmatisch kann die – bis zum Bürgerentscheid reichende und mit der Umbenennung endende – Debatte um den „Hindenburgplatz“ in Münster 2011/12 gelten – vgl. Thomas Großbölting (Hg.): Hindenburg- oder Schlossplatz? Was die Debatte über Münster verrät, Münster 2015 (vgl. auch Anm. 229); vgl. als weitere Beispiele den auf den Raum Westfalen-Lippe bezogenen Sammelband von Matthias Frese (Hg.): Fragwürdige Ehrungen!? Straßennamen als Instrument von Geschichtspolitik und Erinnerungskultur, Münster 2012 mit einem Beitrag von Hans-Ulrich Thamer zum „Fall Hindenburg“ (S. 251–264) und Ursula Föllner, Saskia Luther, Jörn Weinert (Hg.): Straßennamen und Zeitgeist. Kontinuität und Wandel am Beispiel Magdeburgs, Halle 2011 mit einem Beitrag von Dietz Bering „Straßennamen und kulturelles Gedächtnis“ (S. 12–34); aufschlussreiche Beispiele bieten auch die Debatten um das Verhalten wissenschaftlicher und kultureller Eliten während der NS-Zeit in der „geistigen Doppelstadt Jena-Weimar“ – in Jena 2009/11(um den international renommierten Reformpädagogen Peter Petersen), in Weimar seit 2013/14 (um den Direktor des Goethe-Nationalmuseums Hans Wahl), die in beiden Fällen mit
144
Jürgen John
Lehrstücke für das hier erörterte Thema. So beklemmend oder skurril manche solcher Debatten im „Straßenkampf“12 der letzten Jahre auch anmuten mögen. Sie verweisen doch alle auf tiefer liegende Interessen, Konflikte, Defizite und Probleme. Das Gleiche gilt für universitäre Namensdebatten und das ganze Untersuchungsfeld universitärer Namensgeschichte. Hier zeigt sich zudem ein breites Spektrum ambivalenter Haltungen zur Namensfrage. Das reicht von der affirmativen „Traditionspflege als Ausdruck geschichtsbewußten Denkens“13 über die Ansicht, man müsse mit der Namensvergabe namhaften Persönlichkeiten – und sei es nur aus „Gründen der Staatsraison“ – ein „lebendiges Denkmal“ setzen,14 bis zu der abwehrenden Position, der Streit um den Universitätsnamen sei „nutzlose Symbolpolitik“.15 Universitätsnamen und Namensvergaben haben eine mehrfache erinnerungskulturelle Relevanz. Sie tradieren Überliefertes. Sie sind selber erinnerungspolitische Akte. Sie gehen in die gesamte universitäre Erinnerungskultur ein. Und sie sind Untersuchungsfelder erinnerungskultureller Analysen. Namensvergaben finden in der Regel im öffentlichen Raum mit entsprechend inszenatorischem Aufwand statt. Wie Gründungsjubiläen, Denkmäler, Gedenktafeln, Ehrenpromotionen, Ehrenbürgerschaften, Festschriften, akademische Reden und Feiern sind sie erinnerungs- und identitätspolitisch aufschlussreiche Akte öffentlich inszenierter universitärer Traditionspflege, Selbstvergewisserung und Selbstdarstellung. In den letzten Jahren haben entsprechende Forschungen stark zugenommen. 16 Hingegen ist die Namensgeschichte
12 13 14 15 16
Umbenennungen endeten u. neue wissenschaftliche Publikationen veranlassten – vgl. Peter Fauser, Jürgen John, Rüdiger Stutz (Hg.): Peter Petersen und die Jenaplan-Pädagogik. Historische und aktuelle Perspektiven, Stuttgart 2012; Franziska Bomski, Rüdiger Haufe, W. Daniel Wilson (Hg.): Hans Wahl im Kontext. Weimarer Kultureliten im Nationalsozialismus (=Publications of the English Goethe Society, LXXXIV/3 2015). So der bilanzierend-kritische Essay von Benedikt Erenz: Straßenkampf, in: Die Zeit, Nr. 38, 17.9.2015, S. 19. So der Präsident der Universität Bamberg 1988 (vgl. Anm. 8 u. 209). So der Rektor der Universität Rostock in der Senatssitzung v. 8.2.1961 zur Namensfrage „Wilhelm-Pieck-Universität (vgl. Anm. 138). So der Antrag der RCDS-Fraktion in der Sitzung des Studierenden-Parlaments der WilhelmsUniversität Münster am 18.5.2015 gegen die von der Juso-Gruppe geforderte Umbenennung (vgl. Anm. 231). Zu den – dem hier behandelten Thema besonders nahe stehenden – Universitätsjubiläen vgl. Winfried Müller: Erinnern an die Gründung. Universitätsjubiläen, Universitätsgeschichte und die Entstehung der Jubiläumskultur in der frühen Neuzeit, in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 21 (1998), S. 79–102; ders. (Hg.): Das historische Jubiläum. Genese, Ordnungsleistung und Inszenierungsgeschichte eines institutionellen Mechanismus, Münster 2004; ders.: Inszenierte Erinnerung an welche Traditionen? Universitätsjubiläen im 19. Jahrhundert, in: Rüdiger vom Bruch (Hg.): Die Berliner Universität im Kontext der deutschen Universitätslandschaft nach 1800, um 1860 und um 1910, München 2010, S. 73–92; Paul Münch (Hg.): Jubiläum, Jubiläum… Zur Geschichte öffentlicher und privater Erinnerung, Essen 2005; Thomas P. Becker: Jubiläen als Orte universitärer Selbstdarstellung. Entwicklungslinien des Universitätsjubiläums von der Reformationszeit bis zur Weimarer Republik, in: Rainer Christoph Schwinges (Hg.): Universität im öffentlichen Raum, Basel 2008, S. 77–107; Markus Drüding: Akademische Jubelfeiern. Eine geschichtskulturelle Analyse der Universitätsjubiläen in Göttingen, Leipzig, Münster und Rostock (1919–1969), Berlin 2014; Katharina Kniefacz, Herbert Prosch: Selbstdarstellung und Geschichte. Traditionen, Memorial- und Jubiläumskultur der Universität Wien, in: Katharina
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
145
deutscher Universitäten kaum untersucht worden. Fallstudien sind selten. Überblicksdarstellungen geben meist nur knappe Informationen. Selbst Darstellungen, deren Titel sich ausdrücklich auf Universitätsnamen beziehen – wie im Falle der drei preußischen „Friedrich-Wilhelms-Universitäten“17 – bringen es fertig, die Namensvergaben auszublenden. Alles in allem öffnet die Frage nach der Geschichte universitärer Namen, Namensvergaben und Namensdebatten ein weites Untersuchungsfeld mit bislang kaum erschlossenen neuen Zugängen zur Universitätsgeschichte. Universitäre Namensvergaben und -debatten sagen mehr über ihre Akteure aus als über die gewählten oder abgelehnten Namen. Sie geben Auskunft über die an solchen Namensvergaben und -debatten beteiligten Wissens- und Deutungseliten,18 über ihre Selbst- und Geschichtsbilder, Denk- und Deutungsmuster, über ihre Interessen, Motive, Ziele und Absichten. Und sie offenbaren den jeweiligen „Geist der Universität“, den die Protagonisten universitärer Namensvergaben gern für den „Geist ihrer Zeit“ als angeblich allgemeinen „Zeitgeist“ hielten.19 Insofern sind die entsprechenden Diskursabläufe meist über den engeren lokalen Rahmen hinaus erinnerungskulturell, geschichts- und identitätspolitisch von Interesse. Das gilt für bekennende Namensvergaben wie für ihre Gegenstücke: kontroverse Namensdebatten, Namenskonflikte und jene Fälle gleichsam des „Bilder“- oder „Denkmalsturzes“,20 in denen Universitäten – sei es aus freien Stücken, sei es unter politischem oder öffentlichem Druck – Namen ablegen oder wechseln. Bei demonstrativen Ab- oder Umbenennungen ist das offenkundig. Es zeigt sich aber auch, wenn versucht wird, einen als peinlich empfundenen Namensverzicht oder -wechsel möglichst beiläufig und ohne große Öffentlichkeit über die Bühne zu bringen. Umbenennungsdebatten sind selbst dann höchst aufschlussreich, wenn sie – wie in Münster („Wilhelms-Universität“) und Greifswald („Arndt-Universität“) – bislang ergebnislos blieben; oder – anders gesehen – wenn Umbenennungen abgewehrt werden konnten.
17 18 19
20
Kniefacz u. a.: Universität – Forschung – Lehre. Themen und Perspektiven im langen 20. Jahrhundert, Göttingen 2015, S. 381–409; für die Universität Jena vgl. die entsprechenden Beiträge in: John, Ulbricht: Jena (2007). Thomas Becker, Uwe Schaper (Hg.): Die Gründung der drei Friedrich-Wilhelms-Universitäten. Universitäre Bildungsreform in Preußen, Berlin/Boston 2013; vgl. auch Anm. 49. Ulrich Prehn: Deutungseliten – Wissenseliten. Zur historischen Analyse intellektueller Prozesse, in: Karl Christian Führer u. a. (Hg.): Eliten im Wandel. Gesellschaftliche Führungsschichten im 19. und 20. Jahrhundert, Essen 2004, S. 42–69. Als charakteristische Beispiele vgl. Max Wundt: Vom Geist unserer Zeit, München 1920; ders.: Der Sinn der Universität im deutschen Idealismus, Stuttgart 1933; Der Geist der Ernst Moritz Arndt-Universität, Greifswald (1933); der Herausgeber dieses Greifswalder Sammelbandes Hermann Schwarz wirkte eng mit Wundt zusammen; vgl. zu diesen Mitbegründern und radikal„völkischen“ Vordenkern der Deutschen Philosophischen Gesellschaft auch Christian Tilitzki: Die deutsche Universitätsphilosophie in der Weimarer Republik und im Dritten Reich, Teil 1, Berlin 2002 sowie Hans-Christoph Rauh: Ein „braun-gläubiges Schaf“ namens Hermann Schwarz. Zum „politisch-philosophischen Hintergrund“ der Namensgebung „Ernst-MoritzArndt-Universität“, in: Ernst Moritz Arndt im Widerstreit der Meinungen. Materialien zu neueren Diskussionen (=Hefte der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft 7, 2000), S. 84–88. Winfried Speitkamp (Hg.): Denkmalsturz. Zur Konfliktgeschichte politischer Symbolik, Göttingen 1997.
146
Jürgen John
Neben wieder „namenlos“ gewordenen Universitäten gibt es diejenigen, die überhaupt auf die Wahl eines Namenspatrons oder eines anderen bekennenden Namens verzichten und es bei der Bezeichnung „Universität“ belassen. Das waren früher nur wenige. Jetzt sind die meisten der seit den 1960er Jahren gegründeten und fast die Hälfte heutiger bundesdeutscher Universitäten „namenlos“. Sie so zu bezeichnen, ist freilich problematisch. Denn Angaben wie „Universität Hamburg“, „Universität Erfurt“ oder „Universität zu Köln“ sind natürlich offizielle Institutionsnamen. Für das hier behandelte Thema ist es dennoch sinnvoll, zwischen ausdrücklichen „Namensträgern“ und „namenlosen“ Universitäten ohne Namenspatron oder einen anderen bekennenden Namen zu unterscheiden. Grenzfälle stellen standortbezogene latinisierende Bezeichnungen dar. Als bloße Umschreibungen wie „Alma Mater Lipsiensis“ „Universitas Rostochiensis“ oder „Salana“ (Jena) können sie nicht zu den hier untersuchten regulären Universitätsnamen gerechnet werden.21 Solche Bezeichnungen werden in der folgenden Übersicht nur dann berücksichtigt, wenn sie – wie „Leuphana-Universität“ (Lüneburg) – den offiziellen Universitätsnamen oder – wie bei der „Europa-Universität Viadrina“ (Frankfurt/Oder) – einen seiner Bestandteile darstellen. Die starke Zunahme gewollt oder ungewollt „namenloser“ Universitäten seit 1945 ist erklärungsbedürftig. Sie wirft die Frage auf, warum so viele Universitäten Namenspatrone oder andere bekennende Namen meiden. Fürchten sie einen Namensstreit und wollen sich gar nicht erst auf solches Glatteis begeben? Lässt das Ende früherer Gewissheiten es geraten erscheinen, lieber die Finger von solchen Namen zu lassen? Haben Namenspatrone ihre einstige symbolische Bedeutung eingebüßt? Hat der Status „Universität“ schon für sich ein solches symbolisches Gewicht bekommen, dass man ohne Namenspatrone oder andere bekennende Namen auskommt? Deutet das zunehmend fehlende Bedürfnis, sich wie früher mit dem Namen einer Persönlichkeit oder einem sach- bzw. standortbezogenen Namen zu „schmücken“, auf entsprechende Identitätsverluste hin? Oder sind heute Bezeichnungen wie „Elite“- und „ExzellenzUniversität“ wichtiger geworden als bekennende Namen welcher Art auch immer? Unabhängig davon, wie man solche Fragen beantwortet und welche von ihnen wirklich zielführend ist, bleibt zunächst einmal als Befund festzuhalten: Die „Namenlosigkeit“ gehört ebenfalls zur universitären Namensgeschichte. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen plädiert der Beitrag für systematischvergleichende, typologisierende und zugleich auf Tiefenforschungen beruhende Untersuchungen universitärer Namensgeschichte. Auf diese Weise können sich aufschlussreiche neue Zugänge zur Universitätsgeschichte und zur Geschichte universitärer Erinnerungskultur ergeben. Dafür braucht man Gesamtübersichten wie Fallanalysen. Letztere erschließen spezifische Konstellationen, die Anatomie und Abläufe kontroverser Debatten sowie tiefer liegende Motive, Absichten, Interessenlagen und Denkweisen. Gesamtüberblicke erfassen Entwicklungstrends und Kontexte. Sie ermöglichen den Vergleich und die Namenstypologie. Erst auf ihrer Grundlage ist eine Trendgeschichte universitärer Namen und Namensvergaben möglich. Dazu wird im Folgenden ein typologischer, mit Tabellen und charakteristischen Beispielen 21
Deshalb sind die 1953 (Leipzig) und 1976 (Rostock) verliehenen Namen als „Namensvergaben“ und nicht – wie gelegentlich in der Literatur – als „Umbenennungen“ zu bewerten.
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
147
verbundener Überblick versucht,22 der genauere Detail-Untersuchungen anregen könnte. Die Beispiele sind eher knapp und nur bei einigen erinnerungskulturell besonders aufschlussreichen Namensvergaben etwas ausführlicher gehalten. Der letzte Teil des Beitrages porträtiert fünf Fallbeispiele kontroverser Namensdebatten der letzten Jahrzehnte. Der Beitrag berücksichtigt Volluniversitäten, Universitäten mit besonderem Profil, private Universitäten und Technische Universitäten,23 nicht aber Hochschulen ohne offiziellen Universitätsstatus. Der Überblick reicht zeitlich vom Deutschen Kaiserreich nach 1900 bis zur Gegenwart. Er beschränkt sich auf die Universitäten des Deutschen Reiches, des Vier-Zonen-Deutschlands, deutscher Zweistaatlichkeit und des heutigen Bundesgebietes. Der an sich wünschenswerte Vergleich mit anderen nationalen Universitätslandschaften kann im Rahmen dieses Beitrages nicht geleistet werden. Das würde ihn überlasten. Bei den Universitäten okkupierter Gebiete berücksichtigt der Beitrag nur die länger existierende Kaiser-Wilhelm-Universität Straßburg (1872/77 bis 1919) im „Reichsland Elsaß-Lothringen“, nicht aber die als NS-Besatzungsuniversitäten errichteten kurzzeitigen „Reichsuniversitäten“ Straßburg und Posen (1941 bis 1945).
22 Der Überblick und die vom Vf. erarbeiteten Tabellen beruhen neben Auskünften einzelner Universitätsarchive auf der Auswertung von Nachschlagewerken – so von Laetitia Boehm, Rainer A. Müller (Hg.): Universitäten und Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine Universitätsgeschichte in Einzeldarstellungen, Düsseldorf 1983 –, einzelner Universitätsgeschichten sowie aktueller Internet-Seiten bundesdeutscher Universitäten und ihrer WikipediaEinträge, die – bei aller Problematik solcher Einträge – für den Zweck einer solchen Übersicht hilfreich sind. 23 Einschließlich des Karlsruher Instituts für Technologie und der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, die beide de facto den Status Technischer Universitäten haben.
148
Jürgen John
U N I V E RSI TÄTSNA M E N BIS 1945 M I T FA L LBEISPI E L E N Für diese Zeit werden drei Tabellen im zeitlichen Querschnitt verwendet, die Einblick in die jeweilige universitäre Namenslandschaft geben. Die erste Tabelle mit dem Zeitbezug 1913 zeigt die Namenslandschaft vor dem Ersten Weltkrieg, vor den universitären Neugründungen von 1914/19 und vor dem Ende des Kaiserreiches/des dynastischen Systems. Tab. 1
Die Namen reichsdeutscher Universitäten 1913
Monarchische Namenspatrone Name24
Ort
Staat
1 Friedrich-Wilhelms-Universität25
Berlin
Preußen
1810, 1828
26
Breslau
Preußen
[1702], 1811, 1911
27
Bonn
Preußen
1818, 1828
HalleWittenberg
Preußen
[1694], 1817, 1817/29
5 Westfälische Wilhelms-Universität29
Münster
Preußen
1902, 1907
6 Albertus-Universität
Königsberg Preußen
1544
7 Christian-Albrechts-Universität
Kiel
Preußen
166530
8 Georg-August-Universität31
Göttingen
Preußen
173732
9 Philipps-Universität
Marburg
Preußen
152733
10 Ludwig-Maximilians-Universität34
München
Bayern
2 Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität 3 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 4 Königliche vereinte Friedrichs-Universität
28
Gründung(en)
1472, 1802
24 Nur Namensvergaben seit 1800 erfasst. 25 Bis 1828 „Universität zu Berlin“. 26 1505 nicht ausgeführte Gründung; 1702 Gründung als „Leopoldina“ durch den habsburgischen Kaiser Leopold I.; 1811 Neugründung durch Vereinigung der Breslauer „Leopoldina“ mit der 1506 gegründeten und nach Breslau verlagerten „Viadrina“-Universität Frankfurt/Oder; bis 1816 „Viadrina“-Universität Breslau; danach bis 1911 „(Königliche) Universität zu Breslau“. 27 Vorgänger 1786–1797; Neugründung 1818; bis 1828 „Preußische Rhein-Universität“. 28 1817 wurde die Universität Wittenberg (gegr. 1502) der Universität Halle (gegr. 1694) angeschlossen; seitdem „Vereinte Hallische und Wittenbergische Friedrichs-Universität; seit 1829 „Königliche vereinte Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg“; 1856–1918 „Königlich vereinigte Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg“; dann „Vereinigte Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg“. 29 Vorgänger-Universität 1773/80–1818; bei Gründung der Universität Bonn aufgehoben; philosophisch-theologische Ausbildungsanstalt (seit 1826 Akademie) als Nachfolgeeinrichtung. 30 Dänisch-holsteinische Gründung. 31 1732/34 Gründung; 1737 Inauguration. 32 Kurhannoveranische Gründung. 33 Hessisch-landgräfliche Gründung. 34 Gegr. in Ingolstadt, 1800 nach Landshut, 1826 nach München verlegt; Namensvergabe 1802.
149
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland Name
Ort
Staat
Erlangen
Bayern
174236
12 Bayerische Julius-Maximilians-Universität37
Würzburg
Bayern
158238
13 Albert-Ludwigs-Universität39
Freiburg
Baden
145740
14 Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg
Baden
138641, 1806
15 Eberhard-Karls-Universität
Tübingen
Württemberg
16 Ludwigs-Universität
Gießen
Hessen
17 Kaiser-Wilhelm-Universität44
Straßburg
Reichsland Elsaß-Lothringen
1 Königliche Universität45
Greifswald
Preußen
2 Großherzoglich und Herzoglich Sächsische Gesamt-Universität47
Jena
Ernestinische Staaten
1558
1 Universität
Leipzig
Sachsen
1409
2 Universität
Rostock
Mecklenburg-Schwerin
1419
11 Friedrich-Alexander-Universität
35
42
Gründung(en)
1477 160743 1872, 1872
Dynastie- und staatsbezogene Namen 145646
Ohne Namen
1913 gab es im Deutschen Kaiserreich 21 Universitäten, davon zehn preußische, zehn nichtpreußische und die 1872 (wieder) gegründete Reichsuniversität Straßburg im annektierten Reichsland Elsaß-Lothringen. Sie entstammten dem späten 14. bis 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1742 in Bayreuth gegründet, 1743 nach Erlangen verlegt. Fränkisch-brandenburgische Gründung. Vorgänger 1402/03–1413. Fürstbischöfliche Gründung. Stiftung 1457; Eröffnung 1460. Österreichisch-habsburgische Gründung. Kurpfälzische Gründung. 1945 geschlossen; Wiedergründung 1957 als „Justus-Liebig-Universität“. Hessen-darmstädtische Gründung. Wiedergründung 1872; Vorgänger-Universität 1621–1792; 1877–1919 „Kaiser-Wilhelms-Universität“; 1919 1939 französische „Université de Strasbourg“; diese 1939–1945 nach ClermontFerrand evakuiert („Université de Strasbourg repliée à Clermond-Ferrand“); 1941–1945 als NS-Besatzungsuniversität gebildete „Reichsuniversität Straßburg“; 1945 Auflösung der „Reichsuniversität“ und Wiedereröffnung der „Université de Strasbourg“ in Straßburg. 45 Bis 1918; dann „(Preußische) Universität“. 46 Städtisch-pommerische Gründung. 47 Bis 1918; dann „(Thüringische) Gesamt-Universität“; seit 1921 „Thüringische Landesuniversität“; gegr. 1548 als Hohe Schule, 1558 Universität; Erhalterstaaten: Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg und Gotha.
150
Jürgen John
frühen 20. Jahrhundert. Von diesen 21 reichsdeutschen Universitäten – Straßburg mit eingerechnet – trugen 19 Namen; 17 davon monarchische – fürstliche oder königliche – Namenspatrone. Die Universitäten Bonn, Breslau und Münster führten zudem die landschaftsbezogenen Attribute „rheinisch“, „schlesisch“ und „westfälisch“ im Namen, die fränkische Universität Würzburg den Staatsbezug „bayerisch“. Halle zeigte mit dem doppelten Ortsbezug „Halle-Wittenberg“ und mit dem Attribut „königlich-vereinigt“, dass es immer noch Wert darauf legte, als eine seit dem Anschluss Wittenbergs an Halle 1817 „vereinigte“ Doppel-Universität zu gelten. Dadurch blieb der Ortsname „Wittenberg“ der universitären Namenslandschaft erhalten. Im vorangehenden Vereinigungsfall Breslau-Frankfurt/Oder 1811 sah das anders aus. Hier verschwanden die Bezeichnungen „Frankfurt“ und „Viadrina“ bereits nach wenigen Jahren aus dem Breslauer Universitätsnamen. Vier Universitäten hatten 1913 keine Namenspatrone. Greifswald und Jena trugen aber Bezeichnungen, die auf die jeweiligen Staaten bzw. Dynastien verwiesen und deshalb als Universitätsnamen anzusehen sind. Im Falle Jenas verwies der Begriff „Gesamt-Universität“ auf die vier ernestinischen Erhalterstaaten.48 Zwei Universitäten – Rostock und Leipzig – waren im eingangs beschriebenen Sinne „namenlos“. Das ist bei beiden – mit dem Namensintermezzo der DDR-Zeit – bis heute so geblieben. Friedrich-Wilhelms- und Wilhelms-Universitäten Die drei im Kontext preußischer Reformen 1810, 1811 und 1818 neu- bzw. wieder gegründeten Universitäten Berlin, Breslau und Bonn trugen 1913 den Gründernamen des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. – Berlin und Bonn seit 1828, Breslau erst seit 1911. Breslau und Berlin büßten den Namen 1945 ein; Bonn trägt ihn noch heute. Der Name „Friedrich-Wilhelms-Universität“ gilt als Bekenntnis dieser ReformUniversitäten zum preußischen Staat und seinem Bildungsprogramm.49 Zunächst waren sie allerdings ohne Namenspatron geblieben: Berlin „namenlos“ bis 1828, Breslau kurzzeitig mit dem von Frankfurt/Oder übernommenen Namen „Viadrina“, dann als „Königliche Universität zu Breslau“ bezeichnet, Bonn mit dem Namen „Preußische Rhein-Universität“. In dieser Bezeichnung kam das mit der Universitätsgründung 1818 verbundene Kalkül zum Ausdruck, die preußische Macht in der neu erworbenen Rhein-Provinz symbolisch, kulturell und bildungspolitisch zu festigen. Das wurde 48
Angesichts der statuarisch festgelegten großen finanziellen Zuwendungen der von Ernst Abbe gegründeten Carl-Zeiss-Stiftung galt diese mit gutem Grund gleichsam als „fünfter Erhalterstaat“ – vgl. Christoph Matthes: Finanzier. Förderer. Vertragspartner. Die Universität Jena und die optische Industrie 1886–1971, Köln, Weimar, Wien 2014; das ist aber für das hier behandelte Thema ohne Belang, da es sich nicht um einen Namen, sondern um eine charakterisierendwertende Bezeichnung handelt. 49 Thomas Becker: Diversifizierung eines Modells? Friedrich-Wilhelms-Universitäten 1810, 1811, 1818, in: vom Bruch: Universität (2010), S. 43–69; Becker, Schaber: Die Gründung (2013); dieser Sammelband enthält keinen Beitrag zu den Namensvergaben, obwohl er den Namen im Titel führt (vgl. auch Anm. 17); der Wikipedia-Eintrag „Friedrich-Wilhelms-Universität“ (zuletzt abgerufen am 17.7.2015) gibt für Breslau und Bonn fälschlich die Gründungsjahre 1811 und 1818 als Jahre der Namensvergaben an; zum Selbstverständnis der Berliner Universität vgl. den Beitrag von Heinz-Elmar Tenorth in diesem Band.
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
151
dann 1828 mit der Namensvergabe „Friedrich-Wilhelms-Universität“ und dem dadurch betonten Bezug zum preußischen Herrscherhaus mit zugleich beibehaltenem Landschaftsbezug „rheinisch“ bekräftigt. Das Bekenntnis zum preußisch-deutschen Herrscherhaus war auch bei den drei im Kaiserreich an Universitäten vergebenen Namenspatronen unverkennbar: Straßburg 1872 (Kaiser-Wilhelms-Universität), Münster 1907 (Wilhelms-Universität), Breslau 1911 (Friedrich-Wilhelms-Universität). Die Namensvergaben von Straßburg und Münster betrafen die jeweils regierenden Kaiser Wilhelm I. und Wilhelm II. Die Vergabe des Namens „Wilhelms-Universität“ für die damals jüngste deutsche Universität Münster (Gründung 1902) erfolgte während des „Kaiserbesuches“ 1907 in Münster. Der galt allerdings der Kaserne, nicht der Universität. Dort verlas nur der preußische Kultusminister die königlich-kaiserliche Namens-Ordre. Wilhelm II. selbst nahm an dem Festakt nicht teil.50 Die beiden kaiser- und gegenwartsbezogenen Namen von Straßburg und Münster stellten Grenzfälle zum Typus „Politikernamen / politische Namen“ dar. Die Breslauer „Königliche Universität“ wurde zum 100. Jahrestag ihrer Neugründung 1911 in „Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität“ umbenannt. Erst damit schloss Breslau auch namentlich zu der gern so apostrophierten Gruppe der „drei preußischen Friedrich-Wilhelms-Universitäten“ auf. Man kann diese Namensvergabe 1911 unterschiedlich interpretieren: als – wie vier Jahre zuvor im Falle Münsters – klares Bekenntnis zum preußisch dominierten Kaiserreich; oder als ein „verspätetes Bekenntnis“ zum preußischen Staat der Reformzeit, zu seinem Bildungsprogramm und zu der in der Berliner „Friedrich-Wilhelms-Universität“ verkörperten „Idee der deutschen Universität“ – auch in symbolische Abwehr moderner außeruniversitärer Großforschungsprogramme, wie sie vor allem in der beim Berliner Universitätsjubiläum 1910 angekündigten und im Jahr der Breslauer Namensvergabe 1911 vollzogenen Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zum Ausdruck kamen.51 Die zweite Tabelle mit dem Zeitbezug 1932 illustriert die universitäre Namenslandschaft der Weimarer Republik nach dem Ende des Kaiserreiches / des dynastischen Systems, nach Verlust der Universität Straßburg (1919) und nach Gründung der Universitäten Frankfurt / Main (1914), Köln (1919) und Hamburg (1919). Sie spiegelt damit die Veränderungen der Weimarer Zeit bis zum „Goethe-Jahr“ 1932 wider, das zugleich das „Krisenjahr“ der Weimarer Republik war. Die damit verbundene Frankfurter Namensgebung stand am Beginn einer Serie von Namensvergaben mit bürgerlichen Namenspatronen 1932 bis 1934.
50 51
Der Kaiserbesuch von 1907. Ein Blick auf Münster in Wilhelminischer Zeit. Dokumentation einer Ausstellung des Stadtarchivs im Universitätsgebäude vom 23.11.–18.1987, 2Münster 1990. Vgl. dazu den Beitrag von Heinz-Elmar Tenorth in diesem Band.
152 Tab. 2
Jürgen John
Die Namen reichsdeutscher Universitäten 1932
Monarchische Namenspatrone Name
Ort
Staat
1 Friedrich-Wilhelms-Universität
Berlin
Preußen
2 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn
Preußen
3 Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität
Breslau
Preußen
4 Vereinigte [Friedrichs-] Universität
Halle-Wittenberg
Preußen
5 Westfälische Wilhelms-Universität
Münster
Preußen
6 Christian-Albrechts-Universität
Kiel
Preußen
7 Georg-August-Universität
Göttingen
Preußen
8 Philipps-Universität
Marburg
Preußen
9 [Albertus-] Universität
52
Königsberg
Preußen
10 Ludwig-Maximilians-Universität
München
Bayern
11 Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen
Bayern
12 Bayerische Julius-Maximilians-Universität
Würzburg
Bayern
13 Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg
Baden
14 Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg
Baden
15 Eberhard-Karls-Universität
Tübingen
Württemberg
16 Ludwigs-Universität
Gießen
Hessen
53
Staatsbezogene Namen Name 1 Hamburgische Universität
54
2 Thüringische Landesuniversität
52
55
Ort
Staat
Gründung
Hamburg
Hamburg
1919
Jena
Thüringen
1921
Bis 1918 „Königliche Vereinigte Friedrichs-Universität“; dann „(Preußische) Vereinigte Friedrichs-Universität“; 1930 wurde der Name „Friedrichs“ vom preußischen Kultusministerium aus den Satzungen gestrichen; seit 1933 „Martin-Luther-Universität“. 53 1930 wurde der Name „Albertus“ vom preußischen Kultusministerium aus den Satzungen gestrichen. 54 Stadtstaat-Universität; 1919 gegründet; Name 1919–1935, dann bis 1945 „Hansische Universität“. 55 Bis 1918 „Großherzoglich und Herzoglich Sächsische Gesamt-Universität“; dann „(Thüringische) Gesamt-Universität“; seit 1921 „Thüringische Landesuniversität“; seit 1934 „Friedrich-Schiller-Universität“.
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
153
Bürgerlicher Name 1 Johann Wolfgang Goethe-Universität56
Frankfurt/M
Preußen
1 Universität57
Greifswald
Preußen
2 Universität
1914, 1932
Ohne Namen
Köln
Preußen
3 Universität
Leipzig
Sachsen
4 Universität
Rostock
Mecklenburg-Schwerin
58
1919
Von den nunmehr 23 reichsdeutschen Universitäten gehörten zwölf zum Großstaat Preußen, davon zehn staatliche, die neue städtische Universität Köln und die nach Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 gegründete erste deutsche Stiftungsuniversität Frankfurt / Main. Elf Universitäten lagen in nichtpreußischen Ländern. Von den 23 Universitäten trugen 19 Namen, davon 16 monarchische Namenspatrone, die im Falle Königsbergs und Halle-Wittenbergs 1930 vom preußischen Kultusministerium statuarisch gestrichen, aber inoffiziell weiter geführt wurden. Hinzu kamen zwei staatsbezogene Namen: die 1919 gegründete „Hamburgische Universität“ und die Jenaer Universität, die seit der Fürstenabdankung 1918 nur noch „(Sächsische) GesamtUniversität“ und seit der Landesgründung 1920/21 „Thüringische Landesuniversität“ hieß. Erstmals wählte 1932 zudem eine deutsche Universität (Frankfurt / Main) mit Goethe einen nichtmonarchischen Namenspatron aus dem bildungsbürgerlichen Kanon der deutschen Kulturnation. Vier Universitäten waren dann noch „namenlos“: weiterhin Rostock und Leipzig, nunmehr auch Greifswald und die neue Universität Köln. Greifswald, Halle-Wittenberg und Frankfurt / Main hatten 1918 das Attribut „königlich“ abgelegt. Die fürstlich-monarchischen Namenspatrone blieben in der Weimarer Republik weitgehend unangetastet. Lediglich die Namenspatrone „Friedrich“ (Halle-Wittenberg) und „Albertus“ (Königsberg) wurden mit den neuen preußischen Statuten 1930 gestrichen. Das ergab sich in erheblichem Maße aus den Konflikten der republikanischen Hochschulpolitik der preußischen Kultusminister Carl Heinrich Becker (DDP-nahe; bis 1930)59 56
Nach Vertrag 1912 im Oktober 1914 Gründung als „Stiftungsuniversität“ (bis 1967, dann Landesuniversität, seit 2008 wieder „Stiftungsuniversität“); 1914–1918 „Königliche Universität zu Frankfurt a. M.“ seit 1932 „Johann Wolfgang Goethe-Universität“ (seit 2008 „Goethe-Universität“). 57 Bis 1918 „Königliche Universität“; dann „(Preußische) Universität“; seit 1933 „Ernst-MoritzArndt Universität“. 58 Wiedergründung 1919 als städtische Universität; Vorgänger-Universität 1388–1798. 59 Zu Beckers „vernunftrepublikanischer“ Bildungs- und Hochschulpolitik vgl. zuletzt u. a. Béatrice Bonniot: Die Republik, eine „Notlösung“? Der preußische Kultusminister Carl Heinrich Becker im Dienste des Weimarer Staates (1918–1933), in: Andreas Wirsching, Jürgen Edler (Hg.): Vernunftrepublikanismus in der Weimarer Republik, Stuttgart 2008, S. 299–309; John: „Bildungseinheit“, S. 119–129.
154
Jürgen John
und Adolf Grimme (SPD; 1930/32) 60 mit der republikfeindlich eingestellten Mehrheit der Studierenden – und aus der Haltung eines großen Teiles der Professorenschaft, die sich entweder mit ihnen solidarisierte oder zumindest sehr viel Verständnis für die antirepublikanisch politisierte Studentenschaft zeigte. Die älteren Universitäten hielten schon aus Traditionsgründen an den fürstlich-monarchischen Namenspatronen fest. Die Universität Münster bekannte sich aus anhaltend „monarchischer Gesinnung“ weiterhin zum abgedankten Kaiser als Namenspatron. Die neuen Universitäten Frankfurt / Main, Köln und Hamburg gehörten in der überwiegend republikdistanziert bis -feindlich eingestellten Universitätslandschaft zu denjenigen Universitäten, die dem ansonsten verpönten „republikanischen Geist“ noch am ehesten eine Heimstatt gewährten. Sie fühlten sich dem „bürgerlichen Zeitalter“ zweifellos stärker verbunden als die Traditions-Universitäten. Goethe-Universität Frankfurt (1932) Die bürgerliche Stiftungsuniversität Frankfurt / Main verlieh dem 1932 besonderen Ausdruck, als sie Goethe – nach Thomas Manns berühmter Rede zum Goethejahr als „Repräsentanten des bürgerlichen Zeitalters“61 – zu ihrem Namenspatron wählte. Sie überging dabei das „von“ im später geadelten Namen Goethes und wählte die bürgerliche Variante; ebenso wie dann zwei Jahre später die Universität Jena im Falle Schillers. Die Frankfurter Namenswahl und -vergabe am Geburtsort Goethes erfolgte im spätrepublikanischen Kontext des 1932 anlässlich seines 100. Todestages reichsweit und mit einer offiziellen Reichs-Goethewoche in Weimar begangenen „Goethe-Jahres“. Die noch „namenlose“ Stiftungsuniversität nutzte die Chance dieses Gedenkjahres, um sich den prominenten Namen Goethes zuzulegen, der im engen Bezug zum Frankfurter Hochstift ohnehin bereits in den ikonographischen Vordergrund der Universität gerückt war. In diesem Sinne stellte sie den mit der Stadt abgestimmten Antrag an das preußische Staatsministerium mit dem sozialdemokratischen Kultusminister Adolf Grimme. Das Ministerium verlieh ihr den Namen „Johann Wolfgang Goethe-Universität“ im Rahmen eines Goethe-Festaktes am 16. Juni 1932; noch rechtzeitig vor dem „Preußenschlag“ genannten Staatsstreich, mit dem der Präsidialkanzler Franz von Papen am 20. Juli 1932 die republikanische preußische Regierung vertrieb und so den Untergang der Weimarer Republik weiter vorantrieb. Einer ministeriellen Empfehlung, die für den allgemeinen Sprachgebrauch geläufigere einfache Namensform „Goethe-Universität“ zu wählen, folgte die Universität (noch) nicht. Sie blieb bei der damals üblichen umständlicheren Variante mit allen Vornamen.62 60 Kai Burkhardt: Adolf Grimme (1889–1963). Eine Biografie, Köln, Weimar, Wien 2007, der die Konflikte in Halle und Königsberg skizziert (S. 130f.), ohne die statuarischen Namensstreichungen zu erwähnen; Grimme setzte Beckers – letztlich vergebliches – Bemühen fort, einen republikanischen Geist in die preußischen Hochschulen und in die Studentenschaft zu tragen. 61 Thomas Mann: Goethe als Repräsentant des bürgerlichen Zeitalters. Rede zum 100. Todestag Goethes, Berlin 1932. 62 Notker Hammerstein: Die Johann Wolfgang Goethe-Universität. Wie die Universität zu ihrem Namen kam, in: Forschung Frankfurt. Das Wissenschaftsmagazin 17 (1999), H. 2, S. 76–82; aktualisierter Nachdruck ebd. 18 (2000), H. 3, S. 54–59; Michael Maaser, Wolfgang Schopf: Von „Frankfurt“ zu „Goethe“. Eine kleine Namensgeschichte der Universität, ebd. 31 (2014), 1,
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
155
Thüringische Landesuniversität Jena (1921) Zwei sehr unterschiedliche Fälle von Namenswechseln der Weimarer Zeit stechen besonders ins Auge. Das betrifft zunächst die „Gesamtuniversität Jena“. Ihr seit 1918 nur noch rudimentär geführter Name „Gesamtuniversität“ wurde spätestens dann hinfällig, als im revolutions- und republikbedingten Aufbruch 1918 / 19 eine „Neuordnung Thüringens“ begann und sich die bislang ernestinischen, schwarzburgischen und reußischen Kleinstaaten 1920 zum Land Thüringen zusammenschlossen. Das neue Land übernahm die bis dahin von den (ehemals ernestinischen) Freistaaten WeimarEisenach, Gotha, Meiningen und Altenburg getragene Universität Jena. Sie erhielt vom Staatsministerium des Landes (einer DDP-SPD-Koalition) 1921 deshalb den Namen „Thüringische Landesuniversität“.63 Die eher beiläufige Namensvergabe ging zwar nicht von der Universität aus. Sie erfolgte aber im Einvernehmen mit ihr. Wie die Landesregierung hielt es auch der amtierende Rektor für dringend geboten, dass die Universität nun „eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bezeichnung führt“.64 Der leitende Staatsminister Arnold Paulssen (DDP) teilte ihm daraufhin den ab 1. April 1921 geltenden neuen Namen mit. Universitäre Gremien wurden an dieser Namensvergabe nicht beteiligt. Sie waren seit 1919 ohnehin vor allem mit der nötigen grundlegenden Universitäts- (Rektorats-, Senats-, Fakultäts- und Studentenrechts-) Reform befasst. Der Vorschlag eines konservativ gesinnten Germanisten, die „Salana“ nach ihrem ernestinischen Gründer „Thüringische Johann-Friedrich-Universität“ zu nennen, fand kein Gehör. Er wurde zu den Akten gelegt. Universität Halle-Wittenberg (1930) Ganz anders gelagert war der Fall Halle-Wittenberg. Die „Vereinigte Universität“ büßte 1918 nicht nur das Attribut „königlich“, sondern mit dem neuen Statut 1930 auch noch ihren seit 1817 geführten Namen „Friedrichs-Universität“ ein.65 Inoffiziell führte sie ihn zwar weiter, sah sich aber bereits nach einem neuen Namenspatron um. Zumal diese „Bindestrich-Universität“ als ineffektiv galt, unter Schließungsdruck stand und S. 18–22. 63 Jürgen John: Namenswechsel – Wendezeiten? Die Jenaer Universitätsnamen 1921/1934 und ihre Kontexte, in: Helmut G. Walter (Hg.): Wendepunkte in viereinhalb Jahrhunderten Jenaer Universitätsgeschichte, Jena 2010, S. 87–138, hier S. 98–110; zum Kontext vgl. ders., Rüdiger Stutz: Die Jenaer Universität 1918–1945, in: Traditionen – Brüche – Wandlungen. Die Universität Jena 1850 – 1995, Köln, Weimar, Wien 2009, S. 270–587, hier S. 296–311; Beate Häupel: Die Gründung des Landes Thüringen. Staatsbildung und Reformpolitik 1918–1923, Köln, Weimar, Wien 1995; Jürgen John: „Land im Aufbruch“. Thüringer Demokratie- und Gestaltungspotenziale nach 1918, in: Justus H. Ulbricht (Hg.): Weimar 1919. Chancen einer Republik, Köln, Weimar, Wien 2009, S. 17–46. 64 Schreiben v. 6.4.1921 an den leitenden Staatsminister (Universitätsarchiv Jena, Best. BA, Nr. 1859, Bl. 5r, 5v). 65 Die Statuten der preußischen Universitäten und Technischen Hochschulen, Teil 8 (Die Satzung der Universität Halle-Wittenberg), Berlin 1930; vgl. zum Gesamtvorgang und seinen Details Jürgen John: „Lutherjahr“ und „nationale Erhebung“. Die Namensgebung „Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg“ 1933 und ihre Kontexte, in: Hallische Beiträge zur Zeitgeschichte, Heft 19 (2010/1), S. 87–118, hier S. 90–95.
156
Jürgen John
nach einer wirkungsvollen Strategie zur „ideellen Absicherung“ gegen den Niedergang und das Schließungsgespenst suchte. Dabei verfuhr die Universitätsleitung zweigleisig. Sie knüpfte an die provinzsächsischen „Mitteldeutschland“-Pläne an und empfahl Halle-Wittenberg als „provinzial-sächsische Landesuniversität in Mitteldeutschland“.66 Gleichzeit betonte sie die Wittenberg-Tradition der nominellen Doppeluniversität und brachte Luther als möglichen neuen Namenspatron ins Spiel. Der Name „Friedrich“ – tröstete man sich über den Verlust des bisherigen Namenspatrons – sage in der breiten Öffentlichkeit ohnehin wenig. Zudem wisse niemand so recht, welcher Friedrich eigentlich gemeint sei – der ernestinische Kurfürst Friedrich III. (der „Weise“) als Gründer der Universität Wittenberg (1502) oder der brandenburgische Kurfürst (bzw. spätere preußische König) Friedrich III. (I.) als Gründer der Universität Halle (1694). Man solle deshalb besser den Namen „Luther-Universität“ ins Auge fassen.67 Das verweist bereits auf die NS-Zeit und auf die dritte Tabelle mit dem Zeitbezug 1935. Sie zeigt die Namenslandschaft nach der Vergabe neuer Universitätsnamen zu Beginn des NS-Regimes. Tab. 3
Die Namen reichsdeutscher Universitäten 1935
Monarchische Namenspatrone Name
Ort
Staat
1 Friedrich-Wilhelms-Universität68
Berlin
Preußen
Bonn
Preußen
Breslau
Preußen
2 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 3 Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität
69
4 Westfälische Wilhelms-Universität
Münster
Preußen
5 [Albertus-] Universität70
Königsberg
Preußen
6 Christian-Albrechts-Universität
Kiel
Preußen
7 Georg-August-Universität
Göttingen
Preußen
8 Philipps-Universität
Marburg
Preußen
66 Hallische Nachrichten, 23.2.1932; zum Kontext damaliger „Mitteldeutschland“-Debatten vgl. Jürgen John: „Mitteldeutschland“. Begriff – Geschichte – Konstrukt, Rudolstadt/Jena 2001; ders.: Die Idee „Mitteldeutschland“, in: Michael Richter u. a.: Länder, Gaue und Bezirke. Mitteldeutschland im 20. Jahrhundert, Dresden 2007, S. 25–33. 67 So der Dekan der Theologischen Fakultät in seinem Schreiben vom 7.6.1933 an Rektor und Senat der Universität Halle-Wittenberg als Begründung, den Namen „Friedrichs-Universität“ nicht wiederherzustellen, sondern den Namen „Luther-Universität“ zu wählen (Universitätsarchiv Halle, Rep. 4, Nr. 7, n. f.). 68 Bis 1945; seit 1949 „Humboldt-Universität“. 69 Bis 1945;seit 1946 polnische „Uniwersytet Wroclawski“. 70 Bis 1945; 1947–1966 russische „Pädagogische Universität“; 1966–2005 „Kaliningrader Staatliche Universität“; 2005–2010 „Russische Staatliche Universität namens Immanuel Kant“; seit 2010 „Baltische föderale Universität namens Immanuel Kant“.
157
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland 9 Ludwig-Maximilians-Universität
München
Bayern
10 Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen
Bayern
11 [Bayerische] Julius-Maximilians-Universität
Würzburg
Bayern
12 Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg
Baden
13 Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg
Baden
14 Eberhard-Karls-Universität
Tübingen
Württemberg
15 Ludwigs-Universität
Gießen
Hessen
71
Bürgerliche Namenspatrone 1 Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt/M
Preußen
2 Ernst-Moritz-Arndt-Universität72
Greifswald
Preußen
1933
3 Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg
Preußen
1933
4 Friedrich-Schiller-Universität
Jena
Thüringen
1934
Hamburg
Hamburg
1935
1 Universität
Köln
Preußen
2 Universität
Leipzig
Sachsen
3 Universität
Rostock
Mecklenburg74
Politisch ausgerichteter Name 1 Hansische Universität73
Ohne Namen
Bei unveränderter Universitätszahl (23) – davon 12 preußische (zehn staatliche und zwei städtische) und elf nichtpreußische – änderte sich die Namenslandschaft deutlich. Zu den noch 15 monarchischen Namenspatronen und dem bis dahin einzigen bürgerlichen Namenspatron von Frankfurt / Main traten 1933/34 drei weitere bürgerliche Namen aus dem Kanon der „deutschen Kulturnation“. Im Unterschied zu Frankfurt waren sie einst mehr oder weniger mit der Geschichte der jeweiligen Universität verbunden gewesen. 1935 wurde zudem der Name „Hamburgische“ in „Hansische 71 72 73 74
Bis 1945; nicht wiedereröffnet; 1946–1957 Nachfolgeeinrichtung „Justus-Liebig-Hochschule für Bodenkultur und Veterinärmedizin“; 1957 Umwandlung zur „Justus-Liebig-Universität“. 1945–1954 nur „Universität Greifswald“; der Name Arndts ruhte. 1935–1945; zuvor „Hamburgische Universität“, seit 1945 „Universität Hamburg“. 1934 Zusammenschluss v. Mecklenburg-Schwerin u. Mecklenburg-Strelitz zum Land Mecklenburg.
158
Jürgen John
Universität“ geändert. Damit gab es nun 20 Namensträger und noch drei „namenlose“ Universitäten: Köln, Leipzig, Rostock. Die Universitäten Jena, Halle-Wittenberg und Hamburg wechselten (erneut) ihre Namen. Hansische Universität Hamburg (1935) Der Hamburger Namenswechsel 1935 ging auf den dortigen Rektor, Kolonialhistoriker und Philosophen Adolf Rein – einen Vordenker der nationalsozialistischen „politischen Universität“75 – zurück. Seinem Vorschlag folgend, verlieh der Senat der Hansestadt Hamburg am 3. Oktober 1935 den Namen „Hansische Universität“.76 Das war keine nostalgische Verbeugung vor der älteren hansischen Geschichte Hamburgs, sondern ein eindeutig politischer Akt. In dem neuen Namen drückten sich die mit dem Slogan „Hamburg – das deutsche Tor zur Welt“ verbundenen HegemonialAnsprüche auf der Grundlage von „Rasse und Raum“ aus.77 Das entsprach auch der propagandistischen Gau-Rhetorik.78 Damit ersetzten die Protagonisten dieser Namensvergabe den – wie es der Hamburger Senator Heinrich Landahl dann nach dem Ende des NS-Regime bei der Wiedereröffnung der Universität im November 1945 formulierte – „sauberen, sachlichen Namen ‚Universität Hamburg‘“ durch eine „phrasenhaft hohle, aus nationalsozialistischer Gespreiztheit geborene Benennung ‚Hansische Universität‘“.79 Diese narrativ auf die NS-Begriffswelt ausgerichtete Hamburger Namensvergabe blieb jedoch singulär. Offenkundig nationalsozialistisch apostrophierte Begriffe wurden zwar für Universitäten gern verwendet, aber nicht für weitere Namensvergaben handlungsleitend; so etwa der auf den Auszug deutscher Studenten 1409 von Prag nach Leipzig anspielende Begriff „Grenzlanduniversität“ beim Leipziger Gründungsjubiläum 1934.80 Der NS-Hochschulpolitik kam es nach „nationaler Erhebung“ 75 76
77 78
79 80
Adolf Rein: Die Idee der politischen Universität, Hamburg 1933. Rainer Nicolaysen: Geistige Elite im Dienste des „Führers“. Die Universität zwischen Selbstgleichschaltung und Selbstbehauptung, in: Hamburg im „Dritten Reich“, Göttingen 2005, S. 336–356, hier S. 346f.; Amtlicher Anzeiger. Beiblatt zum Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt, Nr. 228 v. 4.10.1935, S. 779; für Quellenhinweise ist der Vf. Rainer Nicolaysen (Hamburg) dankbar. Hamburg, das deutsche Tor zur Welt. 1000 Jahre hamburgische Geschichte, Hamburg 1936, S. 197f. Vgl. Gau Hamburg – Deutschlands Tor zu Welt, in: Das Buch der deutschen Gaue. Fünf Jahre nationalsozialistische Aufbauleistung, Bayreuth 1938, S. 18–25; dieses Gauporträt bezog die „reichspolitische Aufgabe“ und den „Lebenswillen“ des „nationalsozialistischen Hamburgs“ aber v. a. auf den Hafen und das Groß-Hamburg-Gesetz 1937, ohne die – nunmehr – „Hansische Universität“ zu erwähnen. Universität Hamburg. Reden von Senator Heinrich Landahl und Professor Dr. Emil Wolff, Rektor der Universität. Gehalten bei der Feier der Wiedereröffnung am 6. November 1945 in der Musikhalle, Hamburg 1946, S. 10. So der „Leiter der Studentenschaft“ Erich Hengelhaupt in seiner Ansprache beim Festakt („Leipzig als neue Grenzlanduniversität“ müsse „Ausfallstor deutscher Kultur nach dem Südosten“ werden), in: Akademische Reden. Gehalten am 31. Oktober 1934 in der Aula der Universität Leipzig aus Anlass des 525. Jahrestages ihrer Gründung, Leipzig (1934), S. 27: der Vf. dankt Jens Blecher (Universitätsarchiv Leipzig) für die zur Verfügung gestellte Kopie; wie im Falle Hamburgs passte das freilich zur propagandistischen Gau-Rhetorik („Gau Sachsen – Deutschlands Werkstatt und
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
159
und „Gleichschaltung“ der Hochschulen vor allem darauf an, die Hochschul- und Bildungseliten für das NS-System und seinen Kriegskurs zu gewinnen und die Universitäten im Reichs- und Gaumaßstab entsprechend zu mobilisieren. Vordergründig politisch motivierte, gar oktroyierte Namensvergaben passten dazu keineswegs. Niemand kam ernsthaft auf die Idee, Universitäten etwa nach Repräsentanten des NS-Systems zu benennen. Ein angeblich Halle drohender Name „Alfred-RosenbergUniversität“ ist Legende. Sie sollte später den Eindruck erwecken, die Universität habe das mit ihrer Luther-Initiative 1933 unterlaufen.81 Und der Braunschweiger Name „Bernhard-Rust-Hochschule für Lehrerbildung“ (1937) blieb eine Ausnahme.82 Für den Universitätsbereich wurden solche Namen niemals erwogen – auch nicht in Rusts zuständigem Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Arndt-, Luther- und Schiller-Universitäten Greifswald, Halle, Jena (1933/34) Besonders erklärungsbedürftig und umstritten ist der Einzug weiterer bürgerlicher Namenspatrone in die universitäre Namenswelt zu Beginn des NS-Regimes. Die entsprechenden drei Namensvergaben in Greifswald, Halle-Wittenberg und Jena 1933/34 nehmen durch ihren NS-Kontext und ihre Dichte einen besonders auffälligen Platz in der universitären Namensgeschichte ein. Im Kontrast zur Frankfurter Namensvergabe 1932 im damals noch republikanischen Kontext wurden die neuen Namen Arndt, Luther und Schiller von nunmehr zuständigen nationalsozialistischen Amtsinhabern vergeben – und damit in einem Kontext, der eher mit dem Beginn katastrophaler Barbarei als mit der „deutschen Kulturnation“ assoziiert wird. Die Initiativen für diese Namensvergaben gingen freilich von den drei Universitäten selbst aus. In Greifswald forderte ein Theologe namens der „Stahlhelm“-Hochschulgruppe Rektor und Senat auf, den Namen „Ernst-Moritz-Arndt-Universität“ beim kommissarischen preußischen Kultusminister Rust zu beantragen. Entsprechend verfuhren Senat und Rektor. Das preußische Staatsministerium unter Göring stellte dann die Grenzland“, in: Das Buch [1938], S. 127–136); vgl. zum Leipziger Universitätsjubiläum 1934 und dieser Ansprache auch Drüding: Akademische Jubelfeiern (2014), S. 108–117, hier S. 114. 81 Leo Stern: 450 Jahre Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Festrede, Halle 1952, S. 16; Theodor Brugsch: Arzt seit fünf Jahrzehnten. Autobiographie, Berlin (O) 1957 (Neuaufl. 1986), S.278f.; tatsächlich fungierte Rosenberg seit 1938 – auf Bemühen der Universität – mit der Gründung einer Alfred-Rosenberg-Stiftung für wissenschaftlich Zwecke und mehreren Reden als „Protektor“ der Universität – der einzige Fall einer Universität mit einem NS-Reichsleiter als Schirmherr; von Rosenbergs eigenem Projekt einer alternativen Parteiuniversität als „Hoher Schule der NSDAP“ wurde in Halle 1941 nur ein Institut des völkischen Religionswissenschaftlers Wilhelm Brachmann eingerichtet - vgl. dazu in Zusammenfassung der entsprechenden Spezialliteratur Henrik Eberle: Die Martin-Luther-Universität in der Zeit des Nationalsozialismus 1933–1945, Halle 2002, S. 163–168; John: „Lutherjahr“ und „nationale Erhebung“ (2010), S. 102f. 82 Bernhard Rust setzte als preußischer Kultus- und – seit 1934 – als Reichsminister die Umbildung der vor 1933 in Preußen gebildeten „Pädagogischen Akademien“ in „Hochschulen für Lehrerbildung“ um; die Braunschweiger Hochschule erhielt 1937 seinen Namen; vgl. auch Ulf Petersen: Bernhard Rust. Ein nationalsozialistischer Bildungspolitiker vor dem Hintergrund seiner Zeit, Braunschweig u. a. 1994; Anne C. Nagel: Hitlers Bildungsreformer. Das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 1934–1945, Frankfurt a. M.. 2012, S. 102–105.
160
Jürgen John
Namensurkunde aus. Der Festakt fand am 28. Juni 1933 – dem Jahrestag des „Schandvertrages von Versailles“ – statt.83 In Halle regte die Theologische Fakultät an, anlässlich des bevorstehenden 450. Geburtstages Luthers beim preußischen Staatsministerium den Namen „Luther-Universität Halle-Wittenberg“ zu beantragen. Senat und Rektor schlossen sich dem an, wobei der Rektor auf die kurz zuvor erfolgte Namensvergabe in Greifswald verwies. Er stellte dann den Antrag bei Rust. Die auf den 10. November – Luthers Geburtstag – datierte, von Göring und Rust unterzeichnete Namensurkunde wurde bei der als Festakt zur Namensvergabe gestalteten universitären Lutherfeier am 31. Oktober 1933 von einem Ministerialbeamten verkündet.84 Rust nahm weder in Greifswald noch in Halle an den Festakten zu den Namensvergaben teil. In Jena schlug der Rektor dem Thüringer Volksbildungsministerium vor, anlässlich der für den 10. November 1934 zu Schillers 175. Geburtstag geplanten staatlichen Schillerfeiern der Landesuniversität den Namen „Friedrich-Schiller-Universität Jena“ zu verleihen. Nachdem – wie es in der entsprechenden Ministerialvorlage hieß – „Frankfurt schon den Namen Goethe […] weggenommen hat“ und „was sonst unter Umständen einmal Tübingen macht“.85 Das Staatsministerium fasste dann den entsprechenden Beschluss. Der Senat spielte dabei schon keine Rolle mehr. Nun galt bereits das „Führer-Prinzip“ mit dem Rektor als „Führer der Universität.“ Beim Festakt zur Namensvergabe überreichte Thüringens NS-Volksbildungsminister Fritz Wächtler die Namensurkunde. Dieser Festakt fand am 10. November 1934 in der Jenaer Universitätsaula statt86 – parallel zum pompösen Staatsakt unter dem Motto „Die Nation huldigt Friedrich Schiller“ im Deutschen Nationaltheater Weimar im Beisein Hitlers und Goebbels‘. Man könnte diese von den jeweiligen Universitäten ausgehenden und von den NS-Bürokratien dann vollzogenen drei Namensvergaben als Ausdruck regimedistanzierten universitären Eigensinns deuten,87 als erfolgreichen Versuch, eigene Namen anstelle möglicherweise aufgezwungener NS-Namen durchzusetzen oder als Bestreben, sich aus der monarchischen Namenswelt zu lösen. Im Falle Jenas etwa gab es 1933 „keine Neigung“, der Universität „den Namen Johann-Friedrich Universität zu geben“, obwohl sich das 375jährige Gründungsjubiläum angeboten hätte, so an den 83 Dirk Alvermann: Zwischen Pranger und Breitem Stein. Die Namensgebung der Universität Greifswald und die aktuelle Diskussion, in: Ernst Moritz Arndt weiterhin im Widerstreit der Meinungen. Neue Materialien zu einer alten Diskussion (=Hefte der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft e.V., 8, 2003), S. 23–39. 84 Eberle: Die Martin-Luther-Universität (2002), S. 49–51; John: „Lutherjahr“ und „nationale Erhebung“ (2010), hier S. 94f.; Silvio Reichelt: Martin Luther als evangelischer Schutzheiliger. Die Reformationsfeiern an der Universität Halle-Wittenberg 1927–1941, in: Klaus Tanner, Jörg Ulrich (Hg.): Spurenlese. Reformationsvergegenwärtigung als Standortbestimmung (1717–1983), Leipzig 2012, S. 145–169, hier S. 155–158; vgl. auch Anm. 101. 85 Landesarchiv Thüringen - Hauptstaatsarchiv Weimar, Thüringisches Volksbildungsministerium, Abt. C, Nr. 130, Bl. 3r. 86 Margit Hartleb: Die Namensgebung „Friedrich-Schiller-Universität“ 1934, in: Joachim Bauer u. a. (Hg.) Patron Schiller, Friedrich Schiller und die Universität Jena, Jena 2009, S. 63–76; John, Stutz: Die Jenaer Universität (2009), hier S. 463–466; John: Namenswechsel – Wendezeiten (2010), S. 117–121. 87 Diese Interpretationstendenz zeichnete sich v. a. in der Greifswalder Debatte um den Namen „Ernst-Moritz-Arndt-Universität“ seit 1998 ab (vgl. das Fallbeispiel am Schluss des Beitrages).
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
161
ernestinischen Stifter zu erinnern.88 Tatsächlich spricht wenig für solche regimedistanzierten Deutungen. Schon die knapp skizzierten Konstellationen und Abläufe ergeben ein anderes Bild, erst recht die Kontexte. Vom NS-Regime waren keine oktroyierten Namen zu befürchten. Und die drei Namensvergaben 1933/34 passten situativ wie narrativ bestens zur „nationalen Erhebung“ und „Zeitenwende“. Ihre Gemeinsamkeiten und eindeutigen Gegenwartsbezüge zur „neuen Zeit“ des nationalsozialistischen Deutschlands sind ebenso wenig zu übersehen wie ihre Kontinuität zu schon vor 1933 ausgeprägten „nationalen“ Denkweisen, die die gesamte innere und äußere Nachkriegsordnung – das „System von Weimar“ und das „System von Versailles“ – ablehnten. Das zeigte sich trotz aller Unterschiede in Meinungsbildung, Ablauf, Inszenierung und Bezügen der drei Namensvergaben von Greifswald, Halle und Jena. Im Falle Greifswalds gab es keinen direkten erinnerungskulturellen Anlass für den Zugriff auf den Namen Arndts. Dessen 75. Todestag stand erst 1935 an. Umso deutlicher traten bei der Greifswalder Namensvergabe neben den regionalen Bezügen – Arndts Geburt auf Rügen, die Greifswalder Universität als Studien- und erster Wirkungsort Arndts – die politischen Motive hervor: die Wahl Arndts als dezidiert „völkischem“ Dichter, Publizisten, Historiker und Politiker zum Namenspatron und der mit dem auf den 28. Juni gelegten Festakt betonte zeitpolitische Bezug zur Revision der Weltkriegsergebnisse.89 Im Falle Halle-Wittenbergs bot das zwar runde, in der NS-Gedenkhierarchie aber deutlich herabgestufte „Deutsche Lutherjahr“ 1933 (zum 450. Geburtstag Luthers) den Anlass der Namensvergabe, wofür man sich einen entsprechend passgerechten „deutschen Luther“ zurecht deutete.90 Im Falle Jenas stand der Bezug zu der von der NS-Führungsspitze zum Staatsakt proklamierten „Nationalen Schillerehrung“ zum eigentlich wenig gedenkrelevanten 175. Geburtstag Schillers im Vordergrund.91 Der „nationale“ Grundton und das Narrativ „völkischer Freiheit“ verbanden diese drei Namensvergaben. Das zeigten auch die zu den Namensvergaben bzw. in ihrem Umfeld gehaltenen Reden über Arndts „völkischen Freiheitskampf“,92 „Luthers deutsche Sendung“93 oder „Schiller und die Gegenwart“.94 Das alles deutet 88 Ministerialvorlage v. 29.10.1934 (wie Anm. 85); zum Jenaer Universitätsjubiläum 1933 vgl. Stefan Gerber: Universitäre Jubiläumsinszenierungen im Diktaturvergleich: Jena 1933 und 1958, in: John, Ulbricht: Jena (2007), S. 299–322. 89 Der aufschlussreiche Aufsatz von Thomas Vordermayer: Die Rezeption Ernst Moritz Arndts in Deutschland 1909/10 – 1919/20 – 1934/35, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 58 (2010), S. 483–508 betont zwar die Eignung Arndts als „Projektionsfläche völkisch-nationaler“ Deutungen u. erwähnt die Greifswalder Namensdebatte ab 1998, geht aber nicht auf die Namensgebung 1933 ein. 90 John: „Lutherjahr“ und „nationale Erhebung“ (2010), S. 95–102; dort auch Hinweise auf entsprechende Literatur zur Luther-Rezeption. 91 John: Namenswechsel – Wendezeiten (2010), S. 117–121; dort auch Hinweise auf entsprechende Literatur zur Schiller-Rezeption. 92 Heinrich Laag: Der Freiheitskampf des Greifswalder Dozenten E. M. Arndt. Rede bei der Feier anlässlich der Verleihung des Namens Ernst-Moritz-Arndt-Universität am 28. Juni 1933, Greifswald 1933. 93 Karl Heussi: Luthers deutsche Sendung, Jena 1934 (Rede zur Lutherfeier der Jenaer Universität am 18.11.1933); ähnlich auch Gerhard Ritter: Luther der Deutsche, München 1933. 94 Arthur Witte: Schiller und die Gegenwart. Rede bei der von der Universität Jena veranstalteten Feier des 175. Geburtstages Friedrich Schillers gehalten am 10. November 1934, Jena 1935.
162
Jürgen John
nicht auf regimedistanzierten universitären Eigensinn hin, sondern auf „nationalen“ Konsens mit dem neuen Regime, auf Bündnisangebote und symbolischen Ausdruck universitärer Kooperationsbereitschaft. Die im deutschen Bildungsbürgertum insgesamt und bei den universitären Eliten im Besonderen tief verwurzelten Denk- und Deutungsmuster vom „deutschen Wesen“ und von „deutscher Bildung und Kultur“ wurden überwiegend sehr bereitwillig auf die „nationale Erhebung“ 1933 und das „Dritte Reich“ projiziert.95 Das zeigte sich auch und gerade bei diesen drei Namensvergaben. Und es passt zu dem von der neueren NS-Forschung verdeutlichten Befund sehr hoher Zustimmungs-, Kooperations-, Gestaltungs- und SelbstmobilisierungsPotenziale im verbliebenen (nicht ausgegrenzten und emigrierten) Wissenschafts- und Hochschulmilieu. Dass die drei 1933/34 vergebenen Namen und ihre Namenspatrone im „Dritten Reich“ höchst unterschiedliche Karriereverläufe erfuhren, steht auf einem anderen Blatt. Nur der völkisch-antisemitische Vordenker und „Volkskrieg“-Propagandist Arndt erwies sich als sehr gebrauchsfähig für das NS-Regime, der Kirchenmann Luther trotz seiner antisemitischen Schriften erheblich weniger, der Freiheits-Dichter Schiller fast gar nicht. Das wirkte sich dann nach dem Ende des NS-Regimes auch erinnerungskulturell auf den Umgang mit den drei Namensgebungen 1933/34 aus. Nur Arndts Name schien zunächst diskreditiert. Bis 1954 ruhte deshalb der auf ihn bezogene Greifswalder Universitätsname. Dann konnte ihn die Universität wieder tragen. Er passte nun nicht nur regional zum universitären Selbstbild, sondern auch zu den für den Aufbau einer „Nationalen Volksarmee“ bemühten „Befreiungskriegs“-Traditionen. Vor allem galt Arndt in der DDR als fortschrittlicher Patriot und Freiheitskämpfer.96 Luther wurde zwar geraume Zeit als „Fürstenknecht“, „Bauernfeind“ und „Judenhasser“ für die „Irrwege deutscher Geschichte“ – „von Luther bis Hitler“ – mit verantwortlich gemacht,97 dann aber als Repräsentant einer „frühbürgerlichen Revolution“ angesehen und schließlich auch als Reformator in den DDR-Gedenkkanon aufgenommen.98 Der Name Luthers stand weder bei der Hallenser Universität noch bei den „Lutherstädten“ Eisleben und Wittenberg jemals in Frage. Und Schillers Name war als „Weimarer Klassiker“ und Symbolname des 95 Christian Jansen: „Deutsches Wesen“, „deutsche Seele“, „deutscher Geist“. Der Volkscharakter als nationales Identifikationsmuster im Gelehrtenmilieu, in: Reinhard Blomert, Helmut Kuzmics, Annette Treibel (Hg.): Transformationen des Wir-Gefühls. Studien zum nationalen Habitus, Frankfurt a. M. 1993, S. 199–278; Georg Bollenbeck: Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters, Frankfurt, Leipzig 1994. 96 Vgl. z. B. Ernst Moritz Arndt. Wissenschaftliche Konferenz über Werk und Wirken Greifswalder Wissenschaftler zu Beginn der bürgerlichen Umwälzung anläßlich des 125. Todestages von E. M. Arndt (=Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Greifswald. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, 1985), H. 3/4. 97 Alexander Abusch: Der Irrweg einer Nation. Ein Beitrag zum Verstaendnis deutscher Geschichte, Mexiko 1945; Wolfram v. Hanstein: Von Luther zu Hitler. Ein wichtiger Abriss deutscher Geschichte, Dresden 1947. 98 Martin Roy: Luther in der DDR. Zum Wandel des Lutherbildes in der DDR-Geschichtsschreibung, Bochum 2000; Rainer Zimmering: Mythen in der Politik der DDR. Ein Beitrag zur Erforschung politischer Mythen, Opladen 2000, S. 169–299; Wolfgang Flügel: Konkurrenz um Reformation und Luther. Die Konfessionsjubiläen der Kirchen und der SED in den Jahren 1967 und 1983, in: Tanner, Ulrich: Spurenlese (2012), S. 261–285.
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
163
„anderen“ – besseren – „Deutschlands der Dichter und Denker“ nach 1945 ohnehin sehr genehm. Die Jenaer Universität war sichtlich froh, seinen Namen zu tragen. Auch die sowjetische Besatzungsmacht wusste das bei der frühen Wiedereröffnung der Jenaer Universität 1945 zu schätzen.99 Mit den „Schillerjahren“ 1955 und 1959 fand Schillers Name zudem prominenten Eingang in die Erinnerungskultur der DDR.100 Vor diesem Hintergrund ist es nicht übermäßig verwunderlich, wenn die drei Universitäten Greifswald, Halle und Jena lange Zeit keinen Anlass sahen, sich gründlich, kritisch und öffentlich mit ihren Namensvergaben 1933/34 auseinanderzusetzen. Keine von ihnen nutzte etwa deren 50. Jahrestage 1983/84. Das ist im Hallenser Falle besonders erstaunlich. Denn da fielen 1983 das staatsoffiziell begangene „Lutherjahr“ und der 50. Jahrestag der Namensvergabe „Martin-Luther-Universität“ zusammen, ohne dass sich die Universität öffentlich dazu äußerte.101 Mit den Namensvergaben 1933/34 im NS-Kontext meinten offenbar weder die drei Universitäten noch die erklärt „antifaschistische“ DDR etwas zu tun zu haben. Daran änderte sich auch nach dem Ende der DDR zunächst wenig. In Jena hat man sich zwar mehrfach historiographisch mit der Namensvergabe 1934 befasst. Doch wurde erst die Gedenkkonstellation 2009 – 250. Geburtstag Schillers und 75. Jahrestag der Namensvergabe – zum Anlass genommen, um dies auch öffentlich mit einer Ausstellung im Rektorat, einer Rede des Rektors und mit einer szenischen Lesung „Befreit Schiller!“102 in recht überzeugender Weise zu tun. In Halle sah sich die Universitätsleitung ein Jahr zuvor mit studentischen Protestaktionen konfrontiert, als sie 2008 einen Festakt zum 75. Jahrestag der Namensvergabe 1933 in offensichtlicher Unkenntnis damaliger Abläufe und Kontexte vorbereitete.103 Dass die Namensurkunde Görings Unterschrift trug, hatte man schlichtweg nicht gewusst. Erst in dieser Lage gestaltete die Universitätsleitung den geplanten „Festakt“ zu einer erinnerungskulturell kritischen Veranstaltung
99 Jürgen John u. a. (Hg.): Die Wiedereröffnung der Friedrich-Schiller-Universität Jena 1945. Dokumente und Festschrift, Rudolstadt, Jena 1998. 100 Lothar Ehrlich, Gunther Mai (Hg.): Weimarer Klassik in der Ära Ulbricht, Köln, Weimar, Wien 2000; Monika Carbe: Schiller. Vom Wandel eines Dichterbildes, Darmstadt 2005, S. 128–178; Jörg Bernhard Bilke: „Denn er ist unser: Friedrich Schiller“. Zur DDR-Rezeption eines deutschen Klassikers, in: John, Ulbricht: Jena (2007), S. 413–424. 101 Allerdings gingen eine kurz zuvor abgeschlossene Dissertation und eine – leider nicht fortgesetzte – Studie über das Lutherjubiläum 1933 auf die Namensvergabe ein – vgl. Elke Stolze: Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg während der Herrschaft des Faschismus (1933 bis 1945) (Diss. Ms.) Halle 1982, S. 25–37; Siegfried Bräuer: Das Lutherjubiläum 1933 und die deutschen Universitäten (I), in: Theologische Literaturzeitung 108 (1983), S. 641–662, hier S. 645–650. 102 Ausstellung „Patron Schiller. Friedrich Schiller und die Universität Jena“ (9.–12.11.2009); Rede des Rektors am 10.11.2009; theatrale Aktion zur Namensgebung: „Befreit Schiller!“ Eine szenische Vorlesung zur Wiedergeburt des Namenspatrons. Kooperationsveranstaltung der Imaginata und der Friedrich-Schiller-Universität mit dem Theaterhaus Jena am 11.11.2009 (Regie: Mario Portmann, Berlin). 103 Vgl. z. B. das Flugblatt der AG Antifaschismus/Antirassismus im Studierendenrat der MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg „‘Festakt‘ für Göring statt Gedenken für die Opfer?“ (im Besitz des Vf.).
164
Jürgen John
um.104 Und im Falle Greifswalds bedurfte es eines „Zeit“-Artikels über den „fatalen Patron“ Arndt 1998,105 um die Frage zu stellen, ob ein solcher Namenspatron für eine öffentliche Einrichtung der bundesdeutschen Demokratie überhaupt tragbar sei - und so eine jahrelange, massive, allseits schmerzhafte Namensdebatte auszulösen. U N I V E RSI TÄTSNA M E N SEI T 1945 M I T FA L LBEISPI E L E N: „ A LT E U N I V E RSI TÄT E N“ Nach 1945 hat sich die universitäre Namenslandschaft tiefgreifend verändert. Das zeigt schon der Blick auf die rein quantitativen Veränderungen der Namensstruktur. Tab. 4
Die quantitative Namensstruktur
A) Vor 1945 Gesamtzahl
Mit Namen, davon
Monarch.
Bürgerl.
Andere
1913
21
19
17
–
2
Ohne 2
1932
23
19
16
1
2
4
1935
23
20
15
4
1
3
Mit Namen, davon
Monarch.
Bürgerl.
Andere
16
11
5
–
4
20
1
8
11
25
B) Heute Gesamtzahl
Ohne
Universitäten aus der Zeit bis 1945 20
Neue Universitäten 45
Technische Universitäten 15
5
1
–
4
10
80
41
13
13
15
39
104 Aus dem dabei auf Bitten der Hallenser Universitätsleitung gehaltenen Vortrag ist dann der in Anm. 65 genannte Text des Vf. hervorgegangen. 105 Jörg Schmidt: Fataler Patron. Noch immer tragen deutsche Schulen, Kasernen und eine Universität den Namen des völkischen Ideologen und Antisemiten Ernst Moritz Arndt, in: Die Zeit, Nr. 46, 5.11.1998, S. 94; vgl. auch das abschließend behandelte Fallbeispiel „Arndt-Universität Greifswald (1998, 2001–10)“.
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
165
Von den zuvor 23 reichsdeutschen Universitäten blieben nach dem Ende des NSRegimes und des Krieges 1945 noch 20 im Vier-Zonen-Deutschland übrig. Breslau und Königsberg wurden polnisch bzw. russisch, Gießen nicht wieder eröffnet. Die beiden 1941 als NS-Besatzungsuniversitäten eingerichteten „Reichsuniversitäten“ Straßburg106 und Posen waren aufgelöst worden. Heute gibt es im gesamten Bundesgebiet 80 Universitäten, darunter mehrere private Universitäten und 15 Technische Universitäten.107 Die Gesamtzahl hat sich also fast vervierfacht. Das erfolgte vor allem durch den starken Ausbau der altbundesdeutschen Universitätslandschaft seit den 1960er Jahren, seit 1990 auch durch den Zuwachs in den „neuen Bundesländern“. Damit veränderte sich die universitäre Namenslandschaft. Zu den noch 16 Namensträgern unter den verbliebenen „alten Universitäten“ aus der Zeit vor 1945 kamen 25 neue Namensträger hinzu, darunter fünf Technische Universitäten. Damit stieg die Gesamtzahl universitärer Namensträger auf 41. Noch stärker aber stieg die Anzahl „namenloser“ Universitäten. Die Relationen von Namensträgern und „namenlosen“ Universitäten sehen heute mit 41 zu 39 (bzw. 36 zu 29 ohne die Technischen Universitäten) ganz anders aus als 1935 (20 zu 3) oder 1945 (16 zu 4). Deutlich verschoben haben sich auch die Relationen unter den Namensträgern. Trotz ihrer Beharrungskraft machen die früher dominierenden monarchischen Namenspatrone heute nur noch 13 von 41 Universitätsnamen aus. Ihnen stehen 13 bürgerliche Namenspatrone und 15 Universitätsnamen unterschiedlichen Typus gegenüber. Die tabellarischen Überblicke über die deutsche Universitätslandschaft nach 1945verdeutlichen diesen Gesamtbefund. Zunächst ein Überblick über die aus der Zeit vor 1945 stammenden Universitäten in den vier Besatzungszonen bzw. den aus ihnen hervorgehenden beiden deutschen Staaten: Tab. 5
1945 / 46 wieder eröffnete Universitäten
westliche Besatzungszonen/Bundesrepublik Name108
Ort
Land
1 Universität Hamburg109
Hamburg
Hamburg
brit. BZ
2 Christian-Albrechts-Universität
Kiel
Schleswig-Holstein
brit. BZ
3 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn
Nordrhein-Westfalen brit. BZ
4 Universität zu
Köln
Nordrhein-Westfalen brit. BZ
110
Köln
Besatzungszone
106 Zur umstritten-„zweigeteilten“ Erinnerung an die französische „Université de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand“ und an die NS-„Reichsuniversität Straßburg“ vgl. den Beitrag Rainer Möhler in diesem Band. 107 Einschließlich des Karlsruher Instituts für Technologie und der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen mit de facto Status Technischer Universitäten. 108 Namensträger fett. 109 1935–1945 „Hansische Universität“. 110 Der Zusatz „zu“ wurde bereits unter dem ersten Rektorat des klassischen Philologen Josef Kroll (1930/31) erwogen, aber erst unter seinem zweiten Rektorat 1945/50 eingeführt.
166
Jürgen John
Name
Ort
Land
5 Westfälische Wilhelms-Universität
Münster
Niedersachsen
brit. BZ
6 Georg-August-Universität
Göttingen
Niedersachsen
brit. BZ
7 Philipps-Universität
Marburg
Hessen
amerik. BZ
8 Johann Wolfgang Goethe-Universität112
Frankfurt/M Hessen
amerik. BZ
9 Ludwig-Maximilians-Universität
München
Bayern
amerik. BZ
10 Friedrich-Alexander-Universität
ErlangenBayern Nürnberg113
amerik. BZ
11 Julius-Maximilians-Universität
Würzburg
Bayern
amerik. BZ
12 Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg
Baden-Würt
amerik. Zone
13 Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg
Baden-Würt
franz. Zone
14 Eberhard-Karls-Universität
Tübingen
Baden-Würt
franz. Zone
15 [Humboldt-]Universität114
Berlin(Ost)
Berlin
[sowj. Zone]
16 Universität Rostock [1976 – 1990 Wilhelm-Pieck-Universität]
Rostock
MecklenburgVorpommern
sowj. Zone
17 Ernst-Moritz-Arndt-Universität115
Greifswald
MecklenburgVorpommern
sowj. Zone
18 Martin-Luther-Universität
HalleWittenberg
Sachsen-Anhalt
sowj. Zone
19 Friedrich-Schiller-Universität
Jena
Thüringen
sowj. Zone
20 Universität Leipzig [1953 – 1991 Karl-Marx-Universität]
Leipzig
Sachsen
sowj. Zone
111
Besatzungszone
SBZ / Ostberlin / DDR
In allen vier Besatzungszonen wurden die Universitäten und Hochschulen 1945 von den jeweiligen Besatzungsinstanzen vorerst geschlossen. Nur ihr interner Dienstbetrieb ging – je nach Lage und Zerstörungsgrad – weiter. Zunächst blieb unklar, ob 111 Von 1945 bis 1952 ruhte der Name „Wilhelms-Universität“; in dieser Zeit „Westfälische Landesuniversität Münster“. 112 Seit 2008 nur noch „Goethe-Universität“; bis 1967 und wieder seit 2008 „Stiftungsuniversität“. 113 Zusatz „Nürnberg“ seit der Eingliederung der 1919 gegründeten Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Nürnberg 1961. 114 Die Berliner Universität lag im sowjetisch besetzten Ostsektor des bis 1948 von einer alliierten Militärkommandantur verwalteten Berlins; sie unterlag der Befehlsgewalt des sowjetischen Stadtkommandanten und damit der SMAD Berlin-Karlshorst; seit Oktober 1945 war sie der Deutschen (Zentral) Verwaltung für Volksbildung unterstellt; 1946 wurde sie als „Universität Berlin“ („Universität Unter den Linden“) wiedereröffnet; seit 1949 „Humboldt-Universität zu Berlin“. 115 1945–1954 ruhte der Name „Arndts“; in dieser Zeit nur „Universität Greifswald“.
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
167
und wann sie ihren Lehrbetrieb wieder aufnehmen konnten. Auch ihr administrativer Bezug war ungewiss. Das Ende des Reiches betraf sie zwar nicht unmittelbar. Alle Universitäten – mit Ausnahme der „Reichsuniversitäten“ Straßburg und Posen – waren bis 1945 einzelstaatlich oder städtisch getragen. Aber die Staatenlandschaft änderte sich. Schon vor der offiziellen Auflösung Preußens durch den Alliierten Kontrollrat 1947 setzte in allen vier Besatzungszonen eine territoriale Neuordnung ein, die alte Länder verschwinden und neue entstehen ließ. Preußische Provinzen wurden aufgelöst oder umgebildet. Trotz dieser Ungewissheiten genehmigten die vier Militärregierungen den universitären Neubeginn dann doch überraschend zügig. Seit dem Spätsommer 1945 konnten 20 der zuvor 23 reichsdeutschen Universitäten in unterschiedlichen Stufen – Lehrbeginn einzelner Institutionen, vollständiger Lehrbeginn und offizielle Festakte – wieder eröffnet werden: jeweils sechs in den britischen, amerikanischen und sowjetischen Besatzungsgebieten, zwei im französischen Besatzungsgebiet. Nach ersten Lehransätzen in Heidelberg und Tübingen (August 1945) nahm Göttingen (britische Zone) am 17. September 1945 als erste Universität die Lehrtätigkeit in allen Fakultäten (aber ohne Festakt) wieder auf. Die ersten Wiedereröffnungs-Festakte fanden in Marburg (amerikanische Zone) am 25. September 1945, in Tübingen (französische Zone) am 15. Oktober 1945 und in Jena (sowjetische Zone) ebenfalls am 15. Oktober 1945 statt, der letzte Wiedereröffnungs-Festakt in Würzburg (amerikanische Zone) am 12. März 1947. Die meisten Wiedereröffnungsvorgänge lagen zwischen November 1945 und Februar 1946.116 Liebig-Universität Gießen (1957) Als einzige der zum Vier-Zonen-Deutschland gehörenden „alten Universitäten“ blieb die hessische „Ludwigs-Universität“ Gießen (amerikanische Zone) geschlossen. Sie hatte schon zuvor unter Profil- und Schließungsdruck gestanden. Nur eine „JustusLiebig-Hochschule für Bodenkultur und Veterinärmedizin“ erhielt 1946 als Nachfolgeinstitution die Wiedereröffnungs-Lizenz. Sie versuchte lange Zeit vergeblich, mittels verschiedener Wege und Profilierungsansätze – etwa als „Universität der biologischen Wissenschaften“ oder als „Ostuniversität“ heimatvertriebener Wissenschaftler – den Universitätsstatus wieder zu erlangen.117 Erst mit dem auf das Gründungsjahr (1607) bezogenen Jubiläum 1957 gelang es schließlich, die Hochschule wieder zur Universität umzuwandeln. Das war – wie es frohgemut und traditionsbewusst zugleich hieß – ein „Neuanfang im Glanz jahrhundertelanger Tradition“; aber nicht unter dem alten – an den Stifter Ludwig V. von Hessen-Darmstadt erinnernden – Namen „Ludwigs-Universität“, sondern mit dem zuvor schon von der Hochschule gewählten 116 Eine vollständige Übersicht der Wiedereröffnungsvorgänge 1945–1947 ist abgedr. bei John u. a.: Die Wiedereröffnung (1998), S. 449–452. 117 Eva-Marie Felschow u. a.: Krieg. Krise. Konsolidierung. Die „zweite Gründung“ der Universität Gießen nach 1945, Gießen 2008, S. 93–103; zum vorangehenden – ebenfalls scheiternden – Versuch, in Bamberg eine solche „Ostuniversität“ zu errichten und so den 1803 verlorengegangenen Universitätsstatus wieder zu erlangen, vgl. Franz Machilek (Hg.): Haus der Weisheit. Von der Academia Ottoniana zur Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Katalog der Ausstellungen aus Anlaß der 350-Jahrfeier, Bamberg 1998, S. 245–268.
168
Jürgen John
einstigen Gießener Chemieprofessor Justus (von) Liebig als Namenspatron.118 Erstmals avancierte so ein Wissenschaftler zum Namenspatron einer deutschen Universität. Erst viel später folgten weitere Universitäten diesem Beispiel: Magdeburg mit der „Ottovon-Guericke-Universität“ (1993) und ihrem Vorläufer der Technischen Universität „Otto von Guericke“ (1987), Duisburg mit der „Gerhard-Mercator-Universität“ (1994 bis 2003), Hannover mit der „Leibniz-Universität“ (2006). Auch Leipzig („Karl-MarxUniversität“ 1953–1991) könnte man dem Typus „Wissenschaftler als Namenspatron“ zurechnen, wenn dieser Name nicht unverkennbar politisch oktroyiert und deshalb baldmöglichst wieder abgelegt worden wäre. Das Ende Preußens und die monarchischen Namenspatrone Meist wurden die Universitäten 1945/46 unter ihren bisherigen Namen wieder eröffnet. Größere Namensdebatten fanden nicht statt. Die Menschen hatten in der „Zusammenbruchs-Gesellschaft“ nach dem Kriege wahrlich andere Sorgen. Hamburg (britische Zone) freilich legte den aus der NS-Zeit stammenden Namen „Hansische Universität“ wieder ab. Die zum preußischen Vorpommern gehörende „Universität Greifswald“ (sowjetische Zone) musste sich bei ihrer Wiedereröffnung im Februar 1946 zunächst mit dieser Bezeichnung begnügen. Bis 1954 ruhte der diskreditierte Name „Ernst-Moritz-Arndt-Universität“, bis er politisch wieder „salonfähig“ wurde. Widersprüchlich sah es bei den anderen bislang preußischen Universitäten mit brandenburgisch-preußischen Fürsten und Monarchen als Namenspatronen aus. Das faktische, 1947 vom Alliierten Kontrollrat dann regulär verfügte Ende Preußens stellte diese Namen zur Disposition. Sie galten weithin als Bestandteil und symbolischer Ausdruck eines preußischen Erbes, das für den „Irrweg der Nation“ in die „deutsche Katastrophe“ der NS-Zeit mit verantwortlich war.119 Die Universität Münster (britische Zone) wurde im November 1945 nicht unter ihrem bisherigen, auf Kaiser Wilhelm II. bezogenen Namen „Wilhelms-Universität“, sondern als „Westfälische Landesuniversität“ wiedereröffnet. 1952 beschloss der Senat auf Initiative der Juristischen Fakultät, den ruhenden, aber nicht förmlich aufgehobenen Namen „Wilhelms-Universität“ wieder herzustellen. Das löste in den folgenden Jahrzehnten mehrere Debatten über den einer demokratischen Öffentlichkeit schwer zu vermittelnden Namenspatron mit dem ebenso entschlossenen, wie bislang scheiternden Bemühen aus, den Universitätsnamen zu ändern.120 Die „Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität“ Bonn (britische Zone) hingegen nahm im November 1945 unter ihrem bisherigen Namen den Lehrbetrieb wieder auf. Weder 1945 noch später gab es größere Debatten um den Namenspatron der Bonner Universität. Damit trug sie als einzige der drei früheren „Friedrich-Wilhelms-Universitäten“ den Namen 118 Felschow u. a.: Krieg (2008), S. 103–116. 119 Alexander Abusch: Der Irrweg einer Nation. Ein Beitrag zum Verstaendnis deutscher Geschichte, Mexiko 1945; Friedrich Meinecke: Die deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Erinnerungen, Wiesbaden 1946; zur Auflösung Preußens und zur Kritik der „preußenfeindlichen“ Deutungsmuster vgl. Christopher Clark: Preußen. Aufstieg und Niedergang 1600–1947, München 2008, S. 761–773. 120 Vgl. das Fallbeispiel Wilhelms-Universität Münster im letzten Teil dieses Beitrages.
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
169
des preußischen Königs weiter – und trägt ihn noch heute. Ein einzelner Versuch, eine gegen diesen Namen gerichtete Kampagne zu starten, fand keine Resonanz.121 Die seit 1911 ebenfalls den Namen Friedrich Wilhelms III. tragende, nun polnische Universität Breslau wurde 1946 als „Universytet Wroclawski“ wieder eröffnet, die Berliner „Friedrich-Wilhelms-Universität“ ebenso „namenlos“ als „Universität Berlin“. Von der Königsberger Albertus- zur Kaliningrader Kant-Universität Die frühere preußische „Albertus-Universität“ Königsberg lag im 1946 gebildeten sowjetrussischen „Oblast Kaliningrad“. Mit der deutschen Vorgeschichte wurde auch der an den Stifter-Herzog Albrecht von Brandenburg-Ansbach erinnernde Name „Albertus-Universität“ hinfällig. Ihre Nachfolge-Einrichtung hieß von 1947 bis 1966 „Pädagogische Universität“, von 1966 bis 2005 „Kaliningrader Staatliche Universität“ (beides russ.). Mit zunehmender Rückbesinnung auf deutsche Geistestraditionen nach dem Ende der Sowjetunion und als symbolischer Ausdruck deutsch-russischer Annäherung wurde die Kaliningrader Universität 2005 im Beisein des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des deutschen Bundeskanzlers Gerhard Schröder in „Russische Staatliche Universität namens Immanuel Kant“ umbenannt (seit 2010 „Baltische föderale Universität namens Immanuel Kant“, beides russ.). Mit dem Namen Kants bekennt sich die ehemals ostpreußische, seit 1945/46 russische Universität am Geburts- und Wirkungsort des Philosophen zu den von ihm verkörperten klassischen deutschen Geistes- und Humanismus-Traditionen. Kaliningrader „Kant-Universität“ statt Königsberger „Albertus-Universität“ – das steht für einen dortigen erinnerungspolitischen Paradigmenwechsel mit freilich ungewissem Ausgang. Humboldt-Universität zu Berlin (1949) Die im sowjetisch besetzten Ostsektor Berlins gelegene, seit Oktober 1945 der Deutschen (Zentral) Verwaltung für Volksbildung unterstellte vormalige „Friedrich-Wilhelms-Universität“ Berlin wurde am 29. Januar 1946 als „Universität Berlin“ (auch „Universität Unter den Linden“ oder „Linden-Universität“) wiedereröffnet und 1949 in „Humboldt-Universität“ umbenannt.122 Die exponierte Rolle der in Besatzungs121 Auskunft des Leiters des Bonner Universitätsarchivs Thomas Becker v. 15.6.2015. 122 Reimer Hansen: Von der Friedrich-Wilhelms-Universität zur Humboldt-Universität zu Berlin. Die Umbenennung der Berliner Universität 1945 bis 1949 und die Gründung der Freien Universität Berlin 1948, (Berlin 2009); ders.: Von der Friedrich-Wilhelms- zur Humboldt-Universität zu Berlin, in: Konrad H. Jarausch u. a.: Sozialistisches Experiment und Erneuerung in der Demokratie – die Humboldt-Universität zu Berlin 1945–2010 (=Geschichte der Universität Unter den Linden 1810 – 2010, Bd. 3), Berlin 2012, S. 19–123, hier v. a. S. 65–72, 109–123; vgl. auch Rüdiger vom Bruch: Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin. Vom Modell „Humboldt“ zur Humboldt-Universität 1810 bis 1949, in: Alexander Demandt (Hg.): Stätten des Geistes. Große Universitäten Europas von der Antike bis zur Gegenwart, Köln, Weimar, Wien 1999, S. 257–278; Konrad H. Jarausch: Gebrochene Traditionen. Wandlungen des Selbstverständnisses der Berliner Universität, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 2 (1999), S. 121–135; Dieter Langewiesche: Humboldt als Leitbild. Die deutsche Universität in den Berliner Rektoratsreden seit dem 19. Jahrhundert, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 14 (2011), S. 15–37.
170
Jürgen John
sektoren geteilten, seit 1948/49 gespalteten Viermächtestadt, die Sezessionsgründung einer Westberliner „Freien Universität“ (1948) und der beiderseitige Anspruch auf „Humboldts Erbe“ ließen die Berliner Vorgänge zu einem besonders herausragenden Fall werden. Wie bei den anderen Universitäten des sowjetischen Besatzungsgebietes stand der Berliner Festakt am 29. Januar 1946 im Spannungsfeld kontroverser Deutungen als „Wiedereröffnung“, „Neueröffnung“ oder „Neugründung“. Bei der Berliner Universität verband sich das zudem mit der strittigen Namensfrage und mit den Debatten um den „Mythos Humboldt“ und um die auf das „Modell Berlin“ projizierte „Idee der Universität“.123 Bereits zu ihrer Wiedereröffnung 1946 wurde sie inoffiziell oft als „HumboldtUniversität“ bezeichnet. „Aus der Friedrich-Wilhelms-Universität, der Pflanzschule königstreuer Staatsdiener, ist die Humboldt-Universität geworden“, schrieb der frühere Reichskunstwart und Mitherausgeber des Westberliner Tagesspiegel Edwin Redslob – 1948 dann einer der Initiatoren der „Freien Universität“ – am Tage der Wiedereröffnung 1946. „Der Name bedeutet Hochschule der Humanität, begründet auf der Tradition des Humanismus.“124 1947 drängten der Studentenrat und der – noch Gesamtberliner – Magistrat im Kontext der Satzungsdebatten darauf, die Universität nach den Brüdern Humboldt zu benennen. Darauf verständigten sich Ende 1947 auch die Deutsche Verwaltung für Volksbildung und der Leiter der SMAD-Volksbildungsabteilung. Die Namensfrage wurde 1948 durch die Gründung der „Freien Universität“ im amerikanischen Sektor Westberlins politisch akut. Denn die sah sich als einzig legitime Nachfolgerin der alten Berliner Universität und des „Erbes Humboldts“. Kurz vor der offiziellen Gründung der „Freien Universität“ am 4. Dezember 1948 beschloss der Senat der Ostberliner Linden-Universität am 23. November 1948, den Namen „Humboldt-Universität zu Berlin“ zu beantragen. Er wurde ihr am 8. Februar 1949 vom Präsidenten der Deutschen Verwaltung für Volksbildung Paul Wandel (SED) verliehen als – wie es in dessen Schreiben hieß – Bekenntnis zum „Geist der Brüder Wilhelm und Alexander von Humboldt“, zur „Einheit von Geistes- und Naturwissenschaften“ und zu den Grundsätzen der „Humanität“ und der „Völkerverständigung“.125 Damit unterstrich die Ostberliner Linden-Universität mitten im eskalierenden Ost-West-Konflikt und der Berlin-Krise ihren Anspruch, als führende deutsche Universität „Humboldts Erbe“ im nunmehr sozialistischen Sinne zu verwalten. Ein Erbe im doppelten Sinne: Nicht nur das Erbe Wilhelm von Humboldts – auf den sich der an deutschen Universitäten gepflegte „Mythos Humboldt“ in der Regel bezieht, sondern auch das Erbe Alexander von Humboldts. Mit den Gebrüdern Humboldt habe die Berliner Universität nun gleichsam zwei „Ahnherren“ erhalten, heißt es in einer neueren Darstellung zur Berliner Universitätsgeschichtsschreibung.126 123 Vgl. auch den Beitrag von Heinz-Elmar Tenorth in diesem Band. 124 Edwin Redslob: Johannes Stroux. Rektor der Humboldt-Universität, in: Der Tagesspiegel, 29.1.1946, zit. nach Hansen: Von der Friedrich-Wilhelms-Universität (2009), S. 79; vgl. auch Christian Welzbacher: Edwin Redslob. Biografie eines unverbesserlichen Idealisten, Berlin 2009. 125 Zit. nach Hansen: Von der Friedrich-Wilhelms- zur Humboldt-Universität (2012), S. 121. 126 Hannelore Bernhardt: Universitätsgeschichtsschreibung an der Humboldt-Universität zu Berlin – Friedrich Herneck zum 100. Geburtstag, in: Wolfgang Girnus, Klaus Meier (Hg.): Die Humboldt-Universität Unter den Linden 1945 bis 1990. Zeitzeugen – Einblicke – Analysen, Leipzig 2010, S. 59–105, hier S. 63 mit dem lapidaren und inhaltlich eher nichtssagenden Satz
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
171
Von den 20 aus der Zeit vor 1945 stammenden „alten Universitäten“ des VierZonen-Deutschlands bzw. der beiden 1949 gegründeten deutschen Nachfolgestaaten trugen 16 Namen mit immer noch überwiegend monarchischen Namenspatronen. Unter den 14 Universitäten der drei westlichen Besatzungszonen bzw. dann der Bundesrepublik waren Hamburg und Köln „namenlos“. Nur die Universität Frankfurt / Main hatte einen bürgerlichen Namenspatron. Anders sah das bei den sechs Universitäten der SBZ / DDR (einschließlich Ostberlins) aus. Hier gab es seit dem Berliner Namenswechsel von „Friedrich Wilhelm“ zu „Humboldt“ keinen monarchischen Namenspatron mehr. Die drei 1933/34 vergebenen Namen Arndt, Luther und Schiller wurden – mit dem Greifswalder Namensintermezzo bis 1954 – beibehalten. Die beiden „namenlosen“ Universitäten Leipzig und Rostock erhielten 1953 und 1976 „von außen“ oktroyierte politische Namen, die sie dann nach dem Ende der DDR 1990/91 wieder ablegten. Marx-Universität Leipzig (1953) Im Falle Leipzigs bot das staatsoffiziell begangene „Karl-Marx-Jahr“ 1953 zum – nicht übermäßig runden – 135. Geburtstag des Philosophen und Marxismus-Begründers den Anlass. Das SED-Zentralkomitee hatte dieses Gedenkjahr ausgerufen Das Staatssekretariat für das Hoch- und Fachschulwesen wies die Universitäten an, Marx‘ Werk und Lehre im Sinne dieses Aufrufs auch durch Erinnerungszeichen zu würdigen. An den Universitäten Berlin und Jena, an denen Marx studiert bzw. extern promoviert hatte, wurden Marx-Büsten aufgestellt.127 Den Großstädten und ArbeiterbewegungsZentren Chemnitz und Leipzig wies die offizielle Gedenkpolitik eine größere Rolle zu. Chemnitz wurde in „Karl-Marx-Stadt“ umbenannt, die Leipziger Universität in „Karl-Marx-Universität“; obwohl Marx nie in Chemnitz und nur en passant in Leipzig gewesen war. Chemnitz erhielt auf Beschluss der DDR-Regierung am 10. Mai 1953 mit einem Staatsakt im Beisein des Ministerpräsidenten Otto Grotewohl den Namen „Karl-Marx-Stadt“. Der Vorschlag, die Leipziger Universität nach Marx zu benennen, ging angeblich von einem der FDJ angehörigen Medizinstudenten aus. Ihn hätten sich dann – hieß es in den universitätsgeschichtlichen Darstellungen der DDR-Zeit – die FDJ-Hochschulgruppenleitung und schließlich auch der Senat zu eigen gemacht. Der erinnerungspolitische Kontext verweist diese Lesart freilich in das Reich der Legenden. Am 30. April 1953 fasste der Senat den politisch gewünschten Beschluss. Ein alternativer Vorschlag, die Universität nach ihrem einstigen Studenten „Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Universität“ „Ein Höhepunkt in der Besinnung auf ihre Geschichte war für die Universität die Verleihung des Namens ihrer Ahnherren Wilhelm und Alexander von Humboldt“. 127 Tobias Kaiser: „Die Universität Jena kann Karl Marx als einen der ihrigen bezeichnen“. Eine Ikone der Arbeiterbewegung in der Erinnerungskultur der Salana nach 1945 , in: John, Ulbricht: Jena (2007), S. 323–339, hier S. 331f.; vgl. aus der Sicht eines Akteurs rückblickend zum Streit um die Jenaer Marx-Büste 1991/92, die schließlich von ihrem öffentlichen Platz entfernt und deponiert wurde, Gottfried Meinhold: Der besondere Fall Jena. Die Universität im Umbruch 1989–1991, Stuttgart 2014, S. 228–249; vgl. zum Stellenwert von Karl Marx im universitären Gedächtnis auch Ingrid Bodsch (Hg.): Dr. Karl Marx. Vom Studium zur Promotion – Bonn, Berlin, Jena, Bonn 2012.
172
Jürgen John
zu benennen, wenn man nun einmal einen Namenspatron haben wolle, wurde abgelehnt.128 Marx‘ Rang und Universalität seien höher einzustufen als die von Leibniz, hieß es. Zudem habe Leibniz die Leipziger Universität schon frühzeitig verlassen. Die offizielle Namensvergabe „Karl-Marx-Universität Leipzig“ erfolgte im Rahmen eines politisch gestalteten Festaktes am 5. Mai 1953 unter Teilnahme der Staats- und Parteifunktionäre Paul Wandel und Kurt Hager. Die DDR-Regierung „schenkte“ auch der Leipziger Universität eine Marx-Büste. Zweifellos hatte sie mit Karl Marx nun einen Denker von Rang als Namenspatron. Aber es war doch zu offenkundig, dass ihr 1953 ein staatsoffizieller und damit „politischer Name“ aufgenötigt wurde, der im Universitätsmilieu ungeliebt blieb. Das weithin verwendete Kürzel „KMU“ deutet in diesem Falle wohl nicht nur auf bürokratische Gewohnheit und den allgemeinen Trend hin, in der universitären Verwaltungssprache solche Kürzel zu verwenden. Sein Gebrauch drückte sicher auch die Distanz zum nicht selbst gewählten Universitätsnamen aus. Nach dem Ende der DDR hat sich die Leipziger Universität im Zuge ihrer Transformation in das bundesdeutsche Hochschulwesen von diesem Namen getrennt, der eindeutig an ihre DDR-Vergangenheit erinnerte. Am 13. Februar 1991 beschloss das Konzil, mit der neuen Universitätsverfassung und der Wahl eines neuen Rektors den Namen „Karl-Marx-Universität“ abzulegen und so wieder in den „namenlosen“ Zustand zurückzukehren.129 Das geschah eher beiläufig, ohne öffentliche Debatte und ohne sich mit dem zeitweisen Namenspatron selbst auseinanderzusetzen. Mit dem Namen von Karl Marx streifte man symbolisch die DDR-Vergangenheit ab. Es schien unnötig zu sein, darüber etwa abstimmen zu lassen. Damit verhielt sich die Universität Leipzig anders als zuvor die Universität Rostock, die im April 1990 eine Urabstimmung über den Universitätsnamen durchführte und anders als „Karl-Marx-Stadt“, wo am 23. April 1990 eine Volksabstimmung über den künftigen Stadtnamen stattfand. Dabei sprachen sich 76 Prozent für den alten Namen „Chemnitz“ aus, woraufhin am 1. Juni 1990 die Rückbenennung von „KarlMarx-Stadt“ in Chemnitz erfolgte. Außerdem gab es in Karl-Marx-Stadt / Chemnitz eine längere öffentliche Debatte um das – schließlich beibehaltene – monumentale Marx-Denkmal.130 Pieck-Universität Rostock ([1961]/1976) Noch offenkundiger als im Leipziger Fall zeigte sich der politische Charakter der Namensgebung „Wilhelm-Pieck-Universität Rostock“ 1975/76 mit ihrem Vorspiel 1960/61. Hier wurde kein universitär ausgebildeter Repräsentant des Geisteslebens Namenspatron wie 1953 in Leipzig, sondern ein Politiker und Staatsfunktionär. Das 128 Zur Namensvergabe 1953 vgl. Konrad Krause: Alma Mater Lipsiensis. Geschichte der Universität Leipzig von 1409 bis zur Gegenwart, Leipzig 2003, S. 359–361; Ulrich v. Hehl u. a.: Das zwanzigste Jahrhundert (= Geschichte der Universität Leipzig 1409–2009. Ausgabe in fünf Bänden, Bd. 3), Leipzig 2009, S. 506–508. 129 Ebd., S. 815. 130 Alice v. Plato: (K)ein Platz für Karl Marx. Die Geschichte eines Denkmals in Karl-Marx-Stadt, in: Adelheid v. Saldern (Hg.): Inszenierte Einigkeit. Herrschaftspräsentation in DDR-Städten, Stuttgart 2003, S.145–182.
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
173
war seit den auf die jeweils amtierenden deutschen Kaiser bezogenen Universitätsnamen Straßburgs (1872) und Münsters (1907) als Grenzfällen zwischen Stifter- und Politikernamen bislang beispiellos in der universitären deutschen Namensgeschichte. Es blieb auch in der Folgezeit singulär; mit einer, freilich anders gelagerten Ausnahme: 2003 erhielt die Hamburger Bundeswehr-Universität den Namen „HelmutSchmidt-Universität“ und damit ebenfalls einen – zwar im Ruhestand befindlichen, aber damals noch lebenden und von dieser Universität zweifellos gewollten – Politiker zum Namenspatron. Aber hier wählte eine Spezial-Universität der Bundeswehr den Namen des früheren Verteidigungs-Ministers (und Bundeskanzlers) als Ausdruck ihres eigenen Selbstverständnisses zum Namenspatron. Ganz anders sah es im Falle Rostocks aus. Da ging die 1960 beabsichtigte, dann abgebrochene, erst 1975/76 realisierte Namensvergabe „Wilhelm-Pieck-Universität“ auf Beschlüsse der SED-Führungsgremien und des DDR-Ministerrates zurück. Am 9. September 1960 beschloss das SED-Zentralkomitee, den zwei Tage zuvor verstorbenen DDR-Staatspräsidenten im größeren Stile öffentlich zu ehren. Der DDR-Ministerrat fasste am 13. Oktober 1960 einen entsprechenden MaßnahmenBeschluss, der unter anderem die Namensvergaben „Wilhelm-Pieck-Stadt Guben“ und „Wilhelm-Pieck-Universität Rostock“ vorsah.131 Im Falle des an der deutsch-polnischen Neiße-Grenze gelegenen Gubens als Geburtsstadt Piecks waren die Gründe für diesen erinnerungspolitischen Akt nachvollziehbar. Im Falle Rostocks – die überlieferten Akten geben darüber leider keine Auskunft – scheint man unbedingt eine Universität als Namensträger gewollt zu haben. Und da stand unter den sechs Universitäten der DDR nur noch eine „namenlose“ zur Verfügung – Rostock. Bereits wenige Tage nach dem ZK-Beschluss teilte der Staatssekretär für das Hoch- und Fachschulwesen Wilhelm Girnus der Rostocker Universität am 12. September 1960 telegraphisch mit, der Ministerrat sei bereit, ihr „die ehre zuteil werden zu lassen, den namen des 1. praesidenten des deutschen arbeiter- und bauernstaates anzunehmen, sofern der senat diesen wunsch aeussert“. Sie solle dafür unverzüglich den Senat einberufen.132 Noch am gleichen Tage fasste der Senat in einer außerordentlichen Sitzung einstimmig den entsprechenden Beschluss. Allerdings musste er sich erhebliche Mühe geben, ihn mit Bezügen Piecks zur Universität und zur Wissenschaft zu begründen. Der „teure Verstorbene“ habe in Wort und Tat viel für die Wissenschaft getan, auch die Nationalpreise stets persönlich vergeben. Sein Name stehe für eine progressive Hochschulpolitik seit den Neueröffnungen 1945/46. Es gäbe ein „Wilhelm-Pieck-Stipendium“. Und er habe die Universität immerhin zweimal besucht: kurz nach seinem Amtsantritt 1949 und 1951 zur Eröffnung der Schiffsbautechnischen Fakultät.133 131 BArchB, DC 20, Nr. 23579 (enthält auf Guben und Rostock bezogene Unterlagen und Maßnahmepläne zur Durchführung des DDR-Ministerratsbeschlusses v. 13.10.1960); DY 30/J IV 2/2, Nr. 747, Bl. 7r (Beschluss des SED-Politbüros v. 31.1.1961 zur Aufhebung des SED-ZK-Beschlusses v. 9.9.1960). 132 Universitätsarchiv Rostock (UAR), R 2279, n. f.; die Rostocker Namensvergabe-Vorgänge 1960/61 u. 1975/76 sind bislang nicht untersucht und dargestellt worden; der Vf. dankt Frau Bettina Kleinschmidt für die Kopien dieser und der folgend genannten Quellen aus dem UAR. 133 UAR, R 2279, n. f. (Protokoll der Senatssitzung v. 12.9.1960).
174
Jürgen John
Die Universität übermittelte diesen Beschluss dem DDR-Ministerrat, der die Umbenennung Gubens und der Universität Rostock auf der Grundlage seines Beschlusses vom 13. Oktober vorbereiten ließ. Als Termin wurde der 3. Januar 1961 – Piecks Geburtstag – ins Auge gefasst. Allerdings kam nur die Gubener Namensvergabe wie geplant und mehr oder weniger reibungslos mit einem eigenen städtischen Festkomitee unter Leitung des Bürgermeisters zustande.134 Die Rostocker Namensvergabe geriet ins Stocken und unterblieb. Zunächst wurde der geplante Festakt von dem universitär ungünstigen Januar-Termin auf den 25. Februar 1961 – den 15. Jahrestag der Wiedereröffnung der Universität 1946 – verlegt.135 Die offizielle Umbenennung der Universität sollte durch den stellvertretenden DDR-Ministerrats-Vorsitzenden Lothar Bolz (NDPD) erfolgen. Die Verantwortlichkeiten für die vorbereitenden Maßnahmen lagen auf der Regierungsebene beim Staatssekretariat für das Hoch- und Fachschulwesen, auf der regionalen Ebene bei der SED-Bezirksleitung Rostock in Kooperation mit dem Rat des Bezirkes, der Stadt und der Universität. Sie verliefen – mehreren Vermerken des Büros des Ministerrates zufolge – äußerst schleppend. Von einer begeisterten Vorbereitung der Namensvergabe konnte weder an der Universität noch außeruniversitär auf Regional- und Regierungsebene die Rede sein. Ende Januar 1961wurde sie abgebrochen. Das SED-Politbüro hob am 31. Januar den ZK-Beschluss vom 9. September 1960 auf. Das Büro des Ministerpräsidenten vermerkte das am 5. Februar lapidar auf dem Ablaufplan für den zum 25. Februar vorbereiteten Festakt.136 Am 12. Februar 1960 teilte der Büroleiter dem Präsidium des DDR-Ministerrates außerhalb der offiziellen Tagesordnung mit, dass die Beschlüsse zur Umbenennung der Rostocker Universität aufgehoben seien.137 Die Gründe für diesen Abbruch der Rostocker Namensvergabe – ein in der universitären Namensgeschichte singulärer Fall – scheinen vielfältig gewesen zu sein. Sie lagen offenbar vor allem in der reservierten Stimmung an der Universität und in dem unklaren deutschlandpolitischen Kurs wenige Monate vor dem Mauerbau, der die Berliner Partei- und Staatsführungsgremien veranlasste, die hochschulpolitisch heikle Rostocker Namensvergabe wieder fallen zu lassen. Darüber gibt vor allem der Bericht des Rektors am 8. Februar 1961 im Senat Auskunft. Ihm zufolge gab es nach dem hastigen Senatsbeschluss vom 12. September inner- wie außerhalb des Senats erhebliche Diskussionen über Sinn und Nutzen der vorgesehenen Namensvergabe; zwar vielfach Zustimmung, aber auch eine „gewisse Uninteressiertheit“, Ablehnung, sogar Missstimmung und die Ansicht, es sei besser, Fragen der Wissenschaft in den Vordergrund zu stellen. Es sei – betonten der Rektor und einer der Dekane – letztlich eine Frage der Pietät gegenüber dem Verstorbenen und der „Staatsräson“ gewesen, den gewünschten Beschluss am 12. September zu fassen, um dem verstorbenen Staatspräsidenten so ein „lebendiges Denkmal“ zu setzen. Sie hätten auch erwartet, dass die Regierung damit eine „Verpflichtung der Universität gegenüber“ übernehme. Unterdes habe sich aber die „politische Situation 134 BArchB, DC 20, Nr. 23579, Bl.2r–66r. 135 Zur Verlegung und Vorbereitung des Festaktes vgl. BArchB, DC 20, Nr. 23579, Bl. 67r–83r sowie UAR, R 2280 u. 2281. 136 BArchB, DY 30/J IV 2/2, Nr. 747, Bl. 7r; DC 20, Nr. 23579, Bl. 67r. 137 BArchB, DC 20-I/4, Nr. 437, Bl. 165r.
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
175
wesentlich verändert“. Die Berliner Gremien hätten ihre Beschlüsse zur Namensvergabe wieder zurückgenommen. „Mit Rücksicht auf das gesamtdeutsche Gespräch, in das die Universitäten ganz bewußt hineingestellt sind, erschien es in der gegebenen Situation richtiger, auf die Namensgebung zu verzichten.“ Er selbst – erklärte der Rektor – habe dem zugestimmt und bitte den Senat, das nachträglich zu billigen.138 Für die Rostocker Universität war der ganze Vorgang eine höchst fatale Angelegenheit. Zweimal binnen kurzer Zeit hatte sie Berliner Beschlüsse nachzuvollziehen gehabt. Und es sei ein „schmerzlicher Prozess“, feststellen zu müssen, „nicht gründlich genug überlegt“ zu haben.139 Auf einem Pressegespräch am 1. Februar 1961 vermied der Prorektor peinlichst, auf die fatale Namensfrage einzugehen. Er schilderte ausführlich die progressiven Traditionen der Rostocker Universität im allgemeinen und seit der Wiedereröffnung am 25. Februar 1946 im Besonderen. Abschließend bat er die Pressevertreter lediglich, nichts über die Namensfrage zu schreiben.140 Anders als dieser abgebrochene erste Ansatz verlief dann 15 Jahre später die Namensvergabe 1975/76 mehr oder weniger reibungslos mit dem politisch gewollten Ergebnis. Diesmal bot der 100. Geburtstag Piecks den Anlass, der Universität Rostock den „Ehrennamen Wilhelm-Pieck-Universität“ zu verleihen. Erneut fasste das SEDPolitbüro die entsprechenden Beschlüsse. Am 15. Juli 1975 beschloss es die Namensvergabe und legte auch gleich die Maßnahmen fest, um einen strikt kontrollierten Ablauf zu sichern. Diesmal sollte nichts schief gehen: an der Universität Rostock werde – hieß es im bestätigten Beschluss – eine Kommission zur Vorbereitung der Namensvergabe gebildet; die wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Räte der Universität hätten sie öffentlich zu beantragen; der Minister für das Hoch- und Fachschulwesen sei in Zusammenarbeit mit der SED-Bezirksleitung Rostock für die Maßnahmen verantwortlich.141 Am 4. September 1975 stellten die Räte der Rostocker Universität den gewünschten Antrag. Er wiederholte weitgehend die Argumente von 1960 für die Namensvergabe, ohne freilich die damals abgebrochene Initiative zu erwähnen.142 Am 14. Oktober 1975 bestätigte das SED-Politbüro im Umlaufverfahren die Namensvergabe und den Festakt mit der Festrede des für Wissenschaft und Hochschulwesen zuständigen ZKSekretärs Kurt Hager und mit der Namensvergabe durch den Hoch- und Fachschulminister Hans-Joachim Böhme (SED).143 Am 23. Oktober fasste der DDR-Ministerrat den durchführenden Beschluss. Der Festakt fand am 8. Januar 1976 mit der Festrede Hagers unter dem Titel „Ansporn und Verpflichtung“ statt.144 Es ist davon auszugehen, dass die Rostocker Universität, den 1976 verliehenen „Ehrennamen“ eher distanziert trug und sicher nicht als Ausdruck universitärer Identität und Tradition ansah. Das belegt auch die im Falle Rostocks besonders frühzeitige 138 UAR, R 270, n. f. 139 So der Vorsitzende der Universitätsgewerkschaftsleitung in der Senatssitzung am 8.2.1961 (UAR, R 270, n. f.) 140 UAR, R 2281, n. f. (Niederschrift des Pressegesprächs v. 1.2.1961). 141 BArchB, DY 30/J IV 2/2, Nr. 1571, Bl. 5r, 22r. 142 UAR, R 2282, n. f. 143 BArchB, DY 30/J IV 2/3, Nr. 2373, Bl. 1r. 144 UAR, R 2282, n. f. (gedruckte Festrede Hagers), R 2284, n. f. (Mitteilung des Rektors v. 8.1.1976 über die Namensvergabe), R 2288, n. f. (Zeitungsausschnitte mit Berichten über die Namensverleihung).
176
Jürgen John
Initiative 1990, den Namen wieder abzulegen. Der Wissenschaftliche Rat setzte eine Namenskommission ein, die am 14. Februar 1990 ihre Stellungnahme vorlegte: Die Namensvergabe 1975/76 sei ein deutliches Beispiel für die Einflussnahme der SED auf die Universitäten und „ein zeittypischer Ausdruck der Verflechtung von Parteiapparat, Staat und Universität, die den demokratischen Prinzipien einer freien Wissenschaft widerspricht“. Deshalb empfahl die Kommission, Piecks Namen abzulegen, die frühere Bezeichnung „Universität Rostock“ wieder zu führen und sich so „auf die vielhundertjährige Tradition unserer Alma mater Rostochiensis zu besinnen“.145 Zwar verwiesen einzelne Stimmen auf die positiven Seiten im Wirken Piecks und meinten, vor „überhasteten Schritten“ warnen zu müssen. Die Mehrheit sah das aber anders. Eine für den April 1990 angesetzte Urabstimmung aller Universitätsangehörigen – auch der Studierenden – ergab bei einer Wahlbeteiligung von 55,1 Prozent ein klares Votum (79,2 Prozent) für die alte Bezeichnung „Universität Rostock“, die daraufhin den Namen Piecks ablegte.146 U N I V E RSI TÄTSNA M E N SEI T 1945 M I T FA L LBEISPI E L E N: „ N EU E U N I V ERSI TÄT E N“ Schließlich sind noch die seit 1945 entstandenen (neu oder wieder gegründeten) Universitäten in den Überblick einzubeziehen. Tab. 6
Seit 1945 (wieder) gegründete Universitäten147
A) Voll-, Spezial- und Privatuniversitäten Name
Ort
Land
1 Johannes Gutenberg-Universität
Mainz
Rheinland-Pfalz
2 Universität des Saarlandes
Saarbrücken Saarland
148
149
Gründung 1946 1947/48
3 Freie Universität
Berlin(West) Berlin
1948
4 Justus-Liebig-Universität150
Gießen
Hessen
1957
5 Universität Regensburg
Regensburg Bayern
1962
6 Ruhr-Universität
Bochum
1965
Nordrh.-Westfalen
7 Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf
Nordrh.-Westfalen 1965, 1988
8 Universität Konstanz151
Konstanz
Bad.-Württemberg
1966
145 UAR, R 2285, n. f. 146 Ebd.; die Stadt Guben legte ebenfalls 1990 den Namen „Wilhelm-Pieck-Stadt“ ab. 147 Spezialuniversitäten mit (x) gekennzeichnet; zeitweise Zwischenformen kursiv mit Existenzdauer; Namensträger und spätere Namensvergaben fett. 148 Wiedergründung; Vorgänger 1476/77–1798. 149 Vorläufer 1947 als „Centre Universitaire d’Études Supérieures de Hombourg“ unter dem Patronat der Universität Nancy in Homburg gegründet; 1948 Aufnahme des Lehrbetriebes als Universität an den Standorten Saarbrücken und Homburg. 150 Wiedergründung; Vorgänger 1945 geschlossen; dazwischen 1946–1957 „Justus-Liebig-Hochschule für Bodenkultur und Veterinärmedizin“ mit dem Klammerzusatz „ehem. Universität“. 151 Gründung als Reformuniversität.
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland Name 9 Universität Stuttgart
152
10 Universität Mannheim
153
11 Universität Ulm
177
Ort
Land
Gründung
Stuttgart
Bad.-Württemberg
1967
Mannheim
Bad.-Württemberg
1967
Ulm
Bad.-Württemberg
1967
Stuttgart-H. Bad.-Württemberg
1967
13 Universität Bielefeld156
Bielefeld
Nordrh.-Westfalen
1969
14 Universität Augsburg
Augsburg
Bayern
1970
154
12 Universität Hohenheim155
(x)
Doppeluniversität TrierKaiserslautern157
Trier / Rheinland-Pfalz Kaiserslautern
15 Universität Bremen 16 Universität-Gesamthochschule
Bremen
Bremen
1970–1975 1971
Kassel
Hessen
Gerhard-Mercator-Universität159 – Gesamthochschule
Duisburg
Nordrh.Westfalen
1972/80–2003, 1994
Universität Essen160 – Gesamthochschule
Essen
Nordrh.Westfalen
1972–2003
17 Universität Paderborn161
Paderborn
Nordrh.-Westfalen 1972/2003
18 Universität Siegen
Siegen
Nordrh.-Westfalen 1972/2003
19 Bergische Universität
Wuppertal
Nordrh.-Westfalen 1972/2003
20 Otto-Friedrich-Universität164
Bamberg
Bayern
Oldenburg
Niedersachsen
158
162 163
21 Carl von Ossietzky-Universität
165
1971/93
1972/79, 1988 1973, 1991
152 Zur Universität erhoben; vorher Technische Hochschule (1876, Vorgänger 1829); Vorläufer: Hohe Karlsschule (1770–1794). 153 Zur Universität erhoben; vorher Handels- (1907) bzw. Wirtschaftshochschule (1946). 154 Gründung als Medizinisch-Naturwissenschaftliche Hochschule mit Universitätsstatus. 155 Zur Universität erhoben; vorher Landwirtschaftliche Hochschule (1904; Vorgänger 1818). 156 Gründung als Reformuniversität. 157 Im Falle Triers Wiedergründung; Vorgänger 1798 aufgehoben; 1975 Trennung in zwei Universitäten. 158 Gründung als Gesamthochschule; voraus ging eine Pädagogische Hochschule; seit 1993 Universität-Gesamthochschule. 159 Vorgänger-Universität 1655–1818; Wiedergründung 1972 als Gesamthochschule; voraus ging eine Pädagogische Hochschule; 1980 „Universität – Gesamthochschule“; 1994 Name „Gerhard Mercator“; 2003 Fusion zur Universität Duisburg-Essen. 160 Voraus gingen eine Pädagogische und eine Medizinische Hochschule; 2003 Fusion zur Universität Duisburg-Essen 161 Gründung als Gesamthochschule; seit 2003 Universität. 162 Gründung als Gesamthochschule; seit 2003 Universität. 163 Gründung als Gesamthochschule; seit 2003 Universität. 164 Wiedergründung; Vorgänger-Universität 1773–1803 (mit Vorläufer einer 1647 gebildeten Akademie); 1972 Gesamthochschule durch Zusammenschluss der 1923 gebildeten PhilosophischTheologischen Hochschule (zuvor katholisches Lyzeum) und der 1958 gegründeten Pädagogischen Hochschule; 1979 Universität; 1988 alter Name (von 1773) wieder verliehen. 165 Integrierter Vorgänger: Pädagogische Hochschule (seit 1948; zuvor Lehrerseminar seit 1793, 1920–1939 höhere pädagogische Lehranstalt, 1945–1948 Pädagogische Akademie).
178
Jürgen John
Name
Ort
Land
Gründung
22 Universität der Bundeswehr
(x)
München
Bayern
23 Universität der Bundeswehr / Helmut-Schmidt-Universität
(x)
Hamburg
Hamburg
24 Universität Osnabrück166
Osnabrück
Niedersachsen
1974
25 Universität Bayreuth
Bayreuth
Bayern
1975
Hagen
Nordrh.-Westfalen 1974/2003
Trier
Rheinland-Pfalz
28 [Gottfried Wilhelm] Leibniz-Universität
Hannover
Niedersachsen
29 Universität Passau
Passau
Bayern
1978 1980
26 Fernuniversität
(x)
167
27 Universität Trier168 169
1973 1973, 2003
1975 1978, 2006
30 Katholische Universität
(x)
Eichstätt
Bayern
31 Universität zu Lübeck170
(x)
Lübeck
Schleswig-Holstein 1985/2002
32 Leuphana Universität171
Lüneburg
Niedersachsen
1989, 2006
33 Universität Hildesheim
Hildesheim Niedersachsen
1989
34 Universität Koblenz-Landau
Koblenz-L.
Rheinland-Pfalz
1990
35 Universität Potsdam173
Potsdam
Brandenburg
1991
Frankfurt/O Brandenburg
1991
37 Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg
Sachsen-Anhalt
1993
38 Universität Erfurt
Erfurt
Thüringen
1994
Weimar
Thüringen
1996
172
36 Europa-Universität Viadrina174 175
176
39 Bauhaus-Universität
177
(x)
166 Zur Universität erhoben; vorher Pädagogische Hochschule (1953); Vorläufer: Jesuitenuniversität 1629/32. 167 Gründung als Gesamthochschule; seit 2003 Universität. 168 Durch Trennung der Doppeluniversität Trier-Kaiserslautern, wobei Kaiserslautern Technische Universität wurde. 169 1968 Technische Universität (zuvor Technische Hochschule seit 1879, Vorgänger „Höhere Gewerbeschule“ seit 1831); 1978 Volluniversität unter Integration der Pädagogischen Hochschule. 170 1964 Medizinische Akademie (2. Medizinische Fakultät der Universität Kiel); 1973 Medizinische Hochschule; 1985 Medizinische Universität; seit 2002 Universität zu Lübeck. 171 Zur Universität erhoben; vorher Pädagogische Hochschule (1946); „Leuphana“ – antike ElbeSiedlung aus dem 2. Jh. (vielleicht heutiges Lüneburg). 172 Zur Universität erhoben; vorher Pädagogische Hochschule (1946 in Alfeld, seit 1970 in Hildesheim); seit 2003 Stiftungsuniversität. 173 Vorgänger: Pädagogische Hochschule Potsdam; Deutsche Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften Potsdam-Babelsberg. 174 Wiedergründung; die 1506 gegründete Vorgänger-Universität wurde 1811 durch Anschluss an die Universität Breslau geschlossen. 175 1953–1961 Hochschule für Schwermaschinenbau; 1961–1987 Technische Hochschule „Otto von Guericke“, 1987–1993 Technische Universität „Otto von Guericke“. 176 Wiedergründung; Vorgänger-Universität 1392–1816; Vorläufer-Institutionen der neuen Universität: Pädagogische Hochschule Erfurt-Mühlhausen; Medizinische Akademie Erfurt. 177 Zur Universität erhoben; vorher: Hochschule für Architektur und Bauwesen (1954), VorgängerInstitutionen seit 1860, darunter 1919/25 Staatliches Bauhaus Weimar.
179
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland Name
Ort
Land
40 Universität Flensburg
Flensburg
Schleswig-Holstein
2000
41 Universität Duisburg-Essen
Duisburg/ Essen
Nordrh.-Westfalen
2003
42 Universität Vechta179
Vechta
Niedersachsen
2010
43 Universität Witten-Herdecke
Witten
Nordrh.-Westfalen
1982
44 Jacobs University Bremen
Bremen
Bremen
45 Zeppelin-Universität181
Friedrichshafen
Baden-Württemberg
178
Gründung
Private Universitäten
180
2001, 2007 2003
B) Technische Universitäten 1 Technische Universität182
Berlin(West) Berlin
1946
2 Technische Universität183
Dresden
Sachsen [DDR]
1961
Karlsruhe
Bad.-Württemberg 1967–2006
Hannover
Niedersachsen
1968–1978
3 Technische Universität Carolo-Wilhelmina
Braunschweig
Niedersachsen
1968
4 Technische Universität187
Clausthal
Niedersachsen
(1775)/1968
Universität (TH)
184
Technische Universität
185 186
5 Technische Universität
München
Bayern
6 (Technische) Universität188
Dortmund
Nordrh.-Westfalen 1968/2007
1968
178 Zur Universität erhoben; vorher Pädagogische Hochschule (1946); Bildungswissenschaftliche Hochschule (1994). 179 Zur selbständigen Universität erhoben; vorher: Pädagogische Hochschule (1947); 1973–1995 Abteilung Vechta der Universität Osnabrück; 1995 Hochschule Vechta. 180 2001 „International University; 2007 „Jacobs University“. 181 Private Stiftungsuniversität als GmbH; Stiftungsgeberin: Zeppelin Baumaschinen GmbH. 182 Zur Universität erhoben; zuvor Technische Hochschule (1890; Vorgänger 1828–1871). 183 Zur Universität erhoben; zuvor Technische Hochschule (1890; Vorgänger 1828–1871). 184 Namenszusatz „Technische Hochschule“ als Auflage des Ministeriums; 2006 aufgegangen im „Karlsruher Institut für Technologie“. 185 Seit 1978 Universität Hannover. 186 Zur Universität erhoben; zuvor Technische Hochschule „Carolo-Wilhelmina“ (1878); Vorgänger Collegium Carolinum (1745). 187 Seit 1968 Universität; zuvor Bergakademie (1775 gegr.) 188 1968 nach Protesten gegen die Gründung der Ruhr-Universität Bochum als Universität mit Schwerpunkt Natur- und Ingenieurwissenschaften gegründet; seit 2007 Technische Universität.
180
Jürgen John
Name
Ort
Land
7 (Technische) Universität
Kaiserslautern
Rheinland-Pfalz
8 Technische Universität
HamburgHarburg
Hamburg
9 Technische Universität190
Karl-Marx- Sachsen [DDR] Stadt [Chemnitz]
1986
Magdeburg Sachsen-Anhalt [DDR]
1987–1993
10 Brandenburgische Technische Universität192
Cottbus
Brandenburg
1991, 1994
11 Technische Universität
Ilmenau
Thüringen
12 Technische Universität Bergakademie
Freiberg
Sachsen
13 Technische Universität
Darmstadt
Hessen
189
Technische Universität „Otto von Guericke“191 193 194
195
Gründung 1975/2003 1978
1992 [1765], 1993 1997
de facto TU-Status 14 Karlsruher Institut für Technologie196
Karlsruhe
15 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule197 Aachen
Bad.-Württemberg
2006
Nordrh.-Westfalen
[1870/80]
Seit 1946 entstanden 45 neue Universitäten, davon 37 Voll- und acht Spezial-Universitäten (darunter drei private) – 34 bis 1989, elf seit 1990. Zeitweise Zwischenstufen sind dabei nicht mitgezählt. Zunächst blieb der Zuwachs eher gering. Die eigentliche Gründungswelle setzte 1965 ein – allerdings nur in der Bundesrepublik. In der DDR kamen zu den sechs „alten“ Universitäten lediglich zwei Technische Universitäten (Dresden und Magdeburg) hinzu. Erst nach dem Ende der DDR entstanden in den „neuen Bundesländern“ fünf neue Voll- und Spezialuniversitäten sowie drei weitere Technische Universitäten. Von den fünf 1946 bis 1962 gegründeten Volluniversitäten waren vier Namensträger. Danach überwogen die „namenlosen“ Neugründungen. 189 Trennung der Doppeluniversität Trier-Kaiserslautern; 1975–2003 Universität; seit 2003 Technische Universität. 190 1986 Universität, zuvor TH; seit 1992 „TU Chemnitz-Zwickau“; seit 1997 TU Chemnitz. 191 Seit 1993 „Otto-von-Guericke-Universität“. 192 1991 zur Universität erhoben; zuvor Ingenieurhochschule für Bauwesen; Zusatz „Brandenburgische“ 1994; seit 2013 nach Fusion mit der Fachhochschule Senftenberg „Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg“. 193 Zur Universität erhoben; zuvor: Technikum (1894), Hochschule für Elektrotechnik (1953), Technische Hochschule (1963). 194 Bergakademie seit 1765; Zusatz „Technische Universität“ seit 1993. 195 Zur Universität erhoben; zuvor TH. 196 Fusion der Universität Karlsruhe (Universität seit 1967, zuvor TH) mit dem 1953 gegründeten Forschungszentrum Karlsruhe der Helmholtz-Gesellschaft; Namensvorbild: Massachusetts Institut of Technology. 197 Bewusstes Festhalten am Traditionsnamen „Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule“ unter Verzicht auf Status „Technische Universität“
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
181
Insgesamt kamen bei den Voll- und Spezialuniversitäten seit 1946 dauerhaft 20 Namen hinzu; ein monarchischer Namenspatron, acht bürgerliche Namenspatrone – darunter ein Politikername (Bundeswehr-Universität Hamburg) – sowie elf andere Namen unterschiedlichen Typs: drei programmatisch-„bekennende“ Namen (Freie Universität Berlin, Europa-Universität Frankfurt/Oder, Bauhaus-Universität Weimar), vier staatsbzw. landschaftsbezogene Namen (Saarbrücken, Bochum, Wuppertal, Lüneburg), drei Träger- bzw. Funktionsnamen (Katholische Universität Eichstätt, BundeswehrUniversität München, Fernuniversität Hagen), ein Name privater Geldgeber (JacobsUniversität). Bei den Technischen Universitäten ergaben sich fünf neue Namen: ein monarchischer Name, zwei Staats- bzw. Landschaftsbezüge sowie zwei Spezialbezüge. Die meisten (10) blieben „namenlos“. Gutenberg-Universität Mainz (1946) Die vier „westlichen“ Universitätsgründungen der Jahre 1946 bis 1948 trugen sehr unterschiedlichen Charakter. Das spiegelte sich auch in der jeweiligen Namenslage wider. Die Westberliner Technische Hochschule Charlottenburg konnte bei ihrer Wiedereröffnung 1946 problemlos zur – ersten deutschen – „Technischen Universität“ umgestaltet werden. Auf einen regulären Namenspatron verzichtete sie. Bei der Wiedergründung der Universität Mainz 1946 stand der künftige Namenspatron Johannes Gutenberg von vornherein außer Frage. Schon die erste Anregung, die 1798 geschlossene Universität als Zentraluniversität für den französisch besetzten pfälzisch-mittelrheinischen Raum wieder zu eröffnen, schlug diesen Namen vor. Das entspräche den „in den letzten Jahrzehnten in Deutschland aufgekommenen Brauch, Hochschulen den Namen des bedeutendsten Mannes der betreffenden Stadt zu geben.“198 Wenn sich die neue Mainzer Universität nach einem „großen Manne benennen will“, hieß es in einer späteren Begründung, so käme nur Gutenberg in Frage, der mit seiner Erfindertat „das Wissen unzerstörbar und unverlierbar gemacht“ und so in der ganzen Welt verbreitet habe.199 Mit Gutenberg als Namenspatron war man allseits zufrieden. Debatten über ihn hat es nie gegeben, nur eine Glosse über die Bindestriche im Namen „Johannes-Gutenberg-Universität“.200 Universität des Saarlandes (1948) Wie Mainz wurde 1947/48 die Universität Saarbrücken-Homburg im französisch besetzten und seit 1947 Frankreich angeschlossenen Saarland im Zeichen deutschfranzösischer Annäherung gegründet – aber ohne Namenspatron. Die Saarbrücker 198 Anton Felix Napp-Zinn: Anregung für die Wiedereröffnung der Universität Mainz (9.10.1945), abgedr. in: Helmut Mathy (Bearb.): Die Wiedereröffnung der Mainzer Universität 1945/46. Dokumente, Berichte, Aufzeichnungen, Erinnerungen, Mainz 1966, S. 39–44, hier S. 41. 199 Aloys Ruppel: Begründung dafür, daß die neue Mainzer Universität den Namen Gutenberg tragen soll (21.3.1946), abgedr. ebd., S. 57–60, hier S. 59. 200 Kurt Wagner: Der Bindestrich, in: Jahrbuch der Vereinigung Freunde der Universität Mainz 8 (1959), S. 86–89; der Vf. dankt Herrn Christian George (Universitätsarchiv Mainz) für diesen Hinweis.
182
Jürgen John
Universität sollte zu einer „im Westen des deutschen Kulturbodens“ gelegenen „europäischen Universität“ gestaltet werden.201 Beim Beitritt des Saarlandes zur Bundesrepublik 1957 befasste sich dann der Senats-Ausschuss für Siegel und Diplome mit der Frage eines möglichen Namenspatrons. Von den verschiedenen Vorschlägen kämen allerdings nur zwei in Frage: „Nikolaus Cusanus-Universität“ oder „Kaiser Karl-Universität“. Beide wurden verworfen. Cusanus‘ Name sei trotz seiner regionalen Mosel-Bezüge für Saarbrücken als Universitätssitz nicht geeignet; Karl der Große sei zwar „ein gutes Symbol für eine Hochschule auf der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich“, aber „für die jüngste Universität Deutschlands“ wohl doch „zu anspruchsvoll“. Deshalb empfahl der Ausschuss, bei dem Gründungs-Namen „Universität des Saarlandes“ zu bleiben.202 Freie Universität Berlin (1948) Die Westberliner „Freie Universität“ (amerikanischer Sektor) entstand 1948 aus einer studentischen Oppositions- und Sezessionsbewegung mit Unterstützung des Westberliner Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung. Sie stand so ganz im Zeichen des sich zum „Kalten Krieg“ ausweitenden Ost-West-Konfliktes und der Berlin-Krise. Ausgelöst wurde sie durch Repressionsmaßnahmen der Deutschen Verwaltung für Volksbildung gegen den oppositionellen Ostberliner Studentenrat. Die seit dem Auszug der oppositionellen Studenten nach Westberlin maßgeblich von Edwin Redslob betriebene Gründung war in erster Linie politisch motiviert. Sie sah sich zwar in der Tradition der alten Berliner Universität, vor allem aber als alternative freiheitliche Neugründung gegen die Ostberliner Universität. Der vom Vorbereitungsausschuss unter Redslob gewählte Name „Freie Universität“ richtete sich gegen die Entwicklung an der Ostberliner Universität. Er bekannte sich zugleich zur „Idee der Freiheit“ in einem liberalen Humboldt-Verständnis. Im Zeichen dieses programmatischen Namens einer politisch „freien“ und zugleich zukunftsweisenden Reform-Universität standen die Reden zur Eröffnungsfeier am 4. Dezember 1948, darunter die des greisen Historikers Friedrich Meinecke als Gründungsrektor.203 201 Vgl. den Beitrag von Wolfgang Müller in diesem Band sowie ders.: „Über die zukünftige Gestalt der Saarbrücker Universität“ – eine gerade entdeckte Denkschrift Eugen Meyers über den „Ausbau einer neuen deutschen Universität im Westen des deutschen Kulturbodens“, in: Stefan Gerber u. a. (Hg.): Zwischen Stadt, Staat und Nation. Bürgertum in Deutschland, Göttingen 2014, S. 803–817. 202 Universitäts-Archiv Saarbrücken, Ausschuss für Siegel und Diplome des Senats, Sitzungen v. 10. u. 17.4.1957 (der Vf. dankt Herrn Wolfgang Müller für die zur Verfügung gestellte Kopie des Protokolls). 203 Ulrich Schneider: Berlin, der Kalte Krieg und die Gründung der Freien Universität 1945–1949, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 34 (1985), S. 37–101; Siegward Lönnendonker: Freie Universität Berlin. Gründung einer politischen Universität, Berlin (W) 1987; James F. Tent: Freie Universität Berlin 1948–1988. Eine deutsche Hochschule im Zeitgeschehen, Berlin (W) 1988; Bernd Rabehl: Am Ende der Utopie. Die politische Geschichte der Freien Universität Berlin, Berlin (W) 1988; Eberhard Lämmert: Freie Universität Berlin. Veritas – Iustitia – Libertas, in: Demandt: Stätten des Geistes (1999), S. 279–299; Welzbacher: Edwin Redslob (2009), 355–374; Hansen: Von der Friedrich-Wilhelms-Universität (2009); ders.: Von der Friedrich-Wilhelms-Universität (2012), S. 100–109.
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
183
Stand schon in dieser frühen Zeit der Neugründungen ein Namenspatron (Mainz) zwei anders gelagerten „bekennenden“ Namen und einer „namenlosen“ Universität gegenüber, so prägte sich dieser Trend in den folgenden Jahrzehnten weiter aus. Namensvergaben stellten nun die Ausnahmen von der Regel der „Namenlosigkeit“ dar. Dabei kam es mehrfach zu kontroversen Debatten um die Vergabe „alternativer Namen“ wie – letztlich erfolgreich – im Falle Oldenburgs (Ossietzky-Universität) und Düsseldorfs (Heine-Universität)204 oder – vergeblich – im Falle Hannovers 2005/06205 und zuvor Hamburgs. Hier wandte sich 1995 ein Bürgerschaftsabgeordneter an den Universitätspräsidenten mit dem Vorschlag, die „namenlose“ Universität nach dem bis 1933 an der Hamburger Universität wirkenden, von den Nationalsozialisten ins Exil getriebenen jüdischen Philosophen Ernst Cassirer zu benennen. Das läge weniger im Sinne „nachträglicher Wiedergutmachung“. Es böte vielmehr die Gelegenheit, eine „Zentralgestalt des deutschen Geisteslebens“ zum Namenspatron der Hamburger Universität zu wählen. Der Präsident wiegelte ab. Der Denkanstoß, Cassirer stärker zu würdigen, sei richtig. Doch solle man das nicht gleich zu einer „Frage der Namensgebung“ zuspitzen.206 Bei der Ablehnung solcher von den jeweiligen Studentenvertretungen mit getragenen oder ausgehenden „linken“ Initiativen spielte sicher auch noch die nachhallende Erinnerung an die „1968er“-Studentenproteste eine Rolle. Damals kam es im Mai 1968 in Frankfurt / Main und Gießen zu kurzzeitigen, aber spektakulären studentischen „Umbenennungs“-Aktionen: „Karl Marx-Universität“ statt „Goethe-Universität“ (Frankfurt)207 und „Georg Büchner Universität“ statt „Justus-Liebig-Universität“ (Gießen).208 Otto-Friedrich-Universität Bamberg (1988) Im Kontrast zu den alternativen Namensvergaben bzw. -initiativen von Oldenburg, Düsseldorf, Hamburg und Hannover standen die etwas anachronistisch wirkenden Namensvergaben im Rückgriff auf monarchische Namenspatrone: 1968 – ausgerechnet im studentischen Protestjahr – bei der Technischen Universität Braunschweig, die von der bisherigen Technischen Hochschule den Namen „Carolo Wilhelmina“ übernahm. Und 1988 bei der Universität Bamberg, die 1972 als bayerische Gesamthochschule entstand, 1979 den Universitätsstatus erlangte und 1988 im Anschluss an die 1803 aufgehobene Vorgänger-Universität den Namen „Otto-Friedrich-Universität“ erhielt. Mit diesem Doppelnamen griff sie auf zwei fürstbischöfliche Namenspatrone zurück, denen die Vorgänger-Institutionen (Akademie 1647, Universität 1773) einst 204 Vgl. die Fallbeispiele im letzten Teil. 205 Vgl. das Fallbeispiel im letzten Teil. 206 Universitätszeitung uni hh. Berichte und Meinungen aus der Universität Hamburg 26 (1995), H. 3, S. 15f. (der Vf. dankt Herrn Rainer Nikolaysen/Hamburg für die zur Verfügung gestellte Kopie); vgl. auch Birgit Recki: Eine Philosophie der Freiheit – Ernst Cassirer in Hamburg, in: Nicolaysen: Das Hauptgebäude (2011), S. 57–80. 207 Norbert Frei: 1968. Jugendrevolte und globaler Protest, München 2008, S. 145; Notker Hammerstein: Die Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Bd. II: Nachkriegszeit und Bundesrepublik 1945–1972, Göttingen 2012, S. 788. 208 Felschow u. a.: Krieg (2008), S. 155–157; das Universitätshauptgebäude wurde während dieser studentischen Proteste zeitweise geschlossen.
184
Jürgen John
ihre Existenz verdankten. Das war ein unzweifelhaft geschichtspolitischer Akt. Mit diesem Rückgriff auf Stifter des 17./18. Jahrhundert wollte sich die noch sehr junge Bamberger Hochschule, die gerade erst wenige Jahre zuvor den Universitätsstatus erlangt hatte, ein Image zulegen, das sie „alt“ erscheinen ließ. Die Akteure dieser Namensvergabe drückten das freilich vornehmer und geschichtskulturell weitgreifender aus. Mit dem Namen „Otto-Friedrich-Universität“ stelle sich Bamberg – erklärte ihr Präsident zur Namensvergabe – ganz bewusst „in die Tradition der alten Universitäten“, die aus „Dankbarkeit, Ergebenheit und Verehrung“ die Namen ihrer fürstlichen Gründer übernahmen. Sie greife damit einen Brauch wieder auf, der sich in der Neuzeit leider verloren habe. Solche Traditionspflege sei keine verstaubte Angelegenheit, sondern „Ausdruck geschichtsbewußten Denkens“, universitären Selbstbewusstseins, der Besinnung auf Herkunft und Identität. Sie sei in der „Geschichtslosigkeit des Denkens, die sich in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg ausgebreitet“ habe, nötiger denn je.209 Mit dieser „Rückbesinnung auf den alten Namen“210 oder – anders gesehen – dem „neuen Namen im alten Glanz“211 wollte man sich als Traditions-Universität profilieren, die einseitige Bindung an Lehrerbildung und geisteswissenschaftliche Fächer überwinden und sich völlig von der als „strangulierend“ empfundenen Vorgeschichte als Gesamthochschule lösen. Die habe allenfalls geholfen, den Weg zur Universität wieder einzuschlagen. Ansonsten habe dieses einst von der sozial-liberalen Regierungskoalition in Bonn favorisierte Hochschulreformmodell „ohnehin nicht in die bildungspolitische Landschaft des Freistaates“ gepasst.212 Mit der so begründeten Namensvergabe 1988 hob sich Bamberg deutlich vom allgemeinen Trend ab. Alles in allem trat die Namens- und Namensvergabe-Frage in der expandierenden bundesdeutschen Universitätslandschaft zunehmend in den Hintergrund. Sie spielte auch nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten 1990 keine besonders markante Rolle mehr. Nur die in den „neuen Bundesländern“ neu oder wieder gegründeten Universitäten gaben sich in der Mehrzahl Namen. Die Universität Frankfurt (Oder) ging dabei 1991 einen Kompromiss zwischen denen ein, die bei dieser Universität an der deutsch-polnischen Grenze den Europa-Gedanken betonen und denen, die im Rückbezug auf den Namen der 1811 aufgelösten VorgängerUniversität den topographischen Begriff „Viadrina“ – „die an der Oder (Viadrus) gelegene“ – in den Namen haben wollten. Der Kompromiss führte beide Begriffe im Doppelnamen „Europa-Universität Viadrina“ zusammen.213 Die 1993 aus der Technischen Universität gebildete Universität Magdeburg übernahm einfach den Namenspatron Otto von Guericke von den Vorgängern. Ein emphatisches Bekenntnis lässt sich nur bei der 1996 zur Universität erhobenen bisherigen „Hochschule für 209 Siegfried Oppolzer: Otto Friedrich Universität Bamberg, Text des vermutlich am 1.10.1988 gehaltenen Vortrages (Universitätsarchiv Bamberg, VII 4, n. f.), S. 3; der Vf. dankt Frau Margrit Prussat vom Universitätsarchiv Bamberg für die Kopien des Vortrages und der Zeitungsausschnitte. 210 Süddeutsche Zeitung v 3.10.1988. 211 Nürnberger Zeitung v. 30.9.1988. 212 Siegfried Oppolzer: Von der Gesamthochschule Bamberg zur Otto-Friedrich-Universität (1976–1992), in: Machilek: Haus der Weisheit (1998), S. 279–290, Zitat S. 280. 213 Vgl. den Beitrag von Ulrich Knefelkamp in diesem Band.
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
185
Architektur und Bauwesen“ Weimar erkennen. Sie bekannte sich – wie zuvor schon die Bauhochschule bei ihrer Wiedereröffnung 1946 – ausdrücklich zur Tradition des „Staatlichen Bauhauses Weimar“ (1919/25) und nannte sich deshalb „BauhausUniversität“.214 Die 1994 wieder gegründete Universität Erfurt verzichtete auf einen Namenspatron. Obwohl sich der in Erfurt geborene Max Weber sicher angeboten hätte. Seinen Namen trägt das an der Universität Erfurt gebildete „Max-Weber-Kolleg für Kultur- und Sozialwissenschaften“. Abschließend zu diesem Überblick noch zwei Anmerkungen. Es wäre zu prüfen, wie sich die Relation von Namensträgern und „Namenlosen“ darstellt, wenn man auch die mehr als 200 Hoch- und Fachhochschulen ohne Universitätsstatus in die Analyse einbezöge. Einige von ihnen haben Namenspatrone (so die „Hochschule für Musik Franz Liszt“ Weimar seit 1956 oder die „Ernst-Abbe-Fachhochschule“ Jena seit 2012), andere nicht. Zu diskutieren wäre zudem die bei diesem Überblick angewandte – noch recht provisorische – Namenstypologie. Insgesamt haben sich dabei sechs Gruppen bzw. Typen mit jeweiligen Subtypen abgezeichnet: (1) Monarchische Namenspatrone (Einzel- wie Doppelnamen); (2) Bürgerliche Namenspatrone der Kulturnation a) im engeren Sinne des klassisch-bildungsbürgerlichen Kanons, b) im weiteren Sinne auch von Wissenschaftlern / Technikern oder alternativer Namensvorschläge, c) aus der Tradition des eigenen Lehrkörpers; (3) Politiker oder private Geldgeber als Namenspatrone; (4) programmatisch-„verpflichtende“ Namen; (5) topographische Bezüge; und schließlich (6) das heterogene Feld von Dynastie- und Staatsbezügen, Bezügen auf andere Träger und reinen Funktionsnamen. Jeder Versuch einer solchen Typologie ist problematisch. Die Grenzen zwischen den verschiedenen Gruppen bzw. Typen sind mitunter unklar und fließend. Mancher Name lässt sich dem einen wie dem anderen Typus zurechnen. Es gibt Doppelnamen und schwer zuordenbare Sonderfälle. Eine überzeugende Typologie lässt sich zweifellos erst nach weiterer Feinarbeit erstellen. FA L LBEISPI E L E KON T ROV ERSER NA M E NSDE BAT T E N Im letzten Teil dieses Beitrages sind ergänzend zu dem typologischen Überblick noch fünf aufschlussreiche Fallbeispiele kontroverser Namensdebatten kurz zu porträtieren – drei Debatten um Namensvergaben und zwei Debatten um das Ablegen von Namenspatronen. Heine-Universität Düsseldorf (1972 – 1988) Der polarisierende Streit um die Namensvergabe „Heinrich-Heine-Universität“ zog sich fast 20 Jahre hin. Die 1968 gegründete Universität Düsseldorf war zunächst „namenlos“. Während der Arbeiten an der Universitätssatzung setzte sich 1972 ein Teil des Satzungskonvents dafür ein, die Universität nach dem aus Düsseldorf stammenden deutsch-jüdischen Dichter Heinrich Heine zu benennen, scheiterte aber mit 214 Klaus-Jürgen Winkler (Hg.): Neubeginn. Die Weimarer Bauhochschule nach dem Zweiten Weltkrieg und Hermann Henselmann, Weimar 2005; Frank Simon-Ritz u. a. (Hg.): Aber wir sind! Wir wollen! Und wir schaffen! Von der Großherzoglichen Kunstschule zur Bauhaus-Universität Weimar 1860–2010, Bd. 2, Weimar 2012.
186
Jürgen John
dem Antrag. Kurze Zeit später initiierten der PEN-Club und die Heinrich-HeineGesellschaft Großveranstaltungen für diese Benennung, die vom Vorsitzenden des Satzungskonventes moderiert wurden. Das führte zu einem Misstrauensvotum und Abwahlverfahren gegen ihn. Er habe seine Kompetenzen überschritten und seine Pflichten verletzt. Das misslang zwar. Es zeigte aber die gegen einen universitären Namenspatron Heinrich Heine gerichtete Stimmung in Teilen des Lehrkörpers und der Öffentlichkeit. All diese Versuche, Heine zum Namenspatron der Universität zu erheben, scheiterten ebenso wie spätere Vorstöße einer Gruppe von 122 Angehörigen des Lehrkörpers und einer Bürgerinitiative für die Namensvergabe „Heinrich-HeineUniversität“. Nur der Allgemeine Studentenausschuss blieb beharrlich und führte bereits Heines Bild im Briefkopf. Nachdem ein erneuter Vorstoß 1982 im Konvent wieder (mit 41 zu 44 Stimmen) gescheitert war, erreichte der seit 1983 amtierende Rektor dann per Rechtsentscheid, dass die Benennungskompetenz an den Senat ging. Am 20. Dezember 1988 erfolgte schließlich der Senatsbeschluss über den Namen „Heinrich-Heine-Universität“.215 Ossietzky-Universität Oldenburg (1973 – 1991) Die Kontroverse um die Namensvergabe „Carl von Ossietzky-Universität“ verlief nicht minder langwierig und polarisierend als die Düsseldorfer Debatte, aber mit anderen Konstellationen und Konfliktlinien. Hier standen Kontroversen mit städtischer Öffentlichkeit, Kommunal- und Landesregierungen im Vordergrund. Die an der Gründung der Universität maßgeblich beteiligten Gruppen der Professoren- wie der Studentenschaft wollten den Namen. Die Politik verweigerte ihn lange Zeit. Die Konflikte erreichten zeitweise Ausmaße, die nachträglich in das Bild vom „Kalten Krieg um Ossietzky“ gebracht wurden.216 Dabei ging es nicht nur um die Person des 1934/36 im KZ Esterwegen bei Oldenburg inhaftierten Journalisten, „Weltbühnen“Herausgebers und Friedensnobelpreisträgers Carl von Ossietzky, der zwei Jahre nach seiner Haftentlassung 1938 an den Folgen der KZ-Haft gestorben war. Es ging mit ihm zugleich um eine Zentralfigur des linksrepublikanischen intellektuellen Journalismus der Weimarer Zeit, um eine weltweit bekannte Symbolfigur der Opfer des NSTerrors – und um die Bereitschaft oder Nichtbereitschaft, eine solche Persönlichkeit als Namenspatron einer Universität zu akzeptieren. Der Oldenburger Namensstreit hat deshalb auch weit über den lokalen und landespolitischen Rahmen hinaus die Öffentlichkeit im Zweistaaten-Deutschland und im internationalen Maßstab bewegt. 1970 fasste die niedersächsische Landesregierung (eine SPD/FDP-Koalition) den Beschluss, in Oldenburg und Osnabrück Reform-Universitäten zu errichten. Dabei war nur von „Universitäten“ ohne Namenspatron die Rede. Der aus je einem Drittel 215 Holger Ehlert u. a. (Hg.): Die Jahre kommen und vergehn! 10 Jahre Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf 1998, v. a. S. 11–13, 83–87, 273–277. 216 Rainer Rheude: Kalter Krieg um Ossietzky. Warum die Universität Oldenburg fast 20 Jahre lang um ihren Namen streiten musste. Mit einem Vorwort von Bundeskanzler a. D. Gerhard Schröder, Bremen 2009; vgl. zur Namensdebatte auch Hilke Günther-Arndt: 25 Jahre Carl-vonOssietzky-Universität Oldenburg 1974–1999. Die Geschichte der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg, Oldenburg 1999, S. 7–9.
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
187
Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studierenden 1971 für Oldenburg gebildete Gründungsausschuss legte sich von Anfang an auf Ossietzky als Namenspatron fest, der zu einer solchen Reformuniversität gut passte. Dagegen regte sich Widerstand in der Stadt. Der Name klinge schwierig und fremdartig. Die Universität liege damit am „Gängelband der DKP“, die eine öffentliche Kampagne für Ossietzky als Namenspatron führte. Im Vorfeld des Gründungsgesetzes (Dezember 1973) organisierte die Lokalredaktion der „Nordwest-Zeitung“ im April 1973 eine Leserumfrage „Wie soll die Uni heißen?“, die eine deutliche Stimmen-Mehrheit für den Namen „Universität Oldenburg“ (1 951) bei relativ wenigen Stimmen für Ossietzky als Namenspatron (104) ergab.217 Die bestürzten Reaktionen auf diese Umfrage bestärkten den Gründungsausschuss, nun erst recht an Ossietzky als Namenspatron festzuhalten. Im Februar 1974 legte er der Landesregierung den Entwurf einer Grundordnung der Universität vor, der den Namen „Carl von Ossietzky-Universität“ vorsah. Der Kultusminister genehmigte die Grundordnung ohne den Namen und berief sich dabei auf solche Stimmungsbilder. Das Gleiche wiederholte sich im April 1974. Das Konzil der Universität sprach sich einstimmig für die Grundordnung und für die Namensvergabe „Carl von Ossietzky-Universität“ aus. Die Landesregierung lehnte jedoch ab. Das geschah aus koalitionspolitischen Gründen wie aus grundsätzlichen Erwägungen: Als Landeseinrichtung könne sich die Universität nicht selbst einen Namen geben. Und die Landesregierung halte es nicht für „sinnvoll und zeitgerecht, heute noch Universitäten besondere Namen – gleich welcher Art – zu verleihen“.218 Auch der Stadtrat wandte sich gegen einen Namenspatron. Nun eskalierten die Konflikte erst recht. Im November 1974 brachten Mitglieder des Sozialistischen Hochschulbundes am Neubau der Universität die Schrift „Carl von Ossietzky Universität“ an. Es kam zu erregten Landtagsdebatten, in denen die oppositionelle CDU ein hartes Durchgreifen gegen solche Aktionen forderte. Die Schrift wurde in einem Polizeieinsatz entfernt. Der Namensstreit aber hielt an. Er verschärfte sich erneut unter der seit 1976 amtierenden CDU-Landesregierung Ernst Albrechts, die nun die Namensfrage und das staatliche Recht zur Namensvergabe zu einer Grundsatzfrage von Recht und Ordnung stilisierte. Die universitäre Seite blieb standhaft. Sie führte in der Amtszeit dieser Regierung einen ebenso beharrlichen wie lange Zeit vergeblichen Kampf um Ossietzky als Namenspatron. Dabei setzte sie vor allem auf Aufklärungs- und Forschungsarbeit. Sie führte 1978 die „OssietzkyTage“ ein, an denen prominente Referenten zu politischen und gesellschaftlichen Grundfragen sprachen. Eine Denkmals-Initiative sammelte Geld für ein Carl von Ossietzky-Mahnmal. 1979 übergab Rosalinde von Ossietzky-Palm der Universität den Nachlass ihres Vaters. Die Universität gründete 1981 eine Ossietzky-Forschungsstelle, die unter anderem ein Dokumentations- und Informationszentrum in PapenburgEsterwegen einrichtete und bis 1994 die achtbändige „Oldenburger Ausgabe“ der 217 Als weitere mögliche Namenspatrone wurden zur Umfrage gestellt: der Landesfürst Graf Anton Günther (595 Stimmen), der in Oldenburg geborene Philosoph Karl Jaspers (403 Stimmen), der frühere Außenminister Gustav Stresemann (30 Stimmen) und der Oldenburger Biochemiker Wilhelm-H. Schüßler (28 Stimmen) – diese und weitere Angaben nach Rheude: Kalter Krieg (2009), hier S. 85–88. 218 Ebd., S. 74f.
188
Jürgen John
Schriften Ossietzkys veröffentlichte. Allmählich zeichnete sich auch in der Stadt Oldenburg ein Stimmungswandel zugunsten Ossietzkys als universitären Namenspatron ab. Die Stadt verlieh seit 1981 einen Carl von Ossietzky-Preis und vergab 1984 den Namen „Carl von Ossietzky-Straße“. Aber erst nach den Wahlen und dem Regierungswechsel 1990 wurde die Vergabe des Universitätsnamens möglich. Die neue SPD-Landesregierung unter Gerhard Schröder verlieh mit einem Festakt am 3. Oktober 1991 schließlich den Namen „Carl von Ossietzky-Universität. Lessing- oder Leibniz-Universität Hannover (2005/06) Bei den langwierigen Namensdebatten von Düsseldorf und Oldenburg waren die Ausgangsinitiativen letztlich erfolgreich. In beiden Fällen gelang es, „alternative“ – jenseits des bislang üblichen Gedenkkanons liegende, aber offenbar immer noch polarisierende –Namen eines in der NS-Zeit verfemten deutsch-jüdischen Dichters und eines Opfers des NS-Terrors als Universitätsnamen durchzusetzen. Die eher kurze Namensdebatte in Hannover bietet das Gegenbeispiel. Hier agierten zudem einzelne studentische Gruppen ohne Gesamtrückhalt in der Studentenschaft gegen universitäre Gremien, die so die Ausgangs-Initiative leicht mit einem aussichtsreichen AlternativVorschlag unterlaufen konnten. Die Technische Hochschule Hannover hatte 1968 den Status einer „Technischen Universität“ und 1978 – unter Integration der Pädagogischen Hochschule – den einer Volluniversität erlangt. Die neue Universität blieb zunächst „namenlos“. Im November 2005 beantragte die Fachschaft Sozialwissenschaft über den Studentenrat die Namensvergabe „Theodor-Lessing-Universität“. Der aus Hannover stammende, seit 1907 als Privatdozent an der Technischen Hochschule Hannover als Vorläuferinstitution tätige deutsch-jüdische Philosoph und streitbare politische Publizist war 1925 wegen eines Hindenburg-kritischen Artikels zur Zielscheibe hasserfüllter Attacken deutschnational-völkischer Studentengruppen geworden. 1933 hatten ihn nationalsozialistische Attentätern in der Emigration ermordet. Bei einer studentischen Urabstimmung vom Januar 2006 sprachen sich 63,4 Prozent gegen diese Namensvergabe aus. Daraufhin votierte der Senat im April 2006 für den Namen „Gottfried Wilhelm Leibniz-Universität“. Als Namenspatron einer Universität war der Name „Leibniz“ ja noch frei. Die Universität Leipzig hatte ihn 1953 als Alternative zu Marx als Namenspatron zwar erwogen, aber nicht verwenden können. Der Senat der Universität Hannover plante die Namensvergabe zur 175-Jahr-Feier der Vorgänger-Institution, musste sich aber erst die Rechte an dem Namen sichern und die Namensvergabe deshalb verschieben. Er verhandelte und vereinbarte mit der Leibniz-Akademie Hannover die Nutzung dieses Namens und beschloss dann seine Vergabe zum 1. Juli 2006.219 Gleichzeitig legte man sich auf die Kurzform „Leibniz Universität Hannover“ fest, um diese „als Marke etablieren“ zu können. Die Begründung dafür lieferte ein Professor des Instituts für Marketing und Management. Er sei schon dafür, die Universität nach 219 Wikipedia-Eintrag „Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover“, Abschnitt „Namensgebung“; nach Auskunft des Universitätsarchivs Hannover gibt es darüber hinaus bislang keine Darstellung zur Namensdebatte (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_Leibniz_Universit%C3%A4t_Hannover, zuletzt abgerufen am 17.7.2015).
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
189
Leibniz zu benennen. Doch müsse man zuvor die Chancen und Risiken sowie Kosten und Nutzen einer solchen Namensvergabe klären. Sie müsse den „Markenwert“ der Universität steigern. Sonst werde sie zur „reinen Oberflächenkosmetik“ und biete nur einen Namenszusatz. Das setze eine offensive Marketing-Politik voraus, damit die „Markensubstanz“ des Namens „Leibniz-Universität Hannover“ stimme.220 Mit der Benennung „Leibniz-Universität Hannover“ war zwar der dortige Namensstreit entschieden. Wie 1995 in Hamburg das Bemühen um den Namen „Ernst-CassirerUniversität“ scheiterte auch dieser Versuch in Hannover, einen Namenspatron aus dem Kreis der NS-Opfer zu etablieren. Die universitäre Erinnerungskultur Hannovers bleibt aber polarisiert. Der Allgemeine Studentenausschuss hat seinen Sitz im „Theodor-Lessing-Haus“. Wilhelms-Universität Münster (1997/2015) Die 1902 (wieder) gegründete Universität Münster war im November 1945 von der britischen Besatzungsmacht unter dem Namen „Westfälische Landesuniversität“ wieder eröffnet worden. 1952 legte sie sich den 1907 verliehenen Namen „Westfälische Wilhelms-Universität“ erneut mit der juristischen Begründung zu, er sei ja formell nicht aufgehoben worden. Das löste in den folgenden Jahren mehrfach das Bestreben aus, den Universitätsnamen mit dem höchst umstrittenen letzten deutschen Kaiser als Patron zu ändern. Diese Ansätze verliefen stets im Sande. Offiziöse Darstellungen zur Geschichte der Universität gingen auf die Namensvergabe 1907 gar nicht erst ein.221 Zu deren 90. Jahrestag 1997 kam es aber zum Eklat und zu einer sehr emotional geführten Debatte über den Universitätsnamen. In ihr wurden gegensätzliche Grundpositionen im Umgang mit problematischen Namenspatronen und Namensvergaben deutlich, die Grundfragen des hier behandelten Themas betreffen.222 Vor allem linke studentische Gruppen verlangten den Namenswechsel, weil der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. „als Namensgeber einer modernen Bildungsanstalt ungeeignet“ sei.223 Sie sahen in ihm die Symbolfigur des „Wilhelminischen Zeitalters“ und einer für die Katastrophe des Ersten Weltkrieges maßgeblich mit verantwortlichen „Weltpolitik“. Es gab Alternativvorschläge wie „Westfälische FriedensUniversität“ in Erinnerung an die Friedensschlüsse von Münster und Osnabrück 1648 oder „Henriette Herz Universität“ im Gedenken an eine jüdische Münsteranerin und 220 Klaus-Peter Wiedmann: Mit Leibniz zu einer Spitzen-Marke in der Universitätslandschaft? Einige grundlegende Überlegungen aus Marketingsicht, in: Universität Hannover. extern, April 2006, S. 10f.; der Vf. dankt Herrn Lars Nebelung (Universitätsarchiv Hannover) für die Kopie. 221 So der mit einem Geleitwort des Rektors versehene Sammelband von Heinz Dollinger (Hg.): Die Universität Münster 1780–1980, 2Münster 1980, der die Namensvergabe 1907 nur in der Zeittafel (S. 519) kurz erwähnt; im gleichen Band sind die Ergebnisse einer Umfrage in der Bevölkerung Münsters („Die Westfälische Wilhelms-Universität im Spiegel der öffentlichen Meinung“, S. 233–239) abgedruckt, die die Namensfrage ebenfalls ausblendete. 222 Das Folgende beruht auf der Auswertung der freundlicherweise vom Universitätsarchiv Münster zur Verfügung gestellten betreffenden Artikel und Leserbriefe der „Westfälischen Nachrichten“, der „Münsterschen Zeitung“ sowie zweier Artikel der überregionalen Presse in Die Welt v. 3.6.1997 und Die Zeit v. 15.8.1997. 223 So das studentische Senatsmitglied in der Münsterschen Zeitung v. 13.5.1997.
190
Jürgen John
Holocaust-Überlebende. Der Senat sah sich gezwungen, eine Kommission einzusetzen, die mehrheitlich ebenfalls den Namenswechsel empfahl. Der „äußerst ambivalente“ Wilhelm II. sei vor allem wegen seiner antisemitischen Äußerungen unhaltbar.224 Der Senat erklärte sich für nicht zuständig. Man werde sich aber nicht vor der nötigen Diskussion um den umstrittenen Namenspatron drücken. Das Rektorat entschied sich gegen einen Namenswechsel. Dabei stützte es sich auf Umfragen unter Studierenden. Danach stand eine deutliche Mehrheit der Befragten einem Namenswechsel gleichgültig bis ablehnend gegenüber, weil sie sich ohnehin nicht über den Namen mit der Universität identifiziere. Das Rektorat begründete seine Entscheidung mit dem Argument, es sei zum Zeitpunkt der Namensvergabe üblich gewesen, Universitäten nach dem jeweiligen Landesherren zu benennen, ohne dass sich damit „eine Identifikation mit dem Namensgeber verbunden hätte.“ Eine bloße Namensänderung blende die historische Entwicklung der Universität aus. Und ein neuer Namenspatron würde nur eine „Identifikationsdebatte auslösen, die mehr Verwirrung als Nutzen“ stifte.225 Dabei machte sich das Rektorat zumindest teilweise Argumente aus der Debatte zu eigen: Bilderstürmerei sei unangebracht. Damit mache sich die Universität nur lächerlich und löse die Frage aus, ob sie nichts Wichtigeres zu tun habe. Man könne sich „nicht aus der eigenen Geschichte davonstehlen“; die Namensvergabe 1907 habe nun einmal dem allgemeinen „Zeitgeist“ entsprochen.226 Und Wilhelm II. sei schließlich der Repräsentant „jener Zeit, in der die Universität (endlich) wieder begründet wurde“; ohne ihn gäbe es die Universität gar nicht.227 So blieb es bei dem umstrittenen Namenspatron, ohne dass sich das Argument bewahrheitete, gerade er biete die Chance für eine ständige, produktive und kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Das Gegenteil geschah. Bis heute hat es keine gründliche wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Namensgeschichte der Universität gegeben. Auch die dafür geeigneten Anlässe – das Namens-Jubiläum 2007 und der 150. Geburtstag des „Namensgebers“ Wilhelm II. 2009 – verstrichen ungenutzt. Der peinliche Name „Wilhelms-Universität“ wird möglichst gemieden. Die Universitätsleitung weicht lieber in das Kürzel „WWU“ als Markenzeichen aus. Der Studentenausschuss spricht nur von der „Uni Münster“.228 Die Debatte um den Namen „Wilhelms-Universität“ könnte aber wieder aufflammen, nachdem die Stadt Münster 2012 eine höchst aufwühlende Debatte um den „Hindenburgplatz“ hinter sich gebracht hat, die schließlich nach mehreren Beschlüssen und einem Bürgerentscheid zur Umbenennung in „Schlossplatz“ führte.229 Eine Debatte, die geradezu 224 So der Kommissionsvorsitzende Hans Ulrich Thamer (Westfälische Nachrichten v. 15.5.1997); bei der Meinungsbildung spielten die zu diesem Zeitpunkt bereits vorliegenden kritischen Publikationen des britischen Historikers John C. G. Röhl über Wilhelm II. (vgl. Anm. 232) eine wichtige Rolle. 225 Westfälische Nachrichten v. 22.8.1997. 226 Westfälische Nachrichten v. 17.6.1997. 227 Leserbriefe in: Westfälische Nachrichten v. 15.5. u. 3.6.1997. 228 Michel Billig: Wilhelm-Uni. Übergehen und abkürzen statt umbenennen (Glosse v. 16.2.2009 auf der Homepage des AStA Münster); http://iley.de/?article=HOCHSCHULEINWESTFAL EN_wilhelms-uni_uebergehen und abkürzen statt umbenennen; dieser u. die folgenden InternetEinträge wurden zuletzt im Juni 2015 abgerufen. 229 Großbölting: Hindenburg- oder Schloßplatz (2015); vgl. auch Anm. 11; auf Seiten der Um-
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
191
paradigmatische Züge trug, zumal heute noch Straßen und Plätze vieler Städte den Namen „Hindenburg“ tragen. Die schon in der Wilhelm-Debatte 1997 erkennbaren erinnerungskulturellen Gegenpositionen traten in dieser Hindenburg-Debatte 2012 erneut zutage. Einerseits: kein ehrendes Gedenken für einen solchen Militär und Politiker, das dem Image der Stadt nachhaltig schade und einer modernen demokratischen Gesellschaft unwürdig sei; andererseits: keine Bilderstürmerei und keine „Entsorgung der Vergangenheit“, Beachtung des „Zeitgeistes“ und kein Messen mit heutigen Maßstäben; und schließlich: der „Hindenburgplatz“ gehöre nun einmal zu Münster und stelle ein wichtiges Stück kommunaler Identität und Heimat dar. Anzeichen zu einer neuen Debatte um den Namen „Wilhelms-Universität“ gibt es durchaus. „Raus mit Kaiser Wilhelm!“, lautet ein Internet-Eintrag der Juso-Hochschulgruppe Münster vom November 2014. Wilhelm II. sei „der Kopf zu einer Monarchie, die mit dem Ersten Weltkrieg, Kolonialpolitik, Antisemitismus, Frauen- und Demokratiefeindlichkeit in die Geschichtsbücher Eingang gefunden hat.“ „Eine solche Persönlichkeit ist ein denkbar schlechter Namenspatron für eine weltoffene, tolerante und demokratische Hochschule, so wie wir sie uns vorstellen.“230 Deshalb fordere die Juso-Gruppe einen Namenwechsel. Dagegen brachte die Fraktion des Ringes Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) in der Sitzung des Studierenden-Parlamentes am 18. Mai 2015 den Antrag ein, sich gegen eine Umbenennung der Universität auszusprechen, die nur Kosten verursache und Ausdruck einer „nutzlosen Symbolpolitik“ sei. Auch der RCDS halte Wilhelm II. „nicht für einen optimalen Namenspatron“. Aber einen solchen gäbe es ohnehin nicht. Es sei immer etwas auszusetzen. Man müsse „die Dinge eben als historisch gewachsen hinnehmen“. Zudem habe Wilhelm II. bei all seinen Fehlern auch Gutes bewirkt und zum Beispiel die Wissenschaften gefördert. Historiker würden seine Rolle ebenfalls abgewogener beurteilen als früher. Unter dem Namen „Wilhelms-Universität“ habe sich Münster einen weithin guten Ruf erworben. Das Kürzel „WWU“ sei allgemein in Gebrauch und geradezu identitätsstiftend geworden.231 Der Antrag wurde von der liberalen Hochschulgruppe unterstützt, von der Mehrheit linker Listen aber abgelehnt. Der Studentenausschuss hat eine Projektstelle zur Aufarbeitung des Universitätsnamens ausgeschrieben. Man darf gespannt sein, wie sich die Dinge entwickeln und ob Münster nach der durch einen städtischen Platznamen ausgelösten Hindenburg- nun auch eine durch den Universitätsnamen ausgelöste (erneute) Wilhelm-Debatte bekommt.232 benennungs-Befürworter spielte dabei die Hindenburg-kritische Biografie von Wolfram Pyta: Hindenburg. Herrschaft zwischen Hohenzollern und Hitler, 2Müchen 2007 eine maßgebliche Rolle; generell zum Umgang mit dem Namen Hindenburgs vgl. Hans-Ulrich Thamer: Straßennamen in der öffentlichen Diskussion: Der Fall Hindenburg, in: Frese: Ehrungen, S. 251–264. 230 http://jusohsg.de/2014/11/raus-mit-kaiser-wilhelm/, zuletzt abgerufen am 17.7.2015; der Vf. dankt Frau Sabine Happ und Herrn Robert Giesler vom Universitätsarchiv Münster für die Hinweise auf diese und andere Quellen. 231 http://www.stupa.ms/wp-content/uploads/2015/06/Protokoll_StuPa57_9.pdf (Protokoll der Sitzung v. 18.5.2015) zuletzt abgerufen am 17.7.2015; http://rcds-muenster.de/de/news (Mitteilung des RCDS über die Sitzung), zuletzt abgerufen am 17.7.2015. 232 Und es dürfte auch interessant sein, ob und welche Rolle wissenschaftliche Publikationen eventl. dabei spielen – die sehr kritischen Aussagen in der nunmehr vollständig vorliegenden Biographie von John C. G. Röhl: Wilhelm II., 3 Bände, München 1993–2008 (und die kurze
192
Jürgen John
Arndt-Universität Greifswald (1998 – 2010) Bei der langjährigen, mehrfach wieder aufflammenden Greifswalder Namensdebatte ging es um die Rücknahme oder den Erhalt des 1933 verliehenen Namens „ErnstMoritz-Arndt Universität“. Das war nicht das erste Mal, dass der höchst fragwürdige und umstrittene Arndt erinnerungskulturell in die Schlagzeilen geriet. 1995 hatte eine selbsternannte Aktionsfront „Ernst Moritz kann nicht schwimmen“ im nordrheinwestfälischen Solingen eine Büste Arndts entwendet und in der Wupper versenkt.233 Diesem physischen Akt des Denkmalsturzes folgte 1998 der publizistische mit dem schon erwähnten Artikel in der „Zeit“,234 der die Greifswalder Namensdebatte auslöste. Zunächst ging es nur um den in dem Artikel apostrophierten „fatalen Patron“, erst später auch um die Namensvergabe 1933 selber. Die öffentlich an der Universität, in der Stadt und in der Arndt-Gesellschaft geführte Debatte bewegte sich um die Interpretationspole „Antisemit und völkischer Hassprediger“ einerseits oder „Sozialkritiker, Freiheits-Publizist und standhafter Parlamentarier“ andererseits. Sie erreichte um 2001 ihren Höhepunkt und kam auch danach nicht zur Ruhe.235 Wie die zuvor in Münster geführte Debatte um Wilhelm II. ist diese Greifswalder Debatte um den „schaurigen Ernst Moritz Arndt“236 ein Lehrstück erinnerungskultureller Probleme im Umgang mit schwierigen Namenspatronen, unangenehmen Namensvergaben und – hier zudem – sperriger NS-Vergangenheit. Die im Falle Münsters bereits skizzierten gegensätzlichen Grundpositionen zeigten sich ebenso in der Arndt-Debatte. Auch die Pro- und Contra-Argumente wirken ähnlich. Die Arndt als Namenspatron befürwortenden Stimmen erwecken mitunter den Eindruck, sie hätten sich zuvor bei den Wilhelm-Befürwortern von Münster kundig gemacht. Man müsse Arndts positive Seiten, seine pommersche Heimatverbundenheit und sein Wirken für die Universität sehen, hieß es; man müsse ihn „aus seiner Zeit heraus“ verstehen und sein Gedankengut als Ausdruck eines angeblich „allgemeinen Zeitgeistes“ ansehen. Dass es zu Arndts Zeiten ganz andere gedankliche Positionen gab, übersah man geflissentlich. Alles in allem sei Arndt ein geeigneter Namenspatron, der auch durch die Umstände der Namensvergabe 1933 nicht grundsätzlich in Frage gestellt werde. Anträge zur Rücknahme des Namens „Arndt-Universität“ sind von den Universitätsgremien mehrfach abgelehnt worden. 2010 wurde eine Urabstimmung unter Studierenden durchgeführt. Bei sehr geringer Wahlbeteiligung von 23 Prozent sprachen sich 49,9 Prozent für die Beibehaltung des Namens aus. Im Akademischen Senat der Universität votierten 22 Stimmen für, 14 gegen die Beibehaltung des Namens.237
233 234 235 236 237
Taschenbuch-Ausgabe von 2013) einer- und die eher relativierenden Aussagen bei Christopher Clark: Kaiser Wilhelm II. Die Herrschaft des letzten deutschen Kaisers, München 2008; ders.: Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog, München 2013. Vordermayer: Rezeption (2010), S. 484. Schmidt: Patron (1998); vgl. auch Anm. 105. Ernst Moritz Arndt im Widerstreit (2000); Ernst Moritz Arndt weiterhin im Widerstreit (2003). So der Publizist Christoph Dieckmann: Mich wundert, daß ich fröhlich bin. Eine Deutschlandreise, Berlin 2009, S. 85. Infozeitung zur Urabstimmung mit Texten der Initiative „Uni-ohne-Arndt“ und der GegenInitiative „Arndt AG Uni Greifswald“ (2009); Wortmeldungen zu Ernst Moritz Arndt. Drucksache Arndt Januar 2010; Spiegel Online 17.3. u. 18.3.2010.
Universitäre Namen, Namensvergaben und Namensdebatten in Deutschland
193
So blieb es bei dem 1933 vergebenen Namen. Nachwirkungen der Debatte sind eine ständige „Arndt-Arbeitsgemeinschaft“ des Studierendenparlamentes und nun angekündigte Publikationen zur NS-Zeit der Greifswalder Universität. Die kürzlich gestellte ironische Frage, wie lange wohl noch „Greifswalds Akademiker unter Ernst Moritz Arndt leiden müssen“,238 lässt sich zur Zeit kaum beantworten. Die Greifswalder Debatte hat über den Arndt-Streit hinaus noch einmal das beschriebene schwierige erinnerungskulturelle Erbe der drei Namensvergaben 1933/34 vor Augen geführt. Daran hat sich auch in den letzten Jahren nichts Grundsätzliches geändert – trotz des „bösen Erwachens“ 2008 und des dann kurzfristig zur kritischen Veranstaltung umfunktionierten Festaktes in Halle und trotz der recht souveränen kritischen Inszenierung 2009 in Jena. Die anhaltenden Schwierigkeiten im Umgang mit den drei Namensvergaben zeigten die 80. Jahrestage 2013/14. Zu ihnen gab es an allen drei Universitäten keine größeren Veranstaltungen. Diese Schwierigkeiten spiegeln sich auch in den aktuellen Kurzeinträgen auf den Homepages der drei Universitäten zu den Namensvergaben 1933/34 wider, die deren NS-Bezug nur beiläufig bzw. im Falle Jenas lediglich durch die Jahresangabe 1934 erkennen lassen.
238 Erenz: Straßenkampf (2015); vgl. auch Anm. 12; Erenz irrt mit dem Zusatz „den die Nazis der ehrwürdigen, 1456 gegründeten Hochschule 1933 als Namenspatron aufdrückten“.
H U M BOLDT-M Y T H E N U N D U N I V ERSI TÄTS GE SCH ICH T E N Die Historiographie der „Universität zu Berlin“ und die Identitätskonstruktion der deutschen Universität Heinz-Elmar Tenorth ER I N N E RU NGSK U LT U R U N D H ISTOR IO GR A PH I E – U N I V ERSI TÄ R E T R A DI T IONSKONST RU K T ION U N D H ISTOR IO GR A PH ISCH E SE LBST BEOBACH T U NG Die Erinnerungskultur von Universitäten verdankt sich eigenen Praktiken, sie artikuliert sich in zahlreichen, immer ambivalenten materialen und sozialen Formen, in Texten und Gebäuden, Denkmälern oder Festen, Jubiläumsfeiern oder wiederkehrenden Erinnerungstagen, sogar in Orden und Ehrenzeichen, natürlich auch in temporären Ausstellungen oder dauerhaft eingerichteten musealen Orten. Das gilt für alle Universitäten und für die Erinnerungskultur insgesamt; es gibt sicherlich lokale Varianz, aber hohe Vergleichbarkeit.1 Die Selbstbeobachtung der Universität in einer eigenen Historiographie zählt dabei ohne Frage zu den signifikantesten Formen der Konstruktion einer eigenen Geschichte und der Modi ihrer Erinnerung und Präsentation. Diese Texte verbinden die Merkmale und Leistungen der Erinnerungskultur mit den Ambitionen einer themenbezogenen, methodenbewusst organisierten Historiographie und sie können entsprechend in mehreren Referenzen diskutiert werden, kulturell und szientifisch, als Forschungsprodukt und als Konstruktion von Erinnerung. Allerdings, wie Jubiläen bietet auch die historiographische Selbstbeobachtung der Universität „Anlass zu Interaktion und Partizipation, […] und […] ein[en] Anstoß zur Reflexion.“2 1
2
Exemplarisch sei aus jüngerer Zeit die Universität Wien genannt; vgl. Katharina Kniefacz, Herbert Posch: Selbstdarstellung mit Geschichte. Traditionen, Memorial- und Jubiläumskultur der Universität Wien, in: dies., Elisabeth Nemeth, Friedrich Stadler (Hg.): Universität – Forschung – Lehre. Themen und Perspektiven im langen 20. Jahrhundert (=650 Jahre Universität Wien – Aufbruch ins neue Jahrhundert), Wien 2015, Bd. 1, S. 381–409 – mit der ganzen Vielfalt der universitären Erinnerungskultur seit 1365, aber auch mit der erstaunlichen Botschaft, dass z.B. die Feier des Gründungstages erst 1993, als „Rektorstag“, eingeführt wurde; und natürlich fehlen auch die „Festschriften“ zu Jubiläen, z.B. zur 550-Jahrfeier 1865 (vgl. S. 387f.) so wenig wie die Erinnerung an die Kriegstoten und der Nationalsozialismus als kontroverses Thema (402ff.). Daniel Hechler, Peer Pasternack: Deutungskompetenz in der Selbstanwendung. Der Umgang der ostdeutschen Hochschulen mit ihrer Zeitgeschichte, Halle-Wittenberg 2011, S. 225, 196. Dort zitieren sie Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, Bonn 2006, S. 231. Exemplarische Analysen des Zusammenhangs von Universitätsjubiläen und Universitätsgeschichtsschreibung liefert am Beispiel europäischer Universitäten von Prag bis Oslo und Trondheim sowie für Russland und Rumänien – leider nicht für Berlin – Peter Dhondt (Ed.): University Jubilees and University History Writing. Leiden/ Boston 2015.
196
Heinz-Elmar Tenorth
Zwar liefern die dabei erzählten Geschichten – wie Jürgen John in diesem Band generell charakterisiert – zunächst auch nur „erinnerungskulturelle Chiffren auf der geistigen Landkarte“ der deutschen „Universitätslandschaft“, aber doch in besonderer Form. Denn die verbalisierten Selbstbeobachtungen arbeiten immer auch mit der historiographischen Intention, eine eigene und in ihrem Verständnis einzig richtige Lesart der Geschichte ihrer Universität zu verbreiten. Noch in dieser methodisch organisierten Konzentration auf die Vergangenheit sind Historiographien von Universitäten aber gattungstypisch besondere Erzählungen, sowohl unterscheidbar von der professionellen Universitätsgeschichtsschreibung aus der Perspektive von Beobachtern als auch von anderen Elementen universitärer Erinnerungskultur. Meist aus Anlass von Jubiläen entstanden, fungieren sie zwar nicht allein als Jubeltexte, aber sie sind schon anlassbezogen auch nicht nur als rein interesselose Beobachtung von außen interpretierbar; denn Identitätskonstruktion bleibt ihre primäre Funktion. Fraglos gewinnt eine Analyse dieser Selbstbeobachtungen deshalb dann an besonderem Reiz, wenn sie zugleich mit Fremdbeobachtungen kontrastierbar sind. Für die „Universität zu Berlin“, unter unterschiedlichen Namen historisch existent, seit 1949 als Humboldt-Universität zu Berlin, gibt es diese Chance der Kontrastierung von Selbst- und Fremdbeobachtung in besonders dichter Weise. Als Besonderheit der deutschen Universitätslandschaft kann man nämlich notieren, dass sie historisch nicht nur seit langem ein kollektives Selbstverständnis ausgebildet hat, sondern die dabei historisch ausgebildeten Formeln für ihre Identität – nicht nur in „Einsamkeit und Freiheit“ – spätestens im 20. Jahrhundert mit dem Namen Humboldt (meist ist nur Wilhelm gemeint), mit der Berliner Gründung und der in ihrem Kontext entstandenen „Grundschriften“ der „Idee“ der deutschen Universität als „Modell“ der modernen Universität verbunden hat.3 Das wird inzwischen vielfach als „Mythos Humboldt“4 attribuiert, meist ohne die Berliner Gründung von der sich verselbständigenden Humboldt-Erzählung – und deren Status – präzise zu unterscheiden. Der Mythos wird auch schon in kritischer Wendung als eine von Berlin aus inspirierte „Erfindung einer Tradition“5 bezeichnet, ja dekonstruiert. Dennoch lebt der Mythos und sein Narrativ. Noch in ihrem Jubiläumsjahr hat sich 3 4
5
Ernst Anrich (Hg.): Die Idee der deutschen Universität. Die fünf Grundschriften aus der Zeit ihrer Neubegründung durch klassischen Idealismus und romantischen Realismus, Darmstadt 1956. Schon früh bei Mitchell G. Ash: Introduction, in: ders. (Hg.): German Universities. Past and Future. Crisis or Renewal? Oxford 1997, p.vii-xx , dort zur Erläuterung des „Mythos Humboldt“ p. viii; Part One trägt dann insgesamt den Titel: Mythos Humboldt: Universities in Nineteenth- and Twentieth-Century Germany. (dasselbe dt., bezeichnenderweise anders getitelt: Mitchell C. Ash (Hg.): Mythos Humboldt. Vergangenheit und Zukunft der deutschen Universität, Wien 1999). Sehr früh – und anders akzentuiert schon in den Anführungszeichen – Ulrich Herrmann: Bildung durch Wissenschaft? Mythos „Humboldt“, Ulm 1999 – der die Idee keineswegs als Mythos abwertet, sondern aktualisiert. Eine Analyse der außerdeutschen Rezeption von Humboldts Erbe bieten Peter Josephson/Thomas Karlsohn/Johan Östling (Eds.): The Humboldtian Tradition Origins and Legacies. Leiden/Boston 2014. Sylvia Paletschek: Die Erfindung der Humboldt-Universität. Die Konstruktion der deutschen Universitätsidee in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in: Historische Anthropologie 10 (2002), S. 183–205. Mit der Gesamtpointe: „Der Rekurs auf Wilhelm von Humboldt und den Neuhumanismus war im 20. Jahrhundert eine Art Allzweckwaffe“ (S. 205).
Humboldt-Mythen und Universitätsgeschichten
197
die Humboldt-Universität selbst als „das moderne Original“ bezeichnet und als die Mutter aller modernen Universitäten stilisiert.6 Aber wird die damit vollzogene Parallelisierung der Systemgeschichte und Identität der deutschen Universität mit der Lokaltradition der Berliner Gründung und die zugleich unterstellte „Erfindungs“-These von der Geschichte der Berliner Universität auch wirklich bestätigt, treffen die Thesen wie die kritischen Unterstellungen eigentlich zu? Kritisch gegen den Realitätsgehalt des „Mythos Humboldt“ und seiner Tradierung in der Erzählung von der „Idee der Universität“ kann man inzwischen ja schon wissen, dass die Selbstbeobachtung der deutschen Universitäten bis weit ins 20. Jahrhundert eher das „deutsche“ als das Humboldtsche und Berliner Modell attribuiert und transportiert hat;7 kritisch kann man auch sagen, dass dieses vermeintlich weltweit genutzte „Modell“ allenfalls sehr transformiert, nämlich als moderne Forschungsuniversität, international Karriere gemacht hat, zudem aus unterschiedlichen Quellen gespeist;8 kritisch muss man auch festhalten, dass die „Wahrheit des Mythos“ noch gar nicht geprüft worden ist,9 auch nicht im Blick auf die Geschichte der Berliner Universität selbst; schließlich gilt aber auch: Anders als in der „Erfindungs“-These behauptet wird, war den Zeitgenossen schon im gesamten 19. Jahrhundert, auch außerhalb Berlins, Humboldt zumindest als „Gründer“ der Berliner Universität durchaus präsent und des Ruhmes würdig.10 Und gegen eine nationale Engführung muss man sagen, dass auch die Rede vom „Wesen“ oder der „Idee“ der Universität nicht allein als deutsches Thema, von Berlin aus interpretiert und als lokale Folklore gelesen werden muss, sondern durchaus im internationalen Kontext identifiziert werden kann, mit eigenen Quellen, mit signifikanten und bis heute zitierten Autoren – z. B. mit John Henry Newman – und einer eigenen kritischen Beobachtung.11 Mit anderen Worten, die unterstellte Parallelität, vielleicht sogar die Einheit der Identitätskonstruktion der deutschen Universität mit der Geschichte der Berliner Universität und ihrer Selbstwahrnehmung ist selbst Teil des Mythos, den sie beansprucht. Eine Prüfung dieser Mythen, ihrer Geschichte und ihrer Narrationen 6 7
8 9 10 11
Auf ihrer aktuellen Webseite steht der Bereich „Geschichte“ der Universität unter dem Motto „Das moderne Original der Reformuniversität. Die bahnbrechenden Ideen von 1810 haben auch heute nichts an Aktualität verloren.“ Dieter Langewiesche: Die Humboldtsche Universität als nationaler Mythos. Zum Selbstbild der deutschen Universität im Kaiserreich und in der Weimarer Republik, in: Historische Zeitschrift 290 (2010), S. 53–91; ders.: Humboldt als Leitbild? Deutsche Universität in den Berliner Rektoratsreden seit dem 19. Jahrhundert, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 14 (2011), S. 15–37. Sylvia Paletschek: Verbreitete sich ein ‚Humboldt‘sches Modell an den deutschen Universitäten im 19. Jahrhundert? In: Rainer Christoph Schwinges (Hg.): Humboldt International. Der Export des deutschen Universitätsmodells im 19. und 20. Jahrhundert, Basel 2001, S. 75–104. Martin Eichler: Die Wahrheit des Mythos Humboldt, in: Historische Zeitschrift 294 (2012), S. 59–78 resümiert den Mythos und stellt das Desiderat für die Wahrheitsfrage fest. Einzelnachweise in Heinz-Elmar Tenorth: Wilhelm von Humboldts (1776–1835) Universitätskonzept und die Reform in Berlin – eine Tradition jenseits des Mythos, in: Zeitschrift für Germanistik 20 (2010), S. 15–28. Sheldon Rothblatt: The idea of the idea of a university and its antithesis, in: ders. (Hg.): The Modern Universities and its Discontents. The Fate of Newman’s Legacies in Britain and America. Cambridge 1997, S. 1–49.
198
Heinz-Elmar Tenorth
ist deshalb die Absicht der hier folgenden Überlegungen. Die leitende These, um das wesentliche Ergebnis vorab anzudeuten, ist dabei, dass hier mehrere Geschichten aus und in unterschiedlichen Welten existieren, die der Berliner Universität, und schon die in mehrfacher Gestalt, die des Humboldt-Mythos sowie die Identitätskonstruktion der deutschen Universität: Diese Geschichten existieren in unterschiedlichen Quellengattungen und Diskurstraditionen über die Idee stehen neben der eigenen Konstruktion lokaler Erinnerung in Texten und Jubiläumsfeiern. Erst sehr spät in der Geschichte der deutschen Wissenschaft, eindeutig kaum vor den Konflikten des kalten Krieges in der Mitte des 20. Jahrhunderts, laufen diese Überlieferungen zusammen und konstituieren erst dann auch einen zusammenhängenden Diskurs, in dem die spezifische Funktion der Universität im nationalen Wissenschaftssystem vom Humboldt-Label aus erörtert wird. Der Humboldt-Mythos selbst verdankt sich auch erst dieser letzten Phase, nicht schon – wie die viel zitierte These von Sylvia Paletschek sagt – schon der Zeit um 1910. Der Mythos wird dabei zum Träger einer mehrfach defensiven Selbststilisierung, mit der die Universitäten innerhalb eines zuerst politisierten, dann differenzierten Wissenschaftssystems ihre Identität politisch und organisatorisch zu behaupten und ihre unersetzliche Leistung funktional zu klären suchen, im Rückgriff auf eine vermeintlich gut beglaubigte Tradition, nicht zuletzt deshalb so mythisch und trotz ihrer Allpräsenz vielleicht auch deshalb so erfolglos. I DE E N, M Y T H E N, LOK A L E T R A DI T ION E N VON U N I V ERSI TÄT E N – I DE N T I TÄTSKONST RU KT ION E N U N D I H R E GE SCH ICH T E N Der Ursprung der Idee und das Selbstverständnis der Institution Eine Konstante in dieser Geschichte, im Wesentlichen diskursgeschichtlich präsent, ist sicherlich die Rede von der „Idee“ oder vom „Wesen“ der Universität, nicht nur der deutschen Universität. Begriffe wie „Wesen“ oder „Idee“ werden auch schon in der Gründungsphase der Berliner Universität gebraucht, z. B. bei Schleiermacher,12 aber hier noch ihrer eigenen Historizität bewusst. Als „Idee“ wird hier eher ein Konzept tertiärer Bildung neben anderen bezeichnet, nicht etwas das zeitlose Wesen einer Institution. Konzentriert auf die vermeintlich für Berlin zentralen „Grundschriften“13 12 13
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher: Gelegentliche Gedanken über Universitäten im deutschen Sinn (1808), in: Ernst Müller (Hg.): Gelegentliche Gedanken über Universitäten, Leipzig 1990, S. 189. Diese Zuschreibung macht – als Nachfolger einer älteren Edition, vgl. Eduard Spranger (Hg.): Über das Wesen der Universität. Drei Aufsätze von Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Schleiermacher, Henrik Steffens aus den Jahren 1807–1809. Mit einer Einleitung über „Staat und Universität“, Leipzig 1910 (31919) – dann traditionsstiftend erst Ernst Anrich (Hg.): Die Idee der deutschen Universität. Die fünf Grundschriften aus der Zeit ihrer Neugründung durch klassischen Idealismus und romanischen Realismus, Darmstadt 1956. Er präsentiert Texte von Schelling, Fichte, Humboldt, Schleiermacher und Steffens. Anrichs eigene, in vielen Details höchst problematische Schlussfolgerung aus diesen Texten wird im Übrigen meist so wenig diskutiert wie seine stark NS-belastete Vergangenheit. Den Texten wurde ihr Editor jedenfalls nicht zur Belastung.
Humboldt-Mythen und Universitätsgeschichten
199
und die traditionsstiftende Generalisierung einer spezifischen Idee der Universität zu ihrem überzeitlichen Wesen wird dagegen in der späteren Rezeption und bis heute leicht schon übersehen, dass nicht nur die Diskussion in Preußen und Berlin breiter ist14 als die zu Klassikern stilisierten Texte nahelegen. Für die Zeitgenossen15 um 1800 ist die Diskussion über die zu erneuernde Universität auch zeitlich älter als die Vorgeschichte der Berliner Gründung oder gar als Humboldts Amtszeit, und sie wissen auch, dass dieser Reformdiskurs über die Universität nicht nur in Preußen stattfindet, sondern auch in Göttingen oder in Frankreich und preußisch auch schon in Halle eigene Vorläufer hat.16 Angesichts der langen Dauer dieser Reformdebatte seit dem 18. Jahrhundert und der Vielfalt der beteiligten Akteure wundert es deshalb auch nicht, dass die Diskussion vielstimmig ist, keineswegs einheitlich oder gar von Beginn an auf eine im Singular formulierbare Vorstellung von der „Idee der Universität“ eingeschworen. Einig vielleicht noch in der Kritik der alteuropäischen Universität,17 gibt es ansonsten eine Fülle sehr disparater, keineswegs leicht oder einfach harmonisierbarer Vorstellungen von dem, was eine Universität ist oder sein soll. Bereits der Name für diese Einrichtung, die neben den Akademien als Teil der „hohen Schulen“ betrachtet wird,18 ist Teil des Problems. Universitäten sind zwar – europäisch – durch einige traditionale Merkmale unterscheidbar, aber ihr Geltungsrecht ist nicht unbestritten: Tradiert ist der Name sozial, dass „eine Universität […] eigentlich ein Collegium 14
15
16 17
18
Eine erweiterte Sammlung von Texten präsentiert Ernst Müller (Hg.): Gelegentliche Gedanken über Universitäten. Von Engel, Erhard, Wolf, Fichte, Schleiermacher, Savigny, v. Humboldt, Hegel, Leipzig 1990. In eine Edition von „Gründungstexten“ nimmt wiederum die HumboldtUniversität im Jubiläumsjahr 2010 allein Fichte mit dem „Deduzierten Plan“, Schleiermacher, mit den „Gelegentlichen Gedanken“, und Humboldt, mit dem Text „Ueber die innere und äussere Organisation“ sowie mit dem Antrag auf Errichtung vom 24.7.1809 auf, begleitet von der Edition des „Vorläufigen Reglements“ von 1810 (also nicht mit den Statuten von 1817); vgl.: Gründungstexte. Mit einer editorischen Notiz von Rüdiger vom Bruch. Festgabe zum 200-jährigen Jubiläum der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin 2010 (auch: http://edoc.huberlin.de/miscellanies/g-texte–30372/all/hu_g-texte.pdf; zuletzt abgerufen am 10.3.2016). Rudolf Köpke: Die Gründung der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, Berlin 1860, S. 139. In Anm. 29 zu Kap. 4. nennt er z.B. in chronologischer Folge für die Zeit von 1798 bis 1809 insgesamt 30 Schriften, „die sich auf Universitätswesen im allgemeinen oder die Begründung der Berliner im besonderen beziehen“. Noch Köpke ist erkennbar selektiv, denn weder Fichtes noch Humboldts Texte nimmt er in diese Liste auf, auch nicht Kants „Streit der Fakultäten“, wohl aber Schleiermacher und Steffens oder Schellings Methodenschrift. Für die außerpreußische deutschsprachige Reformdiskussion vgl. James Denis Cobb: The Forgotten Reforms. Non-Prussian Universities 1797–1817, Madison 1980. Diese ebenfalls nicht einheitliche Diskussion resümiert bereits sehr plausibel Charles E. McClelland: State, Society, and University in Germany 1700–1914, Cambridge u. a. 1980. Ich rekapituliere im Folgenden, ergänzend, eine Übersicht über die preußische Diskussion, die ich an anderer Stelle mit weiteren Einzelnachweisen gegeben habe, vgl. Heinz-Elmar Tenorth: Eine Universität zu Berlin – Vorgeschichte und Einrichtung, in: ders. (Hg.): Gründung und Blütezeit der Universität zu Berlin 1810–1918. Universität Unter den Linden, Bd. 1, Berlin 2012, S. 3–75, insbes. S. 10ff. Bei Johann Heinrich Zedler (Hg.): Grosses Universallexikon aller Wissenschaften und Künste, Leipzig, 1746, Bd. 49, Sp. 1771 findet sich z.B.: „Die Worte, Universität und Academie, sind zwey Namen, so man denen Hohen Schulen beyleget, die aber gemeiniglich miteinander vermengt werden.“
200
Heinz-Elmar Tenorth
oder Corpus von Lehrenden und Lernenden“ darstellt, „welche gleichsam eine eigene Republick unter sich ausmachen, ihre eigene Jurisdiction und Gesetze haben, von niemand, als des höchsten Landes-Obrigkeit, dependiren“. Eindeutig ist der Status dann von der Zertifizierungsaufgabe her, dass sie „die Ehren-Grade aller Facultäten deren Candidaten conserieren können; welches letzte im Gegentheil die Academien nicht thun dürfen, und daher in diesem Puncte geringer sind als die Universitäten.“19 Unterscheidbar ist die Universität ferner nach den Kriterien der inneren Ordnung, d. h. der Rechte nach außen und der Privilegien des Betriebs. Erst danach wird auch erwähnt, was die alltägliche Praxis auszeichnet: „Solchergestalt ist eine Universität ein Ort, wo allerhand freye Künste und Wissenschafften florieren, und durch öffentlich darzu bestellete Professoren gelehret werden, zugleich auch Doctoren, Licentiaten, Magister und Baccalaurien creiret werden.“ Die Sozialität, Lehrfunktion und das Graduierungsrecht machen also den Kern aus – und alle diese Merkmale gelten in der Universitätsdebatte um 1800 als Indizien ihrer Krise, weil Lehre und Graduierung ohne Qualität arbeiten, die alte Universität also überlebt sei. Man spricht, nicht nur in Frankreich, sondern auch in preußischen Texten schon gern von „Fachschulen“ oder „höheren Lehranstalten“. Die Reformdiskussion will sich auf die alte Binnenordnung sowie die Regeln und Rituale der Universität nicht mehr einlassen, die Graduierungspraxis abschaffen oder qualitativ verbessern, auch die Fakultäten nach Zahl, Status und Funktion verändern oder ganz auflösen, die Lehre verändern und das Studium und die Lebensform der Studenten, jenseits des „Brotstudiums“,20 neu erfinden. Zu den Reformthemen gehört auch, auch StandesPrivilegien und verzopfte Lebensformen der Professoren auf den Prüfstand zu stellen, ihre Praxis neu zu ordnen und z. B. statt der Tradierung des Wissens die Erforschung des Neuen zum Thema zu machen und damit z. B. auch, wie bei Kant, die Bindung der oberen Fakultäten an die öffentlich-staatliche Rolle der akademischen Berufe aufbrechen und die philosophische Fakultät zur kritischen Instanz des Wissens aufwerten. Diese Ideen speisen sich auch aus der Intention, die Rolle des Gelehrten, wie vor allem bei Fichte, mit den höchsten Erwartungen zu besetzen. Die hier projektierte neue Universität ist, mit anderen Worten, vor und um 1800 zwischen der Bewahrung der Tradition und einiger ihrer Elemente und den Erfindungen des Neuen noch keineswegs im Konsens präsent, weder in der deutschen noch in der europäischen Diskussion, weder in ihrer sozialen noch in ihrer epistemischen Funktion – im Konsens anerkannte „Grundschriften“ gibt es jedenfalls nicht. Die Form der Universität, die dann in Berlin 1810 gefunden und etabliert wird,21 ist vor dem Hintergrund dieser Diskussion auch eher ein Kompromiss zwischen 19 Ebd., Sp. 1771. 20 Die Abgrenzungen zwischen dem „Brotstudenten“ und dem „philosophischen Kopf“, die sich in Schillers Jenenser Antrittsvorlesung finden – und analog bei Schelling – gehören auch in diesen Kontext der Reformdebatte, kaum schon zur Praxis der Universität; keineswegs teilen auch alle anderen Texte über das akademische Studium oder die Studenten die Distanz gegen die Fachlichkeit der Ausbildung, die hier vorherrscht. 21 Die im Folgenden geäußerten Argumente zur Geschichte der Universität zu Berlin basieren auf den Ergebnissen der zum 200-jährigen Jubiläumsjahr edierten Bände, vgl. Heinz-Elmar Tenorth (Hg.): Geschichte der Universität Unter den Linden 1810–2010, 6 Bde., Berlin 2010/2012 – Einzelnachweise nur soweit erforderlich.
Humboldt-Mythen und Universitätsgeschichten
201
Tradition und Innovation.22 Denkt man personenbezogen, dann sind aus dem gesamten Diskurs vor allem Schleiermachers Ideen besonders folgenreich sowie die politischadministrativen, nicht etwa die philosophischen Prämissen, die Wilhelm von Humboldt im Einrichtungsprozess zur Geltung bringt, dagegen so gut wie gar nicht Fichtes Pläne, die retrospektiv zu einer der Grundschriften stilisiert werden, oder etwa Hegels Wissenschaftsprogramm und der Romantizismus von Steffens. In der Beibehaltung der Fakultätsordnung kann man Schleiermachers Option erkennen, auch für die starke Rolle, die der Philosophischen Fakultät zugeschrieben wird; die Zugangslösung mit dem seit 1788 diskutierten Abitur ist ebenfalls berlin- und preußentypisch; in der Abwehr der Fachschulen und im Festhalten Humboldts am Begriff der Universität erkennt man die politische Entscheidung gegen das französische Modell, in seinem Verzicht auf alle weitergehenden Vorstellungen – über die finanzielle Autonomie etwa oder über die Symmetrie im Lehrkörper oder über die Vorkehrungen zur Philosophie als Leit-Wissenschaft für alle – sein pragmatisches Einlenken, dem Gründungsakt selbst den Primat vor allen grundlegenden Visionen einzuräumen. Humboldt betont zwar den Forschungsimperativ,23 klassisch formuliert in der später geflügelt werdenden Zuschreibung, „die Wissenschaft als etwas noch nicht ganz gefundenes und nie ganz Aufzufindendes zu betrachten und unablässig sie als solche zu suchen“,24 aber letztlich weiß er und setzt es in der Einrichtungskommission durch, dass Personen, ein Gebäude und Finanzen die Existenzfähigkeit der Universität bestimmen. Deshalb gilt für ihn vor allem, wie es Humboldt selbst ganz pragmatisch prognostiziert und zur Sicherstellung des Forschungsanspruchs der Universität dann auch durchgesetzt hat: „Man beruft eben tüchtige Männer und läßt die Universität sich allmählich encadrieren.“25 Also Rahmenbedingungen setzen, das ist sein Programm, eingeschlossen die neuen Standards in der Bewertung von Zertifikaten und in der Gestaltung der Berufungs- und Graduierungsprozesse, alles Weitere werde sich regeln. Pragmatische Politik, nicht die große Philosophie stiftet die Universität zu Berlin. Die Berufung auf philosophische Abhandlungen und ihre Stilisierung zu „Gründungstexten“ verkennt die Berliner Gründung, ihre historische Gestalt und ihre Funktion in Staat und Gesellschaft. In der konkreten Organisationsform nämlich, wie sie sich seit 181026 22 Dazu schon sehr prägnant Gert Schubring (Hg.): ‚Einsamkeit und Freiheit‘ neu besichtigt. Universitätsreformen und Disziplinenbildung in Preußen als Modell für Wissenschaftspolitik im Europa des 19. Jahrhunderts, Stuttgart 1991. Seine scharfe Zuspitzung auf einen „preußischen Sonderweg“ und die Qualifizierung der Berliner Universität als eine „Kuriosität“ teile ich dagegen nicht. Vgl. Gert Schubring: Spezialschulmodell versus Universitätsmodell: Die Institutionalisierung von Forschung, in: ders., 1991, S. 276–326, Zit. S. 279. 23 So hat Turner Humboldts Orientierung an der Wissenschaft bezeichnet, vgl. R. Steven Turner: The Prussian Universities and the Research Imperative, 1806 to 1848, (Diss. Ms.) Princeton University 1973 sowie die Teilpräsentation zentraler Thesen aus der Dissertation in ders.; The Prussian Universities and the Concept of Research, in: Internationales Archiv für die Sozialgeschichte der deutschen Literatur 5 (1980), S. 68–93. 24 Wilhelm von Humboldt: Ueber die innere und äussere Organisation, in: ders.: Werke; hg. v. Andreas Flitner, Klaus Giel, Bd. IV, Darmstadt 2010, S. 258. 25 Wilhelm von Humboldt: Brief an seine Frau Caroline vom 22. Mai 1810, hier zit. n. Lenz: Geschichte, Bd. 1 (1910), S. 219. 26 Für die aktuelle Diskussion der Gründungsgeschichte bis 1817 Heinz-Elmar Tenorth: The University of Berlin: A Foundation between Defeat and Crisis, Philosophy and Politics, in:
202
Heinz-Elmar Tenorth
und u. a. in der nach konfliktreichen Beratungen mit dem Staat erlassenen Satzung von 1817 spiegelt, dominieren nicht zufällig die Rücksichten, die mit der Gründung auf die lokale Wissenschaftskultur, die ökonomischen Erwartungen und die Politik genommen werden mussten. Die Universität Berlin erhält eine Aufgabe wie alle preußischen Universitäten, denn sie zählt zu den „Universitäten in unseren Landen“, wird nicht als Universität im „deutschen Sinne“ attribuiert, wie noch Schleiermachers Denkschrift und der universitäre Entwurfstext der Satzung formuliert hatten. In diesen Kontext einer „Landesuniversität“ – die Humboldt ja zunächst gar nicht gründen wollte – gehört auch die zweifache Aufgabenbestimmung der Ausbildung für die akademischen Berufe einerseits, für die wissenschaftliche Bildung andererseits, von „Zweckfreiheit“ als Gründungsidee kann also keine Rede sein. Die Universität akzeptiert auch diese überlieferte Zuschreibung an die Landesuniversitäten und sie bleibt traditional auch in ihrer hierarchisch geordneten Personalstruktur oder in der Rolle der Studenten als einer zu kontrollierenden Einheit. Diese Vorgaben der Satzung kehren dann wieder in den Funktionszuschreibungen, die zwischen dem Ministerium Altenstein und der Universität entfaltet werden, in denen die Universität zu Berlin als „preußische Centraluniversität“ deklariert und gestaltet wird. Das ist durchaus ein Privileg, schon ökonomisch und innerpreußisch in der Zuweisung von Ressourcen, auch in der Reputation des Standorts, sowohl deutschlandweit als auch im internationalen Wissenschaftssystem, denn Berlin wurde damit zu einem Ort, der auch die Gesamtheit der Wissenschaften der Zeit zu repräsentieren hatte, die universitas also auch epistemisch, nicht nur sozial realisieren sollte. Ihre Einheitsform findet sie insofern preußisch und damit politisch, im Namen des Gründers, den sie seit 1828 tragen darf, wie die anderen preußischen Universitäten, mit denen das Land seine innovative Politik der höheren Bildung nach 1810 zwischen Berlin, Bonn und Breslau dokumentiert hatte.27 Schon in den Beratungen der Statuten hatte die Universität dabei die Grenzen ihrer Autonomie angesichts des Staates erfahren und anerkannt. Unter dem Ministerium Altenstein waren diese Grenzen vielleicht nicht so rigide gezogen wie noch unter Schuckmann, dem Nachfolger Humboldts, denn im „Demagogenstreit“ nach 1819 stützt Altenstein die Freiheitsrechte der Universität gegen die politischen Kontrollambitionen. Aber Altenstein kann diese förderliche Rolle nur einnehmen, weil die Universität sich selbst in dieser Situation einrichtet und die „Freiheit des Geistes“ und der „Wissenschaft“ von der politischen Freiheit und dem Recht zur politischen Aktion unterscheiden kann. Das Verhältnis von Staat und Universität beruht also systematisch auf dem Zugeständnis wechselseitiger Autonomie, d. h. der Selbständigkeit in der Abhängigkeit. Die Universität beansprucht keine politische Autonomie, ja sie akzeptiert von Beginn an und bis weit ins 20. Jahrhundert z. B., dass das Berufungsrecht beim Staat liegt, wie es Humboldt auch empfohlen hatte, und sie ist auch sonst, sieht man von den 1920er Jahren ab – von denen noch zu reden ist – kein Konfliktherd für die jeweiligen Obrigkeiten.
27
International Journal for the Historiography of Education 4 (1/2014), S. 11–28. Thomas Becker, Uwe Schaper (Hg.): Die Gründung der drei Friedrich-Wilhelms-Universitäten. Universitäre Bildungsreform in Preußen (=Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin 108), Berlin 2013. Zur Namensgebung vgl. umfassend den Beitrag von Jürgen John unten i. d. Bd.
Humboldt-Mythen und Universitätsgeschichten
203
Die erste Historisierung der Gründung – das Jubiläum von 1860 In den politischen Debatten seit dem Demagogenstreit, auch in den späteren Berufungen konservativer Gelehrter nach 1840 diskutiert die Universität ihren politischen Status und ihre korporativen Rechte, aber sie lebt im Konsens mit der traditionellen Zuschreibung als „preußische Centraluniversität“. In der Revolution von 1848 bestätigt sich das; denn die Mehrheit der Professoren und die universitären Gremien bleiben auf Seiten des Staates, auch gegen reformambitionierte demokratisch engagierte Privatdocenten und Studenten.28 Dieses Selbstverständnis bestimmt auch ihre Erinnerungskultur und es artikuliert sich manifest bereits in den Feiern ihres ersten Jubiläums 1860. Hier, mit diesem Ereignis, setzt auch die eigene Historiographie der Universität ein und sie spiegelt im Ursprung dann schon eine Differenz, die sich in der Folgezeit immer neu zeigt, wenn man die differenten Quellen berücksichtigt, nämlich die Differenz zwischen der Jubelrhetorik der universitären Feiern, Feste und öffentlichen Reden und der Form der Beobachtung der Universität, wie sie sich in ihrer Historiographie artikuliert. Mag es noch einen Konsens in der zentralen Referenz auf Preußen geben, so sind doch Differenzen unverkennbar, wenn die Geschichte im Detail historiographisch präsentiert oder emphatisch in öffentlicher Rede zur eigenen Tradition stilisiert wird. Die Universität wählt das Jahr 1860, um die ersten fünfzig Jahre ihres Bestehens zu einem Anlass feierlichen Gedenkens zu machen, also das Datum des Lehrbeginns. Damit bezieht sie sich weder auf die Datierung der Stiftungsurkunde des Königs vom 16. August 1809 noch auf die feierliche Verkündigung der Statuten der Universität, die am 24. April 1817 geschehen war. Dieser Tag gilt jetzt als Tag der „Einweihung“29 der Universität. Die Revolution von 1848 und damit alle Distanz gegenüber dem Königshaus ist im Übrigen bei diesen Feiern 1860 schon so deutlich vergessen, allenfalls in der Negation präsent, wie die nachgehende Bearbeitung ihrer Folgen seit 1849/50 oder ihre lange Vorgeschichte seit 1819. Schon das gilt allerdings nicht für ihre Historiographie, für die erste Geschichte der Universität und für ihren ersten Historiker, Rudolf Köpke.30 Köpke versäumt zwar ebenfalls nicht, das Lob der Universität zu singen, ohne „den Vorwurf ruhmreicher Ueberhebung zu befürchten“, denn der „Antheil Berlin[s] an der Entwickelung der deutschen Wissenschaft in den letzten fünfzig Jahren [sei], zu bekannt“,31 so dass man einen Tadel wegen unangebrachten Selbstlobs nicht befürchten 28 Weitere Details für die hier für 1860 folgenden Argumente in Heinz-Elmar Tenorth: Revolution und Reaktion: Die Universität in der Mitte ihres Jahrhunderts, in: ders. (Hg.): Gründung und Blütezeit der Universität zu Berlin 1810–1918. Universität Unter den Linden, Bd. 1, Berlin 2012, S. 381–423. 29 So in seinem Vorwort Ferdinand Ascherson (Hg.): Urkunden zur Geschichte der Jubelfeier der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin im October 1860. Nebst einem Verzeichnis der Lehrer der Universität von der Gründung bis zum 15. October 1862, Berlin 1863. 30 Rudolf Köpke: Die Gründung der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Nebst Anhängen über die Geschichte der Institute und den Personalbestand, Berlin 1860. Rudolf Köpke (1813 Königsberg –1870 Berlin), Ranke-Schüler, Mitarbeiter an den Monumenta Germaniae Historica, Habil. Berlin 1846, seit 1856 a. o. Professor an der Berliner Universität. Er schrieb im Auftrag des akademischen Senats. 31 Ebd., S. III, Vorwort, S. IV für das folgende Zitat. Zitate aus Köpke 1860 im Folgenden in Klammern im Text.
204
Heinz-Elmar Tenorth
müsse. Köpke erinnert aber nicht allein an die Wissenschaftsgeschichte der Universität als eigenständiges Thema, sondern sogleich auch an die „andere“, die, wie er sagt, „volksthümliche Bedeutung“ der Berliner Universität. Dann erwähnt er einerseits – wie die anderen Festreden – die preußische und kämpferische Tradition, die Einheit von Wissenschaft und Kriegsbereitschaft: „In den Zeiten fremder Gewaltherrschaft ist sie begründet worden, als den deutschen Händen das Schwert entfallen war, und es wieder klar werden sollte, nur der Geist sei es, der frei und lebendig mache.“ Köpke kennt andererseits, anders als die Jubiläumsfeiern der Universität, auch die Schwierigkeiten der Universität in ihrer politischen Umwelt. Er erwähnt „die einengende Gegenwirkung“, die nach dem Wartburgfest in der „Zeit des Mißtrauens“ ausbrach, so dass erst „mit der Vertretung des Regierungsbevollmächtigten durch den zeitigen Rektor und den Richter die freie Bewegung wiedergewonnen wurde“.32 Ihren „europäischen Ruf“ habe die Universität erst danach begründet, nach 1830 also, im „Jahrzehnt ungestörter wissenschaftlicher Entfaltung.“ Köpkes Erzählung der Gründung und Etablierung der Universität hat also ihren eigenen Ton. Natürlich erwähnt er den königlichen „Stifter“ zuerst (14) und sieht auch wesentlich die „Hauptstadt“ Preußens (18ff.) als Referenzort der Gründung, aber dann kommen doch die wirklichen Akteure in den Blick, Beyme früh, dann Stein, Wolf und Humboldt, und zwar der politisch klug agierende und berufende Humboldt, im Bunde mit den berühmten Wissenschaftlern. Die begleitenden „Urkunden“ in Köpkes Geschichte der Gründung und der Folgejahre ergänzen diesen Blick. Sie liefern wenig Philosophie, aber viel administrativ gesteuerte Einrichtungspolitik, eingeschlossen Humboldts Berichte und Anträge an den König. Humboldt ist wesentlich für die Gründung und Einrichtung, aber – wie es seine Anträge an den König auch belegen – er gründet die für Preußen und Berlin zentrale und ökonomisch wie politisch mit großen Hoffnungen besetzte wissenschaftliche Einrichtung, er inszeniert nicht eine Philosophie in einem Akt revolutionärer Gründung des Neuen. Die Festreden33 aus der Berliner Universität, besonders engagiert die des Rektors Boeckh, leben mit Köpke im Konsens der Preußenorientierung, aber sie nennen weder die problematischen politischen Seiten des Verhältnisses von Universität und Staat, wie Köpke sie nach 1810 oder in der Revolution gesehen hat, noch kennen sie selbstkritische Reserve. Boeckh erklärt und überhöht die wissenschaftliche Reputation der Berliner Universität zu einem Resultat des preußischen Geistes, ja er versteigt sich zu der These, „der Fortschritt aber ist zugleich das stetige Wesen des Preußischen Staates, dessen Geist“ – das räumt er immerhin ein – „mit dem Deutschen Geist untrennbar verbunden ist“ (S. 85). Die Universitäten, das habe der Kampf gegen Napoleon gezeigt, seien ja „der Sitz des Deutschen Geistes“ (78). Der Sprecher der deutschsprachigen Universitäten, der Heidelberger Rektor und Jurist Karl Joseph Anton Mittermaier, relativiert zunächst, listig, die Preußenzentrierung der Gründungsgeschichte in seiner eigenen Gründungserzählung dadurch, dass er die bedeutsame Rolle der Berufung Heidelberger Gelehrter für den Gründungsprozess betont. Er kann ja auch auf die 32 33
Ebd., S. V, gilt auch für das folgende Zitat. Hier zitiert nach Ferdinand Ascherson: Urkunden zur Geschichte der Jubelfeier der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin im October 1860, Berlin 1863; Boeckhs Rede v. 15.10.1860, S. 74–88, weitere Nachweise in Klammern im Text.
Humboldt-Mythen und Universitätsgeschichten
205
Theologen Neander und De Wette verweisen und für die Philosophische Fakultät auf Wilken, Hegel und natürlich auf Boeck selbst (S. 41f.). Mittermaier deutet die Ruhmesgeschichte auch gesamtdeutsch um, in dem er auf das Universitätssystem insgesamt abhebt und auf „ein inneres geistiges Band, das die Deutschen Hochschulen verbindet“, so dass „Gemeingut aller“ wird (S. 40), was eine der Hochschulen leistet. Noch feiert sich die Berliner Universität 1860 also so, wie es im Duktus aller Rektoratsreden des 19. Jahrhunderts liegt, als Feier der je nationalen Leistungen, der landesherrlichen, der regionalen, der von bekannten Gelehrten erbrachten Leistungen. Die Distanz zu diesen Geschichten oder die Erinnerung an ihre problematischen Seiten, die deutet sich allenfalls in der Historiographie an, in Jubiläen wird sie ausgespart. Und natürlich, der Ruhm der Institution wird landesherrlich und national zugeschrieben, nicht personalisiert, schon gar nicht auf Humboldt, ohne dass etwa Boeckh (z. B. 78f.) oder die anderen vergessen, dessen Rolle im Gründungsprozess angemessen zu würdigen. Aber vom Mythos ist noch nichts zu sehen. Die Universität Berlin versteht und inszeniert sich preußisch, von 1813 her. Das Wandbild in der Großen Aula zeigt nicht zufällig den Fichte der „Reden an die Deutsche Nation“, noch in der Weimarer Republik werden hier die Feiern inszeniert, als Preußen-Feiern, nicht als Humboldt-Würdigung. Das Berliner Jubiläum 1910 – der Ursprung des Mythos? Wird der Mythos also 1910 erfunden, in dem Jahr, das für den Ursprung des HumboldtMythos und die Erfindung einer Tradition verantwortlich gemacht wurde? 1910 ist tatsächlich in der Erinnerungskultur der Berliner Universität ein besonderes Jahr, und 1910 ist nicht nur wegen der 100-Jahr-Feier Berlins auch ein besonderes Jahr in der Geschichte der deutschen Universität. In der zum Jubiläumsfest angekündigten Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft erwächst ihr doch die Institution, von der die zentrale Stellung der Universität im Wissenschaftssystem erstmals wirklich bedroht wird. Diese Zäsur im Wissenschaftssystem und die Folgen der allmählichen Entwicklung von Wissenschaft zum „Großbetrieb“ werden in Berlin um 1910 durchaus gesehen, auch kritisch.34 Zeitgenössisch und lokal dominiert aber zunächst das Jubiläum: mit dem obligaten Festakt35 und mit der umfassenden Geschichte der ersten hundert Jahre der Universität,36 jetzt aber auch begleitet von intensiven Analysen aus der Universität, die für ihre Selbst- wie Fremdwahrnehmung höchst folgenreich werden. 34 Vgl. meine Hinweise in Heinz-Elmar Tenorth: Transformation der Wissensordnung. Die Berliner Universität vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis 1945, Berlin 2010. Zur Einleitung, in: ders. (Hg.): Transformation der Wissensordnung. Geschichte der Universität Unter den Linden, Bd. 5, Berlin 2010, S. 9–49. 35 Bericht im Auftrag des Akademischen Senats erstattet vom Prorektor Erich Schmidt: Jahrhundertfeier der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin 10.–12.Oktober 1910, Berlin 1911. 36 Max Lenz: Geschichte der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, 4 Bde.: 1. Bd.: Gründung und Ausbau. Halle a. d. S, 1910; 2. Bd.: 1. Hälfte: Ministerium Altenstein, Halle a. d. S. 1910; 2.Bd.: 2. Hälfte: Auf dem Weg zur deutschen Einheit im Neuen Reich, Halle a. d. S. 1918; 3. Bd.: Wissenschaftliche Anstalten, Spruchkollegium, Statistik. Halle a. d. S. 1910; 4.Bd.: Urkunden, Akten und Briefe. Halle a. d. S. 1910.
206
Heinz-Elmar Tenorth
Diese bedeutsam werdenden Begleittexte liefert vor allem Eduard Spranger, mit seiner Habilitationsschrift, in der er sich – 1909 – mit der Bildungsphilosophie Wilhelm von Humboldts37 erstmals auseinandergesetzt, ja sie in einem systematischen Sinne überhaupt erst entdeckt und aus verstreuten Texten als Philosophie rekonstruiert hat, dann, 1910, mit seiner Analyse der preußischen Bildungspolitik. Die wird für das spätere Bild der Universität besonders folgenreich, tritt sie doch an als ein auf neuen Quellen des preußischen Kultusministeriums und einigen Denkschriften Humboldts basierendes Buch zu einer das gesamte Bildungssystem umfassenden und ihm als Urheber zurechenbaren „Bildungsreform Wilhelm von Humboldts“.38 Schon in der frühen Rezeption bedeutsam geworden, liefert Spranger gemeinsam mit der Edition von Texten aus der Gründungsdebatte der Berliner Universität, die er zu Abhandlungen über das „Wesen der Universität“ deklariert und mit einer Abhandlung über „Staat und Universität“ begleitet, die neue Gründungserzählung, ihren Kontext und das vermeintlich philosophisch beglaubigte Bild des Selbstverständnisses der Universität, lokal und in ihrem „Wesen“.39 Das sind insgesamt Arbeiten, die bis heute nicht unkritisiert geblieben sind, bildungstheoretisch40 genauso wie universitäts- und bildungshistorisch.41 Diese Rezeptionsgeschichte interessiert hier weniger als der Impuls zur Diskussion, der von hier aus für die Selbst- und Fremdwahrnehmung der Berliner Universität im Kontext ihres Jubiläums 1910 und vor dem Hintergrund ihrer ersten umfassenden historiographischen Beobachtung bei Max Lenz ausgeht. Versucht man eine grobe Unterscheidung, dann gibt es 1910 für die Konstruktion dieser Selbst- und Fremdbilder zumindest vier differente (individuelle und / oder kollektive) Akteure: Zuerst die Universität selbst, die sich in ihrem Jubiläum in 37 Eduard Spranger: Wilhelm von Humboldt und die Humanitätsidee, Berlin 1909. 38 Eduard Spranger: Wilhelm von Humboldt und die Reform des Bildungswesens, Berlin 1910. 39 Eduard Spranger: Über das Wesen der Universität. Drei Aufsätze von Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Schleiermacher, Henrik Steffens aus den Jahren 1807–1809. Mit einer Einleitung über „Staat und Universität“, Leipzig 1910 (31919) sowie ders.: Universität seit 100 Jahren, Leipzig 1913. 40 Zur bildungstheoretischen Spranger-Kritik u. a. im Verweis auf präsentistische, von 1910 (und später) aus geleitete Deutungen Humboldts durch Spranger Dietrich Benner: Wilhelm von Humboldts Bildungstheorie. Eine problemgeschichtliche Studie zum Begründungszusammenhang neuzeitlicher Bildungsreform. Weinheim/München 1990, insb. S. 22–24 sowie Werner Hürlimann: „Es wäre ein grosses und trefliches Werk…“. Sprangers Beitrag zur vermeintlichen Bildungstheorie Humboldts, in: Zeitschrift für pädagogische Historiographie 9 (2/2003), S. 79–83 – der allerdings im Eifer der Sprangerkritik zu dem gescheiterten Versuch geneigt ist, Humboldt alle Ambitionen zu einer Bildungstheorie überhaupt abzusprechen; dem Problem entgeht Clemens Menze, der zwar nicht Humboldts Bildungsreform darstellt, wie der Titel verspricht, aber doch den philosophischen Gehalt der im Kontext entstandenen Humboldtschen Texte darstellt, vgl. Clemens Menze: Die Bildungsreform Wilhelm von Humboldts, Hannover 1975. 41 Für die preußische Bildungsreform insgesamt ist jetzt vor allem Bd. 3 des Handbuchs der deutschen Bildungsgeschichte einschlägig: Karl-Ernst Jeismann, Peter Lundgreen (Hg.): Von der Neuordnung Deutschlands bis zur Gründung des Deutschen Reiches. 1800 bis 1870 (=Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte Bd. III), München 1987, S. 250–270, für die Geschichte des Gymnasiums Karl-Ernst Jeismann. Das preußische Gymnasium in Staat und Gesellschaft, 2 Bde., Stuttgart 1996. Von einer „Bildungsreform Wilhelm von Humboldts“ wird man heute nicht mehr sprechen.
Humboldt-Mythen und Universitätsgeschichten
207
Festen und Feiern, in ihren Gremien, vor allen in Rektor und Senat, öffentlich inszeniert und ihre Identität historisch wie im Wissenschaftssystem an diesem „preußischen Ehrentag“ (51), so der Greifswalder Rektor, artikuliert; parallel gibt es die Fremdbeobachtung, wie immer aus sympathetischer Distanz, geschlossen schon in den Festreden der Gäste präsent, die 1910 nach Berlin gekommen waren, um – wie 1860 – in den Worten des Heidelberger Rektors den Gleichschritt von „Kultur“ und „Krieg“ als preußische Leistung zu würdigen. Drittens existieren die themen- und jubiläumsspezifischen Analysen, exemplarisch in Sprangers Arbeiten präsent, und – quasi als Kontrollwissen für die historiographischen Zuschreibungen – viertens die von Max Lenz vorgelegten Bände. Angesichts dieser reichhaltigen und vielgestaltigen Diskurs- und Quellenlage kann man kein konsensuales Bild erwarten, an dieser Stelle aber auch keine umfassende Analyse. Hier interessiert nur die Frage, ob 1910, wie die bekannte Zuschreibung lautet, die „Erfindung“ einer Tradition ihren Ursprung und der Mythos Humboldt seinen Ausgangspunkt fand. Das Ergebnis einer neuen Betrachtung der zahlreichen Quellen, um es vorwegzunehmen, bestätigt diese Behauptungen nicht. Es gibt dafür, zum einen, schon die Beobachtung, dass Max Lenz in seiner Geschichte der ersten 100 Jahre keineswegs dem Mythos Nahrung gibt.42 Betrachtet man die Argumente aller Akteure, lässt sich jetzt ergänzen, dass das Jubiläum von 1910 eher das von 1860 bekannte preußische Narrativ für die Geschichte der Berliner Universität fortsetzt, als ein neues zu erfinden. Auch Spranger fügt diesem Narrativ nur eine – allerdings später bedeutsam werdende – Nuance hinzu; aber für die Rolle Humboldts in der Gründung und für die Geschichte der Universität geht er über Lenz nicht hinaus. Die aus der Vergangenheit bekannte Tonlage der preußischen Akteure gibt der Kaiser in seiner Festansprache vor. Er rühmt, dass die Gründung der Universität sich ebenfalls dem „schöpferischen Geiste“ verdankt, „der Preußens Wiedergeburt entsprang“43 und „in Fichte, Schleiermacher, Savigny und deren Freunden lebendig war“, die als die „geistigen Begründer“ der Universität auch von den Gästen gefeiert werden. Der Kaiser spricht aber auch von der „universitas litterarum im Sinne Wilhelm von Humboldts“, die noch nicht vollendet sei, und begründet und verkündet dann – quasi mit Humboldts Ambitionen für die Wissenschaftslandschaft Berlin und als ihre „Vollendung“ (37) – die Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, d.h. „selbständige Forschungsinstitute als integrierende Teile des wissenschaftlichen Gesamtorganismus“, und zwar „unbeeinträchtigt durch Unterrichtszwecke“ (37). Er argumentiert also ohne jede Emphase oder auch nur Anerkennung für die Einheit von Forschung und Lehre in der Universität, und seine Begründung der Einrichtung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ist wohl auch nicht vereinbar mit Humboldts alter Intention, der ja die „leblosen Institute“ erst durch die Verbindung mit der Universität zum Leben erwecken wollte. Wie immer man dieses von Harnack konstruierte Gastgeschenk des Kaisers beurteilt, institutionell gesehen ist es nicht in Humboldts Plan und es ist ein Affront gegen die Universität. Humboldts Ideen werden allerdings 42 43
Bei Paletschek selbst; vgl. dies.: Erfindung (2002), S. 189. Schmidt: Jahrhundertfeier (1911), S. 36, und natürlich zitiert er die Mahnung seines Vorgängers, dass Preußen „durch geistige Kräfte zu ersetzen“ habe, was es „an physischen verloren hatte“ (S. 36).
208
Heinz-Elmar Tenorth
am Schluss wieder paraphrasierend eingebracht, wenn der Kaiser über „die echte Wissenschaft“ spricht und von ihr sagt, dass sie „wie Humboldt so trefflich sagt – aus dem Innern stammt und ins Innere gepflanzt wird, die den Charakter umbildet und Charaktere schafft.“ (38) Erst diese Reduktion von Humboldts Universitäts- und Wissenschaftskonzeption auf die Moralisierung der akademischen Eliten gibt den neuen Ton vor, in dem er auch weiterhin bei den Jubiläumsfeierlichkeiten beansprucht wird. Selbst in seiner „Festrede“ (98–121), nachdem er ausgiebig das bekannte Bild vom „historisch gegebenen Vorrang Berlins und seiner Universität“ hervorgehoben hatte (103), nutzt Max Lenz diese Humboldt-Referenz. Er tut das in einem ausführlichen Zitat,44 um die Ambition der „Denkschrift“ zu zeigen, „welche recht eigentlich die Grundlage unserer Hochschule bildet“ (120) und in der zugleich das „Wesen der Universität“ bestehe. Das heißt für ihn, „die untrennbare Verbindung von Lehre und Forschung zu suchen […], daß wir sie darum noch heute in ihrer Einheit besitzen, wie sehr auch immer ihre Disziplinen sich zersplittert und ihren Zusammenhang verloren haben mögen“, dennoch, so endet er, „bleibt auch unser Glaube“. (120) Mit dieser quasi-religiösen Bekräftigungsformel gegen Spezialisierung und Zersplitterung, gegen die er abschließend auch noch Brentanos romantische Allheitsbeschwörungen von 1810 zur Stütze zitiert,45 wehrt sich Lenz gegen die Skepsis, die seine eigene historiographische Darstellung der Praxis der Universität im ausgehenden 19. Jahrhundert charakterisiert. Gleichzeitig versucht er, gegen die ihm sehr wohl bekannte Tatsache46, dass Humboldts jetzt so viel zitierte Denkschrift in den Gründungen keine Rolle gespielt hat, sie dennoch in diese zentrale Funktion der Gründungsintention zu rücken, weil sie – so seine These – „mit Recht als der vollste und reifste Ausdruck seines Programms für die höheren wissenschaftlichen Anstalten gilt“.47 Aber in seiner Geschichte markiert Lenz selbst die Differenz von „Programm“ und Realität und beschreibt schon für die frühe Phase ebenfalls bereits selbst, dass nicht Humboldts Programm ausschlaggebend war, sondern politische Referenzen. Lenz sieht vielmehr deutlich die Rolle der Politik, im Wissenschaftsbegriff betont er die Bedeutung Hegels, institutionell betont er die Doppelaufgabe, und für das Autonomiethema liest er den Zusammenhang von Staat und Universität selbst viel eher von Fichte aus als mit den Augen des liberalen Humboldt. In der Wertschätzung dieses ja erst spät im 19. Jahrhundert entdeckten Programms trifft sich Lenz allerdings mit Sprangers Thesen über Humboldts „Idee 44 Lenz beruft sich mit der „Denkschrift“ auf den Text „Uebere die innere und äusser Organisation der höheren wissenschaftlichen Lehranstalten in Berlin“, der ja von Bruno Gebhardt erst im ausgehenden 19. Jahrhundert entdeckt worden war. 45 Lenz zitiert Brentanos Interpretation der Inschrift – „Universitati Litterariae“ –, die auf dem Giebel der Universität stand. Brentano hatte romantisierend übersetzt: „Der Ganzheit, Allheit, Einheit/der Allgemeinheit / Gelebter Weisheit / Des Wissens Freiheit / Gehört dieses Königliche Haus! So leg‘ ich Euch die goldnen Worte aus: Universitati Litterariae“ (S. 121). 46 Für die Diskussion im Einzelnen Lenz: Geschichte (1/1910), S. 179–195. Vgl. zur Diskussion seines m. E. gescheiterten Versuchs der Einbindung der Denkschrift in den Planungsprozess von 1809 Tenorth, Einrichtung (1/2012), S. 56ff. 47 Lenz: Geschichte (1/1910), Zit. S. 179, dort in Anm. 1, S. 179f. auch die ausführlichen Überlegungen zur Datierung der Denkschrift.
Humboldt-Mythen und Universitätsgeschichten
209
der Universitäten“48 (jetzt im Plural). „W. v. Humboldts größte Tat“, so Spranger 1910, „ist die Gründung der Universität Berlin.“ Er betont die Abgrenzung gegen die Ideen der Aufklärung und gegen das Modell der Fachbildung oder Verschulung der Universität, lobt noch einmal seine Gewährsmänner von Fichte bis Steffens und speziell Humboldt für die „organische Verbindung“ aller Wissenschaftseinrichtungen in Berlin als Ausdruck der „Idee der Universität“ und für seine politische Leistung: „die feine Linie zwischen staatlichem Machtinteresse und individueller Freiheit“ (210) gefunden zu haben. Aber ob man Spranger darin folgen wird, dass er in Humboldts Zuschreibung von Forschung letztlich „Fichte selbst zu hören“ (208) meint, das ist durchaus schon fraglich. Im Zitat über „Charakter und Handeln“ aus Humboldts Texten kehrt indes die bekannte Moralisierung als Leistung der Wissenschaftspraxis wieder. Aber in der Universität auch die „Lehre von der organischen Einheit aller Wissenschaften“ zu sehen, mit der „die moderne Wissenschaft auf eine ausgesprochen philosophische Basis gestellt“ wurde (202), das geht schon nicht mit Humboldt, sondern nur noch mit Schelling und es wäre vor allem relativ kühn, das der Praxis der Berliner Universität zuzuschreiben. Selbst programmatisch geht das nicht, denn Schleiermachers Verständnis für die Spezialisierung der Forschung wird dabei ebenso wenig berücksichtigt wie Humboldt Anerkennung fachspezifischer Differenzen. Aber Spranger übt sich wenig in autorspezifischer Differenzierung in diesem kurzen Kapitel über die Universität, sondern rechnet „der Bildungsreform Wilhelm von Humboldts“ hier viel zu, was man weder Humboldt noch der preußischen Bildungsreform zurechnen kann. Allerdings, er legt den Grundstein für das, was den Diskurs über „Idee“ und „Wesen“ der Universität und ihr Verhältnis zum Staat dann, nach 1918, bestimmen wird – moralisierend, romantisierend, in organischen Metaphern, jenseits der Realität der Universität, auch nicht allein im Blick auf Humboldtsche Texte, sicherlich jenseits des Selbstverständnisses der Berliner Universität um 1910, sondern weit ausgreifend, im Kern aber politisch in Fichtes Sinn – allerdings, „Humboldt-Mythos“ ist das nicht. Die Konstruktion der Idee aus dem antidemokratischen Affekt – die Universitätsdebatte in der Weimarer Republik Seit dem frühen 20. Jahrhundert aber, oder, folgt man den Erscheinungsdaten in ihrer Dichte und Frequenz dann exakt erst nach 1918 und bis 1933, verselbstständigt sich in Deutschland eine eigene Gattung von Reflexionsliteratur, die vom „Wesen“ oder der „Idee der Universität“ im Singular spricht. Solche Reflexionen finden sich bei sehr unterschiedlichen Autoren, aus dem Wissenschaftssystem49 und aus der Politik50, und 48 Spranger: Humboldt (1910), S. 199; auch für das folgende Zitat. 49 Besonders intensiv rezipiert dann z.B. Karl Jaspers: Die Idee der Universität, Berlin 1923. Helmut Plessner spricht im Blick auf die „Bildungsbedeutung der Wissenschaft“ vom „Wesen der deutschen Universitätsidee“. Vgl. ders.: Zur Soziologie der modernen Forschung und ihrer Organisation in der deutschen Universität (1924), in: ders., Schriften zur Soziologie und Sozialphilosophie, Bd. X, Frankfurt a. M. 1985, S. 7–30, hier: S. 21. 50 Carl Heinrich Becker: Vom Wesen der deutschen Universität, Leipzig 1925, auch in ders.: Internationale Wissenschaft und nationale Bildung. Ausgewählte Schriften, hg. und eingel. von Guido Müller, Köln, Wien 1997, S. 305–328 (dort auf 1924 datiert); bei Müller auch weitere
210
Heinz-Elmar Tenorth
das Thema wird zumal in den Krisendiagnosen über die Universität in den späten 1920er Jahren51 auch in der Öffentlichkeit intensiv behandelt. Der Diskurs spielt zwar immer wieder auch im Kontext der Berliner Universität und er wird auch von Eduard Spranger mit bestritten,52 aber nicht allein von ihm und nicht allein von Berlin aus.53 Schon die Universitäten haben sich in der Rektorenkonferenz und in ihren Hochschultagen ein eigenes Forum kollektiver Artikulation ihrer Interessen geschaffen, politisch wie theoretisch, wissenschafts- und ideengeschichtlich. Dieser Diskurs ist der politischen Zäsur von 1918/19 mehr als nur randständig verbunden, sondern ganz wesentlich von der Demokratisierung des Staates und dem (letztlich gescheiterten) Versuch der umfassenden Neuordnung des Bildungswesens bestimmt, die sich seit den Verfassungsberatungen auf Reichsebene und in der konkreten Politik der Länder ereignet. Diese Neuordnungsversuche beziehen auch Status und Funktion der Universität in die Überlegungen mit ein und diese Aktivitäten bilden den Referenzraum der jetzt intensiv werdenden Debatte über die Universität, die in weiten Teilen eine Debatte über Hochschule und Staat und über die Rolle der Hochschule in der Gesellschaft ist.54 Die Universität und ihr vermeintlich definitiv gefundenes „Wesen“, artikuliert in der „Idee“, wie sie um 1810 scheinbar endgültig formuliert wurde, bildet den argumentativ zentralen Referenzpunkt. Ihre besondere Dynamik erhält die Debatte zusätzlich aus der Tatsache, dass mit der Öffnung für das Frauenstudium seit 1908 und mit der Expansion des Hochschulzugangs seit 1918 auch die gesellschaftliche Funktion akademischer Eliten neu zum Thema geworden war. Das wird im weiteren Verlauf der Weimarer Republik vor allem deshalb brisant, weil die Beschäftigungschancen für akademische Berufe innerhalb und außerhalb des Staatsdienstes in den Inflationsjahren sowie in den Fiskal- und Wirtschaftskrisen der Republik höchst Texte Beckers zur Universität, u. a.: Die Problematik der deutschen Universitäten der Gegenwart“ (1921), S. 287–289 – hier, wie bei Spranger (vgl. Anm. 52), immer im Blick auf die „deutsche“ Universität. 51 Exemplarisch dafür die Diskussion in der Frankfurter Zeitung 1931/32, vgl. Dieter Thomä (Hg.): Gibt es noch eine Universität? Zwist am Abgrund – eine Debatte in der Frankfurter Zeitung 1931–1932, Konstanz 2012. 52 Dazu gehören nach 1918 v. a. die folgenden Texte von Eduard Spranger: Das Wesen der deutschen Universität, Leipzig 1930, jetzt in ders.: Ges. Schr., Bd. X, Hochschule und Gesellschaft, hg. von Walter Sachs, Heidelberg 1973, S. 82–158 sowie für den Kontext: Eduard Spranger: Über Gefährdung und Erneuerung der deutschen Universität (1930), in: ebd., Bd. X, S. 225–238; ders.: Hochschule und Staat (1930), in: ebd., Bd. X, S. 189–224; ders.: Über Sinn und Grenzen einer Hochschulreform (1932) [Rede auf dem VII. Hochschultag, Danzig, 1.Oktober 1932], ebd., S. 254–272; nach 1945 dann ders.: Forschung, Berufsbildung und Menschenbildung an der gegenwärtigen deutschen Universität (1953), ebd., Bd. X., S 159–180. 53 Dem Kontext der Berliner Universität kann man natürlich auch die Schriften von Carl Heinrich Becker zurechnen, der nicht nur Politiker war, sondern dort ein Ordinariat für Orientalische Sprachen innehatte, sowie die von Spranger mit betreute und kritisch diskutierte Dissertation von René König: Vom Wesen der deutschen Universität, Berlin 1935, neu hg. u. mit einem Nachwort versehen von Hans Peter Thurn, Opladen 2000. 54 Für einen umfassenden Überblick über die Universität nach 1918 im Kontext der Wissenschafts- und Gesellschaftsgeschichte verweise ich auf Hartmut Titze: Hochschulen, in: Dieter Langewiesche, Heinz-Elmar Tenorth (Hg.): Die Weimarer Republik und die nationalsozialistische Diktatur. Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, Bd. V 1918–1945, München 1989, S.209–240.
Humboldt-Mythen und Universitätsgeschichten
211
problematisch werden, wie die neu ausgelöste „Überfüllungs“-Debatte55 anzeigt, die zugleich die wachsende politische Radikalisierung der Studenten befördert und ihren Weg in das rechte politische Lager. Die NSDAP findet hier ihre ersten starken Unterstützer. Die Texte der 1920er Jahre zur Idee der Universität beziehen sich in der Regel zwar auf Autoren des späten 18., frühen 19. Jahrhunderts, aber keineswegs allein oder systematisch primär auf Humboldt. Humboldt ist durchaus nicht die dominierende oder gar kritiklos verehrte Referenz, nicht einmal im Berliner Kontext, wie man in der Dissertation von René König56 und an ihrer Rezeption57 zumal in Berlin und durch Spranger lernen kann. König schreibt eine Geschichte, die mit dem „Kampf um Aufhebung oder Reform der Universitäten“ im späten 18. Jahrhundert – und mit Massows Plänen – einsetzt (47ff.), sich dann stark auf Fichtes Konzept einer „Universität im System der freien Selbsttätigkeit“ konzentriert (65ff.), aber die konkrete Gründung als „Tragödie der deutschen Universität“ (151ff.) analysiert, vor allem wegen des damit gestifteten Verhältnisses von „Wissenschaftsbildung und Staat“. Deren Relation sieht König nicht als „Versöhnung“, sondern in der „Einheit von Gegensätzen“ (196) und für ihn ist „das Denken der Welt als Einheit von Gegensätzen […] das rhythmische Grundgesetz des deutschen Geistes“. Aber dieses Denken sei, so König, ein in der Geschichte der Universität „verfehltes Ziel“ (180ff.) – und nicht zuletzt wegen Humboldt selbst, dessen Unterscheidung von „Staat“ und „Nation“ auch systematisch nicht hinreiche. Humboldts Reform wird von René König also vor allem in ihrer „inneren Unvollkommenheit“ gezeichnet und problematisiert, auch angesichts der Tatsache, dass sie im „Polizeistaat“ (198) nach 1819 den Partner nicht fand, den sie in den Reformen von 1810 meinte im Staat unterstellen zu können. Die Professoren wiederum richteten sich in dieser Situation ein, indem sie kein realistisches Verhältnis zum Staat suchten, sondern sich in Abwehr und Überspitzung des „Freiheitsbegriffs“ (198) erschöpften, wie Schleiermacher, oder sich als „unstaatliche, politisch farblose und konventionelle Wissenschaft“ (199) selbst zähmten. Die Idee blieb also schon früh ohne „Wirklichkeit“. König versteht deshalb seine Analyse auch „als Rückführung der gegenwärtigen Diskussion über die Reform der Universitäten auf den idealen Kraftpunkt, aus dem sie allein Leben gewinnen kann; als Aufruf zu Einkehr und Besinnung auf die idealen Wurzeln der deutschen Universität“ (200). König schreibt im Kontext seiner Dissertation deshalb auch nicht zufällig Abhandlungen, die den „pseudophilosophischen Irrweg“58 belegen, den dieser kritische Positivist um 1933 und bis 1935 55
Die Diskussion in der Frankfurter Zeitung geht ausdrücklich auch von der Überfüllungsproblematik aus; vgl. den die Diskussion eröffnenden Beitrag von Hermann Herrigel: Hochschulreform, in: Thomä: Universität (2012), S. 11–15, zit. S. 11 – und sieht die Hochschulen als „Opfer“ des gesteigerten Zugangs sowie vergleichbare spätere Hinweise auf die „Überfüllung“ z.B. bei Tillich oder Jaspers (S. 61, 64). Auch René König nennt noch in seinem Vorwort zur Neuauflage die ÜberfüllungsThematik und das Problem der Akademiker-Beschäftigung als konstantes Systemproblem und Thema der deutschen Universität seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert (König: Vorwort, S. 11f.). 56 König: Wesen (1984). 57 König diskutiert die Geschichte seiner Promotion und die Konflikte mit Spranger in seinen Erinnerungen, vgl. ders.: Leben im Widerspruch, München 1980 (Tb-Ausgabe Frankfurt a. M. 1984). 58 In seinem Nachwort von 2000 diskutiert Hans Peter Thurn so offen wie historisch einfühlsam
212
Heinz-Elmar Tenorth
im „kurzfristigen Schwanken zwischen Demokratie und Diktatur“ nicht vermieden hat. Dieser „Irrweg“ hat ihn sogar – in den Bahnen der von ihm positiv rezipierten Heideggerschen Rektoratsrede – eine ‚„metaphysische Vereinigung‘ von ‚Wissen‘ und ‚Wehr‘“ bis hin zum „Wahn“ einer Legitimation des Krieges argumentativ propagieren lassen – bis er feststellen musste, dass die Nazis von Baeumler bis Krieck seinen Vorschlägen nicht folgen wollten, sondern sie als idealistisch abwehrten (und sogar eine Zeitlang unterstellten, nicht König sei der Autor, sondern Spranger habe sich seines Namens bedient).59 Auch seine bürgerlichen Zeitgenossen, Spranger zumal, haben die intendierte Pointe seiner Dissertation, Humboldts falsches Staatsverständnis, weitgehend ignoriert. René König erinnert in seiner Autobiographie 1980 noch einmal den Entstehungskontext seiner Dissertation in Berlin und an Sprangers „feiges Ausweichen vor einer Stellungahme zu meinem Universitätsbuch“.60 Wie wenig positiv bestimmend Humboldt für diese frühe Debatte der „Idee“ der Universität aber war, und wie bedeutsam die Konzentration auf die Beziehung von Universität und Staat und damit auf das Autonomieproblem, zeigt auch ein anderer außerberliner Text der Weimarer Zeit. Karl Jaspers nämlich kommt 1923 nahezu ohne Humboldt aus. Er spricht zwar – dem Mythos der deutschen Universität entsprechend – von der „Universität in ihrer Eigensubstanz und von ihren Funktionen in der Wirklichkeit“,61 aber er kann, systematisch und zu Anfang, selbst über „Geist, Bildung, Wissenschaft“ schreiben, ohne auch nur einmal Humboldt zu erwähnen. Er nennt allerdings Kant und Hegel, indes nur beim Stichwort Wissenschaft. Selbst im Abschnitt über „die Idee der Universität“ (44ff.) geht er von den „geläufigen Antworten“ aus, wenn er – ohne namentliche Zuschreibung – die bekannten Prinzipien nennt („Verbindung von Forschung und Lehre“, „Entfaltung der Organe zu wissenschaftlichem Denken“, „Beziehung auf ein Ganzes“), dabei durchaus skeptisch,62 was die gleichzeitige Erreichbarkeit der Ziele von „Forschung“ und „Fachschulung“ angeht. Das „Durchdrungensein von der Idee der Universität“ ist für ihn nur Element einer Weltanschauung“ (50; Hervorhebung dort gesperrt), aber offenbar mächtig: „In ihr zu leben, gibt der Existenz Struktur und Farbe und nimmt sie auf in ein Ganzes“ (53) – 63 nur, das alles kann er diskutieren, ohne nur einmal Humboldt zu erwähnen. Noch die angehängte Literatur ist äußerst sparsam. Jaspers verweist auf wenige Autoren und zuerst, und zustimmend, auf Max Weber und auf dessen Vortrag von 1917 „Wissenschaft als Beruf“, also einen zeitgenössisch viel diskutierten Text die für eine kurze Zeit unverkennbare Nähe Königs zum neuen Staat als einen solchen „Irrtum“, ders.: Nachwort, in: König: Wesen (2000), Zit. S. 261; S. 265 für das folgende Zitat. König selbst warnt in seinem Vorwort (S. 9) davor, seine „Ausführungen wörtlich zu nehmen“, wie manche seiner Zeitgenossen es getan hätten. 59 So König ebd., S. 10f. 60 König: Leben (1984), S. 90; in seinem Vorwort zur Neuauflage spricht er von Sprangers „üblicher Entscheidungslosigkeit“ (S. 9). Später habe Spranger sogar ausdrücklich Königs Position zustimmend bewertet. 61 Karl Jaspers: Die Idee der Universität, Berlin 1923, S. V, Vorwort 1923, S. 17 für die folgenden Hinweise, die Literatur S. 81, weitere Nachweise im Text. 62 „vorübergehende Illusion“ (S. 45) sei z.B. die Erwartung, dass man die fachlichen Kenntnisse dauerhaft präsent habe, „die Praxis“ vollende die „Ausbildung“. 63 Und später ist ihm klar, dass diese einheitliche Weltanschauung „heute“ nicht mehr vorhanden ist (S. 61f.) – aber neu geschaffen werden muss.
Humboldt-Mythen und Universitätsgeschichten
213
über die Funktion und den Status von Wissenschaft und die Rolle der Gelehrten;64 dann auf Fichtes Abhandlungen „Über das Wesen des Gelehrten“ sowie auf Fichte, Schleiermacher und Steffens in der Spranger-Edition von 1910 mit dem Hinweis „neben Humboldts Bemerkungen [sic!], die sich zerstreut in seinen Denkschriften finden, die Gedanken, die unsere Philosophen über die Idee der Universität hatten angesichts der geplanten Gründung der Berliner Universität“. Schließlich hält er für die spätere Zeit, „noch lesenswert, aber die zunehmende Problematik und Unzufriedenheit zeigend, Lagarde: Deutsche Schriften. Göttingen“, aber der sei „in der Gesamthaltung unfrei, sehr selbstüberzeugt, zum Fanatischen neigend. Nicht einheitlich und manchmal von schlechter Subjektivität“, dann Nietzsches Basler Vorträge Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten und als Quasi-Empirie universitärer Realität die Auszüge aus autobiographischen Texten berühmter Männer in der Edition von Julius Ziehen (1912).65 Die Leitidee bei Jaspers ist das Konzept von Wissenschaft und seiner Eigenlogik. Hier sieht er die Gefährdungen, und die Gefährdungen gehen vom Staat und von den Folgen der akademischen Berufsausbildung aus, die sich mit der Überfüllung zeigen. Auch Spranger und Becker denken vom Staat aus und wollen Reformen, ohne der Universität zu schaden (der Pädagoge Spranger z. B. platziert die Lehrerbildung ausdrücklich außerhalb der Universität). Spranger und zahlreiche andere Autoren von Tillich bis zu dem katholischen Philosophen Erich Przywara wehren sich aber vor allem gegen die mit der Überfüllung sichtbar werdende und vom Staat, wie sie unterstellen, nicht genügend abgewehrte Tendenz der Ausweitung neuer Fächer und der „Verfachhochschulung“ der Universität. „Verhandelshochschulung“ z. B. ist ein Begriff, mit dem die Berliner Universität gegen die Aufnahme der Betriebswirtschaftslehre in die Universität 1920 und erneut 1924 polemisiert hat,66 nachdem sie schon früher die Ausweitung berufsbezogener Bildung abgewehrt hatte.67 64 Webers Rede wurde zeitgenössisch sehr kontrovers diskutiert. Vgl. exemplarisch nur die aus dem George-Kreis stammende scharfe Abgrenzung bei Erich von Kahler: Der Beruf der Wissenschaft, Berlin 1920. 65 In den späteren, unveränderten Neuauflagen (u.a. ein Reprint von 1980, Berlin, Heidelberg, New York) gibt es ein „Geleitwort“ von Adolf Laufs, der daran erinnert, dass sich Jaspers – 1947 – von einem Wort Gundolfs und der Inschrift am Heidelberger Kollegiengebäude inspirieren ließ: „Die Idee der Universität ist der lebendige Geist“, dann allerdings begleitet von der These „die ‚Treue zur Humboldtzeit‘ verbiete radikale Neuschöpfungen“ (wie Laufs zitiert, S. 6) – und ansonsten nimmt er Jaspers gegen zu scharfe und elitär klingende Ausleseformulierungen in Schutz. 66 Die Autoren der „Denkschrift und Ansätze zur Reform des staatswissenschaftlichen Unterrichts an der Berliner Universität“, u. a. Spranger und der Historiker Hartung, die Nationalökonomen Sering, Herkner, Bortkiewicz und Schumacher, argumentieren gegen die Nationalökonomie als „Brotstudium“, und gegen die Tendenz, dass das Doktordiplom „in einen der Masse zugänglichen Titel zum Erlangen von Brotstellungen, besonders im Erwerbsleben“ verkommt (zit. nach Uwe Czech: Von den wirtschaftlichen Staatswissenschaften zu den modernen Wirtschaftswissenschaften, in: Geschichte der Universität Unter den Linden, Bd. 5, 2010, S. 299). 67 In einem Votum der Philosophischen Fakultät findet sich bereits am 26.2.1909 das Argument gegen weitere berufsbezogene universitäre Studien: „so läge darin der Anfang des Zerfalls der bis jetzt festgehaltenen Einheit, die Juristen würden immer mehr von den philosophisch-historischen Studium abgezogen werden, und ihrem Beispiel folgend jeder praktische Beruf bestrebt sein, die Ausbildung seines Nachwuchses im engen Rahmen fachlichen Unterrichts selbst zu besorgen, die Einheit der Wissenschaft würde verschwinden, und die philosophische Fakultät auf einen Weg gedrängt werden, der dazu führen müsste, sie in eine Fakultät zur Ausbildung von Oberlehrern
214
Heinz-Elmar Tenorth
Die Trennung und Unterscheidung von „Universität“ – als Stätte reiner Forschung und der zweckfreien, „humanistisch“ begründeten, Versenkung in Wissenschaft – und von „Fachhochschulen“ – als Stätte berufsbezogener akademischer Ausbildung (noch nicht im heutigen Sinne) – bildet das Zentrum von Paul Tillichs Artikel 193168 und der darauf folgenden Serie von Stellungnahmen. Die Tendenz dieser Beiträge ist auch ganz eindeutig, dass die Idee der Universität diese Verfachhochschulung der Universität, d. h. ihre primäre Orientierung an der Ausbildung akademischer Berufe, ausschließt. Die öffentliche Debatte 1931/32, auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise und der problematisch gewordenen Akademikerbeschäftigung, verfestigt also nicht allein die Zentrierung auf das Autonomieproblem und die Aversion gegen den demokratischen Staat, sie setzt auch – gegen die Intention und Praxis der Berliner Gründung und gegen die Realität der deutschen Universität – die Idee und das Wesen der Universität gegen die Aufgabe akademischer Berufsausbildung. In den oberen Fakultäten schon immer zentral, werden diese als „Brotstudien“ – bei Schelling und Schiller, nicht bei Humboldt oder Schleiermacher – verächtlich gemachten Ausbildungsaufgaben für die akademischen Eliten und die staatsfunktionale Beamtenrekrutierung aus dem legitimen Kreis universitärer Aufgaben rhetorisch ausgegrenzt. Abwehr berufsbezogener Ausbildung einerseits, starke Autonomieforderungen andererseits charakterisieren also den „Ideen“-diskurs, wie er sich gegen die Republik nach 1918 entwickelt – und die Berliner Universität denkt hier nicht anders. Der für sie wesentliche – und nicht ohne Konflikte realisierte – 69 Akt der historischen Vergewisserung besteht, 1926, in der Einrichtung eines Denkmals für die Gefallenen des ersten Weltkriegs, und Hindenburg ist in Uniform bei der Einweihung präsent. Neubeginn nach 1945 – Alternative Bilder Humboldts und der universitären Tradition Die Diskussion über die Universitäten beginnt unmittelbar nach 1945, und es ist erneut auch der Ideen-Diskurs und die Positionierung zur Tradition, mit denen diese Debatte geführt wird, auch jetzt nicht nur in Berlin, dort aber im Zeichen des beginnenden Ost-West-Konflikts mit besonderer Intensität. Dabei unterschieden sich die Diskussion in Ost und West ganz eindeutig, und zwar sowohl im Grade der Kritik bzw. der Ehrenrettung der universitären Traditionen und damit auch im Bezug auf Humboldt als auch in der Reflexion der Rolle von Staat und Universität. Umfassend muss diese Diskussion hier nicht rekapituliert werden,70 weil sie sich bald nach der Gründung der zu verwandeln.“ (Zit. Universitäts-Archiv, Humboldt-Universität, Phil. Fak. Nr. 11, Bl. 121). 68 Paul Tillich: Gibt es noch eine Universität? Fachhochschulen und Universität (1931), in: Thomä: Universität (2012), S. 16–23; ders.: Hochschulreform (1931), ebd. S 24–36. 69 Dazu Michael Grüttner: Nachkriegszeit, in: Tenorth: Geschichte (2/2012), S. 53ff. 70 Einen guten Überblick mit reichhaltigen Verweisen auf die weitere Literatur bietet Christoph Oehler in Zusammenarbeit mit Christiane Bradatsch: Die Hochschulentwickelung nach 1945, in: Christoph Führ, Carl-Ludwig Furck (Hg.): Bundesrepublik Deutschland (=Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte Bd. VI, 1945 bis zur Gegenwart, Erster Teilband), München 1998, S. 412–446; für die jüngere Forschung wichtig Barbara Wolbring: Trümmerfeld der bürgerlichen Welt. Universität in den gesellschaftlichen Reformdiskursen der westlichen Besatzungszonen (1945–1949) (=Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der
Humboldt-Mythen und Universitätsgeschichten
215
Freien Universität und der beiden deutschen Staaten breit verzweigt. Aber zumal für Berlin und die Humboldt-Rezeption ist die Nachkriegszeit hoch signifikant. Die Debatte im Westen ist höchst kritisch gegen die Vergangenheit, und dann bezieht sie sich auf die NS-Vergangenheit, aber höchst affirmativ gegenüber ihrer eigenen Tradition. Der Ideen-Diskurs gibt dafür die Leitlinie vor. In der 1946 erschienenen, stark überarbeiteten Neuauflage seiner „Ideen“-schrift von 1923 spitzt z. B. Karl Jaspers die Zweckfreiheits-These als Focus der Reflexion noch weiter zu, indem er es als Aufgabe des wissenschaftspolitisch legitimen Staates darstellt, der Universität einen Ort zu geben, dass „irgendwo eine reine, unabhängige, unbeeinflußte Wahrheitsforschung“ stattfinden kann.71 Das ist 1946 natürlich zuerst eine Verarbeitung der Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus, Jaspers wusste wovon er redete, wenn er den Zugriff des Staates auf die Universität kritisierte. Aber der Autor und sein Text belegen in der Kontinuität des Arguments auch, dass die Kritik am Staatszugriff aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus bekräftigt und bestätigt, aber nicht erst erfunden worden ist. Die Nähe zur Debatte über Hochschule und Staat nach 1918 belegt das hinreichend, das Plädoyer für Autonomie wird nicht wegen der Erfahrungen des Nationalsozialismus erfunden, es ist älter. Dabei räumt Jaspers sogar ein, dass die Universität „durch den Staat besteht. Ihr Dasein ist politisch abhängig. Sie kann nur leben, wo und wie der Staat es will. Der Staat ermöglicht die Universität und schützt sie.“ Aber „der staatsfreie Raum“ sei dafür notwendig, er verlangt, dass im Staat „der politische Grundwille herrscht“, der diesen Raum garantiert. Diese Konzentration auf die Autonomiethematik72 und die Selbstbestätigung, die von der westdeutschen Universität in der Tradition gesucht wird, kehrt wieder in den Formeln, in denen die Universitäten ihre Identität artikuliert und das Verhältnis zu ihrer eigenen Vergangenheit definiert haben, bis hin zu der 1949 gegründeten Westdeutsche Rektorenkonferenz. In knapper, zur Formel gewordener Pointierung wird die Universität und ihre Idee im sogenannten „Blauen Gutachten“73 von 1948 als „im Kern gesund“74 erklärt, bedroht auch in der Vergangenheit und auch Wissenschaften 87), Göttingen 2014. Erst nach Abschluss meines Ms. erschien Johan Östling: The Swansong of the Mandarins: Humboldt's Idea of the University in early post-war Germany. In: Modern Intellectual History, 13 (2016)2, p. 387–415. Östling diskutiert Texte von Jaspers, G. Ritter und Werner Richter und zeigt, dass allein Richter Distanz gegenüber der Tradition und Sinn für die Leistungen der amerikanischen Universitäten hat. Den Humboldt-Mythos liest er noch ganz mit Paletschek, die Diskussion nach 1950 oder in der DDR kommt nicht vor. 71 Jaspers: Idee (1946), S. 109; auch für das folgende Zitat. 72 Das belegt auch die rechtshistorische Analyse von Alexander Kluge: Die UniversitätsSelbstverwaltung. Ihre Geschichte und gegenwärtige Rechtsform, Frankfurt a. M. 1958. 73 Das sog. „Blauen Gutachten“, dessen Entstehung der Direktor der Education Branch der britischen Besatzungszone, Robert Birley, angeregt und das der „Hamburger Studienausschuss für Hochschulreform“ erstellt und unter dem Titel „Gutachten zur Hochschulreform“ vorgelegt hat, ist leicht zugänglich in der von der WRK veranlassten Dokumentation von Rolf Neuhaus (Hg.): Dokumente zur Hochschulreform 1945–1961, Wiesbaden 1961, S. 289–368. Für den damit intendierten Reformkontext, der vor allem die Lehre und Erziehung der Studenten betraf, auch Konstantin von Freytag-Loringhoven: Erziehung im Kollegienhaus. Reformbestrebungen an den deutschen Universitäten der amerikanischen Besatzungszone 1945–1960, Stuttgart 2012, S. 164ff. 74 Das Zitat steht in einem Kontext, der etwas ausführlicher die Tradition reklamiert: „dass die Hochschulen Träger einer alten und im Kern gesunden Tradition sind.“
216
Heinz-Elmar Tenorth
von 1933 bis 1945 allenfalls durch den Zugriff des Staates, also von außen. 1948 wird damit nahezu wörtlich eine These wiederholt, die Carl Heinrich Becker schon 1919 vorgetragen hatte,75 auch damals gegen alle Kritik am Bildungswesen und seiner problematischen Rolle in Staat und Gesellschaft, die er selbst erinnert. Die Praxis und die Wahrnehmung der Wissenschaftspolitik in SBZ und DDR bekräftigt dann im Westen dieses Selbstbildnis der Universität, die Dominanz der Autonomieproblematik und die Abwehr des Staatszugriffs, wie sie bald nach 1946 in der Berliner Universität als „Kaderschmiede“ des sozialistischen Staates erlebt wurde. In der Gründungsphase der Berliner Universität wird dagegen wissenschaftspolitisch, vom zuständigen Minister Paul Wandel, und aus der Universität heraus, z. B. vom Rektor Stroux 1946, nicht allein die Universität sehr viel kritischer gesehen, sondern auch ihre Funktion neu reflektiert. Es sind symbolisch hoch aufgeladene Anlässe, die diesen Umgang mit der Tradition und der intendierten Zukunft der Universität sehr früh belegen, vor allem die Wiederaufnahme des Lehrbetriebs 1946 und die Namensgebung 1949. Bei beiden Ereignissen markiert die Stellungnahme zu Humboldt den eigenen neuen Einsatz im Selbstverständnis der Berliner Universität – die den Namen des Königs schon seit dem Kriegsende nicht mehr führt. Bei der Feier zur Wiederaufnahme des Lehrbetriebs am 29.1.194676 spricht der Rektor Stroux, ein Altphilologe, über den Begriff der Kultur und bekräftigt eindeutig den Anschluss an Humboldt,77 indem er „das Programm, das Wilhelm von Humboldt entworfen hat, eine Quelle der Kraft und eine Wegleitung in unsere Zukunft“ nennt. Paul Wandel dagegen dankt in seiner Rede – „Unsere Universitäten und die Idee der Humanität“ – zuerst der sowjetischen Besatzungsmacht, beruft sich auf den Leitgedanken einer „kämpferischen Humanismus“ und plädierte für die soziale Öffnung der Universität, argumentiert also eher gegen die Humboldtsche Tradition der leistungsbezogen-selektiven Elitenrekrutierung und auch gegen den von Stroux zitierten Wissenschaftsbegriff Humboldts, der die Politisierung der Wissenschaften nicht kennt, die Wandel einführt. Für Paul Wandel wird Wilhelm von Humboldt erst bei der Namensgebung 1949 als positiver Bezugspunkt wichtig, aber auch dann noch in einer Akzentuierung, die Wandel schon 1946 primär gesucht hat, in der moralisch-politischen Gleichsetzung mit einem „kämpferischen Humanismus“. Wandel platziert die Namensgebung in einen moralpolitischen Kontext, als Indiz der „gemeinsamen Gesinnung der Humanität und der Völkerverständigung“. Damit nimmt er die dominante Moralisierung Humboldts auf, die schon in der Lenz-Rezeption von 1910 oder bei Spranger 1909 eingeleitet worden war. Spranger, für wenige Monate kommissarischer Rektor der Universität 1945, wird von Wandel zwar zitiert, aber mit dem politisierten Begriff der Humanität sogleich 75
Vgl. Becker: Gedanken (1918/19), in: Müller: Gedanken (1997), zit. S. 195: „Der Kern unserer Universitäten ist gesund“ – und in der Edition von 1919 ist dieser ganze Satz gesperrt gedruckt. 76 Umfassend dazu Reimer Hansen: Von der Friedrich-Wilhelms- zur Humboldt-Universität zu Berlin, in: Geschichte der Universität Unter den Linden Bd. 3, Berlin 2012, insb. S. 65ff., für die DDR-Wahrnehmung des Ereignisses Henny Maskolat: Die Wiedereröffnung der Berliner Universität im Januar 1946, in: Forschen und Wirken (1/1960), S. 605–627. 77 Henny Maskolat: Die Wiedereröffnung der Berliner Universität im Januar 1946, in: Erich Buchholz, Karl Heinig: Beiträge zur wissenschaftlichen und politischen Entwicklung der Universität (=Forschen und Wirken Bd. 1), Berlin 1960, S. 605–627, hier S. 619.
Humboldt-Mythen und Universitätsgeschichten
217
auch ausgegrenzt und später sogar wegen der als „elitär“ geltenden bildungspolitischen Anschauungen explizit abgewehrt78 (aber die Humboldtsche Bildungspolitik bleibt in der DDR-Diskussion selbst kontrovers, wie sich noch 1967 zeigt)79. Nicht zufällig sucht Spranger schon 1946 den Weg nach Westen. Die Namensgebung, 1946 zwar schon diskutiert, aber noch nicht vollzogen,80 hat aber noch eine zweite, ebenfalls eindeutig sozialistisch geprägte Seite. Denn in der gleichzeitigen Beanspruchung von Wilhelm und Alexander wird der Name Humboldt zugleich zum Symbol für die Einheit der Wissenschaften, für die Einheit von Forschung und Lehre und für die den „beiden Brüdern gemeinsame Gesinnung der Humanität und der Völkerverständigung“81, und damit auch zum Indiz für die wissenschaftliche und politische Selbstwahrnehmung der Universität zugleich, dem Anspruch unterworfen „in umfassender Erforschung der Wahrheit beizutragen zur Erneuerung der Nation und zur Erhaltung des Friedens in der Welt“, wie Wandels Verleihungsschreiben an die Universität erwartet. Sie versteht sich als der allein legitime Erbe der Gründung von 1810, wie der Rektor 1949 in Namen der Universität beansprucht – unverkennbar gegen die Freie Universität, die 1948 gegen den sozialistischen Zugriff auf die Universität Unter den Linden gegründet worden war. Jubiläen und Reformen im Zeichen des kalten Krieges: 1960 – Humboldt im Konflikt Das sind zunächst noch lokale Probleme in der geteilten Stadt, aber sie bleiben nicht auf die lokalen Kontroversen begrenzt, sondern werden Bestandteil des kalten Krieges der Universitäten in Ost und West. In einem umfassenden Sinne wird das Selbstverständnis der deutschen Universität insgesamt und zugleich auch die Selbst- und Fremdwahrnehmung der Berliner Universität nicht schon in den Konflikten nach 1945 und bis zur Gründung der Freien Universität 1948, sondern erst 1960 und danach thematisch, erneut in der Selbstinszenierung und in der Historiographie. 1960 ist das Jahr des 150-jährigen Jubiläums der Berliner Universitätsgründung und es ist zugleich das Jahr, in dem der Wissenschaftsrat einen deutlichen Ausbau der Hochschulen empfiehlt82 und dabei auch die Funktion der Universität deutlich vom Akademikerbedarf aus denken kann, den „Humboldtianismus“83 also zugleich bekräftigt und die 78
Ortrud Bimberg: Zur Rezeption der Humboldtschen Bildungsidee durch Eduard Spranger, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universität 17 (3/1968), S. 371–373. 79 Vgl. Helmut König: Die Bildungsidee Wilhelm von Humboldts und ihre Verwirklichung, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universität 17 (3/1968), S. S. 341–348. 80 Alle Einzelheiten dazu bei Hansen: Humboldt-Universität (2012), insb. S. 109ff. 81 Zitiert nach ebd., S. 121. 82 Für dessen Planungen und den dabei sichtbar werdenden Wandel der Leitbilder vgl. Olaf Bartz: Wissenschaftsrat und Hochschulplanung. Leitbildwandel und Planungsprozesse in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1957 und 1975 (Diss. Ms.), Köln 2006. 83 Bartz: Wissenschaftsrat (2006) nutzt diesen Begriff. Seine Darstellung der „Anatomie des Humboldtianismus“ (S. 27ff.) hebt, zutreffend, hervor, dass sich dieses Syndrom unabhängig von seinem Namensgeber historisch identifizieren und diskutieren lässt und auch wohl entfaltet hat, in der Geschichte dieses Phänomens verweist er aber nur auf Paletscheks „Erfindungs“-these und die 1960 aktuelle Version diskutiert er nur sehr knapp, konzentriert auf eine Rektoratsrede
218
Heinz-Elmar Tenorth
Universität auf die Zukunft hin öffnet. Sowohl der Diskurs über die „Idee“ als auch die Selbst- und Fremdbeschreibung der Berliner Universität und ihre Historiographie zeigen sich jetzt in einer neuen Gestalt – und erst jetzt rückt Humboldt in die zentrale Stelle ein, die ihm gelegentlich schon für 1910 zugeschrieben wird. Signifikant dafür ist das Jubiläumsjahr 1960. In dieses Jahr kann man den wirklich folgenreichen Entstehungszeitraum des Humboldt-Mythos platzieren, hier werden auch die Geschichte der Berliner Universität und die wahre Idee der deutschen Universität, ihr Wesen, argumentativ verbunden und – im Konflikt der beiden deutschen Staaten und der jubiläumserzeugten Erinnerungskulturen – kontrovers und konflikthaft ausgelegt. Der Humboldt-Mythos als Einheit von Universitätsidee, Berliner Gründung und aktueller Wissenschaftspolitik findet hier seine radikale Zuspitzung, im Kalten Krieg also, und der Mythos „Humboldt“ wird dabei zu der überwölbenden Gestalt stilisiert, der man danach kaum mehr entkommt. 150 Jahre sind jetzt zu bearbeiten, und die umfangreiche Historiographie zur Berliner Universität, die 1960 publiziert wird, zeigt die Relevanz des Themas, repräsentiert vor allem in den großen Selbstdarstellungen aus Ost und West. Im Jubiläumsjahr erscheint nämlich nicht nur in der DDR die dreibändige offizielle Jubiläumsschrift der Humboldt-Universität, „Forschen und Wirken“,84 sondern parallel auch im Westen eine eigene Historiographie der Berliner Universität. In West-Berlin erarbeitet und unter dem Protektorat der Rektorenkonferenz realisiert, wird eine Edition zentraler Quellen publiziert85 und ein Band von Analysen zur Disziplingeschichte vorgelegt.86 Es überrascht nicht, dass dabei ganz unterschiedliche Geschichten erzählt werden, die allein in Humboldt die gemeinsame, wenn auch nicht übereinstimmende Referenz haben. In der DDR-Festschrift wird zum Jubiläum nicht nur Humboldt als „der Gründer“87 emphatisch vorgestellt (bezeichnender Weise von einem Erziehungsphilosophen), sondern auch weiter Klassikerexegese und -aneignung betrieben, z. B. Marx als
84 85
86
87
H. Coings und im Blick auf Schelsky und Jaspers, ganz ohne Blick auf das Berliner Jubiläum, aber mit viel Sinn für diese Ideologie – die „humboldtianistischen Glaubenslehre“, und ihre „eigene Priesterkaste […] nämlich die Position und die Rolle der Ordinarien.“ (S. 31). Willi Göber, Friedrich Herneck (Hg.): Forschen und Wirken. Festschrift zur 150-Jahr-Feier der Humboldt-Universität zu Berlin 1810–1960, 3 Bde., Berlin 1960. Wilhelm Weischedel (Hg.) in Zusammenarbeit mit Wolfgang Müller-Lauter und Michael Theunissen: Idee und Wirklichkeit einer Universität. Dokumente zur Geschichte der FriedrichWilhelms-Universität zu Berlin (=Gedenkschrift der Freien Universität Berlin zur 150. Wiederkehr des Gründungsjahres der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin), Berlin 1960. Hans Leussink, Eduard Neumann, Georg Kotowski (Hg.): Studium Berolinense. Aufsätze und Beiträge zu Problemen der Wissenschaft und zur Geschichte der Friedrich-Wilhelms-Universität (=Gedenkschrift der Westdeutschen Rektorenkonferenz und der Freien Universität Berlin zur 150. Wiederkehr des Gründungsjahres der Friedrich-Wilhelms-Universität), Berlin 1960. Heinrich Deiters: Wilhelm von Humboldt als Gründer der Universität Berlin, in: Göber, Herneck: Forschen (1/1960), S. 15–39, der Humboldt „den eigentlichen Begründer der Universität Berlin“ nennt (zit. S. 35). Die aus der DDR stammenden biografischen Übersichtsdarstellungen markieren ebenfalls eine Kontinuitätslinie von Humboldt und 1810 bis zur Humboldt-Universität nach 1945, z. B. explizit in Deiters‘ Bahnen und Begriffen auch Herbert Scurla: Wilhelm von Humboldt. Werden und Wirken, Berlin 1970, S. 315ff. sowie Helmut Klein (Hg.): Humboldt-Universität zu Berlin. Überblick 1810–1985, Berlin 1985, zu Humboldt als Gründer S. 12f.
Humboldt-Mythen und Universitätsgeschichten
219
der bedeutsamste Schüler und Student hervorgehoben (obwohl der nicht einmal in Berlin Examen gemacht hat). Signifikanter für die spezifische Deutung sind aber drei systematische Differenzen, die gegenüber der West-Lesart des Humboldtianismus sowie gegenüber der Idee der Universität und der Geschichte der Berliner Universität eingeführt werden: Das betrifft zuerst die Deutung der Leitkonzeption der Universität, dann den Blick auf die Geschichte, schließlich die Verbindung von Humboldt-Deutung mit der Idee der (deutschen) Universität. Für die DDR-Selbstbeschreibung wird als Leitkonzeption eine Trias der Ideen beansprucht. „Die Universität ist eine Trinität von Lehre, Forschung und Erziehung“, so eröffnet der Rektor Kurt Schröder in nahezu religiöser Zuspitzung der Einheitsformel die Festschrift zur 150-Jahr Feier.88 In dieser Pointierung überspringt er nicht nur die starke Abwehr aller Erziehungsambitionen, die bei Humboldt und Schleiermacher in der Gründungsphase und gegen Fichte mobilisiert wurden, er wehrt auch die alten Duale – „Bildung und Wissenschaft“ etwa – ab und auch die Referenz auf „Einsamkeit und Freiheit“ oder andere Autonomieformeln fehlen. Selbstverständlich ist das ein bewusster politischer Akt der Aneignung eines Klassikers und einer Institution zugleich, wie der Staatssekretär für das Hoch- und Fachschulwesen, Wilhelm Girnus, in seinem Geleitwort explizit auch sagt: „Die Humboldt-Universität – und sie ganz allein – ist in der Hauptstadt des ersten Arbeiter-und-Bauern-Staates deutscher Geschichte die legitime Bewahrerin der Traditionen, denen sie ihre Entstehung verdankt; sie beharrt nicht im Überlieferten, sondern führt es auf höherer Stufe weiter.“89 Exakt diesen Anspruch des legitimen Erbes bestreiten die Festschriften aus dem Westen. Für sie war nicht nur 1945 eine Zäsur in der Geschichte der Berliner Universität, sie können auch keine Kontinuität erkennen, sondern sehen 1960 „zwei Universitäten“, weil die alte Universität 1945 „zu bestehen auf(hörte)“.90 Auch das Selbstbild wird anders definiert; denn die West-Deutung geht aus von der „Autonomie“-Frage, und zwar zuerst von der „Autonomie der Fakultäten gegenüber dem Staat“ und vom „Geist akademischer Freiheit“, vom „Bildungsideal des deutschen Idealismus“, der „nicht eigentlich gegen den Staat gerichtet“ war, aber jetzt das „verpflichtende Erbe“ darstellt. Das erlaube „nur einen Weg“ für die Universität und der gelinge „nur ohne Parteilichkeit“.91 Der Gegner und der illegitime Nachfolger sind damit markiert. Die Institution, von der die Rede ist, ist deshalb auch nur die „Friedrich-Wilhelms-Universität“, schon die Bezeichnung der Universität Unter den Linden mit dem Namen der Humboldts erscheint als Akt illegitimer Usurpation. 88 Vgl. Kurt Schröder: 150 Jahre Humboldt-Universität zu Berlin. Das Werden einer jungen Universität, in: Göber, Herneck: Forschen (1/1960), S. 1–13, zit. S. 13. 89 Wilhem Girnus: Zum Geleit, in: Göber, Herneck: Forschen (1/1960), S. VIII; die religiöse Metaphorik zeigt sich auch hier, wenn Girnus auf Karl Marx eingeht, der als „der größte Sohn der Berliner Universität“ (S. VIII) bezeichnet wird und in seiner Lehre die „Alternative“ zum Kapitalismus „offenbarte“ (VII). 90 Hans Leussink in: ders., Eduard Neumann, Georg Kotowski: studium berolinense. Aufsätze und Beiträge zu Problemen der Wissenschaft und zur Geschichte der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, Berlin 1960, Zit. S. IX, S.V und IX für die folgenden Zitate. 91 Ebd., Zit. S. X.
220
Heinz-Elmar Tenorth
Außer in der Artikulation des Selbstverständnisses und in der Reklamation der wahren Tradition und ihres legitimen Erbes unterscheiden sich die Darstellungen auch in ihrer historischen Perspektive. Erwartbar enden die historischen Beiträge in der westlichen Gedenkschrift alle mit dem Jahr 1945, aber die Eindeutigkeit und Konsequenz überrascht doch, mit der in der Perspektive von WRK und FU die politische Dimension der Geschichte der Berliner Universität zugunsten der innerwissenschaftlichen getilgt ist. Das wird dann signifikant sichtbar, wenn man die Themen im Detail nennt, die allein in „Forschen und Wirken“ behandelt werden, aber ohne Zweifel auch das „studium berolinense“ charakterisiert haben: Diese Exklusivität der Thematisierung gilt für die problematischen Ereignisse und Folgen der Revolution von 1848, oder für den Pazifismus innerhalb der Universität oder den Widerstand gegen den Nationalsozialismus und die Erinnerung an seine Opfer sowie, und erwartbar, für die Formen und Folgen der „sozialistischen Umgestaltung der Universität“, bis hin zur Rolle der FDJ und für den internationalen Frieden, dessen Bedeutung der englische Kommunist und Wissenschaftshistoriker John Bernal darstellt.92 Nicht nur im aktuellen Selbstverständnis, auch historisch sind das scheinbar zwei ganz verschiedene Universitäten, die hier erinnert werden, eher zufällig im Wissenschaftsprogramm als eine Einrichtung identifizierbar. Humboldt, das ist der dritte Aspekt, bildet zwar ebenfalls eine von beiden Seiten beanspruchte Referenz, aber auch sie spiegelt keine gemeinsame und gleichsinnige Rezeption. Schon die Gründung – folgt man den Dokumenten, die sie in „Idee und Wirklichkeit einer Universität“ dokumentieren sollen – nehmen z. B. die alten Spranger-Thesen wieder auf und rücken erneut Fichte ins Zentrum der Planung und der Konzeption, trotz aller „Unausgewogenheit“ (XIV), die für ihn unverkennbar sei. Natürlich wird Schleiermacher ins Recht gesetzt und Humboldts spät gefundene Denkschrift. Aber sie wird hier behandelt, als sei sie ein Gründungstext gewesen. Dann folgen die Einrichtungsprozesse in ihrer fakultätsspezifisch variierenden Entwicklung bis weit ins 19. Jahrhundert. Aber insgesamt ist die „Idee“ nicht allein die Humboldts, sondern ein breit ausgefächertes Programm, das viele Referenzen und eine spezifische historische Gestalt hat. Weischedel sieht allerdings für die Universität in ihrer Geschichte, und zwar für die gesamte Geschichte der deutschen Universität, eine Form der Realisierung ihrer Idee, die man nicht anders als widersprüchlich bezeichnen kann; denn trotz aller politischen Friktionen und der von Beginn an unverkennbaren Differenz zwischen Idee und Realität der Universität hält er daran fest, dass „auch die entfremdete Realität noch Erscheinung der Idee bleibt. Die Berliner Universität lebt aus den Gedanken ihrer geistigen Urheber, wenn auch unvermeidlich in der Weise der widerspenstigen Realität.“93 Und erneut fehlt die engagierte Referenz auf „Freiheit“ nicht.94
92 Bd. 1 von „Forschen und Wirken“ präsentiert eben, anders als Leussink u. a., nicht allein Beiträge zur „wissenschaftlichen“, sondern auch zur „politischen Entwicklung der Universität“, während erst die Bände 2 und 3 das Lob der Forschung singen. 93 Weischedel: Vorwort, in: ders., Idee (1960), S. VIII. 94 Ebd., S. XXXIV nennt sie „das größte Problem der Universität“, aktualisiert aber auch den Kontext: „und in besonderem Maße einer Hochschule, die sich ‚Freie Universität‘ nennt.“
Humboldt-Mythen und Universitätsgeschichten
221
Solche Sätze finden sich weder in der weiteren Humboldt-Rezeption und Diskussion in der DDR noch in der Historiographie der Humboldt-Universität selbst. Sie spricht nicht vom „Wesen der Universität überhaupt“, die sich „rasch“ und als „tiefgründige Beziehung“ mit der Gründung ergeben habe, wie Weischedel unterstellt (VII), sondern von der sozialistischen Universität, die der wahre Erbe Humboldts und auch der wahre Vollender der gesellschaftlichen Funktion moderner Wissenschaft geworden sei. Es gibt deshalb nach 1960 in der DDR zwar eine intensive Form der HumboldtAneignung, selbst hier und da Debatten über die „Idee“ der Universität,95 sie weichen aber bald von den Interpretationen ab, die Heinrich Deiters noch 1960 vorgetragen hatte. Jetzt dominiert die Idee der „Sozialistischen Menschenformung“, wie im 1967er Humboldt-Gedenkbuch der Berliner Universität als Gastautor der Greifswalder Rektor Otto Rühle formuliert. Rühle betont explizit, dass seine Diskussion von „Humboldts Universitätsidee“ als „Tradition und Aufgabe“ sich von der üblichen Lesart der Reflexion über „Idee und Gestalt der deutschen Universität“ unterscheidet und über Humboldt hinausgeht. Es ist, wie 1960 beim Rektor der Humboldt-Universität, erneut der Gedanke der „Erziehung“ und der „Sozialistischen Menschenformung“96 als Aufgabe der Universität, von denen aus diese Erweiterung geschieht.97 Rühle fordert sogar eine „weltanschaulich-sittliche Erziehung“98 und bestätigt ganz deutlich, wie weit er sich von Humboldts Abwehr einer staatlich verordneten Gesinnungsbildung abgesetzt hat, ja er hält, anders als Humboldt, auch die akademische Lebens- und Lehrform der Universität für ungeeignet, solchen Erziehungserwartungen zu entsprechen.99 Der Titel seiner Überlegungen – „Humboldts Universitätsidee“ – wird also explizit für Anschauungen eingeführt, die mit Humboldts Universitätsidee nichts zu tun haben, sondern eindeutig politisch und öffentlich funktionalisiert sind.100
95
96 97
98 99
100
Otto Rühle: Idee und Gestalt, Berlin 1966 sowie – im Band der Berliner Universität zu Humboldts Geburtstag – ders.: Humboldts Universitätsidee – Tradition und Aufgabe, in: Werner Hartke, Henny Maskolat (Hg.): Wilhelm von Humboldt 1767–1967. Erbe, Gegenwart, Zukunft (=Beiträge vorgelegt von der Humboldt-Universität zu Berlin anläßlich der Feier des zweihundertsten Geburtstages ihres Gründers), Halle a. d. Saale 1967, S. 162–194 (im Wesentlichen ein Auszug aus Rühle 1966). Rühle: Universitätsidee (1967), S. 188ff. Rühle: Idee (1966), S. 233ff.: „Die Erziehung als Funktion der sozialistischen Universität zielt weiter und ist komplizierter als die Bildungsfunktion. Gewissen zu formen ist schwieriger als Wissen zu gewinnen. […] Schließlich greift die Erziehung in den innersten Kern der Persönlichkeit ein, erfordert zum Teil tiefgehende Änderungen der Persönlichkeitsstruktur“ (Zit. S. 233). Ebd., S. 244. Vgl. Ebd., S. 269: „Sozialistische Erziehung unterscheidet sich in Klasseninhalt, Ziel und Methode von der klassischen bürgerlichen Bildungsauffassung. Sozialistische Überzeugungen, Charaktereigenschaften, Verhaltensweisen können nicht allein durch den persönlichkeitsbildenden Charakter der Vorlesungen, Seminare und Übungen erreicht werden. Sie setzen bewusst gestaltete Verbindung von Erziehung und Bildung auf der Grundlage der marxistisch-leninistischen Theorie voraus.“ (Hervorhebung i. O.) Joachim-Felix Leonhard: Preußen, Humboldt und die Berliner Universität. Instrumentalisierung im Spiegel von Hörfunk und Fernsehen der DDR, in: Thomas Becker (Hg.): Die Gründung der drei Friedrich-Wilhelms-Universitäten. Universitäre Bildungsreform in Preußen (=Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin 108), Berlin 2012, S. 81–107.
222
Heinz-Elmar Tenorth
Die bei Rühle ausgegrenzten Dimensionen der Idee der Universität – u. a. von Einsamkeit und Freiheit, von Bildung durch Wissenschaft, von Autonomie gegenüber dem Staat, von reiner Wissenschaft und Zweckfreiheit, auch die Abwehr von Erziehungsambitionen und schulförmigem Lernen – beherrschen dagegen – und schon wegen solcher östlicher Aneignungsformen – die westliche Diskussion seit und nach 1960. Hier wird nicht allein die Idee der Universität propagiert, hier wird immer auch die spezifische Position der Universität im Wissenschaftssystem diskutiert und damit eine Grenzlinie zur DDR-Debatte und zum DDR-System der Wissenschaften zwischen Universität und Akademie. Das sind gleichzeitig die Bestimmungen und Grenzlinien, die im Humboldtianismus-Syndrom in der westdeutschen Universitätsdebatte bis heute fortwirken. Erneut ist Karl Jaspers dafür ein eindeutiger Zeuge. In der – gemeinsam mit Kurt Rossmann – erarbeiten Neuausgabe der „Idee der Universität“101 sagen sie – 1961 – schon im Vorwort und im Rückblick auf Jaspers‘ alte Texte: „Die Idee ist dieselbe geblieben, die ganz veränderte Daseinssituation aber verlangt, dass ihre Erscheinung sich wandelt.“ Sie sagen sogleich auch, dass „das Bekenntnis zur Traditionsform [nicht mehr] genügt“ und sehen nur eine Alternative: „Entweder gelingt die Erhaltung der deutschen Universität durch Wiedergeburt der Idee im Entschluss zur Verwirklichung einer neuen Organisationsgestalt oder sie findet ihr Ende im Funktionalismus riesiger Schul- und Ausbildungsanstalten für wissenschaftlich-technische Fachkräfte.“ Die „Erneuerung“ müsse deshalb „aus dem Anspruch der Idee“ und „in den Prinzipien des geistigen Lebens und der modernen Wissenschaftlichkeit“ versucht werden. Humboldt spielt jetzt allerdings eine größere Rolle102 als 1923, ja Jaspers und Rossmann rücken die Denkschrift „über die innere und äußere Organisation“ ganz ins Zentrum ihrer Begründung der Idee der Universität und – erstmals in dieser Deutlichkeit – des gesamten Wissenschaftssystems. Kurt Rossmann sieht „Die Universität als geistige Mitte der Wissenschaftsorganisation“ (171ff.) und bezieht „die gegenwärtige Situation“ auf die „Idee Wilhelm von Humboldts“ (172–178). Zwar bleibt er skeptisch gegen die Zeitangemessenheit der „Bildungsuniversität“ des 19. Jahrhunderts, in Humboldts Denkschrift sieht er dagegen immer noch „den ersten, heute noch verbindlichen Entwurf einer dem Geist moderner Wissenschaftlichkeit entsprechenden Universitätsgestalt“. Dann folgen die Elemente, von denen der Humboldtianismus bis heute lebt, vor allem „mit dem grundsätzlichen Postulat der Freiheit und / Einheit von Forschung und Lehre“. Damit habe „Wilhelm von Humboldt diesem Geiste zum ersten Mal eine ihm adäquate institutionelle Form zu verleihen unternommen.“ Die Prinzipien dieser Denkschrift „bedeuten nichts geringeres als die Proklamation der Grundrechte einer bis heute noch nicht verwirklichten modernen Universität.“ (173/174). Sie ist für Jaspers und Rossmann (174–176) „die lebendige Mitte der Wissenschafts- und Bildungsorganisation im ganzen“, „in deren strikter Unterscheidung von jeder Form der Schule“, „zwischen den höheren Schulen und den 101 Karl Jaspers, Kurt Rossmann: Die Idee der Universität. Für die gegenwärtige Situation entworfen, Berlin, Göttingen, Heidelberg 1961. 102 Das dokumentiert die Passage von Kurt Rossmann, Autor des zweiten Teils: „Von der Notwendigkeit, den Bedingungen und den Möglichkeiten der deutschen Universitätsreform“, Nachweise daraus in Klammern im Text.
Humboldt-Mythen und Universitätsgeschichten
223
Akademien“, Ort der „Vermittlung der ‚Wissenschaft als Wissenschaft‘“. Aber sie unterstellen auch, dass die „Erweiterung“ der „Vermittlung“, „Forschung also“ allein den Akademien obliegen sollte“. Erneut kann man also durchaus kritisch gegenüber Jaspers und Rossmann diskutieren, ob das Humboldts Position war und z. B. von seinem so skeptischen Blick auf die Akademien wirklich gedeckt ist.103 Notwendig sei jedenfalls die „Reformierung unserer gesamten, gegenwärtig so verworrenen, weil kopflos gewordenen und sachlich und funktional in fast allen Bereichen sich überschneidenden Wissenschafts- und Bildungsorganisation im Ganzen“ – aber, und das bleibt die wesentliche Konstante des Humboldtianismus bis heute, von der Universität und der ihr zugeschriebenen zentralen Stellung im gesamten Wissenschaftssystem aus. Das erinnert daran, dass parallel Schelskys Denkschrift „Einsamkeit und Freiheit“104 erscheint, der ebenfalls die Forschungsfähigkeit der Universität innerhalb des neuen Systems der Wissenschaften stärken will. Schelsky geht von vergleichbaren Diagnosen aus, zieht aber in seiner Modellkonstruktion andere Konsequenzen, u. a. im starken Plädoyer für Interdisziplinarität. Wie auch immer das Wissenschaftssystem geordnet wird, der Forschungsprimat gilt und andere Erwartungen, etwa die der Erziehung und ihnen zugeordnete Organisationsformen, z. B. das amerikanische College, werden strikt abgewehrt.105 Als der Wissenschaftsrat nach 1960 solche Erwartungen an die Qualifizierung gesellschaftlicher Eliten artikuliert, bilden sich zwischen dem sozialistischen Studenten, präsent im SDS, den Universitäten und den klassischen Theoretikern der Idee der Universität und ihren neuen Anhängern zunächst seltsam erscheinende Bündnisse. Sie belegen aber, welche einheitsstiftende Kraft inzwischen die zur festen Form geronnene Idee der Universität gewonnen hatte. Jetzt lebt der Mythos – und er wirkt, bis nach „Bologna“. FA Z I T – KONST RU K T ION EI N E R I DE E , GE SCH ICH T E EI N ER U N I V E RSI TÄT Die Realität des Mythos ist also unbestreitbar, auch seine Funktion ebenso eindeutig. Es ist sicherlich nicht die eines in der Absicht der Traditionsstiftung inszenierten „Betrugs“ oder einer anlasslosen „Erfindung“, die Funktion ist, schlägt schon Mitchell Ash vor,106 eher ethnologisch erklärbar, als Form der Sinnstiftung, und sie kann, 103 Humboldts Organisationsmodell für Berlin geht eindeutig zu Lasten der Forschungsfähigkeit der Akademie und eröffnet die Forschungsfähigkeit der Universität; Alexander von Humboldt, der ihr korrespondierendes Mitglied war, sagte lapidar: „Die Akademie gleicht einem Hospital, in dem die Kranken besser schlafen als die Gesunden.“ (Hier zit. nach Eginhard Fabian: Die lange Geburt einer Wissenschaftsmetropole 1789–1870, in: Hubert Laitko, Autorenkollektiv: Wissenschaft in Berlin. Von den Anfängen bis zum Neubeginn nach 1945. Berlin 1987, S. 96–171, Zit. S. 110). 104 Helmut Schelsky: Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen Universität, Reinbek 1963 (2Düsseldorf 1971). 105 Dazu umfassend Konstantin von Freytag-Loringhoven: Erziehung im Kollegienhaus. Reformbestrebungen an den deutschen Universitäten der amerikanischen Besatzungszone 1945–1960, Stuttgart 2012. 106 Mitchel Ash: Introduction, in: ders. (Hg.): German Universities. Past and Future. Crisis or Renewal? Oxford 1997, zur Erläuterung des „Mythos Humboldt“ p. viii.
224
Heinz-Elmar Tenorth
systemtheoretisch gesehen, auch als höchst rationale Form der Selbstbeobachtung einer modernen Organisation interpretiert werden. Das belegt schon die jüngere Nutzung, selbst bei Jürgen Habermas,107 auch wenn er sie über seinen Begriff kommunikativer Rationalität erläutert. Nüchtern gesehen fungiert die Idee im historischen Prozess und in der Praxis der Universität wie eine Kontingenzformel für die Einheit der operativen, normativen und reflexiven Dimensionen, natürlich auch in legitimatorischer Absicht,108 die man in einer Organisation ihrer Komplexität und angesichts der paradoxen Erwartungen, denen sie sich konfrontiert sieht, nicht entbehren kann.109 Die erstaunliche, gegen alle aus ihrer Realität generierte Enttäuschungen resistente Stabilität des Mythos Universität, nicht allein des Humboldtschen, ist von daher gut zu verstehen.110 Deshalb ist es eine verfrühte Letaldiagnose, wenn man den „Niedergang dieser Ideologie“111 schon mit der Arbeit des Wissenschaftsrates nach 1960 und der Einrichtung der Gruppen- und Gremienuniversität behauptet. In den heute aktuellen Debatten über die Universität erlebt der Ideen-Diskurs immer neue Inspiration112 und nicht allein bei Philosophen, die immer neu über Bildung und Wissenschaft 107 Jürgen Habermas: Die Idee der Universität, in: ders.: Zeitdiagnosen. Zwölf Essays. 1980–2001, Frankfurt a. M., S. 78–104 – der immer noch von Jaspers ausgeht, aber auch an die SDS-Argumente erinnert, wenn er „den Kern der Universitätsidee von den Schalen ihrer Übervereinfachungen lösen“ will (S. 86) – und die Tradition mit Humboldts Denkschrift erneut ins Recht setzt, aber Einheitserwartungen, Bildung durch Wissenschaft und faktische Geltung im Universitätssystem, wie immer schon, problematisiert. Dennoch hält er, mit Schleiermacher, daran fest, „daß es die kommunikativen Formen der wissenschaftlichen Argumentation sind, wodurch die universitären Lernprozesse in ihren verschiedenen Funktionen letztlich zusammengehalten werden“ (S. 103). 108 Diese Funktion der Rektoratsreden demonstriert sehr überzeugend Dieter Langewiesche: State – Nation – University. The Nineteenth Century „German University Model” as a Strategy for National Legitimacy in Germany, Austria and Switzerland, in: Axel Jansen, Andreas Franzmann, Peter Münte (Hg.): Legitimizing Science. National and Global Publics (1800–2010), Frankfurt a. M., New York 2015, S. 51–79. 109 Heinz-Elmar Tenorth: „Mythos Humboldt“ – eine Notiz zu Funktion und Geltung der großen Erzählung über die Tradition der deutschen Universität, in: Carolin Behrmann, Mathias Bruhn, Stefan Trinks (Hg.): Intuition und Institution. Kursbuch Horst Bredekamp, Berlin 2012, S. 81–92. 110 Heinz-Elmar Tenorth: Mythos Universität. Die erstaunliche Aktualität einer Idee und die resistente Realität von Universitäten, in: Marc Fabian Buck, Marcel Kabaum (Hg.): Idee und Realitäten von Universitäten, Frankfurt a. M. u. a. 2013, S. 15–33. 111 Bartz: Wissenschaftsrat (2006), S. 32. Aber er unterstellt auch: „Somit zerfiel der Humboldtianismus zwischen 1960 und 1970, und ein Nachfolger von vergleichbarer Wirkungsmacht war nicht zur Stelle, wie im Folgenden zu zeigen sein wird. Zum Abschluss der an dieser Stelle vorzubringenden Ausführungen sei jedoch noch betont, dass diese Ideologie gewiss materiell an ihr Ende gekommen war. Nichtsdestotrotz blieb „Humboldt“, bekanntermaßen bis heute, ein ubiquitär eingesetztes Schlagwort in der hochschulpolitischen Diskussion, „Humboldtsche“ Ideale stehen nach wie vor hoch im Kurs, etwa in akademischen Reden mit entweder resignativem oder auch trotzigem Ton, und ein mehr oder weniger diffuses „Humboldt“-Bild gehört weiterhin zum Selbstverständnis der meisten Universitätsangehörigen.“ (S. 34). 112 Man lese nur einige Beiträge der Sammlungen, die seit 2005, also mit der Mythos-Diagnose von Ash, publiziert wurden und die in der Regel eher für als gegen die Geltung der „Idee“ argumentieren: Ulrich Sieg, Dietrich Korsch (Hg.): Die Idee der Universität heute, München 2005 (und Ulrich Sieg, der Herausgeber beginnt mit „Humboldts Erbe“, ebd. S. 9–24, wenn er die Rekonstruktion der Tradition und aktuelle Diagnose erläutert) oder Buck, Kabaum: Idee (2013) oder Norbert Ricken, Hans-Christoph Koller, Edwin Keiner (Hg.): Die Idee der Universität revisited, Wiesbaden 2014.
Humboldt-Mythen und Universitätsgeschichten
225
nachdenken.113 Auch der „Humboldtianismus“ kennt neue Karrieren, wenn er z. B. als eine der beiden Varianten des reflexiven Zugangs auf die Universität genutzt wird, wesentlich als Träger der Idee von Zweckfreiheit und reiner Wissenschaft, abgesetzt gegen einen „Solutionismus“, der Universitäten allein als nachfrageorientierte, arbeitsmarktbezogene und utilitaristisch zu deutende Systeme sieht. Die Auflösung dieser vereinfachenden Konstrastierungen ist dann selbst noch humboldtianisch, aber historisch belehrt, in einer Erinnerung an die alte Doppelaufgabe, jetzt allerdings paradoxierend als „funktionale Zweckfreiheit“ beschrieben.114 Wie geht aber die aktuelle Selbstbeobachtung der Berliner Universität in ihrer Historiographie selbst mit Humboldt in der Erzählung ihrer eigenen Geschichte um? Wie sieht sich die Berliner Universität selbst 2010, im Jahre ihres 200jährigen Geburtstages? Der Mythos lebt in der Selbstinszenierung, das ist die erste Beobachtung. Er lebt in der Erinnerung an die Gründung 1810 und die als Wiedergründung gedeutete Situation von 1991 als Mythos der „Reformuniversität“. Der Mythos lebt auch in der Zuschreibung als Modell der modernen Universität, und der Mythos wird wiederbelebt in der Einheitsformel für die Praxis der Universität, wenn im schließlich erfolgreich bestandenen Exzellenzwettbewerb die Universität unter der Formel „Bildung durch Wissenschaft“ antritt. Humboldt gilt insofern der Universität mehrfach als Symbol ihrer Ambitionen und als Leitkonzept ihrer Selbstbeschreibung als spezifische Organisation im Wissenschaftssystem. Das findet sich auch in den Begleittexten der Hochschulleitung zum Jubiläum von 2010,115 die damit Leitideen aus dem (schon 2002 beschlossenen) „Leitbild“116 113 Kontinuierlich engagiert und viel beachtet Jürgen Mittelstraß; vgl. u.a.: Der Flug der Eule. Von der Vernunft der Wissenschaft und der Aufgabe der Philosophie; Frankfurt a. M. 1989. 114 Solche Argumente artikuliert ein ehemaliger Vorsitzender des Wissenschaftsrates und gegenwärtiger Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, also Peter Strohschneider: Funktionale Zweckfreiheit von Wissenschaft. Eine Erfahrungsskizze, in: Ronald Hitzler (Hg.): Hermeneutik als Lebenspraxis. Weinheim, Basel 2015, S. 293–305. 115 Christoph Markschies: Was von Humboldt noch zu lernen ist. Aus Anlass des zweihundertjährigen Geburtstags der preußischen Reformuniversität, Berlin 2010 – und die einleitenden „Thesen – was ist von Humboldt noch zu lernen?“ setzen mit These 1 so ein: „Der Humboldt-Mythos ist tot. Es lebe Humboldt.“ (S. 7), und dann folgt als 2. These „Humboldt ist aber nicht nur Humboldt“ (S. 8) und das deutet schon an, dass für den Theologen Markschies die wirklich bedeutsame Gründerfigur der Theologe Schleiermacher ist; vgl. auch im selben Band (S. 15–46) seinen Leipziger Vortrag von 2009: „Woran krankt die deutsche Universität? Oder: warum es sich lohnt, Universitätsgeschichte zu treiben“, in dem für alle aktuellen Probleme der Universität Schleiermachers Gründungstexte als Lösung aktualisiert werden. Der Präsident Markschies erfindet aber auch das Jubiläumsmotto: „das moderne Original“, das bis heute, leicht modifiziert, die Webseite der Universität schmückt: „das moderne Original der Reformuniversität“. Für seine Referenzen von Reform auch seine Antrittsrede als Rektor 2006: ders.: Berliner Universitätsreformer aus zweihundert Jahren, in: ders.: Antike ohne Ende, Berlin 2008, S. 149–172, wo neben Humboldt z. B. Virchow eine große Rolle spielt. 116 Beschlossen durch das Konzil der Humboldt-Universität zu Berlin am 13.2.2002; vgl. https://www. hu-berlin.de/de/pr/medien/publikationen/pdf/hu_leitbild_dt.pdf/download, zuletzt abgerufen am 10.3.2016. Der Philosoph Volker Gerhardt hat dafür in der inneruniversitären Debatte die entscheidende Arbeit geleistet, für seine Humboldt-Interpretation vgl. Volker Gerhardt: Humboldts Idee. Zur Aktualität des Programms Wilhelm von Humboldts, in: Henningsen: Humboldt (2007), S. 55–76, aber auch die weiteren Beiträge in diesem Band, die explizit „Humboldts Vermächtnis“ aktualisieren.
226
Heinz-Elmar Tenorth
der Universität aufnimmt: „Als Reformuniversität in einer Situation der Krise gegründet“, womit 1810 und 1990/91 zusammen gebunden werden, versteht sie sich aktuell als „Reformuniversität im Zeichen der Exzellenz“, aber nicht ohne historische Selbstkritik,117 schon in der Leitbilddiskussion und -konstruktion, wie sie z. B. nach 1992 geführt wurde und sich in eigenen Texten niedergeschlagen hat.118 Dieser Selbstbeschreibung kann, erwartbar, auch die Historiographie nicht entgehen, die 2010 aus der Universität heraus für die Geschichte seit 2010 vorgelegt wurde, in der sechsbändigen Universitätsgeschichte, die zwischen 2010 und 2012 erscheint,119 quasi offiziös, weil sie „im Namen des Präsidenten der HumboldtUniversität“ erscheint (mit einer eigenen Werkbiographie,120 die gelegentlich in der Nutzung zu Verwirrung geführt hat).121 Das ist jetzt natürlich, anders als in der Westperspektive von 1960, eine Geschichte, die von der Kontinuität der Berliner Universität Unter den Linden seit 1810 und bis 2010 ausgeht. 1945 vollzieht sich deshalb auch keine Neugründung, gefolgt von einer zweiten Gründung 1948 in Dahlem, sondern nur der Wiederbeginn des Lehrbetriebs Unter den Linden.122Aber 117 Dafür steht auch das Leitbild, und konkret hier: „Der Bezug der Humboldt-Universität auf ihre Tradition erfolgt auch im Bewusstsein ihrer schuldhaften Verstrickung in die Politik. In ihrer Geschichte finden sich Obrigkeitshörigkeit, ständischer Dünkel, politischer Wahn sowie menschenverachtende Lehre und Forschung. Zu ihren dunkelsten Kapiteln gehören die Bücherverbrennung und die Beteiligung an der Verfolgung und Vertreibung ihrer Mitglieder. Vor diesem Hintergrund versteht sich die Humboldt-Universität seit Beginn ihrer Selbsterneuerung im Jahre 1989 als eine Institution, die sich für kritische Distanz gegenüber politischer und gesellschaftlicher Macht entschieden hat. Sie wendet sich gegen jede Form von Diskriminierung, Intoleranz und kultureller Selbstüberhöhung.“ 118 Vor allem signifikant dafür die Beiträge in Bernd Henningsen (Hg.): Humboldts Zukunft. Das Projekt Reformuniversität, Berlin 2007. 119 Heinz-Elmar Tenorth (Hg.): Geschichte der Universität Unter den Linden 1810 bis 2010, 6 Bd., Berlin 2010–2012 (Bd.1: Gründung und Blütezeit der Universität zu Berlin 1810–1918, Berlin 2012; Bd. 2: Die Berliner Universität zwischen den Weltkriegen 1918 bis 1945, Berlin 2012; Bd. 3: Sozialistisches Experiment und Erneuerung in der Demokratie – die Humboldt-Universität zu Berlin 1945–2010, Berlin 2012; 4: Genese der Disziplinen. Die Konstitution der Universität, Berlin 2010; Bd. 5: Transformation der Wissensordnung, Berlin 2010; Bd. 6. Selbstbehauptung einer Vision, Berlin 2010; – Bd. 4–6 editorisch in Zusammenarbeit mit Volker Hess und Dieter Hoffmann). 120 Man erkennt aber den Konstruktionsprozess und die Verantwortlichkeiten, wenn man in der zeitlichen Folge der Erscheinungsdaten der Bände den Übersichten über das Gesamtwerk und die Herausgeber folgt, die jeweils auf den Vorblättern sowie auf den Schutzumschlägen gegeben werden. In den Bänden 4–6, 2010 erschienen, und in den Bänden 2 und 3, 2012 zuerst erschienen, werden nach dem Verweis auf den Auftrag des Präsidenten als Herausgeber „Rüdiger vom Bruch und Heinz-Elmar Tenorth“ genannt, erst in Band 1, zuletzt, wie das Vorwort belegt, aber ebenfalls noch 2012 erschienen, findet sich die neue und für den faktischen Arbeitsprozess korrekte und die Funktionen unterscheidende Formel: „Begonnen von Rüdiger vom Bruch und Heinz-Elmar Tenorth, herausgegeben von Heinz-Elmar Tenorth“. 121 Eine publizistische Einheit oder einen editorischen Kontext wie den folgenden gibt es jedenfalls im deutschen Buchmarkt nicht, weder für die Herausgeber noch für den Erscheinungszeitraum: „Tenorth, Heinz-Elmar und Michael Grüttner (Hg.), 2012–2014. Geschichte der Universität Unter den Linden. 6 Bde. Berlin: Akademie Verlag“ – so zitiert, im Text kurz, im Literaturverzeichnis ausführlich Stefan Gerber: Wie schreibt man zeitgemäße Universitätsgeschichte? In: NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin 22 (2014), S. 277–286. 122 Diese Kontinutitätsthese wird – gegen die explizit andere Geschichte von den vermeintlich zwei
Humboldt-Mythen und Universitätsgeschichten
227
diese Historiographie konstruiert keine alten Mythen neu, sondern nimmt – schon einleitend123 – den Mythos selbst noch als eine Referenz, die der historiographischen Überprüfung bedarf. In der Ausarbeitung, wenn ich das hier als Aussage über eigene Arbeit als Herausgeber und Autor in aller Vorsicht dennoch sagen kann, liest sich die Geschichte deshalb auch eher wie eine kritische Destruktion des Mythos, denn sie präsentiert sich als fortlaufende Erzählung der Differenz von Programm und Realität. Gestützt wird diese Lesart auch durch Parallelgeschichten, die 2010 auch noch geschrieben wurden, z. T. allerdings nur als Versuch der Ehrenrettung für die DDRGeschichte der Universität und ihre eigene Historiographie,124 die man in der öffentlichen Wahrnehmung ungerecht behandelt sah, und im Ergebnis nicht ganz frei von neuen Mythenbildungen, zumal für die Situation von 1989 bis 1991. Die Erinnerungsarbeit war im Detail überzeugender in den zahlreichen Fakultäts-125 und Fachgeschichten126 sowie im politischen Kontext der deutschen Universitätsgeschichte.127 Allein im resümierenden Rückblick wird der Mythos doch beansprucht, allerdings reduziert auf die in Humboldts Programm enthaltene Vision einer „Forschungsuniversität“. Die Geschichte zeigt sie von 1810 bis 2010 dann doch kontinuierlich, freilich genau
123
124
125
126
127
Universitäten seit 1945, die von 1960 bis nach 1990 in der FU wiederholt werden – im Beitrag von Reimer Hansen, übrigens einem FU-Historiker, explizit, materialreich und bisher unwiderlegt dargestellt (vgl. ders.: „Von der Friedrich-Wilhelms-Universität zur Humboldt-Universität“, in: Tenorth: Geschichte (3/2012), insb. S. 65ff.). Dazu muss ich jetzt, leider, eigene Texte als Beleg anführen, u. a. die Einleitung zum ersten Band und die dortige explizite Abgrenzung vom Humboldt-Narrativ und der kritischen Referenz auf die Mythos-Debatte (Bd. 1, 2012, S. XVf.) sowie in der Einleitung zum abschließenden Band 6, der die Humboldt-Rezeption selbst noch diskutiert und die widersprüchliche Realität des Forschungsideals und seine Eigenlogik und Existenz in der politisch kontrollierten Organisation (Bd. 6, 2010, S. 41–43). Wolfgang Girnus, Klaus Meier (Hg.): Die Humboldt-Universität Unter den Linden 1945 bis 1990, Leipzig 2010. Zur Universitätshistoriographie der Berliner Universität und vor allem der HU in der DDR Hannelore Bernhardt: Universitätsgeschichtsschreibung an der Humboldt-Universität zu Berlin – Friedrich Herneck zum 100. Geburtstag, ebd., S. 59–106. Für die juristische Fakultät z.B. besonders elaboriert bei Stefan Grundmann, Rainer Schröder u. a. (Hg.): Festschrift. 200 Jahre Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin 2010, in zahlreichen Detailstudien auch für die Charité und für die medizinische Fakultät, u. a. Johanna Bleker, Volker Hess (Hg.): Die Charité. Geschichte(n) eines Krankenhauses, Berlin 2010. Für einzelne Disziplinen (jetzt nur in Untersuchungen, die anlässlich des Jubiläums erschienen) z. B. Horst Bredekamp, Adam Labuda (Hg.): In der Mitte Berlins. 200 Jahre Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität, Berlin 2010; Wolfgang Hardtwig, Philipp Müller (Hg.): Die Vergangenheit der Weltgeschichte. Universalhistorisches Denken in Berlin 1800–1933, Göttingen 2010; Jutta Hoffmann: Nordische Philologie an der Berliner Universität zwischen 1810 und 1945. Wissenschaft – Disziplin – Fach, Frankfurt a. M. 2009; Steffen Martus, Werner Röcke u. a. (Hg.): 200 Jahre Berliner Universität. 200 Jahre Berliner Germanistik, in: Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge XX (2010), Hefte 1 und 2; für Spezialfragen: Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien der Humboldt-Universität/Projektgruppe Edition Frauenstudium (Hg.): Störgröße „F“. Frauenstudium und Wissenschaftlerinnenkarrieren an der Friedrich-WilhelmsUniversität Berlin – 1892 bis 1945, Berlin 2010. Rüdiger vom Bruch (Hg.): Die Berliner Universität im Kontext der deutschen Universitätslandschaft nach 1800, um 1860 und um 1910, München 2010; Michael Grüttner u. a. (Hg.): Gebrochene Wissenschaftskulturen. Universität und Politik im 20. Jahrhundert, Göttingen 2010.
228
Heinz-Elmar Tenorth
als das, was Weischedel für die Idee generell beansprucht, als eine Realität auch in entfremdeter Wirklichkeit, d. h. als Logik der Forschung in ihrer Eigendynamik auch unter den politisierten Bedingungen des Sozialismus. Die Vision bestimmt, so dieses historiographische Fazit, sicherlich nicht durchgängig die Berliner Universität, politisch bestimmt nicht, aber doch überzufällig häufig, nicht allein als nostalgische Chimäre, sondern in der disziplinären Praxis. Die Forschungsuniversität lebt Unter den Linden also nicht als Organisation, sondern als emergente Realität von Forschung und Lehre, in der Praxis erst zu erzeugen, nicht in den Strukturen der Organisation schon garantiert. Aber der Mythos nährt sich nicht nur von da aus, weil er in der Praxis universitärer Arbeit seine eigene Realität hat, er ist auch in Stein gemeißelt, repräsentiert schon in den Denkmälern der Brüder Humboldt, die den Eingang zur Universität, den sogenannten Ehrenhof, zieren,128 aber auch in ihren großen Porträts die Wände des Senatssaals schmücken, gewissermaßen als Nachfolger des nicht mehr vorhandenen Fichte-Bildes aus den Befreiungskriegen. Aber selbst in den Denkmälern ist der Mythos nicht isoliert, denn im Senatssaal sind auf der Gegenseite zu den Bildern die Büsten von Hegel, Einstein, Thaer und Brugsch präsent,129 und man muss – außen – an Helmholtz vorbei, wenn man ins Haus geht, und kann auch Mommsen im Vorhof nicht übersehen. Die universitas litterarum ist also schon beim Zugang zur Universität symbolisch präsent, auch wenn heute die alte Giebelinschrift fehlt und durch den Namen der Humboldts ersetzt wurde. Die seit der Gründung immer in gleicher Weise bedeutsame politische Dimension fehlt heute ebenfalls nicht. Sie wird schon beim Eintritt in das Hauptgebäude bewusst, wo im Foyer an der Wand des Treppenaufgangs die 11. Feuerbach-These unübersehbar und trotz aller Kontroversen130 nach 1991 erhalten geblieben ist, und politisch ist auch die Gartenseite markiert. Dort erkennt man zwar den als Appellplatz seit 1933 missbrauchten Hof unter dem neu eingesäten Rasen heute nicht mehr, aber man kann das „Mahnmal für die Opfer des Faschismus“ nicht übersehen, das im September 1976 eingeweiht wurde. Es hält, wie die bunten Glasfenster im Ostflügel, in denen die Heroen und Symbole des wissenschaftlichen Sozialismus und seine 128 Die konfliktreiche Vorgeschichte der Aufstellung dieser Denkmäler, die 1869 mit Virchows Engagement für Alexander von Humboldt (!) einsetzt, im Kontext der Ehrung „von Männern ‚mit Zivilverdienst‘“ (Gandert: Prinzenpalais (1992), S. 165), von der Universität auf die gleichzeitige Errichtung eines Denkmals für Wilhelm von Humboldt ausgeweitet wird (und damit Finanzierungsprobleme erzeugt), findet erst 1883 mit der Enthüllung der beiden Denkmäler durch den Kaiser zu einem glücklichen Ende. Das Helmholtz-Denkmal wurde 1899 aufgestellt, Mommsen 1909 (vgl. Klaus-Dietrich Gandert: Vom Prinzenpalais zu Humboldt-Universität. Die historische Entwicklung des Universitätsgebäudes in Berlin mit seinen Gartenanlagen und Denkmälern, Berlin 31992, insb. S. 165ff.) 129 Nur zur Erläuterung, jenseits von Hegel und Einstein: Albrecht D. Thaer (1772–1828) gehörte zu den Gründungsprofessuren der Berliner Universität und gilt als Begründer der Landwirtschaftswissenschaften, Theodor Brugsch (1878–1963) war von 1945–1957 Ordinarius für Innere Medizin. 130 Die Auseinandersetzungen, die schließlich vom Denkmalsschutz beendet wurden, der das gesamte Foyer unter Denkmalschutz stellte, lassen sich verfolgen bei Volker Gerhardt (Hg.): Eine angeschlagene These. Die 11. Feuerbach-These im Foyer der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin 1996.
Humboldt-Mythen und Universitätsgeschichten
229
wissenschaftlichen Leitbilder und Ideologien in einem Triptychon angeordnet sind und so als neue Religion ihren Ausdruck finden, ebenfalls die Erinnerungen an die Zeit wach, als die Humboldt-Universität die Rolle der preußischen Central-Universität beerbte und als Hauptstadt-Universität der DDR erneut den ersten Platz einnahm. Im Blick auf diese Traditionen wird gleichzeitig bewusst, dass die nach 1991 erneuerte Universität die Erinnerung an ihre politische Geschichte vor 1990 durchaus bewahrt hat,131 aber die Erinnerung an ihre eigene Biographie nach 1990 noch nicht baulich dokumentiert.
131 Das gilt nicht für alle Aspekte der aus der DDR baulich überlieferten Erinnerungsstücke, denn Wandbilder sind im Senatssaal ebenso entfernt worden wie im ehemaligen kleinen Senatssaal, der früher den Namen von Marx und Engels trug.
U N I V ERSI TÄ R E ER I N N ERU NGS - U N D F E ST K U LT U R A M BEISPI E L EI N ER BE SON DER E N NACH K R I EGS GRÜ N DU NG – DI E U N I V ERSI TÄT DE S SA A R LA N DE S Wolfgang Müller Gewidmet Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Werner Eck
„Medizinische Annäherung – Voran die Marseillaise“. Diese Schlagzeile des „Spiegel“ vom 22. März 19471 möge die folgenden Ausführungen eröffnen, die Ihnen facettenreiche Mosaiksteine zur Fest- und Erinnerungskultur2 an der Universität des Saarlandes bieten möchten. Sie wissen, dass diese erste, nach dem Zweiten Weltkrieg neu gegründete linksrheinische Hochschule in der damaligen Sondersituation des politisch teilautonomen und ökonomisch durch Wirtschafts- und Währungsunion mit Frankreich verbundenen Saarlandes unter der Ägide Frankreichs und der Universität Nancy entstand.3 Zunächst hatten im Januar 1946 im damaligen Homburger Landeskrankenhaus klinische Fortbildungskurse für Studierende der Medizin stattgefunden, die aber von den benachbarten deutschen Universitäten – aus welchen Gründen auch immer – nicht anerkannt wurden. Daher wandte sich Militärgouverneur Gilbert Grandval an den ihm aus der Résistance bekannten Rektor der Universität Nancy Pierre Donzelot, und man hob unter dem Patronat der Universität Nancy am 8. März 1947 ein „Centre Universitaire d’Études Supérieures de Hombourg“ aus der Taufe, das nach einem zweijährigen Propädeutikum zum Studium an einer französischen Universität führen sollte.4 „Durch diese Initiative – so hatte es Grandval programmatisch 1 2
3
4
Der Spiegel 2. Jahrgang (12/1947), S. 2–3. Über die universitäre Festkultur aus der Perspektive der archivischen Überlieferung informiert der Vortrag des Heidelberger Kollegen Werner Moritz: „Universitätsfeiern – Quellen der (südwestdeutschen) Universität(en)“, den er am 7. November 2008 beim Kolloquium des Landesarchivs Baden-Württemberg „Lebenswelten“ und „Wertewandel“ in der Nachkriegszeit (1945–1970) – Quellenlage und Auswertungsmöglichkeiten gehalten hat. http://www.landesarchivbw.de/web/53154, zuletzt abgerufen am 10.3.2016. Wolfgang Müller: Universität des Saarlandes, in: Nicole Colin, Corine Defrance, Ulrich Pfeil, Joachim Umlauf (Hg.): Lexikon der deutsch-französischen Kulturbeziehungen nach 1945, Tübingen 2013, S. 443–444. Wolfgang Müller: Das Archiv der Universität des Saarlandes, in: Ingo Runde (Hg.): Universitätsarchive in Südwestdeutschland – Geschichte Bestände Projekte. Tagungsband anlässlich des 625-jährigen Jubiläums der Ersterwähnung einer Archivkiste der Universität Heidelberg zum 8. Februar 1388 (=Heidelberger Schriften zur Universitätsgeschichte, Band 1), Heidelberg 2013, S. 157–174. Wolfgang Müller: Von Nancy gegründet und zur europäischen Universität proklamiert. Beiträge des Archivs der Universität des Saarlandes zur Überlieferungssicherung und Erforschung der Universitätsgeschichte, in: Bulletin der Polnischen Historischen Mission (6/2011), S. 196–214. Ders.: „Eine Pflegestätte des Geistes, der die Enge zu überwinden sucht und nach europäischer Weite strebt.“ – Impressionen zur Geschichte der Universität des Saarlandes, in: Bärbel Kuhn, Martina Pitz, Andreas Schorr (Hg.): ‚Grenzen‘ ohne Fächergrenzen. Interdisziplinäre Annäherungen (=Annales Universitatis Saraviensis Philosophische Fakultäten, Band 26), St. Ingbert 2007, S. 265–302. Wolfgang Müller (Hg.): Unter der Ägide der Universität Nancy. Streiflichter zur Gründung des Homburger Hochschulinstituts vor 60 Jahren, Saarbrücken 2007.
232
Wolfgang Müller
formuliert – „soll das seit einem Jahrhundert von Preußen kolonisierte Saarland wieder in die Lage versetzt werden, eine geistige Elite hervorzubringen, die seiner würdig und die unentbehrlich ist für seinen materiellen und geistigen Wiederaufstieg in einem wahrhaft demokratischen Geiste. In Übereinstimmung mit dem Hauptziel unserer gemeinsamen Politik werden schließlich hierdurch engere kulturelle Bande zwischen Frankreich und dem Saarland geschaffen, gemäß den geschichtlichen und geographischen Gegebenheiten.“5 In seiner Festansprache beglückwünschte er die „Herren Studenten“, die „dank ihrer intellektuellen Gaben und dank ihres guten Willens“ als „erste Saarländer [...] zu den Quellen des französischen Geistes zugelassen werden“. Frankreich habe an der Saar „diesen Preußen und diesen Nazis diese Schlüsselstellungen“ des saarländischen Lebens „entrissen, […] um sie euch zu übergeben“. Frankreich hege „hinsichtlich eures kleinen Vaterlandes keine annektionistischen und kolonisatorischen Absichten“ und wolle lediglich beistehen, „euch endgültig von dem preußischen Geiste zu befreien, euch zu helfen, auf allen Gebieten die Meister eures eigenen Geschicks zu werden.“6 Die Eröffnung des Homburger Centre erfolgte mit außerordentlichem protokollarischem Aufwand.7 Bereits am Bahnhof erwarteten eine Ehrenformation und ein Panzerspalier die Festgäste. Der Festakt selbst fand in der Aula, dem Festsaal des Landeskrankenhauses, statt, das 1909 als III. Pfälzische Heil- und Pflegeanstalt eingeweiht und nach der in Versailles beschlossenen Gründung des Saargebiets unter Völkerbundverwaltung in ein Landeskrankenhaus umgewandelt worden war. Beim Festakt wurde auch über die gesamte Breite der Bühnenrampe ein Mosaik in lateinischer Sprache enthüllt. Bemerkenswert ist, dass im Zuge von Umbaumaßnahmen in den frühen 50er Jahren die Aula umgestaltet und die Bühnenrampe samt Inschrift wieder entfernt wurde. Zeitzeugen erinnern sich, das in wenige Einzelstücke zerlegte Mosaik sei zunächst in einem Schuppen gelagert und bei dessen Abriss vermutlich teils als Stückung und Wegbefestigung, teils in einem Vorgarten vergraben worden. Zum sechzigjährigen Jubiläum 2007 wurde die Inschrift mit Übersetzung als Platte an der Außenmauer des jetzt als Bibliothek genutzten Gebäudes wieder angebracht. Die Eröffnungsfeier, an der neben dem französischen Erziehungsminister Marcel Édmond Naegelen und Administrateur Général Émile Laffon auch zahlreiche Professoren aus Nancy und Straßburg im Talar und die Mitglieder der Verwaltungskommission der Saar teilnahmen, fand in der Öffentlichkeit breite Resonanz,8 und 5 6 7
8
Den Briefwechsel Grandval-Müller dokumentiert der Artikel Vor der feierlichen Eröffnung der Homburger Universität. Auf dem Weg zu einer saarländischen Hochschule, in: Saarbrücker Zeitung v. 6.3.1947. Die Festansprachen dokumentiert der Band Verwaltungskommission des Saarlandes (Hg.): Centre Universitaire d’Études Supérieures de Hombourg – Saarländische Hochschule Homburg, Saarlouis 1947; Zitate S. 81, 83. Wie bei den „Französischen Festtagen“ in Saarlouis 1946 und den Feiern zum französischen Nationalfeiertag nach Armin Flender: Öffentliche Erinnerungskultur im Saarland nach dem Zweiten Weltkrieg. Untersuchungen über den Zusammenhang von Geschichte und Identität (=Schriftenreihe des Instituts für Regionalforschungen, Bd. 2), Baden-Baden 1998, S. 36–50. Der Nachweis der diversen Festberichte bei Wolfgang Müller: „Dieses Institut am Leben zu erhalten und zu entwickeln“ – Impressionen zur Kooperation der Medizinischen Fakultäten Homburg / Saar und Nancy, in: Müller: Ägide (2007), S. 10.
Universitäre Erinnerungs- und Festkultur. Die Universität des Saarlandes
233
Abb. 1 Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Universitätsjubiläum enthüllen Universitätspräsident Prof. Dr. Volker Linneweber, der Botschafter der Französischen Republik Bernard de Montferrand und der Ministerpräsident des Saarlandes Peter Müller am 20. Oktober 2008 die neue Inschrift an der Haupteinfahrt der Universität des Saarlandes
234
Wolfgang Müller
der Zeitzeuge Carl Erich Alken nahm einen „bivalenten Farbakzent“ des Festaktes wahr: „In der grauen Misere der Nachkriegszeit setzten die Gründungsfeierlichkeiten einen bivalenten Farbakzent, der in der Rückblende nur vorstellbar wird, wenn man sich die damalige Atmosphäre in Erinnerung rufen kann. Die Besatzungsmacht trat zwar als Gouvernement militaire auf, aber jetzt betont in der Rolle des Maecens, der am Helm noch den Lorbeer des Sieges trug, jedoch in den Händen die Palmes académiques – Flaggenwald, Ehreneskorte einer Panzerbrigade, Generäle und Offiziere in Uniform, als Contrapunkt der Kultusminister aus Paris persönlich, Rektoren und Dekane der französischen Universitäten in ihren prunkvollen Talaren, Hermelin auf karmesinroter Seide, Spitzenjabot und goldene Kette und die Spitzen der saarländischen Regierung in feierlichem Schwarz. Das Protektorat demonstriert die Idee und den Willen, hier etwas Geistiges zu schaffen, das vielleicht noch besteht, wenn die Panzer längst verschrottet und die Lorbeeren am Helm verwelkt sind.“9 Gerade einige Aussagen der Festredner schienen den spezifisch missionarischen Charakter der französischen Kulturpolitik und die Maecenas-Rolle der Besatzungsmacht zu dokumentieren. Ebenso wie die antipreußischen Wendungen Grandvals sollten sie in den folgenden Jahren und nicht zuletzt im Umfeld des Abstimmungskampfes 1955 in den politischen Kontroversen um die Saar immer wieder gerne als Beleg für den französischen „Kulturimperialismus“ herangezogen werden.10 Auffallend bleibt ferner die zeitgenössisch unterschiedliche, gelegentlich verwirrende Bezeichnung der gerade eröffneten Einrichtung. Man sprach von einer medizinischen Akademie, Hochschule oder Schule, der französischen Universität Homburg, der Homburger oder der saarländischen Universität, dem Hochschul-Institut, der saarländischen Hochschule Homburg, dem Saargebiets-Institut oder dem Universitäts-Zentrum. Gelegentlich wird auch heute noch aus lokalpatriotischen Gründen zwischen Homburg und Saarbrücken gestritten, wem das universitäre Erstgeburtsrecht zukommt. Denn wenn auch im Februar 1948 propädeutische juristische, philosophische und naturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen eingerichtet wurden, blieben die Zukunftsperspektiven des Homburger Instituts offen. Der erweiterte Verwaltungsrat des Homburger Instituts beschloss am 9. April bei seiner Sitzung im Pariser Außenministerium am Quai d’Orsay zwar die Umwandlung der Homburger Einrichtung in eine „Universität des Saarlandes“ mit „internationaler Ausstrahlung“, als „Brücke zwischen Frankreich und Deutschland“ und mit einem französischen Rektor an der Spitze.11 Aber die Umsetzung dieser Beschlüsse verzögerte sich. Der Streik der Studierenden des Instituts im Mai dokumentierte diesen Schwebezustand und die ungelösten Probleme. 9 10
11
Carl Erich Alken: Weil Mainz nicht wollte, wurde Nancy Mutter, in: Saarbrücker Zeitung v. 30.11.1973. S. 25. Wolfgang Müller: „Primär französisch gesteuerte und orientierte Einrichtung“ oder „wesentliche Stütze des Deutschtums an der Westgrenze“ – Die Perzeption der Universität des Saarlandes aus der Bonner Perspektive in den frühen fünfziger Jahren, in: Wolfgang Haubrichs, Kurt-Ulrich Jäschke, Michael Oberweis (Hg.): Grenzen erkennen – Begrenzungen überwinden. Festschrift für Reinhard Schneider zur Vollendung seines 65. Lebensjahrs, Sigmaringen 1999, S. 425–441. Sitzungsbericht über die verbreiterte Zusammenkunft des Verwaltungsrates der Universität Homburg, abgehalten Freitag den 9. April 1948 um 10.30 Uhr im Ministère des Affaires étrangères, UA SB, insb. S. 5.
Universitäre Erinnerungs- und Festkultur. Die Universität des Saarlandes
235
Erst am 15. September 1948 ernannte Grandval den von der Universität Nancy kommenden Physiker Jean Barriol zum Rektor der neuen Universität. Anfang Oktober konstituierten sich die vier Fakultäten. Mitte November 1948 nahm dann die Universität des Saarlandes an ihren beiden Standorten Saarbrücken und Homburg den Lehrbetrieb auf. Während die Naturwissenschaftliche Fakultät bis 1950 und die Medizinische Fakultät bis heute in Homburg verblieben, bezogen die Philosophische, Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät ein bislang militärisch genutztes Areal im Saarbrücker Stadtwald. Fünf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, war dort 1937/38 im sogenannten Heimatstil die nach dem zeitweiligen Kommandierenden General des in Saarbrücken stationierten XXI. Armeekorps Fritz Wilhelm Theodor Carl von Below (1853–1918) benannte Kaserne errichtet und am „Tag der Wehrmacht“, am 27. November 1938, vom MG-Bataillon 14 bezogen worden.12 Nach der amerikanischen Besetzung der Saarregion zwischen dem 21. März und dem 13. Juli 1945 richtete die United Nations Relief and Rehabilitation Association (UNRA) in der Kaserne ein mit 7.500 Personen, vornehmlich osteuropäischen Zwangsarbeitern, belegtes Sammellager für „Displaced Persons“ ein, wobei die aus der Sowjetunion stammenden Zwangsarbeiter Saarbrücken „bereits Ende Mai vom Bahnhof Schleifmühle aus mit einem von Soldaten der Roten Armee bewachten Transport Richtung Osten“ verließen.13 Nach der Übergabe des Saarlandes an die französische Besatzungsmacht wurde die ehemalige Below-Kaserne als „Caserne Verdun“ genutzt. Unmittelbar nach Kriegsende wurden wohl auch am Torgebäude der Reichsadler mit dem Hakenkreuz und die beiden jeweils links und rechts angeordneten Plastiken zweier Soldaten beseitigt. Bei einer Renovierung im Herbst 2013 fand sich übrigens unter der Tapete im heutigen Dienstzimmer des Leiters des Haushaltsreferats ein einen Löwenkopf in einem von einem Palmenkranz umrahmten fünfzackigen grünen Stern darstellendes Regimentszeichen, mit dem sich das 5. Regiment der Tirailleurs Marocains verewigt hatte. Nachdem einige Bombenschäden beseitigt worden waren, konnten dann Mitte November 1948 die beiden Fakultäten in die Kaserne einziehen und den Lehrbetrieb aufnehmen. Am Torgebäude wurde jetzt das zweisprachige Namensschild „Universität des Saarlandes – Université de la Sarre“ installiert, das nach dem saarpolitischen Umbruch 1955 abgenommen wurde. Historische Fotos aus dem Universitätsarchiv führten dann zu einer Initiative, das zweisprachige Namensschild in neuer Gestalt und eingerahmt vom Symbol der Europäischen Union wieder zu montieren. Im Rahmen des sechzigjährigen Universitätsjubiläums enthüllten Universitätspräsident Volker Linneweber und der Botschafter der Französischen Republik Bernard de Montferrand im Oktober 2008 das neue Emblem. Dabei stellt sich übrigens auch am Rande die spannende Frage, ob noch in anderen Orten außer in Saarbrücken und in Mainz Kasernen zu Universitäten umgewidmet wurden. 12 13
Tag der Wehrmacht, in: Saarbrücker Zeitung v. 27.11.1938. Fabian Lemmes: Zwangsarbeit in Saarbrücken – Stadtverwaltung, lokale Wirtschaft und der Einsatz ausländischer Zivilarbeiter und Kriegsgefangener 1940–1945, St. Ingbert 2004, S. 274. Auf Seite 271 findet sich auch ein Bericht über Plünderungen der Zwangsarbeiter im Stadtgebiet sowie auf Seite 275 ein Hinweis auf die schwierigen Lebensumstände und den Ausbruch von Infektionskrankheiten im Lager, die „vor allem im Mai zahlreiche Todesopfer forderten“.
236
Wolfgang Müller
In programmatischen Beiträgen im ersten übrigens zweisprachigen deutschfranzösischen Vorlesungsverzeichnis wies beispielsweise der saarländische Ministerpräsident Johannes Hoffmann der neuen Hochschule die Aufgabe zu, „von unserer Heimat aus auch im Bereich der Wissenschaft zur Erneuerung einer abendländischen Gesinnung beizutragen“ und sprach von einer „Pflegestätte des Geistes, der die Enge zu überwinden sucht und nach europäischer Weite strebt, […] eine[r] Burg des Friedens und ein[em] Symbol neuen Werdens. Von ihr sollen die Strahlen beglückender Arbeit in die europäische Zukunft leuchten.“14 Hochkommissar Grandval betonte die Hilfe Frankreichs, und Gründungsrektor Jean Barriol gab als Ziel aus, „diese Universität, an der Professoren und Studenten verschiedener Sprachen zusammenkommen werden, zum Werkzeug einer wahrhaft europäischen Gesinnung zu machen.“15 Das Vorlesungsverzeichnis bietet übrigens auch die Ansprache des katholischen Dozenten und späteren Honorarprofessors Josef Goergen beim Festgottesdienst zur Eröffnung des ersten Studienjahres am 15. November 1948. In seiner Predigt erinnerte er an das Wirken von Albertus Magnus und betrachtete es als „eine glückliche Fügung, daß der Tag der ersten feierlichen Immatrikulation junger saarländischer Studenten zugleich der Gedächtnistag an den Doctor Universalis ist, der genau vor 700 Jahren – 1248 – in Paris […] das Dominikaner-Kolleg St. Jacque [sic!] wieder verließ, um nun als Magister Albertus Coloniensis sich zum umfassendsten Gelehrten, ja zur weit- und tiefstrahlenden Geistesleuchte des mittelalterlichen Abendlandes zu entwickeln.“16 Anlässlich der Unterzeichnung des saarländisch-französischen Kulturabkommens kam der Pionier der Europabewegung und französische Außenminister Robert Schuman mit Erziehungsminister Yvon Delbos am 15. Dezember 1948 ins Saarland. „Der Zug der Wagen fuhr durch die festlich geflaggten Straßen Saarbrückens hinauf zur jüngsten Universität Europas, die mitten im Walde, aber auch […] am Schnittpunkt lateinischer und germanischer Kultur liegt.“ Beim Empfang in der Aula wertete Rektor Barriol den Besuch als besonderes Zeichen „für das Interesse, das Frankreich am Aufbau der jungen Universität nimmt und auch für die Hilfe, die es zu bieten bereit ist.“ Dabei beschwor er das Ziel der Universität, „zunächst auf geistigem Gebiet jene Verschmelzung der beiden Kulturen, der französischen und der deutschen, herbeizuführen“. Erziehungsminister Delbos sah in der neuen Universität „den leuchtendsten Beweis für die geistige Wiedergeburt […], die durch das Saarland unter Mitwirkung Frankreichs erfolge“. Außenminister Schuman wandte sich „in warmen, herzlichen Worten“ an die Studenten und erinnerte sich an seine Studien an deutschen Universitäten. Er plädierte für „neue Auffassungen, neue Ziele“ und dafür, „dass in der Universität in kleinem Rahmen das begründet werden müsse, was im grossen an konstruktiver Friedensarbeit für unsere Völker, für ganz Europa zu leisten sei“.17 14 15 16 17
Universität des Saarlandes Vorlesungs-Verzeichnis – Programme des Cours Winter-Semester 1948/49, Saarbrücken 1948, S. 6. Vgl. Dok. 3. Ebd., S. 5. Vgl. Dok. 1, 2 u. 4. Ebd., S. 8. Robert Schuman: „Die Narben sind noch nicht alle verheilt, aber der Gram wird unsere Herzen nicht mehr lange verschließen“ – Nach der Unterzeichnung des saarländisch-französischen Kulturabkommens fand der französische Aussenminister [sic!] herzliche Worte der französischsaarländischen Freundschaft – Frankreich wie auch das Saarland sehnen sich nach Frieden, Versöhnung und Annäherung, in: Saarbrücker Zeitung v. 16.12.1948.
Universitäre Erinnerungs- und Festkultur. Die Universität des Saarlandes
237
Abb. 2 Am 15. Dezember 1948 besucht der französische Außenminister Robert Schuman die gerade eröffnete Universität des Saarlandes, links Gründungsrektor Prof. Dr. Jean Barriol
Die Aula, die zuvor als Reithalle genutzt worden war, entwickelte sich zum zentralen Versammlungsort der Universität und bot ein Forum für die vielfältigen universitären Veranstaltungen von den Immatrikulationsfeiern über Theateraufführungen, Bälle, Konzerte, Vorträge und Ehrungen.18 Während die erste Immatrikulationsfeier 1948 noch in der Aula des Homburger Landeskrankenhauses stattgefunden hatte, wurde die Saarbrücker Aula seit 1949 zum traditionellen Ort der Immatrikulationsfeiern, ehe diese in den siebziger Jahren im Zeichen steigender Studierendenzahlen ins Auditorium maximum verlegt wurden. Ihr Verlauf hat sich bald nach der Universitätsgründung standardisiert, wie die entsprechenden Akten dokumentieren. Recht aufschlussreich sind dazu auch die zunächst im „Mitteilungsblatt“, den „Communications officielles“, referierten und dann seit Mitte der 50er Jahre gedruckten Berichte der jeweiligen Rektoren und die im Rahmen der Immatrikulationsfeier gehaltenen und seit Anfang der sechziger Jahre gedruckten Fachvorträge. So hatte beispielsweise 1949 Gründungsrektor Jean Barriol auf die mit dem universitären Aufbau aus dem Nichts verbundenen vielfältigen Aufgaben hingewiesen: „Eine Universität besteht nicht nur aus Gebäuden und wissenschaftlichen Apparaten, diesen rein materiellen Hilfsmitteln. Eine Universität ist vielmehr eine Gemeinschaft der Professoren und Studenten. Die unermüdliche Arbeit dieser Gemeinschaft hat die Universität geschaffen und ihr die Seele gegeben. Von uns allen hängt das Ansehen unseres Hauses ab, desgleichen die Ausstrahlungen, die von hier ausgehen und die unerläßlich sind, wenn die Universität ihre volle Bedeutung erlangen will, sei diese Bedeutung nun national als Bildungszentrum für eine saarländische Elite, sei sie international als Schaffung eines Brennpunktes, in der wir eine Synthese unserer Kulturen zu vollziehen wünschen.“19 18 19
Wolfgang Müller (Hg.): Studentische Impressionen aus den frühen Jahren der Universität des Saarlandes, Saarbrücken 2006. Discours de M. le Recteur Barriol, à l’occasion de la cérémonie solennelle d’immatriculation
238
Wolfgang Müller
Sein bis 1956 tätiger Nachfolger im Rektoramt, der französische Germanist Joseph-François Angelloz,20 proklamierte bei seinem Amtsantritt im November 1950: „Europa! Das ist das Wort, das wir als Losung und Parole wählen, indem wir uns als europäische Universität bekennen. [...] Wir wollen auch vor allem aus Saarbrücken einen europäischen Kreuzweg machen. Unsere Universität, die wahrscheinlich als einzige in der Welt zweisprachig ist, wird eine geistige Tauschstelle werden, wo internationale Arbeitsgemeinschaften am Werk sein sollen.“21 1951 hob man bei der Immatrikulationsfeier mit einem Vortrag des Gastprofessors, französischen Ministers und Präsidenten des „Mouvement socialiste pour les États-Unis d’Europe“, André Philip, das Europa-Institut aus der Taufe. Nach einem Architektenwettbewerb wurde nach der Immatrikulationsfeier im November 1952 der Grundstein zum Bau der von Richard Döcker konzipierten Universitätsbibliothek gelegt. Der mit einer lateinischen Inschrift versehene Grundstein Nonis Novembr. / Anno Domini / MCCCCLII ist heute noch im Eingangsbereich sichtbar. Die Bibliothek, die auch auf saarländischen Briefmarken verewigt wurde, galt in den frühen Jahren als das zentrale architektonische Wahrzeichen der Campus-Universität, und Rektor Angelloz bekundete in seiner Festansprache: „Wir bauen an einer Kathedrale des Geistes“, die „der Jugend der Welt und der Wissenschaft allein gehört“.22 Bei der Immatrikulationsfeier im November 1954 hielt der gesamte Lehrkörper erstmals mit Talar und Barett feierlich Einzug. Rektor Angelloz trug dabei die bis zum Ende des Rektorats von Werner Maihofer 1969 verwendete und heute als Dauerleihgabe im Historischen Museum Saar präsentierte erste Amtskette, die Peter Raacke, der „Leiter der Klasse für Metallformung an der saarländischen Schule für Kunst und Handwerk, entworfen und hergestellt hat, eine schwere Kette aus saarländischem Metall und purem Gold mit dem Signet der Universitas Saraviensis.“23 Der letzte Einzug im Talar erfolgte übrigens im Oktober 1967 beim Amtswechsel von Rektor Hermann Krings zu Werner Maihofer. Bereits vor dem Sommersemester 1968 hatte der Senat beschlossen, künftig auf Talare zu verzichten.24 Während seit dem Sommersemester 1951 der Außenumschlag des Vorlesungsverzeichnisses den das damalige Wappen des Saarlandes umrahmenden Namenszug „Universitas Saraviensis – Universität des Saarlandes“ aufwies, präsentierte die Amtskette als Universitätssymbol die von Robert Sessler (Schule für Kunst und Handwerk)
20 21 22 23 24
en date du 22.11.1949 – Die Rede des Herrn Rektor Barriol anlässlich der Immatrikulationsfeierlichkeiten am 22.11.1949, in: Mitteilungsblatt Universität des Saarlandes – Communications officielles Université de la Sarre Nr. 3, 30.11.1949, S. 1–3, Zitat S. 3. Vgl. Dok. 5. Wolfgang Müller: Angelloz, Joseph-François in: Nicole Colin, Corine Defrance, Ulrich Pfeil, Joachim Umlauf (Hg.): Lexikon der deutsch-französischen Kulturbeziehungen nach 1945, Tübingen 2013, S. 96. C(arl) E(rich) Alken, J(oseph) F(rançois) Angelloz: Europäische Universität des Saarlandes – Université européenne de la Sarre, Saarbrücken 1950, S. 10, 16. Vgl. Dok. 6. Feierliche Immatrikulation und Grundsteinlegung, in: Saarbrücker Zeitung v. 6.11.1952. Feierliche Immatrikulation – Begrüßungsrede durch Seine Magnifizenz, Herrn Rektor, Prof. Dr. Angelloz, S. 2, UA SB. Von bunten Socken, einem grasgrünen Dekan, nackten Hosenbeinen und vielen Talaren – Prof. Stämpfli erinnert sich an die Zeit, als Talare noch „in“ waren, in: campus Universität des Saarlandes 19. Jahrgang, Nr. 2/3 (Mai/Juni 1989), S. 9–11. Vgl. Dok. 7.
Universitäre Erinnerungs- und Festkultur. Die Universität des Saarlandes
Abb. 3 Die von Peter Raacke gestaltete und von 1954 bis 1969 verwendete Amtskette des Rektors der Universität des Saarlandes
239
Abb. 4 Werbebroschüre der Universität des Saarlandes zum Studienjahr 1954/1955
gestaltete Eule als Zeichen der Wissenschaft. Die Eule mit weit gespreizten Schwingen zierte seit dieser Zeit nicht nur die Universitätsakten. Sie hielt im Sommersemester 1955 auch Einzug auf dem Innentitel des Vorlesungsverzeichnisses. Es ist im Rahmen dieses Beitrags leider nicht möglich, alle in der Aula durchgeführten Veranstaltungen Revue passieren zu lassen. So wurde beispielsweise am 4. Dezember 1948 Ludwig Limburg zum Präsidenten der Studentenschaft gewählt, sogar die Saarbrücker Zeitung berichtete über dieses Ereignis: „Nach Aufhebung der Sitzung begab man sich, akademische Lieder singend, zum Studentenball in den Klubräumen der Universität [in der damaligen Mensa]. Vorher hatte Limburg aber die vielleicht schwerste Probe des Abends zu bestehen. Von den Kommilitonen auf einen Tisch gehoben, wie einst die alten Franken ihre Häuptlinge auf den Schild stellten, wurde er in schwindelnder Höhe durch die Aula getragen.“25 Viele universitäre Wahlen sollten bis heute folgen. Beispielweise wurde schon im März 1949 durch eine von Studierenden gebildete Theatergruppe unter der Ägide des ersten Dekans der Philosophischen Fakultät Prof. Dr. Arthur Pfeiffer Klopstocks „Messias“ aufgeführt. Weitere Theateraufführungen sowie Konzerte des Collegium musicum und auswärtiger Ensembles oder die Fastnachtsbälle der Studentenschaft in den 50er Jahren „Ball im Geisterwald“ oder „Endstation Mond“ und später dann das jährliche Gaudi-Max sollten sich anschließen.26 Im April 1951 wurde die maßgeblich von der Studierendenschaft initiierte erste Universitätswoche eröffnet, um die Universität in der Öffentlichkeit besser bekannt zu machen und die neuen Labore der von Homburg nach Saarbrücken verlegten 25 Studenten wählen Vorsitzenden – Ludwig Limburg siegt ohne Opposition, in: Saarbrücker Zeitung v. 7.12.1948. 26 Müller: Impressionen (2006).
240
Wolfgang Müller
Naturwissenschaftlichen Fakultät zu präsentieren. Dabei wurde auch eine kleine Ausstellung über die Universität gezeigt unter dem Motto des Artikels der New York Herald Tribune „Die zweisprachige Universität des Saarlandes gehört zu den ersten Institutionen Europas“. Fachvorträge in Saarbrücken und Homburg, ein Fußballfreundschaftsspiel Saarbrücken-Mainz, Aufführungen des studentischen Theaterzirkels und des universitären Filmclubs, ein Ball mit den Mainzer Uni-Rhythmikern und dem seinerzeit aufstrebenden Kabarettisten Hans-Dieter Hüsch rundeten das Programm ab.27 Ein Blick auf die prominenten Besucher und die in den frühen Jahren gehaltenen Gastvorträge vermittelt einen reizvollen Einblick in die wissenschaftlichen Netzwerke, die seinerzeit aktuellen Themen und die Position der Universität des Saarlandes zwischen Frankreich und der Bundesrepublik, die damals ja Ausland war. So referierten beispielsweise „unter anderem die französischen Germanisten Robert Minder und der an der Sorbonne lehrende Maurice Boucher über „Die Neubelebung alter Mythen in der französischen Literatur der Gegenwart“, Eduard Spranger sprach am 31. Mai 1951 über „Gestalt und Gehalt der deutschen Universität im Wandel von 1810 bis 1950“, weitere Gastvorträge hielten der Philosoph Otto Friedrich Bollnow (Januar 1952) , die Germanisten Friedrich Sengle und Benno von Wiese (März 1952), der Direktor des Seminars für vergleichende Literaturwissenschaft der Universität Mainz Friedrich Hirth über „Literarische Künder deutsch-französischer Annäherung von Madame de Staël bis Jean Giraudoux“, der Dekan der Philosophischen Fakultät Leeds Alexander Gillies (März 1952), der mit Rektor Angelloz befreundete Rektor der Universität Hamburg Bruno Snell, der französische Historiker und akademische Lehrer des Saarbrücker Neuhistorikers Jean-Baptiste Duroselle Pierre Renouvin über „Bismarck und Frankreich 1877–1885“ und „Die englische Politik im Umfeld der deutsch-französischen Beziehungen 1920–1933“ und der zeitweise in Amerika lebende deutsche Publizist Waldemar Gurian über den Bolschewismus (Mai 1952). Ferner wären zu nennen: der in Bristol lehrende Germanist Closs, der renommierte Tübinger klassische Philologe Wolfgang Schadewaldt (Dezember 1952), die beiden Pioniere des europäischen Föderalismus Hendrik Brugmans und Alexandre Marc (Februar 1953), der Historiker Jacques Droz mit Ausführungen zur Historiographie der Französischen Revolution in deutscher Sprache (März 1953), der „Stalingrad“-Schriftsteller Theodor Plivier, die Dramatikerin und Erzählerin Ilse Langner, der französische Politikwissenschaftler Raymond Aron über „La crise des doctrines politiques“ (Mai 1953), der deutsche Publizist Friedrich Sieburg mit „Gott in Frankreich?“ (Februar 1954), der Journalist Otto Roegele („Rheinischer Merkur“), der Philosoph Ortega y Gasset über „Der Mensch und die Technik“ und der ehemalige französische Ministerpräsident René Mayer über „Die Ausbildung des Personals für den öffentlichen Dienst in Frankreich“ (März 1954), die beiden Nobelpreisträger Corneille Heymans und Adolf Butenandt (Mai 1954), der „ancien Ministre d’État“ Édouard Bonnefous, (September 1954), Jules Romains zu „La Poésie, suprême conscience de l’époque“ (November 1954), der Direktor der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen in Göttingen Walter 27 Wolfgang Müller: Wie war das damals an der Uni? Vor 60 Jahren: „Universitätswoche“ vom 24. bis 28. April 1951 – Ein historisches Streiflicht aus dem Universitätsarchiv, in: Champus – Das Magazin von Studierenden für Studierende (3/2011), S. 11–13.
Universitäre Erinnerungs- und Festkultur. Die Universität des Saarlandes
241
Wienert oder der Repräsentant der Hohen Behörde Jean Berthoin zum „Schuman-Plan als übernationaler Versuch“ (Dezember 1954).“ 28 Da sich Rektor Angelloz schon früh mit dem Werk Rainer Maria Rilkes beschäftigt hatte, überrascht es kaum, dass zum 25. Todestag des Dichters im Januar 1952 eine „Rilkefeier“ stattfand und man im November jenes Jahres Leonardo da Vinci in einer Feierstunde ehrte. Ferner wurde im November 1953 eine „Mommsen-Gedächtnisfeier“ gehalten. Die Ablehnung des von Konrad Adenauer und Pierre Mendès-France vereinbarten europäischen Statuts für das Saarland in der Volksabstimmung vom 23. Oktober 1955 löste einen politischen Umbruch aus, an dessen Ende der politische Beitritt des Saarlandes zur Bundesrepublik am 1. Januar 1957 und die ökonomische Integration am 6. Juli 1959, die sogenannte kleine Wiedervereinigung im Westen, standen. Diese Veränderungen tangierten auch die „europäische“ Universität, die sich nun zur „Landesuniversität“ entwickelte. Beim Einzug zur Immatrikulationsfeier am 8. November 1955 begleiteten zwar zwei als Minister der Übergangsregierung tätige Professoren der Universität den französischen Rektor und signalisierten damit symbolisch das Engagement der neuen Regierung für die Universität. In heftigen Pressekampagnen wirkten aber die hitzigen Auseinandersetzungen des Abstimmungskampfes nach. Erbittert wurde mit der Hoffmann-Ära und dem dominierenden französischen Einfluss im Land und an der Universität abgerechnet, wie auch das Schlagwort „Universität in deutsche Hände“ zeigte.29 In einer umfassenden administrativen Reorganisation erfolgte der Wechsel vom hierarchisch-zentralistischen Rektoratssystem französischer Prägung zum deutschen System kollegialer Mitverantwortung der Fakultäten, des Senats und des Konzils. Während in der Hoffmann-Ära der Verfassungstag (15. Dezember) mit einem Staatsakt als zentraler Gedenktag und der französische Nationalfeiertag als Feiertag begangen wurden,30 fand am 17. Juni 1956 noch vor dem politischen Beitritt des Saarlandes ein Staatsakt der Regierung statt. Pikanterweise wurde in Saarbrücken auch ein von einer französischen Militärdienststelle genutztes Gebäude Schwarz-Rot-Gold beflaggt und die Flagge dann französischerseits unter Hinweis auf die noch nicht vollzogene Ratifikation des Saarabkommens wieder beseitigt.31 Am 16. Juni hatte übrigens auch die Universität vor dem Verwaltungsgebäude zwei deutsche Fahnen hissen lassen. „In 28 Roger Niemann: Als Pressereferent der Universität des Saarlandes im Dienst der deutschfranzösischen Verständigung, in: Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend 52 (2004), S. 260–274, insb. S. 265–269 mit weiteren Nachweisen zu den genannten Personen. 29 Wolfgang Müller: Die Universität des Saarlandes in der politischen Umbruchsituation 1955/56, in: Rainer Hudemann, Burkhard Jellonek, Bernd Rauls (Hg.): Grenz-Fall: Das Saarland zwischen Frankreich und Deutschland 1945–1960 (=Schriftenreihe Geschichte, Politik und Gesellschaft der Stiftung Demokratie Saarland, Band 1) St. Ingbert 1997, S. 413–425. Werner Maihofer: Vom Universitätsgesetz 1957 bis zur Verfassungsreform 1969. Persönliche Erinnerungen an eine bewegte Zeit der Universität des Saarlandes, in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 22 (1996), S. 373–403. Wolfgang Müller: „Über die zukünftige Gestalt der Saarbrücker Universität“ – eine gerade entdeckte Denkschrift Eugen Meyers über den „Ausbau einer neuen deutschen Universität im Westen des deutschen Kulturbodens“, in: Stefan Gerber, Werner Greiling, Tobias Kaiser, Klaus Ries (Hg.): Zwischen Stadt, Staat und Nation – Bürgertum in Deutschland, Bd. 2, Göttingen 2014, S. 803–817. 30 Flender: Erinnerungskultur (1998), S. 25f. 31 Ebd. S. 61.
242
Wolfgang Müller
der darauffolgenden Nacht wurde eine dieser Flaggen mutwillig von Personen entfernt, die bisher nicht ermittelt und dafür nicht bestraft werden konnten, wie sie es verdienen. Als Rektor und Franzose missbillige ich aufs entschiedenste diese ehrfurchtslose Tat, durch die die Eintracht und der Friede an unserer Universität gefährdet werden“, ließ Rektor Angelloz im universitären „Mitteilungsblatt“ am 21. Juni 1956 verkünden.32 Während sich der französische Rektor Ende September 1956 mit einem in der Presse publizierten Brief an die saarländische Bevölkerung verabschiedete und man – aus welchen Gründen auch immer – auf eine universitäre Abschiedsfeier verzichtete, trat am 1. Oktober 1956 der erste deutsche Rektor, der Jurist Heinz Hübner, sein Amt an. Da die meisten ohnehin auf Zeit abgeordneten französischen Professoren und Dozenten zum 30. September 1957 die Universität verließen, erfolgte ein gravierender Umbruch im Lehrkörper. Auch die an den Kasernengebäuden angebrachten zweisprachigen Institutsschilder verschwanden. Nur über dem Eingang der von André Remondet geplanten und 1955 eingeweihten Philosophischen Fakultät findet sich noch heute im gläsernen Oberlicht der Schriftzug „Philosophische Fakultät – Faculté des Lettres“. Unter dem Vorsitz des Kunsthistorikers Josef Adolf Schmoll genannt Eisenwerth widmete sich übrigens im April 1957 der „Ausschuss für Siegel und Diplome des Senats“ der „Frage einer ev[en]t[ue]l[en] Neugestaltung des Universitätssiegels“ und der damit eng verbundenen „Namengebung der Universität“ und erörterte zwei „ernsthafte Vorschläge [...], die sich auf historische Persönlichkeiten beziehen“ und zwar „1) Cusanus- oder Nikolaus-Cusanus-Universität oder 2) Kaiser-Karl-Universität.“ Während „für Saarbrücken als Sitz der Universität der Name des Cusanus nicht unmittelbar charakteristisch“ erschien, Karl der Große bereits von Aachen beansprucht werde und für Saarbrücken als damals „jüngste Universität Deutschlands als zu anspruchsvoll empfunden werden könnte“, empfahl man weiterhin den eingeführten Namen „Universität des Saarlandes – Universitas Saraviensis“ und verwarf auch „Saar-“ oder „Saarland-Universität“. Die von Robert Sessler gestaltete Eule als Zeichen der Wissenschaft sollte ebenfalls als Symbol beibehalten, aber in einem „verbesserten Entwurf“ als „Synthese aus moderner grafischer Formgebung und dem traditionellen (antiken) Bild der Athena-Eule“ präsentiert werden. Die Eule legte also nun die Flügel an. Die Einführung des nassau-saarbrückischen Löwen als universitäres Symbol lehnte man ab, da „dieses Zeichen zu einseitig die Universität als ‘Staatliche Anstalt’ symbolisiere“ und für eventuelle andere Symbole „keine greifbaren Vorschläge gefunden werden konnten“.33 Noch unter französischer Ägide war auch die Frage universitärer Ehrungen erörtert worden.34 Der eng mit Saarbrücken verbundene Nestor der südwestdeutschen Barockforschung Karl Lohmeyer eröffnete dann im Januar 1957 die mittlerweile doch ansehnliche Reihe der Ehrendoktoren der anfangs vier, heute acht Fakultäten. Die meisten – 32 – Ehrendoktorate hat die Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche 32 33 34
Mitteilungsblatt Universität des Saarlandes Communications officielles Nr. 415 v. 21.6.1956. Protokoll der Sitzungen des Ausschusses für Siegel und Diplome des Senats der Universität des Saarlandes vom 10. und 17. April 1957, S. 1–2. UA SB. Vgl. Dok. 8. Verzeichnis unter http://www.uni-saarland.de/info/universitaet/freunde/ehrungen.html; zuletzt abgerufen am 10.3.2016.
Universitäre Erinnerungs- und Festkultur. Die Universität des Saarlandes
243
Fakultät vergeben. Damit wurden nicht nur lange am Centre Juridique Franco-Allemand wirkende französische Juristen, Professoren der japanischen Partner-Universität Keiō und dem Europa-Institut verbundene Kollegen, sondern auch bekannte Ökonomen wie Herbert Giersch, Erich Gutenberg oder Wolfgang F. Stolper ausgezeichnet. Zu den zehn Ehrendoktoren der Medizinischen Fakultät gehören unter anderem die Nobelpreisträger Andrew Huxley und Erwin Neher35 oder die deutsch-niederländische Pharmakologin Edith Bülbring, zu den 24 Ehrendoktoren der Philosophischen Fakultäten der spanische Schriftsteller Miguel Delibes, der Raumfahrtpionier Jesco Freiherr von Puttkammer, der französische Germanist Gonthier-Louis Fink,36 José Carreras, der Dickens-Forscher Edgar Rosenberg37 und auch Alt-Rektor Angelloz – 1960 übrigens eine nicht unumstrittene Ehrung. 18 Ehrendoktorate haben die NaturwissenschaftlichTechnischen Fakultäten vergeben, unter anderem an den Zoologen Curt Kosswig, die Mathematiker Gottfried Köthe und Hans Zassenhaus, den Professor für Mechanik und Meerestechnik Oskar Mahrenholtz, den Chemiker Henri Bouas-Laurent, die Nobelpreisträger Rudolf Mößbauer und Peter Grünberg38 oder die Verhaltensforscher Hubert Markl und Martin Lindinger. Erster der mittlerweile 28 Ehrensenatoren war 1961 der frühere Ministerpräsident des Saarlandes und Vorsitzende des Universitätsrates Heinrich Welsch. Diese Würde wurde seitdem auch an mehrere eigene Professoren, Präsidenten der 1952 gegründeten und 2014 in die „Universitätsgesellschaft des Saarlandes e.V.“ überführten „Vereinigung der Freunde der Universität“, Förderer und regionale Persönlichkeiten verliehen. Insbesondere frühe Mitarbeiter der Universitätsverwaltung und der Universität regional eng verbundene Persönlichkeiten gehören zum Kreis der zehn Ehrenbürger. Ferner sind fünf Träger der Ehrenmedaille der Universität verzeichnet. Die beiden Gedenktafeln mit universitärem Bezug an der Homburger Aula und der Saarbrücker Universitätsbibliothek wurden bereits erwähnt. Im Senatssaal des Präsidialamtes befindet sich übrigens die Galerie der Porträtfotos der bisherigen Rektoren und Universitätspräsidenten. Nur fünf Hörsäle tragen Namen sozusagen „eigener“ Wissenschaftler. So erinnern die Salle Pierre Voirin39 an den Gründer des Centre juridique franco-allemand und Ehrendoktor der Rechts- und Wissenschaftlichen Fakultät, der große Hörsaal der Chemie an den Professor für organische Chemie 35 36 37 38 39
Wolfgang Müller: Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes zeichnet Nobelpreisträger aus – Ehrendoktorwürde für Prof. Erwin Neher, in: Saarländisches Ärzteblatt 63 (8/2010), S. 17. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät II Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften an Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Gonthier-Louis Fink am 9.2.2010, Universitätsreden 86, Saarbrücken 2011. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät II Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften an Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Edgar Rosenberg am 11.7. 2011, Universitätsreden 97, Saarbrücken 2013. Verleihung der Ehrendoktorwürde an Prof. Dr. h.c. Peter Grünberg am 24.4.2008, Universitätsreden 76, Saarbrücken 2008. Biographie et oeuvre de M. le Doyen Pierre Voirin, in: Mélanges offerts à Monsieur le Professeur Pierre Voirin, doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences économiques de Nancy, Paris 1966, S. 1–24.
244
Wolfgang Müller
Bernd Eistert40 und seit seinem 90. Geburtstag 2004 der Hörsaal der Physiologie an den seit 1954 in Homburg wirkenden Pionier der Nervenphysiologie und Initiator des Sonderforschungsbereichs 38 „Membranforschung“ Robert Stämpfli.41 Anlässlich seines 80. Geburtstages wurde 2011 ein neuer Hörsaal der Informatik nach dem Pionier der Informatik Günter Hotz42 benannt, und das Max-Planck-Institut für Informatik ehrte am 3. Juni 2005 seinen früh verstorbenen Direktor Harald Ganzinger.43 Aufgrund der Initiative seines in Homburg lehrenden Schülers Hermann Muth erhielt der Neubau des Instituts für Biophysik 1965 den Namen Boris Rajewski. Im April 2004 wurde der Grundstein für das von der Deutschen José Carreras-Leukämie-Stiftung e.V. geförderte und am 29. November 2005 eingeweihte neue Forschungsgebäude der Inneren Medizin mit dem José Carreras Zentrum für Immun- und Gentherapie gelegt. In vielfältiger Weise hat die Universität des Saarlandes seit ihrer Gründung internationale Verbindungen nicht nur mit ihrer Mutteruniversität Nancy gepflegt. Seit den frühen 70er Jahren und insbesondere in der Präsidentschaft des Biogeographen Paul Müller zwischen 1979 und 1983 wurden zahlreiche Partnerschaften geschlossen, die nicht nur durch die Vertragsunterschrift, sondern auch eine Baum- Pflanzung auf dem Saarbrücker Campus ihren sichtbaren Ausdruck fanden.44 In dieser Ära entstanden auch die über den Eisernen Vorhang reichenden Kooperationen mit den Universitäten Sofia (1980), Tbilissi und Warschau (1983).45 In der vom Universitätsarchiv betreuten Reihe der mittlerweile über 100 „Universitätsreden“ sind die mit diesen Universitäten begangenen Partnerschaftsjubiläen ebenso dokumentiert worden wie die neueren Ehrenpromotionen, Institutsjubiläen oder herausragende akademische Geburtstagsund Gedenkfeiern.46 40 Manfred Regitz, Heinrich Heydt, Kurt Schank, Werner Franke: Bernd Eistert (1902–1978), in: Chemische Berichte 113, (3/1980), XXIX-LVIII. 41 Wolfgang Müller: Stämpfli, Robert Physiologe, in: NDB 25 (2013), S. 27–28. 42 Wolfgang Müller: Günter Hotz ist einer der Väter der Informatik in Deutschland und wird zum 80. Geburtstag geehrt. Pressemitteilung der Universität des Saarlandes vom 14.11.2011. 43 Wolfgang Müller: Die Universität trauert – Prof. Dr. Harald Ganzinger, in: campus Universität des Saarlandes 34. Jahrgang, Ausgabe 3 (Juli 2004), S. 38. 44 Wolfgang Müller: Von der französischen Universitätsgründung zur Universität der Großregion. Zur Geschichte und Erforschung der internationalen Vernetzung der Universität des Saarlandes, in: Jens Blecher, Sabine Happ (Hg.): Archive im Verbund: Netzwerke und Kooperationen. Frühjahrstagung der Fachgruppe 8 im Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V., 13.–15. März 2013 an der Karls-Universität Prag (Tschechien), (=Wissenschaftsarchive 2013, Bd. 3), Leipzig 2014, S. 211–225. Außerdem Wolfgang Müller: Die Universität des Saarlandes als Brücke zwischen Frankreich und Deutschland – Aspekte ihrer internationalen Vernetzung, in: Mechthild Gilzmer, Hans-Jürgen Lüsebrink, Christoph Vatter (Hg.): 50 Jahre Elysée-Vertrag (1963–2013) - Les 50 ans du traité de l’Élysée (1963–2013). Jahrbuch des Frankreichzentrums der Universität des Saarlandes 13 (2013), S.235–255. 45 Wolfgang Müller: „Aus kleinen Anfängen ist hier eine wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen West und Ost erwachsen, die ihresgleichen in der Bundesrepublik sucht“ – Archivalisches Streiflicht zu den Ostpartnerschaften der Universität des Saarlandes, in: Jens Blecher, Sabine Happ (Hg.): Archive im Verbund: Netzwerke und Kooperationen. Frühjahrstagung der Fachgruppe 8 im Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V., 13.–15. März 2013 an der Karls-Universität Prag (Tschechien), (=Wissenschaftsarchive 2013 Band 3), Leipzig 2014, S. 260–266. 46 http://www.uni-saarland.de/info/universitaet/portraet/geschichte/uni-reden.html; zuletzt abgerufen am 10.3.2016.
Universitäre Erinnerungs- und Festkultur. Die Universität des Saarlandes
245
Damit leistet das Universitätsarchiv einen zentralen Beitrag sowohl zur universitären Erinnerungskultur als auch zur universitären Identität und unterstreicht so die enge Verzahnung zwischen archivischer Überlieferungssicherung und der Dokumentation der Universitätsgeschichte. Ein kurzer Ausblick auf die in unterschiedlicher Intensität und Form begangenen Universitätsjubiläen47 möge die Ausführungen abrunden. Der französische Mai 1968 führte nicht nur Daniel Cohn-Bendit zu einer politischen Kundgebung in die Saarbrücker Aula und zu einem anschließenden Protestmarsch zum deutschfranzösischen Grenzübergang Goldene Bremm, sondern verhinderte auch das nahezu unterschriftsreife Partnerschaftsabkommen mit der Mutteruniversität Nancy. Wegen der hochschulpolitischen Auseinandersetzungen um eine neue Universitätsverfassung wurde dann die für Oktober geplante Zwanzigjahrfeier abgesagt.48 Bei den Feierlichkeiten fünf Jahre später hielt der frühere Saarbrücker Habilitand und damalige EU-Kommissar für Forschung, Bildung und Wissenschaft Ralf Dahrendorf49 die Festrede. 1988 übernahm diese Aufgabe Altrektor Hermann Krings und 1998 die EU-Kommissarin für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung Edith Cresson. Beim Alumnitag 2008 sprach dann der Saarbrücker Alumnus und damalige Präsident der Evangelischen Akademie zu Berlin Robert Leicht. Traditionsgemäß erschienen zu diesen Feierlichkeiten auch stets die französischen Botschafter, auch wenn dann nicht mehr wie 1947 die Marseillaise erklang.
47
Zuletzt aktuell Markus Drüding: Akademische Jubelfeiern. Eine geschichtskulturelle Analyse der Universitätsjubiläen in Göttingen, Leipzig, Münster und Rostock (1919–1969), (=Geschichtskultur und historisches Lernen, Bd. 13), Berlin 2014. 48 Unter anderem Maihofer: Vom Universitätsgesetz (1996), S.373–403 und Wolfgang Müller: Was wollen die Studenten? Saarbrücker Impressionen zum Thema „1968“, in: evangelische aspekte 15 (4/2005), S. 28–31 und ders.: „Affären“ und Widerstände. Auseinandersetzungen um die Notstandsgesetze und Widerstand gegen die Universitätsreform in Saarbrücken, in: evangelische aspekte 16 (1/2006), S. 44–48. 49 Franziska Meifort bereitet an der FU Berlin bei Prof. Dr. Paul Nolte gegenwärtig ihre Dissertation über „Ralf Dahrendorf. Ein Intellektueller in der Geschichte der Bundesrepublik“ vor. Bislang unter anderem: Franziska Meifort: Findbuch zum Nachlass Ralf Dahrendorf (1929–2009), Bestand N 1749, Bundesarchiv, Koblenz 2014. Franziska Meifort: Der Wunsch nach Wirkung. Ralf Dahrendorf als intellektueller Grenzgänger zwischen Bundesrepublik und Großbritannien 1964–1984, in: GWU 63 (3, 4/2014), S. 196–216.
246
Wolfgang Müller
DOK U M E N T E Dok. 1
Herbst 1948
Grußwort des Hohen Kommissars der Französischen Republik im Saarland Gilbert Grandval im ersten Vorlesungsverzeichnis der Universität des Saarlandes zum Wintersemester 1948/49 Anläßlich der Eröffnung der Universität des Saarlandes heiße ich die Professoren und Studenten herzlich willkommen, die dieses Jahr an der Gestaltung eines für das Saarland und für die Annäherung der europäischen Völker wesentlichen Werkes mitarbeiten werden. Ich begrüße ganz besonders die neuen Professoren, die, dem Ruf ihrer saarländischen Kollegen folgend, aus Frankreich, Deutschland und England gekommen sind, um der jungen Universität den internationalen Charakter zu verleihen, der sie kennzeichnen soll. Seit der Gründung des Homburger Instituts sind bedeutende Fortschritte gemacht worden; es sind aber noch einige Hindernisse zu überwinden, die Universität bald zur vollen Höhe zu führen. Ich weiß, daß sie für eine harmonische und fruchtbare Entwicklung auf die Mitarbeit aller Professoren und Studenten zählen kann. Sie darf dabei auch auf die Hilfe Frankreichs rechnen, das, vom Geiste internationaler Verständigung beseelt, seine Unterstützung einer Universität zuteil werden läßt, die nicht nur die Bildung der saarländischen Elite, sondern auch, über nationale Vorurteile hinaus, die Annäherung der Jugend ermöglicht, die das Europa von morgen gestalten wird. GILBERT GRANDVAL Hoher Kommissar der Französischen Republik im Saarland Quelle: Universität des Saarlandes Vorlesungs-Verzeichnis – Programme des Cours Winter-Semester 1948/49, Saarbrücken 1948, S. 3.
Dok. 2
Herbst 1948
Grußwort des Gründungsrektors der Universität des Saarlandes Prof. Dr. Jean Barriol im ersten Vorlesungsverzeichnis der Universität des Saarlandes zum Wintersemester 1948/49 In dem Augenblick, da der Verwaltungsrat den ehrenvollen Ruf zur Leitung der neuen Universität an mich ergehen läßt, möchte ich die Gründe hervorheben, die mich bewogen haben, diese Aufgabe zu übernehmen. Die Gründung einer Universität muß einer neuen Idee, einem neuen Ziel entsprechen. Es handelt sich darum, diese Universität, an der Professoren und Studenten verschiedener Sprachen zusammenkommen werden, zum Werkzeug einer wahrhaft
Universitäre Erinnerungs- und Festkultur. Die Universität des Saarlandes
247
europäischen Gesinnung zu machen. Ich will mich bemühen, diesem Zweck zu dienen, einesteils in der Wahl der Professoren, welche den Ruf der Universität erhöhen sollen, andernteils in der Leitung all derer, die guten Willens in diesem Sinne zu arbeiten wünschen, im Sinne einer europäischen Zusammenarbeit. Neue Laboratorien sollen der Forschung zur Vertiefung gestellt werden, weitere Professoren werden berufen. Die junge Universität des Saarlandes wird morgen ihren Platz inmitten der alten Universitäten Europas einnehmen. Der Rektor BARRIOL Quelle: Universität des Saarlandes Vorlesungs-Verzeichnis – Programme des Cours Winter-Semester 1948/49, Saarbrücken 1948, S. 5.
Dok. 3
Herbst 1948
Grußwort des Ministerpräsidenten des Saarlandes Johannes Hoffmann im ersten Vorlesungsverzeichnis der Universität des Saarlandes zum Wintersemester 1948/49 Die Universität des Saarlandes ist Ausdruck des Willens und der Bereitschaft, von unserer Heimat aus auch im Bereich der Wissenschaft zur Erneuerung einer abendländischen Gesinnung beizutragen. Sie ist die Pflegestätte des Geistes, der die Enge zu überwinden sucht und nach europäischer Weite strebt. Sie soll eine von tiefster Ergriffenheit zum Beruf und vom richtigen Verhältnis zur Gemeinschaftsordnung beseelte Akademikerschaft erziehen, die sich bewußt ist, daß Ideen immer stärker sind als äußere Gewalt. Versöhnung und Verständigung sind das erste und letzte Ziel alles Schaffens an der Saar. Sie allein können die Unrast der Gegenwart und die Spannungen und Überspannungen in den Lebensbereichen des einzelnen und der Völker überwinden. Die wissenschaftliche Arbeit ist hierbei ein wesentlicher Faktor. Jedes ernste wissenschaftliche Streben fördert die Achtung vor menschlichem Denken und Können, Fühlen und Wollen über die Grenzen der Völker hinweg. So wird die Universität des Saarlandes stets eine Burg des Friedens sein und ein Symbol neuen Werdens. Von ihr sollen die Strahlen beglückender Arbeit in die europäische Zukunft leuchten. JOHANNES HOFFMANN Ministerpräsident Quelle: Universität des Saarlandes Vorlesungs-Verzeichnis – Programme des Cours Winter-Semester 1948/49, Saarbrücken 1948, S. 6.
248
Wolfgang Müller
Dok. 4
Herbst 1948
Grußwort des Ministers für Kultus, Unterricht und Volksbildung des Saarlandes Dr. Émile Straus im ersten Vorlesungsverzeichnis der Universität des Saarlandes zum Wintersemester 1948/49 In einer apokalyptischen Gegenwart gilt es, aus Trümmern, Elend und Not eine bessere, neue Welt aufzubauen. Politik, Wirtschaft und Sozialreformen genügen nicht. Ehrfurcht, Liebe, Gemeinschaft und Freiheit sind die Pfeiler dieser Erneuerung, überwölbt vom Glauben an den christlichen abendländischen Geist. Diese Erkenntnis soll die Gestalt unserer neuen Universität bestimmen, eine Stätte der Wahrhaftigkeit und Ehrfurcht durch Wissenschaft und Humanitas zu sein. „Wissenschaft als universales Wissenwollen des Wißbaren“ – Humanitas als Ehrfurcht vor dem Menschsein, dem göttlichen Werk. Wissen macht frei. Freiheit ist Überwindung der Willkür, ist Rückkehr zum Gewissen, zur Einsicht, zur Erkenntnis – ist Anspruch zu erfahren, zu erleben, aus eigenem Ursprung zu wollen. Aber die Freiheit realisiert sich nur in der Gemeinschaft, denn ich kann nur in dem Maße frei sein, wie die anderen es sind. So wirkt die Universität mit an der Schöpfung eines Rechtsstaates freier Menschen, an der Erziehung zum Ideal des Weltbürgers über alle Grenzen hinweg. Mögen Lehrer und Forscher, Studierende und Schüler der Verpflichtung von Wissenschaft und Humanitas dienen in dem Bewußtsein: Mens agitat molem. Dr. STRAUS Minister für Kultus, Unterricht und Volksbildung Quelle: Universität des Saarlandes Vorlesungs-Verzeichnis – Programme des Cours Winter-Semester 1948/49, Saarbrücken 1948, S. 7.
Dok. 5
22.November 1949
Auszug aus der Rede des Gründungsrektors der Universität des Saarlandes Prof. Dr. Jean Barriol bei der Immatrikulationsfeier zur Eröffnung des zweiten Studienjahres Viel Arbeit ist schon geleistet worden; die Aufgaben aber, die noch vor uns liegen, sind außerordentlich groß. Nur Schritt für Schritt kann die Stellung der Universität gefestigt werden und zwar nur durch ausgezeichnete Leistungen in Unterricht und Forschung. Unsere gemeinsame Aufgabe wird es sein, im Hinblick auf dieses Ziel zusammenzuarbeiten. Eine Universität besteht nicht nur aus Gebäuden und wissenschaftlichen
Universitäre Erinnerungs- und Festkultur. Die Universität des Saarlandes
249
Apparaten, diesen rein materiellen Hilfsmitteln. Eine Universität ist vielmehr eine Gemeinschaft der Professoren und Studenten. Die unermüdliche Arbeit dieser Gemeinschaft hat die Universität geschaffen und hat ihr die Seele gegeben. Von uns allen hängt das Ansehen unseres Hauses ab, desgleichen die Ausstrahlungen, die von hier ausgehen und die unerläßlich sind, wenn die Universität ihre volle Bedeutung erlangen will, sei diese Bedeutung nun national als Bildungszentrum für eine saarländische Elite, sei sie international als Schaffung eines Brennpunktes, in dem wir eine Synthese unserer Kulturen zu vollziehen wünschen. Es war Ihr Wunsch, in diese Universität einzutreten. Unser Ziel ist damit das Ihrige geworden. Quelle: Discours de M. le Recteur Barriol, à l’occasion de la cérémonie solennelle d’immatriculation en date du 22.11.1949 – Die Rede des Herrn Rektor Barriol anlässlich der Immatrikulationsfeierlichkeiten am 22.11.1949, in: Mitteilungsblatt Universität des Saarlandes – Communications officielles Université de la Sarre Nr. 3 v. 30.11.1949, S. 1–3, Zitat S. 3.
Dok. 6
6. November 1950
Auszüge aus der Rede des zweiten Rektors der Universität des Saarlandes Prof. Dr. Joseph-François Angelloz bei der Immatrikulationsfeier zur Eröffnung des dritten Studienjahres Die Zahl unserer Studenten beträgt schon 1000; zum größten Teil sind es Saarländer, außerdem noch Deutsche und Franzose. Die Professoren kommen aus dem Saarland, aus Frankreich und Deutschland, aus England und aus der Schweiz, aus Belgien und aus dem fernen Ungarn. Im Monat März des Jahres 1915 betitelte Romain Rolland einen seiner Artikel: „Unsere Nächsten, unsere Feinde“. Hier im Jahre 1950 sind aus den Feinden unsere Nächsten geworden. Ich bin der Meinung, daß der Zeitpunkt gekommen ist, noch einen weiteren Schritt zu tun, dass unsere Universität den Kurs entschlossen einschlagen soll, der ihr durch die Präambel ihres Statuts als Ziel angesetzt wird: Die Regierung des Saarlandes, Überzeugt, daß die geographische Lage unseres Landes im Herzen Europas alle Bemühungen für die Verständigung unter den Völkern von ihm fordert, Durchdrungen von dem Willen, die wirtschaftliche Bedeutung des Saarlandes durch geistige, kulturelle Werte zu ergänzen, Bestrebt, die saarländische Jugend in das kulturelle Leben Europas einzubeziehen, Errichtet gemäß Artikel 33 der Verfassung des Saarlandes und in Anwendung des französisch-saarländischen Kulturabkommens eine Universität des Saarlandes. Europa! Das ist das Wort, das wir als Losung und Parole wählen, indem wir uns als europäische Universität bekennen. Vor einigen Monaten schlug Herr Minister Robert Schuman den wirtschaftlichen Zusammenschluß der Völker des europäischen Abendlandes vor; wir aber wollen die Synthese der geistigen Kräfte Europas erreichen, denn in unserem Geist bedeutet „europäisch“ soviel wie „international“, und wir
250
Wolfgang Müller
wollen aus unserer Gemeinschaft nur diejenigen ausschließen, die sich selbst ausschließen werden. In diesem Sinne hat auch die saarländische Delegation in Straßburg, zu welcher Herr Minister Dr. Braun, Herr Landtagspräsident Müller, Herr Minister Dr. Singer und Herr Minister Dr. Straus gehörten, vor dem Europarat die Anerkennung der Universität des Saarlandes als europäische Universität beantragt. […] Allem Anschein nach ist das Saarland für die erfolgreiche Tätigkeit einer europäischen Universität vorzüglich geeignet, und ein deutscher Kollege schrieb mir, es sei wohl möglich, hier das zu verwirklichen, was man weder in Deutschland noch in Frankreich erreichen könnte. Diese immer brennender erhoffte europäische Universität, die in der Luft zu schweben scheint und sich niederlassen möchte, soll wohl an der Sprachgrenze der germanischen Welt und der Welt, die von den Deutschen die romanische genannt wird, errichtet werden und, wenn möglich, in deren Mittelpunkt. […] Wir wollen uns nicht nur bemühen, den Lehrplan unserer Universität mit dem der anderen Universitäten in Einklang zu bringen, damit die Besten unter den jungen Saarländern, die zukünftige Elite, an den Kulturgütern aller Länder teilhaben, sondern wir wollen auch vor allem aus Saarbrücken einen europäischen Kreuzweg machen. Unsere Universität, die wahrscheinlich als einzige in der Welt zweisprachig ist, wird eine geistige Tauschstelle werden, wo internationale Arbeitsgemeinschaften am Werke sein sollen. Heute schon sind sie da, und dieselben Männer, die bisher zusammengearbeitet haben, werden auch bald nebeneinander leben. Dieses ist vielleicht nur in Saarbrücken möglich. Soll sich denn nicht dadurch die europäische Berufung des Saarlandes offenbaren? Quelle: C[arl] E[rich]Alken, J[oseph] F[rançois] Angelloz: Europäische Universität des Saarlandes – Université européenne de la Sarre, Saarbrücken 1950, Zitate der deutschen Übersetzung S. 8–10, 12, 14–16.
Dok. 7
Mai 1989
Erinnerungen des Professors für Physiologie Dr. Dr. h.c. mult. Robert Stämpfli über das Tragen von Talaren an der Universität des Saarlandes Als ich 1954 im April nach Homburg kam, stellte sich heraus, daß für die feierliche Semestereröffnung und andere Anlässe die Ordinarien Talare zu tragen hatten. So erhielt auch ich einen dunklen, schlafrock-ähnlichen Talar mit grünem Kragen und eine Kopfbedeckung, die im Hinblick auf die französische Periode des Saarlandes am ehesten mit derjenigen eines Chasseur Alpin vergleichbar war. Die mit diesen Attributen der Würde ausgestatteten Professoren sammelten sich für den Einmarsch in die Aula im Rektorat. Man hatte ihnen eingeschärft, dunkle Kleidung, Schuhe und Socken und eine silbergraue Krawatte zu tragen. Die Dekane hatten, entsprechend der Fakultätsfarbe, einen Talar in dieser Farbe. So war der
Universitäre Erinnerungs- und Festkultur. Die Universität des Saarlandes
251
Dekan der Medizinischen Fakultät, Prof. Doenecke, damals grasgrün gekleidet. Prof. Angelloz, der Rektor, besaß einen besonders schönen Talar und, wenn ich mich richtig erinnere, eine goldene Halskette. Ein feierlicher Zug setzte sich dann in Bewegung, hin zur ehemaligen Turnhalle der Kaserne, in welcher sich die Universität eingenistet hatte. Dort erhoben sich die Gäste und Studenten beim Eintreffen des Zuges kostümierter Hochschullehrer, das Orchester unter Prof. Müller-Blattau spielte klassische Musik, Bach und Händel, oder später, unter der Leitung seines Sohnes, öfter den Kanon von Pachelbel. Nach Erreichen der Estrade verteilten sich die Professoren der Fakultät dort nach einem ihnen sorgsam eingeprägten Plan, so daß der Lehrkörper über der Höhe der Zuschauer sich malerisch und wohl gegliedert ausnahm. Natürlich war die Bestuhlung den damaligen Zuständen entsprechend äußerst bescheiden, wackelig und hart, so daß man nach kurzer Zeit seine würdige Position zu verändern trachtete, die Beine übereinander schlug und abwechselnd, mal mehr auf der rechten, mal mehr auf der linken Seite seines Podex, sein Gewicht lasten ließ. Dabei wurde einem auch klar, weshalb man sich bemüßigt gefühlt hatte, Farbe und Länge der Socken vorzuschreiben. Die Zuschauer blickten den Professoren in den vorderen Reihen direkt in die Hosenbeine, erkannten in allen Einzelheiten die Besonderheiten der getragenen Socken und, bei ungenügender Länge sowohl der Socken wie der Hosen, auch den Grad der Behaarung der nackt sichtbaren Unterschenkel. Da die Reden bei solchen Semestereröffnungsfeiern manchmal sehr lang waren, vermute ich, daß die Zuschauer vor allem in den vorderen Rängen dankbar für diese Aussicht waren und vielleicht lieber gehabt hätten, wenn mehr bunte Socken sichtbar gewesen wären. Glücklicherweise war der Lehrkörper, wie es sich für richtige Professoren gehörte, zerstreut und wenig am Aussehen der Schuhe und Socken interessiert, so daß trotz aller Empfehlungen zur Einheit doch manche Verschiedenheit der Bekleidung sichtbar wurde – und wären es nur die Löcher in den Schuhsohlen, die natürlich in den ersten Reihen gut zu sehen waren, dem Besitzer der Schuhe aber eventuell erst nach der Veranstaltung bewußt wurden. So fühlte ich mich vorerst, nach meiner Berufung ins Saarland, als würdiger Professor. Mit den anderen Kollegen lernte auch ich die bei uns in der Schweiz nicht üblichen Bezeichnungen50 als „Magnifizenz“ und des Dekans als „Spektabilität“; dieser Ausdruck hätte meiner Ansicht nach im Hinblick auf den Körperbau unseres damaligen Dekans auch mit „ck“ geschrieben Sinn gehabt... Das Glück des durch den Ornat herausgehobenen Lehrstuhlinhabers wurde mir noch während meiner Amtszeit als Dekan im Jahre 1961 und in den folgenden Jahren zuteil und trug wohl zu meinem Selbstbewußtsein bei. Aber dann kam die Zeit um 1968/69, wo der Professorenstand jäh entwertet, die Talare als „Mief von 1000 Jahren“ und die Assistenten der Professoren als Begleiter der Professorengattinnen beim Einkauf auf dem Markt (zum Tragen der Einkaufstaschen) dargestellt wurden. Die Studentenrevolution in Paris, deren Ausmaß mir frühmorgens bei einer Bahnfahrt nach Poitiers beim Umsteigen in die Gare d’Austerlitz durch einen Taxichauffeur an der Rue Gay Lussac vorgeführt wurde, hatte mich sehr beeindruckt. Nach einer 50
An dieser Stelle ist wohl „des Rektors“ zu ergänzen.
252
Wolfgang Müller
durchkämpften Nacht räumte dort die Polizei in einer von Tränengas geschwängerten Atmosphäre Barrikaden, kaputte Autos und Pflastersteine weg. Es schien mir klar, daß diese Zeiterscheinung wohl auch bei uns im Saarland bald ihre Wirkung entfalten werde. Tatsächlich unterblieb von diesem Zeitpunkt an die feierliche Eröffnung des Semesters und das Tragen der Talare auch in Homburg. Quelle: Von bunten Socken, einem grasgrünen Dekan, nackten Hosenbeinen und vielen Talaren – Prof. Stämpfli erinnert sich an die Zeit, als Talare noch „in“ waren, in: campus Universität des Saarlandes 19. Jahrgang, Nr. 2/3 (Mai/Juni 1989), S. 9–11.
Dok. 8
10. / 17.April 1957
Protokoll der Sitzungen des Ausschusses für Siegel und Diplome des Senats der Universität des Saarlandes unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Josef Adolf Schmoll gen. Eisenwerth Protokoll der Sitzungen des Ausschusses für Siegel und Diplome des Senats der Universität des Saarlandes vom 10. und 17. April 1957. Die beiden Sitzungen fanden jeweils von 20:30 bis 22:30 Uhr statt. Es nahmen an den Besprechungen teil: Für die Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Für die Philosophische Fakultät:
Herr Prof. Dr. Wilhelm W EGEN ER Herr Prof. Dr. SCHMOLL gen. Eisenwerth, zugleich als Vorsitzender des Ausschusses.
Tagesordnung Als einziger Punkt der Tagesordnung wurde die Frage einer evtl. Neugestaltung des Universitätssiegels behandelt. Dabei wurde eingangs festgestellt, dass diese Frage aufs engste mit der Namensgebung der Universität verknüpft ist. Nach Aufzählung aller bisher in Universitätskreisen gesprächsweise erwähnten Namensvorschläge herrschte Übereinstimmung, dass ernsthafter nur zwei Vorschläge diskutiert werden könnten, die sich auf historische Persönlichkeiten beziehen: 1) Cusanus- oder Nikolaus Cusanus-Universität, 2) Kaiser Karl-Universität.
Universitäre Erinnerungs- und Festkultur. Die Universität des Saarlandes
253
Zu 1) wurde erwogen, ob genügend Beziehungen zwischen der Persönlichkeit des Cusanus und dem Saarland – als dem Träger der Universität – bestehen. Cusanus entstammt dem Moselland, Kues und Trier sind zwei Zentren seines Wirkens, im Saarland besass er die reiche Pfarrei St. Wendel als Pfründe. Gegen den Einwand, der Name des Cusanus sei bereits durch die „Cusanus-Stiftung“ konfessionell akzentuiert, lässt sich vorbringen, dass der Name Albertus-Magnus-Universität zu Köln nicht als konfessionell gebunden erscheint, obwohl es einen konfessionellen Albertus-Magnus-Verein gibt. Doch muss zugegeben werden, dass für Saarbrücken als Sitz der Universität der Name des Cusanus nicht unmittelbar charakteristisch erscheint. Zu 2) wurde vermerkt, dass die Karolinger zwar im Gebiet der mittleren Saar und Mosel sehr begütert waren (Diedenhofen, Saargemünd, Völklingen, Wadgassen u.a.) und dieses Gebiet mit dem Mittelpunkt Metz einer der Ausstrahlungspunkte der karolingischen Kultur war, dass weiter der Name Karls des Großen zwar ein gutes Symbol für eine Hochschule auf der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich sei, dass der Name aber einerseits bereits von Aachen in Anspruch genommen wird und dass er andererseits für die jüngste Universität Deutschlands als zu anspruchsvoll empfunden werden könnte. Daher wurde die Empfehlung gefasst, es bei dem Namen Universität des Saarlandes – Universitas Saraviensis zu belassen, obwohl auch hiergegen gewisse Einwände erhoben werden könnten. Für die sprachliche Form der deutschen Bezeichnung muss überlegt werden, ob anstelle der bisherigen – dem französischen Genitiv entsprechenden – Fassung nicht besser „Saarland-Universität“ oder – noch einfacher – „SaarUniversität“ stehen sollte. Auch der Vorschlag „Universität Saarbrücken“ wurde diskutiert, wobei Schwierigkeiten in Bezug auf den Sitz der Medizinischen Fakultät in Homburg auftreten. Bleibt es bei dem topographischen Charakter des Universitätsnamens, so käme als Siegelzeichen nur ein allgemeines in Betracht. Aus einer Reihe von Vorschlägen bleiben zur engeren Auswahl: a) die Eule als Zeichen der Wissenschaft b) der nassau-saarbrückische Löwe (der aber im Gegensatz zum saarländischen Staatssiegel graphisch neugefasst werden müsste) c) oder ein anderes Symbol, das den besonderen Charakter der Universität des Saarlandes erläutern könnte. Da zu c) keine greifbaren Vorschläge gefunden werden konnten und da gegen b) der Einwand erhoben wurde, dieses Zeichen symbolisiere zu einseitig die Universität als „Staatliche Anstalt“, wurde die Empfehlung gefasst, es bei dem Symbol der Eule zu belassen, wobei allerdings dem Graphiker, der den Entwurf lieferte (Robert Sessler, Staatliche Schule für Kunst und Handwerk, Saarbrücken), Gelegenheit gegeben werden sollte, einen verbesserten Entwurf vorzulegen, der vielleicht eine Synthese aus moderner grafischer Formgebung und dem traditionellen (antiken) Bild der AthenaEule anstreben könnte.
254
Wolfgang Müller
Dieses Bild soll für das Siegelbild Verwendung finden, und zwar in runder – nicht in ovaler – Form. Das grosse Universitätssiegel – mit einem Durchmesser von ca. 7 cm – das für Urkunden auch als Prägestempel auszuführen ist, soll die Umschrift tragen: Sigillum Universitatis Saraviensis. Das kleine Siegel (Sekretsiegel) und Signete tragen bei gleicher Form und Ausführung im Durchmesser von ca. 3,5 – 4 cm nur die Umschrift: Universitatis Saraviensis. Die Fakultätssiegel könnten entsprechend geformt sein, nur mit anderer (doppelter) Umschrift, doch ist auch an individuelle Lösungen zu denken mit 4 dem Charakter der Fakultäten entsprechenden Symbolen. Diese müssten allerdings ganz einfach gestaltet sein, evtl. jeweils in Verbindung mit dem verkleinerten Eulensymbol. Die Kommission schlägt vor, zu diesem Punkt die Fakultäten beraten zu lassen. Vielleicht könnte ein Wettbewerb an der Grafikklasse der Staatlichen Schule für Kunst und Handwerk zu neuen Vorschlägen führen, sofern die Fakultäten entsprechende Wünsche äußern und Anregungen geben. Die Fakultätssiegel sollten ca. 5 cm Durchmesser haben, rund sein und ebenfalls lateinische Beschriftung enthalten. Der jeweilige lateinische Text müsste von den Fakultäten beschlossen werden. Prof. Dr. J.A. Schmoll gen. Eisenwerth als Vorsitzender der Kommission für Siegel und Diplome
Quelle: UA SB, Protokoll der Sitzungen des Ausschusses für Siegel und Diplome des Senats der Universität des Saarlandes vom 10. und 17. April 1957, S. 1f. (ms. Ausfertigung).
Z W EI ER L EI ER I N N ERU NG A N EI N E M „ H ISTOR ISCH E N ORT “ – DAS BEDRÜCK E N DE ER BE DER „ R EICHSU N I V ERSI TÄT ST R ASSBU RG“ U N D DI E „U N I V ERSI T É DE ST R ASBOU RG“ 1945 BIS H EU T E Rainer Möhler „Straßburg: Überreste jüdischer NS-Opfer in Rechtsmedizin entdeckt. 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs sind im rechtsmedizinischen Institut von Straßburg Überreste jüdischer Nazi-Opfer entdeckt worden“ – mit dieser Schlagzeile machte SPIEGEL ONLINE am 19. Juli 2015 publik, was vor Ort bereits seit Jahrzehnten immer wieder vermutet, aber bislang nicht hatte nachgewiesen werden können: Die Geschichte der nationalsozialistischen „Reichsuniversität Straßburg“ (1940/41–1944) ist keine ausschließliche Angelegenheit für Archivare und Historiker, sondern immer noch in der Gegenwart präsent, und sei es in Form eines „Glasbehälters mit Hautfragmenten sowie zweier Reagenzgläser mit Magen- und Darminhalt“.1 Es ist dem beharrlichen Drängen des französischen Medizinhistorikers Raphaël Toledano und dem neuen Leiter der Straßburger Rechtsmedizin zu verdanken, dass die Tür zur Asservatenkammer für die Suche nach menschlichen Überresten des monströsen Verbrechens des Straßburger Anatomen August Hirt, seiner „jüdischen Skelettsammlung“ für das SS-Ahnenerbe, endlich geöffnet wurde. Die Fundstücke, bei denen es sich um von den französischen Gerichtsmedizinern 1944/45 bei den Autopsien entnommene Proben handelte, wurden inzwischen auf dem jüdischen Friedhof in Straßburg-Cronenbourg im Ehrengrab für die im nahen Konzentrationslager Natzweiler-Struthof ermordeten 86 jüdischen Opfer beigesetzt.2 Dieser Vorfall zeigt eindrucksvoll das besondere Charakteristikum von „Zeitgeschichte“, dem Teil der Geschichte, der „noch qualmt“,3 und der für die heutigen Zeitgenossen noch lange nicht fertig erzählt ist. Im Fall des vom Deutschen Reich seit Juni 1940 „de-facto“ annektierten Elsass, das während des gesamten Zweiten Weltkrieges völkerrechtlich weiterhin zu Frankreich gehörte und trotzdem vom badischen Gauleiter, Reichsstatthalter und Chef der Zivilverwaltung Robert Wagner rigoros germanisiert und
1
2
3
SPIEGEL ONLINE v. 19.7.2015, http://www.spiegel.de/panorama/strassburg-ueberrestejuedischer-ns-opfer-in-rechtsmedizin-entdeckt-a-1044369.html; zuletzt abgerufen am 22.12.2015. Beim beigefügten Foto wird die aktuelle Meldung mit den Giftgasversuchen (Lost) Hirts, ebenfalls im KZ Natzweiler-Struthof, verwechselt. Zur Person von August Hirt (1898–1945) und seinen „wissenschaftlichen“ Tätigkeiten: Hans-Joachim Lang: Die Namen der Nummern. Wie es gelang, die 86 Opfer eines NS-Verbrechens zu identifizieren, Hamburg 2004. Weitere Meldungen in: Süddeutsche Zeitung v. 23.7.2015, Die Rheinpfalz v. 25.7.2015; an der „Université de Strasbourg“ wurde vom Wissenschaftshistoriker Christian Bonah der Fund zum Anlass genommen, die Einrichtung einer interdisziplinären Forschungskommission zur Geschichte der „Reichsuniversität Straßburg“ vorzuschlagen. Vgl. http://lactu.unistra.fr/index. php?id=22615; zuletzt abgerufen am 22.12.2015. Barbara Wertheim Tuchman: Wann ereignet sich Geschichte? (1964), in: dies.: In Geschichte denken. Essays, Düsseldorf 1982, S. 31–39, hier 31.
256
Rainer Möhler
nazifiziert wurde,4 handelt es sich um zwei „Zeitgeschichten“, die seit Kriegsende mehr oder weniger unverbunden nebeneinander existieren: a) Auf der linksrheinischen Seite im Elsass dominiert seitdem eine Mischung aus heroischer Résistance- und Opfererzählung, die sich nach Kriegsende wegen ihrer durch die geographische Lage als deutsch-französische Grenzregion bedingten „Doppelkultur“ jahrzehntelang gegen den latenten Vorwurf der nationalen Unzuverlässigkeit seitens der Franzosen „de l’intérieur“ erwehren musste; daher wurde jedwede über Einzelfälle hinausgehende elsässische Kollaboration mit der deutschen Besatzungsmacht abgestritten. Die nationalsozialistische „Reichsuniversität Straßburg“ wurde in diesem Zusammenhang als ein ausschließlich reichsdeutsches Phänomen angesehen, das mit dem Elsass und den Elsässern keine nähere Verbindung eingegangen war und nach der Befreiung Straßburgs am 23. November 1944 wieder restlos über den Rhein verschwand;5 b) auf der rechtsrheinischen Seite verabschiedete sich nach Kriegsende die bundesdeutsche Politik, Gesellschaft und Kultur von dem noch bis zum Frühjahr 1945 mit hartnäckigem militärischen Einsatz verteidigten „deutschen“ Elsass und der propagierten „natürlichen“ Einheit der Oberrheinlande – im Gegensatz zur Zwischenkriegszeit und zur deutschen Ostgrenze wurde die Rheingrenze im Nachkriegsdeutschland nicht mehr angezweifelt. Zugunsten der neu zu gestaltenden deutsch-französischen Zusammenarbeit auf nationaler und europäischer Ebene wurde in Paris und Bonn über die gemeinsam erfahrene Zeitgeschichte der „Mantel des Verschweigens“ ausgebreitet, wie es in der Nachkriegszeit der Umgang mit den „Westvertriebenen“, der Verlauf der justiziellen Aufarbeitung der NS-Verbrechen in Frankreich sowie die späten und zähen Verhandlungen um Wiedergutmachungszahlungen für die zwangsrekrutierten Elsässer und Mosellaner („malgré-nous“) zeigen.6 In der deutschen Geschichtswissenschaft interessierten sich seit 1945 nur noch einzelne Historiker für die elsässische Zeitgeschichte: Die Frankfurter Dissertation von Lothar Kettenacker: “Nationalsozialistische Volkstumspolitik im Elsaß“ 4
5
6
Zur NS-Politik im Elsass: Lothar Kettenacker: Nationalsozialistische Volkstumspolitik im Elsaß, Stuttgart 1973; vgl. a. Michael Erbe (Hg.): Das Elsaß: historische Landschaft im Wandel der Zeiten, Stuttgart 2002 sowie Bernard Vogler: Geschichte des Elsass, Stuttgart 2012. Zur Person von Robert Wagner (1895–1946): Ludger Syré: Der Führer von Oberrhein. Robert Wagner, Gauleiter, Reichsstatthalter in Baden und Chef der Zivilverwaltung im Elsaß, in: Michael Kißener (Hg.): Die Führer der Provinz. NS-Biographien aus Baden und Württemberg, Konstanz 1997, S. 733–778, und: Jean-Laurent Vonau: Le Gauleiter Wagner: le bourreau de l‘Alsace, Strasbourg 2011. Zur elsässischen Zeitgeschichtsforschung vgl. die Berichte von Alfred Wahl: Die Zeitgeschichte im Elsaß; ein kritischer Überblick, in: Jean-Marie Gall (Hg.): Das Elsaß. Bilder aus Wirtschaft, Kultur und Geschichte, Bühl 1991, S. 135–146 sowie von Francis Rapp und Bernard Vogler, in: Revue d’Alsace 133 (2007), S. 49–57 und 359–370. Die Geschichte der „Westvertriebenen“ ist bislang ein Desiderat; symptomatisch hierfür ist das Fehlen eines entsprechenden Lemmas bei: Detlef Brandes (Hg.): Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts, Wien 2010. Die deutsch-französischen Verhandlungen über Wiedergutmachungszahlungen an die „Malgré-nous“ zogen sich bis zum „Abkommen zur Einrichtung einer Stiftung für DeutschFranzösische Verständigung“ am 31.3.1981 hin. Hierzu: Markus Mößlang: Auf der Suche nach der „akademischen Heimat“: Flüchtlingsprofessoren in Westdeutschland, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 8 (2005), S. 143–156; Claudia Moisel: Frankreich und die deutschen Kriegsverbrecher. Die strafrechtliche Verfolgung der Kriegs- und NS-Verbrecher und die deutsch-französischen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg, Göttingen 2004; Eugène Riedweg: La libération de l‘Alsace: septembre 1944-mars 1945, Paris 2014.
Das bedrückende Erbe der „Reichsuniversität Straßburg“
257
von 1968 (erschienen Stuttgart 1973 in der Schriftenreihe „Studien zur Zeitgeschichte“) ist bis heute als Solitär „das“ maßgebende Standardwerk geblieben; übersetzt und in Auszügen wurde sie 1978 in den „Saisons d‘Alsace“ veröffentlicht.7 Das bundesdeutsche „Sich-aus-der-Verantwortung-stehlen“ in Bezug auf die nationalsozialistische Politik in den besetzten französischen Ostgebieten zeigte sich zuletzt auch in der Rede des Bundespräsidenten Joachim Gauck in Oradour-sur-Glane am 4. September 2013: Er räumte zwar die Versäumnisse der bundesdeutschen Justiz bei der ausgebliebenen Sühne für das Massaker an den Bewohnern des Dorfes klar ein, erklärte aber die Diskussion um die Schuld der daran beteiligten zwangsrekrutierten elsässischen SS-Soldaten zu einer rein innerfranzösischen Angelegenheit: „Ich bin mir auch der intensiven Debatte in Frankreich bewusst, die um die Frage der Zwangsrekrutierung von Elsässern kreist, die an dem Massaker teilgenommen hatten“.8 Der „Historische Ort“ der Universität Straßburg, ihre aus der Reichslandszeit stammenden Universitätsgebäude um das Kollegiengebäude („Palais universitaire“) am „Place de l’université“ sowie das historisch gewachsene Stadtviertel des „Bürgerspitals“, der „Hospices civiles“, mit seinen Krankenanstalten und Instituten, ist durch „zweierlei Erinnerung an einem Ort“ gekennzeichnet.9
Abb. 1 „Université de Strasbourg“: „Palais universitaire“, Kollegiengebäude (2014) 7
8
9
Lothar Kettenacker: La politique de nazification en Alsace (T. 1–2), in: Saisons d‘Alsace 23 (65/1978), S. 17–132, und ebd. (68/1978), S. 11–149. Die Verbreitung der Forschungsergebnisse Kettenackers wurde massiv vom Hamburger Mäzen und Volkstumspolitiker Alfred Toepfer behindert, der angeblich alle verfügbaren Exemplare in deutschen Buchhandlungen aufkaufen ließ. Zu seiner Person: Georg Kreis (Hg.): Alfred Toepfer: Stifter und Kaufmann – Bausteine einer Biographie. Kritische Bestandsaufnahme, Hamburg 2000. Vgl. a. die Rezension Kettenackers, eine „Gegenschrift“ in Buchform durch den elsässischen NSDAP-Kreisleiter und Journalisten Paul Schall: Elsaß gestern, heute und morgen? Filderstadt 1976, herausgegeben von der „Erwin von Steinbach-Stiftung“. Bundespräsident Joachim Gauck anlässlich seines Besuchs der Mahn- und Gedenkstätte Oradour-sur-Glane am 4.9.2013, vgl. www.bundespräsident.de, zuletzt abgerufen am 22.12.2015. Zum Massaker von Oradour-sur-Glane und zu dem Prozess von Bordeaux 1953: Jean-Laurent Vonau: Le procès de Bordeaux. Les Malgré-Nous et le drame d’Oradour, Strasbourg 2003. Mit dem reich bebilderten wissenschaftlichen Band von Georges Bischoff et Richard Kleinschmager: L‘université de Strasbourg: cinq siècles d‘enseignement et de recherche, Strasbourg 2010, liegt inzwischen ein hervorragender Überblick zur Straßburger Universitätsgeschichte vor.
258
Rainer Möhler
Die parallele Existenz zweier Straßburger Universitäten: die zu Kriegsbeginn Anfang September 1939 nach Clermont-Ferrand evakuierte „Université de Strasbourg“ sowie die seit Juli 1940 im Aufbau befindliche und am 23. November 1941 prunkvoll eröffnete nationalsozialistische „Reichsuniversität Straßburg“, wurde zwar Ende November 1944 durch die Flucht beziehungsweise Inhaftierung der deutschen Universitätsangehörigen und die Rückkehr der französischen Universität nach Straßburg beendet – die Erinnerung an diese Weltkriegsjahre wird aber seitdem in einer sehr gegensätzlichen Art und Weise auf deutscher und französischer Seite betrieben. Z W EI ST R ASSBU RGER U N I V E RSI TÄT E N WÄ H R E N D DE S Z W EI T E N W E LT K R I EGS: DI E EVA K U I ERT E „U N I V ERSI T É DE ST R ASBOU RG“ U N D DI E NAT IONA L SOZ I A LIST ISCH E „ R EICHSU N I V ERSI TÄT ST R ASSBU RG“ Die Planung und Gründung der „Reichsuniversität Straßburg“, die maßgeblich vom Historiker und „Altelsässer“ Ernst Anrich als „Spiritus rector“ (so rückblickend sein Straßburger Fachkollege Günther Franz) gestaltet und vorangetrieben wurde, stellt den letzten Versuch einer nationalsozialistischen Hochschulreform dar.10 Die Startbedingungen im Juli 1940 waren einzigartig: der ungebrochene Nimbus der KaiserWilhelms-Universität in der alten Reichsstadt Straßburg, die weit verbreitete Euphorie in der „Volksgemeinschaft“ über die Beseitigung der „Schmach von Versailles“ nach dem schnellen Sieg über Frankreich, die vorhandenen Baulichkeiten, ohne dass auch das Personal übernommen werden musste, sowie ein immenser finanzieller Spielraum durch die fast unbegrenzten Haushaltsmittel des Chefs der Zivilverwaltung. Auf der Grundlage eines als biologische Weltanschauung betrachteten Nationalsozialismus sollte die verloren gegangene „Universitas“, die Einheit von Geistes- und Naturwissenschaften, wiederhergestellt und die starren Fakultäts- und Fächergrenzen überwunden werden. Fachlich qualifizierte und politisch zuverlässige Professoren sollten als akademische „Kameradschaft“ den Führungsanspruch des Reiches im neuen Europa in Forschung und Lehre an der deutschen Westgrenze vertreten, sinnbildlich zusammengefasst in der Parole von der „Entthronung der Sorbonne!“ Die durch Führer-Entscheid Anfang April 1941 erfolgte Einordnung der „Reichsuniversität Straßburg“ in den Haushalt des Reichserziehungsministeriums führte jedoch zu einer empfindlichen Schwächung des ursprünglichen Konstruktionsplans; trotzdem war die „Reichsuniversität Straßburg“ Mitte der 1940er Jahre mit 99 Professuren (davon 71 „ordentliche“) darauf vorbereitet, nach dem siegreich beendeten Krieg zu einer der bedeutendsten reichsdeutschen Universitäten aufzusteigen. Der Lehrkörper setzte sich aus durchweg jüngeren, fachlich ausgewiesenen und politisch motivierten Professoren zusammen, die später in der Bundesrepublik Deutschland fast alle ihre wissenschaftlichen Karrieren fortsetzten (unter ihnen ein DFG-Präsident und 10
Nachlass Günther Franz (1902–1992) im Universitätsarchiv Stuttgart-Hohenheim: Memoiren, Kapitel 6, S. 127; Helmut Heiber: Universität unterm Hakenkreuz. T. 2: Die Kapitulation der Hohen Schulen. Das Jahr 1933 und seine Themen, München 1992, Bd. 1, S. 242. Der Verfasser bereitet eine umfangreiche Publikation zur Gesamtgeschichte der „Reichsuniversität Straßburg“ vor, die dank eines von der DFG finanzierten „Schreibjahres“ demnächst fertig gestellt wird.
Das bedrückende Erbe der „Reichsuniversität Straßburg“
259
Abb. 2 „Reichsuniversität Straßburg“: Eröffnungsfeierlichkeiten (November 1941)
vier bzw. fünf Direktoren von Max-Planck-Instituten).11 In Straßburg sollte nach den Plänen Anrichs der „rassenkundlichen“ Forschung eine zentrale, die interdisziplinäre Zusammenarbeit vorantreibende Funktion zukommen: Hierfür hatte er anfangs den Bonner SS-Rechtshistoriker Karl August Eckhardt als Rektor und den Tübinger Rassenbiologen Wilhelm Gieseler als Gründungsdekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät vorgesehen; der Freiburger „Rassenkundler“ Hans F.K. Günther sollte in der Philosophischen Fakultät die „Rassengeschichte“ und der Heidelberger Mediziner Ernst Rodenwaldt die medizinische „Rassenhygiene“ übernehmen. Obwohl diese Berufungen scheiterten (auch die des Jenaer Biologen Gerhard Heberer als Ersatz für Gieseler), und die geplanten rassenkundlichen Lehrstühle auf einen einzigen für medizinische „Rassenbiologie“ (erst ab Dezember 1942 mit Wolfgang Lehmann besetzt)12 reduziert wurden, ist die Erinnerung an die „Reichsuniversität Straßburg“ seitdem untrennbar mit dem Begriff der „Rasse“, und zwar mit den verbrecherischen Auswüchsen eines „wissenschaftlichen Rassismus“ verbunden. Neben dem bereits 11
12
DFG-Präsident: Ludwig Raiser (1904–1980), Direktoren eines MPI: Hans Dölle (1893–1980), Hermann Heimpel (1901–1988), Edgar Knapp (1906–1978), Carl Friedrich von Weizsäcker (1912–2007) sowie der Straßburger wissenschaftliche Assistent Hellmut Becker (1913–1993). Biographische und fachhistorische Informationen finden sich in: Frank-Rutger Hausmann: Die Geisteswissenschaften im „Dritten Reich”, Frankfurt a. M. 2011, sowie bei: HansPaul Höpfner: Die Universität Bonn im Dritten Reich. Akademische Biographien unter nationalsozialistischer Herrschaft, Bonn 1999; Wolfgang U. Eckart (Hg.): Die Universität Heidelberg im Nationalsozialismus, Heidelberg 2006; Urban Wiesing (Hg.): Die Universität Tübingen im Nationalsozialismus, Stuttgart 2010; Bernd Martin (Hg.): Von der badischen Landesuniversität zur Hochschule des 21. Jahrhunderts (=550 Jahre Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; Bd. 3), Freiburg 2007. Zur Person von Gerhard Heberer (1901–1973) und der Universität Jena im NS-Staat: Uwe Hoßfeld (Hg.): „Kämpferische Wissenschaft“. Studien zur Universität Jena im Nationalsozialismus, Wien 2003; zu Lehmann: Alexander Pinwinkler: Der Arzt als „Führer der Volksgesundheit“? Wolfgang Lehmann (1905–1980) und das Institut für Rassenbiologie an der „Reichsuniversität Straßburg“, in: Revue d‘Allemagne et des Pays de langue allemande 43 (2011), S. 401–418.
260
Rainer Möhler
erwähnten Anatomen Hirt und seiner „Jüdischen Skelettsammlung“ sind es die mörderischen Menschenexperimente, die Hirt und seine beiden medizinischen Kollegen, der Internist Otto Bickenbach und der Hygieniker Eugen Haagen, an wehrlosen, aus nationalsozialistischer Sicht „rassenfremden“ und daher „wertlosen“ Häftlingen des Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof durchführten.13 Die evakuierte „Université de Strasbourg“ wurde in den Räumlichkeiten der kleinen Provinzuniversität von Clermont-Ferrand (Auvergne) aufgenommen; die Kliniken wurden in der nahe gelegenen Stadt Clairvivre (Departement Dordogne) untergebracht.14 Am 3. November 1939 nahm die „Université de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand“ ihren Unterricht wieder auf; beide Universitäten behielten ihre jeweilige Verwaltung, Organe und Dekanate, während die Lehre gemeinsam angeboten wurde. Die Attraktivität dieses Angebots führte dazu, dass die Studierendenzahlen der „Université de Strasbourg“ in den nächsten Jahren wieder von 1.230 (1940) auf 2.305 (1943) anstiegen, unter denen die deutschen Behörden allerdings zuletzt nur noch ca. 400 bis 500 elsässische (und deutsch-lothringische)15 Studierende vermuteten. Nach dem Waffenstillstand vom 22. Juni 1940 und mit dem Beginn der organisierten Rücktransporte des „rassisch“ und politisch erwünschten Teils der evakuierten Bevölkerung waren etwa 40 Prozent der elsässischen Studierenden in ihre Heimat zurückgekehrt und hatten versucht, ihr Studium an einer der südwestdeutschen Universitäten wieder aufzunehmen. An der zum Wintersemester 1941/42 eröffneten „Reichsuniversität Straßburg“ stieg die Zahl der elsässischen Studierenden von zunächst 210 auf die Höchstzahl von 620 im Jahr 1942/43. Der elsässische Anteil im deutschen Lehrkörper war dem gegenüber deutlich geringer: Neben den „Altelsässern“ und Ordinarien Anrich, seinem Historikerkollegen Andreas Hohlfeld, dem Musikwissenschaftler Josef Müller-Blattau und dem Mediziner Werner Hangarter waren dies als Extraordinarien der aus Toulouse zurückberufene Chemiker Emil(e) Rinck und der in der Aufbauphase vom Chef der Zivilverwaltung im Bürgerspital angestellte Chirurg Adolf / Adolphe Jung (der anschließend durch die Vermittlung des einflussreichen Berliner Psychiaters Max de Crinis an die Charité wechselte) sowie sieben Honorarprofessoren, drei Dozenten und 39 überwiegend medizinische Assistenten.16 Andere elsässische Professoren der „Université de 13
14 15
16
Zu den verbrecherischen Experimenten der Straßburger Medizinprofessoren Otto Bickenbach (1901–1971), Eugen Haagen (1898–1972) und Hirt vgl. Robert Steegmann: Das Konzentrationslager Natzweiler-Struthof und seine Außenkommandos an Rhein und Neckar 1941–1945, Berlin 2010, S. 411–439; zu den Nachkriegsprozessen: Jean-Laurent Vonau: Profession bourreau: Struthof et Schirmeck; les gardiens de camp et les «médecins de la mort» face à leurs juges, Strasbourg 2013. Hierzu: Marie-Pierre Aubert: Les universitaires et étudiants strasbourgeois repliés à ClermontFerrand entre 1939 et 1945. Un chantier de recherches ouvert, in: Revue d‘Allemagne et des Pays de langue allemande 43 (2011), S. 439–454. Aus sprachlichen Gründen werden im Text die „Deutsch-Lothringer“ aus dem „Departement Moselle“ unter den Begriff „Elsässer“ bzw. „elsässisch“ subsumiert; die zum Teil stark divergierende Geschichte von „Moselle-Alsace“ behandelt Philippe Wilmouth. Mémoires parallèles: Moselle-Alsace de 1940 à nos jours; l‘ annexion de 1940–45, les Malgré-Nous, le procès de Bordeaux, Ars-sur-Moselle 2012. Als elsässische Honorarprofessoren arbeiteten an der „Reichsuniversität Straßburg“: Heinrich/ Henri Adrian (1885–1969), Viktor Coulon(-Tauber) (1884-?), Josef/Josephe Lefftz (1888–1977),
Das bedrückende Erbe der „Reichsuniversität Straßburg“
261
Abb. 3 „Reichsuniversität Straßburg“: Verzeichnis der Studierenden, Sommersemester 1942 (S. 1: u. a. der spätere Widerständler Alfons Adam)
Strasbourg“, die bis zum Ersten Weltkrieg ihre akademische Ausbildung an kaiserlichen Universitäten durchlaufen hatten wie der Historiker Fritz Kiener oder der Romanist Ernest Hoepffner hatten ihre Gegnerschaft zum NS-Staat am 5. Februar 1939 durch ihre Unterschrift unter den gemeinsamen Appell von 128 Straßburger Professoren an die französische Regierung, Härte gegenüber der expansiven Außenpolitik Hitlers zu zeigen, offen gelegt und waren dadurch für die „Reichsuniversität Straßburg“ uninteressant geworden.17
17
Emil(e) Linckenheld (1880–1976) und Karl/Charles Mugler (1898–1979) an der Philosophischen sowie Adolf Burr (*1889) und Otto Haas an der Naturwissenschaftlichen Fakultät; Elsässer im Dozentenstatus waren der Leiter des Strahleninstituts im Bürgerspital August(e) Gunsett (1876–1970), der Betriebswirt Max Lauterbach sowie der Archäologe Paul Wernert (1889–1972). Zur Person von Adolf/Adolphe Jung: Wolfgang Müller: Le Professeur Adolphe Michel Jung (1902–1992): La vie mouvementée d´un chirurgien strasbourgeois, in: Annuaire de la Société des Amis du Vieux Strasbourg 35 (2010), S. 137–147. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für die vielfältige Hilfe und elsässischen „Insider-Informationen“ von Dr. Wolfgang Müller, Archivoberrat an der Universität des Saarlandes, bedanken. Der Straßburger Appell vom 5.2.1939 ist abgedruckt in: Elisabeth Crawford (Hg.): La science sous influence. L’université de Strasbourg, enjeu des conflits franco-allemands 1872–1945, Strasbourg 2005, S. 173f.
262
Rainer Möhler
Trotz fehlender völkerrechtlicher Ermächtigung, aber mit Unterstützung des Pariser Militärbefehlshabers und unter Androhung von Repressalien gegen französische Universitäten in der besetzten Zone setzte die deutsche Seite bei der Vichy-Regierung den Rücktransport sämtlicher evakuierter Institutsbibliotheken und Einrichtungsgegenstände der „Université de Strasbourg“ sowie des gesamten Bestandes der Straßburger „Bibliothèque nationale et universitaire“ (BNUS) durch. Darüber hinaus drängten Rektor Karl Schmidt und Kurator Richard Scherberger immer massiver die Deutsche Botschaft in Paris, für die „Liquidierung“ der „Université de Strasbourg“ zu sorgen, „zumal es mit dem Ansehen des Großdeutschen Reiches unvereinbar ist, wenn in Clermont-Ferrand immer noch die Fiktion einer französischen Universität Straßburg aufrecht erhalten“ werde.18 Nach der Besetzung der „freien Zone“ durch die deutsche Wehrmacht am Waffenstillstandstag des Ersten Weltkrieges, dem 11. November 1942, spitzte sich die politische Situation auch in Clermont-Ferrand weiter zu. Mit zwei Razzien am 25. Juni und 25. November 1943 reagierte die deutsche Besatzungsmacht auf Résistance-Akte in Clermont-Ferrand und Umgebung und führte umfangreiche Verhaftungen durch: Zunächst am 25. Juni 1943 in der „Cité universitaire Strasbourgeoise“ in Clermont-Ferrand, bei der 39 Personen festgenommen und zum Teil in die Durchgangslager Compiègne und Drancy eingeliefert wurden; eine zweite, noch umfassendere Razzia erfolgte am 25. November 1943: Deutsche Polizeieinheiten stürmten mit Unterstützung einer Luftwaffeneinheit der Wehrmacht die „Université de Strasbourg“ und erschossen dabei den Ägyptologen Paul Collomp und den 15jährigen Schüler Louis Blanchet. Sie setzten zunächst alle rund 1.200 an der Universität angetroffenen Personen fest, von denen 800 bald darauf wieder freigelassen wurden; ca. 400 Personen wurden einer genaueren Untersuchung unterzogen, 110 von ihnen schließlich in deutsche Konzentrationslager deportiert, von denen nur ein Teil die Lagerzeit überlebte. Die „Université de Strasbourg“ wurde vorläufig gesperrt und erst auf Ersuchen der französischen Regierung wieder freigegeben.19 Am 27. August 1944 wurde Clermont-Ferrand befreit; das letzte Kriegs-Studienjahr 1944/45 endete am 30. Juni 1945 und wurde symbolisch mit einem Universitätsbesuch General de Gaulles sowohl in Clermont-Ferrand als auch in Straßburg abgeschlossen. Ein halbes Jahr später fand am symbolträchtigen 22. November, dem Jahrestag der Eröffnung der französischen „Université de Strasbourg“ nach dem Ersten Weltkrieg, die feierliche Eröffnung der aus der Evakuierung wieder zurückgekehrten Universität statt. In einer Gedenkveranstaltung wurde an die während der deutschen Besatzungszeit ermordeten Mitglieder gedacht; in der 1947 erschienenen Dokumentation „De 18
19
Vom Verfasser erscheint 2016 hierzu ein Aufsatz im französischen Tagungsband zum Abschlusskolloquium des DFG/ANR-Projekts „EDEFFA: Evakuierungen im deutschfranzösischen Grenzraum während des Zweiten Weltkrieges/Les Évacuations dans l’espace frontalier franco-allemand pendant la Seconde Guerre mondiale“; Kurator Scherberger an den Rückführungsbeauftragten Dr. Hans Fegers über Deutsche Dienstpost Frankreich v. 19.2.1943; BA Berlin, R76 IV–1. Hierzu: Aubert: Universitaires (2011), S. 447; Léon Strauss: L’université française de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand (1939–1945), in: Christian Baechler (Hg.): Les Reichsuniversitäten de Strasbourg et de Poznan et les résistances universitaires 1941–1944, Strasbourg 2005, S. 237–261; ders.: Réfugiés, expulsés, évadés d’Alsace et de Moselle: 1940–1945, Colmar 2010.
Das bedrückende Erbe der „Reichsuniversität Straßburg“
263
l‘Université aux Camps de Concentration. Témoignages strasbourgeois“ wurden zunächst 69 Namen mit den jeweiligen Todesumständen und -orten vermerkt, auf der später angebrachten Gedenkplakette im Eingangsbereich des Straßburger „Palais universitaire“ dann insgesamt 119 Namen der „camarades abattus, fusillés, exterminés“; ein aktuelles Faltblatt der „Université de Strasbourg“ nennt die Zahl von „139 membres de l’université sont morts en captivité ou au combat“.20
Abb. 4 Titelblatt der Dokumentation von 1947; De l'Université aux Camps de Concentration (1947)
Abb. 5 Erinnerungstafel in der Eingangshalle des „Palais universitaire“ (2007)
20 De l‘Université aux Camps de Concentration. Témoignages strasbourgeois. Publications de la Faculté des Lettres de l‘Université de Strasbourg, Paris 1947, Nachdruck 4. Auflage Strasbourg 1996, S. 541–546; Strasbourg, Clermont-Ferrand 1943–2013, Une communauté universitaire résistante (2013), online unter: http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/universite/ grands_noms/25nov_2013_tract.pdf; zuletzt abgerufen am 22.12.2015.
264
Rainer Möhler
DER LEHRKÖR PER DER „R EICHSU NIVERSITÄT STR ASSBURG“ NACH 1945: SELBSTGEFÄ LLIGE IGNOR A NZ GEGEN ÜBER DER EIGEN EN HISTOR ISCHEN VER A NT WORTU NG Straßburg wurde am 23. November 1944 befreit – für die „Reichsuniversität“ waren erst seit Mitte September die Universität Tübingen als „Ausweichstelle und Meldekopf“ eingerichtet und kriegswichtige Forschungsprojekte ins Reichsinnere verlagert worden. Die alliierten Panzerverbände überraschten durch ihren schnellen Vorstoß die Stadt und die Universität, deren Betrieb in einem kriegsbedingten reduzierten Ausmaß bis zu diesem Tag aufrecht erhalten worden war – der Gauleiter und Chef der Zivilverwaltung Wagner hatte jede vorzeitige Evakuierung untersagt. Während der Mehrheit des Lehrkörpers die Flucht über den Rhein gelang, sofern sie nicht bereits zuvor vom Reichserziehungsministerium an andere Universitäten im Reichsinnern abgeordnet worden waren, wurden fast alle Kliniker der Medizinischen Fakultät im Bürgerspital als Kriegsgefangene interniert; nur der Pädiater und „Alte Kämpfer“ Kurt Hofmeier (NSDAP 1931) hatte Patienten und Personal im Stich gelassen und sich selbst in Sicherheit gebracht. Die Straßburger Professoren verteilten sich in den nächsten Jahren über das gesamte Bundesgebiet, mit auffälligen Häufungen (Stand am Ende der 1950er Jahre) an den Universitäten Hamburg (10), Freiburg (7), Kiel (6), Tübingen und Mainz (jeweils 5) sowie Göttingen (4); nur sehr wenige wie der Kunsthistoriker Hubert Schrade oder der Rechtswissenschaftler Ernst Rudolf Huber mussten mehrere Jahre warten, bis ihnen der Weg zurück auf einen Lehrstuhl geebnet wurde. Einige Naturwissenschaftler und Kliniker bevorzugten den Wechsel in die Privatwirtschaft, ebenso der Historiker Ernst Anrich, der zunächst in Tübingen, dann in Darmstadt die „Wissenschaftliche Buchgemeinschaft“ (später „Buchgesellschaft“) aufbaute, deren Geschäftsführer er bis zu seiner späten und kurzen politischen Karriere als Vorstandsmitglied der post-nationalsozialistischen NPD Mitte der 1960er Jahre blieb.21 Andere wiederum starteten eine eindrucksvolle zweite Karriere in der bundesdeutschen Wissenschaft und drängten in die politische Öffentlichkeit wie der „Friedensforscher“ Carl Friedrich von Weizsäcker, jüngster Ordinarius an der „Reichsuniversität Straßburg“ und Mitglied des „Uranvereins“ im NS-Staat, und der Gründungsdirektor des Göttinger Max-Planck-Instituts für Geschichte Hermann Heimpel, die beide jeweils sogar als Kandidaten für das Bundespräsidentenamt zeitweise im Gespräch waren.22 Zur Person von Ernst Rudolf Huber (1903–1990): Ewald Grothe: Zwischen Geschichte und Recht. Deutsche Verfassungsgeschichtsschreibung 1900–1970, München 2005; zu Hubert Schrade (1900–1967): Nicola Hille: „Deutsche Kunstgeschichte“ an einer „deutschen Universität“. Die „Reichsuniversität Straßburg“ als nationalsozialistische Frontuniversität und Hubert Schrades dortiger Karriereweg, in: Ruth Heftrig (Hg.): Kunstgeschichte im „Dritten Reich“. Theorien, Methoden, Praktiken, Berlin 2008, S. 87–102; zu Ernst Anrich (1906–2001): Joachim Lerchenmueller: Das Ende der „Reichsuniversität Straßburg“ in Tübingen, in: Bausteine zur Tübinger Universitätsgeschichte 10 (2005), S. 115–174, und René Schlott: Die WBG, ein Unikat der Verlagslandschaft: eine kleine Geschichte der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, Darmstadt 2009. 22 Sein Nachlass in der Universitätsbibliothek Göttingen wurde von ihm testamentarisch bis Ende 2018 gesperrt; zur Person von Hermann Heimpel: Anne Christine Nagel: Im Schatten
21
Das bedrückende Erbe der „Reichsuniversität Straßburg“
265
Von keinem dieser Angehörigen der „Reichsuniversität Straßburg“ sind Notizen, Bemerkungen, Stellungnahmen oder gar öffentliche Worte des Bedauerns überliefert – weder in Akten noch in späteren schriftlichen Äußerungen und zum Teil umfangreichen persönlichen Erinnerungen finden sich Bemerkungen zum Verhalten der „Reichsuniversität“ gegenüber der „Université de Strasbourg“ und dem Schicksal ihrer Angehörigen sowie zu den verbrecherischen medizinischen Experimenten ihrer Straßburger Kollegen und „Kameraden“. Stattdessen sind ihre Erinnerungen von selbstgefälliger Ignoranz und dem Fehlen jeglicher Empathie gegenüber den Opfern gekennzeichnet. Für den Historiker Heimpel war das erste, am eigenen Leib erlebte „Unrecht“ die nach 1945 von der US-Militärregierung unterbundene Berufung an die Universität München. In einem privaten Schreiben äußerte er sich im April 1946: „Die Nazis sind 1933 bei ihrer ‚Säuberungsaktion‘ doch erheblich humaner vorgegangen und haben ihre politischen Gegner einschließlich der Juden mit Pensionen und sogar mit Emeritengehältern weiterleben lassen“23 – zwölf Jahre zuvor hatte er 1934 nicht gezögert, den Leipziger Lehrstuhl seines ehemaligen Münchner akademischen Lehrers Siegmund Hellmann zu übernehmen, der wegen seiner „jüdischen Abstammung“ 1933 entlassen worden war und 1942 im KZ Theresienstadt ermordet wurde. Die „elsässische Frage“ war für Heimpel auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht endgültig beantwortet. Gegenüber seinem Historikerkollegen Gerhard Ritter äußerte er sich im Mai 1949 im Vorfeld des ersten „Internationalen Historikertages“ nach dem Zweiten Weltkrieg, der für das nächste Jahr in Paris geplant war: „Für mich ist Straßburg eine alte Reichsstadt […]. Aber so lange man Europa sagt und ein Land gallisiert, das in seinem Urgrund deutsch ist oder sagen wir lieber: alemannisch und fränkisch, so lange verwinde ich für mich nicht die elsässische Frage“. Auf sein eigenes persönliches „Schicksal“ bezogen (und die Chronologie der Ereignisse ignorierend) bemerkte er in einem weinerlichen Ton: „Aber so lange mein Nachfolger meine Aussteuer benutzt, in meinen Betten schläft und unter meinen Familienbildern sitzt, würde ich mich in Paris in recht temperierter Stimmung als ein solcher befinden, der froh sein muss, dass man nicht merkt, dass er in Straßburg war“. Heimpel war daher eher geneigt, eine „Gegenrechnung“ aufzumachen: „Das Historische Seminar, das ich 1941 antraf, war ein verlotterter Haufen. Was ich verließ, waren dreißigtausend wohlgebundene und wohlgeordnete Bände […]. Ich finde, dass sich mein des Dritten Reichs: Mittelalterforschung in der Bundesrepublik Deutschland 1945–1970, Göttingen 2005, und: Klaus Sommer: Eine Frage der Perspektive? Hermann Heimpel und der Nationalsozialismus, in: Tobias Kaiser (Hg.): Historisches Denken und gesellschaftlicher Wandel: Studien zur Geschichtswissenschaft zwischen Kaiserreich und deutscher Zweistaatlichkeit, Berlin 2004, S. 199–223. Zur diskutierten Kandidatur als Bundespräsident bei Heimpel vgl. Theodor Eschenburg: Der nächste Bundespräsident noch einmal Heuss?, in: DIE ZEIT 13 (37/11.9.1958), S. 3, bei Weizsäcker vgl. Eginhard Hora (Hg.): Carl Friedrich von Weizsäcker. Lieber Freund! Lieber Gegner! Briefe aus fünf Jahrzehnten, München 2002, S. 98–100. Die Persönlichkeit Weizsäckers wird seit einiger Zeit kritisch betrachtet, vgl. u. a. Wolf Schäfer: Plutoniumbombe und zivile Atomkraft. Carl Friedrich von Weizsäckers Beiträge zum Dritten Reich und zur Bundesrepublik, in: Leviathan 41 (2013), S. 383–421. 23 Brief Heimpels an Siegfried A. Kaehler v. 29.4.1946, z. n. Peter Herde: Kontinuitäten und Diskontinuitäten im Übergang vom Nationalsozialismus zum demokratischen Neubeginn; die gescheiterten Berufungen von Hermann Heimpel nach München (1944–1946) und von Franz Schnabel nach Heidelberg (1946–1947), München 2007, S. 31.
266
Rainer Möhler
Nachfolger gelegentlich dafür bedanken könnte“.24 Sein romanistischer Kollege an der „Reichsuniversität Straßburg“, der Österreicher Friedrich Schürr, NSDAP-Mitglied seit 1933, erinnerte sich dagegen Ende der 1960er Jahre gerne an seine Straßburger Jahre und das „schöne Arbeiten mit einer vor allem im Französischen ausgezeichnet vorgebildeten Hörerschaft“. Nach 1945 habe ihm sein französischer Nachfolger bescheinigt: „Vous n’avez pas laissé de mauvais souvenirs à Strasbourg“, was Schürr in seinen Erinnerungen mit der Bemerkung kommentierte: „Schön, wir haben keine schlechten Erinnerungen in Straßburg hinterlassen, wohl aber unsere ganze Einrichtung“ – wem das Straßburger Haus und die Einrichtung gehörte, in der er als Angehöriger der nationalsozialistischen Besatzungsmacht von 1941 bis Ende 1944 lebte, hatte ihn dagegen nie interessiert.25 Und sein Landsmann, der Mathematiker Karl Strubecker, NSDAP-Mitglied von 1941, war sich im Juni 1946 nicht zu schade gewesen, sich gegenüber seinem französischen Vorgänger und Nachfolger auf dem Straßburger Mathematiklehrstuhl, Georges Cerf, der aufgrund des französischen „Judenstatuts“ seinen Lehrstuhl in Clermont-Ferrand verloren hatte, als Opfer „zweier deutscher Diktaturen“ zu präsentieren, dessen berufliche Karriere jetzt schon wieder behindert werde. Er bat Cerf, sich auf offiziellem Universitätspapier bei der französischen Militärregierung in Baden-Baden für ihn einzusetzen, damit er bessere Chancen habe, auf eine der neuen Universitäten in der französischen Zone berufen zu werden.26 Carl Friedrich von Weizsäcker, der in Straßburg unmittelbarer Hausnachbar von August Hirt gewesen war, „vergaß“ 1982 in seinem Vorwort zum Sammelband seines verstorbenen Kollegen und Freundes Ludwig Raiser dessen Berufung und Ernennung durch den „Führer“ Adolf Hitler zum Straßburger Lehrstuhlinhaber für „Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht“, erwähnte aber dessen Leitwort von der „Politischen Verantwortung des Nichtpolitikers“ sowie die Rektorate in Göttingen und Tübingen, den Vorsitz bei der DFG, im Wissenschaftsrat und die jahrzehntelange Mitgliedschaft in der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (Präses von 1970–1973).27 Weizsäckers Straßburger „Mitbewohner“ Hellmut Becker, Sohn des preußischen Kultusministers und Orientalisten Carl Heinrich Becker und (gescheiterter) Doktorand bei Ernst Rudolf Huber erst in Leipzig, dann an der „Reichsuniversität Straßburg“, avancierte in den 1960er und 70er Jahren zum „heimlichen Bundeskulturminister“ (Ulrich Raulff): Becker wurde 1963 zum 24 Heimpel an Gerhard Ritter v. 12.5.1949, z. n. Steffen Kaudelka: Rezeption im Zeitalter der Konfrontation. Französische Geschichtswissenschaft und Geschichte in Deutschland 1920– 1940, Göttingen 2003, S. 134. 25 Friedrich Schürr: Wie ich Romanist wurde, in: Carinthia I, hg. v. Geschichtsverein für Kärnten 158 (1968), S. 116–135, 127. Zur Person von Schürr (1888–1980): Frank-Rutger Hausmann: L’enseignement des langues vivantes dans les Reichsuniversitäten de Strasbourg et de Poznan, in: Baechler: Reichsuniversitäten (2005), S. 179–184. 26 Strubecker an Cerf v. 12.6.1946; Universitätsarchiv Karlsruhe 27011–51 II. Zur Person von Karl Strubecker (1904–1992) vgl. den Nachruf von K. Leichtweiß in: Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 94 (1992), S. 105–117. 27 Konrad Raiser (Hg.): Ludwig Raiser. Vom rechten Gebrauch der Freiheit. Aufsätze zu Politik, Recht, Wissenschaftspolitik und Kirche, Stuttgart 1982, Vorwort von Carl Friedrich von Weizsäcker, S. 9–18; den biographischen Artikel in der NDB schrieb Thomas Raiser: NDB 21 (2003), S. 123f.
Das bedrückende Erbe der „Reichsuniversität Straßburg“
267
Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin ernannt und gehörte zahlreichen Gremien von Bildungseinrichtungen vom „Frankfurter Institut für Sozialforschung“ bis zum Beirat des „Instituts für Zeitgeschichte München“ an. In seinen Erinnerungstexten an die Straßburger Jahre schwärmte er von einer „ungewöhnlich anregenden Zeit […] in dieser merkwürdigen Enklave Straßburg“ und steigerte sich mit zunehmendem Alter in eine Mitwisserschaft an der RésistanceTätigkeit seines elsässischen Assistentenkollegens Guy Sautter hinein.28 Auch von Becker kamen keine Worte des Bedauerns oder des Mitgefühls, so wie er auch seine NSDAP-Mitgliedschaft (seit 1937) nach 1945 konsequent verschwieg: „In einer Welt der Bildungsreform, sexuellen Befreiung, Psychoanalyse und Aufklärung im Geist der Frankfurter Schule war kein Platz für ein dreckiges altes Parteibuch“.29 Aber nicht nur diese einzelnen die Öffentlichkeit suchenden und in wissenschaftspolitischer Verantwortung stehenden „Straßburger“ schwiegen die gesamte Zeit über zur historischen Verantwortung der „Reichsuniversität Straßburg“; auch die Mitglieder des „Bundes der Freunde der „Reichsuniversität Straßburg““, dessen Vermögen über den „Zusammenbruch“ von 1945 hatte gerettet werden können, förderten lieber die wissenschaftlichen Arbeiten ihrer „amtsverdrängten“ Professorenkollegen. Bei seiner Auflösung stifteten die Mitglieder des Bundes 1960 das verbliebene Vereinsvermögen von 47.000 DM der DFG unter der Auflage, damit auch noch in den nächsten zehn Jahren ehemalige Professoren der „Reichsuniversität Straßburg“ zu unterstützen.
Abb. 6 Auszug aus der Niederschrift über die Mitgliederversammlung des Bundes der Freunde der ehem. „Reichsuniversität Straßburg“ e.V., Sitz in Tübingen (29.7.1960) 28 Hellmut Becker zusammen mit Frithjof Hager: Aufklärung als Beruf: Gespräche über Bildung und Politik, München 1992, S. 111. Zum „homme politique“ Guy Sautter (1924–2009), hoher Beamter bei europäischen und internationalen Organisationen, Dozent an der „Université de Strasbourg“ und von 1949–1989 Honorarprofessor an der Universität Freiburg: Alphonse Irjud, in: NDBA H. 32, S. 3380. 29 Ulrich Raulff: Kreis ohne Meister: Stefan Georges Nachleben, München 2009, S. 404.
268
Rainer Möhler
Auf die Idee, mit diesem Geld die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung an der „Université de Strasbourg“ oder der medizinischen Experimente ihrer ehemaligen Kollegen Bickenbach, Haagen und Hirt zu unterstützen, kam dagegen niemand. Stattdessen wurde darauf geachtet, dass die französische Seite keinerlei Kenntnis von diesem Straßburger Geld erhielt: So wurde das Angebot des Kunsthistorikers Hubert Schrade, dem Bund im Vorwort seines neuen Buches „Götter und Menschen Homers“ für die 1.500 DM Druckkostenzuschuss zu danken, vom Vorsitzenden des Bundes, dem ehemaligen Chef der Präsidialkanzlei unter Hitler und Altelsässer Otto Meißner, Ende 1950 erschrocken abgewehrt, „da ich aus naheliegenden Gründen es vermeiden möchte, dass das Bestehen und die Tätigkeit des Bundes der Freunde der „Reichsuniversität Straßburg“ weiteren Kreisen bekannt wird“. Meißners Sohn Hans-Otto bedankte sich 1957 beim ehemaligen Straßburger Ordinarius für „Bürgerliches Recht, Verfahrensrecht, Bauernrecht“ Hans Dölle und jetzigen Direktor des Max-Planck-Instituts für Ausländisches und Internationales Privatrecht in Hamburg für dessen Bemühungen, „das Vermögen des Bundes dem Zugriff der Franzosen zu entziehen und zweckentsprechend zu verwenden“.30 Die ehemaligen Straßburger Professoren und Dozenten hielten untereinander bis in die 1980er Jahre hinein Kontakt: Gegenseitige Beiträge in Festschriften, Nachrufe, privater Schriftverkehr und ein letztes großes Treffen am 23. Mai 1970 in der Heidelberger Stiftsmühle, an dem 16 „Straßburger“ (fast alle mit Ehefrau) und der ehemalige Generalreferent des Chefs der Zivilverwaltung und NS-Oberbürgermeister von Straßburg Robert Ernst teilnahmen, zeugen von dieser „kameradschaftlichen“ Verbundenheit bis ins hohe Alter, ungetrübt von jeder schlechten Erinnerung an die eigene historische Verantwortung.31 „U N I V E RSI T É DE ST R ASBOU RG“ – H EROISCH E R É SISTA NC E U N D OPF ER ER Z Ä H LU NG NACH 1945 Staatspräsident Vincent Auriol verlieh am 31. März 1947 der „Université de Strasbourg“ als einziger französischer Universität die „Médaille de la Résistance française avec rosette“ für ihre aufrechte, kämpferische Haltung während der Zeit ihrer Evakuierung und den Opfergang zahlreicher ihrer Mitglieder.32 Auch heute noch, 70 Jahre nach Kriegsende, wird die Bedeutung dieser Auszeichnung betont und die Erinnerung 30 31
32
Der Schriftverkehr zum Bund der Freunde nach 1945 befindet sich in: BAK, KLERW 410, hier 410–1/1. Der ehemalige Kurator der „Reichsuniversität Straßburg“, Emil Breuer, schrieb 1958 anhand des letzten Vorlesungsverzeichnisses alle ehemaligen Professoren an, um die Auflösung des Bundes der Freunde vorzubereiten und bat um Adressenauskünfte über weitere Kollegen; allein der Münchner Vor- und Frühgeschichtler Joachim Werner (1909–1994) machte hierbei eine Bemerkung zu dem in der Liste aufgeführten Namen von August Hirt: „Siehe KZ Struthof! Diesen Herrn sollten Sie nicht in der Liste führen“ – Werner an Breuer v. 3.2.1958, BAK, KlErw 410–2/162. Université de Strasbourg: Année scolaire 1953/54. Rapport général sur la situation et les travaux de l‘Université de Strasbourg, Strasbourg 1954; Université de Strasbourg: Communiqué de presse, 11.7.2013; vgl. a. http://www.ordredelaliberation.fr/fr/medailles-de-la-resistance; zuletzt abgerufen am 22.12.2015.
Das bedrückende Erbe der „Reichsuniversität Straßburg“
269
an diesen Teil der elsässischen Zeitgeschichte gelebt: Zum Revolutionsfeiertag am 14. Juli 2013 wurde ihr Rektor als Vertreter der ehemaligen „Université de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand“ auf die Ehrentribüne zum Defilee der französischen Truppen nach Paris eingeladen; der jährliche Gedenktag an die zweite große „Rafle“ am 25. November wird in Anwesenheit des Rektors, der Dekane und Studierender der „Université de Strasbourg“ sowie von „Anciens combattants“ und Gästen aus Clermont-Ferrand im Lichthof und in der Eingangshalle des „Palais universitaire“ feierlich begangen. Der enge Kontakt mit der Gastgeber-Universität in Clermont-Ferrand blieb die Jahrzehnte über bestehen: Nachdem bereits 1947 ein „Mémorial des années 1939–1945“ sowie der Zeitzeugenband „De l‘Université aux Camps de Concentration. Témoignages strasbourgeois“ erschienen waren, fanden anlässlich des 20. Jahrestages der NS-Razzien 1963 und erneut zum „40me anniversaire du repli“ 1983 gemeinsame „Journées du souvenir“ statt;33 1968 erschien unter dem Titel „1918–1943–1968 - deux anniversaires“ ein Sonderheft des „Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg“, in dem eine sorgfältige Differenzierung zwischen tatsächlichen Résistance-Akten und „bloßer“ Opfergeschichte vorgenommen wird: „Avoir été victime du nazisme n‘est pas la même chose qu‘avoir été résistant“.34 In Clermont-Ferrand erinnert heute eine Tafel im zentralen Innenhof an die deutschen Razzien, während 1983 in Straßburg die vor der Universität gelegene „Pont de l’Université“ in „Pont d’Auvergne“ umbenannt wurde. Im Gegensatz zu dieser heroischen Résistance- und Opfererinnerung stand von Anfang an die „Nicht-Erinnerung“ an diejenige Institution und ihre Angehörigen, die während des Zweiten Weltkrieges in Straßburg geforscht, gelehrt und gelernt hatten: die deutsche „Reichsuniversität Straßburg“. So wies Anfang der 1950er Jahre der Dekan der Straßburger „Faculté des Lettres“ eine offizielle Anfrage des (französischen) Rektors der Universität des Saarlandes Joseph-François Angelloz zur Person des ehemaligen Straßburger Geschichtsdozenten Hermann Löffler mit der Bemerkung zurück, dass vor Ort keinerlei Informationen zu dieser deutschen Zeit vorlägen und verwies ihn an den „Service des Renseignements Généraux“ bei der Präfektur: „Nous avons le regret de vous informer que nous ignorons tout de la scolarité des ressortissants allemands inscrits à l‘Université allemande de Strasbourg pendant la durée de l‘occupation. Par ailleurs, sur l‘activité ou les De l’Université aux Camps de Concentration (1947); Gabriel Maugain e. a.: Mémorial des années 1939–1945, Paris 1947; La Journée du 23 novembre 1963, à Clermont-Ferrand. Vingtième anniversaire des arrestations des membres des universités de Clermont-Ferrand et de Strasbourg, Strasbourg 1964; Hubert Lutz (Hg.): 40me anniversaire du repli de l‘Université de Strasbourg à Clermont-Ferrand: journée du souvenir, 23 novembre 1979, Clermont-Ferrand 1980; Strasbourg – Clermont-Ferrand – Strasbourg: 1939–1943, 1979–1983 (Se souvenir), Strasbourg 1988. 34 „Pour éviter toute controverse inutile, nous ne publions que les récits de personnes dont l’appartenance à un mouvement de résistance ne souffre aucune contestation. Avoir été victime du nazisme n’est pas la même chose qu’avoir été résistant. Cette dernière notion implique un engagement volontaire dans un mouvement ou un réseau clandestin et une particiation effective à des actions contrôlables“; 1918–1943–1968 – deux anniversaires, in: Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg 47 (oct.-noc., déc. 1968), S. 3–46, 47–53, hier: Julien Freund: Avertissement, S. 6. 33
270
Rainer Möhler
Abb. 7 „Université de Strasbourg“: Feierlichkeiten zum Jahrestag der Razzia am 25.11.2011
Abb. 8 Erinnerungsplakette an die Razzia vom 25.11.1943 in der „Université Clermont-Ferrand“ (entnommen aus: Lutz: Anniversaire (1980)
opinions politiques des dits ressortissants pendant la même période, seul le service des Renseignements Généraux à la Préfecture du Bas-Rhin est habilité à fournir des indications précises“.35 Wider besseres Wissen wurde eine engere Verbindung zwischen dem Elsass, den Elsässern und der „Reichsuniversität Straßburg“ geleugnet, obwohl zahlreiche elsässische Studierende ihr an der „Reichsuniversität Straßburg“ begonnenes Studium an der „Université de Strasbourg“ fortsetzen, und der Chirurg Adolf / Adolphe Jung nach seinem reichsdeutschen Intermezzo, das ihn zuletzt mit deutschen NS-Widerstandskreisen in Berührung gebracht hatte, zunächst als „Agrégé libre“, dann als Professor für „Pathologie chirurgicale“ nach Straßburg zurückkehrte. Elsässische Nachwuchswissenschaftler, die ihre akademische Karriere an der „Université de Strasbourg“ fortsetzen wollten, mussten ihr bereits abgeschlossenes deutsches Promotionsverfahren durch eine erneute, diesmal französische „Thèse“ wiederholen (als ein Beispiel die Dissertation des Mediziners Franz Renatus / René Burgun von 1943 „Zur Geschichte der Dermatologie in Strassburg: 100 Jahre Universitäts-Hautklinik Strassburg 1842–1942“, und die von ihm 1946 eingereichte „Thèse“ „L’histoire de la syphilis à Strasbourg aux XVe et XVIe siècles“).36 Diese „Erinnerungsverweigerung“ hat zur Folge, dass selbst die elsässische Widerstandszelle an der „Reichsuniversität Straßburg“, die „Front de la Jeunesse alsacienne“ mit ihren studentischen Märtyrern Alfons Adam und Robert Kieffer, bislang nicht in den 35
36
Université Strasbourg, Faculté des Lettres, Le Doyen d. 23.6.1951; Universitätsarchiv Saarbrücken Rektorat-Abgelehnte Kandidaten. Zur Person des nationalsozialistischen Nachwuchshistorikers Hermann Löffler (1908–1978), der sich in Straßburg habilitierte und seine akademische Laufbahn als Professor an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg (1962–1973) beendete: Joachim Lerchenmüller: Die Geschichtswissenschaft in den Planungen des Sicherheitsdienstes der SS. Der SD-Historiker Hermann Löffler und seine Denkschrift „Entwicklung und Aufgaben der Geschichtswissenschaft in Deutschland“, Bonn 2000. Zu Franz Renatus / René Burgun vgl. den Artikel von François Joseph Fuchs in: NDBA H. 5, S. 426; die Promotionsurkunde ist abgedruckt in: Jacques Héran (Hg.): Histoire de la médecine à Strasbourg, Strasbourg 1997, S. 619.
Das bedrückende Erbe der „Reichsuniversität Straßburg“
271
Erinnerungskanon der „Université de Strasbourg“ aufgenommen wurde. Der frühen Ehrung Adams als „Etudiant en Lettres - chef du Front de la Jeunesse d‘Alsace – condamné le 7–7–43 – fusillé le 15–7 au stand Desaix“ in der 1947 erschienenen Dokumentation „De l‘Université aux Camps de Concentration“ steht ein weitgehendes Vergessen gegenüber, das zunächst auch das mehrbändige elsässisch-biographische Lexikon „Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne“ (NDBA, 1982–2007) betraf, das die biographische Würdigung Adams erst im Supplementband 2004 nachholte, während der Altelsässer und Nationalsozialist Ernst Anrich als Gründungsdekan der Philosophischen Fakultät der „Reichsuniversität Straßburg“ bereits im ersten Band 1982 historiographisch „gewürdigt“ wurde.37 Die durch das „Grenzlandschicksal“ an der Frontlinie der deutsch-französischen „Erbfeindschaft“ ohnehin bereits labile elsässische Identität war durch die zeitgenössischen Erfahrungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erneut geschwächt worden: die Auseinandersetzungen mit den autonomistischen Kräften in der Zwischenkriegszeit, der nicht immer unproblematische Aufenthalt in den südwestfranzösischen Evakuierungsgebieten, die nationalsozialistische Besatzungsherrschaft mit der Zwangsrekrutierung einer ganzen männlichen Generation in Wehrmacht und WaffenSS, sowie der nach Kriegsende – latent vorhandene oder sogar offen geäußerte – innerfranzösische Vorwurf der elsässischen „Collaboration“ mit dem Feind verstärkten die „malaise alsacien“.38 Die frühen Versuche einer Annäherung oder Versöhnung mit dem „deutschen Feind“ waren daher in der „Université de Strasbourg“ ebenso umstritten wie der Versuch, sie im Rahmen des Aufbaus Straßburgs zur neuen „Capitale européene“ in eine „Europäische Universität“ umzuwidmen: Am 9. April 1949 protestierten fünf Dekane der „Université de Strasbourg“ beim Bürgermeister Charles Frey vehement gegen die Ausrichtung eines Kongresses der europäischen „Union Fédéraliste Interuniversitaires“ unter Anwesenheit von 17 deutschen Vertretern in den Räumen des „Palais universitaire“. Die Dekane, unter ihnen der ehemalige KZHäftling Jean Lassus („Faculté des Lettres“) und der protestantische Theologe Charles Hauter, dessen zwei Söhne in der Besatzungszeit von der deutschen Polizei erschossen worden waren, verwiesen gegenüber dem Bürgermeister auf die Leidensgeschichte der „Université de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand“: „Nous n‘aurions certes pas supposé, il y a quatre ans, que les maîtres et les étudiants de l‘Université de Strasbourg accepteraient d‘être poursuivis, arretés et massacrés pour que l‘Université, si peu de temps après son retour, voie mettre en question dans ces murs même, par des Allemands, son caractère d‘Université française“. Sie erklärten eine Anwesenheit von deutschen Vertretern für „inopportun“: „Nous considérons comme prématurée 37 38
Biographische Artikel in der NDBA: Georges Foessel: Art. Alphonse Adam, H. 43, S. 4435; Léon Strauss: Art. Ernst Anrich, H. 1, S. 50. Hierzu das bekannte Buch des Straßburger Rechtsanwalts, Verteidiger von Eugen Haagen vor dem französischen Militärgericht in Metz 1952: Frédéric Hoffet: Psychanalyse de l‘Alsace, Paris 1951. Auch aktuell wird im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Regionen Elsass, Lothringen und Champagne-Ardennen zur Großregion „Alsace-Champagne-ArdenneLorraine“ erneut von einer Rückkehr der „malaise alsacien“ gesprochen, so im Artikel des L’EXPRESS: „Le retour du ‚malaise alsacien‘“ v. 20.10.2015, http://www.lexpress.fr/region/ alsace/le-retour-du-malaise-alsacien_1727602.html; zuletzt abgerufen am 22.12.2015.
272
Rainer Möhler
l‘entrée des Allemands dans la capitale de l‘Alsace“.39 Dasselbe Unbehagen dürfte auch der Grund gewesen sein, dass es vierzig Jahre dauerte, bis im Mai 1989 die an die konstituierende Sitzung der „Beratenden Versammlung“ des Europarates am 10. August 1949 im umgebauten Lichthof des „Palais universitaire“ erinnernde Plakette im Eingangsbereich des Kollegiengebäudes angebracht wurde; am 17. August hatte an diesem Ort der britische Premierminister Winston Churchill, der in der ehemaligen Villa des Rektors der „Reichsuniversität Straßburg“ Karl Schmidt in der Brahmsstraße Nr. 7 Quartier bezogen hatte, zu den Delegierten gesprochen.40 Anfang der 1990er Jahre erschienen in den „Saisons d’Alsace“ die Erinnerungen des ehemaligen „Conservateur-en-chef“ der Straßburger Museen, Victor Beyer, an seine Zeit als „Étudiant à la Reichsuniversität“; es stellt das bislang einzige veröffentlichte „Ego-Dokument“ eines elsässischen Studenten an der „Reichsuniversität Straßburg“ dar.41 Die elsässische Zeitgeschichtsforschung begann sich erst Anfang der 1980er Jahre vorsichtig der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Besatzungszeit zu nähern; bis dahin galt auch im wissenschaftlichen Bereich der aus einem zeitgenössischen Theaterstück von Germain Muller stammende Spruch: „Enfin […], Redde m‘r nimm devun“.42 Seit 1982 erschienen in der NDBA biographische Artikel auch zu einzelnen Ordinarien der „Reichsuniversität Straßburg“: zu den Historikern Ernst Anrich und Günther Franz (geschrieben von seinem Sohn, dem Archivar Eckhart G. Franz), zum Rektor Karl Schmidt und den Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker sowie zu den bereits erwähnten Medizinern Otto Bickenbach, Eugen Haagen und August Hirt; auch die Straßburger Zeit der beiden elsässischen Wissenschaftler Adolphe Jung und Emile Rinck wird in deren Biographien erwähnt.43 Die erste (medizin)historische Forschungsarbeit an der 39
40 41 42
43
Abgedruckt in: Patrick J. Schaeffer: L’Alsace et l’Allemagne de 1945–1949, Metz 1976, S. 375f.; vgl. a. Anne Kwaschik: An der Grenze der Nationen. Europa-Konzepte und regionale Selbstverortung im Elsass, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 9 (3/2012), http://www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Kwaschik–3–2012; zuletzt abgerufen am 13.3.2016. Frédéric Hoffet zeigte in seiner „Psychanalyse de l‘Alsace“ für eine solche Haltung nur Unverständnis: „Quelle magnifique promesse pour une cité consciente de son destin! Quelle infidélité de la part des malheureux qui restèrent sourds devant cet appel à la grandeur!“; Hoffet: Psychanalyse (1951), S. 183. Literarisch verarbeitet wurde diese frühe „Europafeindlichkeit“ von Teilen der „Université de Strasbourg“ von Martin Graff: Von Liebe keine Spur. Das Elsaß und die Deutschen, München 1996, 24f. Empfehlungen der Konsultativversammlung des Europarates in Straßburg an den Ministerausschuß v. 8.8.–9.9.1949, Europa-Archiv 1949, S. 2580f. Victor Beyer: Etudiant à la Reichsuniversität, in: Saisons d‘Alsace 44 (114/1991–92), S. 213–218; ders.: über seine Erlebnisse als Zwangsrekrutierter: La fureur et le mépris. Souvenirs d’un ‘Malgré-nous’, Illkirch 2001. Hierzu: Ronald Hirlé (Hg.): Le Barabli: histoire d‘un cabaret bilingue, 1946–1992 / Textes de Germain Muller, Strasbourg 2007; Marc Lienhard: Méandres de la mémoire: les Alsaciens sympathisants et collaborateurs du régime nazi, in: Jean-Pierre Rioux (Hg.): Nos embarras de mémoire: la France en souffrance, Panazol 2008, S. 119–129, hier S. 121. Die betreffenden Artikel in der NDBA: Eckhart G. Franz: Art. Günther Franz (H. 11, S. 1013); Jean-Marie Schmitt: Art. Karl Schmidt (H. 33, S. 3475); Léon Strauss: Art. Carl Friedrich von Weizsäcker (H. 39, S. 4162); Robert Steegmann: Art. Otto Bickenbach (H. 43, S. 4484) und Art. Eugen Haagen (H. 45, S. 4651); Jacques Héran: Art. August Hirt (H. 16, S. 1599); François Joseph Fuchs: Art. Adolphe Michel Jung (H. 45, S. 4717); Ute Deichmann: Art. Emile Rinck
Das bedrückende Erbe der „Reichsuniversität Straßburg“
273
Abb. 9 „Université de Strasbourg“: Erinnerungsplakette an die konstituierende Sitzung der Beratenden Versammlung des Europarats im „Palais universitaire“ am 10.8.1949 (2007)
„Université de Strasbourg“ zur Geschichte der „Reichsuniversität Straßburg“ wurde 1991 veröffentlicht: „La Faculté de Medecine de la „Reichsuniversität Straßburg“ (1941–1945) à l’heure nationale-socialiste“ von Patrick Wechsler; sie blieb längere Zeit die einzige ausführliche wissenschaftliche Arbeit zum Thema.44 Mit den Vorträgen auf der internationalen Tagung an der Straßburger „Université Louis Pasteur“ von 1995, die allerdings erst zehn Jahre später zur Veröffentlichung kamen („La science sous influence“), und dem 2004 an der „Université Marc Bloch“ von Christian Baechler organisierten deutsch-französischen Kolloquium „Les Reichsuniversitäten de Strasbourg et de Poznan“ begann eine breitere Beschäftigung mit dem Thema.45 (H. 47, S. 4885). 44 Patrick Wechsler: La Faculté de Medecine de la „Reichsuniversität Straßburg“ (1941–1945) à l’heure nationale-socialiste, Strasbourg 1991, http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/1896/; zuletzt abgerufen am 13.3.2016 ; Wechsler Darstellung wurde 1997 durch einzelne Informationen im Gemeinschaftswerk von Jacques Héran: Histoire (1997), ergänzt. 45 Crawford: Science (2005); Baechler: Reichsuniversitäten (2005). An kleineren Monographien zur „Reichsuniversität Straßburg“ sind zu erwähnen: Horst Kant: Zur Geschichte der Physik an der Reichsuniversität Straßburg in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, Berlin 1997; FrankRutger Hausmann: Hans Bender (1907–1991) und das „Institut für Psychologie und Klinische Psychologie“ an der „Reichsuniversität Straßburg“ 1941–1944, Würzburg 2006 sowie: Catherine Maurer (Hg.): Une université nazie sur le sol français. Nouvelles recherches sur la
274
Rainer Möhler
Die zahlreichen Opfer der verbrecherischen Menschenexperimente der drei Straßburger Mediziner gerieten dagegen seit Kriegsende in Vergessenheit; lediglich beim ersten Nachkriegsprozess Ende 1952 vor dem Militärgericht in Metz fand ihr Schicksal Eingang in die französische, zum Teil noch deutschsprachige Lokalpresse. Bis heute gibt es weder im KZ Natzweiler-Struthof noch an den betreffenden Kliniken und Instituten im Bürgerspital eine Erinnerungsplakette, obwohl inzwischen durch neuere Forschungen Namen und nähere Todesumstände dieser Opfer erforscht worden sind.46 Die durch die alliierten Truppen im Keller der Anatomie im Bürgerspital vorgefundenen Leichen beziehungsweise Leichenteile der 86 Opfer der monströsen „Skelettsammlung“ des Anatomen Hirt waren zunächst im Oktober 1945 ohne weitere Zeremonie auf dem Friedhof in Straßburg-Robertsau in anonymen Gräbern beigesetzt worden; im September 1951 erfolgte auf Wunsch der Jüdischen Gemeinde ihre Umbettung in ein Gemeinschaftsgrab auf dem jüdischen Friedhof in StraßburgCronenbourg. Der Erinnerungstext auf der Stele benannte keinen Täter, sondern formulierte angesichts der Opfer, „morts après d‘atroces souffrances / ayant servi de cobayes humains“, lediglich die abstrakte Schuldanklage an eine „science du mal“.47 Die Umwidmung der Gedenkstätte des KZ Natzweiler-Struthof im Juli 1960 durch Staatspräsident Charles de Gaulle zur „Nécropole nationale“ der französischen Deportationsopfer ließ die jüdischen Opfer Hirts, die in der eigens dazu errichteten Gaszelle des Lagers ermordet worden waren, zur Nebensache werden; die offizielle Lagerbroschüre erwähnte 1964 nur kurz eine „affaire des corps israelites“, ohne jedoch näher darauf einzugehen. Erst 13 Jahre nach Einweihung des „MonumentMémorial“ erhielt das Gebäude mit der Gaszelle 1973 eine Informationsplakette, die allerdings keinen Bezug zu den Opfern Hirts herstellte.48 In Westdeutschland war zu diesem Zeitpunkt der jahrelang vom hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer vorbereitete Prozess gegen die Mitarbeiter Hirts bei der Selektion der Opfer im KZ Auschwitz mit einem skandalösen Urteil zu Ende gegangen: Das Landgericht Frankfurt am Main sprach 1971 den beteiligten Anthropologen Hans Fleischhacker von der Anklage frei, da ihm die Tötungsabsicht Reichsuniversität de Strasbourg (1941–1944), in: Revue d‘Allemagne et des Pays de langue allemande 43 (3/2011). 46 Florian Schmaltz: Otto Bickenbach et la recherche biomédicale sur les gaz de combat à la Reichsuniversität Straßburg et au camp de concentration Struthof-Natzweiler, in: Christian Bonah (Hg.): Nazisme, science et médecine, Paris 2007, S. 141–165; Raphaël Toledano: Les expériences médicales du professeur Eugen Haagen de la Reichsuniversität Strassburg: faits, contexte et procès d‘un médecin national-socialiste, Strasbourg 2010; Julien Reitzenstein: Himmlers Forscher. Wehrwissenschaft und Medizinverbrechen im „Ahnenerbe“ der SS, Paderborn 2014: zu Hirt insb. S. 105–169. 47 Die Inschrift lautete: „Ci-gisent / les corps de 86 juifs, hommes et femmes / amenés de divers camp de concentration / de l‘Europa orientale / au camp de Struthof / morts après d‘atroces souffrances / ayant servi de cobayes humains / au nom d‘une science du mal“, z. n. Serge Barcellini: Le gazage des 87 juifs au camp de Natzweiler-Struthof: les malaises de la mémoire, in: Annette Wieviorka (Hg.): La Shoah: témoignages, savoirs, oeuvres, Vincennes 1999, S. 317–345, 323. 48 „Ministère des Anciens combattants et Victimes de guerre: Chambre à Gaz du camp de concentration de Natzweiler-Struthof. Immeuble classé Monument historique“; z. n. ebd., S. 327f.
Das bedrückende Erbe der „Reichsuniversität Straßburg“
275
nicht bekannt gewesen sei, und verurteilte den Mitarbeiter des SS-Ahnenerbes Bruno Beger wegen Beihilfe zum Mord an 86 Menschen zu der Mindeststrafe von drei Jahren Freiheitsentzug.49 Der Frankfurter Prozess hatte aber die deutsche und internationale Öffentlichkeit erneut mit diesem Kapitel der deutschen Wissenschaftsgeschichte in der NS-Zeit konfrontiert, das bereits im Nürnberger Ärzteprozess 1946/47 und in der 1947 erschienenen Dokumentation von Alexander Mitscherlich und Fred Mielke dokumentiert worden war.50 In Frankreich stellten 1981 Serge Klarsfeld und JeanClaude Pressac das „Struthof Album“ zusammen, nachdem ihnen die zeitgenössische Anklageschrift des französischen Militärstaatsanwalts von 1952 gegen die Straßburger Mediziner zugespielt worden war, und in dem sie die schockierenden Fotodokumente der im Straßburger Anatomiekeller vorgefundenen Leichen beziehungsweise Leichenteile publik machten.51 Anhand der auf einem der Fotos identifizierbaren KZ-Häftlingsnummer „107.969“ konnte eines der Opfer Hirts, der Berliner Kaufmann Menachem Taffel (*28. Juli 1900 in Galizien, Österreich-Ungarn), namentlich identifiziert werden. Angesichts der zunehmenden Präsenz der französischen „Auschwitzleugner“ um Robert Faurisson und Paul Rassinier und der Erfolge der „Front national“ von Jean-Marie Le Pen52 wurde von verschiedenen Interessengruppen immer nachdrücklicher eine angemessene Erinnerung an die jüdischen Opfer Hirts gefordert: Sie erreichten, dass am 24. Mai 1989 eine Plakette auf der „mur du souvenir“ im KZ Natzweiler-Struthof angebracht wurde, die allerdings weder einen konkreten Täternamen nennt noch den rassistischen Charakter dieses Verbrechens hervorhebt und zudem den bei den bereits vorhandenen Erinnerungsplaketten verwendeten Begriff der „Camerades“ durch den distanzierteren des „Déportés“ ersetzt.53 49
50
51 52 53
Zum Prozess vor dem Landgericht Frankfurt: Christiaan F. Rüter (Hg.): Justiz und NSVerbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945–1966, Bd. 35, Amsterdam 2005, S. 199–253, sowie: Irmtrud Wojak: Das „irrende Gewissen“ der NS-Verbrecher und die deutsche Rechtsprechung. Die „jüdische Skelettsammlung“ am Anatomischen Institut der „Reichsuniversität Straßburg“, in: Fritz Bauer Institut (Hg.): „Beseitigung des jüdischen Einflusses...“. Antisemitische Forschung, Eliten und Karrieren im Nationalsozialismus, Frankfurt a. M. 1999, S. 101–130; vgl. a. aktuell Jens Kolata (Hg.): In Fleischhackers Händen: Wissenschaft, Politik und das 20. Jahrhundert. Katalog, Tübingen 2015. Alexander Mitscherlich und Fred Mielke (Hg.): Das Diktat der Menschenverachtung. Eine Dokumentation, Heidelberg 1947; die Verbreitung der ursprünglich von den westdeutschen Ärztekammern selbst in Auftrag gegebenen Dokumentation wurde von ihnen dann aktiv behindert; die Neuauflagen erfolgten seit 1949 unter dem geänderten Titel: Medizin ohne Menschlichkeit. Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses, Frankfurt a. M. 1949ff. – hierzu: Tobias Freimüller: Wie eine Flaschenpost. Alexander Mitscherlichs Dokumentation des Nürnberger Ärzteprozesses, in: Zeithistorische Forschungen / Studies in Contemporary History 7 (1/2010), http://www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Freimueller–1–2010; zuletzt abgerufen am 13.3.2016. Jean-Claude Pressac (Bearb.), Serge Klarsfeld (Hg.): The Struthof Album: Study of the Gassing at Natzweiler-Struthof of 86 Jews Whose Bodies were to Constitute a Collection of Skeletons; a Photographic Document, New York 1985. Hierzu: Henry Rousso: Unter Negationisten. Die Wurzeln der Holocaust-Leugnung in Frankreich, in: ders.: Frankreich und die „dunklen Jahre“. Das Regime von Vichy in Geschichte und Gegenwart, Göttingen 2010, S. 26–63. „Au mois d‘août 1943/87 déportés juifs en provenance du camp d‘Auschwitz, dont 30 femmes furent exterminés dans la chambre de gaz du Struthof dans l‘unique but de constituer, à
276
Rainer Möhler
Abb. 10 KZ Natzweiler-Struthof: Gesamtansicht der „mur du souvenir“ und Erinnerungsplakette Abb. 11
Cercle Menachem Taffel: Veranstaltungsankündigung zur NS-Medizin (1993)
Es ist dem zivilgesellschaftlichen Engagement des 1997 gegründeten „Cercle Menachem Taffel“ um den Straßburger Psychiater Georges Federmann und den Forschungen des deutschen Journalisten Hans Joachim Lang zu verdanken, dass die 86 Opfer der Skelettsammlung des Anatomen Hirt wenigstens ihren Namen und ihre Biographie zurückbekamen. In einer beeindruckenden historisch-detektivischen Suche gelang es Lang Anfang der 2000er Jahre, anhand der zeitgenössisch bereits vom elsässischen Labormitarbeiter Hirts, Henri Henrypierre, auf eigene Initiative und unter Lebensgefahr notierten KZ-Nummern die Lebenswege der jüdischen, überwiegend aus Griechenland nach Auschwitz deportierten Opfer nachzuzeichnen.54 Gegen den zähen und langwierigen Widerstand von Stadt und Universität konnte der „Cercle“ schließlich durchsetzen, dass seit dem 11. Dezember 2005 am Anatomiegebäude im Bürgerspital an diese Opfer erinnert wird. Die gewählte Formulierung lässt das Bemühen erkennen, trotz des „gemeinsamen“ Erinnerungsortes der Straßburger Anatomie jede Verwechslung zwischen der Täterschaft der „Reichsuniversität Straßburg“ und dem jetzigen „Eigentümer“, der damals evakuierten „Université de Strasbourg“, zu verhindern; der „Cercle Menachem Taffel“ als der l‘initiative d‘un professeur de médecine nazi une collection anatomique. / Ce crime contre l‘Humanité rappelle et prolonge le tragique destin des millions de juifs morts dans les autres camps de concentration“ z. n. Barcellini: Gazage (1999), 330f. 54 Lang: Namen (2004); ders.: Retrouver la mémoire. Les noms derrière les chiffres: biographies de victimes de la recherche biomédicale à Strasbourg entre 1941 et 1945, in: Bonah: Nazisme (2007), S. 195–208.
Das bedrückende Erbe der „Reichsuniversität Straßburg“
277
Abb. 12 Buchumschlag der Veröffentlichung von Lang: Namen (2004).
eigentliche und hartnäckige Initiator wurde und wird im Gegensatz zu den für die Anbringung verantwortlichen politischen Beamten und Vertretern der „Université de Strasbourg“ nicht erwähnt: „En mémoire / des 86 victimes juives assassinées en 1943 au Struthof / par August Hirt, professeur à la Reichsuniversität nazie de Strasbourg. / La Faculté de Médecine francaise de Strasbourg annexé était répliée à Clermont-Ferrand. / Souvenez-vous d‘elles / pour que jamais plus la médecine ne soit dévoyée“. Am selben Tag wurde auf dem jüdischen Friedhof in Straßburg-Cronenbourg der neue Grabstein eingeweiht, auf dem jetzt die Namen der 86 jüdischen Opfer festgehalten sind – deutsche Vertreter von Staat, Medizin und Hochschulen hatten trotz Einladung weder an der feierlichen Enthüllung der Plakette noch an der Einweihung des neuen Grabsteins auf dem jüdischen Friedhof teilgenommen.55 Am 12. Mai 2011 weihte der Straßburger Bürgermeister Roland Ries den „Quai Menachem Taffel“ am Bürgerspital ein, der zuvor den Namen von „Louis Pasteur“ getragen hatte. Zwei Jahre zuvor war mit der Zusammenlegung der drei nach dem In-Kraft-Treten des französischen Hochschulgesetzes vom November 1968 aufgeteilten Straßburger Universitäten zur nunmehr wieder einzigen „Université de 55
Hans-Joachim Lang: August Hirt and “extraordinary opportunities for cadaver delivery” to anatomical institutes in National Socialism: A murderous change in paradigm, in: Annals of Anatomy – Anatomischer Anzeiger 195 (2013), S. 373–380; die Artikel von Georges Federmann finden sich auf der Website des “Cercle Menachem Taffel” unter http://judaisme.sdv.fr/histoire/ shh/struthof/taffel.html; zuletzt abgerufen am 22.12.2015.
278
Rainer Möhler
Abb. 13 Erinnerungsplakette am Anatomischen Institut der „Université de Strasbourg“ im Bürgerspital (2007)
Strasbourg“ zum Jahresbeginn 2009 ein weiteres sperriges Kapitel der elsässischen Zeit- und Erinnerungsgeschichte zu Ende gegangen: Die Mitte der 1990er Jahre offen und verdeckt geführte Debatte um die Benennung der „Université de Strasbourg II - Sciences humaines“, der alten „Faculté des Lettres“, mit dem Namen des als Résistance-Kämpfers erschossenen jüdischen Historikers Marc Bloch: Während die Namensgebung mit Louis Pasteur („Université de Strasbourg I – Science“) in der ersten Hälfte der 1970er Jahre erfolgt war, und das Benennungsverfahren mit Robert Schuman („III - Juridiques, politique, sociale“) 1987 abgeschlossen werden konnte, dauerte es bis 1998, dass auch die „Université de Strasbourg I“ im „Palais universitaire“ ihren Namen mit Marc Bloch erhielt, „après une première tentative polluée par une campagne de haine“.56 Sowohl die Geschichte der „Reichsuniversität Straßburg“ als auch die der evakuierten „Université de Strasbourg“ muss noch wissenschaftlich erforscht und geschrieben werden.57 Mit der rechtshistorischen Dissertation von Herwig Schäfer (1999) und der bislang unveröffentlichten medizinhistorischen „Thèse“ von Raphaël Toledano von 2010 zum Straßburger Hygieniker Eugen Haagen, seinen vielfältigen Forschungsgebieten und verbrecherischen Menschenexperimenten im KZ NatzweilerStruthof, liegen aktuell zusammen mit der Dissertation von Patrick Wechsler erst drei größere Monographien zu Teilgeschichten der deutschen „Reichsuniversität 56 Hierzu: Bischoff, Kleinschmager: Université (2010), S. 133–135. 57 Dasselbe gilt auch für die übrigen Zeitabschnitte der „Université de Strasbourg“ im 20. Jahrhundert: „Pour la période contemporaine, l‘inventaire reste à faire. On ne dispose pas encore des instruments de travail nécessaires. La mémoire intellectuelle de l‘université est dispersée à l‘extrême, dans les différentes composantes et dans leurs bibliothèques“: ebd., S. 293.
Das bedrückende Erbe der „Reichsuniversität Straßburg“
279
Straßburg“ vor.58 Geschichte und „Erinnerungsarbeit“ werden allerdings nicht nur von den „professionellen“ Historikern betrieben, wie das Beispiel der Aufklärungsarbeit über die Opfer der Skelettsammlung durch den Journalisten Lang eindrucksvoll zeigt: Im April 2013 wurde die französische Dokumentation „Au nom de la race et de la science, Strasbourg 1941–1944“ in Rothau, der für das KZ Natzweiler-Struthof zuständigen Bahnstation, uraufgeführt; als wissenschaftlicher Berater diente der elsässische Historiker Robert Steegmann, der 2005 seine umfangreiche Straßburger „Thèse“ („Université Marc Bloch“ 2003) zum KZ Natzweiler-Struthof, dem einzigen deutschen Konzentrationslager auf französischem Boden, veröffentlicht hatte.59 Ein Jahr später erschien 2014 die Dokumentation „Le Nom de 86“ (dora films) bei der Raphaël Toledano mitgewirkt hatte.
Abb. 14 Pressemappe der Film-Dokumentation „Au nom de la race“ (2014)
Herwig Schäfer: Juristische Lehre und Forschung an der Reichsuniversität Straßburg 1941–1944, Tübingen 1999; Toledano: Expériences (2010); vgl. a. Frank-Rutger Hausmann: Reichsuniversität Straßburg, in: Ingo Haar (Hg.): Handbuch der völkischen Wissenschaften: Personen, Institutionen, Forschungsprogramme, Stiftungen, München 2008, S. 578–584. 59 Robert Steegmann: Struthof: Le KL-Natzweiler et ses kommandos: Une nébuleuse concentrationnaire des deux côtés du Rhin 1941–1945, Strasbourg 2005; zur 130-Jahr-Feier des Kollegiengebäudes / „Palais universitaires“ vgl. die Website der „Université de Strasbourg“: http://130anspalaisu.unistra.fr/; zuletzt abgerufen am 22.12.2015. 58
280
Rainer Möhler
Abb. 15 „Université de Strasbourg“: „Palais universitaire“, Kollegiengebäude (2014)
Die (Wieder)Anbringung der beiden Figuren „Argentina“ und „Germania“ am Straßburger „Palais universitaire“ anlässlich des 130-jährigen Jubiläums des Kollegiengebäudes 2013, die in den Tagen des Waffenstillstandes im November 1918 von ihren Sockeln gestürzt worden waren, könnte vielleicht ein Zeichen sein, dass sich künftig auch die deutsch-französische Erinnerung an die NS-Zeit im Elsass endlich annähert – bis dahin bleibt die Universität Straßburg ein „Historischer Ort“ mit „zweierlei Erinnerung“; ein „Historischer Ort“, dessen universale Bedeutung als Symbol für die potentielle verbrecherische Dimension einer von ethischen Werten entblößten Wissenschaft entdeckt und erhalten werden sollte.
DI E A LT E F R A N K F U RT ER U N I V ERSI TÄT U N D DI E EU ROPA-U N I V ERSI TÄT – ER I N N ERU NG A L S EI N V ERSUCH Z U R I DE N T I TÄTSBI LDU NG Ulrich Knefelkamp Bei der Anfrage aus Jena, ob ich etwas zum Thema ambivalente Orte der Erinnerung an deutschen Universitäten beitragen kann, stellte sich mir die Frage, wie viel Erinnerungsorte, Rituale und Bereitschaft benötigt man, um eine identitätsstiftende Erinnerung herzustellen und zu erhalten? Daher geht es bei mir nicht um Orte an der Universität, sondern die Universität als Institution ist der Ort der ambivalenten Erinnerung. Hintergrund dafür ist, dass die Europa-Universität Viadrina 1991 als Nachfolgerin der alten Frankfurter Universität wieder begründet wurde. Schon im Namen erhielt sie wieder die alte Funktion als Brücke über die Oder zwischen dem westlichen und östlichen europäischen Raum. Es gelang aber trotz dieser Vorgabe nicht, eine Erinnerungskultur aufzubauen. Dieses Rätsel stelle ich gern der ExpertInnenrunde zur Diskussion vor. H ISTOR ISCH ER Ü BE R BLICK: Um 1500 endete die Phase der von Landesherren als Bildungsinstitutionen für Fachleute und Verwaltungsträger gegründeten Universitäten vor Reformation und Gegenreformation. Die 1502 gegründete Universität Wittenberg entwickelte sich zu der Hochburg der Reformation, die 1506 gegründete Universität in Frankfurt (Oder) wurde ihr katholischer Gegenpartl.1 Sie war nach dem Vorbild der Leipziger Universität organisiert und wurde mit dem größeren Anteil der Lehrenden von dort besetzt, das gilt auch für den Rektor, den Theologen Konrad Wimpina. Im ersten Jahr hatte sie mit etwa 930 Studenten die höchsten Anfängerzahlen von allen deutschen Universitäten. Es entstanden die vier klassischen Fakultäten: Theologie, Jura, Medizin und Artisten-Fakultät. Nach dem vom Landesherrn verordneten Übergang zum Luthertum (1539) erfolgte der Erlass, dass alle Pfarrer, Prediger, Schulmeister, Schreiber und etwas später Kapläne, Ärzte, Kantoren und Schuldiener ihre Ausbildung an der Viadrina absolviert haben sollten. An der Frankfurter Universität lehrte z. B. Professor Georg Sabinus, Schwiegersohn Melanchthons, der u. a. dessen Gedankengut als Gründungsrektor 1544 an die neue Universität in Königsberg brachte. 1613 gab es eine neue Kehrtwende, man musste dem Landesherrn beim Übertritt zum reformierten Glauben folgen. Da weiterhin lutherische Professoren tätig waren, wird dies als eine besonders tolerante Phase hervorgehoben. In der Zeit der Aufklärung entstanden u. a. enge Verbindungen zwischen der neuen Universität Halle und der Frankfurter Universität. Ein bekanntes Beispiel ist Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–1762), der als Professor für „Weltweisheit“ von 1
Zur Geschichte der Viadrina vgl. den kurzen, aber eindrucksvollen Band zu 500 Jahre Gründung der alten Viadrina von Irina Modrow: Wonach in Frankfurt „jeder, der nur wollte, gute Studien machen konnte...“, Schöneiche b. Berlin 2006.
282
Ulrich Knefelkamp
Halle nach Frankfurt (Oder) beordert wurde und dort seine berühmte „Aesthetica“ veröffentlichte. Zum Studium kam Christian Thomasius (1655–1728) von Leipzig nach Frankfurt und war anschließend als Dozent an der Universität Halle tätig. Professor Joachim Georg Darjes (1714–1791) verband die Universitäten Frankfurt und Jena. Um 1800 kam es infolge Industrialisierung und der Auswirkungen der französischen Revolution auch zu einer Neustrukturierung des Bildungssystems und seiner Einrichtungen für das erstarkende Bürgertum.2 Im Jahr 1810 wurde von fortschrittlich denkenden Kräften wie Wilhelm von Humboldt die Friedrich Wilhelm Universität als Reformeinrichtung in der Hauptstadt Berlin gegründet. Angesichts der Nähe zu Berlin und finanzieller Probleme der Frankfurter Universität und der noch nicht ausgebauten Hochschule Leopoldina in Breslau (1701) wurde beschlossen, die Frankfurter Universität nach Breslau zu verlegen und so eine Volluniversität dort zu installieren. Am 19. Oktober 1811 wurde die vereinigte Breslauer Universität eröffnet, erst am 21. Februar 1816 erhielt die „Universitas litterarum Viadrina Wratislaviensis“ ihre Statuten. Die Universität verschwand aus der Stadt Frankfurt, die Gebäude wurden anders genutzt, das Hauptgebäude als Heu- und Strohmagazin für militärische Zwecke, wobei man im Obergeschoss noch die Bibliothek eines verstorbenen Lehrers (Westermannsche Bibliothek) finden konnte. Von 1824–1911 befand sich die Oberschule, das spätere Realgymnasium darin, das dann in eine Volksschule als Georgenschule umgewandelt wurde. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude zwar relativ wenig beschädigt, man ließ es aber verfallen. Am 20. Dezember 1962 wurde das Gebäude gesprengt, wodurch die Universität nun auch baulich aus dem Stadtbild gelöscht wurde. Es ist bezeichnend, dass mit der politischen Wende, noch vor dem Jahresende 1989, engagierte Bürger der Stadt Frankfurt (Oder) Gedanken von der Wiederbelebung der alten brandenburgischen Landesuniversität formulierten und veröffentlichten.3 Darauf erfolgte im Oktober 1990 die Begründung des Vereins der Freunde und Förderer der Frankfurter Oder-Universität e. V. Schon am 6. 12. 1990 wurde der Antrag auf Errichtung einer neuen Universität in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht und beschlossen. Daraufhin eröffnete die Stadt am 1. Januar 1991 ein Gründungsbüro mit dem Beauftragten Jürgen Grünberg und am 24. Mai 1991 wurde der Gründungssenat mit Gründungsrektor Knut Ipsen an der Spitze vom Wissenschaftsminister Hinrich Enderlein eingesetzt. Am 15. Juli 1991 fand die Gründung der Europa-Universität als Reformuniversität statt, die auf Wunsch der beteiligten Frankfurter in Anlehnung an die Vorgängerin den Namen Viadrina4 zusätzlich erhielt. Eine Wunde im kulturellen Gedächtnis war geschlossen! 2 3
4
Vgl. den aus einer Tagung resultierenden Band von Reinhard Blänkner (Hg.): Europäische Bildungsströme. Die Viadrina im Kontext der europäischen Gelehrtenrepublik der frühen Neuzeit 1506–1811, Schöneiche b. Berlin 2008. Über die folgende turbulente Phase berichten Zeitzeugen wie Manfred Stolpe, Wolfgang Pohl, Hinrich Enderlein, Anke Brunn, Hans N. Weiler und Knut Ipsen in: Ulrich Knefelkamp (Hg.): „Blütenträume“ und „Wolkenkuckucksheim“ in „Timbuktu“. 10 Jahre Europa-Universität Viadrina, Berlin 2001. Der Titel versinnbildlicht, welche hochfliegenden Pläne man an einem Ort in einer „akademischen Wüste“ zu der Zeit hatte. Auskunft von Stadtarchivar Targiel: Professor Jodokus Willich verwandte in seinem Druck „Problema de Ebriorvm...“ 1543 den seiner Meinung nach ursprünglichen Namen der Oder
Die alte Frankfurter Universität und die Europa-Universität
283
Die wieder begründete Frankfurter Universität hatte dabei das spezielle Konzept einer Europa-Universität auf deutsch-polnischer Basis mit 30 Prozent polnischen Studierenden, und die alte Brückenfunktion des 16.–19. Jahrhunderts sollte aufgenommen werden, mit weiter Öffnung nach Europa und in die Welt. Eine Universität auf „kleiner Flamme“ mit den „preiswerten“ Studienfächern, Kulturwissenschaften, Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften sollte eingerichtet werden. Demgegenüber hatte man in Frankfurt andere Vorstellungen. Man erwartete, dass viele qualifizierte Fachkräfte des zusammengebrochenen Halbleiterwerks in Forschungsbereichen der neuen Universität untergebracht werden konnten. Der Versuch des Gründungssenats, zu diesem Zweck ein neues Fach wie Wirtschaftsphysik einzurichten, scheiterte. Es kam nur dazu, dass einige Mitarbeiter des Halbleiterwerks in der Verwaltung der Universität untergebracht werden konnten.5 Auch die Erwartung, dass das akademische Personal wirtschaftlichen Aufschwung als Steuerzahler und Verbraucher in die Stadt bringen würde, wurde nicht erfüllt. Unter anderem lag das anfangs an mangelnden adäquaten Wohnungen und Bildungseinrichtungen und daran, dass viele Berliner berufen wurden und die Nähe zu der Metropole Berlin das Pendeln ermöglichte. Dasselbe gilt für die Studierenden. Günstige Wohnungen waren schwer zu bekommen, ein großer Teil wohnte am Anfang in Studentenwohnheimen auf beiden Seiten der Oder. Aber mit zunehmender Zahl der Studierenden und vor allem durch das Semesterticket kam es dazu, dass später der größere Teil der Studierenden im attraktiveren Berlin wohnte – trotz der Zeit raubenden Pendelei, aber mit mehr Möglichkeiten für Jobs. So konnte sich keine von Dozierenden und Studierenden geprägte lebendige Kultur in der Stadt weitflächig ausbreiten. Diese Unverbundenheit von Studierenden und Lehrenden mit Stadt und Universität könnte einer der Gründe sein, warum man sich kaum mit der Geschichte der Universität verbindet beziehungsweise identifiziert. WAS IST A N M AT ER I E L L E M ER BE SICH T BA R? Das Collegiengebäude als Hauptgebäude wurde wie beschrieben 1962 gesprengt.6 Eine versteckte Gedenkmauer mit Relief-Bildnissen von Walter Kreisel (1984) von Professoren,7 einem alten Siegel und einer Abbildung des Hauptgebäudes sowie ein
5
6 7
(Druckort: Francofordij cis Viadrum). Seiner Meinung nach hieß die Oder so in der ptolemaeischen Geographie. Nach heutigem Forschungsstand der historischen Geographie irrte hier aber Willich.- „Viadrina“ = die an der Oder gelegene verselbstständigte sich im Laufe der Jahrhunderte immer mehr, ohne nach heutiger Kenntnis jemals offizieller Name der Frankfurter Universität gewesen zu sein; nie war er auf den Siegeln der Universität oder der Fakultäten. Aber er tauchte in offiziellen eigenen Drucksachen der Universität im 18. Jahrhundert auf. Knut Ipsen: Erwartungen-Visionen-Hoffnungen, in: Knefelkamp: „Blütenträume“ (2001), S. 31 und ders.: Die Wiedergeburt der Viadrina, in: Robert Pyritz, Matthias Schütt (Hg.): Die Viadrina. Eine Universität als Brücke zwischen Deutschland und Polen, Berlin 2009, S. 47–58. Ulrich Knefelkamp: 20 Jahre Europa-Universität Viadrina, in: Jahresbericht des Fördervereins zur Erforschung der Geschichte der Viadrina Nr. 6 (2011), S. 102–110. Vgl. Ralf-Rüdiger Targiel: Zur Geschichte des Großen Collegienhauses der Viadrina, in: UNIon 50 (8/2006), S.32f. Dort sind Porträt-Medaillons von: Schurff, Hieronimus (1481–1554) – Prof. Jura – Rechtsberater
284
Ulrich Knefelkamp
Weg „An der Alten Universität“ in den Innenhof der dafür errichteten Plattenbauten und eine Haltestelle der Straßenbahn „An der Alten Universität“ erinnern an dieses Gebäude und seinen Standort. Es gibt einen Abguss des alten Portals aus dem späten 17. Jahrhundert im Magazin des Regionalmuseums Viadrina. Vis-à-vis des Standorts der alten Universität führt die Collegienstraße zum Bereich um das ehemalige Franziskanerkloster (heute Konzerthalle), das im 16. Jahrhundert an die Universität übertragen wurde. Dort waren die Mensa und der Karzer. Hier ist noch das Stadtarchiv untergebracht, in dem man Nachlässe, Professorenporträts und andere Quellen zur Universitätsgeschichte finden kann. Das regionale Viadrina Museum mit umfangreichen Objekten zur alten Universität ist im „Studentenwohnheim“ der Söhne der adeligen Familien (Junkerhaus) mit eigenem Reitstall untergebracht. Die größte Kirche war die Marienkirche, die nach dem Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger als Ruine bestand, nur die Sakristei hatte ein Dach, sie wurde nach der Wende aufwändig restauriert. Hier fanden alle Festlichkeiten der alten Universität u. a. die Promotionsfeiern statt. W E L CH E GEBÄU DE U M FASST DI E EU ROPA-U N I V ERSI TÄT H EU T E? Das sogenannte Hauptgebäude wurde als Sitz des Regierungspräsidiums im wilhelminischen Barock um 1900 gebaut und ging von der Bezirksverwaltung zur Zeit der DDR über ein gemischtes Behördenhaus mit u. a. Finanzamt und Landbauamt Zug um Zug an die Universität über. Ein Namenszug „Universitas Viadrina“, den es ja nie gegeben hat, täuscht geschichtliche Kontinuität vor und soll wohl identitätsbildend sein. Hinter dem Gebäude der Bezirksverwaltung stand die Bezirksparteischule. Im Bettenhaus wurde nach der Wende ein Kongresshotel untergebracht und im Seminarhaus zog nach und nach die Universität ein. Das Hotel ging in Konkurs und wurde vom Studentenwerk zu Studierendenwohnheim und Mensa umfunktioniert. Das Seminarhaus wurde aufwändig entkernt und zu einem modernen Gebäude mit Audimax, Seminar- und Büroräumen als Auditorium Maximum umgebaut. Hinter und rechts von dem großen Wohnturm wurde auf einem ehemaligen Fabrikgelände am neuen Europaplatz ein neues Vorlesungs- und Mensagebäude mit Atrium errichtet (2002), das nach Gräfin Dönhoff benannt wurde, die ihren 90. Geburtstag an dem symbolischen Brückenort der Europa-Universität feierte. Neu dazugekommen sind 2013 und 2014 nach der Sanierung das ehemalige Logenhaus der Loge „Zum aufrichtigen Herzen“ und ein Gebäude aus der DDR-Zeit auf dem Hof des Logenhauses als Informations- und Medien Zentrum. Nicht weit davon steht das alte neogotische Postgebäude, von dem ein Teil von der Universität angemietet ist. Martin Luthers in Worms; Sabinus, Georg (1508–1560) – Prof. Philosophie; Willich, Jodokus (1501–1552) – Prof. Medizin, Philosophie, Rektor – Gruender der Singakademie; Pelargus, Christof (1565–1633) – Prof. Theologie, Philosophie – Kalendermacher; Daries, Joachim-Georg (1714–1791) – Prof. Jura, Philosophie, Rektor; Beckmann, Joh.-Christof (1641–1717) – Prof. Philosophie, Theologie, Sprachwissenschaft – Geschichtsschreiber (Namensschreibweise der Inschriftentafel beibehalten).
Die alte Frankfurter Universität und die Europa-Universität
285
Abb. 1 Erinnerungsmauer an die alte Frankfurter Universität von 1984
Abb. 2 Erinnerungsmauer von 1984 Collegiengebäude
Als zweiter Standort wurden in der August-Bebel-Straße Gebäude der gelben Kaserne, der ehemaligen Hindenburgkaserne (1878–91 erbaut), für Zwecke der Universität, jetzt vor allem Sprachenzentrum, in den Jahren 1994–98 verändert. Der Hauptteil der Universität ist in der Stadt in älteren und historischen Gebäuden und befindet sich in der Nähe der Oder, auf der anderen Seite der Brücke teilt sich die Europa-Universität das neu erbaute Collegium Polonicum (1998) mit der AMU Posen als Lehr- und Forschungsgebäude.
286
Ulrich Knefelkamp
Abb. 3 Erinnerungsmauer Portalnachahmung
Abb. 2 Erinnerungsmauer für den Historiker Prof. Dr. Johann Christoph Beckmann
Die alte Frankfurter Universität und die Europa-Universität
287
I DE N T I TÄT DU RCH ER I N N E RU NG? Um die Erinnerung an die alte Frankfurt Universität und ihre Leistungen aufrecht zu erhalten und so eine Identität mit ihr aufzubauen, wurden von mir 1997 der Förderverein zur Erforschung der Geschichte der Viadrina (FEGV) und die Forschungsstelle für vergleichende Universitätsgeschichte gegründet. Zu den Mitgliedern des Vereins zählten u. a. der Gründungskanzler der EUV und der Gründungsdekan der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Kollegen der kulturwissenschaftlichen, der rechtswissenschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und einzelne Mitarbeiter und Doktoranden. Als wichtige Verbindung zur Stadt übernahmen der Stadtarchivar und der Vizedirektor des Viadrina Museums Positionen im Vorstand. Der Verein gibt seit 1998 ein Jahrbuch und einige Sonderveröffentlichungen heraus. So erschien zum 10jährigen Bestehen der neuen Universität im Jahr 20018 der genannte Band „Blütenträume“ und „Wolkenkuckucksheim“ in „Timbuktu“, der im wesentlichen Beiträge von Personen enthält, die bei der Gründung oder den Anfängen der Universität dabei waren und so Erinnerung transportierten. Es konnte ein erstes umfangreiches Fazit zum Erfolg der Wiedergründung gezogen werden, das Identität mit der Europa-Universität aufbaute. Im neu gebauten Hörsaalgebäude (2002), dem Gräfin-Dönhoff-Gebäude, wurden auf Initiative von Uwe Scheffler, Strafrechtsprofessor und Vereinsmitglied, einige Hörsäle mit Schildern der Namen von Professoren der alten Universität versehen. Das Jahr 2006 bot Gelegenheit, sich umfassend mit der Geschichte der alten Universität zu befassen, die vor 500 Jahren gegründet worden war. Leider zeigte sich auch hier das geringe Bewusstsein für die große Tradition. Es gab einige Feierlichkeiten und Feste, auch zu 15 Jahre Europa-Universität. Eine Briefmarke zu „500 Jahre Gründung“ wurde gedruckt, das gesamte Briefpapier etc. der EUV erhielt ein neues Corporate Design. Eine geringe Aufarbeitung der Geschichte fand nur am Rand dank der Aktivitäten des Verfassers und des Vereins statt. So gab es erstmalig einen kurzen Überblick über die Geschichte der alten Universität von Irina Modrow.9 Mit Unterstützung von Kulturland Brandenburg wurde eine CD aufbereitet, auf der die Gebäude der alten Universität aus Grundrissen hochgerechnet und rekonstruiert wurden und mit Lebensläufen von Professoren und Studenten gefüllt wurden. Hier konnte man am PC durch die Stadt und zu den Gebäuden laufen, dadurch wurde die alte Universität durch Gebäude und Personen greifbar.10 Außerdem wurde eine Ringvorlesung zum brisanten Thema „Universität und Stadt“ organisiert, die hauptsächlich von Publikum aus der Stadt besucht wurde, während sich auch ein oder zwei Kolleg/innen der Universität dorthin verliefen. Einige Texte, darunter auch von Kollegen aus Jena, wurden veröffentlicht.11 8 9 10 11
Vgl. Anm. 3. Irina Modrow: Wonach in Frankfurt, Schöneiche b. Berlin 2006. Thomas Jaeger, Ulrich Knefelkamp (Hg.): Virtualität oder Realität? Die alte Viadrina im Frankfurter Stadtbild, Frankfurt (Oder) 2006 (CD ROM). Ulrich Knefelkamp (Hg.): Universität und Stadt. Ringvorlesung zum 500. Jubiläum der Gründung der Universität Frankfurt, Schöneiche b. Berlin 2007. Darin der Beitrag zur Erinnerung: Joachim
288
Ulrich Knefelkamp
Eine Initiative des Rotary Clubs hatte vor allem die neue Universität im Focus, aber der Verfasser durfte auch einen Beitrag zur Geschichte der alten Universität beisteuern.12 Das Jahr 2011 war wieder ein Jubeljahr mit 20 Jahre Europa-Universität und Feierlichkeiten; gleichzeitig aber auch die 200-Jahr-Gedenkfeier der Auflösung der alten Universität (1811) und der Zusammenführung der Frankfurter Universität mit der Breslauer Hochschule. Das wurde in Breslau großartig und umfassend gefeiert. An der Europa-Universität hielt der Verfasser einen Vortrag zur Auflösung von 1811, der von Frankfurter Publikum besucht wurde und nur zwei Kollegen aus der Universität. Der Förderverein gab ein Jahrbuch dazu heraus. Im Sommer 2014 fand anlässlich des 300. Geburtstages zur Würdigung des berühmten Professors Baumgarten eine wissenschaftliche Tagung „Schönes Denken – Baumgartens Epoche (1714/2014)“ unter der Leitung von Andrea Allerkamp und Reinhard Blänkner und Jan C. Joerden, zwei Mitgliedern vom Förderverein, statt. In der Öffentlichkeit veranstaltete der Förderverein einen Vortrag von Ulrike Lötzsch (Jena) über die bildungsreformerischen Bestrebungen von Professor Joachim Georg Darjes (1714–91) – ebenfalls 300 Jahre nach dessen Geburtstag.13 Ihn besuchten acht Vereinsmitglieder. Neben diesen Veranstaltungen und Veröffentlichungen wurden weitere Versuche zur Bildung einer Erinnerungskultur vorgenommen. Beim Verfasser wurden drei Doktorarbeiten zur alten Universität abgefasst: Andrea Lehmann zur Berufungspolitik an der philosophischen Fakultät, Claudia Link zum Studium der Medizin, Siegbert Rummler zu Medizinischen Dissertationen.14 Als DFG-Projekt wurde erstmalig mit einem polnischen Partner, der Universitätsbibliothek der Universität Breslau, die Digitalisierung und Erschließung ausgewählter Bestände an alten Drucken und Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Frankfurt durchgeführt. Die Ergebnisse kann man heute im Internet sehen und lesen.15 Seit Mitte der 90erJahre beschäftigt sich die Professur des Verfassers mit der Bauer, Stefan Gerber: „Gaudeamus igitur“ – Universitäre Selbstdarstellung Frankfurt an der Oder und Jena im Vergleich, S. 119–156. 12 Ulrich Knefelkamp: Die alte Viadrina (1506–1811). Ein Rückblick auf ihre Geschichte, herausragende Professoren und Studenten, in: Pyritz, Richard, Schütt, Matthias (Hg.): Die Viadrina. Eine Universität als Brücke zwischen Deutschland und Polen, Berlin 2009, S.29–42. 13 Ulrike Lötzsch: Joachim Georg Darjes (1714–1791), Köln, Weimar 2016, Andrea Allerkamp, Dagmar Mirbach (Hg.): Schönes Denken. Baumgarten im Spannungsfeld zwischen Ästhetik, Logik und Ethik, Hamburg 2016. 14 Andrea Lehmann: Brandenburg-preußische Berufungspolitik in den Frühen Neuzeit (1640– 1740). Initiation des modernen Berufungsverfahrens unter besonderer Berücksichtigung der philosophischen Fakultäten der Universitäten in Frankfurt (Oder), Königsberg, Duisburg und Halle. Diss. phil. Frankfurt (Oder) 2012. Als Buch: dies.: Können und Kennen: Reformen der Brandenburg-preußischen Reformpolitik in der Frühen Neuzeit, 2014; Anna Claudia Link: Das Studium der Medizin an der brandenburgisch-preußischen Universität Viadrina während ihrer letzten Frankfurter Phase, Frankfurt (Oder), Diss Phil. Frankfurt (Oder) 2005. Siegbert Rummler: Medizinische Dissertationen. Ein Beitrag für die Gesundheitliche Volksaufklärung in Brandenburg-Preußen? Schöneiche b. Berlin 2007. 15 Vgl. http://viadru.euv-frankfurt-o.de/cdm/search/collection/viadru; zuletzt abgerufen am 18.2.2016.
Die alte Frankfurter Universität und die Europa-Universität
289
Abb. 5 Hauptgebäude der Europa-Univeristät Viadrina, ehem. Bezirksregierung
Bestandsgeschichte und der Erfassung der Kirchenbibliothek St. Marien, die in der Gertraudenkirche in Frankfurt (Oder), in einem abgesicherten und klimaüberwachten Bereich aufbewahrt wird. Der seltene und wertvolle Bestand ist bisher noch nicht professionell erschlossen worden und in der Forschung und Fachwelt nahezu unbekannt. Unter den insgesamt 770 Titeln befinden sich neben Theologica schwerpunktmäßig Brandenburgica und sogar zeitgenössische Lutherdrucke. Der größte Teil des ProfanaBestands setzt sich aus einer übernommenen Gymnasialbibliothek mit ca. 200 Titeln
290
Ulrich Knefelkamp
aus dem 16.–20. Jahrhundert mit interdisziplinären Fachgebieten zusammen, die dem Profil der drei Fakultäten der Universität entsprechen. Sehr informativ dürften darüber hinaus auch akademische Einladungsschriften aus Frankfurt (Oder) sein, die vorwiegend aus dem 17. Jahrhundert stammen. Diese wertvollen Quellen über das akademische Leben der Universitätsstadt im 17. Jahrhundert könnten nahezu einzigartig sein. In geringerer Anzahl sind auch Leichenpredigten erhalten. Hier sind Impulse und neue Erkenntnisse nach Auswertung dieser Quellengattung über bedeutende Persönlichkeiten zu erwarten. Dieser regional bedeutsame Bestand soll nun erstmals in enger Kooperation zwischen der oben genannten Professur und der Universitätsbibliothek fachgerecht digitalisiert, erschlossen, präsentiert und für Forschung und Lehre sowie die interessierte Öffentlichkeit im Lesesaal der Universitätsbibliothek und über das Internet bequem und einfach zugänglich gemacht werden. Damit endet die Reihe der nicht vollständigen Aufzählung von Projekten, die gleichzeitig Versuche zum Aufbau einer Erinnerungskultur an der neuen Universität darstellten. A BSCH LI E SSE N DE GEDA N K E N: An vielen Stellen, z. B. Homepage der EUV, ist zu lesen, dass die Europa-Universität die Rolle der alten Frankfurter Universität als Brücke zwischen Ost- und Westeuropa übernommen hat und gut ausfüllt; darüber hinaus sogar Kontakte weltweit pflegt. Die Euphorie der Gründungsväter und der ersten Generation von Dozierenden und Studierenden ist vorbei, der Alltag einer Universität ist eingekehrt mit den üblichen Verwerfungen, vor allem in der zu geringen Ausstattung, an Finanzen und Fakultäten, für eine Universität, die weltweit Kontakte pflegen soll. Trotzdem hat es die Generation mit der folgenden Generation geschafft, ein Bild der Europa-Universität aufzubauen, das sogar international Anerkennung findet. Immer noch herrscht z. B. unter Studierenden eine Atmosphäre, die sie gern an die Universität kommen lässt. Die interessanten Studienangebote, die überschaubare Größe, Alumni-Arbeit und Jubiläen als sinnstiftende Rituale alle fünf Jahre zur Erinnerungsbildung im kommunikativen Gedächtnis haben sicher zu einer Identitätsbildung mit der neuen Universität bei vielen Studierenden, Alumni und Universitätsangehörigen immer wieder beigetragen.16 Demgegenüber steht erstens die Tatsache, dass die große Mehrheit ihren Wohnsitz nicht in Frankfurt (Oder) hat. Daher ist es nur in geringem Maß zu einer Verbindung mit der Stadt und Herausbildung einer Identifizierung mit dem Universitätsort gekommen. Demgegenüber steht zweitens die Tatsache, dass es nicht gelungen ist, eine Erinnerungskultur zu schaffen, die eine Verbindung mit der Tradition der alten Universität herstellt. Warum ist das so, was benötigt es, welche Orte, um eine Erinnerungskultur zu schaffen? Kann es sein, dass man mehr benötigt und mehr unternehmen muss als 16
Allerdings ist anzumerken, dass die untergeordnete Stellung des Universitätsarchiv an der EUV und vor allem die Unterbringung in Kellerräumen die Ambivalenz zeigen und nicht darauf hinweisen, dass die Erinnerungskultur an die letzten 25 Jahre der neuen Universität wirklich ernsthaft aufgebaut werden soll.
Die alte Frankfurter Universität und die Europa-Universität
291
es an der Europa-Universität durch den Verfasser, den Verein und wenige andere geschehen ist? Sind Rituale nötig, die die alte Zeit heraufbeschwören? Sicher benötigt Erinnerung mehr als eine versteckte Gedenkmauer. Vergleicht man die Situation mit der an anderen Universitäten, die wieder begründet wurden, so kann man dort eine wesentlich intensivere Verbindung zu der Tradition der Vorgänger feststellen. Diese Universitäten bemühen sich um die Herstellung der Kontinuität, den Aufbau einer Erinnerungskultur und stellen diese Tradition und Leistung immer wieder in den Vordergrund ihres Images, wie es der Verfasser z. B. selbst erleben konnte an der Universität Bamberg. Hier wie an anderen Orten existieren noch ein oder zwei ehemalige Gebäude der alten Universität. Ist das wirklich die Lösung der Frage? Kann man Erinnerungskultur nicht in den Köpfen im leeren Raum aufbauen, auch nicht mit CD im Computer? Benötigen Menschen das Gebäude der alten Universität, in dem sie leben und arbeiten, um zu akzeptieren, dass die Erinnerung an die Traditionen und die Leistungen der Vorgänger wichtig für ihre Identität ist? Es könnte in Frankfurt (Oder) so sein. Andererseits könnte der Mangel an Erinnerungskultur auch damit zusammenhängen, dass es durch die Struktur nur wenige Personen gibt, die sich in ihren Fächern mit der Zeit vor 1945 oder noch viel weiter davor beschäftigen. Daher fehlt die Ambition, sich in den Aufbau und die Pflege von Erinnerungskultur der Vorgängeruniversität (1506–1811) einzubringen und sie im kommunikativen Gedächtnis präsent zu halten. Eine befriedigende Antwort lässt sich hier nicht finden. Es bleibt festzuhalten: Das Interesse an der alten Universität bei der Universitätsleitung, den Dozierenden und den Studierenden ist minimal, die Identität mit der neuen Universität ist demgegenüber groß.
DER U MGA NG M I T NS -DE -PROMOT ION E N Das Beispiel Gießen Eva-Marie Felschow Länger noch als die Auseinandersetzung mit der eigenen NS-Vergangenheit hat an den deutschen Universitäten die Aufarbeitung der während des NS-Regimes aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen erfolgten Doktorgradentziehungen auf sich warten lassen. Trotz des politischen Neuanfangs nach 1945 haben die Universitäten in der BRD und in der DDR wie auch in Österreich dieses besonders unrühmliche Kapitel ihrer Geschichte lange Zeit mit Schweigen übergangen. An der Universität Gießen hat der Prozess der Rehabilitierung der von dieser Unrechtsmaßnahme Betroffenen mehr als 60 Jahre gedauert, mit der Anbringung einer Gedenktafel im Universitätshauptgebäude wurde er 2008 abgeschlossen. Bevor diese Gedenktafel hier näher vorgestellt werden soll, sind zunächst kurz der Hintergrund der zwischen 1933 und 1945 durchgeführten Doktorgradentziehungen und die für Gießen nachweisbaren Fälle zu skizzieren. Zahlreiche Studien haben inzwischen gezeigt, dass der mit der nationalsozialistischen Machtergreifung in Gang gesetzte Prozess der politischen und ideologischen Gleichschaltung sowie die Ausgrenzung und Vertreibung nicht regimekonformer Personen auch vor den Universitäten keineswegs Halt machte. Antidemokratische und antisemitische Denkweisen hatten bereits in der Weimarer Republik Teile der Professorenschaft und zahlreiche Studierende erfasst. An der seit den 1920iger Jahren von Schließungsängsten beunruhigten Universität Gießen1 waren Professoren und Dozenten, die meisten von ihnen aus Opportunismus, wenige aus Überzeugung, schon früh bemüht, den neuen Machthabern entgegenzukommen. Dies zeigte sich bereits bei der Umsetzung des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933, mit dem sich das NS-Regime eine Grundlage zur Vertreibung missliebiger Wissenschaftler – Juden, Marxisten und Demokraten – geschaffen hatte. Die Zwangsmaßnahmen beschränkten sich allerdings nicht nur auf den Lehrkörper. Auch die Studierenden waren der nun herrschenden Willkür ausgesetzt. Vor allem jüdische Studenten und Studentinnen hatten unter Repressionen zu leiden. Sie wurden von der Universität ausgeschlossen oder daran gehindert, ihr Studium mit einer Prüfung ordnungsgemäß zu beenden. Die Diskriminierung machte auch vor ehemaligen Absolventen nicht Halt. Die Universität Gießen wurde 1
Schon seit dem Ende des Ersten Weltkriegs hatte es vermehrt Gerüchte über eine bevorstehende Schließung der hessen-darmstädtischen Landesuniversität gegeben. Angesichts der zunehmenden Konkurrenz mit den Nachbaruniversitäten Marburg und Frankfurt und der schwächer werdenden Bindungen an den Trägerstaat nach dem Ende des Großherzogtums 1918 und der Schaffung des Volksstaats Hessen stellte sich die Frage nach der Existenzberechtigung der Universität Gießen immer drängender. Noch brisanter wurde die Lage am Ende der Weimarer Republik, da mittlerweile auch im Umfeld der Reichsregierung über eine Umstrukturierung des deutschen Hochschulwesens nachgedacht wurde, der die kleineren Universitäten – darunter neben Gießen auch Rostock und Jena – zum Opfer fallen sollten. Vgl. Eva-Marie Felschow, Carsten Lind, Neill Busse: Krieg, Krise, Konsolidierung. Die „zweite Gründung“ der Universität Gießen nach 1945, Gießen 2008, S. 9ff.
294
Eva-Marie Felschow
zum willfährigen Vollzugsorgan des Regimes, indem sie Juden und politisch Andersdenkenden, die einst in Gießen promoviert worden waren, den Doktorgrad entzog. Damit gab sie in beschämender Weise akademische Freiheit und Würde auf. Gießen und die übrigen deutschen Universitäten wurden somit selbst zu einem Teil des Unrechtssystems. Die Möglichkeit einer nachträglichen Aberkennung des Doktorgrades hatte es bereits vor 1933 gegeben. Gründe hierfür waren zum einen bewusste Täuschung oder Fälschung bei der Erlangung des Titels und zum anderen der Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte nach strafgerichtlichen Verurteilungen, die damit auch die Aberkennung des Doktorgrades zur Folge hatten. Allerdings handelte es sich dabei um einige wenige Fälle und die Aberkennung vollzog sich im Rahmen klarer rechtsstaatlicher Vorgaben. Dies änderte sich nach 1933 grundlegend. Die Entziehung des Doktorgrades wurde nun als Mittel zur Diskreditierung missliebiger Akademiker genutzt und diente der Fortsetzung politischer Verfolgungsmaßnahmen. Die Initiative zur Ausweitung und Verschärfung der bisherigen Aberkennungspraxis ging von dem Münchener Studentenführer Karl Gengenbach aus, der auf die große Zahl emigrierter Doktoren hinwies und diese als „Landesverräter“ diffamierte.2 Sein Vorstoß hatte eine Reihe von amtlichen Anweisungen und Verordnungen zur Folge, durch die die angestrebte Demütigung exilierter Akademiker Schritt für Schritt in bürokratische Normen und schließlich in Gesetzesform gebracht wurde.3 Diese genügten zwar keinen rechtsstaatlichen Anforderungen, schufen aber in der Praxis Regelungen für den Ablauf der Doktorgradentziehungen. Dabei übertrugen die Nationalsozialisten das Recht, Emigranten den Doktorgrad zu entziehen, ganz bewusst nicht staatlichen oder parteigebundenen Institutionen, sondern beließen es bei den Universitäten, um diese dadurch in die nationalsozialistischen Willkürakte einzubinden. Der Absicht Karl Gengenbachs entsprechend erfolgte die Aberkennung des Doktorgrades während des NS-Regimes in den meisten Fällen als Sanktionsmaßnahme 2
3
Gengenbach reagierte damit auf das am 14.7.1933 erlassene „Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit“, mit dem sich das NS-Regime das Instrument zur Verfolgung ins Ausland geflüchteter politischer Gegner und Juden schuf (das Gesetz wurde am 15.7.1933 im Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, S. 480 veröffentlicht). Mit einer Eingabe an den Bayerischen Staatsminister für Unterricht und Kultus machte Gengenbach im September 1933 darauf aufmerksam, dass sich unter den Ausgebürgerten eine Reihe promovierter Personen befände, denen als „Landesverräter“ der Doktortitel entzogen werden müsse. Den Anfang machte der Bayerische Kultusminister, der die Anregung von Gengenbach aufgriff und am 3. Oktober 1933 eine Verordnung erließ, Ausgebürgerten den Doktorgrad zu entziehen. Vgl. Renate Wittern, Andreas Frewer: Aberkennungen der Doktorwürde im „Dritten Reich“. Depromotionen an der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, Erlangen 2008, S. 20ff. Dem Beispiel Bayerns folgten schon bald die anderen deutschen Länder. Das Hessische Staatsministerium forderte mit einem Erlass vom 18. Oktober 1933 die Landesuniversität Gießen auf, ihre Promotionsordnungen um eine Bestimmung zu ergänzen, wonach die Doktorwürde bei Widerruf der Einbürgerung oder Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit zu entziehen sei, Universitätsarchiv Gießen (künftig: UAG), PrA Nr. 2027. Ein Überblick über die Entwicklung der Rechtsgrundlagen in: Michael Breitbach: Das Amt des Universitätsrichters an der Universität Gießen im 19. und 20. Jahrhundert. Zugleich ein Beitrag zu den Doktorentziehungsverfahren zwischen 1933 und 1945, in: Archiv für hessische Geschichte und Altertumskunde NF Band 59 (2001), S. 291ff.
Der Umgang mit NS-De-Promotionen. Das Beispiel Gießen
295
nach der Flucht aus dem nationalsozialistischen Deutschland und der damit verbundenen Ausbürgerung. Mit dem Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit wurde der Exilant zugleich für „unwürdig“ erklärt, den akademischen Grad einer deutschen Universität zu führen. Darüber hinaus hatte die Verschärfung der nationalsozialistischen Bevölkerungs- und Rassenpolitik zur Folge, dass zum Beispiel nach Verurteilungen wegen „Rassenschande“ und „Rundfunkverbrechen“ die Weiterführung des Doktortitels untersagt wurde. Außerdem konnten strafgerichtliche Verurteilungen nichtpolitischer Art in bestimmten Fällen als Nebenstrafe – wie schon in der Weimarer Republik – zur Aberkennung bürgerlicher Ehrenrechte einschließlich akademischer Grade gemäß Paragraph 33 Reichsstrafgesetzbuch führen. In anderen Fällen – auch dies betraf meist vorausgegangene strafrechtliche Verurteilungen – hatte die Universität einen eigenen Entscheidungsspielraum, um über den Fortbestand oder die Aberkennung des Doktortitels zu entscheiden. An der Universität Gießen sind während des NS-Regimes 51 Verfahren zur Entziehung des Doktortitels nachweisbar.4 Wegen Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit beziehungsweise wegen der Einleitung von Ausbürgerungsverfahren wurde in 35 Fällen der Doktortitel entzogen. Von diesen Unrechtsmaßnahmen waren vor allem jüdische Promovierte betroffen. Damit erfolgten in Gießen – wie an den meisten deutschen Universitäten – Depromotionen vor allem bei emigrierten Absolventen. In 16 Fällen wurde in Gießen der Doktorgrad unter Verweis auf andere Gründe der „Unwürdigkeit“ entzogen, meist in Verbindung mit vorausgegangenen strafgerichtlichen Verurteilungen. In enger Verbindung mit dem Entzug akademischer Würden standen zudem Methoden zur Promotionsverhinderung und -verweigerung. Auch an der Universität Gießen hat es dies gegeben. Daher hat die Justus-LiebigUniversität sich entschlossen, in zwei Fällen, in denen die Aushändigung des Doktordiploms verweigert wurde, posthum den Doktortitel zu verleihen. Unter den von Doktorgradentziehung Betroffenen befindet sich nur eine Doktorandin, Dr. Frieda Vogel.5 Dies gibt einen Hinweis darauf, dass die Anzahl der vollzogenen Depromotionen mit hoher Wahrscheinlichkeit höher war als dies durch Akten belegt ist. Seit der Zulassung von Frauen zum Studium und zur Erlangung akademischer Grade befand sich in den Jahren vor 1933 ein hoher Anteil von jüdischen Studentinnen unter den ersten Doktorandinnen. Für einige von ihnen ist dokumentiert, dass sie aus dem nationalsozialistischen Deutschland geflüchtet sind – darunter z.B. die 1932 in Gießen promovierte Lehrerin und Schriftstellerin Mona Loeb verheiratete Wollheim, 4
5
Zu den Doktorgradentziehungen an der Universität Gießen vgl. Breitbach: Amt (2001), S. 267– 334; Peter Chroust: Die bürokratische Verfolgung. Doktorgradentziehungen an der Universität Gießen 1933–1945 im Kontext der nationalsozialistischen Verfolgungspolitik, Gießen 2006; Rezension zu Chroust: Verfolgung (2006), von Michael Breitbach, Eva-Marie Felschow, in: Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins, Bd. 91, 2006, S. 430–436; Peter Chroust: Ärzte ohne Titel. Doktorgradentziehungen an der Medizinischen Fakultät der Universität Gießen 1933–1945, in: Sigrid Oehler-Klein (Hg.): Die Medizinische Fakultät der Universität Gießen im Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit: Personen und Institutionen, Umbrüche und Kontinuitäten, Stuttgart 2007, S. 133–161; Helmut Berding: Doktorgradentziehungen an der Universität Gießen 1933–1945, in: Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins, Bd. 94, 2009, S. 177–185. UAG, Phil Prom Nr. 2570.
296
Eva-Marie Felschow
die über Frankreich in die USA emigrierte –, aber eine Doktorgradentziehung ist für sie nicht nachweisbar. Die Quellen zur Frage der Depromotionen sind also sicher nur lückenhaft überliefert. Nach 1945 waren die während der NS-Zeit erfolgten Doktorgradentziehungen zunächst ein Tabuthema, die Universitäten ergriffen von sich aus keine Initiative, sich dem begangenen Unrecht zu stellen und die Betroffenen zu rehabilitieren. Die meisten Universitäten setzten sich nur dann mit dieser Frage auseinander, wenn die Betroffenen selbst sich meldeten und eine Wiederzuerkennung ihres Doktortitels beantragten. Für Gießen sind aus den ersten Nachkriegsjahren insgesamt drei solcher Fälle bekannt. Bereits wenige Monate nach dem Ende des NS-Regimes stellte Friedrich Quack als Erster der Depromovierten am 30. Oktober 1945 einen Antrag auf Wiederzuerkennung seines Doktorgrades. Er hatte 1924 im Fach Chemie promoviert und nach einer Verurteilung zu neun Monaten Gefängnisstrafe wegen Homosexualität als Nebenstrafe im Mai 1939 den Doktortitel entzogen bekommen. Der im Frühjahr 1945 eingesetzte Gießener Rektor, der politisch unbelastete Physiker Karl Bechert, war unsicher, wie er mit diesem Antrag umgehen sollte. Er holte eine Stellungnahme der juristischen Fakultät ein, die empfahl, das Gesuch von Quack bis 1949 und damit bis zum Ablauf der zehnjährigen Straftilgungszeit zurückzustellen. Nachdem sich von den Dekanen drei für und drei gegen den Antrag ausgesprochen hatten, legte Bechert den Fall dem Großhessischen Ministerium für Kultus und Unterricht zur Entscheidung vor. Dieses folgte der Empfehlung der Gießener Juristen nicht und erkannte im August 1946 Friedrich Quack den Doktorgrad wieder zu.6 Die zweite, die sich um die Wiedererlangung ihres aberkannten Titels bemühte, war die schon genannte Dr. Frieda Vogel, eine Jüdin aus Fürth. Sie hatte bei August Messer, Professor für Philosophie und Pädagogik, in Gießen 1931 promoviert und war nach der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ im Juli 1933 emigriert. Daraufhin wurde ihr nach Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft im September 1937 der Doktorgrad entzogen. Nach ihrer Rückkehr aus dem Ausland erhielt Frieda Vogel hiervon Kenntnis und beantragte mit Schreiben vom 31. August 1948 beim Gießener Rektor die Aufhebung dieser Entscheidung. Zu diesem Zeitpunkt war an die Stelle der Universität Gießen die „Justus-Liebig-Hochschule für Bodenkultur und Veterinärmedizin“ getreten, die erst 1957 wieder den Status einer Volluniversität erlangen sollte. Der neue Rektor, der Physiker Paul Cermak, nahm den Aberkennungsbeschluss von 1937 mit der Begründung zurück, dass „Dr. Frieda Vogel die Doktorwürde besitzt“, da mit der „Beseitigung des angezogenen nationalsozialistischen Gesetzes […] auch der Beschluss über die Entziehung der Doktorwürde unwirksam“ geworden sei.7 Mit dem erwähnten Gesetz bezog sich 6
7
Die Begründung für diese Entscheidung des Kultusministers lautete: „Nachdem der Antragsteller das beiliegende polizeiliche Führungszeugnis, in dem seine Vorstrafe den Bestimmungen entsprechend nach 7 Jahren nicht mehr aufgeführt wird, und das empfehlende Zeugnis seiner Firma vorgelegt hat, gebe ich seinem Antrag auf die Wiederzuerkennung seines an der Universität Gießen am 15.1.1924 erworbenen und ihm durch Beschluss vom 3.5.1939 aberkannten Doktorgrades statt.“ Schreiben des Ministeriums vom 30.8.1946 und der gesamte Vorgang in: UAG, PrA Nr. 2672. Beschluss von Rektor Cermak vom 6.9.1948 und der gesamte Vorgang in: UAG, Phil Prom Nr. 2570.
Der Umgang mit NS-De-Promotionen. Das Beispiel Gießen
297
Cermak auf die Verfügung des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern vom 3. April 1937, die sich auf den Paragraphen 2 des Gesetzes über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit vom 14. Juli 1933 stützte. Der Dritte, der sich in dieser Frage an die Gießener Hochschule wandte, war der Schriftsteller und Komponist Stephan Lackner. Er hatte unter dem Namen Ernst Morgenroth sein Studium der Philosophie und Kunstgeschichte an der Universität Gießen mit der Promotion abgeschlossen. Der Philosophieprofessor Theodor Steinbüchel hatte dem jüdischen Studenten noch nach der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ im April 1934 die Promotion ermöglicht.8 Morgenroth hatte zuvor gegenüber dem Dekan der Philosophischen Fakultät erklärt, dass er beabsichtige Deutschland zu verlassen. Nach seiner Emigration wurde ihm nach der Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit im März 1939 von der Universität Gießen der Doktorgrad entzogen. Im Mai 1956 erkundigte sich Lackner in Gießen, ob die NS-Gesetze, auf deren Grundlage ihm der Titel aberkannt worden war, inzwischen widerrufen seien und ob er seinen Doktorgrad automatisch wiedererhalten habe. Antwort hierauf erhielt er vom Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät, der ihm mitteilte, dass die Entziehung des Titels zu Unrecht erfolgt sei, da ihm „nichts anderes vorzuwerfen sei als die Tatsache, dass er Deutschland verlassen“ habe. Außerdem gab der Dekan in seinem Schreiben zu bedenken, „da die Frage [der Depromotionen] grundsätzliche Bedeutung hat, sollte sie ein für allemal geklärt werden“.9 Dazu aber waren die Verantwortlichen an der Universität noch nicht bereit. Vielmehr verdrängte man das Thema weiterhin. Im Mai 1958 wurde dem Theaterkritiker und Regisseur Rudolf Frank, dem nach seiner Emigration in die Schweiz ebenfalls der Doktortitel aberkannt worden war, das Doktordiplom aus Anlass seines fünfzigjährigen Doktorjubiläums in Anerkennung seines literarischen Werks erneuert, ohne dass ein Hinweis auf die erfolgte Depromotion oder gar eine förmliche Wiederzuerkennung des Titels erfolgte.10 Erst im Jahr 1967 widmete sich der Senat der Universität Gießen grundsätzlich dieser Frage und fasste am 8. Februar 1967 einen Beschluss, durch den die Entziehung von Doktorgraden in der Zeit vom Januar 1933 bis Kriegsende 1945 wegen politischer, rassischer oder religiöser Gründe einstimmig als nichtig, das heißt von Anfang an als unwirksam bezeichnet wurde.11 Den Beschlussvorschlag hatte der Jurist Professor Dr. Helmut Ridder, damals Vorsitzender des Rechtsausschusses des Senats, auf Bitten dieses Gremiums vorgelegt. Mit der Nichtigerklärung der während der NS-Zeit erfolgten Depromotionen stellte der Senat klar, dass von den Betroffenen kein Antrag zur Wiederverleihung ihres Titels erfolgen musste und dass eine mögliche Weiterführung des Titels auch nach der Aberkennung nicht unzulässig erfolgt war. Allerdings wurde dieser Beschluss damals nicht veröffentlicht und es wurden auch keine Anstrengungen unternommen, die Betroffenen, soweit möglich, darüber zu informieren. Es erfolgte also keine öffentliche Rehabilitierung. Es wurden lediglich Kopien mit dem Wortlaut dieses Senatsbeschlusses in die Promotionsakten der Degraduierten eingelegt. 8 9 10 11
Vgl. UAG, Phil Prom Nr. 2797. Schreiben von Dekan Egon Ullrich an Stephan Lackner vom 30.7.1956, ebd. Vgl. UAG, Jur Prom Nr. 1253. Sitzungsprotokoll des Senats vom 8.2.1967, UAG, Unterlagen des Senats 20, Karton 5.
298
Eva-Marie Felschow
Mehr als zehn Jahre später kam es dann in einem Fall doch zu einer persönlichen Kontaktaufnahme. Als Professor Dr. Walter Fabian 1979 zu einer Veranstaltung nach Gießen eingeladen wurde, machte er auf die Aberkennung seines Doktortitels seitens der Universität Gießen während des Nationalsozialismus aufmerksam. Vom Nichtigkeitsbeschluss des Gießener Senats, der auch seiner Promotionsakte hinzugefügt worden war, hatte er keine Kenntnis erhalten. Für die Veranstalter war dies eine überaus peinliche Situation. Die Universität nahm diesen Vorfall zum Anlass, Professor Fabian öffentlich zu rehabilitieren. Im November 1979 erneuerte der Fachbereich Erziehungswissenschaften – Walter Fabian war 1925 an der Philosophischen Fakultät im Fach Pädagogik promoviert worden – in einer Feierstunde das Doktordiplom nachträglich aus Anlass des fünfzigjährigen Doktorjubiläums.12 Auch jetzt entschloss sich die Universität nicht, weitere Nachforschungen über den Verbleib der übrigen von Doktorgradentziehung Betroffenen anzustellen und deren öffentliche Rehabilitierung vorzunehmen. Der zuständige Mitarbeiter in der Rechtsabteilung hielt den hierfür nötigen Zeitaufwand für zu groß. In den folgenden Jahren wurden die Historiker auf das Thema aufmerksam und es entstanden erste Untersuchungen, die das Vorgehen bei der Aberkennung akademischer Grade in der NS-Zeit für einzelne Hochschulen zum Gegenstand hatten.13 Dynamik kam in die Aufarbeitung der Doktorgradentziehungen durch eine alle deutschen Universitäten umfassende Erhebung des Sekretariats der Ständigen Kultusministerkonferenz im Jahr 1998.14 Wenig später – im Frühjahr 2000 – reagierten die deutschen Hochschularchivare hierauf und veranstalteten in Bonn eine Fachtagung zu diesem Thema, auf der die Ergebnisse der von der Kultusministerkonferenz durchgeführten Umfrage erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurden.15 Als Fazit der Tagung wurde deutlich, dass sich die meisten Hochschulen bislang um keine Rehabilitierung der Betroffenen bemüht hatten und dass viele Hochschulen über keinerlei Informationen verfügten, in wie vielen Fällen akademische Grade aberkannt worden waren. Diese Feststellung erheblicher Forschungslücken stieß in der 12
13
14
15
Einige Monate zuvor, am 11.7.1979, hatte sich der Präsident der Universität Gießen, Professor Karl Alewell, mit einem Schreiben an Professor Fabian gewandt und darin seinem Wunsch Ausdruck verliehen, dass es zu der vom Dekan des Fachbereichs Erziehungswissenschaften angeregten feierlichen Veranstaltung zur Erneuerung des Doktordiploms kommen möge, „damit die Universität Gelegenheit erhält, zugleich in einem gewissen Umfang eine Wiedergutmachung durchzuführen“. UAG, PrA Nr. 2631. Vgl. u. a. Volker Schupp: Zur Aberkennung der akademischen Grade an der Universität Freiburg. Bericht aus den Akten, in: Freiburger Universitätsblätter, Heft 86 (12/1984), S. 9–19; zum prominenten Einzelfall von Thomas Mann: Paul Egon Hübinger: Thomas Mann, die Universität Bonn und die Zeitgeschichte. Drei Kapitel deutscher Vergangenheit aus dem Leben des Dichters 1905–1955, München, Wien 1974. Der Anstoß hierzu war vom „Verein gegen Vergessen – Für Demokratie“ mit Sitz in Bonn ausgegangen. Dessen Vorsitzender, der Sozialdemokrat Hans-Jochen Vogel, hatte sich 1998 an die Kultusministerkonferenz aus konkretem Anlass gewandt, da an den Verein die Anfrage gerichtet worden war, wie die Universitäten nach 1945 mit der in der NS-Zeit erfolgten Aberkennung akademischer Grade umgegangen seien. Vgl. Stefan Seeling: Von dem Umgang mit der eigenen Vergangenheit, in: Deutsche Universitätszeitung 8 (2000), S. 10f. Bericht über diese Tagung von Wolfgang Müller in: Der Archivar. Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, 53 (11/2000), Heft 4, S. 341–343.
Der Umgang mit NS-De-Promotionen. Das Beispiel Gießen
299
Folgezeit weitere Einzelstudien an.16 Auch das Erweiterte Präsidium der Justus-LiebigUniversität nahm nun im Wintersemester 2004/2005 die Rehabilitierung aller von solchen Unrechtsmaßnahmen Betroffenen in den Blick. Die entscheidende Initiative ging vom Kanzler der Universität Gießen aus. Auf seine Anregung hin setzte das Erweiterte Präsidium im Januar 2005 eine Kommission ein, die unter der Leitung des Vizepräsidenten Professor Jürgen Janek die öffentliche Rehabilitierung vorbereiten sollte. Mitglieder dieser Kommission waren neben dem Kanzler sechs Vertreter verschiedener Fachbereiche – darunter der Historiker Professor Helmut Berding und der Rechtshistoriker Professor Martin Lipp –, ein Jurist aus der Rechtsabteilung der Universität und die Leiterin des Universitätsarchivs. Die Kommission prüfte in mehreren Sitzungen die einzelnen Fälle von Doktorgradentziehung und kam dabei u. a. zu dem Entschluss, in vier Fällen, in denen die Aberkennung des Doktorgrades nach strafrechtlicher Verurteilung als Nebenstrafe erfolgt war, von einer Rehabilitierung Abstand zu nehmen, da diese nach heutiger Rechtsauffassung nicht eindeutig zu beurteilen waren.17 Zudem diskutierten die Kommissionsmitglieder in welcher Form die Rehabilitierung erfolgen sollte und erarbeiteten den Entwurf eines zur Veröffentlichung bestimmten Textes. Darin sollte der Vorgang der Doktorgradentziehung in den gesamthistorischen Kontext eingeordnet werden und die davon Betroffenen durch 16
17
Vgl. u. a. Jens Blecher, Gerald Wiemers: „… durch sein Verhalten des Tragens einer solchen akademischen Würde unwürdig“. Akademische Graduierungen und deren nachträglicher Entzug an der Universität Leipzig zwischen 1900 und 1935, in: Figuren und Strukturen. Historische Essays für Hartmut Zwahr zum 65. Geburtstag, hrsg. von Manfred Hettling u. a., München 2001, S. 679–698; Werner Moritz: Die Aberkennung des Doktortitels an der Universität Heidelberg während der NS-Zeit, in: Zwischen Wissenschaft und Politik. Studien zur deutschen Universitätsgeschichte. Festschrift für Eike Wolgast zum 65. Geburtstag, hrsg. von Armin Kohnle, Frank Engehausen, Stuttgart 2001, S. 540–562; Ralf Forsbach: „…des Tragens eines deutschen Akademischen Grades unwürdig“. Der Entzug von Doktorgraden während des Nationalsozialismus und die Rehabilitierung der Opfer am Beispiel der Universität Bonn, in: Rheinische Vierteljahresblätter 67 (2003), S. 284–299; Margret Lemberg: „…eines deutschen akademischen Grades unwürdig“. Die Entziehung des Doktortitels an der Philipps-Universität Marburg 1933–1945. Schriften der Universitätsbibliothek Marburg 113, Marburg 2003. Bei den Delikten dieser vier Depromovierten, die nicht rehabilitiert wurden, handelt es sich um 1) Beihilfe zum Meineid, Beihilfe zu einer falschen eidesstattlichen Versicherung und Beleidigung, verurteilt zu einer Zuchthausstrafe von 2 Jahren und Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte für die Dauer von 3 Jahren (UAG, PrA Nr. 2772), 2) Abtreibung mit Todesfolge, verurteilt zu einer Zuchthausstrafe von 4 Jahren und zur Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte für die Dauer von 5 Jahren (UAG, PrA Nr. 2679), 3) Erpressung, verurteilt zu einer Gefängnisstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten und zur Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte für die Dauer von 3 Jahren (UAG, PrA Nr. 2673), und 4) Untreue in zwei Fällen, schwere Urkundenfälschung, schwere Falschbeurkundung, schwere Bestechung und Betrug, verurteilt zu 3 Jahren Zuchthaus, einer Geldstrafe von 500 RM und Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte für die Dauer von 3 Jahren (UAG, Vet Med Prom Nr. 233). Die Vergehen der übrigen 13 Doktoranden, denen der Doktorgrad nach strafrechtlicher Verurteilung entzogen worden war und die von der Universität Gießen rehabilitiert wurden, waren Devisenvergehen, „Rundfunkverbrechen“, „Rassenschande“, Kreditwucher, Betrug, Volltrunkenheit. Außerdem befanden sich darunter zwei homosexuelle Depromovierte und auch ein Fall, wo nach Abtreibung der Doktorgrad entzogen worden war. In diesem Fall erfolgte die Rehabilitierung, weil mit der Abtreibung keine Todesfolge (keine fahrlässige Tötung) verbunden war.
300
Eva-Marie Felschow
namentliche Nennung (insgesamt 49 Personen, darunter zwei, denen der Doktorgrad posthum verliehen wurde)18 öffentlich rehabilitiert werden. Der Textentwurf wurde zunächst vom Präsidium und anschließend vom Erweiterten Präsidium einstimmig verabschiedet und als offizielle Stellungnahme der Justus-Liebig-Universität in einer Pressekonferenz am 13. Februar 2006 der Öffentlichkeit bekanntgegeben. Kurz darauf wurde die Stellungnahme am 16. Februar 2006 in der Universitätszeitung UNI-Forum mit weiteren Hintergrundinformationen veröffentlicht.19 Mit dieser öffentlichen Verlautbarung sollte der Prozess der Rehabilitierung allerdings noch nicht abgeschlossen sein. Noch während der Sitzungen der zur Vorbereitung der Rehabilitierung eingesetzten Kommission entstand der Gedanke, durch eine Gedenktafel an das durch die Universität Gießen begangene Unrecht zu erinnern. Entscheidender Ideengeber war auch hier der Universitätskanzler Dr. Michael Breitbach. Er hatte Kenntnis von einer Gedenktafel, die der Offenbacher Künstler Bernd Fischer für eine Frankfurter Schule zur Erinnerung an einen ehemaligen jüdischen Lehrer und zwei seiner Kollegen gestaltet hatte. Fischer war es gelungen, durch zwei zusammengefügte Glasscheiben unterschiedliche Aussagen – ein Bild von KZHäftlingen in Buchenwald, biographische Notizen zu den Lehrern und Aussagen von heutigen Schülerinnen und Schülern zu dem damaligen Geschehen – zu verbinden. Nach einer Betrachtung dieser Tafel vor Ort wurde rasch entschieden, dass Fischer mit der Gestaltung einer Tafel zur Erinnerung an die unrechtmäßig erfolgten Depromotionen an der Universität Gießen beauftragt werden sollte. Auch im Falle Gießens war die Aufgabenstellung, unterschiedliche Aussagen künstlerisch zusammenzufügen. Maßgeblich hierfür war der Ort, an dem die Gedenktafel angebracht werden sollte. Ausgewählt wurde ein Raum im Universitätshauptgebäude, der sogenannte GustavKrüger-Saal, dessen Namensgeber – der Theologe und Kirchenhistoriker Gustav Krüger – der einzige Gießener Professor gewesen war, der während einer Sitzung des Senats im Juni 1933 in einer Rede öffentlich Position gegen die Einschränkung der akademischen Freiheit durch die neuen nationalsozialistischen Machthaber bezogen hatte. Sein Verhalten verdeutlichte, dass alternative Handlungsmuster und Zivilcourage auch während des NS-Regimes möglich waren. Durch den Hinweis auf ihn sollte das Gedenken an die politisch und rassisch begründeten Doktorgradentziehungen mit der Mahnung verbunden werden, sich stets der mit der akademischen Freiheit verknüpften Verantwortung bewusst zu sein. Im Folgenden wird nun die Gedenktafel mit einigen Abbildungen vorgestellt.
18
19
Von den insgesamt für die Universität Gießen nachweisbaren 51 Personen, die von Doktorgradentziehung während der NS-Zeit betroffen waren, wurden vier nicht rehabilitiert, mit den zwei posthum verliehenen Doktorgraden ergibt sich die Zahl von 49 Personen, die zu rehabilitieren waren. Erklärung des Erweiterten Präsidiums und des Präsidiums der Justus-Liebig-Universität Gießen vom 13. Februar 2006, betreffend die Aufhebung der während der NS-Herrschaft verhängten Doktorgradentziehungen sowie Erläuterungen von Michael Breitbach, Eva-Marie Felschow, Jürgen Janek, in: uniforum (der Justus-Liebig-Universität Gießen), Nr. 1, 16.2.2006, S. 4f.
Der Umgang mit NS-De-Promotionen. Das Beispiel Gießen
301
Abb. 1 Auszug aus der Rede, die Gustav Krüger vor dem Senat im Juni 1933 gehalten hat. Er begründete seinen Entschluss, auf eine weitere Mitarbeit im Senat zu verzichten, mit der Einschränkung der akademischen Freiheit durch die neuen Machthaber:20 „Ich verlasse diesen Saal, in dem ich über 40 Jahre an der Selbstverwaltung unserer Alma Mater mitgewirkt habe. Ich verlasse ihn mit den Worten profiteor, professor sum, profitebor.“21
Abb. 2 Die Verwendung eines transparenten Trägermaterials ermöglichte es Bernd Fischer, die Inhalte auf verschiedenen Ebenen darzustellen. Der Glasverbund besteht aus insgesamt drei Scheiben. Den Hintergrund bilden verschwommen angedeutete Hände, die zum Hitlergruß erhoben sind. Als Vorlage hierfür diente das nächste Bild.
20 Die Vorlagen für die Abbildungen 1, 2, 4, 5 und 6 wurden freundlicherweise von Herrn Bernd Fischer zur Verfügung gestellt. Abbildung 3 stammt aus dem Bildarchiv der Universitätsbibliothek und des Universitätsarchivs Gießen. 21 Das Manuskript der Rede von Gustav Krüger ist in seiner Berufungsakte überliefert: UAG, PrA Theol Nr. 4.
302
Eva-Marie Felschow
Abb. 3 Einzug in die Aula anlässlich der „Einweihung des Lehramts für politische Erziehung“ im Dezember 1933. Rechts im Bild mit der Rektorenkette der Theologe und Rektor Professor Heinrich Bornkamm.
Abb. 4 Darüber auf einer nächsten Scheibe das Bild des Gießener Rektors und überzeugten Nationalsozialisten Heinrich Wilhelm Kranz (mit Talar und Rektorenkette) mit Vertretern des NS-Regimes bei einer Universitätsfeier 1940.
Der Umgang mit NS-De-Promotionen. Das Beispiel Gießen
303
Abb. 5 Auf der dritten Glasscheibe befinden sich eine Hintergrundinformation zu den Doktorgradentziehungen sowie der Hinweis auf den Beschluss des Senats von 1967. Auf der rechten Seite die Liste der 49 rehabilitierten Gießener Absolventen, 47 Degraduierte und zwei Personen, denen der Doktorgrad während der NS-Zeit verweigert wurde und die ihn posthum verliehen bekamen.
Abb. 6 Gesamtansicht der Tafel. Auf dem Foto in der Mitte ist ein Bekenntnis der Justus-LiebigUniversität zu dem während der NS-Zeit begangenen Unrecht angebracht. Darin wird betont, dass die Universität selbst Teil des nationalsozialistischen Unrechtssystems war und durch ihr Verhalten zur Fortdauer des Regimes das Ihre beigetragen hat.
304
Eva-Marie Felschow
Neben dem Bezug auf die Persönlichkeit Gustav Krügers und dessen couragiertes Auftreten im Senat war ein weiterer Aspekt für die Wahl dieses Raumes zur Anbringung der Gedenktafel ausschlaggebend. Im Gustav-Krüger-Saal tagt heute das Erweiterte Präsidium, das sich aus den Mitgliedern des Präsidiums sowie den Dekaninnen und Dekanen der elf Fachbereiche zusammensetzt. Es kann als Nachfolgegremium des „Dekaniums“ betrachtet werden, dass während der NS-Zeit über die Entziehung von Doktorgraden zu entscheiden hatte. Die Gedenktafel soll den Mitgliedern des Erweiterten Präsidiums ihre besondere Verantwortung vor Augen führen, damit sich solche Akte der Ausgrenzung und Verfolgung nicht wiederholen. Zwei Jahre nach der öffentlichen Rehabilitierung der Degraduierten wurde die Gedenktafel im Rahmen des alljährlich stattfindenden Akademischen Festakts im November 2008 der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Justus-Liebig-Universität nutzte diese Gelegenheit, um ein langes Versäumnis nachzuholen: Es wurden die Nachkommen der von diesen Unrechtsmaßnahmen Betroffenen – soweit sie ausfindig gemacht werden konnten – nach Gießen eingeladen, um ihnen gegenüber die erfolgte Rehabilitierung persönlich auszusprechen. Unter denjenigen, die dieser Einladung folgten, waren unter anderem die Tochter von Professor Walter Fabian, ein Enkel von Dr. Stephan Lackner und ein Sohn von Dr. Rudolf Frank. Letzterer, Dr. Vincent Frank aus Basel, hielt während des Akademischen Festakts eine vielbeachtete Rede, in der er auf ganz persönliche Weise zu der während der NS-Zeit erfolgten Diskriminierung missliebiger Akademiker Stellung nahm.
AU TOR E N V ER Z EICH N IS Joachim Bauer, apl. Prof. Dr. phil. habil., ist Leiter des Archivs der Friedrich-SchillerUniversität Jena. Jens Blecher, Dr. phil., ist Direktor des Archivs der Universität Leipzig. Klaus Dicke, Prof. Dr. rer. soc., ist am Institut für Politikwissenschaft der FriedrichSchiller-Universität Jena tätig; von 2004 bis 2014 war er Rektor der Universität. Eva Maria Felschow, Dr. phil., ist Leiterin des Archivs der Justus-Liebig-Universität Gießen. Stefan Gerber, PD Dr. phil., ist Leiter der Forschungsstelle für Neuere Regionalgeschichte Thüringens der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Jürgen John, Prof. em. Dr. phil., war bis 2007 Inhaber der Professur für Moderne Mitteldeutsche Regionalgeschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ulrich Knefelkamp, Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat., ist Inhaber der Professur für Mittelalterliche Geschichte der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder. Gottfried Meinhold, Prof. a.D. Dr. phil., war bis 2001 Professor für Germanistische Sprachwissenschaft und 1990 bis 1993 Prorektor für Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Rainer Möhler, OStR i.H. Dr. phil., ist am Historischen Institut der Universität des Saarlandes tätig. Wolfgang Müller, Dr. phil., unterrichtet Archivwissenschaft am Historischen Institut der Universität des Saarlandes und ist Leiter des dortigen Universitätsarchivs. Rainer Nicolaysen, Prof. Dr. phil., ist Leiter der Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte an der Universität Hamburg. Heinz Elmar Tenorth, Prof. Dr. phil., war bis 2011 Inhaber des Lehrstuhls für Historische Bildungsforschung der Humboldt-Universität zu Berlin.
A BK Ü R Z U NGSV ER Z EICH N IS Allgemein geläufige, rein technische und in bibliographischen Angaben übliche Abkürzungen sind nicht erfasst. ANR AStA BAK BArchB BNUS CDU DDP DDR EUV DFG FAZ FDJ FDP FSU FU HU Juso KBW KL KMU KPD LATh - HStA Weimar LMU LVZ MfS MG MLU MPI NDBA NDPD NPD NS NSDAP OPREMA PDS P.E.N.-Club RCDS SBZ SDS
Agence nationale de la recherche Allgemeiner Studierendenausschuss Bundesarchiv Koblenz Bundesarchiv Berlin Bibliothèque nationale et universitaire Christlich Demokratische Union Deutschlands Deutsche Demokratische Partei Deutsche Demokratische Republik Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder Deutsche Forschungsgemeinschaft Frankfurter Allgemeine Zeitung Freie Deutsche Jugend Freie Demokratische Partei Friedrich-Schiller-Universität Jena Freie Universität Berlin Humboldt-Universität zu Berlin Jungsozialisten in Deutschland Kommunistischer Bund Westdeutschland Konzentrationslager Karl-Marx-Universität Leipzig Kommunistische Partei Deutschlands Landesarchiv Thüringen - Hauptstaatsarchiv Weimar Ludwig-Maximilians-Universität München Leipziger Volkszeitung Ministerium für Staatssicherheit Maschinengewehr Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Max-Planck-Institut Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne National-Demokratische Partei Deutschlands Nationaldemokratische Partei Deutschlands Nationalsozialismus Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Optische Rechenmaschine Partei des Demokratischen Sozialismus Poets, Essayists, Novelists-Club Ring Christlich-Demokratischer Studenten Sowjetische Besatzungszone Sozialistischer Deutscher Studentenbund
Anhang
SED SFB SPD SSG TH UAHU UAJ UAG UAR UA SB UL UNRA USA WRK WWU ZK HSA HJB
307
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands Sonderforschungsbereich Sozialdemokratische Partei Deutschlands Sozialistische Studentengruppe Technische Hochschule Universitätsarchiv Humboldt-Universität zu Berlin Universitätsarchiv Jena Universitätsarchiv Gießen Universitätsarchiv Rostock Universitätsarchiv Saarbrücken Universität Leipzig United Nations Relief and Rehabilitation Association United States of America Westdeutsche Rektorenkonferenz Westfälische Wilhelms-Universität Münster Zentralkomitee Abt. Handschriften und Sondersammlungen der ThULB Jena Historisches Jahrbuch
PERSON E N R EGIST ER Das Personenregister enthält die im Vorwort, den Sachtexten und den Dokumenten außerhalb bibliographischen Angaben genannten Namen. Attributiv verwendete Namen sind im Register nicht erfasst. Abbe, Ernst 31, 52, 84, 150 Adam, Alfons 261, 270f. Adenauer, Konrad 241 Adrian, Heinrich (Henri) 261 Albrecht, Ernst 187 Alewell, Karl 298 Alken, Carl Erich 234, 238, 250 Allerkamp, Andrea 288, Amberg, Ernst-Heinz 93 Angelloz, Joseph-François 238, 240f., 242f, 249ff., 269 Anrich, Ernst 198, 258ff., 264, 271f. Aristoteles 24 Arndt, Ernst Moritz 27, 157, 159, 161f., 164, 166, 171, 192f. Aron, Raymond 240 Artin, Emil 40ff. Ash, Mitchell 223f. Assmann, Aleida 12, 24, 52, 115f., 195 Assmann, Jan 11, 24, 134 Astel, Karl 84 Auriol, Vincent 268 Auweter-Kurtz, Monika 40 Bach, Johann Sebastian 91, 251 Baechler, Christian 273 Baeumler, Alfred 212 Barriol, Jean 235–238, 246, 248f. Bauer, Fritz 274 Bauer, Joachim 8, 24, 28, 136 Baumgarten, Alexander Gottlieb 281, 288 Bechert, Karl 296 Becker, Carl Heinrich 153f., 210, 213, 216, 266 Becker, Hellmut 259, 266f. Beger, Bruno 274 Behrends, Rainer 97 Behrendt, Wolfram 98 Below, Fritz Wilhelm Theodor Carl von 235 Benjamin, Walter 116 Berding, Helmut 295, 299 Berendsohn, Walter 42 Bergemann-Könitzer, Marta 64f. Bernal, John 220 Berthoin, Jean 241
Beyer, Victor 272 Beyme, Carl Friedrich von 204 Bickenbach, Otto 260, 268, 272 Biedenkopf, Kurt 102 Biermann, Wolf 79 Bigl, Volker 98ff., 102ff. Bismarck, Otto von 57, 85 Blanchet, Louis 262 Blänkner, Reinhard 288 Blecher, Jens 8, 29, 158 Blobel, Günter 100ff., 104 Bloch, Marc 278 Boeckh, August 204f. Böhme, Ernst 86, 128 Böhme, Hans-Joachim 175 Bohse, Reinhard 96 Bollnow, Otto Friedrich 240 Bolz, Lothar 174 Bonah, Christian 255 Bonnefous, Édouard 240 Borner, Caspar 90, 92 Bornkamm, Heinrich 302 Bouas-Laurent, Henri 243 Boucher, Maurice 240 Brandenburg-Ansbach, Albrecht von 169 Braun, Karl 131 Breitbach, Michael 300 Brentano, Clemens 208 Breuer, Emil 268 Broches, Raphael 44 Brugman, Hendrik 240 Brugsch, Theodor 228 Bülbring, Edith 243 Burgun, René 270 Büsch, Johann Georg 50 Butenandt, Adolf 240 Carl August, Herzog 57f. Carpzov, Benedikt 92 Carrera, José 243f. Cäsar, Carl Julius 129 Cassirer, Ernst 37ff., 41f, 44, 183 Cerf, Georges 266 Cermak, Paul 296f. Chamberlain, Houston Stewart 73, 79
Anhang Churchill, Winston 272 Cohn-Bendit, Daniel 245 Collomp, Paul 262 Coulon(-Tauber), Viktor 261 Cresson, Edith 245 Crinis, Max de 260 Cujé, Lennie 42 Dahrendorf, Ralf 245 Darjes, Joachim Georg 24, 282, 288 Darré, Walther 80 De Wette, Wilhelm Martin Leberecht 205 Deiters, Heinrich 218, 221 Delbanco, Ernst 44 Delbos, Yvon 236 Delbrück, Berthold 60, 131 Delibes, Miguel 243 Demelius, Friedrich Wilhelm 119 Devrient, Otto 114 Dicke, Klaus 7, 9, 82f. Dieterich, Claus-Marco 131 Döbert, Frank 82 Döcker, Richard 238 Dölle, Hans 259, 268 Dominik, Hans 47 Donzelot, Pierre 231 Droysen, Johann Gustav 126f., 132 Droz, Jacques 240 Duroselle, Jean-Baptiste 240 Eckhardt, Karl August 259 Édmond, Marcel 232 Egeraat, Erick van 106f. Eichenhofer, Eberhard 82f. Einstein, Albert 44, 228 Eistert, Bernd 244 Elm, Ludwig 118 Enderlein, Hinrich 282 Erll, Astrid 111 Ernst der Fromme 112 Ernst von Sachsen Meiningen, Prinz 54f. Ernst, Robert 268 Esau, Abraham 17, 64 Esenwein, Jürgen von 116 Fabian, Walter 298, 304 Faurisson, Robert 275 Federmann, Georges 276f. Fichte, Johann Gottlieb 199ff., 205, 207ff., 211, 213, 219f., 228 Fink, Gonthier-Louis 243 Fischer, Bernd 300f. Fischer, Holger 40 Fischer, Theodor 52f., 54f. Fleischhacker, Hans 274 Frank, Rudolf 297
309
Frank, Vincent 304 Franz, Eckhart 272 Freud, Sigmund 71 Frey, Charles 271 Frick, Wilhelm 18, 73–77 Friedrich III. (der „Weise“) 156 Friedrich III. (I.) 156 Fritzsch, Günther 96 Fritzsch, Harald 97 Frommannshausen, Karl Albrecht Vogel von 132 Fuchs, Jürgen 29 Galilei, Galileo 24 Ganzinger, Harald 244 Gasset, Ortega y 240 Gauck, Joachim 257 Gaulles, Charles de 262 Gengenbach, Karl 294 Georg II. 52, 55 Georgen, Josef 236 Cerf, Georges 266 Gerlach, Harald 116f. Gerstenhauer, Max 80 Geussenhainer, Friedrich 44 Giersch, Herbert 243 Gieseler, Wilhelm 259 Gillies, Alexander 240 Girnus, Wilhelm 173, 219 Gobineau, Joseph Arthur de 73, 79 Goebbels, Joseph 160 Goethe, Johann Wolfgang von 31f., 57f., 70, 131, 153f. Göring, Hermann 18, 73f., 85, 160, 163 Göttling, Karl Wilhelm 132, 135 Grandval, Gilbert 231f., 234ff., 246 Greil, Max 18, 72, 75, 77, 80, 83 Greve, Hannelore 35, 39 Greve, Helmut 35, 39 Grimme, Adolf 154 Grober, Julius 87 Gröschner, Rolf 84 Grünberg, Jürgen 243 Grünberg, Peter 282 Guericke, Otto von 184 Guhlmann, Axel 97 Gunsett, August(e) 261 Günther, Hans F. K. 18, 73–80, 82, 85, 88, 259 Gurian, Waldemar 240 Haagen, Eugen 260, 168, 271f., 278 Habermas, Jürgen 224 Haeckel, Ernst 60, 63, 69, 122f. Hager, Kurt 172, 175 Hahland, Walter 63
310
Anhang
Halbwachs, Maurice 24 Hämel, Joseph 63 Hangarter, Werner 260 Harms, Monika 107 Harnack, Adolf von 129, 207 Haun, Wilfried 121 Häuser, Franz 104ff. Hauter, Charles 271 Heberer, Gerhard 259 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 201, 205, 208, 212, 228 Heidegger, Martin 212 Heimann, Eduard 35, 40ff. Heimpel, Hermann 259, 264f. Heine, Heinrich 185f. Hellmann, Siegmund 265 Helmholtz, Hermann von 228 Helmstedt, Martin 98 Henrypierre, Henri 276 Heuss, Theodor 21, 32 Heymans, Corneille 240 Himmler, Heinrich 80 Hirt, August 255, 260, 266, 268, 272, 274–277 Hirth, Friedrich 240 Hitler, Adolf 18, 45, 68, 72–77, 85, 160, 162, 261, 266, 268 HMJokinen 47 Hobbes, Thomas 24 Hodler, Ferdinand 54, 59f., 63ff., 68, 71, 84 Hoepffner, Ernest 261 Hoffet, Frédéric 272 Höffken, Klaus 87 Hoffmann, Johannes 236, 241, 247 Hofmann, Ludwig von 22, 54 Hofmeier, Kurt 264 Hohlfeld, Andreas 260 Hölzel, Horst 122 Hotz, Günter 244 Huber, Ernst Rudolf 264, 266 Hübner, Heinz 242 Humboldt, Alexander von 57, 170, 196, 228 Humboldt, Wilhelm von 57, 170, 196, 198f., 201f., 204–209, 211–214, 216–225, 228, 282 Hus, Jan 108 Hüsch, Hans-Dieter 121, 240 Huschke, Emil 121 Hütter, Elisabeth 101 Huxley, Andrew 243 Ibrahim, Jussuf 17, 26 Ipsen, Knut 282 Janek, Jürgen 299
Jaspers, Karl 187, 212f., 215, 218, 222f., 224 Jellinek, Camilla 132 Jellinek, Georg 132 Jens, Walter 22 Joerden, Jan C. 288 Johann Friedrich I. von Sachsen 54, 112, 131 John, Jürgen 8, 196 Jörg, Heinrich 63 Jung, Adolf (Adolphe) 260, 270, 272 Kant, Immanuel 156, 169, 200, 212 Karl der Große 182, 242 Keeser, Eduard 47 Kettenacker, Lothar 256 Kieffer, Robert 270 Kiener, Fritz 261 Klarsfeld, Serge 275 Klein, Antonie (Toni) 86, 88 Klein, Emil 18, 72, 74–78, 80–88 Klein, Hedwig 44 Knapp, Edgar 259 Knigge, Volkhard 82f. Knorre, Dietrich von 121 Koch, Dietrich 99 Koch, Eckhard 99 Kohl, Helmut 95 Köhler, Otto 121f. Kollár, Ján 118 König, Lothar 127 König, René 211f. Köpke, Rudolf 199, 203f. Kortzfleisch, Gustav von 129 Kosswig, Curt 243 Köthe, Gottfried 243 Kranz, Heinrich Wilhelm 303 Krause, Eckart 38 Kreisel, Walter 283 Krieck, Ernst 212 Krings, Hermann 238, 245 Krüger, Gustav 300f. Kühn, Helga-Maria 129 Künemann, Otto 99 Kunze, Reiner 79 Lackner, Stephan (Morgenroth, Ernst) 297, 304 Laffon, Émile 232 Lagarde, Paul de 213 Landahl, Heinrich 158 Lang, Hans Joachim 276f., 279 Lange, Ferdinand 117 Langhans, Paul Max Harry 79 Langner, Ilse 240 Lapouge, Georges Vacher de 79 Lasch, Agathe 39, 41f., 44 Lassar, Gerhard 44
Anhang Lassus, Jean 271 Lauterbach, Max 261 Le Pen, Jean-Marie 275 Lefftz, Josef (Josephe) 261 Lehmann, Andrea 288 Lehmann, Julius Friedrich 80 Lehmann, Wolfgang 259 Leicht, Robert 245 Leipelt, Hans 44 Leisegang, Hans 29, 78 Leitzmann, Albert 121 Lenz, Fritz 79 Lenz, Johann Georg 57 Lenz, Max 206ff., 216 Lenzen, Dieter 40 Lessenich, Stephan 82f. Liebig, Justus 168 Limburg, Ludwig 239 Lindinger, Martin 243 Link, Claudia 288 Linneweber, Volker 233, 235 Lipp, Martin 299 Liszt, Franz 31, 185 Lockemann, Theodor 121 Loeb (Wollheim), Mona 295 Loest, Eerich 96 Löffler, Hermann 269 Lorenz, Konrad 26 Lötzsch, Ulrike 288 Ludwig V. 167 Lundborg, Hermann 79 Luther, Martin 24, 115, 126, 156, 160ff., 171 Lüthje, Jürgen 37 Lux, Rüdiger 106 Magnus, Albertus 236 Mahrenholtz, Oskar 243 Maier, Willfried 38 Maihofer, Werner 238 Mann, Thomas 30, 44, 154 Marc, Alexandre 240 Markl, Hubert 243 Marshall, James 54, 56 Marx, Karl 31, 98, 171f., 188, 218, 219, 229 Massow, Julius Eberhard von 211 Mayer, René 240 Mayer, Thomas 106 Meinecke, Friedrich 182 Meinhold, Gottfried 7f., 18, 26 Meißner, Hans-Otto 268 Melanchthon, Philipp 281 Melles, Werner von 35, 48f. Mendelssohn Bartholdy, Albrecht 40ff.
Mendès, Pierre 241 Mendt, Dietrich 96 Mentz, Georg 121 Merkel, Georg 128 Messer, August 296 Metz-Becker, Marita 120 Meyer, Hans Joachim 102 Meyer, Reinhold 44 Meyer-Erlach, Wolf 63 Middell, Matthias 105 Mielke, Fred 275 Milbradt, Georg 102f. Minder, Robert 240 Mitscherlich, Alexander 275 Mittermaier, Karl Joseph Anton 204f. Modrow, Irina 287 Mommsen, Theodor 228 Montferrand, Bernard de 233, 235 Morenz, Siegfried 93 Moritz, Herzog 102 Mößbauer, Rudolf 243 Muchow, Martha 44 Mugler, Karl (Charles) 261 Muller, Germain 272 Müller, Paul 244, 250 Müller, Peter 233 Müller, Wolfgang 8, 182 Müller-Blattau, Josef 251, 260 Muth, Hermann 244 Napoleon Bonaparte 60, 204 Neander, August 205 Neher, Erwin 243 Newman, John Henry 197 Nietzsche, Friedrich 71, 134, 213 Nissen, Walter 129 Nora, Pierre 105 Oken, Lorenz 52 Ossietzky, Carl von 186ff. Paletschek, Sylvia 198, 217 Panofsky, Erwin 40ff. Papen, Franz von 154 Pasteur, Louis 273, 277f. Paulssen, Arnold 155 Perels, Kurt 44 Petersen, Peter 17, 26, 82 Petzoldt, Martin 106 Pfeiffer, Arthur 239 Philip, André 238 Pieck, Wilhelm 173–176 Piltz, Ernst 120 Plivier, Theodor 240 Ploetz, Alfred 79 Pressac, Jean-Claude 275
311
312
Anhang
Przywara, Erich 213 Pufendorf, Samuel von 24 Putin, Wladimir 169 Puttkammer, Jesco Freiherr von 243 Quack, Friedrich 296 Raacke, Peter 238f. Rad, Gerhard von 63 Raiser, Ludwig 266 Rajewski, Boris 244 Rassinier, Paul 275 Rathenow, Lutz 29 Raulff, Ulrich 266 Redslob, Edwin 170, 182 Reger, Max 126 Rein, Adolf 36, 158 Rein, Wilhelm 133 Remondet, André 242 Renatus, Franz 270 Renouvin, Pierre 240 Reuter, Fritz 113 Rhodes, Cecil 26 Ridder, Helmut 297 Ries, Roland 277 Rilke, Rainer Maria 241 Rinck, Emil(e) 206, 272 Ritter, Gerhard 265 Rodenwaldt, Ernst 259 Rodin, Auguste 54, 62, 64 Roegele, Otto 240 Rolland, Romain 249 Romains, Jules 240 Rose, Hans 63 Rosenberg, Edgar 243 Rößler, Matthias 102ff., 106 Rossmann, Kurt 222f. Rothe, Margaretha 44 Rudolph, Karl 121 Rühle, Otto 221f. Rummler, Siegbert 288 Rust, Bernhard 45, 159f. Sabinus, Georg 281 Sand, Karl Ludwig 122f. Sauer, Heinrich 82f. Sautter, Guy 267 Savigny, Karl Friedrich von 207 Schadewaldt, Wolfgang 240 Schaeffer, Hermann 132–135 Schäfer, Herwig 278 Scheffler, Uwe 287 Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 198, 200, 209, 214 Schelsky, Helmut 218, 223 Scherberger, Richard 262
Schiller, Friedrich von 31, 57, 85, 131, 154, 159–163, 171, 214 Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst 198f., 201f., 207, 209, 211, 213f., 219f., 224 Schlink, Bernhard 113 Schmidt, Friederike 118 Schmidt, Georg 83 Schmidt, Hans W. 58 Schmidt, Karl 262, 272 Schmidt, Siegfried 117 Schmoll, Josef Adolf (Eisenwerth) 242, 252, 254 Schoch, Magdalene 40–43 Schrade, Hubert 264, 268 Schröder, Gerhard 169, 188 Schröder, Kurt 219 Schubert, Charlotte 105 Schubert, Christoph Friedrich Daniel 22 Schubert, Ernst 128 Schuckmann, Friedrich von 202 Schultze-Naumburg, Paul 80 Schulze, Friedrich Gottlob 133 Schumann, Clara 126 Schumann, Robert 31 Schürr, Friedrich 266 Schwarz, Hermann 145 Schwarz, Otto 65, 67f. Schweninger, Ernst 85 Seebeck, Moritz 132 Sengle, Friedrich 240 Sessler, Robert 238, 242, 253 Sieburg, Friedrich 240 Siemers, Edmund 35f. Sievers, Eduard 122f. Simmel, Georg 130 Snell, Bruno 240 Sophie (Großherzogin) 255 Spranger, Eduard 206–213, 216f., 240 Stämpfli, Robert 244, 250 Steegmann, Robert 279 Steffens, Heinrich 201, 209, 213 Steiger, Günter 118, 121ff. Steinbüchel, Theodor 297 Steinmetz, Max 93 Stekeler-Weithofer, Pirmin 105 Stier, Friedrich 64 Stolper, Wolfgang F. 243 Stolz, Gerd 116 Stoy, Karl Volkmar 133 Stoy, Stephan 121 Straus, Émile 248, 250 Strauß, David Friedrich 118 Stroux, Johannes 216
Anhang Strubecker, Karl 266 Taffel, Menachem 275ff. Thaer, Albrecht Daniel 228 Thieme, Friedrich 121, 123 Thomasius, Christian 282 Tiefensee, Wolfgang 101–104, 106 Timm, David 106 Timm, Uwe 47 Toepfer, Alfred 257 Toledano, Raphaël 255, 278f. Topfstedt, Thomas 101 Ulbricht, Walter 96 Uschmann, Georg 121 Vinci, Leonardo da 241 Vogel, Frieda 295f. Vogel, Hans-Jochen 298 Voirin, Salle Pierre 243 Vollert, Max 121ff., 135 Wagner, Heinz 67 Wagner, Robert 255f., 264 Walther, Helmut G. 83 Wandel, Paul 170, 172, 216f. Wartenberg, Günther 97 Weber, Max 130, 185 Weber, Paul 63, 120f., 212f. Wechsler, Patrick 273, 278
313
Weigel, Erhard 24, 57 Weischedel, Wilhelm 220f., 228 Weiss, Carnelius 97 Weizsäcker, Carl Friedrich von 259, 264ff., 272 Welsch, Heinrich 243 Werner, Joachim 268 Wernert, Paul 261 Wessel, Horst 64f. Wield, Friedrich 48 Wienert, Walter 241 Wiese, Benno von 240 Wigand, Albert 49 Wilhelm II. 142, 151, 168, 189, 190ff. Wilhelm III. 150 Wimpina, Konrad 281 Winter, Christian 97 Wissmann, Hermann von 45–48 Wolff, Emil 49 Zahn, Gustav von 60 Zassenhaus, Hans 243 Zauche, Arno 52, 54 Ziehen, Julius 213 Zinserling, Gerhard 121 Zucker, Friedrich 65 Zwahr, Hartmut 105
Joachim Bauer / Gerhard Müller / Thomas Pester (Bearb.)
Statuten und Reformkonzepte für die Universität Jena von 1816 bis 1829
Quellen und Beiträge zur geschichte der universität Jena – Band 12 Der Band ist das Ergebnis einer gründlichen Quellensichtung und Aufarbeitung. Das Augenmerk richtet sich auf den schwierigen Übergang der Universität Jena hin zur Moderne. Sie spielte in den gesellschaftlichen Reformprozessen um 1800 eine herausragende Rolle. Auch für die thüringischen Herzogtümer, die als Erhalter der Universität fungierten, vornan Sachsen-WeimarEisenach und Sachsen-Gotha-Altenburg, blieb sie ein Markenzeichen. Goethe schrieb dazu 1807: „Wir sind niemals politisch bedeutend gewesen. Unsere ganze Bedeutung bestand in einer gegen unsere Kräfte disproportionirten Beförderung der Künste und Wissenschaften.“ In diesem Band finden sich Quellen, die die ganze Dimension des gesellschaftlichen Umbruchs spiegeln. Das Spektrum reicht von Dokumenten, die im Ergebnis der Konstitutionalisierungsprozesse in Sachsen-Weimar-Eisenach entstanden, über solche, die die Reformbestrebungen in der Studentenschaft augenscheinlich werden lassen, bis hin zu Quellen, die im Detail die Beteiligung Goethes an den Modernisierungsprozessen der Jenaer Universität belegen.
2016 451 Seiten mit 13 Abbildungen. 978-3-515-11299-4 kart. 978-3-515-11331-1 e-Book
Hier bestellen: www.steiner-verlag.de
Gottfried Meinhold
Der besondere Fall Jena Die Universität im Umbruch 1989–1991
Quellen und Beiträge zur geschichte der universität Jena – Band 11 An der Jenaer Universität vollzogen sich die Revolution und das Erneuerungsgeschehen zwischen 1989 und 1991 mit besonderer Konsequenz und gewannen dabei eine auffällige Eigendynamik. Sehr zeitig wurden in der Universität im Oktober 1989 Forderungen nach einer Auflösung der SED erhoben. Bereits im Dezember desselben Jahres erzwang eine universitäre Aktionsgemeinschaft für die demokratische Erneuerung, die vor allem von Medizinern getragen wurde, die Zustimmung des SED-Rektors zu freien und geheimen Wahlen der Gremien sowie zur Wahl eines neuen Rektors, die im Januar stattfanden. Der Autor – Zeitzeuge sowie Akteur – stellt diesen Prozess in seinen Phasen dar und dokumentiert ihn mit vielen erstmals publizierten Zeugnissen. Vor allem die kritischen Situationen, an denen die durchaus konfliktreiche Entwicklung auf Messers Schneide stand – Rektorwahl, Schließungen bzw. „Abwicklung“ ganzer Wissenschaftsbereiche – erfahren eine detaillierte Darstellung, die Tendenzen zur Legendenbildung vorzubeugen vermag. Besonderer Raum wird der ausführlichen Dokumentation der sich in einzelnen Fällen bis Ende 1989 erstreckenden Zusammenarbeit zwischen Universitätsangehörigen und Stasi gewährt.
447 Seiten. 978-3-515-10827-0 kart. 978-3-515-10835-5 e-Book
Hier bestellen: www.steiner-verlag.de
Tom Bräuer / Christian Faludi (Bearb.)
Die Universität Jena in der Weimarer Republik 1918–1933 Eine Quellenedition
Quellen und Beiträge zur geschichte der universität Jena – Band 10 Quelleneditionen zur Universitätsgeschichte der Weimarer Republik sind nach wie vor selten. Mit über 250 meist bislang unveröffentlichten Schriftstücken wird diese Lücke nun für die Jenaer Universität geschlossen. In sieben Abschnitten dokumentiert der Band verschiedene Themenbereiche – dabei stehen über die republikweit Aufsehen erregenden politischen und wissenschaftspolitischen Konflikte hinaus Strukturreformen, Mentalitäten, der Alltag Uni- versitätsangehöriger, prestigeträchtige Bauvorhaben und die universitäre Erinnerungskultur im Mittelpunkt. Die Edition bietet damit ein vielschichtiges, durch neu erschlossene Quellen auch über die Darstellungen der letzten Jahre hinaus reichendes Bild der Jenaer Universität in der ersten deutschen Demokratie. Diese Bandbreite verdeutlicht einmal mehr, dass die Weimarer Zeit auch für diese Traditionsuniversität weit mehr als ein bloßes Vorspiel des „Dritten Reiches“ bedeutete. aus dem inhalt Einleitung p Editionshinweise p Dokumente: Die Nachkriegsphase – Umbruch, Aufbruch und das Ringen um Normalität | Gegenläufige Strömungen – Extremisten, Antisemiten und Demokraten | Die Ära-Greil – Strukturreformen, Berufungspolitik und universitäre Widerstände | Prestigeprojekte – die bauliche Erweiterung der Landesuniversität | Jenaer Studierende – Alltag, Krisen und politische Betätigung | Die Ära Frick/Wächtler p Bildtafeln p Übersicht der Rektoren, Prorektoren und Dekane der Universität Jena 1918–1933 p Personenregister 432 Seiten mit 41 Fotos und 2 Abbildungen auf 17 Tafeln 978-3-515-10608-5 kart.
Hier bestellen: www.steiner-verlag.de
Die Beiträge dieses Bandes gehen auf die Spezifika akademisch-universitärer Erinnerungsorte ein: Vor dem Hintergrund der neueren Gedächtnis- und Erinnerungsforschung erläutern Universitätshistoriker und -archivare ihr Verständnis der Signalbegriffe „Erinnerungsorte“ und „Ambivalenz“. Zwei übergeordnete Problembereiche strukturieren den Band: Der Abschnitt „Erinnerung im Raum“ wendet sich der räumlichen Dimension des Erinnerns zu. Er trägt damit der im zurückliegenden Jahrzehnt
erneuerten geschichtswissenschaftlichen Aufmerksamkeit für die vieldeutige und historisch belastete „Raum“-Kategorie Rechnung. Denn im Zuge des „spatial turn“ ist diese Kategorie auch in der Geschichte von Erinnerungskulturen und Geschichtspolitik stärker als bisher in den Fokus gerückt. Der zweite Teil des Bandes, „Erinnerung, Sprache und Person“, umfasst Beiträge, die sich aus verschiedenen Zugangsrichtungen dem Problem universitärer Identitätskonstruktionen und Geschichtspolitiken widmen.
www.steiner-verlag.de Franz Steiner Verlag
ISBN 978-3-515-11573-5
![Aufbruch an deutschen Hochschulen: Beiträge zur Reform des deutschen Hochschulwesens [1 ed.]
9783428503704, 9783428103706](https://dokumen.pub/img/200x200/aufbruch-an-deutschen-hochschulen-beitrge-zur-reform-des-deutschen-hochschulwesens-1nbsped-9783428503704-9783428103706.jpg)

![Die andere Hälfte der Erinnerung: Die DDR in der deutschen Geschichtspolitik nach 1989 [1. Aufl.]
9783839417737](https://dokumen.pub/img/200x200/die-andere-hlfte-der-erinnerung-die-ddr-in-der-deutschen-geschichtspolitik-nach-1989-1-aufl-9783839417737.jpg)



![Die Chemikerprüfung als vielumstrittene Zeitfrage: Erörtert mit Beziehung auf Schäden des Unterrichts, der Prüfungen und der Studentenschaft an deutschen Hochschulen [Reprint 2020 ed.]
9783111674360, 9783111289595](https://dokumen.pub/img/200x200/die-chemikerprfung-als-vielumstrittene-zeitfrage-errtert-mit-beziehung-auf-schden-des-unterrichts-der-prfungen-und-der-studentenschaft-an-deutschen-hochschulen-reprint-2020nbsped-9783111674360-9783111289595.jpg)
![Körper Gabe: Ambivalente Ökonomien der Organspende [1. Aufl.]
9783839416310](https://dokumen.pub/img/200x200/krper-gabe-ambivalente-konomien-der-organspende-1-aufl-9783839416310.jpg)
![Der Krieg in den Köpfen: Die Erinnerung an den Dreißigjährigen Krieg in der deutschen Krisenerfahrung zwischen Julirevolution und deutschem Krieg [1 ed.]
9783428526550, 9783428126552](https://dokumen.pub/img/200x200/der-krieg-in-den-kpfen-die-erinnerung-an-den-dreiigjhrigen-krieg-in-der-deutschen-krisenerfahrung-zwischen-julirevolution-und-deutschem-krieg-1nbsped-9783428526550-9783428126552.jpg)