Zeitzeuge eines Jahrhunderts: Eine Familiengeschichte zwischen Adolf Hitler, Bruno Kreisky, Donald Trump und Wladimir Putin [1 ed.] 9783205218128, 9783205218104
251 56 3MB
German Pages [576] Year 2023
Polecaj historie
Citation preview
Peter Michael Lingens
Zeitzeuge eines Jahrhunderts Eine Familiengeschichte zwischen Adolf Hitler, Bruno Kreisky, Donald Trump und Wladimir Putin
9783525558461_Kuechler_Numismatik.indb 1
28.10.21 12:49
9783525558461_Kuechler_Numismatik.indb 2
28.10.21 12:49
Peter Michael Lingens
Zeitzeuge eines Jahrhunderts Eine Familiengeschichte zwischen Adolf Hitler, Bruno Kreisky, Donald Trump und Wladimir Putin
9783525558461_Kuechler_Numismatik.indb 3
28.10.21 12:49
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar. © 2023 Böhlau, Zeltgasse 1, A-1080 Wien, ein Imprint der Brill-Gruppe (Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich) Koninklijke Brill NVumfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, V&R unipress und Wageningen Academic. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Umschlagabbildung: Foto Peter Michael Lingens © Ludwig Drahosch. Titelseiten von Kurier, Standard und Falter mit freundlicher Genehmigung der Verlage. Umschlaggestaltung: Bernhard Kollmann, Wien Korrektorat: Vera M. Schirl, Wien Satz: le-tex publishing services, Leipzig
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com ISBN 978-3-205-21812-8
9783525558461_Kuechler_Numismatik.indb 4
28.10.21 12:49
Für: Anna, Christine, Eric, Eva, Holger, Katharina, Kerstin, Lisi, Lukas, Marko, Maximilian, Michael, Mira, Noah, Oliver, Rosa, Sebastian. Mit Dank für Holger Bartel
Inhalt
Vorwort ...................................................................................................... 13 1.
Das verlorene Paradies ........................................................................ 15
2.
Die Welt meiner Mutter – Das Rote Wien .............................................. 20
3.
Der Mann, der leider nicht mein Vater wurde ......................................... 33
4.
Der Seewolf ......................................................................................... 37
5.
Persönlichkeitsfremd ........................................................................... 45
6.
Meine deutsche Familie ....................................................................... 47
7.
Der goldene Helm ................................................................................ 52
8.
Nicht von der Türe weisen .................................................................... 56
9.
Auschwitz ............................................................................................ 63
10. Das Wehrmachtsgericht ....................................................................... 73 11. Der gebührende Platz für eine Hitlerbüste ............................................. 75 12. Heimkehr ............................................................................................ 78 13. Zuhause .............................................................................................. 95 14. Freundschaften und Lieben.................................................................. 104 15. Der Spieler und die verspielte Hinterbrühl ............................................. 108 16. Malerische Irrtümer ............................................................................. 112 17. Sprung vorwärts decken....................................................................... 114
8
Inhalt
18. Warum denn nicht Journalist? .............................................................. 121 19. Christine.............................................................................................. 135 20. Ein Vater namens Wiesenthal ............................................................... 143 21. Der Kurier des Hugo Portisch................................................................ 148 22. Der Übervater ...................................................................................... 159 23. Prager Frost......................................................................................... 164 24. Mit Portisch (k)eine Zeitung gründen..................................................... 168 25. Ossi Bronner sucht einen Chefredakteur ............................................... 172 26. Klaus’ Scheitern, Kreiskys Wagnis ........................................................ 184 27. Der Medienkanzler............................................................................... 188 28. Unter Verdacht .................................................................................... 192 29. Wie werden Skandale aufgedeckt? ....................................................... 195 30. Das Phänomen Jörg Haider .................................................................. 202 31. Chancenlos gegen Kreisky.................................................................... 210 32. Die „Hexen“......................................................................................... 214 33. Kreiskys ungeliebter Reformer.............................................................. 220 34. Die Marseillaise als Schlaflied .............................................................. 223 35. Leben mit Flüchtlingen ......................................................................... 230 36. Der vielgeliebte Hannes Androsch......................................................... 233 37. Das Scheitern unseres Experiments...................................................... 240 38. Neue Eigentümer, Rilke und Hoffmannsthal .......................................... 244
Inhalt
39. Der Vorteil internationalen Ansehens .................................................... 256 40. Der Konflikt Kreisky–Wiesenthal........................................................... 262 41. Ein Mann ohne Eigenschaften .............................................................. 267 42. Gut, dass Kreisky ein Demokrat war...................................................... 269 43. Versöhnung mit den Nazis – aber wie?.................................................. 272 44. Der AKH-Skandal ................................................................................. 278 45. Die Nummer drei der Todesliste des Abu Nidal ...................................... 282 46. Kreiskys ökonomische Visionen ............................................................ 292 47. Wie bekämpft man Arbeitslosigkeit? ..................................................... 304 48. Kreisky gegen Androsch ....................................................................... 308 49. Kein „profil mit Economist“................................................................... 311 50. Kreiskys Ende, die Geburt der Grünen................................................... 318 51. Ein sechsfacher Mord wartet auf eine Anklage ...................................... 324 52. Waldheim ............................................................................................ 330 53. Eine prosaisch gute, neue Ära .............................................................. 336 54. Die Zerreißprobe.................................................................................. 340 55. Die Trennung von profil ........................................................................ 345 56. Das Abenteuer TOPIC ........................................................................... 351 57. Wie aus Michael Eric wurde .................................................................. 359 58. Liberale Verleger sind rar ..................................................................... 363 59. Liberale Wähler sind rar ....................................................................... 366
9
10
Inhalt
60. Leser für Wirtschaftsmagazine sind rar ................................................. 370 61. Ein Türschild im Standard..................................................................... 379 62. Schuld und Sühne ............................................................................... 385 63. Erstmals Schwarz-Blau ......................................................................... 412 64. Der Tag, der die Welt veränderte........................................................... 414 65. Von Haider zu Strache – die Geburt des BZÖ ......................................... 418 66. Ein fremdes Land, verwandte Probleme ................................................ 422 67. Wollen wir uns verteidigen? .................................................................. 424 68. Die Macht der Krone ............................................................................ 428 69. Ein unerwartet erfüllter Lebenstraum .................................................... 431 70. Amerikas präsente Präsidenten ............................................................ 438 71. Warten auf die Krise ............................................................................ 447 72. Wie der Neoliberalismus die EU bedroht................................................ 450 73. Kurz, der perfekte Selbstdarsteller........................................................ 467 74. Das Wunder von Ibiza .......................................................................... 479 75. Erstmals Bürgerlich und Grün ............................................................... 481 76. Der Kriminalfall Kurz ............................................................................ 485 77. Covid-19.............................................................................................. 491 78. Ein krankes Land ................................................................................. 500 79. Schwäche und Chancen der Sozialdemokratie ...................................... 514 80. Das Reptil ........................................................................................... 520
Inhalt
81. Die Chance auf Frieden ........................................................................ 541 82. Teuerung und Inflation unterscheiden sich ............................................ 544 83. China plus Russland gegen USA plus EU ............................................... 550 84. Ausblick .............................................................................................. 552 Epilog ........................................................................................................ 567 Personenregister ........................................................................................ 569
11
Vorwort
Dieses Buch erscheint im Herbst 2023 exakt ein Jahr bevor in den USA und in Österreich Wahlen von schicksalhafter Bedeutung stattfinden. Am 5. November 2024 wird der Präsident der USA gewählt und es besteht die Möglichkeit, wenn auch nicht Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump wieder in dieses Amt gelangt. Dann wäre der mächtigste Staat der Welt kein demokratischer Rechtsstaat mehr, sondern ein faschistoides, innerlich gespaltenes Konglomerat miteinander verfeindeter Bundesstaaten, von denen einige evangelikal faschistisch sind. Die Militärmacht, die als einzige in der Lage ist, Europa vor Wladimir Putin zu schützen, zöge sich mit größter Wahrscheinlichkeit auf sich selbst zurück und ihr starker Mann hätte das größte Verständnis für Russlands starken Mann, dem er innerlich verbunden, wenn nicht durch vergangene Geschäfte ausgeliefert ist. Dieses Buch hofft erklären zu können, wieso Trump ausgerechnet nach Barack Obama an die Macht gekommen ist und warum nicht ausgeschlossen ist, dass er wieder gewählt wird. Es macht hoffentlich gleichzeitig klar, weshalb es so kritisch, wenn nicht unverantwortlich ist, dass die EU militärisch so völlig von den USA abhängt, statt selbst eine starke Streitmacht zu besitzen. Aber auch in Österreich findet im Herbst 2024 eine Wahl statt, bei der es nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich ist, dass mit der FPÖ eine faschistoide Partei die Mehrheit erringt. Dieses Buch hofft einmal mehr erklären zu können, wie es soweit kommen konnte: was die Führer der FPÖ, von Jörg Haider über Heinz Christian Strache bis Herbert Kickl eint; wie sehr Bruno Kreisky und ungewollt Christian Broda diese Partei gefördert haben und warum sie bei großen Teilen der österreichischen Bevölkerung so erfolgreich ist. Da zu befürchten ist, dass es der SPÖ nicht gelingt, bis zum Herbst 2024 so stark zu werden, dass sie gemeinsam mit Grünen und NEOS mehr Mandate als die FPÖ zusammen mit der ÖVP erreicht, bestand die größte Gefahr, dass die ÖVP eingedenk der so erfolgreichen Zusammenarbeit unter Sebastian Kurz und angesichts eines fast deckungsgleichen neoliberalen Wirtschaftsprogramms mit dieser faschistoiden FPÖ koaliert, obwohl sie dann der Juniorpartner und Kickl Kanzler wäre. Doch dann hat VP-Obmann Karl Nehammer Kickls absurde Ablehnung einer Teilnahme des neutralen Österreich am Luftabwehrsystem Sky Shield zum Anlass genommen, in ihm ein „Sicherheitsrisiko“ zu sehen und eine Koalition mit der FPÖ solange auszuschließen, als Kickl sie an anführt. Da auszuschließen ist, dass FPÖ und Kickl sich trennen, scheint das Risiko einer rechtsextrem dominierten österreichischen Bundesregierung damit stark verringert. Gebannt ist es freilich erst, wenn es tatsächlich zu einer Koalition ohne FPÖ gekommen ist. Denn vorerst besteht die (von mir für
14
Vorwort
gering gehaltene) Gefahr, dass Nehammer sich wie Johanna Mickl Leitner nicht an sein Versprechen hält, obwohl er es, in der ZIB2 von Armin Wolf immer aufs neue hinterfragt, denkbar glaubwürdig gegeben hat. Vor allem aber ist nicht auszuschließen, dass Nehammer mangels politischen Erfolges als VP-Obmann abgesetzt und durch jemanden ersetzt wird, der sich die blau-schwarze Option offen hält und sie wahrnimmt, wenn ihm die FPÖ bessere Bedingungen (mehr Ministerposten) anbietet. Die Folgen wären desaströs: Österreich wäre dann ein Staat, in dem eine Partei mit dem größten Verständnis für Wladimir Putin darüber entschiede, was nicht nur innen-, sondern auch außenpolitisch geschieht: Kanzler Kickl könnte jede weitere Maßnahme der EU gegen Russland torpedieren und täte das wohl auch. Obwohl ein solches Fiasko angesichts meines hohen Alters der mit Abstand kürzeste Teil meiner Familiengeschichte wäre, hoffe ich, dass dieses Buch einen Beitrag leistet, es endgültig abzuwenden. Gleichzeitig hoffe ich im mit Abstand längsten Teil meiner Familiengeschichte aufzuzeigen, wie sehr Sozialismus in seiner großen Zeit eine bürgerliche Tugend gewesen ist und weiterhin sein sollte. Wie sehr es den USA schadet, dass es ihn dort nie gegeben hat. Und wie sehr es der EU schadet, dass der Sozialismus dort von einem Neoliberalismus abgelöst wurde, dessen ökonomische Missverständnisse ihren Zusammenhalt gefährden. Peter Michael Lingens
1.
Das verlorene Paradies
Meine früheste Erinnerung an Österreichs Geschichte ist trotz des bereits in ganz Europa tobenden Krieges sonnig: Meine Mutter im Badeanzug auf einem schlampig über eine saftige Wiese gebreiteten Handtuch sitzend. Hinter ihr ein Glashaus, dann sonnendurchflutete Laubbäume. Vor ihr der Rand eines einfachen, gemauerten Schwimmbeckens – der graue, raue Wandstreifen über dem Wasserspiegel hat sich mir besonders eingeprägt. Heute weiß ich, wo sich dieses Becken befand: im unteren flachen Teil des Anwesens des Privatgelehrten Karl Motesiczky im Wiener Nobelvorort Hinterbrühl. Mittlerweile ist es längst zugeschüttet, denn es war den untersten Häusern des SOS-Kinderdorfes im Weg, das der riesige Park heute beherbergt. Auf dem einzigen Foto, das ich Jahrzehnte später von einer Bekannten erhielt, die uns 1940 dort besucht hatte, sah es jedenfalls exakt so aus, wie ich es im Gedächtnis habe. Selber sehen und für ein paar Minuten sogar betreten konnte ich hingegen das Haus, das wir damals bewohnten. Es ist heute das Haus der Kinderdorf-Leitung und ich hätte der Dame, die mir Zutritt gewährte, präzise erzählen können, wie sein größter Wohnraum vor ihrer Zeit eingerichtet war: Mit einer Maria-Theresien-Barock-Kommode, die sich prachtvoll von den weiß getünchten Wänden abhob. Mit einem schweren Jogltisch vor einer hölzernen Eckbank. Und mit zwei ebenso schweren, hohen Lehnstühlen, deren grüner Brokatbezug aus dem Rahmen gefallen wäre, wenn er seinen Seidenglanz nicht schuldbewusst abgelegt hätte. Es sei das gemütlichste Zimmer der Welt gewesen, schwärmte mir meine Mutter immer aufs Neue vor, als sie mich nach ihrer Rückkehr aus dem Konzentrationslager in einem Kärntner Gasthaus wiederfand. Die Beschreibung der Möbel wiederholte sie so oft, dass ich sie vor mir sehe, obwohl ich sie, anders als das Schwimmbad, niemals bewusst gesehen habe. Denn es waren nicht einmal unsere Möbel. Es war auch nicht unser Haus, sondern das des Karl Motesiczky. Genauer gesagt das „Gesindehaus“ seines vielleicht hundert Meter entfernten, heute komplett geschliffenen Schlösschens, das aber schon damals vor sich hin verfallen war – nur die Möbel hatte er übersiedelt. Karl Graf von Motesiczky hatte es von seiner Mutter, Baronin Henriette von Lieben, aus der gleichnamigen jüdischen Bankendynastie geerbt und aus ideologischen Gründen nie bewohnt: Er war, wie mein Vater, der einer deutschen Industriellendynastie entstammte, überzeugter Kommunist. Was er sich neben seiner Wiener Wohnung gestattete – den Liebens gehörte auch das Palais Todesco, das er ebenfalls mied – war die Wohnung im Obergeschoß des Hinterbrühl’schen Gesindehauses, das er freilich nie so nannte und höchstens einmal im Monat aufsuchte.
16
Das verlorene Paradies
De facto wurde es während der Sommermonate von seinen besten Freuden bewohnt: Von meiner Mutter, Dr. jur. stud. med. Ella Lingens, von ihrem Ehemann stud. med. Kurt Lingens und ab dem Frühherbst des Jahres 1939, auch von mir als ihrem einzigen Kind. Es muss sich bei meiner Schwimmbad-Erinnerung also um einen Sommertag des Jahres 1942 handeln, weil jede Erinnerung nach übereinstimmender Überzeugung von Psychologen und Neurologen frühestens im Alter von zweieinhalb Jahren einsetzt und ich am 8. August des Jahres 1939 geboren wurde – exakt 23 Tage vor Beginn des Zweiten Weltkrieges. Das erklärt die zweite meiner frühesten Erinnerungen: Ein dunkler Mercedes auf dem breiten Kiesweg vor dem Gesindehaus. Männer, die aus diesem Mercedes aus- und irgendwann mit mir wieder einstiegen. Einer der Männer ist uniformiert und sitzt mit mir auf der hinteren Bank des Wagens. Während der Fahrt zieht er seinen Revolver aus dem Halfter, zeigt und erklärte ihn mir und lässt mich sogar damit spielen. Ich schaue begeistert zu ihm auf. Meine Erinnerung endet damit, dass ich in einem städtischen Wohnhaus abgeliefert und dort von einer Frau – es war eine Schwester meiner Mutter in ihrem gemeinsamen Elternhaus in der Theresianumgasse 12 in Wien-Wieden – in Empfang genommen wurde. „Danke“, sagte ich artig dem freundlichen Uniformierten, der zweifelsfrei ein SS-Mann gewesen ist. Meine Eltern – doch das erfuhr ich erst viele Jahre später – wurden an diesem 13. Oktober 1942 ins Gefängnis der Gestapo am Wiener Morzinplatz eingeliefert. Mit ihnen auch Karl Motesiczky sowie zwei weitere Mitglieder der kleinen Widerstandsgruppe, deren wesentliches Delikt darin bestanden hatte, in der Stadtwohnung meiner Eltern in der Piaristengasse, im „Gesindehaus“ und im unbewohnten verfallenen Schloss in der Hinterbrühl Juden versteckt zu haben. „Ansonsten“, so erzählte mir meine Mutter im Sommer 1945 nach ihrer Rückkehr aus Dachau, wohin sie gegen Kriegsende aus Auschwitz übersiedelt worden war, „haben wir im Radio heimlich einen englischen Sender namens BBC gehört und uns ausgemalt, wie es sein wird, wenn wir nach dem Krieg wieder glücklich zusammensitzen werden.“ Dazu ist es nicht gekommen: Motesiczky starb in Juni 1943 in Auschwitz an Fleckfieber. Mein Vater glaubte meine Mutter 1944 in Auschwitz verstorben und lebte bei ihrer Rückkehr mit einer anderen Frau zusammen. Ich finde in meiner Erinnerung kein Bild meines Vaters – und schon gar keines, das ihn gemeinsam mit meiner Mutter zeigt. Bei allen weiteren Bildern aus meiner frühesten Kindheit – ein riesiger SchäferBernhardiner-Mischling, auf dem ich reite, ein riesiger hölzerner Esstisch, auf dem ich einer sehr hübschen, blonden Frau entgegenrobbe, eine sonnige Straße, die ich an der Hand meiner Mutter entlanglaufe – bin ich nicht sicher, ob sie wirklich meiner Erinnerung oder den so intensiven Erzählungen meiner Mutter entstammen.
Das verlorene Paradies
Denn in ihrem Herzen blieb die Hinterbrühl bis zu ihrem Tod mit 92 ihr eigentliches Zuhause: Das Paradies, aus dem sie am 13. Oktober 1942 vertrieben worden war. Für mich war das bis zu meinem 27. Lebensjahr nicht anders. Damals gründete ich selbst eine Familie und bewohnte mit ihr ein Haus in einem riesigen, an einen Park grenzenden Garten im 23. Wiener Gemeindebezirk. Er gehörte der Mutter meiner damaligen Ehefrau und ich habe darin ein Fertigteilhaus errichtet. Das übergroße Wohnzimmer habe ich mit gerade noch erschwinglichen bäuerlichen Knochenbarock-Möbeln und einem Jogltisch eingerichtet, zu dem sich nach der Übersiedlung meiner Mutter zwei hohe Lehnstühle mit Bezügen aus grünem Brokat gesellten. Eine Maria-Theresien-Barock-Kommode, für deren Ankauf sie ein relatives Vermögen – ihre Haftentschädigung für Auschwitz – aufgewendet hatte, verblieb vorerst in ihrer Wohnung auf der Wieden, zu der ihr Elternhaus geschrumpft war und steht heute in meinem Haus in Marbella. Als ich 1993 von einem befreundeten Schulkollegen, der Tierarzt von Schönbrunn geworden war, erfuhr, dass einer seiner Klienten einen Schäfer-Bernhardiner-Welpen verkauft, wurde er der erste eigene Hund meiner Kinder und war bald ebenso groß wie in meiner Erinnerung. Unser Anwesen in Mauer, auf dem er mit ihnen herumtollte, war fast so paradiesisch wie die Hinterbrühl. Vielleicht kam ich deshalb damals auf die Idee, meine Erinnerung zu überprüfen und die Gegenwart daran zu messen: Ich fuhr erstmals an den Ort, an dem ich die ersten zweieinhalb Jahre meines Lebens verbracht hatte, um mir das „Gesindehaus“ und seinen Park anzusehen und suchte Nachbarn auf, um mich nach dem Schicksal meines Hundes zu erkundigen. Ich weiß nicht mehr mit absoluter Sicherheit, was sie mir wirklich über ihn erzählten, und sie sind mittlerweile verstorben. Aber in meinem Kopf hat sich jedenfalls folgende Geschichte festgesetzt: Nach der Verhaftung meiner Eltern und Motesiczkys wurde sein Gut von einem höheren Dienstgrad der SS in Besitz genommen. Natürlich hat sich dieser zweifellos hundeliebende Mann auch des Schäfer-Bernhardiner-Mischlings angenommen, den ich zu meinem ersten Geburtstag erhalten hatte und auf dem ich bis zum Eintreffen des Autos mit dem SS-Mann geritten war. Dennoch bin ich ganz sicher, dass mein Hund den hohen SS-Mann nicht mochte, obwohl er offenkundig von ihm gefüttert wurde. Sonst müsste ich eine andere, mir höchst unwillkommene Erklärung für das finden, was dann passiert sein soll: Als der Krieg zu Ende war, so die Story, habe sich der SS-Mann mit Kartons von Lebensmitteln im Glashaus hinter dem Schwimmbad versteckt. Doch mein Hund sei davor auf und ab gelaufen und habe gebellt. Wütend, nach meiner Überzeugung – nicht vielleicht hungrig, weil er zu den Nahrungsmitteln und dem SS-Mann wollte, der ihn gefüttert hatte. Jedenfalls habe der SS-Mann Angst bekommen, dass das Bellen ihn verrät und meinen Hund erschossen.
17
18
Das verlorene Paradies
Ich weiß, wie gesagt, nicht mit Sicherheit, ob es wirklich ganz so gewesen ist, ja nicht einmal, ob die Nachbarn es mir wirklich genau so erzählt haben. Aber für mich ist es eine wahre Geschichte: Alles was mir als Kind lieb war, hat die SS mir genommen.
Die genitale Phase Alle anderen Erinnerungen meiner Mutter an mich sind mit noch größerer Vorsicht zu genießen: der allgemeinen Verklärung jener Jahre wegen – und wegen der speziellen Verklärung, die alle Kinder im Gedächtnis aller Mütter erfahren. Natürlich erwies ich mich schon als Einjähriger als außergewöhnlich intelligent: Nachdem der Kinderarzt meinen Brustkorb mit dem Stethoskop abgehört hatte und gerade dabei war, meine Hüftgelenke zu überprüfen, hätte ich es ihm aus der Hand genommen und versucht, es an seine Brust zu legen. „So etwas ist mir mit einem so kleinen Kind noch nie passiert“, soll er „fassungslos“ gesagt haben. Ich habe versucht, meiner Mutter anzudeuten, dass die Untersuchung vermutlich ein Jahr später als in ihrer Erinnerung stattgefunden hat – mit Zwei versuchen die meisten Kinder durch Nachahmung zu lernen – aber sie war nicht bereit, darüber zu verhandeln. Für sie war ich ein Genie. Dazu von Beginn an, „mit einem angeborenen Sinn für alles Schöne begabt“ (O-Ton meiner Mutter). So hätte ich als Zweijähriger meinen Schemel gepackt und sei mit ihm den ziemlich steilen Weg hoch gestapft, der im hinteren Teil des Motesiczky-Parks einen Wald erschloss. Dort hätte ich mich in einer Kurve an den Wegrand gesetzt, um die Schönheit des Ausblicks zu genießen. So jedenfalls hätte ich es dem Kindermädchen erklärt, das mich eine Stunde hindurch verzweifelt gesucht habe. Ich habe das Kindermädchen später nie mehr gesehen, obwohl ich durch Jahre in der Keusche seiner Mutter in Kärnten wohnen sollte, also konnte ich es nicht mehr fragen, ob es wirklich so gewesen ist. Und einen Vorteil hatte diese mütterliche Affenliebe, die ich sonst von jüdischen „Mamen“ kenne, die ihre Kinder damit gegen die Verletzungen des allgegenwärtigen Antisemitismus wappnen wollen: Es fehlte mir nie an Selbstwertgefühl, auch wenn ich dennoch kein sicherer Mensch wurde. Auch die riesige hölzerne Tischplatte aus meiner Erinnerung hatte nach der Erinnerung meiner Mutter mit meinem Sinn für das Schöne zu tun: Den ganzen Tag über hätte eine ältere Bekannte meiner Eltern sich aufs Reizendste um mich gekümmert, so dass sie mich drängten, ihr vor dem Zubettgehen doch einen Gutenachtkuss zu geben – „Nein, der da“, hätte ich widersprochen und sei über den Tisch zur bildhübschen Verlobten meines Onkels Klaus gerobbt. Dort hätte ich den Gutenachtkuss unter dem Lächeln meines Onkels und den etwas betretenen Blicken meiner Eltern an die errötende junge Frau gebracht.
Die genitale Phase
Ich habe später ein Foto von ihr gesehen und eine unglaubliche, großartige Geschichte über sie gehört – wenn mein Kuss für sie stimmt, habe ich tatsächlich Geschmack bewiesen. In jedem Fall war es meiner Mutter immer sehr wichtig, klarzustellen, dass meine frühkindliche Sexualität erstens mit ausreichend Antriebskraft ausgestattet war und sich zweitens auf das in ihren Augen einzig richtige Objekt konzentrierte: Frauen, die nicht meine Mutter waren. Dass Zielgenauigkeit und Intensität meiner erotischen Wünsche meine Mutter so sehr beruhigten, hing nicht mit ihrer allgemeinen Hingabe an „Sexualität“ zusammen – sie war im Gegenteil im Innersten eher prüde – sondern beruhte darauf, dass sie, zumindest in ihrer Jugend, eine kritiklose Anhängerin der Lehre Sigmund Freuds war: Sexualität hatte die entscheidende Antriebskraft im Leben jedes Mannes zu sein – wer mehr davon besaß, war vom Schicksal begünstigt. Und sie hatte sich auf das andere Geschlecht zu richten – Homosexualität erachtete Freud als Perversion auf der Basis einer zu starken Bindung von Söhnen an ihre Mütter. Dass Josef seine Brüder in Thomas Manns Romantrilogie auch durch die Größe seines Geschlechts in den Schatten stellt, ließ meine Mutter diesen Autor daher immer auch wegen seines psychoanalytischen Einfühlungsvermögens besonders schätzen. Dass er zeitlebens einen intensiven Hang zur Homosexualität verdrängte, nahm sie erst später mit Verblüffung wahr, verzieh es ihm aber als gelungene „Sublimierung“ durch die Niederschrift von „Tod in Venedig“. Die längste Zeit spielte die Psychoanalyse im Kopf meiner sonst so kritischen Mutter aber die Rolle einer Religion: Sie glaubte bedingungslos an Freuds Thesen. Nach einem Selbstmordversuch mit 18 hatte sie eine Psychoanalyse beim FreudSchüler Edward Bibring begonnen – und nicht abgeschlossen, weil er in die USA emigrieren musste. Gemeinsam mit meinem Vater besuchte sie aber neben beider Medizinstudium an der Wiener Universität den Arbeitskreis des Pädagogen August Aichhorn, der es als „Arier“ riskierte, weiterhin psychoanalytische Thesen – wenn auch unter einem anderen Namen – zu vertreten. Eifrigster Teilnehmer dieses Arbeitskreises und teilweise auch sein Financier war Karl Motesiczky, der von einer Verbindung von Psychoanalyse und Kommunismus träumte. Die beiden Heilslehren haben tatsächlich etwas gemeinsam: den verfehlten Versuch einer monokausalen Deutung des Weltgeschehens. Aber das begriff meine Mutter erst viele Jahre später. Damals ergab sich die sofortige intensive Freundschaft meiner Eltern mit Karl Motesiczky mit der Zwangsläufigkeit religiöser Vorbestimmung.
19
2.
Die Welt meiner Mutter – Das Rote Wien
Ich habe in den meisten meiner Bücher und vielen meiner Artikel über meine Mutter geschrieben. Über die Ereignisse, die sie prägten; über die Motive ihres Handelns; über ihre Erfahrungen in Auschwitz; aber auch über ihre Meinung zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen. Das hat mir bei Lesern und Kollegen den Ruf einer „extremen Mutterbindung“ eingebracht: Sie argwöhnen, dass meine politischen Ansichten eigentlich die ihren wären; sie warfen mir vor, das Leichtgewicht meiner Meinung um das Schwergewicht der ihren zu erhöhen; mich im Licht ihrer Leistung zu sonnen. Alle diese Behauptungen stimmen. Alles, was ich denke, fühle und tue ist aus dem Denken, Fühlen und Tun meiner Mutter zu erklären. Auch wenn es manchmal das Gegenteil dessen war, was sie für richtig hielt – dann war es eben das „Gegenteil“. Diese Verzahnung unserer Leben hat einfache, nachvollziehbare Ursachen: Ich war das einzige Kind meiner Mutter. Es gab meinen Vater nur durch die ersten zweieinhalb Jahre meines Lebens – danach lebte er nur in ihren Erzählungen fort. Und sie war eine außergewöhnliche Frau, die zu bewundern auch viele andere Menschen selbstverständlich fanden. (Ihnen fiel diese Bewunderung sogar noch viel leichter, denn sie kannten nur ihre Leistungen, nicht die Probleme, die das Zusammenleben mit ihr gelegentlich aufwarf.) Ich muss also einmal mehr über meine Mutter schreiben, weil meine Lebensgeschichte ohne ihre Lebensgeschichte nicht verlaufen wäre, wie sie verlaufen ist. Ich werde mich aber so kurz wie möglich halten und nur wiederholen, was ich unbedingt wiederholen muss. (Leser, die meine „Ansichten eines Außenseiters“ kennen, mögen entschuldigen, dass ihnen vieles zwangsläufig bekannt vorkommen wird.) Meine Mutter war das fünfte und letzte Kind der Generaldirektorstochter Elsa Reiner, geborene Thommen, mit dem Bahnbeamten Friedrich Reiner. Dass sie eine „geborene Thommen“ war, ist deshalb so wichtig, weil sie es zeitlebens mehr als eine „verehelichte Reiner“ gewesen ist. Ihr Vater Achilles Thommen war und blieb ihr Idol. Er stammte aus einer angesehenen Schweizer Familie, sah extrem gut aus und war ein ausnehmend begabter Ingenieur: als Miterbauer der Semmering- und Vollender der Brennerbahn ging er in die Geschichte der Technik ein. In Innsbruck ist bis heute eine Straße nach ihm benannt. Es war kein Wunder, dass Elsa ihren Vater anhimmelte – Friedrich Reiner konnte unmöglich mit ihm Schritt halten. Ein Psychoanalytiker behauptete vermutlich: Sie hätte Friedrich Reiner gar nicht geheiratet, wenn er in der Lage gewesen wäre, mit ihrem Vater Schritt zu halten.
Die Welt meiner Mutter – Das Rote Wien
Die beiden hatten einander auf einem Ball der „Nordwestbahn“ kennengelernt, deren Verwaltungsrat Achilles Thommen nach Abschluss seiner Bautätigkeiten geworden war. Friedrich Reiner war einer seiner höheren Beamten, tüchtig in seiner Funktion, ein guter Tänzer und „aus guter Familie“: In Ernestinovo, im heutigen Kroatien, besaßen die Reiners ein großes Landgut, das Friedrich Reiner allerdings nur aufsuchte, um dort zu jagen. Achilles Thommen hatte gegen ihn als Schwiegersohn nichts einzuwenden und trug wohl maßgeblich zur Finanzierung des stattlichen Hauses bei, das das junge Paar in der Theresianumgasse bezog und mit Hausbesorger-Ehepaar, Köchin und Näherin bewohnte. Tagsüber kam noch ein Zimmermädchen hinzu. Elsa Thommen hatte zu Recht das Gefühl, ihren Ehemann zu sich emporgehoben und ihm eine gesellschaftliche Stellung verschafft zu haben, die er ohne sie nicht erlangt hätte. Er hatte ihr dafür dankbar zu sein und bewundernd zu ihr aufzublicken – bewundernd zu ihm aufzublicken kam ihr nicht in den Sinn. Ihre Bewunderung blieb auf ihren Vater beschränkt – ihren Ehemann war sie zu mögen bereit. Aber Friedrich Reiner hielt sich nicht an diese Rangordnung. Er überredete seine Familie, den Fluss Drina zu regulieren, der bis dahin einen großen Teil des familieneigenen Gutes zu unbrauchbarem Sumpfgebiet gemacht hatte und gewann auf diese Weise riesige Flächen besten Ackerbodens. Die Geldentwertung erlaubte ihm, die Kosten der Regulierung in kürzester Zeit zurückzuzahlen und mit 60 bei der Bahn pensioniert mutierte er zum Agrarunternehmer: Innerhalb weniger Jahre machte er seinen Teil des Landes, dessen Verwaltung er nun zur Gänze übernahm, zu einem Mustergut, das mit tausend Rindern bald beträchtliche Einnahmen abwarf. Ständig die neueste landwirtschaftliche Literatur studierend, importierte er die damals wenig bekannte Soja Bohne aus den USA, um sie an Stelle von traditionellem Gemüse anzubauen, und angeblich erreichten die Pflanzen auf seinem Boden das Doppelte ihrer normalen Größe. Letztere Angabe stammt von meiner Mutter und ist, wie ihre auf mich bezogenen Angaben, mit leiser Vorsicht zu genießen, denn im Gegensatz zu ihrer Mutter liebte und bewunderte sie ihren Vater. Gesichert ist, dass Friedrich Reiner zu einem der größten heimischen Produzenten von Sojamehl wurde. Damit nicht genug tat er sich mit einem Chemiker zusammen, der ein Verfahren zur Entbitterung des Sojamehls entwickelt hatte und gründete mit ihm die österreichischen Edelsoja-Werke als erfolgreiches Nahrungsmittelunternehmen. Als seine Hausbank, die heute noch bestehende Kathrein-Bank in Wien, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, erwarb er auch an ihr einen erheblichen Anteil. Ohne jede Hilfe seines Schwiegervaters war Friedrich Reiner zu einem vielfachen Millionär geworden, dem durchaus Respekt und gelegentlich sogar Bewunderung entgegengebracht wurde. In dem Ausmaß, in dem das geschehen war, hatte sich die Beziehung zu seiner Frau verschlechtert. Meine Mutter war das letzte Kind, das dieser verschlechterten Beziehung entsprang.
21
22
Die Welt meiner Mutter – Das Rote Wien
„Das wird ihr kräftigstes Kind“, soll der Arzt gesagt haben, als er Elsa Reiner am 18. November 1908 von ihrer dritten Tochter entband. Das war ein zutreffendes Urteil: Ella, wie sie als Abkürzung von Gabriella genannt wurde, war ein physisch ungemein kräftiges Mädchen, das ihr älterer Bruder, wenn er Kämpfe mit anderen Buben austrug, an seiner Seite wissen wollte, weil sie Gleichaltrige in Sekunden zu Boden warf. Später gewann sie Schulfreundinnen, indem sie bei Ausflügen deren Rucksack zu dem ihren schulterte. Sie paddelte donauabwärts bis zum schwarzen Meer oder schwamm von Greifenstein bis Wien. Im Rahmen der Naturfreunde begann sie zu klettern und übertraf auch darin viele ihrer männlichen Kameraden: Sie kletterte „Siebenersteige“ (die schwersten, die es in der Alpinistik gibt) und „führte“ auf Gipfel wie die Drei Zinnen oder die Vajolet-Türme: Sie kletterte voraus, ihre Bergkameraden kletterten hinter ihr am Seil. Für mich, den schon Schwindel packt, wenn er auch nur an den Rand eines Bergplateaus treten soll, (näher als einen Meter komme ich ihm nie) war dieser Mangel an Höhenangst absolut rätselhaft. „Man kann doch auf einem zehn Zentimeter breiten Streifen problemlos durch ein Zimmer gehen. Warum soll man das nicht können, wenn es daneben in einen Abgrund geht?“ versuchte sie vergeblich mir ihren Mangel an Höhenangst zu erklären. Ihre Freiheit von jeder Angst hat zweifellos dazu beigetragen, dass sie das Risiko auf sich nahm, Juden zu verstecken. Dass sie so außergewöhnlich kräftig war, hat zweifellos dazu beigetragen, dass sie Auschwitz überlebt hat. Seltsamerweise fällt es mir dennoch schwer, in meiner Mutter eine „starke Frau“ zu sehen. Denn abseits von Felswänden war sie zutiefst unsicher: hatte immer die panische Angst, von den Menschen, die sie umgaben und gar den Menschen, denen sie gefallen wollte, zurückgestoßen zu werden. Vor Publikum über Themen zu sprechen, die sie mir gegenüber in und auswendig kannte und besser als jeder andere beherrschte, machte ihr solche Mühe, dass ihr gelegentlich die Stimme versagte. Dennoch vermochte dieselbe Frau Gestapobeamten oder SS-Männern ohne das geringste Zittern in der Stimme die Stirn zu bieten. Sie selbst erklärte es wie so vieles mit Sigmund Freud: Es sei der kulturelle Wert von Neurosen, dass Neurotiker in der Gefahr mehr Stärke und Entschlossenheit als Gesunde zeigten. Wahrscheinlich mache ich den Fehler, psychische Stärke mit psychischer Gesundheit gleichzusetzen, wenn ich meine Mutter nicht „psychisch stark“ finden kann. Schon mit zwölf Jahren war ihre Unsicherheit so groß, dass sie insgeheim von dem Alkohol trank, den ihre Eltern in einem eigenen Schrank aufbewahrten: „Es hat damit angefangen, dass ich die Gläser leergetrunken habe, die nach einer Gesellschaft noch am Tisch gestanden sind. In der Wärme des Alkohols habe ich mich eingehüllt gefühlt. Aber ich habe es wieder aufgegeben, als ich bemerkt habe, dass es zu einem Zwang werden könnte, den ich nicht mehr kontrollieren kann.“
Die Welt meiner Mutter – Das Rote Wien
Mit achtzehn vermochte sie ihre unterbewusste Sehnsucht nach dem Tod nicht mehr zu kontrollieren: Sie beging einen ernsthaften Selbstmordversuch. Danach begann sie eine psychoanalytische Behandlung, wie übrigens auch ich sie nach einem weit weniger ernsthaften Selbstmordversuch in etwa diesem Alter begonnen habe. Die Geschichte, die sie ihrem Analytiker als erste erzählte, hat sie auch mir ein gutes Dutzend Male, zuletzt nur wenige Tage vor ihrem Tod erzählt. Sie spielt im Ausseerland, wo meine Großeltern im Sommer stets für mindestens einen Monat einen Bauernhof auf der „Obertressen“ hoch über dem Grundlsee gemietet hatten. (Den Bauernhof darunter bewohnte im Sommer die Familie Freud, was meine Mutter stets als symbolisch erachtet hat.) Natürlich hatte man bei dieser Gelegenheit eigenes Geschirr und manchmal auch die eigene Köchin mit, und Elsa Reiner liebte es, bei Picknicks oder Jausen ein wenig Hof zu halten, indem sie bei dieser Gelegenheit andere sommerfrischende Damen der Gesellschaft empfing. An diesem besonderen Tag kreiste das Gespräch um die empfangenen und ausgetragenen Kinder und Elsa Reiner soll sich dabei – sagt meine Mutter diesmal absolut glaubhaft – folgendermaßen geäußert haben: Also beim Friedl, der unser Erster war, war ich natürlich überglücklich – auch weil es gleich ein Bub gewesen ist. Auch bei der Edith und der Herta hab’ ich mich noch sehr gefreut, denn das waren jetzt Mädchen, auch wenn sie wie der Friedl schwerhörig gewesen sind. Und der Helmut war dann der erste, der endlich gut gehört hat – das war natürlich auch eine Freude. „Aber bei der Ella hatte ich wirklich genug.“ So jedenfalls hörte es meine nebenan im Gras spielende damals sechsjährige Mutter und wollte „am liebsten im Erdboden versinken“. Alles, was sie von ihrer Kindheit erzählte, spinnt diese tiefe Verunsicherung fort. Wenn die Familie, meist ohne Friedrich Reiner, der noch in seinem Gut in Ernestinovo gebraucht wurde (oder sich dort wohler fühlte) am Südbahnhof nach Aussee aufbrach, ging Elsa Reiner mit den größeren Geschwistern voraus, um im stehenden Zug Plätze zu besetzen, während meine Mutter bei den Koffern warten sollte. „Ich habe immer die Angst gehabt, dass sie nicht zurückkommen und ohne mich wegfahren“, erzählte sie mir. Auch von ihren Geschwistern kenne ich dutzende Geschichten über ihr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter: So musste sie, trotz des erheblichen Wohlstandes der Familie, stets die Kleider ihrer beiden älteren Schwestern „auftragen“. Wenn sie zu kurz waren, wurden sie unten angestückelt. Das entsprach zwar auch dem calvinistisch puritanischen Hintergrund ihrer Mutter – die Köchin durfte nur zweimal in der Woche Fleisch servieren und Pölster wurden von der Näherin „gewendet“, nie ausgetauscht – aber bei meiner Mutter bedachte Elsa Reiner nicht einmal die gesellschaftliche Wirkung nach außen, die ihr sonst durchaus nicht gleichgültig war. Als Ella mit einem unten angestückelten Wintermantel in der noblen Privatschule auftauchte, in die man sie selbstverständlich gesteckt hatte, bat deren Direktorin Elsa Reiner zum Sprechtag, um ihr zu empfehlen, ihrer Tochter doch einen neuen Mantel zu kaufen, um den Ruf der Schule nicht zu gefährden.
23
24
Die Welt meiner Mutter – Das Rote Wien
Psychologisch geschult wie sie war, hat meine Mutter stets auch ausgeführt, was sich zur Verteidigung ihrer Mutter anführen ließ: Dass sie ihr die beiden Buben vorzog, sei für den weiblichen Elternteil selbstverständlich (entsprach einmal mehr auch den Thesen Sigmund Freuds); und dass sie sich zwangsläufig vor allem um ihre beiden schwerhörigen Töchter mehr als um sie gekümmert habe, sei zumindest verständlich – schließlich sei sie zu recht besorgt gewesen, dass diese ihr Leben nicht meistern könnten. „Sie war wahrscheinlich der Meinung, dass mich das Schicksal sowieso bevorzugt hat und wollte das ausgleichen.“ Aber auch wenn an dieser Verteidigung manches zugetroffen haben mag – meine Mutter hat es zwar der Fairness halber vorgetragen, aber nie als Entschuldigung gelten lassen: Ihre Mutter war einer der ganz wenigen Menschen, die sie gehasst hat. (Josef Mengele war der einzige mir sonst noch geläufige, ehe diese Rolle meiner zweiten Frau zufiel.) Sie schloss sich den Sozialdemokraten an, weil ihre Mutter eines Tages, als Streikende durch die Theresianumgasse zogen, zur Köchin sagte: „Tini, versperren’S die Tür, damit das rote G’sindl nicht hereinkommt.“ „Bei einer Organisation, vor der meine Mutter sich gefürchtet hat, wollte ich dabei sein“, sei ihr zentrales Motiv gewesen, der SPÖ beizutreten. Sie wusste natürlich sehr genau auch um die politischen und durchaus rationalen Gründe, die dazu führten, dass sie sich den Sozialdemokraten anschloss, und sie hätte sich wieder von ihnen getrennt, wenn sie der Überprüfung durch ihren Verstand nicht standgehalten hätten. Sie ist nicht nur aus Wut gegen ihre Mutter der SPÖ beigetreten – aber es war ihr wichtig, mir gegenüber den emotionalen Hintergrund ihrer politischen Entscheidung aufzuzeigen: Ich sollte begreifen, wie sehr sie ihre Mutter gehasst hat.
Gerda In einer Gruppe dabei zu sein, von ihr aufgenommen und akzeptiert zu werden, ist in einem bestimmten Alter für jeden Jugendlichen wichtig – für meine Mutter, die sich zu Hause nicht akzeptiert fühlte, war es doppelt wichtig. Daran knüpft sich eine Begebenheit an ihrer Schule, die alles, was sie später geleistet hat, vorwegnimmt und für die ich sie mindestens so sehr bewundere. In dieser Schwarzwaldschule gab es, wie in vielen Mädchenschulen, einen „inneren Kreis“: eine Gruppe im Alter nicht allzu weit voneinander entfernter Mädchen, die einander als „beste Freundinnen“ bezeichneten, die gleiche Blusenfarbe und Rocklänge bevorzugten und voneinander abschreiben ließen, sofern sie in dieselbe Klasse gingen. Im konkreten Fall war es eine besonders sportliche Gruppe, deren Mitglieder einander am Wochenende, wie damals viele junge Leute, zu ausgedehnten Wanderungen im Wienerwald trafen.
Jugendbewegt
Meine Mutter wollte unbedingt dazugehören und erkämpfte sich ihren Beitritt, indem sie der Anführerin, ich nenne sie „Gerda“, jeden Satz jeder Französisch-Schularbeit einsagte und sie so vor dem Durchfallen bewahrte. Denn gerade Französisch – das Welsche – passte nicht in Gerdas Weltbild – sie sah nicht ein, warum man mehr als Deutsch lernen sollte. Ihr Lieblingsgegenstand war das Turnen und auch ihre gertenschlanke, biegsame Gestalt imponierte meiner Mutter, die sich für einen zu großen Busen genierte. Dafür imponierte Gerda die Kraft meiner Mutter: Bei den Ausflügen durfte sie Gerdas Rucksack zusätzlich zum eigenen tragen. Jedenfalls war meine Mutter unglaublich glücklich, endlich ein voll akzeptiertes Mitglied des „inneren Kreises“ zu sein. Zu dessen Ritualen zählte, dass man nach einigen Monaten der Mitgliedschaft jemanden vorschlagen konnte, der ebenfalls aufgenommen werden sollte. Meine Mutter schlug ein etwas jüngeres Mädchen namens Trudi vor, mit dem sie sich angefreundet hatte und nach einer gemeinsamen Jause hatte niemand des „Kreises“ etwas dagegen: Trudi mit ihren munteren, dunkelbraunen Augen und ihren lustigen, kurzen Zöpfen, die hin und her baumelten, wenn sie sich vor Lachen schüttelte, schien allen zu gefallen. Am nächsten Wochenende sollte sie erstmals beim gemeinsamen Ausflug mitmachen. Doch dazu kam es nicht: Gerda, die unbestrittene Anführerin, trug meiner Mutter auf, ihr abzusagen. „Wieso?“ „Sie ist nicht rein arisch.“ „Aber ihr habt Trudi doch alle nett gefunden“, wendete sie verständnislos ein. Doch Gerda blieb hart: „Wir wollen so wen nicht bei uns!“ Ich habe meine Mutter leider nie gefragt, was in diesem Augenblick im Detail in ihrem Kopf vorgegangen ist – ich habe sie nur für ihre Antwort bewundert: „Wenn ihr sie nicht mitnehmt, obwohl sie euch nichts getan hat, dann gehe ich auch nicht mit.“
Jugendbewegt Von nun an wanderte meine Mutter nicht mehr mit ihren Freundinnen aus der Schwarzwaldschule, sondern mit ihren Freundinnen aus der sozialistischen Jugendbewegung. Sie folgte dorthin ihrem zwei Jahre älteren Bruder Helmut, der seine Mutter in keiner Weise hasste, nie angestückelte Mäntel tragen musste und sich unter seinen Freunden stets willkommen fühlte. Man musste die Verhältnisse, in die man geboren worden war also keineswegs, wie meine Mutter hassen, um sich damals als Tochter aus wohlhabendem bürgerlichem Elternhaus den Sozialisten anzuschließen – es genügt die leise Rebellion, die alle Kinder irgendwann das Weltbild ihrer Eltern in Frage stellen lässt. Denn dieses Weltbild wies genügend Sprünge auf.
25
26
Die Welt meiner Mutter – Das Rote Wien
Die Monarchie, der beide Großeltern, auch Elsa mit ihrer Herkunft aus der republikanischen Schweiz, im Herzen anhingen, war durch den Ersten Weltkrieg restlos desavouiert – beide waren zu intelligent und dachten zu unabhängig, um zu verdrängen, dass Kaiser Franz Josef ihn vom Zaun gebrochen hatte. Selbst sie verstanden die Wut auf ihn und den Sturz seines Nachfolgers Karl, auch wenn ihnen lieber gewesen wäre, wenn die Sozialisten dabei eine geringere Rolle gespielt hätten. Die Stellung der ChristlichSozialen, die sie selbstverständlich wählten, hatte mit der des Kaisers mitgelitten, waren sie ihm doch ungleich näher als die Sozialisten gestanden. Die allgemeine Unsicherheit, wie es mit dem durch die Friedensverträge amputierten Österreich wirtschaftlich weitergehen würde, war im bürgerlichen Lager mindestens so groß wie bei der Arbeiterschaft, auch wenn die Not eine ungleich geringere und in meinem Elternhaus die wahrscheinlich geringste war: Aus Friedrich Reiners kroatischem Gut kam auch in den schlechtesten Zeiten immer ein Waggon mit Nahrungsmitteln nach Wien. Die allgemeine Not war nur dennoch zu sichtbar, um sie zu verdrängen. Schlangen vor längst nicht mehr so gut gefüllten Geschäften, Kriegskrüppel auf den Straßen, Bettler, die um Almosen baten. Es war unmöglich, die Armut von Familien zu übersehen, deren Erhalter gefallen waren, selbst wenn man sie, wie Elsa Reiner nur an den eigenen Bediensteten miterlebte und selbstverständlich durch Geschenke linderte. Diese Armut war zwar viel weniger dem „Kapitalismus“ als dem Krieg, den zu zahlenden Reparationen, dem Verlust der böhmischen Industrie und balkanischen Getreidefelder geschuldet, aber eine Ideologie, die einen Zusammenhang zwischen Krieg und Kapitalismus konstruierte, schien diesen Widerspruch zu überbrücken. Ella und Helmut Reiner konnte so wenig wie anderen intelligenten, anständigen Jugendlichen aus gutbürgerlichem Haus entgehen, dass die Gegenwart, in der sie lebten, eine höchst ungerechte, für die meisten Menschen von materieller Not gekennzeichnete war. Die Sozialisten hatten den Kaiser verjagt, sie wollten die Not beseitigen und besaßen im Marxismus eine scheinbar bestechende Theorie, die das zwingend besorgen würde. Es galt der Anfang des späteren Bonmots „Wer in der Jugend kein Sozialist/Kommunist war, hatte kein Herz – wer es im Alter immer noch war, hatte kein Hirn.“ Die Unterscheidung in „Sozialisten“ und „Kommunisten“ war dabei eine fließende. Beide glaubten an Karl Marx. Doch während die Kommunisten überzeugt waren, dass der Sozialismus im Wege der von Marx prophezeiten Revolution siegreich verwirklicht würde – wobei sie Revolution durchaus mit gewaltsamer Auseinandersetzung assoziierten – meinten die Sozialisten – Sozialdemokraten nannten sie sich erst viel später zur eindeutigen Unterscheidung – dass man auch auf dem Weg von Wahlen dorthin gelangen könnte. Vor allem befürworteten sie, anders als die Kommunisten, den Kampf der Gewerkschaften. Obwohl sie Marxens „Revolution“ nicht ablehnten, sahen sie doch die Chance, dass gewerkschaftlich erkämpfte Evolution ebenfalls den Sieg des Sozialismus herbeiführen könnte.
Jugendbewegt
In Wirklichkeit waren diese beiden Haltungen unvereinbar: Wenn, wie Marx behauptete, ein „ehernes Gesetz der Geschichte“ zum Klassenkampf und dieser zum Sieg des Sozialismus führen musste, bedurfte es keiner Gewerkschaften. Tatsächlich hat Marx sie abgelehnt, weil sie den Zusammenbruch des Kapitalismus nur durch kurzfristige Scheinerfolge hinauszögern würden – und in kommunistischen Staaten hat es sie folgerichtig nicht gegeben. Aber auch wenn marxistische Theoretiker zeitweise über diese Unvereinbarkeit diskutierten, spielte sie für die Bürgerkinder, die sich dem Sozialismus zuwandten, doch keine größere Rolle. Wirklich gelesen hatten Marx nur die wenigsten, seine Thesen wurden meist nur mündlich weitergegeben, und da blieb meist nur hängen, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse sich ändern mussten und dass die Geschichte dabei auf Seiten der Sozialisten war. Dass selbst ein kaum oder halb verstandener Marxismus so viele junge Menschen faszinierte, lag daran, dass er sich ihnen nicht nur als politische Idee, sondern als „wissenschaftliche Erkenntnis“ präsentierte und damit in eine Welt passte, in der die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse einander überschlugen: 1921 hatte Albert Einstein bei einem Vortrag in der Wiener „Urania“ – einer der vielen von den Sozialisten geschaffenen Einrichtungen der Volksbildung – einen Vortrag über die Ablöse der Newtonschen Physik durch seine Relativitätstheorie gehalten und so wie die Studenten ihr vertrauten, auch wenn kaum einer sie verstand, glaubten sie auch an die Marxsche Theorie der Ablöse des Kapitalismus durch den Sozialismus. Vor allem hatte die Entwicklung in Russland den Marxismus noch nicht moralisch desavouiert – er schien noch rein und unbefleckt. Arthur Köstlers Abrechnung mit den kommunistischen Schauprozessen war noch nicht erschienen, und Karl Popper hatte noch nicht aufgezeigt, dass der Vorstellung einer zwangsläufigen Entwicklung – er nannte sie „Historizismus“ – die Gefahr der Entartung zur Diktatur immanent ist. Vor allem im „Roten Wien“ stellte sich der Sozialismus jungen Menschen viel einfacher als im marxistischen Theoriengebäude dar. Unter einem roten Wiener Bürgermeister – Karl Seitz – hatten „Sozialisten“ in dieser Stadt rundum gewaltige Verbesserungen herbeigeführt. Ferdinand Hanusch hatte als Staatsekretär der Koalitionsregierung Renner die erste Sozialversicherung geschaffen. Der Anatom Julius Tandler hatte als Stadtrat für Gesundheitswesen eine Gesundheitsversorgung geschaffen, die in der Welt ihresgleichen suchte. Der Bankfachmann Hugo Breiter hatte Wiens Finanzen erfolgreich geordnet. Grundsätzlich waren die von den Sozialisten damals in Ämter entsandten Personen, anders als nach dem Zweiten Weltkrieg, stets Kapazitäten ihres Faches. Im Rahmen der Stadtplanung war mit Adolf Loos der führende Architekt des Landes tätig, dem nicht nur revolutionäre Gebäude, sondern auch revolutionäre Projekte gelangen: Am Rosenhügel stellte man unbemittelten Künstlern Baumaterial zur Verfügung, um nach Bauhaus-Plänen eine Künstlersiedlung zu errichten. Der soziale Wohnbau ließ überall Gemeindebauten aus dem Boden schießen, die bis heute architektonisch gelungener als ihre Nachfahren aus den 1950er und 1960er Jahren sind. Und der Karl-Marx-Hof, das
27
28
Die Welt meiner Mutter – Das Rote Wien
„Versailles der Arbeiter“, ist bis heute ein Bauwerk, das kein internationaler Architekt zu besichtigen auslässt, wenn er Wien besucht. Das zentrale Anliegen dieser grandiosen Sozialdemokratie war die Bildung. Otto Glöckel, nach dem Besuch der Lehrerbildungsanstalt wie der Philosoph Sir Karl Popper „nur“ Volksschullehrer, weil die Heranbildung des „neuen Menschen“, den die Sozialdemokratie anstrebte, so früh wie möglich beginnen sollte, führte als Staatssekretär für das Unterrichtswesen eine beispiellose Bildungsreform durch: Zumindest in Wien gelang ihm die völlige Trennung von Kirche und Staat, die in Österreich bis heute nicht vollzogen ist; er predigte die Abschaffung des frontalen Drills und verbannte den Katheder zumindest aus allen Wiener Volksschulen; er förderte die Montessoripädagogik und führte „Schulversuche“ ein. Dass schon er die Gesamtschule der Sechs- bis 14-Jährigen anstrebte, erklärt, wie sehr die SPÖ bis heute daran hängt. „Bildung“ zu forcieren, war, sowenig Marxens Thesen es für den „Sieg des Sozialismus“ erforderten, ein Grundelement des Sozialismus, und was das Rote Wien an Einrichtungen der Volksbildung schuf, war einmal mehr einzigartig: öffentliche Bibliotheken, Volksbildungsabendschulen, Volksbildungskurse, Volksbildungsheime, mit Zentren wie der Urania, wo weltführende Wissenschaftler Vorträge hielten. Und immer konnten Arbeiter sich dort in den Abendstunden fortbilden. Es war dies die wahrscheinlich einzige Epoche, in der Arbeiter das in großer Zahl und mit ungeheurem Eifer auch freiwillig taten – die Volkshochschulen waren voll. Obwohl es einmal mehr keine theoretische Voraussetzung Marx’ für den Sieg der „Arbeiterklasse“, kein vom ihm postuliertes ökonomisches Gesetz war, war die Vorstellung vom „edlen Arbeiter“ doch eine, die sich untrennbar mit dem Marxismus verband und zweifellos auch von Marx geteilt wurde. Der sozialistische Arbeiter, wenn ihm meine Mutter damals ausnahmsweise begegnete, war tatsächlich edel – er vereinte in sich alle Tugenden, die im Bürgertum brüchig geworden waren: Er betrog seine Frau nicht; er trank nicht; er achtete auf seinen Körper, der gesund wie sein Geist sein sollte; er sprach und schrieb Hochdeutsch, statt, wie sozialistische Funktionäre der Nachkriegsära, durch breiten Dialekt zu dokumentieren, dass sie die Arbeiterklasse vertreten. Der Schriftsetzer Franz Jonas, der als Bundespräsident die Beistriche seiner Redenschreiber korrigierte, war das letzte mir noch geläufige Exemplar des „sozialistischen Arbeiters“ im Roten Wien. Es war geradezu schwierig, in dieser Stadt zu leben und als junger Mensch nicht vom „Sozialismus“ beeindruckt zu sein. Zumal auch die meisten Künstler in seinem Bann standen und gegen die bestehenden Verhältnisse aufbegehrten. In der Malerei hatten sie die „Sezession“ begründet, die den Klassizismus revolutionär überwand – meine Mutter und ihr Bruder bewunderten Egon Schiele lange, bevor er weltberühmt war. In der Musik hatten die Zwölftöner (zu meinem Leidwesen) gegen die Klassik aufbegehrt, und Alban Berg hatte mit Wozzeck eine große Oper geschaffen, die das Publikum fühlen ließ, was es bedeutete, der „Unterklasse“ anzugehören. Franz Kafka trug lange eine rote Nelke im Knopfloch, weil die russische
Der innere rote Kreis
Revolution ihn tief beeindruckt hatte. Als Jurist in einer Versicherungsgesellschaft war er immer wieder mit der tristen Situation von Arbeitern, ihrer Ohnmacht gegenüber „oben“ konfrontiert – meine Mutter und ihr Bruder waren wie viele junge bürgerliche Sozialisten tief beeindruckt von seiner „Verwandlung“ und seinem „Prozess“. Aufbruch in völlig Neues war auf allen Ebenen, in der Politik, in der Kunst, in der Wissenschaft gleichermaßen angesagt. Sigmund Freud vermochte sogar zwischen Wissenschaft, Kunst und Politik Neuland zu betreten, indem er Gott als „Projektion“ entlarvte und den Aufstand der Brüder gegen den Hordenvater postulierte. Dass er auch postulierte, dass ein neuerlicher Hordenvater die Brüder neuerlich unterdrücken würde, verdrängten die jungen Sozialdemokraten in ihrer Begeisterung für den Vater der Psychoanalyse. „Sozialismus“ war Inbegriff des politischen Aufbruchs, und intelligente junge Menschen konnten und wollten sich ihm als „Bürgerliche“ so wenig entziehen wie die Arbeiter, denen er Freiheit von Not versprach.
Der innere rote Kreis Der „innere Kreis“ dieses Sozialismus war für meine Mutter der „Verband sozialistischer Mittelschüler“, fast immer nur als „VSM“ abgekürzt und in der Folge der „Verband sozialistischer Studenten Österreichs“, der ebenfalls eher als „VSStÖ“ geläufig war. Beide würde man heute als elitäre Organisationen bezeichnen, weil Arbeiter und andere, auch bürgerliche Angehörige der Unterklasse kaum Mittelschüler und noch viel seltener Studenten waren. Das typische VSM-VSStÖ-Mitglied kam aus einer wohlhabenden bürgerlichen Familie, war im Zweifel jüdisch und in diesem Fall fast immer hochbegabt. Meine Mutter, die zwar nicht jüdisch, aber sehr wohl hochbegabt war, hatte diesmal keine Schwierigkeit, in diesen Kreis aufgenommen zu werden, denn obwohl sie sich selbst nie so empfand, galt sie als hübsch. Dominiert wurden beide Verbände natürlich von Männern, aber ich wage trotz meiner Freundschaft zu Elfie Hammerl zu behaupten, dass alles andere objektiv unfair gewesen wäre: Es hat meines Wissens auf der Welt keine politische Organisation gegeben, die so viele Männer höchster Begabung zu Mitgliedern hatte. Wenn ich hier auf diejenigen näher eingehe, die erstens Freunde meiner Mutter waren und zweitens den Holocaust überlebten, dann weil sie davon ein Bild vermitteln, und weil einige dieser Männer auf dem Umweg über meine Mutter prägenden Einfluss auf mich hatten, da ich das unglaubliche Glück hatte, einige von ihnen noch persönlich kennenzulernen. Nicht persönlich kennengelernt habe ich den Mann, der meiner Mutter theoretisch am nächsten gestanden ist und heute als „Vater der modernen Soziologie“ gilt: Paul Lazarsfeld hatte Mathematik studiert und ein Studium der Psychologie angeschlossen,
29
30
Die Welt meiner Mutter – Das Rote Wien
als er mit 24 ins Leben meiner damals 17-jährigen Mutter trat, die gerade die Schule abgeschlossen hatte. Wie viele der jüdischen VSStÖ-Mitglieder wollte er das hübsche, arische, aber sicher nicht antisemitische Mädchen unter allen Umständen von sich, von seiner Wissenschaft und vom Marxismus überzeugen. Alle drei Vorhaben sollten restlos misslingen, und das sollte in allen drei Fällen auf mich abfärben. Als er meiner Mutter mit seinem ersten größeren Auftrag imponieren wollte – er sollte erforschen, warum Meinl-Schokolade im Gegensatz zu anderen Meinl-Waren wenig gekauft wurde – erntete er bei ihr Spott statt Bewunderung: „Das kann ich Dir sofort sagen: Weil sie im Gegensatz zu den meisten Meinl-Produkten nicht wirklich gut ist.“ Dass er herausgefunden haben wollte, dass es an der Farbe der Verpackung liege, ließ sie ausschließlich an seiner Redlichkeit zweifeln. Auch eine Reihe anderer seiner Umfrage-Erkenntnisse nannte sie „entweder falsch oder trivial“, und er machte den großen Fehler, es auf einen Test ankommen zu lassen: „Was glaubst Du, von wem lässt sich eine Frau im Schuhgeschäft lieber bedienen – von einem attraktiven jungen Mann oder einer hübschen Verkäuferin?“ „Natürlich von einer Frau – sie wird einem Mann doch nicht ihre Hühneraugen zeigen!“, degradierte meine Mutter in einer Sekunde zur Trivialität, was er in einem Monat ermittelt hatte. Die Skepsis gegenüber Umfragen ist ihr zeitlebens geblieben und auf mich übergegangen. Endgültig von mir Besitz ergriffen hat sie, als ich knapp vor Abschluss der achten Klasse an einer Umfrage teilnahm, die ermitteln sollte, ob angehende Maturanten bereits mit einem Mädchen geschlafen haben. Ich weiß nicht mehr mit Sicherheit, wie ich den Fragebogen beantwortet habe: Ich vermute, dass ich „Ja“ hinschrieb, weil ich mich genierte, es noch nicht getan zu haben; es ist aber auch möglich, dass ich ehrlich „Nein“ hinschrieb. Es ist möglich, dass alle anderen ehrlich „Nein“ hinschrieben, aber ebenso möglich, dass sie alle logen, weil sie sich, wie ich, ebenfalls vorm Gegenteil genierten oder aber, weil sie fürchteten, ihr „Ja“ könnte unangenehme Nachforschungen der Direktion nach sich ziehen, wenn es in dieser Klasse zu zahlreich ausfiel. Hundert Prozent „Nein“ konnten ebenso stimmen, wie hundert Prozent „Ja“ falsch sein konnten und das gleiche galt für jedes Ergebnis dazwischen. Ich habe das später gemeinsam mit meinem Kollegen bei der Arbeiter-Zeitung und späteren IFES-Soziologen Ernst Gehmacher die soziologische Unschärferelation genannt: Jede heikle Frage hat in sich die Kraft, die Antwort zu verändern – je heikler (und damit interessanter) die Frage, desto ungenauer die Antwort. (Siehe die vielen Jahre, in denen sich FPÖ-Sympathisanten nur ungern offen zur FPÖ bekannten, so dass sie bei Umfragen immer wesentlich schlechter als bei Wahlen abschnitt.) Dass ich immer wieder geschrieben habe, es sei nützlicher, mehr Elektriker und Installateure auszubilden als noch mehr junge Leute als Soziologen zu „Akademikern“ zu machen, hat zweifellos weniger mit der Soziologie, als mit der mangelnden Zunei-
Der innere rote Kreis
gung meiner Mutter für Paul Lazarsfeld zu tun, der für sie zeitlebens „ein ziemlicher Scharlatan“ blieb. Auch meine Zweifel an den zentralen Thesen des Karl Marx beginnen mit Paul Lazarsfeld. Denn auch sein Bemühen, meine Mutter für den Marxismus zu begeistern, schlug auf eine Weise fehl, von der sie mir amüsiert schon sehr früh erzählt hat. Da Elsa Reiner Lazarsfeld „sehr intelligent und witzig“ fand und meinte, er könnte die ungeliebte Tochter als Mathematiklehrer vielleicht sogar brauchbar versorgen, erhielt er die Möglichkeit, Ella jederzeit zu besuchen und sogar alleine mit ihr in der Bibliothek zu verweilen, die ein Dritter nur durch einen längeren Gang betreten konnte, so dass man sein Kommen gehört hätte. Doch als Lazarsfeld dort angesichts dieser Abschirmung das „Kapital“ aus der Hand legte, um den Arm um ihre Taille zu legen, entzog sie sich dem, indem sie ihn daran erinnerte, dass sie doch eigentlich Marxismus von ihm lernen sollte. Was freilich auch bei den folgenden platonischeren Besuchen gründlich misslang. Meine Mutter fand Marx’ Thesen, die sie von ihm zum ersten Mal genauer hörte, „papieren – alles graue Theorie ohne die geringste Ahnung von der Natur des Menschen“. Erst sekundär deckte sie durch ihre hohe Intelligenz auch die theoretischen Schwächen des Marx’schen Denkgebäudes auf: Sie wollte nicht glauben, dass die Gewerkschaften den Sieg des Sozialismus in Wahrheit verzögerten und wies Lazarsfeld auf die eindeutige Verbesserung der Lebensverhältnisse der Arbeiter in England hin. Sie machte ihn auf den Widerspruch von Marx’ Vorhersage einer sozialistischen Revolution in einem hoch industrialisierten Land und der von den Marxisten für sich beanspruchten Revolution in Russland aufmerksam. Sie war nicht bereit, Klasseninteressen darin zu sehen, dass ihr Vater die Landarbeiter auf seinem Gut in Jugoslawien besser als andere Großgrundbesitzer bezahlte, denn er tat es, weil er die übliche Bezahlung „unanständig“ fand. Dass Lazarsfeld ihre Einwände „unmarxistisch“ nannte, nannte sie „unwissenschaftlich“. Auch die Skepsis gegenüber Marx hat meine Mutter mir weitergeben, bis ich mir durch die Lektüre von Poppers „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ ein eigenes Urteil bilden konnte: Zumindest Marx’ „ehernes Gesetz“, wonach der Kapitalismus zwingend in den Klassenkampf münden muss und dieser zwingend mit dem Sieg des Sozialismus endet, ist weithin erkennbar falsch. Dennoch bringe ich dem Ökonomen Marx wie auch Popper und verblüffenderweise auch dem konservativen Professor für Finanzwissenschaften Erich Streissler, der wesentlichen Einfluss auf mein ökonomisches Verständnis haben sollte, heute größten Respekt entgegen: Er hat mögliche Fehlentwicklungen des Kapitalismus – das Entstehen marktbeherrschender Monopole, einen mörderischen Konkurrenzkampf ohne den Zuwachs an Wohlstand oder das Entstehen von immer mehr „Abgehängten“ – wie kein anderer gesehen und analysiert. Übrigens hätte meine Mutter ihre Einwände gegen Marx auch direkt mit Popper besprechen können, denn auch der später weltberühmte Philosoph gehörte natürlich zum Kreis der beiden sozialistischen Jugendorganisationen, nur hat ihn meine Mutter
31
32
Die Welt meiner Mutter – Das Rote Wien
damals zwar gelegentlich gesehen, aber nicht persönlich gekannt. Meiner Beziehung zu ihm will ich allerdings ein eigenes Kapitel widmen, weil sie prägend und intellektuell die wahrscheinlich wichtigste meines Lebens war. Das Kapitel Lazarsfeld, das mich trotz der angeführten mittelbaren Einflüsse ungleich weniger prägte, will ich hingegen abschließen – zumal es ein ebenso erstaunliches wie rasches Ende fand: Lazarsfeld fragte, zuerst bei Elsa Reiner und dann ihrem Mann, um die Hand ihrer Tochter an und beide stimmten einer Verlobung zu. Das war bei Elsa Reiner insofern erstaunlich, als „Jude“ bei ihr normalerweise ein „No-Go“ war. Als ihr ursprünglich liebster Bruder eine Jüdin heiratete, die noch dazu den niederen Beruf einer Friseurin ausübte, brach sie jeglichen Verkehr mit ihm ab und wollte ihn nicht einmal sehen, als sie, mit 54 an Mundhöhlenkrebs erkrankt, am Sterbebett lag und er sie besuchen wollte. „Für mich war ihr offenbar ein Jude gut genug“, deutete es meine Mutter. Dass sie dieser Verlobung ebenfalls zustimmte, hatte einen typischen Grund: Sie war sicher, auf diese Weise der Obhut ihrer Mutter zu entrinnen und neue Freiheit – vielleicht sogar in finanzieller Hinsicht – zu erlangen. Denn natürlich musste eine „Verlobte“ erstklassige Kostüme an Stelle der abgetragenen ihrer Schwestern besitzen und konnte vielleicht sogar schon demnächst Anspruch auf eine eigene Wohnung erheben. Und natürlich würde sie schon jetzt tun und lassen können, was sie wollte. Lazarsfeld war meiner Mutter, wie ihrer Mutter „sympathisch“, sie fand ihn wie diese „witzig und intelligent“, aber, wie sie mir gestand, „von Beginn an als Mann in keiner Weise attraktiv“. Und das hat bei ihre zeitlebens eine entscheidende Rolle gespielt: Ein Mann musste ihr in erster Linie als Mann gefallen und dann erst als „intelligent“ imponieren. Ich habe dafür das größte Verständnis – es geht mir in Bezug auf Frauen ähnlich – aber es hatte für sie als außergewöhnlich intelligente Frau seine Tücken: Sie verliebte sich in meinen Vater, weil er ein außergewöhnlich gutaussehender Mann war – aber die Ehe mit ihm scheiterte nicht zuletzt daran, dass er ihr intellektuell nicht das Wasser reichen konnte und sich ihr daher unterlegen fühlte. Lazarsfeld wäre ihr wahrscheinlich ein intellektuell adäquaterer Partner gewesen. Aber die Verlobung blieb eine rein platonische: Nachdem meine Mutter unter dem Beifall ihres Vaters, der sie zeitlebens besser als ihre Mutter kannte, für ein Jahr eine Stelle bei der Sozialistischen Internationalen in der Schweiz angenommen hatte – „auch um zu prüfen, wie ernst es Dir mit Deiner Verlobung ist“, löste sie diese schon nach 14 Tagen mittels Postkarte auf.
3.
Der Mann, der leider nicht mein Vater wurde
Ein für sie und mich viel wichtigerer unter den vielen brillanten Männern im VSStÖ gefiel ihr auch als Mann sehr viel besser: Victor Weisskopf. Als ich ihn kennenlernte ging er schon auf die sechzig zu, sah aber immer noch ungemein jugendlich und sportlich aus. Ich habe meiner Mutter sofort geglaubt, dass seinerzeit alle weiblichen Mitglieder des VSStÖ für Weisskopf schwärmten, zumal er auch ganz banal eine „gute Partie“ war. Als Sohn einer begüterten jüdischen Familie hatte er nicht nur in Wien, sondern auch bei Niels Bohr in Kopenhagen theoretische Physik studiert, und niemand zweifelte an seiner künftigen Karriere. Hinzu kam, dass sein Interesse sich keineswegs auf Physik beschränkte, sondern dass er in Musik, Literatur, Schauspiel oder bildender Kunst kaum weniger bewandert war. Gespräche mit ihm, gleich worüber, waren für meine Mutter – und bis zu seinem Tod im Jahr 2002 auch für mich – Festmahle, bei denen man neueste wissenschaftliche Thesen und Ideen so aufbereitet und serviert bekam, dass man sie auch als Laie verstand. Aber genauso herrlich war es, mit ihm in Altaussee, wo seine Eltern einst eine Villa besessen hatten, im Strandcafé wortlos einen Saibling zu genießen. Denn im Gegensatz zu anderen intellektuellen Freunden meiner Mutter, die wie sie ständig diskutieren wollten, war er ein Genussmensch, der auch schweigen und sich einem köstlichen Essen oder herrlichem Sonnenuntergang hingeben konnte. Bei einer dieser Gelegenheiten erzählte er mir, wie sehr meine Mutter ihm seinerzeit gefallen hätte, aber er habe nicht geglaubt, Chancen bei ihr zu haben. „Meine Mutter hat nicht geglaubt, Chancen bei Dir zu haben“, erzählte ich ihm und bedauerte dieses historische Missverständnis zutiefst: Ich hätte niemanden lieber als ihn zum Vater gehabt. Ähnlich brillante, aber auch ähnlich anständige Menschen habe ich in meinem Leben allenfalls im Physiker Leó Szilárd und in Karl Popper kennengelernt – aber die haben meine Mutter in ihrer Jugend nicht verehrt. Nach seiner Emigration in die USA wurde Weisskopf von seinen Kollegen als „Sozialist mit Wien-Erfahrung“ zum Bürgermeister von Los Alamos und Leiter jener Gruppe weltbester Kernphysiker gewählt, die die Atombombe entwickelten, von der sie irrtümlich meinten, dass auch in Hitler-Deutschland dran gearbeitet würde. „Die Techniker haben immer geglaubt, dass es funktionieren wird. Wir, die wir die Grundlagen geliefert haben, haben gezweifelt. Vielleicht wäre es besser gewesen, wir hätten mit unseren Zweifeln Recht behalten“, erzählte er mir. Dass er an der Entwicklung der Atombombe beteiligt war, belastete Weisskopf Zeitlebens. Er verteidigte zwar den Abwurf der ersten Bombe auf Hiroshima, „weil sie den Krieg mit Japan beendet hat, der sonst noch mehr Menschenleben gekostet hätte“, aber
34
Der Mann, der leider nicht mein Vater wurde
er nannte den zweiten Abwurf auf Nagasaki ein „Kriegsverbrechen“: „Es war klar, dass Japan aufgibt, und wir wussten damals schon, wie verheerend die Bombe wirkt.“ Ganz ähnlich wie er sah das ein anderer Physiker, den ich durch ihn kennenlernen und immer wieder treffen durfte: Leó Szilárd. Der gebürtige Ungar, der mit einer Österreicherin verheiratet war, hatte als erster Physiker die Idee gehabt, die in Atomen gebundene Energie mittels einer Kettenreaktion zu nutzen und mit Enrico Fermi die erste solche Kettenreaktion ausgelöst. In einem Brief, den auch Albert Einstein unterzeichnete, hatte er Theodore Roosevelt überzeugt, dass es möglich und notwendig sei, auf der Basis der Kettenreaktion eine Waffe zu entwickeln, um die Welt vor einem Sieg Adolf Hitlers zu schützen. Dieser Brief bewirkte, dass Roosevelt das Projekt „Manhattan“ in Gang setzte, in dessen Rahmen in Los Alamos die Atombombe entwickelt wurde. Szilárd war damit zweifellos deren intellektueller, aber auch politisch organisatorischer Vater. Von seinen amerikanischen Kollegen wurde er wie Eduard Teller als „Marsianer“ bezeichnet, weil er in ihren Augen über „außerirdische“ intellektuelle Fähigkeiten verfügte. Auch die technologischen Voraussetzungen für die Bombe wie für Atomkraftwerke beruhen zum Teil auf seinen Patenten. Weil niemand in der zuständigen Schwedischen Akademie der Wissenschaften seine physikalischen Leistungen auch nur entfernt überblickte, erhielt er niemals den Nobelpreis, der aber auch deshalb an keinen der an der Entwicklung der Atombombe Beteiligten vergeben wurde, weil Alfred Nobel ihn für Leistungen vorgesehen hatte, die dem friedlichen Zusammenleben dienen. (Deshalb auch die weltweite Irritation über die Verleihung des Nobelpreises für Literatur an Peter Handke, der eine Grabrede für den Kriegsverbrecher Slobodan Milošević gehalten hatte.) Was Szilárd oder Weisskopf betraf, war diese Zurückhaltung des Nobelpreis-Komitees freilich grundfalsch: Beide entwickelten die Bombe in der Hoffnung, dass sie niemals eingesetzt würde: Man sollte, so Szilárd, durch einen Abwurf in unbesiedeltem Gebiet ihre gewaltige Sprengkraft demonstrieren und das sollte reichen, den Gegner abzuschrecken. Den Abwurf der zweiten Bombe (auf Nagasaki) sah Szilárd wie Weißkopf als Kriegsverbrechen an. Diese Art durch nichts und niemanden beeinflussbarer ebenso differenzierter wie präziser Beurteilung moralischen Verhaltens war für Weisskopf wie Szilárd typisch, und ich hoffe, mir im Gespräch mit ihnen ein wenig davon abgeschaut zu haben: Die Utopie einer friedlichen Gesellschaft muss auf dem Weg realer, rationaler Maßnahmen angestrebt werden – sie können auch die Entwicklung einer Bombe umfassen. Pazifismus kann auch zum Gegenteil führen. Nach dem Krieg wurde Weisskopf „Head of Physics“ des „Massachusetts Institute of Technology“(MIT) und galt als einer der bedeutendsten Lehrer seiner Wissenschaft. Als Gegner atomarer Bewaffnung zählte ihn auch die „Friedensbewegung“ zu ihren Lehrmeistern. So hatte er als Berater amerikanischer Präsidenten wesentlichen Anteil
Der Mann, der leider nicht mein Vater wurde
am ersten großen Rüstungsbeschränkungsabkommen, indem er jeden Zweifel ausräumte, dass das auf beiden Seiten vorhandene Vernichtungspotential groß genug war, dass dem jeweils Angegriffenen immer genügend davon übrigblieb, das Territorium des Angreifers gleichfalls zu verwüsten. Gleichzeitig rechnete er vor, dass es billiger war, mehrere Angriffs- als eine Verteidigungsrakete zu entwickeln, so dass auch die Idee, sich durch einen Ring von Verteidigungsraketen unverletzbar und damit fähig zu einem Überraschungsangriff zu machen, zum Scheitern verurteilt sei. Mit Henry Kissinger wurde er damit einer der Architekten des bis heute bestehenden „Frieden durch Angst“ – auch wenn er hoffte, dass es irgendwann ein Friede aus Vernunft und Freundschaft sein würde. Ich bin bis heute überzeugt, dass Atomwaffen den Frieden weit mehr absichern als gefährden: Sie sind der Hauptgrund dafür, dass die USA und die UdSSR nie direkt Krieg geführt haben, dass Pakistan und Indien einander nur im Kaschmir bekämpfen und dass Israel vom Iran nicht angegriffen wird. Barack Obamas Vorschlag einer atomwaffenfreien Welt habe ich deshalb für so wenig durchdacht gehalten, wie leider die meisten seiner außenpolitischen Aktivitäten. Weisskopfs Überlegungen wirken also recht intensiv in mir nach. Als begeisterter Europäer mit Sehnsucht nach der Kultur Wiens, Paris’ oder Roms beendete Weisskopf seine MIT-Karriere, indem er die Berufung zum ersten Leiter des Europäischen Kernforschungszentrums CERN in Genf annahm. Dadurch war er zu meiner Freude öfter wieder in Österreich. So beriet er Bruno Kreisky in der heiklen Frage des Umgangs mit der Atomenergie. Er hielt diese zwar – so wie ich aufgrund der Gespräche, die ich mit ihm darüber führen durfte – wegen des Klimawandels zusammen mit Wasser- und Windkraft für eine notwendige zwischenzeitliche Alternative zu Erdgas, Öl und Kohle, „bevor wir so weit sind, Sonnenenergie erfolgreich zu nutzen“(Weisskopf), widersprach aber der Behauptung der Atomlobby, dass in Österreich das Licht ausgehen würde, wenn Zwentendorf nicht in Betrieb ginge. Kreisky sollte die Stilllegung aufgrund der Volksabstimmung beruhigt in Kauf nehmen – wie er das dann auch tat. Am Rande wollte Weisskopf Österreichs Schulen beschenken: Als ich ihm erzählte, wie katastrophal das Physiklehrbuch sei, aus dem Österreichs Mittelschüler sich in den 1980er Jahren informieren mussten, fand er sich bereit, kostenlos ein neues zu verfassen. Helmut Zilk, damals Unterrichtsminister, war begeistert – bis er mir nach drei Wochen erklären musste: „Du, ich hab’ alles versucht, aber ein Lehrbuch, das nicht von einem österreichischen Lehrer verfasst worden ist, war bei der Lehrerschaft einfach nicht durchzusetzen.“ Dass Kreisky, um seine Niederlage vergessen zu machen, der Volksabstimmung den „Atomsperrvertrag“ folgen ließ, fand Weisskopf „nicht ganz durchdacht“: Der Klimawandel würde ein gewisses Maß an Nutzung der Atomenergie erzwingen und moderne Atomkraftwerke würden sicher sein, weil sie nicht mehr, wie in ihren Anfängen, auf einer Technologie beruhten, die aus Gründen ihrer auch militärischen Nutzung möglichst wenig Platz beansprucht. Sehr viel größere Bauten böten viel größere Sicherheit.
35
36
Der Mann, der leider nicht mein Vater wurde
Darin irrte er: heute gelten Atom-Kleinkraftwerke, die ihren Rückstand weiter verwerten als chancenreichste Alternative. Was die Atomkraft insgesamt betrifft, irrte er nicht. Außerhalb Österreichs hat sich die Sicht von Atomkraftwerken als notwendige zwischenzeitliche Ergänzung alternativer Energien im Kampf gegen den Klimawandel weitgehend durchgesetzt. Auch Bruno Kreisky war übrigens selbstverständlich einstiges Mitglied des VSM und Anfangs auch des VSStÖ. Den verließ er allerdings, um sich der „Sozialistischen Jugend“ anzuschließen, in der die SPÖ ihre nicht-jüdischen, jungen Arbeiter sammelte. Dort spielt er, anders als im VSStÖ eine dominierende Rolle. „Im VSStÖ hatte Kreisky das Problem, dass er neben Leuten wie Weisskopf oder Lazarsfeld intellektuell keinen Erfolg hatte“, erzählte mir meine Mutter, „er besaß nicht ihren Witz und ihre Eloquenz, um in Diskussionen zu glänzen. Sein politischer Instinkt und seine politischen Talente sind damals allen entgangen. Obwohl schon sein Wechsel zur sozialistischen Jugend ein Zeichen davon war – sie war später die viel einflussreichere Organisation.“ Das in meinen Augen brillanteste Mitglied des VSStÖ, der Physiker Alexander Weißberg, sprach ohne diese Differenzierung aus, was die jüdische studentische Elite damals in ihrer Mehrheit von Österreichs bis heute bedeutendstem Nachkriegsstaatsmann gehalten hat: „Kreisky war einfach nicht sonderlich intelligent.“ Ich vermute, dass die Geringschätzung, die er im VSStÖ durch hyperintelligente gleichaltrige Juden erfuhr, nicht wenig zu Kreiskys etwas verquerer Einstellung zum Judentum beigetragen hat. Neben Weißberg, der einen IQ von 180 auswies, war ein normal intelligenter Akademiker, an der IQ-Differenz gemessen, tatsächlich ein dummer Mensch.
4.
Der Seewolf
Der Physiker Alexander Weißberg-Cybulski hat im Leben meiner Mutter – und damit auch in meinem Leben – eine entscheidende Rolle gespielt, auf die ich später noch genauer eingehen werde. Hier will ich vorerst nur auf seine Lebensgeschichte eingehen, die in Teilen auch besseren Lexika zu entnehmen ist. Wie so viele Physiker war auch Weißberg, Sohn jüdischer Kaufleute, die 1902 aus Polen zuwanderten, vom Marxismus fasziniert, in dem er die erste naturwissenschaftliche Durchdringung der Ökonomie sah. Im Gegensatz zu Bruno Kreisky, den er für „nicht sonderlich intelligent“ hielt, und im Gegensatz zu meiner Mutter, die dem Marxismus „jede Kenntnis der menschlichen Natur“ absprach, gab er sich dessen Faszination in seiner Jugend so rückhaltlos hin wie allem in seinem Leben – der Wissenschaft, der Kunst, dem Glücksspiel, riskanten Millionengeschäften oder später der Verdammung des Kommunismus. Er gehörte im VSStÖ – wie übrigens auch Österreichs späterer Justizminister Christian Broda, mit dem er sich darüber Jahrzehnte später in unserer Wohnung erbitterte Gesprächsschlachten liefern sollte – nicht zu den „Sozialisten“, sondern den glühenden „revolutionären Sozialisten“, die die „Kommunisten“ an revolutionärem Elan noch überboten. Obwohl er wegen seiner unbändigen Phantasie und seiner überragenden Intelligenz zum Studium der theoretischen Physiker prädestiniert gewesen wäre, studierte er „Technische Physik“, weil er meinte, dass diese der Sowjetunion beim „Aufbau des Sozialismus“ nützlicher wäre. Als ich ihn, vermutlich 1950 bei einem gemeinsamen Urlaub mit meiner Mutter erstmals kennenlernte, war er um die fünfzig ich elf. Damals erschien er mir vor allem riesig. Das lag voran an seinem tatsächlich riesigen, tonnenförmigen Brustkorb, von dem er behauptete, dass er ihn neben Friedrich Torberg zu einem der besten Schwimmer des jüdischen Sportvereins Hakoah gemacht hätte. (Ob es wirklich so war, konnte ich nicht eruieren, und ein wenig neigte er zum Angeben). Ähnlich riesig erschien mir sein Kopf vor allem dank einer gewaltigen, bis tief in den Haaransatz reichenden Stirn. Ein wenig sah er so aus, wie ich mir Julius Cäsar vorgestellt habe – jemand, der zweifellos das Volk hinter sich sammelte, ihm den Weg wies und Befehle gab. Meine Mutter selbst verglich ihn mit dem Kapitän in Jack Londons Roman „Seewolf “: Jemand, der alle anderen intellektuell, psychisch und physisch überragt. Nur nicht meinen Vater als Liebhaber. Tatsächlich habe ich, auch gemessen an Victor Weisskopf oder Karl Popper, nie einen intellektuell brillanteren Menschen kennengelernt. Sein IQ konnte nicht exakt ermittelt werden: Als man bei einem Intelligenztest, dem er sich „Spaßes halber“, wie er sagte –
38
Der Seewolf
in Wirklichkeit seiner beträchtlichen Eitelkeit wegen – unterzog, bei 180 angelangt war, hatte der Tester keine Prüfungsfragen mehr zur Verfügung. Wie Popper oder Weisskopf war Weißberg ein Polyhistor – hatte Kenntnisse nicht nur in allen Wissenschaften, sondern war auch in allen Künsten zu Hause: Er kannte die Partituren diverser klassischer Symphonien auswendig und gab an, den kleinsten Fehler zu hören. (Ein Freund, der mehr als ich von Musik versteht, bestätigte mir, dass das stimme.) Aber er hätte auch ein Symposium über die Malerei der Renaissance leiten können, von der ich selbst, als Student der Malerei, relativ viel verstand. Er konnte ein Dutzend klassischer Monologe und jedes zweite Gedicht Lenaus, Goethes und vor allem Rainer Maria Rilkes auswendig – einen Text einmal zu lesen genügte ihm. Wenn ich an ihn denke, so sehe ich ihn in der Pause eines Waldspazierganges auf einem Baumstumpf stehend Goethes „Prometheus“ oder Rilkes „Josuas Landtag“ rezitieren: „So wie der Strom am Ausgang seine Dämme durchbricht mit seiner Mündung Übermaß, so brach nun durch die Ältesten der Stämme, zum letzten Mal die Stimme Josuas.“ Für mich seit damals die Stimme des Alex Weißberg. Wie für ihn zählen diese beiden Gedichte zu meinen liebsten und bis ich etwa sechzig war, konnte ich, ihn imitierend, auch die meisten Rilke-Gedichte auswendig, die er mir abseits von Josuas Landtag vorgetragen hatte. Allerdings musste ich sie zu diesem Zweck siebenmal lesen und kann heute nur mehr zwei rudimentär. Weißberg hatte, ähnlich wie meine Mutter, zu jedem Zeitpunkt, zu dem er nicht zu einer anderen Tätigkeit gezwungen war, gelesen. Aber während sie, wenn ich sie fragte, woher sie dies oder jenes so selbstverständlich wüsste, meist „aus der Schule“ zur Antwort gab – eine Antwort, die man heute fast nie erhält und die auch ich kaum je geben könnte – war er dem Schulunterricht so gut wie nie gefolgt, sondern hatte unter der Bank die Bücher aufgeschlagen, die ihn interessierten. Ob er dabei denn nie erwischt worden sei, wollte ich wissen. „Ja! Davon kommen die Bildungslücken!“ In Wirklichkeit waren seine Lehrer ihm wohlgesonnen. Sie wussten, dass er alles besser als sie wusste und gaben ihm automatisch die besten Noten. Und sie ließen ihn wortlos durchkommen, obwohl er sich grundsätzlich geweigert hatte, Latein zu erlernen, das er als tote Sprache für völlig unnütz beim Aufbau des Sozialismus hielt. „Kunst“, so sagte er, „ist hingegen unverzichtbar – nur mit der Kreativität des Künstlers kann man physikalische Gesetze entdecken und formulieren.“ Er selbst formulierte, weil er technische, anstelle theoretischer Physik studiert hatte, nur die nach ihm benannte „Weißbergsche Kälte-Regel“, die ihn von Wien ins russische Charkow verschlug, wo er dessen kältetechnisches Institut aufbaute, an dem sein Kollege Lew Landau wichtigste wissenschaftliche Vorarbeiten zur russischen Atombombe durchführte. (Atomare Vorgänge lassen sich bei extremer Kälte besonders gut analysieren). Als der paranoide Josef Stalin Weißberg (und übrigens später auch Landau) im
Der Seewolf
Zuge der großen Tschistka, der größten Verfolgungsaktion der Geschichte, dennoch als „deutschen Spion“ verhaften ließ, setzten sich Albert Einstein und das Ehepaar Joliot-Curie – erfolglos – für seine Freilassung ein. Seine überlegene physische Konstitution, aber wahrscheinlich noch mehr seine psychische Widerstandsfähigkeit, ließen ihn monatelange Gefangenschaft in den Kerkern des KGB überstehen. Tage, die er in seiner Zelle in knöcheltiefem Wasser stehend verbringen musste. Tage, in denen er auf Mahlzeiten und Schlaf verzichten musste. Verhöre, für die er Nacht für Nacht aus dem Schlaf gerissen wurde. Es gab kaum Männer, die diesen Foltern auf die Dauer standhielten – fast alle legten irgendwann ein Geständnis ab, das die Prominentesten von ihnen dann in berühmt gewordenen Schauprozessen wiederholten. Die weniger Prominenten gestanden und verschwanden sofort im sibirischen Gulag. Stalins Diktatur hatte in dieser Hinsicht erstaunliche Ähnlichkeit mit der Diktatur Adolf Hitlers: Man achtete auf die äußere Form. Eine Verurteilung musste eine rechtliche Basis haben und da sie diese so gut wie nie in tatsächlichen Vorgängen hatte – die Anklagen waren freie Erfindungen von Staatsanwälten, die nicht selten wenige Monate später selbst unter vergleichbaren Anklagen im Gefängnis landeten – musste ein „Geständnis“ die rechtliche Basis der zwingenden Verurteilung bilden. Denn jeder Richter hatte ein Plansoll an Verurteilungen zu erfüllen. Weißberg hatte das Glück, diesen absurden Mechanismus zu begreifen oder den Instinkt, ihn zu erahnen – jedenfalls rettete ihm seine wochenlange Weigerung, ein falsches Geständnis abzulegen, das Leben: Die Bürokratie ließ nicht zu, ihn wie Millionen andere in den Gulag zu verbringen. Stattdessen kam sein Untersuchungsrichter ins Gefängnis- hatte er doch offenkundig versagt, indem er Weißberg zu keinem gültigen Geständnis bewegen konnte. Weißberg hat seine Erlebnisse in Russland nach dem Krieg in dem Buch „Hexensabbat“ zusammengefasst und es den Millionen Ermordeter gewidmet. Es wurde, wie übrigens auch ein späteres Buch über Joel Brand, der Juden im Tausch gegen Lastwagen retten wollte, ein Bestseller und zählt zur Standardliteratur über den stalinistischen Terror. Meine Mutter hat das Manuskript nächtelang Korrektur gelesen und auch ich kann die Lektüre nur empfehlen. Sie macht vielleicht begreiflich, warum ich einmal eine TV-Auseinandersetzung mit Günther Nenning spontan verlassen habe, als der meinte, das sowjetische Experiment reiche nicht aus, es nicht doch noch einmal mit der Verwirklichung des „wahren Kommunismus“ zu probieren. Ich hätte diese Diskussion, so sagte ich damals, mit 14 hinter mich gebracht. Tatsächlich waren es die Diskussionen, die Alexander Weißberg in unserer Wohnung mit Christian Broda geführt hat, den er, wie meine Mutter zu seinen Jugendfreunden zählte. Anders als Popper, der Marxens „ehernes Gesetz der Geschichte“ theoretisch als immanent gefährlich ablehnte, lehnte Weißberg vor allem dessen praktische wirtschaftliche Konsequenz – die verheerende kommunistische Staats- und Planwirtschaft – ab: „Wenn man eine Wirtschaftsform einführt, die mit einem Maximum an menschlichem
39
40
Der Seewolf
Einsatz und Materialeinsatz ein Minimum an materiellem Erfolg einbringt und die als Zwangskollektivierung der Landwirtschaft den Hungertod von sieben Millionen Menschen nach sich gezogen hat, dann kann man diese Wirtschaftsform nur im Weg einer Diktatur aufrecht erhalten.“ (Kuba ist dafür bis heute ein Beispiel.) Wieso insbesondere die Planwirtschaft unmöglich funktionieren könne, begründete Weißberg gegenüber Broda mit folgendem Vergleich: „Wenn man nur ganz wenige Einheiten zur Verfügung hat, die sich noch dazu wie Eisenbahnzüge auf Schienen bewegen, dann kann man einen Fahrplan erstellen, der festlegt, wann sie welchen Bahnhof und welches Signal passieren. Aber außer vielleicht in der Schwerindustrie hat man es in der Wirtschaft mit Millionen Einheiten zu tun. Und zu planen, wie die zusammenspielen sollen, ist so, wie wenn man versuchte, den Autoverkehr zu regeln, indem man festlegt, dass das Auto A die Kreuzung um 12:01 Uhr und das Auto B sie um 12:02 Uhr passiert. Das kann nur in totaler Kollision enden.“ Broda ließ freilich nicht locker. Planwirtschaft sei kein zwingendes Element der Staatswirtschaft – es ginge vielmehr darum, dass die Produktionsmittel nicht mehr privaten Personen, sondern zum Wohle aller dem Staat gehören sollten. Ich habe weitere Details dieser Auseinandersetzung nicht mehr in Erinnerung, sondern weiß nur mehr ihr Ende: „Also willst Du alle größeren Betriebe verstaatlichen?“ „Ja“ „Die kleineren auch?“ „Nicht unbedingt.“ „Wieso nicht, wenn es für die größeren richtig ist, sie zu verstaatlichen, warum nicht auch für die kleineren? Erklär mir den Unterschied!“ Broda schwieg. „Also soll man auch die Friseure verstaatlichen? Ja oder Nein? Drück Dich nicht um eine Antwort!“ schrie Weißberg Broda an. „Dann eben Ja“, gab Broda heiser, aber deutlich zur Antwort. Deshalb habe ich ihn trotz seiner enormen Verdienste um den liberalen Rechtsstaat für einen der letzten Kommunisten innerhalb der SPÖ gehalten und bin ihm politisch immer mit einer leisen Reserve gegenübergestanden, die ich übrigens mit Bruno Kreisky teilte: Auch der hat Broda nie aus Überzeugung zum Justizminister bestellt, sondern darin immer nur dem linken Parteiflügel nachgegeben. Dass Brodas Rechtsverständnis ein unverändert marxistisches war, sollte auch für meine Auseinandersetzung mit seiner Staatsanwaltschaft im Rahmen des profil eine recht erhebliche Rolle spielen: Er sah in der Justiz mit Marx ein „Instrument des Klassenkampfes“, das es daher selbstverständlich auch seitens der SPÖ zu nützen galt, da nunmehr ihre „Klasse“ an der Macht war. Dennoch muss ich Karl Marx an dieser Stelle sowohl vor Weißberg wie vor Broda in Schutz nehmen: Er hat weder die kommunistische Staats- noch die kommunistische Planwirtschaft in seinen Thesen propagiert, sondern immer nur von der „Vergesell-
Der Seewolf
schaftung der Produktionsmittel“ als Verwirklichung des Sozialismus geschwärmt. Sein Fehler war, nie zu erklären, was unter Vergesellschaftung zu verstehen ist. Auch die siegreichen Bolschewiki wussten es daher nicht. Es war Lenin, der es kurzerhand als „Verstaatlichung“ auslegte und entsprechend verfuhr, denn nichts eignete sich besser dazu, der kommunistischen Partei alle Macht in Russland in die Hand zu geben. Charakteristischerweise brauchte es den Hitler-Stalin-Pakt des Sommers 1939, um Weißberg aus der Macht des KGB zu befreien. Denn in diesem Pakt wurde unter anderem der Austausch Gefangener vereinbart und während Hitler bei dieser Gelegenheit eine Reihe tatsächlicher russischer Spione an Stalin auslieferte, lieferte Stalin unter anderen den angeblichen „deutschen Spion“ Alexander Weißberg an Hitler aus, indem er ihn der Gestapo in Polen übergab. Dass Weißberg auch das überlebte, ist ein Teil seiner Lebensgeschichte, den er leider nie selber niedergeschrieben hat und den ich hier nur so weit wiedergeben kann, als er mir und meiner Mutter davon erzählt hat und ich diese Erzählungen in Erinnerung habe. Sie beginnen mit einer Schießerei im Hof des Gefängnisses, in das die Gestapo Weißberg sofort gesteckt hatte. Die Bewacher erschossen aus einem Grund, den Weißberg nicht kannte, mehrere Häftlinge, deren Leichen nun herumlagen. Da schoss ihm, wie er erzählte, plötzlich die Idee durch den Kopf, die seinen Gefängnisaufenthalt verändern sollte: „Ich habe einem der Toten meinen Ausweis in die Tasche gesteckt und den seinen an mich genommen. Denn ich habe mir gedacht: Schlechtere Zukunftsaussichten als ich kann hier keiner haben.“ Das stimmte. Weißberg wurde unter seinem neuen Namen nicht aufgerufen (oder keines lebensgefährlichen Verbrechens beschuldigt – ich kann es heute nicht mehr sagen) und konnte im Gefängnisleben Fuß fassen. Aus einer polnischen Familie stammend und mit Mitgliedern der verbotenen kommunistischen Partei Polens bekannt, gelang es ihm relativ bald, engen Kontakt zur polnischen Widerstandsbewegung zu knüpfen. Seine Befreiung wurde vorbereitet. Als erstes wurden mehrere Packungen Zigaretten in seine Hände geschmuggelt, wie sie in allen Gefängnissen der Welt eine gesicherte Währung darstellen. Nachdem er eine Zigarette gegessen hatte und unter entsprechendem Fieber litt, erreichte er bei der Verwaltung seine Überstellung in ein öffentliches Krankenhaus, die nichts absolut Ungewöhnliches war: Die Nazis kurierten Häftlinge immer wieder, ehe sie sie umbrachten – das war Teil der vorgegebenen Rechtsstaatlichkeit. In dem Fahrzeug, das ihn überstellen sollte, zeigte Weißberg dem Fahrer seine Zigarettenpackung und war zu Recht überzeugt von dessen Bestechlichkeit: „Ich habe eine ganze Kiste davon in meiner Wohnung – wenn Du mich vorbeibringst, kann ich sie abholen und wir teilen.“ „Gier und Bestechlichkeit“, so sagte mir Weißberg (und lehrten mich später auch meine Mutter und Simon Wiesenthal, als ich in seinem Büro arbeitete) sei mindestens so sehr eine Konstante des NS-Regimes gewesen wie die Überzeugung von der eigenen
41
42
Der Seewolf
rassischen Überlegenheit und der mit ihr verbundene Antisemitismus: Man hat die Juden immer genau so gerne beraubt wie umgebracht. Ich weiß nicht, wie weit das auf Weißbergs Chauffeur zutraf, aber eine halbe Kiste Zigaretten übte offenkundig eine beträchtliche Anziehungskraft auf ihn aus: Er erklärte sich bereit, die ihm von Weißberg genannte Adresse aufzusuchen. Und Weißberg erklärte sich bereit, die Kiste aus dem obersten Stock des Hauses abzuholen. Ihm kam zu Hilfe, dass er wusste, dass der Fahrer sein Dienstfahrzeug auf keinen Fall länger alleinlassen durfte, – dass er ihn also unmöglich begleiten konnte. Gleichzeitig war ihm klar, dass der Fahrer natürlich immer den Verdacht haben musste, dass er fliehen könnte, – dass er diesen Verdacht also entkräften musste. Das gelang ihm, indem er ihn nur ein paar Sekunden bis zum Hauseingang mitnahm: „Überzeugen Sie sich: Dieses Haus hat nur diesen Vordereingang und keinen Hinterausgang“, überzeugte er ihn durch Augenschein, „ich muss also in fünf Minuten hier vorne wieder herauskommen.“ Er kam nicht heraus: Die Widerstandsbewegung hatte die Wohnung, aus deren geöffnetem Fenster er dem wartenden Fahrer freundlich zuwinkte, durch ein Loch mit der entsprechenden Wohnung des Nachbarhauses verbunden. Durch dessen Stiegenhaus und Hinterausgang auf eine Parallelstraße gelangte Alexander Weißberg in die Freiheit. Seine kommunistischen Freunde hatten auch für seine Unterbringung gesorgt. Er bezog Quartier bei einer hübschen, blonden Polin namens Sophia Cybulska, deren Mann, Graf Cybulski sich ins Ausland abgesetzt hatte. Aus der Einquartierung wurde eine Partnerschaft und in der Folge eine Ehe – auch wenn Weißberg sie meiner Mutter gegenüber zeitlebens als „Scheinehe“ bezeichnete, die er nur eingegangen sei, um sich vor Verfolgung zu schützen. „Ich musste ja mit meinem jüdischen Gesicht in einer Stadt leben, in der auch jeder zweite Pole ein Antisemit war. Das war nur als Sophias Ehemann möglich. Im Haus hat man sie gekannt und geschätzt – da hätte niemand etwas über uns gesagt. Aber wir mussten von etwas leben und um Geschäfte zu machen, musste ich das Haus verlassen. Dann hab’ ich sie gebeten, dass sie neben mir geht und einen arischen Eindruck macht.“ „Sophia mach einen arischen Eindruck“, ist jedenfalls zwischen uns – meiner Mutter, Alex Weißberg, Sophia Cybulska und mir – zum geflügelten Wort geworden und sie hat es lachend akzeptiert. Von ihr weiß ich auch, dass die Geschäfte, von denen mir Weißberg erzählte, tatsächlich stattgefunden haben, denn sie hören sich so abenteuerlich an, dass man sie eher Münchhausen zuordnet. Möglicherweise hatte schon Sophia Cybulska dank ihres hübschen Aussehens und ihrer Deutschkenntnisse kleine Geschäfte mit der Wehrmachtsverwaltung gemacht, indem sie Bürsten und Besen, die sie billig bei Landsleuten einkaufte, an die „Beschaffung“ verkaufte. Jedenfalls gelang es Weißberg mit einem geschäftlichen Talent, das ihn nach dem Krieg zum vielfachen Millionär machen sollte, in dieses Geschäft einzusteigen und es gewaltig auszuweiten: Er wurde zum Hauslieferanten der Beschaffung der deutschen Wehrmacht, soweit es um Güter ging, die in Polen billiger als in Deutsch-
Der Seewolf
land hergestellt werden konnten und an denen die Besatzungsmacht Bedarf hatte. Das Wichtigste davon war Dachpappe, mit der provisorische Unterkünfte gedeckt wurden. Vermutlich die arische Sophia schloss die entsprechenden Lieferverträge ab – Weißberg besorgte die Ware, die angesichts des Krieges zunehmend Mangelware war, bei seinen kommunistischen Freunden, die sie pünktlich lieferten. Teils lieferten sie die Rollen mit der Bahn an die „Beschaffung“, teils wurden sie von der „Beschaffung“ per Bahn an die Bestimmungsorte versendet, an denen die Wehrmacht sie benötigte. Weißberg kannte also die Größe der jeweiligen Ladung, er wusste, woher sie kam oder wohin sie ging, und kannte die Abfahrtszeiten der Züge. So oft er größeren Geldbedarf hatte, teilte er diese Daten der Widerstandsbewegung mit. Deren Partisanen hielten die Züge an geeigneter Stelle auf und raubten sie aus. Sie erreichten ihr jeweiliges Ziel ohne Dachpappe – und die „Beschaffung“ musste neue bestellen. Jede dieser Bestellungen wurde ihr durch ein ordentliches Kick-back versüßt. Zu den großen Mythen des NS-Regimes zählt, dass es Korruption durch deutsche Sauberkeit abgelöst hätte. Nicht, dass es die Nazis und auch SS-Leute nicht gab, die dieses hehre Ziel hatten – ich bin auf Nazis gestoßen, die ihre Eheringe einschmolzen, um das Gold für den Endsieg zu spenden – aber sie waren eine verschwindende Minderheit. Die überwältigende Mehrheit, so lehrte mich meine Mutter aus ihrer reichen Erfahrung mit SS-Bewachern und so lehrte mich meine Arbeit im Büro Simon Wiesenthals, bei der es immer wieder auch um Arisierung ging, war eher etwas korrupter als der Durchschnitt. Auch wenn dazu wahrscheinlich beitrug, dass sie der Propaganda Glauben schenkte, dass Juden ihren Reichtum durchwegs Wucher und Ausbeutung verdankten, so dass es geradezu geboten sei, ihn ihnen wieder abzunehmen. Aber gerade die Erlebnisse des Alex Weißberg zeigen, dass ihre Korruption dieser Entschuldigung in keiner Weise bedurfte. Es war die Korruption ganz normaler kleiner Leute, die das NS-Regime erstmals in ihrem Leben in die Lage versetzt hatte, Macht über große Geldbeträge auszuüben und die den begreiflichen Entschluss gefasst hatten, diese Gelegenheit zu nutzen. Es ist diese meine Erfahrung mit Nazis, die mich stets erwarten ließ, dass Funktionäre der FPÖ, die erstmals Macht in die Hand bekommen würden, sie im Stile Karl Heinz Grassers oder Gernot Rumpolds nutzten würden, so sehr sich die FPÖ als Sauberpartei gebärdet hatte. „Die Leute bei der Beschaffung mussten ja ganz begeistert sein, über welche Summen sie plötzlich verfügten“, erzählte mir Weißberg, „so jemand war vorher vielleicht ein kleiner Beamter, vielleicht der Buchhalter eines Kleinbetriebes gewesen, und nun erlebte er, wie seine Unterschrift Beträge mit mehreren Nullen bewegte. Das musste ihn in Versuchung führen: Was er da in einer Stunde abzweigen konnte, hat er in seinem bisherigen Leben in einem Jahr nicht verdient. Natürlich haben bei der Beschaffung bald alle gewusst, wie unsere Geschäfte laufen. Aber auf die Gier war Gott sei Dank wirklich Verlass. Dass die Dachpappe nicht angekommen ist, hat ja außerdem niemandem wirklich weh getan“, gestand Weißberg der „Beschaffung“ der Deutschen Wehrmacht
43
44
Der Seewolf
in Polen in seiner Erzählung immerhin zu, um ihrer Geschäfte willen nicht das Leben von Kameraden aufs Spiel gesetzt zu haben. Das Dachpappe-Geschäft war nicht blutig. Eine nächste Bestellung wurde jeweils ordentlich erfüllt: Sophia konnte den Deutschen problemlos die Dachpappe anbieten, die die Partisanen erbeutet hatten. „Es war wirklich ein hervorragendes Geschäft“, erinnerte sich Weißberg, „wir haben sehr gut verdient – die haben sehr gut verdient. Aber weißt Du, als Physiker bist Du immer auf der Suche nach dem reinen Experiment mit der einfachsten Versuchsanordnung. Mich hat irritiert, dass wir die Dachpappe immer wieder verladen, immer wieder rauben und neu verladen mussten, wo doch der Sinn des Geschäftes nur darin bestand, dass die Leute bei der Beschaffung ihr Geld erhielten, und dass wir unser Geld erhalten. Also habe ich ihnen vorgeschlagen, die Dachpappe nur zu bestellen und so wenig zu verladen, wie wir sie geliefert haben. Sie sollten nur melden, dass der Zug, auf dem sie sich befunden hat, leider wieder einmal von Partisanen überfallen worden ist und die Partisanen würden alles tun, dass sich herumspricht, dass ihnen schon wieder ein Überfall geglückt ist. So ist es wirklich das reine Geschäft gewesen. Wir haben nichts im Kreis geschickt und nur jeweils verrechnet und kassiert. Ich glaube, mit der Dachpappe, die auf diese Weise bezahlt wurde, hätte man Polen zweimal eindecken können.“ Ich bin von dieser letzten Erzählung, obwohl sie in Sophias Gegenwart stattfand, nicht restlos überzeugt – ich habe schon angedeutet, dass Weißberg gelegentlich zu Übertreibungen neigte – sicher aber ist, dass ihn seine Geschäfte mit der Wehrmacht zum reichen Mann machten. Er hortete Diamanten, in die er sein Geld klugerweise sofort eintauschte und besaß auch nach dem Krieg noch etliche davon. Allerdings sollte er der Gestapo irgendwann im Jahr 1942 doch auffallen und neuerlich verhaftet werden – nur dass er sich diesmal dank seiner Diamanten rasch und relativ einfach wieder freikaufen konnte. Dennoch scheint er sich danach in Polen nicht mehr sicher gefühlt zu haben, denn er rief meine Mutter in Wien an, um bei seiner Jugendfreundin vorzufühlen, ob sie eine Möglichkeit sähe, über Österreich in die Schweiz zu gelangen. Meine Mutter glaubte, einen solchen Weg zu kennen. Er endete mit ihrer Verhaftung.
5.
Persönlichkeitsfremd
Weißberg war wie Weisskopf oder selbst Lazarsfeld immer nur ein guter Bekannter meiner Mutter im Kreis der sozialistischen Studenten gewesen. Ihr erster „Freund“ im heutigen Sinne war Ernst Fischer, ein Redakteur der Arbeiter-Zeitung, der neben glänzenden Artikeln auch ziemlich gute Gedichte schrieb und als politische Hoffnung galt. In mancher Leute Augen hat er diese Hoffnung auch erfüllt: Er wurde nach dem Krieg Obmann der KPÖ und verließ sie aus Protest, als die Russen 1968 in Prag einmarschierten. Meine Mutter hat ihn, wie eigentlich alle Männer, die ihr damals nahestanden, mit erstaunlicher Kühle und in meinen Augen eher unfair beurteilt: „Fischer war jemand, der vor allem mit wenig Arbeit gut leben und dabei Applaus erhalten wollte. Die Diners, zu denen er nach seinem Austritt aus der KP im Jahr 68 im Westen eingeladen wurde, waren wahrscheinlich schon deutlich reichhaltiger als die, die ihm bis dahin in der Sowjetunion aufgetischt worden sind.“ Dass sie mit ihm ins Bett gegangen war, schrieb sie dem Umstand zu, dass sich das damals für junge Sozialistinnen so gehörte. Es gab damals nämlich schon alles, was später die 1968er Bewegung auszeichnen sollte: Jede Menge „freie Liebe“ und sogar „Kommunen“, in der Männer sich Frauen teilten. Selbst der liebste Bruder meiner Mutter, mein Onkel Helmut, der später die beste und treueste Ehe führen sollte, die ich kenne, war als Student Mitglied einer Kommune: Drei Burschen teilten sich drei Mädchen. „Völlig gleichberechtigt?“ wollte ich wissen. „Nicht wirklich. Wenn mein Freund drangekommen wäre, hat meine Freundin ausgerechnet jetzt die Periode gehabt.“ „Also hatte doch jeder seine Freundin?“ „Natürlich – aber das durfte man auf keinen Fall sagen.“ „Und wie ist das Ganze ausgegangen?“ „Irgendwann haben wir die Kommune aufgelöst – warum weiß ich nicht mehr, vielleicht ist einem von uns die Unordnung zu viel geworden oder er hat in einer anderen Stadt studiert. Jedenfalls haben wir die Auflösung beschlossen.“ „Und was war mit den Mädchen?“ „Wir haben beschlossen, dass gelost wird, wer welches Mädchen mitnehmen darf.“ „Und das habt ihr wirklich gemacht?“ „Natürlich – aber ich habe natürlich geschwindelt.“ „Und die anderen auch?“ „Ganz sicher.“
46
Persönlichkeitsfremd
Ich denke, dass es doch ein großer Vorteil ist, dass Burschen und Mädchen heute mit weniger Ideologie miteinander schlafen können. Bei meiner Mutter wäre das ohne Ideologie schwer möglich gewesen. Sie war zutiefst prüde. Sex war für sie trotz ihrer „freudianischen Religion“ immer etwas, das eigentlich Tiere miteinander verband, und das bei Menschen im Idealfall „sublimiert“ wurde. Sie musste zweifellos eine gewaltige puritanische Hürde überwinden, um „freie Liebe“ zu praktizieren. Einmal scheint das, mit aller ideologischen Konsequenz, dennoch auch physisch höchst konsequent der Fall gewesen zu sein, aber sie wollte darüber mit mir nicht sprechen: „Das war persönlichkeitsfremd – das war nicht ich.“ Der einzige Mensch, mit dem sie körperliche Liebe uneingeschränkt erleben wollte und glücklich erlebt hat, war mein Vater. „Er war der beste Liebhaber – niemand konnte ihm auch nur entfernt das Wasser reichen.“ Ihre späte Beziehung mit Alexander Weißberg – die einzige, die sie nach dem Krieg jemals einging – musste daran scheitern, dass sie ihn das in jedem Augenblick fühlen ließ.
6.
Meine deutsche Familie
Mein Vater Kurt Lingens stammte aus einer im Rheinland seinerzeit recht bekannten Familie politisch aktiver Tuchfabrikanten. Ein Josephus Lingens war Gründungsmitglied der katholischen Zentrumspartei und langjähriges Mitglied des Deutschen Reichstages. Wobei der Katholizismus zweifellos auch sein persönliches Zentrum war: Er stiftete die Aachener Marienkirche und war „Geheimkämmerer“ des Papstes. Dergleichen vererbt sich: Vor Mahlzeiten wird bei meiner deutschen Familie, den Geschwistern meines Vaters und ihren Kindern, bis heute gebetet. Denn auch sein Vater, Walther Lingens, war nicht nur ein relativ bekannter Mann, sondern selbstverständlich sehr katholisch. Wie Josephus Lingens war er ebenso selbstverständlich Mitglied der Zentrumspartei und ähnlich wohlhabend – in der Erzählung meiner Mutter „einer der reichsten Männer von Düsseldorf “. Freilich nicht durch eigene Leistung, sondern durch betuchte Erbschaft und durch Heirat. Seine schöne Frau Nini Piedboeuf entstammte der Verbindung zweier Industriellenfamilien, Piedboeuf und Dawans. Die Familie Dawans ist bis heute in der Metallindustrie tätig und war es damals an führender Stelle. Die sogenannten Stahl-Piedboeufs waren ein Zweig der bis heute sehr reichen belgischen Bier-Piedboeufs. Da Bier in Kesseln gebraut wurde, hatten sie sich der Dampfkesselproduktion zugewandt und im Rheinland die „Vereinigten Kesselwerke“ begründet – es gibt sogar ein Buch über ihren Beitrag zu dessen Industrialisierung. Jedenfalls war die Produktion von Dampfkesseln im Zeitalter der Dampfmaschine ein Geschäft wie heute die Produktion von Generatoren. Die recht wohlhabende Familie meiner Mutter, so behauptete sie stets mit einer gewissen Genugtuung – denn alles, was die Familie meines Vaters erhöhte, bereite ihr Genuss – „war arm gemessen an den Lingens in Düsseldorf “. Ob das wirklich stimmt, ist ungewiss. Denn als meine Eltern einander kennenlernten, befanden sich die Vereinigten Kesselwerke „in Liquidation“: Dieseltriebwerke hatten die Dampfmaschine abgelöst und die Kesselproduktion war eingebrochen. Ein Onkel namens Theo musste diese Liquidation als Vormund Nini Piedboeufs abwickeln, indem er die riesigen Betriebsstätten an ein Stahlunternehmen verkaufte. Jeden Monat erhielt mein Vater als einer ihrer Erben darüber eine Abrechnung, auf deren Haben- und Sollseite immer fast gleichgroße Millionenbeträge aufschienen, um am Ende ein paar Pfennige Plus oder Minus zu ergeben. Etwa zum Zeitpunkt meiner Geburt erhielt er die Mitteilung, dass es Onkel Theo gelungen sei, das Unternehmen „so zu liquidieren, dass der Familie Lingens daraus keine Schulden erwachsen sind“. In dem einzigen Gespräch, das ich mit ihm darüber geführt habe, behauptete mein Vater, Onkel Theo sei bei dieser Gelegenheit ein reicher Mann geworden – das entsprach seiner unverändert negativen Vorstellung menschlichen Verhaltens im „Kapitalismus“
48
Meine deutsche Familie
– aber sein Halbbruder Ralf, – ein unvoreingenommener Jurist bestritt das entschieden: Die Liquidierung sei korrekt erfolgt. Für mich blieb von den Kesselwerken nur die für mein Leben durchaus wichtige Erkenntnis übrig, dass Reichtum etwas höchst Vergängliches ist. Ich habe von meinem Vater, dessen Vater angeblich einer der reichsten Männer Düsseldorfs gewesen ist, einen Aschenbecher und eine kaputte Agfa-Kamera geerbt. Und auch vom Wohlstand der Familie meiner Mutter ist nicht viel übriggeblieben. Das Gut in Jugoslawien wurde unter Tito enteignet und lächerlich entschädigt. Die Edel-Soja-Werke wurden von Hitler für „kriegswichtig“ erklärt und mein Großvater musste sie für einen Betrag verkaufen, der gerade noch groß genug war, eine Klage wegen Enteignung auszuschließen, obwohl die erhaltenen Reichsmark nach dem Krieg natürlich jeden Wert verloren hatten. Die Anteile am Bankhaus Kathrein verblieben uns zwar, aber um das Bankgeschäft zu betreiben, hätten wir Kapital einschießen müssen, das wir nicht besaßen, so dass wir sie billigst an den Mehrheitseigentümer verkauften. Das Elternhaus meiner Mutter in der Theresianumgasse und die Hälfte des noch größeren Nachbarhauses (es beherbergte 40 Wohnungen), das uns ebenfalls gehörte, wurde durch den Mieterschutz so entwertet, dass meine Mutter und ihre Schwestern es in den 1950er Jahren um 5000 Schilling verkaufen mussten, weil sie das kriegsbeschädigte Dach aus den Mieteinnahmen nicht zu reparieren vermochten und der Regen es endgültig zu ruinieren drohte. (Der Baumeister, der unser Drittel kaufte, konnte sich die Reparatur dank seiner Firma leisten.) Diese Erfahrung hat meine Einstellung zur Wiener Mietengesetzgebung nicht ganz unerheblich beeinflusst: Ich halte sie bis heute in ihrer Ausgestaltung für ebenso unfair wie wirtschaftsfremd, und das Verhalten, das der legendäre Chefredakteur der Arbeiter-Zeitung Oscar Pollak in diesem Zusammenhang an den Tag legte, ließ mich die Redaktion der AZ verlassen: Unmittelbar nachdem er bei einem privaten Gespräch mit meiner Mutter eingestanden hatte, dass eine geschützte Miete von 1 Schilling pro Quadratmeter, die in der Zwischenkriegszeit festgelegt worden war, 1956 nicht mehr angemessen sein konnte, verfasste er einen Brandartikel gegen „die Hausherren“. Auch von dieser Verlogenheit hat sich einiges bis heute erhalten. Letztlich verblieb meiner Mutter und ihren drei Geschwistern von einem ganzen, einem halben und zwei Drittel Innenstadthäusern mit zusammen gut fünfzig Wohnungen je eine 80 Quadratmeter große Eigentumswohnung in einem der beiden Neubauten, die auf dem Grundstück ihres Elternhauses errichtet worden waren und diese Wohnung, die sie noch um ein Zimmer vergrößern konnte, habe ich von ihr geerbt. Ererbter Wohlstand hält nicht, wenn er nicht sehr groß ist – und selbst dann können ihn wie in Jugoslawien politische Ereignisse hinwegfegen: In Ziffern liege ich sicher nicht daneben, wenn ich annehme, dass meine Familie (meine Großeltern und Eltern) innerhalb ihrer Generationen mindestens fünfzig Millionen Euro verloren haben. Aber anders als die meisten Leute halte ich das weder für ein Unglück noch gar für ungerecht: Ich war und bin der amerikanischen Überzeugung, dass Wohlstand etwas ist, dass man
Meine deutsche Familie
möglichst selbst zu erarbeiten hat und das einem nie zur Gänze gebührt. Das hat mich als Journalist zu einem so energischen Verfechter von Erbschaftssteuern gemacht. Vielleicht lag es auch an der Opposition zu meinem Vater, der so wenig von dieser amerikanischen Einstellung hatte, obwohl er letztlich in die USA emigrierte: Er war der typische Erbe eines Erben und konnte überhaupt nicht mit Geld umgehen. Solange er für mich sorgte – er tat es nur durch die ersten Jahre meines Lebens – tat er es auf der Basis eines Schecks seines Vaters, von dem eine große Familie bequem leben konnte. So behielt er auch nach der Heirat mit meiner Mutter und der Übersiedlung in deren Mietwohnung in der Piaristengasse bzw. in die Hinterbrühl eine 200 Quadratmeter große Mietwohnung in der Doblhoffgasse im ersten Wiener Bezirk und bestellte seine Anzüge selbstverständlich beim Nobelschneider Knize am Graben. Denn selbst nach der Liquidation der Vereinigten Kesselwerke konnte sein Vater selbstverständlich noch bestens vom verbliebenen „Vermögen“ – Aktien mir unbekannten Wertes und 30.000 Golddukaten in bar – leben, seine mittlerweile sechs Kinder standesgemäß versorgen und die Funktion eines Polizeipräsidenten eher aus Pflicht- und Ehrgefühl als um des Gehaltes willen ausüben. Schließlich galt es, die Fähigkeiten, die er an der Militärakademie und als ausgezeichneter Teilnehmer des Ersten Weltkrieges erworben hatte „zum Wohl des Vaterlandes“ anzuwenden. Er hätte sogar die Chance gehabt, zum Wohl Deutschlands, vielleicht sogar der ganzen Welt zu wirken. So versprach er Kölns Bürgermeister Konrad Adenauer ihm in seiner Funktion als Polizeipräsident von Nordrhein-Westfahlen im Kampf gegen die Nazis beizustehen. Doch als die SA drohte, das Kölner Rathaus zu stürmen und Adenauer ihn ersuchte, mit der Polizei gegen die Braunhemden einzuschreiten und für Ordnung zu sorgen, fand er dazu nicht den Mut. Wäre es in diesem großen Bundesland gelungen, den Rechtsstaat gegen den braunen Terror aufrechtzuerhalten, es hätte vielleicht beispielhaft gewirkt: Auch andere Behörden hätten ihn vielleicht nicht so kampflos preisgegeben und der NSDAP freie Hand gelassen. Es ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass sich Hitlers Macht nicht ganz so schnell und so irreversibel gefestigt hätte, wenn mein Großvater damals zu seinem Versprechen gestanden wäre. Jedenfalls soll Adenauer ihm sein Verhalten nach dem Krieg verübelt haben, aber meine deutsche Familie beschwört, dass er letztlich zugestanden hätte, dass es für eine solche Aktion bereits zu spät gewesen sei und ein letzter Brief Adenauers zu den Ereignissen des März 1933 stützt diese Annahme. Wegen des ungebrochenen Ansehens seiner Familie verblieb Walther Lingens nach der Machtergreifung Hitlers als einziger Polizeipräsident, der nicht der NSDAP angehörte, vorerst im Amt, das er weiterhin „pflichtgetreu“ zum Wohl des Vaterlandes ausübte. Das bedeutete zum Beispiel die selbstverständliche Verhaftung oppositioneller Kommunisten durch seine Polizei. Obwohl er gleichzeitig ihres Postens enthobene jüdische Kollegen für mehrere Nächte in seinem Haus unterbrachte – Antisemitismus war der Familie meines Vaters fremd.
49
50
Meine deutsche Familie
Da er der Partei nicht angehörte, wurde er 1935 als Polizeipräsident von Köln zwar dennoch abgelöst, blieb aber weiterhin gehobener Verwaltungsbeamter und landete schließlich auf einem entsprechenden Posten im Innenministerium in Berlin, den er abermals „pflichtgetreu“ ausübte. Obwohl er Hitler persönlich zutiefst verachtete und aus seinem Katholizismus heraus sehr wohl missbilligte, was auf den Straßen geschah, erklärte er meiner Mutter, „dass wir jetzt, da Krieg ist, alle hinter Deutschland stehen müssen“. Die gleiche Erklärung gab er immer wieder auch öffentlich und schriftlich ab. Auf mein Leben sollte die auch nach 1933 angesehene Stellung meines Großvaters jedenfalls erheblichen Einfluss haben: Sie trug wesentlich zur Risikobereitschaft meiner Eltern bei. „Er hat seinen (gleichnamigen) ältesten Sohn Walter einmal binnen weniger Stunden aus der Haft der Gestapo freibekommen, in die er wegen seiner Beziehung zu einer Italienerin geraten ist – da haben wir uns gedacht, er würde auch uns vor dem Schlimmsten bewahren können“, erzählte mir meine Mutter. Walter Lingens jun. der älteste Bruder meines Vaters, war das Enfant terrible der Familie. Gegen den Wunsch seines Vaters hatte er Psychiatrie studiert und nicht wenige Leute fanden, er hätte manches mit seinen Patienten gemein. So ging er grundsätzlich, auch zur Arbeit und zu Gesellschaften, barfuß – bei Italienurlauben auch gelegentlich über glühende Kohlen. „Sehr auffällig“, nannte ihn auch meine Mutter. Jedenfalls spielte er in seiner Familie in Düsseldorf eine reichlich problematische Rolle. Mehr noch als seine jüngeren Brüder Klaus, Kurt und Karl hing er mit allen Fasern an Nini Piedboeuf, der er so ähnlich sah, wie man einer Frau als Mann nur ähnlich sehen konnte und die einen so liebenswerten Gegenpol zu seinem „strengen, aber gerechten“ Vater bildete. Er konnte nie damit fertig werden, dass sie bei der Geburt ihres vierten Sohnes Klaus im Kindbett starb. Meine psychoanalysierende Mutter meint, er hätte seinem Vater eifersüchtig angelastet, dass der trotz dreier Kinder weiterhin mit seiner Frau geschlafen und sie damit dem Risiko einer Geburt ausgesetzt hat. Als Walther Lingens sen. nach einigen Jahren der Trauer und der Abstinenz seine nicht mehr ganz junge Haushälterin heiratete und mit ihr seine erste Tochter Heide und seinen fünften Sohn Ralf zeugte, erklärte Walter Lingens jun. das zum „Verrat“ an Nini Piedboeuf und hetzte vor allem seinen viel jüngeren Lieblingsbruder Kurt mit all seiner suggestiven Überzeugungskraft gegen das Familienoberhaupt und dessen zweite Familie auf. So lange mein Vater noch in seinem Elternhaus lebte und Strafen seines Vaters zu fürchten hatte, übte er sich zwar in widerstrebendem Gehorsam, aber als er endlich mit einiger Mühe die Schule abgeschlossen hatte, ging er zur Subversion über. Zwar schrieb er sich, weil der Vater es anordnete, in eine technischen Hochschule ein, auf der er zum Architekten ausgebildet werden sollte, aber dem standen sein mäßiges Interesse und seine mangelnde Kenntnis der Mathematik im Wege: Er hatte die „Höhere Reife“ nur aufgrund einer Bestimmung geschafft, die vorsah, dass man auch mit einer Fünf
Meine deutsche Familie
in Mathematik bestehen konnte, wenn einem „außergewöhnliche persönliche Reife“ bescheinigt wurde. Die war zwar das Letzte, was mein Vater damals vorzuweisen hatte, aber dafür war er der Sohn des Polizeipräsidenten, und das reichte. Nicht allerdings für die Mathematik, die man an der Technik von ihm verlangte. Eine Zeitlang ließ er sich den Studienerfolg, den er nicht hatte, auf irgendwelchen Formularen bestätigen, die ihm Kommilitonen beschafften, um dennoch zu einem Scheck seines Vaters zu gelangen, dann ging er die Sache grundsätzlicher an: Er trat dem marxistischen „Spartakusbund“ zur Vorbereitung der Weltrevolution gegen Kapitalismus und Imperialismus bei. Nicht einmal sein Vater konnte – und wollte – verhindern, dass er von allen deutschen Universitäten ausgeschlossen wurde. Das führte dazu, dass er in Wien inskribierte. Und hier mit meiner Mutter zusammentraf.
51
7.
Der goldene Helm
Die beiden lernten einander bei einer Tanzveranstaltung der sozialistischen Jugend kennen, bei der er politischen Anschluss gesucht hatte. Der erste Abend wurde charakteristisch für ihre Beziehung: Er endete damit, dass nicht er sie, sondern sie ihn abschleppte. „Ich habe sofort gewusst, dass er der richtige ist“, erzählte mir meine Mutter. „Er war ein so schöner Mensch. Sein goldenes Haar hat geleuchtet wie ein goldener Helm.“ Die Art und Weise, wie sie noch bis ins hohe Alter vom „goldenen Haar“ meines Vaters schwärmte – „ich hatte so gehofft, dass Du es erben würdest, aber wenigstens hast Du seine Figur geerbt“ – war für mich doppelt seltsam. Einmal, weil sonst höchstens Männer so vom Haar einer Frau schwärmen –, ich habe meine Mutter bei ihren Worten daher plötzlich als den „Mann“ in der Ehe meiner Eltern empfunden und war davon irritiert. Zum anderen, weil es mich ebenso irritierend an germanische Heldenverehrung erinnert hat: Mein Vater war für meine Mutter tatsächlich der schlanke, blonde, blauäugige „edle“ Germane, den die Nazis im „Stürmer“ dem kleinen, dunkelhaarigen, buckeligen Juden gegenüberstellten. Obwohl die Juden, die sie näher gekannt hatte, diesem Stürmer-Bild in keiner Weise ähnelten, war mein Vater doch das absolute Gegenbild zu ihnen. Ich kenne nur Fotos meines jugendlichen Vaters. Und da fällt mir neben dem blonden Haar vor allem die schwarze Klappe über seinem rechten Auge auf: Es war von Geburt an missgebildet und schwachsichtig – vermutlich, weil es durch ein Blutgefäß, an dessen Platzen er sehr früh sterben sollte, schlecht ernährt wurde. Erst meine Mutter erfand die Lederklappe, mit der er es fortan verdeckte. „Und glaube mir, es hat mich jede Frau um ihn beneidet.“ Kurt Maria Lingens, wie er mit vollem Namen hieß, war für seine Generation sehr groß – deutlich über 1,80 Meter – hatte breite Schultern, schmale Hüften und extrem lange Beine – in seiner Jugend hatte er eine Zeitlang mit der Idee gespielt, Grotesktänzer zu werden. Sein Gesicht war gleichermaßen kantig, männlich und fein geschnitten und nur durch das kaputte Auge entstellt. Aber seit er die schmale, von meiner Mutter entworfene Lederklappe darüber trug, vermittelte ihm das wie bei Stauffenberg oder Moshe Dajan etwas zusätzlich Verwegenes. Bei unserem zweiten Zusammentreffen nach seiner Auswanderung in die USA – es fand statt, als ich etwa 14 war – holte er mich in Wien aus der Wohnung eines Mädchens ab, in das ich mich verliebt hatte. Sowohl dieses Mädchen wie seine Mutter schwärmten danach von meinem Vater statt von mir. Ich habe also Verständnis für das Schwärmen meiner Mutter.
Der goldene Helm
Eines der Probleme ihrer Ehe bestand von Anfang an darin, dass es nicht auf Gegenseitigkeit beruhte: Mein Vater mochte meine Mutter und war von ihr beeindruckt. Auch gefesselt – in jedem Sinn dieses Wortes – von der Liebe, die sie ihm entgegenbrachte: Sie schlang diese Liebe so dicht um ihn, dass er darin, so meine ich, nie frei zu atmen wagte. Gleichzeitig gab sie ihm Halt: Hatte er sein Leben bis dahin völlig verbummelt – weder ernsthaft studiert, noch sonst etwas Nützliches oder zum Beispiel Künstlerisches unternommen – den „Grotesktanz“ hatte er nach wenigen Unterrichtstunden wieder aufgegeben – so hatte sie ihn darin bestärkt, in Wien ein Studium der Medizin nicht nur deshalb aufzunehmen, weil es weitere Schecks seines Vaters sicherte, sondern weil er damit etwas Nützliches für die Menschheit täte, der er bis dahin nur durch die Weltrevolution nützen wollte. Zuerst sorgte sie dafür, dass er rechtzeitig aufstand, um seine Vorlesungen zu besuchen. Dann sorgte sie dafür, dass er erstmals Prüfungen bestand, indem sie den Lehrstoff tagelang mit ihm durchging. Und schließlich studierte sie mit ihm Medizin. Denn ihr ursprünglicher Wunsch, ihr Jus-Studium zu einer Karriere als Richterin zu nutzen, war daran gescheitert, dass sie mit ihrem Vater jugoslawische Staatsbürgerin geworden war. Die psychoanalytische Behandlung, der sie sich nach ihrem Selbstmordversuch unterzogen hatte, hatte die Lehre Sigmund Freuds ohnehin zu ihrer Religion gemacht, und so strebte sie nun eine Karriere als Psychoanalytikerin an, die damals ein Studium der Medizin zur Voraussetzung hatte. Das gemeinsame Studium schuf zwingend gemeinsame Interessen und gemeinsamen Gesprächsstoff. Dass mein Vater bei den Prüfungen immer ungleich schlechter als meine Mutter abschnitt, wusste sie auszugleichen: Sie schwärmte von seinem ungleich größeren Talent, mit Patienten umzugehen und hatte damit wahrscheinlich sogar Recht. Mein Vater verdankte meiner Mutter, zum erwachsenen Mann geworden zu sein. Als sie auf „Heirat“ drängte, gab er nach – aber er schwärmte nicht von ihr. Stattdessen erbat er als „Bedenkzeit“, eine einmonatige Reise nach Italien, die er mit seinem Motorrad allein unternehmen wollte und meine Mutter willigte zitternd ein, nachdem ihr Psychoanalytiker jedes andere Verhalten als „possessiv“ und damit kontraproduktiv klassifiziert hatte. Allerdings vermochte sie zu vereinbaren, dass er ihr von jeder Stadt, in der er Station machte, einen Brief schreiben sollte, während ihr Brief dort jeweils „poste restante“ auf ihn warten würde. Sie hat innerhalb eines Monats zwanzig Briefe geschrieben, die er ihr nach der Scheidung zurückgegeben hat, so dass ich sie lesen konnte: Im Wesentlichen musste er daraus entnehmen, dass sie umkommen würde, wenn er nicht bald wiederkäme – „obwohl ich Dich natürlich in keiner Weise an mich binden will.“ So hat er meine Mutter am 12. März 1938 geheiratet. Auch ich habe vor meiner ersten Ehe eine psychoanalytische Behandlung durchgemacht. Mein Analytiker hat mir gesagt, dass eine Ehe die Behandlung beenden würde – es sei nicht möglich, eine Beziehung zu analysieren, die man endgültig eingegangen sei. Auch ich habe vor meiner Heirat eine Bedenkzeit genommen, die ursprünglich für ein
53
54
Der goldene Helm
Vierteljahr geplant war, aber stattdessen in wenigen Wochen geheiratet, obwohl meine Verlobte mir keine solchen Briefe geschrieben hat. Nur meine Mutter ließ mich wissen, dass ich meine Verlobte doch dringend heiraten sollte, aber ich habe es durchaus aus Überzeugung getan. Die Ehe hielt immerhin zwanzig größtenteils sehr schöne Jahre. Vielleicht hätte auch die Ehe meiner Eltern trotz mancher Probleme viel länger gehalten, wenn es ihre Verhaftung nicht gegeben hätte. Eher bezweifle ich das freilich. Denn anders als bei mir war diese Ehe der totale Ausbruch aus ihrer bisherigen Männerwelt: Intellektueller Glanz hatte neben dem Glanz des goldenen Haars meines Vaters restlos ausgespielt. Ich kann das verstehen. Aber wenn es nicht die Frau neben einem Mann, sondern den Mann neben einer Frau betrifft, ist es – so sehr Elfriede Hammerl das leugnete – ein Problem: Ein Mann, der sich intellektuell unterlegen fühlt, fühlt sich der Frau in seiner Gesamtheit unterlegen. Männlichen Kampffischen, die auf ein ihnen überlegenes Weibchen treffen, verschließt sich reflektorisch der Paarungsapparat. Bei meinem Vater ging das nicht so weit: Sein Paarungsapparat funktionierte, obwohl meine Mutter ihn intellektuell um Häuser überragte, aber er zog ihr doch dümmere Frauen im Bett bei weitem vor. Und irgendwann nicht nur im Bett, sondern auch im Leben. „Das beweist, dass er kein wirklich starker Mann war!“, pflegt die liebste meiner feministischen Freundinnen einzuwenden und theoretisch hat dieser Einwand eine Menge für sich. Aber in der Praxis ist auch sie, seit ich sie kenne, auf der vergeblichen Suche nach dem Mann, der ihr im Kopf gewachsen und dennoch gut im Bett ist.
Das große Bedauern Auch für mich war das Zusammenleben mit dieser intellektuell so brillanten „großen Frau“ mit Belastungen verbunden. Nicht, weil es mich bekümmerte, ihr intellektuell nicht gewachsen zu sein: Was sie mir an gemessener Intelligenz voraushatte, hatte ich ihr an künstlerischer Intuition voraus. Auch nicht, weil ihre moralische Größe mir ein Minderwertigkeitsgefühl eingeflößt hätte: Sie hat das bewusst verhindert, indem sie sich nie als „Heldin“ gegeben, sondern mir im Gegenteil immer wieder erklärt hat, wie wenig sie sich des Risikos ihres Handelns bewusst gewesen ist. Ich hatte, glaube ich, nicht einmal das in ähnlichen Fällen so häufige Problem, ausschließlich eine weibliche und keine männliche Identifikationsfigur zu besitzen, denn obwohl meine Mutter „vor allem Frau“ sein wollte, war sie in gewisser Weise erstaunlich männlich – sie hat sich immer nur mit ihrem Vater identifiziert. Nein, das Belastende unseres Zusammenlebens bestand in seiner Ehe-Ähnlichkeit: Seit meinem fünften Lebensjahr war ich der „Lebensgefährte“ meiner Mutter. Denn nachdem sie von meinem Vater geschieden worden war, war sie entschlossen, nie mehr einen anderen Mann zu lieben. Obwohl Kurt Lingens seit Jahren mit einer anderen
Das große Bedauern
Frau verheiratet war, anerkannte sie diese Verbindung nie als Ehe. Im Scheidungsvertrag setzte sie die meines Erachtens sittenwidrige Bestimmung durch, dass seine Frau sich niemals „Lingens“ nennen durfte. (Sie verzichtete im Gegenzug auf Alimente für sich, selbst wie sie vor Brodas Scheidungsreform für den schuldigen Mann sehr teuer ausgefallen wären.) „Wenigstens hat er kein Kind mit ihr“, wiederholte sie immer wieder. „Das habe nur ich mit ihm“, bestand sie darauf, dass nur die Verbindung mit ihr eine wirkliche Ehe gewesen sei, um einen für mein Leben lebensgefährlichen Satz anzuhängen: „Du bist das Einzige, was mir von ihm geblieben ist.“ Es ist kein wirklicher Vorteil, das „einzig Verbliebene“ zu sein. Als meine Mutter über neunzig und manchmal schon etwas verwirrt war, hat sie meinen Vater und mich zu verwechseln begonnen. Sie hat mich mit seinem Namen angesprochen oder meiner zweiten Frau vorgeworfen, dass sie ihr den Ehemann weggenommen hätte. Die Scheidung von meinem Vater, nicht Auschwitz war die größte Zäsur im Leben meiner Mutter: „Seither ist mein Leben sinnlos. Wenn es Dich nicht gegeben hätte, hätte ich sterben wollen.“ Meine Mutter lebte diesen gewünschten Tod. Sie lachte fast nie. Sie trug durch Jahre das immer gleiche Kostüm aus schwarzem SS-Stoff, den man ihr bei ihrer Befreiung übergeben hatte und verzichtete darauf, ihr Haar, das durch das Fleckfieber schlohweiß geworden war, zu färben, obwohl sie erst 37 und eine unvermindert schöne Frau war. Wenn ich gelegentlich vom Tod geträumt habe, war er für mich nie ein Mann, sondern eine schöne, weißhaarige Frau. „Meine Mutter sitzt einsam in einem Lehnstuhl aus schwerem Brokat. Ach Mutter, liebe Mutter mein, warum bist Du nur so allein“, habe ich mit elf ein entsetzlich schlechtes Gedicht gemacht, das meine Mutter nichtsdestotrotz bis zu ihrem Tod zwischen den Fotos meines Vaters aufgehoben hat. Es bewies ihr sozusagen, dass ich ein guter Sohn war, der das gebührende Mitleid mit ihrem Schicksal hatte. Auch mit mir selbst hatte ich Mitleid, denn es war wirklich nicht schön, keinen Vater zu haben, obwohl er am Leben war. So wie meine Mutter habe ich immer von ihm geträumt. Ich erinnere mich, wie ich im Tiergarten Schönbrunn einen kleinen Buben beneidet habe, dem, als er fürchtete, das Krokodil könnte entkommen und ihn beißen, von seinem Vater erklärt wurde: „Dann kitzle ich es am Bauch und es kann Dir nichts mehr tun.“ Oder einen anderen Buben, dem sein Vater ein Eis bestellt und der Kellnerin aufgetragen hat: „Aber bitte nicht zu kalt.“ Nur ein Vater, so dachte ich, kann vor Krokodilen schützen und warmes Eis bestellen. So wie ich sie für ihre Einsamkeit bedauert habe, hat meine Mutter mich für meine Vaterlosigkeit bedauert. Es lag ständig ungeheuer viel gegenseitiges Bedauern in der Luft: Das Bedauern des einen hat das Bedauern des anderen sozusagen in seiner Berechtigung bestätigt. Auch das ist nicht unbedingt geeignet, das Zusammenleben zwischen Mutter und Sohn zu erleichtern.
55
8.
Nicht von der Türe weisen
Mein Vater war im Zusammenleben meiner Eltern der politisch „linkere“ der beiden. Er konnte sich immer noch die proletarische Revolution gegen seinen Vater vorstellen, während meine Mutter trotz ihrer Abneigung gegen ihre Mutter immer nur eine gerechtere Gesellschaft wollte. Es irritierte sie, dass Hausgehilfinnen, die viel und lang arbeiteten, in fensterlosen Zimmern wohnten und nichts verdienten. Sie zahlte ihren Hausgehilfinnen deutlich mehr – vom Scheck ihres Vaters. Sie hatte ein Problem damit, sich ein teures Kleid zu kaufen, denn es irritierte sie, dass andere junge Frauen, die ihren Männern auch gefallen wollten, sich keines kaufen konnten. Bis zu ihrer Heirat hatte sie grundsätzlich auf alles verzichtet, was ihre Eltern ihr als „Verlobte“ zugestanden hatten: Kostüme von erstklassigen Schneidern, Reisen erster Klasse, Übernachtungen in besten Hotels, Mahlzeiten in erstklassigen Restaurants. Stattdessen hatte sie ausschließlich in der Mensa oder aus der Blechdose gegessen, hatte blaue oder weiße Blusen zu blauen Kitteln getragen, war dritter Klasse gefahren und hatte in Jugendherbergen übernachtet. Damit meinte sie sich ein Herz, eine Seele und ein politisches Bewusstsein mit jenen Mädchen, die aus Arbeiterfamilien oder aus dem Kleinbürgertum zur sozialistischen Bewegung gestoßen waren. Zu Unrecht, wie ich aus der späteren Bekanntschaft mit einigen dieser Frauen weiß: Sie hielten es für eine ganz besondere Art von Hochmut – nämlich „Herablassung“ – dass meine Mutter Baumwollkittel trug, obwohl sie sich Seidenkleider leisten konnte. Als sie sich endlich selbst Seidenkleider leisten konnten – viele von ihnen waren im Rahmen der sozialistischen Bewegung in gut bezahlte Positionen aufgestiegen oder die Ehefrauen gut bezahlter, aufgestiegener Männer geworden – trugen sie Dior oder Chanel mit dem besten Gewissen der Welt als etwas, das ihnen selbstverständlich zustand. Wissenschaftsministerin Hertha Firnberg ließ ihren Chauffeur sieben Stunden in der Hitze warten, während sie bei Resmann in Salzburg Kleider probierte. Meine Mutter hätte das unmöglich gekonnt: Dass sie und ihr Mann von den Schecks ihrer Eltern lebten, hielt sie nie davon ab, das für ein in keiner Weise gerechtfertigtes Privileg zu halten: „Es hat uns auch sehr erleichtert, Widerstand zu leisten“, behauptete sie – obwohl ich bis heute nicht verstehe, worin diese Erleichterung bestand. Eigentlich war es mein Vater, der als Erster meinte, man müsse Hitler Widerstand entgegensetzen. Er schlug vor, aufrüttelnde Flugzettel in Telefonzellen zu verteilen. „Ich habe das Flugzettel-Verteilen sofort abgelehnt“, erinnerte sich meine Mutter, „es hätte überhaupt nichts gebracht und wir hätten nur ein unverhältnismäßig großes Risiko auf uns genommen. Das wäre unvertretbar gewesen, wenn man ein kleines Kind zu Hause hat.“
Nicht von der Türe weisen
Aber wie vertretbar war es, Juden zu verstecken, wenn man ein zweijähriges Kind zu Hause hatte – ein Alter, in dem ein Kind schon unruhig wird, wenn die Mutter auch nur für ein paar Stunden nicht sichtbar ist? Bis etwa zu meinem zehnten Lebensjahr habe ich mir diese Frage nicht bewusst gestellt. Dann hat sie mir meine Mutter gestellt und ich habe ihr keine rechte Antwort darauf gegeben, weil ich sie nicht verletzen wollte, denn meine ehrliche Antwort wäre „nicht vertretbar“ gewesen. Meine Mutter hat die Brisanz dieser Frage begriffen, denn sie hat in der Folge viel Zeit darauf verwendet, mir zu erklären, dass sie nicht wusste, dass Juden verstecken „Auschwitz“ bedeuten würde. Zwar hätte sie damals, nachdem sie die Flugzettel verwarf, gemeinsam mit meinem Vater beschlossen, „jüdische Freunde, die uns um Hilfe bitten, nicht von der Tür zu weisen“, aber weder ihr noch ihm sei damals klar gewesen, dass es für diese Freunde um Leben und Tod ging und dass man durch ihre Unterstützung selbst den Tod riskierte. Beide wussten natürlich, dass die Nazis Juden hassten, sie hatten gehört, wenn auch nicht selbst gesehen, dass man ihre Geschäfte geplündert und selbst alte Männer gezwungen hatte, die Parolen der abgesagten Volksabstimmung Kurt Schuschniggs vom Gehsteig zu waschen. Aber sie hielten das für Ausschreitungen des Pöbels, nicht für den Beginn der systematischen Ausrottung eines Volkes. Noch 1941 suchte mein Vater in Uniform die Gestapo auf, um dort seine Hand dafür ins Feuer zu legen, dass sein jüdischer Freund Heinrich Lieben sicher in Polen ankäme, wenn man ihm erlaubte, sein eigenes Auto für die Fahrt zu verwenden. Dass der Beamte ihm riet, solche Vorschläge künftig dringend zu unterlassen und das Gebäude schleunigst zu verlassen, verwirrte ihn zwar, aber es rüttelte ihn nicht wach. Man wusste, dass die meisten Juden höchst ungern nach Polen übersiedelten – doch was in Polen mit ihnen geschah, ahnten meine Eltern so wenig wie der Rest der Bevölkerung. Was meine Eltern vom riesigen Rest dieser Bevölkerung unterschied, war der Umstand, dass sie es schon schrecklich genug fanden, dass man Juden nicht mehr erlaubte, auf Parkbänken zu sitzen und sie zur Übersiedlung nach Polen zwang. Als Freunde sie baten, ein jüdisches Mädchen namens Erika für einige Zeit in ihre Wohnung aufzunehmen, weil es nicht nach Polen übersiedeln wolle, sagten sie daher zu, obwohl sie wussten, dass es verboten war. Sie wohnten damals in einer Dachwohnung in der Piaristengasse Ecke Maria-TreuGasse, die meine Mutter nach dem Ende ihrer Verlobung mit Paul Lazarsfeld gemietet hatte. Die junge Jüdin, die sie aufnahmen – sie war knapp achtzehn – erhielt ein Zimmer, das zum Hof schaute und es wurde ihr eingeschärft, sich nicht an Fenstern zu zeigen und niemandem aufzumachen. Ohne Erfolg. Da sie braun werden wollte, legte Erika sich eines schönen Tages nackt auf das blecherne Vordach der großen schrägen Fenster zum Piaristenplatz und es kam zu einem Vorfall, den ich mehrfach beschrieben habe: Die Buben des gegenüberliegenden Piaristengymnasiums entdeckten den erfreulichen Anblick und strömten an
57
58
Nicht von der Türe weisen
die Fenster. Ein Lehrer sah die Sittlichkeit gefährdet und alarmierte die Polizei. Wenig später läutete ein Wachmann an der Tür der Wohnung meiner Eltern, die zu diesem Zeitpunkt bei einer Vorlesung waren. (Mich hatten sie meinem Kindermädchen in der Hinterbrühl überlassen.) Diesmal beherzigte Erika die Anweisung meiner Eltern und machte nicht auf. Aber der Wachmann erklärte, er würde in zehn Minuten wiederkommen und wenn ihm dann nicht geöffnet würde, würde er die Tür aufsprengen lassen. Als er tatsächlich wiederkam, öffnete ihm eine ebenso schöne wie verlegene blonde junge Frau, die ihn vielmals um Entschuldigung bat: Sie habe sich erst anziehen und sammeln müssen. Natürlich geniere sie sich schrecklich, dass sie gesehen worden sei – sie würde das nie mehr tun. „Na, dann will ich es bei einer Verwarnung bewenden lassen“, brummte der Beamte. Als er gegangen war, fiel ein 18-jähriges dunkelhaariges Mädchen, das zitternd im Hinterzimmer gewartet hatte, der blonden jungen Frau um den Hals. Sie war jene Verlobte meines Onkels Klaus, der ich auf dem Jogltisch entgegengerobbt war, um sie zu küssen und sie war erst vor fünf Minuten eingetreten, weil sie wie er, einen Schlüssel zur Wohnung besaß und ihn hier treffen wollte. Stattdessen hatte sie eine ihr unbekannte, junge Jüdin in völliger Panik angetroffen. Dass sie sich dennoch sofort bereitfand, ihr auf die beschriebene Weise zu helfen, ist für mich bis heute atemberaubend. Der Polizist hätte aus dem Piaristengymnasium wissen können, dass man dort ein dunkelhaariges Mädchen beim Sonnen gesehen hatte – dann wäre sie der Irreführung einer Behörde zu Gunsten einer Jüdin schuldig gewesen. Und dass das Gefängnis bedeutete, wusste auch sie. Auch wenn sie so wenig wie meine Eltern ahnte, dass es Auschwitz bedeuten konnte. Sie war mehr Heldin als meine Eltern es damals gewesen sind. Denn die hatten ihr voraus – oder glaubten ihr zumindest vorauszuhaben – dass das Gericht einen Sohn des Polizeipräsidenten Walther Lingens beziehungsweise seine Schwiegertochter nicht gleich ins Gefängnis werfen, sondern doch wohl bedingt verurteilen würde. Sie ahnte, wie sehr es mich in Wahrheit verunsicherte, dass sie so viel Risiko eingegangen war – im tiefsten Inneren fühlte ich mich geringgeschätzt und ausgesetzt. Denn nach Erika hatten meine Eltern weitere Juden versteckt, obwohl ihnen immer klarer werden musste, dass „Judenbegünstigung“ als schweres Delikt betrachtet und entsprechend geahndet wurde. Als die Piaristengasse für die Zahl Versteckter viel zu klein und das Risiko dadurch viel zu groß wurde, verlagerte sich ihre Unterbringung ins Gesindehaus in der Hinterbrühl. Denn dessen Eigentümer bestärkte meine Eltern in ihrem Tun. Ohne dass es dazu der Überredung bedurft hätte, wurde Karl Motesiczky, selbst „geschützter Halbjude“ mit 36 Jahren zum ältesten Mitglied der kleinen Widerstandszelle.
Der Kommunist mit Guarneri-Cello
Der Kommunist mit Guarneri-Cello So wie bei meiner Mutter und meinem Vater gehörten „Reichtum“ und „Neurose“ zu Motesiczkys Familiengeschichte – nur beides mit tausend multipliziert. Motesiczkys Mutter, Henriette von Lieben geborene Todesco, vereinigte die Vermögen gleich zweier bedeutender Familien auf sich. Eduard und Moritz von Todesco, von Kaiser Franz Josef in den Ritterstand erhobene rumänische Juden, betrieben das bedeutendste Großhandelshaus der Monarchie mit angeschlossener Privatbank und wurden an Reichtum nur von den Rothschilds übertroffen. 1871 heiratete Eduards Tochter Anna den zwölf Jahre älteren Leopold von Lieben, der als Präsident der Börsenkammer auch noch reich genug war, am Wiener Universitätsring das Palais Lieben-Auspitz zu errichten, dessen Parterre heute das Café Landtmann beherbergt. Sehr glücklich war die Ehe trotz des vielen Geldes nicht, denn Anna von Lieben wurde Morphinistin und litt an allen möglichen psychosomatischen Symptomen, die sie als „Cäcilie M“ zu Sigmund Freuds berühmtester Patientin machten: Er nannte ihr Krankheitsbild Hysterie und versuchte vergeblich, sie mittels Psychoanalyse zu heilen. Neben ihrem Reichtum scheint sie auch einiges von ihrer komplexen Psyche an ihre Tochter Henriette, Karl Motesiczkys Mutter, vererbt zu haben und die vererbte es ihren Kindern weiter. Durch den frühen Tod des Vaters zu engstem Zusammenleben mit ihr gezwungen, entwickelte Karl eine ganze Reihe psychischer Probleme, die ihn Hilfe bei der Psychoanalyse suchen ließen, während seine Schwester Luise Motesiczky ihren Ängsten und Zwängen in grandiosen Bildern künstlerische Gestalt verlieh und heute unter die bedeutendsten Malerinnen ihrer Zeit gezählt wird. Auch Karl Motesiczky versuchte sich als Künstler – er war ein hervorragender Cellist – vermochte aber nie seine Angst vor einem öffentlichen Auftritt zu überwinden. Als er verhaftet und nach Auschwitz deportiert wurde, ersuchte er, ihm sein GuarneriCello nachzuschicken, was meines Wissens auch geschah. Es hätte vielleicht sogar seine Überlebenschance erhöht, denn einige SS-Leute hielten viel von klassischer deutscher Kultur – doch er starb nach wenigen Wochen an Fleckfieber. Meine Mutter beschrieb ihn mir immer als weltfremden Privatgelehrten. Sie machte sich Zeitlebens Vorwürfe, ihn „in unsere Sache hineingezogen“ zu haben. Aber darin irrte sie: Einer Biographie Motesiczkys, die erst 2004 erschien, entnahm ich, dass er ganz im Gegenteil schon seit Langem weit engere Beziehungen als sie zum Widerstand geknüpft hatte. Er hatte meinen Eltern nur aus Klugheit nie davon erzählt – sie sollten auch unter Folter nichts gestehen können, das andere belastete. Im Nachhinein müsste ich Karl Motesiczky an Stelle meiner Mutter als Kopf der Widerstandszelle in der Hinterbrühl bezeichnen. Von den beiden weiteren Personen, die am selben Tag als Mittäter verhaftet wurden, weiß ich nichts, und auch meine Mutter hat nie von ihnen gesprochen. Wohl aber von zwei Helfern, die ebenfalls mehr als sie selbst riskierten: Das Lehrerehepaar Robert und Hilde Lammer, beide Jugendfreunde meiner Mutter aus dem VSM, war damit
59
60
Nicht von der Türe weisen
beauftragt, an seiner Wiener Schule die Essensmarken für den zugehörigen Bezirk zu verteilen. Dabei behielt es die Marken ein, die aus irgendeinem Grund – Faulheit, Krankheit, Tod – nicht abgeholt wurden und übergab sie meinen Eltern, um auf diese Weise die notwendigste Ernährung der Versteckten sicherzustellen. Das war die Veruntreuung von Volkseigentum und wäre mit dem Tod geahndet worden, wenn es aufgekommen wäre. Ich führe dieses Beispiel wie das der blonden Verlobten meines Onkels immer an, um zu dokumentieren, dass viel mehr Menschen als meine Eltern bereit waren, Risiko auf sich zu nehmen, um Juden zu helfen. Mein Kindermädchen Betty, bei deren Mutter ich nach dem Krieg in Kärnten leben sollte, borgte einer kranken Jüdin, die ihr halbwegs ähnlich sah, ihren Pass, damit diese sich einer Operation unterziehen konnte. Unser Zimmermädchen stellte seine Wohnung zur Verfügung, damit eines der „U-Boote“ gelegentlich ihren Freund treffen konnte. Weder diese Zimmermädchen, noch Betty, noch die Verlobte meines Onkels, noch das Ehepaar Lammer wurden je von Yad Vashem unter die „Gerechten unter den Völkern“ gereiht. Außer in meinen Texten wurden sie nirgends erwähnt. Als Daniel Jonah Goldhagen in seinem Buch „Hitlers willige Vollstrecker“ pauschal so von Deutschen und Österreichern sprach und darüber in der ZEIT eine Diskussion entbrannte, schrieb meine Mutter einen Artikel, in dem sie das energisch bestritt – allein in ihrem Bekanntenkreis hätte es mehr als ein Dutzend aktiver Helfer gegeben. Dass die ZEIT den Text nicht mehr brachte, weil die Diskussion bereits abgeschlossen sei, ärgerte sie bis zu ihrem Tod, denn noch im Jahr davor kam sie darauf zurück. Sie wollte mir gegenüber auf gar keinen Fall die Einzige sein, die etwas riskiert hatte – denn ich sollte auf gar keinen Fall glauben, dass sie mein Glück leichtfertig aufs Spiel gesetzt hätte. „Wir sind in das alles hineingerutscht. Der Anfang war klein, und wir haben gedacht, dass es nicht so gefährlich ist. Dann ist es immer mehr geworden. Und irgendwann bist du drin und kannst nicht mehr zurück. So vieles hängt auch vom Zufall ab.“
Gibt es Schlimmeres als einen Jupo? Vielleicht war es also Zufall, dass Alexander Weißberg, als er das Gefühl bekam, in Polen nicht mehr sicher zu sein, ausgerechnet meine Mutter anrief – vielleicht aber wusste er auch um ihre Risikobereitschaft beim Klettern. Jedenfalls fragte er an, ob sie wisse, wie man aus Österreich in die Schweiz gelangen könne. Er sagte nicht dazu, dass er dabei an sich selbst dachte und er kam auch nicht selbst, sondern schickte vorerst zwei jüdisch-polnische Ehepaare. Meine Mutter sollte ihm das später übelnehmen: „Er wollte, dass die den Weg ausprobieren – wenn es gut gegangen wäre, wäre er nachgekommen.“
Gibt es Schlimmeres als einen Jupo?
Ich kann nicht beurteilen, ob es wirklich so war und kann auch niemanden mehr fragen. Sicher ist nur, dass es nicht gut gegangen ist. Dass meine Mutter Weißbergs Anfrage überhaupt bejahte, lag an einem anderen Zufall. Unter den vielen Juden, die damals eine letzte Chance suchten, Österreich zu verlassen, war mit Heinrich Lieben auch ein schon erwähnter Verwandter Karl Motesiczkys, der durch ihn auch zu einem Freund meiner Eltern geworden war. Dieser Heinrich Lieben hatte, nachdem er zur „Übersiedlung“ aufgefordert worden war, von einem „Jupo“, einem „Judenpolizisten“ namens Klinger Kenntnis erlangt, der bereit sei, Juden gegen eine größere Summe zur Flucht in die noch nicht besetzte Tschechoslowakei zu verhelfen. Es wird nie zu klären sein, ob Klinger Heinrich Lieben seine Hilfe anbot, weil er ihm wirklich helfen wollte, weil er dabei gut verdiente oder weil er durch eine erste gelungene Hilfsaktion Mitglieder von Widerstandsorganisationen in eine Falle locken wollte. Jedenfalls besprach Lieben mit meinen Eltern, dass er ihnen eine Karte aus Prag schreiben würde, wenn er dank Klingers Hilfe tatsächlich dorthin gelangte. Die Karte kam an und es folgte ihr sogar noch ein Telefongespräch. Ob man sich bei Klinger sicher fühlen könne, wollte meine Mutter wissen. „So sicher wie in Abrahams Schoß.“ Aufgrund dieser Information übergaben meine Eltern die beiden jüdischen Ehepaare, die ihnen Alexander Weißberg aus Polen geschickt hatte, an Klinger, der diesmal zusagte, sie über die Grenze in die Schweiz zu bringen. Meine Eltern vereinbarten, sie sollten ihnen von dort auf der Hälfte eines zerrissenen Briefpapiers mitteilen, ob sie gut angekommen seien. Sie erhielten den Brief aus der Schweiz tatsächlich – aber nicht auf der Hälfte des zerrissenen Papiers. Ab diesem Augenblick wussten sie, dass ihnen die Verhaftung drohte. Wenn auch nicht sofort: Die Gestapo wollte beobachten, wer noch zur Widerstandsgruppe gehörte. Klinger, so berichtete ein Überlebender der beiden nach Auschwitz deportierten Ehepaare, hätte sie vor der Grenze der Gestapo übergeben und die hätten sie gezwungen, einen Brief über die erfolgreiche Ankunft zu verfassen – den aber hätten sie bewusst auf dem falschen Briefpapier geschrieben. Bei ihrer Verhaftung und Einlieferung ins Gefängnis der Gestapo am Wiener Morzinplatz hatten meine Eltern und Karl Motesiczky also denkbar schlechte Karten. Meine Mutter versuchte dennoch zu bluffen. Richtig vermutend, dass die Gestapo sie längere Zeit beobachtet hatte, erzählte sie alles, was sie unternommen hatte, exakt so wie es sich zugetragen hatte, unterstellte ihrem Verhalten aber stets harmlose Motive. Ja, jemand aus Polen habe sie gebeten, zwei Ehepaare aufzunehmen, aber sie hätte nicht ahnen können, dass das Juden wären. (Sie hatte das Glück, dass tatsächlich weder ihre Namen noch ihr Aussehen diese Vermutung aufzwang.) Ja, die Paare hätten in die Schweiz wollen und sie hätte sie mit Klinger bekannt gemacht, aber der hätte immer von einem legalen Weg gesprochen. Meine Mutter behauptet, der verhörende Gestapobeamte sei drauf und dran gewesen ihr zu glauben. Ich bezweifle das aus meiner Kenntnis der Polizeiarbeit, die ich als
61
62
Nicht von der Türe weisen
Lokalreporter der Arbeiter-Zeitung und dann des Kurier in hohem Maße gewinnen konnte. Sicher ist, dass der Beamte meinen Vater, wie jeder gewiefte Kriminalist das getan hätte, mit der Behauptung konfrontierte, meine Mutter hätte bereits ein Geständnis abgelegt und dass er besser das gleiche täte. Und sicher ist, dass mein Vater tatsächlich gestand. Sicher ist schließlich, dass der verhörende Beamte meiner Mutter, deren Kaltblütigkeit ihm zweifellos imponiert hatte, vorschlug, in Zukunft als V-Frau für seine Behörde zu arbeiten – dann käme sie frei. Ich glaube allerdings, dass es ihr eher wie den Jupos ergangen wäre – aber sie lehnte sowieso sofort ab. Das sollte ihr Fahrschein nach Auschwitz sein.
9.
Auschwitz
Meine Mutter hat viel und oft mit mir über Auschwitz gesprochen. Sie bestreitet, dass irgendjemand, der nicht dort gewesen ist, es begreifen könne. Ich habe dennoch versucht, etwas von dem Irrsinn, den sie mir näherbringen wollte, in einem Text zusammenzufassen, der in meinem Buch „Auf der Suche nach den verlorenen Werten“ veröffentlicht wurde und den ich hier wiederhole. Denn eine bessere Annäherung an das Erzählte ist mir nie gelungen. (Mit „Ich“ ist in diesem Text immer meine Mutter gemeint). „Die Juden“, sagte Viktor Frankl in der Fernsehdiskussion nach der Ausstrahlung der Serie „Holocaust“, „sind erhobenen Hauptes in die Gaskammern gegangen.“ Frankl war drei Tage in Auschwitz, dann wurde er in das mit Auschwitz nicht vergleichbare Arbeitslager Dürkheim (ein Außenlager des KZ Dachau) überstellt. Ich habe in den zwei Jahren, die ich in Auschwitz war, nur drei Gruppen von Menschen auf ihrem Weg in die Gaskammern erlebt: die naiven, die noch immer meinten, sie gingen in ein Duschbad, die verzweifelten, die vor Angst schrien, und die völlig apathischen, die „Muselmänner“, die nach einigen Monaten KZ zu willenlosen Skeletten heruntergekommen waren. Erhobenen Hauptes zu sterben ist unter anderem eine Frage des Blutzuckerspiegels: Wenn er wegen Unterernährung unter ein gewisses Niveau sinkt, kann man den Kopf nicht mehr heben. Die Vorstellung von Auschwitz als der perfektesten Mordmaschinerie der Weltgeschichte ist Allgemeingut. Aber Auschwitz war gleichzeitig auch eine Orgie des ganz gewöhnlichen Zugrundegehens. Wenn man keine privilegierte Funktion hatte, starb man spätestens nach vier Monaten an Hunger oder Krankheit. Es gab Perioden, in denen mehr Menschen an Fleckfieber starben, als selbst in den Gaskammern ermordet wurden. Fleckfieber wird durch Läuse übertragen. Man kann es als Seuche nur durch Desinfektionsmittel in den Griff bekommen, aber wir wagten nicht, eine Desinfektion zu fordern, weil das Eingeständnis, dass es im Lager Fleckfieber gibt, wahrscheinlich dazu geführt hätte, dass alle Kranken „abgespritzt“ worden wären. Doch schließlich uferte die Epidemie derart aus, dass sogar die Wachmannschaften dadurch dezimiert wurden. Daraufhin hat der SS-Lagerarzt Dr. Josef Mengele das Problem gelöst: Er schickte die Belegschaft eines Blocks vollzählig ins Gas, desinfizierte das Gebäude, desinfizierte dann die Insassen des Nachbarblocks und übersiedelte sie in die leere Baracke. Diese Prozedur reihum, bis alle Blocks desinfiziert waren. So hat Mengele das Fleckfieber besiegt. Mathematisch gesehen hat er einer Vielzahl von Menschen das Leben gerettet. Als ich selbst Fleckfieber hatte, lag neben mir eine jüdische Pflegerin. Als wir, abgefiebert, aus der Bewusstlosigkeit erwachten, sprachen wir leise von unseren dreijährigen Kindern, die in Sicherheit waren. Ein Stück Wurst aus Pferdefleisch wurde ausgeteilt.
64
Auschwitz
„Du musst sie essen“, sagte ich zu der Kameradin, „wenn Du dein Kind draußen wiedersehen willst.“ Sie hielt ihre Wurstscheibe in der Hand, sie führte sie zum Mund, aber sie schaffte es nicht. „Ich kann nicht mehr, leb’ Du weiter“, sagte sie zu mir und hielt mir den Wurstzipfel hin. Ich aß ganz langsam an meiner eigenen Portion, indem ich kleinste Stücke zerbiss und sie zwischen Schneidezähnen und Zungenspitze zerdrückte. Das war der einzige Teil meiner Mundschleimhaut, der noch heil geblieben war. Denn nach dem Fleckfieber ist der Mund mit einer schwarzen Kruste überzogen, unter der, wenn sie beim Kauen abreißt, das blutige Zahnfleisch hervorkommt. Es muss Stunden gedauert haben, bis ich fertig war. Erst dann war ich wieder fähig, mich der jungen Frau neben mir zuzuwenden. Sie war tot. Ihre Hand war noch in meine Richtung ausgestreckt: Ich bog die schon erstarrten Finger auseinander und nahm mir die Wurst. Dann schlief ich tief und fest meiner Genesung entgegen. Auschwitz war nicht nur das Lager des größten Judenmordes der Weltgeschichte, es hat auch mehr Nichtjuden das Leben gekostet als irgendeine andere Mordmaschine. Auch eine halbe Million Roma und Sinti wurde dort vergast. Es starben dort neben Bibelforschern und Kriminellen, neben Franzosen, Ungarn, Tschechen, Holländern und Russen nichtjüdischer Herkunft auch unzählige Deutsche. Als das Frauenlager Auschwitz-Birkenau im August 1942 aufgemacht wurde, bestanden die ersten Transporte aus 1000 slowakischen Jüdinnen und 1000 Deutschen. Im Februar 1943 lebten von den 1000 Deutschen noch 167. Jeder vierte Pole war im Konzentrationslager. Vielleicht macht das einigermaßen begreiflich, warum antideutsche Propaganda in Ostblockstaaten bis zu einem gewissen Grad selbst heute noch Resonanz bei der Bevölkerung hat. Als ich am 20. Februar 1943 in Auschwitz ankam bestand mein Transport aus 34 Frauen: zehn nichtjüdische Deutsche (darunter verstand man damals auch die Österreicherinnen), zehn Jüdinnen und 14 Polinnen und Russinnen. Nach einem Jahr hatte ich Gelegenheit, die Transportliste zu sehen, auf der das weitere Schicksal dieser Frauen vermerkt war. Die zehn Jüdinnen waren alle tot. Von den 14 Slawinnen lebten noch sieben. Von den zehn Deutschen lebte außer mir noch eine – sie war Kapo, Anführerin eines Arbeitskommandos. Üblicherweise war man vier Monate nach der Ankunft in Auschwitz tot. Bei älteren Frauen, bei psychisch oder gar körperlich defekten dauerte es vielfach nur Tage. So kamen eine Zeitlang serienweise Insassinnen von Zuchthäusern zu uns herein. Man sollte meinen, dass sie Auschwitz aus ihrer Gefängniserfahrung eher gewachsen wären. Aber wenn es nicht besonders brutale Sadisten waren, die von der SS in irgendeine Funktion gehievt wurden, dann war das Gegenteil der Fall: von ihren jahrelangen Gefängnisstrafen psychisch zermürbt, starben sie wie die Fliegen. Eine von denen, die gleichfalls sofort starben, war Carola, eine nicht mehr ganz junge, aber gesunde, kräftige Krankenschwester aus Wien. Sie erzählte mir, wie sie ihren jüdischen Freund die ganze Zeit hindurch erhalten hatte, wie sie ihm nach Frankreich
Auschwitz
gefolgt war, um ihn zu heiraten, wie sie dort wegen der Ehe mit ihm verhaftet wurde. Und dann hatte er, der durchkam, sich in die USA in Sicherheit brachte, ihr geschrieben, er habe sie nie geliebt, ihre Heirat sei ein Irrtum, sei in Wahrheit gar keine echte Ehe gewesen. Carola hat diesen Brief nur wenige Wochen überlebt. Durch einen jener unglaublichen Zufälle, die es nur in der Wirklichkeit gibt, habe ich später ihren Mann kennengelernt: Er hat ihr den Brief geschrieben, weil er geglaubt hatte, sie könne damit ihre rassengesetzwidrige Ehe annullieren und ein neues Leben beginnen. Aber auch der, der jung, gesund, randvoll mit Lebenswillen war, hatte nur dann eine Chance des Überlebens, wenn er irgendeine Funktion ergattern konnte. Gesucht waren zum Beispiel Dolmetscherinnen, da ja hier Menschen aus ganz Europa zusammenkamen und die deutsche SS-Elite fast durchwegs keine Fremdsprachen konnte. Wenn etwa der Sanitätsgefreite vor einer Selektion anordnete: „Die Kranken, die schon länger als drei Wochen im Block liegen, alle nackt ausziehen und in der Ecke in einer Reihe aufstellen“, dann übersetzte die Dolmetscherin: „Rasch die Schwachen, für die noch Hoffnung besteht, in den hinteren Betten verstecken, halbwegs Kräftige in die Ecke.“ Mengele begriff, dass man so versuchte, seine Absichten zu durchkreuzen. Er machte es sich einfach, indem er die Selektion durch die Häftlingsärzte durchführen ließ. Jede Ärztin musste eine Liste all ihrer Patientinnen mit voraussichtlicher Dauer des Krankenstandes aufschreiben. Überall dort, wo die Ärztin „mehr als drei Wochen“ geschrieben hatte, ließ er die Nummer für die Vergasung notieren. Schrieb man eine kürzere Frist, so bestand er auf der Entlassung: Frauen, die das Fleckfieber gerade überstanden hatten, überlebten diese Entlassung bestenfalls einen Tag. Die Baracken, in denen wir lebten, waren ehemalige Pferdeställe. Sie hatten keine Fenster. Der Boden war festgestampfter Lehm. Selbst die Kranken im Revier lagen zu viert auf Säcken, die mit Holzwolle gefüllt waren und das mehrere Stockwerke übereinander. Wenn eine Typhuskranke unter sich ließ, wurde der Sack nicht gewechselt. Am Ende jeder Baracke war das ehemalige Kutscherzimmer abgetrennt, das ein Fenster in die Baracke und einen Fußboden besaß. In diesem Zimmer wohnte der Kapo (im Krankenblock: die Ärztinnen). Sie besaßen ein eigenes Bett, Leintücher, ein Handtuch, etwas mehr Suppe aus dem großen Kessel, in dem das Essen ausgetragen wurde, etwas mehr Brot, „organisierte“ Toilettengegenstände. Das alles war ein gewaltiger Vorsprung im Kampf ums Überleben. Wenn eine Blockälteste allzu viel stahl, wurde gemurrt. Wirklich etwas gegen sie zu unternehmen war nicht möglich, aber auch gar nicht sinnvoll. Denn mehr noch als in der Freiheit galt im Lager die weise Erkenntnis: „Die hat schon gestohlen, die nächste muss erst stehlen.“
65
66
Auschwitz
Im Angesicht des Verhungerns ist Stehlen eine absolute Selbstverständlichkeit. Die Vorstellung, dass die SS mit deutscher Gründlichkeit die Ordnung aufrechterhalten hätte, ist grotesk. Wo die Häftlinge aus furchtbarster Not heraus stahlen, stahl die Wachmannschaft aus ungebrochener Habgier. Es gab den sogenannten Effektenblock, den wir „Kanada“ nannten, offenbar weil wir mit diesem Land die Vorstellung unbegrenzten Reichtums verbanden. Dort wurden die abgegebenen Kleider und Wertgegenstände der Häftlinge aufbewahrt. Unter anderem die Juwelen, die viele Juden in Kleidernähten versteckt hatten, weil in ihren Heimatländern das Gerücht ausgesprengt worden war, man könnte sich damit das Leben retten. In Auschwitz wurden die Nähte von eigenen Kommandos aufgetrennt. Diese und andere Arbeiten besorgten Häftlinge, und es war dies die privilegierteste Stellung, die man im Lager innehaben konnte. An jedem Morgen marschierten die sogenannten „Rotkäppchen“ aus dem Lager. (Ein findiger Kapo hatte den Frauen rote Kopftücher verpasst, um sie leichter zusammenhalten zu können.) Vor ihrem Ausmarsch wurden ihre Kleidungsstücke gezählt, und sie durften bei der Rückkehr ins Lager nur genauso viele anhaben. Aber sie gingen hinaus mit dreckigen Fetzen am Leib und kamen zurück in warmen Kostümen und Stiefeln. Und das womöglich jeden Tag von neuem. Sie brachten Goldstücke, Juwelen und Medikamente in der Mundhöhle und tauschten sie bei den Küchenarbeiterinnen in Lebensmittel. Natürlich konnte das alles nur geschehen, weil die Aufseherinnen es nicht verhinderten. Und sie verhinderten es nicht, weil sie aufs heftigste mitstahlen. Eine der Aufseherinnen erzählte mir immer ganz glücklich von dem Schatz, den sie auf diese Weise angehäuft und schon irgendwo vergraben hatte. Eine andere wollte sich vom Gold der ermordeten Juden daheim ihr Häuschen einrichten. Auch der SS-Arzt Dr. Rohde verschmähte es nicht, sich, bevor er in Urlaub ging, einen ordentlichen Schweinslederkoffer „besorgen“ zu lassen. Nicht ohne sich nachher zu bedanken, denn seine Gattin habe sich „sehr darüber gefreut“. Hatte ein rangniedriger SS-Mann keinen direkten Zugang zu diesen Reichtümern, so musste der Arme sogar zu einem Häftling betteln gehen. Dann kam es zu den abenteuerlichsten Dialogen: Ein SS-Mann bat einen Häftling, ihm doch eine Füllfeder mitzubringen. Der Häftling wimmelte ihn ungeduldig ab: „Kommen Sie das nächste Mal, ich hab’ jetzt keine Zeit für Sie.“ Ein SS-Mann konnte mit Recht behaupten, er habe in Auschwitz Häftlinge in modischen Kleidern und Kostümen gesehen. Einer bildhübschen Wienerin zum Beispiel gelang es nur durch ihren Charme, ins „Lagerestablishment“ aufzusteigen. „Der SDG (Sanitätsdienstgrad) hat seinen Kopf in meinen Schoß gelegt, und ich habe ihm die Augenbrauen gezupft“, erzählte sie mir. Wir nannten sie „Hollywood“, weil sie immer so schön und gepflegt aussah. Es gab nicht genug gestreifte Häftlingskleider für die Masse von Frauen. Also mussten, beziehungsweise durften wir Privatkleider tragen. Nicht unsere eigenen, sondern die der
Auschwitz
vergasten Jüdinnen. Um Fluchtversuche zu erschweren, mussten diese Kleider über den ganzen Rücken einen breiten, mit roter Ölfarbe gezogenen Streifen haben. „Hollywood“ löste das, indem sie die Hohlfalte am Rücken ihres blendenden Kamelhaarmantels mit rotem Stoff unterlegte. Es sah aus wie die Kreation eines Modesalons. So ging sie zwischen Leichenbergen durchs Lager. Es gab noch eine Möglichkeit zu überleben, allerdings nicht für Jüdinnen – die Meldung ins Bordell. Irgendwann, ich glaube, es war im Herbst 1943 da wurden junge, passabel aussehende Mädchen mit schwarzem Winkel zusammengerufen. Das waren die sogenannten „Asozialen“ – teils Prostituierte, die sich geweigert hatten, sich in ein Bordell zwängen zu lassen, teils aber ganz einfach nur junge Frauen, die zur Zwangsarbeit eingeteilt worden waren und ihren Arbeitsplatz verlassen hatten. So hatte ich etwa eine Patientin, die einer Uniformschneiderei zugeteilt war, der sie monatlich eine gewisse Zahl von Hosen in Heimarbeit zu liefern hatte. Ihre wohlhabenden Eltern bezahlten einen Schneider, der die Hosen sicher viel ordentlicher für sie nähte, und sie ging Tennis spielen. Irgendjemand denunzierte sie, und so kam sie als sogenannte „Asoziale“ ins KZ. Diesen Mädchen erzählte nun der SS-Lagerführer Hössler, sie könnten auch etwas für die deutsche Kriegsanstrengung tun. Rings um das Lager seien rüstungswichtige Betriebe entstanden (Buna, die Unionwerke usw.), und die Männer dort könnten viel mehr leisten, wenn sie nicht unter „Spannungen“ litten. Also habe man im Block 24 des Männerstammlagers in Auschwitz, einem soliden Ziegelbau, ein Bordell eingerichtet, zu dem sich die Mädchen melden sollten. Die verhinderte Schneiderin zeigte auf und sagte: „Ich dachte, ich soll hier umgeschult werden.“ Man verzichtete auf ihre Dienste, denn es gab genug Freiwillige. Denn das Bordell bedeutete ein geheiztes Zimmer, ein Bett, heiße Duschen, SS-Verpflegung, kurz: Überleben. Wenn je Prostituierte behaupten durften, die Not habe sie zu ihrem Beruf gezwungen, so durften sie es in Auschwitz. Einmal wurde im Block 24 sogar eine Hochzeit gefeiert. Ein Spanienkämpfer von der internationalen Brigade hatte ein Kind zurückgelassen, und die junge Spanierin war mit dem unehelichen Sohn der Schandfleck der Familie. Sie machte sich auf die Reise bis zum Kommandanten von Auschwitz, den sie bat, den Vater ihres Kindes heiraten zu dürfen. Sei es aus Laune, sei es aus Familiensinn, der Kommandant war einverstanden, und die Hochzeit durfte vor der politischen Leitung als Standesbehörde gefeiert werden. Für die Nacht, so hat man mir berichtet, wurde dem Paar ein Zimmer im Bordell zur Verfügung gestellt. Seine Frau durfte dem Häftling ein „Hochzeitsessen“ kochen. Dann kehrte er wieder zurück unter seine Kameraden mit den Hungerödemen.
67
68
Auschwitz
Aber auch außerhalb der Bordelle war hübsch zu sein für eine Frau ein noch größeres Kapital als je in der Freiheit. Es gab nur etwa 50 weibliche SS-Aufseherinnen in Auschwitz aber mehrere tausend SS-Männer. Eine Reihe von Mädchen hatte „Cousins“ unter der Wachmannschaft, von denen sie ständig besucht wurden. Eine Blockälteste, Kommunistin, bekam von einem SS-Mann ein Kind. Zwar versuchte man eine strenge Trennung der Geschlechter durchzuführen, aber das gelang nicht. Manche Arbeiten im Frauenlager wurden von Männerkommandos durchgeführt. Das ermöglichte Kontakte, ja sogar richtiggehende Verhältnisse. Vor allem aber gab es das Leichenkommando: Jede Nacht kam ein Lastwagen und holte die Leichen ab. Während der ärgsten Fleckfieberepidemie im Winter 1943/44 lagen neben meinem sogenannten „polnischen Schonungsblock“ jeden Abend vier Schichten Leichen. Dreißig Meter Blocklänge entlang. Da musste das Auto mehrmals fahren. Der SS-Mann, der es führte, nahm aus Gutmütigkeit oder gegen Bestechung mehr Männer mit, als zum Aufladen nötig waren. Immer ein paar von ihnen konnten sich im Dunkeln mit ihren Partnerinnen treffen. Die anderen warfen inzwischen die steifen Frauenleichen auf den Lastwagen. Dann wechselten sie einander ab. Auch im „Leichenkommando“ zu sein war eine „Funktion“ und eine Chance zum Überleben. Ob man eine solche Funktion erhielt, hing wiederum davon ab, ob eine der schon vorhandenen Funktionärinnen einen protegierte. Am besten vermochten das die Kommunistinnen. Vielfach waren sie bereits von der Illegalität her kampferprobt. Fast durchwegs wussten sie um die Wichtigkeit von Funktionen in einem Gemeinwesen, und untereinander hielten sie eisern zusammen. Obwohl nicht einmal so viel mehr Kommunisten in den Lagern waren als etwa überzeugte Sozialdemokraten oder überzeugte Katholiken, haben sehr viel mehr von ihnen Auschwitz überlebt. Das ist einer der Gründe, warum so viele Kommunisten die internationalen KZ-Organisationen von heute dominieren. Man hat manchen dieser kommunistischen Funktionäre später Vorwürfe gemacht: Als Lagerschreiber hätten sie beispielsweise ihre Genossen von den Todeslisten gestrichen. Und das bedeutete zwangsläufig: Ein anderer rückte zum Sterben nach. Aber es sind eben auch Häftlinge Menschen: Auch für sie ist der konkrete Kamerad, den sie persönlich kennen, näher als die Riesenzahl der anonymen Nummern einer Selektionsliste. Der Druck der wahnwitzigen Verhältnisse hat auf uns allen gelastet. Erst vor kurzem habe ich in Israel eine Frau getroffen, die seinerzeit bei mir Krankenpflegerin war. Natürlich sprachen wir lange über Auschwitz, und sie fragte mich, ob mich der Tod der X auch noch immer belastet. „Welche X?“ fragte ich.
Auschwitz
„Aber“, sagte sie, „ich habe ihr doch damals auf deine Anweisung hin ein Schlafmittel gegeben, damit sie eingeschlafen ist.“ Ich war wie betäubt: „Ja, bist Du denn wahnsinnig, ich habe dir doch keine Anweisung gegeben, jemanden umzubringen.“ „Aber Du hast doch gesagt, dass Du ihr dauerndes Herumschreien nicht mehr hören willst, und dass ich ihr ein Beruhigungsmittel geben soll. Da habe ich gedacht, Du willst, dass sie nicht mehr schreit.“ Ein Urteil über die Pflegerin maße sich an, wer jemals mitangesehen hat, wie tausend Menschen ins Gas geführt werden, weil das die einfachste Möglichkeit ist, eine Baracke zu desinfizieren. Umso phantastischer war es, dass es selbst unter diesen Verhältnissen Ärzte gab, die ein Berufsethos bewiesen, das man heute manchen Kollegen in Freiheit wünschen möchte. So gab es etwa eine ausgezeichnete Ärztin namens Adélaïde Hautval. Sie war wegen Judenbegünstigung ins Lager gekommen und wurde jenem Block 10 zugeteilt, in dem der Gynäkologe Dr. Klauberg, ein buckliger Zwerg, seine Sterilisierungsversuche machte. Hautval weigerte sich – weigerte sich mitten in Auschwitz gegenüber einem SS-Arzt –, derartige Operationen durchzuführen. Man war so verblüfft, dass man den Standortarzt Dr. Wirtz herbeirief, der Hautval denn auch fassungslos anstarrte: „Was heißt, Sie wollen gesunde Menschen nicht operieren? Wissen Sie nicht, dass es zwischen den Menschen Unterschiede gibt – das sind Jüdinnen, die Sie da operieren sollen.“ Hautval sah ihn von oben bis unten an und antwortete vollkommen ruhig: „Doch, auch ich weiß, dass es Unterschiede zwischen den Menschen gibt. Zum Beispiel den zwischen Ihnen und mir.“ Hautval wurde zum Tode verurteilt. Jemand strich ihre Nummer von den Listen. Das allgemeine Chaos ließ sie überleben. Wir im Krankenblock waren alle privilegiert. Meines Wissens wurden Ärzte und Pflegerinnen von Selektionen immer verschont. Trotzdem habe ich in den zwei Jahren Auschwitz ungefähr 35 Kolleginnen „zu Grabe getragen“. Das Fleckfieber habe auch ich nur überlebt, weil mir ein weiterer Zufall zu Hilfe kam: Der SS-Arzt Dr. Rohde war mein Studienkollege in Marburg an der Lahn gewesen. So brachte er mir lebensrettende herzstärkende Medikamente und sorgte dafür, dass ich für einige Monate in das Nebenlager Babice kam – ein landwirtschaftlicher Betrieb, in dem ich mich einigermaßen erholen konnte. Rohde sah in der Endlösung eine „kriegerische Maßnahme“, aber es irritierte ihn irgendwie, gegen Frauen Krieg zu führen. Wir Frauen waren froh, ihn zu haben. Für mich war er ein besonderer Glücksfall. „Mein Gott, wann werden wir zwei wieder einmal in Pfeifers Weinstube in Marburg an der Lahn sitzen?“ fragte er mich einmal. Er hielt es ernsthaft für möglich, dass wir wieder miteinander an einem Tisch sitzen könnten, so wie wir jetzt unter den rauchenden Kaminen saßen.
69
70
Auschwitz
Im Männerlager soll derselbe Rohde gewütet haben. Er wurde nach dem Natzweiler Prozess gehängt. Dieses Phänomen, dass ein Häftling einen SS-Mann als seinen Retter erlebt, während der andere ihn als Bestie beschreibt, ist sehr häufig und hat nach dem Krieg viel zur allgemeinen Verwirrung beigetragen. Für mich beispielsweise war einer der schlimmsten Leute der SS-Arzt Dr. Klein. Als ich ihn einmal angesichts der rauchenden Kamine fragte: „Wie können Sie das, was hier geschieht, mit Ihrem Eid des Hippokrates vereinbaren?“, antwortete er mir: „Wegen dem Eid des Hippokrates schneide ich den eitrigen Blinddarm eines Kranken heraus. Die Juden sind der eitrige Blinddarm am Körper Europas.“ Und dann las ich in dem Buch einer rumänischen Jüdin, dass diese Frau in Auschwitz einen einzigen brauchbaren Menschen kennengelernt hätte: den SS-Arzt Dr. Klein. Sie stammte aus seiner Heimatstadt, Klausenburg, und war die Frau eines seiner Kollegen. Indessen waren auch Klein, Rohde oder gar Mengele nicht typisch für die SS in Auschwitz. Viel eher war es ein kleiner SS-Mann, den ich anlässlich einer Feuersbrunst zu Beginn meiner Haft kennenlernte. Es war damals im alten Effektenblock, der sich noch innerhalb des Lagers befand, ein riesiges Feuer ausgebrochen, das nur mit Mühe gelöscht werden konnte. Ich fragte den SS-Mann, der die Brandruine bewachte, was mit uns geschehen wäre, wenn das ganze Lager niedergebrannt wäre. Er antwortete mit freundlicher Ehrlichkeit: „Wir hätten euch alle abgeknallt, und dann hätten wir endlich heimgehen können.“ Dieser Volksdeutsche aus der Ukraine hatte kaum feindliche Gefühle gegen uns. Hätte man uns alle heimgeschickt, er wäre durchaus einverstanden gewesen. Der KZ-Dienst machte ihn nicht glücklich. Tag und Nacht musste er stundenlang auf den damals noch offenen Wachttürmen stehen. Er muss sich über die Abwechslung gefreut haben, wenn sich jemand dem elektrischen Draht genähert hat und daher laut Befehl abzuknallen war. Eine der schlimmsten Nazi-Megären, die Oberaufseherin Mandl, schützte durch Monate das Leben der Musikerin Alma Rose vom berühmten Rose-Quartett. Mandl, blond, blauäugig, rosig, liebte klassische Musik. Wenn die Jüdin Rose trotz bevorzugter Behandlung – sogar ein Zimmer mit Fußboden stand der Kapelle zur Verfügung. Wenn Rose verzweifelt zu den Krematorien schaute pflegte die Mandl sie zu trösten: „Ich verspreche dir, Du kommst bestimmt als allerletzte ins Gas.“ Alma Rose starb an einer Lebensmittelvergiftung. Eine Freundin aus der Effektenkammer hatte die verdorbene Konserve organisiert, und obwohl die Mandl uns Ärzten dekretierte: „Die Rose darf nicht sterben“, war sie doch nicht zu retten. Dieselbe Mandl peitschte wie wahnsinnig auf Jüdinnen los, die versuchten, aus einem Block zu laufen, in dem Feuer ausgebrochen war. Mir fiel dabei ein erstaunlicher Zug in ihrem derben Gesicht auf – Angst. Jeder Zwischenfall, alles, was die Ordnung der Fünferreihen durcheinander brachte, versetzte auch die Wachmannschaft in Schrecken.
Auschwitz
Anscheinend erwartete sie mehr oder minder bewusst den Zusammenbruch ihrer Ordnung, in der so wenige über so viele herrschten. Wieso es dennoch nie zu dieser Revolte kam? Auch das Loslaufen, das Stürmen eines Lagertores bedarf eines gewissen Blutzuckerspiegels. Vor allem aber geben die Menschen auch noch im Angesicht der Gaskammer nie die Hoffnung auf, dass sie zu den wenigen Überlebenden gehören könnten. Ein Aufstand hätte bedeutet, dass die ersten paar hundert, paar tausend, von den Maschinengewehren auf den Wachttürmen niedergemetzelt worden wären. Und selbst angesichts des Mordens um uns waren wir immer noch ganz gewöhnliche Menschen, keine Selbstmörder. Auch die Mandl war ein ganz gewöhnlicher Mensch. Man konnte sich zu einer Vorsprache bei ihr melden, zum Beispiel wie ich es ein paarmal tat, um die Erlaubnis zu erbitten, meinem kleinen Buben, der noch nicht lesen konnte, einen illustrierten Sonderbrief schreiben zu dürfen. Mandl erlaubte es regelmäßig. Einmal drückte sie mir sogar gerührt einen Gutschein in die Hand. Es war eine Anweisung auf ein „Totenpaket“, eines der Pakete, die nichtjüdischen Häftlingen einmal im Monat geschickt werden durften, im besonderen Fall aber den Adressaten nicht mehr erreichte. Als ich es mir holte, sah ich, für wen es bestimmt gewesen war: für eine der Patientinnen, die am Leben zu erhalten ich nicht imstande gewesen war. Ein anderes Mal erlebte ich die Mandl, wie sie ein paar jüdische Mütter mit kleinen Kindern (die durch einen Zufall nicht direkt von der Rampe in die Krematorien gekommen waren) zu sich rief. Während die Frauen zitternd draußen standen, bat sie die Kinder in ihr Zimmer und schenkte jedem eine Rippe Schokolade. Am nächsten Tag kam die Mandl mit dem Lagerarzt zur Selektion in unser Krankenrevier und schickte dieselben Mütter mit ihren Kindern ins Gas. Ich sollte noch einmal von Mandl hören. Eine meiner Kameradinnen, eine Polin aus der Schreibstube, die das Lager überlebt hatte, wurde nach dem Krieg in Krakau von den Kommunisten zum Tode verurteilt: So wie sie gegen die deutschen Besatzer aufgemuckt hatte, hatte sie sich auch gegen die kommunistischen Unterdrücker gewehrt. Das Urteil für die Frau, die drei Jahre Auschwitz überlebt hatte, lautete auf den Tod durch den Strang. Am Tag bevor die Hinrichtung durchgeführt werden sollte, wurde sie noch einmal in ein Duschbad geführt. Auch die neuen Machthaber sahen auf Ordnung, niemand sollte unsauber ins Jenseits befördert werden. Zugleich mit ihr wurde eine andere Todeskandidatin ins Bad geführt – die Oberaufseherin Mandl. Sie war im großen Auschwitz-Prozess in Krakau ebenfalls zum Tode verurteilt worden. Mandl erkannte den ehemaligen Häftling, und es kam zu folgendem Gespräch: „Darf ich mit Ihnen sprechen?“ „Ja, was wollen Sie von mir?“
71
72
Auschwitz
„Ich werde morgen sterben, und ich bin froh darüber. Ich bin mir in diesen letzten Wochen bewusst geworden, an welchen Verbrechen ich mitgewirkt habe, und mit dieser Last will ich nicht weiterleben. Ich möchte Sie nur etwas fragen: Können Sie mir verzeihen?“ Meine Kameradin – sie wurde tags darauf zu zehn Jahren Zuchthaus begnadigt – erzählte mir, was damals in ihr vorgegangen ist: „Ich habe mir gedacht, da sind wir, zwei nackte Weiber, und morgen werden wir beide tot sein. Was soll man da sagen? Also habe ich gesagt: Ja, ich verzeihe Ihnen.“
10. Das Wehrmachtsgericht
Während meine Mutter mehr als zwei Jahre in dieser Hölle lebte, hatte mein Vater, daran gemessen, wahnsinniges Glück. Wie alle fronttauglichen Männer war er bei seiner Verhaftung Mitglied der deutschen Wehrmacht und bekleidete dort aufgrund seines Medizinstudiums einen Offiziersrang. Jedenfalls erschien sein Kompaniekommandant bei der Gestapo und erklärte dort – juridisch zu Recht, nur dass kein anderer es getan hätte –, dass Kurt Lingens ausschließlich ihm unterstünde und dass er ihn dem allein zuständigen Wehrmachtsgericht überantworten würde. Die Gestapo konnte nicht verhindern, dass er meinen Vater sofort mitnahm. Das Wehrmachtsgericht bestand einmal mehr aus Männern, die keine willigen Vollstrecker waren. Klug nannte der Ankläger Judenbegünstigung zwar ein „schweres Delikt“, sah den Tatbestand aber nicht als restlos erwiesen an. Vor allem aber gab er zu bedenken, dass ein Mediziner wie Kurt Lingens in der aktuellen militärischen Lage dringend gebraucht würde, um den Sieg Deutschlands sicherzustellen. Das sei bei der Strafe abwägend zu berücksichtigen. Die Militärrichter wogen wie er: Sie verurteilten meinen Vater zu drei Wochen Arrest und Verlust seines militärischen Ranges. Die Gestapo war über dieses Urteil so wütend, dass sie alles in Bewegung setzte, um zu erreichen, dass Kurt Lingens wenigstens zu einer sogenannten „Bewährungskompanie“ versetzt wurde, die man im Volksmund nur „Strafkompanie“ nannte: Zu ihren Aufgaben zählte das Räumen von Minen oder das Verlegen von Telefonkabeln an der russischen Front. Nach den Angaben meines Vaters hat keiner seiner Kameraden diese Tätigkeit überlebt, und er selbst überlebte sie einmal mehr nur durch unglaubliches Glück: Er erlitt einen Schuss in die Lunge, dessen Projektil man im Feldlazarett nicht zu entfernen vermochte, so dass er mit einem der letzten Züge, die Russland noch verlassen konnten, heim nach Wien transportiert wurde. Hier gelang die lebensrettende Operation. Während der dennoch langwierigen Genesung betreute ihn eine hübsche, junge Malerin namens Eduarda Massiczek, die als freiwillige Krankenschwester Dienst tat. Nach seiner Entlassung zog sie zu ihm in seine Wohnung in der Doblhoffgasse. Von zwei Bekannten meines Vaters, die ich nach dem Krieg zufällig kennenlernte, erfuhr ich, dass sie mit den beiden viele nette, feuchtfröhliche Abende verbracht hätten. Mein Vater hätte geglaubt, dass meine Mutter in Auschwitz umgekommen sei. So stellte er es auch mir gegenüber dar. Er habe, so sagt er mir, auf zwei Briefe, die er ihr ins Lager schickte, anders als stets zuvor, keine Antwort erhalten und sich das durch ihren Tod erklärt. In Wirklichkeit lag es daran, dass meine Mutter ins KZ Dachau verlegt worden war, weil man dort zur Betreuung von Zwangsarbeitern dringend eine
74
Das Wehrmachtsgericht
Ärztin brauchte, die Deutsch und Polnisch konnte. Deshalb hat sie die Briefe meines Vaters nie erhalten und konnte ihm auch keine Antwort darauf geben. Ich glaubte meinem Vater seine Erklärung für sein Verhalten nur zu gerne, aber es fällt mir schwer. Vor allem angesichts dessen, was meine Mutter erlebte, als sie ihn, aus Auschwitz zurückgekehrt, erstmals wiedersehen wollte: Sie läutete an der Tür zu seiner Wohnung in der Doblhoffgasse und obwohl er sie durch das Guckloch sah, öffnete er ihr nicht. Meine Mutter hatte Auschwitz in der Hoffnung auf dieses Wiedersehen überlebt. Sie hatte sich in Dachau an diese Hoffnung geklammert, als sie beinahe noch zum Tode verurteilt worden wäre: Eine polnische Zwangsarbeiterin hatte spontan die Arbeit niedergelegt und ihre Kameradinnen waren ihr spontan gefolgt; das Lagerkommando hatte darin einen organisierten Streik gesehen und die Häftlinge aufgefordert, die Verantwortliche zu nennen, wenn sie nicht alle aufs Schwerste bestraft werden wollten; sie meldeten meine Mutter, weil sie die einzige Deutsche war und weil sie dachten, das würde sie vor einem Todesurteil schützen. Es schützte sie nicht, aber eine SS-Frau, der sie medizinisch geholfen hatte, sorgte dafür, dass die Vollstreckung des Urteils immer weiter hinausgeschoben wurde und schließlich machte der Vormarsch der Amerikaner sie obsolet – die SS setzte sich schleunigst ab. Meine Mutter war dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen und frei. Sie wollte nur noch mich und meinen Vater in die Arme schließen. Als sie mich 1945 in die Arme schloss, war sie mir fremd – doch ich verbarg es. Als mein Vater ihr die Tür nicht öffnete, brach sie erstmals in diesen gespenstischen Jahren zusammen. Sie hat sich nie mehr davon erholt.
11. Der gebührende Platz für eine Hitlerbüste
Ich habe keinerlei Erinnerung mehr daran, was in mir vorging, als meine Eltern im Oktober 1942 plötzlich verschwunden waren. Selbst die vorangegangenen Erinnerungsbilder, die meine Mutter zeigen, sind ja höchst spärlich. Mein Vater taucht gar nicht darin auf. Das heißt nicht, dass er sich nicht um mich gekümmert hätte – meine Mutter behauptet, er sei ein besonders zärtlicher Vater gewesen und es gibt ein Foto, auf dem wir gemeinsam aus einem Fenster schauen, das etwas von dieser Zärtlichkeit vermittelt – in Erinnerung ist sie mir nicht. Auch nicht die Zärtlichkeit meiner Mutter – nur ihr schemenhaftes Bild am Rand des Schwimmbades und beim Robben über den Jogltisch. Die Theorien Sigmund Freuds, so gestand sie mir, hätten sie immer von allzu zärtlichen Liebkosungen abgehalten. Vielleicht war das gut – so sind sie mir in allen Jahren meiner Kindheit nicht abgegangen. Sie selbst fehlte mir sehr wohl: Ich habe ständig nach ihr gefragt und man hat mir gesagt, sie sei sehr krank und läge im Spital. Diese Antwort erhielt ich von einer Frau, deren Bild für drei Jahre relativ deutlich an die Stelle des schemenhaften Bildes meiner Mutter trat: Eleonore Blaschke, genannt „Nolle“ war von Beruf „Gouvernante“, angeblich zuvor bei der Familie des Burgschauspielers Fred Liewehr. Ich glaube, dass meine Eltern sie schon in der Endphase ihres Studiums für mich engagierten – vielleicht aber tat es auch erst mein Vater, als ihm klar wurde, dass er sich ohne meine Mutter um mich kümmern musste. Wie Nolle aussah, weiß ich am ehesten von einem viel späteren Besuch an ihrem Sterbebett. Jahre nach Kriegsende hatten wir erfahren, dass sie an Krebs erkrankt war, und ich hatte sie mit meiner Mutter aufgesucht: Eine, im Gegensatz zu ihr sehr kleine, unglaublich magere, dunkelhaarige Frau mit einem knorrigen, vom Tod gezeichneten Gesicht, in dem warme, braune Augen sich jetzt doppelt deutlich von der welken, weißen Haut abhoben. Ich wurde angehalten, sie auf die Wange zu küssen und tat es gern. Frühere Bilder sind vage und haben einmal mehr mit Krankheit zu tun. Irgendwann während unseres Zusammenseins war Nolle an Diphterie erkrankt: Ich erinnere mich an ihre kleine, damals freilich viel festere Gestalt in einem dicken grünen Wollkostüm, mit dem sie bei ziemlicher Kälte zu einem Rettungswagen geführt wurde und an die Angst, die ich hatte, dass auch sie nicht zurückkommen könnte. Dieses Bild stammt nicht aus Wien, sondern aus Birnbaum im Kärntner Lesachtal. Ich habe die Ortschaft, in der ich drei Jahre verbrachte, nach dem Krieg wieder aufgesucht. Man erreicht sie über eine Straße mit abenteuerlichen Kurven, über die es gefühlte hundert Meter in die Schlucht der Lesach hinunter geht. Noch zu meiner Zeit hat der Absturz eines Postautobusses dort mehrere Tote gefordert. Auch sonst ist das Tal düster.
76
Der gebührende Platz für eine Hitlerbüste
In der Zeit Maria Theresias wurden Sträflinge hierher verbannt, um in den dichten, dunklen Wäldern Holzfäller-Arbeit zu verrichten. Sie gelten als die Urbevölkerung der Gegend. Bei Birnbaum freilich lichtet sich das Dunkel und weitet sich das Tal zu prachtvollen Almen, die heute ihrer Schönheit wegen einen relativ erfolgreichen Sommer- und Wintertourismus ausgelöst haben. Den winzigen Ort als solchen habe ich nicht in Erinnerung. Wohl aber erstaunlich deutlich dessen damals einziges Gasthaus, das nach seiner Wirtin nur „Gasthaus Strieder“ genannt wurde. Es ist das in meiner Erinnerung einzige große Gebäude – breitbeinig in der Landschaft stehend und mit einem hohen Giebel über mindestens einem Stockwerk. Aus dem Giebelfenster – das ist das Eindrucksvollste in meiner Erinnerung – flatterte an einer Fahnenstange eine riesige Hakenkreuzfahne, die fast bis zum untersten Geschoß reichte und anzeigte, woher der Wind wehte. Der Vorraum des Gasthauses unterstrich diese völkische Begeisterung durch eine bronzene Hitler-Büste, die samt Blumenstrauß auf einer bemalten Truhe prangte. Die Büste ist mir deshalb so präzise in Erinnerung, weil man sie ständig passierte, wenn man über die Treppe ins erste Stockwerk stieg, in dem sich meiner Erinnerung nach das Zimmer befand, das ich mit Nolle teilte. Vor allem aber, weil ich sie zu Kriegsende selbst in Händen gehalten habe. Da wurde die Hakenkreuzfahne nämlich eingeholt und die Büste am Dachboden verstaut. Dort entdeckte ich sie mit Spielkameraden und stellte sie, angesichts der in meinen Augen unwürdigen Unterbringung, schleunigst auf ihren angestammten Platz zurück. Nur dass Frau Strieder, statt mich dafür zu loben, mit mir schimpfte und mir auftrug, sie sofort auf den Dachboden zurückzubringen. Abseits der Fahne und der Büste habe ich auch Frau Strieder in relativ klarer, besonders herzlicher Erinnerung: Trotz ihrer vielen Arbeit fand sie immer wieder Zeit, mir über den Kopf zu streichen, mir irgendetwas Freundliches zu sagen oder mich sogar zu trösten: Nicht nur Nolle, auch meine Mutter würde sicher wieder aus dem Krankenhaus zu mir zurückkommen – ich müsse nur Geduld haben. Ich weiß nicht, ob die Gastwirtin über den wahren Aufenthalt meiner Mutter Bescheid wusste – eher glaube ich, dass es nicht so war, weil Nolle es ihr schwerlich erzählt hat – aber ich halte für möglich, dass sie auch nett zu mir gewesen wäre, wenn sie es gewusst hätte, denn in meiner Erinnerung war sie eine herzensgute Frau. Außerdem hatte sie eine hinreißende Tochter namens Hannelore, die etwa so alt wie ich gewesen ist. Ich erinnere mich genau, dass wir immer wieder gemeinsam auf blühenden Wiesen, einmal auch am Rande eines kleinen Bächleins saßen und an Blumenblättern zupften. Vielleicht sogar mit den Worten: „Sie liebt mich – sie liebt mich nicht.“ Denn ich war nicht mehr ganz unschuldig: Mit Ute, der Tochter eines deutschen Ehepaares, die ein paar Jahre älter als ich war, war ich unter einer Bank des Gastzimmers gelegen und wir hatten einander zwischen die Beine gegriffen und das sehr schön und entschieden verboten gefunden. Aber Ute liebte ich nicht – nur Hannelore. Jedenfalls habe ich meiner Mutter, als wir nach dem Krieg Birnbaum verließen, um ins
Der gebührende Platz für eine Hitlerbüste
nahe Kötschach zu ziehen, aufgetragen, eine Postkarte mit den Worten „Hannelore, ich liebe Dich“ an sie abzuschicken. Aber sie hat das offenkundig nicht getan. Denn als ich 2016 an einer Kärntner Schule ein Referat hielt, wollten mir Freunde eine freudige Überraschung bereiten und hatten Hannelore dorthin eingeladen – da musste ich zu meiner Enttäuschung erfahren, dass sie nicht die geringste Erinnerung an mich hatte. Sonst sind mir aus den drei Jahren in Birnbaum nur noch drei Vorfälle in Erinnerung. Einmal ist ein Aluminiumbehälter vom Himmel gefallen, der aber keine Bombe, sondern nur ein leerer Reservebehälter für Benzin gewesen ist. Trotzdem versetzte er die Menschen in Aufregung, denn man wusste, dass anderswo in Österreich bereits Bomben fielen. Und einmal kreuzte – für mich viel aufregender – eine Gruppe von Hitlerjungen auf. Ich sehe sie bis heute in ihren Uniformen auf dem Balken eines Zaunes vor dem Gasthaus sitzen. Wie der SS-Mann im Auto, der mir seinen Revolver zeigte, zeigen sie mir ihre Bajonette und ich war maßlos beeindruckt, denn ich selbst habe nur einen lächerlichen, ausgerechnet rosafarbenen Hosenanzug an und besitze nur einen Taschenfeitl, weil Nolle alles andere viel zu gefährlich findet. „Heil Hitler“, danke ich ihnen für ihre Bereitschaft, sich mit mir als Vierjährigem überhaupt abzugeben und hätte alles dafür gegeben, einmal zu ihnen zu gehören. Deshalb habe ich es zeitlebens als lächerlich empfunden, jemandem seine HJVergangenheit vorzuwerfen. Die dritte Erinnerung betrifft einen Besuch meines Vaters und ich sehe nicht sein Gesicht, sondern nur seine Uniform vor mir. Er ist nicht allein, sondern mit einer blonden Frau gekommen, die eine Überraschung für mich vorbereitet hat. Gemeinsam führen sie mich zu einem Holzsteg, der einen Graben, vielleicht auch ein zu diesem Zeitpunkt nur schmales Rinnsal überbrückt. Jedenfalls kann man unter dem Steg stehen und seine Unterseite sehen. An ihr hat die Feuchtigkeit zahllose Schwämme wuchern lassen, die mir mit fröhlichen, bunt bemalten Gesichtern entgegenblicken. „Gefallen sie Dir?“ frägt mein Vater erwartungsvoll. „Nein“, sage ich, obwohl es, was die Schwämme betrifft, die Unwahrheit war. So endet meine erste Begegnung mit seiner zweiten Frau.
77
12. Heimkehr
Alles andere aus zweieinhalb Jahren Birnbaum ist weg. Meine Mutter behauptet, sie hätte mich als Fünfeinhalbjährigen bei ihrer Rückkehr kaum reifer vorgefunden, als sie mich als Zweieinhalbjährigen verlassen hat – ich hätte ähnlich wie Oskar in der „Blechtrommel“, meine Entwicklung eingestellt. Ich sehe das angesichts Utes und Hannelores nicht ganz so drastisch, aber der Mangel an Erinnerung an diese Zeit verblüfft auch mich. Nur aus der späteren Erzählung Nolles weiß ich, dass ich viel geweint habe. Dass ich anfangs jeden Abend gefragt habe, wann meine Mutter denn zurückkomme. Dass ich vor dem Einschlafen gebetet habe, dass sie wieder gesund würde. Denn Nolle, die eine fromme Frau war, hat mich zu beten gelehrt und ist am Sonntag auch mit mir in eine Kapelle gegangen. Als sie Diphtherie hatte, habe ich, so sagte ihr Frau Strieder, auch für Nolle gebetet. Doch nichts davon ist mir im Gedächtnis geblieben. Birnbaum erscheint darin erst wieder mit dem Tag auf, an dem meine Mutter zurückgekommen ist. Offenbar wussten wir schon, dass sie kommen würde – die englische Militärpolizei könnte uns voraus verständigt haben – denn wir haben vor dem Gasthaus gewartet. Auch andere Leute sind vor das Gasthaus getreten, denn es kam ein Fahrzeug, das alle sehen wollten: Ein Jeep. Wo meine Mutter darin gesessen ist, weiß ich nicht mehr – wohl aber, wie sie aussah, als sie ausgestiegen ist. Mir fiel auf, dass sie riesige, gefährliche, schwarze Stiefel trug. SSStiefel, wie sie mir später erklärte. Dazu ein strenges, kantiges, schwarzes Kostüm, von dem sie mir später sagte, dass Kameradinnen es aus dem zurückgelassenen, schwarzen Stoff der Totenkopf-SS geschneidert hätten, weil sie jetzt doch in ein kaltes Gebirgsdorf fahre. Am einprägsamsten aber war zweifellos das weiße Haar, das den Kopf meiner Mutter streng nach hinten gekämmt wie Eis bedeckte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich auf meine heimgekehrte Mutter zugelaufen bin – auch nicht daran, dass sie auf mich zugelaufen wäre und mich in den Arm genommen hätte. Am ehesten hat Nolle mich zu ihr hingeführt und zu ihr hochgehoben. Die fremde Frau machte mir Angst. Die erste Nacht mit ihr ist mir in erstaunlich genauer – unangenehmerer – Erinnerung: Meine Mutter hatte sich ausgekleidet und stand nackt in einem auf dem Boden stehenden Metall-Lavoir, um sich zu waschen. Ich hatte Nolle noch nie so gesehen, konnte den Blick einerseits nicht abwenden, fand andererseits, was ich sah höchst unappetitlich. Noch irritierter war ich, als die fremde, weißhaarige Frau zu mir ins Bett stieg. Gott sei Dank war es ein sehr breites Bett, so dass ich weit weg von ihr, ganz nach außen rücken konnte. Es sollte noch viele Tage dauern, bis ich mich an sie schmiegte.
Heimkehr
Ich musste sie erst wiedererkennen – nicht zufällig steht „erkennen“ in der Bibel für „lieben“. Was mir schwer fiel, fiel Nolle noch viel schwerer: Sie hatte zunehmend ihr Kind in mir gesehen – von dem sie sich nun wieder trennen musste, obwohl sie Gouvernante geworden war, weil sie Kinder so gernhatte und selbst keine bekommen konnte. Aber es blieb uns nicht viel Zeit, um gemeinsam Wunden zu lecken. Sie musste Geld verdienen, um zu überleben und reiste zurück ins ferne Wien. Meine Mutter musste Geld verdienen, um zu überleben und das verschlug uns nach Kötschach-Mauthen im nahen Gailtal. Denn oberhalb dieser Ortschaft, die heute unter anderem auch vom Fremdenverkehr lebt und am ehesten als Geburtsort des ÖVP-Alleinregenten Josef Klaus bekannt ist, befindet sich im viel kleineren Ort Laas eine Heilanstalt, die damals eine große Zahl Lungenkranker beherbergte. (Die Ausrottung dieser schlimmsten Volksseuche gelang erst viel später durch die TBC-Impfung und das Penicillin). Die englische Besatzungsmacht hatte durchgesetzt, dass meine Mutter dort sofort als Ärztin beschäftigt wurde, obwohl ihr zum Medizin-Doktorat aufgrund ihrer Verhaftung noch die beiden letzten Prüfungen fehlten. Gegen den Widerstand der Behörden machten die Briten geltend, dass Ella Lingens Erfahrung mit Seuchen habe. Das einzige Problem dieses unerwartet raschen Arbeitsplatzes bestand darin, dass in einer Lungenheilanstalt wegen der hohen Ansteckungsgefahr der TBC keine Kinder wohnen durften. Ich konnte auch nach drei Jahren Trennung unmöglich bei meiner Mutter sein. Und da es das Gasthaus Strieder und Nolle nicht mehr gab, musste ein anderer Platz für mich gefunden werden. Dabei kam uns ein unglaublicher Zufall zur Hilfe: Betty, das mutige Kindermädchen meiner Eltern, mit dessen Pass eine der versteckten Jüdinnen sich einer lebensrettenden Operation unterzogen hatte, stammte aus Kötschach. Ihre Mutter wohnte am Ausgang des Ortes an der Straße nach Birnbaum. Eigentlich müsste man schreiben: Sie hauste in einer „Keusche“ im Überschwemmungsgebiet der Gail, wo der Boden wegen der Überschwemmungen besonders billig war. Das wurde mein neues zu Hause. „Keusche“ steht für ein Mittelding aus Hütte und Haus. Eine Küche von vielleicht zwölf Quadratmetern wurde als gleichzeitiger Wohnraum von zwei winzigen Kabinetten gesäumt – an eines davon grenzte der ebenso winzige Stall. Über allen diesen Räumen, die gemeinsam vielleicht 40 m2 umfassten und ca. 2,20 m hoch waren, lag ein Satteldach, unter dem, wie in einer Scheune, Heu gespeichert werden konnte. Außerdem ragte es noch etwa zwei Meter über die Front hinaus, so dass dort eine Art zweiter Scheune für gestapeltes Holz und einen Hackstock entstand. Wenn ich Angstträume hatte, dann handelten sie von diesem Hackstock: Man würde mich zwingen, den Arm darauf zu legen und jemand würde ihn abhacken. Ich schlief allein in dem einen der beiden Kabinette in einem Bett, das groß genug war, auch meine Mutter aufzunehmen, wenn sie mich am Wochenende besuchte. In dem
79
80
Heimkehr
anderen Kabinett schlief Ursula Dekan mit ihrem Enkel Walter, dem außerehelichen Sohn einer Schwester Bettys. Ein Bad gab es nicht – man wusch sich in der Küche in einem Blech-Lavoir. Das Plumpsklo war ein Bretterhäuschen in etwa zehn Meter Entfernung vom Stall an der Seite eines kleinen Baches, der zur Gail floss und gelegentlich über die Ufer trat. Meist aber war er ein Rinnsal, in dem man köstlich spielen konnte. Im Stall gab es abwechselnd ein Schwein oder eine Ziege. An der Hinterseite des Gebäudes, die der Straße nach Birnbaum zugewendet war, gab es einen winzigen Gemüsegarten, in dem auch Erdbeeren und prachtvolle Fuchsien wuchsen. An die Vorderseite, die der Gail zugewendet war, schloss sich ein Feld, auf dem Kartoffeln angebaut wurden und Mais wuchs. Ich habe Kartoffeln gesetzt und ausgegraben und konnte – was ziemlich schwer ist, weil sie nie stillhält – eine Ziege melken. Mit Walter habe ich das Heu für sie unterm Dach verstaut und möglichst flach getreten. Meine wesentliche Mahlzeit war Polenta (Maissterz): morgens Polenta mit Kaffee, mittags Polenta mit Speck, abends Polenta mit Milch. Als Jugendlicher wollte ich eine Zeitlang absolut keine Polenta essen – doch heute liebe ich sie wieder. Hungrig waren Walter und ich immer. Aber nicht, weil wir zu wenig zu essen, sondern weil wir zu viel zu spielen hatten. Wenn wir über das Maisfeld hinausliefen, kamen wir ans Ufer der Gail, wo wir im Wasser pritscheln oder Wehre bauen konnten. Wenn wir schräg nach rechts liefen, kamen wir in einen kleinen Wald, in dem wir mit den Kindern aus der „Siedlung“ über der Straße Verstecken spielten. Zu spielen hatten wir also ständig und die in dieser Gegend übliche „Kinderarbeit“ – Heu einbringen, Kartoffeln klauben, die Ziege hüten – empfanden wir als Höhepunkte. Ich habe deshalb bis heute gewisse Schwierigkeiten, Kinderarbeit in Entwicklungsländern zwingend als unmenschlich anzuprangern, sofern sie nicht den ganzen Tag in Anspruch nimmt. In den 1990er Jahren habe ich unsere Keusche mit meinem jüngsten Sohn Eric noch einmal angeschaut, um ihm zu zeigen, wo man auch vergnügt aufwachsen kann. Heute existiert sie nicht mehr, denn ein Ehepaar, das davor ein größeres Haus gebaut hat, hat sie abgerissen. Eigentlich schade, denn sie hätte sich als Museum geeignet: So lebt man als „Keuschlerin“, wenn man nicht entfernt eine Bäuerin ist, sondern wie Bettys Mutter, die Witwe eines Eisenbahners. Denn Bettys Mutter war das Wichtigste, Besondere an diesem meinem dritten Zuhause: Ursula Dekan, „die Dekanin“ wie sie nur genannt wurde, zähle ich, wie Victor Weisskopf zu meinen Säulenheiligen – nur dass sie im Gegensatz zu ihm tatsächlich zutiefst fromm war. Ich weiß nicht, was sie zur Witwe gemacht hat, aber sie war nie verbittert – immer nur dankbar, dass der Herr ihr zwei Töchter, einen Sohn Toni, den Enkel Walter und nun auch mich geschenkt hatte.
Heimkehr
Dabei war Toni eher barsch, fast ein wenig cholerisch, gründete immer wieder kleine Unternehmen, mit denen er trotz seines Fleißes und seiner Intelligenz keinen wirklichen Erfolg hatte und war darüber wütend. Die Wut, mit der er dann am Hackstock etwas Holz für seine Mutter schlug, ehe er wieder abreiste, war ein Teil dessen, was mich in meinen Angsträumen verfolgte. Auch mit ihrer zweiten Tochter ging nicht alles gut – mit Walter hatte sie wie so viele Kärntnerinnen einen unehelichen Sohn in die Welt gesetzt, der nun mit mir bei seiner Großmutter aufwuchs. Nur Betty hatte ihr niemals Sorgen und nichts als Freude bereitet. War immer eine besonders gute Schülerin und besonders hübsch gewesen. Hatte ihr aus Wien – genauer aus der Hinterbrühl – immer etwas nach Hause geschickt und ihr bei Urlauben erzählt, dass sie bei einer „guten Familie“ in Anstellung sei. Nichts machte die Dekanin glücklicher, als dass der Herr ihr nun die Möglichkeit gab, sich zu revanchieren. Sie hätte mich auch in ihr winziges Haus aufgenommen und verköstigt, wenn meine Mutter keinen Groschen dazu beigetragen hätte. Wie sollte sie mir nicht helfen, wo sie doch selbst Fremden selbstverständlich half. Ich erinnere mich, dass sie jedes Mal, wenn sie von einem Bauern Milch geschenkt bekam, die sie dann in einem Holztrog zu Butter stampfte, eine Hälfte des entstanden Butterlaibes hinüber in die „Siedlung“ trug, um sie einer „unehelichen Mutter“ – heute würde man sie „alleinerziehend“ nennen – zu schenken, „weil die es ja viel schwerer als ich hat“. Obwohl ich nicht wüsste, wo Ursula Dekan vom Schicksal begünstigt worden wäre oder dass sie besonders viel Zuneigung erfahren hätte, habe ich keinen anderen Menschen erlebt, der so viel Zuneigung weiterzugeben wusste. In der Art und Weise, in der sie einem über den Kopf strich; in der Art und Weise, in der sie einem ihr noch so bescheidenes Essen hinstellte; in der Art und Weise, wie sie einen abends mit einem Gebet zu Bett brachte. Diese winzigen, aber ständig wiederholten Handlungen sind nun einmal der vielleicht wesentlichste Bestandteil einer Mutter-Kind-Beziehung. Und Kinder sind diesbezüglich extrem ungerecht: Sie fragen sich nicht, ob die eigene Mutter ihnen kein Essen zubereitet, sie nicht zu Bett bringt, nicht mit ihnen betet, weil sie anderswo arbeiten muss; sie messen das Ausmaß der Zuwendung vielmehr am Ausmaß der dafür aufgewendeten Zeit. Und es war die Dekanin, die nun, nach Nolles Verschwinden, die meiste Zeit für mich aufgewendet hat. So wenig ich heute mit Religion auch anfangen kann – in der Dekanin habe ich sie als Geschenk empfunden: Mit ihren runzeligen Händen wusste sie mich mit dem zu umhüllen, was sie „die Liebe Gottes“ nannte. Eines höchst ungerechten Gottes, der meiner Mutter dazu nur jedes zweite Wochenende Zeit gab. Dass die Tage mit der Dekanin nicht nur viel Zuwendung, sondern auch viel Gebet mit sich brachten, machte mir nichts aus – eine Zeitlang erschien es mir sogar zusammengehörig. Ich betete gerne jeden Tag einen Rosenkranz. Der Singsang der Stimme
81
82
Heimkehr
der Dekanin begleitet vom rhythmischen Stampfen des Stößels, mit dem sie Butter stampfte oder Polenta zerrieb, war unglaublich beruhigend. Ihr zuliebe stand ich sonntags gerne schon um sechs Uhr morgens auf, um mit ihr und Walter quer über einen langen Feldweg die Morgenmesse in der Kirche von Kötschach zu erreichen. Ihr zuliebe wurde ich, wie Walter, selbstverständlich Ministrant. Ihr zuliebe musste meine Mutter der Kirche von Kötschach fünf Schilling – heute wohl hundert Euro – spenden, damit ich das Weihrauchfass schwingen durfte. (Ich hätte für diese Spende auch die Glocke läuten können, aber das überließ ich älteren Ministranten, weil ich Angst hatte, den richtigen Moment zu versäumen.) Mit Ursula Dekan war ich überzeugt, dass ich mit jeder Messe die Liebe Gottes in mich aufnahm. Teufel und Engel waren dank Ursula Dekan für mich Engel wie sie und Teufel wie Adolf Hitler, der nach meiner Überzeugung mit einem Pferdefuß hinkte. Als ich beim Heimweg aus der Kirche eines Tages Löcher in der frischen Erde erblickte, sah ich dort Kötschachs Eingänge zur Hölle. Nur Walter sah die Dinge irdischer: „Na Michi, des san die Paradeisa.“ Zumindest in dieser Phase meiner Kindheit wäre ich geeignet gewesen, den größten Traum der Dekanin zu erfüllen: irgendein kirchliches Amt, vom Mönch bis zum Priester zu ergreifen. So aber dachte die Dekanin diese Karriere ihrem Enkel Walter zu – vielleicht um die Sünde seiner außerehelichen Geburt zu tilgen. Zwei Jahre nachdem ich ihr Haus verlassen hatte, erreichte sie seine Aufnahme ins Internat des Gymnasiums eines Priesterseminars. Doch nicht immer hält Gott seine schützende Hand über die Anliegen frommer Frauen: Walter, wie seine Mutter ausnehmend gutaussehend und schon mit zwölf ein Mädchenschwarm, konnte sich nichts Schlimmeres als ein zölibatäres Leben vorstellen. Er floh aus dem Internat, wurde zurückgebracht, floh neuerlich und wurde ausgeschlossen. Ich habe ihn Jahrzehnte später nach vielen gescheiterten Versuchen, wie sein Onkel Toni „Unternehmer“ und „reich“ zu werden, als vielfach Vorbestraften wieder getroffen. Zuletzt – auch das ist mittlerweile schon vierzig Jahre her – hat er unter neuem Namen einen neuen Anfang versucht – seine Großmutter, wenn sie noch lebte, betete, dass er mit Gottes Hilfe gelingt. Emotionslos müsste ich diagnostizieren: Die extreme Frömmigkeit seiner Großmutter hat wahrscheinlich mit zu Walters Problemen beigetragen. Mich hat die Erinnerung an Ursula Dekan dennoch zeitlebens daran gehindert, der katholischen Kirche emotional so kritisch gegenüberzustehen, wie sie das rational verdient: Ihr Zölibat ist natürlich „widernatürlich“; es hat natürlich ursächlich mit den tausenden Fällen von Kindesmissbrauch zu tun, die bis heute aufbrechen; ihr feindseliges Unverständnis der Sexualität ist natürlich die Basis zahlloser Neurosen; ihre Frauenfeindlichkeit – „die Frau ist ein Missgriff der Natur“ (Thomas von Aquin) ist natürlich hauptverantwortlich für die noch immer nicht vollzogene Gleichstellung der Frau; Ihre Wissenschaftsfeindlichkeit hat natürlich sinnvollen Fortschritt ständig
Wochenenden
gebremst, ja unterbunden und bremst ihn in der Stammzellenforschung bis heute. Dass in den Schulen vieler US- Bundesstaaten die Theorie der Evolution nicht gelehrt werden darf, ist das Werk jener christlichen Fundamentalisten, die Donald Trumps wichtigste Propagandisten, Unterstützer und Wähler sind. Man muss einen guten Magen haben, den bis heute fortdauernden von der christlichen Kirche verursachten Schaden zu verdauen. Schon gar nicht darf man sich, wie ich, daran erinnern, dass ihre eben erst revidierte Behauptung, die Juden hätten Jesus ermordet, der Urgrund jenes Antisemitismus ist, der den Holocaust hervorgebracht hat: Die Jahre, die meine Mutter in Auschwitz verbracht hat und die ich ohne sie verbringen musste, hängen ursächlich mit dem Christentum zusammen. Aber ich bin christlich geprägt: Emotional wiegt die „Dekanin“ für mich zehntausend Sünden der christlichen Kirche auf. 1948 haben wir Kötschach verlassen und sind nach Wien übersiedelt. Ich glaube, dass Walter traurig war. Die Dekanin hat mich gesegnet.
Wochenenden In Wien ergab sich einmal mehr das Problem meiner Unterbringung. Denn meine Mutter arbeitete einmal mehr in einer Lungenheilanstalt – diesmal in Alland, dreißig Kilometer von Wien entfernt. Sie hatte die Hoffnung, noch einmal Psychoanalytikerin zu werden, endgültig aufgegeben und peilte stattdessen wenigstens den Lungenfacharzt an. Wir mussten von etwas leben und ich musste neuerlich irgendwo unterkommen – es galt ein Internat für mich zu finden. „Das einzige brauchbare Internat in Wien ist das Quäkerheim in Neuwaldegg. Die städtischen Heime sind furchtbar“, beriet Elisabeth Schilder, eine Jugendfreundin und Vertraute Christian Brodas meine Mutter und qualifizierte sich damit entschieden für die Funktion, die sie dereinst einnehmen sollte: Sie wurde, nachdem Broda Justizminister geworden war, erste Leiterin der „Bewährungshilfe“ zur Resozialisierung ehemaliger Häftlinge. Die Heime, vor denen mich ihr Ratschlag bewahrte, waren jene Heime der Stadt Wien, die 2011 durch einen beispiellosen Skandal traurige Berühmtheit erlangten: Ihre „Insassen“, wie man sie wohl nennen muss, wurden von Erziehern und Erzieherinnen, ja selbst von eingeschleusten Besuchern durch Jahre missbraucht und misshandelt. Nicht nur gemessen daran sollte sich das Quäkerheim als Oase erweisen: Ein Schweizer Quäker vom menschlichen Format der Dekanin kümmerte sich dort um das Wohl von Wiener Kindern, die der Krieg fast durchweg zu Waisen gemacht hatte. Ich war eine glückliche Ausnahme: Bloß Scheidungswaise. Meine Eltern wurden 1948 geschieden, wobei mein Vater das alleinige Verschulden auf sich nahm. Seinen Freunden, die ich später kennenlernen sollte, versicherte er, dass
83
84
Heimkehr
das sehr nobel von ihm gewesen sei. Denn in seine Hände sei der Brief eines „Josip“ gelangt, der mit Sicherheit mit meiner Mutter geschlafen habe. Diesen Beischlaf hat es tatsächlich gegeben: Josip war ein russischer Gastarbeiter in Dachau gewesen und meine Mutter hatte sich mit dem Ingenieur, der als Einziger Französisch konnte, angefreundet. In den Tagen, in denen sie beide damit rechneten, dass die SS sie umbringen würde, damit sie nicht in die Hände der Amerikaner fallen, hatten sie eine Nacht miteinander verbracht. Dass mein Vater überhaupt überlegt hatte, dieses Ereignis bei der Scheidungsverhandlung zur Sprache zu bringen, erfüllt mich bis heute mit Zorn und Verachtung. (Ich gehe davon aus, dass Christian Broda es ihm als gemeinsamer Vertrauensanwalt ausgeredet hat.) Meine Mutter verzichtete ohnehin – das nahm Brodas spätere Familienrechtsreform vorweg – auf jegliche Unterhaltszahlung für sich selbst, wie das heute für eine 41-jährige Ärztin selbstverständlich wäre. Damals war es freilich eine einsame Ausnahme, denn es gab keine Scheidung gegen den Willen des Partners. Wenn eine Frau ihr dennoch zustimmte, dann nur gegen sehr viel Geld. Meine Mutter hingegen stellte eine andere Bedingung, die in meinen Augen als „sittenwidrig“ zurückzuweisen gewesen wäre: Die künftige Frau meines Vaters dürfe unter keinen Umständen jemals den Namen „Lingens“ tragen. Tatsächlich hat mein Vater, als er wenig später in die USA emigrierte, den Namen „Lynn“ angenommen, um sie zu heiraten. Ich habe unter dem Pseudonym „Peter Lynn“ meine ersten Kurzgeschichten für das „Kleine Blatt“ geschrieben – eine Art verspäteten Verständnisses von meiner Seite. Für mich wurden bei der Scheidung die gerichtsüblichen Alimente und Besuchstermine vereinbart. Den Betrag weiß ich nicht mehr – nur dass mein Vater ihn nur sporadisch und schließlich kaum mehr bezahlte. Für Besuche bei ihm wurde jedes zweite Wochenende festgelegt. Er lebte jetzt offiziell mit Eduarda Massiczek in der Doblhoffgasse und ich habe zumindest das erste dieser Wochenenden in genauerer Erinnerung. Es begann damit, dass wir einander in der nahen „Conditorei Sluka“ trafen, wo ich eine der bis heute besten Mehlspeisen der Stadt bestellen durfte. Sie schmeckte in meiner Erinnerung schaumig und nach Himbeeren – jedenfalls phantastisch angesichts des rundum herrschenden Hungers. Anders als meine Mutter schien mein Vater Geld zu haben. Er hatte als politisch „unbelastet“ eine Anstellung beim internationalen Kinderhilfswerk des Roten Kreuzes ICRC gefunden und das erlaubte ihm eine solche Einladung. Danach waren wir um die Ecke in seine Wohnung gegangen und er hatte mir Schallplatten vorgespielt und Bilder Edis, durchwegs hübsche Landschaften und Blumenstücke, gezeigt. Ich glaube, dass ich sie nicht schlecht, wenn auch nicht interessant fand. Denn ich hatte damals bereits einen recht ausgeprägten bildnerischen Geschmack: Meine Mutter besaß von ihren zahllosen Reisen hunderte Postkarten mit Reproduktionen der berühmtesten Gemälde der berühmtesten Museen. Der Prado in Madrid war ebenso vertreten, wie
Wochenenden
die Uffizien in Florenz, die Tate Gallery in London, die Münchner Pinakothek, das Rijksmuseum in Amsterdam und natürlich der Louvre in Paris. Mit diesen Postkarten spielten wir an allen Wochenenden, die ihr gehörten, durch Stunden folgendes Spiel: Ein dickes Paket Karten wurde gemischt und verkehrt am Tisch aufgelegt. Immer wenn sie eine Karte aufdeckte, musste ich den Maler erraten – wenn ich eine aufdeckte, war sie an der Reihe. Ich weiß nicht mehr in welchem Alter ich sie eindeutig besiegte, aber ich weiß bis heute, wer meine Lieblingsmaler waren, denn sie sind es geblieben: Botticelli, Vermeer, Lorenzo Lotto, Leonardo da Vinci, Rembrandt und Van Gogh entlarven mich als braven Bildungsbürger. Später kam Egon Schiele hinzu, in dessen erste Nachkriegsausstellung in der Galerie nächst Sankt Stephan meine Mutter mich mitnahm. Eduarda Massiczek konnte da nicht ganz mithalten. Ich hätte ihre Bilder aber vermutlich dennoch nicht so schlecht gefunden, wenn meine Mutter mich am Abend dieses ersten Sonntags mit meinem Vater nicht eingehend gefragt hätte, was wir zusammen getan haben. „In der Conditorei Sluka, in der Papa auch mit Dir war, durfte ich eine herrliche Mehlspeise essen.“ „Und dann?“ „Sind wir in seine Wohnung gegangen.“ „Und dort?“ „Ich weiß nicht.“ „Aber irgendetwas werdet ihr doch gemacht haben“ „Ja, Schallplatten gehört.“ „Das kann doch nicht alles gewesen sein.“ „Wir haben auch Edis Bilder angeschaut“ „War sie auch dabei?“ „Ja, sie war mit uns.“ „Du weißt, dass sie Dir Deinen Vater weggenommen hat.“ „Ja“, antwortete ich mit niedergeschlagenen Augen. Mir war klar, dass ich ihre Bilder „reinen Kitsch“ finden musste. Trotzdem setzte meine Mutter durch, dass mich mein Vater in Zukunft nur mehr allein, ohne „Edi“ sehen durfte. Wenn ich heute versuche, mich zu erinnern, welchen Eindruck ich von „Edi“ hatte, spüre ich wie damals das Gefühl des Verrats in mir aufkommen. Eigentlich fand ich sie eher hübsch – ich hatte auch diesbezüglich sehr früh sehr ausgeprägte Vorlieben – und eher nett. Aber das konnte ich mir damals so wenig eingestehen, wie ich es meiner Mutter gestehen konnte. Ich einigte mich mit ihr darauf, in Edi eine „Hexe“ zu sehen – die ja auch nicht zwingend bucklig und böse aussehen, nur im Herzen böse sein musste. Den Abschied meines Vaters zu seiner Emigration in die USA, der ja eigentlich ein einschneidendes Ereignis gewesen sein müsste, habe ich nicht in Erinnerung. Vielleicht habe ich ihn auch nicht erlebt, weil Edi zweifellos an seiner Seite gewesen ist.
85
86
Heimkehr
Ab 1948 lebte mein Vater in den USA. Durch ein Jahrzehnt als schlecht bezahlter Hilfsarzt in einem riesigen, abgefuckten staatlichen Irrenhaus, weil er die Prüfung zur Nostrifizierung seines Doktorats nicht und nicht schaffte. Ein anderer Emigrant, Hans Hoff, fiel gleich siebenmal durch, kehrte entmutigt nach Wien zurück und wurde hier legendärer Vorstand der psychiatrischen Universitätsklinik. Mein Vater schaffte es im dritten Anlauf – aber zwei Wochen, nachdem er in New York eine Wohnung angemietet hatte, um dort eine private Praxis zu eröffnen, platzte das überlastete Gefäß in seinem Gehirn.
Joschi, der einer Schlange den Kopf abbiss Das „Quäkerheim“, in dem ich dank des Ratschlags der Elisabeth Schilder untergebracht war, befand sich in einer herrlichen Villa in der Promenadegasse in Wien-Neuwaldegg. Es gibt sie heute nicht mehr, aber man kann seitlich, wenn man einen Steig hochgeht, noch Reste des herrlichen Parks sehen, der sie umgab. Auch das Gebäude war herrschaftlich – Palais wäre als Bezeichnung durchaus angemessen und „Ringstraße“ bezeichnete am ehesten den Stil. Jedenfalls gab es Zierrat, Wölbungen und geschwungene Fensterbögen. Dass nur eine Familie in den mindestens drei Stockwerken gewohnt hatte, schien unglaubwürdig, muss aber so gewesen sein, denn es gab im Parterre nur eine riesige Eingangshalle und einen riesigen Wohnsalon, der mit seiner breiten Fensterfront in den Park bequem als Speisesaal mit einem Dutzend langer Tische dienen konnte. Dass darauf inmitten der hungernden Stadt einfaches, aber doch ausreichendes Essen serviert werden konnte, dankten wir den „Quäkern“. Quäker, übersetzt „Zitterer“, so wusste ich von meiner Mutter, sind eine aus England stammende religiöse Gruppe, die dem Christentum nahesteht, das Licht Gottes aber in jedem einzelnen Menschen sieht und zwar die Bibel, aber nicht so sehr die Kirche schätzt. Quäker wollen auch eher diesseits Gutes tun als jenseits mit den Engeln singen. In England habe ich Jahre später riesige in ihrem Besitz befindliche Schokoladefabriken besucht, mit deren Erträgen sie humanistische Projekte finanzierten. Das war eine Haltung, die offenbar manches mit der von Schweizer Calvinisten gemeinsam hatte. Jedenfalls war der Mann, der die Quäker im Wiener Quäkerheim vertrat, ein Schweizer namens Hans Anderfuhren, den man auch in Schweizer Enzyklopädien nachschlagen kann. Ich erinnere von seinem Aussehen nur mehr, dass er eher groß war, dunkle Haare und unglaublich freundliche, braune Augen hatte. Er zeigte meiner Mutter und mir die Räume des Heims, als müsste er sie uns wie die eines Hotels anpreisen: Hier wird gekocht, hier wird gegessen und gelernt – aber es gibt auch Platz zum Basteln und zum Malen. In den riesigen Schlafräumen zeigte er uns die Betten, über denen fast immer ein Kreuz, manchmal auch ein Foto hing. Vor einem der Betten hielt er länger inne: Darüber hing ein Bild Lenins und ein Plakat mit Hammer und Sichel.
Joschi, der einer Schlange den Kopf abbiss
„Das haben wir auch“ sagte er, und seine Stimme ließ keinen Zweifel daran, dass es ihn zutiefst beglückte. Mehr noch als gläubiger Quäker war Anderfuhren gläubiger Kommunist. Siegfried, ein etwa Neunzehnjähriger, dem das gezeigte Bett gehörte, war sein Liebling, dem er auch erste Aufgaben als Miterzieher übertrug und schließlich eine Dachkammer überließ, in der er mit seiner Freundin lebte. Insofern herrschte auch in diesem Heim wenig Sittenstrenge – nur dass sich das vielleicht in Verhältnissen mancher Zöglinge miteinander, nicht aber in Missbrauch niederschlug. Besonders gefragt war Siegfrieds Führungsrolle am ersten Mai. Dann war er es, der uns am Morgen aus den Betten jagte, zusammentrommelte, darauf achtete, dass wir ordentlich gewaschen waren und so rechtzeitig und ausnahmsweise völlig geordnet mit uns antrat, dass wir uns nach einem weiten Weg in die Stadt dem Zug der Kommunisten am Ring anschließen konnten. Dabei nicht mitzumachen – was sonst bei vielen gemeinsamen Tätigkeiten der Fall war – hätte bedeutet, sich Siegfrieds Zorn zuzuziehen, und er war mit Abstand der kräftigste der älteren Burschen. In Summe würde ich schätzen, dass wir etwa sechzig bis achtzig Kinder und Jugendliche beiderlei Geschlechts waren, die das Heim bewohnten. Wenn man von einigen wenigen, die wie ich aus relativ geordneten Verhältnissen kamen, absah, waren sie durchwegs vom Krieg und den ersten Nachkriegsjahren gehärtet. Sie hatten Bomben, brennende Häuser, sterbende Menschen und mörderischen Hunger erlebt. Sie anerkannten Autorität nicht automatisch. Nach meiner Erfahrung gab es nur zwei Wege, ihnen gegenüber Autorität zu erlangen: Entwaffnende Güte, wie Hans Anderfuhren sie ausstrahlte – oder überlegene Körperkraft. Ein Erzieher musste unglaublich gütig oder physisch sehr kräftig sein, um die Kinder dieses Heims zu beeindrucken. Die Erzieherinnen waren unglaublich gütig oder mussten einen Erzieher oder Siegfried zur Hilfe rufen. Am schwersten zu bändigen war Joschi. Niemand, auch nicht er selbst, wusste, ob er wirklich so hieß und wie alt er eigentlich war – vielleicht neun, vielleicht zehn, vielleicht auch älter. Er hatte, seit er denken konnte, auf der Straße gelebt. Als er ins Heim gekommen war, hatte er nicht wirklich verständlich sprechen können. Wohl aber phantastisch raufen: Im Freien hob er sofort einen Stein auf, um damit zuzuschlagen. Im Zimmer packte er zum selben Zweck jeden erreichbaren Gegenstand oder biss so fest zu, dass er selbst für deutliche ältere Buben nicht abzuschütteln war. Essbares nahm er sofort an sich und stopfte es in den Mund. Alles, was sonst noch nutzbar war, stahl er insgeheim. Ich nehme an, dass er die Jahre auf der Straße auf diese Weise überlebt hat: Er stahl aus Geschäften oder in Bauernhäusern und wehrte sich mit Steinen und Bissen, wenn er erwischt wurde. Erst nach dem ersten Jahr, in dem ich ihn miterleben durfte, nutzte er seine Beißkraft nicht nur zum Raufen, sondern setzte sie auch sozialverträglich ein: Für Karamell-
87
88
Heimkehr
Zuckerln oder fünf Groschen war er bereit, einer Ringelnatter den Kopf abzubeißen, wofür er von mir restlos bewundert wurde. Ansonsten ging ich ihm tunlichst aus dem Weg, obwohl ich mich in dieser Heimumgebung auch zu einem sehr guten Raufer entwickelt hatte, der auch wusste, dass man zuerst und sofort ins Gesicht zuschlagen musste – wenn Joschi nicht im selben Zimmer geschlafen hätte, wäre ich sogar „Zimmerstärkster“ gewesen. Ihm gingen selbst ältere Größere aus dem Weg und auch ich überließ ihm normalerweise alles, was er gerade haben wollte. Nicht aber mein erstes „Ruderleiberl“, denn mein Vater hatte es mir aus Amerika geschickt und es war die Sensation des Heims gewesen: Susi, eine rothaarige Sechzehnjährige, hatte mir erlaubt, ihre nackte Brust zu sehen, wenn ich ihr erlaubte, es einmal anzuziehen. Meinen hölzernen Spind, in dem ich es verwahrte, hatte ich von oben her mit einem Nagel verschlossen, um es abzusichern. Aber als ich am Abend ins Zimmer kam, hatte Joschi es an. „Gib es her. Es gehört meinem Vater.“ Keine Antwort. Ich wusste, dass ich im Kampf mit Joschi nur eine Chance hatte: ihn ohne jede Vorwarnung zu Boden zu stoßen und mich auf ihn zu werfen, ehe er überhaupt begriff, was ihm geschah. Der Überfall funktionierte und mir gelang bis dahin Unvorstellbares: Joschi am Boden in eine „Beinschere“ zu bekommen, die es mir erlaubte, ihm durch simples Anspannen der Beinmuskeln den Atem abzuschnüren. Genau das tat ich und setzte es eisern fort, als weitere Zimmerkammeraden eintraten und einen staunenden Kreis um uns bildeten. „Lass mi aus“, keuchte Joschi. „Ich bin doch ned blöd. Dass Du mich dann erschlagst.“ „I tu da nix – i schwörs.“ „Das kenn ich.“ In meiner Erinnerung dauerte dieser Wortwechsel Minuten. Ich hatte Angst, die Kraft in den Beinen zu verlieren und beruhigte mich damit, dass Joschi im Gesicht schon blaurot anlief. „Du bringst mi um. I schwör da, dass i da dei Leibal wieda gib und di in Ruh lass.“ Jetzt mischten sich auch die Umstehenden ein, die offenbar auch gesehen hatten, wie Joschis Gesicht sich verfärbte. „Lass ihn aus“, höre ich sie bis heute rufen und gab zitternd nach. Ich ließ Joschi aus und schüttelte mich aus. Joschi brauchte noch einen Moment, um sich zu erholen, dann stand auch er auf und schüttelte sich aus. Das nächste, was ich sehe, ist nur noch die Sitzfläche eines Stuhls über meinem Kopf. Dass sie nicht darauf gelandet ist, danke ich unserem englischen Erzieher John, der in diesem Augenblick ins Zimmer getreten war und den Stuhl, den Joschi zum Schlag erhoben hatte, zurückriss.
Joschi, der einer Schlange den Kopf abbiss
Joschi musste das Leibchen ausziehen und wurde in Siegfrieds Zimmer übersiedelt. John war uns allen der liebste Erzieher. Er kam aus London und war Maler. Das zog nach sich, dass wir alle malen durften – 1949, in einer Zeit, in der es Malfarben wenn überhaupt, dann nur um ein Schweinegeld zu kaufen gab, durften wir im Quäkerheim mit dem Finger in Farbtöpfe greifen und damit auf Packpapier malen, das John an die Wand geheftet hatte. Ich war überglücklich und bin sicher, dass meine Liebe zur Malerei damals für alle Zeiten unauslöschlich wurde. Malen war aber nicht das Einzige, was wir bei John lernten – wir lernten auch basteln. Einmal mehr unvorstellbar in diesen Jahren hatten wir Holz zur Verfügung und durften unter Johns Anleitung damit Roller bauen. Das Trittbrett meines Rollers war zirka 25 Zentimeter breit und an allen vier Ecken waren mit großen Schrauben stählerne Kugellager anstelle von Gummirädern angebracht; als Lenkstange diente ein hohes Holzkreuz, das mit einem simplen Scharnier am Trittbrett befestigt war. Die so konstruierten Roller waren ungemein robust, und wir besaßen mindestens fünf davon. Wenn wir damit auf die Straßen gingen, entfalteten sie einen Höllenlärm, der jedes heutige Motorrad in den Schatten gestellt hätte und den wir ähnlich wie der Wilde auf seiner Maschin genossen. Unser größtes Vergnügen war es, einige der nahen, steilen Straßen, am liebsten die Schafbergstraße hochzugehen und dann gemeinsam zu Tal zu rasen. Manchmal auch bei irgendwelchen Glocken anzuläuten und davonzusausen, wenn sich jemand zeigte. Ich würde uns die glücklichste Horde Wiens jener Jahre nennen – auch wenn wir so gut wie alle keine Väter hatten. John und Anderfuhren waren der denkbar beste Ersatz. Zudem hatten wir nicht nur liebenswerte hübsche Erzieherinnen – Veronika, die irgendwann Siegfrieds Geliebte wurde, ist mir als bildhübsche Französin in Erinnerung – sondern fast jeder von uns hatte zusätzlich eine Heimmutter – ein älteres Mädchen, zu dem man gelegentlich ins Bett kriechen und es umarmen durfte. Meine Heimmutter war Susi, jene etwa 16-jährige Rothaarige, die mir ihren Busen zeigte, um mein Ruderleiberl anziehen zu dürfen. Meist aber war unser Zusammensein ein viel züchtigeres: Wir saßen gemeinsam auf einem Ast des riesigen Baumes vor dem Eingang zum Heim, denn sie war das einzige unter den Mädchen, das diesen Ast kletternd erreichte und mit Hilfe Johns hatte ich dort sogar ein Sitzbrett angebracht. Wir saßen Stunden dort oben, sahen ins Grüne, erzählten einander Geschichten oder hörten den Vögeln zu. So und so oft auch während meiner Schulzeit, denn meine Lehrerin war weder in der Lage, mich daran zu hindern, den Schulraum – unseren Speisesaal – zu verlassen, noch gar mich von meinem Baum herunterzuholen – Drohungen waren ihr fremd und Strafen im Quäkerheim erstens verpönt und zweitens bei Kindern wie uns nicht zu exekutieren. Frau Schmittli, so nannten wir sie, obwohl sie in Wirklichkeit Schmidt hieß, war zudem Anthroposophin und glühende Verfechterin der Steiner-Pädagogik: Da war Druck verpönt. Der Unterricht begann etwa gegen neun damit, dass wir bunte
89
90
Heimkehr
Stäbe heben und senken oder über den Rücken rollen mussten und dabei oder danach Reime sprachen. Die sprachen wir auch zu allen Buchstaben und Zahlen, die wir auch gelegentlich in Hefte schrieben. Ausgiebig dafür lernten wir, Buben wie Mädchen – Elfie Hammerl wäre begeistert gewesen – häkeln und stricken. Andere Lerninhalte sind mir nicht mehr in Erinnerung. Wenn es uns zu heiß oder zu viel wurde, standen wir auf, öffneten eines der Fenster der riesigen Fensterfront in den Park und kletterten ins Freie. Meist, um ins nahe Neuwaldegger-Bad zu gelangen, in dessen Drahtzaun wir ein Loch geschnitten hatten, um zu kommen und zu gehen, wann wir wollten. Gelegentlich frequentierten wir statt des Neuwaldegger-Bades auch den „Hanslteich“, den man über einen längeren Spaziergang durch ein herrliches Wäldchen erreichte. Das Interessanteste am Hanslteich war, dass Susi dort gelegentlich nackt ins Wasser sprang und dass es Unmengen an Ringelnattern gab, die ich mit der Hand zu fangen wusste und denen Joschi gelegentlich für fünf Groschen den Kopf abbiss. Einmal nahmen wir auch ein Dutzend Nattern mit, um sie Veronika und Siegfried ins Bett zu legen – sie waren darüber eher verärgert, weil die Schlangen dort nicht blieben und aus allen möglichen dunklen Ecken hervorgeholt werden mussten. Es wäre trotzdem ungerecht zu sagen, dass uns kein Pflichtgefühl beigebracht wurde. Es war zum Beispiel selbstverständlich, dass zwei von uns nach dem Essen zum Geschirrabwaschen dablieben. Ich hätte bis heute kein Problem damit, in einer knappen Stunde hundert Teller in heißes Wasser zu tauchen, mit einem Fetzen blank zu putzen, in frisches kaltes Wasser zu tauchen und abzutrocknen. Meiner Frau habe ich das nur nie verraten. Auch eine andere gemeinsame Pflicht gab es, vor der sich niemand drückte: Singen. Es fand fast jeden Abend irgendwo im Speisesaal oder im Park statt. Nicht selten gab es dazu in unserer Mitte ein Lagerfeuer, in dessen Asche wir Kartoffeln braten konnten. Wir saßen im Kreis und sangen Lieder, die Anderfuhren, Schmittli oder Siegfried anstimmten. Bei Schmittli waren es meist Volkslieder: „Hoch auf dem gelben Wagen“, „Am Brunnen vor dem Tore“, „Es wird scho glei dumpa“ und so fort. Siegfried stimmte eher politische Lieder an: „Brüder zur Sonne zur Freiheit“ war sein Favorit und oft das Abschlusslied, sofern Anderfuhren nicht „Wahre Freundschaft soll nicht wanken“ anstimmte. Ich denke, sie hat Buben und Mädchen, Erzieher und Erzieherinnen dieses Heims verbunden, ohne je zu wanken. Das heißt nicht, dass es keine Friktionen gab: Es gab durchaus nicht selten die Momente, in denen John wütend auf den Tisch oder eines der in Zwingen eingespannten Werkstücke drosch. In denen Veronika uns alle zum Teufel wünschte oder Margarethe oder Frau Schmittli erschöpft „So kann ich nicht mehr“, murmelten. Nur Hans Anderfuhren haben wir nie wütend erschöpft oder ratlos erlebt – zumindest nicht wir Kinder.
Das „Bundeskonvikt“
Nur einmal soll sich dergleichen zugetragen haben und der Zwischenfall als solcher ist mir in präziser Erinnerung: Alle paar Monate fuhr Anderfuhren in die Schweiz, um von dort Nahrungsmittel für uns mitzubringen. Geld dafür bewahrte er in seinem Schreibtisch auf. Eines Tages war daraus nach seiner Rückkehr eine Hundert-SchillingNote gestohlen. Anderfuhren rief uns zusammen, um uns davon zu erzählen. „Ich bin dem Dieb nicht böse“, sagte er, „denn er hat sicher Hunger gehabt und nicht gewusst, dass dieses Geld nur dazu da ist, dass ich damit Nahrungsmittel für Euch kaufe. Ich lege jetzt meinen verbliebenen Schein in die Lade und bin sicher, dass der gestohlene morgen daneben liegen wird, weil der Dieb ihn wieder dorthin zurückbringt.“ Am nächsten Tag war der zweite Hundert-Schilling-Schein auch weg. Anderfuhren sagte es uns nicht, aber Margarethe erzählte es uns. Er sei noch immer nicht böse gewesen, aber er hätte geweint. Ich habe von den beiden Jahren im Quäkerheim bis heute profitiert. Als Jugendlicher vor allem, indem ich meine Freude am Malen, am Basteln und am Handwerken konservierte und natürlich, indem ich von den dort erlernten Raufkünsten profitierte. Raufen unter Buben, so behaupte ich, lehrte unglaublich viel über Kriege: Simple militärische Überlegenheit ist, wie simple physische Überlegenheit ein unglaublich starkes Argument bei politischen Auseinandersetzungen. Einigermaßen gleich Starke gehen einander in Heimen und auf internationalen Bühnen eher als unterschiedlich Starke aus dem Weg. Sich auf „Friedensvereinbarungen“ zu verlassen, ohne dass dahinter jemand steht, der ihre Einhaltung dank militärischer Überlegenheit sicherstellt und wie John im letzten Moment einen Schlag abfängt, ist ein höchst riskantes Unterfangen. Und es ist höchst unvorsichtig, davon auszugehen, dass der andere in einer bestimmten Situation so handelte, wie man es gemäß den eigenen Maßstäben täte. Die Joschis schlagen unweigerlich zu.
Das „Bundeskonvikt“ Das Ende meines zweijährigen Aufenthalts im Quäkerheim kam mit dem Beginn der Mittelschule, die ich nach dem Willen meiner Eltern besuchen sollte und die es weder im Quäkerheim noch (damals) in seiner Nähe gab. Zudem hatte eine ProbeAufnahmeprüfung, die ich bei einer Freundin meiner Mutter versucht hatte, beachtliche Schwächen meiner im Quäkerheim erhaltenen Schulbildung offenbart: Ich konnte nach Ansicht dieser Mittelschulprofessorin weder Rechtschreiben noch Schlussrechnen. Sie hielt für ausgeschlossen, dass ich die Aufnahmeprüfung bestehe. Doch meine Mutter nutzte die zweimonatigen Ferien, mich in beiden Belangen einem von ihr selbst gestalteten Crashkurs zu unterwerfen und ich bestand sie irgendwie doch, indem ich bei meinem Aufsatz Worte vermied, bezüglich deren Schreibung ich nicht ganz sicher war. So habe ich es durch alle Jahre bei allen meinen Deutschschularbeiten gehalten und es hat meinen Wortschatz ungemein bereichert, weil ich mir einen Pool
91
92
Heimkehr
von Synonymen zulegte und notfalls der ganzen Story eine andere Richtung gab, um einen „schweren Fehler“ zu vermeiden. Man sieht, wie unser Schulsystem Autoren schafft. Da meine Mutter unverändert in der Lungenheilanstalt Alland arbeitete, wurde es aber nötig, zu einer neuen Schule auch eine neue Unterkunft zu finden, von der ich diese Schule einfach erreichen konnte. Diese Unterkunft wurde das Bundeskonvikt Schützengasse, in der Nähe des Gymnasiums Hagenmüllergasse, denn in beiden war, wenn auch in einer höheren Altersgruppe, bereits mein Cousin Alexander, der Sohn der ältesten Schwester meiner Mutter, Edith, eingeschrieben. Ich kannte ihn von einem Urlaub, den er bei uns in Kärnten verbracht hatte und verehrte ihn, wie jeder kleine Bub einen vier Jahre älteren Buben verehrt. Er, so die richtige Theorie meiner Mutter, würde mir die Eingewöhnung im „Bundeskonvikt“ erleichtern. Denn ansonsten war es das absolute Gegenmodell zum Quäkerheim: so geordnet und kühl, wie jenes chaotisch und warm gewesen war. War das Quäkerheim eine Villa in einem Park der „Promenadegasse“ im grünen Stadtteil „Neuwaldegg“, so war das „Konvikt“ ein dreistöckiges Haus in der „Schützengasse“ im grauen Stadtteil „Erdberg“. Statt von einem kommunistischen Quäker als Heimleiter wurde es von einem Direktor geleitet, der zweifellos entweder der SPÖ oder der ÖVP angehörte, wobei das Wort „Bundes“ etwas mehr für die ÖVP und die Adresse etwas mehr für die SPÖ spricht. Statt dass sich wie im Quäkerheim, Philanthropen und Anthroposophen als „Heimonkeln“ oder „Heimtanten“ um die Kinder kümmerten, kümmerten sich im Bundeskonvikt „Erzieher“ um die „Zöglinge“. Das hieß nicht, dass sie unfreundlich gewesen wären – nur waren sie selten freundlich. Dagegen waren die Kinder im Konvikt nicht viel anders als im Quäkerheim. Auch bei ihnen war der Vater des Öfteren nicht aus dem Krieg zurückgekommen – nur nicht fast immer. Auch die meisten von ihnen hatten Sirenen, Bombenterror und Nächte in Luftschutzkellern erlebt – nur nicht fast alle. Mein Cousin Alexander war zum Beispiel mit seiner Klasse und seinem Lehrer aus einem Internat im niederösterreichischen Amstetten bis Reute in Tirol geflohen. Dort war er in ein Gefecht geraten, von dem ihm ein Splitter in der Schulter zurückblieb und hatte sich dennoch elfjährig zu Fuß fünfhundert Kilometer nach Wien durchgeschlagen – aber sein Schicksal war die Ausnahme, nicht die Regel. Es gab im „Bundeskonvikt“ zumindest keinen „Joschi“, der wie ein Tier aufgewachsen war. Aber vom Krieg gezeichnet waren diese Kinder alle. Wir unterschieden uns eigentlich nicht sonderlich von den Kindern aus Bosnien, Serbien oder Kroatien, die nach dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien in Österreich aufgenommen wurden. Der größte Unterschied zwischen dem Quäkerheim und Bundeskonvikt war das unterschiedliche Klima, das in den beiden Heimen herrschte. Die „Onkel“ und „Tanten“
Das „Bundeskonvikt“
im Quäkerheim waren erstens alle Laien und zweitens alle Ausländer und es überwogen zweitens die Frauen die Männer. Unter den Kindern waren die Geschlechter zumindest gleich verteilt. Unter den Erziehern des Konvikts gab es dagegen selbstverständlich nur Männer und unter den Zöglingen selbstverständlich nur Buben. Das schuf einen völlig anderen Umgang miteinander. Männer können mit Männern nur selten zärtlich sein. Wenn Buben hier fremde Betten aufsuchten, dann nicht die von Mädchen, die sie zärtlich an sich zogen, sondern die eines anderen Buben, um ihn dort ohne jedes erotische Ansinnen aggressiv bis schmerzhaft „auszugreifen“ – oft damit verbunden, ihm „die Decke“ zu geben: Ihm zu zweit oder zu dritt die dunklen, rauen Kotzen, mit denen wir uns zudeckten, über Kopf und Körper zu schlagen und das „Ausgreifen“ auf diese Weise einfacher und verängstigender zu gestalten. Es ging um die Demonstration überlegener Macht. Es gab nichts, vor dem ich mich mehr fürchtete. Für einen Einzelnen war ich dank meiner Vorbildung durch das Quäkerheim ein zu starker Gegner, aber umso mehr wollte man mich zu dritt oder zu viert fühlen lassen, dass ich chancenlos war. Wenn ich es dennoch in vielen Fällen nicht gewesen bin, dann weil mir das Gefühl unter der Bettdecke zu ersticken, Bärenkräfte verlieh: Immer wieder gelang es mir, selbst zwei, drei Buben über mir im wahrsten Sinne des Wortes „abzuschütteln“. Irgendwann wurde daraus sogar ein wichtiger Bestandteil meines Rauf-Repertoires: Sich aus einer unterlegenen Position nach langem Stillhalten, das Aufmerksamkeit und Muskeltonus des anderen nachlassen lässt, durch einen gewaltigen, völlig unerwarteten Ruck in eine überlegene Position zu katapultieren. Ich machte das zunehmend zu meinem neuen Raufstil und in der Abwesenheit Joschis brachte es keinen Nachteil mit sich: Ich ließ den anderen immer zuerst zuschlagen, ehe ich mich wehrte. Das wirkte nach außen hin so nobel wie in einem Wildwestfilm – in Wirklichkeit vermittelte es mir die für einen Sieg nötige innere Aggression. Siegreiches Raufen ist ungeheuer wichtig unter Buben – in Heimen das Wichtigste überhaupt. Denn dort sind Rangordnungen von entscheidender Bedeutung: Wer beim Raufen oben ist, ist es fast überall. Selbst wenn es „nur“ darum geht, mehr vom jeweiligen Essen zu bekommen, das zumindest im Bundeskonvikt immer knapp war. Heimkinder der Nachkriegsjahre zeichnen sich durch blitzschnelles Essen (Schlingen) aus – sie haben immer Angst, nicht genug zu bekommen. Nur als siegreicher Raufer bekam man mehr vom besonders umkämpften Nachtisch. Wobei es zwischen Bundeskonvikt und Quäkerheim auch im Raufen einen erstaunlichen Unterschied gab: Im Quäkerheim wurde im Einzelfall viel härter, aber in der Regel viel seltener gerauft. Da wir eben doch mehr durch Freundschaft verbunden, als durch Aggression voneinander getrennt waren. Schon weil das „Ausgreifen“ in dieser aggressiven Form nicht stattfand, gab es dort nie diese fast alltäglichen Raufhändel. Dass es im Quäkerheim auch Mädchen gab, führte dazu, dass es unter den Buben zwar eine Rangordnung, aber nie wie im Konvikt eine Hackordnung vom Zimmerstärks-
93
94
Heimkehr
ten abwärts bis zum Kleinsten und Schwächsten gab. Im Quäkerheim hatte auch der Schwächste seine Heimmutter, zu der er am Abend ins Bett kroch – im Bundeskonvikt hatte er niemanden. Dass weibliche Wesen dort so völlig fehlten, ließ sie dafür in der Phantasie eine umso größere Rolle spielen: Wir tauschten erste pornografische Fotos, die aus ersten pornografischen Zeitschriften gerissen waren und die immer irgendwer zu bekommen in der Lage war. Und ich konnte mir nächtlichen Frieden, ja zusätzliche Gabeljausen damit erkaufen, dass ich nach dem „Nachtruhe“ des Erziehers Kriminalgeschichten mit eingehenden pornografischen Zwischenspielen erfand und mindestens eine Stunde lang erzählte. So war das Dasein im „Konvikt“ in jeder Hinsicht die optimale Vorbereitung auf das Dasein im „Bundesheer“. Es begann mit dem morgendlichen „Auf, Auf!“ des Erziehers, das wie das „Tagwache“ des Unteroffiziers dazu zwang, bei jeder Witterung alle Fenster aufzureißen, damit die aufgestellten Matratzen auslüften konnten. Es setzte sich, fast noch militärischer als beim Militär, damit fort, dass man barfuß am Gang vor dem Zimmer antreten musste, um gemeinsam einen Waschraum zu erreichen, bei dem es wie beim Militär zu diesem Zeitpunkt kein warmes Wasser gab. Ich bin der Überzeugung, dass die Waschräume von Internaten und Kasernen den Menschen mit ihrer morgendlichen Kälte das Waschen so weit wie irgend möglich abgewöhnen, selbst wenn ihnen am Abend heißes Wasser aus den Duschen entgegen rinnt. Die allgemeine Kühle der Zeit zwischen Schulschluss und heißem abendlichen Duschen wurde von den Zöglingen recht gleichförmig wahrgenommen. Malen, Basteln oder gemeinsames Singen gab es zwar nicht, dafür gemeinsames „Hausübungmachen“ unter absolutem Stillschweigen. Die „Freizeit“ war davon streng getrennt, und ich verbrachte sie mit Tischtennisspielen. Wenn es aufs Wochenende zuging, kam es zu einer Spaltung der Belegschaft: in die Buben, die am Wochenende zu Hause übernachten konnten und bereits ab Freitag sehnsüchtig darauf warteten und in diejenigen, die am Wochenende im Heim bleiben mussten. Man erkannte sie daran, dass sie stundenlang Tischtennis spielten, ausnahmsweise in Büchern lasen und abends die Decke über den Kopf zogen, um darunter zu weinen. Eine „Heimmutti“, sie zu trösten fehlte. Ich nahm, wie im Quäkerheim eine Mittelstellung ein: Ich traf meine Mutter jedes zweite Wochenende, wenn sie in der Lungenheilanstalt Alland dienstfrei hatte.
13. Zuhause
Erst 1952 gelang es meiner Mutter, einen Posten in Wien zu ergattern: Nebenberufliche Fürsorgeärztin in einer Dienststelle der Stadt Wien in der Gonzagagasse, in der Prostituierte auf Geschlechtskrankheiten überprüft wurden und Tuberkulöse in Reihenuntersuchungen früh erkannt werden sollten. Für meine Mutter bedeutete der neue Posten deutlich weniger Geld bei deutlich erhöhten Kosten. Aber wir konnten gemeinsam in ihrem Elternhaus in der Theresianumgasse leben: Die Geschwister Edith und Hertha, die die Wohnung der Eltern übernommen hatten, vermieteten meiner Mutter ein Zimmer und ich bewohnte ein zweites gemeinsam mit Ediths Sohn Alexander. Ich hatte nach zehn Jahren wieder ein „Zuhause.“ Dass ich es mit meinem um vier Jahre älteren Cousin teilen durfte, empfand ich als Glücksfall. Ich hatte mir immer einen älteren Bruder gewünscht. Und ein Cousin erfüllte diese Rolle vielleicht sogar noch besser, denn mit ihm gibt es keine Konkurrenz um die Liebe der Mutter. Ich schaute vorbehaltlos zu Alexander auf, wie jeder Zwölfjährige zu einem Sechzehnjährigen aufschaut – und er war bereit, sich als Dank dafür zu mir herabzulassen, auch wenn ein Sechzehnjähriger behauptet, mit einem Zwölfjährigen nichts anfangen zu können. So war er immerhin bereit, mich aufzuklären. Auch meine Mutter hatte sich dieser Verpflichtung irgendwann, ich weiß nicht mehr wann, unterzogen, aber was immer sie gesagt hatte, war graue Theorie gewesen – schließlich war sie eine Frau. Sie konnte nicht wissen, was Testosteron auslöste, auch wenn sie den Namen des Hormons kannte. Man konnte sie auch nicht fragen, was einen wirklich interessierte: Ob es gut war, wenn man jeden Tag onanierte? Ob man es nicht vielleicht dreimal täglich tun sollte, weil der Penis dadurch wuchs? Wie es sich anfühlte, wenn man bei einem Mädchen dorthin griff, wo man so gerne hin greifen wollte? Ob man es einfach tun oder abwarten sollte, bis sie einen dazu auffordert? Ob man, wenn man es getan hatte, mit einer Ohrfeige oder einem Kuss rechnen durfte? Voran mütterliche Aufklärung wird erst durch brüderliche Aufklärung mit Blut erfüllt und damit glaubwürdig. Wenn Alexander ein Mädchen eine „Weltkatz“ nannte, war das ungleich relevanter, als wenn meine Mutter es „wirklich hübsch“ oder sogar „schön“ fand. Die Fotos der Filmstars, die er aus Kinoprogrammen herausgerissen und an die Wand geheftet hatte – es waren Simone Signoret und Rita Hayworth – prägten meine Vorstellung von weiblicher Attraktivität, während meine Mutter völlig erfolglos auf Greta Garbo verwies.
96
Zuhause
Selbst ein Jahrzehnt später wollte ich unter allen Umständen die Frau kennenlernen, die Alexander „die Schönste, die ich kenne“ nannte: Die Schauspielerin Christine TaborProber sollte auch die schönste Frau sein, die ich je gekannt habe und wurde eine der „großen Lieben“ meines Lebens. Frauen, die meine Mutter mir besonders ans Herz legte, wurden das nie. Neben dieser prägenden Rolle als Schönheitsjuror und Aufklärer war Alexander der Beschützer, als den man sich den älteren Bruder wünscht, wenn man schon keinen Vater hat, mit dessen helfendem oder rächendem Einschreiten man drohen kann. Obwohl klein gewachsen, wusste er mit so großer Aggression, Schnelligkeit und Schlagkraft zuzuschlagen, dass niemand im Heim oder in der Schule sich mit ihm anlegte. Schon im Heim war ich stolz auf seine Schirmherrschaft gewesen, obwohl er sie nicht ausübte, sondern mich aufforderte, mir meinen eigenen Rang zu erraufen, wie ich das auch erfolgreich getan habe. Aber allein, dass es ihn im Stockwerk über mir gab, hat mir innere Sicherheit gegeben. Jetzt in der Theresianumgasse war er mir näher und mein Nutzen war entsprechend größer: Zwei Hausnummern weiter hatte eine Bombe nach Aufräumungsarbeiten eine „G’stätten“ hinterlassen, die uns als Fußballplatz diente und wie immer an solchen Plätzen – jetzt sind es die Drahtkäfige in öffentlichen Parks – gab es die „fremden“, die die „eingesessenen“ Kicker verdrängen wollten. Es brauchte einen einzigen Kampf zwischen Alexander und einem um einen Kopf größeren Achtzehnjährigen, um ein für alle Mal klarzustellen, dass auf dieser „G’stätten“ nichts gegen seinen Willen geschehen konnte. Alexanders Schnellkraft und Schlagkraft kam nicht von ungefähr: Im Hundertmeterlauf war er mit handgestoppten 11,2 Sekunden die Nummer zwei in Wien, aber auch im Kugelstoßen und im Weitsprung unter den besten. Im Feldhandball, das heute kaum mehr gespielt wird, brachte er es bis ins Nationalteam. Auch das hat mir rasend imponiert, denn natürlich spielte Sport auch in meinem Leben die Rolle, die er bei fast allen Buben, Burschen und Männern spielt: Testosteron will wenigstens Wettkampf, wenn Kampf aus zivilisatorischen Gründen (Gott sei Dank) nicht in Frage kommt. Ich brachte für Sport drei positive Voraussetzungen mit: unbändigen Ehrgeiz, daraus resultierende sehr gute Kondition und gute Reflexe. Dem standen zwei entscheidende Negativa gegenüber: Wie meine Mutter brauchte ich endlos, um in einer neuen Bewegung heimisch zu werden. Sie hatte drei Monate gebraucht, um Radfahren zu lernen, auch wenn sie später tausende Kilometer radelte – ich habe in dreißig Jahren Tennis nie eine richtige Rückhand erlernt. Vor allem aber bin ich beim Wettkampf rasend nervös – ich konnte nie gewinnen, sobald Gewinnen von mir erwartet wurde. Der Sport, in dem ich es am weitesten brachte, war dank des „Bundeskonvikts“ Tischtennis, das ich an all den Wochenenden durch all die Stunden trainiert hatte, die ich nicht zu Hause sein konnte. Ich spielte als Nummer 3 in der Mannschaft von WSV-Finanz, die immerhin Wiener Jugendmeister wurde. Allerdings nicht durch mich,
Alexander
sondern durch Viktor Hirsch, der einer der besten jungen Spieler Europas war und später vielfacher österreichischer Meister wurde. Zwar trainierte er in der ganzen Woche nicht so viel wie ich an einem einzigen Tag, aber er war im Gegensatz zu mir ein Bewegungstalent, konnte, wie Alexander, auf Gehsteigen Salti springen, wie das jetzt gelegentlich Fußballer nach Toren auf dem Rasen tun. Einmal fuhr er nach England und kam mit einem großen Pokal zurück. „Hast Du ein Tischtennisturnier gewonnen?“ wollte ich wissen. „Nein, ich hab’ bei einem Turmspringen mitgemacht“, gab er zu Antwort. Ich erreichte meine einzige gute Platzierung bei einem besseren Jux-Turnier, bei dem auf einen einzigen Satz gespielt wurde, den ich gegen jede Erwartung gegen die damalige Wiener Nr. 2 unter den Jugendlichen, den späteren Nationalspieler Karl Troll gewann. Aber wann immer es wirklich um etwas ging, verlor ich gegen Spieler, von denen mein Trainer erwartete, dass ich sie vom Platz schießen würde. Meine Nerven waren absolut nichts für einen Wettkampfsportler – ich sollte später erfahren, dass sie auch nichts für einen Studenten sind, der Prüfungen bestehen muss. Im Stress erfolgreich zu agieren ist offenbar eine eigene Qualität, die mir so sehr abgeht, wie sie meine Mutter ausgezeichnet hat.
Alexander Dass mein Cousin Alexander diese Qualität offenbar besaß, ist erstaunlich, denn das Schicksal schien ihm weder innere Ruhe noch sonderliches Selbstvertrauen in die Wiege gelegt zu haben. Da er für mein Leben an so vielen Stellen eine entscheidende Rolle spielte – eben die des älteren Bruders – will ich ausführlicher auf seine Lebensgeschichte eingehen. Eigentlich war es ein Wunder, dass er geboren wurde. Denn Elsa Reiner hatte ihren beiden schwerhörigen Töchtern Hertha und Edith auf das Eindringlichste von einer Ehe abgeraten – sie würde vorhandenes Unglück nur potenzieren. Die jüngere Hertha, wiewohl bildhübsch und halb so schwerhörig, hatte sich dem schweigend gefügt: Ein einziges Mal in ihrem Leben hatte sie sich vergeblich und selbstverständlich platonisch in einen verheirateten evangelischen Pastor verliebt und war danach ein lautloser Schatten geworden und irgendwann, von mir kaum wahrgenommen, erloschen. Edith hingegen, nahezu taub und alles eher als hübsch, hatte sich mit aller Kraft gegen das Schicksal, das ihre Mutter ihr vorbestimmen wollte, aufgelehnt. Obwohl der Logopäde, den die Mutter beiden Mädchen zu Verfügung stellte, es für aussichtslos gehalten und schon das Erlernen der Zeichensprache empfohlen hatte, erlernte sie durch eisernes Training zu sprechen. Sie betonte die Worte zwar auf eine höchst seltsame Weise, zerdehnte und verzerrte Vokale und Umlaute und zwängte Konsonanten gelegentlich unverständlich dazwischen ein – aber sie sprach und man verstand, was sie sagte.
97
98
Zuhause
Obwohl sie nie eine Schule besuchen konnte, las sie sich erstaunlich viel Bildung an und führte mit ihren jüngeren Geschwistern sogar politische Diskussionen, in denen sie sich als ebenso klug wie bodenständig erwies. Mit der gleichen Energie und Zähigkeit suchte und fand sie einen Mann. Albrecht Traxler von Schrollheim war ein Berufsoffizier aus verarmtem Adel. Mit weniger als 1,70 Meter für einen Mann eher kleingewachsen, aber von sehr angenehmen Gesichtszügen, war er der wohlhabenden Edith ein absolut pflichtgetreuer Ehemann und Alexander ein ausnehmend liebevoller Vater. In den letzten Kriegswochen war er auf Heimaturlaub in Wien und seine Frau und alle Verwandten und Bekannten – es gab unter ihnen keine Nazis, die immer noch auf den Endsieg hofften – flehten ihn an, doch einfach zu bleiben und sich zu verstecken. Aber obwohl er genauso wenig ein Nazi war und am besten wusste, dass die endgültige Niederlage unmittelbar bevorstand, sah er es als seine Pflicht an, in diesem Moment an der Seite seiner Truppe zu stehen – ähnlich wie er es als seine Pflicht angesehen hatte, seiner nicht sehr schönen Frau absolut treu zu sein. Unter Mühen, so erzählten Kameraden später, sei es ihm gelungen, sich zu seiner Kompanie nach Jugoslawien durchzuschlagen. Dort führte er sie zwei Tage lang im Kreis, um sie kampflos – ohne Verlust an Leben – in die Gefangenschaft des vorrückenden Feindes zu übergeben. Er wurde, wie die gesamte Truppe, interniert und starb 1945 in einem jugoslawischen Gefangenenlager an Ruhr. Ich habe sein Verhalten Jahrzehnte später mit dem Rudolf Kirchschlägers verglichen, der damals gerade für die Wahl zum Bundespräsidenten kandidierte. Der 30-jährige Hauptmann warf sich in den gleichen letzten Kriegstagen mit 1200 18-jährigen Fahnenjunkern der Roten Armee entgegen: 200 fielen, 800 wurden verwundet. So sehr mir Kirchschlägers Mut während der russischen Besetzung Prags imponierte – er öffnete die Botschaft für Dissidenten und sammelte Gefährdete mit seiner Dienstlimousine ein – sosehr habe ich Albrecht Traxlers Verhalten während der letzten Kriegstage dem seinen vorgezogen. Die Aggression der SPÖ gegen Berufssoldaten, schon gar gegen solche, die diesen Beruf aus familiärer Tradition ergriffen haben, war immer unsinnig. Die Art und Weise wie Albrecht Traxler seine Truppe übergab, war so wenig zufällig, wie der Umstand, dass adelige Berufsoffiziere die Hauptrolle beim 20. Juli spielten. Für Edith und fast noch mehr für Alexander brach mit Albrechts Tod die Welt zusammen. Edith war klar, dass sie nie mehr einen vergleichbaren Mann finden würde – und Alexander war immer ein „Vater-Sohn“ gewesen. Jetzt erhielt das für ihn nicht weniger, sondern noch viel mehr Bedeutung. Dass seine Mutter nicht besonders schön war, war ihm bis dahin kaum aufgefallen – sein Vater hatte sie so behandelt, als ob sie es wäre. Ihre extreme Schwerhörigkeit und verzerrte Sprache war zwar natürlich auch Alexander nicht entgangen, hatte Edith aber vor ihm so wenig wie vor Albrecht herabgesetzt. Kinder, die zum Spielen zu ihm gekommen waren, hatten aus Respekt vor seinem Vater nie über ihr Gebrechen gesprochen.
Alexander
Jetzt aber, ohne Albrecht, kam es immer öfter vor, dass sie, wie das bei Kindern so roh wie normal ist, drüber lachten, es nachahmten, Witze darüber rissen. In einem Alter, in dem die Meinung anderer Kinder immer wichtiger für die eigene wird, begann sich Alexander, so sehr er seine Mutter liebte, für sie zu genieren. War er, solange es seinen Vater gab, ein besonders lebhaftes Kind gewesen, so verschloss er sich nun zu einem schweigsamen, trotzigen Kind. In der Pubertät verstärkte sich das naturgemäß: Er muckte gegen seine Mutter auf und wurde von einem schweigsamen, trotzigen zu einem schlimmen Kind und vor allem schlimmen Schüler – was bis heute mit schlechteren Noten verbunden ist. Seine hilflose Mutter suchte Hilfe bei einer „Erzieherin“ und fand sie in einer Frau mit dem einprägsamen Namen Zagorska, von der ich nur weiß, dass sie nach Ablauf eines Jahres, das sie Alexander erzogen hatte, triumphierend erklärte: „Jetzt habe ich ihn gebrochen.“ Er war weiterhin ein schlechter Schüler, aber er muckte nicht mehr auf, sondern hörte grundsätzlich auf, Gefühle zu zeigen – was immer in ihm vorging, verbarg er hinter einer Wand ironisch gefärbter Gleichgültigkeit. Das sollte ihn zwanzig Jahre später die Zuneigung seiner Frau kosten, die er aufs Zärtlichste liebte und der er dennoch nie eine einzige Zärtlichkeit zu sagen im Stande war. Irgendwann hielt sie seine angelernte Gleichgültigkeit für echt und trennte sich von ihm. Für mich, einen Zwölfjährigen war freilich auch diese ironische Gleichgültigkeit imponierend – sie erinnerte an amerikanische Filmhelden wie Robert Mitchum oder James Dean, die zweifellos sein Vorbild waren. Ich bewunderte Alexander dafür restlos und hoffte vergeblich, einmal wie er zu werden. Auch an der Schule gewann er dafür Bewunderung oder mindestens Respekt. Insbesondere bei Burschen, die auch Probleme verbargen und als „schlimm“ galten: Oswald „Ossi“ Wiener war der mit Abstand schlimmste davon und musste die Schule letztlich verlassen, nachdem er unter den Tintenfasslöchern der Holzpulte Papier entzündet hatte, so dass Rauchsäulen aus ihnen hochstiegen. Bis dahin war er Alexanders bester Freund und auf diesem Umweg mein größtes Vorbild. Entsprechend seltsam war es für mich, ihm 1968 als Gerichtssaalberichterstatter im Wiener Landesgericht erstmals nach sechzehn Jahren wiederzubegegnen: Die Staatsanwaltschaft warf ihm erfolgreich Religionsstörung vor und wollte erfolglos als Körperverletzung geahndet wissen, dass er auf dem Katheder eines Universitätsprofessors jemandem aufs nackte Gesäß geschlagen hatte. Wegen seines Romans „Die Verbesserung von Mitteleuropa.“ wurde er damals in einer von der Kronen Zeitung aufgeheizten öffentlich Meinung als „perverses Genie“ und „Uniferkel“ gehandelt, während er heute, nach Deutschland ausgewandert und nach Jahren heimgekehrt und in der Steiermark verstorben, als intellektueller Kopf der „Wiener Gruppe“ gilt.
99
100
Zuhause
Ich habe zumindest versucht, in meinem Prozessbericht nicht allzu parteiisch zu sein. Schließlich war er mit zwölf auf dem Umweg über Alexander für mich der wichtigste kulturelle Mentor gewesen, als ich versuchte, mich diesbezüglich von meiner Mutter abzunabeln: In seiner Rebellion gegen die klassische Musik hatte er sich für Jazz aus New Orleans begeistert und diese Begeisterung auf meinen Cousin übertragen, der sie mir mit guten Argumenten gegen meine Mutter weitergab: Spontane Kreativität habe das ständige, brave Wiederholen klassischer Melodien abgelöst. Durch Monate hörten wir in unserm Zimmer ständig neue, von Oswald Wiener geborgte Jazz-Platten an. Von ihm lernte ich Mahalia Jackson Ella Fitzgerald vorzuziehen, weil er sie Alexander als die weit bessere Vokalistin empfahl. Später lehrte mich Alexander in Wieners Gefolge Fatty George und den Art Club schätzen, wo Friedrich Gulda Jazz dann auch für meine Mutter adelte. Bis in meine neue Schule in der Astgasse in Wien 14 setzte sich der Einfluss Oswald Wieners fort: In einer Zeit, in der jede Klasse, die auf sich hielt, ihr eigenes Jazz-Orchester gründete, konnte ich mit meiner Kenntnis des New-Orleans-Jazz punkten und damit meine belächelte Vorliebe für Schubert vergessen machen. Dass ich diese Schule am westlichen Rand Wiens besuchte, obwohl sie von der Theresianumgasse gute 40 Straßenbahnminuten entfernt war, hing damit zusammen, dass meine Mutter kurze Zeit hoffte, Primaria einer Heilanstalt für tuberkulöse Alkoholiker zu werden, die in Laab am Walde stationiert sein sollte – von dort wäre es dann die nächste Mittelschule gewesen. Aber wie meist, wenn meine Mutter vor einem Karrieresprung stand, wurde nichts daraus. Zwar sollte auch die Astgasse nicht meine letzte Schule sein, aber meine Anfänge dort gestalteten sich um vieles besser als in der Hagenmüllergasse – wahrscheinlich, weil ich mittlerweile auch ein besserer Schüler war: Ich hatte meinen Lern- und LehrstoffRückstand aus dem Quäkerheim aufgeholt – wusste endlich, dass man „nämlich“ ohne, „während“ aber mit h schreibt und von welch überragender Bedeutung dergleichen für einen Aufsatz ist. War ich in der Hagenmüllergasse einer der schlechtesten Schüler gewesen, so bewegte ich mich in der Astgasse auf ein „Vorzugszeugnis“ zu. Mit einer letzten Hürde: In Mathematik wollte es nicht und nicht klappen. Auf Vierer folgten immer wieder Fünfer. Dabei verehrte ich meinen Mathematiklehrer, Professor Walter Eschig, wie keinen anderen. In meiner vagen Erinnerung (obwohl ich Zeichnungen von ihm angefertigt habe, von denen ich glaube, dass sie ihm ähnlichsehen) war er eher groß, sehr schlank und hatte ein ausnehmend fein geschnittenes Gesicht, zu dem sein ausnehmend gepflegtes Hochdeutsch passte. Eschig erschien mir die dunkelhaarige Ausgabe meines Vaters und auch meine Mutter nannte ihn „die bei weitem kultivierteste Erscheinung unter Deinen Lehrern“. Ich wollte unbedingt „sehr gut“ oder wenigstens „gut“ bei ihm abschneiden. Zu Hause hatte ich auch keine Probleme, die Beispiele, die er uns vor Schularbeiten über-
Alexander
reichlich als „Hausübungen“ aufgab, rasch und richtig zu lösen. Aber an den Tagen der „Schularbeit“ konnte ich morgens nichts essen oder bestenfalls ein Knäckebrot hinunterwürgen. Und noch jedes Mal traf ich auf der WC-Anlage der Schule mit den fünf, sechs schwächsten Schülern meiner Klasse zusammen und starrte mit ihnen unter unendlichem Harndrang, der sich dennoch erst nach vielen, langen Sekunden in einem befreienden Strahl löste, auf die schwarze Urinoir-Wand des Pissoirs, die sich wenige Minuten später in eine schwarze Wand in meinem Kopf verwandelte: Ich war nicht einmal im Stande, das „erste Beispiel“ der Schularbeit auch nur bewusst zu lesen, geschweige denn zu verstehen. Irgendwann, meist erst in der zweiten Hälfte der Stunde, begann ich endlich zu rechnen, weil ich beim zehnten Mal Lesen ein Beispiel gefunden hatte, das exakt einem der zehnmal geübten Hausübungsbeispiele glich, so dass ich es trotz Blackouts zu lösen vermochte. Ein zweites oft bestenfalls bis zu Hälfte, denn die Panik, nichts zu verstehen, wurde noch jedes Mal von der Panik, nicht fertig zu werden abgelöst. Wurde ich dennoch fertig, wurde es ein „Genügend“, wenn nicht, dann eben ein „Nicht genügend“. Als ich schon Gefahr lief, im Zeugnis kein Genügend mehr zu erreichen, erreichte meine Mutter, dass Eschig am Nachmittag mit mir allein mehrere Beispiele durchging. „Er kann es tadellos“, sagte er, „sein Versagen ist mir unverständlich.“ Das blieb weitgehend so, solange er mein Lehrer war. Während andere Lehrer, voran der Deutsch- und der Französischlehrer mir zunehmend Freundlichkeit entgegenbrachten, blieb Eschigs Verhältnis zu mir – anders als meines zu ihm – so distanziert wie zu allen seinen Schülern, hatte er doch bei Schülern wie Eltern gleichermaßen den Ruf, zwar „streng, aber gerecht“ zu sein. Vor allem dieser letzten Eigenschaft wegen wählte ich ihn zu meinem „Verteidiger“, als ich als „Beschuldigter“ in ein „Disziplinarverfahren“ verwickelt wurde. Im Verlauf der fünften Klasse war zu unserer kulturellen Fortbildung ein Besuch des Filmes „Matthäus-Passion“ im nahen Hietzinger Kino angesetzt worden. In unseren Augen bestand der unbestreitbare kulturelle Höhepunkt darin, dass er gemeinsam mit den Mädchen des nahen Mädchengymnasiums Wenzgasse stattfinden sollte. Natürlich durch den Mittelgang nach Geschlechtern getrennt, aber zwei Stunden lang im selben Raum. Das konnte uns nur in helle Aufregung versetzen. Mein Freund Heinz Hintermayer oder mein Freund Heinrich Litschauer – ich weiß nicht mehr, wer von beiden, denn ich war nicht dabei – gebar die geniale Idee, Knallerbsen zu werfen, um die Mädchen auf uns aufmerksam zu machen. Ich erfuhr davon durch das Raunen, das durch unsere Reihen ging, als wir auf dem Weg zum Kino waren. „Ihr traut’s Euch eh nicht“, entschlüpfte mir eine, wie sich zeigen sollte, lebensgefährliche Bemerkung. Denn Heinz Hintermayer sollte, wie ich aus dem Verlauf des Disziplinarverfahrens erfuhr, in einer Trafik, die wir passierten, tatsächlich eine Knallerbse erstehen. Dass Heinrich Litschauer sie warf, war mir klar, als ich den Knall hörte und sich der halbe
101
102
Zuhause
Saal nach ihm umdrehte, weil seine Wurfhand im Lichtkegel des Filmprojektors zu sehen war. Heute, im Zeitalter der Attentate, hätte daraus tatsächlich Gefahr resultieren können. Damals folgte nur Kichern seitens der Mädchen – und seitens der Schule ein Disziplinarverfahren. Freilich ein Verfahren unter erschwerenden politischen Bedingungen: Da die Wenzgasse, mit der wir den Saal geteilt hatten, eine eindeutig „schwarze Schule“ mit einer „schwarzen“ Direktion war, sah sich der „rote“ Direktor unserer eindeutig „roten Schule“ genötigt, „aufs Energischste“ einzuschreiten, um den Verdacht zu zerstreuen, er könnte einen derart empörenden Vorfall in Gegenwart des schwarzen Lehrkörpers und ihm anvertrauter in Zukunft zweifellos schwarz wählender Mädchen auf die leichte Kappe nehmen, statt ihn mit dem gebührenden Ernst zu ahnden. Schließlich konnte, was während der Matthäus-Passion passierte, als Religionsstörung angesehen werden. Selbst wenn es unser Direktor nicht gleich als solche angesehen haben sollte, wurde er durch die wenigen schwarzen Lehrer unserer Schule – erst später erfuhr ich, dass Walter Eschig an ihrer Spitze stand – hinreichend darauf aufmerksam gemacht. Wenn unsere „rote Schule“ nur den geringsten Verdacht an sich hängen ließ, nicht mit der äußersten Strenge vorgegangen zu sein, so lautete das Gerücht, konnte das eine parlamentarische Interpellation seitens der ÖVP auslösen. Denn zwei Beteiligte, Heinz Hintermayer und ich, gehörten dem Verein sozialistischer Mittelschüler an. Ich weiß bis heute nicht, wie ich unter die Beteiligten geraten bin. Ob jemand meine Bemerkung gehört hatte? Ob Litschauer oder Hintermayer sie erwähnten? Ob sie sie in ihrer Not vielleicht breiter ausgeführt hatten? Jedenfalls war ich plötzlich gleichrangiger Mittäter. Der Disziplinarsenat meiner Schule – ich nehme an, ein solcher ist es formal gewesen – stand damit vor einer Entscheidung, die den roten Direktor an die Grenzen seiner Belastbarkeit bringen musste: Litschauer – formal gesehen als Knallerbsen-Werfer der Haupttäter – stammte aus einer bekannt konservativen, katholischen Familie – ihn zu verurteilen bannte unmöglich die Gefahr, als rote Schule der Geringschätzung einer Religionsstörung bezichtigt zu werden. Gleichzeitig aber konnte Heinz Hintermayer, der sich ideal dazu geeignet hätte, unmöglich von der Schule fliegen, denn er stammte zwar zweifelsfrei aus einer roten Familie, aber sein Vater war „Bundeslastverteiler“, was heute der Chef der Verbundgesellschaft wäre, und bewohnte eine Hietzinger Villa gemeinsam mit Sektionschef Rudolf Fischer, dem Vater des späteren Bundespräsidenten Heinz Fischer. Hintermayer zu feuern hätte den Direktor entscheidenden Rückhalt in der roten Reichshälfte gekostet – der Verbund-General war für seine Durchschlagskraft bekannt. Unter dem Vorsitz meines roten Direktors gelangte der Disziplinarsenat nach Anhörung meines schwarzen „Verteidigers“ Walter Eschig daher zu folgendem salomonischen Urteil: Heinz Hintermayer wurde „strengstens verwarnt“, durfte aber an der Schule bleiben. Heinrich Litschauer musste fliegen, hatte er die Erbse doch geworfen, war
Alexander
aber ein ungeeignetes schwarzes Opfer. Blieb ein einzig geeignetes „rotes“ Opfer, um strengste Ahndung einer allfälligen Religionsstörung zu demonstrieren: Ich. Wie Litschauer wurde ich der Schule verwiesen. Formal konnte das schwer mit meiner Bemerkung begründet werden – also wurde es damit begründet, dass ich der wahre „Kopf “ des Trios gewesen sei. „Wie kommen Sie denn darauf? Das hat doch niemand, auch nicht Litschauer oder Hintermayer behauptet?“ wollte meine Mutter vom Direktor wissen. „Ihr Sohn war doch der intelligenteste der drei“, soll der geantwortet haben. „Und Sie halten es für ein Zeichen besonderer Intelligenz, in einem Kinosaal Knallerbsen zu werfen? Ich hätte es eher für saublöd gehalten“, versuchte meine Mutter vergeblich einzuwenden. Es blieb beim Hinauswurf. Ich habe geglaubt, dieses Verfahren noch einmal mitzuerleben, als ich l996 als angeblicher Anführer eines Gangstersyndikats unter der Anklage stand, meinen Freund Franz K. angestiftet zu haben, dessen Freund, den Staatsanwalt Wolfgang M. anzustiften, das Strafverfahren gegen die Russlandkauffrau Walentina Hummelbrunner rechtswidrig einzustellen. K., das war das Einzige, was feststand, hatte von Hummelbrunner für diesen Dienst sechs Millionen Schilling verlangt, war abgehört und verhaftet worden. Doch die Anklage war überzeugt, den „Kopf “ dieser Tat zu kennen: Mich. K. hatte nichts dergleichen behauptet, obwohl es für ihn entlastend gewesen wäre. M. hatte nichts dergleichen behauptet. Genauso wenig vermutete es Hummelbrunner. Dennoch hatte man mich nicht nur zum gleichrangigen Mittäter, sondern zum „Kopf “ erhoben.
103
14. Freundschaften und Lieben
Die Schule, in die der Hinauswurf aus der Astgasse mich verschlug – die Realschule Marchettigasse in Mariahilf – bot für sich gesehen nicht allzu viel Spannendes. Keinen Eschig, sondern einen besonders freundlichen Klassenvorstand, der eines meiner Lieblingsfächer – Französisch – unterrichtete: Ich war darin der Beste und erhielt dafür eine Auszeichnung der französischen Botschaft. Dass so viele Journalisten, die in den 1950er Jahren Mittelschulen besucht hatten und daher in den 1970er-Jahren in ihren Medien in führende Stellungen gelangt waren, der Schule dennoch so kritisch gegenüberstanden, lag daran, dass man damals immer auch mit Typen konfrontiert war, die dem Raritätenkabinett entkommen schienen. Bei uns in Gestalt des Geschichtsprofessors K., der darüber hinaus das Pech hatte, ein Gnom mit schiefem Gesicht zu sein. Sein Unterricht bestand darin, mindestens zehn Jahreszahlen pro Stunde an die Tafel zu schreiben und zu erwarten, dass wir sie am Ende des Jahres mit Ereignissen verbanden. „Hams was g’lernt Lingens?“, leitete er meine erste Zwischenprüfung schiefmäulig ein. „Jawohl, Herr Professor.“ „Gut. Dann setzn’s sich wieder. Ich werd Sie prüfn, wenn’s nichts g’lernt habn.“ Nach einem Monat gab ich jedes Mitlernen auf und verließ mich auf seine Schwerhörigkeit: Wie alle anderen ließ ich mir jede geforderte Jahreszahl einsagen und da ich mit Klaus Draxler einen der Klassenbesten zum Freund und Nachbarn hatte, der manches wirklich wusste und den Rest schnell genug nachschlug, beendete ich das Jahr mit einem „Sehr gut“ in Geschichte und kann mit Sicherheit sagen, dass ich von diesem Jahr kein einziges historisches Ereignis auch nur entfernt mitbekommen habe. Klaus’ außergewöhnliches Wissen sollte allerdings auf einem anderen Weg erhebliche Bedeutung für mich erlangen. Gemeinsam mit drei weiteren Schülern bildete er ein Rate-Team, das an einem Wissenswettbewerb des österreichischen Hörfunks teilnahm, und ihn vor allem dank seines Wissens auch gewann. Zweitbester des Teams war ein junger Mann, der unser beider enger Jugendfreund wurde: Erhard Busek. Wenn sich Busek später, als er mit Josef Taus die ÖVP-Spitze bildete, eine „Knackwurst mit Brillen“ nannte, so war er damals, als ich ihn näher kennen lernte, bestenfalls ein Frankfurter Würstl – so schlank, dass man zweimal hinschauen musste. Zugleich, und nur das verhinderte unsere restlose Übereinstimmung, unendlich katholisch: Er konnte und kann nicht verstehen, wenn auch akzeptieren, dass man ungläubig sein kann – ich kann zwar akzeptieren, nicht aber verstehen, wie man an ein überirdisches Wesen glauben kann, das die Welt geschaffen hat und sie lenkt. So sehr mich die Wunder
Freundschaften und Lieben
der Natur (für ihn der „Schöpfung“) bis heute in ungläubiges Staunen versetzen und zu tiefster Bewunderung herausfordern, genügt mir diese Bewunderung völlig. Es ist auch für mich atemberaubend, dass sich aus dem Urknall ein Universum und aus anorganischen Substanzen organisches Leben entwickelt hat, das dank der Evolution den Menschen hervorbrachte. Aber ich sehe nicht, worin der Sinn liegen soll, mir vorzustellen, dass wir das alles einem „Schöpfer“ verdanken, zu dem ich deshalb beten soll. Es genügt mir, dankbar dafür zu sein, dass ich lebe und dank meiner Sinnesorgane in der Lage bin, die Natur („die Schöpfung“) anbetungswürdig schön zu finden. So sehr ich die tiefe Gläubigkeit der „Dekanin“ zu schätzen wusste, ist mir die tiefe Gläubigkeit eines Erhard Busek ein Problem. Denn Ursula Dekan war eben eine Bäuerin mit Volksschulbildung und kein Intellektueller, der Freud und Popper gelesen hatte. Politisch stimmten wir freilich fast immer überein, und die Wiener ÖVP unter Busek war die beste, fortschrittlichste Volkspartei, die ich kenne und die einzige, die ich jemals gewählt habe. Dass Busek sich von der neuen Volkspartei des Sebastian Kurz abgewendet hat, hätte türkisen Wählern zu denken geben sollen. Wenn ich mich frage, was mir die Realschule Marchettigasse abseits meiner lebenslangen Freundschaft zu Klaus Draxler und Erhard Busek noch geboten hat, dann war es der Umstand, dass sie im Gegensatz zur Astgasse nur 15 Straßenbahnminuten von meinem Elternhaus entfernt war. Das spielte insofern eine große Rolle, als die (damalige) Straßenbahnlinie 13, mit der ich sie erreichte, just an dieser Stelle die (damalige) Straßenbahnlinie 57 kreuzte, mit der meine erste große Liebe, Christl Glienke in ihre Schule in der Rahlgasse fuhr. Ich brauchte morgens also nur wie bisher aufzustehen, um täglich zu ihr zuzusteigen und an sie geschmiegt, die vier Stationen bis zur Rahlgasse und dann zurück zur Marchettigasse zu fahren. Zu Mittag passte ich sie neuerlich ab, stieg wieder zu und fuhr mit ihr bis zum Auer-Welsbach-Park, in dessen Nähe sie wohnte. Kennengelernt hatten wir einander, wie sich das in den Augen meiner Mutter gehörte, in der Tanzschule Elmayer. Man stand einander dort, an gegenüberliegende Wände des Raumes gepresst, aufgeregt gegenüber, sollte aber gemessenen Schrittes aufeinander zugehen und mit einer Verbeugung um den nächsten Tanz bitten. Ich scharrte in den Startlöchern, denn ihr Pferdeschwanz gefiel mir besser als die braven, toupierten Frisuren der meisten Mädchen und sie lehnte auch ein wenig lockerer an der Wand. Ich erreichte sie prompt rechtzeitig, aber Elmayer pfiff uns zurück – Sprinten sei unzulässig. Trotzdem erreichte ich Christl auch beim zweiten Mal als Erster, denn sie hatte die Gelegenheit genützt, sich mir genau gegenüber einzureihen. Es war, wie das glaube ich meistens ist, Zuneigung auf den ersten Blick. (Wissenschaftler wollen erkundet haben, dass Sekundenbruchteile genügen.) Eine dauerhaftere Beziehung kann daraus werden, wenn man zu seiner Überraschung feststellt, dass die Frau, die man attraktiv gefunden hat, auch noch ähnlich denkt wie man selbst.
105
106
Freundschaften und Lieben
„Lehnen Sie nicht so an der Wand wie gewisse Damen in der Kärntnerstraße“, kritisierte Willy Elmayer-Vestenbrugg, der uns bekanntlich auch „Benehmen“ beibringen sollte, in der dritten oder vierten Stunde. Worauf drei Mädchen – darunter Christl – und drei Burschen – darunter ich – den Saal verließen. „Das brauchen wir uns öffentlich nicht sagen zu lassen“, sagte einer der Burschen, der leider nicht ich war, fast unisono mit Christl. Es zog nach sich, dass meine Tanzkenntnisse beim Foxtrott geendet haben – was mir heute manchmal leidtut. Denn mein unendliches Bewegungsantitalent hat verhindert, dass ich, wie fast alle Frauen, die ich kannte, Tanzen einfach durch Zuschauen und Nachmachen lernte. Boogie erlernte ich Jahre später nur, indem ich mich am oberen Querbalken einer Türe festhielt und viele Wochen hindurch stundenlang einen bestimmten Boogie-Schritt trainierte. 261 Werktage hindurch, jeweils zwischen ca. zwei Uhr Nachmittag – etwa um diese Zeit erreichten wir Christls Wohnung in der Jheringgasse in Fünfhaus – und frühestens um 16 Uhr dreißig – da erreichte sie auch Christls von der Arbeit heimkehrende Mutter – trainierten wir gemeinsam einander zu lieben, ohne miteinander zu schlafen. Für etwas jüngere Leser ist das Gott sei Dank unvorstellbar: Man küsst einander, liegt miteinander auf einem Bett, betreibt „heavy petting“ und hält im letzten Augenblick immer aufs Neue inne, weil „es“ derart verboten ist. Für mich war es das zwar längst nicht im gleichen Ausmaß wie für Christl, aber auch ich hatte von meiner Mutter mitbekommen, dass es ein Verbrechen sei, ein Mädchen womöglich zu schwängern, wenn man nicht entschlossen und in der Lage war, es zu heiraten. Zeitlebens stand meine Mutter daher auf dem gutbürgerlichen Standpunkt, dass es die Aufgabe nicht mehr so junger (nicht mehr gebärfähiger) Frauen sei, junge Männer in die körperliche Liebe einzuführen – aber diese Chance hatte sich mir leider nicht eröffnet. Ich hoffte vergeblich auf Christls versiegenden Widerstand. Für sie aber war das Verbot ein absolutes. Ihre Mutter, eine Kriegswitwe, die als Sekretärin für Wiens evangelischen Bischof arbeitete, hatte ihr eingetrichtert, dass auch Präservative reißen könnten, so dass ich chancenlos war, als ich sie aus der Tasche zog, nachdem ich zwei Stück davon, minutenlang wartend, dass kein anderer Kunde in der Apotheke und der männliche Apotheker frei war, erstanden hatte. Es sollte mich unglaublich verblüffen und in meiner Menschenkenntnis verunsichern, dass ich ein Jahr später, als ich schon nicht mehr mit Christl zusammen war, von meiner Mutter erfuhr, dass Christls Mutter ihr ganz glücklich gestanden hätte: „Ich habe eigentlich nicht geglaubt, dass ich es so lange hinausschieben kann.“ Eigentlich ist meine Liebesbeziehung zu Christl, die wahrscheinlich zu einer eher guten Ehe geworden wäre, letztlich nur an diesem langen Zeitraum immer wieder im letzten Moment verhinderter sexueller Erfüllung gescheitert. Ich beneide daher die jungen Leute, die heute so selbstverständlich miteinander ins Bett gehen, wie Christl und ich miteinander ins Kino gegangen sind. Zumindest an sexueller Verweigerung oder mangelnder Erfahrung scheitern große Lieben heute nicht.
Freundschaften und Lieben
Wenn heute über die politischen Umwälzungen gesprochen wird, die das berühmte 1968er-Jahr mit sich gebracht habe, dann finde ich sie immer nebensächlich neben der Veränderung, die die Pille bewirkt hat – sie hat wirklich ein neues Zeitalter eingeläutet.
107
15. Der Spieler und die verspielte Hinterbrühl
Matura bescheinigt angeblich Reife. Als ich 1957 an der Marchettigasse die Matura ablegte, – mit einer Drei auf meine Deutscharbeit, die die Kommission auf eine Zwei hinaufsetze, aber einer Eins auf die Mathematikarbeit – eine Maturareise und eine erste Liebesnacht hinter mir hatte, glaubte ich mich reif für die erste Berufsentscheidung meines Lebens: Ich inskribierte an der Akademie (heute Universität) für Angewandte Kunst. Nicht, weil ich Künstler, sondern weil ich in den Augen von Alexander Weißberg, reich werden wollte oder jedenfalls sollte: „Industrial Designer“ schien mir ein guter Weg dorthin. Ich weiß nicht mehr, wann Weißberg nach dem Krieg wieder in unser Leben – ins Leben meiner Mutter – getreten ist. Jedenfalls war es für mich vorerst mit der Einladung in ein Restaurant verbunden, das wir uns davor nie leisten konnten – den „Franziskaner“ am Franziskanerplatz. Weißberg war offenkundig ein reicher Mann. Er hatte sich doch noch erfolgreich bis Kriegsende in Polen verstecken können, war dann aber aus irgendeinem anderen Land – vielleicht aus Österreich – nach Schweden ausgewandert. Jedenfalls kursierte darüber die Geschichte, dass er sich beim Konsulat erkundigt habe, was denn geeignet sei, seine Chancen in Schweden aufgenommen zu werden, zu erhöhen. Ein seltener Beruf sei von Vorteil sei ihm geantwortet worden. „Vielleicht König?“, habe er zurückgefragt. Wenn sie nicht wahr ist, ist diese Geschichte gut erfunden, denn sie war typisch für Weißbergs Reaktionen. Seine Schlagfertigkeit verband sich immer mit Witz. Die Schweden haben ihn zwar nicht als König, aber als Physiker ins Land gelassen und er hat von dort aus ein für ihn typisches Geschäft gemacht: Er wusste, dass irgendwo in Polen Motoren für deutsche Junkers-Flugzeuge lagerten, und erwarb sie zum Schrottpreis. Denn er wusste gleichzeitig, dass in Spanien Rümpfe für die gleichen Junkers-Flugzeuge lagen, die er ebenfalls zum Schrottpreis erwarb. Danach verkaufte er dem polnischen Staat die kompletten Flugzeuge zu einem, wie er ihnen versicherte, sehr günstigen Preis. Als Polens Regierung draufkam, zu welchem Preis er die in Polen gelagerten Motoren gekauft hatte, war sie so wütend, dass sie den zugesagten Kaufpreis nicht überwies. Es kam zu einem Prozess, den Weißberg in Schweden prompt gewann. Als Polen weiterhin nicht zahlte, beschlagnahmte die schwedische Justiz ein polnisches Kriegsschiff, das in einer schwedischen Werft auf seine Reparatur wartete. Kurzfristig, so lachte Weißberg, sei er damit Eigentümer eines Kriegsschiffes gewesen – dann war offenkundig der ihm zustehende Kaufpreis eingetroffen.
Der Spieler und die verspielte Hinterbrühl
Alle seine Geschäfte – später baute er in Paris Hochhäuser – bewegten sich in dieser Größenordnung und waren mit einem Risiko dieser Größenordnung behaftet. Weißberg besaß immer viele Millionen oder fast nichts. „Stell Dir vor, Alex ist nach Wien gekommen, um für sechs Millionen Schilling die Hinterbrühl zu kaufen und sie uns zu schenken“, erzählte mir meine Mutter eines Tages aufgeregt. Am nächsten Tag hatte er den gesamten Betrag im Casino verspielt. Ich wusste, dass er ein Spieler war – er verheimlichte es auch nicht, war aber wütend, wenn man es ihm vorwarf: „Ich verspiele nur, was ich mir erarbeitet habe.“ Dass er diesen besonderen Betrag verspielte, hatte freilich mit seinem besonderen Verhältnis zu meiner Mutter zu tun: Ihr die Hinterbrühl zu kaufen hätte ein Bekenntnis zu ihr, fast einen Heiratsantrag bedeutet. Aber Weißberg war mit Sophia Cybulska verheiratet, so sehr er behauptete, dass dies eine reine Scheinehe zum Schutz vor den Nazis gewesen sei. Weißberg wollte diese Verbindung nicht auflösen. Wahrscheinlich, weil er Sophia Dank schuldete – den Eindruck, sie zu lieben, machte er weder auf meine Mutter noch auf mich. Aber er machte auf mich auch nicht den Eindruck, meine Mutter zu lieben. Dass er auch ihr etwas schuldete, meinte ich sehr wohl. Letztlich war es sein Anruf und Auftrag gewesen, dem sie Auschwitz verdankte – obwohl sie angesichts des Umfangs ihrer Aktivitäten vielleicht (wahrscheinlich) auch bei anderer Gelegenheit aufgeflogen wäre. Aber eben dies, sie durch seinen Anruf extremer Gefahr ausgesetzt zu haben, wollte Weißberg zu keinem Zeitpunkt eingestehen. Insofern war für ihn psychologisch doppelt notwendig, ihr die Hinterbrühl doch nicht zu schenken: Um sich nicht endgültig zu ihr zu bekennen – und um dabei bleiben zu können, dass er absolut nichts mit den Auschwitz-Jahren meiner Mutter zu tun hatte. Mit solcher Zielstrebigkeit haben wahrscheinlich noch wenige Leute beim Roulette verloren. Obwohl ich auch dessen nicht so sicher bin: Die wenigen Male, die ich im Kasino war – ich werde darauf noch zurückkommen – fiel mir auf, wie viele Prostituierte dort nahezu systematisch ihr Geld verlieren: Ich glaube, dass sie es als „schmutziges Geld“ ansehen, das zu besitzen sie sich schämen. Weißberg schämte sich seines Geldes nie. Wenn er es gerade hatte, stieg er nicht nur im besten Hotel ab, sondern besaß auch eine Wohnung oder ein Haus in bester Lage. In Paris, wohin er aus Schweden übersiedelt war, bewohnte er eine riesige Wohnung im obersten Stock eines prachtvollen Hauses im teuren 16. Arrondissement gegenüber der Wohnung Brigitte Bardots. Nach dem Verkauf von Hochhäusern, die zu errichten sein Hauptgeschäft in Frankreich gewesen war, übersiedelte er in eine Villa am Bois de Boulogne, die so groß war, dass sie an jeder ihrer vier Ecken einen eigenen Aufzug hatte.
109
110
Der Spieler und die verspielte Hinterbrühl
Gemütlich waren seine Aufenthaltsorte trotzdem nie: Sie sahen immer so aus, als sei er eben im Einziehen oder eben im Ausziehen begriffen – und mit ein paar Monaten auf oder ab stimmte das ja auch. Er hielt sich nirgends lange auf. Ein wenig bin ich ihm darin ähnlich: Ich habe nachgerechnet, dass ich meine eheliche Wohnung mit meiner zweiten Frau Eva in dreißig Jahren zwanzig Mal – und einmal auch das Land – gewechselt habe. Nur dass meine Wohnungen immer schön und gemütlich waren. Während für Alex’ Wohnungen typisch war, dass fast immer Lampenschirme und Vorhänge fehlten, weil Vermieter oder Verkäufer dergleichen dem Mieter oder Käufer nach seinem Geschmack zu besorgen überließen. Und dazu fand er nie die Ruhe und die Zeit. Sehr oft hatte er auch plötzlich kein Geld mehr, weil er alles verspielt oder alles in sein nächstes Projekt gesteckt hatte. Zweimal musste meine Mutter ihm aushelfen, seine Hotelrechnung im Dolder in Zürich zu bezahlen, indem sie einen Kredit aufnahm. Denn wenn er jetzt dort auszog, so hatte er ihr erklärt, würden seine geschäftlichen Gegenüber wissen, dass er kein Geld mehr habe und ihm nur die Hälfte dessen bezahlen, was ihm zustand. Wahrscheinlich war das eine richtige Überlegung – es ist zum Glück für meine Mutter jedenfalls jedes Mal gut ausgegangen und er hat ihr den doppelten Betrag zurückgezahlt und sie konnte das brauchen. Gleichzeitig musste er sich nicht vorwerfen, sich durch ein Geschenk zu ihr bekannt zu haben, denn ein ohne Sicherheiten so schnell gewährter Kredit verdiente 100 Prozent Verzinsung. Wenn Alex uns Geschenke machte, so mussten sie sich stets in einem freundschaftlichen, nicht aber familiären Rahmen halten. Einmal allerdings schenkte er mir eine Aktie, von der er sagte, sie würde dereinst mein ganzes weiteres Leben absichern. Sie gehörte zu einer Eisenbahnlinie, die von Brasilien bis in die USA führen würde und er hatte sein ganzes in Frankreich verdientes Geld in dieses Projekt gesteckt. Denn in Brasilien gab es jede Menge Bodenschätze und in den USA gab es jede Menge Bedarf danach. Eine Eisenbahnlinie, die Angebot und Nachfrage auf dem kürzesten Weg verband, musste ein Millionengeschäft werden, und die gesamte Planung war fertiggestellt und die Regierungen aller von der Trasse betroffenen Länder hatten ihre Zustimmung erteilt. Leider blieb meine Aktie trotzdem Makulatur: In einem der südamerikanischen Länder – ich weiß nicht mehr welchem – wurde die Regierung durch eine Revolution abgelöst, und die neue Regierung verweigerte ihre Zustimmung zu Weißbergs Eisenbahntrasse. Alexander Weißberg war wieder einmal pleite. Außerdem hatten Ärzte in seiner Lunge Wucherungen festgestellt, die sie ursprünglich für Krebs hielten, bis ein von meiner Mutter empfohlener Spezialist sie als gutartig erkannte. Dennoch war Weißberg so geschwächt, dass er kein neues großes Geschäft mehr in Angriff nehmen konnte und nur mehr von der Rente lebte, die Deutschland ihm für seine Haft zugestanden hatte. Wenig später ist er in Paris verstorben und es wurde ein trauriges, verregnetes Begräbnis, bei dem Sophia und meine Mutter gemeinsam hinter dem Sarg gingen und
Der Spieler und die verspielte Hinterbrühl
eine Reihe in Frankreich wie Alex heimatlos gewordener polnischer Juden ihnen ihre Anteilnahme aussprach.
111
16. Malerische Irrtümer
Was ich von Alexander Weißberg erbte, war ein Buch des amerikanischen Industriedesigners Raymond Loewy, in dem dieser die ungeheure Bedeutung dieses Berufes für die Wirtschaft der Zukunft anhand seiner grandiosen Arbeit beschrieb. Jedenfalls war „Industriedesigner“ der Beruf, der mich im Wintersemester 1957/58 an der Akademie für angewandte Kunst inskribieren ließ. Charakteristisch für meine Reife war, dass ich mich zuvor gar nicht erkundigt hatte, ob es dieses Unterrichtsfach überhaupt gab. Industrial Design war für mich einfach der Inbegriff angewandter Kunst und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass an dieser Akademie etwas anders gelehrt würde. Nur weil ich erfuhr, dass man für die Aufnahme Zeichnungen mitbringen müsse, packte ich sie in meine Mappe, fügte ihnen aber den Entwurf eines Sessels und eines Autos bei und war höchst erstaunt, als ich in die Klasse für Malerei aufgenommen wurde. Industrial Design, so erfuhr ich – und hätte es aus den Industrieprodukten Österreichs jener Jahre ersehen können – wurde an der „Angewandten“ gar nicht unterrichtet. Auch gut, dachte ich in etwa. Ich hatte schließlich seit Johns Tagen immer gerne gemalt, hatte kunsthistorische Kenntnisse aus der Fotosammlung meiner Mutter und war mit ihr in jede große Kunstausstellung in Wien gegangen. Nach einer KokoschkaAusstellung im Künstlerhaus hatte ich mit zwölf ein Selbstportrait im Stile Kokoschkas gemalt, und nach einer Ausstellung französischer Künstler in der Albertina, von denen mich Georges Rouault am meisten beeindruckte, ein Hinterglasbild, das ihm nachempfunden war. Beide Bilder hängen bis heute im Wohnzimmer meines Hauses in Spanien, in dem auch die Bilder einiger professioneller Maler hängen und sind noch keinem Besucher negativ aufgefallen. Meine Mutter hatte sie selbstverständlich genial gefunden. Und der Akademie war, was ich ihr in meiner Mappe abseits des Sessels und des Autos anbot, offenbar gut genug, mich zum Maler auszubilden. Leider musste ich bald bemerken, dass sie mir nicht das Geringste beibringen konnte, das über das hinaus ging, was ich schon in der Schule gelernt hatte. Ich hatte nämlich an der Marchettigasse einen hervorragenden Zeichenprofessor namens Bauernfeind gehabt, der uns mit den Worten empfangen hatte: „Ich kann aus Euch keine Künstler machen – das kann man nur selber sein – aber ich kann Euch soweit Zeichnen beibringen, dass am Ende Eurer Schulzeit jeder von Euch ein Portrait seines Nachbarn anfertigen kann, auf dem man ihn erkennt.“ Zu diesem Zweck hatte er uns Leonardo da Vincis Vorlagen menschlicher Proportionen für Körper und Gesichter beigebracht, aber auch Zeichenblätter in Quadrate unterteilt, in denen wir die verschiedensten Strukturen, Holz, Glas, Haut, Fell usw. zeichnerisch so festhalten sollten, wie er es uns vormachte. Tatsächlich konnte jeder von uns in der achten Klasse ein Portrait seines Nachbarn oder
Malerische Irrtümer
ein respektables Selbstportrait zeichnen und einer brachte es sogar so weit, sehr gute Kopien klassischer Zeichnungen aus der Albertina anzufertigen. Dass in meinem Fall noch etwas von Johns Farbenfreude und Fantasie hinzukam, ließ Bauernfeind meine Arbeiten freundlich loben. Ich hatte mir vorgestellt, irgendetwas Ähnliches, wenn auch auf einem höheren Niveau, würde uns an der Akademie erwarten. Aber das war ein grober Irrtum. Uns erwartete Warten auf Professor Bäumer. Eduard Bäumer war, soweit wir das durch den Spalt der offengelassenen Tür zu seinem Atelier sehen konnten, ein respektabler Maler bunter Landschaften, die mich an die „Edis“ erinnerten. In unserer Gegenwart öffnete er diese Türe allerdings nur einmal in der Woche für circa eine Stunde. Dann ging er durch die Reihen unserer Bänke, zu deren Füßen wir die Blätter ausgebreitet hatten, die wir in der betreffenden Woche vor uns hingemalt oder hingezeichnet hatten. Im Wesentlichen ungestört, aber gelegentlich in Gegenwart einer hübschen jungen Assistentin, die nach meinem Wissen dereinst auch Professorin, aber in einem ganz anderen Fach, geworden ist. Uns belästigte sie nicht weiter mit künstlerischen Ratschlägen, verliebte sich aber schließlich in einen sehr feschen Mitschüler und schlug daraufhin immer wieder Malen nach der Natur vor, weil das den beiden Gelegenheit gab, einander in der Natur noch näher zu kommen. Schließlich gab es jede Woche auch eine Unterrichtsstunde in geometrischem Zeichnen, der ich angesichts meiner viel intensiveren Vorbildung aus der Realschule nur einmal beiwohnte und zwei Stunden Aktzeichnen. Das hatte uns so lange aufgeregt, so lange wir uns Modelle wie Renoir oder Modigliani erwartet hatten, aber ältere Frauen vorfanden, deren Körper nicht einmal auf interessante Weise hässlich waren. Ich vermochte sie dank meiner Vorbildung bei Professor Bauernfeind passabel abzubilden – die meisten anderen vermochten es nicht. All diese Werke, Aktzeichnungen, Aquarelle nach der Natur oder was uns eben zu malen oder zu zeichnen eingefallen war, lag nun also zu unseren Füßen ausgebreitet und harrten der Beurteilung durch Professor Bäumer. Der schritt sie mit einem Spazierstock ab, stieß das eine oder andere Blatt damit nach vor oder zur Seite, um es näher zu betrachten oder gar „ganz gut“ oder „unbrauchbar“ zu sagen. Jede Begründung enthielt er den Betreffenden vor oder ersparte sie ihnen. Dann verschwand er bis zur nächsten Woche wieder in seinem Arbeitszimmer. Nach einem halben Jahr wusste ich beim besten Willen nicht mehr, was ich an diesem Institut anfangen sollte – das einzige Highlight, einer bildhübschen Mitstudentin namens Assunta Doggenburg hin und wieder den Radiergummi zu borgen und dabei ihre Hand zu berühren, war mir auf die Dauer zu wenig, zumal sie nicht mit mir ausgehen wollte.
113
17. Sprung vorwärts decken
Offenbar hat mich das Fiasko dieses meines ersten Versuches, einen Beruf zu ergreifen, doch stärker verunsichert, als ich mir eingestehen wollte. Jedenfalls überraschte ich meine Mutter mit dem Wusch, nicht nur meinen Wehrdienst abzuleisten, sondern Berufsoffizier zu werden. Heute würde ich sagen, dass dahinter die unterbewusste Sorge stand, innerlich noch sehr unreif zu sein und ein strenges Korsett, wie das Militär es zweifellos bot, zu brauchen. (Interessanterweise wollte auch mein jüngster Sohn Eric in einer nicht ganz unähnlichen Situation unbedingt zumindest seinen Militärdienst ableisten.) Zu dieser unterbewussten Sorge kam ein Schuss Romantik, der sie ergänzte: Rainer Maria Rilkes Kornett war ein Werk, das mich bis heute – wenn auch mittlerweile voran seiner Sprache wegen – begeistert, und das ich damals wohl auch liebte, weil ich mich mit seiner „Weise von Liebe und Tod“ identifizierte. Der Rest dieses Berufswunsches, den meine Freunde bis heute mit Staunen registrieren, war vergleichsweise rational, soweit politische Motivation das sein kann: Ich war durchaus bewusst bereit, mit meinem Leben dafür einzustehen, dass Österreich sich gegen einen Angreifer vom Charakter Adolf Hitlers oder Josef Stalins wenigstens so lange wehrt, bis vor aller Welt klar ist, dass es unter die Opfer zählt. Mit meinem Vater habe ich zwar – wie über alles Wesentliche – nur ganz kurz über diesen Berufswunsch gesprochen, aber er akzeptierte ihn: Mein Motiv war ihm begreiflich, so sehr er selbst das Militär hasste. „Dein Großvater wird im Grab den Hut ziehen“, spöttelte er nur ein wenig in Erinnerung an dessen militärische Ausbildung und die Freude darüber, dass wenigstens sein Sohn Karl ebenfalls eine militärische Laufbahn gewählt hatte (die freilich bei der SS endete). Restlos einverstanden mit meinem Berufswunsch war meine Mutter, obwohl sie jedes Mal zitterte, wenn ich auch nur eine größere Autoreise unternahm. Österreich verteidigen zu wollen war für sie zeitlebens ein selbstverständliches Motiv, dem sich Angst unterzuordnen hatte. Das galt damals übrigens nicht nur für sie, sondern für fast alle Frauen und Männer, die im Widerstand gewesen waren. Sofern sie nicht Kommunisten waren, sahen sie es durchaus als ihre Aufgabe an, Österreich, nachdem es den Faschismus abgeschüttelt hatte, auch vor dem Stalinismus zu bewahren. Etliche von ihnen haben sich daher ausdrücklich bereit erklärt, am Aufbau eines neuen österreichischen Heeres mitzuwirken. Aber leider sind statt ihnen vornehmlich ehemalige Nazi-Offiziere zum Zug gekommen, sonst hätte dieses Heer von Beginn an einen anderen Geist geatmet. Den Geist, den es im Jahr 1957, im zweiten Jahr seiner Existenz geatmet hat, lernte ich erstmals bei der Musterung kennen: Ich bin an Brust und Beinen relativ stark behaart, was den musternden Militärarzt, vor dem wir uns in der Unterhose zu präsentieren
Sprung vorwärts decken
hatten, zu der Feststellung animierte: „Da sieht man, dass der Mensch vom Affen abstammt.“ Ich wurde trotzdem oder eben deshalb für tauglich befunden und weil aus meiner Meldung hervorging, dass ich eine militärische Laufbahn in Erwägung zog, kam man auch meinem Wusch nach, mich einer Eliteeinheit zuzuteilen. Eine solche war in den Augen der Musterungskommission die erste Kompanie des Gardebataillons in der Wiener Fasangartenkaserne, für die ich mit 1,80 Meter damals auch die ideale Größe mitbrachte. (Ich war sogar der Größte meines Zuges und marschierte daher in der ersten Reihe – heute wäre ich vermutlich der Kleinste und marschierte gerade noch in der letzten.) Dass die 1. Gardekompanie vor allem dazu da war, bei Paraden sinnlose Gewehrgriffe zu klopfen, wusste ich nicht – aber es charakterisiert die Vorstellung, die die Heeresleitung von „Elitetruppe“ hatte. Ihr Kommandant war ausnahmsweise nicht wirklich ein alter Nazi-Offizier, auch wenn er der deutschen Wehrmacht treu gedient hatte: Hauptmann Huber war eine Spezies sui generis. Das Wort „soldatttisch“, das er besonders gern gebrauchte, sprach er grundsätzlich mit tripple-t aus. Sein ganzer Stolz war es, nicht dem gewöhnlichen Fußvolk, sondern der Kavallerie anzugehören, der er, so vermute ich, am liebsten schon zu Kaisers Zeiten gedient hätte. Sein ganzer Kummer war es, die Verweichlichung und Proletarisierung mitanzusehen, die das Heer in seiner gegenwärtigen, republikanischen Gestalt in seinen Augen erlitten hatte. „Drei Mal schon habe ich in einer Eingabe darauf hingewiesen, dass das Kommando nicht „Trab“, sondern „Teee-rab“ lauten muss – aber die haben nicht einmal geantwortet“, gestand er mir, den er seinen Kreisen zuordnete, sein vergebliches Bemühen um soldatttisch korrekte Kommandosprache. (Und rein sachlich muss ich ihm Recht geben – „trab“ kann man wirklich nicht präzise kommandieren.) Am besten freilich charakterisiert ihn ein Ereignis, dessen Zeuge ich wurde, als ich bereits Kommandant eines „Zuges“ war und im Hof zwischen den Gebäuden der Fasangartenkaserne auf neu Einberufene wartete, die nach und nach eintrafen und vorerst entweder herumstanden oder sich auf ihre Koffer gesetzt hatten. Ich werde nie den Augenblick vergessen, in dem Hauptmann Huber ihnen erstmals „erschien“. Denn nur diese Formulierung wird seinem Auftritt gerecht: Als einziger Offiziere trug er immer makellos polierte schwarze Stiefel, in denen seine eher schmalen Beine unter pludernden Hosen staken, so dass sie, vor allem, wenn er weit ausschritt, ein wenig an die dünnen Beine stelzender Straußenvögel erinnerten. Ein Eindruck, der sich noch dadurch verstärkte, dass sich über seiner Paradeuniform auch der blaue Uniformmantel im Gegenwind blähte, den sonst keiner der Offiziere trug, weil er zu sehr an einen Briefträger erinnerte. Der erste Rekrut, auf den diese Erscheinung zuflog, war an diesem Tag ein etwas dicklicher Bursch, dessen Kleidung darauf hinwies, dass er eher vom Land kam. Nicht
115
116
Sprung vorwärts decken
recht wissend, was er tun sollte, stand er jedenfalls von seinem Koffer auf und beugte in leicht gekrümmter Haltung ein wenig – offenbar zu wenig – den Kopf. „Wissen Sie nicht, wer ich bin?“ herrschte Huber ihn an, indem er den seinen unter der Schirmkappe in den Nacken warf, „ich bin Hauptmann Huber, österreichischer Gardeoffizier und Kommandant der Ersten Kompanie.“ „Grüß Gott, Schremser, Elektriker“, suchte der Geblendete ihm die Hand zu geben. Huber konnte durch eine rasche Seitwärtsdrehung nur gerade noch erreichen, dass das misslang, obwohl er immer Lederhandschuhe trug, die ihn vor einer derart niedrigen Berührung geschützt hätten. „Und mit so jemandem sollen wir in den Krieg ziehen“, sagte er zu mir, der neben ihm stand und die Linke korrekt an die Hosennaht, die Rechte an die Mütze gelegt hatte. „Ja“, sagte ich – offenlassend, ob ich damit „so jemanden“ oder das „In-denKriegZiehen“ meinte. Jedenfalls war ich zunehmend unsicher, ob ich, wenn es dazu käme, unter Hauptmann Hubers Kommando stehen wollte. Restlos klar wurde mir das erst einige Wochen später. Unter den Neuzugängen befand sich ein ebenfalls vom Land kommender Bursch, der mir vor allem durch sein beträchtliches Übergewicht und seinen rundum unsportlichen Körper aufgefallen war, der ihn schon bei den ersten kurzen Märschen nach einer Stunde nach Atem ringen und dann zusammenbrechen ließ. Dabei fielen seine Entschuldigungen für dieses frühe Aufgeben so glaubwürdig und hilflos aus, dass nicht einmal der reichlich sadistische Zugsführer Maier (ich erspare ihm die Nennung seines wirklichen Namens) ihn zur Fortsetzung zwang oder ihn auch nur, wie sonst alle Präsenzdiener, anbrüllte. Es war auch ihm rätselhaft, wie es diesen Rekruten bei der Musterung zu dieser Kompanie verschlagen hatte, auch wenn er knappe 1,80 cm groß sein mochte. Selbst in ihm erregte er Mitleid. Paul, so will ich ihn nennen, schlief in einem Zimmer, das meinem gegenüberlag und ziemlich bald verbreitete sich das Gerücht: „Der Blade macht sich jede Nacht an.“ Ein paarmal, so erfuhr ich später, hatte er sein durchnässtes Nachthemd am Morgen vor dem Zugsführer verbergen können, aber dann war ihm das nicht mehr gelungen und Maier hatte bei Hauptmann Huber Meldung erstattet. Der traf folgende Anordnung: Paul hatte sich mit seinem durchnässten Hemd vor seiner Zimmertür auf den Gang zu stellen und die gesamte Kompanie hatte dabei mit „Blick links“ so lange an ihm vorbeizudefilieren, bis der Fleck an seinem Nachthemd getrocknet war. Ich habe eine größere öffentliche Erniedrigung nie erlebt. Tränen der Scham rannen dem dicklichen Achtzehnjährigen über die Wangen und Huber schrie ihn an, als er sie wegwischen wollte: „Habt-Acht-Stellung!“ Wir marschierten eine halbe Stunde an Paul vorbei und ich marschierte mit. Obwohl mir klar war, dass das Militärgesetz mit Sicherheit verbot, was hier geschah. Aber ich hatte zwei Gründe, mich nicht zu exponieren: Noch wollte ich Berufsoffizier werden
Der Läufer
und rechnete mit einem guten Zeugnis Hubers, das ich nicht riskieren wollte. Vor allem aber wollte ich nicht riskieren, an diesem besonderen Wochenende keinen Ausgang zu erhalten, denn ich hatte eine Freundin, die ich unter allen Umständen treffen wollte. Um dieses Treffens willen verstieß ich gegen alles, was meine Mutter mir vorgelebt hatte. Jedenfalls habe ich damals gelernt, dass „Widerstand“ gegen offenkundiges Unrecht in bestimmten Augenblicken erstaunlich schwer sein kann, obwohl demjenigen, der ihn dennoch übt, nicht das Geringste passiert: Gunther Tichy, damals der einzige Student unter den Grundwehrdienern – er wurde später ein anerkannter Wirtschaftswissenschafter – verließ die an Pauls Pranger vorbeidefilierende Kompanie einfach wortlos in sein Zimmer. Ich glaube zwar nicht, dass Huber es sah, aber Zugsführer Maier hat es ihm mit Sicherheit gemeldet. Dennoch ist Tichy nichts passiert, denn natürlich wusste Huber, dass das, was er getan hatte, gesetzwidrig war und dass Tichy es als Jus-Student sofort als gesetzwidrig erkannt hatte. Er konnte nichts gegen Tichy unternehmen, ohne ein großes Risiko für sich selbst einzugehen. Er hätte auch gegen mich nichts unternehmen können, ohne ein enormes Risiko einzugehen. Aber für mich wog das Risiko, meine Freundin nicht zu sehen, schwerer. Schwer genug, um der tiefen Erniedrigung eines anderen Menschen eine halbe Stunde lang schweigend zuzusehen. P. S.: Um mein Verhalten ein wenig plausibler zu machen (nicht zu entschuldigen): Das Mädchen, das am Wochenende zu treffen mir derart wichtig war, war eine der großen Lieben meines Lebens: Ich hatte Heide, eine Achtzehnjährige aus Stuttgart beim Schifahren in Saalbach kennengelernt, wo ich als Hilfsschilehrer jobbte. Sie sah ungefähr so aus wie Uschi Glas in „Zur Sache Schätzchen“ und wir waren eine Woche hindurch in jeder freien Minute zur Sache gekommen – die für sie noch vor dem Schifahren, das sie auch sehr gut konnte, das Schönste der Welt war. Ich hatte davor nur gerade einmal mit einem Mädchen geschlafen und erst durch sie begriff ich, dass es tatsächlich das Schönste der Welt war. Wir verlobten uns nach nur drei Tagen, obwohl – oder weil – meine Mutter, die ebenfalls in Saalbach abgestiegen war, fand, sie teile doch keine meiner sonstigen Interessen. An jenem Wochenende, dem „Pranger“ voranging, hatten wir unter größten Schwierigkeiten unser erstes Wiedersehen verabredet, und ich vermochte tatsächlich einen verbotenen Nachmittag – denn eigentlich durfte ich meine Wiener Garnison nicht verlassen – mit ihr auf einer Wiese unterhalb der Salzburger Feste zur verbringen. Die volle Wehrdienstzeit hielt unsere Verlobung leider – von ihrer, nicht meiner Seite – dann doch nicht. Aber manchmal prägt sich eine einzige Woche für ein ganzes langes Liebesleben ein.
Der Läufer Wenn man von der Liebe absieht, habe ich mir erstaunlich leicht mit den Prüfungen getan, die vermutlich die meisten Heere ihren vernünftigen Bürgern auferlegen. Zwei
117
118
Sprung vorwärts decken
Jahre Bundeskonvikt waren eine optimale Vorbildung. Man fror auf die gleiche Weise, indem man am Morgen bei jeder herrschenden Temperatur die Fenster aufreißen musste, um die aufzustellenden Matratzen zu lüften. Es herrschte die gleiche Art sinnloser Disziplin: So wie Hemden, Wäsche und Socken im Spind des Heims kantig gefaltet zwei Zentimeter nach hinten verschoben parallel zur Vorderkante des Faches liegen mussten, mussten sie das auch im Spind des Heeres. So wie Zahnputz- und Waschzeug im zweiten Fach im Heim stets in scheinbar unbenutztem Zustand in einem rechten Winkel zur Kante liegen mussten, mussten sie das auch beim Militär – was sich am einfachsten bewerkstelligen ließ, indem man beides tatsächlich nie benutzte. Wobei wir beim Bundesheer den enormen Vorteil unserer privaten Koffer hatten, deren Kontrolle die „republikanische Gesinnung“ des neuen Heeres nicht erlaubte, so dass wir dort unsere verschmutzten Wäschestücke ebenso horten konnten wie unsere tatsächlich benutzen feuchten Waschlappen und unsere tatsächlich benutzte Zahnbürste. Ich fiel jedenfalls schon bei der ersten „Spindkontrolle“ positiv auf, weil unser Korporal, als er mit einer Stecknadel die Windungen des Schraubverschlusses meiner Zahnpastatube entlangfuhr, nicht, wie bei allen anderen neu Einberufenen, gröbere Reste der Paste finden konnte, hatte ich diese Tube doch nur ein einziges Mal benutzt. Dieses einzige Mal, so wusste ich als gewiefter Heimzögling, war unverzichtbar, um den Eindruck zu vermeiden, dass ich mir nie die Zähne putzte. Einen weiteren Vorteil bescherte mir auch meine – damals – im Verhältnis zu Hauptschülern und Lehrlingen bessere Kondition. Als Mittelschüler hatte ich offenkundig mehr Sport betrieben und als Angehöriger des Mittelstandes hatte ich mich wahrscheinlich gesünder ernährt. Auch viel länger gewandert war ich dank der WandervogelTradition meiner Mutter und hatte daher nicht sofort Blasen an den Fersen. Jedenfalls konnten mich die ersten Märsche, die von Huber am liebsten an besonders heißen Tagen angesetzt wurden, in keiner Weise ermüden. Auch nicht der erste 60 Kilometermarsch von Wien nach Hainburg, den Huber an einem besonders heißen Tag auf seine besondere Weise zelebrierte: Als nach etwa dreißig Kilometern fast jeder von uns seine Feldflasche leergetrunken hatte und uns natürlich streng verboten war, sie irgendwo nachzufüllen, fuhr er in seinem Jeep ganz langsam an den Marschierenden vorbei und leerte, seine Feldflasche mit der behandschuhten Hand aus dem offenen Wagen haltend, deren Inhalt ganz langsam auf den Asphalt. Wir waren glaube ich, nur mehr ein Dutzend Rekruten, die an diesem Tag nicht vorzeitig wegen offener Blasen oder eines Hitzekollers aufgaben, um die letzten Kilometer auf nachkommenden Heereslastkraftwagen zu verbringen. (Ich habe daran denken müssen, als im Jahr 2017 ein Rekrut während eines Marsches in großer Hitze einer Herzschwäche erlag.) Ich entdeckte an mir, dass es mein ganz besonderer Ehrgeiz war, physisch auf gar keinen Fall zu unterliegen oder gar aufzugeben. Es lag darin etwas von der Emotion, die mich an eine militärische Laufbahn denken ließ und die ich pathetisch etwa so zusammenfasse: Ich bin weder zu feig noch zu schwach zum Kampf – ich finde Kämpfen
Der Läufer
nur widerlich. Wenn ich es dennoch tun muss, dann ausschließlich zur Verteidigung meines Weltbildes. Die praktische Konsequenz dieser Emotion bestand darin, dass ich grundsätzlich freudig lachte, wenn Zugsführer Maier an einer möglichst kotigen Stelle „Sprung… Vorwärts… Decken“ brüllte und diesen Befehl so lange wiederholte, bis die Letzten erschöpft aufgaben (oder sich klugerweise schon zuvor als erschöpft gebärdeten). Einer der größten Triumphe meines Lebens – und das meine ich so todernst wie ich es schreibe – hing mit eben dieser körperlichen Leistungsfähigkeit zusammen und ereignete sich im Hof der Fasangartenkaserne. Dort hatten wir, wann immer es keinen Marsch gab, anzutreten und Gewehre zu klopfen, weil unser Eliteruf ja davon herrührte, dass wir an vorderster Front zu Paraden herangezogen wurden. So gut ich marschiere, so schlecht war ich im Gewehrklopfen – es kam unweigerlich der Moment, in dem ich mich nach der falschen Seite drehte, den falschen Ausfallschritt tat oder an der falschen Stelle klopfte. Dann durfte der Zugskommandant eine Strafe anordnen, die darin bestand, dass man den Hof und insbesondere die dort befindliche Turnhalle umrunden musste. Nur forderte das Militärgesetz in seinem Bemühen um eine neue, republikanische Gesinnung, dass bei einer solchen Strafrunde immer auch ein Vorgesetzter mitlaufen musste. In der republikanischen Praxis genoss er dabei den Vorteil, weder einen 15-Kilo-Tornister noch ein Gewehr tragen zu müssen und sich außerdem mit einem Kollegen abwechseln zu können. Diesen Vorteil bewahrte mein Zugsführer durch acht Runden, dann übergab er leicht außer Atem an meinen Korporal. So gingen wir in die nächsten acht Runden. Bis ich bemerkte, dass auch mein Korporal gewisse Atemprobleme hatte, die schließlich darin mündeten, dass er hinter der Turnhalle, wo niemand uns sah, die Frage keuchte: „Da könnt ma do ruhig a bissl langsama rennan!“ „Kommt nicht in Frage!“, sagte ich nur, beschleunigte und lief, mich gelegentlich demonstrativ umdrehend, weit vor ihm an unserer paradierenden Kompanie vorbei, während er mit Seitenstechen stehen blieb. Einen triumphaleren Moment habe ich physisch in meinem Leben nie erlebt und er brachte mir selbst bei anderen Truppen der Kaserne den unantastbaren Ehrennamen „der Läufer“ ein. Am Rande sorgte das Heer auch für militärische Ausbildung. Das war zu meiner Zeit deshalb ein besonderes Problem, weil in den Jahren des Wirtschaftswunders nur solche jungen Männer bereit waren, Chargen und Unteroffiziere zu werden, die für jeden anderen Beruf ungeeignet waren. Zugsführer Maier war ihr Prototyp. Ich werde nie den Kurs über „Orientierung“ vergessen, den er leitete, als ich als „Gefreiter“ schon für meinen „Zug“, er aber unterhalb Hubers für die Ausbildung der gesamten Kompanie verantwortlich war. „Alsdann, heit tamma se orientiern“, leitete er seine Ausführungen ein, die anzuhören die Kompanie sich im „Hörsaal“ versammelt hatte. „Es sats ja zu den eh vül z’deppat, oba heats ma hoid zua.“ Dann begann er zu erläutern, wie man den Polarstern auffinden
119
120
Sprung vorwärts decken
könnte: „Wann es Trottln den klan Wogn dann endlich gfundn habts, dann tragts die Achs siebmmal auf und dann sats durt.“ „Fünfmal“, flüsterte ich ihm von der Seite zu. „Also enka Gfreita sogt, es san nur fünfmal, hams eam gsagt. Also amals sans siebnmal, amals sans fünfmal – i glaub da kennen sa se obmat im Miniserium bis heit ned aus.“ So orientiert rüsteten die Grundwehrdiener der „Elitetruppe“ 1. Gardekompanie 1958 ab.
18. Warum denn nicht Journalist?
Ich glaube, es war nicht lange danach, dass sich in einer anderen Truppe bzw. einer anderen Kaserne – wo, weiß ich nicht mehr – ein dramatischer Unfall ereignete: Eine Munitionskammer explodierte und riss, wenn ich mich recht erinnere, einen Zugsführer, der dort Munition gezählt hatte, in den Tod. In sämtlichen Tageszeitungen erschienen große Berichte, die über die Ursachen spekulierten. Am ehesten, so ergaben die Ermittlungen, könnte der Zugsführer bei seiner Arbeit geraucht haben. Wahrscheinlich hat er den Tschick in die Munition geworfen, war meine erste Reaktion und ich schrieb einen Leserbrief, in dem ich argumentierte, dass das Hauptproblem des Bundesheeres im katastrophalen intellektuellen Niveau seiner Chargen bzw. Unteroffiziere bestünde. Meine Mutter übergab diesen Leserbrief ihrem Jugendfreund und Chefredakteur der Arbeiter-Zeitung Oscar Pollak. Der fragte sie, was ich denn eigentlich werden wollte, und als sie ihm sagte, die Idee, Berufsoffizier zu werden, hätte ich gerade aufgegeben, fragte er: „Warum denn nicht Journalist?“ Meine Mutter fragte mich das weiter, und ich fand es eine gute Idee. „Journalist“ war neben „Physiker“, „Architekt“ und „Psychiater“ einer der Berufe gewesen, die ich bei einer meiner letzten Schularbeiten durchaus ehrlich als Wunschberuf genannt hatte, nachdem ich mich mit „Berufsoffizier“ lieber nicht lächerlich machen wollte. Ich glaube, dass Pollak mich daraufhin zu einem Gespräch in den Vorwärts-Verlag einlud, das zu seiner Zufriedenheit ausfiel. Zumal ich eine wesentliche Voraussetzung von vorneherein erfüllte: Ich kam aus einem guten roten Stall. Was mit meinem Leserbrief geschah, hätte mich eigentlich mit leiser Skepsis in Bezug auf meine künftige Dienststelle erfüllen müssen: Die Arbeiter-Zeitung hat ihn nie abgedruckt. Und zwar, wie Pollak meiner Mutter erläuterte, mit folgender Begründung: Die ÖVP würde der SPÖ ständig vorwerfen, in Wahrheit gegen das Bundesheer zu sein, obwohl das nur für einen kleinen, linken Flügel, keineswegs aber für die Mehrheit oder gar die Parteiführung zutreffe. Wenn daher im Zentralorgan der SPÖ, der ArbeiterZeitung, ein Leserbrief erschiene, der dem Heer gegenüber als kritisch diffamiert werden könne, so würde die ÖVP diese Chance mit Sicherheit wahrnehmen. Deshalb habe ihm auch seine Frau (Marianne Pollak, die damals glaube ich sogar dem Parteivorstand angehörte) von der Veröffentlichung abgeraten, obwohl sie, wie er, natürlich von der Richtigkeit meiner Argumentation überzeugt sei. Der Einwand meiner Mutter, dass mein Leserbrief doch genau umgekehrt für ein starkes Bundesheer mit qualifizierteren Unteroffizieren eintrete, hielt er zwar für völlig
122
Warum denn nicht Journalist?
richtig, aber für zu kompliziert, um im Zuge einer ÖVP-Kampagne von der Bevölkerung verstanden zu werden. Der Vorgang sagt einiges über parteipolitisches Agieren im Allgemeinen wie im Besonderen aus: Oscar Pollak veröffentlichte in der von ihm geführten Zeitung nicht, wie etwa Oscar Bronner oder Hugo Portisch, was er für richtig hielt, sondern prüfte stets, was die Veröffentlichung für die SPÖ bedeuten würde. Sozialismus war für Oscar Pollak eine Religion – das Gebäude des Vorwärts-Verlages in der Rechten Wienzeile war weit vor der heutigen Parteizentrale in der Löwelstraße ihr Tempel. Otto Bauer hatte in diesen heiligen Hallen Austromarxismus von Weltformat formuliert – etwa eine brillante Kritik an der Verwechslung von Vergesellschaftung mit Verstaatlichung. Die Arbeiter-Zeitung war unter ihrem legendären Chefredakteur Friedrich Austerlitz ein elitäres Blatt gewesen, das für eine intellektuelle Elite komplexe Themen diskutierte. Der Arbeiter, an den sie sich mit ihrem Namen wendete, war unter ihren Lesern nur insofern vertreten, als es ihn als „neuen Menschen“ des Sozialismus der Zwischenkriegszeit zweifellos gab und als seinesgleichen die AZ um sein letztes Geld abonnierte. Aber besonders groß war ihre Auflage unter Austerlitz daher nie. Es war Oscar Pollak, der aus ihr eine Zeitung mit einer nach dem Krieg durchaus breiten Leserschaft machte, indem er die nach wie vor relativ hochgestochene politische Berichterstattung durch die in meinen Augen beste Lokal-, Sport- und Kulturberichterstattung des Landes ergänzte. Er glaubte an den möglichen Spagat zwischen Qualität und Breite, den auch Hugo Portisch im Kurier versuchte und den auch ich bis heute für möglich halte. Der edle, bildungshungrige Arbeiter, der die Idealvorstellungen des Sozialismus erfüllte und im Sozialismus Erfüllung fand, blieb sein Idol – auch wenn es ihn immer weniger gab. Wir sollten ihn aber vor Augen haben, wenn wir schrieben. Einen von ihnen hatten wir tatsächlich vor Augen, wenn wir die Redaktion der Arbeiter-Zeitung betraten. Denn selbstverständlich beschäftigte sie kriegsversehrte Genossen als Portiere und ebenso selbstverständlich hatte man ihnen die größte Ehrerbietung zu erweisen und ja nicht zu glauben, als „Redakteur“ etwas Besseres zu sein. Der Portier am Eingang zur Redaktion saß denn auch auf einem erhöhten Podest und man grüßte ihn mit einem tiefen Neigen des Kopfes von neun Uhr morgens bis zwölf Uhr mittags mit „Guten Morgen“, danach bis 17 Uhr mit „Mahlzeit“, ehe man „Guten Abend“ sagen durfte – denn „Grüß Gott“ war ihm nicht zuzumuten. Lokalchef Franz Kreuzer erklärte mir das am ersten Tag, indem er mich schon im Stiegenhaus abfing und erst an Zerberus vorbeiführte, als er sicher war, dass ich verstanden hatte. Da ich von Kreuzer auch lernte, dass man Kaffee, den man unmittelbar neben seinem Hochsitz aus einem Automaten zapft, nicht ausschüttet, wenn man die Tasse, während man sie trägt, keines Blickes würdigt, sondern eisern über sie hinweg schaut, sah ich dem Portier an jedem Tag mindestens einmal direkt ins Gesicht und habe die leise ehrende Furcht
Warum denn nicht Journalist?
vor dem weißhaarigen Genossen Zeit meiner Arbeit im Vorwärts-Verlag nicht abgelegt – Gläubige gehen mit diesem ehrfürchtigen Neigen des Kopfes an Seitenaltären vorbei. Zum Hauptaltar, der getäfelten Wand im Zimmer des Chefredakteurs, wo hinter Oscar Pollaks Schreibtisch die Fotos von Otto Bauer und Friedrich Austerlitz hingen, blickte ich bis zuletzt mit Herzklopfen auf. Gott sei Dank durfte und musste ich es nach Monaten der Eingewöhnung nur einmal in der Woche betreten – normalerweise trat ich ins Zimmer Franz Kreuzers. Kreuzer, Pollaks Leiter für das Ressort „Gesellschaft“ (es hieß damals weniger nobel „Lokalressort“), war der zweifellos brillanteste Lokaljournalist des Landes. Sein IQ war ehrfurchtgebietend – die Wissenschaftler, die er später als Chefredakteur des ORF immer wieder interviewte, erlebten jeweils staunend, wie er ihre Thesen besser als sie selbst zusammenfasste. Allerdings hätte er meines Erachtens nie eine eigene These entwickelt, denn dazu hätte es neben blanker Intelligenz auch der Kreativität und der Phantasie bedurft, und die gingen ihm weitgehend ab. Seine Intelligenz war wie die meiner Mutter ein einsames, hochgeschossenes Gewächs. Auch sein Stil glich dem ihren: unglaublich präzis, penibel, aber trocken. Ansehen, auch unter bürgerlichen Lesern, verdankte er solchen präzisen, peniblen Recherchen im Zusammenhang mit Österreichern, die von der sowjetischen Besatzungsmacht entführt worden waren – sie hätten zu Anklagen gereicht, wenn die politisch möglich gewesen wären und zeugten nicht zuletzt von Kreuzers Mut, aber auch von Pollaks antikommunistischer Gesinnung. Was die ÖVP nicht hinderte, der Arbeiter-Zeitung dennoch Sympathien für das kommunistische Russland zu unterstellen. Kreuzers Penibilität war gefürchtet: Sie verbesserte nicht nur jede meiner ersten VierZeilen-Meldungen, die unter „Kurz vermerkt“ figurierten, durch mehrere Minuten, sondern tat das angeblich auch, als er die Zeitung später als Chefredakteur übernahm. Es gab keine Zeitung, die die AZ an Präzision in der Wiedergabe auch der banalsten Ereignisse übertraf. Das führte nach etwa einem Jahr, nachdem ich einen gewissen Ruf für das Verfassen spannender Reportagen errungen hatte, zu einer ersten inhaltlichen Auseinandersetzung: Während er, im Einklang mit den meisten Granden der Branche, über die ersten Ausgaben der Kronen Zeitung, die damals auf den Markt kamen – insbesondere die Weihnachtsausgabe mit einem Christbaum als Titelbild – nur hellauf lachen konnte, war ich vom Erfolg dieses Konzepts überzeugt. Die Menschen wollten, so sagte ich ihm, Geschichten, nicht Meldungen lesen. (Dass es des Öfteren übelste, parteiliche, falsche Geschichten sein würden war damals noch nicht offensichtlich.) Es war typisch für Kreuzer, dass er mir diese im Gegensatz zu ihm von Beginn an richtigere Einschätzung der Kronen Zeitung später öffentlich zugestand – an sachlichen Irrtümern festzuhalten, war er nicht bereit, denn das hätte seinem Faible für Präzision (man kann es auch journalistische Redlichkeit nennen) widersprochen.
123
124
Warum denn nicht Journalist?
Später sollte uns nicht nur private Freundschaft, sondern auch die Freundschaft mit Karl Popper verbinden, die uns den Vorteil bescherte, unter den wenigen Österreichern zu sein, mit denen Popper bei jedem seiner Wien-Besuche ausgiebig sprach. Wobei Kreuzer auch Poppers Thesen präziser als ihr Autor wiederzugeben wusste. Der einzige AZ-Redakteur, der meine Einschätzung der Kronen Zeitung teilte, saß im Zimmer neben mir und sollte Österreichs Meinungsforschung revolutionieren: Ernst Gehmacher wurde nach seinem Abschied von der AZ Leiter des „Instituts für empirische Sozialforschung“ IFES und entwickelte u. a. die Methode, aufgrund erster Auszählungen das Endergebnis von Wahlen erstaunlich genau vorherzusagen. Gehmacher war (ist) ähnlich intelligent wie Kreuzer, aber um einiges kreativer: Er schrieb abseits seiner Analysen für die AZ ziemlich gute Kurzgeschichten und einen (mäßig erfolgreichen) erotischen Roman, den er mich gegenzulesen bat. In der Arbeiter-Zeitung war er einerseits ein totaler Außenseiter, andererseits der unbestrittene Ersatz für den „edlen Arbeiter“, den es nicht mehr gab. Es ging die Mär, er stamme aus bäuerlichem Milieu, sei vielleicht sogar das Kind eines Landarbeiters und habe seine gesamte Bildung wie der „neue Mensch“ aus eigenem Antrieb erworben, um sie nun dem Sozialismus dienstbar zu machen. In Wirklichkeit, so erfuhr ich Jahrzehnte später eher erstaunt, stammte er aus einer Salzburger Bürgerfamilie, hatte allerdings dort eine Lesewut vom Format Alex Weißbergs entwickelt: Er las und las und las. Zeitlebens hielt er die Abwertung von Schundromanen für kontraproduktiv – ihn hätten sie, als er sie in einem Koffer auf dem Dachboden des elterlichen Hauses entdeckte, den Genuss des Lesens entdecken lassen. Die Mär von der bäuerlichen Herkunft ergab sich aus seiner Karriere als Werkstudent der Bodenkultur: Um das Geld dafür zu verdienen, arbeitete er als Knecht auf einem Bauernhof nahe Sankt Pölten. Dort fütterte er um vier Uhr morgens das Vieh, fuhr dann nach Wien zu seinen Vorlesungen und war rechtzeitig zurück, um es zu versorgen. Während seines Studiums erlernte er lesend fünf Sprachen, darunter Russisch. (Natürlich auch Englisch, Französisch und Italienisch). Was ihn auszeichnete, war neben seinem Bildungshunger seine sagenhafte physische Konstitution. Wenn ich von mir sage, dass ich als junger Mann nach der Ausbildung beim Bundesheer sehr ausdauernd laufen konnte, so konnte (kann) er das bis zu seinem 90. Geburtstag: Er benutzte (benutzt) grundsätzlich keine Straßenbahn, sondern lief (läuft) mit einem kleinen Netz oder Rucksack am Rücken zu allen seinen Wiener Terminen. Diese Lust am Laufen verband uns. An Wochenenden liefen wir Berge hinunter – aber grundsätzlich auch hinauf. Unsere größte diesbezügliche Tour ließ uns um vier Uhr früh mit seinem Motorroller zum Schneeberg fahren, um ihn hinauf- und hinunterzulaufen; dann hinüber zur Rax; die hinauf und hinunter; dann zurück zum Schneeberg und den wieder hinauf. Um elf Uhr Abend sind wir dort nach einer Strecke von 45 Kilometern und der Überwindung von 4500 Höhenmetern im Schutzhaus angekommen.
Warum denn nicht Journalist?
Ich gestehe, dass ich den Weg hinunter am nächsten Tag kaum mehr laufen konnte und 14 Tage hindurch an einem gewaltigen Muskelkater litt – Gehmacher lief auch danach wie zuvor. Meine Freundschaft mit Ernst Gehmacher reichte und reicht also weit über unsere gemeinsame Arbeit bei der Arbeiter-Zeitung hinaus. In der Arbeiter-Zeitung spielte sie insofern eine wichtige Rolle, als ich mich ihr durch Gehmacher menschlich am meisten verbunden fühlte, obwohl auch die meisten anderen Kollegen besonders nett und besonders gute Journalisten waren. Friedl Scheu war ein hervorragender außenpolitischer Journalist, Kurt Kahl ein hervorragender Kulturjournalist und Martin Maier der in meinen Augen beste Sportjournalist des deutschen Sprachraums: Formulierungen wie „Ein frischer Wind weht von den Bergen – sie haben mit Odol gegurgelt“ oder „Mit ihren Schwüngen bis an den Rand der Piste versuchten die letzten Schifahrer den letzten Schnee an die Wiesen zu nähen“ sind mir bis heute (hoffentlich halbwegs korrekt) im Gedächtnis. Dem Bauernbuben Toni Sailer verhalf Maier mit seinen Erzählungen zu seiner heutigen Unsterblichkeit. Martin Maier berichtete nicht über Sportler – insofern war er kein Journalist, – sondern er erschuf und erfand liebenswerte, bescheidene Helden des Sports, die zu bewundern jedenfalls keinen Schaden anrichtete – im Gegensatz zur Kronen Zeitung, die auch keine journalistische Berichterstattung lieferte, aber Feindbilder erschuf, die zu bekämpfen die Atmosphäre vergiftete. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass es das auch bei der Arbeiter-Zeitung gab. Auch sie erfand und schuf Feindbilder: „Die Hausherren“ sind bis heute eines davon. Das Haus, in dem meine Mutter Oscar Pollak zwei-, dreimal im Jahr zum Tee traf, hatte einmal meiner Mutter und ihren Geschwistern gehört – jetzt gehörten ihnen nur mehr drei Zwei-Zimmer-Wohnungen, obwohl es ursprünglich ein großes Haus mit vielleicht 200 m2 Grundfläche und drei Stockwerken gewesen war. Und auch diese Wohnungen gab es nur, weil das Haus baufällig geworden war. Als der Nachbar an seiner Flanke einen Neubau errichtete, waren in dem von einer Bombe gestreiften Gebäude Sprünge aufgetreten, die sich ständig vergrößert hatten, so dass die Baupolizei es schließlich als baufällig bezeichnete und nicht mehr zur Bewohnung freigab. Das aber war das Beste, was einem „Hausherrn“ damals passieren konnte: Dass sein Haus so kaputt war, dass man es niederreißen musste, bzw. durfte. Denn dann ließen sich auf dem frei gewordenen Baugrund Eigentumswohnungen errichten, die sich verkaufen ließen – meine Mutter und ihre Geschwister verkauften sie nicht allzu gut, denn alles, was ihnen als Erlös verblieb, waren die drei 80 m2 Wohnungen. Ich weiß nicht, wie wir beim Tee mit Oscar Pollak auf dieses Thema zu sprechen kamen. Jedenfalls bestand Einigkeit darüber, dass „Mieterschutz“ und „Friedenszins“ angesichts des Notstands nach dem ersten Weltkrieg eingeführt wurden: Mieter durften nicht gekündigt werden und die Miete durfte pro Quadratmeter einen Schilling nicht übersteigen. Nur dass das Gehalt eines höheren Beamten damals um 300 Schilling lag, so dass er für eine 100 m2 Wohnung ein Drittel seines Gehaltes bezahlte, was übrigens in den meisten Städten der Welt bis heute die übliche Relation ist.
125
126
Warum denn nicht Journalist?
Die SPÖ behielt diese Regelung bei, als dieser Beamte rund 3000 Schilling verdiente – er durfte dann immer noch unkündbar für 100 Schilling auf 100 Quadratmetern wohnen und kann es in manchen Wohnungen für einen immer noch lächerlichen Betrag bis heute. Polack gab meiner Mutter jedenfalls bezüglich aller ihrer Einwände gegen die Beibehaltung dieses Friedenszinses Recht und ich habe schon beschrieben, wie er reagierte: Er schrieb den nächsten Brandartikel gegen die „Hausherrn“. Das war der Anfang einer Entzweiung. Nicht zwischen Pollak und meiner Mutter – die hatte bis zuletzt ein leise schlechtes Gewissen, früher einmal eine wohlhabende Hausherrin gewesen zu sein – aber zwischen Pollak, der SPÖ und mir. Die Kluft vergrößerte sich dramatisch durch Ereignisse, die ebenfalls mit der Wiener Wohnpolitik zu tun hatten. Meine Mutter beschäftigte damals eine Frau mit ausgeheilter Tuberkulose zweimal die Woche für leichte Aufräumarbeiten. Diese Frau Leeb, im Übrigen seit Jahrzehnten eine brave Genossin, hauste mit ihrer Tochter, ihrem Schwiegersohn und beider Kleinkind in einer Zimmer-Küche-Wohnung auf der Heiligenstädter Straße. Meine Mutter reichte für alle Beteiligten um Gemeindewohnungen ein und wurde abschlägig beschieden: „Da haben wir viel schlimmere Fälle“, so erzählte sie mir, hätte der Referent gesagt. Das ließ mich ihn oder seine Vertretung wenig später aufsuchen. In der Tasche hatte ich eine Liste mit sämtlichen Redakteuren der Arbeiter-Zeitung, die in Gemeindewohnungen wohnten. „Daraus mache ich ein Plakat und setze mich damit vor den Stephansdom“, sagte ich. Und siehe, der Herr tat ein Wunder: Kurze Zeit später hatte die Familie Leeb Gemeindewohnungen. Dass ich auch Helmut Zilk diese Geschichte erzählte, hat vielleicht dazu beigetragen, dass er die Vergabe von Gemeindewohnungen viele Jahre später an klare, transparente Kriterien band. Es hat aber nicht nur meinen Abschied von der Arbeiter-Zeitung entscheidend erleichtert, sondern Jahre später wesentlich zu meinem Abschied vom Kurier beigetragen. Weit häufiger nämlich als selbst AZ-Redakteure, saßen bürgerliche Wiener Redakteure in Gemeindewohnungen – einer (er gehörte nicht dem Kurier an) erhielt vier nacheinander, weil er jeder seiner jeweils geschiedenen Frauen eine hinterließ. Das blieb nicht ganz ohne Einfluss auf die Kommunalberichterstattung der bürgerlichen Blätter. Mein unmittelbarer Chef beim Kurier, ein bestens verdienender Kollege, bewohnte zum Beispiel selbstverständlich eine Gemeindewohnung in Wien Döbling. (In einer Siedlung, die bis heute dem sozialistischen Adel vorbehalten ist, nur dass die Beteiligten mittlerweile meist zusätzlich Häuser am Land haben, die sie sich dank der günstigen Wiener Mieten früher als andere anschaffen konnten.) Man kann nicht sagen, dass dieser Kollege die Dinge nicht menschlich gesehen hätte: Er hatte nicht nur für sich eine Gemeindewohnung erhalten – er bemühte sich auch darum, seiner Sekretärin eine zu verschaffen. Das tat er zufällig in einem Augenblick, in dem ich als Lokalreporter auf höchst seltsame, in meinen Augen aufklärungsbedürftige Geschäfte der Gemeinde
„Nee, machn wa zwo Uhr siebzehn“
Wien beim Erwerb oder Verkauf der sogenannten „Skala Gründe“ in Wien-Wieden gestoßen war und ihn bat, mir ein paar Tage für intensivere Recherchen zuzugestehen. „Wissen Sie, ich bemühe mich gerade um eine Gemeindewohnung für Frau G“, sagte mein menschlicher Chef, „ich glaube diese Skala-Geschäfte sollten wir nicht gar so wichtig nehmen.“ Das war mit eines der Ereignisse, die mich Oscar Bronners Angebot annehmen ließen, Chefredakteur seines Nachrichtenmagazins zu werden. Die Grundstücksgeschäfte der Gemeinde Wien waren das erste Thema, das ich dort in Angriff nahm. Aber das war viele Jahre später. Noch war ich bei der Arbeiter-Zeitung – wenn auch mit dem Gefühl zunehmender Distanz. Nicht unbedingt zum Sozialismus, wohl aber zu einem Journalismus, der das, was er für das Wohl der Partei hielt, für wichtiger als die Wahrheit ansah. Eine Einstellung, die die Arbeiter-Zeitung letztlich in den Untergang führte, obwohl sie über die vielleicht besten Journalisten des Landes verfügte. Denn immer mehr Leser zogen den Kurier und lange selbst das wesentlich langweiligere Neue Österreich der Arbeiter-Zeitung vor, weil sie dort zu Recht bedeutend mehr Unabhängigkeit erlebten. Nicht, dass der Kurier der ÖVP nicht deutlich näher als der SPÖ gestanden wäre, aber er hielt nicht automatisch alles, was die ÖVP plante oder tat, für richtig und alles, was die SPÖ plante oder tat, für falsch. In der AZ musste man alles, was die SPÖ plante oder tat, unter allen Umständen für richtig halten – zum Beispiel auch die Beibehaltung des Friedenszinses oder niedriger Mieten in Gemeindewohnungen auch für Personen, die mittlerweile Abgeordnete oder Großunternehmer waren.
„Nee, machn wa zwo Uhr siebzehn“ Ich war damals mit so wichtigen politischen Dingen freilich nicht befasst, sondern eben Lokalreporter: Mein Rayon umfasste Einbrüche, Verkehrsunfälle, Mord und Totschlag. Und dann und wann – dafür schätzte mich Oscar Pollak – gesellschaftliche Probleme. Unter diese fielen, selten aber doch, auch medizinische Themen, für deren präzise Wiedergabe mich Franz Kreuzer schätzte. So kam es, dass er mir den Auftrag gab, bei einem Arzt namens Heinz Humplik, der sich auch mit einer Diät, der „Humplik-Kur“ einen Namen gemacht hat, eine von ihm entwickelte Operation zu recherchieren, die den Haarausfall aufhielt, indem die Spannung der Kopfhaut vermindert wurde und die, sehr zum Ärger Humpliks, in allen Zeitungen als „Glatzen-Operation“ bezeichnet worden war. Er tat mir diesen Ärger hinreichend kund, ich berücksichtigte die von ihm aufgezeigten Fehler in den Berichten von Kollegen, vermied sie und schrieb einen Artikel, der offenbar seine Zufriedenheit fand. „Das ist der einzige fehlerlose Text“, rief er mich schon am Tag der Veröffentlichung an, „der muss ab jetzt von jedem, der über meine Operation schreibt, abgeschrieben werden.“ Ich weiß nicht, ob noch sehr oft über seine Operation geschrieben wurde,
127
128
Warum denn nicht Journalist?
aber ich hatte meinen ersten Fan. Schon wenig später rief er mich wieder an und bat mich zu sich nach Hause. „Sie sind ein guter Journalist“, sagte er in etwa, „wollen Sie nicht auch für eine gute Zeitung schreiben?“ „Schon“, sagte ich und er nannte mir die auch in meinen Augen damals beste: Die zu diesem Zeitpunkt von Wolf In der Maur geführte und von Fritz Molden verlegte Wochenpresse die man damals als bürgerlich-liberal, nicht aber ÖVP-hörig bezeichnen konnte. Sie entsprach als Wochenzeitung in etwa dem, was Portischs Kurier als Tageszeitung war – vielleicht war sie sogar einen Schuss liberaler. Ich hatte etliche Artikel In der Maurs gelesen und zog die Arbeit unter ihm der Arbeit unter Oscar Pollak vor. Die Verhandlungen waren kurz – das angebotene Gehalt war sogar knapp höher als in der AZ und ein eigenes Zimmer sollte ich auch bekommen. Fröhlich wollte ich, von In der Mauer noch über die Stiegen begleitet, das Pressehaus verlassen, als wir dort Fritz Molden begegneten. „Darf ich Ihnen unseren neuen Mitarbeiter Herrn Lingens vorstellen?“ sagte In der Mauer. Molden, der mir ein korpulenter Riese schien, gab mir die Hand, die ich nicht ohne Ehrfurcht ergriff, denn er figurierte damals unter „Pressezar“. „Was wird er denn machen?“ „Lokales, Gesellschaft, vielleicht auch Gericht – er schreibt gut“, sagte In der Maur. „Und was wird er verdienen?“ In der Maur nannte eine Zahl, die ich mit 1700 Schilling in Erinnerung habe – aber ich kann mich irren. „Sind Sie wahnsinnig!“, brüllte Molden, „kommt überhaupt nicht in Frage.“ In der Maur wurde unendlich verlegen. Kollegen auf der Stiege hatten sich neugierig umgedreht. Die Szene glich einem Tribunal. „Ich will niemanden in Schwierigkeiten bringen“, sagte ich, „ich sehe meinen Vertrag als nie geschlossen an“, drehte mich um und ging. Ich habe später, nach seinem Absturz – der Molden-Verlag ging in Konkurs, das mit Abstand Beste, was dem Pressezaren von seinem einstigen Reichtum blieb, war seine zauberhafte Frau – noch ein paar Mal mit Fritz Molden zu tun gehabt. Zuletzt habe ich, ohne ein Honorar zu verlangen, bei ihm ein Buch über Wert und Unwert der Neutralität mit dem Titel „Wehrloses Österreich“ verlegen lassen, das ihm leider kaum Geld eingebrachte, denn es wurde zwar in der Zürcher Zeitung über eine Dreiviertel Seite besprochen, aber in Österreich völlig negiert. Das hat mir leidgetan, denn ich hätte Fritz Molden gerne gute Einnahmen verschafft, habe ich ihn doch diesmal als besonders liebenswerten, herzlichen, zutiefst bescheidenen Menschen kennengelernt. Manche Leute müssen erst tief fallen, damit plötzlich ihr liebenswerter Kern unter der aufgeblasenen Schale sichtbar wird. Humplik, dem In der Maur nur berichtete, was sich zugetragen hatte, schätzte Molden nach der damaligen Schale ein: „So ein aufgeblasener Kerl. Was ist das für ein Benehmen, seinen Chefredakteur in aller Öffentlichkeit bloßzustellen. Ich werde Ihnen
„Nee, machn wa zwo Uhr siebzehn“
etwas Besseres finden Herr Lingens. In Österreich kann man nichts werden. Ich bringe Sie nach Deutschland.“ Und das tat er tatsächlich. Wenig später machte er mich mit einem Hans Haid bekannt, eigentlich einem Salzburger, der es aber zu einem der „großen Nachkriegsvermögen Deutschlands“ gebracht hatte, wie ich einer Münchner Zeitung entnehmen konnte. Zu diesem Zweck hatte Haid aus den USA die Idee von Vertreter-Kolonnen kopiert, die jedem Haushalt eine damals noch als Luxus geltende eigene Wachmaschine verkauften. (Man wusch Wäsche damals noch – in Wahrheit preisgünstiger und umweltfreundlicher – in „Waschsalons“.) Sein Unternehmen, „Lavamat“, war in kurzer Zeit so erfolgreich, dass es den deutschen Waschmaschinenmarkt beherrschte und von Siemens immer größere Rabatte erzwang. Bis es Siemens zu dumm bzw. zu gefährlich wurde und der Konzern Haid Lavamat um viele Millionen abkaufte. Das war sein erster Streich, der zweite folgte gleich: Haid war aufgefallen, dass der deutsche Schreibmaschinen-Handel sich in einer Krise befand – wer immer auf einer Schreibmaschine schreiben konnte, besaß bereits eine. Haid zog daraus den richtigen Schluss, dass er Schreibmaschinenkurse verkaufen musste und entwickelte dafür ein eigenes System, bei dem man mit verschiedenfärbigen Fingerhüten Tasten mit verschiedenfärbigen Auflagen treffen musste. Diese wirklich sehr durchdachten Kurse verkaufte er zu einem akzeptablen Preis, in dem für eine angemessene Zeit die Miete einer Schreibmaschine inbegriffen war – und siehe da, es gab keinen Kurs-Absolventen, der nicht den Restpreis für den Kauf der Maschine bezahlte. Das spülte die nächsten Millionen auf Haids Konto und er besaß dafür Humpliks wie meine Bewunderung. Im Gespräch war er ein angenehmer, wenn auch wenig humorvoller Mann, dessen feine Gesichtszüge von Askese und strenger Diät gekennzeichnet waren. Dem entsprach auch sein calvinistisches geschäftliches Credo: Man muss etwas verkaufen, das den Menschen wirklich nützt. Ein solches Produkt sah er in Waren, die auf die besonderen Bedürfnisse von Eltern zugeschnitten waren: Von Babynahrung über Kinderspielzeug bis zu Eltern-Kind-Hotels, die er über die Mitgliedschaft einer ihm vorschwebenden Organisation preisgünstig anbieten wollte. Wie das Schreibmaschineschreiben sollten die Mitglieder, voran die Mütter, dabei im Weg einer Zeitschrift den optimalen Umgang mit Kindern, voran Babys, lernen. Und diese Zeitschrift sollte ich entwickeln. Richtiger: Weiterentwickeln. Denn es gab bereits ein mehrköpfiges Team, das in zwei Stockwerken des größten Bürohauses am Münchner Stachus Material gesammelt und teilweise auch zu Probetexten verarbeite hatte. Aber weder diese Texte, noch das Konzept, nach dem sie zusammengestellt werden sollten, hatte Haids Zustimmung gefunden. Meine Arbeit sollte das ändern. Vielleicht wäre das sogar geschehen, wenn Haid nicht einen fatalen Managementfehler gemacht hätte: Er machte mich nicht zu einem Teil dieses Teams, dem er offenbar bereits misstraute, setzte mich diesem Team aber auch nicht vor, sondern schuf für mich eine eigene neue Stellung: Er unterstellte mich ausschließ-
129
130
Warum denn nicht Journalist?
lich ihm selbst, forderte mich und das Team aber zu intensivster Zusammenarbeit auf. Der Leiter des Teams war ein etwa vierzigjähriger Norddeutscher – ob er von seiner Ausbildung her „Publizist“, „Kaufmann“ oder „Mutter-Kind-Experte“ war, habe ich nie herausgefunden. Nur dass es für ihn absolut unerträglich war, mit einem zwanzigjährigen Niemand aus Wien zusammenzuarbeiten und ihm nicht einmal vorgesetzt zu sein. Er war so entschlossen, alles, was ich machte, unbrauchbar zu finden, wie ich entschlossen war, es nach meinen Vorstellungen zu entwickeln. Hinzu kam, dass wir auch völlig verschiedene Vorstellungen von Arbeitsintensität hatten, die sich bereits bei unserer ersten gemeinsamen Sitzung herauskristallisierten, zu der er mich mit dem unvergleichlichen Satz einlud: „Also treffen wa uns in diesem Konferenzzimmer um zwo Uhr fufzehn – ne machen wa siebzehn.“ Ab zwei Uhr 17 sprachen wir dann zwei Stunden in meinen Augen völlig Triviales oder völlig Überflüssiges, so dass ich bat, mich endlich zu konkreter Arbeit verabschieden zu dürfen. Das Geschäft mit Müttern und Kindern, so lernte ich, ist ein besonders Besonderes: Es gibt die unglaublichsten Differenzen darüber, was der richtige Umgang miteinander ist. Ich hatte für meine Arbeit den Vorteil, mich wegen des großen Interesses meiner Mutter an Psychologie stets ebenfalls stark dafür interessiert zu haben: Studien wie die des Kinderarztes René Spitz, dass Kinder in Waisenhäusern physisch und geistig zurückblieben, weil sie den Hautkontakt beim Stillen nicht erlebten, waren mir ebenso geläufig wie Studien, wonach das Lächeln eines Babys in der Mutter reflektorisch Pflegereflexe auslöst. Nun aber ging es nicht nur um den Hautkontakt als solchen, sondern um sein Ausmaß, seine Vereinbarkeit mit dem Fläschchen-Geben und die Zeit-Intervalle, innerhalb deren er zu erfolgen hatte. Ich wühlte mich also allein zu dieser Frage durch die dutzenden hochwissenschaftlichen Arbeiten, die eine sensationelle Schwankungsbreite offenbarten: Es gab Wissenschaftler, die zweifelsfrei wussten, dass ein Säugling, dem man nach den ersten Hunger-Lauten kein Fläschchen reicht, schwersten Schaden an Körper und Seele leidet und andere, die ebenso sicher wussten, dass ein Kind, dem man sofort das Fläschchen reicht, niemals Disziplin erlernen würde, was ausschließlich dadurch zu erreichen sei, dass man es exakt alle vier Stunden füttert. Mein Ausweg bestand darin, diese gegensätzlichen Thesen mit der von Humplik geschätzten Präzision wiederzugeben und zu hoffen, dass sie einander auf diese Weise selbst relativierten. Danach ließ ich eine weise Mutter – mich – das Resümee ziehen, das mir der jeweils vernünftigste Kompromiss erschien. Ganz schlecht war das nicht. Jedenfalls ergab ein erster umfangreicher Copy-Test bei zahlreichen Frauen – Haid sparte da in keiner Weise – ein Resultat, das ein gelernter Verleger als optimal eingeschätzt hätte: Bei 90 Prozent der Leserinnen fand der Dummy maximale Zustimmung – bei zehn Prozent ebenso intensive Ablehnung.
„Nee, machn wa zwo Uhr siebzehn“
Aber Haid war kein gelernter Verleger und das Team, das er um sich hatte, hatte ihn zwar nicht durch sein eigenes Konzept überzeugen können, aber es vermochte ihn bezüglich meines Konzeptes zu verunsichern: Man müsse, um nicht überraschend doch Schiffbruch zu erleiden, alles unternehmen, um der so intensiven Ablehnung durch zehn Prozent den Boden zu entziehen. In diesem Sinne müssten Texte und Konzept noch einmal überarbeitet werden. Das geschah mit dem erwarteten Resultat: Die Ablehnung verringerte sich – aber die vorher so intensive Zustimmung verflachte sich in dem Ausmaß, indem die Texte nun bis zur Unkenntlichkeit ausgewogen und ent-emotionalisert worden waren. Ich habe nur mehr eines dieser kastrierten Kapitel zu Gesicht bekommen, dann überraschte Haid mit der Mitteilung, dass er das Projekt nicht mehr weiterverfolge. Es gab das Gerücht, dass er es an einen anderen Verlag verkauft hätte – aber ich konnte es nie verifizieren. Damit war mein Münchner Intermezzo beendet. Ich trug es insofern mit Fassung, als ich während meiner Münchner Emigration unerwartet unglaubliches Heimweh nach Wien entwickelt hatte – mir kamen die Tränen, so oft ich Walzerklänge im Radio hörte. Nach Wien zurückgekehrt, stand ich eine Woche hindurch um fünf Uhr morgens auf, um bei Sonnenaufgang durch die Innenstadt, den Burggarten und den Volksgarten zu streifen, die Fassaden der Häuser – auch die klassizistischen, die ich ansonsten kritisierte – hoch zusehen und um am Ende in der Meierei des Volksgartens oder in der Conditorei Sluka gegenüber dem Hinterausgang des Parlaments ein Frühstück mit Wiener Kaffee zu genießen. Ich war selig. Zu meiner guten Stimmung trug bei, dass ich auf meinem Konto eine Menge in Deutschland Erspartes liegen hatte. Vom Journalismus hatte ich im Moment genug und war entschlossen, endlich etwas Nützliches zu erlernen: Ich inskribierte an der medizinischen Fakultät, um Arzt, Psychiater wie mein ausgewanderter Vater mit psychoanalytischer Schlagseite wie meine Mutter, zu werden. Ihr folgend hatten mich Psychologie, Psychiatrie und Psychoanalyse, aber auch die von der Psychoanalyse heftig abgelehnte Verhaltensforschung schon in meiner Schulzeit mehr als alles andere interessiert. Ich hatte diesbezüglich Arbeiten, die meine Mutter sich zusenden ließ, immer mitgelesen und mit ihr diskutiert – das Studium der Psychiatrie schien mir logisch und eher verwunderte mich, dass ich es nicht sofort ergriffen hatte. Mittlerweile – und ich sollte erst später erkennen, wie sehr mich das belastete – war ich allerdings vierundzwanzig und stand auf einmal nicht mehr auf eigenen Beinen, sondern war wieder völlig auf das Geld meiner Mutter angewiesen. Ich hatte das berechtigte Gefühl, mich sehr, sehr eilen zu müssen, denn fünf Jahre waren bei Medizin die Mindestdauer. Ich eilte mich auch anfangs mit Erfolg. Diverse Kolloquien und die Physikprüfung legte ich zum frühesten Termin ab – allerdings nicht mit der von mir für sicher gehalte-
131
132
Warum denn nicht Journalist?
nen Auszeichnung. Physik war die ganze Schulzeit hindurch mein Lieblingsgegenstand mit immer der besten Note gewesen. Eine Wissenschaft, die ich auch gerne studiert hätte, war sie doch das Fach meiner eindrucksvollsten Vaterfiguren, von Victor Weisskopf bis Alexander Weißberg. Mit ihnen hatte ich physikalische Probleme diskutieren dürfen und nun war ich zwar locker durchgekommen, doch an einer einfachen Frage gescheitert, die über die Auszeichnung entschied und von der ich überzeugt war, sie beantworten zu können. Doch ich war rasend nervös gewesen. So wie nur bei den Mathematikschularbeiten unter Walter Eschig. Am Morgen hatte ich nur ein Knäckebrot essen können; mein Magen schien mir ständig nahe dem Kehlkopf; mein Herz klopfte hörbar. Manche Fragen hatte der Prüfer wiederholen müssen, ehe ich sie verstand. Es war zwar letztlich gut gegangen – aber wirklich nicht mehr. Eine Zwischenprüfung in Anatomie hatte ich dann mit weniger Nervosität mit sehr gutem Erfolg abgelegt und den Stoff für die eigentliche Anatomieprüfung, die schwerste des ersten Studienabschnitts schon durchwegs intus – aber vor ihr kam die Prüfung in Chemie. Und Chemie war immer einer meiner schwächeren Gegenstände an der Schule gewesen – über die Note „befriedigend“ war ich nie hinausgelangt. Es interessierte mich nicht, wie Säfte zusammengerührt wurden und am Ende sich selbst oder einen Papierstreifen verfärbten, genau so wenig wie mich interessierte, dass irgendein Pulver plötzlich staniolfarben brannte. Was mich ausschließlich interessierte, waren die physikalischen, die inneratomaren Vorgänge, die hinter solchen Erscheinungen standen und auf die ging die Lehrerin an der Schule nicht ein. Dass die meisten Klassenkollegen es genau umgekehrt sahen und fanden, dass das Hochzischen und Farbenspiel diverser Flüssigkeiten höchstens noch vom Brennen einer Chemikalie übertroffen wurde, die am Wasser schwamm – sie drängten sich um den Katheder, um es aus nächster Nähe zu verfolgen – war mir rätselhaft. Ich war dennoch der Meinung, mich mit der größten mir möglichen Aufmerksamkeit durch alle Chemieskripten gekämpft zu haben und Klaus Draxler, der mich abgehört hatte, bescheinigte mir noch am Vortag, „weit mehr als nötig“ zu wissen – ich hätte mit meinem Wissen seine Chemieprüfung am Physikalischen Institut bestanden. Tatsächlich hatte ich alles, was in der Chemie mit Physik zusammenhing, begeistert in mich aufgesogen und wirklich nur links liegen gelassen – „gespritzt“, wie man unter Studenten sagte – was ausschließlich mit „Proben“ und Eprouvetten zusammenhing. Schließlich wollte ich zum frühestmöglichen Termin antreten und jeder Prüfling spritzte irgendetwas. (In den USA, so erfuhr ich später von meinem Vater, ist das ausgeschlossen, weil die durchwegs schriftlichen Prüfungsfragen immer alle Gebiete umfassen und es kein Durchkommen gibt, wenn man in einem Teilgebiet versagt. Ich halte das für letztlich sehr vernünftig.)
„Nee, machn wa zwo Uhr siebzehn“
Am Tag meiner Prüfung konnte ich nicht einmal Knäckebrot herunterwürgen. Mein Magen war meinem Kehlkopf so nahe, dass ich glaubte, mich sofort übergeben zu müssen. Das Herz klopfte mir im Gesicht. Ich war der Letzte in der Reihe der Prüflinge. Die Fragen, die ihnen gestellt wurden, drangen nur von ferne an mein Ohr, als wäre ich eben erst aus einer Narkose oder Bewusstlosigkeit. erwacht. Dabei war mir der Dozent, der sie stellte, als besonders guter Lehrer geläufig – er trug weit besser als der für die Chemie zuständige Professor vor. Ich war froh gewesen, bei ihm dranzukommen, war er doch ein durchaus intelligenter Prüfer. Keiner wie der Pharmakologe, der absolut sinnlos vorging. „Wie viel dieses Giftes enthält die Tablette“, hatte er einen Prüfling zur endgültigen Entscheidung über sein Durchkommen gefragt“. „0,06 Milligramm“ hatte der geantwortet. „Also richtig wär’ 0,006“ hatte der Professor geantwortet, „aber ich seh’ Sie haben was g’lernt“ und ihn durchgelassen. Mein Prüfer war nicht von dieser Mentalität, sinnlos Angestrebertes vernünftigem Wissen um Dimensionen vorzuziehen. Er wollte vernünftige, denkende Ärzte ausbilden. Der Prüfling vor mir hatte die Frage nach einer bestimmten Harnprobe nicht beantworten können und nun wollte er von mir wissen, ob ich es konnte. Ich konnte es auch nicht – sie gehörte unter den gespritzten Teil des Stoffes. Der Dozent war schon etwas in Eile. Er klopfte mit dem Finger auf die Platte seines Katheders, das Klopfen brachte mein Herz aus dem Rhythmus. Es flimmerte mir vor den Augen. „Aber sie wollen doch beide Ärzte werden“, hörte ich ihn aus weiter Ferne sagen. „Ja“, sagte ich mit belegter Stimme. „Gut, ich stelle Ihnen die nächste Frage.“ „Kann es vielleicht eine aus dem Bereich der physikalischen Chemie sein? Die interessiert mich besonders“, fragte ich zurück und wusste im selben Moment, dass das die dümmste aller Äußerungen gewesen war. „Sie sollen nicht Physiker, sondern Arzt werden. Sie sollen das können, was jeder können muss, wenn er Arzt werden will“, sagte der Dozent sehr vernünftig. „Erklären Sie mir, auf welche Weise Sie schnell und einfach den Blutzuckergehalt bestimmen?“ Ohrenbetäubendes Schweigen. „Jemanden, der das nicht weiß, kann ich nicht durch die Chemieprüfung kommen lassen“, sagte der Dozent, „kommen Sie wieder, wenn Sie es wissen.“ Ich kam nicht wieder. Ich war am Boden zerstört. Vierundzwanzig – und noch nicht einmal über die beiden einfachsten Prüfungen des ersten Studienabschnittes hinweg. Ich musste die Chemieprüfung wiederholen, um überhaupt zur Anatomieprüfung, die diesen Abschnitt abschloss, antreten zu können. Das Ende des Medizinstudiums erschien mir plötzlich in unendlicher Ferne. Ich gab kampflos auf. Wenn ich heute versuche, dieses Verhalten zu analysieren, komme ich zu keiner wirklich befriedigenden, für mich halbwegs ehrenvollen Erklärung. Das mit der großen
133
134
Warum denn nicht Journalist?
Ferne des Studienabschlusses war eine Ausrede: Selbst wenn ich die Chemie wiederholen musste, kostete mich das schlimmstenfalls ein halbes Jahr – mit etwas Glück konnte ich aber schon früher einen neuen Termin bekommen. Es gibt Leute, die noch mit 70 studieren – allerdings haben die dann nichts mehr zu verlieren. Es war auch nicht unsinnig, unwürdig oder langwierig, den gespritzten Stoff nachzulernen. Aber ich entdeckte plötzlich an mir etwas Neues: Ich hatte panische Prüfungsangst. Angst, wie ich sie bei jeder Mathematikschularbeit erlebte, die ich unter den Augen des von mir so verehrten Professor Eschig ablegen musste. Angst, die mich Tischtennisund Tennis-Matches verlieren ließen, von denen alle, die mich als Spieler kannten, dachten, dass ich sie haushoch gewinnen müsse. Ich war und bin im Gegensatz zu meiner Mutter ein Mensch, der im entscheidenden Augenblick versagt, selbst wenn alles dafür spricht, dass er gewinnen wird: Mein Ausscheiden aus dem profil sollte dafür das Paradebeispiel sein.
19. Christine
Das Scheitern im Medizinstudium war nicht zuletzt von so einschneidender Bedeutung, weil es das Scheitern einer persönlichen Beziehung vorwegnahm und wahrscheinlich mitbedingte: Die dritte der großen Lieben meines Lebens, die Schauspielerin Christine Prober, wurde nicht meine Frau. Ich hatte sie, wie gesagt, durch meinen Cousin Alexander kennengelernt, der sie mir als „das schönste Mädchen, das ich kenne“ beschrieben und das mit einem Werbefolder, auf dem sie Sommerkleider vorführte, den ich bis heute vor mir sehe, unterstrichen hat. Bei einer Party, wie er sie in seiner Junggesellenwohnung immer wieder mit erstaunlichem Erfolg – fast durchwegs bildhübschen Mädchen – veranstalte, hatte er mich ihr vorgestellt und ich hatte mich prompt unsterblich in sie verliebt. Erstens – ich gestehe es – weil sie tatsächlich atemberaubend schön war. Zweitens – und darauf hatte ich bisher meist vergebens gehofft – weil ich mit ihr von der ersten Sekunde an über alles sprechen konnte, was mich interessierte: Wir waren in politischen Fragen ebenso einig wie in Fragen der Gesellschaftspolitik, wir fanden dieselben Bilder schön, dieselben Dramen großartig und dieselben Gedichte Rainer Maria Rilkes wundervoll. Später erfuhr ich, dass sie auch selbst Gedichte geschrieben hatte und wusste, dass sie gut sein würden. Die Sympathie war denn auch sofort eine gegenseitige – nur dass ihre Liebe unumstößlich einem anderen gehörte. Es gelang mir zwar ein paar Mal lange, wunderbare Gespräche mit ihr zu führen, sogar so etwas wie zärtliche Blicke mit ihr zu tauschen, aber nicht mehr. Sie hätte noch nie so sehr mit einem Menschen harmoniert, meinte sie zwar schon damals – aber der Mann, den sie liebte, war zu diesem Zeitpunkt uneinholbar ein mäßig erfolgreicher Schauspieler und Regisseur, dessen Namen ich verdrängt habe. Letztlich gab ich alle meine durchaus energischen und zahlreichen Versuche, sie zu erobern auf, und wir verloren einander aus den Augen. Von meinem Cousin erfuhr ich, dass sie nach Dänemark gefahren war, weil „er“ dort einen Job gefunden hatte und sie bei ihm sein wollte. Ich selbst fuhr etwa ein Jahr danach nach Deutschland, weil ich dort eine Mutter-Kind-Zeitschrift entwickeln sollte, und hörte auf, an sie zu denken. Bis wir einander auf der Maximilianstraße in die Arme liefen und bis zum nächsten Morgen nicht mehr voneinander ließen. In Wien bezogen wir ein Zimmer der Wohnung meiner Mutter, die ihr und der sie sofort sympathisch war. Wir teilten es mit einem zauberhaften kleinen Buben namens Raimund, den ich von der ersten Sekunde an genauso liebte wie sie, obwohl er nicht mein, sondern vermutlich „sein“ Sohn war. Während ich mein Medizinstudium begonnen hatte, hatte sie begonnen, Theater zu spielen. Anfangs winzige Rollen, aber sehr bald größere am Ateliertheater, das damals auf der Rechten Wienzeile residierte und recht angesehen war. (Zufällig sollte mein
136
Christine
jüngster Sohn Eric Jahrzehnte später im mittlerweile in die Burggasse übersiedelten Ateliertheater seine erste große Rolle, den Liliom spielen – das hat mich entsprechend berührt.) Ich war stolz auf Christines Erfolg, aber ich hatte ihm nichts entgegenzusetzen: Ich war ein Medizinstudent und fünf Jahre von einem Abschluss entfernt. Irgendwann war ich ein ganz passabler Journalist gewesen, aber das war vorbei. Ich war zwar jemand, mit dem sie perfekt ihre Rollen einstudieren konnte, weil meine Auffassung davon so gut wie immer mit ihrer übereinstimmte und es mir die größte Freude bereitete, ihr jeweiliges Gegenüber zu simulieren – vor allem wenn sie dieses Gegenüber liebte – aber am Ende war ihr Partner auf der Bühne dann eben doch ein anderer und sie hatte ihn zu lieben. Ich entdeckte, dass es ungemein schwer ist, eine Schauspielerin zur Partnerin zu haben. Zu wissen, dass ein anderer sie jeden Abend in den Armen hält, vielleicht küsst – dass sie jedenfalls glaubwürdig intensivste Gefühle mit ihm teilen muss, während man daheim auf sie wartet. Wobei man immer wieder vergeblich wartet, weil es nach der Aufführung noch so viel zu besprechen gibt, weil der oder jener Kollege Geburtstag hat und man doch nicht einfach heim rennen kann, wenn alle noch zusammensitzen. Von Premieren- oder Dernièren-Feiern gar nicht zu reden. Man musste ein ungemein selbstsicherer, in sich ruhender, im Zweifel nicht mehr so junger und bereits erfolgreicher Mann sein, um an der Seite einer wunderschönen Schauspielerin nicht jeden Abend vor Eifersucht zu sterben, wenn sie um elf noch nicht zu Hause war. Ich war ein zutiefst unsicherer, durch meine Lebenssituation als verspäteter Student zusätzlich verunsicherter Niemand und bin ein paar Dutzend Tode vor Eifersucht gestorben. Meist kann man nicht vermeiden, irgendwann zu zeigen, wie sehr man leidet, und das macht einen nicht attraktiver, sondern bewirkt das Gegenteil: Die Partnerin empfindet einen als jemanden, der sie gegen ihren Willen festzuhalten sucht. Als jemanden, der einen Anspruch erhebt, auf den er keinen Anspruch hat. Irgendwann lässt sie einen wissen, dass sie sich nach den Dutzenden Malen, in denen sie zu Unrecht beschuldigt wurde, ihren Partner oder ihren Regisseur auch nach der Aufführung geküsst zu haben, wirklich in ihn verliebt hat. Bei Christine und mir dauerte es etwa ein Jahr, bis es so weit war. Dann kam der Tag, an dem sie ihre Sachen in ihren Koffer packte, Raimund in den Kinderwagen legte und mein Zimmer für immer verließ. Raimund weinte – und ich weinte auch. Christine Prober zog letztlich nach Deutschland und heiratete dort den um16 Jahre älteren Wiener Schauspieler und Regisseur Günther Tabor, der in Kiel und Berlin als Theaterleiter tätig war. Sie führte mit ihm eine hervorragende Ehe, aus der zwei weitere Söhne hervorgingen und war eine führende Schauspielerin am Berliner Schillertheater. Mit meiner Mutter war sie bis zu deren Tod in intensivem Briefkontakt. Auch wir haben
Psychoanalyse ist ein teures Vergnügen
einander noch einmal in Berlin getroffen und Eric hat bei ihr Ferientage verbracht. Raimund war noch einmal bei mir in Wien. Natürlich werde ich ihr dieses Buch schenken, und sie wird dieses Kapitel mit Verständnis lesen.
Psychoanalyse ist ein teures Vergnügen Mein so totales Scheitern auf allen Ebenen ließ mich taumeln. Als ich eines Abends nicht einschlafen konnte, nahm ich mehrere Schlaftabletten und spülte sie mit einer großen Menge Alkohols hinunter. Meine Mutter wollte darin einen Selbstmordversuch sehen, obwohl ich die Tabletten sicher nicht mit dieser Absicht eingenommen hatte und mir auch der Magen nicht ausgepumpt werden musste. Dennoch begann ich, wie einst sie, eine psychoanalytische Behandlung, die ich jedenfalls als sinnvoll empfand: Ich kannte mich jetzt besser im Irrgarten meiner Probleme aus und wusste sie zu benennen. Dass ich meine Mutter zwar bewunderte, aber keine ihr ähnliche Frau zu lieben vermochte, war mir nicht unbedingt neu, aber ich wusste es jetzt an einem Dutzend Beispielen zu verifizieren. Dass es mir ebenso schwerfiel, eine Frau zu lieben, die völlig anders als sie war, war auch nicht unbedingt überraschend und ergab ein weiteres Dutzend Beispiele, die ich nun besser einzuordnen wusste. In Summe ergaben sich daraus viele vergebliche Versuche, jemanden zu lieben und das war das eigentliche Problem, das auch die Psychoanalyse nicht zu lösen vermochte. Meine Mutter war überzeugt, dass der Verlust meines Vaters die Ursache für diese „Beziehungsunfähigkeit“ sei, und vielleicht war er es auch – aber mein Problem wäre geringer gewesen, wenn sie es nicht so sehr herbeigewünscht hätte. Psychoanalyse ist ein sehr teures Vergnügen und die reine Lehre fordert, dass man das Geld dafür selbst aufbringt. Das ist jedenfalls sinnvoll. Um dieses Geld zu verdienen, versuchte ich mich wieder in einem Beruf: Ich trat ins Antiquitätengeschäft meines Onkels Klaus Lingens ein. Antiquitäten, voran Möbel, hatten mich, wie alle schönen Dinge, immer interessiert und in der Wohnung meiner Mutter war ich, als Erinnerung an die Hinterbrühl, von antiken Möbeln umgeben gewesen. So wie die Malerei der Gotik, des Barocks oder des Jugendstils hatten mich natürlich auch Inneneinrichtung und Architektur dieser Epochen interessiert und ich kannte mich darin passabel aus. Hinzu kam meine Liebe zur Natur, die sich auch als Liebe zum Material Holz manifestierte: Die Lebenslinien im Eichenholz einer gotischen Truhe oder im Furnier einer Barockkommode begeisterten mich. Ich wäre fast so gerne Möbeltischler geworden, wie ich „Industrial Design“ erlernen wollte. Das Geschäft meines Onkels schien gut zu gehen. Es hatte damit begonnen, dass er nach dem Krieg antike Möbel aus seinem Elternhaus verkaufte, mit denen er seinen Teil der Wohnung, die er mit meinem Vater in der Doblhoffgasse teilte, ausgestattet hatte. Nach zirka zehn Jahren in einem winzigen Laden war er ins Basiliskenhaus in der
137
138
Christine
Schönlaterngasse übersiedelt, hatte dort eine schöne Wohnung und in Schwallenbach in der Wachau den noch schöneren Seitentrakt eines Schlösschens gemietet. Klaus schien tüchtig zu sein und war kinderlos – warum sollte ich nicht irgendwann die Hälfte seines Geschäftes übernehmen? Die andere hatte er nämlich – „aus rein wirtschaftlichen Gründen, weil ich ihn brauche“ – bereits seinem langjährigen Freund Robert geschenkt. Seine Homosexualität war aber selbst innerhalb der engsten Familie für ihn ein Tabu – nie hätte er sie in jenen Jahren des Paragraphen 209 gegenüber meiner Mutter oder mir einbekannt. Dabei hatte meine Mutter mir zwar Freuds falsche Überzeugung mitgegeben, dass es sich um eine „psychische Erkrankung“ handle, aber davon, dass Strafe sie sicher nicht heilte, war sie so überzeugt wie ich und hatte mit den „Betroffenen“ auch immer selbstverständlichen Umgang. Mir gegenüber blieb sie bis zuletzt dabei, dass Klaus’ Entwicklung Freuds These belege, dass Homosexualität erlernt wird. Schließlich, so erklärte sie mir, sei er in seiner Jugend immer wieder erfolgreich heterosexuelle Beziehungen eingegangen. Dass das am Druck der Umwelt und seiner Familie lag, wollte sie nicht sehen. Da er extrem gut aussah, gab es auch immer wieder Frauen, die nur zu gerne mit ihm zusammenleben wollten. Die schönste davon, eine Wiener Adelige, war jenes blonde Mädchen, das als seine zufällig anwesende Verlobte die Jüdin Erika vor der Verhaftung bewahrt hatte. Aber wie mit ihr waren auch alle seine späteren Beziehungen mit Frauen zwingend auseinandergegangen. Doch die Falsifizierung einer These Freuds für möglich zu halten, war meiner sonst so kritischen Mutter nicht gegeben. Erst als mein Vater nach seiner Scheidung dringend die moralische Unterstützung seiner Brüder suchte und sich ihrer daher besonders annahm, kam er Klaus so nahe, dass der ihm in den 1950er Jahren bei einem Wien-Besuch erzählte, wie er seine homosexuelle Neigung entdeckt habe: Von seinem Vater auf ein kirchliches Internat in Boppard geschickt, habe ein Pater ihn verführt: „Aber es ist nicht gegen meinen Willen geschehen, sondern ich habe es gewollt.“ Der Druck des Paragraphen 209 ist für jüngere Leser dieses Buches kaum vorstellbar: Obwohl Klaus und Robert seit langem ein Paar waren, flirteten beide auch in meiner Gegenwart immer wieder demonstrativ mit Kundinnen oder Kellnerinnen ihrer Lieblingslokale. Erst als der Paragraph fiel, fiel zumindest vor mir auch Klaus’ Maske: Er umarmte mich und murmelte: „Jetzt werden sie mich dafür nicht gleich verdächtigen und anklagen.“ Damit ich freilich ja nicht glauben sollte, dass unsere Verwandtschaft und ein gewisser Schönheitssinn dafür ausreichten, mich zum Antiquitätenhändler zu machen, begann er meine Lehrzeit damit, dass er mich durch Stunden schwere, schwarze Kupferkessel und Messingmörser blank putzen ließ oder mir befahl, mäßig schöne nachgemachte Refektorium-Tische mit Büffelbeize einzustreichen und zu mattem Glanz hoch zu bürsten, bis mir der Arm herunterfiel. Wenn ich eine Sekunde innehielt, bekam ich ein Staubtuch in die Hand gedrückt. Denn dass ich zu wenig arbeiten könnte, besorgte
Psychoanalyse ist ein teures Vergnügen
meinen Onkel wie einen schwäbischen Finanzminister: Es gehörte zu seiner Vorstellung von einem guten Kaufmann, dass der Lehrling ununterbrochen körperlich tätig sein muss, auch wenn es viel lukrativer gewesen wäre, wenn ich in Wiener Altwarenläden nach historischen Drucken gesucht hätte, wie ich sie mehrfach aufgetrieben und mit beträchtlichem Gewinn verkauft hatte. (Ich habe diese seltsame Liebe zu körperlicher Arbeit später bei meinem journalistischen Lehrmeister Jens Tschebull wiedergefunden: Er wollte unbedingt, dass wir unsere Schreibtische selbst von einem Stockwerk ins andere übersiedelten, statt dass wir in dieser Zeit Geschichten recherchiert hätten.) Einmal bat mich Klaus, mir trotz eingestrichener Büffelbeize eingehend die Hände zu waschen, die Fingernägel zu putzen und eine Standuhr zu schultern. Sie müsse auf diese Weise in die Metternichgasse in den 3. Bezirk geliefert werden, weil sie für ein Taxi zu groß und einen Lastwagen-Transport zu heikel sei: So betrat ich erstmals das Haus meines späteren Freundes Heinrich Treichl. Klaus war also mir gegenüber der denkbar strengste Lehrherr – aber (wie Jens Tschebull) alles eher als ein wirklich guter Kaufmann. Er arbeitete damals mit einem Antiquitätenhändler namens Schiemann zusammen, der auf irgendeine Weise zu dem sagenhaften Privileg gelangt war, antike Möbel in der kommunistischen Tschechoslowakei einkaufen und nach Österreich auszuführen zu dürfen. Mein Onkel sollte sie in seinem Geschäft verkaufen und ihm dafür die Hälfte des Verkaufserlöses geben, was er, durch und durch Ehrenmann, auf den Groschen genau tat. Nur dass er die Erlöse dieser Verkäufe danach allein versteuern musste, so dass ihm so gut wie gar nichts blieb. Als die Steuerbehörde ihn auch noch „einschätzte“, weil sie wie bei jedem Antiquitätenhändler mindestens ein Viertel Schwarzverkäufe vermutete, stand er vor dem Konkurs. Ich rettete ihn durch diverse Vergleiche und indem ich ihm die letzte Renaissancetruhe aus seinem Elternhaus, die er mir zum 18. Geburtstag geschenkt hatte um einen Teil meines in Deutschland ersparten Geldes abkaufte. Gott sei Dank, denn so blieb sie mir als einziges Erinnerungsstück an dieses deutsche Elternhaus erhalten und steht heute im Wohnzimmer meiner geschiedenen Frau. Das Schiemann-Fiasko ließ Klaus das Antiquitätengeschäft an den Nagel hängen und sich auf den Verkauf der Bilder zeitgenössischer Maler verlegen. Das waren damals in Österreich die phantastischen Realisten, vermehrt um Außenseiter wie den nicht wirklich zuordenbaren Anton Lehmden, (den ich unverändert für einen sehr guten Maler halte) oder um Wolfgang Hutter mit seinen hübschen Blumenbildern. Populärster Vertreter der Phantasten, unter denen es auch hervorragende Zeichner wie Ernst Fuchs vor seiner Kitsch-Periode oder wirkliche Phantasten wie Arik Brauer gab, war allerdings „Maître Leherb“, vulgo Helmut Leherbauer, der mit einer Taube am Arm durch die Klatschspalten der Boulevardpresse flanierte und, wie er meinem Onkel sagte, für seine großen Ölbilder hunderttausende Schilling erzielte. Klaus war daher glücklich, ihm nach mehreren Ausstellungen, bei denen sich so teure Gemälde leider nicht verkauften, ein paar der verblieben Bilder „extrem billig um wenige tausend Schilling“ abzukaufen,
139
140
Christine
wie er das übrigens zu geringeren Preisen bei allen Malern tat, die nichts verkauft hatten – „denn von irgendetwas müssen die armen Kerle doch leben.“ Nur dass er auf diese Weise unmöglich von seiner Galerie leben konnte. Als sich herausstellte, dass er wieder beinahe vor dem Konkurs stand und es auch nichts nutzte, dass ich ihm die Renaissancetruhe ein zweites Mal abkaufte, entschloss er sich schweren Herzens, einen seiner kostbaren Leherbs ins Dorotheum zu geben, wo er fassungslos zur Kenntnis nehmen musste, dass sie auch dort fast nichts einbrachten. Da auch jene Fantasten, die mittlerweile relativ erfolgreich geworden waren, nicht mehr in einer Galerie ausstellen wollten, die auf „Leherb“ gesetzt hatte, brach Klaus’ Bilderhandel endgültig zusammen. Er musste aus seiner Wohnung ausziehen und konnte sich dank kirchlicher Fürsprecher mit seinem verbliebenen Freund – der hübsche Robert war ihm abhandengekommen – in zwei feuchten Zimmern einer niederösterreichischen Burg einmieten. Statt mit Barock- oder Renaissance-Möbeln richtet er sie mit „Altwaren“ ein, die er beim nächsten Tandler erworben hatte. Statt wie einst mit Messing-Mörsern, gotischen Schlössern oder barocken Lustern dekorierte er den Raum mit rot und blau lackierten Blechhäferln, die er an Nylonschnüren von der Decke baumeln ließ, damit sie nicht mehr so hoch war. Und das Ganze sah dennoch so gemütlich wie seinerzeit aus. Im Burggraben vor seinem Fenster baute Klaus Gemüse an. Das verkaufte der jüngste Sohn des angeblich einst reichsten Mannes Düsseldorfs dann aus einer schäbigen Aktentasche an ein Wiener Innenstadt-Restaurant, das sich als eines der ersten biologischer Speisen rühmte. Wenn er bei uns eingeladen war, trug er stets den einzigen fadenscheinigen, dunklen Anzug, der noch in seinem Besitz war, legte auch bei größter Hitze niemals das Sakko ab und übergab meiner Mutter immer einen prachtvollen Strauß Blumen, die er im Burggraben gepflückt hatte. Der Maler Karl Anton Fleck hat ihn in einem hervorragenden Portrait, das jetzt bei meinem Sohn Oliver hängt, als klassischen Wiener Gentleman verewigt. Im Gegensatz zu meinem Vater beklagte er seine Armut zu keinem Zeitpunkt und sie war ihm auch zu keinem Zeitpunkt anzusehen. Klaus Lingens vermochte wie eine Antiquität in Würde alt und bei genauem Hinsehen noch schöner zu werden. Einmal im Jahr lud ihn Katharina, die geschiedene Frau seines Bruders Walter, in ihr Haus nach Atrani ein. In ihren Gästezimmern – sie hatte das Haus zur Fremdenpension umgebaut – gab es einen letzten Rest der Möbel aus seinem deutschen Elternhaus, er durfte dort gratis wohnen und bekam von dem herrlichen Essen, das Katharina ihren noblen Gästen auftischte. Ältester italienischer Adel zählte dazu ebenso wie neuester internationaler Geldadel – Jaqueline Bouvier feierte dort ihre Abschiedsparty vom Junggesellinnenleben, ehe sie John F. Kennedy heiratete. Mittlerweile waren Bar und Restaurant zwar nicht mehr auf diesem Niveau – auch Katharina war zwar noch immer
Stubenböden
sehr schön, aber doch um vieles älter geworden – aber den besten Wein der Gegend kredenzte sie noch immer. Klaus hatte sich angewöhnt, schon am Morgen ziemlich viel davon zu trinken. So auch am letzten Tag seines Italienaufenthaltes. Ein wenig benebelt ging er zu dem Zug, der ihn wieder zurück nach Österreich bringen sollte, öffnete die Wagentür und brach tot zusammen. Er ist in Italien begraben.
Stubenböden Ich habe den Antiquitätenhandel, den er aufgegeben hatte, quasi in Eigenregie weiter betrieben: Habe in Antiquitätengeschäften der Peripherie Waren eingekauft, die mir gefielen und sie an teure Geschäfte im 1. Bezirk weiterverkauft. Bis ich in einem großen Altwarenladen in der Nähe von Ybbs auf eine Ware stieß, auf die ich mich spezialisierte: „Stubenböden“-Holzdecken, die aus einer Reihe meist geschnitzter Balken und Zwischenbretter bestanden, die von einem großen Mittelbalken gehalten wurden und so den gemütlichen Plafond vieler Bauernhäuser bildeten. Da damals viele Wiener Landhäuser erwarben und sie stilgerecht adaptieren wollten, konnte ich von meinen „Stubenböden“ leben und meinen Analytiker bezahlen. Wobei es im Übrigen nicht so war, dass Händler wie ich arme Bauern um wertvolles antikes Inventar brachten, sondern wir retteten es vor dem Untergang: Fast durchwegs ersetzten Niederösterreichs Bauern ihre „Stubenböden“ nämlich durch Betondecken und verwendeten die Balken zum Schalen der Betonträger. Dass ich dafür mehr als für Brennholz bezahlte, ließ sie an meinem Verstand zweifeln und diese Zweifel gaben sich erst, als eine Zimmerei „Stubenböden“ in ihren Verkaufskatalog aufnahm. Ich kann mich nämlich rühmen, in Ybbs eine Volkskunst-Industrie ins Leben gerufen zu haben – wenn auch nicht ganz freiwillig. Am liebsten kaufte ich Stubenböden nicht direkt bei Bauern, die ihre Preise ob meiner städtischen Anmutung automatisch verdoppelten, sondern bei einem Großhändler, der sein Hauptgeschäft mit Alteisen machte und Stubenböden nicht wesentlich davon unterschied. Für den sehr großen Plafond im Landhaus eines Wiener Kaufmanns kaufte ich ihm zwei solcher Stubenböden ab, deren Balken ich mischen wollte. Aber als ich einen Transport organisiert hatte, um sie abzuholen, hatte er einen davon an einen Händler verkauft, der ihm 100 Schilling mehr geboten hatte. Ich lief Gefahr, meinen bis dahin größten Auftrag nicht erfüllen zu können. Auf meiner verzweifelten Suche nach einem „Stubenboden“ gleichen Alters (1800–1900) konnte ich einem Bauern zwar zum Doppelten des üblichen Preises die entsprechenden Balken entreißen, mit denen auch er soeben seine Betonträger geschalt hatte, aber sie waren nicht vergleichbar reich geschnitzt.
141
142
Christine
Ich machte also einen Zimmermann ausfindig, von dem man mir sagte, er könne gut schnitzen und der vermochte tatsächlich, die beiden Balkendecken einander anzugleichen. In der Ybbser Zimmerei, deren bester Zimmerer er war, gefiel das entstandene Produkt so gut, dass sie es in ihren Verkaufskatalog aufnahm und meines Wissens durch viele Jahre aus altem Holz geschnitzte und händisch gehobelte „Stubenböden“ vertrieben. Mein Problem war die Montage meiner Stubenböden und ich tat mich zu diesem Zweck mit zwei Burschen zusammen, die auch in ihrem Studium gescheitert waren und auch etwas verdienen mussten. Als ein Kunde zum Stubenboden passende Büchergestelle haben wollte, stellten wir auch die her, indem wir die dicken Mittelbalken als „Stamm“ eines Bücherbaums benutzten. Und als jemand dazu auch passende Einbauschränke haben wollte, entwarfen und produzierten wir auch davon erste Exemplare, für die wir das Material in meinem VW transportierten. Bis meine beiden Mitarbeiter plötzlich samt Auto verschwunden waren. Mit ihnen ein paar tausend Schilling, die ich ihnen für den Holzeinkauf übergeben hatte. Das Auto fand sich später in Italien – den einen der beiden traf ich noch viel später in Wien, nachdem er eine Werbeagentur gegründet hatte. Ich begleitete ihn in seine Wohnung und ging dort nicht sehr freundlich – eher nach Art „Joschis“ – mit ihm um. Denn nicht nur, dass die beiden damals mein Geld mitgenommen hatten, hatten sie auch in diversen Holzgeschäften Rechnungen von mehreren tausend Schilling offen gelassen, die ich begleichen musste. Dazu einen halbfertigen, fünf Meter langen ziemlich komplizierten Einbauschrank, den ich allein fertigstellen musste. Hilfe dabei leistete mir ein junges Mädchen, das meine erste Frau werden sollte. Aber vorerst war ich auch als Unternehmer total gescheitert.
20. Ein Vater namens Wiesenthal
Es war in dieser Zeit meines totalen Scheiterns, dass meine Mutter erstmals privaten Besuch von einem Mann erhielt, der als „Eichmannjäger“ bekannt war. Sie hatte ihn auf internationalen Kongressen diverser KZ-Gemeinschaften kennengelernt und die beiden einte ihre Empörung über die schlechte Behandlung überlebender Sinti und Roma, für deren Entschädigung man sich kaum einsetzte sowie die Irritation darüber, dass Kommunisten die Lagergemeinschaften für ihre Zwecke vereinnahmten – um dort Propaganda gegen die „faschistische revanchistische Bundesrepublik Deutschland“ zu betreiben. Ziemlich einsam stimmten sie immer gemeinsam gegen entsprechende Resolutionen und das mündete schließlich in eine Einladung zum Tee in die Wohnung meiner Mutter. „Obwohl wir beide in Wien wohnen, haben wir uns bisher immer nur im Ausland getroffen“, begrüßte sie ihn. Was ihn prompt sofort seinen ersten Witz erzählen ließ: „Treffen sich zwei Juden im Jahr 41 in New York. ‚Weißt Du wie’s dem Grün geht?‘ fragt der eine. ‚Er ist nach Grönland emigriert und verkauft dort Eisschränke!‘ ‚Und dem Blau?‘ ‚Der verkauft Heizdecken in Südafrika!‘ ‚Und dem Rot?‘ ‚Der ist in Wien geblieben – er is a Abenteurernatur!‘“ „Wir sind, glaub ich, zwa Abenteurernaturen.“ Wiesenthal lachte immer selbst am meisten über seine Witze und sein warmes Lachen war ungemein ansteckend. „Man kann die Erinnerung an diese Zeit nur aushalten, indem man Witze darüber macht“, sagte er mir später, als wir Freunde geworden waren. „Am besten traurige: Treffen sich die letzten zwei Juden im Jahr 41 im letzten für sie noch offenen Wiener Kaffeehaus: ‚Wo is denn der Kohn – kommt der gar nicht mehr her?‘ ‚Er hat sach aufgehängt!‘ ‚No wann a sach kann verbessern!‘“ Meiner Mutter, die wenig Humor hatte, entkam bei Wiesenthals Witzen nur ein halbes Lächeln. Sie kam sofort auf Probleme der Wiedergutmachung innerhalb der Lagergemeinschaft Auschwitz zu sprechen, die im Wesentlichen darin bestanden, dass die Juden nicht verstanden, warum Roma und Sinti für Wohnwägen oder Instrumente, die ihnen weggenommen worden waren, ähnlich entschädigt werden sollten wie jüdische Geschäftsleute, deren Wohnungen oder Geschäft arisiert worden waren. Wiesenthal war von dieser Haltung seiner Glaubensbrüder ähnlich befremdet und berichtete von ähnlichen Auseinandersetzungen in seiner Lagergemeinschaft: „De Jiddn streitn schon um a Geld, dass se noch gar nicht haben“, lachte er einmal mehr sein ansteckendes Lachen.
144
Ein Vater namens Wiesenthal
Etwa zu diesem Zeitpunkt verließ ich die Unterhaltung, um an einem meiner BücherBäume zu arbeiten. Erst viel später erzählte mir meine Mutter, dass sich das folgende Gespräch um mich gedreht hat. Sie mache sich ziemlich Sorgen um mich, sagte meine Mutter. Ich hätte mein Studium aufgegeben, versuchte mich als Antiquitätenhändler, ohne dass eine wirkliche Berufslaufbahn abzusehen sei, befände mich zwar in psychoanalytischer Behandlung, machte aber offenbar keine rechten Fortschritte. Da habe Wiesenthal ihr angeboten: „Soll er doch ein bisschen zu mir in mein Büro kommen, vielleicht kann ich ihm helfen.“ So wurde ich Mitarbeiter in Simon Wiesenthals Büro am Wiener Rudolfsplatz. Ich kenne keinen Menschen, der sich mehr von der Vorstellung unterscheidet, die die Öffentlichkeit von ihm hat. Seine Verdienste sind heute sozusagen amtsbekannt, so dass ich mich dazu sehr kurz halten will: Er hat entscheidend dazu beigetragen, dass die „Vergangenheit“ gegenwärtig geblieben ist und auch die Österreicher den Holocaust nicht völlig verdrängen konnten. Er hat entscheidend dazu beigetragen, dass auch Roma und Sinti als Opfer des Holocaust begriffen wurden. Er hat entscheidend dazu beigetragen, dass NS-Verbrechen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht verjähren. Und er war der einzige Österreicher, der nach 1948 noch Wert darauf gelegt hat, dass Massenmörder hierzulande weiterhin verfolgt wurden und hat einige davon ausgeforscht, auch wenn sie kaum je adäquat verurteilt wurden. Er hat auch einen Beitrag zur Ausforschung des Linzers Adolf Eichmann geleistet, indem er dessen Totschreibung verhinderte und Israel informierte, dass er vermutlich in Argentinien lebt. Einige der israelischen Agenten, die ihn dort wirklich ausgeforscht haben und tollkühn entführen konnten, haben Wiesenthal übelgenommen, dass er statt ihrer als „Eichmannjäger“ bekannt geworden ist, nachdem er ein Buch mit dem Titel „Ich jagte Eichmann“ veröffentlicht hat. Aber wer es gelesen hat, weiß, dass er dort vor allem beschreibt, wie sein eigener Versuch, Eichmann im Ausseerland festzunehmen, fehlgeschlagen ist. Viel mehr geleistet zu haben, hat er nicht behauptet. Dass er ihn bis zuletzt gejagt hat, steht außer Zweifel. Er hat zum Beispiel erwogen, dass ich versuchen sollte, mich mit Linzer Verwandten Eichmanns anzufreunden – aber mein Name war dazu durch meine journalistische Arbeit schon zu punziert. Auch eines der ersten Gespräche, zu denen er mich mitnahm, war das mit einem Informanten, der angeblich gute Beziehungen in die südamerikanische NS-Szene hatte und das mir ob seiner Skurrilität in Erinnerung blieb. Der Mann, dessen Namen ich nicht mehr weiß, spielte an einem bestimmten Tag der Woche jeweils in einem Schachklub in der Wiener Innenstadt, dessen Räume an ein Café angeschlossen waren. Dort mussten wir eine gute halbe Stunde auf ihn warten, denn Wiesenthal bestand darauf, ihn durch den Oberkellner ja nicht „dringend“ zu uns herauszurufen: „Das könnte unsere Beziehung auffällig machen.“ Der Mann, der dann schließlich zu uns stieß,
Ein Vater namens Wiesenthal
war für mich die Hollywood-Version eines Spions: Eine schmale Gestalt im auffallend eleganten Esterhazy-karierten Anzug, der durch einen Regenschirm und einen über den Arm geworfenen Trenchcoat zum Agenten-Outfit aus „Schirm Charme und Melone“ ergänzt wurde; das Haar silbergrau meliert; dazu trotz des schummrigen Raumes eine Sonnenbrille, die, als er sie sich setzend abnahm, zwei ständig den Raum von links nach rechts und von oben nach unten absuchende Augen freigaben. Wenn man einen Spion karikierte, sähe er exakt so aus. Auch die Unterhaltung mit ihm verlief für mich wie eine Karikatur. Wiesenthal fragte nach seiner Gesundheit, seiner Familie, seiner beruflichen Zufriedenheit und wer weiß was noch, um nach einer Viertelstunde endlich die Frage zu stellen, auf die es ihm ankam: „Hast Du etwas Neues von A. E. gehört?“ „Nein“, sagte die Karikatur und damit war das Gespräch beendet. „Damit hast Du einen sehr wichtigen Mann kennengelernt“, sagte mir Wiesenthal und ich konnte nur mühsam ein Schmunzeln verbergen. Insgeheim überlegte ich durch Jahre ein Buch über „Agenten“ zu verfassen, das ich leider nie geschrieben habe: Der Held sah aus wie dieser Mann und der Erzähler – ich – macht sich durch ein Dutzend Kapitel über ihn lustig – bis er eines Tages erschossen wird. Es besteht kein Zweifel, dass Wiesenthal von seinem Ruf als Eichmannjäger extrem profitiert hat. Aber auch die Sache hat davon extrem profitiert: Die weltweite Bekanntheit, die er dadurch erlangt hat, hat wesentlich dazu beigetragen, dass er aus aller Welt angeschrieben wurde und nützliche Informationen erhielt. Das Geld, das er mit dem Bestseller verdient hat, hat wesentlich zur Finanzierung seines Büros beigetragen. Und viele politisch wenig interessierte Menschen haben überhaupt erst durch sein Buch erfahren, wer Eichmann war und welche Bedeutung er für den Holocaust hatte. In meinen Augen ist Wiesenthals Leistung als medialer Botschafter des Holocaust die größte, die er erbracht hat: Sein Buch „Doch die Mörder leben“ trug entscheidend dazu bei, dass sie, zumindest in Deutschland, weiterhin gesucht wurden und lehrte die Bevölkerung, dass es nicht um „Kriegsverbrechen“, sondern eben um Morde ging, die zufällig während eines Krieges stattgefunden haben. Das einprägsamste Beispiel für Wiesenthals Instinkt für Öffentlichkeitsarbeit ist seine Reaktion auf das Tagebuch der Anne Frank: In der Sekunde, in der es herauskam, begriff er, wie sehr sich Millionen Jugendlicher mit diesem Mädchen identifizieren würden. Da auch die Neonaziszene das sofort begriff, hat sie versucht, das Tagebuch als Fälschung zu diffamieren. Aber das gelang ihr nur, bis Wiesenthal in Karl Silberbauer jenen Polizeibeamten ausfindig machte, der die Familie Frank verhaftet hatte. Unter dem Gesichtspunkt der Ausforschung von NS-Verbrechern war das ein völlig unbedeutender Erfolg – aber für die Rezeption des Holocaust in Generationen junger Österreicher und Deutscher war es von überragender Bedeutung. Auch seine eigene Lebensgeschichte hat Wiesenthal zur Volksbildung genutzt: Der Bericht über seine Rettung durch zwei deutsche Mitarbeiter der OstbahnAusbesserungswerke wurde zu einem viel wirkungsvolleren Plädoyer gegen die
145
146
Ein Vater namens Wiesenthal
Kollektivschuld als jede philosophische Erörterung. Dass ausgerechnet diese seine Rettung durch zwei Deutsche durch Bruno Kreisky zur Kollaboration mit der Gestapo umgedeutet wurde, war eben deshalb so tragisch: Es war Volksbildung in die umgekehrte Richtung – Volksverbildung. Das waren auch alle anderen Vorwürfe gegen Simon Wiesenthal: Dass er schwerste Verbrechen rechtsstaatlich bestraft wissen wollte, wurde ihm als gnadenloser Rachedurst ausgelegt. Dass er die Strafbehörden darin unterstützte, Straftäter aufzuspüren und anzuklagen, wurde ihm als „Privatjustiz“ ausgelegt. Dabei hat es im Zusammenhang mit NSStraftaten kein relevantes Schreiben gegeben, das er nicht mit Durchschlag ans Justizministerium abgesendet hat. Schließlich war ich es, der solche Schreiben durch Monate getippt und kuvertiert hat. Wiesenthals Arbeit – so sagte er mir schon am ersten Tag und so sollte ich sie in der Folge erleben – war völlig anders als in der Vorstellung, die die Öffentlichkeit davon hatte: alles eher als spektakulär – denkbar weit von James Bond entfernt. Manchmal, so sagte er mir glaubhaft, sehr schmerzhaft – man müsse ertragen, Grauenhaftes zu lesen. Meist sehr frustrierend – man müsse akzeptieren, fast nichts zu erreichen. Dennoch verschaffe diese Arbeit Genugtuung: Man wisse, etwas Unverzichtbares zu leisten – für Gerechtigkeit zu sorgen. Er sagte das längst nicht so pathetisch, wie es hier klingt und die Frage, die er angefügt hatte, klang ebenso selbstverständlich: „Haben Sie nicht Lust einmal ein bisschen bei mir zu arbeiten? Sie bringen die richtige Nähe zu meinem Thema mit. Und ich habe gehört, dass Sie schreiben können. Da müsste ich nicht alle Briefe selber schreiben.“ Ich habe sofort ja gesagt – nicht, weil mich die Arbeit sofort so fasziniert hat, sondern weil dieser Mann so zu mir gesprochen hatte, wie ich mir immer vorgestellt habe, dass Väter zu ihren Söhnen sprechen. Uns allen, die wir in Wiesenthals Büro gearbeitet haben, ist es so ergangen: Wir wollten diesen väterlichen Mann umarmen, denn wir haben uns von ihm umarmt gefühlt. Typisch für Wiesenthal war, dass er keinen Unterschied zwischen den Verbrechen Stalins und Hitlers machen wollte: Beide hatten Millionen gemordet – Stalin allenfalls nicht ganz so industriell. Er bestand auf der inhaltlichen Verwandtschaft des stalinistischen mit dem faschistischen System: „Die Welt ist rund“, pflegte er zu sagen, „wenn ma geht sehr weit links, kommt ma ganz rechts wieder heraus.“ Ich habe diese gleichermaßen große Abneigung gegen das stalinistische und das faschistische System bei so gut wie allen Menschen wiedergefunden, die ich primär als Anti-Nazis kennenlernte: Bei meiner Mutter oder bei Fritz Molden, bei Hugo Portisch oder bei Kari Schwarzenberg. Und sie wurde von den beiden Männern geteilt, die ich am meisten bewunderte: Von Victor Weisskopf und Karl Popper.
Ein Vater namens Wiesenthal
Unter den Männern, die Wiesenthal bei seiner Arbeit unterstützten, wurde diese Haltung durch zwei Staatspolizisten verkörpert, mit denen auch ich lange freundschaftlichen Kontakt hielt. Sie hatten sich dieser Dienststelle angeschlossen, weil sie wussten, wie wichtig ein guter Geheimdienst ist, wenn es darum geht, Gefahr für Freiheit und Demokratie abzuwehren. Leider nannten sie ihre Recherchen in der Neonaziszene schon damals einen „einsamen Kampf “ ohne Rückendeckung durch den sozialistischen Innen- oder gar Justizminister. Vor allem in Justizminister Christian Broda sahen sie keinen Unterstützer, sondern einen Gegner und hielten ihr Misstrauen gegen ihn für gerechtfertigt: Die Gestapo hatte ihn als Mitglied einer kommunistischen Zelle verhaftet, die NS-Justiz hatte ihm den Prozess gemacht, ihn aber als einzigen Beteiligten freigesprochen; wenig später waren Mitglieder seiner militärischen Einheit verhaftet worden und hatte der Widerstand auf Flugzetteln davor gewarnt, dass Broda ein Spitzel sei. Alle Indizien, die in diese Richtung deuteten, hatten die beiden Staatspolizisten sorgsam gesammelt, zusammengeschrieben und Wiesenthal zwei Kopien dieser Niederschrift übergeben. Er hat dennoch, auch in seinen heftigen Auseinandersetzungen mit Broda, nie von ihrem Inhalt gebraucht gemacht – weil ihm die letzte Gewissheit fehlte, dass der daraus ablesbare schwere Vorwurf stimmt. Eine dieser Niederschiften sollte ebenso ungenutzt in meinem Schreibtisch im profil liegen, als ich wenige Jahre später im Clinch mit Broda lag, weil auch mir die letzte Gewissheit fehlte, einen so schweren Vorwurf zu äußern. Denn die Arbeit bei Wiesenthal hatte und hat entscheidenden Einfluss auf mich als Journalisten: Sie hat mich gelehrt, dass es nichts Wichtigeres gibt, als schwere Anschuldigungen gegen einen anderen Menschen einer unendlich genauen Prüfung zu unterziehen, ehe man sich mit ihnen identifiziert. Es hat in Simon Wiesenthals gesamter jahrelanger Arbeit nicht einen Menschen gegeben, der ihm vorwerfen könnte, ihn fälschlich beschuldigt zu haben. Ich habe mich diesbezüglich zwar um ähnliche Genauigkeit bemüht, bin aber des Erfolges nicht ähnlich sicher – beim Schreiben eines Zeitungstextes kann man als Journalist dem (eitlen) Wunsch erliegen, etwas zuzuspitzen, das andere verletzt, obwohl man es nicht wollte. Vor allem amerikanische Spitzenjournalisten, aber auch schreibende Politiker wie Henry Kissinger, haben deutschsprachigen Kollegen die Kunst voraus, jemanden unmissverständlich zu kritisieren und dennoch nicht persönlich zu verletzten. Ich wollte das immer auch können – bin aber nicht so sicher, dass ich es konnte. Einer der wenigen Menschen, die auch kritisieren konnten, ohne zu verletzen, wurde meine erste Frau Lisl Lingens.
147
21. Der Kurier des Hugo Portisch
Es war meine Tätigkeit als Antiquitätenhändler, die mich Lisi, wie sie nur genannt wurde, etwas vor meiner Tätigkeit für Wiesenthal kennenlernen ließ. Ich kaufte und verkaufte damals Waren in einem winzigen Laden, den ihre Ziehschwester Karin betrieb. Als die mich nach der Trennung von Christine Prober in denkbar niedergeschlagener Stimmung erlebte, erklärte sie mir, ich müsste dringend ihre Schwester – sie verzichtete auf das „Zieh“ – kennenlernen, denn die sei die ideale Frau für mich: „Im ersten Moment ist sie zwar ein Igel, der die Stacheln aufstellt, aber wenn Du sie einmal kennst, merkst Du, wie zart und warmherzig sie ist. Du wirst am Abend nie auf sie warten müssen.“ So war es tatsächlich: Ich verliebte mich viel schneller in Lisi, als sie sich in mich verliebte und sie war unter einer burschikosen, kratzbürstigen Schale tatsächlich so zart und warmherzig, wie Karin sie mir beschrieben hatte. Aber die vielen Jahre, die das profil brauchte, um sich wirtschaftlich zu stabilisieren, bewirkten, dass ich zwar nie auf sie, sie aber nach den zwei ersten Ehejahren fast jeden Abend auf mich warten musste. Ihrer Geduld und Nachsicht danke ich, dass ich mich in zwanzig Ehejahren mit ihr einigermaßen stabilisieren konnte. Es begann damit, dass wir zusammen den riesigen Einbauschrank fertigstellten, den meine Mitarbeiter mir halbfertig zurückgelassen hatten. Und mündete in die Entscheidung, in den Beruf zurückzukehren, in dem ich in der Vergangenheit als einzigem erfolgreich gewesen war – in den Journalismus. Die Rückkehr dorthin gestaltete sich schwieriger, als ich gedacht hatte. In die AZ zurückkehren wollte ich nicht und zweifle auch, dass man mich dort zurückgenommen hätte. Die Redaktion baute ab, weil der Verkauf der Zeitung immer mehr zurückging. Die wirtschaftlich erfolgreichsten Zeitungen waren das Neue Österreich, das die Besatzer zu eben diesem Zweck gegründet hatten: Es sollte die Österreicher zu Bürgern eines neuen Österreich erziehen, in dem Christlich-Soziale und Sozialisten einander nicht mehr bekämpften, sondern zu demokratischen Kompromissen fanden. Chefredakteur Anton Fellner gestaltete zu diesem Zweck eine Zeitung, die politische Auseinandersetzungen grundsätzlich scheute und nur in ihrer Ablehnung jedes Nationalsozialismus Flagge zeigte. Ansonsten war sie fad und verlor zunehmend Leser, was ihr so lange nichts anhaben konnte, als sie zumindest am Wochenende den aus historischen Gründen dicksten Inseratenteil aufwies. Ich sah darin zurecht eine letztlich zum Sterben verurteilte Zeitung, der ich mich nicht unbedingt anschließen wollte. Die andere große, wirtschaftlich florierende Zeitung war der Wiener Kurier des Mühlenbesitzers Ludwig Polsterer. Ebenfalls kämpferisch in der Ablehnung des Nationalsozialismus – schließlich hatte Polsterer dem Widerstand angehört – und in meinen
Der Kurier des Hugo Portisch
Augen dank ihres Chefredakteurs Hugo Portisch die beste Boulevardzeitung der Welt: Morde und jede andere Form von Verbrechen wurden dort mit der Ausführlichkeit beschrieben, die Medienkonsumenten heute nur mehr im Fernsehen mit seiner Abfolge von „Tatorten“, „Sokos“ und „Krimis“ vorfinden – aber zugleich mit diesem süffigen „Lokalteil“ (heute vornehmer Gesellschaftsressort genannt) bot Hugo Portisch seriöse innen- und außenpolitische Berichterstattung, deren jeweils wichtigstes Thema er täglich in seinem Leitartikel analysierte. So wie in seinen Büchern und später in seinen Fernsehsendungen vermochte er die jeweils entscheidende politische Problematik so plastisch darzustellen, dass jedermann sie begriff und bot in vielen Fällen auch eine mögliche demokratische Lösung an. Er war präzise bezüglich der „Fakten“ und seine Analysen waren immer nachvollziehbar, auch wenn sie in der Außenpolitik gelegentlich danebenlagen. So sah er die USA durch Jahre einen erfolgreichen Krieg in Vietnam führen oder glaubte, dass die Engländer mit Rhodesien ein Beispiel für erfolgreiche Entkolonialisierung gäben. In beiden Fällen war es voran sein (von mir geteilter) Glaube an die Anständigkeit der amerikanischen und englischen Befreier und sein (von mir nicht geteilter) grundsätzlicher Optimismus, der ihn zu diesen Fehleinschätzungen verführte. Aber für seine Leser war auch dieser Optimismus ansteckend und ein Atout des Kurier. Im Übrigen irren nur die Journalisten nie in ihren Analysen, die keine überprüfbaren Aussagen machen – also in Wahrheit nichts sagen. Seine Abscheu gegen die nationalsozialistische wie die kommunistische Diktatur war intellektuell fundiert – er hatte Geschichte studiert – und durch persönliche Erfahrung vertieft: Sein Vater war Chefredakteur einer liberalen Pressburger Zeitung gewesen, deren jüdische Eigentümer von den Nazis enteignet worden waren; er war mit einer Jüdin verheiratet (sie starb 2018) und er erlebte die neuerliche Versklavung der Slowakei unter sowjetischer Führung. Ich kenne wenige ähnlich anständige Menschen und es spricht nicht nur für ihn, sondern auch für das Österreich der 1960er und 1970er Jahre, dass ihn die Bevölkerung bei jeder Umfrage mit großer Mehrheit zum Bundespräsidenten haben wollte. Portischs Kurier war schon in der Zeit, in der ich noch an die Arbeiter-Zeitung glaubte, das Blatt gewesen, bei dem ich gern gearbeitet hätte, auch wenn es der ÖVP deutlich näher als der SPÖ stand – aber er gab deren Standpunkte doch korrekt wieder. Er hielt sich an das Gebot „Gentlemen must agree about facts“ und die Art und Weise, in der Hugo Portisch diese Fakten interpretierte war jedenfalls, selbst in den Fällen, in denen er danebenlag, von größtem Anstand gekennzeichnet – und in der Innenpolitik lag er kaum je daneben. Ich wünschte mir also, beim Kurier anzuheuern. Aber das wünschten sich damals sehr viele junge Kollegen, die nicht so lange wie ich vom Fenster verschwunden waren. Da kam mir ein Zufall zur Hilfe. Einer der Bauernhöfe, die ich mit antiken Möbeln auszustatten geholfen hatte, gehörte Kurt Frischler, dem Chefredakteur des von der SPÖ gegründeten Kurier-Konkurrenten Express der in der Folge allerdings das Schicksal der
149
150
Der Kurier des Hugo Portisch
Arbeiter-Zeitung erleiden sollte. Frischler bot mir gar nicht erst an, in seiner Zeitung zu arbeiten, aber er riet mir, mich an Helmut Zilk zu wenden, der vielleicht beim Fernsehen etwas für mich wüsste und mich aus der Zeit in der AZ in guter Erinnerung habe. Das hatte er tatsächlich: Ich hatte dort die erste Zeitungsreportage über seine „Stadtgespräche“ in Städten des Ostblocks verfasst, nachdem Franz Kreuzer mir gesagt hatte: „Der wird in der SPÖ als kommender Mann gesehen.“ Auch ich hatte ihn als solchen empfunden und beschrieben und Jahre später sollten wir herzliche Freunde werden. (Dass er in seiner Gegnerschaft zu den Nazis 1945 Kommunist gewesen war, wusste ich aus der SPÖ. Dass er Jahrzehnte später angeblich wieder mit der KP zusammenarbeiten würde, ist mir bis heute ein Rätsel und ich müsste die entsprechenden Akten sehr genau kennen, um mich mit diesem Vorwurf zu identifizieren: Dass Agenten behaupten, jemand sei als ihre Vertrauensperson tätig gewesen, muss nämlich keineswegs zwingend zutreffen, obwohl Zilks Unterschrift unter einen Beleg ein starkes Indiz gegen ihn ist.) Zilk empfing mich also gerne zu einem Gespräch, sah aber keine Chance auf einen Job im Fernsehen – „aber ich werde den Hugo Portisch anrufen. Der wird Deinen Namen von Deiner Mutter her kennen und das wird Dir helfen“. Es half tatsächlich: Ich wurde probeweise als Lokalreporter in den Kurier aufgenommen. Nach drei Monaten sollte über eine Anstellung entschieden werden. Lokalchef Reinald Hübl fällte die Entscheidung nach einem Monat: Ich wurde mit 1.500 Schilling monatlich (etwa einem Zehntel dessen, was ich in Deutschland verdient hatte) Lokalredakteur des Kurier. Ich hatte das Chaos hinter mir gelassen. Mein erstes Kind, meine Tochter Katharina, wuchs in geordneten Verhältnissen auf.
Morde in Zeiten des Krieges Reinald Hübl war wie Franz Kreuzer ein Profi seines Faches. Er recherchierte und berichtete ähnlich präzise – egal ob es um „Skandale“, „Morde“ oder das Begräbnis der Kaiserin Zita ging. Nur dass er solche Ereignisse hautnäher, „menschlicher“ als Kreuzer beschreiben konnte. Seine Rubrik „Menschlich gesehen“, in der er positive Verhaltensweisen einfacher Bürger lobte, machte einen wichtigen Teil des positiven, von Portisch verbreiteten Kurier-Images aus und stärkte seinen Ruf als „Familienzeitung“. Eine von Hübls professionellen Qualitäten bestand darin, Texte im Ausmaß von zwei Zeitungsseiten in einem Tempo zu diktieren, dem nur Sekretärinnen folgen konnten, die wie Maschinengewehre schrieben. Die hatte er immer – und ich hatte sie in allen meinen späteren Funktionen auch. Denn von Hübl habe ich gelernt, jedweden Stoff in seinem Tempo zu diktieren: Zwei Zeitungsseiten in einer halben Stunde. Auch eine andere Fähigkeit hat die Lokalredaktion des Kurier mir vermittelt: totale Konzentration. Denn wir arbeiteten mindestens zu sechst im selben Zimmer. Keinem schallgedämmten Großraumbüro, sondern einem Zimmer, durch dessen dünne Wände selbst noch Ge-
Morde in Zeiten des Krieges
spräche des Nachbarzimmers drangen, durch dessen Fensterritzen neben der Luft auch noch Verkehrslärm hochstieg, in dem mindestens zwei von sechs Kollegen gerade telefonierten und drei in die Tasten ihrer damals längst nicht elektrischen Schreibmaschinen hieben. Gleichzeitig spuckte ein Fernschreiber ständig rasselnd die Meldungen der Austria Presse Agentur aus und hörte ein Kollege ständig den Polizeifunk ab: „Berta 1 bitte kommen! Kommen!“ In diesem Lärm verfasste ich gar nicht so schlechte Feuilletons, denn ich vermochte allen Lärm, der mich umgab, wie mit Ohropax fernzuhalten, indem ich mich total auf meine Arbeit konzentrierte. In den Anfängen des profil mit seiner unendlichen Personalknappheit, sollte diese Fähigkeit blitzschnellen Diktierens ein gewaltiger geldwerter Vorteil sein, dem freilich nicht nur im profil ein störender Nachteil gegenüberstand: Ich nehme auf diese Weise überhaupt nicht wahr, was sonst noch in meiner Umgebung passiert – dass jemand mich freundlich begrüßt, mich etwas fragt, mir etwas vielleicht sogar Wichtiges mitteilt. „Der ist so arrogant, dass er Dich nicht einmal anschaut, wenn Du ihm zum dritten Mal Grüß Gott sagst“, war nur eine der auf diese Weise heraufbeschworenen Reaktionen. Vor allem meine Frau brauchte eine Weile, um sich daran zu gewöhnen, dass ich sie gar nicht wahrnahm, ihr eine völlig sinnlose Antwort auf eine mir gestellte Frage gab oder dass sie mich viermal zum Essen rufen musste, bis ich es überhaupt bemerkte. Im Kurier freilich brachte mir diese Fähigkeit zu konzentrierter Arbeit relativ rasch Anerkennung durch Hübl und entsprechende Gehaltserhöhungen ein: Er hatte wie Franz Kreuzer die angenehme Fähigkeit, die Leistung eines anderen wertzuschätzen und dabei kein Senioritätsprinzip zu kennen. Der Senior der Redaktion, ein eher spracharmer Polizeireporter namens Josef J., dem Polizeikommissariate freilich dann und wann sogenannte „Exklusiv-Geschichten“ steckten, weil er dafür die Arbeit des Kommissariatskommandanten in die Zeitung unter Nennung des vollen Namens pries, hatte dafür weniger Verständnis. Ansonsten war ich unter meinen Kollegen weder sonderlich beliebt, noch unbeliebt – alleine Josef J. konnte mich wirklich nicht leiden, war Hübels Stellvertreter und sollte ihm nachfolgen. (Später habe ich im profil erlebt, wie heikel es ist, Seniorität zu missachten: Dass ich dem blutjungen, eben erst zu uns gestoßenen Joachim Riedl (heute Leiter des Österreichteils der ZEIT) schon nach der ersten Woche das Schreiben einer Titelgeschichte übertrug, brachte mir die bleibende Abneigung eines unserer Senioren ein.) Nach rund einem Jahr hatte ich mir bei der breiteren Leserschaft des Kurier den Ruf erarbeitet, den ich fünf Jahre zuvor bei der schmäleren Leserschaft der AZ bereits innegehabt hatte: Jemand, der recht passable Reportagen und manchmal auch Feuilletons schreibt. Jemand, der in einer anderen Zeitung einen ähnlichen Ruf hatte, ist seit damals meine beste Freundin: Elfriede Hammerl. So wie ich beim Kurier der Reporter war, den man dann losschickte, wenn ein Ereignis nicht wirklich bedeutend, aber amüsant zu beschreiben war, war sie die Reporterin, der man ähnliche Aufgaben im Neuen
151
152
Der Kurier des Hugo Portisch
Österreich übertrug, und das führte dazu, dass wir einander kennenlernten. Denn die beiden Zeitungen waren im selben Gebäudekomplex zwischen Linden-, und Seidengasse untergebracht. Man traf einander sozusagen automatisch, weil die Mitglieder beider Redaktionen in den gleichen Lokalen zu Mittag aßen und in den gleichen Espressos einen Mokka tranken, wenn sie Spätdienst hatten. Ich war zu diesem Zeitpunkt der in der Öffentlichkeit wesentlich bekanntere Journalist, weil der Kurier die viel bekanntere Zeitung war. Aber auch in der Branche kannten mich viel mehr Kollegen, weil ich, anders als Hammerl, auch für Morde und Raubüberfälle zuständig war und daher an „Tatorten“ und bei Pressekonferenzen der Polizei ständig mit ihnen zusammentraf. Das sollte bei der folgenden Begebenheit eine wesentliche Rolle spielen: Eines Tages waren wir beide dazu abkommandiert, am Flughafen Schwechat die eben gekürte „Miss Welt“ zu empfangen und während alle Redakteure und Fotografen – es waren damals fast nur Männer – vor dem damals noch unscheinbaren alten Flughafengebäude warten mussten, war es ihr irgendwie gelungen, ins Innere zu gelangen und die Miss Welt schon dort zu interviewen, während wir alle noch im Freien zusammenstanden. Schließlich öffnete sich eine der beiden Flügeltüren und eine tatsächlich wunderschöne blonde Frau trat heraus. Die Meute der Kollegen stürzte auf sie zu, um das erste Foto zu schießen und ihr die ersten Worte zu entreißen. Nur ich stürzte nicht los: Ich wusste, dass die schöne Blondine Elfriede Hammerl hieß und Reporterin des Neuen Österreich war. Die „Miss Welt“ war derweil unbemerkt durch die andere Flügeltür getreten. Zumindest sie erreichte ich als erster, während alle anderen erst ihren Irrtum korrigieren mussten. Bei der Rückfahrt im Autobus des Veranstalters, der die Miss Welt eingeladen hatte, zog ich es vor, wieder Elfie Hammerl gegenüberzusitzen. Ihre Texte habe ich erst viele Jahre später mit ähnlicher Begeisterung gelesen, wie ich sie damals angesehen habe, so oft wir einander zufällig wieder beim Mittagessen oder beim Mokka trafen. Wäre ich nicht so kurz verheiratet gewesen, ich hätte aufs Heftigste mit ihr geflirtet. Insofern bin ich ein Beleg für ihre These, dass Männer die beruflichen Qualitäten einer Frau grundsätzlich geringschätzen und allenfalls nachträglich objektiv beurteilen. Heute bewundere ich Elfriede Hammerl auch für ihre Texte und sie ist meine mit Abstand beste Freundin. Es war Reinald Hübls Idee, mich einmal aufs Wiener Landesgericht zu schicken, um seine präzise Berichterstattung über einen großen Strafprozess über die erste Woche hinaus fortzusetzen – damit begann so etwas wie meine Karriere. Strafprozesse interessierten mich, indem sie gleich mehreren meiner Einzelinteressen entgegenkamen: Schließlich hatte ich nicht zufällig für ein paar Monate auch Jus zu studieren begonnen; Psychoanalyse, Psychologie und Psychiatrie waren Interessen, die
Morde in Zeiten des Krieges
ich von meiner Mutter geerbt hatte; die sozialen Ursachen ausgebrochener Konflikte waren ständiger Gegenstand der Diskussionen gewesen, die sie mit ihren sozialistischen Jugendfreunden führte. Das Buch „Die Gesellschaft und ihre Verbrecher“ des Schweizer Kriminologen Paul Reiwald, der Verbrechen psychoanalytisch zu deuten suchte, hatte sie mir geschenkt als ich 17 war, als nicht die Rede davon war, dass ich „Gerichtssaalberichterstatter“ werden könnte. Eine der sicher richtigen Thesen dieses Buches lautet: Es gibt nichts, das Menschen, gleich welcher sozialen Schicht oder politischen Einstellung, mehr fasziniert als das „Verbrechen“. Sonst gäbe es in Fernsehprogrammen nicht mindestens zwei Krimis pro Abend. Gut beschriebene Morde sind wesentlichster Bestandteil der Weltliteratur, von den Königsdramen Shakespeares über die Romane Fjodor Dostojewskis bis zu den Texten von Edgar Allan Poe oder Philip Roth. Gut geschriebene Gerichtssaalberichte konnten von dieser Faszination des Verbrechens profitieren und einer Zeitung Leser bringen, die es normalerweise abgelehnt hätten, das geringste Interesse an „Morden“ einzugestehen. In Österreich hat Daniel Glattauer diese Art qualifizierter Gerichtssaalberichterstattung im Standard in den Rang von „Literatur“ erhoben. (Historisch hat das Charles Dickens getan, der gleichfalls Gerichtssaalberichterstatter gewesen ist.) Ich habe im Kurier zumindest mein Bestes versucht und dafür überraschend erstmals im Leben eine Auszeichnung erhalten: Den „Förderpreis des Dr.-Karl-Renner-Preises“. In zwei Bereichen erzielte ich im Wege der Gerichtssaalberichterstattung sogar so etwas wie politische Wirkung: Ich vermochte den Lesern Morde in der NS- Zeit als „Morde“ nahezubringen, statt sie zu „Kriegsverbrechen“ zu verharmlosen: Es waren Morde, die zufällig in einer Zeit verübt wurden, in der es auch einen furchtbaren Krieg mit zahllosen Kriegsverbrechen gab. Und ich vermochte einer wachsenden Zahl von Lesern vor Augen zu führen, zu wie viel Leid und nebenher Absurdität die damals selbstverständliche Qualifizierung der Homosexualität als „Verbrechen“ führte: Homosexuelle wurden für ihre „Taten“ in Gefängniszellen zusammengesperrt, in denen selbst bei lupenreinen Heterosexuellen homosexuelle Handlungen an der Tagesordnung waren. Der von mir eingehend beschriebene Fall eines homophilen Polizisten, der von ihm aufgestöberte Homosexuelle erpresste und darüber hinaus zum Mörder wurde, brachte bei der Bevölkerung so etwas wie einen Meinungsumschwung mit sich. Als der Paragraph 209 endlich fiel, dankte mir Justizminister Christian Broda, dass ich durch meine Berichterstattung wesentlich dazu beigetragen hätte. Was Strafverfahren gegen Nazi-Mörder betraf, so ließ derselbe Justizminister sie leider mit Vorliebe im Sand verlaufen. Die Scheue Brodas, im Umgang mit Verbrechen der NS-Zeit energisch durchzugreifen war auffällig. Sie fiel nicht nur mir, sondern auch jemandem auf, der im Kurier mein Kollege wurde: Oscar Bronners erste große journalistische Leistung bestand darin im Forum die Nachkriegskarriere einer Reihe sogenannter „Blutrichter“ – Richter, die in der NS-Zeit mörderische Urteile für aus heu-
153
154
Der Kurier des Hugo Portisch
tiger Sicht lächerliche Delikte verhängt hatten – zu beschreiben, von denen unter Broda nicht einer suspendiert worden war und die Mehrzahl in hohe Positionen aufrückte. Der KZ-Häftling Franz Olah, Präsident des Gewerkschaftsbundes und danach Innenminister ging als Intimfeind Brodas so weit, ihn diesbezüglich der massiven Befangenheit zu verdächtigen – im profil sollten entsprechende Recherchen, die bei mir in der Schublade lagen, dann auch für mein Verhältnis zu Broda, aber auch zur Redaktion und zu Bronner eine wichtige Rolle spielen – aber das war erst Jahre später. Zu den aus der NS-Zeit in die Gegenwart ragenden Figuren, die ich als Gerichtssaalberichterstatter näher kennenlernen sollte, zählt der bis heute berüchtigte Psychiater Heinrich Gross. Er ist für mich ein klassisches Beispiel dafür, dass es ein grundsätzliches Problem ist, Menschen, die sich in einer Diktatur „bewährt“ haben, in einem Rechtsstaat weiterhin im Rahmen der Justiz zu beschäftigen. Lange bevor Gross endlich gehen musste, weil klar war, dass er in der NS-Zeit am „Spiegelgrund“ des „Steinhof “ für die Ermordung zahlloser behinderter Kinder verantwortlich war, fiel er am Wiener Landesgericht durch zahllose Gutachten auf, die immer genau dem entsprachen, was die Staatsanwaltschaft und die Polizei gerade von ihm erwarteten. Wo die Staatsanwaltschaft auf ein hartes Urteil drängte, war der Täter in seinem Gutachten jeweils ein schwerer Psychopath, den allenfalls eine harte Strafe zur Raison bringen konnte – wo seine Herkunft aus einer gehobenen Familie ein mildes Urteil nahelegte, war er ein „Neurotiker“ mit positiver Prognose. Man konnte GrossGutachten dieser beiden Kategorien übereinanderlegen und sie erwiesen sich als zu 95 Prozent wortgleich, was nicht zuletzt ein für ihn günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis ergab. Die Justiz liebte ihn – niemand wurde wie er beschäftigt. Das Gutachten, das ihn am besten charakterisiert, erstellte er im Rahmen eines Prozesses gegen acht angesehene Wiener Möbelhändler, die gemeinsam beschlossen hatten, einen neunten – nämlich „Urbanek den Preiseschreck“ – nicht mehr zu beliefern und damit gegen das Kartellgesetz verstießen. Einer von ihnen, Josef F., hatte das nämlich, gesetzesunkundig, bei einem Verhör offen zugegeben: „Wir werden doch nicht so blöd sein, jemanden zu beliefern, der uns die Preise ruiniert.“ Damit war die Anklage gegen acht ebenso ehrenwerte wie angesehene Geschäftsleute unausweichlich, und es musste wohl oder übel zum Prozess gegen sie kommen. So kam es das erste und einzige Mal dazu, dass Hugo Portisch mich bezüglich meiner Berichterstattung ansprach: „Ich weiß, dass Sie immer sehr korrekt berichten“, sagte er mir, indem er mich am Gang zur Seite nahm, „aber ich bitte Sie in diesem Fall um ganz besondere Objektivität.“ Um seine Bitte zu erläutern, ließ er mich einen Brief lesen, den eine „PR-Agentur“ an ihn gerichtet hatte und der in etwa lautete: „Wir, die Agentur X, vertreten die angeführten Firmen“ – es folgten die Namen der acht angeklagten Möbelhäuser – „leider stehen die Leiter dieser Unternehmen in der kommenden Woche unter einer aus der Luft gegriffenen Anklage, von der sie sicher freigesprochen werden. Wenn Ihre Zeitung dennoch über diesen Prozess berichten muss, dann ersuchen wir um
Morde in Zeiten des Krieges
äußerste Objektivität. Über Seriosität und Bonität der von uns vertretenen Unternehmen gibt Ihnen ihre Inseratenabteilung jederzeit Auskunft.“ Ich glaubte ein leises Lächeln auf Portischs Lippen zu erkennen, als er mir den Brief in die Hand drückte und gab ihn ihm mit dem gleichen leisen Lächeln zurück. Dann erwartete ich mit Spannung den Prozess, in dem der Staatsanwalt nicht umhinkam, beim Vortrag der Anklage auf das Geständnis des Josef F. zu verweisen. Wie aber bekämpft ein durch Jahrzehnte in Wien gerichtserfahrener Verteidiger eine Anklage, die auch der Staatsanwalt nicht gerade mit äußerstem Nachdruck vertritt: Er einigt sich auf die Bestellung von Heinrich Gross zum psychiatrischen Sachverständigen. Nun konnte auch Gross den Eigentümer eines der größten Möbelhäuser des Landes nicht einfach für unzurechnungsfähig erklären – schließlich war er dessen amtierender Geschäftsführer. Aber Psychiater Gross entdeckte etwas anders: Josef F, so dozierte er, habe im Krieg einen Steckschuss im Nacken erlitten; der beeinträchtige zwar in keiner Weise seine Denkfähigkeit, wohl aber sein Erinnerungsvermögen. Immer wieder käme es daher vor, dass er an Gedächtnislücken leide, die einzugestehen er sich in seiner gehobenen Position natürlich geniere, so dass er dazu neige, diese Gedächtnislücken mit „Konfabulationen“, erfundenen Geschichten, auszufüllen. „Halten Sie es für möglich“, wollte der auch nicht gerade auf eine Verurteilung versessene Richter wissen, „dass auch das sogenannte Geständnis eine solche Konfabulation gewesen sein könnte?“ „Ich will natürlich in die Beweiswürdigung des hohen Gerichtes in keiner Weise eingreifen“, antwortete Dr. Gross, „aber die Erregung einer Einvernahme hat die Neigung des Angeklagten zur Konfabulation zweifellos verstärkt.“ Der Richter setzte nur noch sein Barett auf, um den Freispruch der acht Angeklagten mangels eines stichhaltigen Beweises zu verkünden. Der Staatsanwalt meldete keine Berufung an. Ich habe diesen Prozessverlauf tags darauf im Kurier so beschrieben wie Florian Scheuba Vergleichbares in seinen Kabarettprogrammen: indem ich ausschließlich die von Gross gebrauchten Sätze präzise wiedergegeben habe. Kein Leser hatte ein Problem, sich ein Urteil zu bilden. Soweit die Berichterstattung des industrienahen „rechten“ Kurier. Die „linke“ Arbeiter-Zeitung, die von sich behauptete, die Interessen der Konsumenten gegen die „Konzerne“ und der Bürger gegen den „Kapitalismus“ zu vertreten, brachte ihren Prozessbericht unter dem Titel „Seriöse Möbelhändler freigesprochen“ – auf Gross’ Rolle für diesen Freispruch ging sie mit keinem Wort ein. Karl Marx hätte dafür eine einfache Erklärung: Das (ökonomische) Sein bestimmt das Bewusstsein. Die Arbeiter-Zeitung hatte kaum Inserate – wenn ihr einer der Möbelhändler auch das einzige Inserat, das er ihr im Jahr vielleicht gab, wegen ihrer Prozessberichterstattung strich, bedrohte das ihre Existenz. Der Kurier hingegen war voll von Inseraten – wenn die Möbelhändler nach dem Prozessbericht dennoch ein Inserat strichen, war es für ihn
155
156
Der Kurier des Hugo Portisch
erstens nicht lebensgefährlich und zweitens mussten sie es in der Woche darauf doch wieder schalten, weil der Kurier damals das mit Abstand wichtigste Werbemedium war. Ich möchte daraus einen grundsätzlichen Ratschlag für Zeitungs- und Zeitschriftenleser ableiten: Sie sind in ihrer Berichterstattung normalerweise – Ausnahmen wie der Falter bestätigen die Regel – umso weniger von Inseraten abhängig, je mehr Inserate sie haben. So fand man die kritischste und damit seriöseste Autoberichterstattung durch Jahrzehnte in Auto Motor Sport, das von Autoinseraten überging. Nur dort konnte man sich schon damals leisten, den VW-Käfer mit seinem winzigen Kofferraum und brustschwachen Boxermotor als nicht mehr ganz zeitgemäß zu kritisieren. Allerdings ist es für jedes Printmedium unendlich schwer, wenn es Grundzüge des herrschenden Wirtschaftssystems – etwa die ökologischen Folgen verkaufsfördernder Werbung – ernsthaft und permanent in Frage stellt. Denn für Printmedien gilt: Der Verkaufspreis ist nur ganz selten in der Lage, den gesamten Gestehungspreis abzudecken – Inserate sind zumindest als „Zubuße“ fast immer unverzichtbar. In ordentlichen Zeitungen wird das so gehandhabt, wie Portisch es im Kurier gehandhabt hat.
Neurotiker und Psychopathen Die Gutachten des Dr. Gross werfen indes ein Problem auf, das ich für ein durchaus wesentliches der Strafjustiz halte: den in meinen Augen zu großen Einfluss psychiatrischer Gutachten auf Strafurteile. Die Psychiatrie ist nun einmal keine sonderlich exakte Wissenschaft. Das ändert nichts an ihrer Nützlichkeit – die gesamte Medizin ist das nicht und ist dennoch ein Segen. Sie hat nur nicht so häufig wie die Psychiatrie Einfluss darauf, ob und wie lange jemand ins Gefängnis kommt. Es ist nämlich vergleichsweise einfach, zu entscheiden, ob jemand an TBC oder Keuchhusten leidet, aber sehr viel schwerer zu klären, ob er an paranoider Schizophrenie oder einer Neurose mit paranoiden Zügen litt, während er eine Bluttat beging – nur dass er im ersten Fall vermutlich als unzurechnungsfähig freigesprochen wird, während er im zweiten Fall zehn Jahre Haft ausfasst. Ich habe erlebt, wie Gutachten ein und denselben Bluttäter als schizophren, schwer neurotisch, schwer psychopathisch und psychisch unauffällig und damit voll schuldfähig beschrieben haben. In Wirklichkeit vermag nicht einmal die Diagnose „Schizophrenie“ die bezüglich der „Schuldfähigkeit“ entscheidende Frage exakt zu beantworten: Ob der Täter nämlich in der Lage war, die Unrechtmäßigkeit seiner Tat zu erkennen und gemäß dieser Erkenntnis zu handeln. Denn ein Schizophrener kann jemanden umbringen, weil er sich von ihm mittels tödlicher Strahlen verfolgt fühlt – aber er kann ihn auch um einiges begreiflicher umbringen, weil er ihm die Freundin weggeschnappt hat. Es ist verdammt schwer zu beurteilen, wie weit eine Tat mit der psychischen Erkrankung des Täters in Zusammenhang steht, und wie weit er in der Lage war, das Unrechtmäßige
Neurotiker und Psychopathen
seiner Handlung zu erkennen. Und dass er in der Lage war, gemäß dieser Erkenntnis zu handeln, würde ich fast immer bestreiten – sonst wäre er ja kaum zum Täter geworden. Ich glaube, dass man sich um der Rechtssicherheit willen nur darauf einigen kann: Eine von zwei Psychiatern unabhängig diagnostizierte endogene Psychose schließt Strafbarkeit aus – auf die Gefahr hin, dass dabei jemand straflos bleibt, der sehr wohl begriff, dass er etwas Verbotenes tat. Allerdings sind Bluttaten, bei denen es auf diese Feinheit ankommt, relativ selten, so dass das Problem zwar ein schwer lösbares, aber kein drängendes ist. Viel gravierender ist der Einfluss psychiatrischer Gutachten auf das Strafausmaß. Ob jemandes zehnter Diebstahl als strafausschließende Kleptomanie oder strafverschärfende Rückfalltäterschaft eingestuft wird, entscheidet zwischen Freiheit und sechs Jahren Haft; zwischen der Einstufung als „Neurotiker“, den Psychotherapie auf den richtigen Weg zurückbringen kann, oder als „Psychopath“, den allenfalls die volle Härte des Gesetzes zu bessern vermag, können zehn Jahre Haft liegen. Als ich meinen Analytiker Wilhelm SolmsRödelheim, selbst Dozent für Psychiatrie, gefragt habe, worin er den entscheidenden Unterschied sieht, meinte er schmunzelnd: „Wenn er dem Psychiater sympathisch ist, ist er ein Neurotiker – ist er ihm unsympathisch, ist er ein Psychopath.“ In Strafprozessen hing das nicht zuletzt vom psychischen Zuschnitt des gutachtenden Psychiaters ab: Heinrich Gross waren Täter aus der Unterschicht so gut wie immer unsympathisch – für die Oberschicht oder gar des Amtsmissbrauchs angeklagte Polizisten brachte er fast immer Sympathie auf. Mit Einschränkung deckte sich diese Verteilung von Sympathie und Antipathie mit der vieler Richter und Staatsanwälte, und das ist bis zu einem gewissen Grad unvermeidlich: Einer ähnlichen sozialen Schicht anzugehören verbindet nun einmal. Deshalb wird Strafjustiz immer und bei noch so gutem Willen bis zu einem gewissen Grad Klassenjustiz sein. Es ist einer der Treppenwitze der Geschichte, dass Justizminister Christian Broda, seines Zeichens ein wütender Gegner der Klassenjustiz, sie befördert hat, indem er den Übergang von der Tat- zur Täterjustiz gepredigt und eingeleitet hat. Denn sobald es um den Täter mehr als um die Tat geht, muss die Psychiatrie als die Wissenschaft, die seine Persönlichkeit beurteilt, deutlich größere Bedeutung innerhalb der Strafjustiz erlangen. Ich stelle diese massive Verschiebung vom Tat- zum Täterstrafrecht aus zwei Seiten in Frage: Wenn es in erster Linie um die „Resozialisierung“ des Täters und erst in zweiter Linie um die Tat – und in keinem Fall um „Rache“ – geht, dann muss man Adolf Eichmann in seinem Versteck in Argentinien als bestens resozialisiert ansehen – er fiel dort niemandem unangenehm auf. Auch die Gefahr einer Tatwiederholung war in seinem Fall angesichts der veränderten politischen Verhältnisse in keiner Weise gegeben, womit auch das Argument der Spezialprävention flachfällt. Nur Generalprävention, der Broda freilich sowenig Berechtigung wie „Rache“ zumaß, war ein brauchbares Argument, wobei man in seinem Sinne argumentieren konnte, dass Eichmanns Verurteilung auch in ihrem Sinn nicht mehr notwendig war, weil 1960, zum Zeitpunkt seiner Ergrei-
157
158
Der Kurier des Hugo Portisch
fung durch Mossad-Agenten nicht einmal Palästinenser behaupteten, dass Juden aus rassischen Gründen ermordet werden dürfen. Es gibt daher gute Gründe, die Strafe sehr wohl voran an der Tat – der Ermordung von sechs Millionen Juden – zu orientieren, und dabei selbst ein gewisses Rachebedürfnis nicht ganz außer Acht zu lassen. Aber auch Adolf Eichmann ist Gott sei Dank ein historischer Einzelfall. Für aktuell und im täglichen Leben wirklich kritisch halte ich den Einfluss der Psychiatrie auf die Länge der Haftstrafen. Die von Broda aus durchaus anständigen Motiven eingeleitete Verschiebung von „Tatstrafrecht“ zum „Täterstrafrecht“ ist in meinen Augen innerhalb der Rechtsprechung zu weit gegangen – der Abstand zwischen Mindest- und Höchststrafe für ein und dasselbe Delikt sollte aus Gründen der Rechtssicherheit ein geringer und nicht so sehr von psychiatrischen Gutachten abhängiger sein. Soweit ich den Weg Verurteilter weiterverfolgt und entsprechende Statistiken gelesen habe, ist es für ihre Resozialisierung mit Abstand am besten, es beim bloßen Urteilsspruch zu belassen und gar keine oder allenfalls eine bedingte Strafe auszusprechen – die Rückfallquote ist dort am geringsten. (Die aktuelle Möglichkeit der Diversion ist diesbezüglich ein großer Fortschritt und erzielt ähnlich gute Resultate.) Dort wo eine Gefängnisstrafe aus Gründen der Generalprävention sehr wohl ausgesprochen werden muss, zeigt die Statistik, dass auch sie umso eher wirkt, je kürzer die Strafe ausfällt. Ein wirklich großer Fortschritt statt eines Risikos wäre mehr Psychiatrie im Strafvollzug: Dem einmal Verurteilten im Wege von Psychotherapie zu helfen ist etwas völlig anderes als Psychiater darüber entscheiden zu lassen, ob er zwei oder zehn Jahre ins Gefängnis kommt. Natürlich sollte jedem Gefangenen das größtmögliche Maß an psychotherapeutischer Betreuung zur Verfügung stehen – aber genau da ist viel zu wenig weitergegangen. Dank Reinald Hübls Unterstützung durfte ich im Kurier zu dieser Problematik meine erste Serie verfassen. Auf einer Seite pro Tag erläuterte ich sie sechs Tage hindurch an dutzenden praktischen Beispielen und möglicherweise war sie die Grundlage des Renner-Preises. Eine andere Folge war, dass ich mit dieser Serie den Respekt Karl Poppers errang, dessen Freundschaft entscheidenden Einfluss auf mein Politikverständnis und meine journalistische Tätigkeit hatte.
22. Der Übervater
Die ZEIT nannte Karl Popper den bedeutendsten Philosophen der Gegenwart. Seine „Logik der Forschung“ ist unter Wissenschaftlern unbestritten: Niemand zweifelt, dass die Widerlegung, („Falsifizierung“) über die Qualität einer These entscheidet, während ihre noch so häufige Bestätigung („Verifizierung“) ihr nur erhöhte Wahrscheinlichkeit bescheinigt – die mit der Falsifizierung endet. Auch „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ ist ein Standardwerk, das Kernthesen des Marxismus ebenso eindeutig falsifiziert wie Thesen des Faschismus. Ich denke (hoffe), dass ich von Popper gelernt habe, auch im Journalismus zumindest zu versuchen, gemäß seiner „Logik der Forschung“ vorzugehen: Ich stelle meinen Texten wenn möglich die von mir vertretene These offen voran, statt sie hinter Scheinobjektivität – „ich gehe ohne jedes Vorurteil an diese Frage heran“ – zu verbergen; und ich suche und führe wo immer möglich auch die Argumente aus, die gegen meine These sprechen und suche sie zu entkräften. (Dass Kommentare aus graphischen Gründen und auf Grund der immer geringeren Bereitschaft, des Publikums längere Texte zu lesen, immer kürzer ausfallen müssen, steht diesem Anspruch leider massiv im Weg.) Auch Poppers möglichst klare, einfache Sprache, die es vermeidet, den Anschein der Wissenschaftlichkeit durch den Gebrauch möglichst vieler Fremdwörter zu erwecken, habe ich für meine sachlichen Texte so weit wie möglich übernommen. Etwas ganz anderes sind literarische Texte. Da können Sätze Gegenteiliges, ja gar nicht Fassbares in manchmal nicht einmal eindeutigen Worten aneinanderfügen. Popper hat sich immer gegen die Behauptung gewehrt, er halte nur Aussagen, die seinen Anforderungen genügen, für relevant: „Ein Rilke-Gedicht oder eine Beethoven-Symphonie“, so sagte er, als er wieder einmal mit diesem dummen Vorwurf konfrontiert wurde, „ist mindesten so wichtig wie eine Aussage Isaac Newtons – aber eben keine wissenschaftliche Aussage. Nur die muss meinen Kriterien genügen.“ Der Name Karl Popper war mir geläufig, seit ich bei meiner Mutter in Wien wohnte. Aus ihrer Wandervogel-Jugend war es für sie selbstverständlich, an jedem Wochenende einen großen Ausflug in den Wienerwald zu unternehmen und ich machte nur zu gerne dabei mit. Erstens, weil ich gerne wandere, zweitens, weil es fast immer zwei, drei Begleiter meiner Mutter aus ihrer VSM und VSStÖ Zeit gab, denen zuzuhören spannend war, und drittens, weil sie meist Kinder in meinem Alter hatten, so dass sich auch jede Menge Gelegenheit zum Spielen und später zum Flirten ergab. Als Führer durch die manchmal durchaus anspruchsvollen Wanderwege – weniger als sechs Stunden wurde nie gegangen – fungierte vor allem Robert Lammer: Jener Volksschullehrer, der zusammen mit seiner Frau die nicht verbrauchten Essensmarken
160
Der Übervater
einbehalten hatte, mit denen meine Eltern Nahrungsmittel für ihre jüdischen U-Boote erwerben konnte. Lammer war für diese Funktion prädestiniert: Sein Vater war ein anerkannter Alpinist im Hochgebirge gewesen – er selbst kannte den Wienerwald wie seine Hosentasche und sah das Wandern immer auch als Sport an – die von ihm geführte Gruppe ging immer sehr zügig, was mir bei Märschen des Bundesheeres zu Gute gekommen ist. Obwohl er aus einer durchaus bürgerlichen Familie kam, lebte er – wie meine Mutter oder Victor Weißkopf – nach den Prinzipien, die für den edlen sozialistischen Arbeiter seiner Generation galten: Der gesunde Geist hatte in einem gesunden Körper zu stecken. Volksschullehrer, statt „Mittelschulprofessor“ war er geworden, weil es ihm darum ging, den „neuen Menschen“ heranzubilden und man damit nicht früh genug beginnen konnte. Natürlich war er dreimal so belesen wie alle mir bekannten Mittelschulprofessoren. Natürlich interessierten ihn Mathematik und Physik mindestens so sehr, wie „deutsche Unterrichtssprache“, die er unterrichtete. Er machte hervorragende Gedichte und sah aus wie eine Miniatur von Wilhelm Furtwängler: Sein schmächtiger, aber trainierter Körper trug einen prachtvollen beinahe zu großen Kopf. Nicht zuletzt von den Größenverhältnissen her teilte er dieses Aussehen mit seinem besten Jugendfreund: dem Philosophen Karl Popper. Beide stammten sie aus bürgerlichen Familien, beide waren sie aus den gleichen Motiven Volksschullehrer geworden, beide waren sie hervorragende Handwerker – Popper hatte sogar das Tischlerhandwerk erlernt – und beide verband das gleiche Ziel: eine bessere Gesellschaft grundzulegen. Popper, den schon damals vor allem die Naturwissenschaften faszinierten, anerkannte neidlos die sprachliche Überlegenheit Lammers: „Von ihm habe ich gelernt, mich klar auszudrücken. Nie herumzuschwafeln, sondern so kurz und präzise wie möglich zu sein.“ Nachdem Popper „Die Logik der Forschung“ verfasst hatte, übergab er Lammer das Manuskript nicht nur, um es Zeile für Zeile gegenzulesen, sondern er übergab es ihm auch physisch, um es aufzubewahren, während er, um der Verfolgung durch die Nazis zu entgehen, nach Neuseeland und schließlich nach England auswanderte. Jedes Buch, das er in der Folge schreiben sollte – und es waren deren viele – schickte er zuvor als Manuskript an Robert Lammer, um es sprachlich zu überprüfen. Als ich Lammer im Wienerwald kennenlernte, war die Korrespondenz mit dem mittlerweile weltberühmten Philosophen das größte Glück des nach wie vor kleinen Wiener Volksschullehrers, der es nur gerade zum Volksschuldirektor brachte und nie auch nur die Chance erhielt, seine pädagogischen Überlegungen in die Wiener Schulpolitik einzubringen. Kein Wunder, dass Lammer mir keine Ruhe ließ, bis ich die „Logik der Forschung“ gelesen hatte. Ich war so begeistert, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben um ein signiertes Exemplar bat.
Der Übervater
Popper reagierte auf eine Weise, die, wie ich später begreifen sollte, für ihn charakteristisch ist: eine Widmung sei eine ernsthafte Angelegenheit. Da er mich nicht kenne, bitte er, ihm einige meiner Artikel zuzusenden, damit er sich ein Urteil bilden könne. Ich schickte ihm die Serie, die ich über die Problematik der Gerichtspsychiatrie geschrieben hatte. Die Texte waren durch Zufall ideal ausgewählt, denn der Inhalt deckte sich mit seinen Bedenken gegen die Zuverlässigkeit ihrer Aussagen. Popper schickte mir das Buch samt Widmung und einer handschriftlichen Bemerkung: Der letzte Absatz meiner Arbeit enthalte einen logischen Fehler, der mir bei größerer Sorgfalt nicht unterlaufen wäre. Immerhin war die Serie, die ich ihm geschickt hatte, sechs großformatige Druckseiten lang, und es bestand kein Zweifel, dass er jedes Wort gelesen hatte, ehe er „Karl Popper“ unter seine Widmung setzte. Denn etwas zu unterschreiben, von dessen Inhalt man sich vorher nicht überzeugt hat, hält er für Unredlichkeit und ist in dieser Auffassung so rigoros, dass er zwei brave Damen des ORF damit in völlige Verzweiflung stürzte: Die beiden hatten ihm anlässlich eines Interviews einen Zettel unterbreitet, auf dem er den Erhalt seines Honorars bestätigen sollte. „Aber ich habe doch noch kein Honorar erhalten.“ „Sie bekommen es sofort nach der Sendung. Das Kuvert ist schon vorbereitet.“ „Dann werde ich unterschreiben, wenn Sie mir das Kuvert übergeben haben.“ Nachsatz mit ernsthaft besorgtem Blick: „Das ist der Anfang der österreichischen Korruption. Von dort bis zum AKH-Skandal ist es nur mehr ein kleiner Schritt.“ Popper spricht jeden Satz mit glühenden Augen. Trotzdem hat sich mir bei unserer ersten Begegnung ein anderer Teil seines Gesichtes am meisten eingeprägt: Ich habe nie einen Menschen mit größeren Ohren gesehen. Es wäre taktlos, auf diese körperliche Besonderheit hinzuweisen, wenn sie nicht so viel Symbolcharakter besäße: Ich habe auch niemals einen Menschen kennengelernt, der so zuzuhören vermochte. Aus irgendwelchen innenpolitischen Gründen – ich glaube, es ging um eine Auseinandersetzung mit Bruno Kreisky – kamen wir bei jenem ersten Zusammentreffen auf den österreichischen Antisemitismus zu sprechen und die versammelte Runde versuchte, dem Gast aus England ein einigermaßen differenziertes Bild zu vermitteln. Popper sprach den ganzen Abend lang vielleicht drei Sätze. Kurz vor Mitternacht verabschiedete er sich mit einem vierten Satz: „Ich möchte mich vielmals bei Ihnen allen bedanken. Ich habe heute Abend sehr viel gelernt.“ Ich dachte damals, diese Art der Bescheidenheit entspringe einer gewissen Koketterie. Aber Popper meinte das vollkommen ernst. Er kennt keinen intellektuellen Hochmut. Es ist ihm (wie übrigens auch Victor Weisskopf oder Leó Szilárd) vollkommen gleichgültig, ob sein Gesprächspartner ein weltbekannter Nobelpreisträger aus Oxford oder ein unbekannter Gerichtsreporter aus Wien ist, ob er drei Stunden lang selbst einen Gedanken vorträgt (was er zu meinem Glück gelegentlich auch getan hat) oder ob er drei Stunden lang zuhört. Wichtig ist ausschließlich die vorgetragene Argumentation.
161
162
Der Übervater
Sie ist das einzige „Ding an sich“ das er gelten lässt. Genussvoll, so wie ein Anatom eine Arterie oder einen Nerv aus dem umgebenden Bindegewebe herauspräpariert, legte er etwa in „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ Marx’ grundlegende Schlussfolgerungen bloß, um sie dann mit ebenso penibler Gründlichkeit zu widerlegen. Der Text ist von großem Respekt vor Marx’ intellektueller Leistung getragen und dennoch vollkommen gnadenlos: Kein Stein des Marxschen Denkgebäudes bleibt auf dem anderen. Auch diese intellektuelle Gnadenlosigkeit gehört zu den Eigenschaften des „großen Humanisten“ (Franz Kreuzer im ORF): „Der Mensch“, lehrt Popper, „ist das einzige Lebewesen, das Ideen an seiner statt sterben lassen kann. Deshalb sollten wir den Krieg der Ideen mit aller Schärfe führen, damit wir uns den wirklichen Krieg ersparen.“ Wie jeder Mensch, der diese Bezeichnung verdient, hasste Popper nichts mehr als den Krieg. Die Angst, dass die riesigen atomaren Arsenale der Supermächte sozusagen aus Versehen zum Einsatz kommen könnten, war zuletzt unser wichtigstes Gesprächsthema. Mit der ihm eigenen Akribie bereitete er das Zusammentreffen vor, indem er mir schrieb, ich müsste unter allen Umständen ein Buch von Robert Kennedy lesen, in dem der Bruder des amerikanischen Präsidenten im Detail beschreibt, wie nahe wir dem 3. Weltkrieg waren, als sowjetische Schiffe Kurs auf Kuba hielten, um dort Atomraketen zu installieren. Dies alles wäre zu vermeiden gewesen, meinte Popper, wenn die Amerikaner anstelle von Atomraketen Mittelstreckenraketen mit konventionellen Sprengköpfen besessen hätten. Sie hätten dann glaubwürdig drohen können, die von den Sowjets auf Kuba installierten Raketenbasen aus der Luft zu zerstören. Dagegen müsse jede Drohung mit Atomraketen grundsätzlich erfolglos bleiben, weil sie unglaubwürdig ist. Wie die meisten Überlegungen Poppers war auch diese zukunftsweisend, und die strategische Diskussion ist wenige Jahre später zu ganz ähnlichen Erkenntnissen gelangt. Popper indessen wollte nicht warten: Von seinem Wiener Hotel aus setzten wir Briefe auf und schickten sie an alle möglichen Politiker (die ihn in ihren Reden wortreich zitiert hatten), ohne freilich mehr als Höflichkeitsantworten zurückzubekommen. Auch dieser Aktionismus ist für Karl Popper charakteristisch. Er kennt nichts Gutes, außer man tut es. Das geht so weit, dass er in politischen Diskussionen gelegentlich zu dem von ihm so verpönten Argument ad hominem griff: Als ein Student eine lange Rede verlas, in der er sich über mangelnde westliche Entwicklungshilfe für die Dritte Welt beschwerte, unterbrach ihn Popper umso kürzer: „Und was haben Sie bisher für die Entwicklungshilfe geleistet? Haben Sie afrikanische Waren gekauft oder Geld gespendet?“ Als der Redner weder auf diese Fragen einging noch mit dem Verlesen seines Statements aufhörte, ließ ihn Popper aus dem Saal weisen. In dem Maße, in dem er älter wurde, verstärkte sich diese scheinbare Intoleranz: „Ich habe zu wenig Zeit, mich mit dummen Argumenten auseinanderzusetzen. Es gibt zu viel Wichtiges, das man kritisieren müsste.“ Eine dieser kritischen Fragen, in der wir
Der Übervater
ausnahmsweise gegenteiliger Meinung waren, war und ist die Nutzung der Atomenergie. Popper hält sie für unzulässig. Man dürfe unter keinen Umständen, formulierte er auch hier sein Credo, eine Entwicklung in Gang setzen, die irreversibel ist und deren Risiken man nicht abschätzen kann. Das ist allerdings der einzige Punkt, in dem er zu diesem Zeitpunkt mit der grünen Bewegung konform ging. Ansonsten machte sie ihm Angst. Nicht, weil nicht auch er die Schonung der Umwelt für richtig und wichtig hielt, sondern weil er in der Ökologie eine Ideologie sah: „Diese Leute meinen, die Wahrheit gepachtet zu haben. Sie glauben, wie die Marxisten, genau zu wissen, wohin die Welt sich bewegt und warten genauso sehnsüchtig auf die entscheidende Krise.“ Wenn er Weltuntergänge diskutierte, war Popper von derselben ernsthaften Aggressivität wie in der Diskussion mit dem studentischen Kritiker der westlichen Entwicklungspolitik: „Sie behaupten jetzt schon zum 3. Mal“, empörte er sich anlässlich seines letzten Vortrages in Wien gegenüber einem grünen Referenten, „dass der Mensch dabei ist, die Natur endgültig zu vernichten. Ich stelle jetzt einmal die These auf, dass es auch genau umgekehrt sein kann: Wenn wir nicht innerhalb der nächsten zehn Jahre Medikamente gegen Aids finden, dann bringt ein Virus den Menschen um. Reden Sie nicht von wissenschaftlicher Erkenntnis, wo Sie ihre persönliche Weltsicht an den Mann bringen wollen.“ Noch schöner formulierte er seine Kritik an der Weltenangst des Philosophen Martin Heidegger. „Leute, die ständig Angst haben, sollten sich psychiatrisch behandeln lassen – nicht aber philosophische Bücher schreiben. Das Grundgefühl des Lebens ist doch die Freude – nicht aber die Angst.“
163
23. Prager Frost
Ansonsten ist mir von meiner Zeit beim Kurier nur der Prager Frühling des Jahres 1968 in bleibender Erinnerung. Hugo Portisch war 1967 als Chefredakteur abgelöst worden und mit Eberhard Strohal hatte ihn ein braver, freundlicher Mann ersetzt, der von dieser Funktion völlig überfordert war. An der Tür zu seinem Zimmer leuchtete beständig das rote Licht, mit dem seine Sekretärin klarmachen musste, dass er nicht zu sprechen war – jedenfalls nicht für seine Mitarbeiter. Auch nicht in Zeiten des immer heißeren Prager Frühlings. Die Reformen Alexander Dubčeks in der Tschechoslowakei waren seit Monaten in einem Ausmaß vorangeschritten, das mir keinen Zweifel daran ließ, dass die Russen sie wie den Aufstand in Ungarn beenden würden – durch Einmarsch. Aber Strohal, den ich beim Umbruch in der Setzerei ausnahmsweise anzusprechen vermochte, – denn auch er konnte diese Aufgabe nicht restlos an jemand anderen delegieren, und ich besorgte sie abends für den Lokalteil, – war vom Gegenteil überzeugt: „Da würde die Sowjetunion doch unter Kulturnationen völlig das Gesicht verlieren. Das kann sie sich nicht leisten.“ „Es wird sie höchstens ein paar Sekunden nachdenken lassen“, sagte ich, „dann marschiert sie ein.“ Ich war dessen deshalb so sicher, weil ich aus meiner Kindheit wusste, wie Halbstarke agieren. In der Zeit, in der ich in die Astgasse in die Schule ging, hatte ich ein entzückendes 13-Jähriges Mädchen namens Ulli (bis zum Händchenhalten) erobert, das im nahen Vorort Hadersdorf-Weidlingau wohnte und daher von den Hadersdorfer 14bis 18-Jährigen beansprucht wurde. Als ich Ulli zum zweiten Mal mit dem Fahrrad besuchen wollte, lauerten sie mir auf und erklärten mir zu fünft, dass ich bei Ullis Haus nichts zu suchen hätte. Obwohl einer der fünf mindestens 17 und ich erst 15 war, hatte ich keine Angst vor der Konfrontation – meine Raufkunst war durch vier Jahre „Heim“ gestärkt. „Also unter Kulturmenschen“, sagte ich vom Rad steigend, „macht man das so, dass ihr einen von Euch aussucht und mit dem schlage ich mich dann.“ Sie fanden den Vorschlag interessant, steckten die Köpfe zusammen, berieten eine Weile, dann sagte der 17-Jährige mich nachäffend „Mir san do in Hadersdorf kane ‚Kulturmenschen‘“ – und alle fünf hieben auf mich ein. Seit damals war mir politisch klar, dass es absurd war, von der Sowjetunion zu erwarten, dass sie nicht in die Tschechoslowakei einmarschiert, wenn diese sich von ihr abzuwenden droht.
Prager Frost
„Wenn wir nicht bald nach Prag fahren, werden die russischen Panzer vor uns dort sein“, murmelte ich, aber Strohal lachte das Lächeln eines überlegenen Chefredakteurs mit außenpolitischer Erfahrung: „Sein Sie nicht so nervös.“ Zwei Tage später – die russischen Panzer waren bereits unterwegs – durfte ich in Begleitung des Fotografen Peter Lehner, der mindestens so energisch gedrängt hatte, doch nach Prag aufbrechen. Wir fuhren in meinem VW, hatten die Kameras unter den Sitzen versteckt, aber der Grenzposten ließ uns sofort ohne jede Kontrolle passieren. Wir sollten jetzt, in der Nacht, nur die Scheinwerfer nicht aufdrehen, damit die Russen uns nicht entdeckten. „Wenn ein Panzer von rechts kommt, musst Du ihm unbedingt den Vorrang lassen“, frotzelte mich Peter Lehner, dessen Humor in solchen Situationen unschätzbar war. Wir erreichten Prag ohne Zwischenfall und stiegen in einem Hotel am Wenzelsplatz ab, in dem schon der eine oder andere internationale Kollege eingecheckt hatte. Die russischen Panzer kamen etwas später als vorhergesagt – die Tschechen hatten überall auf der Strecke, auf der sie kommen mussten, die Straßenschilder so versetzt, dass sie in die falsche Richtung wiesen. Aber mehr als eine Verzögerung hatten sie nicht erreicht. Emil Zatopek, mehrfacher Weltmeister und Olympiasieger auf der Langstrecke und das Sportidol des Landes, brachte als Melder als Erster die Nachricht: Die Panzer haben die Stadtgrenze überschritten. Auf dem Wenzelsplatz sammelten sich tausende, zehntausende, vielleicht noch mehr Menschen – ich weiß nur, dass wir einander ständig gegenseitig berührten. Die Stimmung – das ist mir am eindrücklichsten in Erinnerung – war weit weniger ängstlich als sexuell aufgeladen. Angeblich gibt es Ähnliches bei großen Popkonzerten. Männer und Frauen sahen einander an, als wollten sie auf der Stelle miteinander schlafen und täten es nur deshalb nicht, weil sie nicht versäumen wollten, was sich auf der Bühne zuträgt. Jeder hielt für möglich, dass auf dieser Bühne demnächst geschossen würde – es gab zweifellos einen Hintergrund von Angst – aber gleichzeitig erfüllte uns doch vor allem ein Gefühl unbegrenzter, unbesiegbarer Zusammengehörigkeit. Wenn fremde Menschen einander je durchwegs als Brüder und Schwestern empfunden haben, dann war es hier am Wenzelsplatz der Fall, und der Inzest hörte auf ein Verbrechen zu sein. Ich glaube, es war zuerst nur ein einzelner Panzer, der sich von einer Seitengasse hereinschob. Später, so weiß ich, ragten uns Kanonenrohre aus zahlreichen Geschütztürmen entgegen, erregten aber ebenfalls erstaunlich wenig Angst, obwohl man Panzer nicht zuletzt wegen ihres erschreckenden Bildes einsetzt. Die Einzigen, die Angst zu haben schienen, waren die Panzerkommandanten, die nach und nach vorsichtig aus ihren Luken auftauchten und ratlos in die Menge blickten. Irgendwann ging eine erste junge Frau – sie schien mir die Schönste, die ich je gesehen habe – auf einen der Panzer zu und stecke einen Blumenstrauß in sein Kanonenrohr. In wenigen Stunden sollten Dutzende ihrem Beispiel folgen. Es ist viel über den grandiosen gewaltlosen Widerstand der tschechischen Bevölkerung geschrieben worden – er übertraf sicher alles, was sich die Friedensbewegung
165
166
Prager Frost
in ihren kühnsten Träumen erhofft hatte. Die Prager steckten nicht nur Blumen in alles, was wie der Lauf einer Waffe aussah, sie verwickelten die Soldaten auch ständig in Gespräche, denn in ihren Schulen hatten sie durchwegs Russisch gelernt. Ich habe mir eines dieser Gespräche übersetzen lassen. Ein Mann fragte einen Panzerkommandanten, warum er hier sei. Es gelte, eine Konterrevolution niederzuschlagen, antwortete der offenbar gut geschulte Soldat. „Finden Sie Blumensträuße zum Empfang konterrevolutionär?“, wollte der Prager wissen. Der Soldat schwieg. „Glauben Sie an die Wahrscheinlichkeitsrechnung?“, fragte der Tscheche weiter, der offenbar erkannt hatte, dass er einem gebildeten Mann gegenübersteht. „Ja“, antwortete der Russe. „Gut, dann frage ich jetzt einen der Umstehenden nach dem anderen, ob wir den Kommunismus abschaffen wollen und uns die Konterrevolution wünschen. Ob wir uns der NATO anschließen oder mit Russland in Freundschaft leben wollen.“ Er rief den Nächststehenden herbei und der antwortete wie erwartet. Beim fünften oder sechsten Befragten hielt sich der Russe die Ohren zu. Er sagte nur mehr, dass er hierher abkommandiert sei, dann verschwand er in seinem Fahrzeug. Angeblich musste die russische Führung die gesamte in Prag stationierte Mannschaft nach einer Woche austauschen, so unsicher war sie, dass diese Männer auf ihren Befehl wirklich schießen würden. Ich glaube, dass sich sehr Ähnliches auch hin und wieder in der Ukraine ereignet hat, als Wladimir Putins Panzer dort auf russisch sprechende Ukrainer schießen sollten. Die Aussagen, die der Tscheche, er war ein Lehrer, durch seine Fragen provoziert hatte, waren dennoch Notlügen. Alle Tschechen, mit denen ich in diesen Tagen sprach, bekannten mir gegenüber, dass sie natürlich Privateigentum, freie Wahlen, ein Ende der Planwirtschaft, ein Ende der Vorherrschaft der kommunistischen Partei und der russischen Bevormundung wollten – ich sollte sie mit ihren Aussagen nur nicht zitieren. Die Behauptung mancher ewig Linker – Günther Nenning gehörte dazu – dass ein „Kommunismus mit menschlichem Antlitz“ wie Alexander Dubček ihn zweifellos wollte, bei den Menschen eine Chance gehabt hätte, ist blanke Illusion: Es wäre dann eben kein Kommunismus mehr gewesen. Die Russen wussten, dass die Entwicklung nicht dort stehenbleiben würde, wo sie im Frühling 1968 angelangt war – aus ihrer Sicht intervenierten sie mit vollem Recht. Es war denn auch keineswegs klar, dass die Invasion ohne Blutvergießen abgehen würde. In den folgenden Nächten wurden wir immer wieder durch das Knattern von Maschinengewehren aufgeweckt und sahen durchs Hotelfenster in einen durch ungezählte Leuchtraketen hell erleuchtetem Himmel. Selbst Kollegen, die zuvor in Vietnam gewesen waren, drängten dann ins Innere des Hotels und erklärten mir auch wieso: In Vietnam habe man gewusst, wo die Front verläuft und wie weit man von ihr entfernt ist. Man habe gewusst, wann man sicher war – in Prag sei das immer ungewiss gewesen.
Prager Frost
Genauso gut wie niemand umkommen konnte, konnte der Wenzelsplatz auch zu einem Massengrab werden, denn am Dach jedes seiner Eckhäuser waren Maschinengewehre postiert. Aus ihnen kam auch ein Teil des Geknatters, das uns aufgeschreckt hatte. Aber sie zielten nicht auf Menschen und auch nicht auf Fenster – sie schossen vermutlich in die Luft. Wahrscheinlich aus Nervosität, weil auch irgendwo anders in der Stadt Gewehrfeuer aufgeflammt war. Einer der wenigen, die sich dennoch hinaus auf den Balkon wagten, um den Feuerzauber am Himmel auf Fotos zu bannen, war Peter Lehner. Er kroch auf dem Bauch auf den Betonsockel des Balkons, denn plötzlich gab es auch Schüsse von unten nach oben – eine Kugel schlug über dem Spiegel an der Hinterwand des Zimmers ein – und hätte ihn jederzeit treffen können. Als wir nach Wien zurückkamen, entdeckten wir, dass Strohal dennoch nur einen Bruchteil seiner Fotos wiedergegeben und auch die Hälfte meiner Texte nicht abgedruckt hatte. „Gefahr ist etwas anderes“, sagte er, „wenn man wie ich im Zweiten Weltkrieg gewesen ist, weiß man, wie wirkliche Gefahr beschaffen ist und was man demgegenüber von nervösen Schüssen in die Luft zu halten hat.“ Nur in internationalen Blättern machten Lehners Fotos Furore. Texte wie Fotos gelangten übrigens durch einen Mann nach Wien, der mir noch oft begegnen sollte: Rudolf Kirchschläger, damals österreichischer Botschafter in Prag. Seine Botschaft erteilte nicht nur gegen eine Weisung von Außenminister Kurt Waldheim Visa an Dissidenten, die sich nicht mehr sicher fühlen konnten, sondern er fuhr mit seiner beflaggten Limousine auch ständig durch die Stadt, um verängstige österreichische Touristen einzusammeln. Das Botschaftsgebäude war schließlich bis auf die Gartenstiege hinaus gefüllt. Meine Texte und Peter Lehners Fotos nahm er an einem abgemachten Treffpunkt durchs Autofenster entgegen – dann brachte ein diplomatischer Kurier sie weiter nach Wien. Kirchschläger, der als Bundespräsident so unendlich ruhig, fast einschläfernd sprach, war ein mutiger Draufgänger – er hätte bei seinen Touren auch jederzeit angehalten, festgenommen und verschleppt werden können. Mit demselben Draufgängertum hatte er als junger Offizier in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges noch 2000 Fähnriche an die Front geführt, von denen 200 umkamen. Mut ist etwas sehr Komplexes – ein Autor, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß, hat ihn einmal als „Mangel an Phantasie“ definiert. Aber auch das – meine Mutter belegt es – ist nur ein Teilaspekt dieser manchmal so nützlichen, manchmal so tragischen Eigenschaft.
167
24. Mit Portisch (k)eine Zeitung gründen
Es ist vorstellbar, in welchem Ausmaß das Ausscheiden Hugo Portischs aus dem Kurier mich getroffen hat. (Es traf auch den Kurier, der sofort Leser verlor). Unser schon bis dahin gutes, aber doch in erster Linie dienstliches Verhältnis war durch seinen Abschied in die Nähe von Freundschaft gerückt: Ich gehörte zu denen, die Portisch immer wieder sagten, wie sehr sie ihn vermissen. Aus einem dieser Gespräche wuchs die Idee, gemeinsam eine neue Tageszeitung zu gründen. Zwanzig Millionen Schilling, so meinte Portisch, müsse man zu diesem Zweck zur Verfügung haben. Doch er war nicht wie Hans Dichand der Mann, sich einer politischen Organisation wie dem ÖGB anzubieten und er hatte, im Gegensatz zu einer weit verbreiten Meinung, auch keine Beziehungen zur „Wirtschaft“. So war ich es, der sich auf die Suche nach Geld machte. Dabei begegnete mir ein Mann, der mir noch öfter begegnen sollte, und der den Kurier sogar einmal besessen hatte: Der Rechtsanwalt Ewald Weninger hatte den Ruf, sich für Medien zu interessieren und Geld auftreiben zu können. Er wurde diesem Ruf auch durchaus gerecht. Sein erster Vorschlag betraf eine amerikanische Firma, die bereit sein könnte, Geld für eine Zeitung auszugeben, sofern diese bereit ist, die griechische Militärjunta zu unterstützen – „aber Hugo Portisch wird das vermutlich nicht wollen, obwohl er innenpolitisch schreiben könnte, was er will.“ „Ich glaube, da haben Sie recht“, gab ich für Portisch zur Antwort. Doch Weninger glaubte etwas politisch weniger Anrüchiges zu wissen: Es gebe da einen reichen Italiener, der noch dazu über Medienerfahrung verfüge, erklärte er mir im zweiten unserer höchst anregenden Gespräche im Spätsommer 1969. In einer von diesem Italiener finanzierten Zeitung könnten wir nicht nur innen-, sondern auch außenpolitisch schreiben, was wir wollten, sofern es nicht gerade Italien betrifft. Auch dieser Silvio Berlusconi, so heiße er, würde uns die 20 Millionen sofort zur Verfügung stellen, denn sie wären für ihn eine Kleinigkeit. „Es darf Sie nur nicht irritieren, dass es sich dabei um Mafiageld handelt.“ Es irritierte uns. Ich musste weitersuchen. Das verhalf mir zu einer der seltsamsten Autofahrten meines Lebens. Irgendwo, vielleicht sogar bei Weninger, hatte ich den Namen eines deutschen Anwalts erfahren, der gleichfalls in dem Ruf stand, sich für Medien zu interessieren und über Geld zu verfügen. Wir trafen einander in München und weil seine Zeit sehr knapp war, ersuchte er mich, ihn auf seinem Weg nach Liechtenstein zu begleiten. Ich stieg also in einen schwarzen Mercedes AMG mit getönten Scheiben und neben mich setzte sich ein großgewachsener,
Mit Portisch (k)eine Zeitung gründen
breitschultriger Mann, der trotz des trüben Wetters eine dunkle Sonnenbrille trug und mit einem Schmiss in der braungebrannten Wange wie das Klischee eines SS-Manns in einem Hollywoodfilm aussah. Nur dass er freimütig und nicht ohne Stolz bekannte, dass er wirklich einer gewesen war. Im Fond des Wagens saß statt eines Schäferhundes seine bildhübsche Geliebte, die er aber durchaus wie einen Schäferhund behandelte: Sie hatte still zu sitzen und den Mund zu halten, solang er sprach. Und er sprach ständig und gerne. Dank meines eher germanischen Aussehens – schlank, blond, blauäugig – schätzte er mich offenbar als jemanden ein, der in besseren Zeiten bei der Napola aufgenommen worden wäre. Ich versuche unser Gespräch hier so gut zu rekonstruieren, wie man es nach fünfzig Jahren noch im Gedächtnis haben kann. Nur den norddeutschen Dialekt gebe ich nur bei ein paar Sätzen exakt wieder, die sich mir besonders eingeprägt haben. „Zwanzig Millionen Schilling also wollen Sie?“ begann der Anwalt unser Gespräch, „Wer das als Kredit vergeben kann, versteht etwas von Geld. Und wenn er etwas von Geld versteht, dann geht er entweder auf sicher: Er investiert in Konservendosen und verdient drei Prozent. Oder er geht auf Risiko: Dann geht er ins Waffengeschäft und verdient 30 Prozent. Ihr Zeitungsgeschäft verbindet das Risiko eines Waffengeschäfts mit dem Verdienst von Konservendosen.“ Ich versuchte, ihn anhand von Springer und Augstein davon zu überzeugen, dass man auch mit Zeitungen zum Millionär werden kann, aber er wollte es nicht akzeptieren: Ohne den Krieg und die Amerikaner wären die nie reich geworden. Und wirklich reich seien sie bis heute nicht. „Ich werde ihnen mal sagen, was ein Geschäft ist. „Wir“ – es stellte sich heraus, dass er für eine gigantische Waffenhandelsfirma sprach – „haben zum Beispiel die gesamte israelische Armee mit Gewehren beliefert – da waren 50 Prozent drin. Aber natürlich wollten wir auch mit den Ägyptern ins Geschäft kommen – die Amerikaner wollten das zwar nicht, aber da sind wir unparteiisch und natürlich ist es uns gelungen: Wir haben auch den Ägyptern Gewehre geliefert. Nicht so gute, aber wegen des größeren Risikos waren da 100 Prozent drin. Und dann kommt der Sechstagekrieg und die Araber rennen auf und davon und schmeißen ihre Gewehre in den Wüstensand. Die Israelis sammeln sie ein und können natürlich nichts damit anfangen – sie haben ja schon unsere guten. Also haben sie sie uns als Schrott verkauft. Und wissen Sie, wo sie jetzt sind?“ – er genoss meinen fragenden Blick wie ein Künstler, der sein größtes Werk enthüllt – „wieder bei die Äjypter.“ Ich weiß nicht, wie wahr diese Erzählung ist, aber ganz unglaubwürdig klang sie nicht. Ich gestehe, dass mich der Sieg der Israelis auch mehr beruhigte, als mich die Schrott-Gewehre in den Händen der Ägypter beunruhigten. Auch der SS-Mann zollte den Israelis Respekt: „Wenn die statt der Amerikaner in Vietnam kämpften, wäre der Kriech dort längst jewonnen.“
169
170
Mit Portisch (k)eine Zeitung gründen
„Er scheint auch so einem Ende entgegenzugehen“, warf ich ein, „die Amerikaner wollen ihn nicht mehr führen, nicht zuletzt, weil auch ihre Zeitungen immer mehr dagegen schreiben.“ „Sie glauben doch nicht, dass das wegen der Journalisten so ist. In Wirklichkeit sind wir es, die diesen Krieg nicht mehr wollen. Er ist schlecht fürs Geschäft geworden.“ „Wieso?“ „Schauen Sie, das Waffengeschäft besteht aus zwei Teilen: Der große, das Butterbrotgeschäft, ist die ständige Nachrüstung der amerikanischen Armee, damit sie auf dem höchsten Stand ist. Daneben gibt es das viel kleinere Tagesgeschäft: Das sind die Waffen und das ist die Munition, die man für die gerade laufenden Kriege verbraucht. Da war der Vietnamkrieg am Anfang natürlich gut, aber dann kam ein kritischer Punkt: Es wurde in Vietnam so viel verbraucht, dass wir Gefahr liefen, das Nachrüstungsgeschäft, also das Butterbrotgeschäft, mit den vorhandenen Kapazitäten nicht mehr zu bewältigen. Es bestand das enorme Risiko, dass die USA beginnen, in Europa einzukaufen und womöglich entdecken, dass manche Waffen dort billiger und besser sind. Das hätten wir nur verhindern können, indem wir unsere Kapazitäten ausgeweitet hätten. Aber das wäre geschäftlich unsinnig gewesen – ein enormer Aufwand, der sich nicht gerechnet hätte, weil der Vietnamkrieg ja sicher nicht ewig gedauert hätte. Also haben wir begonnen, ihn schlecht zu machen. Sie glauben doch nicht, dass wir keinen Einfluss darauf haben, was die Zeitungen über einen Krieg schreiben. Wenn es in Vietnam Frieden geben wird, dann weil auch wir diesen Frieden jetzt wollen.“ „Sie sollten also eigentlich den Friedensnobelpreis bekommen.“ „In Wirklichkeit sehr wohl. Die Waffenindustrie ist heute gegen jeden zu langen, zu großen Krieg – da leidet am Ende immer auch die Wirtschaft und dann hat das Land nicht mehr das Geld, sein Heer zu bezahlen. Und total zusammengeschossene Länder können die längste Zeit überhaupt keine Waffen mehr kaufen: Klene Krieche ja, jroße Krieche nee.“ „Vielleicht haben Sie trotzdem Verständnis dafür, dass unsereins ganz gern auch auf kleine Kriege verzichtet.“ „Das könnten Sie nicht. Ohne Rüstungsindustrie bricht Ihnen jede Konjunktur irgendwann zusammen. Das ist die einzige Industrie, die immer Arbeitsplätze schafft. Was glauben Sie, wo die USA, aber auch England oder Frankreich heute wären, wenn dort die gesamte Rüstungsindustrie zusperrte?“ „Ich weiß es nicht genau. Ich kenne den Anteil der Militärindustrie am BIP nicht. Aber man könnte doch besser etwas Vernünftigeres erzeugen als Waffen, die man nicht oder nur zum Kaputtmachen braucht und Munition, die sich beim Verwenden in Staub auflöst. Selbst wenn man lauter sinnlose Blumentöpfe erzeugte, die man nicht benutzt oder ständig fallen lässt, hätte man wirtschaftlich genau den gleichen die Wirtschaft belebenden Effekt, wie wenn man Waffen und Munition erzeugt.“ „Da haben Sie Recht. Aber kein Wähler würde der Regierung bewilligen, lauter Blumentöpfe zu erzeugen. Diese Bewilligung bekommen Sie nur, wenn Sie sagen, dass
Mit Portisch (k)eine Zeitung gründen
Sie die Nation vor Feinden schützen müssen. Nur mit dieser Emotion können sie so viel Geld locker machen.“ „Aber geht das nicht doch auch mit positiven Emotionen? Man könnte die Menschen doch vielleicht auch für Entwicklungshilfe, für den Sieg über den Hunger begeistern.“ „In enem jeringen Umfang is det richtich. Dethalb haben alle, die in der Kriechsindustie investiert sind och n kleenes Been in der Entwicklungshilfe“. Als ich vierzig Jahre später mit der Wiederaufbau-Firma Halliburton des Bush-Vize Dick Cheney im Irak konfrontiert war, gedachte ich beeindruckt meines SS-Lehrers. Er hatte dann übrigens doch auch ein Angebot für uns bereit: Sein Unternehmen würde uns Geld geben, sofern wir durch unsere Berichterstattung die griechische Militärjunta unterstützten. „Ich weiß“, sagte ich, „mein Kollege hat das leider schon einmal abgelehnt.“ „Dann brauchen Sie keinen Investor, sondern einen Weltverbesserer oder einen Wohltäter.“
171
25. Ossi Bronner sucht einen Chefredakteur
Ossi Bronner ist kein Wohltäter, aber ein Weltverbesserer. Er hat das profil und den Standard aus keinem anderen Motiv gegründet. Ich weiß heute nicht mehr, woher wir einander kannten. Vielleicht aus der „Fledermaus“, in der ich als Fan seines Vaters häufig Gast war, vielleicht aus dem VSM, vielleicht aus dem Kreis um Erhard Busek, vielleicht aus Döbling, wo ich mehrere Freunde und vor allem Freundinnen hatte, die auch ihm gefielen. Wir sind nicht mehr auf so freundschaftlichem Fuße, dass ich ihn fragen wollte und es ist letztlich unerheblich. Sicher ist, dass wir irgendwann beide Redakteure beim Kurier und damals sehr wohl herzlich befreundet waren. Auch, weil wir dort beide ein wenig die Rolle von Außenseitern innehatten: Ich, weil ich versuchte, so etwas wie literarisches Schreiben in einer Tageszeitung zu etablieren – er, weil er (im Einklang mit Hugo Portisch) dort jene intensive Recherche etablieren wollte, die amerikanische Medien auszeichnete. Als Journalist war er denn auch erstmals aufgefallen, als er in Wien eine Sammlung für den NS-Verbrecher Franz Novak veranstaltet hatte und die erstaunlich positiven Reaktionen der Bevölkerung dokumentierte. Danach hatte er unter eingehendem Aktenstudium im Forum jene gespenstischen Urteile von Blutrichtern der NS-Zeit dokumentiert, die unter Justizminister Christian Broda unverändert Dienst taten und bis zuletzt nicht suspendiert wurden. „Unten steht ein Lastwagen und es werden Bücher abgeladen – der Bronner braucht Material für eine Kurzmeldung“, spotteten Kollegen. Ich spottete nicht – und das verband uns. Vor allem aber verband uns natürlich die Geschichte unserer Familien in der NS-Zeit: Nazis für lebensgefährlich zu halten, eint weit über jede Weltanschauung hinaus. Darüber hinaus resultierte daraus eine gemeinsame, in Österreich damals sehr umstrittene Sympathie für die amerikanischen Befreier: Beide waren wir, wie Hugo Portisch, denkbar froh darüber, dass es sie gab und dass uns die NATO auch vor der sowjetischen Diktatur schützte. Was die Innenpolitik betraf, so waren wir am ehesten Liberale – beiden war die SPÖ allenfalls um Nuancen lieber als die ÖVP, aber das lag nicht so sehr an ihrer innenpolitischen Zielsetzung, als daran, dass Gerhard Bronner, wie meine Mutter, aus der Sozialdemokratie kam und wir automatisch in diesem politischen Milieu sozialisiert worden waren. Charakteristischerweise hatte auch Oscar Bronner – nicht in meiner Zeit – als Volontär bei der Arbeiter-Zeitung mit journalistischer Arbeit begonnen. Im Lauf der Jahre waren wir beide, denke ich, ohne es bezüglich Bronners zu wissen, zu Wechselwählern mutiert – aber schon dieser Satz zeigt, wie wenig Bedeutung die innenpolitische Zuordnung für uns hatte.
Ossi Bronner sucht einen Chefredakteur
Ansonsten hatten wir beide viel für hübsche Mädchen übrig, was für mich als junger Ehemann, anders als für ihn als Junggeselle, ein Problem war – obwohl die hübschen Mädchen sowieso stets sehr viel mehr für ihn als für mich übrig hatten. Wenn ich mich zurückerinnere, habe ich ihn immer ein wenig um seine bildhübschen Zimmergefährtinnen (die hübschesten weit und breit) beneidet. Er fand mich dafür immer den etwas besseren Journalisten. Der größte Unterschied zwischen uns betraf das Selbstbewusstsein: Ich habe nie völlig an mich geglaubt – Bronner war immer völlig von sich überzeugt. Jedenfalls hatte er nie die geringsten Zweifel an seinen Fähigkeiten, auf welchem Gebiet auch immer. Ich denke, dieses Selbstbewusstsein, das mir auch bei anderen meiner jüdischen Freunde begegnete, liegt an der Rolle, die die berühmte „jiddischen Mame“ in ihrem Leben spielt: Von der ersten Sekunde an trichtert sie ihren Kindern ein, dass sie die Besten weit und breit sind – denn nur diese Selbstgewissheit lässt sie die lebenslange Konfrontation mit dem ubiquitären Antisemitismus überstehen. In den Texten, die über Bronner geschrieben wurden, habe ich in Bezug auf ihn zwar keine Bestätigung für diese meine These gefunden, aber ich hoffe, dass ich nicht restlos danebenliege – es kann ja auch der Vater die Rolle der „Jiddischen Mame“ gespielt haben. Präzise kann ich jedenfalls beschreiben, wie sich sein Selbstbewusstsein in der Praxis geäußert hat. So hatte er in der Zeit, in der wir beim Kurier waren, vermutlich durch seine Freundschaft mit Mariusz Demner, dem die größte Werbeagentur des Landes gehört, Gefallen am Werbegeschäft gefunden und ebenfalls eine Agentur gegründet. Nach einigen winzigen Aufträgen hatte diese Agentur einen ersten Jahresauftrag seitens einer jüdischen Firma namens „Kohlpack“ erhalten. Das erzählte mir Bronner, um mir vorzuschlagen: „Wärst Du bereit, nach Deutschland zu gehen, und dort die deutsche Filiale meiner Agentur zu übernehmen?“ Er war von der Sekunde an, in der er eine Werbeagentur gegründet hatte – schon vor dem Kohlpack-Auftrag – überzeugt, dass es Österreichs größte Agentur mit europaweiten Filialen werden würde – und wenn er im Werbegeschäft geblieben wäre, hätte es mich in keiner Weise gewundert, wenn es so gekommen wäre. Eine andere für ihn typische Begebenheit ereignete sich, als er profil bereits gegründet hatte. Ich hatte vom Verkaufsdirektor eines Schweizer Waffenkonzerns sensationelle Informationen über Interna des Schweizer Waffenhandels erhalten – über die Summen, die Staatschefs, Militärs und Beamten überwiesen worden waren – und träumte von einer entsprechenden Serie im profil. Bronner hatte sofort die richtige Idee, dass wir das Material auch zu einem Buch verarbeiten sollten und so suchten wir Österreichs damals wichtigsten Verleger Fritz Molden auf. Auf der Fahrt in sein Büro besprachen wir, welches Garantiehonorar wir fordern sollten. Das höchste bis dahin bezahlte, so informierte ich Bronner, hatte Hugo Portisch mit 30.000 Schilling erhalten. „Wir verlangen fünfzigtausend – denn Dein Buch wird ein internationaler Bestseller“, gab Bronner den Weg vor. „Probieren wir’s“, war ich einverstanden.
173
174
Ossi Bronner sucht einen Chefredakteur
Bronner und Molden setzten sich einander gegenüber, sprachen eine gute Viertelstunde über alles Mögliche, dann endlich ein paar Minuten über den Inhalt des geplanten Buches. Bis Molden die Frage stellte: „Und wie hoch stellen Sie sich das Garantiehonorar vor?“ „Fünfhunderttausend Schilling“, sagte Bronner, während ich mit offenem Mund nach Luft rang. „Kein Problem“, sagte Molden, während ich den Mund zuklappte. Kurz nach diesem Gespräch musste der Molden-Verlag Konkurs anmelden, weil er sich bei den Memoiren der Stalin-Tochter Swetlana übernommen hatte. Die uns zugesagten 500.000 Schilling trugen daran keine Mitschuld, denn das Buch kam nicht zustande: Der Verkaufsdirektor hatte mir zwar die Unterlagen gezeigt, die seine Vorwürfe belegten, sich aber ausbedungen, sie mir nur Story für Story zu übergeben. Sein Ziel war jedoch leider nicht das Aufdecken der weltweiten Korruption im Rahmen von Waffenkäufen, sondern die Bezahlung ihm von seiner Firma angeblich vorenthaltener Provisionen. Die ersten Unterlagen, die er mir übergab, betrafen ein Feuerleitsystem, das Österreich viermal teurer als Deutschland bei ihm gekauft hatte, und ich konnte daraus eine erste spannende profil-Story machen. (Auch wenn sie, wie damals fast alle unserer Stories, nicht die geringste Reaktion der zuständigen Ministerien oder gar der Staatsanwaltschaft provozierte.) Danach war ihm kein Wort und vor allem kein Blatt mehr zu entreißen – ich gehe davon aus, dass er im Gefolge dieser ersten Story nicht weiter um seine Provision kämpfen musste. Als der zuständige österreichische Verteidigungsminister Karl Lütgendorf etwas später unter nicht ganz geklärten Umständen den Tod fand, fanden sich in seinem Safe übrigens Aktien des Schweizer Unternehmens, für das mein Gesprächspartner tätig gewesen war. Der Safe eines französischen Spitzenpolitikers, über dessen gigantische Zahlungen aus der Schweiz er mir die spannendsten Unterlagen gezeigt hatte, wurde leider nie von einer Staatsanwaltschaft geöffnet. Ich habe also nie erfahren, ob die Unterlagen, die ich diesbezüglich gesehen habe, Moldens 500.000 Schilling wert gewesen wären. Sehr weit daneben lag Bronner mit seiner Einschätzung wahrscheinlich gar nicht – aber ich hätte nie gewagt, sie vorzutragen. Er wagte es immer. Denn Geld bedeutete Bronner nichts. Er war, was mein SS-Begleiter einen „Weltverbesserer“ nannte. Er wollte notwendige, gute, anständige Texter unter die Leute bringen und besaß den Optimismus immer daran zu glauben, dass ihm das gelingen würde. Das geschäftliche Gelingen ergab sich nach seiner Überzeugung aus der Notwendigkeit einer besseren Welt. Innerhalb dieser übergeordneten Überzeugung konnte er, ihr untergeordnet, geschäftlich ungemein präzise denken: Um notwendige Texte zu verlegen, brauchte man einen Verlag, der genug Geld verdiente, diesem Zweck nachzukommen. Das ging am leichtesten, indem dieser Verlag etwas von dem vielen Geld absaugte, das damals in
Der Sprung ins Wasser
Printwerbung floss. Bronner überlegte also, wie ein Druckwerk beschaffen sein müsste, in dem Werbeagenturen besonders gerne Inserate schalten. Sein Gedankengang ist mir bis heute präzise in Erinnerung: Es muss ein Hochglanzprodukt sein, damit teure Inserate für hochwertige Güter perfekt aussehen; die Leser müssen wohlhabend sein, damit die Agenturen solche Inserate schalten; wohlhabende Leser sind am ehesten unter Wirtschaftstreibenden, Eigentümern oder Managern von Unternehmen zu finden – also muss man eine Hochglanzzeitschrift für Wirtschaftstreibende gründen. Also gründete Bronner den trend-Verlag als Herausgeber des monatlichen Wirtschaftsmagazins trend, das tatsächlich von der ersten Ausgabe an Gewinn machte. Ich war von diesem Konzept schon als er es mir vortrug, überzeugt – so viel verstand auch ich von Werbung – aber als Bronner mir vorschlug, die Chefredaktion zu übernehmen, schrak ich zurück: Erstens war ich nicht mutig genug, meinen sicheren Job beim Kurier gegen ein noch so chancenreiches Abenteuer zu tauschen, zweitens verstand ich nichts von Wirtschaft. Ich wusste im Kurier aber einen Redakteur, der mir mehr davon zu verstehen schien und vom unfähigen Chefredakteur Eberhard Strohal eben wegen Unfähigkeit gekündigt worden war: So wurde Jens Tschebull erster Chefredakteur des trend und erwies sich als Goldgriff. Denn Bronners Konzept war zwar theoretisch goldrichtig, aber bezüglich der praktischen Umsetzung hatte er eine völlig falsche Vorstellung vom österreichischen Lesermarkt: Er plante den trend als hochgestochenes Produkt, das exklusiv – als Abonnement und kaum am Kiosk – an die wirtschaftliche Elite des Landes vertrieben werden sollte. Tschebull, der wusste, wie klein diese Elite war, schuf eine Zeitschrift, die zwar vielleicht auch die Eigentümer oder Generaldirektoren eines Unternehmens, vor allem aber dessen mittlere Angestellte lasen. Dazu Steuerberater, vielleicht auch Anwälte oder gutverdienende Angehörige der Mittelschicht, die wissen wollten, was die wirklich Reichen so tun. Tschebull schuf eine Wirtschaftsillustrierte – dadurch hatte der trend von Beginn an eine ausreichend große, ausreichend wohlhabende Leserschaft. Schon anderthalb Jahre nachdem er den trend gegründet hatte, kam Bronner das zweite Mal auf mich zu: „Jetzt mache ich das, was ich wirklich wollte – ein politisches Magazin. Machst Du jetzt mit?“
Der Sprung ins Wasser Als Oscar Bronner mir 1969 anbot, Chefredakteur eines von ihm geplanten Nachrichtenmagazins zu werden, hatte ich drei Gründe „Ja“ zu sagen. Der erste: Meine eigenen Bemühungen, eine Zeitung zu gründen, waren kläglich gescheitert. Es war mir nicht gelungen, Geld für eine Tageszeitung aufzutreiben, obwohl ich mit Hugo Portisch den besten Journalisten des Landes als Partner zur Seite hatte. Ebenso fehlgeschlagen war mein Versuch, bei der SPÖ Unterstützung für die Gründung
175
176
Ossi Bronner sucht einen Chefredakteur
eines Wochenmagazins zu erhalten: Man hätte zwar gerne über eine Zeitschrift verfügt, die nicht automatisch die Partei der ÖVP ergriff, aber man war nicht sicher, dass ich automatisch die Partei der SPÖ ergreifen würde und wusste aufgrund vergangener teurer Desaster mit Tageszeitungen („Express“, „Neue Zeitung“) auch nicht mehr, wie man die Mittel für den Start einer Wochenzeitung aufbringen sollte, obwohl dafür viel weniger Geld notwendig gewesen wäre. Zweitens: Oscar Bronner war gegenüber einer SP-nahen Organisation nicht nur der von vornherein viel geeignetere, weil unabhängige Partner, sondern er hatte darüber hinaus mit dem monatlich erscheinenden, florierenden Wirtschaftsmagazin trend auch eine gewisse finanzielle Basis für ein zusätzliches politisches Magazin geschaffen. Dazu waren wir nicht nur miteinander bekannt, sondern damals herzlich befreundet. Drittens und nicht zuletzt war ich im Kurier frustriert. Mit dem Ausscheiden Portischs, den ich verehrte und der mich schätzte, war diese Zeitung für mich nur mehr ein „sicherer Arbeitsplatz“ – nicht mehr das Medium, mit dem ich mich identifizierte. Gleichzeitig sah ich dort keine Aufstiegschance: Ich hatte mich um die Leitung des Lokalressorts beworben, nachdem dessen Chef, Reinald Hübl, der gehofft hatte, Portisch als Chefredakteur nachzufolgen, zur Kronen Zeitung gewechselt war – aber Portischs’ Nachfolger dachte nicht daran, mir diese Chance zu geben. Statt Hübls oder des hoch professionellen, aber nicht ausreichend ÖVP-nahen Innenpolitikers Arnold Klima war mit dem altgedienten, freundlichen Außenpolitiker Eberhard Strohal ein Mann zum Chefredakteur der „führenden Tageszeitung Österreichs“ bestellt worden, der zwar ausreichend ÖVP-Nähe, sonst aber kaum Führungsqualität besaß. Unser persönliches Verhältnis war zusätzlich getrübt, seit er mich trotz meines Drängens nicht und nicht nach Prag fahren lassen wollte, obwohl ich im Gegensatz zu ihm genau wusste, dass die Russen dort einmarschieren würden; und es war doppelt getrübt, als er danach auch noch die Hälfte meiner dort verfassten Texte nicht veröffentlicht hatte. Jetzt zog mir Strohal nicht nur den spracharmen Polizeireporter Josef J. als Lokalchef vor, sondern überließ mir nicht einmal die Gerichtssaalberichterstattung als selbstständiges Ressort, obwohl ich dafür immerhin einen Renner-Preis erhalten hatte. Theoretisch entschied damit der Polizeireporter Josef J., wie viel Platz meine Prozessberichte erhielten: Das wollte ich nicht abwarten und nahm Oscar Bronners Angebot freudig an. So trug Eberhard Strohal wesentlich zu meinem Karrieresprung bei. Entscheidungen von Chefredakteuren – das sollte ich in der Folge noch einmal erleben und werde darauf zurückkommen – tun das des Öfteren: Nicht nur Tschebull wurde trend-Chefredakteur und später auch Teilhaber, nachdem Strohal ihn gekündigt hatte, sondern auch Georg Waldstein wurde zum Mitbegründer des „Gewinn“ und Multimillionär, nachdem Tschebull ihn gemaßregelt hatte.
Der Sprung ins Wasser
Um zu besprechen, wie Bronners neues politisches Magazin beschaffen sein sollte, trafen wir einander im Garten meiner Frau Lisi in Mauer, denn der war nur wenige Gehminuten von Bronners damaligem Wohnhaus, einem Bungalow auf dem Maurer Berg, entfernt. (Der von seinem Vater finanzierte Bungalow war die zentrale Sicherheit für den Kredit zur Gründung des trend gewesen.) Als sich nach und nach eine Mannschaft herauskristallisierte, blieb der Garten meiner Frau unser Treffpunkt, denn sie versorgte uns mit herrlichen Mehlspeisen. Die Urmannschaft des profil bestand, wenn man von Bronner selbst absah, aus nur gerade sechs Personen. Schreibende Journalisten waren neben mir: Claus Gatterer, ein hervorragender parteiunabhängiger außenpolitischer Autor, nach dem bis heute ein wichtiger Publizistik-Preis benannt ist; Helmut Voska, Ex-Pressereferent des brillanten VP-Finanzministers Stephan Koren, der 1970 durch die Wahlniederlage der ÖVP seinen Job verloren hatte; und Jörg Walberer, ein aus Deutschland stammender Kulturjournalist, der sich von der Programmillustrierten Hör Zu getrennt hatte. Zu diesen Schreibern kam als vorläufiger Art-Direktor der Karikaturist Erich Eibl, der als Mensch und als Zeichner vielleicht eine Nuance zu liebenswürdig für eine so raue Branche, aber jedenfalls ein Profi war. Dazu kam schließlich als enge Vertraute Bronners Nora Anders, die seine Sekretärin wurde. Kurz darauf stieß auch noch Georg N. zu diesem Gründungsteam. Er war Innenpolitikredakteur der Salzburger Nachrichten und, wie heute Andreas Koller, für seine vergleichsweise unparteiischen, nicht zwingend SP-feindlichen Texte dieser „bürgerlichen“ Zeitung bekannt geworden. Bronner verpflichtete ihn als Co-Chefredakteur an meiner Seite, und ich hatte nichts gegen eine solche Arbeitsteilung, die uns als Team zweifellos stärkte. Er – doch das sollte sich erst Monate später herausstellen – hatte sehr wohl etwas dagegen. Einvernehmlich klar war uns allen von Beginn an, dass wir parteiunabhängigen, investigativen Journalismus bieten wollten, denn dafür gab es jede Menge Platz. Am ehesten hatte er noch, wenn auch mit sozialdemokratischer Schlagseite, in der Fernsehsendung „Horizonte“ stattgefunden, die mit Heinz Brantl ein bekennender Sozialdemokrat leitete, bis sie noch in den 1960er Jahren eingestellt wurde. Mit massiver ÖVP-Schlagseite fand investigativer Journalismus daraufhin nur noch in der Wochenpresse statt, die allerdings voran ihrer Parteilichkeit wegen ein Schattendasein fristete. Um sein Magazin schon rein äußerlich von der Wochenpresse abzusetzen, hatte Bronner profil immer im Magazinformat und immer auf Glanzpapier statt auf Zeitungspapier geplant. Chefredakteur der ersten Ausgaben, die im Monatsrhythmus erschienen, war allerdings weder Georg N. noch ich, sondern durch ein Jahr hindurch trend-Chefredakteur Jens Tschebull, dem Bronner seit dem Erfolg mit dem trend am ehesten zutraute, sein Konzept für profil auf Schiene zu bringen: Ein Nachrichtenmagazin vom Zuschnitt des amerikanischen Time, in dem es, wie seinerzeit auch im Spiegel keine namentlich genannten Autoren, sondern nur „die Redaktion“ gab. Alle Texte waren daher in der
177
178
Ossi Bronner sucht einen Chefredakteur
gleichen Magazinsprache abzufassen, hatten möglichst viele „Fakten“ anzuführen und scheinbar jede eigene Meinung zu vermeiden. Bei den Fakten dürfe es keinen Fehler geben, „der Leser muss glauben, dass hinter jedem Absatz eine große Organisation steht, die seinen Inhalt erhoben und die Richtigkeit dreimal überprüft hat“, mahnte Bronner und hatte kein Problem, sich unsere Fünf-Mann-Redaktion als diese große Organisation vorzustellen. Ich glaube, dass damals sowohl er wie Tschebull tatsächlich der Ansicht waren, dass es möglich ist, „reine Fakten“ zu berichten – in Wirklichkeit ist es blanke Illusion: Jeder Journalist wählt die Fakten entlang einer ungefähren Vorstellung aus, die er von den zu beschreibenden Vorgängen bereits im Kopf hat – es ist, wie wir seit Karl Popper wissen, gar nicht anders möglich, wenn seine Aussage wirklich eine solche sein soll. Die gemeinsame Sprache war ein logischer Ausfluss der Vorstellung von der großen Organisation, die nur Fakten berichtet. Und vor allem im Spiegel gab es sie tatsächlich: Die Spiegel-Redaktion umfasste einschließlich einer die „Fakten“ prüfenden „Dokumentation“ rund 500 Mitglieder. Bei uns mussten im monatlichen profil zu Beginn fünf und im wöchentlichen profil neun Journalisten durch gemeinsame Sprache eine große Organisation vortäuschen. Was diese gemeinsame Sprache betraf, so war Tschebull ein brillanter Lehrmeister: „Ihr dürft ja nicht glauben, dass die Leser nichts dringlicher zu tun haben, als Eure Texte zu lesen“, erklärte er uns in etwa, „das Gegenteil ist der Fall. Euer typischer Leser ist ein halbgebildeter Dentist. Er hat den ganzen Tag gearbeitet, liest eigentlich nur mit Interesse, was er beruflich lesen muss, hat die ganze Woche über in für ihn daher mäßig interessante Tageszeitungen hineingeschnuppert und soll nun auch noch das profil lesen. Wenn ihr ihn nicht schon mit dem ersten Absatz gefangen nehmt, schläft er Euch weg. Ihr müsst in jedem Absatz um seine Aufmerksamkeit kämpfen. Einen unerwarteten Vergleich gebrauchen, ein noch so winziges Wortspiel nutzen, wenigstens mehrere Worte wie in einem Stabreim mit dem gleichen Konsonanten beginnen lassen. Das Wichtigste ist ein gelungener Schlussabsatz, der ihn mit dem befriedigten Gefühl einschlafen lässt, etwas Gutes gelesen zu haben.“ Ich bin bis heute restlos von diesem Rezept für diese Art der Berichterstattung überzeugt und habe es zu Tschebulls Überraschung in sprachlicher Hinsicht durch die ersten Jahre des profil peinlich befolgt, obwohl ich die dahinterstehende Grundidee der Aneinanderreihung angeblich rein objektiver „Fakten“ mit Karl Popper für total verfehlt hielt: Sie täuscht dem Leser meinungslose Objektivität vor und lässt ihn dadurch besonders leicht auf die dahinterstehende immer gegebene Sicht des Autors hereinfallen. Es ist sehr viel ehrlicher, ihn durch die Nennung des Autors präzise darüber zu informieren, wessen Meinung ihm vorgetragen wird, und möglichst auch gleich in den ersten Absätzen präzise und schnörkellos zu formulieren, welche These der Autor vertritt. Das macht es dem Leser ungleich leichter, diese These anhand der im Text angeführten „Fakten“ und Argumente zu überprüfen – sie anhand eigener Gegenargumente zu falsifizieren oder (wie man als Autor zweifellos hofft) ihr zu folgen.
Der Sprung ins Wasser
Als ich 1975 Herausgeber des profil wurde, habe ich die Zeitschrift daher total in diesem Sinne umgestellt und jedem Autor seine persönliche Sprache belassen. Auch in einer anderen, in meinen Augen ausschließlich positiven Hinsicht orientierte sich Bronner an amerikanischen Vorbildern: Er war, wie übrigens auch Tschebull, der theoretischen Ansicht, dass der Eigentümer sich nur in redaktionelle Belange nur einzumischen hat, indem er als „Herausgeber“ den „Chefredakteur“ bestellt. Danach sei der Inhalt der Zeitschrift dessen Sache. Der „Herausgeber“ wie österreichische Zeitungen ihn kannten – ein Vertrauter des Eigentümers, der über dem Chefredakteur steht und die „Linie der Zeitung“ bestimmt, indem er in letzter Instanz über ihren Inhalt entscheidet – war in Bronners wie Tschebulls Augen überflüssig. In der Praxis des profil waren diese Funktionen freilich zu Beginn nie so getrennt und Bronner als Gründer und Eigentümer natürlich immer gegenwärtig. Wir waren ja letztlich eine kleine Gruppe von Leuten, die auf ziemlich engem Raum zusammensaßen. Erst unter Jens Tschebulls Führung – er folgte Bronner nach dessen Ausscheiden im Jahr 1975 als Geschäftsführer – machten wir daraus ein wichtiges Statut, das die Unabhängigkeit des profil bis heute absichert: Der Chefredakteur ist immer zugleich Herausgeber der Zeitschrift. Tschebull hat jedenfalls nach den ersten Ausgaben nie an profil-Konferenzen teilgenommen und das auch später als Herausgeber nicht getan. Was Bronner sich abseits der journalistischen Grundkonzeption – Time – immer vorbehielt, war der graphische Aufritt, den er als keineswegs amateurhafter Maler auch hervorragend konzipierte: Das profil der ersten zwei Jahre hatte als damals einzige Zeitschrift ein rein weißes Cover, auf dem sich vor allem Grafiken perfekt abhoben und es hatte auf der vorletzten Seite einen „Cartoon“, wie er in amerikanischen Zeitschriften geläufig war. Anfangs gestaltete Erich Eibl neben dem Cartoon auch meist das Cover. Später hatten wir unglaubliches Glück, indem Bernhard Paul, heute umjubelter Eigentümer des Zirkus Roncalli, unser Art-Direktor wurde. Er gestaltete die Cover zwar fast nie selber, brachte aber zwei geniale Künstler, die an der graphischen Lehranstalt seine Mitschüler gewesen waren, ins profil mit: Gottfried Helnwein und Manfred Deix. Ich kann mir nur ans Revers heften, beide nach Kräften gefördert und Deix gegen alle, anfangs sehr heftigen Angriffe aus dem Kreis der auf Bronner folgenden Eigentümer in Schutz genommen zu haben. Helnwein, mit dem mich bald auch private Freundschaft verband und den ich für einen großen Maler hielt und halte, konnten wir uns leider schon relativ bald nicht mehr leisten – der „Stern“ und andere internationale Magazine zahlten ein Vielfaches für seine Titelbilder. Deix blieb der Zeitschrift länger erhalten, obwohl er von den Geschäftsführern, die Bronner folgten, an seiner Leistung gemessen, miserabel bezahlt wurde und profil einmal freiwillig verließ, um zum kurzlebigen linken Extrablatt zu wechseln, das ihm weniger reaktionär als die von mir geleitete Zeitschrift schien. Nach seiner Rückkehr ins reaktionäre profil fiel er 1992 dennoch dem Sparstift des mäßig
179
180
Ossi Bronner sucht einen Chefredakteur
fähigen Geschäftsführers zum Opfer. Bis dahin zeichnete er, wie ich schrieb, „des Öfteren für den besseren Leitartikel verantwortlich“. Der Einzige, den er auch angesichts seiner Steueraffäre nicht boshaft karikieren wollte, war Hannes Androsch, denn der war der erste Politiker, der Deix’ Qualität sofort erkannte und ihm Cartoons abkaufte. Mir war er weniger dankbar: Als ich 1996 im „Prozess des Jahrzehnts“ heulend auf der Anklagebank saß, reihte er mich unbarmherzig unter die Opfer seiner Zeichenkunst. Seinerzeit hatten wir zwar inhaltlich gut zusammengearbeitet – oft hatten wir die Idee zu seiner Zeichnung gemeinsam entwickelt – aber danach war es ständig zu Auseinandersetzungen gekommen: Die fertigen Zeichnungen erreichten mich jedes Mal zu einem Zeitpunkt, zu dem sie „spätestens“ seit einer Viertelstunde in der Druckerei sein sollten. Und zwar ganz gleich wie früh wir uns auf ihren Inhalt geeinigt hatten. Deix konnte offenbar nur unter maximalem Zeitdruck arbeiten. In seiner späteren Arbeit für andere Zeitschriften scheint sich das insofern geändert zu haben, als er sie dort nie mehr mit der Akribie und Sorgfalt ausführte, die seine profil-Cartoons gekennzeichnet hatten. Ich habe sie immer als „Gemälde“ angesehen und den Fehler gemacht, nur eines seiner Blätter, Kreisky als lieber Gott, persönlich zu erwerben. Allerdings habe ich dafür gesorgt, dass sie gesammelt als trend-profil-Bildband auf den Markt kamen und ihn mit den Worten vorgestellt: „Deix ist ein Künstler von Weltformat.“ Graphisch hat das monatliche profil der ersten Jahre dieses Weltformat zweifellos besessen.
Die einstige FPÖ des Friedrich Peter Die erste Titelgeschichte des neugeschaffenen profil widmete sich der Rolle der FPÖ, die Bruno Kreisky durch „Duldung“ zu einer SPÖ-Minderheitsregierung verholfen hatte, indem sie deren erstes Budget mitbeschloss. Ich stand und stehe dieser rot-blauen Kooperation weit kritischer gegenüber, als unser damals vermutlich vor allem von Georg N. verfasster Text – in meinen Augen war sie Kreiskys politischer Sündenfall. Die „Fakten“ waren einfach: Zwangsläufig gab es in der ehemaligen „Ostmark“ nach Ende des Zweiten Weltkrieges zahlreiche mehr oder minder engagierte ehemalige Nationalsozialisten, die den alliierten Sieg als Niederlage empfanden. In den ersten Jahren hatte man sie, sofern sie Parteimitglieder gewesen oder als „belastet“ eingestuft worden waren, vom Wahlrecht ausgeschlossen – aber es war vermutlich unumgänglich, diesen Zustand irgendwann zu beenden. Nicht zuletzt, weil die Amerikaner angesichts des Kalten Krieges auf eine geschlossen im westlichen Lager stehende Gesellschaft drangen und sogar NS-Wissenschaftler wie Wernher von Braun oder ehemalige Mitglieder des NS-Nachrichtendienstes für sich beschäftigten, waren sie es, die empfahlen, den „Ehemaligen“ ihr Wahlrecht relativ
Die einstige FPÖ des Friedrich Peter
rasch zurückzugeben. Nur dass sie sie in Österreich, anders als in Deutschland, keinem intensiven Umerziehungsprogramm unterworfen hatten, weil Österreich bekanntlich „Hitlers erstes Opfer“ war: Man hatte zwar die schlimmsten österreichischen Verbrecher, deren Morde man kannte und deren man habhaft wurde, vor Gericht gestellt und abgeurteilt – aber das war es. Kaum je hatte man die Bevölkerung, wie etwa im deutschen Dachau, mit den in Mauthausen oder in Ebensee vorgefunden Leichen konfrontiert; der Nürnberger Prozess war hierzulande ein Prozess, der nur die Deutschen anging; die Alliierten hielten Hitler so sehr für einen Deutschen, wie sie Beethoven für einen Österreicher hielten. Viele „Ehemalige“ unter den Österreichern sahen die NS-Zeit daher unverändert als „groß“ an, auch wenn sie leider durch eine militärische Niederlage beendet worden war. Wenig überraschend errang der „Verband der Unabhängigen“ (VdU) als ihr Sammelbecken bei den Wahlen des Jahres 1949 daher elf Prozent der Stimmen. Politischen Einfluss erlangte dieser VdU dennoch nicht, denn keine der beiden großen Parteien, weder die ÖVP, die bei den ersten Nachkriegswahlen die Mehrheit errungen hatte, noch die SPÖ, die nur knapp hinter ihr lag, wollte mit ihm koalieren. Weil der VdU auf diese Wiese weder etwas bewirken konnte, noch Posten oder Wohnungen zu vergeben hatte, verlor er seine Wähler sukzessive an SPÖ und ÖVP, wo man sie ja keineswegs zurückstieß, sondern als Verstärkung willkommen hieß. Insbesondere in der SPÖ, wo es an Akademikern für die Besetzung wichtiger gehobener Funktionen mangelte, war man froh, sie unter „Ehemaligen“ zu finden, die sich aus Dankbarkeit noch dazu besonders willfährig zeigten. Der „Bund sozialistischer Akademiker“, BSA, gelangte so zu seinem Spitznamen BSS. Alles, was für den VdU galt, galt noch mehr für die Partei, die 1956 aus ihm hervorging: die FPÖ. Anton Reinthaler, ein ehemaliger SS-Brigadeführer und Mitbegründer des VdU bildete als erster FP-Obmann sozusagen das weithin sichtbare Bindeglied, bis er 1958 durch den ehemaligen SS-Mann Friedrich Peter abgelöst wurde. Auch die Peter-FPÖ besaß keinen politischen Einfluss und hatte keine Pfründe zu vergeben. Sie verlor daher noch schneller ständig Wähler an die beiden Großparteien. Deren Obmännern war freilich immer klar, dass sie mit Hilfe dieser „Freiheitlichen“, wie sie sich nannten, die parlamentarische Mehrheit erringen konnten, solange sie über Sitze im Parlament verfügten. Der zur Demokratie bekehrte ehemalige HeimwehrAngehörige Julius Raab hatte daher schon 1953, zu Zeiten des VdU, einen vorsichtigen Versuch unternommen, eine solche Mehrheit zu bilden, war aber am roten Bundespräsidenten Theodor Körner gescheitert, der hinter den Kulissen ein entschiedenes Veto einlegte, das zu überwinden Raab nur durch Körners Ablöse und damit im Wege einer Staatskrise möglich gewesen wäre. So trocknete das freiheitliche Lager denn mangels Einflusses kontinuierlich aus, und Ende der 1960er Jahre war höchst fraglich, ob die FPÖ überhaupt noch die Vier-ProzentHürde überwinden würde.
181
182
Ossi Bronner sucht einen Chefredakteur
Das änderte sich schlagartig in dem Moment, in dem Bruno Kreisky den „Freiheitlichen“ unübersehbare Avancen machte und höchst wahrscheinlich schien, dass er mit ihnen eine Regierungskoalition bilden würde. SP-Bundespräsident Adolf Schärf, der mir als Gerichtssaalberichterstatter durch die besonders häufige Begnadigung schwerster Kriegsverbrecher aufgefallen war, wäre dem, anders als Theodor Körner, sicher nicht im Wege gestanden. Wer die FPÖ wählte, konnte also endlich hoffen, etwas zu bewirken und vielleicht auch etwas – einen Posten, eine Wohnung – zu bekommen. Zumal Kreisky Peter auch ein konkretes Geschäft anbot: Wenn der ihn unterstützen würde, würde er das Wahlrecht dahin ändern, dass kleine Parteien leichter zu Mandaten kämen. (Eine Maßnahme, die man demokratiepolitisch sowohl begründet gutheißen, wie begründet ablehnen konnte.) Kreisky hatte bei seinem Unternehmen zwei starke Wegbegleiter: Wiens in der SPÖ denkbar mächtigen Finanzstadtrat und späteren Bürgermeister Felix Slavik, der dem Widerstand angehört hatte und damit keine Angst vor innerparteilichen Vorwürfen haben musste, und den ähnlich mächtigen Gewerkschaftspräsidenten Franz Olah, für den das als ehemaligen KZ-Häftling nicht minder galt. Am meisten sah aber zweifellos Bruno Kreisky selbst sich legitimiert, diesen Weg einzuschlagen: Wer, wenn nicht ein Jude, konnte und durfte ehemaligen Nazis die Hand reichen? Erleichtert wurde ihm das nicht zuletzt dadurch, dass er die Schrecken der NSZeit nicht selbst miterlebt, sondern im schwedischen Exil überlebt hatte. Was er selbst erfahren hatte, war die Verfolgung der Sozialisten wie der Nationalsozialisten durch das Dollfuß-Regime, auf die er mehrfach zu sprechen kam: „Wir sind gemeinsam in den Kerkern des Ständestaates gesessen.“ Er hatte dort offenbar einen besonders sympathischen Nazi zum Zellennachbarn, denn so wie er von ihm sprach, machte er den Eindruck, sich ihm weit eher durch Verfolgung verbunden, als durch Weltanschauung von ihm getrennt zu fühlen. Kreisky hatte freilich auch ein höchst rationales Motiv so zu handeln, wie er es tat. Das wichtigste teilte er zweifellos mit Julius Raab, Wolfgang Schüssel oder Sebastian Kurz: Es war ein einfacher, sicherer Weg zur Macht. Wie Schüssel und Kurz hielt er es auch für denkbar legitim, ihn einzuschlagen, denn schließlich hatte er den Sieg des Sozialismus zum Ziel, in dem Kreisky, nicht anders als Schüssel oder Kurz im Sieg ihres Neoliberalismus, einen unschätzbaren Vorteil für die Bevölkerung sah. Dazu war Kreisky vermutlich ehrlich – und gegen alle Evidenz – der Meinung, dass die FPÖ sich an der Seite der SPÖ zu einer links-liberalen Partei entwickeln würde – nicht anders als Schüssel und Kurz vielleicht ehrlich – und gegen alle Evidenz – der Meinung waren, sie würde sich an der Seite der ÖVP zu einer rechts-liberalen Partei entwickeln. Allerdings machte die Wählerschaft der FPÖ in den 1960er Jahren Kreiskys Annahme mehr als unwahrscheinlich: Sie bestand in ihrer überwältigenden Mehrheit
Die einstige FPÖ des Friedrich Peter
aus seinerzeit eingefleischten NS-Sympathisanten. Allenfalls mischten sich darunter ganz wenige Außenseiter, die einem, wenn man sie zufällig kennenlernte, durchaus sympathisch sein konnten: Männer, die unter ihresgleichen diskutieren wollten, warum ihre für hehr gehaltene Ideologie derart entgleist war. (Ich habe einen dieser Männer kennengelernt und kurzfristig sogar in der Redaktion beschäftigt.) Dazu kamen, ebenso rar, ein, zwei maßlos naive echte Liberale vom Schlage Wilfried Gredlers, die in der FPÖ tatsächlich eine Chance zum Liberalismus sahen. In Summe aber unterschied sich die FPÖ-Wählerschaft bis in die Ära Friedrich Peters deutlich von der Wählerschaft der Ära Jörg Haiders oder gar H.-C. Straches: Sie stand dem NS-Regime innerlich noch ungleich näher. Heute hingegen besteht sie in ihrer überwältigenden Mehrheit aus Protestwählern, die so wenig Beziehung zur Politik haben, dass sie kaum mehr wissen, was Nationalsozialismus bedeutet. Das Haupthindernis für die denkbare Transformation der FPÖ in eine liberale Partei bildeten zu allen Zeiten die FPÖ-Funktionäre. In der Peter-FPÖ waren sie wie Peter selbst des Öfteren SS-Männer, Gauleiter und selbstverständlich NSDAP-Mitglieder gewesen. Mittlerweile ist diese erste Generation von FP-Funktionären zwar verstorben oder lange in Pension – nur dass die zweite Generation in erstaunlich vielen Fällen aus ihren Söhnen oder Töchtern besteht, die jede Schuld von sich weisen können, aber allen Grund haben, das Handeln ihrer Väter nicht wirklich schlimm zu finden. Jörg Haider war dafür typisch: Sein Vater gehörte als Angehöriger der „Österreichischen Legion“, die aus Nazi-Deutschland heraus für den Anschluss kämpfen sollte, zu den begeisterten Nazis – der Sohn konnte jede Verbindung zur NSDAP oder gar Mitschuld an ihrer Politik mit Recht zurückweisen – obwohl er natürlich ähnlich von seinem Elternhaus geprägt war wie ich von dem meinen. Ganz allgemein gilt: Jemand, der sich um eine politische Funktion bewarb, war ein vergleichsweise politischer Mensch, der den braunen Ursprung und Hintergrund der FPÖ zwangsläufig kannte – dennoch lieber dort als in der SPÖ, der ÖVP oder bei den Grünen eine Funktion auszuüben, brauchte also die Bereitschaft, in diesem Ursprung und Hintergrund nicht das geringste Problem zu sehen. Es durfte den Betreffenden zum Beispiel nicht irritieren, einem Obmann zu dienen, der wie Friedrich Peter während des Krieges nicht der Waffen-SS, sondern einer Einheit der allgemeinen SS angehört hatte. Oder einen Obmann zu verehren, der wie Jörg Haider SS-Männer auf einem amtsbekannten Treffen „Ehemaliger“ am Ulrichsberg dafür pries, dass sie „ihrer Gesinnung treu geblieben“ sind. Bekanntlich hat Peters Vergangenheit, als er sie erfuhr, auch Bruno Kreisky nicht irritiert, sondern er hat Simon Wiesenthal, der sie bekannt machte, als Mafia beschimpft und als Gestapospitzel verleumdet. Ich leugne nicht, dass mich das an Bruno Kreisky irritierte, obwohl ich es zum Teil seiner besonderen psychischen Struktur zuschreibe, auf die ich in einem späteren Kapitel eingehe.
183
26. Klaus’ Scheitern, Kreiskys Wagnis
Als Bruno Kreisky 1970 seine Kooperation mit Peter einging, war ihm dessen SSVergangenheit allerdings noch nicht bekannt. Eine SS-Vergangenheit war noch nicht salonfähig – Peter hatte sie verschwiegen und galt öffentlich immer nur als einstiges Mitglied der Waffen-SS, zu der man auch gegen seinen Willen eingezogen werden konnte. Kreiskys rationale Motive überwogen die irrationalen also bei weitem: Er wollte Bundeskanzler werden, Österreich mit der SPÖ in eine sozialdemokratische Zukunft führen und das bürgerliche Lager spalten: Neben der christlich-sozialen ÖVP sollten Bürgerliche auch die FPÖ als angeblich liberale Alternative wählen können und die sollte der SPÖ dankbar sein und nahestehen. Der Anfang des profil war damit auch der Anfang der Ära Kreisky und beide profitierten dabei von einem Aufbruch, der eigentlich schon 1964 eingesetzt hatte: Die Bevölkerung war mit den Leistungen der Großen Koalition, die die Nachkriegsjahre dominiert hatte, nicht mehr zufrieden. Ein wenig glich die Stimmung in den letzten Jahren der schwarz-roten Koalition Julius Raabs mit Bruno Pittermann daher der Stimmung, die die rot-schwarzen Koalitionen Alfred Gusenbauers, Werner Faymanns oder Christian Kerns mit Wilhelm Molterer, Josef Pröll oder Reinhold Mitterlehner kennzeichnete: Die Bevölkerung hatte den Eindruck, dass zu viel gestritten und zu wenig geleistet würde. So wie das 2017 in mancher, freilich keineswegs in jeder Hinsicht stimmte, stimmte es auch damals in manchen Belangen: So war der rote Vizekanzler Bruno Pittermann mit dem schwarzen Bundeskanzler Alfons Gorbach, der Raab nachgefolgt war, in einem lächerlichen Streit über den Umgang mit den Nachkommen des Hauses Habsburg befangen, der als roter „Habsburger-Kannibalismus“ in die Geschichte einging, während so wichtige Fragen, wie etwa die Organisation der verstaatlichten Industrie unbeantwortet blieben. Im Februar 1964 demissionierte Gorbach und wurde von seinem bisherigen Finanzminister Josef Klaus abgelöst, der sich einen Ruf als „Reformer“ gemacht hatte, weil er den Einfluss des Staates auf die Industrie eindämmen wollte. Auch die vom ihm gebildete Regierung demissionierte freilich schon im Oktober 1965, weil es zu keiner Einigung über das Budget gekommen war. Für die folgenden Wahlen erwies sich Pittermann als Klotz am Bein der SPÖ. Immer noch in dummem Habsburger-Kannibalismus befangen, unterließ er es, eine Wahlempfehlung der KPÖ zurückzuweisen und ermöglichte der ÖVP damit die „Rote Katze“ wieder aus dem Zylinder zu zerren. Gleichzeitig bestanden er und sein Verkehrsminister Otto Probst darauf, ein Bodensee-Schiff, das die Vorarlberger „Vorarlberg“ nennen wollten, „Karl Renner“ zu taufen und verstießen damit gegen den geheiligten Föderalismus.
Klaus’ Scheitern, Kreiskys Wagnis
Beides zusammen bescherte der SPÖ eine Erdrutschniederlage, deren tiefere Ursache man dennoch nicht mit diesen beiden Fehlern gleichsetzen darf: Vielmehr war die Bevölkerung 1966 einfach nicht mehr überzeugt, dass die „große Koalition“ das Maß aller Dinge war. Ohne dass das ihre eigentliche Absicht gewesen wäre, bescherte sie der ÖVP mit 85 Mandaten (+ 4) erstmals seit 1945 die absolute Mehrheit. Klaus nutzte sie, um die erste Alleinregierung in Angriff zu nehmen. Ich erinnere mich der Irritation Hugo Portischs im Kurier: Er forderte den Kollegen Max Eissler, der in der „Frage zum Tag“ jeweils die Meinung von ein paar befragten Passanten wiedergab, energisch auf, ein zweites Mal auf die Straße zu gehen, um mehr Befragte zu finden, die einer Großen Koalition den Vorzug gäben. Denn für Portisch war die Große Koalition Symbol der Überwindung jener verhängnisvollen Spaltung in ein linkes und ein rechtes Lager, die dem Nationalsozialismus Vorschub geleistet hatte, und wie mich irritierte ihn, dass Klaus sich auf Plakaten als „Echter Österreicher“ nicht zuletzt von den Juden Pittermann und Kreisky abgehoben hatte. Doch alle Sorgen über ein autoritäres Regieren Klaus’ oder einen bräunlichen „Rechtsruck“ erwiesen sich in der Folge als ähnlich unbegründet wie bei der Regierung Wolfgang Schüssels. Gleichzeitig erwies sich Klaus sehr wohl als Reformer: Er dämmte den übergroßen politischen Einfluss auf die verstaatlichte Industrie wie versprochen durch eine neue rechtliche Konstruktion zurück und erbrachte damit eine Vorleistung zu ihrer späteren Privatisierung; und er setzte vor allem die Entpolitisierung des Rundfunks exakt so durch, wie es ein von allen Zeitungen unterstütztes Volksbegehren gefordert hatte. Denn diesen Rundfunk hatte die Große Koalition bis dahin wie einen Hund an der Kette gehalten: Der Hörfunk gehörte der ÖVP, die ihn in ihrer medienpolitischen Ahnungslosigkeit für weit einflussreicher als das Fernsehen gehalten hatte – das Fernsehen gehörte der SPÖ. So sah auch die Berichterstattung beider Anstalten aus. Der von Gerd Bacher geführte „neue ORF“ war demgegenüber eine Sensation – ein Medium, dessen Unabhängigkeit und vor allem Unparteilichkeit selbst die des Kurier in den Schatten stellte. Anfangs zur Linken heftig kritisiert, machte Bacher ausgerechnet den einstigen Propagandisten des kroatischen Ustascha-Regimes, Stjepan „Stipe“ Tomičić zum ORF-Chefredakteur, weil der bei den Salzburger Nachrichten unter dem Pseudonym Alfons Dalma als stellvertretendem Chefredakteur sein journalistisches Vorbild gewesen war. Doch Dalma erwies sich auch im ORF in erster Linie als hoch professioneller Leiter einer Nachrichtenredaktion und hütete sich, den Kritikern seiner Ustascha-Vergangenheit Anlass zum Einschreiten zu geben. Ebenso unmöglich war es, der von Franz Kreuzer geleiteten Fernsehberichterstattung zu entnehmen, dass er davor Chefredakteur des Zentralorgans der SPÖ, Arbeiter-Zeitung, gewesen war: Er war einfach ein hoch professioneller Journalist, der versuchte nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgetreuer Berichterstattung zu liefern. Und die Journale des „schwarz“ geleiteten Hörfunks boten schon damals, ebenso parteiunabhängig, die beste
185
186
Klaus’ Scheitern, Kreiskys Wagnis
politische Information des Landes. (Weil es mit Sicherheit Leser gibt, die dem ORF diese Qualitäten heute bestreiten, halte ich an dieser Stelle fest: Ich halte seine Redakteure unverändert vor allem ihrem journalistischen Gewissen verpflichtet und die notorische ORF-Beschimpfung für höchst ungerecht.) Der Mann, der am meisten vom reformierten ORF profitierte, war Bruno Kreisky. Zuerst, weil der ORF plötzlich seiner Verpflichtung nachkam, die Regierung zu kontrollieren und daher ausgiebig über Probleme und Skandale der Alleinregierung Klaus berichtete. Danach, weil die Österreicher in den Diskussionen des ORF Bruno Kreiskys großbürgerliche Eloquenz im Gegensatz zur kleinbürgerlichen relativen Sprachlosigkeit seiner bürgerlichen Gegenspieler Karl Schleinzer, Josef Taus oder Alois Mock erlebten. Noch mehr als die Bestellung Gerd Bachers zum ORF-Intendanten sollte sich allerdings die Bestellung des parteilosen Professors für öffentliches Recht Hans Klecatsky zum Justizminister zum Nachteil der Regierung Klaus auswirken. Anders als Christian Broda, unter dessen Ministerschaft Verfahren, die die SPÖ betrafen, eisern eingestellt werden sollten, gelangten unter Klecatsky Verfahren, die die ÖVP betrafen, eisern zur Anklage: Der schwarze Landeshauptmann Viktor Müllner wurde ebenso wegen Korruption angeklagt, wie eine Reihe schwarzer Beamten in einem riesigen BauskandalProzess. Beide Verfahren vermittelten der Bevölkerung ausgiebige und tiefe Einblicke in „schwarze“ Korruption – aber niemand bewunderte die Regierung Klaus dafür, dass ihr Justizminister sie aufgedeckt und der Bestrafung zugeführt hatte, obwohl darin eine gewaltige, für die Hygiene eines Staatswesens wesentliche Leistung lag. Auch eine Strafrechtsreform, die sich kaum von der unter Christian Broda ab 1971 schrittweise durchgeführten unterschied, hatte Klecatsky fertig in der Schublade, konnte sie aber nicht verwirklichen, weil die katholische Kirche und mit ihr Josef Klaus die darin vorgesehenen Aufhebungen der Strafbarkeit der Homosexualität und des Schwangerschaftsabbruches nicht akzeptierten. So blieb in der öffentlichen Wahrnehmung nur der Eindruck einer korrupten ÖVP, nicht aber eines hervorragenden Justizministers haften. Natürlich hatte auch die in Deutschland so heftige 68er-Bewegung Einfluss auf Österreich, denn zwangsläufig waren ihre Ausläufer zu uns herübergeschwappt. Ich kenne zwar eine Reihe von Österreichern – auch Journalisten, die sich selbst als „Achtundsechziger“ bezeichnen – aber mir ist ihre politische Aktivität hierzulande nicht sonderlich einprägsam in Erinnerung. Wohl gab es die „Uniferkel-Aktion“ der Gruppe um Oswald Wiener, die voran die Kronen Zeitung erregte, und auch die Hippie-Welle aus den USA war zu unser herübergeschwappt und wahrnehmbar. Aber das große, neomarxistisch gefärbte Aufbegehren, das man in Deutschland beobachten konnte, blieb in Österreich meines Erachtens höchst begrenzt. Nur in Gestalt einer kriminellen Aktion erlangte es kurzfristig Aufmerksamkeit: 1976 verschaffte sich die RAF durch die Entführung des Industriellen Walter Michael Palmers, auf die ich später noch zu sprechen komme, einen größeren Geldbetrag. Aber
Klaus’ Scheitern, Kreiskys Wagnis
anders als in Deutschland hatte die RAF in Österreich auch unter Linksintellektuellen weit und breit keine Sympathisanten. Entscheidenden gesellschaftspolitischen Einfluss übte in den späten 1960er Jahren in meinen Augen nur die Verbreitung der „Pille“ aus, die Frauen eine ungeahnte neue Freiheit bescherte. Den Todesstoß versetzte der Regierung Josef Klaus jedenfalls in keiner Weise eine Revolte der 68er, sondern ihr brillanter Finanzminister Stephan Koren: Da Europas Konjunktur 1968 eine kräftige Delle erlitt, überwand Koren den österreichischen Abschwung lehrbuchmäßig durch massives Deficit-Spending – um das ausgegebene Geld 1969 ebenso lehrbuchmäßig wieder hereinzuholen, indem er erhöhte Steuern auf Alkohol, Luxusgüter und die bis heute gültige Steuer auf den Kauf neuer Kraftfahrzeuge einführte. Das folgte in der damaligen Situation ungebrochener Nachfrage exakt den Anweisungen von John M. Keynes und bescherte Klaus’ Nachfolger Bruno Kreisky einen nahezu schuldenfreien Staatshaushalt. Doch die Österreicher, die immer besonders wenig Ahnung von Volkswirtschaft hatten, erlebten es als „schwarze Teuerungslawine“: Bei den Wahlen von 1970 erlitt die ÖVP eine Erdrutschniederlage – die SPÖ erzielte zwar keine absolute, aber eine satte relative Mehrheit, die Kreisky perfekt nutzte. Er begriff, wie viele junge Österreicher trotz ihrer Begabung vom Aufstieg ausgeschlossen waren, weil sie nicht die richtigen Eltern hatten, die in der Lage waren, sie an Mittelschulen zu schicken und ihnen Studien zu finanzieren und ging dagegen mit höchst einfachen Mitteln vor: mit der Freifahrt an Schulen und mit dem Gratisschulbuch. Auch ich, der aus zwar verarmtem, aber bürgerlichem Haus kam, begriff damals nicht, wie bedeutsam das war: Erstens, war die Beschaffung so vieler Schulbücher zu Beginn eines Schuljahres tatsächlich ein beschwerlicher finanzieller Kraftakt – vor allem aber unterschieden sich Kinder, die neue Lehrbücher hatten, eben sehr sichtbar von Kindern, die mit gebrauchten aus der Schülerlade vorliebnehmen mussten. Das Gratisschulbuch beseitigte einen Klassengegensatz. Ebenso wichtig war, dass Kreisky die Frustration so vieler gar nicht primär linker Intellektueller begriff, die in Österreich keine Karriere machen konnten, weil jede akademische Karriere Mitgliedern des CV vorbehalten war. Erstmals konnte ein NichtCV-ler Ministerialrat oder Universitätsprofessor werden. Die (nicht wirklich hohen) Kosten für Schülerfreifahrt oder Gratisschulbuch, ebenso einen Geldbetrag bei jeder Geburt, der sinnvoll an bestimmte Untersuchungen geknüpft war, brachte Hannes Androsch problemlos im Budget unter. Nach einem Jahr dieser hervorragend funktionierenden von der FPÖ geduldeten, roten Minderheitsregierung errang Kreisky bekanntlich 1971 die absolute Mehrheit und sollte das Land in den folgenden zwölf Jahren als „Sonnenkönig“ und „Medienkanzler“ ohne jede Hilfe der FPÖ allein regieren.
187
27. Der Medienkanzler
Bruno Kreiskys Naheverhältnis zu den Medien ist Legende: Journalisten fraßen ihm aus der Hand. Im Fernsehen profitierte er von einer sonoren Stimme und vor allem der ruhigen Langsamkeit, mit der er sie gebrauchte: Sein langsames Sprechen verlieh jedem Satz gleichermaßen Unverwechselbarkeit und Gewicht – die Zuhörer konnten keine Sekunde daran zweifeln, dass sie Bedeutendes zu hören bekommen würden, wenn Kreisky „Ich bin der Meinung“ sagte. Dabei verdankte er diese Sprachgewalt einem Sprachfehler, den er freilich mit eiserner Disziplin überwunden hatte: In seiner Kindheit war Kreisky ein „Polterer“ gewesen, der die Wörter überhastet hervorgesprudelt, plötzlich wie ein Stotterer neu angesetzt und Silben verschluckt hatte. Doch ein guter Logopäde hatte ihn perfekt behandelt, indem er ihm beibrachte, sich beim Sprechen jede Menge Zeit zu nehmen, die Wörter so langsam wie möglich und ständig auf ihre Artikulation achtend auszusprechen. Jede einzelne Silbe sollte ihm dabei so wichtig wie möglich sein. Meine Mutter behauptete, man habe Polterer mit einer Glaskugel im Mund sprechen lassen, um sie zu dieser Langsamkeit und Präzision zu zwingen. Ob das auch bei Bruno Kreisky der Fall war, weiß ich nicht, jedenfalls war seine Sprechtechnik im Alter Burgtheater-reif. Hinzu kam, dass er, aus einem gebildeten jüdischen Elternhaus kommend, Diskussionen gewohnt war und sich daher vor allem als ungleich schlagfertiger erwies, als seine ÖVP-Kontrahenten, die meist einem viel sprachärmeren, kleinbürgerlichen Milieu entstammten. Kreisky dankte seine sprachliche Überlegenheit in Fernsehdiskussionen nicht zuletzt seiner Jugend im „Verein sozialistischer Mittelschüler“ (VSM) und im „Verband sozialistischer Studenten“ (VSStÖ), denn so wie man in Burschenschaften mit Säbeln focht, focht man dort mit Worten. In beiden Organisationen musste er sich in dieser Disziplin gegenüber durchwegs hochbegabten jungen Juden, deren IQ nie unter 140, oft aber weit darüber lag, behaupten. Er galt diesen VSStÖ-Kollegen zwar als „nicht besonders intelligent“ (so der Physiker Alexander Weißberg) und erlangte unter ihnen auch keine führende Stellung, aber normal intelligenten Österreichern war er mit der dort gewonnen Eloquenz um Längen überlegen. Vielleicht gerade weil seine jüdischen Konkurrenten ihn geringgeschätzt hatten, legte er besonderen Wert darauf, nunmehr für seine Eloquenz geschätzt zu werden. Er wäre immer, so sagten mir mehrere seiner Mitstreiter, am liebsten nicht nur Parteivorsitzender der SPÖ, sondern auch Chefredakteur der Arbeiter-Zeitung gewesen. Dass er Franz Kreuzer dort als Chefredakteur absetzte, hing nach ihrer Meinung damit zusammen, dass er sich für den besseren Journalisten hielt.
Der Medienkanzler
Ich habe Kreisky, um diese seine geheime Liebe wissend, nach seinem Ausscheiden aus der Politik eingeladen, Kommentare für profil zu schreiben. Das freilich geriet zu einem Fiasko: Ein erster Text war so dürftig, dass ich ihn nur durch heftigstes, fast schon unzulässiges Redigieren soweit verständlich machen konnte, dass ich ihn drucklegen konnte, ohne den damals schon ziemlich kranken, ziemlich alten Mann dem Spott preiszugeben. Mit der erfundenen Behauptung, sein Text hätte bei den Lesern Zweifel an der politischen Unabhängigkeit des profil heraufbeschworen, verhinderte ich, dass ein zweiter noch viel schlechterer Text diesen Spott tatsächlich heraufbeschworen hätte. So perfekt Bruno Kreisky gesprochen hat, so schlecht hat er geschrieben. Da ich ihn zumindest oberflächlich persönlich kannte und mich in meinen Leitartikeln positiv zur Politik der SPÖ geäußert hatte, war ich nicht restlos verblüfft, als ich schon bald nach der Gründung des profil einen Anruf des Kanzlers erhielt, in dem er mir zu meinem jüngsten Kommentar gratulierte. Nicht seine Sekretärin, sondern sofort er selbst war am Apparat: „Hallo, hier spricht Bruno Kreisky. Ich störe Sie doch nicht, aber ich wollte Ihnen sagen …“ Es gibt den Journalisten nicht, der sich durch einen solchen Anruf nicht geehrt gefühlt hätte. Wirklich verblüfft war ich erst bei Kreiskys zweitem Anruf. Diesmal erzählte er mir, dass er bezüglich einer bestimmten politischen Entscheidung – ich weiß heute nicht mehr welcher – unschlüssig sei und meinen Rat suche – „weil ich weiß, wie gut Sie die Dinge einschätzen …“ Ich gab also nur zu gerne meinen Rat und war in meinen nächsten Texten zwangsläufig mit Kreiskys Entscheidung zufrieden. Lange glaubte ich mich dem Kanzler auf diese Weise durch ein intimes Vertrauensverhältnis verbunden – bis ich durch einen Kollegen erfuhr, dass Kreisky ihn in einer anderen Sache mit den exakt gleichen Worten um Rat gebeten hatte. Heute weiß ich, dass kein wesentlicher Journalist jener Jahre nicht von Bruno Kreisky angerufen und um Rat gefragt wurde. Trotzdem war das nicht blanker, zynischer Opportunismus – Kreisky liebte diese Gespräche unter „Kollegen“. Er schätzte ihren Rat tatsächlich und konnte aus ihren Äußerungen natürlich auch tatsächlich das Ausmaß an Zustimmung ablesen, das seine Entscheidungen finden würde. Es freute ihn aber auch einfach, ihnen durch seine Gratulation zu ihren Texten Freude zu bereiten. Manchmal war man von seiner Freundlichkeit geradezu betroffen: Jemand hatte Kreisky erzählt, dass meine Tochter unter einer „Skoliose“ – einer Seitwärtsverkümmerung der Wirbelsäule – litt, und so machte er mir bei einem Telefonat ganz ernsthaft das Angebot, anlässlich eines Staatsbesuchs in den USA Spezialisten der Mayo-Klinik nach den neuesten SkolioseBehandlungsmöglichkeiten zu befragen. Ich lehnte dankend ab, weil ich meine Tochter in Behandlung des Skoliose-Spezialisten der Schulthess-Klinik in Zürich, Professor
189
190
Der Medienkanzler
Schuster wusste, die der Mayo-Klinik auf diesem Gebiet als einzige ebenbürtig war – aber ich bin sicher, dass Kreisky sich tatsächlich erkundigt hätte. Wie fast alle guten Politiker mochte er die Menschen und wollte ihnen Gutes tun. Solchen, die es nicht erwarteten, sogar in besonderem Ausmaß – er genoss die verblüffte Wertschätzung, die ihm auf diese Weise entgegen strömte. Da es lange Zeit viele gute Gründe gab, auch seiner Politik Wertschätzung entgegenzubringen, war das gegenseitige Verhältnis von Journalisten zum ersten roten Bundeskanzler zwangsläufig ein außergewöhnlich gutes, selbst wenn sie nicht wie ich aus einem sozialdemokratischen Milieu kamen. Hinzu kam, dass Kreisky einer der ersten Politiker war, die vor Ronald Reagan oder Boris Johnson begriffen, dass Politik Teil des Showbusiness ist. Um erfolgreich zu sein, musste man bei den Zuhörern im Gespräch bleiben – und dazu musste man Bühnenpräsenz besitzen und authentisch sein. Kreiskys Bühnenpräsenz war überragend. Wie Jörg Haider oder Helmut Zilk sah er seinen Gesprächspartnern stets direkt in die Augen und hielt sie mit seinem Blick persönlich fest. Auch jede seiner Gesten war perfekt auf die Situation abgestimmt: Wenn er die Brille von der Nase nahm, sie langsam putzte, um Josef Taus dann zu sagen, dass er sich nicht so oberlehrerhaft gebärden sollte, dann saß das wie ein Karate-Hieb. Dass er nie in den typischen Politik-Sprech verfiel, nie eingelernte Phrasen drosch, sondern immer so antwortete wie ein normaler Mensch eben antwortet, war ein entscheidendes Geheimnis seines Erfolges. Er konnte beruhigt „Da hab ich mich eben geirrt“, sagen, ohne an Reputation zu verlieren und man gestand ihm zu, auch grantig oder unwirsch zu reagieren, ja hielt den Journalisten, der eine solche Reaktion herausgefordert hatte, für respektlos. Seine Schlagfertigkeit war gefürchtet. Ich werde nie vergessen, wie er einen Redakteur der Volksstimme zur Schnecke machte, als der ihm erklärte, dass ein sowjetischer Funktionär, anders als ein österreichischer Minister, nur das Sechsfache eines Arbeiters verdiene. „Ich weiß, ihr habt’s den bargeldlosen Verkehr erfunden: Dem steht nur gratis ein Auto samt Chauffeur zur Verfügung, er wohnt nur gratis in einer Datscha, isst und trinkt gratis und fährt sogar auf einer eigenen Straße.“ Das Publikum lachte, dem Volksstimme-Kollegen klappte der Kiefer herunter. Nicht zuletzt unter kommunistischen Staatsmännern genoss Bruno Kreisky höchstes Ansehen, weil er nie den Eindruck machte, auf ihre Lügen hereinzufallen oder um ihr Wohlwollen zu buhlen. Da sie durchwegs wussten, wie sehr sie bei fast jedem Satz logen, verachteten sie Politiker, die ihnen glaubten oder zu glauben vorgaben in Wahrheit – Bruno Kreisky achteten sie dafür, dass er ihre Lügen durchschaute und kein Hehl daraus machte. (Ähnlich wie Kreisky genossen zuvor etwa Winston Churchill oder Charles de Gaulle erstaunliches Ansehen im Sowjetimperium, „obwohl“ – in Wirklichkeit „weil“ – sie ihren Antikommunismus nie verbargen.) Nicht zuletzt wusste Kreisky, anders als die meisten seiner Kontrahenten, dass es im Showgeschäft immer auch der künstlerischen Improvisation und der Abwechslung
Der Medienkanzler
bedarf: Man muss von Zeit zu Zeit etwas Neues, Unerwartetes darbringen, wenn man im Gespräch bleiben will. So erinnere ich mich einer Presskonferenz, bei der Kreisky die Idee eines „Kabinetts der besten Köpfe“ aus dem Hut zog und damit eine wochenlange Diskussion auslöste. Einer seiner damals engsten Vertrauten, Karl Blecha, mit dem auch mich aus dem VSStÖ ein gewisses Vertrauensverhältnis verband, schwor mir glaubwürdig, dass Kreisky diese Idee zuvor noch nie geäußert und mit niemandem besprochen habe: „Ich bin eine halbe Stunde mit ihm im Auto hierhergefahren, und er hat mir kein Wort davon gesagt – ich war so baff wie Du.“ Kreisky verwirklichte die Idee der „besten Köpfe“ dann auch in keiner Weise – aber sie festigte seinen Ruf als weltoffener, unparteiischer Denker. Es gab keine Pressekonferenz Bruno Kreiskys, von der die Journalisten nicht wenigstens mit einer Äußerung in die Redaktion heimkehrten, über die sich etwas schreiben ließ: Er versorgte sie mit Stoff, und nicht zuletzt dafür wurde er von ihnen geliebt. Kritisch war nur, ihn nicht wiederzulieben, sondern ihm, auch nur in einem Einzelfall, ernsthaft zu widersprechen. Kollegen, die das taten, entzog er seine Liebe – er schnitt sie von seinem Informationsfluss ab. Peter Rabl etwa verweigerte er nach kritischen Fragen bei einem TV-Interview eine Weile jedes weitere Gespräch. Es konnte auch ernster kommen: Von der Zürcher Zeitung erreichte er als vermutlich einziger und erster Politiker, dass sie einen kritischen Österreich-Korrespondenten abzog. Und in Deutschland intervenierte er bei der SPD, um zu verhindern, dass Gerd Bacher, den er in Österreich als Fernsehintendanten abgesetzt hatte, dort zum Fernsehintendanten bestellt worden wäre. Diesbezüglich kannte er keine Gnade und sah sich damit uneingeschränkt im Recht. Die zugehörige Argumentation sah in etwa folgendermaßen aus: Seine Politik, so war er überzeugt, war absolut richtig – und über weite Strecken war sie das ja wirklich; wenn Journalisten sie lobten, bewies das, dass sie objektive Journalisten waren; kritisierten sie seine Maßnahme hingegen, so war das der zwingende Beweis, dass sie nicht objektiv sein konnten – und Journalismus, der nicht objektiv war, brauchte er sich als Kanzler nicht gefallen zu lassen. Das sollte viele Jahre später auch ich erfahren: Als ich Kreisky in der Causa-PeterWiesenthal kritisierte, forderte er von den Eigentümern des profil meine sofortige Abberufung und hatte dabei das beste Gewissen der Welt, war er doch der toleranteste Kanzler, den dieses Land jemals gehabt hatte und ist er doch als solcher in die Geschichte eingegangen.
191
28. Unter Verdacht
Im profil, so sollte ich lernen, musste ich mich allerdings vorerst weniger vor äußeren als vor inneren Gegnern schützen. Wir machten einander das Leben von Beginn schwerer als nötig durch unseren gemeinsamen Versuch, das Redaktionsleben transparenter und demokratischer als in allen bisherigen Zeitungen zu gestalten. So wollten wir beispielsweise sicherstellen, dass die unterschiedlichen Gehälter, die wir bezogen, in etwa den unterschiedlichen Leistungen entsprachen. Zu diesem Zweck wurde die Gehaltsliste öffentlich gemacht und dann sollte jeder Kollege bei drei Gehältern, die er zu hoch fand, ein Minus, bei denen, die er zu niedrig fand, ein Plus neben den Namen schreiben. Danach wurde ausgewertet und es zeigte sich, dass eine reizende junge Kollegin mit Abstand die meisten Minus auf sich vereinte, während Georg N. und ich trotz unserer deutlich höheren Gehälter nicht ein Minus aufwiesen. Man könnte sagen, dass so viel Transparenz sich als höchst sinnvoll erwies. Ich bezweifle es in Österreich dennoch, denn es zerstörte das kollegiale Klima: Die so öffentlich an den Pranger Gestellte brach in Tränen aus und kündigte wenig später ihren Vertrag. Aus einer ähnlichen Motivation – um die Redaktion demokratischer zu gestalten – hatten wir vereinbart, dass ein Chefredakteur zurücktreten müsste, wenn zwei Drittel der Redaktionsmitglieder es forderten. Ich hatte dem selbstverständlich und aus Überzeugung zugestimmt, ohne auch nur entfernt zu vermuten, dass es in absehbarer Zeit zur Anwendung kommen könnte. Eher war es zur Abwehr eines künftigen von der Redaktion nicht gewollten Chefredakteurs gedacht und ist bis heute ein Statut des profil und mittlerweile auch mancher anderer Redaktionen. Ich glaubte unsere Redaktion im besten Einvernehmen. Wir hatten uns geeinigt, die Doppelchefredaktion dahingehend wahrzunehmen, dass wir einander abwechselten: eine Ausgabe wurde inhaltlich von Georg N. gestaltet und redigiert – die nächste gestaltete und redigierte ich. Im Monatsrhythmus ergab das keinerlei Problem und beförderte einen positiven, sportlichen Wettbewerb – natürlich versuchte jeder Chefredakteur, „seine“ Ausgabe so gut wie möglich zu gestalten. Der praktische Erfolg schien diese Konstruktion von Monat zu Monat zu bestätigen. Deshalb fiel ich aus allen Wolken, als mir mitgeteilt wurde, Georg N. habe bei Bronner eine Sitzung gemäß dem Chefredakteursstatut beantragt – die Redaktion sollte über eine Reihe gegen mich vorgebrachter Vorwürfe abstimmen. Die Vorwürfe waren: Ich beabsichtige den bei der Redaktion sehr angesehenen Justizminister Christian Broda durch von mir gesammeltes Material über sein Verhalten in der NS-Zeit zu Fall zu bringen; ich wolle den Kollegen Robert Sterk kündigen, obwohl wir ihn eben erst der Redaktion der Arbeiter-Zeitung abgeworben hatten; und
Unter Verdacht
ich verhielte mich bei der Produktion meiner Ausgaben derart schusselig, dass der Produktionsleiter gedroht habe, das Handtuch zu werfen. Ich war wie vom Donner gerührt. Keiner dieser Vorwürfe traf auch nur entfernt zu. Während ich mir bei den beiden ersten, zweifellos gravierendsten, wenigstens vorstellen konnte, wie sie aus Missverständnissen zustande gekommen sein konnten, war mir der dritte restlos rätselhaft: Ich hatte durch Monate die Seiten des „blauen“ Morgen-Kurier in der Druckerei allein gestaltet, und das war in Zeiten des Bleisatzes eine wirklich herausfordernde Aufgabe, die gute Nerven braucht: Die einzelnen Artikel lagen als Bleisatz-Würste auf einem Tisch, mussten gelesen werden, obwohl sie einem verkehrt gegenüberlagen und dann durch Anweisungen an einen gehobenen Setzer, einen „Metteur“, in höchstens zehn Minuten innerhalb eines Metallrahmens so angeordnet werden, dass sich eine Zeitungsseite ergab, in der dreispaltige, zweispaltige und einspaltige Texte so verschachtelt waren, dass sich ein graphisch attraktives Gesamtbild ergab. Kein wichtiger Text durfte übrigbleiben, kein Text zu lang oder zu kurz sein. Wenn man das Zeitlimit überschritt, versäumte man den Zug, der den Kurier in die Bundesländer transportierte. Wenn einem diese Form des „Umbruches“ – so nennt man die entsprechende Tätigkeit – unter den Voraussetzungen der Morgenausgabe einer Tageszeitung zur Routine geworden ist – und das war bei mir der Fall – dann kommt einem die Produktion der Seiten einer Monatszeitschrift geradezu lächerlich einfach vor und ich glaubte mich – wie sich später herausstellen sollte völlig zu Recht – mit dem Produktionsleiter im besten Einvernehmen. Der Vorwurf in Bezug auf Christian Broda war zwar ebenso falsch, aber er konnte einem Missverständnis entspringen: Ich besaß tatsächlich aufgrund meiner Arbeit für Simon Wiesenthal das schon beschriebene Material bezüglich Brodas erstaunlicher Verschonung im Prozess gegen eine kommunistische Widerstandszelle. Simon Wiesenthal hatte das Material über ihn zwar gesammelt, aber nie veröffentlicht, weil ihm die letzte Gewissheit für die Richtigkeit eines so schweren Vorwurfes fehlte. Ich habe dieses Material aus dem gleichen Grund ebenfalls nie veröffentlicht: Es fehlte mir die letzte Gewissheit. Wobei hinzutrat, dass mir Broda mit dem Verweis auf seinen tatsächlich sehr einflussreichen Verteidiger im NS-Verfahren eine vernünftige Erklärung für die Ereignisse angeboten hatte. Aber Georg N. konnte fälschlich glauben, dass ich das Material veröffentlichen würde. Und die Redaktion konnte es vielleicht auch glauben, weil ich mich zuletzt kritisch zu Broda als Minister geäußert hatte: Mir gegenüber hatte er sich eindeutig für die Liberalisierung von Haschisch ausgesprochen – als ich das schrieb, hatte er seine Äußerung bestritten und ich hatte der Redaktion ärgerlich von diesem Verhalten berichtet. Aber genügte das, mir vorzuwerfen, dass ich Material in Besitz hatte, das sich geeignet hätte ihn zu stürzen? Konnte man einem Journalisten überhaupt vorwerfen, Material, das zweifellos nicht irrelevant war, über einen Justizminister zu besitzen? Und wie sollte ich beweisen, dass ich nicht vorhatte, es zu veröffentlichen?
193
194
Unter Verdacht
Vor Richtern eines Schöffensenats hätte die Anklage, ich hätte diese Veröffentlichung geplant, wahrscheinlich mangels Beweisen keine Chance gehabt – aber Christian Broda war (nicht zu Unrecht) das Idol junger Linksliberaler, wie sie sich in der profil-Redaktion versammelt hatten. Ich musste den Vorwurf ernst nehmen. Auch der Vorwurf Robert Sterk betreffend war ernst zu nehmen. Wir hatten ihn tatsächlich der Arbeiter-Zeitung abgeworben und waren tatsächlich in der Folge von seinen Leistungen etwas enttäuscht gewesen. Ich hatte mit Georg N., der meine Enttäuschung teilte, über seine Kündigung gesprochen, wir waren aber zu dem Schluss gelangt, ihn nicht zu kündigen, weil wir ihn eben erst aus einer gesicherten Position heraus zu uns geholt hatten und er also einen schweren beruflichen Nachteil erlitten hätte. Aber die Redaktion musste meinen Entschluss nicht kennen – und grundsätzlich war sie kollegial gesinnt und hätte Sterks Kündigung unter den gegebenen Umständen zweifellos abgelehnt. Doch wie bewies ich, dass ich sie nicht geplant hatte? Ich war, von der Stimmung her, in der seltsamen Situation, meine Unschuld beweisen zu müssen, statt dass man mir meine Schuld bewiesen hätte. Und Oscar Bronner war in der seltsamen Situation eines ermittelnden Untersuchungsrichters. Das erste Thema, dessen er sich annahm, war Robert Sterk. Und der erste Kollege, den er dazu „vernahm“, war Helmut Voska. Ob der von einer gewissen Unzufriedenheit meinerseits mit Sterks Leistung wisse? Voska bejahte, aber schon der nächste Satz rettete mich: Er wisse davon aus einem Gespräch mit Georg N., dass der die Kündigung Sterks ernsthaft ins Auge gefasst habe. Wenn eine solche Kündigung geplant gewesen sei, dann sicher mit Georg N.s Einverständnis. Damit war die Untersuchung beendet, die beantragte Redaktionssitzung fand nicht statt. Da dieser gegen mich erhobene Vorwurf offensichtlich falsch war, sah Bronner keinen Grund, die anderen unbewiesenen Vorwürfe für richtig zu halten. Dass der Produktionsleiter erklärte, er habe nicht unter meiner, sondern der Schusseligkeit von Georg N. gelitten, war nicht mehr von Bedeutung. Bronner entschied, dass die Führung des profil in Zukunft ausschließlich in meiner Hand liege und Georg N. beugte sich einer entsprechenden Änderung seines Vertrages. Nach wenigen Monaten kündigte er und wechselte zu einer anderen Zeitung. Noch etwas später erbte er ein riesiges Wohnhaus in bester Lage und zog sich gänzlich aus dem Journalismus zurück.
29. Wie werden Skandale aufgedeckt?
Die wichtigste von mir in der Anfangszeit des profil initiierte Titelgeschichte betraf Wiens allmächtigen Bürgermeister Felix Slavik. Denn eine meiner letzten Erinnerungen an den Kurier betraf undurchsichtige Grundstücktransaktionen der Gemeinde Wien, die genauer zu recherchieren mein Chef Reinald Hübl mit der Begründung abgelehnt hatte, dass er sich gerade um eine Gemeindewohnung für unsere Sekretärin Frau G. bemühe. Natürlich wohnte auch er selbst preisgünstig in einer Gemeindewohnung in bester Döblinger Lage und nicht anders wohnten damals alle Kommunalberichterstatter gleich welcher Zeitung in vergleichbaren Nobel-Gemeindewohnungen. Das ließ Wiens Kommunalberichterstattung nicht gerade gemeindekritisch ausfallen und wir wollten vorführen, dass es auch anders geht. Es wurde leider nicht wirklich die Titelgeschichte, die ich erhofft hatte: Abseits der enormen Verzögerung des Baus einer U-Bahn durch sein absurdes Projekt einer Magnetschwebebahn, die Wien auf Stelzen durchquert hätte, vermochten auch wir Felix Slavik kein dramatisches Versagen nachzuweisen. Vor allem kein mit Sicherheit unsauberes Geschäft – so sehr viele seiner Aktivitäten, wie der Text nicht wirklich fair festhielt, vom „Geruch der Korruption umweht“ waren. Eher am Rande nahm ich in den von mir gestalteten Textpassagen auf einen Vorfall Bezug, den ich selbst erlebt hatte: Auf einer Dienstreise nach Saloniki hatte Slavik ständig versucht, der zu seiner Begleitung abgestellten griechischen Hostess auf den Hintern zu greifen, was diese mit genervtem Gesicht hinzunehmen gezwungen gewesen war. Heute hätte dieser glaubwürdige Bericht, für dessen Richtigkeit es mehrere Kollegen als Zeugen gab, vermutlich gereicht, Slaviks sofortigen Rücktritt auszulösen – damals reichte er der Staatsanwaltschaft zur Beschlagnahme des profil. Denn bezüglich einer Behauptung, die das Intimleben betraf, hielt sie auch bei einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens einen Wahrheitsbeweis für unzulässig. Da sich die Beschlagnahme unter Wiens Trafikanten freilich sofort telefonisch herumsprach, verschwanden die angelieferten Hefte in der Sekunde unter der Budel und der Verkauf war der mit Abstand höchste je von uns erreichte. Selbst eine nachgedruckte Auflage, in der die inkriminierten Zeilen geschwärzt waren, verkaufte sich noch blendend. In der Folge war ich entschlossen, die Story zu finden, die den Geruch der Korruption endlich zum Verdacht der Korruption erhärten sollte. (Auch wenn das nach damaliger Pressejudikatur nicht genügte: Nur wenn die angeführten Verdachtsmomente zu einer rechtskräftigen Anklage des Betreffenden führten, blieb die Zeitung, die sie vorgetragen hatte, von einer Strafe wegen „übler Nachrede“ verschont. Der Versuch,
196
Wie werden Skandale aufgedeckt?
Korruption anhand korrekt beschriebener Indizien aufzudecken, war für eine Zeitung daher hochgradig gefährlich.) Es wäre schön, wenn ich jetzt schreiben könnte: „Durch meine akribischen Recherchen in den verschiedensten Unterlagen stieß ich auf ein höchst dubioses Geschäft im Wiener Hafen, das nur dank der Beziehung eines der Beteiligten zu Felix Slavik so düster ablaufen konnte, wie es abgelaufen ist.“ Aber die Wahrheit ist eine andere: Ich stieß durch einen Anwalt auf einen Mann, von dem er mir sagte, dass er Felix Slavik hasse – den Kaufmann Herbert Herzog. Der lieferte mir die Stories, die Slavik letztlich stürzen sollten. Meine ganze Leistung bestand darin, die Dokumente, die Herzog mir übergab, auf ihre Glaubwürdigkeit und Echtheit zu prüfen. Sie betrafen ein großes Teppichgeschäft, das Herzog an Land gezogen hatte und das ihm der Makler Josef M. mit Hilfe des Wiener Hafendirektors entriss, was vermutlich kaum möglich gewesen wäre, wenn dieser Hafendirektor nicht um die guten Beziehungen des Josef M. zu Felix Slavik gewusst hätte. Die Geschichte stank – ich konnte daran aufgrund der eingesehenen Unterlagen keinen Zweifel haben. Darüber zu schreiben war für mich dennoch ein ziemliches, der Redaktion nicht bekanntes Problem: Josef M. war der Wahlonkel meiner damaligen Frau Lisi. Zusammen mit Lisi war daher auch ich mehrmals bei Josef M. und seiner besonders netten Gattin – einer Cousine Felix Slaviks – eingeladen gewesen und ausgerechnet mit ihr verband mich sofort besondere Sympathie: Anders als die Mutter meiner Frau, hatte sie es besonders ehrenwert gefunden, dass ich bei Simon Wiesenthal gearbeitet hatte und auch was Österreichs Innen- und Gesellschaftspolitik betraf, hatte ich mich mit ihr besonders gut verstanden. Die beiden waren kinderlos und sahen in meiner Frau eine Art Ziehkind und in mir einen adäquaten Schwiegersohn. Ich wäre also sehr froh gewesen, wenn das Material, das Herzog mir anbot, das geschäftliche Verhalten des Josef M. nicht in ein reichlich problematisches Licht gerückt hätte. Aber die Unterlagen waren leider hieb- und stichfest und die Schlussfolgerung daraus war journalistisch eindeutig: Herzog war Unrecht geschehen, er war um hohe Gewinne gebracht worden, und dabei hatte das Verhalten des von Felix Slavik bestellten und nicht abberufenen Hafendirektors eine wesentliche Rolle gespielt. Unter dem Titel „Hafenbrüder“ schrieb ich darüber einen Text, der so beschaffen war, wie ich mir die Korruptionsberichterstattung des profil vorstellte: locker, ironisch, presserechtlich unangreifbar. Dass Josef M. zufällig eine dem Bürgermeister besonders liebe Cousine zur Frau hatte, habe ihn bei seinen Geschäften beflügelt und alle anderen Beteiligten zu besonderer Sorgfalt bewogen – nur deshalb, nicht vielleicht weil der Hafendirektor von diesem Draht zum Bürgermeister wusste, habe er die Teppiche nicht an Herzog herausgegeben, obwohl er eindeutig ihr Eigentümer war. Der Artikel war in Wien Gesprächsthema Nr. 1 und abermals ein großer Verkaufserfolg. Denn um zu verhindern, dass uns eine akkurat durchgeführte Beschlagnahme vielleicht doch erhebliche Verkäufe kosten könnte, hatte ich die „Dokumente“ einge-
Wie werden Skandale aufgedeckt?
führt: eine Beilage auf gelbem Papier, die ins profil eingelegt war und die der Polizist im Fall des Falles separat herausnehmen konnte, so dass das Heft selbst der Beschlagnahme entging. (Das war deshalb so wichtig, weil die Inserenten ihr Geld zurückfordern konnten, wenn die Beschlagnahme rechtlich begründet und erfolgreich war.)1 Es gab aber keinen Antrag auf Beschlagnahme und auch keine Klage wegen übler Nachrede, weil sie dank der Ironie des Textes sehr schwer festzumachen gewesen wäre. Es gab allerdings auch keine Zitierungen in anderen Zeitungen, weil die ebenso schwergefallen wären. (Abgesehen davon, dass uns andere Zeitungen damals generell so selten wie möglich zitierten, weil profil ihnen nicht geheuer war.) In der Woche darauf war ich auf Urlaub und mein Kollege Helmut Voska verfasste den Text auf der Basis meiner oder eigentlich Herzogs Unterlagen in der dafür üblichen Zeitungssprache. Obwohl der Sachverhalt keine entscheidende Veränderung erfahren hatte, gab es zwar wieder keine Beschlagnahme, aber die Androhung einer Klage sowie mehrere Zitierungen in Tageszeitungen, die für zusätzliche Werbung und Aufregung sorgten. Obwohl der Text mir journalistisch nicht gefiel – ich empfand ihn als Holzhammerangriff an Stelle der mir vorschwebenden Florettattacke – brachte er profil wahrscheinlich den Durchbruch. Die nächsten „Dokumente“ wurden von den Käufern derart sehnlich erwartet, dass sie „ihr“ Exemplar in der Trafik reservierten und vor allem unsere Abonnements sprunghaft anstiegen. Der Inhalt der folgenden „Dokumente“ ging weit über die „Hafenaffäre“ hinaus und betraf endlich Grundstücksgeschäfte: Die Grundstückgeschäfte des Maklers Josef M. Auch sie habe ich nicht detektivisch recherchiert, sondern Herzog lieferte mir die Unterlagen dafür fein säuberlich von Geschäft zu Geschäft zusammengestellt, in einer rosa Mappe, von der er sagte, dass empörte Beamte sie ihm übergeben hätten. Im Wesentlichen waren es immer Grundstücksgeschäfte, die Josef M. ohne das geringste Risiko eingehen und mit hohem Gewinn abschließen konnte, weil er immer genau wusste, welches Grundstück die Gemeinde demnächst dringend brauchen oder billig verkaufen würde. Meist kreditierte ihm die Zentralsparkasse sofort den vollen Kaufpreis. Ich weiß nicht, ob Josef M. sein Wissen tatsächlich Felix Slavik verdankte – er ging auch im Büro des zuständigen Wohnbaustadtrates aus und ein, und manches spricht dafür, dass das Leck eher dort gelegen ist – aber der Bürgermeister hätte es schließen müssen. Ich beschrieb diese Geschäfte einmal mehr ironisch, weil mir das mehr Freude machte, und diesmal entfaltete auch die Ironie ihre Wirkung: Die Leser schmunzelten und die Auflage des profil stieg von Mal zu Mal. Es war ausschließlich Herzogs Material, das Felix Slavik schließlich derart in die Enge trieb, dass er einen gravierenden Fehler machte: Statt sich auf die Untätigkeit der
1 Oscar Bronner legt Wert auf die Feststellung dass er eine vergleichbare Beilag schon für das forum eingeführt hat – mir war das, als ich die „Dokumente“ im profil einführte, unbekannt
197
198
Wie werden Skandale aufgedeckt?
Staatsanwaltschaft in den aufgezeigten dubiosen Grundstückgeschäften zu verlassen, fiel er auf gefälschte Unterlagen herein. Zwei Ganoven verkauften ihm Photokopien, die angeblich bewiesen, dass Oscar Bronner von der ÖVP Geld erhalten hätte, um ihn fertigzumachen. Günther Traxler (heute im Standard für die Kritik an unseriösem Journalismus zuständig) veröffentlichte diese Fälschungen ohne Rückfrage bei Bronner oder mir in der Arbeiter-Zeitung und für einen Tag waren wir hilflos und geschockt. Die ÖVP dementierte die Zahlung zwar, aber das nutzte nichts, denn sie war Partei. Sehr viel mehr nutzte, dass Bronners angebliche Unterschrift auf der Empfangsbestätigung für angebliche drei Millionen Schilling so exakt mit seiner Unterschrift im Firmenbuch übereinstimmte, dass es abseits der Unwahrscheinlichkeit einer solchen Bestätigung nur eine Erklärung dafür gab: Sie war von dort kopiert. Noch ein paar Tage später konnte profil das Geständnis des einen der beiden Ganoven abdrucken, die die Fälschung hergestellt hatten. Profil-Co-Chefredakteur Gerd Leitgeb, von der eingegangenen roten Neuen Zeitung zu uns gestoßen und mit entsprechend guten Beziehungen zum roten Wien ausgestattet, hatte ihn dort ausfindig gemacht, in die Redaktion mitgebracht und das Protokoll mit ihm aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft von Justizminister Christian Broda brachte es fertig, trotz dieses Protokolls und trotz erstatteter Strafanzeige keine Anklage gegen die beiden Fälscher zu erheben – profil sei, so ihre Begründung, kein Schaden erwachsen. Dass Felix Slavik bzw. der Gemeinde Wien ein solcher zumindest in der Höhe des bezahlten Honorars erwachsen war, hielt die Staatsanwaltschaft für unerheblich, weil weder Slavik, noch die Gemeinde Wien ihn geltend gemacht hätten. So war es um Österreichs Strafjustiz in der Ära des sicherlich bedeutendsten Justizreformers der Nachkriegszeit bestellt. Gott sei Dank gab es in der Strafjustiz aber auch Gerichte: Die Ratskammer des Wiener Landesgerichts stimmte einer sogenannten Subsidiaranklage zu und die beiden Männer wurden wegen Betruges zu angemessenen Strafen verurteilt. Wenig später trat Felix Slavik zurück. Nicht wegen der Berichterstattung des profil – denn dann hätte die Staatsanwaltschaft die von uns aufgezeigten Geschäfte der Gemeinde Wien vielleicht doch näher untersuchen müssen –, sondern weil er zugelassen hatte, im Sternwartepark Bäume zu fällen und die Kronen Zeitung ihn dafür gerügt hatte. Die profil-Redaktion feierte dennoch im Marchfelderhof, dass ihre Berichterstattung nicht völlig wirkungslos gewesen war. Josef M. und seine Frau emigrierten und machten in einem anderen Land mit großem Erfolg neuerlich hervorragende Grundstücksgeschäfte – „wir müssten geradezu dankbar sein“, ließen sie meine über die ganze Entwicklung zutiefst unglückliche, aber standhafte Schwiegermutter wissen. Auch ich bin für dieses Ende dankbar, denn ich hätte gerade Frau M. sehr ungern nachhaltig geschadet.
Da ist der Worm drin
Es war dies die wahrscheinlich größte Härte meines Jobs: Profil-Chefredakteur zu sein, zwang fast ununterbrochen dazu, Leuten Verletzungen zuzufügen. Und leider nicht selten auch solchen, die man gekannt und eigentlich geschätzt hat. Mit irgendeiner Rechercheleistung meinerseits hatte die Berichterstattung, die profil zum Durchbruch verhalf, nichts zu tun – sie wurde ausschließlich von Herbert Herzog erbracht. Ich behaupte, dass das für die meisten großen Aufdeckberichte der meisten Medien gilt: Sie werden einem wie die Pentagon Papers, von einem Insider geliefert, der dafür manchmal hoch anständige, manchmal höchst persönliche, gelegentlich auch durchaus üble Motive hat. Die Leistung des veröffentlichenden Journalisten besteht zum einen darin, dass er glaubwürdige, echte, von problematischen oder gar gefälschten Dokumenten unterscheiden kann – zum andern darin, dass er durch seine bisherige Arbeit das Vertrauen potentieller „Lieferanten“ errungen hat: Sie müssen sicher sein, dass er sie weder verraten wird, noch dass die Zeitung die Veröffentlichung auf Druck des Eigentümers oder gar gegen Bezahlung des Betroffenen unterlässt. Ein Journalist der – wie etwa Alfred Worm – in beiden Bereichen ohne Fehl und Tadel war, konnte im Büro warten und es landeten ausreichend Aktenstücke auf seinem Tisch.
Da ist der Worm drin Der Aufdecker der Nation, Alfred Worm, war auf erstaunlich Weise zu uns gestoßen: Monatelang war er mit seiner Aktentasche von Redaktion zu Redaktion gelaufen und hatte dort einen dicken Ordner voller Unterlagen ausgebreitet, die in seinen Augen bewiesen, dass die gemeindeeigene Baufirma „Bauring“ bei einem Projekt in SaudiArabien 550 Millionen Schilling (ca. 40 Millionen Euro) in den Sand gesetzt hatte und dass es dabei zu seltsamen Rückflüssen nach Wien gekommen war. Aber keiner der von Worm aufgesuchten Chefredakteure hatte die Zeit, sich in den Monsterakt zu vertiefen – ich hingegen konnte sie mir dank unseres Monatsrhythmus nehmen und das Aktenkonvolut studieren. Der Inhalt war überzeugend – die Sache stank gewaltig. Ich bat Worm, seine Argumente möglichst präzise niederzuschreiben – ich habe Journalismus nie für eine Geheimwissenschaft gehalten, die nur wenige beherrschen – und eine Woche später war ich im Besitz einer inhaltlich fulminanten Titelgeschichte. Ich musste aus ihr zwar eine Unzahl empörter Aufschreie wie „unerhört!“, „verbrecherisch!“, „verlogen!“, jeweils mit Rufzeichen, eliminieren, aber was blieb, war ein sehr präziser Text, der ein aus vielen Gründen unter hohen Kosten völlig gescheitertes Bauprojekt beschrieb, das einem Muster entsprach, dem ich bei der Gemeinde Wien immer wieder begegnet war: Sie gründete Firmen, die die Gewinne privater Unternehmen entweder als weit überhöht entlarven oder kopieren sollten – und dabei pleitegingen.
199
200
Wie werden Skandale aufgedeckt?
Eine Installationsfirma, einen Heurigen und sogar eine Apotheke hatte die Gemeinde solcherart bereits in die Pleite geführt – eine Baufirma fehlte noch in dieser Sammlung. Während bei allen anderen Firmen immer nur das Gerücht bestand, sie habe auch der Parteifinanzierung gedient, gab es beim „Bauring“ ein konkretes Indiz: Die Auftraggeber hatten, so schrieb Worm, einen Millionenbetrag auf ein Konto des Wiener Bankhauses Winter überwiesen und von profil nach der Begründung gefragt, hatten die österreichischen wie die arabischen Beteiligten Auskünfte gegeben, die einander diametral widersprachen. Wir waren überzeugt, dass die Staatsanwaltschaft aufgrund unseres Berichtes das Konto bei der Bank Winter öffnen und seinen Eigentümer ausfindig machen würde – doch die Staatsanwaltschaft Wien sah dazu keinen Anlass. Sie sah nie einen Anlass aufgrund noch so präziser Recherchen des profil in Affären tätig zu werden, in die die SPÖ auf irgendeine Weise verwickelt sein konnte – nicht bei den erstaunlichen Grundstücksgeschäften des Josef M., nicht bei der teuren Pleite des gemeindeeigenen Installationsunternehmens, nicht bei der unerklärlichen Überweisung im Zuge der Bauring-Pleite. Das war natürlich auf keinen Fall die vorauseilende Unterwerfung unter die theoretisch mögliche Weisung von SP-Justizminister Christian Broda oder gar bewusste Absicht, sondern entsprach zweifellos der zulässigen Überlegung, dass nur dort angeklagt werden soll, wo die Staatsanwaltschaft einer Verurteilung so gut wie sicher sein kann – und das war sie eben auf der Basis von profil-Berichten nie. Im Falle des Baurings signalisierte allerdings letztlich die SPÖ selbst, dass sie ein gewisses Maß an Aufklärung für nützlich hielt: Im Juni 1974 beschuldigte auch ein kritischer Prüfungsbericht des Kontrollamtes der Stadt Wien zwei Ex-Direktoren des Baurings, durch fahrlässiges Verhalten bei Geschäften im arabischen Raum 550 Millionen Schilling Verlust eingefahren zu haben. Bürgermeister Leopold Gratz versprach, den Bericht an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten. Dass teilweise Rückflüsse in Arabien geleisteter Provisionen der heimischen Parteienfinanzierung gedient haben könnten, schloss er kategorisch aus. Die nun doch tätig werdende Staatsanwaltschaft ermittelte zwar nicht beim Bankhaus Winter, formulierte aber eine Anklage gegen das Bauringmanagement. Der folgende Prozess war geprägt von gegenseitigen Schuldzuweisungen, unter anderem auch an die Politik. Der als Zeuge geladene Ex-Bürgermeister Slavik und dessen 1973 ins Amt berufener Nachfolger Gratz wiesen die Verantwortung ebenso von sich wie der Aufsichtsratsvorsitzende Stadtrat Reinhold Suttner. Da auch die angeklagten Manager freigesprochen und nur erschütternder Ahnungs- und Sorglosigkeit geziehen wurden, stellte sich im Nachhinein heraus, wie recht die Staatsanwaltschaft doch gehabt hatte, den profil-Bericht zu ignorieren. Durch ein Jahrzehnt durchgehalten, stellte die so rücksichtsvolle wie vorsichtige Tätigkeit der Staatsanwaltschaft Wien in meinen Augen allerdings ein gewisses gesellschaftliches Problem dar: Sie musste bei der Bevölkerung den Eindruck erwecken, dass
Da ist der Worm drin
Korruption, wenn sie sich in der Nähe der Regierung ereignet haben könnte, kaum je zu gerichtlicher Verfolgung führt. Das müsse den Ruf nach einem „Saubermann“ befördern, „der mit eisernem Besen aufräumt“, schrieb ich damals – und exakt so ist es gekommen: Jörg Haider hat sich wie weiland Adolf Hitler als dieser Saubermann präsentiert und der FPÖ entsprechenden Zustrom verschafft. (Wobei mir aus der Erfahrung meiner Mutter klar war, dass die FPÖ die Korruption zur Blüte führen würde, sobald sie selbst an die Macht kam.) Auch wenn das kaum seine Absicht war, hat Brodas leitender Wiener Staatsanwalt Otto F. Müller – Spitzname „Blut-und-Boden-Müller“ – entscheidend zum Aufstieg Jörg Haiders und seiner FPÖ beigetragen. Nebenher auch zum Aufstieg des profil: Das Magazin konnte durch Jahre journalistisch von der Berichterstattung über Skandale leben, die die Justiz ignorierte.
201
30. Das Phänomen Jörg Haider
Der „Saubermann“, dessen Aufstieg die so häufige Einstellung von Strafverfahren, die die SPÖ betrafen, beförderte, hieß Jörg Haider und so wenig wie von der mangelnden Ahndung von Skandalen durch die Justiz ist er vom Aufstieg Bruno Kreiskys zu trennen, weil Haider ohne Kreisky vermutlich keine FPÖ mehr vorgefunden hätte; und weil Kreisky den Cordon sanitaire niedergerissen hatte, der Politiker mit „brauner Vergangenheit“ oder „braunen Äußerungen“ in der Nachkriegszeit von Spitzenpositionen ausgeschlossen hatte. Zudem besaß Jörg Haider eine Reihe für einen Politiker nützlicher Qualitäten: Er sah gut und immer etwas jünger aus, als er wirklich war – wie Sebastian Kurz hätten ihn Mütter gern zum Schwiegersohn gehabt. Er war intelligent und schlagfertig und konnte als Assistent des Professors für Rechts- und Staatswissenschaften Günther Winkler sogar so etwas wie eine akademische Karriere vorweisen. Und er war, wenn er einen Raum betrat, sofort präsent: Wie Bruno Kreisky, Hannes Androsch, Helmut Zilk oder Sebastian Kurz zählte er zu den Politikern, die ihrem Gegenüber, egal ob einfacher Arbeiter bei einer Betriebsbesichtigung oder politischer Funktionär bei der Begrüßung in einer Sektion während des Gespräches in die Augen sehen, so dass der Betreffende sich ernst genommen und im Falle des einfachen Bürgers geehrt fühlt. Dazu besaß er ein ungeheuer feines Sensorium für die Stimmung seiner jeweiligen Umgebung: Er konnte – exakt wie Helmut Zilk – mit SP-nahen Arbeitern völlig anders als mit VP-nahen Beamten, mit Bauern völlig anders als mit Waldbesitzern, mit Wienern völlig anders als mit Tirolern sprechen. Es war kein Zufall, dass ihn die Kärntner sofort als einen der ihren empfanden, obwohl er aus dem oberösterreichischen Bad Goisern stammte und danach die längste Zeit in Wien gelebt hatte. Natürlich wusste er auch ganz genau, wie er mit mir, einem ihm kritisch gesinnten Journalisten sprechen musste, dessen Mutter im KZ gewesen war. Obwohl keine Zeitschrift mehr als profil über ihn schrieb, habe ich ihn nur zweimal persönlich getroffen. Das erste Mal, weil ich, um seine Wahlkampfmethoden mitzuerleben, mit ihm abgesprochen hatte, in der Shopping-City-Süd mit ihm über Zuwanderung zu diskutieren, um die Reaktion der zufälligen Zuhörer zu beobachten. Unser Gespräch während der gemeinsamen Anfahrt war ein angenehmes, bei dem er die Notwendigkeit kritischer Medien betonte und Verständnis dafür zeigte, dass profil ihn nicht gerade mit einem roten Teppich willkommen hieß – er bitte nur, ihn nicht „vorzuverdammen“, ohne seine Ansichten näher zu kennen. Davon konnte in meinem Fall keine Rede sein. Ich wusste, dass er dem sogenannten „Atterseekreis“ der FPÖ angehörte, von dem mir Wilfried Gredler, einer der raren ernsthaft bemühten Liberalen in der FPÖ, erzählt hatte, dass man sich dort um eine
Das Phänomen Jörg Haider
liberale Öffnung der Partei bemühe. Ich kannte zwar auch gegenteilige Ansichten zu dieser Runde, aber da ich nie an einer ihrer Zusammenkünfte teilgenommen hatte, war ich geneigt, im Zweifel die positive Einschätzung Gredlers zu akzeptieren. Natürlich war mir auch die Familie bekannt, aus der Jörg Haider stammte. Sein Vater Robert Haider hatte der „Österreichischen Legion“ angehört, die Österreich aus Deutschland kommend im Kampf erobern sollte – um dorthin aufgenommen zu werden, musste man sehr früh ein sehr enthusiastischer Nazi sein. Tatsächlich hatte Robert Haider, seit seinem 15. Lebensjahr Hitlerjunge, eine Kampfausbildung in der SA erhalten und war 1934 nach München geflohen, nachdem eine SA-Hundertschaft Engelbert Dollfuss zwar ermordet, nicht aber die Macht errungen hatte. Umso triumphaler war seine Heimkehr im Zuge des Anschlusses ausgefallen, und die Partei belohnte seinen Einsatz mit dem Posten eines „Gaujugendwalters“. An der Front erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, war aber persönlich nicht an Kriegsverbrechen beteiligt und wurde deshalb nach dem Krieg als „minderbelastet“ eingestuft. Sein jugendliches Alter in der NS-Zeit ließ ihn mir am ehesten als verführten Idealisten erscheinen und als solcher ist er wohl auch seinem Sohn erschienen. Wie wichtig das für die Vater-Sohn-Beziehung ist, wusste ich von meinem Kollegen und späteren Co-Chefredakteur Gerd Leitgeb: Sein Vater war in der NS-Zeit Militärarzt gewesen und das offenbar in so problematischem Zusammenhang, dass er nach dem Krieg längere Zeit interniert wurde und nicht ordinieren durfte. Gerd Leitgeb sah darin ausschließlich gewaltige Ungerechtigkeit: Sein Vater sei ein engagierter Arzt, ein Idealist und wunderbarer Vater gewesen – man könne ihn doch nicht dafür verdammen, dass er an Hitler geglaubt hätte. Als profil-Chefredakteur schrieb Leitgeb durchwegs anständige Texte, unter denen mir einer besonders in Erinnerung ist: Er setzte sich darin extrem für einen BundesheerUnteroffizier ein, der nach dem Tod eines ihm anvertrauten Rekruten unter medialen Beschuss geraten war. Man könne diesen Mann, argumentierte Leitgeb, doch nicht dafür verdammen, dass er die Ausbildung aus Überzeugung so gestaltete, dass sie in einem Krieg auch von Nutzen gewesen wäre. Jahre später vom profil-Co-Chefredakteur zum alleinigen Chefredakteur des Kurier befördert, vermochte er zwar dessen Auflage zu pushen, wurde von den Eigentümern aber zu Recht gekündigt, nachdem er „Parteien“ in seinen Texten mehrfach abgewertet hatte. Danach unter dem ehemaligen Krone-Hälfte-Eigentümer Kurt Falk, dessen Vater ebenfalls ein begeisterter Nationalsozialist gewesen war, Blattmacher der Boulevardzeitung täglich Alles, schrieb Leitgeb Texte, die nur mehr FPÖ-Wähler begeistern konnten: fremdenfeindlich, parteienfeindlich, ohne Verständnis für das demokratische System. Die Sozialisation durch den Vater schlug endgültig durch. Von mir sozialisiert hatte er sich offenkundig so verhalten, wie das ebenfalls zu seinen Möglichkeiten zählte, – er war keine festgefügte Person. Es war ihm wichtig, von mir wertgeschätzt zu werden, und dazu hatte ich Grund: Er war ein hervorragend recherchierender „Reporter“, schrieb fast so schnell wie ich und verstand viel von
203
204
Das Phänomen Jörg Haider
unserer Branche: Er war es, der mich überredete, profil, wie alle „Magazine“ vom Spiegel bis Time, mit einem roten Rand zu versehen, „weil es doch einen Grund haben muss, dass alle es tun“, und dessen Rat ich am ehesten vertraute, wenn es darum ging, zwischen zwei möglichen Titelgeschichten zu entscheiden. Dass er seine Fähigkeiten zuvor für die schlechte, in ihrer Berichterstattung total von der SPÖ abhängige Neue Zeitung ebenso eingesetzt hatte, wie er sie danach für das unabhängige profil, den bürgerlichen Kurier und zuletzt das faschistoide täglich Alles einsetzte, erklärte er mir damit, dass er eben ein „Söldner“ sei – was ich insofern nicht recht glauben wollte, als er seine Texte nicht nur mit enormem Einsatz recherchierte, sondern ihren Inhalt auch energisch vertrat. Leitgeb degradierte sich zum „Söldner“, weil er damit aller Welt – und insbesondere mir – demonstrativ vorführen wollte, dass „Idealisten“ wie sein Vater ja leider nicht gefragt sind. Persönlich war er absolut integer: Als ich ihm einmal vorschlug, doch Obmann des österreichischen Boxsport-Verbandes zu werden, der sich zu diesem Zeitpunkt in einem desolaten Zustand befand und dringend jemanden suchte, der für diese Funktion in Frage kam – Leitgeb war Wiener Jugendmeister im Schwergewicht gewesen – lehnte er es mit der Begründung ab, dass er in dieser Funktion nur erfolgreich sein könnte, wenn er Kämpfe gemäß ihren finanziellen Begleitbedingungen ausrichtete – und das käme für ihn nicht in Frage und könnte auch profil zum Schaden gereichen. Was mir sonst noch an ihm auffiel, war sein abweisendes Verhältnis zu Frauen – er erfand für einige unserer weiblichen Mitarbeiterinnen, die sich nicht gerade durch rasend kollegiales Verhalten auszeichneten, die Bezeichnung „Hexen“ und hatte weder Frau noch Freundin, aber meines Wissens auch keinen Freund – ich glaube, dass er praktizierte Homosexualität strikt abgelehnt hätte. Bei gelegentlichen nächtlichen Spaziergängen – er arbeitete wie ich bis spät in die Nacht – gestand er mir, dass er meist bis vier Uhr früh nicht einschlafen könne und ständig schwerste Schlafmittel nehmen müsse. Mit 62 kam er bei einem Bergunfall um, bei dem unter Leuten, die ihn kannten, der (dem Hergang nach eher falsche) Verdacht aufkam, es könnte sich um einen Selbstmord gehandelt haben. Die Ähnlichkeit zur Lebensgeschichte Jörg Haiders springt mich dennoch geradezu an, während ich diese Zeilen schreibe. Beide, so glaube ich, waren unter ihrer gehärteten Oberfläche zutiefst verunsicherte, weiche Menschen – und dieses Verunsichertsein hing nicht zuletzt damit zusammen, dass sie ihre Väter lange entbehren mussten und für ungerecht hielten, was ihnen in ihrem „Idealismus“ widerfahren war. Ich glaube, dass es sehr schwer ist, der Sohn eines Vaters zu sein, den man liebt und von dem man doch weiß oder bei ehrlichem Nachdenken wissen müsste, dass er mit großer Intensität einem verbrecherischen Regime gedient hat und habe es immer als ein glückliches Schicksal betrachtet, zufällig als Sohn von Widerstandskämpfern geboren worden zu sein. Meine Mutter hat mich immer in dieser Haltung bestärkt: Auch sie hat für das Problem von Söhnen, die ihre idealistischen Nazi-Väter lieben, immer Verständnis gehabt.
Das Phänomen Jörg Haider
Jemanden wie den ehemaligen Verteidigungsminister der FPÖ Friedhelm Frischenschlager, der sich trotz eines nationalsozialistischen Vaters letztlich zu einem engagierten Kritiker braunen Gedankengutes entwickelte, hat sie dafür bewundert: Es ist eine große psychische Leistung, seinen Vater gern zu haben und sein Gedankengut dennoch abzulehnen. Ich bin daher auch Jörg Hader, als wir gemeinsam in die Shopping-City fuhren, nicht mit Vorurteilen entgegengekommen – ich habe für möglich gehalten, dass er diese Leistung zu vollbringen vermag. Unsere öffentliche Diskussion zur Zuwanderung vor einem Publikum, das sich höchst zufällig ergab, sollte für mich mit einer charakteristischen Niederlage enden: Ich war zwar recht gut vorbereitet, wusste alle wirtschaftlichen und natürlich auch humanen Argumente, Menschen aufzunehmen, die aus ärmsten Ländern zu uns kamen, um sich hier als Gastarbeiter zu verdingen – aber ich war hilflos gegenüber der Fähigkeit Jörg Haiders, eine erfolgreiche Trennlinie zwischen „guten“ Gastarbeitern, die natürlich auch er schätze und solchen Gastarbeitern zu ziehen, die Hammeln in Höfen brieten, „unser“ Sozialsystem ausnutzten, die Löhne „unserer“ Arbeitskräfte drückten und vor ihnen zu Gemeindewohnungen kämen. Denn er wusste zu jeder dieser Behauptungen ein einprägsames Beispiel zu erzählen, von dem sich unmöglich klären ließ, ob es der Wahrheit entsprach oder frei erfunden war – jedenfalls konnte ich es inmitten der Shopping-City nicht entkräften. Gleichzeitig zog er mitdiskutierende oder fragende Zuhörer durch die Art und Weise, in der er auf sie einging, sofort derart in seinen Bann, dass sie zu seinen vehementen Mitstreitern wurden. Der Rattenfänger von Hameln war nichts gegen ihn. Bei einem Gespräch, das der Falter anlässlich des 50-jährigen Bestehens des profil arrangierte, wurden Bronner und ich gefragt, ob wir durch unsere intensive Berichterstattung über Jörg Haider nicht wesentlich zu seinem Aufstieg beigetragen hätten. Beide mussten wir zugeben, dass da „etwas dran“ ist – aber es sei eben unmöglich, ein offenkundiges Phänomen zu negieren und man müsse sich zwangsläufig mit dem auseinandersetzen, was jemand in der Öffentlichkeit Stehender öffentlich sagt. Man konnte nicht unberichtet lassen, dass er an einem Treffen ehemaliger SS-Leute, „Ehemaliger“ und Neonazis am Ulrichsberg teilgenommen hat und dass er dort seine Bewunderung für solche SS-Leute ausgedrückt hat, „die ihrer Gesinnung treu geblieben sind“. Allerdings hätte ich Haider nicht so oft aufs Titelblatt rücken müssen, wenn wir über ihn schrieben, denn viel mehr Menschen als diejenigen, die unsere kritischen Geschichten lasen, sahen nur sein Gesicht wie auf einem Wahlplakat aus den in Trafiken aufliegenden profil-Exemplaren leuchten. Wir aber wussten, dass ein Haider-Cover eine zehn Prozent erhöhte Auflage brachte – in der dann freilich wieder zehn Prozent mehr Menschen unseren kritischen Text mitbekamen. Vielleicht noch dramatischer ist dieses mediale Dilemma, wenn man die Berichterstattung zu Terrorattentaten voran im Fernsehen betrachtet: Sie erzeugt genau das Aufsehen, das die Terroristen zu erreichen suchen. In manchen Fällen bewirkt sie ver-
205
206
Das Phänomen Jörg Haider
mutlich unmittelbar das nächste Attentat: Das Messerattentat auf der London Bridge war mit großer Wahrscheinlichkeit Ansporn zum unmittelbar folgenden Messerattentat in Den Haag. Man fügte dem IS den größten Schaden zu, wenn alle Zeitungen und Fernsehstationen sich darauf einigten, darüber jeweils nur mit wenigen Sätzen, ohne Bilder und Gespräche mit erschütterten Zeugen oder Hinterbliebenen zu berichten. Bronner meinte, dass das im Zeitalter von „Social Media“ erstens ausgeschlossen und zweitens unter Konkurrenten unmöglich zu vereinbaren sei. Ich kann darauf nichts Ernsthaftes erwidern. Nur dass ich hoffe, dass sich mit der Zeit im Rahmen der Social Media wenigstens die Medien durchsetzen, die derzeit als seriöse Fernsehsender, seriöse Tages- oder Wochenzeitungen bekannt sind, so dass wenigstens seriöse Journalisten, nicht Algorithmen darüber entscheiden, mit welchen Informationen die Bevölkerung vorrangig konfrontiert wird. Vorerst machen mir die sozialen Medien vor allem Angst. Egal, ob sie wie in China der Überwachung der Bevölkerung dienen oder wie in den USA oder in Großbritannien ihr Wahlverhalten beeinflussten, ohne dass die Bevölkerung es überhaupt merkt. Nicht zuletzt die 800.000 „Follower“ Heinz-Christian Straches machen mir Angst. Und ich wage gar nicht, mir auszumalen, wie viele Follower Jörg Haider hätte, wenn er heute noch lebte. Allerdings war auch die Auseinandersetzung, die seriöse Journalisten in seriösen Medien mit ihm suchten, nicht ganz leicht. Obwohl ich erst viele Jahre später als Chefredakteur der Wochenpresse intensiv damit zu tun hatte, möchte ich auf zwei seiner wesentlichen Aussagen eingehen: Die erste machte er im Zuge der Aufnahme von Wirtschaftsflüchtlingen und sie bestand in der Forderung nach „Kontingentierung“, bei der man nicht zuletzt berücksichtigen sollte, welche Zuwanderer Österreich wirtschaftlich brauche. Als Haider sie erhob, wurde sie in fast allen Medien als inhuman bis faschistoid zurückgewiesen, während man aus heutiger Sicht wohl sagen müsste, dass sie höchst vernünftig war. Das war ein grundsätzliches Problem im Umgang fast aller Medien mit Haider: Unter den vielen falschen von ihm erhobenen Forderungen und inmitten der vielen falschen von ihm geübten Kritik, gab es immer auch richtige Forderungen und zu Recht geübte Kritik: Immer alles und jedes, was er vorbrachte, abzulehnen, war sicher ein grundlegender Fehler, der ihm wie der FPÖ nutzte. In dem Ausmaß, in dem die Bevölkerung erlebte, dass „nicht kontingentierte“ Zuwanderung natürlich zu Problemen führte, war sie geneigt, auch richtige Einwände gegen die FPÖ für falsch zu halten. Besonders diffizil gestaltete sich eine Auseinandersetzung über eine HaiderÄußerung, die weit größere Prominenz erlangte: Im Verlauf einer Sitzung des Kärntner Landtages, die sich mit Beschäftigungspolitik befasste und in der Landeshauptmann Haider in seiner Rede immer wieder durch Zwischenrufe der SPÖ unterbrochen wurde, rastete er mit folgenden Worten aus: „Na, das hat’s im Dritten Reich nicht gegeben,
Das Phänomen Jörg Haider
weil im Dritten Reich haben sie ordentliche Beschäftigungspolitik gemacht, was nicht einmal Ihre Regierung in Wien zusammenbringt. Das muss man auch einmal sagen!“ Natürlich war diese Bemerkung gleich mehrfach – beginnend mit ihrer Einleitung – unerträglich und es war auch unerträglich, Hitlers „ordentliche Beschäftigungspolitik“ isoliert in den Raum zu stellen, ohne die 60 Millionen Toten, die auch mit ihr verbunden waren, zu erwähnen. Insofern führte Haiders Entgleisung zu Recht zu seiner Abwahl, beziehungsweise seinem Rücktritt. Dennoch war richtig, dass im Dritten Reich „ordentliche Beschäftigungspolitik“ betrieben wurde – so sehr das von renommierten Kollegen wütend bestritten wurde. Ich wusste aus den Erzählungen meiner Mutter, mit welcher Bestürzung sie beobachtet hatte, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland schon unmittelbar nach Hitlers Machtergreifung drastisch zurückgegangen war und wie sehr dieser Rückgang arbeitslosen Österreichern imponiert hatte. Der Rückgang hatte lange vor der folgenden Hochrüstung eingesetzt, denn Hitler verwirklichte ein Programm, das deutsche Ökonomen – unter ihnen ein Jude – schon seit längerem vergeblich zur Umsetzung vorgeschlagen hatten, und das im Sinne von Keynes voran öffentliche Aufträge zur Arbeitsbeschaffung vorsah. Ich habe den gewiss nicht rechten Ökonomen Felix Butschek gebeten, diese These zu prüfen und er belegte sie in der Wochenpresse mit Zahlen. Im Übrigen wäre selbst die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Rüstung erfolgreiche „Beschäftigungspolitik“ gewesen: Die USA überwanden die Weltwirtschaftskrise, indem ihnen die Hochrüstung gegen Hitler in den Jahren 1940 bis 1944 Wirtschaftswachstumsraten zwischen 17 und 20 Prozent bescherten. Ich habe es aus zwei Gründen für verfehlt gehalten, Haiders Äußerung auch inhaltlich zurückzuweisen: Einmal, weil es wesentlich für das Verständnis von Hitlers Erfolg bei der Bevölkerung ist, dass es ihm gelang, die dramatische Arbeitslosigkeit der 1930er Jahre anfangs durch ganz normale volkswirtschaftliche Projekte, etwa Wohnungsbauten und den Bau kleinerer Straßen, später durch den Bau von Autobahnen, die zwar auch militärischen Zwecken, aber sehr wohl auch dem normalen Verkehr dienten, und danach durch fast nur mehr Rüstungsprojekte zu bekämpfen. Und es ist gerade jetzt wichtig zu wissen, dass Arbeitslosigkeit und Angst um Arbeitsplätze zu allen Zeiten einen idealen Nährboden für faschistische Systeme darstellen: Ohne die Arbeitslosigkeit der 1930er Jahre hätte es Hitler vermutlich nicht gegeben. Und es ist ebenso wichtig zu wissen, dass keynesianisches Deficit-Spending als Gegenmittel jedenfalls ungleich besser funktioniert als die von Reichskanzler Heinrich Brüning exekutierte Austeritätspolitik, die das Elend auf die Spitze trieb. Nicht zuletzt halte ich es für gefährlich, den Eindruck zu erwecken, dass ein düsteres Regime unmöglich erfolgreiche Wirtschaftspolitik betreiben könne: Beim düsteren Regime Josef Stalins fielen mörderische Innenpolitik und katastrophale Wirtschaftspolitik zwar zusammen – aber August Pinochets düsteres Regime beendete unleugbar Chiles
207
208
Das Phänomen Jörg Haider
Wirtschaftskrise. Und das autoritäre China betrieb die längste Zeit eine wesentlich bessere Wirtschaftspolitik als das demokratische Indien. Hitlers Regime war auch dann das verbrecherischste der Geschichte, wenn er eine jedenfalls in ihrem volkswirtschaftlichen Ansatz „ordentliche Beschäftigungspolitik“ betrieb. Haiders Entgleisungen waren natürlich nicht zufällig, sondern entsprachen durchaus seiner Sozialisation – man konnte von ihm durchaus auch als von einem „Keller-Nazi“ sprechen, auch wenn das die österreichischen Gerichte vermutlich zu seiner Hochzeit nicht zugelassen hätten. Und für ganz so einfach halte ich es nicht einmal heute. Im Jahr 1988 baten mich jüdische Freunde Bruno Kreiskys, mit Haider ein Interview zu führen, in dem er beweisen würde, dass er gelernt habe und von braunen Thesen abgerückt sei. Das Interview fand in einer privaten Wohnung im 1. Bezirk statt und meine perfekte Sekretärin Aniko Dalosch schrieb es mit. Es verlief folgendermaßen: Ich begann mit der Frage, ob er mit mir übereinstimme, dass Auschwitz das bisher größte Verbrechen der Weltgeschichte sei. Er reagierte primär wie alle Neonazis, indem er auf „Dresden“ hinwies. Aber er war bereit, diesen Vergleich als unzulässig anzusehen, nachdem ich eingewendet hatte, dass man einen Mann, der einen Raubmörder unschädlich macht, indem er ihn k. o. schlägt und ihm dabei das Nasenbein bricht, schwer mit diesem Raubmörder gleichsetzen kann, auch wenn er vielleicht Notwehrüberschreitung verantwortet; weil Notwehrüberschreitung unmöglich „Massenmord“ vergleichbar ist. Unsere jeweils minutenlangen Diskussionen endeten damit, dass Haider den Holocaust „das größte Verbrechen der Geschichte“ nannte und dem Interview damit zu seinem Titel verhalf. Ähnlich lange Diskussionen führten dazu, dass er Deserteure, die sich Partisanen anschlossen, nicht mehr „Verräter“ und den Kampf der Partisanen für ihre Heimat „verständlich“ nannte. In der Folge habe ich leider den Fehler gemacht, mit diesem Interview etwas zu wollen: Ich habe die ausgiebigen Diskussionen, die zu diesen Einsichten führten, nicht abgedruckt. Einerseits, weil das Interview dann das gesamte Heft gefüllt hätte – vor allem aber, weil ich Haider in diesen Diskussionen besser kennengelernt zu haben glaubte und sein neues Image nicht schmälern wollte. Ich verwarf Aniko Daloschs Warnung, dass „der Dir doch nur was erzählt“. Sehr viel später erfuhr ich durch einen verrückten Zufall, wie Haider reagiert hat, als ihn der Neonazi Norbert Burger, in dessen Haus er, wie seinerzeit H.-C. Strache verkehrte, wegen dieses „Schand-Interviews“ wütend zur Rede stellte. „Der Lingens ist total naiv, der is ma einegfoin, und politisch hat uns das unglaublich genützt“, hörte ihn jemand sagen, der dort damals ebenfalls verkehrte. Ich glaube dennoch bis heute, dass Haider mich in diesem Interview nicht einfach anlog. Er war in meinen Augen (und etwa auch in den Augen Stefan Petzners, der ihn sehr viel besser kannte) eine höchst komplexe, widersprüchliche Persönlichkeit: Ich
Das Phänomen Jörg Haider
glaube, dass er seine Antworten in dem Moment, in dem er sie mir gab, mit einem Teil seiner Persönlichkeit ernst gemeint hat. Er wollte auch von mir, dem Sohn von Widerstandskämpfern, geschätzt werden. Nur dass er sich in Burgers Umgebung von Burger geschätzt wissen wollte und dass er sich ungleich mehr in dessen als in meiner Umgebung aufhielt. Die Sozialisierung durch Burger als Peer und die Sozialisierung, die er durch sein Elternhaus erfahren hat, haben ihn nun einmal ungleich stärker geprägt als Zeitungsberichte, die wahrscheinlich auch er über die NS-Zeit und den Holocaust gelesen hat oder die paar Stunden im Gespräch mit mir. Für einen Kommentar im Falter habe ich versucht, meine Erfahrungen mit der Haider-FPÖ so kurz wie möglich zu resümieren: − Er hat Blößen, die sich ÖVP und SPÖ wie jede regierende Partei gelegentlich gaben, wie Hitler maximal genutzt, um „Parteipolitik“ generell zu diffamieren; − und er hat die richtige Einsicht, dass Zuwanderung reguliert gehört, ausschließlich dazu genutzt, einen maximalen Gegensatz zwischen „uns“ (guten, tüchtigen) Österreichern und (kriminellen, kostspieligen, das Sozialsystem ausnutzenden) „Ausländern“ zu konstruieren und dabei auf ein bewährtes Rezept Hitlers zurückgegriffen: „500.000 Arbeitslose – 400.000 Juden“, plakatierte Hitler – „140.000Arbeitslose – 180.000 Gastarbeiter“ plakatierte Haider. Aber er war innerlich ungleich widersprüchlicher als Heinz-Christian Strache – ein neurotischer, bis zuletzt Gespaltener, der sich deshalb und nicht, weil er auf eine vermeintliche Oligarchin hereinfiel, politisch umbrachte. Dass er sich auch physisch umbrachte, indem er alkoholisiert zu schnell in einer Kurve fuhr, passte zu seiner komplexen, gespaltenen Persönlichkeit. Strache ist in sich um einiges stimmiger. Ich habe ihn deshalb auch nie, wie manche Kollegen, als „schwache Haider-Kopie“ unterschätzt, sondern war überzeugt, dass er Haiders Erfolge bei den Wählern noch übertreffen würde. Jetzt übertrifft Herbert Kickl auch H.-C. Straches Erfolg.
209
31. Chancenlos gegen Kreisky
Die Politiker, die Bruno Kreisky auf Seiten der ÖVP gegenüberstehen sollten, kannte ich zwar natürlich in ihrer politischen Funktion, aber mit Ausnahme von Erhard Busek nicht persönlich. Auf Josef Klaus, der Kreisky 1970 so eindeutig unterlegen war, folgte kurz das schwarze Urgestein, Hermann Withalm, der aber schon nach kürzester Zeit dem Kärntner Karl Schleinzer aus dem rechten, nationalen Flügel der Partei Platz machte. (1942 war Schleinzer der NSDAP beigetreten, wurde nach dem Krieg aber als unbelastet eingestuft.) Ich habe Schleinzer anlässlich seines tragischen Todes – er verunglückte auf der Fahrt nach Wien am 19. Juli 1975 tödlich mit seinem Auto – aufgrund von Gesprächen mit Mitarbeitern unter dem Titel „Ich bin kein Roboter, viel tut mir weh“ als einen Mann portraitiert, der nicht in der Lage war, Emotionen zu zeigen und mitzureißen – denn als solchen habe ich ihn politisch erlebt. Als ich das Portrait, das ich nicht wirklich zutreffend in mein Buch „Begegnungen“ aufgenommen hatte, bei dessen Vorstellung guten Gewissens vorlas – ich war der Überzeugung, niemandem unter den Zuhörern damit weh zu tun – meldete sich aus der letzten Reihen Schleinzers Witwe zu Wort und sagte, dass ich ihrem Mann aufs Gröbste Unrecht tue: Er sei kein Roboter, sondern ganz im Gegenteil ein besonders herzlicher Mensch gewesen. Innerhalb seiner Familie konnte ich mir das sehr gut vorstellen – nach außen hin nicht. Aber da ich ihn nicht einmal selbst gesprochen hatte, war auch durchaus möglich, dass ich mich einfach geirrt habe. Das Problem bestand darin, dass mein möglicher Irrtum in einer Auflage von rund 70.000 Exemplaren verbreitet wurde. Ich konnte Frau Schleinzer damals nichts anderes als „wenn ich mich geirrt habe, tut mir das leid“, antworten und wiederhole es hier. Jemandes Portrait zu schreiben ist zwangsläufig die schwierigste, heikelste Aufgabe eines Journalisten. Ich führte normalerweise zu diesem Zweck stets nicht nur Gespräche mit Freunden und Mitarbeitern des Portraitierten, sondern immer mehrstündige Gespräche mit ihm selbst und hatte mir zudem zur Maxime gemacht, ihn im Zweifel lieber zu positiv als zu negativ darzustellen. Mit Ausnahme von Frau Schleinzer haben Verwandte oder Freunde der von mir Portraitierten oder sie selbst denn auch keine Einwände gegen meine Texte erhoben. Es sollte für den Zeitungs- oder Zeitschriftenleser aber klar sein, dass es sich bei einem „Portrait“ um ein in Wahrheit nicht nur sehr heikles, sondern auch sehr kühnes Unterfangen handelt – man kennt ja nicht einmal sich selbst mit Gewissheit. In der Öffentlichkeit, nur das kann ich mit Gewissheit sagen, hatte Schleinzer bis zu seinem Tod jedenfalls keine Chance gegen Kreisky: Er besaß nicht dessen Charisma beziehungsweise dessen Showtalent, und seine Strategie, „nationale“ Kandidaten für
Chancenlos gegen Kreisky
wichtige Ämter aufzustellen, um FP-Wähler zu gewinnen, ging nicht auf: Als Kreisky nach einem Jahr Minderheitsregierung Neuwahlen riskierte, errang die SPÖ die absolute Mehrheit. Auch Schleinzers in der Folge vorgebrachten wirtschaftspolitischen Einwänden – Androsch türme Schulden auf – stand stets gegenüber, dass es den Österreichern gerade von 1970 bis 1975 besser und besser ging. Mit Schleinzers Tod wurde der Industrielle Josef Taus VP-Obmann und bezüglich seiner Intelligenz bestand für mich kein Zweifel, dass er Kreisky ebenbürtig war. In seiner ersten TV-Konfrontation spielte Kreisky ihn dank seines Showtalents freilich dennoch restlos an die Wand: Er riet ihm, die Brille von der Nase nehmend und Taus vors Gesicht haltend, doch sein oberlehrerhaftes Gehaben abzulegen. Wenn einer in dieser Diskussion von Natur aus „oben“ war, dann war es Bruno Kreisky. Erstmals wurde klar, wie sehr die Fähigkeit, sich im Fernsehen der Öffentlichkeit gut zu präsentieren und bei den Zeitungen gut anzukommen, über Erfolg oder Misserfolg in der Politik entschied – Taus’ zweifelsfrei hohe intellektuelle Fähigkeiten waren daneben fast irrelevant. Zwei Witze illustrieren das Verhältnis Kreisky-Taus in der öffentlichen Wahrnehmung am besten: Taus und Kreisky fischen an der Alten Donau, immer wenn Taus einen Fisch fängt, tötet er ihn, indem er ihm mit einem Stein auf den Kopf schlägt, ehe er ihn hinter sich in einen Korb wirft – Kreisky hingegen streichelt ihm vorher sanft über den Kopf; als Zuschauer bei Taus buhen, wendet der sich leise an Kreisky: „Aber des geht ned anders, sonst leidet der Fisch – Streicheln nutzt nix.“ „Doch“, sagt Kreisky, „der Fisch wird so auch hin.“ Taus’ vergebliche Versuche, bei den Zeitungen mittels durchaus kluger aktueller wirtschaftspolitischer Vorstöße Boden zu gewinnen, illustriert der zweite Witz: Taus kündigt an, er würde über den Wörthersee gehen; durch Monate übt er im Schweiße seines Angesichts, dann gelingt ihm das Wunder tatsächlich und er lädt die Presse zu einer Demonstration; Schlagzeile des nächsten Tages: „Taus kann nicht schwimmen.“ Er erholte sich nie mehr von seiner ersten TV-Niederlage – zur tiefen Enttäuschung einer Wählerschaft, die große Hoffnungen in ihn gesetzt hatte, meldete er sich ein Jahr hindurch kaum zu Wort und ich stellte in meinem Leitartikel mit durchschlagendem Erfolg die Frage: „Wo ist Josef Taus?“ – wenig später musste er zurücktreten. Persönlich bin ich nur zweimal mit Taus zusammengetroffen: Einmal bei einer Diskussion über Wirtschaftspolitik, in der wir überraschenderweise keineswegs diametrale Thesen vertraten und einmal bei einem Mittagessen, zu dem er mich nach Hause einlud und das mir bis heute in Erinnerung ist: Er forderte seine Frau auf, uns zu servieren und uns dann allein zu lassen. Dieses Verhalten gegenüber Frauen ist mir in der ÖVP auch bei ihrem kleinen, dicken Wirtschaftsbund-Obmann Rudolf Sallinger – Spitzname „Kugelblitz“ – begegnet: Er ließ seine Töchter servieren und wollte das Gespräch mit mir, exakt wie Josef Taus, ohne seine Frau führen – die im Übrigen außergewöhnlich schön war und in deren Steinmetzbetrieb er eingeheiratet hatte.
211
212
Chancenlos gegen Kreisky
Dass das Frauenbild der SPÖ ein so viel moderneres als das der ÖVP war, hat zweifellos wesentlich zur jahrelangen sozialdemokratischen Dominanz beigetragen. Entscheidend war meines Erachtens schon die gegen Bruno Kreiskys Einwände beschlossene Fristenlösung. Ich glaube, dass ihr mit Ausnahme engagierter Katholikinnen auch eine Mehrheit der ÖVP-Wählerinnen klammheimlich zustimmte: Ein Kind auch gegen den eignen Willen austragen zu müssen, war nun einmal das größte aller weiblichen Handicaps. Bezüglich Brodas Familienrechtsreform war die Zustimmung meines Erachtens geteilt: So gut wie alle Frauen begrüßten, dass der Mann nicht mehr „Oberhaupt der Familie“ war, aber ich bin weit weniger sicher, dass – selbst innerhalb der SPÖ – eine Mehrheit die Reform des Scheidungsrechts begrüßte: Die Frauen wussten, welche auch finanzielle Macht es ihnen verliehen hatte, einer Scheidung zu widersprechen. Das ändert sich, so meine ich, erst in dem Ausmaß, in dem sie selbst besser verdienten und der Wunsch nach Scheidung nicht mehr fast nur von Männern, sondern immer öfter auch von Frauen ausging. Dass die SPÖ die Berufstätigkeit der Frau forcierte, während die ÖVP sie unverändert auf Haus und Herd reduzieren wollte, war ein Hauptgrund für die fortgesetzten schwarzen Niederlagen. Schon damals, in den 1970er Jahren, spielte die Einstellung zu „Kindergärten“ dabei die Rolle eines Lackmustests: Die SPÖ wollte mehr GratisKindergarten-Plätze – die ÖVP wollte mehr Kinderbeihilfe. Vollends beseitigt ist diese Differenz bis heute nicht, aber auch unter ÖVP-Politikern dürfte es heute eine Mehrheit geben, die weiß, dass Kindergartenplätze die Voraussetzung für die Berufstätigkeit der Frau sind. Sie hätten das schon in den 1970er Jahren einem damals wenig beachteten Artikel des profil entnehmen können, in dem wir über die entsprechende Auseinandersetzung in Frankreich berichteten: Konservative, Sozialisten, Kommunisten und Vertreter der Kirchen hatten dort einen gemeinsamen Arbeitskreis gebildet und waren zu folgenden Schlüssen gekommen: − Eine Mehrheit der Frauen will – ob es einem passt oder nicht – berufstätig sein. − Damit das trotz Kindern möglich ist, braucht es Kindergartenplätze. − Die für alle Beteiligten vernünftigste Form sie zu schaffen, sind Betriebskindergärten, weil das Wege spart und Müttern sogar die Möglichkeit gibt, in einer Arbeitspause einen Moment bei ihrem Kind vorbeizuschauen. Konsequenz dieser Einigung war – trotz unverändert denkbar verschiedener Familienbilder der beteiligten Organisationen – die Förderung von Betriebskindergärten, die bis heute für die hohe französische Geburtenrate verantwortlich ist, während die ständige Erhöhung der Kinderbeihilfen in Österreich – obwohl auch sie immer der Steigerung der Geburtenrate dienen sollte – nie vergleichbar erfolgreich war.
Chancenlos gegen Kreisky
Unter den katholischen Ländern verzeichnet nur Frankreich auch ohne Zuwanderung eine ausreichende Geburtenrate und hat das zweifellos der in den 1970er Jahren getroffenen einvernehmlichen Lösung zu danken. Auch in Österreich wäre eine Förderung von Betriebskindergärten bis heute das probateste Mittel, die „einheimische“ Geburtenrate zu steigern, und man erreichte in absehbarer Zeit sogar vielleicht „französische“ Geburtenraten, wenn man gleichzeitig die Ganztagsschule zur Regel und die Halbtagsschule zur Ausnahme machte. Bis vor wenigen Jahren brachte die ÖVP freilich auch der Ganztagschule Widerstand entgegen – aber er schmilzt von Jahr zu Jahr. Obwohl Rudolf Sallinger zu den Männern gehörte, die das konservative Frauenbild der ÖVP konservierten, muss ich ihm eine Reihe erstaunlicher Qualitäten bescheinigen. So schämte er sich zum Beispiel in keiner Weise seiner Herkunft aus einfachsten Verhältnissen, sondern machte daraus ein Markenzeichen: Als er bei einem Meeting mit amerikanischen Politikern nicht in der Lage war, ihren auf ihn ausgebrachten Toast auf Englisch zu erwidern, bat er den Übersetzer ihnen zu sagen, er habe leider seiner Armut wegen nie englisch lernen können – und erntete damit tosenden Applaus. Gemeinsam mit dem ganz ähnlich gestrickten Gewerkschaftspräsidenten Anton Benya bildete er die stärkste sozialpartnerschaftliche Achse, die Österreich je hatte: Was sie vereinbarte, hielt eisern, und das trug wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg der SPÖ unter Hannes Androsch bei. Auch ÖVP-intern, als Obmann des Wirtschaftsbundes, verhielt sich Sallinger erstaunlich: Er war es, der Erhard Busek zu seinem Generalsekretär bestellte und durch seine Protektion auch zum Generalsekretär der ÖVP machte. 1976 von dort zum ÖVPObmann Wiens bestellt, machte Busek Wiens „Schwarze“ zur ersten „grünen“ Umweltschutzpartei und zur sicherlich buntesten ÖVP, die es ja gab. 1989 Bundesminister für Wissenschaft und Forschung im Kabinett des Sozialisten Franz Vranitzky, sollte er 1991 als Nachfolger des „grünen“ VP-Obmanns Josef Riegler auch Obmann der ÖVP werden, hatte aber keine Chance, Franz Vranitzky abzulösen. Für mich ist Sallingers Busek dennoch bis heute der intellektuellste, weltoffenste Politiker, den die ÖVP je hervorgebracht hat, und wenn ich mir je einen Schwarzen zum Kanzler gewünscht habe, dann ihn. Auf Josef Taus folgte allerdings längst nicht Erhard Busek, sondern 1979 Alois Mock, dem man ein gewisses Charisma nicht absprechen konnte. Ihm sollte es weit besser als dem Industriemanager Taus gelingen, die ÖVP als „Wirtschaftspartei“ zu profilieren, und mit einer Volksbefragung zum Wiener „Konferenzzentrum“ sollte er Kreisky 1981 sogar die erste von der ÖVP verantwortete politische Niederlage bereiten. Doch zu diesem Zeitpunkt befand sich Kreisky schon im zehnten Jahr seiner Alleinregierung.
213
32. Die „Hexen“
Ich selbst habe Frauen im profil nach Kräften gefördert – wir hatten sicher die Redaktion mit dem damals größten Frauenanteil. Frauen für weniger fähig als Männer zu halten, wäre für mich angesichts meiner Mutter absurd gewesen und die katholische Vorstellung, dass die Frau an den Herd gehört, hatte ich auch von vornherein nie. Zudem hatte ich einen höchst banalen Grund, besonders viele Frauen zu engagieren: Sie waren – jedenfalls damals – zum gleichen Gehalt die wesentlich besseren Journalisten. Sigrid Löffler, Ursula Pasterk, Trautl Brandstaller, Erika Wantoch, Elisabeth Spira oder Elfriede Hammerl schrieben ihre männlichen Kollegen rein stilistisch durchwegs an die Wand und waren etlichen von ihnen auch an Wissen und Bildung deutlich überlegen. Pasterks oder Brandstallers politische Analysen hatten ein ganz anderes Format als die Helmut Voskas. Erika Wantoch schrieb grandiose Portraits, auch wenn mich eines davon die Freundschaft Werner Schneyders kosten sollte, denn sie fand Dieter Hildebrandt den sehr viel besseren Kabarettisten. Elisabeth Spira hat mir zwar nur eine einzige Geschichte geliefert, aber die war hinreißend – nur leider erfunden. Sigrid Löffler schließlich wird unter die führenden Literaturkritikerinnen des deutschen Sprachraums gezählt. Elfie Hammerl zähle ich nicht unter die Journalistinnen, sondern unter die Schriftstellerinnen, und bin zuversichtlich, dass das irgendwann auch andere tun werden. Man musste als Frau eben Top-Leistungen erbringen, um in einer damals noch ganz von Männern dominierten Branche zumindest relativ weit nach oben zu gelangen. Manche dieser Frauen mussten – ihrer Situation geschuldet – noch über eine zusätzliche Qualität verfügen: Sie mussten ihre männlichen Kollegen auch im Gebrauch ihrer Ellbogen übertreffen. Der kollegiale Umgang mit Männern war weder Ursula Pasterks noch Trautl Brandstallers oder Sigrid Löfflers Stärke. Wobei Sigrid Löffler auch mit Frauen schwer umgehen konnte – sie war diesbezüglich ein Komet für sich. Um klarzumachen, wie wenig sie von den Überlegungen ihrer Kolleginnen und Kollegen hielt, pflegte sie bei den wöchentlichen Redaktionskonferenzen, bei denen wir zuerst den Inhalt des vergangenen Heftes kritisierten und dann den Inhalt des nächsten Heftes diskutierten, grundsätzlich in einem Buch oder einer anderen Zeitschrift zu lesen. Aber auch die Hoffnung, sie würde mangels Interesses eben die ganze Zweit schweigen war voreilig: Wenn man schon glaubte, sie hätte kein Wort gehört, fand sie Gelegenheit, einen Satz oder auch nur Halbsatz eines Kollegen blitzschnell und fast immer zutreffend in der Luft zu zerreißen. „Die Schlange züngelt“, nannte es Gerd Leitgeb und das war ein Bild, wie Sigrid Löffler es nicht treffender geschaffen haben könnte: Gerade weil sie sich davor so gar
Die „Hexen“
nicht am Gespräch beteiligt und ausschließlich in ihr Buch oder ihre Zeitschrift geblickt hatte, erinnerte ihr plötzliches Aufblicken mit funkelnden Brillengläsern und ihre so punktgenaue Argumentation tatsächlich an das sich Aufrichten einer Schlange, die ihr Opfer ins Visier nimmt. Derjenige, dessen ungeschickte Äußerung ihre kritische Analyse traf, reagierte denn auch meist exakt so schockstarr, wie man es den Opfern von Schlangen nachsagt: Er wusste nichts zu erwidern – sowohl, weil sie meist recht hatte, wie auch, weil er so überrascht war. Das Problem war nur, dass zur Redaktionskonferenz einer Wochenzeitung, die oft gute zwei Stunden in Anspruch nimmt, immer auch „Brainstorming“ gehört: Die Möglichkeit, zu sagen, was einem gerade in den Kopf kommt, auch wenn es vielleicht ein Unsinn ist. Löfflers tödliche Kritik eines solchen Unsinns machten Redaktionskonferenzen nicht unbedingt kreativer und zudem selten gemütlich. Natürlich erstreckte sich ihre tödliche Kritik auch auf von mir verzapften Unsinn. Aber während ich gegenteilig auch sehr kritisch vorgebrachte Meinungen Erhard Stackls oder Joachim Riedls – gelegentlich warf Riedl mir das Götz-Zitat an den Kopf – nie als wirklich feindlich empfand, war das bei Sigrid Löffler anders: Ich hatte das Gefühl, dass sie mich aus tiefster Seele hasste und allem, was ich sagte, grundsätzlich widersprechen würde. Das war insofern erstaunlich, als man mir glaubwürdig erzählte, dass sie Otto Schulmeister, dem denkbar autoritären Chefredakteur der „Presse“, der wir sie abgeworben hatten, niemals widersprochen habe, obwohl er für seine ausgeprägt konservativen – Kritiker meinten reaktionären – Ansichten berühmt war. Ich hasste Sigrid Löffler sicher nicht – ich mochte sie nur umso weniger, je länger ich mit ihr zusammenarbeiten musste, und überlegte immer wieder, mich von ihr zu trennen, weil sie das redaktionelle Klima in einem solchen Ausmaß beeinträchtigte. Aber ich nahm jedes Mal aufs Neue davon Abstand, weil sie nun einmal blendend schrieb und mir ihre Boshaftigkeit letztlich nichts anhaben konnte, denn ich war nun einmal – zu ihrem Bedauern – ihr Chef und nicht umgekehrt. Getrennt habe ich mich nur einmal von einer Journalistin, obwohl sie mir persönlich besonders sympathisch war: Elisabeth Spira kam von einem Managementseminar, über das sie berichten sollte, mit einer köstlichen satirischen Reportage zurück, die ich sofort zum Druck beförderte hätte, wenn ich nicht erfahren hätte, dass sie das Seminar gar nicht besucht und den Text frei erfunden hatte. „Das geht bei einem Nachrichtenmagazin nicht“, musste ich ihr sagen und verhalf ihr damit, wie Jens Tschebull Georg Waldstein, indem er ihn dafür rügte, den Sportteil der Presse zu lesen, zu einem Karrieresprung: Für den ORF erfand sie mit „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ eine der populärsten Sendungen und wurde zum „Professor“. Dass ich mich nicht entschließen konnte, mich von Löffler zu trennen, hätte beinahe dazu geführt, dass die zweifellos brillanteste Autorin unter den bei profil beschäftigten Frauen das Handtuch warf: Elfriede Hammerl.
215
216
Die „Hexen“
Ich kannte Hammerl bereits seit ihren Anfängen beim Neuen Österreich, wo sich mir ihr Aussehen allerdings weit mehr als ihre Texte eingeprägt hatte. Das änderte sich, als sie zum Kurier wechselte und dort, sozusagen in meine Fußstapfen tretend, Feuilletons schrieb. Ich sprach sie deshalb mehrfach auf einen Wechsel zum profil an, aber Bronner fand ihre Texte nicht so gut wie ich und als sie das bei den ersten gemeinsamen Gesprächen merkte, zog sie sich zurück. Wenig später übersiedelte sie mit ihrem Mann – einem deutschen Auslandskorrespondenten, der sich für den weit besseren Journalisten hielt – in die USA, und Verhandlungen wurden gegenstandslos. Erst als die Ehe, wie ich das erwartet hatte, auseinanderging, und sie 1983 nach Österreich zurückkehrte, kamen sie wieder in Gang: Sie zeigte mir einen Text, der von einer Mutter handelte, die von ihrer neuen Aufgabe erdrückt wird, – „Ich bin die dicke Mama, die weiß, wo die blaugrüne Mütze ist“ – und fragte mich, ob eine wöchentliche Kolumne vergleichbaren Inhalts im profil Platz hätte – ich brauchte niemanden zu fragen und sagte „Ja“. Womit ich nicht gerechnet hatte, war der wütende Widerstand Sigrid Löfflers, den sie wie nie zuvor vor jedermann, selbst vor dem Geschäftsführer artikulierte: Die Texte würden profil und dem Feminismus zum Nachteil gereichen. Mir war zwar der Feminismus kein sonderliches Anliegen, wohl aber profil: So sehr Löffler jede Hammerl-Kolumne bei jeder Redaktionskonferenz in der Luft zerriss, so heftig verteidigte ich sie nicht nur gegen ihre Einwände, sondern auch gegen die Einwände einiger Kollegen unter der Führung von Helmut Voska, den die feministische Schlagseite der Texte störte – denn es waren Texte, die beim Publikum genau das Echo erzielten, das meine „Mutter-Kind“-Texte in München erzielt hatten: begeisterte Zustimmung bei der überwältigenden Mehrheit – extreme Ablehnung bei einer Minderheit. Für einen Verleger das beste denkbare Echo: Ich war überzeugt, dass Hammerls Kolumne unseren Leseranteil unter Frauen entscheidend erhöhen würde. Interessanterweise begriffen diverse mir folgende Chefredakteure diese auch rein wirtschaftlich eminente Bedeutung der Hammerl-Texte nie in ihrem vollen Ausmaß: Es gab immer wieder Überlegungen, sich von ihr zu trennen – zum Glück für profil ohne Erfolg. Dass Sigrid Löffler letztlich von profil-Chefredakteur Hubertus Czernin gekündigt werden sollte, zog hingegen, wie er mir sagte, jedenfalls keinen Verlust an weiblichen Lesern nach sich: Es gab zwar viele Leser und Leserinnen, die Löfflers Texte brillant fanden – aber keine, die sich dafür begeisterten oder sie wütend ablehnten. Ich persönlich gehörte bis zuletzt zu denen, die sie brillant fanden: Niemand anderer schrieb ähnlich brillante Verrisse. Niemand anderer wagte, Karajans miserable Inszenierungen in Salzburg miserabel zu finden. Niemand anderer wusste die misslungene Regie eines Stückes oder die misslungene Gestaltung eines neuen Fernsehformates, so präzise zu sezieren – am Ende ihres Textes war dergleichen in jeden seiner unbrauchbaren Bestandteile zerlegt. Löffler-Verrisse waren Hinrichtungen, und wenn man einen Autor, einen Fernsehintendanten oder Regisseur ähnlich miserabel fand, konnte man diese
Die „Hexen“
Hinrichtungen genießen. Selbst Elfriede Hammerl genoss sie ähnlich wie ich – man kann nur nicht behaupten, dass uns Sigrid Löffler dadurch ans Herz wuchs. Seltsamerweise irritierten mich auch die ihrer Texte, in denen sie jemanden lobte. Denn auch das tat sie total: so wie sie Hinrichtungen exekutierte, errichtete sie Denkmäler. So feierte sie etwa Rudolf Kirchschläger wie einen Heiligen, ohne auch nur mit einem Satz zu erwähnen, dass er als junger Leutnant in den letzten Tagen des Krieges hunderte junge Männer in den Heldentod geführt hatte, statt sich zu ergeben und ihr Leben zu retten. Ich habe Kirchschläger trotzdem in seiner Rolle als mutiger Botschafter in Prag, als sachkundiger Außenminister und als unparteiischer Bundespräsident geschätzt – aber ich vermochte relativierende Fakten nicht einfach wegzulassen – allenfalls falsch einzuschätzen. Löffler vermochte Fakten wegzulassen – das sollte, auf einem längeren Umweg, den zu beschreiben sich lohnt, zum Krieg zwischen uns führen: So unterhielt Sigrid Löffler das mit Abstand beste Verhältnis innerhalb der Redaktion zu ihrem unmittelbareren Kollegen im Kulturressort Horst Christoph, der ihr absolut ergeben war. Sie war aber nicht nur seine eigentlich alleinige Chefin – mir hätte er nie so viel Einfluss auf seine Texte zugestanden –, sondern auch die eigentliche Chefin des damaligen Kulturverantwortlichen der „Presse“ Hans Haider. Nach Theaterpremieren, die sie nicht selbst kommentierte, pflegte sie mit Haider am Telefon und Christoph an ihrer Seite eine Art Befehlsausgabe abzuhalten: „Wir sollten diese Inszenierung …“ Es folgte eine präzise Instruktion darüber, wie die Texte, die in den beiden so unterschiedlichen Medien zu einer Aufführung, Ausstellung oder Lesung erschienen, abzufassen seien. Eine dieser Telefonkonferenzen, die ich zufällig miterlebte, betraf das Theaterstück „Die Bürger von Wien“ von Peter Turrini, das zwar noch gar nicht aufgeführt wurde, zu dem es aber, wie sie sagte, eine höchst berichtenswerte Begleitmusik gebe, über die sie die beiden Kollegen informieren wolle: Der Fernsehintendant Ernst Wolfram Marboe unternehme alles, um die Aufführung des Stückes zu unterbinden, weil er sich durch die Hauptfigur, einen hinkenden Fernsehintendanten, der allen Frauen nachsteigt, verunglimpft fühle – er habe diesbezüglich beim Volkstheater, in dem die Erstaufführung stattfinden sollte, interveniert. Diese Ungeheuerlichkeit gelte es aufzudecken. Tatsächlich orientierte sich Turrini in diesem Stück mit fast fotografischer Genauigkeit an Wolfram Marboe. Mit ihm seit Jahren befreundet, hatte er ihn in stundenlangen Gesprächen zu den Versuchungen und Problemen der Funktion eines Intendanten befragt, ohne ihm allerdings zu sagen, dass ein Fernsehintendant die Hauptperson seines nächsten Stückes sein würde. Als Marboe darauf Teile dieser Gespräche fast wörtlich als Texte der Hauptfigur der „Bürger von Wien“ wiederfand, war es tatsächlich zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen, die damit geendet hatte, dass Turrini sich bei Marboe in einem Brief vielmals für seinen Vertrau-
217
218
Die „Hexen“
ensbruch entschuldigte – leider füge er immer wieder ausgerechnet Freunden solche Verletzungen zu. Jeder mit dem Thema befasste wusste von diesem Brief. Daher war ich beim Redigieren des Löffler-Textes, in dem sie auf Marboes angebliche Versuche, die Aufführung der „Bürger von Wien“ zu verhindern einging, gleich doppelt verwundert: Erstens, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass er so dumm sein könnte, einen solchen Versuch zu unternehmen: Er war lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass es ausgeschlossen war, die Aufführung eines Turrini-Stückes zu verhindern – dass ein solcher Versuch vielmehr die größte Reklame für das Stück gewesen wäre. Zweitens kam mir der leise Verdacht, dass Sigrid Löffler diese Reklame unternahm. Ich recherchierte also beim Volkstheater nach, und erwartungsgemäß wusste man dort nicht das Geringste von einer Marboe-Intervention. Noch mehr aber erstaunte mich Löfflers ausführlich erörterte Behauptung, dass Marboe doch nicht den geringsten Grund zur Irritation habe, weil der hinkende Intendant in den „Bürgern von Wien“ doch nichts als eine „Chiffre“ sei. Das stand in einem gewissen Widerspruch dazu, dass Marboe wegen eines Fußleidens tatsächlich hinkte und in diametralem Widerspruch zu Turrinis eingehender Entschuldigung. An sich hätte ich die Möglichkeit gehabt, Löfflers Text seiner sachlichen Fehlinformation wegen einfach nicht zu bringen, und Helmut Voska, der mit Marboe befreundet war, drängte mich dazu – es ginge nicht an, einen nachweislich falschen Vorwurf zu veröffentlichen. Aber das hätte nur nach sich gezogen, dass Löffler mich der Zensur zu Gunsten Marboes beschuldigt hätte und so wählte ich einen anderen Weg: Ich brachte Löfflers Text so wie er war – aber ich setzte meinen Text, mit allen ihn widerlegenden Recherchen daneben. Das war nur in dieser Form einzigartig: Joachim Riedl oder Erhard Stackl vertraten im außenpolitischen Teil des profil immer wieder das Gegenteil dessen, was ich im Leitartikel vertrat. Allerdings waren sie und ich stets einig in Bezug auf die von uns berichteten Fakten – wir interpretierten sie nur unterschiedlich. Bezüglich Löffler – und das war einmalig – fehlte diese Einigkeit. Ich glaube nicht, dass Löffler diesen „Krieg“ bei aller stilistischen Brillanz ihres Textes bei den Lesern gewonnen hat. Auch in Bezug auf „Einschätzungen“ trennte uns manches: Ich fand die eine oder andere Inszenierung, die Löffler grandios fand, miserabel. Aber ich anerkannte ihren diesbezüglichen Vorrang als Leiterin des Kulturteils, der sicherlich der stilistisch brillanteste Kulturteil des deutschen Sprachraums war. Nur dass ich stilistische Brillanz nicht zwingend mit inhaltlicher Qualität gleichsetzte, auch wenn sie bei den meisten Löffler-Texten gegeben war. Nur privat kam es auch diesbezüglich zu Problemen: „Ein grässlicher Kitsch“, sagte ich vom Bild eines Malers, den mein Onkel in seiner Galerie ausstellte und fühlte mich
Die „Hexen“
als ehemaliger Student der Malerei nicht so absolut unzuständig. „Das habe ich gerade gekauft“, sagte Sigrid Löffler. Mag sein, dass Erlebnisse wie dieses, oder die Doppel-Conference über „Die Bürger von Wien“ dazu führten, dass Löffler profil verließ, um bei der Kronen Zeitung anzuheuern. Sie verbrachte dort einen Zeitraum, den ich heute nicht mehr bemessen kann, flehte mich aber nach einem angeblich heftigen Krach mit der Krone-Redaktion an, sie wieder ins profil zurückzunehmen. „Als Mitarbeiterin gerne“, sagte ich, „aber nicht mehr als Mitglied der Redaktion.“ Ich hätte Redaktionskonferenzen satt, bei denen sie uns allen und mir ganz besonders zeige, für wie blöd sie uns halte. „Nie mehr“, sagte Sigrid Löffler, würde sie das tun. Ich würde in ihr die loyalste Mitarbeiterin und Mitstreiterin haben. Als ich immer noch zögerte, hatte sie Tränen in den Augen, und ich gab nach. Wenige Wochen später war sie wieder ganz die Alte: Wann immer sie sich zu Wort meldete, züngelte die Schlange. „Am liebsten würden Sie mich auf der Stelle hinauswerfen“, sagte sie anlässlich unseres letzten Zusammentreffens, „aber ich bin zu gut.“ „Ja“, sagte ich, „leider.“ Im Nachhinein bin ich nicht sicher, ob es nicht doch besser gewesen wäre, sich von ihr zu trennen, denn ein vergiftetes Redaktionsklima kann eine Zeitschrift umbringen. Ich warnte Peter Rabl, der mir 1988 nachfolgte, vor Löfflers Giftspritzen, aber er glaubte, sie zu gewinnen, indem er sie zur stellvertretenden Chefredakteurin machte – und bereute es bitter: „Alles, wovor Sie mich gewarnt haben, ist eingetreten.“ Erst sein Nachfolger Hubertus Czernin fand die Kraft, auf Löfflers stilistische Qualitäten zu verzichten und trennte sich von ihr. Sie avancierte zur Leiterin des Feuilletonressorts der ZEIT – um sich nach zwei Jahren mit der ZEIT-Redaktion zu entzweien; danach entzweite sie sich im „Literarischen Quartett“ mit Marcel Reich-Ranicki; danach entzweite sie sich mit den Eigentümern der von ihr im Alleingang geleiteten Zeitschrift „Literaturen“ über deren Linie. Ich würde das „Entzweien“ ihre zentrale Fähigkeit nennen – wenn ich nicht wüsste, dass sie durch alle Jahre mit bewundernswerter Festigkeit an der Seite ihres an einer psychischen Krankheit leidenden Ehemannes gestanden ist. Heute ist Journalismus eine der Branchen, in denen Frauen – Hammerl wird es bestreiten – endgültig gleichberechtigt sind: Mit Alexandra Föderl-Schmid gab es durch zehn Jahre eine Chefredakteurin beim Standard und Martina Salomon leitet seit 2018 den Kurier. Als Ressortleiterinnen sind Frauen sowieso längst selbstverständlich. Das hat auch den Typus der Frauen, die heute im Journalismus Karriere machen verändert: Sie braucht keine doppelten Ellenbogen mehr. Die Zusammenarbeit mit Petra Stuiber im Standard sollte für mich ein reines Vergnügen sein und im Falter arbeite ich jetzt in einer Redaktion, in der Frauen in der Mehrheit sind, was ich als unverbesserlicher Macho journalistisch wie optisch genieße.
219
33. Kreiskys ungeliebter Reformer
Dass Bruno Kreisky trotz der Förderung, die alle ÖVP-Obmänner durch mehrheitlich bürgerliche Zeitungen erfuhren, und trotz Haiders demagogischer Begabung durch neun Jahre mit solchem Erfolg allein regieren konnte, dankte er neben seiner unvergleichlichen Bühnenpräsenz zwei Männern an seiner Seite: dem „linken“ Christian Broda und dem „rechten“ Hannes Androsch. Mit beiden war ich zwar nicht „verhabert“, kannte sie aber zufällig auch privat – Broda sogar relativ gut. Er zählte unter die Jugendfreunde meiner Mutter, war der Scheidungsanwalt meines Vaters und immer wieder bei uns zu Gast, um in unserem Wohnzimmer an politischen Diskussionen teilzunehmen. Eine davon, mit dem Physiker Alexander Weißberg, der durch seine Erfahrungen in der Sowjetunion vom glühenden Kommunisten zum glühenden Antikommunisten geworden war, habe ich bereits erwähnt, weil sie Brodas politische Haltung offenbarte: Bei einer Auseinandersetzung mit Alexander Weißberg hatte er den Vorteil der Verstaatlichung von Betrieben bis hinunter zum Friseursalon verteidigt. Weißberg, meine Mutter und ich haben ihn daher für einen der letzten, zwar der Sozialdemokratie (also demokratischen Wahlen) verpflichteten, aber dennoch dem sowjetischen Kommunismus klammheimlich eng verbunden Politiker gehalten. Jemand, der das ähnlich sah, war Bruno Kreisky. Er misstraute Broda politisch und hat ihn nie aus eigenem Antrieb zum Justizminister gemacht, sondern darin immer nur den Forderungen des linken Flügels der Partei und der Gewerkschaft nachgegeben – auch wenn er natürlich wusste, in Broda einen hervorragenden Justizfachmann zu haben. Brodas Strafrechtsreform – heute unbestritten eine seiner großen gesellschaftspolitischen Leistungen – begegnete Kreisky in manchen Bereichen beinahe mit der Skepsis des Josef Klaus: Er sorgte sich, dass die Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs das gute Verhältnis der SPÖ zur katholischen Kirche und sein gutes Verhältnis zu Kardinal Franz König zerstören würde. Nur weil die Frauen innerhalb der SPÖ darauf beharrten, kam diese Reform dennoch zustande. Auch von Brodas Familienrechtsreform war Kreisky nicht begeistert. Nicht nur, weil er abermals das Verhältnis zur katholischen Kirche gefährdet sah, sondern auch, weil er die Unauflöslichkeit der Ehe für ein hohes Gut hielt und sie persönlich lebte: Es war nicht denkbar, dass er sich von seiner schwerfälligen, zu Depressionen neigenden Ehefrau getrennt hätte. Ich erinnere mich, wie rührend er sich darum sorgte, dass sie bei Einladungen in seine Villa ins Gespräch einbezogen wurde, so mühsam sich das für seine Gäste gestaltete.
Kreiskys ungeliebter Reformer
Ganz im Sinne meiner Mutter hatte Kreisky zwar eine „Beziehung“ zu einer sehr schönen Frau (die ich zufällig weit besser als ihn selber kannte), aber seine Ehefrau hätte er nie für sie verlassen. Kreisky war gesellschaftspolitisch das, was er auch durch Sprache und Kleidung ausdrückte: ein Bürgerlicher. Damit war er auf seltsame Weise jenen scheinbar von ihm so unterschiedenen glühenden Sozialisten vom Schlage eines Franz Jonas ähnlich, die ihre Ehefrauen auch nie verlassen (allerdings auch nie betrogen) hätten. Denn es waren diese glühenden Sozialisten, die als Letzte die Tugenden hochhielten, die innerhalb des Bürgertums zunehmend verkommen sind: eheliche Treue, Leistung, Fleiß, Bildung. Jonas hätte nie den leisesten Dialekt gesprochen; er wäre nie anders als im dunklen Anzug in ein Theater gegangen; korruptes Handeln war bei ihm undenkbar. Kreisky nahm alle diese Haltungen zwar nicht mit Jonas’ puritanischer Strenge ein, aber sie waren ihm sehr nahe. In gewisser Weise verband ihn das auch mit meiner Mutter, die wie Jonas auch nur in festlicher Kleidung ins Theater ging und wie Jonas auch nie ein Dialektwort über die Lippen brachte. Und was die Ehe betraf, so war sie katholischer als heutige Katholiken: Sie verteidigte, dass die Frau dem Mann an seinen Wohnort zu folgen hatte, „weil er eben im Allgemeinen das höhere Gehalt nach Hause bringt“; sie verteidigte, dass er entschied, in welche Schule die Kinder gehen und welchen Beruf sie erlernen, „denn einer muss es schließlich entscheiden – ich halte nichts davon, diese Entscheidungen Richtern zu überlassen“; und am Extremsten widersprach sie Brodas Scheidungsreform: „Sie wird dazu führen, dass mehr und mehr Ehen geschieden werden; das Unglück, das für alle Beteiligten damit verbunden sein wird, wird vor allem für die Kinder weit größer sein als das Unglück, das darin besteht, eine schlechte Ehe irgendwie aufrechtzuerhalten.“ Dass ihr Mann sich von ihr scheiden ließ, weil er sich, während sie in Auschwitz war, in seine Krankenschwester verliebt hatte, ließ sie sogar die Klage auf „Ehestörung“ verteidigen und die Gleichstellung unehelicher mit ehelichen Kindern für verfehlt halten, „weil sie dazu führen wird, dass die finanzielle Situation der ersten Familie sich zu Lasten der zweiten Familie dramatisch verschlechtert“. Man kann nicht sagen, dass sich alle dieser Prophezeiungen als restlos falsch erwiesen haben und auf mich und meine journalistischen Stellungnahmen haben sie zweifellos erheblichen Einfluss ausgeübt: Ich habe Brodas Scheidungsreform mit einigen Argumenten meiner Mutter im profil kritisiert – allerdings auch der begeisterten Zustimmung Raum gegeben. Hatte Broda diese Reform, taktisch denkbar geschickt, damit begründet, dass sie nur dazu dienen sollte, längst nicht mehr gelebte „Papierehen“ aufzulösen – er illustrierte das am Beispiel eines Mannes, der keine neue Ehe eingehen konnte, weil eine Polin, die er im Krieg geheiratet und seit Jahrzehnten nicht gesehen hatte, sich nicht von ihm scheiden ließ – so sagte ich wie meine Mutter vorher, dass bald die Hälfte aller neuen Ehen geschieden sein würde und schrieb einen Leitartikel, in dem ich behauptete: Es
221
222
Kreiskys ungeliebter Reformer
muss um der Kinder willen möglich sein, sich zur Aufrechterhaltung einer Ehe zu zwingen. Acht Jahre später sollte ich meine heutige Frau Eva treffen und mich scheiden lassen, obwohl zumindest eines meiner drei Kinder erst elf Jahre alt war.
34. Die Marseillaise als Schlaflied
Journalismus ist ein Beruf, der besonders wenig Zeit für die Familie lässt – schon gar, wenn er mit der Gründung eines Unternehmens verbunden ist. Um profil als Monatsmagazin herzustellen, hatte die Mannschaft gerade noch ausgereicht. Um es im 14-Tage-Rhythmus herzustellen wurde sie auf neun Mitglieder vergrößert, die wenig später auchl das wöchentliche profil herstellen mussten. Dass das gelang, war eigentlich ein kleines Wunder, wenn man es mit den fünfhundert Redakteuren und „Fakten-Checkern“ des „Spiegel“ verglich. Da es Nummer für Nummer nachprüfbar ist, behaupte ich, dass es in erster Linie meiner gewaltigen Arbeitskraft zu verdanken war, dass „profil“ die ersten Jahre als Wochenmagazin überlebte. Da ich es von Reinald Hübl gelernt hatte, vermochte ich meine Texte durchwegs zu diktieren, und wie er hatte ich zu diesem Zweck in Johanna Fally und Aniko Dalosch Sekretärinnen zur Verfügung, die wie die Maschinengewehre schrieben. Nur so ist es zu erklären, dass ich in manchen Nummern die Titelgeschichte mit einem Dutzend Seiten, den Leitartikel mit mehreren Seiten und dazu noch Kurzmeldungen verfasste. Im Allgemeinen betrat ich die Redaktion in den ersten Jahren spätestens um neun Uhr morgens und verließ sie frühestens um elf Uhr abends. Als profil noch am Mittwoch erschien, verbrachte ich auch das Wochenende in der Redaktion und schrieb am Sonntag nicht selten bis zwei Uhr morgens – dann meist mit der Frau des stellvertretenden Chefredakteurs Helmut Voska, die ebenfalls eine hervorragende Sekretärin, aber nicht unsere Angestellte war und mit der mich eine herzliche Freundschaft verband. Die Leidtragenden dieser Arbeitsorgien waren meine Frau Lisi und meine Kinder. Anders als viele Männer habe ich mir als erstes Kind immer eine Tochter gewünscht. Katharina war noch dazu eine zauberhafte Tochter – das Abbild ihrer zauberhaften Großmutter Nini Piedboeuf. Es gibt diese genetischen Sprünge über zwei Generationen hinweg: Auch mein Onkel Klaus Lingens erkannte in Katharina sofort seine Mutter wieder. Ich habe nie verstanden, dass es Vätern schwerfällt, eine Beziehung zu ihrem ersten Kind aufzubauen, weil es angeblich eine Störung ihrer Beziehung zur Ehefrau darstellt. Katharina störte nie. Wenn sie aufschluchzte, weil sie nicht einschlafen konnte oder weil sie nass geworden war, war ich es, der sie mindestens so oft wie meine erste Frau aus dem Bettchen gehoben, neu gewickelt und beruhigt hat. Nur unsere Schlaflieder waren verschieden. Bei ihr „Schlaf Kindlein schlaf “, bei mir die Marseillaise, weil sie das einzige Lied war, das ich halbwegs richtig singen konnte. Wenn überhaupt, dann war unsere Beziehung zu eng: Katharina hat auch aufgeschluchzt, wenn ich in ihrer Gegenwart gestolpert bin.
224
Die Marseillaise als Schlaflied
Sie war immer um alle besorgt, die nicht so stark und so sicher wie sie waren: Igel, die ein Hund verletzt hatte, Vögel, die an ein Fenster geflogen und mit angebrochenem Flügel liegen geblieben waren. Die nahm sie dann in unser Haus mit, um sie gesund zu pflegen. Sie hatte dafür eine erstaunlich gute Hand, so dass sie länger überlebten, als man gedacht hätte. Wenn sie am Ende dennoch starben, half ich ihr sie zu begraben. Denn anders als für ihre beiden Brüder, hatte ich für sie während ihrer beiden ersten Lebensjahre als Gerichtssaalberichterstatter des Kurier noch ausreichend Zeit: Ich war dank meiner Schreibschnelligkeit sogar besonders früh, schon gegen 16 Uhr zu Hause. Das änderte sich mit dem profil dramatisch. Als zwei Jahre später ihr nicht weniger hinreißender Bruder Sebastian zur Welt kam, war ich in unserem Haus in Mauer nur mehr Gast: Ausschließlich den Samstag hielt ich mir für die Familie frei und selbst dann hatte ich nicht selten Akten mit. Jeden Abend, so erzählte mir meine Frau, habe Sebastian gefragt, wann ich denn heimkomme. Oft rief sie mich dann an, um mich danach zu fragen und manchmal sagte ich in gutem Glauben „Heute könnte es mir gelingen, um acht zu Hause zu sein.“ Ich kann nicht erklären, warum ich diese Versprechen immer wieder gab – wahrscheinlich war es so etwas wie Feigheit – denn ich hielt sie fast nie. „Er ist bis um acht am Gartentor gesessen und hat auf Dich gewartet“, erzählte mir Lisi und mir kommen heute noch die Tränen, wenn ich daran denke. An einem der Samstage, die ich ausnahmsweise zu Hause war, musste ich entdecken, dass Sebastian trotz seiner Intelligenz nur ganz mühsam lesen konnte: Bei einer „Schnitzeljagd“ mit anderen Kindern hielt er, verzweifelt und immer verlegener in ihrer Mitte stehend, den gefunden Zettel in der Hand und vermochte ihm nicht zu entnehmen, welches die nächste Aufgabe war. Eine unendliche Minute stand er so da, dann begannen ihm die Tränen aus den Augen zu rinnen. Ich kann sie in Erinnerung daran bis heute auch nicht zurückhalten. Ich fragte seine Mutter, ob sie seine Leseschwäche denn nicht bemerkt hätte. „Doch“, sagte sie, aber an der Steiner-Schule habe man ihr gesagt, „dass manche Blumen eben früher und mache erst später blühen.“ In Wirklichkeit litt er an einer schweren Legasthenie, die ein von mir eilig engagierter, wunderbarer, mittlerweile leider verstorbener Lehrer namens Karl Grohmann – ich hatte ihn von Kari Schwarzenberg und dessen Sohn „Aki“ geerbt – auch prompt zu behandeln und zu korrigieren vermochte. Innerhalb eines Jahres holte Sebastian mit diesem Lehrer an fünf Vormittagen jeder Woche all das an Lehrstoff nach, was er in der Steiner-Schule angesichts seiner Legasthenie in sieben Jahren nicht erlernt hatte, und legte mit Erfolg die Hauptschulprüfung ab. (Zu Ehren der Steiner-Schule möchte ich anmerken, dass sie damals in Wien in ihren Anfängen stand und kaum ausgebildete Pädagogen zur Verfügung hatte, während sie heute eine durchaus empfehlenswerte Schule ist.)
Die Marseillaise als Schlaflied
Zumindest in diesem einen Lernjahr war ich trotz profil an jedem Vormittag zwei Stunden für Sebastian da – aber umso weniger für meine Frau und meine anderen Kinder. Ebenfalls an einem der Samstage, die ich zu Hause war, entdeckte ich, dass Katharina immer schräg, mit abgewinkeltem Oberkörper am Fahrrad saß. Ich ging zu einem Orthopäden, der eine Skoliose – eine meist angeborene Verkrümmung der Wirbelsäule – vermutete. Theresa Schwarzenberg, selbst Ärztin, verwies mich an ein damals in Österreich auf Skoliose spezialisiertes Krankenhaus im steirischen Murau. Dort verkündete der Primar nach einer Woche stationären Aufenthalts eine niederschmetternde Diagnose: Die Wirbelsäule sei nicht von vorneherein verkrümmt, sondern versuche eine Schrägstellung des Beckens auszugleichen, die davon herrühre, dass ein Fuß Katharinas im Wachstum zurückbleibe. Ich wusste nicht, wie ich mein Weinen an ihrem Krankenbett verbergen sollte und hätte es auch nicht gekonnt, wenn mir Theresa Schwarzenberg nicht beigestanden wäre. Auf einem stundenlangen Spaziergang vom Schloss der Schwarzenbergs in den Wald machte sie mir Mut: „Man wird bestimmt etwas machen können.“ (Das Schicksal wollte es, dass sie zwanzig Jahre später bei einem lächerlichen Schiunfall – sie war eine der besten Schifahrerinnen, die ich kenne – und auf einer denkbar einfachen Piste gestürzt ist und eine Querschnittlähmung davontrug, die sie heute nur mühsam gehen lässt.) Ein zur Hälfte in der Schweiz lebender Bekannter riet mir, der Diagnose des Murauer Krankenhauses zu misstrauen und die Schulthess-Klinik in Zürich aufzusuchen: „Wenn die Ärzte dort das gleiche wie in Murau sagen, dürfte es richtig sein. Wenn sie etwas anderes sagen, liegt Murau falsch.“ Ich steckte also 20.000 Schilling (1.500 Euro) ein und fuhr nach Zürich, um die Schulthess-Klinik aufzusuchen. Der Termin war telefonisch für 14 Uhr vereinbart und Punkt 14 Uhr kam die Sekretärin aus dem Zimmer des Skoliose-Spezialisten Professor Schuster ins Wartezimmer, um mir zu sagen, dass es leider zu einer Verspätung komme. Ich dachte an ähnliche Mitteilungen in österreichischen Spitälern und geriet in leise Panik, ob wir unseren Rückflug erreichen würden. Um 14:05 Uhr bat mich Professor Schuster unter vielen Entschuldigungen in sein Zimmer: Das Gespräch mit seinem letzten Patienten habe ausnahmsweise über die geplanten 50 Minuten samt zehn Minuten Reserve gedauert – aber nun habe er 50 Minuten für Katharina und mich zur Verfügung. Die hatte er tatsächlich – und zwar ohne die Störung eines einzigen Telefongespräches. Denn Telefonate, so erfuhr ich später, nahm er nur am Vormittag eines bestimmten Tages entgegen, der allen Anrufern mitgeteilt wurde. Ähnlich perfekt organisiert war die folgende Untersuchung meiner Tochter. Was in Murau in einer Woche gemacht worden war – ein Röntgen und die Bestimmung der Knochendichte – geschah in den folgenden zehn Minuten und endete mit einer freudigen Überraschung: „Also das von den unterschiedlich wachsenden Beinen ihrer Tochter können wir nicht bestätigen“, meinte der Professor, „eine Längendifferenz von einem halben Zentimeter ist ganz
225
226
Die Marseillaise als Schlaflied
normal. Aber man darf eben nicht die Länge auf einem Röntgenbild vom Oberschenkel mit der Länge auf einem Röntgenbild vom Unterschenkel zusammenzählen, wie das auf Ihren mitgebrachten Röntgens gemacht wurde, sondern muss ein Röntgen vom ganzen Bein machen, sonst ist die Fehleranfälligkeit zu groß.“ Katharina und ich hätten vor Freude beinahe aufgeschrien. Schuster holte ein in der Zimmerecke abgestelltes Demonstrationsskelett und zeigte ihr eine skoliotische Wirbelsäule. „Das haben eine Menge Menschen“, erklärte er ihr, „meistens ist es angeboren und stört gar nicht. Aber bei Dir ist es stärker und wenn man nichts unternimmt, kann es sich verschlechtern. Wir können aber etwas unternehmen“, – er ging zum Skelett und hob den Kieferknochen an, so dass die Wirbelsäule sich streckte – „Du wirst eine Zeitlang ein Mieder tragen müssen, das Deine Wirbelsäule auch so streckt. Dann wird alles wieder gut sein.“ Er meinte, dass ein solches Mieder auch in Österreich angefertigt werden könne, und dort vielleicht billiger komme, aber die Werkstatt der Schulthess-Klinik sei darauf spezialisiert. Ich zögerte keine Sekunde, einen entsprechenden Termin zu vereinbaren. Dann wartete ich leicht verängstigt, aber dennoch hochzufrieden auf die bereits ausgestellte Rechnung und fingerte nach den 20.000 Schilling, die ich eingesteckt hatte. Ich bezahlte 2000 Schilling (150 Euro) – nur das Doppelte dessen, was ich in Murau als Trinkgeld hinterlassen hatte und ein Zehntel dessen, womit ich im schlimmsten Fall gerechnet hatte. Katharina erhielt in abermals nur einem Tag ihr Mieder mit Stahlstütze bis zum Kinn in Zürich angemessen und war zwar nicht glücklich – sie trug fortan einen Rollkragenpullover, um den Stahlring und die Stahlstäbe, die ihn hielten zu verbergen – aber sie war auch nicht verzweifelt, hatte ihr Professor Schuster deren Funktion doch eingehend erklärt und ihr vor allem versichert, dass sie als junge Frau ganz gesund sein würde. Dass sie schon als Vierzehnjährige so weit sein sollte, erreichte er, indem sein Büro für uns am Tag der Miederanpassung einen Termin bei einem anderen Professor, der als „Hormon-Papst“ bekannt war, arrangierte. Der empfahl eine exakt dosierte Hormontherapie zur vorzeitigen Einleitung der Geschlechtsreife und damit zu einem vorzeitigen Ende des Knochenwachstums: Katharina würde maximal fünf Zentimeter unter der aus ihrem Knochenkern ersichtlichen Größe von 1,70 Meter bleiben und die Skoliose würde so gut wie unsichtbar sein. Genau so war es. Damit aber ist diese Geschichte noch nicht ganz zu Ende. Das angepasste Mieder muss nach 14 Tagen noch einmal nachjustiert werden, weil das Leder des Korsetts etwas nachgibt. „Aber das können Sie viel billiger in Österreich machen lassen“, sagte Professor Schuster, „der Professor X – ich erspare ihm die Namensnennung – macht das ganz hervorragend, nicht anders als wir.“ Ich rief also bei Professor X an, um einen Termin zu vereinbaren. Die Sekretärin nannte ein mehrere Monate entferntes Datum. „Aber das geht nicht“, wandte ich ein,
Die Marseillaise als Schlaflied
„das Mieder muss nach spätestens 14 Tagen adjustiert werden. Drauf hat mich Professor Schuster von der Schulthess-Klinik ausdrücklich hingewiesen.“ „Ach, Sie sind Privatpatient – da hätten wir übermorgen etwas frei.“ Danke, sagte ich und flog noch einmal nach Zürich. Ich habe meinen Erfahrungen mit der Schweizer Medizin einen Artikel mit der Überschrift „Fahren Sie in die Schweiz, wenn Sie krank sind“ gewidmet. Ein Spitaltag dort, so recherchierte ich, verursachte damals die Hälfte der Kosten eines Spitaltages in Österreich. Da es mich interessierte, wie und warum die Schweizer Medizin so offenkundig besser und dennoch preiswerter funktionierte, nutzte ich meinen nächsten Termin zu einer Recherche beim zuständigen Redakteur der Neuen Zürcher Zeitung. Der empfing mich in einem Zimmer von etwa fünf mal fünf Metern, dessen Wände von oben bis unten mit Literatur über Sozialversicherungsprobleme gefüllt waren. Obwohl ich deren österreichisches Problem durch meine Mutter als Ministerialrätin im Sozialministerium recht gut kannte, kannte er sie wesentlich besser als ich – Sebastian Kurz hätte ihn jederzeit zur Beurteilung seiner Sozialversicherungsreform heranziehen können. Wir sprachen also über andere österreichische Themen, die ihn interessierten und gingen dann Mittagessen. Danach begann er mir das Schweizer System auseinanderzusetzen: Es unterschied sich (damals) vom österreichischen unter anderem dadurch, dass man nur unterhalb einer bestimmten Gehaltsgrenze einen für alle gleichen erstaunlich niedrigen monatlichen Beitrag bezahlen musste. Arztrechnungen waren grundsätzlich primär selbst zu bezahlen und wurden dann, ich glaube nur zu 80 Prozent, refundiert. Für den durchschnittlichen Schweizer war das kein Problem – er verfügte über ausreichende Ersparnisse. War er chronisch krank oder nachweislich „arm“, so wurde ihm der gesamte Betrag refundiert beziehungsweise vorgestreckt. Das bewirkte zweierlei: Jeder Schweizer Patient agierte von sich aus kostenbewusst – fragte zum Beispiel, ob es für das ihm verschrieben Medikament nicht ein kostengünstigeres Generikum gibt. Dass erstklassige Behandlung in keiner Weise unbezahlbar war, hatte ich am eigenen Leib erlebt und verstand plötzlich, warum ich im Warteraum der Schulthess-Klinik keineswegs mit Superreichen, sondern unter anderem – ich hatte bei den folgenden Besuchen speziell darauf geachtet – mit mindesten so vielen einfachen Arbeitern zusammengesessen war. Einziger in Österreich immer wieder gegen dieses System vorgebrachter seriöser Einwand: Wer „arm“ war, musste es sich amtlich bescheinigen lassen. Er wurde deshalb zwar um nichts schlechter behandelt – aber er musste es vor sich selber eingestehen. Einer guten medizinischen Versorgung stand auf diese Weise nichts entgegen – die Schweizer Daten für Volksgesundheit waren damals meiner Erinnerung nach leicht besser als die auch sehr guten österreichischen – aber das Gesamtsystem war deutlich billiger. Als die Schweizer Sozialversicherung meinte, mit den aktuellen niedrigen Beiträgen nicht mehr auszukommen und sie erhöhen wollte, entschied sich die Bevölkerung in
227
228
Die Marseillaise als Schlaflied
einer Volksabstimmung dagegen – es müsse gelingen, die Kosten in den öffentlichen Spitälern zu senken, denn die privaten Spitäler kämen mit geringeren aus. Tatsächlich hatten diese privaten Spitäler damals eine präzise Kostenrechnung eingeführt, die die öffentlichen Spitäler in der Folge übernahmen. Österreich führte diese „Spitalkostenrechnung“ erst mehr als ein Jahrzehnt später ein, und Bruno Kreiskys Sozialministerin Ingrid Leodolter bezahlte dafür zehn Millionen Schilling, obwohl die Schweiz erlaubt hätte, die ihre zu kopieren. Bis dorthin bin ich in meinem Gespräch mit dem Kollegen aus der Zürcher Zeitung zwar nicht gekommen, aber die geringeren Kosten des Schweizer Modells waren mir um einiges klarer, nachdem er sie mir gute drei Stunden hindurch erläutert hatte. Dann unterbrach er für fünf Minuten, um ein eingelangtes Fernschreiben durchzulesen und setzte unsere angeregte Unterhaltung fort. „Müssen Sie heute gar nichts schreiben?“, fragte ich ihn gegen fünf Uhr Nachmittag besorgt, nachdem er mir den gesamten Tag gewidmet hatte, und erhielt eine Antwort, die ich bis heute im Ohr habe: „Also Zeit zum Gespräch muss sein. Aber alle zwei Wochen erwartet man schon ein Piece von mir.“ Das ist eine Erklärung für die Qualität dieses Weltblattes. Seine Ressortleiter, aber auch Redakteure, so fand ich heraus, verdienten damals, an der Kaufkraft gemessen, eher weniger als etwa Ressortleiter und Redakteure des „Kurier“ – das erlaubte es, die Neue Zürcher Zeitung dennoch zu tragbaren Preisen herzustellen. Als ich wissen wollte, ob diese relativ niedrigen Gehälter nicht dazu führten, dass Journalisten in doppelt so gut bezahlte Stellungen anderer Zeitungen wechselten, kam eine Antwort, die mir ebenfalls unvergesslich in Erinnerung ist: „Also ich kann mich nicht erinnern, dass jemals jemand zu einer anderen Zeitung wechseln wollte. Nur zweimal hat uns jemand verlassen: Unser Feuilletonchef hat eine Professur für Literatur an der Universität Bern angenommen. Und ein Kollege aus der Wirtschaft wurde Generaldirektor der Schweizer allgemeinen Rück(-versicherung)“. Damit ist die Geschichte dieses Besuches in der Schulthess-Klinik noch immer nicht ganz zu Ende: Jahre später lernte ich die bildhübsche Tochter meiner Tennispartnerin Andrea Aichelburg kennen, die unter einer Skoliose litt, die mit der meiner Tochter nicht vergleichbar war. Ihr Oberkörper war zu ihrem Unterkörper um gute dreißig Grad abgewinkelt. Entsprechend groß war der Knick in ihrer Seele. Nun wusste ich aus meinen Erkundigungen über Professor Schuster, dass er zu den damals drei, vier Ärzten weltweit gehörte, die derartige Verkrümmungen begradigen, indem sie einen Stahlstab in die Wirbelsäule einsetzen und schrieb ihn wegen des jungen Mädchens an: Ob er bereit sei, sie sich anzusehen. Er war nicht nur bereit, sie sich anzusehen, sondern sie sechs Stunden lang zu operieren. Kostenlos. Mit einer Begründung, die mir bis heute die Tränen in die Augen treibt: „Also wenn man der Einzige ist, der so etwas kann und das Lebensglück eines jungen Menschen, der nicht das Geld hat, hängt davon ab, dass man ihn operiert, dann muss man das natürlich machen. Das gehört sich einfach.“
Die Marseillaise als Schlaflied
Solange denen, die sich „Armut“ bescheinigen lassen müssen, solche Ärzte zur Verfügung stehen, ist etwas am zugehörigen Gesellschaftssystem richtig, auch wenn es mir fremd ist. (Es gibt übrigens auch in Österreich Ärzte, die vergleichbar handeln: Dozent Werner Reiter, ein hervorragender Urologe, eröffnete eine Kassenpraxis in Wien Favoriten statt einer Privatpraxis in der Wiener City, um dort ein Publikum zu betreuen, das sich wegen seiner Herkunft aus der Türkei oder vergleichbaren Ländern kaum je einen Universitätsdozenten leisten könnte, obwohl es seiner Armut wegen eher mehr als die Österreicher unter urologischen Problemen leidet.) Katharina musste das Ledermieder aus der Schulthess-Klinik mit dem Stahlgestänge, das den Kopf mit einem Stahlring hochhielt, bis zu ihrem 14. Lebensjahr tragen – heute ist ihr nichts von ihrer Skoliose anzumerken. Ich habe durch sie zwei gesunde Enkel, und Dutzende Kinder haben in ihr eine engagierte Sonderschullehrerin, die mit 80 Kilo schweren Behinderten zu Rande kommt. Denn ganz konnte sie es nicht lassen, sich für Verletzte einzusetzen. Der eigentliche Leidtragende ihrer Skoliose und der Legasthenie Sebastians war mein jüngster Sohn aus erster Ehe, Oliver. Denn um ihn, der sechs Jahre nach Sebastian zur Welt kam, habe ich mich zweifellos am wenigsten gekümmert, schien er doch ein Kind ohne jedes Problem: Nie krank, immer ein erstklassiger Schüler, dann ein noch besserer Student, der sich als Jahrgangsbester der Webster-Universität aussuchen konnte, welchen Job er annehmen wollte. Was er nie hatte, war von mir ihm allein gewidmete Aufmerksamkeit und Zeit – und vor allem daran messen Kinder Liebe. Ich glaube, dass er mittlerweile weiß, dass dieses Maß auch täuschen kann – aber geschlossen ist dieser Riss aus der Kindheit bis heute nicht – nur vernarbt.
229
35. Leben mit Flüchtlingen
Alle meine Kinder sind zusammen mit Flüchtlingen aufgewachsen – und werden diese Tradition hoffentlich fortführen, soweit ihre Platzverhältnisse das zulassen. Angesichts der Lebensgeschichte meiner Mutter war sie unvermeidlich: Hatte sie Juden unter Lebensgefahr in ihren Haushalt aufgenommen, so nahm ich Flüchtlinge ohne die geringste Gefahr in mein noch dazu jeweils großes Haus auf. Erstmals während des Vietnamkrieges, als die Bilder verzweifelter Kriegswaisen um die Welt gingen: Im Einvernehmen mit meiner Frau Lisi machten wir uns erbötig, eines dieser Kinder in unser Haus in Mauer aufzunehmen. Statt eines Kindes wurde uns eine 23-jährige Koreanerin zugeteilt, die in Vietnam die Tochter des Eigentümers einer Supermarktkette gewesen war. Sie hatte mit Sicherheit noch nie in einem so kleinen Zimmer gewohnt, wie wir es in unserem damals noch sehr kleinen Haus für sie freimachten, und war vor allem Bedienstete gewöhnt. So war sie zwar nett zu Sebastian und Katharina, kam aber nie auf die Idee, sich bei ihrer Betreuung nützlich zu machen. Auch wenn sie nicht unbedingt wie eine der Vietnamesinnen aussah, die man damals erstmals in Nachtclubs zu sehen bekam, legte sie doch größten Wert auf ausgiebige Kosmetik und Körperpflege. Das bedingte bei einem Badezimmer für nunmehr sieben Personen einen gewissen Stress: Vor allem Lisi überlegte lange, ob sie sie nicht doch darum ersuchen sollte, ihre beim Kopfwaschen immer wieder ausgehenden schwarzen Haare aus dem Waschtisch zu entfernen. Wir entschieden, es ihr zu sagen und sie nahm es stoisch zur Kenntnis. Ich weiß bis heute nicht, wie sie innerlich eigentlich zu uns stand. Obwohl sie mit großem Fleiß extrem rasch Deutsch lernte, hatten wir nie den Eindruck, dass sie gern mit uns sprach – „unser stummer Gast“ nannte ich sie manchmal. Nach drei Jahren waren ihre Sprachkenntnisse so gut, dass sie eine Anstellung als Telefonistin fand, und wir waren nicht unglücklich, dass sie ausziehen wollte. Meine Mutter, die überlegte, zu uns nach Mauer zu übersiedeln, übernahm ihr kleines Zimmer und schlug ihr vor, ihre 100 Quadratmeter große Wohnung in der Theresianumgasse in Ordnung zu halten und dafür dort in meinem ehemaligen Zimmer zu wohnen. Die Idee war, dass sie die Möglichkeit behalten wollte, doch auch selbst dort zu übernachten, wenn sie ins Theater oder in die Oper ging. Das Arrangement klappte. Aber als meine Mutter, die die Wohnung anders als geplant, kaum mehr aufsuchte, meinte, als Telefonistin könnte sie nun, da sie die Wohnung so gut wie allein für sich hätte, dafür doch eine kleine Miete zahlen, kam es zu Unstimmigkeiten, und die junge Frau verschwand aus unserem Leben – ich habe das weder als Verlust noch als Gewinn
Leben mit Flüchtlingen
empfunden und Lisi erging es ebenso. Die freundlichsten Erinnerungen an sie haben wohl meine Kinder. Ganz anders war das bei einem rumänischen Ehepaar, das ich im Einvernehmen mit meiner zweiten Frau Eva in unsere riesige Wohnung am Modenapark aufnahm. Der Mann, ein mittlerweile verstorbener jüdischer Journalist, der behauptete, von Ceausescus „Securitate“ verfolgt worden zu sein, war uns von Freunden meiner Mutter ans Herz gelegt worden und ist mir vor allem durch seinen Redeschwall in Erinnerung. So wollte er durch Minuten nicht verstehen, wieso ich, der ich doch ein prominenter Journalist war, mein Auto nicht einfach in zweiter Spur abstelle – er habe das in Rumänien immer so gehandhabt. Es fiel mir nicht ganz leicht, meinen Zweifel daran zu verbergen, dass er wirklich von der „Securitate“ verfolgt worden ist, aber seine Frau und vor allem sein Sohn taten mir unverändert leid. Alexandru, so hieß der ungemein hübsche, ungemein intelligente Bub, erlangte sogar im Fernsehen Bekanntheit: Der damalige Präsident des Wiener Stadtschulrates Kurt Scholz präsentierte ihn als Beispiel dafür, wie schnell Ausländerkinder perfektes Deutsch erlernen können. Tatsächlich hatte der ungemein sprachbegabte Alexandru Deutsch einerseits beim täglichen Fernsehen, andererseits beim täglichen Spielen mit unserem jüngsten Sohn Eric erlernt und war durch Jahre dessen engster Freund gewesen. Seine Mutter, eine Krankenschwester, ist bis heute eine Freundin meiner Frau und zweifellos ein menschlicher und wirtschaftlicher Gewinn für Österreich. Von ihrem Mann, der sich von ihr scheiden ließ und mittlerweile verstorben ist, kann man das nicht sagen: Er verdiente nur durch ein paar Monate als Arzthelfer eigenes Geld. Alexandru wurde angesichts seines unerträglichen Vaters ein unglücklicher Mensch. Ein eindeutiger menschlicher, wie wirtschaftlicher Gewinn für Österreich war ein bosnisches Ehepaar, das wir nach unserer Übersiedlung in ein Haus in Enzesfeld dort aufnahmen: Mit seinem Sohn Merced teilte unser fünf Jahre jüngerer Sohn Eric drei Jahre hindurch das Zimmer so begeistert, wie ich seinerzeit mit Alexander und ist mit ihm bis heute befreundet. War schon sein Vater ein ungemein fleißiger Arbeiter, so ist Merced für Österreich ein erheblicher Zugewinn: Als hervorragender Mechatroniker hat er heute längst sein eigenes, großes Haus in einem Nachbarort errichtet und leistet weiter ein Vielfaches dessen, was er Österreich gekostet hat. Den letzten Flüchtling nahm Eric 2015 in seine Wohnung in der Burggasse auf: Souahib behauptet, als Tunesier vom IS verfolgt worden zu sein, weil er den Terroristen nicht mit seinen Sprachkenntnissen zur Verfügung stehen wollte. Ich zweifle, dass sein Asyl-Ansuchen positiv beschieden werden wird, aber mit diesen Sprachkenntnissen wollte ihn ein Wiener Restaurant sofort als Kellner einstellen, durfte das aber nicht, weil es Asylwerbern generell nur unter Ausnahmebedingungen und in eigeschränkten Bereichen arbeiten dürfen und es in Wien angeblich genügend Stellung suchende Kellner gibt. Meine und Erics Sympathie verwirkte er, als er während dessen zeitweiliger Abwesenheit, ohne zu fragen, andere Leute in der Burggasse einquartierte – das führte dazu, dass wir ihn baten, ein anderes Quartier zu finden, was ihm offenbar gelang.
231
232
Leben mit Flüchtlingen
Ich habe das alles so ausführlich und differenziert beschreiben, um klarzumachen, dass der Umgang mit Flüchtlingen nichts Einfaches, Schwarz-Weißes, sondern etwas ziemlich Komplexes ist – bei dem der Gewinn den Verlust aber zweifellos überwiegt.
36. Der vielgeliebte Hannes Androsch
Den Politiker, der die Ära Kreisky nach dem Familien- und Strafrechtsrechtsreformer Christian Broda am stärksten prägen sollte, Hannes Androsch, kannte ich persönlich, wie Broda, schon länger – nämlich aus meiner Mitgliedschaft beim Verband sozialistischer Studenten VSStÖ. Zudem nahmen wir beide besonders gerne an Diskussionen in der Wohnung der besonders hübschen Tochter des Abgeordneten Peter Strasser, Andrea, teil, die ich auch privat seit vielen Jahren kannte und in die ich mit siebzehn vergeblich verliebt war – wie übrigens auch der spätere Bundespräsident Heinz Fischer. Ich glaube, dass sie das wahre Zentrum des Verbandes sozialistischer Studenten meiner Generation gewesen ist, auch wenn sie mir Jahrzehnte später gestand, die politischen Diskussionen dort weder verstanden noch geschätzt zu haben. Mit Fischer verband mich nicht nur, dass wir beide Andrea verehrten, sondern auch, dass unklar war, ob wir innerhalb des Verbandes zum „linken“ Flügel unter Karl Blecha oder zum rechten Flügel mit Hannes Androsch zählen. Nur dass man es bei mir wirklich nicht wusste, während man von Fischer sagte, er gehöre beiden Flügeln an. Ich meine, dass wir beide insofern klar links standen, als uns das Wichtigste am Sozialismus die Unterstützung Schwacher war. Darüber, wie die erfolgen sollte, stand ich wahrscheinlich rechts von Fischer. Auch dass er Kämpfe mied, war für Fischer typischer als für mich und wurde ihm später in den meisten seiner Funktionen innerhalb der SPÖ als Mangel an Kanten ausgelegt. Erst in seiner Funktion als Bundespräsident fand seine Fähigkeit, alle Seiten zu verstehen und zwischen ihnen zu vermitteln, durchwegs Anerkennung. Im Grunde war es, gerade in Österreich, ein Segen, dass es da jemanden gab, mit dem man nicht „kämpfen“ musste, sondern diskutieren konnte. So waren wir etwa stets diametral entgegengesetzter Ansicht über den Wert der Neutralität, aber das hat in keinem Augenblick unsere Gesprächsfähigkeit und schon gar nicht unsere Freundschaft beeinträchtigt. Befreundet waren wir nämlich bereits seit ich 14 gewesen war: Heinz Fischer hatte in derselben Villa in Hietzing gewohnt, wie mein Schulfreund Heinz Hintermayer, wegen dessen Knallerbse ich aus der Schule geflogen war. Fast gleichaltrig – Fischer ist ein Jahr älter – hatten wir uns rasch angefreundet, zumal wir ähnlich gut Tischtennis spielten und uns gute Matches liefern konnten. Obwohl ich Fischer im profil immer wieder recht heftig kritisiert hatte, zählte er zu denen, die nicht eine Sekunde an meiner persönlichen Integrität zweifelten, als ich im „Prozess des Jahrzehnts“ vor Gericht stand – und das war viel. Von Hannes Androsch kann ich das nicht sagen – aber schließlich hatte ja auch ich Zweifel an seiner Integrität und hatte diese Zweifel sogar in zahlreichen Texten festgehalten.
234
Der vielgeliebte Hannes Androsch
Androsch war in den Flügelkämpfen des VSStÖ die Gallionsfigur des rechten Flügels, obwohl er ihn meiner Erinnerung nach nicht anführte und damals ein gutes Stück links von mir argumentierte. So erinnere ich mich einer Diskussion bei Andrea Strasser, in der er mit guten Argumenten die damals durchaus gegebenen Erfolge der verstaatlichten Industrie verteidigte, während ich die Verstaatlichung mit den Argumenten Alexander Weißbergs grundsätzlich für verfehlt hielt. Aber Androsch dominierte diese Diskussion dank seines viel größeren wirtschaftlichen Wissens und seiner viel größeren Autorität – ich erlitt eine klare Niederlage, was mir insofern weh tat, als ich sie vor der angebeteten Andrea Strasser erlitt. Dass Bruno Kreisky es riskiert hat, Androsch trotz seiner Jugend – er war 1970 erst 32 – zum Finanzminister zu machen (wenngleich er nicht seine erste Wahl für diese Position war), spricht für seinen Mut, seine Menschen- und vielleicht sogar seine Sachkenntnis, denn zweifellos hat er sich zuvor mit ihm darauf geeinigt, dass Österreich sich in der Finanzpolitik an John M. Keynes und nicht an Friedrich August Hayek orientieren würde – schließlich war Kreisky in Schweden mit der schwedischen Schule der Nationalökonomie bekannt geworden, die das sehr ähnlich sieht. Parteiintern war Androsch’ Kür dennoch eine Riesenüberraschung, die bis in die Diskussionsrunden meiner Mutter ausstrahlte. Der gehörten damals neben Christian Broda und Alexander Weißberg, sofern er in Wien war, der Buchhändler Heinrich Neider, der Österreich-Korrespondent der Zürcher Zeitung Ernst Halperin, der KommunismusExperte Franz Borkenau und Österreichs Botschafter in Jugoslawien Karl Hartl an. „Ich bringe mein Geld in die Schweiz“, spaßte Hartl, als Androschs Ernennung diskutiert wurde und niemand erhob energischen Einspruch. Die Kommentare der bürgerlichen Presse zu seiner Ernennung waren ohne jeden Spaß rundum vernichtend – so gut wie überall wurde der nahende Staatsbankrott vorhergesagt. Ich, der damals wenig von Wirtschaft verstand, blieb ziemlich einsam bei der Vorsicht des gelernten Lokalreporters: Ich las mir Androschs Äußerungen zur Budgetpolitik durch, konnte darin auf Anhieb nichts Unsinniges entdecken und schrieb in meinem profil-Leitartikel, man möge abwarten, statt jetzt schon zu urteilen: Erst zu Ende des Jahres möge man Androsch „feuern oder feiern“. Das versetzte mich am Ende seines ersten Amtsjahres angesichts bester Wirtschaftsdaten in die angenehme Lage über Androsch zu schreiben: „Man muss ihn feiern.“ Jemand verlas diesen Leitartikel im Parlament, und auf den Bänken der ÖVP vermochte niemand etwas zu erwidern. Ich halte Androsch bis heute für einen hervorragenden Finanzminister und bei allen halbwegs wirtschaftskundigen „Bürgerlichen“ wird diese Meinung – fast etwas zu enthusiastisch – geteilt. Wohl gibt es auch eine Minderheit, die ihm bis heute die laufenden Budgetdefizite und die mit ihnen angestiegene Staatsschuld zur Last legt, aber diese Kritiker begreifen nicht, dass dieser gestiegenen Staatsschuld gewaltig gestiegenes Staatseigentum in Form neuer Autobahnen, U-Bahnen, Stromleitungen, Wasserleitun-
Die Villa Androsch
gen, Kanälen usw. gegenübersteht und dass die Wirtschaftswachstumsraten der Ära Androsch europaweit ihresgleichen suchen. Noch entscheidender für Österreichs heute so hervorragende Wirtschaftsstruktur war seine Entscheidung für die „Härte“ des Schilling: Als 1974 eine Konjunkturdelle Österreichs Exportwirtschaft in Bedrängnis brachte, weil die traditionelle Bindung des Schilling an die starke D-Mark ihre Produkte vergleichsweise teuer machte, plädierte die Industriellenvereinigung dafür, diese Bindung zu lockern und den Schilling abwerten zu lassen. Bruno Kreisky schloss sich diesem Anliegen an, und normalerweise hätte das dazu geführt, es zu verwirklichen. Aber Androsch, beraten von Nationalbank-Präsident Stephan Koren widersprach dem Kanzler aufs Energischste und gemeinsam mit Koren setzte er durch, dass die strikte Bindung des Schilling an die D-Mark beibehalten wurde und der Schilling entsprechend „hart“, das heißt für Exporteure teuer blieb. Das zwang Österreichs Betriebe und Unternehmen, die Effizienz ihrer Produktion und die Qualität ihrer Produkte zu optimieren, wenn sie sie dennoch erfolgreich exportieren wollten, und schuf jene hervorragende Wirtschaftsstruktur, von der wir bis heute zehren.
Die Villa Androsch Im Verhältnis Kreiskys zu Androsch hat zweifellos eine später oft beschworene emotionale Komponente eine Rolle gespielt: Kreisky sah in Androsch tatsächlich so etwas wie einen nicht nur politischen Ziehsohn. Zudem verkörperte Androsch für ihn ein arisches Ideal: groß, schlank, blond, blauäugig – nicht leicht mit einem Juden zu verwechseln. Ich bin dieses seltsamen Zusammenhanges so sicher, weil ich ihn auch in Kreiskys Verhältnis zu Journalisten beobachten konnte: Sein besonderer Liebling war durch lange Zeit ein dürftig schreibender Innenpolitiker des „Express“, von dem ich nur in Erinnerung habe, dass er groß, schlank, blond und blauäugig war und dass Kreisky ihn für seine angeblich brillanten Texte lobte, während er den tatsächlich brillanten Texten eines sehr intelligenten, sehr jüdisch aussehenden Kollegen mit erstaunlichen Reserven begegnete. Kreiskys Vorliebe für blauäugige Blonde hatte nichts Homophiles an sich – wohl aber war sie Teil von Kreiskys leise verquerem Verhältnis zum Judentum: Androsch wäre ihm wirklich der liebste Sohn gewesen. Es ist zwar falsch, diese Vater-Ziehsohn-Beziehung zwischen Kreisky und Androsch für die Ursache ihres späteren Zerwürfnisses zu halten, aber dessen Heftigkeit hat sie sehr wohl bedingt: Kreisky war von Androsch, den er so sehr geschätzt hatte, am Ende maßlos enttäuscht. Heute ist Hannes Androsch ein hoch angesehener, milliardenschwerer Industrieller und hat sich zur Gänze aus der Politik zurückgezogen – allenfalls gibt er als „elder
235
236
Der vielgeliebte Hannes Androsch
statesman“ sein Urteil darüber ab. Wenn wir einander zufällig begegnen – am ehesten bei einem Konzert oder im Theater – dann drehen wir möglichst schnell den Kopf zur Seite. Das gegenseitige Gespräch ist ausgeschlossen. Am Anfang dieses Zerwürfnisses stand die Villa Androsch. Jemand – ich weiß nicht mehr wer – hatte profil und andere Zeitungen auf die prachtvolle Villa in Wien-Neustift aufmerksam gemacht und Zweifel angemeldet, dass Androsch sie aus seinem Einkommen bezahlen konnte. Die Zweifel wurden so heftig, dass von seiner Seite Erklärungen angeboten wurden: Die glaubwürdigste war die, dass sein Schwiegervater Paul Schärf, seines Zeichens Generaldirektor der städtischen Versicherung ihm geholfen habe. Auch ich wollte es glauben, aber Herbert Herzog, jener Herbert Herzog, der mir bei meinen Texten über Felix Slavik so entscheidend unter die Arme gegriffen hatte, schlug mir vor, es zu überprüfen: Vor mir rief er im Finanzministerium an und bat in etwa: „Grüß Sie Herr Kollege, können Sie mir nachschauen, ob das Steuerbekenntnis des Herrn Paul Schärf im Vorjahr ein I-Signal gehabt hat?“ „Nein“, antwortete der Beamte. „Danke“, sagte Herzog. Und zu mir: „Kein I-Signal bedeutet, dass er kein Vermögen einbekannt hat – also konnte er unmöglich legal Androschs Villa finanzieren.“ Herzog war der Einzige, der tatsächlich so agiert hat, wie recherchierende Reporter im Kino dargestellt werden. Dass Androsch am Ende tatsächlich wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde, lag abermals nicht an meinen grandiosen Recherchen, sondern an simpler, eigentlich selbstverständlicher journalistischer Redlichkeit: Im Gegensatz zu vielen normalerweise recht qualifizierten Redaktionen (etwa der Salzburger Nachrichten) war die des profil nicht bereit, die völlig abstruse Geschichte der Finanzierung der Androsch-Villa durch seinen Wahlonkel Gustav Steiner zu glauben und widerlegte diese restlos unglaubwürdige Behauptung Stück für Stück, wie das natürlich auch jeder anderen Zeitschrift oder Zeitung problemlos möglich gewesen wäre. Doch fast alle Zeitungen oder Zeitschriften befanden sich in „bürgerlicher Hand“ und das „bürgerliche Lager“ verehrte Hannes Androsch mit wenigen Ausnahmen – voran CA-General Heinrich Treichl – wie keinen anderen Politiker einer sozialdemokratischen Regierung. Vor allem Unternehmer sahen ihn schon damals als einen der ihren an, der nur durch einen unglücklichen Zufall in der falschen Partei groß geworden war. Zudem gilt Steuerhinterziehung in Österreich sowieso als Kavaliersdelikt und dass sie durch einen amtierenden Finanzminister begangen worden war, wurde nicht wirklich als erschwerend erachtet. Jedenfalls war Karl Schwarzenberg mit seiner Ansicht, es sei ein Problem, wenn ausgerechnet dem Papst Ehestörung nachgewiesen würde, im Falle Androsch im bürgerlichen Lager ziemlich isoliert. Dass profil ab 1975 im Eigentum der Industriellenvereinigung stand, ließ die Eigentümer mein Verhalten in der Causa Androsch daher nicht gerade einmütig unterstützen. Aber – und das kann man als Journalist gar nicht hoch genug schätzen – man ließ mich gewähren.
Die Villa Androsch
Ich tat, was ich als meine journalistische Pflicht bezeichnen würde – Vergnügen machte es mir wahrhaftig keines. Ich schätzte Androsch als Politiker, wir kannten einander wie beschrieben, und eher waren wir einander sympathisch gewesen. Noch dazu wollte der Zufall, dass wir einander in den folgenden Jahren häufiger denn je zuvor begegneten. Denn wir waren beide begeisterte Ausseer: Ich war dort mit meiner Mutter jedes Jahr, seit wir wieder in Wien lebten auf Sommerurlaub gewesen und hatte schließlich an der Straße zum Sommersbergsee das kleine Ausgedingehaus eines Bauern erworben – Androsch besaß ein herrliches Haus am Altausseer See und war durch den Erwerb der Salinen-AG zum Salzbaron und neuen Erzherzog Johann des Ausseerlandes geworden. Und wie der Zufall so spielt, hatte sich auch einer unserer besten gemeinsamen Freunde, der Chef der Casino AG Leo Wallner dort angesiedelt. Da wir alle drei auf einem ziemlich ähnlichen Niveau Tennis spielten, und es im Ort Bad Aussee die damals besten Tennisplätze und bei Regen – der in Aussee bekanntlich recht häufig ist – die einzige Tennishalle gab, war unvermeidlich, dass wir einander im Sommerurlaub gut drei-, viermal in der Woche begegneten, ja lange Zeit in Lois Grill sogar den selben Tennislehrer hatten und gleichermaßen mit ihm befreundet waren. (Mit mir sollte er auch später zu tun haben, weil er die sehr erfolgreiche Werbeagentur „Grill&Gull“ gründete – mit Androsch gründete er sogar eine gemeinsame Firma). Diese enge Verflechtung unserer Lebenswege führte zu den seltsamsten Szenen: Immer wieder spielten wir in der Tennishalle, die über zwei Plätze verfügte, nebeneinander und beobachteten dann nicht nur argwöhnisch, wer von uns besser spielte oder den besseren Partner hatte, sondern hatten insbesondere das Problem, dass Bälle von seinem Platz gelegentlich auf meinen Platz herüberrollten oder Bälle von mir bei ihm landeten: Die hoben wir dann jeweils auf, ohne den anderen anzusehen und vor allem ohne ein Wort mit ihm zu sprechen und warfen sie ausschließlich den gegenseitigen Partnern zu, um einander nicht „Danke“ sagen zu müssen. Das seltsamste Erlebnis ergab sich, als es im Kurhaus zu einer Tanzveranstaltung kam, an der wir beide teilnahmen. Ich forderte dort nämlich im Verlauf des Abends eine sehr hübsche Frau zum Tanzen auf, mit der ich mich während des Tanzens so gut unterhielt, dass wir drauf und dran waren, unsere Adressen auszutauschen – bis sich herausstellte, dass sie die Schwester Hannes Androschs und ich der Journalist Peter Michael Lingens war. Ich weiß nicht, ob ich die Absurdität der Situation ausreichend zu vermitteln vermag: Zwei Männer, die unter normalen Umständen vermutlich gute Freunde geworden wären, sahen einander nie mehr im Leben ins Gesicht, geschweige denn gaben sie einander je wieder die Hand. Das ist die wahrscheinlich größte Unannehmlichkeit dieses Berufes. Androsch besteht bis heute darauf, zu Unrecht verurteilt worden zu sein und hat einer entsprechenden Argumentation in seinen Memoiren viele Seiten gewidmet. Mein Kollege Paul Lendvai hat mich boshaft beauftragt, diese Memoiren zu rezensieren und
237
238
Der vielgeliebte Hannes Androsch
ich habe geschrieben, dass ich ebenso viele Seiten darauf verwenden müsste, diese Argumentation zu widerlegen. (Das Problem seines Falles lag darin, dass die Behörde, die ihn untersuchte, sein eigenes Finanzministerium war und daher die längste Zeit zu höchst erstaunlichen Entscheidungen kam.) Dass ich diese detaillierte Widerlegung aber für überflüssig hielte: Die Österreicher – mich eingeschlossen – würden Androsch nicht als Steuerhinterzieher, sondern als hervorragenden Finanzminister, erfolgreichen Industriellen und raren Mäzen im Gedächtnis behalten.
Skandale kosten Inserate Obwohl die Berichterstattung über den Steuerfall Androsch dem profil vermutlich eine etwas vergrößerte Leserschaft bescherte – sicher ist nicht einmal das – stand die Zeitschrift trotz ihrer stabilen und sogar ziemlich kaufkräftigen Leserschaft auf wirtschaftlich wackeligen Beinen. Während die Bevölkerung bis heute meint, dass Enthüllungsjournalismus vor allem dem Zweck diene, die Gewinne eines Mediums zu erhöhen, ist im Großen und Ganzen das Gegenteil der Fall, denn Zeitschriften leben nicht von ihrer Verkaufsauflage, sondern von ihren Inseraten. Und in einer Zeitschrift, die wirtschaftliche Skandale aufzeigt, inserieren Wirtschaftstreibende längst nicht so gern, wie in einer Zeitschrift, die wirtschaftliche Leistungen lobt. Wirtschaftlich war profil in den ersten Jahren daher vom Erfolg des trend abhängig, der zwar weit weniger Leser, aber weit mehr Inserate hatte. Jens Tschebull ließ mich das als Chefredakteur des trend und später als Geschäftsführer des Verlages unmissverständlich wissen: „Sie schmeißen mit beiden Händen das Geld hinaus, das wir verdienen.“ Allerdings galt seine Kritik nicht vielleicht dem Aufdeckjournalismus, der die eigentliche Ursache dieses Phänomens war, sondern einer Haltung der profil-Redakteure, die er für Faulheit und Hochmut hielt: Sie weigerten sich, ihre schweren Schreibtische zu tragen, als die profil-Redaktion von einem Stock des Gebäudes in der Marc-Aurel-Straße in einen anderen übersiedelte. „Ich war mir in meinem Leben nicht zu gut, Kohlesäcke zu schleppen“, erzählte er uns glaubwürdig aus seinem Vorleben in Kärnten und ließ sich nicht davon überzeugen, dass es wirtschaftlich richtiger sei, für die Übersiedlung von Schreibtischen Möbelpacker zu bestellen, als Journalisten mit dieser Arbeit vom Schreiben abzuhalten. Tschebull war einer der besten Wirtschaftsjournalisten und schlechtesten Wirtschaftsmanager, die ich kenne: Seine Sorge, Journalisten könnten sich für irgendetwas zu gut sein, trieb die seltsamsten Blüten. So kontrollierte er bei Spesenabrechnungen die Lochung der Fahrscheine auf ihre Übereinstimmung mit den Fahrzielen, die der Betreffende für seine Tätigkeit aufgesucht hatte und witterte in fehlerhafter Übereinstimmung Betrug, statt für wahrscheinlich zu halten, dass der richtige Fahrschein verlorengegan-
Skandale kosten Inserate
gen oder verwechselt worden war. Was er nicht kontrollierte, war die Frage, ob die Druckpreise, die profil der Kurier-Druckerei bezahlte, angemessen waren (sie lagen weit über dem Marktüblichen) oder ob die personellen Ressourcen der Inseratenabteilung des profil ihrer schwierigen Aufgabe entsprachen. Gelegentlich nahm sein Misstrauen gegen die eigenen Leute tragisch-komische Züge an. So fanden wir die ausländischen Zeitungen, die uns zur Lektüre zur Verfügung standen und die zu diesem Zweck auf einem riesigen Tisch in der Redaktion lagen, eines Tages mit Heftklammern zugezwickt. Wir dachten an einen blöden Scherz und wer in den nächsten Tagen dringend eine ausländische Zeitung brauchte, ging in die nahe Trafik, um sich eine zu kaufen. Bis Tschebull uns so triumphierend wie wütend erklärte: „Niemand liest die ausländischen Zeitungen, die der Verlag für teures Geld anschafft – kein Mensch hat mich auf die zugeklammerten Zeitungen angesprochen.“ Dass kein Mensch ihn für den Urheber dieses für uns „blöden Scherzes“ gehalten hatte, hielt er nicht für möglich. Ein Kollege aus dem trend, Georg Waldstein, verdankt dem steten Misstrauen Tschebulls gegenüber unser aller Fleiß, dass er heute vielfacher Millionär ist. Zu unserer erlaubten täglichen Lektüre gehörte die der „Presse“. Tschebull ertappte Waldstein dabei, dass er nach dem politischen und dem Wirtschaftsteil der Presse auch deren Sportteil las. „Was haben die Resultate der Fußballspiele mit Ihrer Arbeit zu tun?“, stellte er Waldstein zur Rede. Der wusste keine Antwort, kündigte aber in der Folge und gründete gemeinsam mit Kollegen im Rahmen des Kurier-Konzerns das Wirtschaftsmagazin ECO, das profil und trend einiges an Inseraten wegnehmen sollte. Noch etwas später sollte er gemeinsam mit dem Wirtschaftschef der Kronen Zeitung Georg Wailand den „Gewinn“ gründen, der zum schärfsten Konkurrenten des „trend“ wurde und ihn an Rentabilität um Längen übertraf. Denn der „Gewinn“ vermied erfolgreich einen Fehler, der dem „trend“ zumindest gelegentlich, profil hingegen ständig unterlief: Er berichtete kaum je kritisch über „Affären“ in Unternehmen und beschränkte sich auf simple wirtschaftliche Unterweisung einer wirtschaftsfernen Bevölkerung bei Fragen, wie man seine Steuererklärung oder sein Testament am besten abfasst und stellte nie in Frage, dass der Markt immer Recht hat. Deshalb gibt der Markt solchen Zeitschriften immer durch überragenden Erfolg Recht: Der „Gewinn“ machte Waldstein zum vielfachen Millionär. Ein Medium, das die Moral von Unternehmen ständig kritisch hinterfragt oder gar Grundelemente unserer Wirtschaftsordnung – zum Beispiel das Schüren von Bedürfnissen durch Werbung oder die Unfehlbarkeit des Marktes – in Frage stellt, wird wirtschaftlich immer erhebliche Probleme haben.
239
37. Das Scheitern unseres Experiments
Das Defizit des profil blieb daher durch die ersten Jahre fast unverändert hoch, weil sich die Kosten nicht senken ließen, wenn man die Qualität nicht senken wollte. Auf einem kleinen Markt wie dem österreichischen ist diese dem Zeitungsgeschäft innewohnende Problematik besonders groß: Die Redaktion einer Zeitschrift, einer Zeitung oder eines Senders muss, um Gutes zu leisten, immer eine bestimmte Mindestgröße – bei einer Tageszeitung um die hundert feste Redaktionsmitglieder, bei einer Wochenzeitung um die dreißig – haben, ganz gleich ob diese Zeitung oder Zeitschrift acht Millionen Österreicher oder achtzig Millionen Deutsche zu potentiellen Käufern hat. Nur dass eine für Inserenten relevante Zahl in Deutschland eben zehnmal so leicht wie in Österreich zu erzielen ist und dass es in Deutschland mindestens zehnmal so viele potentielle Inserenten gibt. Und eine Zeitschrift oder Zeitung lebt wirtschaftlich eben voran von der Zahl ihrer Inserate. Ich musste das schmerzlich erleben, als ich viele Jahre später die Wochenpresse/Wirtschaftswoche herausgab: Sie erreichte mit einer Reichweite von 3,2 % prozentuell etwas mehr Leser als die deutsche „Wirtschaftswoche“ mit 3,1 % – aber in absoluten Zahlen waren es eben nur 256.000 gegenüber 2.480.000 Lesern. Während die deutsche „Wirtschaftswoche“ einer der Goldesel des Holtzbrinck-Verlages war, kam die österreichische Wirtschaftswoche nicht aus ihren Verlusten heraus und ist auch das Wirtschaftsmagazin „Format“, das sich kritischer als der „Gewinn“ mit Unternehmen auseinandersetzte, eingegangen. Obwohl profil also schon in den ersten Jahren in der deutschen Verlagswelt höchstes Ansehen genoss – Zeit-Eigentümer Gerd Bucerius wollte es erwerben und kam zu diesem Zweck nach Wien – war es wirtschaftlich unverändert „passiv“ und damit ein „Übernahmekandidat“. Dass es überhaupt überlebte, lag nicht zuletzt daran, dass seine Redakteure sich dort – ein wenig wie in der Neue Zürcher Zeitung – mit niedrigeren Gehältern begnügten, als ihnen mittlerweile von anderen Zeitungen angeboten wurden. Zum einen, weil man die politische Unabhängigkeit des profil zu schätzen wusste, zum anderen, weil man sich als „besonders“ empfand: als Teilnehmer an einem damals in Österreich einmaligen Medienexperiment. Bronner wusste das auch immer zu betonen: Man „durfte“ bei profil arbeiten – das musste einem etwas wert sein. (Im „Standard“ sollte er das Jahrzehnte später ganz ähnlich handhaben.) Gleichzeitig stellte er allerdings in Aussicht, dass er die Redaktion irgendwann durch Mitbeteiligung am Erfolg dieses Experiments beteiligen würde – entsprechend groß war der Einsatz für die Zeitschrift.
Das Scheitern unseres Experiments
Was diese anfänglich hohe Zufriedenheit der Mitarbeiter mit den Jahren trübte, war Bronners subjektiv als „zunehmend“ empfundener Widerstand in konkrete Verhandlungen über die künftige Mitbeteiligung zu treten und war Jens Tschebulls, bei aller Anerkennung seiner Leistung, nicht so leicht verdaulicher Führungsstil. (Auch mein Führungsstil begeisterte die Mannschaft vermutlich nicht gerade – jedenfalls solange sie keinen anderen Chef kennengelernt hatte.) So wie Georg Waldstein spielte irgendwann eine ganze Reihe von trend-Redakteuren mit dem Gedanken, in einer angenehmeren Arbeitsatmosphäre mehr Geld zu verdienen. Diese leise Unzufriedenheit blieb der Branche nicht verborgen und erfüllte sie mit leiser Genugtuung. Lange genug hatte sie den aufstrebenden Verlag vor allem mit Staunen betrachtet, dann war zum Staunen Argwohn und wohl auch etwas uneingestandener Neid getreten: Die sollen nur nicht glauben, dass sie etwas Besseres sind. (Schließlich hatten profil- oder trend-Redakteure durch Jahre die kleinen Geschenke, die viele Unternehmen bei Pressekonferenzen verteilen mit den Worten „Nein Danke, ich bin profil-(trend-)Redakteur!“ zurückgewiesen.) Bei den beiden Branchenriesen, Kronen Zeitung und Kurier, trat zum Argwohn vielleicht auch leise Sorge: Da wuchs etwas heran, über das man keine Kontrolle hatte und von dem man nicht wusste, wie viel größer es noch werden konnte. Bei den Krone-Eigentümern überwog das Staunen die Sorge vermutlich bei weitem: Was will dieser freche Zwerg? Bei den Kurier-Eigentümern überwog vermutlich die leise Sorge: Dieser Zwerg wuchs und wuchs. Die jeweiligen Kurier-Eigentümer erlebten, dass profil den redaktionellen Abstieg der einst führenden Tageszeitung seit der Ära Portisch dokumentierte; die Kronen Zeitung war zwar viel zu groß und zu stark, um die von profil an ihrer Berichterstattung ständig geübte Kritik auch nur zu spüren, aber Hans Dichand, der Zeit seines Lebens intellektuell geschätzt werden wollte, fühlte sich durch die Kritik des profil ans Bein gepinkelt: Er nutzte seinen „Staberl“ gleich mehrmals, um profil klarzumachen, wie unbedeutend es sei – und maß ihm eben damit Bedeutung zu. Die Zeitschrift wurde nicht zuletzt für ihre Kritik an der „Krone“ gerne gelesen. Als der „trend“-Verlag angesichts der leisen Unzufriedenheit der Mannschaft plötzlich eine Achillesferse zeigte, reifte bei beiden Branchenriesen der Entschluss, den Zwerg fertigzumachen. Der Kurier bot abtrünnigen Redakteuren des trend die Chance, das wöchentliche Wirtschaftsmagazin „Eco“ zu gründen, das freilich gar nicht so sehr dem „trend“ als vielmehr, wegen seines Wochenrhythmus, dem profil zusetzte: Obwohl sich seine Verkaufsauflage später als erstaunlich gering herausstellen sollte, nahm es profil dank seines „Wirtschaftsimages“ lebenswichtige Inserate weg. Noch viel gefährlicher schien ein Projekt, das Kurt Falk und Hans Dichand in der Kronen Zeitung vorbereiteten: Gemeinsam mit „Zeit“-Eigentümer Gerd Bucerius, dem profil so gefallen hatte, dass er es kaufen wollte, planten sie die Wochenzeitschrift „ZeitBild“, für die sie den stellvertretenden Kurier-Chefredakteur Arnold Klima als künftigen Chef anheuerten und damit einen Mann gewannen, der auch auf profil-Redakteure
241
242
Das Scheitern unseres Experiments
eine gewisse Anziehungskraft ausübte, war er im Kurier doch nur deshalb nicht zum Chefredakteur geworden, weil er die ÖVP nicht automatisch der SPÖ vorzog. Beide Branchenriesen boten also nicht nur attraktive Arbeitsplätze in vergleichsweise unabhängigen Qualitätsprodukten, sondern auch vorzügliche Gehälter, ja „Handgelder“ für den Übertritt an. Mir etwa bot ein von mir trotz seiner katholischen Schlagseite durchaus geschätzter Grande des Kurier ein Handgeld von einer Million Schilling und den Einbau in die Chefredaktion des Blattes an, wenn ich mich zum Wechseln bereiterklärte, um danach darauf hinzuweisen, was mir blühte, wenn ich ablehnte: „Wir kaufen Ihnen Ihre Redaktion unter dem Hintern weg und wenn Sie dann kommen wollen, wird kein Platz mehr für Sie frei sein.“ Wenig später sah sich Oscar Bronner einer von ihm in keiner Weise für möglich gehaltenen Situation gegenüber: Im „trend“ hielten nur mehr Jens Tschebull und ein Kollege eisern zu ihm – im profil war es kaum anders: Absolut sicher konnte er dort nur auf mich und zwei weitere Kollegen zählen – einige hatten sogar schon Vereinbarungen mit dem „Zeit-Bild“ abgeschlossen. „Die Leute waren die Freiheit, die ich ihnen geboten habe, nicht wert“, schäumte ein maßlos enttäuschter Oscar Bronner und verwirklichte im nächsten Moment die hinausgezögerte Mitbeteiligung: Tschebull und ich sollten die Hälfe des trend-Verlages erhalten. Für Tschebull war das ein überzeugendes Angebot: Er wusste, dass er gemeinsam mit seinem verbliebenen Mitarbeiter in der Lage war, die nächste Ausgabe des Monatsmagazins zu produzieren und dass er danach ausreichend weitere Mitarbeiter finden würde. Ich hatte es deutlich schwerer: Um auch nur die nächste Ausgabe herzustellen, brauchte ich mindestens sieben Redakteure und die hatte ich nicht mehr. Tschebull machte den vernünftigen Vorschlag, profil von wöchentlichem wieder auf monatliches Erscheinen umzustellen, aber ich kam zu einem anderen Entschluss: Da ich überzeugt war, dass wir im gleichzeitigen Kampf mit den beiden Branchenriesen unterliegen würden, empfahl ich Bronner an den anständigeren der beiden – und das war für mich mit Abstand der Kurier – zu verkaufen und leitete diesen Verkauf auch blitzartig ein: Ich rief Gerd Bacher an, von dem ich wusste, dass er die Kronen Zeitung hasste und dass man seine Medienexpertise in der Industriellenvereinigung mindestens so sehr wie im Kurier selbst schätzte und warnte ihn, dass Bronner zum Verkauf des trend-Verlages gezwungen sei – wenn der Kurier nicht blitzartig handle, machte womöglich die Kronen Zeitung das Rennen. Der Kurier (die Industriellenvereinigung) handelte blitzartig: Am nächsten Tag hatte Bronner ein Anbot über 50 Millionen Schilling (3.633.642 Euro) für den trend-Verlag auf dem Tisch. Tschebull und ich entwarfen ebenso blitzartig ein Modell für die Mitbeteiligung der wichtigsten abtrünnigen Redakteure, denn zumindest profil war ohne sie wertlos. Aus 25 Prozent formten wir eine Gesellschaft, mit der wir am trend-Verlag beteiligt bleiben wollten. Sie war der letzte Rest unserer Ambition, Journalismus anders als alle anderen
Das Scheitern unseres Experiments
zu betreiben – wir wollten an „unseren“ Zeitschriften beteiligt bleiben und waren der irrigen Meinung, dass die Sperrminorität von 25 Prozent dabei besonders nützlich wäre. Tschebull selbst erhielt nach diesem Modell mit 15 Prozent den höchsten, ich mit 7,5 Prozent den zweithöchsten Anteil. Die anderen Anteile bemaßen wir nach der Anzahl der Jahre, die der Betreffende den Redaktionen angehört hatte. Unsere Angebote waren gutes Geld wert, denn der Kurier hatte informell zugesagt, auch 25 Prozent der Anteile, die den Redakteuren gehörten, in spätestens einem Jahr zu erwerben. Bronner erhielt seine 25 Millionen sofort, kaufte in Wien in der Böcklinstraße ein herrliches Haus, ging aber letztlich in die USA, um der Malerei zu frönen. Tschebull wurde an seiner Stelle Geschäftsführer des trend-Verlages. Ich blieb Chefredakteur des profil und wurde unserem Statut gemäß zugleich dessen neuer Herausgeber. Damit war ich plötzlich doppelt abgesichert, denn neben dem profil-Statut galt nun zusätzlich das Kurier-Statut, wonach die Redaktion die Bestellung eines neuen Chefredakteurs mit Zweidrittelmehrheit ablehnen konnte. Ich glaube nicht, dass den Käufern bewusst war, was es bedeutete, dass diese beiden von ihnen akzeptierten Statuten nun zusammenfielen: Sie konnten einen neuen Herausgeber für profil, der mich als oberste redaktionelle Instanz abgelöst hätte, nur bestellen, wenn zwei Drittel der Redakteure damit einverstanden waren. Jedenfalls ist das bis heute eine massive Absicherung der Unabhängigkeit des profil.
243
38. Neue Eigentümer, Rilke und Hoffmannsthal
Ich ahnte damals nicht, dass diese Absicherung für mich ohne jede praktische Bedeutung sein sollte. Denn wider Erwarten ergab sich ein erstaunlich gutes Einvernehmen zwischen mir und den neuen profil-Eigentümern. Da wir es, wie jedes ordentliche Medium, für unsere Pflicht hielten, die Regierung zu kontrollieren, hatten Industrielle, die in ihrer Mehrheit der ÖVP nahestanden, in der Zeit einer SP-Alleinregierung wenig dagegen einzuwenden, dass profil rote Korruption oder Verschwendung bei Staatsaufträgen aufzeigte. Hinzu kam, dass ich der Volkspartei in meinen rein betriebswirtschaftlichen Ansichten damals näher als der SPÖ stand: Ich hielt und halte es im Allgemeinen für verfehlt, dass der Staat Unternehmen besitzt oder gar führt. Und damals schien mir, anders als heute, sogar die sehr starke gewerkschaftliche Absicherung von Arbeitsverhältnissen ein Problem: Betriebe, so war ich überzeugt, müssten die Möglichkeit haben, ihre Belegschaft so rasch wie möglich ihrer Auftragslage anzupassen. Ich erinnere mich eines Heurigen, zu dem der damalige Präsident des KurierAufsichtsrates Stepski-Doliwa alle führenden Mitarbeiter des Kurier-Imperiums, also auch des trend-Verlages, einlud, bei dem ich insbesondere diese meine These – sehr zur Freude der anwesenden Industriellen – energisch vertrat: Unternehmen müssten Mitarbeiter, wie in den USA, ohne Probleme kündigen können – nur so würde die Wirtschaft stets stark genug sein, ihnen anderswo neue Jobs anzubieten. „Haben Sie schon einmal jemanden gekündigt?“, unterbrach mich plötzlich eher barsch ein Mann, der sich zuvor nicht am Gespräch beteiligt hatte, mich jetzt aber aufforderte, mich einen Moment zu ihm zu setzen. „Nein“, antwortete ich etwas erstaunt. „Dann reden Sie nicht so daher. Wissen Sie was es heißt, einen Menschen zu kündigen? Jemanden, der vielleicht Frau und Kinder hat. Jemanden der vielleicht Raten für sein Haus abzahlen muss – und Sie erwarten, dass er selbstverständlich sofort ganz wo anders hinzieht, um einen neuen Job anzunehmen.“ Der Mann, der mich unterbrochen hatte, war der Generalanwalt des RaiffeisenKonzerns Christian Konrad, der zehn Jahre später der für mich wichtigste Vertreter der Eigentümer sein sollte und den ich seit damals schätze: Einer der Männer, die energisches Handeln und unternehmerisches Denken mit christlicher Gesinnung zu verbinden wissen. Selbstverständlich mag Konrad keine Nazis. Selbstverständlich missfiel ihm die Aufwertung „Ehemaliger“ durch Bruno Kreisky. Selbstverständlich war er ein Anhänger der Sozialpartnerschaft. Dass Wolfgang Schüssel 2000 mit der FPÖ koalieren sollte, lehnte er trotz des erstaunlichen Erfolges, den es für die ÖVP primär mit sich brachte,
Neue Eigentümer, Rilke und Hoffmannsthal
energisch ab, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm gefiel, dass die neue ÖVP unter Sebastian Kurz 2017 neuerlich eine solche Koalition einging. Deren Umgang mit „Flüchtlingen“ kritisierte er öffentlich, und insofern war es auch keineswegs ein Zufall, dass es abgelehnt wurde, ihn als Aufsichtsratsvorsitzenden der Albertina zu verlängern. In allen Jahren, die ich mit Konrad zusammenarbeiten sollte, erwies sich dieser praktizierende Katholik als Liberaler: Wir hatten nur die Abmachung, dass ich ihn verständigen würde, wenn eine Recherche des profil sich unmittelbar gegen Raiffeisen richtete. Dann pflegte er zu sagen: „Geben Sie dem X Gelegenheit zu einer Stellungnahme – wenn er was Blödes sagt, ist er selber schuld.“ Ich besuche Christian Konrad bis heute zumindest einmal im Jahr. Dann sprechen wir über Politik, über Medien, über frühere Zeiten: Er ist nicht mehr der mächtige Generalrat von Raiffeisen, ich bin nicht mehr der relativ mächtige Chefredakteur des profil. Auch der Machtverlust verbindet. Fast so eng gestaltete sich mein Verhältnis zu einem Miteigentümer des Kurier, von dem ich und alle Menschen, die mich kannten, das am wenigsten erwartet hätten: Zu Wiens „Garagenkönig“ Hans Pruscha. Pruscha, das war kein Geheimnis, hatte sein erstes Geld in den Nachkriegsjahren durch Schleichhandel verdient, hatte sich dann aber, vor allem durch den Bau von Tiefgaragen zu einem der reichsten Männer des Landes hochgearbeitet. Er hatte Häuser gekauft und Tankstellen errichtet, sich an den verschiedensten Geschäften beteiligt und dabei fast durchwegs viel Geld verdient. Gleichzeitig war er unendlich sparsam. „Ich habe Sie neulich im Hausboot essen gesehen“, sprach er mich an, als wir einander im sogenannten „Bermudadreieck“ des 1. Bezirks begegneten, denn dort befanden sich sowohl das Büro des profil wie zwei seiner Garagen, „ist das nicht sehr teuer?“ Er selbst, so sollte ich lernen, nahm sein Mittagessen grundsätzlich im billigsten Restaurant des damals noch nicht so fashionablen Rudolfsplatzes ein und bestellte dort grundsätzlich das Menü. Sein nahes Büro war das kleinste eines großen Kaufmanns, das ich je gesehen habe. Es lag über einer seiner Garagen, war von dort über eine Eisenstiege zu erreichen, maß etwa zwölf Quadratmeter, die freilich neben seinem Schreibtisch und einem größeren Sessel, auf dem man ihm gegenübersitzen konnte, eine Reihe von Regalen aufnehmen mussten, in denen Ersatzteile für Fahrzeuge, Proben von Baumaterial und Prospekte gestapelt waren. Eines der köstlichsten Gespräche, das wir dort führten, handelte von einer Garage der Stadt Wien, für deren Errichtung ein Bauunternehmen der Stadt Wien den Zuschlag erhalten hatte, obwohl es für den Quadratmeter das Doppelte dessen offeriert hatte, was Pruscha für seine Garagen bezahlte. Pruscha, den die Gemeinde mit fünf Prozent beteiligt hatte, um seine Expertise zu nutzen, erzwang die neuerliche Ausschreibung und diesmal erhielt das gemeindeeigene Unternehmen den Zuschlag zu einem von ihm akzeptierten Preis.
245
246
Neue Eigentümer, Rilke und Hoffmannsthal
„Aber dann wollte ich von diesem Geschäftsführer wissen“, so erzählte er mir, „wie er dazu gekommen ist, gleich hundert Prozent auf den Preis aufzuschlagen. Und wissen Sie, was der mir geantwortet hat? ‚Mir ham sie denkt, mir können u-bahnmäßig anbieten.‘“ Pruschas Zorn auf die verbreitete Korrumpierung war gewaltig und er begründete sie auf interessante Weise: „Wissen Sie, bei der ersten Million kann man nicht ganz zimperlich sein“, – er selbst verschwieg nie, sie mit Schleichhandel verdient zu haben – „aber danach ist Korruption einfach ein Zeichen von Untüchtigkeit und Dummheit – ein intelligenter Mensch riskiert sein Vermögen nicht durch eine Petite, auf die man ihm drauf kommen kann. Ab der ersten Million meidet man das Gericht.“ Ich glaube, dass Pruscha schlicht und einfach ein anständiger Mensch war, der außerhalb der Nachkriegszeit auch sonst nie kriminell gehandelt hätte. Nicht zuletzt unterstützte er Menschen, denen geschäftlich Unrecht geschehen war und einen davon kannte ich aus nächster Nähe: Herbert Herzog wurde, nachdem ihm sein Teppichgeschäft restlos entrissen worden war und man selbst das Haus seiner Mutter gepfändet hatte, von Hans Pruscha über Wasser gehalten. Auch das wollte er allerdings nicht als Streben nach Gerechtigkeit, sondern als Geschäft verstanden wissen: „Manchmal verliere ich dadurch Geld – aber so und so oft ist mir der Betreffende dankbar, erholt sich wirtschaftlich und macht danach Geschäfte, an denen er mich beteiligt.“ Bei Herzog weiß ich nicht, wie die Bilanz aussah, als dieser einem Herzinfarkt erlag und sich bei der Obduktion herausstellte, dass er davor schon mehr als ein Dutzend Mini-Infarkte erlitten hatte. „Ich habe ihm immer gesagt, er soll das Teppichgeschäft abschreiben und sich neuen Geschäften zuwenden“, erzählte mir Pruscha, „bei seinem Talent hätte er das in kurzer Zeit wieder verdient. Aber er war nicht bereit, das Prozessieren zu lassen, um, wie er sagte, Gerechtigkeit zu erhalten – so ein Blödsinn.“ Die mit Abstand engste Beziehung zu den neuen Eigentümern ergab sich zu einem Mann, der damals unter ihnen der wahrscheinlich einflussreichste war – zu Heinrich Treichl. Den Namen kannte ich schon aus der Zeit, in der ich mich bei meinem Onkel im Antiquitätenhandel versucht hatte und er mir auftrug, eine Standuhr in Treichls Wohnung in die Metternichgasse zu tragen, weil ein Autotransport sie auf gar keinen Fall beschädigen sollte. Treichl, so sagte mir mein Onkel, sei ein ganz besonderer Kunde: Niemand verstünde mehr als er von Antiquitäten und er kenne auch deren Preise ganz genau – „es ist eine Ehre, ihm etwas zu verkaufen.“ Dementsprechend hatte er mich aufgefordert, mich zu frisieren und mir die Nägel zu putzen, ehe ich die Wohnung betrete. Treichl war nicht zu Hause und ich stellte die Uhr in einem Vorzimmer ab, an dem mir schon damals die an seiner Wand hängenden Bilder auffielen. Da sammelte jemand Bilder ohne Rücksicht auf ihre „Zeit“ oder ihren „Preis“: Es gab Barockes in prächtigen Rahmen genauso wie aktuelle Skizzen. Später sollte ich lernen, dass das für die ganze Wohnung galt. Ein Treichl achtet
Neue Eigentümer, Rilke und Hoffmannsthal
nicht neureich darauf, dass in einem Zimmer nur Barockmöbel, in einem anderen nur Biedermeiermöbel stehen und Teppiche, Vorhänge zu dieser Zeit passen: In einem der Zimmer bedeckte eine schlichte Kokosmatte den Boden, in einem anderen stand eine abgewetzte Lederbank, die bei der Renovierung seiner Bankzentrale ausgemustert worden war. Bei den Sitzmöbeln hatte die Bequemlichkeit eindeutigen Vorrang und er scheute auch nicht vor anheimelndem Kitsch zurück – die zutiefst kleinbürgerliche Angst vor kleinbürgerlichem Kitsch, wie ich sie idealtypisch bei Helga Rabl-Stadlers Architektur-Journal-Wohnung in Salzburg beobachten konnte, war ihm fremd. Der Zufall wollte es, dass ich ihm ein zweites Mal, knapp vor seinem Aufstieg in den Vorstand der Creditanstalt-Bankverein im Gerichtssaal begegnen sollte, wo ich für den Kurier einen Prozess wegen Betruges verfolgte. Es ging, so glaube ich, um betrügerische Krida, und der Angeklagte verantwortete sich damit, dass Treichl, der damals für Kredite zuständig war, schuld an seiner misslichen Lage gewesen wäre. Dabei deutete er immer wieder an, dass Treichl dafür einen Grund gehabt hätte – man hätte ihm ein „Kuvert“ in die Hand drücken müssen, um besser behandelt zu werden. Die Äußerungen waren nicht der direkte Vorwurf der Bestechlichkeit, für den man Beweise fordern konnte, sondern sie erweckten einen entsprechenden Geruch und der Angeklagte, wie sein Anwalt wussten diesen Geruch bei der Befragung des Zeugen Treichl ungeheuer geschickt aufrechtzuerhalten. Ich schrieb damals in meinem Prozessbericht – und der Richter stimmte dem in seinem Urteil zu – dass das ein Missbrauch des Rechtes des Angeklagten sei, auch Unwahres zu sagen. Gerade weil wir einander in keiner Weise kannten, so sagte mir Treichl später, habe ihm dieser Bericht bei der Diskussion, die seiner Bestellung zum Vorstand voranging, genutzt: Der Einwand eines in der Öffentlichkeit beschädigten Rufes sei mit Hinweis auf den Kurier zurückgewiesen worden. Tatsächlich kennengelernt haben wir einander beim „Forum Alpbach“, dem ich für profil beiwohnte und bei dem damals fast nur Banker und Wirtschaftsmanager beziehungsweise Wirtschaftspolitiker Vorträge hielten, weil man sie für die einzigen hielt, die den Durchblick haben. Treichl wie ich fanden das beim Vortrag eines damals angesagten deutschen Industriemanagers nicht unbedingt gegeben und äußerten das beim Verlassen des Vortragssaales ziemlich gleichzeitig an dessen Ausgang. Das führte dazu, dass wir den Rückweg zum Hotel gemeinsam antraten, wobei es Treichl und mich gleichermaßen freute, dass das Eigentum der Industriellenvereinigung am Kurier-Imperium uns sozusagen beruflich verband. Darüber hinaus kannte Treichl den Namen meiner Mutter aus Zeitungsberichten über ihre Zeugenaussagen in Auschwitzprozessen und am Rande auch, weil die CA zu den Sponsoren der Sigmund-Freud-Gesellschaft zählte, deren Generalsekretärin meine Mutter damals war. Das intensive Wissen um Österreichs Antisemitismus und die Verfolgung der Juden bildete damit eine automatische Gemeinsamkeit, die wir nicht
247
248
Neue Eigentümer, Rilke und Hoffmannsthal
ausführen, sondern nur in einem Halbsatz andeuten mussten, um uns emotional zu verbinden. Wir waren einander nach den ersten fünf, sechs Sätzen sympathisch. Dann wollte es der Zufall, dass in einem der prächtigen Vorgärten der denkmalgeschützten Alpbacher Bauernhäuser ein großer Strauch Hortensien gerade blühte. „So wie das letzte Grün in Farbentiegeln sind diese Blätter, trocken, stumpf und rau“, sagte Treichl die ersten Zeilen des Rilke-Gedichts „Blaue Hortensien“ bei seinem Anblick vor sich hin. „Hinter den Blütendolden die ein Blau nicht auf sich tragen, nur von ferne spiegeln“, ergänzte ich. „Verwaschenes wie an einer Kinderschürze“, setze er fort, „Nichtmehrgetragenes dem nichts mehr geschieht“, setzte ich fort – als das Gedicht zu Ende war, war unsere Freundschaft besiegelt. In der Folge haben sich diese Gemeinsamkeiten nur mehr verdichtet. Ich erzählte ihm, auf welche Weise das Bemühen meiner Mutter, Juden zu retten, in Auschwitz geendet hatte – er erzählte mir, wie das Bemühen seines Bruders Wolfgang, gegen Hitler zu kämpfen, damit geendet hatte, dass er im Rahmen einer britischen Offensive hinter den deutschen Linien absprang und dabei zu Tode kam. Er erzählte mir von seiner und Wolfgangs Liebe zu den Stücken Arthur Schnitzlers und den Gedichten Rainer Maria Rilkes – ich erzählte ihm von meiner und Alexander Weißbergs Liebe zu diesen beiden Autoren. Als ich ihm erzählte, wie eng die Freundschaft meiner Eltern zu Karl von Motesiczky war, stellte sich heraus, dass dessen Mutter Henriette von Lieben eine engste Verwandte der Treichls war und dass ihre Mutter Anna von Lieben eine von Sigmund Freunds berühmten Hysterie-Patientinnen war, von der meine Freud-begeisterte Mutter mir immer wieder erzählt hatte. Ich erzählte ihm von ihrem unerfüllten Wunsch, Psychoanalytikerin statt Juristin zu sein – er erzählte mir vom unerfüllten Wunsch seines Bruders Wolfgang, Künstler statt Banker zu sein: Wolfgang Treichl hatte Gedichte und Theaterstücke geschrieben, die Entwürfe von Gedichten Rilkes und von Stücken Schnitzlers sein konnten. Wie sein Bruder hatte Heinrich Treichl Rilke und Hugo von Hofmannsthal zu seinen Lieblingsautoren erkoren, als er, weil sein Vater eine Bank in Deutschland leitete, dort in die Schule ging und dem deutschen Nationalismus etwas entgegenstellen wollte – ich hatte Rilkes Gedichte erstmals rezitiert, als ich in München-Schwabing mit deutschen Schauspielschülern zusammenlebte und vergeblich versuchte, eine Zeitschrift für Eltern so zu konzipieren, wie sie mir, nicht aber meinem deutschen Partner gefiel. Später hatte ich Rilkes Gedichte gelegentlich rezitiert, wenn ich mit einem Mädchen zu einer sehr engen Beziehung gelangte und mit ihm teilen wollte, was mir wichtig war, und manchmal auch, weil es eine gute Chance bot, ihm näherzukommen: Ich hatte, vor allem in meiner Jugend, eine tiefe, angenehme Stimme und nahm sogar anderthalb Jahre hindurch Unterricht bei Kammerschauspielerin Elisabeth Orth, die Gedichte wie keine andere zu rezitieren vermag. Wie es dazu kam, ist erzählenswert. Die jüdische Kultusgemeinde plante damals für den Tag des Novemberpogroms Lesungen aus Werken „verbotener“ jüdischer Autoren
Neue Eigentümer, Rilke und Hoffmannsthal
und eine sehr hübsche junge Frau kam ins profil, um dafür finanzielle Unterstützung zu erbitten. Ich musste ihr sagen, dass unser Geschäftsführer die nie bewilligen würde, worauf sie mich fragte, ob unser Kulturteil die Veranstaltung nicht wenigsten positiv ankündigen könnte. „Wenn ich die Frau Löffler darum bitte, macht sie das ganz sicher nicht“, musste ich ihr sagen, denn mein Verhältnis zu Sigrid Löffler war exakt so beschaffen. „Können Sie denn gar nichts für uns tun?“, sagte die junge Frau im Hinausgehen. „Ich könnte gratis Heine lesen“, sagte ich lachend und meinte es ausschließlich sarkastisch. Etwa einen Monat später erhielt ich einen Brief der Kultusgemeinde: „Sehr geehrter Herr Lingens, wir danken ihnen herzlich für Ihre Bereitschaft im Rahmen unserer Veranstaltung ‚Verbotene Dichter‘ aus Werken Heinrich Heines zu lesen.“ Völlig konsterniert rief ich bei der Kultusgemeinde an, um dort mitzuteilen, dass ich einen Witz gemacht habe, als ich einer jungen Dame, deren Namen ich nicht einmal wusste, sagte, dass ich höchstes gratis Heine lesen könnte. Jetzt waren meine Gesprächspartner konsterniert: „Aber wir haben bereits die Plakate gedruckt – es ist eine große Veranstaltung und es kommen viele Leute.“ Ich erbat Informationen über die Veranstaltung und erfuhr, wer sonst noch zu Lesungen eingeladen war: Burgschauspielerin Libgart Schwarz, Miguel Herz-Kestranek und Axel Corti. Damit stand mein Entschluss fest, meine Teilnahme unter allen Umständen zu vermeiden – ich würde mich doch nicht vor hunderten Zuschauern rasend blamieren. Zum Glück, so dachte ich, ist Axel Corti mein Freund. Er hatte mein Buch „Auf der Suche nach den verlorenen Werten“ in seiner Radiosendung „Schalldämpfer“ aufs Wärmste empfohlen und daraus hatte sich eine Bekanntschaft und sehr bald besonders enge Freundschaft entwickelt, die durchaus mit Sprache zu tun hatte: Wir unterhielten uns ständig über Bücher, Filme und Theater und Corti meinte lachend, jemand wie ich wäre der ideale Burgtheaterdirektor – ich hätte eine Ahnung von Betriebsführung und Wirtschaft, würde nie selbst Regie führen wollen, aber wissen, wie gutes Theater beschaffen sein soll. Als mir klar war, dass ich nicht vor Publikum Heine lesen wollte, war ich überzeugt, dass Corti mir aus der Patsche helfen würde. Ich erzählte ihm, durch welches Versehen es zu meiner Einladung gekommen war und bat ihn, die Heine-Lesung für mich zu übernehmen. Aber ich irrte. „Du hast Dir das eingebrockt – also löffle das aus“, sagte Corti nur und hängte den Hörer ein. Ich gab noch nicht auf. Zufällig kannte ich oberflächlich auch Elisabeth Orth: Mein Sohn Sebastian hatte beim gleichen wunderbaren Lehrer wie ihr Sohn Cornelius Nachhilfestunden in Mathematik genommen und im Vorzimmer waren wir einander begegnet und ins Gespräch gekommen. Bei ihr hatte ich mehr Glück. Ich schilderte ihr mein Problem und sie willigte ein, meinen Part zu übernehmen – ich war erlöst. Aber nur für einen Tag, dann rief sie mich an, um mir abzusagen: Sie habe am vorgesehenen
249
250
Neue Eigentümer, Rilke und Hoffmannsthal
Abend eine Vorstellung der „Frau vom Meer“ und sei daher leider doch nicht in der Lage, meiner Bitte nachzukommen. Meine Verzweiflung muss sehr glaubwürdig geklungen haben, denn als ich sie bat, mir wenigstens ein, zwei Stunden Unterricht zu geben, willigte sie ein. Der Unterricht kam in meinem Haus in Mauer zustande und ich trug ein paar Heine-Gedichte vor, so gut ich das eben konnte: zutiefst romantisch bei den entscheidenden Sätzen zu Tränen gerührt. Ihre Kritik werde ich nie vergessen: „Das Publikum soll weinen – nicht Sie.“ Trotzdem tat sie das Klügste, was eine Lehrerin tun kann. „Sie machen das nicht schlecht“, sagte sie, „lesen Sie möglichst natürlich, einfach wie jemand, der den Sinn eines Textes vermitteln will, haben Sie Vertrauen in Ihre gute Stimme und es wird schon gut gehen. Wenn Sie in den nächsten Tagen heiser werden sollten – und das wird sicher passieren – nehmen Sie Emser Pastillen und der Hals beruhigt sich.“ Am späten Nachmittag vor meinen Auftritt traf ich Axel Corti in einem Espresso nahe der Kultusgemeinde. Ich war natürlich heiser geworden, hatte aber Emser Pastillen genommen und zwei weitere in der Hosentasche. „Gegen die Aufregung hilft am besten ein Achtel Glühwein“, sagte Axel Corti. Wenn schon ein Achtel hilft, helfen zwei Achtel sicher besser, dachte ich, der noch nie Glühwein getrunken, aber ein Viertel Wein bis dahin nie gespürt hatte. Ich nahm das Viertel Glühwein also unmittelbar vor der Vorstellung gemeinsam mit den beiden Emser Pastillen zu mir, ohne zu bedenken, dass das die Wirkung beider Substanzen verstärkt: Kopf und Kehlkopf sind gleichermaßen benommen. In diesem Zustand begann ich im vollbesetzten Saal mit meiner Lesung. Ich hatte mir zur Vorbereitung auf einer CD angehört, wie Will Quadflieg denselben Text gelesen hatte und hielt mich so gut ich konnte an diese Vorlage. Solange ich in seinem Rhythmus und seinem Tonfall blieb, gelang mir das erstaunlich gut und ich merkte in meiner Trance – denn in eine solche hatte mich der Glühwein versetzt – wie das Publikum in meinen Atemrhythmus verfiel und offenkundig zufrieden mitging. Um freilich in der Sekunde, in der ich von der Quadflieg-Vorlage auch nur im geringsten abwich, unruhig zu werden – dann eilte ich mich, ihr wieder sklavisch zu folgen und erfolgreich den entscheidenden letzten Satz zu erreichen: „Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.“ Applaus drang durch die Trance vage an mein Ohr – ich war gerettet. Tags darauf entschloss ich mich – ich war zeitlebens sehr schnell in meinen Entschlüssen – die Sache ernst zu nehmen: Ich bat Elisabeth Orth, mich zwei Stunden in der Woche zu unterrichten und sie willigte ein. Für mich – nicht unbedingt für sie – waren diese Stunden eine ungeheure Bereicherung. Ich lernte zum Beispiel, dass man dasselbe Heine-Gedicht, das ich im Geist der Romantik bis zu Tränen gerührt vorgetragen hatte, viel besser im Geist Heines mit einem im Hintergrund verborgenen ironischen Lachen vorträgt. Dass es unzählige Gedichte gibt, die sich sowohl mit dieser leisen Heiterkeit wie vollkommen ernst vortragen lassen, ja dass die meisten Gedichte zahllose Varianten
Neue Eigentümer, Rilke und Hoffmannsthal
des Vortrages zulassen, die man der Übung halber alle durchprobieren soll, um dann dennoch auch bei hundert Wiederholungen ganz exakt bei der Version zu bleiben, die man als optimal zum öffentlichen Vortrag ausgewählt hat. Professionell vortragen heißt, beim hundertsten Mal nicht anders als beim dritten Mal zu sprechen. Immerhin bin ich so weit gekommen, in „Du holde Kunst“ im ORF aus Rilkes „Neuen Gedichten“ zu lesen und ein paarmal Gedichte von Rilke, Peter Turrini und mir selber auch vor Publikum vorzutragen und so auch zu einer Unterrichtstunde bei Otto Schenk zu gelangen, bei der ich ihm probeweise „Die Weise von Leben und Tod des Cornets Christoph Rilke“ vortrug. „Das habe ich selten so schön gehört“, sagte Schenk und auch wenn er übertrieb, habe ich sicher nie besser vorgetragen – die Liebe zu einem Werk kann einem Flügel verleihen. Auf den Boden der Realität zurück brachte mich folgendes Erlebnis im Rahmen meines Unterrichts bei Elisabeth Orth: Da ich Schnitzler natürlich sehr mochte, hatte ich mit ihr mehrfach geübt, die „Weihnachtseinkäufe“ zu lesen, denn die Rolle des Anatol passte nach Alter und Lebenserfahrung perfekt zu mir – ich war überzeugt, meine Sache recht gut zu machen. Zufällig betrat der damals 16-jährige Cornelius Obonya das Zimmer und seine Mutter schlug ihm vor, sich auch einmal als Anatol zu versuchen. Er las den Text zum ersten Mal, war vom Alter her viel zu jung dafür und hatte nie vergleichbare persönliche Erfahrungen gemacht – dennoch las er mich in Grund und Boden. So und nicht anders musste man diesen Text lesen, wusste ich jetzt. Das Publikum hätte in diesem 16-Jährigen Anatol gesehen – ich hatte mich fälschlich für ihn gehalten. Ich rezitierte weiterhin gelegentlich Gedichte – zum Beispiel in Alpbach beim Spaziergang mit Heinrich Treichl – aber ich beschloss, doch lieber beim Schreiben zu bleiben als zum Sprechen zu wechseln. Auch die Brüder Heinrich und Wolfgang Treichl waren letztlich lieber bei ihrer Ausbildung zu Bankkaufleuten geblieben als ihrer künstlerischen Neigung nachzugeben, aber in schwerer Stunde kamen sie darauf zurück: Unmittelbar nachdem Wolfgang Treichl ein Stück im Stile Schnitzlers über den inneren Widerstand gegen den Nationalsozialismus geschrieben hatte, desertierte er und wurde nach langer sinnloser Gefangenschaft von der britischen Armee dazu ausersehen, im Fallschirm über Österreich abzuspringen und ihr vom Boden her Informationen zu liefern. Dabei wurde er entdeckt und abgeschossen. Heinrich Treichl bewunderte ihn für seinen Mut und warf sich vor, nicht dasselbe getan zu haben, ja sogar ein brauchbarer deutscher Soldat gewesen zu sein: „Es ist das Absurde, dass man, wenn man als Soldat in der deutschen Wehrmacht kämpfte, ernsthaft gekämpft hat, obwohl man Hitler gehasst hat. Man kämpft ernsthaft, weil man sein eigenes Leben retten und auch seine Kameraden nicht im Stich lassen will.“
251
252
Neue Eigentümer, Rilke und Hoffmannsthal
Einer der Kameraden, den Treichl nicht im Stich lassen wollte und der ihn nicht im Stich lassen wollte, war Hans Igler, ab 1972 als Eigentümer der Schoellerbank, Präsident der Industriellenvereinigung und damit über den Kurier sozusagen mein oberster Eigentümervertreter. So kam es, dass die beiden befreundeten Männer mir unabhängig voneinander erzählten, wie sie sich während ihres ungewollten Kampfes für die deutsche Wehrmacht innerlich über Wasser hielten: „Immer wenn wir eingegraben in einem Loch das Artilleriefeuer abwarten mussten, haben wir Gedichte von Rilke und Hofmannsthal rezitiert und gewusst, dass das unser wahres zu Hause ist“, sagten sie fast unisono. Ich denke, das war einer der Gründe, die dazu führen sollten, dass Hans Igler es strikte ablehnte, mich zu kündigen, als Bruno Kreisky es im Zuge der Auseinandersetzung mit Simon Wiesenthal von ihm verlangte. Ein zweiter Grund könnte darin gelegen sein, dass Iglers engster Vertrauensmann in der Industriellenvereinigung, Ernst-Gideon Loudon, zu meinem persönlichen Freund geworden war. 1975 hatte Igler ihn nämlich zum Geschäftsführer des Kurier gemacht und damit war er der Vertreter der Eigentümer, der letztlich auch über profil herrschte. Loudon und ich lernten einander also zwangsläufig beruflich kennen und bald stellte sich heraus, dass uns etwas sehr Wesentliches verband: Auch die Familie Loudon hatte dem Widerstand angehört. So war Loudon von der Aufwertung der FPÖ durch Bruno Kreisky nicht minder als ich irritiert und genauso wenig bereit, mich Kreiskys Vorliebe für diese Partei zu opfern. Hinzu kam, dass unsere Freundschaft mittlerweile die gesamte Familie umfasste: Ziemlich gleich alt hatten wir beide ähnlich viele Kinder und wohnten noch dazu beide in Wien Mauer. Wir besuchten einander immer öfter und weil die Loudons auf einem landwirtschaftlichen Areal wohnten, das zu einem Teil an eine Tennishalle vermietet war, in der sie natürlich auch selbst jederzeit spielen konnten, stellte sich zudem sehr bald heraus, dass unsere Ehefrauen beide recht gut Tennis spielten, so dass sich gemeinsam ein recht passables gemischtes Doppel ergab. Wir sahen einander also zumindest einmal die Woche zum Tennis; unsere Kinder spielten währenddessen miteinander; danach und am Wochenende diskutierten wir die Politik, über deren Berichterstattung er im Kurier und ich im profil als Herausgeber wachte. Aus der beruflichen Zusammenarbeit ergab sich eine Freundschaft, die bis heute anhält
Piller the Killer Davor war das Verhältnis zwischen dem trend-Verlag und dem Kurier nicht ganz so harmonisch gewesen. Im Herbst 1974, unmittelbar nach Bronners Abschied, hatte Jens Tschebull in seiner Eigenschaft als trend-Chefredakteur nämlich eine Serie über „Pri-
Piller the Killer
vatbanken“ in Auftrag gegeben, unter denen sich zwangsläufig auch die Schoellerbank Hans Iglers befand. Ein trend-Redakteur – ich weiß nicht mehr welcher – stellte Recherchen zu ihr an und das kam dem damaligen Geschäftsführer und starken Mann des Kurier, Helmut Lenhardt, zu Ohren. Der war mit der Industriellenvereinigung ebenso eng wie mit der ÖVP vernetzt, und das hatte auch seine Karriere in den Medien geprägt: Ursprünglich Wirtschaftsredakteur in den Salzburger Nachrichten hatte ihn Gerd Bacher, wie Alfons Dalma, zum ORF geholt und dort zum kaufmännischen Direktor gemacht. Als Bacher dort gehen musste, musste auch Lenhardt gehen, und beide wechselten an die KurierSpitze. Doch während Bacher als dessen Chefredakteur bald wieder abtrat, weil ihm in Deutschland eine Bestellung zum Fernsehintendanten winkte – die dann doch nicht realisiert wurde, weil Kreisky bei der SPD gegen ihn intervenierte – blieb Lenhardt dem Kurier erhalten und wollte auch gegenüber dem trend Stärke zeigen. Er rief Jens Tschebull an und forderte, dass der Redakteur, der über die Schoellerbank recherchiert, mit ihm sprechen möge. Tschebull antwortete, wie es seinem Selbstverständnis und seinem Verständnis von unabhängigem Journalismus entsprach: „Wenn Sie relevante Kenntnisse aus der oder über die Schoellerbank besitzen, wird sich der Kollege dazu gerne die Zeit nehmen.“ Lenhardt begriff es als Kriegserklärung, und nur Tage später war Tschebull in allen seinen Funktionen gekündigt und abgefertigt. Ich selbst war in diesen Blitzkrieg nicht involviert, hörte nur im Nachhinein von Tschebulls Äußerung und fand sie ebenso mutig wie undiplomatisch. Ich hätte den Kollegen veranlasst, sehr wohl mit Lenhardt zu sprechen; Lenhardt hätte zweifellos versucht, den Text zu Gunsten der Schoelerbank zu beeinflussen; ich hätte dafür gesorgt, dass seine Stellungnahme im Text wiedergegeben wird, dass ihr freilich alles entgegengestellt wird, was ihr sachlich entgegenzustellen ist. Meine Lösung wäre von Lenhardt vermutlich gerade noch zähneknirschend akzeptiert worden: Man kann nur schwer jemanden hinauswerfen, wenn er dafür gesorgt hat, dass beide Seiten ihre Meinung äußern konnten, auch wenn davon nur eine zutraf und der Text wenig Zweifel ließ, welche das war. Ich glaube, dass man als Angestellter in meinem Beruf gelegentlich diese Art von Kompromissen schließen muss, solange der Text dadurch nicht falsch, sondern nur überflüssig lang wird. Tschebull hingegen war kompromisslos korrekt. So kam der trend-Verlag und mit ihm das profil zu seinem neuen Geschäftsführer Peter Piller. Gleichzeitig erhielt der trend einen neuen Chefredakteur und Herausgeber: Georg Waldstein, der die Zeitschrift verlassen hatte, weil Tschebull ihn wegen des Lesens des Presse-Sportteils zurechtgewiesen hatte, kehrte sozusagen im Triumph zurück. Ich blieb unbestrittener Herausgeber des profil. Das mit Abstand führende Nachrichtenmagazin des Landes war zu diesem Zeitpunkt endlich auch wirtschaftlich zumindest kein Verlustbringer mehr. Immer schon war
253
254
Neue Eigentümer, Rilke und Hoffmannsthal
seine Leserschaft ja nicht nur ziemlich groß, sondern auch ziemlich kaufkräftig gewesen. Fachchinesisch: Sie gehörte mehrheitlich der A- und B-Schicht an. Das schlug sich jetzt trotz fortgesetzter Skandalberichterstattung doch zunehmend im Inseratenaufkommen nieder. Gleichzeitig sollte sich Peter Piller rundum als Glücksfall erweisen. Er trug zwar den Spitznamen „Piller the Killer“, aber er wurde ihm im Redaktionsbetrieb in keiner Weise gerecht: Er wusste eher noch besser als Tschebull, dass eine ausreichend große, gute und damit zwingend auch ausreichend gut bezahlte Redaktion unverzichtbare Voraussetzung für eine gute Zeitschrift war und ließ uns in völliger Ruhe – auch ohne ständige Ermahnungen wegen mangelnden Fleißes – unsere Arbeit tun. Die seine bestand darin, an vielen Schrauben zu drehen: Er verstärkte die Inseratenabteilung; er verbesserte die Bedingungen für Druck und Vertrieb und optimierte diesen: Um eine Zeitschrift gut zu verkaufen, muss man die Trafiken stets ausreichend beliefern; liefert man ihnen zu viele Hefte, hat man zu viele „Retouren“ und zu hohe Produktionskosten, liefert man ihnen zu wenige, verkauft man zu wenig. Das ist von Trafik zu Trafik ständig zu überprüfen und optimal abzustimmen. Unter Piller gingen die Retouren ständig zurück und nahmen die Verkäufe ständig zu. Je länger Piller im trend-Verlag tätig war, desto mehr Gewinn machte der Verlag, und desto größer fiel der Beitrag des profil zu diesem Gewinn aus. Leider dauerte dieser Piller-Abschnitt absolut gesehen nur kurze Zeit. Dann wurde „Piller the Killer“ wegen seines großen Erfolges im trend-Verlag Geschäftsführer des Kurier-Konzerns und Waldstein wurde neuer Kurier-Herausgeber. Piller baute die neue Großdruckerei des Kurier-Konzerns in Inzersdorf, Waldstein bestellte meinen Co-Chefredakteur Gert Leitgeb zum neuen Kurier-Chefredakteur. Für kurze Zeit übernahm das Management des trend-Verlages den Kurier-Konzern. Der trend-Verlag selbst erhielt mit Günter Enickl einen braven, nie anders als ÖVP wählenden, den Eigentümern loyal verpflichteten Geschäftsführer, mit dem ich leider um einiges schlechter als mit „Piller the Killer“ harmonierte: Ich hielt ihn für mäßig tüchtig und für alles, nur keinen Verleger. Obwohl ich das nie aussprach, hat er es vermutlich bei jedem Gespräch mit mir gespürt. Da der Verlag damals immer besser verdiente, lag ich ihm ständig in den Ohren, doch weitere Produkte, insbesondere ein Frauenmagazin zu gründen. Enickl zog es vor, dem Kurier nicht nur hohe Gewinne abzuliefern, sondern auch noch einen extrem hohen Druckpreis an die Kurier-Druckerei zu bezahlen, was dort vermutlich auch gern gesehen wurde. Dass es die Gewinne der „Redaktionsgesellschaft“ (der MitarbeiterBeteiligungs-GmbH) schmälerte, sah man ihm dort zweifellos nach, und die Mitarbeiter wussten es nicht. Er hatte bei seiner Ablehnung neuer Projekte vielmehr auch immer erstaunlich großen Rückhalt in den Redaktionen des trend wie des profil. Das lag nicht zuletzt daran, dass die in Gestalt der „Redaktionsgesellschaft“ am Unternehmen beteiligten Redakteure die Gewinne dieser Gesellschaft nicht durch Investitionen in neue Projekte
Piller the Killer
geschmälert sehen wollten. Sie waren eben im Wesentlichen Journalisten und keine Kaufleute. Ich bin deshalb bis heute nicht restlos überzeugt, dass die Mitarbeiterbeteiligung in der beschriebenen Form ein so sinnvolles Modell ist. Und ich sollte diese Haltung der Kollegen besonders schmerzhaft erfahren, als ich aus eigener Initiative ein solches neues Projekt startete: Ein Nachrichtenmagazin für Kinder, das ich Miniprofil taufen wollte und das es bis heute unter dem Namen TOPIC gibt. Die Auseinandersetzung darüber sollte zu meinem Ausscheiden aus profil führen und aufs engste mit der Person Günther Enickls, noch mehr allerdings mit meiner Mutter, verknüpft sein – doch das war erst viele Jahre später. Vorerst stellte es nur ein gewisses Problem für mich dar, dass der ÖVP-nahe Günter Enickl den ÖVP-nahen Chefredakteur Helmut Voska sehr viel lieber als mich als Herausgeber des profil gesehen hätte, was ich zu spüren bekam. So besaß ich als Herausgeber die sogenannte „Budgethoheit“, das heißt, ich konnte im Rahmen meines redaktionellen Budgets anstellen, wen ich wollte: Wenn jemand ausschied, konnte ich ihn, ohne Enickl zu fragen, durch den Journalisten ersetzen, den ich für geeignet hielt – etwa auch einen konservativen Kolumnisten durch den linken Günther Nenning. Nur war es leider so, dass Gehaltserhöhungen, wie sie die meisten Kollegen jedes Jahr erwarteten, jedes Jahr ein höheres Redaktionsbudget erforderten, und dem musste Günter Enickl sehr wohl zustimmen. In der Zusammenarbeit mit Peter Piller hatte der sich auf meine Empfehlungen verlassen – jetzt musste ich lernen, dass es für mich wesentlich besser war, diese Verhandlungen mit dem Geschäftsführer gemeinsam mit Helmut Voska zu führen, weil Enickl meinem Stellvertreter sehr viel seltener etwas abschlug. Die Redaktion wusste um diese Qualität Voskas und wusste sie zu nutzen. So hatten wir mit Enickl einmal eine in meinen Augen mehr als ausreichende Erhöhung fast aller Gehälter ausgehandelt, die ich aber zwangsläufig nicht gleichmäßig über die gesamte Redaktion verteilte, sondern bei der es natürlich immer auch jemanden gab, der sich benachteiligt fühlte – im konkreten Fall ein gewisser Charles B. B. sagte mir, dass er sich benachteiligt fühle, ich sagte ihm, mehr hätte ich für ihn bei Enickl nicht erreichen können. Worauf B. sich an Voska wendete, der Enickl allein aufsuchte. Am Tag darauf konnte der mir unterstellte Helmut Voska Charles B. eine fulminante Gehaltserhöhung anbieten, der ich schwer widersprechen konnte, ohne B. endgültig zum Todfeind zu haben. Dergleichen trug, da es sich wiederholte, nicht unbedingt dazu bei, meine Stellung innerhalb der Redaktion zu stärken.
255
39. Der Vorteil internationalen Ansehens
Wenn meine Stellung dennoch eine extrem starke war, dann trotz des Geschäftsführers. Ich besaß das uneingeschränkte Vertrauen der Eigentümer und des linksliberalen Flügels der Redaktion, dessen Mitglieder wussten, dass ich ihre Rückendeckung gegenüber nicht unbedingt linksliberalen Eigentümern war. Nicht zuletzt war meine Stellung stark, weil profil immer mehr nicht nur nationales, sondern auch internationales Ansehen besaß: Man achtete es in Deutschland – aber man kannte es selbst in Washington und im Kreml. Das führte zu erstaunlichen Einladungen, deren erste von einem Geheimdienstoffizier im Kreml ausging, der natürlich auch Vova Badian und meinen Cousin Alexander Traxler kannte, über deren glänzende Russlandgeschäfte ich im 13. Kapitel geschrieben habe. Offiziell war es eine Einladung der Firma meines Cousins, aber sie führte mich bis an den Schreibtisch des damaligen Chefs des Geheimdienstes, dessen Namen ich nicht mehr, dessen Schreibtisch ich aber in präziser Erinnerung habe, weil darauf mindestens zwanzig verschiedenfärbige Telefone standen, um sie auf diese Weise sofort unterscheiden zu können: Er war durch sie mit jedem wichtigen Machthaber des Systems direkt und abhörsicher verbunden. Ansonsten beeindruckte mich, dass er meine letzten Leitartikel zum sowjetischamerikanischen Verhältnis sicher besser als jeder österreichische Politiker kannte und nun durchaus rational und ohne wütende antiamerikanische Vorurteile mit mir diskutierte. Ich fragte meinen Cousin, wie das möglich sei und der gab mir eine damals verblüffende Antwort: Wenn jemand weiß, wie es wirklich um die USA und um Russland steht, dann der Geheimdienst. Wenn man mit Dir redet, will man Dich nicht missionieren, sondern erhofft sich seriöse zusätzliche Informationen. Kleinere Geheimdienstbeamte waren weniger beeindruckend. So war der Firma meines Cousins natürlich ein solcher zugeteilt, den er auch noch aus der Firmenkasse bezahlen musste und der mich in der Folge auf Schritt und Tritt begleitete, um mir Moskau zu zeigen. Mein Cousin hatte mir geraten, ein Dutzend billiger Feuerzeuge mitzunehmen und nun begriff ich warum: Bessere Restaurants waren zum Beispiel zugesperrt, obwohl darin offenkundig serviert wurde und auch genügend Platz frei war. Man wurde aber eingelassen, wenn man den Kellnern durch die Glastür ein Feuerzeug zeigt und es ihnen danach auch gleich in die Hand drückte.
Der Vorteil internationalen Ansehens
Für meinen Begleitoffizier hatte ich auf Anraten meines Cousins neben einem Feuerzeug noch etwas mitgenommen, was ihn geradezu beglückte: Tennisschuhe der Größe 42, denn die waren in ganz Moskau nicht zu kaufen. Was den Wert der Feuerzeuge bedingte, weiß ich nicht – sie mussten nur offenkundig „westlich“ sein, auch wenn sie in Wahrheit in China hergestellt wurden. Denn für einen Russen waren sie damit automatisch zehnmal so gut wie ein russisches Feuerzeug und damit ein Prestigeobjekt. Egal ob für Kellner oder Mädchen in Tanzlokalen. Prostitution gab es natürlich offiziell nicht – aber die hübschesten, intelligentesten Mädchen der Welt, die für ein Parfum zu jedem abendlichen Vergnügen bereit waren. Die, die mein Cousin mir als Begleiterin fürs Bolschoi-Ballett empfahl, war Ingenieurin. Dass sie abends in keiner Weise müde war, obwohl in der Sowjetunion damals jede Frau einen Beruf auszuüben und in einer Fabrik zu arbeiten hatte, lag daran, dass deren Schriftführer sie für ein kleines monatliches Entgelt als „anwesend“ eintrug, obwohl sie nie anwesend war. Es gab nur noch eine zweite Gruppe von Frauen, die der Arbeit auf die gleiche Weise entkamen: Neben den Prostituierten die Ehefrauen politischer Funktionäre. Auch sonst war Moskau so, wie die billigsten Klischees es beschrieben und wie Bruno Kreisky es gegenüber jenem Redakteur der Volksstimme entlarvend dargestellt hatte: Man bekam wirklich fast nichts zu kaufen – deshalb trugen Frauen wie Männer ständig eine Tasche mit sich, mit der sie sich überall anstellten, wo sich eine Schlange gebildet hatte. Denn das bewies, dass es dort etwas zu kaufen gab, und auch wenn man es selbst nicht brauchte, steckte man es in diese Tasche, um es gegen irgendeine andere rare Ware zu tauschen. Es gab wirklich die Straße, auf der ausschließlich die Spitzen des Kreml fuhren. Gleichzeitig mussten selbst hohe Funktionäre beim Parken immer die Scheibenwischer mitnehmen, weil sie so sonst zu hundert Prozent gestohlen worden wären. Mein höherer Begleitoffizier – jener, der mich eingeladen hatte – bezog tatsächlich nur das vierfache Gehalt eines Arbeiters, aber er konnte so viel Geld gar nicht ausgeben. Zum einen, weil es gehobene Güter, zu denen schon Tennisschuhe zählten, kaum gab. Zum anderen, weil ihm in seiner Position eine kostenlose 100-Quadratmeter-Wohnung und ein kostenloses Büro zustanden, während normalerweise zehn Bürger sich eine solche Wohnung teilen mussten. Dazu stand ihm ein kostenloses Auto zu, das er auch mitten auf der Kreuzung parken konnte. Als dort dennoch ein Polizist auf uns zukam, rechnete ich mit einer Ermahnung – aber ich irrte: er salutierte. Im Club der Offiziere konnte er jeden Tag einen Teller Kaviar samt jeder Menge Wodka um nur einen Rubel konsumieren, während man in Wien dafür das Zwanzigfache ausgelegt hätte. Man konnte in Moskau tatsächlich mit dem vierfachen Gehalt eines Arbeiters wie ein Krösus leben – wenn man zum Club gehörte.
257
258
Der Vorteil internationalen Ansehens
Auch das Gespräch, das wir dort führten, wird mir lange in Erinnerung bleiben: Ich kritisierte heftig die sowjetische Politik gegenüber dem damals von russischen Truppen besetzen Afghanistan, und mein Gegenüber gab mir in fast allen Belangen Recht. „Hat er nicht Panik, dass das am Nachbartisch einer versteht und an den Geheimdienst meldet?“, fragte ich wieder einmal erstaunt meinen Cousin. „Nicht im Geringsten – der Bericht landet auf seinem Schreibtisch.“ Ich schrieb über meine Erlebnisse in Moskau einen Bericht, den ich, glaube ich, „Die Feuerzeug-Gesellschaft“ nannte und mein Cousin hatte jedenfalls keinen Nachteil dadurch. Geheimdienstoffiziere waren zweifelsfrei unter den Männern, die Michail Gorbatschow 15 Jahre später die Überwindung des kommunistischen Systems ermöglichten, und auch wenn Wladimir Putin es jetzt zu einem ganz normalen diktatorischen System umgestaltet hat – eine intellektuelle Elite ihres Landes waren diese Offiziere des Geheimdienstes immer.
Die Naivität der Amerikaner Das galt auch für die Männer, die damals in den USA vergleichbare nachrichtendienstliche Positionen innehatten: Der Mann, der mich zu einer zweimonatigen Reise durch die Vereinigten Staaten einlud, war ein ungarischer Jude, Sohn eines Budapester Theaterdirektors, und seine Befugnisse erstreckten sich nicht nur auf Österreich, sondern über ganz Osteuropa. Nachdem ich ihn kennengelernt hatte, war ich stolz darauf, dass er unter die Leser des profil zählte – ich habe in meinem Beruf nur wenige ähnlich kluge Männer kennengelernt. Natürlich war meine Berichterstattung eine den USA genehme. Das lag daran, dass meine Emotion ihnen gegenüber einmal mehr durch die Erzählungen meiner Mutter vorgegeben waren. Ihre Befreiung aus dem Konzentrationslager Dachau durch die achte Armee Dwight D. Eisenhowers war für sie und wurde für mich „das“ Befreiungserlebnis. Die Amerikaner waren für sie und mich diejenigen, die uns von Hitler erlöst hatten. Und zwar ohne, wie die Russen, durch einen Angriff der deutschen Wehrmacht gefährdet zu sein. Sie hätten sich trotz der deutschen Kriegserklärung darauf beschränken können, auf ihrem Kontinent zu bleiben und Engländer und Russen nur weiterhin mit Waffen zu versorgen, statt wie sie in Europa zu sterben. Es ist schwer zu bestreiten, dass ihrem Feldzug gegen Hitler nicht ausschließlich eine eigennützige, sondern auch eine nicht unerhebliche moralische Motivation zu Grunde lag – die übrigens einer der Gründe ist, warum ehemalige Nazis den USA bis heute innerlich so viel feindseliger als Russland gegenüberstehen – sie können moralische Überlegenheit nicht ertragen. Allerdings besteht kein Zweifel, dass diese moralische Motivation für den Eintritt in den zweiten Weltkrieg mich relativ blind gegenüber reichlich amoralischen Aktivitäten der USA in anderen Bereichen gemacht hat. Es war mir nie ein sonderliches Anliegen,
Die Naivität der Amerikaner
ihre katastrophale Politik in Südamerika zu kritisieren. Wie Hugo Portisch, der mir diesbezüglich sehr ähnlich war, wollte ich lange nicht sehen, dass der Vietnamkrieg durch seine Dauer und die Art und Weise, wie er geführt wurde, zu einem Verbrechen ausartete. Beide, Portisch wie ich, waren wir zwar, wie ich meine zu Recht der Ansicht, dass Ho Chi Minhs Nordvietnam den Süden überfallen hat, aber wir übersahen, wie autoritär doch auch die südvietnamesische Führung war und wie viel weniger Rückhalt als Ho sie in der eigenen Bevölkerung hatte. Portisch schwärmte in seiner Kurier-Serie ausgiebig von den Wehrdörfern Südvietnams und auch mir schienen sie lange ein tauglicher Versuch, einen düsteren Feind abzuwehren. In Summe bedauerte ich die amerikanische Niederlage unter dem Motto: Auch wenn man einen Krieg in großer Entfernung von zu Hause aus anständigen Motiven führt, muss man ihn gewinnen, um nicht lauter verbrannte Erde zu hinterlassen. Statt dass ich erkannt hätte, dass die immer schlimmeren Kriegsverbrechen der US-Armee, dass Millionen abgeworfener Napalmbomben diesem Krieg den moralischen Anspruch genommen hatten. Mein letzter großer journalistischer Irrtum aus traditioneller Sympathie für die USA sollte sich 2003 ereignen: Ich war bereit, Colin Powell zu glauben, dass Saddam Hussein im Irak tatsächlich Massenvernichtungswaffen verbirgt – ich erinnere mich, wie ich auf der Journalismusakademie, wo ich unterrichtete, gegen alle Einwände meiner Studenten auf Powells Integrität bestand, weil ich einfach nicht wahrhaben wollte, dass die USA einen Kriegsgrund erfinden, obwohl die CIA auch den Grund für den Eintritt in den Vietnamkrieg erfunden hatte. Nicht zuletzt hatte an meinem so hartnäckig positiven Bild von den USA jener zweimonatige Besuch des Landes erheblichen Anteil, zu dem mir mein jüdisch-ungarischer Leser verholfen hat. Denn allein die Bedingungen, zu denen meine Einladung gewährt wurde, zeigten die USA von ihrer besten Seite: Ich könne reisen, wohin ich wolle; man sei bemüht, jedes von mir gewünschte Gespräch zu arrangieren – ganz gleich, ob ich einen linken Gewerkschafter, einen Apartheid-Kritiker oder einen General von West Point treffen wollte; und natürlich sei völlig egal, ob und was ich über meinen Aufenthalt schriebe: Man sei überzeugt, dass ich die USA am Ende meiner Reise mehr als zuvor zu schätzen wüsste. Über weite Strecken traf das auch zu. Ich lernte eine Reihe von Vorurteilen abzulegen. So hatte mir mein Vater, der 1948 in die USA emigriert war, dieses Land immer als kulturelle Wüste beschrieben. Nun lernte ich, dass es dort nicht nur die reichsten und größten Museen gab, sondern dass sie meist auch viel besser als europäische Kunstsammlungen auf die Bedürfnisse von Menschen eingerichtet waren, für die Kunst etwas Neues und Unbekanntes war: Es waren Stätten, die etwa auch Kinder zur Kunst erzogen und die dafür schon damals alle multimedialen Möglichkeiten nutzten. Museumsbesuche waren Familienfeste bis hin zum preiswerten Essen in vorzüglichen Museumsrestaurants. Gleichzeitig waren Kleinstädte ungeheuer stolz auf ihre kleinen Museen, selbst wenn die nur eine Skizze eines Impressionisten ihr Eigentum nannten – sie wurde dort wie eine Monstranz verwahrt und angebetet.
259
260
Der Vorteil internationalen Ansehens
Und natürlich gab es eine Menge Menschen, die unglaublich viel von Kunst verstanden. So war unter meinen Gastgebern ein Ehepaar, das die örtliche Wirtschaftskammer – dort eine kleine, unbedeutende Organisation – leitete und ungleich mehr über Österreichs aktuelle Literatur wusste als ich. Mein in die USA emigrierter Vater hatte sich offenbar geweigert, solche Menschen kennenzulernen – ich begegnete ihnen weit öfter als ich dachte. Besonders spannend verlief die Begegnung mit einem der Absolventen von West Point, General William Davis: Ein Mann, der diesen Beruf aus einem ähnlichen Motiv ergriffen hatte, aus dem ich mit 18 Berufsoffizier werden wollte – weil er den Krieg hasste. Nie hatte man im Gespräch mit ihm das Gefühl, einem Militär gegenüberzusitzen – seine Sorge, dass ein bloßes Missverständnis eine militärische, womöglich gar atomare Auseinandersetzung mit der Sowjetunion auslösen könnte, übertraf die jedes meiner Gesprächspartner aus der Politik. Viel mehr als einem General glaubte man einem unendlich vorsichtigen, kenntnisreichen Diplomaten gegenüberzusitzen. Solange die Generäle der USA so beschaffen sind, so dachte ich, werden sie jeden US-Präsidenten mehr als jeder Außenminister vor einem vermeidbaren Krieg warnen. Dass Davis zufällig ein Schwarzer war, hatte wahrscheinlich Einfluss darauf, dass ich dem schwarzen West-Point-Absolventen Colin Powell Jahrzehnte später so bedingungslos abnahm, dass Saddam Hussein tatsächlich Atomwaffen horte – die beiden Generäle verschwammen in meinem Unterbewusstsein zur gleichen denkbar integren Person. Der Kontakt mit Davis war ein so herzlicher, dass wir einander viele Jahre später in Wien wiedertrafen, um über Politik zu sprechen und dass er meinen jüngsten Sohn Eric, der damals Politikwissenschaften studierte, zu sich nach Washington einlud. Davis’ Sohn, so erfuhr ich auf diese Weise, gelang es als Journalist Einblick in den Ku-KluxKlan zu erlangen und darüber ein wichtiges Buch zu schreiben. Es besteht also eine vage Chance, dass der Kontakt mit meiner Generation nicht ganz abreißt. Mein Hauptinteresse während dieser offiziösen Reise in die USA galt der Apartheid, weil ich sie für die größte Schwäche der USA hielt. Aber auch diesbezüglich erlebte ich eine Überraschung: Ein Urteil, das der Oberste Gerichtshof erst wenige Jahre zuvor gefällt hatte, revolutionierte das Land auf unglaubliche, beispielhafte Weise: Schwarze, so hielt der Gerichtshof in diesem Urteil fest, seien in den USA durch Jahrhunderte unterdrückt worden – daher sei es zulässig und widerspreche nicht dem Gleichheitsgrundsatz, sondern erfülle ihn endlich, dass Schwarze nunmehr für längere Zeit bevorzugt würden – so lange, bis echte Gleichberechtigung erreicht sei. Das gleiche gelte für Frauen: Auch sie seien durch Jahrhunderte unterdrückt, Männern längst nicht gleichgestellt gewesen – auch sie seien daher so lange zu bevorzugen, bis echte Gleichberechtigung erreicht sei. Das oberstgerichtliche Urteil hatte eine Reihe konkreter Gesetze zur Folge. Voran: Schwarze und Frauen mussten auch dann an Universitäten aufgenommen werden, wenn sie einen schlechteren Notendurchschnitt als Weiße und Männer hatten. In
Die Naivität der Amerikaner
Unternehmen, die Staatsaufträge erhielten, waren sie bei der Ausbildung zu Fachkräften Weißen beziehungsweise Männern vorzuziehen. Jeder zweite schwarze Anwärter auf Fachausbildung hatte eine solche zu erhalten, obwohl das in keiner Weise dem schwarzen Bevölkerungsanteil entsprach. Man kann sich vorstellen, dass das für den zurückgestellten weißen, männlichen Anwärter für einen gehobenen Job nicht ganz leicht zu verdauen war, und es ist heute einer der Gründe dafür, dass Donald Trump unter „weißen, älteren Männern“ so besonders viele Anhänger hat. Auf meiner Reise stieß ich rundum auf die enormen Probleme, zu denen das Urteil führte und die selbst schwarze Gesprächspartner einbekannten: Schwarze wollten sich in Krankenhäusern zum Beispiel nicht von schwarzen Ärztinnen behandeln lassen, weil die den Ruf hatten, ungleich schlechter als ihre männlichen oder gar weißen Kollegen zu diagnostizieren, zu behandeln oder zu operieren. In einer Zeitung – Zeitungen beugten sich dem oberstgerichtlichen Urteil fast durchwegs freiwillig – stieß ich auf folgendes Bild: In der sowieso untergeordneten Abteilung für „Haus und Garten“ saßen lauter schwarze Journalistinnen einem einsamen weißen Chef gegenüber, der jeden ihrer Beiträge im Eilzugtempo restlos umschrieb. Ob das nicht böses Blut schaffen müsse, fragte ich ihn. Als Antwort drückte er mir die Originalfassung des Textes in die Hand, den er eben umgeschrieben hatte: Sie war keinem Zeitungsleser zuzumuten. Als ich meinen Gastgeber nach meiner Reise wieder traf, um ihm meine Eindrücke zu schildern, ging ich entsprechend lang auf dieses Thema ein. „Glauben Sie nicht“, fragte ich ihn, „dass die Art und Weise, wie man es in Angriff genommen hat, die Apartheid zu beenden, ein wenig naiv ist?“ Seine Antwort war eine der weisesten, die ich je erhalten habe: „Wurden nicht alle großen Fortschritte der Menschheit nur auf naive Weise erzielt?“ Tatsächlich sind Schwarze heute in den USA in einem ursprünglich kaum glaublichen Ausmaß nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch gleichberechtigt. Es ist undenkbar, dass sie nicht wie Weiße zu Bürgermeistern, Oberbefehlshabern oder Ministern würden. Es gibt mehr schwarze Rechtsanwälte als ihrem Bevölkerungsanteil entspricht. Mit Colin Powell führte ein Schwarzer die amerikanischen Streitkräfte an. Und mit Barak Obama konnte ein Schwarzer Präsident der Vereinigten Staaten sein. Dass Donald Trump ihm folgte und die Ermordung eines Schwarzen durch weiße Polizisten im Juni 2020 riesige Demonstrationen auslösten, ist wie gesagt wahrhaftig auch kein purer Zufall – aber geschichtlich betrachtet wird es eine Episode bleiben.
261
40. Der Konflikt Kreisky–Wiesenthal
Wenn man will – und viele Sozialdemokraten wollen das – kann man in der Affäre Kreisky-Peter-Wiesenthal auch nur eine Episode innerhalb der Ära Kreisky sehen, die in Summe zweifellos eine große Ära war. Aber gerade nachdem man im Rahmen der kurzen Koalition zwischen Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache erlebt hat, was Koalieren mit der FPÖ bedeutet, muss man sich fragen, ob dem, was zwischen Bruno Kreisky und Friedrich Peter passiert ist, nicht doch grundsätzliche Bedeutung zukommt: Schließlich war es die erste abgesprochen Zusammenarbeit dieser Art innerhalb der zweiten Republik. Ich bin nicht sicher, ob es die folgenden Koalitionen unter Fred Sinowatz, Wolfgang Schüssel und zuletzt Sebastian Kurz ohne dieses Vorbild jemals gegeben hätte. Denn bis dahin hatten SPÖ wie ÖVP eine über das Tagesgeschäft hinausgehende Zusammenarbeit mit dieser Partei abgelehnt, solange ihre Funktionäre keinen eindeutigen Schlussstrich unter die „Vergangenheit“ gezogen hatten. „Nationale“ Wähler mussten bis dahin zu dem Eindruck gelangen, ihre Stimme zu verschenken, wenn sie sie weiterhin einer FPÖ gaben. Denn ohne Chance auf Regierungsbeteiligung hatte sie auch keine Chance, Posten oder Wohnungen zu vergeben. Es war für „Ehemalige“ viel nützlicher Aufnahme (und Posten) innerhalb der ÖVP wie der SPÖ zu finden, die um diesen Wählerzuwachs buhlten. Die FPÖ als Partei drohte daher in den späten 1960er Jahren mangels politischen (und damit auch wirtschaftlichen) Einflusses zu entschlafen. Es war fraglich, ob sie weiterhin die Fünf-Prozent-Hürde schaffen würde. Das änderte sich durch Bruno Kreisky: Indem er klarmachte, dass er gewillt ist, mit der FPÖ Friedrich Peters zu koalieren, machte er auch klar, dass diese Partei in Zukunft politischen Einfluss haben und damit vielleicht doch Posten und Wohnungen vergebenen würde. Damit war es nicht mehr sinnlos, die FPÖ zu wählen, wenn man ihr innerlich nahestand. Ohne Kreiskys Eingreifen, so behaupte ich, hätte eine erhebliche Wahrscheinlichkeit bestanden, dass die FPÖ in den 1970er Jahren als Partei entschlafen wäre und ihre Wähler in SPÖ, ÖVP und vielleicht auch den Grünen aufgegangen wären. Simon Wiesenthal sah das ähnlich und hielt es wie ich für eine fatale Weichenstellung. Was diese politische Ablehnung einer politischen Weichenstellung bei Wiesenthal zur persönlichen Abneigung gegen Kreisky steigerte, war aber erst die Zusammensetzung der Minderheitsregierung, die 1970 durch die Duldung der FPÖ zustande kam. Bekanntlich gehörten ihr nicht weniger als vier ehemalige NSDAP-Mitglieder, darunter ein SS-Mann an.
Der Konflikt Kreisky–Wiesenthal
Das ließ Wiesenthal öffentlich protestieren und auch ich halte es für das katastrophale Durchbrechen eines bis dahin aufrechten Cordon sanitaire: Wie soll die Bevölkerung es für problematisch halten, Männer in eine Regierung aufzunehmen, die sich nie unmissverständlich von ihrer braunen Vergangenheit distanziert haben, wenn der jüdische Bundeskanzler kein Problem darin sieht? Schon als Wiesenthal diese Regierungszusammensetzung 1970 kritisierte, nannte ihn Wiens beliebter Bürgermeister Leopold Gratz (für sich genommen ein harmloser Napola-Absolvent – aber später durch den Kriminalfall Lucona zu trauriger Berühmtheit gelangt) zur Freude Bruno Kreiskys den „Kopf einer privaten Spitzel- und Staatspolizei, die sich gesetzwidriger Methoden bedient“. 1975 sollte Kreisky diese Anschuldigung auf abenteuerliche Weise wiederholen. Politischer Ausgangspunkt dieser Zuspitzung war, dass Kreisky zu diesem Zeitpunkt fälschlich befürchtete, nicht neuerlich eine absolute Mehrheit zu erreichen und die FPÖ daher – wie schon seinerzeit geplant – als Koalitionspartner zu brauchen. Das hätte bedeutet, dass ihr Obmann Friedrich Peter Vizekanzler geworden wäre. Das Schicksal wollte es, dass Simon Wiesenthal meines Erachtens erst kurz davor, vielleicht aber auch schon früher – es macht keinen wesentlichen Unterschied – ausgerechnet in einem Buch, das im ÖGB-eigenen „Europa-Verlag“ verlegt wurde, auf das „Kriegstagebuch der 1. SS Infanteriebrigade (mot)“ gestoßen war und dabei als eines von deren Mitgliedern einen Friedrich Peter entdeckt hatte, der sich nach genauer Überprüfung als ident mit dem FPÖ-Obmann Friedrich Peter herausstellte und der Einheit durch zwei Jahre angehört hatte. Peter selbst hatte immer angegeben, im Krieg der Waffen-SS angehört zu haben und die war – auch in Wiesenthals und meinen Augen – nicht automatisch eine „kriminelle Organisation“. Die 1. SS-Infanteriebrigade hingegen gehörte erstens zur allgemeinen SS und war zweitens – das ergab das Tagebuch – eine Woche für Woche mit Massenmord befasste Mörderbande schlimmster Art: Sie mordete durch Jahre nur hinter der Front, und sie ermordete Frauen und Kinder nicht anders als Männer. Wiesenthal wagte zu meinen, dass jemand, der zwei Jahre hindurch Mitglied dieser Einheit gewesen ist, in ihr mit einem Orden ausgezeichnet wurde und sich zu keinem Zeitpunkt von ihr distanziert hat, nicht geeignet sei, Vizekanzler der Republik Österreich zu werden und übergab Bundespräsident Kirchschläger ein entsprechendes Dossier. Viele Granden der SPÖ – Karl Blecha, Hannes Androsch, Elisabeth Pittermann – sind bis heute der Ansicht, dies sei ein übler Akt des überzeugten VP-Wählers Wiesenthal gewesen. Ich meine, dass jeder, der in Kenntnis dieser Umstände war, die Pflicht gehabt hätte, Peter als Vizekanzler zu verhindern. Und ich lege in langjähriger Kenntnis Wiesenthals meine Hand dafür ins Feuer, dass er nicht anders gehandelt hätte, wenn die ÖVP Friedrich Peter als Vize-Kanzler vorgesehen hätte. Aber in Österreich will man nicht nur nicht glauben, dass Journalisten ihrem Gewissen folgen, – man bezweifelt es auch bei einem Juden, der wie durch ein Wunder das KZ überlebt hat und nun nicht von einem Mann regiert werden will, der seine
263
264
Der Konflikt Kreisky–Wiesenthal
Zugehörigkeit zu einer besonders üblen SS-Einheit verschwiegen hat. Sondern man sieht darin „politische Gegnerschaft“. Da ich Wiesenthals Verhalten aus nächster Nähe miterlebt habe, muss ich in diesem Zusammenhang mit einer ganzen Reihe von Vorurteilen aufräumen. Eines davon lautet, dass Wiesenthal auf Seiten der ÖVP hasserfüllt gegen die SPÖ gekämpft hätte. Das ist in dieser Form falsch. Zweifellos war Wiesenthal insofern ein eindeutig Bürgerlicher, als ihn das in der Nachkriegszeit noch stark marxistische Vokabular der SPÖ befremdet hat. Aber von hasserfüllter Gegnerschaft kann nicht die Rede sein: Er schätzte meine Mutter, die eine deklarierte Sozialdemokratin war und er nahm mich in sein Team auf, obwohl auch ich damals ein deklarierter Sozialist gewesen bin. Was ihn gegen die SPÖ einnahm, waren ausschließlich die konkreten Erfahrungen, die er im Rahmen seiner ganz spezifischen Arbeit mit ihr machte: Er, der Nazi-Mörder den Gerichten überantworten wollte, musste erleben, wie der rote Innenminister Oskar Helmer – ein deklarierter Antisemit – dem roten Justizminister Otto Tschadek einen NS-Massenmörder nach dem anderen zur Begnadigung empfahl, und wie der rote Bundespräsident Adolf Schärf alle dieser Begnadigungen durchführte. Danach musste er erleben, wie unter dem roten Justizminister Christian Broda Massenmorde an Juden überhaupt nur mehr in Ausnahmefällen zur Anklage gelangten. Ich, als sozialdemokratischer Journalist, konnte die SPÖ wegen ihrer allgemeinen Politik der ÖVP dennoch vorziehen und Christian Broda für seine liberalen Rechtsreformen dennoch bewundern – Simon Wiesenthal, der NS-Verbrecher der Justiz überantworten wollte, konnte das nicht. Das erklärt auch sein gespanntes Verhältnis zur stets rot dominierten israelischen Kultusgemeinde. Deren Funktionäre schätzten die SPÖ begreiflicherweise für die Unterstützung, die sie der Gemeinde zuteilwerden ließ. Aber für Simon Wiesenthal, der für rechtliche Genugtuung an jüdischen Mordopfern kämpfte, musste unbegreiflich sein, dass diese Funktionäre das völlige Versagen der roten Justiz mit keinem Wort kritisierten. Ähnlich hat sich auch Simons Verhältnis zu Bruno Kreisky entwickelt. Er hatte zu Kreisky – ich bin dafür Zeuge – ursprünglich überhaupt keine Meinung. Die bildete sich erst, als er erlebte, wie Kreisky die FPÖ aufwertete, indem er mit ihr eine Defacto-Koalition einging. Und wie er in die Minderheitsregierung, die er dadurch bilden konnte, eben gleich vier ehemalige Nationalsozialisten, darunter einen SS-Mann berief. Ich war zwar auch irritiert, aber ich habe Kreiskys SPÖ trotzdem für eine weitere Amtsperiode gewählt. Doch ich war damals Chefredakteur des profil, dessen Interesse vor allem der Öffnung und Modernisierung Österreichs galt. Simon Wiesenthals Interesse galt vor allem der Aufarbeitung des Nationalsozialismus – es musste ihn bestürzen, wie Bruno Kreisky dessen einstige Bannerträger salonfähig machte. Trotzdem hasste Simon Wiesenthal Bruno Kreisky in keiner Weise – er war nur außerstande, ihn zu verstehen. „Kreisky meint, die Leute werden ihn nicht mehr für
Der Konflikt Kreisky–Wiesenthal
einen Juden halten, weil er sich mit so vielen Ehemaligen umgibt“, formulierte er es mir gegenüber „in Wirklichkeit ist er nur ihr Hausjud.“ Als Wiesenthal 1975 dem Kriegstagebuch der 1. SS Infanteriebrigade entnahm, dass Friedrich Peter zwei Jahre lang Dienst tat, tat er also etwas völlig Selbstverständliches, indem er dieses Material dem Bundespräsidenten übergab – es bedurfte dazu keines Hasses gegen Bruno Kreisky. Aber obwohl Wiesenthal die Übergabe des Materials ausdrücklich so terminisierte, dass sie den Wahlausgang nicht beeinflussen konnte, ist Bruno Kreisky auf die bekannte Weise ausgerastet: Er nannte Wiesenthal eine Mafia, die Privatjustiz übe und unterstellte ihm schließlich, überlebt zu haben, indem er mit der Gestapo kollaborierte. Der deutsche Staatsanwalt Rolf Si,chting, der Wiesenthals KZ-Akte kannte und wusste, dass er überlebt hat, weil zwei anständige Deutsche den ihnen als Zwangsarbeiter zugeteilten Juden unter Gefahr für sich selbst vor der Erschießung gerettet hatten, nannte Kreiskys Äußerungen „infam“ und meinte, ich könnte ihn damit zitieren. Ich, der in Wiesenthals Büro gearbeitet hatte, die Umstände seines Überlebens nicht minder genau kannte und darüber hinaus wusste, dass er keinen Schritt ohne Verständigung der zugehörigen Strafbehörden unternahm, nannte sie bloß „opportunistisch“ und im Zusammenhang mit der Spitzel-Anschuldigung „ungeheuerlich“, „unmoralisch“ und „würdelos“. Dazu stehe ich bis heute. Nicht, weil ich, wie man mir nachsagt, ein Kreisky-Feind bin, sondern weil ich diese seine konkrete Aktion, im Gegensatz zu vielem, was er sehr wohl für Österreich geleistet hat, ungeheuerlich finde. Ich habe damals im profil aufgefordert, dass Leute, die das ähnlich sehen, sich melden mögen: Es meldeten sich ganze zwölf Personen, darunter der Politologe Anton Pelinka und Helga Treichl, die Frau des Chefs der Creditanstalt (CA) Heinrich Treichl, dessen Job sie damit riskierte. Nicht meldeten sich die großen Antifaschisten des Landes und der SPÖ, vom Bildhauer Alfred Hrdlicka über die Historikerin Erika Weinzierl bis zu Günther Nenning. Bruno Kreiskys Handeln war Linken und Genossen heilig. Gegenüber der Öffentlichkeit erklärte Kreisky, Friedrich Peter genieße so lange sein volles Vertrauen, als nicht erwiesen sei, dass seine Einheit an Erschießungen teilgenommen hat. Das ließ mich meine alten Beziehungen zur „Mafia“ wieder aufnehmen: Ich rief meinen holländischen Kollegen Jules Huf an und der beschaffte aus Deutschland einen Akt, aus dem hervorging, wie Peters Kompanie an einem einzigen Tag 1.089 jüdische Einwohner des Dorfes Leltschitky in die von ihnen ausgehobenen Gräben geschossen hat. Vom ORF zu seinen Einsätzen bei der SS-Infanteriebrigade befragt, erklärte Friedrich Peter: „Ich habe nur meine Pflicht getan.“ Kreisky dachte nicht daran, ihm sein Vertrauen zu entziehen. 83 Prozent der Österreicher fanden, dass er in der Auseinandersetzung mit Wiesenthal Recht hat. Die SPÖ forderte einen verfassungswidrigen Ausschuss zur Unter-
265
266
Der Konflikt Kreisky–Wiesenthal
suchung von Wiesenthals Tätigkeit. Die Kronen Zeitung forderte, ihn des Landes zu verweisen. Als ich Wiesenthal in diesen furchtbaren Tagen seiner nationalen Ächtung besuchte, erzählte er mir unter Tränen: „Als ich gestern mit meiner Frau im Türkenschanzpark spazieren war, haben uns die Leute angespuckt. Cyla hat gesagt, dass sie es nicht mehr aushält: Wir sollten zu Paulinka nach Israel gehen. Meinst Du, dass ich aufgeben soll?“ „Nein“, habe ich gesagt, „zumindest Du musst das durchstehen.“ Ich zähle es bis heute zu Wiesenthals größten Leistungen, dass er den Hass ertragen hat, der ihm in Österreich allenthalben entgegengeschlagen ist. Das hat sich erst geändert – auf eine sehr charakteristische Weise geändert – als Wiesenthal Kurt Waldheim gegen den Vorwurf in Schutz genommen hat, ein Kriegsverbrecher zu sein. Wieder haben das manche Leute dem Umstand zugeschrieben, dass Waldheim der Präsidentschaftskandidat der ÖVP gewesen ist. Wieder muss ich dieser Unterstellung aus jahrzehntelanger Kenntnis Wiesenthals entgegentreten: Er hätte einen SPÖ-Kandidaten ganz genau so gegen den falschen Vorwurf eines NS-Verbrechens in Schutz genommen.
41. Ein Mann ohne Eigenschaften
Kurt Waldheim erregte meine politische Aufmerksamkeit erstmals, als ich noch beim Kurier war und für diesen vom Einmarsch der Russen in Prag berichtete. Österreichs späterer Bundespräsident Rudolf Kirchschläger war damals dort Botschafter und spielte eine hervorragende Rolle: Er nahm zahllose tschechische Dissidenten schützend ins Botschaftsgebäude auf. Er handelte damit rundum gegen eine Anordnung des damaligen Außenministers der Regierung Klaus, Kurt Waldheim, der strikt neutrales Verhalten eingefordert hatte. Und es charakterisiert beide Männer: Kirchschläger, der Mut zeigte und dabei keineswegs gegen ein Gesetz oder die Neutralität verstieß – und Waldheim, der ja nichts falsch machen, sich bei den mächtigen Russen ja nicht unbeliebt machen wollte. Keine eigene Meinung zu entfalten oder jedenfalls erkennen zu lassen, war zweifellos die unter seinen Eigenschaften, die ihn zum Generalsekretär der Vereinten Nationen aufsteigen ließ: Alle Beteiligten konnten sicher sein, dass er, anders als etwa Dag Hammarskjöld, nie von sich aus politische Initiative entfalten würde. Bruno Kreisky hatte seine Kandidatur für diese Funktion nach Kräften unterstützt und stets in den höchsten Tönen von seinen außenpolitischen Fähigkeiten gesprochen – ob aus Überzeugung oder weil es Österreich natürlich ehrte, den UN-Generalsekretär zu stellen, weiß ich nicht. Dass in Waldheims Amtszeit besonders viele antiisraelische Resolutionen beschlossen wurden, was Juden in aller Welt ihm übelnahmen und eine entscheidende Rolle in seiner „Affäre“ spielen sollte, war meines Erachtens kein Nachweis einer antisemitischen Einstellung, sondern Ausfluss der Mehrheitsverhältnisse in der Vollversammlung: Die Mehrheit der UN-Mitglieder war nun einmal gegen die israelische Politik und Waldheim hätte allenfalls versuchen können, schwankende Mitglieder umzustimmen. Das hätte sicher nicht gereicht, die Resolutionen abzuwenden, aber es hätte ihn bei den zahlreichen antiisraelischen Mitgliedern unbeliebt gemacht – und das vermied er tunlichst. Nur bei Israelis und Juden unbeliebt zu sein – so würde ich es formulieren – störte ihn nicht. (Zur Qualität der Resolutionen will ich mich hier genauso wenig äußern wie zur Qualität der israelischen Politik jener Jahre. Nur Zionismus in einer dieser Resolutionen mit Rassismus gleichzusetzen, war zweifellos absurd.) Dass die ÖVP Waldheim nach seinem Abschied als UN-Generalsekretär als ihren Kandidaten für die Wahl des Bundespräsidenten im Jahr 1983 aufstellte, war von ihr aus gesehen logisch: Die Österreicher würden einen Mann, der ein so hohes Amt bekleidet hatte, natürlich für einen großen Mann halten. Auch wenn er dieses Amt genau umgekehrt voran seiner totalen Bedeutungslosigkeit und der relativen Bedeutungslosigkeit Österreichs verdankte.
268
Ein Mann ohne Eigenschaften
Die ÖVP konnte zu Recht hoffen, der SPÖ mit Waldheim zum ersten Mal nach vielen Jahren eine Wahlniederlage zuzufügen. Fred Sinowatz, der die SPÖ eben erst von Bruno Kreisky übernommen hatte, musste zu Recht fürchten, seine erste Wahlniederlage zu erleiden und reagierte hysterisch: Aus Österreich gelangten Informationen, die Waldheims Vergangenheit, voran seinen Dienst bei der deutschen Wehrmacht ins Zwielicht rückten, in die USA und über einen Artikel der New York Times zurück nach Österreich. Damit sollte 1981 die Affäre Waldheim beginnen, über die ich in einem späteren Kapitel ausführlich berichten werde. Hier nur so viel: Gegen Waldheim wurden diverse, mehr oder minder zutreffende Beschuldigungen erhoben, deren gravierendste in der Behauptung bestand, er hätte Kriegsverbrechen begangen – dafür fehlte jeder Beweis. Es weiß das niemand so genau wie ich, denn der Einzige, der es ebenso genau wusste, der einstige Chefredakteur des profil, Hubertus Czernin, ist leider tot. Gemeinsam haben wir mit aller Akribie, die ich bei Wiesenthal gelernt habe und für die Czernin berühmt geworden ist, jeden Schritt und jede Handlung Waldheims untersucht – ungleich genauer untersucht als irgendwer sonst – und die Ergebnisse waren eindeutig: Es gibt keine Indizien und schon gar keinen Beweis, dass Waldheim in der NS-Zeit an Verbrechen beteiligt war. Dass Wiesenthal ihn gegen den Vorwurf, ein Kriegsverbrecher zu sein, in Schutz nahm, war daher zu hundert Prozent gerechtfertigt. In Österreich hat Waldheim die Wahl zum Bundespräsidenten bekanntlich aus den absolut falschen Gründen turmhoch gewonnen und gleichzeitig ist Simon Wiesenthal aus den absolut falschen Motiven plötzlich – weil er ihn gegen einen falschen Vorwurf in Schutz genommen hatte – zur persona grata geworden: Die Kronen Zeitung, die ihn wegen seines Hinweises auf den zweijährigen Dienst Friedrich Peters in eine SSMordbrigade des Landes verweisen wollte, hat ihn auf einmal gefeiert. Im Ausland ist Wiesenthals so berechtigte Verteidigung Waldheims hingegen denkbar schlecht angekommen: Sie hat ihn den Friedensnobelpreis gekostet.
42. Gut, dass Kreisky ein Demokrat war
Bruno Kreisky ist für mich unverändert ein herausragender Politiker, der große Verdienste um Österreich errang, und ich habe ihn dafür durch Jahre auch gewählt. Persönlich fand ich ihn darüber hinaus anständig, ausnehmend nett und war in Grenzen mit ihm befreundet – aber kritiklose Bewunderung ist mir grundsätzlich fremd. Und wer Kreisky nicht kritiklos bewunderte, wurde zum „Kreisky-Hasser“ hochstilisiert und in dieser Eigenschaft zu TV-Diskussionen eingeladen. Die Faszination, die die autoritäre Vaterfigur Bruno Kreisky ausübte, macht mir als Österreich-typisch bis heute Angst: Wäre Kreisky nicht Gott sei Dank ein Demokrat gewesen, in Österreich wären ihm die Menschen, nicht anders als Adolf Hitler, überall hin gefolgt – die sogenannten Eliten miteingeschlossen. Die Österreicher sehnen sich bis heute nach einem Kaiser. Nicht einmal Kreiskys öffentliche Äußerung: „Wenn die Juden ein Volk sind, dann sind sie ein mieses“, ließ sie erkennen, dass er ein offenkundig verqueres Verhältnis zu seinem Judentum hatte. In meinen Texten anlässlich der Auseinandersetzung mit Simon Wiesenthal habe ich dieses verquere Verhältnis darzustellen versucht, um sein Fehlverhalten zwar nicht zu entschuldigen, aber zu relativieren – und versuche es hier wieder: Juden sind in Österreich in einem solchen Ausmaß mit dem ubiquitären Antisemitismus konfrontiert, dass sie nur zwei Möglichkeiten einfachen psychischen Überlebens haben: Sich in ihrem Judentum abzukapseln oder sich maximal zu assimilieren – so zu werden wie (fast) jeder Österreicher. Kreisky gelang das: Er wurde wie (fast) jeder Österreicher ein bissl’ ein Antisemit. Ich habe für diesen jüdischen Antisemitismus also ein gewisses Verständnis – Kreisky teilt ihn mit dem großen Karl Kraus – in der Affäre Peter Wiesenthal verlor er nur jedes Augenmaß: Er verhielt sich – ausnahmsweise – tatsächlich „ungeheuerlich“. Auch die Justiz jener Jahre verhielt sich charakteristisch: Obwohl Bruno Kreisky für Wiesenthals Verdächtigung als Gestapospitzel nicht das kleinste Indiz zu präsentieren vermochte, wurde ich in letzter Instanz schuldig gesprochen, weil ich sein Verhalten „ungeheuerlich“ genannt hatte. Ein solches Werturteil, so urteilte das Oberlandesgericht über meine Nichtigkeitsbeschwerde, stünde einem Journalisten nicht zu. Erst zehn Jahre später zerriss der Europäische Gerichtshof dieses Urteil in der Luft. Auch die Meinungsfreiheit musste sich in Österreich erst sehr langsam ihren Weg bahnen und hätte es ohne EuGH wohl nie geschafft. Bruno Kreisky fiel es besonders schwer, damit umzugehen und es lohnt, das im Detail zu wiederholen: Bei der Zürcher Zeitung erreichte er den Rückzug eines ÖsterreichKorrespondenten, der ihn nicht kritiklos für den größten Kanzler aller Zeiten hielt; Peter
270
Gut, dass Kreisky ein Demokrat war
Rabl, der ihn wie ich differenziert zu sehen versuchte, versagte er nach einer kritischen Frage jedes weitere Interview; Gerd Bacher wurde dank Kreiskys Intervention im letzten Moment doch nicht Intendant eines deutschen Fernsehsenders. In meinem Fall wendete sich Kreisky als erster und einziger Politiker an die Eigentümer des profil und verlangte dort meine sofortige Absetzung. Damit bin ich zurück beim Präsidenten der Industriellenvereinigung Hans Igler. Wie jedem Präsidenten der Vereinigung österreichischer Industrieller musste ihm an einem guten Einvernehmen mit dem Kanzler gelegen sein. Bei Igler kam aber noch ein beträchtliches privates Interesse hinzu: Er stand mit der Regierung in Verhandlungen wegen eines Kredites für seine maroden Textilunternehmen. Dennoch lehnte Igler meine Kündigung in der Sekunde ab und ich meine, dass das Respekt verdient. So wie es Respekt verdient, dass Kreiskys Regierung ihm den erhofften Kredit trotz dieser Weigerung gewährte. Profil, unabhängig wie immer, berichtete kritisch, dass Iglers Textilwerke trotz des Kredits zugrunde gegangen sind und dass der Kredit zu Lasten der Republik viel Geld gekostet hat. „Medienkanzler“ Kreisky war zwar intolerant, aber nicht nachtragend. Auch nicht mir gegenüber: Nach seinem Abschied aus der Politik im Jahr 1983, als plötzlich viele Medien seine partiellen Fehler entdeckten und ihn kaum mehr beachteten, freute er sich über die großen Interviews, in denen profil ihn jeden Sommer zu Wort kommen ließ, und wir grüßten einander so freundlich wie zu Beginn seiner Amtszeit. Mit Helga Treichl – die sein Verhalten in der Causa Wiesenthal als eine von zwölf profil-Lesern wie ich „ungeheuerlich“ gefunden hatte, wurde er, wie mit mir, per Du. Es war ihm, so bin ich überzeugt, persönlich unmöglich, „nachtragend“ zu sein. Denn es war ein Kennzeichen seiner psychischen Struktur, dass er von allem Menschen geliebt werden wollte. Auch und vor allem von denen, die ihm kritisch gegenüberstanden: Von Angehörigen des Adels zum Beispiel, die in Österreich mit Ausnahmen, die die Regel bestätigten, fast durchwegs einem leisen katholischen Antisemitismus anhingen und in deren Kreise Bruno Kreisky in seiner Jugend sicher nie Aufnahme finden konnte. Als Bundeskanzler führte er ihnen vor, wie ungerecht das ihm gegenüber gewesen ist: Er beendete den Habsburger-Kannibalismus der SPÖ; er ließ sich unter dem Bild Maria Theresias fotografieren – nicht nur, um sich selbst zu erhöhen, sondern auch um der kaiserlich-königlichen Vergangenheit Österreichs die Referenz zu erweisen; er ernannte den Adeligen Karl Lütgendorf gegen einigen Widerstand zum Verteidigungsminister, obwohl es unter Parteifreunden qualifiziertere Bewerber gab. Auch keineswegs nur aus politischem Kalkül, sondern auch aus innerem Antrieb trieb er die Aussöhnung mit der katholischen Kirche voran, die den Antisemitismus, unter dem er gelitten hatte, grundgelegt hat: Auch die Katholiken sollten sehen, wie falsch sie damit lagen, in einem „jüdischen Kanzler“ einen kirchenkritischen Kanzler zu vermuten.
Gut, dass Kreisky ein Demokrat war
In Wirklichkeit entsprang auch sein erstaunliches Verhältnis zu ehemaligen Nationalsozialsozialisten diesem seinem Wunsch, von allen geliebt zu werden: Sie sollten erleben, dass sie in ihm, dem jüdischen Kanzler, den Mann hatten, der sie von einem Makel befreite. Ich betrachte diesen Wunsch Bruno Kreiskys, geliebt zu werden, bei aller kritischen Distanz mit Sympathie: Er war ein wesentlicher Grund für seinen Erfolg bei den Menschen.
271
43. Versöhnung mit den Nazis – aber wie?
Bruno Kreisky ist seit vier Jahrzehnten tot, aber der Umgang mit dem Nationalsozialismus, so hat die türkis-blaue Koalition gezeigt, ist unverändert ein Problem. Voran eines der FPÖ mit ihrer Vielzahl von „Einzelfällen“. Aber eben auch ein Problem der gesamten Nation: Es gibt in keinem anderen Land eine vergleichbar große Partei mit derart offenkundigen braunen Rändern. Die AfD, die man am ehesten mit ihr vergleichen kann, hat diese Ränder zwar auch, aber Liederbücher, in denen die Vergasung der siebenten Million Juden besungen wird, sind im Umkreis ihrer Kader noch nicht aufgetaucht. Und vor allem ist undenkbar, dass Angela Merkel die Koalition mit der AfD einer Koalition mit der SPD so vorgezogen hätte, wie Sebastian Kurz die Koalition mit der FPÖ einer Koalition mit der SPÖ. Und das hat unverändert mit der ganz besonderen Beziehung der Österreicher zur „Vergangenheit“ zu tun: Die wurde hier nie „verarbeitet“, sondern verdrängt und verschlampt. Ich habe dazu seinerzeit im Zusammenhang mit der Affäre Kreisky-PeterWiesenthal einen Kommentar geschrieben, der mir unverändert relevant erscheint: „Es gibt in Österreich ein seltsames Phänomen: den hartnäckigen Widerstand zu differenzieren. Wirtschaftskriminalität wird hier niemals geächtet werden, weil die feste öffentliche Meinung herrscht, dass ‚eh alle‘ Firmen, die Großaufträge bekommen, dafür bestechen und ‚eh alle‘ Politiker, die Großaufträge vergeben, sich bestechen lassen. Diese Bereitschaft in ‚allen‘ Schuldige zu sehen, führt in der Praxis dazu, dass auch der übelste Einzelne ‚unschuldig‘ auf seinem Sessel bleiben kann.“ Was den Nationalsozialismus betrifft, ist ein ähnliches Phänomen eingetreten: Man streitet darüber, ob wir „alle“ auf eine kollektive Weise schuldig geworden oder – ebenfalls „alle“ – schuldlos in die von uns losgelösten Verbrechen eines fernen „Dritten Reichs“ verwoben wurden. Zwischen zwei so gewaltigen philosophischen Alternativen ersparen wir uns die Auseinandersetzung mit konkreter, erkennbarer und beurteilbarer Schuld. Schuld im Sinne des Strafrechts: Bei denen, die während des Krieges ganz gewöhnlich gemordet haben (manchmal unter den mildernden Umständen der Hysterie und des Druckes, für die es im geltenden Strafrecht die entsprechenden Strafmilderungsgründe gibt). Schuld im Sinne des Kriegsrechts: Bei denen, die jenes Minimum an Fairness verletzt haben, das auch in Kriegen vereinbart ist. Schuld im Sinne politischer Unmündigkeit: Bei denen, die ein Regime, das sein faschistisches Programm weithin hörbar verkündete, an die Macht befördert – oder jedenfalls nicht an ihrer Erringung behindert – haben. Es stimmt nicht, dass Chaos, Hysterie und Druck im „Dritten Reich“ die Möglichkeit zur freien Entscheidung zwischen Gut und Böse aufgehoben hätten: Man konnte dem
Versöhnung mit den Nazis – aber wie?
Mann, den die Gestapo aus seiner Wohnung holte, noch rasch ein Esspaket zustecken oder die Wohnung arisieren. Man konnte „Dienst nach Vorschrift“ oder Überstunden im Sold der Vernichtung machen. Man konnte sich um die Mitgliedschaft in den politischen Organisationen Hitlers reißen oder ihnen ausweichen, solange es ging. Es gibt die wunderschöne Unterredung, die Fürst Heinrich Schwarzenberg während des Krieges mit dem Prinzen Croy geführt hat. Schwarzenberg, an sich ein engagierter Nazi-Gegner fragte Croy, den er als Ratgeber schätzte, ob er nicht doch angesichts des großen Besitzes, der auf dem Spiel stand, wenigstens dem NS-Kraftfahrcorps beitreten sollte, das ihn schon mehrfach dazu aufgefordert hatte. Croy antwortete, er hätte „volles Verständnis“, Besitz sei ja wirklich sehr wichtig und die verlangte Mitgliedschaft vergleichsweise unerheblich. Nur müsse Schwarzenberg dann auch „vollstes Verständnis“ dafür haben, dass er, Croy, nicht mehr mit ihm rede. Schwarzenberg (der innerlich ohnehin so eine Antwort erhofft hatte) ist nicht beigetreten. Der Besitz ging trotzdem nicht verloren. Niemand ist durch diese Aktion gerettet worden. Sie hat nichts mit dem zu tun, was man gemeinhin „Widerstand“ nennt. Nichts bleibt als eine Anekdote, die man sich gelegentlich bei Schwarzenbergs erzählt. Und doch lag auch darin – auf der subtilen Ebene der Sünde wider den Geist – eine Entscheidung zwischen Gut und Böse. Das Böse dieser Zeit zu beurteilen, setzt voraus, dass wir uns des Guten, das in dieser Zeit auch geschah, bewusstwerden. Ich glaube, trotz allem, was geschehen ist, dass es in diesem Land mehr „Gerechte“ gegeben hat, als uns jene, die sich vor ihnen genieren, heute einreden wollen: Dass sie nur heute den Wert einer solchen winzigen Handlung, angesichts der Größe der Verbrechen, die sie nicht verhindern konnten, unterschätzen. Vielleicht sollten wir mehr Vertrauen in das Urteil der Geschichte haben (und brauchten es dann weniger erregt und ängstlich abzulehnen). Weise verkündet dieselbe altmodische Kirche, die zur Qual unseres Gewissens die „Sünde“ erfunden hat, dass die „guten Taten“ nicht an ihrem Umfang, sondern an ihrem Inhalt gemessen werden. Ein Bruno Kreisky, der sein persönliches Ansehen mit der gleichen Intensität, mit der er sich vor Friedrich Peter stellte, dazu eingesetzt hätte, dieses andere, bessere Österreich transparent zu machen, hätte diesem Land – nach 30 Jahren – gegeben, was es zur Bewältigung seiner Vergangenheit am meisten braucht: mehr Selbstvertrauen. Die würdige Bewältigung der Vergangenheit setzt voraus, dass wir alle etwas mehr an unsere Fähigkeit zum Widerstand glauben: Es stimmt nicht, wie eine Minderheit uns einzureden sucht, dass jeder von uns mit etwas Pech ein Mitglied einer Mordbrigade – vielleicht ein Mörder – geworden wäre. Zu diesen Brigaden wurde man nicht eingezogen, sondern man durfte sich darum bemühen, in diese „führernächsten Organisationen des Reichs“ aufgenommen zu werden. Es stimmt nicht (wie sich gerade die Anständigsten, die es am wenigsten nötig haben, immer wieder fragen), dass unter dem Druck der Befehle und der Hysterie des Augenblicks auch sie vielleicht auf Frauen und Kinder geschossen hätten. Denn es steht dem sehr großen Druck eine noch viel größere Hemmung entgegen: In fast allen
273
274
Versöhnung mit den Nazis – aber wie?
Strafprozessen über NS-Verbrechen die ich erlebt habe (und ich war Jahre hindurch Gerichtssaalberichterstatter), standen nicht die berühmten „kleinen Soldaten“ vor Gericht, die „nur ihre Pflicht“ taten, sondern Menschen, bei denen die Hemmung, Wehrlose zu töten, auf pathologische Weise vermindert war. Und es ist ein Märchen, dass niemand sich dem Druck, auf Wehrlose zu schießen, entziehen konnte: Es ist, obwohl sich die Verteidigung in sämtlichen NS-Prozessen durch Jahrzehnte darum bemühte, nicht ein Fall (nicht ein einziger!) entdeckt worden, in dem einem Angehörigen einer Organisation des „Dritten Reiches“ für seine Weigerung, an Verbrechen teilzunehmen, etwas Ernsthaftes zugestoßen wäre. Jeder konnte sich bei einiger Intensität des Bemühens weg melden. Vorausgesetzt, er war bereit, lieber, wie so viele an der Front, den eigenen Tod zu riskieren als im Hinterland den Tod von Wehrlosen auf sich zu laden. Soldaten mit jener Würde, die ich meine, legten den allergrößten Wert darauf, in jedem einzelnen Fall aufs Peinlichste von den Mitgliedern jener Mordbrigaden des Hinterlands unterschieden zu werden: Es waren diese Brigaden, die überhaupt erst den Hass – und nicht selten die Bestialität – erzeugten, die die kämpfende Truppe später durch Partisanen zu spüren bekam. Statt die Vorwürfe, die gegen bestimmte Exponenten des NS-Regimes wegen ganz bestimmter Handlungen, Unterlassungen oder Verstrickungen erhoben werden, stets als Anschlag auf die eigene Integrität oder die gesamte Wehrmachtsgeneration zu empfinden (und deshalb zum Beispiel in sogenannten Kriegsverbrecherprozessen die absurdesten Freisprüche zu fällen), könnte man diese Feststellung konkreter Schuld auch als demonstrative Absage an das unglückselige Modell der „Kollektivschuld“ begreifen. Österreichern und Deutschen wird Kollektivschuld heute nicht von außen aufgeladen, sondern sie nehmen sie – während sie sie bewusst auf das Heftigste leugnen – unbewusst von sich aus auf sich: Indem sie von jedem Vorwurf meinen, er wäre in Wahrheit gegen sie alle gerichtet. Indem sie gerade jene Differenzierung, die sie entlasten könnte, bekämpfen. Die wichtigste Differenzierung ist zweifellos die in Menschen, die strafrechtliche Schuld auf sich geladen haben und in solche, die (in einem mehr oder minder großen Ausmaß) moralisch mitschuldig sind. Eine würdige Bewältigung der Vergangenheit wurde daher nicht, wie eine Minderheit immer wieder vorbetet, durch die Durchführung von NS-Prozessen behindert, sondern sie wurde durch sie beschleunigt. Hätte dieses Land seine NS-Prozesse schneller, früher und präziser geführt, es könnte seiner Vergangenheit ruhiger, weniger neurotisch und selbstsicherer ins Auge sehen. Stattdessen hat es diese Phase übersprungen: Es hat zwar gleich nach dem Krieg eine kurze Spanne gegeben, in der eine Menge sogenannter Volksgerichtshof-Verfahren abgewickelt wurden, aber danach sind nicht „ununterbrochen“ wie manipulativ unterstellt wird, „Menschen vor den Richter geschleppt worden“, sondern genau umgekehrt. Es hat pro Jahr nicht einmal so viele Prozesse gegen NS-Mörder gegeben wie gegen Mörder
Versöhnung mit den Nazis – aber wie?
aus der heimischen Unterwelt. Um die Stimmen der Ehemaligen buhlend – gar nicht erst versuchend, sie in einem wirklichen Lernprozess für die Demokratie zu gewinnen – haben diverse Innenminister (vor allem Oskar Helmer) und Justizminister (vor allem Otto Tschadek) ihre Tätigkeit vor allem im Nichtverfolgen und Verfahrenseinstellen entfaltet. Deshalb, und nicht, weil die Staatsanwälte oder die Wiesenthals so unersättlich wären, gibt es heute noch immer Strafanzeigen wegen Verbrechen während des Krieges. Denn auch dieses Märchen ist zu entlarven: Es ging seit Jahrzehnten nicht mehr um „Kriegsverbrechen“ (das sind Überschreitungen der im Krieg zulässigen Methoden), sondern um Verbrechen, die sich – fast wäre man geneigt zu sagen: zufällig – während der Zeit des Krieges (ohne Nutzen für die Kriegsführung und sogar meist zu ihrem Schaden) ereignet haben. Morde in Konzentrationslagern, Morde in Ghettos, Morde im Hinterland: zum Beispiel jene Erschießungen von Juden. Roma und Sinti in den russischen Wäldern, die zur allwöchentlichen Aufgabe von Peters 1. SS-Infanteriebrigade gehörten. Die Differenzierung durch das Strafrecht ist eine zwingende Voraussetzung für die Bewältigung der Vergangenheit, aber sie wie Kreisky für die einzig Notwendige zu halten, ist absurd. Der VP- Abgeordnete Leopold Helbich hat nicht die geringste strafrechtliche Schuld auf sich geladen, als er dem Journalisten Georg Novotny in einem Kuvert 100.000 Schilling zustecken wollte. Trotzdem war er für die ÖVP selbstverständlich untragbar. Und jeder ÖVP-Politiker, dem man nachgewiesen hätte, dass er von dieser konkreten Praktik Helbichs wusste, ohne sie abzustellen, wäre ebenso untragbar gewesen. Aber es ist „eine ganz ungeheuerliche Verleumdung“ (Bruno Kreisky), wenn Wiesenthal meint, Friedrich Peter wäre untragbar als Vizekanzler, weil er von den wöchentlichen Morden der Einheit, der er 20 Monate hindurch gedient hat, zumindest gewusst haben muss. Es geht, um noch einmal jeglichem Missverständnis vorzubeugen, nicht darum, dass behauptet würde, Friedrich Peter sei ein Mörder. Das hat auch Simon Wiesenthal keine Sekunde lang getan. Es gibt dafür weder Beweise noch Zeugen. Behauptet wurde lediglich, dass er Monate lang bei einer Einheit war, deren nahezu wöchentliche Aufgabe das Morden gewesen ist. Das muss nicht, wie Kreisky tönend ausrief, „erst bewiesen werden“, sondern es steht aus den eigenen Aufzeichnungen dieser Einheit fest. Geschlossen wird daraus, dass Friedrich Peter den Charakter dieser seiner Einheit gekannt haben muss. Dass er sich nicht von ihr weg gemeldet, sondern in ihr (unter 5.000 Angehörigen) mit einem von insgesamt 35 Orden ausgezeichnet wurde. Und dass er dieses ganze Zwischenspiel – warum wohl? – bei den Angaben, die er zu seiner Person zu machen hatte, verschwieg. Behauptet wird, dass diese Umstände Friedrich Peter als Abgeordneten, als Führer einer Oppositionspartei und Partner einer österreichischen Regierung untragbar ma-
275
276
Versöhnung mit den Nazis – aber wie?
chen. Das ist ein Mindesterfordernis politischen Anstandes. Die „Ungeheuerlichkeit“ liegt nicht bei Simon Wiesenthal, der es zur Diskussion gestellt hat, sondern bei Bruno Kreisky, der es von dieser Diskussion abzusetzen wünscht. Es gibt über den Fall Peter hinaus sehr prosaische Gründe, darüber nachzudenken, ob nicht alle beteiligten Parteien von sich aus mit Nazis in Spitzenpositionen etwas vorsichtiger umgehen sollten. An erster Stelle: Weil jemand, der in solcher Nähe von NS-Verbrechen agiert hat, erpressbar sein kann. Trotzdem scheint mir ein anderes Argument noch viel gewichtiger: Ich glaube, dass ein Mann, der ein schwerer Nazi einer gewissen Größenordnung gewesen ist, eines unzweifelhaft bewiesen hat – dass er nichts von Politik versteht. Es stimmt zwar, dass damals viele hereingefallen sind, es stimmt auch, dass es nicht so leicht war, vorherzusehen, wohin sich die Dinge entwickeln. Es stimmt sogar, dass bei manchen Menschen sehr idealistische Motive der Ursprung des großen Irrtums waren. Das alles sind Milderungsgründe. Niemand käme auf die Idee, solche Leute heute schief anzuschauen. Aber es ist unverständlich, wenn dann ausgerechnet diese Leute, die mit solcher Blindheit geschlagen waren, dass sie sich zu Sondereinheiten meldeten, um dem Führer näher zu sein und ihm mit allen Fasern zu dienen, dass ausgerechnet diese Leute sich berufen fühlen, Politik zu machen. Es hängt mit dem zusammen, was ich die Würde der Vergangenheitsbewältigung genannt habe. Selbst wenn ein Friedrich Peter sich restlos unschuldig fühlt, selbst wenn er meint, heute ein Demokrat wie jeder andere zu sein, stünde es ihm besser an, sich im Hintergrund der Politik zu halten. Wäre er wirklich der Geläuterte, als der er sich gibt: Er nähme von sich aus seinen Abschied. Friedrich Peter nahm seinen Abschied natürlich nicht. Da Bruno Kreisky nicht daran dachte, ihn dazu aufzufordern, dachte schon gar niemand anderer daran. Allerdings kandidierte er 1978 nicht mehr für das Amt des Bundesparteiobmanns der FPÖ und sein Nachfolger wurde der Grazer Bürgermeister Alexander Götz. Die graue Eminenz der FPÖ blieb er dennoch. Als Kreisky bei den Wahlen von 1983 die absolute Mehrheit verlor, aber ebenfalls die graue Eminenz der SPÖ blieb, handelte er mit ihm die kleine rot-blaue Koalition unter Kanzler Fred Sinowatz mit Norbert Steger als Vizekanzler aus, die in Österreichs Geschichte, die erste Koalition mit dieser Partei war. (In vielen Medien, selbst im Standard wir dieser „Ehre“ immer wieder fälschlich der schwarzblauen Koalition unter Wolfgang Schüssel verliehen.) Erst als er dritter Präsident des Parlaments werden, und damit das zweithöchste Amt des Staates nach dem Bundespräsidenten mitbekleiden sollte, brach plötzlich aufgestauter Widerstand los: Tausende Menschen, darunter auch all jene, die während Kreiskys Kanzlerschaft zu diesem Thema eisern geschwiegen hatten, unterschrieben Proteste, denen Peter sich fügte, um die rot-blaue Koalition nicht zu gefährden. Steger (2022, während ich diesen Text bearbeite, Chef des Gremiums, das den Generaldirektor des ORF bestellt) würdigte Peters Verdienste und seinen unermüdlichen
Versöhnung mit den Nazis – aber wie?
Einsatz für die Partei, der er auch weiterhin als ihr Klubobmann im Parlament diente. Als er 1986 dort endgültigen Abschied nahm, geschah es unter Standing Ovations des gesamten Hauses. Und das im Wissen darum, dass er, im ORF konfrontiert mit seiner Tätigkeit bei der 1. SS-Infanteriebrigade nur sechs Worte zur Antwort gegeben hatte: „Ich habe nur meine Pflicht getan.“ Meine Eltern haben ihre Pflicht offenbar negiert. Die Männer des 20. Juli – in Österreich etwa Oberstleutnant Robert Bernardis oder Major Carl Szokoll – haben durch Widerstand aufs Gravierendste gegen ihre Pflicht verstoßen – man muss es so formulieren, um die Obszönität dieses Satzes zu begreifen. Aber hat das heute noch irgendeine Relevanz? Was hat es mit einer Generation zu tun, die die Verbrechen der NS-Zeit weder begangen, noch auch nur ermöglicht hat. Warum soll diese unbefleckte Generation sich nach wie vor damit auseinandersetzen müssen, was nicht einmal ihre Eltern, sondern ihre Großeltern schlecht gemacht, zum Teil auch verbrochen haben? Es bleibt nur die abgedroschene Antwort: Weil man vielleicht aus den Mechanismen, die damals zur Katastrophe führten, lernen kann: Zum Beispiel wie kritisch es ist, den wirtschaftlichen Abstieg größerer Teile der Bevölkerung zuzulassen; wie kritisch es ist, andere Völker oder andere Religionen verächtlich zu machen, ja zu diffamieren; wie wichtig es ist, autoritären Anfängen demokratischen Widerstand und Zivilcourage entgegenzusetzen. Soll das alles geschehen, weil wir fast acht Jahrzehnte nach dem Krieg als Österreicher noch immer diesbezügliche Verantwortung empfinden sollten – also doch eine andere Art von besonderer Schuld? Nein! Nicht besondere Schuld – auch keine Abart davon. Aber eine gewisse Scham: Wir sind, ohne den geringsten nachvollziehbaren Grund, stolz darauf, das Volk zu sein, das Mozart, Haydn oder Schubert hervorgebracht hat. Ich meine, dass es auch keinen nachvollziehbaren Grund braucht, Scham drüber zu empfinden, dass wir auch Hitler, Kaltenbrunner oder Eichmann hervorgebracht haben. Ich halte Scham in dieser Hinsicht für ein natürliches Gefühl.
277
44. Der AKH-Skandal
Die Auseinandersetzung, die profil das meiste Geld – die meisten Inserate – kosten sollte, war zweifellos die mit Hannes Androsch, denn sie begleitete uns durch ein Jahrzehnt. Erst kostete sie Inserate, weil von Österreichs Großunternehmern niemand mehr als Androsch geschätzt wurde, dann kostete sie Inserate, weil Androsch nach seiner Ablöse als Finanzminister zum Vorstandsvorsitzenden der größten Bank des Landes, der Creditanstalt-Bankverein (CA) bestellt wurde und diese ihrerseits sowohl Anteilseigner, wie Kreditgeber der meisten großen Unternehmen des Landes war und daher schwerlich eine Ausnahme bei der Wertschätzung Androschs sein konnte. Mich persönlich unterzog Androschs Finanzministerium – sicher zufällig – einer einzigartigen Steuerprüfung: Ich musste nicht nur die Herkunft jedes noch so kleinen auf meinem Konto gelandeten Betrages nachweisen – etwa nach Jahren eines Geburtstagsgeschenks von umgerechnet 70 Euro meiner Mutter, – sondern auch jede meiner Ausgaben begründen: Etwa in welchem Antiquitätengeschäft ich um wie viel Geld einen Schrank erworben hatte. Gott sei Dank hatte ich in Eva eine Ehefrau, die mit der Akribie einer Juristin jede noch so winzige Rechnung archiviert hatte. Nach einem halben Jahr war die Prüfung beendet und die Beamten hatten beim schlechten Willen keinen falsch versteuerten Groschen auffinden können. Gemessen an der Größenordnung meiner Einnahmen im Verhältnis zu denen Hannes Androschs hätte eine Steuerprüfung seiner Einnahmen hundert Jahre in Anspruch nehmen müssen. Nach Androschs Villa in Neustift erregte seine Steuerkanzlei „Consultatio“ das meiste mediale Interesse. Er hatte sie, als er sein Amt als Finanzminister annahm, nicht verkauft, sondern einem Treuhänder übertragen und die Führung seinem engsten Mitarbeiter Dkfm. Franz Bauer übertragen. Das reichte in den Augen der Österreicher aus, das Problem der Vereinbarkeit zu beseitigen, und ist aus Androschs Sicht zweifellos verständlich: Wieso sollte er ein vom Vater ererbtes florierendes Unternehmen – selbst für einen guten Preis – verkaufen, um ein politisches Amt zu übernehmen, das er jederzeit verlieren konnte? In der Realität ist es dennoch ein Problem: Es wird niemanden verwundern, dass sich der Umsatz der Consultatio bald vervielfachte, obwohl Finanzminister Androsch keinen Steuerfall, in den sie involviert war, selbst entschied. Mehrere Zeitungen problematisierten diesen Zustand, aber profil war eines der wenigen Medien, für das die Consultatio ein Dauerthema blieb. Denn ihr Name fiel auch im Zusammenhang mit einem offenkundigen Skandalbau: Dem Bau des Wiener Allgemeinen Krankenhauses.
Der AKH-Skandal
Die Kosten dieses Spitalbaus explodierten auf allen Ebenen. Manchmal mit ähnlich grotesken Details wie 2018 beim KH Nord: Wurden dort 95.000 Euro für die esoterische Vermessung ausgegeben, so waren es beim AKH eine Million Schilling für „Baumerfassung“ – ein Plan, auf dem der Baumbestand eingezeichnet war. Ähnlich großzügig wurden fast alle Leistungen im Rahmen des Baues honoriert: Im Endeffekt koste das Wiener Allgemeine Krankenhaus statt der geplanten einen Milliarde Schilling (rund 73 Millionen Euro), 45 Milliarden Schilling (rund 3,3 Milliarden Euro) und damit das Sechsfache eines gleich großen, gleich ausgestatteten Klinikums in Aachen. Der daraus resultierende Verlust, den Finanzminister Androsch als einer der beiden Bauherren – der andere war Leopold Gratz als Wiener Bürgermeister – zumindest politisch zu verantworten hatte, wurde seiner Leistung als Finanzminister aber nie gegenübergestellt. Obwohl eine von seinem „Consultatio“-Partner Franz Bauer gegründete Beratungsfirma namens „Ökodata“ sowie die Ausstattungsfirma „Odelga“ auch bei Ausschreibungen zum Allgemeinen Krankenhaus höchst erfolgreich waren, so dass es das Gerücht gab, alle in den Bau involvierten Firmen erlaubten sich deshalb so enorme Kostenüberschreitungen, weil Androsch daran mitverdiene und nichts dagegen unternähme. Es war wieder nicht die geniale Recherche eines Journalisten, sondern Wiens VizeBürgermeister Erhard Busek, der mich auf die letztlich richtige Spur hinwies: Im Café Prückel erzählte er mir von zwei Firmen in Liechtenstein, an die alle Firmen, die im AKH Aufträge erhalten wollten, einen Prozentsatz der Auftragssumme einzahlen müssten. Die Eigentümer übergangener Firmen hätten ihm das glaubwürdig erzählt. Vergeben würden die Aufträge durch einen Mann namens Adolf W. – wir sollten versuchen, der Sache bei ihm nachzugehen. Der Kollege, den ich damit beauftragte, war Alfred Worm. Worm führte das Gespräch mit Adolf W. in zwei Richtungen: Einerseits natürlich, um herauszufinden, in welcher Beziehung W. zur Firma in Liechtenstein stand, andererseits aber – und das war eigentlich unser anfangs größeres Interesse – ob Androsch tatsächlich von den Aufträgen des AKH profitierte. Deshalb ließ Worm im Gespräch mit W. durchblicken, dass er sein Interesse an dessen Aktivitäten verlieren könnte, wenn W. ihm etwas gegen Androsch in die Hand gebe. W. tat das zwar nicht, aber er trat der Idee, dass Androsch am AKH mitverdienen könnte, auch nicht entrüstet entgegen. Worm zitierte entsprechende Antworten W.s im profil, Androsch schäumte und stellte W. zur Rede, worauf der behauptete, er hätte die zitierten Äußerungen nie gemacht. Doch was weder er noch ich wusste: Worm hatte ein Tonbandgerät in der Tasche getragen und das Gespräch aufgezeichnet. Falls er vor Gericht der Falschzitierung geziehen würde, müsse er es gegen seinen Willen als Beweismittel herausrücken. (Manchen Leuten erzählte Worm, er habe nur geblufft und in Wirklichkeit gar kein Tonband mitgehabt. Mit mir war eine Mitnahme jedenfalls nicht abgesprochen und falls sie doch stattgefunden hat, war es strafrechtlich sicher besser, sie als „Bluff “ auszugeben.)
279
280
Der AKH-Skandal
Adolf W. ließ es jedenfalls nicht auf eine Probe ankommen: Er war einer Unwahrheit überführt und besaß seitens der SPÖ keine Rückendeckung mehr. Als Worm in der folgenden Ausgabe einen Bericht schrieb, der Buseks Indizien nachzeichnete, die dafür sprachen, dass Firmen, die nach Liechtenstein Beträge bezahlten, die immer einem bestimmten Prozentsatz ihrer Auftragssumme entsprachen, diese Aufträge dann auch erhielten, eröffnete die Staatsanwaltschaft immerhin ein Verfahren in Gestalt von „Vorerhebungen“. Aber es wäre nicht die Staatsanwaltschaft Wien der Ära Broda gewesen, wenn sie nicht zu dem Schluss gekommen wäre, dass die Indizien nicht reichten, die Untersuchung zu vertiefen: Gegen die Untersuchungsrichterin, die das Verfahren fortführen wollte, plädierte sie für seine Einstellung. Die Untersuchungsrichterin – die spätere freiheitliche Abgeordnete Helene PartikPablé – wehrte sich und bekam vor der Ratskammer Recht: Der größte Korruptionsskandal der Republik wurde gegen den Willen der Staatsanwaltschaft doch weiterverfolgt. Die FPÖ konnte triumphieren. Allerdings erst nachdem sich ein kleines Wunder ereignet hatte: Gegen alle seine bisherigen Gepflogenheiten gab Liechtenstein dem Antrag Partik-Pablés auf Öffnung des Kontos der Liechtensteiner Firmen Plantech und Geproma wegen des dringenden Verdachtes einer kriminellen Handlung statt. Dieses Wunder rettete auch mich und wahrscheinlich die Existenz des profil. Denn Siemens, als der größte genannte Auftragnehmer und größter Zahler an die Plantech und Geproma, von denen Adolf W. behauptete, sie seien nichts als eine Versicherung der Auftragssumme, hatte profil auf 100 Millionen Schilling wegen Rufschädigung geklagt. Gleichzeitig zählte auch der Generaldirektor von General Electric zu den weiteren Verdächtigen und stand an der Spitze der Industriellenvereinigung und damit der Eigentümer des profil. Trotzdem hat niemand versucht, auf unsere Berichterstattung Einfluss zu nehmen. Trotzdem – und das scheint mir bis heute charakteristisch – gibt es in der Öffentlichkeit nicht die Gewissheit, dass profil in völliger Unabhängigkeit von seinen Eigentümern handelt, sondern es wurde weiterhin als Postille der Industriellenvereinigung und wird bis heute als Raiffeisen-Postille diffamiert. Die Österreicher wollen nicht an unabhängigen Journalismus glauben, selbst wenn, wie im konkreten Fall, ein Eigentümervertreter des profil wegen der Berichterstattung des profil in Untersuchungshaft genommen wird. (Der General-Electric-Chef wurde im Übrigen durch die weiteren Erhebungen entlastet und ist rehabilitiert.) Strafrechtlich scheint mir der AKH-Skandal in mehrfacher Hinsicht relevant: − Er zeigt, wie entscheidend es für die Aufdeckung von Korruption ist, dass Unternehmer daran mitwirken – nur dass einer von ihnen Erhard Busek informierte, ermöglichte ein Strafverfahren. Deshalb ist es so wichtig, beteiligten Unternehmern in vergleichbaren Fällen von vorneherein und per Gesetz Straffreiheit als „Kronzeugen“ zuzubilligen.
Der AKH-Skandal
− Für mich ist eindeutig, dass derjenige, der sich bestechen lässt, eine ungleich höhere Strafe verdient als der, der Unternehmensverantwortliche besticht. Für jemanden, der für das Schicksal von hunderten, ja tausenden Angestellten verantwortlich ist, ist es ungeheuer schwierig, Bestechung zu vermeiden, wenn man weiß, dass sie der einzige Weg ist, um zu Großaufträgen zu kommen. Adolf W. wurde mit gutem Recht zu acht Jahren Haft verurteilt. Über den moralischen Zustand der unter Hannes Androsch wirtschaftlich blühenden, unter Christian Broda gesellschaftlich liberal geöffneten Republik Österreich zeichnete Manfred Deix damals einen seiner besten Cartoons: Eine riesige Ratte, die einem Kanal vor dem AKH entsteigt. Androsch sollte mir erst 1980 journalistisch neuerlich und zwar ein letztes Mal begegnen: Damals behauptete Armin Rumpold, der die Ökodata als Fachmann in Beratungsfragen mitbegründet hatte, mir gegenüber, dass neben Dkfm. Bauer immer auch Androsch zu einem Drittel an der Ökodata beteiligt gewesen sei. Zum Beleg zeigte er mir einen Vertragsentwurf, auf dem in Bauers Handschrift „Dr. A. verdeckt“ vermerkt war. Ich riet ihm, damit nicht gleich an die Öffentlichkeit zu treten, sondern es mir zu ermöglichen, Androsch und Bauer getrennt voneinander damit zu konfrontieren. Aber Rumpold wollte mehr mediale Öffentlichkeit und veranstaltete eine Presskonferenz. Als Bauer und Androsch befragt wurden, stimmten ihre Antworten exakt überein: Es sei dies ein Entwurf gewesen, den Androsch sofort entrüstet zurückgewiesen habe.
281
45. Die Nummer drei der Todesliste des Abu Nidal
Am 1. Mai 1981 verblüffte ein rätselhafter Mord die Wiener: Der sozialdemokratische Stadtrat für Verkehr und Energie Heinz Nittel wurde in der Nähe seiner Wohnung im Bezirk Hietzing ermordet. Es war schwer vorstellbar, dass Nittel dort Feinde hatte, aber es deutete auch nichts auf einen Raubmord oder eine Beziehungstat hin. Höchstens, dass er durch einen Schuss durch das Fenster seines Autos ermordet wurde, hätte auf die richtige Spur eines professionellen Mordes bringen können. Ich war als alter Lokalreporter deshalb zumindest nicht restlos überrascht, als mich unsere Mitarbeiterin Renate Poßarnig mit der in ihren Augen gesicherten These konfrontierte, dass Nittel in seiner Eigenschaft als Präsident der Österreichisch-Israelischen Gesellschaft und Gründer des „Jewish Welcome Service Vienna“ einem Mordanschlag der syrischen Terror-Gruppe Abu Nidal zum Opfer gefallen sei. Ich weiß heute nicht mehr, wie die Kärntnerin Poßarnig zu uns stieß, nur dass sie ausnehmend hübsch war und glaubwürdig von ihren guten Beziehungen zu Libyens damaligem Staatschef Muammar Gaddafi erzählte, der für seine Wertschätzung hübscher Frauen weithin bekannt war. Um ein Interview von ihm zu bekommen, war sie scheinbar zum Islam konvertiert und das Interview hatte damit geendet, dass er sie längere Zeit in seinem Palast untergebracht hatte. Auf der Basis dieser Beziehungen sei ihr die Information über den Mord an Nittel zuteilgeworden. Sie besaß dafür auch ein Indiz: Einen Bericht der regierungsnahen syrischen Zeitung „Falentin el Thawra“, in der Nittel als Agent des israelischen Imperialismus bezeichnet wurde, was ein Höchstmaß an Feindschaft signalisierte. profil veröffentlichte also Poßarnigs These und wurde dafür prompt, voran vom Kurier verspottet. Wir ließen Poßarnig, die sich nicht nur durch Schönheit, sondern auch durch fast schon fatalistischen Mut auszeichnete – „ich reise auf eigene Gefahr“ – deshalb nach Syrien reisen, weil ihr dort zusätzliche Informationen versprochen worden waren. Tatsächlich kehrte sie mit einer dicken Mappe voller Materials zurück. So interviewte sie in Damaskus drei Mitglieder des palästinensischen „Revolutionskomitees von el-Assifa“, einer Gruppe, die sich von Arafats Palästinensischer Befreiungs-Organisation (PLO) abgespalten hatte und in wütender Opposition zu ihr stand. Diese Gruppe, die auch als „Abu-Nidal-Organisation“ firmierte, übernahm ganz offen die Verantwortung für den Mord an Nittel. Die Tat sei als „Warnung für den österreichischen Bundeskanzler“ zu verstehen. „Kreisky soll sich nicht in unsere Angelegenheiten mischen“, sagten die Interviewten wörtlich, „wir werden ihn töten, wenn er seine Vermittlungstätigkeit zwischen Israel und der PLO nicht einstellt.“
Die Nummer drei der Todesliste des Abu Nidal
Wir verarbeiteten das Material zu einer Titelgeschichte „Syriens Krieg gegen Österreich: Kreisky muss weg“ und gaben darin Poßarnigs These wieder: Syriens Herrscher habe sich, wie alle arabischen Potentaten, die Sache der Palästinenser zu eigen gemacht, wolle aber einen Palästinenserstaat, der wie der Libanon in enger Abhängigkeit von ihm stünde, während die PLO einen unabhängigen Palästinenserstaat anstrebe. Ich begleitete Poßarnigs Titelgeschichte mit einem Leitartikel, der die besondere politische Dummheit und gleichzeitige Feigheit der Aktionen Abu Nidals herausstrich. Das führte dazu, dass ein Mann mich anrief, der damals als inoffizieller Außenminister der PLO und eigentlicher Verbindungsmann zu Bruno Kreisky galt und mein Freund werden sollte: Issam Sartawi. Unser damals erstes Telefongespräch verlief denkbar seltsam: Ich machte kein Hehl daraus, dass ich, nicht zuletzt aufgrund der Lebensgeschichte meiner Mutter, kein Freund der PLO und der Nahost-Initiative Bruno Kreiskys war. Sartawi antwortete, dass die Geschichte meiner Mutter ein Grund mehr dafür gewesen sei, mich anzurufen: Er suche die Versöhnung Israels mit den Palästinensern. Der Staat, den sie an der Seite Israels erhalten sollten, so erläuterte er mir später, solle gemeinsam mit Israel der demokratische, fortschrittliche Nukleus einer neuen, sich der Demokratie öffnenden arabischen Welt sein. Ich hielt und halte das für ein Hirngespinst – aber ein wunderschönes. Meine Haltung zu den Palästinensern war, wie so vieles, von meiner Mutter geprägt: Ich war zwar der Meinung, dass ihnen Unrecht geschehen sei – aber ich hielt dieses Unrecht für unerheblich neben der Ermordung von sechs Millionen Juden und war deshalb der Ansicht, dass die Palästinenser es um der Gründung Israel als „jüdische Heimstätte“ willen, ertragen sollten. Begonnen hat dieses Unrecht bekanntlich damit, dass die Briten, die Palästina im Auftrag des Völkerbundes verwalteten, dort sowohl den Palästinensern wie den Juden die Aussicht auf einen eigenen Staat eröffneten, wobei die Palästinenser zweifellos die klare Mehrheit der Bevölkerung stellten. Nach dem Holocaust überwog indessen weltweit die Überzeugung, dass die Juden einen ausreichend großen eigenen Staat erhalten müssten und die UNO sprach ihnen 56 Prozent des Gebietes, allerdings einschließlich der damals unbewohnbaren Negev-Wüste zu. Den Palästinensern sollten die verbleibenden 44 Prozent zukommen, Jerusalem sollte einen eigenen Status unter internationaler Verwaltung erhalten. Die Israeli nahmen diesen Teilungsplan an, die Palästinenser lehnten ihn gemeinsam mit allen arabischen Staaten ab. Gleich darauf überfielen deren Armeen das neu gegründete Israel in der Absicht, die Juden „zurück ins Meer“ zu treiben. Bekanntlich verloren die Arabischen Streitmächte schon diesen ersten arabischisraelischen Krieg: Der winzige Judenstaat behauptete sich und drängte in der Folge auch solche Palästinenser aus dem Israel zugesprochenen Gebiet, die dort gelebt hatten, ohne an den Kriegshandlungen teilzunehmen.
283
284
Die Nummer drei der Todesliste des Abu Nidal
In Summe entstand eine große Zahl heimatloser Palästinenser, und ich sah darin wie meine Mutter durchaus ein historisches Unrecht – auch wenn die Palästinenser durch ihr Verhalten daran Anteil hatten. Nur meinte ich mit meiner Mutter, dieses Unrecht könnte und sollte dadurch gelindert werden, dass die arabischen Bruderländer diese Palästinenser aufnehmen und ihnen eine neue Heimat bieten. Stattdessen rissen sie nur Teile des den Palästinensern zugesprochenen Landes an sich und behandelten sie als „Fremde“, die weder Grund erwerben durften noch andere Bürgerrechte erhielten. Letztlich brachte die UNO das Gros der Heimatlosen in Lagern unter, wo sie zwangsläufig zunehmend auf Rache sannen. In diesen Lagern – zumindest darin war ich mit Sartawi einig – entstand die PLO. Aber während er immer von einem palästinensischen Volk mit eigener Sprache und Kultur sprach, sprach ich von palästinensischen Vertriebenen: Ich war der Ansicht, dass die arabischen Bruderstaaten diese Vertriebenen so aufnehmen sollten, wie Österreich und Deutschland nach dem Krieg die sudetendeutschen Vertriebenen aufgenommen haben. Auch den Sudetendeutschen, so argumentierte ich gegenüber Sartawi, sei durch Vertreibung Unrecht geschehen, an dem sie durch ihre Sympathien für Hitler einen gewissen eigenen Anteil hatten – doch dieses Unrecht sei durch Aufnahme in Bruderländer friedlich gelöst worden, ohne dass ihnen ein eigener Staat angeboten worden sei. Zudem gebe es einen riesigen Palästinenserstaat: Jordanien. Ich verstand damals nicht und verstehe bis heute nicht, warum die internationale Gemeinschaft nicht von den haschemitischen Herrschern Jordaniens fordert, die Mehrheit der Palästinenser in ihrem Staat demokratisch anzuerkennen. Von einem „Palästinenserstaat“ an der Seite Israels, wie er bekanntlich bis heute gefordert wird, habe ich damals nichts gehalten, weil ich mit Simon Wiesenthal der Meinung war, dass er, wenn er alle Palästinenser, die dort Aufnahme suchen, tatsächlich aufnimmt, angesichts deren hoher Geburtenrate schon bald aus allen Nähten platzen würde und dass das zu ständigen Auseinandersetzungen mit Israel führen müsse. Sartawis Alternative eines mit Israel befreundeten Palästinenserstaates als Nukleus einer dereinst demokratischen arabischen Welt hielt ich dem gegenüber für eine reine – wenn auch sympathische – Fata Morgana. Das war sie zweifellos auch. Aber als mit den Abkommen von Oslo 1994 ein palästinensischer Staat beschlossen wurde, habe ich meine Ansicht dahingehend revidiert, dass Israel diesen Staat akzeptieren und ihm Erfolg wünschen sollte – denn umso erfolgreicher er wäre, desto friedlicher würde sich das Zusammenleben mit Israel gestalten. Leider bin ich mit diesem Wunsch bekanntlich restlos gescheitert: Arafat wollte die auf seinem Gebiet agierenden Terroristen der Hamas nie entschlossen daran hindern, weiterhin Raketen auf Israel abzufeuern, und intern verkam das von ihm geführte Staatswesen trotz massiver Zuwendungen seitens der EU durch die massive Korruption seiner Familie und seiner Freunde. Auf der anderen Seite tat auch Israel alles, um diesem Staatswesen keinen Erfolg zu bescheren: Nach diversen militärischen Siegen
Die Nummer drei der Todesliste des Abu Nidal
war das Gebiet, das sie den Palästinensern für ihren Staat überließen, ein zerrissenes, in dem unter dem Druck ultrareligiöser israelischer Parteien noch dazu immer größere israelische Siedlungen errichtet wurden und in dem die Israelis bei jedem ihrer „Vergeltungsschläge“ gegen Raketen oder Attentate der Hamas immer auch Kraftwerke und andere öffentliche Einrichtungen zerstörten. Daran hat sich bekanntlich bis heute wenig geändert, wenn man davon absieht, dass Donald Trump den Israelis zugestand, sich das Westjordanland einzuverleiben und Jerusalem ausschließlich als eigene Hauptstadt zu betrachten. Als ich Issam Sartawi 1980 kennenlernte, war die Situation hingegen noch viel offener: Es war noch nicht einmal so weit, dass die PLO Israel anerkannte und es war noch längst nicht so weit, dass die Staaten Europas die PLO anerkannten. Bruno Kreisky war der Politiker, der diese Anerkennung als Speerspitze zu erreichen suchte, und Sartawi war der Mann, auf den er sich dabei innerhalb der PLO in erster Linie stützte. Eigentlich war er nach seinem Medizinstudium in Bagdad Herzchirurg in den USA gewesen – höchst erfolgreich, wie er mir glaubhaft versicherte: „Ich hätte dort wie Sie mit Frau und Kindern in einem Haus mit Garten leben können.“ Stattdessen war er 1967 als 32-Jähiger rückgewandert, um sich der „palästinensischen Sache“ anzunehmen. Er wurde innerhalb der PLO zum Kopf einer der ersten Flugzeugentführungen und dabei kam es, ohne dass er es beabsichtigt hätte, zu einem Schusswechsel, bei dem eine unbeteiligte Frau den Tod fand. „Das war für mich der Grund, meine Haltung und meine Ziele zu überdenken: Damals habe ich mich entschlossen, der Gewalt abzuschwören – wir mussten unseren Staat in friedlichen Verhandlungen erreichen. Und diese Verhandlungen setzten die Anerkennung Israels voraus.“ Später ging er weiter: er behauptete in unseren Gesprächen, dass die Palästinenser, wie die Juden, das begabteste Volk des arabischen Raumes und durch Zuwanderung „europäisiert“ wären – deshalb könnten und müssten diese beiden Völker zu Freunden werden. Ich nehme an, dieser für einen Frieden jedenfalls nützlichen Vorstellung entsprang sein Traum, dass sie den „demokratischen Nukleus“ einer sich öffnenden arabischen Welt bilden sollten. Auch wenn sich Traum und politische Nützlichkeit in Sartawis Denken nicht leicht trennen ließen. Am Anfang neigte ich deshalb dazu, ihn nicht ganz ernst zu nehmen – ihn für einen Phantasten mit übertriebener Neigung zur Selbstdarstellung zu halten. Dazu trug der Ablauf unserer Zusammentreffen bei. Stets fanden sie unter mir höchst übertrieben scheinender Geheimhaltung statt. Sartawi rief mich unter falschem Namen aus einem Hotel an, dessen Namen er mir nicht verriet und bestellte mich zu einem Treffen in ein anderes Hotel. Dort erwartete er mich in der Halle immer an einem Ecktisch mit Blick sowohl auf einen Ein- wie einen Ausgang gerichtet und vor allem immer mit einem geladenen Revolver in der Tasche seines Sakkos.
285
286
Die Nummer drei der Todesliste des Abu Nidal
Als ich ihm vorschlug, wegen der Hitze doch ins Freie zu gehen, meinte er: „Wenn Du neben mir gehst, riskierst Du, dass Du eine Kugel abbekommst, wenn auf mich geschossen wird. Die Leute, die mich treffen wollen, nehmen da keine Rücksicht.“ Ich lachte. „Das halte ich aus“, sagte ich, und hielt es wie den geladenen Revolver in seiner Tasche für einen Teil seiner Selbstgefälligkeit. Zwei Jahre später, am 10. April 1983 streckten ihn radikale Palästinenser beim Verlassen eines Hotels im portugiesischen Albufeira durch neun Schüsse nieder. Die AbuNidal-Organisation beanspruchte den Mord für sich. Im Zusammensein mit mir, das ein zunehmend freundschaftliches war, trug Sartawi zwei Anliegen vor: Er bat mich, ein Gespräch mit Simon Wiesenthal zu vermitteln – und er wollte mit meiner Mutter sprechen. Wiesenthal lehnte trotz meiner energischen Bitte ab: Es sei ihm unmöglich, mit jemandem zu sprechen, durch dessen Anschlag jemand umgekommen sei. Dass ich ihm erklärte, dass dieser Todesfall in Sartawis Planung der Flugzeugentführung nicht vorgesehen war, ließ er nicht gelten – er habe ihn in Kauf genommen. Vor allem ließ er nicht gelten, dass der Tod dieser Frau der Anlass für Sartawis totales Umdenken gewesen sei – obwohl er sehr wohl mit Albert Speer gesprochen hat, nachdem dieser seine Strafe verbüßt hatte. Eine verbüßte Strafe, so meine Wiesenthal, sei etwas anderes. Ich bin bis heute der Ansicht, dass Sartawis Wandlung vom Terroristen zum Kämpfer für eine israelisch palästinensische Versöhnung weit höher als Speers abgesessene Strafe zu werten ist. Noch erfolgloser verlief das zustande gekommene Gespräch Sartawis mit meiner Mutter. Im Gegensatz zu meiner Frau glaubte sie ihm kein Wort und warf mir vor, auf ihn hereinzufallen: „Der ist doch genauso falsch wie Arafat, der auch vom Frieden spricht und die Hamas weiter Raketen auf Israel abfeuern lässt. Er missbraucht Deine politische Naivität – genau wie Jörg Haider.“ Sartawi musste sterben, damit sie an seine ehrliche Absicht glaubte. Das Gespräch mit meiner Mutter sollte allerdings nicht das letzte sein, das Sartawi in meinem Haus in Mauer führte. Kurz nach der Veröffentlichung jenes Interviews, in dem Bruno Kreisky die Anerkennung der PLO gefordert und für einen palästinensischen Staat plädiert hatte, erhielten Österreichs Sicherheitsbehörden glaubhafte Informationen, dass sich ein arabisches Killerteam in Wien aufhielte und drei Opfer im Visier habe: Bundeskanzler Kreisky als Nummer 1, Innenminister Erwin Lanc, außenpolitisch ein enger Vertrauter Kreiskys, als Nummer 2 und mich als Nummer 3. Tatsächlich wurde auch ich in der Falentine al Thawra als Agent des israelischen Imperialismus bezeichnet. Das Innenministerium ließ mir eine entsprechende Verständigung zukommen und bot mir an, einen Polizisten vor mein Haus in der Maurer Valentingasse 12 zu stellen. Ich lehnte dankend ab: „Daraus schließen die Killer höchstens, dass ich für Österreich wirklich von Bedeutung bin, und halten das Attentat für umso nützlicher. Der Garten
Die Nummer drei der Todesliste des Abu Nidal
meines Hauses grenzt an einen riesigen Park – von dort kann man sich jederzeit viel besser als von der Straße her unbemerkten Zutritt verschaffen.“ Ich beschloss lieber Simon Wiesenthal zu fragen, wie er sich durch alle Jahre geschützt habe. Er sagte, er habe, wie ich wisse, stets einen geladenen Revolver bei sich gehabt und irgendwann habe er auch eine Alarmanlage rund um den Garten seines Hauses installiert: „Aber immer, wenn ein Vogel durchgeflogen oder eine Katze durchgelaufen ist, haben die Sirenen meine gesamte Nachbarschaft aufgeschreckt und so habe ich sie wieder ausgeschaltet.“ So kam es, dass ich schließlich Issam Sartawi fragte, wie ich mich schützen solle. Er machte sich erbötig, ein Team gut ausgebildeter Freunde in unserem Haus unterzubringen, die für meine Sicherheit sorgen würden. Ich stellte mir daraufhin eine Schlacht zwischen Abu-Nidal-Killern und Sartawi-Kämpfern in meinem Garten vor und schlug das Angebot dankend aus. Das Einzige, was mir dann bleibe, meinte Sartawi, sei doch die Selbstverteidigung: Ich solle unseren Garten mit einem Zaun umgeben, mir einen Hund anschaffen und einen Revolver zulegen. Der Hund würde bellen, wenn jemand den Zaun überwindet, und das gebe mir Zeit, ihn zu erschießen – das sei die relativ beste Art mich zu schützen. Ich erwarb zwar keinen Revolver, aber tatsächlich, in Anlehnung an die Hinterbrühl, wo ich als kleiner Bub auf ihm geritten war, einen Schäfer-Bernhardiner-Mischling. Außerdem besprach ich mit dem Geschäftsführer des trend-Verlages Günter Enickl die Anschaffung eines zwei Meter hohen Drahtzaunes auf Verlagskosten. Als der entsprechende Kostenvoranschlag auf 300.000 Schilling (ca. 21.800 Euro) lautete, lehnte der Geschäftsführer sofort ab, erwarb für mich aber eine Lebensversicherung, die der Verlag von der Steuer absetzen konnte. Ich weiß heute nicht mehr, ob ich meine Gefährdung je wirklich ernst genommen habe – ein wenig kam mir das Ganze wie meine unter Geheimhaltung abgehaltenen Treffen mit Issam Sartawi vor: Bis zu seiner Ermordung fühlte ich mich eher wie in einem Theaterstück. Ich habe meine Frau Lisi gefragt, ob sie sich damals gefürchtet habe und sie verneinte ebenfalls: „Nicht so wirklich.“ An der möglichen Unterbringung einer Truppe Sartawis in unserem Haus habe sie vor allem die Vorstellung geschreckt, so viele Männer unterzubringen, zu verköstigen und für sie aufzuräumen. Auch ich, so ihr Eindruck, sei nie ernsthaft besorgt gewesen – obwohl Heinz Nittel nach seiner Erwähnung in der Falentine el Thawra wirklich ermordet worden war. Ich schaute zwar am Morgen, ehe ich wegfuhr, unter mein auf der Straße geparktes Auto, um allenfalls dort angebrachten Sprengstoff zu entdecken – aber ich war gleichzeitig sicher, keinen vorzufinden. Auch im Innenministerium schwankte man zwischen ernsthafter Sorge und Zweifel: Die Morddrohungen könnten auch nur ein Bluff der nach Aufmerksamkeit lechzenden el-Assifa-Leute sein.
287
288
Die Nummer drei der Todesliste des Abu Nidal
„Bis heute“, so schrieb etwa der (fast rundum fehlinformierte) „Spiegel“, „gibt es keinerlei konkreten Beweis dafür, dass der bekannt israelfreundliche SPÖ-Stadtrat Nittel (wirklich) von Palästinensern erschossen wurde – die derzeit heißeste Spur weist eher in Richtung der rechtsradikalen deutschen Wehrsportgruppe Hoffmann.“ Doch für die akute Gefährdung Kreiskys sprachen gleich mehrere schwerwiegende Indizien: Proteste und Interventionen der Österreicher bei der syrischen Regierung, von deren Territorium aus die el-Assifa-Leute operierten, zeigten bislang keinerlei Wirkung. Vergebens sprach der Wiener Botschafter Franz Parak mehrmals im syrischen Außenministerium vor und verlangte, den Terroristen um Abu Nidal das Handwerk zu legen. Nichts geschah. Das Büro der el-Assifa im Herzen von Damaskus ist nach wie vor in Betrieb, die Publikation „Falastine al Thawra“ erscheint weiterhin in einer Druckerei, die der syrischen Luftwaffe untersteht. Ebenso vergebens schrieb Kreisky einen persönlichen Brief mit der Bitte um Intervention an Syriens Staatschef Hafis el Assad. Der Präsident stellte sich taub. Vollends nervös machte die für Kreiskys Sicherheit Verantwortlichen ein Zwischenfall in der Nacht vom 15. auf den 16. Juni: Gegen Mitternacht entdeckten einige Nachbarn der Kanzlervilla in der Armbrustergasse 15 einen jungen Mann in Jeans, der eine Feuerleiter erkletterte und von da oben die Kreisky’sche Wohnung studierte. Als sie ihn anriefen, sprang er mit halsbrecherischem Satz in die Tiefe und verschwand im Dunkeln. Die mobilisierte Polizei hatte das Nachsehen. Gleichsam zur Bestätigung der höchsten Alarmstufe traf wenige Tage später eine vertrauliche Warnung Jassir Arafats an der Donau ein. Der PLO-Chef benachrichtigte die Österreicher über die Anwesenheit einer el-Assifa-Mordbrigade in Wien. Eine ähnliche Meldung kam aus der österreichischen Botschaft in Damaskus. Tatsächlich sind – wie Minister Lanc dieser Tage gegenüber profil bekannte – am 18. Juni drei verdächtige Palästinenser in Wien eingeflogen. Fünf weitere folgten per Schiene. Lanc: „Von diesen fünf wissen wir nicht, ob sie noch in Wien sind.“ Erwin Lanc sieht sich nun vor der Aufgabe, quasi über Nacht einen kugelsicheren Kordon rund um den Regierungschef zu schließen. Neuerdings wimmelten Tag und Nacht an die 30 Bewacher rund um den Kanzler. Sie lagerten im Erdgeschoß seiner Villa, stehen der Sekretärin Margit Schmid im Weg und treten einander wechselseitig auf die Füße. Schießen können sie allesamt, weil sie langjährige Angehörige der Antiterrorgruppe „Cobra“ sind. Trotzdem weiß Lanc, dass auch die massivsten Vorkehrungen im Ernstfall nur wenig healfen. Kreiskys Gartengrundstück im Heurigen-Bezirk Grinzing steigt nämlich nach hinten an und ist daher voll einzusehen. Und Kreisky liebt extrem gutartige, jeden Einschleicher freundlich begrüßende Boxerhunde – bissigen deutschen Schäferhunden vermag er nichts abzugewinnen. So forderte die Großmachtpolitik des kleinen Österreich ihren Preis. Kreiskys Hang, sich unter die Mächtigen der Erde zu mengen, hat ihm auch deren ständigen Begleiter eingetragen, die Angst ums eigene Leben.“ (Ende des Spiegel-Zitates)
Israel auf faschistoiden Abwegen
Gewarnt hat Lanc nicht Arafat, sondern dessen „Außenminister“ Issam Sartawi, der mir vergeblich Verteidiger schicken wollte. Auch mein Schäfer-Bernhardiner namens „Columbus“ hätte jedem „Einschleicher“ in unseren Garten freundlich die Hand geleckt – aber es hat sich keiner gezeigt. Das letzte Mal traf ich Sartawi in meinem Haus in Aussee, und wir fassten den Entschluss, dass wir hier gemeinsam seine Memoiren zu Papier bringen würden. Dem kam Abu Nidal zuvor. Bruno Kreisky blieb seiner Vision eines palästinensischen Staates an der Seite Israels sein Leben lang treu und wenn man will, kann man sagen, dass er Geschichte schrieb, indem er sie entscheidend vorantrieb, denn sie existiert ja noch heute. Obwohl ihr ein sehr prosaisches Ende droht: Israels militärische Überlegenheit scheint dazu zu führen, dass es sich die Gebiete, auf denen dieser Staat entstehen sollte, langsam aber sicher einverleibt.
Israel auf faschistoiden Abwegen Im Frühjahr 2023 lagen Kreiskys Bemühungen um einen palästinensischen Staat, Issam Sartawis Tod und seine (und meine) naive Hoffnung auf Aussöhnung mehr als vierzig Jahre zurück und die Situation ist ungelöst wie eh und je. Während ich schreibe, beschießen die beiden Seiten einander wieder mit besonderer Heftigkeit – es gibt ein paar tote Israelis und ein paar Duzend tote Palästinenser. Der Palästinenserstaat steht tatsächlich vor seinem prosaischen Ende, obwohl Joe Bidens Außenminister Blinken noch immer von ihm spricht. Israel drohe immer weniger äußere Gefahren, aber es drohe ihm Gefahr von innen: Die vielen Jahre als Besetzer und das Scheitern jeder Versöhnung haben Israels Demokratie ausgehöhlt. Wenn Israels Parlament wirklich in vollem Umfang beschließen sollte, dass es Entscheidungen des Obersten Gerichthofes als letzten Schutz für die Rechte der in Israel und den besetzten Gebieten lebenden Palästinenser annullieren kann, dann betritt es den Weg zum faschistoiden Staat. Das schmerzt mich fast physisch: „Nächstes Jahr in Jerusalem“, so erzählte mir meine Mutter, hätten die Jüdinnen gerufen, die wussten, dass sie ins Gas geführt wurden. Seither war ihr und ist mir Israel so wichtig wie Österreich. Zweifellos ist es unter der Bedrohung, unter der es steht – der Iran vernichtete es lieber gestern als heute – besonders schwer, einer faschistoiden Entwicklung zu widerstehen: Natürlich will man in dieser Lage einen starken Führer und legt Wert auf schnellstes, ungehindertes Handeln. Aber bisher hat Israel diese Anforderungen innerhalb einigermaßen rechtsstaatlicher Grenzen erfüllt – jetzt ist es dabei, sie zu überschreiten. Die aktuelle Schuld daran trägt Benjamin Netanjahu, der seit jeher behauptet, der so notwendige starke Führer zu sein. Das war schon bisher fraglich, weil er der Annäherung
289
290
Die Nummer drei der Todesliste des Abu Nidal
Israels an seine arabischen Nachbarn stets am meisten im Wege stand, statt sie wie Shimon Perez zu erleichtern. Allerdings hat es diese Annäherung dennoch gegeben: Durch reinen Zeitablauf ist Israels Bedrohung trotz des Iran in Summe gesunken: Frieden und Waffenstillstände mit den größten arabischen Ländern stehen auf immer festeren Beinen. Daher verstärkt sich mein Verdacht, dass es Netanjahu bei seinem Bemühen, unter allen Umständen an der Regierung zu bleiben, nicht so sehr um die Sicherheit Israels als um die eigene Sicherheit geht: Sobald er nicht mehr Regierungschef ist, drohen ihm, wie Recep Tayyip Erdogan in der Türkei, viele Jahre Gefängnis für Korruption. Diese Bedrohung büßt Israels Bevölkerung seit 2023 mit der einzig noch zahlenmäßig möglichen Koalition von Netanjahus Likud mit Parteien der extremen religiösen Rechten. Diese religiöse Rechte war und ist in meinen Augen Israels zentrales Problem. Fanatische Religion ist immer und überall – vom Iran der Mullahs bis zu Donald Trumps USA – das größte Hindernis für Vernunft. Spätestens in dem Moment, in dem religiöse Parteien als Zünglein an der Waage die Politik einer Regierung entscheiden, wird es lebensgefährlich. Gefährlich war es schon bisher: Die Ultrareligiösen arbeiten nicht und leisten keinen Militärdienst. Aber sie waren und sind es, derentwegen der Siedlungsbau in den besetzen Gebieten vorangetrieben wurde und wird, der einen Palästinenserstaat so unendlich erschwert. Ich war aus vielen, hier schon beschrieben Gründen primär kein Anhänger dieses Staates, aber da man sich mit dem Osloer Abkommen auf die Vorstufe zu ihm geeinigt hat, war ich der Meinung, dass Israel alles tun sollte, damit er funktionieren kann, denn umso eher würde man in gegenseitigem Frieden leben. Aber es tat mit dem Siedlungsbau das Gegenteil und die Hamas tat das Gleiche, indem sie nicht aufhörte, Israel mit Raketen zu beschießen und Attentate durchzuführen. Auch damit habe ich nicht nur ein intellektuelles, sondern auch emotionales Problem: Wenn man wie ich mit Issam Sartawi befreundet war, der die Anerkennung Israels durch die PLO wie kein anderer betrieben und durchgesetzt hat, der dafür letztlich mit seinem Leben für dieses Bemühen gebüßt hat, dann kann man seinen Traum nicht ganz aus dem Gedächtnis streichen: Dass Israel und ein mit ihm befreundeter Palästinenserstaat der Nukleus einer demokratischen arabischen Welt sein könnten. „Da ist es doch viel einfacher, Israelis und Palästinenser bilden gleich einen gemeinsamen Staat“, war es mir damals in meiner areligiösen Gedankenlosigkeit entschlüpft. „Das geht nicht“, hatte Sartawi Israels Partei ergriffen, „nach dem Holocaust muss Israel ein jüdischer Staat sein.“ Natürlich war das auch für mich in der nächsten Sekunde evident, aber es hat meine Abneigung gegen Religion nicht vermindert. Heute ist mir natürlich auch bewusst wie naiv wir letztlich beide waren: Höchstens Daniel Barenboim hat sich in seinem israelisch-palästinensischen Orchester Freundschaft zwischen Juden und Arabern vorstellen können. Aber einmal mehr sorgte Netanjahu für das absolute Gegenteil: Sein Gesetz, das Israel seit 2018 als „Staat der Juden“ defi-
Israel auf faschistoiden Abwegen
niert, macht arabische Israelis zu Bürgern zweiter Klasse und war der erste Schritt zum faschistoiden Staat. Und natürlich gereicht der fortgesetzte Status als Besatzer Israels Rechtsstaat zum Schaden: Wenn die Religiösen in den besetzten Gebieten „Erez Israel“ sehen, unterscheidet sich das nicht rasend von Putins Überzeugung, dass die Ukraine eigentlich Teil Russlands ist. Ich maße mir nicht an zu wissen, welche Politik Israel betreiben solle. Aber ich weiß, welche Schäden es mit der aktuellen Politik riskiert: Sie kann Israel die bedingungslose Unterstützung der „democrats“ in den USA kosten; sie leistet dem ubiquitären Antisemitismus Vorschub, der in Österreich bekanntlich „Da sieht man’s ja, die Juden sind die Nazis von heute“, lautet; und vor allem verliert Israel die Kraft der Moral.
291
46. Kreiskys ökonomische Visionen
So sehr Kreiskys Vision (und Sartawis und meine Hoffnung) in Bezug auf Israel und die Palästinenser gescheitert ist, war es dennoch einer seiner imponierenden Charakterzüge, in großen Dimensionen zu denken, und Visionen zu verfolgen. Es gab keine Aufgabe, der er sich nicht gewachsen fühlte, die er nicht in Angriff nahm, und von der er nicht glaubte, sie lösen zu können. Egal ob es darum ging, in den Palästinensern künftige Partner Israels zu sehen oder daran zu glauben, dass er aus einer Partei „Ehemaliger“ wie der FPÖ eine liberale Partei machen könne, die zum idealen Partner der SPÖ würde. Ich schreibe diese felsenfeste Überzeugung von sich selbst wie bei Oscar Bronner primär der „jiddischen Mame“ zu, aber die Erfahrung, in einem Land mit sprichwörtlich antisemitischer Bevölkerung als Jude zum Kanzler geworden zu sein, hat sie zweifellos optimiert. Auch für die Wirtschaftspolitik, die die SPÖ in seiner Ära betreiben sollte, dachte Kreisky in großen Dimensionen und hegte er Visionen: Die Sozialisten, so sagte er, würden zeigen, dass sie in Wirklichkeit die besseren Kapitalisten sind. Das erlaubte ihm, einerseits durchaus wirtschaftsfreundlich zu agieren und alle jene Lügen zu strafen, die meinten, die SPÖ würde „Privateigentum“ und „Profite“ verdammen – aber bestehende „kapitalistische“ Strukturen dennoch von links anzuzweifeln: Er wollte Österreich auf den Weg Schwedens führen, wo es gleichfalls gelang, eine ungemein starke, profitorientierte Privatwirtschaft mit außergewöhnlichen sozialen Errungenschaften zu verbinden. Dass das neutrale Schweden nicht der EWG, sondern der Freihandelszone EFTA angehörte, ließ ihn Österreich daher durchaus überzeugt in die EFTA führen, ohne dass er den Versuch gemacht hätte, den Widerstand der Sowjetunion gegen einen Beitritt zur europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG zu brechen: Er sah in der von Großbritannien dominierten EFTA keineswegs ein Vehikel zweiter Klasse auf dem Weg zu einem vereinten Europa. Österreich erlebte die Einigung Europas daher in seiner Ära nur als Zaungast und sie war auch für die Berichterstattung des profil anfangs überhaupt kein Thema. So gab es zum Beispiel keinen Text, der sich damit befasste, dass Großbritannien nur deshalb mit Österreich und Schweden der EFTA beigetreten war, weil Charles de Gaulle ein Veto Frankreichs gegen den Beitritt der Briten zur EWG eingelegt hatte. Mich für ein vereintes Europa zu begeistern, blieb sozusagen meine Privatsache. Einmal mehr teilte ich dabei die Emotionen meiner Mutter, die den HabsburgerKannibalismus der SPÖ unter anderem deshalb nicht mitmachte, weil sie Otto Habsburg wegen seines Widerwillens gegen Hitler und sein Engagement für die PaneuropaBewegung Richard Coudenhove-Kalergis schätzte. Sie war es denn auch, die mich auf
Kreiskys ökonomische Visionen
Coudenhove-Kalergis Paneuropa-Manifest hinwies, das bis heute ein Dokument von erstaunlicher Klarsicht ist: 1923 sieht Coudenhove darin einen alles Vergangene an Grauen übertreffenden Krieg vorher, in dem einander Frankreich und Deutschland gegenüberstehen und fordert exakt jene Einigung von 26 europäischen Staaten zur Bildung einer gemeinsamen Organisation, die heute mit der EU vollzogen ist. Sogar den EuGH nimmt er als unverzichtbare „gemeinsame Gerichtsbarkeit“ vorweg und erhofft wirtschaftliche Stärke durch gemeinsames Wirtschaften und politische Stärke durch gemeinsame Verteidigung, wobei er damals Russland als gefährlichsten Gegner ausmacht und in den Amerikanern potentielle Verbündete sieht. Leider ist die EU militärisch noch nicht so weit wie Coudenhove schon 1923 war: Ein europäisches Heer lässt unverändert auf sich warten, obwohl sich die NATO in der Ära Donald Trumps als höchst brüchiges Verteidigungsbündnis erwies. Wäre Österreich Adeligen weniger feindlich gesinnt, es setzte Coudenhove ein Denkmal: Er hat die EU 1923 weiter gedacht als sie 2023 dastehen wird. Als Verweser des paneuropäischen Erbes trat in den 1960er Jahren einmal mehr der Sohn einer Adeligen auf: Otto Molden, der Bruder des Verlegers Fritz Molden hatte mit Paula (von) Preradović die Autorin der österreichischen Bundeshymne zur Mutter und teilte mit Otto (von) Habsburg den Widerwillen gegen Hitler. Er desertierte von der deutschen Wehrmacht und war wie sein Bruder am Aufbau der einzigen ernsthaften Widerstandsbewegung des Landes O5 beteiligt, was Fritz Molden nach dem Krieg seine Lizenz für die Herausgabe der „Presse“ eintrug, während Otto Molden sich in der Politik versuchte: Er begründete das Europäische Forum Alpbach und 1960 die „Europäische Föderalistische Partei“ EFP. Die Vorgeschichte dürfte erklären, warum ich dieser Partei mit größter Sympathie gegenüberstand. Dass ich ihr Mitglied wurde, hatte allerdings mit der atemberaubenden Schönheit ihrer Sekretärin zu tun: Cecily Herberstein, wenig später die Frau meines Freundes Axel Corti, leitete das Büro der EFP in Wien, als ich mich dort über die Zukunft dieser Partei informieren wollte. Als sie mich fragte, ob ich mich nicht zur Mitgliedschaft entschließen könnte, unterschrieb ich das Formular, ohne nachzudenken und gestehe im Nachhinein, dass ich bei ihr jede Parteimitgliedschaft, außer die zur FPÖ oder zur KPÖ unterschrieben hätte. Einer ihrer Programmpunkte war es, Esperanto als europäische Sprache einzuführen – das dürfte erklären, dass ich im profil nie zur EFP und ihrer Vision eines Vereinten Europa Stellung bezogen habe. Genau so wenig wie zur EFTA: Europas Einigung vollzog sich zu meiner Schande lange Zeit außerhalb unserer Berichterstattung. Erst nach Jahren, als sich der wirtschaftliche Erfolg der EWG als so viel größer als der der EFTA erwies und Österreich wie Großbritannien und Schweden die Mitgliedschaft bei der EWG anstreben sollte, nahm auch die profil-Berichterstattung Europa wahr. Wirtschaftspolitisch sah Kreisky sich der „schwedischen Schule“, das heißt einer expansiven Budgetpolitik verpflichtet, und die Sozialisten erwiesen sich damit durch Jahre tatsächlich als die besseren Kapitalisten. Heute könnte ich das mit Hilfe der
293
294
Kreiskys ökonomische Visionen
„Saldenmechanik“ einfach erklären: Mehr Einkäufe des Staates bedingen zwingend auch mehr Verkäufe der Unternehmen = Wirtschaftswachstum. Damals hat es auch mich verblüfft, denn die ökonomische Ansicht der Leute, die in den Augen der meisten Journalisten etwas von Wirtschaft verstanden, war, wie heute, gegenteilig: Hohe Staatsausgaben seien ein Fehler. Jedenfalls ließen die erhöhten Staatsausgaben und Budgetdefizite Hannes Androschs, der Saldenmechanik folgend, Österreichs Wirtschaft in Riesenschritten wachsen und seit der harte Schilling ihre Struktur optimiert hatte, gab es immer mehr Unternehmen, die weltweite Konkurrenzfähigkeit erlangten. Kreiskys ökonomischer Kurs bewährte sich aber auch bei der Überwindung der großen internationalen Wirtschaftseinbrüche seiner Ära: der „Ölkrisen“ der Jahre 1973/74 und 1979, die – lange vor dem Krieg in der Ukraine – aufzeigten, wie sehr eine massive Erhöhung des Ölpreises die Wirtschaft aller europäischen Staaten zu gefährden vermag. Zur Überwindung dieser „Ölpreisschocks“ beschritten die verschiedenen Staaten die verschiedensten Wege. Der Bruno Kreiskys war ein strikt keynesianischer: Er kämpfte mit allen Mitteln gegen den Verlust von Arbeitsplätzen –„ein paar Milliarden mehr Schulden machen mir weniger Sorgen als hunderttausend Arbeitslose“ – und setzte auf Deficit-Spending. Damit stieß er jedes Mal auf energischen Widerspruch der ÖVP, und auch ich begriff damals nicht, wie recht er damit hatte. Erst als ich zusammen mit dem Ökonomen Professor Gunther Tichy anlässlich Kreiskys Abschied die Daten nachrecherchierte, erkannte ich retrospektiv, wie erfolgreich seine Strategie gewesen war: Zwar litten natürlich auch wir unter diesen Krisen – sie erzeugten Pleiten und ließen auch bei uns die Arbeitslosigkeit steigen – aber in Summe überwand Österreich beide Ölpreisschocks doch besser als die meisten anderen Volkswirtschaften: Die Arbeitslosenzahlen waren bald wieder unter den niedrigsten weit und breit, Industrieund Dienstleistungsunternehmen zählten unverändert zu den besten und stärksten. Dass die Wirtschaftsgeschichte dennoch nicht zwingend gerecht ist, führte Margaret Thatcher in Großbritannien vor: Sie reagierte neoliberal, brach mit eiserner Konsequenz die übergroße Macht der britischen Gewerkschaften, schloss ebenso richtig unrentable Kohlegruben und setzte auf eine höchst aktuelle, Kreisky entgegengesetzte Strategie: Sparen des Staates. Betrachtet man dessen Folgen isoliert, so erlitt Großbritannien dramatische Einbrüche seiner Wirtschaft – nur dass es im selben Jahrzehnt zufällig Ölreserven an seiner Küste entdeckte: Aus dem Boden sprudelndes Nordseeöl verschaffte auch Thatcher den Ruf, die Krise blendend überwunden zu haben. Kreisky beließ es allerdings nie dabei, die „große Linie“ der Wirtschaftspolitik vorzugeben, er nahm – positiv gesehen – immer auch persönlichen Anteil an konkreten Projekten, beziehungsweise mengte sich – negativ gesehen – in sie ein. Da Österreichs Handelsbilanzdefizit damals vor allem davon herrührte, dass die autobegeisterten Österreicher ihre Autos zwangsläufig im Ausland kauften, begeisterte sich Kreisky für die immer wieder durch die Köpfe spukende Idee einer österreichischen
Kreiskys ökonomische Visionen
Autofertigung. Auch Rennfahrer Niki Lauda wollte zusammen mit Udo Proksch, auf den ich später noch ausführlicher zu sprechen komme, eine solche ins Leben rufen und gründete zu diesem Zweck sogar eine gemeinsame Gesellschaft mit ihm. Die beiden sprachen diesbezüglich bei Kreisky vor, aber der dachte in größeren Dimensionen: Er wollte eine österreichische Autoproduktion in Kooperation mit VW. Am 6. September 1976 erschien in der Kronen Zeitung ein Interview, das aufhorchen ließ: Innerhalb der nächsten Jahre würde Österreich eine Autoindustrie aufbauen und jährlich 40.000 Kraftwagen vom Band laufen lassen, hieß es da. Die Ankündigung kam von Franz Geist, Generaldirektor der ÖIAG, (heute ÖBAG) in der die Eigentumsrechte des Bundes an der damals mächtigen verstaatlichten Industrie zusammengefasst waren: Die VOEST zählte unter die potentesten Stahlerzeuger der Welt. Das Genie von sechs Ingenieuren, die in Linz und Donawitz das LD-Verfahren erfanden, ein Sauerstoffblasverfahren, bei dem die Stahlerzeugung mittels reinen Sauerstoffs optimiert wird, hatte dazu geführt, dass sie nicht nur selbst die besten Stähle erzeugte, sondern Lizenzen ihres LD-Verfahrens in die ganze Welt zu verkaufen vermochte. Beste Stahlbleche und damals hohe Gewinne sprachen also durchaus für eine österreichische Autoproduktion. Noch mehr sprach in meinen Augen dafür, dass es in Graz die beste Motorenbauschule der Welt gab, so dass österreichische Ingenieure weit überproportional Spitzenpositionen bei BMW, Mercedes oder VW besetzten. Nicht minder groß war die automobile Tradition des Landes mit Gräf & Stift, den Steyr-Werken und natürlich der Familie Porsche, deren Oberhaupt Ferdinand Piech größter Aktionär von VW war. Kreisky schwebte ein von VW vertriebener „Austro-Porsche“ vor. Wie fast immer fiel die bürgerliche Presse über seine „Schnapsidee“ her, und auch sein Finanzminister Hannes Androsch und andere Berater hielten sie, wie die Direktoren der damals staatlichen Banken, für eine Nummer zu groß. Bei einem, eigens zu diesem Thema abgehaltenen, Kongress kamen die versammelten Experten zu dem Schluss, dass eine österreichische Autoindustrie „keine gute Idee“ sei. Ich teilte diese Meinung weder damals, noch teile ich sie heute: Die erhoffte Vertriebskooperation mit VW kam meines Erachtens vor allem deshalb nicht zustande, weil Ferdinand Piech sich keinen gefährlichen Konkurrenten für VW heranziehen wollte. Genauso wenig wollten BMW, Opel oder Mercedes einen österreichischen Konkurrenten und erteilten potentiellen Betriebsstätten in Wien und Graz daher vorsorglich Aufträge als Zulieferer für ihre Autos: In Aspern wurden Getriebe, in Graz voran Motoren für deutsche Autos nicht nur gebaut, sondern auch entwickelt, was die Zulieferindustrie weiter wachsen ließ, so dass sie heute von der Erzeugung von Dimmern und Ventilen bis zur Fertigung von Bodenteppichen reicht. Mit 400.000 Fahrzeugen fertigt Magna in Graz heute im Auftrag der großen deutschen Konzerne mehr Autos als etwa Volvo, und nicht weniger als 450.000 Österreicher sind in der erweiterten Automobilindustrie beschäftigt. Letztlich dank Kreiskys Vision.
295
296
Kreiskys ökonomische Visionen
Das Zwentendorf-Paradoxon Da es jeweils die extreme Abhängigkeit vom Öl war, die Österreichs wirtschaftlichen Aufstieg unterbrochen hatte, dachte Bruno Kreisky auch in Bezug auf die Energieversorgung in den damals fortschrittlichsten Dimensionen. Bereits die Regierung Josef Klaus hatte 1969 den Bau eines Kernkraftwerks in Zwentendorf genehmigt, Kreisky hatte ihn 1971 zur Freude der Industriellenvereinigung beschlossen und sein Energieplan des Jahres 1976 sah gleich drei Kernkraftwerke für Österreich vor. Siemens, mit Österreich seit jeher durch umfangreiche Niederlassungen und Forschungsstätten verbunden, übernahm den Bau eines Siedewassereaktors in Zwentendorf, der sich allerdings durch ein Erdbeben verzögerte: Das Fundament erlitt Risse und musste erneuert werden. Danach ging das Kraftwerk, politisch scheinbar bestens abgesichert, seiner Fertigstellung entgegen. Aber nicht zuletzt durch das Erdbeben hatte sich natürlich auch in Österreich grundsätzlicher Widerstand gegen die Atomenergie formiert und spaltete die Bevölkerung. Mit einigem medialen Erfolg gingen „Mütter gegen Atomkraftwerke“ in Hungerstreik, während die Industrie auch nicht ganz ohne Erfolg behauptete, in Österreich würden ohne Zwentendorf die Lichter ausgehen. Manfred Deix hielt die Debatte in einem Cartoon fest, dessen Inhalt wir wie so oft gemeinsam entwarfen: Ein Häuflein Atomkraftbefürworter, deren Körper von Krebsgeschwüren übersäht ist, steht einem Häuflein von Atomkraftgegnern mit Fellschürzen und Zündsteinen gegenüber, und jede Gruppe zeigt der anderen den Vogel. Am erfolgreichsten propagierte in meinen Augen der Risikoforscher Wolfgang Kromp den Widerstand, indem er sich anfangs nicht so grundsätzlich atomenergiefeindlich zeigte, sondern nur behauptete, dass die Schweißnähte des Siedewasserbehälters nicht dicht seien und dass ihr Platzen eine Nuklearkatstrophe auslösen könnte. Ich war durch meine Freundschaft mit Viktor Weißkopf ein Befürworter der Atomenergie, weil mir seine Behauptung, dass sie als Zwischenschritt zur direkten Nutzung der Sonnenenergie, unverzichtbar sein würde, um eine Klimakatastrophe durch den Glashauseffekt abwenden zu können, einleuchtend schien, und weil ich überzeugt war, dass ein Mann von so ausgeprägter Humanität eine Technologie, die er wie wenige andere kannte, nie aus wirtschaftlichen Gründen zulassen würde, wenn er sie für gefährlich hielte. Dass Siemens nicht in der Lage sein sollte, die Nähte eines Siedewasserbehälters dicht zu schweißen, hielt ich zwar für sehr unwahrscheinlich, lud aber, vermutlich auf Drängen Reinhard Tramontanas drei einschlägige Techniker, Professoren der TU-Wien, zu einem Streitgespräch mit Kromp in die Redaktion ein. Ob die meisten meiner Kollegen im profil der Atomenergie auch eher positiv oder eher negativ gegenüberstanden, weiß ich nicht – jedenfalls versuchten wir alles, um die Diskussion in meinem Zimmer so präzise und fair wie möglich zu führen. Doch Kromp blieb so eisern bei seiner Überzeugung, dass die Nähte nicht sicher genug seien,
Das Zwentendorf-Paradoxon
wie die Professoren das bestritten. „Sie halten das Zehnfache der maximal denkbaren Belastung aus“, behauptete schließlich einer von ihnen abschließend – und damit gingen wir auseinander. Im Vorraum hörte ich durch die zu meinem Zimmer offengebliebene Tür, wie sein Kollege ihn fragte, woher er diese Ziffer denn hätte. „Geh die hab ich erfunden – was sollst tun, wenn Du mit einem diskutierst, der die defekte Schweißnaht genauso erfunden hat“, gab der Gefragte zur Antwort. Ich erlebte erstmals ein bis heute aktuelles Problem: Es ist für Laien – und das sind Journalisten fast immer – ausgeschlossen, sich eine korrekte Meinung in technischen Fragen zu bilden, wenn selbst ein Professor einer Hochschule sich nicht zu korrekten Aussagen verpflichtet fühlt. Ob die Aussage Kromps auch erfunden war, kann und will ich nicht beurteilen. Ich blieb jedenfalls bei meiner durch Weisskopf gebildeten Meinung und vertraute der Siemens-Schweißtechnik. Bruno Kreisky, der sich mit Weisskopf beriet, ging es zweifellos nicht anders. Doch die Opposition gegen die Atomenergie ließ sich nicht aufhalten. Je heftiger die Industrie mit Plakatserien, Vierfarbinseraten und teuren Werbesports für Zwentendorf warb, desto erfolgreicher waren ihre Gegner mit handgeschrieben Zetteln, auf denen sie es für lebensgefährlich erklärten. Der ursprünglich gewaltige Vorsprung der Zwentendorf-Befürworter begann zu schrumpfen, die Gegner legten zu. Worauf Bruno Kreisky den gleichen Weg einschlug, den David Cameron einschlug, als der ursprünglich gewaltige Vorsprung der EU-Befürworter schrumpfte und ihre Gegner immer mehr Zulauf erhielten: er setzte – in der festen Überzeugung, der Debatte damit ein siegreiches Ende zu bereiten – eine Volksabstimmung an. Denn Meinungsumfragen prophezeiten dafür weiterhin einen, wenn auch nicht mehr so eindrucksvollen Sieg der Befürworter. Doch entweder wurde Kreisky erstmals nervös oder er wollte unbedingt einen klaren Sieg – jedenfalls machte er seinen bis dahin größten Fehler: Er erklärte, er würde zurücktreten, wenn die Abstimmung gegen Zwentendorf ausgehe. Was das bewirkte, konnte ich unter den Eigentümern des profil unmittelbar persönlich beobachten: Selbst glühende Anhänger der Kernkraft wie Heinrich Treichl sahen sich plötzlich außerstande, für Zwentendorf zu stimmen. Denn in der Industriellenvereinigung wie im Wirtschaftsflügel der ÖVP sah man die unwiederbringliche Chance, den Sonnenkönig, gegen den man bisher so ohne den geringsten Erfolg angekämpft hatte, zu stürzen. Die Abstimmung ging mit einem Überhang von 30.068 Stimmen gegen Zwentendorf aus, und für keinen Soziologen besteht der geringste Zweifel, dass das ausschließlich an diesem Schwenk innerhalb der ÖVP lag: Die Hoffnung auf Kreiskys Abschied verhinderte Zwentendorf.
297
298
Kreiskys ökonomische Visionen
Der dachte freilich nicht daran, sein Versprechen einzulösen und vollzog seinerseits eine totale Kehrtwendung: Statt zurückzutreten, beschloss er den „Atomsperrvertrag“, mit dem Österreich für alle Zeiten von der Atomenergie Abschied nahm. Weisskopf, der ihn die ganze Zeit über beraten hatte, fand es zwar schade um das viele ausgegebene Geld, beruhigte Kreisky aber bezüglich der künftigen Energieversorgung – die sei auch ohne Zwentendorf zweifelsfrei gewährleistet. Nur den Atomsperrvertrag nannte er mir gegenüber „unbedacht“ und eine Reihe meiner Bekannten dachte ähnlich. In den folgenden Jahren vollzog sich in Bezug auf die Atomenergie allerdings etwas ganz Ähnliches wie in Bezug auf die Entscheidung zur „immerwährenden Neutralität“. Hatte insbesondere unter den Unterhändlern des Staatsvertrages, gleich ob sie der ÖVP oder der SPÖ angehörten, ursprünglich kein Zweifel darüber geherrscht, dass sie eine Einschränkung unserer Souveränität und der leider unvermeidbare Preis für den Staatsvertrag war, so wurde daraus mit der Zeit ein integraler Bestandteil der österreichischen Identität: Die Bevölkerung ist heute vom enormen Nutzen der Neutralität so überzeugt wie von der enormen Gefahr der Kernkraft. Kein österreichischer Politiker, der Erfolg haben möchte, vergisst, die Neutralität für unverzichtbar zu halten und gegen rundum errichtete Atomkraftwerke zu protestieren. Weltweit herrscht freilich trotz Tschernobyl und Fukushima die Ansicht Weisskopfs vor, dass die Atomkraft unverzichtbar sein wird, um die Lücke zu schließen, die bei der Stromversorgung zwischen dem aus Klimagründen unbedingt nötigen Abschied von Erdöl und Kohle und der Energiegewinnung aus Sonne und Wind klafft. In den meisten Staaten der Welt und selbst der EU werden daher trotz Österreichs Gegnerschaft Kernkraftwerke errichtet und gefährden uns, wenn sie tatsächlich gefährlich sein sollten, nicht minder als Zwentendorf. Auch ich glaube an ihre Notwendigkeit und meine, dass sie auch sicher sind, wenn sie nicht direkt über einer Erdbebenlinie errichtet oder katastrophal gewartet werden. Obwohl ich mit dieser Ansicht im Widerspruch zu einem anderen meiner Idole stehe: Karl Popper sprach sich gegen die Nutzung der Kernkraft aus, weil wir zu wenig über sie wüssten, um Entscheidungen zu treffen, die so lange unverrückbar in die Zukunft fortwirken, wie radioaktive Strahlung zu ihrem endgültigen Erlöschen braucht. Meine Gegenposition lautet: Wir wissen derzeit so viel über die Erderwärmung durch den Glashauseffekt und die relativ kurze Zeit, die uns bleibt, eine Klimakatastrophe zu vermindern, dass wir die Risiken der Kernkraft in Kauf nehmen müssen, solange wir nicht auf eine völlig neue, ausreichend ergiebige Quelle alternativer Energie gestoßen sind. Nicht zuletzt gibt es mittlerweile eine neue Generation von Atomkleinkraftwerken, die nicht nur besonders sicher sein sollen, sondern auch das Problem der Endlagerung gelöst haben, indem gebrauchtes radioaktives Material so verarbeitet wird, dass man es nicht mehr tief unter der Erde vergraben werden muss, um vor Strahlung geschützt zu sein. Wir wissen nicht nur mehr über den Klimawandel, sondern auch mehr über Atomkraftwerke.
Pleiten und Pannen
Pleiten und Pannen Dass sein persönliches Engagement Zwentendorf nicht herbeigeführt, sondern verhindert hatte, hielt Bruno Kreisky nicht davon ab, sich immer wieder auf diese Weise zu engagieren. So begeisterte er sich für die Kameras des Unternehmens Eumig in Fohnsdorf, in dem ihm darüber hinaus „sozialistischer Kapitalismus“ ideal verwirklicht schien: Man hatte dort als erstes Unternehmen die 40-Stundenwoche eingeführt, zahlte dennoch beste Gehälter und beschäftigte einen eigenen Frauenarzt. Mein Kollege Ronald Barazon, damals Leiter des Wirtschaftsressorts der „Salzburger Nachrichten“, wollte dennoch nicht an dieses soziale Paradeunternehmen glauben: Er hatte die Wertschöpfung des Unternehmens durch die Anzahl seiner Angestellten dividiert und war auf eine gespenstisch niedrige Zahl gekommen, die er auch mir genannt hat. Bruno Kreisky kannte sie offensichtlich nicht. Als in Fohnsdorf die Kohleförderung zugesperrt werden musste, glaubte er Arbeitslosigkeit zu vermeiden, indem Eumig wuchs. Er drängte das Management der Länderbank, das der SPÖ nahestand, Eumig mit Krediten zur Seite zu stehen, und Eumig nahm im Gegenzug Bergarbeiter auf. 1981 bestätigte sich Barazons Rechnung: Eumig war pleite. 3000 Mitarbeiter waren arbeitslos, die Länderbank stöhnte unter zwei Milliarden Schilling Verlust und ihr Management musste zurücktreten. Wenig später bereitete ihr die betrügerische Pleite der Firma Klimatechnik einen Schaden von weiteren fünf Milliarden Schilling und gefährdete ihre Existenz. Ich war nicht bereit, dieses doppelte Versagen von dem Umstand zu trennen, dass die Länderbank zwar nicht „verstaatlicht“ war, wohl aber im Eigentum des Staates stand. Vielmehr fühlte ich mich in meiner Skepsis gegenüber verstaatlichten Unternehmen bestätigt, die ich seinerzeit in meiner Diskussion mit Hannes Androsch offenkundig nicht erfolgreich zu begründen vermochte, weil er mir den Erfolg der VOEST entgegenhalten konnte. Nur war die VOEST nicht wegen, sondern trotz Verstaatlichung erfolgreich. Ihr zentrales Unternehmen, die „Hermann Göring Werke“ in Linz waren (nicht zuletzt von Zwangsarbeitern) nach neuesten technischen Erkenntnissen errichtet worden und daher von vornherein leistungsfähiger als das Gros der Konkurrenz. Wir hatten das rasende Glück, dass dieses „deutsche Eigentum“ 1945 noch dazu in der amerikanischen Zone lag und daher von den USA beschlagnahmt wurde: Anders als die Ölförderanlagen im niederösterreichischen Zistersdorf, die Russland als Kriegsentschädigung beanspruchte, übergaben die USA die VOEST 1946 ins Eigentum der Republik, und Deutschland akzeptierte diese Enteignung als Entschädigung Österreichs. Erstes Opfer Hitlers gewesen zu sein, bewährte sich auch ökonomisch. Auf diese Weise, nicht auf der Basis irgendeiner „Ideologie“, gelangte die VOEST ins Staatseigentum.
299
300
Kreiskys ökonomische Visionen
Die Ideologie brachte erst die SPÖ mit, die mit Karl Waldbrunner als Minister ihre Verwaltung übernahm. Er, und vermutlich auch andere in der SPÖ, verwechselten „Staatseigentum“ wie Lenin und Stalin mit Marxens „Vergesellschaftung“, obwohl Österreichs wichtigster marxistischer Denker, Otto Bauer, in einem Aufsatz ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, dass „Verstaatlichung“ die schlechteste Organisation eines Unternehmens darstelle, weil es dann von ahnungslosen Beamten statt von engagierten privaten Eigentümern geführt würde. Aber in der SPÖ der Nachkriegszeit – ich habe darauf schon hingewiesen – hatten die wenigsten marxistische Literatur gelesen, und so blieb es bei der Vorstellung, „Verstaatlichung“ sei etwas Sozialistisches und daher zu verteidigen. Bruno Pittermann als SP-Obmann und Karl Waldbrunner als „verstaatlichten Minister“ hatten dabei das gleiche Glück wie Margaret Thatcher beim neoliberalen Sparen des Staates in England: Da sechs geniale Ingenieure zufällig im gleichen Zeitraum das LD-Verfahren entdeckten und die Anlagen der Hermann Göring Werke so neu waren, stellte sich die längste Zeit nicht heraus, dass die VOEST alles andere als optimal geführt wurde. Zum grundlegenden Verhängnis wurde ihr eine wirtschaftliche Betrachtung, der auch – so seltsam verläuft Wirtschaftsgeschichte manchmal – der neoliberale Sebastian Kurz und sein Wirtschaftsteam besonders heftig anhingen, dass Lohnverhandlungen nämlich „betriebsspezifisch“ geführt werden sollen: Ein Unternehmen, dem es sehr gut gehe, könne durchaus höhere Löhne zahlen – es müsse nur verhindert werden, dass Gewerkschaften durch ihr Mitverhandeln in allen Unternehmen annähernd gleiche Löhne für annähernd gleiche Tätigkeiten durchzusetzen suchten, denn das hielten schwache Unternehmen nicht aus. Dieser Kurzschluss ist freilich das absolute Gegenteil freier Marktwirtschaft, denn im Gegensatz zur sogenannten „solidarischen Lohnpolitik“ intelligenter Gewerkschafter, verschlechtern „betriebsspezifische“ Lohnverhandlungen die Wirtschaftsstruktur. Regierte wirklich der Markt, so müssten Hochofenarbeiter nämlich aus schwachen Stahlbetrieben mit niedrigen Gehältern ständig zu starken Stahlbetrieben wie der VOEST abwandern, um an deren höherem Lohnniveau zu partizipieren. Dieser Zustrom müsste das höhere VOEST-Lohnniveau langsam aber sicher senken, während die schwachen Stahlbetriebe die Löhne anheben müssten, um nicht ohne Arbeitskräfte dazustehen. Übrig bliebe im marktwirtschaftlichen Idealfall ein mittleres Lohnniveau, bei dem gleiche Arbeit annähernd gleich bezahlt würde und das folgende Vorteile hätte: Ganz schwache Stahlunternehmen, die von diesem mittleren Lohnniveau überfordert wären, müssten zusperren und ihre Marktanteile stärkeren Stahlunternehmen wie der VOEST überlassen. Die wiederum könnte angesichts mittlerer Löhne so große Gewinne machen, dass sie in der Lage wäre, weitere Unternehmen zuzukaufen und in die besten neuen Anlagen zu investieren. Im Gegensatz zur „betriebsspezifischen“ sorgte die „solidarische Lohnpolitik“ daher für die optimale Wirtschaftsstruktur. Aber es haben nicht nur die wenigsten Sozialisten
Pleiten und Pannen
Marx gelesen, sondern auch die wenigsten Bürgerlichen die Lehrbücher bürgerlicher Betriebs- und Volkswirtschaft. Die VOEST jedenfalls bezahlte unter Kreisky „betriebsspezifisch“ überhöhte Löhne und glänzte wie Eumig mit außergewöhnlichen Sozialleistungen, zumal ihre Betriebsräte fast durchwegs zugleich Nationalräte waren und sich dieser Erfolge rühmen, beziehungsweise finanziell von ihnen profitieren konnten. Das ging so lange gut, bis eine internationale Flaute die Stahlpreise einbrechen ließ: Plötzlich hatte die VOEST zu viele zu teure Arbeitskräfte und hätte sich eigentlich durch Kündigungen sanieren müssen. Das widersprach gleichermaßen Kreiskys Überzeugung und Vision, und er ließ an dieser seiner Einstellung keinen Zweifel. Unter entsprechendem politischem Druck versuchte das VOEST-Management – diesmal im rein marktwirtschaftlichen Sinne zu Recht – dem Unternehmen Marktnischen zu erschließen: Es entwickelte und baute in der Tochterfirma Noricum mit der GHH45 Kanonen mit über 30 Kilometern Reichweite, obwohl ihm das durch den Staatsvertrag untersagt war. Diese Kanonen gelangten, wie das bei Waffen fast immer der Fall ist, natürlich dorthin, wohin sie auf keinen Fall gelangen durften: in den kriegsführenden Iran und den kriegsführenden Irak. Ein SP-Politiker rechtfertigte das mir gegenüber auf besonders amüsante Weise: Österreich verstoße damit nicht gegen die Neutralität, denn es habe ja beide Kriegsparteien gleichermaßen beliefert. Der österreichische Botschafter Herbert Amry, der in Athen auf die Umwege gestoßen war, über die diese Geschäfte abgewickelt und verschleiert wurden, sah das anders und verständigte das Außenamt. Obwohl er Morddrohungen erhielt, wollte er sich noch einmal mit seinem Informanten treffen, um Details zu erfahren. Doch unmittelbar vor dem Treffen starb er an Herzversagen, das leider nicht gesichert diagnostiziert werden konnte, weil sein Leichnam sofort eingeäschert wurde. Allerdings hatte er, was er bis dahin erfahren hatte, in drei Fernschreiben ans Außenministerium berichtet. Aber obwohl einem Strafprozess gegen das NoricumManagement ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss folgte, konnte nie geklärt werden, ob sie Außenminister Leopold Gratz auch erreichten. Ein viertes, angeblich entscheidendes Telegramm verkam auf nie geklärte Weise im Innenministerium. Innenminister Karl Blecha musste deshalb immerhin zurücktreten. Wesentliche Recherchen zur Aufklärung der Affäre leistete ein Fotojournalist, der zwar bei mir vorgesprochen, den ich aber nicht ernst genommen hatte: Es gelang ihm an den Irak adressierte Kisten mit Bestandteilen der Kanone zu fotografieren. In der eben gegründeten Monatszeitschrift „Basta“ hatten die Brüder Helmuth und Wolfgang Fellner richtiger reagiert, dem Fotografen seine Reise finanziert, und ernteten nun die Früchte: Basta ging als die Zeitschrift in die Pressegeschichte ein, die den NoricumSkandal aufgedeckt hat. Davor war sie als die Zeitschrift in die Pressegeschichte eingegangen, die eine der größten Zeitungsenten der Nachkriegszeit produzierte: Sie hatte eine Satire über angeblich 1000 vom Schauspieler Herbert Fux vernaschte Frauen ernst genommen und als
301
302
Kreiskys ökonomische Visionen
Tatsache ins Blatt gerückt und damit zwar einen gewaltigen Verkaufserfolg, aber gleich darauf gewaltiges Gelächter und eine Klage geerntet. Aber die Brüder Fellner erledigten auch das gewohnt genial: Sie erreichten die nächste gewaltige Verkaufsauflage mit einer Story über ihre Versöhnung mit Herbert Fux. Für mich war der Erfolg von Basta insofern relevant, als Helmut Voska und Alfred Worm abwechselnd damit drohten, dorthin zu wechseln. Bezüglich Voskas wäre das kein großer journalistischer Verlust gewesen, bezüglich Worms sehr wohl, aber ich blieb vorerst zu Recht zuversichtlich, dass er profil erhalten bleiben würde. Etwa um diese Zeit, (ich kann den genauen Zeitpunkt nicht mehr fixieren) ließ mich der fortgesetzte Misserfolg verstaatlichter Unternehmen eine Diskussion mit Ferdinand Lacina führen, dem ab 1982 als Verkehrsminister ihre Verwaltung oblag. Lacina zählte in der SPÖ zur „linken“ Fraktion, war mir aber als besonders wirtschaftskundig aufgefallen. (Er hatte lange in der wirtschaftspolitischen Abteilung der Arbeiterkammer gearbeitet, die unter der Leitung von Eduard März, eines guten Bekannten meiner Mutter, einen hervorragenden Ruf hatte. Danach war er im Bundeskanzleramt für Wirtschaftsfragen zuständig gewesen). „Wie viele Pleiten verstaatlichter Unternehmen“, so fragte ich ihn, „muss es noch geben, damit Sie nicht mehr daran glauben, dass Verstaatlichung eine gute Organisationsform für ein Unternehmen ist?“ „Geben Sie mir vier Jahre Zeit“, antwortete er und wir schlossen eine nicht sehr ernste Wette ab: Wenn er nach vier Jahren nichts mehr von der Verstaatlichung halten sollte, würde er mir eine Kiste Sekt schenken – wenn sie sehr wohl funktionierte, müsste ich ihm eine schenken. So gingen wir auseinander und dachten nicht mehr daran. Die VOEST (ihr Tochterunternehmen Noricum) sollte mit der GHH45 zwar kurzfristig gut verdienen, ihr Grundproblem aber in keiner Weise lösen: Ihre Belegschaft war zu teuer. Da die internationale Flaute anhielt, geriet sie und gerieten auch diverse ähnlich organisierte verstaatlichte Betriebe in massive wirtschaftliche Turbulenzen. Worauf Bruno Kreisky sich einmal mehr persönlich einmengte und etwas ganz Ähnliches tat wie Jörg Haider, als das Land Kärnten die Haftung für die Hypo Alpe Adria übernahm: Die Republik Österreich übernahm die Haftung für Österreichs verstaatlichte Industrie. Das hatte auch Auswirkungen, die denen der Haftungsübernahme durch Kärnten sehr ähnlich waren: Österreichs Banken gewährten den verstaatlichten Unternehmen, voran der VOEST, jede Menge Kredite, weil die dank der Haftung der Republik völlig unbedenklich schienen. Das VOEST-Management sah sich nicht gezwungen, die Strukturen des Unternehmens zu reformieren, sondern legte das viele Geld anderwärtig an: Es spekulierte damit auf dem Ölterminmarkt. In Summe häufte die VOEST im Rahmen des sogenannten „Intertrading-Skandals“ Verluste in der Höhe von mindestens 5,7 Milliarden Schilling (414 Millionen Euro) an. Andere verstaatlichte Unternehmen reformierten unter dem neuen Geldsegen auch zu wenig und verbrannten nur etwas weniger Geld.
Pleiten und Pannen
In Summe brachte das die Banken nun sehr wohl ins Wanken: CreditanstaltBankverein (CA) und Länderbank, die zwei größten Banken des Landes, waren nach den üblichen Bilanzkriterien pleite. profil hatte diese Entwicklung trotz seiner schmalen Wirtschaftsredaktion vor allem dank ihres Mitarbeiters Franz G. Hanke ziemlich präzise verfolgt, und eigentlich hätten wir täglich einen entsprechend vernichtenden Bericht zur Lage der Banken veröffentlichen können. Wir taten es erstmals in unserer Geschichte nicht: Ernie Loudon, als Geschäftsführer des Kurier so etwas wie Eigentümer des profil und zugleich einer meiner besten Freunde, war, wie ich, überzeugt, dass ein solcher Bericht Österreich in eine wirtschaftliche Katastrophe – einen Bankenrun – gestürzt hätte. Wir einigten uns darauf, dass profil zwar über die Probleme der Banken berichten, nie aber ihr Kapital ihren Verlusten gegenüberstellen würde. Außerdem würden wir nie über beide Banken zugleich berichten. So ist es dann auch geschehen. Es war das einzige Mal, dass wir bewusst auf eine rundum wahrheitsgemäße Berichterstattung verzichtet haben. Die staatliche Länderbank überlebte dank reichlicher staatlicher Zuschüsse und gelangte unter Franz Vranitzky wieder zu einigem Erfolg, ehe sie 1990 nach neuerlichen Schwierigkeiten mit der wirtschaftlich starken Zentralsparkasse der Stadt Wien fusionierte und letztlich in der Bank Austria aufging. In der ging letztlich auch die CA auf. Vorerst sollte allerdings Hannes Androsch sie übernehmen, der dort freilich nur einzog, weil Bruno Kreisky ihn gezwungen hatte, das Amt des Finanzministers aufzugeben. Ferdinand Lacina vergaß zwar, mir eine Kiste Sekt zu schenken, nahm aber aufs energischste die Privatisierung der verstaatlichten Industrie in Angriff und vollendete sie in seiner Ära als Finanzminister, die bis zum Jahr 1990 dauern sollte.
303
47. Wie bekämpft man Arbeitslosigkeit?
Erstmals musste sich Kreisky auch mit einem Problem auseinandersetzen, das Österreich bis dahin nicht zu tangieren schien: Mit steigender Arbeitslosigkeit. Bis dahin schien das Land diesbezüglich tatsächlich eine Insel der Seligen – die rote Alleinregierung konnte sich ständig einer der niedrigsten Arbeitslosenraten Europas rühmen. Es war das viel bewunderte Deutschland, in dem das Problem steigender Arbeitslosigkeit erstmals sichtbar wurde. Nach Ansicht der meisten Ökonomen hatte es etwas mit der Stagflation in Japan zu tun, wo die Wirtschaft trotz gesteigerter staatlicher Investitionen nicht wachsen wollte. Das war sicher ein Grund, nur dass das Nichtfunktionieren meines Erachtens an der zu niedrigen Dimension der Investitionen lag. Stattdessen sahen Anhänger von Friedrich August Hayek endlich dessen These bestätigt, dass der Staat nicht in die Wirtschaft eingreifen möge und dass Keynes tot sei. Ich hatte, vor allem bezüglich der gestiegenen Arbeitslosigkeit in Deutschland, eine ganz andere These: Dass ihre besondere Höhe sie in diesem so perfekt industrialisierten Land nämlich davon herrühren könnte, dass wegen der immer produktiveren Maschinen nicht mehr so viele Arbeitskräfte gebraucht würden, um ausreichend Güter herzustellen – ich hatte – wahrscheinlich zu früh – die Vorstellung, dass bereits eingetreten sei, was auch Keynes für den Augenblick propagierte, indem das Angebot die Nachfrage locker befriedigt: Dass dann „Arbeitszeitverkürzung“ angesagt sei, um Vollbeschäftigung zu sichern. Das etwa vertrat ich auch in zahlreichen Texten des profil. Es führte dazu, dass eines Tages ein Mann namens Franz G. Hanke in der Redaktion auftauchte, der diese These in der Folge gegen lächerliche Honorare mit noch ungleich mehr Energie, Emotion und vor allem wesentlich größerer ökonomischer Vorbildung vertrat. Die Emotion hatte einen familiären Hintergrund: Sein Vater war unter dem Druck der Arbeitslosigkeit der Zwischenkriegszeit zur Verzweiflung des Sohnes zum glühenden Nationalsozialisten geworden und der sah daher in Arbeitslosigkeit – das verband ihn mit mir – den entscheidenden Beitrag zu Hitlers Aufstieg. Beide traten wir vor allem deshalb so vehement für Arbeitszeitverkürzung ein, weil wir meinten, sie sei ein probates Mittel, Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Heute sehe ich das zwar immer noch so, bin aber vorsichtiger: Ich bin nicht mehr so sicher, dass Arbeitszeitverkürzung vorhandene Arbeitslosigkeit aufsaugt – wohl aber, dass eine Gesellschaft mit verkürzten Arbeitszeiten weit weniger von Arbeitslosigkeit gefährdet ist. Die Gewerkschaften hatten Arbeitszeitverkürzung zwar immer in ihrem Programm, setzten sich in der Praxis aber kaum dafür ein. Denn diejenigen ihrer Mitglieder, die
Wie bekämpft man Arbeitslosigkeit?
beschäftigt waren, wollten damals nicht kürzere Arbeitszeiten, sondern mehr Geld. Sie und nicht die Arbeitslosen wurden von der Gewerkschaft vertreten. Was die Beteiligten nicht begriffen, war der Tatbestand, dass steigende Arbeitslosigkeit es immer schwerer machen musste, höhere Löhne durchzusetzen – es bildete sich jene berühmte „industrielle Reservearmee“, die es den Unternehmen erlaubte, Lohnwünsche zurückzuweisen, weil es genug Arbeitskräfte gab, die bereit waren, auch zu einem niedrigeren Lohn zu arbeiten, wenn ihnen das einen Job sicherte. Der einzige Gewerkschafter, der die Problematik wie wir sah, Alfred Dallinger, war trotz seiner Intelligenz ein Außenseiter innerhalb der Gewerkschaften – von der Wirtschaft wurde er als „Narr“ bezeichnet, der ihren Untergang herbeireden wolle. Als es um die Frage ging, wer Präsident des ÖGB werden sollte, wurde ihm unter dem Applaus der Wirtschaft der denkbar simpel gestrickte Karl Sekanina vorgezogen, der allerdings etwas später seinen Hut nehmen musste, weil er sich in der Gewerkschaftskasse vergriff. Weder Kreisky noch die sozialdemokratische deutsche Regierung versuchten, dem Problem steigender Arbeitslosigkeit mit Arbeitszeitverkürzung wenigstens etwas von seiner Schärfe zu nehmen. Kreisky setzte vielmehr gemeinsam mit Hannes Androsch voll auf die bis dahin gültige Politik Keynes: Staatliches Geld sollte die Wirtschaft so ausreichend wachsen lassen, dass doch Vollbeschäftigung zu Stande kam. Es kam zu Kreiskys berühmtem Ausspruch, dass ihn ein paar Millionen Staatsschulden weit weniger irritierten als Arbeitslose. Ich war damals nicht sicher, ob das stimmt, aber als ich, wie ich schon beschrieben habe, gemeinsam mit dem Wirtschaftswissenschaftler Gunther Tichy nach Kreiskys Rücktritt die Wirtschaftsdaten seiner Ära nachrecherchierte, zeigte sich, dass Österreich trotz partieller Katastrophen wie der Intertrading-Pleite besser über die Wirtschaftsdelle hinweggekommen war als fast alle anderen Staaten. Heute wüsste ich das auch zu begründen – damals nahm ich es staunend zur Kenntnis. Dennoch glaube ich bis heute, dass sukzessive Arbeitszeitverkürzung im Verein mit hohen Staatsausgaben der optimale Weg gewesen wäre, dem Problem steigender Arbeitslosigkeit zu begegnen. Die ökonomischen Probleme der Arbeitszeitverkürzung waren natürlich Hanke wie Dallinger wie mir immer bewusst – wir waren ja alles eher als „Antikapitalisten“: − Natürlich konnte der Produktivitätsfortschritt nicht doppelt an die Arbeitnehmer weitergegeben werden – sowohl als Arbeitszeitverkürzung wie als Lohnerhöhung. Nach unserer Vorstellung hätte die Wirtschaft eine durch den Produktivitätsfortschritt gerechtfertigte Lohnerhöhung von drei Prozent in zwei Teilen weitergegeben: als anderthalb-prozentige Lohnerhöhung, um den Wunsch der Arbeitnehmer nach mehr Lohn zu befriedigen – aber gleichzeitige Arbeitszeitverkürzung im Ausmaß einer Belastung der Lohnkosten von ebenfalls 1,5 Prozent (beides immer zuzüglich zur Abgeltung der Inflation). − Heute – meines Erachtens viel zu spät, gibt es ein dem angenähertes Modell: Arbeitnehmer können wählen, ob sie mehr Freizeit oder mehr Lohn wollen.
305
306
Wie bekämpft man Arbeitslosigkeit?
− Klar war uns auch, dass Arbeitszeitverkürzung von Unternehmern mit gesteigerter Rationalisierung beantwortet würde: dass sie leistungsfähigere Maschinen einkaufen würden, um teurer gewordene Arbeit zu ersetzen. Da wir in Wirklichkeit beide überzeugte Anhänger des kapitalistischen Systems waren, hielten wir das für einen zusätzlichen Vorteil der Arbeitszeitverkürzung: Sie würde die Struktur der Wirtschaft verbessern, obwohl auf diese Weise ein Teil der durch die Verkürzung vielleicht hinzugewonnen Arbeitsplätze gleich wieder wegrationalisiert würden. Ich bin bis heute überzeugt, dass die Peitsche erhöhter Lohnkosten für die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur unerlässlich ist. − Schließlich war uns auch klar, dass Arbeitszeitverkürzung Fachkräfte verknappen kann. Aber diesbezüglich hatten wir mehr Zutrauen zum Markt als unsere Kritiker: Zunehmender Fachkräftemangel würde dazu führen, dass Fachkräfte endlich höher entlohnt würden und das würde dazu führen, dass viel mehr Menschen sich zu Fachkräften ausbilden lassen. − Zuletzt war uns natürlich auch das Problem sehr kleiner Betriebe bewusst: Wenn zwei Mann nur mehr 30 statt 40 Stunden arbeiteten, kann es ihnen unmöglich werden, Aufträge abzuwickeln. Solche Familienbetriebe, so empfahlen wir, müssten zu etwas größeren Betrieben fusionieren, was abermals eine Strukturverbesserung der Wirtschaft wäre. − Heute klingt das alles nicht mehr ganz so utopisch. Es gibt eine Reihe angesehener Ökonomen, die der Überzeugung sind, dass die moderne Technologie von Digitalisierung bis künstliche Intelligenz mehr Arbeitsplätze überflüssig macht, als sie schafft und dass Arbeitszeitverkürzung daher unvermeidlich sein wird, wenn man Massenarbeitslosigkeit vermeiden will. Damals wurden wir von der Bundeswirtschaftskammer und nicht wenigen Wirtschaftsjournalisten nicht nur Utopisten genannt, sondern wie Dallinger zu Narren erklärt. Hanke fasste seine Überlegungen übrigens zu einem Buch zusammen das unter dem Titel „Aufbruch ins Paradies – jetzt beginnt die Herrschaft der Vernunft“, das unter Grünen eine Zeitlang Kultstatus besaß und noch immer erstaunlich viele Käufer findet, obwohl die Herrschaft der Vernunft gerade in der Nationalökonomie sicher noch nicht begonnen hat. Hanke selbst sollte wenig später auf tragische Weise sterben: Noch während er für profil schrieb, stellte sich heraus, dass er an Krebs litt und dass sich die Tumoren bereits in seinem ganzen Körper, bis hin zu den Knochen, verbreitet hatten. Ich musste sein Leiden bei fast täglichen Besuchen miterleben: Knochenkrebs ist die wahrscheinlich schmerzhafteste Erkrankung, die es gibt. Hanke erhielt täglich Morphium-Injektionen und da er wusste, dass meine Mutter Ärztin war, flehte er mich an, ihm doch eine tödliche Dosis Morphium zu besorgen. Ich weiß, dass ich dazu völlig außerstande war. Man kann einen Menschen, den man schätzt, nicht aus noch so viel Mitleid aktiv beim Sterben helfen – es ist psychisch und
Wie bekämpft man Arbeitslosigkeit?
physisch unmöglich und ich misstraue Menschen, die behaupten, dass sie es könnten. Ich bin daher froh, dass die Bundesregierung den entsprechenden Paragraphen sehr, sehr vorsichtig reformiert hat.
307
48. Kreisky gegen Androsch
Die Auseinandersetzung zwischen Bruno Kreisky und seinem wichtigsten Krisenhelfer Hannes Androsch schwelte durch Jahre vor sich hin. Für Androsch selbst rührt sie bis heute ausschließlich davon her, dass Kreisky ihn als Konkurrenten empfand und als solchen loswerden wollte. Zu diesem Zwecke hätte er sich diverser SP-Linker, voran Herbert Salchers bedient, und eine willfährige Justiz hätte ihn auf der Basis absurder Konstruktionen letztlich zu Fall gebracht. Auch ich halte für möglich, dass Kreisky Androsch irgendwann als Konkurrenten empfand – als Konkurrenten gefürchtet hat er ihn sicher nie: Er saß zu allen Zeiten viel zu fest im Sattel. Vielmehr hat er irgendwann Zweifel an Androschs wirtschaftlicher Sauberkeit bekommen, die bei ihm mit persönlicher Enttäuschung verbunden war. Denn – und diesbezüglich stimmte die vielzitierte Formel vom „Vater-(Zieh-)Sohn-Konflikt“ – er hatte sehr viel von Androsch gehalten und viel mehr als seinen „Konkurrenten“ hatte er in ihm seinen „Kronprinzen“ und logischen Nachfolger gesehen. Doch der Eindruck, dass Androsch nichts dagegen hatte, durch die Politik sehr reich zu werden, war irgendwann auch für Kreisky nicht mehr zu übersehen. Das Geschäftsvolumen seiner Steuerberatungskanzlei Consultatio hatte sich in seiner Amtszeit als Finanzminister zwangsläufig vervielfacht und er hatte daraus Millionen auf eine Weise entnommen, die nur er als steuerschonend ansah, während ein Gericht sie letztlich als Steuerhinterziehung werten sollte. Gleichzeitig war die Uraltgeschichte von der Finanzierung seiner Villa in Wiener Neustadt über zwei Konten, die angeblich seinem Wahlonkel Gustav Steiner gehörten, die zweifellos einfachste Steuerverkürzung, die man sich vorstellen konnte. Es bedurfte in keiner Weise „absurder Konstruktionen“ der Justiz, um daraus ein Steuervergehen abzuleiten, sondern jeder andere Mensch wäre sofort dafür verurteilt worden. Nur weil Finanzbeamte, die dem Finanzminister Hannes Androsch unterstanden, die Erhebungen gegen ihn durchführten und ihm absurde Persilscheine erteilten, dauerte sein Verfahren 16 Jahre. Dramatische Unmoral kann ich freilich nicht darin sehen, dass diese beiden Konten von Androsch – aber vielleicht auch von seinen Eltern für ihn – angelegt und der Finanz nicht gemeldet wurden. Denn das war damals in Österreich gängige Praxis: Nahezu niemand, höchstens ein Narr wie ich, gab seine auf Konten liegenden Gelder bekannt, denn Österreichs Bankgeheimnis schützte sie so ehern wie höchstens noch in der Schweiz oder in Liechtenstein.
Kreisky gegen Androsch
Wir waren durch Jahrzehnte ein Land erfolgreichster Steuerhinterziehung an der Grenze zur Steueroase und wurden außerhalb Österreichs auch so gesehen. Steuerverkürzung war (ist) hierzulande zweifelsfrei ein Kavaliersdelikt. Das Problem Androschs in meiner Wahrnehmung war nur, dass es ein Unterschied ist, ob irgendwer oder der Finanzminister ein Steuerdelikt begangen hat. In den Worten Kari Schwarzenbergs oder Heinrich Treichls: Es ist ein Unterschied, ob irgendwer oder der Papst Ehestörung begeht. Noch schwieriger ist die moralische Wertung des Wachstums der Consultatio: Auch wenn Androsch nicht das Geringste dazu tat, hatte sich ihr Geschäftsvolumen in seiner Amtszeit als Finanzminister vervielfacht, weil Unternehmen natürlich annahmen, dass es ein Vorteil sein würde, von Androschs Kanzlei vertreten zu sein. Der Besitz einer Steuerberatungskanzlei ist eben in Wahrheit mit dem Amt des Finanzministers unvereinbar, auch wenn man ihre Führung in diesem Zeitraum abgibt. In Wirklichkeit hätte Kreisky Androsch 1970 sagen müssen, dass er nur entweder die Kanzlei verkaufen oder Finanzminister werden kann – und niemand hätte Androsch übelnehmen können, wenn er das Eigentum an der Kanzlei dem zwar gut bezahlten, aber unsicheren Job eines Finanzministers vorgezogen hätte. Kreisky irritierten die uneingestandenen Schwarzkonten denn auch anfangs weit mehr als das unvermeidliche Wachstum der Consultatio. Das irritierte ihn erst, als es im Zuge des AKH-Skandals Gesprächsthema wurde: Die Ökodata, die Aufträge aus der Errichtung des AKH erhielt, war nun einmal eine Tochterfirma der Consultatio, auch wenn Androschs enger Vertrauter Franz Bauer sie gegründet hatte, und auch wenn es sich bei seinem handgeschrieben Vermerk „Dr. A. verdeckt“ um einen Vorschlag handelte, von dem Bauer und Androsch unisono sagen, dass Androsch ihn sofort zurückgewiesen habe. Die ungute Optik dieses Konnexes konnte Kreisky nicht übersehen. Profil hatte die „Schwarzkonten“ ebenso wie die Tätigkeit der Consultatio und der Ökodata zwar ausführlich beschrieben, aber das war in zahllosen Etappen geschehen und manches – etwa die Art und Weise, in der Androsch die Consultatio dem damaligen Präsidenten der Rechtsanwaltskammer zu treuen Händen übertragen hatte – war juridisch ebenso komplex wie umstritten. Ich war daher nicht verwundert, dass Kreisky mich bat, es ihm in einem Gespräch, das etwa anderthalb Stunden dauern sollte, zu erläutern, und tat es in dem Sinn, in dem ich es hier niedergeschrieben habe. Als Kreisky mich fragte, ob ich die Summe der Vorgänge für vereinbar mit der Funktion eines Finanzministers hielte, sagte ich, was ich auch im profil geschrieben hatte: „Nein.“ Heute würde ich sagen: Fast so wenig vereinbar wie mein Verhalten in der Causa Hummelbrunner mit der Chefredaktion des Standard oder des profil, obwohl ich diesbezüglich nicht wie Androsch gerichtlich verurteilt wurde. Kreisky jedenfalls ließ am Ende unseres Gespräches keinen Zweifel daran, dass er schon zuvor innerlich entschlossen war, sich von Androsch als Finanzminister zu
309
310
Kreisky gegen Androsch
trennen. Kurz danach forderte er, was er von Beginn an hätte fordern müssen: Dass ein Finanzminister kein Unternehmen besitzen dürfe, das ihn in Interessenskonflikte bringen muss. Er müsse ein solches Unternehmen verkaufen oder das Amt abgeben. Es war klar, dass Androsch die zig Millionen schwere Consultatio nie verkaufen würde, sondern seinen Abschied aus dem Amt des Finanzministers vorzog. Zumal Kreisky ihm eine goldene Brücke baute, um auch Androschs beträchtliche Anhängerschaft in der Partei nicht restlos zu vergrämen: Er machte ihn zum künftigen Generaldirektor der CA. Obwohl das einmal mehr den problematischen Einfluss des Staates auf Wirtschaftsunternehmen aufzeigte: Eigentlich sollte ein Kanzler niemanden zum Vorstand einer Bank machen können. Zum neuen Finanzminister machte Kreisky Andreas Salcher, den ich persönlich ein wenig kannte. Der stand politisch keineswegs weit links von Androsch, der ja eine durchaus linke, eben „schwedische“ Wirtschaftspolitik betrieben hatte, sondern dachte diesbezüglich ganz ähnlich und betrieb in seiner kurzen Amtszeit ebenfalls „schwedische“ Wirtschaftspolitik – wenn auch mit weniger Begabung für öffentlichkeitswirksames Auftreten. Es ist anzunehmen, dass er seine Anzeige gegen Androsch wegen Steuerhinterziehung im Rahmen zweier Konten bei der Zentralsparkasse in Absprache mit Kreisky einbrachte – jedenfalls tat er es im Einvernehmen mit ihm. Unter anderen als den ursprünglichen Finanzbeamten konnte das eingeleitete Verfahren nicht anders enden, als es geendet hat: 1991 wurde Androsch wegen einer der offensichtlichsten Steuerhinterziehungen weit und breit verurteilt, nachdem er 1986 bereits wegen Falschaussage vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum AKH verurteilt worden war. Wenn immer ich über mein Verhalten in der Causa Androsch nachdenke – die aktuelle Schwäche der SPÖ und die Stärke der FPÖ führen dazu, dass das erstaunlich oft geschieht – überfallt mich Ratlosigkeit. Auf der einen Seite besteht für mich kein Zweifel, dass Androsch sich als Politiker in einem Ausmaß und auf eine Art und Weise bereichert hat, die aufzuzeigen und in manchen Bereichen einer strafrechtlichen Beurteilung zuzuführen, die wichtigste Aufgabe jedes an wirtschaftlicher Sauberkeit und am Rechtsstaat interessieren Mediums darstellt. Andererseits besteht für mich auch kein Zweifel, dass es Österreich ungleich besser gegangen wäre und ginge, wenn Androsch Finanzminister geblieben wäre, wenn er Kreisky als Kanzler nachgefolgt wäre und vielleicht heute noch regierte. Österreich wäre dann vermutlich hinter der Steueroase Luxemburg, aber vor den Steuerschonländern Irland und Holland, das Steuerschonland mit dem höchsten kaufkraftbereinigten BIP pro Kopf der Eurozone. Es wäre mit Androsch führend im Bereich der Digitalisierung und hätte weit bessere Schulen und Universitäten. Ich weiß keinen Ausweg aus diesem gedanklichen Dilemma.
49. Kein „profil mit Economist“
Zu den Menschen, mit denen ich in allen Fragen, sei es die Beurteilung Hannes Androschs oder Bruno Kreiskys, sei es in der Bewertung der NS-Zeit oder des Stalinismus restlos übereinstimmte, gehörte durch alle Jahre Karl Schwarzenberg. Und zwar so sehr, dass wir gelegentlich über das Ausmaß dieser Übereinstimmung Witze machten: wir erfanden im Gespräch ein Land, das er regiert und in dem ich vergeblich die Opposition darstelle – ohne zu ahnen, dass er einmal wirklich einer Regierung angehören würde. Es gab nicht nur keine außenpolitische, sondern auch fast keine innenpolitische Frage, in der wir nicht zum selben Urteil gekommen wären und keine politische Persönlichkeit, zu der wir nicht dieselbe Einstellung hegten. Beide bewunderten wir gleichermaßen Winston Churchill, beide sahen wir in Robert Kennedy den weit begabteren der Kennedy Brüder oder in Richard Nixon trotz Watergates einen Präsidenten mit außergewöhnlicher außenpolitischer Weitsicht. Wir hegten die gleiche Bewunderung für den sozialdemokratischen deutschen Kanzler Helmut Schmidt und seinen bürgerlichen Gegenspieler Karl Theodor zu Guttenberg und hielten den Text, mit dem Schmidt den toten Guttenberg in der ZEIT würdigte, gleichermaßen für ein literarisches wie politisches Ereignis. So hatten wir uns den Umgang zwischen Menschen verschiedener politischer Herkunft immer vorgestellt. Schwarzenberg zu kennen, verdankte ich Oscar Bronner, mit dem mich im Übrigen ähnlich große politische Übereinstimmung verband. „Der Fürst ist einer der wenigen Liberalen in dieser Republik“, hatte Bronner ihn mir vor unserem ersten Zusammentreffen beschrieben und das hat sich rundum bewahrheitet, obwohl Schwarzenberg sich auf seinem Schloss bis heute als „Seine Durchlaucht“ anreden lässt. (Da die Schwarzenbergs stets auch die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzen, ist die Bezeichnung „Fürst“ rechtlich gedeckt.) Er erwartet nicht Respekt vor seiner Person, wohl aber Respekt vor der Geschichte: Die Pflege dieser anachronistischen Anrede – die zu ertragen „ihrer Durchlaucht“ Theresa Schwarzenberg geradezu physisch schwerfiel – ist die Form, in der er selbst der Geschichte diesen Respekt erweist – „Es ist gar nicht leicht, sein eigenes Museum zu sein“, nennt er es. Seine ganze Lebensgeschichte ist museal: Kennengelernt hatte ihn Bronner als armen Studenten im Café Hawelka, wo „Kari“ wie Freunde ihn nennen, ihm durch sein enormes historisches Wissen auffiel. Bis der arme Student plötzlich, weil sein Onkel, Fürst Joseph Schwarzenberg keine Nachkommen hatte, von dessen Bruder Heinrich adoptiert wurde, um, der musealen Tradition folgend, Joseph als nächstes „Oberhaupt“ der Familie Schwarzenberg nachzufolgen.
312
Kein „profil mit Economist“
In dieser Eigenschaft war er bekanntlich der wichtigste Unterstützer der tschechischen Dissidenten und zu den vielen uns verbindenden Einschätzungen zählte die Bewunderung für die Art und Weise, in der Tschechen dem Einmarsch der Russen begegnet waren, wie die Überzeugung, dass sie nie einen „Kommunismus mit menschlichem Antlitz“, sondern immer die freie Wirtschaft des Westens (samt aller ihrer Schwächen) wollten. Es wunderte mich in keiner Weise, dass Václav Havel ihn nach der Wende zum tschechischen Außenminister machte – ich halte es vielmehr bis heute für eine vergebene Chance, dass kein österreichischer Kanzler ihn zum österreichischen Außenminister gemacht hat, denn ich wüsste niemanden, der dieses Amt mit mehr Kenntnis und Fingerspitzengefühl und zugleich geradliniger Integrität ausgefüllt hätte. Angeblich hat es unter Josef Klaus einen solchen Versuch gegeben, aber er blieb jedenfalls erfolglos. Ebenfalls angeblich – bei Wikipedia steht es bis heute so – war Schwarzenberg auch an der Gründung des trend beteiligt, indem er Bronner Kredit gab. Der sagte mir, dass das nie der Fall gewesen sei – er sei dem Gerücht aber nie entgegengetreten, weil es dem trend-Verlag wirtschaftlich genutzt habe, dass man Schwarzenbergs Geld im Hintergrund vermutete. Sicher ist nur, dass Schwarzenberg am Schicksal des trend wie des profil regen Anteil nahm und darüber erfreut war, dass ich außenpolitisch so sehr mit ihm übereinstimmte. Profil hatte zwar immer eine außenpolitische Berichterstattung, aber sie reichte vor allem im Umfang nie entfernt an die innenpolitische heran. Eher gab es glänzende Einzelleistungen. Ganz zu Beginn durch Claus Gatterer als Mitglied des Gründungsteams, später gab es in Werner A. Perger einen herausragenden Deutschland-Korrespondenten und Joachim Riedl, heute Österreich-Korrespondent der Zeit, schickte glänzende Reportagen aus den USA. Als Paradelinken der Redaktion hatte ich ihn in der Hoffnung dorthin geschickt, dass die Kenntnis des Landes sein Urteil differenzieren würde – und so war es. Denn einen George W. Bush und gar Donald Trump zu erleben, blieb ihm zu meinem Glück erspart. Auch aus Israel erhielten wir durch Henryk M. Broder hervorragende und vor allem auch witzige Texte und in Othmar Lahodynsky hatten wir den ersten Korrespondenten, der, im Gegensatz zu Henri Nannen, korrekt von der autoritären Machtergreifung General Wojciech Jaruzelskis in Polen berichtete – ich hatte ihn rechtzeitig dorthin geschickt, weil ich mich an den Ärger erinnerte, den es mir bereite hatte, vom Kurier nicht rechtzeitig zum Einmarsch der Russen in die Tschechoslowakei entsendet worden zu sein. Denn auch die Polen, so war mir immer klar, wollten keinen reformierten Kommunismus, sondern Demokratie und Marktwirtschaft nach westlichem Muster. Diesen Wunsch konnte nur ein einheimischer General oder der russische Einmarsch unterdrücken. Mit seiner Polen-Berichterstattung empfahl sich Lahodynsky für die Funktion als EU-Korrespondent, die er bis heute innehat. Seine Funktion in Polen übernahm die
Kein „profil mit Economist“
aus Polen stammende Joana Radzyner, die in der Folge ähnlich exzellent für den ORF berichten sollte. Zusammengehalten wurden diese, für sich genommen exzellenten Bruchstücke außenpolitischer Berichterstattung durch Erhard Stackl, der die gleiche Leistung Jahre später im Standard erbringen sollte. Auch er gehörte zur „linken“ Fraktion der Redaktion, und wahrscheinlich war das ein gewisser Ausgleich zu meiner außenpolitischen Rechtslastigkeit. Wir bezweifelten nie den gegenseitigen Willen, außenpolitische Ereignisse so redlich wie möglich zu analysieren und sie an denselben humanen Maßstäben zu messen, auch wenn wir dann und wann zu unterschiedlichen Schlüssen kamen. Im Heft waren meist beide Sichtweisen zu lesen – meine freilich als Leitartikel, die Stackls oder Riedls weiter hinten in ihren Texten. Ich selbst bezog meine außen- und vor allem auch wirtschaftspolitischen Informationen im Gegensatz zu Stackl in erster Linie aus dem Economist und auch das einte mich mit Karl Schwarzenberg, und führte in den frühen 1983 zu einem verlegerischen Unternehmen, dessen Scheitern den wahrscheinlich entscheidenden Bruch in meinem Verhältnis zum profil bewirkte. Schwarzenberg kannte – ich weiß nicht woher – den damaligen Herausgeber des Economist (und späteren Chef der Murdoch-News-Corporation) Andrew Knight und brachte uns in London bei einem Abendessen zusammen, dass von einer von Knight offenbar verehrten Adeligen nach einem Klavierkonzert des Österreichers Alfred Brendel gegeben wurde. Das Konzert war wunderbar, das Essen war wunderbar, der Wein war wunderbar, die Gastgeberin war wunderschön – all das hat vermutlich dazu beigetragen, dass Knight interessiert aufhorchte, als ich ihn fragte, ob er es nicht spannend fände, mit dem Economist auch am „Kontinent“ Fuß zu fassen. Das gegenseitige Interesse und die gegenseitige Sympathie waren so groß, dass innerhalb eines Monats folgendes Übereinkommen zwischen dem trend-Verlag und dem Economist unterschriftsreif vorlag: − Profil nennt sich in Zukunft „profil mit Economist“. − Es hat das Recht, beliebige Texte des Economist zu übernehmen, sie nicht wörtlich, sondern sinngemäß ins Deutsche zu übersetzen, durch Österreichbezüge zu ergänzen und im Umfang von durchschnittlich zwölf Seiten zu veröffentlichen. Es erhält die englischen Texte zu diesem Zweck bereits in ihrer Rohfassung, so dass ausreichend Zeit für ihre Übersetzung und Bearbeitung zur Verfügung steht, obwohl profil vor dem Economist erscheint. − dafür hätte profil ein Honorar bezahlt, das ich in Ziffern nicht mehr in Erinnerung habe, das aber dem Gehalt zweier Jungredakteure entsprach.
313
314
Kein „profil mit Economist“
Ich war der Überzeugung, den Vertrag meines Lebens ausgehandelt zu haben und profil die Chance zu verschaffen, von einem österreichischen zu einem Welt-Magazin zu werden, das den Spiegel an Einfluss erreicht, wenn nicht übertrifft. Zudem sah ich in der unumstritten besten Wirtschaftsberichterstattung der Welt, an der wir auf diese Weise Teil gehabt hätten, eine enorme wirtschaftliche Chance: Endlich würden wir die Inserate bekommen, die uns aufgrund unserer innenpolitischen Berichterstattung und unserer Reichweite zustanden. Selbst der übervorsichtige Geschäftsführer des Verlages, Günter Enickl sah das Abkommen rundum positiv. Nicht aber, so sollte ich im letzten Moment erkennen, die Redaktion. Ein Teil des Widerstandes war mir von Beginn an begreiflich: Die Mannschaft hatte Angst, dass zwölf jedenfalls gefüllte Seiten Mitarbeiter überflüssig machen könnten. Ich glaubte diese Angst zu beseitigen, indem ich mit Enickls Einverständnis garantierte, dass die Größe der Redaktion unverändert bliebe und verwies darauf, dass ja auch die zulässige Bearbeitung der Texte Aufwand erfordere. Doch damit erreichte ich nur, dass man mich auf die Schwierigkeit rascher Übersetzungen aufmerksam machte und machte in diesem Zusammenhang einen Fehler, dessen Gewicht ich erst im Nachhinein begreifen sollte: „Ein professioneller Übersetzer wie meine Mutter übersetzt so einen Text in einer halben Stunde“, sagte ich, „den werden wir uns auch noch leisten können.“ Meine Mutter übersetzte auf medizinischen Kongressen gelegentlich simultan aus dem Französischen ins Englische und ich wusste daher, wie schnell das ging, aber einige Kollegen wollten es anders verstehen: „Der Lingens will seine Mutter in der Redaktion unterbringen.“ Der energischste Einwand kam von dem Kollegen, dessen Mitarbeit mir am wichtigsten war: Erhard Stackl sah die Linie des profil durch die Zusammenarbeit mit dem „reaktionären“ Economist gefährdet und war darin mit Joachim Riedl einig. Beide sind heute ständige Economist-Leser. Damals glaubte ich sie damit zu beruhigen, dass ich versprach, dass vom Economist abweichende Meinungen immer Platz finden würden, so wie die ganze Zeit über Meinungen Platz gefunden hatten, die von der meinen abwichen – aber das war angesichts von zwölf Seiten offenbar nicht überzeugend, und auch ich muss zugeben, dass es nur in Ausnahmefällen möglich gewesen wäre. Ich dachte, dass der internationale Ruf des Economist die Bedenken dennoch überwiegen würde, doch das sollte sich ebenfalls als Irrtum erweisen: Die Nummer 2 in der profil-Redaktion, Chefredakteur Helmut Voska hatte ihn nie gelesen. Er wandte sich zwar nicht so klar wie Stackl gegen das Projekt, sondern tat es mit der ihm eigenen Vorsicht: Die Durchschnittsbevölkerung, so sagte er, würde mit dem Economist wenig anfangen können – viel mehr Leser gewännen wir, wenn wir kontinuierlich über die Bundesländer und nicht nur gelegentlich über Sport berichteten. Ich dachte (zu Unrecht) genug verlegerische Autorität zu besitzen, dem erfolgreich zu widersprechen.
Kein „profil mit Economist“
Ich habe alle diese Einwände gegen das Projekt in diesem Text auf knappem Raum zusammengefasst und damit klingen sie ziemlich kompakt, aber in den Konferenzen, in denen wir sie besprachen, wurden sie immer nur ansatzweise, immer nur als „Bedenken“, nie, schon gar nicht von Voska, als grundsätzliche Gegnerschaft vorgebracht. Wäre ich ein besserer Psychologe gewesen, so hätte ich begriffen, dass „Untergebene“ ihre Vorbehalte gegenüber einem „Vorgesetzten“ immer nur als „Bedenken“ vorbringen – aber ich weigerte mich, mich und die Redaktion des profil in diesen Kategorien zu sehen. Ich verließ die Konferenzen vielmehr in der Überzeugung, dass meine Argumente die Bedenken der Mannschaft letztlich entkräftet hätten. Wahrscheinlich ist das die Überzeugung, in der jeder Chef eine solche Konferenz verlässt. Vielleicht wäre ich meiner Sache nicht ganz so sicher gewesen, wenn das Projekt mich nicht derart begeistert hätte. So hingegen ordnete ich die jeweiligen Einwände unter „begreifliche Sorgen“ ein, „wie sie große Veränderungen immer begleiten und sich geben werden, wenn die Sache läuft“. Auch der vorsichtige Geschäftsführer Günter Enickl war dieser Ansicht. In der Inseratenabteilung hatte sich eines ihrer wichtigsten Mitglieder, Gottfried Satek, begeistert von den wirtschaftlichen Chancen der Kooperation gezeigt, und Inseratenleiter Peter Allmayer-Beck einen entsprechend enthusiastischen Bericht übergeben, von dem er allerdings nicht sicher ist, dass er auch Enickl weitergegeben wurde, denn Allmayer-Beck zählte, wie ich erst später erfahren sollte, aus unerfindlichen Gründen, nicht gerade zu meinen Freunden. Jedenfalls war Enickl ein Anhänger der Kooperation: Er lud mich ins Restaurant Schwarzenberg ein, um ihren von ihm als sicher erachteten Abschluss bei einem Glas Champagner zu feiern. Tags darauf fuhr ich gemeinsam mit Helmut Voska zum Kurier, um auch die notwendige Unterschrift von Kurier-Geschäftsführer Ernie Loudon einzuholen, der längst eingeweiht und ein begeisterter Befürworter des Projektes war. Ich chauffierte und die Fahrt von der Marc-Aurel-Straße in die Seidengasse dauerte wegen des Verkehrs eine gute halbe Stunde, aber die Zeit verflog wie Minuten, weil ich den Vertrag meines Lebens in der Mappe wusste, die ich zwischen Voska und mir auf dem großen Kardantunnel meiner Alfetta lag. Loudon erwartete uns schon, ich legte den Vertrag vor ihn hin und erläuterte noch einmal kurz die wichtigste Punkte, Loudon zückte bereits die Feder – da holte Voska einen Zettel aus der Tasche, um ihn an den verdutzten Loudon weiterzugeben: „Ich muss Sie drauf aufmerksam machen, dass die Redaktion fast geschlossen gegen dieses Projekt ist“, sagte er in etwa – und tatsächlich hatten alle Mitglieder mit Ausnahme des Außenseiters Franz G. Hanke und des späteren Kurier-Chefredakteurs Franz Ferdinand Wolf in diesem Sinne unterschrieben. „Gegen so großen Widerstand ist das Projekt leider nicht durchzuführen“, sagte ich tonlos.
315
316
Kein „profil mit Economist“
Rückblickend bin ich unverändert der Überzeugung, dass ich einen großen Fehler begangen habe, die Kooperation kampflos aufzugeben. Der Widerstand der Redaktion war zwar nach außen hin sehr geschlossen, aber er war einer ganz besonderen Konstellation geschuldet: Voska wollte mir seit langem eine Niederlage zufügen, weil er mich als Herausgeber beerben wollte. Ich wusste das, weil Ernst Wolfram Marboe, an sich mit ihm befreundet, mir erzählt hatte, dass er in der ÖVP Unterstützung für diesen Wechsel an der profil-Spitze suche, sie aber nur bei seinem Freund, Kurt Bergmann, gefunden habe. Er, Marboe, habe ihm von dem Unterfangen abgeraten – es sei für ihn eine Schuhnummer zu groß und ich habe die wichtigsten Eigentümer des trend-Verlages geschlossen hinter mir. Tatsächlich war ich auch völlig unbesorgt gewesen: Ich begriff, dass ein gleichaltriger Kollege, der in der ÖVP verankert war, seine Chance suchte, aber ich schätzte sie so gering wie Marboe ein. Voskas Widerstand wäre erlahmt, wenn ich mich entschlossen gezeigt hätte. Strategisch richtig wäre gewesen, das Projekt in einer großen Konferenz in Anwesenheit von Loudon, Enickl und Gottfried Satek von der Anzeigenabteilung neuerlich zu besprechen. Zu erklären, dass man die Sorgen und Einwände gegen ein so neuartiges Unterfangen verstehe, aber keinen Zweifel zu lassen, dass man es umsetzen würde. Loudon hätte der Jobgarantie mehr Gewicht verliehen und Enickl hätte vor Gottfried Satek schwerlich bestritten, dass die Kooperation unser Inseratenimage massiv verbesserte. Bezüglich der Englisch-Übersetzungen wäre ein Probebetrieb vorzuschlagen gewesen, wobei klargeworden wäre, dass ich natürlich in keiner Weise vorhatte, meine Mutter für diesen Zweck zu engagieren. Hätte Voska dennoch öffentlich widersprochen, so wäre er in einen gewissen Gegensatz zu seinem Freund Enickl geraten, und ich hätte ihm sehr freundlich vorschlagen können, die Zeitschrift mit einer hohen Abfertigung zu verlassen, wenn er seine Einwände für so gewichtig halte. Das hätte ihn zweifellos sofort veranlasst, das Gewicht seiner Einwände zu verringern, weil er erlebt hätte, dass Loudon die Alternative seiner Kündigung für durchaus gangbar gehalten hat. Damit wären die Gegner des Projekts ihres gewichtigsten Sprechers beraubt gewesen und hätten nicht zuletzt ganz simpel gefürchtet, wie Voska eine Abfertigung angeboten zu erhalten. Zumal ihre Stellung in der Redaktion weit weniger stark war. Sie waren nicht so lange dabei, sie hatten Günter Enickl nicht zum persönlichen Freund und sie zählten in der Branche nicht zu denen, die sofort einen ähnlich bezahlten Job angeboten erhalten. Charles B. etwa, wie Voska der ÖVP politisch eng verbunden, zählte nicht zu den Stars der Zeitschrift und hätte vermutlich schlicht Angst bekommen. Die Kulturredakteurin Sibylle Fritsch stand der ÖVP meines Wissens nicht nahe, schätzte die Zusammenarbeit mit Voska zwar entschieden mehr als die Zusammenarbeit mit mir und bevorzugte seinen Arbeitsstil, konnte aber auch nicht sofort mit einem vergleichbaren Posten rechnen. Genauso wenig konnte das Erika Wantoch, die die Zusammenarbeit mit Voska ebenfalls besonders schätzte, ohne mir aber wirklich feindlich gesinnt zu sein. Beide hätten keinen Aufstand gegen das Projekt angeführt und Sigrid Löffler wäre wegen ihrer
Kein „profil mit Economist“
amtsbekannten Feindschaft zu mir in dieser Rolle nicht sehr glaubwürdig gewesen, zumal die Economist-Berichterstattung die Kulturberichterstattung in keiner Weise berührte. Mein wirkliches Problem bestand darin, dass die „linken“ Kollegen, die normalerweise am eindeutigsten an meiner Seite standen, weil sie wussten, dass ich ihre Stellung garantiere – Erhard Stackl und Joachim Riedl – in diesem ganz besonderen Fall gegen mich waren, auch wenn sie natürlich nicht nur die „reaktionäre“ Haltung des Economist, sondern auch „Übersetzungsprobleme“ fürchteten und ins Treffen führen konnten. Aber die „Übersetzungsprobleme“ wären mit dem versprochenen „Probebetrieb“ kein wirkliches Argument mehr gewesen und mir von Angesicht zu Angesicht vorzuwerfen, dass ich bereit wäre, profil zu einem „reaktionären Medium“ zu machen, wäre ihnen schwer gefallen. Ich glaube rückblickend, dass die Kooperation, Anfangs auf vier, fünf Seiten beschränkt und erst mit der Zeit auf zwölf Seiten ausgeweitet – sehr wohl geklappt hätte. Aber ein wenig erging es mir, als ich Voskas Zettel mit den gesammelten Unterschriften sah wie Oscar Bronner, als er erlebte, wie viele Kollegen bereit waren, in andere Redaktionen zu wechseln: Ich war fassungslos, schockstarr, nicht mehr sicher, dass es den psychischen Aufwand wert war.
317
50. Kreiskys Ende, die Geburt der Grünen
Vielleicht war auch Bruno Kreisky irgendwann einfach des Kämpfens müde. Obwohl er die Auseinandersetzung mit Androsch gewonnen hatte, war er öffentlich, mehr als der Finanzminister, angeschlagen. Die Probleme der verstaatlichten Industrie waren selbst einer so wirtschaftsfernen Bevölkerung wie der österreichischen nicht entgangen. Die diversen Skandale und Pleiten, vom AKH über Noricum bis Eumig, wurden von ihr zwar nie mit Kreisky als Kanzler, aber doch zunehmend mit der SPÖ in Zusammenhang gebracht. Selbst die Öl-Spekulationen der VOEST im Intertrading-Skandal brachte sie nicht in Zusammenhang mit Kreiskys Haftung für die verstaatlichte Industrie, aber es konnte ihr nicht entgehen, dass da Millionen auf dilettantische Weise versenkt wurden, und dass jetzt Millionen an Steuergeld zur Rettung diverser rot verwalteter Unternehmen aufgebracht werden mussten. Profil, nicht anders als die versammelte bürgerliche Presse, ritt zu Recht darauf herum. Ohne Mitwirkung des profil, prangerte die bürgerliche Presse gleichzeitig Androschs Abgang als Finanzminister und Salchers Ernennung als klassisches Beispiel für Kreiskys wirtschaftliches Missmanagement an, obwohl Salcher alles tat, um das durch die Sanierung der verstaatlichten Industrie und der staatlichen Banken angeschlagene Budget zu sanieren. Dazu kamen von bürgerlicher Seite sorgsam gepflegte Gerüchte über Kreiskys angeschlagene Gesundheit. Auch ein ärztliches Attest konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass seine Nieren ihn zu Spitalsaufenthalten zwangen. Tatsächlich musste er schmerzhafte Nierendialysen über sich ergehen lassen. Dass er häufiger als früher übel gelaunt schien, wurde von informierten Journalisten mit diesen Nierenproblemen in Zusammenhang gebracht, obwohl es vielleicht auch davon herrührte, dass zumindest er selbst ahnte, dass zuletzt immer mehr Dinge wirtschaftlich schiefgelaufen waren. Die SPÖ gewann die Wahlen des Jahres 1983 zwar immer noch mit klarer Mehrheit, aber Bruno Kreisky nahm seinen Abschied. Schnörkellos. Ohne zu lamentieren. Erstaunlich selbstverständlich für einen Sonnenkönig.
Die Folgen der Ära Kreisky Nur für eine Übergangszeit hielt Kreisky parteiintern weiter die Fäden in der Hand: genau so lang, um sicherzustellen, dass sein Nachfolger Fred Sinowatz keine Koalition mit der ÖVP, sondern mit der von ihm seit jeher bevorzugten FPÖ einging, in der Jörg Haider Norbert Steger als Obmann nachgefolgt war. Kreisky meinte, damit das
Die Folgen der Ära Kreisky
„Bürgerliche Lager“ für alle Zeiten geschwächt zu haben – ich meine, dass er damit die politische Aufwertung der FPÖ vollendet und Österreich eine dauerhafte Mehrheit rechts der Mitte beschert hat, die in den Triumph von Sebastian Kurz gemündet ist. Nur ein zufälliges Wunder in Gestalt des Ibiza-Videos verhinderte, dass eine Koalition der FPÖ mit der ÖVP nicht noch heute regiert. Für die Berichterstattung einer Zeitschrift wie profil war Kreiskys Abgang ein messbarer Verlust, obwohl die Ereignisse sich zuspitzten: Es gab niemanden, der allein durch die „Meinung“, der er jede Woche war, Seiten füllen konnte – Fred Sinowatz konnte das nicht entfernt, obwohl er im Allgemeinen sagte, was er tun würde. Ich hatte über ihn zu Beginn seiner Karriere eine Coverstory mit dem Titel „Hamlet vom Land“ geschrieben. Richtig an meinem Text war der Verweis darauf, dass er, im Gegensatz zu seinem rustikalen Auftreten, ein erstaunlich feinsinniger Intellektueller war, der die Bücher, von denen andere behaupteten, dass sie sie gelesen hätten – Robert Musils „Mann ohne Eigenschaften“ war das Paradebeispiel – wirklich gelesen hatte. Mit mir teilte er die Bewunderung für Karl Popper und hatte auch dessen wichtigste Bücher tatsächlich gelesen. Der Satz, mit dem er berühmt wurde – „es ist alles sehr kompliziert“ – war für ihn typisch, denn es war kein Eingeständnis mangelnder intellektueller Kapazität, sondern er begriff wie die meisten intelligenten Menschen, wie komplex die meisten offenen Fragen in Wirklichkeit sind. Aber ganz anders als Hamlet vermochte er als Unterrichtsminister überaus energisch zu handeln: Alle Reformen, mit denen die SPÖ gleich zu Beginn ihrer Regierungszeit ein breites Publikum erreichte – Schülerfreifahrt, Koedukation, Entfall von Aufnahmeprüfungen, Einführung eines Oberstufenrealgymnasiums, in das man von der Hauptschule leichter wechseln konnte und das Forcieren höherer technischer Lehranstalten – wurden erfolgreich von Sinowatz umgesetzt. Sein Unglück begann erst damit, Bruno Kreisky nachfolgen zu müssen. Obwohl die FPÖ in Norbert Steger erstmals einen Obmann hatte, dem man keine NS-Vergangenheit nachsagen konnte, war er keineswegs glücklich mit ihr zu koalieren – „nationales Gedankengut“ war ihm fremd. Aber er war gewöhnt zu tun, was die Partei ihm auftrug. Und die Partei war noch immer Bruno Kreisky, auch wenn er seinen Abschied genommen hatte. Fred Sinowatz, Sohn eines kroatischen Maschinenschlossers und einer Hausgehilfin war sich zeitlebens bewusst, dass Leute wie er Bildung und Aufstieg im Burgenland ausschließlich der Sozialdemokratie verdankten. Sein zweiter berühmt gewordener Satz – „Ich wäre nichts ohne die Partei“ – war die korrekte Beschreibung seines Werdeganges. Sein Problem war dennoch keineswegs mangelnde Führungsqualität – er besaß das Zeug zum Kanzler –, sondern es bestand darin, in Bruno Kreisky nicht nur einem „Kometen für sich“ (Günther Nenning), sondern einem Regierungschef nachzufolgen, der ihm vor allem unbewältigte Skandale und Schulden hinterließ: Der AKH-Skandal wirkte noch immer nach; die Intertrading-Pleite der VOEST war noch in frischer Erinnerung und musste vor allem bezahlt werden. Anders als die Regierungen Kreiskys hatte die Regierung Sinowatz’ nichts mehr zu verschenken, sondern rundum abzuzahlen.
319
320
Kreiskys Ende, die Geburt der Grünen
Wobei die Bevölkerung gar nicht ahnte, wie sehr neben der verstaatlichten Industrie auch die staatlichen Banken saniert werden mussten. Zu diesen gewaltigen finanziellen Problemen kam der innerparteiliche Konflikt zwischen dem verbliebenen Lager Hannes Androschs und dessen Nachfolger Herbert Salcher und kam vor allem der Konflikt rund um das geplante Kraftwerk Hainburger Au, das die Gewerkschaft unter allen Umständen errichten wollte, während sich eine Reihe junger Linker den grünen Umweltaktivisten anschloss, die es unter allen Umständen verhindern wollten. Im Dezember 1983 gab es einen gültigen Wasserrechtsbescheid, dieses Kraftwerk zu errichten, doch als Arbeiter begannen, den Auwald zu roden, um Platz für die Staumauer zu schaffen, stellten sich ihnen Umweltaktivisten in den Weg. Angeführt wurden sie von der schönen Adeligen Freda Meissner-Blau, die sich schon gegen Zwentendorf engagiert hatte, obwohl man sie damals noch eher als Ehefrau des kurzfristigen Chefredakteurs der Arbeiter-Zeitung Paul Blau kannte. Die Besetzung der Hainburger Au gilt bekanntlich als Geburtsstunde der Grünen, obwohl es schon davor zwei politische Gruppierungen gab, die sich „grün“ nannten, aber in Zwentendorf hatte ihr Widerstand noch nicht die entscheidende Rolle gespielt – jetzt aber war die Zeit offenbar reif, nach Strom aus Atomkraft auch Strom aus Wasserkraft zu verhindern. Eine Generation, die dem wirtschaftlichen Aufstieg nicht mehr alles unterordnete, weil sie ihn bereits geschafft hatte, konnte sich den Luxus leisten, „Natur“ zu bewahren. Das jedenfalls war meine nicht unbedingt faire Sicht des Konflikts, die vielleicht dadurch erhärtet wird, dass ein bemerkenswert großer Teil der Aubesetzer aus Wiens Nobelbezirk Döbling kam. Ich war – was man als Journalist nie zugeben sollte – kein unbefangener Beobachter: Beim Bundesheer hatte man, um uns zu quälen, auch eine Übung in der Hainburger Au angesetzt, die sich zu diesem Zeitpunkt, im Frühsommer, Witterungsbedingt durch unvorstellbare Gelsen-Dichte auszeichnete. Ich erinnere mich, wie mein Vordermann beim Auseinanderschlagen des Buschwerks, durch das wir Zugang zur Au suchten, in einer hellgrauen Wand aus Gelsen verschwand und danach nur mehr als dunkelgrauer Schatten sichtbar war. Ich tauchte für Sekunden in dieselbe Wand, dann liefen wir beide schreiend zurück ins Freie. Aber es wäre nicht die 1. Gardekompanie gewesen, wenn unser Zugsführer uns nicht befohlen hätte, sofort wieder in die Au einzutauchen. Nur dass er sich selbst, weil die republikanische Gesetzgebung ihn zwang, Übungen mitzumachen, eine Zigarette ansteckte und kräftig an ihr sog. Doch er hatte die Hainburger Gelsen unterschätzt: Sie setzten sich selbst auf seine die Zigarette haltende Hand, und wenige Sekunden später flohen wir alle gemeinsam. Ich war nicht in der Lage, in dieser Au ein einmaliges Naturjuwel zu sehen, dessen seltene Fauna dringend vor der Zerstörung durch ein Kraftwerk zu schützen war. Dass die Berichterstattung des profil dennoch nicht völlig einseitig ausfiel, fiel mir zwar
Die Folgen der Ära Kreisky
schwer, aber die Zeitschrift war Gott sei Dank immer ein pluralistisches Medium, und in Günther Nenning hatte sie auch einen Au-Aktivisten in ihren Reihen. Ursprünglich war es der World Wildlife Fund (WWF), der die Kampagne gegen das Kraftwerk gestartet hatte, aber sie erhielt Unterstützung aus der studentischen Jugend gleich welcher politischen Ausrichtung, und in Günther Nenning hatten sie einen Publizisten an ihrer Seite, der viel von PR verstand. Ein Volksbegehren zur Erhaltung der Au und zur Errichtung eines Naturschutzgebietes wurde gestartet und fand in Nobelpreisträger Konrad Lorenz einen denkbar prominenten Unterstützer. Auch meine Haltung zu Konrad Lorenz war zwiespältig. Ich war zwar ein begeisterter Leser seiner Bücher und ebenso begeisterter Jünger der Verhaltensforschung, die mir eine solidere Wissenschaft als die Psychologie und insbesondere die Psychoanalyse schien und teilte diese Begeisterung mit meiner Mutter, die mir ständig entsprechende Lektüre besorgte. Als Generalsekretärin der psychoanalytischen Gesellschaft versuchte sie sogar, Psychoanalytiker und Verhaltensforscher an einen gemeinsamen Tisch zu vereinen, weil sie sich daraus eine ungemein fruchtbare Diskussion erhoffte, aber die von ihr kontaktierten Analytiker, voran ihr Präsident Harald Leupold-Löwenthal, lehnten energisch ab: Verhaltensforschung war in ihren Augen faschistoides Teufelszeug. Sie wiesen darauf hin, dass Lorenz in der NS-Zeit das Verhalten domestizierter Schweine exakt wie das von Juden beschrieben hatte und dass das NS-Regime seine Wissenschaft besonders schätzte, weil viele seiner Thesen sich wunderbar zur Ablehnung „Fremdrassiger“ eigneten. Tatsächlich hatte Lorenz 1940 eine „Ausmerzung ethnisch Minderwertiger“ gefordert und im „Erkennen und Ausschalten… mutationsbedingter Faktoren… die wichtigste Aufgabe der Rassenpflege überhaupt“ erkannt. Meine Mutter sah diese Schlagseite der Verhaltensforschung zwar, meinte aber, dass das nichts an ihrer wissenschaftlichen Bedeutung ändere und die gemeinsame Diskussion umso wichtiger sei. Aber wie so oft setzte sie sich mit ihrer emotionslosen Betrachtungsweise nicht durch. Ich sah das wie sie und war gespannt, was mich erwartete, als mich Karl Popper zu einem gemeinsamen Mittagessen mit Konrad Lorenz einlud. Die beiden Wissenschaftler schätzten einander in besonderem Ausmaß, was wohl auch damit zusammenhing, dass Popper in der Psychoanalyse eine Pseudowissenschaft sah, der er – wie ich – die Verhaltensforschung entschieden vorzog. Deshalb blieb mir ein Teil unserer Unterhaltung in besonders klarer Erinnerung: Es ging um Lorenz’ Buch „So kam der Mensch auf den Hund“, das ich mit Begeisterung verschlungen hatte. Um mich auf das Mittagessen einzustimmen, hatte ich es noch einmal gelesen und war bei der neuen Ausgabe, auf die ich dabei zugriff, auf eine Fußnote gestoßen, die mich verblüffte: „Mein Kollege XY“, so hieß es darin in etwa, „vermochte nachzuweisen, dass der Haushund doch durchwegs vom Schakal abstammt.“ Das war deshalb so verblüffend, weil Lorenz’ Buch von der ersten bis zur letzten Seite darauf basierte, anhand des Verhaltens von Hunderassen einen entscheidenden Unterschied zwischen vom Wolf abstammenden „lupusblütigen“ und vom Schakal abstammenden „aureusblütigen“ Hunden zu diagnostizieren.
321
322
Kreiskys Ende, die Geburt der Grünen
Ich hatte ein Problem damit, in einer Fußnote zu erfahren, dass es diesen von Lorenz postulierten Unterschied, von ihm durchaus eingestanden, gar nicht gab und dachte, ihn in Verlegenheit zu bringen, indem ich ihn darauf ansprach. Aber weit geirrt: „Dann habe ich mich eben geirrt und der beobachtete Unterschied im Verhalten hat andere Gründe. Unseriös wäre nur gewesen, das nicht anzumerken“, sagte er nur kurz und nicht einmal verärgert. Karl Popper, für dessen Sicht der Wissenschaft die „Falsifizierung“ einer These die entscheidende Rolle spielt, sie zu verwerfen, sah das genauso: Es würde immer wieder vorkommen, dass man eine falsche These aufstellt; sie zu publizieren sei dennoch nützlich, weil ein anderer Wissenschaftler die beobachteten Unterschiede vielleicht durch eine neue, bessere These besser erklären könne; man dürfe die Falsifizierung der eigenen These nur nicht unter den Tisch fallen lassen. Mir schien eine diesbezügliche Fußnote unverändert ein bisschen zu wenig Wissenschaftlichkeit, aber ich habe diesen Einwand bei diesem Mittagessen nicht erhoben: Mein Respekt vor Lorenz war zu groß. Ein wenig von diesem Respekt sollte er allerdings durch eine andere Erörterung bei diesem Mittagessen einbüßen. Es ging darum, dass er begeistert erzählte, dass er sich ein neues Auto gekauft habe. Was es denn sei, wollte Popper wissen. „Ein Mercedes“, antwortete Lorenz. „Welcher?“, wollte ich wissen. Ich weiß nicht mehr, welches Modell Lorenz mir nannte, aber der Nachsatz hat sich mir eingeprägt: „Acht Töpferln haben es schon sein müssen.“ Ich bin noch immer ein Fan der Verhaltensforschung, ich halte Konrad Lorenz trotz Achtzylinder-Limousine noch immer für jemanden, der die Wissenschaft vom Verhalten von Lebewesen unglaublich bereichert hat – aber es hat meine Haltung zu Flusskraftwerken nicht ins Gegenteil verkehrt, dass er das Kraftwerk Hainburg ablehnte. Im Mai 1984 fand zur Unterstützung des Konrad-Lorenz-Volksbegehrens eine später so genannte „Pressekonferenz der Tiere“ statt, in der Günther Nenning in der Verkleidung eines Hirschs, der Wiener VP-Stadtrat Jörg Mauthe als Schwarzstorch, Peter Turrini als Rotbauchunke und der heutige VP-Vertreter im EU-Parlament Othmar Karas als Kormoran auftraten. Das funktionierte wie erhofft: Alle Medien waren voll von Liveberichten und plötzlich war das zweite geplante Donau-Laufkraftwerk hinter dem Kraftwerk Freudenau ein Thema, das Wien, ja Österreich wie Zwentendorf entzweite. Im Dezember 1984 organisierte die Österreichische Hochschülerschaft einen Marsch ins Augebiet, an dem rund achtausend Menschen teilnahmen. Mehrere hundert davon blieben in der Au, einige ketteten sich an „Bruder Baum“. Die jungen Männer und Frauen, die den Büschen so nahe waren und in Zelten kampierten, erwischten entschieden eine bessere Jahreszeit als ich bei meinem Bundesheereinsatz: In den Nächten ihrer Aktion hatte es Minusgrade, die ausgehalten zu haben sie zu Recht bewundert wurden – Gelsen hingegen halten keine Minusgrade aus.
Die Folgen der Ära Kreisky
Da die Aubesetzung widerrechtlich war, wurde nach erfolglosen Aufmärschen von Baugewerkschaftern mit Schaufeln und Spaten letztlich die Polizei gerufen – sowohl um Schlimmeres zu verhindern, wie um die Au doch zu räumen. Aber das bestärkte die Besetzer nur in ihrem Widerstand. Der ließ die Polizei aggressiv werden, und es kam zu Szenen wie in jüngster Zeit bei der Demonstration von Klimaschützern: Bei den Zusammenstößen zwischen 800 Gendarmen und Polizisten und etwa 3000 Aubesetzern wurden 19 Menschen verletzt – darunter Angehörige eines italienischen Fernsehteams. Redakteure und Kameraleute des ORF wurden tätlich an ihrer Arbeit gehindert, was breite ORF-Berichterstattung sicherstellte, nachdem schon seit längerer Zeit die Kronen Zeitung voll hinter den Aubesetzern gestanden war. Am Abend desselben Tages demonstrierten in Wien vierzigtausend Menschen gegen das Vorgehen der Regierung und gegen den Kraftwerksbau. Am 21. Dezember 1984 verhängte die Bundesregierung einen Rodungsstopp. Am 22. Dezember 1984 verkündete Fred Sinowatz unter dem Druck der Kronen Zeitung einen Weihnachtsfrieden, und die Aubesetzer feierten einen medienwirksamen Weihnachtsgottesdienst. Anfang Jänner 1985 erklärte der Verwaltungsgerichtshof weitere Rodungen bis zum Abschluss des laufenden Beschwerdeverfahrens für unzulässig. Im März 1985 wurde das Konrad-Lorenz-Volksbegehren durchgeführt und von „nur“ 353.906 Menschen unterzeichnet, weil sowieso klar war, dass das Kraftwerk Hainburg so wenig wie Zwentendorf in Betrieb gehen würde. Tatsächlich hob der Verwaltungsgerichtshof den Wasserrechtsbescheid, der es erlaubte, im Juli 1986 auf. Sinowatz hat sich im Verlauf dieser Auseinandersetzung nicht ungeschickt verhalten – der erzielte „Weihnachtsfriede“ wurde ihm gutgeschrieben – aber er konnte auch keinen Lorbeer ernten. Der Sozialdemokratie insgesamt erwuchs in den Grünen – die beiden bereits existierenden Gruppierungen vereinigten sich zu einer gemeinsamen Partei – ein starker Gegner, der sie 2020 beinahe einholen sollte, denn er besetzte viele Felder, auf denen sie bis dahin die Themenführerschaft besessen hatte. Sinowatz’ Absturz sollte sich allerdings in einem Bereich ereignen, in dem sie sich auf der gleichen Seite befanden: im Zuge der Affäre Waldheim. Doch davor hatte er noch eine andere Affäre auszusitzen, die schon in der Ära Kreisky begonnen hatte und die die SPÖ in der Ära Sinowatz in ihren Grundfesten erschütterte: Den Fall Lucona.
323
51. Ein sechsfacher Mord wartet auf eine Anklage
„Jetzt kommen die Proleten ans Ruder, und ich verschaffe ihnen, was sie nicht haben, ein Ambiente, in dem sie tanzen, fressen und saufen können – aber tanzen werden sie nach meiner Pfeife“, vertraute Udo Proksch einer seiner adeligen Freundinnen an und leitete damit eines der düstersten Kapitel in der Geschichte der SPÖ ein: Die Lucona-Affäre, die mit seiner Verurteilung wegen sechsfachen Mordes endete. Es war tatsächlich die Sehnsucht nach sozialem Aufstieg, die einen großen Teil der in den 1970er Jahren führenden sozialdemokratischen Politiker zu Mitgliedern eines „Herrenclub“ werden ließ, den Proksch im ersten Stock über der ehrwürdigen Konditorei Demel am Kohlmarkt etabliert hatte: Der „Club 45“ sollte fast die Prominenz der Loge P2 in Italien erreichen. Und Proksch bot dort tatsächlich, was er versprochen hatte. Nicht nur bestes Essen und beste Getränke, sondern auch schöne Frauen. Dass er das Zusammensein mit ihnen auch filmte, wurde erst später publik, trug aber zweifellos dazu bei, dass nach seiner Pfeife getanzt wurde. Es gab kaum einen unter den SPÖ-Granden, der den Club 45 nicht besuchte – nur solche, die ihm eher fern und solche, die ihm besonders nahestanden. Eher fern standen ihm Heinz Fischer oder Bruno Kreisky, der dort nur zweimal auftauchte – besonders nahe standen ihm Innenminister Karl Blecha oder Wiens Bürgermeister Leopold Gratz, den mit Proksch auch eine enge persönliche Freundschaft verband. Für profil war Gratz vor allem der sehr viel intelligentere Nachfolger von Felix Slavik als Wiener Bürgermeister. „Was tut Leopold Gratz außer Whisky trinken?“, lautete zwar die Schlagzeile zu einem Titelblatt, das ihn mit Whisky-Glas in der Hand zeigte – denn tatsächlich war seine Neigung, dieses Getränk schon vormittags zu sich zu nehmen, stadtbekannt – aber er tat eine ganze Menge: Der Bau der heutigen U-Bahn löste Slaviks abstruses Projekt einer die Stadt auf Stelzen querenden Alwegbahn ab, der Kurpark Oberlaa entstand und die Donauinsel wurde von einem Schutz gegen Überschwemmungen zum Freizeitprojekt umfunktioniert. An ihrem Eingang entstand Kreiskys UNO-City. Blendend aussehend und ein sehr guter Redner gewann Gratz die Wiener Wahlen für eine nach Slavik eher ratlose SPÖ jeweils mit Traumergebnissen, die sie nie mehr, auch nicht unter Helmut Zilk, erreichen sollte. Seine in meinen Augen größte Leistung bestand darin, seinen besonders fähigen Finanzstadtrat Hans Mayr und seinen ähnlich fähigen Magistratsdirektor Josef Bandion in Ruhe arbeiten zu lassen und deren Leistungen nach außen hin perfekt zu verkaufen. Man muss nicht immer selbst ein Arbeitstier sein, um sich zum Bürgermeister zu eignen.
Ein sechsfacher Mord wartet auf eine Anklage
Das einzige von ihm zu verantwortende Fiasko – der extrem verteuerte Bau des Wiener Allgemeinen Krankenhauses – wurde mit seinem Namen so wenig wie mit dem Namen des zweiten Bauherrn, Hannes Androsch assoziiert. Das war teils Glück, teils lag es an unpräziser Berichterstattung: Der damals größte Spitalsbau Europas wurde von den Wiener Medien als quasi extraterritorial betrachtet, obwohl er Wiens Budget bis heute belastet, weil das Riesenspital nicht kostengünstig zu führen ist. Anders als Androsch geriet Gratz in diesem Zusammenhang auch nie in den Geruch der Korruption (die freilich auch Androsch in keiner Weise nachgewiesen wurde). Dass es Gratz wichtig war, das Flair eines „Sir“ und gewiss keines Proletariers auszustrahlen, war stadtbekannt, und er beherrschte diese Rolle noch besser als Androsch: Der Jaguar, den er als Dienstwagen fuhr, passte zu seiner Kleidung wie zu seiner Sprache, während Androschs „l“ trotz Villa in Neustift immer ein wenig an seinen Heimatbezirk Floridsdorf erinnerte. Der Club 45 war tatsächlich genau der „Herrenclub“, der Gratz zu seiner Vorstellung eines „Sir“ noch fehlte. Gleichzeitig bot er ihm innerhalb der SPÖ das stärkste Netzwerk. Vor allem, nachdem Androsch bei Kreisky in Ungnade gefallen war, avancierte Gratz mit diesem Netzwerk zum wahrscheinlichsten SP-Obmann und Bundeskanzler nach dem Sonnenkönig. Wenn Udo Proksch nicht dazwischengekommen wäre. Proksch stammte aus dem deutschen Rostock. Seine Eltern waren, selbst noch nach dem Krieg, glühende Nationalsozialisten. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass er von ihnen mitbekommen hat, dass es Herrenmenschen und Untermenschen gibt und dass er sich ohne Zweifel zu den Herrenmenschen zählte, die zu Recht auf „ans Ruder gelangte Proleten“ herunterschauen. Dass man in ihm, wie in Adolf Hitler, auch einen wild gewordenen Kleinbürger sehen konnte, den es nicht anders als „Proleten“ nach „Größe“ drängt, hätte er vermutlich heftig bestritten. Zweifellos besaß er – wie übrigens auch Hitler – eine künstlerische Ader: An der Akademie für angewandte Kunst studierte er „Industrial Design“, wie auch ich es studieren wollte, wie es aber 1956 dort noch nicht gelehrt wurde. Offenbar war er darin begabt, denn er erhielt mehrere Staatspreise als Brillendesigner und verdiente damit gutes Geld. In der Wiener Innenstadt, in der auch die Redaktion des profil lag, war er eine bekannte Figur. Noch bevor ich ihn persönlich kannte, wusste ich vom Hörensagen, dass er Unmengen Alkohols verträgt, dass er, wenn er betrunken ist, einfach irgendwo hin uriniert und dass er wunderschöne Frauen um sich hat. Dass ich schließlich auch wusste, wie er aussah, lag daran, dass ich zweimal, weil man es mir dringend empfahl, im Café Gutruf in der Milchgasse 1 ein Beefsteak aß und dort auf ihn und den mir besser bekannten Eigentümer Rudi Wein stieß, von dem ich wusste, dass er Interessen des Ostblocks vertrat – es hat mich daher später nicht gewundert, dass das auch für Proksch galt: „Nationale“, bis hin zu H.-C. Strache, hatten nie Berührungsängste mit autoritären
325
326
Ein sechsfacher Mord wartet auf eine Anklage
Kreml-Regimen. Die FPÖ Straches verband bekanntlich ein Freundschaftsvertrag mit Wladimir Putins „Einiges Russland“. Später sollte ich erfahren, dass Proksch als enger Vertrauter von Kreiskys adeligem Verteidigungsminister Karl (von) Lütgendorf, der ebenfalls zu den Stammbesuchern des Club 45 zählte, aus Bundesheerbeständen ein ganzes Waffenarsenal, darunter selbst ausrangierte Düsenflugzeuge erhalten und mit einem Heeresoffizier Sprengübungen durchgeführt hatte. Teile dieser Gerätschaft sollte er in der Folge auf das Schiff Lucona verladen, um eine Uranerzaufbereitungsanlage vorzutäuschen, sie hoch zu versichern und mittels getimter Sprengung im Ozean zu versenken. Obwohl sich einiges von dieser unverfrorenen Brutalität durchaus in seinem stadtbekannten Verhalten offenbarte, muss es an ihm auch andere, mir unbekannte Seiten gegeben haben, denn er übte auf mehrere durchaus feinsinnige und im Übrigen besonders schöne Frauen – Erika Pluhar war die schönste unter ihnen – eine mir unbegreifliche Anziehungskraft aus. Eine Anziehungskraft, der mit Reinhard Tramontana auch das feinsinnigste Mitglied meiner Redaktion erlegen war: Er zählte nicht nur zu Prokschs Freunden, sondern zu seinen fast schwärmerischen Bewunderern. Tramontana, Sohn einer alleinerziehenden Archivarin der Presse, gehörte unserer innenpolitischen Redaktion an und glaubte sich auch immer zu ihrer Leitung befähigt. Ich war der Ansicht, dass er nicht den geringsten politischen Instinkt besitze, wohl aber hervorragend schriebe. Als er sich eines Tages innerhalb eines seiner politischen Texte über irgendetwas, ich weiß nicht mehr was, lustig machte, erkannte ich sein enormes Talent für Satire und setzte ihn von da ab praktisch nur mehr dafür ein: Sein „profan“ wurde, vor meinem Leitartikel, zur meistgelesenen profil-Rubrik. Obwohl alle Versuche, ihn in einer leitenden Funktion der Zeitschrift zu beschäftigen krachend fehlschlugen, machte ich ihn schließlich zum stellvertretenden Chefredakteur, um seiner überragenden Bedeutung für die Zeitschrift äußere Anerkennung zu verleihen. Das war insofern ein Fehler, als er hin und wieder doch in dieser Funktion wahrgenommen werden wollte, verlangte einen Text zu redigieren oder eine Beilage zu gestalten, was jedes Mal dramatisch schief ging. Nicht zuletzt, weil er eines mit Udo Proksch und Leopold Gratz gemein hatte: Er trank schon am Morgen Alkohol – nur dass er ihn nicht vertrug. Oder präziser: Er vertrug nicht genug, um Kollegen Anweisungen zu geben und zum Beispiel eine Beilage zu gestalten – aber er vermochte selbst in diesem betrunkenen Zustand dennoch grandiose Texte zu schreiben. Wie Joseph Roth, vermochte er schriftlich immer noch perfekt zu formulieren, obwohl er kaum mehr klar sprechen konnte. Ich machte irgendwann den nächsten Fehler, ihm zu raten, doch eine Entziehungskur in Kalksburg zu machen, erntete aber wütenden Widerstand: Er sei kein Alkoholiker und ich sei der Einzige, der ihn dafür halte – ein Stockwerk tiefer in der Redaktion des trend wüsste man ihn besser einzuschätzen. Ich machte den nächsten Fehler, indem ich behauptete, dort würde von diesem oder jenem Kollegen auch zu viel getrunken.
Ein sechsfacher Mord wartet auf eine Anklage
Beginnend mit diesem Gespräch über Alkohol sah Tramontana in mir einen Gegner, und im trend sah man in mir einen Menschen, der mit dem zartbesaitetsten, wunderbarsten Mitglied der profl-Redaktion nicht umzugehen wüsste. Das sollte in der Auseinandersetzung, die meinem Ausscheiden aus profil voranging, eine gewisse Rolle spielen: Meine innerredaktionellen Gegner trafen einander in einem Raum des trend, um ihr Vorgehen zu besprechen. Mehr Verständnis für mein Verhalten gegenüber Reinhard Tramontana fand ich bei den verschiedenen Frauen, die ihn liebten und ihn im wahrsten Sinne des Wortes vor dem Ertrinken retten wollten. Die letzte von ihnen war die Tochter eines mit mir befreundeten Architekten und gemeinsam hofften wir, Tramontana würde es mit ihrer Hilfe schaffen, vom Alkohol loszukommen. Aber er schaffte es nicht: am 6. Oktober 2005 sollte er an Multiorganversagen durch jahrzehntelangen Alkoholkonsum sterben. Das Ausmaß, in dem in Österreich, aber wahrscheinlich auch in anderen Ländern, der Umgang mit Alkohol den Umgang von Menschen miteinander beeinflusst, ist mir erst heute bewusst: Wahrscheinlich war es nicht zuletzt der Alkohol, der Tramontana so eng mit dem so anders gearteten Udo Proksch verband: Auch Proksch hätte Tramontana zweifellos heftig gegen den Vorwurf verteidigt, ein Alkoholiker zu sein. Als die Affäre Lucona aufkam, verteidigte Tramontana Proksch zuerst heftig gegen den Vorwurf ein Betrüger, dann noch viel heftiger gegen den Vorwurf ein Mörder zu sein, obwohl die Verdachtsmomente mit Händen zu greifen waren. Natürlich war diese Affäre von Beginn an Gegenstand der Berichterstattung des profil. Denn der Mann, der sie aufdeckte und fast all das zu Tage förderte, was Gerald Freihofner in der Wochenpresse, Hans Pretterebner in seinem Bestseller „Der Fall Lucona“ und ich im profil darüber zu Papier brachten, war der Rechtsanwalt des profil Werner Masser. Zugleich war Masser nämlich der Anwalt der Bundesländer-Versicherung, bei der Udo Proksch seine Uranaufbereitungsanlage – in Wirklichkeit eine ausrangiere PlastikExtruder-Anlage garniert mit ein paar Bundesheerversatzstücken – über 212 Millionen Schilling (15,4 Millionen Euro) versichert hatte. Als die Lucona am 23. Jänner 1977 nach einer Detonation – einer mit Zeitzünder versehenen Sprengladung – im indischen Ozean versank und sechs von zwölf Besatzungsmitgliedern den Tod fanden, glaubte Masser von Anfang an jenem Matrosen, der von einer Detonation gesprochen hatte und recherchierte in der Folge mit der Präzision Herbert Herzogs (der mir geholfen hatte, die seltsamsten Geschäften der Gemeinde Wien aufzudecken) die zahlreichen Ungereimtheiten in den Behauptungen Prokschs über die Herkunft seiner Urananlage. Masser trug auch mir und wahrscheinlich auch Freihofner an, ein Buch daraus zu machen, aber zumindest ich meinte, dazu neben meiner Arbeit im profil keine Zeit zu haben und hätte es auch nie so spannend wie Hans Pretterebner verfasst: Es wäre mir zu schwer gefallen, zu glauben, in welchem Ausmaß SP-Minister daran beteiligt waren, die Aufdeckung eines so offenkundigen Verbrechens zu behindern.
327
328
Ein sechsfacher Mord wartet auf eine Anklage
Für mich war der Tatbestand, dass die Staatsanwaltschaft trotz immer erdrückenderer Beweise keine Anklage gegen Proksch erhob, nur einfach die Fortsetzung dessen, was ich durch Jahre erlebt hatte: Ein Verfahren, das für die SPÖ unangenehm werden konnte, wurde von ihr so gut wie nie als anklagereif erachtet. Wochenpresse wie profil schrieben ganz offen Woche für Woche vom dringenden Verdacht des sechsfachen Mordes und nichts rührte sich – es klagte uns auch niemand wegen übler Nachrede. Dass Innenminister Karl Blecha daran mitwirkte, dass Proksch 1985, als er endlich verhaftet wurde, schon nach wenigen Tagen aus der U-Haft entlassen wurde und am Ende floh und dass Parlamentspräsident Leopold Gratz schließlich aus Rumänien ein offenkundig vom Geheimdienst produziertes falsches Dokument zu Prokschs Entlastung mitbrachte, führte am Ende dazu, dass beide ihren Hut nehmen mussten, auch wenn ich nicht glaube, dass sie Proksch tatsächlich für einen Mörder hielten. Erst als Taucher das Wrack der Lucona untersuchten und dort Sprenglöcher fanden, war klar, dass es nicht bloß um Betrug, sondern um Mord ging. Der Einzige in unserer Redaktion, der Proksch trotz der wöchentlich von mir publizierten erdrückenden Indizien bis zuletzt für unschuldig hielt, war Reinhard Tramontana: Er belagerte mich so lange, bis ich ihm erlaubte, in einem eigenen Kommentar alle Argumente zusammenzufassen, die in seinen Augen für diese Unschuld sprachen. Der Text erschien neben meinem Gegentext, obwohl das nicht mehr „Pluralität“, sondern eigentlich „Fehlberichterstattung“ war: Nichts sprach ernsthaft für Prokschs Unschuld. Dennoch ließ selbst die künstlerisch großartige Dokumentation, die Robert Dornhelm über Prokschs Leben drehte, eine klare Aussage über ihn als Mörder vermissen – sie hätte den Film einen Teil seines Reizes gekostet. Selbst der sechsfache Mord reichte nicht aus, Prokschs Tat die Faszination zu nehmen und ihn zu einem ganz gewöhnlichen Mörder zu stempeln. Die einzige Erklärung dafür bietet unverändert Paul Reiwalds Buch „Die Gesellschaft und ihre Verbrecher“, in dem er dieses Verhältnis psychoanalytisch deutet: Es gibt nichts, was auch die anständigsten Menschen mehr fasziniert, als das „große Verbrechen“, das zu begehen sie sich verbieten, während der „große Verbrecher“ seine Begehung wagt. Die Strafjustiz sollte allerdings immun gegen diese unterbewusste Bewunderung des großen Verbrechens sein. Dass Prokschs sechsfacher Mord unter Christian Broda durch Jahre nicht zur Anklage gelangte, erforderte einmal mehr weniger psychoanalytische Einsichten, als praktische Erfahrungen: Die Staatsanwaltschaft sah nie für anklagereif an, was der SPÖ zum Schaden gereichen konnte. Auch dass Brodas Nachfolger Harald Ofner als FPÖ-Justizminister der rot-blauen Regierung Fred Sinowatz’ „die Suppe zu dünn“ für eine Anklage befand, entsprach dieser Erfahrung. Es sollte es einmal mehr eines parteiunabhängigen Rechtsgelehrten – Egmont Foregger als Justizminister der rot-schwarzen Koalition unter Franz Vranitzky – bedürfen, um endlich Anklage gegen Proksch zu erheben: 1992 wurde er wegen sechsfachen Mordes, sechsfachen versuchten
Ein sechsfacher Mord wartet auf eine Anklage
Mordes und schweren Betruges zu lebenslanger Haft verurteilt und starb im Juni 2001 an den Folgen einer Herztransplantation. Gegen Foreggers neuerliche Bestellung zum Justizminister legte die SPÖ ein Veto ein. Das katastrophale Funktionieren der Strafjustiz unter Justizministern, die von einer Regierungspartei bestellt werden, ist leider ein bis heute ungelöstes Problem und lässt mich intensiv auf die angepeilte parteiunabhängige „Bundesstaatsanwaltschaft“ hoffen.
329
52. Waldheim
Wie stark das Vertrauen der Wähler in die SPÖ war, mag man daran ermessen, dass selbst ein GAU wie die Affäre Lucona sie in keiner Weise die Macht verlieren ließ: Umfragen bescheinigten ihr 1986 nach wie vor einen klaren Vorsprung vor der ÖVP des Alois Mock. Aber bei der Bundespräsidentenwahl dieses Jahres sah Mock die Chance, ihr wenigstens eine Teilniederlage zuzufügen: Er wusste, dass die Bevölkerung in Zeiten eines schwarzen Kanzlers zum Ausgleich einen roten Bundespräsidenten bevorzugt hatte und also Sympathien für einen schwarzen Bundespräsidenten gegenüber einem roten Kanzler haben konnte. Und er hatte dafür vor allem einen optimalen Kandidaten: Kurt Waldheim, der bis 1981 Generalsekretär der Vereinten Nationen gewesen war. Dass die SPÖ unter dem nicht mehr so strahlenden Kanzler Fred Sinowatz die mögliche Niederlage ihres Kandidaten, des hochanständigen, aber farblosen Arztes Kurt Steyrer fürchtete, war jedem politischen Beobachter klar. Trotzdem war ich ein wenig erstaunt, als Sinowatz’ einflussreicher Sekretär Hans Pusch mich ins Kanzleramt bat, um mir etwas zu zeigen, das gerade mich besonders interessieren könnte: Ein Foto von begeisterten Hitler-Anhängern auf dem Wiener Heldenplatz, aus deren Menge ein Gesicht vergrößert herauskopiert war. „Finden Sie nicht auch, dass der Kurt Waldheim verdammt ähnlich sieht?“, sagte Pusch. Aber ich konnte nicht mehr sagen, als dass das höchst unscharfe Bild einen jungen Mann zeige, der wie Waldheim blonde Haare habe – solche gebe es tausend. In den Verlag zurückgekehrt hörte ich aus der innenpolitischen Redaktion, dass es Gerüchte über eine angebliche NS-Vergangenheit Waldheims gebe. Eine amerikanische Zeitung würde dazu mit einem großen Bericht herauskommen. „Dann befragen wir ihn doch dazu“, beauftragte ich meinen Kollegen Hubertus Czernin, der wenig später mit der Auskunft zurückkehrte: „Waldheim ist durchaus kooperativ. Ich habe ihn gefragt, ob wir in seinen Wehrmachtsakt Einblick nehmen dürfen und er hat sofort ‚Ja‘ gesagt.“ Wir nahmen also mit seiner Vollmacht Einblick und entdeckten jene Mitgliedschaft seines Reitvereins bei der SA, die profil den Ruhm eintrug, Waldheims SA-Vergangenheit aufgedeckt zu haben. Datum des Eintritts war der 18. November 1938. Nun hatte ich lange genug bei Simon Wiesenthal gearbeitet, um eine SA-Vergangenheit einschätzen zu können: Wenn man sie früh erwarb, musste man dazu ein glühender, verdienstvoller Nazi sein – im November 1938 konnte man im äußersten Fall selbst gegen seinen Willen SA-Mitglied werden, weil alle möglichen Organisationen in die SA inkorporiert wurden oder Wert auf ihre Inkorporierung legten. Ein Reitverein war eine Organisation, für die beides typisch war.
Waldheim
Ich schrieb also einen Leitartikel, in dem ich klarlegte, dass man aus einer solchen späten SA-Mitgliedschaft überhaupt nichts schließen könne, und dass sie, wenn nichts anderes vorläge, mit der Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten durchaus vereinbar sei. Dieser Ansicht bin ich bis heute. Kurz darauf erschien die New York Times mit Anschuldigungen, die freilich viel schwerer wogen: Der Text und ein Foto rückten Waldheim in die Nähe des Kriegsverbrechers General Alexander Löhr. US-Today schrieb von Waldheim als dem „butcher“ (Schlächter) des Balkans. Aus dem Wehrmachtsakt, der uns vorlag, ging allerdings nur hervor, dass Waldheim Ordonnanzoffizier im Stab der Heeresgruppe E Löhrs war – nicht weniger, aber auch nicht mehr. Mit der von mir bei Wiesenthal erlernten Akribie, die für Czernin mindestens so typisch war, machten wir uns daran zu überprüfen, ob es darüber hinaus die Teilnahme an einem Kriegsverbrechen gab. Es ist ausgeschlossen, hier Details und Wendungen dieser Überprüfung zu beschreiben und sie wurde ja von einer renommierten internationalen Historikerkommission wiederholt – das Resultat war in beiden Fällen das gleiche: Waldheim muss von gewissen Verbrechen der Wehrmacht gewusst haben – dafür, dass er daran schuldhaft mitwirkte, gibt es keinen Beleg und auch kein ernsthaftes Indiz. Ein wenig wird die Waldheim-Berichterstattung in relativ vielen Medien durch das in der NY-Times erschienene Foto mit Alexander Löhr charakterisiert: Es erweckt den Eindruck eines besonderen Naheverhältnisses der beiden – weil alle andere Personen (ich hoffe nicht von Mitarbeitern der NY-Times) aus dem Foto herauskopiert wurden. In Wirklichkeit handelte es sich um eine routinemäßige Dienstbesprechung, an der unter mehreren anderen auch Waldheim als Nachrichtenoffizier seiner Einheit teilnahm und der kein verbrecherischer Befehl Löhrs zugeordnet werden kann. Eine bekannte Kolumnistin des NY-Weltblattes, die bei mir auftauchte und der ich zu erklären versuchte, dass Waldheim primär aus einer anti-nationalsozialistischen Familie stamme und Flugzettel gegen den Anschluss verteilt habe, und dass man aus seiner späten SA-Mitgliedschaft nicht automatisch auf eine NS-Gesinnung schließen könne, schleuderte mir als Gegenargument ins Gesicht: „Aber er hat doch die Uniform der deutschen Wehrmacht getragen.“ „Mein Vater auch“, versuchte ich ihr beizubringen, „und er hat Hitler gehasst.“ Die ÖVP, seit Bruno Kreisky in der Defensive, sah 1985 die große Chance, erstmals einen politischen Sieg zu erringen: Sie stellte den ehemaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen als ihren Kandidaten bei der Wahl des Bundespräsidenten auf, nachdem sie Fred Sinowatz’ Angebot, ihn zum gemeinsamen Kandidaten zu machen, ausgeschlagen hatte. Sinowatz sah die Gefahr einer ersten roten Niederlage.
331
332
Waldheim
Zu dieser Zeit hatte der Journalist Georg Karp bei der Durchsicht alter Akten zufällig entdeckt, dass Waldheim in seiner Jugend bei der SA und später am Balkan an einer Front gewesen war, an der die deutsche Wehrmacht besonders viele Kriegsverbrechen begangen hatte. Wie weit er die SPÖ darüber informierte und wie diese Informationen in die Redaktion der NY-Times gelangten, ist bis heute unklar. Sicher ist, wie ich beschrieben habe, dass die SPÖ die Information zu verbreiten begann, dass Waldheim eine verschwiegene NS-Vergangenheit haben könnte. Am 28. Oktober 1985 machte Fred Sinowatz die Zuhörer einer Tagung der SPÖ im Burgenland darauf aufmerksam, dass Waldheims NS-Vergangenheit im Wahlkampf noch eine beträchtliche Rolle spielen würde. Die Abgeordnete Ottilie Matysek notierte diese Aussage in ihrer Mitschrift, und diese Notiz sollte der Grund für Sinowatz’ Verurteilung wegen falscher Zeugenaussage sein. Denn als Alfred Worm behauptete, Sinowatz habe diese Aussage gemacht, klagte der ihn wegen übler Nachrede – aber Worm wurde freigesprochen, weil der Richter Worms Behauptung als zutreffend einstufte: Es bestehe kein Zweifel, dass Sinowatz im Burgenland tatsächlich so über Waldheim gesprochen habe. Der hervorragende Historiker Oliver Rathkolb schreibt in einem Text über Fred Sinowatz, den er politisch so positiv wie ich beurteilt, dass dieses Gerichtsurteil höchst umstritten sei, weil zahlreiche SP-Funktionäre als Zeugen ausgesagt hätten, dass keine solche Sinowatz-Aussage gefallen sei. Doch weil ich diesem Prozess von Anfang bis zum Ende beigewohnt habe, muss ich widersprechen: Ich habe Zeugen selten so offensichtlich lügen sehen. Oft waren ihre Aussagen wortgleich, weil sie so eindeutig eingelernt und aufeinander abgestimmt waren. Jedes andere Urteil des Richters wäre ein krasses Fehlurteil gewesen. Dass ein Gutachten bestätigte, dass Matysek die entsprechende Passage in einem Zug mit der gesamten Mitschrift verfasst hat, hat es für mich nicht gebraucht, um zu wissen, dass sie im Gegensatz zu Sinowatz’ Zeugen die Wahrheit sagte. Ich halte Fred Sinowatz trotz seiner falschen Zeugenaussage für einen hochanständigen Menschen: Er, der als armer „Kroate“ unter anderen als sozialdemokratischen Bedingungen nie in der Lage gewesen wäre zu studieren, geschweige denn zum Minister aufzusteigen, war nur nicht in der Lage, sich von einem Motto zu trennen, das er ebenfalls auf einer Parteitagsrede verkündete: „Der Partei verdanke ich alles, ohne Partei bin ich nichts.“ Das stimmte nicht: Fred Sinowatz war ein Mensch von beträchtlichem Format. Nicht zuletzt hatte er die Größe besessen, zu erkennen, dass er der Führung der SPÖ nach Kreisky nicht gewachsen war und das Gespür besessen, Franz Vranitzky zum neuen Parteichef und damit Bundeskanzler zu machen. Ich möchte meine persönliche Sicht der Affäre Waldheim hier ein letztes Mal zusammenfassen: − Waldheim war primär zweifellos ein Anti-Nazi. Seine besonders schöne Frau stand dem Nationalsozialismus deutlich näher – das mag seine Einstellung mit der Zeit verwässert haben.
Waldheim
− Die Mitgliedschaft bei der SA durch die Inkorporierung seines Reitvereins in diese Organisation ist mit einer aktiv beantragten Mitgliedschaft nicht zu vergleichen. Es ist durchaus denkbar, dass er zu keinem Zeitpunkt oder erst sehr spät davon erfuhr. Dann seinen Austritt zu beantragen wäre ein heroischer Akt gewesen, den kaum jemand vorgenommen hätte – schon gar nicht, wenn er auf möglichst viel Heimaturlaub für sein Studium Wert gelegt hat. − Bei seinem Einsatz am Balkan war Waldheim mit Alexander Löhr einem General unterstellt, den man als einen der schlimmsten Kriegsverbrecher bezeichnen muss: Auf gegnerische Partisaneneinsätze reagierte er mit unverhältnismäßigen kollektiven Erschießungen. Davon hat Waldheim als Nachrichtenoffizier zweifellos gewusst, das anfangs (unter anderem auch mir gegenüber) geleugnet, später aber zugegeben. Wie weit er aus den Ziffern der ihm vorliegenden Berichten auf den kriegsverbrecherischen Charakter von Anti-Partisanenaktionen schließen musste, ist kaum zu klären. Mit Sicherheit hat er daran in keiner wie immer gearteten Weise teilgenommen, keine entsprechenden Befehle erteilt oder auch nur weitergegeben und wäre auch nicht in der Lage gewesen, sie zu verhindern. Auch die „Historikerkommission“ hat ihn daher keines Kriegsverbrechens beschuldigt. − Was sie ihm vor allem vorwarf, war sein Wissen um die Deportation von 50.000 Juden aus Saloniki im Jahr 1943, von der er als Nachrichtenoffizier Kenntnis gehabt haben müsse. Aus den ihm als Nachrichtenoffizier vorliegenden Berichten ging diese Deportation zwar nicht hervor, aber in seinem Kommando auf einem Hügel gegenüber der Stadt habe man davon wissen müssen. Auch Simon Wiesenthal hat diese Ansicht geteilt. Ich halte dieses Wissen zwar auch für wahrscheinlich, nicht aber für gesichert. Denn von meiner Mutter wusste ich, dass sie sich drei Monate hindurch in Auschwitz in Sichtweite der Gaskammern und Krematorien befunden hat, ohne zu wissen, was dort geschieht. Denn weder die Häftlinge noch die SS-Leute, so erzählte sie mir, hätten ein Wort darüber gesprochen, weil ihnen nicht nur ein Verbot, sondern auch das Grauen den Mund verschloss. Erst als sie eine Kameradin gefragt hatte, woher denn der ständige süßliche Geruch in der Luft komme, habe diese sie aufgeklärt: „Ja weißt Du denn nicht …“ Waldheim hat sich zum exakten Datum der Deportationen in Saloniki – so ergab sein „Watchlist“-Verfahren – auf Heimaturlaub befunden. Ich halte die Behauptung der Historikerkommission, dass er von diesen Deportationen wissen musste, im Lichte der Erfahrung meiner Mutter daher für zumindest problematisch: Es ist sehr wohl denkbar, dass die Bewohner von Saloniki oder die Offiziere im Wehrmachtskommando gegenüber der Stadt bei Waldheims Rückkehr darüber so wenig sprachen, wie die Häftlinge und SS-Leute in Auschwitz über die Vergasungen. Was für mich bleibt, ist, dass Waldheim in seinen Memoiren nur denkbar kurz auf seinen Dienst bei der Wehrmacht einging – er selbst erklärt es damit, dass er in diesem
333
334
Waldheim
Buch ja vor allem anderen über seine Arbeit als UN-Generalsekretär berichten wollte, und dass es auch sonst nicht den Charakter von Memoiren habe. Das scheint mir eine zulässige Erklärung. Allerdings hat er auch einem amerikanischen Abgeordneten, der ihn ausdrücklich nach seinem Wehrdienst fragte, keine ausreichende Antwort gegeben. Es besteht für mich wenig Zweifel, dass er wenig Lust hatte, seinen Wehrdienst zum Gesprächsthema zu machen: Nachrichtenoffizier unter Löhr gewesen zu sein, hätte seinen Aufstieg zum UN-Generalsekretär sicher nicht befördert. Ein Mann, der zumindest im Nachhinein erklärt hätte, wie sehr ihn Löhrs Vorgehen am Balkan, nunmehr, da er Genaues darüber wisse, bestürze, war Waldheim sicher nicht – „Größe“ war ihm fremd. Seine für mich schlimmsten Worte gebrauchte er in einer Wahlrede, die Ruth Beckermann in ihrem Film „Waldheims Walzer“ festhielt: „Da können sie noch so lang nach einem Verbrechen suchen – sie werden nichts finden!“ Pause. Und dann mit einem Gesichtsausdruck, den ich in seiner Widerlichkeit leider nicht wiedergeben kann: „Wir waren anständig!“ Das über die Einheit Löhrs gesagt zu haben ist unverzeihlich. Dennoch: Dass er moralische Größe vermissen ließ, dass er um seiner UN-Karriere willen so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf seinen Dienst am Balkan lenken wollte, dass er um seiner Wahl zum Bundespräsidenten willen einen antisemitischen Wahlkampf duldete und sich der „Wehrmachtsgeneration“ mit diesem unsäglichen „Wir waren anständig“ andiente, rechtfertigte nicht, Waldheim wie einen Kriegsverbrecher zu hetzen. Das Verhalten des World Jewish Congress ist mir zwar bezüglich einzelner Mitglieder verständlich: Wenn man wie Eli Rosenbaum weiß, dass der eigene Vater in Wien unter dem Gejohle der Umstehenden die Straße aufwaschen musste, ist man allergisch gegen das Leugnen einer österreichischen Mitverantwortung an Verbrechen und kann meinen, in Waldheim einen leugnenden Verbrecher ertappt zu haben. Aber das war er nicht und das musste man bei besserer Recherche sehr bald wissen. Ihn dennoch wie einen Kriegsverbrecher zu hetzen, hat mich gestört, hat meine Mutter gestört, hat Simon Wiesenthal gestört. Der WJC hat zwar immer behauptet, er habe Waldheim ja nur des Verschweigens, nie aber einer Tat verdächtigt, aber in dieser Form hat er es immer nur im Nachhinein dargestellt. Primär hörten sich seine Vorwürfe immer wie der Vorwurf schwerster Verbrechen an und so wurden sie von den meisten Medien auch wiedergegeben. Waldheim in den USA auf die „Watchlist“ der Personen zu setzen, die ihrer Vergangenheit wegen dort nicht einreisen dürfen, ist und bleibt absurd. So sah das meine Mutter, die gegen Hitler kämpfte. So sah das Fritz Molden, der gegen Hitler kämpfte. So sah das Simon Wiesenthal, der NS-Verbrecher wie kein anderer verfolgte. Privat war Waldheim übrigens ein liebenswerter Mensch, Ehemann und Vater – von seinen Schwächen als Politiker sollte das nicht ablenken.
Waldheim
Die Diskussion, die sich in Österreich aufgrund seiner „Affäre“ ergab, war für das Land zweifellos im höchsten Ausmaß nützlich – auch wenn man sie sehr viel besser am Beispiel Friedrich Peters geführt hätte.
335
53. Eine prosaisch gute, neue Ära
Zu Sinowatz’ Qualitäten zählte nicht zuletzt, um die Qualität anderer Politiker zu wissen: Nachdem er aufgrund seiner Rolle in der Affäre Waldheim zurückgetreten war, machte er Franz Vranitzky zu seinem Nachfolger. Der war der in meinen Augen vor Bruno Kreisky beste Kanzler, den die SPÖ Österreich nach dem Krieg bescherte, und ich möchte diese Behauptung begründen. Die Begründung hat drei Teile: Erstens: Anders als Kreisky wusste Vranitzky um die nachhaltige Gefahr, die die Zusammenarbeit mit einer Partei vom Charakter der FPÖ für Österreich bedeutet. Zuzulassen, dass die Gesinnung der FPÖ weiterlebt, bedeutete, sich für alle Zeiten rechtsextremem Nationalismus auszuliefern und der gefährdet die Demokratie bis heute. Vranitzky hat die von Kreisky begonnene Zusammenarbeit mit der FPÖ daher beendet, sobald er das konnte – nach Neuwahlen im Jahr 1986. Als erster österreichischer Kanzler fand er in einer Rede in Israel adäquate Worte für den Umgang mit der „Vergangenheit“: „Es gibt eine Mitverantwortung für das Leid, das zwar nicht Österreich als Staat, wohl aber Bürger dieses Landes über andere Menschen und Völker gebracht haben. Wir bekennen uns zu allen Taten unserer Geschichte und zu den Taten aller Teile unseres Volkes, zu den guten wie zu den bösen; und so wie wir die guten für uns in Anspruch nehmen, haben wir uns für die bösen zu entschuldigen – bei den Überlebenden und bei den Nachkommen der Toten.“ Ich halte den aus diesen Worten sprechenden politischen Anstand unverändert für wichtiger als alle Errungenschaften, die uns die Regierungen Kreiskys zweifellos bescherten. Denn – und das ist der zweite Teil meiner Argumentation – es ist ein Irrtum davon auszugehen, dass es diese Errungenschaften nicht gegeben hätte, wenn Kreisky mit der ÖVP, statt mit der FPÖ koaliert hätte. VP-Justizminister Hans Klecatsky hatte eine Strafrechtsrechtsreform in der Lade, die sich kaum von der Christian Brodas unterschied und die Josef Klaus nur aus Angst vor der katholischen Kirche unterließ. Unter einem Kanzler Kreisky hätte ein schwarzer Justizminister Klecatsky sie sehr wohl durchgeführt – und ganz sicher hätte Klecatsky, wenn er unter Kreisky nicht Justizminister, sondern nur Justizsprecher der ÖVP gewesen wäre, Justizminister Christian Broda nicht an ihrer Durchführung gehindert. Ich glaube auch nicht, dass der VP-nahe Professor für Finanzwissenschaften, Stephan Koren, ein schlechterer Finanzminister als Hannes Androsch gewesen wäre, so sehr ich dessen Leistungen schätze. Denn Androschs wesentlichste Leistung – die gegen Kreisky fortgesetzte Bindung des Schilling an die D-Mark – beruhte auf Gesprächen, in denen
Eine prosaisch gute, neue Ära
ihn Notenbankchef Koren von dieser Notwendigkeit überzeugt hat. Dass Androsch und Kreisky die Konjunktur-Dellen ihrer Ära mittels Deficit-Spending besser als die Regierungen der meisten anderen Länder überwanden, wäre unter einem Duo KreiskyKoren mit Sicherheit kaum anders gewesen, denn es war Koren, der schon unter Josef Klaus vorgeführt hatte, dass man Konjunktur-Dellen am besten durch Deficit-Spending überwand. Es ist also nicht nur sehr unwahrscheinlich, dass die zweifelsfreien Erfolge der Ära Kreisky in einer Koalition mit der ÖVP nicht zustande gekommen wären, sondern sogar sehr wahrscheinlich, dass es die wichtigsten davon genauso gegeben hätte. Und vielleicht – wenn auch nicht mit solcher Wahrscheinlichkeit – wäre die rot-schwarze Regierung sogar genauso in eine Alleinregierung Kreiskys gemündet, denn das Gros dieser 13 Jahre war überall in Westeuropa von wirtschaftlichem Aufschwung begleitet, der höhere Sozialleistungen und höhere Einkommen zuließ. Hingegen – und das ist der dritte Teil meiner Argumentation – hätte sich Österreich das Fortleben der FPÖ erspart, wenn Kreisky nach den Wahlen des Jahres 1970 mit der ÖVP statt mit der FPÖ zusammengearbeitet hätte. Ich bleibe auch diesbezüglich bei meiner schon vorgebrachten Argumentation: Der Rest „nationaler“ Wähler, die zu Ende der 1960er Jahre gerade noch die FPÖ wählten, obwohl diese Partei mangels Regierungsbeteiligung weder Einfluss besaß noch Posten oder Wohnungen zu vergeben hatte, wäre in der ÖVP und der SPÖ aufgegangen, wenn Kreisky der immer schwächeren FPÖ nicht durch seine Zusammenarbeit mit ihr urplötzlich wesentliche politische Bedeutung verliehen hätte. Vielleicht wäre sie schon bei der Wahl von 1970 an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und mit beträchtlicher Wahrscheinlichkeit hätte sie die folgende Wahl ohne die Wahlrechtsreform, die Kreisky zum Dank für die Duldung seiner Minderheitsregierung zu ihren Gunsten erließ und ohne die Vermutung der Wähler, dass er sie weiterhin brauchen könnte, nicht überstanden. Bruno Kreisky hat der FPÖ das Leben gerettet. Und darunter leidet Österreichs Politik bis heute. Denn diese Partei ist eben keine liberale, sondern eine rechtsextreme Partei und noch charakteristischer als Jörg Haider war H.-C. Strache als ihr Anführer: Als Neonazi sozialisiert und gleichzeitig bereit, die Kosten für die Gucci-Tasche seiner Frau aus Parteifördergeld zu bestreiten. Jetzt hat Strache in Herbert Kickl einen Nachfolger, der sogar noch besser als er in der Lage ist, rechtsextremes Gedankengut in zugkräftigste Slogans zu verpacken. Franz Vranitzky, so behaupte ich, hätte sich, wäre er 1970 schon an der Macht gewesen, auch dann nicht zur Zusammenarbeit mit der FPÖ bereitgefunden, wenn ihm das die Kanzlerschaft beschert hätte. Das ist eine moralische und politische Qualität, die ich höher schätze als Kreiskys erfolgreiche Machtergreifung und denkbar erfolgreiche Regierung. Alles andere konnte Kreisky um eine Klasse besser als Vranitzky. Der besaß nicht entfernt Kreiskys Charisma. US-Außenminister Henry Kissinger hätte ihn vermutlich
337
338
Eine prosaisch gute, neue Ära
nie, wie Kreisky, einen „großen europäischen Staatsmann“ genannt, dessen Bedeutung „weit über sein kleines Land hinausreicht“. Vranitzky wäre nie durch die Anerkennung der PLO als Vertretung der Palästinenser als „Visionär“ in die Nahost-Geschichte eingegangen. Visionen lagen ihm fern und er bedachte dergleichen angeblich (er dementierte es später, obwohl es zu ihm gepasst hätte) mit dem Satz: „Leute die Visionen haben, brauchen einen Arzt.“ Vranitzky, daran will ich keinen Zweifel lassen, war kein außergewöhnlicher, kein zutiefst beeindruckender, sondern nur ein ziemlich intelligenter, ziemlich anständiger, ziemlich erfolgreicher Politiker, unter dessen Führung es den Menschen ziemlich gut gegangen ist. Ich bin ein Banause und ziehe seinesgleichen charismatischen Sonnenkönigen vor. So sehr mich die Reformen Kreiskys und Christian Brodas gefreut hatten, hatte mich das Verhältnis des „Sonnenkönigs“ zur „Vergangenheit“ doch immer irritiert. Es war für den Sohn einer Jahre in Auschwitz und Dachau Eingesperrten eben doch schwierig, sich für eine Alleinregierung mit vier ehemaligen Nazis als Ministern zu begeistern. Und natürlich hatte auch Kreiskys Verhalten gegenüber Simon Wiesenthal in der Affäre um Friedrich Peters SS-Vergangenheit tiefe Spuren bei mir hinterlassen: Ich empfinde dieses Verhalten nun einmal bis zum heutigen Tag als „ungeheuerlich“, auch wenn ich es mir psychologisch erklären und entsprechende Milderungsgründe finden konnte. Nicht zuletzt ist es auch nicht völlig spurlos an mir vorübergegangen, dass Kreisky im Zuge meiner Berichterstattung zu seinem Konflikt mit Wiesenthal von der Industriellenvereinigung meine Absetzung verlangt hatte, auch wenn er damit ohne Erfolg geblieben war und ich selbst dann keine existentielle Not gelitten hätte, wenn er erfolgreich gewesen wäre – ich hätte eben eine hoch bezahlte Kolumnistenfunktion im Kurier oder die Chefredaktion einer deutschen Illustrierten angenommen, die mir mehrfach angeboten worden war. Trotzdem irritierte mich, dass Bruno Kreisky im Gegensatz zu Franz Vranitzky jemand gewesen ist, der sich zu persönlicher Vergeltung hinreißen ließ: Gegen Gerd Bacher intervenierte er bekanntlich bei der SPD, um zu verhindern, dass er Intendant eines deutschen Fernsehsenders wurde. Bei der Zürcher Zeitung erreichte er den Rückzug eines ihm kritisch gesinnten Korrespondenten. Peter Rabl verweigerte er das Gespräch, nachdem der ihm kritische Fragen gestellt hatte. Kreisky, so sehr er Toleranz predigte und als tolerant gefeiert wurde, war persönlich intolerant: Man konnte nur „für“ oder „gegen“ ihn sein. Ich hingegen fand vieles an seiner Politik positiv, einiges aber sehr wohl negativ oder halb so großartig. Was mich die ganze Zeit über irritierte, war das Gefühl, dass so viele Österreicher ihn nicht anders als den „Kaiser“ oder den „Führer“ verehrten – absolut kritiklos. Und dass er das brauchte: Kritik ertrug er nicht. Er war nur nicht nachtragend und versöhnte sich irgendwann auch mit mir. Kreisky, das hat er mit den meisten „charismatischen“ Politikern gemein, wollte von den Menschen verehrt, ja geliebt werden und er war ja Gott sei Dank ein Demokrat, so dass es nicht schadete, dass er kritiklos verehrt wurde.
Eine prosaisch gute, neue Ära
Beklommen hat es mich trotzdem gemacht. Dass mich der ORF in der Folge immer nur als „Kreisky-Gegner“ einlud, war absurd – ich zähle nur bis heute nicht zu Kreiskys kritiklosen Verehrern. Von Links wird gegen Vranitzky eingewendet, dass mit ihm die Zeit der nicht mehr wirklich sozialistischen Kanzler begann. Das stimmt insofern, als er nie ein Marxist war – aber das trifft auch auf Kreisky zu – nur dass Vranitzky auch nicht versuchte, eine andere Vision an Stelle des Marxismus zu setzen, während Kreisky mit seiner These, dass es alle Bereiche des Lebens zu demokratisieren gelte, doch so etwas wie eine Vision geschaffen hat. Vranitzky war nur in dem Sinne Sozialist, in dem sein Freund, der ehemalige Chef der Werbeagentur GGK Hans Schmidt oder auch ich es bis heute sind: Wir schlagen uns im Zweifel auf die Seite der Schwächeren und treten für eine Verbesserung ihrer Lage ein. Obwohl wir beide wirtschaftlich relativ erfolgreich sind – Schmid ist sogar extrem erfolgreich – halten wir Vermögenssteuern nicht wie Sebastian Kurz oder Gernot Blümel für Teufelszeug, sondern für notwendig, sinnvoll und fair, obwohl sie unser persönliches Vermögen schmälerten. Diese Haltung kann man auch als Christlich-Sozialer oder als Liberaler einnehmen und vor allem auch für ökonomisch richtig halten: Wenn ein Maximum der Menschen dank ausreichend guter Einkünfte in der Lage ist, ein Maximum zu konsumieren, dann können Unternehmer ein Maximum verkaufen. Vranitzky wollte den Kapitalismus nicht überwinden, sondern auch für „Schwächere“ so ertragreich wie möglich gestalten. Das deckt sich mit meiner Haltung. Gemeinsam mit Außenminister Alois Mock verfolgte er sehr konsequent eine Politik, die man zwar nicht als sozialistisch, aber damals durchaus als visionär bezeichnen konnte: Er bereitete mit aller Energie den Übertritt Österreichs aus Kreiskys EFTA in die EU vor und wusste ihn der Bevölkerung auf seine kühlere, wenig charismatische Art auch schmackhaft zu machen. In der historischen Volksabstimmung vom 12. Juni 1994 sollten sich bekanntlich 66,64 Prozent der Österreicher für den Beitritt zur Europäischen Union aussprechen. Man kann also nicht einmal sagen, dass Vranitzkys politisches Lebenswerk ein so viel geringeres als das Kreiskys gewesen wäre – es war nur sehr anders beschaffen.
339
54. Die Zerreißprobe
Für mich persönlich begann die elfjährige Ära Vranitzky mit der größten Veränderung meines bisherigen Lebens: Ich lernte meine zweite Frau Eva kennen. Dass wir einander trafen, hing mit meinem unveränderten Interesse am Schicksal des österreichischen Bundesheeres zusammen. Ich folgte immer wieder Einladungen von Reserveoffizieren, die seinen Zustand oder die Konsequenzen der österreichischen Neutralität mit mir diskutieren wollten und hielt diesbezügliche Referate. Ein besonders engagierter dieser Reserveoffiziere war der Wiener Rechtsanwalt Hans Schmidt und so nahm ich gerne eine Einladung zu einer Abendveranstaltung in seiner Wohnung an. Die entpuppte sich dann als eher dürftiges Hauskonzert, aber der Hausherr machte mich mit seiner ehemaligen Konzipientin Eva bekannt und fünf, sechs gewechselte Sätze genügten, mich unsterblich in sie zu verlieben. Verlieben funktioniert ja laut wissenschaftlicher Forschung innerhalb von Sekundenbruchteilen und das Bewusstsein ist nur am Rand daran beteiligt – für mich hat dieses besondere mich Verlieben in meine zweite Frau jedenfalls bis heute den Charakter eines Blitzschlages, dem auszuweichen unmöglich war. Sehr groß, sehr blond und mit riesigen blauen Augen war Eva zweifellos schön – aber von einer Art Schönheit, die ich – sie sollte darüber später hellauf lachen, denn das Gegenteil stimmte – mit Sympathien zur FPÖ assoziierte und die daher theoretisch Abstand zwischen uns schuf. Doch genau dieser Abstand erhöhte auf absurde Weise meinen Wunsch ihn zu überwinden. „Wo ist Ihr Mann?“, fragte ich in der unterbewussten Hoffnung, dass er nicht anwesend sein würde. „Mein geschiedener Mann ist dort drüben“, antwortete sie, und vielleicht betonte sie das Wort „geschiedener“ in der unterbewussten Hoffnung, mir gegenüber klarzustellen, dass sie nicht fix gebunden war. Ich lernte ihren geschiedenen Mann tatsächlich kurz kennen, fand, dass auch er sehr gut aussah, war aber dennoch überzeugt, es mit einer Frau zu tun zu haben, die Männer, die ihr nicht mehr genügten, eben verließ. Auch das schuf primär eine Distanz – die zu überwinden mir einmal mehr umso reizvoller schien. Erst später sollte ich fassungslos erfahren, dass es genau umgekehrt gewesen war: Nicht sie hatte ihren Mann, sondern er hatte sie trotz zweier Kinder verlassen. Ich sollte an diesem Abend keine Sekunde mehr von ihr lassen: Sprach mit ihr über Filme, die ich schätzte und war zu Recht überzeugt, dass sie auch ihr gefallen hatten. Sprach mit ihr über Theateraufführungen, die ich schätze und war zu Recht überzeugt, dass sie auch sie schätzte. Sprach mit ihr – und das hatte den Charakter eines Lackmustests – über Gedichte, die ich liebte und war sicher, dass auch sie sie liebte: „Ja, die Sprache Rilkes ist wie Musik“, sagte sie, und ich fühlte eine solche Hitze
Die Zerreißprobe
zwischen uns aufsteigen, dass ich einen Moment lang ernsthaft daran dachte, sie vor allen Anwesenden an mich zu ziehen und zu küssen, obwohl ich sie nur gerade eine Stunde kannte. Ich nahm nur gerade noch davon Abstand, schlug ihr aber vor, die Gesellschaft zu verlassen und in die Conte-Bar zu wechseln und war zu Recht überzeugt, dass sie „Ja“ sagen würde. Damit es nicht auffiel, ging ich allein voraus und wartete vor dem Haustor. Ich wartete zwei Stunden, aber sie kam nicht. „Hans und Leni haben vorgeschlagen, gemeinsam noch etwas auf der Gitarre zu spielen und zu singen und dass ich da unbedingt dabei sein müsste“, erzählte sie mir später, „und da habe ich mir gedacht, dass das vielleicht ein Zeichen des Himmels ist. Denn ich habe ja gewusst, dass Du verheiratet bist und Kinder hast – und das war nicht gerade die Beziehung, die ich mir anfangen wollte.“ Ich, der kurz zuvor einen Kommentar geschrieben hatte, wonach man sich zu zwingen hat, bei der Frau zu bleiben, mit der man Kinder hat, missachtete das Zeichen, das sie mir durch ihr Nichterscheinen geben wollte und schickte ihr am nächsten Morgen 50 rote Rosen. „Mir ist klar“, schrieb ich dazu, „dass vermutlich jeder zweite Mann, dem Sie begegnen, versucht, Ihnen den Hof zu machen, so dass Sie das manchmal schon etwas ermüdend finden. Deshalb verspreche ich: Ich werde ganz vorsichtig und behutsam sein.“ Auch das war ich nicht: „Ich will ein Kind von Dir“, sagte ich, als ich das erste Mal mit ihr schlief. „Das ist verrückt“, sagte sie, „wir kennen uns ganze zwei Wochen.“ Das im Jahr darauf nach unzähligen energischen Versuchen gezeugte Kind Eric ist jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, 34. Was ich hier als Beginn einer durch drei Jahrzehnte und bis heute fortdauernden großen Liebe beschrieben habe, kann man auch als Beginn einer durch sechzehn Jahre fortdauernden, kaum zu ertragenden Zerreißprobe beschreiben: als fast völlige Entzweiung mit meiner Mutter; als Abfolge immer schwerwiegenderer beruflicher Fehlentscheidungen; als Suche nach Selbstvernichtung. Denn durch ein gutes Jahrzehnt vermochte ich diese Liebe nicht mit meinem Gewissen zu versöhnen. Seit ich denken konnte, hatte ich gelernt, dass es nichts Schlimmeres als das Verlassen einer Frau gibt, mit der man Kinder hat. Ich hatte erlebt, wie meine Mutter sich ihr ganzes Leben hindurch nicht davon erholte, dass mein Vater sie verlassen hatte. Ich wusste von mir selbst, dass ich das immer auch als ein schmerzhaftes Mich-Verlassen empfunden und ihm durch Jahrzehnte nicht verziehen hatte. Es gab auch keine Milderungsgründe für mein Handeln: Ausschließlich ich war an der Auflösung meiner ersten Ehe schuld. Meine erste Frau Lisi war alles andere als „herzlos“ oder „kalt“ gewesen; ich hatte auch mit ihr gute Gespräche geführt, in denen wir in allen wesentlichen Fragen übereinstimmten; sie war eine wunderbare Mutter unserer drei Kinder, die ich mir nicht minder als Eric gewünscht hatte.
341
342
Die Zerreißprobe
Die heute übliche Behauptung, dass an einer Scheidung immer beide Teile Schuld tragen, trifft zwar hin und wieder, aber keineswegs immer zu: In meinem Fall war ausschließlich ich am Scheitern meiner ersten Ehe schuld. Denn es war auch nicht so, dass ich meine erste Frau erotisch uninteressant gefunden hätte – ich war nur dennoch außerstande, ohne Eva zu sein. Also versuchte ich vorerst meine neue Beziehung neben der alten weiterzuführen, was ein erstaunliches Ausmaß an Täuschung erforderlich machte. Abende mit Eva zu verbringen, fiel mir relativ leicht, weil ich nur zu oft am Abend lange gearbeitet hatte und es jetzt vorschieben konnte. An Wochenenden mussten mir Tennisfreunde Alibis geben: Mich anrufen und am Sonntag zu einem dringenden Herrendoppel außerhalb Wiens bitten. Eine angebliche Tagung in Deutschland gab mir Gelegenheit, zwei Tage mit Eva in Krems zu verbringen. Aber ich wollte auch mit ihr ausgehen, sie nicht nur gemeinsam mit ihren, sondern auch gemeinsam mit meinen Kindern erleben, ohne dass die es begreifen durften. Das erforderte eine denkbar komplexe Konstruktion, aber sie gelang: Wenige Wochen nachdem wir einander kennengelernt hatten, saßen meine Tochter Katharina und mein ältester Sohn Sebastian tatsächlich gemeinsam mit Eva und mir am Tisch, ohne zu ahnen, was sie mir bedeutete. Anlass dazu bot eine Opernball-Einladung des profil für die deutsche Schi-Weltmeisterin Rosi Mittermaier, die mehrmals an unseren Schi-Tests teilgenommen hatte. Ich hatte diesen „profil-Ski-Test“ ursprünglich aus meiner eigenen Schi-Begeisterung heraus eingeführt, aber er hatte sich bald zu einem Geschäftszweig entwickelt: Hatte ich die verschiedenen Schimodelle, durch Folien unkenntlich gemacht, ursprünglich mit ein paar Freunden und bewusst auch einigen schlechten Fahrern auf ihr Verhalten getestet, so schickten die Skifirmen bald ihre prominentesten ExRennläufer, um den Test, wie sie sagten, professioneller zu gestalten und wir mussten ein komplexes System, mit dem Zwang auch negative Wertungen zu vergeben, erdenken, um die Tests dennoch objektiv zu gestalten. Rosi Mittermaier war eine dieser prominenten Läuferinnen und ich konnte meiner Frau glaubwürdig erklären, dass ich mich am Opernball ihrer annehmen müsse, so dass es wenig Sinn hätte, wenn sie auch mitkäme – Katharina und Sebastian böte sich aber eine ideale Chance, nicht nur den Opernball, sondern auch Rosi Mittermaier kennenzulernen. Jetzt brauchte ich nur noch jemanden, der vor ihnen glaubwürdig Evas Begleiter zu sein schien und verfiel auf Ossi Bronner, der gerade aus den USA nach Österreich zurückgekehrt war. Ohne ihm zu sagen, wie ich zu Eva stand, bat ich ihn, sie von zu Hause abzuholen und auf den Ball mitzubringen, was er nur zu gerne tat, nachdem er sie gesehen hatte. So erlebte ich Eva eine halbe Nacht lang gemeinsam mit zweien meiner Kinder und freute mich, dass sie nett miteinander sprachen. Dann schickte ich sie mit dem Taxi nach Hause, um eine Stunde später Rosi Mittermaier in ihrem Hotel abzuliefern. „Dabei
Die Zerreißprobe
bringe ich auch gleich Deine Begleiterin heim“, hinderte ich Bronner, Eva nach Hause zu bringen und hatte sie den Rest der Nacht für mich. Das war alles bis ins Detail durchdacht – ich hätte nicht für möglich gehalten, dass ich zu so viel Täuschung fähig sei. Auch Bronner hatte es nicht für möglich gehalten. „No, ihr habt mich ja ordentlich anrennen lassen“, meinte er, als wir ihn Wochen später als Paar besuchten. Sechs Jahre später sollte die Ballnacht, in der Bronner offiziell ihr Begleiter gewesen war, Eva veranlassen, mich energisch davor zu warnen, von der Wochenpresse/ Wirtschaftswoche zu ihm in den Standard zu wechseln. Er hatte ihr damals, während ich mit Mittermaier tanzte, nämlich ausführlich erzählt, wie er den Standard gründen und der Financial Times nachbilden würde, und dass er ihn diesmal „sicher nicht wie das profil an Michael Lingens aus der Hand geben“, würde. Leider sollte ich ihre Warnung nicht ernst nehmen und doch als Co-Chefredakteur in den Standard wechseln, was zu einem Teil meines von meiner Mutter prophezeiten beruflichen Abstieges werden sollte. Es dauerte noch bis in den August, bis ich in meiner Ehe endlich reinen Tisch machte: Ich gestand Lisi, dass ich seit einem halben Jahr eine andere Frau liebte und mit ihr zusammenleben wollte, und ich gestand es, was fast noch schwieriger war, auch meinen Kindern. Sie verdammten mich nicht, aber sie weinten und ich weinte mit ihnen. Doch das Schlimmste stand mir noch bevor: Ich musste es meiner Mutter gestehen. Lisi hatte sie vorbereitet und mir war klar, wie sie reagieren würde: „Du wärst nie gegangen, wenn Eva sich nicht an Dich geschmissen hätte.“ „Eva hat sich nicht an mich geschmissen – ich bin ihr nachgelaufen.“ „Warum hältst Du sie Dir nicht einfach als Geliebte, wenn Du es unbedingt brauchst? Und bleibst bei Deiner Frau und Deinen Kindern!“ „Weil ich Eva zu sehr liebe!“ „Und Deine Frau bedeutet Dir nichts?“ „Lisi bedeutet mir nach wie vor mehr als fast alle anderen Menschen. Aber in den letzten Jahren müsstest Du doch auch gemerkt haben, dass etwas nicht mehr so wie früher ist.“ „Das kann sich wieder ändern.“ „Ich liebe Eva. Daran kann sich nichts ändern.“ „Weil sie Dich verhext hat. Mit ihrem offenherzigen Dekolleté mit ihren kurzen Röcken. Es war ihr egal, dass Du verheiratet warst und drei Kinder hast.“ „Es war ihr nicht egal. Ich habe behauptet, ich lebte längst nicht mehr mit meiner Familie zusammen. Ich habe sie belogen, wie Alex Dich über seine Ehe mit Sophia belogen hat. Als sie dann begriffen hat, dass so vieles eine Lüge war, dass ich natürlich an Lisi und den Kindern hänge, war es für uns beide zu spät. Wir konnten nicht mehr ohne den anderen sein.“
343
344
Die Zerreißprobe
„Und Lisi bringst Du um und es macht Dir nichts aus.“ „Es macht wir wahnsinnig viel aus. Du kannst Dir nicht vorstellen, wie sehr es mich quält. Ich werde immer für sie und die Kinder da sein: Man wird mich nicht wie meinen Vater mahnen müssen, dass ich etwas zahle. Die Familie wird nicht schlechter als vorher leben. Bei meinem Gehalt ist das möglich.“ „Was heißt nicht schlechter als vorher – ohne Ehemann, ohne Vater.“ „Ich werde mindestens zweimal in der Woche auf Besuch kommen. Ich war wegen meiner Arbeit in der Vergangenheit nicht öfter für meine Familie da.“ „Das ist etwas völlig anders. Da wussten alle, dass Du für sie arbeitest. Aber jetzt gehört alles Deiner zweiten Frau. Sie hat alles, Deine erste Frau hat nichts. Obwohl Du ihr alles verdankst: Dein schönes Zuhause, Deine Karriere, Dein Ansehen – nichts davon hättest Du ohne den Rückhalt von Lisi erreicht.“ „Ich weiß das. Ich weiß, was für eine wunderbare Frau sie ist. Ich weiß, was ich ihr zu verdanken habe – aber ich liebe Eva.“ „Herunterziehen wird Sie Dich. Heruntergehen wird es von jetzt ab mit Dir, so wie es mit Deinem Vater nach der Scheidung heruntergegangen ist. Im Beruf, im Leben, in allem.“ Wir haben das später „den Fluch“ meiner Mutter genannt, und er sollte sich beruflich mit erstaunlicher Präzision erfüllen: Ich sollte profil völlig sinnlos aufgeben; ich sollte völlig sinnlos von der Wochenpresse, wo ich von den Eigentümern geschätzt wurde, zum Standard wechseln, wo Oscar Bronner mich so wenig wie möglich als Chefredakteur sehen wollte, obwohl er mich in dieser Funktion engagiert hatte; und als ich die Chance erhielt, wieder Herausgeber des profil zu werden, zerstörte ich sie durch einen absurden Telefonanruf, mit dem ich ein Strafverfahren gegen mich lostrat, in dessen Verlauf ich alles tat, um eine Verurteilung möglich zu machen: Ich fürchtete mich panisch vor dieser Verurteilung und schwelgte dennoch in der Vorstellung, einsam in einer Zelle zu sitzen und meine Schuld zu büßen. Man kann das Ausmaß meines Schuldgefühls nur verstehen, wenn man sich vor Augen führt, dass ich seit meinem sechsten Lebensjahr mit einer Mutter aufwuchs, die zutiefst depressiv war und diese Depression darauf zurückführte, dass ihr Mann sie verlassen hatte – und obwohl ich wusste, wie schmerzhaft das für sie und auch für mich war, hatte ich nun genau dasselbe getan.
55. Die Trennung von profil
Fast immer, wenn ich mit meiner Mutter, Lisi und meinen Kindern bei Tisch gesessen war – und das war von 1980 bis zu ihrem Tod im Jahr 2002 an jedem Wochenende der Fall – hatten sich die Gespräche – gegenüber den Kindern nicht unbedingt fair – um Politik gedreht. Zwangsläufig hatte sie das zu Fragen provoziert: „Warum ist der Androsch wütend auf profil?“ „Was hat Bruno Kreisky gegen Simon Wiesenthal?“, „Was haben die Amerikaner gegen Kurt Waldheim?“ und so fort. Dann hatte ich mich bemüht, diese Fragen so zu beantworten, dass auch unser Jüngster, Oliver, die Antwort verstand. Das hatte schon sehr bald die Idee in mir geweckt, eine Zeitschrift für Kinder zu schaffen, in der man nicht nur Märchen und Geschichten über Tiere lesen konnte. Als ich durch Zufall in einer Elsässischen Zeitung auf eine Sonntagsbeilage stieß, die als „Journal des Enfants“ politische Großereignisse in kindgerechter Sprache anbot, war mein Entschluss gefasst: Ich wollte ein „Mini-profil“ für Kinder, ein Nachrichtenmagazin für Acht- bis Zwölfjährige schaffen. Einerseits um künftige Leser für profil heranzuziehen, andererseits, weil ich nach einer Umfrage unter Bekannten der Meinung war, dass ein solches Produkt durchaus auch kommerziellen Erfolg haben konnte. So überzeugt, dass ich Geschäftsführer Günter Enickl vorschlug, ein solches Magazin zu gründen: Ich würde mich mit 25 Prozent auch an den entsprechenden Investitionen beteiligen. Enickl war erwartungsgemäß weniger begeistert – alles, was die Gewinne des Verlages primär reduzierte, traf bei ihm, wie ein so oft vorgeschlagenes Frauenmagazin, auf skeptische Zurückhaltung. Ähnlich war das – ebenfalls jedes Mal – bei der damals am Gewinn des Verlages mitbeteiligten Redaktionen von trend und profil. Nur dass die Ablehnung diesmal auf charakteristische Weise in sich gespalten war. Auf einer schwarzen Tafel, an der Redaktionsmitglieder ihre Meinungen zu diesem oder jenem deponierten, fanden sich abwechselnd Anschläge etwa folgenden Wortlauts: „Lingens plant ein Kinder-Magazin. Das wird eine sichere Totgeburt zu Lasten unserer Gewinne.“ Oder aber: „Lingens will sich auf unsere Kosten bereichern – das neue Kinder-Magazin soll ihm zu 25 Prozent gehören.“ Mündlicher Hauptvertreter beider Meinungen war wie immer mein Stellvertreter Helmut Voska, der wie beim Economist eine Chance witterte, mir eine Niederlage zuzufügen, aber in diesem Fall auch Alfred Worm, der es liebte, sein kommerzielles Wissen zu demonstrieren. Dass die beiden Ansichten – es drohe ein finanzielles Debakel (Worm) und ich wolle mich bereichern (Voska) logisch unvereinbar waren, fiel niemandem auf.
346
Die Trennung von profil
Ich war diesmal entschlossen, mich anders als beim Economist über Voskas Widerstand hinwegzusetzen und den Widerstand Worms nicht ernst zu nehmen. Da ereignete sich etwas abermals Charakteristisches: Eine Verlagskonferenz wurde einberufen, bei der ich mich gegen den Vorwurf verteidigen sollte, meine Stellung als profil-Herausgeber zu Gunsten „meines“ Projektes (das zu 75 Prozent dem Verlag gehörte) zu missbrauchen. Der Hintergrund: Jemand war in meinen versperrten Schrank eingebrochen und hatte dort einen Brief entwendet, in dem ich die Landeshauptleute um Wohlwollen für den Vertrieb einer für Kinder geeigneten Zeitschrift an ihren Schulen bat. Ich hatte mein zweites „Bronner-Erlebnis“ nach der Economist-Ablehnung: Das Gefühl unfassbarer Missachtung meines Bemühens um Erfolg. Dazu das Gefühl, mich in einer Schlangengrube zu befinden, in der nicht einmal ein versperrter Schrank Sicherheit bietet. Die Verteidigung vor versammelten Redakteuren des profil wie des trend, sowie den relativ zahlreichen Angestellten der Inseratenabteilungen fiel mir allerdings relativ leicht: Die Landeshauptleute sind gleichzeitig oberste Landesschulbehörde – man musste daher ihre Zustimmung haben, wenn man eine Zeitschrift an Schulen vertreiben wollte. Das anerkannte relativ rasch auch die Redaktionsversammlung. Ich aber war diesmal entschlossen zu handeln: Ich würde mich von Helmut Voska trennen. Wenn man fast alles, was man in einer Zeitschrift oder einem Verlag tun will, gegen seinen Stellvertreter durchsetzen muss – das galt angesichts der Freundschaft zwischen Voska und Geschäftsführer Enickl de facto, wenn auch nicht de jure für jedes Projekt, jedes Engagement eines Mitarbeiters, jede Gehaltsbemessung – dann gibt es den Punkt, an dem man keine andere Möglichkeit hat, auch wenn man in der wesentlichsten Funktion – der Leitung der „Konferenz“, in der festgelegt wird, wer welche Themen bearbeiten soll – unabhängig ist. Ich mochte Machtkämpfe zwar nicht – ich hatte Macht (und Arbeit) ja durchaus freiwillig mit Voska und Gert Leitgeb geteilt – aber wenn ich Machtkämpfe führen muss, bin ich dazu durchaus fähig. Um Voskas Einfluss zurückzudrängen, hatte ich daher nach dem Abgang von Leitgeb zum Kurier, dessen Chefredaktion er für kurze Zeit übernahm, mit dem ehemaligen Chefredakteur der Wochenpresse Franz Ferdinand Wolf einen zweiten stellvertretenden Chefredakteur engagiert, mit dem ich harmonierte und der nächste Schritt war ebenso wohlüberlegt: Ich war entschlossen, die abseits der Konferenz wichtigste redaktionsinterne Aufgabe exakt gleichberechtigt zwischen Voska und Wolf zu teilen: Beide sollten Woche für Woche abwechselnd die eintreffenden Manuskripte verwalten, sie redigieren, soweit sie mir nicht als „heikel“ vorzulegen waren und ihnen den endgültigen Platz und die endgültige Länge zuweisen, die sie im Heft erhielten. Es war dies die nach mir wichtigste Machtposition, denn der redaktionelle Raum wurde immer wieder durch neu eintreffende Inserate verringert und damit zur begehrten Mangelware: Ein Text, für den kein Platz mehr da war, erschien nicht. Darüber hinaus
Die Trennung von profil
empfanden die meisten Redakteure „Redigieren“, auch wenn es sich auf rein stilistische Verbesserungen beschränken musste, als „übergeordnete Tätigkeit“, während etwa in amerikanischen Zeitschriften die Arbeit des recherchierenden Reporters die bei Weitem angesehenere ist. Aber während Gerd Leitgeb immer auch Reporter geblieben war, hatte Voska sich total auf das Verwalten des redaktionellen Raumes beschränkt und die Texte, im Gegensatz zu mir, auch so wenig wie möglich redigiert, weil die meisten Kollegen das als angenehmer empfanden. Anders als Leitgeb sah er im reinen Platzverwalten seine entscheidende Funktion. Ich war daher überzeugt, dass er sie nie mit Franz Ferdinand Wolf teilen würde. Das war die einfachste und eleganteste Form, ihn los zu werden – er würde seinen Hut nehmen und seine Abfertigung erhalten. Voska glaubte sich – freilich zu Unrecht – durch seinen Freund und Geschäftsführer Günter Enickl gegen diesen Schachzug abgesichert und scharte „seine“ Leute in der Redaktion um sich: Sigrid Löffler, die weniger „für Voska“ als „gegen mich“ war, ihren Kultur-Kollegen Horst Christoph, der stets das gleiche wie sie tat, zwei Kolleginnen, denen Voska nicht zuletzt als Mann gefiel und einen Kollegen, der ihm (der ÖVP) politisch am nächsten stand. Verstärkt wurde diese „Voska-Fraktion“ der profil-Redaktion durch den Inseratenchef des Verlages Peter Allmayer-Beck, den ich und der mich kaum kannte, aber aus unerfindlichen Gründen nicht mochte, so dass die Voska-Fraktion sich in seinem Zimmer im Stockwerk des trend traf, um die Strategie für einen Gegenangriff zu besprechen. Alfred Worms Rolle war die einzige mir unbekannte. Auf meiner Seite standen diesmal die eher linken, jedenfalls weniger ÖVP-nahen und jüngeren Kollegen: Joachim Riedl, Christian Ortner, Christoph Kotanko, Josef Votzi, Otmar Lahodynsky. Erhard Stackl nahm als Betriebsrat eine mir zwar freundlich gesinnte, aber vor allem vermittelnde Rolle ein. Die Front war seit Monaten in etwa entlang dieser Linie verlaufen und das hatte die praktische Arbeit auf die beschriebene Weise erschwert. Voskas Pech in der „Endschlacht“, einer neuerlichen Verlagskonferenz, die wegen „Unruhen in der profil-Redaktion“ einberufen worden war, war, dass dort von unbeteiligten Dritten aus der Verwaltung die Forderung erhoben wurde, profil doch so wie den trend zu organisieren: Dort thronte Herausgeber Helmut Gansterer über zwei gleichberechtigten Chefredakteuren und so sollte doch auch ich es halten. Ich willigte nur zu gerne ein. Helmut Voska, auf diese Weise öffentlich zur Arbeitsteilung mit Franz Ferdinand Wolf verdammt, reagierte wie ich es erwartet hatte: Das kam für ihn nicht in Frage. Sein Freund, Geschäftsführer Günter Enickl war verzweifelt: Er konnte nichts gegen diese Entwicklung unternehmen, denn ich besaß für Voskas Abgang die Rückendeckung des Kurier-Geschäftsführers Ernst Gideon Loudon. Dass der Falter aus den Fenstern seiner, dem trend-profil Verlagsgebäude gegenüberliegenden Redaktion ein Transparent „Falter für Foska“ hängte, war ihm kein wirklicher Trost. (Die falsche Schreibung von
347
348
Die Trennung von profil
Voskas Namen beruhte darauf, dass man im Falter keine Ahnung von ihm hatte – nur in mir einen düsteren Reaktionär sah.) Die Verlagsversammlung hatte mir einen unerwartet einfachen Sieg beschert. Es war der pure Zufall, dass ich sozusagen zwischen Tür und Angel auf ein Mitglied der trend-Anzeigenabteilung stieß, das mir zuraunte: „In diesem Haus werden Sie keine ruhige Minute mehr haben.“ Dieser leise Satz traf in meinem Kopf dröhnend mit einem Satz zusammen, den meine Mutter mir zwei Tage zuvor an den Kopf geworfen hatte: „Was Du mir durch Deine Scheidung antust, ist schlimmer als Auschwitz.“ So wie sich zwei Wellen von gleicher Amplitude, wenn sie einander treffen, zu einer stehenden Welle von gewaltiger Kraft verdichten können, nahmen mir diese beiden Sätze plötzlich jede Fähigkeit zu überlegtem Denken. Das Einzige, was noch da war, war das Gefühl, von allem genug zu haben und nur mehr weg zu wollen. In diesem Zustand traf ich Diplomkaufmann Enickl zum theoretisch alles abschließenden Gespräch, bei dem ich eigentlich nur mehr bei der Entscheidung zur gleichberechtigten Doppelchefredaktion Wolf–Voska bleiben musste, um ihn los zu sein. „Sie sehen müde und abgespannt aus“, sagte Enickl – um einer Eingebung folgend fortzusetzen: „Haben Sie nicht eigentlich immer viel lieber geschrieben, als sich mit der Redaktion herumzuschlagen? Ich mache Ihnen einen Vorschlag: Wir zahlen Ihnen ihr gesamtes bisheriges Gehalt allein für Ihren Leitartikel. Und Sie haben die Möglichkeit, die ganze Zeit bei ihrer neuen Frau und dem kommenden Kind zu sein. Ist das nicht eine wunderbare Lösung?“ „Ja“, sagte ich, ohne eine Sekunde nachzudenken. Auch dass Dr. Loudon, den ich mit meinem Entschluss konfrontierte, mir völlig verblüfft energisch davon abriet und dass „meine“ Hälfte der Redaktion ihn in keiner Weise begriff, hielt mich nicht davon ab, ihn zu verwirklichen. Ich befand mich in einem Tunnel, an dessen Ende mir „alles abwerfen“ der einzig mögliche Ausgang schien. Als ich von Loudon in die Redaktion zurückkehrte, hatte Enickl bereits den Rundfunk verständigt. „Leichenblass und tonlos“, so erzählte mir meine Frau, hätte ich meinen Abschied erläutert. Tatsächlich war mir schon während des TV-Interviews völlig klar, dass ich etwas Wahnwitziges getan hatte. Der Fluch meiner Mutter hatte sich zu erfüllen begonnen.
Depression, Risiko, Glück Die Depression, die mich erfasst hatte, umfing mich wie ein betäubendes Schlafmittel: Ich wollte mich eigentlich nur hinlegen, die Augen schließen und nichts mehr denken. Aber genau das konnte ich nicht: Die Erinnerung an die Entscheidung, die ich getroffen hatte, kreiste in meinem Kopf wie die Erinnerung an ein nicht wiedergutzumachendes Verbrechen. Ich suchte nach einer anderen Reaktion auf die Bemerkung des Mitarbeiters
Depression, Risiko, Glück
der Anzeigenabteilung und erlebte mich sie abwechselnd lachend negieren oder ihm energisch widersprechen – bis ich begriff, dass das ein Wachtraum war. Ich suchte nach einer anderen Antwort auf Enickls Angebot und erdachte auch sie so konkret, als fände das Gespräch soeben statt: „Ich glaube, dass es mir unter den geänderten Umständen viel mehr Freude machen wird, die Redaktion zu führen“, hörte ich mich sagen, „und wenn ich mich nicht mehr mit unsinnigen Widerständen herumschlagen muss, werde ich auch ausreichend Zeit für meine Frau und das Kind haben – es waren ja nur diese Widerstände, die mich so viel Zeit gekostet haben.“ In allen meinen gedachten Reaktionen war ich siegessicher, kraftvoll, selbstbewusst und hielt sie für die Wirklichkeit – bis ich begriff, dass ich k. o. in meinem Bett lag und seit Stunden nicht einschlafen konnte. Meine Depression war so tief, dass ich eine befreundete Ärztin bat, mir ein starkes Schlafmittel zu verschreiben, von dem ich dann eine doppelte Dosis zu mir nahm: Nur so vermochte ich einzuschlafen und den jeweils folgenden Tag in einer Art somnambulem Zustand zu verbringen. Eva, die von meinem Ausscheiden aus dem Redaktionsgetriebe profitieren sollte, erlebte mich zum ersten Mal in unserer Beziehung als „abwesend – ich wusste nicht, wie ich Dich auffangen soll“. Ich hatte meine Entscheidung in keiner Weise mit ihr besprochen und sie begriff es nicht, ja verstand es als Missachtung: „Du hast es nicht für wert befunden, eine so entscheidende Frage mit mir zu diskutieren“, warf sie mir noch Jahre später vor und rein sachlich hatte sie Recht: Ich diskutierte nie mit ihr, ehe ich wahnwitzige Entscheidungen traf. Ich diskutierte nicht mit ihr, als ich meine profil-Herausgeberschaft hinschmiss; ich sollte nicht mit ihr diskutieren, als ich die besonders angenehme Geschäftsführung und Chefredaktion der Wochenpresse aufgab, um zum Standard zu wechseln; und ich sollte mein Verhalten in der Causa Hummelbrunner nicht mit ihr diskutieren, obwohl es zu einem Strafprozess und zur größten Krise meines Lebens führen sollte. Aber nicht, weil sie mir dieser Diskussion nicht wert war, sondern weil alle diese Entscheidungen Tunnel-Entscheidungen waren – ich traf sie, ohne zu denken im Dunklen. Nur im Nachhinein lässt sich darin eine Linie erkennen: Alle diese Entscheidungen folgten dem Fluch meiner Mutter – sie führten abwärts. Enickls Rechnung, dass Helmut Voska neuer Herausgeber würde, ging nicht auf: Loudon beförderte zuerst Franz Ferdinand Wolf, und als der zum Kurier wechselte, um dort Gerd Leitgeb abzulösen, Peter Rabl in diese Funktion. Noch etwas Unerwartetes ereignete sich: Günter Enickls Sohn verstarb an einem platzenden Aneurysma und es gelang mir, vielleicht gerade weil ich selbst depressiv war, ihm und seiner Frau einen tröstenden Brief zu schreiben. Ich hatte ihn ja immer für einen liebenswerten, anständigen Menschen, wenn auch keinen guten Verleger gehalten, und wie furchtbar es war, ein Kind begraben zu müssen, konnte ich mir lebhaft vorstellen. Ich kam also auch zum Begräbnis und von diesem Tag an entwickelte
349
350
Die Trennung von profil
sich eine herzliche Freundschaft mit ihm und seiner Frau. Er hätte mich, erklärt er mir, immer völlig falsch eingeschätzt, hätte gedacht, ich würde ein katholisches Begräbnis verachten, wolle profil zu einer linken Zeitschrift machen und ihn als Geschäftsführer ablösen. Ich weiß nicht, wie er zu allen diesen Vorstellungen gekommen ist, aber er hatte sie offenkundig und nun, da er sie in dem Menschen, den er kennenlernte, nicht bestätigt sah, packte ihn schlechtes Gewissen: „Dass ich Dich veranlasst habe, das profil zu verlassen, war der größte berufliche und menschliche Fehler meines Lebens“, gestand er vor seiner und meiner Frau. Ich begriff im Nachhinein, was mein größter beruflicher und menschlicher Fehler gewesen ist: Ich habe mich immer nur aus einem konkreten Anlass für jemand anderen interessiert – für Reinhard Tramontana, als sein Alkoholismus ihn zu töten drohte, für Erhard Stackl, als er von seiner geliebten Frau verlassen wurde – aber unter normalen Umständen habe ich es vermieden, mich für das Privatleben von Mitarbeitern zu interessieren. Das wurde mir als Arroganz ausgelegt, und sobald man im Geruch der Arroganz steht, werden sachliche Gründe gefunden, die einen zum „Gegner“ stempeln. Die österreichische Unternehmenskultur erfordert eine gewisse „Verhaberung“ mit den Mitarbeitern und besonders unter den Führungskräften eines Unternehmens, damit diese Art der Gegnerschaft nicht entstehen kann – Österreich kennt keine Arbeitsverhältnisse ohne ein gewisses menschliches Naheverhältnis. Meine Mutter, die auch immer der Meinung war, bei ihren Mitarbeitern beliebt zu sein, weil sie sie korrekt behandelte und ihnen half, wenn sie in ernsten Problemen waren, war auch völlig verblüfft, als ihre Sekretärin ihr anlässlich ihres Abschiedes vorwarf: „Sie haben mich in zehn Jahren nicht einmal gefragt, wie es mir geht.“ Ich habe Günter Enickl in zehn Jahren auch nicht einmal danach gefragt – außer an dem Tag, an dem sein Sohn starb.
56. Das Abenteuer TOPIC
Was mich die Depression letztlich überwinden ließ, war die Notwendigkeit, praktische Probleme zu lösen. Ich war zwar nicht mehr Herausgeber des führenden österreichischen Nachrichtenmagazins profil, wohl aber des ersten österreichischen Nachrichtenmagazins für Kinder, Klex/TOPIC. Nun musste ich beweisen, dass es keineswegs die Totgeburt sein würde, als die Alfred Worm, einige Kollegen des trend oder der Chef der Inseratenabteilung Peter Allmayer-Beck es angesehen hatten. Da sie wie Enickl seit Bronners Ausscheiden am Betriebsergebnis des trend-Verlages beteiligt waren, waren sie dem Projekt so skeptisch gegenübergestanden, dass es letztlich überhaupt nur dank der Befürwortung durch Kurier-Geschäftsführer Ernie Loudon zustande gekommen war: Er und nicht trendVerlagsleiter Enickl hatte für einen Kredit bei Raiffeisen gesorgt. Voran Loudon war ich schuldig, dass TOPIC ein Erfolg wurde. Mein Ausscheiden aus dem Verlag erhöhte die Erfolgsaussichten nicht gerade: Ursprünglich war ich natürlich davon ausgegangen, die Zeitschriften in den Räumen des trend-Verlages zu produzieren und vor allem seine Inseratenabteilung zu nutzen – jetzt brauchten wir eigene Räume und ich musste begründete Zweifel haben, dass Allmayer-Beck beim Akquirieren von TOPIC-Inseraten besonders erfolgreich sein würde. Diese Zweifel entpuppten sich als Segen: Enickl stieg erleichtert auf meinen Vorschlag ein, die dem trend-Verlag gehörenden 75 Prozent des Projektes zu einem sehr günstigen Preis an Mitglieder meiner Familie zu verkaufen, und da ich durch mein Ausscheiden aus profil steuerfrei zu einer recht beträchtlichen Abfertigung gekommen war, konnten sie diesen Preis mit meiner Hilfe auch sofort bezahlen. Wir wurden 100 Prozent Eigentümer des ersten Nachrichtenmagazins für Kinder, das sich ursprünglich KLEX, aber sehr bald nur mehr wie seine Mutation für Jugendliche, TOPIC nannte. TOPIC ist die Ursache dafür, dass Eva und ich heute relativ wohlhabend sind: Die Zeitschrift sollte schon nach einem Jahr ausgeglichen bilanzieren und in den folgenden 35 Jahren durchwegs Gewinne schreiben, ehe wir 2019, was uns davon noch gehörte – nämlich die Hälfte – an unseren mittlerweile langjährigen Partner, den Verlag Jung-Österreich (JÖZV) verkauften, der seinerseits mittlerweile Europas größtem Bildungsverlag, der deutschen Klett-Gruppe gehört. Ich will damit Werbung für selbstständiges Unternehmertum machen: Als erfolgreicher Angestellter kann man zwar ruhig und angenehm leben – aber nur als Unternehmer kann man wohlhabend werden. Ob man es tatsächlich wird, hängt zwar stark vom Glück, aber entscheidend davon ab, ob man Grund hat, an seine Sache zu glauben. Oscar Bronner hat immer an den
352
Das Abenteuer TOPIC
trend, an das profil und an den Standard geglaubt, weil er überzeugt war, dass die Leser gute Medien am Ende auch kaufen würden – Eva und ich haben immer an TOPIC geglaubt, weil es ein gutes Medium für Kinder war und ist. Rational überlegt, war der Erwerb der 75 Prozent freilich ein gewaltiges Risiko, denn der Kaufpreis war zwar ein geringer, aber was wir mit der Kinderzeitung-ZeitschriftenGmbH erwarben, waren primär einmal vier Millionen Schilling (vor 35 Jahren 291.000 Euro) offener Kredite, die wir voran dazu verwendet hatten, in anderen Zeitungen für TOPIC zu werben. Wenn das Projekt schief gegangen wäre, so hätte Eva letztlich persönlich für den noch offenen Kredit gehaftet, denn die Bank hatte immer auch ihre persönliche Haftung verlangt und die Haftung des Kurier hatte Dr. Loudon in der Eile zu unterschreiben vergessen. (Hätte er die Unterschrift im Falle eines Verlustes nachträglich noch so korrekt als vereinbart bezeichnet, man hätte das wohl als unzulässigen Freundschaftsdienst für mich angesehen.) Als Unternehmer wohlhabend zu werden, bedeutete also auch, durch längere Zeit mit dem Gefühl zu leben, dass man zur Zahlung von (damals gewaltigen) 291.000 Euro herangezogen werden und bis aufs Existenzminimum gepfändet werden kann. Wenn ich mich heute zurückerinnere, dann stelle ich fest, dass ich dieses Risiko einfach nicht ernsthaft wahrgenommen, nicht einmal wirklich bedacht habe. Nur Eva, so gestand sie mir, habe damals durch Monate schlecht geschlafen. In späteren Jahren, in denen TOPIC eine für beide Seiten lukrative Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz verband, habe ich versucht, dessen Funktionären zu erklären, dass wir deshalb mehr Gewinn als sie beanspruchten, weil wir dieses enorme Risiko getragen hätten, während sie nie das geringste Risiko trugen – der Versuch war absolut erfolglos: „Funktionäre“ sind außerstande, diesen Unterschied zu „Unternehmern“ zu sehen. Eine zweite Erfahrung, die man erst als Unternehmer macht, lautet leider: Es ist fast ausgeschlossen die Anfangszeit eines kleinen Unternehmens zu überstehen, wenn man Angestellte hat. So hatte ich ursprünglich vorgehabt, dass TOPIC eine „Chefredakteurin“ und einen „Artdirektor“ haben sollte. Aber als wir die Summen sahen, die sich aus 14 Journalisten-Monatsgehältern brutto ergaben, verwarf ich dieses Vorhaben in der Sekunde. Wer etwas gründet, reduziert Anstellungen am besten auf ein Minimum und am ehesten geht das, indem man so viel wie möglich selber macht und für den Rest seinen Ehepartner einspannt. Während ich noch Leitartikler des profil war, verfasste ich daher fast alle Texte für TOPIC – im Monat waren das viermal 16 Seiten – selber, indem ich sie am Wochenende Eva diktierte, die so schnell wie meine besten Sekretärinnen schrieb. Sie wiederum, die ursprünglich nur als Geschäftsführerin vorgesehen war, wurde nun Sekretärin, Artdirektorin, Grafikerin und Produktionsleiterin in einem, wobei Grafik und Produktion insofern mit gewaltigem Aufwand verbunden waren, als es damals noch keine Agenturen gab, bei denen man Fotos elektronisch anfordern und nach ihrer Verwendung abrechnen konnte. Eva leistete diese Arbeit anfangs als Schwangere und später als Mutter eines neugeborenen Kindes.
Das Abenteuer TOPIC
Zuletzt darf man, wenn man Unternehmer wird, auch nicht zimperlich und schon gar nicht eitel sein. So war es nunmehr meine Aufgabe für Inserate zu sorgen und dafür war es zwar ein Vorteil, dass man mich als einstigen Chefredakteur des profil kannte, aber zugleich musste ich zur Kenntnis nehmen, dass ich Werbechefs – früher hatte ich sie oft abfällig „Werbefritzen“ genannt – plötzlich wie ein Schulbub ausgeliefert war: Nicht sie begegneten mir, ich musste ihnen mit dem größten Respekt begegnen. Denn TOPIC musste Inserate haben, wenn es überleben wollte. Nur ganz zu Beginn traf ich zu meinem Glück nicht auf „Werbefritzen“, sondern auf „Leiter der Öffentlichkeitsarbeit“. So unterstützte etwa die Führung von IBM damals grundsätzlich jedes neue Qualitätsmedium mit Inseraten – es hatte die ersten Inserate in profil geschaltet und nun schaltete es auch die ersten Inserate in TOPIC, obwohl es damit sicher keinen Computer verkaufte. Ähnlich agierte Siemens – die Idee einer Zeitschrift, die Kindern Bildung vermittelt, besaß bei großen Unternehmen ein grundsätzliches Wohlwollen, das auch alle politischen Parteien veranlasste, das Projekt zu begrüßen – ich durfte es im Parlament vorstellen – denn wenn ich als Herausgeber etwas mitbrachte, dann war es, dass man mir den Wunsch, Bildung zu vermitteln, abnahm und mich für unparteiisch hielt. Es gab sogar regelrecht Fans unter den Inserenten des ersten Jahres: Der Werbeleiter der Länderbank, Josef Holböck, bastelte mit mir gemeinsam Comicstrips, die Kinder mit Wirtschaft vertraut machen sollten, und sah darin, wie später der Werbeleiter der „Erste Bank“ eine wesentliche Bildungsaufgabe des Geldinstituts. Die einzige Bank, deren Werbeleiter das nach einem kurzen Zwischenspiel nicht so sehen sollte, war übrigens die Nationalbank, obwohl man aus ihren Statuten einen Bildungsauftrag herauslesen könnte. Zu Beginn war es für mich also noch nicht demütigend, um Inserate für TOPIC zu ersuchen. Aber es wurde umso schwieriger, sie zu bekommen, je mehr die beträchtliche Verbreitung der Zeitschrift das kaufmännisch vollauf gerechtfertigt hätte. Denn statt mit Leitern einer Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit bekam ich es nun immer öfter tatsächlich mit „Werbefritzen“ zu tun, die mir zum Beispiel erklärten, dass 100.000 durch Zahlungseingang nachgewiesene Abonnenten kein Argument seien, weil sie in der Mediaanalyse nicht als solche ausgewiesen würden, da ja Schulen und nicht das einzelne Kind die Zeitschrift bestellten. Dass wir Waschkörbe begeisterter Zuschriften vorweisen konnten, war für Werbefritzen kein Argument: „Ohne Mediadaten brauchen Sie gar nicht mehr vorzusprechen, Herr Lingens.“ Ich halte mich so lange beim Thema „Inserate“ auf, um klar zu machen, welch überragenden Einfluss werbende Unternehmen auf das Überleben von Medien haben: Ihr Medienverständnis ist unverzichtbar, um Qualitätsmedien ihre stets schwierige Anfangszeit überstehen zu lassen. Und nur sie können ihr Überleben in stürmischen Zeiten – etwa während einer Pandemie – sichern. Voran eine Qualitätstageszeitung mit ihrer großen Redaktion kann nie wie zuletzt TOPIC so viele Käufer haben, dass sie sich allein aus dem Verkauf auch nur annähernd zu finanzieren vermag. Es wird daher
353
354
Das Abenteuer TOPIC
die Mitschuld der Werbeabteilungen der großen Unternehmen sein, wenn die großen Qualitätszeitungen von der New York Times über den Guardian bis El País das Feld seriöser Information demnächst zu Gunsten von Facebook, Twitter und Co räumen müssen, wo sich auch der größte Unsinn nicht nur kostendeckend, sondern mit hohem Gewinn verbreiten lässt, weil ungleich weniger Redaktionskosten anfallen. Denn ihrer gigantischen Verbreitung wegen wird immer mehr in diesen Sozialen Medien anstatt in den zitierten Qualitätsmedien geworben. Beziehungsweise: Nur die Werbeabteilungen einiger großer Unternehmen konnten im letzten Augenblick für ein absolutes Minimum an Anstand innerhalb der sozialen Medien sorgen: als Starbucks, Coca-Cola und einige mehr drohten, so lange nicht mehr in Facebook oder Twitter zu werben, als selbst die abenteuerlichsten Lügen von Donald Trump dort kommentarlos wiedergegeben würden0, erreichten sie, dass diese Digital-Giganten Trumps Aussagen wenigstens mit Warnhinweisen versahen und nach dem Sturm aufs Kapitol bewusst auf ihre Wiedergabe verzichteten. (Während ich diese Zeilen schreibe will Tesla-Gründer Elon Musk Twitter kaufen und wieder für Trumps Lügen öffnen.) Es ist auch keine Lösung, dass die sozialen Medien, in denen jedermann veröffentlicht, was ihm gerade durch den Kopf geht, sich zur Selbstzensur verpflichten. Medien, denen die Masse der Menschen vertraut, müssten vielmehr weiterhin solche sein, in denen qualifizierte Journalisten Informationen eingehend auf ihre Glaubwürdigkeit prüfen, statt dass Algorithmen die Meldungen an die Spitze befördern, die die meisten „likes“ erhalten haben. Das aktuelle Geschäftsmodell der „sozialen Medien“ ist mit qualifizierter Berichterstattung unvereinbar: Um für Inserenten möglichst interessant zu sein, brauchen sie möglichst viele Inhalte, die von möglichst vielen Menschen angeklickt werden, und das erreichen sie, indem Algorithmen die besonders süffigen Informationen für die Leser immer weiter nach vorne reihen. Besonders süffig sind aber kaum je sachliche Informationen, sondern Informationen, die möglichst stark polarisieren – etwa Verschwörungstheorien oder die Lügen von Trump-Anhängern über Hillary Clinton oder Joe Biden. Die „Sozialen Medien“ bevorzugen damit systematisch die unsachliche vor der sachlichen Information. Erfolgreiches Wirtschaften, so werden hoffentlich zumindest intelligente Vorstandsvorsitzende großer Unternehmen irgendwann begreifen, braucht aber in freien Gesellschaften vertrauenswürdige, sachliche Information durch vertrauenswürdige Medien. Und noch viel mehr braucht jede Gesellschaft diese vertrauenswürdigen Medien, um eine freie Gesellschaft zu bleiben. Es ist absurd, „Demokratie“ darin zu sehen, dass jedermann in den sozialen Medien seinen persönlichen Unsinn, ja jedwede Lüge sofort verbreiten kann – die digitalen Medien müssen für falsche oder ehrenrührige Information vielmehr genauso haften wie jede Zeitung und Rundfunkanstalt: Man muss bei Gericht Berichtigungen einklagen und wegen übler Nachrede klagen können, und wenn die Klage berechtigt war, müssen die
Was sind „wertvolle Texte“?
„sozialen Medien“ zu Geldstrafen verurteilt werden, die ihren gigantischen Einnahmen angemessen sind. Nur wenn die „sozialen Medien“ solcherart Recht und Gesetz unterliegen, stellen sie eine Bereicherung dar – andernfalls sind sie als „asoziale Medien“ lebensgefährlich: Um ein Haar hätten Trumps Antidemokraten das Kapitol erfolgreich gestürmt und gewählte Mandatare umgebracht. Absurde Desinformationen über Covid-19 und die Impfung dagegen hat die Eindämmung der Pandemie erheblich erschwert und damit die Zahl der Toten vermehrt. Der Niedergang qualifizierter Medien im Zeitalter der Algorithmen – Berichterstattung digitaler Giganten wird eines der größten demokratiepolitischen Probleme der Zukunft sein. Ich sehe dieses Problem als größer an, als den unbestreitbaren Vorzug sozialer Medien in Diktaturen, die alle anderen Medien beherrschen, für ein Minimum an unabhängiger Information zu sorgen, wie das etwa während des Ukraine-Krieges in Russland so lange der Fall war, bis Wladimir Putin auch die Nutzung der sozialen Medien zu unterbinden vermochte.
Was sind „wertvolle Texte“? Texte für Kinder zu schreiben, ist denkbar schwierig. Denn man kann nicht voraussetzen, dass gängige Begriffe verstanden werden, sondern muss sie fast durchwegs erklären. Während man sich in Texten für Erwachsene durch vorsichtige Formulierungen darüber hinwegschwindeln kann, einen Vorgang nicht mit letzter Gewissheit zu durchschauen, ist das bei Kindern unmöglich: Man kann für sie nur eindeutig oder gar nicht schreiben. Darüber hinaus muss der Text kurz sein, um sie nicht zu ermüden und er muss spannend sein, um nicht gleich weggelegt zu werden. Um alle diese Bedingungen zu erfüllen habe ich für TOPIC-Texte im Allgemeinen doppelt so lang wie für profil- oder Falter-Texte gebraucht. Kinder-geeignete Texte bei außenstehenden, oft sehr angesehenen Kollegen zu bestellen, ging fast durchwegs schief – ich konnte sie nicht verwenden, ohne sie umzuschreiben. Dass es im TOPIC des ersten Jahres überhaupt Texte eines Außenstehenden gab, lag daran, dass unser erster „freier Mitarbeiter“ unter die besten Kinderbuchautoren der Welt zählte: Thomas Brezina war von sich aus an uns herangetreten, hatte mir erklärt, dass ihm TOPIC gefalle und dass er gern daran mitarbeiten würde. Einen schnelleren, professionelleren, bescheideneren und liebenswerteren Mitarbeiter habe ich selten erlebt: Als es galt, unsere Unterlagen aus dem trend-Verlag zu übersiedeln, schleppte er sie mit uns ins neue Büro am Modenapark. Als wir, auf seinen Rat hin, ein erstes EDV-Gerät bei IBM kauften, erreichte er eine Ermäßigung und schulte meine Frau darauf ein. Wenn ich ihn anrief, dass ich in dieser Woche beim besten Willen keine Titelgeschichte für TOPIC wüsste, lag zwei Stunden später eine perfekte auf meinem Tisch.
355
356
Das Abenteuer TOPIC
Sein wichtigster Text war allerdings sein Roman „Die Ritter von der Pickelrunde“, den wir in Fortsetzungen abdruckten: Kein anderer österreichischer Autor wusste so genau, wie Kinder ticken und was sie lesen wollen. Der Abdruck fand begeisterten Widerhall und trug entscheidend dazu bei, dass wir unsere Anfangsauflage von 12.000 Stück schon sehr bald weit hinter uns ließen. Unsere Zusammenarbeit – nicht unsere Freundschaft – fand dennoch ein freilich charakteristisches Ende, als TOPIC der entscheidende Schritt zum wirtschaftlichen Überleben gelang: Wir erreichten eine enge Zusammenarbeit mit dem „Österreichischen Buchklub der Jugend“ (ÖBJ), der als wichtigste Organisation des Landes zur „Leseförderung“ angesehen wird und den ein ministerieller Erlass daher darin begünstigt, Lesestoff – eben auch TOPIC – an Schulen zu vertreiben. Brezinas Text, so befand der damalige ÖBJ-Geschäftsführer, sei leider „kein wertvoller Lesestoff für Kinder“ wie der Buchklub ihn fördere – TOPIC müsse sich davon trennen. Statt, wie wir es vorhatten, Brezinas nächsten Roman abzudrucken, mussten wir, um die Zusammenarbeit mit dem ÖBJ nicht zu gefährden, den unglaublich faden „wertvollen“ Text einer katholischen Kinderbuchautorin nachdrucken. TOPIC ist daran nicht zu Grunde gegangen, weil es genug andere spannende Texte bot – aber es zeigt auf, was die vom Unterrichtsministerium anerkannten für Leseförderung zuständige Organisation von Leseförderung verstand: Sie lehnte aufs Energischste einen Jugendbuchautor ab, dessen Bücher mittlerweile Millionenauflagen erreichen und in sämtliche Weltsprachen übersetzt sind. Dass wir dem ÖBJ in einer so wichtigen Frage nachgaben, hatte einen simplen Grund: Hatten wir TOPIC bis dahin nur dank des „Wohlwollens“ der Landeshauptleute an Schulen vertrieben, so wurde der ÖBJ durch den Erlass des Unterrichtsministeriums ausdrücklich zu diesem Vertrieb ermächtigt. An fast jeder Schule gab es einen „BuchklubReferenten“ – einen vom Ministerium zu Leseförderung verpflichteten Lehrer, der sich des Vertriebs von Produkten des ÖBJ annahm – das war für uns wirtschaftlich mehr wert als der beste Fortsetzungsroman. Innerhalb erstaunlich kurzer Zeit hatte TOPIC rund 100.000 Abonnenten. Das wieder ging zu Lasten eines Verlages, der seit Jahrzehnten Zeitschriften an Schulen verkaufte und das nicht mit Hilfe des ÖBJ, sondern mit Hilfe des Österreichischen Jugendrotkreuzes tat, dem dafür sogar ein eigenes Gesetz zur Verfügung steht: Alle Schulen sind vom Unterrichtsministerium her verpflichtet, Anliegen des Roten Kreuzes zu fördern. So wie Buchklub-Referenten Eltern empfehlen können, Produkte des Buchklubs anzukaufen, können Rot-Kreuz-Referenten ihnen Produkte des Roten Kreuzes zum Ankauf empfehlen. Die Zeitschriften, die auf diese Weise von Generationen von Volksschülern durchaus gerne gelesen wurden – voran die „Spatzenpost“, „Das kleine Volk“ und „Jungösterreich“ (später JÖ) – waren freilich ganz anders als TOPIC gestaltet: Statt aktueller Nachrichten boten sie vor allem Märchen und Sagen und das nicht jede Woche, sondern nur elfmal im Jahr.
Was sind „wertvolle Texte“?
Als Geschäftsmodell war das optimal: Die Texte waren meist gratis, es brauchte nur einen Verantwortlichen, um sie auszuwählen. In Wirklichkeit konnte ein Mann die elf Ausgaben in zwei Wochen planen, ein Grafiker sie durchgestalten und ein Druckvorgang im Monat genügte zu ihrer Herstellung. Der Verlag, der auf diese angenehme Weise sein Geld verdiente, war eine Arbeitsgemeinschaft aus dem österreichischen Bundesverlag und zwei Druckereien. An der Schule verkauft wurden die Rot-Kreuz- Zeitschriften von den Lehrern noch leichter als Zeitschriften des Buchklubs mit den Worten „und für das Jugendrotkreuz abonnieren wir wie immer…“ Denn das Jugendrotkreuz erhielt einen Prozentsatz von jedem verkauften Abonnement und fungierte als „Herausgeber“. „Kleines Volk“, „Spatzenpost“ oder „JÖ“ waren im Untertitel „Zeitschriften des Österreichischen Jugendrotkreuzes“. Damit komme ich zur Rolle des Zufalls: Präsident des Roten Kreuzes war seit 1974 mein Freund Heinrich Treichl. Als er erfuhr, dass ich an Schulen mit einigem Erfolg eine Zeitschrift verkaufte, sprach er mich darauf an und drückte mir „Spatzenpost“ und „Kleines Volk“ in die Hand: „Kannst Du mir herausfinden, was diese Zeitschriften“ – er nannte mir die Zahl der Abonnements – „ungefähr einbringen?“ Eine Woche später wusste er es: Die Arbeitsgemeinschaft verdiente blendend. Treichl verlangte von ihr eine größere einmalige Nachzahlung und sein neuer Geschäftsführer beim Jugendrotkreuz, der Schweizer Roland Siegrist, setzte einen neuen für das Rote Kreuz deutlich lukrativeren Vertrag durch. Siegrist wieder war es, der Treichl informierte, dass dem „Kleinen Volk“, der „Spatzenpost“ und „JÖ“ in TOPIC eine ernsthafte Konkurrenz erwachse. Unser Verlag war zwar finanziell ein Zwerg – der Buchklub überwies uns vom niedrigen Verkaufspreis eines Abonnements nur einen noch viel kleineren Teilbetrag, so dass wir uns vorerst weiterhin vorwiegend aus Inseraten finanzieren mussten – aber unsere Auflage wuchs und wuchs. „An den Schulen“, so erzählte mir der neue Geschäftsführer des ÖBJ, Gerhard Falschlehner, „hat TOPIC Kultstatus – es wird unseren Referenten aus der Hand gerissen“. Die gleiche Information erhielt Heinrich Treichl von Roland Siegrist und entschied: „If we can’t beat them, lets join them.“ Auf beider Rat hin kaufte die „Arbeitsgemeinschaft“ die Hälfte der „Kinderzeitung Zeitschriften GmbH“ und so wurde auch TOPIC im Untertitel eine „Zeitschrift des Jugendrotkreuzes“, wenn auch „unter Mitwirkung des Buchklubs der Jugend“. Daraus ergaben sich entscheidende Vorteile: Hatten TOPIC und „JÖ“ bis dahin gegeneinander um zehn- bis 15-jährige Leser gekämpft, so teilten sie diesen Markt nunmehr zwischen sich auf: JÖ widmete sich in seinen Texten nur mehr den Zehn-, bis maximal 13-Jährigen, was wegen der relativen Homogenität dieser Gruppe journalistisch auch viel einfacher war – TOPIC schrieb für die 13- bis maximal 16- Jährigen, die ebenfalls eine relativ homogene Gruppe mit gleichartigen Interessen bildeten. Keine Zeitschrift musste mehr Angst haben, die falsche Altersgruppe sexuell aufzuklären und damit wütende Proteste von Eltern zu provozieren. Auch für die Lehrer war es einfacher: Sie
357
358
Das Abenteuer TOPIC
boten JÖ nur mehr in der 5. und 6. Schulstufe, TOPIC nur ab der 7. Schulstufe an und konnten damit rechnen, dass die Texte zu den Lerninhalten dieser Schulstufen passen würden. Sie wurden damit zu sehr präzisen Lehr- und Lerninstrumenten, die dennoch ungleich lieber als Schulbücher gelesen wurden. Der größte Vorteil der neuen Konstruktion war aber zweifellos ein ökonomischer: TOPIC erschien nicht mehr wöchentlich, sondern wie alle Zeitschriften des Roten Kreuzes nur mehr monatlich und das nur elfmal im Jahr. Ein einziger Druckvorgang für 48 Seiten kommt aber ganz ungleich billiger als vier Druckvorgänge für je 16, also insgesamt 64 Seiten und die Hefte müssen auch nur einmal, statt viermal im Monat zu beträchtlichen Kosten versendet werden. Obwohl die Kinder also etwas weniger Text von deutlich geringerer Aktualität erhielten, kostete ein TOPIC-Abonnement von nun an das Gleiche wie ein JÖ-Abonnement und etwa so viel wie ein Mittagsmenü, was angesichts der geringen Gestehungskosten ein guter Preis war. Jetzt waren es nicht mehr wir, die einen Teil der Buchklubeinnahmen erhielten, sondern der Buchklub erhielt wie das Rote Kreuz einen Teil unserer Einnahmen als Provision für die Unterstützung beim Vertrieb an den Schulen. Der finanzielle Durchbruch war geschafft. Um die Jahrtausendwende erreichten JÖ und TOPIC je rund 130.000 Schüler in Österreich und rund 13.000 in Südtirol und anderen Ländern – das war in beiden Fällen etwa die Hälfte der betreffenden Jahrgänge. Dazu kamen eine Menge Eltern und Großeltern, die in TOPIC eine verständlichere Erläuterung der Finanzkrise als in den meisten Tageszeitungen vorfanden. Rund 20.000 bedürftige Schüler und 7000 Lehrer erhielten die Zeitschrift gratis, aber je 100.000 Schüler bezahlten ein volles, und je 10.000 Südtiroler ein ermäßigtes Abonnement, das dank des günstigen Druckvorganges und des Vertriebes durch idealistische Lehrer immer preisgünstig sein konnte. Die „Totgeburt“ war still und unauffällig zu einer der größten Zeitschriften des Landes geworden und machte jedes Jahr Gewinn. Es gibt in Europa übrigens nirgends etwas Vergleichbares und dass es in Österreich überhaupt noch Kinder gibt, die sinnerfassend lesen können, hängt nicht zuletzt mit diesen Jugendzeitschriften zusammen. Ich kann das heute beruhigt schreiben, denn ich besitze daran keine Anteile mehr.
57. Wie aus Michael Eric wurde
Hatte mich die Notwendigkeit, das Überleben von TOPIC zu sichern, rein physisch gezwungen, die Depression zu überwinden, in die mich das Zurücklegen der profilHerausgeberschaft gestürzt hatte, so überwand ich sie im Kopf erst ein halbes Jahr später mit der Geburt meines dritten Sohnes. Da der Blasensprung überraschend zwei Wochen zu früh erfolgt war, war ich gemeinsam mit meiner Frau mit der Rettung ins Allgemeine Krankenhaus gefahren und dort hatte die Ärztin mich eingeladen, der Geburt beizuwohnen. Man sollte diese Möglichkeit immer wahrnehmen, nicht zuletzt, um mitzuerleben, mit welchen Schmerzen die Geburt für die Frau verbunden ist. Ich bildete mir jedenfalls ein (und sie hat es mir später bestätigt), ich hätte Eva, als gegen Abend endlich starke Wehen einsetzten, geholfen, indem ich jeden ihrer Atemzüge so laut und deutlich wie möglich mit ihr gemacht und ihre Hand dabei gehalten habe. „Dass Sie mir nur nicht ohnmächtig werden“, warnte mich die Hebamme, in meinen Augen völlig überflüssig. Dann weiß ich nur noch, dass alle Beteiligten – meine Frau hatte zwei Studentinnen gestattet, zu Lehrzwecken anwesend zu sein – sich plötzlich über sie warfen und offenbar mit Händen pressten und zogen. „Es steckt irgendwie“, sagte irgendwer, und mir drohte tatsächlich schlecht zu werden, aber das Problem wurde offenkundig gelöst. Ich weiß jedenfalls, dass ich der Erste war, dem die Hebamme das nasse, warme Bündel Leben in die Arme legte, dass da eben die Welt erblickt hatte. „Jetzt möcht’ ich ihn aber auch haben“, sagte meine Frau und die Hebamme gab ihr den klugen Rat, ihn sofort an die Brust zu legen. „Dann schießt die Milch schneller ein!“, erklärte sie, und jedenfalls saugte das Neugeborene ab der ersten Sekunde, als gelte es sein Verdursten abzuwenden. „Vampirli“ war der erste Name, den es von den Anwesenden erhielt, bis Mutter und Sohn glücklich einschliefen. Eigentlich wollte Eva „Vampirli“ nach mir Michael nennen, weil ihr mein zweiter Vorname besonders gefiel – so jedenfalls hatte sie ihn genannt, als sie seine ersten Bewegungen in ihrem Bauch spürte, und so wollte sie ihn nennen, als er jetzt in ihren Armen schlief. Ich hatte das akzeptiert, obwohl es mir fremd war, weil ich es nur aus konservativen Familien kannte. Als mich meine Mutter am nächsten Morgen fragte, wie ich den Neugeborenen nennen würde, begriff ich in keiner Weise, was ich auslöste, als ich „Michael“ zur Antwort gab. „Du willst ihn Michael nennen – weißt Du, wie sehr Du Lisi und deine Kinder damit verletzt, dass Du ausgerechnet ihn nach Dir nennst?“ „Eva und ihre Kinder fanden es einen schönen Namen.“
360
Wie aus Michael Eric wurde
„Es ist Dein Name, den ich Dir gegeben habe. Das kannst Du mir nicht antun – wenigstens das nicht.“ „Wir haben das Kind Michael genannt, seit wir wussten, dass es ein Bub ist.“ „Eben. Bei keinem anderen Deiner Kinder hast Du der Geburt beigewohnt.“ „Weil das damals nicht üblich war. Jetzt ist das anders und der Arzt hat es mir vorgeschlagen.“ „Wenn Du ihn Michael nennst, ist das so wie es war, als Dein Vater mir die Tür nicht aufgemacht hat, als ich aus Auschwitz zurückgekommen bin.“ Das war das Ende meiner Unterhaltung mit meiner Mutter am Tag nach der Geburt meines dritten Sohnes. „Macht es Dir sehr viel aus, wenn wir ihn doch nicht Michael nennen?“, fragte ich Eva, als ich sie am nächsten Nachmittag wieder im Krankenhauer besuchte. „Wir haben ihn immer Michael genannt, wenn er in meinem Bauch gestrampelt hat: Er war und ist für mich Michael.“ „Aber er ist doch auch so das Kind, das wir uns so gewünscht haben – müssen wir meine Mutter mit seinem Namen unbedingt todunglücklich machen? Es ist doch nur ein Name.“ „Deine Mutter hat in ihrem Scheidungsurteil auf jeden finanziellen Anspruch verzichtet, nur damit festgehalten wurde, dass die zweite Frau Deines Vaters nicht Lingens heißen darf. Aber wenn es ihr so wichtig ist, dass unser Kind nicht Michael heißt, dann von mir aus.“ So kam es, dass wir unseren gemeinsamen Sohn, auf Vorschlag von Evas Sohn Holger, „Eric“, nach dem Gitarristen Eric Clapton nannten. Ich fügte für meinen Freund Christian Ortner ein „Christian“ an, und Eva schmuggelte am Standesamt ein „Michael“ als nie gebrauchten dritten Vornamen ein. „Du hast an dem Nachmittag im Spital so verzweifelt ausgeschaut, dass Du kaum wiederzuerkennen warst“, sagte sie mir später. Und das stimmte nicht nur für diesen Tag – es stimmte immer wieder, wenn ich mit meiner Mutter auf Eric zu sprechen kam. So erzählte ich ihr an einem der Samstage, die ich eisern bei meiner ersten Familie in Mauer verbrachte, dass Eric erkrankt sei. „Was hat er für Symptome“, fragte meine Mutter, die eine hervorragende Diagnostikerin war. Ich zählte sie auf. „Das ist Morbus Crohn – das ist letal.“ Ich habe mich zwar nicht ernsthaft gefürchtet, dass Eric sterben würde – denn ich kannte solche Ausbrüche meiner Mutter mittlerweile. Spurlos ging dennoch nicht an mir vorüber, dass sie seinen Tod wünschte. Gott sei Dank verbesserte sich ihr Verhältnis zu Eric dramatisch, nachdem sie in Lisis Garten in Mauer einen ersten Nachmittag mit dem Zweijährigen verbracht hatte. Wie alle meine Kinder hatte er das Glück, ein sehr herziges Kleinkind zu sein, und die Genetik wollte es, dass er mir von ihnen am ähnlichsten sieht. Nicht nur mir, sondern auch meinem Vater, dessen blondes Haar er geerbt zu haben schien. Es dunkelte zwar
Wie aus Michael Eric wurde
später völlig nach, aber da hatte es meine Mutter bereits mit dem „goldenen Helm“ meines Vaters identifiziert, über den ich bereits berichtet habe. Was an meinen Vater erinnerte, verzieh sie letztlich immer. Im Laufe der Jahre sollte „Mauer“ zu Erics zweitem Zuhause werden. Er liebte seine Geschwister, voran Katharina, die ihn wie ihr Kind in den Arm genommen hatte; er liebte Lisi und vor allem ihre Mutter (meine erste Schwiegermutter), die sich des Kleinen sofort so annahm, als sei er ein Kind ihrer Tochter. Und er liebte „Columbus“, den Schäfer-Bernhardiner-Mischling, den ich für meine ersten Kinder gekauft hatte, weil ich in der Hinterbrühl mit einem Schäfer-Bernhardiner-Mischling aufgewachsen war und damit mein verlorenes Paradies verband. „Lumpus“ nannten die Kinder den unendlich freundlichen, riesigen Hund – und „Lumpus“ nannte sich Eric noch als Siebenjähriger, wenn er von fremden Leuten gefragt wurde, wie er heißt. Für Eva war „Mauer“ ein Verdikt. Jeden Mittwoch verbrachte ich dort, anfangs allein, später mit Eric, Nachmittag und Abend und immer den gesamten Samstag, den sie, müde von der Arbeit an TOPIC deshalb meist im Bett zubrachte. Ich machte zwar, als Eric drei war und wir mit seinen Geschwistern Sebastian und Oliver erstmals einen gemeinsamen, sehr netten Skiurlaub verbracht hatten, den Versuch, sie einfach nach Mauer mitzunehmen, aber als sie erfuhr, dass Lisi an diesem Tag zufällig nicht anwesend war, wollte sie den Garten nicht betreten. Meine Mutter hätte sie sicher nicht hereingelassen. Sie hasste Eva konsequent: Sie war für Sie „Edi“, die Hexe, die ihr ihren Mann entrissen hatte. Es dauerte sechzehn Jahre, bis sie erstmals aus eigenem Willen mit Eva zusammentraf und erst knapp vor ihrem Tod hat meine Mutter meine Ehe mit Eva akzeptiert. Ich weiß bis heute nicht mit Sicherheit, ob Brodas Familienrechtsreform, die in praktisch allen fortgeschrittenen Staaten das christliche Eherecht abgelöst hat, der Gesellschaft zum Vorteil oder zum Nachteil gereicht. Bezüglich der Ehepartner neige ich dazu, es für einen Vorteil zu halten – bezüglich der Kinder schwanke ich. Mein Schulfreund Klaus Draxler (er vertrat Österreichs Wissenschaft bei der EU), der in einer denkbar schlechten Ehe aufgewachsen ist, erläuterte mir eindringlich, um wie viel lieber ihm die Scheidung seiner Eltern gewesen wäre und ich habe Dutzende Menschen getroffen, die das bestätigten. Ich selbst weiß freilich sehr genau, wie schmerzhaft es war, in einer geschiedenen Ehe aufzuwachsen und kenne Dutzende Menschen, die das ebenfalls bestätigen. Mein Sohn Oliver, der bei meiner Trennung erst elf war, also wirklich in einer geschiedenen Ehe aufwuchs, bestätigt es nicht: „Wir haben ganz andere Probleme gehabt.“ Er hatte sich eng an Eva angeschlossen, bis meine Mutter ihm erklärte, dass das „Verrat“ an seiner Mutter sei – worauf er sich zurückzog. Eine seriöse Untersuchung darüber, in welchem System, dem katholischen oder dem liberalen, die Zahl der Leidenden die größere ist, gibt es nicht – weder was die jeweils verlassenen Ehepartner noch was die Kinder betrifft.
361
362
Wie aus Michael Eric wurde
Was mich betrifft, so habe ich die sechs Jahre, die Broda vorschreibt, um die „Zerrüttung“ einer Ehe festzustellen und eine Scheidung auch gegen den Widerspruch der ersten Frau zu ermöglichen, abgewartet und mich dennoch „schuldig“ scheiden lassen, denn erstens entsprach es der Wahrheit und zweites gab es ihr einen besseren Pensionsanspruch. Mein bis dahin geschaffenes Vermögen – das von mir finanzierte Haus in Mauer und ein Ausgedingehaus in Aussee – habe ich meiner ersten Familie ebenso überlassen wie mehr als 80 Prozent meines freilich sehr hohen Gehalts. Damit hoffte ich zumindest den formalen Ansprüchen meiner Mutter genug getan zu haben.
58. Liberale Verleger sind rar
Obwohl ich weiterhin den Leitartikel des profil schrieb, ging es mir unendlich ab, profil zu „machen“ – „Zeitung zu machen“ ist eine Sucht. Und obwohl Peter Rabl profil durchaus gut machte, gab es eine Reihe von Leuten, die Misstrauen hegten, dass das so bleiben würde und denen das Lingens-profil abging. Darunter vor allem zu Beginn ein großer Teil jener profil-Redakteure, die „meiner Fraktion“ angehört hatten: Christian Ortner, Christoph Kotanko, Joachim Riedl oder Helmut Votzi, die es in der Folge durchwegs zu führenden Funktionen in den verschiedensten Zeitungen bringen sollten. Der erste von ihnen, der mich besuchte, war Christian Ortner, mit dem mich auch persönliche Freundschaft verband und der mich fragte, ob wir nicht etwas Eigenes gründen könnten. Es gab mit den „Buben“, wie meine Frau sie nannte, den Kern einer eigenen Redaktion und darüber hinaus die verlässliche Information, dass auch Alfred Worm, der mit Peter Rabl noch weniger als mit mir zurechtkam, sich uns im Fall eines glaubwürdigen neuen Projektes anschließen würde. Und für dieses Projekt gab es Interessenten. Zuerst zu meiner Überraschung den Juniorchef eines großen Autohauses, dann aber einen Mann, der damals als der reichste Österreichs galt: Karl Kahane, der sein Geld vor allem mit Ölbohrlizenzen und zugehöriger Ausrüstung gemacht hatte. Kahane zählte zu den Unterstützern Bruno Kreiskys und ich kannte ihn vage, weil er es gewesen war, der mein Interview mit Jörg Haider eingefädelt hatte, bei dem der neue FPÖ-Chef Auschwitz das größte Verbrechen der Geschichte nannte. Kahane wusste um meine Distanz zu Kreisky in Fragen der Zusammenarbeit mit der FPÖ, aber ihm lag, wie er mir sagte, an einem Medium, das nicht im Eigentum des „bürgerlichen Lagers“ stand und bereit war, auch gute sozialdemokratische Politik anzuerkennen. Im Wissen um den hochqualifizierten Kern einer Redaktion begann ich ein solches Wochenmagazin zu planen, zumal Kahane auch das Wiederaufleben eines Traumes für durchaus realistisch hielt: Der Kooperation mit dem Economist. Da ich keine direkte Konfrontation mit profil wollte, sollte das neue Magazin mit dem Arbeitstitel „Republik“ anders gestaltet sein: Die Texte sollten weit kürzer, straffer als die des profil sein, dafür sollten große Fotos und moderne Grafik wie im einstigen monatlichen profil eine weit größere Rolle spielen. Im Wesentlichen war es das Konzept von „News“, nur dass uns kein ähnlich zugkräftiger Titel einfiel. Ich erstellte also ein grafisches Konzept, ein inhaltliches Konzept und einen Businessplan, in dem ich davon ausging, dass das neue Magazin in fünf Jahren den Break-even erreichen würde, was wahrscheinlich mein einziger Fehler war: Oscar Bronner hätte in meiner Lage wie beim Standard behauptet, das Unternehmen würde vom ersten
364
Liberale Verleger sind rar
Tag an Gewinne machen. Vielleicht machte ich noch einen zweiten Fehler: Wissend, dass Kahane mit vielen Unternehmern befreundet war, schlug ich vor, dass neben ihm neun weitere Unternehmer Teilhaber der Zeitschrift werden und sich für fünf Jahre zu einem bestimmten jährlichen Inseratenvolumen verpflichten sollten. Das komme keinem dieser Unternehmen teuer – den Werbegegenwert erhielten sie jedenfalls – und minimiere auch Kahanes Risiko. Er war mit meinem Businessplan denn auch zufrieden, reiste nach England, um die Wiederaufnahme der Economist-Kooperation zu prüfen und rund ein Jahr hindurch war ich der Überzeugung, wir würden die Zeitschrift, an der die Redaktion 15 Prozent Anteile halten würde, demnächst gründen. Die Absage kam unerwartet. Im Wesentlichen ließ Kahane als Begründung durchschimmern, dass die in Frage gekommenen Unternehmer nicht sicher gewesen seien, dass wir nicht auch kritisch über ihre Tätigkeit berichten würden, wenn es dazu Anlass gebe. Ich denke, dass auch er selbst dessen nicht ganz sicher war – und im Grunde ehrte uns das. Wohlhabende Liberale, die bereit sind, eine Zeitschrift ausdrücklich um ihrer unabhängigen Berichterstattung willen zu gründen, sind leider rar. Die Brüder Fellner hatten jedenfalls das Glück, mit „News“ nicht auf ähnlich gestaltete Konkurrenz durch die „Republik“ zu treffen. Auch Peter Rabl hatte insofern Glück, als ihm nicht die Hälfte seiner Journalisten abhandenkam, so dass profil der News-Konkurrenz dank seiner ungleich höheren Qualität jederzeit standzuhalten vermochte. Als Herausgeber und Chefredakteur agierte Rabl bestimmter und damit innerredaktionell zweifellos erfolgreicher als ich, erbte aber auch eine Redaktion, in der niemand an seinem Sessel sägte und nach den Turbulenzen der Vergangenheit ein Bedürfnis nach Ruhe herrschte. Obwohl ich ihn gewarnt hatte, machte er Sigrid Löffler zur stellvertretenden Chefredakteurin und es gab daher kurzfristig auch niemanden, der ihm in der Redaktionskonferenz klargemacht hätte, dass er eigentlich nicht zu ihrer Leitung befähigt sei – erst nach einigen Monaten fand Löffler zur alten Form zurück und Rabl gab mir nachträglich mit meiner Warnung Recht. Löffler zu kündigen, unterließ auch er – sie schrieb auch ihm zu brillant. Auch mit Alfred Worm konnte er schon relativ bald die Probleme nicht vermeiden, die auch ich mit ihm gehabt hatte: Worm begriff nicht, dass man als Chefredakteur nicht automatisch – ohne ausreichende Belege – jemanden in einer Zeitung zum Kriminellen stempeln konnte, weil er, Worm, von dessen Kriminalität überzeugt war, denn wenn der Betreffende die Zeitschrift erfolgreich klagte, dann war das nicht das Problem Worms, sondern das Problem des Chefredakteurs. Wahrscheinlich hatte Worm auch in Rabls Ära mit 90 Prozent seiner Voraus-Verdächtigungen recht, aber dass Rabl sie auch nicht automatisch ins Blatt rücken wollte, führte zu den gleichen Diskussionen, zu denen es bei mir geführt hatte. Nur dass sich Worm jetzt bei seinen Besuchen bei mir über Rabls
Liberale Verleger sind rar
angebliche Feigheit ausweinte und sie seiner ÖVP-Nähe zuschrieb. Letztlich bereitete das seinen Wechsel zu News vor. Ansonsten führte Rabl mir vor, dass ich in keiner Weise unersetzlich war. Profil blieb unter seiner Leitung die gleiche Zeitschrift, die es unter meiner Leitung gewesen war: investigativ und unparteiisch. Aufgrund seiner Ehe mit Helga Stadler, der Tochter Gerd Bachers, die es als Helga Rabl-Stadler zur VP-Spitzenfunktionärin bringen sollte, galt Rabl den Eigentümern zwar als ÖVP-näher, aber ob er es wirklich war, weiß ich bis heute nicht – mit Sicherheit spielte es keine Rolle für seine Berichterstattung. Bezüglich der FPÖ, das war mir wichtig, dachte er exakt wie ich: Eine Partei, deren Funktionäre ein schwer erträgliches Verhältnis zur „Vergangenheit“ haben, schien auch ihm schwer erträglich. Ob wir auch die Entwicklung der FPÖ ähnlich sahen weiß ich nicht mit Sicherheit – sicher aber waren wir ähnlich skeptisch: Norbert Steger hatte dort Friedrich Peter als Obmann zwar abgelöst und erklärt, sie zu einer liberalen Partei zu machen – „Nazis raus“ hatte er tatsächlich in einer Rede gesagt – aber Manfred Deix hatte im profil darauf mit einem köstlichen Cartoon reagiert, der unverändert auf viele FP-Funktionäre zutraf: Steger, die Worte „Nazis raus“ ausstoßend, bleibt verzweifelt in einem sich leerenden Saal zurück. Auch das Glück war Steger nicht hold: FP-Verteidigungsminister Friedhelm Frischenschlager begrüßte den verurteilten SS-Kriegsverbrecher Walter Reder, der nach langem „nationalen“ Bemühen in Italien aus der Haft entlassen worden war, am Flugplatz mit Handschlag, weil in seiner Partei kein anderes Verhalten denkbar war. Dabei war Frischenschlager alles eher als ein Neonazi. Er hatte vielmehr eine in meinen Augen großartige Leistung vollbracht: Obwohl aus einer „nationalen“ Familie stammend und in diesem Milieu sozialisiert, hatte er bei seinem Studium der Politikwissenschaften, unter anderem bei meinem Jugendfreund Norbert Leser, erkannt, welchem Verbrecher die Bevölkerung aufgesessen war. Der Handschlag war nichts als ein unbedachter Reflex gewesen. Wie bei Heide Schmidt, die, aus einer Vertriebenen-Familie stammend, die gleiche Lernleistung vollbracht hatte, war seine Gegnerschaft zum Nationalsozialismus ehrlich und durchdacht und ließ ihn bekanntlich 1993 mit ihr aus der FPÖ austreten und das „Liberale Forum“ gründen. Aber der „Handschlag“ war passiert und die Vorstellung, dass die FPÖ aus einer „nationalen“ zu einer liberalen Partei werden könnte, war öffentlich diskreditiert. Zumal sie Norbert Steger nach seinen ersten Sätzen nie mehr so klar vertrat, denn er wäre dann noch viel früher als Obmann abgelöst worden. Ich schrieb damals im profil einen Leitartikel, in dem ich Stegers Bemühen unter dem Titel „Der Liberaal“ als taktisch motiviert bezeichnete. Im Nachhinein bin ich darüber nicht glücklich: Es hätte vielleicht doch eine winzige Chance gegeben, dass Steger seine liberalen Ambitionen, gestärkt durch Applaus, weiterverfolgt und am Ende durchgesetzt hätte. Wahrscheinlich ist es freilich nicht: Das Gros seiner Funktionäre tickte eindeutig: Eine Palastrevolution machte Jörg Haider 1986 zum neuen FPÖ-Chef in alter „nationaler“ Tradition.
365
59. Liberale Wähler sind rar
Die raren Liberalen in Haiders Partei revoltierten gegen diese Rechtswendung: 1993 gründeten Friedhelm Frischenschlager und Heide Schmidt das „Liberale Forum“, das sich bewusst gegen alles Braune verwahrte und wie die deutsche FDP und später die NEOS, in denen es 2014 aufging, als erste Partei in Österreich liberale Ziele auf seine Fahnen schrieb. Es lohnt, sich Passagen aus dem Parteiprogramm in Erinnerung zu rufen, um zu sehen, wie fortschrittlich diese Partei schon damals konzipiert war: „Das Liberale Forum ist überzeugt von der Fähigkeit des Menschen, seine moralische wie intellektuelle Autonomie durch die Kraft der Vernunft selbst zu entfalten. Sein Recht auf Selbstbestimmung und individuelle Entwicklung muss daher stets gegen Bevormundung durch Gesellschaft und Staat verteidigt werden. Das Liberale Forum leitet daraus für sich und die Politik die Aufgabe ab, Urteilsfähigkeit sowie persönliches und gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein vorzuleben, zu wecken und dauerhaft zu fördern. Freiheit und Würde des Einzelnen herzustellen und zu garantieren, seine größtmögliche Selbstbestimmung durch entsprechend zweckvolle Organisation von Gesellschaft und Staat zu ermöglichen, sind Ausgang und Zielpunkt liberaler Politik.“ Aber dann im Unterschied zu FPÖ: „Freiheit bedeutet für uns Liberale nicht schrankenlose Selbstentfaltung auf Kosten anderer und auf Kosten ökologischer Ressourcen, sondern demokratisch gestaltete politische Willensbildung, die dem Einzelnen so viel Freiheit wie möglich einräumt und nur so viel Beschränkungen seiner Freiheit wie notwendig auferlegt.“ Natürlich war das „Liberale Forum“ marktwirtschaftlich orientiert und hielt wenig von Verstaatlichung. Aber soziale Absicherung und Ökologie spielten immer eine zentrale Rolle. „Liberale Wirtschaftspolitik ist ökologisch verträglich, ökonomisch erfolgreich und sozial verantwortlich. Liberale Wirtschaftspolitik hat Rahmenbedingungen zu schaffen, welche die Nachfrage nach Arbeitsleistung heben und die Finanzierbarkeit von Arbeitsplätzen erleichtern. Wirtschaftswachstum an sich ist kein Selbstzweck, sondern Folge des Zieles, mehr Wohlstand für mehr Menschen zu schaffen. Der Ideologie eines unverzichtbaren, in erster Linie mengenmäßigen Wachstums ist durch wirtschaftliche Rahmenbedingungen entgegenzutreten, die auf eine Stabilisierung beziehungsweise Verringerung des Rohstoffverbrauches abzielen, qualitative Produktionsverbesserung bevorzugen und eine ökologische Entsorgung sicherstellen.“ Manches liest sich angesichts der Finanzkrise prophetisch: „Geldwirtschaft ist kein Selbstzweck, sondern wesentliche Grundlage einer funktionierenden Realwirtschaft. Daher sind für Banksystem und Kapitalmarkt Regelungen zu finden, welche die ökonomischen Grundfunktionen sichern. Unbeschränkt wachsender Finanzertrag (exponen-
Liberale Wähler sind rar
tielle Zinseszinseffekte) zerstört die Fundamente der Realwirtschaft, welcher dadurch langfristig das Kapital entzogen wird. Gleichzeitig fehlt dem nominellen Zuwachs des Finanzkapitals langfristig die realwirtschaftliche Grundlage, was sozial unverträgliche Ausgleichsbewegungen in Form von Inflation und/oder Kapitalmarktkrisen zur Folge hat.“ Gesellschaftspolitisch stand das Liberale Forum links von der ÖVP: Es begrüßte „offene Formen des Zusammenlebens“, trat energisch dafür ein, die Situation der Frau zu verbessern und plädierte natürlich für Karl Poppers „offene Gesellschaft“. Am Rande legte es selbstverständlichen Wert auf eine echte Trennung von Kirche und Staat oder sah den Konsum von Cannabis nicht als strafwürdiges Verbrechen an. Nach außen hin vertreten wurde das Liberale Forum durch Heide Schmidt, die ebenso eloquent argumentierte, wie sie zu ihrem politischen Schaden ehrlich war. So trafen wir einander erstmals persönlich anlässlich einer Diskussion über die Osterweiterung der EU und die Frage, wie weit Österreich seinen Arbeitsmarkt auch für Arbeitskräfte aus Slowenien, Polen oder Ungarn öffnen sollte. Beide waren wir überzeugt, dass das letztlich unerlässlich sein würde und befürworteten es im Sinne einer europäischen Einigung. Aber obwohl dazu keine Notwendigkeit bestand, erklärte Heide Schmidt von sich aus, dass das auch Probleme für österreichische Arbeitskräfte bedingen könnte: Die niedrigen Ansprüche von Arbeitskräften aus dem Osten könnten auf die Löhne drücken und österreichische Firmen könnten in den Osten abwandern. Da war mir klar, dass das Liberale Forum unter den Zuhörern dieser Diskussion kaum Wähler finden würde. Ich selbst dachte damals erstmals im Leben daran, mich politisch in einer Partei zu betätigen, folgte aber ausnahmsweise meiner Frau, die mich davon abhielt: „Du hast doch gesehen, wie es Schmidt mit ihrer Ehrlichkeit ergangen ist – Du hältst das nicht durch.“ Während die SPÖ das „Liberale Forum“ begrüßte, stellte es doch einen potentiellen Koalitionspartner dar, war die ÖVP im gleichen Ausmaß irritiert, stellte es doch erstmals eine echte Alternative für bürgerliche Wähler dar. Bürgerliche Zeitungen, die „bürgerlich“ in Österreich die längste Zeit mit „ÖVP“ gleichsetzten, begriffen diese Gefahr und gingen ziemlich geschlossen zu einer ziemlich gleichartigen Berichterstattung über: Obwohl das liberale Parteiprogramm wahrhaftig zahllose Anknüpfungspunkte zu hochaktuellen Fragen bot, konzentrierte sich jedes Interview mit Heide Schmidt auf die Frage, ob sie es tatsächlich für unzulässig halte, in Amtsräumen und Schulräumen Kruzifixe aufzuhängen, während sie Cannabiskonsum nicht mehr mit Gefängnis geahndet sehen wolle. Schmidt musste zwangsläufig sagen, was sie dazu dachte, und sagte es wie immer ehrlich – an keiner der ökonomischen Überlegungen des liberalen Programms zeigten die Journalisten, nachdem dieser Komplex abgehandelt war, noch irgendein Interesse. Berichte wie der folgende Auszug aus einem Text der „Presse“ im Jahre 2008 waren in der Zeit der Gründung des Liberalen Forum leider undenkbar, obwohl sie damals
367
368
Liberale Wähler sind rar
so zutreffend wie heute gewesen wären: „Freiheit ist nicht nur Recht, sondern auch Verantwortung“ – so steht es in der Charta des Liberalen Forums. Doch was bedeutete dies für die konkrete Umsetzung liberaler Politik? Ein Überblick über die Positionen der Heide-Schmidt-Partei: − Grundsicherung: Für das LIF ist die vn der rot-schwarzen Regierung geplante bedarfsorientierte Mindestsicherung lediglich eine bundesweite Vereinheitlichung der Sozialhilfe. Das LIF-Modell der Grundsicherung hingegen ist ein Rechtsanspruch für jedermann – ohne Ausfüllen von Formularen, ohne Anstellen bei Ämtern. Dafür werden auch sämtliche bisherigen Sozialtransfers gestrichen. Ausnahmen kann sich das LIF bei Pflegegeld und Behindertenzuschuss vorstellen. 750 Euro, so die LIF-Berechnungen, soll jeder Österreicher unabhängig von seinem sonstigen Einkommen als Grundsicherung erhalten. Für die Besserverdienenden wäre das dann eine Art Steuergutschrift.“ − Ausländerpolitik: Das LIF wünscht sich „ordentliches Zuwanderungsmanagement“, das ein Bleiberecht für Asylwerber, die schon mehrere Jahre in Österreich sind, mit einschließt. − Homo-Ehe: Das LIF tritt für eine rechtlich abgesicherte Partnerschaft Homosexueller ein, die vor dem Standesamt geschlossen werden soll. Beim Thema Adoption hält man sich noch bedeckt. „Wir reden nicht über den zweiten Schritt, bevor nicht der erste getan ist“, sagt LIF-Chef Alexander Zach. − Landesverteidigung: „Das LIF macht sich für die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht stark. Stattdessen sollte es eine gemeinsame EU-Armee geben.“ − Steuerreform: Die Progressionsstufen sollen erhöht werden. Am Höchststeuersatz wird vorerst nicht gerüttelt. Einerseits will das LIF den Faktor Arbeit über eine Senkung der Lohnnebenkosten entlastet wissen, andererseits können sich die Liberalen aber vorstellen, Kapital über eine „Vermögenszuwachssteuer“ zu besteuern. − Bildung: „Das Ziel ist eine gemeinsame Mittelschule der Zehn- bis Vierzehnjährigen mit starker innerer Differenzierung.“ Ich würde jede dieser Forderungen damals wie heute unterschreiben und habe das LIF gewählt, solange es existierte, aber das hat bekanntlich nicht für sein eigenständiges Überleben gereicht. Die „NEOS“, in denen es 2014 aufging, sind der erste vermutlich dauerhaft erfolgreiche Versuch, eine liberale Partei in Österreich zu etablieren. Sie wurde von der „bürgerlichen“ Presse nicht sofort bekriegt, denn auch die war mittlerweile liberaler geworden, aber vor allem waren die NEOS so etwas wie eine liberalere ÖVP, die ihrerseits davon ausging, sie in Zukunft zum Koalitionspartner zu haben. Aber die NEOS, die dank ihres Gründers Matthias Strolz auch immer eine Menge grüner Thesen vertraten, widerstanden der Versuchung, sich festzulegen: Je näher die ÖVP unter Sebastian Kurz zur FPÖ rückte, desto näher rückten sie unter der Führung von Strolz’ Nachfolgerin Beate Meinl-Reisinger auch sozialdemokratischen Positionen.
Liberale Wähler sind rar
Während ich diese Zeilen schreibe, halte ich für möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, dass Österreich zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie sie lesen, auf eine Koalition aus SPÖ, Grünen und NEOS zusteuert Auch ich konnte mir vorstellen, die NEOS zu wählen. Ich teile ihre gesellschaftspolitischen Vorstellungen, ihr Eintreten für ein Berufsheer und ihr Bemühen um wirtschaftspolitische Sauberkeit und schätze Beate Meinl-Reisingers Eloquenz. Für komplett verfehlt hielt und halte ich allerdings, wie der Ökonom Werner Kogler von den Grünen, das neoliberale Eintreten der NEOS für „Sparen des Staates“ im Wege einer „Ausgabenbremse“, so dass ich 2019 doch lieber die Grünen gewählt habe.
369
60. Leser für Wirtschaftsmagazine sind rar
Mein Einvernehmen mit den Eigentümern des profil war trotz meines unverständlichen Abschiedes ein weiterhin gutes, und so kam es, dass sie mich ersuchten, mir Gedanken über die Zukunft der Wochenpresse zu machen, die eingeklemmt zwischen profil und nunmehr auch NEWS immer größere Verluste schrieb. Da auch der Platz eines Stadtmagazins durch den Falter bereits erfolgreich besetzt war, glaubte ich, die einzige Chance der Wochenpresse in der Umgestaltung zu einem wöchentlichen Wirtschaftsmagazin zu sehen. Als Raiffeisen-Boss Christian Konrad mir anbot, dessen Chefradakteur zu sein, mich an der Betriebsgesellschaft zu beteiligen und als einer ihrer beiden Geschäftsführer auch wesentlichen Einfluss auf alle wirtschaftlichen Entscheidungen zu haben, nahm ich dieses Angebot an und tauschte es gegen meinen Vertrag als Leitartikler des profil, den ich sowieso als Zumutung gegenüber dessen Herausgeber und Chefredakteur Peter Rabl empfand. Konkret schwebte mir als Zukunft der Wochenpresse eine Mischung aus dem britischen Economist und der deutschen Wirtschaftswoche vor. Politik würde zwar weiterhin eine wesentliche Rolle spielen, aber wir würden voran aus volkswirtschaftlicher Sicht über sie berichten. Zugleich würden betriebswirtschaftliche Analysen von Branchen und Unternehmen, aber auch Börsenkurse eine weit größere Rolle als im profil spielen. Einen kleinen, aber feinen Kulturteil wollten und mussten wir beibehalten, denn er war ein Atout der bestehenden Wochenpresse. Als zweiten Geschäftsführer teilte man mir einen besonders netten Profi zu, der sich zwar in allen verlegerischen Belangen nach mir richten musste, mir aber alles abnahm, was in Richtung Buchhaltung ging. Einen großen Arbeitsumfang, wie er sich aus der Doppelfunktion als Geschäftsführer und Herausgeber dennoch ergab, war ich aus den Anfängen des profil gewohnt. Zudem war ich durch einen zweiten Chefredakteur entlastet, der mir, anders als Helmut Voska und Jahrzehnte davor Georg N., nicht nach dem Leben trachtete: Aus dem profil begleitete mich mein Ex-Kollege und Freund Christian Ortner in die Wochenpresse und hatte, was die Wirtschaft betraf, weitgehend freie Hand, zumal er davon damals wesentlich mehr als ich verstand. (Heute ist er immer noch mein Freund und veröffentlicht das „Zentralorgan des Neoliberalismus“, dessen Thesen ich im Falter und in diesem Buch nach Kräften bekämpfe.) Wenig später verstärkte ich unsere Wirtschaftskompetenz auf Ortners Rat hin durch das Engagement von Christian Rainer, der damals in der siechen Arbeiter-Zeitung der SPÖ für hochwertige Wirtschaftsberichterstattung gesorgt hatte und bis 2022 der am längsten amtierende Herausgeber des profil sein sollte. Ergänzt wurde dieses hochprofessionelle Duo durch Walter Ostowicz, der in der in der Wochenpresse schon bis dahin qualifizierte
Leser für Wirtschaftsmagazine sind rar
ökonomische Texte geschrieben hatte und sich freute, dass sie nun zentrale Bedeutung haben sollten. Tatsächlich gelang es diesem Team, der Wochenpresse innerhalb kürzester Zeit den Ruf eines ernsthaften Wirtschaftsmagazins zu verschaffen, das nicht von „Dentisten“ gelesen wurde, wie trend-Chefredakteur Jens Tschebull sie uns als die typischen Leser ökonomischer Texte dargestellt hatte, sondern von den Vorstandsvorsitzenden der damals wichtigsten Banken, Guido Schmidt-Chiari (Creditanstalt-Bankverein), Hans Haumer (Girozentrale) oder Gerhard Randa (Länderbank). Zu meiner besonderen Freude las sogar Heinrich Treichl die Wochenpresse jede Woche, während er profil nur während meiner Auseinandersetzung mit Bruno Kreisky in der Affäre Peter-Wiesenthal durchgehend gelesen hatte. Die zentralen Themen jener Jahre waren umfangreicher Wirtschaftsberichterstattung günstig. Zuerst war es der von Bundeskanzler Franz Vranitzky so energisch betriebene Beitritt Österreichs zur EU, den wir alle, Ortner, Rainer, Ostowicz und ich gleichermaßen herbeisehnten. Danach bot der Zusammenbruch des Kommunismus in der Sowjetunion und schließlich die deutsche Wiedervereinigung reichlich Stoff für wirtschaftliche Analysen. Keiner von uns hatte diesen Zusammenbruch des Kommunismus vorhergesehen, alle hatten wir ihn gleichermaßen herbeigesehnt. In einem profil-Leitartikel über den vergessenen russischen Einmarsch in Prag hatte ich immerhin die Hoffnung geäußert, dass der gewaltlose Widerstand der tschechischen Bevölkerung nicht völlig umsonst gewesen sei, weil er die russischen Soldaten zum Nachdenken gezwungen habe. Heute muss man die entscheidende Ursache für diesen Zusammenbruch aber in einer wirtschaftlichen Entwicklung sehen, die der amerikanische Präsident Ronald Reagan eher ahnungslos einem Höhepunkt zuführte: Weil Reagan riesige Rüstungsausgaben tätigte, die ein Laserwaffensystem im Weltraum schaffen sollten, geriet die Sowjetunion bei ihrem Versuch, mitzuhalten, wirtschaftlich endgültig ins Trudeln. Eine Bevölkerung, der es nie gut gegangen war, erlebte, dass es ihr noch schlechter ging. Diesen Abstieg erlebten selbst kommunistische Funktionäre und ausgerechnet die Mitarbeiter des Geheimdienstes, von denen ich einige kennengelernt hatte, wussten am besten, wie kaputt ihr ökonomisches System im Vergleich mit dem westlichen war. Die sowjetische Elite – zu der man Geheimdienstler zählen muss – glaubte meines Erachtens nicht mehr an dieses System. Es war von innen her morsch und der Stoß, den ihm Reagans Hochrüstung versetzte, ließ es implodieren. Die Entwicklung hätte freilich auch eine blutige sein können: Ein sowjetischer Diktator, wie Geheimdienstchef Lawrenti Beria oder selbst noch Nikita Chruschtschow, hätte seine Macht eisern mit den KP-Chefs stets zur Verfügung stehenden Mitteln – Geheimpolizei, Folter und Haft – aufrechterhalten. Es war ein unglaublicher historischer Glücksfall, dass mit Michail Gorbatschow ein Mann an der Spitze der Sowjetunion stand, der für das Einkerkern von Menschen nichts übrighatte – der vielleicht, wie Alexander Dubček während des Prager Frühlings an die Möglichkeit eines „Kommunismus
371
372
Leser für Wirtschaftsmagazine sind rar
mit menschlichem Antlitz“ glaubte, so sehr ich den persönlich für eine Illusion halte. Jedenfalls reagierte Gorbatschow bekanntlich nicht mit Geheimpolizei und Kerker, sondern mit „Glasnost“ und „Perestroika“: Er wollte mit breiter öffentlicher Diskussion eine Reform der sowjetischen Wirtschaft einleiten, bekannte sich in einer großen Parteitagsrede aber auch zu allen anderen Fehlentwicklungen – voran zu den Verbrechen Josef Stalins: Zu dessen bis dahin geleugnetem Nichtangriffspakt mit Hitler, ja selbst zum Massaker sowjetischer Truppen an gefangenen polnischen Politikern und Intellektuellen in Katyn, das bis dahin der SS in die Schuhe geschoben worden war. Er rehabilitierte den Regimekritiker Andrei Sacharow, der den Archipel Gulag beschrieben hatte und sorgte für den Rückzug der sowjetischen Besatzer aus Afghanistan. Noch weiter ging Boris Jelzin, der ihn ablöste, nachdem er einen Putschversuch stalinistischer Generäle gegen Gorbatschow erfolgreich niedergeschlagen und damit ungeahnte Popularität gewonnen hatte: Als erster Kreml-Herr bestand Jelzin nicht mehr darauf, dass sich die Länder des „Ostblock“ sowjetischem Diktat unterwarfen. Das entließ am Ende selbst Ostdeutschland in die Unabhängigkeit und ermöglichte die deutsche Wiedervereinigung. Die historische Katastrophe für Russland bestand in Jelzins schwerer Alkoholkrankheit: Er war der Aufgabe, das immer noch riesige Land zu regieren und die komplexe Transformation einer Diktatur in eine rechtsstaatliche Demokratie, vor allem aber der kommunistischen Planwirtschaft in eine soziale Marktwirtschaft zu bewerkstelligen in keiner Weise gewachsen. So bestand die Einführung des „Kapitalismus“ etwa darin, „Volksaktien“ für die bis dahin größten Unternehmen – voran solche, die Öl förderten – einzuführen, obwohl kein Mensch eine Ahnung davon hatte, was Aktien sind. Mit charakteristischen Folgen: Einige wenige Männer, die es durch Korruption schon im kommunistischen System zu Geld gebracht hatten, kauften dem Volk diese „Stücke Papier“ um einen Pappenstiel ab. Es war dies einer der Wege, auf dem sie zu ihren heutigen Milliardenvermögen gelangten, die im Wesentlichen aus den gewaltigen Bodenschätzen Russlands bestehen, für die es weit und breit keinen Verkehrswert gab, so dass es von politischen Beziehungen abhing, wie viel man davon erwerben konnte. Es entstand eine Feudalwirtschaft von Rohstoff-Oligarchen, statt dass aus endlich unbestrittenem Privateigentum auch eine mittelständische Industrie gewachsen wäre. Was einzig gewachsen war, war die schon in kommunistischen Zeiten ubiquitäre Korruption, die sich nun auch noch mit physischer Gewalt verband: Gangsterbanden jeder Art machten sich breit. Mein Cousin Alexander Traxler, der in Russland Geschäfte betrieb, beschrieb mir die Zustände in Moskau als schlichtweg unerträglich: Unter Jelzin würden Geschäfte geplündert, man habe Angst, am helllichten Tag im Restaurant eines Hotels überfallen zu werden und Angst in ein Taxi zu steigen, dessen Lenker man nicht kannte. Man sei zum Bahnhof gekommen und der Zug sei nicht gefahren oder zum Flughafen und das Flugzeug sei nicht geflogen. „Es war das totale Chaos – erst unter Wladimir Putin hast Du in Russland wieder normal leben können.“
Leser für Wirtschaftsmagazine sind rar
In einem luziden Intervall hatte Jelzin den jungen KGB-Offizier, der sich zuvor als rechte Hand des korrupten Bürgermeisters von Petersburg Anatoli Sobtschak bewährt hatte, zu seiner rechten Hand und zum Leiter des KGB gemacht – und der KGB besaß jahrzehntelange Übung darin, Menschen, gleich ob Bürger oder Gangster, unter Kontrolle zu bringen und unter Kontrolle zu halten. Ich glaube, dass bis heute gilt: Putin und sein KGB haben einen funktionierenden russischen Staat geschaffen – und mittlerweile auch wieder eine funktionierende Diktatur. Die von Jelzin zugelassene deutsche Wiedervereinigung war das Thema, bei dem die Wochenpresse erstmals nachwies, dass es sich für wirtschaftlich Interessierte lohnte, sie zu lesen. Christian Ortner, der bei ihm studiert hatte, bat den Professor für Finanzwissenschaften an der Universität Wien, Erich Streissler, zu analysieren, was diese Wiedervereinigung wirtschaftlich bringen würde. Die meisten Ökonomen erwarteten damals ein neues Wirtschaftswunder – Streissler prophezeite das Gegenteil: Es würde Jahrzehnte dauern, bis die desolate ostdeutsche Industrie ihren Rückstand aufgeholt habe, bis die desolate ostdeutsche Infrastruktur westdeutsches Niveau erreiche, und bis vor allem der Lebensstandard im Osten Deutschlands sich dem im Westen Deutschlands angenähert habe. Gleichstand ist bekanntlich bis heute nicht erreicht. Für mich war diese Analyse Streisslers ein Schlüsselerlebnis: Je mehr ich Jahr für Jahr sah, wie recht er behielt, desto größer ist meine Bewunderung für ihn geworden, denn die richtige Vorhersage ist das wichtigste Kennzeichen qualifizierter Wissenschaft. Wobei es, wie ich später erfahren sollte, zu Streisslers besonderen Qualitäten gehörte, seine Wissenschaft und sich selbst auch ironisch zu betrachten: „Ich bin ein ausgezeichneter ökonomischer Prognostiker“, sagte er in einer Vorlesung, „ich habe mit 50 Prozent meiner Vorhersagen Recht.“ Das gilt übrigens auch für mich. Einer der wenigen wirtschaftspolitischen Artikel, die ich für die Wochenpresse/Wirtschaftswoche schrieb, behandelte die Einführung des Euro, die ich zwar bejahte – was ich heute, so wie es gehandhabt wurde, nicht mehr täte – aber ich erkannte richtig eines der gravierenden damit verbundenen Probleme: Wenn ein Land gegenüber anderen Ländern wirtschaftlich in massiven Rückstand gerät, dann könnte es bei gemeinsamer Währung, die eine Abwertung ausschloss, die einzige Chance auf wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit darin sehen, seine Löhne zu senken – und das würde sich in der Praxis nur mit größten Schwierigkeiten durchführen lassen. In Wirklichkeit ist es freilich viel schlimmer gekommen, als ich für möglich hielt: Ausgerechnet das wettbewerbsfähigste Land der EU, Deutschland, hielt seine Löhne im Verhältnis zu seiner Produktivität massiv zurück (senkte seine Lohnstückkosten deutlich) – das musste die Wettbewerbsfähigkeit aller seiner Konkurrenten auf geradezu katastrophale Weise verringern: Die Lohnstückkosten Italiens lagen 2017, als ich darüber ein Buch schreiben sollte, um 30, die Frankreichs um 20 Prozent über denen Deutschlands.
373
374
Leser für Wirtschaftsmagazine sind rar
Erich Streissler sollte jedenfalls der Ökonom sein, dessen Überlegungen mich bis in die Gegenwart begleiten. Damals beeindruckten sie unsere zunehmend intellektuelle Leserschaft, die aber auch Ortners, Rainers und Ostowicz’ ökonomische Überlegungen zumindest lesenswert fand. Jedenfalls verlieh uns die Wirtschaftsuniversität Wien den „Czipin-Preis“ für die erfolgreiche Umgestaltung einer politischen Wochenzeitung in ein wirtschaftspolitisches Wochenmagazin. Journalistisch schienen wir es geschafft zu haben. Ich war derjenige, der am ehesten der innenpolitischen Berichterstattung treu blieb, und in deren Zentrum stand nun Jörg Haider. Dass Franz Vranitzky im Gegensatz zu Bruno Kreisky und Fred Sinowatz zu keinem Zeitpunkt mit ihm koalieren wollte, ist bekanntlich als „Haiders Ausgrenzung“ in die Geschichte eingegangen. Das beruht freilich ausschließlich darauf, dass Haider diese Formulierung immer aufs Neue wehleidig gebraucht hat und dass sie von Journalisten immer aufs Neue wiederholt wurde. In Wirklichkeit ist etwas Selbstverständliches geschehen: Vranitzky hat weder die politischen Ziele der Haider-FPÖ geteilt noch Haiders Charakter geschätzt – also hat er es vorgezogen, mit der ÖVP unter Alois Mock zu koalieren. Normalerweise nennt man das konsequente, anständige Politik. Es ist richtig, dass das den Zulauf zur FPÖ nicht gebremst hat: Als Vranitzky sein Amt antrat, lag sie bei sechs Prozent – als er 1996 abtrat, um dem jüngeren Viktor Klima noch zwei Jahre Zeit zu geben, um bis zum Wahltermin an Bekanntheit, Statur und Popularität zu gewinnen, lag sie bei 22 Prozent. Haider verstand es, konsequent auf das „Ausländer“-Thema zu setzen, denn die Zuwanderung nahm aus zwei Gründen erheblich zu: − Im ehemaligen Jugoslawien herrschte Krieg, der vor allem in Bosnien zu einer gewaltigen Fluchtbewegung führte. − Und im Gefolge der Aufnahme ehemaliger Ostblockstaaten in die EU ließen deren offene Grenzen immer mehr „Ausländer“ in Österreich Arbeit suchen. Beides war unabwendbar. Nachdem sich Kroatien und Slowenien in Volksabstimmungen als unabhängig erklärt hatten, war ausgeschlossen, dass sie sich dem Wunsch des serbischen Kommunisten Slobodan Milošević fügen würden, Jugoslawien zu erhalten. Dessen Versuch, seine Forderung militärisch durchzusetzen, konnte nur in Krieg münden. Bosnien, zwischen Kroatien und Serbien gelegen, wurde beinahe zwingend zum Hauptleidtragenden der militärischen Auseinandersetzung. Es war schwer möglich, Flüchtlinge abzuweisen, die aus einem Gebiet stammten, das noch bis 1918 zu Österreich-Ungarn gehört hatte. Mein persönlicher Beitrag das Problem zu lösen, bestand darin, dass ich eine bosnische Familie in meine Wiener Wohnung, und danach eine andere in mein Haus in Enzesfeld aufnahm – aber ich habe immer verstanden, dass man das nicht konnte, wenn man eine kleine Wohnung hatte und wenig verdiente. Dann war man vielmehr irritiert, dass Bosnier bereit waren, für
Der nächste Tunnel
noch weniger Geld harte Arbeit zu leisten und damit massiv auf die eigenen (niedrigen) Löhne drückten. Das galt auch für Polen, Bulgaren, Kroaten, Ungarn und Rumänen, die plötzlich nach Österreich einreisen und nach ein paar Jahren Übergangsfrist auch arbeiten durften, oder schon zuvor „schwarz“ Arbeit fanden. Auch wenn die Religion selbst bei den Bosniern keine Kluft darstellte, schuf es Probleme: Konkurrenz entstand nicht nur am Arbeitsmarkt, sondern auch am Wohnungsmarkt und am Markt für Sozialleistungen. Vor allem entstanden Probleme an den öffentlichen Schulen, die dem Unterricht so vieler fremdsprachiger Kinder nicht gewachsen waren. Es war ein politischer Fehler, dass man es Jörg Haider überließ, als einziger auf diese Probleme hinzuweisen und sie dabei nach Kräften aufzubauschen, während die SPÖ versuchte, sie kleinzureden oder gar zu leugnen. Denn da sie unübersehbar waren, gelangten immer mehr Menschen immer öfter zu der Ansicht, Haider habe auch mit seiner aufgebauschten Darstellung Recht. Was immer er sagte, wurde zuerst einmal als „reaktionär“ zurückgewiesen – obwohl unter viel tatsächlich Reaktionärem auch manches Richtige war. So forderte er etwa Zuwanderungskontingente, deren Zulassung auch davon abhängen sollte, welche Ausbildung die Betreffenden haben. Ich wagte in der Wochenpresse zu schreiben, dass das nicht unrichtig sei – worauf ich mich prompt dem Vorwurf ausgesetzt sah, reaktionäres Gedankengut zu verteidigen. Einige Monate später begriff man auch in der SPÖ, dass Kontingente nicht ganz unrichtig waren – man vollzog die richtigen Erwägungen Haiders nach und erweckte damit einmal mehr den falschen Eindruck, dass auch seine tatsächlich reaktionären Übertreibungen berechtigt wären. Diese Problematik im Umgang mit der FPÖ – sie ging nicht von Vranitzky aus – hat sich bis heute gehalten: Es ist kontraproduktiv, jeden Gedankengang eines Reaktionärs zurückzuweisen – auch Reaktionäre können hin und wieder Recht haben.
Der nächste Tunnel Mit Clemens August Andreae, Professor für politische Ökonomie an der Universität Innsbruck, gewann ich – ursprünglich eher zynisch an das angestrebte Wirtschaftsimage denkend – einen zur Rechten sehr angesehen, zur Linken als „reaktionär“ eingestuften Ökonomen als Herausgeber für die Wochenpresse. Heute würde Andreae als „Neoliberaler“ bezeichnet und war das wohl auch, aber ich erinnere mich an ihn vor allem als vorurteilsfreien Denker, der als rarer Rechtsintellektueller hierzulande zwangsläufig Gegenstand unsinniger Vorurteile war: Man beschäftigte sich kaum mit dem, was er sagte, sondern legte es mit dem Stempel „rechts“ zur Seite – insofern war er ähnlich einsam wie der Linksintellektuelle Alfred Dallinger, dessen Überlegungen man mit dem Stempel „links“ zur Seite legte.
375
376
Leser für Wirtschaftsmagazine sind rar
Andreaes Zugang zum Printmedium „Wochenpresse“ war prophetisch: „Ich mache bei Euch mit, weil wir derzeit kein ernst zu nehmendes Wirtschaftsmagazin haben und weil ich glaube, dass Wirtschaftsberichterstattung wichtig ist. Aber ich glaube nicht, dass ihr als Medium viel Zukunft habt: Papier ist ein teurer, umweltschädigend erzeugter Rohstoff, es zu bedrucken ist eine altmodische Form der Informationsübermittlung. Die wird in Zukunft durch den Äther viel billiger und schneller geschehen.“ Andreae sollte diese Zukunft übrigens auf tragische Weise nicht mehr erleben: Eine der ökonomischen Entwicklungen, die ihn begeisterten, war der wirtschaftliche Aufholprozess des Königreichs Thailand, das sich damals von einem unterentwickelten Land zu einem der „Tigerstaaten“ entwickelte, die an der Schwelle zum Industriestaat standen. Es sei phantastisch das mitzuerleben, sagte er mir, und wichtig herauszufinden, welche Faktoren es begünstigen und welche es bremsen. Zu diesem Zweck wolle er im Mai 1991 eine Studienreise nach Thailand und Hongkong unternehmen, und ich sollte ihn, so redete er mir zu, doch auf ein paar Tage begleiten – das gebe eine spannende Wirtschaftsreportage für die Wochenpresse her. Ich überlegte denkbar ernsthaft, mit ihm zu fliegen – erstens, weil das Thema auch mich interessierte und tatsächlich eine Reportage wert war, zweitens, weil ich gerne mit Andreae diskutierte. Aber wie ich es auch drehte und wendete – es ging sich zeitlich einfach nicht aus: Wir waren ein zu kleines Team, um einen wichtigen Autor für eine Woche verreisen zu lassen. Das schloss auch aus, dass Christian Rainer oder Christian Ortner Andreae begleiteten, obwohl auch sie es einen Moment lang erwogen. Andreae buchte den Flug mit der Lauda Air also allein und kehrte nicht zurück: Beim Rückflug zerschellte die Maschine aufgrund einer vom Piloten nicht erwarteten und in ihren Folgen nicht trainierten Schubumkehr der Turbinen an einer Felswand. Insgesamt starben bei diesem größten Unglück der österreichischen Luftfahrt 223 Menschen. Wenig später sollten wir auch insofern einen neuen Herausgeber erhalten, als mir ein, wie ich meinte entscheidender geschäftlicher Schachzug gelang: Im Gespräch mit dem Eigentümer und damaligen Geschäftsführer der Holtzbrinck-Gruppe, Dieter von Holtzbrinck, gelang es mir, ihn vom Nutzen einer Zusammenarbeit der Wochenpresse mit der deutschen Wirtschaftswoche zu überzeugen: Sie könnten internationale Texte gemeinsam nutzen und letztlich könnte aus der Wochenpresse die österreichische Wirtschaftswoche werden. Tatsächlich kaufte Holtzbrinck dem Kurier die defizitäre Wochenpresse ab, wobei der Kaufpreis freilich dem verkauften Unternehmen gutgeschrieben werden musste. Ich glaube bis heute, dass das eine Konstruktion war, die zumindest eine faire Chance hatte. Dass wir sie nicht wahrnehmen konnten, hatte einen wesentlichen Grund darin, dass Holtzbrinck und mein an sich hervorragender Inseratenleiter Michael Brauner gleichermaßen darauf drängten, die Umbenennung der Wochenpresse in Wirtschaftswoche möglichst rasch durchzuführen und dass wir ein so heikles Unterfangen mit einem viel zu geringen Werbeaufwand begleitet haben. Das hatte entscheidenden –
Der nächste Tunnel
negativen – Einfluss auf die berühmte „Mediaanalyse“: Jene Meinungsumfrage, bei der erhoben wird, wie viele Menschen eine bestimmte Zeitung oder Zeitschrift lesen. Die Wochenpresse-Wirtschaftswoche mit ihrem vorerst unklaren Namen wurde trotz all unseres Bemühens nicht öfter genannt, als die ursprüngliche Wochenpresse, zumal sie tatsächlich nicht mehr Leser als diese hatte. Die Umstellung zum Wirtschaftsmagazin hatte nämlich nach sich gezogen, dass die ursprünglichen, an möglichst ÖVP-naher Politik und vor allem auch an Kultur interessierten Leser der bisherigen Wochenpresse sehr bald fast zur Gänze abgesprungen und durch völlig neue, voran wirtschaftlich Interessierte und eher ÖVP-kritische Leser ersetzt worden waren. Es hatte ein totaler Leseraustausch stattgefunden. Hätten wir die Zeitschrift neu als Wirtschaftsmagazin gegründet, so hätte die Branche es als Riesenerfolg gewertet, dass sie nach einem Jahr schon drei Prozent Leser hat – so wertete sie es als Misserfolg, dass sie noch immer nur die gleichen drei Prozent Leser wie die „alte“ Wochenpresse auswies. Im Nachhinein bin ich zwar weiterhin überzeugt, dass wir als politische profil- und News-Konkurrenz noch viel weniger Chancen gehabt hätten – aber vielleicht ist Österreich auch einfach zu klein für ein wöchentliches Wirtschaftsmagazin. Bekanntlich ist auch Format, das sich in dieser Rolle versuchte, Pleite gegangen. Wahrscheinlich ist die Zahl wirtschaftsinteressierter Leser und ziemlich sicher ist die Zahl entsprechender Inserenten in Österreich zu gering. Während die „Wirtschaftswoche“ in Deutschland mit drei Prozent Reichweite ein Goldesel ist, hatte das Wirtschaftsmagazin „Wochenpresse/ Wirtschaftswoche“ mit seinen drei Prozent Reichweite zwar mittlerweile dank seines verbesserten Images mehr Inserate als früher – aber keineswegs genug, um ausgeglichen zu bilanzieren. Ich musste Dieter von Holtzbrinck jedes Mal, wenn ich ihn traf, auf die Zukunft vertrösten, auch wenn ich an sie glaubte. Denn die Stimmung in der Mannschaft war enthusiastisch und eine völlig andere als zuletzt im profil: Niemand sägte wie Helmut Voska an meinem Sessel; es gab keine zwei einander bekämpfenden Lager; und Christian Rainer und Christian Ortner waren nicht wie Alfred Worm oder Reinhard Tramontana Primadonnen. Ich hatte erstmals das Gefühl, ein beliebter Chef zu sein. Und dennoch ergriff mich einmal mehr ein unbändiger Drang, hinzuschmeißen, was ich hatte und gerade tat. Dass sich der wirtschaftliche Erfolg nicht schneller einstellte, ließ mich an meiner fachlichen Eignung zum Chefredakteur eines Wirtschaftsmagazins zweifeln, konnte ich Christian Rainer oder Christian Ortner doch immer nur zuhören, nie ihnen etwas sagen und vorschlagen. Ich sei eben doch, so sagte ich mir, ein politischer Journalist, der in einem vorwiegend politischen Medium schreiben sollte. Weil ich völlig zufällig Oscar Bronner auf der Straße traf, fragte ich ihn, ob er mich nicht vielleicht im Standard brauchen könnte, der zu diesem Zeitpunkt gerade ein Jahr alt war. „Ja“, sagte er, und ich entschloss mich noch im gleichen Gespräch zum Wechsel. Wieder wie in einem Tunnel, wieder ohne zuvor mit meiner Frau zu reden.
377
378
Leser für Wirtschaftsmagazine sind rar
Das absurde Verlassen der Wochenpresse/Wirtschaftswoche sollte zu meiner nächsten gravierenden Fehlentscheidung auf dem Weg zu meinem beruflichen Abstieg werden.
61. Ein Türschild im Standard
Formal war dieser Abstieg nicht sichtbar: Co-Chefredakteur des Standard neben Gerhard Sperl und hinter Herausgeber Oscar Bronner war eine durchaus respektable Position. Nur Eva warnte mich, als ich sie vor vollendete Tatsachen stellte: „Du hast durch Jahre journalistisch fast alles alleine entschieden – Bronner wird alles tun, damit Du im Standard absolut nichts mehr entscheidest.“ Ich habe das Gespräch, das ihr Grund zu dieser Annahme gab, bereits beschrieben, aber ich nahm es nicht ernst: „Ich hatte nie ein Problem im Umgang mit Bronner“, habe ich ihr in etwa gesagt, „es stört mich nicht, hinter jemandem zurückzustehen, der so intelligent wie er ist und ich teile meine Kompetenzen auch gern mit Sperl, denn der ist ein Profi.“ Denn wie der trend dank Jens Tschebull viel leserfreundlicher ausgefallen war, als Bronner ihn konzipiert hatte, war auch der Standard dank Sperl viel leserfreundlicher ausgefallen als in Bronners Konzept. Dieses Konzept kannte ich so genau, weil ich, als er den Standard gründete, ursprünglich seine erste Wahl für dessen Chefredaktion gewesen war. Ich verscherzte mir das, als ich in Gehaltsverhandlungen mit Enickl in einem Brief aus taktischen Gründen behauptete, ich würde ein lukratives Angebot Bonners verwerfen. Enickls von Bronner geerbte Sekretärin Nora Ander, Bronner nach wie vor herzlich verbunden, gab ihm eine Kopie dieses Briefes und der nahm – begreiflicherweise – von mir Abstand. Zuvor freilich hatte er mich nach Hamburg mitgenommen, als er dort die Finanzierung des Standard durch den Springer-Verlag besprach. Sein Gesprächspartner war ein vielleicht sechzigjähriger norddeutscher Unternehmensvorstand, der mindestens so gediegen wirkte, wie sein riesiges getäfeltes Büro – ich prüfte unwillkürlich, ob meine Fingernägel und Schuhe auch ausreichend geputzt waren – doch Bronner agierte von Beginn an auf Augenhöhe. Die beiden Herren sprachen erstaunlich kurz über das offenbar unbestrittene Konzept des Standard, das Bronner wie ursprünglich beim trend denkbar rigide gehalten hatte, und jetzt nur zusammenfasste: Einmal mehr sollte die Zeitung nur die absolute Elite ansprechen und daher nur einen großen Politik – und einen noch größeren Wirtschaftsteil haben. Indem man auf einen Lokal- und Sportteil verzichten und den Kulturteil sehr klein halten würde, könne man mit einer sehr kostengünstigen Redaktion auskommen und würde Dank des hervorragenden Inseratenumfeldes schon nach kürzester Zeit Gewinne machen. Wie immer war diese Grundidee richtig – wie beim trend nahm sie meines Erachtens zu wenig Rücksicht auf den kleinen österreichischen Markt, auf dem eine Kopie der Financial Times zu wenig Leser finden würde. Ich wagte also – kaufmännisch ungewollt kontraproduktiv – die Frage zu stellen, ob man das Konzept auch abgetestet habe.
380
Ein Türschild im Standard
„Herr Bronner hat uns überzeugt“, antwortete der gediegene Vorstand nur, und ich biss mir auf die Zunge, weil mir klar wurde, dass meine Frage das für Österreich so wichtige Projekt gefährdet hatte. Wie viele Millionen Springer damit verloren hat, ist hinterher irrelevant. So wie Jens Tschebull den trend nie so rigide wie von Bronner geplant, verwirklicht hat, wurde der Standard auch mit Gerfried Sperl weit weniger rigide als von Bronner vorgetragen verwirklicht. Kultur- und Sportteil zählen heute zu seinen Atouts und der Lokalteil war absolute Sonderklasse, solange Daniel Glattauer dort über sex and crime schrieb. Bronners Grundidee, mittels massiver Wirtschaftslastigkeit und der vom rosafarbenen Papier unterstrichenen Anmutung qualitätvoller Berichterstattung auf ausreichende Werbeeinnahmen zu setzen, war einmal mehr goldrichtig, und er hatte einmal mehr die Bereitschaft, es in erstaunlich hohem Ausmaß dem realen Markt anzupassen – freilich auch das Glück und die Menschenkenntnis, Mitarbeiter zu gewinnen, die ihm dabei halfen. Das wieder funktionierte so gut, weil wirtschaftlicher Erfolg, so sehr er wusste, dass er die unverzichtbare Voraussetzung für das Überleben eines Mediums war, nie sein entscheidendes Anliegen gewesen ist: Er wollte immer in erster Linie „die beste Zeitung“ machen, und das verlieh allen Beteiligten Flügel. Wobei er im Standard anders als im profil oder im trend erstmals auch selbst als Chefredakteur agierte und sich in seiner Funktion als Herausgeber diesmal auch journalistisch das letzte Wort vorbehielt. Ich hatte damit kein Problem: Schließlich hatte ich mich zu Beginn des profil problemlos der Führung Jens Tschebulls unterworfen, hatte meine Kompetenzen als profil-Chefredakteur dann durchaus gern mit Georg N. und später durchaus freiwillig mit Gerd Leitgeb und Helmut Voska geteilt – solange das funktionierte, schien es mir einfach sachdienlich. Schon gar kein Problem hatte ich damit gehabt, mich einem Könner wie Hugo Portisch als letzte journalistische Instanz unterzuordnen. Ich hätte mich Bronner im profil genauso untergeordnet, wenn er es wie den Kurier organisiert hätte – er hatte es nur wie den trend ganz anders organisiert. Wenn er den Standard wie den Kurier mit seiner eindeutigen Vorherrschaft und Sperl und mir ebenso eindeutig nachgeordnet, organisieren wollte, war mir das absolut verständlich: Jedes Unternehmen braucht voran eine klare Organisation – ein rasch reagierendes Medium ganz besonders. Ich hatte kein Problem mit Bronners Anspruch – deshalb konnte ich mir nicht vorstellen, dass er eines mit meiner Mitarbeit haben könnte. Wahrscheinlich hätten meine Alarmglocken schrillen sollen, als erstmals vereinbarte Ansprüche meinerseits zur Diskussion standen. So sah mein Vertrag vor, dass meine Kommentare auf einer „prominenten Seite“ erscheinen sollten. Welche Seiten einer Zeitung „prominent“ sind, hielt ich für ausreichend klar: die erste Seite, allenfalls die Seiten 2 und 3 als erste Seiten, wenn man eine Zeitung aufschlug, sowie die letzte Seite – sicher keine Seiten irgendwo dazwischen. Jedenfalls waren die wichtigsten Kommentare aller österreichischen Qualitätszeitungen auf einer der genannten Seiten angesiedelt
Ein Türschild im Standard
und Hans Rauscher, der nach mir Star-Kommentator des Standard wurde, wurde es zu dessen Vorteil auf Seite 1. Meine Kommentare stellte Bronner auf die Seite 6, und als ich zu meinen wagte, das entspreche nicht dem Vertrag, erklärte er lapidar: „Die Seite 6 ist prominent.“ Wahrscheinlich hätte ich sofort energisch widersprechen sollen, doch ich hatte keine Lust auf sofortigen Streit. Allerdings hätte ich spätestens in dem Moment einen Rechtsstreit androhen müssen, in dem Bronner eine Konferenz der Chefredaktion ansetzte und dazu zwar Sperl, nicht aber mich einlud, denn darüber, dass wir gleichberechtigte Chefredakteure waren, konnte vertraglich nicht der geringste Zweifel bestehen. Doch ich unterließ es, eine gerichtliche Auseinandersetzung auch nur anzudrohen – sowohl weil ich den Standard unverändert als wichtiges Projekt empfand, als auch, weil es jetzt kein anderes Medium gab, zu dem ich einfach wechseln konnte oder wollte. Und auch die bloße Androhung eines Prozesses, das war mir klar, würde die weitere Zusammenarbeit mit Bronner extrem ungemütlich machen. Ich passte. Wenn Bronner die tägliche Blattkonferenz nicht leitete, leitete sie Sperl und ich unternahm auch dagegen nichts. „Sie müssen das verlangen“, riet mir Michael Hann, der das Wirtschaftsressort leitete, aber ich sah darin keinen Vorteil für die Zeitung – Sperl machte seine Sache ja tadellos. Stattdessen schlug ich vor, bis auf weiteres neben meinen Kommentaren das innenpolitische Ressort zu leiten, für das es noch keinen fixen Ressortleiter gab und das 1996 mit der innenpolitischen Berichterstattung des Kurier, der Presse oder der Salzburger Nachrichten nicht Schritt halten konnte. Das galt in diesen ersten Jahren für viele Teile der Standard-Berichterstattung. Was sie den genannten Zeitungen voraus hatte, war die absolute politische Unabhängigkeit, keineswegs die höhere Qualität. Aber Bronner hatte das Glück – oder er hatte richtig berechnet – dass die Menschen auch in der innenpolitischen Berichterstattung das rosafarbene Papier à la Financial Times mit höchster Qualität gleichsetzen würden: Diese so auffällig gefärbte Zeitung unterm Arm zu halten oder in ihr zu lesen, wies den Betreffenden sozusagen weithin sichtbar als politisch unabhängigen Intellektuellen aus – und wer wollte das nicht sein. Mittlerweile – und das ist Bronners außergewöhnliche Qualität – besitzt der Standard in jedem Ressort die inhaltliche Qualität, die er damals vorgab und zählt für mich zu den besten Tageszeitungen der Welt. Bronners Marketing war immer genial – er fand am Ende auch immer die Mannschaft, die die „beste Zeitung“ zu verwirklichen vermochte. Zudem begriff er als Erster, wie wichtig das Internet war und fand den besten denkbaren Mitarbeiter in seinem eigenen Sohn aus einer früheren Beziehung: Alexander Mitteräcker wurde zum genialen Leiter des Standard-online. Während andere Blätter vor allem anfangs versuchten, den Leser tunlichst bei ihren Internettexten zu halten, verlinkte der immer alles mit allem und machte den Standard damit zum Lexikon: Man kann sich dort in jedes
381
382
Ein Türschild im Standard
Thema gleichermaßen verbreitern wie vertiefen. Es gibt auf der Welt keine bessere Online-Zeitung. Ich habe diese Ära freilich nicht mehr erlebt: Meine eigenen Versuche, auch nur das Geringste abzuändern, verliefen so erfolglos wie meine Frau mir prophezeit hatte. So wagte ich einmal zu sagen, dass wir auf der prominenten Seite 2 nicht so viel Platz für das internationale Flugwetter verwenden sollten. „Willst Du schon wieder alles besser wissen“, herrschte Bronner mich an, „Unternehmensvorstände wollen wissen, wo sie Regen erwartet.“ „Ich denke dafür genügt eine hintere Seite“, warf ich erfolglos ein – erst viel später verschwand das internationale Flugwetter von der Seite 2. So führte ich im Standard eine eher seltsame Existenz: Ich hatte ein wunderschönes Zimmer, an dessen Tür ein Schild mit der Aufschrift „Chefredakteur“ prangte, aber kein Redakteur betrat es jemals deswegen. Nachdem ein Ressortleiter für die Innenpolitik gefunden worden war, zog ich mich weitgehend auf meine Kommentare zurück, von denen Daniel Glattauer den einen oder anderen „berührend“ fand. Hatte ich meine journalistische Arbeit bis dahin immer als erfüllend erlebt, selbst wenn diese Erfüllung wie im letzten profil-Jahr auch tägliche Auseinandersetzungen umfasste, so erledigte ich meine Arbeit im Standard „gewissenhaft“ und „pflichtbewusst“ und verließ die Redaktion pünktlich nach acht Stunden. Die Politik hatte auch stark an Faszination verloren: Auf den Manager Franz Vranitzky, der im Nadelstreif sozialdemokratische Politik machte, folgte der Manager Viktor Klima, von dem mir nur mehr der Nadelstreif und sein Wechsel in die VW-Zentrale in Erinnerung ist. Die rot-schwarze Koalition verwaltete eine reiche, dank Androsch extrem leistungsfähige Volkswirtschaft ohne gravierenden Fehler und gemessen an Sebastian Kurz und seiner türkis-blauen Koalition war Klimas Koalition eine Traumregierung, obwohl die SPÖ mit ihm endgültig aufhörte, die Partei zu sein, die mit Nachdruck und Erfolg die Interessen der Unterschicht vertrat: „Arbeiter“ erlitten Reallohnverluste – „Ausländer“ drückten fühlbar auf ihre Löhne. Die Probleme an den Wiener Schulen, die Arbeiterkinder vorwiegend besuchten, wurden kritisch. Die FPÖ trug nichts zu ihrer Lösung bei, aber sie profitierte unaufhaltsam davon. Ich denke, dass ich die Ereignisse im Standard zutreffend kommentierte – an herausragende Texte erinnere ich mich nicht. Ich selbst habe den Standard damals voran um der Gerichtssaalberichte Daniel Glattauers willen gelesen. Einmal schlug ich vor, sie um Kommentare Elfriede Hammerls zu bereichern und wollte ihr dafür ein Drittel meines Gehalts abtreten, aber das verwarf die Geschäftsführung. Erfüllung fand ich in diesen drei Standard-Jahren zu Hause. Dieses zu Hause war nicht mehr die riesige Wohnung am Wiener Modenapark, sondern ein noch viel größeres, herrliches Haus mit Garten im niederösterreichischen Enzesfeld. Zu diesem Ortswechsel war es aus sehr unterschiedlichen Gründen gekommen: Schräg gegenüber unser Wohnung befand sich in der Neulinggasse ein Haus, dessen Eigentümer es um der optimalen Verwertung willen unbedingt leer bekommen wollte; dem standen Hauptmieter entgegen, die in einer Wohnung, die über ein ganzes
Ein Türschild im Standard
Stockwerk reichte, nicht zuletzt zahllose Antiquitäten unterbringen mussten und auf keinen Fall aus dieser Gegend wegziehen wollten; die einzige nahe Wohnung, in der sich ihre Möbel halbwegs unterbringen ließen und die ihnen gefiel, war unsere; das ließ den seit Jahren suchenden Hausherren vier Millionen Schilling (290.691 Euro) dafür bezahlen, dass wir sie seinen Mietern überließen und unser Mietvertrag gab uns das nötige Weitergaberecht. Gleichzeitig hatte ich, wie bei meinen ersten Kindern, immer davon geträumt, dass auch Eric im Grünen aufwächst und nun bot mir mein Freund Franz K. an, um eine Million Schilling (aus denen er zu seinem Vorteil letztlich drei Millionen machte) das alte Schulhaus von Enzesfeld, unmittelbar neben dessen herrlicher gotischer Kirche und unter dem Enzesfelder Schloss zu kaufen. Ich fuhr hin und war von der Lage begeistert, auch wenn das Gebäude eher einer Ruine glich. Aber ich besaß mittlerweile meinen eigenen polnischen Baufachmann, hatte mir über einen Tennisfreund die notwendigen Konzessionen für Elektro-, und Wasserinstallationen besorgt und war damit autark: Ich gründete eine eigne Installationsfirma, für die meine Frau als Geschäftsführerin die nötigen Kupferrohre, Muffen oder Ventile bestellte, seit sie TOPIC-Fotos einfacher über Agenturen bestellen konnte. So renovierten wir das Schulhaus in Enzesfeld so preiswert wie perfekt: Das Haus ist bis heute ein Schmuckstück und Eric träumt davon, es irgendwann zurück zu erwerben, denn er verbrachte dort gemeinsam mit Merced, dem Sohn unserer bosnischen Kriegsflüchtlinge, die schönsten Jahre seiner Kindheit. Ich verbrachte dort die bis dahin schönsten Jahre meiner zweiten Ehe. Zu ihren Besonderheiten zählte, dass der spannungsgeladene Zustand der ersten Monate, den der Volksmund mit „Schmetterlingen im Bauch“ umschreibt, durch die Jahre ungeschmälert fortdauerte und mich die nicht so glückliche berufliche Situation im Standard fast vergessen ließ. Aber so, als ob das Schicksal nicht weniger als vollständiges Glück vorgesehen hätte, ergab sich plötzlich auch beruflich eine Perspektive, von der ich nicht einmal zu träumen gewagt hätte: Wie jedes Jahr hatte ich den damaligen Eigentümervertreter des profil Christian Konrad aufgesucht, mit dem mich, wie mit den meisten Eigentümern, ein unverändert freundschaftliches Verhältnis verband; ihn einmal im Jahr zu besuchen war eine Tradition, die ich auch durch alle Jahre der Wochenpresse aufrechterhalten habe und bis heute pflege; bei dem Besuch im Jahr 1996 offenbarte mir Konrad plötzlich seine Unzufriedenheit mit dem Zustand des profil – er nehme in Kauf, dass es nicht gerade seine politische Linie verfechte, aber es ereigneten sich Entgleisungen – ein Titelblatt habe den Kopf Franz Vranitzkys wenig geglückt über einem nackten Körper montiert – und das Inseratenimage sei nicht mehr das alte und das habe die wirtschaftliche Situation verschlechtert. Ob ich, so fragte mich Christian Konrad aus heiterem Himmel, nicht Lust hätte, wieder profil-Herausgeber zu werden. Das war etwa so, als ob man mich gefragt hätte, ob ich nicht Lust hätte, den Eurojackpot zu gewinnen.
383
384
Ein Türschild im Standard
„Natürlich“, sagte ich, „ich weiß nichts, was ich lieber wäre.“ Ich habe mich später gefragt, ob ich nicht verpflichtet gewesen wäre, auf Hubertus Czernin Rücksicht zu nehmen, der mir ja wohl seinen Platz überlassen oder seine Abfertigung nehmen und gehen musste. Ich gestehe, dass ich bei meiner Antwort keine Sekunde an ihn gedacht habe. Ich wusste aus unserer jahrelangen Zusammenarbeit, dass Konrad keine politische Linie vorgab und seine wirtschaftlichen Argumente klangen für mich plausibel. Schwer krank (Czernin litt an einer seltenen Erkrankung, an der er später auch starb) neben mir als Chefredakteur weiterzuarbeiten oder als Herausgeber hoch und steuerfrei abgefertigt zu werden schien mir kein wirkliches Unglück. Aber das ist ein Argument, das mir erst nachträglich eingefallen ist – ich sagte Konrad zu, ohne zu denken. Denn der Himmel schien sich mir aufgetan zu haben – ehe ich nur wenige Tage später in die Hölle stürzte.
62. Schuld und Sühne
Der Abend, der mein Leben auf so dramatische Weise verändern sollte, begann überaus angenehm in einem schummrigen Lokal namens „Ofenloch“, in dem wir das Ehepaar Franz und Eva K. trafen. Ich glaube, dass wir gut aßen, etwas Rotwein tranken und dass Franz K. am Ende bezahlte. Er bestand immer darauf, die Rechnung zu übernehmen, wenn er gemeinsam mit anderen Essen ging: Es war ihm wichtig, klarzustellen, dass er der finanziell Potenteste der jeweiligen Tischgesellschaft war – und die längste Zeit war er es auch. „Geld zu haben“ war der entscheidende Teil seines Selbstwertgefühls, und die längste Zeit hatte er Geld. Ich kannte ihn damals seit rund zwanzig Jahren und zählte ihn zu meinen guten Freunden, obwohl diese Freundschaft sich in den Augen der meisten Leute nicht schickte. Denn K. wurde dem Rotlichtmilieu zugezählt, obwohl er sein Geld höchst achtbar verdiente: Seine Autovermietung war die damals größte des Landes und in zahllosen Prozessen hatte er Österreichs Kfz-Versicherungen gezwungen, Schäden blitzartig und kundenfreundlich abzuwickeln, während es zuvor jeweils eines Kraftaktes des Geschädigten bedurfte, zu seinem Recht zu kommen. Wir hatten einander auch nicht im Rotlichtmilieu kennengelernt, sondern er war der Lebensgefährte einer guten Bekannten, die zuvor die Freundin eines meiner besten Freunde gewesen war: Lajos Ruff, mit dem sie zusammenlebte, war der Sohn eines ungarischen Höchstrichters, hatte sich als Student dem ungarischen Widerstand angeschlossen, war verhaftet und der Prominenz seines Vaters wegen „nur“ in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Nachdem ihm 1956 die Flucht gelungen war, hatte er seine Erlebnisse in dem Buch „The Brain-Washing Machine“ niedergeschrieben, das zu seiner Anhörung im US-Senat führte. Ruff imponierte mir nicht nur wegen des mutigen Widerstandes, den er dem kommunistischen Regime geleistet hatte – „Widerstand“ gehörte nun einmal zu den in meiner Familie am meisten geschätzten Tugenden – sondern er imponierte mir auch als Autor: „The Brain-Washing Machine“ war ein sehr gutes Buch. Als Oscar Bronner ein Team für den neugegründeten trend suchte, hatte ich ihm daher nicht nur Jens Tschebull als Chefredakteur, sondern auch Lajos Ruff als Autor empfohlen und tatsächlich war er bereits stellvertretender Chefredakteur des trend, als ich Chefredakteur des profil wurde. Natürlich vertiefte die Arbeit im selben Verlag unsere sowieso enge Freundschaft, und so kam es, dass Lajos mindestens jedes zweite Wochenende im Garten meiner ersten Frau Lisi in Mauer verbrachte und dabei natürlich seine Freundin Alexandra und ihren Sohn Christoph Fälbl mithatte, mit denen uns bald ähnlich herzliche Freundschaft verband. (Später sollte ich Christoph Fälbl darin bestärken, Schauspieler statt Koch zu werden, was er mir gutschrieb.) Als Lajos und Alexandra sich leider zerstritten, blieb die Freundschaft zu ihr und ihrem
386
Schuld und Sühne
Sohn unverändert und so empfingen wir sie in unserem Garten nicht weniger gerne mit ihrem neuen Lebensgefährten: dem Autovermieter Franz K. Der brachte immer eine Bonbonniere oder Blumen und immer beste Laune mit und vermochte mit seinen Erzählungen dafür zu sorgen, dass meine Frau und ich noch Stunden nach seinem Abschied darüber lachten. Ich habe nie einen anderen Menschen kennengelernt, der sich so sehr für „Geld“ zu begeistern vermochte. Von einer Transaktion, die „Geld! einbrachte, vermochte er mit beinah sich überschlagender Stimme so zu schwärmen, wie andere Männer von einer Liebesnacht: „Stell Dir vor, an Koffer mit Mille hat dem das einbracht. Oben a Schicht aus lauter Mille und drunter no amal ane. A ganzer Koffer mit nix als Mille“, habe ich den Anfang einer seiner typischen Erzählungen in Erinnerung, die glaube ich, damit endete, dass dem Besitzer nicht nur der Koffer, sondern mit ihm die Ehefrau abhandenkam – wobei der Verlust des Koffers in den Augen von K. die ganz ungleich größere Tragödie war. „Geld“ gehörte so zu seiner Familiengeschichte wie „Widerstand“ zu meiner. Sein Vater, der größte Fleischhauer des 3. Bezirks, so erzählte er mir, habe sich zu seinem 60. Geburtstag in Gold aufwiegen lassen. Sein Palais auf der Wiener Landstraße ließ das nicht ganz unglaubwürdig erscheinen. Den Sohn behandelte dieser Patriarch, wie sich das gehörte: Wenn er von der Mittelschule heimkam und seine Aufgaben gemacht hatte, musste der „Franzi“ selbstverständlich im Geschäft helfen und dabei halbe Kälber schultern. Wenn er etwas nicht perfekt schaffte, setzte es ebenso selbstverständliche Ohrfeigen. Aber die nahm er dem Vater nicht übel, sondern liebte ihn für alles, was er bis zu seinem Tod von ihm mitbekommen hatte. Wenn er etwas nie ausließ, dann den Besuch am Grab dieses übermächtigen Vaters. Als ich ihm zum Geburtstag eine Zeichnung schenkte, die ein Illustrator des profil nach einem Foto des Vaters angefertigt hatte, fiel er mir dafür um den Hals: „Das ist das schönste Geschenk, das ich je bekommen habe.“ Er revanchierte sich mit einem für ihn typischen Geschenk: Sieben Zahlen, mit denen ich an einem bestimmten Roulette-Tisch des Casinos auf der Kärntnerstraße sicher gewinnen würde, wenn ich nach seiner Anweisung spielte. „Glaubst Du, dass es ein System gibt, mit dem man im Casino gewinnt?“, fragte er mich. „Nein“, gab ich zur Antwort. „Kannst Du aufstehen und gehen, wenn Du gewonnen hast?“ „Ich denke schon.“ „Wirst Du auch aufstehen und gehen können, wenn Du hörst, wie eine von den Zahlen, die ich Dir gebe, noch einmal kommt?“ „Wenn das zum Gewinnen notwendig ist, dann schon.“ „Gut dann geb’ ich Dir die Zahlen.“ Ich weiß sie bis heute, weil ich sie eine Woche lang jeden Abend wiederholt habe: Zero, sechs, acht, elf, 17, 26, 32. K. hatte sie ermittelt, indem er die Ergebnisse dieses und eines weiteren Tisches drei Wochen hindurch mitgeschrieben beziehungsweise mitschreiben
Schuld und Sühne
lassen hatte. Denn es gibt immer wieder Roulette-Maschinen, die einen winzigen Fehler haben, die zum Beispiel nicht absolut waagrecht eingebaut sind, erklärte er mir den aus seinen Listen ersichtlichen Überhang gewisser Ziffern, um einen ebenso offensichtlichen Beweis seiner Intelligenz mitzuliefern: „Man darf nicht einfach die Ziffern nehmen, die in den drei Wochen am häufigsten gekommen sind – das können zufällige Ausreißer sein – man muss die nehmen, die an den meisten Tagen am häufigsten gekommen sind.“ Ich setzte zum Spaß eine Woche hindurch den Mindesteinsatz darauf und ging tatsächlich mit mehreren Tausend Schilling (mehrmals 72,67 €) Gewinn nach Hause. Dazu einer interessanten Erkenntnis über Spieler: Fast alle von ihnen sind süchtig – es kamen praktisch jeden Abend dieselben Leute und hörten nicht auf zu spielen, obwohl sie fast jeden Abend verloren. Besonders viele unter ihnen waren offenkundige Prostituierte – sie trennten sich Abend für Abend von einem Geld, für das sie sich genierten. Mir wurde klar, warum K. mich gefragt hatte, ob ich an ein „System“ glaube – denn fast alle von ihnen verloren nach einem „System“. Obwohl sie sahen, dass ich an jedem Abend nach wenigen Minuten mit einem manchmal größeren, manchmal kleineren Gewinn nach Hause ging, indem ich auf immer dieselben Zahlen setzte, kam keine dieser Frauen auf die Idee, mir nach zu setzen. Sie wollten verlieren – ihr Unterbewusstsein war ungleich stärker als jede rationale Einsicht. Nur dem Croupier war aufgefallen, dass ich immer gewann: Er hatte es gemeldet und die Maschine war ausgetauscht worden. Die gespielte Woche reichte, mich nur noch einmal im Leben ein Casino aufsuchen zu lassen – in Las Vegas, um mir die Zaubershow von Siegfried und Roy anzusehen. Im Übrigen bin ich bis heute der Ansicht, dass es ein gewaltiges Problem ist, dass insbesondere Österreich ein Zentrum des Glücksspiels ist. Casinos sind zwar unvermeidlich, wenn man Untergrund-Spielhöllen vermeiden will, und zumindest verlieren dort eher wohlhabende Menschen ihr Geld. Die wirkliche Katastrophe ist das „kleine Glücksspiel“, das auch über Apps funktioniert und bei dem voran „kleinen Leuten“ das Geld aus der Tasche gezogen wird. Während die USA dieses kleine Glücksspiel verboten haben, ist es in Österreich, eng verwoben mit den großen politischen Parteien, eines der größten Geschäfte der beteiligten Unternehmen wie des Staates. Dass diese enge Verschränkung mit der Politik zu Affären führt, die, wie die Bestellung des FPÖ-Funktionärs Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casino AG, in Strafverfahren münden, ist eine zwingende Folge. Und gesellschaftspolitisch sollte einem klar sein: Glücksspiel ist in den Ländern am erfolgreichsten, wo die sozialen Bedingungen es den meisten Menschen besonders schwer machen, durch Arbeit reich zu werden. Nicht nur K.s Umgang mit dem „Glücksspiel“ und die Art und Weise, in der er seine Autovermietung betrieb, zeugte von seiner hohen Intelligenz, sondern auch ein Geschäft, das er aus seiner Fleischer-Vergangenheit entwickelt hatte: Er kaufte für Bauern, die dafür zu wenig Kapital hatten, Kälber, übergab sie ihnen gegen ein gewisses Entgelt zur Fütterung, um sie zum günstigsten Zeitpunkt zu verkaufen.
387
388
Schuld und Sühne
Es gab kein Geschäft – vom Autoverleih über Geldverleih bis zur Wursterzeugung – über dessen Maximierung er nicht nachgedacht hätte. „Hirntschechern“ nannte er das und gab sich ihm durch Stunden hin. Ich beschreibe das so ausführlich, weil es vielleicht begreiflich macht, wie sehr es ihn aus der Bahn werfen musste, als eine verständliche Entscheidung des Obersten Gerichtshofes, die ich dennoch „Lex K.“ nennen würde, sein Mietwagengeschäft von einem Tag auf den anderen zusammenbrechen ließ: Schadenersatz bei einem Autounfall zu leisten hatte bis zu diesem Urteil geheißen, dass die Kfz-Vollkaskoversicherung dem Eigentümer eines beschädigten Autos für den Zeitraum der Reparatur ein Auto derselben Preisklasse zur Verfügung stellen musste, das K. aus seinem Fuhrpark zu einem entsprechend hohen Preis zur Verfügung stellte. Das Urteil besagte, dass die Versicherung einen „Vollkasko“-Vertrag abschließen konnte, der diese Form des „vollen“ Schadenersatzes ausschloss. Am nächsten Tag stand K. mit einer riesigen Garage voller teilweise sündteurer Autos da, für die er keine Verwendung mehr hatte, so dass er sie so schnell wie möglich – das heißt zu schlechten Preisen – verkaufen musste. Heute weiß ich, dass das seinem Geschäft den Todesstoß versetzte. Damals, als wir im „Ofenloch“ zu Abend aßen, wusste ich es nicht. Ich wusste nur, dass er, wie immer, auch neue Geschäftsideen verfolgte: So schwärmte er von einem Hotel, das er billig erwerben und zu einem Nobelaltersheim in der Wiener Innenstadt umfunktionieren würde, weil Zimmer und Bäder sich ideal dazu eigneten und fragte mich, ob ich mich daran beteiligen wollte. Da er dabei an einen ziemlich hohen Betrag dachte, lehnte ich ab. Wohl aber hatte ich ihm schon wenige Tage zuvor 1,5 Millionen Schilling (109.000 €) zur Beteiligung an einem Grundstücksgeschäft überlassen. Nachträglich bin ich nicht ganz sicher, ob das Geld, mit dem er unser gemeinsames Abendessen wie immer alleine bezahlte, nicht dennoch bereits meines war. Danach – es war ungefähr 22 Uhr – wollte er nach Hause gehen. Doch ich hielt ihn zurück, denn ich hatte an diesem Abend noch eine zweite Verabredung: Ich wollte meinen Sohn Sebastian und seine Verlobte Christine in der Eden Bar zum Tanzen treffen. Auch meinem Freund Christian Ortner, zugleich mein Nachfolger als Chefredakteur der Wochenpresse/Wirtschaftswoche, hatte ich vorgeschlagen, einander bei dieser Gelegenheit wieder einmal zu sehen und nun machte ich K. den verhängnisvollen Vorschlag, doch in die „Eden“ mitzukommen. Denn im Gegensatz zu mir war er ein hervorragender Boogie-Tänzer und meine Frau tanzte für ihr Leben gerne Boogie – was mit mir ein für sie nur mäßiges Vergnügen war. (Ich habe im 14. Kapitel beschrieben, weshalb ich die Tanzschule bereits nach den ersten Stunden verließ und eigentlich nur Slowfox halbwegs gut und gerne tanzte). K. zögerte – aber letztlich gaben seine und meine Frau den Ausschlag, dass er doch mitkam. So kam der Abend zu Stande, von dem die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage gegen ihn und mich behauptete, ich habe ihn sorgfältig arrangiert, um mit K. zu besprechen,
Schuld und Sühne
wie man die Russlandkauffrau Walentina Hummelbrunner um ein paar Millionen erleichtert. Ich kannte Walentina Hummelbrunner von der Eröffnung eines Restaurants, mit dem sie eines der von ihr erworbenen Palais in Hietzing wirtschaftlich nutzen wollte. Meine künftige Schwiegertochter Christine hatte davon erfahren, weil sie wenige Häuser weiter in einem Kosmetiksalon gearbeitet hatte, und wir freuten uns über ein gutes Lokal in relativer Nähe. Wir aßen also noch ein-, zweimal dort, aber ohne Walentina Hummelbrunner ein weiteres Mal zu treffen. Wenig später sperrte der Kosmetiksalon, in dem Christine gearbeitet hatte zu, weil die Eigentümerin ihn aus Altergründen nicht mehr führen wollte. Christine hatte gehofft, ihn vielleicht pachten zu können, aber die geforderte Summe überstieg ihre Möglichkeiten um Längen. Da erfuhr sie, dass Walentina Hummelbrunner die Eröffnung eines Kosmetiksalons plante, um ein weiteres ihrer Häuser wirtschaftlich zu nutzen und bewarb sich um dessen Leitung. Hummelbrunner nahm diese Personalentscheidung nicht selbst vor, sondern hatte ihre Geschäftsführerin damit betraut. Bei der hatte sich Christine nach zwei Wochen unter zahlreichen Bewerberinnen als die Beste qualifiziert und schwärmte bereits von ihrem neuen Job. Doch im letzten Satz des letzten Gespräches brachte sie sich um ihre Chance: „Der Ordnung halber muss ich Ihnen sagen“, sagte sie der Geschäftsführerin, „dass ich an einer Allergie leide, so dass ich eine Perücke tragen muss. Niemand kann es sehen, es verschlechtert sich auch nicht und ist in keiner Weise ansteckend – aber ich wollte es Ihnen nicht verschweigen.“ Die Geschäftsführerin drückte so behutsam sie konnte ihr Bedauern aus: „Ihre Ehrlichkeit ehrt Sie. Ich hätte Sie auch wirklich gerne genommen. Aber eine Allergie in einem Kosmetiksalon – das geht einfach nicht. Das kann ich unseren Kundinnen nicht zumuten.“ Christine war am Boden zerstört. Es war ja nicht nur ihr Traum gewesen, einen Kosmetiksalon zu führen, sondern die Allergie prägte ihr Leben, seit sie eine Frau war. Als sie mir von der Absage erzählte, sah ich sie erstmals weinen. Da fasste ich – nicht sehr optimistisch, aber um mir nicht vorzuwerfen, es nicht versucht zu haben – den Entschluss, Walentina Hummelbrunner anzurufen, um sie umzustimmen. Das Gespräch begann auch nicht sehr erfolgversprechend. Hummelbrunner verwies auf ihre geschäftliche Verantwortung und auf das Pouvoir ihrer Geschäftsführerin. Ich versuchte einzuwenden, dass Christine durch Jahre ohne jedes Problem in einem nahen Kosmetiksalon mit denkbar anspruchsvoller Kundschaft gearbeitet habe – aber ich hatte damit wenig Erfolg. Der kam erst, als ich ihr von den Problemen meines Sohnes Sebastian erzählte, der jeden Abend vergeblich am Gartentor auf mich gewartet hatte und dessen Legasthenie so lange übersehen worden war, dass er mit zehn kaum lesen konnte. Das habe ihn in einem Maße verunsichert, dass er, so gut er aussah, nicht glaubte, je die richtige Frau zu finden. Deshalb, so versuchte ich Walentina Hummelbrunner klarzumachen, sei ich so unendlich glücklich gewesen, dass er in Christine eine so hübsche, tüchtige Partnerin gefunden hatte. Da er in der Sport- und Nahkampf-
389
390
Schuld und Sühne
schule des Bundesheeres als Masseur tätig sei, hätten die beiden schon phantasiert, vielleicht sogar gemeinsam im Kosmetiksalon Arbeit zu finden. (Heute führen sie einen gemeinsamen Salon, der laut NEWS-Ranking unter die besten von Wien zählt.) Ich habe nie genau erfahren, was Walentina Hummelbrunner an meiner Erzählung so sehr berührte – jedenfalls schwenkte sie plötzlich um 180 Grad: „Ich habe auch ein Kind – ich weiß, wie das ist“, sagte sie nur. „Ich werde mit meiner Geschäftsführerin reden.“ Schon tags darauf erhielt Christine die Nachricht, dass sie doch engagiert sei. Dafür war ich Walentina Hummelbrunner unendlich dankbar – und schätze sie dafür bis heute. Schließlich war ich mit der Führungsfunktion in einem Unternehmen genügend vertraut, um zu wissen, was es bedeutet, eine Entscheidung der eigenen Geschäftsführerin zu revidieren: Man tut das normalerweise nie, weil man befürchten muss, dass sowohl sie wie alle ihre Mitarbeiter es als Desavouierung empfinden – man konnte das Gefüge des gesamten Unternehmens durcheinanderbringen, wenn man eine Entscheidung der eigenen Geschäftsführung in ihr Gegenteil verkehrte. Im Strafprozess wurde ich von Tränen geschüttelt, als ich von dem Telefongespräch mit Hummelbrunner und ihrer Reaktion erzählte und Manfred Deix hat mich in diesem Zustand entsprechend sarkastisch karikiert. Aber vielleicht können Eltern, die auch Kinder haben, doch etwas von meiner Dankbarkeit für Walentina Hummelbrunner nachempfinden. Ich glaube, dass es noch Sommer war, als Christine ihren neuen Job antrat und dass es auf Weihnachten zuging, als sie mir erzählte, dass gegen Walentina Hummelbrunner, die eine so wunderbare Chefin sei, ein Strafverfahren wegen ihrer Geschäfte in Russland laufe. Etwas später konnte man auch in Zeitungen darüber lesen – ich glaube, dass ich den Inhalt der gegen sie erhobenen Vorwürfe aus einem Artikel der Wochenpresse/ Wirtschaftswoche erfuhr. In meiner Erinnerung ging es um undurchsichtige Geldflüsse aus Geschäften ihres damaligen Ehemannes, die bei ihr gelandet waren bzw. um den mit den meisten Russlandgeschäften verbundenen Verdacht der Korruption. Auch meine Einstellung zum wiedergegebenen Vorwurf habe ich in Erinnerung und zweifellos war und ist sie eines Chefredakteurs des Standard und ehemaligen Herausgebers des profil unwürdig: Ich habe die allfälligen Geschäfte der Walentina Hummelbrunner und ihres Ehemanns in Russland nicht für sonderlich unmoralisch gehalten, obwohl ich für durchaus möglich hielt, dass Korruption dabei eine Rolle gespielt hat. Denn man konnte in Russland meines Wissens nur „undurchsichtige“ oder gar keine Geschäfte machen. Das wusste ich deshalb so gut, weil mein Cousin Alexander Traxler, mit dem ich wie ein Bruder aufgewachsen bin (ich habe im 13. Kapitel ausführlich darüber geschrieben) bis zu seinem Tod ein höchst erfolgreicher Russlandkaufmann gewesen ist und mir immer wieder über seine Geschäfte in der Sowjetunion erzählt hat: Dass dort überhaupt Waren in Geschäfte gelangten, sei durchwegs der Korruption zu danken gewesen –
Schuld und Sühne
sie sei das Einzige, was die kommunistische Planwirtschaft russischer Prägung soweit abgemildert habe, dass die Menschen irgendwie überleben konnten. Ich habe meinen Cousin daher seiner Russlandgeschäfte wegen nicht für einen Kriminellen gehalten – und Walentina Hummelbrunner auch nicht. Selbst Österreichs Behörden hatten lange Zeit Verständnis für Geschäfte mit der Sowjetunion: Sie ließen zu, die Bestechung sowjetischer Beamten von der Steuer abzusetzen. Heute weiß ich, dass ich Walentina Hummelbrunner möglicherweise selbst mit dieser meiner milden Einschätzung Unrecht getan habe – die Geldflüsse an sie stellten einen berechtigten Anspruch dar, den sie in einem Zivilprozess rechtskräftig durchsetzte. Ich will nur nicht verschweigen, dass ich ihr helfen wollte, obwohl ich die Beimengung von Korruption für möglich hielt. Jedenfalls war das die Einstellung und waren das die Emotionen, mit denen ich ihr und ihrem Verfahren gegenüberstand, als ich mit meiner Frau am Abend des 6. Jänner 1996 mit Franz K. und seiner Frau in der Eden Bar auf meinen Sohn Sebastian und seine Verlobte Christine traf: Ich war Walentina Hummelbrunner dankbar für ihr Verhalten diesen beiden gegenüber, und ich hielt ihre Russlandgeschäfte – unmoralischerweise – nicht für rasend unmoralisch. Dass wir auf ihr Verfahren zu sprechen kamen, hat Gründe, die ich heute nicht mehr rekonstruieren kann. Vielleicht lag es daran, dass neben Christine und Sebastian auch ein Koch des Restaurants der Walentina Hummelbrunner zu uns stieß – vermutlich, weil die beiden ihn dazu eingeladen hatten – und dass deshalb über das natürlich auch für ihn höchst spannende Thema gesprochen wurde. Genauso gut konnte es daran gelegen sein, dass an diesem Abend Christian Ortner zu uns stieß, denn ich hatte ihm erzählt, dass ich ab elf in der „Eden“ sein und mich freuen würde, ihn wieder einmal zu treffen. Denkmöglich ist daher auch, dass er auf das Verfahren zu sprechen kam, weil er sich plötzlich mit lauter Bekannten der Walentina Hummelbrunner konfrontiert sah und die Wochenpresse, die er leitete, ja darüber berichtete. Jeder von uns – Franz K. und seine Frau ausgenommen – kann angesichts dieses Zusammentreffens vom Verfahren gegen Walentina Hummelbrunner zu sprechen begonnen haben, weil es jeden von uns interessierte. In der Anklage gegen mich sollte die Staatsanwaltschaft diese Zusammenkunft als eine von mir mit größtem Bedacht arrangierte ansehen: Um K. für meinen Plan zu gewinnen, die Russlandkauffrau um ein paar Millionen zu erleichtern, hätte ich ihn in die Eden eingeladen, um unser Vorgehen dort zu besprechen. Offenbar weil die Eden Bar, in der man nur Tisch an Tisch sitzen kann, ein so diskreter Ort ist; weil ich dringend einen Angestellten der Walentina Hummelbrunner als Zuhörer dabei haben wollte; und auch gleich Christian Ortner, damit die Wochenpresse aus erster Hand über das geplante Verbrechen berichten kann. Ob Franz K. schon vorher in der Zeitung über das Verfahren gegen Walentina Hummelbrunner gelesen hatte, weiß ich nicht – eher ja, denn er pflegte Zeitungen zu lesen. Jedenfalls erfuhr ich anlässlich des gemeinsamen Gespräches von ihm, dass er den
391
392
Schuld und Sühne
Staatsanwalt Wolfgang M., bei dem dieses Verfahren zu diesem Zeitpunkt anhängig war, nicht nur flüchtig kannte – das war mir geläufig –, sondern angeblich mit ihm befreundet war. Das ließ mich die Äußerung machen, die mein Leben verändern sollte: „Glaubst Du, dass Du bei ihm ein gutes Wort für die Hummelbrunner einlegen kannst?“ Franz K. bejahte – ich weiß heute nicht mehr, mit welchen Worten – meinte aber, dass er zu diesem Zweck mit ihr sprechen wolle, um sich auszukennen. Christine sagte zu, die beiden bekannt zu machen. Der Abend dauerte ziemlich lang. K. tanzte längst nicht so oft Boogie mit meiner Frau, wie ich das für sie erhofft hatte – ich glaube, dass ich öfter mit seiner Frau Foxtrott getanzt habe. Ich weiß auch nicht mehr, ob wir eher viel oder eher wenig getrunken haben. Sicher ist, dass Eva und ich in einem Innenstadthotel übernachtet haben, weil es uns wegen einsetzenden Schneefalls zu spät zur Heimfahrt ins 40 Kilometer entfernte Enzesfeld war. Was sie mir dann am Morgen über ihre Erinnerungen an ihr Gespräch mit Franz K. erzählte, ließ bei mir Alarmglocken schrillen: Er habe sie auffallend eingehend nach den Vermögensverhältnissen der Walentina Hummelbrunner befragt. Ich erinnerte mich seiner Fähigkeit aus allem und jedem ein Geschäft zu machen und in mir keimte ein furchtbarer Verdacht: Er könnte versuchen, auch seine Bekanntschaft mit Wolfgang M. zu einem Geschäft zu nutzen und daraus könnte eine Katastrophe erwachsen. Sobald ich in Enzesfeld bei einem Telefon war, rief ich bei ihm an. Als ich ihn nicht erreichte, tat ich etwas Wahnwitziges: Verklausuliert, damit seine Bedienerin es nicht womöglich mitbekommen würde, sprach ich Sätze auf seinen Anrufbeantworter, die einige Wochen später hunderte Male im Rundfunk zu hören sein sollten – in etwa: Rede zuerst mit deinem Freund M. und hör Dir an, was er sagt. Wenn Du Geld von Hummelbrunner verlangst, kann sie das als Pression empfinden. Das liest sich heute so furchtbar wie es damals klang, auch wenn es in erster Linie eine Warnung war: Wenn Hummelbrunner sich erpresst fühlen muss, bekommst Du massive Probleme. In zweiter Linie sind diese Sätze freilich der unauslöschliche Beweis, dass ich K. keineswegs davon abhalten wollte, mit M. zu sprechen und ihm meine Bitte vorzutragen – meine Worte waren nur die Warnung, dabei nicht durch die Forderung nach Geld in ein offenes Messer zu laufen. Genauso ist es bekanntlich gekommen: Von Franz K. immer heftiger bedrängt und mit der Forderung konfrontiert, Millionen dafür zu bezahlen, dass er ihre angeblich bevorstehende Verhaftung verhindere, hatte Walentina Hummelbrunner sich schon nach kurzer Zeit an die Polizei gewendet und die war auf höchst professionelle Weise tätig geworden. Weil mit Wolfgang M. ein schon zuvor intern umstrittener Staatsanwalt und dazu ein Rechtsanwalt – K.s Anwalt Manfred Merlicek – involviert schienen, hatte das „Einsatzkommando gegen organisierte Kriminalität“ den Fall übernommen; man hatte Walentina Hummelbrunner verkabelt und zugehört, wie Franz K. von ihr sechs Millionen Schilling für seine Intervention forderte; um jeden Zweifel zu beseitigen hatte
Schuld und Sühne
man abgewartet, dass sie ihm einen entsprechend präparierten Geldkoffer übergab und ihn dann verhaftet. Obwohl ich genau diese Katastrophe in meiner Warnung befürchtet hatte, habe ich sie in keiner Weise erwartet, sondern bin in den Tagen nach dem Eden-Besuch wie immer meiner Arbeit nachgegangen. Ich erwartete, früher oder später von Christine zu erfahren, wie es mit dem Verfahren der Walentina Hummelbrunner weitergegangen ist. Doch dann – ich glaube es war ein Samstag und ich holte wie immer eine Zeitung vom Enzesfelder Zeitungsstand – die furchtbare Überraschung: Die halbe Seite 1 des Kurier war der Verhaftung das Franz K. mit einem Geldkoffer der Walentina Hummelbrunner gewidmet. Mir gefror das Blut in den Adern. Weniger als mir galt meine Angst zu diesem Zeitpunkt Christine, von der klar war, dass sie Franz K. mit Walentina Hummelbrunner bekannt gemacht hatte. Ich fuhr also so schnell wie möglich zur zuständigen Polizeidienststelle, wurde höflich zur Einvernahme gebeten und vermochte klarzustellen, dass Christine keine Ahnung davon hatte, wie Franz K. sich verhalten würde: Sie sei, wie ich, der Meinung gewesen, er würde ihrer Chefin bei ihrem Verfahren irgendwie helfen können. Niemand sah Grund an den Worten des Chefredakteurs des Standard zu zweifeln. Dass ich Franz K. gebeten hatte, zu helfen, indem er bei Wolfgang M. „ein gutes Wort für die Hummelbrunner einlegt“ verschwieg ich, obwohl der Beamte mich mehrmals fragte, wie ich mir erklären könne, dass K. immer wieder auch auf mich zu sprechen gekommen sei. Es war dies meine erste und leider nicht letzte Lüge in diesem Verfahren, denn eines war mir klar: Wenn meine Worte an ihn bekannt wurden, war es das Ende meiner beruflichen Karriere: Man konnte als Standard-Chefredakteur nicht darum bitten, bei einem Staatsanwalt ein gutes Wort für eine der Korruption Verdächtige einzulegen. Nicht aber war mir klar, dass ich wenige Monate später wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch vor Gericht stehen würde. Ich habe meine Worte so wenig dafür gehalten, wie in der Folge zwei über mich urteilende Schöffensenate. Die Wahrheit ist, dass ich bei meinen Worten an überhaupt nichts dachte –, außer dass ich Walentina Hummelbrunner helfen wollte. Ich hatte jedenfalls vorerst keine Angst vor einer Anklage gegen mich, sondern nur Angst vor dem Prozess gegen Franz K., denn ich wusste, dass ich die Lüge, die ich bei der Polizei vorgebracht hatte, als Zeuge vor Gericht unmöglich aufrechterhalten konnte. Gleich nach der Polizei suchte ich daher Christian Konrad auf, um ihm zu sagen, dass ich doch nicht wieder profil-Herausgeber werden könne: Ich sei in die Affäre K. verwickelt und habe zwar nichts verbrochen, mich aber auf eine Weise verhalten, die mit dieser Funktion unvereinbar sei. Christian Konrad wollte das nicht glauben, aber ich ließ ihm keine Wahl: „Ich kann das dem profil nicht antun.“ Mein Traum, nach neun Jahren wieder in den Job zurückzukehren, den ich so sinnlos hingeschissen hatte, als meine Mutter meine Ehe mit Eva „schlimmer als Auschwitz“
393
394
Schuld und Sühne
genannt hatte, war geplatzt. Ihr „Fluch“, dass ich in dieser Beziehung alles verlieren würde, was ich in meiner Ehe mit Lisi aufgebaut hatte, stand unmittelbar vor der Erfüllung.
Angst Denn natürlich hatte ich den Prozess gegen Franz K. panisch zu fürchten. Nicht, so glaubte ich damals, wegen einer strafrechtlichen Verurteilung, wohl aber wegen der unvermeidlichen, breiten Berichterstattung über mein zweifellos unkorrektes, eines Chefredakteurs des Standard und einstigen Herausgebers des profil unwürdigen Verhaltens. Doch durch einen Monat seit Franz K.s Verhaftung herrschte Ruhe. Nur einmal kam eine Karte von ihm, in der er schrieb, er sei doch immer mein Freund gewesen – warum ich denn bei den Behörden so wenig über mein Verhältnis zu Walentina Hummelbrunner sage. Aber statt über seinen Anwalt Kontakt zu ihm aufzunehmen, machte ich den Fehler, aus Angst um meinen Ruf, auch den geringsten Kontakt zu ihm zu meiden – obwohl zwanzig Jahre Freundschaft eigentlich ausreichen sollten, ihn in seiner Lage nicht alleinzulassen. Im März rächte sich dieser Fehler: Alle Sender des ORF übertrugen stündlich die Sätze, die ich warnend auf K.s Anrufbeantworter gesprochen hatte. K.s Frau hatte der Justiz das Tonband übergeben, weil sie meinte, dass es ihn entlaste. Das tat es in keiner Weise – aber es vernichtete mich: Auf einmal war klar, dass ich viel tiefer in den Kriminalfall K. verwickelt war, als irgendjemand bis dahin angenommen hatte. Auch ich selbst hatte es bis dahin nicht begriffen. Diese Sätze in den nächsten Tagen zu allen Stunden und an jedem Ort zu hören, fühlte sich wie Keulenschläge an. Ich glaube seit damals zu wissen, was es bedeutet, vor Scham am liebsten im Erdboden versinken zu wollen und es so ganz und gar nicht zu können. Es ist erstaunlich laut: Man hört die Schläge des eigenen Herzens gegen die Schädeldecke trommeln, spürt das Gehirn explodieren und das Blut in den Adern brausen; gleichzeitig ist es erstaunlich still: Man ist außerstande, die Worte eines anderen zu hören, etwas zu sagen oder gar zu denken außer: Ich will nicht mehr sein. Etwas abgemildert – wie hinter Milchglas – sollte dieser Zustand mich die rund zwei Jahre, die mein Strafverfahren letztlich dauern sollte, gefangen halten und klang auch danach nur ganz langsam ab. Hauptleidtragende waren meine Frau und vor allem unser achtjähriger Sohn Eric. Er musste mich zweimal ansprechen, bis ich ihn hörte; meine Antworten gehorchten dem Zufallsprinzip – sie passten nur gelegentlich zu seiner Frage. Ich versuchte zwar, wie früher mit ihm zu spielen – weil es Winter war, gingen wir Skifahren – aber er musste mich anstoßen, um loszufahren und wenn er mich fragte, ob ich gesehen habe, wie gut
Angst
ihm sein Rechtsschwung gelungen sei, log ich „Ja“ und kam damit nicht durch: „Lüg’ nicht Papa. Du hast doch gar nicht hingeschaut.“ Eric sagte mir später, er habe nicht begreifen können, wieso ich plötzlich ein so anderer gewesen sei. Er habe gewusst, dass irgendetwas passiert ist – aber nie was. Seine Volksschullehrerin im niederösterreichischen Enzesfeld, wo fast jeder fast jeden kennt, hatte meiner Frau versprochen, darauf zu achten, dass ihn Kameraden nicht vielleicht „blöd anredeten“, weil sie zu Hause gehört hatten, was über mich in der Zeitung stand – doch keines der Kinder tat das. „Nur mit mir hat niemand darüber geredet, was über Dich in der Zeitung gestanden ist, niemand hat mir erklärt, worum es gegangen ist“, warf Eric mir vor. „Wir wollten Dich schonen“, antwortete ich. „Ihr habt mich nicht geschont – ich musste glauben, es liegt an mir.“ Meine Stellung als Co-Chefredakteur des Standard war selbstverständlich in der Sekunde unhaltbar geworden, in der das Tonband öffentlich geworden war. Meine Frau fuhr mich nach Wien, um meinen Rücktritt zu besprechen, denn aus Angst, ich könne gegen den Pfeiler einer Autobahnbrücke fahren, ließ sie mich nicht mehr ans Steuer. Oscar Bronner empfing mich mit eisiger Miene. Im Hintergrund seines Zimmers standen sein Anwalt Daniel Charim und ein Co-Geschäftsführer, den die Bank Austria entsandt hatte, weil sie ihm damals einen Kredit für den Kauf der Anteile der Axel Springer AG gewährt hatte. Beide beteiligten sich aber die längste Zeit in keiner Weise am Gespräch. „Ich lege mein Amt selbstverständlich zurück, bis die Vorwürfe gegen mich geklärt sind“, begann ich. „Das genügt nicht“, sagte Bronner, ich müsse sofort ausscheiden. Ich hatte Ähnliches erwartet und war darauf vorbereitet. Aus meinen vorigen Dienstverhältnissen besaß ich zwar Anspruch auf eine Abfertigung von sechs Millionen Schilling (436.037 €), aber ich hätte sie angesichts der finanziellen Lage des Standard zu keinem Zeitpunkt gefordert und in der aktuellen Situation tat ich es schon gar nicht. „Ich möchte nur meine gesetzliche Abfertigung“, sagte ich, „ich glaube es sind zwei Millionen Schilling.“ „Kommt nicht in Frage“, sagte Bronner. „Ich bin Juristin“, mischte meine Frau, sich ein, „ein anhängiges Strafverfahren im Stadium der Vorerhebungen ist kein Kündigungsgrund und berührt den Anspruch auf gesetzliche Abfertigung nicht.“ Das wisse er, sagte Bronner. Wenn ich seinen Vorschlag akzeptierte, würde mein Ausscheiden in der Berichterstattung des Standard mit Stillschweigen übergangen – andernfalls müsse er über die Gründe berichten: „Und ich weiß nicht, was das für einen Eindruck auf die Staatsanwaltschaft macht.“ Das war nicht als Drohung gemeint, sondern sollte mich schonen. Aber es zeigte mir, dass Bronner überzeugt war, in mir einen Kriminellen engagiert zu haben. In späteren Interviews pflegte er zu sagen, er wolle sich zu meinem Fall nicht äußern, aber es war klar, was er davon hielt. Es war undenkbar, dass er einen Franz K. zum Freund gehabt
395
396
Schuld und Sühne
hätte und noch undenkbarer, dass er den gebeten hätte, bei einem Staatsanwalt ein gutes Wort für eine der Korruption verdächtige Person einzulegen. Dennoch schmerzte mich, dass er offenbar ernsthaft glaubte, ich habe eines finanziellen Vorteils wegen so gehandelt. Schließlich kannte er mich seit vielen Jahrzehnten. Er wusste, wie ich zu ihm gehalten und Handgeld und Co-Chefredaktion des Kurier ausgeschlagen hatte, als fast alle Redakteure des trend-Verlages ihn verlassen wollten. Ich dachte, dass er wüsste, dass ich nie für Geld für jemanden intervenieren würde, wohl aber sehr oft aus Freundschaft jemandem geholfen habe. Aber er scheint mich anders eingeschätzt zu haben und ich muss zugeben, dass damals tatsächlich alles, was der Standard über meinen Fall berichten konnte gegen mich sprach. Ich ging in ein Nebenzimmer, um mich mit meiner Frau zu beraten, Bronner zog sich zur Beratung mit seinem Co-Geschäftsführer zurück. Der erschien etwas später, um mir mitzuteilen, dass man doch gewillt sei, meine gesetzliche Abfertigung zu bezahlen – auf alle anderen Ansprüche müsse ich unabhängig vom Ausgang eines allfälligen Strafverfahrens verzichten. Das tat ich selbstverständlich, weil ich es immer vorgehabt hatte. Mit Bronner habe ich durch die nächsten zwanzig Jahre kein Wort gewechselt – mittlerweile grüßen wir einander wieder. Staatsanwalt Johann Fuchs, heute selbst eines Amtsmissbrauchs verdächtigter Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien (seine Verurteilung in erster Instanz wurde vom Oberlandesgericht aufgehoben), der mich bis dahin als Zeugen vernommen hatte, lud mich jetzt erstmals als „Beschuldigten“ vor. Das Gespräch zwischen ihm und mir war bis dahin ein besonders angenehmes gewesen – ich hielt für möglich, dass er zu meinen Lesern zählte – jetzt war es weiterhin ein sehr höfliches, aber zwangsläufig bohrendes: Fuchs wollte eine Erklärung für meine Sätze am Tonband. Aber statt sie wenigstens sofort so zu erklären, wie ich es letztlich tat, versuchte ich ihm eine völlig unglaubwürdige Lüge aufzutischen. Ich merkte, wie enttäuschend er das fand – aber die Panik, in die ich geraten war, hinderte mich daran, auf eine Weise zu handeln, die mir im Strafverfahren nützen würde. Immerhin war mir nach dieser Einvernahme klar, dass ich einen Strafverteidiger brauchte. Ich wendete mich also an Daniel Glattauer, dessen Gerichtssaalberichte im Standard ich so sehr geschätzt hatte, erzählte ihm meine Geschichte in der Hoffnung, dass er mich nicht für einen geldgierigen Kriminellen halten würde und bat ihn, mir den in seinen Augen besten Strafverteidiger zu nennen. Seine Antwort war eindeutig: Herbert Eichenseder. Eichenseders erste Erkundigungen in meinem Fall sahen eher positiv aus. In der Staatsanwaltschaft, so erzählte er mir, rätsle man, was man mit mir anfangen könne. Franz K. zu warnen sei für sich gesehen noch kein Delikt. Man würde mich im Prozess gegen ihn als Zeugen laden und abwarten, was sich aus meiner Aussage ergebe. Der Richter, der den Vorsitz in diesem Verfahren führe, Paul W., würde mich allerdings
Angst
denkbar scharf vernehmen – erstens sei er dafür bekannt und zweitens nicht gerade mein politischer Freund. (W. war Mitglied eines Vereins zur Pflege des deutschen Liedgutes und bekannt für seine Forderung nach Wiedereinführung der Todesstrafe) Nach diesen vergleichsweise positiven Informationen aus dem Wiener Landesgericht trat Eichenseder einen Urlaub an. Auch ich fuhr mit Eva und Eric auf Urlaub – möglichst weit weg ins kroatische Trsteno, wo wir gegen Ende des Jugoslawienkrieges ein Haus gekauft hatten. In diesem notdürftig hergerichteten Haus – es war im Krieg in Brand gesteckt worden – verbrachten wir in brütender Hitze einen Urlaub, bei dem ich versuchte, mit der Möglichkeit einer Anklage fertig zu werden, die mich zum Verbrecher stempeln konnte, und die ich dennoch in gewisser Hinsicht nicht als völlig ungerecht empfand: Ich hatte ja schwerste Schuld auf mich geladen: Ich hatte meiner Mutter etwas angetan, das „schlimmer als Auschwitz“ war – meine erste Familie zerstört, indem ich mich um Evas willen von ihr getrennt hatte. Das Gefühl untilgbarer Schuld ergriff in solchem Ausmaß Besitz von meinem Kopf, dass ich nichts anderes denken und fühlen konnte – wäre Eva nicht jede Sekunde bei mir gewesen, ich hätte mich umgebracht. „Hab keine Angst, schau auf zum Himmel um zu lernen, wie absolut egal Millionen Sternen, die Frage deiner Schuld und Sühne ist. Du misst noch immer mit dem falschen Maß. Zerbrich das über Dich gestülpte Stundenglas. Gib Dich der Ewigkeit des Weltalls hin, und jeder Augenblick hat wieder Sinn. Hab keine Angst, auch meine Liebe ist gelassen, ein Fels, ein Berg, ein Meer, ein Baum. Wenn wir einander an den Händen fassen, sind wir ein Stern in einem andren Raum“, habe ich ihre Worte in einem Gedicht zusammenfasst. Einmal besuchte uns Alfred Worm und suchte, mir Optimismus zu vermitteln: Es sei undenkbar, dass ich wegen meines Telefonanrufs angeklagt würde. Auch für meine Frau hatte er Trost: Wir sollten uns doch endlich den Kauf eines Konzertflügels leisten, den wir aus Angst vor der Empörung meiner Mutter über eine so große Ausgabe ständig aufgeschoben hatten – das würde unser beider Laune verbessern. Einen Moment tröstete sein Optimismus. Aber kaum waren wir wieder in Österreich zurück und hatten den Flügel erworben, war dieser Trost vergessen. Die Weite des Meeres war der Nähe des Prozesses gewichen und ich fühlte mich mit meiner Schuld wieder alleine. Während sie mich bis dahin gelähmt hatte, brauste und hämmerte sie jetzt wieder dröhnend in meinem Kopf und trieb mich dazu, wie manisch etwas zu unternehmen, um Linderung zu erlangen. Ich erinnerte mich meiner Kindheit bei der katholischen „Dekanin“, und wie sehr mich ihr Glaube an Gott damals getröstet hatte. Obwohl ich mittlerweile in keiner Weise religiös war, bat ich Salzburgs Bischof Reinhold Stecher um ein privates Gespräch. Ich kannte ihn aus Briefen, die wir gewechselt hatten, nachdem er in seiner Diözese die Verehrung des „Anderl von Rin“ verboten hatte, der angeblich einem jüdischen Ritualmord zu Opfer gefallen war – das hatte mir imponiert und es hatte sich so etwas wie eine Brieffreundschaft daraus ergeben. Jetzt traf ich
397
398
Schuld und Sühne
Stecher, um mit ihm meine eigentliche Schuld zu besprechen: Die Schuld, meine Ehe gebrochen zu haben. Ich weiß nicht mehr, was er mir genau erwiderte – nur dass Gott vor allem barmherzig sei: Ich solle seiner Barmherzigkeit vertrauen. Nach dem Gespräch ging es mir besser, aber kaum war ich wieder in Wien, erfasste mich neuerlich die alte Unruhe – ich konnte unmöglich nichts tun, musste ständig etwas unternehmen. So wollte ich wenigstens Menschen, die mir wichtig waren, davon überzeugen, dass ich kein Krimineller war, der auf Geld aus war, sondern jemand, der jemandem aus Dankbarkeit helfen wollte. Ich setzte mich an die Schreibmaschine und schrieb in etwa zusammen, was ich hier über meine Motive niedergeschrieben habe: Warum ich Walentina Hummelbrunner so dankbar war; warum ich ihr helfen wollte, obwohl mir klar war, dass das nicht korrekt war; und nicht zuletzt, um absolut ehrlich zu sein: dass mir der Ausbruch aus dem absolut korrekten Verhalten, für das ich bekannt war, sogar eine gewisse Genugtuung bereitetet hatte – dass ich durchaus darauf hoffte, dass meine Intervention Erfolg haben würde. Ich schrieb diesen Text für mich selbst, für meine Frau, für meine Mutter und für Kollegen, auf deren Freundschaft und moralisches Urteil ich wertlegte, voran meinen Chefredakteur beim Kurier und Partner beim Versuch eine eigene Zeitung zu gründen, Hugo Portisch – es schien mir Sinn zu machen, ihnen dieses Schreiben zu schicken. Doch plötzlich ergriff mich die absurde Vorstellung, dass auch Staatsanwalt Fuchs mich besser begreifen würde, wenn er es las: Ich fasste die wahnwitzige Absicht, es auch ihm zu schicken. Meine Mutter, über den Inhalt des Textes erschüttert, überredete mich, ihn vorher wenigstens einem ihr befreundeten Richter zu zeigen. Der war, als ich ihn aufsuchte, ein todkranker Mann und sollte wenig später an Prostatakrebs sterben. Er las den Brief durch und sagte dann die entscheidenden Worte, beinahe wie Bischof Stecher: „Haben Sie Vertrauen in die Justiz – wenn es ihr Gewissen erleichtert, dann übergeben sie ihr dieses Papier.“ Ein letztes Mal bevor ich es abschickte, zeigte ich es einem weiteren quasi „Sachverständigen“: dem Psychoanalytiker Harald Leupold-Löwenthal, mit dem ich befreundet war – nur meiner Frau zeigte ich ihn, wie so vieles, nicht. „Bist Du wahnsinnig? Von der Strafjustiz psychologisches Verständnis zu erwarten, zeugt von Realitätsverlust. Wenn die von Deinen Schuldgefühlen lesen, gibt’s nur eine mögliche Reaktion: Na der muss ordentlich Dreck am Stecken haben. Und wenn Du glaubst, Du kannst denen etwas so Diffiziles auseinandersetzen wie den Umstand, dass bei Deiner saublöden Intervention auch die unterbewusste Faszination des Unmoralischen mitspielen könnte – dann wirst Du schön schauen, was herauskommen wird. Sperr diesen Brief in einen Safe, damit Du ihn ja nicht abschickst“, beschwor mich Leupold-Löwenthal. Vergebens. Die Anklageschrift, die ich kurz darauf in Händen hielt, gab ihm mehr als Recht: Für sie war ich jetzt nicht mehr eine Randfigur, die jemanden warnen wollte, in ein Messer zu laufen, sondern der zentrale Täter.
Angst
Ich habe erzählt, dass mir Vergleichbares schon einmal passiert ist: Weil ich zu meinen Schulkollegen Heinz Hintermayer und Heinrich Litschauer, die Knallerbsen gekauft und geworfen hatten „ihr trauts Euch eh ned“ gesagt hatte, war ich vom Disziplinausschuss der Schule plötzlich zum Spiritus Rector dieser Aktion erklärt worden, obwohl weder Litschauer noch Hintermayer das behauptet hatten. Die Staatsanwaltschaft Wien entschied nicht sehr viel anders: Obwohl weder Staatsanwalt Wolfgang M. noch Franz K. – für den es entlastend gewesen wäre – behauptet hatten, ich habe die Idee gehabt, Walentina Hummelbrunner um ein paar Millionen zu erleichtern, und obwohl sie selbst diesen Verdacht schon gar nicht hegte, wurde mir von der Anklage eben dies unterstellt: Ich habe Franz K. Geld geborgt und entdeckt, dass er in Wirklichkeit pleite sei, weil sein Projekt eines Nobelaltersheims gescheitert sei – deshalb hätte ich mich gesorgt, mein Geld von ihm nie mehr zurückzuerhalten. Gleichzeitig hätte ich vom Strafverfahren gegen Walentina Hummelbrunner erfahren und sofort begriffen, dass es nur im Wege eines Amtsmissbrauches aufgehalten werden könne. In den von der Anklage genutzten Worten: „Er, (Lingens) sprach daher seinen Freund K. auf dessen Freundschaft zu Dr. M. an, setzte ihm auseinander, dass alleine Dr. M. Hummelbrunner auf die bezeichnete Weise (Niederschlagung des Verfahrens) vor den ihr drohenden nachteiligen Folgen bewahren könne und eröffnete ihm zugleich die Perspektive, wie man in weiterer Folge die Verpflichtung der wohlhabenden Frau Hummelbrunner … gewinnträchtig nutzen könnte.“ Derart präpariert sei K. „übers Ziel hinausgeschossen, so dass er in seinem ungestümen Tatendrang erpresserisch vorgegangen ist. Für Lingens’ Motivation sei freilich ‚entscheidend‘ gewesen, dass er die Chance erkannte, von K. einen Geldbetrag von 2,5 Millionen Schilling zurückzuerhalten.“ Dass Staatsanwalt Wolfgang M. zum benötigten Amtsmissbrauch jederzeit bereit und fähig sei, wisse Lingens aus einem gemeinsamen Gespräch mit ihm und Wiens Polizeipräsidenten; doch weil Walentina Hummelbrunner sich an die Polizei gewendet habe, sei sein Plan gescheitert. Als ich diese Anklage las, gefror mir einmal mehr das Blut in den Adern: In meinen schlimmsten Albträumen hatte mir zwar vorstellen können, dass man mir die Beihilfe zu einer Straftat anlastet –, dass ich sie mir ausgedacht hätte, erschien mir so absurd wie seinerzeit der Vorwurf, mittels Knallerbsen zur Religionsstörung aufgefordert zu haben. Meine Mutter und meine Frau, beide Juristinnen und ähnlich vor den Kopf gestoßen, meinten, man müsse Einspruch gegen diese absurde Anklage erheben, aber Anwalt Eichenseder winkte ab: Das sei aussichtslos und kontraproduktiv, denn die Generalprokuratur habe ihr schon zugestimmt. Die ursprüngliche Anklage, die Staatsanwalt Fuchs entworfen hatte – in ihr waren Franz K. und Staatsanwalt Wolfgang M. die Initiatoren der Tat und ich nur eine rätselhafte Begleitfigur – sei endgültig durch diese ersetzt. Diesem Rat Eichenseders fügte ich mich und verzichtete auf einen Einspruch. Ich möchte aber hier – weil es dabei immerhin um mein Schicksal ging und weil in den Auseinandersetzungen zwischen der ÖVP und der Wirtschafts- und Korrup-
399
400
Schuld und Sühne
tionsstaatsanwaltschaft gelegentlich so getan wurde, als seien fragwürdige Anklagen absolut undenkbar, doch auf ein paar Probleme der Anklage gegen mich eingehen, so sehr ich meine, dass die aktuelle Anklagebehörde die seit langem effizienteste ist. Ich werde meinen Fall daher in der Folge so streng nach dem Buchstaben des Gesetzes abhandeln, wie das nach Ansicht von Rechtsexperten, Richtern und Staatsanwälten ständig geschieht.
Anatomie eines Verfahrens Klar ist, dass Erhebungen gegen mich einzuleiten waren, nachdem K.s Frau den Behörden das Tonband von meinem Anruf übergeben hatte, und nachdem ich selbst eingestanden hatte, K. gebeten zu haben, bei M. ein gutes Wort für Hummelbrunner einzulegen. Diese Erhebungen nicht einzuleiten, bloß weil ich prominent war und als besonders anständig galt, wäre absurd gewesen. Schließlich hatte gerade ich die Staatsanwaltschaft Wien in meinen Kommentaren im profil durch siebzehn Jahre dafür kritisiert, Verfahren trotz dringender Verdachtsmomente nicht einzuleiten, wenn sie auch nur entfernt Probleme für die regierende SPÖ erwarten ließen: In der sogenannten „Bauringaffäre“, bei der dieses Unternehmen der Stadt Wien Millionen in den Wüstensand gesetzt hatte, hatte sie beispielsweise ein Konto bei einer vom profil genannten Bank nicht geöffnet, obwohl dorthin nachweislich aus Arabien Millionen überwiesen worden waren und die arabischen Auftraggeber über den Zweck dieser erstaunlichen Überweisung das diametrale Gegenteil der Bauring-Verantwortlichen gesagt hatten. Auch als zwei Betrüger Felix Slavik gefälschte Belege verkauften, die beweisen sollten, dass profil von der ÖVP drei Millionen Schilling erhalten hätte, um den Wiener Bürgermeister fertigzumachen, sah die Staatsanwaltschaft keinen Grund, sie anzuklagen – ein Richtergremium musste eine „Subsidiaranklage“ beschließen, um sie des Betruges zu überführen. Der Höhepunkt der Verfahrensscheue der Wiener Anklagebehörde war zweifellos der Skandal um die Megakorruption bei der Errichtung des Wiener Allgemeinen Krankenhauses, bei dem die Staatsanwaltschaft auf Einstellung des Verfahrens plädierte und nur durch eine Untersuchungsrichterin dazu gezwungen werden konnte, es doch zu führen und ein ominöses Konto in Liechtenstein zu öffnen. Meine diesbezügliche Kritik am Leiter der Staatsanwaltschaft Wien, Otto F. Müller, war sozusagen amtsbekannt, hatte er doch einmal beinahe durchgesetzt, die Telefone des profil abhören zu lassen, um zu erfahren, woher wir vertrauliche Informationen erhielten, die eine Staatsanwältin betrafen, die ihn rechtswidriger Weisungen zur Behinderung eines Verfahrens beschuldigt hatte. Es wäre also abwegig gewesen, wenn die Staatsanwaltschaft ausgerechnet im Umgang mit einem gegen mich erhobenen, keineswegs grundlosen Verdacht ungerechtfertigte Zurückhaltung gezeigt hätte – sie ermittelte mit aller Energie und ich war der Letzte, der sich darüber beschweren durfte.
Anatomie eines Verfahrens
Allerdings sagt die österreichische Strafprozessordnung, dass sie, anders als etwa die amerikanische Anklagebehörde, die Pflicht hat, nicht nur alles zu ermitteln, was für den gegen mich erhobenen Verdacht spricht, sondern auch alles, was mich entlastet und gegen ihn spricht. Darüber hinaus darf sie eine Anklage am Ende nur erheben, wenn sie von ihrer Richtigkeit überzeugt ist und zudem annehmen muss, dass sie auch zu einer Verurteilung führen wird. (Ich halte das übrigens für höchst problematische Erfordernisse, aber das ist ein anderes Thema.) Der Verdacht gegen mich war klar: Ich konnte vorgehabt haben, den Staatsanwalt Wolfgang M. auf dem Umweg über Franz K. zum Amtsmissbrauch anzustiften. Nicht so klar war mein Motiv. Denn die von mir vorgebrachte psychologische Begründung hatte die Anklageschrift verworfen – vielmehr sah sie mein Motiv darin, dass ich befürchte, Franz K. würde mir ihm überlassenes Geld nicht zurückgeben, weil er mit seinem Bemühen, ein Wiener Innenstadthotel in ein Altersheim umzuwandeln krachend Schiffbruch erlitten hatte und vor der Pleite stehe – da hätte ich die Chance gesehen, dass er sich durch seinen Beitrag zur amtsmissbräuchlichen Einstellung des Verfahrens gegen Walentina Hummelbrunner saniert und seine Rückzahlung an mich einhalten kann. Diese These hat einige Haken: So behauptete die Anklage zum Beispiel, mir sei sofort klar gewesen, dass das Verfahren Hummelbrunner nicht anders als amtsmissbräuchlich einzustellen sei. Aber im Widerspruch dazu steht die Realität: Das Verfahren wurde ohne jedes Zutun von K., M. oder mir rechtskräftig eingestellt. Bei der Frage, ob ich wirklich so dringend Geld brauchte, dass ich bereit war, dafür ein Verbrechen zu begehen, hätte man doch auch meine Vermögensverhältnisse prüfen müssen: Ich besaß damals ein aus Gewinnen meiner Firmen finanziertes Haus im Wert von neun Millionen Schilling (654.055 €), einen Verlag, der mit einer ganzen Reihe erfolgreicher Zeitschriften damals etwa 1,5 Millionen Schilling netto (109.000 €) im Jahr abwarf, dazu eine funktionierende Firma für Heizungs- und Elektroinstallationen, durch die wir soeben zwei sanierte Wohnungen am Modenapark teuer (n um mehrere Millionen Schilling) verkauft hatten; darüber hinaus und beinahe zuletzt war ich gut bezahlter Chefredakteur des Standard und hatte, weil es mir so gut ging, der Geschäftsführung eben angeboten, meine Kollegin Elfriede Hammerl für ein Drittel meines Gehalts als Kolumnistin zu engagieren. Selbst wenn K. mein ihm übergebenes Geld verloren haben sollte, hätte ich das problemlos verkraftet – jedenfalls ungleich problemloser als ein Verfahren wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Aber die Staatsanwaltschaft hat sich gar nicht erst bemüht, meine Vermögensverhältnisse zu eruieren, und ich gebe zu, dass nur zu oft auch solche Leute betrügen, stehlen oder veruntreuen, die es in keiner Weise nötig haben. Die Staatsanwaltschaft nahm offenbar an, dass ich in diese Kategorie gehöre. Schon etwas erstaunlicher war ihre Annahme, dass ich um mein Geld fürchte, weil ich um K.s Pleite mit seinem Altersheimprojekt wusste. Denn ich hatte davon keine Ahnung und hielt es, soweit ich es kannte, für eine blendende Idee. Vor allem aber hatte
401
402
Schuld und Sühne
ich K. nur wenige Tage vor dem Eden-Besuch anderthalb (nicht zweieinhalb) Millionen Schilling (109.000 €) übergeben, um sie für mich anzulegen – und das tut man nur sehr, sehr selten, wenn man die bevorstehende Pleite des Betreffenden fürchtet. Die Anklage und der vorsitzende Richter Paul W. hielten diesen Widerspruch offenbar für nicht wirklich erheblich. Bei Staatsanwalt Fuchs bin ich dessen nicht so sicher. Er schloss den Vortrag der Anklage, die jedes Strafverfahren einleitet, nämlich mit einem angesichts der Strafprozessordnung erstaunlichen Satz ab: Der Prozess müsse erweisen, ob sich alles tatsächlich der Anklage gemäß zugetragen habe. Das größte Problem bereitete der Anklage allerdings die Judikatur. Urteile des Obersten Gerichtshofes besagen nämlich: Voraussetzung für die Strafbarkeit als Amtsmissbrauch auf dem Umweg über einen Dritten „ist in subjektiver Hinsicht, dass der Bestimmende (der Anstifter) es für gewiss hält, der Beamte werde bei bestimmungsgemäßem Verhalten vorsätzlich seine Befugnis missbrauchen“. Weniger juristisch: Ich hätte überzeugt sein müssen, dass Staatsanwalt M. zum Amtsmissbrauch bereit ist. In meinem Fall übersprangen Anklage und Urteil diese Klippe, indem sie ausführten, dass ich aus einem gemeinsamen Mittagessen mit dem Wiener Polizeipräsidenten Günther Bögl und Staatsanwalt M. wisse, dass M. „Interventionen zugänglich“ ist. Im ganzen Prozess wurde dennoch kaum über dieses gemeinsame Mittagessen gesprochen. Weder Staatsanwalt M. noch vor allem Polizeipräsident Bögl wurden dazu vernommen, und offenbar hatte das auch die Staatsanwaltschaft nicht getan, sonst hätte die Anklage es ausgeführt. So sollte das so wesentliche Mittagessen erst bei der Wiederholung des Prozesses vor dem Landesgericht in Krems zum Gegenstand einer Zeugenaussage werden, obwohl es von der Judikatur her entscheidenden Einfluss auf das Urteil haben musste. Dass es zu diesem zweiten Prozess kommen musste, folgte aus der Prozessführung durch Präsident Paul W. – oder präziser der Art und Weise, in der er sein Urteil abfasste. Im Prozess selbst agierte W. exakt so, wie ich es von einem Richter erwartet hatte, der die Wiedereinführung der Todesstrafe fordert und „das deutsche Liedgut“ pflegt: Statt mir zumindest die vage Möglichkeit zu geben, mein Handeln zusammenhängend zu begründen, stellte er nur Fragen, die anders als mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten, er wütend unterbrach. Recht typisch für den Verlauf der Verhandlung war die im Gegensatz dazu eingehende Befassung mit einem Foto, das eines der Palais der Walentina Hummelbrunner zeigte und einen Text der Wochenpresse illustrierte. Der Staatsanwalt ging davon aus, dass es von der Fotografin Nora Schuster-Merlicek stamme und damit ein Indiz für die Verwicklung des vierten Angeklagten, des Rechtsanwalts Manfred Merlicek in den Amtsmissbrauch sein konnte: Er habe das Foto womöglich bei seiner Frau in Auftrag gegeben, um Hummelbrunners Vermögensverhältnisse zu erkunden. Ich bin bisher noch nicht auf die Anklage gegen Manfred Merlicek eingegangen, weil seine behauptete Verwicklung in den Fall in Wirklichkeit einem Justizskandal gleichkommt: Er war K.s sehr erfolgreicher Anwalt in dessen zahllosen Auseinandersetzungen
Anatomie eines Verfahrens
mit Kfz-Versicherungen gewesen und als K. Walentina Hummelbrunner weismachen wollte, dass er ihr in ihrem Strafverfahren helfen könne, hatte er sie gedrängt, sich von Merlicek vertreten zu lassen. Hummelbrunner war dem, in der Meinung, dass K. ihr durch einen besonders guten Anwalt helfen wolle, gefolgt und hatte Merlicek tatsächlich gebeten, sie zu vertreten. Der hatte denkbar korrekt den Anwalt angerufen, der sie bis dahin vertreten hatte, und dessen Einverständnis erbeten – das war alles, was er in ihrer Angelegenheit tat. Die Anklageschrift hatte daraus Merliceks Bereitschaft konstruiert, den Amtsmissbrauch durch Staatsanwalt M. zu erleichtern und in der Verhandlung sollte das Foto seiner Frau als Beleg für sein Motiv dienen: Es informierte ihn angeblich über Hummelbrunners Reichtum. Darüber wurde lange verhandelt – bis sich herausstellte, dass das Foto gar nicht von Nora Schuster-Merlicek, sondern einem ganz anderen Fotografen stammte. Offenbar auf der Basis dieses nie überprüften Indizes und seiner bloßen Rechtsbeziehung zu K. war Merlicek nicht nur angeklagt, sondern in U-Haft genommen worden und sechs Wochen im grauen Haus gesessen. Er erlitt wenige Tage nach der Verhandlung trotz seines Freispruches einen Herzinfarkt. Anwalt Eichenseder hatte mich auf diese Art der Prozessführung vorbereitet und mir geraten, nur möglichst oft „Jawohl, Herr Präsident“, zu sagen. Ich hätte das auch getan, wenn ich nicht von Weinkrämpfen geschüttelt worden wäre, als ich versuchte, zu erklären, warum ich Walentina Hummelbrunner so dankbar für ihr Verhalten gegenüber meiner Schwiegertochter gewesen bin. Ich muss auch eingestehen, dass der Eindruck, den ich vor Gericht machte, nicht der eines angesehenen 57-jährigen Journalisten war, den man für seine präzisen, sachlichen Analysen kannte, sondern dass ich als ein Mensch erschien, der – offenbar unter dem Druck einer präzisen, begründeten Anklage – vor dem psychischen Zusammenbruch steht und selbst der geringsten Belastung nicht mehr gewachsen ist. Nur dass die Belastung so gering nicht war. Was Eva und ich den „Fluch“ meiner Mutter genannt hatten, stand unmittelbar vor der Erfüllung: Aus einem geachteten Chefredakteur, den manche Leute das „Gewissen der Nation“ nannten, war ich zu einem zwielichtigen Geächteten geworden. Wenn es nach dem Willen des vorsitzenden Richters Paul W. gegangen wäre, wäre ich im Gefängnis gelandet. „Ich verurteile ihn auf jeden Fall“, hallte in mir wider, was er meinem Anwalt gesagt hatte, „ich weiß nur noch nicht, nach welchem Paragraphen.“ Ich empfand das auch nicht als ungerecht. Denn es gab in meinem Verhalten noch eine weitere Ebene, die ich erstmals wahrnahm, als ich nach K.s Verhaftung völlig mit mir alleine war: In mir blitzte die Vorstellung auf, wie gut und richtig es wäre, im Gefängnis zu sitzen und die Schuld abzutragen, die ich wirklich auf mich geladen hatte: Die Schuld, meine erste Frau und drei Kinder für meine zweite Frau zu verlassen.
403
404
Schuld und Sühne
„Was Du mir antust, ist schlimmer als Auschwitz“, klangen die Worte meiner Mutter in jeder Sekunde in mir nach und riefen nach der schwersten denkbaren Bestrafung. Eine Bestrafung, auf die ich zielsicher hinarbeitete, obwohl ich damit auch das Glück meiner zweiten Familie aufs Spiel setzte. Angefangen mit meinem Ersuchen an Franz K., sich bei Wolfgang M. für Walentina Hummelbrunner einzusetzen, obwohl weder sie noch Christine mich darum gebeten hatten; fortgesetzt durch das Gespräch auf einem Anrufbeantworter, der mein Fehlverhalten unbestreitbar auf Tonband bannte; und vollendet durch ein Schreiben an die Staatsanwaltschaft, das überhaupt erst dazu führte, dass die ursprüngliche Anklage gegen mich verworfen und durch eine neue, mit mir als zentralem Täter ersetzt wurde. Man hätte Selbstzerstörung nicht zielführender durchführen können.
Eine Verschwesterung Man könnte freilich auch sagen, dass der heraufbeschworene Strafprozess mir letztlich ermöglichte, meine erste und meine zweite Familie zu versöhnen. Anders als für die Staatsanwaltschaft war für meine erste Frau Lisi, wie für meine zweite Frau Eva gleichermaßen klar, dass ich in dieses Strafverfahren nur geraten war, weil ich mich für Walentina Hummelbrunners Verhalten gegenüber meiner künftigen Schwiegertochter und meinem Sohn dankbar erweisen wollte – sie kannten mein Verhältnis zu meinen Kindern. Dass mir der Richter nun dennoch Haft in Aussicht gestellt hatte, führte dazu, dass Lisi Eva erstmals in ihr Haus nach Mauer einlud, um gemeinsam zu besprechen, wie sie mich vor dem psychischen Zusammenbruch bewahren könnten. Selbst meine Mutter behinderte diese Verschwesterung nicht bewusst. Die beiden Frauen begleiteten mich gemeinsam ins Landesgericht und nahmen nebeneinander in den Besucherbänken Platz, während ich auf der Anklagebank Platz nahm. Nur in einem Interview mit der Zeitschrift NEWS konnte meine Mutter ihre Gefühle nicht verbergen: Dass es so weit mit mir gekommen sei, erzählte sie der Interviewerin, liege daran, dass ich durch Eva mit einem Menschen wie Franz K. in Kontakt gekommen sei, den ich als Ehemann meiner ersten Frau gemieden hätte. Meine Mutter behauptete zwar, die Interviewerin habe ihr zugesagt, sich nur ganz privat dafür zu interessieren, wie ich Franz K. kennengelernt habe und nichts darüber zu schreiben – was ich in Kenntnis dieser Kollegin für möglich halte – aber ihre ehrliche Meinung war das Gesagte zweifellos: Meine Mutter glaubte sich zu ihrem Fluch berechtigt. Nachdem der Prozess in zwei Tagen Verhandlung immer nur das Gleiche erbracht hatte –, dass K. nämlich von Hummelbrunner immer energischer sechs Millionen Schilling gefordert hatte, um die Einstellung ihres Verfahrens zu erreichen und dass Staatsanwalt Wolfgang M. dazu nicht den geringsten Beitrag geleistet hatte und leisten konnte, weil das Verfahren vom Untersuchungsrichter übernommen worden war, endete
Zweimal Krems
der Prozess am 6. August 1996 nach stundenlanger Beratung damit, dass K. wegen Erpressung zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt wurde. Wolfgang M., Manfred Merlicek und ich wurden freigesprochen. Als Paul W. die Freisprüche verkündete, brandete im vollbesetzten großen Schwurgerichtssaal Beifall auf. „Ruhe“, brüllte W., „sonst lasse ich den Saal räumen.“ Dann begründete er das Urteil wie vorgesehen vorerst mündlich. Klar und deutlich begründete er meinen Freispruch in Gegenwart des beisitzenden Richters und der Schöffen damit, dass es „nicht anginge, in meiner Frage, ob K. bei Staatsanwalt M. nicht ein gutes Wort für Hummelbrunner einlegen könne, auch schon Anstiftung zum Amtsmissbrauch zu sehen.“ Vor dem Landesgericht fielen Eva, Lisi und ich einander gegenseitig um den Hals. Eine ausnehmend sympathische Journalistin von NEWS, die die Szene beobachtet hatte, bat mich, ihr zu erzählen, was wir jetzt tun würden und wie ich den Prozess erlebt hätte. Ich wolle lieber keine Interviews geben, sagte ich ihr – sie würde auch gar nichts schreiben, antwortet sie, es interessiere sie einfach privat. „Natürlich war das Verfahren abenteuerlich“, erzählte ich ihr darauf in etwa, „Sie haben ja erlebt, wie Paul W. nur Belastendes hören und Entlastendes einfach nicht wahrnehmen wollte. In keinem anderen westeuropäischen Land wäre eine solche Prozessführung möglich gewesen.“ Zwei Tage später konnte ich das Gespräch, das ich privat und vertraulich zu führen glaubte, wortwörtlich in NEWS lesen. Ich weiß nicht, ob und wie weit das auf die schriftliche Urteilsausfertigung Einfluss hatte, die ich zwei Monate später zitternd in Händen hielt: Selbstverständlich, so erklärte Paul W. dort, habe meine Äußerung Wolfgang M. zum Amtsmissbrauch angestiftet und auch sonst hätte ich exakt so agiert, wie die Anklage behauptet – doch sei ich freizusprechen gewesen. Am 7. August 1996, dem Tag meines Freispruches, stand dessen absurde Begründung, die ihn zwingend aufheben musste, freilich noch in den Sternen. Ich dankte meinem Verteidiger Herbert Eichenseder und sah meinem Geburtstag am 8. August wie einer Wiedergeburt entgegen.
Zweimal Krems Ich war im „Prozess des Jahrzehnts“ zwar freigesprochen, aber natürlich war die Rückkehr zum Standard schon Bronners Haltung wegen ausgeschlossen. Um irgendetwas zu tun, arbeitete ich in der Werbeagentur meines Tennis-Freundes Christian Mang, verließ sie aber schon wenige Monate später, um ein völlig unerwartetes Angebot anzunehmen: Der konservative Chefredakteur der Presse Andreas Unterberger bot mir, der doch
405
406
Schuld und Sühne
eher der Linken zugezählt wurde, an, Kommentare für die Rubrik „Quergeschrieben“ zu verfassen. Er war der Erste, der bereit war, in mir wieder einen Journalisten zu sehen. Nachträglich tut mir leid, dass ich „Quergeschrieben“ letztlich aufgegeben habe, um wieder Kommentare fürs profil zu schreiben. Unterberger musste das als Undankbarkeit empfinden – aber das Heimweh war zu groß. Noch jemand sah in mir unverändert einen anständigen Journalisten: Maximilian Gottschlich, Professor für Publizistik an der Universität Wien berief mich zum Lektor seiner „Akademie für Publizistik“ an der Donau-Universität Krems – ich sollte dort „Stil“ lehren. Das war insofern schwierig, als besonders viele Studenten aus dem ehemaligen Ostblock stammten und Deutsch nur gerade sprechen konnten. Gottschlich brachte es irgendwie fertig, ihnen Stipendien, voran des Sponsors VW, zu verschaffen, denn er hielt zu Recht für wichtig, dass sie, in ihre Heimat zurückgekehrt, jenen Journalismus vertreten sollten, der ein wesentliches Element der Absicherung einer freien Gesellschaft ist. Nach einem Jahr habe ich den Vertrag mit Krems aufkündigt, als Gottschlichs Vertrag aufgekündigt wurde – ich glaubte ihm das schuldig zu sein. Krems sollte für mich dennoch überragende Bedeutung erlangen – wenn auch in ganz anderem Zusammenhang: Dort, nur ein paar Fahrminuten von der Universität entfernt, sollte mein zweiter Strafprozess ablaufen. Denn der Oberste Gerichtshof konnte gar nicht anders, als das freisprechende Urteil wegen inneren Widerspruches aufheben – der Fall, so entschied er in einer nur halbstündigen Sitzung, müsse neuerlich verhandelt werden. Frank Höpfel, Professor am Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität Wien, der der Verhandlung am Wiener Landesgericht von Beginn an beigewohnt und das schriftliche Urteil studiert hatte, hatte ursprünglich erwogen, eine Anzeige wegen Verdachts des Amtsmissbrauches gegen Paul W. zu erstatten, begnügte sich dann aber mit einem Artikel für das Rechtspanorama der Presse, in dem er auf „Rechtsschutzlücken im Strafprozess oder: Der Freispruch, der keiner war“ einging: Es sei ein doch eher gravierendes Problem, wenn mündliche und schriftliche Urteilsbegründung diametral entgegengesetzt ausfielen, so dass ein Freispruch zwingend ungültig werde. „Eine fehlerhafte Begründung“, so formulierte er entlang einer naheliegenden Vermutung, „kann dadurch zu erklären sein, dass sie von einem überstimmten Mitglied des Senates abgefasst wurde, woraus eine gewisse Befangenheit entsteht. Zeichnet sich eine solche Situation ab, so hätte der Vorsitzende den Beisitzer zu beauftragen. Die Geschäftsordnung zwingt ihn aber nicht dazu – sie enthält eine bloße Ermessensvorschrift. Damit berührt sie nicht die Gültigkeit des Urteils, wohl aber das Prinzip des fair trial.“ Für mich bedeutete die „Rechtsschutzlücke“ etwas Simpleres: Ich stand vor dem nächsten Prozess. Herbert Eichenseder versuchte zwar, das in der Verhandlung vor dem Obersten Gerichtshof abzuwenden, indem er argumentierte, der Oberste könne das aufgehobene
Hauptsache weg
Urteil anhand der gesicherten Beweise von sich aus durch ein freisprechendes Urteil ersetzen – aber mir war klar, dass das nicht gelingen würde. Ich selbst wollte Jahre später einen Vertreter des Justizministeriums – ich glaube es war der höchste Beamte von Justizministerin Claudia Bandion-Ortner – ebenfalls auf die Problematik hinweisen, dass der Vorsitzende die schriftliche Urteilsbegründung unkontrolliert nach seinem Gutdünken abfassen könne, stieß aber auch nicht auf ernsthaftes Interesse. Weil der Oberste Gerichtshof in seinem Urteil zu Recht die Befangenheit von Wiener Strafrichtern für möglich hielt, war das neuerliche Verfahren dem Landesgericht Krems zugewiesen worden. Herbert Eichenseders einziger Trost: Kein Richter in Krems sei mit Paul W. vergleichbar. Tatsächlich verlief die Kremser Verhandlung so, wie man sich eine mitteleuropäische Gerichtsverhandlung vorstellt. Der vorsitzende Richter und die beisitzende Richterin fragten ruhig und sachlich – niemand brüllte. Meine Frau wurde nicht beinahe der falschen Zeugenaussage verdächtigt, als sie erklärte, keine Ahnung von der Pleite K.s mit seinem Altersheim zu haben. Und vor allem ging das Gericht erstmals auf das so wesentliche Mittagessen zwischen Polizeipräsident Günther Bögl, Wolfgang M. und mir ein, dem ich angeblich entnommen habe, dass M. jederzeit sein Amt missbrauchen würde. Bögl sagte aus, er habe mich ersucht, eine Angelegenheit, die eigentlich voran seine Frau betraf, nicht neuerlich aufzurühren und die anderen Zeitungen hätten ihm das bereits zugesagt – nur profil habe noch gefehlt. Doch hätte ich eine solche Zusage, wie auch Wolfgang M. sich erinnerte, nicht gegeben. Im Oktober 1998 wurde ich auch vom Schöffensenat in Krems freigesprochen. Als der Staatsanwalt neuerlich Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung anmeldete, wurde mir schwarz vor den Augen. Ich erlitt zwar nicht, wie Manfred Merlicek, einen Herzinfarkt – ich hätte nur am liebsten nicht mehr gelebt: „So verurteilt mich doch endlich, wenn ihr das unbedingt wollt“, schrie ich, „ich will lieber verurteilt werden, als noch einmal zehn Jahre warten zu müssen! Dann ist es wenigstens vorbei.“
Hauptsache weg Die Vorstellung, dass mir dieser Prozess noch ein drittes Mal drohen könnte, war für mich in diesem Augenblick tatsächlich schlimmer als die mir beinahe vertraute Vorstellung, einsam in einer Zelle zu sitzen – ich fühlte mich von diesem Staat, dem ich immerhin durch Jahrzehnte zu dienen glaubte und mindestens bis zum 6. Jänner 1996 untadelig gedient hatte, verfolgt: War ich wirklich ein Schwerverbrecher, weil ich Franz K. gefragt hatte, ob er bei Wolfgang M. nicht ein gutes Wort für Walentina Hummelbrunner einlegen könne?
407
408
Schuld und Sühne
Zwar ließen mich Freunde, von Bronner vielleicht abgesehen, das nicht fühlen – Hugo Portisch nannte mich im Interview einen „höchst ehrenwerten Mann“, der „so viel Verfolgung nicht verdient“ habe, Politiker wie Franz Vranitzky, Ferdinand Lacina oder Heinz Fischer reagierten nicht anders als früher, wenn ich sie gelegentlich als Autor der Presse anrief – aber ich hatte dennoch ständig das Gefühl, für jeden Bürger weithin sichtbar ein gestreiftes Häftlingsgewand zu tragen. Um diesem Gefühl zu entkommen, wollte ich unseren Urlaub einmal mehr in unserem Haus im kroatischen Trsteno verbringen. Es ging mir dort auch gleich besser: Ich hatte ein besonders vergnügliches Zusammentreffen mit einem meiner ehemaligen Studenten an der Kremser Journalismus-Akademie, der im nahen Dubrovnik zu Hause war, und genoss einmal mehr die Ruhe und Weite des Meeres. Am Wochenende setzten wir mit dem kleinen motorisierten Ruderboot, das wir uns angeschafft hatten, zur nahen Insel Lopud über und nahmen dort in einem Fischrestaurant ein frühes Abendessen ein, um rechtzeitig wieder heimzukommen. Unser Tisch im Freien stand Rücken an Rücken mit einem weiteren Tisch, von dem ich jetzt österreichische Worte hörte: „Was hat denn der Lingens g’macht?“, fragte eine Frau einen Mann über ein Strafverfahren, das offensichtlich Gegenstand des gemeinsamen Tischgespräches einer größeren Gruppe war. „A Russin hat a abstieren wollen“, antwortete der. Das war der Moment, in dem ich beschloss, Österreich zu verlassen. Bei Evas Vater, einem Meteorologen, erkundigten wir uns, in welcher Region des Mittelmeeres wir das beste Klima vorfänden – denn in Kroatien war es im Sommer unerträglich heiß und im Winter sehr kalt gewesen. „Eindeutig die Küste Andalusiens“, hatte er geantwortet und ich hatte mir eine Liste internationaler Schulen für Eric an dieser Küste besorgt. Gegen Weihnachten flogen wir bereits nach Málaga, um nach einem neuen Wohnort samt Schule zu suchen. Wir verfielen auf „Salobreña“, an der „Costa Tropical“, das in einem Buch über die schönsten Orte des Mittelmeers als einzige Destination Spaniens angeführt war, weil es fast wie Saint-Malo auf einem Berg mit riesiger Felsflanke beinahe im Meer gelegen ist und von einer prachtvollen maurischen Festung – dem letzten Rückzugsort der Mauren nach ihrer Vertreibung aus Granada – gekrönt ist. In der Villensiedlung „Monte de los Almendros“ (Berg der Mandelbäume), die der Felswand von Salobreña gegenüberliegt und einen herrlichen Blick auf sie eröffnet, erwarben wir die Option für den Kauf eines Hauses mit riesigem Garten zum Preis einer größeren Wiener Wohnung, denn eine internationale Schule war in Almuñécar nur zehn Autominuten entfernt. In den folgenden Semesterferien besuchten wir Salobreña mit Eric, zeigten ihm das Haus, das wir vielleicht erwerben würden, und es gefiel ihm nicht nur, sondern er schien sich in diesem fremden Land wohlzufühlen. Oder ahnte in Wirklichkeit nur, wie sehr ich mich danach sehnte, Österreich zu verlassen und nach Spanien zu übersiedeln: „Warum übersiedeln wir denn nicht schon?“,
Hauptsache weg
fragte er uns jedenfalls im Sommer und so schlossen wir unsere Firma für Installationen, verkauften unser Haus in Enzesfeld und bereiten unsere Abreise vor. Es war der Tag vor unserer Abreise, an dem wir den Garten meiner ersten Frau Lisi in Mauer aufsuchten, um uns zu verabschieden. Als wir gegen Abend auf das Tor zugingen, das vom Garten auf die Straße führt, begleiteten uns der BernhardinerSchäfer-Mischling Kolumbus und ein zweiter Hund des Hauses. „Meine Hunde, meine Hunde“, schluchzte Eric plötzlich auf und warf sich auf den Boden, um sie zu umarmen. Aber statt zu begreifen, was ich ihm antat, drängte ich nur zur Eile. „Ich hasse Spanien“, sollte Eric ein paar Monate später an die Mauer unseres Hauses in Salobreña schreiben, nachdem örtliche Jugendliche eine Schnur über die Straße gespannt hatten, um ihn zu Fall zu bringen, als er sie mit seinem Fahrrad entlangfuhr. Für ihn war die Eingewöhnung anfangs zweifellos am schwierigsten – Kinder können gnadenlose Chauvinisten sein. Einfach war die Eingewöhnung auch für meine Frau nicht: Wir hatten das Haus, dessen Kauf wir noch im Sommer abgeschlossen hatten, einer Baufirma zum Umbau übergeben, um einen großen Wohnraum zu erhalten, in dem ihr Bösendorfer-Konzertflügel Platz finden sollte, aber als wir ankamen, war der Umbau nicht entfernt fertig – es fehlten noch alle Fenster, Türen und Installationen. Der in eine riesige Holzkiste verpackte Flügel und unsere von einer Spedition angelieferten Enzesfelder Möbel, aber auch Koffer mit Hausrat und Kleidung, konnten zwar mit einem Kran durch die riesige Fensterfront des künftigen Wohnzimmers gehievt werden – dann aber mussten wir die Fensterfront provisorisch mit Plastikplanen verschließen und eine brauchbare Bleibe suchen. Wir fanden sie, indem wir – diesmal um den Preis einer Wiener Garçonnière – ein Haus auf dem antiken Hauptplatz von Salobreña, unterhalb seiner maurischen Festung kauften und jeweils zum Rohbau am „Monte“ fuhren, wenn wir etwas aus den Akten unseres Verlages oder Hausrat aus einem Koffer brauchten. Aber das antike Haus am alten Hauptplatz von Salobreña war wunderschön – in seinem „Patio“ (Hof) gab es die Überreste einer phönizischen Säule und wie in Enzesfeld war uns die prachtvolle Kirche des Ortes benachbart. Als wir in diesem Patio mit seinem rot gefliesten Boden erstmals ein herrliches, spanisches Frühstück mit riesigen Eiern zu uns nahmen, war ich nahe daran, meinen Entschluss zur Übersiedlung zu feiern. So schmerzhaft Erics erste Erfahrung mit den ansässigen Buben gewesen war, so gut war sie mit den ansässigen Mädchen: Ob er eine „Novia“ (Braut) habe, wollte die zwölfjährige Tochter eines Nachbarn wissen, und als wir für ihn verneinten, meldete sich ihre sechsjährige Schwester: „Wenn er meine Schwester nicht will, könnte er mich nehmen“, erklärte sie uns mit erster Mine und verstand nicht, warum wir lachten. In den Tagen darauf spielte Eric mit den Söhnen der Nachbarn bereits Fußball am Marktplatz, auch wenn sie ihn dabei durchwegs klar übertrafen. Ich selbst vertrug die Übersiedlung mit Abstand am besten. Meine Tätigkeit als Antiquitätentischler, deren desaströses Ende ich beschrieben habe und die vielen Wohnungsrenovierungen, die ich organisiert und mit unseren Firmen durchgeführt hatte,
409
410
Schuld und Sühne
hatten mir eine Reihe diesbezüglicher Fertigkeiten vermittelt: Ich konnte Mauern errichten und verputzen, Schalungen für Beton fertigen oder Fliesen verlegen, und der Umstand, dass die spanischen Arbeiter bemerkten, dass ich ihre Arbeit zu schätzen wusste, weil ich etwas davon verstand, ließ mich, nachdem ich das notwendigste Vokabular erlernt hatte, wie schon in Österreich besonders gut mit ihnen auskommen. Tatsächlich sollten wir in den nächsten Jahren auch davon leben, dass ich alte Häuser kaufte – am alten Hauptplatz Salobreñas waren es gleich drei – sie renovierte und dann vermietete oder verkaufte. War es mir schon zuvor im Gegensatz zu den Annahmen der Staatsanwaltschaft wirtschaftlich sehr gut gegangen, so ging es uns nun blendend. Ich glaubte, die Affäre Hummelbrunner endgültig hinter mir zu haben und versuchte die letzte verbliebene Klippe zu überwinden: Indem ich meine Mutter zu einem Winterurlaub in unserem Haus am warmen „Monte“ einlud, hoffte ich, ihren durch 16 Jahre konservierten Hass gegen meine zweite Frau zu überwinden. Und beinahe schien mir das am dritten Tag zu gelingen: „Ich habe gar nicht gewusst, dass Du so begabt bist“, sagte sie, als sie Eva zum ersten Mal auf ihrem Flügel eine Beethoven-Sonate spielen hörte – um freilich schon tags darauf ins alte Muster zurückzufallen: „Ein wirklich herrliches Haus, einen herrlichen Garten und ein Schwimmbad habt ihr hier – und Lisi sitzt in Mauer und hat nichts.“ Das wiederholte sich alle paar Tage, wobei die Bewunderung für Eva meist dünner und der Hinweis auf Lisis Leid meist intensiver ausfiel. Als ich Eva vorschlug, den Aufenthalt meiner Mutter um weitere Monate zu verlängern, weil ihr die Wärme so gut tue, weigerte sie sich: „Ich halte das einfach nicht aus.“ „Du musst es aushalten. Meine 88-jährige Mutter versucht nach sechzehn Jahren, sich mit Dir zu versöhnen – ich weiß, dass sie immer wieder zurückfällt, aber sie versucht es ehrlich – da kann ich von Dir verlangen, dass Du nicht aufgibst.“ „Du musst doch sehen, dass es einfach nicht geht.“ „Dann müssen wir uns eben trennen“, sprang es mir über die Lippen und obwohl ich es im nächsten Augenblick zurücknehmen wollte, war es ausgesprochen und löste die erste Krise in unserer Ehe aus, die eine innere Ursache hatte. Meine Mutter reiste nach fast sechs Monaten ab, und wenig später erlitt ich einen massiven Herzinfarkt. Der Infarkt zeitigte unerwartete wirtschaftliche Folgen in Wien: Die Mannschaft, die meine mittlerweile vier Zeitungen für das Rote Kreuz produziert hatte, stellten mich vor die Alternative, ihr die Produktion dieser Zeitschriften in Eigenregie zu überlassen oder auf ihre weitere Mitarbeit zu verzichten. Mein physischer Zustand ließ mir wenig Wahl: Was meine Frau und ich alleine behielten war das Jugendmagazin TOPIC, nur dass der Mitarbeiter, der es bisher als Chefredakteur geleitet hatte, es nun als Haupteigentümer einer eigenen Zeitungsproduktionsfirma sehr viel teurer leitete. Ich konnte ihn in dieser Funktion nicht loswerden, weil das Rote Kreuz in unserem Vertrag diesbezüglich ein Mitspracherecht besaß, aber als er im Glauben für mich, wie fürs Rote Kreuz unverzichtbar zu sein, selbst kündigte, um neue Bedingungen durchzu-
Hauptsache weg
setzen, nahm ich diese Kündigung gegen heftigen Widerstand des Roten Kreuzes an und machte TOPIC wieder selber. Dass der Gewinn darauf schon im folgenden Jahr erheblich höher ausfiel, ließ auch das Rote Kreuz diese Lösung akzeptieren. Nur zum Herausgeber der von mir gegründeten Zeitschrift machte man mich nicht wieder: Ich hatte die Herausgeberschaft angesichts meines Prozesses zurückgelegt, um TOPIC nicht womöglich zu beschädigen, und man beließ es dabei, mich durch einen ehemaligen Sektionschef des Unterrichtsministeriums zu ersetzen, der mir in der Folge gelegentlich erklärte, wie man schreibt und eine Zeitung macht. Im Wesentlichen verstanden wir einander dennoch erstaunlich gut und in manchen Bereichen agierte er verlegerisch tatsächlich besser als ich: Während ich den TOPIC-Umfang zu Lasten der Gewinne freiwillig von den 48 Seiten unseres Schwesterblattes JÖ auf 64 Seiten erweitert hatte, riet er mir, zu den 48 Seiten zurückzukehren, weil die Lehrer zu wenig Zeit hätten, im Unterricht so viel Text zu verwenden. Unser Gewinn – und mit ihm der des Roten Kreuzes – stieg also unerwartet ein weiteres Mal. Über die Höhe der Provision des Roten Kreuzes gab es vor allem mit unserem Miteigentümer, dennoch ständige Auseinandersetzungen: Er – und ich – fanden, die rund sieben Prozent (neben einem noch stattlicheren Entgelt für den Buchklub, der das viel dichtere Referentennetz besaß), seien mangels jeglichen Risikos und marginalen eigenen Aufwandes des Roten Kreuzes reichlich – das Rote Kreuz sah es anders. Ein halbes Jahr nachdem wir unsere Hälfte 2019 an unseren Miteigentümer verkauft hatten, kündigte es unseren Kooperationsvertrag mit der redundanten Begründung, dass es den Kooperationsertrag mit dem Verlag gekündigt habe, so dass TOPIC nicht mehr die Bedingung erfülle, eine Zeitschrift des Roten Kreuzes zu sein. Über die Frage, ob das ein berechtigter Grund zur sofortigen Aufkündigung dieser Kooperation war, entbrannte ein Rechtsstreit, der bis heute andauert. Mittlerweile gibt es jedenfalls ein von meinem ehemaligen Team hergestelltes Konkurrenzprodukt des Roten Kreuzes zu TOPIC, das allerdings etwas mehr kostet. Ich kann aus allen diesen unternehmerischen Erfahrungen jedenfalls nicht schließen, dass es besonders zielführend ist, seine Mitarbeiter hoch zu bezahlen und zum Teil auch am Unternehmen zu beteiligen oder nach Jahren hoher und risikoloser Gewinne ein besonders partnerschaftliches Verhalten des Roten Kreuzes zu erwarten. Finanziell ist meine Frau und bin ich durch die veranlagten Gewinne vergangener Jahre und den Erlös aus dem TOPIC-Verkauf jedenfalls so abgesichert, dass ich es mir leisten konnte, meine Kolumnistentätigkeit für profil und danach für den Falter, als minimal bezahltes Hobby auszuüben. Sie war auch von Spanien aus gut möglich, rückte die Entfernung doch die Dimension österreichischer Entwicklungen in ein richtigeres Verhältnis.
411
63. Erstmals Schwarz-Blau
ÖVP-Obmann Wolfgang Schüssel war mir bis 1999 nur durch seine Intelligenz aufgefallen. Klein gewachsen, stets besonders adrett mit Mascherl statt Krawatte gekleidet, bei Home-Reportagen mit Vorliebe am Klavier paraphrasierend, wirkte er immer ein wenig wie ein in der Schule nicht so beliebter Vorzugsschüler, der freilich Mutters Liebling ist – man verstand, dass er das auszugleichen suchte, indem er der Öffentlichkeit vorführte, wie gut er Fußball spielte und wie schnell er auf Berge stieg. Doch sobald er den Mund aufmachte, war klar, was er am besten konnte: Blitzschnell denken, präzise formulieren und in jeder Diskussion Treffer landen. Er war der Einzige, der Jörg Haider in einer Fernsehdiskussion eine klare Niederlage zufügte. Was er sagte, hatte der Wirtschaftsbund der ÖVP schon immer, aber nie so klar und treffend gesagt: „Weniger Staat, mehr privat“, war ein wirksamer neoliberaler Slogan, den er glaubwürdig vor sich hertrug und anaand verfehlter betriebswirtschaftlicher Entscheidungen verstaatlichter Unternehmen wirkungsvoll zu illustrieren wusste. Schüssel strahlte „Wirtschaftskompetenz“ aus. Nur strahlte Franz Vranitzky die nicht minder aus – zugleich war seine soziale Sicht volkswirtschaftlicher Zusammenhänge damals in Österreich noch entschieden populärer als die neoliberale. Die SPÖ war seit Hannes Androsch mindestens so sehr wie die ÖVP als „Wirtschaftspartei“ etabliert und so gut er auch formulierte, so wenig konnte Schüssel den Rückstand der ÖVP in der Gunst der Bevölkerung vermindern. Da er auch kein fremdenfeindlicher Populist war, gewann sie auch in keiner Weise zu Lasten von Jörg Haiders FPÖ. Schüssel schien ein Talent ohne Chance auf Verwirklichung. Dass er 1999 offen mit dem Gedanken an Rücktritt spielte, falls die ÖVP bei den Wahlen im Oktober hinter die FPÖ zurückfallen sollte, schien auf den ersten Blick sowohl zu seinem Charakter wie zu seiner Situation zu passen. Tatsächlich wurde Schüssels ÖVP bei den Wahlen am 3. Oktober 1999 nur mehr drittstärkste Partei hinter Haiders FPÖ. In den folgenden, sich hinziehenden Koalitionsverhandlungen beanspruchte die ÖVP wie zuvor den Finanzminister, den die SPÖ ihr nicht geben wollte, obwohl auch sie Stimmen verloren hatte. Das war der Moment, in dem ich für möglich hielt, dass die Verhandlungen scheitern und dass Schüssel sich selbstständig machen könnte – sein Ehrgeiz war für mich immer unübersehbar. Ich begann in meinen Kommentaren jedenfalls relativ früh, die Entwicklung zu vermuten, die am 4. Februar 2000 ihren Abschluss finden sollte: Ein trotz VP-Mitgliedschaft
Erstmals Schwarz-Blau
widerstrebender Bundespräsident Thomas Klestil gelobte die Regierung der ersten VPFP-Koalition unter Wolfgang Schüssel als Bundeskanzler an. Die „national“ kaum exponierte Freiheitliche Susanne Riess-Passer wurde Vizekanzlerin und ihr damaliger Parteikollege Karl-Heinz Grasser Finanzminister. Haider selbst blieb Kärntner Landeshauptmann und graue Eminenz seiner Partei. Ich empfand diese erste schwarz-blaue Regierung nicht als die Katastrophe, als die ich 1970 Bruno Kreiskys Bundesregierung unter Duldung der FPÖ empfunden hatte. Und zwar aus den folgenden Gründen: Der Cordon sanitaire, der die FPÖ von jeder Regierungsbeteiligung ausgeschlossen hatte, war de facto bereits mit dieser rotblauen Kooperation Kreisky-Peter und de jure seit der Regierung Sinowatz-Steger durchbrochen. Im Gegensatz zum Kabinett Kreisky I wies das Kabinett Schüssel I keine ehemaligen SS-Leute und NSDAP-Mitglieder als Minister auf. Darüber hinaus war ich sicher, dass Wolfgang Schüssel seine FP-Partner, anders als Kreisky, richtig einschätzte und zuversichtlich, dass er sie so an die Wand spielen würde, wie er Jörg Haider in der Fernsehdiskussion an die Wand gespielt hatte. Nicht zuletzt hielt ich Jörg Haider trotz seiner braunen Entgleisungen in seiner Haltung für längst nicht so festgefügt wie Friedrich Peter, dem eine solche Entgleisung nur einmal, und von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, passierte: „Ich habe nur meine Pflicht getan“, hatte er geantwortet, als er im ORF nach seiner zweijährigen Tätigkeit in einer Woche für Woche mit Massenmord befassten Kompanie befragt wurde. Daran gemessen hielt ich Haider für lernfähig. Das Ausland sah das bekanntlich völlig anders und verhängte die berühmten „Sanktionen“ gegen Österreich, die die anfangs sehr bescheidenen Sympathien der Österreicher für die schwarz-blaue Regierung naturgemäß genauso erhöhen mussten wie die Ächtung des Auslands für Kurt Waldheim dessen Wahl zum Bundespräsidenten befeuert hatte. „Jetzt erst recht“, ist ein fester Bestandteil der österreichischen Identität rechts der Mitte.
413
64. Der Tag, der die Welt veränderte
Am 11. September 2001 sollte mir klar werden, wie unbedeutend selbst wesentliche Entwicklungen in Österreich in Wirklichkeit waren: Im spanischen Fernsehen sah ich, so fassungslos wie wohl jedermann, wie zwei Flugzeuge in die Türme des World Trade Center in New York und ein drittes ins Pentagon bei Washington krachten. Der arabische Terrorismus war mir natürlich geläufig. Schließlich hatte profil als einziges Medium schon den Mord an Stadtrat Heinz Nittel als terroristischen Akt der Abu-Nidal-Organisation erkannt und die intensive Auseinandersetzung mit ihr hatte mir selbst eine Morddrohung eingetragen. Aber dieser Terror, der sich voran gegen Israel und dessen Freunde richtete, hatte in Grenzen noch einen rationalen Hintergrund: Man konnte die Gründung Israels als Palästinenser aus nachvollziehbaren Gründen als feindlich empfinden. Was ich bis dahin nicht gekannt hatte, war die Verbindung des Terrorismus mit einem archaischen Islam, in dem der Kampf gegen die Lebensart des Westens als heiliger, sinnstiftender Krieg empfunden wurde. Ich glaube zwar unverändert, dass es sich bei den Attentätern um psychisch abnorme Persönlichkeiten handelt – einer von ihnen hielt in seinem Testament fest, dass keine Frau seinen Leichnam berühren dürfe – aber die Verschränkung mit der Religion ist beängstigend eng: Man muss wirklich glauben, im Himmel von 70 Jungfrauen als Märtyrer gefeiert zu werden, um vollbesetzte Flugzeuge in Wohnbauten zu steuern, in denen, wären sie schneller zusammengestürzt, 80.000 Menschen den Tod gefunden hätten. So, als 80.000-facher Mord, war der Anschlag jedenfalls geplant, nachdem ein Sprengstoffanschlag auf dasselbe Ziel misslungen war. Eine ganze Reihe massiver Anschläge – selbst gegen ein Kriegsschiff – ließ durchaus schon vorher zu, von einem Krieg islamischer Terroristen gegen den ungläubigen Westen zu sprechen. Charakteristisch für seine Irrationalität war, dass weder Bin Laden noch andere der primären Mitglieder der al-Kaida selbst aus bedrohten Ländern stammten: Bin Laden stammte bekanntlich nicht aus Afghanistan, sondern aus einer reichen saudischen Unternehmerfamilie und hatte es dennoch, wie voran eine Reihe von Ägyptern, als seine heilige Pflicht angesehen, in diesem fernen Land an der Seite der Mudschaheddin gegen die russische Armee zu kämpfen. Aber selbst darin konnte man noch die rationale Forderung nach der Befreiung eines Landes erblicken – kaum aber im Mord an tausenden amerikanischer Zivilisten, deren Regierung die Mudschaheddin im Kampf gegen die russische Armee mit viel Geld unterstützt hatte. Es war wirklich die nicht-islamische westliche Lebensart, die mit den Türmen des World Trade Centers in sich zusammenstürzen sollte.
Der Tag, der die Welt veränderte
Damit war meines Erachtens auch unvermeidlich, dass George W. Bush in einen „Krieg gegen den Terror“ zog. Die amerikanische Bevölkerung hätte nicht verstanden, wenn er anders darauf reagiert hätte, dass das World Trade Center entgegen der Absicht der Terroristen „nur“ 2.731 Menschen unter sich begrub, zu denen noch 265 als Passagiere der entführten Flugzeuge kamen. Es war auch durchaus verständlich, dass er hoffte, bei dieser Intervention die Taliban, die der al-Kaida Schutz und Trainingsmöglichkeiten geboten hatten, als Beherrscher Afghanistans abzusetzen, um dort einen Staat zu errichten, in dem Musik und Tanz nicht mehr verboten sind und Frauen nicht nur in Begleitung eines Mannes und verschleiert auf die Straße gehen dürfen. Nur hätte er bei besserer Kenntnis des Landes ahnen können, dass dieser Versuch auch mit einer schmerzhaften Niederlage enden konnte. Ich ahnte es deshalb, weil einer der weltbesten Journalisten, John Lee Anderson, der Afghanistan gut kannte, in Spanien zu meinem besten Freund geworden war. Die Freundschaft hatte zwei Ursachen: erstens, dass Anderson ebenfalls am Monte des los Almendros und später sogar in einem meiner Häuser in Salobreña wohnte, zweitens, dass ich auch nach vier Jahren in Spanien viel besser englisch als spanisch sprach. In Wien hatte ich zwar kurz einen Spanischkurs besucht und war eigentlich rasch vorangekommen, weil ich Französisch als Unterrichtssprache gehabt hatte, aber jetzt in Spanien gerieten mir die beiden so eng verwandten Sprachen ständig durcheinander. Ich verstand zwar halbwegs gut, wenn ein Spanier halbwegs langsam sprach – was bei den meisten Spaniern ihrem Naturell zu widersprechen scheint, meist sprechen sie wie Maschinengewehre – aber selbst konnte ich mich eigentlich nur den Bauarbeitern, mit denen ich ständig zu tun hatte, halbwegs verständlich machen. Eric dagegen sprach bald wie ein Andalusier und Eva, die nacheinander eine Reihe immer schwierigerer Kurse besucht hatte, legte schließlich die Übersetzerprüfung ab. Jetzt erst merkte ich, wie sehr Sprachkenntnis mit Integration zusammenhängt: Eva integrierte sich in Spanien ungleich besser als ich. Sie war ein ungleich beliebterer Gast in einem langsam entstehenden spanischen Bekanntenkreis, denn sie konnte auch zur Unterhaltung beitragen, während ich nur zuhören konnte. Hinzu kam, dass mit Ausnahme der Mutter von Erics Freundin, einer Journalistin, niemand gerne über Politik sprach – am liebsten wurde von der Qualität des Essens, der Schönheit von Kleidern oder von glücklichen oder unglücklichen Beziehungen gesprochen. So kam es, dass John Lee Anderson zu meinem mit Abstand wichtigsten Gesprächspartner nach meiner Frau und meinem Sohn wurde, weil ich nur mit ihm länger über Politik sprechen konnte – ich verbesserte mein Englisch statt meines Spanisch. Anderson arbeite vor allem für den New Yorker, aber auch für Time und Life. Seine Spezialität waren Reportagen aus Ländern, von denen man wenig wusste, weil in ihnen Krieg herrschte oder weil ihre autoritären Regime keinen freien Zugang gewährten. So war er auch länger in Afghanistan gewesen, und was er mir von dort erzählte, klingt 2021, während ich diese Zeilen schreibe, prophetisch: Es sei völlig ausgeschlossen,
415
416
Der Tag, der die Welt veränderte
dort als fremde Armee einen Krieg zu gewinnen. Die Niederlage der Russen, die einer kommunistischen Regierung zur Hilfe kamen, sei vorprogrammiert gewesen, denn die Afghanen kämpften ebenso fanatisch wie verschlagen, ebenso mutig wie opferbereit. Ihr Wille zur Selbstbehauptung könne durch nichts und niemanden gebrochen werden. Anderson hatte über Afghanistan ein Buch mit dem vielsagenden Titel „The Lion’s Grave“ (Das Grab des Löwen) geschrieben, und wenn George Bush es gelesen hätte, hätte er die US-Truppen schon 2002 wieder abgezogen. Den internationalen Durchbruch hatte Anderson mit der Standardbiographie des kubanischen Nationalhelden Che Guevara „CHE“ erzielt. Als Einziger hatte er dabei auch die Schattenseiten dieses linken Idols, dessen Foto Millionen Jugendzimmer und T-Shirts ziert, recherchiert: Als einer von Guevaras Kampfgefährten sein Gewehr für einen Moment unbewacht stehenließ, hatte er dessen strengste Bestrafung gefordert, denn für einen Guerillero war das zweifellos ein großer Fehler. „Erschießt ihn“, hatte er seine Kameraden aufgefordert. Aber die hatten sich geweigert, einen Mann, der durch Jahre an ihrer Seite gekämpft hatte zu erschießen – da hatte er seinen Revolver gezogen und es selbst getan. Nachdem er diese Szene in seinem Buch festgehalten hatte, hatte sich eine Reihe weiterer Mitstreiter Guevaras gemeldet und Ähnliches berichtet – das Idol so vieler freiheitsliebender Menschen hatte eine pathologische Beziehung zum Töten. Gleichzeitig verursachte Guevara Kubas bis heute andauernde Wirtschaftskrise: Er war es, der nach einer Moskaureise die Verstaatlichung aller Unternehmen und selbst der Landwirtschaft durchgesetzt hatte. Dass er als Arzt gleichzeitig für Kubas hervorragende medizinische Versorgung verantwortlich zeichnet, wiegt diesen gewaltigen wirtschaftlichen Schaden nicht auf. Am Rande zählten auch zwei Kubaner, die nach Spanien geflohen waren, zu unseren Gesprächspartnern und erzählten uns ihre sehr typische Lebensgeschichte: Der eine war der Sohn eines Bauern, der immer auf Fidel Castros Seite gestanden war und im Sieg der Revolution auch einen persönlichen Sieg gesehen hatte. Bis das Regime ihm sein Land und seinen Hof wegnahm, um an dieser Stelle ein Hotel zu errichten und ihn zur Übersiedlung in ein 20-Quadratmeter-Haus in Havanna gezwungen hatte. Der Sohn, ein Bewegungstalent, hatte sich als Tänzer in Touristenlokalen durchgeschlagen und schließlich einen Fluchtversuch unternommen, der ihm Bisse eines Hais und einen längeren Aufenthalt im Gefängnis eintrug, in dem er Folter und Misshandlung erlebte. Das nächste Mal hatte er sich, statt zu fliehen, von einer rasch geheirateten Spanierin in ihre Heimat mitnehmen lassen und sich auch relativ rasch wieder von ihr getrennt. Er hatte darin ein nützliches Rezept im Umgang mit Frauen gefunden. Unser zweiter kubanischer Bekannter war der Sohn einer Opernsängerin und eines Architekten und gemessen an kubanischen Verhältnissen war es seiner Familie hervorragend gegangen. Dennoch hatte seine Mutter ein Gastspiel ihres Ensembles in Graz zum Absprung genutzt und schließlich in Andalusien Asyl erhalten. Ihr Sohn war als Mitglied des kubanischen Volleyballteams ebenfalls ein Privilegierter gewesen
Der Tag, der die Welt veränderte
– dennoch hatte auch er eine Europatournee seiner Mannschaft zum Absprung genutzt. Beiden, Mutter und Sohn, ging es nach ihrer Flucht alles andere als gut: Sie fand als schwarze Sängerin keine Anstellung mehr, denn davon hatte Spanien genügend, ihm untersagte der Weltvolleyballverband die Mitwirkung bei jedem Team, das dort Mitglied ist. Bei einigen Teams spielte er unter falschem Namen, dann war er für den Spitzensport zu alt und verdiente sein Geld, indem er sich bei spanischen Hochzeiten, bei denen das zum üblichen Programm zählt, als Stripper verdingte und gelegentlich als Fotomodell arbeitete. Derzeit versucht er, nachdem er sein Doktorat für Leibesübungen seit Jahren nostrifiziert hatte, als Polizist endlich eine Anstellung zu erhalten, die es ihm erlaubt, ausreichend für den gemeinsamen Sohn mit einer Spanierin aufzukommen. Im Grunde ist seine soziale Stellung eine ganz ungleich schlechtere als sie das damals in Kuba gewesen ist und heute in Kuba wäre – dennoch hielt er die kubanische Diktatur so wenig aus wie sein bäuerlicher Freund: Es ist eben bis heute eine düstere Diktatur – wenn auch unter Palmen. Anderson, der Kuba liebte, sah das größte Verbrechen, das diese Diktatur verübt hat, darin, dass sie das Land in ein Bordell verwandelt hat. Die Kubaner und Kubanerinnen, so sagte und schrieb er, seien tatsächlich die besten Liebhaber und Liebhaberinnen der Welt aus purer Lebensfreude – jetzt verkauften sie sich aus purer Not. Mein einziger kurzer Aufenthalt in Kuba bestätigte, was tausende Sextouristen erleben: Natürlich gibt es, wie seinerzeit in der Sowjetunion, offiziell keine Prostitution. Sie spielt sich, abseits der Hotels, die dafür einschlägige Reisen anbieten, so ab, dass sich, als ich mich in einen Park auf eine Bank setzte, ein Mann neben mir niederließ und mich flüsternd – der Kontakt zu Ausländern war verboten – fragte, ob ich nicht Lust hätte, seine Cousine kennenzulernen. Dass ich keine hatte, erfüllte ihn mit Bedauern. Von Frauen wird man dagegen nur angesprochen, wenn sie und ihre Freundinnen den Schutz eines Polizisten genießen, der auf diese Weise mitverdient. Das Land ist tatsächlich zu einem riesigen Bordell verkommen – mit den kommunistischen Funktionären als Zuhältern, denn der Sextourismus ist die wahrscheinlich wichtigste Einnahmequelle. Es ist manchmal seltsam, welche Gesellschaftsmodelle zur Linken idealisiert werden.
417
65. Von Haider zu Strache – die Geburt des BZÖ
In Österreich wandelte sich die SPÖ in diesen Jahren von einer linken Partei sukzessive zu der Partei, die sie heute ist: Nach Franz Vranitzky war mit Viktor Klima sein Verkehrsund Finanzminister und davor Manager der OMV ihr Obmann geworden. In der Sozialdemokratie war Klima ein weiterer Beleg für den stattgefundenen Generationenund Paradigmenwechsel: Für die Generation ihrer Heroen, von Viktor Adler über Otto Bauer bis Bruno Kreisky war charakteristisch, dass sie eigentlich der „Klasse der Bourgeoisie“, entstammten und sich um der Gerechtigkeit willen für die „Arbeiterklasse“ engagiert hatten. Für die neuen SP-Führer Vranitzky und Klima war charakteristisch, dass sie der Arbeiterklasse entstammten, sich aber aus ihr emporgearbeitet hatten: Jeder von ihnen hatte trotz der bescheidenen Einkünfte der Eltern, neben der Arbeit mit großem Erfolg studiert und beide sahen ihre Aufgabe darin, die gesellschaftlichen Verhältnisse, unter denen das möglich war, zu erhalten und allenfalls zu verbessern. Ordnete man Bruno Kreisky den Nadelstreifanzug vom Nobelschneider Knize am Wiener Graben zu, so assoziierte man mit seinen Nachfolgern Vranitzky und Klima eher einen Nadelstreifanzug von „Tlapa“ auf der Favoritenstraße – bei aufrechter Sehnsucht nach einem Knize-Anzug. Beinahe-Obmann Hannes Androsch, dessen Vater bereits ein wohlhabender Steuerberater gewesen war, lag irgendwo dazwischen. Klima war von Spanien aus gesehen eine Fortsetzung von Vranitzky mit noch viel weniger Charisma. Die Wählerschaft der SPÖ, die in ihrer Mehrheit ja auch längst nicht mehr aus Arbeitern, sondern aus vielfach durchaus gehobenen Angestellten bestand, konnte sich freilich mit diesem nach außen hin extrem bürgerlich gewordenen Parteivorsitzenden durchaus identifizieren – nur verlor die Partei mit ihm weiter an Strahlkraft: Sie bot keine Visionen mehr, sondern hatte erreicht, wofür sie angetreten war. Im Vergleich dazu bot die Schüssel-ÖVP mit „Weniger Staat, mehr privat“ bürgerlichen Wählern sehr wohl eine neoliberale Vision. Schüssel formte sein Kabinett nach einem Jahr der schwachen freiheitlichen Minister wegen zwar um, sorgte aber stets penibel dafür, dass man seiner Regierungstätigkeit selbst beim schlechtesten Willen keine „nationale“ Schlagseite nachsagen konnte – er beschloss, im Gegenteil, endlich ein Gesetz, arisiertes jüdisches Eigentum rascher zu ersetzen. Ebenfalls beschlossen wurde gegen gewaltige rote Empörung eine kleine Pensionsreform, die das Pensionssystem stärkte. Und gemäß Schüssels neoliberalem Motto „Weniger Staat, mehr privat“ kündigte sein Finanzminister Karl-Heinz Grasser – wie der Finanzminister Sebastian Kurz’ – das erste „Nulldefizit“ seit Jahrzehnten an. Die opponierende SPÖ fand das nicht wirtschaftlich verfehlt, sondern versuchte vorzurechnen, dass er es in Wahrheit nicht erreicht habe.
Von Haider zu Strache – die Geburt des BZÖ
Heute, da ich mehr von Wirtschaft verstehe, weiß ich wie blödsinnig „Nulldefizite“ sind – damals da ich nichts davon verstand, hielt ich Grasser, wie die Mehrheit der Österreicher für einen eher guten Finanzminister. Ansonsten bewahrheitete sich meine Vermutung, dass FPÖ-Funktionäre sich meist schon in dem Moment blamieren, in dem sie ein Ministeramt bekleiden: Der erste FP-Justizminister trat schon nach einer Woche wegen Unfähigkeit zurück. Wolfgang Schüssel beherrschte, wie ich es erwartet hatte, mit seiner Eloquenz, weit vor Susanne Riess-Passer, die politische Szene, und Jörg Haider konnte dem als Landehauptmann in Kärnten nichts entgegensetzen. Die FPÖ, das war klar, konnte in dieser Konstellation nur verlieren: In einer Koalition rechts der Mitte war sie neben der ÖVP der Schmiedl neben dem Schmied – zumal Schüssel sich fremdenfeindliche oder gar braune Ausfälle verbat und sie damit um ihre publikumswirksamste Argumentation brachte. So profitierte die SPÖ bei den Wahlen des Jahres 2002 zwar auch vom Niedergang der FPÖ – sie gewann 3,36 Prozent hinzu – aber sie blieb damit weit hinter den Zugewinnen der Schüssel-ÖVP von 15,39 Prozent. Das Scheitern der Koalitionsverhandlungen zwischen Schüssel und Klima nahm Klima auf seine Kappe, obwohl es von Schüssel ausging und übernahm einen Top-Job in der Privatwirtschaft: Er wurde Chef von VW-Argentinien. Die von Schüssel bevorzugte Einigung mit den Grünen scheiterte am Widerstand von deren linkem Wiener Flügel, sonst hätte es schon 2002 die erste schwarz-grüne Koalition gegeben, wie sie Sebastian Kurz 2020 mit Werner Kogler verwirklichte. Ich hielt und halte dieses Scheitern für einen schweren Fehler des grünen Parteichefs Alexander Van der Bellen wie Wolfgang Schüssels: Die beiden hätten dem Land eine zweite Koalition mit den Freiheitlichen – denn die wurde es bekanntlich – ersparen können. Denn nicht nur die unfähigen blauen Minister stellten ein dieser Partei immanentes Problem dar, sondern der größte, nämlich „nachhaltige“ Schaden erwächst Österreich aus den vielen im Rahmen von Koalitionen mit der FPÖ in hohe Verwaltungs- und Justizpositionen beförderten Freiheitlichen – man wurde und wird sie durch Jahrzehnte nicht mehr los und sie besaßen und besitzen dort nicht selten mehr reale Macht als in der Politik. Das ist auch die schlimmste Folge von zwei Jahren türkis-blauer Koalition unter Sebastian Kurz. Ich will diese extremen Reserven gegenüber freiheitlichen Funktionären – nicht gegenüber Wählern der FPÖ – begründen: Wer die FPÖ heute wählt, ist sich kaum je ihrer Herkunft aus einem Sammelbecken ehemaliger Nationalsozialisten oder der zahllosen „Ehemaligen“ und SS-Männern in der Reihe ihrer Funktionäre bewusst – er wählt diese Partei, weil er sich von den anderen Parteien vernachlässigt fühlt, weil er zu den sozial Abgehängten gehört und sich von der FPÖ vertreten fühlt, weil er Angst vor Zuwanderung oder in der Zeit der Pandemie die Lockdowns verflucht hat. Mit der braunen Vergangenheit der FPÖ und ihren bis in die Gegenwart so zahlreichen braunen Einsprengseln haben diese Motive nichts zu tun.
419
420
Von Haider zu Strache – die Geburt des BZÖ
Wenn jemand hingegen Funktionär einer Partei werden will, so hat er ein gewisses Interesse an Politik. Dann kann ihm die Vergangenheit der FPÖ nicht völlig unbekannt sein, dann muss er eine Ahnung von der SS- oder NSDAP-Vergangenheit so vieler ihrer Funktionäre haben, die Auseinandersetzung um Haiders Äußerungen am Ulrichsberg oder zu Hitlers Beschäftigungspolitik kennen, oder etwas von Peters Tätigkeit bei einer SS-Mordbrigade mitbekommen haben. Es gibt auch unverändert keine andere Partei, deren Funktionärskader sich vorzugsweise aus Burschenschaften rekrutiert, in denen man „zum Spaß“ davon singt, dass man die Vergasung der siebenten Million Juden schaffen würde. Wenn jemand sich dennoch zur politischen Mitarbeit ausgerechnet bei dieser FPÖ entscheidet, obwohl es zur Rechten mit der ÖVP eine unproblematische Alternative gibt, die sich etwa wirtschafts- oder gesellschaftspolitisch nicht wesentlich von der FPÖ unterscheidet, dann sind ihm diese massiven braunen Einsprengsel offenkundig vollkommen gleichgültig – und solche Leute sehe ich ungern im Nationalrat, als Minister, als Sektionschef oder gar als Höchstrichter. Diejenigen, die solche Einsprengsel zwar sehen, aber für selten halten, halte ich entweder für schwachsichtig oder für maßlos naiv – und sehe sie daher auch nicht gerne in der Politik. Ohne die Möglichkeit, lautstark gegen „Ausländer“ zu agitieren, weil Schüssel sich das verbat, erlebte die FPÖ in seiner Ära jedenfalls ihr bis dahin zweifellos schlimmstes Tief. Die von ihr forcierte Forderung nach einer Steuerreform sollte sie aus diesem Tief herausführen, aber aufgrund eines Jahrhunderthochwassers, das den Staat eine Menge Geld kostete, sah sich Schüssel veranlasst, diese Reform zu verschieben. Vizekanzlerin Riess-Passer, um den Ruf der FPÖ und Karl-Heinz Grasser um sein Nulldefizit besorgt, schlossen sich Schüssels Argumentation an und willigten in eine Lösung ein, die sich kaum von einem Aufschub unterschied. Aus meiner heutigen Kenntnis volkswirtschaftlicher Zusammenhänge müsste ich sagen, dass die Durchführung der Steuerreform richtig gewesen wäre, weil sie die Kaufkraft der Bevölkerung und damit die Konjunktur gestärkt hätte – wie ich es damals gesehen habe, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls empörte die Verschiebung der Steuerreform, zu der Riess-Passer und Grasser ihre Zustimmung gegeben hatten, das Gros der blauen Parteifunktionäre. Zwar kaum aus volkswirtschaftlichen Gründen, wohl aber weil sie sich um die Chance gebracht sahen, endlich wieder einmal bei der Bevölkerung zu punkten. Unter der Führung von Ewald Stadler, aber durchaus im Einverständnis mit Jörg Haider, der überlegte, doch wieder Parteiobmann zu werden, wurde die Forderung nach einem Sonderparteitag erhoben, der am 7. September 2002 im steirischen Knittelfeld stattfand und die Ablehnung jedes Kompromisses mit der ÖVP zur neuen Parteilinie erklärte. Zu den Funktionären, die besonders vehement auf diese kompromisslose Politik drängten, gehörte der damals noch nicht in vorderster Reihe stehende Heinz-Christian Strache
Von Haider zu Strache – die Geburt des BZÖ
– der damit wahrscheinlich den Grundstein zu seiner Karriere bis an die Parteispitze legte. Nachdem ihr Kompromisspapier vom Kärntner FP-Granden Kurt Scheuch am Rednerpult demonstrativ zerrissen worden war, traten Susanne Riess-Passer und Karl-Heinz Grasser zurück und die schwarz-blaue Koalition war gesprengt. Die Wahlen des Jahres 2002 sollten offenbaren, wie sehr die FPÖ durch die Koalition an der Seite der ÖVP gelitten hatte: Sie rasselte von 52 auf 18 Mandate herunter und erzielte nur mehr ein Drittel der Stimmen von 1999. Die ÖVP dagegen steigerte ihre Mandate von 52 auf 79 Mandate und war damit triumphaler Wahlsieger und erstmals nach 1966 wieder stärkste Partei. Die Parallele zu Kurz’ triumphalem Wahlsieg 2019 ist offenkundig. Bei den Wahlen zum Europaparlament im Juni 2005 erreichte die Riess-PasserFPÖ ihren absoluten Tiefpunkt: Statt einstigen 23,4 Prozent erreichte sie nur mehr 6,31 Prozent der Stimmen – Rechtsaußen Andreas Mölzer holte via Vorzugsstimmen das einzige Mandat. Als Reaktion machte Jörg Haider seine Schwester Ursula Haubner zur neuen Parteiobfrau – als Zugeständnis an den rechten Parteiflügel in Wien avancierte Heinz-Christian Strache zum Landesparteichef und zu einem ihrer Stellvertreter. Die katastrophalen Umfragewerte ließen es in der Partei brodeln: Ein Links-Rechts-Richtungsstreit entbrannte. Haubner entmachtete den rechten Parteiflügel, darunter auch Strache. Nach dem Parteiausschluss von EU-Mandatar Mölzer eskalierte der Konflikt. Beim FPÖ-Parteitag wurde eine Kampfkandidatur Haider gegen Strache erwartet. Doch es kam anders: Am 4. April 2005 gründete Haider mit Teilen der bisherigen Regierungsmannschaft das BZÖ – mit ihm selbst als Parteichef. Das führte dazu, dass die FPÖ ihn für drei Tage ausschloss, ehe es dort zur Palastrevolution kam: Heinz-Christian Strache löste Jörg Haider als Parteichef ab und sollte diese Funktion durch zwölf Jahre, bis „Ibiza“, innehaben. Haiders BZÖ gab sich ein erstaunlich liberales, kaum mehr nationales Programm und einen ebensolchen Auftritt und verblieb damit in der Koalitionsregierung mit der ÖVP, fällte aber wahrscheinlich schon sein eigenes Todesurteil – es sollte bis zu den NEOS dauern, bis eine liberale Partei sich in Österreich erfolgreich etablieren konnte. Ich habe als Journalist zu keinem Zeitpunkt den Fehler gemacht, Strache als schwache Haider-Kopie abzutun: Er war in sich immer weit stimmiger „national“ und fremdenfeindlich und im Gegensatz zu Haider kein politisch komplizierter und vor allem kein psychisch komplizierter Mensch: Österreichs nationale Wähler konnten sich auf seine xenophobe Politik verlassen. Schon bei den Wahlen des Jahres 2006 erreichte die FPÖ mit seinem Kurs immerhin 26 Mandate, das BZÖ nur mehr vier. Ganz ähnlich ist das jetzt mit Herbert Kickl. Dass Haider am 11. Oktober 2008 alkoholisiert in den Tod raste, war der durchaus stimmige Abschluss eines Lebens mit in sich zutiefst gespaltener Persönlichkeit.
421
66. Ein fremdes Land, verwandte Probleme
Auch Spanien war ein Land, das eine „Vergangenheit“ zu bewältigen hatte und während die Herrschaft Hitlers mehr als ein halbes Jahrhundert zurücklag, waren in Spanien 1999, als wir dorthin übersiedelten, erst 24 Jahre seit dem Tod des „Generalissimo“ Franco vergangen und erst rund 20 Jahre, seit erstmals freie Wahlen stattgefunden hatten. Ich wusste zwar um Francos Diktatur – ein Freund meiner Mutter, den ich gut kannte, hatte als „Spanienkämpfer“ am Bürgerkrieg teilgenommen und selbstverständlich waren wir nie nach Spanien auf Urlaub gefahren, obwohl es mit sonnigen Stränden und niedrigsten Preisen lockte – aber es ist ein großer Unterschied zwischen dem „Wissen“ um eine Diktatur und dem „Bewusstsein“ davon. Ich wusste also, dass Francos Diktatur dem Austrofaschismus unter Engelbert Dollfuß ähnlich, nur noch viel enger mit dem Katholizismus verbunden war. In Wirklichkeit sind die Unterschiede gewaltig: Auch unter Dollfuß gab es zwar einige Konzentrationslager, in denen Gegner interniert waren – aber in Spanien gab es Dutzende davon und seine Gegner wurden dort bis in den Tod gefoltert. Eine Million Spanier war unter Franco eingesperrt, nicht einige wenige, sondern hunderttausende waren gefoltert und hingerichtet worden. Anders als Dollfuß, der in Hitler immerhin den Teufel erkannt und die Nationalsozialisten bekämpft hatte, war Franco überhaupt erst durch die militärische Hilfe Hitlers und Mussolinis an die Macht gekommen, indem sie ihm halfen, den Bürgerkrieg zu gewinnen. Allenfalls die Bevölkerung war vergleichbar gespalten in begeisterte Anhänger Francos und voran kommunistische und sozialdemokratische Gegner seiner Politik. So wie es in Österreich zahllose alte Nazis gab und gibt, gab und gibt es in Spanien weiterhin zahllose „Franquisten“ – allerdings haben sie erst jetzt in der rechtsextremen VOX so etwas wie ein politisches Sammelbecken. Bis dahin wählten sie die konservative „Partido Popular“ und fühlten sich dort vor allem in der Ära José Aznars gut aufgehoben. In Andalusien, wo die längste Zeit die sozialdemokratische PSOE dominierte, waren sie vergleichsweise selten anzutreffen, wohl aber stieß man dort immer wieder auf deutsche Nazis, die nach dem Krieg hierher übersiedelt, wenn nicht geflohen waren: Einige der größten Anwesen auf den Hügelkuppen rund um Salobreña gehörten ihnen und wurden, wie im Film, von deutschen Schäferhunden bewacht. Dass wir mehr über Francos Herrschaft erfuhren, lag vor allem daran, dass das hübscheste Mädchen seiner internationalen Schule Erics erste spanische Freundin geworden war, und ihre Eltern uns in ihr Haus einluden. Hinzu kam, dass ihre Mutter Journalistin war und uns vor allem über die Situation der Frauen unter Franco informierte – daran gemessen waren sie unter Dollfuß und selbst Hitler emanzipiert gewesen.
Ein fremdes Land, verwandte Probleme
Die so enge Verbindung mit einem besonders konservativen Katholizismus, der immerhin die Inquisition hervorgebracht hatte, verbannte die spanische Frau restlos zu Haus und Herd und unterwarf sie wie fast nirgendwo sonst in Europa dem männlichen „Familienoberhaupt“. Dieser mächtige Staatskatholizismus ist bis heute spürbar. Jeder zweite Mann heißt Jesús oder mindestens José (Josef) auch wenn er Pepe, wie bei uns Pepi gerufen wird. Frauen heißen natürlich bevorzugt María. Selbst im sozialdemokratischen Andalusien gibt es unzählige katholische Privatschulen und Heime und Braut, „novia“, zu sein ist für Spanierinnen unverändert von überragender Bedeutung. Auch die überragende Bedeutung der Prostitution ist als typisches Relikt katholischer Sexualmoral bis heute erhalten: Außerehelicher Geschlechtsverkehr findet in der spanischen Generation meines Alters in Bordellen statt. Deshalb gibt es am Eingang und am Ausgang jedes andalusischen Städtchens oder selbst kleinen Ortes ein Bordell. Auch der Widerstand gegen diesen Katholizismus ist freilich rundum spürbar. Die spanische Porno-Industrie floriert; in einem Striplokal Barcelonas ist der Geschlechtsverkehr eines kleinwüchsigen Mannes mit mehreren Frauen grauslicher (zum Verlassen des Lokals animierender) Höhepunkt des Programms. Am seltsamsten machte sich der Widerstand vieler Spanier gegen die katholische Kirche bemerkbar, als die Regierung im Zuge des Beitritts zur EU die Straffreiheit der Homosexualität beschloss: Ursprünglich war eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung dagegen – aber als die Bischofskonferenz sich öffentlichkeitswirksam gegen diese Straffreiheit aussprach, verkehrte sich die deutliche Gegnerschaft innerhalb weniger Wochen in ebenso deutliche Zustimmung zur Straffreiheit. Dazu passt, dass Spanierinnen, wenn sie emanzipiert sind, es in besonderem Ausmaß sind – sie nähern sich Männern erstaunlich offensiv und rauchen zu Lasten ihrer Haut fast noch mehr als sie. Es dürfte noch eine Weile dauern, bis sich das weniger emotionale Verhältnis der jungen spanischen Generation zur Emanzipation von katholischer Sexualmoral und Ehe durchgesetzt hat.
423
67. Wollen wir uns verteidigen?
In Österreichs Sozialdemokratie war auf den glücklosen Viktor Klima unterdessen Alfred Gusenbauer als Vorsitzender der SPÖ gefolgt. Auch er entstammte einer Arbeiterfamilie, auch er hatte erfolgreich studiert, sein Anspruch auf höhere bürgerliche Weihen äußerte sich in der Behauptung, ein Kenner erlesener Weine zu sein. Mir war das ein Tick zu viel der Noblesse, obwohl mir einer meiner linken Freunde, der Kabarettist und Schriftsteller Werner Schneyder, der, anders als ich, ein Kenner erlesener Weine war und Gusenbauer näher kannte, versicherte, dass der wirklich viel von Weinen verstehe und besonders intelligent sei. Jedenfalls sollte es unter ihm mit der SPÖ wieder aufwärtsgehen. Die erneuerte schwarz-blaue Koalition unter Schüssel profitierte nämlich nicht mehr von „Sanktionen“ der EU, sondern wurde an ihren Leistungen gemessen und die waren nicht weiter herausragend, auch wenn es weiterhin keine rechten Entgleisungen gab. Wohl aber eine bei der Bevölkerung wenig populäre Entscheidung, mit der Österreich noch bis 2022 beschäftigt sein sollte: Die Koalition beschloss mit dem Eurofighter einen sündteuren Abfangjäger für die „Luftraumüberwachung“ anzuschaffen. Ich habe mich dank meines Interesses für das Bundesheer (ich habe bereits erläutert, warum ich ursprünglich Offizier werden wollte) immer wieder mit unserer Landesverteidigung auseinandergesetzt: Ich wollte ein in der Praxis effizientes Heer. Abfangjäger erfüllten vor allem eine theoretische Verpflichtung: Die dem neutralen auferlegte Verpflichtung, seinen Luftraum zu überwachen und nicht zuzulassen, dass fremde Militärflugzeuge ihn ungehindert durchfliegen. In der Praxis war das angesichts der konkreten Bedrohungslage unmöglich: Da der einzige potenzielle Aggressor, die UdSSR, seine Flugzeuge in unmittelbarer Nähe, in Ungarn und der Tschechoslowakei stationiert hatte, wären unsere Abfangjäger in dem Zeitraum, den eine MIG gebraucht hätte, Österreich anzusteuern, nicht einmal in der Luft gewesen – nur wenn sie ständig kreisten, konnten sie diese MIG allenfalls abwehren. Doch dafür genügend Maschinen zu haben, wäre, ganz abgesehen von unserer massiven Unterlegenheit, extrem teuer gewesen. Erfolgreichen Widerstand, so war ich überzeugt, konnte Österreich allenfalls am Boden und dort vor allem in den Bergen leisten. Ich war und bin daher der Ansicht, dass man der Verpflichtung aus dem Staatsvertrag, den Luftraum zu kontrollieren, so billig wie möglich nachkommen soll, und Österreich tat das bis dahin auch mit billigeren Abfangjägern aus dem gleichfalls neutralen Schweden. Eurofighter hatten meines Erachtens nur dann Sinn, wenn Österreichs Luftwaffe als Teil der Luftwaffe der NATO agiert hätte. Das war vermutlich auch der Hintergrund der Überlegungen Wolfgang Schüssels: Er, aber mindestens so sehr die führenden Politiker der FPÖ, spielten damals mit dem Gedanken einer NATO-Mitgliedschaft,
Wollen wir uns verteidigen?
die seit der „Wende“ von Russland auch nicht mehr zu verhindern gewesen wäre – in diesem Zusammenhang war der Kauf der Eurofighter vernünftig. Nur dass die Österreicher bekanntlich der Überzeugung sind, dass es die Neutralität ist, die optimalen Schutz vor Krieg bietet – auch wenn Hitler einen neutralen Staat nach dem anderen überfallen hat – und an dieser Überzeugung hatte sich auch unter Schüssel nichts geändert: Er musste ihr Rechnung tragen und die Idee des Beitritts zur NATO wieder aufgeben. Was aufrechtblieb, war die Anschaffung der Eurofighter um 1,7 Milliarden Euro – obwohl damit kein Budget mehr für solche Anschaffungen übrigblieb, die die Kampfkraft des Bundesheeres ernsthaft erhöht hätten. Österreichs Bundesheer – das ist bis heute so – entsprach immer nur einer ungeliebten Verpflichtung, nie dem Willen, dieses Land auch wirklich zu verteidigen: Weder um die Neutralität zu verteidigen noch gar, um einen Beitrag zu Europas Sicherheit zu leisten, greifen die Österreicher überzeugt zur Waffe. Das ist auch mehr als verständlich: Wann immer sie im 20. Jahrhundert Waffen in die Hand genommen haben, haben sie damit nicht ihr Vaterland verteidigt, sondern in fremden Ländern für die imperialen Vorstellungen des Kaisers oder Adolf Hitlers gekämpft. In beiden großen Kriegen sind sie letztlich auf der Seite der Verlierer gestanden, gleich ob man sie im Zweiten Weltkrieg zu den Opfern oder den Tätern zählt. Es ist begreiflich, dass die Lust der Österreicher, neuerlich zur Waffe zu greifen, nach 1945 eine äußerst geringe gewesen ist. Ich würde sogar die These aufstellen, dass Österreich ohne Armee geblieben wäre, wenn Staatsvertrag und Neutralität nicht zur Bewaffnung gezwungen hätten. So wurde das Bundesheer zwar in die Welt gesetzt, dann aber bis an die Grenze der Kindesweglegung vernachlässigt. Während diesem Verhalten auf der Linken vielfach kaum verdeckte Abneigung zugrunde lag, war es auf der Rechten bloß ein Mangel an Zuneigung. Herausgekommen ist in beiden Fällen dasselbe: Das niedrigste Wehrbudget Europas. Weder SPÖ noch ÖVP, weder Präsenzdiener noch Bevölkerung haben dem Bundesheer in ihrer Mehrheit jemals zugetraut, seiner Aufgabe gewachsen zu sein. 80 Prozent der Österreicher, so ermittelte die sozialwissenschaftliche Studiengesellschaft am Höhepunkt des Kalten Krieges, billigten selbst einer tiefgreifenden Reform der Landesverteidigung keinerlei Rückwirkung auf ihre Sicherheit zu. Dass man die Neutralität nach dem Muster der Schweiz verteidigen müsse, stand zwar in der Neutralitätserklärung, aber seit 1957 hat Österreich kaum ein Zehntel des Betrages für seine Verteidigung aufgewendet, den die Schweiz oder Schweden dafür aufgewendet haben – und das, obwohl beide Länder damals strategisch weniger exponiert gewesen sind und bereits starke Heere besaßen, während das Bundesheer neu geschaffen werden musste. Die Anschaffung sündteurer Eurofighter, die die reale Kampfkraft des Heeres noch dazu eher verminderten als erhöhten, konnte in dieser Situation nicht populär sein: Sie wurde zu einem Motiv der kommenden schwarz-blauen Wahlniederlage.
425
426
Wollen wir uns verteidigen?
Sicherheit bot immer nur die NATO Österreichs territoriale Integrität war übrigens die meiste Zeit hindurch trotz dieses so schwachen Bundesheeres gewährleistet: Der Warschauer Pakt musste damit rechnen – oder hat zumindest immer gefürchtet – dass ein von ihm verübter Übergriff auf Österreich die NATO auf den Plan rufen würde. Österreichs Politiker haben sich dessen in Krisensituationen auch immer beim US-Präsidenten versichert. Wie problematisch es ist, wenn ein Aggressor die NATO nicht fürchten muss, zeigt der russische Überfall auf die Ukraine: Putin hätte niemals gewagt, in die Krim einzumarschieren, wenn die Ukraine der NATO angehört hätte oder wenn er auch nur zu fürchten gewesen wäre, dass ihre Truppen der Ukraine zur Hilfe kommen. Doch beides war nicht der Fall. Dass die Ukraine Mitglied der NATO wurde, hat der Widerstand Angela Merkles und Emmanuel Macrons verhindert, die „Putin nicht reizen“ wollten; und dass Putin nicht fürchten musste, dass die NATO der Ukraine mit Truppen zur Hilfe kommt, hat US-Präsident Joe Biden klargestellt. Dass Biden diesbezüglich so viel zurückhaltender als frühere US-Präsidenten reagierte, hat einen simplen Grund: Die USA waren noch nie so kriegsmüde wie nach den Kriegen im Irak und in Afghanistan. Amerikanische Eltern sind es satt, dass ihre Söhne in fremden Ländern zu deren Verteidigung fallen. Tatsächlich ist schwer einzusehen, dass es voran amerikanische Soldaten sein müssen, die sich in Europa einem Aggressor entgegenstellen: Theoretisch stehen in den Mitgliedsländern der EU genügend Soldaten unter Waffen, um ein schlagkräftiges EU-Heer zu bilden und diese Länder sind auch reich genug, dieses Heer mit den besten Waffen auszurüsten. Was fehlt, ist eine gemeinsame Beschaffung, eine gemeinsame Struktur und ein gemeinsames Kommando – vor allem aber ein gemeinsamer Wille. Derzeit plädiert nur Emmanuel Macron für eine ernsthafte europäische Armee – alles, was geplant ist, ist eine Eingreiftruppe von 5000 Mann. Die EU bleibt dabei, sich auf die USA zu verlassen. Dabei kann der nächste Präsident der USA schon ab 2024 im schlimmsten Fall wieder Donald Trump heißen, der das US-Engagement in der NATO massiv in Frage stellt und im Übrigen ein Bewunderer Wladimir Putins ist, dem er auch nicht ganz unbefangen gegenübersteht: Putin könnte jederzeit wasserdicht beweisen, dass Russland massiv zu Trumps Gunsten in den Wahlkampf gegen Hillary Clinton eingegriffen hat, und er könnte vermutlich beweisen, dass Geld des russischen Geheimdienstes Trump vor der Pleite gerettet hat. Ohne eigenes schlagkräftiges Heer steht Europa Putin im schlimmsten Fall ab 2024 ohne gesicherten Beistand der NATO gegenüber. Aber außer Emmanuel Macron (und in Österreich NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger) gibt es eigentlich niemanden, der meint, dass die EU dringend eine eigene schlagkräftige und einsatzfähige Armee brauche. Einer solchen Armee sollten meines Erachtens aus Gründen der Solidarität auch österreichische Berufssoldaten angehören – ich werde es immer für unanständig halten,
Sicherheit bot immer nur die NATO
sich gegenüber einem Aggressor auf „Neutralität“ zu berufen. Ein wirtschaftliches Problem schaffen die dazu notwendigen Staatsausgaben weder in Österreich noch in der EU, sofern es auch eine entsprechende eigene Militärindustrie gibt. Die Militärausgaben der USA sind vielmehr im Wege der US-Militärindustrie eine beständige Stütze der USKonjunktur – nicht anders unterstützen die Militärausgaben der EU die EU-Konjunktur. Man kann nur irgendwann, in einer Welt ohne Putins, zu dem Schluss kommen, dass es zu diesem Zweck vernünftigere Ausgaben gibt. Dass eine EU-Armee das gleiche europäische Gerät – eben den Eurofighter – nutzen sollte, steht hingegen außer Zweifel: Ebenso, dass sein Kauf auch im Falle des Beitritts zur NATO sinnvoll gewesen wäre. Nur für ein österreichisches Bundesheer, das auf jeden Fall außerhalb der NATO bleiben wollte, war er das falsche, weil viel zu teure Gerät. Insofern sprach es für Gusenbauers Intelligenz, dass er den Kauf mit genau dieser Begründung ablehnte: Die Eurofighter seien ausschließlich teuer und trügen nichts zu Österreichs realer Landesverteidigung bei. Sie waren, wie wir heute wissen, vor allem eine Gelegenheit zu gigantischer Korruption. Gusenbauers Opposition gegen den Kauf, den er freilich in der Folge dennoch absegnete, trug vermutlich erheblich zum eher überraschenden Ergebnis der Wahlen des Jahres 2006 bei: Die ÖVP verlor kräftig an Stimmen und die SPÖ wurde mit knappem Vorsprung wieder stärkste Partei. Die Grünen überholten erstmals die FPÖ.
427
68. Die Macht der Krone
Am 8. Jänner 2007 einigten sich SPÖ und ÖVP wieder auf die gewohnte Große Koalition – diesmal mit Wilhelm Molterer als VP-Vizekanzler und Finanzminister. Innerhalb der SPÖ stieß das Koalitionsübereinkommen auf nur 75 Prozent Zustimmung, weil der Ausstieg aus dem Eurofighter-Kauf nicht durchgesetzt worden war – was noch viel Geld kosten sollte. Als erste politische Änderung der rot-schwarzen Koalition unter Alfred Gusenbauer wurde die Legislaturperiode von vier auf fünf Jahre verlängert, denn die Koalition verfügte über die dazu notwendige 2/3-Mehrheit. Gleichzeitig wurde das Wahlalter auf 16 Jahre herabgesetzt. Persönlich halte ich beides für problematisch und verstehe, dass fast alle Staaten vierjährige Regierungsperioden haben und das Wahlrecht erst 18-Jährigen einräumen: Zwei Jahre mehr Erfahrung erlauben meines Erachtens ein besseres Urteil, und dass man eine schwache Regierung erst nach fünf Jahren abwählen kann, scheint mir ein größerer Nachteil als der Vorteil längerer nicht durch Wahlen unterbrochener Regierungsarbeit. Zu diesem Zweck scheint es mir sinnvoller, gemeinsame Termine für die Wahlen in den Bundesländern zu fixieren. Zu einem ersten schwerwiegenden Konflikt zwischen den Koalitionsparteien kam es, als der Verfassungsgerichtshof die Erbschaftssteuer für verfassungswidrig erklärte, weil jemand, der Geld erbte, eine (wenn auch nicht sehr hohe) aber immerhin merkbare Erbschaftssteuer entrichten musste, während der Erbe noch so großer Immobilen, wegen deren grotesk niedriger Einheitswerte mit einer lächerlichen Zahlung davonkam. Für die „Reparatur“ dieses Problems setzte das Höchstgericht eine Frist bis zum 31. Juli 2008. Die SPÖ wollte die Einheitswerte neu ermitteln, um die Erbschaftssteuer als solche beizubehalten, die ÖVP plädierte für ihre Abschaffung. Da die Koalition sich nicht einigen konnte, verstrich die Reparaturfrist ungenutzt. Seither sind wir eines der wenigen Länder ohne Erbschaftssteuer. Im Kampf, doch wieder eine einzuführen, unterlag die SPÖ der ÖVP bis heute: Den Konservativen ist nichts so wichtig wie der steuerfreie und leistungsfreie Zugewinn der möglichst immer gleichen Familien. Am 24. Februar 2008 verkündete Alfred Gusenbauer, nach einem unerwartet starken Anstieg der Verbraucherpreise, ohne vorherige Information des Koalitionspartners, die im Koalitionsabkommen für 2010 geplante Steuerreform auf 2009 vorzuziehen und je 100 Euro an Bedürftige zu überweisen, was für seine ökonomische Intelligenz spricht. Zugleich beschloss die SPÖ gemeinsam mit der FPÖ, den Grünen und dem BZÖ gegen den ausdrücklichen Willen der ÖVP, dass ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss Beschuldigungen gegen Beamte des VP-geführten Innenministeriums untersuchen möge und legte es offensichtlich auf eine Sprengung der Koalition an.
Die Macht der Krone
Denn die Sozialdemokraten besaßen die besten Karten, die man in Österreich bei Neuwahlen besitzen konnte: Die Unterstützung der „Kronen Zeitung“. Gemeinsam mit Infrastrukturminister Werner Faymann hatte Gusenbauer nämlich am 27. Juni 2008 mittels Leserbrief an den Herausgeber der „Krone“ Hans Dichand bekannt gemacht, dass die SPÖ fordert, dass „zukünftige Vertragsänderungen (der EU), die die österreichischen Interessen berühren, in Österreich nur durch eine Volksabstimmung entschieden werden können“, wie Dichand und Kronen Zeitung es seit langem gefordert hatten. Diese Unterstützung ihrer Forderung lohnte die „Krone“ mit politischer Unterstützung der SPÖ. Ich war und bin zwar auch dafür, dass die Bevölkerung Einfluss auf EU-Verträge haben muss – die EU hat diesbezüglich ein gewaltiges demokratisches Defizit, das ihrer gesamten Konstruktion innewohnt – aber ich halte den Einspruch des demokratisch gewählten Parlaments gegen einen allfälligen neuen EU-Vertrag für zielführender als eine Volksabstimmung mit ihrer immensen Emotionalität. Und insbesondere halte ich es für ein ewiges demokratisches Defizit Österreichs, dass die Kronen Zeitung politische Entwicklungen weit vor dem Parlament zu entscheiden vermochte. „Was sagt der Staberl dazu?“, war die Frage nach der Meinung des wichtigsten Kolumnisten der Kronen Zeitung und wichtigsten Sprachrohrs Hans Dichands, die alle österreichischen Regierungschefs nach Bruno Kreisky, ausgenommen vielleicht Wolfgang Schüssel, mehr beschäftigte als die Meinung wichtiger Mitarbeiter, Berater oder selbst ihres Klubs. Gegen die „Krone“ und „Staberl“ wurde nichts beschlossen. So verzögerte sich etwa die Einführung einer „Quellensteuer“ auf Zinsen und Einkünfte aus Aktientransaktionen um ein Jahrzehnt, weil die „Krone“ sie als „Sparbüchelsteuer“ diffamierte, während sie in Wirklichkeit voran die Einkünfte des Multimillionärs Hans Dichand erheblich geschmälert hätte. Der Einfluss der „Krone“ unter Hans Dichand – nicht der heutigen Kronen Zeitung, die sich diesbezüglich stark verändert und verbessert hat – war deshalb ein so unheilvoller, weil sie unter seiner Führung eine so unglaublich hausmeisterliche, wenn nicht reaktionäre Zeitung war. Mit enormem journalistischem Knowhow bediente sie die Emotion, die auch Jörg Haider bediente: „Wir, die wir tüchtig und rechtschaffen sind“, stehen beständig „Anderen“ gegenüber, die das nicht sind. „Anderen“, die Kurt Waldheim und die „Wehrmachtsgeneration“ verunglimpfen; „Anderen“, die Karl Schranz seinen Weltmeistertitel nicht gönnen; „Anderen“, die Simon Wiesenthal schätzen, statt dass er, wie die „Krone“ nach seiner Auseinandersetzung mit Bruno Kreisky forderte, „des Landes verwiesen“ wird. Typisch für die damalige – nicht die heutige – Kronen Zeitung war, dass sie Wiesenthal ein paar Jahre später in den Himmel hob, als er Kurt Waldheim gegen den Vorwurf in Schutz nahm, ein Kriegsverbrecher zu sein – damit war er wieder einer von „uns“.
429
430
Die Macht der Krone
In Wirklichkeit ist diese Überbetonung des „Wir“ im Gegensatz zu den „Anderen“ die Basis aller autoritären, faschistoiden Systeme. Es war jedenfalls ein enormer Vorteil für Gusenbauer, die Kronen Zeitung auf seiner Seite zu wissen, als er seinen Regierungspartner ÖVP mit Vorwürfen überhäufte. Dem so vielfach innenpolitisch brüskierten Vizekanzler Wilhelm Molterer blieb nichts übrig, als am Morgen des 7. Juli 2008 trotz ungünstiger Umfragen „sofortige Neuwahlen“ zu fordern. Gusenbauer trat bei diesen Wahlen nicht mehr selbst als Spitzenkandidat der SPÖ an, denn der war mit Werner Faymann der Favorit der Kronen Zeitung geworden: Nicht nur hatte er das Kleinformat als Wiener Stadtrat und dann als Infrastrukturminister wie kein anderer mit Inseraten gefüttert und damit das System der Inseraten-Korruption geschaffen – er löste damit sogar ein (eingestelltes) Strafverfahren aus –, sondern er war auch die treibende Kraft hinter dem Leserbrief an die „Krone“ bezüglich der Forderung an Brüssel gewesen. Auch in Spanien und damit ohne Kontakt zur österreichischen Bevölkerung war für mich als Kommentator sonnenklar: Mit der Unterstützung der „Krone“ konnte der nächste Kanzler nur Werner Faymann heißen und sollte es bis 2016 bleiben.
69. Ein unerwartet erfüllter Lebenstraum
In Spanien hatten uns meine Geschäfte mit renovierten Häusern in der Zwischenzeit exakt so viel eingebracht, dass wir zusätzlich zu unserem ursprünglichen Haus am Monte de los Almendros ein diesmal noch größeres Haus mit einem Hallenbad und einem riesigen runden Außenschwimmbecken auf einem Grundstück darunter bauen konnten und demnächst dorthin übersiedeln wollten. Aber dazu kam es nicht, denn Erics internationale Schule implodierte. Wir überlegten eine Weile, ihn in eine spanische Schule zu geben, was nachträglich gesehen wahrscheinlich das Beste gewesen wäre, aber er überraschte uns mit dem Wunsch, wieder in seine alte internationale Schule in Wien gehen zu wollen – in Wirklichkeit hatte er zweifellos immer dortbleiben wollen und nur meinem Wunsch nachgegeben, Österreich zu verlassen. Wahrscheinlich war es nicht zuletzt mein schlechtes Gewissen, das mich veranlasste, seinem Wunsch zuzustimmen und bis auf weiteres nach Wien zurück zu übersiedeln, obwohl es unsere Familie zerriss. Denn nun war es Eva, die in Spanien bleiben wollte. „Ich fühle mich hier zum ersten Mal zu Hause“, sagte sie, „ich möchte nicht schon wieder übersiedeln.“ Tatsächlich waren wir in den fast zwanzig Jahren, die wir damals zusammenlebten, in Österreich neunmal und in Spanien zweimal übersiedelt, ehe wir am Mandelbaumberg eine endgültige Bleibe gefunden zu haben glaubten. Und im Gegensatz zu mir war Eva in Spanien voll integriert. Herzlich befreundet mit diversen Eltern von Erics Mitschülern, mit dem hervorragenden Arzt unserer Urbanisation, mit einer Reihe jüngerer Leute aus Salobreña, mit denen wir jede Woche mindestens zweimal tanzen gingen. Nicht zuletzt hatte sie erstmals seit ihrer Jugend wieder Konzerte als Pianistin gegeben. Klavier zu spielen war für sie zeitlebens wichtiger als mir selbst das Schreiben – allenfalls mein gelegentliches Rezitieren von Gedichten Rilkes ließ sich damit vergleichen: Sie fühlte sich den Empfindungen Schuberts, Beethovens, Liszts oder Chopins dann so nahe, wie ich den Empfindungen Rilkes – nur dass sie ungleich besser Klavier spielte als ich Rilke rezitierte. Sie hatte mit sechs die ersten Klavierstunden genommen, war mit elf an die Musikschule des Konservatoriums gewechselt und hatte mit zwölf so gut gespielt, dass Thomas Kakuska, wenige Jahre später Bratschist des weltberühmten Alban-Berg-Quartetts, unbedingt mit ihr musizieren wollte. Die Mütter der beiden unterbanden die Zusammenarbeit aus grotesken Gründen – sie befürchteten ein Liebesverhältnis des 19-Jährigen mit der Zwölfjährigen – während es in Wirklichkeit nur das gemeinsame Empfinden einer Dvorak-Sonatine war, das beide so wunderbar durchflutet hatte, dass Eva sich bis heute daran erinnert: „Schönere Augenblicke gegenseitigen Gebens und Nehmens gibt es nicht.“ Täglich acht Stunden übend war sie mit 13 vom Mozartsaal des Musikvereins
432
Ein unerwartet erfüllter Lebenstraum
bis zum Grazer Forum Stadtpark aufgetreten und hatte eigentlich gedacht, Künstlerin zu werden, ehe extrem sich verstärkende Kurzsichtigkeit ihr immer mehr Angst vor Auftritten auf einem Podium einflößte. Den Abschluss ihres Klavierstudiums verhinderte die Kurzsichtigkeit nicht – man brauchte die Augen nur, um Werke einzustudieren, dann spielt man sie aus einem unterbewussten Gedächtnis – aber um aufzutreten war ihr die innere Sicherheit verloren gegangen und der Verlauf ihrer ersten Ehe hatte ihr wenig Grund gegeben, diese Sicherheit zurückzugewinnen. Jetzt, in Spanien, da der Bösendorfer-Konzertflügel, den wir auf den Rat Alfred Worms hin inmitten meines Strafprozesses endlich gekauft hatten, im riesigen Wohnraum unseres Hauses am „Monte“ mit Blick auf die maurische Festung von Salobreña endlich einen adäquaten Platz gefunden hatte, hatte sie wieder täglich viele Stunden geübt, und als sie die Konzerte spanischer Pianisten in Granada hörte, fand sie zu Recht, dass sie wieder auftreten könnte. Sie gab ein erstes umjubeltes Konzert im nahen Städtchen Motril und dann eine ganze Reihe von Solokonzerten bis hin zu einem Schubert-Abend beim Festival von Granada. Spanien hatte Eva einen Lebenstraum erfüllt und den wollte sie nicht aufgeben. Wir einigten uns darauf, dass vorrangig ich gemeinsam mit Eric in Wien leben und nur immer wieder nach Spanien fahren sollte, während sie vorrangig in Spanien leben und uns immer wieder in Wien besuchen sollte. Ich kaufte in Wien eine Wohnung in unmittelbarer Nähe von Erics internationaler Schule und wir begannen unser verändertes Familienleben relativ guten Mutes. Was Eva und ich nicht wussten, war, dass Eric abermals einem fremden Wunsch, dieses Mal dem Wunsch seiner Mutter, in Spanien zu bleiben, nachgegeben hatte. Während er ihr vor seiner Abreise das Gefühl vermittelt hatte, eigentlich völlig erwachsen zu sein, sie nicht mehr zu brauchen und nur zu gerne alleine zu wohnen, litt er in Wirklichkeit unter der Trennung von der Mutter, denn ich war kein Ersatz für sie. Nach einem Jahr beendeten wir das Experiment getrennter Wohnsitze und Eric und ich übersiedelten zurück nach Spanien. Da wir der internationalen Schule bei Salobreña weiterhin zutiefst misstrauten, blieb uns nichts anderes übrig, als Eric in der nächsten internationalen Schule, im 150 Kilometer entfernten Marbella anzumelden. Das machte eine halbe Übersiedlung nötig: Wir erwarben in Marbella einen kleinen Bungalow, in dem wir während der fünf Schultage gemeinsam mit Eric auf ziemlich engem Raum wohnten – am Wochenende fuhren wir in unser großes Haus in Salobreña. Denn in Marbella hatte Eva nur ein elektrisches Yamaha-Klavier, auf dem sie mit Kopfhörern üben konnte, während in Salobreña ihr Bösendorfer wartete, um ihren laufenden Konzerten an der Küste den letzten Schliff zu geben. Bis auch diese Konstruktion sich als brüchig erwies: Eric hatte seine Schulfreunde und vor allem Freundinnen in Marbella und am Wochenende immer weniger Lust, es mit uns in Salobreña zu verbringen. Wir entschlossen uns also wieder einmal – exakt zum 13. Mal – zu übersiedeln und ein adäquates Haus in Marbella zu kaufen.
Ein unerwartet erfüllter Lebenstraum
An sich hatten wir Marbella, als wir seinerzeit die Küste entlanggefahren waren, um bei internationalen Schulen halt zu machen, links liegen gelassen – was wir über die Stadt gehört hatten, stieß uns eher ab. Dabei ist es ein durchaus hübsches, barockes Städtchen mit einem relativ schönen Strand und einem wunderschönen bergigen Hinterland, in dem die Stadt Ronda voller barocker und maurischer Paläste traumhaft über einer Hochebene thront. Ronda hatten wir besucht, schon weil Rainer Marie Rilke dort gelebt und es begeistert beschrieben hat. Bis heute erinnert dort mehr an ihn als in Wien – selbst eine Fahrschule ist nach ihm benannt. Wir hatten die prachtvolle, barocke Stierkampf-Arena Rondas besucht, waren in einem riesigen, maurischen Palast bis auf den Grund der Schlucht hinabgestiegen, mit der ein Fluss die Stadt in zwei Hälften spaltet und hatten in einem maurischen Restaurant hervorragend gegessen. Dann aber waren wir nicht hinunter nach Marbella, sondern anderthalb Stunden hinauf nach Granada gefahren, um die Alhambra vor dem Hintergrund der schneebedeckten Sierra Nevada zu bestaunen. Nur das Wissen meines Schwiegervaters, dass es dort im Sommer unerträglich heiß ist, ließ uns in Granada nicht nach einem Haus suchen. Stattdessen stachen wir, wie die vertriebenen Mauren senkrecht durchs Gebirge hinunter zur Küste, wo es in Almuñécar, knapp neben Salobreña, die internationale Schule gab, die Eric schließlich besuchen sollte und nun nicht mehr besuchen wollte. Was wir von Marbella kannten, war fast nur der Slogan, dass es die Stadt der „Reichen und Schönen“ sei, und meine Frau war zwar schön, aber ich war nicht reich. Jedenfalls nicht nach den Maßstäben, die wir durch Erics neue Schulkollegen kennenlernten: Wenn sie Geburtstag hatten, mieteten sie eine Diskothek, um hundert Freunde zu bewirten, und ein Mädchen, dem er gefiel, obwohl es einem saudischen Prinzen versprochen war, logierte mit ihrem Vater in einer Villa mit 3000 Quadratmeter Wohnfläche. Als Eric ihr erzählte, dass er keinen Wien-Flug mehr buchen konnte, um rechtzeitig einem Fest seiner Geschwister beizuwohnen, stellte sie eine Frage, die fortan bei uns zum geflügelten Wort wurde: „Why didn’t you lease a jet?“ Das Zweite, was wir von Marbella wussten, war, dass man dort „zum Golfen“ hinfuhr und auch damit verbanden wir nichts Positives: Auch nahe Enzesfeld, wo wir fünf Jahre durchaus gerne gelebt hatten, gab es einen Golfklub, aber wir verbanden mit ihm nur einen unglaublich überheblichen Adeligen, der einen verscheuchte, wenn man dem Golfplatz auch nur in die Nähe kam. Dass Friedrich Flick, als er noch lebte, angeblich mit seinem Hubschrauber einflog, um den Platz zu „bespielen“, machte mir Golf auch nicht sympathischer, zumal ich es – völlig zu Unrecht – nicht wirklich für einen Sport hielt: Man musste weder Muskeln noch Kondition haben, um einen Golfball zu schlagen – nur eine unglaublich vertrackte Bewegung perfekt ausführen. Ich hatte es ein einziges Mal probiert und war dank meines Bewegungsantitalents restlos gescheitert: Statt des Balls flog ein Stück Wiese in die Luft. „Vögeln Sie noch oder golfen Sie schon?“, war ein Bonmot, dem ich eine Menge abgewinnen konnte.
433
434
Ein unerwartet erfüllter Lebenstraum
Dennoch, das ließ sich nicht leugnen, waren die vielen trotz der Hitze stets grünen Golfplätze Marbellas schön und seine ebenso grünen Villenviertel sympathisch und gepflegt. Viele Straßen waren das weit weniger, denn die Stadt wurde von der korruptesten Regierung des Landes verwaltet. Jesús Gil, ihr legendärer Bürgermeister, war in Dutzende Strafverfahren verwickelt, die auf erstaunliche Weise nie zu Prozessen führten: Als ein Polizist aufgrund einer Anordnung der Zentralregierung Zugang zur Wohnung eines Richters erhielt, sprang der aus dem Fenster – in seinen Schränken fanden sich hunderte Akten aus eingestellten Gil-Verfahren. Dass der Polizist überhaupt tätig werden konnte, lag daran, dass die Zentralregierung auf einen Paragraphen zurückgegriffen hatte, der eigentlich dafür gedacht war, einen Staatsstreich zu unterbinden: Er erlaubte es der Bundesregierung, eine aufständische Stadtregierung und ihre Verwaltung abzusetzen und ihre Agenden zu übernehmen. Denn alles in Marbella, vom Baustadtrat bis zum Polizeipräsidenten war korrupt – der Baustadtrat hatte den Spitznamen „La Mano“, die Hand, und die Staatsanwälte hielten es mit dem aus dem Fenster gesprungenen Richter: „Wenn ein Staatsanwalt Ihren Parkplatz mit seinem Ferrari okkupiert, sollten Sie sich nicht mit ihm anlegen“, lautete ein gängiges Bonmot, „er bringt Sie vor Gericht, so wie er La Mano davor bewahrt.“ Als Gil 2004 inmitten ständiger Anschuldigungen wegen Korruption einem Herzschlag erlegen war, übernahm eine schwer korrupte Bürgermeisterin sein Amt, so dass man bei ihrer Verhaftung in einer Schönheitsklinik unter ihrem Bett Müllsäcke mit Fünfhunderteuroscheinen fand. Die fand man auch unter den Betten anderer Stadtfunktionäre – das wurde zu einem der Gründe, weshalb die EU Fünfhunderteuroscheine abschaffen wollte. In mancher Hinsicht hatte Marbella unter Gils Herrschaft freilich geblüht. Es waren unglaublich viele Villen in Bausperrgebieten errichtet worden, denn gemeinsam mit „La Mano“ hatte Gil einen neuen, mittlerweile ungültig erklärten Bebauungsplan in Kraft gesetzt. Zugleich hatte er Marbella zu einer sicheren Stadt gemacht, indem er zahllose zusätzliche Polizisten eingestellt hatte: Die vielen Mafiosi, die sich in Marbella angesiedelt hatten, wollten nicht von Taschendieben belästigt werden. In dieser Stadt also wollten auch wir uns nun ansiedeln und suchten zu diesem Zweck ein Haus in der Nähe von Erics neuer internationaler Schule. Doch während wir Häuser in Salobreña immer sehr preisgünstig erworben hatten – erstens weil sie damals allgemein billiger waren und zweitens weil wir uns jede Menge Zeit genommen hatten – hatten wir es in Marbella eilig, weil die Schule demnächst begann. Das Haus, das wir uns schließlich von einer extrem geschickten Maklerin viel zu teuer andrehen ließen, lag in einer ruhigen Straße etwa hundert Höhenmeter über Marbellas berühmtem Yachthafen „Puerto Banús“, war angeblich von dessen Architekten geplant worden und trug wegen der vielen Pinien in seinem Garten den klingenden Namen „El Pinar“. Was wir unter vielem anderen nicht wussten, war, in welchem Ausmaß Pinien nadeln und dass man sie, weil sie unter Naturschutz stehen, auch dann nicht fällen darf, wenn sie sich schon
Ein unerwartet erfüllter Lebenstraum
gefährlich neigen – eine von ihnen sollte nicht nur auf unser Dach stürzen, sondern sogar noch das Dach des Nachbarn verletzen. Die Lage des Hauses war gut. Sein Garten überragte mit einer Terrasse an seinem vorderen Ende die Villen darunter, so dass man freien Blick auf das nicht mehr so nahe Meer, auf Marbellas prachtvollen felsigen Berg, die Concha, und, wenn man sich an die Brüstung der Terrasse stellte, auf einen der größten Golfplätze hatte. Unter der Terrasse gab es eine 60 Quadratmeter große Wohnung, es gab ein wegen der vielen Pinien sehr schattiges Schwimmbad, dessen Wärmepumpe, wie der Verkäufer uns zu sagen vermied, nicht funktionierte und es gab das nicht sehr große, abgewinkelte Hauptgebäude, das von der Straße über Stiegen durch einen kleinen Vorgarten zu erreichen war. Von der Straße aus war das Haus höchst unauffällig – die Taxifahrer kannten nur das extrem auffällige Haus schräg gegenüber: „Ah unterm Mafiaboss wohnen Sie“, ließ man uns bei unserer ersten Anfahrt wissen. Wobei das riesige, schönbrunngelbe, schräg oberhalb unseres Grundstücks gelegene Haus mittlerweile einer zweifellos integren, ich glaube schwedischen Familie gehört – nur als Eva ihr Auto erstmals unter seiner Gartenmauer parkte, wurde es mit Zement überschüttet. Der Verkäufer unseres Hauses, ein „Conte“ trug einen noch klingenderen Namen als das Haus selbst, den ich verdrängt habe. Das Hauptgebäude, das er geschaffen hatte, war das eigentliche Problem der viel zu teuer erworbenen Immobilie: Wohl der Vornehmheit wegen hatte er sich nicht mit der Bungalow-Raumhöhe von 2,60 Metern begnügt, sondern den etwa 70 Quadratmeter großen Wohnraum so überdacht, dass er im hinteren Drittel eine Scheitelhöhe von sechs Metern erreichte. Gleichzeitig hatte die Vorderfront des Raumes zwei erstaunlich kleine Fenstertüren in den vorderen Garten, weil in ihrer Mitte ein nobler Kamin viel zu viel Platz einnahm. Die einzig große Fenstertüre schaute an der Seitenwand über eine überdachte Terrasse in einen hässlich betonierten „Patio“. Dafür war das neue Haus vornehm dunkel. Ich baute also wieder einmal um: Die seitliche Terrasse versah ich, zwischen einigen wenigen tragenden Säulen mit riesigen Glasschiebetüren, so dass sich ein lichtdurchfluteter angeflanschter Wohnraum von rund 40 Quadratmetern ergab. Eine zweite, an der Vorderfront des Wohnzimmers gelegene, offene Terrasse überdachte ich und verglaste sie ebenfalls völlig, um die bisherige Vorderfront mit ihrem Monsterkamin wegzureißen, so dass sich der große Wohnraum um weitere 40 Quadratmeter vergrößerte. Aus der Ausführlichkeit, mit der ich diese chirurgischen Eingriffe beschreibe, ahnen Sie vermutlich schon, dass mir „Umbauen“ zeitlebens Freude machte. Im konkreten Fall führte es zu dem mit 150 Quadratmetern größten und mit sechs Meter Scheitelhöhe höchsten Raum, den wir je bewohnten. Nur etwas täglich beim Bauen über den Daumen Verändertes kann auf so einzigartige Weise zu einem höchstpersönlichen Ganzen zusammenwachsen. Für jedes Möbel, für jedes Bild, für jede Skulptur gab es am Ende die geeignete Wand, und Evas riesiger Konzertflügel, der noch jeden anderen Wohnraum erschlagen hatte, passte wie angegossen in den angeflanschten, gegenüber dem
435
436
Ein unerwartet erfüllter Lebenstraum
Hauptraum etwas abgesenkten neuen Raum, der aus der seitlichen Terrasse entstanden war. Ihn und den gegenüber dem Hauptraum ebenfalls abgesenkten Teil der vorderen Terrasse fliesten wir mit rotem Marmor, so dass sich diese beiden Teile prachtvoll vom beige belassenen Marmorboden des ursprünglichen Wohnraums abhoben. Marmor – um keine falschen Assoziationen aufkommen zu lassen – ist in Spanien preiswert und daher ein durchaus üblicher, unglaublich pflegeleichter Fußbodenbelag. Durch die riesigen Fensterflächen des Klavierzimmers sah man nach vorne in den großen Garten, der seinerseits in eine Terrasse mündete. Zur Seite und nach hinten sah man in den ehemals betonierten, nun mit großen roten und kleinen blauen Steinen gefliesten Patio, in dessen äußerster, von den roten Mauern des Gästezimmers mit der Garage gebildeten Ecke, der Torso eines „Kriegers“ aus Carrara-Marmor leuchtet, den mein Freund Ferdinand Böhme geschaffen und aus Österreich hierher transportiert hatte. So ähnlich wie ich dieses Haus baute, komponiert man Musik. Meine Frau machte Musik wie nie zuvor. Sie saß, wie in ihrer Jugend, wieder acht Stunden täglich am Klavier – mit Blick auf den Torso und zwei Palmen, die aus der Mitte des Patio wachsen. Marbella, so mussten wir bald feststellen, war, nachdem eine Reihe hervorragender Musiker vom so korrupten, wie unfähigen Kulturstadtrat vertrieben worden waren, eine kulturelle Wüste. Eva gründete also die „Hausmusik Marbella“ und als erstes luden wir den Pianisten Vincenzo Maltempo ein, den wir bei einem Geburtstagsausflug nach Venedig entdeckt hatten, als er dort anlässlich seines Sieges bei einem Wettbewerb im Teatro La Fenice ein Konzert gab. Ich hatte ihn an der Bühnentüre abgepasst und gefragt, ob er gegen eine Woche Urlaub und tausend Euro bei uns in Marbella spielen würde und mir gratuliert, als er eingewilligt hatte. Später – wir sind seither Freunde – erfuhr ich, dass das sein bis dahin höchstes Honorar war: Es gibt mehr als ein Dutzend begnadeter Pianisten – meine Frau meint, dass die meisten besser als Lang Lang spielen – die dennoch so wenig verdienen, dass sie nur gerade überleben. Denn die großen Konzerthäuser engagieren nur immer wieder die gleichen, bekannten Namen, weil die meisten Zuhörer meinen, dass nur sie hervorragend musizierten. Ich habe einem Beamten des Finanzministeriums deshalb einmal vorgeschlagen, man solle Honorare für Hauskonzerte doch von der Steuer absetzen können – er wies das mit der Bemerkung zurück: „Sie glauben offenbar, dass sie besser als wir über die Qualität von Musikern entscheiden können.“ Ich vielleicht nicht – meine Frau sicher. Indem wir in allen großen Restaurants der Gegend Zettel mit der Ankündigung unserer Konzerte verteilten – E-Mail-Adressen waren damals noch nicht so geläufig – und Eva später auch vom örtlichen Fernsehen eingeladen wurde, um neben der wichtigsten Maklerin Marbellas, Kristina Szekely „Neues für Marbella“ anzukündigen, füllten wir unser Wohnzimmer etwa einmal im Monat mit bis zu hundertfünfzig Zuhörern, die wir zuvor durch ein riesiges Buffet im Patio auf den Kunstgenuss einstimmten.
Ein unerwartet erfüllter Lebenstraum
Die Verluste kompensierten wir durch die gelegentlichen Auftritte meiner Frau. Das Problem war, dass so viele unserer Zuhörer ständig den Wohnort wechselten, aber mit der Zeit bekamen wir doch einen gewissen Kundenstock zusammen und manchmal waren auch interessante Leute darunter: Einer davon, ein junger Amerikaner, dem ich erzählte, wie sehr ich mich freute, dass Hillary Clinton künftig Präsidentin seines Landes sein würde, belehrte mich: Die sei nicht schlecht – aber der Mann, den es zu wählen gelte, sei ein gewisser Barack Obama. Er riet mir, unbedingt sein Buch „An American Dream“ (Ein amerikanischer Traum) zu lesen – das würde mich überzeugen. Es überzeugte mich tatsächlich – lange bevor Obama in Österreich auf Titelseiten geriet.
437
70. Amerikas präsente Präsidenten
Amerikas Präsidenten waren mir angesichts meiner Voreingenommenheit für die USA immer geläufig. Ich hatte mich, wie alle Europäer, für John F. Kennedy und noch mehr für seinen Bruder Bob begeistert, dessen grandioses Buch „Zivilcourage“ ein Freund meiner Mutter ins Deutsche übersetzt hatte. Ich hatte den so gar nicht charismatischen Lyndon B. Johnson für seine Sozialgesetzgebung und vor allem die Gesetze gegen Rassendiskriminierung bewundert, die er erlassen hatte, um der revolutionären Entscheidung des Supreme Court gerecht zu werden, Schwarze beruflich zu bevorzugen, nachdem man sie durch Jahrhunderte benachteiligt hatte. Und ich hatte selbst dem unbeliebten Richard Nixon zu Gute gehalten, dass er den Frieden von nur zwei Beinen – UdSSR und USA – durch seine Annäherung an China auf damals stabilere drei Beine gestellt hat. Am meisten befasst hatte ich mich mit Ronald Reagan, denn in Wien hatte ich mich herzlich mit seiner ehemaligen Personalchefin und dann Botschafterin in Österreich Helene von Damm angefreundet und ihr beim Abfassen ihrer Memoiren „Wirf die Angst weg, Helene“ geholfen. Helene hatte Österreich nach einem unangenehmen Zwischenfall mit ihrem Lehrherrn als Sechzehnjährige verlassen und die USA so kennengelernt, wie ich sie schätzte: Man beurteilte sie nicht nach ihrem Alter, ihrer Herkunft oder einem Diplom, sondern nach dem Verstand und der Energie, mit der sie Probleme löste. Sehr bald hatte sie sich für den Wahlkämpfer Ronald Reagan begeistert, der als erster Politiker die neoliberalen Ideale Milton Friedmans lautstark auf seine Fahnen heftete und mit dem Talent des ehemaligen Schauspielers vortrug: Die USA, so predigte er, brauchten Deregulierung und einen schlanken, sparenden Staat. Helene fand das auch, schloss sich seinem Team an und machte sich durch ihr Talent im so wichtigen „Fundraising“ unentbehrlich. Reagan belohnte sie für die vielen von ihr gesammelten Spenden mit einem der einflussreichsten Ämter seiner Administration: Sie traf die Vorentscheidung über die neuen Beamten und Funktionäre, die mit jeder Regierung neu ernannt werden. Auch unter meinen Freunden in der Industriellenvereinigung hatte Reagans neoliberale Politik damals zustimmende Aufmerksamkeit erregt: „Glauben Sie nicht auch, dass wir da sehr viel lernen könnten?“, war eine Formulierung, mit der einander Banker und Unternehmer beim Forum Alpbach begrüßten, um Zusammengehörigkeit und progressives Denken zu signalisieren. Was sie meistens nicht wahrnahmen, war, dass Reagan nach zwei wirtschaftlich erfolglosen Jahren das absolute Gegenteil dessen tat, was er als wichtigsten Teil seines Programms verkündet hatte: Die USA sparten nicht, sondern gaben wie nie zuvor Geld aus. Obwohl er, den man in Europa vorschnell als „schießwütigen Cowboy“
Amerikas präsente Präsidenten
verunglimpft hatte, keine eigenen Kriege führte, – er unterstützte nur den Kampf der Mudschaheddin gegen die russischen Truppen in Afghanistan mit Geld – flossen Abermilliarden in Rüstung, denn er träumte von Laserwaffen im Weltraum, die die USA unverwundbar machen würden. Die UdSSR, die mitzuhalten versuchte, zerbrach wirtschaftlich an diesen Megaausgaben, und daraus resultierte die „Wende“. Reagan erreichte sie, ohne sie geplant zu haben, so wie seine hohen Staatsausgaben zu einer Hochkonjunktur führten, obwohl er niedrige Staatsausgaben für die wichtigste Voraussetzung einer Hochkonjunktur gehalten hatte. (Ich werde in späteren Kapiteln erklären, warum das mathematisch so sein muss.) Sein Nachfolger George H. Bush, der Reagans erhöhte Staatsschulden zu reduzieren suchte, hatte denn auch prompt mit einer viel dürftigeren Konjunktur zu kämpfen, denn der einzige Krieg, den er führte, erforderte keine Rüstung und war denkbar kurz: Unter der Führung von Stabschef Colin Powell vertrieben die USA in nur sechs Wochen die Armee Saddam Husseins aus dem von ihm überfallenen Emirat Kuweit, begnügten sich aber mit diesem schnellen Erfolg. Dass Bin Laden darin dennoch eine Kriegserklärung des Westens gegen den Islam sah, konnte George H. Bush nicht wissen. Der Demokrat Bill Clinton, der ihm folgte, indem er höheres Wirtschaftswachstum versprach – „It’s the economy, stupid!“ (Auf die Wirtschaft kommt es an, Dummköpfe!) errang in Europa den Ruf eines sehr erfolgreichen Präsidenten. Niemand verstand hier, dass die Republikaner ihn wegen seiner Affäre mit Monica Lewinsky mit solcher Inbrunst verfolgten – in Wirklichkeit zeichnete sich in dieser Verfolgung bereits die totale innenpolitische Spaltung der USA in „republicans“ und „democrats“ ab, die Barack Obama das Regieren so sehr erschwerte und in der Präsidentschaft Donald Trumps gipfelte. Nachträglich betrachtet war Clintons Wirtschaftspolitik keineswegs unproblematisch, auch wenn ihr Problem einem höchst sympathischen Motiv entsprang: Weil er wollte, dass sich auch die unterste soziale Schicht der Amerikaner, voran Schwarze, den amerikanischen Traum eines eigenen Hauses erfüllen kann, drängte er die staatsnahen (praktisch verstaatlichten) größten Hypothekenbanken des Landes, „Fannie Mae“ und „Freddie Mac“, auch Menschen mit geringer Bonität Kredite für Hauskäufe einzuräumen und veränderte auch das Pfandrecht in diesem Sinne. Damit legte er den Grundstein zur Subprime-Krise des Jahres 2007 und die ihr folgende Finanzkrise. Sein Nachfolger George W. Bush, unterschied sich von seinem Vater George H. Bush nicht nur durch das W. an Stelle des H., sondern vor allem durch die sehr viel geringere Zurückhaltung beim Führen von Kriegen. Der erste gegen die Taliban, die in Afghanistan der al-Kaida des Osama bin Laden eine Heimstätte geboten hatten, war freilich unvermeidlich: Er konnte vor der amerikanischen Bevölkerung nur mit einem Militärschlag darauf reagieren, dass am 11. September 2001 ein Terrorkommando der al-Kaida 2.731 Menschen unter den Trümmern des einstürzenden World Trade Center begraben hatte.
439
440
Amerikas präsente Präsidenten
Nachträglich betrachtet hätte er seine Truppen danach allerdings möglichst rasch wieder abziehen und die Taliban weiter regieren lassen sollen – schließlich regieren sie nach 20 Jahren und 2.500 gefallenen US-Soldaten dort jetzt erst recht. Aber er – und auch ich – hatte geglaubt, in Afghanistan so etwas wie eine westliche Demokratie errichten zu können und die Herrschaft fanatischer „Islam-Studierender“ – das ist die wörtliche Übersetzung von „Taliban“ – auf immer zu beenden. Ein Regime, das Tanz und Musik verbot, Mädchen das Lernen an Schulen untersagte und Frauen nur vollverschleiert auf die Straße gehen ließ, schien auch Amerikas NATO-Partnern unerträglich. Selbst der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, billigte Bushs Einmarsch in Afghanistan. Doch die USA und ihre Verbündeten – im Grunde die „westliche Welt“ – haben den Krieg gegen die Taliban bekanntlich schlicht und einfach verloren. Ob Bush mit seiner Intervention restlos gescheitert ist, wird sich dennoch erst entscheiden, wenn dieses Buch schon gedruckt ist: Vorerst sieht es allerdings so aus, als ob die nunmehr herrschende Generation der Taliban gegenüber Frauen keineswegs liberaler als die abgelöste wäre. Bushs zweiter Krieg, der Einmarsch in Saddam Husseins Irak, war anders als der Einmarsch in Afghanistan mehr als vermeidbar. Man wird sein Resultat zwar auch erst in Zukunft endgültig beurteilen können, aber sicher ist, dass die USA ihn unter doppelt falschem Vorwand begonnen haben: Es stimmte bekanntlich weder, dass Hussein den Terror der al-Kaida unterstützte, noch, dass er Massenvernichtungswaffen entwickelte. Zur Linken ist man überzeugt, dass Bushs einziges Motiv in den Ölvorkommen des Irak bestand. In denen bestand es in meinen Augen „auch“, aber ich denke, dass andere Motive gleichfalls eine Rolle spielten. So war Saddam Hussein zweifellos ein skrupelloser Diktator, der etwa den Widerstand irakischer Kurden brach, indem er Tausende Bewohner eines kurdischen Dorfes mit Giftgas erstickte. Zudem hatte er immerhin zwei Kriege vom Zaun gebrochen – einen gegen den Iran, dem die USA freilich klammheimlich zugestimmt hatten, mit einer halben Million Toten und den gegen Kuwait. Es gab also durchwegs auch objektive Gründe, Husseins Sturz herbeizuwünschen. Bei George W. Bush spielte aber wohl ein subjektiver Grund die wesentlichere Rolle: dass er seinen Vater, George H. Bush, der Hussein nur zurückgeschlagen, nicht aber gestürzt hatte, übertreffen wollte. Auch der Irakkrieg mündete bekanntlich bei Gott nicht in eine westliche Demokratie und in Frieden: Der Irak wurde von blutigem Terror erschüttert, die al-Kaida, die Bush zum Vorwand für seinen Einmarsch gedient hatte, fasste im Gefolge des Krieges wirklich dort Fuß; und ihr Terror ging fließend in den Terror des „Islamischen Staates“ über, der eine Weile später neben großen Teilen des Irak auch halb Syrien beherrschte, ehe er mit vereinten Kräften der USA, Russlands, Baschar al-Assads und vor allem syrischer wie irakischer Kurden geschlagen werden konnte. Was die Kurden bekanntlich nicht davor bewahrte, danach von den USA fallengelassen zu werden und den Angriffen der Türkei ausgesetzt zu sein, obwohl die von ihnen regierte Region einer Demokratie und einem
Amerikas präsente Präsidenten
Rechtsstaat mit Abstand am ähnlichsten sieht. Ich kenne kein Volk, dem in jüngerer Zeit mehr Unrecht als den Kurden geschah. Das gegenwärtige Regime des Irak ist zwar ein demokratisch gewähltes, steht aber auf denkbar wackeligen Beinen, weil es nicht gleichzeitig einen Rechtsstaat zu schaffen vermochte. Man kann nur – mit mehr Optimismus als in Afghanistan – auf die Zukunft hoffen. Ich habe mich nachträglich gefragt, warum „Krieg“ so selten „Frieden“ schafft. Pazifisten glauben es zu wissen – er schaffe das nie. Aber das ist nachweislich falsch: Die Intervention der USA, die Hitlers Niederlage besiegelte, schuf Frieden in Westeuropa und die US-Intervention in Korea schuf ein demokratisches, rechtsstaatliches Südkorea. Seither sind freilich alle US-Interventionen, von Vietnam über den Irak und Libyen bis Afghanistan, schiefgegangen. Dabei lassen sich mehrere Gemeinsamkeiten erkennen. Die einfachste ist militärisch: Der militärische Erfolg der USA beruhte, weil sie ihre Soldaten maximal schonen wollen, fast ausschließlich auf ihrer Lufthoheit. Luftschläge aber bedingen, so sorgsam man zielt – was in Vietnam bei Gott nicht der Fall war – extremes Leid der Zivilbevölkerung: Leute, deren Haus zerbombt wurde, können den USA kaum gewogen sein. Andere gravierende Fehler beruhen auf mangelnder Kenntnis von Kultur, Gesellschaft und Geschichte des jeweiligen Landes: Der Vietkong etwa kämpfte voran für die Befreiung Vietnams von der französischen Kolonialherrschaft – erst lange danach für die Ausbreitung des Kommunismus, die die USA mit ihrer Intervention verhindern wollten. Iraks Saddam Hussein war zwar ein Despot – aber ein aufgeklärter: Er hielt archaische religiöse Gegensätze seines Landes unter Kontrolle. Gleichzeitig ging es der ihm ergebenen Bevölkerung durchaus gut: Die Wirtschaft florierte – im Gegensatz zu den Nachbarländern gab es sogar geteerte Straßen; das Gesundheitssystem funktionierte – es gab funktionierende Spitäler; das Bildungssystem funktionierte und Frauen waren fast gleichberechtigt. Saddam Husseins Irak war für die Mehrheit der Bevölkerung ein weit lebenswerterer Staat, als der Staat, der ihm folgte. Ein großes Problem mit Saddam Hussein hatte nur die kurdische Minderheit. Ähnliches galt für Libyen unter Muammar al-Gaddafi, den eine US-Intervention stürzte, um Warlords und Chaos Platz zu machen. In Afghanistan wieder regieren in Wahrheit bis heute Stämme, die nicht nur in Gestalt der Taliban einem archaischen Islam anhängen, wenn man statt von der Stadtbevölkerung von der ungleich größeren Landbevölkerung ausgeht. Ebenfalls gemeinsam ist den Desastern der USA, dass sie in allen Ländern, in denen sie in jüngerer Zeit intervenierten, auf die falschen Männer setzten, um ihre Agenda zu vertreten: Das Regime Südvietnams, das sie gegen Nordvietnam verteidigten, war zwar liberaler als das Ho Chi Minhs, aber korrupter und ohne dessen Rückhalt in der Bevölkerung. Ganz ähnlich das neue Regime Afghanistans oder des Irak – in Libyen fehlte selbst ein korruptes Regime, um es zu Unrecht zu unterstützen.
441
442
Amerikas präsente Präsidenten
Bei allen diesen Staaten – am meisten in Afghanistan, am wenigsten im Irak – war es pure Illusion, zu glauben, dass „Wahlen“ und „Entwicklungshilfe“ in absehbarer Zeit westliche Demokratie und schon gar einen Rechtsstaat schaffen könnten. Dass das nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland und Japan gelang, lag daran, dass beide zuvor zivilisatorische Hochburgen und relative Rechtsstaaten gewesen waren und dass sie soeben erlebt hatten, zu welchen Katastrophen Diktatur und Rechtlosigkeit führen. Dass die Koreaner soeben die Diktatur Japans am eigenen Leib erlitten hatten und dass ihr konfuzianischer Glaube Bildung in so besonderem Ausmaß wertschätzt, war vermutlich der Hauptgrund dafür, dass auch sie schneller als andere Völker Demokratie erlernten. Dazu kam, dass die USA in Deutschland, Japan und Südkorea lange, intensive Erziehungsarbeit geleistet hatten und damit wahrscheinlich die entscheidende Voraussetzung dafür schufen, dass der Marshallplan und andere Entwicklungshilfen die positive Gesamtentwicklung wirtschaftlich abzusichern vermochten. Es scheint, dass die Bevölkerung gewisse Voraussetzung bereits mitbringen muss, damit Rechtsstaat und Demokratie eine Chance haben. In allen Staaten, in denen die Interventionen schiefgingen, hat es an diesen Voraussetzungen gemangelt. Daher haben die jüngeren US-Interventionen nie funktionierende Staaten geschaffen. Daraus scheint zu folgen, dass sie sie besser unterlassen sollten. Aber wenn die USA im Zweiten Weltkrieg nicht Hitlers Kapitulation besiegelt hätten, wäre Österreich vielleicht bis heute die „Ostmark“, die mittels SS und Gestapo von Massenmördern regiert würde.
Der Masseverwalter Barack Obama war der Präsident, der sich mit Bushs außen-, wie wirtschaftspolitisch desolatem Erbe auseinandersetzen musste. Gemeinsam banden Irak- und Afghanistankrieg zu hohen Kosten beträchtliche Mengen an Truppen. Obama begann damit, sie aus dem Irak abzuziehen, weil er sie in Afghanistan mehr zu brauchen glaubte – nachträglich ist klar, dass sie dort nichts ausrichteten und dass ihr Abzug nur die Probleme im Irak verschärfte. Gleichzeitig ergab sich in Syrien ein neues, zusätzliches Problem: Die „Arabellion“, der Versuch der arabischen Völker, ihre despotischen Regime abzuschütteln, hatte bekanntlich dazu geführt, dass Syriens Diktator Baschar al-Assad auf sein eigenes Volk schießen ließ, als es demokratische Forderungen erhob. Obama, der erklärt hatte, die USA würden einschreiten, wenn Assad die „rote Linie“ des Einsatzes von Giftgas überschreite, unternahm nichts, als er es tat. Obama untergrub damit nicht nur die Glaubwürdigkeit der USA, sondern verlor auch die Möglichkeit, das weitere Schicksal Syriens zu beeinflussen. Die nahm an seiner Stelle Wladimir Putin wahr, der sich von Beginn an auf Assads Seite gestellt hatte und dessen Sieg über den Aufstand sicherstellte: Der Massenmörder Assad blieb syrischer Präsident und sorgte mit Nordkorea, Eritrea und Venezuela dafür, dass immerhin vier Staaten Putins Krieg in der Ukraine guthießen.
Der Masseverwalter
Sehr viel erfolgreicher agierte Obama bei der Bewältigung des wirtschaftlichen Erbes George W. Bushs beziehungsweise Bill Clintons. Bekanntlich hatte sich eines der großen Bankhäuser der USA, Lehman Brothers, mit Aktien eingedeckt, die findige Absolventen neoliberaler Wirtschaftsuniversitäten aus den unter Clinton so reichlich gewährten Krediten an Hauskäufer gebastelt hatten. Diese sogenannten „Derivate“, die von allen führenden Ratingagenturen mit Tripple A als „top-sicher“ bewertet wurden, erwiesen sich bekanntlich als weitgehend wertlos, weil finanzschwache Schuldner ihre Hauskreditraten spätestens in dem Augenblick nicht mehr bezahlen konnten, in dem FED-Chef Alan Greenspan aus Angst um den Dollar die Zinsen drastisch erhöhte. Marktgläubig hatte Bush Lehman Brothers pleitegehen lassen und damit die Finanzkrise ausgelöst: Jede Bank hatte Angst, einer anderen Bank Kredite zu gewähren, weil sie fürchtete, die könne ebenfalls wertlose Derivate gehortet haben und ebenfalls pleitegehen. Obama überwand diese Verkrampfung des Bankenapparates, indem er wackelnden „systemrelevanten“ Banken, ganz gegen die neoliberalen Thesen von den Selbstheilungskräften des Marktes, staatliche Kredite gewährte. Nach diesem Schema überwand bekanntlich auch die EU ihre Bankenkrise, denn auch zahlreiche europäische Banken hatten wertlose US-Derivate erworben und ihren Kunden weiterverkauft, so dass auch in Europa Bankenpleiten drohten. Obamas wirtschaftspolitische Leistung war also eine durchaus beträchtliche, auch wenn er das Grundproblem der USA – das immer größere Auseinanderklaffen von Arm und Reich – allenfalls marginal zu lindern vermochte. „Obamacare“ ist dafür ein typisches Beispiel: Die USA verbinden bekanntlich das teuerste Gesundheitssystem der Welt mit bestenfalls durchschnittlicher Volksgesundheit und Lebenserwartung, weil die „Republicans“ jede Art öffentlicher Krankenversicherung wütend ablehnen, obwohl ihr Erfolg in jedem westeuropäischen EU-Land seit hundert Jahren überprüft werden kann. Gegen diesen absurden Widerstand, den auch manche „Democrats“ teilen, vermochte Obama nur die Pflicht jedes Amerikaners zum Abschluss einer Versicherung seiner Wahl durchzusetzen, sofern er nicht bei seinem Arbeitgeber versichert ist. Die weiterhin privaten Versicherungen konkurrieren zwar, aber ihre Leistungen sind weiterhin weit teurer als bei uns, wobei sie sich freilich darauf ausreden können, dass eben doch nur ein Teil der Bevölkerung – und zwar der nicht so gesunde Teil – bei ihnen versichert ist. Das System ist weiterhin teurer und leistungsschwächer als das europäische, aber immerhin sind dadurch 30 Millionen Amerikaner, die zuvor gar nicht versichert waren, jetzt mäßig, aber doch krankenversichert. Deshalb sind auch alle Bemühungen der Republicans, Obamacare unter Donald Trumps Regierung wieder abzuschaffen, letztlich am öffentlichen Widerstand gescheitert. Gar nicht durchgekommen ist Obama mit seinen Bemühungen, öffentliche Schulen und andere Teile der heruntergekommenen US-Infrastruktur durch große, öffentliche
443
444
Amerikas präsente Präsidenten
Investitionen zu verbessern: Die Republicans haben ihn dort, als sie in seiner zweiten Amtsperiode die Mehrheit im Repräsentantenhaus errangen, eisern scheitern lassen, obwohl das der von ihnen angeblich vertretenen „Wirtschaft“ zum Schaden gereichte. Wie jeden noch so bürgerlichen Reformer diffamierten sie Obama wegen „Obamacare“ und der Forderung nach Infrastrukturinvestitionen erfolgreich als „Sozialisten“. Was sie in Wahrheit noch weniger hinnahmen, war dennoch seine Hautfarbe: Ein schwarzer Präsident durfte kein erfolgreicher Präsident sein.
Wann endet der Rassismus? Die Berichterstattung des ORF (des Teams der ZIB 2) zu den ständig wiederkehrenden Rassenunruhen in den USA war intensiver als die von Sendeanstalten mit ungleich größeren Budgets. Die Worte eines schwarzen ORF-Kameramanns beschrieben die Dimension des Konfliktes und das Verfahrene der Situation präziser und kürzer als jeder Experte. Und eindringlicher als der zwölfjährige Keedron Bryant mit dem Song „I Just Wanna Live“ konnte man das Leid der schwarzen Bevölkerung nicht vermitteln: Man spürte die Ketten an den Handgelenken seiner Vorfahren. Dieser Berichterstattung, Bryants Video auf YouTube und der leichten Verabredung per Handy dankten es die überraschten Initiatoren, dass am 4. Juni 2020 in Wien fünfzigtausend Menschen auf die Straße gingen, um das seit Jahrzehnten eindrucksvollste Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Ein deshalb so positives Zeichen, weil aus Transparenten und Befragungen der Teilnehmer kein Zweifel daran bestand, dass sie nicht nur den Rassismus meinten, der George Floyd unter dem Knie eines US-Polizisten die Luft zum Atmen genommen hat, sondern sich durchaus daran erinnerten, dass auch Marcus Omofuma nicht mehr atmet, weil österreichische Polizisten ihm 1999 bei seiner Abschiebung den Mund verklebt hatten. Wenn man so jung wie die meisten Demonstranten war, musste es einen erschüttern, dass der Rassismus in den USA noch immer derart groß ist. Wenn man so alt wie ich ist, sieht man trotz allem den gewaltigen Fortschritt: Als ich vor nicht einmal fünf Jahrzehnten aufgrund einer Einladung des State Department für zwei Monate die USA bereiste und dem Rassenkonflikt dabei natürlich besondere Aufmerksamkeit schenkte, herrschte in Alabama noch heftige Erregung darüber, dass 1956 der erste schwarze Student dort eine Universität betreten hatte. Heute gibt es mehr schwarze Rechtsanwälte als dem schwarzen Anteil an der Bevölkerung entspricht, es gibt einen beträchtlichen schwarzen Mittelstand, Schwarze sind selbstverständlich Bürgermeister, Generäle oder Minister, und mit Barack Obama gab es eben trotz allem Rassismus den ersten schwarzen Präsidenten. Am Anfang dieser unglaublichen Fortschritte stand eine revolutionäre Entscheidung des Supreme Court, auf die ich schon ausführlich eingegangen bin: Weil Schwarze und Frauen durch Jahrhunderte diskriminiert wurden, erklärte das höchste Gericht der
Wann endet der Rassismus?
USA es für zulässig, ja notwendig, sie so lange zu bevorzugen, bis echte Gleichberechtigung erreicht ist. Dieses Urteil hatte dank Lyndon B. Johnson folgende gesetzlichen Konsequenzen: − Schwarze und Frauen mussten trotz schlechterer Noten als Weiße und Männer an Universitäten aufgenommen werden und konnten diese abschließen – das erklärt den gewaltig gewachsenen Mittelstand. Obwohl es auch zur Folge hatte, dass selbst Schwarze sich nicht von schwarzen Ärztinnen behandeln lassen wollten, weil sie ihrem Können misstrauten. − Unternehmen, die Staatsaufträge erhielten, mussten zu jedem Weißen auch einen Schwarzen zum Facharbeiter ausbilden, obwohl Schwarze einen viel geringeren Anteil der Bevölkerung stellen. Auch das stärkte den schwarzen Mittelstand – und erzürnte Weiße, die nicht Facharbeiter wurden. Donald Trump wurde zweifellos nicht zuletzt von zornigen weißen Männern gewählt, die auf diese Weise bei der Ausbildung zu Facharbeitern und bei der Aufnahme in Universitäten zurückstehen mussten. Gegen letzteres wurde 2021 von einem Anhänger Donald Trumps geklagt und es ist nicht undenkbar, dass er mit seiner Klage vor dem aktuellen Supreme Court Recht bekommt, denn Trump hat dort drei neutrale bis liberale Richter durch konservative ersetzt – dann wäre nach dem bereits rückgängig gemachten bundesweiten Recht auf Abtreibung ein weiterer der größten gesellschaftlichen Fortschritte der USA rückgängig gemacht. Der jedenfalls gegebene aktuelle Rückschlag im Verhältnis von Schwarzen und Weißen wäre allerdings dennoch nicht so augenfällig, wenn Barack Obama nicht einen so augenfälligen Fortschritt signalisiert hätte. Und er wäre vor allem nicht so lebensgefährlich, wenn der weiße Mittelstand der USA weiterhin wirtschaftlichen Aufstieg erlebt hätte, auch wenn sein wirtschaftlicher Vorsprung gegenüber Schwarzen schrumpft. Aber das Gegenteil war der Fall: In einem Wirtschaftssystem, das seit jeher auf maximale Ungleichheit setzte, gelangt derzeit, wie überall auf der Welt, eine immer kleinere Oberschicht zu so exzessivem Reichtum, dass kaum mehr Platz für wachsenden Wohlstand von Mittelstand und Unterschicht bleibt. Die Forderung der US-Gründerväter nach dem „größtmöglichen Wohlstand der größtmöglichen Zahl“ wird seit Jahrzehnten nicht mehr erfüllt: Erstmals zählt eine große Zahl weißer Amerikaner unter die wirtschaftlichen Absteiger und Deklassierten. Weiß zu sein ist damit ihr letztes verbliebenes Privileg – Polizist zu sein ist eine letzte Gelegenheit, es zu realisieren: Man kann einen Schwarzen anhalten, ihn zwingen, sich mit Händen am Rücken vor einem niederzuknien und ihn schlagen, wenn er nicht pariert. Manche Verhaltensforscher vertreten die These, dass es eine zwar durchaus überwindbare, aber instinktive Schranke im Umgang von Weißen mit Schwarzen und vice versa gebe. Mein Sohn Eric falsifiziert sie: Mit vier spielte er einen Tag lang alleine mit einem kohlrabenschwarzen Gleichaltrigen – als meine Frau ihn am Abend fragte:
445
446
Amerikas präsente Präsidenten
„No, hast Du schön mit dem schwarzen Buben gespielt?“ antwortete er „Mit welchem schwarzen Buben?“ Rassismus ist anerzogen. Meine Mutter, sonst der toleranteste Mensch, pflegte davon zu sprechen, dass „Negerlippen“ sie irritierten. Sie habe einen vom südafrikanischen Regime verfolgten „Neger“ zwar wie einen verfolgten Juden in ihrer Wohnung versteckt, aber der physische Kontakt mit ihm wäre ihr unmöglich gewesen. Die Verschränkung der Körperfarbe mit der Sexualität machte Rassismus für ihre Generation zu einer tatsächlich fast reflexiven Schranke. Eric, meiner Frau oder mir ist sie fremd.
71. Warten auf die Krise
Im Herbst 2006 nutzte Eric die Einberufung zum Bundesheer, um zurück nach Österreich zu übersiedeln. Er zog die feste Struktur des Heeres dem Beginn eines Studiums vor, und ich verstand ihn. Wir pendelten wieder einmal zwischen Österreich und Spanien, denn wir hatten uns dort in ein neues Abenteuer gestürzt: Wir betrieben eine Diskothek in Granada, weil wir meinten, dass unser schwarzer kubanischer Freund sie als Tanzlehrer ideal betreiben könne. Aber die Eröffnung fiel mit dem Beginn der spanischen Immobilienkrise zusammen, die nahtlos in eine spezifisch spanische Finanzkrise überging: Spaniens Banken hatten viel zu viele Kredite zum Bau viel zu vieler Ferienwohnungen vergeben und gerieten ins Wanken, als diese Kredite immer öfter nicht bedient werden konnten. Die wenigsten jungen Leute hatten das Geld, es in Diskotheken auszugeben, und unser Kubaner wollte nur mehr „Chef “, nicht mehr „Tänzer“ sein – die Diskothek wurde unser erster geschäftlicher Flop: Wir brachen das Disko-Abenteuer so verlustreich wie eilig ab. In Wien hatten wir die geschäftlich sinnvolle, aber für unser Zusammenleben kontraproduktive Idee, eine sehr große Wohnung zu mieten, in der tagsüber die Produktion von TOPIC stattfand, während wir in einem kleinen Teil privat wohnten und schliefen. Vor allem aber beherbergte die Wohnung in bester Lage nicht nur TOPIC, sondern als Untermieter auch noch ein Startup, an dem mein Sohn Oliver beteiligt war: Es hatte die TOPIC-Website entwickelt und verfolgte diverse Internetprojekte. Das bedeutete trotz der Größe der Wohnung tagsüber sehr heftigen Betrieb von insgesamt elf Arbeitskräften und unserer wie deren Klienten. Am Morgen konnte es passieren, dass Eva am Weg ins Badezimmer mit Klienten des Startups zusammenstieß und trotz zweier Toiletten herrschte auch dort permanentes Gedränge. Außerdem erwies sich die lächerliche Verrechnung für das gemeinsame gekaufte Toilettenpapier und vor allem die gemeinsam betriebene Telefonanlage als erstaunlich schwierig: Dem Startup, das wenig später um 50 Millionen Dollar verkauft wurde, waren die Papierkosten zu hoch – uns schockierte eine plötzlich gigantische Telefonrechnung. Als ich herausfand, dass sie vor allem aus Anrufen bei Rotlicht-Nummern resultierte, geriet mein Sohn unter schweren Verdacht, bis sich herausstellte, dass das Startup entsprechende Kontakte für eines seiner IT-Projekte sammelte. Die Differenzen wurden gütlich beigelegt – aber unser Privatleben litt doch erheblich: Eva konnte schwer begreifen, dass wir im spärlich abgetrennten, eher dunklen Teil einer Wiener Wohnung lebten, wo sie einmal mehr nur am Elektro-Klavier mit Kopfhörern spielen konnte, während uns in Marbella ein großes Haus mit Garten, Bösendorfer und Schwimmbad zur Verfügung stand. Sie wollte lieber in Marbella als in Wien sein, und ich konnte ihr schwer widersprechen.
448
Warten auf die Krise
Als das Startup um 50 Millionen Dollar an ein US-Unternehmen verkauft wurde, nachdem die Betreiber Oliver seinen Anteil ein paar Wochen zuvor mit kleinem Aufschlag abgekauft hatten, gaben wir die Großwohnung in der City auf und mieteten für TOPIC und uns eine kleinere, auch im privaten Teil hellere Wohnung. Nur hatte unser dortiger Schlafraum einen anderen Nachteil, den wir erst in der ersten Nacht entdeckten: Er grenzte mit seinem Fenster unmittelbar an den damals an der Außenwand des Gebäudes angebrachten Schacht für die Seile der Aufzugsanlage – wann immer jemand nachts den Lift benutzte, wachten wir auf. Es blieb dabei, dass Eva sich nach ihrem Bösendorfer und dem Haus in Marbella sehnte. Mir hingegen bot der Wien-Aufenthalt die Möglichkeit, wieder im Kaffeehaus zu sitzen und geruhsam alle Zeitungen zu lesen. So stieß ich 2002 in der Presse auf einen Artikel des Ökonomen Erich Streissler, den ich aus seiner treffenden Analyse der wirtschaftlichen Folgen der deutschen Wiedervereinigung in der Wochenpresse in bester Erinnerung hatte. Auf einer Doppelseite argumentierte er darin, dass die hohen Militärausgaben der USA, verbunden mit den enorm gestiegenen Privatausgaben der Amerikaner (auf der Basis immer höher bewerteter Häuser, die ihnen ermöglichten, immer höhere Kredite aufzunehmen) zu einer nicht mehr tragbaren Verschuldung führen müssten und dass deren Abbau eine Weltwirtschaftskrise auslösen würde. Ich hielt diese Argumente für stark und nutzte sie zu einem anderthalbstündigen Referat, das ich im November 2002 vor Managern der Versicherungswirtschaft hielt und das mit folgenden Sätzen endete: „Damit gehen die USA, und damit bin ich bei meiner Eingangsthese, einer massiven Rezession entgegen. Die Aktienkurse sind noch immer zu hoch und werden sich nicht erhöhen, sondern im Gegenteil weiter verfallen. Das bedeutet übrigens nicht unbedingt, dass europäische Aktien deshalb steigen, denn meistens werden sie von der Entwicklung in New York mitgerissen und natürlich wird sich auch der amerikanische Markt für europäische Waren verengen. Mit fallenden Aktienkursen und einem sinkenden Dollarkurs, verkehrt sich der Kapitalfluss in die USA aber in einen Abfluss. Ohne weitere Auslandskredite, so argumentiert Professor Erich Streissler in einer wegweisenden Analyse in der Presse, werden die Amerikaner daher gezwungen sein, ihr Leistungsbilanzdefizit abzubauen, das heißt ihre Sparleistung trotz stagnierender Einkommen drastisch zu erhöhen, indem sie ihren Konsum drastisch verringern. Im Zusammenwirken mit den zusammenbrechenden Investitionen muss das einen doppelt rezessiven Effekt haben. Ihn, Streissler, schaudert es bei diesem Gedanken. Mich auch.“ In den Jahren, die meinem Vortrag folgten, habe ich, als die prophezeite Krise nicht und nicht eintraf, Streissler immer wieder angerufen und mich nach ihrem Verbleib erkundigt. Seine Antwort ließ nie einen Zweifel offen: „Warten Sie ab. Es nimmt nur die Fallhöhe für den Absturz weiter zu.“ Heute würde ich seiner unverändert richtigen Analyse der amerikanischen Probleme dennoch eine in meinen Augen bessere amerikanische Reaktion gegenüberstellen: Der von Streissler befürchtete Kapitalabfluss ist meines Erachtens nicht das Problem, als
Warten auf die Krise
das er ihn einstufte – die US-Notenbank FED ist, wie bei der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre, in der Lage, notwendiges Kapital zu schaffen, indem sie Dollars „druckt“ – der Staat muss sie im Idealfall nur statt in Rüstung und verpuffende Munition in die Stützung seiner in Bedrängnis geratenen Banken, Unternehmen und Bürger sowie in Arbeitsbeschaffung durch die Verbesserung der Infrastruktur investieren. So hat es die Regierung Barack Obamas 2009 auch gehandhabt, um die Finanzkrise wie beschrieben zu überwinden. In Österreichs Wirtschaftsredaktionen war man, als die Subprime-Krise in den USA einsetzte, weil die überhöhten Hauspreise einbrachen und die Hauseigentümer aus der Unterschicht (der Subprime-Schicht) ihre Kreditraten nicht mehr begleichen konnten, so dass die Banken ins Wanken gerieten, restlos überrascht und sah auch nicht, dass Europa mitgerissen würde. „Haben Sie ein Haus in den USA?“, verstand der Chef des profil-Wirtschaftsressorts die Aufregung nicht. Streissler, der sie verstand, wurde in der Folge zu den ersten ORF-Diskussionen über die natürlich auf Europa übergesprungene Finanzkrise nicht eingeladen. Was mich betrifft, so ergeht es mir bis heute ähnlich, obwohl ich die Probleme neoliberaler Wirtschaftspolitik, erst im profil und dann im Falter, meist recht zutreffend analysiere. Für den ORF ist Franz Schellhorn, der Chef der Agenda Austria, der mir im profil als Kommentator ökonomischer Fragen nachfolgte der Mann, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu diesen Fragen fast ausschließlich einlädt.
449
72. Wie der Neoliberalismus die EU bedroht
Ich habe die Probleme des Neoliberalismus in einem Buch für den Falter-Verlag mit dem missverständlichen Titel „Die Zerstörung der EU – Deutschland als Sprengmeister, Österreich im Schlepptau“ eingehend behandelt, aber es hat sich, vermutlich dieses Titels wegen, so gut wie gar nicht verkauft. Der Titel war deshalb so schlecht, weil er die Auslegung zulässt, dass ich die EU für bereits zerstört halte und deshalb ablehne – in Wirklichkeit hat mich genau umgekehrt die Sorge, dass die EU kaputtgehen könnte, zum Schreiben dieses Buches veranlasst. Denn neben ihrem bekanntesten Konstruktionsfehler – dem Zwang zur Einstimmigkeit, der ihr die Handlungsfähigkeit nimmt – erfüllen mich die Konstruktionsfehler, die sich aus der Einführung des Euro ergeben haben, mit unverändert größter Sorge: Der Euro, von dem man dachte, er würde die Vereinigung der EU vollenden, spaltet sie – und das hat einerseits eine Menge mit seiner Verwaltung durch Deutschland zu tun und ist andererseits eine Folge der ökonomischen Missverständnisse des Neoliberalismus. „Wie der Neoliberalismus die EU bedroht“, wäre der richtige Titel meines Buches gewesen.
Die Probleme des Euro Erstmals gezeigt hat sich die Schwäche des Euro bekanntlich 2010 in der „Griechenlandkrise“: Spekulationen gegen den Euro drohten die Währung der Eurozone umzubringen. Erfolgreiche Spekulation gegen eine Währung oder, wie im Falle Griechenlands, gegen die Anleihen eines Landes, die in dieser Währung begeben werden, setzt Mangel an Vertrauen in ihren Wert oder gar ihr Fortbestehen voraus. Wenn die EU nie zugelassen hätte, dass über eine Pleite Griechenlands diskutiert wird, weil immer die gesamte EU oder zumindest die gesamte Eurozone mit ihrer Wirtschaftskraft vollstes Vertrauen in Wert und Überleben des Euro haben, dann hätten sich Kredite für Griechenland nie in einem so kritischen Ausmaß verteuert, und es hätte die unbestritten vorhandenen gravierenden Schwächen seiner wirtschaftlichen Struktur in sehr viel größerer Ruhe verbessern können. Es gibt nämlich keinen ökonomischen Grund dafür, dass ein gutes griechisches Unternehmen, dessen Bilanzen man einsehen und dessen Produktionsanlagen und Produkte man ansehen kann, für seinen Kredit deutlich mehr zahlen muss als ein gutes österreichisches Unternehmen, das von der kreditierenden Bank auf die gleiche Weise überprüft werden kann. Dieser erhebliche Unterschied, „Spread“, ergab sich nur, weil 2010 nicht mehr absolut sicher war, dass die EZB hinter Griechenland noch genauso wie hinter Österreich steht.
Die Probleme des Euro
Im Gegensatz dazu erhält ein gutes Unternehmen selbst der ärmsten USBundesstaaten, die immer wieder am Rande einer Pleite stehen, zu allen Zeiten problemlos preisgünstige Dollar-Kredite, weil niemand an Wert und Überleben des Dollar zweifelt. Denn es zählt zu den besonderen Stärken des Dollar, dass selbstverständlich nicht die einzelnen US-Bundestaaten, sondern die riesigen USA in ihrer Gesamtheit mit ihrer gewaltigen Wirtschaftskraft für ihn haften. Eben dem hat sich Deutschland beim Euro energisch widersetzt. In der Terminologie des Stammtisches: „Wir fleißigen, sparsamen, disziplinierten Deutschen werden doch nicht für Schulden haften, die diese faulen, untüchtigen, verschwenderischen, undisziplinierten… (an dieser Stelle kann fast jede andere Bevölkerung eingesetzt werden) womöglich auftürmen.“ In der Terminologie deutscher Ökonomen: „Es muss unbedingt verhindert werden, dass andere Volkswirtschaften sich bei ihrer Gebarung auf die Wirtschaftskraft und Budgetdisziplin Deutschlands verlassen.“ Deshalb wurden im Vertrag von Maastricht strengste (sinnlos einschränkende) Budgetkriterien – ein Budgetdefizit von maximal drei Prozent und eine maximale Staatsschuldenquote von 60 Prozent des BIP – vorgegeben. Dass Deutschland diese Kriterien als erstes Land nicht einhielt, weil die Wiedervereinigung zwingend eine expansive Budgetpolitik nötig machte, wird verdrängt. Statt dass man bei dieser Gelegenheit begriffen hätte: Die Drei-Prozent-Grenze beim Budget und die 60 Prozent Staatsschuldengrenze erschweren die richtige Reaktion auf größere wirtschaftliche Schwierigkeiten, wie sie zum Beispiel die Finanzkrise mit sich brachte und nun Pandemie und Ukrainekrieg mit sich bringen. Dass die USA ihren Bundesstaaten keine vergleichbaren Budgetkriterien vorschreiben und dennoch erfolgreich für deren Kredite haften, fiel deutschen Politikern, Ökonomen und Bürgern nicht auf. Der Euro befand sich angesichts der Sturheit, mit der deutsche Politiker und Ökonomen den Grundsatz getrennter Haftung verteidigten, in der Griechenlandkrise bereits unmittelbar vor dem Exitus, als EZB-Chef Mario Draghi ihn gegen heftigste Kritik seitens des deutschen Finanzministers Wolfgang Schäuble und führender deutscher Ökonomen gerade noch zu retten vermochte, indem er erklärte, ihn „mit allen Mitteln“ (also auch denen Deutschlands) zu verteidigen. Diese Aussage genügte, die Spekulanten den eiligen Rückzug antreten zu lassen. Deutschlands Oberster Gerichtshof, Angela Merkel und Wolfgang Schäuble können sich freilich bis heute innerlich nicht wirklich mit Draghis Aussage identifizieren, obwohl der EuGH mittlerweile entschieden hat, dass die gemeinsame Haftung zum Wesen einer gemeinsamen Währung gehört. Deutschlands innere Haltung zu dieser Frage hatte sehr konkrete praktische Folgen: So hat sie verhindert, dass sich ein schwächeres oder schwächelndes EU-Mitglied günstige Kredite im Wege von „Eurobonds“ verschaffen kann, was ganz ungleich billiger als Griechenlands fortgesetzte „Rettung“ gewesen wäre. Schwächelnde US-Bundesstaaten profitieren demgegenüber bei ihren Krediten selbstverständlich von der Bonität der
451
452
Wie der Neoliberalismus die EU bedroht
USA. Zudem zahlt die Regierung ihnen zur Linderung der dennoch gelegentlich verbleibenden minimalen Zinsdifferenzen außerdem noch Zinszuschüsse. Das führt zu einem zweiten grundlegenden Unterschied in der Handhabung von Dollar und Euro: In den USA ist nicht nur die gemeinsame Haftung selbstverständlich, sondern es gibt auch eine selbstverständliche gemeinsame, solidarische Abfederung von Risiken. So finanziert die US-Regierung neben der Landesverteidigung stets auch die Arbeitslosigkeit und die Gesundheitsprogramme aller Bundesstaaten – eine Lösung, die man sich in Deutschland für die EU nie vorstellen konnte. Jede durchgehende Finanzierung von Ausgaben und Abfederung von Risiken der einzelnen EU-Mitgliedstaaten durch ein zentrales Budget wird vielmehr – anders als strukturelle Förderungen wie etwa das Burgenland sie erhielt – energisch als kontraproduktiv zurückgewiesen. Am Stammtisch, wie unter deutschen Ökonomen mit dem gleichen Argument, dass diese Unterstützung ausschließlich dazu diene bzw. dazu führe, auf finanzielle Disziplin zu verzichten und notwendige Strukturreformen zu unterlassen. Dem gegenüber macht die gemeinsame Abfederung von Risiken durch die von der US-Regierung verteilten Transferleistungen schätzungsweise 30 Prozent ihres Budgets aus und sorgt entsprechend erfolgreich für den notwendigsten internen Ausgleich zwischen den ärmeren und den reicheren Bundesstaaten. Dass dieser Ausgleich in der EU so viel geringer ist, ist ein entscheidender Grund dafür, dass sie so viel leichter zerfallen könnte. In Deutschland sieht man den Geburtsfehler des Euro nicht in diesem Mangel an Gemeinsinn und Solidarität, sondern fürchtet, genau umgekehrt, nichts so sehr wie eine „Transferunion“. Den Geburtsfehler des Euro sieht man ausschließlich darin, dass so unterschiedlich starke Volkswirtschaften wie Portugal, Deutschland und Luxemburg ihn verwenden dürfen. Dabei unterscheiden sich Mississippi, Kalifornien und Delaware in ihrer wirtschaftlichen Stärke (im BIP pro Kopf) im exakt gleichen Ausmaß wie Portugal, Deutschland und Luxemburg, und kein US-Ökonom sieht darin einen Geburtsfehler des Dollar. Der viel eher relevante Unterschied ist der in der Mobilität: Ein Einwohner Mississippis, der dort zu wenig verdient oder keinen Job findet, übersiedelt ungleich leichter nach Kalifornien als ein Portugiese nach Deutschland, denn dort ist die Sprache und die Kultur eine andere und er findet sehr viel schwerer eine passende Wohnung. In Europa müssten statt der Arbeitskräfte wenigstens die Unternehmen mobiler sein. Der Umstand, dass die Löhne in manchen Regionen weit geringer als etwa in Österreich oder Deutschland sind, müsste noch viel häufiger dazu führen, dass neue Betriebe in diesen Niedriglohnregionen gegründet werden. Aber das stößt begreiflicherweise auf massiven nationalen Widerstand der Ausgangsstaaten und funktioniert ungleich langsamer als in den USA. In jedem Fall brauchte Europa aufgrund dieser geringeren Mobilität nicht weniger, sondern mehr internen Ausgleich. Deutschland ist zwar bereit, diesen nötigen internen Ausgleich zwischen dem armen Sachsen-Anhalt und dem reichen Bayern herzustellen,
Die Verabsolutierung des Marktes
so wie Österreich ihn zwischen Kärnten und Salzburg herstellt, aber wenn es um Portugal oder gar Griechenland geht, hat diese Bereitschaft enge Grenzen. Es gibt keinen Satz, den man aus dem Mund deutscher, aber auch österreichischer Finanzpolitiker der Ära Sebastian Kurz’ häufiger hörte als diesen: „Es muss unter allen Umständen vermieden werden, dass die EU zur Transferunion verkommt.“ Es fehlt völlig die Einsicht, dass die USA wirtschaftlich stark sind, obwohl sie eine Transferunion sind und etwa Mississippi oder Louisiana weit überproportional von Mitteln der US-Bundesregierung profitieren. (In beiden Bundesstaaten machen sie mehr als die Hälfte des Budgets aus.) Um ihren Transfer-Horror zu rechtfertigen, wird von deutschen wie österreichischen Journalisten/Ökonomen darauf hingewiesen, dass die US-Bundesregierung einzelnen Bundessaaten, die in wirtschaftliche Probleme geraten – etliche sind immer wieder dem Bankrott nahe – keineswegs rettend unter die Arme greift, sondern erwartet, dass sie ihre Probleme selber lösen. Aber man löst sie eben ungleich leichter, wenn Zahlungen an Arbeitslose, die Kosten aller Gesundheitsprogramme und alle Militärausgaben durch die US-Bundesregierung abgedeckt sind und man zudem Zinszuschüsse für die im Problemfall doch etwas erhöhten Zinsen erhält. Vor allem aber sind die Zinsen wirtschaftlich schwächelnder Bundesstaaten eben immer nur ganz geringfügig erhöht, weil völlig unbestritten ist, dass die ganzen USA „mit allen Mitteln“ für den Dollar haften, so dass die „Finanzmärkte“ ihm zu Recht ungebrochenes Vertrauen entgegenbringen. Alle Versuche, die EU mit einem größeren gemeinsamen Budget auszustatten, um ihr ebenfalls eine deutlich bessere Abfederung von Risiken zu ermöglichen, trafen und treffen nicht nur in Deutschland auf heftigen Widerstand, sondern trafen insbesondere auch auf den heftigsten Widerstand Österreichs unter Sebastian Kurz. Erst die Covid19-Epidemie hat diesen Widerstand in der EU-Kommission kurzfristig überwunden, indem die Union – gegen Kurz’ Protest – erstmals gemeinsam einen Milliardenkredit aufgenommen und ihren schwächsten Mitgliedern, Italien, Portugal oder Polen, besonders viel davon zugeteilt und einen Teil sogar geschenkt hat. Dass dürfe aber nie mehr geschehen, versprachen Sebastian Kurz und Angela Merkel. Dass Gemeinschaft nicht ohne Gemeinsinn funktioniert, geht ihnen nicht ein.
Die Verabsolutierung des Marktes Unverständnis für Gemeinsinn zeichnet die meisten Thesen des Neoliberalismus aus. Eine exakte Definition dieser Wirtschaftsreligion – denn eine solche ist es – gibt es nicht. „Wikipedia“ etwa, spricht von „unterschiedlichen Strömungen“ des Neoliberalismus und führt darunter Ludwig Erhards soziale Marktwirtschaft ebenso an, wie Milton Friedmans „Chicagoer Schule“. Ich hingegen zähle die soziale Marktwirtschaft Erhards eher zum Gegenteil des Neoliberalismus und sehe den Einfluss von Friedmans Chicagoer Schule als entscheidend an: Sie lehrt zwar nicht mehr, dass der Staat, wie im
453
454
Wie der Neoliberalismus die EU bedroht
Manchesterliberalismus, gar keinen Einfluss auf die Wirtschaft nehmen soll – denn das ist in die Weltwirtschaftskrise gemündet – wohl aber, dass dieser Einfluss sich auf das Nötigste beschränken soll und die „Marktkräfte“ klar den Vortritt haben müssen. Weil daher eigentlich entscheidend wäre, was man unter dem „Nötigsten“ versteht, bringt auch diese Definition – wie die meisten Definitionen – nicht viel. Auch ich halte die Marktkräfte zum Beispiel für überaus bedeutsam und sehe eine eminente Gefahr darin, sie ungenügend zu respektieren und bin doch sicher kein Neoliberaler. Ich will mich daher weniger mit Definitionen als mit der Praxis neoliberal gesinnter politischer Funktionäre auseinandersetzen und meine, dass folgende Überzeugungen sie eint: − Sie sind überzeugt, dass der Markt immer Recht hat. − Sie sind überzeugt, dass es den Menschen umso besser geht, je besser es der Wirtschaft geht. − Sie sind überzeugt, dass es der Wirtschaft umso besser geht, je mehr die sogenannte „Angebotsorientierung“ verwirklicht ist: Je leichter Unternehmen Kredite erhalten, je weniger Steuern sie zahlen müssen und je weniger Einschränkungen sie unterliegen, desto besser können sie sich angeblich entwickeln und für ein preisgünstiges, hochwertiges Angebot an Gütern und Dienstleistungen sorgen. Die Nachfrage nach diesem Angebot, so meinen Neoliberale, ergebe sich von selbst. − Zugleich sind sie überzeugt, dass der Staat dringend sparen – also nicht zu viel nachfragen soll. Nun ist es keineswegs so, dass ich überall das Gegenteil dieser Behauptungen für richtig halte – das tue ich allenfalls bezüglich des Sparens des Staates, das ich nur in einem Ausnahmefall für richtig halte: Wenn er andernfalls Unternehmen Kapital und Ressourcen streitig machte – doch davon sind wir derzeit meilenweit entfernt. Ich bin bloß nicht so absolut sicher, dass die angeführten neoliberalen Behauptungen immer und überall voll und ganz zutreffen. Daher will ich mich Stück für Stück mit ihnen auseinandersetzen und beginne mit der zentralen These des Neoliberalismus, wonach der Markt immer Recht hat. Bekanntlich geht der Markt mit Adam Smith davon aus, dass sich ein optimales Ergebnis für alle Teilnehmer auch dann einstellt, wenn jeder einzelne Teilnehmer nur seinen persönlichen, egoistischen Erfolg anstrebt. Auch für mich ist der Markt bis auf Weiteres – künstliche Intelligenz könnte das ändern – das mit Abstand beste theoretische wie praktische Modell zur Herstellung eines Gleichgewichtes von Angebot und Nachfrage beziehungsweise zur Ermittlung des niedrigsten dazu geeigneten Preises. Nur kann dieses Modell nur dann optimal funktionieren, wenn alle Marktteilnehmer in der Praxis auch die logischen Voraussetzungen dieses theoretischen Modells erfüllen: Alle Marktteilnehmer müssen im gleichen Ausmaß über alle marktrelevanten Informationen verfügen und in der Lage sein, gemäß diesen Informationen rational und zu ihrem Vorteil zu handeln.
Die Verabsolutierung des Marktes
In der Praxis, auf real existierenden Märkten, sind diese beiden Bedingungen so gut wie nie auch nur annähernd vollständig erfüllt: Manche Marktteilnehmer besitzen durch ihre wirtschaftliche Macht ständig einen erheblichen Informationsvorsprung; manche haben die Möglichkeit, Informationen zu manipulieren; manche sind in der Lage, allen anderen die Sicht zu verstellen, indem sie etwa marktrelevante Aktivitäten ins Ausland verlagern; manche sind durch ihre faktische (etwa militärische) Macht in der Lage, andere an der Wahrnehmung ihres Vorteils zu hindern, usw. usw. Es ist daher unverantwortlich, den real existierenden Markt wie so viele Neoliberale mit dem theoretischen Modell des Marktes gleichzusetzen und zu erwarten, dass er zwingend und jederzeit das optimale Resultat liefert. Es ist aus dem gleichen Grund unerlässlich, den real existierenden Markt, gegen die Einwände diverser Neoliberaler, zahlreichen Spielregeln zu unterwerfen, die ihn dem idealen theoretischen Markt wenigstens so weit wie möglich annähern. So ist es insbesondere notwendig, die möglichst präzise, gleichwertige Information aller Teilnehmer abzusichern, indem etwa Bilanzierungsvorschriften die Vergleichbarkeit von Bilanzen sicherstellen und Aktiengesellschaften alle Quartale über ihre Entwicklung Auskunft geben müssen. Auch müssten alle Beteiligten wissen, welche Chancen und Risiken komplexe Finanzinstrumente enthalten: Wenn das, wie bei vielen „Derivaten“, niemand weiß, weil sie als „Privatverträge“ figurierten und ihr Handel bis 2007 in den USA durch das Machtwort eines neoliberalen Finanzministers (Henry Paulson) und eines neoliberalen FED-Chefs (Alan Greenspan) keiner der Auflagen unterlag, denen Aktien unterliegen, dann verstößt man gegen eine der wichtigsten Voraussetzungen eines funktionierenden Marktes: die Transparenz. Ebenso selbstverständlich muss es Vorschriften geben, die dafür sorgen, dass unter den Teilnehmern des Marktes tatsächlich Chancengleichheit besteht. Wenn ein Unternehmen etwa das Monopol besitzt, Glühlampen herzustellen, dann hat der Konsument als Marktteilnehmer keine Möglichkeit mehr, um den Preis zu handeln, wenn er nicht im Dunklen sitzen will. Deshalb muss es Antitrust-Gesetze geben, die marktbeherrschende Unternehmen verhindern. Es muss Antidumping-Gesetze geben, die verhindern, dass ein extrem kapitalstarkes Unternehmen seine Konkurrenz ausschaltet, indem es die Preise seiner Waren durch längere Zeit unter den korrekten Kosten zu halten vermag. Einen Markt ohne Spielregeln zu fordern, kann nur jemandem passieren, der, wie US-Präsident Ronald Reagan zu Zeiten der „Chicago Boys“, den Unterschied zwischen theoretischem Modell und real existierenden Märkten nie verstanden hat oder der, wie Alan Greenspan und andere Neoliberale, in einer, im günstigsten Fall naiven, „Deregulierungsmanie“ befangen ist. Selbst unter den ungünstigsten Voraussetzungen stellt der Markt allerdings des Öfteren – vielleicht sogar meist – ein letztlich eher richtiges Resultat her: Die privaten Schulden der Amerikaner sind ja letztlich schlagend geworden, die US-Aktienkurse sind ja letztlich trotz Greenspans Eingriffen eingebrochen, die von den Ratingagenturen falsch bewerteten Derivate sind ja letztlich auf ihren wahren Wert reduziert worden. Es hat nur sehr, sehr lange gedauert: Immerhin hat Amerikas Bevölkerung 20 Jahre
455
456
Wie der Neoliberalismus die EU bedroht
hindurch zu viel ausgegeben, ohne dass „selbstkorrigierende Marktmechanismen“ sie zu mehr Vorsicht gezwungen hätten. Der real existierende Markt hat leider gelegentlich eine ziemlich lange Leitung. Seine Reaktionszeit ist sein gravierendstes Problem: Wenn es Jahre dauert, ehe eine extrem negative Entwicklung ausklingt oder eine positive sich einschleift, ist es nicht „links“ oder gar „kommunistisch“, doch für Eingriffe von außen zu plädieren, die nicht nur mehr Transparenz, sondern auch eine Verkürzung der Reaktionszeit bewirken. Die ganze Gewerkschaftsbewegung bewirkte nicht zuletzt die Verkürzung zu langer Reaktionszeiten des real existierenden Marktes: Vielleicht hätten alle Unternehmer wie Henry Ford auch ohne Streiks irgendwann – in hundert Jahren – von sich aus erkannt, dass sie ihre Arbeiter gut bezahlen müssen, damit die ihre Autos kaufen können oder dass Arbeitsunfälle sie mehr kosten, als die Absicherung der Maschinen. Aber gewerkschaftlich organisierte Streiks und die ihnen folgenden gesetzlichen Veränderungen, für die in Europa vor allem die Sozialdemokratie verantwortlich war, haben diesen Lernprozess doch sehr beschleunigt. Was wieder nicht heißt, dass es solcher Eingriffe immer bedarf: In den USA hat es im 19. Jahrhundert weit weniger Streiks als in Europa gebraucht, um dort bessere Bedingungen für die Arbeitnehmer herzustellen. Es gab dort nämlich anders als in Europa, keine industrielle Reservearmee, sondern im Gegenteil einen ständigen Arbeitskräftemangel. Die höheren Löhne oder die besser gesicherten Maschinen setzten sich daher auf dem Weg eines funktionierenden Arbeitsmarktes durch. Es war das Bestehen einer industriellen Reservearmee, das den entscheidenden Unterschied gemacht hat: In Europa, wo es sie gab, war es sehr schwer, höhere Löhne durchzusetzen, die sicherstellten, dass die produzierten Waren auch gekauft werden konnten, in den USA, wo es die längste Zeit keine industrielle Reservearmee gegeben hat, war es leicht. Es ist also insbesondere der Arbeitsmarkt, bei dem die Herstellung des marktgerechten Gleichgewichtes seine Tücken hat, und das liegt daran, dass die oben angeführten Voraussetzungen für ein klagloses Funktionieren kaum je gegeben sind: Arbeitnehmer verfügen nur selten über alle marktrelevanten Informationen und haben vor allem große Probleme, gemäß diesen Informationen zu handeln. Das hat sogar schon Adam Smith, in seinem ersten Buch (Kapitel 8) angemerkt: Er sah Arbeiter bei Lohnverhandlungen in einer schwächeren Position als Unternehmer, weil diese sich weit leichter zusammenschließen und ein Kartell bilden können, während den Arbeitern ein Zusammenschluss wegen ihrer großen Zahl schwerer falle und damals außerdem gesetzlich verboten war. Der „Vater“ der Marktwirtschaft, Adam Smith, nahm also die Notwendigkeit gewerkschaftlichen Zusammenschlusses vorweg, und bis vor nicht allzu langer Zeit war das von ihm erwähnte Ungleichgewicht bei Lohnverhandlungen durch die Macht der Gewerkschaften in vielen Ländern beseitigt – aber heute ist es von Neuem entstanden: Unternehmen sind mobil genug, ihre Produktion zunehmend in Entwicklungsländer fast ohne Gewerkschaften zu verlagern, während der Mobilität der Arbeitnehmer selbst innerhalb der EU, ja innerhalb des eigenen Landes, eine Vielzahl praktischer Wider-
Die Verabsolutierung des Marktes
stände entgegenstehen: Arbeitnehmer hängen an ihrem „Heimatort“ – sie haben dort ein Haus, Verwandte und Freunde, die sie ungern verlassen; und Arbeitnehmer hängen an ihrem Beruf: Es ist nicht so einfach, ein guter Kellner zu werden, wenn man bisher ein guter Schlosser gewesen ist. Kapital kann den Ort seines Einsatzes und die Form seines Einsatzes blitzartig verändern – Menschen können das nicht. Vor allem aber ist Arbeitslosigkeit nicht irgendeine von vielen möglichen Folgen des Marktgeschehens, sondern eine Konsequenz, die die gesamte Existenz des Betroffenen infrage stellt. Arbeitslosigkeit macht Angst – und Angst essen nicht nur Seele, sondern auch Verstand auf. Gefährdete Arbeitnehmer sind daher nur in Ausnahmefällen in der Lage, „rational und zu ihrem längerfristigen Vorteil“ zu handeln. An zwei Beispielen: Beispiel 1: Wenn die Gefahr zu vieler Arbeitskräfte für zu wenige Jobs besteht, müssten alle Arbeitnehmer, wenn sie informiert, rational und zu ihrem nachhaltigen Vorteil handelten, eigentlich so heftig wie nie zuvor konsumieren, denn das vergrößere den Bedarf an Gütern und sichere damit Arbeitsplätze. In der Praxis tun sie das Gegenteil: Sie schränken ihren Konsum so weit wie irgend möglich ein, um die erwarteten schwierigen Zeiten zu überleben. (Dass der Staat den Konsum dann auch noch einschränkt, zeigt, dass der Verstand von Politikern selbst ohne materielle Existenzangst angeknabbert wurde.) Beispiel 2: Rationale Arbeitnehmer müssten, wenn sie Kündigungen fürchten, ihr Angebot an Arbeitskraft verknappen, das heißt Überstunden unbedingt ablehnen. In der Realität tun sie in ihrer Sorge das Gegenteil: Erklären sich, jeder für sich, bereit, noch viel mehr Überstunden als bisher zu leisten und vielleicht sogar weniger Lohn dafür zu bekommen. Das wieder bedeutet, dass der Überhang des Angebotes von Arbeitskraft über den Bedarf an Arbeitskraft noch größer wird. Gleichzeitig können geringer entlohnte Beschäftigte noch weniger einkaufen, als sie aufgrund ihrer Ängste sowieso schon einkaufen wollen, was den Unternehmen, für die sie so lange und so billig arbeiten, in Wirklichkeit schadet, weil sie nicht mehr so viele Waren an diese Menschen verkaufen können. Aber bis die Unternehmer das erkennen, kann es viele, viele Jahre dauern, denn auch sie sind gelegentlich nicht in der Lage, ihren langfristigen Vorteil zu erkennen. Die Auseinandersetzung des Jahres 2019 um den Zwölf-Stunden-Tag in Österreich illustriert diese Problematik plastisch: Die betroffenen Arbeitnehmer haben einschließlich ihrer Gewerkschaft akzeptiert, dass der Wirtschaft die Anordnung der 60-Stundenwoche zugestanden werden muss, statt dass mehr Leute eingestellt werden müssten, um Großaufträge zeitgerecht zu bewältigen. Die Gewerkschaft hat nicht einmal erreicht, dass Arbeitnehmer die Vier-Tage-Woche mit dem gleichen Recht einfordern können, wie Arbeitgeber die 60-Stunden-Woche anordnen dürfen. Wo nicht einmal Adam Smith an die Chancengleichheit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern am Arbeitsmarkt glaubte, behaupteten Sebastian Kurz und Co ernsthaft, dass Arbeitnehmer dreimal hintereinander verweigern können, „freiwillig“ zwölf Stunden
457
458
Wie der Neoliberalismus die EU bedroht
zu arbeiten, seit die Arbeitgeber für solche Anordnungen nicht einmal mehr zwingend die Gewerkschaft einbinden müssen.
Geht es uns gut, wenn es der Wirtschaft gut geht? Damit zur wahrscheinlich zentralen Frage: Geht es uns wirklich immer besser, wenn es der „Wirtschaft“ besser geht? Ich behaupte: Nein, „immer“ ist das nicht der Fall. So ginge es der „Wirtschaft“ zum Beispiel bis 2007 in der EU wie in den USA hervorragend, agierte die Politik doch denkbar „angebotsorientiert“: Unternehmenssteuern waren und sind niedrig wie nie, und es fehlte weder an Rohstoffen noch, bis zum Ukrainekrieg, an preisgünstiger Energie. Also sprudelten die Unternehmensgewinne wie schon lange nicht – dennoch sprudeln die Einkommen bzw. Löhne der Bevölkerung in keiner Weise. Die nachfolgende unbestrittene Grafik der Arbeiterkammer zeigt unmissverständlich, wie sich der Anteil der Löhne am Bruttoinlandsprodukt (die Lohnquote) im Verhältnis zum Anteil der Gewinne am Bruttoinlandsprodukt (der Gewinnquote) zwischen 1976 und 2011 in Österreich entwickelt hat. Die Lohnquote fiel und fällt in dem Ausmaß, in dem die Gewinnquote stieg und steigt. (Die Turbulenzen in den Jahren 2009/10 signalisieren in keiner Weise ein Ende dieser Auseinanderentwicklung, sondern zeigen nur an, dass die Finanzkrise die Gewinnquote kurzfristig beeinträchtigt hat, weil Aktionäre Geld verloren haben – danach geht der Anstieg der Gewinnquote weiter wie zuvor).
Abb. 1 Die Verteilung von Löhnen und Gewinnen, Quelle: AMECO-Datenbank.
Das verfehlte Sparen des Staates
So sieht das Verhältnis von Gewinn- zu Lohnquote nicht nur in Österreich aus – so sieht es in allen Ländern der EU, in allen Bundesstaaten der USA und in Wahrheit in der ganzen Welt aus. Daher halte ich die neoliberale Behauptung, dass es den Menschen umso besser geht, je besser es der Wirtschaft geht, zumindest für die letzten vierzig Jahre in den USA und in der EU für widerlegt.
Das verfehlte Sparen des Staates Damit bin ich bei der Rolle staatlichen Sparens im Rahmen des Neoliberalismus und behaupte: Sparen des Staates, wie der Vertrag von Maastricht es fordert, wie Deutschlands vormaliger Finanzminister Wolfgang Schäuble es predigte, wie Kanzlerin Angela Merkel es via Sparpakt der gesamten EU unter Strafdrohung verordnete und wie Sebastian Kurz es auf seine Fahne schrieb, ist die meiste Zeit hindurch wirtschaftlich maximal kontraproduktiv. Woher kommt die deutsche Vorstellung, dass der Staat, um eine geeignete Infrastruktur herzustellen, keine Schulden eingehen darf? Mastermind war der Ökonom Kenneth Rogoff, der aufgrund von Wirtschaftsdaten aus 200 Jahren und 44 Staaten ermittelt haben will, dass eine Staatsschuldenquote von über 90 Prozent die Wirtschaft im Schnitt um 0,1 Prozent schrumpfen lässt. Das ist erwiesenermaßen falsch: Rogoff wurde nicht nur ein simpler Rechenfehler nachgewiesen, sondern er hat auch Volkswirtschaften, deren Wachstum seiner These massiv widersprachen – Kanada, Australien, Neuseeland – nicht berücksichtigt. Es gibt die magische 90-Prozent-Grenze nicht. Die Entwicklung der USA falsifiziert sie durch empirische Beobachtung weithin sichtbar: Obwohl sie mittlerweile bereits mit 121,5 Prozent ihres BIP verschuldet sind, wächst ihre Wirtschaft weit stärker als die der Eurozone mit ihrer Schuldenquote von ca.102 Prozent. Die 60-Prozent-Schuldenobergrenze, die die EU in Maastricht für ihre Mitglieder festgelegt hat und mit dem „Austerity-Pakt“ (Sparpakt) überall (wieder) erreichen wollte, ist genauso willkürlich und im Übrigen wirtschaftsfremd. Um es ausnahmsweise am Vergleich mit einer Privatperson zu illustrieren: Jemand, der im Jahr 60.000 Euro (5.000 € pro Monat) verdient, dürfte gemäß dieser Obergrenze keinen Kredit von mehr als 36.000 Euro aufnehmen. Wenn er zu den üblichen Kreditbedingungen eine Wohnung um 120.000 Euro kaufte, müsste man ihn wie Griechenland entmündigen und unter Kuratel stellen. Ähnlich absurd fällt der Vergleich mit einem Unternehmen aus: Ein Unternehmer griffe sich an den Kopf, wenn man ihm verböte, mehr als 60 Prozent seines Jahresertrages kreditfinanziert zu investieren – die Volkswagen AG investiert soeben ein Vierfaches davon, um die Umstellung auf E-Autos zu beflügeln. In Wirklichkeit ist die Verpflichtung des Staates, ausreichend in seine Infrastruktur und die Beschäftigung seiner Bevölkerung zu investieren, eine noch viel größere, denn das Wohl aller Unternehmen und aller Bürger auf seinem Staatsgebiet hängt davon
459
460
Wie der Neoliberalismus die EU bedroht
ab. Den enormen Wert einer hochentwickelten staatlichen Infrastruktur konnte man aus dem Vergleich von West- mit Ostdeutschland ablesen: Der Westen musste dem Osten durch Jahrzehnte zig Milliarden überweisen, um dessen Infrastruktur auf ein annähernd ähnliches Niveau zu bringen und hat das noch immer nicht ganz erreicht. Allein der Einblick in eine Tabelle der Staatsschuldenquoten sollte eigentlich jede Überbewertung dieser Ziffer ausschließen: Glaubt man wirklich, dass Bulgarien mit seiner Staatsschuldenquote von 26,3 Prozent wirtschaftlich besser funktioniert als die USA mit ihren 121 oder Japan mit seinen 235 Prozent? In Wahrheit signalisieren die 26,3 Prozent Bulgariens das genaue Gegenteil: Dass es nämlich notwendige Investitionen in sein Straßen-, Strom-, oder Kanalnetz, in seine Schulen, Verwaltung oder Rechtsstaatlichkeit verabsäumt hat. Staatsschulden können dann kritisch werden, wenn die Finanzmärkte das Vertrauen in die Rückzahlungsfähigkeit eines Staates verlieren – siehe Griechenland als die EU Zweifel an ihrer Haftung zuließ. Aber sie schaden weder den USA noch Japan, weil nicht die geringsten Zweifel an deren Rückzahlungsfähigkeit und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit bestehen. Auch die höchst populäre, von konservativen Politikern beständig im Mund geführte Behauptung, dass hohe Staatsschulden „zu Lasten der künftigen Generationen“ gingen, ist reine Polemik. Denn wenn der Staat heute Schulden eingeht, um z. B. ein Glasfasernetz zu installieren, dann haben gerade „künftige Generationen“ den entscheidenden Nutzen davon. Genauso wie sie am meisten von beschleunigten Bahnverbindungen oder verbesserten Schulen und Universitäten profitieren. Selbst die Zinsen, die ein Staat für seine Kredite (Staatsanleihen) zahlen muss, kommen künftigen Generationen zugute – nämlich den Personen oder Institutionen, die diese Staatsanleihen handeln bzw. gezeichnet haben. Vollauf verloren geht aus Gründen der „Saldenmechanik“, auf die ich noch ausgiebig zu sprechen komme, kein einziger auf dieser Welt jemals ausgegebener Betrag. Deshalb ist es auch blanker Unsinn (obwohl ihn auch bedeutende Persönlichkeiten, ja Ökonomen immer wieder äußern), dass die Welt an der gegenseitigen immer höheren Verschuldung krankt oder gar zu Grunde gehen wird, denn jeder Schuld entspricht zwingend – aus Gründen der Saldenmechanik – der Mathematik wie der Logik – ein gleich großes Guthaben. Nur die Verteilung kann auf krankhafte Weise durcheinandergeraten sein. Die „schwarze Null“ im Staatshaushalt, wie Wolfgang Schäuble oder Olaf Scholz, Hartwig Löger oder Gernot Blümel sie feierten und Deutschlands neuer Finanzminister Christian Lindner sie so bald wie möglich wieder erreichen will, ist aus saldenmechanischen Gründen nur dann nicht sofort und unmittelbar schädlich, wenn alle notwendigen Investitionen des Staates ausdrücklich von ihrer Berechnung ausgenommen sind – in jedem anderen Fall ist sie kompletter volkswirtschaftlicher Schwachsinn, den man durchaus täglich erkennen und mit der „Saldenmechanik“ begründen kann, wenn man nicht aus religiösen Gründen die Augen schließt.
Das verfehlte Sparen des Staates
Entwickelt wurde die „Saldenmechanik“ von dem 1987 verstorbenen deutschen Ökonom Wolfgang Stützel: Sie ist der erfolgreiche Versuch, Ökonomie unabhängig von (religiösen) Wertvorstellungen, privaten Verhaltensweisen und speziellen Umständen zu betrachten und sich dabei nur auf die Gesetze der Mathematik bzw. der Logik zu stützen. In diesem Sinne will ich die Kontraproduktivität staatlichen Sparens in einer Nachfragekrise „saldenmechanisch“ (= mathematisch =logisch) begründen. Der zentrale Satz der Saldenmechanik – in Wirklichkeit der Logik wie der Mathematik – lautet: Es kann keinen Verkauf ohne gleich großen Einkauf geben. Das aber besagt: Die Zahl der Verkäufe kann sich nur erhöhen, wenn sich die Zahl der Einkäufe im gleichen Ausmaß erhöht. Das wieder bedeutet: Es kann ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP), also den vermehrten Verkauf von Gütern und Leistungen einer Volkswirtschaft, nur geben, wenn der Einkauf von Gütern und Leistungen im gleichen Ausmaß wächst. Das aber ist höchst unwahrscheinlich, wenn einer der drei großen Player einer Volkswirtschaft, der Staat, klarstellt, dass er jetzt und in Zukunft weniger einkaufen wird, weil er sparen will. Denn der zweite große Player, Unternehmer und Unternehmen, wäre schwachsinnig, wenn er in dem Augenblick mehr einkauft, in dem der Staat klarstellt, ihm weniger abzukaufen. Die gleiche Argumentation im Detail, um zu begründen, dass der Wiener Professor für Finanzwirtschaften Erich Streißler so recht hat, wenn der lehrt, dass der Staat insbesondere in einer Krise nicht sparen darf und warum John M. Keynes so recht hat, wenn er fordert, dass der Staat investieren muss, um sie zu überwinden: Als „Einkäufer“ kommen drei große Gruppen in Frage: erstens Bürger als Endverbraucher von Gütern und Dienstleistungen; zweitens Unternehmen bzw. Unternehmer, die Güter und Dienstleistungen einkaufen, um damit mehr und andere Güter und Dienstleistungen zu produzieren; drittens der Staat, der Güter und Dienstleistungen einkauft, um damit seine Aufgaben zu bewältigen, die vom Bau und Betrieb von Straßen oder Wasserleitungen bis zum Bau und Betrieb von Bahnen, Schulen, Universitäten, Spitälern, Ämtern oder Gerichten reichen. Die aktuelle „Nachfrage“ – die Bereitschaft einzukaufen – dieser drei Gruppen ist im Gefolge von Krisen durch folgende empirische, durch einen längeren Zeitraum beobachtete Erfahrungen gekennzeichnet: − Die Einkäufe der Bürger neigen im Gefolge einer Krise, wie die Finanz- oder die Covid-19-Krise eine war, zu relativer Stagnation. Bei den einkommensstarken, wohlhabenden Bürgern, weil sie, wie der Name sagt, schon sehr viel haben und ihr Geld angesichts der nur kurz zurückliegenden Krise lieber sparen. Bei den einkommensschwachen, ärmeren Schichten, die nur zu gerne mehr kauften, geht einerseits ebenfalls unverändert eine leise Krisenangst um, die selbst sie so weit wie möglich sparen lässt – vor allem aber sind ihre Realeinkommen vielfach gesunken, statt gestiegen. Gemeinsam geben die Bürger daher als Konsumenten nach einer Krise kaum mehr, sondern manchmal sogar weniger als früher für Einkäufe aus.
461
462
Wie der Neoliberalismus die EU bedroht
− Zweiter Groß-Eeinkäufer ist der Staat. Den verpflichtet das Abkommen von Maastricht, beziehungsweise der Spar-Ppakt Merkels und Schäubles zum Sparen. − Daher wäre die nächste große Gruppe, die der Unternehmen und Unternehmer, schwachsinnig, wenn sie angesichts stagnierender Einkäufe der Bürger und eines sparenden Staates mehr Waren einkauften oder gar Erweiterungsinvestitionen tätigten, um ihre oft schon jetzt nicht voll ausgelasteten Produktionsanlagen zu vergrößern. Erstmals in der Geschichte – und anders als selbst John M. Keynes es jemals erlebt hat – sind Unternehmen derzeit Nettosparer: Statt Kredite aufzunehmen legen viele von ihnen Geld auf die hohe Kante, kaufen allenfalls eigene Aktien zurück oder Aktien verwandter Unternehmen zu, bzw. fusionieren. Mehr Güter und Dienstleistungen als früher kaufen sie zwar in Einzelfällen – nicht aber in Summe. Es ist daher mathematisch (logisch) unmöglich, dass die Wirtschaft der EU unter den Voraussetzungen eines sparenden Staates in ernst zu nehmendem Ausmaß wächst. Es ist tatsächlich so einfach – jeder Schüler der vierten Klasse Volksschule kann es verstehen. Und darin liegt wahrscheinlich schon wieder der Nachteil dieser Argumentation. Leute sagten mir: „Wenn es so einfach ist, dann ist doch ausgeschlossen, dass Leute wie Schäuble, Merkel, Kurz, Hartwig Löger, Gernot Blümel oder Christian Lindner es nicht verstehen.“ Ich habe darauf nur eine Antwort gefunden: Durch Jahrzehnte haben tausende hoch dekorierte Bakteriologen Schalen mit Bakterienkulturen als unbrauchbar weggeworfen, weil leider Schimmel hineingekommen ist und die Kulturen vernichtet hat – bis endlich einer den so einfachen Schluss zog: Aus Schimmel können wir ein optimales Medikament – Penizillin – herstellen. Wem die Mathematik nicht als Begründung für die Kontraproduktivität des staatlichen Sparens der Eurozone genügt, den überzeugt vielleicht ein empirischer Vergleich der Eurozone mit den USA, die ihren Staatsschulden wenig Aufmerksamkeit schenken: Am Höhepunkt der Finanzkrise 2009 gab es zwischen dem realen BIP pro Kopf der USA (48.557 Dollar) und dem realen BIP pro Kopf der Eurozone (36.135 Dollar) einen Abstand von 12.442 Dollar. Bis zum Jahr 2017, in dem ich mein Buch schrieb, war er auf 15.350 Dollar pro Kopf angewachsen. Noch deutlicher ist der Unterschied der Arbeitslosenraten: Während sich jene der USA von 2009 bis 2017 halbierte und vor der Pandemie unter vier Prozent lag, lag die der Eurozone 2017 bei 9,6 Prozent und lag 2021 noch immer über sieben Prozent. Schäuble & Co. halten dem entgegen, dass die Staatsschuldenquote der USA bis 2017 auf 108 Prozent des BIP gestiegen ist, während die der Eurozone nur bei 90,4 Prozent angelangt ist. Aber diese Zahl ist eben selten relevant – Japan hatte zeitweise eine Staatsschuldenquote von 250 Prozent, Bulgarien eine von 20,4 Prozent und ich denke, Sie borgten ihr Geld dennoch lieber Japan als Bulgarien. In Wahrheit müsste es heißen: Weil die USA ihre Staatsschulden nicht durch einen Sparpakt beschränkt haben, haben sie die so viel bessere wirtschaftliche Entwicklung erzielt.
Wenn Arbeitnehmer Preise subventionieren
Wenn Arbeitnehmer Preise subventionieren Verkompliziert wird diese saldenmechanische Betrachtung des Sparens, für die ich Sie vielleicht gewinnen konnte, auf den ersten Blick dadurch, dass wir beobachten, dass manche Volkswirtschaften trotz Sparens sehr wohl recht gut, ja – siehe Deutschland – sogar besser als andere wachsen. Aber auf den zweiten Blick ist das saldenmechanisch leicht zu erklären: Sie wachsen dann eben, weil andere Volkswirtschaften, mit denen sie Handel treiben, ihre Einkäufe aus irgendeinem Grunde steigern. Innerhalb der EU hat eine Reihe von Staaten seine Einkäufe gegenüber Deutschland erhöht, indem ihre Konsumenten sich verschuldet haben, und auch außerhalb der EU – etwa in Russland, den USA oder China – erzielt Deutschland Exportrekorde. In allen Fällen aus dem gleichen Grund: Deutschlands zu allen Zeiten hochwertige Waren sind seit 2000 dank „Lohndumping“ konkurrenzlos preisgünstig. Damit bin ich beim zweiten großen Problem angelangt, das Deutschland der EU aufbürdet: Die „Lohnzurückhaltung“, die seine Unternehmen seit der rot-grünen Regierung Gerhard Schröders im Jahr 2000 üben, verdient die Bezeichnung „Lohndumping“, denn sie beruht nicht voran auf immer effizienteren Produktionsprozessen, sondern voran auf immer niedrigeren, inadäquaten Löhnen. Bis dahin hatte sich die Entwicklung der Löhne der größeren Volkswirtschaften nämlich an ihren jeweiligen Produktivitätszuwächsen und der jeweiligen Inflation orientiert und damit einer Formel gehorcht, die in Österreich nach dem einstigen, langjährigen Gewerkschaftspräsidenten Anton Benya „Benya-Formel“ hieß: Lohnerhöhung = Produktivitätssteigerung + Inflation. Diese Formel war zwar von den Gewerkschaften durchgesetzt, aber von den Arbeitgebern akzeptiert, weil sie ökonomisch Sinn macht: Die Kaufkraft der jeweiligen Bevölkerung wächst durch Lohnerhöhungen, die dieser Formelf olgen in einem Ausmaß, das es ihr theoretisch erlaubte, alle von dieser Volkswirtschaft produzierten Güter und Leistungen auch zu kaufen, obwohl sie durch den Produktivitätszuwachs mehr geworden sind und sich durch die Lohnerhöhungen im Ausmaß der Inflationsrate verteuert haben. Natürlich kauft die Bevölkerung jedes Landes nicht nur die von der eigenen Volkswirtschaft erzeugten Waren, sondern auch die Waren anderer Volkswirtschaften – aber so lange die meisten Volkswirtschaften der EU nach der Benya-Formel agierten, gab es in Summe immer genug Kaufkraft, um das in Summe gestiegene Warenangebot trotz seiner durch Lohnerhöhung bedingten Verteuerung zu kaufen. Vor allem vor dem kontraproduktiven staatlichen Sparen hat die EU daher funktioniert, wobei es Deutschland dank seiner besonders hohen Verkaufserfolge auch außerhalb der EU immer besonders gut gegangen ist. Aber in den späten 1990er Jahren entdeckte Holland angesichts steigender Arbeitslosigkeit, die teils auf dem vorangegangenen Ölpreisschock, teils auf einer zu hohen Bewertung des Gulden beruhte, die Möglichkeit, seinen Waren im Konkurrenzkampf
463
464
Wie der Neoliberalismus die EU bedroht
einen Preisvorteil zu verschaffen, indem es seine Löhne nicht mehr nach der BenyaFormel, sondern um einen geringeren Prozentsatz erhöhte. Dieses Rezept kopierte Gerhard Schröder mit der Agenda 2000 für die mit Abstand größte und stärkste Volkswirtschaft der Eurozone, Deutschland, weil die sozialdemokratisch dominierten Gewerkschaften dem sozialdemokratischen Kanzler nicht den notwendigen Widerstand entgegensetzten. Deutschlands sowieso preiswerte Waren erhielten so einen Preisvorteil, der sie unschlagbar günstig machte: Seine Lohnstückkosten waren 2017 um 20 Prozent geringer als die Frankreichs, das weiter nach der Benya-Formel vorging und 30 Prozent geringer als sie Italiens oder Spaniens, die ihre Löhne zum eigenen Schaden über die Benya-Formel hinaus erhöht hatten. Zugleich verminderte sich die Kaufkraft innerhalb Deutschlands in einem Ausmaß, das ausschloss, dass seine Bevölkerung theoretisch im Stande gewesen wäre, alle dort vermehrt produzierten Waren zu kaufen: Deutschland musste und muss zwingend mehr und mehr Waren exportieren und das ging und geht zwingend zu Lasten anderer Volkswirtschaften. Mit Deutschland, als seinem mit gewaltigem Abstand wichtigstem Handelspartner, hätte Österreich seine Löhne auch dann nicht mehr nach der Benya-Formel erhöhen können, wenn es das gewollt hätte – jedenfalls übte es nach 2000 ebenfalls, wenn auch nicht im deutschen Ausmaß, „Lohnzurückhaltung“ und gelangte auf diese Weise ebenfalls zu einem, wenn auch nicht ganz so großen Wettbewerbsvorteil: 2017 lagen seine Lohnstückkosten zehn Prozent unter denen Frankreichs und 20 Prozent unter denen Italiens. Die ökonomischen Folgen waren zwingend: Voran deutsche, dahinter österreichische, holländische und übrigens auch Schweizer Waren (die Schweiz übte außerhalb der EU Lohnzurückhaltung) gewannen und gewinnen gegenüber skandinavischen, französischen oder gar italienischen Waren beständig immer größere Marktanteile. Nicht, weil ihre Waren so sehr an Qualität gewonnen haben oder so viel effizienter produziert werden als zuvor, sondern weil sie ihre Arbeitnehmer so viel schlechter als zuvor bezahlen. Deutsche (Schweizer, österreichische, holländische) Arbeitnehmer subventionieren die Warenpreise ihrer Unternehmen, indem sie zum Teil sogar Reallohnverluste erleiden. Mit diesen sinkenden Löhnen verminderte sich zugleich die Kaufkraft Deutschlands, Österreichs, Hollands, der Schweiz), so dass die sowieso teureren französischen, italienischen oder spanischen Waren noch weniger Absatzchancen haben. Während Deutschland immer höhere Exportüberschüsse erzielte, verschlechterten sich die Leistungsbilanz Frankreichs Italiens oder Spaniens immer massiver. Das erschütterte und erschüttert Europas Wirtschaftsgefüge gleich doppelt. In den Ländern, die solcherart Marktanteile verlieren, musste und muss es zu hohen Arbeitslosenraten, explodierender Jugendarbeitslosigkeit und steigender Verschuldung kommen, während in Deutschland,
Wenn Arbeitnehmer Preise subventionieren
Österreich, der Schweiz oder Holland hohe Gewinne mit zunehmender Arbeitskräfteknappheit einhergehen. Deutschland spricht von einem Beschäftigungswunder: Seit 2007 sind auf seinem Gebiet trotz Sparens 5,4 Millionen neue Stellen geschaffen worden, 580.000 alleine 2020. Das Wunder ist keines: Mindestens so viele Arbeitsplätze sind in all den Ländern verlorengegangen, denen Deutschland mittels Lohndumping Marktanteile abgenommen hat und deren Verschuldung gleichzeitig im Ausmaß des deutschen Überschusses gestiegen ist. Weil Deutschland, Österreich, Holland oder die Schweiz auf die beschriebene Weise so große Marktanteile innerhalb der EU gewonnen haben, sind sie wenig davon betroffen, dass der Sparpakt den Warenabsatz innerhalb der EU in seiner Gesamtheit eingebremst hat – sie können zu Lasten der anderen EU-Mitglieder wachsen und sind in der Lage, gegenüber allen anderen EU-Mitgliedern immer höhere Leistungsbilanzüberschüsse zu erzielen, der gegenüber Frankeich hat sich verzehnfacht. Ihr müsst es eben wie wir machen, reagieren Deutsche, wenn man sie mit diesem Tatbestand konfrontiert. Sie begreifen nicht, dass das gesamte System dann implodieren muss, weil lauter zurückgehaltene Löhne ausschließen, dass mehr und mehr Güter und Leistungen gekauft werden. Das deutsche Verhalten verstößt denn auch gegen das in der EU, aber auch im World-Trade-Abkommen vereinbarte wirtschaftliche Gleichgewicht – kein Land soll dauerhaft Überschüsse haben – und gegen die vereinbarte Zielinflation von 1,9 Prozent, die verwirklicht wäre, wenn alle Länder unverändert nach dem Benya-Formel agierten. Aber da es dem mächtigen Deutschland mit dieser unfairen Politik gut geht, unternimmt die von Deutschland dominierte EU-Kommission nichts, es zu ändern. Zumal der sie beherrschende Neoliberalismus sich dadurch auszeichnet, dass er alles, was sich in der Wirtschaft – auch mit noch so viel Verletzung der Spielregeln – de facto ereignet, für richtig, weil „marktgerecht“ hält. Jedenfalls wird das so bleiben, solange alle anderen Länder die beschriebene Unfairness akzeptieren und sich nicht zusammenschließen, um eine andere Politik durchzusetzen. Bisher haben das nur die USA versucht: Schon Barack Obama erwog und Donald Trump drohte, deutsche Waren mit Zöllen zu belegen – aber letztlich sind die USA so riesig und so reich, dass sie auch mit einer ständig negativen Handelsbilanz gegenüber Deutschland leben können. Nur ob Spanien, Italien oder Frankreich das auf die Dauer auch können, ist fraglich – die Folge der deutschen Politik kann auch der Zerfall der EU sein. Das – in groben Zügen – wollte ich in meinem Buch aufzeigen. Im April 2023 wurde Angela Merkel von Bundespräsident Walter Steinmayr mit dem höchsten deutschen Orden, dem Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung, ausgezeichnet. „16 Jahre lang haben Sie Deutschland gedient – mit Ehrgeiz, mit Klugheit, mit Leidenschaft. 16 lange Jahre haben
465
466
Wie der Neoliberalismus die EU bedroht
Sie für Freiheit und Demokratie, für unser Land und das Wohlergehen seiner Menschen gearbeitet – unermüdlich“, so Steinmayr. Das trifft zu: Merkel war eine anständige, um das Wohl der Deutschen bemühte Frau. Ich meine, dass man ihre Ära in zwanzig, dreißig Jahren historisch dennoch ganz anders einordnen wird: Der von ihr über Europa verhängte „Austerity-Pakt“, der die Maastricht -Kriterien mittels Strafen verschärfte und damit unausweichlich gemacht hat, war für ein dramatisches wirtschaftliches Zurückbleiben der EU hinter die USA verantwortlich: war deren reales BIP pro Kopf 2009, zu Ende der Finanzkriese nur um 9.615 Dollar höher als das der Eurozone, so hat sich dieser Abstand bis 2021 auf 27.797 Dollar fast verdreifacht. Selbst innerhalb Deutschlands hat Merkels Sparen neben Schulen, Straßen und der Bundesbahn vor allem die Bundeswehr, aber auch ganz Europas Wehrkraft und Rüstungsindustrie kaputtgespart, so dass sie bis heute Probleme hat die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. Dass die Ukraine solche Unterstützung überhaupt braucht, weil sie von Russland überfallen wurde, hängt gleichfalls unmittelbar mit Angela Merkel zusammen: Voran sie hat sich der Aufnahme der Ukraine in die Nato widersetzt, um Wladimir Putin nicht zu reizen. Nicht zuletzt hat Merkel die von Gerhard Schröder begonnene Politik der „Lohnzurückhaltung“ unverändert fortgesetzt und damit die von mir beschriebenen wirtschaftlichen Probleme Südeuropas prolongiert und voran in Frankreich und Italien gefährlich verschärft. Aber obwohl die deutsche Unternehmen dank „Lohnzurückhaltung“ gegenüber den Waren aller anderen Länder bis heute einen gewaltigen Wettbewerbsvorsprung genießen. ist sie auch den Deutschen selbst nicht gut bekommen: jedes fünfte deutsch Kind ist armutsgefährdet. Dass die AfD soviel Zulauf erhielt, liegt nicht zuletzt daran, dass die niedrigen Löhne voran in der Zeit der Inflation erstaunlich große Teile der deutschen Bevölkerung mit ihrem Geld kaum auskommen ließ.
73. Kurz, der perfekte Selbstdarsteller
Dass Österreich 2017 mit Sebastian Kurz scheinbar aus dem Nichts einen Neoliberalen zum Kanzler erhielt, hatte auf den ersten Blick fast nur damit zu tun, dass er 2015 mit der „Schließung der Balkanroute“ die Urangst der Menschen vor einer Invasion „Fremder“ zu bannen vermochte. Auf den zweiten Blick erweist sich die Abwertung, die Kanzler Werner Faymann und mit ihm die rot-schwarze Koalition in den Jahren davor in der öffentlichen Meinung erfahren hat, als mindestens so entscheidend. Obwohl Faymann recht ähnlich wie Kurz aufgestiegen war – auch er griff auf ein Netzwerk von Jugend an Getreuer zurück – fehlte ihm dessen Fähigkeit, Leistungen, die er im Gegensatz zu Kurz sehr wohl erbrachte, erfolgreich zu verkaufen. So überwand Faymanns rot-schwarze Koalition die weltweite Finanzkrise des Jahres 2008 auf der Basis eines von den Sozialpartnern geschnürten Maßnahmenpakets mit einem besonders geringen Verlust an Wachstum und Zuwachs an Verschuldung. Aber statt dass er und sein schwarzer Finanzmister Josef Pröll dafür Applaus erhalten hätten, (auch wenn der voran den Sozialpartnern gebührt hätte) verblieben beide im Schatten des Debakels der Hypo-Alpe-Adria-Bank. Das war zwar von Jörg Haider grundgelegt worden – indem das Land Kärnten die Haftung für die Bank übernahm und sie so zu extrem riskanten Geschäften verleitete – aber Josef Pröll hatte es durch den absurden Rückerwerb der Bank von der deutschen „Nord-LB“ sinnlos verschärft. Freilich hat derselbe Josef Pröll im Rahmen der Finanzkrise eine Leistung vollbracht, die große Ähnlichkeit mit Kurz’ „Schließung der Balkanroute“ hatte: Er hat die Staaten des ehemaligen Ostblocks hinter sich versammelt und in Brüssel in ihrem Namen zu erreichen geholfen, dass ihnen massive Finanzhilfe zuteilwurde. Damit hat er nicht nur sie vor einem Wirtschaftseinbruch bewahrt, sondern auch verhindert, dass Österreichs im ehemaligen Ostblock besonders aktive Banken dort ins Wanken gerieten. Auch die Inlandsprobleme der Banken – manche hatten ebenfalls wertlose USDerivate erworben – hat die Regierung Faymann-Pröll erfolgreich gelöst und mit noch größerem Erfolg den Aufschwung nach der Finanzkrise eingeleitet: Österreichs Wirtschaft wuchs stärker als die deutsche. Doch auch das vermochte die rot-schwarze Koalition in keiner Weise erfolgreich zu verkaufen. Ihr zentrales Problem bestand darin, dass die ÖVP nicht ertrug, die Regierung nicht anzuführen, sondern nur mitzugestalten: Statt den gemeinsamen Erfolg zu loben, kritisierten ihre Funktionäre die Regierung heftiger als selbst Funktionäre der opponierenden FPÖ. Voran der Chef der Bundeswirtschaftskammer Christoph Leitl profilierte sich dabei auf einzigartige Weise: Er behauptete lautstark, Österreich sei unter Faymann als Wirtschaftsstandort „abgesandelt“, obwohl er damit die Leistung seiner eigenen Bundeswirtschaftskammer bei der sozialpartnerschaftlichen Bewältigung der Krise desavouierte. Vor allem aber
468
Kurz, der perfekte Selbstdarsteller
gab es keine Behauptung, die in größerem Widerspruch zu den Daten der Wirtschaft gestanden wäre: Österreich verzeichnete zu diesem Zeitpunkt hinter den Niederlanden und vor Deutschland weiterhin das vierthöchste BIP pro Kopf der Eurozone, seine Industrieproduktion wuchs aber stärker als selbst die Deutschlands, und der Abstand zum BIP pro Kopf der Niederlande schrumpfte. Die OECD bescheinigte Österreich in ihrem Bericht für das Jahr 2013, der der Bundeskammer vorlag, nicht nur, dass es die Finanzkrise voran dank der funktionierenden Sozialpartnerschaft erfolgreich überwunden habe, sondern fasste die Situation, in der es sich befand, folgendermaßen zusammen: „Alles in allem hat Österreich ein bemerkenswertes Wohlstandsniveau erreicht. Starke Zugewinne des materiellen Lebensstandards wurden begleitet von sozialem Zusammenhalt und einem Zugewinn an Freizeit, besonders im Ruhestand. Speziell bemerkenswert für eine kleine offene Volkswirtschaft war das Ausmaß an Stabilität, das zur hohen Lebensqualität beigetragen haben dürfte. Hohe Familienbeihilfen dürften ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Das Inlandssozialprodukt pro Kopf ist ständig gewachsen und hat zu deutlichen Erhöhungen der Haushaltseinkommen geführt, während signifikante Umverteilung gleichzeitig Ungleichheit und Armut vermieden haben. Die Arbeitslosenrate ist niedrig und die Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen ist im Allgemeinen groß, was damit zusammenhängen dürfte, dass die Durchschnittseinkommen hoch und die Arbeitsplätze sicher sind. Der hohe Lebensstandard manifestiert sich auch in guten Wohnverhältnissen und darin, dass Wohnen, insbesondere durch großzügige Sozialbauten, leistbar bleibt.“ Das war das Urteil der „Internationalen Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit“ über jenes Österreich, von dem Christoph Leitl erklärte, es sei als Wirtschaftsstandort „abgesandelt“. Normalerweise wäre es die Aufgabe der Medien gewesen, Leitls Behauptung als restlos falsch zurückzuweisen – aber die mehrheitlich bürgerlichen Medien wiesen sie nicht zurück, sondern gaben sie genussvoll wieder, störte doch auch sie, dass nicht die ÖVP, sondern die SPÖ die Regierung anführte. Statt sich an Wirtschaftsdaten zu orientieren, orientierte sich ihre Berichterstattung an abstrusen von Leitl ins Treffen geführten „Rankings“ und am „ständigen Streit“, der alles, was die Regierung tat, tatsächlich ständig begleitete, weil die ÖVP sich auch in jedem Detail als Opposition gerierte. Leider versagte auch der öffentliche Rundfunk: Auch in der ZIB wurde Leitls so massiv falsche Behauptung zu keinem Zeitpunkt mit Wirtschaftsdaten konfrontiert, obwohl ZIB-Moderatoren normalerweise keinerlei politische Schlagseite erkennen lassen. Ich halte für wahrscheinlich, dass sie sich in der Politik einfach heimischer als in der Volkswirtschaft fühlen – dass in ihrem Team jemand fehlt, dem sie das entscheidende Anliegen ist. Jedenfalls verbreitete auch der ORF nur Leitls so süffige Bemerkung und befragte die rot-schwarze Regierung voran zu ihrem „täglichen Streit“. „Kein Streit“, so sollte Kurz daraus lernen, ist in einem Land, das am liebsten von einem Kaiser regiert würde, wesentlicher Bestandteil erfolgreichen Regierens. Entscheidend dafür, dass er eine SPÖ-geführte Regierung so einfach ablösen konnte, war
Kurz, der perfekte Selbstdarsteller
dennoch die initiale Unwahrheit über den Wirtschaftsstandort Österreich, die Christoph Leitl in die Welt gesetzt hatte: der Bundeskammerchef war Kurz’ wichtigster Wegbereiter. Kurz’ größte eigene Leistung war die vielzitierte „Schließung der Balkanroute“. Es gibt Kollegen, die ihm auch die absprechen: Nicht seine Initiative, sondern Angela Merkels Abkommen mit der Türkei habe zur Eindämmung der Flüchtlingsflut geführt. Das stimmt zwar insofern, als dieses Abkommen auf die Dauer zweifellos unverzichtbar war – aber den Anfang hat gemacht, dass alle betroffenen Balkanstaaten Zäune errichtet haben, und das wurde auf einer von Außenminister Kurz initiierten Tagung vereinbart. Bei dieser Tagung zeigte sich nicht zuletzt sein taktisches Geschick: Er unterließ es – und wurde auch dafür kritisiert – Griechenland dazu einzuladen, denn das hätte den gemeinsamen Beschluss ungemein erschwert, hätten die Griechen doch sofort darauf hingewiesen, dass sich die ausgesperrten Flüchtlinge bei ihnen stauen würden. Dennoch war das meines Erachtens nicht „rücksichtslos“ (wie ihm vorgeworfen wurde), sondern taktisch richtig, um den erhofften Erfolg zu erzielen. Kurz hat nie unterlassen, darauf hinzuweisen, dass Griechenland in der durch die Zäune geschaffenen Situation dringend finanzieller Hilfe bedürfe. Seine gesamte, anfangs als „menschenverachtend“ kritisierte Haltung – dass der Flüchtlingsstrom an der „Außengrenze“ aufgehalten werden müsse – ist mittlerweile so gut wie unbestrittene (manchmal leider brutal umgesetzte) EUMaxime: Flüchtlingspolitik kann nur funktionieren, wenn die notwendigste Ordnung gewahrt bleibt. Obwohl ich, eingedenk der Leistung meiner Mutter in der NS-Zeit, Zeit meines Lebens Flüchtlinge in meine Wohnung aufgenommen habe, bin auch ich von dieser Notwendigkeit zu einer gewissen Ordnung überzeugt. Die EU kann unmöglich alle Menschen aufnehmen, die in anderen Teilen der Welt keine Zukunft sehen, denn es gäbe hunderte Millionen solcher „Wirtschaftsflüchtlinge“. Sie muss sich darauf beschränken, den Menschen Asyl zu gewähren, die „Flüchtlinge gemäß der Genfer Konvention“ sind: denen Verfolgung und Tod wegen ihrer Rasse, Religion, sexuellen Orientierung oder politischer Überzeugung droht. Krieg, bei dem ständig allen der Tod droht, ist kein Asylgrund gemäß der Genfer Konvention. Was nicht heißt, dass man nicht auch Kriegsflüchtlinge aufnehmen soll – aber umso weniger kann man „Wirtschaftsflüchtlinge“ aufnehmen. Für diese Beschränkung des Asylrechtes gibt es auch abseits der Zahlen gute Gründe: „Wirtschaftsflüchtlinge“ sind im Allgemeinen die am besten ausgebildeten und initiativsten Mitglieder einer Bevölkerung – also genau die Menschen, die ein Land braucht, um die eigene Wirtschaft und irgendwann auch ein funktionierendes demokratisches System zu entwickeln. Es ist, so inhuman das klingen mag, kein Vorteil, wenn arme Länder genau diese Menschen verlieren, indem wir sie aufnehmen. Es gibt aber, abseits der Zahlenverhältnisse, auch gute Gründe, warum funktionierende Länder nicht beliebig viele Menschen aufnehmen können: Weil sie dann nämlich womöglich zu funktionieren aufhören: Parteien wie die FPÖ, die „Wahren Schweden“,
469
470
Kurz, der perfekte Selbstdarsteller
die „Lega Nord“ oder das „Rassemblement National“ Marine Le Pens stellten längst in fast allen Mitgliedsländern der EU die Mehrheit, wenn neben den Konventionsflüchtlingen auch jede Menge „Wirtschaftsflüchtlinge“ aufgenommen würden. Anders als die einstigen USA oder Kanada mit ihren gewaltigen Platzreserven und ihrem Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften ist die EU relativ eng besiedelt. Sollten die derzeitigen Trends anhalten, wird ihre Bevölkerung zwar bis 2080 von 513 auf 504 Millionen schrumpfen, aber das ermöglichte in diesem Zeitraum den problemlosen Zuzug von neun, nicht aber von Abermillionen Menschen. Dieser Zuzug muss, um die bestehende Gesellschaft nicht zu überfordern, auf kontrollierte Weise geschehen – sobald er unkontrolliert erfolgt, löst er Urängste aus, die der Hirnforscher und Wissenschaftspublizist Hoimar von Ditfurth 1989 kurz vor seinem Tod (also lange vor dem aktuellen Problem) so erklärte: „Es gibt drei angeborene Handlungsanweisungen im Menschen. Sie stammen aus dem vor-, und frühsteinzeitlichen Dschungel: Hab Angst vor jedem Menschen, den Du nicht persönlich kennst! Die Rechte Deiner Horde sind den Rechten aller anderen Kollektive übergeordnet! Du musst, wenn Du glaubst, das Überleben Deiner Horde nicht anders sichern zu können, den Konkurrenten totschlagen! Wenn wir von Horden von Fremden lesen, die hier einwandern, dann revoltiert dieses Gesetz der Steinzeit in uns. Deswegen sind wir keine Faschisten. Es ist menschlich, davor Angst zu haben. Nur muss dann die Hirnrinde tätig werden …“ Alles, was seit der Frühsteinzeit geschehen ist, musste in einer weniger tiefen Schicht – eben der Hirnrinde – erlernt werden: Die Erweiterung des „Wir“-Gefühls von der Horde zum Stamm, vom Stamm zur ethnischen Gemeinschaft und von ihr zur Nation. Nur weil sie sich als Angehörige der gleichen Nation empfinden, waren Wiener, Salzburger oder Tiroler bereit, den Kärntnern zur Hilfe zu kommen, als diese vom Hypo-Debakel heimgesucht wurden – aber es fällt ihnen schon viel schwerer, den Griechen bei ihren Problemen zur Hilfe zu kommen, weil unser „Wir“-Gefühl sie nicht ausreichend umfasst. So haben die Österreicher zwar noch ohne „steinzeitlichen“ Widerstand zwei Millionen sudetendeutscher Flüchtlinge aufgenommen, und die einstige Gemeinsamkeit in der k. u. k. Monarchie hat es ihnen emotional erheblich erleichtert, auch Flüchtlinge aus Ungarn, Tschechien oder Bosnien aufzunehmen. Aber jetzt, bei Syrern oder Afghanen hat ein Teil der Bevölkerung mit einer vergleichbaren Aufnahmebereitschaft ein Problem: Die Betreffenden sind unserer Heimathöhle eben doch um einiges ferner. Dass uns die Ukraine um so vieles näher ist, macht verständlich, dass Ukraine-Flüchtlinge, anders als Syrien-Flüchtlinge, selbst in Ungarn mit offenen Armen aufgenommen werden. Für H.-C. Strache oder Herbert Kickl war und ist es zwangsläufig immer besonders leicht, an die Steinzeitschicht unseres Bewusstseins zu appellieren: Sie hatten damit angesichts eines Flüchtlingsstroms aus Arabien oder Afghanistan zwangsläufig den Erfolg, den Hoimar von Ditfurth schon bei denen prognostiziert hat, die keineswegs
Kurz, der perfekte Selbstdarsteller
„Faschisten“ sind – wie groß musste ihr Erfolg erst bei denen sein, die sehr wohl zu faschistoidem Empfinden neigen. Sebastian Kurz hätte angesichts seiner ursprünglich enormen Beliebtheit vielleicht die Chance gehabt, gegenzusteuern und hat das als Staatssekretär für Integration auch eine Zeitlang getan – um triumphale Wahlsiege einzufahren war es aber auch für ihn ungleich bequemer, sich in Worten und bald auch Taten von Syrern und vor allem Afghanen abzugrenzen. Denn es ist denkbar beschwerlich, gegen die von Agitatoren geschürte steinzeitliche Angst im Stammhirn an die Gehirnrinde zu appellieren. Und es funktioniert auf keinen Fall, indem man vorhandene Probleme – etwa das der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt oder auf dem Sexualmarkt – leugnet. Denn es gibt das durchaus reale Problem des Lohndrucks durch „billige“ Zuwanderung, so wie es das durchaus reale Problem sexueller Übergriffe gibt, wenn Männer mit denkbar unterschiedlichen Frauenbildern auf Frauen in Miniröcken treffen. Man kann dann nur immer aufs Neue in der Hirnrinde deponieren, dass diese durchaus realen Probleme durchaus lösbar sind. Dass, um bei der besonders emotionalen Frage der „Übergriffe“ zu bleiben, ausreichend Polizei und eine energische Justiz sehr wohl dafür sorgen können, dass diese Übergriffe sich in tragbaren Grenzen halten und in absehbarer Zeit immer seltener werden: Alle Studien belegen, dass Zuwanderer mit der Zeit die Kultur des Gastlandes übernehmen und nicht umgekehrt. Manchmal sind auch Vergleiche hilfreich: Den angeblichen und gelegentlich auch wirklichen Vergewaltigungen durch Afghanen stehen beispielsweise die zahllosen, unbestreitbaren Vergewaltigungen von Kindern und Stiefkindern durch Väter und Stiefväter in der heimischen Gesellschaft gegenüber. Das Phänomen der häufigen Vergewaltigung ist, wie das des Kindesmissbrauchs und seiner Beförderung durch den Konsum davon hergestellter Bilder, wie er dem Schauspieler Florian Teichtmeister zum Verhängnis wurde, ein offenkundig gemeinsames – die Gehirnrinde ist vielleicht nach vielen mühsamen Diskussionen bereit, anzuerkennen, dass wir es bei uns wie bei den anderen bekämpfen müssen. Am Sexualneid und an der sexuellen Angst gemessen, ist das Überwinden der Angst vor wirtschaftlicher Konkurrenz ein relatives Kinderspiel – zumindest solange die Wirtschaft funktioniert und letztlich jedem eine Chance auf ein menschenwürdiges Einkommen bietet. Genau das aber bietet sie derzeit vielen Menschen weder in der EU noch in den USA: Es geht einer wachsenden Unterschicht nicht besser, sondern schlechter als früher, und das musste das Problem der Zuwanderung dramatisch verschärfen. Über einige der Gründe dafür, dass es den Menschen nicht besser, sondern schlechter als bisher geht, habe ich in den vergangenen Kapiteln so viel geschrieben, dass Sie es vermutlich nicht mehr hören wollen: „Lohnzurückhaltung“ und „Sparen des Staates“ entspringen volkswirtschaftlichen Missverständnissen, die sich zum Schaden
471
472
Kurz, der perfekte Selbstdarsteller
der Flüchtlingspolitik leider tief in die Gehirnrinde vieler wichtiger Ökonomen und Staatenlenker eingegraben haben. Erfolgreiche Flüchtlingspolitik beginnt meines Erachtens mit besserer Wirtschaftspolitik im eigenen Land: Wenn es weniger „Abgehängte“ in der eigenen Bevölkerung gibt, werden die Grenzen, in denen sie Flüchtlinge aufzunehmen bereit ist, weniger eng ausfallen, als Herbert Kickl und Sebastian Kurz sie gezogen haben. Das Problem bestand unter anderem darin, dass Kurz’ Vorstellung von guter Wirtschaftspolitik – nämlich „Sparen des Staats“ – das Gegenteil von tatsächlich guter Wirtschaftspolitik gewesen ist. Wer, wie er „im System“ – angeblich ohne Verlust an Leistung – sparen wollte, hielt diese Fiktion vor der Bevölkerung am einfachsten und populärsten aufrecht, indem er die Leistungen für Flüchtlinge kürzte – von der Beihilfe für ein drittes Kind, das bei ihnen zahlreicher als in der heimischen Bevölkerung ist, bis zur Kinderbeihilfe für slowakische oder serbische Ganztagspflegerinnen. Die Kürzungen erwiesen sich zwar durchwegs als verfassungs- und EU-rechtswidrig, aber der Applaus der Bevölkerung war schon erzielt. Leider scheitern auch Bemühungen, die Kontrolle über die Zuwanderung auch auf korrekte Weise zu verbessern, am Widerstand des Stammhirns: − So fordert George Soros aus gutem Grund, aber vergeblich, dass es ein gewisses Maß an geordneter, legaler Einwanderung in die EU geben müsse – aber das reicht Ungarns Viktor Orbán, ihn als Staatsfeind zu desavouieren, der Ungarn mit „Ausländern“ überschwemmen wolle. − Und natürlich soll und muss man in viel größerem Ausmaß vor Ort helfen. Das ist zwar eminent schwierig, aber es geht. Männer wie Karl Heinz Böhm oder Frauen wie Christine Wallner führen es im Kleinen vor. Entwicklungshilfeexperten heranzubilden, sollte eine der wichtigsten, vornehmsten Aufgaben von Wirtschaftsuniversitäten sein: Ich kenne zum Beispiel keine Literatur, die überzeugend klärt, wie weit Eigennutz der Geberländer dabei ein Vorteil oder ein Nachteil ist, obwohl mir eben dies eine der wesentlichsten Fragen scheint. − Österreich hat sich freilich zu allen Zeiten durch extrem niedrige Entwicklungshilfe ausgezeichnet, und der Neoliberalismus begegnet dem Problem mit dem üblichen Mangel an Wissen: Unterentwickelten, schwachen Volkswirtschaften, die in besonderem Ausmaß „Wirtschaftsflüchtlinge“ hervorbringen, „Freihandel“ zu predigen, wie das neoliberale Ökonomen mit Vorliebe tun, ist unverantwortlich, denn ohne schützende Zollmauern kann sich weder deren Industrie noch selbst deren Landwirtschaft entwickeln: Nicht einmal bei der Produktion von Hühnerfleisch sind afrikanische Staaten der freien Konkurrenz großer europäischer oder amerikanischer Nahrungsmittelunternehmen gewachsen. Die heute so erfolgreiche Autoindustrie Südkoreas konnte sich nur hinter Zollmauern von 400 Prozent für jedes ausländische Auto entwickeln.
Kurz, der perfekte Selbstdarsteller
Wahrscheinlich müssen wir Entwicklungsländern erlauben, ihre Produkte zollfrei an uns zu liefern, obwohl unseren Produkten auf ihrer Seite Zollschranken gegenüberstehen. Wann die vermindert oder aufgegeben werden können oder sogar aufgegeben werden sollen – weil die ausländische Konkurrenz die Unternehmen des Entwicklungslandes dann nicht mehr umbringt, sondern ihre Leistung befördert – ist eine der unendlich komplexen Fragen, die die von mir geforderten Entwicklungshilfeexperten vielleicht zufriedenstellend lösen können. − Eine mit Sicherheit richtige, wichtige Hilfe für unterentwickelte Länder besteht darin, diesen Ländern nicht, wie zeitweilig der IWF, einzureden, dass Sparen des Staates der beste Weg zu ihrem Aufstieg ist. Auch und gerade in Afrika gilt diesbezüglich die Saldenmechanik: Der Staat muss in Infrastruktur investieren. Man muss „nur“ mit aller Energie verhindern, dass die politischen Führer erhaltene Entwicklungshilfegelder vor allem für Waffen ausgeben oder auf ihre Schweizer Konten umleiten. Man könnte zum Beispiel strengste Strafen für Bankinstitute festlegen, denen solche Korruptionskonten nachgewiesen werden. Der nötige politische Druck ließe sich herstellen, indem man der Öffentlichkeit klar macht, dass diese Korruptions-Kkonten einer der Gründe für die aktuelle Fluchtbewegung nach Europa sind. − Neben finanzieller Hilfe muss es sicher auch intellektuelle und weltanschauliche, Hilfe geben. Dabei scheint mir der Hinweis auf die Notwendigkeit der Geburtenkontrolle der wichtigste: Selbst die gelegentlich gar nicht so schlechten Wachstumsraten etlicher afrikanischer Staaten reichen nämlich nicht aus, die Bevölkerung dieser Länder zu versorgen, solange sie mit noch größeren Raten wächst. Was ich an Sebastian Kurz’ „Ausländer“-Politik auszusetzen habe, beginnt jedenfalls erst mit dem Zeitpunkt, zu dem er Kanzler wurde: dass er sie zunehmend inhuman betrieben hat, indem er Zuwanderer stigmatisierte, sinnlos Abschiebungen gut Integrierter forcierte oder finanzielle Leistungen, die vornehmlich ihnen zugutegekommen wären, durchwegs verfassungswidrig zu kürzen suchte. So gekonnt wie er die Stimmung gegenüber Flüchtlingen als „Staatssekretär für Integration“ verbessert hatte, so gekonnt verschlechterte er sie als Kanzler. Kurz’ in meinen Augen größter Fehler, seine neoliberale Wirtschaftspolitik, vermochte er Gott sei Dank nur in Ansätzen zu verwirklichen, denn bis zu ihm war Österreichs Wirtschaft durch Bruno Kreiskys „schwedische Schule“, das heißte einen deutlichen Keynesianismus geprägt, dem aber mit Stephan Koren auch der lange Zeit wichtigste Wirtschaftsfachmann der ÖVP anhing. Ergänzt wurde beides mit unglaublichem Erfolg durch die „Sozialpartnerschaft“: Die Bereitschaft der Bundeswirtschaftskammer als Vertretung der Arbeitgeber und der Arbeiterkammer, als Vertretung der Arbeitnehmer, beziehungsweise der Gewerkschaften, alle wirtschaftlichen Probleme gemeinsam zu besprechen.
473
474
Kurz, der perfekte Selbstdarsteller
Diese „Nebenregierung müsse entmachtet werden“, gebrauchte Kurz ein wohlklingendes Argument, scheiterte aber mit dem Versuch, die gesetzliche Finanzierung der Arbeiterkammer abzuschaffen und ihr damit die Lebensader abzuklemmen. Dagegen gelang es ihm, gegen den Widerstand zumindest intelligenter Gewerkschafter, die sogenannte „betriebsspezifische Lohnpolitik“ salonfähig zu machen: Erfolgreiche Betriebe sollten beruhigt höhere Löhne zahlen, schwachen Betrieben sollten kollektivvertraglich erhöhte Löhne erspart bleiben. Klingt vernünftig, ist aber das Gegenteil und war (siehe Kapitel 46 – Pleiten und Pannen) die Ursache für die Intertrading-Pleite: Die lange Zeit erfolgreiche VOEST konnte angesichts viel zu hoher Löhne die Absatzkrise für Stahl nicht bewältigen. Ansonsten gelang ihm nur, auch Keynes historischem Widersacher Friedrich Gustav Hayek, der Eingriffe des Staates in die Wirtschaft bekanntlich grundsätzlich ablehnte, wieder salonfähig zu machen, indem er die Chefin des Hayek Instituts Barbara Kolm (FPÖ) zur Vizepräsidentin der Nationalbank und mit Robert Holzmann einen ihr verwandten Ökonomen zum Gouverneur der Nationalbank machte.
Kurz von innen Wie Kurz zum Kanzler wurde, ist bekanntlich nicht vom Kriminalfall Kurz zu trennen. Für die Obmannschaft der ÖVP schien er aber sicher nicht nur mir als der seit Langem begabteste Kandidat, ja ich habe ihn, um ehrlich zu sein, für das größte politische Talent seit Bruno Kreisky gehalten. Er war denkbar telegen – dass er, wie Jörg Haider viel jünger aussieht als er ist, war nie ein Nachteil, denn es gibt genügend Wähler, die sich einen solchen Schwiegersohn wünschen. Besonders angenehm hat mich persönlich sein gutes Deutsch berührt: dass er auf „Volksnähe durch Dialekt“ verzichtete; dass er über Nebensätzen nie das Zeitwort des Hauptsatzes vergaß; dass er aus dem Stand präzise zu diskutieren vermochte. Wenn Kurz bei deutschen Talkshows auftrat, hatte man nicht, wie bei den meisten österreichischen Teilnehmern, den Eindruck, dass er nicht mit den deutschen Diskutanten mithalten kann, sondern er war ihnen absolut ebenbürtig. Auch wenn ich nicht sein Wähler war, habe ich Österreich daher durch Kurz gut repräsentiert gesehen, und viele konservative Deutsche haben sich ihn bekanntlich zu ihrem Kanzler gewünscht. Wenn ich seine wirtschaftspolitischen Ansichten nicht für so völlig verfehlt gehalten hätte, hätte ich ihn jedenfalls für einen höchst passablen österreichischen Kanzler gehalten. Denn anders als meine Kollegen im Falter habe ich seinen Charakter nicht durchschaut. Hier rächte sich, dass ich so lange in Spanien gelebt hatte, und nicht wie früher mit den Details seiner politischen Karriere vertraut war. Nichts an Kurz sei „faschistisch“ schrieb ich in meinem ersten Falter-Kommentar, während Herausgeber Armin Thurnher ihn so genial wie treffend einen „Feschist“ nannte.
Türkis-Blau
Der Falter hat in der Folge bekanntlich ausführlich beschrieben, wie Kurz seinen Weg nach oben beschritt: Mit einer kleinen Gruppe Getreuer plante er das „Projekt Ballhausplatz“ nicht nur bis ins kleinste Detail, sondern verfolgte es mit einer Brutalität, die ihresgleichen sucht. Kurz’ Überzeugung von sich selbst übertraf die aller mir bekannten Politiker, mit Ausnahme vielleicht Bruno Kreiskys, aber den übertraf er dafür an Menschenverachtung: Jemanden ohne jeden Grund politisch umzubringen oder Menschen etwas vorzuenthalten, auf das sie den denkbar größten Anspruch gehabt hätten, störte ihn in keiner Weise. Ich gestehe, dass er mich damit völlig überrascht hat – ich habe mir sein Verhalten gegenüber Reinhold Mitterlehner in keiner Weise vorstellen können. Erst sein Mailverkehr mit dem Generalsekretär des Finanzministeriums Thomas Schmid hat mir die Augen geöffnet. Dass er jemand ist, der ein zwischen Christian Kern und Reinhold Mitterlehner geplantes Projekt, das 1,2 Milliarden Euro für den Nachmittagsunterricht von Kindern vorsah, nur deshalb torpediert, weil Mitterlehner dadurch vielleicht länger Vizekanzler geblieben und seinem sofortigen Aufstieg im Wege gestanden wäre, habe ich ihm nicht zugetraut. Der Coup gelang bekanntlich wie geplant. Mitterlehner, durch die dauernden Zwischenrufe Reinhold Lopatkas und Wolfgang Sobotkas, die sich als perfekte Unterstützer von Christoph Leitl erwiesen, genervt, verlor die Nerven und warf das Handtuch. Nicht zuletzt, nachdem die Moderatoren der „Zeit im Bild“ einmal mehr nicht auf die realen Wirtschaftsdaten zu reden gekommen waren, sondern Kern, wie Mitterlehner, immer nur die Frage gestellt hatten: „Wie lange hält diese Koalition noch?“ Indem man das jede Woche fragt, kann man, ohne es zu wollen, jede Koalition umbringen. Aus den Neuwahlen vom 15. Oktober 2017 ging die „Liste Sebastian Kurz – die neue ÖVP“ mit 31,5 Prozent bekanntlich als triumphaler Sieger hervor.
Türkis-Blau Es war nach der so erfolgreichen Demontage der rot-schwarzen Koalition klar, dass Kurz mit den Freiheitlichen koalieren würde, denn nur das fand den Beifall der Mehrheit der Bevölkerung – die Demontage der SPÖ war eben umfassend gelungen. Erstaunlich war nur, wie rasch Kurz und Strache sich zu einigen vermochten. Denn die FPÖ hatte sich bis dahin doch eher als „national“, aber „sozialistisch“ gegeben und der SPÖ auch ständig Wähler abgenommen, indem sie Arbeitern erklärte, wie sehr zuwandernde „Ausländer“ ihre Löhne drücken und ihnen Sozialleistungen und Sozialwohnungen streitig machen. Einzig Herbert Kickl soll angesichts des türkis-blauen Koalitionsabkommens, das aufgrund übereinstimmender Wirtschaftsprogramme im Blitztempo erzielt wurde, die Frage gestellt haben: „Und wo bleiben da unsere Leute?“
475
476
Kurz, der perfekte Selbstdarsteller
Wer „die Leute“ des Sebastian Kurz waren, schien aus der Liste seiner größten Parteispender ziemlich klar: Stefan Pierer, René Benko, Heidi Horten, Ingrid Flick, die „Tiroler Adlerrunde“ – jedenfalls niemand, der unter einer Million Euro im Jahr verdient. Während ich diesen Text korrigiere, ermittelt die Staatsanwaltschaft, ob einige von ihnen in seiner Ära verbotene finanzielle Vorteile erhalten haben. So schrieb Thomas Schmid bekanntlich an einen Finanzbeamten, der mit dem Steuerfall des Multimillionärs Siegfried Wolf befasst war „Vergiss nicht – Du hackelst im ÖVP-Kabinett!! Du bist die Hure für die Reichen.“ Auf Kurz’ Verlangen geht jedenfalls die Senkung der Körperschaftsteuer, die Unternehmer vor allem trifft, von 25 auf geplante 21 Prozent zurück. Und natürlich hat die ÖVP sich zu allen Zeiten – auch schon vor Kurz – vehement und mit Erfolg gegen adäquate Vermögenssteuern gewehrt. Dass sie unverändert zu den niedrigsten der Welt zählen, ist ein nachhaltiger Nachteil der österreichischen Steuerstruktur. Italien hat die EU-Kommission 2021 vorgeschrieben, die Einheitswerte seiner Liegenschaften den Verkehrswerten anzupassen – dass sie in Österreich noch weiter auseinanderklaffen, ist ihr offenbar entgangen. Dennoch glaube ich, dass man Kurz Unrecht tut, wenn man meint, er wollte sich mit seiner neoliberalen Politik in erster Linie seinen Spendern dankbar erweisen. Das wollte er zwar mit großer Wahrscheinlichkeit auch – dennoch glaube ich, dass er, wie so viele Ökonomen und Wirtschaftsjournalisten und mit ihnen immer mehr Bürger, auch ehrlich an die Grundidee des Neoliberalismus glaubt: Es gehe uns allen umso besser, je besser es den Unternehmen geht. Dass unser aller Lohnanteil am Bruttoinlandsprodukt seit Jahrzehnten in dem Ausmaß fällt, in dem der Gewinnanteil der Unternehmen steigt, nehmen bis heute weder Ökonomen noch Journalisten noch Bürger in seiner vollen Bedeutung wahr. Genauso wenig, dass die so wichtigen Investitionen der Unternehmen in keiner Weise gestiegen sind, obwohl ihre Steuern in den letzten Jahrzehnten ständig mit dieser Begründung gesenkt und beinahe halbiert wurden. Dabei ist diese nachteilige Entwicklung wirtschaftlich logisch: Weil die Arbeitnehmer real kaum mehr und zu einem erheblichen Teil sogar weniger als früher verdienen, ihre Kaufkraft also relativ sinkt, und weil zugleich auch noch der Staat mit seinen Einkäufen spart, wären die Unternehmer schwachsinnig, wenn sie kräftig investierten um ihre sowieso nicht ausgelasteten Kapazitäten noch ausweiteten. Was also tun viele von ihnen mit ihren gestiegenen Gewinnen? Sie investieren sie an der Börse: kaufen eigene Aktien zurück; kaufen Aktien verwandter Unternehmen um zu fusionieren; spekulieren aber auch ganz einfach: investieren in die Finanzwirtschaft, statt in die Realwirtschaft, weil das eine Zeitlang – irgendwann wird es sich rächen – das ungleich lukrativere Geschäft ist. Selbst die steuerliche Entlastung der Löhne, die Kurz durchführte (ihre steuerliche Belastung ist übrigens nicht größer als in Deutschland und im Verhältnis zum BIP eher unterdurchschnittlich, nur die Sozialversicherungsabgaben – freilich auch die Pensionen – sind bei uns höher) kommt den Bürgen umso eher zugute, je wohlhabender sie sind.
Türkis-Blau
Denn rund 2,5 der 6,8 Millionen Beschäftigten zahlen keine Lohnsteuer, die sich durch die Absetzbarkeit von 3.000 Euro pro Kind verringern ließe und fallen auch nicht unter die „kalte Progression“, deren einkommenserhöhende Abschaffung mittlerweile von der schwarz-grünen Koalition beschlossen wurde. Dem Geringverdiener kann man nur durch höhere Beihilfen helfen, die möglichst treffsicher nur ihm zugutekommen – und durch einen höheren Mindestlohn, wie es ihn mittlerweile zwar in Deutschland, nicht aber in Österreich gibt. Das Wichtigste für das relative Wohlergehen von Geringverdienern waren und sind freilich zu allen Zeiten preisgünstige Leistungen des Staates: gute Straßen, Kanäle oder elektrische Leitungen; preiswerter öffentlicher Verkehr; geförderte soziale Wohnbauten; eine (etwa im Gegensatz zu den USA) bezahlbare Gesundheitsversorgung; gute, für alle zugängliche Bildungseinrichtungen, bis hin zu Hochschulen; bezahlbarer Zugang zu Theatern, Museen oder Konzerten. Auch all das kommt natürlich auch „Reichen“ und „Wohlhabenden“ zugute, aber sie tragen durch ihre höhere Steuerleistung überproportional zu diesen Gütern und Leistungen bei. Die Güter und Leistungen des Staates sind wesentlicher Teil der von der OECD zu Recht gerühmten hierzulande geübten Umverteilung. Ein Staat, der diese Leistungen so „sparsam“ wie möglich bereitstellt, handelt sozial – ein Staat, der solche Leistungen „einspart“ – ein kleineres Budget mit weniger Umverteilung aufweist – handelt unsozial: Er nimmt der überwältigenden Mehrheit seiner Bürger, voran den Geringverdienern, etwas weg. Diesem Staat auch noch via Schuldenbremse aufzubürden, keine Kredite aufzunehmen – seine „Leistungen“ sind es ja, die „Schulden“ bedingen – ist wirtschaftlich schlicht dumm: So verkommen seit Jahren Deutschlands Bahnen, Straßen, Brücken oder Schulen. Auch die USA vermeiden bekanntlich immer wieder ausreichende Großinvestitionen des Staates, sofern sie nicht der Rüstung gelten, aber sie tun das nicht voran aus Schuldenphobie, sondern voran aus neoliberaler Ideologie: Schulen, Straßen und Brücken verkommen dort aus der Überzeugung der Republikaner, dass jedes wirtschaftliche Eingreifen des Staates als „Sozialismus“ des Teufels sei. In beiden Fällen ist ausnahmsweise der Vergleich des Staates mit einem Unternehmen angebracht: Eine Unternehmensführung handelte unverantwortlich, wenn sie es unterließe, Kredite aufzunehmen – Schulden einzugehen – um in die besten Maschinen und in das am besten qualifizierte Personal zu investieren. An einem konkreten Beispiel: Eine der wichtigsten wirtschaftspolitischen Aktionen des Staates zur Sicherung des Standortes stellt angesichts der unausweichlichen Digitalisierung der Industrie die Verlegung von Glasfaserkabeln dar. Derzeit stellt Österreich dafür eine lächerliche Milliarde pro Jahr bereit. Mindestens das Zehnfache wäre sinnvoll und leicht finanzierbar – aber natürlich verhinderten „Schuldenbremse“ und „Nulldefizit“ entsprechende Kreditaufnahmen, trotz der in der Ära Kurz niedrigsten Zinsen aller Zeiten.
477
478
Kurz, der perfekte Selbstdarsteller
Die ÖVP zu wählen bedeutete unter Kurz, die neoliberale Wirtschaftsideologie mit der wirtschaftlichen Ahnungslosigkeit der schwäbischen Hausfrau zu kombinieren. Viel hat sich daran bis heute nicht geändert, denn die „Schuldenbremse“ ist unverändert ideologisches Anliegen der EU.
74. Das Wunder von Ibiza
Dass Arbeiter in den letzten zehn Jahren Reallohnverlust von zehn bis 20 Prozent erlitten haben, hat sie nicht von der FPÖ zur SPÖ zurückwechseln lassen, denn sie sind überzeugt, dass es mit ihr nicht anders gekommen wäre, hat sie doch ein Gutteil dieser Zeit regiert. Eher glauben sie, dass diese Reallohnverluste der liberalen roten Zuwanderungspolitik anzulasten sind, und zu einem kleinen Teil stimmt das auch: Die geringen finanziellen Ansprüche von Zuwanderern aus dem ehemaligen Ostblock haben tatsächlich auf die Löhne gedrückt, nur hätte die SPÖ das angesichts der Grundfreiheiten der EU nicht vermeiden können. Auch Geringverdiener der ÖVP haben aus ähnlichen Gründen nicht zur SPÖ gewechselt. Wie Falter-Chefredakteur Florian Klenk, war ich daher noch 2019 der Meinung, dass die türkis-blaue Koalition trotz ununterbrochener „Einzelfälle“ mindestens zehn Jahre – zwei Legislaturperioden – fortdauern würde: „Kein Streit“ und die Erinnerung an die „Schließung der Balkanroute“, verbunden mit der ökonomischen Ahnungslosigkeit, im „Nulldefizit“ eine große Leistung, statt einen großen Fehler zu sehen, würden ausreichen, das sicherzustellen. Doch dann ereignete sich im Mai 2019 „Ibiza“. Nicht, dass ich nicht immer überzeugt gewesen wäre, dass H.-C. Strache zu jeder Korruption bereit ist, aber ich habe nicht mit seiner Unachtsamkeit und auch nicht mit dem Geschick der Fallensteller Julian H. und Ramin M. gerechnet. „Ich freue mich über die Festnahme des kriminellen Drahtziehers der Ibiza-Falle“, erklärte H.-C. Strache zur Verhaftung des Privatdetektivs Julian H. „und hoffe nunmehr auf rasche und restlose Aufklärung und auch auf die Aufdeckung der weiteren Mittäter, Auftraggeber und Hintermänner.“ In meinen schlimmsten Albträumen überfiel mich die Sorge, dass das irgendwann die gängigste politische Einordnung des Ibiza-Videos sein könnte: Eine kriminelle Falle, die einen naiven Politiker die Karriere gekostet hat. Denn Straches Äußerungen auf dem Video, dessen bin ich als langjähriger GerichtssaalBerichterstatter so gut wie sicher, werden für ihn keine Verurteilung ergeben. Die hatten bis zum Juli 2022 nur die Aufsteller der Ibiza-Falle, Julian H. und der Anwalt Ramin M. zu fürchten. Dann wurde das diesbezügliche Verfahren gegen Julian H. mit unbekannter Begründung eingestellt. Ich hatte gehofft, dass die Einstellung damit begründet würde, dass dem Land und seiner wirtschaftlichen Sauberkeit mit dem Video der größtmögliche Dienst erwiesen wurde und dass das anders als im Wege geheimer Videoaufzeichnung nicht zu erreichen war. Aber auch das Verfahren gegen Ramin M. wurde nicht mit dieser Begründung, sondern im Wege einer Diversion beendet – für mich persönlich bleibt der Anwalt ein Held.
480
Das Wunder von Ibiza
Ohne das Ibiza-Video hätte Österreich mit H.-C. Strache auf Jahre hinaus einen Vizekanzler gehabt, der bereit ist, Staatsaufträge an Leute zu vergeben, die seiner Partei Geld spenden. Denn es war ja nicht so, dass Sebastian Kurz Käuflichkeit und Unfähigkeit auf Seiten der FPÖ erkannt und sich deshalb von ihr getrennt hätte – das Ibiza-Video hat ihm nur die publikumswirksamste Chance gegeben, sich von ihr zu trennen und bei Neuwahlen umso besser abzuschneiden, weil er rechtsextremen Ballast in Form von „Einzelfällen“ los war.
75. Erstmals Bürgerlich und Grün
Das dank Ibiza abrupte Ende der türkis-blauen Koalition führte bekanntlich nach einer kurzen Nachdenkpause Sebastian Kurz’ zur ersten bürgerlich-grünen Koalition Europas mit entsprechendem Neuigkeitswert und vor allem großem Vorbildcharakter. Die immer sichtbareren Folgen des Klimawandels haben die grünen Parteien überall in Europa gestärkt und alle vorhandenen Parteien „ergrünen“ lassen. In Österreich und Deutschland, mit ihrer starken ökologischen Tradition, war der Grün-Trend besonders stark und hätte den Grünen schon früher wesentlich mehr Stimmen beschert, wenn ihre Obfrau Eva Glawischnig nicht plötzlich ausgerechnet beim Glücksspielkonzern Novomatic angeheuert hätte. Ich kann mir das nur durch eine schwere persönliche Krise erklären, und es hat den Grünen zwangsläufig einen massiven Rückschlag beschert, der ebenso zwangsläufig nicht von Dauer sein konnte: Der Klimawandel ist dazu ein zu gewaltiges, zu unübersehbares Phänomen. Ich glaube, dass der weltweite Grün-Trend in Paris eine nicht nur richtige, sondern auch durchführbare Klimavereinbarung ermöglicht hat, indem sie Schwellenländern wie China oder Indien noch relativ lange Zeit gibt, ihren CO2 -Ausstoß zu reduzieren, so dass sie ein brauchbares Wohlstandsniveau erreichen können, und indem Entwicklungsländer finanziell dabei unterstützt werden sollen, klimaschonende Technologien einzuführen. Es ist durchaus gerecht, dass Europa seinen CO2 -Ausstoß viel früher reduzieren soll, und noch gerechter wäre es, wenn die USA mit dem größten CO2 Fußabdruck pro Person der Welt es täten. Donald Trump hatte durch seinen Ausstieg aus dem Pariser Abkommen zwar einen dicken Strich durch diese Rechnung gemacht, aber die Technologie ließ ihn nicht ganz so zerstörerisch wie befürchtet ausfallen: „Fracking“, dessen primär enorme Umweltschädlichkeit sich mittlerweile durch neue Methoden erheblich vermindert hat, ermäßigte den Preis von Erdgas in den USA derart, dass US-Unternehmen es aus diesem Grunde zunehmend statt Kohle und Erdöl einsetzen und etwas weniger klimaschädlich als diese beiden ist es immerhin. Inzwischen ist Joe Biden dem Pariser Abkommen wieder beigetreten, aber sein Versuch, auch in den USA voran auf alternative Energien zu setzen, ist leider durch den extremen Widerstand der Republikaner, aber auch den eines demokratischen Senators aus dem Kohlestaat Virginia, längst nicht so erfolgreich wie erhofft ausgefallen. Die EU hat unterdessen tatsächlich versucht, mit gutem Beispiel voranzugehen und ausgerechnet die Covid-19-Pandemie hat ihr erstmals ein eigenes, noch dazu großes Budget beschert, klimaschonende Investitionen voranzutreiben. In Worten klingt ihr diesbezügliches Programm – „Fit for 55“ – sogar nach dem optimalen Programm, den CO2 -Ausstoß der EU bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren: Der Handel mit ständig sich
482
Erstmals Bürgerlich und Grün
verteuernden CO2 -Zertifikaten soll dafür sorgen, dass er dort zuerst verringert wird, wo es am kostengünstigsten ist; eine sukzessiv erhöhte CO2 -Steuer soll dafür sorgen, dass alles, was CO2 produziert, sich sukzessive verteuert; das so eingenommene Geld soll die Belastungen der jeweils Betroffenen ebenso abfedern wie ein eigens geschaffener Sozialfonds von 70 Milliarden Euro; und Zölle sollen die Importe aus Volkswirtschaften, deren CO2 -Ausstoß sich nicht in diesem Ausmaß verteuert, so belasten, dass daraus fairer Wettbewerb folgt. In der Praxis ist „Fit for 55“ freilich ein Hindernislauf: Die EU kann steuerlich nichts vorschreiben, nur empfehlen; in der Vergangenheit haben sich CO2 -Zertifikate kaum verteuert – Industrien mit starker Lobby erhielten sie billigst; jede Volkswirtschaft wird versuchen, „ihre“ CO2 -Steuer so niedrig wie möglich anzusetzen, um keinen Wettbewerbsnachteil gegenüber „anderen“ zu haben; und die Zölle, die Wettbewerbsfairness gegenüber China sichern sollen, werden schwer zu ermitteln und noch schwerer durchzusetzen sein. Zugleich haben die Gelbwesten-Proteste in Frankreich gezeigt, wie allergisch die Bevölkerung auf die Verteuerung von Treibstoff reagiert – nun musste sie selbst vor der Katastrophe des Ukrainekrieges mit der Verteuerung von Brennstoff durch die CO2 -Steuer und aller Güter durch teurere Zertifikate rechnen. Dass Abermillionen Diesel- und Gas-Zentralheizungen ausgetauscht werden sollen, trifft mit Haus- und Wohnungseigentümern wenigstens eher Wohlhabende (es ist eine ungewollte Immobiliensteuer) und gleichzeitig profitieren zumindest die Aktienbesitzer unter ihnen davon, dass die Erzeugung von Wärmepumpen und Solarpaneelen das Wirtschaftswachstum stützt. Alle anderen laufen freilich Gefahr, Reallohnverluste zu erleiden: Sie fahren teurer, heizen teurer und müssen mehr für verteuerte Waren bezahlen. Das sozial abzufedern, wird nicht nur weit teurer als erwartet sein, sondern gestaltet sich auch höchst diffizil: Zahlt man „Pendlern“ fast so viel „Teuerungsausgleich“ wie der teurere Treibstoff sie mehr kostet, hat die Steuer kaum Lenkungseffekt. Den hat sie nur, wenn Pendler deutliche finanzielle Vorteile davon haben, mit einer Bahn statt ihrem Auto zu fahren. Das wieder setzt ein um viel Geld blitzartig massiv erweitertes öffentliches Verkehrsnetz voraus. Denn der Übergang zum E-Auto wird sich als halb so wirksam entpuppen: Nur bei der Bahn, die den Strom der Oberleitung entnimmt, verringert sich der CO2 -Ausstoß drastisch – E-Autos müssen ihn wenig effizienten Akkus entnehmen, die ihrerseits große Mengen zusätzlichen Stroms aus Kraftwerken brauchen. Zwar ergeben zahlreiche Studien, dass dabei weniger CO2 als zuvor entsteht, doch sie gehen davon aus, dass der zusätzlich gebrauchte Strom „grün“ (Klimaneutral) erzeugt werden kann. Der deutsche Techniker und Blogger Kai Ruhsert hat darüber ein Buch und diverse Kommentare mit dem Titel „Der E-Auto-Schwindel“ geschrieben – so weit gehe ich nicht, aber seine Grundüberlegungen sind meines Erachtens beachtenswert: Sehr viele E-Autos brauchen sehr viel zusätzlichen Strom, um ihre Akkus zu speisen. Österreich hat das enorme Glück, seinen Strombedarf schon jetzt zu 84 Prozent „grün“, voran aus Wasserkraft zu decken; bei Deutschland, das Ökostrom
Erstmals Bürgerlich und Grün
mit sehr viel Geld extrem fördert, liegt dessen Anteil bei 45 Prozent; bei den meisten anderen Ländern mit Ausnahme Frankreichs mit seinen Atomkraftwerken ist er viel geringer. Die von sehr viel mehr E-Autos zusätzlich gebrauchte Strommenge muss aber möglicherweise selbst in Österreich mittels kalorischer Kraftwerke erzeugt werden, wie wir sie schon jetzt als Backup brauchen, wenn weniger Wasser fließt oder weniger Wind weht. Auch in Deutschland sind vorerst noch Kohlekraftwerke Teil dieses Backups, in den meisten Ländern sind sie dessen Rückgrat. In den Worten des Energieberaters Dieter Seifried: „Will man wissen, wie viel Emissionen zusätzlicher Stromverbrauch verursacht, darf man nicht mit einem Durchschnittswert für die Kraftwerksemissionen rechnen, sondern muss fragen, welche Kraftwerke für den zusätzlichen Strombedarf eingesetzt werden. Die Antwort darauf ist eindeutig: Bei dem derzeitigen Ausbautempo der erneuerbaren Energien wird Strom für Elektrofahrzeuge in den nächsten 15 Jahren nicht aus umweltfreundlichen Energiequellen kommen, sondern aus einer Mischung von Braunkohle, Steinkohle und Erdgas.“ Verwendet man diesen Mix für die Rechnungen, die in 29 von 38 Studien den Vorteil von E-Autos behaupten, so nähert man sich Ruhserts Schlussfolgerung: Die längste Zeit erhöhen sie den CO2 -Ausstoß sogar. Nur wenn man die Erzeugung grünen Stroms im selben Tempo wie den Absatz von E-Autos steigern könnte, wäre die Bilanz ausgeglichen – aber das dürfte selbst in Österreich sehr schwer sein: Selbst bei uns, die wir dank Wasserkraft die besten Voraussetzungen haben – wir hätten noch bessere, wenn die „Grünen“ weniger Wasserkraftwerke verhindert hätten – ist keineswegs gesichert, dass wir ausreichend grünen Strom für die E-Zukunft haben werden. Denn viel mehr grüner Strom erfordert ungleich mehr Solarparks, Windparks und Stromleitungen – wie sie ständig auf (grüne) Bürgerproteste stoßen und weiter stoßen werden. Zugleich kann die türkis-grüne Regierung gar nicht heftig genug dagegen protestieren, dass andere Länder versuchen, mittels Atomkraft CO2 -armen Strom zu erzeugen, der via Verbund auch uns zugutekommt. Dabei ist unsere Atom-Abstinenz, wie ich schon beschrieben habe, denkbar grotesk entstanden: Um bei der Volksabstimmung über Zwentendorf eine sichere Mehrheit für das Kraftwerk zu erreichen, erklärte Bruno Kreisky, er würde zurücktreten, wenn man sie verfehlte. Das ließ fanatische ÖVPler bis in die Spitze der Industriellenvereinigung gegen Zwentendorf stimmen und entschied das Votum. Kreisky, statt zurückzutreten, beschloss den „Atomsperrvertrag“, um seine Niederlage vergessen zu machen. Ihm danken wir die österreichische Überzeugung, dass Atomkraft des Teufels ist und sahen uns durch Tschernobyl und Fukushima darin bestätigt. Dass Franzosen, Briten oder Finnen sie nicht gleichermaßen fürchten, halten wir für Blindheit. Ich halte für Blindheit zu übersehen, dass Tschernobyl und Fukushima zusammen noch immer weniger Tote verantworten, als berstende Dämme von Wasserkraftwerken und vor allem als die Luftverschmutzung durch fossile Brennstoffe wie Öl, Kohle und Gas: An den solcherart zurückbleibenden Minipartikeln sterben nämlich ziemlich
483
484
Erstmals Bürgerlich und Grün
unbestritten acht Millionen Menschen pro Jahr – 24.000 jeden Tag. Daran sind die Todeszahlen von Tschernobyl oder Fukushima zu messen. Vor allem, seit gleichzeitig ein zentrales Problem der Atomenergie, die Endlagerung radioaktiven Materials aus Kernkraftwerken, mittlerweile physikalisch gelöst ist: Man kann es, nachdem man es chemisch zerlegt hat, mittels Neutronenbeschusses so behandeln, dass es nur mehr durch 50 Jahre und nicht mehr gefährlich strahlt – eine entsprechende Anlage in den Niederlanden funktioniert bereits. Mit Hannes Androsch bin ich daher überzeugt, dass eine massive Reduktion des CO2 sehr viel mehr Kernkraftwerke als Brückentechnologie brauchen wird – nicht, weil ich deren Probleme negiere, sondern weil ich technologische Entwicklungen mitverfolge und für die rationale Abwägung von Kosten, Nutzen und Risiken bin. Es gibt den Einwand, dass ihre Errichtung gewaltiger staatlicher Zuschüsse bedarf – aber deren bedürfen auch Anlagen zur Produktion alternativer Energie. Jedenfalls sollte man die Entscheidung über die Rentabilität beruhigt den jeweiligen Auftraggebern und dem Markt überlassen. Die EU hat Atomkraft jedenfalls zu Recht zur grünen Energie erklärt und bei den Grünen anderer Länder, etwa Englands, hat deshalb schon seit Längerem ein Umdenkprozess eingesetzt – bei uns und in Deutschland fällt Umdenken schwer – gegen Atomkraft zu sein ist nicht rationale Abwägung, sondern Ideologie. Generell glaube ich, dass die EU nicht nur sehr viel mehr Atomkraftwerke, sondern auch dringend eine neue Politik für den ländlichen Raum braucht: Er muss viel schneller ans digitale Netz angeschlossen werden und durch Kostenzuschüsse wieder Arztpraxen, Schulen und Postämter erhalten – alles Einrichtungen, die den Verkehr so erheblich vermindern, wie sie die Lebensqualität erhöhen. All das geht, wie so vieles, nicht allein via „Markt“ – es braucht den aktiven Staat. Dem stand die türkis-grüne Koalition unter Kurz neoliberal gegenüber: Den lehnte Kurz freilich ab, und es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Grünen unter seiner Führung durchgesetzt hätten, was sie unter Karl Nehammer durchgesetzt haben. Aber Kurz musste nicht seiner inhaltlich miserablen Politik wegen, die Führung der Partei und der Regierung abgeben, sondern weil Ibiza den „Kriminalfall Kurz“ nach sich zog und er den nicht überstand.
76. Der Kriminalfall Kurz
Ob Sebastian Kurz am Ende auch kriminelles Verhalten von Gewicht nachgewiesen werden kann, steht zu dem Zeitpunkt, zu dem ich dieses Manuskript abschließen muss, in den Sternen. Sicher ist, dass man froh sein muss, dass die Staatanwaltschaft sein Verhalten ernsthaft untersucht. Denn ein funktionierender Staat braucht eine Staatsanwaltschaft, die ihn und die Bevölkerung nicht nur vor Blutverbrechen, sondern auch vor Korruption schützt. In der Ära Kreisky war diese Staatsanwaltschaft unter Justizminister Christian Broda auf die von mir beschriebene Weise auf dem linken Auge blind: Megakorruption in der linken Reichshälfte wie sie beim Wiener Allgemeinen Krankenhaus passierte, wurde erst angeklagt, wenn Richter die Staatsanwaltschaft dazu zwangen. Das entsprach einer Problematik, die sich erst mit der geplanten Bestellung einer parteiunabhängigen Spitze der Staatsanwaltschaft geben wird. Denn die größte Korruption spielt sich zwangsläufig im Bereich staatlicher Großaufträge ab und berührt damit so gut wie immer die Regierungsparteien. So lange an der Spitze der Staatsanwaltschaft ein Justizminister steht, der von einer Regierungspartei gestellt wird, muss die Staatsanwaltschaft ein Problem damit haben, regierungsnahe Großkorruption aufzudecken. Auch in der schwarz-blauen Ära Wolfgang Schüssels wurde sie etwa in keiner der Korruptionsaffären tätig, die Jahre später zur Anklage gegen Karl-Heinz Grasser führten. Wobei sich zur beschriebenen Grundproblematik noch das Zusatzproblem gesellte, dass Korruption immer gewiefter betrieben wird, so dass es auch fachlich immer schwerer ist, sie zu verfolgen. Dieses Zusatzproblem löste SP-Justizministerin Maria Berger in der Ära von Kanzler Alfred Gusenbauer: Sie gründete die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), die sich auf Großkorruption spezialisierte. Dass mit den Grünen eine Partei die Justizministerin stellte, die dank ihrer kurzen Regierungsbeteiligung noch nicht in staatliche Korruption verwickelt sein konnte, erwies sich als historischer Glückfall, und wahrscheinlich war mit Alma Zadić noch dazu wie mit Maria Berger eine besonders kompetente und unabhängige Person an die Spitze dieses Resorts gelangt, was man freilich einmal mehr als historischen Glückfall bezeichnen muss – es ersetzt nicht die geplante Kür einer parteiunabhängigen Bundesstaatsanwaltschaft. Zwangsläufig musste es unter Zadić das Interesse junger Staatsanwälte der WKStA wecken, aus dem Ibiza-Video von H.-C. Strache zu erfahren, dass der Glücksspielkonzern Novomatic angeblich „alle schmiert“, und wenig später gaben ihr die anonymen Strafanzeigen eines offenkundigen Insiders berechtigten Anlass einzuschreiten. Der in
486
Der Kriminalfall Kurz
diesen Anzeigen mit vielen Details belegte Verdacht besteht, während ich die Zeilen schreibe, unverändert: Es habe einen „Deal“ zwischen der türkis-blauen Regierung Kurz-Strache und Novomatic gegeben, das Glücksspielgesetz zu ändern, Novomatic zusätzliche Gaming-Lizenzen zu verschaffen und das in Wien verbotene „kleine Glücksspiel“ wieder zuzulassen, wenn FPÖ-Bezirksrat Peter Sidlo als Gegenleistung zum Finanzvorstand der Casino AG gemacht wird. Die ÖVP habe bei diesem Deal mitgemacht, indem sie mit Josef Pröll und Walter Rothensteiner zwei Aufsichtsräte der Casino AG stellte, die Sidlos widerrechtliche Bestellung vornahmen. Ihr Finanzminister Hartwig Löger, beziehungsweise sein blauer Stellvertreter Hubert Fuchs und Generalsekretär Thomas Schmid, die die Republik als Dritteleigentümer der Casino AG vertraten, hätten sich zum Vorteil der Novomatic nicht gegen diesen Deal gewehrt, sondern seien in Verhandlungen über die Änderung des Glücksspielgesetzes eingetreten. Sicher ist, dass Sidlo tatsächlich zum Finanzvorstand bestellt wurde, obwohl ihm der zuständige Headhunter die Qualifikation abgesprochen hatte und obwohl die Verträge des bisherigen Finanzvorstandes zu diesem Zweck vorzeitig und zum Preis von mehreren Millionen Euro gelöst werden mussten, womit Pröll und Rothensteiner sich dem Verdacht der Untreue, Finanzminister Löger und seine Beamten sich dem Verdacht des Amtsmissbrauches ausgesetzt sahen. Natürlich, so argwöhnt die WKStA, habe auch Sebastian Kurz diesen Hintergrund-Deal mittragen müssen und natürlich bestehe gegenüber der Führung der Novomatic der Verdacht der Bestechung. Die WKStA führte bei den Genannten eine Reihe von Hausdurchsuchungen durch, die diese Verdachtsmomente erhärteten – ob sie zu Anklagen reichen, steht während ich diese Zeilen schreibe, wie schon angeführt, in den Sternen, und natürlich gilt für alle Genannten die Unschuldsvermutung. Dass große Mengen Geldes nicht gerade produktiv ausgegeben wurden, steht aber außer Zweifel. Im Zuge der vielen angeführten Hausdurchsuchungen wurden bekanntlich immer wieder Handys beschlagnahmt und ausgewertet, und voran das Handy des Generalsekretärs des Finanzministeriums Thomas Schmid erwies sich dabei als Fundgrube und Quelle weiterer Strafverfahren, denn er hatte zwar versucht, seinen Inhalt zu löschen, aber die WKStA vermochte ihn aus seinem Backup zu rekonstruieren. Ins Zentrum der so ermittelten, neuen möglichen Straftatbestände rückte bekanntlich Kanzler Sebastian Kurz. Aus seinen Chats mit Schmid leitet die WKStA im Zusammenhang mit ihrer Kenntnis des „Projekt Ballhausplatz“ den Verdacht ab, dass die Gratiszeitung Österreich der Brüder Wolfgang und Helmuth Fellner seitens des Finanzministeriums zig Millionen an Inseraten erhielt, weil Wolfgang Fellner sich bereit erklärt haben soll, Texte und frisierte Meinungsumfragen zu veröffentlichen, die erheblich zum Rücktritt Reinhold Mitterlehners und zum Wahlsieg Sebastian Kurz’ beitrugen. Wieder resultierten aus diesem Verfahren eine ganze Reihe Beschuldigter: Die Brüder Fellner als Bestechende und Bestochene; Sebastian Kurz und die ÖVP als Nutznießer der Bestechung; die Meinungsforscherinnen Sophie Karmasin und Sabine Beinschab, die die frisierten
Der Kriminalfall Kurz
Meinungsumfragen ermöglicht haben sollen; Thomas Schmid, der den ganzen Deal eingefädelt haben soll, und, wie Finanzminister Gernot Blümel, die Vergabe der Inserate verantwortet. Schließlich besteht nicht zuletzt der Verdacht, dass Kurz sich bei Schmid bedankt hat, indem er dafür gesorgt haben soll, dass der Alleinvorstand der staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG wurde. Wieder erhärten diverse Chats auf diversen Handys diesen Verdacht: Schmid an Kurz: „so weit bin ich noch nie gegangen“; Schmid über die Brüder Fellner: „Wer zahlt schafft an…“; Kurz an Schmid über dessen Vorstandsvertrag: „Kriegst eh alles, was Du willst.“ Sicher ist, dass die Inseraten-Millionen geflossen sind. Sicher ist, dass die Umfragen zu Kurz und Mitterlehner in Österreich frisiert waren. Sicher ist, dass die Meinungsforscherin Sabine Beinschab diese Umfragen als angebliche „Studien“ vom Finanzministerium bezahlt erhielt, obwohl das Ministerium sie weder brauchte, noch in jedem Fall überhaupt etwas erhalten hat. Ein wasserdichter Beweis dafür, dass Sebastian Kurz diese Aktivitäten, die zweifelsfrei zu seinem Nutzen stattfanden, tatsächlich selbst veranlasst hat, scheint mir, während ich darüber schreibe, noch nicht vorzuliegen – theoretisch könnte Thomas Schmid zum Beispiel auch aus lauter Liebe zu Kurz so gehandelt haben, wie die WKStA ihm vorwirft. Im Herbst 2022 hat Schmid freilich ganz anderes zu Protokoll gegeben: Kurz habe ihn zu seinen Aktivitäten veranlasst und sei ständig in sie eingebunden gewesen. Allerdings machte Schmid diese Angaben, nach denen er, wie Sabine Beinschab, den Status eines „Kronzeugen“ zu erlangen sucht, der straffrei bleibt, sofern er ein vollständiges und reumütiges Geständnis abgelegt hat und Wesentliches zur Aufklärung noch unbekannter Sachverhalte beiträgt. An sich passen seine nunmehrigen Aussagen zu einer Reihe Chats, und auch, dass Kurz Nutznießer der manipulierten Berichterstattung war, steht außer Zweifel. Ob Schmids Aussagen zu einer Anklage Kurz’ in der Inseratenaffäre reichen, war bei Abschluss diese Manuskripts im April 2023 aber ungewiss, und es gilt auch für alle in diesem Zusammenhang Genannten die Unschuldsvermutung – nur am entstandenen Sittenbild dürfte sich wenig ändern. Inzwischen gibt es zu dem Vorwurf, dass die Zeitung der Brüder Fellner auf kriminellem Wege Millionen an Staatlichen Inseraten erhalten hätten, auch den Vorwurf, dass das auch für die Medien der Familie Dichand, Heute und Kronen Zeitung gelte und auch dafür gibt Anhaltpunkte in Chats, die freilich noch weit von Beweisen entfernt sind. Einmal mehr gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Aber das Ausmaß, in dem sie mittlerweile in Österreich gelten muss, sollte doch zu denken geben. Dass Kurz schließlich zur Seite und wenig später zurücktrat, lag am relativ harmlosesten, aber am besten dokumentierten der gegen ihn erhobenen Vorwürfe: Dass er nämlich vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der alle angeführten
487
488
Der Kriminalfall Kurz
Vorwürfe politisch untersuchte, falsch ausgesagt hätte, nur ganz am Rande von der Bestellung Thomas Schmids zum ÖBAG-Vorstand informiert gewesen zu sein. Das widerspricht zweifelsfrei seinen mit Schmid ausgetauschten Chats, und schon gar dessen nunmehriger Aussage. Eine diesbezügliche Anklage schien den Grünen jedenfalls Ende 2021 so wahrscheinlich, dass sie Kurz nicht mehr für fähig hielten, seinen Verpflichtungen als Kanzler nachzukommen, und tatsächlich hat die WKStA ihren Bericht mittlerweile fertiggestellt – aber ob er wirklich zur Anklage führt, entscheidet das Justizministerium. Jedenfalls zwang die Wahrscheinlichkeit einer solchen Anklage Kurz am 2. Dezember 2021 zur Seite zu treten. Wie er das tat, enthüllte sein in meinen Augen größtes Talent: Sebastian Kurz hätte Schauspieler werden sollen. Seine Abschiedsrede näherte sich dem Vortrag von Grillparzers Ode an Österreich durch den einstigen Star-Mimen des Burgtheaters Raul Aslan: Seit dem Tag, da er begonnen habe sich politisch zu engagieren, habe er versucht, „einen Beitrag für Österreich“ zu leisten und das Glück gehabt, „diesem wunderschönen Land als Bundeskanzler zu dienen“. Nun sei er, wie andere Große vor ihm, mit falschen Vorwürfen konfrontiert, doch stark im Wissen um seine Unschuld und gestärkt durch das Vertrauen so vieler, die hinter ihm stünden. Doch weil die Unschuldsvermutung für ihn nicht gelte und sich die Grünen gegen ihn entschieden hätten, mache er Platz – „denn mein Land ist mir wichtiger als meine Person“. Und am Rande: „Leider“ seien die falschen Vorwürfe gegen ihn „mit Chats vermengt“, bei denen er „in der Hitze des Gefechtes“ manches gesagt habe, das er heute „definitiv nicht mehr so sagte“ – doch selbst er sei ein Mensch. Was für ein Mensch konnte man einmal mehr besagten Chats mit Thomas Schmid entnehmen: Sein damaliger Parteiobmann Reinhold Mitterlehner figuriert darin nur als „Arschloch“; die schwarzen Landeshauptleute figurieren als „alten Deppen“; und als die Gefahr droht, dass das „Arschloch“ in der Koalition mit Christian Kern einen Erfolg einfährt, weil die Regierung 1,2 Milliarden für den Nachmittagsunterricht von Kindern aufwenden will, erreicht Kurz bei Schmid nicht nur, dass der diesen Plan innerhalb der ÖVP maximal torpediert, sondern will dazu auch selbst den größtmöglichen Beitrag leisten: „Bitte, kann ich ein Bundesland aufhetzen?“ Genauso habe ich mir einen Kanzler, dem es nur um das Wohl der Menschen in unserem Land „und natürlich der Familien“ geht, immer vorgestellt. Ich war so naiv zu hoffen, dass der Charakter, den seine Chats offenbaren, es der ÖVP unmöglich machte, sich weiter von Kurz führen zu lassen, doch das war ein Irrtum: dass sie mit Kurz Wahlen gewonnen hatte, blieb für die Volkspartei, wie für die „Republicans“ im Falle Donald Trumps, ungleich gewichtiger als seine Haltung gegenüber Kindern und ihren Familien. Nicht die ÖVP trennte sich von Kurz –, sondern er trennte sich nach einem Monat, in dem er nur mehr Parteiobmann war, von der Politik, weil die Grünen ihm und der ÖVP keine Wahl ließen. Denn zu Ehren der Grünen ist festzuhalten, dass ihnen die Begründung der Staatsanwaltschaft für die vorgenommenen Hausdurchsuchungen und Kurz’ Chats mit Schmid
Der Kriminalfall Kurz
sehr wohl reichten, die türkis-grüne Koalition aufs Spiel zu setzen: Sieben Mandatare wollten jedenfalls für den von der Opposition gegen Kurz eingereichten Misstrauensantrag stimmen – es hätte die Partei zerrissen, wenn Werner Kogler sich ihnen nicht angeschlossen hätte. Das wieder machte den VP-Landeshauptleuten klar, dass die ÖVP Gefahr lief, alle Macht zu verlieren, wenn es wirklich zu diesem Misstrauensvotum gegen Kurz gekommen wäre und Grüne, SPÖ, FPÖ und NEOS eine Konzentrationsregierung gebildet hätten. Also haben sie Kurz vor die Wahl gestellt, entweder als Kanzler zur Seite zu treten und dem Misstrauensvotum damit die Basis zu entziehen oder ihren Rückhalt zu verlieren – diese Sprache hat er verstanden. Fast so logisch war, dass Kogler die türkis-grüne Koalition fortsetzte, nachdem seine Bedingung, Kurz durch einen Unbelasteten zu ersetzen, mit dem Diplomaten Alexander Schallenberg erfüllt worden ist. Dass Kurz knapp vor Weihnachten 2021 die Geburt eines Sohnes durch seine langjährige Lebensgefährtin zum Anlass nahm, endgültig zurückzutreten, erlaubte ihm einen gesichtswahrenden Abgang. Dass Schallenberg wenig später durch Karl Nehammer abgelöst wurde, war insofern logisch, als die ÖVP niemanden anderen von vergleichbarer Popularität in ihren Reihen hatte. Dazu kam Nehammer aus dem ÖVP-Kernland Niederösterreich, war telegen und durch kein Strafverfahren belastet. Er machte seine Sache vorerst auch durchaus passabel und es war nicht einmal gesichert, dass er Kurz’ miserable Wirtschaftspolitik und unsympathische Flüchtlingspolitik in der bisherigen Form fortsetzt. Inzwischen droht freilich auch ihm Ungemach: Der Rechnungshof bezweifelt, dass die ÖVP bei ihren Wahlkämpfen jemals die Ausgabenobergrenze eingehalten hat und will das prüfen – wenn sich sein Verdacht als berechtigt herausstellt, hat Nehammer als seinerzeitiger Generalsekretär der Kurz-ÖVP ein zumindest optisch beträchtliches Problem. Kurz’ letzte Schlagzeile im Jahr 2021: Er heuerte bei der US-Investment-Firma „Peter Thiel Capital“ an, nachdem er schon als Kanzler dafür vorgesehen war, anlässlich der Verleihung eines deutschen Preises an Thiel die Laudatio für den deutschstämmigen Silicon-Valley-Tycoon zu halten. Er kennt Thiel schon länger und der zählt in den USA zu den einflussreichsten und erfolgreichsten Tech-Unternehmern. Erste Milliarden macht er mit dem Bezahldienst PayPal, weitere durch seine Beteiligung an Facebook und heute gilt sein Datenanalyse-Unternehmen „Palantir“ als das wertvollste seiner Assets: Es analysiert Daten für die US-Armee, sämtliche US-Nachrichtendienste und andere Behörden. Thiel erreichte das nicht zuletzt, indem er als einzige Silicon-ValleyGröße zwei Millionen Dollar für den Wahlkampf von Donald Trump spendete und Kollegen bei Apple oder Google überzeugte, sich zumindest mit Trump zu arrangieren. Diese Sympathie Thiels für Trump verblüffte ursprünglich, hatte der sich doch stets höchst abfällig über Schwule geäußert, während Thiel, nachdem ein Verlag ihn geoutet hatte, diesen zwar zugrunde richtete, sich dann aber voll stolz zu seiner Homosexualität bekannte. Thiels unautorisierter Biograph meint daher, die gegenseitige Sympathie könne darauf beruhen, dass Thiel der philosophischen These anhängt, Staaten sollten
489
490
Der Kriminalfall Kurz
eigentlich von brillanten Unternehmern möglichst autoritär und ohne Rücksicht auf Institutionen und Medien geführt werden und dass Trump diesen Typ Staatsführer verkörpere. Nicht zuletzt eint Thiel mit Trump, dass sie beide Sebastian Kurz für einen der begabtesten Politiker Europas halten. Bleibt übrig, Kurz’ kurzes politisches Zwischenspiel historisch einzuordnen: Er hat auf extrem üble, aber hoch effiziente Weise verhindert, dass die besonders aussichtsreiche rot-schwarze Regierung Kern-Mitterlehner heute noch regiert. Und er hat den Beweis geliefert, dass nichts wichtiger ist, als Politik gut zu verkaufen, indem man gut aussieht, eloquent argumentiert und sich den Anschein zu geben vermag, alles neu, anders und besser zu machen. Mit dem Slogan, „Ich patze niemanden an“ kann man seine Gegner erfolgreich anpatzen; mit perfekter Message-Control kann man den Eindruck erwecken, dass in der eigenen Regierung kein Streit herrscht; mit der perfekt vorgetragenen Behauptung, den bisherigen Postenschacher abzuschaffen, kann man mehr Postenschacher denn je betreiben; und mit der Behauptung, die bisherige Korruption zu beseitigen, kann man ideale Bedingungen für Korruption im staatsnahen Bereich aufbereiten und sie im Umgang mit Inseraten und Glücksspiel zu greller Blüte führen. PR, so bewies Kurz, kann politische Leistung erstaunlich lange perfekt ersetzen. Wie immer, wenn die FPÖ mitregierte, sind unter Kurz gleichzeitig Freiheitliche in gewichtige Positionen in der Verwaltung oder in Höchstgerichten gelangt, was ich für einen nachhaltigen Schaden halte. Kurzfristig hat Kurz der FPÖ zwar Wähler weggenommen, indem er Zuwanderung noch energischer und fremdenfeindlicher als sie abgelehnt hat – langfristig ließ die geschaffene Stimmung diese Wählergruppe wachsen und zur FPÖ zurückkehren. Während ich diese Text korrigiere ist sie in Umfragen bereits stärkste Partei vor ÖVP und SPÖ. Dass Kurz einen wirtschaftspolitisch völlig verfehlten, neoliberalen Kurs vertreten hat, hat man ihm zu meinem Leidwesen nur in den unter diesem Kurs besonders leidenden Ländern Italien, Spanien oder Portugal verübelt, in der EU-Kommission nicht begriffen und in Deutschland begrüßt. Demgegenüber war Christian Kern, den er ablöste, in meinen Augen der Politiker, der hierzulande am meisten von Wirtschaft verstand und um die Kontraproduktivität staatlich Sparens genauso Bescheid wusste, wie um die Problematik der „Lohnzurückhaltung“. Es ist zwar ungewiss, ob er sich damit gegenüber einem Finanzminister Mitterlehner durchgesetzt hätte, aber zumindest hätte er uns Nulldefizite erspart und wäre innerhalb der EU statt wie Kurz eine Stimme des ökonomischen Schwachsinns eine Stimme der ökonomischen Vernunft gewesen.
77. Covid-19
Einen Moment lang habe ich gehofft, dass die breite Bevölkerung den Widersinn staatlichen Sparens daran erkennt, dass er tödlich sein kann. In Italien sind so viel mehr Menschen als überall sonst an Covid-19 gestorben, weil sich die Zahl seiner Intensivbetten im Zuge staatlichen Sparens von fünf je tausend Einwohner auf zwei verringert hat. Gleichzeitig lag die hohe Zahl Infizierter nicht zuletzt daran, dass junge Italiener wegen der niedrigen Löhne immer öfter mit ihren alten Eltern in derselben Wohnung leben müssen. Auch in Spanien, Frankreich oder Portugal haben diese Wohnverhältnisse und die Einsparungen im Gesundheitssystem wesentlich zu den anfangs besonders hohen Todesraten beigetragen. Später gingen ausgerechnet diese angeblich untüchtigen Staaten allerdings klar besser mit der Organisation des Impfens um, so dass die Todesrate sank und sich der von Ländern mit mehr Intensivbetten annäherte. Entscheidend begrenzt wird die Leistungsfähigkeit der Medizin nicht so sehr durch die Zahl der Betten, die mit den entsprechenden Apparaturen zur Beatmung ausgestattet sind – die lassen sich relativ schnell nachrüsten – als vielmehr durch die Zahl der Pfleger und Pflegerinnen, die damit umgehen können. Und die fehlen selbst in Österreich, wo es 5,5 Intensivbetten pro 1000 Einwohner gibt oder in Deutschland, das mit sechs pro 1000 Einwohner die EU-weit meisten davon hat. Denn für Pfleger und Pflegerinnen, die fast durchwegs in staatlichen Krankenhäusern arbeiten, will der sparende Staat möglichst wenig Geld ausgeben, weil das sein Budget so sichtbar belastet. Er bezahlt Pflege daher schlecht und niedrige Löhne und lange Arbeitszeiten sorgen dafür, dass es auch wenig Nachwuchs gibt. Das bereitet uns, während ich diesen Text korrigiere, schon angesichts der hoch ansteckenden, wenn auch weniger letalen Omikron-Variante beträchtliche Probleme und wird künftigen Generationen kräftig auf den schmerzenden Kopf fallen. Den Anfang der Pandemie hat Österreich hingegen eher gut bewältigt. Die Regierung wurde zwar von ihrem Hereinbrechen völlig überrascht, obwohl eigentlich klar sein musste, dass eine Krankheit, die in Asien wütet, angesichts der Globalisierung auch auf Europa überspringen würde. Doch ich habe das so wenig wie Sebastian Kurz bedacht und muss es mir mehr als er vorwerfen, denn Lesen gehört zu meinem Beruf. Erst mit drei Jahren Verspätung habe ich mich erstmals mit einem Text des Microsoft-Gründers Bill Gates befasst, der schon 2015 eingehend vor den Folgen von Pandemien warnte und auch ein entsprechendes Warnsystem empfohlen hat. Es hat auch eine Warnung durch die Weltgesundheitsorganisation gegeben, aber sie wurde, wie die meisten Warnungen vor wirklich großen Gefahren, viel zu spät ernst genommen. Die meisten Regierungen Europas wurden, wie die österreichische der Gefahr erst gewahr, als sich in Italien die Särge stapelten. Dass in Oberitalien anfangs so besonders viele Menschen starben, hatte
492
Covid-19
viele Gründe: Neben fehlenden Intensivbetten und beengten Wohnverhältnissen, die vielen Vorerkrankungen, die der hohen Industrialisierung und entsprechend schlechten Luftqualität dieser Region geschuldet waren – aber es lag auch daran, dass anfangs niemand eine Ahnung hatte, wie man mit einer Seuche umgehen muss. In Europa lagen die letzten Seuchen, Pocken, Tuberkulose, Kinderlähmung, viele Jahrzehnte zurück, weil Impfungen sie ausgerottet hatte. Sebastian Kurz reagierte daher anfangs durchaus richtig, indem er im Zweifel zu extremer Vorsicht mahnte. Dass das immer ungemein pompös – durch den fernsehgerechten, gleichzeitigen Auftritt von Kanzler, Gesundheits- und Innenminister – geschah, die mit anderen Worten wiederholten, was Kurz schon gesagt hatte, so dass für Diskussion kaum Zeit blieb, entsprach seinem Führungsstil, aber auch dem ewigen Wunsch der Österreicher nach einem starken Führer: Franz Joseph, Engelbert Dollfuß, Adolf Hitler und selbst Bruno Kreisky waren Staatsmänner, deren Aussagen die längste Zeit nicht ernsthaft diskutiert wurden und die die Eigenverantwortung der Bürger auf ein Minimum reduzierten. Die Bevölkerung hielt sich an Kurz’ dramatische Worte: „Demnächst wird jeder jemanden kennen, der an Covid-19 gestorben ist“, – und ein energischer Lockdown vermochte die Infektionskurve erstaunlich gut abzuflachen. Die Probleme begannen, als Eigenverantwortung gefragt gewesen wäre: Wann immer die Regierungen die angeordneten „Maßnahmen“ lockerte, trug die Bevölkerung kaum mehr Masken und ging kaum mehr auf Distanz – bis steigende Infektionszahlen den nächsten Lockdown auslösten. Als der Anführer, Sebastian Kurz, im Sommer 2021 nicht weiterhin Unangenehmes zu Lasten seiner Umfragewerte, sondern Angenehmes zu Gunsten der Wahlen in Oberösterreich verkünden wollte, erklärte er bekanntlich im Gegensatz zu allen Virologen, die Pandemie sei „redimensioniert“ – es sei nicht mehr Sache des Staates, sie zu bekämpfen. Das konnte nur dazu führen, dass Österreich zielsicher die vierte Welle der Epidemie ansteuerte, die die erste an Gewalt und Toten übertraf, obwohl mittlerweile eine wirksame Impfung zur Verfügung stand. Dass Österreich knapp vor Deutschland eine der niedrigsten Durchimpfungsraten jener Länder aufwies, die sich jede Menge Impfstoff leisten konnten, hatte sehr unterschiedliche Gründe: Herbert Kickl, der Norbert Hofer als Chef der FPÖ abgelöst hatte, sah die Chance, seine Partei durch die wortgewaltige Kritik an Maßnahmen und Impfung aus dem Umfragetief herauszuholen, in das sie „Ibiza“ gestürzt hatte. Während er, wäre er noch Innenminister gewesen, meines Erachtens die Einhaltung aller „Maßnahmen“ aufs schärfste mittels berittener Polizei und Trojaner auf jedem Handy überwacht und am lautesten eine „Impfpflicht“ gefordert hätte, kritisierte er diese Maßnahmen in Opposition aufs Schärfste und erklärte alles, was die Impfung beförderte, zur „Diktatur.“ Es gibt meines Erachtens keine Haltung, die Herbert Kickl nicht wortgewaltig einnähme, wenn sie seiner Partei nützt. Kickl nützte dabei, dass Krankheit und Impfung in Österreich wie Deutschland mit besonders viel Emotion verbunden sind. Zur nationalen Rechten zählt man sich seit
Covid-19
jeher einer überlegenden Rasse zu, deren mythische Helden wie Siegfried fast unverletzlich waren. Dazu passt die Argumentation, dass die natürlichen Abwehrkräfte völlig reichten, das Virus in Schach zu halten. Mich hat aber auch nicht wirklich überrascht, dass erstaunlich viele Grüne, Alternative bei den Protestmärschen mitmarschierten, zu denen Kickl aufrief: Dort glaubt man sich dem Rest der Bevölkerung überlegen, weil man erkannt hat, dass es abseits „scheinrationaler“ wissenschaftlicher Erkenntnisse, „spirituelle Kraftfelder“ gibt – in Wien wurden bekanntlich 95.000 Euro an einen Esoteriker bezahlt, der das Klinikum „Nord“ mit einem „Energie-Schutzring“ umgab. Beides hat nationalsozialistische Tradition: Der „Völkische Beobachter“ war durch lange Zeit eine Zeitung, die der „Esoterik“ huldigte, ehe voran „völkisches“ Fühlen den viel größeren Raum einnahm. Menschen, die im „Volkskörper“ etwas Besonders sehen, weil „das Ganze mehr als seine Teile“ ist, haben einiges gemein mit Menschen die das „Natürliche“ allem „Künstlichem“, von Menschenhand Geschaffenem, vorziehen. Beide idealisieren die Natur, die in ihren Augen nur Gutes schafft – es fällt ihnen entsprechend schwer, dem von ihr offenbar auch geschaffenen Virus als etwas nicht so Gutem entgegenzutreten: Eine Reihe von Esoterikern befürwortet „natürliche Erkrankungen“ als Erweiterung des Bewusstseins. Dass die entscheidenden Impfstoffe von Moderna und Pfizer/Biontech „gentechnisch“ hergestellt werden, musste zur extremen Rechten wie zur grün-alternativen Linken besonders irritieren, legt man dort doch den größten Wert auf „Gentechnikfreiheit“ – auf keiner österreichischen Nahrungsmittelpackung darf dieser Hinweis fehlen. Die Reserve gegen gentechnisch Hergestelltes beruht einmal mehr auf der emotionalen Scheu, in die „Natur“, eben die Gene, einzugreifen und hat natürlich auch eine rationale Komponente: Es ist eine eher gespenstische Vorstellung, dass Wohlhabende ihre Nachkommen genetisch optimieren. Aber es ist extrem sinnvoll, genetische Schäden an Föten frühzeitig zu erkennen, und man wird viele lebensbedrohende Krankheiten gentechnisch heilen können. Nicht zuletzt wird es höchst sinnvoll sein, in Zeiten zunehmender Erderwärmung Nutzpflanzen herzustellen, die höhere Temperaturen aushalten und womöglich ertragreicher als die bisherigen sind. Denn der Klimawandel wird die fruchtbaren Ackerflächen und den Ertrag unserer gängigen Nutzpflanzen zunehmend vermindern – es wird ein großer Vorteil sein, wenn wir die wachsende Weltbevölkerung mittels gentechnisch optimierter Nutzpflanzen ernähren können. Die Gefahr, die solcher „grüner“ Gentechnik innewohnt, wird auf absurde Weise überschätzt – in den USA wird „Genmais“ seit vielen Jahrzehnten problemlos angebaut und konsumiert – zur grünen Linken wird er wie Zyankali geächtet. Leider hat der Europäische Gerichtshof in Unkenntnis des gentechnologischen Fortschritts ein von Österreich heftig akklamiertes Urteil gefällt, das Unternehmen bei „grüner“ Gentechnik zur Optimierung von Pflanzen extreme Restriktionen auferlegt und die gentechnikfeindliche Stimmung in der Bevölkerung quasi offiziell beglaubigt. Daraus werden in künftigen Jahren erhebliche ökonomische Nachteile gegenüber
493
494
Covid-19
amerikanischen oder asiatischen Unternehmen resultieren, die gentechnisch Nahrung herstellen. Um die Unwissenschaftlichkeit der aktuellen Gesetzgebung an einem Beispiel zu illustrieren: Es ist zulässig, Nahrungsmittel durch radioaktive Bestrahlung wie sie ja auch in der Natur vorkommen kann, zu „natürlichen“ Mutationen anzuregen, die als nützlich erachtet werden – solche Nahrungsmittel werden in Österreich anstandslos verkauft und verzehrt – aber die viel sicherere gentechnische Herstellung eines Nahrungsmittels ist verboten. Geeichte Grüne werden natürlich auch die angeführte radioaktive Bestrahlung als „künstlich“ ablehnen, aber auch jede noch so „natürlich“ gezüchtete Pflanze unterscheidet sich selbstverständlich genetisch von der Ausgangspflanze durch irgendeinen Vorteil in ihrer Nutzung – nur dass die Züchter dabei den Zufall nutzen, der die Gene von Pflanzen etwa aufgrund der Sonneneinstrahlung, Blitzschlägen oder natürlicher Radioaktivität von Zeit zu Zeit vorteilhaft mutieren lässt, während Gentechniker die „Genschere“ nutzen, die mit extremer Präzision Gene entfernen oder einfügen kann. Die Gefahr, dass es auf natürliche Weise zu einer für den Menschen höchst nachteiligen gesundheitsschädlichen Mutation einer Pflanze kommt, ist ungleich größer, als dass dergleichen in einem gentechnischen Labor passiert. So wie wir uns weit weniger davor fürchten müssen, dass ein „künstlicher“ Virus aus Laboren Chinas oder den USA entkommt, als dass ein „natürlicher“ Virus auf eine für uns bedrohliche Weise zu einem lebensgefährlichen Virus mutiert – denn genau das ist schon mehrmals – von Aids bis Ebola – passiert. Dass der SARS-CoV-2 Virus vermutlich auf dem Umweg über Mäuse zum OmikronVirus mutiert ist, der sowohl Impfungen wie Immunität nach stattgefundener Erkrankung unterläuft, könnte die Pandemie bis zu dem Zeitpunkt verlängern, zu dem Sie diesen Text lesen, denn die Krankheit verläuft dank Impfung zwar weniger gefährlich (seltener tödlich), aber die extrem erhöhte Ansteckungsgefahr kann uns in Gestalt immer neuer Mutationen noch länger begleiten. Gott sei Dank haben wir in gentechnisch hergestellten Impfstoffen die beste Waffe gegen diese „natürlichen“ Seuchen, denn sie lassen sich den jeweiligen Mutationen am schnellsten anpassen.
Die sozialen Folgen der Pandemie Mich hat Covid-19 insofern persönlich betroffen, als ich mit 83 Jahren und drei Herzinfarkten entschieden der Covid-Hochrisikogruppe angehöre. Angst vor dem Tod habe ich zwar nicht – ich habe mich im Verlauf meines Strafverfahrens eingehend mit dem Tod auseinandergesetzt und damals wäre er mir wohl zu früh gekommen, so sehr ich ihn zeitweise herbeigesehnt habe – aber jetzt, 24 Jahre später, habe ich das Gefühl, ein
Die sozialen Folgen der Pandemie
recht erfülltes, glückliches Leben geführt zu haben: Der Tod wäre schade, aber er ist kein furchtbares Schrecknis. Die Rückkehr aus Spanien war eben doch eine Heimkehr nach Österreich, wo unsere sechs Kinder lebten. Zwei sind glücklich verheiratet, drei leben in funktionierenden Partnerschaften, der Sechste, der Sohn meiner Frau, den ich kaum minder als Sohn empfand, bewältigte eine schwere Krise erfolgreich. Man kann in diesem Alter ja sowieso nicht mehr als „Erzieher“ eingreifen, nur froh sein, dass man offenbar nichts alles falsch gemacht hat. Statt in einem großen Haus in Marbella wohnen wir jetzt in einem winzigen Haus in Klosterneuburg, dessen Garten sich freilich auf einen warmen Arm der Donau öffnet und das selbst mit ganz wenig Geld locker zu erhalten ist. Dabei sind wir wirtschaftlich durch den Verkauf von TOPIC so abgesichert, dass ich das Einkommen aus meinem Beruf nicht wirklich brauche. Ich habe mich daher beruflich neuerlich verändert und schreibe für das niedrigste Zeilenhonorar meines Lebens. Obwohl der Wechsel diesmal nicht abwärts führte: Als Christian Rainer meine Kommentare im profil nur mehr zweimal im Monat statt wöchentlich haben wollte, obwohl sie mehr Leserreaktionen als seine Leitartikel provozierten, wechselte ich zum Falter, dessen Chefredakteur Florian Klenk mir als zweite, verbesserte Ausgabe meiner selbst erschien: Er ist ähnlich neugierig; er schreibt ähnlich persönlich und ist den Menschen, über die er schreibt, innerlich zugewendet, selbst wenn sie seine Texte ablehnen: Einen der besten verfasste er, nachdem er einen solchen Kritiker aufgesucht und intensiv mit ihm diskutiert hatte. Obwohl der Falter auch unter seiner Führung von geeichten Schwarzen oder gar Freiheitlichen als „linkslinks“ diffamiert wird, ist er linksliberal wie das profil, und vielleicht noch mehr als dort bedeutete das: den sozial Schwachen zugewendet. Außenpolitisch könnte man die Berichterstattung sogar als konservativ bezeichnen: Es fehlte ihr jede linkslinke grundsätzliche Ablehnung der USA, so kritisch natürlich auch der Falter Donald Trump und die aktuellen Republikaner sieht. Innenpolitisch ist der Falter wie profil regierungskritisch und weil er auf der Seite der Schwachen steht, zwangsläufig der SPÖ und den Gewerkschaften näher als der ÖVP und der Bundeswirtschaftskammer. Was „Skandale“ betrifft, so ist er wie das profil „investigativ“ und hat es diesbezüglich in der öffentlichen Meinung beinahe überholt. Vor allem – und das war für mich entscheidend – wusste man im Falter wie im profil stets um das Wesen der FPÖ und ihrer jeweiligen Führungspersonen: Niemand hat sie präziser als Nina Horaczek analysiert. Wie im profil schreiben im Falter besonders viele begabte Frauen und wollen manchmal absolut nicht den geringsten Unterschied zwischen den Geschlechtern sehen, während ich Männer als leider genetisch aggressiver einstufe. Wir dürften uns darüber nicht einigen können. Aber das hat dem innerredaktionellen Klima bisher nicht geschadet. Ich arbeite unverändert gern, habe das Gefühl, vor allem im Bereich der Wirtschaft durch meine Texte Vernünftiges zur Meinungsbildung beizutragen und hoffe das auch mit diesem Buch zu tun. Summa summarum: Ich lebte gerne noch eine Weile – der Tod wäre schade – aber er ist kein furchtbares Schrecknis.
495
496
Covid-19
Ich habe Covid-19 denn auch bisher recht gut hinter mich gebracht. Den letzten Herzinfarkt erlitt ich am 25. Dezember 2019 und nach einer Bypass-Operation konnte ich auf der Intensivstation liegen, ohne dass mein „altes“ Leben gegen das eines jungen Covid-19-Patienten abgewogen werden musste. Die diversen Lockdowns unterschieden sich nicht rasend von meinem normalen Leben, denn ich gehe seit Jahren selten aus und treffe allenfalls nahe Verwandte oder sehr liebe Freunde. Zudem verbrachte ich die Tage, in denen selbst Spazierengehen – sinnlos – verboten war, in unserem Stelzenhaus in Klosterneuburg, wo kein Polizist je Spaziergänge im nahen Auwald kontrollierte. Da ich dreimalmal geimpft war, hielt ich mich bis zum Auftauchen der Omikron-Variante für sozusagen aus dem Schneider. Mit ihr zeigte sich zwar, dass ich es doch nicht zur Gänze bin: Ich kann die Möglichkeit einer tödlichen Erkrankung nicht zur Gänze aus meinem Bewusstsein streichen – aber die mittlerweile vierfache Impfung macht eine so schwere Erkrankung doch ziemlich unwahrscheinlich und ein Impfstoff, der auch vor weiteren Varianten des SARS-CoV-2 schützt, wird längst zur Verfügung gewesen sein, wenn Sie diese Zeilen lesen. Was mir Sorgen macht, sind eher die sozialen Verwerfungen, mit denen Covid-19 verbunden ist. So hatte die schlimmste historische Pandemie, die Pest, immerhin einen raren Vorteil: Sie verminderte die Ungleichheit. Denn wo ein Drittel der Bevölkerung wegstarb, mussten die reichen Überlebenden ihre Handwerker und Landarbeiter höher entlohnen, um nötigste Leistungen zu erhalten. Covid-19 kann man diese nivellierende Wirkung nicht nachsagen: Zwar sanken für ein paar Monate die Aktienkurse recht kräftig, aber sie erholten sich erstaunlich rasch, weil die Staaten das kontraproduktive Sparen gegen keynesianisches Investieren tauschten. Mittlerweile haben die reichsten Männer der Welt ihr Vermögen seit Beginn der Pandemie verdoppelt. Gleichzeitig werden sich reiche Länder, die USA und die Industrieländer Europas, wirtschaftlich weit schneller als arme Länder erholen, verfügen sie doch über weit mehr Impfstoff. Das wieder verdanken sie – so schwer mir diese Feststellung fällt – Donald Trump: Ausgerechnet er hat die Impfstoffbeschaffung perfekt gehandhabt. Und zwar zu meinem Leidwesen, indem er auf eine Gruppe neoliberaler Ökonomen gehört hat, wie sie die Universität von Chicago hervorbringt und wie sie als Gegner der Regulierung von Finanzprodukten 2007 entscheidend zur Finanzkrise beigetragen haben. Diese „Chicago Boys“ überzeugten Trump, dass es im Kampf gegen eine Pandemie in erster Linie um Tempo geht: Es gilt, der exponentiellen Verbreitung von Infektionen Paroli zu bieten. Innovative Medizin, so überzeugten sie Trump am Beispiel von Aids, nütze dabei mehr als die Forderung nach gesteigerter Hygiene. Wichtiger als alles andere sei die Beschleunigung medizinischer Innovation. Um die zu erreichen, zeigten sie eine Einsicht, die Neoliberalen normalerweise denkbar fremd ist: Der „Markt“, so befanden sie, honoriere medizinische Forschung nicht rasch genug – deshalb müsse die öffentliche Hand den in Frage kommenden Firmen diese Forschung, samt der Schaffung von Produktionskapazitäten, im Voraus bezahlen.
Die sozialen Folgen der Pandemie
So kam es zu den Milliarden Dollar, die Trump schon in Impfung investierte, bevor der Impfstoff auf den Markt kam. War das Eintreten der Chicago Boys für diese fast planwirtschaftliche Vorfinanzierung der Forschung unerwartet, so haben sie erwartungsgemäß das Tempo der staatlichen Gesundheitsbehörde FDA bei der Zulassung von Medikamenten kritisiert: Bei Seuchen – so verwiesen sie einmal mehr auf die exponentielle Ausbreitung – müsse Schnelligkeit vor Genauigkeit gehen. Entsprechende Aussagen Trumps in den sozialen Medien erzeugten den Druck, der die widerstrebende FDA so viel früher als die in der EU für solche Prüfungen zuständige EMA eine vorläufige Notzulassung für Pfizer und Moderna erteilen ließ. Zusammen hat das dafür gesorgt, dass in den USA schon ein Drittel der Bevölkerung geimpft war, als die EU erst mit Impfungen begann. Was Trump erwartungsgemäß weniger am Herzen lag, war Impfschutz für den Rest der Welt. Sein Nachfolger Joe Biden ist bereit, auch diesbezüglich einen Eckpfeiler der Marktwirtschaft in Frage zu stellen: Er hat vorgeschlagen, den Patentschutz befristet zu lockern, um die Impfstoffproduktion armer Länder zu verbilligen. Das kann als humane Großtat in die Geschichte eingehen, wenn es mit der nötigen Weitsicht geschieht. Denn „Patentschutz“ ist ein rechtsstaatlicher und damit ebenfalls humaner Wert: Pharmafirmen haben Impfungen auch deshalb so atemberaubend schnell entwickelt, weil sie im Vertrauen auf „Patentschutz“ mit hohen Gewinnen rechnen durften. Ihnen diese Gewinne zu sehr zu nehmen – sie zu enteignen – scheint mir daher problematisch. Folgender Kompromiss schiene mir künftig gangbar: Ehe der Staat die Entwicklung eines Impfstoffes mit Milliarden vorfinanziert, vereinbart er mit Pfizer & Co eine Lizenzgebühr, die sich nach einem Jahr halbiert. Diese halbierte Gebühr ist nach der Impfung der eigenen Bevölkerung, die nach einem Jahr ausreichend stattgefunden haben sollte, zwar auch von armen Ländern zu entrichten, aber die USA (die EU) unterstützen sie dabei finanziell so weit, dass sehr arme Länder die Impfung praktisch geschenkt bekommen. Denn EU und USA profitieren auch am meisten vom weltweiten Ende der Pandemie. Die aktuelle für die dritte Welt laufende Impfaktion scheint mir jedenfalls unterfinanziert. In Österreich vergrößert Covid-19 den vorhandenen Abstand zwischen eingesessener und zugewanderter Bevölkerung. Denn Bürger „mit Migrationshintergrund“ wohnen in viel größerer Zahl in kleinen Wohnungen, in denen man sich leichter ansteckt. Sie arbeiten öfter in Berufen mit erhöhter Ansteckungsgefahr – an Supermarktkassen, in der Pflege, in Schlachthäusern – und weil sie so selten in gehobenen Berufen tätig sind, waren sie auch seltener durch Heimarbeit vor Ansteckung geschützt. Alle drei Handikaps teilen sie zwar mit heimischen Geringverdienern, voran Frauen, aber die müssen doch meist für weniger Kinder sorgen. In Berlin, wo sich die angeführten Phänomene summieren, schätzen Gesundheitsbehörden die Zahl der Covid-19-Erkrankten mit Migrationshintergrund auf zwei Drittel der insgesamt Infizierten – in Wien wird es kaum völlig anders sein.
497
498
Covid-19
Das größte daraus erwachsende Covid-19-Problem wird erst in Zukunft dramatisch sichtbar werden: Kinder mit Migrationshintergrund haben durch die Unterrichtsausfälle noch viel geringere Chancen auf höhere Schul- und Lehrabschlüsse. Denn noch seltener als Kinder der heimischen Unterschicht hatten sie Laptops und kaum je konnten ihnen die Eltern beim Homeschooling helfen. Dass das reiche Österreich nicht jedem Kind seit Langem einen Gratislaptop zur Verfügung stellt, ist einmal mehr der „Ausgabenbremse“ geschuldet: „Sparend“ nimmt man mehr Jugendliche mit mangelnder Schulbildung in Kauf, obwohl das zwingend mehr künftige Arbeitslose bedeutet. Zugleich schafft es mehr Covid-19 Folgetote: Ungenügende Ausbildung und damit weit höhere Armutsgefährdung verkürzt die Lebenserwartung um bis zu zehn Jahre. Auch mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind die verschiedenen Staaten recht verschieden umgegangen. Wenn Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel behaupteten, dass Österreich besonders gut durch die Corona-Krise gekommen sei, war das zumindest kühn: Mit dem Rückgang des BIP um 6,5 Prozent im Jahr 2020 lagen wir im untersten Drittel der EU, schnitten aber unter den wirtschaftlich starken Ländern des „Nordens“ am schlechtesten ab. Deutschland, dessen BIP pro Kopf fast exakt dem Österreichs gleicht, beklagte nur ein Minus von fünf Prozent. 60 Prozent dieses schlechteren Abschneidens rechnete „Agenda Austria“ glaubhaft Österreichs viel größerer Abhängigkeit vom Fremdenverkehr zu – die restlichen 40 Prozent muss man im Unvermögen vermuten. Allerdings hat Österreich den Wirtschaftseinbruch dank hoher Staatsausgaben relativ gut überwunden: Ab Herbst 2021 war schon wieder das Niveau vor Corona erreicht. Das hat, während ich diesen Text korrigiere, dennoch heftige Kritik an den zu diesem Zweck gewährten zahlreichen Subventionen für Betriebe geführt: Die zu diesem Zweck eigen gegründete Gesellschaft habe vielen Betrieben viel zu viel Geld überwiesen. Die Problematik ist eine, die uns verfolgen wird: Zwangsläufig soll schwächelnden Unternehmen rasch geholfen werden – gleichzeitig vermindert das zwangsläufig die Treffsicherheit. Ich persönlich sehe die Schnelligkeit für wichtiger an – aber man wird erst hinterher sagen können, ob das stimmt. Mittlerweile scheint zumindest in allen Staaten weit klarer als nach der Finanzkrise, dass der Staat nicht vorhandenes Geld ausgeben – Schulden machen – muss, wenn er die Wirtschaftsleistung erhöhen will, weil das notwendig ist, wenn weder Konsumenten noch Unternehmen höhere Schulden machen. Nur dass dieser mathematische Zusammenhang immer gilt, wollen Wolfgang Schäuble oder Olaf Scholz, Magnus Brunner oder Christian Lindner nicht wahrhaben. Sie bleiben bei der Frage der schwäbischen Hausfrau, die auch Lou Lorenz-Dittlbacher oder Armin Wolf bei jeder zweiten ZIB2 mit weit aufgerissenen Augen stellten: „Und wer soll diese Schulden bezahlen?“ Niemand! Die österreichische Wirtschaft wird, wenn der Staat genug Geld aufwendet, immer intakt über Krisen hinweggekommen. Niemand wird an ihrer Qualität, Potenz
Die sozialen Folgen der Pandemie
und Bonität zweifeln. Das Gleiche gilt für alle anderen Volkswirtschaften der EU, wenn sie nicht plötzlich zu sparen beginnen und es gilt schon gar für die Volkswirtschaft der USA.
499
78. Ein krankes Land
Selbst die größten Probleme der Pandemie erschienen mir zu allen Zeiten klein neben den Problemen, die der kranke Zustand der USA aufwirft. Das größte Glück der freien Welt, hatte mir Simon Wiesenthal 1988 für seine Memoiren „Recht nicht Rache“ mitgegeben, bestünde darin, dass der mit Abstand stärkste Staat der Welt, die USA, zufällig eine rechtsstaatliche Demokratie sind; wenn dort Faschismus ausbräche, sei das daher das größte anzunehmende Unglück. Dieser GAU drohte mit dem Auftauchen Donald Trumps. Seine TV-Auftritte ließen mich fast so fassungslos vor dem Bildschirm zurück wie Ausschnitte aus Reden Adolf Hitlers: Wie konnten und können Millionen Amerikaner dieser Karikatur eines Staatsmannes zujubeln? Müssen diese Leute nicht jeden Verstand verloren haben? Offenkundig nicht: Auch unsere Großeltern waren weder schwachsinnig noch verrückt und umjubelten dennoch zu Millionen einen lächerlichen schnauzbärtigen Mann, der weit Schlimmeres als Trump gesagt und sofort zu tun begonnen hatte. Auch Trumps Wähler sind keine Schwachsinnigen oder Verrückten. Die Soziologin Arlie Russell Hochschild ist durch fünf Jahre zwischen der Berkeley-Universität und der Trump-Hochburg Louisiana gependelt, um in die Welt jener weißen, älteren, evangelikalen Männer einzudringen, die ihm zum Wahlsieg verhalfen. Das Ergebnis ihrer Studien hat sie in dem großartigen Buch „Strangers in Their Own Land“ zusammengefasst, aus dem ich hier Bruchstücke referiere. Voran Daten: Louisiana ist der zweitärmste US-Bundesstaat und zählt zum historischen „Süden“. Hatten Weiße bundesweit zu 39 Prozent Barack Obama gewählt, so waren es in Louisiana nur 14 Prozent. Denn Louisiana ist „Tea Party“-Land: Hat diese evangelikale Retro-Gemeinde USA-weit 20 Prozent – rund 40 Millionen – Anhänger, so bekennen sich in Louisiana 50 Prozent zu ihren Zielen. Vom Süden ausgehend ist die Tea-Party-Bewegung zu Kopf, Rückgrat und Muskulatur der republikanischen Partei geworden. Ihren Hass auf „Democrats“ und „Washington“ begründet die Tea-Party-Bewegung etwa so: − Die bringen uns, die Arbeitenden (the makers), durch hohe Steuern um unser Geld, um es Nichtstuern (the takers) zuzustecken. − Ihre Medien wollen uns vorschreiben, diese Nichtstuer auch noch zu bemitleiden. − Und vor allem: Die Nichtstuer befürworten Todsünden wie Abtreibung oder Homosexualität und wenden sich von Jesus ab.
Ein krankes Land
Dazu Daten: Unglaubliche 42 Prozent der Amerikaner halten für wahrscheinlich oder jedenfalls möglich, dass Jesus im Jahr 2050 auf Erden wiedergeboren wird. In der Hälfte der US-Bundesstaaten wird Charles Darwins „Evolution“ nicht unterrichtet; im Bible Belt gibt es keine Veranstaltung ohne Gebet, im Parlament keine Rede, in der Gott die USA nicht mehrmals segnet. Das hat Vorteile: Der Unterschied zwischen Gut und Böse bleibt wichtig. Aber es hat einen erheblichen Nachteil: Religion ist wie dem Faschismus ein Hang zum Irrationalen und die Überzeugung von der Überlegenheit der eigenen Sache immanent. So wie man als überzeugter Katholik seinen eigenen allmächtigen Gott für den einzig richtigen hält und zu halten verpflichtet ist, stattet der überzeugte Faschist seinen Führer mit Allmacht aus und lässt sich von ihm zum Gehorsam verpflichten. Oft genug war etwa der Katholizismus deshalb unmittelbar mit faschistoiden Systemen à la Franco-Spanien, Mussolini-Italien oder Ustascha-Kroatien verbunden. In Österreich konnte man bekanntlich beobachten, wie leicht es Katholiken fiel, dem frommen Diktator Engelbert Dollfuß zuzujubeln – der in Hitler freilich als einer der wenigen Staatsmänner seiner Zeit sofort den Teufel erkannte. Ähnlich leicht wie Katholiken wurden allerdings Sozialisten zu Nazis, obwohl ihnen Karl Marx die Religion als „Opium fürs Volk“ ausgeredet hatte: Faschismus okkupiert nur zu gern den von der Religion freigegebenen irrationalen Raum. Beide Phänomene gibt es auch in den USA: Ihre vielen christlichen Fundamentalisten jubeln Donald Trump zu, weil er eine Abtreibungsgegnerin zur Höchstrichterin gemacht hat. Aber dort, wo die Religion Raum freigibt, dringt faschistoides Denken und Fühlen nicht minder ein: Auch die faschistoiden „proud boys“ sind typisch für Trumps Wählerschaft. Amerikaner sind aber nicht nur besonders religiös – sie sind mehrheitlich „evangelikal“, also engagierte Protestanten. Seit Max Weber wissen wir, wie sehr der Kapitalismus auf Protestantismus aufbaut. Voran die Prädestinationslehre des Johannes Calvin besagt, dass das Leben jedes Menschen von Gott vorherbestimmt ist, der natürlich auch weiß, ob jemand zu den Verdammten oder den Erwählten zählt. Ein Zeichen, wohin man gehört, liefere allerdings der Lebenswandel: Wer gottgefällig – sparsam und fleißig – der Gemeinschaft diene, sei am ehesten auserwählt. Das verkam – keineswegs im Sinne des Erfinders – zu der Überzeugung, dass Reichtum gottgefällig sei. Dass der Dienst an der Gemeinschaft mit zur Gottesgefälligkeit zählt, wurde zwar zunehmend vergessen – aber ein Rest davon äußert sich bis heute in der Bereitschaft reicher Amerikaner zu „Wohltätigkeit“. „Sozialismus“, der es als Aufgabe des Staates und nicht wohltätiger Milliardäre ansieht, Arme zu unterstützen, hat es in den USA nicht gegeben. Dass Gewerkschaften dort dennoch als erste höhere Löhne und den Achtstundentag durchgesetzt haben, war nicht Verdienst sozialistischer Politik, sondern Ausfluss funktionierenden Kapitalismus in einem sehr großen Land: Arbeitskräfte waren lange so rar, dass Unternehmer ihnen zwingend entgegenkommen mussten. Auch heute, da sie ihnen nicht so zwingend ent-
501
502
Ein krankes Land
gegenkommen müssen, glauben die Amerikaner an diesen Kapitalismus calvinistischen Zuschnitts an Stelle unserer sozialen Marktwirtschaft. Das hat meist den Vorteil, dass die US-Wirtschaft stärker wächst – und immer den Nachteil, dass der soziale Ausgleich zu kurz kommt. Dass der Kapitalismus Bürger höchst unterschiedlichen Reichtums hervorbringt ist für Amerikaner selbstverständlich: Natürlich sind nicht alle Menschen auserwählt – aber man kann stets darum kämpfen, zu ihnen zu gehören. Wenn jemand arm blieb, war er eben verdammt. Evangelikale Amerikaner sind überzeugt, dass der nirgendwo anders so große Unterschied zwischen Reichen und Armen ein Gottgegebener ist, den durch den Staat zu verwischen ketzerisch wäre. Die ärmsten Menschen in den ärmsten US-Bundesstaaten kämpfen daher wütend gegen staatliche Sozialprogramme und wählen, wie Arlie Russell Hochschild beschrieb, Donald Trump, der ihnen die Hoffnung belässt, doch noch selbst zum Millionär zu werden. Der Abstand von Republikanern zu den Demokraten ist dank der Tea-Party zum Abgrund geworden. Störte es 1960 nur fünf Prozent der Befragten, wenn ihr Kind einen Anhänger der anderen Partei heiratete, so stört es heute ein Drittel der Demokraten und 40 Prozent der Republikaner mehr als die Heirat eines schwarzen Partners. Diese Kluft ist nicht entstanden, weil die Demokraten nach links, sondern weil die Republikaner so weit nach rechts gerückt sind. Der Republikaner Dwight D. Eisenhower hat Spitzenverdiener nach dem Zweiten Weltkrieg noch mit 91 Prozent, Erbschaften mit 80 Prozent besteuert und massive Infrastrukturinvestitionen getätigt – dem lag zu Grunde, dass Reichtum nie ererbt, sondern selbst geschaffen sein sollte und dass hohe Einkommenssteuern der angemessene Beitrag auserwählter Reicher zu einem Gemeinwohl sind, das durch den Zweiten Weltkrieg gelitten hatte und daher wieder hergestellt werden musste. Der Abstand der Republikaner unter Eisenhower zu den Republikanern unter Trump in Zahlen: Statt Eisenhowers Spitzensteuersatz von 91 Prozent ist ihnen ein Spitzensteuersatz von 40 Prozent zu hoch und sie fordern Budgetkürzungen selbst bei Gesundheit oder Bildung. Dabei sind republikanische Staaten durchgehend ärmer als demokratische und hängen damit weit mehr von Bundesmitteln ab. Denn durchwegs haben sie mehr Arbeitslose, mehr minderjährige Mütter und mehr Kranke. Die Lebenserwartung ihrer Bürger ist um fünf Jahre geringer als die der Bürger demokratisch regierter Bundesstaaten: Zwischen Louisiana (75,7) und Connecticut (80,8) ist ein Unterschied wie zwischen den USA und Nicaragua. 44 Prozent von Louisianas Budget muss Washington beisteuern – aber nirgendwo ist „Washington“ verhasster. Zur Armut kommen die größten Umweltprobleme der USA. Zeitweise waren Louisianas Gewässer durch Rückstände seiner Ölindustrie so vergiftet, dass Krebs ganze Familien hinwegraffte und Straßen „Cancer Alley“ genannt wurden. Dennoch sind selbst Hinterbliebene mit der Tea-Party und Louisianas Gouverneur für die Abschaffung
Ein krankes Land
der Enviroment Protection Agency EPA: Diese Bundesumweltschutzbehörde koste nur Jobs, Steuergeld und Unabhängigkeit von Washington. Was geht in den Familienvätern vor, die die USA so unwirtlich erleben? Hochschild beschreibt es mit einem Bild, das ihre Gesprächspartner durchwegs zutreffend nennen: Sie sehen sich in einer Warteschlange am Fuß eines Berges, der unverändert den amerikanischen Traum verbirgt – ein Häuschen, ein Auto und Kinder, die es weiter als ihre Eltern bringen. Doch mit 50 Jahren stehen sie noch immer in der Warteschlange, obwohl sie immer denkbar hart gearbeitet haben. Der Grund kann also nur sein, dass sich andere vor ihnen eingereiht haben – „weil Washington ihnen hilft“: − Schwarze – die sie weit hinter sich glaubten – weil „Washington“ Unternehmen, die Staatsaufträge erhalten, zwingt, sie – vor Weißen – zu Qualifizierungslehrgängen zu entsenden. − Frauen, die „dank Washington“ mit schlechteren Noten als Männer studieren und promovieren. − Selbst Schwule, Zuwanderer und Flüchtlinge genießen in den Augen der evangelikalen weißen Männer „Washingtons“ Unterstützung. Wer aber unterstützt sie, die weißen evangelikalen Männer? Worauf können sie „politisch korrekt“ wenigstens stolz sein? Auf ihre Arbeit – obwohl sie schlechter denn je entlohnt wird? Wenn sie stolz sind, Weiße zu sein, gelten sie als Rassisten. Wenn sie stolz sind, Männer und heterosexuell zu sein, gelten sie als homophob. Wenn sie stolz sind, Christen zu sein, gelten sie als beschränkt. Sie sind Fremde im eigenen Land – einzig Donald Trump weiß sie zu schätzen. Gesichert ist, dass ältere, weiße, evangelikale, autoritär gesinnte Männer die große Mehrheit seiner Wähler bilden. Ihre Schulbildung und ihr Einkommen sind, wie bei der FPÖ, relativ geringer, aber wie unter den Freiheitlichen gibt es unter ihnen auch bestens Ausgebildete und Wohlhabende. Nur fürchten sie nicht weniger als der Mittelstand, dass ihr Wohlstand akut bedroht ist – sie sind, wie FPÖ-Wähler weit überdurchschnittlich Pessimisten. Zu 70 Prozent sind sie der Meinung, dass sich Kultur und Lebensart überwiegend zum Negativen verändert haben. Zu 83 Prozent sind sie der Überzeugung, das Land müsse besser vor äußeren Einflüssen geschützt werden und die Politik sei dazu nicht mehr in der Lage. Das sei nur Donald Trump. Das trauen sie ihm nicht zuletzt zu, weil er so „ganz anders als alle“ ist – von der grellen Frisur über den grellen Reichtum bis zum grellen Aufstand gegen die „political correctness“, mit dem er ihnen aus der Seele spricht: Natürlich irritiert sie, dass Feministen das Patriarchat infrage stellen; dass ihre „Ehe“ nicht mehr als die Verbindung zweier „Schwuchteln“ wert sein soll; dass „Neger“ Präsidenten statt Butler werden oder dass manche Leute kaum Unterschiede zwischen Christentum und fremden Religionen sehen. Das überfordert – wie in Österreich – vor allem Teile der Landbevölkerung: Es ist ihnen zu viel der „Öffnung“ in zu kurzer Zeit.
503
504
Ein krankes Land
So wie sich das Gefühl der Bedrohung hierzulande auf den Flüchtlingsstrom aus Afrika konzentriert, konzentriert es sich in den USA auf den Flüchtlingsstrom aus Mexiko. Sie sehen in Donald Trump „endlich einen, der sich traut, die Wahrheit zu sagen“, wenn er Mexikaner als Dealer und Kriminelle verteufelt, obwohl sie in der Kriminalitätsstatistik so unauffällig sind wie bei uns asylberechtigte Syrer. Sie glauben, dass nur er sie wirksam schützen kann, indem er eine Mauer an der Grenze zu Mexiko errichtet. Nicht nur Trump ist pathologisch krank – ein Narzisst wie er im Lehrbuch steht – sondern das ganze Land ist derzeit krank. Das politische System ist krank: Seit der Supreme Court 2010 entschieden hat, in Wahlkämpfen Spenden jeder Größenordnung zuzulassen, können reaktionäre Milliardäre Abgeordnete und Gesetze kaufen. Die Medienlandschaft ist krank: Ohne öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es kein Medium, dessen Information die Bevölkerung als weitgehend objektiv ansieht. Fox News im Eigentum eines reaktionären Milliardärs agiert gleichberechtigt neben CNN im Eigentum liberaler Milliardäre. Gleichberechtigte Informationsquellen sind auch Facebook, YouTube & Co, deren Algorithmen dafür sorgen, dass die extremsten Aussagen die weiteste Verbreitung finden und dass man Wahlen unbemerkt und perfekt manipulieren kann: Wer aus den Daten der sozialen Medien die psychischen Besonderheiten jeder Wählergruppe ermittelt, weiß, mit welchen Nachrichten man sie füttern muss, um ein bestimmtes Wahlverhalten zu erreichen. Und natürlich wissen das auch russische IT-Spezialisten. Es brauchte zwar den Psychopathen Donald Trump, um jenen Sturm aufs Kapitol zu ermöglichen, zu dem er mit der Lüge, der Wahlsieg über Joe Biden sei ihm gestohlen worden, aufstachelte, bis fanatische, republikanische Abtreibungsgegner gemeinsam mit faschistoiden „proud boys“ auf andersgesinnte Abgeordnete einprügelten – aber es bedurfte eines Hintergrundes, der sich folgendermaßen zusammenfassen lässt: − Die immer schon große ökonomische Ungleichheit ist extrem gewachsen. − Die politische Spaltung des Landes ist extrem vertieft. − Die evangelikale weiße Mittel- und Unterschicht ist zunehmend deklassiert. − und die ungeregelte Macht angeblich sozialer Medien erleichtert den Machtmissbrauch durch Faschisten, die auf ihrer Klaviatur zu spielen wissen.
Die Probleme der Abgehängten Dass Trump die zweifellos übelste Person war, die je zum amerikanischen Präsidenten gewählt wurde, hat mich allerdings nicht zu einem Fehler veranlasst, der meines Erachtens voran die deutschsprachige Berichterstattung über ihn gekennzeichnet hat. Dass er ein „Populist“ ist, besagt zwar, dass er Sorgen und Ängste der Bevölkerung dazu nutzt, auf häufig undemokratische, nicht unbedingt rechtsstaatliche Weise an die Macht zu gelangen, aber es besagt auch, dass er Sorgen und Ängste der „Population“
Die Probleme der Abgehängten
(Bevölkerung) ins Zentrum seiner Politik gerückt hat. Es wurde übersehen, dass Trump auch durchaus berechtigte Ziele verfolgt hat und dabei nicht ohne Erfolg gewesen ist. So erhob Trump seine hierzulande so heftig kritisierte Forderung nach Zöllen gegen billige Importe durchaus im berechtigten Interesse seiner Wähler. Seine Wirtschaftskriege – die in der EU nur angeführt werden, um ihr schwaches Wachstum zu erklären, obwohl sie dessen geringster Grund sind – waren durchwegs erfolgreich: Schon mit seiner Aufkündigung des Freihandelsvertrages mit Mexiko hat eine Reihe von Firmen beschlossen, ihre Autos doch lieber in den USA als in Mexiko zu fertigen, und im neuen Abkommen sind Mexikos US-Exporten Schranken auferlegt. Auch mit Kanada haben die USA günstigere Bedingungen als zuvor erreicht, und selbst im Handelskrieg mit China wurde ihnen ein besserer Zugang zu dessen Markt zugesichert. Nicht unbedingt, weil Trump so genial verhandelt hat, sondern weil die USA kraft ihrer wirtschaftlichen Stärke vermutlich jeden Gegner zu Konzessionen zwingen können. Es ist wohl so, wie Kanadas Ex-Premier Pierre Trudeau formulierte: „Neben den USA zu leben ist wie mit einem Elefanten im Bett zu liegen. Egal wie freundlich und ausgeglichen das Tier auch sein mag, man ist von jedem Zucken und Brummen betroffen.“ Schon gar, wenn Donald Trump den Elefanten reitet. Auch wenn Deutschlands Zeitungen noch so ausführlich berichten, dass auch USÖkonomen Trump vorrechnen, dass Steuern auf EU-Importe zu Preissteigerungen in den USA führen würden, berührte das Trumps Wähler wenig. Erstens stehen diese Berechnungen auf wackeligen Beinen, und zweitens werden, selbst wenn sie stimmen sollten, mehr US-Waren verkauft, sobald Zölle Importe verteuern. Und nur das interessiert Metallarbeiter, die keinen Job mehr haben. Einfache Amerikaner erinnern sich der Zeit, in der die USA viel weniger Freihandel zugelassen, viel weniger Billigmetalle und nicht ganz so viele Luxusautos eingeführt haben: In dieser Zeit ist es ihnen besser gegangen. Ich habe mich daher auch gehütet, Trumps Androhung von Zöllen für deutsche Autos, die Österreich mit seiner Zulieferindustrie massiv mitbetroffen hätten, aus lauter Patriotismus als empörend abzulehnen. Deutschlands Exporterfolge sind für die USA ein messbares Problem: Sie haben gegenüber Deutschland ein fortdauerndes Handelsbilanzdefizit von rund 50 Milliarden Euro, das zum größten Teil auf Autoimporten beruht. Natürlich gilt wie überall, dass deutsche Autos besonders gut sind und in den USA daher immer besonders gefragt waren. Aber dank „Lohnzurückhaltung“ sind sie mittlerweile auch deutlich preiswerter, und der dank des Sparpaktes so schwache Euro verbilligt sie noch einmal: Hat der Euro unmittelbar nach der Finanzkrise 1,5 Dollar gekostet, so hat er mittlerweile bis zum Gleichstand abgewertet und diese Kursrelation begünstigt deutsche Exportgüter zusätzlich gewaltig: Kostete ein 10.000 Euro teures deutsches Auto 2009 am Höhepunkt der Krise 15.000 Dollar, so kostet es heute dank der neuen Kursrelation nur mehr um die 11.500 Dollar. Donald Trump ließ sich von Zöllen gegen europäische, voran deutsche Autos daher nur abbringen, indem ihm die EU im Gegenzug die Abnahme von Erdgas versprach,
505
506
Ein krankes Land
das die USA dank „Fracking“ reichlich herstellen. Zölle verhängte er ausschließlich gegen Eisen und Aluminium, die Deutschland weit weniger treffen. Hingegen sind Zölle sehr wohl ein probates Mittel gegen Exporte, die die eigene Bevölkerung zu sehr treffen. Die These des Nobelpreisträgers Paul Krugman, dass der globale Freihandel größere Serien zulässt und dass das z. B. die Autoproduktion verbilligt, trifft zwar zu, aber für alle einfachen Waren (etwa Agrarprodukte) ist es irrelevant. Und der amerikanische Autoarbeiter hat auch nicht so viel davon, dass BMW- oder GM-Aktionäre dank größerer Serien größere Gewinne machen und sich reiche Amerikaner leichter einen großen Mercedes kaufen können. Das Beispiel der Billigstähle aus China illustriert die Lage am klarsten: Natürlich ist einfacher chinesischer Stahl, der in chinesischen Fabriken auf nicht mehr so schlechten Anlagen von sehr viel billigeren Arbeitern hergestellt wird, sehr viel preiswerter als einfacher US-Stahl. US-Billigstahl-Produzenten sind dieser Konkurrenz angesichts amerikanischer Löhne, zu denen sich auch noch höhere Umweltstandards addieren, unmöglich gewachsen. Denn es stimmt auch die These des Wirtschaftsnobelpreisträgers Bertil Ohlin: Ein Land, das sich aufgrund hochqualifizierter Arbeitskräfte auf hochpreisige Qualitätsprodukte spezialisiert, muss zur Kenntnis nehmen, dass ein Niedriglohnland mit geringer qualifizierten Arbeitskräften sich auf einfache Billigprodukte spezialisiert. Unter Freihandelsbedingungen müssen dessen Einfachprodukte die Einfachprodukte der USA daher verdrängen – mit der zwingenden Folge, dass amerikanische Geringqualifizierte in Bedrängnis geraten. Doch das gilt eben nur unter Freihandelsbedingungen. Sobald China-Stahl über eine 20 prozentige Zollbarriere gehievt werden muss, ist US-Stahl wieder konkurrenzfähig – und nur das ist für US-Stahlarbeiter relevant, selbst wenn Stahl dadurch auch für ihn teurer wird. Immerhin hat Trump mit seinen Zöllen gegen China erreicht, dass in den USA wieder metallproduzierende Werke eröffnet wurden: Als in Missouri ein stillgelegtes Aluminiumwerk wiedereröffnet wurde, konnte sich der republikanische Funktionär, der es eröffnete, des Andrangs ehemaliger Mitarbeiter nicht erwehren. Es gibt in einer Demokratie zu Trumps Politik der Zollschranken nur eine erfolgversprechende Alternative: Die US-Hochtechnologie-Unternehmen, die dank des globalen (um China erweiterten) Freihandels gigantische Gewinne einfahren, müssten etwas davon an die Verlierer dieses globalen Freihandels – die geringqualifizierten Stahlarbeiter – abgeben. Doch das passiert nicht. In Europa hat man für diese Art des Ausgleiches – den die EU nicht minder braucht – wenigstens die Instrumente des Sozialstaates (Transfers und Gratisleistungen) zur Verfügung – auch wenn Neoliberale beides abbauen wollen. In den USA hingegen ist der Sozialstaat von vornherein neoliberal unterentwickelt. Für US-Metallarbeiter, die um ihren Job bangen sind Trumps Zölle daher einfach Politik, die ihnen hilft.
Ist Freihandel immer das Beste?
Ist Freihandel immer das Beste? Deutsche Medien stellen freilich die Behauptung auf, dass Zölle grundsätzlich eine katastrophale, unfaire Beschränkung wirtschaftlichen Erfolges und daher übelster Protektionismus darstellen, während schrankenloser Freihandel das einzig Faire sei und die Wirtschaft rundum maximal befördere. Folgt man der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der EU-Kommission oder den Industriellenvereinigungen Österreichs wie Deutschlands, so ist er eine epochale Errungenschaft und unverzichtbar für wirtschaftlichen Erfolg und Wohlstand. Letztere Sicht teilt die Mehrheit der Medien wie der Ökonomen. Daher konzentriere ich mich hier auf die Einwände der Minderheit. Mein Ausgangspunkt ist dabei die Vision „fairen Handels“ wie er dann gegeben ist, wenn für alle Unternehmen gleiche Bedingungen gelten: Wenn sie den gleichen Steuer- und Umweltgesetzen unterliegen, gleichartig bemessene Löhne zahlen und keine Verzerrung durch Währungen erfolgt. Optimal gibt es das nur im eigenen Land. Doch auch im Verbund der EU sind fast alle Währungen mit dem Euro verzahnt und Umweltgesetze differieren zumindest nicht unerträglich. Bei den Steuergesetzen kann man darüber allerdings schon heftig streiten, wenn man nach Irland, Holland, oder Malta schaut. Dass die Löhne im Ex-Ostblock ungleich niedriger sind, wird dagegen dadurch mehr als egalisiert, dass dort auch die Produktivität ungleich niedriger ist. Damit klaffen die Lohnstückkosten gegenüber dem ehemaligen Ostblock zumindest nicht allzu weit auseinander. Dass sie in Deutschland mit der höchsten Produktivität dank Lohnzurückhaltung mittlerweile aber die relativ niedrigsten sind, schafft selbst im EU-internen Freihandel die angeführten gewaltigen Probleme, an denen, wenn man sie nicht in den Griff bekommt, die EU zerbrechen könnte und die Eurozone akut vom Zerbrechen bedroht ist. Die absolute Gleichsetzung von Freihandel mit wirtschaftlichem Erfolg ist jedenfalls ein absoluter Mythos. Historisch sind alle starken Industrien, die Englands, Deutschlands oder der USA im Gegenteil hinter hohen Zollmauern entstanden, und in der jüngeren Geschichte war das in Japan, China oder Südkorea nicht anders. Südkorea zum Beispiel hat seine hervorragende Automobilindustrie entwickelt, indem es ausländische Autos mit 400 Prozent Zoll belastet hat. Das erklärt im Umkehrschluss, warum „Freihandel“ für (afrikanische) Entwicklungsländer so problematisch ist: Ihre Industrien sind denen starker Industrienationen im freien Wettbewerb derart unterlegen, dass sie sich ohne schützende Zollmauern nicht entwickeln können. Selbst deutsches Hühnerfleisch ist noch billiger als somalisches – nicht einmal Afrikas Nahrungsmittelindustrie hält auch nur der Nahrungsmittelindustrie Europas, geschweige denn der USA stand. War Trumps Zollpolitik in meinen Augen für Amerikas wirtschaftlich schwächere Bevölkerung im Wesentlichen sehr wohl richtig, so war seine Steuerpolitik jedenfalls
507
508
Ein krankes Land
nicht durchgehend falsch: Er senkte die hohe Körperschaftsteuer amerikanischer Unternehmen von 36 auf 20 Prozent und leider nicht minder die Steuer von Superreichen. Aber er hat mit der gleichzeitigen Senkung der Steuern des Mittelstandes und der Unterschicht richtigerweise auch die Massenkaufkraft erhöht und hoffte, dass die Summe der Steuersenkungen die Wirtschaft beflügeln würden. Das ist auch geschehen: Die erhöhte Massenkaufkraft und die gesenkte Körperschaftsteuer erzeugten einen Boom, auch wenn die US-Staatsschuldenquote auf diese Weise nicht so völlig unkritisch anstieg, wie das bei vermehrten Investitionen des Staates der Fall gewesen wäre. Die hatte Trump allerdings durchaus auch im Sinn: Er wollte nicht nur seine Grenzmauer zu Mexiko bauen, sondern auch in die Infrastruktur des Landes investieren. Doch in seiner ersten Amtsperiode verweigerten ihm die eigenen Tea-Party-Republikaner die Zustimmung, weil sie Investitionen des Staates außer zur Stärkung des Militärs grundsätzlich ablehnen, und in der zweiten Halbzeit wollten die erstarkten Demokraten ihm nicht unbedingt Erfolge bescheren. Dabei hätte selbst der Bau seiner absurden „Mauer“ zu Mexiko die Wirtschaft beflügelt. Auch wenn es Wolfgang Schäuble oder Olaf Scholz so wenig glauben wie Gernot Blümel oder Magnus Brunner: Jede Investition des Staates, selbst in normalerweise Unnützes, beflügelt die Wirtschaft. In den Jahren 1941, 42 und 43 wuchs das reale BIP der USA durch Rüstungsausgaben um 17, 19 und 17 Prozent. Auch unter Trump genügte es daher, dass die USA wie immer rüsteten, und im Gegensatz zur EU zumindest nicht sparten, dass ihre Wirtschaft weit stärker als die der EU gewachsen ist. Zumindest gemessen an der EU hat Trump gut gewirtschaftet – auch weit besser als Deutschlands sparsame Angela Merkel oder Österreichs sparsamer Sebastian Kurz: Der Boom, den er entfachte, indem er, die Staatsschulden negierend, die Steuern ohne ausreichende Gegenfinanzierung drastisch senkte, bescherte den USA mit drei Prozent das im „Westen“ höchste Wachstum, die niedrigste Arbeitslosigkeit und Geringverdienern die seit langem größten Einkommenszuwächse und die längste Zeit kaum Inflation. (Dass sie 2020/21 kräftig stieg, liegt voran am Anstieg des Öl- und Gaspreises, den Trump nicht verantwortet.) Und selbst Corona hat Trump ökonomisch besser als die EU bewältigt, indem er den Wirtschaftseinbruch durch massiv erhöhtes Arbeitslosengeld abfing: Das US-BIP schrumpfte trotz Trumps miserabler Covid-19-Politik nur um 3,5, das der EU um 7,8 Prozent. Sparen des Staates hat eben seinen Preis: Es kommt die Wirtschaft teuer. Folgt man den Thesen der EU für gutes Wirtschaften, so hätte es Trumps Erfolg nicht geben dürfen. „Amerikas wundersames Wachstum“, überschrieb der Korrespondent der neoliberalen Frankfurter Allgemeinen Zeitung Winand von Petersdorff denn auch seinen Bericht über die US-Wirtschaft, um verblüfft festzuhalten: „Eine der Weisheiten (der deutschen Wirtschaftspolitik) lautete, dass eine deutliche Erhöhung der Staatsdefizite und eine Steuersenkung, die nicht durch zusätzliche Staatseinnahmen
Ist Freihandel immer das Beste?
gegenfinanziert war, zwangsläufig die Zinsen nach oben treibe (und so) die zusätzliche Dynamik ersticke, die die Steuersenkung entfachen sollte. In Wirklichkeit allerdings stiegen die Zinsen nicht, sondern wiesen eher nach unten. Eine andere liebgewonnene Vorstellung war, dass die US-Wirtschaft nahe an der Kapazitätsgrenze produziere, weshalb ein Konjunkturprogramm aus Steuersenkung und zusätzlichen Ausgaben letztlich in (gefährliche) Inflation münden würde. Doch auch sie unterblieb.“ Während ich diese Zeilen schreibe, könnte sie allerdings einen gewissen Anteil an der US-Inflation von acht Prozent haben, die freilich wie in der EU voran durch die Verteuerung von Öl und Gas zustande gekommen ist. Die unter Trump so stark erhöhten Löhne und die durch das hohe Arbeitslosenentgelt verminderte Achtsamkeit der Bürger bei ihren Einkäufen könnte mit zur hohen Inflation beigetragen haben. Würde Nationalökonomie in Deutschland (in der EU) als Wissenschaft statt als Glaubenslehre betrieben, hätte der zitierte FAZ-Bericht zur Folge, dass Ökonomen und Journalisten sich fragten, ob ihre „liebgewonnenen Vorstellungen“ zutreffen. Vielleicht hätte man sich dann doch der von einem deutschen Ökonomen entwickelten Saldenmechanik erinnert, die so überzeugend erklärt, dass erhöhte Staatsausgaben die Wirtschaft nicht ersticken, sondern beflügeln. Und die „Kapazitätsgrenzen“ der US-Wirtschaft wurden allenfalls zwischen 1941 und 1945 erreicht, als die Notenbank jede Menge Geldes druckte und der Staat es in gigantische Rüstungsaufträge steckte – aber auch das erzeugte keineswegs Inflation. Vielleicht hätte man dann die Inflationstheorie des Monetarismus, wonach jede Erhöhung der Geldmenge Inflation erzeuge, doch ad acta gelegt. Aber deutsche Ökonomen prüfen nicht, sondern glauben: Dass Staatsschulden und Gelddrucken zwangsläufig des Teufels sind, ist für sie – anders als für viele angloamerikanische Ökonomen – Glaubensgewissheit. Angesichts der beschrieben ökonomischen Entwicklung taten sich die „Democrats“ denn auch ziemlich schwer, Trump auf wirtschaftlichem Gebiet entgegenzutreten. Dass Trump mit dem Charisma „ganz anders als alle Politiker zu sein“ die Wahlen gegen den nicht unbedingt charismatischen Joe Biden dennoch verlor, stand angesichts des komplexen US-Wahlsystems mit seiner Bevorzugung der Swing-Staaten auf des Messers Schneide und lag entscheidend am Corona-Virus: Hätte Trump dessen Verbreitung nicht so katastrophal gemanagt, er hätte die größten Chancen gehabt, Biden zu schlagen. Denn dass es Trump selbst bei optimalem Corona-Management unmöglich gewesen wäre, einen Einbruch der US-Wirtschaft zu verhindern, war Gott sei Dank eine zu komplexe Überlegung, um von allzu vielen Wählern angestellt zu werden. So aber erlitten die US-Aktienkurse aufgrund der Pandemie doch einen deutlichen Knick, und das irritiert in den USA nicht nur die Reichen, sondern auch die Massen, weil Aktienbesitz bis in die Unterschicht reicht. Trump verlor sein bis dahin zugkräftigstes Argument: Dass die Börse noch nie so gut wie in seiner Amtszeit gelaufen sei. Nur auf diese Weise reichten die durch Corona unvermeidlichen wirtschaftlichen Probleme, zusammen mit der Abneigung, die das „andere“ Amerika Trump entgegen-
509
510
Ein krankes Land
brachte, letztlich zu Bidens Sieg: Er erhielt bekanntlich 81,2 Millionen Stimmen – aber Trump erhielt mit 74,2 Millionen Stimmen mehr Stimmen als jeder republikanische Präsident der jüngsten Zeit. Und er kann sie neuerlich erhalten, wenn es Biden nicht gelingt, für den „kleinen Mann“ ökonomisch ähnlich erfolgreich wie Trump zu sein, indem zusätzliche Jobs entstehen und ihm mehr Geld in der Tasche bleibt. Biden müsste die versprochenen Investitionen in die US-Infrastruktur, die Trump nicht gelungen sind, daher so schnell wie möglich durchführen und hat bekanntlich ein 1,2 Billionen Dollar großes Investitionspaket bereits durchgesetzt. Während ich diese Zeilen schrieb, hoffte er, weitere Billionen-Programme durchzusetzen – und hatte dabei neben den Republikanern, die Fundamental-Opposition betreiben, demokratische Senatoren zu Gegnern, die, wie Sebastian Kurz oder die Spitze der EU nicht an die Saldenmechanik glauben und wie die Republikaner meinen, dass hohe Staatsausgaben des Teufels sind.
Die vergebene Chance Dabei hatte Bidens Präsidentschaft aufs Hoffnungsvollste begonnen. Ursprünglich schien er zwar nur weitermachen zu wollen, wo der, trotz rhetorischer Höhenflüge, nur gebremst reformierende Barack Obama aufgehört hat, doch er wollte offenkundig mehr und suchte die Offensive. Seine von Finanzministerin Janet Yellen auf der Tagung der G20 durchgesetzte Forderung nach globalen Mindeststeuern für Unternehmen gab die Richtung vor: Der Staat sollte wieder die Verantwortung für die Wirtschaft übernehmen. Die Bestellung der bisherigen Präsidentin der US-Notenbank FED und Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Kalifornien Janet Yellen zur Finanzministerin stellte die größte Linksverschiebung der US-Wirtschaftspolitik seit Jahrzehnten in Aussicht. Ihre Kritik am immer größeren Abstand der kleinen Einkommen und Vermögen von den großen Einkommen und Vermögen richtet sich gegen zentrale neoliberale Entwicklungen. Sie ist überzeugt von der Notwendigkeit von Eingriffen seines starken Staates in die Wirtschaft. (Nicht zuletzt bestreitet ihr Ehemann, Wirtschaftsnobelpreisträger George Akerlof, die behauptete Unfehlbarkeit des Marktes). Yellen begründet ihre Politik wie ich mit der Saldenmechanik: Nur wenn sich zu den zögerlichen Einkäufen von Konsumenten und Unternehmern vermehrte Investitionen (= Einkäufe) des Staates addieren, kann die Summe aller Einkäufe = die Summe aller Verkäufe, also die Wirtschaft, wachsen. Entsprechend eindeutig bestärkte Yellen Joe Biden in seinen Plänen, die Infrastruktur der USA durch umfangreiche Investitionen zu sanieren. Schließlich erinnert New Yorks U-Bahn an einen fahrenden Schrotthaufen, sind die öffentlichen Schulen ihrer Aufgabe immer weniger gewachsen, ist das Gesundheitssystem trotz Obamacare unterentwickelt – und vor allem hinken die USA im Kampf gegen den Klimawandel der EU hinterher und leiden zunehmend an dessen
Die vergebene Chance
Manifestationen: In vielen Bundesaaten sinkt der Grundwasserspiegel immer weiter ab. Yellen wollte daher endlich massivste Investitionen in den Klimaschutz. Finanzieren wollte sie diese Mega-Investitionen, indem die Körperschaftsteuer für Unternehmen wieder von 21 auf 28 Prozent erhöht wird, sowie durch höhere Steuern „für die reichsten Amerikaner“ (Biden), die 900 Milliarden Dollar einbringen sollten. Zumindest Amazon-Eigner Jeff Bezos signalisierte Zustimmung: Die Intelligentesten unter den Reichsten, Bezos, Bill Gates oder Waren Buffett, wissen, dass ihr Reichtum unter Bidens Investitionen nicht leidet, sondern in Wahrheit abgesichert würde. Am schwersten fällt es Biden und Yellen zweifellos von vornherein, ihr größtes Anliegen umzusetzen: Die extreme Ungleichheit der USA zu mindern. Denn sie ist ein zentraler Bestandteil der US-Wirtschaftsideologie, wie die ersten Siedler, Protestanten calvinischer Prägung, sie grundgelegt haben. Sie drangen (zu Recht) auf die Trennung von Staat und Kirche, die in katholischen Ländern Garant autoritärer Herrschaft und wirtschaftlichen Rückstandes war. Die Habsburgermonarchie war dafür beispielhaft: Gelderwerb galt der Kirche als mindere, profane Tätigkeit; Zinsen waren verboten; der Kaiser wollte keine Industrie in seiner Nähe. Zwangsläufig entwickelten sich protestantische Länder wie die Schweiz, Holland oder England wirtschaftlich ungleich besser, waren Calvinisten doch darin einig, in wirtschaftlichem Erfolg ein äußeres Zeichen für den Besitz der Gnade Gottes zu sehen. Diese protestantische Haltung zu wirtschaftlichem Wohlergehen und persönlicher Freiheit suchten die Gründerväter der USA in der neuen Welt zu verwirklichen: In der „Erklärung der Menschen und Bürgerrechte“ wurde die Gleichheit der Bürger festgeschrieben – das größtmögliche Wohlergehen der größtmöglichen Zahl wurde zum Ziel guter Politik erklärt. Das schuf dem Kapitalismus in den USA optimale Voraussetzungen: Er akzeptierte zwar enorme Vermögensunterschiede als selbstverständlichen Ausfluss unterschiedlicher „Gnade“, aber er wollte wirtschaftliche Chancengleichheit seiner Bürger: Bis zu Ronald Reagan reichte die Erbschaftssteuer bis 70 Prozent, weil nur jenes Vermögen Gottes Gnade signalisiert, das eigener Leistung entspringt. Das alles ist nicht mehr gegeben. Die USA haben die Forderung nach dem größtmöglichen Wohlstand der größtmöglichen Zahl maximal verraten. Spätestens seit Reagan nahm die religiöse Grundströmung der US-Wirtschaft eine neue fatale Richtung. Reagan trat zwar an, um den Staat schwach und seine Ausgaben gering zu halten, aber sie fielen, wie ich beschrieben habe, höher denn je aus: Indem er die UdSSR zu Grunde rüstete, löste er ungewollt einen keynesianischen Boom aus. Von seinem ursprünglichen Vorsatz blieb nur übrig, den Staat möglichst schwach zu gestalten, und das gelang ihm durch umfangreiche Deregulierung. Da die Amerikaner diese Deregulierungen gleichzeitig mit dem Rüstungsboom erlebten, hielten sie sie fälschlich für dessen Ursache. Zugleich war Deregulierung eines der Anliegen einer ökonomischen Überzeugung, die Milton Friedman zum brillanten Hohepriester hatte: des Neoliberalismus. Die „Chicago Boys“, wie seine Jünger genannt wurden, glauben, den größtmöglichen Wohlstand
511
512
Ein krankes Land
der größtmöglichen Zahl durch die beschriebene „Angebotsorientierung“ zu verwirklichen: Die Wirtschaft würde umso besser funktionieren, je geringer Unternehmensund Vermögenssteuern und je seltener Regulierungen wären. Vereinfacht: Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s allen gut. Glaube zeichnet sich dadurch aus, dass gegenteilige empirische Erfahrungen ihn nicht erschüttern: So kräftig die Gewinne der Unternehmer wuchsen, so dürftig wuchs der Wohlstand der meisten Amerikaner, so mäßig ist ihre Lebenserwartung und so kaputt die US-Infrastruktur. Selbstverständlich torpedierten die Republikaner alle Pläne Bidens und Yellens nach Kräften. Erstens, weil die Zeiten gelegentlicher gemeinsamer Beschlüsse seit langem vorbei sind, sofern es nicht um Rüstung geht oder ein Shutdown der gesamten Verwaltung abgewendet werden muss. Zweitens weil auch sie nicht begreifen, dass nur hohe Staatsausgaben Krisen überwinden: Schließlich hatten sie sich auch gegen Großinvestitionen Trumps gesträubt, weil sie großen finanziellen Einfluss des Staates für „Sozialismus“ (= des Teufels) halten. Drittens wollen die wenigen, die mehr von Wirtschaft verstehen, Biden unter keinen Umständen Erfolg gönnen. Sie hatten auch ein Mittel, Biden die Umsetzung seiner Pläne maximal zu erschweren: den „Filibuster“: Mit ihm können sie verhindern, dass der Senat einem Gesetz des Repräsentantenhauses zustimmt, obwohl die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris ein Dirimierungsrecht besitzt, das den Demokraten dort die Mehrheit verschaffte. Ursprünglich bestand der Filibuster darin, dass ein Mandatar einen Beschluss so lange verhindern konnte, als er eine Rede hielt. Inzwischen muss er gar nicht mehr dauerreden, sondern sich nur auf diese Tradition berufen, um einen Beschluss aufzuhalten, und nur 60 von 100 Senatoren können diese Blockade außer Kraft setzen. Die Demokraten müssen also ständig versuchen, zehn republikanische Senatoren auf ihre Seite zu ziehen. Das funktioniert, wenn überhaupt, nur mittels perfekter Packelei: Einem Senator, der in seinem Bundesstaat für (s)ein Projekt die Zustimmung und/oder Subvention des Bundes benötigt, wird diese zugesagt, wenn er im Gegenzug den Filibuster verhindert. Wenn es jemanden gab, dem man zutraute, dergleichen erfolgreich auszuhandeln, dann war es Joe Biden. Doch darin irrten die Optimisten: In der Ablehnung jedes von Biden initiierten Gesetzes waren die Republikaner einig wie nie zuvor. Nahezu unlösbar wurde Bidens Problem aber dadurch, dass es unter den „Democrats“ zwei Flügel gibt: den progressiven, der der Saldenmechanik vertraut und Bidens Pläne so vollständig wie möglich erhalten will – und einen, zwar viel kleineren, neoliberalen, der in höherer Staatsverschuldung, fast wie die Republikaner oder Sebastian Kurz, eine Katastrophe sieht. Zwei Vertreter dieses Flügels haben erklärt, dass sie den Investitionen in die Entwicklung des Sozialstaates und zur Abwehr des Klimawandels, die Biden mit 3,5 Billionen Dollar veranschlagt, sicher nicht zustimmen werden. Tatsächlich haben sie nur 1,5 Billionen akzeptiert.
Die vergebene Chance
Ich hatte darauf gesetzt, dass der Wunsch nach Machterhalt sie letztlich zu einem Kompromiss bewegen würde, der klar in Richtung zu Bidens Wünschen verschoben ist. Aber ich habe mich geirrt: Senator Joe Manchin, Kohlehändler im Kohlestaat West Virginia, weigerte sich solange Bidens mittlerweile längst massiv abgespeckten Investitionen zuzustimmen, als darin weiterhin Investitionen enthalten waren, die die Kohleverbrennung einschränken sollten. Erst als diese Investitionen gestrichen und das Volumen des Pakets neuerlich erheblich reduziert worden war, stimmte er ihm zu. Damit muss es Biden weit schwerer als erhofft fallen, den Amerikanern innerhalb der kurzen, ihm verbleibenden Zeit zu demonstrieren, dass es ihnen unter seiner Regierung besser als unter Trumps Regierung geht. Verstärkt um berechtigte Kritik an Bidens zwar unvermeidlichem, aber chaotischen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan, und um das Problem der durch hohe Erdölpreise gestiegenen Inflation hat das bei den Midterm-Wahlen zwar „nur“ dazu geführt, dass die Republikaner eine denkbar knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus erreichten, aber das reicht, Biden für den Rest seiner Amtszeit zu lähmen. Ist Biden wirtschaftlich gelähmt und kann überhaupt nichts mehr durchsetzen, dann hat ein vom Impeachment befreiter Donald Trump 2024 immer noch eine, wenn auch nicht sehr große Chance auf ein Comeback. Dann stehen wir unmittelbar vor der Gefahr eines faschistoiden Amerika – und mit Simon Wiesenthal halte ich das nach wie vor für die größtmögliche, der freien Welt drohende Katastrophe. Ich hoffe daher, dass die Demokraten nicht mehr Biden mit seiner AfghanistanBelastung, sondern einen unverbrauchten Jüngeren ins Rennen um die Präsidentschaft schicken. Ansonsten hoffe ich auf die Frauen, die schon verhindert haben, dass die Republikaner die Midterm-Wahlen mit der von ihnen erwarteten deutliche Mehrheit gewannen: Die Tee-Party-Republikaner versteifen sich nämlich darauf, in „ihren“ Bundesstaaten, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch restlos zu beseitigen oder zumindest extrem einzuschränken und das ist etwas, was sich die Mehrheit der amerikanischen Frauen nicht nehmen lässt.
513
79. Schwäche und Chancen der Sozialdemokratie
Wie es in Europa weitergeht, hängt von Deutschland ab. Wenn Deutschland sich dauerhaft auf den Sparpakt versteift, wonach die Staatsschuldenquote von 60 Prozent und das Budgetdefizit von drei Prozent wieder erreicht werden soll, wird die Wirtschaft der EU weiter kränkeln. Und wenn es weiter bei seiner Lohnzurückhaltung bleibt, wird es Ländern, die ihre Löhne adäquat erhöht haben, weiter Marktanteile wegnehmen und ich kann mir nicht vorstellen, wie Italien oder Spanien das auf die Dauer überstehen. Die Partei, die die Politik Deutschlands am ehesten ändern konnte, war die SPD, aber in den letzten 40 Jahren hat sie extrem geschwächelt: Sie schien kaum minder vom deutschen Sparwahn und vom Neoliberalismus infiziert als CDU, CSU oder FDP und hat es so gut wie völlig Angela Merkel und der CDU/CSU überlassen, die Politik der EU zu gestalten und dank Deutschlands überragender Wirtschaftskraft zu dominieren. Die deutsche Sozialdemokratie machte die Schwäche mit, die fast alle sozialdemokratischen Parteien Europas in den letzten Jahrzehnten durchlebten und die ihre zentrale Ursache in der Schwäche der Gewerkschaft hat: Sie erzielt die Erfolge nicht mehr, die sich die Sozialdemokratie an ihre Fahne heften konnte. Spätestens ab 1980 haben alle Gewerkschaften massiv an Macht und Einfluss verloren. Als Ursache wurde lange Zeit und wird auch jetzt nicht zu Unrecht angeführt, dass sie so gut wie alles erreicht hätten, was Sozialisten je gefordert haben: Wohlstand, humane Arbeitsbedingungen, Krankenversicherung, Pensionsversicherung, kostenlosen Zugang zu Bildung, Aufstiegsmöglichkeiten und soziale Sicherheit. Die Gewerkschaften, so hieß es, und argumentierte Hans Rauscher im Standard nicht anders als die Frankfurter Allgemeine Zeitung, hätten sich durch ihre Erfolge sozusagen selbst überflüssig gemacht. Aber heute, und das scheint mir wesentlich, sind diese Erfolge längst nicht mehr sicher: Krankenversicherung und Pensionsversicherung kämpfen mit künstlich herbeigeredeten Finanzierungsproblemen; Bildungschancen wurden nicht im erhofften Umfang wahrgenommen; Reallöhne schrumpfen; und vor allem ist die Sicherheit des Arbeitsplatzes erstaunlicher Unsicherheit gewichen. Trotzdem sind die Gewerkschaften nicht wieder erstarkt. Schon seit langem sind ihnen die höher qualifizierten Arbeitskräfte entglitten und vertreten ihre Interessen lieber in Eigenregie; unzureichend qualifizierte Arbeitnehmer in ihren neuen, oft kurzfristigen und isolierten Arbeitsverhältnissen vermögen sie nicht zu organisieren, geschweige denn erfolgreich zu vertreten; vor allem aber stehen sie den Herausforderungen der Globalisierung schockstarr gegenüber. Es ist für einen Betriebsrat schon sehr schwer, hinzunehmen, dass gelegentlich Arbeitsplätze abgebaut werden müssen, um der nationalen Konkurrenz standzuhalten – aber wie schwer muss es ihm erst fallen, hinzunehmen, dass sein Betrieb schließen
Schwäche und Chancen der Sozialdemokratie
muss, weil die Arbeitskräfte im benachbarten Ungarn billiger sind und sein Betrieb es nicht geschafft hat, dem durch gesteigerte Produktivität zu begegnen. Und selbst wenn er Ungarn, Polen oder Tschechien irgendwann zähneknirschend als Mitgliedstaaten desselben Wirtschaftsraumes akzeptiert – wie soll er damit fertigwerden, dass billige Arbeitskräfte in Indien oder Indonesien die Schließung seines Betriebes herbeiführen können, weil die notwendige Produktivitätssteigerung versäumt wurde? Gewerkschaften sind immer national organisiert, die Weltwirtschaft ist zunehmend global organisiert. Das Problem wird so lange akut sein, als in den unterschiedlichen Ländern des Globus die unterschiedlichsten Einkommensverhältnisse herrschen beziehungsweise es wird erst gelöst sein, wenn sich die Einkommen einander angeglichen haben. Liberale Ökonomen sind der Ansicht, dass man diesen Prozess am besten dem Markt überlässt, auch wenn er sehr, sehr lange dauert: Produktionen wandern so lange aus Ländern mit hohen Lohnkosten in Länder mit niedrigeren Lohnkosten ab, bis die teuren Arbeitskräfte der Hochlohnländer es relativ billiger geben, während die Löhne in den ursprünglichen Niedriglohnländern ständig steigen, weil die zugewanderte Produktion den Bedarf an Arbeitskräften laufend erhöht. Dieser Prozess ist für die Niedriglohnländer, deren Gehaltsniveau ständig steigt, allerdings zwangsläufig sehr viel angenehmer als für die Hochlohnländer, deren Gehaltsniveau zumindest relativ ständig sinkt. Ökonomen mit großer internationaler Erfahrung, wie der ehemalige stellvertretende Finanzminister Deutschlands Heiner Flassbeck, von 2003 bis Ende 2012 Chefvolkswirt bei der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD), meinen daher, dass es in der Praxis nur einen wirksamen Schutz gegen extreme Verwerfungen aufgrund dieser Lohnungleichheit geben kann: Zölle bzw. abgesprochene Handelsbeschränkungen, wie Donald Trump sie einführte und wie sie die deutsche Presse als Todsünde brandmarkt. Solange die Gewerkschaften keine tragfähige Idee haben, wie sie durch ihre Aktivität die Angleichung der Einkommen auf internationaler Ebene schmerzlos beschleunigen können, haben sie zwangsläufig sehr viel schlechtere Karten als noch vor vierzig Jahren in Händen: Nur bei Beamten, Müllmännern oder Lokführern können sie noch relativ einfach, (und gelegentlich zu Lasten aller anderen Bürger) deutlich höhere Löhne durchsetzen, weil die auf nationaler Ebene unersetzbar sind. Der gewerkschaftliche Kampf ist auf eine neue Weise wieder so schwer wie vor 200 Jahren geworden. Aber das heißt nicht, dass man ihn aufgeben kann. Man muss ihn nur mit noch mehr Einsatz führen und vor allem ökonomisch zu argumentieren lernen: Man muss allen Beteiligten, auch Unternehmern, klar machen, dass die Wirtschaft besser, nicht schlechter funktioniert, wenn die Arbeitnehmer ein Maximum des Möglichen verdienen, weil gut bezahlte Arbeitnehmer, wie der „Kapitalist“ Henry Ford sehr gut wusste, mehr Autos kaufen können.
515
516
Schwäche und Chancen der Sozialdemokratie
Wolfgang Stürzels Saldenmechanik beweist es mit mathematischer Gewissheit: Wenn die Bürger mehr einkaufen können, können die Unternehmer mehr verkaufen. Das kann man auch Unternehmern oder zumindest den sie vertretenden Organisationen und Parteien erklären. Der einzelne Unternehmer wird zwar immer für die jeweils niedrigste Entlohnung eintreten – das ist seine betriebswirtschaftliche Rolle. Aber es ist die betriebs- wie volkswirtschaftliche Rolle der Gewerkschaft und sollte die politische Rolle der Sozialdemokratie sein, ihm dabei maximalen Widerstand zu leisten und zum Beispiel Mindestlöhne zu fixieren. Dass DGB wie ÖGB die Probleme der prekär Beschäftigten und der Arbeitslosen stets zu Gunsten der Anliegen der Beschäftigten vernachlässigt haben – dass sie die prekär Beschäftigten so wenig zu organisieren vermochten – erweist sich jetzt als ein ähnlich gravierender Nachteil wie der, den Europas Gewerkschaften seinerzeit gegenüber den amerikanischen Gewerkschaften zu tragen hatten: Die prekär Beschäftigten sind eine neue industrielle Reservearmee – sie haben solche Angst um ihren jeweiligen Job, dass sie noch so schlechte Bezahlung und Arbeitsbedingungen akzeptieren. Dass weder Gewerkschaften noch Sozialdemokratische Parteien in der Lage sind, die prekäre Beschäftigung durch Gesetze einzudämmen, ist ihr größtes praktisches Versagen und der strukturelle Hintergrund der Krise beider Organisationen. Dass sie nicht in der Lage sind, falsche ökonomische Überlegungen der Neoliberalen öffentlich zu widerlegen und auf der Basis einer veränderten öffentlichen Meinung bei Verhandlungen doch wieder Druck – nämlich politischen Druck – auszuüben, ist ein eminentes intellektuelles und politisches Versagen und der zweite strukturelle Hintergrund der Krise der Sozialdemokratie. Es bedurfte daher einer ganz speziellen Konstellation, damit die SPD 2021mit 25,7 Prozent als stärkste Partei aus den deutschen Wahlen hervorgehen konnte und damit die Union mit 24,2 Prozent auf den zweiten und die Grünen mit 14,8 auf den dritten Platz verwies. Doch diese überraschende Reihung war nicht in erster Linie wirtschaftspolitisch begründet – es ging im Wahlkampf vielmehr in erster Linie um Personen. Die SPD dankte ihren Spitzenplatz ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, der den rechten Flügel seiner Partei repräsentiert und eher unter dem Druck der Parteijugend immerhin für einen deutlich höheren Mindestlohn plädierte. Sein größtes Atout bestand jedoch darin, dass er, der als Finanzminister Angela Merkels nicht anders als sein Vorgänger Wolfgang Schäuble agiert hatte, als einziger Regierungserfahrung besaß und so mehr „Kontinuität“ als der Kandidat der Union Armin Laschet ausstrahlte. Laschet wiederum hatte es fertiggebracht, die ursprünglich deutliche Zustimmung zur Union von 35 auf 24 Prozent zu reduzieren. Nachdem er sich innerhalb der CDU gegen den Kandidaten der „Wirtschaft“ Friedrich Merz durchgesetzt hatte, setzte die CDU durch, dass er gegen den weit populäreren CSU-Chef Bayerns Markus Söder zum gemeinsamen Kanzlerkandidaten gekürt wurde. Dass Söder, aber auch zahlrei-
Schwäche und Chancen der Sozialdemokratie
che Funktionäre in der Folge immer wieder Zweifel an dieser Kür angemeldet haben, übertrug sich zwangsläufig auf die Wähler, zumal Laschet in etwa das Charisma von SP-Geschäftsführer Christian Deutsch ausstrahlte. Den entscheidenden Fehler beging er bei der Flutkatastrophe in seiner Heimat Nordrhein-Westfahlen: Statt sich voran um die Opfer zu kümmern, machte er Wahlkampf und wurde vom Fernsehen gefilmt als er lachte. Die nicht gerade faire Gegenüberstellung dieses Lachens, das sicher nicht der Flutkatastrophe galt, mit dem Leid der Opfer, warf ihn in einem Ausmaß zurück, das auch ein eloquenter Kandidat in den folgenden TV-Konfrontationen nicht aufgeholt hätte. Laschet, der zu Recht die volle Verantwortung für die Wahlniederlage auf sich nahm, trat denn auch sofort zurück, um der Union die Chance zu geben, vielleicht doch gemeinsam mit Grünen und FDP eine Regierung zu bilden. Aber diese Rechnung ging nicht auf: Umfragen signalisierten, dass die Bevölkerung eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP vorzog – etwas Terrain hatte die Sozialdemokratie also doch gewonnen, indem sie im Wahlkampf für einen höheren Mindestlohn und Vermögenssteuern eintrat. Dennoch waren es nicht die politischen Ideen der Sozialdemokratie, mit denen sie Platz eins erreichte, sondern es war das restlose Unvermögen Armin Laschets, das die Union den ersten Platz kostete. Einen ähnlichen Absturz in der Wählergunst verantwortete die grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock: Obwohl der Klimawandel immer offensichtlicher wurde, stürzten die Grünen, die im März mit 27 Prozent noch Platz eins belegt hatten, auf die aktuellen 14,6 Prozent ab. Baerbock war, um des Zeitgeistes willen, ihrem weit bekannteren und populäreren Co-Parteichef Robert Habeck vorgezogen worden, und obwohl der nicht gegen sie stichelte, verspielte sie ihre Glaubwürdigkeit, indem sie Nebeneinkünfte anzumelden vergaß, ihren Lebenslauf schönte und ein Buch schrieb, das sich über weite Strecken als abgeschrieben erwies. Dass sie dennoch zu einer großartigen, wortgewaltigen Außenministerin werden würde, erkannten die meisten Wähler so wenig wie ich. Wirklich neu für Deutschland war, dass es durch die dramatische Schrumpfung der Union, abgesehen von einer schwarz-roten Großen Koalition, die niemand wollte, erstmals zwingend drei Parteien brauchte, um eine mehrheitsfähige Regierung zu bilden. Denn die zuvor so naheliegende „österreichische“ Kombination aus Union und Grünen ging sich wegen beider Absturz nicht mehr aus. Vielmehr erlebten Deutschlands Wähler, was Österreichs Wähler durch Jahre erlebt haben: Sie hatten auf die künftige Zusammensetzung ihrer Regierung keinen Einfluss mehr. Eine Koalition aus Union, Grünen und FDP mit einem Nachfolger Armin Laschets als Kanzler war ebenso möglich, wie eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP mit Olaf Scholz als Kanzler, obwohl sich diese beiden Varianten politisch beträchtlich unterscheiden. Es war der Chef der FDP, Christian Lindner, der entschied, zu welcher Koalition es kam. Denn wie in Österreich hatten die deutschen Parteien nicht gesagt, welche Koalition sie anstreben.
517
518
Schwäche und Chancen der Sozialdemokratie
Dieses Problem gibt es de facto bei allen Mehrparteienkoalitionen wie sie in fast allen Ländern der EU immer häufiger werden, und ich halte es für gravierend: Nicht mehr der Wähler entscheidet, welche Richtung seine Regierung einschlägt, sondern eine von mehreren kleineren Parteien entscheidet, welche der größeren Parteien mit ihr eine Regierung bildet. Sie hat als „Zünglein an der Waage“ einen extrem überproportionalen Einfluss. Exakt so ist es auch in Deutschland gekommen: Das Programm der deutschen AmpelRegierung aus SPD, Grünen und FDP trägt in weit überproportionalem Ausmaß die Handschrift von FDP-Chef Christian Lindner: Es bekennt sich entschieden zur „Ausgabenbremse“, obwohl etwa der Co-Chef der Grünen, Robert Habeck ganz genau weiß, wie kontraproduktiv sie für die wirtschaftliche Entwicklung ist. Vernünftige Wirtschaftspolitik konnte diese Koalition daher nur auf einem Umweg machen: Obwohl Christian Linder, der in der Regierung die Funktion des Finanzministers für sich durchsetzte, seinen Wählern die Einhaltung der „Ausgabenbremse“ versprochen hatte, hat die Ampelkoalition unter Olaf Scholz 2021 zusätzlich 60 Milliarden Euro in den Klimaschutz investieren und damit ein Wahlversprechen der Grünen erfüllen können. Möglich wurde das, indem Lindner 60 Milliarden, die seinem Vorgänger Olaf Scholz noch als Finanzminister der Regierung Merkel vom Bundestag zur Überwindung der Pandemie bewilligt worden waren, weil die Verfassung das zu diesem Zweck ausnahmsweise gestattet hatte, in Anspruch nahm. Die nunmehr opponierende CSU/CDU sprach von einem „Taschenspielertrick“, weil das Geld einem ganz anderen Zweck – eben dem Klimaschutz – zugeführt wird und dürfte beim Bundesverfassungsgerichtshof gegen diese „zweckwidrige“ Verwendung klagen und dabei recht gute Karten haben. Aber bis der Gerichtshof ein Urteil fällt, wird das Geld zum Vorteil Deutschlands schon geflossen sein – gleich ob damit zusätzlich Windparks geschaffen oder weitere Teile der deutschen Bahn endlich elektrifiziert wurden. Danach bescherte der Überfall Wladimir Putins auf die Ukraine Deutschland und der EU eine „Zeitenwende“: Christian Linder beantragte unter Zustimmung aller anderen Parteien, bis auf die „Linke“, ein „Sondervermögen“ von 100 Milliarden Euro, um die Deutsche Bundeswehr kampftauglich zu machen, nachdem man sie durch ein Jahrzehnt kaputtgespart hatte. Da der Sparpakt nach wie vor ausgesetzt ist, konnten beide Investitionen beschlossen werden, obwohl die „Schuldenbremse“ in Deutschland wahnwitzigerweise im Grundgesetz verankert wurde. Da Deutschlands Bevölkerung schrumpft, werden die zusätzlichen Großaufträge von Unternehmen wahrgenommen, in denen zunehmender Mangel an Facharbeitern herrscht, so dass diese die besten Chancen auf kräftige Gehaltserhöhungen haben sollten. Da die Regierung gleichzeitig den von der SPD geforderten höheren Mindestlohn beschlossen hat, sollte das deutsche Lohnniveau insgesamt stärker als in den Jahren der „Lohnzurückhaltung“ steigen, was einen doppelten Vorteil hätte: Zum einen legte
Schwäche und Chancen der Sozialdemokratie
die deutsche Kaufkraft zu, so dass deutsche Unternehmen, mehr von den Waren, die sie aufgrund gestiegener Produktivität vermehrt erzeugen, im eigenen Land absetzen können – zum anderen schrumpfte der deutsche Lohnstückkosten-Vorteil gegenüber französischen oder italienischen Waren zumindest um ein paar Prozent, statt bei 20 bis 30 Prozent zu verharren. Das machte den Konkurrenzkampf zumindest um eine Nuance fairer. In der Europäischen Union schöpfen Italien und Frankreich zudem leise Hoffnung, dass Deutschland sich in Hinblick auf den „Austerity-Pakt“ bewegen könne. Ich hege diese Hoffnung auch: Meine Zuversicht wächst, dass Deutschland sich nicht mehr mit aller Kraft dagegenstemmen wird, dass die EU die Maastricht-Kriterien von sich aus dahin ändert, dass Staaten sich zu mehr als 60 Prozent ihres BIP verschulden dürfen. Um die Skurrilität der aktuellen Situation zu illustrieren zitiere ich eine Meldung der „Frankfurter Allgemeinen“: „Deutschland hat im abgelaufenen Jahr sechs Milliarden daran verdient, sich höher zu verschulden.“ Weil deutsche Staatsanleihen als so sicher gelten, muss Deutschland nämlich nicht Zinsen zahlen, wenn es sich auf den Finanzmärkten Geld ausborgt, sondern es bekommt dafür Zinsen – eben die beschriebenen sechs Milliarden. Es könnte sogar noch mehr Geld einnehmen, wenn es höhere Schulden machte – doch daran hindert es die 60-Prozent-Schuldengrenze. Österreich, dessen Anleihen als ähnlich sicher galten, war übrigens bis vor Kurzem in der gleichen Situation. Auch wir konnten, wenn wir das wollten, viele Milliarden aufnehmen und dafür Zinsen bekommen, statt Zinsen zu bezahlen. Gleichzeitig hätten wir diese Milliarden dazu verwenden können, unser Glasfasernetz und unsere Ganztagsschulen viel rascher auszubauen oder unsere Züge zu beschleunigen. Inzwischen haben Ratingagenturen unsere Bonität aber etwas herabgestuft, so dass wie für ausgeliehenes Geld keine Zinsen mehr bekämen – denkbar billig bekämen wir es nach wie vor. Vielleicht kommt doch irgendwann der Moment, in dem man begreift, dass vor allem die Geldwirtschaft anders funktioniert, als die traditionelle Nationalökonomie annimmt: Souveräne Staaten oder Staatengemeinschaften können jede beliebige Menge Geldes schaffen und das ist solange nützlich, als damit Nützliches produziert wird: Zum Beispiel ein zusätzlicher Windpark oder eine elektrifizierte Bahnstrecke. Lindner könnte sich seinen Eiertanz und ein allenfalls negatives Urteil des Bundesverfassungsgerichtes um die zusätzlich ausgegebenen 60 Milliarden sparen, wenn er, wie sein grüner Kollege Robert Habeck kapierte, dass es immer legitim ist, wenn ein Staat Geld für Nützliches ausgibt und dass es schwachsinnig ist, ihn durch eine „Ausgabenbremse“ daran zu hindern, solange er dieses Geld nicht Konsumenten oder Unternehmern wegnimmt. So wie es natürlich besser ist, wenn alle Staaten ihre Löhne gleichermaßen im Ausmaß ihres Produktivitätszuwachses und der Inflation erhöhen, weil dann alle mehr produzierten Waren mit Gewissheit von den Entlohnten gekauft werden können. Die Vernunft in Gestalt der Mathematik kann sich durchsetzen – es ist nur leider kein Verlass darauf.
519
80. Das Reptil
Mit der „Wende“ und der Implosion der Sowjetunion im Jahr 1989 schien sich die Vernunft auf allen weltanschaulichen Linien durchgesetzt zu haben: Ich erinnere mich, dass ich Texte schrieb, wonach Russland und die USA in Zukunft gemeinsam fast alle Probleme lösen und den Frieden wie nie zuvor sichern könnten. Francis Fukuyamas „Ende der Geschichte“ schien gekommen. Diese Ansicht war schon alleine deshalb völlig falsch, weil sie den steilen Aufstieg der chinesischen Diktatur zur Weltmacht nicht in Betracht zog. Aber sie sollte sich in Bezug auf Russland als nicht minder falsch herausstellen: Wladimir Putin, der aus den Wirren der Wende als neuer Herr des Kreml hervorging, unterscheidet sich heute nur mehr quantitativ von den letzten „reinrassigen“ sowjetischen Diktatoren, Leonid Breschnew und Juri Andropow, deren totalitäre Herrschaft seine Jugend prägten und der er nachtrauert. Zumindest Putins Charakter habe ich nie falsch eingeschätzt: Ich sah sein Gesicht immer als das eines Reptils und wagte nur nicht, ihn so zu beschreiben, weil es mir unzulässig schien, politisches Verhalten aus Gesichtszügen abzuleiten. Anders die verstorbene US-Außenministerin Madeleine Albright, die ihr erstes Zusammentreffen mit Putin lange vor seinen Kriegen in Syrien und der Ukraine so beschrieb: „Intelligent – aber er machte auf mich den Eindruck eines Reptils.“ Ein Tier, das bewegungslos lauert, ehe es erbarmungslos zubeißt. Zumindest Putins Werdegang hätte jedermann zu denken geben müssen: Er wollte von Jugend auf nur Agent eines Geheimdienstes werden, und er bewarb sich beim brutalsten, den Russland zu bieten hatte: Beim Inlandsgeheimdienst KGB, dessen gefürchteter Chef damals Juri Andropow war, ehe er Leonid Breschnew als düsterer Staatschef nachfolgte. Nachdem man ihm bei einem ersten Kontakt bedeutet hatte, er müsse zumindest ein Studium abgeschlossen haben, studierte er schnell und erfolgreich Jus und wurde tatsächlich 1973 in den Geheimdienst aufgenommen, mit dem Breschnew sein Riesenreich unter Kontrolle hielt. Dass der Auslandsgeheimdienst nicht ganz so perfekt funktionierte, hatte 1968 dazu geführt, dass der Chef der kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, Alexander Dubček, einen ernsthaften Versuch unternehmen konnte, einen „Kommunismus mit menschlichem Antlitz“ zu erproben: Die „Zensur“ wurde aufgehoben, die Menschen konnten ins Ausland reisen, es bestand die Absicht, private Betriebe zuzulassen. Nicht zulassen wollte freilich auch Dubček eine andere als die kommunistische Partei, und auch die Zugehörigkeit zum „Warschauer Pakt“ und damit zum russisch dominierten „Ostblock“ stand außer Frage. Ich habe schon im 21. Kapitel, das von meiner Tätigkeit im Kurier handelt, beschrieben, dass die tschechische Bevöl-
Das Reptil
kerung gar keinen Kommunismus – auch keinen mit „menschlichem Antlitz“ – wollte, aber das behielten die Tschechen für sich, um Dubčeks Experiment nicht zu gefährden. Leonid Breschnew, der sich eigentlich auch für Russland eine Politik mit weniger Angst vor dem Gefängnis und mehr Wohlstand wünschte, ließ Dubček eine Weile gewähren. Bis ihm sein KGB-Chef Juri Andropow klar machte, dass das, was sich in der Tschechoslowakei ereignet, letztlich lebensgefährlich für das sowjetische Imperium sei: Ein „Kommunismus mit menschlichem Antlitz“ der zulasse, dass nicht nur die kommunistische Wirtschaft, sondern sogar die kommunistische Partei kritisiert und hinterfragt würde, sei der Beginn der „Konterrevolution“ und damit der Anfang vom Ende der kommunistischen Vorherrschaft. Unter dem erlogenen Vorwand, dass das tschechoslowakische Zentralkomitee Russland um Hilfe gegen einen konterrevolutionären Umsturz gebeten habe, durchstießen russische Panzer – offiziell war von Panzern des Warschauer Paktes die Rede – am 21. August 1968 die tschechoslowakische Grenze. Die russischen Panzerkommandanten erlebten Ähnliches, wie sie es jetzt in der Ukraine erleben. Statt dass die Bevölkerung sie begeistert begrüßte, trafen sie rundum auf Widerstand. Allerdings nicht auf bewaffneten Widerstand, sondern auf den großartigsten „unbewaffneten Widerstand“ den man sich vorstellen kann: Man steckte ihnen Blumen in die Kanonenrohre und forderte sie auf, doch nach Hause zu fahren. Da die Bevölkerung auch hier durchwegs perfekt Russisch sprach, verwickelte sie die russischen Soldaten in immer längere Diskussionen, so dass die russischen Mannschaften nach einer Woche ausgetauscht werden mussten. Aber letztlich ist unbewaffneter Widerstand, wie die Friedensbewegung ihn preist, eben chancenlos: Nach einer Woche setzten Panzer und Maschinengewehre sich durch: Der Prager Frühling wich wieder jenem eisigen Regime, das der KGB für das einzig richtige hielt. So war der KGB beschaffen, dem Wladimir Putin unbedingt angehören wollte, und so war die russische Politik beschaffen, die mittels des KGB durchgesetzt wurde. Absolut logisch wurde KGB-Chef Juri Andropow nach Breschnews unerwartetem Tod sein düsterer Nachfolger als Staatschef. In Andropows Ära als Staatschef stieg Putin zum Major des KGB auf, ohne dort eine besondere Rolle zu spielen. Die spielte er erst unter Michael Gorbatschow und Boris Jelzin, der ihn völlig überraschend und gegen verblüffte alteingesessene Konkurrenz zum Chef des KGB machte. Das ist er in Wahrheit bis heute, auch wenn der KGB mittlerweile in FSB umgetauft ist: Es ist der FSB, durch den und mit dem Putin Russland regiert. Denn er sieht darin eine Tugend: „Ich handle nach den Maximen, von denen ich in meiner Jugend geprägt wurde – das sind für mich die Maximen es KGB.“ Wenn man Putin wohlwollte, wie mein in Russland lebender mittlerweile verstorbener Cousin Alexander Traxler, dessen Russlandgeschäft ich schon beschrieben habe, so anerkennt man, dass seine Präsidentschaft das Chaos der Ära Boris Jelzins beendet hat.
521
522
Das Reptil
Wenn Putin den Zusammenbruch der Sowjetunion unter Jelzin eine historische Katastrophe nennt, dürfte er das ehrlich meinen, hat es aus seiner Sicht doch einiges für sich: Putins Vater, zuvor hoch dekoriertes Mitglied der kommunistischen Partei war mit dem Ende der Sowjetunion plötzlich nicht mehr als ein immer schlechter verdienender Fabrikarbeiter. Die Familie war nur mehr ganz gewöhnlich arm. Gleichzeitig war die Art und Weise, in der sich die Sowjetunion unter Michail Gorbatschow und vor allem unter Boris Jelzin auflöste, auch objektiv eine Katastrophe. Die „Wende“ war nämlich nicht in erster Linie deshalb zustande gekommen, weil die Bevölkerung die herrschende kommunistische Nomenklatura gestürzt hätte, sondern sie hatte voran wirtschaftliche Ursachen: Da die sowjetische Planwirtschaft vergeblich versuchte, mit der von Ronald Reagan betriebenen Hochrüstung mitzuhalten, zeigte sie sich endgültig außerstande, auch nur die primitivsten Konsumbedürfnisse der Bevölkerung zu erfüllen. Einer Bevölkerung, der es schon immer schlecht gegangen war, ging es auf einmal noch schlechter und diese Verschlechterung machte selbst vor Parteimitgliedern nicht halt. Die Erkenntnis, dass die kommunistische Wirtschaft in keiner Weise funktionierte, verbreitete sich innerhalb der Nomenklatura interessanterweise voran im KGB, denn dessen Mitglieder konnten Fremdsprachen, durften ins Ausland reisen, sahen ausländisches Fernsehen und lasen ausländische Zeitungen. Was Michael Gorbatschow und auch viele von ihnen forderten, war primär noch keineswegs das Ende der Sowjetunion, sondern voran ein wirtschaftlich besser funktionierender Kommunismus und allenfalls, ein wenig ähnlich wie Alexander Dubček, ein Kommunismus mit freundlicherem Antlitz. Gorbatschow forderte zwar „Glasnost“ – Offenheit – und „Perestroika“ – Umgestaltung – aber längst nicht Karl Poppers „offene Gesellschaft“. Weil man das kommunistische Nicht-Funktionieren voran im KGB entdeckt hatte, versuchte man dort erstmals „Eigentum“ zu dulden: Es war dem KGB möglich, im Ausland Firmen zu gründen und dort Devisen anzuhäufen, indem diese Firmen russische Bodenschätze verkaufen durften. An sich war der Erlös dazu gedacht, dem KGB die Mittel zu verschaffen, im Ausland zu agieren – etwa die „Friedensbewegung“ zu finanzieren, die naive junge Menschen allenthalben gegen die NATO auf die Straße gehen ließ. Aber sehr bald entdeckten die KGB-Funktionäre, wie nützlich es war, einige dieser Devisen selbst und im Inland zu besitzen, und auch dafür fand sich ein Umweg, der „sozialistisch“ aussah: KGB-Funktionäre erhielten Lizenzen, um aus dem Ausland dringend benötigte Produkte zu erwerben, indem sie im Tauschweg russische Bodenschätze dafür lieferten. Am dringendsten benötigt wurden damals Nahrungsmittel, und der wichtigste der Bodenschätze war Öl – „Nahrungsmittel für Öl“ – hieß daher eines der damals wichtigsten Programme und es bot gleich mehrere Möglichkeiten, reich zu werden: Reich wurde natürlich, wer eine Lizenz erhielt, und das geschah zwar am ehesten, indem er dem KGB angehörte, aber man konnte auch einfach sehr initiativ sein und einen ausländischen Partner für solche Tauschgeschäfte finden. Reich wurde ferner, wer solche Lizenzen vergab, also nicht nur dem KGB angehörte, sondern auch
Das Reptil
eine wesentliche Funktion in der Verwaltung innehatte. Zu dieser Kategorie zählte nach seiner Heimkehr aus Ostdeutschland, wo er primär eingesetzt gewesen war, Wladimir Putin, indem er innerhalb des KGB zur rechten Hand des Bürgermeisters von Sankt Petersburg aufstieg. Reich wurde man nicht zuletzt, indem man Einfluss auf den Hafen hatte, in dem die ausländischen Waren eintrafen und die russischen Bodenschätze verladen wurden, denn das ermöglichte den Zugriff auf beides. Diese Chance nahmen einerseits politische Funktionäre wahr, die für die Verwaltung des Hafens zuständig waren, andererseits aber auch ganz gewöhnliche Kriminelle, wie sie in allen Häfen der Welt einen gewissen Einfluss auf das Geschehen haben. Putin war also in einer mehrfach privilegierten Situation: Er hatte mit der Nähe zum Bürgermeister Einfluss auf den Hafen, er vergab Lizenzen und er wusste mit den Kriminellen des Hafens umzugehen. Catherine Beltons Bestseller „Putins Netz“ legt nahe, dass er schon in Petersburg gewaltige Reichtümer anhäufte – er selbst bestreitet das. Obwohl es also erste Möglichkeiten gab, Privateigentum und Geld anzuhäufen, war das unter Gorbatschow noch immer die Ausnahme von der Regel, in der unverändert alles dem Staat, das heißt der kommunistischen Partei gehörte. Mit dieser Regel sollte erst Boris Jelzin brechen, der von Demokratie, Privateigentum und freier Marktwirtschaft träumte und sogar über beträchtliches Charisma verfügte – nur dass er leider ein schwerster Alkoholiker war. Der Alkohol ist die traditionelle Geißel Russlands: Der Hauptgrund für die niedrigste Lebenserwartung Europas, die Männer nur 65, Frauen nur 76 Jahre alt werden lässt, wobei die Emanzipation die Frauen, wie überall, auch beim Trinken aufholen lässt. Ich erinnere mich einer Einladung aus dem Umfeld meines Cousins, die eine Frau gab, weil ihr Mann gerade im Krankenhaus lag – das sah sie als ideale Gelegenheit zu gemeinsamen Saufgelagen und orgiastischen Feiern an. In Moskaus Nomenklatura waren derartige Feiern an der Tagesordnung und Jelzin war ihr ständiger Gast. Indem er selbst bei der Begrüßung ausländischer Staatsoberhäupter wankte oder Anordnungen nur lallend geben konnte, beschwor er die wahrscheinlich kritischste Situation bei Gorbatschows „Umgestaltung“ der Sowjetunion mit herauf: Hardliner unter den Militärs der kommunistischen Partei und des KGB, die fürchteten, dass die neue „Offenheit“ dazu führen könnte, dass sie jede Macht verlieren, und taten sich zusammen, um Gorbatschow zu stürzen. Während er in Sotschi urlaubte, fuhren Panzer vor dem Parlament auf. Aber da war es der Trinker Jelzin, der sich ihnen mit gleichsam bloßen Händen entgegenstellte, die Panzer anhielt und die Stimmung durch seine Rede kippen ließ – Gorbatschow blieb im Amt, die Aufrührer des Putschs wurden festgenommen und vor Gericht gestellt. In der Krise hatte der Neurotiker Jelzin die von meiner Mutter behauptete Kaltblütigkeit bewiesen und wurde damit zu Gorbatschows logischem Nachfolger. Nur dass er politisch ganz anders als dieser tickte: Er wollte keinen verbesserten Kommunismus
523
524
Das Reptil
mehr, sondern er wollte Russland ernsthaft und von Grund auf liberalisieren. Er löste die kommunistische Partei auf und er war es, der die sowjetischen Satellitenstaaten, von Polen über Ungarn bis Ostdeutschland, in die Freiheit entließ – erst mit ihm endete die Sowjetunion. Damit verursachte er, was Putin die größte Katastrophe der Weltgeschichte nannte. Es zählt zur Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet Jelzin Putin zum Chef des KGB machte, weil er ihm, so wie dem Bürgermeister St. Petersburgs, dabei geholfen hat, auch in Moskau die notdürftigste Ordnung wiederherzustellen.
Putins Ruhe und Ordnung Denn das Moskau Jelzins befand sich in jenem Zustand, den mein Cousin mir als unerträglich geschildert hatte: Man konnte mitten am Tag im Restaurant eines FünfSterne-Hotels von Gangstern überfallen werden, die einem die Wertsachen abnahmen. Rundum wurden Geschäfte geplündert, indem man die Inhaber überfiel oder einfach die Auslagenscheiben einschlug. Es war ein Risiko, in ein Taxi zu steigen, dessen Lenker man nicht kannte; Banken zahlten Gelder nicht aus; Züge, Autobusse und Flugzeuge hielten ihre Fahrpläne nicht ein. Die Stadt funktionierte so, wie man sich „Funktionieren“ unter der Verwaltung eines schwersten Alkoholikers vorstellt. So kam es, dass mein Cousin es „das größte Glück“ nannte, dass Jelzin Putin zu seiner rechten Hand machte: Der wusste als KGB-Agent, wie man auch Gangster zum Rückzug zwingt. Putin selbst beschreibt sein Engagement durch Jelzin schmunzelnd als puren Zufall – er sei als Arbeitsloser nach Moskau gekommen und habe dort einen neuen Job gefunden. Catherine Belton beschreibt es als konsequenten Schritt einer sorgsam geplanten Karriere innerhalb und mit Hilfe des KGB, der in Putin den Mann sah, der am ehesten in der Lage sein würde, ihm den alten Einfluss zurückzugeben. Da er auch für Jelzin sehr bald der Einzige war, der inmitten des allgemeinen Chaos in der Lage war, die nötigsten Entscheidungen real umzusetzen, machte ihn Jelzin zum Chef des in FSB umbenannten KGB. Es ergab sich eine der absurdesten Situationen der Weltgeschichte: Putin, den er damit zum zweitmächtigsten Mann Russlands machte, verachtete Jelzin und wollte alles, nur nicht dessen liberale Politik verwirklichen. Was er, wie die meisten KGB-Mitglieder, ausschließlich anstrebte, war eine besser funktionierende Wirtschaft und gerade dort waren Jelzins Ambitionen tatsächlich in einer Katastrophe gemündet: Die Art und Weise, in der Jelzin die kommunistische Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft überführen wollte, erwies sich als restlos chaotisch. Denn es gehörte ja noch alles dem Staat und sein Eigentum war nicht nach den Gesetzen geregelt, die wir für Eigentum kennen und die etwa das Staatseigentum an Österreichs verstaatlichter Industrie regelten, sondern alles war völlig ungeklärt. Vorerst besaßen zwangsläufig vor allem alle möglichen Parteifunktionäre Verfügungsgewalt über die verschiedensten Rohstoffe fördernden Unternehmen. Aber auch deren Direk-
Putins Ruhe und Ordnung
toren verfügten in mehr oder minder großem Ausmaß darüber und natürlich gab es immer die Verfügungsgewalt des KGB. Gleichzeitig gab es weder für Unternehmen noch für Bodenschätze einen Verkehrswert: Man konnte den Wert eines Unternehmens, das Öl förderte, ebenso gut bei 25 Millionen, bei 250 Millionen oder bei 25 Milliarden Rubel vermuten und bei seiner Privatisierung bei einer dieser Ziffern ansetzen – ob der angesetzte Wert zutraf, stand in den Sternen. Gleichzeitig verlieh es den Personen gewaltigen Einfluss, die diese Werte festlegten, also einmal mehr Parteifunktionären, KGB-Funktionären, aber auch Unternehmensdirektoren. Jeder von ihnen hatte die denkbar größte Möglichkeit, sich phantastisch zu bereichern. Das „Volk“, dem theoretisch alles gehörte, schnitt selbst dann am schlechtesten ab, wenn Jelzin ihm Gutes tun wollte. Am vielleicht typischsten Beispiel: Sowjetische Betriebe sollten dem Volk nach Jelzins Willen nunmehr wirklich gehören, indem neben dem Staat Angestellte und Arbeiter Aktien dieser Unternehmen erhielten; aber sie hatte keine Ahnung, was Aktien sind und was sie damit anfangen sollen. Die hatten nur die paar initiativen jungen Männer oder Funktionäre, die schon zuvor dank „Lizenzen“ reich geworden waren. Mit dem dort verdienten Geld kauften sie der ahnungslosen Bevölkerung um ein paar Rubel die „Papierzettel“ ab, die sie als Aktien erhalten hatten, denn um die erhaltenen Rubel konnte der Mann auf der Straße sich Brot und Butter kaufen. Diese wenigen geschickten jungen Männer – der spätere Oligarch Michail Chodorkowski gehörte zu ihnen – erwarben auf diese Weise um einen Pappenstiel Unternehmen, die über die größten Bodenschätze des Landes verfügten. Männer seines Schlages waren auch die ersten und einzigen, die Banken gründeten, und daraus ergab sich ein noch größeres Geschäft: Der Staat, der kein Geld hatte, um auch nur seine wichtigsten Angestellten zu bezahlen, kam auf die Idee, es sich von diesen Banken zu borgen, indem er ihnen große Staatsbetriebe, etwa ein großes Ölförderunternehmen, verpfändete. Nicht ahnend, was ein Unternehmen wert war und nicht ahnend, wie sie die Rückzahlung aufgenommener Kredite bewerkstelligen sollten, kamen die Funktionäre der staatlichen Stellen damit jeweils in Verzug und die verpfändeten Unternehmen fielen an die Bank beziehungsweise deren Eigentümer. Abermals erwarben ein paar geschickte junge Männer auf diese Weise Unternehmen, die viele Milliarden wert waren, um wenige Millionen. So kam der abenteuerliche Reichtum jener „Oligarchen“ zu Stande, deren Jachten und Immobilien im Ukrainekrieg beschlagnahmt wurden, sofern sie sie nicht rechtzeitig ihren Töchtern übertragen hatten. Putin erlebte ihre Bereicherung als rechte Hand Boris Jelzins und besaß aus seiner Zeit im Petersburger Hafen eine gewisse Erfahrung im Umgang mit plötzlich steinreich gewordenen jungen Männern. So begann er, unter den Oligarchen eine für ihn nützliche Auslese zu treffen: Er beließ diejenigen in Freiheit, die ihren Reichtum mit Personen
525
526
Das Reptil
seines Vertrauens teilten und ließ diejenigen einsperren, die wie Chodorkowski meinten, ihn nicht mehr zu brauchen. Damit blieb Russlands Wirtschaft auf die Existenz einer Reihe riesiger, Rohstoffe ausbeutender Monsterunternehmen beschränkt. Zwar entstand mit der von Jelzin so dringend geforderten Einführung von Privateigentum zwangsläufig auch eine Reihe erfolgreicher Kleinbetriebe, aber die Zahl erfolgreicher Mittelbetriebe ist für ganz Russland geringer als für Österreich. Wenn man Putin wohlwill, kann man ihm zubilligen, dass es zweifellos sein Wunsch blieb, die Wirtschaft Russlands zu stärken und zu modernisieren – aber es war und ist zu diesem Zweck unverändert am leichtesten, die Oligarchen zu etwas mehr „Teilen“ zu zwingen, als eine rundum funktionierende, differenziert industrielle Struktur zu schaffen. Zumindest solange Öl, Erdgas und Kohle in ausreichendem Ausmaß vorhanden sind und einen ausreichend hohen Preis erzielen, lässt sich der russische Staat auch auf der Basis dieser oligarchischen Struktur finanzieren. Aber nicht nur für die Oligarchen wurde Putin der Mann, mit dessen Macht sie rechnen mussten, – er wurde es auch für Jelzin selbst. Denn dessen Schwiegersohn und Tochter gehörten mit zu den Leuten, die im Zuge der „Privatisierung“ unendlich reich geworden waren. So hatten private Firmen im Auftrag der Moskauer Liegenschaftsverwaltung die Paläste des Kreml zu horrenden Kosten renoviert und die Spur einer ausländischen Firma, die sich dabei eine goldene Nase verdiente, führte direkt zu Jelzins Tochter und wurde nicht nur von russischen, sondern auch von Schweizer Staatsanwälten verfolgt. Es kam der Augenblick, in dem im dank Jelzin damals noch freien Parlament erwartet wurde, dass Russlands Generalstaatsanwalt zuschlagen und Anklage gegen sie erheben würde. Doch er schlug nicht zu, denn wenige Tag vor dem erwarteten Termin wurde im Fernsehen eine zweifellos vom FSB hergestellte Videoaufzeichnung ausgestrahlt, die den verheirateten Staatsanwalt im Bett mit zwei Prostituierten zeigte. Er musste nach langen parlamentarischen Auseinandersetzungen letztlich zurücktreten, und der Angriff der Justiz auf die Familie Jelzins unterblieb. Das war der Moment, in dem Jelzin Putin als seinen am besten geeigneten Nachfolger nominierte. Im folgenden Wahlkampf hatte er dennoch den großen Nachteil, ein bis dahin öffentlich kaum bekannter, nicht sonderlich charismatischer Beamter der Verwaltung zu sein. Doch dieses Image wandelte sich mit dem Tschetschenienkrieg: Nachdem es in Moskau Terroranschläge gegeben hatte, von denen der mit Polonium vergiftete Ex-FSB-Agent Alexander Litwinenko behauptete, sie seien vom FSB selbst verübt worden, flog Putin persönlich im Jagdflugzeug zu den russischen Truppen, die in Tschetschenien kämpften und erwarb in der Folge den Ruf des Mannes, der als einziger im Stand sei, dort den Sieg zu erringen. So aufgewertet siegte er überraschend bei den damals noch durchaus demokratischen Präsidentschaftswahlen um Jelzins Nachfolge. Es sollten die letzten Wahlen in Russland sein, die man als frei und demokratisch bezeichnen kann.
Der gute Zar
Der gute Zar Putins Ära erwies sich für die Bevölkerung als jedenfalls erfolgreicher, als alles, was sie bis dahin erlebt hatte. Oligarchen plünderten die Rohstoffe des Landes zwar weiterhin, aber sie taten es nicht mehr ausschließlich zum eigenen Vorteil, sondern mussten es im Einvernehmen mit Putin tun, mit seinen Vertrauten teilen und so viel davon an die Bevölkerung abgeben, dass diese langsamen wirtschaftlichen Aufstieg, statt wie unter Jelzin Abstieg und eine Rubel-Krise nach der anderen erlebte. Entscheidend für diesen steigenden Wohlstand war freilich nicht Putins ökonomisches Können, sondern die internationale Entwicklung des Ölpreises, der sich seit seinem Amtsantritt versiebzehnfachte, weil insbesondere auch Chinas Wirtschaft immer mehr Öl brauchte. Gleichzeitung vermochte Putin „Ruhe und Ordnung“ wiederherzustellen, weil er im KGB gelernt hatte, wie man Menschen unter Kontrolle bringt, und wer nichts an ihm zu kritisieren hatte, empfand Ruhe und Ordnung ausschließlich als Fortschritt. Putins ideologische und emotionale Heimat blieb freilich unverändert der KGB. (Leser, die das Thema genauer interessiert empfehle ich Catherine Beltons preisgekrönten Bestseller „Putins Netz“.) Dass die „Wende“ der Demokratie eine Chance bot, war für ihn ein historischer Zufall und ein Risiko, das er beendete, indem er seine Methoden der neuen Zeit anpasste: Weil es nun Wahlen gab, ließ er nur Kandidaten zu, die der FSB auf ihre absolute Loyalität zu ihm überprüft hatte. Wenn potentielle Gegner wie Alexei Nawalny dennoch eine gewisse Popularität erreichen, erleiden sie Giftanschläge und enden im Gefängnis. Weil es Gerichte gibt, kontrolliert er dank der Allmacht des FSB wie ehedem die Justiz: Potente Gegenspieler wie Michail Chodorkowski, ursprünglich ein Förderer Putins, landen zehn Jahre im Gefängnis, um sich dann nach London abzusetzen. Sicher sind sie auch dort nicht: der Ex-Agent Alexander Litwinenko wurde mit Polonium vergiftet, nachdem er kriminelle Machenschaften innerhalb des KGB angeprangert hatte. Und natürlich kontrolliert Putin die Medien in einem Ausmaß, das Breschnew zufriedengestellt hätte: Kritische Medien wurden sukzessive geschlossen, kritische Journalistinnen wie Anna Politkowskaja werden zufällig auf der Straße erschossen. Jeder weiß, dass der FSB hinter diesen Morden steckt, aber Putin spricht von „lächerlichen Unterstellungen“ und lächelt dabei tatsächlich. Seine Fähigkeit zu lügen ist atemberaubend: Russische Soldaten, die in die Krim oder in den Donbass einmarschierten, wollte er erst nie gesehen haben, um dann lächelnd zu sagen, sie hätten dort geurlaubt und daran hätte man sie schließlich nicht hindern können; Tage vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine erklärte er im Fernsehen täglich, dass er nicht an einen Einmarsch dächte; und die Leichen hunderter, zum Teil aus nächster Nähe in den Kopf geschossener Zivilisten in der von den russischen Truppen verlassenen Vorstadt Butscha erklärte er zu einer „Inszenierung westlicher Geheimdienste“, die Leichen genutzt hätten, die wahrscheinlich nachrückenden Truppen Wolodymyr Selenskyjs zu
527
528
Das Reptil
verantworten hätten, auch wenn ein drei Wochen altes Luftbild bewies, dass sie schon damals genauso auf der Straße lagen, wie Selenskyjs Truppen sie vorgefunden hatten. Putin vermag zu lügen, wie einst Adolf Hitler: Er ist so stolz auf die Perfektion, mit der er es tut, dass er sich nicht verkneifen kann, durch ein spöttisches Lächeln zu demonstrieren, für wie unwichtig oder dumm er die Reaktion westlicher Beobachter hält. Und sie war lange genug erstaunlich dumm: Gerhard Schröder wurde noch vor wenigen Jahren in Deutschland nicht ausgelacht, wenn er Putin einen „lupenreinen Demokraten“ nannte, und die vom späteren Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier konzipierte und von Angela Merkel abgesegnete Außenpolitik setzte auch noch auf Russlands „Wandel durch Handel“, als es bereits die Krim annektiert hatte. Die katastrophalste Folge zeitigte die ständige Rücksichtnahme auf Putins politische Empfindsamkeit: Es war voran Merkel, die verhinderte, dass die Ukraine nicht wie das Baltikum in die NATO aufgenommen wurde, obwohl immer klarer wurde, wie sehr sie sich vor Putin zu fürchten hatte. Er habe sich bezüglich Putins geirrt und die politische Entwicklung Russlands falsch eingeschätzt, gestand Steinmeier 2022 immerhin ein. In Österreich fand sich niemand auch nur zu einer Spur dieses Eingeständnisses bereit, obwohl man Putin zu allen Zeiten – selbst unmittelbar nach der Annexion der Krim – den roten Teppich ausgerollt hatte: Bundespräsident Heinz Fischer begrüßte ihn mit einer halben Umarmung, die von der FPÖ nominierte Außenministerin Karin Kneissl bedankte sich mit einem Knicks dafür, dass er auch einer Einladung zu ihrer Hochzeit gefolgt war und sie zum Tanz aufgefordert hatte. Die FPÖ hatte mit Putins Staatspartei „Einiges Russland“ überhaupt gleich einen Freundschaftsvertrag geschlossen. Und natürlich waren die Funktionäre der Bundeswirtschaftskammer glücklich über die „traditionell freundschaftlichen Beziehungen“ zu seinem Imperium, auch wenn sie bekanntlich in die totale Abhängigkeit von seinen Gaslieferungen gemündet sind.
Krieg ist Männersache Dass Putin sich nicht mit seiner Allmacht innerhalb Russlands begnügte, sondern immer wieder auch Vorstöße ins Ausland unternimmt, liegt daran, dass er wie die meisten Diktatoren auch eitel und ein Mann ist – er will sich auf die Brust schlagen und „ich bin der Größte“ schreien können. Auch wenn manche Feministinnen gravierende Unterschiede im Verhalten der Geschlechter leugnen, gibt es doch auch abseits sozialer Rollenbilder die höhere männliche Aggression: Buben raufen von Geburt an mehr als Mädchen. Krieg, aus welchem Grunde immer, ist Männersache: Alle Kriege wurden von Männern losgetreten; nur Männer waren so blöd, jubelnd in den Ersten Weltkrieg zu ziehen – wenn auch nicht zuletzt
Krieg ist Männersache
Frauen sie dafür bewunderten; Hitlerjungen waren stolz, schon „Männer“ zu sein, als Adolf Hitler sie in den „Volkssturm“ berief. Eroberer profitieren von der überschießenden männlichen Aggression, weil siegreicher Kampf Männern „Ehre“ einbringt; weil er ihnen ermöglicht, „historische Missionen“ zu erfüllen; weil Herrschaft sie wie nichts anderes aus der Masse ragen lässt. Mit 1,70 Meter ist Putin ein für heutige Verhältnisse ausnehmend kleiner Mann, den diesbezüglich Minderwertigkeitskomplexe plagen könnten. Es ist kein Zufall, dass er sich bis heute so gerne mit nacktem Oberkörper oder beim Eishockeyspielen zeigt: Er genießt es, im Kampf von Mann zu Mann zu siegen. Ich halte Freuds Ansicht, dass Revolver, Gewehre und Kanonenrohre phallische Symbole sind, für eine seiner eher richtigen Thesen und hege das antifeministische Vorurteil, dass es Frauen, weil sie neun Monate schwanger sind und Kinder unter Schmerzen gebären, schwerer als Männern fällt, Leben in Kriegen zu vernichten. Daneben hat Putin (und haben andere Staatsführer) natürlich auch rationale Gründe, siegreiche Kämpfe im Ausland zu suchen: So weiß Putin natürlich, dass russische Siege im Ausland die Bevölkerung von ihrem nicht so gloriosen Dasein im Inland ablenken. In Putins militärischer Hilfe für Syriens Diktator Bashar al-Assad mischten sich mehrere Motive: Sie lenkte die Aufmerksamkeit der Russen perfekt in die Ferne, aber sie befriedigte vor allem Putins Eitelkeit: Er konnte einen Prestigeerfolg gegen den Präsidenten der USA Barack Obama feiern, indem er ihn in Syrien an die Wand spielte: Obwohl Obama erklärt hatte, er würde eingreifen, wenn Assad die „rote Linie“ des Einsatzes von Giftgas überschreite, schritt er bekanntlich nicht ein, sondern nahm Putins Vorschlag an, die Vernichtung allfälliger Giftgasvorräte zu überwachen. Damit überließ er es Putin, über das Schicksal Syriens zu entscheiden. Assad ist heute eine reine Marionette Putins. Russland ist damit weiter ein wichtiger Player im Nahen Osten und hat in Syrien nebenher einen wichtigen Militärstützpunkt im Mittelmeer. In Libyen profitierte Putin ähnlich clever vom Chaos, das die USA dort hinterließen, indem er einen der verbliebenen Warlords unterstützt und damit auf seiner Seite hat. In diversen anderen afrikanischen Staaten verfolgt er höchst erfolgreich eine noch simplere Politik: Die von seinem „Koch“, einem von vielen Oligarchen, der unter anderem vom Staat benötigte Kantinen betreibt, finanzierte Privatarmee namens „Wagner“, die unter anderem Kriminelle in Strafanstalten als Söldner rekrutieren darf, und auch in der Ukraine am brutalsten kämpft, hilft dem jeweiligen afrikanischen Diktator beim Erhalt oder Erreichen der Macht und der dankt es, indem er Putin verpflichtet bleibt. Im Stillen erfolgreich war Putin auch in Großbritannien, wo ein Geschäftsmann, der seine Millionen in Russland verdient, die Wähler bei der Abstimmung über den Brexit im Wege von „Cambridge Analytics“ in den sozialen Netzen mit Falschnachrichten über die Absichten der EU fütterte. Und noch erfolgreicher entschied er, unter den Augen des FBI, die amerikanischen Präsidentschaftswahlen gegen Hillary Clinton zu Gunsten Donald Trumps, indem er in den sozialen Netzen Material gegen sie verbreitete und indem seine „Bots“ dort Stimmung für Trump und gegen Clinton machten.
529
530
Das Reptil
Auch das war gleichzeitig höchst rational: Unter Trump war die NATO nicht mehr das einige transatlantische Bündnis, das russischen Vorstößen entschlossen entgegentrat. In Summe haben alle diese Erfolge Putin darin bestärkt, die Krim anzugreifen und zu annektieren. Zusammen mit dem Wissen, dass Barack Obama auch das Überschreiten einer „roten Linie“ durch den Einsatz von Giftgas nicht geahndet hatte, sah er im Frühjahr 2021 kein untragbares Risiko darin, seine Armee auch an der Grenze zur sonstigen Ukraine aufmarschieren zu lassen, um klarzumachen, dass sein Einfluss nicht dort endet. Seine gleichzeitige Behauptung, dass die immer größere Ausbreitung der NATO nach Osten Russlands Sicherheit bedrohe, glaubt niemand so wenig wie Putin selbst. Ich habe, als ich als Herausgeber des profil noch eine gewisse Bedeutung für den KGB hatte, über meinen schon erwähnten Cousin einen KGB-Spitzenagenten näher, und einen anderen flüchtig kennengelernt und bin selten auf Männer gestoßen, die damals – zur Zeit des sowjetischen Afghanistan-Krieges und lang vor der „Wende“ – so genau wussten was im „Westen“ vorgeht: Wie viel besser dessen Wirtschaft funktioniert oder warum man in den USA mit einem Sieg der afghanischen Mudschahedin über die russische Armee rechnete. Höhere Angehörige des KGB waren, weit vor höheren Militärs, immer eine intellektuelle Elite: Sie bildeten sich keine Gefahren ein, die es nicht gab. Der KGB-Mann Putin wusste und weiß genauer als jeder andere, dass die NATO nicht daran denkt, militärisch gegen Russland vorzugehen. Aber es zu behaupten war innenpolitisch für ihn nützlich, lenkt es die russische Bevölkerung doch optimal von der laufenden Verminderung ihrer persönlichen Freiheit ab, kann er doch behaupten dass die Bedrohung durch die NATO ihn zu mehr Überwachung möglicher westlicher Aktivitäten innerhalb Russlands zwingt, und dass er zu hohen Investitionen in die Rüstungsindustrie zu Lasten von Investitionen in die Konsumgüterindustrie gezwungen ist. Die von ihm kontrollierten Medien stellen die behauptete Bedrohung daher einmütig als real dar und freie Massenmedien, die ihnen widersprächen, gibt es in Russland längst nicht mehr. Natürlich glaubt Putin auch nicht, dass die Ukrainer im Donbass einen Völkermord an den Russen begehen. Wohl aber glaubt er vermutlich ehrlich, dass Russen dort schlechter als Ukrainer behandelt werden und hat damit in Grenzen Recht – es gibt übertriebenen ukrainischen Nationalismus und es gibt eine kleine Partei, die tatsächlich Neonaziideen nachhängt und eine Zeitlang sogar einige Sitze im Parlament hielt, ehe sie sie unter Wolodymyr Selenskyj verlor. Nicht zuletzt scheint Putin auch ehrlich zu glauben, dass die Ukraine keine eigene Nation, sondern ausschließlich ein Teil Russlands ist: Schließlich war sie das unter seinen KGB-Lehrmeistern Breschnew und Andropow, und mangelnde Geschichtskenntnisse haben Diktatoren noch nie in ihren Aktivitäten beeinflusst. (Auch Österreich könnte mit diesem Geschichtsverständnis in der Ukraine einmarschieren, um sich Galizien zurückzuholen, hat es doch lange zur Monarchie gehört).
Das nicht für möglich Gehaltene
Das nicht für möglich Gehaltene Wenn ich in den vergangenen Kapiteln immer wieder kritisiert habe, wie sehr man in der EU, voran in Deutschland und Österreich, Putins immer autoritärere Politik innerhalb Russlands übersehen hat, dann verdränge ich, wie sehr ich selbst seine immer aggressivere Außenpolitik übersehen habe: Obwohl ich sein Verhalten im Tschetschenienkrieg kannte, obwohl mich sein Verhalten in Syrien empört hatte, obwohl ich wusste, dass er in Georgien und Moldawien militärische Vorstöße unternommen hatte und in die Krim einmarschiert war, hielt ich bis zuletzt für ausgeschlossen, dass er auch in den Rest der Ukraine einmarschieren würde. Das hatte mehrere Ursachen: Zu einem Teil lag es daran, dass ich mir sein Vorgehen in Georgien, Moldawien und selbst in der Krim damit zu erklären versuchte, dass es in Georgien oder Moldawien ja tatsächlich an der Grenze zu Russland eine russische Minderheit gab, von der ich für möglich hielt, dass sie von der Mehrheit nicht allzu gut behandelt wurde. Bei der Krim wiederum wusste ich, dass sie ja tatsächlich durch Jahrhunderte ein besonders schöner Teil Russland gewesen ist, ehe der Ukrainer Nikita Chruschtschow sie seiner ukrainischen Heimat angegliedert hat – ein wenig so, wie Adolf Hitler das herrliche Salzkammergut seiner Heimat Oberösterreich angliederte. Den Anspruch der Krimtartaren auf die Krim ließ ich unter den Tisch fallen. Jedenfalls halte ich für durchaus möglich, dass die Bevölkerung der Krim auch in einer freien Abstimmung für den Anschluss an Russland gestimmt hätte und Putin „nur“ auf Nummer sicher gehen wollte. Natürlich war mir klar, dass der russische Einmarsch in der Krim das Völkerrecht verletzte und ich hätte Putin schwerlich wie Österreichs Politiker, weiterhin den roten Teppich aufgerollt und ihn mit Umarmungen empfangen. Aber ich konnte mir nicht vorstellen – wollte mir nicht vorstellen – dass er die Ukraine in ihrer Gesamtheit erobern will. Anders als meine Frau, die von der ersten Sekunde des Aufmarsches russischer Truppen an der ukrainischen Grenze an, von seinem Einmarsch überzeugt war, wollte ich bis zuletzt an eine russische Drohgebärde glauben, die nur dazu dient, Nord Stream 2 endlich in Betrieb zu nehmen. Mein außenpolitischer Verstand hat nie zuvor in so hohem Ausmaß ausgesetzt: Alleine aus dem Umstand, dass Putin die ganze Welt und insbesondere auch die russische Bevölkerung über den Inhalt seiner Forderungen – kein Beitritt der Ukraine zur NATO, Ende jeglicher Erweiterung der NATO in Osteuropa – informiert hatte, hätte ich sofort ablesen müssen, dass er gezwungen ist, eine massive Reaktion zu setzen – weil ihn die zwingende Ablehnung dieser Forderungen nicht nur vor der ganzen Welt, sondern vor allem auch vor der eigenen Bevölkerung blamiert hätte. Ich vergaß, dass Putin seit Obamas Einlenken in Syrien keine „roten Linien“ mehr anerkannte. Dass ihn die laue Reaktion des Westens auf seine Vorstöße in Moldawien und Georgien darin bestärkt haben musste, dass seine Vorstöße in ehemals sowjetische Territorien ungeahndet bleiben. Ich vergaß vor allem, dass die dürftige Reaktion des
531
532
Das Reptil
„Westens“ auf den Einmarsch und die Annexion der Krim ihn geradezu zum Einmarsch in die gesamte Ukraine einlud. Ich kann es nicht anders als so erklären: Ich wollte, wie wir alle, Krieg mitten in Europa einfach nicht für möglich halten. Leider habe ich in diesem Zusammenhang auch Putins Rationalität völlig falsch eingeschätzt. Zwar besitzt die Ukraine Gas und Öl, aber davon hat Russland selbst reichlich und wird in Zeiten, in denen die EU auf alternative Energien umstellt, nicht viel mehr davon verkaufen können. Außerdem befinden sich die größten Gas- und Ölreserven der Ukraine auf der Krim und die hatte Putin schon annektiert. Bleibt, dass die Ukraine dank ihres fruchtbaren Bodens einst „Kornkammer“ der Sowjetunion gewesen ist, bis die Kollektivierung der Landwirtschaft selbst dort Hungernöte auslöste. Aber es ist wenig wahrscheinlich, dass ukrainische Bauern einer russischen Besatzungsmacht viel mehr Korn als damals ablieferten. Ein so riesiges Land wie die Ukraine militärisch dauerhaft zu beherrschen, ist so gut wie ausgeschlossen: Es kostet nur viel Geld, während nicht einzumarschieren Putin über Nacht Geld eingebracht hätte, weil Nord Stream 2 in Betrieb genommen worden wäre und ihm erlaubt hätte, die Leitungen durch die Ukraine nicht mehr zu benützen. Alle Welt rätselt, was Wladimir Putin dennoch zum Einmarsch bewegt hat. Sicher das falsche Geschichtsbild. Sicher die Sehnsucht nach alter Bedeutung: „Make Russia great again.“ Dennoch gilt wohl auch die Antwort der ukrainischen Bachmann-Preisträgerin Tanja Maljartschuk: „Er ist einfach ein gewalttätiger Mann. Einer, der mit seiner Aggression nicht zu Rande kommt.“ Mit meiner Frau führe ich seit Beginn des Krieges eine Diskussion darüber, ob man Putin aufgrund des Ukrainekrieges „geisteskrank“ nennen kann. Abertausende Ukrainer, aber auch Abertausende Russen in den Tod zu führen, um im besten Fall ein verwüstetes Land mit verwüsteten Städten zu erhalten – so ihre Argumentation – kann für einen geistig gesunden Menschen doch keine Alternative dazu sein, steinreich in einem Palast in Moskau zu sitzen und Russland zu beherrschen. Ich gebe ihr zu, dass man das so sehen kann – aber ich glaube, dass es eben doch einen gravierenden Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt: Für Männer, voran für kleine Männer, ist „Beherrschen“ offenkundig essentiell. Was sonst über Putins Motive behauptet wird, widerlegt sich bei jeder Konfrontation mit den Fakten. Voran die Version der „Putin-Versteher“, die nirgends so zahlreich wie in Österreich und Deutschland sind: Es sei doch verständlich, dass sich Russland durch die NATO-Osterweiterung bedroht fühle – ein kluger, Frieden suchender Westen hätte sie unterlassen. Weil, so setze ich boshaft fort, Russland allen Grund hat, sich vor Polen, Estland oder Lettland zu fürchten, während diese Länder nicht den geringsten Grund zur Furcht vor Russland haben, obwohl sie im Zuge des Hitler-Stalin-Paktes (über den zu sprechen Putin verbot) auf Befehl des Kremls überfallen wurden. Für Putin-Versteher verkörpert die NATO, die sie während des Kalten Krieges davor geschützt hat, dass der Kreml seine Macht über Ungarn, die Tschechoslowakei oder
Das nicht für möglich Gehaltene
Ostdeutschland auch auf die BRD und Österreich hinaus ausdehnte, das wahre Böse, obwohl sie laut einsehbarer Verträge ein Verteidigungsbündnis ist. Obwohl sie nie, wie der Warschauer Pakt in Ungarn, einen Volksaufstand mit Panzern in Blut oder den Prager Frühling im Keim erstickt hat. In den wenigen Fällen, in denen die NATO, nicht die USA, militärisch agierte (im Irak agierten die USA nicht als NATO, sondern in einer „Koalition der Willigen“) besaß sie für ihr Eingreifen die Bewilligung des UNSicherheitsrates, in dem Russland ein Vetorecht besitzt. Es gab einen einzigen „Out of Area“-Einsatz der NATO ohne solche Bewilligung: Er fand statt, nachdem die Serben in Srebrenica 8000 Bosnier massakriert hatten und sollte verhindern, dass auch tausende Albaner serbischen Massakern zum Opfer fallen. Aus dieser Aktivität auf besondere Aggressivität der NATO zu schließen, überlasse ich dem Leser. Damit will ich nicht behaupten, dass jeder bewilligte NATO-Einsatz richtig und erfolgreich gewesen wäre – ich weiß um das Chaos, das er in Libyen hinterlassen hat und um die Niederlage in Afghanistan. Aber beides bietet Putin nicht den geringsten Anlass, sich vor einem NATO-Einmarsch in Russland zu fürchten. Die behauptete Furcht war immer purer Vorwand. Es ist zwar richtig, dass Russland im Zuge der deutschen Wiedervereinigung mündlich zugestanden wurde, die NATO nicht nach Osten zu erweitern – aber es hatte einen guten Grund, dass das nicht im Rahmen eines Vertragswerks geschah: Es war völlig undenkbar, Polen, Balten oder Letten, die Jahrzehnte unter der Bedrohung russischer Panzer gelitten hatten, die Aufnahme in die NATO zu verweigern. Im Übrigen war sie der Form nach mit Russland denkbar vernünftig abgesprochen: Das Abkommen enthielt die NATO-Zusage, nur die Selbstverteidigungsfähigkeit dieser neuen NATO-Staaten zu stärken – deshalb wurden dort ursprünglich keine US-Kontingente stationiert und keine Atomsprengköpfe disloziert. Es stimmt auch, dass Putin die Osterweiterung immer abgelehnt und aus dieser Ablehnung kein Hehl gemacht hat. Aber diese Ablehnung hatte nur ein ernstzunehmendes Motiv: männliche Eitelkeit und Ablenkung der eigenen Bevölkerung. Das zitierte Abkommen mit der NATO hat Putin mit seinem Einmarsch hinfällig gemacht: Die NATO kann von nun an in Polen, im Baltikum oder in Rumänien zu ihren Raketen ebenso Atomsprengköpfe dislozieren, wie Putin sie auf der anderen Seite der Grenze bei seinen jüngsten Manövern vorgeführt hat und sie hat bereits überall amerikanische Kontingente stationiert. Putin zwingt die NATO durch sein Verhalten, nicht die NATO zwingt Putin durch ihr Verhalten, zu einer vehementen Gegenreaktion. Das widerlegt ein Märchen: Dass er nämlich ein brillanter Taktiker sei. In Wahrheit hat schon sein Säbelrasseln das Gegenteil all dessen bewirkt, was er fordert: Die NATO wird sich zwar nicht in die Ukraine ausdehnen, in die sie sich aufgrund der deutschen Zurückhaltung gar nicht ausdehnen konnte, aber Schweden und Finnland treten der NATO bei; alle NATOStaaten erhöhen ihre Verteidigungsbudgets drastisch, Polen oder Balten werden am
533
534
Das Reptil
massivsten aufrüsten; in allen an Russland angrenzenden Staaten verstärkten die USA ihre mannschaftliche Präsenz. Bekanntlich hat Putins Vorgehen in der Ukraine auch die EU, die er davor nach Kräften zu schwächen suchte, in erstaunlichem Ausmaß geeint. Es fand tatsächlich die vom deutschen Kanzler Olaf Scholz formulierte „Zeitenwende“ statt. Nur mehr eine winzige Minderheit zweifelt, dass man in Putin einem gefährlichen Aggressor gegenübersteht und dass Wolodymyr Selenskyj in der Ukraine „westliche Werte“ verteidigt. Hätte die NATO vor zwei Jahrzehnen in dieser Situation vermutlich direkt eingegriffen, so herrscht zwischen den USA und der EU jetzt immerhin Einigkeit darüber, dass man die Ukraine massiv unterstützen muss, auch wenn es einige Zeit gedauert hat, bis auch Olaf Scholz klar war, dass man ihr zu diesem Zweck auch schwere Waffen liefern muss. Weniger klar ist erstaunlicherweise der Bevölkerung voran Deutschlands und Österreichs, dass natürlich auch Sanktionen gegen Russland jede Berechtigung haben, denn sie bringen auch Einbußen mit sich, weil Russland als größter Rohstoff- und Energielieferant natürlich Gegenmaßnahmen ergreift. Diese Einbußen an Wohlstand bieten Europas Parteien der extremen Rechten optimale Möglichkeiten Proteststimmen zu sammeln, indem sie, wie die FPÖ Sanktionen grundsätzlich in Frage stellen. Ihre bis zum Ukrainekrieg grundsätzlich große Sympathie für Putin, – die FPÖ hatte mit seiner Partei „Einiges Russland“ bekanntlich einen Freundschaftsvertrag geschlossen, Frankreichs „Rassemblement national“ hatte von ihm Finanzhilfe erhalten – erleichterte ihnen diese Haltung auch psychologisch: Sie wurden de facto zu Putins fünfter Kolonne. In Österreich nahm das skurrile Formen an: Die FPÖ, die in der Koalition mit der ÖVP Wolfgang Schüssels die Neutralität noch gegen den Beitritt zu NATO tauschen wollte, erklärt jetzt mit Herbert Kickl, dass Österreichs Teilnahme an den Sanktionen und seine vehemente Kritik an Putin die Neutralität gefährde. Und wenn man die Neutralität so streng auslegt, wie der Professor für Völkerrecht Alfred Verosta, der den Staatsvertrag als Experte begleitete, stimmt das sogar: „Der neutrale Staat vermeidet normalerweise jegliche Parteinahme.“ Das Problem ist, dass die Österreicher der Neutralität mit der denkbar größten Hingabe anhängen, ohne zu wissen, was sie wirklich leistet, und welche Pflichten sie dem Staat auferlegt. Dass Beate Meinl-Reisinger Kanzler Karl Nehammer im Frühjahr 2023 vorwarf, den Kopf in den Sand zu stecken, indem er jede Debatte über Österreichs Sicherheit mit dem Hinweis auf die Neutralität abwürgt, kann die NEOS nur Stimmen kosten. Denn die Neutralität ist eine heilige Kuh, die Nehammer auch sogleich fütterte: „Die Neutralität war und ist hilfreich für die Republik Österreich und sie bleibt hilfreich!“ 1997 sah das selbst die ÖVP wie beschrieben anders, obwohl Russland damals niemanden überfallen hatte: „Es habe sich gezeigt“, beschloss ihr Bundeparteivorstand, „dass die europäische Sicherheit … vor allem in der neuen NATO entwickelt wird.“ Deshalb solle Österreich „der neuen NATO beitreten“. Diese klare Formulierung schwächte
Das nicht für möglich Gehaltene
Wolfgang Schüssel als Chef einer schwarz-blauen Koalition erst in der Regierungserklärung zum Konjunktiv ab, nachdem er Meinungsumfragen gelesen hatte. Nicht einmal die SPÖ war in ihrer Ablehnung der NATO immer so konsequent wie ihr Klubobmann Heinz Fischer. 1993 konnte sich Kanzler Franz Vranitzky vorstellen, dass sich die Neutralität „als überflüssig und überholt erweisen könnte, wenn ein kollektives Europäisches Sicherheitssystem zustande kommen sollte“, und 1997 antwortete SPKanzler Viktor Klima im Standard auf die Frage, ob er sich eine NATO-Mitgliedschaft vorstellen könne: „Wenn wir ein europäisches Sicherheitssystem haben … warum sollten wir das dann nicht tun?“ Wolfgang Schüssel musste sich also nicht so völlig isoliert fühlen, wenn er eine NATO-Mitgliedschaft anstrebte. Aber so einig alle Unterhändler des Staatsvertrags, von Leopold Figl über Bruno Kreisky bis zu Julius Raab darin waren, dass die Neutralität eine massive Einschränkung unserer Souveränität darstellt, so eindeutig sieht der heutige Souverän darin einen Status, der uns auszeichnet. Zum einen, weil jedes Land sich ausgezeichnet sehen will – was umso leichter fiel, als die Neutralität uns unter so beneidenswerte Länder wie die Schweiz und Schweden reihte; zum anderen, weil mit dem Staatsvertrag und der Neutralität Österreichs unglaublicher wirtschaftlicher Aufstieg einsetzte und man meint, dass auch sie daran Teil gehabt habe, obwohl sie ihn etwas bremste: Sehr vorsichtige Investoren investierten lieber in NATO-Ländern. Dafür erfüllte Bruno Kreisky die Neutralität mit Glanz: Er sah Österreich = sich, durch die Neutralität zum Schiedsrichter berufen: Währende Schwedens Olof Palme die USA kritisierte, was er tun konnte, weil Schweden nie „immerwährend“ (Dauernd) neutral war, kritisierte Kreisky nach Auffassune Verostas neutralitätswidrig, die UdSSR. Der Frage, ob Neutralität tatsächlich vor Krieg schützt, trat neben so viel Glanz in den Hintergrund: Mit dem neutralen Luxemburg, dem neutralen Belgien, dem neutralen Holland, dem neutralen Dänemark und dem neutralen Norwegen wie schon erwähnt, fünf neutrale Staaten überfallen, ohne dass deren Neutralität das geringste Hindernis gewesen wäre, und Russland überfiel zugleich ohne einen Gedanken an dessen Neutralität zu verschwenden das neutrale Finnland. Dass die Schweiz verschont blieb, lag ausschließlich daran, dass Hitler den Plan General Guderians, überraschend über die angeblich nicht panzergängigen belgischen Ardennen statt über die Schweiz nach Frankreich vorzustoßen, für den mit Abstand besten hielt. Schweden wiederum war militärisch ungemein stark: In Deutschland wusste man, dass seine Armee immer imstand sein würde, am Ende auch die eigene Stahlerzeugung zu zerstören. Ein Angriff auf Schweden hätte daher mit Sicherheit bedeutet, dass es keinen kriegswichtigen Stahl mehr geliefert hätte – darauf konnte Deutschland es nicht ankommen lassen. Mit seiner Neutralität hatte Schwedens Verschonung so wenig wie die Verschonung der Schweiz zu tun. Falsch ist natürlich, um auch das zu wiederholen, die Behauptung, dass Österreich in der Vergangenheit durch seine Neutralität geschützt gewesen sei. In kritischen Situatio-
535
536
Das Reptil
nen, etwa im „Prager Frühling“ versicherte sich die Regierung immer in den USA, dass die NATO Österreich, anders als heute die Ukraine, auf jeden Fall verteidigen würde und das wusste man im Kreml. Dennoch gab es unter russischen Militärs gelegentlich Planspiele, die sich erstaunlich intensiv mit Österreich befassten. Das wichtigste davon war die Aktion „Polarka“, die davon ausging, dass die UdSSR das abtrünnige Jugoslawien zur Ordnung ruft und dass Österreich bei dieser Gelegenheit „seine Neutralität missachtet“, was die UdSSR „zwingt“, einen gravierenden Fehler Nikita Chruschtschows wieder gut zu machen, der es mit dem Staatsvertrag in den Westen entließ. Nach glaubwürdigen Aussagen Abgesprungener hat Marschall Gregori Schukow, der die UdSSR zum Sieg gegen Hitler geführt hatte, dieses Planspiel sehr ernst genommen, aber Chruschtschow sei der Stärkere gewesen. Was wurde aus den vielen in diesem Buch angeführten Neutralen? Alle sind heute NATO-Mitglieder oder wollen es wie Schweden und Finnland werden. Alle begründen das mit ihrer Erfahrung. Österreich müsste also starke Gründe haben, warum es der NATO fernbleibt. Der wirksamste ist der Umstand, dass der Beitritt Geld in Form massiver Aufrüstung kostete. Vor allem aber können sich die Österreicher nach wie vor relativ sicher fühlen, sind sie doch von der waffenstarrenden Schweiz und lauter NATO-Staaten umgeben. Trittbrettfahren ist also ungleich billiger. Stellt sich die Frage, warum es nicht alle Staaten so weise wie Österreich machen? Die rationale Antwort lautet: Weil das System dann implodierte und Putin demnächst Europa beherrschte. Die moralische Antwort wollen wir nicht hören: „Neutral“ ist ein Mann, der sieht, wie jemand einen anderen mit Füßen gegen den Kopf tritt und vorbeigeht, weil er sich entschlossen hat, sich nie einzumengen. Propagandistisch sollte die NATO Russland lautstark anbieten, ebenfalls NATOMitglied zu werden, wie das nach der Wende lange angedacht gewesen ist – es gibt bis heute ein eigenes NATO-Russland-Gesprächsformat, diese Annäherung vorzubereiten. Die NATO wäre sicher bereit, ein NATO-Land Russland gegen Angriffe wessen immer zu verteidigen – es sei denn, es wäre die eigene Bevölkerung, die Putins Regime in Frage stellt.
Die Angst vor Freiheit Genau das ist es, was Putin so fürchtet und mit dem Krieg in der Ukraine in erster Linie abzuwenden sucht: Dass die Russen durch den Blick ins Nachbarland auf die Idee kommen könnten, dass politische Freiheit persönlich und ökonomisch vorteilhaft ist. (Damit will ich übrigens nicht behaupten, dass der Übergang der Ukraine oder eines anderen ehemaligen Ostblockstaates von der kommunistischen Planwirtschaft zur Marktwirtschaft ökonomisch immer besonders gut gelungen ist.)
Die Angst vor Freiheit
Zumindest Frieden lässt sich leider mit Abstand dadurch am besten sichern, dass potentielle Gegner Angst voreinander haben. Das Wissen um die tödliche atomare Schlagkraft der jeweils anderen Seite war und ist daher die beste Absicherung des Friedens: Diesmal hat sie zum Beispiel verhindert, dass Joe Biden Wolodymyr Selenskyjs Forderung nach einer „Schließung des Himmels“ nachgegeben hat. Denn die Sorge, dass ein einziger gegenseitiger Abschuss den Dritten Weltkrieg auslösen könnte, war nie unberechtigt, obwohl Putin angesichts der massiven Überlegenheit der NATO wahrscheinlich den Schwanz eingezogen hätte – aber es wäre nicht leicht gewesen, den Dritten Weltkrieg damit zu entschuldigen, dass man sich leider in der Einschätzung Putins geirrt hat. Schaffte man Atomwaffen ab, so würde der Dritten Weltkrieg, der Krieg zwischen Indien und Pakistan oder die Vernichtung Israels um vieles wahrscheinlicher. Wie Barack Obama eine atomwaffenfreie Welt zu fordern, ist leider ausschließlich naiv – sie wäre weit gefährlicher als die, die wir haben. Gefährlich sind Atomwaffen nur in den Händen von Wahnsinnigen, etwa „Gotteskriegern“, und daher ist es richtig, ihre Verbreitung mit allen Kräften zu beschränken. Aber Putin ist, im Gegensatz zu einer Behauptung des Leiters der österreichischen Diplomatischen Akademie Emil Brix im Falter und im Gegensatz zur Einschätzung meiner Frau, eben doch nicht wahnsinnig, sondern nur „ein gewalttätiger Mann“ – er will sich nicht umbringen. Daher hat Joe Biden seine nukleare Drohung zu Recht einfach negiert. Allerdings bedingt der Umstand, dass Atomwaffen nur im äußersten Fall eingesetzt würden, dass im Normalfall zahllose konventionelle Kriege möglich waren und sind. Daher muss an kritischen Schnittstellen immer auch konventionelles Gleichgewicht herrschen. Dieses Gleichgewicht gegenüber der Sowjetunion und Russland schuf in Europa die NATO, aber es wurde voran von den USA finanziert und von ihren Truppen gewährleistet. Nur wird das in Zukunft kein US-Präsident im bisherigen Ausmaß fortsetzen: Amerikanische Eltern haben es satt, dass ihre Söhne ihr Leben auf fernen Kriegsschauplätzen riskieren. Deshalb ist es unerlässlich, dass die EU eine eigene Streitmacht schafft. Leider bedingen die ökonomischen Fehler Angela Merkels nicht nur den großen wirtschaftlichen Rückstand der EU gegenüber den USA, sondern auch ihren noch viel größeren militärischen Rückstand. Unter Helmut Kohl zählte die Bundeswehr 1983 annähernd die von der NATO geforderten 500.000 Mann – im Jahr 2011 waren es bei Abschaffung der Wehrpflicht nur mehr 206.091. Hatte die neue Berufsarmee anfangs immerhin 188.017 Berufssoldaten, so sind es heute nur noch 175.177. Starke Berufsheere – denn nur gut bezahlten Berufssoldaten ist zuzumuten, ihr Leben zu riskieren – kosten Geld, das das sparende Deutschland nicht ausgeben wollte: Die Bundeswehr wurde kaputtgespart. Frankreich, Spanien oder Italien vernachlässigten ihre Armeen nicht minder, weil Merkels Sparpakt es gebot. Dabei wären auch Ausgaben für Soldaten und Waffen gleichzeitig Einnahmen anderer Wirtschaftsteilnehmer und kurbelten die Wirtschaft in dem Ausmaß an, in dem die
537
538
Das Reptil
„Schuldenbremse“ sie gebremst hat. Deutschlands Finanzminister Christian Lindner versteht das zwar nicht, aber der Krieg in der Ukraine hat ihn bekanntlich gezwungen, beim Bundestag die Bewilligung für ein „Sondervermögen“ von 100 Milliarden einzuholen, das es ihm ermöglicht, über zwei Prozent jährlich für die Modernisierung der Bundeswehr auszugeben, während er gleichzeitig schon bewilligte 60 Milliarden in den Klimaschutz investiert, um die kritische Abhängigkeit von russischem Erdgas zu vermindern. Das wird Deutschland nicht unter Schulden ersticken lassen, sondern im Gegenteil seine Konjunktur beleben, sofern ein Lieferstopp für russisches Gas sie nicht abwürgt. Viel mehr als Deutschland, mit seiner restlos ausgelasteten Wirtschaft, bedürfen allerdings alle anderen Länder der Aufhebung der Schuldenregeln, damit auch sie ihre Armeen modernisieren und ihre Abhängigkeit von russischem Gas verringern können. Bis dahin finanzieren vor allen andere Staaten der EU Deutschland und Österreich Putins Krieg, denn das Naheverhältnis des deutschen Ex-Kanzlers Gerhard Schröder, des Ex-ÖIAG-Aufsichtsrates Siegfried Wolf und des Ex-OMV-Chefs Rainer Seele zu Putin hat sie zu den relativ weltgrößten Abnehmern von russischem Gas gemacht, so wie sie sich jetzt in der absolut größten Abhängigkeit davon befinden. WIFO-Chef Gabriel Felbermayr meinte dennoch, dass wir auf dieses Gas verzichten und in einem maximalen Kraftakt alternative Energien erschließen sollten. Er, aber auch der Energieexperte Walter Boltz sind der Ansicht, dass der entstehende Engpass sich für ein Jahr durch den Zukauf von (teurerem) Flüssiggas bewältigen lasse, und die deutsche Akademie für Wissenschaften Leopoldina und die deutsche Wirtschaftsweise Veronika Grimm sah das ähnlich: Der Wirtschaftseinbruch, den Deutschland dadurch erlitte, sei nicht größer als der, den die Pandemie verursacht hat und läge bei maximal sechs Prozent des BIP. Gleichzeitig gab es etliche Strategen, die meinten, ein Jahr könne reichen, Putin zum Einlenken zu bewegen und einen Verhandlungsfrieden möglich machen. Es sei deshalb absolut richtig, dass die EU mit ihren Sanktionen riskiert, dass Putin den Gashahn zudreht. Ich glaube zwar auch, dass sie das riskieren kann, aber es gibt, so bin ich leider sicher, nur zwei gegen Wladimir Putin gerichtete Sanktionen, die absolut richtig sind, weil sie einerseits große Wirkung entfalten und andererseits keine Eigentore darstellen. So ist es absolut richtig, Russland jeden Zugang zu Hochtechnologie zu sperren, denn das wirft seine industrielle Produktion auf Jahrzehnte hinaus zurück und erschwert zugleich unmittelbar seine Waffenproduktion. Und es ist absolut richtig, die Vermögen Russlands und aller Unterstützer Putins einzufrieren und sie bei der Reise in die EU dem Risiko der Verhaftung auszusetzen. Beides wird zwar nach menschlichem Ermessen weder Putin stürzen noch den Ukrainekrieg beenden, aber es wird vielleicht dazu beitragen, ihn doch nach einem Kompromissfrieden suchen zu lassen. Dagegen mindert ein Öl-Embargo der EU zwar Putins Einnahmen, aber es gibt genug Abnehmer außerhalb der EU, um diese Minderung nicht dramatisch ausfallen zu lassen. Für die Wirtschaft der EU ist wenig russisches Öl zwar auch nicht lebensgefährlich, aber
Die Angst vor Freiheit
doch mit politisch schwer verträglichen Einbußen verbunden, denn russisches Öl ist nun einmal besonders preisgünstig. Früher hat man argumentiert: Wir, die wirtschaftlich hochentwickelten Staaten, werden immer reicher, indem wir unterentwickelten Staaten wie Russland ihre Bodenschätze preisgünstig abkaufen. Wenn wir das nicht mehr tun, rechnet das vorsichtige Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) für Deutschland mit BIP-Verlusten, die sich über etwa zehn Jahre erstrecken und nach 18 Monaten mit einem Minus von drei Prozent ihren Höhepunkt erreichen. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) geht sogar von einem Minus von sechs Prozent aus – immer ohne dass Putin in Russland vor dem Sturz stehe und ohne dass er den Krieg in der Ukraine aus ökonomischen Gründen beenden müsse. Bei einem Erdgasembargo sieht die Rechnung noch viel schlechter aus. Russland kann Gas zwar mangels Leitungen nicht so leicht teuer an andere Abnehmer verkaufen, aber Europa, Deutschland und allen voran Österreich sind in besonderem Ausmaß auf russisches Gas angewiesen. Österreich war es ursprünglich zu 79 Prozent, die mittlerweile angeblich auf 21 Prozent reduziert wurden. Aber zu welchem Preis? Norwegen und die Niederlande können ihre Erdgasproduktion kaum mehr erhöhen, LNG aus den USA, das die Lücke vor allem füllen müsste, kostet das Doppelte von russischem Gas! Für Deutschland, mit seiner ursprünglich 40-prozentigen Abhängigkeit von russischem Gas, vermochte das IMK für den Fall eines Lieferstopps in seiner Modellrechnung überhaupt keine tragfähige Zahl für das zu erwartende BIP-Minus zu ermitteln – es sei in seiner Größe gar nicht abzuschätzen. Ein sofortiges Embargo für russisches Gas, so resümiert der Bericht des zuständigen deutschen Handelsverbandes, der für Österreich eher noch kritischer ausfiele, hätte damit gravierende Folgen für die gesamte europäische Wirtschaft: 40 Prozent der Erdgasimporte der EU stammten noch 2020 aus Russland. Zwar haben die USA angekündigt, in den nächsten Jahren ein Drittel der Lieferungen aus Russland zu ersetzen, aber es kostet eben das Doppelte und es fehlt an entsprechenden Terminals, auch wenn Deutschlands erstes in wenigen Monaten, statt in Jahren, errichtet wurde. Die Vorstellung, dass der russische Staat durch die Embargos pleitegehen könnte, wie Ratingagenturen glauben machten, nachdem sie die russische Währung auf Ramschniveau heruntergestuft hatten, strotzten vor ökonomischer Ahnungslosigkeit. Pleitegehen können Unternehmen – Staaten, die über eine eigene Notenbank verfügen, können immer für genug Geld sorgen – sie können Geld nur schwer am Kapitalmarkt aufnehmen oder ihre Währung gegen Devisen tauschen. Nur hat Russland, trotz Beschlagnahmen, sogar nach wie vor ausreichend Devisen. Völlig falsch ist leider auch die entscheidende Vorstellung, dass Putin Dank der Embargos zu wenig Geld für Waffen und Munition für seinen Krieg haben könnte. Russische Waffen kauft er mit russischem Rubel, den ihm seine Notenbank beliebig liefern kann – ausländische Waffen braucht er nicht. Waffenimporte machen nur gerade
539
540
Das Reptil
0,7 Prozent der gigantischen russischen Waffenexporte aus, die die zweitgrößten hinter den USA sind. Man kann (soll) Putin durch größere Waffenlieferungen an die Ukraine am Schlachtfeld zum Einlenken in seinem Krieg zwingen – durch Erdöl- oder Gasembargos kann man es nicht.
81. Die Chance auf Frieden
Friede, ob gerecht oder ungerecht, tritt ein, wenn eine Kriegspartei die andere besiegt hat oder wenn beide Kriegsparteien im Verlauf des Kampfes irgendwann zu dem Schluss kommen, dass sie ihre Position nicht mehr verbessern können. Diese Chance ist gering, aber sie besteht unverändert: Weitere militärische Rückschläge können dazu führen, dass Wladimir Putin zu zweifeln beginnt, dass er seinen Krieg in absehbarer Zeit gewinnt und dass er gleichzeitig trotzdem die Möglichkeit sieht, ihn gesichtswahrend zu beenden, indem er vor seiner Bevölkerung behaupten kann, er habe einen historischen Sieg errungen. Der erreichbare Waffenstillstand sähe dann wohl etwa so aus, wie Tesla-Gründer Elon Musk ihn skizziert hat: Gegen Abzug der russischen Truppen aus dem Kampfgebiet könnte es eine internationale Anerkennung der Annexion der Krim geben, während gleichzeitig die Neutralität der restlichen Ukraine nach dem Muster der Schweiz international verankert und vor allem von den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland – also de facto der NATO – in wasserdichten Verträgen garantiert wird. Ein Jahr nach dem Abzug der letzten russischen Soldaten und damit nach Rückkehr der Flüchtlinge, gäbe es im Falle einer solchen Lösung in Luhansk und Donezk eine international überwachte Abstimmung über deren künftigen Status, der daraufhin ebenfalls internationale Anerkennung fände. Natürlich müsste die neutrale Ukraine abseits der beschriebenen internationalen Garantie über ein denkbar starkes eigenes Heer verfügen. Während ich diese Zeilen schreibe, im Jänner 2023, sieht es nicht nach diesem Waffenstillstand – Frieden kann man es nicht wirklich nennen – aus: Putin bombardiert unverändert die Infrastruktur der Ukraine in der Hoffnung, dass immer mehr Ukrainer erfrieren oder verhungern. Die Ukrainer sind unverändert entschlossen, ihre Heimat zu verteidigen, und die Waffenlieferungen des Westens, weit voran der USA und finanzielle Milliardenunterstützung, zu der auch die EU angemessen beträgt, erlaubt es ihr, den Kampf fortzuführen. Vorläufig ist es grober Unsinn zu meinen, dass die westliche Unterstützung den Krieg umso mehr befördere, je mehr Waffen Wolodymyr Selenskyj erhält: Nur mehr und stärkere Waffen werden Putin daran zweifeln lassen, dass sein so viel größeres Heer diesen Krieg in absehbarer Zeit gewinnt. Deshalb hoffe ich so sehr, dass ukrainische Piloten, entgegen allen Dementis, polnische MiG-9 von grenznahen Flugplätzen abholen und dass Panzer und Panzerabwehrwaffen, Raketenwerfer und Boden-Luft-Raketen, inklusive Patriot Luftabwehr, die Ukrainische Armee möglichst rasch erreichen. Krieg mit „angezogener Handbremse“ ist nicht human, sondern dauert nur noch viel länger.
542
Die Chance auf Frieden
Völkerrechtlich sind diese Waffenlieferungen in keiner Weise problematisch: Es ist zulässig, einem angegriffenen Staat jede Menge noch so starker Waffen zu liefern. Das ständige Zögern, voran der deutschen Regierung, das zu tun, ist kontraproduktiv, denn es stärkt Putins Zuversicht. An sich ist freilich denkbar verständlich, dass die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg so ganz und gar nicht mit Waffen assoziiert werden wollten. Die NSKriegsbegeisterung wurde vielfach von einem unterbewussten Pazifismus in der Tradition der österreichischen Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner („Die Waffen nieder“) abgelöst, der einem Denkfehler Vorschub leistet: dass nämlich voran Waffen für Kriege verantwortlich wären. Schon die Wiederbewaffnung der BRD und ihr NATO-Beitritt bedurften des Drucks der USA und der Überzeugungskraft Konrad Adenauers, der schon Hitler mit Waffen entgegentreten wollte und dabei vielleicht sogar Erfolg gehabt hätte, wenn mein Großvater ihn nicht im Stich gelassen hätte. Scholz lässt die Ukraine zwar nicht im Stich, aber er unterstützt sie mit angezogener Handbremse, weil er, wie Angela Merkel, die der Ukraine die Aufnahme in die NATO verweigerte, Angst hat, Putin zu sehr zu vergrämen. Dass nur ein ausreichend bewaffnetes Heer vielleicht sogar absehbaren Frieden herbeiführen kann, ist unterbewussten Pazifisten fremd, auch wenn sie bewusst anerkennen, dass NATO-Mitglieder weder angegriffen haben noch je angegriffen wurden. Voran den Nachkommen von Familien, die seinerzeit der NSDAP besonders nahestanden, fällt schwer, die NATO als friedlich anzusehen, wird sie doch von den USA angeführt. Dass sich die, anders als das überfallene Russland, aus moralischen Gründen am Krieg gegen Hitler beteiligt und seine Niederlage besiegelt haben, wird ihnen nie ganz verziehen. Obwohl Deutschland der NATO nach außen überzeugt angehört, ist sie vielen Deutschen so suspekt wie der Ruf nach militärischer Stärke des „Westens“. Jedenfalls hat die Scheu der Deutschen, mit Waffen assoziiert zu werden, zu einer der österreichischen Neutralität sehr nahen Haltung geführt: Deutschland schätzt Äquidistanz, tat sich schwer, sich am NATO-Einsatz gegen die Taliban zu beteiligen, und hielt sich, freilich zu Recht, aus der „Koalition der Willigen“ im Irakkrieg heraus. Aber es lieferte Kiew zu Unrecht lange keine Kampfpanzer und wollte ihr in der Folge keine Kampflugzeuge liefern. Denn trotz ihres großen Einsatzes können die Ukrainer ihre dramatische numerische Unterlegenheit nur mittels überlegener Waffen wettmachen, und nur ein militärisches Patt schafft die winzige Möglichkeit eines Waffenstillstands. Das Interesse daran wäre meines Erachtens allerdings so klar zu signalisieren, wie die Bereitschaft zu Waffenlieferungen, um Putin nicht in die Lage zu bringen, die Joe Biden zu Recht fürchtet: dass er doch zu Atomwaffen greift. Es braucht intensive Diplomatie und schwere Waffen zugleich. Denn trotz der Erfolge der Truppen Wolodymyr Selenskyjs, etwa in Cherson, teile ich die Befürchtung des Militäranalysten Markus Reisner, dass sie uns übersehen lassen, wie erfolgreich Putin die Infrastruktur der Ukraine zerstört: Die befreiten Bürger im dunklen Cherson frieren. Auf die Dauer kann ein Land mit 43,8 Millionen Einwohnern
Die Chance auf Frieden
dem Angriff eines Landes mit 150 Millionen Einwohnern ohne überlegene Waffen extrem schwer standhalten. Beide Länder dürften bisher mindestens 100.000 Soldaten verloren haben – Putin kann sie problemlos ersetzen, Selenskyj nicht mehr lange. Mit billigen Drohnen aus dem Iran vermag Putin Stellungen der Ukraine so lange zu beschießen, bis deren Luftabwehr ihr Pulver verschossen hat und seine Marschflugkörper gezielte Verwüstung anrichten können. Deutschland hat Selenskyj zum Zweck solcher Luftabwehr bisher 14 Haubitzen geliefert – aber nur Munition für zwei Tage. Der Nachschub stockt, weil die Bundeswehr sie nicht auf Lager hat und auch im Rest der EU Produktionskapazitäten fehlen. Dass Kampfpanzer trotz des Drängens der Grünen und der FDP vorerst nicht geliefert wurden, liegt nicht zuletzt daran, dass sie rar sind. Merkels Austerity-Pakt hat nicht nur die Bundeswehr kaputtgespart, sondern die Wehrkraft der EU als Ganzes minimiert, während Putin die Rüstung Russlands in Vorbereitung seiner Kriege maximiert hat. Hier liegt das größte Problem, das Deutschland der EU aufbürdet: Sie ist dank deutschen Sparens und seiner Scheu vor Waffen wehrlos. Nur ein militärisch starkes Deutschland könnte mit Frankreich den Kern einer EU-Streitmacht bilden, die nicht total auf die USA angewiesen ist. Dabei zeigt der Ukrainekrieg, dass kein US-Präsident seinem Volk künftig den Einsatz und die Kosten zumuten wird, die üblich waren, als Nikita Chruschtschow oder Leonid Breschnew Russland regierten – obwohl Putin aggressiver als beide ist. Ein Problem bestünde erst, wenn die westlichen Waffenlieferungen Selenskyjs Zuversicht, den Krieg zu gewinnen so sehr steigerten, dass auch er jeden Waffenstillstand = Kompromissfrieden ablehnte, weil es zweifellos immer ein ungerechter Frieden wäre: Es ist und bleibt ungerecht, wenn Putins völkerrechtswidriger Einmarsch in die Krim mit der Anerkennung ihrer Annexion endet. Aber nur diese Anerkennung beendete das unendliche Leid, das der fortgesetzte Krieg verursacht.
543
82. Teuerung und Inflation unterscheiden sich
Für uns, die EU und die USA hat der Ukrainekrieg zwar nicht unendliches Leid, wohl aber eine Inflation von lange nicht da gewesener Höhe mit sich gebracht. Erreichte sie während des Ölschocks der 1970er Jahre um die neun Prozent, so überschritt sie diesmal in Österreich, wenn auch nicht für ein Jahr, aber sehr wohl für einen Monat, die Elf-Prozent-Marke, und wird noch länger weit über den von der EZB erwünschten zwei Prozent im Jahr bleiben. Der hohe Öl-/Gas-Preis, der sie verschuldet, hängt im Gegensatz zu einer von vielen, auch prominenten Ökonomen geäußerten Meinung, nur am Rande mit ihrer Geldpolitik, sondern fast immer von der Weltpolitik ab, sonst müsste er bei einem derart begrenzten Gut ständig weit höher sein. 1973/74, als die Inflation 9,3 Prozent erreichte, explodierte er zum Beispiel, weil die in der OPEC vereinten arabischen Staaten sich zur Drosselung der Öl-Förderung verabredet hatten, um eine andere Israel-Politik der USA zu erreichen – sie waren wütend, weil die USA durch gigantische Waffenlieferungen im letzten Moment eine Niederlage Israels im JomKippur-Krieg abgewendet hatten. Im Allgemeinen sorgten die USA freilich durchgehend für einen viel zu geringen Ölpreis, indem sie den Golfstaaten drohten, ihnen sonst keine Waffen zu liefern.
Der von den USA akzeptierte hohe Ölpreis 2019/20 aber waren sie dank „Fracking“ selbst weltgrößter Öl-/Gas-Produzent und ihre Fracking-Industrie hatte entsprechendes Interesse an einem guten Ölpreis, weil sie Öl wie Gas am kostspieligsten fördert. Das ließ die USA dem von der OPEC und Russland gemeinsam beschlossenen hohen Ölpreis ursprünglich zustimmen. Die OPEC schätzte den hohen Ölpreis, weil ihre Mitglieder gut daran verdienen und Putin brauchte ihn, um seinen Staat, vor allem aber um seinen künftigen Ukrainekrieg zu finanzieren. Viel zu spät merkten die USA, dass sie sich, indem sie ihn akzeptierten, zwei Eigentore geschossen hatten: Der diesmal nicht durch sie gesenkte Ölpreis erleichterte Putin nicht nur den Krieg, sondern wurde zentrale Ursache einer auch in den USA lange nicht mehr erlebten Inflation und ließ Joe Biden, dessen mögliche Wiederwahl sie extrem gefährdet, eine eilige Reise nach Saudi-Arabien unternehmen, um dessen Herrscher Kronprinz Mohammed bin Salman dazu zu bewegen, die Ölförderung auszuweiten und den Ölpreis damit zu senken. Aber bin Salman zeigte Biden die kalte Schulter: Er verübelt ihm, dass der ihn öffentlich des Mordes an dem oppositionellen Journalisten Jamal Khashoggi zieh und ist offenbar der Meinung, dass er Waffen auch anderswo, vielleicht aus Russland, günstig bekommt.
Der von den USA akzeptierte hohe Ölpreis
Auf autoritäre Verbündete ist leider kein absoluter Verlass. Die USA wie die EU werden daher noch einige Zeit unter der ölpreisbedingten Teuerung leiden, aber sie wird sukzessive zurückgehen. In Wirklichkeit sollte man nämlich zwischen Teuerung und Inflation unterscheiden und von Inflation nur sprechen, wenn ein sich selbst verstärkender Prozess in Gang gekommen ist, bei dem hohe Preise immer höhere Löhne bedingen, die ihrerseits permanent zu noch höheren Preisen führen. Aber das ist weder in der EU noch in den USA der Fall. Allenfalls könnten in den USA die durch sehr hohes Arbeitslosengeld zusätzlich vermehrten sehr hohen Einkommen in der Ära Trump zur Teuerung beigetragen haben, denn natürlich steigen die Preise auch, wenn die Lohnkosten deutlich gestiegen sind und wenn die Konsumenten weniger genau auf ihre Ausgaben achten, weil sie ohnehin genug Geld haben. Preissteigerungen dieser Art, die eine fast schon überhitzte Konjunktur zur Ursache haben, bekämpft man lehrbuchmäßig, indem man die Geldpolitik strafft und die Zinsen für Kredite erhöht. Das hat die FED bereits 2020 getan und es ist, wenn es sich tatsächlich um eine solche Überhitzung handeln sollte, denkbar, dass es nutzt und dass sich die hohe Inflationsrate in den USA auch deshalb 2022 deutlich verringert hat. Ebenso gut aber auch zugleich könnte das freilich zur Ursache haben, dass wieder weit mehr ins Fracking investiert wurde und der US-Ölpreis dadurch deutlich sank. In der EU hat es aber mit Sicherheit keine überhitzte Konjunktur gegeben und die Löhne sind nicht nur nicht übermäßig gestiegen, sondern real vielfach gefallen. Dennoch ist auch in der EU der Ruf nach einer strafferen Geldpolitik immer lauter geworden, und nach einigem Sträuben ist EZB-Präsidentin Christine Lagarde ihm nachgekommen: Auch die EZB hat die Zinsen drastisch erhöht. Meines Erachtens wird das die Inflation kaum senken – Öl und Gas werden dadurch weder mehr, noch billiger – wohl aber könnte es die sowieso schwächelnde Konjunktur abwürgen und eine Rezession herbeiführen, die die Inflation dann auf die schlechteste mögliche Weise sehr wohl senkt. Es gibt zwar, wie gesagt, zahlreiche und prominente Ökonomen, die die Teuerung (Inflation) als Ausfluss der in den letzten zehn Jahren ultralockeren Geldpolitik der FED wie der EZB sehen. Ich halte das für verfehlt und glaube, es begründen zu können: Die Geldpolitik war durch mehr als zehn Jahre ultralocker und statt von Inflation war sie in der EU durch zehn, in den USA durch 13 Jahre beinahe von Deflation begleitet: Zinsen wie Preise stiegen fast gar nicht. Die Theorie des deutschen „Star-Ökonomen“ Hans-Werner Sinn, die Inflation habe sich in diesen zehn beziehungsweise 13 Jahren wie in einer Ketchupflasche angestaut und pflatsche nun plötzlich heraus, scheint mir eher abstrus – jedenfalls sehr viel weniger einleuchtend als die These, dass ihr die Verteuerung von Öl und Gas durch den Ukrainekrieg zugrunde liegt. Schon eher zutreffen könnte Sinns These für die Aktienkurse: Durch 13 Jahre hat die lockere Geldpolitik sie ohne reale Wertsteigerung der zugrundeliegenden Unternehmen in die Höhe schießen lassen – jetzt schrumpft diese Aktienblase aufgrund der höheren Zinsen besonders schnell zusammen.
545
546
Teuerung und Inflation unterscheiden sich
Österreichs schwarz-grüne Regierung hatte, wie alle Regierungen, natürlich aufs heftigste mit den Folgen der massiven Teuerung zu kämpfen. Während die vereinte Opposition aus SPÖ, FPÖ und NEOS wie üblich erklärte, sie habe in diesem Kampf „total versagt“, hat sie meines Erachtens anfangs viel richtig gemacht: Sie hat begriffen, dass der Staat nicht jedem finanziell beistehen, sondern nur die Schwachen unterstützen kann. Mindestens die Hälfte der Österreicher kann die höheren Benzin-, Gas-, Strom- oder Nahrungsmittelpreise, wenn auch verärgert, stemmen. Sie mit Steuergeld zu unterstützen, hieße, ihnen Geld zu geben, das ihnen als Steuerzahler gleich wieder abgenommen werden müsste. Als besonders dumm hat sich die „Deckelung“ durch Abschaffen einer üblichen Steuer erwiesen: Dass Deutschlands Finanzminister die Steuer auf Treibstoff senkte, hat den Staat rund drei Milliarden Euro Steuereinnahmen gekostet und den Preis von Treibstoff kaum gesenkt – nur die Gewinne der Unternehmen erhöht, die damit handeln. Das gilt im Prinzip auch für die von der SPÖ unverdrossen geforderte Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel – der mögliche Steuerausfall wäre aber so gering, dass man diese Maßnahme, um ihrer Popularität willen, auch durchführen kann, zumal der Lebensmittelhandel vielleicht anders als der Treibstoffhandel reagiert. Ansonsten ist es immer kostengünstiger, die Beihilfen für die wirklich sozial Schwachen deutlich zu erhöhen, wie das die Regierung getan hat, und der Gesamtbevölkerung nur gewisse Mindestkontingente an Energie verbilligt zur Verfügung zu stellen. Leider hat die Regierung das in Österreich erst sehr spät getan und bei allem was sie tat, war die Treffsicherheit extrem gering, weil die Finanz mangels Vermögenssteuern keine präzisen Daten über die Finanziellen Verhältnisse der Bürger besitzt, wie sie am ehesten eine treffsicher Unterstützung erlaubten. Danach ging es um die noch viel schwierigere Unterstützung der Industrie. Anders als bei den Bürgern musste ihre Wettbewerbsfähigkeit als Grundlage ihrer Existenz gesichert werden. Deutschland hat zu diesem Zweck große Beträge lockergemacht, obwohl das nicht automatisch einleuchtet: Die Verteuerung der Energie hat ja selbst die USA oder China nicht viel anders als die EU getroffen, so dass sich an den Konkurrenzverhältnissen nicht so viel geändert haben sollte. Schon gar nicht innerhalb der EU oder innerhalb Österreichs. Aber wenn Deutschland „wummst“, müssen wir als wichtigster Handelspartner nachziehen. Freilich nur bei den Unternehmen, die mit deutschen Unternehmen in Konkurrenz stehen und denen die hohen Energiepreise auch ernsthaft schaden. Bisher hatte man diesbezüglich unterschieden – dann setzte die ÖVP durch, dass es kaum mehr Unterscheidungen gab: Auch Unternehmen ohne jede deutsche Konkurrenz und ohne übermäßige Energiekosten – etwa Hotels – erhalten gewaltige Unterstützung. Waren es im deutschen Modell im Jahr 2023 14 Prozent der Energiekosten, die einem Unternehmen ersetzt werden sollten, so waren es im österreichischen Modell 45 Prozent. Zwar hat Österreich gemäß EU-Vorgabe wie Deutschland fünf Förderstufen, in denen mit der Höhe der Förderung und deren Länge auch immer strengere Bedingungen
Der von den USA akzeptierte hohe Ölpreis
erfüllt sein müssen, aber in Österreich fehlt, dass das Unternehmen auch in der untersten Förderstufe eine gewisse Mindest-Energieintensität nachweisen muss. Damit stieg die für Unternehmensförderung vorgesehene Summe von 1,5 auf fünf bis zu neun Milliarden. Das ist mehr als problematisch: Der nicht wirklich treffsichere Ausgleich des Rückgangs niedriger Einkommen durch staatliche Zahlung hat die allgemeine Kaufkraft nicht wesentlich verringert und das sollte für die meisten Betriebe völlig ausreichen um zu überleben. Gleichzeitig wird die Körperschaftsteuer im Jahr 2024 von 25 Prozent auf 23 Prozent gesenkt, weil das angeblich die Investitionen fördert. Die Realität: In den letzten vier Jahrzehnten wurden die ursprünglich auf Unternehmensgewinne entfallenden Steuern halbiert – die Investitionen aber sind so gering wie nie zuvor, weil darüber ganz andere Kriterien entscheiden. In Summe erfüllt die Regierung die Forderung ökonomisch unkundiger Reicher – der Staat verliert Geld für sinnvolle Investitionen. Ansonsten hat die grün-schwarze Regierung allerdings vieles erreicht, das vorangegangene Regierungen stets nur versprachen: Sie hat die kalte Progression abgeschafft, die einem einen Teil einer Lohnerhöhung wieder wegnimmt, wenn man dadurch in eine neue Steuerklasse kommt, und sie hat vor allem die Kinderbeihilfen sofort erhöht und in der Folge eine Reihe von Beihilfen an die Inflation angebunden, so dass sie in Zukunft mit dieser steigen. Beides stellt eine erhebliche Strukturverbesserung dar. Auch eine eher vernünftige Preisbremse für Strom wurde je wie beschrieben eingeführt: Man erhält ein bestimmtes, unbedingt nötiges Kontingent davon zu einem ermäßigten Preis, indem der Staat die Mehrkosten übernimmt. Was man über dieses Kontingent hinaus verbraucht, muss man zu den hohen Gestehungskosten bezahlen, denn wir sollen ja zum möglichst sparsamen Umgang mit Energie angehalten werden. Nicht nur, um trotz der gestiegenen Energiekosten mit unserem Geld auszukommen, sondern um den Klimawandel einzubremsen. Die schwarz-grüne Regierung hat also im meinen Augen nicht „total versagt“, sondern manches ganz gut, anderes eher schlecht und einiges sehr schlecht gemacht. Ich glaube, dass Österreichs Politiker sich, ihren Parteien und dem Land den denkbar größten Dienst erwiesen, wenn sie zu dieser scheinbar winzigen Änderung ihres Verhaltens fähig wären: Wenn sie, wie bei der Rückübersiedlung ins prachtvoll sanierte Parlament wortreich beschworen, in der Lage wären, die Vorschläge, Anträge und Leistungen der Parteien, denen sie nicht angehören, nicht automatisch als total verfehlt zu bezeichnen, sondern zu differenzieren. Selbst ein Antrag der FPÖ ist hin und wieder ein Fortschritt. Das zuzugeben, macht berechtigte Kritik an ihr sehr viel glaubwürdiger. Beate MeinlReisinger von den NEOS hatte natürlich Recht, als sie energische Auseinandersetzungen einen wesentlichen Teil des Parlamentarismus nannte, den als „Streit“ zu diffamieren, unzulässig bis gefährlich sei. Karl Popper hat sogar gemeint, dass wir den Krieg der Worte mit aller Schärfe führen sollen, um jeden wirklichen Krieg zu vermeiden. Er
547
548
Teuerung und Inflation unterscheiden sich
konnte das in den Streitgesprächen, in denen ich ihn erlebt habe, denn er begegnete jedem Menschen mit Respekt. In einer rationalen Gesellschaft hätten wir den Preis von Öl und Gas aus eigenem Antrieb längst sukzessive über das heutige Niveau angehoben, um jenen CO2 -Ausstoß zu verringern, der uns unzweifelhaft – allenfalls über den Zeitraum kann man streiten – einer Klimakatastrophe entgegenführt. Natürlich ist es ein Problem, wenn diese Verteuerung nicht geplant und sukzessive, sondern zufällig und auf einmal durch einen Krieg erfolgt, aber wenn wir es bewältigen, wird das ein wesentlicher Beitrag zur Rettung des Planeten sein. Und wir können es bewältigen, indem wir die Erschließung alternativer Energie in einem Kraftakt massiv vorantreiben. Die EU hat zu diesem Zweck bekanntlich erstmals einen gemeinsamen Kredit aufgenommen, und kein Land sollte zögern, sich zu diesem Zweck sogar noch mehr zu verschulden. Einmal mehr ist die „Schuldenbremse“ dabei ein widersinniges Hindernis. Mit dem Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO Gabriel Felbermayr und mit der deutschen „Wirtschaftsweisen“ Veronika Grimm bin ich überzeugt, dass Österreich und Deutschland die anstehende Herausforderung meistern und dass auch die anderen EU-Staaten, die weniger von russischem Gas abhängen, mit ihr zu Rande kommen. Die 2022/23 beobachtete massive Teuerung wird, wenn Sie diesen Text lesen, auf jeden Fall zurückgegangen sein, und die EZB wird sich das auf jeden Fall gutschreiben, aber ich glaube, dass die wesentlichen Gründe andere sind: Der besonders milde Winter 2022/23 hat uns weit weniger Öl und Gas als sonst verbrauchen lassen, so dass es trotz der gedrosselten Förderung billiger geworden ist. Gleichzeitig haben die USA ihr Fracking wieder verstärkt und auch das hat Öl und Gas vermehrt und verbilligt und die Inflation in den USA besonders stark zurückgehen lassen. Sowohl in den USA wie in der EU gibt es allerdings einen beträchtlichen Anteil der Inflation, der sich nicht durch die Verteuerung der Energie erklären lässt. Für mich ist ziemlich offensichtlich, dass er darauf beruht, dass viele Unternehmen die Inflation zum Anlass genommen haben, ihre Gewinne zu erhöhen: Da die Konsumenten höhere Preise erwartet haben, haben sie nicht bemerkt, dass auch solche Unternehmen die Preise massiv erhöht haben, die kaum Anlass dazu hatten – auch Bestattung wurde um 30 Prozent teurer. Eigentlich müssten es die Wettbewerbsbehörden sein, die prüfen, wie weit sie diese Art der Teuerung zurückdrängen können. Was die Notenbanken dagegen anrichten können, sehe ich jedenfalls nicht. Normalerweise gehen Notenbanken nur dann – durchaus lehrbuchmäßig – mit Zinserhöhungen gegen eine hohe Inflation vor, wenn dieser Inflation Lohnerhöhungen zugrunde liegen, die massiv über den Produktivitätszuwachs hinausgehen und alle Waren damit zwingend verteuern. In den USA ist das, wie gesagt, denkbar: Es kann sein, dass die vom Ölpreis initiierte Inflation dort deshalb so hoch ausgefallen ist, weil unter Biden, vor allem aber unter Trump, auch besonders massive Lohnerhöhungen stattgefunden haben, die die Lohnkosten stark erhöht, und damit zwingend auch die Waren verteuert haben.
Der von den USA akzeptierte hohe Ölpreis
In der EU aber konnte das nicht sein, denn die deutsche „Lohnzurückhaltung“ hat die Löhne ja ausdrücklich weniger als die Produktivität steigen lassen, und das hat aufgrund der gegenseitigen Konkurrenz das Lohnniveau überall in der EU gesenkt. Die Lohnkosten sind entsprechend niedrig geblieben und können unmöglich die wesentliche Ursache von Preissteigerungen gewesen sein. Genauso wenig die Ursache einer überhitzten Konjunktur. Dass die EZB ihre Zinsen dennoch wie die FED massiv anhebt, könnte daher auch in eine Rezession münden. Denn erhöhte Zinsen erschweren staatliche wie private Investitionen – am frühesten spürbar wurde das in der Bauwirtschaft. Gleichzeitig erhöhen höhere Zinsen, durchaus gewollt und lehrbuchmäßig, die Arbeitslosigkeit, denn wenn man davon ausgeht, dass die hohe Inflation auch von den hohen Löhnen herrührt, dann verhindert eine leicht gestiegene Arbeitslosigkeit am erfolgreichsten, dass weitere Lohnerhöhungen durchgesetzt werden. Die Arbeitslosigkeit zu erhöhen ist daher ein lehrbuchmäßiges Rezept der Notenbanken, gefährliche Inflation durch überhöhte Lohnerhöhungen und eine überhitzte Konjunktur rechtzeitig zu verhindern. Sollte die EZB hingegen von lauter falschen Voraussetzungen ausgegangen sein, weil überhöhte Löhne und überhitzte Konjunktur für die Inflation in der EU keine Rolle spielten und sie von verteuertem Öl und von überhöhten Gewinnen herrührt, dann bewirken durch erhöhte Zinsen erschwerte Investitionen und erhöhte Arbeitslosigkeit möglicherweise nicht die Vermeidung gefährlicher Inflation, sondern Rezession. Richtig wäre meines Erachtens gewesen, zuerst die Maastricht-Kriterien zu modifizieren, dann Deutschland davon abzubringen, die „Lohnzurückhaltung“ abzustützen, indem es Hartz-IV-Arbeitslose dazu zwingt, sehr schnell neue, oft mäßig bezahlte Arbeitsverhältnisse einzugehen – (auch wenn diese Bestimmung neuerdings etwas gelindert wurde). Erst wenn Finanzkrise und Covid-19-Krise in allen Staaten der EU – auch in ihrem „Süden“ – endgültig ausgestanden gewesen wären, hätte die EZB meines Erachtens die Zinsen anheben sollen. Denn natürlich ist es unter normalen Umständen ökonomisch besser, wenn Geld einen Preis hat, der verhindert, dass es am falschen Ort – etwa nur in der Geld- statt in der Realwirtschaft – angelegt wird. So wie EU und EZB es gehandhabt haben, ist es ein heikles Experiment, und ich bin gespannt, wie es ausgeht. Sie werden, wenn Sie diese Zeilen lesen, vielleicht schon mehr wissen. Natürlich hoffe ich, dass Rezession vermieden werden konnte, bin diesbezüglich aber nicht so optimistisch wie die EZB.
549
83. China plus Russland gegen USA plus EU
In seinem genialen Science-Fiction-Roman „1984“ hat George Orwell die selbstverständliche Verdrehung der Wahrheit in der Diktatur der Zukunft prophezeit: Wladimir Putin forderte ein Ende der Bedrohung durch die NATO, nachdem er die Krim annektiert hatte und unmittelbar bevor seine Truppen in die Ukraine einmarschierten. Chinas auf Lebzeiten bestellter Staatschef Xi Jinping forderte das Ende der Bedrohung durch die NATO, nachdem er Hongkong kassiert hatte und während seine Kampfjets täglich den Luftraum Taiwans verletzten. Die Annäherung des russischen De-facto-Diktators an den chinesischen De-jureDiktator, die durch ihre gemeinsame Erklärung anlässlich der Olympiade in Peking gekrönt wurde, hat sich im Gleichschritt mit den Protesten und Sanktionen vollzogen, die der „Westen“ gegen beider immer autoritäreres Vorgehen verhängte: Seit den Protesten gegen das Tian’anmen-Massaker ist Russland Chinas größter Waffenlieferant. Seit den Protesten gegen Russlands Militärhilfe für Bashar al-Assad steht Xi Jinping hinter Putin. Seit den westlichen Sanktionen gegen die russische Annexion der Krim planen Jinping und Putin eine gemeinsame Pipeline für russisches Gas zum Preis von 400 Milliarden Dollar in den kommenden 30 Jahren, nachdem Russland schon zuvor Chinas größter Öl-Lieferant geworden ist. Dazu öffnete sich Russland chinesischen Investitionen und vereinbarte eine „umfassende strategische Zusammenarbeit“. Die Militärmacht, die so entstand, umfasst derzeit 1,6 Millionen chinesische Soldaten bei 252 Milliarden Dollar jährlichen Militärausgaben plus 850.000 russische Soldaten bei Militärausgaben von 61,7 Milliarden Dollar. Die Situation wäre angesichts von 778,2 Milliarden Dollar jährlicher Militärausgaben der USA und 200 Milliarden jährlicher Militärausgaben der EU dennoch nicht so bedrohlich, gäbe die EU ihr Geld gezielter und einvernehmlicher aus und hätten Jinping und Putin es nicht so ausdrücklich zu ihrem Ziel erklärt, die US-Vormacht zu brechen. Denn mit Simon Wiesenthal halte ich es unverändert „für das größte Glück der freien Welt, dass die stärkste Militärmacht der Welt zufällig ein demokratischer Rechtsstaat ist – es wäre das größte anzunehmende Unglück, wenn die USA faschistisch würden“. Dieser GAU ist leider seit dem Sturm aufs Kapitol nicht ausgeschlossen: Wenn Donald Trump 2024 doch wieder an die Macht kommen sollte, wird er alles tun, um Justiz, Medien und Staatspolizei im Stile Putins unter Kontrolle zu bringen und die NATO hat er bekanntlich für sinnlos und nicht im amerikanischen Interesse erklärt. Und schon ohne Trump war der „Westen“ schwach wie nie zuvor, weil die Amerikaner nach einer Abfolge verlorener Kriege von Vietnam bis Afghanistan jedes größeren Engagements im Ausland, unter welchem Präsidenten immer überdrüssig sind, und weil einander innerhalb der USA Republikaner und Demokraten zerfleischen.
China plus Russland gegen USA plus EU
Dennoch suhlt sich die EU, der Großbritannien abhandengekommen ist, in ungebrochener militärischer Impotenz. Das wieder sollte klar machen, wie wichtig es mir ist, dass die EU endlich eigene militärische Potenz gewinnt. Eine eigene Streitmacht der EU wäre weder ein personelles noch gar ein ökonomisches Problem: Höhere Militärausgaben beflügeln die Wirtschaft, auch wenn höhere Ausgaben für Wärmepumpen das sinnvoller täten. Aber anders als Russland müssen die Staaten der EU nicht weniger für Wärmepumpen ausgeben, wenn sie ihre Militärbudgets erhöhen, sondern können beides nebeneinander finanzieren. Ebenso problemlos lassen sich die 600.000 Mann, die in ihren nationalen Armeen schon jetzt unter Waffen stehen, auf 800.000 Berufssoldaten aufstocken, um eine Russland adäquate Streitmacht zu bilden, indem sie Truppen und Gerät aufeinander abstimmen und einem gemeinsamen Kommando unterstehen. Das Problem der EU ist zum einen der gemeinsame Wille: Ungarn will seine Armee sicher nicht französischem Kommando unterstellen, Griechenland nicht dem Kommando Deutschlands und Österreich glaubt sich durch Neutralität gesichert. 27 Staaten haben 27 Vorstellungen davon, wie Sicherheit zu erzielen ist. Aber so völlig unterschiedlich können diese Vorstellungen angesichts des Verhaltens von Russland doch nicht sein. Zumindest Frankreichs Emmanuel Macron fordert eine europäische Streitmacht, und in Helsinki hat die EU 1999 eine Eingreiftruppe von 50.000 Mann geplant. Im Frühjahr 2021 beschloss sie eine von 5000 Mann: Ein Lichtblick gemessen an ihrer bisherigen Wehrkraft – aber lächerlich gemessen an der Armee Russlands und der Gefahr, dass ein wiedergewählter Donald Trump die NATO aufkündigt, dass selbst eine vernünftige republikanisch dominierte Regierung weitere Milliarden für Militärhilfe an die Ukraine in Frage stellen könnte und dass kein künftiger US-Präsident den Amerikanern zumuten wird, wie im Zweiten Weltkrieg für Europas Freiheit zu sterben. Daher glaube ich, dass die EU nichts dringender braucht als eine starke eigene Armee. Das ist nicht Kriegstreiberei, sondern die einzig funktionierende Sicherung des Friedens.
551
84. Ausblick
Wenn ein Buch im Herbst erscheinen soll, dann muss man es inhaltlich etliche Monate davor abgeschlossen haben. Sofern es dabei nur um mich als Person geht, ist das einfach: Ich bin nach wie vor glücklich verheiratet, schreibe jede Woche einen Kommentar für den Falter, habe keine finanziellen Sorgen und auch meinen Kindern geht es im Großen und Ganzen gut. Wenn ich ein Problem habe, dann ist das – einerseits alterstypisch, andererseits doch auch als Folge eines eher stressigen Lebens – der Umstand, dass ich nach drei Herzinfarkten physisch älter als 84 bin. So muss ich täglich dreimal vier Pillen zu mir nehmen, die einerseits meinen Cholesterinspiegel und Blutdruck senken, andererseits Parkinson bremsen sollen. Parkinson ist neu und der Neurologe ist draufgekommen, nachdem ich ihn aufgesucht hatte, weil ich seit einem Jahr immer größere Probleme beim Gehen hatte, die freilich gar nicht von Parkinson, sondern von einer Polyneuropathie, einem Rückzug der Nerven in den Füßen, herrühren. Das irritiert mich, wenn ich mich daran erinnere, dass ich beim Bundesheer „der Läufer“ war. Schrecken jagt es mir aber keinen ein, denn in meinem Alter verlaufen auch Erkrankungen langsamer, und Alois Mock war mit Parkinson noch ein ziemlich erfolgreicher Außenminister. Trotzdem war ich froh, die kalten Monate beim Schreiben in unserem Haus in Marbella zu verbringen, denn das ist ebenerdig und barrierefrei. Außerdem war es dort immer gut warm – nicht nur des Klimas wegen, sondern weil in Spanien der Strom und der Gaspreis nicht so hochgeschnellt ist. Während Österreich mit 11,2 Prozent eine Inflation verzeichnete, die weit im oberen Mittelfeld der EU lag, war sie in Spanien mit sechs Prozent die niedrigste. Nicht so sehr, weil Spanien so viel besser gemanagt hat, sondern weil Spanien sein Erdgas seit jeher mittels langfristiger Verträge billig aus Marokko und Algerien bezieht. Damit bin ich nicht mehr bei mir, sondern zurück bei jenem politischen Umfeld, das in allen vergangenen Kapiteln mein Hauptthema war. Ich muss also in diesem letzten Kapitel zwangsläufig darauf eingehen, wie dieses politische Umfeld beschaffen ist, und das ist im Moment denkbar schwer: Alles ist offen. Ich muss spekulieren, wohin es sich entwickelt, obwohl ich von Karl Popper weiß, dass man aus der Vergangenheit nur wenige Schlüsse darauf ziehen kann.
Wer kann den Ukrainekrieg gewinnen? Am schwersten dürfte wohl sein, die Entwicklung der Ukraine einzuschätzen, so offensichtlich zwei in der Vergangenheit begangene Fehler sind: Es war falsch, bei Putin auf
Wer kann den Ukrainekrieg gewinnen?
„Wandel durch Handel“ zu setzen, und es war falsch, dass Angela Merkel und Emmanuel Macron aus Sorge, Putin damit zu reizen, verhindert haben, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wurde. Wäre sie ein NATO-Mitglied, so gäbe es diesen Krieg nicht, denn die NATO ist Russland dank der Stärke der US-Armee in einem konventionellen Krieg so überlegen, dass Putin ihn nie vom Zaun gebrochen hätte. Es ist das Einzigartige des Ukrainekrieges, dass er trotz drückender militärischer Überlegenheit des „Westens“ stattfindet, weil Putin die lockere Hinnahme seines Einmarsches in die Krim als Einladung empfunden hat. Wahrscheinlich hätte er Kiew auch relativ rasch eingenommen, wenn mit Wolodymyr Selenskyj nicht ein so außergewöhnlicher Mann an der Spitze der Ukraine stünde, der statt einer „Mitfahrgelegenheit in die USA“ Waffenhilfe gefordert hat und Marx’ These Lügen straft, dass es die ökonomischen Verhältnisse sind, die den Lauf der Geschichte bestimmen. Obwohl auch das nicht ganz falsch ist: Es war nicht zuletzt das Bedürfnis nach ökonomischem Fortschritt, dass die Staatschefs der Ukraine bewegt hat, sich der EU zuzuwenden, und der „Westen“ hoffte durchaus, sich dadurch zu stärken, dass er auch die riesige rohstoffreiche Ukraine zu den Volkswirtschaften zählen würde, die zu ihm gehören. Die USA haben die Unruhen am Majdan, die letztlich in der Regierung Selenskyjs mündeten, bekanntlich durchaus befördert und die Armee der Ukraine im Wissen um die kritische Nachbarschaft Russlands seit Jahren reformiert und hochgerüstet. Diese beiden Umstände, die außergewöhnliche Entschlossenheit und Führungsstärke Selenskyjs und die weit über Putins Erwartungen hinausgehende Kampfkraft der ukrainischen Armee haben den von ihm erhofften Blitzsieg verhindert. Zwar kämpfen Soldaten, die ihre Heimat verteidigen, immer ungleich besser als Soldaten, die nicht recht wissen, wozu sie in ein fremdes Land entsendet wurden, aber auf den ersten Blick müsste die Armee einer 150-Millionen-Nation mit der zweitstärksten Rüstungsindustrie der Welt im Rücken auch die hochgerüstete Armee einer 44-Millionen-Nation letztlich besiegen. Die Feministin Alice Schwarzer und die Gallionsfigur der deutschen „Linken“, Sahra Wagenknecht waren im Frühjahr 2023 in einem „Manifest für den Frieden“ dessen sogar ganz sicher: „Die Ukraine kann zwar – unterstützt durch den Westen – einzelne Schlachten gewinnen. Aber sie kann gegen die größte Atommacht der Welt keinen Krieg gewinnen. Das sagt auch der höchste Militär der USA, General Milley.“ Aber auch wenn er das sagt, stimmt es nicht: Eben erst hat die Atommacht USA in Afghanistan den Krieg gegen die Taliban verloren und 1968 verlor die Atommacht Sowjetunion dort den Krieg gegen die Mudschaheddin, die von den USA mit Waffen unterstützt wurden. Ausgeschlossen ist ein Sieg der Ukraine gegen die Atommacht Russland also in keiner Weise und ich würde sogar so weit gehen, einen Sieg Russlands über die Ukraine auszuschießen, solange der Westen sie mit Waffen unterstützt. Allerdings war und ist Afghanistan nach zwei afghanischen „Siegen“ ein restlos zerstörtes Land und wie Schwarzer und Wagenknecht ersparte ich der Ukraine lieber das
553
554
Ausblick
gleiche Schicksal: Wenn die Russen erst nach vielen Jahren aufhören, sie zu bombardieren, ist die Ukraine unbewohnbar. Trotzdem maße ich mir nicht, wie Schwarzer und Wagenknecht, an, zu entscheiden, was die Ukrainer und Selenskyj wollen: endlich Frieden – oder Gerechtigkeit bis hin zur Rückeroberung der Krim mit sicher noch hunderttausenden Toten. Der Militäranalytiker Walter Feichtinger hat im ZIB2-Gespräch mit dem Mitunterzeichner des Manifests Hajo Funke gemeint, dass die Ukrainer laut Meinungsumfrage zu 85 Prozent weiterkämpfen wollen. Ich halte Umfragen in Zeiten des Krieges zwar für höchst problematisch – welcher Soldat gibt schon zu, dass er nicht mehr kämpfen will – aber wir haben nur diese Umfragen und Selenskyjs Aussagen. Die sehen Schwarzer und Wagenknecht denkbar kritisch: „Präsident Selenskyj macht aus seinem Ziel kein Geheimnis: Nach zugesagten Panzern fordert er jetzt auch Kampfjets, um Russland auf ganzer Linie zu besiegen.“ Meines Wissens fordert er nicht „Russland auf ganzer Linie zu besiegen“, sondern nur Putins vollen Rückzug aus der Ukraine, und das steht ihm zweifellos zu: Putin hat in der Ukraine nichts zu suchen. Trotzdem – und da treffe ich mich, wenn auch von der anderen Seite kommend, mit dem Manifest – wird der volle Rückzug Putins kaum zu erreichen sein und besteht tatsächlich die Gefahr, dass er, ehe er eine zweifelsfeie Niederlage erleidet, Atomwaffen einsetzt. Ich halte das zwar für sehr unwahrscheinlich, weil es sein und Russland Ende wäre, aber das Risiko, mich in dieser Einschätzung zu irren, ist mir und bekanntlich vor allem Joe Biden zu groß. Insofern – und da treffe ich mich abermals mit dem Manifest – glaube auch ich, dass es zumindest zu Waffenstillstandverhandlungen kommen sollte, die vielleicht in einen ungerechten Kompromissfrieden münden. Vermutlich differiere ich mit Schwarzer und Wagenknecht auch nicht in der Frage, wie ein Frieden aussehen muss, der Chancen darauf hat, von Putin akzeptiert zu werden – nämlich so wie ich es in Kapitel 81 beschrieben habe: Selenskyj müsste auf jeden Fall auf die Krim verzichten, vielleicht auch akzeptieren, dass es in den Städten, nicht den Bezirken Lugansk und Donezk zu neuerlichen, freilich international überwachten Abstimmungen kommt. Im Gegensatz zu Schwarzer und Wagenknecht glaube ich, dass Selenskyj das auch weiß und nicht zuletzt dürfte er sich wohl auch dem bloßen „Ratschlag“ Bidens fügen, wenn der ihm erklärt, dass er ihm nur bis zu einem solchen Kompromissfrieden Waffen und Munition liefert. Völlig unterschiedlicher Meinung mit Schwarzer und Wagenknecht bin ich freilich in der Frage, wie man Friedensverhandlungen am ehesten erreicht. Laut Manifest sollte Kanzler Olaf Scholz „sich jetzt an die Spitze einer starken Allianz für einen Waffenstillstand und für Friedensverhandlungen setzen“, nachdem er die entscheidende Forderung des Manifests erfüllt hat: „Wir fordern den Bundeskanzler auf, die Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen. Jetzt!“ Um das zu fordern, muss man wirklich ein „deutscher Intellektueller“ sein: In der Sekunde, in der Scholz auch nur andeutete, die Eskalation der Waffenlieferungen zu
Russlands gesicherter Niedergang
stoppen, wäre jede realistische Chance auf erfolgreiche Waffenstillstandsverhandlungen dahin, denn Wladimir Putin wäre endlich sicher, diesen Krieg zu gewinnen. Scholz hat denn auch das Gegenteil dessen getan, was das Manifest fordert: Er hat der Lieferung von schweren Panzern zugestimmt. Brigadier Feichtinger hat in der angeführten Diskussion ausgeführt, dass er den Zeitpunkt für Verhandlungen noch nicht gekommen sieht, weil beide Seiten noch nicht sähen, dass sie ihre militärische Position nicht mehr verbessern können. Ich teile diese Ansicht. Man muss nicht so sehr darauf warten, dass Selenskyj durchblicken lässt, dass er zu einem Kompromissfrieden bereit ist, sondern man muss vor allem darauf warten, dass Putin die Bereitschaft zum Rückzug aus der Restukraine erkennen lässt. Bisher verschärfte er seine Angriffe. Putins Bereitschaft zum Kompromiss erreicht man nicht, indem man Waffenlieferungen „stoppt“, sondern indem man sie, ganz im Gegenteil, massiv forciert: Putin muss ernsthaft fürchten, dass sich seine militärische Situation verschlechtern könnte. Man kann allenfalls zugleich mit der Ankündigung weiter eskalierender Waffenlieferung Verhandlungen in Richtung zu einem Kompromissfrieden fordern – nicht die Waffenlieferungen stoppen und dann auf Verhandlungen hoffen. Leider ist meine Hoffnung, dass es zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie diese Zeilen lesen, bereits zu solchen zielführenden Verhandlungen gekommen ist, gering. Aber selbst die plötzliche Implosion des Regimes Wladimir Putins ist denkbar. Dass die Söldner-Truppen seines ursprünglichen Vertrauten Jewgeni Prigoschin trotz der heftigen Kritik, die der an diesem Regime übte, ungehindert bis 40 Kilometer vor Moskau vordringen konnten, ohne dass sich ihnen jemand in den Weg stellte, zeigt, dass Putins Macht beträchtliche Sprünge hat: Es ist keineswegs klar, wie viele der hohen Militärs, der Geheimdienstchefs oder der Oligarchen voll hinter ihm stehen, und wie sicher er sich einer Bevölkerung sein kann, die dem aufständischen Prigoschin zumindest in der Grenzstadt Rostow zugejubelt hat. Putins Regime kann auch von einem Tag auf den anderen zusammenbrechen. Nichts ist in Russland umöglich.
Russlands gesicherter Niedergang In jedem Fall wird Putins Russland noch lange unter den Folgen des Ukrainekrieges leiden. Die Sanktionen haben seine Wirtschaft schon bisher geschädigt, ihr jährliches Wachstum hat nach der Krim-Invasion nur mehr 0,3 Prozent betragen, und mittelfristig werden die Sanktionen Russland massiv schädigen: Es wird aufgrund der Liefersperre für Hochtechnologie in den wichtigsten Bereichen – der Digitalisierung und der Entwicklung künstlicher Intelligenz, und damit auch bei der Entwicklung moderner Waffen – meilenweit zurückbleiben. Darüber hinaus wird die lupenreine Diktatur, zu
555
556
Ausblick
der Russland geworden ist, einem fortgesetzten Braindrain unterliegen: Begabte werden das Land weiterhin, wann immer sie können, verlassen. Sollte Putin den Ukrainekrieg wider Erwarten doch gewinnen, weil der „Westen“ Schwachsinniges à la Alice Schwarzer ernst nimmt, so wird das Russland wirtschaftlich dennoch weiter zurückwerfen: Ein so riesiges Land wie die Ukraine, in dem man von der Bevölkerung gehasst wird, zu besetzen, ist unendlich teuer. Öl, Gas und Kohle, von denen Russland wirtschaftlich lebt, werden zwar unter allen Bedingungen weiterhin Geld einbringen, weil China, Indien und diverse Entwicklungsländer es weiterhin kaufen, aber sie werden dafür deutlich weniger bezahlen als die EU, die den Übergang zu alternativen Energien mit Abstand am schnellsten schaffen wird.
Was bremst den Klimawandel am besten? Damit bin ich bei der gegenwärtig größten Herausforderung aller Völker: Wird es gelingen, eine Klimakatastrophe zu vermeiden? Als ich im Falter schrieb, dass meine größte diesbezügliche Hoffnung dem technologischen Fortschritt gilt, habe ich wütenden Widerspruch geerntet: Der Klimawandel sei nur aufzuhalten, indem wir unser gesamtes ökonomisches Verhalten von Grund auf ändern. Wenn das stimmen sollte, bin ich pessimistisch: Die Menschen werden von einer Wirtschaftsordnung, die mittels Produktion nach maximalem Wohlstand strebt, nur marginal abgehen. Nur in dem Ausmaß, in dem Fortschritte der Technologie – dazu zählt natürlich auch Recycling – ihnen ermöglichen, diesen Wohlstand beizubehalten, werden sie den Ausstoß von CO2 reduzieren. Ich glaube daher, dass die EU bis 2030 kaum die Klimaziele erreicht, die sie sich gesetzt hat. Schon gar nicht werden Russland, China oder Indien ihre in Paris vereinbarten Klimaziele erreichen, denn deren Bevölkerung strebt zwangsläufig unseren Wohlstand an. Aber auf lange Sicht bin ich zuversichtlicher: Einmal, weil ich – wenn auch unbegründet – hoffe, dass sich die Klimatologen bei der Berechnung des Zeitraums, der uns noch zur Verfügung steht, so irren wie die Geologen, die uns 1968 im „Club of Rome“ erklärten, dass wir in 20 Jahren kein Öl mehr hätten. Das heißt nicht, dass ich nicht dafür wäre, alle uns möglichen Anstrengungen zu unternehmen – aber ich bin nicht so sicher, dass Hysterie uns dabei maximal nützt. Mich stört die unterbewusste Sehnsucht mancher Grüner nach der Apokalypse. Ich erinnere mich einer nun 50 Jahre zurückliegenden Diskussion, bei der ein grüner Apokalyptiker Karl Popper an den Kopf warf „Der Mensch ist dabei, die Natur zu vernichten.“ „Vielleicht vernichtet ein Virus die Menschen“, hielt ihm Popper entgegen. Boshaft könnte man sagen, dass sowohl Viren wie Erderwärmung eine faire Chance haben, die Menschen zu dezimieren. Dennoch glaube ich mit Popper an unsere faire Chance zu überleben, weil unser Selbsterhaltungstrieb in dem Ausmaß zunehmen wird,
Was bremst den Klimawandel am besten?
in dem Begleitphänomene des Klimawandels, von Tornados, über Waldbrände bis zu großräumigen Überflutungen noch sichtbarer werden. So wie ich davon ausgehe, dass wir immer rasch genug gentechnisch Impfstoffe herstellen können, die uns vor dem Untergang durch eine tödliche Pandemie schützen, gehe ich davon aus, dass wir letztlich doch genügend großtechnische Verfahren entwickeln und weltweit ausbauen werden, dass es uns möglich sein wird, auf fossile Energien zu verzichten und dennoch ohne größere Einschränkungen Wohlstand zu produzieren. Aktuell ist es leider oder Gott sei Dank die Verteuerung des Öls durch den Ukrainekrieg, die uns wahrscheinlich am wirksamsten vor der Klimakatastrophe schützt: Das unheilige Kartell aus bin Salmans OPEC und Putins Russland hat Öl und Gas in einem solchen Maße verteuert, dass wir die Erschließung alternativer Energien wie nie zuvor beschleunigen. Dass OPEC plus Russland im Frühjahr 2023 beschlossen haben, die Öl/Gas-Förderung neuerlich zu drosseln, stabilisiert den Öl-Preis und wird diesen Zustand für längere Zeit erhalten: Es gibt keine Maßnahme, die den Klimawandel ähnlich wirksam bekämpfte. Denn wenn man vom Methan aus Rindermägen absieht, hängt die Erwärmung der Atmosphäre so gut wie ausschließlich davon ab, wie viel Öl/Gas wir verbrennen. Allein der letzte Beschluss der OPEC + bedeutet, das täglich eine Million Barrels (159 Millionen Liter) weniger Öl gefördert und verbrannt werden. Das bremst die Erwärmung stärker als die paar E-Autos, die täglich mehr auf die Straße kommen. Regierte Vernunft die Politik, so würde eine solche stete Verteuerung des Öls, in sozialverträglich abgefederter Form, einvernehmlich beschlossen. Vorerst hat die EU immerhin beschlossen, den Europäischen Emissionshandel über die Industrie hinaus auf fast alle Sektoren, insbesondere auch auf die Bereiche Gebäude und Verkehr, auszuweiten. Zirka 85 Prozent aller europäischen CO2 -Emissionen sind damit zukünftig an Emissionsrechte gebunden. Die Menge dieser Emissionszertifikate soll kontinuierlich sinken, so dass sie sich sukzessive verteuern, und der entsprechende Kostendruck sollte dazu zwingen, in allen Bereichen das jeweils Kostengünstigste zu unternehmen, um diesen Ausstoß zu verringern. Die EU ist-im Gegensatz zu mirzuversichtlich auf diese Weise ihre Klimaziele bis 2030 und weiter bis 2050 zu erreichen. Ich glaube zwar, dass sie damit große, den CO2 -Ausstoß vermindernde technologische Verbesserungen erreichen wird, aber auch wenn das natürlich sinnvoll ist, zweifle ich, dass es den Klimawandel verhindert: Ich teile diesbezüglich die Einwände des deutschen Ökonomen Heiner Flassbeck, der in seiner Argumentation vom eingangs beschrieben Tatbestand ausgeht: Die Erwärmung der Atmosphäre kann nur in dem Ausmaß vermindert werden, in dem weniger Öl/Gas gefördert und damit verbrannt wird. Global ist das leider bisher trotz des Pariser Klimaabkommens in keiner Weise gelungen: Die CO2 Emissionen sind vielmehr weiter gestiegen, obwohl zumindest die EU seit zwanzig Jahren Gegenmaßnahmen ergriffen hat und es den Emissionshandel in der Industrie längst gibt. Dieser Misserfolg liegt daran, dass die Erwärmung eben nicht in erster Linie davon abhängt, ob in der EU weniger CO2 aus Schloten und Auspuffen kommt – wobei nicht einmal das gelungen ist, aber vielleicht in Zukunft gelingen könnte – sondern ob
557
558
Ausblick
weltweit weniger CO2 emittiert wird. Und diesbezüglich, so meint Flassbeck, unterliege man in der EU einem Denkfehler: Dass in der EU weniger Öl verbrannt wird bedeute nämlich in keiner Weise, dass auch weltweit weniger Öl verbrannt würde. Vielmehr wird jeder Liter Öl, den die EU nicht kauft und verbrennt, sofort von Indien, China oder irgendeinem Entwicklungsland gekauft und verbrannt, um sich unserem Lebensstandard anzunähern. Das sei, meint Flassbeck und meine ich mit ihm, ökonomisch unvermeidlich und bedeute: Was immer wir weniger verbrennen, verbrennen andere mehr. „Nur wenn man sich das eingesteht“, meint Flassbeck, „kann es gelingen, ganz andere internationale Vereinbarungen zu treffen, bei denen die Produzenten fossiler Energieträger von Anfang an mit an Bord sind und eine kontinuierliche Reduktion der Förderung festgeschrieben wird. Nur ein solches globales Abkommen kann den Rahmen vorgeben, innerhalb dessen sich alle erfolgreich anpassen können.“ Ich halte diese Einbindung der Ölproduzenten, voran Saudi Arabiens und der Golfstaaten nicht nur für notwendig, sondern auch für möglich. Durch Jahrzehnte haben sie sich nämlich der Forderung der USA nach einem niedrigeren Ölpreis gebeugt, um sich deren Waffenhilfe zu sichern – umso mehr sollten sie eine Vereinbarung akzeptieren, die ihnen zugesteht, den Ölpreis in einem festgesetzten Rhythmus und Ausmaß kontinuierlich zu erhöhen und damit noch länger von ihrem Öl zu profitieren. Joe Biden unternimmt derzeit leider das Gegenteil: Aus Angst, dass die Teuerung ihn 2024 die Wahlen kostet, versuchte er – erfolglos – die Saudis zur Rücknahme ihres Beschlusses zur Förderkürzung zu bewegen. Aber statt dass die EU sich von ähnlichen Ängsten leiten lässt, sollte sie in dieser Frage die Führungsrolle übernehmen und Biden überzeugen, dass die zitierte Einigung mit der OPEC der bessere Weg ist, weil er zu messbaren Erfolgen bei der Abwehr des Klimawandels führen wird, mit denen alle Beteiligten bei den Wählern punkten können. Das Richtige – die kontinuierliche Verteuerung des Öls durch kontinuierliche Reduktion der Förderung – kann nur geschehen, wenn alle Beteiligten begreifen, dass sie zu ihrem Vorteil ist, indem es den Planeten schützt. Am schwersten ist dieses Begreifen für die breite Bevölkerung: Sie wird die Verteuerung des Öl nur akzeptieren, wenn sie sozialverträglich erfolgt. Dazu müssen die Regierungen über einen neoliberalen Schatten springen: Sie müssen die Steuern auf Arbeit in dem Ausmaß senken, in dem sie die Steuern auf Vermögen erhöhen. Man wird um den Abbau der gewaltigen Differenz zwischen Arm und Reich nicht herumkommen, wenn man die Zukunft lebenswert gestalten will. Gleichzeitig könnte die EU, wenn sie begreift, dass ihr Bemühen weniger Öl zu verbrennen, nicht dazu führt, dass weltweit weniger Öl verbrannt wird, zu einer weniger hektischen Anpassung unseres Öl/Gas-Verbrauchs kommen. Denn Menschen, die damit finanziell massiv überfordert sind, sind sonst auch im Begreifen der notwendigen Verteuerung überfordert.
Die Risiken der EU
Die Risiken der EU Kompliziert, wie die Dinge laut Fred Sinowatz leider sind, ist nunmehr die durch das teurere Öl und Gas bedingte Inflation, die Österreich und der EU die größte Sorge bereitet. Rundum herrscht Ratlosigkeit und Entsetzen bezüglich des fortgesetzten, scheinbar unaufhaltsamen Wachstums der FPÖ, die bei Wahlen zweifellos stärkste Partei würde. In Ostdeutschland ist die AfD stärkste Partei. In Frankreich wächst das rechtsextreme „Rassemblement National“, auch wenn ein kluges Wahlrecht Marine Le Pen vorerst am Regieren hindert. In Italien regieren die rechtsextremen „Fratelli d’Italia“, auch wenn die Regierung Giorgia Melonis weniger rechtsextrem als Hebert Kickl scheint. Es gibt zurzeit kein EU-Land, in dem rechtsextreme Parteien nicht massiv wachsen. Das ist zwar tatsächlich entsetzlich – aber kein Rätsel. Am Beispiel Österreichs: Seit 2000 haben Österreichs Arbeiter laut Rechnungshof einen Reallohnverlust von 13 Prozent erlitten. 2022/23 bescherte ihnen die Inflation primär einen zusätzlichen Verlust von bis zu 11,2 Prozent, den die Regierung durch erhöhte Beihilfen auf 4,2 Prozent gelindert hat. Dass der Reallohnverlust unterer Sozialschichten damit dennoch ein insgesamt gewaltiger ist, der weit über Arbeiter hinausreicht, ist evident. In allen anderen EU-Staaten ist das nicht besser, sondern eher schlimmer: Rundum zweistellige Reallohnverluste der unteren Sozialschicht müssen ein Treibsatz für die Unzufriedenheit mit den Regierenden sein. Für die Inflation als Ursache dieser Verluste sind weder die jeweiligen Regierungen verantwortlich, noch ist die EU daran schuld – sie ist dem beschriebenen Kartell geschuldet. Aber die weit gewichtigere Basis der zweistelligen Reallohnverluste hat sich die EU selbst zuzuschreiben: Sie beruht, wie ich im Kapitel über den Neoliberalismus beschrieben habe, auf ihrer kontraproduktiven Politik staatlichen Sparens und jener deutschen „Lohnzurückhaltung“, die zwingend das Lohnniveau aller konkurrierenden EU-Staaten gesenkt hat und senkt. Die grüne Ex-Abgeordnete Ulrike Lunacek hat mich anlässlich der Vorstellung meines Buches über die „Zerstörung der EU“ dafür kritisiert, dass sich meine Kritik so sehr gegen Deutschland richtet. Aber sie richtet sich nicht gegen Deutschland, sondern nur gegen deutsche Regierungen, die einen Maastricht-Vertrag durchgesetzt haben, der die Staaten zu kontraproduktivem Sparen zwingt; gegen Angela Merkel, die ihn mit dem „Austerity“-Pakt durch Strafandrohungen verschärft hat, und die nicht einmal von ihm abgerückt ist, als der „Internationale Währungsfonds“ feststellte, dass er mehr geschadet als genützt hat, weil, so wiederhole ich, zum ermüdenden x-ten Mal, weniger Einkäufe des Staates zwingend weniger Verkäufe der Unternehmen bedingen. Kürzlich hat mich einer meiner Söhne gefragt, warum ich die immer gleichen, ermüdenden Vorwürfe in Kommentaren wie in Büchern derart stur permanent wiederhole? Weil ich, so habe ich ihm gesagt, die Panik habe, dass sich die Geschichte wiederholen
559
560
Ausblick
könnte: Dass eine falsche Wirtschaftspolitik einen neuerlichen Faschismus heraufbeschwört. An sich hat der Wirtschaftsabschwung durch Covid-19 bekanntlich dazu geführt, dass die EU den Austerity-Pakt und die mit ihm verordnete „Ausgabenbremse“ befristet außer Kraft gesetzt hat, und die Wirtschaft hat sich auch prompt weit schneller als erwartet erholt. Aber Deutschlands Finanzminister Christian Lindner und Österreichs Finanzminister Magnus Brunner wollen die Ausgabenbremse so bald wie möglich wieder installieren, und die EU hat die absurden Maastricht-Kriterien nicht einmal dahingehend modifiziert, dass wenigstens Investitionen, die die Digitalisierung, künstliche Intelligenz und den Klimaschutz fördern, bei der absurden Schuldenobergrenze von 60 Prozent des BIP nicht eingerechnet werden müssen. Der unbeugsame Optimist in mir hofft, dass selbst das massive Wachstum rechter, EU-kritischer Parteien auch sein Gutes haben kann: Es kann dazu führen, dass die EU den Mastricht-Vertrag doch endlich modifiziert. Es braucht dazu nur leider viel Glück. Viel Glück braucht es auch zu einer Lohnpolitik, die in Zeiten der Inflation von der deutschen Lohnzurückhaltung wegkommt. Die Gehälter aller Staatsbediensteten deutlich zu erhöhen, war sicher ein guter Anfang, aber es braucht eine deutliche Erhöhung all der Unternehmenslöhen, die in in zwei Jahrzehnten „Lohnzurckhaltung“ zurückgeblieben sind. An sich erleichtert starke Teuerung Lohnforderungen, aber dem steht im Wege, dass viele Ökonomen befürchten, dass es durch massiv höhere Löhne zu echter Inflation – also zu einer sich selbst verstärkenden Teuerung kommt, in der höhere Löhne höhere Preise nach sich ziehen, die noch höhere Löhne und damit noch höhere Preise bewirken und so fort. Ich sehe diese Gefahr durch die aktuellen Lohnforderungen der Gewerkschaften in der EU zwar nirgends gegeben, aber die zitierten Ökonomen sind der Ansicht, dass die EZB die Zinsen auch aus diesem Grund weiter deutlich anheben muss. Wenn die Staaten der EU endlich doch ausreichend investieren, kann das gut gehen, aber wenn die EU schon bald wieder zum Austerity-Pakt (zur „Ausgabenbremse“) zurückkehrt scheint mir das nicht gesicheert. Ich halte die massive Anhebung des Leitzinses als Reaktion auf die aktuelle Teuerung daher für höchst problematisch: Ich verstehe nicht, wie eine Leitzinserhöhung den Preis für Öl oder Gas senken soll, es sei denn – und das wäre eine Katastrophe – sie bewirkte einen massiven Wirtschaftseinbruch, bei dem von beidem viel weniger gebraucht wird. Ich glaube, dass man diesbezüglich dringend zwischen „Teuerung“ und „Inflation“ unterscheiden muss: Echte Inflation, von der Gefahr ausgeht, liegt nur vor, wenn steigende Preise zu überhöhten Löhnen führen, die ihrerseits noch höhere Preise bedingen, sodass es in einem sich selbst verstärkenden Kreislauf zu immer höheren Preisen kommt. Das ist in der EU sicher nicht der Fall – die Löhne sind ja dank unsinniger „Lohnzurückhal-
Die Risiken der EU
tung“ weniger als die Produktivität gestiegen und in den USA, wo sie unter Trump wie Biden kräftig, aber keineswegs extrem gestiegen sind, spielen sie neben der EnergieVerteuerung eine allenfalls marginale Rolle. Ich kann eine „gefährliche Inflation“ also trotz der sicher unangenehmen Teuerung, gegen die man sozial Schwache zweifelos durch höhere Beihilfen schützen muss, weit und breit nicht sehen. Es sei denn, man vertritt die seltsame Theorie des deutschen „Starökonomen“ Hans Werner Sinn, dass nicht der Ölpreis, sondern die lockere Geldpolitik der Notenbanken die zentrale Ursache der Teuerung wäre. Seltsam ist die Theorie deshalb, weil diese lockere Geldpolitik in den USA durch dreizehn, in der EU durch zehn Jahre mit den denkbar niedrigsten Preissteigerungen verbunden war. Aber Sinn ist nicht umsonst ein „Starökonom“: Nach seiner Ansicht hat sich die Inflation in diesen 10 bis 13 Jahren wie Catchup in einer Plastikflasche angestaut und pflascht nun plötzlich auf einmal heraus. Ganz frei von dieser absurden Sicht scheint man auch in der FED und der EZB nicht zu sein: Hatte die FED den Leitzins angesichts der fortgeschrittenen Erholung der US-Wirtschaft nur in kleinen, behutsamen Schritten angehoben – denn natürlich soll extrem billiges Geld eine Ausnahme und nicht die Regel sein – so reagierte sie angesichts einer auch in den USA zehnprozentigen Inflation mit einer plötzlich raschen und massiven Anhebung, wie sie meines Erachtens nur gerechtfertigt wäre, wenn echte, gefährliche Inflation statt ölpreisbedingter Teuerung vorgelegen wäre. Hintergrund dieses Fehlers: Die „democrats“ befürchteten, dass die hohe Teuerung Joe Biden, obwohl er nichts für sie kann, jede Chance bei Wahlen kosten könnte und das erhöhte den Druck auf die FED. In der EU ereignete sich Ähnliches. Weil sie sich in Wirklichkeit noch immer nicht voll (viel weniger als die USA) von der Finanz- und der Corona- Krise erholt hatte, hatte EZB- Chefin Christine Lagarde den Leitzins ursprünglich niedrig gelassen. Aber dann setzte, ausgehend von ehemaligen deutschen Notenbankgouverneuren, die schon immer gegen das verbilligte Geld opponiert hatten – heftig unterstützt von Österreichs Notenbank- Chef Robert Holzmann – und Ökonomen wie Hans Werner Sinn immer größerer Druck auf das EZB- Direktorium ein, den Leitzins ebenfalls kräftig anzuheben, und im Frühjahr 2023 gab Lagarde dem nach. Dabei hätten EZB wie FED vor abrupten Leitzinserhöhungen gewarnt sein müssen: Genau so hatte FED-Chef Alan Greenspan 2007/8 agiert und damit die Pleite von Lehman Brothers ausgelöst. Diesmal hielt die Silicon Valley Bank (SVB), die sich auf die Finanzierung von Startups spezialisiert hatte, die veränderte Zinssituation nicht aus, denn bei erhöhten Zinsen sinkt der Wert von Anleihen, von denen sie besonders viele in ihren Büchern hatte. Das ist zwar ein eindeutiger Fehler ihres Risikomanagements, aber in einem angespannten Zinsumfeld sind solche Fehler eben letal. Die SVB ging zwar relativ sanft pleite – ihre Kunden erhielten ihr dort angelegtes Geld aus einem gemeinsamen Topf ersetzt, in den alle Banken eingezahlt haben, so dass nur die Aktionäre ihr Geld verloren – aber das Bankensystem stand doch unter Schock. Eine zweite US Bank musste von größeren Banken mit Milliarden gerettet werden, und Joe Biden garantierte den Kunden aller Banken ihre Einlagen, indem die FED versprach, alle in Not geratenden Geldhäuser
561
562
Ausblick
anonym zu unterstützen – das verhinderte einen Bankenrun, bei dem eine Bank dadurch zu Grunde geht, dass plötzlich das Gros ihrer Kunden wie in der SVB ihr Geld abzieht. Noch während die Schockwelle aus den USA an die EU brandete, geriet hier zufällig eine der größten Banken Europas, die Schweizer „Credit Suisse“ in eine dramatische Schieflage, der ebenfalls schwere Managementfehler – eine einzigartige Abfolge von Skandalen – zugrunde lag. Man konnte den Eindruck gewinnen, dass sich die Bankmanager nicht all zu sehr von jenen Großkunden der Credit Suisse unterscheiden, die Gelder aus Drogengeschäften oder Korruption zu waschen versuchten und damit gewaltige Strafen und einen noch größeren Vertrauensverlust seriöser Kunden der Bank provozierten. Jedenfalls endete die Schieflage der Bank damit, dass die größte Bank der Schweiz, die UBS, die Credit Suisse um nur drei Milliarden Euro erwerben und damit auffangen musste, wobei die Schweizer Notenbank mit zig Milliarden Schützenhilfe leistete. Da es in der EU bereits seit 2014 eine Einlagesicherung gibt und weil die Banken hier die ganze Zeit über strenger als in den USA mittels Stresstests überwacht werden, legte sich die Aufregung auch in der EU relativ rasch: Es dürfte uns keine neue Finanzkrise drohen. Was der EU sehr wohl droht – ist eine Rezession. Denn ein massiv erhöhter Leitzins erschwert die Investitionen, die in der EU dank staatlichen Sparens sowieso zu spärlich geflossen sind.
Die Widerstandsfähigkeit der EU Habe ich in der Vergangenheit vor allem gefürchtet, dass die Europäische Union zerfallen würde, so bin ich jetzt zwar noch immer nicht sicher, dass ihr Zusammenhalt Deutschlands Lohnzurückhaltung und den noch immer nicht reformierten AusterityPakt aushält, aber ich habe gelernt, dass sie außerordentlich widerstandsfähig ist. Sie hat bisher noch jede Krise durch Weiterwursteln bewältigt, weil sie am Ende doch zu irgendeinem Kompromiss gefunden hat. So hat die Covid-19 Krise bekanntlich nicht nur dazu geführt, dass der Sparpakt befristet ausgesetzt wurde, sondern dass die EU gegen den Widerstand Angela Merkels und Sebastian Kurz’ erstmals gemeinsame Kredite aufgenommen (Schulden gemacht) hat und damit über ein eigenes Budget verfügt. Aus dem haben alle Staaten erhebliche Summen bekommen, um sie in Digitalisierung, KI und Klimaschutz zu investieren, aber voran den hochverschuldeten Staaten des „Südens“ wurden darüber hinaus Geschenke gemacht, die etwas von dem Unheil gutmachen, das ihnen die deutsche Lohnzurückhaltung zugefügt hat, bewirkt sie doch, dass die Unternehmen des „Südens“ ständig Marktanteile an deutsche Unternehmen verloren haben. Durch diese Geschenke ist es auf einem Umweg zu einer Art hinkender einmaliger „Transferunion“ gekommen, wie es sie in den USA dank
USA: Entwarnung ist leider unmöglich
ihrer Verfassung ständig gibt. Das hat mit Sicherheit wesentlich dazu beigetragen, ein Auseinanderbrechen der EU bisher vorerst zu verhindern. Ansonsten ist die EU – und das bedingt einen Teil ihrer Widerstandsfähigkeit – die Region der Welt, in der zu leben mit Abstand am angenehmsten ist. Sie wird wirtschaftlich zwar immer hinter den USA zurückbleiben, aber das muss bei erfolgreichem Weiterwursteln ihre Existenz nicht gefährden, und der doch weitgehend erhaltene Sozialstaat wird Arm und Reich hoffentlich nie in dem lebensgefährlichen Ausmaß spalten, in dem das in den USA der Fall ist. Die größte Sorge bereitet mir, dass die EU in ihrer Sicherheit so extrem von den USA abhängt, obwohl kein künftiger US-Präsident akzeptieren wird, dass voran Amerikaner einem Aggressor wie Putin entgegentreten. Ich wiederhole meine Überzeugung, dass die EU eine eigene Streitmacht braucht und sie ohne Verlust an Wohlstand auch finanzieren kann, wenn sie die eigene Rüstungsindustrie ausbaut. Im Idealfall ergänzt in spätestens zehn Jahren eine militärisch gestärkte EU die militärisch seit jeher starken USA.
USA: Entwarnung ist leider unmöglich Außerhalb ihrer militärischen Potenz bleiben die USA leider weiterhin ein krankes Land: Die Kluft zwischen Arm und Reich oder zwischen Republikanern und Demokraten schließt sich nicht, weil die Republikaner nicht auf eine bloß politische, sondern eine quasi religiöse Weise nach rechts gerückt sind und sich unter ihnen derzeit keine Führungspersönlichkeit zeigt, die dem Einhalt gebietet. Die USA brauchen eine „Aufklärung“, in der sich rationales Denken gegen evangelikales Fühlen durchsetzt, und leider tragen die durchschnittlichen Schulen, abseits der Eliteschulen und Eliteuniversitäten, wenig dazu bei, eine intelligente Bevölkerung heranzubilden. Ein populistischer Republikaner vom Schlage Donald Trumps bleibt als Präsident unverändert eine reale Möglichkeit, denn ein krankes Wahlrecht verschafft den Republikanern einen ständigen Startvorteil, den die evangelikalen weißen Männer in den republikanischen Bundesstaaten beständig durch Gesetze festzurren. Nur weil sie sich gleichzeitig darauf versteifen, den Schwangerschaftsabbruch zu verbieten, haben die Demokraten faire Chancen, die nächsten Wahlen zu gewinnen. Wobei es meines Erachtens ein großer Vorteil wäre, wenn sie sie nicht mehr mit Joe Biden als Kandidaten bestritten: Leute meines Alters sind für solche Jobs zu alt. Aber manchmal sind sie leider auch zu alt, das zuerkennen: Derzeit will Biden wieder antreten – ich kann nur hoffen, dass er trotz seines Alters gewinnt. Sollte der GAU eintreten, dass Donald Trump wiedergewählt wird, sind die USA ernsthaft von einem evangelikalen Faschismus bedroht, und das bleibt für den Rest der Welt die Katastrophe, als die sie Simon Wiesenthal eingestuft hat. Aber auch der
563
564
Ausblick
Sieg eines nicht so düsteren Republikaners wird die USA angesichts des derzeitigen Zustands dieser Partei nicht heilen.
Der chinesische Drache ist halb so stark China wird zwar wirtschaftlich weiterhin weit besser als Russland, aber längst nicht so gut wie die EU oder gar die USA funktionieren. Seine Industrie wächst zwar ständig, aber sie ist extrem ineffizient: China muss ungleich mehr Manpower, Rohstoffe und Energie aufwenden, um ein bestimmtes Produkt herzustellen als westliche Industrieländer. Das BIP ist diesbezüglich kein tauglicher Indikator, weil es diesen so viel größeren Aufwand außer Acht lässt. In seiner Produktivität, als viel wesentlicherer ökonomischer Kennzahl, hinkt China westlichen Ländern, voran den USA um Längen hinterher. Hinzu kommt, dass es sich durch die lange, scheinbar extrem erfolgreiche Ein-Kind-Politik ein extremes Alterungsproblem eingehandelt hat: Die arbeitsfähige Bevölkerung ist zwar in absoluten Zahlen riesig, aber relativ hat sie ungleich mehr Alte als in westlichen Ländern zu erhalten – das kostet. Auch Chinas Armee ist zwar in absoluten Zahlen riesig, aber in ihrer viel wichtigeren Ausrüstung mit wirkungsvollen Waffen kommt sie einmal mehr nicht entfernt an die US-Armee heran. Das Einzige, was in China wirklich perfekt zu sein scheint, ist die Absicherung der Diktatur Xi Jinpings, die gespenstische Züge trägt: Dass die Bürger via Gesichtserkennung bis in den letzten Winkel verfolgt und gemäß ihrem Gehorsam gegenüber der Diktatur belohnt und bestraft werden, haben sich nur George Orwell und Aldous Huxley ausmalen können – dass es Wirklichkeit werden könnte, habe ich bis vor zehn Jahren nicht geglaubt. Da dachte ich, dass sich in China, eher als in Russland, „Wandel durch Handel“ ereignen könnte: Der so massiv steigende Wohlstand könnte wie in Südkorea in Demokratie münden. Aber das war wie in Russland ein Irrtum, der in der Person Xi Jinping begründet scheint. Allerdings bringt seine sich ständig verschärfende Diktatur einmal mehr einen gewaltigen Nachteil für die Effizienz der Wirtschaft mit sich: In diesem Klima können sich die Wissenschaften nicht frei entfalten und wandern die besten jungen Leute ab, um anderswo zu studieren und des Öfteren zu bleiben: Es gibt eine gewaltige chinesische Zuwanderung in die USA – wie Russland leidet China ständig unter einem massiven Braindrain. Aber auch unmittelbar steht die Diktatur der optimalen Entwicklung der Wirtschaft massiv im Weg: Unternehmen und Unternehmer stoßen ununterbrochen an bürokratische Mauern, wie sie zur Aufrechterhaltung einer Diktatur unverzichtbar sind. Während der geniale Unternehmer Jack Ma, der das mit Amazon vergleichbare Unternehmen Alibaba gegründet hat, neue Initiativen zurückstellen musste, treffen, wie seinerzeit in der Sowjetunion Parteifunktionäre milliardenteure Entscheidungen, die
Das blauschwarze Risiko
Industrieruinen zurücklassen und zu Monsterpleiten führen. Diese kaschiert der Staat durch immer höhere unproduktive Schulden. Derzeit kann man sich zwar nicht vorstellen, wie die chinesische Hightech-Diktatur jemals gestürzt werden kann und Xi Jinping verkündet lauthals, wie China die USA als Weltmacht ablösen wird – aber genau das verkündeten auch die Diktatoren der Sowjetunion, unmittelbar bevor sie erstaunlich rasch in sich zusammenbrach, weil sie genau diesem Wettstreit wirtschaftlich nicht gewachsen war.
Das blauschwarze Risiko Was das aus der Sicht solcher weltpolitischer Entwicklungen fast unsichtbar kleine Österreich betrifft, so sehe ich für seine nähere Zukunft blauschwarz: Wenn wir nicht sehr viel Glück haben, wird das Land ab Herbst 2024 durch eine blau-schwarze Regierung unter der Führung der FPÖ „orbanisiert“. Schon die Erfolge Jörg Haiders und Heinz Christian Straches haben gezeigt, wie empfänglich die Österreicher für rechtsextreme politische Vorstellungen und Führungspersönlichkeiten sind, aber Herbert Kickl, der seinen Vorgängern schon immer die süffigsten Slogans geliefert hat – „Daham statt Islam“, „Pummerin statt Muezin“, – überragt beide an Intelligenz und demagogischer Redegewalt. Er hat die Probleme, vor die Covid-19 und Inflation jede Regierung jedes Landes gestellt hat, und die Fehler die natürlich auch unsere schwarz-grüne gemacht hat, optimal genutzt, um unter dem Rückgriff auf alle hierzulande vorhandenen fremdenfeindlichen und reaktionären Instinkte Stimmen zu gewinnen und seine Partei damit erstmals in allen Umfragen zur mit Abstand stärksten des Landes zu machen. Ursprünglich schien selbst das nicht ganz so gefährlich, weil auf Bundesebene keine andere Partei mit ihr koalieren wollte, aber nach keineswegs zwingenden Koalitionen in den urschwarzen Bundesländern Niederösterreich und Salzburg scheint das anders: Die Abscheu, die der liberale und vor allem christliche Flügel der ÖVP dem Weltbild Kickls entgegenbrachte, ist erloschen. Zugleich hat man ein fast deckungsgleiches Wirtschaftsprogramm, erinnert sich der funktionierenden Zusammenarbeit unter Sebastian Kurz und will auf keinen Fall auf Regierungsmacht verzichten, selbst wenn nun Kickl als Kanzler den Ton angäbe. (Allenfalls ist er bereit, Karl Nehammer für die ersten zwei Jahre den Vortritt zu lassen und das Kanzleramt dann erst zu übernehmen – die Macht wäre immer bei ihm.) Hans Rauscher hat im Standard darauf hingewiesen, wie wichtig neben einem Wirtschaftsressort – man wird mit guten Chancen das Finanzministerium anstreben – das Justiz-Ressort für die ÖVP ist: Ein schwarzer Justizminister oder mit blau-schwarzer Mehrheit bestellter „Bundesanwalt“ kann dort all die Strafverfahren einstellen, die nicht nur viele VP-Funktionäre, sondern die ÖVP als Ganzes massiv belasten. Das alleine dürfte reichen, die blau-schwarze Koalition allen anderen Möglichkeiten vorzuziehen.
565
566
Ausblick
Die einzige Möglichkeit, diese Koalition und ihre Risiken mit Sicherheit zu vermeiden, besteht darin, dass voran die SPÖ bis zum Herbst 2024 so viele rechte Wähler und Nichtwähler hinzugewinnt, dass eine Koalition aus SPÖ, Grünen und NEOS die Mehrheit im Parlament stellt. (Denn wenn die SPÖ Wähler von NEOS oder Grünen hinzuzugewinnt, ist nicht gewonnen.) Leider halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass das der in sich gespaltenen SPÖ gelingt und hege daher die Angst, dass Österreich 2024 neben Ungarn, aber vor Polen und Italien, tatsächlich zu dem Land der EU wird, das die rechtsextremste aller Regierungen aufweist und dessen Kanzler Kickl mehr Einwände gegen die Waffenlieferungen und Sanktionen der EU und der USA zu Gunsten der Ukraine hegt als gegen Russlands Überfall auf dieses Land. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und mit Sicherheit lässt früher oder später ein MegaKorruptionsskandal die FPÖ scheitern – ehe ihr nächster Obmann wieder 30 Prozent erreicht.
Epilog
Den aktuellen Zustand der Welt einen guten zu finden ist angesichts der hier angerissenen Themen leider unmöglich. Jedenfalls hat es meine Generation, die derzeit rundum abtritt, entschieden leichter gehabt als die, die mir folgt. Trotz gelegentlicher Krisen war es jemandem, der arbeiten wollte, zumindest in Westeuropa immer möglich, auch Arbeit zu finden, von der er leben konnte – das scheint mir in absehbarer Zeit weder für die Länder Südeuropas, voran Spanien, Italien und Griechenland, noch für die Länder des ehemaligen Ostblocks gesichert: Die Wirtschaftspolitik der EU (Deutschlands) hat sie nachhaltig benachteiligt, statt sie zu stärken. Aber selbst für Österreich bin ich nicht sicher, dass meine Kinder wie ich erleben werden, dass es ständig aufwärts geht. Die bevorzugte Situation, zu der uns „Lohnzurückhaltung“ auf Kosten des „Südens“ verholfen hat, hat uns derzeit zwar extreme Knappheit, voran an qualifizierten Arbeitskräften beschert, und ich hoffe, dass meine Kinder immer unter diese qualifizierten Arbeitskräfte zählen werden, aber die doch ziemlich große Gruppe mäßig qualifizierter Österreicher hat eben doch beträchtliche Reallohnverluste erlitten: Über eine adäquate Wohnung zu verfügen, wird für sie eher schwer sein – ,jedenfalls schwerer als für meine Generation. Insgesamt werden wir zwar unverändert wohlhabender – dafür sorgt der technologische Fortschritt – aber die Kluft zwischen Reichen und Wohlhabenden einerseits und Geringverdienern bis Armen andererseits ist doch auch in Österreich und den reichsten Ländern des „Nordens“, voran Deutschland und Holland in einem kritischen Ausmaß gewachsen. Die letzten Jahrzehnte waren eben immer weniger Jahre des sozialistischen Ausgleichs und immer mehr Jahre der neoliberalen Aufspaltung. Der Sieg faschistischer oder zumindest faschistoider Parteien ist in vielen Ländern selbst Westeuropas eine reale Möglichkeit. Die „sozialdemokratische Epoche scheint, so wie es aussieht, mit meiner Generation zu Ende. Vor allem aber war meine Generation zwar einem „kalten“, nicht aber einem tatsächlich, mitten in Europa wütenden Krieg ausgesetzt. Dass er unendliches Leid über die Ukraine, aber auch für viele Familien Russlands mit sich gebracht hat, wissen wir; dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse Russlands drastisch verschlechtern werden, können wir vermuten, aber wir können nicht wissen, wie sehr sich durch diesen Krieg auch unsere wirtschaftlichen Verhältnisse verschlechtern – nur dass sie sich kaum verbessern werden ist sehr wahrscheinlich. Nur dem Klimawandel werden wir durch diesen Krieg etwas besser gerüstet gegenüberstehen, weil wir relativ rasch sehr viel mehr grüne Energie erschlossen haben werden. Aber das heißt nur, dass wir seinen Auswirkungen relativ, nicht dass wir ihnen absolut besser gewachsen sind. Es besteht, wenn ich Klimatologen folge, die Gefahr von Kippreaktionen – extreme Dürre und Walbrände oder umgekehrt Überflutungen
568
Epilog
können plötzlich extrem zunehmen. Die uns folgende Generation kann drastischen Hungerkatastrophen in schon jetzt armen Ländern und durch sie ausgelöster Massenflucht gegenüberstehen, wie sie meine Generation trotz unzähliger Kriege nicht erlebt hat. Zumal die üblichen Kriege, etwa in Afrika, ja keineswegs enden werden. Nur dem Klimawandel werden wir durch den Krieg in der Ukraine etwas besser gerüstet gegenüberstehen, weil wir relativ rasch sehr viel mehr grüne Energie erschlossen haben werden. Aber das heißt nur, dass wir seinen Auswirkungen relativ, nicht dass wir ihnen absolut besser gewachsen sind. Es besteht, wenn ich Klimatologen folge, die Gefahr von Kippreaktionen: extreme Dürre und oder umgekehrt Überflutungen können plötzlich extrem zunehmen. Das kann zu Hungerkatastrophen in vielen schon jetzt armen Ländern führen und Massenflucht nie da gewesenen Ausmaßes auslösen. Besser gar nicht vorstellen will ich mir, was es für die Generation meiner Kinder bedeuteten kann, wenn es wegen Taiwans zu einer militärischen Konfrontation zwischen den USA und China kommt, während der Krieg in der Ukraine unverändert fortdauert. Aber auch wenn es nicht zu diesem GAU kommt, war meine Generation, dessen bin ich sicher, in einem einzigartigen Ausmaß vom Schicksal begünstigt. Wir hatten das unglaubliche Glück, seit Ende des zweiten Weltkrieges in einem Land zu leben, in dem der Wohlstand für alle ständig zugenommen hat und in dem innerer und bis vor kurzem äußerer Frieden herrschte. Dafür kann man nur unendlich dankbar sein.
Personenregister
A Adenauer, Konrad 49 Adler, Viktor 418 Akerlof, George 510 Allmayer Beck, Peter 315 Anderfuhren, Hans 86ff Anderson, Jon Lee 415 Andreae, Clemens August 375ff Andropow, Juri 520ff Androsch, Hannes 180, 187, 202, 211, 213, 220, 233–238, 263, 278ff, 325ff, 336ff, 345, 382, 412, 484 Arafat, Jassir 282–289 Aslan, Raul 488 Assad, Bashar al 131, 288, 440, 442, 529 Aznar, José 422 B Bacher, Gerd 185ff, 191, 242, 253, 270, 338, 365 Badian, Vova 256 Baerbock, Annalena 517 Bandion-Ortner, Claudia 407 Bandion, Josef 324 Barazon, Ronald 299 Barenboim, Daniel 290 Bauer, Franz 278ff, 309 Bauer, Otto 122ff, 300, 418 Beinschab, Sabine 486ff Belton, Catherine 523ff, 527 Benya, Anton 213, 464ff Berger, Maria 485 Bergmann, Kurt 316 Bezos, Jeff 511 Biden, Joe 289, 354, 426, 481 Blaschke, Eleonore ( Nolle) 75ff
Blecha, Karl 191, 232, 263, 301, 324, 328 Blümel, Gernot 339, 460, 462, 487, 498, 508 Böhm, Karlheinz 472 Brandstaller, Trautl 214 Brezina, Thomas 355ff Broda, Christian 12, 37, 39ff, 55, 83ff, 147, 153ff, 157ff, 172, 186, 192ff, 200ff, 212, 220ff, 233ff, 264, 280ff, 328, 336, 338, 361, 485 Bronner, Oscar 121, 127, 153ff, 172ff, 192ff, 205, 216, 240, 242, 252, 292, 311ff, 317, 342ff, 346, 351, 363, 377ff, 385, 395ff, 405, 408 Brunner, Magnus 498, 508, 559 Burger, Norbert 208 Busek, Erhard, 104ff, 172, 210, 213, 279ff Bush, George 416 Bush, George W. 439, 443 C Calvin, Johannes 23, 86, 129, 501, 511 Chodorkowski, Michael 526ff Chruschtschow, Nikita 371, 531, 536, 543 Churchill, Winston 190, 311 Clinton, Bill 439, 443 Clinton, Hillary 354, 426, 437, 529 Corti, Axel 249ff, 293 Coudenhove-Kalergi, Richard 293 Cybulska, Sophia 42, 109 Czernin, Hubertus 216, 219, 268, 330ff, 384 D Dalma, Alfons 185, 253 Dalos, Aniko 208, 223 Darwin, Charles 501 Davis, William 260
570
Personenregister
Deix, Manfred 179ff, 281, 296, 365, 390 Dekan, Ursula 80ff, 105, 397 Deutsch, Christian 517 Dichand, Hans 108, 241, 429 Dolfuß, Engelbert 182, 422, 492, 501 Draghi, Mario 451 Draxler, Klaus 104ff, 132, 361 Dubcek, Alexander 164, 166, 371, 520ff E Eibl, Erich 177, 179 Eichenseder, Herbert 396ff, 403, 405ff Eichmann, Adolf 144ff, 157ff, 277 Einstein, Albert 27, 34, 39 Eisenhower, Dwight D. 258, 502 Eissler, Max 185 Enickl, Günther 254ff, 287, 314ff, 345ff, 379 Eschig, Walter 100ff, 131ff F Fälbl, Christoph 385 Falk, Kurt 203, 241 Fally, Johanna 223 Falschlehner, Gerhard 357 Faymann, Werner 184, 429ff, 467 Feichtinger, Walter 554f Felbermayr, Gabriel 538, 548 Fellner, Helmuth 486 Fellner, Wolfgang 301, 486 Figl, Leopold 535 Fischer, Heinz 45, 102, 233, 324, 408, 528, 535 Flassbeck, Heiner 486, 515, 557 Foregger, Egmont 328 Frankl, Viktor 63 Freud, Siegmund 18, 22, 24, 29, 53, 59, 75 Freihofner, Gerald 327 Frischenschlager, Friedhelm 365f Fritsch, Sybille 316 Fuchs, Hubert 486
Fuchs, Johann 396 Furtwängler, Wilhelm
160
G Gaddafi, Muammar 282, 441 Gansterer, Helmut 347 Gaulle, Charles de 190, 292 Gehmacher, Ernst 30, 124f Glattauer, Daniel 153, 380, 382, 396 Glawischnig, Eva 481 Glienke, Christl 105 Glöckel, Otto 28 Gottschlich, Maximilian 406 Gorbach, Alfons 184 Gorbatschow, Michael 258, 371f, 521ff Götz, Alexander 276 Grasser, Karl Heinz 43, 413, 418ff, 485 Gratz, Leopold 200, 263, 279, 301, 324 Gredler, Wilfried 183, 202f Grill, Alois 237 Grohmann, Karl 224 Gross, Heinrich 154ff Gusenbauer, Alfred 184, 424, 427ff, 485 Guttenberg, Karl Theodor 311 H Habek, Robert 517, 519 Haider, Hans 217 Haider, Jörg 12, 183, 190, 201ff, 286, 302, 318, 337, 363, 365, 374ff, 412ff, 419ff, 429, 467, 474 Haider, Robert 203 Hammerl, Elfriede 29, 54, 90, 151ff, 214ff, 219, 382, 401 Handke, Peter 34 Hanke, Franz C. 303ff, 315 Hanusch, Ferdinand 27 Hartl, Karl 234 Hautval, Adelaide 69 Havel, Václav 312 Hayek, Friedrich August 234, 304, 474
Personenregister
Helbich, Leopold 275 Helnwein, Gottfried 179 Herberstein, Cecily 293 Herz-Kestranek, Miguel 249 Herzog Herbert 196, 199, 236, 246, 327 Hildebrandt, Dieter 214 Hitler, Adolf 41, 48, 50, 56, 181, 201, 203, 207, 209, 248, 251, 258, 284, 292, 325, 331, 334, 422, 425, 492, 501, 529, 531, 535f, 542 Ho Chi Minh 259, 441 Hofer, Norbert 492 Holböck, Josef 353 Höpfel, Frank 406 Horaczek, Nina 495 Hübel, Reinhard 151 Huf, Jules 265 Hummelbrunner, Walentina 103, 309, 349, 389ff, 398ff, 407, 410 Humplik, Heinz 127ff Hussein, Saddam 259ff, 439ff I Igler, Hans 252f, 270 In der Maur, Wolf 128 J Johnson, Boris 190 Johnson, Lyndon B. 438, 445 Jonas, Franz 28, 221 Jelzin, Boris 372, 521, 523, 525 K Kahane, Karl 363 Karas, Othmar 322 Kern, Christian 475, 488, 490 Keynes, John M. 187, 207, 234, 294, 304f, 461f, 473f, 496, 511 Kickl, Herbert 15, 209, 337, 421, 470, 472, 475, 492, 534 Kirchschläger, Rudolf 98, 167, 217, 263, 267
Klaus, Josef 79, 184, 186f, 210, 220, 296, 312, 336f Klenk, Florian 479, 495 Klecatsky, Hans 186, 336 Klima, Viktor 374, 418, 424, 535 Knight, Andrew 313 Kissinger, Henry 35, 147, 337 Kogler, Werner 369, 419, 489 Koo, Sebastian 462 König, Franz 220 Konrad, Christian 244f, 370, 383, 393 Koren, Stephan 177, 187, 235, 336, 473 Köstler, Arthur 27 Kotanko, Christoph 347, 363 Kreisky, Bruno 12, 182–191, 208–213, 220–222, 233–235, 244, 253, 257, 262–277, 282–283, 285–286, 288–289, 292–299, 301–305, 308–311, 318–326, 331–332, 336–339, 345, 363, 371, 374, 413, 418, 429, 473–475, 483, 485, 492, 535 Kreuzer, Franz 122ff, 127, 150f, 162, 185, 188 Kromp, Wolfgang 296 Kurz, Sebastian 12, 105, 182, 202, 227, 245, 262, 272, 300, 319, 339, 368, 418f, 453, 457, 459, 467, 471ff, 475ff, 480f, 485ff, 490ff, 498, 508, 510, 512, 562 L Lacina, Ferdinand 302f, 408 Lahodinsky, Othmar 312, 347 Lammer, Robert 59f, 159f Lanc, Erwin 286, 288f Laschet, Armin 516f Lauda, Niki 295 Lazarsfeld, Paul 29, 31f, 36, 45, 57 Leherbauer, Helmut 139 Lehner, Peter 165, 167 Leitgeb, Gerd 198, 203f, 214, 254, 346f, 349, 380 Leitl, Christoph 467f, 475 Lenhardt, Helmut 253
571
572
Personenregister
Lenin, Wladimir Iljitsch 41, 86, 300 Leupold-Löwenthal, Harald 321, 398 Lieben, Heinrich 57, 61 Lieben, Henriette 14, 59, 248 Lindner, Christian 460, 462, 498, 517ff, 538, 559 Lingens, Ella 15, 79 Lingens, Kurt 15, 47, 54, 73 Lingens, Klaus 137, 140, 223 Lingens, Walter 50 Löffler, Sigrid 214ff, 249, 316, 347, 364 Löger, Hartwig 460, 462, 486 Löhr, Alexander 331ff Lorenz, Konrad 321f Lorenz-Dittlbacher, Lou 498 Loudon, Ernst Gideon 252, 303, 315f, 347ff Lütgendorf, Karl 174, 270, 326 M Macron, Emmanuel 426, 551, 553 Maier, Martin 125 Maljartschuk, Tanja 532 Mandl, Maria 70f Mang, Christian 405 Mann, Thomas 18 Marboe, Ernst Wolfram 217f, 316 Marx, Karl 26, 31, 40, 155, 501 Masser, Werner 327 Massiczek, Eduarda 73, 84f Mauthe, Jörg 322 Mayr, Hans 324 Meinl-Reisinger, Beate 547 Mengele, Josef 24, 63, 65, 70 Merkel, Angela 272, 451, 453, 459, 462, 469, 508, 514, 516, 518, 528, 537, 542f, 553, 559, 562 Merlicek, Manfred 392, 402f, 405, 407 Merz, Friedrich 516 Milosevic, Slobodan 34, 374 Mitterlehner, Reinhold 184, 475, 486ff Mock, Alois 186, 330, 339, 374, 552
Molden, Fritz 128, 146, 173f, 293, 334 Molterer, Wilhelm 184, 428, 430 Motesiczky, Karl 14–18, 58ff, 248 Müllner, Viktor 186 N Nawalny, Alexei 527 Neider, Heinrich 234 Nehammer, Karl 484, 489, 534 Nenning, Günther 39, 166, 255, 265, 319, 321f Nidal, Abu 282f, 288f Nittel, Heinz 282, 287f, 414 Nobel, Alfred 34 O Obama, Barack 35, 261, 437, 439, 442ff, 449, 466, 500, 510, 529ff, 537 Obonya, Cornelius 251 Olah, Franz 154, 182 Orth, Elisabeth 248ff Ortner, Christian 347, 360, 363, 370 P Palmers, Walter Michael 186 Partik-Pablé, Helene 280 Pasterk, Ursula 214 Paul, Bernhard 179 Peter, Friedrich 180f, 183, 262 ff, 268, 273, 275f, 335, 338, 365, 413 Petzner, Stefan 208 Piedboeuf, Nini 47, 50, 223 Piech, Ferdinand 295 Piller, Peter 253ff Pittermann, Bruno 184f, 300 Pittermann, Elisabeth 263 Pluhar, Erika 326 Politkowskaja, Anna 527 Pollak, Oscar 48, 121ff, 127f
Personenregister
Popper, Karl 27, 31, 33, 37ff, 105, 124.146.159ff, 178, 298, 319, 321, 366, 522, 547, 552, 556 Portisch, Hugo 122, 128, 146, 148–156, 164, 168–176, 185, 241, 259, 380, 398, 408 Poßarnig, Renate 282 Powell, Colin 259ff, 439 Prober, Christine 135f, 148 Proksch, Udo 295, 324–328 Pröll, Josef 184, 467, 486 Pruscha, Hans 245f Putin, Wladimir 12, 166, 258, 291, 326, 355, 372f, 426f, 442, 518, 520–544, 552–556, 562 Q Quadflieg, Will
250
R Raab, Julius 181f, 184, 535 Rabl-Stadler, Helga 247, 365 Rabl, Peter 191, 219, 338, 349, 363f, 370 Radzyner, Joana 313 Rainer, Christian 370, 376f, 495 Rathkolb, Oliver 332 Reagan, Ronald 190, 371, 438f, 455, 511, 522 Reich-Ranitzky, Marcel 219 Reiner, Elsa 19, 22ff, 26, 31f, 97 Reiner, Friedrich 19ff, 26 Reisner, Markus 542 Reiter, Werner 229 Reiwald, Paul 153, 328 Renner, Karl 184 Riedl, Joachim 151, 215, 218, 312, 314, 317, 347, 363 Riess-Passer, Susanne 413, 419ff Rogoff, Kenneth 459 Roosevelt, Theodor 34 Rosenbaum, Eli 334 Roth, Joseph 59, 88f, 140, 326 Rothensteiner, Walter 486 Rosé, Alma 70
Ruhsert, Kai 482 Rumpold, Armin 281 Russell-Hochschild, Arlie
500, 502
S Sailer, Toni 125 Salcher, Herbert 398, 320 Sallinger, Rudolf 211, 213 Sartawi, Issam 283–290, 292 Schallenberg, Alexander 489 Schäuble, Wolfgang 451, 459f, 462f, 508, 516 Schellhorn, Franz 449 Schenk, Otto 251 Scheuba, Florian 155 Schiele, Egon 28, 85 Schilder, Elisabeth 86 Schleinzer, Karl 186, 210 Schmidt, Hans 339, 340 Schmid, Thomas 475f, 486ff Schmidt, Heide 365, 367 Schmidt, Helmut 311 Schneyder, Werner 214, 424 Scholz, Olaf 460, 498, 508, 516–518 Scholz, Kurt 231 Schüssel, Wolfgang 182, 244, 262, 276, 412f, 418–420, 424f, 535 Schwarzenberg, Karl 224, 236 Schwarzenberg, Theresa 225, 311 Schwarzer, Alice 553, 555 Seitz, Karl 27 Selenskyj, Wolodimir 527f, 530, 534, 541ff, 553ff Sichting, Rolf 265 Sidlo, Peter 387, 486 Silberbauer, Karl 145 Sinn, Hans Werner 560f Sinowatz, Fred 262, 268, 276, 318f, 323, 328, 330ff, 336, 374, 413, 558 Slavik, Felix 182, 195–198, 236, 324, 400 Söder, Markus 516 Soros, George 472
573
574
Personenregister
Sobotka, Wolfgang 475 Spira, Elisabeth 214f Stackl, Erhard 215, 218, 313–315, 347, 350 Stalin, Josef 38f, 41, 114, 146, 174, 207, 300, 311, 372, 532 Stecher, Reinhold 397ff Steger, Norbert 276, 318f, 365, 413 Steiner, Gustav 236, 308 Sterk, Robert 192, 194 Strache, Heinz C. 12, 183, 206, 208f, 262, 325f, 337, 418, 420f, 470, 475, 479f, 485f Streissler, Erich 31, 373f, 448f Strohal, Eberhard 164f, 167, 175f Stützel, Wolfgang 461 T Taus, Josef 104, 186, 190, 211–213 Teller, Eduard 34 Thatcher, Margaret 294, 300 Thommen, Achilles 19f Thurnherr, Armin 474 Tichy, Gunther 117, 294, 305 Tramontana, Reinhard 296, 326f, 349, 377 Traxler, Alexander 256, 372, 390, 521 Treichl, Heinrich 139, 236, 246, 248, 251, 265, 297, 309, 357, 371 Treichl, Helga 265 Treichl, Wolfgang 248, 251 Trudeau, Pierre 505 Trump, Donald 12, 83, 261, 285, 290, 293, 312, 354, 426, 439, 443, 445, 466, 481, 488ff, 495f, 500–505, 513, 515, 529, 550f, 563 Tschebull, Jens 139, 175–179, 215, 238–243, 252–254, 371, 379f, 385 Turrini, Peter 217f, 251, 322 U Unterberger, Andreas
405f
V Van der Bellen, Alexander 419 Voska, Helmut 177, 194, 197, 214, 216, 218, 223, 255, 302, 314–316, 345–348, 370, 377, 380 Votzi, Josef 347, 363 Vranitzky, Franz 213, 303, 328, 332, 336–340, 371, 374f, 383, 408, 412, 418ff, 535 W Wagenknecht, Sarah 553f Wailand, Georg 239 Waldheim, Kurt 167, 266–268, 323, 330-336, 345, 413, 429 Waldstein, Georg 176, 215, 239, 241, 253 Wallner, Christine 472 Wallner, Leo 237 Wantoch, Erika 214, 316 Weber, Max 501 Weinzierl, Erika 265 Weissberg-Cybulski, Alexander 37, 39, 41f, 46, 60f, 108, 110, 112, 132, 188, 220, 234, 248 Weisskopf, Victor 33–37, 45, 80, 132, 146, 161, 297f Weninger, Ewald 168 Wiener, Oswald 100, 186 Wiesenthal, Simon 41, 43, 143–148, 183, 191, 193, 196, 252, 262f, 268–276, 284, 286f, 330–334, 338, 345, 371, 429, 500, 513, 550, 563 Wolf, Armin 498 Wolf, Franz Ferdinand 315, 346f Worm, Alfred 199f, 279f, 302, 332, 345f, 351, 363f, 377, 397, 432 X Xi Jinping
550, 564
Personenregister
Y Yellen, Janet
510f, 512
Z Zadic, Alma 485 Zatopek, Emil 165 Zilk, Helmut 35, 126, 150, 190, 202, 324
575






![Der Austro-Porsche: Bruno Kreisky und die österreichische Automobilindustrie [1 ed.]
9783205208433, 9783205206798](https://dokumen.pub/img/200x200/der-austro-porsche-bruno-kreisky-und-die-sterreichische-automobilindustrie-1nbsped-9783205208433-9783205206798.jpg)
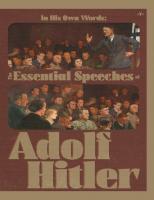


![Zeitzeuge eines Jahrhunderts: Eine Familiengeschichte zwischen Adolf Hitler, Bruno Kreisky, Donald Trump und Wladimir Putin [1 ed.]
9783205218128, 9783205218104](https://dokumen.pub/img/200x200/zeitzeuge-eines-jahrhunderts-eine-familiengeschichte-zwischen-adolf-hitler-bruno-kreisky-donald-trump-und-wladimir-putin-1nbsped-9783205218128-9783205218104.jpg)