Tausendundein Abend. Mein Sängerleben [1 ed.]
Anton Dermota, lyrischer Tenor und weltweit gefeierter Mozartinterpret, der fast alle Opernhäuser und Konzertsäle der We
871 34 184MB
German Pages 378 Year 1978
Polecaj historie
Citation preview
Anton Dermota, lyrischer Tenor und weltweit gefeierter Mozartinterpret, der fast alle Opernhäuser und Konzertsäle der Welt kennt, schrieb mit „Tausendundein Abend“ die Chronik eines exemplarischen Sängerlebens. Eine Autobiographie, die das Musikleben im letzten halben Jahrhundert spiegelt.
'S
S ^ to n Uermota ^iisendimdeiii P
Mein H o e i Sangerleben
m
Anton Dermota, lyrischer Tenor, „Meistersänger des Belcanto“ und einer der bedeutendsten Mozart interpreten unserer Zeit, dem nach Joseph Marx „jene ideale Verbindung von Schönheit und intensivem Ausdruck geglückt ist, die das Wesen der Mozart’schen Gesangsmelodie ist“, gibt hier seinen Lebensbericht. Eine Autobiographie, die in ihrer Geradlinigkeit sympathisch berührt und die uns den Menschen und den Künstler näherbringt. Dermota wurde 1910 in einem slowenischen Dorf geboren, und die Schilderung seiner Kindheit - „wir waren unser elf oder zwölf, so genau kann ich das nicht mehr sagen“ - ist ein Stück Kulturgeschichte aus der alten österreichisch-ungarischen Monarchie, wie man es wohl sonst kaum noch wo nachlesen kann. Der Weg vom Kleinknecht des Pfarrers von Bled über die Laibacher Organistenschule und die Gesangsausbildung bei Frau Radö-Danielli in Wien bis zum ersten Opernengagement war weit und hart. Aber auch eingesäumt von freundlichen Gestalten und glück lichen Fügungen. Konsequenter Fleiß ist sicherlich eine der Stärken Dermotas und mit dafür verantwortlich, daß er neben den großen Mozartrollen auch die wesentlichen Partien des italienischen, französischen, deut schen und slawischen Repertoires gesungen hat, daß seine künstlerische Spannweite von der Klassik bis
zur Moderne, vom Oratorium bis zum Lied, dem seine besondere l.iebc gehört, reicht. Aber diese Authobiographie bleibt nie auf die Selbst darstellung beschränkt. Es gibt ja kaum einen Dirigenten von Toscanini bis zu Böhm und Karajan, unter dem er nicht gesungen hat und kaum große Sänger und Sängerinnen, mit denen er nicht auf der Bühne gestanden wäre. Und so weitet sich die Lebensgeschichte dieses Künst lers, der fast alle Opernhäuser und Konzertsäle der Welt kennt und seit mehr als 40 Jahren zum Ensemble der Wiener Oper gehört, wie von selbst zu einem Spiegelbild des Musiklebens im letzten halben Jahr hundert. Das schlichte und noble Zeugnis eines exemplarischen Sänger lebens.
Umschlagfoto: Fotostudio Payer, Wien
J
A N T O N DERM OTA
Tausendundein Abend ME I N S Ä N G E R L E B E N
Lizenzausgabe mit Genehmigung des Paul Neff Verlages, Wien, für die Deutsche Buch-Gemeinschaft C. A. Koch’s Verlag Nachf., Berlin Darmstadt Wien Diese Lizenz gilt auch für die Bertelsmann Club GmbH, Gütersloh, die Europäische Bildungsgemeinschaft Verlags-GmbH, Stuttgart, die Buchgemeinschaft Donauland Kremayr & Scheriau, Wien und die Buch- und Schallplattenfreunde GmbH, Zug/Schweiz '© 1978 by Paul Neff Verlag, Wien Schutzumschlag; Günter Hädeler Druck und Bindung: Wiener Verlag Printed in Austria • Buch-Nr. 03404 i
M einer Frau, der Fegleiterin in der Kunst und im Fehen
Inhalt Vorwort............................................................................. I. Wir waren unser elf oder zwölf............................
9 11
K in d h eitsta g e in K ro p a / A l s K lein k n ech t in B le d
II. Hunger macht m utig........................................... V o m O rgan isten sch ü ler
37
C h o rm eister
III. Aus dieser Stimme wird nichts.................................
50
M u sik stu d e n t u n d O p em ch o rist in L a ib a c h
IV. Sie fangen ja gut an ................................................
61
V o n d e r Schule K a d ò an d ie S ta a tso p er
V. Willst du zu mir nach Salzburg kommen? ............
81
E r s te K öllen , e rste P rem ieren
VI. Dreierlei Feuertaufen...........................................
95
M a tth ä u s-P a ssio n , E u gen O negin u n d A sse n tie ru n g
VII. Es gibt keine kleinen Partien................................ 108 Begegnung m it P ß tz n e r u n d S tra u ss / N eu e A u fg a b en , neue K ollegen / H o ch ze it im D r itte n R eich
VIII. Wenn das nur gut ausgeht....................................131 H itle r -B ille tts u n d ih re F olgen / D e r G a u le ite r u n d d ie P a rtisa n en / F u rtw ä n g ler u n d d ie N eu n te
IX. Wen die Götter lieben......................................... 139 V o n S troh m ZM B öhm / D ie G e b u rt eines W ien er M o z a r ts tils
X. Nur Ruhe, meine Herrschaften ............................ 151 R equ iem vo r dem E isern en / B eethoven in K r a k a u / D ie O p e r bren n t
DERMOTA / TA U SE N D U N D E IN ABEND
XL Waren wir nicht großartig...................................... 156 D k S tu n de N u ll /
W ir spielen w ied er O p e r /
M ein e M os^ irtkollegen
XII. Paß nix gut.......................................................... 186 M it d e r W ien er O p e r in d ie W e lt / M e in D e b ü t am T e a tro C olon
XIII. Kein Grund 2ur Beunruhigung ...............................210 W ie d e r in B uenos A ir e s / L a n d u n d L e u te in A rg e n tin ie n / D a s verh in d erte M e t-G a s ts p ie l
XIV. Wir sind alle nur Menschen .....................................230 Begegnung m it g ro ß en D irig e n ten / K o k o sch k a u n d d ie Z a u b erflö te / A u f g ro ß e r T o u r in A u s tr a lie n
XV. O Gott, welch ein Augenblick..............................256 W ir k au fen ein H a u s / O p ern fest u n d O p e rn k rise / Z eitgen össisch es am R in g / M ein e F a m ilie
XVI. Viele sind zwar berufen, wenige aber auserwählt . . . . 274 D ie P ro b lem a tik des G esan gsu n terrich ts / W ettb ew erb e u n d M e iste rk u rse / V o m M o z a r ts til u n d d e r K u n st d es L iedgesan ges
XVII. Das Schöne erhebt...............................................297 In tern a tio n a le F e stsp ie ltä tig k e it / M ein e O rg e l / A u to g ra p h e n - u n d K u n stsam m eln a ls L eid en sch a ft
XVIII. Nun schmiede mich, den
letzten Stein...............321
G edan ken zu m O p ern b etrieb von h eu te / D a s G en eration sproblem / Z w e ite r F rü h lin g
Anhang.............................................................................. 340 R e p e rto ire / E h ru n gen u n d T ite l / D isk o g ra p h ie / B ildn ach w eis / P erson en register
Vorwort Als ich 1976 meine vierzigjährige Zugehörigkeit zur Wiener Staatsoper beging, erhielt ich aus Schloß Grafenegg in Nieder österreich, wo ich einigemale bereits gesungen hatte, eine Einla dung besonderer Art. Dr. Gerhard Grossberger, der sich mit Erfolg bemüht, aus Grafenegg ein lebendiges Kulturzentrum zu machen, schlug mir vor, anläßlich meines Jubiläums in einem Zwiegespräch mit dem Wiener Musikschriftsteller Professor Dr. Alexander Witeschnik einen Rückblick auf mein Sängerleben zu geben. Ich sollte von meiner Herkunft, von meiner Kindheit und meiner künstlerischen Entwicklung erzählen, wobei das Gespräch durch Gesangseinlagen, begleitet von meiner Frau am Flügel, und durch die Wiedergabe teils schon historischer Schall platten ergänzt werden sollte. Die Matinee, der man den Titel »Ein Leben für die Kunst« gegeben hatte, kam bei den Zuhörern so gut an, daß sie ein paar Monate später als Abendveranstaltung des »Wiener Kulturkrei ses« im Musikverein wiederholt wurde. Das Grafenegger Zwie gespräch hatte aber noch eine weitere Auswirkung: meine Freun de und Bekannten, die mich zum ersten Mal vor einem Publikum sprechen gehört hatten, begannen mir zuzureden, daß ich doch die Erinnerungen und Erfahrungen meines Sängerlebens nieder schreiben sollte. Ich hatte gegen diesen Vorschlag nichts als Bedenken. Erstens fand ich es überflüssig, die vielen Künstlermemoiren noch weiter zu vermehren. Zweitens widerstrebte es mir einfach, mich über mein Berufs- und Privatleben zu verbreitern. Drittens bezweifelte
DERMOTA / T A U S E N D U N D E IN ABEN D
ich, daß die Schilderung meines Lebens einen größeren Leser kreis interessieren könnte und obendrein schien es mir sehr frag lich, ob sich dafür ein Verleger finden würde. Alle diese Beden ken wurden von meinen Freunden der Reihe nach widerlegt. Sie meinten, daß die fünf Jahrzehnte meines Sängerlebens wenigstens für meine Familie und für meine Freunde aufgezeichnet werden sollten und daß ich auch der Fachwelt gegenüber gewisse Ver pflichtungen hätte. So ließ ich mich schließlich überreden. Ein Verleger fand sich, der das Risiko des Unternehmens auf sich nahm und mir den Mut zur Arbeit gab. Ihm, dem Paul Neff Verlag, und seinem Lei ter, Karl Andreas Edlinger, habe ich also zu danken. Namentlich zu danken habe ich weiters Jürgen E. Schmidt, der die Diskogra phie besorgt hat, ebenso aber auch allen Freunden, die mir bei diesem Wagnis - denn das war es für mich - mit Rat und Tat zur Seite standen. Mein ganz besonderer Dank aber gilt meiner Frau, denn ohne ihre Hilfe wäre dieses Buch nie geschrieben worden. Erwähnen muß ich noch eine besondere Schwierigkeit bei die ser Arbeit: ich habe nie ein Tagebuch geführt und so gut wie kei ne Aufzeichnungen über mein Leben und meine Tätigkeit gemacht. So mußte ich mich fast ausschließlich auf mein Gedächtnis verlassen. Es können mir daher Irrtümer unterlaufen sein, für die ich den Leser im voraus um Nachsicht bitten muß. Er möge das Buch so aufnehmen, wie es gedacht ist: als den Bericht eines ausübenden Künstlers, der damit Rechenschaft legen wollte, und dessen Metier nicht das Schreiben, sondern das Singen und Musizieren war und ist. Wien, Ober-St. Veit, im Sommer 1978 A. D.
Wir waren unser elf oder zwölf Kindheitstage in Kropa — A ls Kleinknecht in Bled
Meine Kindheit stand im Zeichen der Armut, einer heute kaum noch vorstellbaren Armut. Der kleine slowenische Marktflecken Kropp im Bezirk Radmannsdorf - heute Kropa bei Radovljica -, wo ich am 4. Juni 1910 im Sternbild der Zwillinge geboren wur de, zählte 600 Seelen und 104 Häuser, von denen drei baufällig und unbewohnbar waren. Der Boden, auf dem der Ort steht, ist hart und karg. Es gab nur drei Bauern in der Gemeinde, von denen einer der Pfarrer und der zweite der Gastwirt war. Die übrigen Bewohner Kropas lebten von Nägeln, das heißt vom eisenverarbeitenden Handwerk. In den bewaldeten Bergen, die das Tal einschließen, wurde bereits vor Jahrhunderten Eisenerz gefunden und gefördert, im Ort wurde es verhüttet und verarbeitet. In neuerer Zeit freigelegte Reste von spätmittelalter lichen Schmelzöfen beweisen die alte Eisenhütten-Tradition des Orts. Verarbeitet wurde das Eisen vor allem zu Nägeln der ver schiedensten Sorten: Zimmermannsnägel, Schiffsnägel, Nägel für Eisenbahnschwellen, Schubnägel. Sie alle wurden von Hand geschmiedet. Noch heute fühle ich das wohlige Gruseln, das uns Buben beim Blick in die schwarze Tiefe der aufgelassenen Bergwerk schächte ergriff Wenn wir Steine hinunterwarfen, schienen sie ins Unendliche zu fallen. Noch liegt mir das unablässige, hundert fache Hämmern im Ohr ; noch sehe ich die glühenden Essen vor
DERMOTA / TA U S E N D U N D E IN ABEND
mir, die von primitiven Bretterbuden umschlossen waren. Rund um die Feuerstelle standen dicht gedrängt die Arbeiter, denn das kostbare Holzkohlenfeuer mußte rationell genützt werden. Die Blasebälge der Essen wurden mit Wasserkraft angetrieben. Eines dieser alten Schaufelräder wird in Kropa heute noch als Schau stück in Betrieb gehalten. Die primitive Bretterbude, durch die im Winter der eisige Wind pfiff, so daß die Arbeiter im Gesicht die Hitze, im Rücken die Kälte hatten, nannten wir »vigenc«, ein Wort, das nicht zu übersetzen ist. Und die »vigenci« gaben dem Ort sein charakteri stisches Gepräge. Sie erstreckten sich rechts und links der Kroparica, des Gemeindebaches, von dessen Ursprung bis zum Orts ausgang. Die Kroparica war für uns die Lieferantin des Trink-, Gieß- und Waschwassers und zugleich die Energiequelle für Essen und Hämmer, also faktisch Lebens- und Arbeitsspenderin in einem. Fast das gesamte Leben der Ortsbewohner spielte sich in den »vigenci« ab. Die Arbeit begann um vier Uhr früh und endete meist spät am Abend; fünfzehn Stunden und mehr hatte man »Feuer in den Augen«. Eine geregelte Mittagspause gab es nicht. Gekocht wurde am offenen Feuer der Esse. Jede Familie hatte da ihre Eisentöpfe stehen, in denen die einfachen Speisen gewärmt wurden —saure Rüben, Fisolen, Erdäpfel oder »Zganci«, eine Art Polenta aus Mais- oder Heidenmehl. Die Mahlzeit, zu der sich auch die nicht beim »vigenc« beschäftigten Familienmitglie der einfanden, wurde an Ort und Stelle verzehrt. Die Kinder kamen fast während der Arbeit zur Welt ; auch ich bin gleichsam inmitten der hämmernden Mühsal, bei Feuer und Lärm, geboren, denn nicht nur der Vater, ein stattlicher Mann vom Jahrgang 1880, werkte am Amboß, sondern auch die um vier Jahre jüngere, zart gebaute Mutter. Es war Schwerarbeit. So ziale Rechte oder Hilfen gab es nicht; wer krank wurde, blieb sich selbst überlassen. Die alten Leute, die nicht mehr arbeiten konnten, erhielten im günstigsten Fall ein »kot«, eine Ecke in der
I / WIR W A R E N UN S ER ELF O D E R ZWÖLF
Fami lienWohnung, wo sie geduldet waren. Andernfalls fristeten sie ihr kümmerliches Dasein im Armenhaus. Dort lebten sie von den milden Gaben, die sie sich in der bäuerlichen Umgebung zusammenholten, sofern sie gehfähig waren. Noch heute sehe ich sie vor mir, die gebeugten Gestalten, mit der »malha«, dem Bet telsack, auf dem Rücken. Natürlich hatten wir keinen Arzt. Erst viele Jahre später kam der Doktor aus Radmannsdorf, der Bezirksstadt, einmal die Woche mit seinem Zeugl herüber und ordinierte drei Stunden in einer Privatwohnung. Er war ein gestrenger, wortkarger Herr der alten Schule, ein Tscheche mit schmalem, knochigem Gesicht und gepflegtem Äußeren. Dr. Oves —im Slowenischen bedeutet das Wort »Hafer« - sah seine Patienten oft bloß an und entließ sie ohne Untersuchung schon in der Tür wieder als gesund. Bis etwa zur Jahrhundertwende erfolgte die Entlohnung der Arbeiter nur zum kleineren Teil in Bargeld, der Hauptteil bestand in Naturalien. Die Bemessung der Lebensmittel menge fiel oft recht willkürlich aus: »Du hast in dem Monat schon dein Mehl, deinen Kukuruz, deine Erdäpfel und deinen Speck bekom men. Jetzt ist Schluß!« So herrschte damals bei uns noch eine Art Leibeigenschaft, die Joseph II. doch längst aufgehoben hatte. An der Spitze der Gemeinde stand der Pfarrer, der von seiner Pfründe, deren Felder seine Angehörigen bearbeiteten, leben konnte; an zweiter Stelle in der Ortshierarchie stand der Ober lehrer und dann kamen die »gospoda«, die Herren. Das waren die ansässigen Unternehmer, denen die »vigenci« mit den Essen, zumeist aber auch die Häuser gehörten, in denen die Arbeiter wohnten. Mieterschutz gab es keinen. Wenn die Kinder zu laut waren oder dem Hausherrn sonst etwas nicht paßte, wurde gekündigt. Der übliche Kündigungstermin war im Frühjahr zu Georgi. Oft mußte der Vater unser lebhaftes Treiben mit den Worten dämpfen : »Ruhe, sonst wird uns der Hausherr den Heili gen Georg ansagen!« Das Gros der Ortsbewohner war den »gospoda« auf Gedeih
DERMOTA / T A U S E N D U N D E IN AB EN D
und Verderb ausgeliefert. Auch die Familie Dermota mit ihrer großen Kinderschar mußte alle paar Jahre umziehen. Das änderte sich erst, als sich etliche mutige Leute zusammentaten und eine Genossenschaft gründeten. Sie erfolgte parallel mit einer allmäh lichen Ablösung der Handarbeit durch die Maschinen. Mein Vater war einer der ersten, die von der Handschmiede in die Fabrik hinüberwechselten. Dort erhielt er endlich als Lohn auf die Hand, was es bisher für ihn kaum gegeben hatte : bares Geld. Das bedeutete eine, wenn auch bescheidene, doch bisher kaum gekannte persönliche Freiheit. Der Vater war ein loyaler Lfntertan des Kaisers; vermutlich erhielt er einst den Taufnamen - Joza = Joseph - nach dem Kai ser in Schönbrunn, während die Mutter Liza ihren Namen der Kaiserin Elisabeth verdankte. Obgleich unser Teil Sloweniens Oberkrain nannte man ihn damals —von Kärnten durch die Karawanken getrennt war, gehörte er bis zum Ende des Ersten Weltkrieges zur Monarchie. So kam ich, der Drittgeborene, noch als Alt-Österreicher auf die Welt. Wir waren unser elf oder zwölf —ganz genau weiß ich das nicht mehr, denn einige Geschwister starben schon im Säuglings alter. 1907 kam jedenfalls als erstes Kind ein Mädchen zur Welt und wurde nach dem Vater Jozefa getauft. Ein Jahr später traf der Bruder Hijacint ein, der mit 18 Jahren auf einen rostigen Huf nagel trat und unter Tetanus-Krämpfen starb. Unter den Brü dern, die nach mir kamen, gab es neben Leopold, dem Vierten in der Reihe, der später wie ich Sänger wurde, die »Heiligen Drei Könige«: Gasper, das Kind Nummer sechs, und die Zwillinge Melchior und Balthasar. Aber die erlauchten biblischen Namen brachten den Dreien kein Glück. Balthasar starb im Säuglingsal ter, Melchior mit neun Jahren, Gasper fiel samt seinem Sohn einem Autounfall zum Opfer. Mehr als ein Dutzend Jahre hindurch gab es in der Familie regelmäßig ein »freudiges Ereignis«. Daß mehrere Kinder die Windeln nicht überlebten, wurde nicht weiter als tragisch emp1 4
1 / WIR W A R E N UNSER ELF O D E R ZWÖLF
Funden, Gott gab und Gott nahm, und wenn er nahm, war ein Bsser weniger. Ich habe mich bis zu meinem zwanzigsten Lebensjahr eigentlich kaum je sattessen können. Um die schmale Kost etwas aufzubessern, wurden wir Kinder in die reicheren Nachbardörfer geschickt —Dobrava, Cesnjica, Jamnik oder wie sie alle hießen —um Fallobst zu sammeln und auf den Erdäpfelund Rübenfeldern Nachernte zu halten, soweit das die Bauern erlaubten. Zuweilen ernteten wir auch dann, wenn sie es nicht erlaubten. Das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern war patriarcha lisch. Vater und Mutter wurden von uns nicht geduzt, sondern mit »Sie« angesprochen. Es gab keinen Widerspruch, väterliche Befehle waren wortlos zu erfüllen. Beide, Vater und Mutter, waren - das spürten wir - voll Güte ; aber es war eine verschäm te Güte, man zeigte sie nicht. Der Tag begann für uns Kinder mit der Messe um 7 Uhr, in die wir täglich geschickt wurden. Auf dem Weg zur Kirche liefer ten wir eine leere Milchkanne im Pfarrhaus ab. Der Pfarrer besaß zwölf Kühe, und seine Schwester, die Pfarrersköchin, teilte die kostbare Milch zu, die für die jeweils Kleinsten unter uns bestimmt war. Abgerechnet wurde am Wochenende. Nach der Messe, bei der ich ministrierte, holten wir die gefüllte Milchkan ne ab, um sie heimzubringen. Beim Verlassen des Pfarrhofs hat ten wir Tag für Tag mit einer Versuchung zu kämpfen. Neben dem Kuhstall befand sich nämlich der Schweinekoben, in dem auch das Schweinefutter zubereitet wurde. In einem Riesenkessel brodelten da Rüben, Karotten und Erdäpfel. Ihr verführerischer Duft störte manchmal sogar unsere Andacht in der Kirche. Die Versuchung war zu groß, als daß wir nicht mitunter rasch und verstohlen ein paar Brocken aus dem Kessel holten. Später in meinem Leben hat mir selten etwas so herrlich geschmeckt wie diese dampfenden Brocken aus dem Schweinekessel, mit denen wir unseren morgendlichen Heißhunger stillten. Nach einem bescheidenen Frühstück, meist im »vigenc« einge 1 5
DERMOTA / TA U S E N D U N D E IN ABEN D
nommen, kam die Volksschule und nach der Schule die Arbeit. Wir hatten die Holzkohle für die Schmiede von den Meilern in den Wäldern zu holen, die oft bis zu zwei Stunden entfernt lagen. Oder wir gingen, mit der Kraxe auf dem Rücken, Kleinholz für den Winter sammeln, denn Brennholz zu kaufen, daran war nicht zu denken. Da alle Kinder des Orts auf Holzsuche in die Wälder ausschwärmten, war die Konkurrenz groß und es dauerte oft lan ge, bis wir unsere Trage vollhatten. Einmal durfte ich die Mutter nach Ljubljana, Sloweniens Hauptstadt, begleiten, wo sie Nägel abzuliefern und dafür Le bensmittel einzutauschen hatte. Gegenüber dem Bahnhof setzte sie mich an den Straßenrand und sagte: »Da bleibst du sitzen! Ich bin bald wieder zurück!« Aber das war ein vages Verspre chen; sie kam nicht so bald wieder. Mir wurde bang und bänger. Der Verkehr auf der Straße, der Lärm der fremden und, wie mir schien, riesigen Stadt, der Staub und die Hitze —das alles ängstig te mich. Wenn ich je in meinem Leben so etwas wie völlige Gott verlassenheit verspürt habe, war es damals am Straßenrand in Ljubljana. Fast ebenso schlimm erging es mir, wenn mich der Vater auf seinen Handelswegen zu den Bauern der Umgebung mitnahm. Auch er verspätete sich mitunter. Dann fiel die Dämmerung ein, und ich saß einsam und verlassen in irgendeiner Bauernstube bei wildfremden Menschen. Ich hörte die Ave-Glocken läuten. Um diese Zeit wäre ich daheim schon zu Bett gegangen. Vater und ich aber hatten noch einen weiten Weg durch unheimliche, dunk le Wälder vor uns. Angst und Heimweh packten mich, ich weinte bitterlich. Als der Vater endlich kam, bat ich ihn flehend: »Nach Hause, Vater, nach Hause, bitte nach Hause ...!« Zwei weitere Vorfälle sind mir noch im Gedächtnis geblieben. Einmal hatte ich vor Beginn des Schulunterrichts Holzkohle von der Sammelstelle einzuholen. Es war strenger Winter und klirren der Frost. Durch unsern Ort fließt, wie erwähnt, die Kroparica. Sie entspringt außerhalb des Dorfs direkt aus dem Berg und — i6
I / WIR W A R E N UN S ER ELF O D E R ZWÖLF
laut Valvasors bekanntem Werk »Ehre des Herzogtums Krain« — soll ihr Wasser heilkräftig bei Augenleiden sein. Ich hatte meine Kohle im »vigenc« abgeliefert und wollte, ehe ich zur Schule ging, rasch im Bach die kohlegeschwärzten Hände waschen. Die Stufen waren vereist, ich glitt mit meinen Holzschuhen aus, der Buckelkorb fiel mir mit einem Schwung übers Genick und ich stürzte kopfüber in das eiskalte, reißende Wasser. Zum Glück waren Leute zugegen. Sie fischten mich heraus, trockneten mich an der nächsten Esse, die Mutter steckte mich ins Bett und so bekam ich nicht einmal einen Schnupfen, dafür aber einen schul freien Tag. Damit bewies sich für mich die Heilkraft des Wassers, von der ich sonst, zumindest an den Augen, nicht viel verspürt habe. Der zweite Vorfall hatte ernstere Folgen. Es war spät im Herbst, als wir zum Holzklauben ausgeschickt wurden. Der Tag war kurz, es dunkelte früh. Wie sollten wir in der knappen Zeit im Wald unsere Kraxen füllen ? Da kamen wir plötzlich auf dea sündigen Gedanken, das nötige Brennholz aus dem Schuppen unseres Nachbarn zu holen. Der hatte schon einen prächtigen Vorrat aufgestapelt. Wir konnten die Prügel zwischen den luftig angenagelten Latten leicht mit Händen greifen. Und das taten wir denn auch. Stück um Stück langten wir hastig und schwei gend heraus und füllten damit unsere Kraxen bis oben. Daheim lobte der nichtsahnende Vater das schöne Holz, das wir so eifrig gesammelt hatten. Aber die Sache kam rasch ans Licht, und es gab ein fürchterliches Donnerwetter. Natürlich erhielt der Nachbar sein Holz zurück, wir aber bekamen die gerechte Strafe. Unser Vater konnte sehr streng sein. Das Knien in der Ecke war für diesmal zu milde: man legte uns noch ein kantiges Scheit unter die Knie, damit uns für alle Zeiten das Holzstehlen verginge. Dazu kam das Schlimmste, der Hunger, denn zur Strafverschärfung wurde uns auch die Nahrung entzo gen. Gottlob gab es die Mutter, die insgeheim die Strafe milderte, die sie zuvor doch ausdrücklich vom Vater gefordert hatte. 1 7
DERMOTA / T A U S E N D U N D E IN ABEN D
Nächtlicherweile trat sie ans Bett des Delinquenten und steckte ihm ein Stück Brot unter die Tuchent. Und damit war das göttli che Gleichgewicht in unserer Welt wieder hergestellt. Und noch ein Ereignis, das belanglos scheint und doch unsere kindlichen Herzen zum erstenmal mit bitterer Enttäuschung füllte: Es war mitten im Ersten Weltkrieg, als der Bürgermeister durch öffentlichen Anschlag kundtat, daß zu medizinischen Zwecken getrocknete Maiglöckchenblätter benötigt und entspre chend bezahlt würden. Wir stürzten uns mit Feuereifer auf die Erschließung dieser Einnahmsquelle. Wochenlang streiften wir durch die Wälder, sammelten die angeblich begehrten Blätter, trockneten sie in der Sonne und füllten sie in zahllose Säcke —bis sich herausstellte, daß das Ganze eine Ente, ein Gerücht, war und daß keinerlei Interesse an getrockneten Maiglöckchenblättern bestand. So endeten unser Fleiß, unsere Mühe und unsere Hoff nung auf dem Misthaufen ... Trotz allem war es eine glückliche Kindheit. Wir hatten ja kei ne Vergleichsmöglichkeiten, weil es auch den anderen nicht bes ser ging. Besitz oder Eigentum gab es für uns Kinder nicht. Klei der, Schuhe, selbst das Spielzeug war allen Kindern in der Fami lie gemeinsam. Die Hosen oder Kittel vererbten sich von einem auf den andern, bis sie zerfielen. Zuletzt sah man die Hose vor lauter Flicken nicht mehr. So lebten wir neidlos und wunschlos und nahmen alles, wie es kam. Und schon die kleinsten Freuden machten uns reich. Wenn es dunkel wurde, begannen wir zu singen. Licht gab es keines, Kerzen oder Petroleum waren zu teuer. So sangen wir, um uns die Angst vor der Finsternis zu vertreiben: Volkslieder oder einfache Kunstlieder, einstimmig oder mehrstimmig. Unser Vorrat an Liedern war unerschöpflich. Gesungen wurde übrigens nicht nur daheim im Dunkeln, sondern immer und überall im Ort. So groß die Armut war, so unbarmherzig die Mühsal, so auf geschlossen war man für Gesang und Spiel. Unsere Gemeinde i8
I / WIR W A R E N UN S ER ELF O D E R ZWÖLF
l)csaß nicht nur einen Kirchenchor, sondern auch einen Gesangs verein und überdies einen Theaterverein, der unter der Leitung von Pfarrer und Lehrer stand. Gespielt wurde an Sonntagnach mittagen um drei, »nach dem Segen«, in den Maga2Ìnraumen der Cjenossenschaft. Im »Parterre« saß man auf Nägelkisten, im »Parkett« auf Sesseln, die aus allen Häusern zusammengeholt wurden. Die Eigentümer schrieben ihre Namen mit Kreide drauf, um Verwechslungen auszuschließen. Das Einholen der Sessel war für uns Kinder eine Aufgabe, die wir mit Leidenschaft erfüll ten. Wir turnten dann meist auf die »Galerie«, das heißt auf bis zu fünf Meter hoch aufgestapelte Kisten, was nicht ganz unge fährlich war. Bisweilen polterte einer der Buben während einer dramatischen Szene mitsamt den Kisten ins »Parterre«. Ich erinnere mich noch an ein Stück, das sich um Andreas 1lofers tragisches Schicksal rankte. Unser Vater spielte den Tiro ler Freiheitshelden, ich durfte sein Söhnlein darstellen, das sich in einer rührenden Szene von ihm zu verabschieden hatte. Ein anderes Drama, das mich besonders beeindruckte, stammte von dem vielgespielten slowenischen Dramatiker Franc S. Finzgar, einem Geistlichen. Mein Vater war ein hagerer, mittelgroßer, sehniger Mann mit schwarzem, buschigem Haar und dunklem Teint. Er war beweg lich, temperamentvoll, fleißig, interessiert und mit einer schönen, ausdrucksvollen Schrift begabt. Er las auch viel : Zeitungen, Zeit schriften und Bücher. Kropa besaß eine öffentliche Bücherei ; sie wurde von der Familie eifrig genützt. Später, als es der Vater bis zum Vertreter der einzigen nennenswerten slowenischen Versi cherung gebracht hatte, bestellte er sogar ein Buchabonnement, durch das jährlich vier bis fünf Bände ins Haus kamen. Manche musische Begabung steckte in ihm. So war er nicht nur ein eifriger Heldenvater im Theaterverein, sondern auch ein geschätzter Baßbariton, der bis ins hohe Alter im Kirchenchor und im Chor des Kulturvereins, den später ich leitete, fleißig mit wirkte. Er starb im 76. Lebensjahr. Übrigens muß auch meine 1 9
DERMOTA / T A U S E N D U N D E IN ABEND
Schwester Jozefa darstellerische Talente gehabt haben, weil sie häufig Mädchenrollen übernahm. Sie und die anderen Schwestern waren ständige Mitglieder des Kirchenchores, der bis heute besteht. Fünf Geschwister leben noch in meiner Heimat. Zwei Brüder haben denselben Beruf ergriffen wie ich; Leopold und Gasper wurden lyrische Tenore. Leopold, der Viertgeborene, der an der Wiener Volksoper, am Salzburger und Innsbrucker Landesthea ter sowie auf mittleren deutschen und Schweizer Bühnen auftrat, war einmal, 1951, sogar mit mir zusammen bei den Salzburger Festspielen beschäftigt; unter dem Namen Leo Cordes-Dermota sang er außer dem Tenorsolo in Mozarts C-Moll-Messe den Arbaces im »Idomeneo« unter Georg Solti. Dabei ergab sich die traurige Situation, daß am Tag einer »Idomeneo«-Aufführung aus Kropa die Nachricht kam, unsere Mutter liege im Sterben. Weil ich dreifach beschäftigt war —in der »Zauberflöte«, im »Othello« und in Beethovens »Neunter« -, einigten wir uns dar auf, daß Leopold zur Mutter fahren solle, indes ich für ihn ein sprang. So mußte ich innerhalb weniger Stunden auch noch die Partie des Arbaces übernehmen. Bruder Leopold kam noch zurecht, um die Mutter lebend vor zufinden, ich konnte nur mehr ihrem Begräbnis beiwohnen. Da wurde mir erst völlig klar, was diese Frau geleistet hatte. Ihr gan zes Leben war nichts als Aufopferung für die Familie gewesen, ihr ganzes Leben hatte sie nichts für sich gefordert - und kaum etwas für sich erhalten. Sie hatte sich bei Lohnarbeit und häuslichen Pflichten aufgezehrt wie eine Kerze, die an beiden Enden brennt. Leopold ist den steinigen Weg von der Handschmiede über die fachliche Ausbildung zum Maschinenschlosser gegangen und hat nebenbei als Externist Klasse für Klasse des Gymnasiums bis zur Matura absolviert. Noch in der Heimat begann er mit dem Gesangsstudium, das er dann in Wien bei derselben Lehrerin wie ich fortsetzte. Später gab er das Singen auf, heiratete in Wien und ist heute Leiter des Heimatmuseums in Kropa.
I / WIR W A R E N UNSER ELF O D E R ZWÖLF
Auch Gasper, einer der »Heiligen Drei Könige«, arbeitete vor erst in der heimatlichen Fabrik, wo er gleichfalls zum MaschinenschloSvSer ausgebildet wurde. Dann absolvierte er die technische IFachschule in Ljubljana und schließlich ging er zum Gesangsstu dium über. Er wiikte viele Jahre als erfolgreiches Mitglied der Nationaloper in Ljubljana und als Erster Tenor des renommier ten Slowenischen Vokal-Kammer-Oktetts, bis er, im Alter von 50Jahren, zusammen mit seinem Sohn tragisch verunglückte. Um einer alkoholisierten Frau auszuweichen, die unversehens auf die bahrbahn getorkelt war, verriß Gasper seinen Wagen und stieß frontal mit einem entgegenkommenden italienischen Auto zusammen. Er war auf der Stelle tot, sein Sohn starb auf dem Weg ins Spital. Mein Heimatort genoß stets einen besonderen kulturellen Ruf. Aus allen Nachbardörfern und oft sogar von weither kamen die Ixute zu unseren Veranstaltungen. Der Gesangsverein gab bescheidene Konzerte im ländlichen Stil, bot vor allem vierstim mige Männer- und gemischte Chöre. Auch im Kirchenchor wur de vierstimmig gesungen. Dank der cäcilianischen Bewegung gab es eine reiche einschlägige Literatur. Die Komponisten oder Bearbeiter waren meist geistliche Herren. Drei von ihnen möchte ich hier nennen: Monsignore Stanko Premerl, Domkapellmeister und später Ehrenkanonikus von Ljubljana, Domprälat Franc Kimovec und Franziskanerpater Hugolin Sattner, der für die ländlichen Chöre so richtig »nach Maß« schrieb und einer der fruchtbarsten Komponisten im Volkston war. Alle drei wurden später meine Lehrer. Wir lebten damals mit dem Kirchenjahr. Weihnachten, Ostern, Pfingsten —die »heiligen Zeiten« -, das waren die unvergeßli chen Höhepunkte. Dazu kam das festliche Läuten, ein durchaus lx)dcnständiger Brauch meiner Heimat, der nach längerer Unter brechung heute wieder geübt wird. Es handelt sich um ein rhythmisch-harmonisches Zusammenläuten aller Glocken, die
DERMOTA / TA U S E N D U N D E IN ABEN D
nicht mit dem Seil zum Schwingen gebracht, sondern von Hand mit dem Klöppel angeschlagen werden, und zwar nach einem genauen, oft sehr komplizierten, doch frei improvisierten Rhythmus, etwa i : 2 : 3 :4 oder 3 : i : 4 : 2. Oder es wurde die größte Glocke mit dem Seil zum Klingen gebracht, und zwischen ihren weitausschwingenden Schlägen fügten die anderen Glöck ner ihre rhythmischen Klöppel schlage ein. Da die Dörfer eng bei sammenlagen und man bei günstigem Wind auch das nachbarli che Geläute mithören konnte, versuchte man, die Glocken im Umkreis harmonisch aufeinander abzustimmen. Zu besonderen Anlässen spielten sie dann alle zusammen - ein überwältigendes rhythmisch-musikalisches Erlebnis. Es gab auch Glöcknerwettbe werbe zwischen den einzelnen Dörfern, bei denen die besten Gruppen prämiert wurden. Über Zustand und Stimmung der Glocken —ebenso wie über den Zustand der Kirchenorgeln — wachte Prälat Franc Kimovec mit feinem Ohr und großer Sach kenntnis. Weihnachten begann mit dem Hausputz und mit dem Backen des Festbrotes, genannt »potice«, eines strudel artigen Backwerks, das Rosinen, Zibeben und Nüsse enthielt. Sein Duft allein war schon ein Teil des Festes. Zu Weihnachten durfte man auch sein bestes Gewand anziehen. Hatte man Glück und war eben an der Reihe, so erhielt man ein neues Kleidungsstück. Ansonsten gab es keine Geschenke. Beschenkt wurde man durch das bessere Essen, durch die erwartungsfrohe Stimmung, durch das Freisein von Arbeit. Vater und Mutter waren daheim und einmal nur für uns da. Das war das Schönste. Am Heiligen Abend trug der Vater, an der Spitze der ganzen Familie, laut betend ein Räucherbecken durchs Haus, ehe wir uns zum bescheidenen Festmahl an den Tisch setzten und das Krip penlicht angezündet wurde. Der Christbaum war damals noch nicht üblich. Inbegriff der Weihnacht war die Krippe, die jedes Jahr neu aufgebaut wurde. Zwar blieben die kunstvoll von Hand geschnitzten Figuren immer dieselben, doch der Berg, über den
I / WIR W A R E N UNSER ELF O D E R ZWÖLF
die Hirten mit ihren zahlreichen Schafen zum Stall pilgerten, wurde immer frisch gebastelt. Das war Sache des Vaters, dem wir dabei helfen durften, das nötige Material zusammenzutragen: 1iolz, Papiermaché und vor allem recht viel Moos für die Almen und Wiesen von Bethlehem. Wir holten es aus dem Wald und mußten es oft erst aus einer dicken Schneeschicht herausgraben — aber auch das gehörte zur Vorfreude. Nach dem Essen wurden Weihnachtslieder gesungen, und dann ging man »Krippenschauen«. Ohne sich anzumelden, klopf te man an die nachbarliche Türe und bewunderte nach Gebühr die dortige Krippe. So ging’s reihum durch die ganze Gemeinde, die an diesem Abend wie eine einzige Familie war. Nachher gab es daheim eifrige Diskussionen darüber, wo diesmal die schönste Krippe zu sehen gewesen war, bis die Glocken unserer Pfarrkir che zur Mitternachtsmette riefen. Aus allen Windrichtungen, oft von weither, kamen die Andächtigen mit Holzfackeln in den F^änden, um die Geburt des Herrn zu feiern. Es war herrlich anzusehen, wie von den verschneiten Hängen die Lichter hernie derschwankten und der Pfarrkirche zuströmten, die bald zum Bersten voll war. So arm und klein unsere Gemeinde auch war, hatte sie doch zwei Gotteshäuser. Neben der Pfarrkirche, die St. Leonhard, dem Schutzpatron der Gefangenen und der Tiere, geweiht ist und deren Ursprung bis in die Gotik zurückreicht, wovon heute infol ge der vielen Umbauten freilich kaum mehr etwas zu merken ist, gibt es noch eine Filialkirche, und zwar eine barocke, auf einem Hügel gelegene Marien-Wallfahrtskirche. Im zugehörigen Mes nerhaus war die Familie Dermota zweimal eingemietet. Der Vater versah das Amt des Mesners und versorgte die Kirche mit allem Notwendigen, die Mutter reinigte sie und schmückte sie mit Blumen : das alles trug nichts weiter ein als das freie Quartier. Die Marienkirche besitzt übrigens —im Gegensatz zur Pfarr kirche mit ihrer mechanischen Orgel —ein pneumatisches Instru ment, an dem ich Jahre später als Zögling der Organistenschule 2
3
DERMOTA / TA U S E N D U N D E IN ABEND
von Ljubljana in der Ferienzeit meine ersten praktischen Versu-. che im Orgelspiel anstellte, wobei der Vater und gelegentlich auch die Brüder für mich den Blasebalg traten. Der Vater tat es — im Gegensatz zu den Brüdern —gerne und nicht ohne Stolz auf den künftigen Organisten. Wenn ich mich aber zu lange im Spiel verlor oder zu viele Register auf einmal zog, dann konnte es geschehen, daß er müde wurde und seine Tätigkeit jäh einstellte, so daß mir mit einem Mal die Luft ausging. Er trat dann vor mich hin und stellte kurz und bündig fest: »Genug für heute!« Beide Eltern sind im Mesnerhaus gestorben; die Schwester Jozefa lebt heute noch dort. Wenn ich in die Heimat komme, dann ist dieses alte Haus an der Marienkirche mein liebstes Ziel. Während mir die Schwester eine einfache Jause bereitet, steigen alte Erinnerungen auf, und es sind merkwürdigerweise lauter schöne Erinnerungen. Doch zurück zur Weihnacht meiner Kindheit. Am Silvestertag begann das Neujahrs- und Dreikönigssingen und währte bis zum 7. Jänner. Kaspar, Melchior und Balthasar pilgerten zu den Feier tagen in Kropa und an den Wochentagen in den Nachbardörfern von Haus zu Haus. Dreikönigssingen war ein Vorrecht der Ministranten. Ich war einer von ihnen. Also legten wir unsere Ministrantenkittel an und stülpten uns bunte Papierkronen aufs Haupt, in die weihnachtliche Szenen aus durchsichtigem Farb papier eingelassen waren. Eine brennende Kerze beleuchtete die Herrlichkeit von innen. War die Kerze ausgebrannt, dann wurde eine neue angesteckt. Daß uns dabei das heiße Wachs auf die Köpfe tropfte, störte uns weiter nicht. Abends hatten dann die Mütter ihre liebe Not, die diversen Häupter vom Wachs zu säu bern. Als Zeichen der königlichen Würde hatten wir seltsame Krummsäbel umgegürtet, vielleicht eine Erinnerung an die Tür kenzeit. Der Mohr war stets der jüngste. Er mußte es sich gefal len lassen, daß man ihm das Gesicht mit Ofenruß schwärzte. Mit den Jahren avancierte man dann zum Melchior und schließlich 2
4
I / WIR W A R E N UNSER ELF O D E R ZWÖLF
zum Kaspar, der von den dreien der nobelste war, denn er brach te das Gold, Begleitet wurden die Könige von einer Art Beschüt zer, einem ausgedienten Ministranten, der auch die Spenden in IEmpfang nahm. Öffnete sich auf unser Klopfen die Haustüre, dann lief folgende Szene ab: Zuerst sangen wir gemeinsam ein Lied, dann stellte sich jeder einzeln mit einem Spruch vor, der so abgefaßt war, als ob wir drei uns soeben zufällig getroffen hätten. Auf die Frage »Woher kommen Eure königliche Hoheit?«, antwortete der erste: »Ich bin dort zu Hause, wo die Sonne am Morgen aufgeht und bin Gasper genannt.« Hierauf der zweite: »Ich bin dort zu Hause, wo die Sonne zu Mittag steht und werde Miha genannt.« Schließlich der dritte: » Ich bin dort zu Hause, wo die Sonne durch Gottes Gnade untergeht und werde Boltezar genannt.« Diese Szene ist zweifellos der Rest eines alten Laienspiels, das verlorengegangen ist. Zuletzt kam dann ein Streitgespräch zwi schen uns dreien, das damit endete, daß die Heiligen Drei Köni ge - hitzig, wie wir uns Morgenländer vorstellten, und gar nicht mehr heilig —die Krummsäbel zückten. Ein Blick auf den Stern über uns aber brachte rasch die Versöhnung, und dann konnte der Vierte endlich die Gaben in Empfang nehmen, die in Kropa stets aus bescheidener Münze bestanden. Nach den Feiertagen zogen die Drei Könige in die nähere Umgebung zu den Bauern, wo sie mitunter auch derbere Lieder vortrugen, um die Zuhörer zu erheitern und besonders mildtätig zu stimmen. In den bäuerli chen Gegenden wurden uns meist Naturalien gespendet: Dörr obst, Backwerk, Schweinsohren, Blutwürste und was dergleichen 1lerrlichkeiten mehr sind. So kehrten wir abends mit reicher Beu te heim, die streng und gerecht unter uns aufgeteilt wurde. Ich sagte, daß das Dreikönigssingen ein Vorrecht der Mini stranten war. Dessen ungeachtet aber bildeten sich zahlreiche »wilde« Kindergruppen —die auf eigene Faust von Tür zu Tür Dreikönigssingen gingen. Auch so manche Alte nützten die Gele genheit, um ihren »malha«, ihren Bettelsack, zu füllen. Da gab es 2
5
DERMOTA / TA U S E N D U N D E IN ABEND
vor den Gehöften oft ein Gedränge mit kleinen Machtkämpfen, so daß die sonst so freigebigen Hausväter schließlich nur noch die Tür öffneten, um kurz abzuwinken: »Heute geben wir nichts mehr!« Alles hat schließlich seine Grenzen. Die Karwoche wurde von der ganzen Gemeinde miterlebt. Am Palmsonntag brachten die Leute ihre »bigavenca« zur Wei he: dicke geflochtene Weidenruten, die mit farbigen Bändern, allerlei Frühlingsgrün, eingebundenen Feigen, Orangen und roten Äpfeln geschmückt und mit Wacholder- oder Ölzweigen bekrönt waren. Je größer die Rute, desto größer das Ansehen. Ich erinnere mich noch an die phantastischen Ruten aus dem bäuerli chen Nachbardorf, die so mächtig waren wie barocke Kirchen säulen. Zwei Mann mußten sie tragen. Das gab ein Aufsehen! Wenn die Glocken nach Rom flogen, setzten wir Buben mit unseren Ratschen ein. Die Ministranten verwendeten in der Mes se Holzklappern statt des Geläuts, zum Gottesdienst aber rief die große »ragla«, eine mächtige hölzerne Schnarre in Form eines Andreaskreuzes, die weit durch die Gegend ratschte. So wurde auch die Mittagszeit »eingeläutet«. Am Gründonnerstag entzün dete der Pfarrer dreizehn Kerzen, entsprechend der Zahl der Teilnehmer am letzten Abendmahl. Die Kerzen steckten auf einem Leuchter in Dreieckform, und dieser Leuchter war die ein zige Lichtquelle in der schwarzverhangenen Kirche, ln diesem mystischen Halbdunkel wurden die Psalmen gesungen. Nach jedem Psalm wurde eine Kerze ausgelöscht, bis mit dem Erlö schen der letzten die Andacht beendet war. Gleich nach dem Palmsonntag wurde das Heilige Grab aufge stellt, das riesenhafte Dimensionen hatte. Eine Seitenkapelle der Kirche verwandelte sich dafür in ein geistliches Theater. Die Kulissen, die bis zum Kirchengewölbe hinaufgezogen wurden, waren mit Szenen aus der Passion bemalt. Vor dem Heiligen Grab hielten holzgeschnitzte und buntbemalte Bewaffnete in barocker Türkentracht, die Hellebarde in der Hand, Wache. Am Altar selbst, der eigens für das Heilige Grab aufgebaut wurde. 26
1 / WIR W A R E N UN S ER ELF O D E R ZWÖLF
knieten zwei Engelsgestalten, in anbetender Haltung Weihrauch fässer schwingend. Diese Szenerie wurde noch höchst theatralisch mit zahlreichen in allen Farben schillernden Kugeln ausgestattet, die mit Wasser gefüllt waren. Hinter jeder Kugel brannte ein Öllämpchen; das gab ein warmes, tröstliches Licht, das zur Andacht einlud. Es war im Grunde das erste barocke Theater, das ich erlebte, und es hat mir einen unauslöschlichen Eindruck gemacht. Der Karfreitag war der Tag der stillen Andacht. Der ganze Ort schien vom Karfreitagszauber erfaßt. Die Ortsbewohner kamen mit behutsamen Schritten und verhaltener Stimme in die Kjrche. Alles strebte zum Heiligen Grab, um dort ein Gebet zu verrichten und die fünf Wundmale des zur Verehrung ausgesetz ten Kruzifixes zu küssen. Am Karfreitagabend wurden im mysti schen Dunkel der Kirche die volkstümlichen Passionslieder gesungen. War diese Andacht zu Ende und hatte der letzte Besu cher die Kirche verlassen, so hob mit einem Mal die befreiende Osterstimmung an. Der Mesner begann mit seinen Helfern die Vorbereitungen für die Prozession zu treffen. In den Bänken wurden die stattlichen Kirchenfahnen aufgestellt, die so groß und schwer waren, daß je drei Mann sie tragen mußten. Und auch die hatten beim Umgang noch ihre Not, wenn es galt gegen den Wind anzukämpfen. Dazu kamen die Traglaternen, der Himmel, der große Bottich mit dem zu weihenden Wasser, die Holzscheite für die Feuerweihe. Schließlich wurden die während der Kar woche entblößten Altäre festlich geschmückt. Am Karsamstag frühmorgens fand vor der Kirche die Feuerund Wasserweihe statt. Daheim aber begann das Großreinema chen, das Kochen und das Backen und das Eierfärben, das wir Länder selbst besorgen durften. Die Ostergaben für uns waren nicht mehr als ein oder zwei bunte Eier und —ganz selten —eine der frischen Orangen, die die Marktweiber aus Istrien feilboten. Vor der Auferstehungsprozession wurde in der Pfarrkirche die Segnung der Speisen vorgenommen. Das gab ein farbenprächti2 7
DERMOTA / T A U S E N D U N D E IN ABEND
ges Bild, wenn die festlich gekleideten Frauen und Mädchen zur Kirche schritten, die bunten, kunstvoll geflochtenen Körbe, oft von der Größe eines Wagenrades, frei auf dem Kopf tragend. Diese Körbe waren angefüllt mit österlichen Speisen wie »poticen«, Schinken, geselchten Krainer Würsten, bunten Eiern, Kren, Orangen, und zugedeckt mit kunstvoll besticktem weißen Lin nen. Sobald es dämmerte, strebte alles zur Auferstehung. Die Pro zession bewegte sich von der Kirche hinunter in den Ort, umging fast ganz Kropa und wurde bei der Rückkehr in die Kir che mit Orgelbrausen empfangen. Die Glocken läuteten zum erstenmal wieder, und sie läuteten fort und fort, während der ganzen Prozession, bis der Herr auferstanden und das letzte Hal leluja verklungen war. Der Festgottesdienst am Ostersonntag, den ich als Ministrant aus nächster Nähe miterlebte, zählt zu den stärksten Eindrücken meiner Kindheit. Der Zusammenklang von Musik und Gesang, vom Duft des Weihrauchs und dem Glanz der goldgestickten Festornate entführte mich in eine schönere Welt. Im Zurückblikken weiß ich, daß dieses barocke Himmel s-lEeater den Kunst sinn in mir geweckt und befruchtet hat, und wenn heute in mei nem Heim von allen Wänden und aus allen Nischen Heilige grü ßen, so wurde der Keim für diese Sammlerleidenschaft damals in mein Herz gelegt. Am Ostermontag nach dem Segen begab sich alt und jung auf eine große Wiese außerhalb des Ortes, die »dolga niva«, das lan ge Feld. Es war eine richtige Volkswanderung, ein bunter Auf bruch in den Frühling, zugleich eine Erinnerung an den Gang der Jünger nach Emmaus. Auf der Wiese begann ein fröhliches Treiben. Die Alten packten die österlichen Speisen aus dem Ran zen und taten sich gütlich, die jungen trieben allerlei Spiele. Schon zuvor hatten die Mädchen ihren auserwählten Burschen als Zeichen ihrer Gunst Ostereier geschenkt. Am Vortag des i6. Mai, des Namenstags von Johann Nepo 28
I / WIR W A R E N UNSER ELF O D E R ZWÖLF
muk, dessen Bildstock auch in Kropa wie fast auf allen Brücken der Kroparica stand, begann im Ort ein seltsames Spiel. Die Schulkinder liefen zusammen und teilten sich in drei Gruppen: der unteren, der mittleren und der oberen Gruppe des Ortes. Mit Stöcken und Weidenruten bewaffnet, gingen sie aufeinander los. Das Kampfspiel artete meist in eine allgemeine Balgerei aus, und ich wundere mich noch heute, daß die Eltern niemals einge schritten sind. Sie ließen wohl den Buben freien Lauf, ihre Kräfte auszutoben. Das Spiel ging sicher auf einen alten Volksbrauch zurück. Ich vermute, daß darin die Volkswut über das Martyrium des Heiligen, der in Prag von der Moldaubrücke in den Fluß gestürzt wurde, zum Ausdruck kam. Hatten die Stärkeren gesiegt, so endete die Balgerei in friedli cher Andacht. Die Kinder und die Erwachsenen versammelten sich bei den Bildstöcken, die man schon vorher mit Frühlingsblu men geschmückt hatte. Die Kerzen an den Bildstöcken wurden angezündet und in der stimmungsvollen Dämmerung volkstümli che Heiligenlieder gemeinsam angestimmt. Um diese Zeit fanden auch die Bittprozessionen statt, die ein fruchtbares Jahr erflehten. Dreimal ging der Pfarrer mit den Teil nehmern der Prozession über die Flur und segnete sie. Erst nach dem dritten Prozessionstag durften wir Kinder die Winterschuhe ausziehen und barfuß gehen. Das war immer wieder ein herrli ches Erlebnis. Neben den großen Kirchenfeiern waren auch die traditionel len Wallfahrten richtige Volksfeste, an denen Männer und Frau en, zuweilen mitsamt ihren Kindern, teil nahmen. Drei Ziele waren besonders beliebt: eine Stunde weit von Kropa entfernt die Kirche zum heiligen Rochus, der bekanntlich alle Wunden heilt; eine Stunde weiter das Muttergottes-Nationalheiligtum in Brezje, das Mariazell Sloweniens, das heute noch das alljährliche I^ilgerzief der ganzen Nation ist; und schließlich, drei Stunden entfernt, die Kirche zur heiligen Lucia in Drazgose, die bei Augenleiden angerufen wird. Die Lucia-Kirche ist die schönste 2 9
DERMOTA / T A U S E N D U N D E IN ABEND
bäuerliche Barockkirche, die ich je gesehen habe. Geschmückt mit kunstvollen goldenen Altären und zahllosen musizierenden Engeln, mehreren himmlischen Orchestern, die das Herz fröhlich stimmten, war sie ein unvergleichliches ländliches Juwel. Von ihr steht kein Stein mehr. Im Zweiten Weltkrieg, während der Kämpfe zwischen den Partisanen und der deutschen Wehrmacht, wurde das Dorf mitsamt seiner Kirche dem Erdboden gleichge macht. Heute steht dort ein neues Dorf und eine neue Kirche und ein mächtiges Partisanendenkmal, von dem aus man weit ins Land hineinsieht. Nur die Landschaft ist unverändert, unversehrt geblieben und herrlich wie eh und je. Es ist ein Hügelland mit unzähligen Bergkirchlein, die einst zum Schutz gegen die Einfälle der Türken errichtet und mit einem Wall umgeben wurden. Ihre Glocken bildeten ein Sig nalsystem, mit dessen Hilfe man sich verständigen konnte, von wo und wann Gefahr drohte. Mein Vater unternahm gerne Ausflüge in die Berge. Einmal nahm er Hijacint und mich auf eine richtige Gewalttour mit. Drei Stunden Weges war es zunächst schon bis Drasgoze, dem Wall fahrtsort zur heiligen Lucia; von dort ging es steil hinauf zum Gipfel. Samstag zu Mittag zogen wir bei Sonnenschein los; als wir oben am Ziel anlangten, war es halb sechs. »Jetzt werd’ ich euch was zeigen«, meinte der Vater, führte uns zu nur ihm bekannten Stellen im Fels, wo Enzian und Edelweiß blühten, und begann in aller Ruhe zu pflücken. Da fiel plötzlich Nebel ein; im Nu hatte sich das Wetter geändert. Der leichte Wind wurde zum Sturm, und ehe wir’s uns versahen, peitschte der Regen auf uns nieder. Der Vater schien ebenso erschrocken wie wir. Aus seinen bangen Selbstgesprächen entnahmen wir, daß er sich der gefährlichen Situation durchaus bewußt war. Im triefenden Gestein war kaum mehr ein Weg zu finden. Als wir endlich im Dunkeln auf eine Almhütte stießen, waren wir naß bis auf die Haut. Dort ver brachten wir die Nacht, zitternd, frierend und schlaflos, denn das Vieh drängte sich urn die Hütte und seine Glocken hielten uns wach. 3 0
I / WIR W A R E N UNSER ELF O D E R ZWÖLF
Im Morgengrauen brachen wir wieder auf. Es regnete immer noch in Strömen. Der Vater hatte offenbar die Orientierung ver loren und wählte die falsche Markierung; wir verirrten uns immer wieder, aber schließlich und endlich fanden wir doch zurück nach Drasgoze. Es war Sonntag und zudem der Tag der großen Wallfahrt. Von allen Seiten strömten die Pilger herbei. Der Vater wollte unbedingt dem Gottesdienst beiwohnen, um so mehr, als der Chor aus Kropa die Messe sang. Erst als die Feier vorüber war, kehrten wir endlich heim. Wir Buben waren um ein glücklich überstandenes Abenteuer reicher und hatten nicht ein mal einen Schnupfen davongetragen. —Wie oft dachte ich später als Sänger an dieses Abenteuer, wenn ich mich beim geringsten Luftzug um meine Stimme sorgte. Ein Tag meiner Kindheit hat sich mir besonders eingeprägt. Es war der 21. November 1916, ein gewöhnlicher Wochentag, als plötzlich alle Glocken in beiden Kirchen zu läuten begannen. Was war geschehen? Die Eltern klärten uns auf: »Der Kaiser in Wien ist gestorben!« Ein Jahr später sah ich zum erstenmal Militär, österreichisch ungarische Truppen, die über Kropa an die Isonzo-Front gingen. Zum erstenmal auch hörte ich militärische Blasmusik, die auf mich einen unauslöschlichen Eindruck machte. Verzückt blickte ich auf den Kapellmeister, der in deutscher Sprache seine Kom mandos gab, von denen ich kein Wort verstand. Ich stürzte heim, nahm einen Kochlöffel aus Mutters Lade, sprang auf einen Tisch und fuchtelte wild mit meinem Takt stock herum, während ich in einem von mir erfundenen Phantasie-Deutsch einer imaginären Kapelle Befehle erteilte. Noch etwas hat uns enormen Eindruck gemacht : Die Gulaschkanone. Nach der militärischen Essenausgabe durften wir uns mit einem Blechnapf bei ihr anstellen und erhielten das, was übriggeblieben war. Daneben, beim Plachenwagen mit den duf tenden Kommißbroten, habe ich zum erstenmal in meinem Leben einen »Diebstahl« begangen, den ich bis heute nicht 3 1
DERMOTA / T A U S E N D U N D E IN ABEN D
bereue. Ich nahm eines der Brote, trug es heim und erlebte die Überraschung, daß ich dafür vom Vater nicht bestraft wurde, sondern daß die gan2e Familie das Brot einträchtig aufaß. Eines Nachmittags wurde eine Feldmesse mit Kommunion abgehalten. Das war ungewohnt ; Messen pflegten sonst nur am Morgen gelesen zu werden. Auf unsere Frage erhielten wir zur Antwort: »Das ist für Soldaten, die aufs Schlachtfeld gehen.« Das Wort Schlachtfeld ängstigte mich; ich dachte an das Schlachten der Tiere, bei dem wir Buben oft verbotenerweise zugesehen hat ten, und war überzeugt, daß alle diese armen Menschen abge schlachtet werden sollten. Rund ein Jahr später kam der Zusammenbruch der Mittel mächte. Ich erlebte den Rückzug der Armee von der italienischen Front, der durch unsere Gegend führte, wobei die Soldaten alles zurückließen, was sie nicht mehr brauchen konnten: Waffen, Munition, vor allem aber Pferde, die dann wild durch die Wiesen streiften. Sie wurden von den Ortsansässigen eingefangen und wanderten in den folgenden Hungertagen in die Kochtöpfe. Trotz des Hungers bemächtigte sich meiner Landsleute das euphorische Gefühl : Der Krieg ist aus, nun muß alles besser wer den! Noch sehe ich die begeisterten Menschen durch die Gassen von Kropa ziehen, singend, harmonikaspielend, fahnenschwin gend. Plötzlich gab es neue Fahnen mit neuen Farben. Am I. Dezember 1918 wurde das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen ausgerufen. Unter der Führung des Lehrers traten wir Kinder geputzt und gestriegelt in Zweierreihen zum Festgot tesdienst an und sangen das Tedeum. Die allgemeine Hochstim mung ergriff auch uns, und irgendwie fühlte ich: eine neue Zeit ist angebrochen. Aber ich bin mit den politischen Ereignissen den privaten vor ausgeeilt. So sei nachgetragen: Mit sechs Jahren kam ich in die Volksschule, die drei zweistufige Klassen umfaßte, so daß man sechs Jahre brauchte, um sie zu absolvieren. Noch sehe ich im 3 2
I / WIR W A R E N UN S ER ELF O D E R ZWÖLF
Geiste über dem Katheder, an dem der gevStrenge Herr Oberleh rer saß, das große Brustbild des bärtigen Kaisers von Schön brunn hängen, der mit gütigem Blick auf uns herabsah. Nach des sen Tod veränderte sich das Bild über Nacht. Nun sah aus dem alten Rahmen ein junges, bartloses Antlitz auf uns nieder, Kaiser Karl. Und wieder zwei Jahre später verwandelte sich das Bild neuerlich: jetzt trug der ältere Herr, der sich im Dreiviertelpor trät darbot, wieder einen Bart, und auf dem Haupt einen feschen Kolpak mit einem herrlichen weißen Roßschweif An seiner Brust prangten unzählige Dekorationen und Orden. Der Bärtige erschien mir ein wenig fremdartig, aber irgendwie imponierend. Es war König Peter Karadjordjewitsch, der Herrscher über Ser ben, Kroaten und Slowenen. In den sechs Jahren meiner Volksschulzeit hatte ich fünf Leh rer, drei Männer und zwei Frauen. Eine der Lehrerinnen war sehr jung und reizvoll, so daß ich mich auf scheue Art in sie ver liebte. Ich glaube, es war die erste Hinneigung zum anderen Geschlecht, die mich heftiger bewegte. Gelehrt wurden uns nicht nur die normalen Grundfächer, son dern auch ein wenig die schönen Künste. Neben dem Schul sin gen mit Harmoniumbegleitung, das besonders gepflegt wurde, spielten wir unter Anleitung des Lehrers auch Theater, und zwar Märchen- und Kinderspiele. Natürlich wurden die Eltern eingela den, ihre Sprößlinge zu bewundern. Ich erinnere mich noch an eine »Schneewittchen«-Aufführung, bei der ich einen Zwerg spielen durfte. Es waren für mich die ersten Schritte in die Zau berwelt des Theaters, die nicht ohne Folgen blieben. Im Mesner haus der Pfarrkirche, wo wir damals wohnten, gab es einen Dachboden mit allerlei geheimnisvollem Gerümpel und alten, zerschlissenen Kleidern, die unsere nun einmal geweckte Phanta sie mächtig anregten. Wir fertigten Kulissen und Kostüme, ver klebten die Dachluken mit durchscheinendem Farbpapier - das war unsere Bühnenbeleuchtung! —und spielten auf eigene Faust Theater. In einem Schuppen neben der Marienkirche fanden wir 3
3
DERMOTA / TA U S E N D U N D E IN ABEND
die Windladen und Stimmstöcke der alten abgetragenen Orgel, die auf mich eine besondere Anziehungskraft übten, denn mit ihnen konnte man herrliche »Szenen« bauen. In der letzten Volksschulklasse gab es für mich auch die erste Begegnung mit dem Film. Ein Mann kam mit einem Koffer angerückt und führte uns seine primitiven Streifen vor. Es waren bescheidene Versuche, aber wir bestaunten sie sehr. Den Kampf zwischen David und Goliath samt ihren Kriegern, der in über schneller und dadurch besonders tumultuöser Bewegung ablief, beeindruckte uns Buben ganz besonders. Schwierigkeiten hatte ich in der Schule keine, denn ich war von Natur aus wißbegierig und saugte förmlich in mich ein, was man uns zeigte oder erklärte. So lernte ich mühelos und zählte stets zu den Besten, deren Namen am Ende des Schuljahres in ein goldenes Buch eingetragen wurden. Dazu gab es noch eine Belohnung, die ich 1916 und 1917 erhielt: eine Silberkrone mit dem Bildnis des Kaisers Franz Joseph, eingefaßt in himmelblaue Seide. Das Ganze sah aus wie ein richtiger Orden und wurde auch so dem Schüler feierlich an die Brust geheftet. Kleinere Auszeichnungen für besondere Leistungen — das tadellose Aufsagen eines Gedichts, eine besonders gute Nacher zählung usw. “ gab ès auch während des Schuljahres in Form von bunten Kärtchen mit Goldprägung und der Aufschrift: »Spomin pridnosti —Dem braven Schüler«. Es war eine große Freude, wenn man voll Stolz ein solches Kärtchen daheim vorweisen konnte. Ich habe all die Jahre die bunten Blättchen gesammelt und kann sagen, daß ich’s zu einer stattlichen Anzahl brachte. Als die Zeit des Abschieds von der Volksschule kam, hatten etliche Klassenkameraden bereits die Aufnahmsprüfung ins Gymnasium bestanden. Ich durfte daran nicht denken. Dem Vater fehlten dazu einfach die Mittel. Meine Enttäuschung war groß, denn insgeheim hatte ich auf irgendein Wunder gehofft. Doch ehrlicherweise muß ich mir heute eingestehen, daß ich, hät te ich die Mittelschule besuchen dürfen, sicher Lehrer oder Geist 3
4
I / WIR W A R E N UNSER ELF O D E R ZW( ) LF
lieber, aber gewiß nicht Sänger geworden wäre. Der Vater begab sich zum Pfarrer —man ging ja mit allen Anliegen zu ihm —,um dessen Rat darüber einzuholen, was mit mir geschehen solle. Und der geistliche Herr riet, mich für ein Jahr nach Bled (Veldes) zu seinem Bruder zu schicken, der dort gleichfalls Pfarrherr war. So würde die Familie wenigstens einen Esser weniger haben. Und das geschah auch. Es war der erste schwere Abschied von daheim, und was mich erwartete, war kein Vergnügen. Der Pfarrer von Bled betrieb zusammen mit seinen Geschwi stern eine große Bauernwirtschaft mit Vieh und Feldern. Dort wurde ich mit meinen zwölf Jahren Kleinknecht und zugleich Hilfsmesner, Stallbursche, Botengänger und Ministrant. Meine Tätigkeit spielte sich zwischen Viehstall und Kirche ab. Um sechs Uhr früh wurde die Kirche aufgeschlossen, und damit begann mein geistlicher Dienst. Zwei Messen wurden gelesen, bei denen ich zu ministrieren hatte. Dazu kam das Säubern der Kirche, das Läuten der Glocken, ja, und auf den Turm mußte ich steigen, um die Kirchenuhr aufzuziehen. Meine Hauptarbeit aber war, neben verschiedenen Handgriffen für die Hauswirtschaft, beim Betreu en der Tiere zu helfen: Futter mähen und einbringen, Stall aus misten und den Mist auf die Felder bringen, das Vieh füttern und auf die Weide führen. All das um Gottes Lohn, für nichts als Kost und Quartier. Ich erinnere mich noch genau: Es war an einem bitterkalten Herbsttag, der Rauhreif lag schon auf den Feldern, als ich noch barfuß die Herde auf die Weide trieb. Da erbarmte sich meiner ein altes Weiblein und schenkte mir ihre abgetragenen Schuhe. Ich nahm sie dankbar an, kürzte die hohen Absätze und war nun glücklich beschuht. Mein Quartier war der Stall. Dort stand meine Schlafstelle, eine Matratze auf einem rostigen Eisengestell. Ein Dutzend Kühe und zwei Pferde waren meine Schlafgenossen und spendeten dem Raum ihre tierische Wärme, so daß er selbst an eiskalten Wintertagen erträglich temperiert war. Zuweilen kamen Bettel3
5
DERMOTA / TA U S E N D U N D E IN ABEND
leute ins Pfarrhaus, die urn Nachtquartier baten. Der Pfarrer konnte sie nicht abweisen, und so wurden sie in den Stall geschickt. Da war ich dann nächtlicherweile in der Gesellschaft von allerlei unheimlichen, bärtigen Gesellen, die meine lebhafte Phantasie noch unheimlicher machte, als sie ohnehin schon waren. Manchmal erwachte ich mitten in der Nacht und fühlte ein heißes Schnauben über meinem Gesicht. Ein Pferd hatte sich losgemacht und suchte meine Nähe. Das war ein wunderbarer Trost in meiner Einsamkeit und meinem Heimweh. Aber es gab auch andere Lichtblicke. Dazu gehörten beschei dene musikalische Erlebnisse. Ich weiß noch, wie tief mich das Orgelspiel in der Kirche beeindruckte. Wenn der Organist das volle Werk —das Pleno —spielte, fühlte ich mich wunderbar erhoben. Im Mesnerhaus, im Probenzimmer des Kirchenchores, stand ein Harmonium. Dort habe ich mich manchmal eingeschli chen und versucht, nach dem Gehör gewisse Melodien zu spie len, wobei mir zum erstenmal das Wunder der Terz- und SextHarmonie aufging. Im Sommer konzertierte im Kurpark von Bled die Militärka pelle von Ljubljana. Der Kurpark liegt in nächster Nähe der Kir che, so daß ich die Musik gut hören konnte. Da bin ich oft lau schend gestanden und habe die Walzer, Märsche und OpernPotpourris in mich aufgenommen. Zu den Lichtblicken zählten auch die Taufen und Hochzeiten, bei denen ich Mesnerdienste versah und wo zuweilen ein gutes Trinkgeld für mich abfiel. Ich habe davon kaum etwas für mich behalten, sondern alles auf Heller und Pfennig meinen Eltern abgeliefert. Anderthalb Jahre versah ich mein mühseliges Amt in Bled. Inzwischen hatte man daheim, auf Anraten des Pfarrers von Kropa, der meine musikalische Begabung erkannt hatte, beschlos sen, mich nach Ljubljana, in die Diözesan-Organistenschule, zu schicken. Und damit endete nicht nur mein Dienst in Bled, son dern so eigentlich auch meine Kindheit.
Hunger macht mutig Yom Organistenschüler
Chormeister
I.jubljana, in den zwanziger Jahren eine Stadt von 60.000 Seelen, bedeutete für mich die große Welt, und die 40-Kilometer-Reise dahin war meine erste Fahrt mit der Eisenbahn. Kurz zuvor, als ich mit der Mutter beim Heidelbeerenpflücken war, hatte sie mir scheu über den Kopf gestrichen und gemeint: »Wenigstens einer soll es besser haben.« Organist, das war zwar immer noch ein bescheidenes Dasein, aber unleugbar ein sozialer Aufstieg. Um mir den Abschied von daheim zu erleichtern, begleitete mich der Vater in die Stadt. Sicher schritt er neben mir her, ein schwarzes Holzköfferchen aus seiner Rekrutenzeit in der Hand, das meine notwendigsten Habseligkeiten enthielt. Es wurde trotzdem ein schwerer Abschied. Die Tränen steckten mir in der Kehle, aber ich unterdrückte sie, denn ich schämte mich ihrer. Umarmungen gab es in unserer Familie selten, Küsse nie. Ich erinnere mich nicht, in meiner Kindheit von meiner Mutter jemals einen Kuß empfangen oder ihr einen gegeben zu haben. In Ljubljana hatten wir entfernte Verwandte mit dem deut schen Namen Wagner. Sie wohnten draußen am Rand der Stadt in einem kleinen Haus, das von vier Familien mit insgesamt 18 Personen bevölkert war. Nun kam ich als neunzehnter dazu. Natürlich gab’s für mich keinen eigenen Raum. Ich bekam ins Vorzimmer ein Feldbett, das ich abends aufschlug und am Mor gen wieder zusammenklappte. Daneben blieb gerade so viel Platz, 3
7
DERMOTA / TA U S E N D U N D E IN ABEND
daß die anderen noch an mir vorbei in ihre Zimmer konnten. So lag ich zwischen vier Türen, die sich morgens zu den verschie densten Zeiten öffneten, und schlief den tiefen Schlaf der Jugend. Ich war glücklich und zufrieden, denn im Vergleich zu meiner Unterkunft im Pfarrerstall war mein neues Quartier geradezu nobel zu nennen. Zwei Söhne des Hauses besaßen ein gemeinsames Zimmer. Dort befand sich ein Tisch, an dem ich meine Aufgaben machen, dort stand - was für ein Glück! - ein altes Hammerklavier, an dem ich zu gewissen Zeiten, wenn ich niemanden störte, üben durfte. Ich stürzte mich eifrig ins Lernen, mit dem ganzen Ernst meiner vierzehn Jahre. Noten lesen konnte ich bereits; nun erhielt ich zum erstenmal regelrechten musikalischen Unterricht. Die Diözesan-Organistenschule wurde von der Kirche unter halten und vorwiegend von geistlichen Herren geleitet. Es war eine gute Schule. Sie vermittelte eine ebenso solide wie systemati sche Grundausbildung für den Organistenberuf und darüber hin aus. Durch sie empfing ich einen Schatz an musikalischem Wis sen und Können, der mir später über viele Probleme hinweghalf In Ljubljana waren zwei von mir bereits genannte geistliche Voll blutmusiker meine Lehrer: Stanko Premer! und Franc Kimovec. Sie unterrichteten uns in Harmonielehre und Kontrapunkt, wobei wir uns bis zu kleinen Kompositionsversuchen vorwagten. Wir lernten Volkslieder und geistliche Gesänge setzen und har monisieren. Für Musikgeschichte, Instrumentationskunde und Stimmbildung gab es weltliche Lehrer. Unter ihnen befand sich der damals schon betagte Hofrat und Professor Dr. Josef Mantuani, der Musikgeschichte unterrichtete und zuvor Kustos der Musikabteilung der Nationalbibliothek in Wien gewesen war eine international anerkannte Persönlichkeit auf dem Gebiet der Musikwissenschaft. Im Praktischen wurde im ersten Jahr Klavier unterrichtet, im zweiten und dritten Jahr kam die Orgel dazu. Da eine Organi stenstelle den Mann nur selten ernähren konnte, gab es zur Vor 38
Il / H U N G E R MACHT MUTIG
sorge noch weitere Disziplinen: Schönschreiben, Buchführung, wirtschaftliche Organisation und ähnliche Fächer, die für das Amt eines Sekretärs bei Gemeinde oder Raiffeisenkasse befähig ten. Das kam mir später sehr zugute, als ich in meinem Heimatort für zwei Jahre eine kleine Beamtenstelle übernahm. Unsere Schule verfügte nur über drei Räume, einen größeren und zwei kleinere. Im größeren befand sich die Orgel, in den bei den kleineren stand je ein Klavier. Ein von Direktor Premerl aus gearbeiteter Wochenplan war streng darauf bedacht, jedem Schü ler die gleiche Anzahl an Übungsstunden zu ermöglichen. So waren die drei Instrumente, besonders aber die Orgel, pausenlos von 6 Uhr früh bis 9 Uhr abends besetzt. Da die Räume bloß durch einfache Türen voneinander getrennt waren, kann man sich vorstellen, was da im Lauf des Tages an dissonanten Klän gen produziert wurde und wie gute Nerven man brauchte, um sich trotz der Störungen von nebenan auf das eigene Spiel zu konzentrieren. Obligat für alle Organistenschüler war die Mitwirkung am Domchor unter der Leitung von Regens-Chori Premerl. Ich begann dort noch als Sopran, stand also —ein wenig geniert —an der rechten Seite des Orgeltisches unter den Frauen und Mäd chen. Auch während des Mutierens habe ich niemals mit dem Sin gen ausgesetzt. Es war einfach so, daß mich der Domkapellmei ster eines Tages auf die andere, die Männerseite, hinüberbeorder te - und damit war ich ein Tenor. Das also war der Anfang mei ner tenoralen Laufbahn vor mehr als fünfzig Jahren. Premerl war nicht nur Komponist und Domkapellmeister, sondern auch Direktor der Organistenschule und konzertierender Orgel virtuose. Überdies war er Geistlicher aus innerer Berufung - ein asketischer Typ und fortschrittlicher Geist, hager, glatzköp fig, streng, menschenscheu, mit erheblichen Kontaktschwierigkei ten. Ich verehrte ihn nicht nur, ich fürchtete ihn auch. Das Wort Ehrfurcht war hier wirklich am Platz. Dr. Kimovec, sein Kollege, 3 9
DERMOTA / T A U S E N D U N D E IN ABEND
war das diametrale Gegenteil: Ein eher bäuerlicher Typ, aufge schlossen, jovial, unproblematisch, konservativ, humorig - ein musischer Seelenhirt, den man einfach gern haben mußte. Wie ausgezeichnet der Orgel unterricht gewesen ist, erhellt aus der Tatsache, daß ich schon nach dem zweiten Jahr eine - wenn auch bescheidene - Organistenstelle in Ljubljana übernehmen konnte. In der Kirche zu Sankt Florian durfte ich auf einer kleinen barokken Orgel die Schulgottesdienste betreuen. Zum erstenmal in meinem Leben erhielt ich für die Musikausübung, die ich beruf lich anstrebte, eine kleine Entlohnung, die der Religionslehrer, der übrigens wie ich aus Kropa gebürtig war, aus eigener Tasche bezahlte. Sie war sehr bescheiden, aber ich konnte mir darum immerhin die notwendigen Noten oder - wenn ich sehr sparsam war - im Lauf von zwei Monaten ein Kleidungsstück kaufen. Im dritten Jahrgang berief mich —und das war ein gewaltiger Vertrauensbeweis —Direktor Premerl zu seiner Vertretung an der mächtigen Domorgel, wo ich bereits drei Manuale zu bewäl tigen hatte. Sowohl bei Messen wie auch bei Kirchenfesten durfte ich im Auftrag des verehrten Meisters substituieren. Das waren einschneidende Erlebnisse für mich, voll Wagnis, aber auch voll Freude. Alles überstrahlte jener Tag, an dem der Erzbischof von Ljubljana im Dom feierlich einzog, um die Firmung zu spenden, und ich damit betraut wurde, die Orgel zu spielen. Es kam der Augenblick, da der Bischof mit großer Assistenz unter den gewaltigen Klängen des Königsinstruments feierlich aus dem Dom schritt. Da saß ich nun, kaum siebzehnjährig, und griff beglückt voll in die Tasten, daß das Gotteshaus davon erfüllt war bis zum Rand. Es war beseligend, mehr noch, es war berau schend. Zum erstenmal fühlte ich bewußt die geistig-seelische Macht, die in der Musik liegt. Während des ersten Laibacher Jahrs kam der Vater für meinen bescheidenen Unterhalt auf, im zweiten Jahr war ihm das nicht mehr möglich; da langte seine Zuwendung gerade noch für das geringe Quartiergeld, für alles andere mußte ich selbst sorgen. 40
II / H U N G E R MACHT MUTIG
Nun war es bei uns seit jeher Sitte, daß die Studenten mittags in den verschiedenen Klöstern die sogenannte Klostersuppe emp fangen durften. Das war eine Art Eintopf, der einmal besser, ein mal schlechter den Magen füllte. So bewarb auch ich mich, mit einer Empfehlung unseres Pfarrers bewaffnet, um die Suppe im Franziskanerkloster von Ljubljana, das mitten in der Stadt liegt und eine der schönsten Kirchen der Stadt besitzt. Nach dem Anstellen in langer Reihe erhielt man durch eine Fensterluke von einem Pater einen Schöpflöffel voll Suppe in einen Teller geschüttet, den das Kloster beistellte. Nun befand sich gegenüber der Domkirche, direkt unter der Wohnung Premerls, die größte Dampfbäckerei der Stadt. Der Duft des frischgebackenen Brotes drang oft genug verführerisch in unsere Nasen. Da erfuhr ich von einem Kollegen, daß der Bäcker Gratisbrot an Studenten ausgab, wenn eine Flmpfehlung Premerls vorlag. Ich zögerte nicht, denn Hunger macht mutig, sprach bei Premerl vor und erhielt die Empfehlung. Von diesem Tag an ging die Vaterunser-Bitte »Gib uns heute unser tägliches Brot« für mich pünktlich in Erfüllung. Es war ein kleiner Laib Schwarzbrot von einem halben Kilo, aber für mich eine fürstli che Zubesserung. Bald fand ich heraus, daß es in Ljubljana ein Kloster gab, das nur auserwählte Studenten verköstigte. Es war das sogenannte Marienheim, das sich ansonsten hauptsächlich der Alten annahm. Durch Ausdauer und Protektion gelang es mir, unter die »Auser wählten« zu kommen. Ein gewaltiger Fortschritt! Wir durften ordentlich an Tischen in einem Vorraum sitzen und bekamen eine ausgiebige Mahlzeit von zwei, manchmal sogar drei Gängen. Eine weitere Steigerung gab es im letzten Jahrgang. Da wechselte ich, dank Premerl, hinüber ins noble Entbindungvsheim der Stadt, das außer seinen Säuglingen und Wöchnerinnen nur noch zwei Studenten verköstigte. Inmitten von jungen Müttern, aufkeimen dem Leben und steriler Sauberkeit genossen wir zwei Glückskin der unsere Mahlzeit an einem gedeckten Tisch und fühlten uns 4 1
DERMOTA / T A U S E N D U N D E IN ABEN D
königlich. Man sieht jedenfalls: Ich zögerte, wenn sich eine Gele genheit bot, nicht, sie beim Schopf zu fassen und überließ keines wegs dem lieben Gott allein mein Schicksal. Was mir zu meinem Glück noch fehlte, war ein heiliger Mar tin, der bereit war, mit mir seinen Mantel zu teilen. Denn Mantel besaß ich keinen, und die Winter in Ljubljana sind hart und streng. Im zweiten Jahr meiner Organistenausbildung erbarmte sich meiner der Schwiegersohn meiner guten Tante und schenkte mir seinen abgetragenen Mantel. Obwohl er mir viel zu groß war, genierte ich mich nicht, mit ihm auf die Straße zu gehen. Wer friert, schaut nicht auf die Paßform. Und dann geschah es — es war zu Allerheiligen 1927 -, daß der Vater plötzlich in Ljublja na erschien. Mit einem feierlichen Gesicht und einem großen Paket unter dem Arm. Er öffnete es, und hervor kam ein funkel nagelneuer Wintermantel : schwarz, mit Samtkragen, wie es damals Mode war. Verfertigt hatte ihn der Schneider in Kropa, mein Taufpate. Das Prachtstück paßte wie angegossen, obwohl man mir niemals Maß genommen hatte. Es war der erste eigene Mantel in meinem Leben, und ich hatte das Gefühl : Jetzt bist du jemand! In diese Zeit fällt mein erster Versuch mit dem Fahrrad. Ich erinnere mich noch, daß es in ganz Kropa nur drei Fahrradbesit zer gab; so rar war dieses Vehikel damals. Nun besaß ein junger Verwandter der Tante Wagner ein altes Damenfahrrad, und obwohl man Räder nicht gerne herborgte, bekam ich es doch geliehen. Nach den ersten geglückten Versuchen, wagte ich mich bereits in die Stadt hinein und da passierte es: ausgerechnet beim Überqueren des Platzes vor der Philharmonie, um deren Leitung sich einst große Musiker beworben hatten, stieß ich direkt in einen Brotlieferwagen. Am Pferdefuhrwerk gab es einen Bruch der Deichsel, an meinem Vorderrad einen gewaltigen Achter. Meiner erster Gedanke war : Den Schaden kannst du nicht bezah len! Aber der Kutscher war gutmütig, hatte ein Einsehen oder selbst ein schlechtes Gewissen und ließ mich laufen. Ich lieferte 4 2
II / H U N G E R MACHT MUTIG
das verbogene Fahrrad ab, selbst innerlich ein wenig verbogen, und habe es danach nicht wieder bestiegen. Obwohl Ljubljana ein ständig bespieltes Opernhaus hatte, kam ich mit diesem Institut kaum in Berührung. Wie hätte ich auch in meiner finanziellen Lage an einen Opernbesuch denken können ? Ein einziges Mal kam ich in eine Vorstellung, als mir ein Sohn von Tante Wagner seinen Abonnementsitz überließ. Man gab die »Fledermaus«, und ich kann nicht sagen, daß das Werk, wie die ser ganze erste Opernbesuch überhaupt, einen umwerfenden Ein druck auf mich gemacht hätte. Wohl fühlte ich die besondere Atmosphäre, bewunderte das festliche Weiß-Rot-Gold des Zuschauerhauses und genoß besonders das Stimmen der Instru mente, aber wie gesungen, wie gespielt wurde, ist mir völlig ent schwunden. Am besten gefiel mir eigentlich der Gefängnisdirektor Frank und hier wieder die Schlußpointe seiner Schwips-Pantomime im letzten Akt, wenn ihm das Zeitungsblatt über das schlafende Gesicht fällt und die Zigarre ein Ixich durch die Zeitung brennt. Am Ende des dritten Jahrgangs gab es in der Organistenschule eine Abschlußprüfung, die ich mit Auszeichnung bestand. Und damit erhob sich die Frage: Was jetzt? Wieder spielte Direktor Premerl Schicksal für mich. In der Pfarre Bled war die Organi stenstelle freigeworden, die mir schon seit Beginn meiner Ausbildung zum Organisten insgeheim zuge dacht war. Dort sollte ich anfangen. Und so geschah es auch. Im Juni 1927 trat ich das Organistenamt ebendort an, wo ich wenige Jahre zuvor als Kleinknecht gedient hatte. Die schöne alte Kir che, ein barockisierter gotischer Bau, stand längst nicht mehr. Man hatte sie seinerzeit, trotz der Proteste von Dr. Kimovec, abgerissen und durch eine neugotische ersetzt. Ihr Erbauer war kein geringerer als Friedrich Schmidt, der Schöpfer des Wiener Rathauses. Das alte barocke Pfarrhaus war jedoch stehenge blieben ; dort bekam ich mein Quartier. Als ich über die Schwelle trat, überfielen mich verwirrende Gefühle. Ich dachte an meine 4
3
DERMOTA / T A U S E N D U N D E IN ABEN D
armselige Hirtenzeit und war über den glücklichen Wandel der Dinge sehr froh. Mit dem Pfarrer gab es leider kein ersprießliches Verhältnis. Für ihn war ich immer noch der kleine Stallknecht. Er war sehr gealtert, war halbblind und noch strenger und starrköpfiger geworden. Ich mußte nicht nur das Organistenamt, sondern auch die Mesnerdienste übernehmen: Kirche reinigen, öffnen und schließen, Glocken läuten, Turmuhr aufziehen wie ehedem. Dazu gelegentlich auch Matrikel schreiben in der Pfarrkanzlei. Aber die Kirche hatte eine Orgel, die als die beste meiner engeren Heimat galt: ein pneumatisches Instrument mit zwei Manualen und etwa vierzig klingenden Stimmen, was man schon ein mächtiges Werk nennen kann. Sie war meine ganze Freude. Dazu kam ein gut besetzter Chor, den ich gleichfalls zu betreuen hatte. Das heißt, nach außen hin leitete und dirigierte ihn ein pensionierter Ober lehrer. Die Verantwortung dafür, daß alles in Ordnung ging, hat te ich zu tragen. Zweimal in der Woche gab es Chorproben, dazwischen Taufen, Hochzeiten, Begräbnisse. Meine Kost erhielt ich bei benachbarten Bauern. Dort wurde ich wie ein Mitglied der Familie aufgenommen. Der Sohn des Hauses, ein Chorsänger, half mir beim Mesnerdienst, wo er nur konnte. Bled war damals schon eine aufstrebende Sommerfrische und auch der König hatte dort seine sommerliche Residenz. Zuweilen erschien ein Mitglied der königlichen Familie zum Got tesdienst. Dann spielte das 17jährige Bürschlein an der Orgel vor erlauchtem Auditorium und war sich der Ehre, aber auch der Verantwortung, wohl bewußt. Gelegentlich kamen mit den Som mergästen auch angehende Berufssänger nach Bled. Die fanden sich dann gerne in der Kirche ein und boten sich für eine Einla ge —ein Ave Maria oder eine Händel-Arie —in der Sonntagsmes se an. Mit ihnen hatte ich zu proben. Und so kam ich zum ersten mal mit den Freuden und Leiden des professionellen Sologesangs in Berührung. Um diese Zeit hatte ich auch meinen ersten Kontakt mit dem 4
4
II / H U N G E R MACHT MUTIG
Radio. Ljubljana begann damals mit bescheidenen Sendungen. Ich besaß einen primitiven Detektorapparat und baute mir dazu eine riesige Antenne auf dem Dach des Mesnerhauses. Auf dem Kri stall herumstochernd, hörte ich fasziniert die alten Schall platten, die man übertrug, aber auch die erste Direkt-Übertragung, ein Konzert der Laibacher Garnisonskapelle, die mich mit staunen der Begeisterung erfüllte. Mein Organistendienst in Bled währte etwa anderthalb Jahre. Dann erreichte mich eines Tages völlig unerwartet ein Ruf aus meinem Heimatort, joze Gaspersic, der Direktor der eisenverar beitenden Genossenschaft, war zugleich die Seele des sehr ent wickelten und von großer Begeisterung getragenen Musiklebens in Kropa. Er war ein hochbegabter Mann, dessen Traum es einst gewesen, sich ganz der Musik zu widmen. Aber das Schicksal hat te ihn auf einen anderen Posten gestellt. Nun leitete er das Musikleben von Kropa ehrenamtlich. Aus den Laien, die er her anbildete, hatte sich sowohl eine Bläsergruppe wie auch ein klei nes Streichorchester entwickelt, die es beide, zusammen mit dem bestehenden Chor, zu beachtlicher Leistung gebracht und sich bereits wiederholt öffentlich bewährt hatten. Mit den Aufgaben wuchs die Belastung; Gaspersic konnte die Arbeit einfach nicht mehr leisten und suchte eine Kraft, die die Musikpflege in seinem Sinne weiterführte. Dabei verfiel er auf mich. Anläßlich eines Besuchs in Kropa, kamen wir ins Gespräch und er machte mir den Vorschlag: »Wir brauchen einen Chor meister. Ich kann es nicht mehr schaffen. Hätten Sie nicht Lust dazu? Wenn Sie das Ehrenamt übernehmen, erhalten Sie eine Anstellung in der Genossenschaft, von der Sie leben können!“ Ich griff sofort und bedenkenlos zu. Vierfach war die Verlokkung. Erstens litt ich immer noch unter Heimweh und konnte nun endlich wieder nach Hause. Zweitens hatte ich die Möglich keit, mehr Ordnung in meinen Alltag zu bringen, drittens konnte ich mich materiell verbessern und schließlich - das war die größ te Verlockung! - bot sich mir eine gewisse Selbständigkeit. Ich 4
5
DERiMOTA / T A U S E N D U N D E I N A B E N D
durfte mich als Chorleiter frei entfalten und hatte keinen Aufpas ser mehr über mir. Im Herbst 1929 trat ich mein neues Amt in Kropa an. Meine Arbeit im Werkbüro der Fabrik begann um 8 Uhr früh. Ich hatte fast ausschließlich Schreibarbeit zu verrichten; etwa Auftragsli sten für bestellte Waren auszufertigen und ähnliches. Es war weder ein anstrengendes noch ein aufregendes Geschäft. Gaspersic hatte mir einfach einen »Job« zugeschanzt, der mir reichlich Zeit für meine anderen Pflichten ließ. Desto eifriger stürzte ich mich auf meine musikalischen Aufga ben. Den Männerchor, den ich übernahm, erweiterte ich umge hend auf einen gemischten Chor. Mit ihm studierte ich die näch sten Auftritte ein. Gleich im ersten Jahr boten wir ein weltliches Programm und außerdem ein geistliches Konzert in der Kirche, mit Orgel-Einlagen, die ich selber spielte. Das war eine Ausnah me, denn eines war mir nicht vergönnt: zugleich Organist in meiner Heimatgemeinde zu werden. Der Schwiegervater von Direktor Gaspersic, ein hoher Sechziger, waltete seit Jahrzehnten an der Orgel von Kropa und wachte eifersüchtig darüber, daß außer seinem Schwiegersohn niemand an »sein« Instrument her ankam. Gleichsam als Ersatz dafür gründete ich aus jungen Chorsän gern ein Vokalquartett, bei dem ich den Part des Ersten Tenors übernahm. Der harmonische Zusammenklang, die Homogenität der vier Stimmen, ist mir noch heute gegenwärtig. Es war gewiß der erste Versuch dieser Art in meiner Heimat, und wir sind wie derholt erfolgreich mit Kunst- und Volksliedern aufgetreten. Häufig wurde ich von den Nachbardörfern gerufen, um dort Chöre einzustudieren oder als Organist einzuspringen, wenn es galt, Kirchenfeste zu verschönern. Das waren die ersten »Gast spiele« in meinem Leben. Natürlich gab es auch Schwierigkeiten : mit den Sängern, die nicht immer leicht bei der Stange zu halten waren, und mit den Noten, für die es meist an Geld fehlte. Ich mußte die Stimmen selbst abschreiben und mit einem sogenann46
II / H U N G E R MACHT MUTIG
ten Opalograph vervielfältigen - ein schwieriges Verfahren, bei dem das gesamte Notenbild mit Spezialtinte auf Stein gezeichnet wird, von dem dann die Kopien abgezogen werden. Besonderen Erfolg hatten wir mit der Darbietung folkloristischer Singspiele, Stücke mit schlichter Handlung und eingefloch tenen Volksliedern, die wir in Kostüm und Maske szenisch auf führten. Es war der geglückte Versuch, die allgemeine Sanges freudigkeit des Ortes auch dramatisch auszuwerten. Ich selbst sang oft die Hauptrollen oder begleitete, in Ermangelung eines Klaviers, auf dem Harmonium. Als Spielort diente uns eine auf gelassene Sagemühle, die mit bescheidenvSten Mitteln adaptiert worden war. Heute besitzt Kropa ein Kulturzentrum, das alle Sprachen spricht. Aber außer für ein paar Filmvorführungen am Wochenende wird das aufwendige Haus kam genützt. Es scheint, daß Überfluß nicht gut tut. Wir hatten damals weit weniger Mit tel, aber bedeutend mehr Eifer und Idealismus. Ednmal wurden wir auch von Radio Ljubljana eingeladen, mit dem verkleinerten Chor im Studio eine Sendung zu produzieren. Das Studio war eine primitive Holzbaracke im Zentrum der Stadt. Der Straßenlärm drang durch die dünnen Wände, und ab und zu pfauchte und pfiff auch lautstark die Eisenbahn vorbei. Ganze drei Mann hielten den Betrieb aufrecht: der ProgrammDirektor, der Ansager, der zugleich technischer Leiter war, und eine Schreibkraft. Während meiner Zeit in Kropa konnte ich natürlich daheim wohnen und war so wieder in die Familie einbezogen. Das bedeutete, daß ich mein Gehalt in der Regel in die Familienkasse ablieferte. Nur gelegentlich behielt ich etwas für mich, um mir das Notwendigste anzuschaffen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse hatten sich in der Familie ein wenig gebessert, seit die beiden Schwestern als Fabriksarbei terinnen mitverdienten. Nicht so die beiden Brüder Leopold und Gasper, die als Lehrlinge in die Maschinenschlosserei gingen, um 4
7
DERMOTA / T A U S E N D U N D E IN ABEND
Später, als Facharbeiter, eine bessere Position zu erringen. Leopold absolvierte neben der Lehre als Externist eines öffentli chen Gymnasiums alljährlich eine Klasse und brachte es so bis zur Matura. Eine beachtliche Leistung, aber auch ein überzeugen der Beweis für den leidenschaftlichen Drang von uns Burschen, den beengten Verhältnissen unseres Zuhauses zu entkommen. Leopold ging später ans Konservatorium in Ljubljana und darauf - sozusagen immer in meinen Fußstapfen - nach Wien, um bei derselben Ixhrerin, bei der ich studierte, Gesangsunterricht zu nehmen. Auch ihm gelang es, wie schon erwähnt, ins Engage ment zu kommen und vSOals zweiter Dermota die Sängerlaufbahn anzutreten. Gasper kam auf anderen Wegen zu dem gleichen Ziel. Nach dem er schon einige Zeit als Maschinenschlosser tätig gewesen war, bezog er die technische Mittelschule in Ljubljana und stu dierte dort nebenbei Sologesang am Konservatorium. Als festver pflichtetes Mitglied der Nationaloper Ljubljana war er schließlich der dritte Dermota-Tenor, bis ihn die Partisanen in die Wälder holten. Die Wellen der Wirtschaftskrise von 1929/30, die eine Welt erschütterte, schlugen bis nach Kropa. Ein Großteil der Fabrik mußte stillgelegt werden. Das Gespenst der Arbeitslosi^eit ging um. Gaspersic legte mir nahe, mich wieder um einen Organisten posten zu bewerben, damit mein Amt im Werksbüro für einen Mann frei würde, der sonst ohne Verdienst dastünde. Wieder half Direktor Premerl. Er empfahl mich an den Pfarrer des nahegele genen Dorfes Trzic (Neumarktl), wo die größte Schuhfabrik des Landes stand. Es war ein strahlender Sonntag im Februar 1930, als ich von Kropa dorthin aufbrach. Ich ging die 15 Kilometer zu Fuß, und ich erinnere mich noch des seltsamen Glücksgefühls, das mich beherrschte, als ich durch die frostklirrende, winterlich verzauberte Landschaft wandelte, immer die blitzenden, majestä tischen Bergspitzen der Karawanken vor mir. Um die Mittagszeit traf ich im Pfarrhaus von Trzic ein, wo ich 48
I
K in d h e it
in
K r o p a : d ie E ltern . H ie r
bei
einem
Besuch m it F rau D e rm o ta
2
D a s W a s se rra d
eines heute
» V ig en c«, bereits
ein
Schaustück f ü r die T ouristen
8 / 9
S tu d ien zeit
oben H ild a w a ld ,
in
W ie n :
B e rg e r -W e y e r-
D erm o ta s
sp ä tere
F ra u , unten d a s erste Photo d e r W ie n e r Z eit,
1 9 3 5
II / H U N G E R MACHT MUTIG
schon erwartet wurde. Der geistliche Herr lag krank darnieder, machte mir aber sofort ein verlockendes Angebot. Ich sollte nicht nur das Amt des Organisten, sondern auch das des Chorleiters und das des Kapellmeisters einer Blasmusik übernehmen, und zwar gegen ein Honorar von 1400 Dinar monatlich. Das war um 300 Dinar mehr, als mein Beamtengehalt betrug und immerhin bereits eine Summe, um die man einen guten Maßanzug kaufen konnte. Trotzdem erbat ich mir Bedenkzeit. Ich weiß nicht, war um ich es tat, was mich dazu bewog. Wie ich mir auch das Merk würdige nicht erklären kann, das nun folgte. Am späten Nachmittag kam ich nach Hause und nahm die Sonntagszeitung zur Hand, die der Vater abonniert hatte. Ich war stets ein eifriger Zeitungsleser, aber die Annoncen beachtete ich nie. Warum ich es gerade damals tat, kann ich nicht deuten. Es muß wohl höhere Fügung gewesen sein, denn ich kann und will nicht glauben, daß unser Leben dem blinden Zufall ausgeliefert ist. Eine winzige dreizeilige Anzeige fiel mir ins Auge, in der zu lesen stand, die Nationaloper von Ljubljana suche für ihren Opernchor einen Ersten Tenor. Ein Wink des Schicksals! Ich zögerte keinen Augenblick und fuhr schon am nächsten Tag nach Ljubljana.
Ill
Aus dieser Stimme wird nichts M usikstudent und Opemchorist in h/iibach
Ich suchte zunächst einen alten Kameraden aus der Organisten schulzeit auf, der, 20 Jahre älter als ich, inzwischen führender Tenorist im Domchor und arriviertes Mitglied des Opernchores geworden war. Er versprach sofort, mir zu helfen, das heißt, mei ne Bewerbung durch Empfehlung zu unterstützen. Was er so überzeugend tat, daß ich auf der Stelle engagiert wurde, und zwar - es klingt unwahrscheinlich, ist aber wahr - ohne Probesingen, also ohne auch nur einen Ton von mir gegeben zu haben. Bedin gungen konnte ich natürlich keine stellen. Die 1000 Dinar, die man mir als Gehalt bot, waren materiell ein erheblicher Rückfall. Aber er wurde aufgewogen durch eine Aussicht, die sich mir vielversprechend anbot: Wenn du deine Stellung an der Oper festigst, kannst du weiter Musik studieren. Und diese Überlegung gab den Ausschlag. Ich setzte mich sofort hin und schrieb an den Pfarrer von Trzic, dankte ihm für sein freundliches Angebot, das ich nun doch nicht annehmen konnte, legte ihm meine Gründe dar und bat um sein Verständnis. In ähnlichem Sinn klärte ich auch Regenschori Premerl über die neu entstandene Situation und meine weiteren Pläne auf, die er voll und ganz billigte. Allerdings mußte ich ihm versprechen, im Notfall in seinem Domchor aus zuhelfen. Mit I. September 1930 durfte ich mich »Opernsänger« nennen. 5
0
Ill / AUS D I ES E R STI MME WI RD NI CHTS
wenn ich auch nur ein ganz bescheidenes Mitglied des Chores war. Und ganz bescheiden mußte ich anfangen, denn ich verfügte weder über Bühnenerfahrung noch über ein Repertoire. Aul3erdem war ich der Jüngste im Chor, der unter den alten, abgebrüh ten Routiniers von vornherein keinen leichten Stand hatte. Opernchorist in der Provinz, das bedeutete - ich konnte mich bald davon überzeugen —musikalisches Proletariat. Man war an die täglichen Probendienste gebunden, und wer etwa die ehrgei zige Absicht zeigte, aus der musikalischen Tagesfron auszubre chen, wurde von den Kollegen mit scheelen Augen angesehen. Ich aber hatte von Haus aus diesen Ehrgeiz. Unverzüglich warf ich mich aufs Studium und belegte sämtliche Fächer, die das damalige Staatskonservatorium zu bieten hatte: vom Kontra punkt bis zur Formenlehre, von der Musikgeschichte bis zur Instrumentenkunde und zum Dirigieren, wobei ich auf dem etwas schmalen, doch soliden Fundament der einstigen Organi stenschule weiterbauen konnte. Ich wünschte, daß die jungen oder die angehenden Sänger von heute gezwungen wären, wenigstens einen Teil dieses Weges der musikalischen Grundausbildung zu gehen. Um wieviel tiefer wür den sie in die Aufgabe ihres künftigen Berufes eindringen. Heute baut man fast ausschließlich auf das Stimm-Material ; aber das allein genügt nicht. Ein Sänger muß die musikalischen Zusam menhänge, muß Form und Struktur eines Werkes verstehen. Erst dann wird er eine Partie aus dem Geist der Musik heraus gestal ten können. Natürlich belegte auch ich die Hauptfächer Stimm bildung und Sologesang und erarbeitete mir in der Opernklasse die Grundzüge eines Repertoires. Leiter dieser Opernklasse war der Kapellmeister der Laibacher Oper Dr. Danilo Svara, und die erste Partie, die ich bei ihm studierte, war der Alfred Germont in Verdis »Traviata«. Warum gerade der Alfred? Ich habe meine damaligen stimmli chen Fähigkeiten vorsichtig eingeschätzt und mir nicht zu viel zugemutet, folglich also jene Partie gewählt, die keine extremen
DERMOTA / TA U S E N D U N D E IN ABEN D
Anforderungen an Höhe und Volumen der Stimme stellt. Wie richtig ich damit entschied, ergibt sich daraus, daß die »Traviata« später, in meiner Sängerlaufbahn, eine entscheidende Rolle spiel te. Natürlich kam ich in Terminschwierigkeiten. Die täglichen Chordienste begannen um halb zehn, viele meiner Vorlesungen aber dauerten von acht bis zehn oder gar elf Uhr vormittag. Was tun? Es gab nur einen Weg; den schweren Bittgang zum Opern direktor. Ich wagte ihn mit klopfendem Herzen, aber festem Mut, und das Wunder geschah. Der Direktor - sein Name sei hier dankbar genannt, er hieß Mirko Polie — zeigte Verständnis, obwohl er sich darüber im klaren sein mußte, daß er mich als Chorsänger gerade durch mein Studium bald verlieren würde. So durfte ich, der Benjamin des Chors, mit seiner Zustimmung als einziger verspätet zu den Proben eintreffen. Dadurch stempelte ich mich zum hoffnungslosen Außenseiter. Quartier nahm ich zunächst wieder bei Tante Wagner, die mir nun schon ein eigenes Zimmer zur Verfügung stellen konnte. Aber die langen Wege von der Peripherie in die täglichen Vorle sungen und die langen Heimmärsche nach Schluß der Vorstel lungen wurden mit der Zeit untragbar. So suchte und fand ich ein Zimmer in der Stadt. Das konnte ich mir bereits leisten, denn mein Gehalt war nach etwa einem Jahr überraschend auf 1500 Dinar aufgebessert worden. Davon konnte ich bescheiden leben und außerdem noch ein wenig die Familie daheim unter stützen. Der Chordienst in der Oper war so umfassend, daß er mich neben dem Studium völlig ausfüllte. Gespielt wurde täglich außer Montag, und zwar abwechselnd Oper und Operette. Das Theater mit seinem Fassungsraum für etwa sechshundert Personen hatte einen zahlenmäßig bescheidenen Besucherstock. So war es not wendig, das Programm häufig zu wechseln. Wurde eine Oper zehnmal gegeben, war das schon ein Erfolg. Das traf natürlich nicht auf die Operette zu, die in den Hauptpartien stets mit den 5
2
Ill / AUS DI E S E R STI MME WI R D NI CHTS
ersten Opernkräften besetzt wurde, daher auf recht hohem Ni veau stand und mit Recht sehr beliebt war. Von ihr hat das Thea ter, nebst der bescheidenen staatlichen Subvention, so eigentlich gelebt. Welche Opern wurden gespielt ? So gut wie keine von Mozart, ln den Jahren meiner Choristen-Zeit gab es nur eine einzige - die für mich später so wichtige »Così« —, und auch sie verschwand rasch aus dem Spielplan. Fundament des Repertoires war die ita lienische Oper, obgleich es gerade hier politische Schwierigkeiten gab. Nach dem Ersten Weltkrieg war nämlich ein Großteil von Istrien und Dalmatien an Italien gefallen. Nun taten die italieni schen Behörden alles, um die dort ansässigen Slowenen zu unter drücken. Das ging so weit, daß die slowenische Volksgruppe nicht einmal in der Kirche in ihrer Muttersprache beten durfte. Der verletzte Nationalstolz wandte sich darum oft in heftigen Angriffen gegen die Leitung der National-Oper wegen ihrer »unverantwortlichen« Pflege und Förderung der italienischen Oper. Daß sich Direktor Polie an weniger Gängiges heranwagte, wie Massenets »Weither«, Charpentiers »Louise« oder Giordanos »André (Tenier«, überdies auch an so anspruchsvolle Werke wie »Walküre« und »Parsifal«, zeigt nicht nur seine Ambitionen, sondern auch seinen künstlerischen Ernst. Eine Selbstverständlichkeit war die eifrige Pflege der slawi schen Oper: Tschaikowskis »Eugen Onegin« und »Pique Dame« (in der ich eine meiner ersten kleinen Solopartien bekam), wei ters Borodins »Fürst Igor« und Dvoraks »Rusalka« dominierten, wurden aber an Popularität weit übertroffen durch Smetanas »Verkaufte Braut«. Dieses Zugstück wurde dann im Sommer auch im nahegelegenen Tivoli-Park, dem Stolz von Ljubljana, aufgeführt. Die Premiere, an einem Sonntagnachmittag, war für mich das erste Opernerlebnis unter freiem Himmel. Laibach widmete sich natürlich auch der slowenischen, kroati schen und serbischen Nationaloper mit Werken zeitgenössischer 5
3
DERMOTA / TA U S E N D U N D E IN ABEND
Autoren, die sich aber nicht immer durchsetzen konnten. Das sicherste und bis heute an Beliebtheit nicht überbotene Werk die ser Art war »Die Oberkrainer Nachtigall« (»Gorenjski slavcek«) von Josip Foerster, einem eingewanderten tschechischen Kom ponisten, der seinerzeit Domorganist und Kapellmeister war und außerdem die Organistenschule der Diözese, meine erste Ausbil dungsstätte, mitbegründet hatte. Direktor Polie dirigierte alljährlich auch ein Orchester-Chor konzert mit dem gemischten Laibacher Laienchor. Zu dessen Verstärkung holte er gelegentlich ein paar Leute aus dem Opern chor heran. So wurde auch ich einige Male verpflichtet und hatte Gelegenheit, die Gattung Oratorium, die sonst in meiner Heimat kaum gepflegt wurde, näher kennenzulernen. Ich durfte in Haydns »Schöpfung« und Beethovens »Neunter« mitwirken, wurde aber am meisten beeindruckt durch »Fausts Verdammnis« von Hector Berlioz, und dies nicht nur wegen des hinreißenden Rakoczy-Marsches, sondern auch vor allem wegen des dramati schen Impetus und der großartigen Instrumentierung, mit der sich mir ein neues Reich der Töne erschloß. Später habe ich die sehr anspruchsvolle Partie des Faust sowohl in der französischen Original spräche als auch deutsch mit großer Begeisterung gesungen, und immer hat dabei die Erinne rung an das erste Erleben des Werkes mitgeklungen. Um diese Zeit knüpften sich auch meine Beziehungen zum Laibacher Rundfunk. Ich wurde öfter dazu herangezogen, mit dem neugebildeten Radio-Salon-Orchester allerlei merkwürdige Bearbeitungen zu interpretieren. So sang ich Richard Wagners »Winterstürme« aus der »Walküre« zur Begleitung einer ZehnMann-Kapelle oder Franz Schuberts »Am Meer« nicht mit der originalen Klavier-, sondern mit Orchesterbegleitung. Gerne erinnere ich mich der Volksliedsendungen, die ich mitgestaltete und die sehr beliebt waren. Mein Begleiter am Klavier war der schon vorhin genannte Leiter der Opernklasse am Staatskonser 5
4
Ill / AUS D I E S E R STI MME WI R D NI CHTS
vatorium, Dr. Svara, der merkwürdigerweise acht Jahre vorher mein erster Klavierlehrer in der Organistenschule gewesen war, inzwischen aber in Deutschland Musik studiert und außerdem das Doktorat der Handelswissenschaften erworben hatte. Was nun den Operetten-Spielplan der Laibacher Oper von damals betrifft, so zeigte er eine höchst sonderbare Zusammen setzung. Es gab keine »Fledermaus« und keinen »Zigeunerba ron«, ja es gab überhaupt keinen Johann Strauß! Die Serienerfol ge waren vielmehr - neben Kalmans »Gräfin Mariza« und Nedbals »Polenblut« —Paul Abrahams »Ball im Savoy« und seine »Viktoria und ihr Husar« sowie die »Mascotte« von Edmond Audran, einem heute völlig vergessenen französischen Komponi sten in der Nachfolge Offenbachs, weiters die »Drei Musketiere« von Benatzky, vor allem aber dessen »Weißes Rößl«, das auch bei uns dauernd die Ränge und die Kassen füllte. Die klassische Operette war ausschließlich durch Karl Zellers liebenswürdigen »Vogelhändler« vertreten, der für mich insofern Bedeutung erlangen sollte, als mir darin über Nacht die Partie des Grafen Stanislaus und damit die erste Solopartie zugewiesen wurde. Und weil ein Unglück selten allein kommt, mußte ich fast zur selben Zeit innerhalb von zehn Stunden die Bariton-Partie des Marullo im »Rigoletto« übernehmen. Ich weiß nicht mehr, wie ich das überstanden habe. Ich wurde von Lampenfieber geschüttelt; aber schließlich ging alles gut. Der Direktor war zufrieden, und es gab für mich sogar einige Anerkennung aus den Reihen der Kollegen, auf deren Kameradschaft ich ja beson ders angewiesen war. Die Chorsänger hatten eine gemeinsame Garderobe, einen großen Raum, der untertags als Probensaal diente. Dort hatte jeder für abends sein Kästchen mit den paar notwendigen Uten silien, und so roch es nach Schminke, Naphthalin und Arbeits schweiß. Diese undefinierbare Theaterluft hat mich rasch in ihren Bann geschlagen. Auch die Pausen zwischen den Auftritten ver brachten wir in diesem kuriosen Mehrzweckraum. Die einen füll5 5
DERMOTA / T A U S E N D U N D E IN ABEN D
ten sie mit dem Erzählen deftiger Witze, die anderen mit Karten spielen, Rauchen oder Z^itunglesen, wieder andere benützten die Pauken, die von den Orchesterproben hier standen, als Tische für ihre Schachpartien. Ich selbst nützte die Zeit zum Studium und zur Vorbereitung auf den nächsten Unterrichtstag am Konserva torium. Ich habe die Spannungen zwischen den Mitgliedern des Cho res, die Eigenheiten der Solisten, das Intrigenspiel und die Eifer süchteleien, den Tratsch hinter den Kulissen miterlebt, und ich habe in den vier Jahren meines Chordienstes den Opernbetrieb mit all seinem Drum und Dran von Grund auf kennengelernt. Auch von seiner prekären materiellen Seite. Die Theaterkrise der dreißiger Jahre machte vor unserer Oper nicht halt. Oft blieben die staatlichen Zuschüsse, die aus Belgrad kommen sollten, aus. Dann mußte sich das Theater selber erhal ten. Blieben die Kassen leer, gab es am Ersten keine Gage. Waren die Sonntagsvorstellungen gut besucht, bestürmten wir am andern Morgen den Kassier, um wenigstens ein a conto zu ergattern. Trotzdem kam es vor, daß wir am Letzten des Monats die Gage noch nicht hatten, die wir am Ersten hätten bekommen sollen. Aber damals ging meine Zeit im Opernchor bereits dem Ende zu. Die Abschlußprüfungen im Staatskonservatorium nahten. Ich muß erwähnen, daß man dort alljährlich kleine Schülerkonzerte gab, Abende mit gemischtem Programm. Bei solcher Gelegenheit hatte ich meinen ersten Konzert-Auftritt als Solist: ich sang die Arie des Alfred aus »Traviata«, ich sang die große Arie des Lenski aus »Eugen Onegin« und ich sang Lieder zeitgenössischer slowenischer Komponisten. Parallel zu den Schülerkonzerten gab es szenische Darbietun gen von Opernfragmenten, mit Klavierbegleitung, aber in Kostüm und Maske. Ich erinnere mich noch meiner ersten Auf tritte: es war die Sterbeszene aus »Traviata«, der zweite Akt aus Gounods »Margarete« mit der berühmten Faust-Cavatine, die Duell Szene aus »Eugen Onegin« und —höchst sonderbar —die 5 6
Ill / AUS D I ES E R STI MME WI R D NI CHTS
große Szene zwischen Manrico und Azucena im »Troubadour«. Wie ich als schmächtiger, halbverhungerter Anfänger mit lyri scher Stimme als Manrico gewirkt haben muß, möchte ich mir heute lieber nicht vorstellen. Bei den Schülerkonzerten hatte ich übrigens als Zögling der Klavierklasse einmal einen Pianistenauftritt, bei dem ich die klei nen Präludien von Bach, die Bagatellen von Beethoven und aus den Impromptus von Schubert spielte. Außerdem hatten wir Gesangsschüler uns wechselseitig zu begleiten. Bei einem der Konzerte war ich einer sehr begabten Sopranistin zugeteilt, die unter anderem die zwei Brahmslieder »Auf dem Kirchhof« und »Vergebliches Ständchen« vortrug. Es war dies meine erste bewußte Begegnung mit Brahms. Ein weiteres Betätigungsfeld erschloß sich uns Gesangsschü lern im Rahmen der Laibacher Volkshochschule. Bei dieser Gele genheit hörte ich von einem Kollegen mit schöner Baritonstim me Schuberts »Krähe«, ein Lied, das mich tief ergriffen hat. Spä ter wurde auch ich zum Singen eingeladen, und da wählte ich unter anderem Schuberts Ständchen »Leise flehen meine Lieder«. Für solche Darbietungen gab es ein kleines Honorar. Es war mein erster »Verdienst« als Konzertsänger. Eines Tages trat Monsignore Premerl an mich mit der Frage heran: »Wollen Sie nicht in unserer Organistenschule die Anfän gerklasse für Klavier übernehmen ?« Dieses Angebot war zu ver lockend; ich konnte es nicht abweisen. Und weil mein Tag bereits voll ausgelastet war, so habe ich zwei Jahre lang die Kla vier-Abc-Schützen in den Morgenstunden von bis 8 Uhr früh unterrichtet. Ich machte mir keine Illusionen. Ich baute nicht auf meine Stirnme, deren Zukunft ungewiß war, sondern auf den Lehrberuf Nach Absolvierung des Staatskonservatoriums wollte ich aus dem Opernchor scheiden und in einer Mittelschule Musiklehrer werden. Dazu aber fehlte mir als Mindesterfordernis die soge nannte kleine Matura, das heißt, ich mußte, um mein Ziel zu 5
7
DERMOTA / T A U S E N D U N D E IN ABEND
erreichen, neben allen meinen Pflichten auch noch vier Klassen Mittelschule als Externist absolvieren. Daß ich es tatsächlich schaffte, erscheint mir heute fast wie ein Wunder. Gesundheitlich geriet ich dabei in ernste Gefahr, war nervlich und körperlich erschöpft. Ein verständnisvoller Arzt rettete mich durch Eisenin jektionen vor dem Zusammenbruch. So habe ich diese schwere Zeit überstanden. Die Abschlußprüfungen im Staatskonservatorium waren streng und feierlich. Festlich gekleidet saß die Jury um den grün bespannten Konferenztisch, der Direktor erschien im Cut. Als Gesangs-Kandidat hatte man ein Prüfungsstück öffentlich vorzu tragen, das erst 48 Stunden vorher bekanntgegeben wurde. Die Auswahl behielt sich der Direktor vor. Er hieß Julius Betetto und hatte in jüngeren Jahren als lyrischer Baß unter der Direktion Schalk an der Wiener Staatsoper gesungen. Jetzt war er gefeierter Baß der Laibacher Oper, und in seiner Dreifach-Funktion als Direktor, Gesangspädagoge und Solist die absolute musikalische Autorität der Stadt. Wir nannten ihn nur »Meister«, und so trug er sich auch. Zwei Tage vor einem Auftreten in der Oper —er war ein großartiger Kezal und ein trefflicher Lothario in »Mi gnon« sowie ein eindrucksvoller Collin in »Bohème« - pflegte er nur mehr zu flüstern, ging mit hochgestelltem Mantelkragen durch die Gassen, einen Schal um den Fiais, ein Taschentuch vor dem Mund. Seine Sprechstunden als Direktor des Konservatori ums sagte er natürlich ab. Ich zählte nicht zu seinen Schülern, sondern lernte bei Frau Wanda von Wistinghausen, einer gewesenen Opernsängerin pol nischer Abstammung. Sie war eine standesbewußte Dame, die sehr auf Distanz hielt. Gesangstechnisch habe ich bei ihr herzlich wenig profitiert, aber sie war hochmusikalisch, spielte vorzüglich Klavier und hat mich wiederholt im Rundfunk am Flügel beglei tet. Zu Direktor Betetto hatte sie ein etwas gespanntes Verhältnis, wie es sich eben aus den in Provinzschulen üblichen Eifersüchte 5
8
Ill / AUS D I ES E R STI MME WI R D NI CHTS
leien ergibt. Vielleicht war das der Grund, weshalb Betetto mir, dem Schüler der Konkurrenz, ein besonders schwieriges Prü fungsstück zuteilte: die B-Dur-Arie »II mio tesoro intanto« aus Mozarts »Don Giovanni«. Ich hatte die Arie vorher nie gehört, geschweige denn gesun gen. Der »Don Giovanni« stand nicht im Repertoire der Laiba cher Oper. Von den technischen Schwierigkeiten der Arie ahnte ich nichts. Ich habe mich mit derlei Problemen erst viel später in Wien von Grund auf auseinandergesetzt. Damals löste ich meine Aufgabe rein intuitiv, doch es war wohl ein Wink des Himmels, daß ich so früh auf Mozart hingelenkt wurde. Die Prüfung bestand ich, wie alle Abschlußprüfungen, mit Auszeichnung. Daraufhin wurde mir nahegelegt, mich um ein Stipendium zu bewerben. Es stand da ein bescheidener Fonds zur Verfügung, der alle paar Jahre frei wurde. Vor mir hatten zwei Pianisten und ein Geiger das Stipendium erhalten; ich war der erste Sänger, der sich darum bewarb. Daß ich es tatsächlich erhielt, ist eigentlich rätselhaft, denn man holte selbstverständlich auch das Urteil Direktor Betettos ein, und das war vernichtend: »Aus dieser Stimme wird nichts! Für eine Solisten-Karriere reicht sie keinesfalls!« Von diesem Ausspruch habe ich erst viel später erfahren, als ich schon Mitglied der Wiener Staatsoper war. Da kam ich ein mal nach Ljubljana und begegnete Betetto wieder, ja, ich trat sogar mit ihm zusammen in Puccinis »Bohème« auf Er sang sei nen berühmten Collin, ich —als Gast —den Rudolf. Wir sprachen über vieles, über die Zustände an der Wiener Oper, über sein eigenes unbefriedigendes Sängerschicksal (»wäre ich damals nur in Wien geblieben ...!«), über sein einstiges Fehlurteil aber, mit dem er beinahe meine Sängerlaufbahn und damit mein Leben verbaut hätte, sprachen wir kein Wort. Das Stipendium, das mir für die Ausbildung zum Sänger oder zum Musiklehrer verliehen wurde, bot mir die Möglichkeit, unter drei Musikstädten zu wählen: Paris, Prag oder Wien. Ich ent5
9
DERMOTA / TAUSENDUNDEIN
ABEND
schied mich für Wien. Eine Bedingung war an das Stipendium geknüpft: Ich mußte mich verpflichten, nach abgeschlossenem Studium in die Heimat zurückzukehren und dort meine erworbe nen Kenntnisse und Fähigkeiten - sei es als Sänger, sei es als Pädagoge - zur Verfügung zu stellen, oder aber das Stipendium zu refundieren. Tatsächlich habe ich später die empfangenen Gel der auf Heller und Pfennig zurückgezahlt. Mein Entschluß, nach Wien zu gehen, wurde durch zwei Umstände bestimmt. Ich hatte nicht nur gehört, ich wußte, daß Wien ein reiches Konzert leben und eine berühmte Oper hatte. Schon während meiner Beamtenzeit in Kropa besaß ich einen kleinen Radioapparat mit Batteriebetrieb und Kopfhörern. Er hatte es mir ermöglicht, ganze Abende lang Musik aus den Welt städten, vor allem aber aus Wien, zu hören. Damals gab es viele Übertragungen aus der Staatsoper, und ich versäumte kaum eine, wobei es mir besonders die Vorstellungen mit Alfred Piccaver angetan hatten. Außerdem hatten sich - und das war der zweite Grund -- vor mir einige Musikstudenten aus meiner Heimat für Wien entschie den und mir geraten, das gleiche zu tun. Auf diese Weise ist mir auch meine spätere Gesangslehrerin Marie Rado empfohlen wor den. Eine Sopranistin, die in Wien Frau Radös Schülerin war, hatte bereits in Laibach und Belgrad Karriere gemacht, und sie war es, die mir den Weg zu Frau Rado wies. Ich schrieb an die Pädagogin, meldete mich an und eines Tages - es war Ende Sep tember 1934 —packte ich meinen Koffer und fuhr nach Wien.
IV
Sie fangen ja gut an Von der Schule Rado an die Staatsoper
Es war eine Fahrt ins Ungewisse. Aber ich hatte Vertrauen und war guter Dinge. Vor mir lag die Welt —vor allem die Welt der Musik, die ich bereits mehr liebte, als ich ahnte. Für ein Quartier war gesorgt. Ein mir befreundeter Musikstudent aus meiner Hei mat hatte es mir abgetreten : ein Hofkabinett in der Starhemberg gasse, bei einer Witwe nach einem pensionierten Südbahn beamten. Er hatte es bewohnt, während er bei Friedrich Buxbaum die Celloklasse absolvierte. Später wurde er Operndirektor in Ljubljana und machte als Dirigent eine beachtliche internatio nale Karriere. Seine Mutter bezog eine Pension aus Österreich. Mit Hilfe dieser Pension war es möglich, das Stipendium für mich ohne Umstände nach Wien zu überweisen. Auf dem Kom pensationswege wurden einfach Pensions-Schillinge gegen Stipendien-Dinare ausgetauscht und so die Schwierigkeiten bei der Überweisung von Devisen überwunden. Verständlich, daß sich bei diesem Tausch oft Verzögerungen ergaben, so daß ich wie derholt in Geldnöte geriet. Aber ich machte mir darüber keine Sorgen. Die Angst, daß es einmal gar nicht mehr langen und ich ohne Mittel dastehen würde, kannte ich damals nicht. Das kam erst viel später. Ich habe es erfahren : Je weniger der Mensch hat, desto unbeschwerter ist er. Mein Stipendium betrug monatlich etwa i6o gute alte Schillin ge. Die täglichen Privatlektionen bei der Gesangslehrerin koste6i
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
ten rund 6o Schilling, die Miete machte 35 Schilling aus. Dazu kamen Klavierstunden bei Professor Anton Trost für insgesamt 25 Schilling. Blieben als Rest bare 40 Schilling, also ein wenig mehr als ein Schilling pro Tag. Wie konnte ich davon leben? In der Johann-Strauß-Gasse, wo Frau Rado wohnte, stand ein bescheidenes bürgerliches Gasthaus; dort kostete das billigste Mittags-Menü S 1,20. Das war für mich zu viel. Ich trat daher mit dem Wirt in Verhandlungen ein und wir einigten uns schließlich auf ein Menü zu 80 Groschen, ohne Fleisch und ohne Mehlspeise. Dazu kaufte ich täglich ein halbes Kilogramm Schwarzbrot, das ich über den Tag verteilte. Den ersten Teil verzehrte ich zum Frühstück, das ich mir selbst aus Kaffee-Extrakt bereitete, den zweiten genoß ich abends mit einer Gulaschsuppe oder einem ähnlichen billigen Gericht beim stadtbekannten Otto Kaserer kurz O K genannt —, dem ersten Selbstbedienungsrestaurant Wiens. Später übergab mir Frau Rado ein paar Schüler —meine Kollegen —zum Korrepetieren, und da fielen für mich einige Schillinge ab. Ich fühlte mich in der Großstadt ziemlich verloren und suchte Anschluß. Da erinnerte ich mich, daß in Simmering ein enger Landsmann von mir, namens Slibar, wohnte. Seine Mutter hatte ich noch gekannt, als sie zur Weihnachtszeit in Kropa mit einer Gruppe singend von Haus zu Haus gegangen war. Sie war ein Original und im übrigen die wandelnde Überlieferung sloweni schen Liedgutes. Dank ihres Gedächtnisses konnte Joze Gaspersic, lange bevor es das Tonband gab, eine Fülle slowenischer Volkslieder aufzeichnen und damit für die nachkommenden Generationen retten. Ich wurde bei den Slibars freundlich aufgenommen, ja Frau Slibar bemutterte mich förmlich, und der Kontakt wurde bald so herzlich, daß ich mich fast jeden Sonntag in Simmering einstellte, wo ich auch mit einer kräftigen Mahlzeit bewirtet wurde. Gestärkt pilgerte ich dann meist mit den Kindern Slibar ins Kon zerthaus, zu einem der beliebten, populären Sonntagnachmittag62
IV /
SIE F A N G E N JA G U T AN
Konzerte der Tonkünstler unter Anton Konrath oder Guido Binkau, der Jahrzehnte später als Pädagoge an der Wiener Musik akademie mein Kollege werden sollte. Der Stehplatz kostete 30 Groschen ; dafür reichte es gerade noch. So habe ich einen Großteil der klassischen Konzert 1itérâtur kennengelernt, darunter den »Messias«, die »Jahreszeiten«, das Mozart-Requiem. Vater Slibar nahm mich auch einmal auf den Zentralfriedhof mit, wo er zu Allerheiligen einen Würstelstand betrieb. Dort half ich ihm seine Ware ausrufen - »Heiße, heiße ...!« —und durfte mich dafür mit Frankfurtern und Debrezinern sattessen. Der Sohn des Hauses, Alfred, war Pilot im Zweiten Weltkrieg, geriet in russische Gefangenschaft, schlug sich auf der Flucht bis Wien durch, schaffte hier in kürzester Zeit den Dr. Dipl.-Ing., praktizierte anschließend in Stuttgart bei Mercedes und in den USA und ist heute hochangesehener ordentlicher Professor der Technischen Universität in Wien. Auf seinem Spezialgebiet, der Maschinendynamik und der Unfallforschung, hat er internationa le Anerkennung gefunden. Mit ihm und seiner Familie sind wir über all die Jahre hinweg in herzlicher Freundschaft verbunden geblieben. Auch sonst bewährte sich die Kontaktfreudigkeit und Solidari tät meiner in Wien lebenden Landsleute, so daß ich bald bei mehreren Familien ein und aus ging und favSt nach jeder Hunger woche mit einem ausgiebigen sonntäglichen Mittagstisch rechnen konnte. Ich war also eine Art Kostgänger mit wechselnden Nähr vätern und -müttern. Da war etwa ein slowenisches Pensionistenehepaar in der Wiedner Hauptstraße. Der Mann hatte noch in der Monarchie bei der Südbahn gedient. Sein Bruder war Universitätsprofessor für Theologie in Ljubljana, er aber schwärmte auf die romanti scheste und weltfremdeste Weise für den russischen Kommunis mus. Durch dieses Ehepaar fand ich Eingang in die Familie Komarek, die in der nahen Triester Straße wohnte, und deren Tochter Dora später meine Kollegin an der Staatsoper wurde. 63
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
Dora Komarek kam schon mit sechs Jahren als Ballett-Elevin ans Haus am Ring und wechselte dann zum Gesang über. Ihre erste Rolle als Sängerin war die Esmeralda in der »Verkauften Braut«, in der sie auch ihre Tanzkunst verwerten konnte. Später war sie eine reizende Papagena und gefeierte Soubrette, bis sie von Willi Forst für den Film entdeckt und unter dem Namen Dora Komar groß herausgestellt wurde. In der Premiere von Aimé Maillarts Spieloper »Das Glöckchen des Eremiten« in der Staatsoper, unter Knappertsbusch im Herbst 1938, war ich ihr Partner auf der Bühne. Sie hat später geheiratet und ist nach Bra silien übersiedelt. Vater Komarek war ein begeisterter WagnerAnhänger. Ich erinnere mich noch, daß wir einmal bei ihm zu dritt das »Meistersinger«-Quintett sangen, wobei ich den Stolzing übernahm und die fehlenden Stimmen auf dem Klavier ergänzte. Mein Hofkabinett in der Starhemberggasse war nicht heizbar. Es stand zwar ein alter Ofen drin, aber der war nicht zu gebrau chen, was nichts ausmachte, denn ich hatte ja ohnehin kein Geld für Brennmaterial. Ein einziges Mal hat meine spätere Frau, als ich mit schwerer Bronchitis zu Bett lag, versucht, den Ofen in Schwung zu setzen. Dabei wären wir beide fast erstickt. Ansonsten aber war ich gut aufgehoben und fühlte mich zufrieden und glücklich, weil ich keine Ansprüche an das Leben stellte. Meine Hausfrau, eine kultivierte jüdische Dame, hatte Verständnis für mich und steckte mir auch manchmal ein Stück Mehlspeise oder sonst eine Kleinigkeit zu. Vor allem durfte ich, wenn sie sich nicht gestört fühlte, auf ihrem Klavier im Neben zimmer üben, und dieses Zimmer war geheizt. Gesangsübungen schätzte sie weniger, aber das konnte ich begreifen. Wenn ihre beiden erwachsenen Töchter Besuch bekamen, mußte ich das Feld räumen. Ein Untermieter beeinträchtigte offenbar das Pre stige der Familie. Meine Gesangslektion fand täglich um 11 Uhr vormittags statt und dauerte etwa dreißig Minuten. Das erwies sich bald als zu 64
IV /
SIE F A N G E N JA G U T AN
wenig. Deshalb bestellte mich Frau Rado oft noch für den Nach mittag oder Abend zu sich und ich bekam —ohne zusätzliche Kosten —eine zweite Ixktion. Marie Rado-Danielli —so nannte sie sich, womit sie auf ihre Beziehungen zu alten italienischen Gesangsmeistern hinwies - war eine weißhaarige ältere Dame, stattlich, gewichtig, mit markantem, ausdrucksvollem Gesicht, eine starke Persönlichkeit, die absolutes Vertrauen einflößte. Sicher war sie eine Frau mit reicher Lebenserfahrung und wohl auch reicher Vergangenheit, aber davon wußten wir nicht viel. Ich habe nie etwas von ihrer Karriere gehört, weiß nicht einmal, ob sie je auf der Bühne gestanden ist, obgleich sie sich gerne auf die Materna, die berühmte Wagner-Sängerin, berief. Ihre Wohnung in der Johann-Strauß-Gasse bestand aus drei Räumen, die von einer geheimnisvollen, anheimelnden BohèmeAtmosphäre erfüllt waren. Die Wohnungstüre, die ein weibliches Faktotum zu öffnen pflegte, führte in ein dunkles Vorzimmer. Von hier erreichte man das Unterrichtszimmer, dessen Fenster in den Draschepark hinausgingen. Wie oft habe ich aus diesen Fen stern auf die Bäume des Parks geschaut: hoffnungsvoll, frohlokkend, verzweifelt. Das dritte Zimmer bewohnte der Gatte Rado, ein pensionierter Hauptmann der k. und k. Armee, Typus des altösterreichischen Offiziers, ein väterlicher Kavalier und eine Autorität wie seine Gattin. War das bejahrte Faktotum einmal nicht zugegen, bemühte sich der Herr Hauptmann a. D. persön lich, die Schüler einzulassen. Aber schon stürzte Frau Rado zur I ure und entschuldigte sich bei ihm in aller Form wegen der Störung, obgleich es immer rätselhaft blieb, worin er eigentlich gestört wurde. Eine einzige kleine Schwäche hatte meine Lehrerin: das Rau chen. Nach jeder Lektion stemmte sie sich mit ihrer stattlichen l 'igur in den Türstock und paffte eine Zigarette. Sie wird wohl auf dreißig Stück pro Tag gekommen sein, denn sie unterrichtete oft von 9 Uhr früh bis 9 Uhr abends. Ich kann heute noch nicht begreifen, wie sie das durchgestanden hat. Schon gar, seit ich 6
5
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
selbst unterrichte, weiß ich, was es heißt, diesen Karren ein Leben lang zu ziehen, notabene mit der Gewißheit, daß nur ein Bruchteil der Schüler ans Ziel kommen wird. Die Rado hat aber - zu ihrer Ehre sei es gesagt —immer, auch bei weniger hoff nungsvollen Schülern, ihren vollen Einsatz geleistet. Uns Schülern war sie eine wenn auch respektgebietende, so doch mütterliche Freundin. Man konnte selbst mit ganz persönli chen Anliegen zu ihr kommen. So hat sie manchen Konflikt ent wirrt, manchen Liebeskummer und manches Herzweh gelindert, wohl auch aus der Erkenntnis, daß sich jeder seelische Druck sofort auf die Stimme überträgt. Dadurch entstand ein Vertrau ens- und Treueverhältnis, das auch an ihrer Lehrmethode keinen Zweifel aufkommen ließ. Diese Methode war so, daß ich noch heute zu ihr stehe. Damit meine ich: es gibt keine allein gültige Gesangsmethode und schon gar nicht eine Methode für alle. Ich jedenfalls verdan ke der Rado-Schule die Grundzüge meiner Gesangstechnik. Daß ich dann im Laufe meiner Praxis, im Ausüben meines Berufes, auf sehr viele weitere Geheimnisse des Gesanges und der Gesangstechnik gekommen bin, schmälert nicht den Wert des technischen Fundaments, das mir Frau Rado auf ihre Art vermit telt hat. Ihre Methode fußte auf der Erkenntnis, daß der menschliche Körper durch die Tiefatmung beim Singen als einheitlicher Reso nanzkörper zum Schwingen gebracht werden muß und daß die Verbindung von der Brust- zur Kopfresonanz, die durch die Wir belsäule hergestellt wird, nie unterbrochen werden darf. Die sogenannte Resonanz der weichen Körperteile, besonders das »In-die-Maske-Singen«, lehnte sie entschieden ab. Den Ansatz punkt, das heißt die Postierung des Tones im Kopf, hatte man sich oberhalb der Augen, also in der Gegend der Fontanelle, des Keilbeins, vorzustellen, und dieser Fixpunkt durfte beim Singen nie verlassen werden. Um das Verständnis dieser Theorie zu erleichtern, zeichnete sie den menschlichen Kopf mit dem Keil 66
IV /
SIE F A N G E N JA G U T A N
bein als Zentralpunkt, skizzierte aber das Keilbein als eine Brükke, auf der die Töne als Männchen spazierengingen. Dazu gab sie die Erklärung: Von diesen Männchen darf keines herabfallen, sonst wäre das ein mißlungener Ton. Auch sonst war der Unterricht der Rado mit vielen Zeichnun gen verbunden. So hat sie etwa die wichtige Funktion der Wir belsäule, die die Verbindung zwischen dem Zwerchfell, wo die Stütze sitzt, und der Kopfresonanz herzustellen hat, in vielen Skizzen festgehalten, die vielleicht anatomisch nicht immer kor rekt, aber für uns alle verständlich waren. Die Erklärungen dazu hat sie gleichfalls zu Papier gebracht, so daß man sich mit dieser Materie auch außerhalb der Gesang stunden befassen konnte. Ich besitze noch heute viele Aufzeich nungen und maschingeschriebene Abhandlungen von ihr, die einen guten Einblick in die Radö-Methode geben und für Fach leute von großem Interesse sein könnten. Die eigentliche Kunst war nun freilich, das Geschriebene in die Tat umzusetzen, das heißt: der Schritt von der Theorie zur Praxis. Es versteht sich, daß das nicht alle Schüler gleich gut tra fen. Ich selbst habe mich dem Studium dieser Materie mit wahrer Besessenheit hingegeben und so kam es oft vor, daß ich außer halb meiner Lektion zu Frau Rado gerannt bin, um sie —mitten in den Unterricht hineinplatzend ~ über Probleme zu befragen, die mir beim Üben gerade begegneten. Dank eines Empfehlungsschreibens der Laibacher Operndirek tion hatte ich die Möglichkeit, die Staatsoper auf dem Stehplatz der 3. Galerie zum Regiepreis von 20 Groschen zu besuchen. Die se Möglichkeit nützte ich fast täglich, so daß ich die fixen Reper toireopern, wie »Traviata«, »Rigoletto«, »Boheme« oder »Tosca«, dutzende Male und in immer wieder wechselnder Besetzung hörte. Dabei registrierte ich mit größter Spannung, wie die ver schiedenen Tenöre gewisse Klippen, die mir bekannt waren, nah men, und bat dann oft noch Frau Radö zu später Stunde telefo6
7
DERMOTA / TAUSENDUNDEIN
ABEND
nisch um Aufschluß, wie man diese oder jene Phrase, die mir nicht ganz geglückt schien, besser singen könnte. Und diese groß artige Frau hat das nie als Belästigung oder gar Zumutung emp funden, sondern hat mir stets mit größter Bereitwilligkeit über jedes Detail Aufschluß gegeben. Natürlich war ich auch bestrebt, Werke zu hören, die nicht zu meinem Repertoire gehörten, wie etwa die großen WagnerOpern, insbesondere den »Ring«. Ich konnte lange Zeit keine Beziehung zu Wagners Musik finden, aber ich ließ nicht locker, denn mir war bewußt, daß ich auch hier einen Zugang finden mußte, wollte ich nicht bloß ein Tenor, sondern ein kundiger Musiker werden. Ähnlich ging es mir mit Richard Strauss, vor allem mit dem »Rosenkavalier«, mit dem ich vorerst nichts anzu fangen wußte. Ich sehe mich noch ratlos auf den Stufen zum Stehplatz sitzen und mir über den dritten Akt den Kopf zerbre chen. Heute zählt der »Rosenkavalier« längst zu meinen Lieb lingsopern. Einer der prominentesten Radö-Schüler war mein Landsmann Josef Gostic, der erst als reifer, erfolgreicher Sänger immer wie der nach Wien fuhr, um sich von Frau Radö beraten und weiter bilden zu lassen. Er und ich, wir beide haben den Ruf der RadöSchule gefestigt, natürlich vor allem in unserer Heimat. So kam es, daß Frau Rado stets reichlich mit jugoslawischem Nachwuchs versorgt war. Dazu gehörte später auch mein Bruder Leopold, der in den Wirren des Zweiten Weltkrieges nach Wien kam und gleichfalls bei Frau Rado zum lyrischen Tenor ausgebildet wurde. Ich habe außer Marie Rado keinen Gesangslehrer mehr gehabt, sondern habe alle technischen Probleme, die an mich her antraten, allein zu lösen versucht, und zwar aus persönlicher Erfahrung und aus der Einschätzung der eigenen Möglichkeiten. Das war mir vielleicht nur deshalb soweit geglückt, weil ich die Selbstkontrolle immer sehr ernst genommen habe. Erst an mei ner Frau gewann ich eine Kritikerin, deren Meinung mir viel 68
IV /
SIE F A N G E N JA G U T AN
bedeutete und 2u einem ständigen Korrektiv meiner Leistungen wurde. Ich bin der festen Überzeugung, daß mir meine Frau vom Schicksal bestimmt war. Die Umstände, unter denen ich sie ken nenlernte, rechtfertigen diese Überzeugung. Ich konnte nicht ahnen, daß sie mir, nur wenige Häuser entfernt von der RadóSchule, in einem Gasthaus begegnen würde. Es war das bereits erwähnte Riedl sehe Lokal in der Johann-Strauß-Gasse, wo ich mein tägliches 8o-Gröschen-Menü einzunehmen pflegte. Meist tat ich das, ohne meine Umgebung zu beachten, immer nur an mein Singen denkend. Mein Stipendium war ja limitiert; ich wollte daher in mög lichst kurzer Zeit möglichst viel profitieren und hatte mir vorge nommen, in zwei Jahren meinen Abschluß zu erreichen, entwe der als Pädagoge oder als Sänger. So hatte ich für nichts anderes Sinn als für mein Studium. Ich setzte mich zum Essen immer in die gleiche Ecke, überflog halb in Gedanken die Speisekarte, um festzustellen, was ich nicht bekommen würde, und sah mich kaum um. Die Schnitzel und Torten an den Nebentischen irritierten mich nicht. Irdische Genüsse spielten damals für mich überhaupt keine Rolle. Eines Tages aber muß ich doch mit etwas wacherem Blick aufgesehen haben, denn plötzlich stellte ich fest, daß am Tisch direkt mir gegenüber ein junges blondes Fräulein Platz genom men hatte. Das war mir durchaus nicht unangenehm. Anderntags blieb ihr Platz leer und das registrierte ich beinahe ein wenig ent täuscht. Am dritten Tag war sie wieder da und ich konnte ein gewisses Gefühl der Freude vor mir nicht ganz verbergen. Das Wechselspiel wiederholte sich. Sie kam nicht täglich, sondern dann und wann, und wenn sie nicht kam, fehlte sie mir. Mein Interesse war geweckt. Es gab noch keinerlei Beziehung, aber ich beschäftigte mich in Gedanken bereits mit der jungen Dame. Etwa derart : Heute ist sie nicht da. Schade! Sie wird doch 69
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
nicht etwa krank sein? Eines Tages wagte ich einen gezielten Blick auf mein wieder erschienenes Gegenüber und konnte fest stellen, daß dieser Blick zwar schüchtern, doch deutlich erwidert wurde. Da wußte ich: Dort ist keine Abneigung oder Ablehnung, aber auch keine Abenteuerlust, sondern Anteilnahme. Ich war noch recht unerfahren im Umgang mit dem weiblichen Ge schlecht und mit der eigenen Verliebtheit, denn meine Schwär merei für die Volksschullehrerin zählte doch wohl nicht. Daß ich überhaupt den Mut aufbrachte, mich bemerkbar zu machen und mein Gegenüber anzureden, dazu bedurfte es noch eines äußeren Anstoßes. Den lieferten mir zwei Gäste am linken Nebentisch, eine Generalswitwe mit ihrer Tochter. Die Tochter hatte merkwürdi gerweise gleichfalls Gesang studiert. Sie wurde von einem jungen Beamten hofiert, den ich dann häufig mit ihr im Konzert traf Die beiden haben später geheiratet. Nun war es die Generalin, die bald die heimlichen Funken zwischen mir und dem blonden Fräulein merkte und die auf sehr dezente Art zu vermitteln such te. Das war relativ einfach, denn sie kannte uns beide und zog uns beide ins Gespräch. So ergab es sich zwangsläufig, daß wir uns erst einmal grüßten und allmählich auch miteinander spra chen. Mein deutscher Wortschatz war damals noch sehr beschei den, aber das Wesentliche fand sich schon. Im übrigen trug ich ja vorsichtshalber stets ein Wörterbuch bei mir. Ich hatte schon früher gemerkt, daß sich mein blondes Gegen über die Zeit des Wartens auf die Speisen damit verkürzte, daß sie in Noten blätterte. Das gab einen wunderbaren Anknüpfungs punkt. Und so fand unser erstes Gespräch, das sich natürlich um die Musik drehte, sozusagen zwischen Suppe und Rindfleisch statt. Ich erfuhr, daß sie Klavier studierte - an der Akademie für Musik und darstellende Kunst in der Meisterklasse Emil von Sauer —und daß sie das mit derselben Besessenheit tat, wie ich das Singen, sowie daß sie bereits etliche Kinder als Schüler hatte und sich damit ihr Studiengeld aufbesserte. 7 0
IV /
SIE F A N G E N JA G U T AN
Das also war im Winter 1934 meine schicksalhafte Begegnung mit Hilda Berger von Weyerwald, der Tochter eines Wirklichen Hofrats, der zu dieser Zeit Bezirkshauptmann in Zwettl war und den ich erst viel später als einen ebenso gütigen wie respektge bietenden Herrn und als Idealtyp des altösterreichischen Beam ten kennenlernte. Unser erstes Gespräch hatte gewissermaßen coram publico und par distance stattgefunden. Als wir zum erstenmal gemeinsam das Gasthaus verließen, hoffte ich auf einen recht langen Weg zu zweit. Aber daraus wurde nichts. Es stellte sich nämlich sofort heraus, daß Fräulein Hilda nur ein paar Schritte weiter wohnte. Meine Enttäuschung wich bald dem son derbaren und zugleich irgendwie erheiternden Bewußtsein, daß in der Straße, die nach dem Walzerkönig Johann Strauß benannt war, das Schicksal eigens für mich alles zusammengedrängt hatte, was mein Leben ausmachte: die Radö-Schule im Haus Num mer 36, die Gaststätte Riedl auf 22 und die elterliche Wohnung des Fräulein Berger von Weyerwald auf 28. Zunächst verabredeten wir, gemeinsam Konzerte zu besuchen, bald aber waren wir so vertraut miteinander, daß ich sie auffor dern durfte, mit mir zur Rado zu kommen, um mich beim Lied gesang zu begleiten. Frau Radö pflegte das im allgemeinen selbst zu tun; nun war sie froh, eine berufene Pianistin als Helferin zu finden. Aus diesen Anfängen entwickelte sich für Hilda bald die Rolle einer Assistentin. Sie begleitete fallweise auch die anderen Schüler und lernte dabei die Radö-Methode von Grund auf ken nen. Das war für mich später von großer Bedeutung, weil ihr kri tisches Urteil eben fachkundig und damit für mich maßgebend war. Die Beziehung zwischen ihr und Frau Rado wurde mit der Zeit so herzlich, daß sie dort bald aus- und einging und, so wie ich, mit jedem Anliegen zur Meisterin kommen konnte. Um diese Zeit —es war im Mai 1935 —wagten wir auch schon unseren ersten gemeinsamen Konzertabend, der im Ehrbarsaal stattfand. Außer uns präsentierte sich noch eine slowenische Kol 7
1
DERMOTA / TAUSENDUNDEIN
ABEND
legin aus der Radó-Schule. Hilda bot am Flügel einige Solostücke. Das finanzielle Risiko des Abends mußten wir selbst tragen. So klapperten wir auch die entferntesten Bekannten ab, um die Ein trittskarten an den Mann zu bringen. Das war mühsam, denn häufig genug nahm man uns nur deshalb ein paar Karten ab, weil man uns lästige Eindringlinge wieder loswerden wollte. Aber die Mühe lohnte sich. Wir hatten mit unserem buntgemischten Pro gramm einen Erfolg, den sogar —und das war für uns das Wich tigste —die Wiener Presse zur Kenntnis nahm. Professor Anton Trost, der Pianist, der uns begleitete, war übrigens ein Landsmann von mir und Sauer-Schüler wie Hilda. Er heiratete in Wien eine Pianistin und wirkte als Pädagoge an der Horakschen Musikschule. Später wurde er nach Ljubljana, sei ner Heimatstadt, als erster Rektor der neugegründeten Staatsaka demie für Musik berufen und begann dort auch eine neue pianistische Karriere, kehrte aber sofort nach seiner Pensionierung nach Wien zurück, wo er auch gestorben ist. Hilda hatte in ihrer Kindheit selbst öffentlich gesungen, unter anderem im Kinderchor von Wilhelm Kienzls »Evangelimann« in der Wiener Volksoper. Zu ihrem reichen Bekanntenkreis gehörten viele Persönlichkeiten, die eine gewisse Rolle im Wie ner Musikleben spielten, so der Brucknerschüler Carl Führich, der ihr erster Klavierlehrer und ein anerkannter Komponist sowie Chormeister des Eisenbahner-Gesangvereins war, weiters der Komponist, Chordirigent, Korrepetitor und Musikkritiker Carl Lafite und der Begründer und Chormeister des Lehrer-acapella-Chors Hans Wagner-Schönkirch, ein Freund ihres Vaters. Hilda führte mich in diese Kreise ein, und dadurch wurde ich immer häufiger dazu eingeladen, bei öffentlichen Konzerten und Akademien der verschiedenen Chorvereinigungen solistisch mit zuwirken. Ich sang nicht nur die damals sehr beliebten nachro mantischen Lieder von Carl Lafite, sondern auch schon Schu bert-Gesänge, darunter —und daran erinnere ich mich besonders 7
2
________ KONZERTDIREKTION DR. MENDELSSOHN_________
QROSSER
EHRBARSAAL
IV. M Ü H L Q A 8 S E 3 0
FREITAG, DEN 24. MAI 1935, 8 UHR ABENDS
Arien',Lieder'U.Duettenabend Mira Gnus
Anton Drmota
Mitwirkend; H i l d a B e r g e r - W e y e r w a l d (Klavier) Am Flügel: P r o f . A f i t o f i T r o s t P R O G R A M M Durante (1684— 1 755)................. Aria religiosa Aria profana Beethoven (1770—1827) . . . . Adelaide Lotti (1 7 0 0 ).................................. Pur Dicesti Schumann (1810—1856) . . . Schubert (1797-1828) . . . .
Mir« Gnus Anton Drmota
Romanzo Fis-Dur Deutsche Tänze (1930 von Regierungsrat WagnerSchönkirch aufgefunden)
Hilda Bargor-Wayarwald Mozart (1756—1 7 9 1 ) ................. Hochzeit des Figaro: Arie der Susanne Puccinf (1868—1 9 2 4 )................. Manon Lescaut: Arie der Manon
Mira Gnus Meyerbeer (1791 — 1864)
. . . Die Afrikanerin: Arie de« Vasco da Gama Donizetti (1797—1848) . . . . Liebestrank: Arte des Nemorino
Anton Drmota — P A U S E
—
Jugoslavische Musik T ajcevic...........................................Sedam balkanskih igara : (7 balkanische TSnze) I. II. V, VI, VII
Hilda Bargar>Wayarwald L a jo v ic ........................................... Kaj hi le gledal (Warum schaust du nur . . .)
B aranovic.......................................Oj rumena ruzo Lelijo (Ach rote Blume Lelijo
Mira Gnus
K o n jo v ic ...................................... Pod ponderi (Unter dem Fenster)
R a v n i k ...........................................Cej so tèste stazice (Wo sind die Wege)
P a v c i c ...........................................Potrkan ples (Bauemtanz)
Anton Drmota
Chopin (1810—1 8 4 9 ) ................. Ballade As-Dur
Hilda Bargar-Wayorwald Schum ann...................................... In der Nacht Liebhabers Ständchen
Mira Gnus Anton Drmota
Konzertflügel : Ehrbar Preis ; 30 g
DKRMOTA /
TAU SENDUNDEIN
ABEND
gerne —das schwierige Tenor-Solo des Schubert-Chors »Nacht helle«, das, in exponierte Höhen reichend, das ganze Ensemble überstrahlt. Derlei Mitwirkungen brachten mir keinerlei Honorar, aber viel persönlichen Erfolg und reiche Gelegenheit, Podiums erfahrung zu sammeln. Außerdem gaben sie den Anstoß für eine folgenschwere Wen dung. Professor Wagner-Schönkirch empfahl mich dem damali gen Direktor der Wiener Staatsoper, Felix von Weingartner, und machte mir damit Mut, mich um ein Vorsingen zu bewerben. Schon wenige Tage nach meiner Anmeldung wurde ich dazu ein geladen. Das entscheidende Singen fand in den letzten Märztagen 1936 mittags auf der Bühne und vor dunklem Zuschauerraum statt. Ich konnte nicht sehen und nicht ahnen, wer dort unten saß. Zum Einsingen wählte ich Beethovens »Adelaide«, dann kam die »Don-Giovanni«-Arie des Octavio »II mio tesoro«. Dar auf erscholl aus dem Zuschauerraum ein lautes »Danke schön!«, und damit war das Vorsingen beendet. Hinter der Bühne wurde mir mitgeteilt: »Sie werden von uns hören!« Nun, darauf wartete ich die längste Zeit vergebens. Daher mel dete ich mich kurz entschlossen noch einmal zum Vorsingen an. Der Vorgang vom erstenmal wiederholte sich. Diesmal wußte ich allerdings, daß im Zuschauerraum unter anderen nicht nur Direktor Kerber, sondern auch Professor Ferdinand Großmann, der Chordirektor des Hauses, saß, der sich später internationalen Ruf als Stimmfachmann und Gesangspädagoge erwarb. Ich sang dieselben Stücke wie beim erstenmal und ergänzte sie durch die große Arie des Kalaf aus Puccinis »Turandot«, die zweifellos weit über meine damaligen stimmlichen Verhältnisse ging. Trotz dem wurde ich anschließend sofort in die Direktion beordert. Kurz darauf stand ich vor Erwin Kerber, der nach dem jähen Abgang Felix von Weingartners vorerst provisorisch die Ge schäfte des Hauses führte. Gleichsam mit einem Satz wischte er jede Distanz und damit auch meine Beklemmung fort, indem er mich duzte. Das tat er übrigens mit allen jungen Ensemble 7
4
IV /
SIE F A N G E N JA G U T AN
mitgliedern, die ihm zu Gesicht standen, wie ich später feststellen konnte. Kopfschüttelnd faßte er mich ins Auge und meinte dann in seinem leichten Salzburger Dialekt: »Ja, Burschi, mit der ver hungerten G’stalt wird’s nix. Du hast ja gar kein’ Resonanzkör per für die Stimm’! Und kein’ Umfang für die Bühne. Du mußt jeden Tag drei Schinkensemmeln zusetzen, damit was aus dir wird!« Worauf ich schüchtern erwiderte: »Ja, Herr Direktor, aber wo soll ich sie hernehmen?« »Ah so!« brummte er und sah mich teilnahmsvoll an. Ich weiß nicht mehr, wie unser Gespräch weiter verlief, ich weiß nur, daß er so freundlich und väterlich zu mir war, wie ich mir das von einem heutigen Operndirektor kaum vorstellen kann. Schließlich entließ er mich mit den Worten: »Und jetzt sagst nicht Herr Direktor zu mir, du sagst einfach Onkel! Einverstanden?« Beflügelt ging ich heim. Es gab keinen Zweifel: meine weni gen ehrlichen Worte in schlechtem Deutsch hatten Eindruck auf Kerber gemacht. Er würde mich nicht vergeSvSen. Mein Gefühl täuschte mich nicht. Schon wenige Wochen später erhielt ich ein Schreiben von der Staatsoperndirektion mit der Einladung, in der Vorstellung der »Zauberflöte« vom 27. Mai 1936 als Erster Geharnischter zu gastieren. Ich war glücklich und begriff die klu ge Disposition Direktor Kerbers. Er wollte meine Stimme auf der Bühne ausprobieren, und dies in einer kleinen Rolle, bei der ich möglichst wenig anstellen konnte. Als Erster Geharnischter hatte ich nicht zu agieren, sondern bloß ciazustehen, so daß ich ungehindert auf den Dirigenten schauen und ins Publikum sin gen konnte. Direktor Kerber kommentierte diese Tatsache —wie ich später erfuhr —mit den Worten: »Da kann er wenigstens nicht stolpern.« Mit nur einer Klavierprobe bestand ich die Feuerprobe. Es passierte nichts. Josef Krips dirigierte, Charles Kullmann sang den Tamino, Elisabeth Schumann die Ramina, Marie Gerhart die Königin der Nacht, Hans Duhan den Papageno, Dora Komarek 7
5
DERMOTA /
TAU SENDUNDEIN ABEND
die Papagena. Zuletzt bekam ich noch ein kleines Honorar, mein erstes an der Staatsoper verdientes Geld. Das Gastspiel wiederholte sich am 9. Juni unter Carl Alwin mit Vera Schwarz als Pamina. Damit aber schien diese Episode auch zu Ende. Die Staatsoper rührte sich nicht mehr. Ich wurde nervös und ungeduldig. Von einem Tag zum andern wartete ich vergebens auf eine Nachricht. Sie kam nicht. Ich befand mich in einer Zwangssituation. Mein Stipendium ging zu Ende, ich mußte eine Entscheidung herbeiführen. In dieser Lage fand ich den Mut zu einem verzweifelten Schritt. Ich drang in die Privatwohnung des gefeierten lyrischen Tenors und Kammersängers der Staats oper Koloman von Pataky ein, den ich mir längst als Vorbild auserkoren hatte. Er wohnte höchst vornehm im Wiener Hoch haus in der Herrengasse und hatte eine sehr elegante Frau, die sichtlich irritiert war von dem unscheinbaren ungebetenen Besu cher. Ich wurde nicht ins Zimmer geführt. So brachte ich im Vor zimmer stockend meine Verehrung für den Künstler zum Aus druck, schilderte meinen Fall und bat ihn, ein gutes Wort für mich bei der Direktion einzulegen, was Koloman von Pataky in freundlicher Unverbindlichkeit weder zusagte noch abschlug. Um diese Zeit schrieb die Wiener Konzerthausgesellschaft einen Internationalen Musikwettbewerb aus, der auch einen Gesangswettbewerb einschloß. Ich meldete mich an und sang vor der Jury im Mozartsaal mein Standardprogramm: beim ersten Durchgang die Octavio-Arie, beim zweiten Durchgang, zu dem ich über Frau Rado telefonisch herbeigerufen wurde, die »Turandot«-Arie, und beim dritten und letzten Durchgang die Arie »Land so wunderbar« aus der »Afrikanerin« von Giacomo Meyerbeer, mit der ich damals wohl ebenso überfordert war wie vorher mit der Kalaf-Arie. Trotzdem kam ich gut an. Den ersten Preis errang ein bis dahin völlig unbekannter jun ger Bulgare namens Todor Mazaroff, den Direktor Kerber dann an der Staatsoper als Radames herausstellte und durchsetzte. Ich ersang zwar keinen Preis, aber eine Bronzemedaille. Es gab ein 7 6
IV /
SIE F A N G E N JA G U T A N
Abschlußkonzert der Preisträger im Großen Konzerthaussaal, das auch der Rundfunk übertrug; unsere Namen gingen durch die Presse. Dadurch wurde die namhafte Wiener Künstleragentur Starka auf mich aufmerksam und bot mir ein Gastspiel an der Slowakischen Nationaloper in Bratislava an. Ich sollte den Alfred in Verdis »Traviata«, und zwar in slowenischer Sprache, singen. Da ich die Partie seinerzeit am Staatskonservatorium von Ljub ljana slowenisch studiert hatte, konnte ich mit beiden Händen zugreifen. Das Preßburger Opernhaus, von Gottfried Semper erbaut, ist ein schönes Provinztheater aus der Ringstraßenzeit der Monar chie mit einem Fassungsraum für etwa i zoo Personen. Die Vorstellung war szenisch recht bescheiden und mit spar samen Vorhang-Dekorationen ausgestattet, die Handlung in die Gegenwart verlegt. Wir spielten also in Frack und Abendkleid. Es war mein erstes Auftreten im Frack, der freilich aus dem Fun dus stammte. Für mich gab es eine Klavier-, eine Bühnenstellund eine Orchesterprobe. Ich hatte zwar mächtiges Lampenfie ber, aber im Grunde ein sicheres Gefühl und keinerlei Bedenken. Ich sagte mir: Du kannst die Partie, also muß es gut gehen. Die Kollegen waren nett zu dem Anfänger und machten ihm keine Schwierigkeiten. Nun war es mein sehnlicher Wunsch, daß auch Hilda meinen ersten großen Auftritt in einer Solopartie miterleben möge. Wir hatten uns gewissermaßen insgeheim bereits verlobt, und sie hat te mich aus diesem Anlaß ihrem Vater präsentiert, der nur selten von seinem Amtssitz im fernen Zwettl nach Wien reiste. Bei einem Mittagessen kam die Begegnung zustande, der ich mit eini ger Bangnis entgegengesehen hatte. Aber der Herr Hofrat zeigte so viel Feingefühl, Takt und Herzensbildung, daß bald jede Scheu von mir abfiel. »Der junge Mann ist nicht unsympathisch«, äußerte er sich nachher zu Hilda. Er hatte wohl mit großer Erleichterung festge stellt, daß er es nicht mit einem Halbwilden aus dem Balkan, son7
7
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN ABEND
dem mit einem bescheidenen Studenten und netten Burschen zu tun hatte, von dem nicht zu befürchten war, daß er seiner lieben Tochter ein Leid zufügen würde. Später, als ich meinen ersten Vertrag mit der Staatsoper erhielt, war er sehr stolz auf mich. »Das ist ja bisher nur meinem Freund Richard Mayr gelungen«, erklärte er, »so jung an die Staatsoper zu kommen.« Schriftlich erteilte er Hilda die Erlaubnis, zu meiner Preßburger Bühnentaufe zu kommen - wobei er ihr höchstpersönlich den Reisepaß ausstellte—, allerdings unter zwei Bedingungen. Erstens durfte sie nicht allein reisen und zweitens nicht über Nacht bleiben. So fuhr ein befreundeter Beamter, der das Ver trauen des Vaters besaß, als »Gouvernante« mit. Die beiden kamen am Mittag vor der Auffühmng in Preßburg an, und da erfuhren wir am Bahnhof, daß die letzte »Preßburger« nach Wien bereits um 9 Uhr abends abging. Folglich sah Hilda nur die ersten beiden Akte und konnte den Schlußbeifall, der meinen Erfolg bestätigte, nicht mehr miterleben. Sie fuhr dennoch glück lich heim. Ich tröstete mich über ihre Abreise mit meinem ersten nennenswerten Honorar, denn ich hatte es sofort in voller Höhe ausbezahlt bekommen, und suchte ein Restaurant auf. Zu nächtli cher Stunde verzehrte ich eine ausgiebige Portion Schweinsbra ten mit Knödel und Kraut - mit größtem Genuß und dem herrli chen Gefühl : Jetzt bist du ein Opernsänger und kannst dir etwas leisten. Kaum war ich nach Wien zurückgekehrt, erreichte mich eine Aufforderung der Agentur Starka, auf Engagement nach Graz vorzusingen. Wenige Stunden später stand ich im Vorraum der Agentur in der Mariahilfer Straße und bestaunte die ungezählten Widmungsfotos berühmter Sänger, die da an den Wänden hin gen. Von Maria Jeritza und Elisabeth Schumann über Emil Schipper und Hans Duhan bis Jan Kiepura fehlte kaum ein gro ßer Name. Ich war zutiefst beeindruckt. Im Studio, wo das Kla vier stand, saß nicht nur der Direktor des Grazer Opernhauses, Viktor Pruscha, sondern auch die gesamte Familie Starka: Starka 7
8
IV /
SIE F A N G E N JA G U T A N
senior, Starka junior sowie dessen Schwester. Ich sang meine Mozart- und Puccini-Arien und wurde vom Fleck weg engagiert. Direktor Pruscha zückte einen vorbereiteten Vertrag, ich unter schrieb bedenkenlos. Als ich damit triumphierend zur Rado kam, begann Hilda, die zugegen war, vor Enttäuschung zu weinen, Frau Rado aber schlug die Hände über dem Kopf zusammen und meinte ent setzt: »Was hast du da angerichtet!« Beide waren überzeugt, daß ich nun meine Wiener Chance verspielt hätte. Frau Rado machte überdies kein Hehl aus ihrer Sorge um meine Entwicklung: »Du bist noch nicht so weit, daß du ohne Kontrolle ins Engagement gehen kannst!« Das war eine eiskalte Dusche! Aber es kam noch schlimmer. Als Direktor Kerber zu Ohren kam, daß ich mit Graz abgeschlos sen hatte, zitierte er mich zu sich und machte mir ein Donner wetter, daß die Wände bebten. Seine Empörung gipfelte in dem Satz: »Ja, wenn du lieber nach Graz gehst als zu mir in die Staats oper, dann ist dir eben nicht zu helfen!« Ich war zerknirscht und schilderte ihm meine Zwangslage. Daß mein Stipendium zu Ende ginge und ich praktisch in der Luft hinge, weil sich die Staatsoper nicht mehr gerührt hatte. Das besänftigte ihn etwas, und ich erfuhr nun aus seinem Munde, er hätte meinen Vertrag längst eingegeben, aber der Unterrichtsmi nister, Hans Pernter, hätte bisher aus Ersparnisgründen gezögert, das Formular zu unterzeichnen. Nun erzählte ich ihm von meiner Vorsprache bei Pataky, und da meinte Kerber, schon halb ver söhnt: »Heute abend bin ich zusammen mit Pernter bei Pataky zum Abendessen. In dieser gelösten Atmosphäre werde ich Pemter dazu bringen, deinen Vertrag zu unterschreiben. Das mach’ ich schon! Voraussetzung ist freilich, daß du deinen Vertrag mit Graz löst. Wie du das machst, ist deine Sache!« Das war eine bittere Nuß! Ich trat den Kanossagang an und ließ mich bei Direktor Pruscha melden, der im Hotel Meissl und Schaden abgestiegen war. Es kam zu einer unerquicklichen Aus7
9
DER iM OTA / T A U S E N D U N D E I N
ABEND
Sprache, bei der mich Pruscha sehr ungnädig behandelte. »Sie fangen ja gut an«, knurrte er, »noch bevor Sie den Vertrag über haupt antreten, werden Sie schon vertragsbrüchig. Sie werden ’s weit bringen!« Aber schließlich gab er doch nach und entließ mich aus dem Vertrag. Das Gegenangebot der Wiener Staatsoper hatte ihn sichtlich beeindruckt. Zudem wollte er es sich wohl auch mit Direktor Kerber nicht verderben. Ich mußte nur noch der Agentur Starka die ausbedungenen Prozente bezahlen —und damit war der Fall erledigt. Noch vor dem Sommer erhielt ich den vom Unterrichtsminister unterfertigten Vertrag. Mit Datum vom I. September 1936 war ich ordentliches Mitglied der Wiener Staatsoper. Meine Gage : 300 Schilling monatlich.
Willst du zu mir nach Salzburg kommen ? ErsU Köllen, erste Premieren
Nachdem mir Direktor Kerber feierlich den Vertrag überreicht hatte, fragte er mich so nebenbei : »Was machst du eigentlich im Sommer?« Und als ich antwortete, daß ich keinerlei Pläne hätte, fragte er weiter: »Willst du zu mir nach Salzburg kommen?« Kerber war ja nicht nur Mitbegründer, sondern auch seit Jahren Leiter der Salzburger Festspiele, denen er sich immer sofort nach dem Saisonschluß in der Staatsoper mit allen Kräften widmete. Sein Angebot war für mich wie ein Geschenk des Himmels. Daß ich noch vor Antritt meines Engagements in der Staatsoper bei den Salzburger Festspielen mit wirken sollte, war für mich kaum zu begreifen. Überglücklich sagte ich zu. Da zog Kerber einen Straßenbahnfahrschein aus der Westentasche und kritzelte gleich die Bedingungen meines Vertrags darauf Die Partie, die ich übernehmen sollte - es war die Partie des Zorn in den »Meister singern« unter Toscanini; die Zeit meiner Anwesenheit in Salz burg, nämlich von Anfang Juli bis finde August; die Zahl der Vorstellungen, bei denen ich mitzuwirken hatte - insgesamt vier -, und das Honorar, das ich bekommen sollte —je Vorstellung bare 300 Schilling. Das war viel Geld für die damalige Zeit! Genau soviel wie ich in der Oper pro Monat bekommen sollte. Die Partien der Meister wurden schon in Wien einstudiert, so daß wir uns in Salzburg als sorgfältig vorbereitetes Ensemble präsentieren konnten. Als Studienleiter und Korrepetitor wurde 81
DER iM OTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
uns ein gewisser Erik Leinsdorf zugeteilt, ein junger, noch unbe kannter Mann, der erst viel später eine Weltkarriere machen soll te. Unvergeßlich für mich, wie Leinsdorf am Klavier fast alles auswendig spielte und dies mit größter Präzision und ohne sich je zu irren. In der gefürchteten Prügelszene gab er uns jeden Ein satz, ohne auch nur in die Noten zu blicken, eine Leistung, wie ich sie nie wieder erlebt habe. Gleich zu Beginn schrieb er uns die einzelnen Partien mit Bleistift auf Blätter im Taschenformat, so daß wir von Anfang an das Notenbild vor uns hatten. Ich war noch nie in Salzburg gewesen, kannte dort auch keine Seele, und wußte natürlich nicht, wo ich wohnen sollte. So ging ich kurz entschlossen zu »Onkel« Kerber ins Eestspielhaus. ET amtierte in einem kleinen niedrigen Kämmerchen, in dem man mit der Hand die Decke erreichen konnte. Durch eines der Eenster sah man auf den Platz vor dem alten Eestspielhaus. Und als hätte er geahnt, was Gotik und Barock und die bildende Kunst später für mich bedeuten würden, ließ er mich zunächst durch dieses Eenster schauen und erläuterte: »Das ist die FTanziskanerkirche mit der berühmten Pacher-Madonna und daneben steht der große Dom mit seiner herrlichen Orgel und seinen unermeß lichen Kirchenschätzen. Das mußt du dir alles anschauen!« Ich befolgte seinen Rat und wurde bald zum selbständigen Eorscher, der die Schönheiten dieser unvergleichlichen Stadt, ihre Kunst und ihre Landschaft, mit der Seele suchte und fand. Das schuf eine innere Bindung zwischen mir und Salzburg, die nie wieder abriß. Kerber verwies mich dann auf das Quartierbüro im Pestspiel haus, das den Mitwirkenden half, ein Quartier zu finden. So konnte ich schon am nächsten Tag ein Privatzimmer in der Alt stadt beziehen, das ein bescheidenes, gebücktes Mütterchen ver mietete. Ich war sofort daheim. Die gute Alte bemutterte mich und kredenzte mir ein Erühstück, das ich kaum bewältigen konn te. Noch dazu war es im Zimmerpreis inbegriffen! Plötzlich schien mir alles so billig! Ich konnte nun mit meinem Honorar 82
V /
W I L L S T D U ZU MIR N A C H S A L Z B U R G ?
wie ein Fürst leben und überdies noch Ersparnisse machen. Salz burg war mein erster Ausflug in die »große Welt«, aber im Ver gleich zu dem, was ich später auf Reisen erlebte, war es ein gemütliches Zuhause. Dann ging’s an die Arbeit. Wir kamen dank Leinsdorf einiger maßen sicher und daher nervlich unirei astet zu den Proben. Aber schon der Name Toscanini bewirkte, daß wir mit einiger Bangnis dem Kommenden entgegensahen. Da im alten Festspielhaus neben der Bühne nur kleine Probenzimmer zur Verfügung stan den, die die Versammlung der Meister nicht fassen konnten, wur den die Klavierproben in die Alte Universität, gegenüber dem Festspielhaus, verlegt. Toscanini, dessen tiefliegende dunkle Augen stark kurzsichtig waren, konnte, wenn er uns die Einsätze gab, die einzelnen Sän ger kaum richtig ausnehmen. Das war wohl der Flauptgrund dafür, daß er einen Suggeritore, einen Subdirigenten, zur Seite hatte, der zu soufflieren und die Einsätze zu geben hatte. Tosca ninis markante Züge wirkten asketisch und im allgemeinen sprach er sehr leise. Obwohl er mit allen Fasern mitten im musi kalischen Geschehen lebte, stand er doch immer irgendwie außerhalb, ein wenig entrückt. Seine Gesten, seine Worte, seine Befehle, kurz alle seine Äußerungen waren knapp und kurz. Unwillkürlich bemühte man sich, seine Wünsche spontan zu erfüllen. FT wußte die Stellen im Klavierauszug, die er meinte, auswendig. Sobald er merkte, daß sein Wollen, auf dem Weg über den Dolmetscher, der immer zugegen war, nicht gleich ver standen wurde, konnte er sehr ungeduldig werden. So kam es auch bei uns bald zu einem seiner gefürchteten Tobsuchtsanfälle. FT warf den Klavierauszug in hohem Bogen mitten unter die Meister und rannte aus der Probe. Ich weiß bis heute nicht, wer oder was diesen Ausbruch ausgelöst hat. Da es keine falschen Töne gegeben hatte, konnte sich seine Wut nur am Ausdruck oder am Tempo entzündet haben. Später, bei den Orchester- und Bühnenproben, gab es bei uns 8
3
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
keine Zwischenfälle mehr. Toscanini kümmerte sich offenkundig nicht um das Bühnengeschehen, für ihn war das musikalische Geschehen alles. Herbert Graf, der Regie führte und guten Kon takt zum Maestro hatte, verstand es so einzurichten, daß es zwi schen Bühne und Orchester nie zu Reibungen kam. Wohl aber gab es Schwierigkeiten mit dem vorgesehenen Hans Sachs, dem Star-Bariton Friedrich Schorr, der aus New York kam und dort als erster Mann in seinem Fach galt. Schorr umging das volle Aussingen seiner Partie, das Toscanini auch schon bei den Proben verlangte, mit immer neuen Ausreden. Als er schließlich auch bei der ersten Orchesterprobe bloß markierte, riß Toscanini die Geduld und er forderte energisch einen Ersatz für Schorr. In der Presse wurde Schorr als indisponiert gemeldet und aus München traf ein neuer Mann ein: Hans Hermann Nis sen, der sich bald als ein großartiger Sachs erwies. Seine Partner waren Herbert Alsen als Pogner, Hermann Wiedemann als Beck messer, Charles Kullmann als Stolzing, Richard Sallaba als David, Lotte Lehmann als Eva und Kerstin Thorborg als Magdalena. Toscaninis besondere Liebe gehörte Lotte Lehmann als Evchen, obgleich die Künstlerin damals längst über diese Rolle hinausgewachsen war. Aber ihr Gesang war so innig, so mäd chenhaft und blühend, daß man einfach darüber hinwegsah. Das herrliche Quintett in der Sachs-Stube, das von ihrer glockenhaften Stimme angeführt wurde, gehört zu meinen unvergeßlichen Eindrücken. Lotte Lehmann war schon bei den Orchesterproben sehr nervös, und es tat ihr wohl, wenn ihr die Kollegen hinter der Bühne die Daumen drückten. Sie brauchte die Bezeugung der Sympathie, die seelische Hilfe aus der Kulisse. Wie groß Toscani nis Sympathie für die Lehmann war, beweist die merkwürdige Tatsache, daß er im »Fidelio«, mit dem die Festspiele 1936 eröff net wurden, die große Arie der Leonore eigens für sie um einen halben Ton tiefer transponierte. Doch zurück zu den »Meistersingern«. Die Premiere fand am 8. August 1936 im Festspielhaus statt. Wir standen mit vibrieren 84
V /
W I L L S T D U ZU MIR N A C H S A L Z B U R G ?
den Nerven hinter der Bühne und warteten gespannt auf den festlichen C-Dur-Akkord, mit dem das Vorspiel einsetzt. Den elektrisierenden Augenblick, in dem sich Probenschweiß plötz lich in Kunst verwandelt, habe ich später immer wieder erlebt, aber nie mehr so intensiv wie damals. Toscanini wählte unge wöhnlich angespannte Tempi. Ungewöhnlich war überhaupt die se Aufführung, in der der Maestro mehr Toscanini als Wagner dirigierte ; die Wirkung jedoch war unbeschreiblich und nicht nur für mich ebenso unvergeßlich wie unwiederholbar. Zum künstlerischen Ereignis gesellte sich der festliche äußere Rahmen, der gesellschaftliche Glanz. Das Festspielpublikum von damals ist mit dem heutigen kaum vergleichbar. 1936 kam wirk lich alles, was im In- und Ausland Rang und Namen hatte, zu den Toscanini-Premieren - von den namhaftesten Künstlern über die gekrönten Häupter und die Mitglieder der englischen Adelsfamilien bis zu den Finanzgrößen aus Übersee. Möglich, ja wahrscheinlich, daß nicht alle Mitwirkenden die Größe des Ereignisses so empfunden haben wie ich, der ich vom »Land« kam und dem alles aufregend neu war. Aber ich hatte dieses undefinierbare Salzburger Amalgam von künstlerischem und gesellschaftlichem Zauber in einer wirklichen Sternstunde erfah ren und ging davon berauscht nach Hause, ohne mit den Kolle gen, die mir ja noch recht fern standen, zu feiern. Trotz meiner kleinen und bescheidenen Partie empfand ich es als Auszeich nung, daß ich an diesem Abend mit dabei gewesen war. Auch bei den drei Reprisen gab es unter Toscanini keinerlei Absinken, sondern noch eine Steigerung. Meine Meister-Kolle gen füllten die langen Pausen zwischen den einzelnen Aufzügen mit einem Gang ins Wirtshaus oder mit einer Tarockpartie; ich blieb im Haus und hörte mir alle Vorstellungen vom ersten bis zum letzten Takt an und war jedesmal aufs neue gebannt. Nach der vierten Aufführung —sie fand am 22. August statt —hieß es schweren Herzens Abschied nehmen von Salzburg. Aber es gab einen Trost; Ich hatte begründete Aussicht, im folgenden Jahr 8
5
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
wieder in die Festspielstadt zu kommen, denn die Wiederaufnah me der »Meistersinger« unter Toscanini war für 1937 bereits fixiert. Am I. September 1936 zog ich schüchtern ins erlauchte Flaus am Wiener Opernring ein und bekam sofort meine erste Gage ausbezahlt. Damit hob sich mein Selbstbewußtsein gewaltig. Ein neuer bedeutender Abschnitt in meinem bisher ziemlich unsiche ren Dasein hatte begonnen. Plötzlich war man wer, man durfte sich ja Staatsopernsänger nennen. Natürlich ließ ich mir unver züglich Visitkarten drucken. Noch am Abend des i. September stand ich in der mir nun schon vertrauten Repertoire-Vorstellung der »Zauberflöte«, mit der Josef Krips die neue Saison eröffnete, als Erster Geharnisch ter auf der Bühne. Margarita Perras sang die Königin der Nacht, Karl Etti den Zweiten Geharnischten ; sonst gab es die gewohnte Besetzung. Mein Name stand erstmals ohne den Zusatz »als Gast« auf dem Programm. Im September wurden mir noch vier weitere Aufgaben anver traut: der Steuermann im »Fliegenden Holländer« unter Carl Alwin mit Alfred jerger in der Titelpartie, der Ruiz im »Trouba dour«, gleichfalls unter Alwin mit Helge Roswaenge als Gast von der Staatsoper Berlin, ferner die Stimme des Seemanns in »Tristan und Isolde« unter Bruno Walter und die kleine Partie des Kavaliers Borsa in »Rigoletto«. Dazu kamen bis Anfang Februar 1937 der Page Tebaldo in Verdis »Don Carlos«, den Bruno Walter mit Franz Völker neueinstudiert hatte, die Episo denpartie des Schreibers Isepo in Ponchiellis »Gioconda« unter Krips, der Erste Gefangene in »Fidelio« unter Knappertsbusch mit Max Lorenz als Florestan und der Harlekin im »Bajazzo«, dessen Titelpartie Alfred Piccaver sang. Durch die kleine Partie des Ruiz im »Troubadour« wurde ich Partner berühmter Gast-Tenöre. Einer von ihnen war Jan Kiepura, ein geborener Pole und ein geborener Charmeur. Seine Stimme strahlte ebenso wie sein Gebiß. Im Stehparterre wurde 86
V /
W I L L S T D U Z U iMIR N A C H S A L Z B U R G ?
chronisch darüber gerätselt, ob Kiepuras Zähne echt seien. Die Stimme war es jedenfalls, das kann ich bezeugen. Ebenso kann ich bezeugen, daß Kiepura, um größer zu erscheinen, Stöckel schuhe und ständig eine Perücke trug. Er war begabt mit jenem Überschuß an Temperament und Kraft, der das Publikum im Sturm gewinnt. Seine ersten Wiener Auftritte fielen in die Zeit, bevor er für die Kino-Leinwand entdeckt wurde. Als ich ihn ken nenlernte, war er bereits der gefeierte F^ilmstar. Wenn er sang, füllte sich das Haus mit dem Kinopublikum, das ihn vergötterte. In der Selbstreklame kannte er keine Hemmungen. Zum Beispiel scheute er sich nicht, ein paar Arbeitslose anzuheuern, die er, mit Plakattafeln behängt, durch die Kärntner Straße schickte. Darauf stand zu lesen: »Heute singt Jan Kiepura in der Staatsoper.« Ob er nun den Manrico, den »Rigoletto«-Herzog, den Don José oder den Kalaf sang —dieser vor allen war seine Leibrolle —, fast immer mußte er die großen Arien wiederholen. Nach Schluß der Vorstellung gab es regelmäßig ein Riesentheater. Das Publi kum tobte, Applaus und Geschrei nahmen kein Ende, bis Kiepu ra vor den eisernen Vorhang trat und ohne Musikbegleitung — Dirigent und Orchester waren längst aus dem Haus —einen sei ner Schlager ins Auditorium schmetterte. »Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frau’n ...« Der Rummel setzte sich dann auf der Straße fort. Die vor dem Bühnentürl harrende applaudierende Menge erhielt weitere Zugaben: Kiepura sprang auf das Dach seines Autos (so wie in einem seiner Filme) und sang von dort in Siegerpose —ohne Rücksicht auf die kalte Nachtluft und seine strapazierte, erhitzte Kehle —einen weiteren Schlager: »Du bist meine Sonne ...!« Es war eine Sensation. So etwas hatte es vor ihm nicht gegeben. Mir, »dem Kollegen Antonio Dermota«, schenkte er sein Foto mit eigenhändiger Widmung und hob mich damit in seine prominente Nähe. Von völlig anderem Kaliber war der Schwede Jussi Björling, später ein Star der Met und nur sehr selten in Wien zu Gast. Die ser Mann mit der gedrungenen Statur und dem glatten, faltenlo8 7
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN ABEND
sen Gesicht verfügte über eine warme, weiche und runde Stimme mit ausgezeichneter Höhe. Bei ihm gab es nie einen forcierten Ton. Hörte man ihm zu, so hatte man den Eindruck, Singen sei durchaus keine anstrengende Tätigkeit. Temperament war im all gemeinen nicht seine Sache. Einmal aber erlebte ich, daß auch er aus der Fasson geriet : Es war in einer »Troubadour«-Vorstellung, in der ich als Ruiz agier te. Björling als Manrico, den er übrigens schwedisch sang, war eben bei der Stretta angelangt. Um seine Kampfeswut zu doku mentieren, riß er den Degen in die Höhe. Und dann blieb ihm das gefürchtete hohe C in der Kehle stecken. Wütend stürzte er nach hinten und schleuderte die Waffe im hohen Bogen von sich. Nur einem glücklichen Zufall war es zu danken, daß er keinen der Bühnenarbeiter traf, die in der Kulisse zuhörten. Das Publi kum applaudierte trotz des verunglückten Spitzentones heftig, aber Björling war nicht vor den Vorhang zu bringen. Er rannte in seine Garderobe und löschte seinen Grimm mit einem gewal tigen Krug Bier, der dort immer für ihn bereitstand. Über alle Vorgänge im Hause wachte Erwin Kerber mit gro ßer Umsicht, aber ohne Lärm und ohne Aufsehen. Er war der Idealtyp des musischen österreichischen Beamten und dazu der geborene Organisator. Äußerlich wirkte er wie ein Salzburger Naturbursch, blond, blauäugig, mit mehreren Schmissen auf der rechten Wange, die den ehemaligen nationalen Studenten verrie ten. Obwohl er mit einer recht guten Portion Bauernschläue begabt war, konnte man ihm keine wirkliche Falschheit oder Hinterlist Zutrauen. Ich habe auch nie eine von ihm erlebt, obwohl er als Operndirektor - nicht zuletzt durch den Umbruch von 1938 —oft in schwierige Situationen geriet, die kaum zur all seitigen Zufriedenheit zu lösen waren. Ich aber wußte mich bei Erwin Kerber in bester Hut. Ich konnte mit jedem Anliegen zu ihm kommen und bin immer erleichtert aus seinem Direktionszimmer gegangen. Er mag so 88
V /
W I L L S T D U ZU MIR N A C H S A L Z B U R G ?
etwas wie ein väterliches Verantwortungsgefühl mir gegenüber empfunden haben. Das kam auch dadurch zum Ausdruck, daß er mir nach Möglichkeit in jenen Aufführungen neue Partien gab, bei denen er selbst Regie führte. So etwa den Liebhaber Silvain in Maillarts »Das Glöckchen des Eremiten«, den er gründlich mit mir erarbeitete, den Hans in der »Verkauften Braut« und den Alfred in der »Fledermaus«. Für die Prosastellen legte er Wert auf bestes Burgtheater-Deutsch, so daß die Proben oft in Sprach übungen ausarteten. Dabei war er auch als Regisseur kein Dikta tor, sondern ein freundlicher Ratgeber. Bevor er mir eine Gebär de oder eine Wendung empfahl, erkundigte er sich zuerst kollegi al : »Glaubst du, wird dir das so liegen ?« Wie gut er sein Künstlervölkchen zu behandeln wußte, zeigt die folgende Episode: In der Staatsoper gab (und gibt) es eine Künstlerloge, die ich als Mitglied des Hauses benützen durfte. Ich tat das ausgiebig und war fast so etwas wie ein Stammgast. Nun saß ich wieder einmal vorne an der Brüstung, als sich die Türe öffnete und der große Alfred Piccaver hereinrauschte. Sofort sprang ich auf und machte ihm Platz, wagte aber nicht ihn anzu sprechen. Am nächsten Tag ließ mich Kerber zu sich rufen und sagte : »Was hast du da angestellt ? Soeben war der Kammersän ger Piccaver bei mir und hat sich darüber beklagt, daß du dich ihm nicht vorgestellt hast!« Ich war wie vor den Kopf gestoßen, aber Kerber beruhigte mich : »Reg dich nicht auP. Ich hab dem Piccaver gesagt, daß du von Natur aus schüchtern bist und dich einfach nicht getraut hast, vor so einem großen Künstler den Mund aufzumachen. Und das hat er mit großer Befriedigung zur Kenntnis genom men.« Noch eine Begegnung mit einem lebenden Denkmal der Staatsoper fällt in diese Zeit. Als ich eines Vormittags zur Probe kam, raunte mir der Portier zu: »Herr Dermota, der Kammersän ger Slezak ist da!« Ich hatte Leo Slezak nicht mehr auf der Bühne erlebt, denn ehe ich nach Wien kam, hatte er seinen Abschied 89
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
genommen. Nun saß da auf der Bank, wo die Direktionsbesucher zu warten pflegten, ein starker Mann im weiten Havelock, mit einem riesigen Schlapphut auf dem Haupt. »Ich werde Sie dem Herrn Kammersänger vorstellen«, sagte der Portier in freundlichem Übereifer und bugsierte mich in Slezaks Nähe. »Herr Kammersänger«, redete er Slezak an, »wir haben hier einen jungen Tenor, der eben erst engagiert wurde.« Slezak sah mich würdevoll an und sagte dann mit Pathos: »Junger Freund, ich möchte Ihnen für Ihre Karriere einen guten Rat geben ... Vergessen Sie nie, beim Singen alle Löcher zuzuma chen!« Ich habe diesen Rat mit einer ehrfürchtigen Verbeugung ent gegengenommen und lange vergeblich über seinen Sinn gerätselt. Der sonderbare Einfall, die verstaubte Spieloper »Das Glöck chen des Eremiten« ins Repertoire aufzunehmen, stammte nicht von Kerber, sondern von Knappertsbusch, der - um das allzu monotone »eiserne Repertoire« der Oper zu erneuern - zuweilen etwas eigenwillige Ideen hatte. Bei seinen BesetzungsVorschlägen sah er weniger auf stimmliches Vermögen als auf gutes Ausse hen. »Sie wären mein Parsifal«, sagte er einmal zu mir. Nun war ich zwar ein schlanker Jüngling und sicher ein reiner Tor, aber niemals ein Wagnerscher Parsifal. Wenn ihm zwei junge Leute gefielen, dann suchte er für sie einfach ein passendes Stück. So kamen Dora Komarek und ich zum »Glöckchen«. Später hat Knappertsbusch auch Engelbert Humperdincks »Königskinder« ausgegraben und neu einstudiert, weil er in der blutjungen, bildhübschen Esther Rethy eine Gänsemagd fand, wie sie ihm vorschwebte. Ich brachte für Mai 11arts Königssohn die Jugend mit, wenn auch nicht die erforderliche Stimmkraft für diese anspruchsvolle Partie, die üblicherweise mit einem Helden tenor besetzt wurde, wie etwa in München mit dem Wagner-Hel den Julius Pölzer. Trotzdem erinnere ich mich gerne an die Insze 90
V /
W I L L S T D U Z U MIR N A C H S A L Z B U R G ?
nierung, die leider nur zu bald wieder verschwand, an die herrli che, meisterhaft instrumentierte Musik und an die genußreichen Proben. Knappertsbusch war ein wunderbarer Musiker, und es war eine reine Freude und ein Gewinn, mit ihm zu arbeiten. Die absolute Sicherheit seiner Stabführung, die Klarheit seiner sparsa men Gestik bewirkten, daß man sich bei ihm immer geborgen fühlte. Wenn trotzdem einem Sänger etwas passierte, dann konn te er den »Patzer« mit sehr kräftigen Ausdrücken zusammenput zen. Einmal übersprang ich als Walther von der Vogelweide im ersten Aufzug von Wagners »Tannhäuser« einen wichtigen Ein satz. Es war ein auffallender Schmiß, da der Vogelweider das Ensemble der Minnesänger anführt. Ich wartete deshalb nach Aktschluß beim Ausgang des Orchestergrabens, um mich bei Knappertsbusch zu entschuldigen. Aber er ließ mich nicht zu Wort kommen. »Sie Sch ... Sie!«, fuhr er mich an und rauschte vorbei. Das saß. Aber damit war der Fall auch erledigt. Knap pertsbusch hat mir den Schmiß nie nachgetragen. Meine erste große Partie an der Staatsoper sang ich dann im Frühjahr 1937 unter Josef Krips. Es war der Alfred in Verdis »Traviata«. Meine Aufgabe wurde dadurch erschwert, daß zwei ganz berühmte Sänger als meine Partner auf der Bühne standen : Jarmila Novotna als Violetta und Alexander Sved als Vater Germont. Die Novotna, eine gebürtige Pragerin, war der Inbegriff der Diva, schön, elegant, attraktiv, kurz, eine ideale Bühnenerschei nung mit ebenso idealer Stimme. Ihre Glanzrollen waren die Marie in der »Verkauften Braut«, die Pamina in der Salzburger »Zauberflöte« unter Toscanini, die Giuditta mit Richard Tauber in der Wiener Uraufführung dieses I^här-Werks, dessen Titel partie ihr der Komponist auf den Leib geschrieben hatte. Alexander Svéd, der aus Budapest kam, besaß eine der schön sten lyrischen Baritonstimmen, die ich bis dahin gehört hatte. Auch er war eine starke, ja imponierende Persönlichkeit auf der 9 1
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
Bühne und ein Grandseigneur im Leben, der sich gerne ein »von« zulegte. Ich hatte das Glück, mehrmals sein Partner zu sein, so etwa als Lenski im »Eugen Onegin«, dessen Titelpartie er sang. Seine Stärke aber waren die Verdi-Partien. Sein Rigolet to, sein René, sein Graf Luna sind mir unvergeßlich. Svéd ging später nach den USA, hatte große Erfolge an der Met, kehrte aber nach dem Krieg nach Europa zurück, sang in Budapest und suchte dann wieder Kontakt mit Wien. Doch leider - seine Zeit war vorbei. Bei der »Traviata« aber stand seine Stimme im Zenit, ebenso wie die der Novotna. Ich mußte kopfüber in die Repertoire-Vor stellung hineinspringen. Es gab nur eine kleine »Bühnen«-Probe im alten, später zerstörten Pausensaal der Oper. Hans Duhan führte Regie und stellte sich eindeutig auf die Seite der großen Novotna. Ich erinnere mich noch, daß ich mich ein wenig lin kisch anstellte, weswegen mich Duhan heftig anfuhr. Als ich mich aus Nervosität räusperte, donnerte er los : »Was fällt Ihnen denn ein? Sie können doch nicht Ihre Partnerin anhusten!« Ich erwiderte nichts. Als Neuling mußte man sich schon eini ges gefallen lassen. Dafür entschädigte mich die Kritik, die mich geradezu als Ent deckung feierte. So verkündete das »Morgenblatt« : »Großer Erfolg eines slowenischen Tenors an der Wiener Staatsoper.« Und schrieb dann: »Der Zauber dieser Stimme beruht auf einer chromatisch aparten Timbrierung. Samtweich, dunkel legiert fließt dieser echt slawische Tenor wohlgeführt dahin. Der Künst ler weiß um die Methodik der Atemführung, versteht es, durch ausgezeichnete An- und Abschwellung den Phrasen Plastik zu verleihen. Sein Gesang ist stets kunstvoll geformt, klug und über legt phrasiert, sein Spiel ist einfach und eindrucksvoll. Dies Debut war äußerst vielverheißend.« Und der Kritiker des »Echo« stellte fest: »Der junge, sehr jun ge Dermota hat zweifellos einen Tenor von Qualität ... auf diese Stimme habt acht! ... Sie hat nicht nur ein berückendes Timbre, 9
2
V /
W I L L S T D U ZU MIR N A C H S A L Z B U R G ?
sie hat auch so etwas wie eine Art - Staatsopemstil. Während zeitweise gern neue Tenornamen auftauchen, deren paar große Töne weite Stimmöden verdecken müssen, ist hier ein harmo nisch und natürlich blühendes Organ.« Später nahm mich Duhan als Externisten in seine Opernklasse an der Akademie für Musik und darstellende Kunst auf Er brauchte für seine öffentlichen Opern-Fragment-Abende im Aka demietheater einen Tenor, und ich konnte dabei etwas lernen. In diesem Rahmen sang ich unter anderem Szenen aus »Manon«, »Eugen Onegin«, »Bohème«, »Butterfly« und »Carmen«. Bei der »Carmen«-Generalprobe passierte ein Zwischenfall, der auch schlimm für mich hätte ausgehen können. Die Bühne zeigte die Schmugglerschenke des zweiten Akts. Ich sollte als Don José mit »He holla« frisch-fröhlich auftreten. Aber ich trat nicht auf »Was ist denn los? Dermota, auftreten!« rief Duhan aus dem Parkett. Aber ich konnte nicht. Eine Leiter hatte sich von der Wand gelöst und war mir auf den Kopf gefallen. Ich lag als ver wundeter Sergeant in der Kulisse. Viele Jahre später wurden Duhan und ich gute Freunde. Schließlich bot er mir sogar das Du-Wort an, und das wollte schon etwas heißen, war er doch fast eine Generation älter als ich. Seine Tragik war, daß er so früh —in den besten Jahren - sei ne erfolgreiche Sängerlaufbahn beenden mußte. Ich glaube, er hat das nie überwunden, obwohl er zum Ausgleich eine geradezu erstaunliche Vielseitigkeit entwickelte : er lehrte in der Akademie, führte in der Staatsoper Regie, fungierte lange Zeit im Haus als Betreuer des Repertoires, organisierte und dirigierte, ja, er kom ponierte sogar! Sein Singspiel »Mozart«, in dem Wolfgang Ama deus, Constanze und Schikaneder höchst persönlich auftraten, ging in der Volksoper über die Bühne. Schließlich wirkte er als »Kulturstadtrat« auch im kulturpolitischen Bereich, aber all das konnte ihm den relativ frühen Abgang von der Bühne nicht ersetzen. Im Grunde war Duhan —so vermute ich —fast ein Leben lang ein unglücklicher Mensch. 9
3
DERMüTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
In der Zeit meines ersten Alfred an der Wiener Staatsoper wurde ich mehrmals nach Ljubljana eingeladen. Ich sang dort den Rudolf in der »Bohème« und den Linkerton in der »Butterfly«. Diese Auftritte wurden quasi als Sensationsgastspiele eines renommierten Sängers der Wiener Staatsoper angekündigt. Ich erinnere mich aber sehr genau, daß ich keine Sensationen bot. Es gab keine Orchesterproben und ich hatte überdies die beiden Partien noch nie auf der Bühne verkörpert. So passierten Pannen, an die ich nicht gerne zurückdenke. In der großen Arie des Rudolf, jener mit dem »eiskalten Händchen«, erwischte ich das hohe C keineswegs nach Wunsch, und die Schlußarie des Linker ton »Leb wohl, mein Blütenreich« begann ich gleich um eine Terz zu hoch. Ich erfing mich wieder, der Vorhang mußte nicht fallen, aber es war doch ein ausgewachsener Schmiß. Die Kolle gen, die in mir noch den kleinen Choristen von ehedem sahen, fühlten sich nicht ohne Schadenfreude in ihrer Meinung über mich bestätigt, und mein späterer Kollege und Freund Josef Gostic, damals der führende Tenor der Laibacher Oper, soll, wie ich später hörte, kopfschüttelnd die Aufführung mit den Worten verlassen haben: »Na also, da habt ihr s!« Besser erging es mir mit einem eigenen Lieder- und ArienAbend in Ljubljana. Es war mein erstes selbständiges Konzert. Wie riskant ein solches Unternehmen war, davon hatte ich damals keine rechte Ahnung. Die kam erst viel später, als mit den wachsenden Aufgaben auch meine Selbstkritik wuchs. Ein mir befreundeter Laibacher Zahnarzt, der in einem väterlichen Ver hältnis zu mir stand und vielen jungen Gesangsstudenten unter die Arme griff, stiftete mir für das Konzert einen Frack. Es war der erste eigene in meiner Sänger-Karriere. Der Frack trug übri gens wesentlich dazu bei, daß ich nicht nur beim Publikum, son dern auch bei der Presse gut ankam. Ljubljanas führender Kriti ker schrieb am andern Tag: »Der junge Mann wirkt auf dem Konzertpodium sehr sympathisch und der Frack steht ihm ausge zeichnet.« Ich habe das für ein besonderes Lob gehalten.
VI
Dreierlei Feuertaufen Matthäus-Passion, E u^n Onegin und Assentierung
In Wien war für Mitte März 1937 eine Aufführung von Bachs „Matthäus-Passion“ unter Knappertsbusch und unter Mitwirkung des Staatsopernchors angesetzt. Koloman von Pataky, der für die schwierige Partie des Evangelisten vorgesehen war, erkrankte plötzlich und fiel zehn Tage vor der Aufführung aus. Einen Ersatztenor aus Deutschland dafür zu holen, stieß wegen der wachsenden politischen Spannungen auf Schwierigkeiten. In Österreich aber fand sich weit und breit kein Evangelist. Die Aufführung schien in Gefahr. In dieser Situation trat Professor Ferdinand Großmann, der die Chorleitung innehatte, an mich heran und fragte, ob ich bin nen acht Tagen die Partie des Evangelisten übernehmen könnte. Ich war erfreut und besorgt zugleich. Erfreut, weil man mir diese Leistung zutraute, und besorgt, weil ich die Partie nicht studiert, ja, weil ich überhaupt noch nie ein Werk von Bach gesungen hat te. Meine bisherige Arbeit hatte fast ausschließlich der Oper gegolten, auf dem Konzertgebiet war ich noch unsicher und eine stilistische Aufgabe wie diese war mir überhaupt fremd. Alles das hielt ich Großmann vor, aber er ließ sich nicht abschrecken. »Ich studiere selbst die Partie mit Ihnen«, sagte er. »Wir kom men täglich zusammen. Ich übernehme die Verantwortung.« Das gab mir eine gewisse Sicherheit, und ich sagte zu —mit jenem Gottvertrauen, das ein gerütteltes Maß an Vertrauen zu Groß9
5
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
mann und zu mir selber einschloß und das man vielleicht nur in der Jugend aufbringt. Wohl war ich mir der gewaltigen techni schen, musikalischen, stimmlichen und stilistischen Schwieri^eiten bewußt, aber mich lockte einfach die neue große Aufgabe. In den folgenden Tagen hatte ich für nichts anderes Sinn als für Bachs Evangelisten. Großmann war ein hervorragender, ebenso fachkundiger wie unermüdlicher Lehrer. Er hat mir nicht nur die richtige Aussprache des Textes beigebracht, sondern mir auch geholfen, die schwierigen Stellen —die Partie liegt sehr hoch - stimmlich zu bewältigen ; und er hat mich schließlich zum rich tigen stilistischen Ausdruck hingeführt und mir damit einen völ lig neuen Bereich erschlossen. Später habe ich noch viel mit ihm gemeinsam musiziert: im Konzertsaal bei Bachs h-Moll-Messe, bei Mozarts »Requiem«, bei Haydns »Schöpfung« und »Jahres zeiten« sowie in der Wiener Hofburgkapelle bei Messen, die Großmann als künstlerischer Leiter der Wiener Sängerknaben dirigierte. Die Aufführung der »Matthäus-Passion« vom 15. März 1937, werde ich nie vergessen. Ich bestand dabei vor Knappertsbusch, vor der Presse und vor mir selbst. Ich hatte das herrliche Gefühl, daß mir fast alles gelungen war. Carl Lafite schrieb dazu in der »Neuen Freien Presse« : »Von den Protagonisten ist namentlich Dermota als Evangelist erwähnens- ja rühmenswert. Er hat sich den Part klug zurechtgelegt; die gelenkige, leicht ansprechende und mit Kopfresonanz förm lich getränkte Stimme gehorcht den kühnsten Anforderungen.« Kurz darauf begegnete ich in der Künstlerloge der Staatsoper den gefeierten Wagner-Tenor Gunnar Graarud, den ich bis dahin nicht persönlich gekannt hatte und der trotz seiner schwinden den Stimmkraft als Tristan, Siegfried und Parsifal immer noch Knappertsbuschs besondere Gunst besaß. Als ich mich vorstellte, horchte er auf »Ah, Sie sind das...!« meinte er. »Ich gratuliere. Von Ihnen hat mir ja Knappertsbusch Wunderdinge erzählt. Bei Ihrem Evangelisten in der Matthäus96
IO
Dehü^ in S a lz
bu rg :
a ls
M e iste r
Z o rn in den » M e i stersin g ern « Toscanini,
11
u n ter
1 9 3 6
B e i einer K u n d -
fu n k a u fn a h m e : rechts R ic h a r d
am
F lü gel S trauss,
d a h in ter H ild a D e r m ota
16
Bei
b u rger 1 9 3 9 ,
den
S a lz
Festspielen erstm a ls m it
eigenem A u t o
VI / D R E I E R L E I F E U E R T A U F E N
Passion ist es ihm, so gestand er mir, an manchen Stellen kalt über den Rücken gelaufen.“ - Das war für mich die schönste Bestätigung meiner Bewährung in einer schwierigen Aufgabe. Dieser Bewährung verdankte ich es, daß ich im Konzertleben bald immer häufiger mitwirken durfte. So wurde ich von der Konzerthausgesellschaft eingeladen, bei einer Aufführung von Beethovens »Neunter« unter Karl Böhm, die für Anfang April 1937 angesetzt war, die Tenorpartie zu übernehmen. Es war mei ne erste »Neunte«, und ich kam gleich zur ersten Chor-Orchester-Probe zu spät. Und das geschah so: Ich hatte knapp vorher ein Gastspiel in Prag zu absolvieren, mein zweiter vorsichtiger Schritt zu meiner Auslandstätigkeit. Ich sang am Prager National theater (Narodni divadlo) den Linkerton und den Lenski und kehrte erst am Tag der Konzertprobe, die für 19 Uhr angesetzt war, nach Wien zurück. Ich mußte mich beeilen, war aber über zeugt, daß ich auch um 19.50 Uhr noch viel zu früh dran sein würde, denn mein Einsatz war ja erst im 4. Satz fällig. Ein ver hängnisvoller Irrtum! Böhm probte natürlich nur den 4. Satz mit Chor, Solisten und Orchester, und so entstand die peinliche Situation, daß man auf mich warten mußte. Bevor ich mich noch entschuldigen konnte, fuhr mich Böhm an : »Na, Sie haben aber Starallüren ! Das ist doch wirklich uner hört!« Ich hätte mich bei dieser meiner ersten Begegnung mit meinem späteren zweimaligen Staatsoperndirektor am liebsten in den Boden verkrochen. Gottlob glätteten sich die Wogen rasch. Ich konnte Böhm davon überzeugen, daß es sich meinerseits um ein Mißverständnis gehandelt hatte, und meine Mitwirkung fiel zu seiner Zufriedenheit aus. Wenige Wochen später wurde mir abermals eine wichtige konzertante Aufgabe anvertraut, diesmal in besonders prominen tem Rahmen. Paris rüstete im Frühjahr 1937 zur Weltausstellung. Österreich sollte dabei nicht nur durch seine wirtschaftlichen, technischen und sportlichen, sondern auch durch seine künstleri schen Leistungen —vor allem durch seine Musik —würdig vertre9
7
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN ABEND
ten sein. Also mobilisierte man das Beste, das man hatte: die Wiener Philharmoniker und den Staatsopernchor unter Bruno Walter. Als Abschluß des Österreich-Tages wurde ein abendli ches Konzert mit zwei unsterblichen österreichischen Werken angesetzt: Mozarts »Requiem« und Bruckners »Tedeum«. Im Solisten-Quartett, neben Elisabeth Schumann, Enid Szantho und Alexander Kipnis, sollte ich die Tenorpartie übernehmen. Ich hatte diese Werke noch nie gesungen. Aber Bruno Walter, mit dem ich kurz vorher in der Oper in engeren Kontakt gekom men war, worüber gleich zu berichten sein wird, schenkte mir sein volles Vertrauen, das ich, gottlob, rechtfertigen konnte. Dazu fällt mir eine kleine Episode ein, die sich bei meiner ersten Korrepetitionsprobe zutrug. Der mir zugewiesene SeniorKorrepetitor der Staatsoper, Professor Redl, ein Riese von Gestalt mit einem kindlichen Gemüt, schlug am Klavier die ersten Takte von Bruckners »Tedeum« an, brach laut lachend wieder ab und sagte in geringschätzigem Ton: »Und das soll Musik sein ...!« —Auf so merkwürdige Weise wurde ich in die herrliche Welt der Brucknerschen Musik eingeführt. Das Konzert fand im Théâtre des Champs-Elysées statt, wo neun Jahre später auch die Staatsoper mit »Cosi fan tutti« gastierte. Dabei hat mich alles Drum und Dran derart beein druckt, daß mir die Einzelheiten des Konzerts selbst nicht mehr gegenwärtig sind. Es war —nach Salzburg —immerhin mein zweiter Ausflug in die »große Welt«. Paris lockte mit seinen Rei zen. Meine Freizeit verbrachte ich fast vollständig im Lx>uvre und in den anderen Museen. Am Abend nach dem Festkonzert arran gierten Professor Großmann und einige Philharmoniker eine Spritztour durch das nächtliche Paris. In mehreren Taxis fuhren wir von einem Nachtlokal zum anderen. Es war amüsant, fast in jedem der »verrufenen« Lokale Kollegen des Wiener Ensemble zu begegnen. Wien konnte sich also nach dem erfolgreichen Konzert auch im Pariser Nachtleben behaupten. Das Pariser Konzert, das internationales Aufsehen erregt hatte. 98
VI /
DREIERLEI F E U E R T A U FE N
wurde kurz darauf im Großen Musikvereinssaal in Wien in der selben Besetzung wiederholt -* »Anton Dermota sang besonders rein und ausdrucksvoll«, vermerkte die »Reichspost« —und für eine Plattenaufnahme mitgeschnitten. Die technische Qualität der Aufnahme dürfte aber nicht sehr befriedigend ausgefallen sein, denn das Material verschwand auf Jahrzehnte in irgendeinem Archiv, bis vor kurzem überraschend eine Schwarzpressung davon auf dem Plattenmarkt erschien. Auf jeden Fall ist die Plat te heute ein historisches Dokument von hohem Wert. Wenig später - es war bereits Juni - sang ich in Baden bei Wien in Haydns »Schöpfung«. Das Kurorchester der Stadt bot eine hübsche Aufführung, die mir die erste Berührung mit Joseph Haydns Meisterwerk verschaffte, das ich später noch oft interpre tierte. In der Staatsoper hatte ich vor diesen KonzertVerpflichtungen noch den Vierten Knappen in Wagners »Parsifal« unter Knappertsbusch übernommen, dann aber war der Augenblick gekom men, da mir zum ersten Mal eine Hauptpartie in einer Premiere zugewiesen wurde: die Rolle des Lenski in Tschaikowskis »Eugen Onegin«, unter der Leitung von Bruno Walter, mit Jar mila Novotna als Tatjana und Alexander Sved in der Titelrolle. Und dabei hatte ich die erste entscheidende Begegnung mit Bru no Walter. Eines Tages —es war Anfang März 1937 —wurde ich in den Musiksalon der Staatsoper bestellt, der unmittelbar neben dem Direktionszimmer lag. Der herrliche Raum mit seinem Barock mobiliar ist leider dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen. In einer Ecke stand ein Flügel, an den Wänden hingen wertvolle Gemälde in massiven Goldrahmen. Einige dieser schweren Bil der habe ich noch im März 1945 aus dem brennenden Haus zu tragen und zu retten versucht. In diesem Salon pflegten nur die Spitzendirigenten zu proben: Richard Strauss, Clemens Krauss, Bruno Walter, Hans Knappertsbusch und —als letzter Direktor 9
9
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
des alten Hauses - Karl Böhm. Ich fand mich pünktlich um fünf Uhr nachmittags, mit dem Klavierauszug bewaffnet, ein. Es war der Auszug Charles Kullmanns, der nach Amerika abgewandert war und von dem ich nicht nur die Partien, sondern auch die Klavierauszüge erbte. Kurz darauf erschien Bruno Walter. Mir war er als ein stiller Mann von starker persönlicher Ausstrahlung geschildert worden, als sehr zurückhaltend und als einer, der seinem Gegenüber wenig entgegenkam. Ich machte eine andere Erfahrung. Schon wie er mir die Hand reichte, wie er sich ans Klavier setzte, nahm er mir jede Scheu. Walter war ein hervorragender, ja virtuoser Pianist. Ich habe nur wenige Dirigenten kennengelernt, die das Klavier so souverän beherrschten. Bekanntlich hatte er viele gro ße Liedersängerinnen —vor allem Elisabeth Schumann und Lotte Lehmann - am Flügel begleitet. Nun begann er die Partie des Lenski Takt für Takt mit mir durchzuarbeiten. Dabei stellte sich bald heraus, daß mir die Partie durchaus nicht auf den Leib geschrieben war, sondern stellenwei se für mich zu tief lag. Ein anderer Dirigent hätte mich vermut lich abgewiesen mit der Bemerkung: »Die Partie liegt Ihnen doch nicht so gut!« Walter aber begann die tiefen Stellen, die mir zu schaffen machten, mit dem Bleistift zu punktieren, das heißt, höher zu setzen. Und weil er merkte, daß mir auch die Ausspra che des Deutschen gelegentlich Schwierigkeiten bereitete, so etwa das helle A, änderte er auch den Text zu meinen Gunsten, wobei er mit feinem Sprachgefühl zugleich die Sangbarkeit der Worte verbesserte. Wir saßen stundenlang beisammen; Bruno Walter bot mir nicht nur im entscheidenden Moment die nötige Hilfe, er hat mir gleichsam Gesangsunterricht erteilt —ein leuch tendes Beispiel dafür, wie sich früher in der Staatsoper ein großer Dirigent zu einem kleinen Anfänger verhielt. Heutzutage wäre das kaum denkbar. Schließlich war der Klavierauszug über und über mit Walters Schriftzeichen bedeckt. Ich besitze ihn noch heute, denn ich habe
VI /
DREIERLEI FE UERT AUFEN
ihn meiner Autographensammlung einverleibt. Für mich ist er eine kostbare Erinnerung an einen großen Künstler und Men schen. Wenige Wochen vor der Premiere - sie war für den 19. April angesetzt - erkrankte ich an schwerer Bronchitis. Ich mußte ins Krankenhaus, und dort wurde mir Höhenluft verordnet. So fand ich mich eines Tages auf der Bürgeralpe bei Mariazell. Und wäh rend ich dort oben rasch gesundete, lernte ich gleichzeitig die Partie des Lenksi auf meine Weise auswendig. Um die Mittags zeit, wenn die Sonne kam, wanderte ich laut singend über das verschneite Plateau. Da störte ich niemand und wurde von nie mand gestört. So kam ich nicht nur ausgeheilt, sondern auch wohlvorbereitet zu den entscheidenden Proben. Ich wußte genau, was für mich auf dem Spiel stand und welche Erwartungen Erwin Kerber und Bruno Walter in mich setzten. Und ich glau be, ich habe sie nicht enttäuscht. Bis Saisonschluß gab es noch zwei Reprisen in der Premierenbesetzung unter Bruno Walter, und am i. Juni sang ich wieder die Stimme des Seemanns in einer Repertoirevorstellung des »Tristan«. Am Pult stand damals ein junger Gastdirigent vom Stadttheater Aachen, von dem ich vor her nie gehört hatte. Er hieß Herbert von Karajan. Da es keine Probe gegeben hatte und ich meinen Part von der höchsten Höhe des Schnürbodens sang, ist mir Karajan überhaupt nicht zu Gesicht gekommen und dieses Dirigentengastspiel fast spurlos an mir vorübergegangen. Inzwischen waren die ersten Kritiken zur »Eugen-Onegin«Premiere erschienen, die ich begreiflicherweise mit großem Eifer studierte und getreulich sammelte. Da schrieb etwa die »Große Volkszeitung« : »Beachtenswert auch Anton Dermota in der Rol le des Lenski, des unreifen, innerlich zerrissenen und leiden schafterfüllten Jünglings. Sein Tenor hat Farbe und Feuer. Beifall dankte ihm auf offener Szene.« Und die »Presse« ergänzte: »Die sentimentale e-Moll-Arie war auf das feinste gegliedert und phra-
DERMOTA /
TAU SENDUNDEIN
ABEND
siert. Auch in der leidenschaftlich erregten Ballszene zeigte sich wieder einmal, daß sich junge Talente fördern lassen, sofern nur Kapellmeister und Regisseur zu fördern sich bereit finden.« Besonders schmeichelhaft für mich war das Urteil des Kriti kers im »Echo«, der mich mit der Novotna in einem Atem nann te: »Jarmila Novotna und Anton Dermota haben beide dieses fast ein bißchen jenseitig Poetische, mit dem sie die ursprüngliche und zeitlose Idee, die >Eugen Onegin< bedeutet, glaubhaft machen. Und dabei ist eigentlich schon alles Lob gespendet.« Doch weiter hieß es: »Der junge Dermota, kaum erst entdeckt und schon zu großer Hoffnung aufstrahlend, bringt die Kennzei chen seiner Persönlichkeit auch in seiner Rolle ausgezeichnet zur Geltung... sein Tenor, dessen edles Licht wir erst kürzlich rühm ten und von dem sogar in der scheinbar klanglosen Tiefe ein mil der Glanz aufstrahlt, hat sich gestern schön entfaltet.« Eine Kritik aber machte mir zu schaffen. Sie erschien im »Neuen Wiener Tagblatt« und lautete: »Anton Dermota ist in erstaunlich kurzer Zeit in die vordere Reihe des Opernensembles gerückt, und niemand wird bestreiten, daß der junge, sympathi sche Sänger den Aufstieg durchaus verdient hat. Es fragt sich nur, ob die Vorrückung gerade in der günstigsten Richtung erfolgt. Ein leichter, feiner, gertenschlanker Tenor mit zarten, pastellhaften Klangfarben, eine fast noch knabenhafte Erschei nung, degagiertes Wesen und offenkundiges Talent für saubere, deutliche Wortartikulation ... sollte dÄ nicht ein legitimer und sehr verheißungsvoller Anwärter auf das Fach des Spieltenors heranwachsen, ein Jacquino, Pedrillo oder David? Von dieser Linie sieht man ihn derzeit ein wenig abgedrängt und einem anspruchsvolleren lyrisch-dramatischen Rollentyp zustreben. Gewiß, er macht auch als Ixnski in Tschaikowskis >Eugen Onegin< seine Sache sehr nett und sehr geschickt, wie er sich ja auch als Alfred in der >Traviata< bereits erfolgreich erprobt hat. Er weiß seine Gaben stets vorteilhaft einzusetzen, seine hübsche, weiche, anschmiegsame Stimme, die so mühelos anspricht und
VI /
DREIERLEI FEUERTAUFEN
gerade nur in der tiefen Lage noch einiger Festigkeit bedarf, sei nen Takt und sein Feingefühl für delikate Vortragsnuancen und sein Talent für zärtliche Legatophrasen. Das Ganze wirkt aber doch noch recht schmächtig; die weite, faltenreiche Gewandung der Rolle sitzt ein wenig schlotternd auf einem schmalen Jüng lingskörper, der noch nicht ganz ausgewachsen ist...« Unterzeichnet war die Kritik mit »Kr.« und es war kein Geheimnis, daß sich dahinter der einflußreiche Kritiker Professor Heinrich Kralik verbarg. Seine Zeilen erregten mich in doppelter Hinsicht, zunächst deshalb, weil hier ein maßgebender Mann der Feder mich einer so eingehenden und in gewisser Hinsicht fast liebevollen Würdigung für wert hielt, dann aber, weil derselbe Mann, den auch ich hochschätzte, mich in aller Öffentlichkeit in eine, wie ich überzeugt war, falsche Richtung drängen wollte. Dagegen wehrte ich mich im Inneren. Ich wollte kein Spiel tenor werden, obgleich ich später tatsächlich den David und den jacquino, allerdings niemals den Pedrillo, gesungen habe. Mein Traum waren die Mozart-Partien sowie das italienische und fran zösische Fach vom Des Grieux und Rudolf bis zum Cavaradossi und Don José als oberster Grenze. Dorthin war ich ja bereits auf dem Weg. Darum ärgerte mich das »schmächtig« und »schlot ternd«, und in meinem jugendlichen Ärger griff ich kurz ent schlossen zum Telephon, läutete mit unsicherem Gefühl Kralik auf und bat ihn um eine Unterredung, worauf er mich zu sich in die Wohnung einlud. Kralik empfing mich freundlich. Es kam zu einem für mich sehr nützlichen und fruchtbaren Gespräch. Ich vertrat meinen Standpunkt, erklärte mein Ziel und er nahm alles freundlich zur Kenntnis. Kralik hat mir später nie mehr Ratschläge erteilt. Im »Dritten Reich«, als ich mich geradewegs auf mein Ziel hin ent wickelte, war er zum Schweigen verurteilt. Wenn wir uns nach 1945 begegneten —Kralik wurde wieder erster Musikkritiker der »Presse« und überdies Leiter der Musikabteilung des Österreichi schen Rundfunks —grüßten wir uns freundlich. Er hat noch mei103
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN ABEND
nen Florestan und meinen Palestrina erlebt, den er mir übrigens gleichfalls nicht zutraute, aber über sein Fehlurteil und unser Gespräch von einst verlor er nie mehr ein Wort. Kritiker sind eben auch nur Menschen. Ich war für ihn nun der »hochverehrte, hochgeschätzte Nobel-Tenor des Flauses mit dem unverwechsel baren Timbre«. Er war übrigens selbst ein Mann von echter Noblesse. Sehr im Gegensatz zu seiner Gattin, vor der man sich in acht nehmen mußte. Ihre gefährlichen Urteile über Künstler, die sie in der Wiener Gesellschaft verbreitete, waren gefürchtet. In Künstler kreisen war man überzeugt, daß sie die Kritiken ihres Mannes nicht nur beeinflußte, sondern gelegentlich - besonders wenn sie abfällig waren —sogar selbst schrieb. Als ich einmal mit schwerer Erkältung singen mußte, brüskier te besagte Dame meine Frau in der Pause einer Aufführung im Parkett der Oper mit den Worten: »Warum lassen Sie denn Ihren Mann singen ? Denken Sie nur ans Geld! ?« Knapp vor Ende der Saison 1936/37 traf mich ein Blitz aus heiterem Himmel. Dazu muß ich weiter ausholen : Mit 20 Jahren, also 1930, hatte ich mich zum erstenmal der Militärbehörde meiner Heimat gestellt. Damals war ich als »untauglich« abgewiesen worden —zu meinem großen Ixidwe sen; galt es doch in unserer ländlichen Gemeinde unter Burschen geradezu als Schande, wenn man nicht »behalten« wurde. Der Vorgang wiederholte sich bei der zweiten Musterung. Erst bei der dritten wurde ich »tauglich« befunden und sollte meinen Militärdienst antreten. Doch zugleich hatte ich mein Zwei-jahresStipendium erhalten. Ich suchte daher um eine vorläufige Dis pens vom Militärdienst an und erhielt studienhalber einen Auf schub bis zum 27. Lebensjahr. Dieses Alter hatte ich 1937 erreicht, ohne mir seiner Bedeu tung bewußt zu werden. Entsprechend verblüfft war ich, als mich der Einberufungsbefehl aus meiner Heimat ereilte. Pflicht 104
VI /
DREIERLEI FEUERT AUFEN
gemäß meldete ich den Vorfall sofort der Direktion der Staatso per. Schon am andern Tag brachten die Zeitungen die Meldung: »Junger Tenor der Staatsoper muß nach Jugoslawien einrücken!« Ich hatte, wie erwähnt, meine ersten großen Partien, den Alfred und den Lenski, bereits hinter mir und es scheint mir nicht ausgeschlossen, daß bei den Z^itungsmeldungen die Direk tion der Staatsoper ein wenig nachgeholfen hat. Aber das nützte mir nichts. Ich mußte rasch zusammenpacken und nach Ljubljana fahren, um mich zu stellen. Am nächsten Tag, um 9 Uhr früh, fand ich mich auf dem Kasernenhof ein. Meine Situation war trist. Neun Monate Militärdienst, das bedeutete: ein ganzes Jahr fern der Oper, in der ich eben erst richtig Fuß gefaßt hatte. Mei ne junge Karriere schien ernsthaft in Frage gestellt. Wie konnte ich freikommen ? Theoretisch bestand die Möglichkeit einer Superrevision, das heißt einer neuerlichen militärärztlichen Untersuchung mit negativem Erfolg, also eine endgültige Untauglichkeitserklärung. At:>er ich war ja gesund und in einer so guten körperlichen Verfassung wie nie zuvor! Nun kannte ich, wie bereits erwähnt, einen angesehenen Zahn arzt in Ljubljana, der mir schon früher - mit dem Frack! - gehol fen hatte und der mir auch jetzt beizustehen versprach. »Ich werde mich erkundigen, wer der zuständige Militärarzt ist, werde mit ihm sprechen, und ein wenig mit Vitamin D, das heißt mit den nötigen Dinars, nachhelfen. Dann wird es schon gehen!« Aber ich mißtraute diesem Optimismus. Lieber wäre ich auf Nummer sicher gegangen. Unversehens kam ich am Kasernenhof ins Gespräch mit einem Kameraden, dem ich meine Lage schil derte. Gemeinsames Schicksal verbindet. Er fragte mich : »Bist du Nichtraucher?« Und als ich bejahte, sagte er: »Da hast du zwei Zigaretten. Inhaliere sie, so schnell du kannst. Du wirst sehen, das wirkt Wunder!« Ich überlegte nicht lange, nahm die Zigaretten —es waren »Sava«, die kommunste und billigste Sorte -, eilte auf die nächste 105
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
Toilette und inhalierte, was das Zeug hielt. Als ich wieder ins Freie trat, die Sonne brannte bereits auf unsere Köpfe, wurde mir totenübel. Schwankend schloß ich mich dem Zug derer an, die sich zur Wiederuntersuchung beim Militärarzt gemeldet hatten. Wir mußten den Kasernenhof überqueren. Der Weg, etliche hun dert Meter weit, schien kein Ende zu nehmen. Dann galt es noch, den zweiten Stock zu ersteigen. Mir zitterten die Knie, der Boden schwankte mir unter den Füßen. Während ich mich automatisch meiner Kleider entledigte, stellte ich halb unbewußt fest, daß da mehrere Militärärzte tätig waren, die in den nächsten Minuten mein Schicksal entscheiden konnten. Ob auch der für mich richti ge dabei war? Aber es kam gar nicht soweit. Während ich, einge klemmt in eine Schlange nackter Männer, in einem langen Korri dor wartete, wurde mir plötzlich schwarz vor den Augen, und ich fiel um wie ein Stück FIolz. Ich hatte mir eine perfekte Niko tinvergiftung mit Kreislaufkollaps angeraucht. Im Unterbewußtsein vernahm ich noch, wie die Kameraden nach einem Arzt riefen und eine barsche Offiziersstimme befahl : »Mit Wasser anschütten!« Dann spürte ich einen eisigen Schock, sah Licht vor meinen Augen und hörte, wie der zu Hilfe gerufene Militärarzt zu mir herabsprach: »Steh’ auf! Du brauchst nicht einzurücken!« War das eine Falle? So wie die, die man Tosca und Cavaradossi stellt ? Der Arzt wußte wohl, daß ich vom Theater kam. Aber ich konnte gar nicht aufstehen, selbst wenn ich es gewollt hätte. So wurde mir ein Uniformierter beigegeben, der mich zusam menklaubte, mir die Kleider überzog und mich ins nahe Hotel quartier mehr trug als führte. Dort sank ich ins Bett und fiel in einen tiefen, bleiernen Schlaf Als ich erwachte, rief ich meinen befreundeten Zahnarzt an. Er kam und verordnete mir zwei Fast tage mit Bettruhe. Nach diesen zwei Tagen erhob ich mich, noch etwas schwach, aber besten Mutes, packte meine Sachen, fuhr zu rück nach Wien und meldete mich - nach einer Unterbrechung von nur vier Tagen - wieder zum Dienst in der Staatsoper. io6
VI /
DREIERLEI FEUERTAUFEN
So endete meine militärische Karriere auf höchst unmilitäri sche Weise. Ich habe nie eine schriftliche Bestätigung meiner Freistellung in die Hand bekommen, aber man hat mich auch nie wieder einberufen. Ob der Nimbus der Staatsoper so viel Ein druck auf die Herren Offiziere gemacht oder ob mein zahnärzt licher Freund seine »Vitamine« erfolgreich eingesetzt hatte, das weiß ich nicht und habe auch nie den Drang verspürt, es zu erforschen. Eines aber weiß ich bestimmt: daß ich durch meine Tätigkeit an der Staatsoper meiner Heimat besser gedient habe als durch das Klopfen von Gewehrgriffen.
VII
Es gibt keine kleinen Partien Begegnung m it I^ tzn er und Strauss — Neue Au^aben, neue Kollegen Hochzeit im D ritten Reich
Im Sommer 1937 gab es ein glückliches Wiedersehen mit Salz burg. Zur Partie des Zorn in den »Meistersingern« kam für mich noch meine bewährte Antrittsrolle, der Erste Geharnischte, in der neuinszenierten »Zauberflöte«, die Toscanini dirigierte. Hel ge Roswaenge sang den Tamino, Jarmila Novotna die Pamina, Willi Domgraf-Faßbaender den Papageno, Dora Komarek die Papagena und Alexander Kipnis den Sarastro. Toscanini leitete außerdem die Eröffnungspremiere des »Fidelio«, so daß man nicht ganz zu Unrecht von »Toscanini-Festspielen« sprach. Ich hatte Gelegenheit, die berühmte Reinhardt-Inszenierung von Goethes »Faust« in der Felsenreitschule —mit Ewald Baiser in der Titelrolle, Werner Krauss als Mephisto und Paula Wessely als Gretchen - zu sehen und war zutiefst beeindruckt. Mein Deutsch hatte sich bereits so sehr verbessert, daß ich der Handlung ohne weiteres zu folgen vermochte. Ich weiß noch, wie sehr mich vor allem die Darstellung des Gretchens durch die Wessely erschüt tert hat. Allmählich war ich auch mit meinen Kollegen in privaten Kontakt gekommen. Dazu bot ja Salzburg mit seinen freundli chen Gaststätten und der herrlichen Umgebung reichlich Gele genheit. So erinnere ich mich gerne an eine Einladung des von mir hochgeschätzten Kollegen Hermann Gallos - auch er einer 108
VII /
ES G I B T K E I N E K L E I N E N P A R T I E N
der Meister in den »Meistersingern« —zu einer Autofahrt an den Königsee. Gal los besaß einen offenen Daimler, wie es sich für einen »gestandenen« Kammersänger gehörte, und für mich hatte das Autofahren damals noch den Reiz völliger Neuheit. Es wurde ein wunderschöner Tag, und als ich gegen Abend in mein Quartier kam, lag da für mich die Nachricht, mich umge hend im Festspielhaus einzufinden. Dort erfuhr ich, daß ich auf Wunsch Bruno Walters in der »Tristan«-Aufführung von heute auf morgen die Stimme des Seemanns übernehmen sollte. Hilda verbrachte den Sommer mit ihren Eltern in Lienz und nahm auf der Reise dorthin einen kurzen Zwischenaufenthalt in Salzburg, so daß wir ein paar schöne Stunden miteinander ver bringen konnten. Später erstand ich von meinem Salzburger Honorar einen Verlobungsring, fuhr zwischen zwei Vorstellun gen nach Lienz und hielt in aller Form um Hildas Hand an. Der Ring hat alle Kriegs- und Nachkriegswirren überdauert und schmückt noch heute die Hand meiner Frau. In Lienz kam ich meiner künftigen Schwiegermutter zum erstenmal näher. Sie, die Bozener Patrizierstochter, war nicht nur äußerlich eine imponierende Schönheit, sie beeindruckte auch durch Geist und Temperament. Und sie hat sich ihre geradezu unglaubliche Vitalität bis zu ihrem Tod - sie starb 1975 im 90. Lebensjahr —bewahrt. Übrigens verband uns von Anfang an die Liebe zu den Bergen - bei ihr waren’s die Dolomiten, bei mir die Karawanken -, die sicher unser Naturell geprägt hatten. Im Herbst trat ich in der Staatsoper in das Ensemble einer »musikalischen Legende« ein, deren Titelpartie —damals von Josef Witt gesungen —ich erst drei Jahrzehnte später selbst sang: Hans Pfitzners »Palestrina«. Man gab mir die winzige Episode des Bischofs von Dandini, der wirklich nicht mehr als »Der Bischof von Dandini, ich ...!« im Konzilsakt zu rufen hat. Aber dazu kamen noch die Erscheinung des Ersten Meisters der Ton kunst im ersten Akt und der Dritte Kapellsänger im dritten Akt. 109
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
Und diese drei Chargen blieben mir für viele Jahre - praktisch bis zu dem Tag, da ich die Titelpartie übernahm. So hatte ich Gelegenheit, das großartige Werk unter vielen Dirigenten - darunter Rudolf Moralt und Robert Heger - zu erleben. Josef Witt gab später die Titelrolle an Julius Patzak ab und wurde Regisseur des Werkes. Musikalischer Leiter meiner ersten »Palestrina«-Vorstellung war Bruno Walter, der mit Pfitzner befreundet war, das Werk in München uraufgeführt hatte und besonders schätzte. So wurde »Palestrina« in München und Wien fast so etwas wie ein Repertoire-Stück, das durch alle Abonnements ging. Es ist bemerkenswert, daß es damals durch aus nicht jene Aufführungs- oder Besetzungsprobleme dabei gab wie heute. In diese Zeit fiel meine erste und einzige persönliche Begeg nung mit Pfitzner. Der Meister hielt sich vorübergehend in Wien auf und wurde von einer Dame der Gesellschaft zum Tee gela den. Mich bat die Hausfrau, die selbst Sängerin war, bei diesem Anlaß ein paar Pfitzner-Lieder zu singen. Da mir Pfitzners Lied schaffen nicht geläufig war, traf sie für mich eine kleine Auswahl der dankbarsten und gängigsten Lieder. Der Nachmittag kam, ich wurde mit dem Meister bekannt gemacht. Mit seiner kleinen, schmalen Statur, seinen tiefliegenden Augen, den buschigen Augenbrauen, dem scharfgeschnittenen Mund, dem Spitzbart und dem in die Stirn reichenden, angegrau ten Haar wirkte er auf mich wie eine Figur aus einem Märchen buch. Er nahm nicht viel Notiz von mir, blitzte mich nur kurz und kritisch durch seine Brille an, nahm mir die Noten aus der Hand, blätterte kurz darin und knurrte: »Immer wieder dieselben Lieder. Etwas Gescheiteres konnten Sie nicht finden?!« Mich und meine Frau, die mich begleiten sollte, berührte das höchst sonderbar. Aber beim Musizieren erholten wir uns wieder, und im Anschluß daran wurde es noch ein anregender, gewinnbrin gender Abend. Ich bin Pfitzner nicht wieder begegnet; aber sein »Palestrina« I IO
VII /
ES G I B T K E I N E K L E I N E N P A R T I E N
hielt die geistige Verbindung zwischen ihm und mir aufrecht. Viele Jahre später, als ich Autographen zu sammeln begann - der Meister war schon tot —, konnte ich von Josef Witt die ausge dehnte Korrespondenz zwischen ihm und Hans Pfitzner erwer ben, wobei ich mich eigentlich wunderte, daß sich Witt so leicht von diesem Schatz trennte. Unter den Briefen findet sich einer, in dem Pfitzner auf seine Weise Wien eine Liebeserklärung macht : »In Wien hat jeder Trambahn-Schaffner mehr Ahnung, wer ich bin, als in München die Herren vom Kultusministerium.« Am 28. Oktober 1937 sang ich dann in der Staatsoper meinen ersten Octavio in Mozarts »Don Giovanni«, oder richtiger »Don Juan«, wie damals auf dem Programm zu lesen stand, denn es wurde deutsch gesungen. Es handelte sich nicht um eine Premie re, sondern um eine Repertoire-Vorstellung, und zwar unter Josef Krips. Die Titelpartie sang Alfred Jerger, den Leporello Fritz Krenn, die Donna Elvira Luise Helletsgruber, die Donna Anna Ella Flesch. Jerger, der Typ des Verführers auf der Bühne wie im Leben, war ein idealer Giovanni vom Schauspielerischen her, von seiner Ausstrahlung, seiner Vitalität, seinem Tempera ment, weniger vom Stimmlichen. Die Champagnerarie war nie sein Fall. Aber auf stimmliche Perfektion legte man damals nicht so viel Wert wie heute; Ausdruck und Bühnenwirkung waren entscheidend. In die Vorstellung wurde ich einfach hineingeworfen; schwimm oder ertrink! Die einzige Konzession an den Anfänger war ein rasches Durchsingen seiner Arien mit Orchester im Anschluß an eine reguläre Probe für eine bevorstehende Premie re. Die Musiker waren bereits im Begriff zusammenzupacken, der Dirigent zeigte sich pressiert und etwas ungnädig, es herrschte eine Atmosphäre allgemeinen Unwillens, etwa derart: Muß das sein ? Na ja, aber dann rasch .. .1 Ich fürchte, an dieser üblen Gepflogenheit hat sich bis heute nicht viel geändert. Ich schaffte es trotzdem. Dabei kam mir zugute, daß der Octa vio völlig passiv bleibt. Er hat nur zu kommen und zu gehen,
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
Donna Annas Hand zu halten und seine Arien vor der Rampe ins Publikum zu singen. Da konnte darstellerisch nicht viel pas sieren, gesanglich aber mußte man überzeugen. Ich glaube nicht, daß meinethalben die Presse geladen war, aber Direktor Kerber saß in der Loge und merkte meine Sicherheit. Und so wurde der Abend für mich später zum Sprungbrett für die erste große Mozart-Partie bei den Salzburger Festspielen. Kurz vor Jahresende, am 25. Dezember 1937, übertrug man mir, gleichsam als Weihnachtsgeschenk, die Partie des Sängers im »Rosenkavalier«, ein großer Vertrauensbeweis von seiten der Direktion. Wieder stand Josef Krips am Dirigentenpult, Anny Konetzni sang die Marschall in, Margit Bokor den Oktavian, Ade le Kern die Sophie, Fritz Krenn den Ochs. Für mich war es die erste Begegnung mit Richard Strauss, in dessen weiteren Opern werken —»Salome«, »Arabella«, »Daphne« und »Capriccio« — ich später viele und vielseitige Aufgaben übernahm. Und dann kam das Schicksalsjahr 1938. Es bescherte mir zunächst noch eine neue tragende Partie, die freilich nur von kurzem, ja kürzestem Bestand war. Am 9. März, dem Tag, da Bun deskanzler Schuschnigg seine für 13. März anberaumte Volksab stimmung verkündete, brachte die Staatsoper, zusammen mit der Uraufführung von Franz Salmhofers »Iwan Sergejewitsch Tarassenko«, den selten gespielten romantischen Einakter »Djamileh« von Georges Bizet zum erstenmal auf die Bühne. Josef Krips diri gierte, die dänische Altistin Else Brems sang die Titelpartie, mir war die männliche Hauptrolle anvertraut: Harun, ein blasierter junger Türke, der durch die List und treue Hingabe seiner Skla vin Djamileh zur wahren Liebe geführt wird. Beide Partien bie ten gesanglich dankbare Aufgaben, die Partitur ist reich an musi kalischen Schönheiten. Was fehlt, ist die Bühnenwirksamkeit. Der Versuch, ein rares Werk wieder zu entdecken, schlug fehl. Die Neuheit verschwand schon nach zwei Vorstellungen aus dem Repertoire. Die zweite fand am 14 März —einen Tag nach Hitlers Einmarsch in Wien —vor fast leerem Haus statt.
VII /
ES G I B T K E I N E K L E I N E N P A R T I E N
Die politischen Ereignisse hatten auch in der Staatsoper ihre Schatten vorausgeworfen. Einmal waren am Schluß einer »Tri stan«-Vorstei lung, die Bruno Walter dirigierte (ich war wieder als »Stimme des Seemanns« mit dabei), Stinkbomben geworfen worden. Anny Konetzni, die Isolde, konnte nicht weitersingen, Bruno Walter aber bewahrte die Nerven und dirigierte den Liebestod gelassen zu Ende. Als Carl Alwin am i i.März am Ring den Einsatz zu »Eugen Onegin« gab —ich sang wieder den Lenski - hatte Bundeskanzler Schuschnigg bereits über den Rundfunk seinen Rücktritt verkündet. Die politische Atmosphäre war aufs äußerste gespannt. Das Parkett war nur schütter besetzt, und während der Vorstellung verließen die Zuschauer nach und nach das Haus. Alwin, bekannt wegen seiner Vorliebe für rasche Tem pi, dirigierte noch rascher als sonst. Als ich nach der Vorstellung die Kärntnerstraße betrat, bran dete mir eine erregte Menschenmenge entgegen. Der Ring war völlig blockiert. Vom Bundeskanzleramt am Ballhausplatz wehte bereits die Hakenkreuzfahne. Opernchronisten berichten, daß die Staatsoper in dieser kriti schen Zeit ihre Pforten einige Tage geschlossen hielt. Das stimmt nicht. Mit Ausnahme des 26. März - der der Vorbereitung einer Festvorstellung diente - und des 29. März wurde täglich gespielt. Am 12. März dirigierte Knappertsbusch den »Tristan«, am 13. März, als die deutschen Truppen in Wien einmarschierten, stand Alwin zum letztenmal am Pult der Wiener Oper. Man gab »Carmen« mit Todor Mazaroff als Don José. Bald darauf verlor das Haus am Ring viele seiner besten Stützen, unter ihnen Bruno Walter, Felix von Weingartner und Josef Krips, Richard Tauber und Alexander Kipnis, Rosette Anday und Elisabeth Schumann. Lotte Lehmann hatte sich schon früher ins Ausland begeben. Neue Kräfte kamen von »draußen« : Furtwängler, Reichwein, Leopold Ludwig; Max Lorenz, Roswaenge, Schöffler, Manowarda; Maria Müller, Else Schulz, Martha Rohs, Gertrude Rünger. Junge hauseigene Kräfte rückten vor: Esther Rethy, Maria Rei1
1
3
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN ABEND
ning, Fritz Krenn. Richard Odnopossoff verließ das Konzertmei sterpult; an seine Stelle trat der junge Wolfgang Schneiderhan. Ich selbst stand in diesen turbulenten Märztagen zweimal auf der Bühne: am 14. als Harun und am 16. als Belmonte, den ich wenige Tage zuvor — wie gewöhnlich als Einspringer ohne Orchesterprobe —hatte übernehmen müssen, so daß ich wieder einmal meine Partner erst am Abend auf der Bühne kennenlern te. Es war mein zweiter Einstieg ins Mozartfach, und auch er war —wie mein erster mit dem Octavio und wie später mein dritter mit dem Tamino - nicht vorgeplant, sondern das Ergebnis rei nen Zufalls. Im Grunde war ich nur in einer einzigen von den vier Partien, die mir den Ruf eines authentischen Mozart-Stilisten eingetragen haben, von vornherein für eine Neuinszenierung vorgesehen und konnte die erforderlichen Proben mitmachen: als Ferrando in »Cosi fan tutte« unter Karl Böhm, jener Inszenierung, die den legendären Wiener Mozartstil begründete. Bereits am 17. März hatte ich —wieder als Belmonte —eine längst eingegangene ausländische Verpflichtung zu erfüllen: ein Gastspiel in Bordeaux, wo sich eine Reihe prominenter Sänger zu einer Mozart-Stagione zusammenfanden, unter ihnen Elisabeth Schumann, Maria Reining und William Wernigk aus Wien, die für die vorangegangene »Figaro«-Inszenierung bereits vorausge fahren waren, weiters Paul Schöffler aus Dresden und der Bassist Sterneck aus München. Auf dem Programm stand außer dem »Figaro« auch die »Entführung«. Als Dirigent war Josef Krips verpflichtet, als Regisseur der international anerkannte RichardStrauss-Fachmann Dr. Otto Erhardt, der bereits mehrere StraussUraufführungen in Dresden inszeniert hatte und später seine Kenntnisse über die authenthische Interpretation Strauss’scher Werke in mehreren Publikationen niedergelegt hat. Er hatte bereits 1933 Deutschland verlassen und ging später nach Süd amerika, wo er Oberspielleiter am berühmten Teatro Colon in Buenos Aires wurde. Dort bin ich ihm nach 1948 bei meinen all 114
VII /
ES G I B T K E I N E K L E I N E N P A R T I E N
jährlichen Gastspielen in der argentinischen Hauptstadt wieder begegnet. Vor dem Gastspiel in Bordeaux galt es ein Hindernis zu neh men: die Ausreisegenehmigung. Die Grenzen wurden bereits streng kontrolliert. Ob man mich fahren lassen würde Bis zuletzt mußte ich um die Genehmigung bangen. Daß ich sie schließlich doch erhielt, verdankte ich vermutlich meinem jugo slawischen Paß, der mir später nichts als Schwierigkeiten bereiten sollte. In Bordeaux überkam mich der südfranzösische Frühling wie ein Rausch : Blüten und Blumen, Sonne und Meeresluft, die schö ne Stadt und der gute Wein! Was in Wien in den letzten Tagen geschehen war, schien mir wie ein Spuk, wie ein böser Traum. Aber bei der ersten Probe im Theater überfielen mich die Kolle gen: »Du kommst direkt aus Wien! Sag’, was ist dort los!« Nun, ich versuchte, sie zu beruhigen: »Wien steht noch und die Staats oper auch...« Aber die Stimmung blieb gedrückt, und sie über trug sich auch auf die Vorstellungen. Das französische Publikum merkte davon nichts, sondern zeigte sich begeistert. Einzig als Elisabeth Schumann am letzten Tag einen Liederabend gab, blieb das Haus halbleer. Die Franzosen hatten damals wenig Verständ nis für das deutsche Lied. Elisabeth Schumann kehrte nicht mehr nach Wien zurück, sondern ging von Bordeaux direkt nach Lon don, wo sie eine neue Heimat fand. Beim Abschied übergab sie mir ein mächtiges Notenpaket —es waren vorwiegend Orchester stimmen Richard Strauss’scher Lieder - mit der Bitte, dieses Leihmaterial in Wien an die Universal-Edition zurückzustellen. Damit setzte sie eine Art Schlußpunkt. Der Münchner Bassist Sterneck, als Osmin mein Partner, war nicht so klug und kehrte heim. Er wurde aus rassischen Gründen ins KZ verschleppt und ging dort elend zugrunde. Am 27. März stand ich wieder auf den Brettern der Staatsoper: als Erster Gefangener in einer »Fidelio«-Festaufführung unter Knappertsbusch mit Max Lorenz als Gast-Florestan von der 1
1
5
DERMOTA /
TAU SENDUNDEIN
ABEND
Staatsoper Berlin, gegeben »Aus Anlaß der Anwesenheit des Ministerpräsidenten Generalfeldmarschall Hermann Göring«. Damit begann auch in der Staatsoper das »Tausendjährige Reich«. Es war trotz allem eine Ära mit durchaus österreichi schem Einschlag. Dafür sorgte schon Direktor Kerber, der als ruhender Pol in der Erscheinungen Flucht für die geistige Konti nuität des Hauses bürgte —so lange man ihn bürgen ließ. »Wenn i in der Früh in mein Direktionszimmer komm’, klopf i zuerst an«, pflegte er zu scherzen, »vielleicht sitzt scho a anderer an mein’ Schreibtisch.« Ich selbst fand mich in einer zwiespältigen Lage. Mein Bekanntenkreis geriet vorübergehend fast völlig ins nationalso zialistische Fahrwasser. Freunde und Kollegen waren wie ausge wechselt. In dieser Bewegung, die einem Taumel glich, kam ich mir fremd und deplaciert vor. Ich konnte mit der Euphorie, die die Masse befallen hatte, nichts anfangen und stand den Ereignis sen verständnislos gegenüber. Im Grunde ging mich das alles ja nichts an : ich war weder ein Deutscher noch überhaupt ein poli tisch Interessierter. Aber natürlich liebte ich Wien und hing an der Staatsoper, wo meine Karriere so verheißungsvoll begonnen hatte. Zudem war ich verlobt und trug mich bereits mit Heirats gedanken. Durch die Aufnahme in Hildas Familie war ich sozial eine Stufe höher gestiegen, was zweifellos zu meiner weiteren Entwicklung wesentlich beigetragen hat. Hildas Großvater väterlicherseits war als Landesschulinspek tor von Oberösterreich Amtsnachfolger Adalbert Stifters und mit dem Dichter persönlich befreundet gewesen. Er war 1901 von Kaiser Franz Joseph in den Adelsstand erhoben worden und hat te —nach seinem oberösterreichischen Geburtsort Weyer - den Adelstitel von Weyerwald gewählt. Nun mußte ich erleben, daß sein Sohn, mein künftiger Schwie gervater, ein Mann von nobelster österreichischer Gesinnung, gemaßregelt, in Schutzhaft genommen und seiner Funktion als Bezirkshauptmann enthoben wurde. Nur dem Umstand, daß Hil 116
VII /
ES G I B T K E I N E K L E I N E N P A R T I E N
da und ihre Schwester Rosa, eine Studienrätin, unerschrocken für ihren Vater intervenierten, war es zu danken, daß er nicht ein fach auf die Straße gesetzt, sondern wenigstens zwangs pensioniert wurde. Nach zwei Herzinfarkten war er ein gebroche ner Mann. Für mich gab es in der Staatsoper keinerlei Schwieri^eiten, im Gegenteil, es kam mir der plötzlich eingetretene Mangel an Tenören zugute. Mit Richard Tauber hatten ja auch Koloman von Pataky und Charles Kullmann Wien verlassen. Pataky, mein tenorales Vorbild, war mit einer Frau jüdischer Abstammung verheiratet und ging nach Südamerika, wo er —so erzählte man mir später —das Gehör verlor. Seine geschäftstüchtige Frau soll daraufhin ein ungarisches Restaurant eröffnet haben, das die bei den über Wasser hielt. Mir aber fiel auf diese Weise der Tamino zu. Ich sang ihn wie schon erwähnt ohne Orchesterprobe und daher begreiflicherwei se mit viel Lampenfieber - erstmals am i6. Mai 1938 in einer Repertoire-Vorstei lung, die aber als Festvorstellung für eine Par tei-Größe aufgezogen war. Derartige Festvorstellungen gab es nun alle Augenblicke. Diesmal galt sie dem Reichsminister für Justiz Dr. Gürtner, ein Name, der heute so gut wie vergessen ist. Luise Helletsgruber war meine erste Pamina, Knappertsbusch dirigierte; es war mein erster Mozart mit ihm, und er schien mit mir sichtlich zufrieden. Seine knappen, anerkennenden Worte haben mir sehr wohl getan. Ich glaube, daß er für mich eine gewisse Sympathie hegte. Er war, neben Dr. Böhm, mein häufig ster Dirigent. Nach der Vorstellung gab es einen Empfang in den Repräsen tationsräumen der Staatsoper. Dabei konnte ich zum erstenmal den »Zauber der Montur« —die vielfältigen Uniformen der neu en Machthaber —aus nächster Nähe bewundern. Als neuer Tenor des Hauses trat nun Helge Roswaenge in den Vordergrund. Er war ein sehr ruhiger, sehr wortkarger und sympathischer Kollege. Privatgesellschaften mied er, genau wie 1
1
7
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
ich. Als Sänger war er ein Phänomen. Er bekannte mir gegenüber einmal, daß er eigentlich nie richtig singen gelernt hätte. »Was ich technisch brauche, habe ich meinen schreienden Kindern abgehört ; denn bei den Kindern sitzt die Stimme immer richtig.« Ich weiß nicht, wie weit er das ernst gemeint hat. Mein Laryngologe, Dr. Kriso, der Gatte meiner späteren Kollegin Emmy Loo se, erzählte mir, daß Roswaenge streng vegetarisch lebte und zeit weise nur trockene Semmeln mit Milch zu sich nahm. Trotzdem verfügte er über geradezu unglaubliche Kraftreserven. In der Exilzeit der Staatsoper im Theater an der Wien, nach 1945, stand er oft fünfmal in der Woche in schwierigsten, anspruchsvollsten Partien auf der Bühne. Als ihn Dr. Kriso einmal fragte: »Wie schaffen Sie das eigentlich, Herr Kammersänger.^« erwiderte er leicht erstaunt: »Ich tue ja sonst nichts außer singen.« Im Theater an der Wien begegneten wir einander einmal im engen Stiegenhaus, das zur Direktion führte. Wir kamen kurz ins Gespräch. Ich hatte abends die Titel partie in »Hoffmanns Erzäh lungen« zu singen und fragte ihn »Haben Sie eigentlich nie den Hoffmann gesungen.^« worauf er zur Antwort gab: »Nein, den singe ich nicht; der ist mir zu viel Operette!« Aber das Schicksal wollte es, daß gerade Roswaenge schließlich ganz von der Oper zur Operette hinüberwechselte, um sein Sängerleben noch etwas zu verlängern. Soviel ich mich erinnere, war seine letzte Partie, die er im Rahmen einer Tournee sang, der Sou Chong in Lehars »Land des Lächelns«. Der 15. Juni 1938 ist für mich ein wichtiges Datum. An diesem Tag durfte ich —eingeladen von der Gesellschaft der Musik freunde —ein bedeutendes österreichisches Oratorienwerk mit aus der Taufe heben: Franz Schmidts »Buch mit sieben Siegeln«. Man übertrug mir die Tenorpartie im Solisten-Quartett, das noch mit Erika Rokyta, Enid Szantho und Josef von Manowarda besetzt war, der auch die »Stimme des Herrn« übernahm. Oswald Kabasta, Chef der Wiener Symphoniker, Leiter der Musikabtei lung der »Ravag« (damals Reichssender Wien) und persönlicher 118
VII /
ES G I B T K E I N E K L E I N E N P A R T I E N
Freund des Komponisten, hatte die musikalische Leitung. Franz Schütz, Direktor der Musikakademie und gleichfalls mit Schmidt befreundet, spielte den wichtigen Orgelpart, der eigens für ihn geschrieben war. Es wurde ausgiebig und intensiv geprobt, aller dings die längste Zeit ohne den Evangelisten Johannes. »Der schwitzt noch beim Studium der Partie in München«, verriet Kabasta mit genüßlich-schadenfroher Miene. Gemeint war Rudolf Gerlach, den ich weder früher noch später je hörte, der aber bei der Uraufführung seinen schwierigen Part bewunde rungswürdig bewältigte. Es wurde ein denkwürdiges Ereignis für die Musikstadt Wien und ein Triumph für den schwerkranken Komponisten, der, schon vom Tode gezeichnet, aufs Podium geführt wurde und mit Tränen in den Augen für den überwältigenden Beifall dankte. Obwohl ich damals noch kein Autogrammsammler war, bat ich den Meister um eine Widmung, und er schrieb mir mit zitternder Hand in den Klavierauszug: »Zur Erinnerung, mit Dank. Franz Schmidt.« Bald darauf ist er gestorben. Sein Oratorium aber ist geblieben, lebendig und herrlich wie am ersten Tag. Anton Lippe, der Dom kapellmeister von Graz, und Josef Krips trugen es um die Welt, Krips und Mitropoulos machten es in Salzburg festspielreif Bei der Salzburger Aufführung unter Mitropoulos im Jahr 1959 sang ich bereits die Partie des Johannes. Mitropoulos dirigierte die schwierige Partitur auswendig, was sogar den Wiener Philharmo nikern, die nicht leicht zu beeindrucken sind, Respekt abnötigte. Auch bei der Gedenkaufführung, die anderthalb Jahrzehnte spä ter der junge Grazer Kapellmeister Alois Hochstrasser zum 100. Geburtstag Franz Schmidts mit dem Niederösterreichischen Tonkünstler-Orchester und dem Grazer Concertchor bot, sang ich wieder den Evangelisten. In dieser Wiedergabe wurde das Werk dann 1976 von Preiser-Records auf Schallplatte festgehal ten. Meine erste Begegnung mit dem Medium Schallplatte fiel übri119
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
gens schon in den Vorsommer 1938. Von einem Wiener Agenten wurde ich 2u Telefunken nach Berlin vermittelt. Die Aufnahme fand in der Berliner Singakademie statt, einem Haus mit großer Tradition und einem herrlichen Saal mit ebensolcher Akustik. Ich war aufgeregter und nervöser als je auf der Bühne. Aber der Pro duzent, Direktor Herbert Grenzebach, nahm mir mit seinem köstlichen Berliner Humor alle Ängste und half mir über jede Klippe. Ich hatte damals zur Schallplatte noch kein rechtes Ver trauen. Die Langspielplatte war noch nicht erfunden, die zer brechliche Schellackplatte konnte je Seite nur eine Nummer auf nehmen. Also mußte ich für sechs Arien drei Platten besingen, und zwar mit je zwei Arien aus Massenets »Manon«, aus Pucci nis »Tosca« und aus »Turandot«. Direktor Grenzebach kam per sönlich nach Wien, um mir die Erstpressungen zu überbringen. Als ich sie auf meinem technisch mangelhaften Plattenspieler ablaufen ließ, rannte ich enttäuscht aus dem Zimmer. Ich fand mich und meine Stimme auf der Platte völlig unbefriedigend und fremd. Und das erinnert mich an einen Ausspruch Furtwänglers, der sich so ungern fotografieren ließ und diese Abneigung ein mal mit den Worten begründete: »Ich bin nun einmal nicht mein Typ!« Grenzebach war völlig überrascht und meinte zu meiner Frau: »Ja, was hat er denn? Die Aufnahmen sind doch großartig gelun gen!« Da er ein kompetenter Mann war, mußte ich sein Urteil wohl gelten lassen. Die Schallplatten kamen also in den Handel, verkauften sich jahrelang sehr gut und sind später dank der tech nischen Weiterentwicklung klanglich verbessert worden. Heute sind sie schon als historisch zu werten. Übrigens hatten sich mei ne Frau und ich auf den Besuch des Plattenproduzenten beson ders vorbereitet. Unser Haushalt war jung, und wir wollten einen guten Eindruck machen. Also bestellten wir, höchst nobel, das Büffet beim Demel. Das »Ereignis« wurde mit einem Glas ech ten Gumpoldskirchner aus der Kellerei des befreundeten Profes sor Mairecker begossen. 1 2 0
VII /
ES G I B T K E I N E K L E I N E N P A R I ' I E N
Der Salzburger Sommer 1938 brachte dann meinen ersten Festspiel-Octavio und zwar unter Karl Böhm, der Bruno Walter abgelöst hatte. Ich trat damit in die Fußstapfen des italienischen Tenors Dino Borgioli, der die Partie in den beiden vorangegan genen Jahren gesungen und den ich noch in bester Erinnerung hatte. Es gab, zum Unterschied von Wien, diesmal auch für mich ausgiebige Proben, die unter Böhm ebenso zielstrebig wie harmo nisch verliefen. Außerdem hatte ich mir die Partie bereits zu eigen gemacht und konnte sie persönlich gestalten, wieder mäch tig angeregt durch die für mich begeisternde Atmosphäre der Stadt, angeregt auch durch die Prominenz meiner Partner. Mit freudiger Verwunderung stellte ich fest,' daß die »Don-Giovanni«-Besetzung vom Vorjahr fast unverändert zur Stelle war: Ezio Pinza in der Titelrolle, Luise Helletsgruber als Donna Elvi ra, Elisabeth Rethberg als Donna Anna, Virgilio Lazzari als Leporello, Herbert Alsen als Komtur und Karl Etti als Masetto. Nur Margit Bokor als Zeriine fehlte; an ihre Stelle trat Maria Cebotari. Elisabeth Rethberg, die dramatischeste Donna Anna, die ich je erlebte, war mit Ezio Pinza eng befreundet. Ganz Salz burg wußte davon, und das gab der erotischen Spannung zwi schen Don Giovanni und Donna Anna zusätzlichen Reiz. Später haben die beiden geheiratet. Bei einer der Reprisen entstand plötzlich Unruhe hinter den Kulissen, Spannung, Getuschel. Was war geschehen? Alsbald stellte sich heraus, daß soeben die Nachricht durchgekommen war, die jüngere Tochter Bruno Walters habe sich in der Schweiz das Leben genommen. Ezio Pinzas wegen! Man kann sich vor stellen, welcher Schock diese Hiobsbotschaft für den Titelhelden des Abends gewesen sein muß. Alle Mitwirkenden standen unter dem Eindruck des tragischen Geschehens. Ezio Pinza konnte man die Niedergeschlagenheit und Nervosität trotz Schminke förmlich vom Gesicht ablesen. Nach dem Fallen des Vorhangs stürzte er wie von Furien gehetzt zu seinem Wagen, der vor dem Bühnentürl bereitstand, und brauste ab in die Schweiz. Wenige
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
Tage später stand er wieder als Verführer auf der Bühne und sang seine Partie in gewohnter Perfektion, als ob nichts gesche hen wäre. Die Illusion der Bühne überwältigte die Realität des Lebens... Unverändert herrlich spielten die Wiener Philharmoniker, sang der Staatsopernchor. Verändert hatte sich nur das Publikum. Aus einem kunstliebenden Kreis internationaler Prominenz war ein breitgefächertes nationales Publikum geworden, das allen Gauen Deutschlands entstammte, und aus dem die Gauleiter, die Militärs und die Industriekapitäne hervorstachen. In den Zeitun gen gab es auf Grund »höherer Weisung« keine Kritiken mehr, sondern nur noch eine »Berichterstattung«. Ich war gespannt, wie sich das auswirken würde und schlug die »Salzburger Zei tung« auf Dort hieß es: »Don Ottavio war heuer Anton Dermota. Mit ihm steht einer unserer hoffnungsvollsten lyrischen Tenó re auf der Bühne. Wohltuend wirkt die unverbrauchte Frische seiner Stimme, die mühelos die Höhe nimmt und edel bestrebt ist, dem starken Gefühlsausdruck seiner Arien gerecht zu werden. Auch ihm dankte ein aufrichtiger Sonderbeifall.« —Das war also ein Bericht und keine Kritik. Mir schien der Unterschied nicht sehr gravierend. Außer im »Don Giovanni« war ich noch in der »Fidelio«und »Tannhäuser«-Premiere beschäftigt: dort sang ich den Ersten Gefangenen, hier den Walther von der Vogel weide, beide Male unter Knappertsbusch, der für den »Tannhäuser« die Pari ser Fassung wählte, in der Walther, seines einzigen Solo-Auftrit tes beraubt, nicht in den Sängerkrieg des zweiten Aufzuges ein greift. Eine gekürzte Partie somit, aber anspruchsvoll in ihrer hohen Stimmlage und verantwortungsvoll als führende Stimme im Ensemble der Minnesänger. Um den langen Nachmittag und die Nervosität vor der Premiere zu überbrücken, verfiel ich auf die sonderbare Idee, zu Fuß auf den Gaisberg zu wandern. Ich kam gerade noch rechtzeitig in die Garderobe. Ein Ixichtsinn, wie man ihn sich nur in der Jugend leistet.
VII /
ES G I B T K E I N E K L E I N E N P A R T I E N
Ganz allmählich bin ich meinen kleinen Partien entwachsen, ihnen aber trotzdem nicht völlig untreu geworden. (So singe ich etwa die Stimme des Seemanns und den Walther von der Vogel weide noch heute.) Und das war gut so. Ich bin nach wie vor der Meinung, daß man sich als junger Sänger Zeit zum Reifen lassen muß, eine Maxime, die heute sehr zum Nachteil des Nachwuch ses oft mißachtet wird. Und ich bin weiters der Meinung, dal5 auch einem arrivierten Sänger keine Perle aus der Krone fällt, wenn er sich für eine kleine Partie einsetzt. Das fördert nämlich jenen Ensemblegeist, von dem man leider sagen muß, daß er im Opernbetrieb von heute selten geworden ist. Im übrigen halte ich es mit dem bekannten Theaterwort: »FLs gibt keine kleinen Partien, es gibt nur kleine und große Sänger.« Eine kleine Rolle zu großer Wirkung zu bringen, ist bisweilen die größere Kunst. Darum will ich noch drei weitere kleinere Partien erwähnen, die im Herbst 1958 in der Staatsoper auf mich warte ten und die allerdings schon als erste Partien gelten: der Froh im »Rheingold« —eine meiner wenigen Wagner-Rollen —, den ich erstmals unter Knappertsbusch sang, der Alfred in der »Fleder maus« und der Narraboth in der »Salome«. Der Alfred war meine erste Johann-Strauß-Partie. Ich sang sie in einer Aufführung, die Alfred Jerger nicht nur neuinszeniert, sondern auch neu textiert hatte. Als Rosalinde war Maria Rei ning zum erstenmal meine Partnerin. Später war sie dann als Elvira im »Don-Giovanni«-Ensemble, war meine Mimi und mei ne Butterfly. Viele Jahre war ich ihr Hans in der »Verkauften Braut«, aber auch ihr unglücklicher Leukippos in der »Daphne«, die sie so wunderbar verkörperte. Mit besonderer Wärme denke ich an ihre Pamina, die sie —mit mir als Tamino - auch in Salz burg sang. Sie besaß eine der schönsten, innigsten und ausdrucks vollsten Stimmen, die mir in meiner Sänger1aufbahn begegnet sind. Und sie besaß noch mehr: Demut im Leben und in der Kunst. Und damit hat sie auch ihre Bühnenfiguren geadelt. Sie war die ergreifendste Marschallin im »Rosenkavalier«, eine Für123
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
stin Werdenberg von reinstem maria-theresianischen Geblüt, und die überzeugendste Arabella vor Lisa della Casa. Der Narraboth wieder erschloß mir, mehr noch als die Partie des Sängers im »Rosenkavalier«, den Zugang zu Richard Strauss. Dessen lyrische Partien - der Matteo in »Arabella«, der eben erwähnte Leukippos in »Daphne« und der Flamand in »Capric cio« —wuchsen mir organisch zu. Mit Richard Strauss hatte ich wiederholt persönlichen Kon takt. Er dirigierte mehrere Male die »Salome« in der Staatsoper und probte auch mit uns Solisten. Dabei setzte er sich gerne an den Flügel, um selbst zu begleiten. Die Arbeit verlief sehr ruhig, sachlich und leger. Wenn er etwas auszusetzen hatte, dann betraf es meist den Rhythmus. Der streng rhythmische Vortrag schien ihm besonders wichtig. Eine weitere Begegnung mit Strauss fand 1941 in München statt. Ich wurde eingeladen, bei der Münchner Erstaufführung der »Daphne« die Partie des Leukippos zu übernehmen. Es wur de eine beispielhafte Aufführung. Rudolf Hartmann, der RichardStrauss-Regisseur schlechthin, führte Regie, Clemens Krauss diri gierte, der Meister saß in der Proszeniumsloge und kam nach der Vorstellung auf die Bühne. Dort »inszenierte« Krauss soeben den Applaus. Er war ja nicht nur ein brillanter Dirigent, sondern auch ein llieaterfachmann ersten Ranges, der sich auf alle Mittel der Musikbühne ver stand: auf die menschliche Stimme ebenso wie auf die Inszene, die Dekoration, die Kostüme, die Maske und sogar die Technik. Alle Theatereffekte wußte er zu nützen, um das Äußerste an Wirkung zu erzielen. Dazu gehörte für ihn auch die »VorhangTour«, mit der er oft nicht unwesentlich den Erfolg einer Auf führung beeinflußte. In der Gestalt des 'Fheaterdirektors La Roche im »Capriccio«, dessen Text von Krauss stammt, hat er sich selbst ein bleibendes Denkmal gesetzt. Nun dirigierte er die Künstler wohldosiert vor den Vorhang. Das nahm alle so sehr in Anspruch, daß niemand das Erscheinen des Meisters merkte. 124
VII /
ES G I B T K E I N E K L E I N E N P A R T I E N
Richard Strauss sah sich den Zauber eine Zeitlang schweigend an, dann trat er zu Clemens Krauss und sagte ganz bescheiden: »Darf ich vielleicht auch einmal mitkommen?« Lachend nahmen wir ihn in die Mitte und präsentierten ihn im Triumph dem tobenden Publikum. Mit mir war Strauss offenbar zufrieden, denn er schenkte mir nach der Premiere sein Bild und schrieb darauf die Widmung: »Meinem vorzüglichen Leukippos«. In Wien übertrug man mir dank meines Münchner Erfolges —im Jahr darauf die Rolle des Leukippos, die künftig in meinem Repertoire blieb. Als Strauss später einmal über den Text der »Daphne«, den Joseph Gregor verfaßt hat und dessen Sinn nicht leicht zu verste hen ist, befragt wurde »Meister, worum handelt es sich eigentlich in dieser Oper?«, soll er lächelnd geantwortet haben: »Lieber Freund, da müssen S’ den Gregor fragen. Für mich handelt sich’s jedenfalls um die Tantiemen.« Si non è vero ... Zwei Jahre nach der Münchner »Daphne« entschloß sich der Reichssender Wien, zum bevorstehenden 80. Geburtstag des Meisters eine Reihe seiner Lieder auf Tonband aufzuzeichnen, wobei Strauss selbst die Begleitung am Flügel übernahm. Als Lied-Interpreten wurden außer mir noch Maria Reining, Milde Konetzni, die Finnin Lea Piltti, die in der Staatsoper das Kolora turfach sang, und der Bariton Dr. Alfred Poell verpflichtet. Strauss wählte die Lieder selbst aus; dabei fiel mir der Löwenan teil zu. Ich erinnere mich noch gut, wie bescheiden er sich ans Klavier setzte und wie großzügig er begleitete. Da gab es keine langen Erklärungen, aber auch keine Proben. Wir improvisierten und musizierten einfach drauflos. Leistete sich der Sänger einmal ein Ritardando oder eine Fermate, die nicht in den Noten stand, konzedierte der Meister das und gab nach, ja mehr noch, er freute sich sichtlich darüber, wenn ein lang ausgehaltener hoher Ton besonders gut gelang und honorierte ihn mit einem freundlichen Lächeln. Das Ergebnis war von bestechender Lockerheit. 125
D E R M O TA /
TAU SENDUNDEIN
ABEND
Meine Frau kam stets zu den Aufnahmen mit, um die authenti sche Begleitung des Meisters kennenzulernen und ihm auf seinen Wunsch umzublättern. Bei einer Aufzeichnung sang Lea Piltti das Lied »Ich schwebe«, dessen Begleitung in der linken Hand recht weite Baß-Sprünge aufweist. Da wandte sich Strauss an meine Frau und sagte freundlich auffordernd: »Das ist mir zu schwierig. Gehen S’, spielen Sie mir die Bässe!« So haben Hilda und der Meister das Lied dreihändig begleitet - ein Kuriosum, auf das meine Frau heute noch stolz ist. Einmal kamen wir zu spät zur Aufnahme. Emil von Sauer, der große Pianist, Leiter der Meisterklasse für Klavier an der Akade mie und f lildas Ixhrer, war gestorben. Das Begräbnis fand knapp vor dem Aufnahmetermin statt. Es gab kein Taxi. So mußten wir zu Fuß zum Rundfunkgebäude eilen. Als wir in der Argentinier straße ankamen, stand Richard Strauss schon beim Ausgang, um wegzugehen. Bange brachten wir unsere Entschuldigung vor. Aber der Meister winkte freundlich ab und sagte mitfühlend: »Wieder ein großer Musiker weniger.« Und er machte kehrt, ging mit uns zurück in den Aufnahmeraum, setzte sich ans Kla vier und in Kürze hatten wir die Lieder aufgezeichnet. Von diesen Aufnahmen ist so viel Material erhalten, daß es fast dreieinhalbjahrzehnte später für zwei Langspielplatten verwendet werden konnte, die viel Beachtung fanden und heute bereits als historisch gelten. Mit der Münchner Oper hatte ich während des Krieges einen Gastvertrag, so daß ich häufig, zumeist im Schlafwagen, zwischen Wien und München pendelte. Einmal wurde mir die Partie des Königssohns in Humperdincks »Königskinder« zugeteilt, die ich bereits in Wien unter Kn appert sbusch gesungen hatte. Das Schlafwagenabteil war überheizt, die trockene Luft legte sich mir auf die Stimme ; ich kam heiser in München an. Eine Absage war unmöglich, es gab keinen Ersatz. Ich mußte also schauen, damit fertig zu werden. In meiner Soloszene im 2. Akt passierte es dann. Ich stand, vom Scheinwerfer übergossen, als strahlender Prinz ganz allein auf der Bühne. 126
VII /
ES G I B T K E I N E K L E I N E N P A R T I E N
Und meine Kehle war plötzlich wie zugeschnürt. Die Worte sind noch nicht erfunden, die schildern könnten, was ein Sänger in solchen Augenblicken empfindet. Es sind Momente, die ewig dauern. Man leidet Höllenqualen und möchte am liebsten in der Versenkung verschwinden. Ich weiß nicht, wie ich diese Situa tion überlebte. Irgendwie ging mein Auftritt zu Ende und das Münchner Publikum zeigte sich gnädig. Mußte ich mehrere Tage in München bleiben, dann stieg ich im Hotel »Vier Jahreszeiten« ab, wo auch Richard Strauss und Knappertsbusch zu logieren pflegten. Natürlich ließ ich mir dort das berühmte Extrazimmer zeigen, wo die vielberufene Skat partie stattfand, die Strauss so sehr liebte, daß er sie im »Inter mezzo« sogar auf die Opernbühne brachte. Hatte ich einen Gastvertrag mit München, so hatte anderseits der beliebte Münchner Baßbariton Georg Hann, übrigens ein gebürtiger Wiener, einen Gastvertrag mit Wien. Dadurch konnte es gelegentlich Vorkommen, daß wir im Schlafwagen zusammen trafen. In Verdis »Falstaff« standen wir dann auch gemeinsam in Wien auf der Bühne, Hann sang die Titelrolle, ich den Fenton, Clemens Krauss dirigierte. Nach einer dieser Vorstellungen kam Krauss, der sonst keine »Vorhang-Tour« zu versäumen pflegte, entgegen seiner Gewohnheit nicht zum Applaus. Hann wurde sichtlich nervös. Nach jedem Vorhang fragte er: »Ja, wo is’ denn der Chef heute? Warum kommt er denn nicht? Is er bös’? War’n wir so schlecht?« Daraus konnte man entnehmen, wie Krauss von seinen Münchner Sängern vergöttert und zugleich gefürchtet wurde. Hann war auch im Leben eine Falstaff-Natur, ein vergnügter Genießer, alles andere als ein Kostverächter. Nun begab sich’s, daß wir eines Nachts, nach der Vorstellung, nicht nur im selben Zug, sondern auch im selben Schlafwagenabteil von Wien nach München fuhren. Kaum hatten wir uns etwas häuslich eingerich tet, holte Hann eine dicke Aktentasche hervor und packte aus: 1
2
7
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
Fleisch, Wurst, Schinken, Speck, dazu zwei Flaschen Wein —kurz alles, was das gestrenge Kriegsregime verboten hatte und was damals normalerweise auch kaum mehr zu haben war. Etwa bis Linz dauerte sein Nachtmahl, an dem er mich großzügig teilhaben ließ. Dabei erzählte er: »Wissen S’, i bin nämli in München bekannt wie’s falsche Geld. Wenn i über’n Viktualien markt geh’, dann rufen mi die Marktweiber an: >Kommen S’, Herr Kammersänger, i hab’ da was Guats für Ihna; Sie können hab’n, was S’ woll’n!< —Siegst, des is Popularität!« Vom Segen der Popularität bekam auch ich etwas zu spüren. Gegenüber der Münchner Oper befand sich ein Laden, dessen Besitzerin für die Theaterleute schwärmte. Als ich zum erstenmal ihr Geschäft betrat, erkannte sie mich sofort und versorgte mich von da an ausgiebig mit Obst und Gemüse —kostbare zusätzliche Vitamine für unsere kleine Tochter, die bereits das hoheC krähte. Wir hatten nämlich 1939 geheiratet. Sobald ich mich finanziell gesichert fühlte, durfte ich ernstlich an Ehe denken. Im Herbst 1938 gingen Hilda und ich auf Wohnungssuche. Das war gerade zu diesem Zeitpunkt nicht schwierig, denn überall wurden —ganz ohne Ablöse! - Wohnungen angeboten, deren Mieter geflohen oder emigriert waren. Im Rathausviertel fanden wir genau das, was wir suchten, eine schöne Fünfzimmerwohnung. Es war seltsamer Zufall! —die Wohnung eines jugoslawischen Architek ten, der nach Ljubljana zurückging. Es war mein Wunsch, die Hochzeit in meiner Heimat zu fei ern, zum Leidwesen von Hildas Eltern, die aber dennoch dafür Verständnis aufbrachten, um so mehr, da wir so die standesamtli che Trauung umgehen konnten, auf die wir alle keinen Wert leg ten. Hilda stimmte zu. Als sie aber die nötigen Papiere besorgen wollte, gab es unerwartete Schwierigkeiten. Man erklärte ihr unumwunden, wenn sie einen Jugoslawen heiraten wolle, noch dazu in dessen Heimat, sei sie nicht wert, eine Deutsche zu sein. Hilda ließ sich nicht einschüchtern, beharrte auf ihrem Wunsch und erhielt am Ende doch alle erforderlichen Dokumente. 128
VII /
ES G I B T K E I N E K L E I N E N P A R T I E N
Am 16. Februar 1939 fuhren wir nach Ljubljana. Es war ein strahlender, sonniger Tag, so recht dazu angetan, meine Heimat, die Hilda nun zum erstenmal sah, im schönsten Licht zu präsen tieren. Zuerst besuchten wir meinen alten Freund und Gönner, den Zahnarzt Dr. Tavcar, der als unser Trauzeuge vorgesehen war. Seine Ordination befand sich im einzigen Hochhaus der Stadt, von dessen Dachterrasse sich ein traumhafter Blick auf Laibach und seine Umgebung bot. Der Sonnenuntergang dort oben, der alles unter uns mit Gold übergoß, paßte so recht zu unserer Stim mung. Abends gingen wir in die Oper. Ich wollte Hilda doch zeigen, wo ich einst —lang war’s her! —Chorist gewesen war. Wie klein kam mir nun alles vor, wie eng und bescheiden. Man gab —fast hätte ich geschrieben: natürlich - die »Verkaufte Braut«. Und wer sang die Titelpartie Ausgerechnet Jarmila Novotna, meine Traviata, Tatjana, Pamina. Das war eine nette Überraschung. Am späten Nachmittag des 17. Februar fand dann im engsten Kreis die Trauung statt, und zwar in der Kirche jener freundli chen Patres, bei denen ich einst als Musikstudent meine Kloster suppe bekommen hatte. Als zweiter Trauzeuge fungierte mein Bruder Leopold, der damals gerade in Ljubljana studierte. Mit ihm fuhren wir anschließend nach Kropa, wo Hilda meine Eltern kennenlernen sollte. Es galt ohnehin in meiner Heimat als ganz unüblich, daß der Bräutigam seine künftige Gattin nicht vor der Ehe in die Familie einführte, aber daß ich eine Ausländerin mitbrachte, war überdies etwas Besonderes. Die Eltern wohnten hoch droben im Mesner haus der Marienkirche, der »Kapelca«. Als wir im tiefen Schnee den Berg hinanstapften, dachte ich ein wenig bange an die kom mende Begegnung. Meine Eltern sprachen kein Wort deutsch; wie würden sie und Hilda einander verstehen? Aber dann löste sich alles wie von selbst. Mein Vater kam uns auf halbem Weg entgegen. Es dunkelte schon. Als er unser 129
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
ansichtig wurde, hielt er an. Hochaufgerichtet stand er da, mit feierlichem Gesicht. Hilda ging auf ihn zu und umarmte ihn schweigend. Und er, der seinen eigenen Kindern gegenüber nie eine Zärtlichkeit gezeigt hatte, küßte die ihm Fremde auf Stirn und Wange. Damit war wortlos ein Band der Zuneigung geknüpft, das nie mehr abriß. Oben, bei der Mutter, wiederholte sich der Vorgang noch herzlicher. Hilda legte ihr das Brautbukett in die Hände; es war für die Kirche gedacht. Mit Tränen in den Augen trug die Mutter die Blumen zum Marienaltar. Dann saßen wir um den alten, geschnitzten Familientisch; es gab ein bescheidenes Hochzeitsmahl, zu dem auch der Pfarrer geladen war. Meine Frau hatte das Gefühl, hier schon immer daheim gewesen zu sein. Noch am selben Abend fuhren wir zurück nach Ljubljana. Anderntags gab es dann eine kleine »Hochzeitsreise« mit dem Auto in die verschneiten Berge, bei der uns die beiden Trauzeugen begleiteten, sowie ein abendliches Treffen mit meinen ehemaligen Studienkollegen und Professoren von der Akademie. Nach dreimal 24 Stunden kehrten wir als jungvermähltes Paar nach Wien und an die Arbeit zurück.
vili
Wenn das nur gut ausgeht H itler-B illetts und ihre Folgen — D er Gauleiter und die Partisanen — Furtwängler und die Neunte
Bereits während der Wohnungssuche, im Herbst 1938, bekam ich meine dritte —und letzte —Wagner-Partie zugeteilt, den David in den »Meistersingern«. Leopold Reichwein, ein leidenschaftlicher Parteigänger des neuen Regimes, dirigierte: Alfred Jerger sang den Sachs, Set Svanholm, der junge schwedische Heldentenor, dessen Stern im Sommer bei den Salzburger Festspielen strahlend aufgegangen war, den Stolzing. Dazu kamen im Jänner 1939, drei Wochen vor unserer Hoch zeit, mein erster Linkerton mit der Reining als Butterfly und dem Richard-Strauss-Neffen Rudolf Moralt am Pult, und im April der Fenton in der sehr gelungenen Neuinszenierung von Verdis »Falstaff«. Die Titelrolle verkörperte mit drastischem Humor Alfred jerger, der Vielbeschäftigte. Wilhelm Loibner, der bislang ein zurückgezogenes Korrepetitorendasein geführt hatte, trat dabei erstmals als Premierendirigent in Erscheinung. Ein denkwürdiges Ereignis begab sich im Rahmen der 6. Reichstheater-Festwoche, die Anfang Juni in Wien stattfand: die Erstaufführung von Richard Strauss’ »Friedenstag« am Vor abend des 75. Geburtstags des Meisters. Ulrich Roller (Sohn des großen Alfred Roller), der bald darauf an der Ostfront fiel, hatte das monumentale Bühnenbild entworfen, der Strauss-Spezialist Rudolf Hartmann führte Regie, Clemens Krauss, damals Chef der 1 3 1
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
Münchner Oper, dirigierte. Viorica Ursuleac, die Gattin des Diri genten, und Hans Hotter verkörperten die Hauptpartien. Mir war die kurze Episode des Piemontesen anvertraut, der ein kleines Lied zu singen hat. Er überbringt dem Kommandanten den Befehl des Kaisers, die Festung unter allen Umständen zu halten. Am dramatischen Höhepunkt —dem Ende des Dreißigjährigen Krieges — kündet plötzlich gewaltiges Glockengeläute den Anbruch des Westfälischen Friedens und bringt damit das ver söhnliche Ende. Die Premiere blieb die einzige Aufführung. Es gab keine Re prise mehr, denn wenige Wochen später rollten bereits die deut schen Panzer über die polnische Grenze. Die Friedensglocken verstummten. In dem Sommer, der zwischen »Friedenstag« und Kriegsbe ginn lag, sah ich Adolf Hitler zum erstenmal. Es war in Salzburg, wo er die Aufführungen des »Don Giovanni« und der »Entfüh rung« besuchte, in denen ich mitwirkte. Von der Bühne aus ließ sich erkennen, daß Hitler mit völlig unbewegter Miene in seiner Loge saß. Immerhin hatte er —oder sein Adjutant —beide Male dafür sorgen lassen, daß jeder von uns Solisten am Schluß der Vorstellung, bei der Verbeugung, einen Riesenlorbeerkranz mit Hakenkreuzschleife bekam, dem ein Billett mit eigenhändiger Widmung des »Führers« eingebunden war. Das gesamte En semble, überwiegend Deutsche und Italiener, grüßte mit ausge strecktem Arm zu Hitlers I-oge hin. Ich war der einzige, der’s nicht tat. Mit beiden Händen hielt ich krampfhaft den Lorbeer kranz fest. Als jugoslawischer Staatsbürger fühlte ich mich weder veranlaßt noch berechtigt, den »Deutschen Gruß« zu leisten. Damit hatte ich keine Demonstration und auch keine Mut probe beabsichtigt. Gleichwohl wurde mein Verhalten in dieser Weise gewertet, und ich war mehr erstaunt als erschrocken, als die Kollegen nachher zu mir in die Garderobe kamen und mit gedämpfter Stimme, teils schmunzelnd, teils kopfschüttelnd, meinten: »Wenn das nur gut ausgeht!« Vor allem der mit mir 1 3 2
vili /
W ENN DAS NUR GUT AUSGEHT
eng befreundete Karl Titze, philharmonischer Streicher und Sekundgeiger des Kamper-Kvarda-Quartetts, warnte mich ein dringlich: »Du giltst ohnedies schon als Nazi-Fresser!« Woher diese Meinung kam und wer sie verbreitet hatte, blieb mir ver borgen. Zum Glück hatte der Vorfall keine üblen Folgen. Im Gegen teil, ich wurde sogar zum anschließenden großen Empfang im Hotel »Österreichischer Hof« eingeladen, wo es von Uniformen nur so wimmelte. Kein Zweifel, Mozarts Geist verflüchtigte sich in dieser Atmosphäre ... ln Salzburg, wo ich außer den beiden Mozart-Partien noch den Sänger im »Rosenkavalier« unter Karl Böhm und den Tenorpart der »Neunten« von Beethoven unter Knappertsbuch gesungen hatte, begann bereits das, was man in Kriegs- und Nachkriegszeit als »Hamstern« bezeichnete. Auch meine Frau und ich wurden von der allgemeinen Kaufwut erfaßt. Wir deckten uns vor allem mit Lebensmitteln ein. Nun kam es uns zustatten, daß ich damals bereits mein erstes Auto erworben hatte, dessen Gepäckraum wir mit unseren Vorräten voll stopften. Die Koffer kamen aufs Dach und oben drauf lagen die Lorbeerkränze mit den Schleifen, was einen Kollegen zu der Feststellung veranlaßte: »Ihr reist ja wie die Zigeuner!« Die Hakenkreuzschleifen hat der Wind verweht, die Kränze haben unsere Küche - und die Küchen vieler Freunde - noch jahrelang mit Lorbeergewürz versorgt, Hitlers Billetts aber hob ich sorgsam auf Ein Exemplar habe ich später meiner Autogra phensammlung einverleibt. Viele Jahre danach gab es zum histo rischen Wiener Treffen Kennedy —Chruschtschow eine Festvor stellung der »Zauberflöte«, in der ich den Tamino sang. Dabei erhielt ich von dem hohen sowjetischen Gast einen großen Blu menstrauß mit eigenhändig signierter Karte. Ich habe auch diese Karte meiner Sammlung eingefügt. So sind Hitler und Chru schtschow bei mir friedlich vereint. Ob sie sich auch ander wärts zusammengefunden haben ...? 1
3
3
DERMOTA / TAUSENDUNDEIN
ABEND
Das zweite Exemplar der Hitler-Billetts hat vermutlich mei nem Vater und meinen beiden Brüdern das Leben gerettet. Und das kam so: 1941 wurde im Zug der kriegerischen Ereignisse auch meine Heimat besetzt und dem Gau Kärnten angeschlossen. Viele meiner Landsleute wurden ausgesiedelt. Auch meine Fami lie mußte befürchten, eines Tages verschleppt zu werden, ln die ser Situation übergab ich die Karte meinem Vater mit der Gebrauchsanweisung: »Wenn Sie je in Schwierigkeiten kommen sollten, zeigen Sie sie vor!« Dieser Fall trat tatsächlich zwei Jahre später ein, als der Parti sanenkrieg in den Wäldern rund um Kropa bereits in vollem Gang war und die deutsche Wehrmacht hart durchgriff, um das Vordringen der Partisanen zu verhindern. Nun war Mariä Himmelfahrt in unserer Heimatgemeinde ein großer Feiertag, der im Morgengrauen mit allen Glocken einge läutet wurde. Mein Vater hatte als Mesner diese Pflicht zu erfül len. Das tat er auch am 15. August 1943, dann legte er sich wieder nieder. Aber er schlief nicht lange. Plötzlich ratterten motorisierte deutsche Einheiten heran, schlugen an die Haustür und holten den Vater und die beiden Brüder aus den Betten. Sie wurden, mit anderen Ortsbewohnern, vor dem Gasthaus zusammengetrieben und zum Abtransport bereitgemacht. Der Kommandant der motorisierten Truppe war überzeugt, daß der Vater mit seinem Glockengeläute um 4 Uhr früh den Partisanen ein Zeichen gege ben habe: »Achtung! Die Deutschen rücken an!« In dieser verzweifelten Lage fiel meiner Schwester das HitlerBillett ein. Sie holte es eilends herbei und zeigte es dem Kom mandanten. Der las erstaunt: »Herrn Anton Dermota - Adolf Hitler«. Die Zauberformel wirkte, der Kommandant salutierte und ließ meine Leute frei. Für diesmal war die Gefahr abgewendet. Aber wenig später kam die böse Überraschung von der anderen Seite. Es begannen nämlich die Partisanen bereits die männliche Jugend der Dörfer systematisch auszuheben und in die Wälder mitzunehmen, um sie 1
3
4
vili /
W ENN DAS NUR GUT AUSGEHT
dort militärisch zu formieren. So holten sie zu nächtlicher Stunde auch meinen Bruder Gasper. Da er weder seelisch noch körper lich dem Partisanenleben gewachsen war, nützte er die erste Gelegenheit, die sich bot, um mit zwei anderen Leidensgenossen aus unserer Ortschaft zu flüchten. Es gab nur eine Mögliciikeit, sich in Sicherheit zu bringen: indem man sich der deutschen Besatzungsmacht stellte. Das taten die drei denn auch und kamen dabei vom Regen in die Traufe. Sie wurden in einem aufgelassenen Frauenkloster interniert, das als Todeslager bekannt war. Dort sammelte die deutsche Wehr macht alle »politisch unzuverlässigen« Personen als Geiseln. Glückte den Partisanen irgendeine Aktion —die Sprengung einer Brücke oder einer Gleisanlage —so wurde aus diesem Reservoir wahllos eine Gruppe Menschen herausgeholt und - als Repressa lie und zur Einschüchterung der Bevölkerung —am Ort des Überfalls erschossen. Anderntags konnte man dann auf öffentli chen Anschlägen die Namen dieser Opfer lesen. So erbarmungs los wurde der Krieg hüben und drüben geführt. Eines Tages rief mich meine Schwester in Wien an und schil derte mir voll Verzweiflung das Schicksal des Bruders. Nun kannte ich den Kärntner Gauleiter Rainer von den Salzburger Festspielen her, aus einer Zeit, da Rainer noch Gauleiter von Salzburg war. Unverzüglich machte ich mich auf und fuhr mit dem nächsten Zug nach Klagenfurt. Es war ein Samstag, als ich dort eintraf und ich dachte noch: Heute wirst du kein Glück haben. Trotzdem eilte ich klopfenden Herzens zur Gauleitung, wo es anders kam, als ich befürchtet hatte. Rainer war im Amt. Ich hatte ihn bisher nur in seiner braunen Uniform gesehen, nun saß er in Zivil, in Kärntner Landestracht, an seinem Schreibtisch und begrüßte mich freundlich. Ich schüttete ihm mein Herz aus. Er beruhigte mich, ließ sich sofort mit dem Sicherheitbeauftragten in Veldes verbinden, der für das besetzte Slowenien zuständig war, und beauftragte ihn, mich noch am gleichen Tag zu empfangen und dafür zu sorgen. 135
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN ABEND
daß mir mein Bruder übergeben werde. Ich hätte mich verpflich tet, so erklärte Rainer am Telephon, den Bruder nach Wien mit zunehmen, wo er als gelernter Maschinenschlosser eingesetzt werden könnte. Und dann ging alles sehr rasch. Ich fuhr nach Veldes, suchte das Hotel auf, in dem die deutschen Behörden amtierten, und mußte einen Revers unterschreiben, daß ich die bevorstehende Autofahrt durch das partisanengefährdete Gebiet auf eigene Gefahr unternehme. Dann wurde ich in ein Dienstauto verfrach tet, rechts und links nahmen Militärpolizisten Platz und dahin ging es in eiliger Fahrt. Wir kamen unbehelligt ans Ziel. Als das schwere Tor zum Kloster aufgestoßen wurde, starrten uns aus zahllosen Fenstern und Luken des Gebäudes Maschinengewehre entgegen. Im Hof wimmelte es von Soldaten und Waffen aller Art —wie in einer belagerten Festung. Der Lagerkommandant, der bereits aus Vel des informiert war, kam uns entgegen. Nun hatte ich die letzte, die schwerste Hürde zu nehmen. Innerlich zitternd bat ich den Kommandanten, mir nicht nur den Bruder, sondern auch dessen Fluchtkameraden herauszugeben. Ich könnte mich —so machte ich ihm klar —nie wieder zu Fiause blicken lassen, würde ich seine zwei Leidensgenossen im Stich lassen. Und da erwies sich, daß ein unerschrockenes Wort am rechten Ort seinen Eindruck nicht verfehlt : tatsächlich gab man mir alle drei heraus. Noch sehe ich den endlosen, schmalen Klosterkorridor vor mir, aus dessen Tiefe uns drei schwankende, bleiche Männer ent gegenkamen. Sie waren ja überzeugt, daß ihre Stunde gekommen sei und sie den letzten Gang antreten mußten. Da erkannte mich mein Bruder. Ein Leuchten ging über sein Gesicht - und dann schüttelte ich die Hände dreier glücklicher, dem I^ben wiedergeschenkter Menschen. Das Militärauto brach te uns noch bis zur nächsten Bahnstation, von der wir den ersten Zug nach Wien nahmen. Schon in der folgenden Woche wurde 136
vili /
W ENN DAS NUR GUT AUSGEHT
mein Bruder der Radiofabrik Ingelen zugeteilt, deren Direktor Ivan Senk mit uns befreundet war. Dort überlebte Gasper die restliche Kriegszeit unter verhältnismäßig günstigen Bedingun gen. Sein Arbeitskamerad an der benachbarten Maschine hieß Anton Benya. Auch die beiden geretteten Landsleute wurden ohne weitere Schwierigkeiten »dem Arbeitsprozeß eingeglie dert«. Die Kriegszeit, die so viele private und politische Schrecknisse brachte, hatte für mich aber auch ihre freundlichen Seiten, vor wiegend im Künstlerischen. Es bedeutete mir viel, als ich im März 1940 zum erstenmal in einem Abonnementkonzert der Wie ner Philharmoniker mitwirken durfte — wenngleich mich die Einladung dazu auf etwas sonderbare Weise erreicht hatte. Ich saß gerade —es war drei Uhr nachmittags —bei einer Kunstauktion im Dorotheum, als im Saal plötzlich mein Name ausgerufen wurde. Ich erhob mich, ging zum Telephon, an dem sich der Vorstand der Wiener Philharmoniker, Professor Wil helm Jerger, meldete und mich bat, unverzüglich in den Musik vereinssaal zu kommen. Wilhelm Furtwängler wünsche meine Mitwirkung bei Beethovens »Neunter« im bevorstehenden Nico lai-Konzert. Ich war über diese spontane Aufforderung nicht wenig über rascht. Dann stellte sich heraus, daß Max Lorenz, der für den Tenorpart verpflichtet worden war, während der Probe plötzlich von Indisposition befallen wurde. Ich eilte also in den Musikve rein, kam tatsächlich mitten in die Probe und übernahm meinen Part. So fand meine erste persönliche Begegnung mit Furtwäng ler statt, der sich über diese Lösung sehr befriedigt zeigte. Die Aufführungen unter dem großen Dirigenten haben mir für alle Zeiten das Ideal einer authentischen Wiedergabe von Beethovens »Neunter« vermittelt. Unter keinem anderen Diri genten habe ich die »Neunte« so oft, aber auch so tief, so aus drucksvoll, so beethovennahe erlebt wie unter Furtwängler. 1
3
7
DERMOTA / TAUSENDUNDEIN
ABEND
Dreizehn Jahre später, im Jänner 1953, war ich dann - wieder in einem Nicolai-Konzert, wieder bei Beethovens »Neunter« ~ Zeuge, als Furtwängler mitten in der Aufführung zusammen brach. Er war wie immer ein wenig zu spät gekommen. Das SoloQuartett wartete bereits im Künstlerzimmer auf ihn. Rasch machte er - wie gewohnt —am Klavier eine kurze Verständi gungsprobe mit uns, wobei er nur die Schlußkadenz vornahm. Er schien uns nervöser als sonst. Nach dem Scherzo betraten wir Solisten unauffällig die Orgelempore, nahmen Platz und hörten andächtig das Adagio an. Hörten mit leisem Erschrecken, wie das Tempo langsamer und langsamer wurde, und merkten, wie die Musiker pultweise zu spielen aufhörten —wir sahen ja über die Brüstung hinweg bloß die Zuhörer. Dann wurden Stimmen laut, ich sprang auf und sah gerade noch, wie die beiden Konzertmei ster den zusammenbrechenden Dirigenten auffingen und so sei nen Sturz vom Podium verhinderten. Schreckensrufe und große Verwirrung. Furtwängler wurde, von zwei Philharmonikern gestützt, ins Künstlerzimmer geleitet, das Orchester verließ das Podium, das Publikum wurde um Geduld gebeten. Furtwängler wurde auf ein Sofa gebettet und erholte sich all mählich. Als er die Augen aufschlug, murmelte er: »Was ist geschehen ? Wir müssen weitermachen ...« Aber Vorstand Jerger wußte das zu verhindern. Ein Arzt eilte herbei, das Publikum wurde entlassen. Vier Monate später —am 30./31. Mai 1953 —hat man das unterbrochene Konzert nachgeholt. Furtwängler schien wieder der alte. Aber es schien nur so. Schon im Jahr darauf legte er für immer den Stab aus der Hand. Meine Verbundenheit mit den Wiener Philharmonikern blieb viele Jahre bestehen. Ich konnte mit diesem wundervollen Klang körper wiederholt im Konzertsaal auftreten, bis mir eines Tages - es war im September i960 - für diese meine Tätigkeit die Nico lai-Medaille des Orchesters verliehen wurde, die mir besonders teuer ist, denn sie wurde nur wenigen Sängern zuteil.
IX
Wen die Götter lieben Von Strohm ^ Böhm
—D ie
Geburt eines Wiener M akartstils
Im September 1940 bekam die Staatsoper einen neuen Direktor, oder - wie es damals hieß —Generalintendanten : Karl Heinrich Strohm. Man hatte ihn mit großen Vorschußlorbeeren aus Ham burg hergeholt, wo er sich als Schöpfer eines hauseigenen, reprä sentativen Opernstils verdient gemacht hatte. In Wien wurde er mit einer Festfanfare von Richard Strauss und mit dem persönli chen Segen des Reichsstatthalters Baldur von Schirach in sein Amt eingeführt. Fünf Monate später war der ganze Zauber vorbei, Strohm ver schwand fast über Nacht spur- und geräuschlos in der Versen kung. »Der Strohm war nur ein Rinnsal«, munkelten die bösen Zungen. In Wien war er jedenfalls glücklos. Ob ihm die neue, großarti ge Position zu Kopf gestiegen war ? Ich habe Strohm aus unseren wenigen Begegnungen als einen ruhigen, gesetzten, ja fast scheu en Mann in Erinnerung, aber dieses Erscheinungsbild täuschte offenbar. Die Art wie er das ehrwürdige Haus am Ring innerlich und äußerlich ummodeln wollte, beweist das Gegenteil. Dafür ein kurioses Beispiel: Die kleine Wendeltreppe zur Direktion, die alle seine Vorgänger benützt hatten, genügte ihm nicht, weshalb er ein eigenes Tor in der Kärntnerstraße aufmachen ließ, von dem er über die breite Erzherzogs-Stiege in seine Räume gelangen konnte. 1
3
9
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
Diverse Anzeichen von Größenwahn steigerten sich rasch zu einer geistigen Krise, die im Februar 1941 zu seiner Einlieferung in eine Nervenklinik führte. Strohm ist dann auch in geistiger Umnachtung gestorben. Noch einmal, viel später, begegnete mir sein Name im Katalog eines Autographen-Auktionshauses. Da wurde aus irgendeinem Nachlaß ein Teil seiner Korrespondenz mit Theaterleuten angeboten. Nach Strohms Abgang trat an seine Stelle - provisorisch Ernst August Schneider, der mit Strohm nach Wien gekommen war. Aber aus diesem Provisorium wurde —wie so häufig in Wien —ein solider Dauerzustand. »Ernst August«, der Verständ nisvolle, Hilfsbereite, Humorgesegnete und Liebenswerte, blieb bis zu seinem Tod im Jahre 1976, zuletzt als Leiter des Künstleri schen Betriebsbüros, der gute Geist und die graue Eminenz der Staatsoper. Mit ihm blieben zunächst auch Knappertsbusch als musikalischer Chef und Kerber —der eigentlich durch Schneider hätte verdrängt werden sollen - als Co-Direktor dem Haus erhal ten. Um diese Zeit war Kerber einmal bei uns zu Gast. Wir schwärmten damals schon für Barockmöbel und hatten einen schönen Mariatheresien-Schrank erworben, der wegen seiner Ausmaße nur in der Diele Platz fand. Kerber betrat unsere Wohnung, sah den Schrank und rief aus: »Na servus, was die andern im Salon haben, hast du schon im Vorzimmer!« Im Gespräch entwickelte er dann einen fast seherischen Pessi mismus. Er war schon damals vom Zusammenbruch des Dritten Reiches felsenfest überzeugt und schilderte, wie er sich über die schlimmste Zeit nach dem verlorenen Krieg hinwegzuretten gedachte : »Ich werd’ mich mit einem kleinen Freßpackerl auf dem Schnürboden der Staatsoper einquartieren. Dort werden mich die Russen bestimmt nicht suchen.« Das war in vollem Ernst gemeint, doch es kam nicht dazu. 1 4 0
IX /
W EN DIE GÖTTER LIEBEN
Kerber verließ im März 1942 die Staatsoper. Bei seiner Verab schiedung, zu der sich das ganze Ensemble auf der Bühne einge funden hatte, hielt er eine kurze Dankesrede. Wir kamen uns vor wie bei einem Begräbnis. Kerber ging zurück nach Salzburg, woher er stammte. Aber sein Lebenswille war dahin. Elf Monate leitete er noch das Lan destheater, dann starb er —an gebrochenem Herzen, wie ich überzeugt bin. Während dieser Salzburger Monate hat mein Bru der Ixopold - der zweite lyrische Tenor mit dem Namen Dermota —unter Kerbers Obhut die ersten Bühnenschritte getan; eine seltsame Parallele zu meinem Beginn. Im Herbst 1942 hatte Lothar Müthel, seit Mai 1939 Burgthea terdirektor, als Generalintendant automatisch auch die Leitung der Staatsoper übernommen. De facto hat er kaum in die Agen den Ernst August Schneiders eingegriffen, er wurde auch weder feierlich in sein Amt eingeführt, noch dem Ensemble offiziell vorgestellt. Als ich eines Tages in der Direktionskanzlei einen breitschultrigen Mann im schwarzen Mantel und mit großem schwarzen Hut bemerkte, erkundigte ich mich, wer das denn sei, und erfuhr; »Unser Intendant, Lothar Müthel.« Soviel ich mich erinnere, ist Müthel nur ein einziges Mal in der Staatsoper nachdrücklich in Erscheinung getreten: als Regisseur einer Neuinszenierung von Beethovens »Fidelio«, einer niveauund eindrucksvollen Aufführung, bei der Furtwängler am Pult stand. Wenn er dirigierte, dann herrschte im Haus jene innere Spannung und Hochstimmung, die einen Opernabend für Mit wirkende und Zuschauer zum Erlebnis macht. Als eine Premiere von ähnlicher Leuchtkraft habe ich die Neu inszenierung der »Zauberflöte« durch Gustaf Gründgens in Erinnerung, bei der ich unter Knappertsbusch, alternierend mit Roswaenge, den Tamino sang. Unter allen »Zauberflöten«, die ich aktiv miterlebte, war diese die duftigste und irrealste, ein ech tes Zaubermärchen für Erwachsene. 141
DERMOTA /
TAU SENDUNDEIN
ABEND
Gründgens brachte allerlei reizvolle Neuheiten ins Spiel. So wurde die Flöte erstmals nicht geblasen, sondern bloß durch die Luft geschwungen und tönte dann von selbst, wie es sich für eine richtige Zauberflöte gehört. Oder: Tamino stürzte zu Beginn nicht wie üblich in wilder Flucht vor der bösen Schlange auf die Bühne, sondern zog sich, von dem Untier völlig hypnotisiert, schreckerstarrt, mit abwehrender Gebärde und schrittweise zurück. Pamina schlief in einem richtigen Märchenbett, zu Häupten und Füikn von zwei weißen Elefanten flankiert. Schon diese wenigen Beispiele beweisen Gründgens’ Wissen um die Gesetze, aber auch um die Geheimnisse des Theaters. Seine Art, mit wenig Aufwand seine Vorstellungen zu verwirklichen —es gab bei ihm kein lautes Wort - übertrug sich wohltuend und befruchtend auf alle Mitwirkenden. Diese »Zauberflöte« bildete dann auch den Glanzpunkt einer »Mozartwoche des Deutschen Reiches«, die trotz fortvSchreitender Verdüsterung durch den Krieg Ende November/Anfang Dezember 1941 in Wien festlich begangen wurde. Anlaß war Mozarts 150. Todestag. Es gab eine neuinszenierte »Entführung« unter Böhm, einen »Idomeneo«, den der greise Richard Strauss neu bearbeitet hatte und auch dirigierte, sowie eine »Cosi«, die Clemens Krauss komplett aus München brachte und deren Beset zung eine Neuentdeckung für Wien aufwies: eine zauberhafte Despina. Es war Hilde Güden, die nach 1945 zu einer der rei zendsten, damenhaftesten, wienerischesten Stützen des Staats opernensembles wurde. Wie sehr die Staatsoper damals, trotz aller kriegsbedingten Einschränkungen, aus dem Vollen schöpfte, ergibt sich aus der Tatsache, daß alle Premieren in durchaus gleichwertiger Doppel besetzung stattfanden, das heißt: es gab eigentlich zwei Premie ren hintereinander. Nur in der Partie des Octavio im »Don Juan« war ich allein besetzt; ich sang ihn in beiden Premieren der Mozartwoche unter Knappertsbusch. Meine Partnerinnen des ersten Abends waren die Schwestern 142
IX /
W EN DIE GÖTTER LIEBEN
Anny und Hilde Konetzni. Wenn ich im Terzett zwischen den beiden Damen, Donna Anna und Donna Elvira, stand, deren Stattlichkeit noch durch riesige Krinolinen unterstrichen wurde, dann war ich wirklich nur ein Schatten, wie es dem Charakter des Octavio entspricht. Ich konnte damals, als das Leben immer schwieriger und här ter wurde, wahrhaftig nicht über Unterbeschäftigung klagen. An manchen Tagen war ich fast pausenlos tätig. Vormittags Probe bis 13 Uhr, nachmittags Mitwirkung bei einem Konzert oder einer Rundfunkaufnahme, abends »Boheme«, »Zauberflöte« oder »Don Juan« am Ring. Man war ausgelastet und schonte sich nicht. Immer häufiger kam es auch —meist am Wochenende —zu Mitwirkungen bei den KdF-(»Kraft durch Freude« )-Konzerten, Berufungen, denen man sich kaum entziehen konnte. Die Pro gramme, die in der Regel durch den Äther gingen, hatten stets zwei Teile. Im ersten gab es Arien, Duette und Ensembles aus Opern, im zweiten Operette. So wurde ich auch mit der leichteren Muse vertraut und trat nach und nach in die Fußstapfen Richard Taubers, dessen berühmte Schlager nun mir zufielen: »Dein ist mein ganzes Herz«, »Schön ist die Welt«, »Freunde, das Leben ist lebens wert.« Von Lehars Operette »Schön ist die Welt«, bei deren Rund funkaufnahme unter Leitung des Komponisten ich mitwirkte, besitze ich einen Klavierauszug mit den Zeilen: »Meinem lieben Freund Anton Dermota, dem hervorragenden Operntenor, al1erherzlichst gewidmet —Franz Lehar, Wien, lo. i. 1942.« Lehar stand wiederholt persönlich am Pult. Das »Dritte Reich« konnte auf ihn und seine Musik —trotz seiner jüdischen Frau —nicht verzichten. Ich erinnere mich einer gemeinsamen Rundfunkaufnahme zu der Zeit, als in Wien bereits Bomben fie len. Lehar besaß noch seinen Mercedes und machte sich erbötig. 1
4
3
DERxMOTA / T A U S E N D U N D E I N
ABEND
mich nach Hause zu bringen. Trotz all seiner Privilegien war ihm nicht wohl in seiner Haut, und er sagte, seinen Sou Chong wört lich zitierend, beim Abschied zu mir: »Doch wie’s da drinn’ aus sieht, geht niemand was an ... « Im Rahmen der KdF-Konzerte waren wir, obwohl das Reisen immer schwieriger wurde, viel unterwegs, meist mit buntge mischten Programmen. Je kleiner der Ort, desto bunter die Mischung. Mitunter mußten wir in primitiven, eiskalten Sälen auftreten - im Wintermantel. Doch das Publikum war uns unendlich dankbar. Wir spürten, wie glücklich die Menschen waren, für kurze Stunden dem trostlosen Alltag entfliehen zu können. Manchmal kehrte ich doppelt beschenkt heim, beschenkt nicht nur mit Beifall, sondern mit allerlei Nahrhaftem. Solche Gaben wogen bereits mehr als der frenetischeste Applaus. Es gab gewisse Gegenden, die uns besonders lockten, so etwa das nahe Preßburg, wo im Vergleich zu Wien noch Milch und Honig floß. Hatte man einen proben- und aufführungsfreien Tag in Wien, so gastierte man in Preßburg, in das man am Vormittag fuhr und das man am nächsten Morgen mit dem Frühzug so wie der verließ, daß man rechtzeitig zur Probe in Wien war. Auf die se Art habe ich in Preßburg meine erste goldene Uhr ersungen. Bukarest zählte gleichfalls zu den gesegneten Orten. Die Staatsoper bot dort komplette Gastspiele mit »Don Juan« und »Cosi fan tutte«, zu denen wir mit Sonderzügen gebracht wur den. An den freien Tagen zwischen den Vorstellungen stürmte das Ensemble die Bukarester Geschäfte, in denen es noch bei uns längst unerreichbare Köstlichkeiten zu kaufen gab: Würste, Geflügel, Kaffee, Cognac und so weiter. In Wien feierte man die Feste, wie sie fielen. Besonders gerne denke ich an die feuchtfröhliche Künstlerrunde bei Professor Franz Mairecker, dem künstlerisch wie menschlich prächtigen Konzertmeister unseres Orchesters. Mairecker besaß ein Weingut in Gumpoldskirchen, auf das er uns öfter einlud. Außer meiner Frau und mir fanden sich meist die Kollegen Gallos und Duhan 144
1 7
A l s H e rzo g in » G ig o le tte « m it G eorg O eggl in d e r T ite lp a r tie
» S W lÄ isipi ^ H ïll
1 8 / i 9
Z w e im a l g ro ß e s K o n z e r i : oben Beethovens N e u n te in B a y reu th u n ter H in d em ith
u n d m it B ir g it N ilsson , I r a M a la n iu k u n d L u d w ig W e b e r; rechts W ie la n d W agner. U n ten M o z a r ts R equ iem , B ru n o W a lte r s le tzte s S a lzb u rg er K o n zert. Zw ischen D e rm o ta u n d B ru n o W a lte r L is a della C a sa , rechts I r a M a la n iu k u n d C esa re S iep i 2 0
A l s D o n O ctavio in » D o n G io va n n i« u n ter F u rtw ä n g ler bei den S a lzb u rg er F e st
spielen
1 9 5 5
2 1 / 2 2
P a rtie n
In zn^ei H a u p tdes
slawischen
F aches: oben a ls F e n s k i in » E u g e n O n egin « u n d unten in d e r T ite lp a r tie des » D a lib o r «
IX /
W EN DIE GÖTTER
LIEBEN
ein sowie ein paar Herren aus der Staatstheaterverwaltung. Neben dem herrlichen Tropfen, den es im tiefen Keller zu verko sten gab, genoß ich den Anblick der jahrhundertealten, wunder voll geschnitzten Weinfässer, die mich stark beeindruckten. In der Staatsoper hatten wir uns darauf eingerichtet, mit dem Krieg zu leben. Längst gab es »Geschlossene Vorstellungen für die Wehrmacht«, längst gab es auf den Programmzetteln Anwei sungen für das Publikum über das Verhalten bei Fliegeralarm und »Beim Erscheinen unserer verwundeten Frontsoldaten in der Mittelloge«. Im strengen Winter 1942/43 gab es gelegentlich Ausfälle wegen Kohlenmangels, und als am 3. Februar 1943 Sta lingrad fiel, wurde die »Salome«-Vorsteilung, bei der ich unter Knappertsbusch den Narraboth hätte singen sollen, abgesagt, und das Haus blieb zum 2^ichen der Trauer drei Tage geschlossen. Im übrigen hatte ich persönlich nie das Gefühl, daß der Opernbetrieb durch den Krieg ernsthaft gestört wurde. Gab es bei den Vormittagsproben Luftalarm, und das kam immer häufi ger vor -, die feindlichen Bomber flogen meist gegen elf Uhr in den Wiener Raum ein —war dafür gesorgt, daß man von der Bühne oder aus dem Probenraum auf kürzestem Weg in die Luftschutzräume des Hauses gelangte, die tief unter der Erde lagen. Nach der Entwarnung, kehrte alles geschlossen zur Probe zurück, und die Arbeit ging weiter, als wäre nichts geschehen. Im Jänner 1943 übergab Müthel die Leitung der Staatsoper fei erlich an Karl Böhm, mit dem - nach Jahren - wieder ein Diri gent an die Spitze des Hauses trat. Als bedeutender Mozart-Inter pret und persönlicher Freund von Richard Strauss brachte Böhm von vornherein eine klare Linie mit. Während der Krieg seinem katastrophalen Ende zusteuerte, legte Böhm - gemeinsam mit dem Regisseur Oscar Fritz Schuh und dem Bühnenbildner Caspar Neher - den Grundstock für den später weltberühmten Wiener Mozartstil und beging in der Staatsoper glanzvolle Richard-Strauss-Feste. Die zielbewußte 1
4
5
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
Mozartpflege fand ihren Höhepunkt in jener »Cosi-fan-tutte«Inszenierung des Dreigestirns Böhm-Schuh-Neher im Wiener Redoutensaal, die, aus der Not geboren, mit einem Minimum an szenischem Aufwand —zwei Tischchen, zwei Bänken und vier Stühlen aus weißem, verspieltem Eisengeflecht —Jahrzehnte überdauert hat und in ganz Europa zum Inbegriff des neuen Wiener Mozartstils geworden ist. Es standen zugleich zwar die anderen Mozart-Opern im Repertoire, aber nur jene »Cosi«, die fast nichts an optischen Reizen zu bieten hatte, sondern ganz auf das gesungene Wort, auf das Zusammenspiel der Sänger und damit das Menschliche abgestellt war, blieb bestehen und als künstlerische Tat von historischem Zuschnitt in Erinnerung. Das Wunder dieser Aufführung lag nicht nur in ihrer Abstraktion, sondern auch in ihrer theatralischen Symmetrie —das Spiel der Personen, ein wenig vom Geist der Marionetten gesegnet, war fast wie mit dem Zirkel abgemessen - und nicht zuletzt in der Harmonie der Stimmen. Irmgard Seefried, Martha Rohs, Aida Noni, Anton Dermota, Erich Kunz und Paul Schöffler —so lautete die ursprüngliche Besetzung, und diese sechs Sänger bildeten auch den eigentlichen Kern des legendären Mozart-Ensembles. Ich empfinde es heute noch als ein Glück, daß ich mit dabei sein durfte. Diese Inszenierung hat sich aus der dürftigen Zeit des Krieges hinübergerettet in die noch dürftigere Nachkriegszeit, feierte Tri umphe in aller Welt - nicht zuletzt bei den Salzburger Festspie len ~ und bewahrte ihre Faszination noch in den Tagen des Wohlstands. Dabei ist bemerkenswert, daß die Herren der Beset zung standhaft blieben, während die wankelmütigen Damen mehr oder weniger rasch wechselten : auf Irmgard Seefried folg ten Elisabeth Schwarzkopf und Lisa della Casa, auf Martha Rohs der Reihe nach Elisabeth Höngen, Dagmar Hermann, Sena jurinac und schließlich Christa Ludwig, und als Despina folgten der Noni, die zurück nach Italien ging, Hilde Güden und Emmy Ix)ose. 146
IX /
WEN DIE GÖTTER LIEBEN
Erst als neue, jüngere Regisseure nachrückten und die »Cosi« im Haupthaus wieder aufwendiger in Szene setzten, war es mit der Modell-Aufführung von 1943 vorüber. Bei der JubilaumsAusstellung »100 Jahre Wiener Oper am Ring« im Redoutensaal, 1969, wurden ihre gesamten Requisiten den Opernfreunden noch einmal vor Augen geführt - nun schon Museumsstücke. Doch kehren wir zurück zur ersten Direktion Böhm. Im Gegensatz zu Knappertsbusch, der Proben nicht sehr liebte (wes halb ihn die Philharmoniker sehr liebten), begann Böhm sofort fleißig, präzise, solide und diszipliniert mit uns zu arbeiten, wobei er sein leicht cholerisches Temperament nicht verleugnete. Böhm konnte sehr herzlich sein, aber er konnte auch plötzlich ins Gegenteil Umschlägen. Dabei kamen oft die Unrichtigen zum Handkuß. Auch ich mußte gelegentlich als Blitzableiter herhalten. Aber ich habe es ihm nie nachgetragen, denn war sein Groll ver raucht, dann war die Angelegenheit für ihn erledigt und das gute Einvernehmen wieder hergestellt. Als Intimus von Richard Strauss, von dem er bei seinem Amtsantritt ausdrücklich als »lieber Freund« begrüßt worden war, brachte Böhm die authentischen Tempi des Meisters und dessen verbürgte Interpretation mit. Seine Intensivierung der Strauss-Pflege am Ring gipfelte in einer festlichen Woche zu Ehren des 80jährigen Komponisten, der seinen Geburtstag diri gierend in der Staatsoper beging. Die Festwoche umfaßte fast das gesamte Opernwerk des Mei sters, einschließlich der »Couperin-Suite« und der »Josefslegen de« sowie des »Capriccio«, das erst drei Monate zuvor seine Wiener Erstaufführung erlebt hatte. Böhm dirigierte, Georg Hartmann führte Regie, so daß eine prachtvolle Aufführung im Sinne des Komponisten und des Textdichters Clemens Krauss zustande kam. Im Gegensatz zur »Cosi«, war »Capriccio« ver blüffend verschwenderisch ausgestattet. Für den Salon der Gräfin hatte Robert Kautsky nicht an Architektur und Mobiliar gespart, die Kostüme waren aus kostbarem Brokat geschneidert. Ich weiß 1
4
7
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
noch, wie schwer ich als Flamand an meinem Prachtkleid trug. Vermutlich hatte man französische Möbelstoffe -- Kriegsbeute aus Paris —verarbeitet. Mit meinen Partnern Martha Rohs (Clai ron), Erich Kunz (Olivier) und Paul Schöffler (La Roche) bilde ten wir ein organisch gewachsenes Ensemble, das durch Alfred Jerger (Graf), Peter Klein (Monsieur Taupe) und die unvergeßli che Maria Cebotari (Gräfin) ideal ergänzt wurde. An die Cebotari kann ich nur mit tiefer Rührung denken als an eine jener lichtvollen, mozartnahen Erscheinungen, die früh entschwinden. Wen die Götter lieben ... Mit keiner Partnerin bin ich so oft auf der Bühne gestanden wie mit ihr, und immer waren wir dort oben ein Liebespaar: in der »Entführung«, in der »Zauberflöte«, im »Don Giovanni«, in der »Traviata«, im »Rigoletto«, im »Falstaff«, in der »Boheme«, der »Butterfly«, der »Salome« und in »Capriccio«. Zwei Begegnungen mit ihr, jenseits der Bühne, haben sich mir tief eingeprägt. Es war 1946. Wir sollten beide von Graz, wo wir bei den dortigen Festwochen tätig waren, nach Salzburg zu den ersten richtigen Festspielen nach dem Krieg: sie als »Figaro«Gräfin und Zeriine, ich als Don Octavio. Um die von den Russen kontrollierte Enns-Brücke zu vermeiden, brachte uns ein engli sches Militärauto auf abenteuerlichen Um- und Seitenwegen in die amerikanische Zone. Der kaum gefederte Kübel rüttelte und schüttelte uns förmlich die Seele aus dem Leib. Maria Cebotari war in Erwartung ihres ersten Kindes, und ich hatte Angst, daß ihr etwas zustoßen könnte. Sie aber saß da, still und geduldig wie ein Engel, und hatte wohl auch einen Schutzengel über sich, denn sie kam unversehrt in Salzburg an und sang ihre Gräfin so himmlisch wie eh und je. Und dann stand ich - nur drei Jahre später - an ihrem Sterbe bett. Als ich die Todkranke sah, erschrak ich zutiefst und sank unwillkürlich vor ihrem Bett in die Knie. Das also war sie, meine Traviata, die ich so oft auf der Bühne als Sterbende in den Armen gehalten hatte. Ich war erschüttert und hörte kaum die 148
IX /
W EN DIE GÖTTER
LIEBEN
tröstlichen Worte, die Direktor Salmhofer zu ihr sagte, während er die schmale, blasse Hand der Kranken streichelte : »Na, da hast du deinen Alfred! Jetzt werdet ihr bald wieder miteinander auf der Bühne stehen!« Dabei wußte Salmhofer genau wie ich —,daß die Cebotari nur noch wenige Tage zu leben hatte.
Nur Ruhe, meine Herrschaften Kequiem vor dem E.isemen — Beethoven in Krakau — D ie Oper brennt
Am 25. Mai 1944 beging Böhm mit »Fidelio« den 75. Geburtstag des Hauses am Ring. Raoul Aslan sprach einen Prolog in anti kem Versmaß, von Josef Weinheber verfaßt. An den Dichter erinnern mich zwei Begegnungen. Die eine fand in Salzburg mit ten im Krieg zur Festspielzeit statt. Im Anschluß an eine Opernpremiere gab es wieder einmal einen Empfang im »Öster reichischen Hof«, zu dem auch ich geladen war. Uniformierte in braun und schwarz beherrschten das Bild. Als ich das Hotel betrat, saß da im Vorraum in einer Ecke ein Mann im Steireran zug mit mächtigem Haupt und gedrungenem Körper, ein Glas Wein vor sich, in tiefe Gedanken versunken und völlig unbe rührt von dem Prominententrubel ringsum. Mein Begleiter, eine mir unbekannte Parteigröße, wies mit dem Kopf zu dem sonder baren Gast und sagte leise : »Kennen Sie ihn ? .. .Josef Weinheber ... Der größte deutsche Dichter seit Hölderlin ... Leider dem Alkokol verfallen ...« Das zweite Mal begegnete ich Josef Weinheber in Wien bei einer Rilke-Feier im Festsaal des Industriehauses. Ich sang, wie immer begleitet von meiner Frau, Lieder nach Versen des Dich ters. Rilkes Schwester war anwesend und übergab mir ein selte nes Foto ihres Bruders, auf das sie ein paar Dankesworte geschrieben hatte. Neben ihr in der ersten Reihe saß Weinheber und hörte meinem Vortrag völlig gesammelt zu. Am Schluß 1 5 1
DERMOTA / TAUSENDUNDEIN ABEND
erhob er sich, trat zu mir, ergriff meine Hand und sagte schlicht : »Auch ich danke Ihnen!« Das war viele Jahre später der Anlaß für mich, Weinheber in meine Autographensammlung aufzunehmen. Ich erwarb vier Gedichte aus seiner Feder und dazu einen seiner letzten Briefe, den er kurz vor seinem Freitod geschrieben hatte. Die letzte reguläre Vorstellung im alten Haus am Ring wurde von Knappertsbusch dirigiert. Mit der »Götterdämmerung« endete die Saison 1943/44 geradezu symbolisch. Auf höhere Wei sung blieben ab September sämtliche Theater geschlossen. Der »totale Krieg« wurde angeordnet. Trotzdem war das für uns noch nicht das Ende, denn die vier bedeutendsten Opernhäuser — München, Dresden, Berlin und Wien - erhielten die Erlaubnis, konzertant weiterzuarbeiten. Die Veranstaltungen unter Böhm fanden entweder vor dem Eisernen Vorhang oder bei offener, schwarzverhängter Bühne statt, meist am Samstag und Sonntag, so daß jedes Programm zweimal gegeben wurde. Auf diese Art erklangen im Haus am Ring Beethovens »Neunte« und seine »Missa solemnis«, das Mozart- und das Verdi-Requiem sowie gemischte Programme mit Liedern und Arien. Ein Teil der Philharmoniker und der Solisten war dafür von Berlin aus freigestellt. Irmgard Seefried, Elisabeth Höngen, Erich Kunz, Paul Schöffler und ich gehörten zu diesen Bevorzugten; die übrigen Kollegen wurden für die Rüstung dienstverpflichtet oder zum Volkssturm eingezogen. Wir hatten freilich nicht nur der Wiener Staatsoper zur Verfü gung zu stehen, sondern auch sonst an Orten, wo man uns ver langte. So wurde ich eines Tages nach Krakau befohlen, um bei einer Aufführung der »Neunten« durch die Krakauer Philharmo nie mitzuwirken. Nun war Krakau fast schon Kriegsgebiet und nur noch mit Militärzügen erreichbar. Wie ich hinkam, war mei ner Findigkeit und Ausdauer überlassen. Gelang es mir nicht, galt ich als Saboteur. Glücklicherweise erreichte ich mein Ziel, aller dings unter argen Strapazen. Der polnische Chor sang das Lied 1 5 2
X /
NUR RUHE, M EINE H ERRSCHAFTEN
an die Freude in deutscher Sprache —man kann sich denken, mit welchen Gefühlen - und Hans Swarowsky, der über Vermittlung von Clemens Krauss Chef der Krakauer Philharmonie geworden war, dirigierte. Nach der Aufführung gab es für uns Künstler einen Empfang auf der Burg Wawel, dem mit unschätzbaren Kunstwerken aus gestatteten ehemaligen Sitz der polnischen Könige. Die Stim mung war gedrückt, die Atmosphäre unheilschwanger. Es wurde nicht über Musik, nur über die militärisch-politische Lage gespro chen. Kein Wunder, denn in der Ferne grollte bereits der Donner der russischen Geschütze. Von diesem düsteren Festabend ist mir ein Bild unvergeßlich geblieben. Wir saßen nach dem Abendessen in einem Erker, und auf dem Sockel vor den Fenstern standen die zwölf Apostel, eine wundervolle kleine Schnitzgruppe, qualitativ auf der Höhe eines Veit Stoß und seines berühmten Krakauer Altars. Ob die Zwölf das Inferno des Krieges überstanden haben, weiß ich nicht, aber in meiner Flrinnerung leben sie fort als der Inbegriff des Voll kommenen in einer stürzenden Welt. In Wien häuften sich die Angriffe feindlicher Bomber. Unsere Wohnung war nur wenige hundert Meter vom Burgtheater ent fernt, dessen Luftschutzräume ich mit meiner Familie benützen durfte. Ich sehe noch Ewald Baiser vor mir und Erhard Busch beck, die »graue Eminenz« des Burgtheaters, wie sie mit Helm, Feuerpatsche und Sandkübel ihren Luftschutzdienst versahen. In einer Ecke saß Raoul Aslan und unterhielt sich freundlich gedämpft mit ein paar anwesenden Kindern oder las still für sich in einem Gebetbuch. Als das Burgtheater im April 1945, knapp vor Kriegsende, von einer Bombenkette getroffen wurde, befand ich mich mit meiner Frau und unseren beiden kleinen Kindern im Keller des Hauses. Es war, als ob der Bau völlig über uns zusammenstürzte. Das Licht erlosch, und durch die Luftschächte drangen derart dichte H3
DERMOTA /
TAU SENDUNDEIN
ABEND
Staubwolken, daß wir kaum atmen konnten. Die Kinder began nen zu weinen. Die Notbeleuchtung flammte auf. Da stand plötzlich Raoul Aslan mitten unter uns und rief mit seiner sanften und doch so klangvollen Stimme: »Nur Ruhe, mei ne Herrschaften, nur Ruhe!« Selbst mitten in Chaos und Todes gefahr hatte er nichts von seiner Gelassenheit und seiner Würde verloren. Genau einen Monat zuvor —am 15. März 1945 - hatte sich das Schicksal der Staatsoper erfüllt. Am Vormittag hatte ich noch eine Probe mit Klavier zu Flotows »Martha«, die für eine Vorstellung im Redoutensaal vorge sehen war, danach erreichte ich meine Wohnung gerade in dem Augenblick, als die Sirenen zu heulen begannen. Die nächste Stunde verbrachte ich mit meiner Familie im Luftschutzkeller des Burgtheaters. Als wir nach der Entwarnung wieder nach Hause kamen, sahen wir aus unseren Fenstern im dritten Stock schwar ze Rauchwolken über der Inneren Stadt. Ich riß ein Fenster auf und hörte zu uns herauf den Schrei : »Die Oper brennt!« Schnell entschlossen eilte ich den Ring entlang zur Oper. Schon von ferne sah ich, wie dicker Qualm zum Himmel stieg. Ich rannte hinüber in die Kärntnerstraße. Die riesigen Betonbe hälter für Löschwasser waren leer. Beim Bühneneingang fand ich außer Erich Majkut keine bekannte Seele, nur fremde, verstörte Menschen, die ratlos durcheinanderliefen. »Rettet das Notenarchiv!« hörte ich einen Ruf Wir hasteten ins Archiv, das im ersten Stock auf der Höhe der Direktionsräu me lag, ergriffen die Notenbündel und warfen sie sowie alles, was wir nur erreichen konnten, durch die Fenster auf die Kärntner straße. Im Salon neben der Direktion hingen kostbare Gemälde in schweren Rahmen. Wir hoben sie von den Wänden, schleppten sie hinunter und deponierten sie gegenüber der Oper, im soge nannten »Deutschen Eck«. Dort hat sie vermutlich ein »Kunst 1 5 4
NUR RUHE, M EINE HERRSCHAFTEN
sinniger« für sich gerettet. Sie sind seither jedenfalls spurlos ver schwunden. Was ich sonst noch aus dem Haus trug, weiß ich nicht. Ganz zuletzt stand ich auf der Höhe der dritten Galerie und riß eine Logentür auf. Vor mir lag die Hölle! Bühnen- und Zuschauer raum waren ein einziges Flammenmeer, in dem sich nichts mehr unterscheiden ließ. Diesen Blick ins Inferno werde ich niemals vergessen. Als ich endlich nach Stunden die brennende Oper verließ, wankte ich völlig verstört nach Hause. Den Rest der Nacht ver brachte ich am Fenster, mit dem Blick zur brennenden Oper. Das also war das Ende.
XI
Waren wir nicht großartig? D ie Stunde N u ll — W ir spielen wieder Oper —Meine Mo:renz, der den Florestan hätte singen sollen, vom Attersee, wo er sich aufhielt, nicht eingetroffen war, weshalb man die Par tie Willi Franter übertrug, der bisher nur für kleine Partien enga giert war. Franter besaß keine sehr glückliche Figur für den Flo restan; er war klein und untersetzt und trotz der Hungerzeit recht rundlich und hatte zwar eine laute aber nicht sehr edle Stimme. Er zog sich jedoch sehr gut aus der Affäre und sang die i66
XI /
W A R E N WIR N IC H T G R O S S A R T IG
Partie auch noch in der zweiten Aufführung. Nachher konnte er sich in Wien nicht recht durchsetzen und ging in die deutsche Provinz. Zur dritten Vorstellung war bereits Max Lorenz einge troffen. Er kam wohlgenährt aus dem »Schlaraffenland«, wie wir armen Wiener Hungerleider nicht ganz ohne Neid feststellten. In diesen Tagen erreichte die Hungersnot in Wien ihren Höhepunkt. Oft genug kam man mit leerem Magen zur Vorstel lung, und ich frage mich heute noch, woher wir die Kraft zum Singen und Spielen nahmen. Salmhofer organisierte im unzerstört gebliebenen Stiegenhaus der Staatsoper am Ring eine Art Mittags-Eäntopf. Jeder von uns brachte sein Gefäß mit und erhielt ein paar Schöpfer voll »Drahtverhau«, wie wir das Dörrgemüse nannten. Meine Frau verstand sich darauf, dieses Gericht ein wenig zu strecken und aufzuwerten, mit Zutaten, die man sich im Schleichhandel erwarb, der vor allem im Ressel-Park, nächst der Karlskirche, blühte. Für ein Kilogramm Butter mußte man zwei Abendhonorare geben. Ich erinnere mich noch an einen Schwarzhändler in der Josefstadt, bei dem man ab und zu ein paar Kilo Mehl ergattern konnte. »Geld interessiert mich nicht«, pflegte er zu sagen, »bringen Sie mir etwas Wertbeständiges!« So verschwanden manche Dinge, die uns etwas bedeuteten, im Schleichhandel. Im Ibeater an der Wien gab es später bereits regelrechte »HausVersorger«. Das waren Bühnenarbeiter, die ihre Beziehun gen zu den Bauern in Wiens Umgebung hatten und sich aufs »Organisieren« verstanden. Sie gingen von Garderobe zu Garde robe, um nach den »Wünschen« zu fragen und brachten dann, zumeist am Wochenende, verläßlich allerhand Nahrhaftes mit, vor allem Fleisch jeder Art. Ich bin überzeugt, es war oft genug Fleisch aus zweifelhaften Quellen. Aber danach fragte damals kei ner ; Hauptsache, Fleisch war da. Lünmal war ich selbst beim »Organisieren« von Lebensmitteln erfolgreich. Ein Bekannter meines in Wien studierenden Bruders Leopold besaß ein Akkordeon, das er gegen nahrhafte Dinge ein 167
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN ABEND
zutauschen bereit war. Ich wurde um Rat gefragt. Nun wußte ich, daß die musikliebenden Russen im unzerstört gebliebenen Kon zerthaus aus und ein gingen. Es gelang mir, einen seriösen Unter offizier ausfindig zu machen, den der Tausch interessierte. Das Akkordeon ging in seinen Besitz über, er gab dafür einen Sack Mehl und eine gehörige Portion Speck - eine kostbare Beute, die wir redlich unter uns Dreien —dem Besitzer, dem Vermittler und dem Organisator —aufteilten. Einziger Lichtblick in dieser düsteren Zeit waren die Amerika ner mit ihren üppigen Einladungen. Die erste erreichte uns nämlich das Solisten-Ensemble - nach der Eröffnungsvorstellung im Theater an der Wien, an die sich sonst keine Nachfeier ange schlossen hätte. Sie kam von einem amerikanischen BrigadeGeneral namens L. D. Flory, der in Grinzing eine Herrschaftsvilla bezogen hatte und dort ein ebenso gastfreundliches wie kunstsin niges Haus führte. Unvergeßlich das Buffet, das uns erwartete! Eine solche Fülle erlesener Delikatessen hatten wir seit Jahren nicht mehr gesehen. Endlich konnten wir uns wieder einmal gründlich satt essen! Wir bedankten uns dafür mit unserer Kunst. Das war der Beginn. Von diesem Tag an wurden wir Mitglie der der Staatsoper immer wieder —und vor allem zu Fest- und Feiertagen - von Offiziershaus zu Offiziershaus weitergereicht. Dabei ging es stets sehr leger zu. Ein telefonischer Anruf melde te: »Bitte, um halb acht Uhr wird der Wagen kommen. Sie abzu holen!« Nach der Bewirtung setzte sich meist Josef Krips ans Klavier —er begleitete alles auswendig -* und wir sangen uns quer durchs Opern-Repertoire. Bekanntschaften wurden ge knüpft, Freundschaften geschlossen. Mit General Flory stehen wir, meine Frau und ich, sogar noch heute in brieflicher Verbin dung. Übrigens gab es erst kürzlich mit ihm nach 52 Jahren in Wien ein überaus herzliches Wiedersehen. Die Amerikaner haben damals viel für die Künstler getan. Am ersten Heiligen Abend nach dem Krieg waren wir eben dabei, für unsere Kinder ein 168
XI /
W A R E N WIR N IC H T G R O S S A R T IG
Bäumchen zu schmücken, da hörten wir schwere Schritte vor der Türe. Es klingelte, wir öffneten und da stand ein baumlanger amerikanischer Offizier, stellte eigenhändig ein mächtiges Paket und eine große Torte vor uns hin und war, ehe wir uns noch bedanken konnten, verschwunden. Einer, der stets bei diesen Einladungen mit dabei war, obwohl er durchaus nicht zu den namhaften Mitgliedern der Staatsoper zählte, war der Kollege Alfred Muzzarelli, Spezialist für jene Chargenrollen, für die man eigentlich kaum eine Stimme braucht, wie den Muff in der »Verkauften Braut«, den Alcindor in der »Bohème« oder den Wirt in »Hoffmanns Erzählungen«. Seine Leibrolle aber war der Notar im »Rosenkavalier«, mit dem er geradezu identifiziert wurde. In irgendeiner französischen Pro vinzstadt soll er einmal sogar den König Marke im »Tristan« gesungen haben und damit ins sogenannte erste Fach vorgedrun gen sein, was sich freilich niemand recht vorstellen konnte, der ihn kannte. Er besaß also einen Baß, aber eigentlich war seine Stimme undefinierbar, was er mit Selbstironie und nicht ohne Anflug von Stolz so zu kommentieren pflegte: »Mit einer Stimm’ fünf Direktionen überleben, das is’ nix Besonderes, aber ohne Stimm’, das is’ a Kunst!« Trotzdem hatte er die Passion, Ge sangsunterricht zu erteilen, freilich auch selbst immer wieder gelegentlich Gesangsunterricht zu nehmen. Muzzarelli war zweifellos ein Original, von Erscheinung schlank und elegant, der geborene Gesellschaftsmensch, weshalb man ihn gerne überall einlud. Bei den amerikanischen Parties erschien er mit Monokel und aufgekrempelter Hose. Einmal trug er ein Hemd mit einem leicht ausgefransten Kragen. Als man ihn dezent darauf aufmerksam machte, richtete er sich hoch auf und sagte ungerührt: »Aber sauber is ’s!« In Gesellschaft hofierte er gerne die Damen der älteren Semester. Je älter sie waren, desto mehr bemühte er sich um sie. Nur von Adel mußten sie sein. In der Oper war er ein guter Hausgeist, der gerne in alles dreinredete und jeden mit guten Ratschlägen versorgte. Mich 169
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
selbst behandelte er immer mit liebevoller Herablassung wie einen hoffnungsvollen Anfänger: »Du mußt dich standesgemäß anziehen! Ein Opernsänger muß was gleichschauen!« Und da er immer Geld brauchte, bot er mir, der ich alle meine guten Sachen verloren hatte, Teile seiner Garderobe an und ich kaufte ihm zwei getragene Anzüge ab, die ich wenden und umarbeiten ließ, sowie einen Pelzmantel. Später hat er mich in einen der vor nehmsten Wiener Schneidersalons - Prix am Graben —einge führt, wo man mich bestens bediente und wo ich Stammkunde blieb, solange die Firma bestand. Die erste Neueinstudierung im Theater an der Wien, »Hoff manns Erzählungen« am 24. Oktober unter Krips, brachte mir mit der Titelpartie eine neue Aufgabe, die mich faszinierte. Es war, genaugenommen, die erste Rolle, bei der es nicht nur auf den Gesang ankam, sondern in der ich mich auch schauspiele risch zu erproben hatte. Und ich hatte den Ehrgeiz, die Figur des Hoffmann vom Text und von der Musik her zu gestalten. Dabei hoffte ich sehr auf die Hilfe von Oscar Fritz Schuh, der Regie führte. Aber diese Hoffnung wurde leider nicht erfüllt. Ich mußte selbst versuchen, mir die Rolle zurechtzulegen, was mir, wie ich glaube, einigermaßen gelungen ist. Jedenfalls erreichte mich eines Tages ein Briefchen folgenden Inhalts: »Gestern war ich in der Staatsoper und wurde von Ihrem Hoffmann tief beeindruckt. Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen dafür herzlich zu danken. - Ihre Jane Tilden.« Dieses Urteil einer prominenten Schauspielerin durfte ich als Bestätigung meiner Bemühungen werten. Die weiteren Partien waren mit Irmgard Seefried, Paul Schöff1er, Erich Kunz, Herbert Alsen und Peter Klein bestens besetzt. Da Schöffler und Klein jeweils die ihnen zustehenden vier Par tien sangen, wollte auch Irmgard Seefried - nach dem prominen ten Vorbild der Gutheil-Schoder - alle drei Sopranpartien über nehmen. Das tat sie denn auch, aber nur bei den ersten beiden Vorstellungen, dann nie mehr wieder. Sie war viel zu klug, um ihre Grenzen nicht zu erkennen. Im legendären Mozart-Ensemble 170
XI /
W A R E N WIR N IC H T G R O S S A R T IG
war sie zweifellos das stärkste, vollblütigste Theatertemperament : impulsiv, spontan und nicht ganz frei davon, gelegentlich auch einmal über die Grenze zu gehen, aber immer präsent, immer engagiert, immer ganz »drinnen« in ihrer Rolle, immer restlos die Gestalt, die sie jeweils verkörperte. Eine Flamme, die vom Anfang bis zum Ende unvermindert brannte und leuchtete. Sie hat sich nie geschont, sich nicht und nicht ihre Stimme. Ihre Domäne war Mozart, weit weniger das italienische Fach. Bei Mozart war sie auch am häufigsten meine Partnerin und zwar als Pamina und Fiordiligi. In den »Meistersingern« hatte ich als David Gelegenheit, ihr unvergleichliches, warmherziges Evchen auf der Bühne direkt mitzuerleben. Auch habe ich mit Inngard Seefried im Inland wie im Ausland viel Konzert gesun gen: fast die ganze klassische Oratorien-Literatur von Händels »Messias« über Bachs »Hohe Messe«, Haydns »Schöpfung« und Mozarts »Requiem« bis zu Beethovens »Neunter« und »Missa solemnis«. Als Kollegin kam sie mir immer herzlich und offen entgegen; gemäß ihrer schwäbischen Mundart nannte sie mich »Tonerle«. In Gesellschaft war sie gerne der laute Mittelpunkt, sie konnte aber auch, wenn sie Probleme hatte, ganz still werden. Charakteristisch für sie: die Sammlung hinter den Kulissen vor ihrem Auftritt; da war sie kaum mehr sie selbst, sondern bereits ganz die Gestalt, die sie zu verkörpern hatte. Mit Sena Jurinac, der Tochter eines kroatischen Arztes und einer Wienerin, begegnete mir die erste hochbegabte Landsmän nin auf den Brettern der Volksoper. Sie war nicht die erste schö ne Stimme, die aus meiner jugoslawischen Heimat dem Wiener Ensemble zuwuchs, und nicht die letzte. Vor ihr kamen die Alti stin Mela Bugarinovic, der schon genannte Tenor Josef Gostic, der Bariton Stanoje jankovic und der Bassist Marjan Rus, nach ihr die Altistinnen Georgine Milinkovic und Biserka Cvejic und ~ viel später - die Sopranistin Olivera Miljakovic, um nur einige zu nennen. Die Jurinac aber übertraf sie alle an Vielseitigkeit, Musikalität und Gestaltungskraft. 171
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN ABEND
Als sie 1944, ein frisches Naturkind, aus Zagreb, wo sie als Mimi und Gretchen reüssiert hatte, nach Wien kam, konnte sie sich wegen der eben verfügten Theatersperre nicht vorstellen. Erst 1945, in den schweren Tagen des Wiederbeginns der Oper, erhielt sie Gelegenheit dazu durch den provisorischen Leiter Alfred Jerger, der ihre besondere Begabung gleich erkannt haben mußte. Sie war damals genau das, was man in Wien einen »lieben Kerl« nennt: eine freundliche, temperamentvolle, gelegentlich auch zu Späßen aufgelegte Kollegin, die sich allseitiger Beliebt heit erfreute. Schon ihr Cherubin, ihre erste Wiener Partie, und ihre Mimi wurden große Erfolge. Und weil nicht nur Not am Mann, sondern auch an der Frau war, erhielt sie weitere schöne Möglichkeiten, sich mit ihrer weichen, slawischen Stimme und ihrem unverkennbaren Herzenston in die Gunst des Wiener Publikums zu singen. Ihre natürliche schauspielerische Begabung fand stets den passenden Ausdruck. So ist sie »die Jurinac« geworden. Das oft zitierte Wiener Mozart-Ensemble gewann in ihr eine wesentliche Stütze. In diesem Rahmen war sie am häufigsten meine Partnerin als Donna Anna, als Dorabella, als Pamina. Sie war aber auch meine Mimi, meine Marie in der »Verkauften Braut«, meine Manon, meine Giulietta und Antonia in »Hoff manns Erzählungen«. Am meisten bewunderte ich die Selbstver ständlichkeit, mit der sie völlig organisch vom Cherubin zur »Figaro«-Gräfin, vom Octavian zur Marschallin hinüberreifte, und es bezeichnet die Reichweite ihrer Begabung, daß sie in bei den Rollen ein Begriff wurde. Sie besaß eben die Fähigkeit, sich in die Bühnengestalten derart einzufühlen, als durchlebe sie tat sächlich im Verlauf des Abends ihr Schicksal. Als Beispiele dafür möchte ich ihre Manon, ihre Mimi, ihre Butterfly und vor allem ihre Jenufa hervorheben. Wenn vom Wiederbeginn der Wiener Opernkunst die Rede ist, so darf meine liebe Kollegin Emmy Loose nicht vergessen 172
XI /
W A R E N WIR N IC H T G R O S S A R T IG
werden. Ihre quicklebendige Despina, ihr köstliches, frisches Blondchen, ihre muntere Papagena, ihre zu Herzen singende Zerline waren wesentliche Beiträge zum Wiener Mozartstil. Als Kol legin zeigte sie stets Temperament und geistige Beweglichkeit, als Künstlerin besaß sie viel gesunden Ehrgeiz, der sie befähigte, ihr Fach sehr zu erweitern: Ännchen, Olympia, Martha, Sophie lau ten ein paar Stationen ihrer künstlerischen Entwicklung. Ihr all zufrüh verstorbener Gatte, Dr. Kriso, war ein hochgeschätzter, von vielen Ensemblemitgliedern ständig konsultierter Laryngologe und als solcher unser Helfer in allen Sängernöten. Die alle überragende Persönlichkeit aber stand wohl mit Paul Schöffler auf der Bühne, ein Vollblutkünstler, dem niemand den einstigen sächsischen Volksschullehrer angesehen hätte, auch wir nicht, die ihm als Kollegen nahestanden. Eines seiner Lieblings wörter war »fulminant«; und fulminant, das war er selber: als Sänger, als Darsteller, als Künstler, als Mensch. Sein Hans Sachs, sein Jago, sein Don Alfonso, sein La Roche sind bereits Opern geschichte geworden. Schöffler besaß Gemüt, innere Wärme und eine Ausstrahlung, der man sich auch im Privatleben nicht ent ziehen konnte. Zugleich war er von einer seltsamen Unrast erfüllt, die ihn oft zu sprunghaften Reaktionen trieb. Eben noch der netteste, aufgeschlossenste Kollege, konnte er plötzlich ver stummen. In Gesellschaft brach er zuweilen mitten in einem gemütlich geführten Gespräch fast schockartig auf: »Ich muß jetzt gehen!« —und weg war er. Oder er sagte abrupt mitten im Gespräch: »Komm’, machen wir ein Spielchen!« Dazu lud er uns gern nach dem Abendessen zu sich in die Wohnung. Wir spielten dann meist —bei einem Glas Rotwein »Frische Viere«, ein primitives und simples Hasardspiel, bei dem man, trotz des geringen Einsatzes, den wir bestimmten, sehr viel verlieren konnte. Mit von der Partie waren Leopold Ludwig, der vielbeschäftigte Dirigent neben Moralt, sowie die Kollegen Erich Kunz, Marjan Rus und Alfred Muzzarelli. Hatte Muzzarelli die magerste Börse, so war ich wohl der schwächste Spieler und des 173
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
halb auch oft der Hauptverlierer. Das Bluffen, auf das es hier vor allem ankam, habe ich nie gelernt. Einmal erschien Schöffler plötzlich und also völlig überra schend an einem Sonntagvormittag in unserer Wohnung, sah sich kurz um und sagte: »Hier müssen wir ein wenig umstellen!« Und schon begann er, ohne zu fragen, unsere Möbel hin- und herzurücken, wobei er viel Geschmack bewies. Dann stellte er unvermittelt fest »So, jetzt ist’s recht!« und verschwand wieder, so rasch wie er gekommen war. Als wir im Mozartjahr 1941 mit »Don Giovanni« im »Protek torat« gastierten und zwar in jenem Prager Ständetheater, wo einst die Uraufführung stattgefunden hatte, war die tschechische Hauptstadt noch voll der köstlichsten Dinge, die es in Wien längst nicht mehr gab. Paul Schöffler nahm meine Frau am Arm und sagte: »Komm’, gehen wir ein wenig Auslagen anschauen!« Als sie, reichlich verspätet, zurückkehrten, trug meine Frau einen neuen Hut und einen neuen Pelzmantel. Schöffler hatte sie (auf meine Kosten) und nach seinem Geschmack neu eingekleidet. Als wir abreisten, kam er mit einem Riesenpaket angerückt. Auf die Frage: »Ja, was hast du denn da, Paul?« wickelte er mit den Worten »Das ist mein Honorar!« den Torso einer großen barokken Holz-Pietä aus dem Papier. Er war nicht nur ein sachkundiger Sammler, er malte auch selbst. Die Kopie nach einem alten niederländischen Meister geriet ihm so gut, daß ich unwillkürlich bewundernd ausrief: »Aber das sieht ja aus wie echt!« Das hat ihn sehr gefreut. Durch ihn bin auch ich zum Sammeln angeregt worden. Er selbst hatte so seine eigenen »Methoden«. Oft holte er ein Stück, das er bestellt hatte, gar nicht ab, weil er es sich plötzlich anders über legt hatte, oder er brachte eine Antiquität, die er noch nicht ganz ausbezahlt hatte, nach einem Jahr wieder zurück mit der Frage: »Ist das inzwischen nicht im Wert gestiegen? Bekomme ich da nicht noch was heraus ?« Schöffler war ein Frühaufsteher. Wenn wir anderen uns auf 174
XI /
W A R E N WIR N IC H T G R O S S A R T IG
Gastspielreisen um 9 Uhr zum Frühstück setzten, kam er schon vom Schwimmen oder Tennisspielen. Seine besondere Leiden schaften waren Golf, Fischen, Autofahren und —das »zarte Ge schlecht«. Seine Gattin, eine Engländerin, lebte während des Krieges mit beider Sohn in London. Schöffler wohnte allein und sehr nobel im Palais Rainer auf der Wieden, das später unbegreif licherweise abgerissen wurde - ein unersetzlicher Verlust! Dort führte ihm eine »Perle« namens Bella den Haushalt. Als Künstler war er sich seines Wertes bewußt, aber er trug das nie zur Schau. Auch wenn er die prominentesten Rollen sang, drängte er sich nie bei der Vorhangtour in den Vordergrund. In der Garderobe erschien er zur Vorstellung als letzter und war als erster wieder weg. Kein anderer hat sich so rasch abgeschminkt und umgezogen wie er. Wie Schöftler kam auch Fdisabeth Höngen aus Dresden, für mich der Inbegriff einer Charaktersängerin. Kraft ihrer Persön lichkeit beherrschte sie die Bühne vom ersten Augenblick ihres Auftritts an und verlieh selbst einer Nebenrolle —wie etwa der Marzelline im »Figaro« oder der Gräfin in »Pique Dame« —dra matischen Akzent. Die Herbheit ihrer Stimme wurde durch ihre Gestaltungskraft nicht nur überdeckt, sondern vielfach zur Stei gerung des Ausdrucks eingesetzt. Als Partnerin auf der Bühne strahlte sie eine gewisse intellektuelle Kühle aus. Leidenschaftli che Gefühle konnte ich bei ihr nicht entdecken. Wenn ich als Ferrando in »Cosi« von der Dorabella-Höngen zur FiordiligiSeefried wechselte, so war das wie ein Wechsel zwischen kalt und heiß. Die Höngen war die erste, die - lange vor Fischer-Dieskau - aus Deutschland den in sich geschlossenen, stilistisch reinen und einheitlichen Liederabend nach Wien brachte und hier durchsetzte. Mein alter Freund, Erich Kunz, die wienerischeste Säule des Mozart-Ensembles, der geborene Singschauspieler, kam auf die Welt, um den Papageno zu singen, um ein auf Weber und dessen »Freischütz« gemünztes Pfitzner-Wort zu variieren. Er war und 175
DERMOTA / TAUSENDUNDEIN
ABEND
ist auch im Leben der lustige »Vogelfänger«, steht gerne im Mit telpunkt und hat gerne die Lacher auf seiner Seite. Für eine witzi ge Pointe ist ihm keiner zu gut oder zu hoch. Auch Karajan und Karl Böhm wurden von ihm nicht verschont. Er kann sich auch mit einer kleinen Charge ins Zentrum spie len und macht aus der kleinsten Rolle eine große, er ist unver wechselbar und nicht zu kopieren. Dabei ist die Stimme gar nicht das Primäre. Seine Gestalten sind so rund und lebendig, daß man oft gar nicht merkt, wie locker und sicher er seine Stimmittel ein setzt. Seine Leibrollen, der Papageno, der Figaro, der Leporello, der Guglielmo, aber auch der Beckmesser sind für mich derart durch ihn geprägt, daß ich sie mir nur schwer anders vorstellen kann. Als Partner auf der Bühne kann er gefährlich werden. Seine halblauten Zwischenbemerkungen während des Spiels, die in kei nem Büchl stehen, kommen meist so überraschend und treffend, daß man oft Mühe hat, das Lachen zu verbeißen und nicht aus der Rolle zu fallen. Eigentlich müßte man über Kunz in Anekdo ten berichten. Und so möchte ich wenigstens eine erlebte kleine Geschichte von ihm erzählen : Im ersten Bild der legendären »Cosi« hatten wir beide Knie hosen und weiße Strümpfe zu tragen. Da der gute Erich über kei ne üppigen Waden verfügt, ließ er sich von seiner Mutter in die Strümpfe eine kleine Auflage hineinstricken. Damit erschien er dann bei der ersten Kostümprobe, streckte mir eines seiner wohl geformten Beine entgegen, und sagte triumphierend: »Da, schau dir meine Füß’ an, na, was sagst du jetzt dazu!« Anfang Jänner 1946 erhielt ich als Almaviva in Rossinis »Bar bier« eine neue Rosina als Partnerin. Sie hieß Elisabeth Schwarz kopf und war eine ebenso kluge wie schöne junge Frau mit einer faszinierenden Stimme. Meine erste Begegnung mit ihr lag damals schon mehrere Jahre zurück. Sie hatte einmal, mitten im Krieg, am Ring als Blondchen in einer RepertoireVorstellung der »Entführung« gastiert, in der ich den Belmonte sang. Damals 176
XI /
WA R E ^ N W I R N I C H T G R O S S A R T I G
war sie ein adrettes blondes Mädchen und wurde - wie es hieß von allerhöchsten Stellen in Berlin protegiert. Deshalb hatte sie später die größten politischen Schwierigkeiten. Ich erinnere mich noch an eine Vorstellung, da stand ihr Name bereits auf dem Programm und dann durfte sie doch nicht auftreten. Als es im Herbst 1946 unter Rudolf Moralt zu einer Neuein studierung von Mozarts »Entführung« kam - den Osmin sang Ludwig Weber, ich den Belmonte - mußte die Premiere verscho ben werden. Die maßgebenden Herren - Salmhofer, Krips und Hilbert —hatten größte Mühe, die »belastete« Kollegin bei den Besatzungsmächten durchzusetzen und sie als Gewinn dem Ensemble einzufügen. Die Premiere fand dann am 20. Oktober statt, eine Woche später, als der »Don Giovanni« unter Krips »anläßlich der Feier 950 Jahre Österreich« mit Schöffler in der Titelrolle und einer neuen Donna Anna, namens Ljuba Welitsch, neu in Szene gegangen war. So kam es, daß ich innerhalb von 14 Tagen zweimal den Belmonte und viermal den Don Octavio sang. In der dritten Reprise der »Entführung« stand übrigens ein hochgewachsener junger Schauspieler in der Sprechrolle des Selim Bassa erstmals auf den Brettern der Staatsoper an der Wien : Curd Jürgens. Die Schwarzkopf aber war dann noch oft meine Partnerin, nicht nur als Rosina und Konstanze, sondern auch als Donna Elvira, als Mimi in der »Boheme« sowie als Traviata und Gilda, später auch als bildschöne Gräfin in »Capriccio« und als Mar schallin im »Rosenkavalier«. Sie war immer eine sichere, nette und kollegiale Partnerin. Ich habe sie als eine große und wahrhaft besessene Künstlerin kennen- und schätzengelernt, die kein Mit tel verschmähte, in ihrer Karriere voranzukommen, die sich aber sehr hohe Ziele steckte und höchste Ansprüche an sich selbst stellte. Ich habe von ihr auf der Bühne, wenn sie zurück in die Kulisse kam, wiederholt die schärfsten selbstkritischen Worte gehört, wie: »Das war scheußlich! ... Das ist mir ganz daneben gegangen«. Oder sie sagte zu mir hinter der Szene: »Mensch, das 177
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
war schön! Wie machst du das?« —Sie hat sich später ganz von Wien gelöst, hat in London den Schallplattenkönig Walter Legge geheiratet, der ihr strengster Kritiker war und aus ihr eine inter nationale Größe gemacht hat. Im Herbst 1946 hatte Dr. Egon Hilbert seinen Posten als Lei ter der Bundestheaterverwaltung angetreten. Kein Geringerer als Ixopold Figl, der spätere Bundeskanzler der Zweiten Republik, hatte ihm diesen Posten bereits im gemeinsamen Konzentrations lager Dachau zugesagt. Nun kam Hilbert über Salzburg, wo er im Landestheater kurze Zeit tätig gewesen war, nach Wien und riß mit einem Arbeitseifer und einem Enthusiasmus, die an Beses senheit grenzten, alle Agenden an sich. Ich erinnere mich noch an eine temperamentvolle Äußerung Franz Salmhofers, der sich heftig gegen die Beschneidung seiner Machtbefugnisse zur Wehr setzte: »Das lasse ich mir nicht gefallen! Immer Hilbert und wie der Hilbert! Der Operndirektor bin ich!« Hilberts Verdienste um die Staatsoper in den Jahren des Wie deraufbaus. vor allem um das Wiedergewinnen ihrer Weltgel tung, sind unbestritten. Sein Leibspruch »tJber uns die Oper!« war für ihn mehr als eine pathetische Phrase. Aber er machte es seiner Umgebung zuweilen recht schwer, diese Verdienste anzuerkennen. Er war ein fanatischer Organisator und ein perfekter Propagandist, auch seiner selbst. Wenn ihm etwas wichtig war, dann gab es überhaupt nichts Wichtigeres in der Welt. Seine Rastlosigkeit verbreitete Hektik und Nervosität. Vor jeder Auf führung eilte er von Garderobe zu Garderobe, um sich persön lich davon zu überzeugen, daß alle Sänger rechtzeitig eingetrof fen waren. Dabei begrüßte er jeden einzelnen, was an sich eine nette Geste war, aber oft genug die nötige Konzentration vor dem Auftritt störte. Doch Hilbert ließ sich nicht beirren. Selbst als er schon vom Tod gezeichnet war, schleppte er sich noch zur Begrül^ungstour »seiner« Künstler durch die Garderobengänge, ruhelos bis zuletzt. Mich sprach er mit Du an, obwohl ich ihn immer per Sie anre 178
XI /
W A R E N WIR N IC H T G R O S S A R T IG
dete. Wer ihn nicht kannte, dem mußte seine Vertraulichkeit das Gefühl geben, daß man als Künstler bei ihm bestens aufgehoben sei. Aber das täuschte oft. I lilbert war ein Meister im Abwim meln ungelegener Anliegen und im Verschleiern gegebener Ver sprechungen. Ich‘wurde schließlich vorsichtig und ging zu Be sprechungen mit ihm nur noch in Begleitung meiner Frau. Dieser Vorsicht bedienten sich übrigens auch alle meine Kollegen. Einmal aber begegnete mir ein ganz anderer Hilbert. Auf dem Weg in die Stadt —es war an einem Vormittag —machte ich im Vorübergehen einen Sprung in die Michaelerkirche. Die Kirche war leer, nur ganz vorne am Altar kniete ein Mann, tief im Gebet versunken. Als ich näher kam, merkte ich überrascht; es war Egon Hilbert. Leise und fast ein wenig verudrrt verließ ich die Kirche, und viele Gedanken gingen mir durch den Kopf Am 4. März 1946 wurde mir —auf Grund meiner zehnjährigen Zugehörigkeit zur Wiener Staatsoper - der Titel eines Kammer sängers verliehen. Es war die erste Verleihung dieser Art in der Zweiten Republik und wohl eine der frühesten Amtshandlungen, die Dr. Hilbert vornahm. Es gab weder eine Feier noch ein De kret, sondern lediglich ein ganz unansehnliches Schreiben. Das Originaldekret habe ich erst zehn Jahre später aus der Hand des Unterrichtsministers Dr. Drimmel erhalten, der es auch Unter zeichnete. Die Verleihung fand in Dr. Hilberts Chefzimmer in der Bundestheaterverwaltung statt, die damals noch im Gebäude der Hofreitschule residierte. Der Raum wurde beherrscht von einem dekorativen Porträt der Kaiserin Maria Theresia, das mich besonders beeindruckt hat. Hilbert sprach ein paar Worte und überreichte uns in Anwesenheit von Franz Salmhofer und Raoul Aslan, dem damaligen Direktor des Burgtheaters, die Schriftstükke. Ich sage uns, denn gleichzeitig erhielt Maria Eis den Titel einer Kammerschauspielerin. Als sie das Zimmer betrat, wischte sie sich Tränen aus den Augen. Ich weiß nicht, worüber sie sich kränkte, aber ich glaube, daß der Grund bei Dr. Hilbert lag, der wohl irgendeine Zusage nicht eingehalten hatte, denn Aslan legte 179
DER iM OTA /
TAUSENDUNDEIN ABEND
ihr begütigend den Arm um die Schulter und tröstete sie mit den würdevollen Worten: »Maria, kränke dich nicht. Du bist die Eis, das genügt!« Noch vor dem »Don Giovanni« wurde auch die »Salome« wieder ins Repertoire im Theater an der Wien aufgenommen, wobei mir die Partie des Narralx)th anvert raut wurde. Moral t dirigierte, aber das Ereignis war die neue Salome : Ljuba Welitsch. Sie war noch während des Krieges aus ihrer Heimat Bulgarien als Gesangsschülerin an die Wiener Musikakademie gekommen und hatte sich in der Volksoper, die sich damals »Opernhaus der Stadt Wien« nannte, ihre ersten Sporen ver dient, ohne besonders aufzufallen. Nun war sie bereits meine Giulietta gewesen, wurde bald meine Donna Anna (auch bei den Salzburger Festspielen) und später meine Manon und meine Tat jana. Ihre Leibrolle aber war und blieb die Salome, diese ihre ele mentare Salome, die jeden Rahmen sprengte und mit der ihr kometenhafter Aufstieg begann. Wenn ich als Narraboth tot auf der Bühne lag, dann hatte ich jedesmal Angst, daß sie mir in ihrem Furioso ins Gesicht trat. Sie war die Primadonna schlecht hin, mit allen ihren Attributen, extrovertiert und impulsiv als Künstlerin wie als Mensch. In »Hoffmanns Erzählungen« hatte ich sie als Giulietta leidenschaftlich zu umsingen. In einer Vor stellung nun - wir spielten uns ganz vorne an die Rampe drängte sie sich mir nach dem großen Duett stürmisch entgegen, riß mich an sich und flüsterte: »Küss’ mir den Busen!« Ich war so verblüfft, daß ich beinahe in den Orchestergraben fiel. Nach der Szene traf sie hinter der Bühne auf meine Frau, die fast bei allen Vorstellungen, in denen ich sang, zugegen war, strahlte sie an und sagte triumphierend: »Waren wir heute nicht großartig? Das war Theater!« Ljuba Welitsch hat ihre große Zeit bewußt erlebt und sie hat alles dazu getan, daß auch die Welt davon wußte. Als wir viele Jahre später wieder einmal einander begegneten und ich sie an i 8 o
XI / W A R E N W IR N I C H T G R O S S A R T I G
diese Zeit und ihre Triumphe erinnerte, lächelte sie nur und sagte völlig abgeklärt und ganz ohne Bitterkeit: »Verklungene Feste ... Du warst damals mein liebster Partner. Wie lange ist das her? Und du singst immer noch ... Du bist ein Phänomen!« Im Herbst 1947 ergänzte Krips die Mozart-Renaissance im Theater an der Wien mit einer neuen »Zauberflöte«, bei der mir wieder der Tamino zufiel, Irmgard Seefried meine Pamina war und Wilma Tipp sich mit ihrer ersten sternflammenden Königin eine wichtige Position im Mozart-Ensemble ersang. Meine erste Begegnung mit ihr fand mitten im Krieg statt bei einer Freilicht aufführung von Rossinis »Barbier«, die als KdF-Vorstellung auf dem Heldenplatz in bescheidener Szenerie gegeben wurde. Alfred Jerger, ihr Entdecker, der den Doktor Bartolo sang, führte Regie. Wilma Tipp erschien als wienerisches blondes Rosinchen, schüchtern und scheu, zart und lieblich. Sie war damals mit einem tüchtigen Wiener Fleischhauer verheiratet, der gute Bezie hungen zu nahrhaften Quellen hatte und öfter Künstler zu einem Heurigen im 10. Wiener Gemeindebezirk einlud, wo man —und das sah ich zum ersten Mal —den Wein in Zisternen lagerte. Als Staatsopernmitglied nach dem Krieg ist die Tipp in jeder Hinsicht rasch gewachsen. Ich habe von Anfang an die unge wöhnliche Entwicklung ihrer Begabung miterlebt, die mir durch aus Achtung abverlangt hat. Sie war eine liebenswerte, unkompli zierte Kollegin, die genau wußte, was sie wollte und was sie konnte. Sie war als Königin der Nacht, als Pamina, Konstanze und Elvira vor allem meine Partnerin bei Mozart; sie war aber auch meine Olympia, eine reizende Puppe mit kristallklaren Koloraturen, war später meine anmutige Antonia und besonders meine Martha, wohl die liebreizendste Martha, die mir je auf der Bühne »entschwand«. Eine besonders noble FTscheinung im Wiener MozartEnsemble war Hilde Güden. Sie wußte sich mit Geschmack zu geben. Sie als Partnerin zu haben, gab einem ein sicheres Gefühl, obwohl sie gerne Distanz hielt. Sie drängte sich nie an die Rampe 181
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN ABEND
vor und ließ auch ihre Partner gelten. Eine gewisse Reserviert heit und Vornehmheit lag in ihrem Wesen. Trotzdem oder gera de deshalb wurde sie in Gesellschaft, ohne es anzustreben, sehr leicht zum Mittelpunkt. Ihre schöne silberhelle Stimme eroberte die internationale Opernwelt. Durch viele Jahre war die Güden ständiges Mitglied der Metropolitan Opera in New York. In Wien brillierte sie als Rosalinde in der Karajanschen »Fleder maus«, in der ich einige Male den Alfred sang. Sie war meine Ramina, meine Traviata, meine Mimi, aber auch meine Zdenka in der Schallplattenaufzeichnung der »Arabella« unter Georg Solti und sie wäre beinahe auch meine Melisande geworden ; in dieser Partie aber ging sie mir leider auf traurige Weise verloren, wie später noch zu schildern sein wird. In diesem Zusammenhang darf ich auch meinen Freund und Kollegen, den hochgeschätzten Spiel- und Charaktertenor Peter Klein nicht vergessen, dessen Mime und David internationale Anerkennung gefunden haben. Aber auch zum Wiener MozartStil hat er viel beigetragen. Ich erwähne seinen verschmitzten, quicklebendigen Pedrillo und seinen verschlagenen Monostatos. ln nachhaltiger Erinnerung sind mir seine drei Gestalten in »Hoffmanns Erzählungen« geblieben, aus denen er wahre Kabi nettstücke machte, wie überhaupt seine Stärke darin lag, daß er aus jeder noch so kleinen Partie eine psychologische Studie form te, so daß sie dank seiner Charakterisierungskunst aber auch sei ner Meisterschaft der Maske zu einem wesentlichen Akzent der Aufführung wurde. Hier wäre auch der Ort, ein kleines Gedenkblatt für Josef Krips einzulegen. Er war die musikalische Seele der Oper nach dem Krieg. Ohne ihn ist der Wiederbeginn der Wiener Staats oper, ja des Wiener Musiklebens überhaupt nach 1945 undenkbar. Er hat die von Karl Böhm begründete Mozart-Pflege fortgesetzt und er hat mit dem Böhm-Ensemble, das er vorfand, leiden schaftlich weitergearbeitet. In den ersten Tagen und Wochen der Zweiten Republik war er fast ununterbrochen im Einsatz. Er war 182
Xî /
W A R E N WIR N I C H I
GROSSARTIG
damals der einzig Verfügbare, der dirigieren durfte. Weder Böhm, noch Krauss, noch Furtwängler, noch Knappertsbusch, noch Karajan waren zugelassen. Und so dirigierte er an manchen Tagen beinahe pausenlos durch: um 9 Uhr die Messe in der Fiofburgkapelle, um ii Uhr ein Konzert, abends Oper und zwischen durch eine Probe. Er hat sich in diesen Tagen sehr für die unver sehrte Existenz der Wiener Philharmoniker eingesetzt und es hat mich immer wieder gewundert, daß ihn das Orchester später nie mals eingeladen hat, eines ihrer Abonnementkonzerte zu dirigie ren. Ich glaube, daß Josef Krips in seiner 1leimatstadt leider etwas unterschätzt wurde. Das mochte wohl an seinem Wesen gelegen sein. Krips war kein Schaudirigent. Wenn er leidenschaftlich in die Musik eintauchte - und das war eigentlich immer der Fall dann kümmerte er sich nicht um den optischen Eindruck seiner Dirigiergebärden. Beim Musizieren vergaß er die Umwelt. Höre ich mir heute seine Mozart-Platten an, etwa die Sinfonien, die er mit dem Conzertgebouw-Orchester eingespielt hat, so stelle ich gerne fest, daß diese Aufnahmen mit zu den vollkommensten Mozart-Interpretationen zu zählen sind, vergleichbar nur den Aufnahmen von Bruno Walter und Karl Böhm. Und Mozart —so sagte Bruno Walter einmal - Mozart ist das Allerschwerste. Meine erste Mitwirkung unter Krips fand in der Saison 1936/37 im Musikverein statt. Ich sang die Tenorpartie in Beet hovens »Neunter«. Krips, der damals die Dirigentenklasse an der Musikakademie leitete, dirigierte eine Schüleraufführung. Ich war kein Akademieschüler, zwar schon Staatsopernmitglied, aber den noch ein kleiner Anfänger. Und so wurde ich auch von ihm behandelt. FT hat mich erst allmählich akzeptiert. Dann bin ich an seiner Seite gewachsen und schließlich hat er mir das Duwort angetragen und wir sind Freunde geworden. Das erste Mal, daß er mich als Sänger direkt verlangte, war, als er mich telefonisch zu einer Mitwirkung in der Hofkapelle einlud: »Würden Sie das mir zuliebe tun ?« ~ Nach der Messe gab es 183
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
als Belohnung meist ein reichliches Mittagessen bei Rektor Schnitt, dem schon legendär gewordenen Vater der Wiener Sän gerknaben, was in den Hungermonaten nach Kriegsende ein wahrer Glücksfall war. War Schnitt mit unserer Leistung zufrie den, dann sagte er: »Die Messe war sehr schön. Du kannst dir morgen einen Rucksack Erdäpfel holen!« Er hatte sich, dank sei ner Beziehungen zu seinem heimatlichen Weinviertel, für »seine« Buben einen eisernen Vorrat zusammengehamstert, der in einem Verschlag unter der Stiege zur Burgkapelle gelagert war. Nach dem Essen steckte sich Krips eine dicke Zigarre an und dann kam es im kleinen Kreis zu guten und anregenden Gesprä chen. Oder Rektor Schnitt holte die Tarockkarten hervor - er war ein passionierter Kartenspieler - und wir tarockierten ein paar Stunden, wobei sich als vierter Partner meist ein Domvikar einstellte. 1946 kam Krips wiederholt zu uns in die Wohnung am Schmerlingplatz. Dort begleitete er unsere beiden Töchter Tanja und Jovita, die damals vier und sechs Jahre alt waren, und mit denen Fdilda ein Duett aus der »Matthäus-Passion« als Geburts tagsüberraschung für mich, einstudiert hatte. Ein anderes Mal nahm er sich die sechsjährige Jovita vor und brachte es so weit, daß sie sich mit dem Gebet der Agathe aus dem »Freischütz« (»Leise, leise, fromme Weise«) sogar unseren Gästen präsentie ren konnte. Gerne erzählte er später, Jovita wäre seine jüngste Agathe gewesen. Krips konnte sehr gesellig und umgänglich sein, er konnte aber auch plötzlich aufbrausen und übers Ziel schießen. In den Wochen und Monaten seines Totaleinsatzes nach dem Krieg, den er in Wien als Hilfsarbeiter überdauert hatte, nicht ohne insge heim seine musikalische Tätigkeit fortzusetzen, da war er voll Ungeduld, wohl auch voll künstlerischem Drang, der zu lange zurückgestaut gewesen war. Seine zweite Gattin Mizzi, eine Dame der Gesellschaft mit viel Geschmack, die ihn überallhin begleitete und viel für ihn und die gerechte Wertschätzung seiner Persönlichkeit getan hat, mochte wohl auch mitgewirkt haben an 184
XI /
W A R E N WIR N IC H T G R O S S A R T IG
seiner Ungeduld und seinem Gefühl, immer gegen irgendwas oder irgendwen ankämpfen zu müssen. Ich erinnere mich an einen Vorfall in Wiener Neustadt, wo in dieser 2^it ein Staatsopernensemble unter Krips gastierte. Irgend jemand hatte eine abfällige Bemerkung über den Dirigenten gemacht, Frau Mizzi hatte sie gehört und brachte eine furchtbare Szene ins Rollen, die in der erbitterten Anklage gipfelte: »Ihr seid alle seine Feinde! Ihr seid seiner nicht wert!« Die Atmo sphäre war derart erhitzt, daß die Gefahr bestand, Krips würde nicht ans Pult gehen, obgleich der Saal bereits voll besetzt war. Ich habe Freund Krips in allen Situationen erlebt. Ich habe ihn lachen und ich habe ihn weinen gesehen, ich habe ihn sehr selbst bewußt und ich habe ihn ganz demütig gesehen. Eines Sonntag nachmittags ~ es war Jahre später ~ kam er mit seiner Gattin als Gast in unser neues Heim in Ober-St. Veit. Wir saßen im Garten und sprachen über Gott und die Welt. Da äußerte er spontan den Wunsch, die Abendmesse zu besuchen: »Ich habe heute meine Christenpflicht noch nicht erfüllt!« In der Kirche stand er neben mir und betete laut, wie ein frommes Kind. Überrascht stellte ich fest: »Was für ein tief religiöser Mensch!« Und wieder Jahre später —Krips hatte bereits in den USA gro ße Karriere gemacht - erhielten wir von dort einen Brief aus sei ner Hand, darin schrieb er unter anderem: »Wenn ich gelegent lich meine, vom I^ben nicht gerecht behandelt zu werden, dann gehe ich in ein Spital, binde mir eine Schürze um und helfe Spei sen an die Leidenden austragen. Dann werde ich wieder ganz ruhig und zufrieden mit meinem lieben ...« — Auch das war Josef Krips.
XII
Paß nix gut! M it der Wiener Oper in die W elt —Mein Debüt am Teatro Colon
Zu Beginn des Jahres 1947 traf in der Staatsoper eine Einladung nach Frankreich ein : zum Blumenfest nach Nizza und ans Pariser Theater der Champs-Elyseés. Dieser Einladung vorausgegangen war ein Gastspiel der Pariser Oper im Theater an der Wien mit Debussys »Pelleas und Melisande« unter Roger Desormière, der von den Wiener Mozart-Aufführungen derart angetan war, daß er seinen Landsleuten ein Gegengastspiel des Wiener Emsembles empfahl. Die Staatsoper folgte dieser Einladung im März 1947 mit »Cosi« und »Don Giovanni« unter Krips, mit der ganzen Ausstattung: mit Solisten, Chor, Orchester, Bühnentechnikern, Kostümen und Dekorationen. Zu diesem Zweck mußte eigens ein französischer Militärtransport organisiert werden. Wir waren uns der Bedeutung dieses Ereignisses durchaus bewußt, denn es war nicht nur die erste Auslandstournee der Wiener Oper, sondern auch das erste deutschsprachige Gastspiel in Frankreich nach dem Krieg. Wir reisten im Schlafwagen, also angenehm und komfortabel. Aber die Freude währte nicht lange. An der Ennsbrücke, dem neuralgischen Punkt am Grenzüber gang von der russischen in die amerikanische Besatzungszone, ergab sich das erste Hindernis. Und ausgerechnet ich war der Stein des Anstoßes. Ich war ja immer noch jugoslawischer Staats bürger und somit seit 1945 Angehöriger eines kommunistischen Staates. Mein jugoslawischer Paß erregte daher die Aufmerksam186
XII /
PASS N IX G U T
keit der russischen Grenzorgane. Ein Jugoslawe in diesem Zug? Das wirkte verdächtig. Außerdem stellte sich angeblich heraus, daß in meinem Paß einer der zahllosen erforderlichen Stempel fehlte. Also: »Paß nix gut!« Alle Erklärungen blieben erfolglos. Die Weiterreise wurde gestoppt, keiner durfte den Zug verlassen außer den Mitgliedern der Direktion. Die Aufregung war groß, die Stimmung höchst gespannt. Ich fühlte mich schuldig, obwohl ich nichts dafür konnte. Salmhofer und seine rechte Hand, Dr. Heinrich Reif-Gintl, damals Vizedirektor der Staatsoper im Theater an der Wien, der eigentliche Organisator der Reise und damit die Seele des Unter nehmens, strapazierten das Telefon, verbanden sich mit Linz und Wien und holten mitten in der Nacht alle Obrigkeiten, die erreichbar waren, aus den Betten. Nach endlosen Ferngesprä chen, Debatten und Palavern gaben die Russen endlich nach. Der Zug setzte sich in Bewegung und mir fiel ein Stein vom Herzen. Als wir bei Buchs die Schweizer Grenze passierten, hatte ich das Gefühl: jetzt atmest du freie Luft. Es war ein wunderschöner sonniger Morgen, wir stürmten aus den Coupés, atmeten tief und dann überfielen wir den nächsten Kiosk und kauften mit den paar Schweizer Fränkli, die wir auf die Reise mitbekommen hat ten, was wir nur noch vom Hörensagen kannten: echte Schwei zer Schokolade. In Nizza empfing uns ein herrlich warmer Frühling. Wir saßen auf einer Caféterrasse im Freien und ließen den bunten Festzug an uns vorüberziehen. Ich habe den Blumenkorso im Wiener Prater nie erlebt. Und also war es das erste Mal, daß ich derarti ges sah: dieses Meer von Blumen, diesen endlosen Zug geschmückter Wagen, beladen mit heiteren maskierten Menschen und überlebensgroßen Papiermachéfiguren. Von den Aufführungen in Nizza, die mit Jubel aufgenommen wurden, ist mir das Opernhaus selbst in Erinnerung geblieben. Ich sehe noch die stimmungslose Riesenbühne mit ihren alten, 187
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
verstaubten Kulissen vor mir. Wie gut, daß wir unsere eigenen Dekorationen mitgebracht hatten! Wien, so arm es damals war, hatte uns vergleichsweise geradezu prächtig ausgestattet. Ich habe später, wenn ich allein im Ausland gastierte, noch oft diese dürf tige, verstaubte Atmosphäre auf den Opernbühnen angetroffen und es wurde mir dabei immer wieder bewußt, wie splendid man dagegen in Wien für die Illusion durch das Theater sorgte. Die Aufführungen in Paris wurden zu einem überwältigenden Erfolg, die französische Presse feierte das Wiener Gastspiel als ein historisches Fest der Versöhnung. Ich nützte die Freizeit zu einem Besuch des Invalidendoms mit der Grabstätte Napoleons und verbrachte viele Stunden im Ix>uvre, sowie in der Orangerie im erlauchten Kreis der französischen Impressionisten. Unser Hotel lag unmittelbar neben dem Fheater der ChampsElysées. Nach einer Vorstellung saß ich mit Erich Kunz in mei nem Zimmer, da klopfte es an die Tür und herein trat Rudolf Bing. F> war damals noch nicht der große Chef der Met, sondern der künstlerische Leiter der Festspiele in Glyndebourne. Voll Begeisterung schwärmte er von unseren Mozart-Interpretationen und dann fragte er mich, ob ich Zeit und Lust hätte, im kommen den Sommer in Glyndebourne mitzuwirken. Ich sagte freudig zu und er verließ uns wieder. Als er draußen war, sagte Kunz trokken: »Und mich hat er net amol ignoriert!« Aus Glyndebourne wurde leider nichts für mich. Denn, wie’s eben so kommt in unserm Beruf, es wurde nicht ich, sondern Kunz dorthin ver pflichtet. Bei mir meldete sich Bing erst später aus New York. Mit Paris hatte sich für die Staatsoper das Tor in die Welt auf getan. Im Herbst 1947 kam ein Ruf aus London zu einem dreiwö chigen Gastspiel in Covent Garden. Das schon traditionelle »Mozart-Reisegepäck« wurde durch Beethovens »Fidelio« und Richard Strauss’ »Salome« ergänzt. Außer Krips dirigierte noch Clemens Krauss, der inzwischen wieder zugelassen worden war. FFlde Konetzni sang die Leonore, Ludwig Weber den Rocco, Julius Patzak den Florestan, ich wieder den jacquino. 188
XII /
PASS N I X G U T
Patzak, Lieblingstenor von Clemens Krauss, war ein ebenso musikalischer wie seiner selbst sicherer Sänger. Mir war er immer ein wenig rätselhaft. Ich habe keinen anderen Tenor gekannt, der sich so völlig in der Hand hatte wie er. Als ich ihn einmal nach einer Aufführung der »Matthäus-Passion« unter Karajan, in der wir Partner waren —er sang die schwierige und anstrengende Partie des Evangelisten, ich die Tenorarien —als ich ihn nach der Aufführung beglückwünschte und meinte: »Bewundernswert, wie Sie das schaffen!«, da antwortete er mit seiner heiseren Sprechstimme: »Soll ich Ihnen das Ganze gleich noch einmal von hinten nach vorne singen ?« Obwohl er gerne erzählte, daß er nie auch nur eine einzige Gesangsstunde genommen habe, sang er im Grunde alles: vom Heurigenlied bis zur »Winterreise«, vom lamino bis zum Lohengrin, vom Turridu bis zum Radames. Vor der Londoner »Fidelio«-Premiere zündete er sich eine Zigarette nach der ande ren an. Als ihn meine Frau, die diesmal mitgekommen war, frag te, ob er nervös sei, erwiderte er lachend: »Was, ich, ner\^ös.^ Ich singe den F'lorestan schon ein Leben lang. Mir kann nichts pas sieren!« Und dann passierte es doch. Im zweiten Teil seiner großen Kerkerarie »Und spür ich nicht linde, sanft säuselnde Luft? ...« stieg Patzak derart aus, daß er einfach nicht mehr zurückfand. Wir standen hinter der Bühne und hielten vor Schreck den Atem an. Er aber trug es mit Gelassenheit. Dieser »Umfaller« hat schließlich dem stürmischen Erfolg der Aufführung keinen Abbruch getan. Meine Frau und ich wohnten in London privat, nächst dem Hydepark, bei einer Dame, die uns verwöhnte. Das perfekte eng lische Frühstück, das sie uns auftischte, mit Kaffee oder Tee, Por ridge, Würstchen, gebratenem Schinken und Fisch, zählt zu den angenehmsten Londoner Eindrücken. Natürlich auch die Natio nal Gallery, das British Museum und die Tate Gallery mit den Turners sowie die Wallace-Collection, die für uns eine große 189
DERMOTA / TAU SENDUNDEIN
ABEND
Entdeckung bedeutete, so daß wir sie dreimal besuchten: ein schmuckes Palais mitten in der Stadt, von einem Park umgeben, angefüllt mit den kostbarsten Schätzen —alten Italienern und Holländern, Meistern der englischen Kunst, Gobelins, Waffen, Möbel, Silber, Porzellan ...! Das war meine Welt! Und das hatte ein einziger Mensch im I.auf seines Lebens gesammelt. Ich muß gestehen, daß ich, als Sammler, bei aller Bewunderung den Neid nicht ganz unterdrücken konnte. Und noch ein Erlebnis, das ich von der Reise mit heimnahm: Der große Tenorkollege Richard Tauber lebte schwerkrank in London und wünschte sich sehnlich, noch einmal mit dem Wie ner Ensemble den Don Octavio zu singen. Ich wurde formhalber gefragt, ob ich bereit wäre, die Partie für einen Abend an Tauber abzugeben, ich wußte aber genau, daß das für mich überhaupt keine Frage sein durfte. Ich habe mir dann die denkwürdige »Giovanni«-Aufführung mit Tauber im Rundfunk angehört — unser gesamtes Gastspiel wurde direkt übertragen —und war tief beeindruckt. Seine Technik und seinen Mozart-Stil fand ich noch einmal als mustergültig bestätigt. Wenige Wochen später war Richard Tauber nicht mehr am Leben. Alfred Piccaver, ein zweiter großer Tenor aus der Glanzzeit der Wiener Oper, lebte gleichfalls in London, zusammen mit sei ner Frau, zurückgezogen in einem stillen Vorort. Wir, eine Grup pe des Wiener Ensembles, suchten ihn auf und es wurde ein schöner, verklärter Nachmittag. Wir schwelgten in Erinnerungen an die große Zeit des gefeierten Tenorkollegen. FT stellte immer wieder Fragen: »Was haben Sie alles in der Zwischenzeit erlebt? Wie sieht es in Wien aus?« Doch als er gefragt wurde, ob er nicht wieder zurückkäme in die Stadt seiner Triumphe, winkte er nur müde ab. Er hatte längst resigniert und das Feuer in ihm war erloschen. Viele Jahre später kam er doch nach Wien. Bei der Eröffnung der neuerbauten Staatsoper am Ring sah ich ihn als Gast in der Ehrenloge. Was mag er wohl empfunden haben, als ich unter Böhm eine seiner Glanzrollen, den Florestan, sang? 190
XII /
PASS N I X G U T
Piccaver blieb dann doch in Wien und da hatte ich, kurz vor seinem Tod, noch eine letzte stumme Begegnung mit ihm. Ich überquerte eines Nachmittags in Eile den Resselpark und bemerkte auf einer der Bänke einen gebückten, grauhaarigen Herrn, der mir bekannt vorkam, wandte mich noch einmal um und da wußte ich : es war Piccaver. Er hatte die Fiände auf einen Stock gestützt und schien zu träumen. Ihm schräg gegenüber lag die Staatsoper, das Haus, in dem man ihm so viele Ovationen bereitet hatte. Bald darauf wehte von diesem Haus die Trauerfah ne für ihn. Die Staatsoper konnte schon wenige Monate nach London mit ihren inzwischen weltberühmten Mozart-Aufführungen in Bel gien derartige Lorbeeren ernten, daß die Gastspiele in Brüssel in den kommenden Jahren zur schönen Gepflogenheit wurden. Die Aufführungen fanden nicht in einem Theater, sondern im Palais des Beaux Arts statt, einem Konzertsaal, der für unser Gastspiel adaptiert wurde, wobei unsere Bühnentechniker freilich immer alles Erforderliche mitbrachten, um daraus mit erstaunlicher Improvisationsgabe eine Opernbühne zu zaubern. Besonders gerne erinnere ich mich an eine Aufführung von Donizettis »Liebestrank« in deutscher Sprache, in der ich den Nemorino sang. Meine große Arie »Eine heimliche Träne (Una furtiva lacrima)« hatte so viel Beifall, daß ich sie wiederholen mußte. Beim zweiten Mal sang ich sie italienisch und das war das einzige Mal in meiner Laufbahn, daß ich eine Arie in zwei Spra chen vortrug, worauf sich der Applaus noch steigerte. Vielleicht erwartete man, daß ich die Arie auch noch in französischer Spra che singen würde. Königin Elisabeth von Belgien, eine große Musikfreundin, Stifterin des nach ihr benannten Violinwettbewerbes, versäumte keine unserer Vorstellungen. Ich bin der großen alten Dame spä ter in Salzburg wieder begegnet, als sie einen meiner Liederaben de - wie immer mit meiner Frau am Flügel - besuchte und nach her sogar zu uns in die Garderobe kam, wo sie lächelnd Zeuge 191
DERMOTA / TAU SENDUNDEIN
ABEND
war, wie wir immer wieder aufs Podium gerufen wurden. Mit großer Geduld wartete sie, bis ich auch die allerletzte Zugabe gesungen hatte. Die diplomatische oder, wenn man will, politische Bedeutung dieser Staatsoperngastspiele bald nach dem Krieg ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Sie haben Österreich in dieser kriti schen Zeit auf eine liebenswürdige und eindringliche Weise im Konzert der Nationen wieder ins Gespräch gebracht. Egon Hil bert vergaß jedenfalls nie, in aller Öffentlichkeit laut und ver nehmlich auf diese Bedeutung hinzuweisen, und auch der öster reichische Botschafter in Brüssel war sich dessen bewußt. Er ver anstaltete große Empfänge, an denen die gesellschaftlichen Spit zen der Stadt teilnahmen. Noch vor dem zweiten Brüsseler Besuch konnten die Kräfte der Staatsoper auch den Süden erobern. Unter Karl Böhm gastierten wir im Winter 1948, wieder mit Mozart, in Mailand und Rom. Bei »Don Giovanni«, der in der Mailänder Scala vier mal über die Bühne ging, gab es eine gemischte Besetzung: Paul Schöffler sang die Titelpartie, Maria Cebotari die Donna Anna, ich den Octavio; der Leporello und die Zeriine aber waren mit italienischen Kräften besetzt. Die Inszenierung ahmte das berühmt gewordene Alfred Rollersche Konzept nach: zwei »Ecktürme« als stehende Rahmenarchitektur bei wechselndem Hintergrund. Bei der Premiere riß der fallende Vorhang vor der Pause eine dieser Säulen mit; sie fiel unglücklicherweise dem Leporello und der Zeriine auf die Beine. Es gab Schmerzen und Tränen und die Fortsetzung der Vorstellung schien gefährdet. In aller Eile wurden die beiden Verletzten ärztlich versorgt. Die Zeriine sang schließlich ihre Partie hinkend und mit stark banda giertem Bein zu Ende, auch der Leporello, Tancredi Pasero, neben Ezio Pinza damals der berühmteste italienische Bassist, rettete unter Aufbietung seiner letzten Kräfte den Abend. Die Inszenierung ging dann mit uns ins Teatro Comunale nach Rom, wo Hilde Güden als neue Zeriine und Erich Kunz als 192
2 8
W iedereröffnung d e r W ie n e r S ta a tso p er i c ) ) y a l s F lorestan in d e r » F id e lio « - F e s t
vorstellung m it M a r th a M o d i als L eonore
XII /
PASS N IX G U T
neuer Leporello dazukamen. Freund Kunz brachte meine Frau mit, die gerade unser drittes Kind erwartete, und begrüßte mich mit den Worten: »Gott sei Dank, daß ich sie dir wohlbehalten übergeben kann. Ich habe vSchon gezittert, daß sie mir in Venedig einen Stammhalter beschert!« - Es wurde dann - wenige Wo chen später —tatsächlich ein Sohn und somit unser Stammhalter, und wir tauften ihn auf den Namen Marian. In Rom bezogen wir eines der nobelsten Hotels in der Via Nazionale. Als ich mich am andern Morgen ankleiden wollte, fehlten meine neuen Schuhe, die ich abends zum Putzen vor die Türe gestellt hatte. Sie blieben verschwunden. Auf meine Beschwerde klärte mich der Hoteldirektor auf: »In unserem Hotel stellt man die Schuhe nicht vor die Tür.« Basta! Aber ein Unglück kommt bekanntlich selten allein. Am nächsten Tag hatte ich mich mit meiner Frau und dem gesamten Ensemble nach der Probe zu einem gemeinsamen Mittagstisch in einem Ristorante vereinbart. Mittag war längst vorbei und Hilda nicht erschienen. Ich wurde unruhig. Da rief mich der Kellner zum Telefon. Am andern Ende meldete sich meine Frau mit tränenerstickter Stim me: »Mir ist das ganze Geld gestohlen worden!« Ich erschrak: es war immerhin mein gesamtes Honorar der vier Vorstellungen in Mailand und das war nicht wenig. Ich beruhigte sie, soweit ich konnte, und empfahl ihr: »Nimm dir ein Taxi und komm her!« Als sie erschöpft und niedergeschlagen eintraf, erzählte sie: Beim Einsteigen in den Autobus seien im Hinblick auf ihren Zustand gleich mehrere italienische Fahrgäste aufgesprungen, um ihr galant den Sitz anzubieten. Bei dieser Prozedur muß ihr einer der Kavaliere unbemerkt die Handtasche geöffnet und sie um das Kuvert mit der gesamten Barschaft erleichtert haben. Als sie es merkte, war es zu spät und der »Kavalier« längst über alle Berge. Unsere triste Lage hat dann der österreichische Botschafter, Dr. Johannes Schwarzenberg, in sehr nobler Weise mit einer entspre chenden Hilfe überbrückt. Er betreute uns auch sonst aufs beste. Bei einer Führung durch Rom bekannte er: »Ich lebe nun schon 1 9 3
D E R M O TA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
20 Jahre hier und weiß immer noch nicht um alle Geheimnisse dieser wundervollen Stadt.« Unvergeßlich eine Fahrt mit ihm in die toskanischen Berge, wo er ein kleines Buen Retiro hatte, in traumhafter Lage und mit herrlicher Fernsicht. Und dann ereignete sich ein sonderbarer Vorfall in der Bot schaft, wo Schwarzenberg aus Anlaß unseres Gastspiels einen glänzenden Empfang gab. Alles, was Rang und Namen hatte in Rom, war geladen. Ich war eben im Gespräch mit irgendeiner prominenten römischen Persönlichkeit, da trat ein Herr auf mich zu und stellte mich zur Rede: mit welchem Recht ich mich hier in dieser Gesellschaft befände. Er verlangte meine Legitimation und forderte mich dann auf, sofort das Fest zu verlassen, sonst hätte ich mir die Folgen selbst zuzuschreiben. Ich war wie vor den Kopf gestoßen. Es stellte sich heraus, daß ich den jugoslawi schen Gesandten vor mir hatte und daß ich als jugoslawischer Staatsbürger mich zuerst bei ihm hätte melden müssen, um die Genehmigung zur Teilnahme am Empfang von ihm einzuholen. Davon wußte ich nichts, und hätte ich es gewußt, so hätte ich es doch nicht getan. Ich wandte mich an Schwarzenberg und schil derte ihm kurz meine Situation. Er beruhigte mich und sagte lächelnd: »Das mache ich schon, die Sache wird sofort erledigt!« Und so geschah es auch. Ich aber machte mir Gedanken über die Schwierigkeiten, in die mich immer wieder meine jugoslawische Staatsbürgerschaft brachte. Den Höhepunkt der Ereignisse rund um unser römisches Gastspiel brachte der Tag, an dem das gesamte Ensemble von Papst Pius XII. in Sonderaudienz empfangen wurde. Als wir vor dem Heiligen Vater standen, da fühlte wohl jeder von uns die Bedeutung der Stunde und die Größe der Persönlichkeit, die uns da gegenübertrat. Wir wurden einzeln vorgestellt und der Papst fand für jeden ein passendes Wort in deutscher Sprache. Einmal ging ein Schmunzeln über seine Züge, als er zu Wilma Lipp sag te: »Ah, Sie sind soprano leggiero (Koloratursopran)!«, worauf die Lipp munter korrigierte: »Nein, Heiliger Vater, ich bin Kolo 194
XII /
PASS N IX G U T
ratursopran!« Als der Papst den Zustand meiner Frau merkte, machte er über sie das Kreu2eszeichen und sprach dazu die Wor te: »Ich segne Sie und Ihr Kind!« So ist unserem Sohn schon vor der Geburt ein päpstlicher Segen zuteil geworden. Als ich vorge stellt wurde, hob Pius XII. die Augenbrauen und sagte anerken nend: »Oh, il tenore!« Sein Tonfall zeigte mir, daß in Italien >il tenore< gleich nach dem lieben Gott kommt. Im Frühling 1949 gab es ein Wiedersehen mit dem Süden. Im Rahmen seines Maggio Musicale beging Florenz eine MozartWoche. Die Staatsoper brachte einen Zyklus von fünf Werken, die ausschließlich von Krips dirigiert wurden. Ich war der einzige Tenor des Gastspiels und hatte daher neben dem Belmonte, Octavio, Ferrando und Tamino auch noch die Solopartie im »Requiem« zu singen. Die freie Zeit gehörte fast ausschließlich der Besichtigung der Kunstschätze dieser herrlichen Stadt. In den Uffizien war ich am Ende fast wie zu Hause. Wenn ich heute an den fiorentini sehen Mai von damals denke, der in unserem Fall zum Juni wurde, dann fühle ich noch heute die schöne Harmonie, die innerhalb des Mozart-Ensembles herrschte. Wir waren wie eine Familie. Da saßen wir einmal im Schatten einer Trattoria beim gemeinsamen Mittagessen - der Arno floß silbergrau an uns vorüber —und genossen die köstli chen italienischen Spezialitäten und den noch köstlicheren italie nischen Rotwein. Der liebe alte Kollege Hermann Gallos erzähl te, angefeuert vom Wein, temperamentvoll ein Erlebnis. Im Eifer des Erzählens fegte er mit einer heftigen Gebärde die Karaffe vom Tisch. Sie flog direkt auf mich zu, ich bekam sie zwar noch zu fassen, doch der Rotwein floß mir beim Hemdkragen hinein und bei den Schuhen wieder heraus. Mein schöner, heller Anzug schien ruiniert. Kollege Gallos war bestürzt und zu jeder Buße bereit. Die Kellner stürzten auf mich zu, brachten mich in die Küche und übergossen mich förmlich mit Wasser, so daß ich schließlich aussah, als hätte man mich aus dem Arno gefischt. So erreichte ich mein Hotel, hängte den Anzug ans Fenster und, sie1 9 5
DER iM OTA /
TAU SENDUNDEIN
ABEND
he da, am nächsten Tag war nicht ein Fleck mehr zu sehen. Das spricht für die Güte des italienischen Weins und der florentinischen Sonne. In Rom, dieser herrlichen Stadt, durfte ich noch oft gastieren: in der Oper, im Konzertsaal und im Rundfunk. Im Teatro Comu nale sang ich im Lauf der Jahre unter anderem den Tamino in zwei verschiedenen Neuinszenierungen der »Zauberflöte«, die auch von zwei verschiedenen Dirigenten geleitet wurden. Der erste war der italienische Altmeister Vittorio Gui, der, mit seinen knappen, eckigen Dirigiergesten sichtlich aus der ToscaniniSchule kommend, eine sehr persönliche, sehr eigenwillige Deu tung der »Zauberflöte« mitbrachte und besonders auf Disziplin und Präzision bedacht war. Als zweiter dirigierte Ernest Ansermet, der große Apostel der Moderne, der sich da sicher nicht auf seinem ureigensten Gebiet bewegte, aber doch eine starke innere Beziehung zu Mozart fühlen ließ und uns alle zu einem schönen, lockeren Musizieren führte. In der Pause wurden wir dem dama ligen Staatspräsidenten Luigi Einaudi vorgestellt. Diese Auffüh rung brachte meine letzte Begegnung mit Ansermet, der kurze Zeit darauf starb. Eines der römischen Konzerte, bei denen ich mitwirkte, ist mir in besonderer Erinnerung geblieben. Es wurde von Dr. Egon Hilbert organisiert, der nun Leiter des Österreichischen Kulturin stituts in Rom war, und fand Mitte Oktober 1959 im Vatikan, in der Aula della Benedizione, vor Papst Johannes XXIII. statt. Heinz Wallberg brachte mit den Wiener Symphonikern und dem Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde Mozarts Requiem und Bruckners Tedeum zur Aufführung. Als Zuhörer hatte man bloß die beim Heiligen Stuhl akkreditierten Diplomaten geladen. Das Soloquartett war in unmittelbarer Nähe des Heiligen Vaters placiert, so daß ich gelegentlich sein Mienenspiel beobachten und sehen konnte, wie tief ihn besonders Mozart beeindruckte. Nach Beendigung des Konzerts wurden wir ihm kurz vorgestellt und empfingen aus seiner Hand die päpstliche Medaille. 196
XII /
PASS N IX G U T
Am nächsten Tag - es war ein Sonntag —sangen wir noch in der Kirche Santa Maria dell’Anima Haydns Nelson-Messe. Sechs Jahre später wurde ich vom Vatikan zum Komtur des päpstli chen Gregorius-Magnus-Ordens ernannt. Kardinal-Erzbischof Dr. Franz König überreicht mir im Wiener erzbischöflichen Palais diese ganz seltene Auszeichnung, die ich unter den vielen mir verliehenen besonders schätze. Inzwischen aber war ein Ereignis eingetreten, das für meine Sängerlaufbahn von besonderer Bedeutung werden sollte. Doch da muß ich ein wenig zurückgreifen. Es war in den kritischen Märztagen 1938, als bei uns das Telefon klingelte und sich ein Herr Erich Engel vom Teatro Colon in Buenos Aires meldete. Er fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, im nächsten Jahr am »Colon« zu singen und lud mich zu einem Gespräch in die Staatsoper ein. Bei diesem Gespräch stellte sich heraus, daß Herr Engel ein gebürtiger Wiener, ehemals Studienleiter bei Fritz Busch in Dresden und 1933 nach Argentinien emigriert war, wo er am Teatro Colon die Stelle eines artistischen Direktors beklei dete. Er erklärte mir, daß es am »Colon« eine dreigeteilte Stagio ne gäbe, dort Temporada genannt, nämlich eine französische, eine deutsche und eine italienische, und lud mich für 1939 ein, das deutsche lyrische Tenorfach zu übernehmen. Ich sagte mit Freuden zu und wir schieden in der Hoffnung, uns in Bälde wie derzusehen. Aber die politischen Ereignisse machten uns einen Strich durch die Rechnung. Ich hörte nichts mehr von Herrn Engel und hatte seine Einladung fast schon vergessen, als 1947 —beinahe zehn Jahre später —eine Nachricht von ihm eintraf, in der er mich einlud, im folgenden Jahr, also 1948, am Teatro Colon zu gastieren. Ich sagte ohne Bedenken zu, suchte sofort bei der Staatsoperndirektion um einen sogenannten Karenzurlaub an, der mir bewilligt wurde, und dann begannen die Verhandlungen. Dabei ergab sich, daß man drei Partien für mich vorgesehen hat te: den Max im »Freischütz«, den Leukippos in der »Daphne« 1 9 7
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
und den Ferrando in »Cosi«, und in dieser Reihenfolge sollten auch die Premieren stattfinden. Das heißt: man hatte für mich eine Antrittspartie festgelegt, die ich noch nie gesungen hatte und die schon ins dramatische Fach tendierte. Ich war ernstlich besorgt, daß man mir da einen ungünstigen Start zumutete, der mir die Zukunft im Teatro Colon verbauen könnte. Mein Wunsch wäre es gewesen, mit Mozart zu beginnen und mit Weber zu enden. Aber als Neuling konnte ich natürlich keine Bedingungen stellen. Ich mußte akzeptieren oder absagen. Nach sehr gründlicher Überlegung und nachdem ich mich mit der Par tie des Max vertraut gemacht hatte, ergriff ich schließlich etwas unsicher die gebotene Chance, von der ich mir sagte, daß sie so bald nicht wieder kommen würde. Tatsächlich wirkte ich dann durch zehn Jahre am »Colon« mit, das letzte Mal 1958, als das Haus mit einer Festaufführung von Beethovens »Neunter« sein fünfzigjähriges Bestehen feierte. Zur ersten Überfahrt, die Anfang September 1948 stattfand, reiste ich nach Genua, um mich dort einzuschiffen. Ich war allein, meine Frau kam erst später mit dem Flugzeug nach. Ich hatte die Schiffsreise gewählt, die zwanzig Tage dauerte, um sie gleichsam als Urlaub zu genießen. Als ich das schwimmende »Riesenhotel« betrat, das den beziehungsvollen Namen »Columbus« führte — auch ich war eben daran, Amerika zu entdecken —umfing mich eine Luxuswelt, die mir unwirklich schien und die mich leicht verwirrte. Ich reiste i. Klasse, also hochnobel. Schon die Speise karte war vielversprechend. Dazu kam das bunte Treiben, kamen die Arrangements und Einrichtungen, mit denen man den Passa gieren die lange Reise zu verkürzen suchte. Es gab ein Schwimm becken und es gab Kinovorstellungen, es gab Tanzfeste und Par ties. Eine Schiffskapelle musizierte, allerlei Spiele wurden veran staltet. Ich hielt mich davon meist fern, verbrachte viele Stunden auf Deck, genoß die warmen Abende mit ihrem sternbesäten Him mel und wurde nicht müde, das Leben im Meer zu beobachten : 198
XII /
PASS N I X G U T
die fliegenden Fische, die Delphine, die in ganzen Schwärmen das Schiff begleiteten, und die Wale, die sich in gemessener Ent fernung zeigten und sich wie Säulen aus dem Wasser erhoben, ganz so wie es Vater Haydn in seiner »Schöpfung« musikalisch so eindringlich schildert. Trotzdem begann mich die Fahrt allmählich zu ermüden. Nach etlichen Tagen bekam ich sogar einen Anflug von Heimweh. Ich fühlte mich fremd unter Fremden und empfand bedrückt, wie einsam sich doch der Mensch unter Hunderten von Menschen fühlen kann und wie klein in der Unendlichkeit zwischen Him mel und Wasser. Im Bauch des Schiffes befanden sich Flunderte von Emigran ten - displaced persons, wie mich der Kapitän aufklärte. Das waren Flüchtlinge, denen der Boden in Europa zu heiß gewor den war, aber auch solche, die, unschuldig am politischen Geschehen, zwischen den Fronten zerrieben zu werden drohten, vielfach auch Leute aus dem Osten, Menschen aus meiner Hei mat, die freiwillig oder gezwungen auf der Seite Hitlers gekämpft hatten und die, der kommunistischen Bedrohung in ihrer Heimat entkommen, nun auch im Westen keine Gegenliebe fanden ... das waren die Habenichtse, die eben erst aus den englischen und amerikanischen Lagern freigelassen worden waren ... das waren die Namenlosen, die niemand haben wollte und die nun hofften, sich »drüben« eine neue Existenz aufbauen zu können. Sie hatten keinen Zutritt zum Nobeldeck, aber zuweilen verirrte sich doch einer herauf und dann erschrak ich über die soziale Kluft, die sich da plötzlich auftat. Ich habe, schon bedingt durch meine Herkunft, immer viel Verständnis für soziale Probleme gehabt. Und so hat mir auch dieser kaum überbrückbare Kontrast zwi schen den armen Teufeln unter Deck und der sorglosen, luxuriö sen Welt über Deck viel zu denken gegeben. Ein weiterer Schatten fiel auf mich und diese Reise dadurch, daß ich fast so etwas wie ein politischer Gefangener war. Als Inhaber eines jugoslawischen Reisepasses durfte ich das Schiff 199
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
nicht verlassen und konnte daher auch die verschiedenen Ausflü ge ins Landesinnere nicht mitmachen. So habe ich die großen Städte, an deren Häfen angelegt wurde —Santos, Rio, Montevi deo - nur vom Schiff aus gesehen. Es war die Zeit, da Tito mit Moskau brach und mit dem Bann Stalins belegt wurde. Von die sem Bann bekam auch ich, Titos »Untertan«, etwas zu spüren, obwohl ich stets ein apolitischer Mensch war. Durch mich waren meine Frau und meine Kinder ebenfalls jugoslawische Staatsbür ger und also in der gleichen Zwangslage wie ich. Als ich diese Umstände überdachte, wurde mir klar, daß es an der Zeit war, diese Situation zu ändern und mich um die österreichische Staats bürgerschaft zu bewerben. Wenn ich im nächsten Jahr wieder nach Buenos Aires eingeladen werden sollte, dann wollte ich ohne Schwierigkeiten reisen. Einer der wenigen, mit denen ich auf der Reise in persönli chen Kontakt kam, war ein ungarischer Aristokrat, der sich rechtzeitig abgesetzt hatte und nun für Argentinien optierte. Wir kamen auf Deck ins Gespräch, er lud mich in seine Kabine und dort zeigte er mir Kunstschätze, vor allem antikes Silber, daß mir, der ich schon von Sammlerleidenschaft erfaßt war, die Augen übergingen. Er hatte auch sein Auto aus Europa mitgenommen, einen schneidigen feuerroten Zweisitzer, mit dem ich ihn dann in Buenos Aires durch die Straßen flitzen sah. Dort begegneten wir einander wieder und er bot mir das kostbare Silber, das mich schon am Schiff so beeindruckt hatte, zum Kauf an. Aber ich besaß nicht die nötigen Mittel —meine Honorare waren noch recht bescheiden —und später habe ich ihn leider aus den Augen verloren. je näher wir dem Äquator kamen, desto lauter wurde das Trei ben an Bord. Am Äquator selbst gab es die übliche Taufe. Passa giere, die ihn zum ersten Mal passierten, wurden bisweilen samt der Kleidung ins Wasser getaucht. Das blieb mir zwar erspart, aber ich war schließlich trotzdem naß von oben bis unten und erhielt meinen Äquator-Taufschein ausgehändigt. Am Abend
XII /
PASS N I X G U T
ging dann das größte Fest der Reise in Szene. Die Tische bogen sich und Champagner floß reichlich. Schon vorher hatte man ver sucht, ein künstlerisches Programm zusammenzustellen und zu diesem Zweck die Liste der Passagiere durchgesehen. Dabei stieß man auf einen Geiger, einen Pianisten und natürlich auch auf mich. Ein vorwiegend weibliches Komitee wurde gebildet, mit einer Komtesse an der Spitze, die in aller fbrm an die auserkore nen Opfer, also auch an înich, herantrat. Ich sagte gerne zu, wies aber darauf hin, daß ich weder Frack noch Smoking mit hatte. Also mußte der Maître cH lotel veranlaßt werden, mir seine »Unifoma« zu borgen, mit der ich dann einigermaßen konzert mäßig ausstaffiert wurde. Abends sang ich die Arien aus »Bohe me« und »Tosca« und es war das erste und einzige Mal, daß ich sie auf einem Schiff unter freiem Himmel sang, während über uns das Kreuz des Südens strahlte. In Buenos Aires herrschte bereits Vorfrühling. Ich wurde von einem Agenten des Teatro Colon, einem soignierten alten Herrn deutscher Abstammung, empfangen, bezog mein Hotel und mel dete mich umgehend im Theater, wo ich den Probenplan und die nötigen Auskünfte erhielt. Eine überaus herzliche Begrüßung gab es mit Herrn Engel, der wirklich der gute Engel des Hauses zu sein schien. Er war für den gesamten Ablauf des Betriebes ver antwortlich, und da die Stelle des Direktors mehr eine Ehrenpo sition war, die man politisch oder gesellschaftlich angesehenen Persönlichkeiten übertrug, so sah ich in ihm den eigentlichen Direktor. Schon am nächsten Tag fand die Begegnung mit dem musika lischen Chef der deutschen Saison statt. Es war Erich Kleiber und er nahm mir sofort alle Bedenken und Ängste, die ich im Hinblick auf mein Debüt als Max hatte: »Ja, warum fürchten Sie sich denn vor dieser Partie ? Ich versichere Ihnen, daß Sie damit hier bestens ankommen. Dafür übernehme ich die Verantwor tung. Lassen Sie alle Bedenken fallen und kommen Sie mit mir auf die Bühne!«
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
Er führte mich auf die riesenhafte, leere Bühne, die auf mich geradezu gespenstisch wirkte, weil in ihrer Mitte auf einem Stän der nur eine einzige Glühbirne hing, die mehr Schatten als Licht gab. Der eiserne Vorhang war hochgezogen. Vor mir gähnte wie ein Abgrund der gewaltige, finstere Zuschauerraum mit seinen über 4000 Plätzen. Ich erschrak zutiefst. Diesen gigantischen Raum sollte ich armer Teufel mit meiner Stimme füllen! Aber in dem Augenblick sagte Kleiber: »Wenn ich jetzt einen Geiger hät te, der einen leisen Flageolett-Ton anstimmte, und ich führte Sie in die letzte Reihe auf der höchsten Galerie, so würden Sie dort den Ton genau so gut oder vielleicht sogar noch besser hören als hier auf der Bühne.« Ich hatte schon von der wunderbaren Akustik des Teatro Colon gehört, die jene vielgerühmte des Wiener Großen Musik vereinssaales noch übertreffen sollte. Außerdem kannte Erich Kleiber meine Stimme von früher. Ich hatte 1958 in Brüssel unter seiner Stabführung das Tenorsolo in der »Neunten« gesungen, die damals fünfmal en suite gegeben wurde. Er mußte also wis sen, was er mir zumuten konnte. Diese Überlegung und Kleibers beruhigende Worte gaben mir meine Fassung und Zuversicht wieder. Im Lauf der Proben lernte ich das Haus besser kennen, das mit seinen Logen, seinen bis zur Decke reichenden Rängen und seinem rotgoldenen Dekor an die großen europäischen llieater erinnert und mit seiner leicht verstaubten Patina und sei ner traditionsgesättigten Atmosphäre, die von einer fast zeremo niellen Ordnung bestimmt war, auf mich starken Eindruck mach te. Wollte man ins »Allerheiligste« der Direktion Vordringen, mußte man erst zwei uniformierte Diener passieren. So oder ähn lich mußte es wohl einst —nach Berichten der älteren Kollegen in der k. u. k. Hofoper zugegangen sein. Auf der Probebühne begegnete ich einem alten Bekannten, Dr. Otto Erhardt, dem profunden Richard-Strauss-Kenner, der aus Dresden emigriert war und nun am Teatro Colon eine Art Chef regisseur-Stelle einnahm. Er erwies sich wieder als ebenso bedeu-
XII /
PASS N IX G U T
tender Theatermann wie humorige Persönlichkeit. Als Regisseur konnte er einen zur Verzweiflung bringen, denn er sprühte förm lich vor Nervosität und irritierte damit die Sänger oft derart, daß sich Erich Kleiber gezwungen sah, energisch dazwischen zu fah ren: »So lassen Sie sie doch in Frieden singen! Sie machen es ohnedies besser, als Sie von ihnen verlangen!« Eünmal setzte er sich selbst aufs Programm: als Selim Bassa in der »Entführung«. Bei den drohenden Worte, die er zu Belmonte, also zu mir, zu sagen hatte, »Du bist der Sohn meines ärgsten Feindes ...«, spiel te ihm seine Nervosität einen Streich und er begann: »Du bist der ärgste Sohn meines ...« Hier merkte er seinen Irrtum und fiel vollends aus der Rolle. Dagegen war die Probenarbeit mit Erich Kleiber ein reines Vergnügen. Ich hatte ihn - wie erwähnt - in Brüssel kennen gelernt, wo er in den dreißiger Jahren im Palais des Beaux Arts alljährlich einen sogenannten Kleiber-Zyklus dirigierte. Damals mußte er an mir und meiner Stimme Gefallen gefunden haben. Wieviel Verständnis er für Sänger hatte, beweist eine Mahnung, die er mir damals gleichsam mit auf den Weg gab: »Das Timbre einer Stimme ist wie der Staub auf den Flügeln eines Schmetter lings«, sagte er. »Fängt man den Schmetterling und bleibt der Staub zwivschen den Fingern haften, dann ist der Schmelz der Farben dahin. Ähnlich ist es mit der menschlichen Singstimme. Wird sie überanstrengt, so geht ihr Timbre verloren und ihr Schmelz, das Persönliche, ist für immer dahin.« Ich habe das damals als eine beachtenswerte Warnung emp funden, meine Entwicklung nicht zu forcieren. Wenn mir Kleiber nun nach zehn Jahren die Partie des Max übertrug, dann mußte er wohl Vertrauen in die gesunde Entwicklung meiner Stimme gehabt haben. Kleiber ging der Ruf eines überstrengen Einstudierers voraus. Ich kann das nur bedingt bestätigen. Genauigkeit und Gewissen haftigkeit gegenüber dem Werk, mithin musikalische Strenge, waren für ihn selbstverständlich. Aber diese Strenge führte bei 203
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN ABEND
ihm nie zu persönlichen Konflikten ; sie war nie so geartet, daß man sich als Sänger von Kleiber angegriffen fühlte, denn er ver mochte kraft seiner Persönlichkeit davon zu überzeugen, daß sei ne Einwände durchaus im Dienst des jeweils zu interpretieren den Werkes standen. Neben der Tür zu seinem Zimmer hing eine Tafel mit der für ihn bezeichnenden Inschrift: »Routine ist der Tod allen Musizierens.« Sie beleuchtet seinen musikalischen Ernst und seine Strenge auch gegen sich selbst. Von Kleiber »ging etwas aus«, wie wir Sänger zu sagen pfle gen. Wenn er am Pult stand, mit seinem eher kleinen, aber gedrungenen Körper und seinem markanten Kopf, der fast hals los auf seinem Nacken saß —weshalb ich ihn immer »den kleinen Napoleon« nannte -, dann gab es eine gleichsam magische Ver bindung zwischen Orchester und Bühne. Als Sänger fühlte man sich bei ihm in guter Hut. Passierte einmal auf der Bühne ein kleiner Schnitzer, dann reagierte er nicht mit bösen Blicken, wie das bei andern Dirigenten so häufig der Fall ist, sondern mit einem verschmitzten Lächeln. Außerhalb des Theaters konnte er sehr nett und jovial sein. Er war mit einer Amerikanerin verheiratet, einer blendenden Erscheinung und kultivierten Persönlichkeit, die außerhalb von Buenos Aires lebte, wo die Kleibers eine Olivenplantage besaßen. Sie kam häufig ins Teatro Colon, um die Vorstellungen zu besu chen oder ihren Gatten abzuholen. Dabei fuhr sie einen amerika nischen Jeep und es war für mich amüsant zu sehen, wie sich der große Dirigent mit einem Schwung in den offenen Wagen hin einbugsierte. Als ich ihm meine Frau vorstellte, die mit dem Flugzeug nachgekommen war und alle meine argentinischen Auftritte miterlebte, sagte er vergnügt zu ihr: »Ach, wir kennen uns ja beinahe. Ihre Tante war in Linz meine Französischleh rerin!« Einmal verließen wir nach einer Prol^e gemeinsam das Thea ter. Bevor wir uns trennten, meinte er väterlich: »Jetzt gehen Sie ins Hotel und bleiben schön brav drei Tage daheim. Die Luft 204
XII /
PASS N I X G U T
riecht nach einer kleinen Revolution!« Dazu muß gesagt werden, daß damals —es war die Zeit der Peronschen Diktatur —immer wieder in Argentinien Revolutiönchen aufflammten. Nun, es pas sierte nichts; es gab ein paar Massenaufmärsche mit viel Geschrei, das war alles. Aber ich empfand es doch als recht freundlich, daß sich Kleiber auch außerhalb des Theaters um meine Sicherheit sorgte. Die Premiere —Grand Abono genannt —wurde zu einem glanzvollen, vor allem gesellschaftlichen Ereignis. In Buenos Aires war die Oper, zumindest damals, Treffpunkt der oberen Zehntausend. Es gehörte einfach zum guten Ton, mit dabei zu sein. Die Abonnements der vornehmen Familien vererbten sich von Generation zu Generation. In den Kritiken pflegte man auch zuerst die anwesenden Mitglieder der Hautevolée aufzuzählen und erst danach kam die Aufführung mit ihren Künstlern zur Sprache. Ein besonderes Kuriosum des Teatro Colon: Auf der Ebene des Parketts gab es sogenannte Trauerlogen. Zuschauer, in deren Familie es einen Todesfall gegeben hatte, konnten von hier aus ungesehen der Aufführung beiwohnen. Vielen anderen aber kam es bei der Premiere weniger darauf an, zu sehen und zu hören, als selbst gesehen zu werden. Mir, der ich aus dem ausgebluteten Österreich kam, erschien der Reichtum, der sich da zur Schau stellte, geradezu märchenhaft. Die Premiere am Teatro Colon wurde für mich zu einer der stärksten Nervenproben meines Sängerlebens. Das Lampenfieber stieg bis zu jenem Grad, in dem man meint, keinen einzigen Ton in der Kehle zu haben. Aber dann überwand ich meine Nervosi tät, und in dem Augenblick, da ich auf der Bühne stand, war das Lampenfieber wie weggeblasen. Ich hatte das Gefühl, »gut in Fahrt« zu sein, doch als der Applaus nach der großen Arie »Durch die Wälder, durch die Auen« in meinen von Wien ver wöhnten Ohren eher schüchtern klang, dachte ich: Mir scheint, da unten sitzen lauter Einarmige! 205
DERMOTA /
TAU SENDUNDEIN
ABEND
In dieser etwas gedrückten Stimmung 20g ich mich in meine Garderobe zurück, um den Aktschluß abzuwarten. Es erscholl der Ruf des Inspizienten: »Zum Vorhang, bitte!«, ein Ruf, der nur in der Sprache verschieden - in allen Theatern der Welt der gleiche ist und der die Künstler des abgelaufenen Aktes auffor dert, sich zur Verbeugung vor den Vorhang zu begeben. Ich schätzte meinen persönlichen Erfolg nicht hoch genug für die Verbeugungstour ein und blieb vor meinem Schminktisch sitzen. Da kam ganz überraschend Erich Kleiber in meine Garderobe gestürmt und rief mir in höchster Erregung zu: »Kommen Sie doch zum Vorhang!« Und als ich mir erlaubte zu sagen, »Aber, Herr Professor, ich habe nicht das Gefühl, daß ich einen beson deren Erfolg hatte«, faßte er mich bei der Hand und rief noch lauter: »Sie haben einen Riesenerfolg gehabt. Sie Tepp, Sie!!« Mit diesen Worten zog er mich auf die Bühne und von da an sei ne Seite vor den Vorhang, was ich als eine große Auszeichnung empfand. Dank der Ermutigung durch Kleiber verlief auch die weitere Vorstellung gut, bis auf einen kleinen Zwischenfall, der mich aber eher heiter stimmte. Als der böse Kaspar, den Hans Hotter sehr eindrucksvoll verkörperte, die Aufforderung an mich richte te, »Schieß, Max!«, da wollte die Unglückstaube nicht vom Him mel, sprich Schnürboden, fallen. Erst als wir die Hoffnung fast schon aufgegeben hatten, fiel sie, etwas verspätet, mit einem dumpfen Schlag auf die Bretter, von einer Staubwolke gefolgt. Ich wurde im Lauf des Abends immer sicherer und die Pre miere endete mit einem großen Erfolg. Die Presse feierte den »Freischütz« geradezu überschwenglich und auch mein Max kam gut davon. So schrieb »La Prensa« : »Dermota sang die Partie des Max mit leuchtender Stimme und beherrschte damit souverän die Szene.« Einer der Kritiker beschloß sein Lob mit den Worten »Warten wir seinen Mozart ab« und bestätigte damit indirekt meine ursprünglichen Bedenken gegen die Reihung der Premie-
206
XII /
PASS N IX G U T
Jedenfalls hatte ich die Feuerprobe bestanden und wir schrit ten nun zur Vorbereitung der nächsten Oper, der »Daphne« von Richard Strauss. Wieder stand Kleiber am Pult, doch diesmal führte nicht Otto Erhardt, sondern Josef Gielen Regie. Auch Gielen, der spätere Burgtheaterdirektor, war aus Dresden gekom men, wo er sowohl in der Oper als auch im Schauspiel gewirkt hatte. F> war ein ruhiger und überlegen gestaltender Bühnen fachmann, mit dem zu arbeiten reine Freude war. Er kam bereits mit einem klaren Konzept zur Probe, das planmäßig und zielbe wußt durchgezogen wurde. Es herrschte eine gute Atmosphäre, die dem Sänger half, auch seine eigene Auffassung der Partie zur Geltung zu bringen. Bald merkte ich, daß sich Dirigent und Regisseur mit der »Daphne« besondere Mühe gaben. Diese Oper war für Buenos Aires eine Novität und sollte eine Ehrung für Richard Strauss sein, dessen 85. Geburtstag bevorstand. Bei den Klavier- und Bühnenproben fiel mir ein sehr junger Korrepetitor auf; er hieß Michael Gielen und war der Sohn des Regisseurs. Michael arbeitete sich später nach Anfängen in Wien über Stationen in Stockholm und Brüssel in die erste Reihe der heute mittleren Dirigentengeneration vor. Derzeit ist er als Nach folger Christoph von Dohnanyis musikalischer Chef der Frank furter Oper. Die »Daphne« krankte ein wenig an der Besetzung. Vom Wie ner Ensemble wirkte neben mir als l^ukippos noch Ludwig Weber in der Rolle des Peneios. Die schwierige Partie des Apollo sang der schwedische Heldentenor Set Svanholm, der längst in Wien ein vielbejubelter Wagnerheld war und in dieser Tempora da zusammen mit Kirsten Flagstad in »Tristan und Isolde« Tri umphe feierte. Ich schätzte ihn als besonders sympathischen und liebenswerten Kollegen, der keinerlei Allüren kannte. Die Titel partie aber war mit einer damals hoch im Kurs stehenden ameri kanischen Sängerin namens Rosa Bampton besetzt, die schon die Agathe gesungen hatte und von Kleiber sehr geschätzt wurde. Sie 207
DERMOTA / TAUSENDUNDEIN
ABEND
war eine schöne, hochgewachsene Erscheinung und eine bedeu tende Künstlerin mit einer großen, für die Partie freilich zu schweren Stimme. Die Figur geriet dadurch zu monumental und widersprach der Illusion der leichtfüßigen Nymphe. So wurde die südamerikanische Erstaufführung der »Daphne« das, was man einen Achtungserfolg nennt. Die Presse zeigte sich respektvoll gegenüber Richard Strauss und sprach von einer Kulturtat, die Kleiber für das Musikleben von Buenos Aires gesetzt habe. Übri gens wurde die Aufführung heimlich aufgezeichnet und kam um 1970 als Piratenpressung auf den Plattenmarkt. Später wiederhol te sich diese gesetzwidrige Praxis, die Künstler zu schädigen, bei vielen Aufnahmen der Salzburger Festspiele. Bei der dritten Premiere, »Cosi fan tutte«, gab es für mich zwei merkwürdige Überraschungen. Die erste war die völlig ver staubte Ausstattung, mit der man sich begnügte. Kulissen aus dem Fundus und Kostüme aus diversen italienischen Opern wur den da einfach zusammengewürfelt. Ich bekam seltsame Gefühle, wenn ich an die szenisch zwar bescheidene, aber künstlerisch ach so reiche Aufführung von Wien dachte. Die zweite Überraschung war der Umstand, daß ich als einzi ger Gast von einem einheimischen Ensemble blutjunger Sänger umgeben war. Erich Engels Gattin, Edita, wirkte seit ihrem Abgang vom Colon, wo sie lange Jahre erfolgreich als Soprani stin tätig gewesen war, als ausgezeichnete Gesangspädagogin und erzog, in engem Kontakt mit der Oper und mit ihrem Mann, dem Studienleiter des Hauses, ein Ensemble junger Leute, die sie von Grund auf schulte, mit dem Erfolg, daß man es nun wagte, eine Mozart-Premiere mit diesem Nachwuchs zu besetzen. Klei ber setzte volles Vertrauen in die pädagogische Arbeit des Flhepaares Engel und bewies diese Einstellung dadurch, daß er auch die »Cosi« dirigierte. Das in Wien viel diskutierte und so oft ver gebens praktizierte Problem »Opern-Studio« schien im »Colon« ideal gelöst. Mir war nicht ganz klar, ob meine Aufnahme in dieses Nach208
XII /
PASS N IX G U T
Wuchsensemble als Auszeichnung anzusehen sei oder ob man mich hier nicht ein wenig zu billig verkaufte. Jedenfalls tat ich mich am Anfang etwas schwer, da ich ja aus dem großartigen Wiener Ensemble kam. Aber ich war jung genug, mich anzupas sen und die nicht unkomplizierten Proben mit Dr. Erhardt, der sich auch für Mozart kompetent fühlte, durchzuhalten, je länger wir probierten —und wir probierten für »Cosi« am längsten — desto heimischer fühlte ich mich unter der debütierenden Jugend. Das Ergebnis faßte die argentinische Presse in folgendes Urteil zusammen: »Es gab eine >Cosifolg gab. Ich sehe ihn noch, wie er nach dem Essen aus Zeitungspapier kleine Flugzeuge faltete und sie aus dem offenen Fenster der hochgele genen Rautenstrauch-Wohnung über die Stadt segeln ließ, was ihm offensichtlich eine geradezu kindliche Freude bereitete. Ich selbst habe bei Rautenstrauchs wiederholt Schubert und Schumann gesungen, namentlich die herrliche »Dichterliebe«, für 215
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN ABEND
die das Ehepaar eine besondere Vorliebe hatte. Mit seinem Namen ist auch ein außerordentliches landschaftliches Erlebnis für mich verbunden. Zwischen zwxi Vorstellungen im »Colon« lud mich das Paar nach Bariloche, einer noblen Sommerfrische ein, die an einem See gelegen und von der gewaltigen, mit ewi gem Schnee bedeckten Bergkette der Anden umrahmt ist. Nahe Bariloche besaßen die Rautenstrauchs ein entzückendes Land haus im eleganten Tiroler Stil, inmitten eines völlig unberührten MärchenWaldes. Sah man vom Balkon des Hauses in die Tiefe, so blickte man in einen kleinen, schwarzblauen See von einer fast unheimlichen Schönheit. Dort verlebte ich mit den Freunden paradiesische Tage. Die anregenden Gespräche am offenen Kamin waren Balsam für die strapazierten Nerven; desgleichen die stundenlangen Wanderungen durch die herrliche Natur, die vielfach urhaften Charakter hatte. Dabei fiel mir auf, wieviel Totes diese Natur barg. Riesige Bäume ragten abgestorben in den Himmel, kaum eine Vogelstimme war zu hören. Bisweilen ver dorrten auch die Grasmatten, der Humus versandete ... wir stan den auf vulkanischem Boden. Es war für mich eine völlig neue Welt. Zum gesellschaftlichen Leben in Buenos Aires gehören die sogenannten »Asados«. Das sind Einladungen zu zwanglosem und gemütlichem Beisammensein im Freien, also zumeist in den kleineren oder größeren Gärten der Gastgeber, wobei am offe nen Feuer Fleisch in Mengen gebraten und den Gästen angeboten wird — natürlich mit den dazugehörigen alkoholischen Getränken, vor allem den hochqualifizierten Weinen aus dem eigenen Land, so etwa aus Mendoza, einer berühmten Weinge gend, wo die Rebe im großen Stil gepflanzt wird. Es gibt das klei ne »Asado« im intimen Freundeskreis und das große »Asado« mit unzähligen Gästen. In beiden Fällen aber ist das Fleisch-Gril len das zentrale Ereignis, bei dem sich alles um die Feuerstelle versammelt, die fast wie ein Opferaltar wirkt. Ich habe diese sympathische, typisch argentinische Form der »Party« sehr 216
XIII /
KEIN G R U N D ZUR B E U N R U H IG U N G
geschätzt und gehe wohl nicht fehl in der Annahme, daß in ihr ein alter heidnischer Brauch der indianischen Ureinwohner fort lebt. Die zweite Einwanderungswelle wurde durch die Machtergrei fung Hitlers in Deutschland und Österreich ausgelöst. Zu den Emigranten dieser Epoche zählte auch der bedeutende Laryngologe Dr. Leo Forschner, den ich schon in Wien als Student wie derholt konsultiert hatte —wobei er von mir nie ein Honorar nahm - und den ich nun überraschend in Buenos Aires wieder traf Er hatte, ehe er sich dort etablieren durfte, alle seine Prüfun gen in spanischer Sprache wiederholen müssen, eine gewaltige Leistung. Nun war er längst auch hier zum maßgebenden SängerArzt geworden, und ich zählte wieder zu seinen Patienten. Immer wenn ich in Buenos Aires sang und unter den klimatischen Ver hältnissen litt - und das war leider sehr oft der Fall —,dann habe ich bei ihm ärztliche Hilfe gesucht und gefunden. Dabei entwikkelte sich unsere Bekanntschaft bald zu einer wahren Freund schaft, die bis zu seinem Tod dauerte. Forschner und seine Gattin, eine geborene Argentinierin, waren ebenso gastfreundlich wie musikbesessen. Wir sind bei ihnen wiederholt mit Clemens Krauss zusammengetroffen, und bei solchen Gelegenheiten gab es immer ein typisches Wiener Essen. Der Doktor besaß das erste Tonbandgerät, das mir unter die Augen kam. Auf sein Drängen hielt ich zum Spaß eine kleine Ansprache und sang ein paar Lieder auf Band. Er konnte davon nicht genug bekommen. Ich aber war stark beeindruckt von die sem magischen Gerät, und als die Grundig-Apparate aus Deutschland auch in Österreich auf den Markt kamen, war ich einer der ersten, der einen erwarb. Aber völlig vertraut bin ich damit nie geworden. Im Grunde blieb mir die Technik immer fremd. Neben Dr. Forschner praktizierte in Buenos Aires noch ein zweiter Sänger-Arzt, ein liebenswürdiger alter Herr namens de Luca, der in einem vornehmen Patrizierhaus wohnte. Im Laufe 2 1 7
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
seiner fünfzigjährigen Praxis hatte er zahllose ihm gewidmete Sängerfotos gesammelt, mit denen er sein Heim schmückte. Da fehlte kein großer Name von Schaljapin bis Caruso, von Battistini bis Tita Ruffo, von Gigli bis Toti dal Monte, von Friedrich Schorr, Michael Bohnen und Max Lorenz bis zu Renata Tebaldi und Mario del Monaco. Ich habe es mir zur Ehre angerechnet, daß er auch von mir ein Foto mit Namenszug für seine Samm lung erbeten hat. Doktor de Luca kannte die Sänger besser als jeder Operndirektor, denn sie waren ja alle seine Patienten. Und er begnügte sich bei diesen seinen prominenten Patienten nicht mit einer der üblichen Ärztekarteien, sondern führte richtig Buch über sie. Der dicke Foliant, den er hinterließ, stellt zweifellos eine unschätzbare Dokumentation dar, die hoffentlich im Archiv des Teatro Colon aufbewahrt wird. Die dritte Einwanderungswellc erfolgte 1945 vor allem durch jene engagierten Hitler-Anhänger, denen in Europa der Boden zu heiß geworden war. Sie fanden im Polizeistaat Perons jedwede Unterstützung; manche von ihnen - und gerade die prominenten Nazibonzen — kamen sogar zu hohen Positionen. Ungefähr zugleich mit ihnen trafen die Flmigranten aus den Oststaaten ein, die dem Kommunismus entflohen waren. Dabei kam es gelegentlich zu grotesken Begegnungen. Ich erinnere mich an einen Empfang, den eine große Emigrantenor ganisation in einem Nobelhotel der Stadt gab, zu dem auch ich eingeladen war, der ich mit meinen Papieren damals sozusagen zwischen Ost und West hing. Und da sah ich - ich traute meinen Augen nicht —,wie zwei »Todfeinde« aus dem Jugoslawien von gestern, zwei diametral entgegengesetzte politische Größen aus der unmittelbaren Vergangenheit, in legerem, freundschaftlichem Gespräch mit dem Champagnerglas einander zuprosteten. Der eine war der »Poglavnik« Ante Pavelic, der Kroatenführer, der schon in den dreißiger Jahren als eingeschworener Separatist die Abtrennung Kroatiens vom Königreich Jugoslawien angestrebt hatte, die dann von Hitler vollzogen wurde. 218
XIII /
KEIN G R U N D ZUR B E U N R U H IG U N G
Als im Oktober 1934 König Alexander von Jugoslawien in Marseille, wo er zum Staatsbesuch in Frankreich landete, zusam men mit dem französischen Außenminister Barthou ermordet wurde, führten die Fäden dieses Attentats nachgewiesenermaßen zu Ante Pavelic als dem Drahtzieher. Dessen Gesprächspartner beim Empfang war aber kein ande rer als Ministerpräsident Stojadinovic, der starke Mann des königlichen Jugoslawien unter Peter, dem Sohn des ermordeten Alexander. Und nun standen die beiden einander weder als erbit terte Feinde noch als gestrandete Existenzen gegenüber, sondern als angesehene Leute in bester Position. Was doch die Politik, so ging es mir angesichts dieser Begegnung durch den Kopf, für seltsame Wege geht! Immer wieder stieß ich in Buenos Aires auf Landsleute aus meiner Heimat. Ich habe den Kontakt mit ihnen nicht gesucht, er ergab sich von selbst. Sie hatten meist ein hartes Schicksal, muß ten fast alle in Argentinien ganz von vorne beginnen, nahmen jede Beschäftigung, auch die primitivste an, wurden Tellerwä scher, Nachtwächter, Dienstmänner, Bauhilfsarbeiter, nur um zu überleben. Aber die Slowenen sind zäh, genügsam und fleißig und finden sich in jeder Lage zurecht. Viele haben drüben eine bescheidene Karriere gemacht, nicht auf krummen Wegen, son dern durch Fleiß und Ausdauer, sind Kaufleute, kleine Fabrikan ten, aber auch Beamte im argentinischen Staatsdienst geworden. Ich denke da an einen jungen Mann aus meiner engeren Heimat, der sich drüben eine mechanische Werkstätte geschaffen hatte, die so gut ging, daß er die Aufträge kaum bewältigen konnte. Das Schicksal zweier Menschen aber berührte mich persönlich. Der eine hieß Josef Mikelj und war zwanzig Jahre zuvor, wäh rend meiner kurzen Beamtenlaufbahn in Kropa, mein Bürokolle ge gewesen. Vor dem kommunistischen Regime flüchtend, hatte er sich auf leidensvollen Wegen mit fünf Kindern nach Argenti nien gerettet. In der Zeitung las er, daß ich drüben angekommen war und suchte mich im Theater auf. So begegneten wir einander 219
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
wieder. Als er mich zum erstenmal zu seiner Familie führte, haus te sie in einem traurigen Notquartier, in einem Bau, der bereits zum Abbruch freigegeben war. Fünf Jahre später besaß Mikelj bereits ein eigenes Häuschen und war Angestellter einer Indu striefirma, in der er sich von Jahr zu Jahr verbessern konnte und von der er schließlich eine auskömmliche Pension bekam. Seine Kinder hatten alle ihren Weg gemacht, einige geheiratet, es gab bereits Enkelkinder und sie waren alle zu Argentiniern gewor den. »Ich bleibe hier«, sagte Freund Mikelj lächelnd zu mir. »Ich habe mich eingelebt und hier eine zweite Heimat gefunden.« Durch ihn wurde ich auf Rudolf Wagner aufmerksam, der in tristen Verhältnissen lebte. Er war der hoffnungsvolle Sohn jener »Tante« Wagner aus Ljubljana, bei der ich als Musikstudent ein bescheidenes, aber freundliches Quartier gefunden hatte. Er war daheim die Stufenleiter bis zum hohen Ministerialbeamten emporgestiegen, hatte aber dann als Offizier auf der falschen Sei te gekämpft. Hätten ihn die Partisanen gefaßt, wäre er bestimmt ums Leben gekommen. So floh er nach Südamerika und ließ sei ne Frau mit drei Kindern unversorgt zurück. Als er drüben ankam, war er bereits fünfzig Jahre und konnte nicht mehr so recht Fuß fassen. Bei unserer Wiederbegegnung, fristete er sein Leben als eine Art Dienstmann. Obwohl er selbst kaum etwas zu beißen hatte, schickte er ständig Pakete an seine Familie. Ich half ihm gelegentlich mit etwas Geld aus, schrieb ihm häufig Briefe und redete ihm zu, doch zu uns nach Wien zu kommen. Aber er wagte es nicht. Bei unserer zweiten Begegnung biwakierte er vorübergehend in einem ausrangierten Autobus ohne Räder als Viehhüter in der Pampa. Dann hörte ich nichts mehr von ihm. Erst als ich nach Jahren wieder einmal in meine slowenische Heimat kam, vernahm ich, daß Rudolf Wagner als schwerkranker Mann doch zurückgekehrt und dann in einem Pflegeheim gestorben sei. Um meinen Landsleuten in Argentinien eine Freude zu berei ten, nahm ich bei einem Liederabend des Teatro Colon eine Rei-
XIII /
K EIN G R U N D ZUR B E U N R U H IG U N G
he slowenischer Lieder ins Programm auf. Von überall her waren dazu Slowenen angereist und brachten mir durch eine Abord nung einen Lorbeerkranz, mit unseren Landesfarben geschmückt, sowie einen Riesenstrauß roter Nelken —in meiner Heimat die Nationalblume schlechthin. Unter Jubel und Tränen erlebten sie ein Stück ihrer verlorenen Heimat. Ich glaube, es war das erste Mal, daß im Colon slowenisch gesungen wurde, und es war über das Künstlerische hinaus ein unvergeßliches Familienfest. Mit der dritten Einwanderungswelle kamen auch viele, denen Europa zu unsicher schien und die deshalb freiwillig ihre Karte auf Argentinien setzten, um später eventuell wieder auf den alten Kontinent zurückzukehren. Als der Koreakrieg ausbrach, rieten auch mir einige Freunde, mich abzusichern, das heißt, mir eine über die Zeit der Temporada hinausreichende Daueraufenthalts genehmigung zu verschaffen. »Sie werden sehen«, so argumen tierten sie, »es kommt zu einem dritten Weltkrieg. Hier aber sind Sie sicher. Weder die Amerikaner noch die Russen sind an Süd amerika interessiert.« —Ähnliche Überlegungen dürfte Kollege Hans Hotter angestellt haben, denn er ließ zunächst seine Gattin mit dem Sohn in Buenos Aires zurück. So erwog auch ich, uns für den Notfall abzusichern, und habe daher den Rat meiner einflußreichen Freunde nicht in den Wind geschlagen. Ich verschaffte mir tatsächlich mit ihrer Hilfe eine solche Aufenthaltsgenehmigung, »Cedula« genannt, die ich frei lich nie benützte. Gleichzeitig nahm ich spanischen Sprachunter richt. Die Lektionen waren oft schon um sieben Uhr früh ange setzt —so überlaufen war der Lehrer —, und das war für mich sehr bitter, denn die Vorstellungen im Theater begannen immer erst um neun, so daß ich oft erst um halbzwei Uhr früh ins Bett kam. Mein Sprachlehrer, ein deutscher Einwanderer der ersten Welle, war derart von Hitler besessen, daß manchmal die Hälfte unserer »spanischen Stunde« durch politische Diskussionen aus gefüllt war. Übrigens ging mir Clemens Krauss mit gutem Beispiel voran.
DERMOTA /
TAU SENDUNDEIN
ABEND
Als wir eines Tages in einem argentinischen Beisei, das zu fre quentieren er keineswegs verschmähte, nach dem Mittagessen beisammen saßen, sprang er plötzlich auf, sah auf die Uhr und sagte: »Ich muß jetzt gehen, ich habe Spanischstundei« Er vertrat die Ansicht, daß man sich angesichts der weltpolitischen Lage entweder für Spanisch oder für Russisch entscheiden müsse, und fügte hinzu: »Ich habe mich entschieden, hier ist es sicherer, dar um bleibe ich hier!« Ich machte mir meinen Reim darauf. Krauss versuchte damals allen Ernstes, sich in Buenos Aires niederzulassen. Kleiber half ihm dabei auf kollegialste Weise. So verschaffte er seiner Gattin Viorica Ursuleac ein Engagement am Colon, als Brangäne im »Tristan«, die zwar nicht ihre Partie war, doch die Isolde hatte man bereits an Kirsten Flagstad vergeben. Clemens Krauss dirigierte in Buenos Aires im »Parke Palermo« ein Reihe mit großem Elrfolg aufgenommener »Fledermaus«Freilichtaufführungen. Der Chef der größten Künstleragentur Südamerikas war damals der deutschbürtige Argentinier José Schramml. Als Bevollmächtigter des Teatro Colon schloß er —immer schon für ein Jahr im voraus —auch die Verträge mit mir. Er war ein beleibter älterer Herr, etwas kränklich, sehr nervös und hektisch und im Gespräch kaum zu bremsen. Plötzlich, von unüberwindli cher Müdigkeit befallen, schlief er oft mitten im Satz ein; nun mußte man eben warten, bis er wieder erwachte. Dann entrang sich seiner Brust ein Seufzer: »Heute ist wieder eine unerträgli che >Humeda< (hohe Luftfeuchtigkeit)«, und begann seine Erzäh lung von vorne. So nahm das Gespräch kein Ende ... Neben den Colon-Konzerten gab es noch eine weitere Kon zertreihe im größten Kinosaal der Stadt —»Grand Rex« ge nannt -, bestritten vom städtischen Orchester. Auch dort wurde hervorragende Musik geboten. Es dirigierten unter anderen Otto Klemperer, Clemens Krauss und Herbert von Karajan, der nicht so ankam, wie er es erhofft hatte. Ich habe unter Krauss nur wenige Partien gesungen: den
XIII /
KEIN G R U N D ZUR B E U N R U H IG U N G
David in den »Meistersingern«, den Narraboth in der »Salome« und den Sänger im »Rosenkavalier«. Das war nach 1945 im llieater an der Wien. Krauss’ Staatsopern-Ära am Ring habe ich nicht mit erlebt, denn als ich ans Haus kam, war er eben nach Berlin gegangen. Aber ich habe bei zweien seiner exemplarischen Schallplattenproduktionen mitgewirkt: bei der »Fledermaus«, in der Patzak den Eisenstein, ich den Alfred sang, und bei der »Salome«, die heute noch im Handel ist, mit Christi Goltz in der Titelpartie und Hans Braun als Jochanaan. Krauss hatte »seine« Sänger, die für ihn unantastbar waren, so, menschlich sehr verständlich, seine Gattin Viorica Ursuleac, und, wie schon erwähnt, Julius Patzak, der ihm als der Tenor schlecht hin galt. Als Mensch und Künstler war Krauss der geborene Grandseigneur, der sich seiner Macht bewußt war und sie auch bewußt ausgeübt hat. Am Pult war er ein sehr genauer Arbeiter. Was er einmal einstudiert hatte, das saß. Gerne benützte er neben dem Taktstock sein weißes Stecktuch, das er in die linke Hand nahm, um damit seine Dirigiergesten zu unterstreichen, aber auch um Unstimmigkeiten zwischen Bühne und Orchester abzu fangen. Mich hat das immer sehr irritiert, was ich mir einmal zu bemerken erlaubte. Doch da kam ich schlecht an. »Sie können einfach Ihre Partie nicht!», damit schnitt er mir das Wort ab. Aber ich hatte diese Partie doch schon unzählige Male gesungen, immer zur Zufriedenheit von Dirigenten, Publikum und Presse. E^he Erich Kleiber von Buenos Aires abging, kam er nach Wien, wo er nicht nur Konzerte mit den Wiener Philharmoni kern dirigierte, darunter eine Wiedergabe von Beethovens »Neunter«, bei der ich das Tenorsolo sang, sondern auch SchallPlattenaufnahmen machte, und zwar ebenfalls die »Neunte« und jene berühmte »Rosenkavalier«-Produktion, von der man sagt, sie sei bis heute unübertroffen. Damals war Kleiber auch als künftiger Direktor des schon im Wiederaufbau befindlichen Hau ses am Ring im Gespräch. Ich weiß noch, daß er, um das Niveau des Ensembles kennenzulernen, eine »Traviata«-Vorstellung im 223
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
Theater an der Wien besuchte, in der Elisabeth Schwarzkopf die Titelpartie und ich den Alfred sang. Sein Gegenkandidat war Cle mens Krauss, so daß sich —wie denn anders in Wien? —zwei Parteien bildeten. Später wurde dann keiner der beiden zum Direktor bestellt. Sie starben eigentlich beide an gebrochenem Herzen. Clemens Krauss 1954, ein Jahr vor der Eröffnung des wiederaufgebauten Hauses am Ring, bei einem Gastspiel im fernen Mexiko. —Welch eigenartiges Spiel des Schicksals - er wollte ja Südamerika zum neuen Domizil wählen! Erich Kleiber, der große Mozart-Diri gent, starb 1956, also ein Jahr nach der Operneröffnung, gerade an Mozarts Todestag, einsam in einem Züricher Hotel. Als ich mich am Ende der Temporada 1951 in Buenos Aires von Kleiber verabschiedete, sagte er: »Wir sehen uns in Wien wieder, aber ich komme nur, um das Staatsopern-Projekt zu begraben. Man geht auf meine Intentionen nicht ein ... ich kann mich mit den dortigen Verhältnissen nicht abfinden ...« Und als ich zu bedenken gab: »Aber Sie könnten sich doch nicht ganz an Wien binden?«, erwiderte er sehr ernst: »Doch! Ich bin ja ein Wiener. Ich würde dort bleiben, bis ich sterbe ...!« Auf einem der Rückflüge nach Europa bekam ich plötzlich hohes Fieber. Die Ursache war eine tückische Hautkrankheit, die mir schon seit Jahren zu schaffen machte. Ich war, wie sich erst viel später herausstellte, allergisch gegen Fäulnis und gegen Staub jeder Art, Blütenstaub, Bühnenstaub, Schminkpuder. Die Folgen waren eine meinem Laryngologen unerklärliche Fleiserkeit und ein Juckreiz, der sich oft ins Unerträgliche steigerte. Das Leiden war schon in Buenos Aires wieder ausgebrochen und hatte mich beim Singen heftig irritiert. Nun wollte ich mich auf der Zwi schenstation in Dakar einem Arzt anvertrauen, aber der Kollege Marko Rothmüller, der gleichfalls in dieser Temporada am Colon beschäftigt war —er sang den Wozzeck —, riet mir dringend ab: »Nicht hier! Sonst stecken sie dich in die Quarantäne!« In Wien angekommen, begab ich mich sofort zu dem namhaf224
XIII /
K E IN G R U N D ZUR B E U N R U H IG U N G
ten Dermatologen Professor Riehl, der mich unverzüglich in die Isolierstation des Wilhelminenspitals einwies. Da lag ich nun, von oben bis unten einbalsamiert und einbandagiert und streng gemieden von meinen Bekannten. Einmal erschien Dr. Reif-Gintl als Abgesandter der Staatsoper zu einem »Pflichtbesuch«. Er behandelte mich wie einen Aussätzigen, berührte die Türklinke meines Zimmers nur mit dem Ärmel seines Mantels, vermied es peinlich, mir in die Nähe zu kommen oder mir gar die Hand zu geben und war sichtlich erleichtert, als er sich wieder verabschie den konnte. Man hatte mich, wie sich herausstellte, in die LupusStation gelegt. Erst nach vier Wochen konnte ich die Klinik ver lassen, aber da war für mich eine große Chance bereits dahin. Monate zuvor hatte sich nämlich, anknüpfend an unsere sei nerzeitige Begegnung in Paris, Rudolf Bing aus New York gemeldet und mich zu einem Gastspiel an die Met eingeladen. Der Wiener Theater- und Konzertagent Martin Taubmann, ehe maliger Kulturoffizier der englischen Besatzungsmacht, hatte mit mir den Vertrag geschlossen, demgemäß ich an der Met den David in den »Meistersingern« und —in zweiter Besetzung nach di Stefano —den des Grieux in der Original spräche singen sollte. Meine Erkrankung machte diese Pläne zunichte. Ich mußte das Gastspiel absagen und habe mir damit die Gunst Rudolf Bings für immer verscherzt. Zwar sandte ich zu meiner Rechtfertigung die ärztlichen Zeugnisse ein, doch das hat Bing nicht zu besänfti gen vermocht. Die Verstimmung blieb. Martin Taubmann verriet mir, daß Bing überzeugt war, ich hätte ihn absichtlich hängen las sen. Mag sein, daß wir, in der Hoffnung auf meine baldige Gene sung, die Absage zu lange hinausschoben und ihn damit in Schwierigkeiten brachten. Ob er wohl der Meinung war, daß man sich zu seinem Vergnügen ins Spital legt, noch dazu in die Lupus-Station ? Wie dem 'auch sei, ich wurde nie wieder an die Met eingeladen. Den Vertrag habe ich allerdings aufbewahrt, als Beleg dafür, daß das für die internationale Geltung eines Sängers doch vielleicht etwas zu hoch bewertete Engagement an die Met 225
DERMOTA / TAUSENDUNDEIN ABEND
auch in meinem Leben nicht gefehlt hat, wenngleich ich es zu meinem Bedauern nicht absolvieren konnte. Von einem vierzehntägigen GastvSpiel in Neapel, 1950, bei dem ich am Teatro San Carlo den David und den Octavio sang, sind mir drei Einzelheiten besonders im Gedächtnis geblieben. Den stärksten Eindruck vermittelten mir, neben der süditalienischen Landschaft und ihren fröhlichen Menschen, die kostbaren Zeu gen antiker Kultur. Natürlich besuchten wir auch Capri —eine Fahrt, die ich, wie schon erwähnt, mit einer ausgewachsenen Seekrankheit bezahlte —und die Villa des Axel Munthe, aber all das wurde übertroffen von den Ausgrabungen in Pompeji und den reichen Schätzen etruskischer Kunst in Paestum. Im »Don Giovanni« stand mir eine neue Donna Anna gegen über, eine schüchterne junge Dame, deren Namen ich noch nie gehört hatte, deren Stimme jedoch aufhorchen ließ. Im Kreis der Kollegen, beim gemeinsamen Essen, wo es oft laut und lustig zuging, saß sie, kaum beteiligt, still an unserem Tisch. Es war Bir git Nilsson, die später, als sie längst schon die Musikbühnen der Welt erobert hatte, auch in Wien meine leidenschaftliche, hinrei ßende Donna Anna war. Eines Abends gab man im San Carlo eine »Boheme« mit ita lienischer Besetzung, deren Rodolfo Lauri Volpi war. Ich beschloß, mir den weltberühmten Kollegen anzuhören, denn ich hatte Volpi noch von 1936 her in bester Erinnerung. FT sang damals ~ am Zenith seiner Karriere - in der Wiener Staatsoper den Kalaf und im Konzerthaus eine Auswahl der beliebtesten Arien und italienischen Volkslieder. Nun geschah es, daß er nach seiner großen Arie (»Che gelida manina«) so wütend und gna denlos ausgezischt und ausgepfiffen wurde, wie dies nur im heiß blütigen Italien möglich ist. Hemmungslos zeigte das Publikum sein Mißfallen. Volpi stand wie zerstört an der Rampe und ver suchte zum Publikum zu sprechen, aber man ließ ihn nicht zu Wort kommen. Schließlich setzte er sich kraft seiner Persönlich keit doch durch, brachte das Publikum mit einer kurzen Anspra 226
XIII /
KF Ì I N G R U N D Z U R B E U N R U H I G U N G
che zur Ruhe, und die Vorstellung endete dann sogar mit gro ßem Beifall für ihn. Dieser erregende Vorfall gab mir sehr zu denken. Wie brutal doch das lieben mit einem Sänger umgehen kann! Gestern noch trugen sie ihn auf Händen, heute treten sie ihn mit Füßen. Ich habe eine derart drastische Ablehnung eines Künstlers sonst nie erlebt. Noch zwei Tenor-Kol legen möchte ich erwähnen, die mich beide viel beschäftigt haben. Der eine war Mario del Monaco, der in Buenos Aires gerade seine kometenhafte Laufbahn begann, als ich zum ersten Mal am Colon gastierte. Die italienische Stagione ging dort eben zu Fmde. Fane der letzten Vorstellungen war der »Troubadour« mit del Monaco, dessen Name mir schon bekannt war. Ich beschloß, mir die Aufführung anzuhören und bat Herrn Engel um eine Karte. »Um Gottes willen«, meinte Engel mit gespieltem Fmtsetzen, »gehen Sie nicht hinein! Das ist ein Tenor, der nur forte singen kann.« Nun war ich erst recht neugierig, diesen Mann zu hören, und — fand Engel bestätigt: ein Tenor auf Hochtouren, der ohne Rück sicht auf Verluste sein großartiges Stimmaterial wie ein Krösus verschwendete. In Wien wurde ich dann del Monacos Partner. In Karajans »Othello«-Produktion von 1957 sang er die Titelpartie, ich den Cassio. Dabei verstärkte sich mein erster Eindruck. Wenige Jahre später begegnete ich del Monaco noch einmal. Während ich als Belmonte in Mozarts »Entführung« und als See mann im »Tristan« unter Karajans Leitung an der Mailänder Scala gastierte, hörte ich mir an einem freien Abend in der Kulis se die Blumenarie des Don José in »Carmen« an, die del Monaco sang. Ich traute meinen Ohren nicht. Wohin war die Herrlichkeit dieser großartigen Stimme verschwunden, die mich ein Dutzend Jahre zuvor so fasziniert hatte? Del Monaco gelang es zwar zwei fellos, sein Publikum hinzureißen, aber darunter hatte seine Stim me frühzeitig gelitten. Durch den restlosen Einsatz seiner pracht vollen Stimme und die Intensität, mit der er sich jeweils in die 227
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
darzustellende Gestalt hineinlebte, hat er als Othello, als Radames, als Manrico Maßstäbe gesetzt. Es war eine Weltkarriere. Ob er sie zu teuer erkaufte? Heute leitet del Monaco in Italien ein Sängerstudio und berät auf seine Art die jungen Sänger, wobei er den Nachwuchs genauso wenig schont, wie er sich selbst geschont hat. Nach der »Don Giovanni«-Premiere im Rahmen eines Gast spiels an der Mailänder Scala unter Karl Böhm, im Jahre 1948, gab es in Direktor Ghiringhellis Prachtwohnung einen großen Empfang. An die hundert Gäste waren geladen, darunter auch wir Mitglieder des »Giovanni«-Ensembles. Man sprach viel über eine vorangegangene sensationelle »Othello«-Aufführung und die Entdeckung eines neuen faszinierenden Titelhelden: eines Chilenen namens Ramon Vinay. Ghiringhelli redete von ihm in höchsten Tönen. Ich hatte die Aufführung nicht miterlebt und auch den Namen Vinay nie gehört. Aber er blieb mir im Gedächtnis haften. Und dann begegnete ich Ramon Vinay persönlich. Es war im Salzburger Festspielsommer des Verdi-Jahres 1951, als Furtwäng ler den »Othello« dirigierte, der sonst durchaus nicht seine Domäne war. Ich durfte den Cassio singen, die kurz zuvor von Karajan entdeckte jugoslawische Sopranistin Dragica Martinis sang die Desdemona, Schöffler den Jago, Vinay den Othello. Nein, er sang ihn nicht, er war der Othello schlechthin: ein Riese an Gestalt, mit gekräuseltem Haar und stechendem Blick (was der Partie sehr zustatten kam) und einer von Temperament vi brierenden Stimme —wir nannten ihn nur den »Wilden« -, ein Vulkan der Leidenschaften, ein Naturereignis! Vinay sang alle Proben mit vollstem Einsatz seiner gewaltigen Mittel. Ich habe keinen ähnlichen Othello mehr erlebt. Vinay hat in dieser seiner Leibrolle die Welt erobert, sich dabei aber frühzeitig total veraus gabt. Duplizität der Fälle. Später übernahm er in Bayreuth den Tristan und sang noch an der Staatsoper in der »Salome« unter Karajan den Herodes. In 228
XIII /
K EIN G R U N D ZUR B E U N R U H IG U N G
dieser Partie ging er mit uns auch zur Weltausstellung nach Brüs sel, aber da begann bereits der Abstieg. Später wechselte er ins Baritonfach über und schließlich wurde es still um ihn. Sein Othello aber wird mir unvergeßlich bleiben. Im Herbst 1951 gastierte Maria Jeritza als Salome im Theater an der Wien. Sie hatte schon ein Jahr zuvor als Tosca und San tuzza ihr dankbares Wiener Publikum im Sturm wiedererobert. Nun wurde ich als Narraboth Zeuge der Ovationen, die man ihr bereitete. Sie sang die Partie im mitgebrachten historischen Kostüm, das mit einer Riesenschleppe versehen war. Während ich als Toter am Boden lag, fegte sie damit über die Bühne und über mein Gesicht und wirbelte ganze Wolken von Staub auf. Von ihrer stimmlichen Verfassung bekam ich keinen Eindruck. Vor meinem »Selbstmord« hatte sie nicht viel zu singen, und als ihr großer Einsatz begann, trug man meine »Leiche« bereits hin ter die Bühne. Gefesselt von ihrer Persönlichkeit, wartete ich dann den großen Schlußgesang der Salome ab. Er beeindruckte mich stark. Unwillkürlich dachte ich mir dabei: Welche Faszina tion muß die Jeritza im 21enith ihrer Künstlerschaft ausgestrahlt haben!
XI V
Wir sind alle nur Menschen Begegnung m it Dirigenten — Kokoschka und die Zauberflöte
■
A u f großer Tournée in A ustralien
Wenn ich diese für mich so fruchtbaren Jahre überblicke, häufen sich in meiner Erinnerung die Begegnungen mit großen Dirigen ten. Es gab eigentlich kaum einen von Rang und Namen, unter dessen Leitung ich nicht gesungen hätte. Der erste Kontakt mit Otto Klemperer ergab sich bei einer SchalIplattenaufnahme von Gustav Mahlers »Lied von der Erde« mit den Wiener Philhar monikern im Großen Musikvereinssaal. Die Probe, die bereits mitgeschnitten werden sollte, war für mittags angesetzt, das Orchester versammelt: ich nahm davor Platz und sah dem Erscheinen des Dirigenten, dem der Ruf eines »Schwierigen« vorausging, mit einigem Respekt entgegen. Klemperer hatte damals schon seine schwere Kopfoperation hinter sich und konnte sich nur mühsam am Stock fortbewegen. Mit größter Anstrengung und nur mit fremder Hilfe bestieg er das Podium, ein bresthafter Riese, warf sich in den bereitgestell ten Stuhl, hob beide Arme und gab wortlos den Einsatz. Wir spielten und sangen das Werk vom Anfang bis zum Ende durch ; er unterbrach mit keiner Silbe. Als der letzte Ton verklungen war, sagte er, durch die Krankheit sprachgestört und daher schwer verständlich: »Es war sehr schön. Sie können gehen!« Er hörte sich nicht einmal das Band an, geschweige denn, daß er ans Korrigieren und Ausfeilen gegangen wäre, Arbeiten, die für Sän230
X IV / WIR S IN D A L L E N U R M E N S C H E N
ger und Orchester ebenso selbstverständlich wie ermüdend sind. Später habe ich unter Klemperer in London bei einigen Schall plattenaufnahmen für die BBC sowie bei einer Aufführung der »Missa solemnis« mitgewirkt. Auch dirigierte Klemperer einige Abende im Theater an der Wien, so eine »Don Giovanni«-Auf führung, bei der ich den Octavio sang. Er erschien im Orchester graben im Frack, aber mit billigen GummivStiefeln an den Füßen, in denen die verdrückte Frackhose steckte. Sobald er saß, streckte er die Beine von sich, ließ sich vom nächsten Geiger die Stiefel ausziehen und dirigierte in Socken. Bei einer der Klavierproben zu »Don Giovanni« kam es zu einer Auseinandersetzung. Ehe er die Probe begann, fragte Klemperer den Leporello Erich Kunz: »Was für eine Perücke werden Sie tragen?« - »Eine graue natürlich!« —Darauf Klem perer: »Rot muß sie sein! Und was werden Sie anziehen ...?« Er wollte sich offenbar ein Bild vom optischen Eindruck der Auf führung machen und hatte da seine eigenen Vorstellungen. Kunz gab keine sachliche, sondern eine leicht mit Humor gewürzte Auskunft. Das brachte Klemperer derart in Rage, daß er wütend die Probe verließ. Trotzdem war es durchaus möglich, mit Klemperer in sehr herzlichen Kontakt zu kommen. FT war ein geistreicher und bele sener Alann, der sich über Gott und die Welt tiefe Gedanken machte. Als Vademecum trug er stets ein kleines Büchlein mit ausgewählten Goethe-Gedichten bei sich und war sehr bestürzt, als er es eines Tages verloren hatte. Bei einem Tee in der Wohnung eines uns aus London befreundeten Ehepaares, das in der Wiener Prinz-Eugen-Straße ein gastliches Haus führte, traf Klemperer auf den Grazer Dom kapellmeister Monsignore Anton Lippe, den er bald in ein litur gisches Gespräch verwickelte. Klemperer war Konvertit und ich wurde Zeuge, wie er sich leidenschaftlich für die katholische Religion und ihre Riten engagierte. Später hörte ich von Lippe, daß Klemperer eifrig die Messe besuchte und häufig zur Kom231
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN ABEND
munion ging. Wegen seines Leidens wurde er ständig von seiner Frau und später von seiner Tochter begleitet. Im dritten Festspielsommer nach dem Krieg, es war im August 1947 und ich war in vier »Cosi«-Vorstellungen im Salz burger Landestheater angesetzt, sahen meine Frau und ich, auf der Heimfahrt mit unserem »Steyr-Baby«, das uns ein Freund geborgt hatte, Otto Klemperer hilflos im strömenden Regen vor dem Festspielhaus stehen. Wir hielten an und machten uns erbötig, ihn in sein Hotel zu bringen. »Österreichischer Hof«, brummte er. Aber wir hatten nicht mit der Diskrepanz zwischen seinen Ausmaßen und denen unseres Kleinwagens gerechnet. Diesen hilflosen großen Menschen in das Mini-Auto hineinzu bringen, war bei Gott keine leichte Aufgabe. Am Pult war Klemperer eine imponierende Gestalt. Er diri gierte grundsätzlich ohne Taktstock und dabei begab sich immer wieder das gleiche ergreifende Schauspiel: der totale Triumph des Geistes über den kranken Körper. Wilhelm Furtwängler dirigierte eine ganze Reihe von Konzer ten im Teatro Colon, darunter auch die »Matthäus-Passion«, die viermal hintereinander aufgeführt wurde und bei der ich sowohl den Evangelisten als auch die Tenor-Arien sang. Ehe es zu die sen Aufführungen kam, gab es bedeutende Schwierigkeiten, da sich Furtwängler kaum mit dem Orchester verständigen konnte, dessen Mitglieder nur spanisch sprachen, wovon er kein Wort verstand. Das hatten sie bald heraus und nützten es bei der Probe auf nicht sehr noble Weise, was Furtwängler allmählich zur Verzweißung brachte. Schließlich verlor er die Nerven, warf, aufs höchste erregt, das schwere eiserne Dirigentenpult um, das nicht den Musikern, sondern der Altistin Margarethe Klose und mir auf die Beine fiel. Dann stürzte er davon und erklärte dem Direk tor wütend, daß er sich eine solche Behandlung nicht bieten las se, daß er das Konzert nicht dirigieren und mit dem nächsten Flugzeug abreisen werde. 232
XIV /
WIR S IN D ALL E N U R M E N S C H E N
Die Affäre ging durch die argentinische Presse, und es bedurf te großen diplomatischen Geschicks, Furtwängler zu beruhigen. Schließlich glätteten sich die Wogen, das Konzert fand statt und Furtwängler erlebte einen überwältigenden Triumph. Als ich nach der ersten Aufführung ins Hotel kam, lag da für mich ein kleines Kärtchen mit der Unterschrift des Studienleiters Erich Engel und den Worten: »Ich danke Ihnen für das Erlebnis.« Das hat mich sehr gefreut. Richtig stolz aber machte mich eine Äuße rung Furtwänglers, die mir meine Frau später hinterbrachte. »Ihr Gatte«, so sagte er zu ihr, »ist für mich der beste Fwangelist mei nes I^bens.« Das bedeutete mir mehr als das üppigste Honorar und die schmeichelhaftesten Pressestimmen. Noch einen seltsamen Zwischenfall gab es mit Furtwängler. Bei einem seiner Colon-Konzerte sollte Margarethe Klose Mah lers »Lieder eines fahrenden Gesellen« singen, wurde aber krank. Daraufhin ließ mir Furtwängler die Solostimme ins Hotel brin gen mit der Frage, ob ich nicht für die Klose einspringen könnte. Nun gab es wohl eine Transposition der Lieder für höhere Stim me, aber für diese Fassung fehlte das Orchestermaterial. Abgese hen davon, daß ich die Lieder noch nie gesungen hatte, erledigte sich die Angelegenheit damit praktisch von selbst. Ich wunderte mich aber, daß der große Dirigent diese Notlösung überhaupt in Erwägung gezogen hatte. In Buenos Aires kam ich Furtwängler privat etwas näher. Das »Damenkomitee« der Stadt, eine für Nord- und Südamerika typi sche Einrichtung, gab zu Ehren des Dirigenten ein Galadiner im Nobelhotel Plaza, zu dem ich eingeladen war. Ich hatte die Ehre, Furtwängler direkt gegenüber zu sitzen, und so kam ich sehr intensiv mit ihm ins Gespräch, konnte seine Meinung über Musik und Musikinterpretation hören und seine fundierten Ansichten bewundern. Zur Erinnerung an dieses Gespräch habe ich die von Furtwängler signierte und mit ein paar netten Worten versehene Alenükarte in meiner Autographensammlung aufbewahrt. Meine nächste Begegnung mit Furtwängler schlägt gleichsam 233
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
die Brücke zwischen Salzburg und Bayreuth. Während der Fest spiele 1953, bei denen ich im »Don Giovanni« unter P^urtwängler und in »Cosi« unter Böhm mit wirkte, hatte ich zwischen zwei Salzburger Vorstellungen eine Verpflichtung in Bayreuth zu erfüllen, wo alljährlich im Festspielhaus Beethovens »Neunte« aufgeführt wurde. Nun war der Fall so: in den vorangegangenen Jahren hatte immer F'urtwängler dirigiert, für 1953 hatte man Paul Hindemith eingeladen, die Leitung des Konzerts zu übernehmen. Das scheint Furtwängler richtig irritiert zu haben. Als er erfuhr, daß ich die Tenor-Partie sang, kam er zu mir in die Garderobe und sagte: »Müssen Sie denn das machen? Sie singen doch ohnehin so viel mit mir hier in Salzburg!« —Ich war überrascht und ant wortete: »Herr Doktor, ich habe schon vor langer Zeit die Einla dung angenommen und muß meine Zusage selbstverständlich einhalten.« Darauf Furtwängler: »Nun ja, wenn es sein muß... Aber Sie müssen mir nachher genau berichten, wie’s der Hinde mith gemacht hat!« Das versprach ich gerne und fuhr mit meiner Frau nach Bay reuth, wo wir beide zum ersten Mal die Verzauberung am Grü nen Hügel erlebten. Man hatte uns zwei Plätze für die »Götter dämmerung« reserviert, wir kamen mit dem Auto so knapp vor der Vorstellung an, daß wir das Hotel nicht mehr aufsuchen konnten, sondern uns rasch in einer Künstlergarderobe umziehen mußten. Und dann nahm uns die Atmosphäre und das künstleri sche Ereignis völlig gefangen. Wir waren beide tief beeindruckt, obwohl mir außer der Varnay und Windgassen die Besetzung nicht mehr in Erinnerung ist. Aber gerade darin erfüllte sich ja wohl der tiefere Sinn von Bayreuth: nicht die Mitwirkenden sind entscheidend, sondern Richard Wagner und sein Werk. Am andern Tag wechselte man von Wagner zu Beethoven. Die Probe unter Hindemith war nicht aufregend; auch nicht die Aufführung. Mit sparsamsten, etwas eckigen Dirigiergesten und seinem kurzen Militär-Taktstock machte sich Hindemith auf kol 234
XIV /
WIR S IN D A L L E N U R M E N S C H E N
legiale Weise dem Orchester und den Solisten verständlich. Von Temperament, PTuer, Suggestion, wie sie sonst von großen Diri genten auszugehen pflegen, habe ich nichts verspürt. Die »Neun te« wurde schlicht und korrekt musiziert. Und so hat denn auch die Aufführung und die Dirigierleistung Hindemiths weniger Eindruck bei mir hinterlassen als das anschließende Treffen in der »Eule«, dem berühmten Künstlerlokal am »Hügel«, und die damit verbundene völlig zwanglose und menschlich sympathi sche Begegnung mit dem von mir hochverehrten Komponisten Hindemith. Zum Andenken daran brachte ich ein Porträtfoto des Meisters heim, dem er seinen Namenszug mit schwungvoller Feder über die mächtige Stirne geschrieben hatte. Am nächsten Tag fuhren wir nach Salzburg zurück und wieder einen Tag später stand der »Don Giovanni« auf dem Programm. Furtwängler erschien voll Neugierde und Ungeduld in meiner Garderobe und die Frage »No, wie war’s?« platzte förmlich aus ihm heraus. Ich sagte: »Ja, Herr Doktor, es war eine Neunte, aber kein Furtwängler!« Das hat dem großen Dirigenten sichtlich wohlgetan. Bis zuletzt habe ich unter Furtwängler gesungen: in der »Zau berflöte«, im »Fidelio« und immer wieder in der »Neunten« und in der »Matthäus-Passion«. Und ich wurde schließlich - in der Salzburger Felsenreitschule mit ihrer problematischen Akustik — Zeuge seiner zunehmenden Schwerhörigkeit. Machte sich der Verkehrslärm von der Straße stärker geltend oder trommelte gar der Regen auf das ausgespannte Dach, hatten wir oft das Gefühl, gleichsam im luftleeren Raum zu singen. Der Kontakt mit dem Dirigentenpult wurde immer schwächer und wir spürten deut lich, daß Furtwängler musikalisch anders atmete als wir; es man gelte also an der nötigen Koordination. 1955, zwei Jahre später, mußte er dann krankheitshalber die Leitung der »Zauberflöte« an Georg Solti abgeben. Doch an und für sich war diese »Zauberflöte« in Salzburg ein besonderes Ereignis, da Oskar Kokoschka das Bühnenbild für die 235
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
Felsenreitschule und die Kostüme entworfen hatte. Kokoschka war schon bei den ersten Proben als höchst interessierter Beob achter zugegen. Er war nicht immer mit der Regie Herbert Grafs einverstanden und versuchte, seine Wünsche in sehr verbindli cher Weise geltend zu machen. Als es dann zu den Kostümproben kam, zeigte sich, daß das ganze Ensemble mit der von ihm entworfenen Kostümierung alles eher als glücklich war. Ich wurde als Märchenprinz aus der Eichendorff-Welt gekleidet, mit einem spitzen grünen Hütel mit kecker Feder, das mich lebhaft an die italienischen Bersaglieri erinnerte, was mich persönlich jedoch gar nicht störte. Papageno, Erich Kunz, der sich nie ein Blatt vor den Mund nahm, brachte die Unzufriedenheit der Kollegen in halblauten Andeutungen zum Ausdruck, doch leider so, daß sie der Künstler hören mußte. Kokoschka ließ sich aber in keiner Weise beeinflussen, lehnte jede Änderung an seinen Entwürfen strikte ab und war sichtlich verstimmt, so daß bei den Schlußproben eine leicht angespannte Atmosphäre herrschte. Aber dann ging die Premiere mit großem Erfolg über die Bühne und ich glaube, auch Kokoschka war innerlich versöhnt. Wir feierten nachher die Premiere mit ein paar Freunden in einem Salzburger l.okal. Die Feier zog sich hin, es wurde später als beabsichtigt. Wir mußten noch einmal zum Festspielhaus zurück, weil wir dort unseren Wagen abgestellt hatten. Es war gegen halb zwei Uhr früh, als wir unseren Parkplatz erreichten, und der Festspielbezirk lag im hellen Mondlicht. Ich sah mich um. Da kam vom Domplatz her eine Gesellschaft, aus der sich bald die markante Gestalt Oskar Kokoschkas löste. Auch er hatte offenbar mit Freunden »nachgefeiert«. Er bemerkte mich, lief auf mich zu, umarmte mich vor allen Leuten und küßte mich auf bei de Wangen, laut rufend: »Mein Tamino, mein Tamino!« Als Zeichen seiner Verbundenheit sandte mir der große Künstler eine seiner Lithographien, ein spätes Selbstporträt, mit einer sehr persönlichen Widmung: »Dem lieben Sänger Mozarts 236
XIV /
WIR S IN D AL L E N U R M E N S C H E N
in Dankbarkeit für ein künstlerisches Erlebnis. Oskar Kokoschka, Salzburg, Sommer 1955.« Wir sind seit damals in Verbindung geblieben und standen auch gelegentlich im Schriftwechsel. In einem seiner Briefe aus Villeneuve an mich, datiert mit 4. September 1956, kam er aus führlich auf die Salzburger »Zauberflöte« zu sprechen. »Heute hörten wir«, so schrieb er, »die >Zauberflöte< von Belgien über tragen und wir waren wieder ganz hingerissen von Ihnen, von der süßen Pamina und der herrlichen Königin der Nacht. Ich will gar nicht von dem armen Papageno reden, der noch so leibhaftig und voll Humor uns im Sinne gegenwärtig ist. —Wie herrlich war doch diese Aufführung, und vollkommene Künstler- und Meisterschaft von Ihnen allen hat Mozarts Genius noch einmal im hellsten Licht erstrahlen lassen in einer Zeit, der die Mensch lichkeit und das Spirituelle schon fast zur Sage zu werden droht. - Ihre wunderbare Stimme und Einfühlung habe ich erst heute so recht genossen, da mich nichts mehr ablenkte, kein Gedanke mehr daran, ob ein Regen die Aufführung unmöglich machte oder störte, ich war tief ergriffen und ebenso meine Frau. —Ich danke Ihnen auch noch herzlichst für die lieben Geburtstagswün sche, wollte bloß, ich wäre noch fünfzig Jahre jünger ... Mit allen liebsten Wünschen und in aufrichtiger Verehrung, lieber Meister, Ihr ergebener Oskar Kokoschka.« Als ich Ende der dreißiger Jahre anläßlich meines ersten Gast spiels in Brüssel den Direktionsraum des Palais des Beaux Arts betrat, fiel mir unter den Bildern der Z^lebritäten das Porträt eines schlanken, jungen Mannes auf Ich fragte Direktor Cuvillier, den späteren Begründer der »Jeunesses musicales«, wer das sei. »Das ist Herbert von Karajan«, erhielt ich zur Antwort, »ein hochbegabter Mann, der bei uns viel konzertierte, als er General musikdirektor in Aachen war. Er hat hier seine ersten Auslands erfolge gefeiert.« Das war das erste Mal, daf^ ich Karajan »zu Gesicht« bekam. 237
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
denn bei seinem einmaligen Gastspiel in der alten Staatsoper am Ring, als ich im »Tristan« die Stimme des Seemanns vom Schnürboden sang, konnte ich ihn —wie schon erwähnt —nicht sehen. Eine meiner frühesten Mitwirkungen unter seiner Stabführung fand 1946 im Rahmen einer Aufführung der »Matthäus-Passion« im Wiener Musikverein statt, bei der Patzak den Pwangelisten, ich die Tenor-Arien sang. Auf der Heimfahrt von einer der Pro ben fügte es sich, daß Karajan neben mir auf der rückwärtigen Plattform der Straßenbahn stand. Wir kamen auf die bevorste hende Salzburger Festspiel premiere von Mozarts »Don Giovan ni« zu sprechen, bei der ich wieder den Octavio singen sollte. Karajan war für die musikalische Leitung vorgesehen, doch die amerikanische Besatzungsmacht legte dagegen ihr Veto ein. Bei der Straßenbahnfahrt legte mir Karajan in völlig entspanntem, legerem Gespräch die Besetzung dar, die für ihn bereits fest stand, bis auf die Donna Anna, die später mit Ljuba Welitsch besetzt wurde. In Salzburg übernahm dann Josef Krips statt Karajan die »Don Giovanni«-Vorsteilung, die erstmals in italie nischer Sprache gesungen werden sollte. Das ergab Schwierigkei ten, weil der italienische Souffleur noch nicht eingetroffen war. Man vertröstete uns von einer Probe zur andern, aber er kam nicht. Karajan, der zu jeder Probe erschien und sich als stiller Beobachter in irgendeine Ecke zurückzog —was Krips offensicht lich irritierte -, sah unsere Notlage, kam nach vorne und sagte: »Ich werde soufflieren!« Er schlüpfte gewandt in den Souffleur kasten und half uns solange aus, bis der Souffleur eintraf. Karajan hatte damals bereits eine wichtige, aber undefinierbare Position in Salzburg. Die Direktion hatte ihm sogar einen alten Steyr-Wagen samt Chauffeur zur Verfügung gestellt, damit er leichter das Festspielhaus erreichen konnte. Er wohnte auf der Zistelalm, oben am Gaisberg, während wir mit unseren Kindern in halber Höhe auf der Gersbergalm Quartier genommen hatten. Nach einer Probe bat ich ihn, mich im Wagen auf die Alm mit238
XIV /
WIR S IN D ALLE N U R M E N S C H E N
2unehmen. »Aber gerne«, sagte er, »wir müssen nur vorher mei ne Frau abholen. Sie spielt in Parsch Tennis.« Während der Fahrt erzählte ich, daß ich daran dachte, mir ein Auto anzuschaffen. Das interessierte ihn sehr, und es gab bis zu unserer Ankunft oben kein anderes Gesprächsthema mehr. In diesem Jahr produzierte Karajan bereits mit den Wiener Philharmonikern die »Zauberflöte« für »His Masters Voice«, eine der ersten Aufnahmen nach dem Krieg. Irmgard Seefried sang die Pamina, Wilma Fipp die Königin der Nacht, Ludwig Weber den Sarastro, FTich Kunz den Papageno, ich den Tamino. Da passierte es mir, daß ich einen Termin einfach übersah. Alles war zur Aufnahme bereit, nur ich fehlte. Als mich daheim der mahnende Anruf erreichte, sprang ich auf die nächste Straßen bahn. Ich hatte ja noch keinen Wagen und Taxis waren damals Mangelware. Während die Tramway langsam dahinratterte, wur den mir die Minuten zu Stunden. Als ich atemlos das Ziel erreichte und ein paar entschuldigen de Worte stammelte, sagte Karajan kurz angebunden zu mir: »Ich bin gewohnt, daß meine Künstler zu gegebener Zeit eingesungen und aufnahmebereit vor dem Mikrophon stehen!« Man kann sich meine Verfassung vorstellen, als ich nun unmittelbar die Flöten-Arie »Wie stark ist nicht dein Zauberton« schallplattenreif zu singen hatte. In solchen Situationen muß der Sänger Nerven aus Stahl haben, um trotzdem sein Bestes zu geben. Die Aufnahme glückte und es blieb bei Karajan keine dau ernde Verstimmung zurück. Ich sang bald darauf im Musikverein unter seiner Leitung das Verdi-Requiem —es war Karajans erste Interpretation des Werkes nach dem Krieg. Jahre später erreichte meine Frau ein Anruf aus Berlin : »Kann Ihr Mann morgen für einen erkrankten Kollegen bei der SchalIplattenaufnahme des Mozart-Requiems mit den Berliner Philharmonikern unter Her bert von Karajan einspringen ?« Ich befand mich gerade in Annaberg bei Mariazell auf FTholung von einer schweren Bronchitis, zögerte aber trotzdem nicht 239
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
mit meiner Zusage, denn diese Aufgabe lockte mich zu sehr. Die Möglichkeit, wieder mit Karajan zu musizieren, wollte ich mir nicht entgehen lassen. Ich fuhr sofort von Annaberg nach Wien —meine Frau hatte bereits eine Flugkarte besorgt —und flog noch am selben Abend nach Berlin. Als ich spät nachts in mei nem Zimmer im Hotel Kempinski anlangte, fiel ich todmüde ins Bett. Es war vereinbart, daß ich am nächsten Morgen vor 9 Uhr mit dem Wagen abgeholt würde. Ein Klingeln weckte mich aus tiefem Schlaf. Ich hob den Hörer ab und hörte eine Stimme sagen: »Wir sind da und warten in der Halle auf Sie!« Es war zehn vor neun. Ich hielt mein Gesicht unter den Wasserstrahl, sprang iii die Kleider und haste te unrasiert und ohne Frühstück hinunter in die Halle. Während der Fahrt dachte ich »Wenn das nur gut geht...«, und blitz schnell kam mir die Erinnerung an die seinerzeitige »Zauberflö ten«-Aufnahme mit Karajan in Wien, bei der ich gleichfalls unvorbereitet vors Mikrophon getreten war. Wir kamen gerade noch zurecht. Karajan dankte mir mit net ten Worten für mein Einspringen, ich konnte mich in der Garde robe noch rasch mit ein paar Tönen einsingen, dann kam schon das Zeichen zum Beginn. Wilma Lipp, Christa Ludwig und Wal ter Berry hatten bereits ihre Plätze auf dem Podium eingenom men, ich setzte mich dazu und schon war mein Fdnsatz da: »Mors stupebit et natura ...« Es ging alles gut. Die Aufnahmen verliefen zur allgemeinen Zufriedenheit, und die kurz darauf erschienenen Platten fanden große Anerkennung. Im Mai 1958 sang ich an der Mailänder Scala —neben dem Belmonte in der »Entführung« —unter Karajan die Stimme des Seemanns im »Tristan«. Vor meiner Abreise kam der Sekretär des Maestro, André von Mattoni, zu mir in die Garderobe und bat mich, für Karajan ein Paket nach Wien mitzunehmen. Wegen der Formalitäten an der Grenze mußte ich wissen, was in dem Paket enthalten sei. »Wäsche«, erklärte Mattoni und zeigte mir fein plissierte weiße Smokinghemden, wie sie damals in Italien 240
è 2 9
P o r tr ä t von B o i^ d a r Ja k a c, d em bedeutendsten lebenden slowenischen G r a p h ik e r ,
sig n iert m it
17.
1 1 .
1 9 5 1
F E S T IV A L
DETE
S O M M E R F E S T S P IE L E
D UB ROÏ N I K îO.VII ~ 1 4 Vili
DUBiOVACKE^UETNE IGR I" ; HI;IM IM*« ♦ I” »* Du bist die Ruh’< wählte, da war man versucht, diese Wor te als Motto dem ganzen Abend voranzustellen. Haben wir das jemals so gehört.^ Im stillen Sternenlicht letzter Entmaterialisie rung, in so makelloser Kantilene, ohne jeden äußeren Affekt, so daß der tiefe Friede, der daraus strömte, schier die Welt verges sen ließ. Wer das zuwege bringt, der hat jenen Grad erreicht, wo Schale und Kern zur Einheit der Natur, wo Berufung und Künst lerschaft zum Untrennbaren, zur Erfüllung verschmolzen sind. Dermota ist in seinem F^ach auf einsamer Höhe angelangt. 291
DERMOTA / TAUSENDUNDEIN ABEND
Nicht jeder Mozart-Sänger darf sich der Vollendung auch bei Schubert rühmen. Aber da ist jedes der Lieder, wie es sein muß ... Wir haben herbere, nie aber innigere Wiedergaben, grüb lerisch-gedanklichere Durchforschung der Sinngebung, nie aber eine tiefer empfundene und überzeugendere gehört. Wer an die sem Abend als Gast in Wien weilte, der mag erkannt und gespürt haben, wie Schuberts Genius aus dieser Landschaft erwuchs, wie man ihm nur hier wieder begegnen kann. Hilda Berger-Weyerwald am Flügel: Was soll zum Lobe der seltenen Frau noch gesagt werden, die dem Künstler im Leben und im Liede Weggenossin zu jenen Gipfelhöhen der Kunst geworden ist? Aus der Zweisamkeit zur Einheit ist ein weiter Weg, und nicht vielen ist er vergönnt. Die Begeisterung, die die ses Wiener Familienfest umtoste, ist schwer mit Worten zu beschreiben.« Es liegt mir durchaus nicht, mein eigenes Lob zu singen. Aber zum Leben eines Sängers gehört nun einmal auch das Urteil der Presse. Ich bewahre daheim ganze Stöße von Kritiken aus aller Welt auf, von denen hier nur ein paar Beispiele gebracht werden können, wobei man mir die kleine Eitelkeit wohl verzeihen wird, daß ich mir nicht gerade die schwächeren ausgesucht habe. Um diese 2^it hatte ich mir bereits einen weiten Bereich des deutschen Liedes erarbeitet: von Haydn bis Richard Strauss, von Mozart bis zur gemäßigten Moderne. Marx, Pfitzner, Hindemith, Salmhofer, Uray, Skorzeny, Kornauth, Rubin, von Einem, Schol ium und viele andere, das waren die Zeitgenossen, deren Lieder ich in meine Programme aufnahm und zum Teil auch aus der Taufe hob. Richard Strauss und Joseph Marx haben mich noch selbst am Flügel begleitet, und davon sind auch Schallplattenaufnahmen im Handel erschienen. Mit Marx verband mich bis zuletzt eine sehr persönliche Beziehung. Er apostrophierte mich stets mit dem Ehrentitel »Mein Liedersänger«. Übrigens sind aus seiner Schule zwei Generationen slowenischer Komponisten hervorgegangen, 292
XVI /
VIELE SIND BE R U FE N
SO daß seine Verbindung mit meiner Heimat sehr rege war. Im Scherz sagte er gerne : »Ob die slowenischen Komponisten Kom munisten sind, weiß ich nicht, aber daß sie überzeugte >Marxisten< sind, davon kann ich mich immer wieder überzeugen, wenn ich als Gast in Ljubljana von ihnen geradezu verwöhnt werde.« Bei einer Matinee, die anläßlich seines 8o. Geburtstages im Jah re 1963 im Brahmssaal des Wiener MusikVereins stattfand, sang ich, zum letzten Mal von Marx selbst begleitet, seine Lieder. Damals erinnerte ich ihn noch einmal an mein Anliegen: »Herr Hofrat, sie haben mir so oft versprochen, etwas Neues für mich zu schreiben«, worauf er in seiner humorvollen Art erwiderte: »Lieber Freund, Sie müssen Geduld haben. Die Muse hat mich noch nicht geküßt.« Als Trost schrieb er für uns eines seiner beliebtesten Lieder, das »japanische Regenlied«, ab und über sandte es uns mit einer sehr persönlichen Widmung. Zwei Jahre später war Marx gestorben. In meiner Autogra phensammlung befinden sich mehrere seiner Lieder in Urschrift, darunter eines seiner schönsten »Hat dich die Liebe berührt« — ein kostbarer Schatz, mir besonders teuer, und deshalb ständig in meinem Repertoire. Die Todesnachricht erreichte mich in München, während ich dort als Juror wirkte. Erik Werba, der mit Marx eng befreundet war und gleichfalls in der Jury saß, regte spontan eine Gedenk sendung im Bayerischen Rundfunk für den verstorbenen Meister an. Ich sang, von Werba begleitet, eine Gruppe seiner Lieder, und die Aufzeichnung wurde noch am selben Tag gesendet. Das war mein Abschied von Joseph Marx. Mehrere Komponisten haben eigens für uns Lieder geschrie ben. So hat uns etwa Fritz Skorzeny drei seiner Lieder nach Tex ten von Christian Morgenstern gewidmet: »Frühlingsregen«, »Leise Lieder« und »Der Abend«, die auch, von uns interpre tiert, auf Schallplatte festgehalten wurden, und Gottfried von Einem hat uns sein Weinheber-Lied »An eine Geliebte« zugeeig net, das wir 1977 anläßlich der Eröffnung des Hobokensaales in
293
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
der Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek zur Uraufführung brachten. Auch eine Reihe Komponisten aus meiner Heimat haben mir Lieder gewidmet, die ich in Wien erstaufgeführt habe. Ich halte das Musikschaffen meiner slowenischen Landsleute für sehr wertvoll, und es verdient, international bekanntgemacht zu wer den. Es ist mir daher eine Herzensangelegenheit, ihre Lieder in mein Repertoire aufzunehmen und sie auch einer breiteren Öffentlichkeit darzubieten. Die Liederabende im Brahmssaal des Wiener Musikvereins sind uns besonders ans Herz gewachsen, denn sie haben eine ganz eigene Atmosphäre. Zugang zum Publikum fanden wir überall, wo wir musizierten, aber diese Harmonie mit den Zuhö rern, diese Wärme, diese fast schon familiäre Stimmung, die sich im Verlauf des Abends wie von selbst einstellt —das haben wir nur in Wien erlebt. Etwas ganz Besonderes sind auch die sommerlichen Palaiskon zerte —etwa im Auersperg, Palffy und Pallavicini —und vor allem die Abende im Spiegelsaal von Schönbrunn, wo Touristen aus aller Welt oft zum ersten Mal dem deutschen Lied begegnen. Aber wir haben nicht nur in Wien, nicht nur in Österreich Liederabende gegeben, wir haben mit dem Lied ganz Europa bereist, von Helsinki im Norden bis Rom, Florenz und Neapel im Süden, von Budapest, Belgrad und Bukarest im Osten bis Amsterdam, London und Paris im Westen. Und ich darf wohl ein wenig stolz darauf sein, daß es uns in drei Kontinenten gelungen ist, das deutsche Lied so zu interpretieren, daß es über all Verständnis, ja Begeisterung fand. Als ich zum ersten Mal in der Beethovenhalle in Bonn die »Winterreise« sang, verfaßte ein Kritiker über den Abend ein ausführliches Feuilleton, das in der Feststellung gipfelte: »Wir haben die >Winterreise< schon oft und von bedeutenden Interpre ten gehört, aber nun haben wir zum ersten Mal den authenti schen Schubert erlebt. Wie Anton Dermota sein Organ durch die 294
XVI /
VIELE SIND B E R U FE N
leisen Passagen führt, ist einfach faszinierend, wie er das Halb dunkel des Zwischenreichs aus Sehnsucht und Traum klanglich immer genau zu treffen versteht, ist packend im einzelnen wie auf die Dauer.,. Ideal im Sinne des problemlosen Zusammen spiels und Mitgehens war die Begleitung von Hilda Dermota am Klavier. Auch hier weiche, verhaltene, beseelte Klänge ohne übermäßigen Gefühlsschwall —schwingende Kantabilität, Wie ner Schubert.« Und als wir beim V. Internationalen Musikfestival in Barcelo na einen Abend mit ausgewählten Liedern von Beethoven, Schu bert, Schumann und Brahms boten, berichtete »La Vanguardia« den Lesern: »Bewundernswert an Anton Dermota ist nicht nur seine wohlklingende, kräftige und beherrschte Stimme, die ihm auch an jenen Stellen, die ein Höchstmaß an männlicher Zärtlich keit verlangen, den Dienst nicht versagt. Sein außerordentlich fei nes Musikgefühl, aus dem er unzählige Mittel und Nuancen des Ausdrucks schöpft, ermöglicht ihm vollkommene seelische Hin gabe an jedes Lied, mit der es ihm gelingt, uns die höchste der Illusionen zu vermitteln: daß er nicht ein auswendig gelerntes Werk interpretiert, sondern dieses unter dem Einfluß höchster Inspiration neu kreiert. Bewundernswert ist ebenso die strenge Auswahl, mit der Dermota seine Programme nach höchsten künstlerischen Maßstäben zusammenstellt. Diese Meisterlieder stellen gleichzeitig auch hohe Anforderungen an den Begleiter, denen Hilda Dermota mit ihrem virtuosen Spiel und feinem musikalischen Empfinden aufs Höchste gerecht wird. So entsteht eine einmalige Synthese vollkommener Schönheit.« Wenn ich heute versuche, die positive Wirkung meiner Lied interpretation zu erklären, so würde ich am ehesten zu der Fest stellung kommen, daß ich mich nie gescheut habe, Empfindun gen auszudrücken. Ich bin überzeugt, daß beim Liedgesang Gefühle mitschwingen müssen und daß heute das Lied von vie len Interpreten zu intellektuell aufgefaßt wird und dadurch unterkühlt wirkt. Die Blüte des Liedes liegt in der Romantik. Das 295
DERMOTA / TAUSENDUNDEIN
ABEND
kann und darf man nicht verleugnen, auch wenn romantische Gefühle heute nicht hoch im Kurs stehen, ja sogar gerne belä chelt werden. Schließlich soll jedes Kunstwerk aus dem Geist der Zeit seiner Entstehung heraus interpretiert und nicht willkürlich dem jeweiligen Zeitgeschmack angepaßt werden.
XVII
Das Schöne erhebt Internationale Festspieltätigkeit —Meine Orgel — Autographen- und Kunstsa/n/neln als Feidenschaß
Wenn von Festspielen die Rede ist, denke ich nicht an die Infla tion, die diese Einrichtung in den letzten Jahrzehnten erfahren hat, ich denke vielmehr zuerst an Salzburg, Wiege der Festspiele unserer Zeit, das von Anbeginn meiner Laufbahn ein wesentli cher Bestandteil meiner beruflichen Täti^eit war. Über zwanzig Jahre habe ich dort fast ohne Unterbrechung Sommer für Som mer gesungen und die festlichen Auftritte in der Mozartstadt zählen zu meinen schönsten Erlebnissen. Wenn ich heute auf der Autobahn an Salzburg vorbeifahre, dann grüße ich im Geist die unvergleichliche Stadt, grüße ich Mozart voll Dankbarkeit dafür, daß ich dort, wo der Genius geboren wurde, so lange in seinem Dienst vStehen durfte. Mehrere Sommer sang ich auch bei den Bregenzer Festspielen, wo ich auf der riesigen Seebühne als Sultan Suleiman in Johann Strauß’ »looi Nacht« gegen Wind und Wetter anzukämpfen hat te. Kam der Wind von der falschen Seite, dann wurde die Stim me hoffnungslos nach Lindau verweht und man mußte sich sehr anstrengen, um die Zuhörer nicht völlig zu enttäuschen. Begann es zu regnen —und das passierte öfter —,mußte die Vorstellung abgebrochen werden, und der ganze Zauber fiel regelrecht ins Wasser. Es war trotzdem eine interessante Aufgabe und —nach dem 297
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
Alfred in der »Fledermaus« und dem Herzog in der »Nacht in Venedig«, die ich im Haus am Ring gesungen hatte - meine drit te Begegnung mit Johann Strauß, die mir, ich bekenne es gerne, Freude gemacht hat. Meine Partnerin als verführerische Leila war die charmante Fdanni Steffek mit ihrem silbrigen Sopran. Ein Jahr darauf sang ich im intimen Bregenzer Kornhausthea ter unter der musikalischen Leitung Heinrich Hollreisers den schmachtenden Liebhaber Nureddin in Peter Cornelius’ liebens wertem »Barbier von Bagdad« und trat damit die Nachfolge mei nes hochgeschätzten Kollegen Georg Maikl an, der in dieser Par tie in der alten Staatsoper brilliert hatte. Der Barbier selbst, einst eine Leibrolle des großen Richard Mayr, war in Bregenz bei Oskar Czerwenka in besten Händen. Auch als Konzertsänger wirkte ich bei den Bregenzer Festspielen mehrmals mit. So erin nere ich mich an eine sehr schöne »Schöpfung« unter Joseph Keilberth und an die konzertante Urfassung von Beethovens »Fidelio« unter Ferdinand Leitner, an das »Buch mit sieben Sie geln« unter Josef Krips sowie an mehrere Liederabende gemein sam mit meiner Frau, bei denen wir unter anderem die Zyklen »Die schöne Müllerin« und »Dichterliebe« brachten. Mit Bregenz ist auch eine kleine heitere Begebenheit verbun den. Auf Anregung und unter der Führung des Akademischen Malers Alfred Birkle, den wir von Salzburg her kannten, fuhren wir mit den Kindern in legerer sommerlicher Adjustierung —ich in kurzer Lederhose —nach Uberlingen und besichtigten dort die schöne Basilika. In meiner Begeisterung über die sakralen Kunst schätze, die es da zu bewundern gab, überstieg ich das Absperr seil vor dem Altar, um eine der herrlichen Holzplastiken besser zu sehen. Da trat eine geistliche Schwester, die mich offenbar im Verborgenen beobachtet hatte, auf mich zu und sagte sanft : »Das ist verboten. Sie dürfen nicht den abgesperrten Altarraum betre ten!« Ehe ich etwas erwidern konnte, nahm unser Freund die Schwester beiseite und flüsterte ihr etwas ins Ohr, worauf sie 298
XVII /
DAS SCHÖNE ERHEBT
eine ehrfürchtige Haltung annahm und mich gewähren ließ. »Was haben Sie ihr denn gesagt?« fragte ich leise. »Daß sie ein Bischof in Zivil sind«, raunte er mir belustigt zu. Inzwischen hat te die geistliche Schwester meine Frau und meine Kinder bemerkt. Sie wandte sich daher im Zweifel neuerdings mit gedämpfter Stimme an unseren Maler. Der aber war um die Ant wort nicht verlegen. »Er ist natürlich evangelisch«, klärte er sie auf Damit gab sich die Gute zufrieden und zog sich achtungsvoll zurück. Als wir die Kirche verließen, standen Buben und Mäd chen am Straßenrand Spalier. Das hatte die liebe geistliche Schwester arrangiert, der ich hiemit Abbitte leiste für den kleinen Schwindel. Im übrigen hat Bregenz seine eigene Festpielatmosphäre, die ich wohltuend empfand. Gemütlichkeit herrscht vor, die Turbu lenz von Salzburg fehlt. Sind einmal die Proben vorbei, genießt man als Sänger so etwas wie einen erholsamen Urlaub. Atmosphärisch näher bei Salzburg liegt Edinburgh mit seinen Festspielen. Auch dort thront eine Festung über der Stadt, auch dort gibt es das gewisse lebhafte gesellschaftliche Treiben. Ich gab in Edinburgh mit meiner Frau einen Liederabend mit klas sisch-romantischem Programm und wirkte unter Otto Klemperer bei einer Aufführung von Gustav Mahlers »Lied von der Erde« mit. Anstatt einer Altistin war ein Bariton, nämlich Dietrich Fischer-Dieskau, mein Partner. Eine Besetzungs-Variante, die schon von Mahler vorgesehen, für mich aber neu war. Beim Holland-Festival in Amsterdam habe ich zum ersten Mal in Mahlers »Sinfonie der Tausend« mitgewirkt. Es war eine beachtliche Aufführung. Rafael Kubelik dirigierte. Als ich ihm bei der ersten Orchesterprobe verriet »Herr Kapellmeister, ich singe den Part in dieser Sinfonie zum ersten Mal«, sah er mich mit seinen großen Augen ein wenig verschmitzt an und erwider te: »Und ich dirigiere sie zum ersten Mal!« Damit war von vorn herein die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gege ben. 299
DERMOTA / TAUSENDUNDEIN ABEND
Daß ich auch beim Maggio musicale in Florenz sowie bei den Bayreuther Festspielen mitwirken durfte, wenn auch dort nicht im Dienste Wagners, habe ich bereits erwähnt. Ergänzen aber möchte ich noch, daß auch Kopenhagen am Rande der interna tionalen Festivals in seinem Vergnügungspark Tivoli alljährlich sein eigenes Musikfest feiert. Dort sang ich in den sechziger Jah ren im Rahmen eines »Così fan tutte«-Gastspiels von Mitglie dern der Staatsoper in der schon legendären Wiener Besetzung, wobei die Aufführung kurioserweise nicht im Opernhaus der Stadt, sondern im Konzertsaal des Vergnügungsparks stattfand. Mit der gleichen Aufführung gastierten wir übrigens auch zur Festspielsaison im Opernhaus von Monte Carlo, einem kleinen, goldstrotzenden Residenz-Theater, das sich im Gebäude des Spielcasinos befindet. Wir sangen und agierten dort Wand an Wand mit dem Roulette. Theaterspiel und Glücksspiel unter einem Dach. Wir hatten die Erlaubnis, im Casino aus- und einzu gehen, und ich nützte die Gelegenheit als interessierter Beobach ter, einige Kollegen aber versuchten ihr Glück mit der rollenden Kugel, natürlich mit wechselndem Erfolg. Am Vormittag wäh rend unserer Probe fand im Park des Casinos als Touristenattrak tion ein Schießen auf lebende Tauben statt. Wir waren darüber so empört, daß sich die Gattin Paul Schöfflers spontan entschloß, ein Protestschreiben an den Fürsten zu richten. Tatsächlich wur de im Jahr darauf, als ich als Alfred in »Traviata« mit einem rein italienischen Ensemble wieder dort gastierte, nur noch auf Ton tauben geschossen. In meiner Heimat veranstaltet Dubrovnik, die historische Stadt Dalmatiens, die in ihrer Schönheit gerne mit Venedig ver glichen wird, seit vielen Jahren sommerliche Festspiele, die fast ausschließlich unter freiem Himmel stattfinden, was dank der konstanten Wetterlage und des milden Klimas —im Gegensatz zu Bregenz —kein Risiko bedeutet. Ein Liederabend mit Mozart, Schubert und Schumann (»Dichterliebe«) im Atrium des herrli chen Palazzo Sponsa wird mir unvergeßlich bleiben. Es war ein 300
XVII /
DAS SCHÖNE ERHEBT
wunderschöner Abend, über uns spannte sich ein südlicher Ster nenhimmel, um uns, 2um Teil zwanglos gelagert auf den Stufen und auf dem Steinboden, ein andächtig lauschendes Publikum, unter ihm auffällig viel Jugend in legerer, malerischer Kleidung. In solch lockerer, gelöster und dennoch festlicher Atmosphäre läßt es sich wunderbar musizieren. Ein anderes Mal sang ich Bachs h-Moll-Messe unter Milan Horvath in der schönen alten Franziskanerkirche und war sehr beeindruckt von der Klangfülle des einheimischen Chores und der Reinheit der frischen Stimmen. Schönste Erinnerungen verbinden mich auch mit Athen und seinen Festspielen, wo ich im antiken Amphitheater Herodes Attikus bei einer großartigen Aufführung von Beethovens »Neunter« im Solisten-Quartett mitwirkte. Das Konzert, das erst spät am Abend begann, wurde von der Goethe-Gesellschaft ver anstaltet und finanziert. Die Bamberger Symphoniker spielten, Joseph Keilberth dirigierte. Ein gewaltiger Chor war aufgeboten. Die steil ansteigenden Stufen der Arena waren bis hoch hinauf gesteckt voll mit Menschen. In der ersten Reihe saß der junge König Konstantin mit seiner Suite. Vor uns grüßte die festlich angestrahlte Akropolis und legte Zeugnis ab von der einstigen Größe dieses historischen Bodens. Und darüber wölbte sich der milde griechische Himmel. Anschließend wurden wir dem König vorgestellt, und dann gab es einen Empfang beim deutschen Botschafter, der damit goldene Brücken schlug von Volk zu Volk, denn auch in Grie chenland waren damals die Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs noch nicht vergessen. Ein ausgesuchter Kreis von Künstlern und Politikern fand sich im Traumgarten der Botschaft ein, und der rege Gedankenaustausch währte bis in die frühen Morgenstun den. Es war mein erster Besuch in Athen, und ich sammelte mit Eifer so viele Eindrücke, wie’s in der kurzen Zeit nur möglich war: die Akropolis, das Nationalmuseum mit seinen etruskischen 301
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN ABEND
Schätzen, die allein eine Reise wert sind, die bedeutendsten Stät ten der näheren Umgebung - Daphni, Eleusis und natürlich Kap Sunion mit seinem schlanken Poseidontempel beim herrlichen Sonnenuntergang und dazwischen ein paar Badeausflüge an wenig frequentierte Strände mit kristallklarem Wasser. Es ist im Westen kaum bekannt, daß auch Bukarest sein Festi val hat. Ich wurde schon in den Jahren kurz nach dem österrei chischen Staatsvertrag dorthin eingeladen, in der Oper den Florestan zu singen und zusammen mit meiner Frau einen Lieder abend zu geben. Ich erinnere mich noch, daß die Straßen der rumänischen Hauptstadt damals fast leer waren und es außer den öffentlichen Verkehrsmitteln so gut wie keine Fahrzeuge gab. Mitten auf dem Hauptplatz aber stand ein einsamer Mercedes, umdrängt von der rumänischen Jugend. F]r gehörte, wie wir spä ter erfuhren, dem Tenor und späteren Kollegen an der Staatsoper Dimitri Usunow, der aus seiner bulgarischen Heimat hierher gekommen war, um den Othello zu singen. Ich konnte ihn hören und kann nur sagen, daß er mit seiner großartigen Leistung noch weit mehr Aufsehen erregte als mit seinem Wagen. Unser Liederabend fand im sogenannten Kulturpalast statt, einer riesigen Halle mit über 3000 Plätzen. Wir hatten noch nie in einem so großen Saal Lieder interpretiert. Das Haus war zum Bersten voll, und ich konnte mir das nur damit erklären, daß wir zu den allerersten Künstlern zählten, die aus dem Westen kamen. Später hörte ich, daß in jeder Lehne der 3000 Sitze ein kleiner Lautsprecher eingebaut war. Im übrigen war alles bestens organisiert. Eine offizielle Einla dung folgte der anderen. Von der ersten Stunde unseres Aufent halts an war uns ein »Dolmetsch« beigegeben, der am Morgen zu uns ins Hotel kam und erst am Abend von unserer Seite wich. Weit lockerer und freizügiger erschien uns die Atmosphäre in Budapest, das seine Festwochen im September zu feiern pßegt. Wir wurden 1972 eingeladen, in ihrem Rahmen Schuberts »Win terreise« zu singen und hatten den Fdndruck, daß wir sehr gut 302
XVII /
DAS SCHÖNE ERHEBT
verstanden wurden und daß es, zumindest im Bereich der Musik, keinen Eisernen Vorhang gab. In einem Presse- und Rundfunk interview stellte man uns viele Fragen über die Verhältnisse in Wien und forderte uns anderseits auch auf, offen und ungeniert über die in Budapest gewonnenen Eindrücke zu sprechen. Finnland hat in Jan Sibelius seinen musikalischen Nationalhel den, und das Festival von Helsinki, das im Juni stattfindet, ist nach ihm benannt. 1958 erreichte mich eine Einladung aus Hel sinki, im Rahmen des F^estivals ein Mozartarien-Konzert mit Orchester, weiters einen Liederabend mit meiner Frau zu geben und schließlich auch noch das Tenorsolo in der »Neunten« unter Paul Kletzki zu singen. Zum Liederabend äußerte die Festspiellei tung den Wunsch, ich möge die Hälfte des Programmes mit Sibelius-Liedern bestreiten. So weilten wir eine ganze Woche in dieser schönen nordischen Stadt, die auf uns in ihrer Eigenart sehr anziehend wirkte. Als wir um zehn Uhr abends auf dem Flugplatz in Helsinki ankamen, mußten wir warten, bis man uns abholte. Ich kaufte mir eine deutsche Zeitung und las sie bei »Tageslicht«. Wir wurden im sogenannten Sibelius-Hotel einquartiert, wo der Komponist die langen finnischen Winter zu verbringen pflegte. Sonst lebte er völlig zurückgezogen auf seinem Landsitz in Järvenpää. Bekanntlich hat Sibelius in Wien Musik studiert und so zeigen seine frühen Lieder deutliche Anklänge an die deutsche LiedRomantik, besonders an Brahms, aber auch an den jungen Richard Strauss und an Gustav Mahler. Ich aber versuchte für unseren Abend einen Querschnitt durch sein Liedschaffen zusammenzustellen, und da konnte ich auch in den Liedern sehr klar seinen Durchbruch zur Eigenständigkeit feststellen. Im gro ßen und ganzen sind die Sibelius-Lieder blutvolle Romantik mit leicht folkloristischem Einschlag, sehr sangbar und meist sehr sicher auf den sängerischen Effekt hin konzipiert. Die finnische Presse sprach nach dem Liederabend in zahlrei chen Berichten von »meisterhafter Stimmtechnik«, von »hervor 303
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN ABEND
ragenden künstlerischen Fähigkeiten« und würdigte eingehend die »seelenvolle, tiefempfundene Interpretation« der Sibelius-Lieder. Wir haben die Gastfreundlichkeit der Finnen genossen und uns mit diesem sympathischen, offenen, warm empfindenden Menschenschlag im kalten Norden sehr bald angefreundet. Und ich habe die Sehenswürdigkeiten ihrer Hauptstadt ebenso erlebt wie die weite melancholische Landschaft der tausend Seen voller Geheimnisse. Ich versäumte auch nicht, den Heldenfriedhof zu besuchen, der Zeugnis ablegt für den Mut und die Tapferkeit des kleinen finnischen Volkes. Das überlebensgroße Monument Feld marschall Mannerheims beherrscht die Prachtstraße der Haupt stadt. Ich wurde später wieder eingeladen, und zwar gleich zu drei Liederabenden. Einer fand abermals im Rahmen des SibeliusFestivals statt, der zweite wurde für den Bildschirm aufgezeich net und den dritten gab ich im fernen Savonlinna, einer kleinen Stadt beim Ladogasee, nahe der russischen Grenze, im Rahmen eines Liedkurses, wobei ich von dem ehemaligen Studienleiter der Wiener Staatsoper, Prof Karl Hudez, begleitet wurde, der den Kurs durch viele Jahre leitete. Auch mein Kollege Peter Klein war jahrelang in Savonlinna tätig, gab dort dramatischen Unterricht und führte Regie bei den Opernaufführungen, die im malerischen Hof einer alten Festung auf einer nahegelegenen Insel stattfanden. Ich kann mir vorstel len, daß besonders Kleins »Fidelio«-Inszenierung, mit der er gro ßen Erfolg hatte, in dieser Naturkulisse starke Wirkung gehabt haben muß. Festspiele großen Formats bietet seit über anderthalb Jahr zehnten Barcelona, wo ich auch früher schon durch einige Jahre bei der Opernsaison des ehrwürdigen »Liceo« tätig war. Bei Bar celonas Festspielen wirkten meine Frau und ich fast kontinuier lich mit, jedenfalls —neben Salzburg —wohl am häufigsten. Es begann 1965 mit einem Gastspiel der Wiener Philharmoniker, das den Abschluß ihrer großen Südamerika-Tournee unter Karl 304
XVII /
DAS SCHÖNE ERHEBT
Böhm bildete. Auf den Programm standen Mozarts Requiem und Beethovens »Neunte«. Im Soloquartett sangen mit mir Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig und Walter Berry. Anschließend an dieses Konzert erhielten wir die Einladung zu einem Liederabend, der so begeistert aufgenommen wurde, daß junge Enthusiasten einen Club der »Dermotistas« gründeten, der in der Folge eine rührende Aktivität entfaltete. Man kannte mich ja in Barcelona bereits von meinen mehrmaligen Gastspie len im »Liceo«. Als ich 1970 an meinem Geburtstag in Barcelona sang, veranstaltete der Club in einem Hotel eine Feier, so daß wir einen Großteil der Nacht inmitten der jungen Leute verbrachten. Wir haben in Barcelona im Lauf der Jahre so ziemlich alle wichtigen Liederzyklen zu Gehör gebracht: »An die ferne Geliebte« von Beethoven, die beiden Schubert-Zyklen, die Schu mann-Liedreihen, sehr viel Hugo Wolf und natürlich auch Gustav Mahlers »Lieder eines fahrenden Gesellen«. Nach mei nem dritten Auftreten im Rahmen des V. Internationalen Musik festivals schrieb ein Kritiker: »Wer seinen letztjährigen Liedera bend im Tinell-Saal gehört hat, dürfte den Namen Dermota schwerlich vergessen, und wer ihn jetzt im Musikpalast gehört hat, dem wird auch dieses zweite Rezital unauslöschlich in Erin nerung bleiben, denn in jeder Hinsicht außerordentliche Darbie tungen wie diese, bei denen uns der Zeitbegriff verloren geht, sind etwas, das sich tief im Bewußtsein jedes Musikfreundes nie derschlägt.« Und als wir ein Jahr aussetzten, vermerkte die spanische Pres se: »Seit dem III. Internationalen Musikfestival, in dessen Rah men er als Solist mit den Wiener Philharmonikern auftrat, ist uns der Name Anton Dermota vertraut, und wenn das Programm des nächsten Festivals erscheint, suchen wir zuerst seinen Namen unter den aufgebotenen Künstlern. Ohne Dermota fehlt dem Festival ein wesentlicher Akzent...« Aus meiner solistischen Tätigkeit ergab sich fast organisch meine Verpflichtung als Juror sowie als Leiter von Meisterkur305
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN ABEND
sen. So habe ich in Barcelona viele Schüler unterrichtet, aber auch viele Freunde gewonnen. Die Stadt selbst mit ihrer großen Vergangenheit, mit ihrem Hafen, aus dem einst Kolumbus zu sei nen Entdeckerfahrten aufgebrochen ist, mit ihren berühmten »Ramblas«, dem malerischen Korso mit seinem üppigen bunten Blumen- und seinem lauten Kleintiermarkt, übte auf uns eine nie nachlassende Anziehungskraft aus. Besonders aber begeisterte uns der herrliche, denkmalpflegerisch musterhafte »Circolo goti co«, das gotische Viertel, wie es keines in solcher Fülle und sol chem Zustand anderswo gibt. Immer wieder besuchten wir die Museen alter katalanischer Kunst und in jüngster Zeit natürlich auch das Picasso-Museum, das man dem großen Sohn der Stadt in einem eigens dafür adaptierten gotischen Palast eingerichtet hat. Hier begegnen einander zwei Welten, und die alles verbin dende Kunst schlägt die Brücke über die Jahrhunderte. Zu den jüngsten Festspielen zählt der Carinthische Sommer, der sich von bescheidenen Anfängen allmählich zu einem inter nationalen Anziehungspunkt entwickelt, was das alleinige Ver dienst des Philharmonikers, Professor Helmut Wobisch, ist, der diese Veranstaltung im Süden Österreichs ins Leben gerufen hat. Ich sang dort 1976, begleitet von meiner Frau, in der stimmungs vollen Stiftskirche von Ossiach vor einer andächtigen Hörer schaft ein Programm geistlicher Lieder von Bach bis Hugo Wolf und im Jahr darauf im Villacher Kongreßhaus das Tenorsolo in Liszts »Faust«-Sinfonie mit den Budapester Philharmonikern unter janos Ferencsik. Noch zwei Veranstaltungen dieser Art möchte ich erwähnen: Die »Musica sacra« in Perugia, bei der die ganze Stadt in Bewe gung gerät, und wo ich unter Lorin Maazel in der »Missa solemnis« sang, und die »Europäischen Wochen« in Passau, die —ähn lich dem »Carinthisehen Sommer« - der Initiative eines einzigen Mannes, des Intendanten Walter Hornsteiner, zu danken sind. 1977 sang ich dort im Mozart-Requiem und gab, zusammen mit meiner Frau, einen Liederabend im gotischen Rathaussaal. 306
XVII /
DAS SCHÖNE ERHEBT
Schließlich darf hier auch Hermann Preys »Schubertiade in Hohenems« nicht vergessen werden, jenes Schubert-Fest familiä ren Charakters, das einzig und allein dem persönlichen Einsatz eines Sängers zu danken ist. Ich wurde im Sommer 1978 von mei nem Kollegen Prey für zwei Abende nach Hohenems verpflich tet, das mit seinem Schloß nicht nur eine besondere Stimmung, sondern auch einen historisch bedeutsamen Schauplatz bietet. Hier wurden zwei der wichtigsten Handschriften des Nibelun genliedes aufgefunden, hier hatte Erzbischof Graf Colloredo, der in der Geschichte Salzburgs und im Leben Mozarts eine bedeu tende Rolle spielte, seinen Stammsitz. Der eine der beiden Abende brachte erstmalig eine original getreue Wiederholung jenes einzigen Schubert-Konzerts, das zu Lebzeiten des Komponisten und zu dessen Gunsten stattfand. Ich hatte das Tenorlied »Am Strome« mit obligatem Horn und Kla vier zu singen. Das Konzert fand im zwar überdachten, aber nicht zugfreien Schloßhof statt. Es war kalt und es regnete. Und obwohl meine Mitwirkung kaum länger als zehn Minuten dauer te, erkältete ich mich dabei schwer. Für den nächsten Abend war im Festsaal des Schlosses die »Schöne Müllerin« angesetzt, bei der mich meine Frau begleitete. Ich hatte das Gefühl vollständi ger Heiserkeit und fürchtete, keinen Ton hervorbringen zu kön nen. Dennoch betrat ich das Podium, um den Veranstalter Prey nicht durch eine so kurzfristige Absage in Schwierigkeiten zu bringen. In den folgenden Fünfviertel-Stunden habe ich viele meiner Sünden abgebüßt. In solcher Situation muß man ein Höchstmaß an Selbstbeherrschung aufbringen, um den Abend zu retten. Zur nervlichen und körperlichen Belastung kommt noch das bedrückende Bewußtsein, weit von der eigenen Leistungsfä higkeit entfernt zu sein. Solche Abende gehören zu den bittersten Stunden eines Sängers. Neben dem Gesang war es vor allem die Orgel, die mich ein Leben lang begleitete. Ihr Klang hat mich schon als Kind faszi307
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
niert, mit ihr begann meine musikalische Laufbahn. Das abge brauchte Wort von der »Königin der Instrumente« hat hier wirklich seine Berechtigung. An majestätischer Klangfülle, an Farbenreichtum der Stimmen, an Vielfalt des Ausdrucks über trifft sie alle anderen Instrumente. Wann immer ich auf Reisen zu einer Kirche mit einer bedeutenden Orgel kam, sah ich sie mir gerne an und spielte sie, wenn es möglich war. Dazu eine Begebenheit aus meiner Heimat: Unweit von Kropa hatte mein verehrter Lehrer aus der Organistenzeit, Dr. Kimovec, der anerkannte Orgelfachmann des Landes, in seiner dörfli chen Geburtspfarre den Bau einer neuen Kirchenorgel veranlaßt, in der er gleichsam sein ganzes Wissen und all seine Erfahrungen auf diesem seinem Spezialgebiet verwirklichte, so daß die Orgel zu einer der größten und bedeutendsten des Landes wurde. Meine Neugier war groß, und ich wollte das Instrument ken nenlernen. Anläßlich eines sommerlichen Urlaubs in meiner Hei mat machte ich einen Abstecher in das abgelegene Dorf. Es war schon spät am Abend, aber die Kirche stand noch offen und der Organist war zufällig anwesend. Er erlaubte mir, die Orgel auszu probieren. Ich stürmte auf die Empore, nahm auf der Orgelbank Platz und war schon mitten im Präludieren. Vom Klang berauscht, zog ich sämtliche Register. Das mächtig brausende Spiel drang durch die offene Kirchentür bis ins Dorf und rief die Bewohner herbei, die sich verwundert fragten, was denn das Orgelspiel zu so unge wohnter Stunde zu bedeuten hätte. Als ich wieder vom Chor hinabstieg, hatte sich bereits eine ansehnliche Menge versammelt, und ich war erstaunt über die magische Wirkung des Orgelklanges. Später erzählte ich den Vor fall Dr. Kimovec, der inzwischen zum Dompropst von Ljubljana ernannt worden war, und rühmte das großartige Instrument. Er war sichtlich gerührt über mein Lob, und so konnte ich ein wenig von der Freude, die mir »sein« Instrument vermittelt hat te, an ihn, den Initiator, weitergeben. 308
XVII /
DAS SCHÖNE ERHEBT
Derlei Erlebnisse steigerten meinen früherwachten Wunsch, eine Hausorgel 2u besit2en. Als ich nach meinem Verkehrsunfall für längere Zeit vom Opernbetrieb ausgeschaltet und ans Haus gebunden war, wurde dieser Wunsch besonders lebhaft, und ich ging daran, ihn 2u realisieren. Für die Orgel mußte in unserem Haus ein eigener Raum vor gesehen werden. Zu diesem Zweck wurde an der Rückseite des Hauses ein Anbau errichtet mit direktem Ausgang in den Garten. Für die Orgel selbst hatte ich die angesehene Firma Rieger ins Auge gefaßt, die ihre Instrumente bis Amerika, Japan und Australien liefert. Das Unternehmen ist nach dem Zweiten Welt krieg vom Sudetenland nach Österreich übersiedelt, hat sich in Vorarlberg niedergelassen und dort einen großen Aufschwung genommen. Von Bregen2 aus besuchte ich die Werkstätten und konnte mich davon über2eugen, daß dort noch wie vor Jahrhunderten der alte Handwerksgeist herrscht. Sorgfalt, Solidität und Gedie genheit bestimmen die Arbeit, die 2umeist von Hand geleistet wurde. Es freut mich heute noch, daß meine Hausorgel keine Konfektionsware, sondern ein mit ausgesuchtem Material »nach Maß« gebautes Instrument ist. Die Orgel wurde unter Beratung erster Fachleute, vor allem des erfahrenen Firmenchefs, Dipl.-Ing. Glatter-Göt2, weitgehend nach meinen Wünschen gebaut. Sie ist, im Gegensat2 2u den pneumatischen Orgeln der jüngst vergangenen Zeit, ein rein mechanisches Instrument, wie es der Orgel-Renaissance unserer Tage entspricht, in der man bewußt auf die bewährte barocke Orgelbauweise 2urückgegriffen hat, und besit2t mit ihren rund 1400 H0I2- und Metallpfeifen, 21 klingenden Stimmen, 2wei Manualen und Pedal für eine Heimorgel eine beachtliche Größe. Ihr Klangvolumen würde für eine mittlere Kirche reichen und wirkt bei vollem Werk in unserem Haus fast übermächtig. Am schönsten klingen die sanften, dunklen Flötenstimmen, wobei die Wahl der Register viele Farbmischungen ermöglicht. 309
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
Im Frühjahr 1963 kam das Instrument mit einem Lastautozug direkt vors Haus gefahren und wurde an Ort und Stelle zusam mengebaut. Drei Mann arbeiteten eine Woche lang. Es gab viel Aufregung, bis das Instrument aufgestellt war. Als auch noch das Stimmen beendet und das Optimum an Klangharmonie erreicht war, verließen die Orgelbauer unser Haus. Nun konnte ich end lich voll Erwartung und Ungeduld das Instrument in Besitz neh men. Als ich den ersten Akkord niederdrückte, empfand ich, vom Klang förmlich getragen, jenes erhebende Gefühl, das mich einst als Knabe erfaßt hatte, als ich zum ersten Mal Meister Premerl auf der Domorgel von Ljubljana beim Hochamt vertreten durfte. Ein nettes Detail am Rande; Vor Abschluß der Arbeiten an der Orgel erinnerten mich die Werkleute »diskret« an die alte Sitte, wonach sie nach getaner Arbeit Anspruch auf eine Menge Weines hätten, die dem Inhalt der größten Pfeife entspreche. Ich habe natürlich verstanden! Heute ist der Orgelraum, der auch einen Großteil meiner Bücher birgt, mein »Buen retiro«. Ich kann dort ungestört lesen, studieren, Orgel spielen. Eine bequeme Schlafgelegenheit und ein kleines Bad ermöglichen es mir, mich vollständig zurückzuziehen. Niemand stört mich, es gibt kein Telefon, ich kann also »der Welt abhanden« kommen. Am schönsten freilich ist es, wenn ich im Sommer die Glaswand zum Garten öffne und so halb in der freien Natur meine Orgel spiele, wobei die Vögel rundum miteinstimmen. Die Lust am Sammeln muß wohl in der Natur des Menschen liegen. Ich mache da keine Ausnahme und habe mich schon früh dem Kunstsammeln verschrieben. Als zweites Gebiet kam später das Sammeln von Autographen dazu. Es begann damit, daß ich gelegentlich einmal den Namenszug eines bedeutenden Musikers erwarb oder gar ein Notenzitat in irgendeinem Antiquariat aufstöberte. Aber das war noch kein systematisches Sammeln. 310
XVII /
DAS SCHÖNE ERHEBT
Die Anregung dazu kam an meinem 50. Geburtstag. Bei einer Feier in unserem Flaus brachte mir ein lieber alter Freund, Jac ques Samuel, selbst ein leidenschaftlicher Autographensammler, als Geschenk eine vollbeschriebene Visitkarte von Johannes Brahms. Als ich die Karte in der Hand hielt, fühlte ich plötzlich so etwas wie eine Ausstrahlung, eine Art geheimen Kontakt mit dem Genius. Und in diesem Augenblick hatte mich die Sammel leidenschaft gepackt, eine Leidenschaft, die sich als ebenso schön wie kostspielig erwies, weil ich mich darauf konzentrierte, nur erlesene Musikhandschriften zusammenzutragen. Sehr bald bemerkte ich, daß ich da eine mächtige Konkurrenz hatte, da das Autographensammeln weltweit verbreitet ist und gerade für Handschriften der namhaften Komponisten geradezu phantastische Preise verlangt und geboten werden. Wie kommt man überhaupt zu einem wertvollen Autograph? Kaum je durch ein privates Angebot, wenn etwa eine Sammlung aufgelöst wird, weit häufiger über ein Antiquariat. Der gangbar ste Weg aber führt über spezialisierte Auktionshäuser, die genaue Kataloge herausgeben und auf Wunsch dem jeweiligen Interes senten zuschicken, der sich dann je nach finanziellen Kräften die gewünschten Stücke auswählen kann. Daß man sie nur in den seltensten Fällen wirklich zugeschlagen bekommt, ist eine bedau erliche Tatsache. Dennoch gelang es mir, im Lauf von über zweieinhalb Jahr zehnten einige bedeutende Autographe in meinen Besitz zu brin gen. Als erste konnte ich zwei unveröffentlichte Schubert-Lieder aus privater Hand erwerben. Sie waren im April 1816 nach Tex ten von Leopold Graf Stolberg komponiert und trugen die Titel »Stimme der Liebe« und »Lied in der Abwesenheit«. Im Deutsch-Verzeichnis führen sie die Nummern 412 und 416. Der bekannte Wiener Komponist Prof Karl Pilss, damals mein lieb ster Korrepetitor in der Staatsoper, hatte sie von entfernten Nachkommen Schuberts geschenkt bekommen. Nun brauchte er Geld für eine Investition in seiner Wohnung und mußte sich des 3 1 1
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN ABEND
halb von ihnen trennen. Er hatte sie übrigens bereits Berufsanti quaren angeboten, aber nicht den gewünschten Preis erzielt. Ich jedoch gab ihm den Betrag, und so kam ich zum eigentlichen Grundstock meiner Sammlung. Wie sich auch auf diesem Gebiet die Zeiten geändert haben! Heute würde man solche Stücke einem angesehenen Auktions haus zur Versteigerung anbieten —ich denke da etwa an J. A. Stargardt in Marburg —und dadurch sicher einen Spitzenpreis erzielen. Später konnte ich dazu bei einem deutschen Antiquar und Verleger als ganz große Seltenheit ein kleines Mozart-Autograph erwerben, und zwar ein Andantino für Klavier, das im Köchel verzeichnis mit 588 b bezeichnet ist. Die Niederlassung des Anti quars in Tutzing am Starnbergersee liegt übrigens sinnigerweise in der Mozart-Gasse. Von demselben Antiquar erstand ich zwei weitere Raritäten: eigenhändige Abschriften Beethovens aus einem Concerto grosso von G. F. Händel. Beethoven hat bekanntlich Händel hochge schätzt. Gleich zu Beginn meiner Sammlertätigkeit fand ich in einem heute leider nicht mehr existierenden Wiener Antiquariat ein frü hes Hugo-Wolf-Lied »Sie haben heut’ abend Gesellschaft« nach einem Gedicht von Heinrich Heine, und später —gleichfalls im Wiener Handel —das vollständige Autograph eines Liedes von Joseph Haydn, betitelt »Ein kleines Haus«, signiert und datiert »den 2oten July 1801«, sowie ein ganzes Konvolut handschriftli cher Transkriptionen Schubertscher Lieder von Franz Liszt, dar unter Paraphrasen von »Lindenbaum« und »Liebesbotschaft«. Von einem jungen Wiener Händler konnte ich nebst einigen Briefen von Verdi zwei für mich besonders wertvolle Albumblät ter des Meisters erstehen: eines mit dem Schlußduett RadamesAida und ein anderes mit der Offertoriumstelle »Hostias et preces tibi Domine« aus dem Tenorpart des Requiems, die ich so oft gesungen habe. 3 1 2
XVII /
DAS SCHÖNE ERHEBT
Im bereits genannten Marburger Auktionshaus gelang es mir, ein Schumann-Autograph zu ersteigern, und zwar das Lied »Gei sternähe«, das auf der Rückseite ein zweites Lied, »Mein Gar ten«, mit Bleistift skizziert, enthält. Das Blatt ist Adele Preyer, einer Freundin Clara Schumanns, gewidmet. Dabei hatte ich einen sehr prominenten Konkurrenten als Mitbieter, nämlich das Institut »Preussischer Kulturbesitz« in Berlin. Es ist leicht auszu denken, wie hart der Kampf um den Erwerb dieser Handschrift geführt wurde. Im selben Auktionshaus konnte ich übrigens später eines der schönsten Lieder von Hugo Wolf im Autograph ersteigern: »Komm, o Tod« aus dem »Spanischen Liederbuch«, datiert 1890, nebst einem erschütternden Brief aus der Nervenheilanstalt, sowie ein handschriftliches Lied von Richard Strauss »Lob des Leidens« vom Jahre 1886, das ich in mein Repertoire aufnahm und wiederholt in Konzerten sang. Als einen besonderen Glücksfall empfand ich den Erwerb der handschriftlichen Partiturblätter vom Beginn des Finales der ach ten Sinfonie von Anton Bruckner sowie die komplette Partitur seines vierstimmigen Männerchors mit Altsolo und Klavierbe gleitung »Um Mitternacht«, mit Bruckners eigenhändiger Wid mung an den Sängerbund »Frohsinn« in Linz. Beide Manuskripte stammten aus dem Besitz von Karl Aigner, dem Musiklehrer der Sängerknaben von Sankt Florian, der mit Bruckner persönlich befreundet war. Durch Zufall erwarb ich eine Handschrift von Mozarts Sohn Franz Xaver Wolfgang: ein Lied für vierstimmigen gemischten Chor, betitelt »Chant à l’amitié«, das auf der Rückseite ein Lied mit Klavierbegleitung, »Elle pleurait«, aufweist. Und da ich bald darauf als Ergänzung einen Brief von Konstanze Mozart erwer ben konnte, den sie, schon als »Etatsräthin von Nissen« 1827 aus Salzburg nach Wien schrieb, hatte ich so etwas wie einen Autographen-Satz aus der Familie Mozart beisammen. Der Zufall wiederholte sich: zum Lied-Autograph Joseph 3 1 3
DERMOTA / TAU SENDUNDEIN
ABEND
Haydns fand sich ein Brief seines Bruders Michael vom Jahre 1805, zu Franz Schuberts Liederhandschriften ein Brief seines Bruders Ferdinand an den Wiener Verleger Tobias Haslinger von 1854, zu den Schumann-Liedern ein Erinnerungsblatt von 1850, auf dem Robert Schumann den Beginn seines Liedes »An den Sonnenschein«, seine Gattin Clara den Anfang der Violinstimme seines Trios opus 80 notierte, dazu von Johannes Brahms, der bekanntlich dem Ehepaaar Schumann sehr nahestand, vier Fragmente eines Notenblattes mit Skizzen zu einem von Brahms offenbar verworfenen Lied »Nachtstück«, die die langjährige Hauswirtin des Meisters, Celestine Truxa, aus dem Papierkorb herausgefischt hat. Die Familie Richard Wagners ist in meiner Sammlung beson ders zahlreich vertreten: Der Meister selbst durch ein hand schriftliches Partiturblatt aus dem Festgesang für vierstimmigen Männerchor »Der Tag erscheint«, und durch mehrere Briefe, darunter auch einen an seine erste Frau Minna; Cosima und ihr erster Gatte Hans von Bülow durch mehrere Briefe ; Franz Liszt, Wagners Schwiegervater, nebst den schon erwähnten Transkrip tionen noch mit einem Foto samt eigenhändiger Widmung, wei ters mit einer vollbeschriebenen Visitenkarte und einigen interes santen Briefen ; Siegfried, der Sohn, durch ein Schreiben und ein Familienfoto, auf dem sich natürlich auch die später prominenten Wagner-Enkel Wieland und Wolfgang befinden. Von Gustav Mahler schließlich glückte es mir, nebst Skizzen zum Scherzo seiner fünften Sinfonie eine ausgedehnte Korre spondenz zu erwerben, in der der designierte Hofoperndirektor vor Antritt seines Amtes ausführlich und leidenschaftlich seine Ideen und Pläne darlegt, dazu später einen Brief von Alma Mah ler, der sich auf den bereits verstorbenen Gatten bezieht, und als Ergänzung zwei Briefe des Dichters Franz Werfel, der bekannt lich Almas dritter Gatte war. In der —bisher unveröffentlichten —Mah1er-Korrespondenz finden sich übrigens Stellen, in denen der kommende Direktor 3 1 4
XVII /
DAS SCHÖNE ERHEBT
heftige Angriffe auf den damaligen Hofopernbetrieb und auf sei nen Vorgänger im Amt, Wilhelm Jahn, richtet: »Wir müssen für notwendigen Ersatz in manchen Fächern Vorsorgen ... wir müs sen eine ganze Menge Opern, die ganz oder teilweise falsch besetzt sind, umbesetzen, um sie wieder möglich zu machen ... so könnte ich Ihnen Seiten über Seiten voll schreiben und fände kein Ende. Es ist dies ja natürlich in einem künstlerischen Haushalt, der seit vielen Jahren nur von Handlangern besorgt wird...« Oder: »Wir sind durch unverzeihliche Lässigkeit Jahns, welche ich geradezu Gewissenlosigkeit nennen muß, vorderhand vom I. August nächsten Jahres ohne Tenoristen ... hier ist es jetzt sehr schwer, Repertoire zu machen ...« Nicht unerwähnt möchte ich lassen, daß sich auch die Haupt vertreter der »Wiener Schule« in meiner Sammlung befinden: Joseph Matthias Hauer durch sein »Testament« von 1937, in dem er sich als alleinigen Urheber des Zwölftonsystems bezeichnet, wozu sich ein Richard-Strauss-Brief von 1922 fügt, in dem es heißt: »Herr Hauer schreibt die normale Handschrift der >anbrechenden< Bolschewiken«; Arnold Schönberg durch ein musikali sches Albumblatt mit ein paar handschriftlichen Takten sowie durch einige Briefe, in denen er sich unter anderem als Einge rückter im Ersten Weltkrieg bitter über die verlorene Zeit beklagt; sein bedeutendster Schüler Alban Berg durch mehrere Schreiben, in denen er eindringlich seine triste finanzielle Lage schildert und um zwei Freikarten für ein Schönberg-Konzert bit tet, und schließlich Anton von Webern durch einen Brief und zwei Blatt mit Bleistift geschriebener Skizzen zu Choral-Vorspie len. Meine Sammlung ist im Lauf der Jahre so angewachsen, daß die Nationalbibliothek aufmerksam wurde und der Leiter ihrer Musikabteilung, Prof Dr. Franz Grasberger, mich einlud, in sei nem Institut, das sich im Gebäude der Albertina befindet, eine Auslese meiner Handschriften auszustellen. Die kleine Exposi tion wurde im Juni 1971 eröffnet. Dabei zeigte sich die Möglich515
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN ABEND
keit, aus dem Bestand der Ausstellung ein komplettes l>iederabend-Programm zusammenzustellen, das meine Frau und ich zur Eröffnung darboten, was gewiß in seiner Art ein einmaliger Fall war. Die Ausstellung fand lebhaftes Interesse, der hübsche Katalog war in Kürze vergriffen. Das war gleichsam die Krönung unserer Sammeltätigkeit, aber keineswegs ihr Ende. Die Katze läßt bekanntlich das Mausen nicht. Und so werde ich eifrig weitersammeln, so lange und so weit die »Kräfte« reichen. Weit früher noch als die Handschriften berühmter Musiker beeindruckten mich die schönen Dinge der bildenden Kunst. Der festliche Schmuck der barocken Kirchen meiner Heimat erregte schon in der Kindheit meine Phantasie. Daraus entwickelte sich später wie von selbst der Wunsch, mich mit schönen Dingen zu umgeben. Dieser Wunsch ging erst allmählich in Erfüllung. Es begann mit einem Schrank. Es war freilich kein gewöhnli cher Schrank, sondern ein maria-theresianischer Tabernakel. Ich sah ihn zufällig in einer Auslage in der Innenstadt, und er zog mich unwiderstehlich an. Ich betrat den Laden, erkundigte mich nach dem Preis und leistete spontan eine Angabe. Das war vor eilig, wie sich gleich herausstellte. Denn nur wenige Schritte wei ter, in der nächsten Gasse, sah ich einen ähnlichen Schrank, nur viel schöner. Neugierig geworden, betrat ich auch dieses Geschäft und erfuhr, daß dieser Schrank genau so viel kostete, wie der, den ich eben beangabt hatte. Leicht verstimmt kehrte ich heim und erzählte den Vorfall meiner Frau, die mich beruhigte: »Ich werde versuchen, den Kauf rückgängig zu machen. Es wird mir schon gelingen!« Der Händler hatte tatsächlich ein Einsehen; er refundierte die Angabe und wir erwarben den schöneren Schrank, der noch heute unser Heim ziert. Bald aber zeigte sich, daß dieses eine Stück nach Ergänzung verlangte und in uns den Wunsch weckte, einen ganzen Raum stilgerecht einzurichten. So erstanden wir nach und nach zum 316
XVII /
DAS SCHÖNE ERHEBT
Tabernakel schrank eine barocke Kommode, einen zweiten Schrank und eine dazupassende Sitzgarnitur samt Tisch, womit auch dieser Wunsch in Erfüllung ging. Freilich, die Wände waren noch kahl. Zwei, drei Bilder fehl ten ; sie würden dem Raum die nötige Wärme geben. Wir waren entschlossen, sie anzuschaffen und damit war der erste Schritt zum Sammeln von Gemälden getan, das meine große Leiden schaft werden sollte. Das erste Bild ersteigerte ich auf einer Auktion im Wiener Dorotheum, ohne es vorher gesehen zu haben. Ich kam mitten in die Versteigerung hinein, blieb ganz hinten in der letzten Reihe stehen, sah aus der Fmtfernung, wie der Ausrufer ein Bild hoch hob, und hörte seine Worte: »Holländisch ... 17. Jahrhundert ... Öl auf Holz, beschädigt...« Ich weiß nicht, was mich trieb, die Hand zu heben. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich hob sie noch einmal und ein drittes Mal und dann war mir das Bild zuge schlagen. Ich ging zur Ausgabestelle, um zu bezahlen, und nun sah ich das Bild erst richtig. Es war nicht etwa leicht beschädigt, sondern hatte mittendurch einen großen Sprung. Da war ich recht unglücklich. Als ich mich umdrehte, stand hinter mir mein Mitbieter. In meiner Enttäuschung bot ich ihm das Bild an, er aber lachte leicht schadenfroh und lehnte dankend ab. Die Pointe kam später: dieser Mann, der gleichfalls ein lei denschaftlicher Kunstsammler war, wurde der Zahnarzt unserer Familie. Ich nahm also das Bild unter den Arm und ging damit zu jenem Händler, bei dem ich seinerzeit den Tabernakel schrank nicht erstanden hatte. Er beruhigte mich: »Lassen Sie das Bild hier. Ich habe einen guten Restaurator, der wird das richten!« Nach einigen Wochen verständigte er mich : »Das Bild ist fer tig. Es ist so schön geworden, daß ich es Ihnen gerne abkaufe!« Ich war hoch zufrieden, behielt das Bild natürlich, bestellte dazu den passenden Stilrahmen —und so war der Grundstock für eine künftige Gemäldesammlung gegeben. 317
DER iM OTA / T A U S E N D U N D E I N
ABEND
Anders erging es mir mit der Plastik, Hier erwarb ich die ersten Figuren auf geradem Weg. Ich hatte zu unserem Händler nun volles Vertrauen gefaßt; er war, wie sich erwies, führend in seiner Branche. Nachdem ich bei ihm noch das eine oder andere barocke Möbel erworben hatte, wandte ich mich an ihn mit dem Wunsch, eine schöne Plastik zu besitzen. Und nun zeigte sich, daß er unser Vertrauen durchaus verdiente. Er bot mir aus sei nem Privatbesitz zwei gotische Figuren, die Heiligen Katharina und Barbara, an, die mich sofort faszinierten. Ich überlegte nicht lange und griff zu. So hatte ich hier wie dort einen anspruchsvol len Start. Alte holländische Malerei und gotische Plastik, das war ein Beginn, der Maßstäbe setzte für das weitere Antiquitätensam meln. Ich konzentrierte mich auch zunächst auf diese beiden Gebiete, aber bald entdeckte ich die Schönheit der Barockplastik, entdeck te den Zauber des österreichischen Biedermeier und seiner lie benswürdigen Malerei, wobei mich vor allem das Blumenstück anregte, das ja eine international anerkannte Hochleistung des Wiener Biedermeier darstellt. Als Ergänzung dazu konnte ich eine kleine Serie Kothgasser-Gläser erwerben, vor allem solche mit Blumenmotiven. Erst viel später erstreckte sich mein Interesse auch auf die österreichischen Impressionisten, von Emil Jakob Schindler und seinem Kreis bis Klimt und Schiele, wobei mir gelegentlich auch Blätter noch lebender Künstler in die Hand kamen. Allmählich erkannte ich auch den Reiz des Renaissance- und Barocksilbers und erwärmte mich eben noch rechtzeitig für diese besonders begehrte Sparte des Kunstgewerbes, als noch zu relativ günstigen Bedingungen schöne und gute Stücke zu erstehen waren. Das ist heute vorbei. Altes Silber ist auf dem Kunstmarkt zu einer unerschwinglichen Rarität geworden. Daß man im Laufe einer langjährigen Sammlertätigkeit so mancherlei erlebt. Positives wie Negatives, versteht sich. Im Übereifer und in der ersten Begeisterung greift man einmal dane318
XVII /
DAS SCHÖNE ERHEBT
ben, man läßt ein anderes Mal eine günstige Gelegenheit vor übergehen, man wird gelegentlich auch wohl übervorteilt, man tut mitunter aber auch einen guten Griff und es gelingt das, was man im Jargon der Händler und Sammler eine »Trouvaille« nennt. Zwei Episoden sollen das Gesagte illustrieren. Während der FestspieEeit entdeckte ich bei einem Salzburger Antiquitäten händler eine gotische Kleinplastik des heiligen Sebastian, die mich entzückte. Aber der Preis schien mir zu hoch, und ich konn te mich deshalb nicht zum Kauf entschließen. Trotzdem ging mir die Figur lange nicht aus dem Sinn. Viele Jahre später wurden wir zu einem prominenten Wiener Kunsthändler eingeladen. Und da stand plötzlich, mitten unter seinen privaten Kunstschät zen —ich traute meinen Augen nicht —, der gotische Sebastian. Meine Sammlerleidenschaft überwältigte mich; jetzt setzte ich alles daran, den Heiligen in meinen Besitz zu bringen. So habe ich die Figur, die mir einst zu teuer war, vom Gastgeber schließlich um mehr als das Zehnfache des ursprünglichen Preises erworben. Ein anderes Mal begleitete ich als Berater einen Kollegen, der bei einem Händler einen barocken Tisch erstehen wollte. Als wir den Laden betraten, bemerkte ich mitten unter allerlei Antiquitä ten an einem schlecht beleuchteten Schreibtisch ein Blumenstück und fragte im Vorübergehen um den Preis, der mir relativ bescheiden schien. Dann beriet ich meinen Kollegen beim Tisch kauf, nahm vor dem Verlassen des Ladens das Blumenstück mit und bezahlte es. Es war ungerahmt und sah nicht sehr attraktiv aus. Ich ging deshalb zu einem angesehenen, mir bekannten Galeriebesitzer und bat ihn um sein Urteil. Er fragte nach dem Preis, den ich bezahlt hatte, und bot mir sofort das Doppelte. Ich wehrte lächelnd ab ; da bat er mich, ihm das Bild wenigstens als Leihga be für seine eben in Vorbereitung befindliche Ausstellung über das Blumenstück des 19. Jahrhunderts zu überlassen. Da wußte ich endgültig: das war eine »Trouvaille«. 319
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
Das Bild stammt übrigens von Johann Baptist Drechsler, dem Begründer der später so berühmten Blumenmalerei-Schule des Wiener Biedermeier, und wurde zum Grundstein meiner zielbe wußt aufgebauten Sammlung von Blumenbildern des 19. Jahr hunderts. Es war unvermeidlich, daß früher oder später auch die Fach kreise auf unsere Sammlung aufmerksam wurden. So erhielt ich im Lauf der Jahre immer wieder Einladungen, Leihgaben für bedeutende öffentliche Ausstellungen zur Verfügung zu stellen, und ich habe mich, wenn auch nicht leicht, in mehreren Fällen dazu entschlossen. Nicht nur in Wien (Belvedere) und Salzburg (Residenz, Domoratorien), sondern auch in Augsburg, London und Quebec (zur 2^it der Weltausstellung in Montreal) sind Kunstgegenstände aus unserem Besitz gezeigt worden. Dazu ein kleines, heiteres Detail : Einmal schickte man uns einen Lastwagen, aus dem zwei bärenstarke Männer kletterten, die beauftragt waren, »die beiden Leihgaben« abzuholen. Meine Frau brachte lächelnd das Gewünschte. Es waren zwei kleine, leichte Aquarell-Blätter, in Seidenpapier gehüllt, die man mühelos in einer Aktenmappe hätte transportieren können. Daß Sammeln eine echte Leidenschaft werden kann, habe ich so an mir selbst erfahren. Um ein begehrtes Stück zu erstehen, gab es oft finanzielle Schwierigjceiten, weil hier der rasche Ent schluß meist entscheidend ist ; sonst ist das ersehnte Objekt dahin und man trauert ihm vergeblich nach. Geht man beim Ankauf auch manchmal über seine Verhältnisse, so hat es sich doch auf längere Sicht gezeigt, daß Kunsterwerb nicht die schlechteste Anlage ist. Die Zinsen, die er bringt, sind die täglichen Freuden im Umgang mit den erworbenen Gegenständen. Was ich durch meine Stimme ersang, das habe ich wieder in Kunst investiert, und die Ausstrahlung der mich umgebenden Kunstwerke hat mich immer von neuem angeregt, denn das Schöne erhebt und trägt über den grauen Alltag hinaus.
XVIH
Nun schmiede mich, den letzten Stein Gedanken
Opembetrieb von heute —D as Generationsproblem
—
Zweiter Frühling
Hier scheint es mir nun angebracht, einige Worte zum Titel die ses Erinnerungsbuches zu sagen. »Tausendundein Abend« —gewiß eine imponierende Zahl, die aber doch nur symbolisch, als Anleihe bei Leporello, zu verste hen ist. Trotz fehlender Aufzeichnungen konnte ich mir ausrech nen, daß ich allein an der Wiener Staatsoper mehrere taUvSend Abende gesungen —und keine zehn Mal abgesagt habe. Dazu kamen die Auslandsgastspiele, die Konzerte und Oratorien, die Mitwirkung bei Festspielen - schon in Salzburg 150 Vorstellun gen zwischen 1936 und 1959I - und erst recht die unzähligen Liederabende im In- und Ausland. Ein gewaltiges Arbeitspensum also und ein langer, schwerer, aber schöner Weg liegt hinter mir. Ich konnte ihn nur bewältigen durch die im doppelten Sinne selbstlose Begleitung meiner Frau. Sie half mir, die auf jedem Weg unvemieidlichen Tiefpunkte zu überwinden, sie gab mir Mut, wenn ich verzagen wollte, und sie freute sich an meinen Erfolgen, die ich immer als unsere gemein samen angesehen habe. Und so glaube ich, rückblickend mit einiger Berechtigung von einem erfüllten Leben sprechen zu können. Wenn ich heute gefragt werde, ob ich bereit wäre, diesen Weg noch einmal zu gehen, gibt es für mich nur eine Antwort: Ja! 3
2
1
DERMOTA /
TAU SENDUNDEIN
ABEND
1980 werde ich 70 Jahre alt. Es ist Zeit, die 7\ktivitäten allmäh lich einzuschränken - auf der Bühne, im Konzertsaal, im Platten studio. In nächster Zeit werden noch einige Schallplatten erschei nen, die schon von mir besungen sind, darunter Aufnahmen aus den Jahren 1938 bis 1945. Dieses Doppelalbum wird vorwiegend jene Tonbänder erfassen, die, bisher unveröffentlicht, in den verschiedenen deutschen Rundfunkarchiven aufgefunden wur den. Die Arbeit für die Schallplatte ist eine spezielle Tätigkeit, die ganz eigenen Gesetzen unterliegt. Neben dem Beitrag des Sängers sind so viele technische Komponenten im Spiel - die Akustik des Raumes, die Geschicklichkeit des Toningenieurs usw. —, daß es schwierig ist, alles auf einen Nenner zu bringen. Häufig muß eine Aufnahme mehrere Male wiederholt werden, bis endlich alle Beteiligten mit dem Ergebnis zufrieden sind. Das kann für den Sänger aufreibend sein. Singt er mit Klavierbegleitung, dann sind Korrekturen verhältnismäßig einfach. Finden aber die Aufnah men mit Orchester statt, mag es Vorkommen, daß dann, wenn endlich im Orchester alles stimmt, der Sänger, der stets seinen vollen Einsatz geben muß, mit seinen Kräften am Ende ist. Dar um sind Aufnahmen, die aufs erste gelingen, immer die besten. Jede Korrektur mindert den Schwung und die Spontaneität. Schallplattenperfektion wird mit viel Mühe erzeugt und eignet sich deshalb nicht zum Vergleich mit der lebendigen Leistung in Konzert und Oper. Während meiner fast fünfzigjährigen Bühnentätigkeit hat sich der Opern betrieb grundsätzlich geändert. Der Ensemblegedanke hat sich überlebt, das geschlossene, hauseigene Ensemble gehört der Vergangenheit an. Ich bin der Überzeugung, daß ein quali tätsvolles ganzjähriges Bespielen eines Opernhauses heute nur mehr schwer möglich ist. Tonfilm, Rundfunk, Fernsehen, vor allem aber die technisch vervollkommnete Schallplatte haben bewirkt, daß der Hörer mit 322
XVIII /
N U N S C H M IE D E MICH, D E N
LETZTEN STEIN
höchsten Ansprüchen in eine Opernvorstellung kommt. Er ahnt ja zumeist nicht, wie stark diese Schallplatte technisch aufgebes sert ist und daß oft der Toningenieur am Mischpult die »Spitzen qualität« produziert hat. Auf der Platte, die er daheim hört, wer den ihm fast ausschließlich Spitzensänger geboten, deren I^istung er dann gerne zum Maßstab nimmt. Ein Opernhaus ver mag aber nicht täglich die Qualität zu erreichen, die mit der Schallplatte konkurrieren könnte. Erstens, weil es so viele Spit zensänger gar nicht gibt, und zweitens, weil sie, wenn es sie gäbe, kein Opernhaus der Welt bezahlen könnte. Der weitere Grund für den Zerfall des Ensembles ist die Hek tik unserer Zeit. Das Flugzeug hat dazu geführt, daß die bedeu tenden Sänger fast ständig unterwegs sind. Seßhafte Naturen gibt es kaum mehr unter ihnen. Ja, wir sind so weit, daß ein Sänger, der sich nicht Lorbeeren im Ausland holt, im eigenen Haus nichts gilt. Die Direktoren geben einem jungen Sänger erst dann eine Chance auf ihrer Bühne, wenn er sich in der jeweiligen Auf gabe bereits anderwärts bewährt hat. Und so ist in den großen Häusern meist nur jener Rest des Ensembles ständig zur Verfü gung, der mit kleinen und kleinsten Partien betraut wird und den man geringschätzig »Sänger zweiter Kategorie« nennt. Es gibt natürlich Ausnahmen unter den gefragten Sängern, die von sich aus keine übermäßige Reiselust verspüren. Zu diesen Reiseunlustigen möchte ich mich auch selbst zählen. Schon im F^inblick auf meine Familie und meine Liebhabereien bin ich eher ein seßhafter Typ. Diese Anhänglichkeit an ein Haus im Sin ne des alten Ensemblegeistes hat Vor- und Nachteile. Der Vor teil : Man kann ein geruhsameres, geordnetes Leben führen und auch vom Publikum für diese Treue bis zu einem gewissen Grad honoriert werden. Der Nachteil: Die Direktion zieht nur allzu gerne den falschen Schluß, der Betreffende werde im Ausland nicht verlangt und sei daher auch daheim minder zu bewerten. Der dritte Feind des Ensembles ist das grassierende Starwesen, man könnte es auch Star-Unwesen nennen. Die wenigen Spitzen323
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN ABEND
Sänger ihres Fachs jagen von Haus zu Haus, von Kontinent zu Kontinent, was den Stimmverschleiß enorm beschleunigt. Das Bewußtsein, daß die beste z^it eines Sängers relativ kurz bemes sen ist, verleitet sie zu solchem Raubbau. Man kann immer wieder die Beobachtung machen, wie hoff nungsvolle junge Sänger, mit schönstem Material begabt, in die sen Sog gezogen, von skrupellosen Agenten zu früh an die gro ßen Häuser vermittelt und so einer vorzeitigen Abnützung preis gegeben werden. Die Bilanz solcher verantwortungslosen Prakti ken ist traurig. Und da werde ich immer wieder gefragt: Warum gibt es so wenig schöne Stimmen und so wenig gute Sänger.^ Meine Antwort lautet: Gute Stimmen gab und gibt es immer, nur hat man sich früher mehr Zeit für die Entwicklung und das Ausreifen der Stimme gelassen, im Gegensatz zu heute, wo die größten Begabungen frühzeitig verbraucht werden. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt auch die mangelnde Erziehung des sängerischen Nachwuchses innerhalb der Opern häuser. Ich möchte hier noch einmal auf meinen ersten Direktor, Erwin Kerber, und sein großes Verständnis, sowie auf die liebe volle Arbeit meines Mentors Bruno Walter hinweisen, wobei ich mir durchaus bewußt bin, daß das auch damals schon Ausnah men waren, wie sie im heutigen Opernbetrieb überhaupt nicht mehr denkbar wären. Aber ein gewisses Maß an verständnisvol ler Förderung sollte und müßte der junge Sänger auch im Opern alltag von heute erwarten können. Fan Ansatz dazu, der zu eini gen Hoffnungen berechtigt, ist das Opernstudio der Wiener Staatsoper unter Hilde Güden und Otto Wiener, eine Idee, die in der Geschichte des Hauses immer wieder auftauchte, aber bisher nie recht zum Tragen kam. Wenn ich an meine Anfänge in der Oper zurückdenke, so ist es mir fast unbegreiflich, wieso die Regisseure heutzutage eine derart dominierende Stellung erreichen konnten. Für einen den kenden Sänger liegt in den Werken des gängigen Opernrepertoi 324
XVIII /
N U N S C H M IE D E MICH, D E N
LE TZ TEN STEIN
res, von denen ja nach wie vor die Opernhäuser der Welt leben, in Handlung und Musik alles so klar zutage, daß eine gewaltsame Neudeutung durch den zuweilen auch noch musikfremden Regis seur unangebracht, ja überflüssig erscheint. Was dabei nur allzu oft herauskommt, ist bekannt: eine vom Geist der Entstehung des Werkes weit entfernte Interpretation, eine Vergewaltigung der Musik und damit auch des Komponisten. Wie überflüssig, ja sinnlos das Ganze ist, zeigt sich an jenen Inszenierungen, bei denen schon nach der dritten oder vierten Vorstellung von der ursprünglichen Besetzung nur noch küm merliche Reste bleiben, die Aufführung aber weiter läuft, die neubesetzten Sänger von der ursprünglichen »Auffassung« des Regisseurs keine Ahnung haben, im günstigsten Fall Anweisun gen von einem Hilfsregisseur bekommen, und im übrigen, sich selbst überlassen, den Abend je nach ihrer Qualität zum Erfolg oder Mißerfolg führen. Wird es ein Erfolg, dann ist damit der Beweis geliefert, daß es auf der Opernbühne keineswegs auf den Regisseur, sondern in erster Linie auf den Sänger ankommt. Anders verhält es sich mit den Dirigenten. Hat bis zu den ent scheidenden Orchesterproben der allmächtige Regisseur das gro ße Wort geführt, so kommt es nun auf die Musik und damit auf den Dirigenten an. Es sei denn, daß sich beide, Regisseur und Dirigent, in einer Person vereinen —eine Union, von der ich glaube, daß in ihr, trotz mancher Vorteile, entweder der eine oder der andere zu kurz kommt. Von der Bedeutung des Dirigenten für den Sänger macht sich der Laie meist keine rechte Vorstellung. Es ist aber so, daß schon die geringste Hemmung, die vom Pult ausgeht —ich denke da besonders an rhythmische oder dynamische Unstimmigkeiten -, einen Sänger irritieren und in seiner Leistung mindern kann. Im Laufe meiner Tätigkeit in drei Kontinenten habe ich alle Kategorien von Dirigenten kennengelernt: den Typ des »Takt schlägers vom Dienst« ebenso wie die überragende Persönlich keit des Spitzenkönners, am häufigsten natürlich den Mann der 325
DERMOTA / TAUSENDUNDEIN
ABEND
Mittelklasse, den versierten, verläßlichen Kapellmeister, die Stüt ze des Opernalltags. Dabei machte ich die Erfahrung, daß man seine Partie desto gelöster und intensiver gestaltet, je größer die Persönlichkeit am Pult, je stärker ihre Autorität ist. Hat man dabei das Gefühl, nicht nur sicher geführt, sondern zugleich auch als Individualität anerkannt zu werden, so ist die Voraussetzung für eine Höchstleistung gegeben. Es ergibt sich im Idealfall so etwas wie ein gemeinsames Atmen zwischen Dirigenten und Sänger. Im Leben jedes Opernsängers kommt einmal der Zeitpunkt, da er seinem Each entwachsen ist, und das Generationsproblem an ihn herantritt. Handelt es sich gar um den tenoralen Liebhaber, so wird dieses Problem besonders gravierend. Schwärmt der Rudolf eine Mimi an, die seine Enkelin sein könnte, dann ist er einfach nicht mehr glaubhaft. Die Folgen sind klar: es stellt sich allmählich das ungute Gefühl beim Sänger ein, nicht mehr richtig am Platz zu sein. Eine offene Aussprache mit der Direktion über das entstande ne Problem wäre in diesem Fall angebracht. Leider kommt es nur selten dazu. Dabei müßte in diesem offen geführten Gespräch ein Nachlassen der stimmlichen Kapazität des Sängers überhaupt nicht zur Diskussion stehen, sondern lediglich die Glaubwürdig keit der darzustellenden Gestalt den Ausschlag geben. Wird einem Sänger so die Wahrheit gesagt, dann wird er, wenn auch nicht gerne, zugeben, daß der Direktor nicht ganz im Unrecht ist. Denn Glaubwürdigkeit ist oberstes Gesetz der Büh ne. Schminke vermag viel, aber sie kann aus einem Sechzigjähri gen keinen Dreißiger machen. Diese Erkenntnis schmerzt, wenn man selbst davon betroffen wird. Auch mir ist sie nicht leicht gefallen. Als ich zum ersten Mal zu dieser Erkenntnis kam —ich hatte gerade meinen 50. Geburtstag gefeiert -, machte ich mir über die se Problematik Gedanken und bekam das Gefühl einer gewissen 326
XVIII /
N U N S C H M IE D E MICH, D E N
LETZ TEN STEIN
Unsicherheit. Es war in der Ära Karajans, und ich wollte mich darüber mit meinem Direktor aussprechen; also bat ich um einen Termin. Er empfing mich in der Pause einer »Tristan«-Vorstel lung, bei der ich wieder einmal den Seemann sang, in seinem Direktionszimmer, ein Glas Milch vor sich und die Füße auf dem Tisch, worüber ich mich durchaus nicht wunderte, denn das war seine Yoga-Methode, sich zu entspannen. Nachdem ich mein Anliegen vorgebracht hatte, sagte er: »Sie müssen verstehen, ich muß die jungen Leute heranziehen.« Und dann fiel das unvemieidliche Wort vom »Generationswechsel«. Ich war etwas betroffen, aber ich dachte über seine Worte nach. Diesem Gespräch folgte der allmähliche Abbau meiner jugend lichen Partien. Die ersten, die ich abgegeben habe, waren die Liebhaber des italienischen Fachs. Das geschah fast unbemerkt, als Karajan für das italienische Repertoire die Original spräche einführte und - auf Grund seines Vertrages mit der Mailänder Scala —es so gut wie ausschließlich mit italienischen Kräften besetzte. Er tat damit übrigens nichts anderes, als die meisten großen Opernhäuser der Welt damals längst zu tun pflegten. Als ich in Buenos Aires gastierte und nach großen F^rfolgen im deut schen Fach dort den Vorschlag machte, im Colon einmal auch eine italienische Partie zu singen, meinte Studienleiter Fingel: »Auch ich würde das sehr begrüßen, aber das ist bei uns leider kaum möglich. Es gehört einfach zur Tradition des Hauses, daß italienische Opern nur mit Italienern besetzt werden.« Die erste Mozart-Partie, die ich abgab, war der Octavio in »Don Giovanni«; dann folgte der Ferrando in »Così«, und auch das ging wie selbstverständlich vor sich, als das alte MozartEnsemble zerfiel, die bereits historisch gewordene Schuh-NeherInszenierung sich auflöste, Günther Rennert die Oper in Wien neu inszenierte und dafür nicht nur einen neuen Stil, sondern auch eine neue Besetzung brachte. Seltsamerweise blieben mir die andern Alozart-Liebhaber bis in die Gegenwart erhalten: den Belmonte sang ich noch 1972 in 327
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
der Staatsoper, den Tamino sogar noch 1977 in der Volksoper. Und es ist merkwürdig, daß mir das Publikum in diesen Partien nicht nur den Liebhaber abnahm, sondern auch die Jugend zu glauben schien, die ich nun wirklich nicht mehr hatte. Derartige Probleme gibt es beim Liedgesang freilich nicht. Als ich 1970, bereits seclizigjährig, in Barcelona gastierte, stellte die spanische Presse fest: »Wenn nicht gegenteilige Beweise vorlä gen, wäre man versucht zu bezweifeln, daß der Solist des Lieder abends von gestern wirklich derselbe Mann ist, der schon vor fünfunddreißig Jahren im Ensemble der Wiener Oper mitwirkte. Ebenso möchte man bezweifeln, daß jener Tenor, der 1936 unter Bruno Walter an die Öffentlichkeit trat, eine frischere und be herrschtere Stimme haben konnte als der Sänger, der zum Inter nationalen Musikfestival nach Barcelona eingeladen wurde.« Und vier Jahre danach, im Juli 1974, schrieb die »Wiener Zei tung« über meinen Liederabend in Schloß Schönbrunn: »Ein Altern scheint es hier nicht zu geben; ungebrochene Kraft und tenorales Feuer verbinden sich mit einer Interpretationskunst, die Frucht einer lebenslangen Auseinandersetzung mit dem Genre des Liedes ist. Fast nichts ist hier müde, alles jedoch reif gewor den. Solche Abende sollten einfach nicht enden.« Und ein paar Monate später, im April 1975, berichtete die »Presse« unter dem Titel »Im zweiten Frühling«: »Unvergeßli ches Bild: Der weißhaarige Sänger, Hand in Hand mit seiner ebenso weißhaarigen Gattin und Begleiterin am Podium des Brahmssaales, von den Ovationen des jugendlichen Publikums umbrandet, sichtbar von Herzen glücklich über den wieder ein mal errungenen Triumph —da ist keiner, dem man ihn lieber gönnte als Anton Dermota. - Was ist das Geheimnis dieses Erfolges, der dem Künstler in seinem >zweiten Frühling< nun schon seit Jahren treu bleibt? Gewiß nicht Nostalgie; denn die jungen Leute, die ihn da im letzten Jeunesses-Konzert umjubel ten, waren damals, in den vierziger und fünfziger Jahren der ersten Glanzzeit, zum überwiegenden Teil noch gar nicht auf der 328
XVIII /
N U N S C H M IE D E MICH, D E N
LETZTEN STEIN
Welt. Nein: Was sie spüren, ist die eminente menschliche und künstlerische Disziplin dieses Sängers, die ihn, den Fährnissen des nun doch schon vorgerückten Alters zum Trotz, immer wie der die Herrschaft über die widerspenstige Materie, über die Pro bleme des Textgedächtnisses und der fremden Sprache gewinnen läßt. Es ist das faszinierende Erlebnis, wie da während der ersten Liedgruppe jedesmal von neuem der optimale Stimmsitz, die rechte geistige und emotionelle Konzentration errungen werden muß ; und wie dann plötzlich bei der zweiten Gruppe ... die kost bare Stimme wieder voll da ist, mit höchster Kunst der Phrasie rung geführt wird, zu eindrucksvollen Höhepunkten aufblüht. Dazu die aus einem erfahrungsreichen Leben gewonnene Stärke des Ausdrucks ... Hilde Berger-Weyerwalds noble, ebenso anpas sungsfähige wie persönliche Begleitkunst zu rühmen, hieße Eulen nach Athen tragen; schade, daß sie nur >ihn< begleitet. Ein wun dervoller Abend.« Im Sommer 1978 wurde ich abermals zu einem Liederabend in Schönbrunn eingeladen. Ehe ich das Schloß betreten konnte, mußte ich mir erst den Weg durch jene Menschenmenge bahnen, die keinen Zutritt mehr gefunden hatte. Tage zuvor war das Konzert bereits ausverkauft. Es gelang mir gerade noch, ein paar unserer Studenten ohne Karten in den Festsaal der Großen Gale rie zu bringen. Und dann stand ich —nur wenige Tage nach dem durchlittenen Abend in Hohenems - wieder auf dem Podium und sang, von meiner Frau begleitet, die »Schöne Müllerin«. Über das Ergebnis berichtete die »Wiener Zeitung« unter dem Titel »Beglückung mit Dermota« folgendermaßen: »Lieder abende mit Anton Dermota gehören zum Beglückendsten und Erstaunlichsten, was Wien auf dem Liedsektor derzeit zu bieten hat... Wenn er >Die schöne Müllerin< singt, dann ereignet sich ein vokales Wunder. Zum einen hört man nach wie vor —und dies nach längerer Erkrankung des Künstlers - eine erstaunlich unverbrauchte, frische Stimme, die nichts von ihrem Schmelz, ihrer Strahlkraft eingebüßt hat; zum andern erlebt man eine Wie329
DERMOTA / TAUSENDUNDEIN ABEND
dergabe, wie sie eindringlicher, schlichter, ehrlicher empfunden nicht vorstellbar ist. Dermota vollbrachte eine Leistung, wie sie eben nur durch ständige Beschäftigung mit diesen Liedern über vier Jahrzehnte hin reifen und gedeihen kann. Diese den Charak ter und die Gefühlswelt der >Müllerlieder< voll auslotende Inter pretation läßt einen nicht mehr los. Zweifellos hat an ihr auch Hilda Berger-Weyerwalds sensible, in Ton und Ausdruck äußerst einprägsame Klavierbegleitung wesentlichen Anteil. —Als >Des Baches Wiegenlied< verklungen war, machte sich im Publikum echte Ergriffenheit bemerkbar; so sehr hatte es Dermota in sei nen Bann gezogen. Der anschließende Beifall erreichte dann höchste Begeisterungsgrade.« Ich habe aber nicht nur die freundlicheren Mül 1er-Lieder, son dern auch immer wieder die düstere »Winterreise« gesungen und fand auch damit die volle Zustimmung bei Presse und Publikum. »Als Anton Dermota vorige Saison die >Schöne Müllerin< sang, hatte man nur einen Wunsch: Er möge auch noch die >Winterreise< vortragen«, schrieb der »Kurier« im Februar 1975. »Nun ist der Wunsch in Erfüllung gegangen und hat auch gleich Erfüllung gebracht... Dermota interpretierte gemeinsam mit sei ner Frau, Hilda Berger-Weyerwald, diese Schubertsche Liedpas sion mit solch tenoralem Glanz, mit solcher Wehmut und Legato-Traurigkeit, mit solch nobler Empfindung und packender Konzentration, daß man nach und nach, Lied für Lied, die Gewißheit empfing: Hier ereignet sich Epochales, hier schließt sich ein Kreis, der vielleicht vor 150 Jahren bei den Hausmusik abenden mit Schubert am Klavier und dem Tenor Michael Vogl seinen Ausgangspunkt hatte ... Nach 20 Jahren fast ausschließli cher Bariton- und Baßinterpretationen gab er den Liedern zurück, was ihnen von Schubert eingehaucht worden ist: den Kontrast zwischen düsterer, dunkler Mollstimmung und dem Schmelz eines lyrischen, hellen, einschmeichelnden Timbres. Kei ne tiefe Stimme kann diesen Dualismus aus Todessehnsucht und Lebensfreude ähnlich ausdrücken ...« 330
XVIII /
N U N S C H M IE D E MICH, D E N
LETZTEN STEIN
Im Gegensatz dazu wurde mir der Generationswechsel auf der Opernbühne nicht leicht gemacht. Als Werner Düggelin 1968 zur Direktionszeit Egon Hilberts die »Entführung« in der Staatsoper neu inszenierte, ohne damit viel Erfolg zu haben, wurde die Par tie des Belmonte mit Fritz Wunderlich besetzt. Ich sollte alternie rend mit ihm singen, wurde auch zu den Proben aufgeschrieben, aber es wurde nicht mit mir gearbeitet. Die Premiere wurde von der Kritik heftig zerpflückt. Am Morgen einer Reprise kam Wunderlich mit dem Schlafwagen aus München heiser in Wien an, so daß er sich mittags zur Absage gezwungen sah. Die Staatsoper rief mich an; ich sollte wieder einmal als Retter in der Not einspringen. Es war bereits zwei Uhr nachmittags, und ich hatte die Partie in dieser Inszenierung nie wirklich geprobt. Dennoch sagte ich zu. Am nächsten Morgen, wir saßen gerade beim Frühstück, läute te die Hausglocke. Ein Bote brachte einen großen Blumenstrauß und dazu einen Brief, mit den Worten: »Ich danke Ihnen, mei nem großen Vorbild, für die liebenswürdige Hilfe, indem Sie für mich in der gestrigen >Entführung< rettend eingesprungen sind. Ihr Fritz Wunderlich.« Das war der seltene Fall eines Dankes, der mich darum besonders gefreut hat. Eine viel krassere Fehldisposition erlebte ich in der Zeit, als Rudolf Gamsjäger, ehe er die Direktion antrat, bereits Vorberei tungen für seine Ära traf Mitten in der sommerlichen Urlaubsru he, am 15. August 1972, rief er mich an und schlug mir vor, in einer geplanten Neuinszenierung der »Salome« unter der musika lischen Leitung von Karl Böhm die Partie des Herodes zu über nehmen. Ich war über diesen Vorschlag sehr überrascht. Meiner bisherigen Partie in der »Salome«, dem Narraboth, war ich wohl entwachsen, ich zweifelte aber sehr, ob der Herodes, eine typi sche Charakterpartie, für mich geeignet wäre. Gamsjäger redete mir zu: »Ich bin überzeugt, daß das eine sehr schöne Aufgabe für dich ist. Wenn du den Klavierauszug nicht hast, so kauf dir einen auf unsere Rechnungl« Ich begann sofort 331
DERMOTA / TAUSENDUNDEIN
ABEND
eifrig mit dem Studium. Es fiel mir aber keineswegs leicht, in die ses für mich völlig fremde Fach einzusteigen. Im Herbst wurde ich offiziell mit dem Studium der Partie beauftragt, wobei Gams jäger freilich bereits einschränkend hinzufügte : vorausgesetzt, daß Böhm mit dieser Besetzung einverstanden ist. Kurz darauf wurde ich verständigt: Karl Böhm wünsche sich als Herodes Hans Hopf aus München, ich aber solle die Partie mitstudieren. Die Bühnenproben begannen, und ich wurde dazu überhaupt nicht eingeladen. Ich protestierte, doch ohne jeden Erfolg. In der Direktion erfand man immer neue Ausflüchte. Damals widerfuhr es n*iir zum ersten und einzigen Mal in mei nem Leben, daß ich eine Partie, um die ich mich keineswegs beworben, die ich vielmehr halb gegen meinen Willen pflichtund auftragsgemäß studiert hatte, nicht singen durfte. Viel Arbeit, Mühe und Nerven hatte mich dieses Studium gekostet, und nun war alles vergebens. Eine Zumutung für einen Sänger, der immerhin fast vier Jahrzehnte dem Haus einige Dienste erwiesen hatte, eine persönliche Mißachtung, wie sie mir unter den zehn Direktionen, die ich erlebt beziehungsweise überlebt habe, nicht widerfahren ist. Und dann fand ich wie zum Trost eine mich künstlerisch begeisternde neue Aufgabe: die Partie des Dalibor in der gleich namigen Oper von Smetana. Als Alternativ-Besetzung für den rumänischen Tenor Ludovic Spiess, einer Neuentdeckung für Wien, mußte ich bereits bei der öffentlichen Generalprobe aus helfen. Spiess fiel aus mir unbekannten Gründen aus, ich wurde wortwörtlich auf der Straße aufgelesen und rasch in die Oper gerufen, schlüpfte in ein Kostüm, das gar nicht für mich geschneidert war, und betrat, völlig unvorbereitet und uneingesungen, die Bühne. So rettete ich die Generalprobe. Einen Dank für solch einen Einsatz darf man freilich nicht erwarten. Spiess, der dann doch die Premiere sang, blieb nur kurze Zeit in Wien. So übernahm ich die Partie und sang sie, solange die Oper im Repertoire blieb. 332
XVIII /
N U N S C H M IE D E MICH, D E N L E T Z T E N S T E IN
Ich habe sie stets mit Begeisterung gesungen. Das Slawische in der Musik und im Milieu lag mir ja gleichsam im Blut. Dalibor, der böhmische Freiheitsheld, wird gerne der slawische Florestan genannt. In der Kerkerszene mit Dalibors Freiheitsvisionen sind tatsächlich Parallelen zu »Fidelio« gegeben. Die Partie des Titel helden verlangt aber —nebst vielen lyrischen Passagen —auch äußerst kraftvolle Akzente, so daß ich mich ausdrucksbedingt bis an die Grenzen der stimmlichen Möglichkeiten steigern mußte. So gelang mir, wie ich hoffe, eine überzeugende Verkörperung dieses unglücklichen Helden. Das bestätigte die Presse, die unter der Überschrift »Der beste Dalibor« wie folgt berichtete: »... wie immer wiederholte sich das Erstaunliche, daß man durch diesen Sänger die Partie zum ersten Male zu hören glaubte. Es kann nicht oft genug betont werden: eine schöne Stimme allein macht noch keinen Sänger, erst der Künstler, der in der Musik lebt, der mit der Figur atmet, dessen Seele aufgegangen ist in dem, was er singt. Das ist bei Dermota der Fall. Wann immer er singt, wird durch ihn Musik zu einer Kostbarkeit, in jedem Ton durchgefühlt, in den feinsten Nuancen empfunden und mit voll kommener Natürlichkeit meisterhaft dargestellt.« Ins Charakterfach begab ich mich bald darauf mit zwei kleine ren Partien in zeitgenössischen Werken, die durch Neueinstudie rungen von 1968 beziehungsweise 1970 wieder in das Repertoire der Staatsoper aufgenommen wurden. »Katharina Ismailowa« von Dimitri Schostakowitsch ist eine Oper voll krassem Gesche hen, Ehebruch, Mord und Totschlag. Ich sang den jungen Ismailow, den Sohn des Kaufmanns Boris, mit dem Paul Schöffler sei nen Abschied von der Bühne nahm. In einer Szene, in der Ismailow von seiner Frau das Geständnis der Untreue erzwingen will und dabei von ihrem Liebhaber erschlagen wird, bringt die Par tie starke dramatische Akzente und erfordert vom Sänger gesang lich wie darstellerisch leidenschaftliche Ausbrüche. Ganz anders verhält es sich mit der Charakterpartie des Malers Titorelli in Gottfried von Einems Kafka-Oper »Der Prozeß«, die in einer 333
DERMOTA /
TAUSENDUNDEIN
ABEND
einzigen geschlossenen Szene eine Art gesanglicher Insel bietet. Ich konnte später den handschriftlichen Entwurf dieser ganzen Szene in einer Auktion erwerben und in meine Sammlung auf nehmen. Beide Opern hielten sich leider nur kurz auf dem Spiel plan. Eine weitere Möglichkeit ins Charakterfach hineinzuwachsen, wurde mir dann durch die Einladung der Wiener Volksoper geboten, die Titelpartie in Wilhelm Kienzls »Evangelimann« zu übernehmen. Dieses Werk, das man so gerne als »verstaubt« abtut, das ich aber als eine echte Volksoper voll schlichter musi kalischer Schönheit bewerte, stand längere Zeit nicht mehr im Repertoire und wurde im Herbst 1973 für mich aufgefrischt. Ich hatte gewisse Bedenken, die Partie zu übernehmen, weil ich nun doch wieder —im ersten Akt - als junger Liebhaber auf der Bühne stehen sollte. Deshalb machte mir Volksoperndirektor Karl Dönch den Vorschlag, die Partie zu teilen : ein junger Tenor sollte den ersten Akt, ich den zweiten und dritten singen. Aber dann entschloß ich mich doch, die ganze Partie durchzuführen. Schließlich - und das gab für mich den Ausschlag - liegt das Schwergewicht der Partie nicht im ersten, sondern in den beiden anderen Akten. Dort kommt ihre Dramatik voll zur Wirkung, dort hat Matthias seine großen Momente, seine dankbarsten Auf gaben. Der Erfolg gab mir recht. Daß das so volkstümlich gewordene Auftrittslied im 2. Akt, »Selig sind die Verfolgung leiden«, beim Publikum gut ankommen würde, war zu erwarten. Daß es mir gelang, die Gestalt des schwergeprüften Mannes und sein Schick sal glaubhaft zu machen, konnte ich an der Reaktion, an der ech ten Rührung des Publikums erkennen. Auch die Presse bestätigte es mit folgenden Worten: »Anton Dermota in der Titelpartie und wahrscheinlich im stillen sein Jubiläum feiernd. Er singt nun vierzig Jahre in permanenter Künstlerschaft ... Weiterhin ausgeglichen und vorbildlich, mit dem für Generationen unverwechselbar ins Gedächtnis eingegra 334
XVIII /
N U N S C H M IE D E MICH, D E N L E T Z T E N ST E IN
benen Timbre und seiner ehrlichen Künstlerschaft als ver2eihender Evangelimann einfach erschütternd. Wie gut, daß man das noch miterleben kann ...« Ich habe Wilhelm Kienzl noch persönlich gekannt und denke gerne an unsere Begegnung mit ihm und seiner Gattin Henny zurück. Wir waren wiederholt Gäste in seinem Heim, einem AltWiener Haus im 2. Bezirk mit leicht vergilbter, aber durchaus anheimelnder Atmosphäre, voll von Erinnerungsstücken, Medail len, Schleifen und Lorbeerkränzen. Ich wurde angeregt, mich mit Kienzls Liedern zu beschäftigen und dann auch vom damaligen Präsidenten der Gesellschaft der Musikfreunde, Alexander Hryntschak, eingeladen, einen Liederabend mit Werken aus dem Kienzl-Kreis zu geben. Viel später sind mir zwei Liederhand schriften des Meisters zum Geschenk gemacht worden, und ich habe sie nicht ohne Rührung meiner Sammlung einverleibt. Daß ich mich in meinen späten Jahren zuletzt auch noch in einer Buffo-Partie versuchen würde und dies zudem mit ganz besonderem Erfolg, hätte ich mir nie träumen lassen. Als man 1973 in der Staatsoper Tschaikowskys »Eugen Onegin« neu ins zenierte, wurde mir auf Wunsch des Regisseurs, Rudolf Noelte, die kleine Partie des Monsieur Triquet angeboten, jenes alten französischen Hauspoeten, der Tatjana zu Ehren ein Couplet vor trägt. Ich hatte in nicht weniger als vier Inszenierungen an der Staatsoper den Lenski gesungen —zum erstenmal, wie schon erwähnt, 1937 unter Bruno Walter, zuletzt 1961, mit Dietrich Fischer-Dieskau als Onegin -, er war eine meiner Lieblingspar tien. Und nun sollte ich den alten Triquet singen. Es kostete mich einige Überwindung zuzustimmen. Und dann kam die große Überraschung schon bei der Generalprobe. Als ich mein Couplet beendet hatte, setzte stürmischer Applaus mit lauten BravoRufen ein. Ich war über diesen unerwarteten Erfolg, den ich mir einfach nicht erklären konnte, ziemlich sprachlos. Noch in der Garderobe konnte ich mich nicht fassen. »Das kann doch nicht 335
DERMOTA / TAUSENDUNDEIN
ABEND
wahr sein«, sagte ich zu meiner Frau. Sie aber lächelte nur: »Es ist doch wahr!« Bei der Premiere wiederholte sich die Szene in gesteigerter Form: die Vorstellung wurde durch den spontanen Beifall des ganzen Flauses unterbrochen, und ich mußte nach meinem Abgang noch zweimal auf die Bühne, um mich für den Applaus zu bedanken. So habe ich, fast gegen meinen Willen, eine neue Partie und ein neues Fach erobert. Leider verschwand auch diese Oper allzu rasch aus dem Repertoire. Gleichwohl habe ich das Couplet des Triquet noch einmal gesungen, und zwar zu einem besonderen Anlaß, der Hochzeit des Wiener Psychiaters, Universitätsprofessor Dr. Erwin Ringel, in Dürnstein. Wenige Tage nach der Feier erhielt ich einen Dankbrief des Professors, dem das Autograph eines lateinischen Gedichts von Matthias Claudius beigeschlossen war. Dieses Autograph war nicht nur von hohem Sammlerwert, sondern auch seinem Inhalt nach höchst sinnvoll für mich ausgewählt. Claudius begrüßt darin die Genesung eines Freundes, der eben von schwerer Krankheit ins Leben zurückgekehrt ist. Professor Ringel spielte darauf in seinem Begleitbrief mit folgenden Wor ten an : »Verehrter Herr Kammersänger! Nach längerer Krankheit sind Sie uns in wunderbarer Weise und in schönerer Form denn je wiedergegeben worden. Der Chor Ihrer begeisterten Anhänger dankt Gott für diese wunderbare Entwicklung und bittet Ihn zugleich. Sie noch ungezählte Jahre uns in dieser großartigen Form und in bester Gesundheit zu erhalten ... Da es für mich eindeutig ist, daß Matthias Claudius sein lateinisches Gedicht vorausahnend für Sie und Ihren Weg geschrieben hat, ist es für mich auch die selbstverständlichste Sache der Welt, daß es eben in Ihre Häde gehört, jeder soll das haben, was am besten zu ihm gehört...« Die Krankheit, von der hier die Rede ist, war meine Herzat tacke, die sich als Folge einer Palestrina-Aufführung einstellte 336
STA A TSO PER
I
Mittwoch, 26. Oktober 1977
I I
Eteschränktar Koctanvarkaii - Prais« III
Anläßikh der AOjöhrigen Zugehörigkeit zur Wiener Staatsoper von Kammersänger Anton Dermota
1 1 I
PALESTRINA I 1
Musikalische Legende in drei Akten von Hans Pfitzner Dirigaiil: Hors! Stain Bühnanbild: Günihar Schneidar-Siamssan
i
1
Spiallailung; Ridxird Blalschodwr Kostüme: Ronny Reiter
Inizanierung: Hoiu HoHw
tol^
' Kar1*Jo«gf Hgring a. 0. Kordinol Christoph Modrvsthf, fOrtlbisd^ von Triont Tupomir Franc Carlo Borromao. r6misd>ar Kordinol . -------■»-*-. Dar Kordiaol von Loihrinpan . Abdbu« dar Fotrtofth von Asatrian . Anton BriMvon MOgIrti, ErzbiacMvon _______ __ ____ Grof luna. Orotor das KAnips von Sponian . . . Qottfriad Ho
Brsdlof Ercola Sorarolus, Za
I
«dJun^rth
Kirdia Sl. Mario Mopgiora in Re Iphino. sain Sohn ...............................vf.*wr« m KopallsAnpar dar päpstlidian Kopalla, Enbisshöfa. Bi«Mfa, Kbf, O
dar Tonkunt?*"..................... Orai Enpalstlimman..............................
.lîîïS’ï-.lI Silvia Harm
lia Hondlung spiate imNovambar und Oanmbar ISdS, dam Johro dar Baandigvng das Triantinar Karaik - Dar ar
1
Kasseneröffnung 17 Uhr
Anfang 18 Uhr
Ende nach 22 Uhr
Donnerstag, 27. Oktober. Richard Strouu Tage: Die Frau ohne Schatten. Bei aufgehobenem Abomemenl. Besdiränkler Korlenverkauf. Pieise V (Anfang I S Uhr) Freitag, 28. Oktober. Richard Strauss Toge: Capriodo. kn Abormemenl 5. Gruppe. Beschränkter Kartenverkauf. Preise IV (Anfang 19J0 Uhr) Samstag, 29. Oktober. In russischer Sprache: Boris Godunow. Beschränkter Kartenverkauf. Preise V (Anfang 1 Ì .3 0 Uhr) Sonntag, 30. Oktober. BoHettabend; Adog» Hcmmcrklovier - Nomos Alpha - Apollo - Lieder eines fahrenden Geseflen Bei aufgehobenem Abonnement. Preise IV (Anfang 19 Uhr)
I I II iI I
, , ............................................................. jBlSÎBl5ÎË0nËl5lBt5fSl5TBilïTSiIiïBËfËI^^ _
P rogram m d e r Ju h iläu m svorstellu n g a n lä ß lich d e r
40jä h rig e n
Z u g eh ö rig k eit A n to n
D erm o ta s z u r W ien er S ta a tso p e r
337
D E R M O T A / TAU SENDUNDEIN
ABEND
und einen zweimonatigen Spitalsaufenthalt notwendig machte. Ich hatte nämlich, trotz aller ärztlichen Warnungen, die Titelpar tie von Pfitzners Werk aus Anlaß meiner vierzigjährigen Zugehö rigkeit zur Wiener Staatsoper übernommen. Es war die große, meinem Alter entsprechende Aufgabe schlechthin. »Palestrina« hatte mich eigentlich durch meine gan ze Opernlaufbahn begleitet, beginnend mit 1937, als ich im Haus am Ring den »Ersten Meister« sang. Später kamen andere, durchwegs kleinere Partien hinzu. 1965/66, als der damalige Direktor Egon Hilbert das Werk wieder in den Spielplan auf nahm, bot er mir die Partie des Novaggerio an, mit der ich mich durchaus nicht befreunden konnte. Ich erklärte ihm, für mich käme nunmehr nur die Titelpartie in Frage. Zusammen mit dem jungen Fritz Wunderlich wurde sie mir tatsächlich zugeteilt. Nach der Ära Gamsjäger —von 1972 bis 1976 —übernahm Dr. Egon Seefehlner zu Beginn der Spielzeit 1976/77 die Staatsopern direktion. Er tat’s mit viel Idealismus und vielen schönen Plänen, von denen ich ihm wünschen möchte, daß er sie - zum Nutzen des Hauses, dem ich so innig verbunden bin —verwirklichen kann. Er war es, der mir den Vorschlag machte, den Palestrina zu meinem Jubiläum zu singen. Ich tat’s mit ehrlicher Freude und mit hohem künstlerischen Erfolg, wie unter anderem die Worte eines Wiener Musikkritikers beweisen, die unter dem Titel »Ein begnadeter Tenor« erschienen sind: »Anton Dermota feierte in der Titelpartie von Pfitzners >Palestrina< seine 40jährige Zugehöri^eit zur Wiener Staatsoper. Ein Sänger, der vier Jahrzehnte hindurch an ein und demselben Opernhaus singt, klingt das heute nicht wie eine Legende ? - Der Flugverkehr hat die Distanzen zwischen den Opernhäusern ver ringert, dafür aber auch die Karrieren der reisenden Stars ver kürzt. Auch an der Staatsoper sind viele Tenöre gekommen und gegangen. Anton Dermota ist geblieben, und das mit unvermin dertem Stimmglanz. - Palestrina zählt heute zu seinen besten Par tien. Erschütternd vermag er die Einsamkeit dieses schöpferi 338
XVIII /
N U N S C H M IE D E MICH, D E N
LETZTEN STEIN
sehen Menschen darzustellen, seine Resignation und seine Weis heit. Dermota, eine der letzten Persönlichkeiten eines inzwischen legendär gewordenen Wiener Ensembles ...« Pfltzners »Musikalische Legende« gilt als Meilenstein in der Operngeschichte und als eines der Werke, die an Ausführende wie Publikum höchste Anforderungen stellen. Für mich bedeutet die Verkörperung der Titelpartie die Krönung meines Opernre pertoires. Das Schicksal eines schaffenden Künstlers, dem eine Aufgabe übertragen ist, gegen die er sich zunächst aufbäumt, im Zweifel an der eigenen Kraft und Fähigkeit, ihr gerecht zu wer den, bis er schließlich —dem Ruf der ihm vorangegangenen Mei ster gehorchend —diese Aufgabe übernimmt und in Selbstüber windung ihrem letzten Geheimnis entgegenreift - dies alles dar zustellen, mehr noch, zu durchleben und glaubhaft zu machen, verlangt vom Sänger nicht nur stimmliche Ausdruckskraft und Bühnenerfahrung, sondern auch Lebensweisheit und innere Rei fe. So und nicht anders bin ich an diese Partie herangegangen. Wenn Palestrina nach vollbrachtem Werk, erschöpft, aber ver söhnt, sich an die Orgel setzt, um sich in Demut der Allmacht zu empfehlen, dann empfinde ich diese Szene immer so, als hätte sie Pfitzner für mich geschrieben. Darum mögen die letzten Worte, die Palestrina zu singen hat, am Ausklang dieses I^bensberichtes stehen : Nun schmiede mich, den letzten Stein, An einem deiner tausend Ringe, Du Gott —und ich will guter Dinge Und friedvoll sein.
Repertoire
Das Verzeichnis notiert das Repertoire getrennt nach Oper, Oratorium und Lied, wobei dem nach den Nationalfächern unterteilten Opernrepertoire die Klassische Operette angegliedert wurde.
Deutsche Oper
KIENZL : Der Evangelimann, Matthi
HÄNDEL: Julius Cäsar, Sextus;
D ’ALBERT: Die toten Augen, Ein
Kodelinde, Grimwald. GLUCK : Alceste, König Admet. MOZART : Die Zauherflöte, Erster Geharnischter, Tamino; Die IB^ntführung aus dem Serail, Belmonte ; Così fan tutte. Ferrando ; Don Giovanni, Octavio ; Fidelio,
Erster
Gefangener, Jacquino, Florestan (auch WEBER : Der Freischütz, Max. WAGNER: Die Meistersinger von Meister
Vogelsang,
David;
PFITZNER : Palestrina, Erster Mei ster,
Dritter Kapellsänger,
Bischof
Dandini, Palestrina. WOLF-FERRARI : Die neugierigen STRAUSS:
Der
Friedenstag
Ein
Piemonteser; Salome, Narraboth; Der Kosenkavalier, Ein Sänger, Ein Wirt;
in der Erfassung).
Nürnberg
Hirt.
Frauen, Florindo.
Idomeneo, Arbaces. BEETHOVEN :
as Freudhofer.
Zorn, Das
Meister Rheingold,
Froh; Der fliegende Flolländer, Steuer mann; Tannhäuser, Walther von der Vogel weide ; Tristan und Isolde, Ein jun ger Seemann; Das Liebesverbot, Lucio (konzertant); Parsifal, Vierter Knappe;
Arabella, Matteo, Graf Elemer; D a phne, Leukippos ; Capriccio, Flamand. HINDEMITH: Mathis der Maler, Hans Schwalb. KRENEK: Karl V , Franz I. (kon zertant). BERG : Wozzeck, Tambourmajor. MARTIN : Der Sturm, Ferdinand. VON EINEM : Der Prozfiß, Titorelli.
Tohengrin, Ein Edler. CORNELIUS : Der Barbier von Bag dad, Nureddin. LORTZING: Zar und Zimmermann, Marquis von Chateauneuf. FLOTOW : Martha, Lionel. NICOLAI: Die lustigen Weiber von Windsor, Fenton. HUMPERDINCK : Die Königskinder, Königssohn.
340
Italienische Oper D O N IZ E T n : Don Pasquale, Erne sto ; Der Tiebestrank, Nemorino. ROSSINI: Der Barbier von Sevilla, Graf Almaviva. VERDI: Traviata, Alfred Germont; Kigoletto, Herzog von Mantua, Borsa, Marullo; Der Troubadour, Ruiz; Mac-
ANHANG /
REPERTOIRR
heth, Macduff; Simone Boccanegra, Ga
STRAUSS: Die Fledermaus, Alfred;
briele Adorno; Othello, Cassio; Fal
1001 Nacht, Suleiman; Eine Nacht in
staff, Fenton.
Venedig, Herzog.
LEONCAVALLO: Beppo. PUCCINI:
Der
Bajazzo,
Bohème,
Rudolf;
hied Fa
Madame Butterfly, Linkerton; Turandot,
Das klassische, romantische und zeitgenössische Repertoire mit Lie
Altoum ; h a Rondine, Roger. DALLAPICCOLA: Der Geangene,
dern von Bach, Haydn, Mozart, Beet
Der Gefangene (konzertant).
Op. 48, und An die ferne Geliebte,
hoven
(Sechs
Lieder von
Geliert,
Op. 98), Schubert (Die schöne Mülle Französische Oper
rin,
Winterreise,
Schwanengesang),
des
Schumann (Liederkreis nach Heine,
Eremiten, Silvain. OFFENBACH : Hoffmanns Erzählun
Op. 24, Liederkreis nach Eichendorff,
gen, I loffmann.
Op. 48),
MAILLART : Das
Glöckchen
Op. 39, und Dichterliebe nach Heine, Mendelssohn,
Cornelius,
MASSENET : Manon, Des Grieux.
Brahms, Wolf, Mahler (Lieder eines
BIZET : Djamileh, El Harun.
fahrenden Gesellen), Reger, Pfitzner,
POULENC: Gespräche der Karmelite-
Strauss, Marx, Schönberg, Webern, Hindemith, v. Einem u. a. m.
rinnen, Beichtvater.
Oratorien, Chorwerke Slawische Oper CARISSIMI : Historia di Jephte. TSCHAIKOWSKIJ : Fique
Dame,
Tschekalinski ; Eugen Onegin, Lenski, Triquet.
Der
Messias; Judas
BACH : Matthäuspassion, Evange
BORODIN : Fürst Igor, Vladimir. MUSSORGSKIJ :
HÄNDEL:
Maccabäus ; Samson ; Belsazar.
Boris
Godunow,
Fürst Schuiskij. SCHOSTAKOWITSCH :
list und Tenorarien ; Johannespassion, Evangelist und Tenorarien ; Lukaspas sion, Evangelist; Weihnachtsoratori
Katerina
lsmailon>a, Sinowij Ismailow. SMETANA: Die verkaufle Braut, Hans ; Dalibor, Dalibor. JANACEK: ]enufa, Laca. STRAWINSKY : Oedipus Rex, Oedi pus.
um, Evangelist und Tenorarien; Hmoll-Messe;
Magnificat;
Kantaten
Nr. 12, 29, 50, 78, 106. HAYDN : Die Schöpfung; Die Jah reszeiten ; Die sieben Worte des Erlö sers am Kreuz; Missa in tempore bel li ; 'Fheresienmesse ; Mariazellermesse ; Nelsonmesse ; Harmoniemesse ; Pau
KJassische Operette ZELLER: Der Vogelhändler, Graf Stanislaus.
kenmesse. MOZART :
Krönungsmesse ;
C-
moll-Messe ; Requiem.
3 4 1
DERMOTA / TAUSENDUNDEIN
BEETHOVEN: Missa solemnis; C-Dur-Messe; Christus am Ölberg;
ABEND
ROSSINI : Stabat Mater. VERDI : Requiem. MAHLER:
IX .Symphonie; Chorphantasie.
Das
Lied
von
der
Erde; Lieder eines fahrenden Gesel SCHUBERT: Es-Dur-Messe; As-
Das
klagende
Lied;
PFITZNER : Von deutscher Seele. JANACEK: Missa glagolskaja.
THOLDY: Elias; Paulus. LISZT : Christus ; Faust-Sinfonie ; Graner Messe. BERLIOZ: Fausts Verdammung. BRAHMS: Rinaldo; Liebeslieder walzer. BRUCKNER:
len;
VIII. Symphonie, Tenorsoli.
Dur-Messe. MENDELSSOHN-BAR
SCHMIDT : Das Buch mit sieben Siegeln, Evangelist und Tenorsoli. SCHÖNBERG : Gurrelieder. HONEGGER : König David. KODALY : Psalmus hungaricus.
F-moll-Messe ; Te
KRONSTEINER: Maria. STRAWINSKI : Canticum sacrum.
Deum.
MARTIN : In terra pax.
DVORAK : Requiem.
Ehrungen und Titel 1946, Ernennung zum Kammersänger
chen Hochschulprofessor der Hoch
1955, Mozart-Medaille 1959, Ehrenkreuz für Wissenschaft
Kunst in Wien
und Kunst I. Klasse 1959,
Papst-Medaille
schule für Musik und darstellende 1970,
von
Johan
Max
Reinhardt-Medaille
der
Salzburger Festspiele
nes XXIII.
1971,
1960, Nicolai-Medaille der Wiener
hauptstadt Wien in Gold
Ehrenmedaille
Philharmoniker
1973,
1960, Ehrenmitgliedschaft: des Soli
Barcelona
Enrique
der
Bundes
Granados-Medaille,
stenverbandes der Wiener Staatsoper
1974,
1961, Ehrenring der Solisten der Wie
Hochschulprofessor
ner Staatsoper
1974, Orden der jugoslawischen Fahne mit dem goldenen Kranz
1965, Ernennung zum Professor
Berufung
zum
ordentlichen
1965, Komtur des päpstlichen Grego
1976, Goldenes Ehrenzeichen für Ver
rius Magnus-Ordens
dienste um das Land Wien gesamten
1976, Großes Ehrenzeichen für Ver
künstlerischen Personals der Wiener Staatsoper
dienste um das Bundesland Nieder
1969, Jubiläumsring
des
österreich
1969, Ehrenmitgliedschaft der Wiener
1977, Großes Silbernes Ehrenzeichen
Staatsoper
für
1970, Berufung zum außerordentli
Österreich
Verdienste
um
die
Republik
Diskographie Die Anordnung der nachstehenden Diskographie erfolgte der besseren Über sicht wegen in zwei Gruppen. Beginnend mit den Normalplatten, wurden zuerst die Einzelaufnahmen des Künstlers berücksichtigt, im Anschluß daran sein Mit wirken bei Gesamtaufnahmen und Sammelprogrammen, ln beiden Gruppen wur de größtmögliche Chronologie angestrebt, soweit die Aufnahmedaten feststellbar waren. Die Chronologie wird nur dort unterbrochen, wo es sich um Erstveröf fentlichungen von historischen Aufnahmen handelt, die ursprünglich nicht für die Schallplatte bestimmt waren. Aus räumlichen Gründen war es nicht möglich, Nummernänderungen, Umkoppelungen, Auskoppelungen einzelner Arien und Querschnitte durch Gesamtaufnahmen zu berücksichtigen. Jede Aufnahme erscheint daher nur unter ihrer ursprünglichen Veröffentlichungsnummer. Jürgen E. Schmidt
L Soloaufnahmen a) Normalplatten mit 78 Umdrehun
Dein ist mein ganzes Herz, aus Das
gen
Tand des Tächelns (Lehar)
Telefunken
Du Märchenstadt im Donautal, aus
Ich schloß die Augen, aus Manon
Das Spitv^/entuch der Königin (Strauß)
A 104j 3 (1959)
(Massenet)
Komm in die Gondel, aus Eine Nacht
Flieh, o flieh, holdes Bild, aus Manon
in Venedig (Strauß)
(Massenet)
A 10301 (1940)
E 2910 (1959) Wie sich die Bilder gleichen, aus Tosca
Dies Bildnis ist bezaubernd schön, aus Die Zauberßöte (Mozart)
(Puccini)
Nur ihrem Frieden weih’ ich mein
Und es blitzten die Sterne, aus Tosca
Leben, aus Don Giovanni (Mozart)
(Puccini)
E 3162 (1941) Daß nur für mich dein Herz erbebt,
A 10000 (1959) O weine nicht, Liu, aus Turandot (Puc
aus Der Troubadour (Verdi)
cini)
Sie wurde mir entrissen, aus Kigoletto
Keiner schlafe, aus Turandot (Puccini)
(Verdi) E 3336 (1942)
A 10087 (1940)
Una furtiva lagrima, aus Der Liebes
Célèbre Serenata (Toselli)
trank (Donizetti)
La Serenata (Tosti)
Rückseite: Georg O e ^ l
A 10413 (1940)
E 3733 (1943); in Österreich E 1046
Du bist meine Sonne, aus Giuditta
Der Odem der Liebe, aus Cosìfan tutte
(Lehar)
(Mozart)
343
DERMOTA / TAU SENDUNDEIN ABEND
Mutter, der Rote war allzu feurig, aus
15012 (30 cm) auf einer Seite, gekop
Cavalleria rusticana (Mascagni)
pelt mit einem Orchesterstück
E 3871 (1943) O Mimi, nie kehrst du wieder, aus Ca b) Langspielplatten
Bohème (Puccini) Die Stunde ist heilig, aus Die Macht des
Decca
Schicksals (Verdi) mit Georg Oeggl E 3880 (1943) Ich weiß für solch ein Leid, aus Mada me Butterfly (Puccini) Leb
wohl,
mein
Dalla sua pace, aus Don Giovanni (Mozart) K 28393 II
Blütenreich,
aus
mio
tesoro,
aus
Don
Giovanni
(Mozart) K 28393
Madame Butterfly (Puccini) mit Wal
Dies Bildnis ist bezaubernd schön, aus
traute Demmer und Georg Oeggl
Die Zauherflöte (Mozart) 71116
A 11054(1943)
Kein Andres, das mir so im Herzen
Decca
Wiener
Der Nußbaum (Schumann)
Karl Böhm
Mondnacht (Schumann)
Der Nußbaum (Schumann) M 38123
loht, aus Capriccio (Strauss) 71116 Philharmoniker,
Dirigent:
mit F4ilda Dermota, Klavier
Die Lotosblume (Schumann) M 38124
M 619 (September 1947)
Nimmersatte Liebe (Wolf) K 28400
Ich liebe dich (Grieg)
Der Musikant (Wolf) K 28400
Wiegenlied (Brahms)
Auf ein altes Bild (Wolf) K 28400
mit Ivor Newton, Klavier
Der Gärtner (Wolf) K 28400
M 620 (April 1948)
Ständchen (Strauss) M 38123
Heimliche Aufforderung (Strauss)
Zueignung (Strauss) M 38124
Morgen! (Strauss)
mit Hilda Dermota, Klavier
mit Ivor Newton, Klavier F 9355 (April 1948)
LXT 2592 (September 1950)
Dies Bildnis ist bezaubernd schön, aus
Die Nummern hinter den einzelnen
Die Zauberflöte (Mozart)
Titeln beziehen sich auf die gleichzei
Dalla sua pace, aus Don Giovanni
tige Veröffentlichung der Aufnahme
(Mozart)
als
K 2125 (April 1948)
Lediglich 71116 war eine 17-cm-Platte
Normalplatte
mit
78
U. p. M.
mit 45 Umdrehungen. Harmona
Die
Glück, das mir verblieb, aus Die tote
erschien auch in Lizenz bei der ameri
Stadt (Korngold) mit Hilde Zadek
kanischen Firma Everest unter der Nummer 3202, 1978 wurde sie von der
Niederösterreichisches Tonkünstleror
deutschen
chester, Dirigent; Wilhelm Loibner
»Dokumente«
14004 (25 cm) auf zwei Seiten
642233. Das auf der Plattenhülle ange
344
vorstehend
angeführte
Teldec
in
der
Platte
Reihe
wiederveröffentlicht
ANHANG /
DISKOGRAPHIE
gebene Aufnahmedatum »März 1951«
Una furtiva lagrima, aus Der Liebes
ist unrichtig.
trank (Donizetti)
Telefunken
Recondita armonia, aus Tosca (Pucci ni)
Una furtiva lagrima, aus Der Liebes
E lucevan le stelle, aus Tosca (Puccini)
trank (Donizetti)
Orchester der Städtischen Oper, Ber
Recondita armonia, aus Tosca (Pucci
lin, Dirigent : Artur Rother
ni) A II 599
NT 382 (April 1955 - Mozart-Arien)
E luce van le stelle, aus Tosca (Puccini)
In England erschienen die fünf ersten
A 11599 Wohin seid ihr entschwunden, aus
Mozart-A rien gekoppelt mit Ah! si ben mio, aus Der Troubadour (Verdi)
»Eugen Onegin« (Tschaikowsky) UV
Ella mi fu rapita, aus Kigoletto (Verdi)
110 (EP)
unter der Nummer LGX 66048
Orchester der Städtischen Oper, Ber
Anton Dermota - Lieder und Arien
lin, Dirigent: Artur Rother TM 68037
Widmung (Schumann)
(Mai 1954)
Der Nußbaum (Schumann)
Dichterliebe (Schumann)
Die Lotosblume (Schumann)
Widmung (Schumann)
Schöne Fremde (Schumann)
Der Nußbaum (Schumann)
Nina (Pergplesi)*
Mondnacht (Schumann)
Pur dicesti (Lotti)*
Die Lotosblume (Schumann)
O del mio dolce ardor, aus Paris und
Schöne Fremde (Schumann)
Helena (Gluck)*
mit Hilda Dermota, Klavier
Die ihr des unermeßlichen Weltalls
LE 6522 (Mai 1954) - in England:
Schöpfer ehrt (Mozart)*
LGX 66023
Ich baue ganz auf deine Stärke, aus
Arien aus deutschen, italienischen und
Die Entführung aus dem Serail (Mozart)*
russischen Opern
Per pietà, non ricercate, Arie, KV 420 (Mozart)*
Der Odem der Liebe, aus Cosìfan tutte (Mozart)
Una furtiva lagrima, aus Der Liebes
Wie stark ist nicht dein Zauberton,
trank (Donizetti)
aus Die Zauberflöte (Mozart)
Recondita armonia, aus Tosca (Puccini)
Hier soll ich dich denn sehen, aus Die Entführung aus dem Serail (Mozart)
E lucevan le stelle, aus Tosca (Puccini)
Konstanze, dich wiederzusehen, aus
Wohin seid ihr entschwunden, aus
Die Entführung aus dem Serail (Mozart)
Eugen Onegin (Tschaikowsky)
Wenn der Freude Tränen fließen, aus
mit Hilda Dermota, Klavier
Die Entführung aus dem Serail (Mozart)
Orchester der Städtischen Oper, Ber lin, Dirigent: Artur Rother
Wohin seid ihr entschwunden, aus Eugen Onegin (Tschaikowsky) Ich baue ganz auf deine Stärke, aus
BLE 14503 (November 1956 - die mit
Die Entführung aus dem Serail (Mozart)
Stern versehenen Titel)
345
D E R iM O T A
/
T A U S E N D U N D E IN
A B E N D
Amadeo
Temna, lepa noe (Janko Ravnik)
Lieder von Joseph Marx
V razkosni sreci (janko Ravnik)
japanisches Wiegenlied
Pocitek pod goro (Lueijna Marija
Marienlied
Skerjanc)
Selige Nacht
Vecerna
Waldseligkeit
Skerjanc)
impresija
(Lueijna
Marija
Venetianisches Wiegenlied
Vizija (Lueijna Marija Skerjanc)
Hat dich die Liebe berührt
Sonce
Am Flügel der Komponist
Ti si zacarala me (Marijan Lipovsek)
AVRS 3006 (1957) Auf der B-Seite der Platte singt Wil
O, saj ni smrti (Pavel Sivic)
ma Lipp sechs weitere Marx-Lieder Lieder von Fritz Skorzeny
Na gori (Jakob jez) V dno srea (Marjan Kozina)
Frühlingsregen
Veseli gosti (Marjan Kozina)
I.eise Lieder
mit Hilda Dermota, Klavier
Der Abend Ich wünsch’ es mir
LP 44 Lieder von Benjamin Ipavec
Die Widmung
Ce na poljane rosa pade
mit Hilda Dermota, Klavier
Pozabil sem mnogokaj, dekle
V
zavesah (Slavko Osterc)
Vse je tiho (Vilko Ukmar)
AVRS 5010
Iz gozda so ptice odplule
Auf der B-Seite der Platte befindet
Ciganka Marija
sich die Fantasie-Sonate »In memo-
V spominsko knjigp
riam Ginette Neveu« von Fritz Skor
üblaku
zeny.
Mak zari Na poljani
Telefunken Winterreise (Schubert) mit Hilda Dermota, Klavier BLE 43072/75, Stereo SLT 43072/73 (September 1962)
Gallus (Jugoslawien)
Menih V mrak in vihar mit Hilda Dermota, Klavier LP 54 (1972) Auf der B-Seite befindet sich die Sere nade von Benjamin Ipavec. Preiserrecords
Lieder slowenischer Komponisten
Ein Liederabend mit Anton Dermota
Pred durmi (Josip Paveie)
Dichterliebe (Schumann)
Mlada pesem (josip Paveie)
An Chloë (Mozart)
Otoznost (Marij Kogoj)
Abendempfindung (Mozart)
Cveti, eveti rozica (Anton Lajovic)
Nacht und Träume (Schubert)
Mesec v izbi (Anton Lajovic)
Der Musensohn (Schubert)
Vecer (Anton Lajovic)
Wir wandelten (Brahms)
Vasovalec (janko Ravnik)
Ständchen (Brahms)
5 4 C
ANHANG /
DISKOGRAPHIE
Nimmersatte Liebe (Wolf)
Ich trage meine Minne (Strauss)
Der Gärtner (Wolf)
Die Nacht (Strauss) Seitdem dein Aug’ in meines schaute
Ach weh mir unglückhaftem Mann (Strauss)
(Strauss)
Du meines Herzens Krönelein
Breit’ über mein Haupt (Strauss)
(Strauss)
Ich liebe dich (Strauss)
Ständchen (Strauss)
Zueignung (Strauss)
mit Hilda Dermota, Klavier
Heimliche Aufforderung (Strauss)
SPR 3256 (Januar 1973)
Maria Reining und Lea Piltti singen
Richard Strauss begleitet 1
weitere 12 Lieder des Komponisten
Heimkehr (Strauss)
PR 3262 (Historische Aufnahmen von
Seitdem dein Aug in meines schaute
1942)
(Strauss)
Die schöne Müllerin (Schubert)
All mein Gedanken (Strauss)
mit Hilda Dermota, Klavier
Glückes genug (Strauss)
SPR 3274 (Dezember 1976)
In goldener Fülle (Strauss)
Winterreise (Schubert)
Sehnsucht (Strauss)
mit Hilda Dermota, Klavier
Hilde Konetzni und Alfred Poell sin
SPR 3287 (Dezember 1976)
gen weitere 10 Lieder des Komponi
An die ferne Geliebte (Beethoven)
sten
Auf dem Strom (Schubert)*
PR 3261 (Historische Aufnahmen von
Liederkreis op. 39 (Schumann)
043) Richard Strauss begleitet 2
mit Hilda Dermota, Klavier
Du
meines
Herzens
und Robert Freund, Horn Krönelein
(Strauss)
SPR 3292 (Oktober 1974 und Februar 1977)*
II. M itwirkung bei Gesamtaufnahmen Messe in h-Moll, B W V 232 (Bach)
Staatsopernorchester
Emmy Loose, Hilde Ceska, Gertrud
Dirigent:Jonathan Sternberg
Burgsthaler-Schuster,
Oceanic OCS 24 Die Meistersinger von Nürnberg: 1. Akt
Anton
Heiller,
Alfred
Poell,
Akademie-Kammer
(Wagner) Partie des David
chor, Wiener Symphoniker Dirigent: Hermann Scherchen
Hilde Güden, Else Schürhoff, Gün
Westminster WL 3037-9 (1930) Stabat mater (Rossini)
ther Treptow, Paul Schöffler, Otto
Ilona Steingruber, Dagmar Hermann,
Wiener Staatsopernchor, Wiener Phil
Paul Schöffler
harmoniker
Akademie-Kammerchor,
Edelmann, Karl Dönch
Wiener
Dirigent: Hans Knappertsbusch
347
D E R M O T A
/
T A U S E N D U N D E IN
Decca EXT 2560-1 (Aufgenommen
A B E N D
Die Aufnahme erschien dann voll
im September 1950)
ständig als EXT 2659-64
Diese Aufnahme erschien auch auf 78
Sinfonie Nr. 9 d-Moll Op. 125 (Beetho
U. p. M.: X 53046-53: K 28385-92 Die Fledermaus (Joh. Strauß) Partie des
ven) Hilde Güden, Sieglinde Wagner, Eud-
Alfred Hilde Güden, Wilma Lipp, Sieglinde
wig Weber Singverein der Gesellschaft der Mu
Wagner, Julius Patzak, Alfred Poell
sikfreunde, Wiener Philharmoniker
Wiener Staatsopernchor, Wiener Phil
Dirigent : Erich Kleiber
harmoniker
Decca EXT 2725-6 (Aufgenommen
Dirigent : Clemens Krauss
im Juni 1952)
Decca EXT 2550-1 (Aufgenommen
Die Aufnahme wurde später auf nur
im September 1950)
eine Platte reduziert: EXT 5645
Diese Aufnahme erschien auch noch
Kantate Nr. 78 »Jesu, der du meine See
auf 78 U. p. M.: K 23112-22 : K 28405-
le« (Bach) Kantate Nr. 106 »Gottes Zeit ist die
16 Die Zauherflöte (Mozart) Partie des
allerbeste Zeit« (Bach)
Tamino Wilma Eipp, Irmgard Seefried, Eud-
Teresa Stich-Randall, Dagmar Her
wig Weber, George Eondon, Erich
Chor und Orchester der »Bach Guild«
mann, Hans Braun
Kunz
Dirigent : Felix Prohaska
Singverein der Gesellschaft der Mu
The Bach Guild (Vanguard) BG 537
sikfreunde, Wiener Philharmoniker
(1954)
Dirigent : Herbert von Karajan
In Europa: Amadeo AVRS 6003
Columbia CX 1013-5 (Aufgenommen
Salome (Strauss) Partie des Narraboth
im November 1950)
Christel Goltz,
Diese Aufnahme erschien auch noch
Margareta
Kenney,
auf 78 U. p. M.: EWX 426-44
Julius Patzak, Hans Braun Wiener Philharmoniker,
Das Lied von der Erde (Mahler)
Clemens Krauss
Elsa Cavelti, Wiener Symphoniker,
Decca EXT 2863-4 (Aufgenommen
Dirigent : Otto Klemperer Vox PE 7000 (Aufgenommen im Mai
im März 1954) Der Kosenkavalier (Strauss) Partie des
1951)
italienischen Sängers
Zur Zeit als Pickwick
MPD 901
Dirigent:
Maria Reining, Sena Jurinac, Hilde
erhältlich
Güden, Eudwig Weber, Alfred Poell
Die Meistersinger von Nürnberg: i. und
Wiener Staatsopernchor, Wiener Phil
3. Akt (Wagner) Partie des David Besetzung wie beim 2. Akt
harmoniker Dirigent: Erich Kleiber
Decca EXT 2646-7 (i, Akt) und EXT
Decca EXT 2954-7 (Aufgenommen
2648-50 (3. Akt)
im Mai und Juni 1954) MissasolemnisD-dur Op. 123 (Beethoven)
(Aufgenommen im September 1951) 3 4 8
ANHANG /
DISKOGRAPHIE
Maria Stader, Marianna Radev, Josef
Vanguard VRS 471-2 (Aufgenommen
Greindl
im juni 1955)
Chor der St. Hedwigs-Kathedrale, Ber liner Philharmoniker
Arabella (Strauss) Rolle des Matteo
Dirigent : Karl Böhm
Lisa della Casa, Hilde Güden, George
In Europa: Amadeo A VRS 6024-5
Deutsche Grammophon 18224-5 LPM
London, Otto Edelmann
(Aufgenommen im Januar 1955)
Wiener
Così fan tutte (Mozart) Partie des Fer
Georg Solti
Dirigent:
Decca LXT 5403-6 (Aufgenommen
rando Lisa
Philharmoniker,
della
Emmy
Casa,
Loose,
Christa
Erich
Ludwig,
Kunz,
Paul
im Mai und Juni 1957) Sinfonie Nr. 9 d-Moll Op. 125 (Beetho
Schöffler
ven)
Wiener Staatsopernchor, Wiener Phil harmoniker
Teresa Stich-Randall, Majdan, Paul Schöffler
Hilde
Dirigent : Karl Böhm
Wiener
Decca LXT 5107-9 (Aufgenommen
Symphoniker
im Mai 1955) Don Giovanni (Mozart) Partie des Don
Dirigent : Karl Böhm
Ottavio Suzanne Danco, Lisa della Casa, Cesa
men im Juni 1957) Fantasie für Klavier, Chor und Orchester
re Siepi, Fernando Corena,
c-Moll Op. 80 (Beethoven)
Hilde
Güden, Walter Berry, Wiener Staats opernchor, Wiener Philharmoniker
Staatsopernchor,
RösslWiener
Philips (Fontana) 668 CL (Aufgenom
Hans Richter-Haaser, Klavier —Tere sa Stich-Randall, Judith Hellwig, Hilde
Dirigent :Josef Krips
Rössl-Majdan,
Decca LXT 5103-6 (Aufgenommen
Schöffler
Erich
Majkut,
Paul
im juni 1955) Missa solemnis d-Moll »Ne/son-Messe«
Wiener Symphoniker, Dirigent: Karl
(Haydn)
Philips (Fontana) 663 000 ER (Aufge
Böhm
Teresa Stich-Randall, Elisabeth Hön
nommen im juni 1957)
gen, Frederick Guthrie
Magnificat für Soli, Chor und Orchester in
Akademie
Kammerchor,
Orchester
der Wiener Staatsoper (Volksoper)
D-Dur, F W V 243 (Bach)
Dirigent ; Mario Rossi
Mimi Coertse, Margarita Sjöstedt, Hil de Rössl-Majdan, Frederick Guthrie,
Vanguard VRS 470 (1955)
Josef Nebois, Chor des Österreichi
In Europa: Amadeo A VRS 6021
schen Rundfunks
Die Schöpfung (Haydn) Partie des Uriel
Orchester der Wiener Staatsoper in
Teresa Stich-Randall, Anny Felber-
der Volksoper
mayer, Frederick Guthrie, P. Schöffler
Dirigent : Felix Prohaska
Wiener
The Bach Guild (Vanguard) BG 555,
Staatsopernchor,
Wiener
Staatsopernorchester (Volksoper)
Stereo 5005 (Aufgenommen 1957)
Dirigent: Mogens Wöldike
In Europa : Amadeo A VRS 6076
349
D E R M O T A
/
T A U S E N D U N D E IN
A B E N D
Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125 (Beethoven)
Singverein
Joan
Musikfreunde, Berliner Philharmoni
Sutherland,
Norma
Proctor,
der
Gesellschaft
Arnold van Mill
ker
Chorale du Brassus et Choeur des Jeu
Dirigent : Herbert von Karajan
der
nes de l’Eglise Nationale Vaudoise
Deutsche Grammophon 138 767 (Auf
Orchestre de la Suisse Romande, Diri
genommen im Oktober 1961)
gent : Ernest Ansermet
Der Rosenkavalier (Strauss) Partie des
Decca SXL 2274 & ACL 77 (Aufge
Wirtes Regine
nommen im April 1959) Die Fledermaus (Joh. Strauß)
Crespin,
Yvonne
Minton,
Helen Donath, Manfred Jungwirth
Gerda Scheyrer, Wilma Lipp, Christa
Wiener Staatsopernchor, Wiener Phil
Ludwig, Karl Terkal, Walter Berry Das Philharmonia Orchester und
Dirigent : Georg Solti
Chor, Dirigent : Otto Ackermann
Decca SET 418-21 (Aufgenommen im
harmoniker
Columbia CX 1688-9 (Aufgenommen
November 1968)
im Juni undjuli 1959) Missa in tempore belli »Paukenmesse«
Requiem K V 626 (Mozart)
(Haydn)
Otto Edelmann
Wilma
Lipp,
Hilde
der
Rössl-Majdan,
Netania Davrath, Hilde Rössl-Majdan,
Singverein
Walter Berry, Wiener Kammerchor
Musikfreunde, Wiener Philharmoni
Gesellschaft
der
Orchester der Wiener Staatsoper in
ker
der Volksoper
Dirigent: Bruno Walter
Dirigent : Mogens Wöldike
Sony (Japan) SOCO i i i (Aufgenom
Vanguard VRS
1061, Stereo
2075
(Aufgenommen im Mai i960)
men im Juni 1956) Das Buch mit sieben Siegeln (Schmidt)
In Europa: Amadeo AVRS 6193
Partie des Johannes
Kantate Nr. 12 »Weinen, Klagen, Sor
Robert Holl, Margarita Kyriaki, Her
gen, Zagen« (Bach)
tha Töpper, Thomas Moser, Artur
Kantate Nr. 29 »Wir danken dir, Gott«
Korn, Rudolf Scholz, Grazer Concert-
(Bach)
chor.
Netania Davrath, Hilde Rössl-Majdan,
künstlerorchester, Dirigent: Alois J.
Niederösterreichisches
Ton
Walter Berry, Wiener Kammerchor
Hochstrasser
Orchester der Wiener Staatsoper in
Preiserrecords SQPR 3263-4 (Aufge
der Volksoper
nommen im Dezember 1975)
Dirigent: Mogens Wöldike
Messe c-Moll K V 427 (Mozart)
The Bach Guild (Vanguard) BG 610,
Edita
Stereo 5035 (Mai i960)
mayer, Robert Holl ORF-Chor, ORF-Symphonieorchester,
In Europa: Amadeo AVRS 6212
Gruberova,
Regina
Winkel
Requiem K V 626 (Mozart)
Dirigent : Anton Heiller
Wilma
Unverkäufliche Schallplatte des ORF
Lipp,
Walter Berry
350
Hilde
Rössl-Majdan,
(1976)
ANHANG /
DISKOGRAPHIE
^ in zeltitel in Sammelprogrammen II
mio
tesoro,
aus Don Giovanni
(Mozart) - Querschnitt Clara Ebers, Bruna Rizzoli, James Pea
Amadeo AVRS 1064 Wer ein Lielxrhen hat gefunden, aus Die Entführung aus dem Serail (Mozart)
se, Walter Berry Hamburger Rundfunkorchester, Diri
Szene und Duett Osmin-Belmonte
gent: Wilhelm Brückner-Rüggeberg
Wiener
Saga 5362—Joker SM 1108
Karl Böhm (Aufgenommen 1944)
(mit Herbert Al sen) Philharmoniker,
Dirigent:
Dalla sua pace, aus Don Giovanni
»Opernabend der Erinnerung«
(Mozart) »Le Grandi Opere Liriche«
BASf^ 05 21549-0
Hamburger Rundfunkorchester, Diri
Heimkehr (Strauss) »Richard Strauss
gent: Wilhelm Brückner-Rüggeberg
Liederalbum« BASF 22 21807—4
Joker SM 1142 Un’ aura amorosa, aus Cost fan tutte
Könnt’ ich mit ihnen fliegen, aus Cag
(Mozart) »Le Grandi Opere Liriche«
liostro in Wien (Strauß) (mit Edita Gru-
Hamburger Rundfunkorchester, Diri
berova)
gent: Wilhelm Brückner-Rüggeberg
Wo die wilde Rose erblüht, aus Das Spitzßntuch der Königin (Strauß)
Joker SM 1143 Ich hab’ auf meiner Fahrt gar viel
ORF-Symphonieorchester,
geseh’n, aus 1001 Nacht (Strauß)
Julius Rudel
Dirigent :
Orchester der Bregenzer Festspiele,
»Johann Strauß für Fortgeschrittene«
Dirigent: Heinrich Hollreiser
Unverkäufliche Schallplatte des ORF
»20 Jahre Bregenzer Festspiele«
(1975)
Live-M itschnitte, die ohne Wissen und Billigung der m itw ir kenden Künstler veröffentlicht wurden : Die Meistersinger von Nürnberg (Wagner)
Alexander Kipnis, Julie Osvath
Partie des Zorn
Wiener Staatsopernchor, Wiener Phil
Maria Reining,
Kerstin
Thorborg,
harmoniker
Henk Noort, Hans Hermann Nissen
Dirigent: Arturo Toscanini (Salzbur
Wiener Staatsopernchor, Wiener Phil harmoniker
ger Festspiele 1937) Requiem K V 626 (Mozart)
Dirigent: Arturo Toscanini (Salzbur
Elisabeth Schumann, Kerstin Thor
ger Festspiele 1937)
borg Alexander Kipnis
Die Zauberflöte (Mozart) Partie des i.
Wiener Staatsopernchor, Wiener Phil
Geharnischten
harmoniker
Jarmila Novotna, Helge Rosvaenge,
Dirigent: Bruno Walter (Paris 1937)
351
D E R M O T A
/
T A U S E N D U N D E IN
Daphne (Strauss) Partie des Leukippos
A B E N D
Othello (Verdi) Partie des Cassio
Rose Bampton, Set Svanholm, Ludwig
Dragica Martinis, Ramon Vinay, Paul
Weber Chor und Orchester des Teatro Colon
Schöffler, Sieglinde Wagner Wiener Staatsopernchor, Wiener Phil
Dirigent ; Erich Kleiber (Buenos Aires
harmoniker
1948)
Dirigent : Wilhelm Furtwängler (Salz
Don Giovanni (Mozart) Partie des Don
burger Festspiele 1951)
Ottavio Elisabeth
Sinfonie Nr. 9 d-M oll op. 125 (Beethoven) Schwarzkopf,
Ljuba
Irmgard Seefried, Rosette Anday, Paul
Welitsch, Tito Gobbi, Erich Kunz
Schöffler
Wiener Staatsopernchor, Wiener Phil
Singverein der Gesellschaft der Mu
harmoniker Dirigent; Wilhelm Furtwängler (Salz
Dirigent: Wilhelm Furtwängler (Mai
sikfreunde, Wiener Philharmoniker
burger Festspiele 1950)
1953 Wien)
Fidelio (Beethoven) Partie des Jacqui-
Don Giovanni (Mozart) Don Ottavio
no
Elisabeth
Kirsten Flagstad, Elisabeth Schwarz
Grümmer, Cesare Siepi, Otto Edel
Schwarzkopf,
Elisabeth
kopf, Julius Patzak, Paul Schöffler
mann
Wiener Staatsopernchor, Wiener Phil
Wiener Staatsopernchor, Wiener Phil
harmoniker Dirigent: Wilhelm Furtwängler (Salz
harmoniker
burger Festspiele 1950)
burger Festspiele 1955)
Dirigent: Wilhelm Furtwängler (Salz
Bildnachweis E lf r ie d e I ls e
A lf r e d K a r l
W
B e r lin - W
C e r m a k ,
E llin g e r ,
P h o t o
U m
B r o n e d e r ,
B u h s ,
W
ie n ;
ilm ie n :
W
1 0 ,
ie n :
H a n s F r itz
G e b a u e r ,
H a g e n , K e r n ,
W
L a u z e n s k y ,
H e r th a
1 4 ,
2 0 ,
19 3 9 ,
A
B a y r e u th :
ie n ;
35
2 5
18
N e w
D r . A lle m
ie n : ü lle r ,
3 8 W
s - P h o t o s
ie n :
1 3
A g e n c y ,
t h e n : 3 2
B r u n o F r a n z
S a lz b u r g :
W
S c h u ld a -M
U n io n
s c h la g p h o t o
P h o t o
2 8
3 4
S a lz b u r g :
P a y e r ,
F r e d
2 6
e r s d o r f :
e n
V ö lk e l,
W
ie n :
1 7
V o t a v a ,
W
ie n :
2 4
K u r t
Z e r z a w y ,
n ic h t a u s
W
z it ie r te n
d e m
A r c h iv
ie n :
3 3
B ild e r d e s
s t a m
A u t o r s .
Personenregister
Abendroth
262
Abraham Aigner
55
Betetto Bing
38 f.
Binkau
313
Claudius
188,223
336
Colloredo
63
Alsen
84, 121, 166, 170
Alwin
76, 86, 113
Birkle 298 Bizet 112
Cornelius
Anday
113, 163, 269,
Björling
Cuvillier
Böhm
276 Ansermet Aslan
196, 266 f.
151, 153 F, 179
Audran
33
97, 100, II7,
331 f
Dermota, 218
Borgioli
121 33
Brahms
37, 289 f, 293,
188, 223, 234, 241, 260, 267, 293, 301,
303, 3II, 314 Braun 163, 223, 282 Brems
112
Bruckner 281, 313
98
Bülow, von
314
Benya
Busch
244 f, 313 247
191, 193, 198, 200,
197
203, 210, 231, 234,
Buschbeck
133
Buxbaum
237 ff, 249 F, 233 ff.
61
263, 270, 273, 273, 277, 282 f, 287,
Hilda s. Dermota,
Caruso
Hilda
Casa Lisa della
Berlioz Berry 305
34 213,240,247,
71 f, 77 ff.
109 f, 116 f, 120, 126,
174, 179 F, 184, 189,
Berger von Weyerwald,
Berger von Weyerwald, Rosa 117
Berger v. Weyer
136 ff, 161, 167 f. 171
Berg
14
Dermota, Hilda geb.
128 ff, 133, 131,
Brückner
Bugarinovic
Berger
Dermota, Hijacint
wald
196, 268,
303, 312 Benatzky 33 137
14,
160
Borodin
219 20, 34, 37,
14
Bernadette
20 f, 47 f, 133 f, 137,
242
74, 97, 135, 137 f-. 141, 132, 136, 183,
267, 269 f
273 Dermota, Gasper
II2, 121
Barthou Beethoven
298
Debussy
Barbieri
218
171
Czerwenka
Dermota, Balthasar
Bokor
Battistini
Cvejic
298 237
192, 212, 228, 244 ff.
Bohnen
207
88
260 f, 264 f, 267, 303,
Baiser
Bampton
Dermota Leopold
121, 133, 142, 143 f. 131 f, 176, 182 f, 190,
Bach 37, 9 3 f, 171, 301, 306 108,133
307
Cordes-Dermota, Leo s.
218
289 ff, 293, 298 f. 124,
146, 247 Cebotari
302 ff, 303 ff, 316, 320 f, 328 ff, 336
121, 148 f.
192 Charpentier
33
Chruschtschow
Dermota, Jovita 133F, 136 ff, 161, 184, 200, 210, 237, 233 F, 238,
133
271, 299
353
D E R M O T A
Dermota, Joza (Joseph) 21 ff, 34 f, 37, 40, 129 F, 134 Dermota, Jozefa 23 Dermota, Julia 273
20,
T A U S E N D U N D E IN
Gigli
533 Eis 179 f Elisabeth von Bel
Giordano
20, 47 ff, 68, 129, 141, 167
191
Gostic
68, 94, 171
208
Gounod
36
Engel, Erich
197, 208,
Graarud
96
Erhardt
Graf
114, 202, 207,
209,213 Etti
86, 121
Ferencsik
Dermota, Marian
Figl
84, 236
Grasberger 12 3
Greindl
242
Grenzebach
193, 195,
306
178,263
Finzgar
19
247,282 141b
Güden
Flesch
Gui
271 14
Dermota, Nikolaus 273
111
Flory
168 217
Foerster
Dermota, Tatjana
Forst
34
142, 146, 181 f.
192, 269, 324 196
Gulda
Forschner
213
Gürtner
117
Gutheil-Schoder
170
64
133 f, 136 ff, 161,
Franter
166
Hakansson
184, 200, 210, 237,
Fricsay
243 f.
Händel
233 f, 238, 269 ff.
Fuchsig
270
Hann
299
Führich
72
Hartmann, Georg
Desormière
186
Dohnanyi
207
Domgraf-Faßbaender
108
Dönch
334 320
Drimmel
179, 262, 270
Düggelin
331
Duhan
73, 79, 92 f.
144, 289 Dvorak
Furtwängler
113, 120,
137 f, 141, 183,
Einaudi
354
127 b
124, 131 Haslinger
267
Hauer
33
Gal los
108 f, 144,
247 196
314
313 34, 96,
99, 171, 197, 199, 241, 268, 271, 292, 312,
193 f Gamsjäger
331 f, 338
Gaspersic
43 f, 48, 62
Gerhart
73
Gerlach
119
Ghiringhelli Gielen
147
Hartmann, Rudolf
232 ff, 244, 247, 238,
Ghazarian Edelmann
282
171, 312
Haydn, Joseph
Drechsler
93 f.
Gründgens
29% 335 Flagstad 207,222
173,
74,
Grümmer
238, 272 f, 299 Dermota, Marian
120
Großmann 98
Fischer-Dieskau
Dermota, Melchior
313
Gregor
200, 210, 237, 255 f.
(Enkel)
33
Engel, Edita
Dermota, Liza 14, 20 ff, 37, 129 f. (Sohn)
218
Glatter-Götz 309 Goltz 223, 244, 269
227, 233, 327 14,
A B E N D
Einem, von 246, 292,
gien
271,
Dermota, Leopold
/
207
280 228
314 Haydn, Michael Heger
iio
Heine
312
Helletsgruber II7, 121 Herbeck
281
314
111,
A N H A N G / P E R S O N E N R E G IS T E R
Hermann
Kaufmann
146
Hilbert
Kennedy
234 f.
Kerber
267 f, 292 Hitler
132 ff, 199,
217 f, 221 Hochstrasser Hollreiser Hol2meister Höngen Hopf
262, 332
Hornsteiner Hotter
132, 206, 221,
Hryntschak Humperdinck
90, 126
Hüni-Mihacsek Jahn
271
315
Jankovic
21, 38 f, 43,
86, i n ,
98,108,113
195, 237, 248, 298
222 ff, 244, 267 148,
Krips, Mizzi
166,
170,
318
Klose
232 f
Knappertsbusch
64,
Lazzari
196
133,
140 ff.
Jürgens
177
Kokoschka
Jurinac
146, i6 4 f, 171
Komar, Dora
Kafka
Komarek
118
235 ff
Leinsdorf Leitner
63 f, 76, 90,
108
333 55
Konetzni, Anny
Kamann
262
143 Konetzni,
loi, 176,
182 f, 189, 222, 227 ff,
237 ff,
265,
267, 269 f, 284, 327
82 f 298
Lind
249
Lipp
165, 181, 194,
239 f, 267, 284
Kalman Karajan
121 178
Lehar 91, 143 Lehmann 84, 100, 113
s. Komarek Kabasta
72,96
Legge
145, 147, 152, 183, 260, 267
283
112 f.
Lippe Liszt
125,
Loibner
131,248
London
284
212
Loose 197
Hilde
119,231 306, 312, 314
143, 164 b, 188, 210, König
152,
2 39, 265, 284
Lafite
Juch
148,
192 b, 210, 231, 236,
262
126 f,
Johannes XXIII.
75, 84, 100,
170, 173, 175 f, 188,
113, 115, 117, 122 f.
79, 229, 276
299
Kullmann 117 Kunz 146,
303
Klimt
184 f
118, 173
Kubelik
222, 230 ff.
246, 299 Kletzki
Kriso
172, 181 jeritza
75, 86, 91,
170, 177, 181 ff, 188,
201 ff, 213,
86, 90 f, 95 f, 99,
137
i n f, 114, 165
Krips, Josef
123, 131, 148, 164 f. jerger, Wilhelm
108,
III ff, 119, 165, 168,
Kmentt
171
Jerger, Alfred
183 Krenn
79, 86 f
Klemperer
304
99,
124, 127, 131, 142,
Krauss, Werner
72,334 b
182, 284, 304
335
Hudez, Prof
112
Kimovec
Klein
282
Krauss, Clemens
147, 153, 188 f, 217,
Kleiber
306
133
103, 263, 291
222 f, 224
308 Kipnis
166, 173, 269
Kralik
140 f, 324
Kiepura
247
292
298, 301 74 ff, 79, 81 f.
Kienzl
146, 152, 164,
63
Kornauth
88 ff, loi, II2, 116, Kern
119
268,298
Konrath
147
Keilberth
196, 260, 331, 338 Hindemith
263
Kautsky
177 ff, 192,
118, 146, 165,
172, 265, 284
355
D
Lorenz
E
86,
R
M
113,
O
T
115,
137, 166 f, 218, 262 Luca, de
217F.
Ludwig,
Christa
146,
A
/
T
A
U
S
Moralt
Ludwig, Leopold
113,
175
N
D
U
N
D
E
131, 177,
HO,
247
Morgenstern Moser 282 Mozart
240, 265 f, 305
E
293
Mahler, Alma
314
Mahler, Gustav
230,
233, 242, 299, 303, Maikl
298
Maillart Mairecker Majkut
154
Mannerheim
304
Manowarda Mantuani Marboe Martini Marx
161 311 123 F.
312 F, 327
Materna
33,120,250
Mattoni, von
240
Mayr, Richard
Müthel
141, 145
Polie
32 FF.
Muzzarelli
169, 173
Pölzer
90
Ponchielli 276
Nedbai
53, 77 143 F, 327 226
268
Premerl
21, 38 FF, 43,
48, 50, 57, 310 Prey
84, 313
Preyer
Noelte
335
Prix
Noni
146 91 F, 99, 102,
108, 129
86
Poulenc
Nissen
282, 307 313 170
Pruscha
79 F.
Puccini
59,74,120,
165, 250
78, 298
76, 113, 280
OdnopossoFF
Melichar
165
OfFenbach
Mikelj
194 F.
125,164F.
Mazaroff Meyerbeer
282
Pius XII. Poell
Novotnà
65
121, 192
Pitzinger 226
Nilsson
Massenet
113
Pinza
Munthe
228 282
190 F. Pilss Piltti
Neher
Maschat
109 FF, 175,
297, 300, 303, 307,
266 292 f.
86
Pierer
Naval
260,264
Martin
Perras
272, 273, 283 FF, 292,
113, 118 38
205, 214,
292,338 F. Piccaver 60, 86, 89,
Müller, Maria
120, 144
214
Perón, Juan
152, 171, 181, 183,
313
64,89
79
Perón, Evita
Pfitzner
Mozart, Konstanze
305, 314
Pernter
117, 133, 142, 146,
237, 230, 263, 268,
306
ABEND
218
53, 59, 96, 98,
192, 195 F, 206, 224, Maazel
I N
Oves
250
114 Radó-Danielli
33
Rainer
219 F.
133F.
Milinkovic
171
Pasero
192
Rapotec
Miljakovic
171
Pataky
76, 79, 95, 117,
Rautenstrauch
Mitropoulos Modi
119
Monaco, del
280 218,
Monte, dal
356
218,282
iio , 188 F, 223,
238, 262 Paulik Pavelic
227 F.
Ravel
276 Patzak
262
Molnar-Talajic
164 218 F.
PernerstorFer
60, 62,
65 FF, 71, 76, 79
13
164
254 213 F.
267
Ray 252 F. Redl 98 Reichwein
113, 131
ReiF-Gintl
187,225,
242
A N H A N G / P E R S O N E N R E G IS T E R
Reining
i i 3 f , 123,
125, 131
Simionato Sittner
Schubert
282
Renner 164 Rennert 262, 327
Skorzeny Slezak
89 f, 276
Rethberg
Slibar
62 f.
Rethy
121
90, 113
Rieger
309
34, 37, 72, 74,
136, 213, 268, 281 ff.
273
289 ff, 293, 300, 302,
292 f.
307, 3 I I , 314, 330 Schubert, Ferdinand 314
Smetana 33, 332 Solti 20,182,233
Schuh
143 f, 164, 170,
327
Riehl
225
Spiess
332
Schulz
Rilke
151
Spüler
163
Schumann
Ringel
336
Rohs
113, 146, 148
Rokyta
118
Roller
131
Rossi Lemeni Rossini
282
176, 181
Roswaenge
86, 108,
213,268,
289 f, 293, 300, 313 f.
Sutherland
267
Svanholm
131,207
Svara
113
Schumann, Clara 313 f.
31, 35
Svéd 91,99 Swarowsky 133
Schumann, Elisa
Szantho
100 f, 113 ff. Schuschnigg ii2 f .
beth
98, 118
73, 79, 98,
Schalk
38
117 f, 141 Rothenberger 269
Schiele
318
Rothmüller
Schipper
79
Schwarz, Vera
139
Schwarzenberg
I I 3,
224
Schindler
Schütz
Rubin
292
Schirach
Ruffo
218
Schlusnus 289 Schmidt, Franz 118 f.
Rünger Rus
113
171, 173
Sabata, de Sallaba
242 f.
84, 164
Salmhofer
112,149,
166 f, 177 ff, 187, 260, 292 Samuel
311
Sattner
21
Sauer, von Seefehlner Seefried
Schmidt, Friedrich
338
164 ff, 170 f, 181,
Schneiderhan,
137
Sibelius Siepi
303 f.
247
Stollbcrg
311
Stoß 133 Strauß, Johann
33, 71.
123, 297 f. 68,
99, 112, I I 3, 124 f.
292
131, 139, 142, 143,
313
147, 188, 202, 207 f.
84, 218
Schostakowitsch
243 219
Strauss, Richard
263 ff, 300, 333
263,
268, 290, 292, 303, 313, 313
353
Schramml
ii4 f.
Stojadinovic
114
173 f, 192, 228, 262,
Schorr
312
Stich-Randall
184
Schönberg
Senk
Sterneck
271
Schöffler i i 3 f , 146, 148, 132, 163, 170,
282, 284, 291
200
Starka 77 ff. Steffek 282,298
269
Scholium
77
176 f, 224, 242, 247,
Stargardt
Schnitt
193 f. 146,
305
Stalin
Walter
76
Schwarzkopf
Schneider-Siemssen
Wolfgang
146, 132,
267
Schneider, Ernst 140 f.
239, 262, 265, 269, Semper
43
Schneiderhan,
72,126
119
Schwalb
318
222
Strawinsky
241, 244
357
DERMOTA / TAU SENDUNDEIN
Strohm
139 f.
Vinay Vogl
Tauber
91, 113, 117,
143, 190 Taubmann
Weber, Carl Maria
228
von
330
Völker
86
Volpi
226
262, 284
225
129
Wächter
Tebaldi
218
Wagner (Familie)
84
37,
43, 32, 68, 220
261
Wagner, Cosima
Tilden
170
Wagner, Minna
314 314
133
Toscanini
8 1 ,83ff,
Treu, Paul
Trau, Thomas Trost
272
272 272
Truxa
Tschaikowski
114
Wessely
108
Wagner, SiegFried
314
Wiedemann
Wagner, Wieland
314
Wieland
99,
Wakhewitch
2 5 5 , 335
Wallberg Uray
Wallerstein
292
Ursuleac
132,222F.
Usunow
302
Wallmann
268
Verdi
234 51, 92, 131, 152,
243, 250, 312
324
268
234
Wistinghausen
38
109 FF, 163
Wobisch WolF
196
306
231,233,268,
281 F, 290 F, 303 F, 312 F.
268
Wöss Walter, Bruno
Varnay
Wiener
Witt
72, 74
84
271
Windgassen
W agner-Schönkirch 53,
177, 180, 237 273, 282, 293
W erni^
314
314
Werba
300, 314
Wagner, WolFgang
62, 72, 271
Welitsch
WerFel 314 Werner 138
34,
91, 108, 196 Treu, Antonia
313
Weingartner 74, 113 Weinheber 131 F, 293
90 F, 123, 234, 250,
Wagner, Richard
2CX5
Titze
Webern
266,269
Tietjen Tito
173, 212
Weber, Ludwig 177, 188, 207, 210, 239,
Tavcar Thorberg
ABEND
86,
248
Wunderlich
98 FF, 109 F, 113, 121, 183, 212, 260, 264,
Zadek
269
324, 335
Zeller
33
331,338

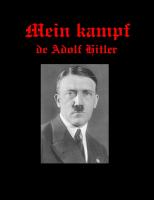








![Tausendundein Abend. Mein Sängerleben [1 ed.]](https://dokumen.pub/img/200x200/tausendundein-abend-mein-sngerleben-1nbsped.jpg)