Rechtsnatur, Aufgabe und Funktion der Sachmängelhaftung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch [1 ed.] 9783428432240, 9783428032242
132 36 17MB
German Pages 232 Year 1974
Polecaj historie
Citation preview
KLAUS HERBERGER
Rechtsnatur, Aufgabe und Funktion der Sachmängelhaftung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch
Schriften zum Bürgerlichen Recht Band 19
Rechtsnatur, Aufgabe u n d F u n k t i o n der Sachmängelhaftung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch
Von Dr. Klaus Herberger
J g | ® ι
DUNCKER
&
s
Aw/e)'Vr
HUMBLOT
/
BERLIN
Alle Rechte vorbehalten © 1974 Duncker & Humblot, Berlin 41 Gedruckt 1974 bei Buchdruckerei Richard Schröter, Berlin 61 Printed in Germany ISBN 3 428 03224 1
Vorwort Die Regelung der Sachmängelhaftung ist seit dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches Gegenstand der verschiedensten Kontroversen. Viele Streitpunkte sind nach wie vor ungeklärt. Neue Fragen treten hinzu, etwa, wie sich die Haftung bei Verkauf von Gesellschaftsanteilen darstellt, wenn bestimmte Bilanzangaben unrichtig sind oder die Erträge des Unternehmens hinter den Erwartungen des Käufers zurückbleiben. Die höchstrichterliche Rechtsprechung ist ständig bemüht, die bestehenden Zweifelsfragen auszuräumen. So hat der Bundesgerichtshof erst vor Jahresfrist eine Grundsatzentscheidung über das Verhältnis der Sachmängelhaftung zur Haftung aus culpa i n contrahendo gefällt (BGH vom 16. März 1973; B G H 60, 319 ff.). Daß dennoch eine Vielzahl von Fragen offen ist, liegt daran, daß eine dogmatische Basis, ein einheitliches Grundverständnis der Gewährungsleistungsregelung fehlt. Daraus erklärt sich auch das Verhältnis der Sachmängelhaftung zu den allgemeinen Normen, wie es von der überwiegenden Literatur und von der Rechtsprechung gesehen wird. Die vorliegende Arbeit unternimmt nun den Versuch, die Sachmängelhaftung als ein einheitliches Rechtsinstitut darzustellen, das der Beseitigung einer Leistungsstörung dient, die darin besteht, daß der Gläubiger eine fehlerhafte Sache geliefert erhält. Der zentrale Gedanke, der der Untersuchung zugrunde liegt, ist dabei, daß die Parteien eine Vereinbarung über die Eigenschaften der Sache treffen. Die Sachmängelhaftung greift ein, w e i l die Sache i n ihren Eigenschaften nicht der Vereinbarung entspricht. Der Ansatzpunkt ist nicht neu. Schon Flume vertrat i n seiner berühmten Monographie „Eigenschaftsirrtum und K a u f " von 1948, daß eine solche Eigenschaftsvereinbarung möglich ist. Die Folgerungen, die w i r aus dieser Grundthese ziehen, unterscheiden sich jedoch ganz erheblich von denen Flumes. Nach unserer Ansicht entsteht durch eine derartige Vereinbarung eine entsprechende Verpflichtung zu mangelfreier Leistung. Die Sachmängelhaftung ist damit eine sekundäre Ausgleichsregelung, die den Fall der mangelhaften Leistung abschließend regelt, so daß die allgemeinen Normen weder vor noch nach Gefahrübergang Anwendung finden. Zwischen dem Eigenschaftsirrtum
β
Vorwort
und der Sachmängelhaftung besteht kein Konkurrenzverhältnis. § 119 I I ist keine Nichterfüllungsregelung, wie das Flume m i t seiner Lehre vom geschäftlichen Eigenschaftsirrtum vertritt, sondern ein echter F a l l des Erklärungsirrtums. Soweit die Sachmängelhaftung eingreift — das ist der Fall, wenn die Sache nicht die vereinbarten Eigenschaften besitzt —, fehlt es schon am Tatbestand eines Erklärungsirrtums. Der Käufer hat den Verkäufer i n dem Umfang verpflichtet, i n dem er i h n verpflichten wollte. I m dogmatischen Ausgangspunkt und i n den einzelnen Schlußfolgerungen erhält die Untersuchung eine zusätzliche Bestätigung durch das „Einheitliche Gesetz über den internationalen Kauf beweglicher Sachen" von 1964, das inzwischen am 16. A p r i l 1974 für die Bundesrepublik Deutschland i n K r a f t getreten ist. Die für die Sachmängelhaftung nach deutschem Recht gefundenen Lösungen entsprechen weitgehend diesem internationalen Kaufgesetz, das i n seinen wesentlichen Grundzügen i n der Abhandlung berücksichtigt wird. Das sollte ein weiterer Anlaß für einen Teil der Literatur sein, die bezogenen Positionen neu zu überdenken. Die Arbeit wurde i m Wintersemester 1972/73 von der juristischen Fakultät der Ruprecht-Karl-Universität Heidelberg als Dissertation angenommen. Sie wurde i m wesentlichen Ende 1972 abgeschlossen, doch sind Rechtsprechung und Literatur bis Januar 1974 nachträglich noch berücksichtigt worden. Ich danke Herrn Professor Dr. Hermann Weitnauer, der die A b handlung betreut hat, und Herrn Professor Dr. Wolfgang Hefermehl als zweitem Berichterstatter für ihre liebenswürdige Unterstützung und ihre wertvollen Anregungen. Danken möchte ich auch Herrn Ministerialrat a.D. Dr. J. Broermann für die Aufnahme der Arbeit i n die Schriftenreihe zum Bürgerlichen Recht. Heidelberg, i m M a i 1974 Klaus Herberger
Inhaltsverzeichnis
I.Einführung in den Problemkreis und Zielsetzung
15
I I . Das Verständnis der Gewährleistungsregelung nach herrschender Lehre
20
1. Kurzer Überblick über die Entwicklung der herrschenden Lehre
20
2. Die Definition der Gewährleistung u n d die Unterscheidung echteunechte Gewährleistung
22
3. Der Rechtsgrund der Gewährleistung beim Spezieskauf
24
4. Ursache des bisherigen Verständnisses regelung
30
der
Gewährleistungs-
I I I . Kritik an der herrschenden Lehre 1. Grundsätzliche K r i t i k
32 32
a) Die Einheitlichkeit der Sachmängelvorschriften
32
b) Die Einheitlichkeit des Haftungsgrundes
35
c) Die Einheitlichkeit der Erfüllungswirkung
39
2. Spezielle K r i t i k
40
a) K r i t i k an den Ansichten, die den Rechtsgrund der Gewährleistung außerhalb des Vertrages suchen aa) Argument aus § 633 I bb) A r g u m e n t aus § 459 I I cc) A r g u m e n t aus § 463
40 40 41 41
b) K r i t i k an den Ansichten i m einzelnen
43
3. K r i t i k an der Grundlage der h. L., der Lehre Zitelmanns a) Die Ansicht der Motive
46 46
b) Die der h. L . widersprechenden älteren Ansichten
47
c) Die Ansicht der Rechtsprechung
48
d) Die herrschende Lehre u n d der subjektive Fehlerbegriff
54
e) Die Widerlegung Zitelmanns
56
I V . Rechtsnatur der Gewährleistung nach geltendem Recht 1. Die Vereinbarung v o n Eigenschaften a) Die Vereinbarung v o n Eigenschaften zum gewöhnlichen Gebrauch
60 60 61
8
nsverzeichnis b) Die Vereinbarung v o n Eigenschaften zu einem bestimmten Gebrauch
62
c) Die Zusicherung v o n Eigenschaften
65
d) Gegenüberstellung der Haftungsgruppen (Exkurs: Unternehmenskauf)
65
e) Die Sachmängelhaftung als dispositives Recht u n d das V e r ständnis des § 460
73
2. Die Gewährleistung u n d die Leistungspflicht
74
a) Das Fehlen einer Herstellungspflicht bzw. eines Mängelbeseitigungsanspruchs beim Spezieskauf b) Das Fehlen einer anspruch festlegt
gesetzlichen Norm, die den
Leistungs-
75 77
c) Das Argument aus § 306
83
d) Zusammenfassung
87
V.Aufgabe und Funktion der Gewährleistung — dargestellt am Beispiel des Kaufs
88
1. Die Elemente der Schuld: Identität u n d Eigenschaft
88
2. Die Sachmängelhaftung beim Gattungskauf
95
a) Der Nachlieferungsanspruch
95
b) Die Sachmängelhaftung
97
aa) Die Konkretisierung u n d ihre Bedeutung i m Verhältnis des Nachlieferungsanspruchs zum Gewährleistungsanspruch bb) Die Konkretisierung u n d die V e r j ä h r u n g
98 106
cc) Die Konkretisierung durch Geltendmachung eines Sachmängelanspruchs 108 dd) Vergleich Gattungskauf — Spezieskauf 109 c) Zusammenfassung
110
3. Die Begriffe Erfüllungspflicht, Leistungspflicht, Gewährleistungspflicht 111 a) Die Erfüllungspflicht b) Die Gewährleistung rechte
111 als Regelung sekundärer
Ausgleichs-
115
4. I n h a l t u n d Durchführung der einzelnen Sachmängelansprüche . . 116 a) Wandlung u n d Minderung
116
b) Schadensersatz wegen Nichterfüllung
124
aa) Anwendungsbereich α) Schadensersatz beim Spezieskauf 1. Infolge Zusicherung (§463 S. 1) 2. Infolge arglistigen Verschweigens von Fehlern (§ 463 S.2) 3. § 463 als Gewährleistungsanspruch
124 124 124 127 129
nsverzeichnis 4. Haftungsinhalt u n d Anspruchskonkurrenz: Mangelfolgeschaden — positive Vertragsverletzung — culpa i n contrahendo ß) Schadensersatz beim Gattungskauf bb) Umfang des Anspruchs cc) Durchführung des Anspruchs 5. Beweislastfragen V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen 1. Grundsätzliche Überlegungen
131 141 142 146 150 153 153
2. Verzug u n d Einrede des nichterfüllten Vertrages (§ 320, 326) . . . . 155 a) Spezieskauf 156 b) Gattungskauf
162
3. Unmöglichkeit (§§275 ff., 323 ff.)
162
4. Zusammenfassung
168
5. Die Anfechtung gemäß § 119 I I
169
a) Die Ansichten zur Konkurrenzfrage
169
b) Grundsätzliche Stellungnahme zu den Ansichten
170
c) Die Rechtsnatur des Eigenschaftsirrtums 172 aa) Das Verständnis des § 119 I I nach der h. L . u n d nach der Lehre Flumes 172 bb) K r i t i k an der Lehre Flumes 173 cc) K r i t i k an der herrschenden Lehre 175 dd) Darstellung der eigenen Ansicht über die Rechtsnatur des Eigenschaftsirrtums 184 d) Darstellung der eigenen Ansicht über das Konkurrenzverhältnis der §§459 ff. zu §119 I I 190
V I I . Die Sachmängelhaftung nach dem Einheitlichen Kaufgesetz 1. Der Geltungsbereich des E K G
195 196
2. Die Rechte des Käufers bei Vorliegen eines Sachmangels nach der Regelung des E K G 197 a) Die vertraglichen Pflichten des Verkäufers b) Die aa) bb) cc)
197
Sanktionen i m Falle vertragswidriger Lieferung 199 Keine Regelung der Unmöglichkeit 200 Das Sanktionssystem des E K G 202 Die Sanktionen i m Falle mangelhafter Leistung 208 α) Die Untersuchungs- u n d Rügepflicht 208 ß) Der Gefahrübergang als Voraussetzung der Rechte des Käufers 210 γ) Die einzelnen Rechte des Käufers 212 1. Der Erfüllungsanspruch 212 2. Die Aufhebung des Vertrages 216
10
nsverzeichnis 3. 4. 5. 6.
Die Herabsetzung des Kaufpreises Der Anspruch auf Schadensersatz Der Verlust bzw. der Ausschluß der Rechte Die Gefahrtragung bei Untergang der übergebenen, mangelhaften Sache
7. Konkurrenzen
217 217 219 220 223
V I I I . Schlußbetrachtung
224
Literaturverzeichnis
225
Abkürzungsverzeichnis a. Α., Α. Α .
= anderer Ansicht
a.a.O.
= am angegebenen Ort
Abh.
=
Abs.
= Absatz
Abhandlung
AcP
= Archiv für die zivilistische Praxis (Band u n d Seite)
a. E.
= am Ende
ALR Anh.
= Allgemeines Landrecht f ü r die Preußischen Staaten von 1794 = Anhang
Anm.
=
Anmerkung
Art.
=
Artikel
AT
= Allgemeiner T e i l
Aufl.
= Auflage
BB
= Der Betriebsberater (Jahr u n d Seite)
Bd.
=
Band
Bern.
=
Bemerkung
BGB BGBl
= Bürgerliches Gesetzbuch = Bundesgesetzblatt, I = T e i l I, I I = T e i l I I
BGH
= Bundesgerichtshof u n d amtliche Entscheidungssammlung i n Zivilsachen (Band u n d Seite) = Bundesrepublik Deutschland = beziehungsweise = culpa i n contrahendo = Der Betrieb (Jahr u n d Seite) = das heißt = Dissertation = Deutsche Justiz (Jahr u n d Seite) = Deutsche Juristenzeitung (Jahr u n d Spalte) = Deutsches Recht (Jahr u n d Seite) = ebenda = Einleitung
BRD bzw. c. i. c. DB d. h. Diss. DJ DJZ DR ebd. Einl. EKG ff. FN Gruch. Beitr.
= Einheitliches Gesetz für den internationalen K a u f beweglicher Sachen von 1964 = folgende = Fußnote = Beiträge zur Erläuterung des Deutschen Rechts, begründet von Gruchot (Band u n d Seite)
12
Abkürzungsverzeichnis
h. Α.
= herrschende Ansicht
HEZ
= Höchstrichterliche u n d Seite)
HGB
=
h. L .
= herrschende Lehre
Entscheidungen i n Zivilsachen
(Band
Handelsgesetzbuch
HRR
= Höchstrichterliche Rechtsprechung (Jahr u n d Nummer)
i. S. d.
= i m Sinne des
i. V. m. JBl Jh. Jb.
JR
= i n Verbindung m i t = Juristische Blätter (Österreich; Jahr u n d Seite) = Jherings Jahrbücher f ü r die Dogmatik des heutigen Römischen Rechts u n d Deutschen Privatrechts (Band u n d Seite) = Juristische Rundschau (Jahr u n d Seite)
Jus
= Juristische Schulung (Jahr u n d Seite)
JW
= Juristische Wochenschrift (Jahr u n d Seite)
JZ
= Juristen-Zeitung (Jahr u n d Seite)
Kap.
=
KG
=
Kapitel Kammergericht
LB
=
Lehrbuch
LG
=
Landgericht
LM
LZ MDR Mot. m. w. N. NJW Nr. OLG OLGE
= Nachschlagewerk des Bundesgerichtshofes i n Zivilsachen; Herausgeber Lindenmaier u n d M ö h r i n g (§ des Gesetzes u n d N u m m e r der Entscheidung) = Leipziger Zeitschrift f ü r Deutsches Recht (Jahr u n d Seite) = Monatsschrift f ü r Deutsches Recht (Jahr u n d Seite) = Motive zum B G B = m i t weiteren Nachweisen = Neue Juristische Wochenschrift (Jahr u n d Seite) = Nummer = Oberlandesgericht = Entscheidungen der Oberlandesgerichte i n Zivilsachen
Prot.
= Protokolle zum B G B
pW RabelsZ
= positive Vertragsverletzung = Zeitschrift f ü r ausländisches u n d internationales P r i v a t recht, begründet von Ernst Rabel (Jahr u n d Seite) = Randziffer = Das Recht (Jahr u n d Seite bzw. N u m m e r der Entscheidung) = Reichsgericht u n d amtliche Entscheidungssammlung i n Zivilsachen (Band u n d Seite) = Kommentar der Reichsgerichtsräte u n d Bundesrichter zum Bürgerlichen Gesetzbuch = Kommentar der Reichsgerichtsräte u n d Bundesrichter zum Handelsgesetzbuch
(Jahr u n d Seite)
Rdz, R Z Recht RG RGRK HBG
Abkürzungsverzeichnis s.
= siehe
S.
= Seite
SchlHA
= Schleswig-Holsteinische Anzeigen (Jahr u n d Seite)
Seuff. Arch.
= Seuffert's A r c h i v f ü r Entscheidungen der obersten Gerichte
SJZ
= Süddeutsche Juristenzeitung (Jahr u n d Spalte)
i n den deutschen Staaten (Band u n d Nummer) Soergel Rtspr.
= Rechtsprechungssammlung, Herausgeber: Soergel
Sp.
=
u. a.
= unter anderem
Spalte
u. ä.
= u n d ähnliches
u. U.
= unter Umständen
usw.
= u n d so weiter
vgl.
= vergleiche
Warn. Rtspr.
= Die
Rechtsprechung
des
Reichsgerichts,
Herausgeber:
Warneyer (Jahr u n d Nummer) WM
= Wertpapier-Mitteilungen (Jahr u n d Seite)
z. B.
= zum Beispiel
ZGR
= Zeitschrift f ü r Unternehmens- u n d Gesellschaftsrecht (ab 1972; Jahr u n d Seite) = Zeitschrift f ü r das gesamte Handelsrecht u n d Wirtschaftsrecht (Band u n d Seite) = Zitierweise = Zivilprozeßordnung
ZHR zit. ZPO
I. Einführung i n den Problemkreis und Zielsetzung Wer ein Rechtsgeschäft abschließt, das die Veräußerung, Gebrauchsüberlassung oder Herstellung einer Sache zum Inhalt hat, erwartet als Gläubiger, daß Leistungsgegenstand eine Sache ist, die i n ihren Eigenschaften der Vereinbarung entspricht. W i r d eine mangelhafte Sache geleistet, erhält der Gläubiger nicht, was i h m gebührt. Das Gesetz gibt i h m Gewährleistungsansprüche. Innerhalb des BGB finden sich verstreut für viele Vertragstypen Gewährleistungsregeln. Beim Kaufvertrag: §§ 459 ff., bei kaufähnlichen Verträgen: § 493, beim Tausch: § 515, bei der Annahme an Erfüllungs Statt: § 365, bei der Miete §§ 537 ff., bei der Pacht: § 581 I I , bei der Leihe: § 600, beim Werkvertrag: §§ 633 ff., Werklieferungsvertrag: § 651, bei der Aufhebung einer Gemeinschaft: § 757, bei der Schenkung: § 624 I I , bei der Ausstattung: § 1624 II, beim Überbau: § 915 I 2, bei der Erbauseinandersetzung: § 2042 II, beim Vermächtnis: § 2183. Gewährschaftsregelungen finden sich heute i n allen Rechtsordnungen. Sie tragen dem Rechtsgedanken Rechnung, daß der Gläubiger Schutz verdient, wenn eine mangelhafte Sache geleistet wird. Insoweit kann man davon sprechen, daß die Gewährleistungsnormen dem Wortsinn entsprechend einer „ausgleichenden Gerechtigkeit" dienen. Eine Aussage über den Rechtsgrund der Regelung ist damit noch nicht gemacht 1 . A l l e Normen dienen der Verwirklichung der Gerechtigkeit. Das Gesetz geht dabei von bestimmten Grundprinzipien aus. Die einzelne Norm erhält ihr spezielles Gepräge gerade i n der Wechselwirkung m i t diesem gesetzlichen Gefüge. Wenn w i r also nach dem Rechtsgrund der Gewährleistung fragen — die Klärung dieser Frage bildet den ersten Schwerpunkt des Themas — so fragen w i r nach dem Grund der Gewährleistung i m Rahmen der gegebenen gesetzlichen Regelung. Der Grund kann je nach dem gesetzlichen System verschieden sein. Die Beantwortung der Frage hängt davon ab, welche Funktion die Gewährleistung i m System wahrnimmt. Ist sie Sanktion für nicht gehörige Erfüllung oder billiger Ausgleich, obwohl v o l l erfüllt wurde? Die Lö1 Dies n i m m t jedoch Raasch, S. 25, an, w e n n er schreibt, daß die Gewährleistung ihre Rechtfertigung allein unter dem Gesichtspunkt einer höheren Gerechtigkeit erhält u n d darin auch ihre letzte rechtliche Begründung findet. Dagegen m i t Recht Flume , S. 43 F N 36; von Blume, Ih. Jb. 55, 212; Soergel! Siebert / Ballerstedt, Bern. 10 vor § 459.
16
I. Einführung i n den Problemkreis und Zielsetzung
sung dieser Frage hat nicht nur dogmatische Bedeutung, an sie schließt sich die Lösung wichtiger anderer Fragen an. Die Gewährleistungsregelung des BGB m i t der Unterscheidung zwischen Sach- und Rechtsmangel geht auf das Römische Recht zurück. Dennoch kann bei dieser Untersuchung über Rechtsnatur, Aufgabe und Funktion der geltenden Sachmängelhaftung nicht das System des Römischen Rechts herangezogen werden. Eine lange Entwicklungszeit liegt zwischen beiden Rechtsbereichen. Die Regelung des BGB entspricht nicht mehr der des Römischen Rechts; das Römische Recht selbst hat i m Bereich der Gewährleistung einen großen Wandel durchgemacht 2 . Das nachklassische und justinianische Recht entspricht i n seiner Gewährleistungsregelung nicht mehr dem klassischen Römischen Recht 3 . Die Pflicht, das Eigentum an der Sache zu verschaffen, war dem römischen Juristen unbekannt. Nach § 433 I 1 ist sie heute geltendes Recht. Deshalb erscheint es nicht sinnvoll, die geltende Gewährleistungsregelung aus den Quellen, dem Römischen Recht zu erklären 4 . Es lassen sich zwar Entwicklungen verfolgen und bestimmte Regelungen auf entsprechende römisch-rechtliche zurückführen, doch unser heutiges gesetzliches Gefüge ist ein anderes. Eine Regelung ist aber nur i m Zusammenhang m i t dem gesetzlichen System verständlich. Eine davon losgelöste abstrakte Betrachtung muß fehlgehen. Es kann daher Rabel 5 nicht zugestimmt werden, wenn er das Wesen der Gewährleistung für nur historisch erklärbar hält. M i t Recht weist von Blume 6 darauf hin, daß man damit i n der Erkenntnis des Rechtsgrundes der Gewährleistung keinen Schritt weitergekommen ist, w e i l immer noch die Frage bleibt, wie die Römer ihre Regelung rechtfertigten. Es kann nicht i n Frage gestellt werden, daß die römischen Quellen für das historische Verständnis der Gewährleistungsnormen Bedeutung haben; über das gegenwärtige System können sie jedoch keinen A u f schluß geben. Überzeugend wäre eine historische Erklärung des Wesens der Gewährleistung nur, wenn keine Veränderung des Rechts stattgefunden hätte. Aus diesem Grunde berücksichtigt die Darstellung die römischen Quellen nicht, sondern versucht von dem bestehenden Rechtssystem ausgehend, die Sachmängelhaftung, ihre Ursache und ihre Rechtsfolgen darzulegen. 2
Vgl. Flume , S. 56 ff.; Korintenberg, Abschied, S. 71 ff. Flume , S. 56 ff.; Krückmann, Gewährschaft, S. 18 F N 8. A u f diesem historischen Weg k o m m t z. B. Hayman, S. 29, 30 zu dem E r gebnis, die Mängelhaftung beruhe einzig auf dem Irrtumsschutz; diese A n sicht w i r d heute k a u m mehr vertreten. 6 Rabel, Warenkauf I I , § 79, S. 132; i h m zustimmend Graue, S. 281 unter I V a u n d Enneccerus / Lehmann, 11. Aufl., S. 363, anders jedoch ab 12. Aufl. 6 Ih. Jb. 55, 212; ebenso Krahmer, Gegenseitige Verträge, S. 110 ff.; Flume , S. 44; Kohler L B I I 1, S. 73. 3
4
I. Einführung i n den Problemkreis u n d Zielsetzung
Die Gewährleistungsnormen sind seit der Kodifikation des BGB Gegenstand erheblicher Meinungsverschiedenheiten. Das hat seinen Grund darin, daß über ihr Wesen und ihre rechtliche Funktion keine Klarheit besteht 7 . Das Gesetz gibt keine Definition des Begriffs „Gewährleistung". Er findet sich zwar an vielen Stellen des Gesetzes8, doch fehlt eine einheitliche Ausgangsregelung. Der erste Entwurf des BGB sah zwar i n den §§ 381 ff. allgemeine Hegeln über die Gewährleistung für Sachmängel vor. Doch wurde zugunsten einer speziellen Regelung beim Kauf von einer allgemeinen Normierung Abstand genommen 9 . Die Kommission 1 0 begründete dies damit, daß „die Anschaulichkeit, die Verständlichkeit und die praktische Handhabung des Gesetzes gewinnen werde, wenn man die Rechtssätze vorerst auf den Kauf beschränke, auf dessen Gebiete die Hauptanwendungsfälle liegen". Diesem Umstand nun ist es zuzuschreiben, daß das Gesetz die Gewährleistung nicht klar genug gegenüber den allgemeinen Vorschriften abgrenzt. Und daraus resultiert wiederum der Streit u m das Wesen der Gewährleistung: Einerseits erkennt das Gesetz die Gewährleistung als eigenes Rechtsinstitut an, andererseits aber läßt es offen, welchen Platz sie innerhalb des Gesetzes einnimmt, welche Funktion sie ausübt 11 . So ist es nicht verwunderlich, daß schon 1904 von Schollmeyer 12 der Versuch unternommen wurde, die Gewährleistungsnormen systematisch zu erfassen. Die Schrift Schollmeyers gab den Anstoß für eine unüberschaubare Zahl weiterer. Der Streit u m die Rechtsnatur der Sachmängelhaftung hatte seinen Anfang genommen. Ausgehend von der Abhandlung Schollmeyers wurde die Diskussion nicht über die Rechtsnatur der Sachmängelhaftung als solcher geführt, vielmehr versuchte man, eine Lösung jeweils für einen Vertragstyp, meist den Kauf, zu finden. Notwendige Folge einer solchen einseitigen Betrachtung der Gewährleistung mußte es sein, daß die Regelung i n den einzelnen Vertragstypen unterschiedlich beurteilt und qualifiziert wurde. Gegenüber der großen Zahl von Schriften, die sich mit den Gewährleistungsnormen jeweils eines Vertragstyps befassen, gibt es wenige, die die Gewährleistungsnormen der verschiedenen Vertragstypen nebeneinander behandeln und damit an den Komplex der Sachmängelhaftung geschlossen herangehen. Unter den wenigen sind hierbei die 7
Vgl. Larenz I I , § 41 I, S. 33; vgl. auch Kramer JB1 72, 401 ff. Vgl. §§ 365, 459 ff., 537 ff., 633 ff., 757, 624 I I , 2042 I I , 2183. Vgl. 2. Entwurf §§ 397 ff. 10 Prot. I, S. 653. 11 Vgl. Oertmann, S. 116. 12 Erfüllungspflicht u n d Gewährleistung, i n Ih. Jb. 49, 93 ff. 8 9
2 Herberger
18
I. Einführung i n den Problemkreis und Zielsetzung
Monographie von Süß13 und die Schrift von Schöller 14 hervorzuheben. Die Monographie Korintenbergs 15 behandelt zwar die Gewährleistung auch unter allgemeinen Gesichtspunkten, doch ist das Werk i m wesentlichen auf die Sachmängelhaftung beim Werkvertrag ausgerichtet. Gemeinsam ist allen Arbeiten, daß nicht der Versuch gemacht wird, die i m Gesetz verstreuten Gewährleistungsnormen als eine einheitliche Regelung zu sehen, die gemeinsamen Grundsätzen unterliegt. Vielmehr werden die Gewährleistungsnormen jedes Vertragstyps gesondert betrachtet und die vermeintlichen Unterschiede, also gerade das Trennende, herausgearbeitet. Diese Bemühungen gipfelten i n der Lehre, daß es eine „echte" und eine „unechte" Gewährleistung gebe 16 . Der Versuch, die Gewährleistung als eigenes Rechtsinstitut zu erfassen, endete m i t der Feststellung, die Gewährleistungsregelung sei je nach Vertragstyp verschieden zu beurteilen. Der Versuch, die Gewährleistung systematisch zu erfassen, war damit fehlgeschlagen 17 . Nicht zu Unrecht nennt Flume ls das Gebilde, das sich als Ergebnis dieser dogmatischen Überlegungen präsentiert, „eine wenig ergiebige Frucht am Baume der Begriffsjurisprudenz". Doch auch Flume bietet, obwohl er sich klar zur Dogmatik bekennt 1 9 , keine dogmatische Eingliederung der Gewährleistungsvorschriften i n das Gesetz 20 , so daß er sich die K r i t i k Korintenbergs 21, dem vor allem seine K r i t i k galt, gefallen lassen muß, er lasse die Rechtsnatur der Gewährleistung so gut wie unerörtert. A l lein m i t der Feststellung — wie sie Flume t r i f f t —, die Gewährleistung ergebe sich aus dem Kaufvertrag 2 2 , ist noch nicht viel gewonnen. Es bleiben zu viele Fragen offen, die nur zu lösen sind, indem man die Gewährleistung systematisch i n das gesetzliche Gefüge einordnet. Gerade Flumes Ansicht, darin ist Korintenberg voll und ganz zuzustimmen, verlangt nach einer klaren Dogmatik für die Gewährleistung,
13
Wesen u n d Rechtsgrund der Gewährleistung f ü r Sachmängel, 1931. Die Folgen schuldhafter Nichterfüllung, insbesondere der Schadensersatz wegen Nichterfüllung bei Kauf, Werkvertrag, Miete u n d Dienstvertrag nach dem BGB, i n Gruch. Beitr. 46, 1 ff., 253 ff. 15 E r f ü l l u n g u n d Gewährleistung beim Werkvertrage, 1935. 16 Siehe darüber unten I I , 2. 17 Dieses Ergebnis macht Rabeis Ablehnung einer dogmatischen Einglieder u n g der Gewährleistung verständlich, vgl. Warenkauf I I , § 79, S. 132: „Die Rechtssätze, die aus der Sachmängelhaftung eine besondere eigentümliche Rechtsinstitution machen u n d so rätselhaft umdüstert scheinen, verdienen dieses Aufsehen nicht. Das Wesen der Gewährleistung ist n u r historisch erklärbar." 18 S. 40. 19 Vgl. S. 43 F N 36. 20 Vgl. dazu unten I V , 2, b. 21 Spezies, S. 92. 22 S. 41. 14
I. Einführung i n den Problemkreis u n d Zielsetzung
19
nach einer „klaren Erkenntnis des Verhältnisses von Erfüllung und Gewährleistung" 2 3 . Legt man die bisherige Literatur über die Gewährleistung zugrunde, so muß man zu dem Ergebnis kommen, daß den Gewährleistungsnormen insgesamt ein einheitlicher, verbindender gesetzgeberischer Grundgedanke fehlt. Die vorliegende Arbeit setzt es sich nun zum Ziel, die Regelung der Gewährleistung für Sachmängel als ein einheitliches, gemeinsamen Prinzipien unterliegendes Rechtsinstitut darzustellen. Entwickelt werden soll dies anhand der drei wichtigsten Vertragstypen, des Kaufs, des Werkvertrags und der Miete. Dabei geht es zunächst nur u m die dogmatische Bestimmung der Gewährleistungsnormen. Die Lösung dieser Frage ermöglicht es, alle weiteren Fragen, die i m Zusammenhang m i t der Sachmängelhaftung stehen, zu lösen: Ohne Erkenntnis des Wesens der Gewährleistung können keine befriedigenden Antworten gefunden werden 2 4 . So drängen sich als Fragen auf: Gerät der Gläubiger i n Annahmeverzug, wenn er es ablehnt, eine angebotene mangelhafte Sache abzunehmen, oder gerät der Schuldner i n Schuldnerverzug 25 ? Wie ist das Verhältnis der Gewährleistung zu den Normen der Unmöglichkeit (§§ 323 ff.) und zum Eigenschaftsirrtum (§ 119 II)? Besteht neben der Sachmängelhaftung noch ein Leistungsanspruch, z. B. ein Nachlieferungsanspruch? Wer hat die Mangelhaftigkeit der Sache zu beweisen? Ausgangspunkt der Arbeit muß die Frage nach dem Rechtsgrund der Gewährleistung sein. Warum haftet der Verkäufer, der Warenhersteller, der Vermieter?
23
Spezies, S. 92. So auch Süß, S. 9: Erst nach der E r m i t t l u n g des Wesens der Gewährleistung könnten die einzelnen Streitfragen beantwortet werden. Resultate, die dies nicht beachten würden, hingen juristisch i n der L u f t . Ebenso f ü r das österreichische Recht Kramer JB1 72, 401 ff. 25 Gerade bei dieser Frage erweist sich die Bedeutung der dogmatischen Einordnung der Gewährleistung. Selbst Rabel, der diesem Versuch ablehnend gegenübersteht, vgl. F N 17, muß zugeben, daß es von der Einordnung der Gewährleistung abhängt, ob der Käufer eine fehlerhafte Sache zurückweisen kann, ob er die Einrede der exceptio non rite adimpleti contractus oder einen entsprechenden Rechtsbehelf hat (vgl. Rabel „ Z u den allgemeinen Bestimmungen über Nichterfüllung gegenseitiger Verträge", S. 733 bzw. i n Gesammelte Werke I I I , S. 169). 24
2·
I I . Das Verständnis der Gewährleistungsregelung nach herrschender Lehre 1. K u r z e r Uberblick über die Entwicklung der herrschenden L e h r e
Schon sehr kurze Zeit nach Inkrafttreten des BGB wurde die Frage nach dem Rechtsgrund der Gewährleistung gestellt. Das Gesetz hatte es unterlassen, die Gewährleistung von den allgemeinen Normen klar abzugrenzen. So war es unvermeidbar, daß man sich über die Anwendungsbereiche der Regelungen i m Verhältnis zueinander Gedanken machte. Diese Frage aber ließ sich wiederum nur beantworten, wenn man die Rechtsnatur der Gewährleistungsansprüche ermittelte. Als erster 1 erhob Schollmeyer 2 1904 die Frage nach dem Rechtsgrund der Gewährleistung. F ü r Schollmeyer ergaben sich dabei zwei entgegengesetzte Bereiche, die Erfüllungspflicht und die Gewährleistungspflicht 3 . Zur Erfüllungspflicht sollten alle Verpflichtungen des Schuldners gehören, „die geschuldete Leistung an den Gläubiger i n Schuldtilgungsabsicht zu bewirken". Die Gewährleistungspflicht diene dazu, „ f ü r die Freiheit von Sachmängeln gewisser A r t und für das Vorhandensein zugesicherter Eigenschaften einzustehen". Eine Sache frei von Mängeln zu leisten, gehöre nicht zur Erfüllungspflicht, weder beim Spezies-4 noch beim Gattungskauf. Beim Gattungskauf bestehe nur die Pflicht, Sachen mittlerer A r t und Güte zu leisten 5 , beim Spezieskauf müsse die Sache nur i n dem Zustand erbracht werden, i n dem sie sich bei Vertragsschluß befinde 6 . Nach Schollmeyer greift also die Gewährleistung nicht ein, weil mangelhaft erfüllt wurde, sondern i m Gegenteil, obwohl mit der mangelhaften Sache v o l l erfüllt wurde 7 .
1 Die Frage w a r zwar vorher schon mehrmals angeklungen, vgl. etwa Leonhard, Die Beweislast, S. 392, 393, doch niemals i n dieser K l a r h e i t u n d Konsequenz gestellt worden. 2 Ih. Jb. 49, 93 ff. 3 S. 93. 4 S. 97. 5 Schollmeyer geht dabei davon aus, daß ein Abweichen von mittlerer A r t u n d Güte noch k e i n Fehler sei, vgl. S. 99 ff. « S. 97, 104. 7 S. 97.
1. Kurzer Überblick über die E n t w i c k l u n g der herrschenden Lehre
21
Eine Besonderheit ergibt sich für Schollmeyer, wenn die konkrete Sache nach Kaufabschluß aber vor Gefahrübergang fehlerhaft wird. Ist die Sache i n dem Zustand, i n dem sie sich bei Kaufabschluß befand, geschuldet, so greifen die Gewährleistungsansprüche für nach Kaufabschluß entstandene Fehler ein, obwohl eine Erfüllungspflicht zur Leistung der Sache i n mangelfreiem Zustand, nämlich i m Zustand des Vertragsabschlusses, bestand 8 . Die von Schollmeyer vorgenommene Differenzierung zwischen Erfüllungspflicht und Gewährleistungspflicht wurde i m weiteren Verlauf von der Lehre übernommen und verfeinert. So schreibt Dernbwrg i n der 3. Auflage 9 seines Lehrbuchs 10 , der Käufer einer Speziessache habe keinen Anspruch auf Leistung der Mängelfreiheit. Ausgenommen werden dabei die Fälle des arglistigen Verschweigens und der Zusicherung einer Eigenschaft. Wenn Dernburg unmittelbar nach dieser Feststellung unter Ablehnung der Ansicht Schollmeyers ausführt, der Käufer dürfe die mangelhafte Sache zurückweisen, er komme damit nicht i n Annahmeverzug, vielmehr gerate der Verkäufer i n Verzug, wenn er eine mangelhafte Sache anbiete, so zeigt das, daß hier noch die letzte Klarheit fehlt. Ist Mängelfreiheit nicht geschuldet, so kann der Verkäufer nicht durch Anbieten einer fehlerhaften Sache i n Verzug kommen. Verzug t r i t t ein, wenn die geschuldete Leistung nicht erbracht wird. V i e l klarer formuliert es 1910 Max Wolff 11. Die Gewährleistung setze voraus, daß keine Leistungspflicht bestehe. Eine Verpflichtung, das zu leisten, wofür Gewähr geleistet würde, sei ausgeschlossen12. Wolff schließt sich damit ausdrücklich der Lehre Schollmeyers an 1 3 , er lehnt jedoch den von Schollmeyer gebrauchten Begriff „Erfüllungspflicht" als verwirrend ab und ersetzt i h n durch den Begriff der Leistungspflicht 1 4 . Obwohl Wolff der Lehre Schollmeyers folgt, differenziert er doch schon zwischen Spezies- und Gattungskauf: Nur beim Spezieskauf habe der Verkäufer keine Verpflichtung zur Leistung einer mangelfreien Sache. Für den Gattungskauf lehnt Wolff die Ansicht Schollmeyers ab. Hier sei der Verkäufer verpflichtet, die Sache mangelfrei zu 8 Dementsprechend taucht f ü r Schollmeyer i n diesem F a l l auch die Frage nach der Konkurrenz m i t den allgemeinen Normen auf: Bei unbehebbaren Mängeln m i t §§ 323 ff., vgl. S. 104 ff., bei behebbaren m i t §§ 320, 326, vgl. S. 113 ff. 9 I n der 1. u n d 2. Auflage von 1901 findet sich diese Ansicht noch nicht. 10 1906, L B I I 2, § 185 I, S. 69. 11 Ih. Jb. 56, 1 ff. 12 S. 2, 3. 13 S. 4. 14 S. 4.
22
I I . Das Verständnis der Gewährleistungsregelung η ach herrschender Lehre
liefern 1 5 . Komme es zur Konkretisierung und Übergabe, so erlösche der Leistungsanspruch. Der Käufer habe dann jedoch, wie beim Spezieskauf, die Gewährleistungsansprüche. 2. D i e Definition der Gewährleistung und die Unterscheidung echte — unechte Gewährleistung
I n der Folgezeit setzte sich die von Wolff vertretene Ansicht endgültig durch 16 . Die letzte und konsequenteste Ausgestaltung erhielt sie jedoch erst durch Süß17 (1931) und Korintenberg 18 (1935). I n dieser Form ist sie noch heute herrschende Lehre 1 9 . Danach ist die Gewährleistungspflicht keine Ersatzpflicht, sondern eine eigene primäre Verpflichtung, die gerade darauf beruht, daß eine Verpflichtung, das zu leisten, wofür man haftet, nicht besteht 20 . Eine Ersatzpflicht müsse immer an die Nichterfüllung einer Leistungspflicht anknüpfen. Die Gewährleistung greife aber nicht ein, weil Mängelfreiheit geschuldet sei, sondern obwohl Mängelfreiheit nicht geschuldet sei. W i r d eine mangelhafte Sache geleistet, so trete volle Erfüllung ein. Die Gewährleistung greife ein, obwohl v o l l erfüllt worden sei 21 . Konsequent w i r d daher auch beim Spezieskauf angenommen, daß die Sache i n dem Zustand zu leisten sei, i n dem sie sich gerade befindet 22. Damit müßte man eigentlich zu dem Ergebnis kommen, daß überall dort, wo die Sachmängelhaftung eingreift, eine Pflicht zu mangelfreier Leistung nicht bestehe 23 . Diese Konsequenz war für die herrschende Lehre nicht tragbar, da zumindest beim Werkvertrag das Gesetz un15 S. 67. Diese Differenzierung zwischen Gattungs- u n d Spezieskauf findet sich schon bei Leonhard, Die Beweislast (1904), S. 392, 393; Nowicki, S. 27, 39 (1907); Oertmann, Recht 1908, 347, 351. 16 Oertmann, Kommentar § 433 A n m . 2 a u n d i n : Der junge Rechtsgelehrte 1935, 353 ff.; Leonhard, Schuldrecht I, S. 498 f.; I I , S. 77 ff., 80. 17 Wesen u n d Rechtsgrund der Gewährleistung für Sachmängel (1931). 18 E r f ü l l u n g u n d Gewährleistung beim Werkvertrage (1935); vorher schon (1926) i n der Dissertation, Der Mängelbeseitigungsanspruch u n d der A n spruch auf Neuherstellung beim Werkvertrag. 19 Vgl. Enneccer us / Lehmann, § 108 I ; Soergel / Siebert / Ballerstedt, Bern. 13 vor § 459; Larenz I I , § 41 I I e; Busbach, S. 50f.; Esser, § 64 I ; Fikentscher, § 70 I ; Medicus, Festschrift Kern, S. 316. 20 Siehe Süß, S. 37, 38, 50; Korintenberg, Erfüllung, S. 10 ff., 16 ff.; Raape, S. 483. 21 Vgl. Süß, S. 19, 50; Larenz I I , § 41 I I e; Korintenberg, Erfüllung, S. 16 ff. u n d Abschied, S. 73; Schniewind, S. 55; vgl. auch Graue, S. 60, 61. 22 So Süß, S. 225; Larenz I I , S. 58 F N 1; die Annahme Schollmeyers (S. 97, 104), die Sache sei so zu leisten, wie sie bei Kaufabschluß sei, w a r als w i d e r sprüchlich erkannt worden, w e i l i m Falle einer Verschlechterung der Sache zwischen Kaufabschluß u n d Gefahrübergang die Gewährleistung auf eine Leistungspflicht zurückgehen würde. Vgl. auch unten I V , 2, b. 23 So auch noch konsequent Schollmeyer, S. 100 f., w e n n er beim Gattungskauf eine Pflicht zu mangelfreier Leistung verneint.
2. Die Unterscheidung echte — unechte Gewährleistung
23
zweideutig den Schuldner zu einer mangelfreien Leistung verpflichtet (vgl. § 633 I). Die herrschende Lehre löste dieses Problem m i t der Erklärung, nicht überall, wo das Gesetz Sachmängelhaftung angeordnet habe, handle es sich wirklich u m Gewährleistung. Wandlung und M i n derung seien keine für die Gewährleistungspflicht typischen Rechtsbehelfe; sie kämen auch außerhalb der Gewährleistung vor 2 4 . A l l e i n die Tatsache, daß an irgendeiner Stelle des Gesetzes Sachmängelvorschriften normiert sind, läßt also für die herrschende Lehre noch nicht den Rückschluß zu, daß es sich dabei w i r k l i c h u m Gewährleistungsvorschriften handelt. Die Frage nach der Rechtsnatur einer Sachmängelvorschrift hängt für die h. L. jeweils davon ab, ob eine Verpflichtung zu mangelfreier Leistung besteht. Für die Sachmängelnormen bei den einzelnen Vertragstypen ergibt sich damit nach h. L. folgendes Bild: Beim Spezieskauf, bei dem eine Verpflichtung, mangelfrei zu leisten, verneint w i r d 2 5 , ist die Sachmängelhaftung „echte" 2 6 Gewährleistung, beim Gattungskauf 21, bei der Miete 28 und beim Werkvertrag 29 hingegen, bei denen eine Pflicht zu mangelfreier Leistung bejaht wird, ist die Sachmängelhaftung „ u n echte" 30 Gewährleistung. Die h. L. n i m m t also innerhalb der Sachmängelvorschriften eine Trennung vor, indem sie echte oder primäre Gewährleistung nur beim Spezieskauf bejaht, ansonsten aber eine unechte oder sekundäre Gewährleistung annimmt. Letztlich begründet w i r d dieses Ergebnis damit, daß für den Spezieskauf i n § 433 I 1 keine Pflicht, mangelfrei zu leisten, normiert sei. Beim Gattungskauf dagegen ergebe sich die 24
Vgl. Süß, S. 106, 107; Korintenberg, Abschied, S. 74. Vgl. Süß, S. 37, 38, 49; Larenz I I , § 41 I, I I e; Flume, S. 35, 39; Korintenberg, Erfüllung, S. 152, 153 u n d F N 16 auf S. 39; Diss. S. 15; anders aber dann i n Abschied, S. 79, vgl. dazu A n m . 26. 26 Vgl. z. B. Raape, S. 483. Die begriffliche Trennung echte — unechte Gewährleistung geht auf Korintenberg zurück. Während er i n seiner Dissertation, S. 14 u n d i n seinem Buch Erfüllung, S. 10, 16, 20 ff., 52, 152 ff. noch die Formulierung primäre — sekundäre Gewährleistung benützt, verwendet er später das Begriffspaar echte — unechte Gewährleistung, vgl. Spezies, S. 95, 96, Abschied, S. 73 ff. I n dieser letzten Schrift gibt Korintenberg nicht, w i e Flume meint, die begriffliche Trennung auf, sondern r ä u m t lediglich ein, daß auch beim Spezieskauf eine Leistungspflicht zu mangelfreier Leistung bestehe, daß also auch beim Spezieskauf eine unechte Gewährleistung v o r liege; vgl. auch Korintenberg, Spezies, S. 95 ff. Ebenso Graue, S. 59 ff., 287 ff. 27 Süß, S. 91; Korintenberg, Diss., S. 16; Erfüllung, S. 153; Oertmann, S. 354; Raape, S. 482, 483; Busbach, S. 48; Fikentscher, § 70 V I I ; Soergel / Siebert / Ballerstedt, vor § 459 Bern. 10, 13; Düringer / Hachenburg / Hoeniger, V 1, Einl. I V . Kap. unter A , S. 103, 105, 106. 28 Süß, S. 37, 38, 102; Flume, S. 39. 29 Süß, S. 49, 106; Korintenberg, Diss., S. 18; Erfüllung, S. 52, 153; Oertmann, S. 354, 356; Flume, S. 39. 30 Vgl. Anm. 26. 25
24
I I . Das Verständnis der Gewährleistungsregelung
ach herrschender Lehre
Pflicht zu mangelfreier Leistung daraus, daß der Verkäufer m i t einer mangelhaften Sache gemäß § 480 I 1 nicht erfüllen könne, es sei denn, der Käufer gäbe sich mit der Sache zufrieden. Beim Miet- und Werkvertrag bestimme das Gesetz sogar ausdrücklich i n den §§ 536 bzw. 633 I, daß der Verkäufer verpflichtet sei, eine mangelfreie Sache zu erbringen. 3. D e r Rechtsgrund der Gewährleistung beim Spezieskauf
F ü r die h. L. ergeben sich zwei dogmatisch zu scheidende Pflichten innerhalb der gesamten Sachmängelregelung des BGB. Während für den Bereich der sog. unechten Gewährleistungspflichten die Erklärung des Rechtsgrundes einfach ist, bereitet sie bei der sog. echten Gewährleistungspflicht erhebliche Schwierigkeiten. Die unechte Gewährleistung hat ihren Rechtsgrund in der vereinbarten Verpflichtung, mangelfrei zu leisten. Sie dient der Vertragserfüllung und findet darin ihre Rechtfertigung. Ganz anders verhält es sich nach h. L . bei der echten Gewährleistung. Diese dient nicht der Vertragserfüllung. Es bedarf daher einer besonderen Erklärung, warum sie besteht, auf welchen Rechtsgrund sie zurückzuführen ist 3 1 . I m einzelnen bestehen darüber folgende Ansichten: a) Wenn § 459 von Fehlern spricht, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem „nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauch" aufheben oder mindern, so geht die Formulierung vermutlich auf die Lehre Windscheids über die „Voraussetzung" z u r ü c k 3 2 ' 3 3 . Sie ist daher an erster Stelle zu nennen. Windscheid u versteht unter der Voraussetzung eine unentwickelte Bedingung 35 : Der Erklärende stellt seine Willenserklärung nicht unter 31 Vielfach w i r d diese Frage übergangen. So z. B. von Düringer / Hachenburg / Hoeniger, V 1, Einl. I V . Kap. A n m . 114. 32 Wenngleich der Gesetzgeber ausdrücklich eine Übernahme der Windscheid'schen Voraussetzungslehre i n das Gesetz abgelehnt hat, vgl. Mot., I S. 249. 33 Vgl. Oertmann, Geschäftsgrundlage, S. 71 u n d Crome, AcP 78, 124, der diese gesetzliche Formulierung nicht zu Unrecht ein „Kuckucksei" nennt, das i n den Abschnitt über die Gewährleistung für Sachmängel hineingelegt worden ist. Süß, S. 129 F N 1 u n d Max Wolff, Ih. Jb. 56, 14, hingegen leugnen einen Einfluß der Windscheid'schen Lehre auf die gesetzliche Ausdrucksweise. I n w i e w e i t der Gesetzgeber von der Lehre Windscheids beeinflußt war, läßt sich nicht mehr m i t Sicherheit feststellen. A l l e i n die Tatsache jedoch, daß der Begriff „vorausgesetzte Eigenschaft" sich schon i m A L R V 1 § 319 f i n det, spricht noch nicht unbedingt dafür, w i e Wolff meint, daß der Begriff neutral gemeint war. Dafür hatte die Lehre Windscheids zu große Bedeutung gehabt. 34 I m Ergebnis w i r d diese Ansicht auch von Max Wolff, S. 12 ff. vertreten. Obwohl er sich von der Lehre Windscheids distanziert (S. 12 ff.) u n d sich
3. Der Rechtsgrund der Gewährleistung beim Spezieskauf
25
den Vorbehalt einer Bedingung, er w i l l jedoch die rechtliche Wirkung nur bei Bestehen bestimmter Umstände. Diese Umstände müssen nicht ausdrücklich erklärt werden. Es genügt, wenn sie sich aus dem Inhalt der Willenserklärung 3 6 oder aus den Begleitumständen 37 als gewollt ergeben. Der Erklärungsgegner muß jedoch i n der Lage sein, die Voraussetzung zu erkennen. Bei der Voraussetzung stellt sich der Erklärende einen Umstand positiv vor. Er setzt den Umstand als gegeben voraus, rechnet also nicht mit seinem Fehlen, weil er sonst den U m stand zur Bedingung erhoben hätte 3 8 . I m Unterschied zur Bedingung erklärt die Vertragspartei also nicht „ich w i l l , wenn", sondern „ich w i l l , würde aber nicht wollen, wenn n i c h t . . ." 3 9 . Legt man diese Ansicht zugrunde, so ist der Rechtsgrund der Gewährleistung darin zu finden, daß der Käufer — was dem Verkäufer erkennbar war — Fehlerfreiheit vorausgesetzt hat, seine Erwartung jedoch nicht erfüllt wurde. Die Gewährleistungsnormen wären danach besondere Rechtsfolgebestimmungen für einen Fall der „Voraussetzung". b) Von Lenel 4 0 wurde die Lehre Windscheids für den Bereich der Gewährleistung 4 1 dahingehend abgewandelt, daß es nicht darauf ankomme, „was man vorausgesetzt hat, sondern nur auf das, was man vorauszusetzen nach Treu und Glauben dem Gegner gegenüber berechtigt w a r " 4 2 . Für Lenel ist also nicht entscheidend, ob die Vertragspartei einen Umstand tatsächlich vorausgesetzt hat. Es ist unerheblich, ob der Käufer sich besondere Gedanken gerade über die Fehlerfreiheit gemacht hat. Dieses Ergebnis begründet Lenel damit, daß für Klagen aus Sachmängeln nicht der Nachweis eines Irrtums erforderlich ist, sondern einzig der Nachweis eines Fehlers 43 . eher zur Ansicht Lenels (S. 22 ff.) bekennt, steht er doch der Ansicht W i n d scheids näher, da er dem Verkäufer den Gegenbeweis einräumt, der Käufer habe die fragliche Eigenschaft nicht vorausgesetzt (S. 27), u m damit die H a f tung zu beseitigen. F ü r die Ansicht Lenels erscheint ein solcher Gegenbeweis ausgeschlossen, ausgenommen der Nachweis der Kenntnis. 35 Vgl. PandektenR. I § 97; AcP 78, 194 ff. 36 PandektenR. I § 98, S. 511. 37 PandektenR. I § 98, S. 514; der Lehre Windscheids folgt Bekker, § 119, Α , Β u n d Beilage I, S. 367 - 376. 38 A c P 78, 194. 39 A c P 78 195. 40 A c P 74, 213 ff.; A c P 79, 49 ff.; ähnlich Max Wolff , S. 22 ff., vgl. dazu A n m . 34. 41 Ansonsten ist Lenel ein entschiedener Gegner Windscheids, vgl. AcP 79, 96 ff. 42 AcP 79, 105. 43 AcP 79, 103; f ü r Lenel wäre dementsprechend ein Haftungsausschluß durch den Nachweis, der Käufer habe eine Eigenschaft nicht vorausgesetzt, w i e es M a x W o l f f f ü r möglich hält, vgl. A n m . 34, undenkbar, es sei denn, der Verkäufer weist dem Käufer Kenntnis des Mangels nach.
26
I I . Das Verständnis der Gewährleistungsregelung
ach herrschender Lehre
c) Der Windscheid'schen Voraussetzungslehre ebenfalls eng verbunden ist die Begründung von Oertmann. Der Grund für die Sachmängelhaftung ist „die beim Geschäftsschluß zu Tage tretende und vom etwaigen Gegner i n ihrer Bedeutsamkeit erkannte und nicht beanstandete Vorstellung eines Beteiligten oder die gemeinsame Vorstellung der mehreren Beteiligten vom Sein oder vom E i n t r i t t gewisser Umstände, auf deren Grundlage der Geschäftswille aufbaut" 4 4 . Oertmann nennt diese Vorstellung die „Geschäfts grundlag eweil sie nicht Inhalt des Vertrages wird, sondern dem Vertrag zugrunde liegt. Der wesentliche Unterschied 45 zur Lehre Windscheids besteht darin, daß die Lehre von der Geschäftsgrundlage nicht auf den Willen einer Vertragspartei abstellt, sondern auf einen äußeren Tatbestand, die nach außen in Erscheinung getretene Vorstellung der Partei. Außerdem ist nur das Geschäftsgrundlage, was von beiden Seiten 46 als solche zugrunde gelegt wurde, sei es auch nur, daß der Erklärungsgegner die Vorstellung des Erklärenden nicht beanstandet hat, während die Voraussetzung i m Windscheid'schen Sinn ein einseitiges Moment ist, das für den Gegner nur erkennbar sein muß. d) Aufbauend auf der These Oertmanns vertritt Locher 47 seine Lehre von der Verfehlung des Geschäftszwecks. Für Locher ist Geschäftsgrundlage „die Gesamtheit derjenigen Umstände, ohne deren Vorhandensein, Fortbestand oder E i n t r i t t der m i t dem Geschäft nach seinem Inhalt bezweckte Erfolg (der Geschäftszweck) durch das Geschäft trotz ordnungsmäßigen Abschlusses und trotz Aufwendung der nach dem Inhalt des Geschäftes den Beteiligten zuzumutenden Opfer nicht erreicht werden kann" 4 8 . Der Geschäftszweck Lochers ist aber i m Gegensatz zu Oertmanns Geschäftsgrundlage Vertragsbestandteil, und zwar neben dem eigentlichen Vertragsinhalt. Ziel der Zweckvereinbarung ist es nicht, unmittelbar irgendwelche Rechtsfolgen hervorzurufen, sie hat vielmehr rein deklaratorische Bedeutung. Die Zweckvereinbarung ist somit keine Bedingung der eigentlichen Vertragserklärung 4 9 , sonst würde m i t E i n t r i t t der Bedingung die Erklärung keine Auswirkung haben. Dementsprechend sieht Locher den Grund für die Beachtlichkeit der Zweckvereinbarung i m Hinblick auf den ganzen Vertrag nicht i n der 44
Geschäftsgrundlage, S. 37. Vgl. dazu Locher, AcP 121, 3 ff. Geschäftsgrundlage, S. 72. 47 A c P 121, 71 ff. 48 A c P 121, 71, 72. 49 A c P 121, 29: „Die Zweckgebundenheit des Rechtsgeschäftes bedeutet nicht eine Selbstbeschränkung des Willens i n dem Sinne, daß der als psychologische Realität feststellbare Parteiwille durch die Erreichung des Zweckes bedingt wäre." 45
46
3. Der Rechtsgrund der Gewährleistung beim Spezieskauf
27
Zweckvereinbarung unmittelbar, denn diese ist, wie schon gesagt, eine rein deklaratorische Vereinbarung, keine Folgenvereinbarung. Er findet vielmehr den Rechtsgrund für die Beachtlichkeit der Nichterreichung des Geschäftszweckes und damit, i m Falle eines Mangels, für das Eingreifen der Sachmängelvorschriften in der Rechtsordnung selbst, die ihrerseits die Zweckvereinbarung gerade deshalb zuläßt, um daran Rechtsfolgen zu knüpfen. Diese gehen nicht unmittelbar auf den Parteiw i l l e n zurück — ein solcher Rechtsfolgewille besteht gerade nicht —, sondern allein auf das Gesetz, das seinerseits an das Vorliegen einer Zweckvereinbarung anknüpft 5 0 . Rechtsgrund der Gewährleistung ist für Locher also unmittelbar das Gesetz, mittelbar die Zweckvereinbarung, für deren Vorliegen die gesetzliche Regelung getroffen wurde. e) A u f die Lehre Windscheids geht auch die Ansicht von Süß51 zurück. Süß übernimmt die Theorie Krückmanns 5 2 vom „virtuellen Vorbehalt", u m damit den Rechtsgrund der Gewährleistung zu erklären 5 3 . Krückmann greift die Voraussetzungslehre Windscheids auf. Für i h n ist jedoch die Voraussetzung nicht aktuell, sondern rein virtuell 54, sie läßt also den Geschäftswillen unbedingt bestehen. Als Rechtfertigung dafür, daß die Partei sich von den Folgen ihrer „unbedingten und vorbehaltlosen Erklärung" freimachen kann, braucht Krückmann daher noch einen anderen Umstand und diesen findet er i n der Nichtzumutbarkeit. „Das Rätsel der Voraussetzungslehre liegt i n der Nichtzumutbarkeit, i n einem Anderswollendürfen, aber nicht i n einem vermeintlichen Nichtgewollthaben 5 5 ." Für Krückmann steht also jede Erklärung unter einem virtuellen Vorbehalt, der jedoch nur dann Beachtung findet, wenn eine Nichtzumutbarkeit vorliegt. Süß führt nun diese Ansicht zur Begründung der Gewährleistung an: Der Käufer kauft unter der Voraussetzung einer bestimmten Sach50
Vgl. Locher, A c P 121, 30, 31. Wesen u n d Rechtsgrund der Gewährleistung für Sachmängel, 1931. Vgl. A c P 131, 1 ff., 257 ff. 63 Krückmann selbst hat die Anwendung seiner Lehre zur E r k l ä r u n g der Sachmängelhaftung ausdrücklich abgelehnt, vgl. A c P 131, 93. Er begründet die Gewährleistung damit, daß die eine Partei nicht das leisten müsse, was sie leisten soll, w e n n die andere nicht leistet, was sie leisten soll, vgl. Gewährschaft, S. 18. D a m i t k o m m t er i n die Nähe der Annahme einer L e i stungspflicht, die sich auf die Mängelfreiheit erstreckt, wenngleich dieser Gesichtspunkt nicht k l a r herausgearbeitet w i r d , sondern letztlich die Gewährleistung m i t einem Vertrauenstatbestand begründet w i r d , vgl. Gewährschaft, S. 20 ff. 54 A c P 131, 9: „Die Selbstbeschränkung i m richtig verstandenen Sinne Windscheid's ist potentiell, v i r t u e l l aber nicht aktuell." 55 AcP 131, 11. 51
52
28
I I . Das Verständnis der Gewährleistungsregelung
ach herrschender Lehre
eigenschaft und bemißt dementsprechend den Preis. Jedem Kauf ist ein virtueller Vorbehalt immanent, bei Fehlerhaftigkeit der Sache, nicht zu kaufen oder zumindest nicht zu dem vereinbarten Preis. Folge der Fehlerhaftigkeit ist eine Äquivalenzstörung. Da aber Wesensgehalt jedes gegenseitigen Vertrages die Äquivalenz ist, ist der der Äquivalenz beraubte Vertrag dem Käufer nach Treu und Glauben nicht zumutbar 56. Rechtsgrund der Gewährleistung ist für Süß also der virtuelle Vorbehalt, der Beachtung findet, weil ein der Äquivalenz beraubter gegenseitiger Vertrag nicht zumutbar ist. f) Neben den bisher genannten Theorien, die den Rechtsgrund der Gewährleistung m i t Hilfe einer klaren Dogmatik zu erfassen versuchen, findet sich eine große Zahl von Ansichten, die die Gewährleistung m i t dem Gedanken des Irrtums- und Vertrauensschutzes begründet, wobei die einzelnen Meinungen einmal mehr den Irrtumsschutz 57 , also die subjektive Seite, einmal mehr den Vertrauensschutz 58 , also die objektive Seite betonen. Hervorzuheben ist hierbei noch die Begründung von Korintenberg, der den Vertrauensschutz ganz vom Gedanken des Irrtumsschutzes loslöst und i h n allein als Rechtsgrund für die Gewährleistung heranzieht: Der Käufer einer Sache w i r d durch die Gewährleistung geschützt, w e i l er trotz Fehlens eines Erfüllungsanspruchs nach Treu und Glauben auf die Fehlerlosigkeit der verkauften Sache vertrauen durfte 59'60. g) Unter dem Einfluß von Flume 61 w i r d zwar heute von der h. L . 6 2 eingeräumt, daß die Gewährleistung auch im Vertrag begründet 56
Süß, S. 129, 130, 211. Savigny, S. 358 ff.; Haymann, S. 29, 30; Pisco, S. 66 ff.; aber auch die Protokolle I, 671: „ A n sich liege beim K a u f einer Sache, die m i t einem v o m Käufer nicht gekannten Mangel behaftet sei, ein I r r t u m i m Beweggrunde vor. Diesem werde i n Abweichung von dem allgemeinen Grundsatze der Unbeachtlichkeit eines solchen I r r t u m s durch positive Vorschrift die W i r k u n g beigelegt, daß der Käufer wegen des Mangels Wandlung oder Minderung verlangen könne." 58 von Blume, Ih. Jb. 55, 213, 214; Busbach, S. 54. 59 Korintenberg, Spezies, S. 96; Abschied, S. 70, 73, 74. I n seinem Buch „ E r f ü l l u n g u n d Gewährleistung beim Werkvertrage", S. 22, ist die Formulier u n g noch nicht so klar. Wenn Korintenberg dort von einem „Einstehen für die Wahrheit des i n dem Gläubiger erweckten Glaubens" der Fehlerlosigkeit spricht, dann zeigt das noch eine gewisse Verbundenheit m i t dem I r r t u m s schutzgedanken. 60 Ä h n l i c h schon Leonhard I, S. 498; I I , S. 78, 79; wie Korintenberg auch Fabricius, JZ 1967, 464, 470, der jedoch w e i t e r h i n aus § 242 eine Nebenpflicht zu mangelfreier Leistung ableitet. 61 Eigenschaftsirrtum u n d Kauf, S. 42, 48. Die Ansicht Flumes selbst n i m m t eine Sonderstellung ein. Sie läßt sich nicht unter die h. L. einbeziehen u n d bedarf daher einer besonderen Würdigung; vgl. dazu unten I V , 2, b. 57
3. Der Rechtsgrund der Gewährleistung beim Spezieskauf
29
sei 63 , jedoch w i r d eine Pflicht zur Leistung einer mangelfreien Sache abgelehnt, so daß, wie schon bisher, die Gewährleistungsregelung beim Spezieskauf nicht der Erfüllung dient, sondern einen besonderen gesetzlichen Ausgleich darstellt. Dementsprechend w i r d letztlich der Rechtsgrund der Gewährleistung nicht i n der Vertragsvereinbarung gefunden, sondern i n einem der Faktoren, die bereits genannt wurden. So greifen Enneccerus / Lehmann64 auf den Treu- und Glaubensgrundsatz zurück. Der Rechtsgrund ist für sie „ i n der nach Treu und Glauben ausgedeuteten Leistungsvereinbarung zu finden". Larenz 65 zieht den Gedanken von der enttäuschten Erwartung 6 6 und den Gedanken der subjektiven Äquivalenz 6 7 m i t heran: Der Grund für die Mängelansprüche liegt darin, „daß der Käufer i n einer Annahme oder Erwartung enttäuscht wird, die er nach dem Vertrage zu hegen berechtigt war. Er war zu der Erwartung, die Sache sei mangelfrei, nach dem Vertrage deshalb berechtigt, w e i l dem Kaufvertrage als gegenseitigem Vertrage das Prinzip der subjektiven Äquivalenz immanent ist" 6 8 . Auch bei Raape 69 findet sich das Argument des Äquivalenzausgleichs. Dem Käufer gebührt die Sache frei von Mängeln, w e i l er für sein gutes Geld gute Ware haben w i l l . I n diesem Sinne argumentiert auch Ballerstedt: „Die Sachmängelhaftung ist eine dem Fehlen einer entsprechenden Leistungspflicht Rechnung tragende Folgerung aus dem dem Kaufvertrage als Austauschvertrage zugrunde liegenden Gedanken, daß die Parteien ihre beiderseitigen Leistungen als wertgleich gelten lassen wollen 7 0 ."
62
Vgl. Larenz I I , § 41 I I e; Enneccerus / Lehmann, § 108 I ; Soergel / Siebert / Baller stedt, vor § 459 Bern. 10; Graue, S. 60; Raape, S. 482 ff. 63 Daß es keine Gewährleistung ohne gültigen Kaufvertrag gibt u n d somit die H a f t u n g auf den Vertragsschluß zurückzuführen ist, w a r nie bestritten; so schon Schollmeyer, S. 93; R G 71, 432; R G 87, 256. N u r wurde der Rechtsgrund der gesetzlichen Regelung bisher außerhalb des Vertrages gesucht, während die angeführten Meinungen den Rechtsgrund i m Vertrage selbst begründet sehen. 64 § 108 I. 65 Larenz I I , § 41 I I e, S. 59: „Der G r u n d f ü r die Haftung des Verkäufers liegt also zwar auch i m Kaufvertrag, aber .. 66 Wie w i r i h n z. B. bei Leonhard, vgl. A n m . 60, oder Korintenberg, vgl. A n m . 59, finden. 67 Diese Begründung finden w i r schon bei Krückmann, AcP 131, 93; Gewährschaft, S. 18, u n d i n abgewandelter F o r m bei Süß, S. 129, 130, 211; ebenso Esser, § 64 I. 68 Larenz I I , § 41 I I e, S. 58. 69 A c P 150, 484. 70 Soergel / Siebert l Ballerstedt, vor § 459 Bern. 15.
30
I . Das Verständnis der Gewährleistungsregelung
ach herrschender Lehre
4. Ursache des bisherigen Verständnisses der Gewährleistungsregelung
Jede Ansicht baut auf einer bestimmten Hypothese auf, die oft nicht mehr deutlich zu erkennen ist, und doch steht und fällt jede Folgerung, die auf der Hypothese beruht, m i t dieser. Bei der Auseinandersetzung u m den Rechtsgrund der Gewährleistung w i r d meist der Ausgangsgedanke nicht erwähnt, w e i l er weitgehend unbestritten ist. Die Hypothese, auf der die h. L. aufbaut, ist die These Zitelmanns 71, daß die Erklärungen der Parteien über die Eigenschaften der Sache beim Spezieskauf nicht verpflichtender Vertragsbestandteil werden könnten. Dementsprechend kann die Sachmängelhaftung beim Spezieskauf für die h. L., sieht man einmal von der Ansicht Flumes, die eines besonderen Eingehens bedarf, ab 7 2 , auch nicht ihren Rechtsgrund i n der Nichterfüllung einer Vertragspflicht haben. Sie ist daher auf die oben angeführten Begründungen angewiesen. Bei einer Untersuchung über den Rechtsgrund der Gewährleistung kommt man nicht umhin, diese wichtige Grundlage darzulegen und einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Entwickelt hat Zitelmann seine Theorie für den Bereich des Irrtums. Nach Zitelmann 7 3 kann die Leistungsvereinbarung immer nur die Spezies als solche betreffen, niemals aber deren Eigenschaften. Der Wille sei durch zwei Faktoren bestimmt: a) durch die Vorstellung eines bestimmten Werdens und b) die Vorstellung eines bestimmten Objekts, an dem dieses Werden eintreten soll 7 4 . Z u a) Der Wille beziehe sich immer auf einen bestimmten Erfolg, auf eine Veränderung der rechtlichen Situation der bestimmten Sache 75 . Die Vorstellung von dem Sein der Sache sei niemals auf einen Erfolg gerichtet. Die Erfolgsabsicht beziehe sich einzig auf die konkrete Sache. Zu b) Der Erklärende wähle ein bestimmtes Objekt zum Gegenstand des erstrebten Erfolges. M i t der Individualisierung sei die Wahl abgeschlossen. Die Vorstellungen über die Eigenschaften der Sache hätten keine individualisierende Wirkung, hätten also keinen Einfluß auf Wille und Erklärung, sie seien vielmehr nur 71 72 73 74 75
I r r t u m u n d Rechtsgeschäft, 1879. Vgl. I V , 2, b. S. 435 ff. Vgl. S. 438. Vgl. S. 436 ff.
4. Ursache des bisherigen Verständnisses der Gewährleistung
31
dem Willen vorgeschaltetes M o t i v 7 6 . Stehe das Objekt der Veränderung einmal fest, so sei die Willensbildung abgeschlossen. Sie konzentriere sich auf den bestimmten Gegenstand. Wenn der Erklärende diesem Gegenstand bestimmte Eigenschaften zuschreibt, so handle es sich dabei nicht um ein Wollen, sondern um eine Vorstellung vom Sein des Gegenstandes 77 . Was „ist", könne nicht gewollt werden. Das sei logisch und psychologisch völliger Nonsens. „Ich kann wohl beabsichtigen, daß diese vor m i r stehende Person sterbe, aber nicht, daß diese vor m i r stehende Person, deren Tod ich beabsichtige, Carl F. sei 7 8 ." Nach dieser Ansicht kann also eine Eigenschaft nur insoweit Gegenstand der vertraglichen Vereinbarung werden, als diese zur Bedingung der Willenserklärung gemacht w i r d oder i n einem besonderen Garantievertrag zugesagt wird. I m letzteren Fall führt das zu einer Einstandspflicht für ein bestimmtes „Sein". Dieser Ansicht Zitelmanns folgt i m Ergebnis noch heute die h. L . 7 9 . Bei einer Willenserklärung könnten Spezifizierung und Bestimmung bestimmter Eigenschaften nicht gleichzeitig Geltung haben, da sonst die Willenserklärung als i n sich widersprüchlich nichtig wäre. Die Rechtsordnung lasse daher nur der Spezifizierung Wirkung zukommen 8 0 . Beim Spezieskauf ist danach Vertragsgegenstand allein die Sache i n ihrer jeweiligen Beschaffenheit. Nicht Gegenstand des Vertrages ist das Vorliegen oder Fehlen bestimmter Eigenschaften.
76
Wie unangefochten die Lehre Zitelmanns war, zeigt sich daran, daß selbst der 1. Entwurf den Eigenschaftsirrtum als M o t i v i r r t u m ansieht, vgl. Mot. I, S. 199. 77 S. 439: „ W o h l ist es Sache meiner Absicht, ob dieses oder ob jenes Objekt Träger der Veränderung sein solle; aber wenn dieses Objekt einmal feststeht, dann muß ich auch alle Eigenschaften desselben m i t i n den K a u f nehmen, dann k a n n meine Absicht nicht mehr beabsichtigen, daß dieses individuelle Objekt so oder so sei, diese oder jene Eigenschaft habe." 78 S. 440. 79 Schollmeyer, S. 97; Süß, S. 49, 76; Haymann, S. 30; Larenz I I , § 41 I ; Geschäftsgrundlage, S. 20 F N 1; Flad, Festschrift f ü r Bumke, S. 244. 80 Larenz, ebd.
I I I . K r i t i k an der herrschenden Lehre Die Ansicht der herrschenden Lehre weist i n sich zu viele Ungereimtheiten auf, als daß sie ohne weiteres hingenommen werden kann. I m folgenden soll daher zu den einzelnen Aussagen kritisch Stellung bezogen werden. Zunächst g i l t es, die Unstimmigkeiten der h. L. i m Verhältnis zum bestehenden System aufzuzeigen. 1. Grundsätzliche K r i t i k a) Die Einheitlichkeit der Sachmängelvorschriften
Der Haupteinwand, der gegen die h. L. erhoben werden muß, ist der, daß sie eine Trennungslinie zwischen Gattungs- und Spezieskauf gezogen hat 1 . Ergebnis der systematischen Untersuchungen der h. L . ist, daß die Sachmängelhaftung beim Gattungskauf einen anderen Rechtsgrund und eine andere Funktion hat als beim Spezieskauf. Dort ist sie sekundäre Ausgleichspflicht, die aus der vertraglichen Schuld hervorgeht, hier ist sie primäre Einstandspflicht, die m i t „Treu und Glauben", m i t dem „Vertrauensschutz" oder ähnlichen Gesichtspunkten gerechtfertigt wird. Die von der h. L. entwickelte Ansicht führt zu der Erkenntnis, daß die Gewährleistung, wie sie i m Gesetz geregelt ist, kein einheitliches Rechtsinstitut ist. Dies ist u m so erstaunlicher, als alle Untersuchungen über die Gewährleistung es sich zum Ausgangspunkt gesetzt hatten, die Gewährleistung als eine besondere rechtliche Regelung zu erfassen. Das Ergebnis der systematischen Eingliederungsversuche durch die h. L. ist, daß es keine einheitliche Systematik der Gewährleistung gibt. Diese Lösung kann nicht befriedigen. Der Gesetzgeber hatte i m 1. Entwurf zum BGB i n den §§ 381 ff. eine generelle Gewährleistungsregelung für Sachmängel vorgesehen, die für alle auf Sachveräußerung gerichteten Verträge gelten sollte 2 . A l l e i n aus Gründen der praktischen Handhabung und der Verständlichkeit 8 1 Dies w i r d allgemein von der h . L . zugegeben; vgl. z.B. Wolff , S. 69, der die Unterschiedlichkeit jedoch f ü r gerechtfertigt hält, w e i l der Gattungskauf i n W i r k l i c h k e i t k e i n Kauf, sondern ein Innominatkontrakt, ein Vertrag über die Vornahme von Handlungen sei. 2 Mot. I I , S. 225; vgl. auch Mot. I I , S. 212: Die Sachmängelhaftung habe w i e die Rechtsmängelhaftung f ü r alle sog. lästigen Veräußerungsverträge Bedeut u n g und deshalb werde sie i n den allgemeinen Bestimmungen des Schuldrechts geordnet. 3 Prot. I, S. 653.
1. Grundsätzliche K r i t i k
33
wurden die Sachmängelbestimmungen aus dem allgemeinen Teil herausgenommen und speziell für den Kaufvertrag normiert, w e i l dort, nach Ansicht der Kommission, die Hauptanwendungsfälle liegen. Dies beweist, daß der Gesetzgeber von einer einheitlichen Vorstellung über den Rechtsgrund und die Funktion der Gewährleistung ausging 4 . Diese Vorstellung ist zwar nirgendwo i m Gesetz klar zum Ausdruck gebracht, doch muß sie sich an Hand der gesetzlichen Ordnung finden lassen. Die h. L. ist den Weg entgegengesetzt gegangen. Sie hat nicht an Hand des Gesetzes einen Gewährleistungsbegriff und ein Gewährleistungsverständnis entwickelt, sie hat vielmehr zunächst den Begriff „Gewährleistung" entsprechend den Römischen Quellen geprägt 5 und dann versucht, das Gesetz i n diese begriffliche Konstruktion zu zwängen 6 . Die logische und konsequente Folge mußte dann das Begriffspaar echte-unechte Gewährleistung sein. Das BGB hat jedoch die römisch-rechtliche Gewährleistungsregelung nicht unverändert übernommen, so daß eine Verwendung des römischrechtlichen Gewährleistungsbegriffs bei der Entwicklung einer Systematik zu Ungereimtheiten führen mußte. So ist z.B. dem klassischen Römischen Recht eine Sachmängelhaftung beim Gattungskauf fremd, während das BGB diese ausdrücklich bestimmt. I n den Motiven 7 führt der Gesetzgeber aus, daß die Gewährleistung i m wesentlichen i n Übereinstimmung m i t dem preußischen Allgemeinen Landrecht (ALR) geregelt worden sei. Dort heißt es i m 1. Teil, Titel 5, § 317: „Auch die Leistung der Gewähr gehört zur Erfüllung eines Vertrages." Diese Formulierung ist der römisch-rechtlichen Vorstellung genau entgegengesetzt. M i t diesem Hinweis soll nun nicht die Behauptung verbunden werden, daß das A L R allein dem BGB zugrunde gelegt wurde. N u r angesichts der verschiedenartigen Quellen, auf die sich der Gesetzgeber gestützt hat, muß das Vorgehen der h. L. als bedenklich bezeichnet werden, einen durch eine dieser Quellen geprägten Begriff zu übernehmen und unter dessen Verwendung eine systematische Klärung herbeizuführen. Wie sehr diese K r i t i k berechtigt ist, beweist 4 So meint das Reichsgericht, R G 161, 324, daß der Grundsatz der Gewährleistung f ü r Sachmängel bei entgeltlicher Veräußerung, Herstellung oder Gebrauchsüberlassung das gesamte Schuldrecht durchziehe. Es handele sich dabei u m einen allgemeinen Rechtsgedanken, den z. B. § 493 i n speziellerer F o r m z u m Ausdruck bringe. 5 Vgl. z.B. Schollmeyer, S. 93; Haymann, S. 30; Süß, S. 37; Korintenberg, Erfüllung, S. 20, 21, 25, 26. β Flume , S. 40, spricht deshalb hier nicht zu Unrecht von „Begriffsjurisprudenz". 7 Mot. I I , S. 224.
3 Herberger
34
. K r i t i k an der herrschenden Lehre
die Tatsache, daß Korintenberg, der zum erstenmal den Unterschied echte-unechte Gewährleistung scharf herausgearbeitet hat, 1947 seine Ansicht aufgegeben hat 8 . Er führt i n seinem „Abschied von der Gewährleistung" aus: „Es müßten schon zwingende Gründe dafür gegeben sein, daß die moderne Rechtsordnung bei der formalistischen Konstruktion der Gewährleistung für Sachmängel der Kaufsache stehenbleiben müßte, nachdem bereits das Allg. Landrecht die Erfüllungspflicht des Verkäufers zu sachmängelfreier Leistung festgelegt hatte und auch das österreichische aBGB jedenfalls bei behebbaren Mängeln die Erfüllungspflicht des Verkäufers zur Leistung einer sachmängelfreien Kaufsache auch für den Spezieskauf klar ausgesprochen hat. Die „echte" Gewährleistung des Römischen Rechts paßt i n die moderne Rechtsordnung nicht mehr hinein." Das Gesetz hat eine klare Trennungslinie zwischen der Rechtsmängelhaftung und der Sachmängelhaftung gezogen; während jene zu den allgemeinen Normen führt, unterliegt diese besonderen Regelungen. Die h. L. hat nun den Trennungsstrich m i t ihrer Ansicht verschoben. Auf der einen Seite steht die Haftung 9 für Nichterfüllung, nämlich die Rechtsmängelhaftung und die Gewährleistung beim Gattungskauf, Werkvertrag und Mietvertrag, auf der anderen Seite steht das Einstehenmüssen beim Spezieskauf, obwohl v o l l erfüllt wurde. Die h. L. verschiebt also zwei vom Gesetz klar getrennte Bereiche ineinander und zieht die Grenze i n einem der Bereiche 10 . Danach ist systematisch die Gewährleistung beim Gattungskauf der Rechtsmängelhaftung gleichzustellen, da beide der Vertragserfüllung dienen, während auf der anderen Seite die Gewährleistung beim Spezieskauf systematisch anders zu bewerten ist. Diese unterschiedliche Systematik innerhalb der Gewährleistung steht einem einheitlichen Verständnis der Funktion und Aufgabe der Gewährleistungsnormen entgegen. Es drängt sich hierbei die Frage auf, warum die Gewährleistung beim Gattungskauf eine andere Funktion haben soll als beim Spezieskauf. Immer häufiger w i r d diese Frage i n der Literatur gestellt und die Möglichkeit einer unterschiedlichen Funktion der Gewährleistung beim 8 Abschied von der Gewährleistung, i n : Justizblatt für den O L G - B e z i r k K ö l n 1947, 69 ff. 9 Der Begriff Haftung sagt noch nichts aus über die A r t der jeweiligen Pflicht. Vgl. Süß, S. 38; Flume, S. 36 F N 9; Korintenberg, Abschied, S. 75, 76, anders allerdings noch Erfüllung, S. 24, 25; dort w i r d aus dem Begriff auf eine Gewährleistungspflicht geschlossen. Z u m Beispiel „haftet" der Gattungsverkäufer, obwohl es sich dabei unstreitig u m eine sekundäre L e i stungspflicht handelt. Auch i n § 437 w i r d der Begriff „haften" i n diesem Sinne verwendet. 10 A u f diese Folge der h. L . weist auch Graue, S. 132, hin.
1. Grundsätzliche K r i t i k
35
Gattungs- und Spezieskauf verneint 1 1 » 1 2 . Schließlich hat der Gesetzgeber Stück- und Gattungskauf einheitlich normiert und m i t den gleichen Rechtsbehelfen, Wandlung und Minderung, ausgestattet. Aus dem Gesetz selbst ergibt sich, daß beim Einsetzen der Gewährleistung Gattungs- und Spezieskauf einander vollkommen gleichen. b) Die Einheitlichkeit des Haftungsgrundes
Beim Spezieskauf haben w i r eine konkrete Sache. Diese ist Gegenstand der Leistungspflicht. Weist die Sache bei Gefahrübergang einen Fehler auf, so greift die Gewährleistung ein. Beim Gattungskauf ist die Situation nicht anders. Zwar besteht zunächst eine Leistungspflicht über irgendeine Sache von mittlerer A r t und Güte. Die Gewährleistung setzt jedoch eine konkrete Sache voraus. Ein Fehler kann nur an einer bestimmten Sache festgestellt werden und dementsprechend kann die Frage nach der Gewährleistung überhaupt erst gestellt werden, wenn eine konkrete Sache Gegenstand des Vertrages geworden ist. Für das Eingreifen der Gewährleistung beim Gattungskauf ist also unabdingbare Voraussetzung, daß die Gattungsschuld sich in eine Speziesschuld verwandelt ls. Gemäß § 459 I 1 ist für die Gewährleistung Gefahr Übergang Voraussetzung. Nach § 446 geht die Gefahr m i t Übergabe der verkauften Sache über. Nun ist aber beim Gattungskauf auch nach h. L. eine Sache m i t den vereinbarten Eigenschaften verkauft. W i r d eine fehlerhafte Sache übergeben, so kann die Gefahr nicht übergehen, weil die übergebene Sache nicht der verkauften entspricht; damit kann auch die Gewährleistung nicht eingreifen. U m den Gefahrübergang herbeizuführen, ist ein Billigungsakt des Käufers insoweit erforderlich, als er die angebotene Gattimgssache annimmt 1 4 . Damit w i r d aus der Gattungsschuld 11 Korintenberg , Abschied, S. 77; Flume , S. 42, der jedoch, w i e später noch auszuführen sein w i r d (vgl. I V , 2, b), dadurch, daß er beim Spezieskauf einen Leistungsanspruch auf Mängelfreiheit verneint, i m Ergebnis die Gewährleistung beim Gattungskauf doch anders einstufen muß als beim Spezieskauf. A u f diese Inkonsequenz Flumes weist auch Korintenberg , Spezies, S. 99 zu Recht hin. 12 Schollmeyer w a r gerade i n dieser Frage konsequent, w e n n er sowohl bei Spezies- (Ih. Jb. 49, 97) wie bei Gattungskauf (S. 100) einen Anspruch auf Leistung einer mangelfreien Sache verneinte. Damit w a r für i h n i n beiden Fällen der Rechtsgrund u n d die F u n k t i o n der Gewährleistung gleich. F ü r Schollmeyer verlief die Trennungslinie noch zwischen Rechtsmängel- u n d Sachmängelhaftung. 13 Vgl. Kreß, § 26 I I Β c; Fikentscher , § 28 I I 1 a. E.; R G 69, 407. 14 Daß es gerade auf diese B i l l i g u n g ankommt, w i r d meist nicht erkannt. So jedoch schon Wolff, S. 71, der aber nicht die Folge sieht, daß die Gattungsschuld damit zur Speziesschuld w i r d , vgl. Wolff, S. 76. U n k l a r Goldschmidt, Z H R 19, 112.
3*
36
. K r i t i k an der herrschenden Lehre
eine Speziesschuld 15 . Es ist nun so, als ob von Anfang an die bestimmte Sache geschuldet gewesen wäre. M i t der Billigung w i r d jedoch lediglich die Identität des Schuldgegenstandes festgelegt, nicht etwa die Sache als Erfüllung angenommen. Der Käufer w i l l nicht erklären, daß die Sache die geschuldete ist, also fehlerfrei, er w i l l nur, daß an Stelle einer generellen Schuld eine konkrete Schuld, nämlich über die spezielle Sache, tritt. Seiner Gewährleistungsrechte w i l l er sich nicht begeben. Bevor beim Gattungskauf die Frage der Gewährleistung auftaucht, muß sich die Gattungsschuld i n eine Speziesschuld verwandelt haben. Es ist genauso, als ob die Sache von Anfang an als Spezies geschuldet gewesen wäre. Unter diesen Umständen aber kann der Rechtsgrund der Gewährleistung bei der Gattungs- und Speziesschuld niemals verschieden sein, denn die Voraussetzungen sind i n beiden Fällen genau gleich, wenn die Gewährleistung eingreift. I n beiden Fällen liegt eine Speziesschuld vor, ist eine konkrete Sache geschuldet. Weist die Sache einen Fehler auf, so kann der Rechtsgrund für die daran anschließende Rechtsfolge immer nur der nämliche sein und nicht auf verschiedenen dogmatischen Überlegungen fußen. Das gleiche gilt bei Werkvertrag und Miete. Auch bei diesen Verträgen kann die Gewährleistung nur eingreifen, wenn der Schuldgegenstand selbst feststeht. Die Gewährleistung setzt einen Sachmangel voraus, ein Sachmangel kann aber nur festgestellt werden, wenn der Schuldgegenstand feststeht. Generell läßt sich also sagen, daß die Gewährleistung immer eine Speziesschuld voraussetzt und daß deshalb der Rechtsgrund der Gewährleistung überall der gleiche sein muß. Daß eine Vereinbarung über Eigenschaften beim Spezieskauf i m Gegensatz zum Gattungskauf nicht Vertragsbestandteil werden könne, und daß deshalb der Rechtsgrund jeweils ein anderer sein müsse, kann nicht stimmen, w e i l jeder Gattungskauf sich vor Gefahrübergang durch die beiderseitige Konkretisierung i n eine Speziesschuld umwandelt, für die dann die gleichen rechtlichen Gesichtspunkte gelten müssen wie für einen ursprünglichen Spezieskauf. Das Argument, daß allein beim Gattungskauf, beim Werkvertrag und bei der Miete die Eigenschaft vertraglich vereinbart werden könne, beim Spezieskauf aber nicht, und daß deshalb die Gewährleistung unterschiedlich zu beurteilen sei, ist 15
Bei Leistung einer mangelhaften Sache k a n n die Konkretisierung immer n u r m i t B i l l i g u n g des Käufers eintreten (so auch Fikentscher, § 70 V I I ; Medieus, § 13 I I 3 c; Emmerich, i n Athenäum-Zivilrecht, § 4 I 3, F N 12). Eine K o n kretisierung nach § 243 I I scheidet aus, da eine mangelhafte Sache nicht von mittlerer A r t u n d Güte ist. I m übrigen f ü h r t § 243 I I nicht zu einer Umgestaltung der Speziesschuld i n eine Gattungsschuld (vgl. A n m . 18).
1. Grundsätzliche K r i t i k
37
s o m i t u n s c h w e r z u e n t k r ä f t e n . Es k a n n d a b e i a n dieser S t e l l e n o c h d a v o n abgesehen w e r d e n , d i e R i c h t i g k e i t d e r L e h r e Z i t e l m a n n s i m e i n z e l n e n z u u n t e r s u c h e n 1 6 . D i e f e h l e n d e S c h l ü s s i g k e i t z e i g t sich schon d a r a n , daß d i e G a t t u n g s s c h u l d d e r Speziesschuld v o r E i n g r e i f e n
der
G e w ä h r l e i s t u n g v o l l k o m m e n gleich ist, f ü r beide also d i e gleichen V o r aussetzungen g e l t e n müssen. B i e t e t d e r V e r k ä u f e r e i n e Gattungssache a n u n d e r k l ä r t sich d e r K ä u f e r m i t dieser Sache e i n v e r s t a n d e n , so w i r d d i e K a u f v e r e i n b a r u n g d a h i n g e h e n d eingeschränkt, daß n u n a n S t e l l e irgendeiner
Sache diese spezielle Sache S c h u l d g e g e n s t a n d s e i n
soll.
D i e P a r t e i e n v e r ä n d e r n d e n V e r t r a g s i n h a l t 1 7 . D a m i t besteht a n S t e l l e d e r u r s p r ü n g l i c h e n G a t t u n g s s c h u l d eine Speziesschuld 1 8 . Das z e i g t sich 16
Vgl. dazu I I I , 3, e. O L G Jena, O L G E 38, 121; R G 43, 184; 70, 426: „ D a m i t ein bestimmter Gegenstand Schuldgegenstand w i r d , damit also eine Speziesschuld begründet w i r d , bedarf es einer Willenseinigung beider Teile dahin, daß sich der V e r trag auf die Leistung eines bestimmten Gegenstandes beschränken soll u n d m i t einem anderen Gegenstande nicht erfüllt werden kann." Vgl. auch Wolff, S. 71. 18 Leider w i r d dieser F a l l meist nicht k l a r v o n der Konkretisierung nach § 243 I I getrennt u n d dementsprechend generell die Möglichkeit der U m wandlung einer Gattungsschuld i n eine Speziesschuld abgelehnt (vgl. z. B. Heck , § 9, a 6 u n d 8, S. 30, 31). § 243 I I b r i n g t nur eine Gefahrtragungsregel (so auch Larenz I, § 11 I, der aber gleichzeitig eine U m w a n d l u n g i n eine Speziesschuld bejaht). Geht die konkretisierte Sache unter, so soll der Schuldner frei werden. M i t der Konkretisierung nach § 243 I I w i r d die Gattungsschuld nicht zur Speziesschuld (so jedoch Schollmeyer , S. 96; Fikentscher, § 44 I I 1 b; Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., A n m . V I I I A a; Kuhn , i n R G R K , 11. Aufl., § 433 A n m . 172, bejaht ebenfalls die U m w a n d l u n g i n eine Speziesschuld, doch bleibt unklar, zu welchem Zeitpunkt diese eintritt). Es besteht ein Vertrag über eine Gattungssache. Dieser Vertrag k a n n nicht einseitig verändert werden. Insoweit ist, was § 243 I I betrifft, Heck Recht zu geben. Dementsprechend ist es auch möglich, die Bindung des Schuldners, die § 243 I I hervorruft, unter Umständen wieder aufzuheben, z. B. unter dem Gesichtspunkt v o n T r e u u n d Glauben (vgl. R G 91, 112; Enneccerus / Lehmann, § 6 I V 2; Esser, § 18 I I 3, S. 115 f.). E r k l ä r t sich der Gläubiger m i t der ausgesonderten Sache einverstanden, dann — erst — wandelt sich die Gattungsschuld i n eine Speziesschuld (obwohl Goldschmidt, Z H R 19, 112, dies leugnet, k o m m t er doch unserer Ansicht sehr nahe, w e n n er meint, daß m i t der Annahme durch den Käufer die Sache zur verkauften werde u n d sich der Gattungskauf i n einen Spezieskauf auflöse). M i t der Konkretisierungshandlung i m Sinne des § 243 I I bringt der Schuldner zum Ausdruck, daß er m i t der konkreten Sache erfüllen wolle. A n diese E r k l ä r u n g ist er nach § 243 I I gebunden (vgl. § 145). Die Bindung entfällt, § 146 entsprechend, w e n n der Gläubiger die Sache als E r f ü l l u n g ablehnt (so m i t Recht R G 91, 112) oder eine andere Sache als Erfüllung h i n n i m m t (so B G H B B 65, 349). Akzeptiert dagegen der Gläubiger die Sache, so wandelt sich damit die Gattungsschuld i n eine Speziesschuld. Beide Teile sind sich darüber einig, daß nunmehr die konkrete Spezies Schuldgegenstand sein soll (so auch Wolff, S. 71). M i t dieser Einigung entsteht die Speziesschuld (so richtig O L G Jena OLGE 38, 122; R G 70, 426). Letztlich k o m m t es jedoch f ü r die hier zu entscheidende Frage gar nicht darauf an, ob § 243 I I schon eine Umgestaltung b e w i r k t . Nach § 243 I I t r i t t eine Konkretisierung nicht ein, w e n n eine fehlerhafte Sache ausgew ä h l t wurde. Bei Leistung einer fehlerhaften Sache k a n n jedenfalls die Konkretisierung n u r m i t Einverständnis des Käufers eintreten (ebenso Em17
38
. K r i t i k an der herrschenden Lehre
am deutlichsten daran, daß nun nurmehr m i t dieser Sache erfüllt werden kann 1 9 und i m Falle ihres Unterganges die Unmöglichkeitsnormen eingreifen 20 . Wenn aber die Gattungsschuld zur Speziesschuld wird, bevor die Gewährleistung eingreift, so müssen für sie die gleichen Gesichtspunkte gelten wie für die ursprüngliche Speziesschuld. Das bedeutet: Würde man der h. L. folgen, so müßte m i t der Umwandlung der Schuld die Eigenschaftsvereinbarung hinfällig werden. M i t der Konkretisierung durch beide Seiten 2 1 steht fest, daß die bestimmte Sache Schuldgegenstand sein soll; m i t den gleichen Argumenten wie bei der ursprünglichen Speziesschuld müßte man nun die getroffene Eigenschaftsvereinbarung als Vereinbarung über das „Sein" der Sache verstehen. Als solche aber wäre sie, abgesehen vom Falle der Garantie, nicht verpflichtender Vertragsbestandteil. Oder man müßte nun annehmen, die Leistung erstrecke sich auf etwas Unmögliches: Diese Sache mit den bestimmten Eigenschaften, die die Sache jedoch nicht hat. Die Behauptung, daß beim Spezieskauf eine Vereinbarung über die Eigenschaften i m Gegensatz zum Gattungskauf nicht möglich sei und daher die Gewährleistung einen anderen Rechtsgrund habe, ist somit nicht stichhaltig. Dadurch, daß die Gattungsschuld m i t der beiderseitigen Konkretisierung zur Speziesschuld wird, gilt für sie das gleiche, wie für die ursprüngliche Speziesschuld. A l l e Argumente dort vorgebracht, müssen also auch hier gelten und umgekehrt. Auch hier gelten für Werkvertrag und Miete die gleichen Überlegungen. M i t der beiderseitigen Konkretisierung w i r d der Vertrag dahingehend geändert, daß die Schuld sich auf die bestimmte Sache erstreckt. Vom Vertragsschluß her gelten aber noch die Vereinbarungen über die Eigenschaften. Es stehen sich also Vereinbarung einer konkreten Sache und Vereinbarung bestimmter Eigenschaften gegenüber wie beim ursprünglichen Spezieskauf. Von diesem Augenblick an müßten die gleichen Überlegungen gelten. Hält man m i t Zitelmann eine Vereinbarung über Eigenschaften für ausgeschlossen, so müßte dies nach der beiderseitigen vertraglichen Änderung, der Konkretisierung, auch bei Gattungskauf, Werkvertrag und Miete gelten. Da die Gewährleistung erst nach der Umwandlung i n eine Speziesschuld eingreifen kann, kann die vor der Umwandlung bestehende merich, i n Athenäum-Zivilrecht, § 4 1 3 , F N 12; Medicus, § 13 I I 3 c), der Verkäufer seinerseits die Konkretisierung nicht durch Anbieten einer anderen fehlerfreien Sache verhindern (BGH N J W 1967, 33). Vgl. unten V, 2, b. 19 Vgl. Enneccerus / Lehmann, § 6 I V 2. 20 Enneccerus / Lehmann, § 6 I V 1. 21 Eine einseitige Konkretisierung gemäß § 243 I I reicht nicht, vgl. A n m . 18.
39
1. Grundsätzliche K r i t i k Lage nicht für
eine unterschiedliche B e g r ü n d u n g
des Rechtsgrundes
der G e w ä h r l e i s t u n g herangezogen w e r d e n . Es m u ß v i e l m e h r d i e L a g e verglichen werden, bei deren Vorliegen i n allen Fällen die G e w ä h r l e i s t u n g e i n t r e t e n k a n n ; u n d da i s t es so, daß i m m e r eine Speziesschuld v o r l i e g t . D a m i t erscheint nachgewiesen, daß f ü r Spezies- u n d G a t t u n g s k a u f k e i n u n t e r s c h i e d l i c h e r R e c h t s g r u n d g e l t e n k a n n , w i e es die h. L . annimmt. c) Die Einheitlichkeit der Erfüllungswirkung Wenn beim Gattungskauf
m i t Konkretisierung
eine
Speziesschuld
entsteht, so i s t es f ü r d i e P a r t e i e n genauso, als ob sie v o n A n f a n g a n e i n e n Spezieskauf abgeschlossen h ä t t e n . Z u e i n e m G a t t u n g s k a u f k o m m t es i n der Regel, w e i l eine Spezies, die d e n V o r s t e l l u n g e n der P a r t e i e n entspricht, i m Augenblick der vertraglichen V e r h a n d l u n g e n
räumlich
oder z e i t l i c h — noch — n i c h t v o r h a n d e n ist. W ä r e die Sache u n m i t t e l b a r g r e i f b a r , w ü r d e n die P a r t e i e n sofort e i n e n Spezieskauf abschließen. Es ist n u n u n v e r s t ä n d l i c h , w a r u m b e i m Spezieskauf die L i e f e r u n g der k o n k r e t e n Sache v o l l s t ä n d i g e E r f ü l l u n g ,
dagegen b e i m
Gattungskauf
d i e L i e f e r u n g der k o n k r e t i s i e r t e n Sache u n v o l l s t ä n d i g e E r f ü l l u n g sein soll. I n b e i d e n F ä l l e n w i r d die k o n k r e t geschuldete Sache 2 2 geleistet. I n b e i d e n F ä l l e n h a b e n d i e P a r t e i e n v o r h e r e r k l ä r t , w e l c h e Eigenschaften 22 Die beiderseitige Konkretisierung muß der E r f ü l l u n g vorausgehen, sei es auch n u r eine logische Sekunde. Eine generelle Schuld ist nicht erfüllungsfähig, da es keine generelle F o r m der E r f ü l l u n g gibt. E r f ü l l t w i r d i m m e r m i t einer konkreten Sache, einer konkreten Handlung. Ist die Gattungssache fehlerfrei, so k a n n E r f ü l l u n g doch n u r eintreten, wenn die Parteien vorher die Sache zur geschuldeten erklärt haben. I n der Regel erfolgt dies k o n k l u dent, indem der Käufer die angebotene Sache annimmt. Dieses F a k t u m bew i r k t die U m w a n d l u n g i n eine Speziesschuld. Unrichtig ist es, wie Heck, § 9, a 6 anscheinend meint, daß diese Annahme eine Erfüllungsannahme darstellt, aber keine U m w a n d l u n g der Gattungs- i n eine Speziesschuld bewirke. Der Käufer w i l l n u r die Schuld auf die angebotene Spezies beschränken, er w i l l sie aber damit noch nicht als E r f ü l l u n g gelten lassen. Bietet der Verkäufer eine mangelhafte Sache an, so k a n n der Käufer diese Sadie unter Vorbehalt seiner Rechte zur geschuldeten machen und, w e i l sie fehlerhaft ist, Wandlung verlangen. Daran zeigt sich, daß die Annahme der Sache durch den Käufer keine Erfüllungsannahme ist, sondern eine Konkretisierung der Schuld auf die Spezies, w o m i t die Gattungsschuld zu einer Speziesschuld w i r d . Daß der Verkäufer schon vorher gemäß § 243 I I oder § 300 I I i m Falle des zufälligen Untergangs der ausgesonderten fehlerfreien Sache von seiner Leistungspflicht frei w i r d , beruht nicht darauf, daß Erfüllung eingetreten ist. Vielmehr w i r d der Verkäufer frei, obwohl er nicht erfüllt hat. E r f ü l l u n g ist Herstellung eines Leistungserfolges (vgl. Larenz I, § 18 I). Dieser t r i t t erst ein, w e n n eine fehlerfreie Sache übergeben u n d übereignet ist. Dazu aber ist die M i t w i r k u n g des Käufers erforderlich, die dadurch erfolgt, daß er die Sache als die geschuldete akzeptiert. Der E r f ü l l u n g geht also zwingend notwendig der A k t der beiderseitigen Konkretisierung des Schuldgegenstandes voraus, der dann zu einer U m w a n d l u n g i n eine Speziesschuld führt.
40
. K r i t i k an der herrschenden Lehre
die Sache haben soll. Einen Unterschied i n der Erfüllungswirkung kann es daher nicht geben 23 . Entweder ist i n beiden Fällen m i t der mangelhaften Sache v o l l erfüllt und die Gewährleistung eine echte Gewährleistung, oder es ist i n beiden nicht v o l l erfüllt, dann handelt es sich u m unechte Gewährleistung. Entsprechendes hat für Werkvertrag und Miete zu gelten, denn auch dort wandelt sich die Schuld vor Eingreifen der Gewährleistung immer i n eine Speziesschuld um. Eine Gewährleistung für Sachmängel bei einer Gattungsschuld kann es begrifflich nicht geben 24 . Als Zwischenergebnis läßt sich daher festhalten, daß die Gewährleistung entgegen der Ansicht der h. L . innerhalb des BGB einen einheitlichen Rechtsgrund und eine einheitliche Funktion haben muß. 2. Spezielle K r i t i k
Wenn es nur einen Rechtsgrund der Gewährleistung gibt, so gibt es dafür auch nur eine Erklärung. Die Gewährleistung kann entweder eine echte oder eine unechte sein, nur hat dies dann überall i m Gesetz zu gelten. Die Begründung des Rechtsgrundes der Gewährleistung ist erst dann stichhaltig, wenn sie immer zutrifft. I m folgenden sollen daher die einzelnen Ansichten über den Rechtsgrund der Gewährleistung geprüft werden. a) Kritik an den Ansichten, die den Rechtsgrund der Gewährleistung außerhalb des Vertrages suchen
Überwiegend w i r d der Rechtsgrund der Gewährleistung außerhalb des Vertrages gesucht, wobei die einzelnen Meinungen stark divergieren. A l l e i n schon die Zahl der verschiedenen Ansichten zeigt, daß es an einer überzeugenden Begründung fehlt. Andererseits besteht so gut wie völlige Einigkeit, daß beim Gattungskauf, Werkvertrag und Miete der Rechtsgrund der Gewährleistung die vertragliche Vereinbarung ist, eine mangelfreie Sache zu leisten, so daß sehr viel mehr dafür spricht, den Rechtsgrund der Gewährleistung innerhalb des Vertrages als außerhalb zu suchen. aa) Argument
aus § 633 I
Wenn das Gesetz i n § 633 I bestimmt, daß der Unternehmer zu mangelfreier Herstellung verpflichtet ist, und bei Nichterfüllung dieser 23
So auch Graue, S. 291. Insoweit w a r das klassische Römische Recht konsequent, w e n n es die Gewährleistung beim Gattungskauf nicht vorsah. Vgl. Windscheid / Kipp, § 394 A n m . 20; Goldschmidt, Z H R 19, 98 ff. m. w . N. 24
2. Spezielle K r i t i k
41
Pflicht die Gewährleistung anordnet, so heißt das, daß die Haftung eingreift, weil nicht fehlerfrei geleistet wurde. Die Gewährleistung ist hier eindeutig eine Folge für mangelhafte Erfüllung des Vertrages. Die Ansichten, die den Hechtsgrund der Gewährleistung außerhalb des Vertrages suchen, gehen fehl, weil dieser Rechtsgrund zumindest beim Werkvertrag nicht zutrifft. bb) Argument
aus § 459 II
Ein weiterer Widerspruch ergibt sich für diese Ansichten, wenn eine Zusage i m Sinne des § 459 I I vorliegt. Da eine solche Zusicherung von Eigenschaften anerkanntermaßen 25 Vertragsbestandteil wird, würde die Gewährleistung innerhalb des Spezieskaufs zwei Rechtsgründe haben: Bei zugesicherten Eigenschaften wäre sie vertragliche Haftung, bei nicht zugesicherten Eigenschaften wäre sie außervertragliche Haftung. Ein und dasselbe Rechtsinstitut kann aber nicht auf vollkommenen verschiedenen Rechtsgründen beruhen. cc) Argument
aus § 463
Nach § 463 hat der Verkäufer i m Falle einer Zusicherung oder der Arglist Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu leisten. Diese Regelung ist für alle Ansichten, die den Rechtsgrund der Gewährleistung außerhalb des Vertrages suchen, unverständlich 26 . Z u m einen spricht § 463 von Schadensersatz wegen Nichterfüllung, d. h. das Gesetz unterstellt, daß die Leistung einer mangelhaften Sache nicht gehörige Erfüllung ist. Damit bringt es gerade das Gegenteil von dem zum Ausdruck, was die h. L. annimmt. Teilweise h i l f t sich die h. L. damit, daß sie § 463 S. 1 als Garantiehaftung ansieht 27 ; die Zusicherung von Eigenschaften führe zu einem Garantievertrag. Dann sind aber i n diesem Falle Wandlung und Minderung wiederum Sanktionen für nicht einwandfreie Erfüllung 2 8 , die Ansicht der h. L. ist u m einen Widerspruch reicher 29 .
25
Vgl. z. B. Larenz I I , § 41 I I c 1. Vgl. Süß, S. 61, 87 ff. u n d F N 1 auf S. 87; Geppert, Ih. Jb. 67, 219; Korintenberg, Abschied, S. 74; Lenel, A c P 123, 184; Haymann, Haftung, S. V I I I u n d AcP 135, 231; v. Blume, Ih. Jb. 55, 218; Stoll, A c P 126, 188; Wolff, S. 77 ff., 83 ff. 27 Vgl. Wolff, S. 49; Larenz I I , § 41 I I c 1; Soergel / Siebert / Ballerstedt, v o r § 459 Bern. 20; a. A . jedoch Süß, S. 87, der auch § 463 S. 1 für eine Verschuldenshaftung hält. Süß meint, der Verkäufer könne sich vergewissern, ob die Sache die Eigenschaft habe. Unterlasse er das, so handele er fahrlässig. 28 Haymann, J W 1932, 1862 u n d Wolff, S. 49, versuchen diesem w i d e r sprüchlichen Ergebnis dadurch auszuweichen, daß sie den Begriff „Zusiche26
42
. K r i t i k an der herrschenden Lehre
Außerdem kann § 463 S. 1 kein Garantietatbestand sein, denn eine Haftung t r i t t nicht ein, wenn die bei Vertragsschluß vorhandene Eigenschaft später wegfällt. Ziel der Garantie ist es aber, für einen Erfolg einzustehen. Die Annahme einer Garantie i n § 463 S. 1 wäre nur richtig, wenn der Verkäufer auch für Fehler, die nach Vertragsschluß aber vor Gefahrübergang entstehen, haften würde, denn erst m i t Gefahrübergang t r i t t der erstrebte Erfolg ein und i n diesem Zeitpunkt müßte die Garantie einsetzen. Da das gerade nicht der Fall ist, kann man § 463 S. 1 nicht als Garantiehaftung begründen. Weiterhin ist das Verschuldensmoment i n § 463 S. 2 für die h. L. systemwidrig 3 0 . Die echte Gewährleistung greift nach h. A. ein, weil das Gleichgewicht gestört ist. Für die Frage des Gleichsgewichts ist aber ein Verschulden bedeutungslos 31 . Die h. L. versucht daher, § 463 S. 2 als Haftung für culpa i n contrahendo zu erklären 3 2 . Doch auch diese Begründung ist i n sich nicht schlüssig, da die Haftung für culpa i n contrahendo nur auf das negative Interesse geht 3 3 , während § 463 eindeutig das positive Interesse erfaßt. Die Ansicht der h. L., die den Rechtsgrund der Gewährleistung beim Spezieskauf außerhalb des Kaufvertrages sucht, steht nicht i m Einklang m i t dem Gesetz, gleichgültig welche spezielle Begründung i m Einzelfall für die Gewährleistung herangezogen wird. Trotzdem sollen noch, um dieses Ergebnis zu untermauern, die einzelnen oben erwähnten Meinungen über den Rechtsgrund der Sachmängelhaftung kurz 3 4 untersucht werden.
r u n g " i n § 459 I I u n d § 463 S. 1 für nicht identisch erklären. Auch hier zeigt sich, wie die h. L. das Gesetz entgegen dem W o r t l a u t auslegt, denn daß es sich u m zwei verschiedene Begriffe i n den §§ 459 I I u n d 463 S. 1 handeln soll, wäre unverständlich (so auch Flume , S. 79, Raape, S. 489, Kuhn, i n R G R K , § 459 Anm. 25). 29 Süß, S. 87, versucht diesen Widerspruch gerade dadurch zu umgehen, daß er § 463 S. 1 als Verschuldenshaftung, nämlich als Haftung f ü r c. i. c. betrachtet (vgl. A n m . 27). Gegen die Annahme Süß' spricht, daß § 463 S. 1 bei Zusicherung immer eingreift, selbst w e n n dem Verkäufer ein Verschulden nicht zur Last fällt. Sichert der Verkäufer i n gutem Glauben etwas zu, so kann, wenn der Mangel verborgen ist, nicht von einem Verschulden des Verkäufers die Rede sein. Es erscheint n u r der Käufer schutzwürdiger als der Verkäufer, w e i l der Verkäufer bewußt einen Haftungstatbestand geschaffen hat. I m übrigen normiert § 463 eine Haftung über das positive Interesse, während die c. i. c.Haftung n u r das negative betrifft. 30 Vgl. dazu unten V, 4, b, aa, α. 31 Vgl. Süß, S. 86. 32 Vgl. Süß, S. 87; Larenz I I , § 41 I I c 2; Korintenberg, Erfüllung, S. 187; Krückmann, Ih. Jb. 59, 324; Graue, S. 282; RG 95, 60; RG HRR 1932, 441. 33 B G H 6, 330, 335; aber auch Larenz I, § 9 I. 34 Eine ausführliche Widerlegung der bis 1930 vertretenen Ansichten findet sich bei Süß, S. 122 ff.
2. Spezielle K r i t i k
43
b) Kritik an den Ansichten im einzelnen
aa) Gegen die Ansicht Windscheids ist einzuwenden, daß dem BGB der Gedanke einer unentwickelten Bedingung fremd ist. Entweder ist etwas Teil der Willenserklärung oder aber nur deren Motiv. Dazwischen gibt es nichts. Es kann also nur eine Bedingung — ausdrücklich oder stillschweigend — i n Betracht kommen, oder ein Willensmotiv. Das Motiv ist nach dem geltenden Recht unbeachtlich 35 . bb) Wenn Lenel die Formel Windscheids objektiviert, so h i l f t das nicht weiter. M i t der Feststellung, es komme auf das an, was man vorauszusetzen berechtigt sei, ist noch nichts gewonnen. M i t Lenels These bleibt die Frage, warum man überhaupt berechtigt ist, etwas vorauszusetzen, unbeantwortet. Normalerweise findet nur das Beachtung, was vertraglich vereinbart wurde. Das ist i m Falle des Spezieskaufs nach h. L. allein die Leistung dieser Sache. Ein Schutz des enttäuschten Vertrauens — darauf läuft letztlich Lenels Ansicht hinaus — ist vom Gesetz nicht vorgesehen. Warum gerade i n diesem Fall das Gesetz hilft, während es sonst Hoffnungen, Vertrauen, also nicht ausdrücklich zum Gegenstand des Vertrages gemachte Vorstellungen, unbeachtlich sein läßt, bleibt offen. cc) Gegen die Meinung Oertmanns ist u. a. 36 vorzubringen, daß sie beim Spezieskauf die Gewährleistung nicht einheitlich erklären kann. Da die Geschäftsgrundlage nicht Vertragsbestandteil ist, kann sie nicht als Rechtsgrund der Gewährleistung i m Falle einer Zusicherimg angesehen werden 3 7 . Denn die Zusicherung ist ein Teil des Vertrages. Oertmann gibt sogar zu, daß die Geschäftsgrundlage allein nicht ausreicht, u m die Haftung für Fehler, die die Tauglichkeit zum gewöhnlichen Gebrauch aufheben, zu erklären 3 8 . Als Begründung der Sachmängelhaftung ist daher die Geschäftsgrundlage Oertmanns unzureichend. dd) Lochers Lehre vom Geschäftszweck kann letztlich die Gewährleistung auch nicht erklären 3 9 . Zwar nimmt Locher an, daß die Vereinbarung über die Eigenschaften als Geschäftszweck Vertragsbestandteil wird, doch t r i t t die Sachmängelhaftung nicht auf Grund der Vereinbarung ein, sondern auf Grund des Gesetzes. Damit aber w i r d die Zweckvereinbarung von der psychologischen Seite her fragwürdig. Der Wille und dementsprechend die Willenserklärung geht nach Zitelmann, auf 35 Das gilt auch i m Hinblick auf § 119 I I . Darüber, daß § 119 I I kein M o t i v i r r t u m ist, w i e teilweise angenommen w i r d , siehe unten V I , 5, c, cc. 36 Süß, S. 135; Flume , S. 44, 71; vgl. weiterhin die ausführliche K r i t i k bei Locher, AcP 121, 1 ff. u n d Rhode, AcP 124, 257 ff. 37 Dies räumt auch Oertmann, Geschäftsgrundlage, S. 75 ein. 38 Geschäftsgrundlage, S. 72. 39 Vgl. Süß, S. 146; Flume, S. 44, 72.
44
. K r i t i k an der herrschenden Lehre
dessen Hypothese auch Locher aufbaut, auf eine Veränderung, einen rechtlichen Erfolg. Lochers Zweckvereinbarung hat aber keinen solchen rechtlichen Erfolg zum Inhalt. Sie ist eine rein deklaratorische Erklärung. Das allein ist schon eine dem geltenden Recht fremde Konstruktion. Wenn aber diese Konstruktion nicht einmal ausreicht, u m die Sachmängelhaftung zu begründen, sondern letztlich doch wieder auf das Gesetz zurückgegriffen werden muß, so ist sie unbrauchbar. Denn offen bleibt danach die Frage, warum das Gesetz die Gewährleistung benötigt. Die dogmatische Frage bleibt ungeklärt. ee) Süß, der gerade die unter aa) bis dd) behandelten Ansichten eingehend untersucht und ihre Schwächen aufgedeckt hat, versucht mittels einer Synthese von subjektiven und objektiven Momenten die Gewährleistung zu erklären. Für i h n ist der Rechtsgrund der Sachmängelhaftung der virtuelle Vorbehalt, der jedoch allein wegen der durch die Inäquivalenz bedingte Nichtzumutbarkeit Beachtung findet. Zum einen ist dazu zu sagen, daß der virtuelle Vorbehalt eine Denkfigur ist, die dem geltenden Recht fremd ist. Das BGB kennt drei Bereiche: 1. den äußeren Tatbestand, die nach außen gelangte objektiv zu würdigende Erklärung, 2. den inneren Tatbestand, den Willen zu handeln, ein bestimmtes Geschäft vorzunehmen, und 3. das Willensmotiv, die Ursache, warum man etwas w i l l . I n keine der drei Kategorien paßt jedoch die Figur des virtuellen Vorbehalts. A m nächsten kommt der 3. Fall. Doch ist das Willensmotiv für das Gesetz gerade unbeachtlich. Die Figur des virtuellen Vorbehalts ist daher abzulehnen 40 . Zum anderen ist auch die Hypothese von Süß, daß ein der Äquivalenz beraubter Vertrag unzumutbar ist, unzutreffend 4 1 . Ein solcher Grundsatz besteht nicht 4 2 . Vielmehr ist es den Parteien überlassen, was sie als äquivalent gelten lassen wollen. ff) Was die Ansichten anbelangt, die m i t dem Gedanken des Irrtumsund Vertrauensschutzes oder Treu und Glauben argumentieren, so sind diese nicht geeignet, die Gewährleistung dogmatisch einzuordnen 43 . Vom Irrtumsschutz kann z. B. keine Rede sein, wenn ein Fehler erst nach Vertragsschluß aber vor Gefahrübergang entsteht, weil i n diesem Falle ein I r r t u m gar nicht vorliegen kann. Und was den Begriff des enttäuschten Vertrauens angeht, so hat er als solcher noch keine klare dogmatische Aussagekraft 44 . Die Beachtung eines außerhalb des rechts40
Ähnlich Flume , S. 45. Vgl. z.B. die Lehre von der Geschäftsgrundlage: N u r schwere Ä q u i v a lenzstörungen finden Beachtung; so selbst Larenz I, § 21 I I . 42 So auch Flume , S. 45, 46. 43 Vgl. Flume , S. 44. 44 Ablehnend auch Krückmann, Ih. Jb. 59, 105 ff., 107. M i t Recht f ü h r t Weitnauer, AcP 168, 207, 213, aus, daß der Vertrauensschutz kein Rechts41
2. Spezielle K r i t i k
45
geschäftlichen Vorganges liegenden Vertrauenstatbestandes ist i m Gesetz nicht vorgesehen. Der Gedanke des Vertrauensschutzes ist nur ein „τόπος". Nicht jedes enttäuschte Vertrauen findet Berücksichtigung. Das Vertrauen muß gerechtfertigt und schutzwürdig sein. A n verschiedenen Stellen hat der Gesetzgeber die erforderliche Wertentscheidung selbst getroffen. Demgegenüber gilt für gegenseitige Verträge das Prinzip der subjektiven Äquivalenz. Die Parteien bestimmen selbst, was sie zu erwarten berechtigt sind, worauf sich ihr Vertrauen bezieht. Weiterhin spricht gegen den Gedanken des Irrtums- und Vertrauensschutzes, daß i n diesen Fällen der Käufer die Beweislast zu tragen hätte 4 5 . Regelmäßig muß derjenige, der einen Anspruch geltend macht, diesen auch beweisen. Gemäß § 460 ist es aber gerade so, daß der Verkäufer dem Käufer beweisen muß, dieser habe den Mangel gekannt. Auch muß normalerweise i m Falle des Irrtums der Irrende den Schaden tragen, nicht aber der Gegner 46 . Das gleiche müßte für den Gesichtspunkt des enttäuschten Vertrauens gelten. Auch m i t dem Gedanken von Treu und Glauben läßt sich die Gewährleistung nicht erklären, denn letztlich steht jeder Vertrag unter dem Vorbehalt von Treu und Glauben. Damit w i r d nur der Gerechtigkeitsgesichtspunkt angesprochen. Offen bleibt damit weiterhin, auf welchem Wege, mittels welcher Funktion das gerechte Ergebnis erreicht w i r d 4 7 . Der Gerechtigkeit kann sowohl mittels echter wie mittels unechter Gewährleistung Genüge getan werden. Auch der Gesichtspunkt von Treu und Glauben ist also dogmatisch unbrauchbar, u m die Gewährleistung zu erklären. gg) Gegen die Ansicht der modifizierten h. L., die den Rechtsgrund der Gewährleistung auch i m Vertrag begründet sieht, müssen keine zusätzlichen Argumente herangezogen werden, da der Rechtsgrund dort gerade nicht entscheidend i n der vertraglichen Vereinbarung gesehen wird, sondern i n verschiedenen anderen bereits angeführten prinzip oder Rechtssatz sei, „sondern n u r ein f ü r die Rechtsgestaltung maßgeblicher Gesichtspunkt unter manchen anderen". Die Konkretisierung dieses allgemeinen Prinzips steht vor der fast unlösbaren Aufgabe, i n der Einzelfrage zu entscheiden, w a n n das Vertrauen gerechtfertigt ist u n d deshalb Schutz verdient. Die Entscheidung k a n n n u r durch den Gesetzgeber erfolgen oder hat sich doch i m Wege der Parallelwertung an gesetzlich vorgegebenen Wertungen zu orientieren, w i e das etwa bei der Lehre über die Rechtsscheinhaftung geschehen ist. Der Versuch, aus dem Vertrauensschutzgedanken i m Wege der Rechtsfortbildung konkrete Tatbestände abzuleiten, erscheint daher bedenklich (so aber Diederichsen, Die Haftung des Warenherstellers, S. 295 ff.; Canaris, Die Vertrauenshaftung i m deutschen Privatrecht; v. Craushaar, Der Einfluß des Vertrauens auf die Privatrechtsordnung). 45 Wolff, S. 43; vgl. auch Süß, S. 206. 46 So auch Titze, J W 1927, 2965. 47 So sehr richtig Graue, S. 278, 279 gegen die Begründung von Süß.
46
. K r i t i k an der herrschenden Lehre
und kritisierten Faktoren. Der Gedanke von Treu und Glauben 4 8 sowie der Begriff des enttäuschten Vertrauens 4 9 führen nicht weiter 5 0 . Ein Äquivalenzausgleich 51 findet durch das Gesetz regelmäßig nur i m Falle schwerer Äquivalenzstörungen statt, so daß auch dieser Gedanke nicht tragfähig ist, die Gewährleistung zu begründen 52 . Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die h. L., die den Rechtsgrund der Gewährleistung beim Spezieskauf außerhalb des Vertrages sucht, keine überzeugende Begründung anbietet. Die h. L. setzt sich vielmehr i n Widerspruch zu dem ausdrücklichen Wortlaut des Gesetzes. Das legt den Gedanken nahe, daß die Ausgangshypothese der h. L. unrichtig sein muß. 3. K r i t i k a n der Grundlage der h. L., der Lehre Zitelmanns
Wie schon ausgeführt 53 , beruht die Ansicht der h. L. auf der Hypothese Zitelmanns, daß eine Eigenschaft beim Spezieskauf nicht vereinbart werden könne. Diese Hypothese muß konsequent zu der von der h. L. vertretenen Ansicht führen, daß es eine echte und eine unechte Gewährleistung gebe, daß beim Spezieskauf i m Gegensatz zum Gattungskauf keine Verpflichtung zu sachmangelfreier Leistung bestehe, w e i l eine bestimmte Eigenschaft nicht vereinbart sei. Da aber jeder Gattungskauf durch die beiderseitige Konkretisierung zu einer Speziesschuld w i r d 5 4 und dabei gleichzeitig auch der Vertragsinhalt verändert wird, so kann die These Zitelmanns nicht stimmen. I n beiden Fällen besteht vor E i n t r i t t der Erfüllung ein Spezieskaufvertrag, für den jeweils die gleichen Gesichtspunkte gelten müssen. Es ist daher eine nähere Untersuchung der These Zitelmanns erforderlich. Vorher erscheint es jedoch angebracht, einige Ansichten darzustellen, die offensichtlich Zitelmann nicht gefolgt sind, wenngleich dies nicht immer klar zum Ausdruck kommt. a) Die Ansicht der Motive 55
I n den Motiven w i r d ausgeführt, die Sachmängelhaftung sei i m obligatorischen Veräußerungsvertrag begründet. Die Motive leiten die Haftung also aus der vertraglichen Vereinbarung ab, und zwar unmit48 49 50 51 52 53 54 55
So Enneccerus / Lehmann, § 108 I. So Larenz I I , § 41 I I e. Siehe oben ff). So Soergel / Siebert / Ballerstedt, vor § 459 Bern. 15; Raape, S. 484. Vgl. Anm. 41. Vgl. I I , 4. Vgl. I I I , 1, b. Mot. I I , 224.
3. K r i t i k an der Grundlage der herrschenden Lehre
47
telbar aus i h r 5 6 . Dies setzt aber gedanklich voraus — wenngleich der Gesetzgeber diese Konsequenz nicht gesehen haben mag —, daß die Vereinbarung von Eigenschaften auch beim Spezieskauf möglich ist 5 7 . b) Die der h. L. widersprechenden älteren Ansichten
Die Meinung, daß der Speziesverkäufer nicht verpflichtet sei, eine mangelfreie Sache zu liefern, wurde schon früher als unbefriedigend erkannt. Dementsprechend sah man teilweise die Leistung einer fehlerhaften Sache als nicht gehörige Erfüllung an, wenngleich auch auf verschiedenen Überlegungen basierend 58 . aa) So wurde die Gewährleistung von einem Teil der Lehre als besondere Rechtsfolgeregelung für einen Fall der Unmöglichkeit angesehen 59 . Die Unmöglichkeitsnormen greifen ein, wenn eine Leistung, zu der eine Partei verpflichtet ist, unmöglich wird. Wer also die Gewährleistung als einen Sonderfall der Unmöglichkeit ansieht, setzt damit voraus, daß eine Verpflichtung zu mangelfreier Leistung besteht 60 . bb) Wenn weiterhin einige Ansichten dem Käufer das Recht einräumen, eine mangelhafte Speziessache m i t der Einrede des nichterfüllten Vertrages zurückzuweisen 61 und so den Verkäufer i n Leistungs56 Vgl. Mot. I I , 211: „Gemeinsam ist den Instituten" (Anm.: gemeint sind die Rechtsmängel- u n d die Sachmängelhaftung) „zwar der Rechtsgedanke, daß die Haftung i n beiden Richtungen unmittelbar aus dem fraglichen Rechtsgeschäft, an welches sie sich knüpft, entspringt, also nicht auf der Annahme einer besonderen nebenherlaufenden Garantiepflicht beruht." 57 Darauf weist auch Flume , S. 50, F N 69 hin. 58 O L G Breslau, O L G E 36, 43; O L G Hamburg, Seuff. Arch. 60, S. 54, Nr. 29; Adler, Z H R 71, 481, Z H R 75, 453 ff., 457; Endemann I, § 161 F N 31; Emmerich, S. 68; Krückmann, Ih. Jb. 59, 107; Kisch, S. 193 ff.; Regelsberger, Ih. Jb. 40, 274; Kluckhohn, Gruch. Beiträge 59, 1041 ff.; Eccius, Gruch. Beitr. 43, 268; Staub / Könige, 9. Aufl., Exkurs zu § 374 HGB, A n m . 42; Dörr, L Z 1918, 888 ff.; Titze, JW 1927, 29641; Düringer / Hachenburg, 1. Aufl., I I I . Bd., S. 74, 81 ff.; anders aber dann Höniger i n der 3. Aufl., Bd. V 1, Einl. I V A 1 Anm. 115; Lobe, i n RGRK, 9. Aufl., § 459 Anm. 2; Kuhn i n R G R K , § 459 A n m . 3. 59 Kohler I I 1, § 26 V I , Schöller, Gruch. Beitr. 46, 14, u n d Regelsberger, Ih. Jb. 40, 274, nehmen teilweise Unmöglichkeit an. Gegen diese Ansicht Lobe, i n RGRK, 9. Aufl., § 459 A n m . 7 Β c u n d Kuhn, i n R G R K § 459 A n m . 35: Es handele sich angesichts der unteilbaren Leistung u m totale Unmöglichkeit. Ebenso O L G Celle, Seuff. Arch. 59, 349, Nr. 197; Warney er, § 459 A n m . 102. Anders aber Kuhn i n R G R K , § 433 Anm. 172: Dort w i r d Teilunmöglichkeit bei nachträglichen unbehebbaren Fehlern angenommen. 60 Dies hebt auch Graue, S. 280, hervor. 61 Vgl. O L G Celle, Seuff. Arch. 59, 349, Nr. 197; Staudinger / Kober, 9. Aufl., § 440 I Β 3 a; Dernburg I I 2, § 185 I u n d DJZ 1903, 4: Das Angebot einer m a n gelhaften Sache sei kein dem Vertrag entsprechendes. A b der 3. Aufl. zweifelt Dernburg jedoch, ob es sich bei der Einrede u m die Einrede des nichterfüllten Vertrages handelt; vgl. auch Düringer / Hachenburg, 1. Aufl., 3. Bd., S. 74, 81 ff.; Krückmann, Ih. Jb. 59,125.
48
. K r i t i k an der herrschenden Lehre
Verzug zu setzen, so liegt dem ebenfalls die Annahme einer Pflicht zu sachmangelfreier Leistung zugrunde 62 . cc) Weiterhin hervorzuheben ist an dieser Stelle die Abkehr Korintenbergs, des maßgeblichen Begründers der Lehre von der echten und unechten Gewährleistung, von der h. L. I n seinem „Abschied von der Gewährleistung" 6 3 führt er aus, eine moderne Rechtsordnung wie das Bürgerliche Gesetzbuch habe die echte Gewährleistung — auch beim Spezieskauf — nicht mehr nötig 6 4 , sie normiere vielmehr einen Vertragserfüllungsanspruch auf eine mangelfreie Sache. Werde diesem Anspruch nicht Genüge getan, so greife die Sachmängelhaftung zum Zwecke der Erfüllung, also als unechte Gewährleistung ein. Nur eine Rechtsordnung wie die römische, die nicht den Weg zum Erfüllungsanspruch gefunden habe, müssen den Ausgleich auf dem Wege der echten Gewährleistung herbeiführen. Da aber schon das A L R die Erfüllungspflicht postuliert habe, so könne nicht angenommen werden, daß das BGB bei der römisch-rechtlichen Konstruktion stehengeblieben sei. Der Gesetzgeber des BGB habe z. B. anders als das Römische Recht einen Anspruch auf Verschaffung des Eigentums festgelegt und dementsprechend die Rechtsmängelhaftung geschaffen. Daraus sei zu folgern, daß er auch für den Bereich der Sachmängel den Weg zu einer Erfüllungspflicht hinsichtlich der Fehlerfreiheit gefunden habe 65 . Es bestehe also sowohl beim Spezies- wie beim Gattungskauf eine Pflicht zur Leistung einer mangelfreien Sache. c) Die Ansicht der Rechtsprechung
Das Reichsgericht hat die Thesen der h. L. nicht übernommen, vielmehr immer den Standpunkt vertreten, die Leistung einer fehlerhaften Sache sei mangelhafte Vertragserfüllung. Ganz klar bringt dies das Reichsgericht zwar selten zum Ausdruck 6 6 , doch w i r d regelmäßig bei Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft dem Käufer das Recht eingeräumt, die fehlerhafte Sache zurückzuweisen und gegen den Anspruch des Verkäufers die Einrede des nichterfüllten Vertrages zu erheben 67 bzw. Schadensersatz wegen — echter — Nicht62 Dernburg I I 2, § 185 I, ist widersprüchlich u n d inkonsequent, w e n n er eine Verpflichtung zu sachmangelfreier Leistung verneint, aber trotzdem die Zurückweisung einer fehlerhaften Leistung zuläßt. Vgl. darüber I I , 1. 63 Justizblatt f ü r den O L G - B e z i r k K ö l n 1947, 69 ff. 64 S. 74, 75, 77. 65 S. 75. 66 So aber R G 66, 76 (II, 26.4.1907): Die Gewährleistung sei ein Anspruch wegen mangelhafter Vertragserfüllung. Ebenso RG 53, 91 (II, 27.11.1902). 67 R G 66, 279 ff. (II, 2. 7.1907). Konsequent w i r d deshalb auch dem V e r k ä u fer vor der Erfüllungsannahme durch den Käufer die Beweislast f ü r die Fehlerfreiheit aufgebürdet.
3. K r i t i k an der Grundlage der herrschenden Lehre
49
erfüllung zu verlangen 68 . Allerdings handelt es sich bei diesen Entscheidungen immer u m zugesicherte Eigenschaften, die nach Ansicht des Reichsgerichts Vertragsbestandteile sind. Das Reichsgericht geht dabei davon aus, daß eine Zusicherung durch rechtsgeschäftliche Vereinbarung Teil des Vertrages w i r d 6 9 , also nicht etwa Gegenstand eines selbständigen Neben- oder Vorvertrages 70 . Dementsprechend ist die A n nahme einer die Eigenschaften m i t einschließenden Leistungspflicht folgerichtig. Daß die Ansicht des Reichsgerichts nicht auf die Fälle der Zusicherung beschränkt ist 7 1 , zeigt die Entscheidung des V. Senats vom 22.11. 190272. Dort läßt es das Gericht dahingestellt sein, ob eine bestimmte Größe eines Grundstücks als zugesichert anzusehen ist und behandelt unabhängig davon die Frage der Abnahmepflicht des Käufers. Letztlich w i r d dem Käufer nur deshalb kein Recht eingeräumt, die Annahme der fehlerhaften Sache abzulehnen, w e i l die Größendifferenz als zu gering angesehen w i r d 7 3 . Grundsätzlich läßt also das Gericht die Verweigerung der Abnahme einer mangelhaften Sache zu, was zu dem Rückschluß nötigt, daß eine Pflicht zu mangelfreier Leistung unterstellt wird. Die Linie der Rechtsprechung des Reichsgerichts w i r d noch deutlicher i n den Entscheidungen, die gemeinhin als Entscheidungen über den Fehlerbegriff angesehen werden. I n diesen Urteilen geht es nicht nur darum, wann ein Fehler vorliegt, sondern auch darum, welche vertraglichen Pflichten bestehen, was also von den Parteien vereinbart ist. Das Reichsgericht geht davon aus, daß für die Frage, was ein Fehler i. S. d. § 459 I ist, die vertragliche Vereinbarung maßgeblich ist. Es vert r i t t damit prinzipiell einen subjektiven Fehlerbegriff. Die Entscheidungen RG 67, 86 und RG 97, 351 werden von der L i t e r a t u r 7 4 als Entscheidungen i. S. eines objektiven Fehlerbegriff angesehen. Dem kann nicht unbedingt beigepflichtet werden. a) I n der Entscheidung vom 15.11.1907 75 führt der I I . Senat lediglich aus, daß die Gewährleistung nicht eingreife, weil das Fehlen der bloß 68
R G 52 352 ff. ( I I 24.10.1902). Vgl. R G 54, 223' (vj 1. 4.1903); R G 95, 120 (II, 18.2.1919); R G 67, 87 (II, 15.11.1907). 70 So ausdrücklich R G 52, 1 ff., 3 (V, 7. 6.1902). 71 Dies n i m m t jedoch Flume, S. 138, an; vgl. A n m . 89 d. Abh. 72 R G 53, 70 ff., 73. 73 Das Gericht f ü h r t aus, w e n n der Käufer wegen der Geringfügigkeit des Mangels nicht wandeln könne (vgl. § 468), dann habe er auch k e i n Recht, die Abnahme zu verweigern, vielmehr verlangten Treu u n d Glauben i n diesem Falle, daß der Käufer die Sache auch m i t dem Fehler abnehme. 74 Vgl. z. B. Staudinger / Ostler, § 459 RZ 21; Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 15. 75 R G 67, 87. 69
4 Herberger
50
. K r i t i k an der herrschenden Lehre
vorausgesetzten, nicht vertraglich zugesicherten Höhe des bisherigen Ertrages eines Geschäftsbetriebes grundsätzlich überhaupt kein Fehler i. S. des § 459 BGB sei. Nur durch vertragliche Zusicherung könne die Höhe des Ertrages in der Vergangenheit einer i. S. des § 459 erheblichen Eigenschaft der Sache rechtlich gleichgestellt werden. Die Überlegungen des Reichsgerichts gingen dahin, daß die Ertragskraft keine der Sache unmittelbar anhaftende Eigenschaft sei, also auch zu keinem Fehler führe. Dennoch läßt das Reichsgericht durch Vereinbarung die rechtliche Gleichstellung m i t einer Eigenschaft zu. Daraus läßt sich nicht die Annahme eines objektiven Fehlerbegriffs ableiten. Es ist selbstverständlich — das vertritt auch die subjektive Theorie heute — daß, sofern eine besondere Vereinbarung fehlt, die objektiven Maßstäbe gelten 76 . Wenn das Reichsgericht annimmt, daß durch Vereinbarung etwas, was normalerweise nicht als Eigenschaft gilt, der Eigenschaft haftungsmäßig gleichgestellt werden kann, so tendiert diese Ansicht viel eher zum subjektiven Fehlerbegriff. Es wäre auch unverständlich, daß der gleiche Senat elf Tage später am 26.11.1907 77 seine Meinung aufgegeben haben sollte, ohne dies hervorzuheben. I n der letztgenannten Entscheidung w i r d bei der Frage, was als Fehler zu gelten hat, einzig auf den Vertrag abgestellt: „Nach den Umständen des gegebenen Vertrages war verkauft ein Boot, bei dem solche Schwächen keine Fehler i. S. d. § 459 I sind." b) Auch die zweite für den objektiven Fehlerbegriff angeführte Entscheidung 78 erging durch den II. Senat, und zwar am 13.1.1920. Es ist darauf hinzuweisen, daß der gleiche Senat i n einer anderen Entscheidung am 19. 5.1916 79 ausgeführt hat, daß es für die Frage der Fehlerhaftigkeit einer Geige auf den Vertragsinhalt ankomme, nämlich ob die Geige gerade aus der Werkstatt des Stradivarius herrührend verkauft worden sei. Wenn es nun i n RG 97, 351 heißt, eine Orchestergeige sei keine fehlerhafte Sologeige, so ist dies irreführend. Die Entscheidung beruht letztlich darauf, daß i n dem zugrunde liegenden Fall der Verkäufer eine Gewähr für die Güte der Geige abgelehnt hatte und deshalb ein Fehler verneint wurde. Die Entscheidung liegt damit auf der Linie der Entscheidung RG 135, 340 ff., 343, wonach ein Fehler nicht vorliegen kann, wenn der Verkäufer eine Zusicherung ausdrücklich abgelehnt 76 77 78 79
So auch der gleiche I I . Senat a m 4.12.1908, i n RG 70, 82. RG 67, 146 ff. R G 97, 351. Warn. Rtspr. 1916, 394, 395.
3. K r i t i k an der Grundlage der herrschenden Lehre
51
hat, denn in diesem Fall könne man nicht davon sprechen, daß der Käufer die Eigenschaft noch vorausgesetzt habe. Und somit w i r d es verständlich, wenn der I. Senat i n seiner Entscheidung vom 27.11.1926 80 ausführt, daß die Entscheidung RG 97, 351 kein Abweichen von der bisherigen Ansicht des Gerichts darstelle. Es kann also festgehalten werden, daß das Reichsgericht grundsätzlich einen subjektiven Fehlerbegriff vertreten hat. Gerade i n diesem Zusammenhang werden die angeführten Entscheidungen regelmäßig gewürdigt, doch haben sie eine weitergehende Bedeutung. Haben die Parteien nichts besonderes vereinbart, gilt für die Frage, ob ein Fehler vorliegt, der objektive Maßstab 81 . Den Parteien steht es jedoch frei, beliebige Vereinbarungen darüber zu treffen, wie die Sache sein soll, zu welchem Gebrauch sie tauglich sein soll 8 2 . Von dieser Vereinbarung hängt es dann ab, ob ein Fehler vorliegt oder nicht. Wenn das Reichsgericht also ausführt, von einem vorausgesetzten Gebrauch i. S. d. § 459 I könne nur dann die Rede sein, wenn die Vertragsschließenden i n Abweichung vom objektiven Maßstab durch gegenseitige Willenserklärungen einen besonderen „Gebrauch vereinbaren" 8 3 , so ist dies dahin zu verstehen, daß die Parteien sich zur Leistung einer Sache mit bestimmter Eigenschaft verpflichten können, und zwar auch beim Spezieskauf. Das Reichsgericht betont ausdrücklich, daß es sich bei dieser Vereinbarung nicht um einen besonderen Nebenvertrag handelt, sondern um einen Bestandteil des gesamten Vertrages. Daraus folgt aber, daß diese Gebrauchsvereinbarung nicht, wie es zunächst den Anschein hat, eine Garantieerklärung für irgendeinen Gebrauch ist. Sie läßt sich vielmehr nur als eine Vereinbarung über die Eigenschaften der Sache verstehen. Die §§ 459 ff. greifen nicht ein, weil ein bestimmter vereinbarter Gebrauch unmöglich ist, sondern deshalb, weil eine bestimmte Eigenschaft nicht vorhanden ist, weil ein Fehler vorliegt 8 4 . 80
R G 115, 286 ff. Vgl. R G 70, 82 (II, 4. 12.1908); RG L Z 1933, 1249 f. (I, 17. 5. 1933). R G 70, 82; RG L Z 1933, 1249 f. 83 R G 70, 82; R G L Z 1911, 928 f. (II, 26. 9. 1911); R G L Z 1933, 1249 f.; R G L Z 1916, 222 (II, 19.10.1915). I n sich widersprüchlich RG 131, 343 ff. (VI, 19. 2. 1931), wenn auf R G 70, 86 Bezug genommen u n d gleichzeitig angeführt w i r d , die Zweckbestimmung müsse für beide Teile Geschäftsgrundlage geworden sein. Die Geschäftsgrundlage ist niemals Vertragsinhalt, wie es die Gebrauchsvereinbarung ist; so schon Oertmann, Geschäftsgrundlage, S. 31. Was Geschäftsinhalt ist, kann nicht Geschäftsgrundlage sein (Enneccerus/ Nipperdey, § 177 I V ; Soergel / Siebert / Knopp, § 242 Bern. 390). Unzutreffend daher auch B G H B B 1961, 305. I n gleicher Weise mißverständlich Mezger, S. 23. Vgl. auch A n m . 90. 84 So auch Flume, S. 142. 81
82
4*
52
. K r i t i k an der herrschenden Lehre
M i t der „GebrauchsVereinbarung", wie sie das Reichsgericht annimmt, kann nur eine Vereinbarung bestimmter Eigenschaften gemeint sein. Es ist regelmäßig eine Frage des Zufalls, ob die Parteien, formal gesehen, einen bestimmten Gebrauch vereinbaren oder eine bestimmte Eigenschaft. I n beiden Fällen ist dasselbe Vertragsziel zum Ausdruck gebracht. Für einen bestimmten Gebrauch muß die Sache bestimmte Eigenschaften haben. Maßgeblich für die Haftung nach §§ 459 ff. ist nicht die Vereinbarung des Gebrauchs, sondern die Vereinbarung einer Eigenschaft, eines Zustandes der Sache. Die Haftung nach §§ 459 ff. greift nicht deshalb ein, weil ein bestimmter Gebrauch nicht möglich ist, sondern deshalb, w e i l die Sache von anderer Beschaffenheit ist, als sie sein soll. Für die Haftungsfrage kann deshalb die Vereinbarung der Parteien nur als Eigenschaftsvereinbarung Bedeutung haben. I n diesem Sinne ist auch die Figur der „Gebrauchsvereinbarung" des Reichsgerichts zu verstehen. Daß das Reichsgericht regelmäßig von Gebrauchsvereinbarung spricht und nicht von Eigenschaftsvereinbarung, beruht darauf, daß i n den jeweiligen Entscheidungen i n erster Linie das Problem des Fehlers i n Frage stand und nicht das Problem der vertraglichen Schuld. Welche Eigenschaften geschuldet sind, ergibt sich aus dem vereinbarten Gebrauchszweck 85 . Kauft jemand ein Pferd, u m damit zu reiten (Gebrauchszweck), und verpflichtet sich der Geschäftsgegner ein für diese Zwecke geeignetes Pferd zu besorgen, so besteht die vertragliche Schuld des Verkäufers darin, ein Pferd zu leisten, das alle Eigenschaften eines Reitpferdes hat. W i r f t das Pferd jeden Reiter ab, so fehlt eine vereinbarte Eigenschaft und der Verkäufer haftet. Die Vereinbarung des Gebrauchszwecks dient also der Umschreibung der gewollten Eigenschaften 86 . Das Reichsgericht hat dies i n seinen Entscheidungen meist 8 7 nicht klar hervorgehoben, doch folgt dies daraus, daß das Gericht nur zu prüfen hatte, ob ein Fehler vorlag. Hierfür genügte die Ermittlung, daß ein bestimmter Gebrauch vereinbart war. Die Feststellung, daß die Gebrauchsvereinbarung i m Rahmen der §§ 459 ff. nur die Aufgabe hat festzulegen, welche Eigenschaften die Sache haben soll, konnte das Reichsgericht übergehen, weil es auf diese Unterscheidung für die Frage, was ein Fehler ist, nicht ankam. Es ist unerheblich, ob ich feststelle, das Pferd hat einen Fehler, w e i l es sich zum Reiten nicht eignet (Gebrauch), oder ob ich sage, das Pferd hat einen Fehler, w e i l es nicht die Eigenschaften eines Reitpferdes hat. Dogmatisch geht es i n jedem Falle u m die Eigenschaften des Pferdes, 85 86 87
So auch R G 161, 330 ff.; vgl. Anm. 88. Ebenso Flume , S. 142. Deutlich jedoch i n R G 161, 330 ff.; vgl. Anm. 88.
3. K r i t i k an der Grundlage der herrschenden Lehre
53
denn nur bei einem Beschaffenheitsfehler gelten die §§ 459 ff. Die Frage des Gebrauchszwecks hat nur mittelbare Bedeutung. Nur so w i r d es auch erklärlich, daß das Reichsgericht nicht nur bei der Haftung für eine zugesicherte Eigenschaft, sondern auch bei der Haftung für eine vorausgesetzte Eigenschaft eine vertragliche Vereinbarung fordert. Es ist unwahrscheinlich, daß das Reichsgericht für die beiden Bereiche wesensmäßig verschiedene Vereinbarungen, einmal Vereinbarung über die Eigenschaft, einmal Vereinbarung über den Gebrauchszweck, angenommen hat, ohne den Unterschied deutlich hervorzuheben. Vor allem hat das Reichsgericht eine Vereinbarung von Eigenschaften i m Wege der Zusicherung für möglich gehalten, wobei diese Vereinbarung nicht als selbständiger Garantievertrag, sondern als Bestandteil der vertraglichen Verpflichtung angesehen wurde, woraus sich ergibt, daß das Reichsgericht keine Bedenken hatte, eine Eigenschaftsvereinbarung auch beim Spezieskauf zuzulassen. Deshalb können diese Bedenken auch sonst keine Rolle gespielt haben. Es ist nicht anzunehmen, daß das Reichsgericht Gebrauchsvereinbarung gesprochen hat, w e i l es einbarung nicht für möglich hielt, vielmehr darf daß es unter der Gebrauchsvereinbarung eine rung verstanden h a t 8 8 ' 8 9 .
regelmäßig von einer eine Eigenschaftsverangenommen werden, Eigenschaftsvereinba-
88 So eindeutig R G Warn. Rtspr. 1916, 394 Nr. 244 (II, 19.5.1916), S. 395: Das Gericht hätte prüfen müssen, „ob nicht i n der Tat nach dem Inhalt des Vertrages Gegenstand desselben . . . eine Geige gewesen ist, bezüglich deren eine H e r k u n f t von Stradivarius i n Frage kommen konnte, u n d ob es nicht nach dem Willen beider Parteien ausgeschlossen sein sollte, daß die Geige eine moderne Fälschung sei". Auch R G 99, 147 (II, 8.6.1920): Vertragsmäßig sei Walfischfleisch zu liefern gewesen. Die gelieferte Sache habe nicht die Eigenschaft von Walfischfleisch gehabt (Anm.: Es w a r Haifischfleisch), deshalb greife die Haftung nach § 459 I ein. R G 161, 330ff. (V, 5.10.1939) S. 335: „Nach der neueren Rechtsprechung des Reichsgerichts . . . schafft einzig die Untauglichkeit zum Vertragszweck den Fehler, u n d bei einem vertraglich vorausgesetzten Gebrauch ist es dieser, der die v o m Käufer zu beanspruchende Beschaffenheit der Sache bestimmt." R G 101, 64 ff. (II, 7.12.1920): W a r eine Gummiplantage Kaufgegenstand, „so betraf der Kauf eine Sache, die die Eigenschaft hat, Gummibäume zum Zwecke wirtschaftlicher A u s n ü t zung zu tragen". RG 129, 280 ff. (VI, 19. 6.1930): Vereinbarung über die Eigenschaft landwirtschaftlicher Nutzbarkeit. R G 114, 239 ff. (II, 6. 7.1926): Vereinbarung über die Eigenschaft der Echtheit eines Thomabildes. R G 115, 286 ff. (I, 27.11.1926): Vereinbarung über die Eigenschaft der Echtheit einiger Bilder von Ostade u n d Teniers. R G 135, 340 ff. (II, 11.3.1932): Vereinbarung über die Eigenschaft der Echtheit eines Ruisdael. 89 Wenn Flume, S. 138, meint, das Reichsgericht habe die Ansicht vertreten, die Kaufvereinbarung könne sich beim Spezieskauf abgesehen von der Zusicherung nicht auf die Eigenschaft beziehen, so scheint uns das durch die angeführten Entscheidungen widerlegt.
54
. K r i t i k an der herrschenden Lehre
Die Ansicht des Reichsgerichts, der auch der B G H folgt 9 0 , geht also i n folgende Richtung: Die Parteien können — auch beim Spezieskauf — bestimmte Eigenschaften vereinbaren, wobei es von der Intensität der Erklärungen abhängt 91 , ob eine Zusicherung vorliegt oder nur eine einfache Vereinbarung. Der Verkäufer ist verpflichtet, die Sache m i t diesen Eigenschaften zu erbringen. Pehlen der Sache vereinbarte Eigenschaften, so haftet der Verkäufer gemäß §§ 459 ff. Für das Reichsgericht sind damit die §§ 459 ff. Ansprüche wegen nicht gehöriger Erfüllung. Eine Vereinbarung über Eigenschaften ist i m Gegensatz zur h. L. und Zitelmann möglich. d) Die herrschende Lehre und der subjektive Fehlerbegriff
Das Reichsgericht hat den subjektiven Fehlerbegriff entwickelt. Von seiner Sicht aus war dies auch konsequent. Die h. L. hat nun diesen subjektiven Fehlerbegriff übernommen 92 und damit auf dogmatisch fragwürdigem Wege den Erklärungen der Parteien über die Eigenschaften Geltung verschafft. Nach der h. L. können die Parteien keine Eigenschaften einer Speziessache vereinbaren. Nun kann aber auch die h. L. die ausdrücklichen Erklärungen der Parteien nicht ganz übergehen. Kauft jemand eine bestimmte Kiste und vereinbaren beide Parteien, daß die Kiste zum Versand von Büchern tauglich sein soll, so ist klar, daß sie nicht der Vereinbarung entspricht, wenn sie für Bücher zu schwach ist. Für die h. L. nun geht die Vereinbarung nur über diese Kiste. Hat die Kiste die Eigenschaften einer normalen Kiste, so könnte es an sich zu keiner Fehlerhaftung kommen 9 3 . Ein solches Ergebnis würde jedoch den ausdrücklichen Erklärungen der Parteien zuwiderlaufen. Deshalb muß auch die h. L. die Äußerungen der Parteien beachten. Sie tut dies, indem sie die Erklärungen für die Frage, ob ein Fehler vorliegt, heranzieht. 90 Der B G H v e r t r i t t wie das Reichsgericht einen subjektiven Fehlerbegriff, berücksichtigt also i m Einzelfall die — oft stillschweigend getroffene — V e r einbarung über Eigenschaften der Sache. Vgl. B G H 52, 51 ff. = B G H JZ 1970, 28 f. m i t ablehnender Anm. Fabricius (Vertreter des objektiven Fehlerbegriffs; vgl. A n m . 92). B G H L M Nr. 2 zu § 459 Abs. I : Einigung über den Gebrauchszweck sei erforderlich, jedoch sei dies auch stillschweigend möglich. Ebenso B G H 16, 54 ff.; B G H B B 61, 305, wo jedoch unzutreffend die V e r einbarung als Geschäftsgrundlage angesehen w i r d , vgl. dazu A n m . 83. Vgl. ferner B G H L M Nr. 2 zu § 459 Abs. I I : Zusicherung n u r bei ernsthafter Willenserklärung. 91 Vgl. R G L Z 1911, 928 f.; RG 161, 330 ff.; 114, 239 ff. 92 Vgl. Larenz I I , § 41 I ; Enneccerus / Lehmann, § 108 I I 1; Soergel ! Siebert I Baller stedt, vor § 459 Bern. 11. N u r Fabricius, JZ 1967, 464 ff., 469 f. ist konsequent und v e r t r i t t eine objektive Theorie. 93 So konsequent die objektive Theorie; vgl. z. B. Schubert, S. 64 u n d die I V , A n m . 1 aufgeführten Vertreter der objektiven Theorie.
3. K r i t i k an der Grundlage der herrschenden Lehre
55
Damit aber verlagert sie in unzulässiger Weise ein Problem, das dem Bereich der Willenserklärung angehört, i n den Bereich des Fehlerbegriffs. Die h. L. braucht, u m die Haftung aus § 459 begründen zu können, die Erklärungen der Parteien, andererseits leugnet sie, daß solche Erklärungen möglich sind. Auch die h. L. kann den Äußerungen der Parteien über die Beschaffenheit nur dann Bedeutung zukommen lassen, wenn diese m i t Rechtsfolgewillen gemacht wurden, denn nur so läßt sich unerhebliche Motivation von verbindlicher Erklärung trennen. Die h. L. fingiert deshalb bei jedem Spezieskauf eine A r t Gattungskauf: Jede Spezies gehöre einer bestimmten Gattung an. Für die Mängelfrage komme es darauf an, als welcher Gattung zugehörig die Sache verkauft werde 9 4 . Die h. L. vermengt damit Spezies- und Gattungsschuld. Die Gattungselemente, die die h. L. zur Erklärung des subjektiven Fehlerbegriffs benötigt, sind jedoch nur Umschreibungen für bestimmte Eigenschaften. Denn gekauft ist gerade keine Gattungssache, sondern eine Spezies. Erklärt jemand „Ich kaufe diese Bücherkiste", so enthält seine Erklärung zwei Elemente: die Kiste zu kaufen verbunden m i t der Erklärung, daß die Kiste bestimmte Eigenschaften haben soll 9 5 , nicht aber die Erklärung, diese Kiste aus der Gattung der Bücherkisten zu kaufen. Die Haftung t r i t t nicht deshalb ein, weil die Sache einer anderen Gattung angehört, als der zugehörig sie verkauft wurde, dies wäre allerdings die Konsequenz aus der h. L., sondern deshalb, weil die konkrete Kiste nicht die Eigenschaften hat, die sie haben sollte. Es ist vollkommen unerheblich, ob jemand erklärt „Ich kaufe diese Bücherkiste" oder ob er sagt „Ich kaufe diese Kiste. Sie muß aber geeignet sein für den Büchertransport" 9 6 . I m letzteren Fall kann nicht von einem Kauf aus einer Gattung die Rede sein, die Kiste ist nicht als Bücherkiste angesprochen, sondern allein als Kiste. Es kann aber keinem Zweifel unterliegen, daß beide Fälle gleich zu behandeln sind 9 7 , denn i n beiden Fällen wollen die Parteien das Nämliche. Die Formulierung ist jeweils eine Frage des Zufalls. 94 95
Vgl. Larenz II, § 411.
So auch R G 101, 64 ff.; vgl. A n m . 88. R G L Z 1933, 1249 f. glaubt noch, daß m a n die beiden Fälle scheiden müsse: „Es k a n n hiernach zweifelhaft sein, ob die Verwendung der Maschine z u m Bedrucken von Pergamentpapier einen nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch bedeutet oder ob es richtiger ist, zu sagen, daß durch die Bezeichnung der Maschine, als Pergamentpapierdruckmaschine n u r die A b grenzung des Vertragsgegenstandes gegenüber verwandten Gegenständen b e w i r k t werden sollte, so daß es darauf ankommt, welches der gewöhnliche Gebrauch einer Pergamentpapierdruckmaschine ist." Letztlich läßt das Reichsgericht jedoch die Frage dahingestellt, w e i l die Haftung i n jedem Falle eintrete. 97 So dann auch R G L Z 1933, 1250. 96
56
. K r i t i k an der herrschenden Lehre
Die h. L. zeigt, daß auch sie nicht an den Erklärungen der Parteien über die Eigenschaften vorbeigehen kann. M i t dem subjektiven Fehlerbegriff ist die Lehre Zitelmanns aufgegeben. Die Hypothese der h. L., beim Spezieskauf könne eine Eigenschaft nicht vereinbart werden, erscheint damit u m so fragwürdiger. M i t dem subjektiven Fehlerbegriff widerlegt die h. L. sich selbst. e) Die Widerlegung Zitelmanns
Die h. L. nimmt i m Anschluß an Zitelmann 9 8 an, daß eine Vereinbarung über Eigenschaften beim Spezieskauf nicht möglich sei, weil Gegenstand des geschäftlichen Willens nur der individuelle Gegenstand sei 99 . Das „Sein" der Sache könne nicht gewollt sein. Diese letzte Feststellung ist sicher richtig. Doch u m dieses „Sein" geht es bei den Erklärungen der Parteien gar nicht. Der Käufer einer Sache w i l l nicht, daß der Kaufgegenstand so ist, sondern er w i l l , daß der Gegenstand so sein soll 1 0 0 . Er w i l l also den Gegenstand nicht absolut gesehen, sondern 'er w i l l i h n und m i t i h m zusammen bestimmte Eigenschaften 101 . Der Gegenstand läßt sich nicht ohne Eigenschaften denken, er ist vielmehr eine Einheit m i t diesen, und dementsprechend richtet sich der Wille auch auf diese Einheit 1 0 2 . Zitelmann glaubt, der Wille beziehe sich nur auf die individuelle Sache, nicht aber auf die Eigenschaft. Das ist psychologisch unrichtig. Per Gegenstand w i r d zu einem bestimmten Zweck gekauft und für diesen Zweck muß er bestimmte Eigenschaften haben. Der Wille richtet sich dabei sowohl auf die Sache wie auf die Eigenschaft. Der Käufer ist sich regelmäßig nicht darüber i m klaren, ob er einen Spezies- oder einen Gattungskauf abschließt. Seine psychologische Situation ist aber i n beiden Fällen die gleiche. Nach der Lehre Zitelmanns hingegen müßte die psychologische Seite verschieden sein: Nur beim Gattungskauf würde sich der Wille auf die Eigenschaften beziehen. Entschließt sich jemand zum Kauf einer Lampe, die er i m Schaufenster gesehen hat, unter der Voraussetzung, daß die Lampe das Prüfzeichen V D E aufweist, so kann es zu einem Spezies- oder zu einem Gattungskauf kommen. Der Wille des Käufers ist vorgegeben, und es ist regelmäßig zufallsbedingt, ob es i m Anschluß an die Erklärung des Käufers zu einem 98
Vgl. Zitelmann, S. 435 ff. Vgl. I I , 4. Dies hat schon Adler, Z H R 75, 463 ff. erkannt. So auch Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 459 A n m . 2; Schmidt-Rimpler, S. 215. 101 Einen dahingehenden W i l l e n hielt schon Adler f ü r möglich u n d dementsprechend rechnet er eine Erklärung darüber zum I n h a l t des Vertrages. 102 So grundlegend Flume, S. 17 ff.; ähnlich aber schon Holder, Festschrift f. Bekker, S. 66 F N 3 u n d Kommentar § 119 A n m . 1. 99
100
3. K r i t i k an der Grundlage der herrschenden Lehre
57
Spezies- oder Gattungskauf kommt. Erklärt der Käufer, „Ich w i l l diese Lampe, sie muß aber VDE geprüft sein", so ist die willensmäßige Situation die gleiche wie wenn er erklärt „Ich w i l l eine Lampe, wie sie i m Fenster steht m i t dem VDE-Zeichen". Es widerspricht also der psychologischen Situation anzunehmen, daß nur dann, wenn es zum Abschluß eines Gattungskaufes kommt, der Wille sich auf die Eigenschaft der VDE-Prüfung bezieht. Untersucht man den inneren Tatbestand selbst, so ergibt sich folgendes: Der Käufer hat keinen doppelten Willen i n dem Sinne, daß er einmal die Sache als solche w i l l und zum anderen bestimmte Eigenschaften, sondern er w i l l immer die Sache mit den Eigenschaften. Die Sache als solche gibt es ebensowenig wie die Eigenschaften ohne die Sache. Der Wille ist also auf eine Einheit bezogen. Obwohl Larenz 1 0 3 dies einräumt, meint er, entscheidend könne nur sein, durch welche Merkmale der Gegenstand für die Rechtsordnung hinreichend individualisiert werde, und dafür genüge das „sinnliche Hier und Jetzt, das i n dem ,diesen' gemeint ist". Dagegen ist zu sagen, daß nicht ein Stück Materie Gegenstand des Willens ist, sondern bestimmte Materie, Materie m i t bestimmten Eigenschaften. Schon die Verwendung eines bestimmten Begriffs macht die Materie zu einer solchen mit bestimmten Eigenschaften. Erkläre ich, auf einen Strohsack weisend, dieses Pony zu kaufen, so wäre unter strenger Beachtung der Lehre Zitelmanns verkauft das, worauf ich gedeutet habe, der Strohsack, denn das sollte Gegenstand der rechtlichen Veränderung sein. I n Wirklichkeit aber wollte ich niemals einen Strohsack kaufen, sondern ein Pony. Deshalb kann es auch nicht richtig sein, wenn Larenz 1 0 4 meint, daß die Bezeichnung „dies" zur rechtlichen Individualisierung 1 0 5 genüge. Die Folge dieser Ansicht wäre, daß i m Rahmen des § 154 der Vorbehalt einer Einigung über Eigenschaften unbeachtlich wäre. Einigen sich zwei Parteien über den Verkauf eines konkreten Rennwagens zu einem bestimmten Preis, vereinbaren sie aber, später, z. B. nach einem Rennen, noch einzelne „gesollte" Eigenschaften festzulegen, so wäre der Vertrag schon geschlossen, wenn es nur auf das „dies" ankäme und die Erklärungen über die Eigenschaften nicht Vertragsbestandteil werden könnten. Dieses Ergebnis aber stünde i m Widerspruch zu § 154. 103
Larenz, Geschäftsgrundlage, S. 20 A n m . 1. Larenz, ebd.; so auch Mohnen, S. 29. tos Dagegen schon Holder i n seinem Kommentar, § 119 A n m . 1 u n d i n Festschrift f. Bekker, S. 66 F N 3: „Geradezu verkehrt ist es, einer ,bloßen' Eigenschaft das Individualisierungsmerkmal als etwas Wichtigeres gegenüberzustellen." 104
58
. K r i t i k an der herrschenden Lehre
Ein weiteres Bedenken erhebt sich gegen die Ansicht von Larenz. Bei abwesenden Sachen, die Gegenstand eines Spezieskaufes sind, ist die Individualisierung m i t dem Begriff „dies" gar nicht möglich, vielmehr ist dabei eine Individualisierung regelmäßig nur durch Angabe der Sacheigenschaften möglich. Hatte sich ein Käufer eine Anzahl von Schmuckstücken bei einem Juwelier zeigen lassen, und w i l l er den Kauf telefonisch abschließen, so w i r d die Erklärung etwa so lauten: „Ich kaufe den goldgefaßten Smaragdring mit den Perlen, den Sie m i r am . . . gezeigt haben." Bei einer abwesenden Sache ist also eine Erklärung über die Eigenschaften erforderlich, u m überhaupt die Sache zu individualisieren, so daß sie dabei in jedem Falle Vertragsbestandteil werden müßte 1 0 6 . Nun kann es aber für die Frage des Willens und der Erklärung keinen Unterschied machen, ob die Sache anwesend ist oder abwesend. Die Frage, ob das „dies" zur Individualisierung der Sache genügt oder nicht, leitet i n eine falsche Richtung. Ob die Eigenschaftsbestimmung zur Individualisierung der vertragsgegenständlichen Sache erforderlich ist, ist gar nicht entscheidend für die Frage, was Vertragsbestandteil wird. Kauft jemand „diese goldene Uhr", so erfolgt die Erklärung „golden" nicht zum Zwecke der Individualisierung, sondern, u m den Umfang der vertraglichen Schuld festzulegen 107 . Genauso ist es, wenn jemand eine Gattungssache kauft, nur daß dort die Eigenschaftsbestimmung, da die Sache noch nicht individualisiert ist, auch noch dem Ziel der Individualisierung dient. Dieser Umstand darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Eigenschaftsbestimmung vor allem dem Zweck dient, den Umfang der vertraglichen Verpflichtung festzulegen. Wenn Larenz weiter ausführt, die „Reduktion der tatsächlich inhaltsreicheren, weil die Beschaffenheitsmerkmale i n ungeschiedener Einheit m i t umfassenden psychologischen Vorstellung auf den Willen und die Erklärung, lediglich ,diesen', durch das Hier und Jetzt und weiter durch nichts individualisierten Gegenstand zu kaufen", sei ein juristischer Denkakt, um zu verhindern, daß die Willenserklärung als i n sich widersprechend der Nichtigkeit anheimfalle, so kann dieses Argument mit der Feststellung entkräftet werden, daß eine solche Nichtigkeitsfolge nicht eintritt, weil ein Widerspruch innerhalb der Erklärung gar nicht vorliegt. Die Erklärung setzt sich zusammen aus der Bestimmung der Sache und der Bestimmung der Eigenschaften, die die Sache haben soll. Daß 106
So auch konsequent Mohnen, S. 52 ff.
ίο? V g l > γ
A n m
.
6 u n d
23.
3. K r i t i k an der Grundlage der herrschenden Lehre
59
die Sache die Eigenschaften nicht hat, die sie haben soll, macht die Erklärung nicht widersprüchlich. Das wäre nur möglich, wenn die Erklärung darüber ginge, daß die Sache so ist. Doch das wurde gerade abgelehnt. M i t Recht sagt Flume 1 0 8 , daß es hier keine Unrichtigkeit, keinen Widerspruch innerhalb der Erklärung geben könne. Einen Widerspruch gibt es nur innerhalb der Seinskategorie, nicht aber i m Bereich des Werdens. Die Willenserklärung ist nun aber auf ein Werden gerichtet, nicht auf ein Sein. Inhalt der Erklärung ist z. B. nicht, daß die konkrete Sache, die den Gegenstand des Kaufes bildet, blau ist, sondern, daß sie blau sein soll. Damit ist ein Widerspruch innerhalb der Erklärung ausgeschlossen109. Eine andere Frage ist, ob die infolge der eindeutigen Erklärung entstandene Vereinbarung auf eine unmögliche Leistung gerichtet i s t 1 1 0 und damit gem. § 306 nichtig ist. Gegenstand des Willens ist also niemals allein die mit einem „dies" konkretisierte Materie, sondern die Materie mit einer Summe von Eigenschaften, die ich durch einen engeren oder weiteren Begriff bezeichnen kann: Lebewesen, Tier, Säugetier, Pferd, Reitpferd, Turnierpferd. Die Ansicht Zitelmanns, daß sich der Wille beim Spezieskauf nicht auf die Eigenschaften der Sache erstrecke, und diese deshalb auch nicht Gegenstand der Willenserklärung sein könnten, ist somit unrichtig 1 1 1 . Die Willenserklärung erfaßt auch die Eigenschaft 112 . Damit ist der Weg frei für ein neues Verständnis der Gewährleistung.
108
Flume , S. 108. So auch Flume , S. 20, 21, 108; Schmidt-Rimpler, S. 215, 216. Siehe darüber I V , 2, c. 111 Zitelmann w i r d auch durch das Gesetz selbst widerlegt. So bestimmt § 536, daß der Vermieter dem Mieter die Mietsache i n einem zu dem vertragsmäßigen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen habe. Das heißt aber, daß eine Eigenschaftsvereinbarung, u n d zwar auch bei der Speziesmiete, möglich sein muß. 112 So schon Flume , S. 17 ff. u n d A T § 24, 2 b, S. 477; i h m folgend Kegel, AcP 150, 360; Erman / Weitnauer vor § 459 Rdz. 2 ff., 17; Korintenberg, Spezies, S. 90; Enneccerus / Nipper dey, § 168; Staudinger / Coing, § 119 Rdz 16 unter zu 3 b ; Raape, S. 481 ff., 494; Soergel / Siebert / Hefermehl, § 119 Bern. 20, 27; Palandt / Heinrichs, § 119 A n m . 4 a; Kramer, JB1 72, 401 ff.; Huber, S. 402 f.; Schubiger, S. 26 unter I I I vor 1. u n d S. 22 unter b, S. 131 unter a; auch Fikentscher, § 70 I I 1, 2 d. 109
110
I V . Recbtsnatur der Gewährleistung nach geltendem Recht 1. D i e Vereinbarung v o n Eigenschaften
Wenn der Wille sich nicht nur auf ein bestimmtes Objekt, sondern auch auf Eigenschaften erstrecken kann, die das Objekt haben soll, so können sich die rechtsgeschäftlichen Erklärungen auch auf die gesollte Beschaffenheit der Sache beziehen und diese damit zum Vertragsbestandteil machen. Das bedeutet, daß sich auch beim Spezieskauf die Sachmängelhaftung auf den Vertrag zurückführen läßt. Damit w i r d die Gewährleistungsregelung insgesamt verständlich. Die Haftung t r i t t ein, w e i l die Parteien mit ihrer Vereinbarung einen Haftungsgrund geschaffen haben. Ein Zurückführen der Gewährleistung auf den Vertrag ist aber nur dann stichhaltig, wenn i n allen Fällen, i n denen das Gesetz die Sachmängelhaftung vorsieht, eine Vereinbarung vorliegt. Normiert das Gesetz, wenn auch nur i n einem Fall, die Haftung für Sachmängel, obwohl keine Vereinbarung über die die Haftung begründende Eigenschaft vorliegt, so läßt sich die Gewährleistung nicht aus dem Vertrag heraus begründen. Dann müßte man der h. L. Recht geben, daß der Rechtsgrund der Gewährleistung außerhalb des Vertrages zu suchen ist. Das Kauf recht kennt drei Haftungsgruppen: 1. Haftung für Fehler, die den Wert oder die Tauglichkeit zum gewöhnlichen Gebrauch oder 2. zu dem nach dem Vertrage vorausgesetzten oder mindern (§ 459 1 1)
Gebrauch aufheben
3. Haftung für das Vorhandensein der zugesicherten Eigenschaft (§ 459 II). Daß der Verkäufer nach § 459 I I dafür haftet, daß die Sache bei Gefahrübergang bestimmte zugesicherte Eigenschaften hat, nach § 459 I aber dafür, daß sie nicht m i t Fehlern behaftet ist, ändert nichts daran, daß es i n beiden Fällen u m die Nichterfüllung der gleichen Verpflichtung geht. Der Verkäufer haftet, w e i l die Sache nicht die vereinbarte Eigenschaft hat. I n § 459 I ist das Tatbestandsmerkmal negativ, i n § 459 I I positiv gefaßt. Es macht keinen Unterschied, ob der Käufer für das Vorhandensein von negativen Eigenschaften (Fehlern) haftet oder
1. Die Vereinbarung von Eigenschaften
61
für das Nichtvorhandensein von positiven Eigenschaften. I n beiden Fällen haftet er, w e i l die Sache nicht die Eigenschaften hat, die sie nach der Vereinbarung haben soll 1 , w e i l sie negativ von dem abweicht, wie sie sein soll. Und wie sie sein soll, bestimmt der Vertrag. Diese Behauptung ist jedoch nur richtig, wenn sich i n allen drei Haftungsgruppen immer eine Vereinbarung nachweisen läßt über die Eigenschaft, hinsichtlich derer es zur Sachmängelhaftung kommt. a) Die Vereinbarung von Eigenschaften zum gewöhnlichen Gebrauch
Wenn nach § 459 I 1 gehaftet w i r d für Fehler, die den gewöhnlichen Gebrauch aufheben oder mindern, so müssen, soll die Haftung ihren Rechtsgrund i n einer Vereinbarung haben, alle Eigenschaften, die zum gewöhnlichen Gebrauch erforderlich sind, vereinbart worden sein. Meist vereinbaren die Parteien nicht ausdrücklich bestimmte Eigenschaften. Sie erklären nur, diesen Tisch, diesen Koffer, diese Uhr zu kaufen bzw. zu verkaufen. Jeder Gegenstand erhält aber erst durch bestimmte Eigenschaften seinen Charakter als „Ding von dieser A r t " . Wenn jemand also Tisch sagt, dann meint er eine Sache m i t bestimmten Eigenschaften, nämlich eine Platte mit Beinen. Jede begriffliche Kennzeichnung einer Sache enthält also eine mehr oder minder große A n zahl von Eigenschaftsangaben. M i t dem Begriff werden die Eigenschaften Bestandteil des Willens. Maßgeblich für das Zustandekommen einer Vereinbarung ist jedoch, abgesehen von der falsa demonstratio, nicht der innere Wille, sondern der objektive Erklärungstatbestand 2 . Danach hat die Willenserklärung den Inhalt, der sich aus dem allgemeinen Sprachgebrauch oder der Verkehrsüblichkeit ergibt. Die Erklärung, diesen Tisch zu kaufen bzw. zu verkaufen, ist also gemäß §§ 133, 157 dahingehend auszulegen, daß der Tisch alle Eigenschaften haben soll, die zum gewöhnlichen Gebrauch eines Tisches erforderlich sind. Einfacher ist es, von den gewöhnlichen Eigenschaften zu sprechen, denn 1 Vgl. Erman / Weitnauer vor § 459 Rdz 6; v. Caemmerer, S. 15 ff., 18; Kreuzer, Kolloquium, S. 37. Daraus folgt notwendigerweise ein subjektiver Fehlerbegriff, w i e i h n auch die h. L., jedoch teilweise unter anderen V o r zeichen v e r t r i t t , vgl. oben I I I , 3, d. Vgl. Larenz I I , 1 41 I a; Soergel / Siebert / Ballerstedt, vor § 459 Bern. 11; Enneccerus / Lehmann, § 108 I I 1; Esser, § 64 I I ; Palandt / Putzo, § 459 A n m . 2; Staudinger / Ostler, § 459 Rdz 21; Flume, S. 109, 119, 126; Busbach, S. 8; Schubiger, S. 31 f., 45; R G 114, 239 ff.; 115, 2861; 135, 339 ff.; 161, 330, 335; B G H 16, 55; 52, 51 ff. A.A. die objektive Theorie vgl. Haymann, JW 1932, 1863, Nr. 32; Schubert, S. 64; Oertmann, § 459 A n m . 1, 4, 5; Lobe i n R G R K , 9. Aufl., § 459 A n m . 4 I a ; R. Schmidt, N J W 1962, 710 ff.; Fabricius, JuS 1964, 1 ff., 46 ff.; JZ 1967, 464 ff.; 1970, 29 ff. 2 Vgl. Larenz, A T , § 19 I I a, S. 278 f.
62
I V . Rechtsnatur der Gewährleistung nach geltendem Recht
die g e w ö h n l i c h e n Eigenschaften
eines Tisches s i n d die, die er
zum
g e w ö h n l i c h e n G e b r a u c h h a b e n m u ß . D a m i t e r g i b t sich, daß die g e w ö h n l i c h e n Eigenschaften e i n e r Sache m i t 3
vereinbart
sind 4 » 5 u n d
damit
6
Vertragsbestandteil werden . b) Die Vereinbarung von Eigenschaften zu einem bestimmten Gebrauch Gemäß § 459 I 1 g r e i f t d i e S a c h m ä n g e l h a f t u n g auch ein, w e n n F e h l e r v o r l i e g e n , d i e d i e T a u g l i c h k e i t z u d e m nach d e m V e r t r a g vorausgesetzt e n G e b r a u c h a u f h e b e n oder m i n d e r n . W i e schon a u s g e f ü h r t 7 , d i e n t d i e B e s t i m m u n g des Gebrauchs n u r d e m Z w e c k , d i e Eigenschaften d e r Sache z u b e s t i m m e n . D i e G e b r a u c h s v e r e i n b a r u n g i s t also i n W i r k l i c h k e i t eine E i g e n s c h a f t s v e r e i n b a r u n g 8 . Dies f o l g t daraus, daß d i e Sachm ä n g e l h a f t u n g eine H a f t u n g f ü r das F e h l e n b e s t i m m t e r Eigenschaften ist, n i c h t aber eine H a f t u n g f ü r d i e U n t a u g l i c h k e i t d e r Sache z u e i n e m b e s t i m m t e n Gebrauch. D e r G e b r a u c h h a f t e t d e r Sache n i c h t u n m i t t e l b a r an. E r b e s t i m m t sich erst d u r c h d i e menschliche V e r w e n d u n g . Diese aber i s t a b h ä n g i g 3 Wenn Flume , S. 109, darauf hinweist, daß nicht die Beschaffenheit als solche vereinbart ist, sondern die Sache m i t bestimmten Eigenschaften, so sagt er etwas Selbstverständliches. Eine Eigenschaft ohne Sache gibt es nicht, sie k a n n daher ohne die Sache nicht vereinbart sein. 4 Ebenso Flume , S. 81 ff. u n d A T § 24, 2 c, S. 479; Korintenberg, Spezies, S. 90; Palandt / Heinrichs, § 119 A n m . 4 a; Soergel / Siebert / Hefermehl, § 119 Bern. 21, 28; Soergel / Siebert / Ballerstedt, vor § 459 Bern. 11; Staudinger/ Coing, § 119 Bern. 16, 33, 52; Huber, S. 403 ff.; Raape, S. 481 f.; Schubiger, S. 31 f. Allerdings ist die Begründung i n der angegebenen L i t e r a t u r teilweise etwas abweichend. So schreibt Lobe i n R G R K 9. Aufl., § 459 A n m . 2, die gewöhnliche Eigenschaft sei ohne weiteres I n h a l t der Leistungspflicht als „gesetzlich präsumierter Vertragsinhalt". Kuhn i n R G R K § 459 A n m . 3, f ü h r t aus, die gewöhnliche Eigenschaft würde v o m Gesetz aufgrund einer Vermutung als Vertragsinhalt angesehen (ebenso Huber). Beide gelangen zur Einbeziehung der gewöhnlichen Eigenschaften i n den Vertragsinhalt nicht durch Auslegung der Willenserklärung, sondern dadurch, daß sie auf den gesetzlichen Tatbestand zurückgreifen. D a m i t w i r d aber das Entscheidende, nämlich daß die Haftung auf eine Vereinbarung zurückgeht, nicht deutlich; der Erklärungstatbestand der Willenserklärung w i r d durch eine gesetzliche Vermutung verdeckt. 5 Dieser Gedanke findet sich, allerdings für die Rechtsgewähr, schon i n Mot. I I , 212. Dort w i r d S. 211 ausgeführt, sowohl Rechtsgewähr w i e Sachgewähr beruhten auf dem Vertrag (vgl. I I I A n m . 56). Wenn es dann weiterh i n auf S. 212 heißt, die vertragliche Verpflichtung müsse nicht besonders erfolgen, sie folge aus der Erklärung, so liegt es nicht fern, daß dies auch bei der Sachmängelhaftung gelten sollte, zumal beide Haftungsfälle auf den Vertrag gestützt werden. β Interessant ist die Formulierung v o n Lenel, AcP 79, 104 ff., die schon i n diese Richtung geht. Das stillschweigend Selbstverständliche müsse auf dem Gebiete der bonae f i d e i - K o n t r a k t e dem ausdrücklich E r k l ä r t e n gleichstehen. 7 Vgl. I I I , 3, c. 8 So auch schon R G 161, 330 ff., 335; vgl. I I I , A n m . 88; Wolff, Ih. Jb. 56, 17.
1. Die Vereinbarung von Eigenschaften
63
von den Eigenschaften der Sache. Der logische Zusammenhang ist daher: Weil die Sache bestimmte Eigenschaften hat, kann sie i n bestimmter Weise verwendet werden, nicht aber umgekehrt, weil die Sache zu einem bestimmten Gebrauch taugt, hat sie bestimmte Eigenschaften. Der Gebrauch bestimmt sich aus den Eigenschaften, nicht die Eigenschaften aus dem Gebrauch. Wenn also jemand eine Sache zu einem bestimmten Gebrauch w i l l , so w i l l er notwendigerweise die Sache m i t den Eigenschaften, die den Gebrauch ermöglichen. Das Gesetz spricht von der Tauglichkeit zum „vorausgesetzten Gebrauch", nicht von „vorausgesetzten Eigenschaften", weil es i n der Regel einfacher ist, die Eigenschaften einer Sache durch Anführung des bezweckten Gebrauchs zu kennzeichnen. Soll ein verkauftes Pferd nach dem Vertrag zu Turnierzwecken geeignet sein, so soll es alle Eigenschaften haben, die man von einem Turnierpferd erwartet. Genausogut könnten die Parteien den Kauf eines Pferdes vereinbaren, das die Eigenschaften hat, sich reiten zu lassen, zu springen, eine gewisse Schnelligkeit zu besitzen etc. Es ist jedoch einfacher, alle diese Eigenschaften durch Angabe des Gebrauchszwecks zusammenfassend zum Ausdruck zu bringen. Einigen sich die Parteien darauf, daß die Sache zu einem bestimmten Gebrauch tauglich sein soll, so einigen sie sich damit über die Eigenschaften, die die Sache für diesen Gebrauch haben muß. Damit w i r d Vertragsinhalt eine Sache m i t den zu dem bestimmten Gebrauch erforderlichen Eigenschaften 9 . 9
Unrichtig Staudinger / Ostler, § 459 Rdz 21, wenn er meint, das Vorhandensein der vorausgesetzten Eigenschaften sei eine gesetzlich präsumierte Kaufbedingung. Die Konsequenz daraus wäre, daß, liegt die vorausgesetzte Eigenschaft nicht vor, der K a u f hinfällig werden müßte. Wie u n k l a r die Ansicht Ostlers ist, zeigt sich i n § 459 Rdz 28, wenn es dort heißt, die Voraussetzung müsse auf einer Wülenseinigung beruhen, jedoch müsse es zu keiner vertraglichen Einigung kommen, der Gebrauch müsse allein zur Geschäftsgrundlage gemacht werden. Die gleiche Ansicht findet sich i n R G 131, 343 ff. u n d B G H B B 1961, 305, vgl. dazu I I I , Anm. 83, 90. Geschäftsgrundlage u n d Willenseinigung schließen sich gegenseitig aus. Liegt eine Willenseinigung vor, so w i r d der Gegenstand der Einigung Vertragsbestandteil. Die Geschäftsgrundlage dagegen ist niemals Bestandteil des Rechtsgeschäftes, sondern, wie der Begriff schon sagt, dessen Grundlage. So hat schon Oertmann, Geschäftsgrundlage, S. 31, den Begriff geprägt. Ebenso die h. L., vgl. z. B. Larenz I, § 21 I I . Es bleibt unverständlich, zu welcher A r t von Willenseinigung es nach Ostler kommt. U n k l a r auch Brüggemann i n R G R K - H G B , § 377 Anm. 41. Zustimmung verdient dagegen i m Ergebnis die Entscheidung B G H 52, 51 ff.: E i n Wieder Verkäufer, der Hasenfleisch geliefert erhält, das unter dem Verdacht des Salmonellenbefalls steht, hat die Rechte aus § 459 ff. u n d nicht, w i e Fabricius (JZ 1970, 29 ff.) meint, Ansprüche wegen positiver Vertragsverletzung oder culpa i n contrahendo. Der Verkäufer hat die — stillschweigend — vereinbarte Eigenschaft, daß die Sache genußtauglich u n d damit verkäuflich ist, nicht erfüllt u n d haftet daher.
64
I V . Rechtsnatur der Gewährleistung nach geltendem Recht
Daß die Eigenschaftsvereinbarung und nicht die Gebrauchsvereinbarung entscheidend ist, w i r d dadurch bestätigt, daß es Eigenschaften gibt, die keinen speziellen Gebrauch ermöglichen; trotzdem muß, wenn sie entgegen der Vereinbarung fehlen, die Sachmängelhaftung eingreifen. So ist die Farbe eine Eigenschaft, die — wenigstens i n der Regel — keinen besonderen Gebrauch schafft. W i r d ein braunes statt, wie vereinbart, ein blaues Auto geliefert, so kann man nicht davon sprechen, daß der Gebrauch i n irgendeiner Weise beeinträchtigt ist. Ausnahmen sind jedoch denkbar, etwa wenn jemand z. B. ein Fahrzeug m i t der Sicherheitsfarbe orange haben w i l l . Unter dem gleichen Aspekt werden auch die Fälle verständlich, bei denen es darum geht, daß der verkaufte Kunstgegenstand von einem anderen Künstler, als angenommen, herrührt. Das Reichsgericht verfeuchte diese Fälle m i t dem vereinbarten Gebrauch zu begründen 10 und rief damit berechtigte K r i t i k hervor 1 1 . Daß ein Kunstwerk von einem bestimmten Meister stammt, ist sicher eine Eigenschaft des Werkes, doch diese Eigenschaft bewirkt keine besondere Gebrauchsmöglichkeit, genausowenig wie die Farbe eines Gegenstandes. Deshalb läßt sich die Haftung hier nicht m i t einer Gebrauchsvereinbarung begründen, eine solche liegt nicht vor, sondern allein m i t der Eigenschaftsvereinbarung. Der Übergang zwischen dem Fall des vorausgesetzten Gebrauchs und dem Fall des gewöhnlichen Gebrauchs ist fließend. Dies hängt damit zusammen, daß es neben den Grundbegriffen immer engere Spezialbegriffe gibt. Ob jemand einen „Holztisch" kauft oder einen „Tisch aus Holz", ist unerheblich. Ist der gelieferte Tisch aus Metall, so würde i m ersten Fall eine gewöhnliche Eigenschaft fehlen, i m zweiten jedoch eine besonders vereinbarte. M i t Recht hat daher das Gesetz beide Fälle vollkommen gleichgestellt. Daß trotzdem eine Differenzierung vorgenommen wird, ist berechtigt, da sie sich aus der sprachlichen Begriffsbildung ergibt. Ein Spezialbegriff kann niemals alle denkbaren Eigenschaften einer Sache erfassen. Dafür ist dann eine besondere Vereinbarung erforderlich. I m übrigen kommt es nicht selten vor, daß der Käufer von der Kaufsache gerade nicht die gewöhnlichen Eigenschaf10
Vgl. z.B. R G 115, 286ff. Vgl. z . B . Haymann, JW 1932, 1863, Nr. 32. H a y m a n n meint, i n diesen Fällen greife die Gewährleistung ein, w e i l eine vertragliche Vereinbarung, eine Zusicherung gemäß § 459 I I vorliege (S. 1864). Regelmäßig ist dies aber nicht der Fall. H a y m a n n unterstellt hier etwas, u m das gewünschte Ergebnis zu rechtfertigen. Eine Zusicherung w i r d i n den wenigsten Fällen des K u n s t handels vorliegen. Was H a y m a n n richtig erkennt, ist, daß sich diese Fälle n u r m i t einer Eigenschaftsvereinbarung erklären lassen; da er eine Vereinbarung von Eigenschaften außer i m Wege der Zusicherung nicht f ü r möglich hält, muß er i n diesen Fällen eine Zusicherung unterstellen. 11
1. Die Vereinbarung von Eigenschaften
65
ten erwartet, sondern ganz untypische, u. U. den gewöhnlichen konträr entgegengesetzte Eigenschaften. I n diesem Fall kann eine Sachmängelhaftung für die gewöhnlichen Eigenschaften nicht eingreifen. Der Verkäufer haftet nur dafür, daß die Sache die vereinbarten Eigenschaften hat. Begründen läßt sich dieses Ergebnis nur, wenn man eine Eigenschaftvereinbarung anerkennt 1 2 . c) Die Zusicherung von Eigenschaften
I m Falle der Zusicherung w i r d auch von der h. L. eine Vereinbarung über die Eigenschaften angenommen 13 , so daß hier die Begründung der Sachmängelhaftung aus dem Vertrag keine Schwierigkeiten macht. Dahingestellt bleiben soll i m Augenblick noch die Frage, welche A r t von Vereinbarung m i t der Zusicherung entsteht 14 . Eigene Bedeutung hat die Zusicherung neben der Vereinbarung von bestimmten Eigenschaften deshalb, weil sie eine erweiterte Haftung schafft (vgl. § 463). Darin besteht der eigentliche Unterschied zwischen § 459 I und 459 I I 1 5 . Der Entstehungsgrund der Haftung ist jedoch jedesmal die Vereinbarung. d) Gegenüberstellung der Haftungsgruppen (Exkurs: Unternehmenskauf)
Der Rechtsgrund der Haftung ist also i n beiden Fällen gleich. Die unterschiedliche Rechtsfolge erhält ihre Rechtfertigung aus der unterschiedlichen Intensität der Erklärung. Der herrschenden Lehre, die eine Eigenschaftsvereinbarung nur als Zusicherung nach § 459 I I i n Form einer Garantie für möglich hält, § 459 I dagegen als Fall der „echten Gewährleistung" behandelt, gelingt 12 Vgl. Wolff , Ih. Jb. 56, 18 ff. u n d die dort angeführten Beispiele, die gerade unsere These bestätigen. Z. B. erwähnt Wolff den Fall, daß ein baufälliges Haus z u m Abbruch verkauft w i r d . Der gewöhnliche Gebrauch eines Hauses ist, darin zu wohnen. Stellt man nicht auf den Vertrag ab, so würde dem Haus, w e n n es nicht bewohnbar ist, eine Eigenschaft z u m gewöhnlichen Gebrauch fehlen, obwohl die Parteien gerade vereinbart haben, daß die Bewohnbarkeit des Gebäudes nicht Vertragsgegenstand sein soll. Ebenso v. Caemmerer, S. 16, der als Beispiel die Bestellung ungebundener Bücher bringt. 18 Vgl. Wolff , S. 49; Soergel / Siebert / Ballerstedt, § 459 Bern. 20; Larenz I I , § 41 I I c 1. So auch Lobe i n R G R K , 9. Aufl., § 459 A n m . 5 b ; R G 52, 1 ff.; 54, 223; 67, 87. 14 Die h. L. n i m m t eine Garantie an, vgl. dazu V, 4, b. 15 Vgl. Staudinger / Ostler, § 459 Rdz 21 a. E. M i t Recht weist deshalb Weitnauer (Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 6) darauf hin, daß das Fehlen einer durch Zusicherung i m Sinne des § 459 I I erheblich gewordenen Eigenschaft gleichzeitig i m m e r ein Fehler i m Sinne des § 459 I ist (ebenso v. Caemmerer, S. 15 f., 18; Immenga, AcP 171, 17). Unzutreffend deshalb B G H N J W 1970, 653; vgl. dazu weiter i m Text.
5 Herberger
66
I V . Rechtsnatur der Gewährleistung nach geltendem Recht
es — das folgt zwangsläufig aus der dogmatischen Differenzierung — nicht, das Verhältnis der beiden Absätze zueinander befriedigend zu lösen. Auch die Rechtsprechung kann i n diesem Punkt nicht immer überzeugen, w e i l auch sie nicht klar genug sieht, daß § 459 I und § 459 I I auf dem gleichen Rechtsgrund beruhen. Die Unklarheit zeigt sich deutlich bei der Frage, welche Rechte der Käufer beim Unternehmenskauf hat. Die §§ 433 ff. regeln den Kauf von Sachen und Rechten. Sie sind jedoch nach heute einhelliger Ansicht auch anwendbar, wenn ein Unternehmen als eine wirtschaftliche Einheit von Sachen und Rechten aller A r t Gegenstand des Vertrages ist 1 6 . Schwierigkeiten tauchen jedoch auf bei der Anwendung der §§ 459 ff., da die gesetzliche Regelung unmittelbar nur auf körperliche Gegenstände abgestimmt ist. Das zeigt sich nicht nur bei der Regelung des Gefahrübergangs 17 oder der Verjährung 1 8 , sondern auch bei der Haftungsgrundlage des § 459. Rechtsprechung und Literatur wenden zwar überwiegend die §§ 459 ff. entsprechend an, als Haftungsgrundlage w i r d aber regelmäßig nur § 459 I I anerkannt. Nur wenn der Verkäufer eine bestimmte Eigenschaft des Unternehmens zugesichert hat, soll der Käufer Sachmängelansprüche haben 19 . Eine Haftung nach § 459 I w i r d i n der Regel m i t der Begründung verneint, es handele sich bei dem vom Käufer geltend gemachten Umstand (mangelnde Ertragsfähigkeit, Bilanzunrichtigkeit usw.) u m keinen Fehler 2 0 . Dieser Argumentation liegt die Vorstellung zugrunde, daß § 459 I nur für der Sache unmittelbar anhaftende Eigenschaften gelte. Zurückzuführen ist diese Überlegung auf die einseitige 16 R G 63, 57; 67, 86; 68, 54; 70, 220/224; 98, 289/292; 100, 201/203; B G H W M 1970, 819/820; J Z 1969, 336; N J W 1959, 1584/1585; Palandt / Putzo, vor § 459 A n m . 3 d ; Erman / Weitnauer, § 433 Rdz 25; Staudinger / Ostler, § 433 Rdz 29. 17 Übergabe der verkauften Sache bzw. Auslieferung an die Versandperson (§§ 446, 447). 18 Fristbeginn bei beweglichen Sachen m i t der Ablieferung, bei G r u n d stücken m i t der Übergabe. 19 B G H N J W 1970, 653/655; O L G München N J W 1967, 1327; R G J W 1935, 1558; J W 1915, 1117; R G 67, 86 (vgl. aber A n m . 20); 63, 57. Demgegenüber hält B G H N J W 1959, 1584/1585 offenbar auch § 459 I grundsätzlich f ü r anwendbar; ebenso R G 138, 356. Zweifelnd B G H W M 1970, 819/821. Bei einer auf die Z u k u n f t gerichteten Zusicherung, etwa derart, daß andere als die angeführten Schulden nicht vorhanden sind u n d auch nachträglich nicht entstehen werden, n i m m t R G 146, 120/125 ein selbständiges Garantieversprechen an (ebenso O L G München a.a.O. ; Erman / Weitnauer, § 459 Rdz 36; Kuhn i n R G R K , § 459 A n m . 28; Immenga, AcP 171, 2). 20 B G H W M 1974, 51 f.; N J W 1970, 653/655; R G Recht 1910 Nr. 672; J W 1935, 1558; Staudinger / Ostler, § 459 Rdz 24; Soergel / Siebert / Ballerstedt, § 459 Bern. 20; Larenz I I , § 41 I a, S. 35/36. Deutlich k o m m t die Divergenz i n R G 67, 86 f. z u m Ausdruck. Das Reichsgericht lehnt es einerseits ab, die Ertragsfähigkeit als möglichen Fehler i. S. des § 459 I anzuerkennen, andererseits sieht es einen Fehler darin, daß die verkaufte Pension i n W i r k l i c h k e i t ein Absteigequartier war.
1. Die Vereinbarung von Eigenschaften
67
Betonung der Gebrauchstauglichkeit, die den Blick dafür verstellt, daß i m Falle des § 459 I i n Wirklichkeit eine Eigenschaftsvereinbarung vorliegt. Eine ganze Reihe von rechtlich erheblichen Umständen, die ein Unternehmen betreffen, ermöglichen keinen besonderen Gebrauch des Unternehmens, haben also keinen direkten Einfluß auf dessen Tauglichkeit, sind aber dennoch i n dem von der Rechtsprechung geprägten Sinne „Eigenschaften" des Unternehmens, weshalb auch eine Haftung bei Zusicherung dieser Umstände nach § 459 I I bejaht wird. Haben die Parteien bei den Vertragsverhandlungen bestimmte Erklärungen oder Äußerungen über Eigenschaften des Unternehmens abgegeben, so steht die Rechtsprechung vor dem Dilemma, entweder i n diesen Erklärungen eine Zusicherung zu sehen und Schadensersatz zuzubilligen, oder dem Käufer mangels Zusicherung jegliche Ausgleichsansprüche abzusprechen. Dieses „Alles-oder-Nichts"-Prinzip w i r d jedoch der Sachlage nicht gerecht. Sofern man die §§ 459 ff. überhaupt auf den Unternehmenskauf anwendet 2 1 , muß auch § 459 I berücksichtigt werden. Ob und i n Welchem Umfang gehaftet wird, bestimmt sich allein danach, welche Eigenschaften von den Vertragspartnern vereinbart worden sind, und danach, m i t welcher Intensität die Zusage erfolgte. Beim Unternehmenskauf ergeben sich dabei Besonderheiten, die aus dem Kaufgegenstand „Unternehmen" resultieren. M i t dem Begriff „Unternehmen" ist noch so gut wie keine Aussage über bestimmte Eigenschaften getroffen. Jedes Unternehmen ist ein eigenes lebendes Gebilde m i t einem Spektrum verschiedenster Eigenschaften, die nur i h m zukommen. Typische Eigenschaften, die einem „Unternehmen" immanent sind und damit zwangsläufig zum Geschäftsinhalt werden, gibt es wenig 2 2 . Bei einem Unternehmenskauf kann daher eine Haftung für Fehler, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen Gebrauch aufheben oder mindern, regelmäßig nicht i n Betracht kommen 2 3 . Auch kann ein Mangel des Unternehmens nicht schon deshalb angenommen werden, w e i l einzelne zum Vermögen des Unternehmens gehörende Gegenstände mangelhaft sind 2 4 . Dagegen bestehen keine Bedenken, dem Käufer Sachmängelansprüche zu geben, wenn er sich 21 Heck (§ 91, 11) u n d Hoeniger (in Düringer / Hachenburg, § 25 A n m . 14) lehnen die Anwendung der §§ 459 ff., insbesondere m i t Rücksicht auf die ihrer Ansicht nach f ü r den Unternehmenskauf nicht passende Verjährungsvorschrift des § 477, ab. 22 Als typische Eigenschaft könnte m a n etwa den Umstand ansehen, daß das Unternehmen unter Beachtung gesetzlich vorgeschriebener handelsrechtlicher Pflichten geführt wurde. 23 Ebenso Huber, S. 406. 24 I m Einzelfall k a n n sich jedoch etwas anderes ergeben. Vgl. R G 102, 307: Mängel des lebenden Inventars als Mängel des verkauften Rittergutes.
5·
68
I V . Rechtsnatur der Gewährleistung nach geltendem Recht
m i t dem Verkäufer über bestimmte Eigenschaften des Unternehmens geeinigt hat. Eine solche Einigung, die sich z. B. aus der Höhe des Kaufpreises ergeben kann 2 5 , kann eine einfache Eigenschaftsvereinbarung i m Sinne des § 459 I oder eine Zusicherung i m Sinne des § 459 I I m i t der verschärften Haftungsfolge sein. Was i m Einzelfall vereinbart ist, muß durch Auslegung ermittelt werden 2 6 . Wenn deshalb der B G H 2 7 i n einer geringeren als bei Vertragsschluß vorausgesetzten Ertragsfähigkeit eines Unternehmens (oder eines Grundstücks) keinen Mangel i m Sinne des § 459 I sieht, die Ertragsfähigkeit vielmehr nur i m Wege einer Zusicherung (§ 459 II) als verpflichtenden Vertragsbestandteil anerkennen w i l l , so kann dem nicht zugestimmt werden. I n der Überlegung des B G H steckt jedoch ein zutreffender Gesichtspunkt. Die Ertragsfähigkeit läßt sich nicht als gewöhnliche, der verkauften Sache unmittelbar anhaftende Eigenschaft ansehen. Es gibt keine „normale" Ertragsfähigkeit, m i t der der Käufer rechnen darf und die deshalb mit Gegenstand der Erklärung wird. Nur durch zusätzliche (allerdings auch stillschweigend mögliche) Vereinbarung w i r d die Ertragsfähigkeit Vertragsbestandteil. I n der Regel w i r d diese besondere Vereinbarung auf eine Schadenersatzpflicht zielen, also eine Zusicherung beinhalten 2 8 . Das muß jedoch nicht immer sein.
25
Vgl. Huber, S. 407; Flume , S. 189 f. Dabei ist entscheidend, wie der Käufer die Äußerungen des Verkäufers unter Berücksichtigung seines sonstigen Verhaltens und der Umstände, die zum Vertragsschluß geführt haben, nach Treu u n d Glauben m i t Rücksicht auf die Verkehrssitte verstehen durfte ( B G H 59, 160 f ü r die Zusicherung; ebenso B G H W M 1971, 797). 27 N J W 1970, 653/655. Die Ertragskraft w i r d i n ständiger Rechtsprechung als eine Eigenschaft anerkannt, für deren Vorliegen der Verkäufer m i t einer Zusicherung die Haftung übernehmen k a n n (vgl. B G H NJW 1959, 1584/1585; R G Recht 1916 Nr. 216; 1921 Nr. 1331; 1929 Nr. 229; J W 1935, 1558; R G 63, 57; 96, 156; 132, 76/78; 134, 86). Teilweise w i r d jedoch verlangt, daß die A n gaben einen längeren Zeitraum umfassen, da n u r dann eine einigermaßen sichere Beurteilung der Ertragsfähigkeit möglich sei ( B G H N J W 1970, 655; R G J W 1935, 1558; 1915, 1117; abweichend offenbar R G Recht 1914 Nr. 2246). Die Vorlage der Schlußbilanz eines einzelnen Geschäftsjahres reiche nicht aus. B G H W M 1974, 51 geht noch weiter: Da Bilanzen n u r ein M i t t e l seien, u m i n Verbindung m i t anderen Umständen Rückschlüsse auf die Ertragsfähigkeit zuzulassen, kämen die Gewährleistungsvorschriften der §§ 459 ff. für sie nicht i n Betracht. 28 Soweit der Vertrag keiner besonderen F o r m bedarf (vgl. V, A n m . 119), k a n n die Zusicherung auch stillschweigend oder durch konkludentes Handeln erfolgen ( B G H 59, 158; st. Rspr.; Enneccerus / Lehmann, § 108 I I 1 b). Eine Zusicherung k a n n u. U. i n dem beiden Vertragsparteien bekannten V e r w e n dungszweck gesehen werden (BGH W M 1971, 797; 1971, 1121). Die bloße Kenntnis des Verkäufers v o m Verwendungszweck allein reicht aber nicht aus (BGH W M 1971, 797), ebenso nicht die bloße Warenbezeichnung, die Verwendung eines Warenzeichens oder das Bestehen von D i n - N o r m e n (BGH 59, 303, 308 f.; — Butterverunreinigung; 48, 118, 123 — Trevira; NJW 1968, 2238). Ob i n einer Werbung, die Hersteller u n d Händler für M a r k e n a r t i k e l 26
69
1. Die Vereinbarung von Eigenschaften
D i e P a r t e i e n k ö n n e n auch eine einfache E i g e n s c h a f t s v e r e i n b a r u n g ü b e r d i e E r t r a g s f ä h i g k e i t t r e f f e n , so daß § 459 I g i l t 2 9 , n u r m u ß diese V e r e i n b a r u n g eben zusätzlich g e t r o f f e n w e r d e n . E i n e bloße V o r a u s s e t z u n g des K ä u f e r s i m S i n n e e i n e r E r w a r t u n g oder H o f f n u n g r e i c h t n i c h t aus. Entsprechendes g i l t auch f ü r sonstige „ E i g e n s c h a f t e n " des U n t e r n e h m e n s 3 0 , w o b e i es gerade b e i m U n t e r n e h m e n s k a u f w i c h t i g ist, als E l e m e n t der V e r p f l i c h t u n g d i e Eigenschaft z u sehen u n d n i c h t , w i e das Gesetz f o r m u l i e r t , d i e G e b r a u c h s t a u g l i c h k e i t , w e i l — das w u r d e o b e n schon b e t o n t — es U n t e r n e h m e n s e i g e n s c h a f t e n g i b t , die k e i n e n besonderen Gebrauch ermöglichen. E i n besonderer garantie.
F a l l der Eigenschaftsvereinbarung
ist die
Bilanz-
D u r c h d i e B e z u g n a h m e auf d i e B i l a n z w e r d e n d i e d a r i n aus-
gewiesenen A k t i v a u n d Passiva i n i h r e m B e s t a n d als U n t e r n e h m e n s eigenschaften zugesichert (§ 459 I I ) 3 1 . D i e Z u s i c h e r u n g k a n n sich zusätzlich auf die vorgenommenen Bewertungen beziehen32. A u c h ohne be-
u n d deren Qualität betreiben, eine Zusicherung von Eigenschaften gesehen werden kann, hängt v o m Einzelfall ab ( B G H 48, 118, 123 f. — Trevira). 29 Wie hier Putzo, i n A n m . zu B G H N J W 1970, 653; Erman ! Weitnauer, vor § 459 Rdz. 6; Immenga, A c P 171, 1 ff., 17; abweichend Huber, S. 412 F N 63. 30 A l s Eigenschaften des Unternehmens, die auf G r u n d Vereinbarung zu einer Sachmängelhaftung führen können, kommen neben der Ertragsfähigkeit i n Betracht: Schuldenfreiheit bzw. Schuldenstand i n bestimmter Höhe (vgl. R G 100, 201, 204; 146, 120, 125), der Kundenkreis (RG J W 1915, 1117; R G Recht 1914 Nr. 2246), die Fabrikate des Unternehmens (RG Recht a.a.O.), aber auch der Umsatz (RG J W 1915, 1117; R G Recht a.a.O.), w e i l die M i t t e i l u n g darüber, einen Maßstab „ f ü r die Beurteilung der A r t , des Umfangs u n d allgemein des Wertes des Geschäftes" gibt (RG J W 1915, 506). Wenn demgegenüber der B G H (NJW 1970, 653, 655) i n dem Umsatz keine Eigenschaft sieht, w e i l der Höhe der Warenumsätze nach A r t u n d Umfang des jeweiligen Unternehmens durchaus verschiedene Bedeutung zukomme u n d sich der Reinertrag erst aus den wesentlichen Kostenfaktoren zuverlässig ermitteln lasse, so k a n n dem nicht zugestimmt werden. F ü r den B G H hat der Umsatz offensichtlich n u r Bedeutung als ein Faktor, der Rückschlüsse auf die E r tragskraft zuläßt. Der Umsatz ist aber nicht n u r relevant f ü r die Frage der Ertragsfähigkeit, sondern beispielsweise auch für die Stellung des U n t e r nehmens i m Marktgeschehen. E r ist daher durchaus i n der Lage, unabhängig von der Ertragsseite ein Unternehmen i n einem wesentlichen P u n k t zu kennzeichnen (ebenso Putzo, i n A n m . zu B G H N J W 1970, 653; Larenz I I , § 41,1 b). 81 Die Eigenschaften des Unternehmens ergeben sich also mittelbar aus der Bilanz (vgl. B G H W M 1970, 819, 821). Die Vorlage unrichtiger Bilanzen ist regelmäßig kein F a l l einer falschen Auskunftserteilung, da keine selbständige darauf gerichtete Nebenverpflichtung besteht ( B G H a.a.O.); anders aber B G H W M 1974, 51 f., vgl. dazu A n m . 33 u n d V, A n m . 173. 82 Die Bedenken des B G H ( W M 1970, 821), es sei fraglich, ob unrichtige Bewertungen überhaupt einen Sachmangel darstellen können, w e i l der Wert einer Sache keine i h r innewohnende Eigenschaft sei, erscheinen nicht berechtigt, wenn der Verkäufer zusagt, daß die Bilanz nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung errichtet worden ist, w e i l die Bewertung sich innerhalb des gesetzlich abgesteckten Spielraums halten muß, i n diesem
70
I V . Rechtsnatur der Gewährleistung nach geltendem Recht
sondere Garantieübernahme kann es durch die Vorlage von Bilanzen zu einer verbindlichen Vereinbarung über den i n den Bilanzen ausgewiesenen Bestand an A k t i v a und Passiva kommen 3 3 . Es liegt dann eine Eigenschaftsvereinbarung nach § 459 I vor. Gegen die Übertragung dieser Grundsätze auf den Kauf von Gesellschaftsanteilen, der sich nicht gleichzeitig als Unternehmenskauf darstellt 3 4 , bestehen Bedenken nur insofern, als der Kauf von GesellUmfang also objektiviert u n d damit auf ihre Richtigkeit nachprüfbar ist. So f ü h r t der B G H W M 1974, 51, 52 — allerdings für eine Haftung aus c. i. c. — zutreffend aus, es komme darauf an, welche A u f k l ä r u n g aus den überreichten Bilanzen erwartet werden dürfe, insbesondere was üblicherweise Bilanzinhalt sei u n d welche Bilanzangaben üblicherweise einer zusätzlichen E r l ä u terung außerhalb der Bilanz bedürften. Das muß auch f ü r die Bewertungen gelten. 33 Ebenso Hub er, S. 409 ff. Nicht zugestimmt werden k a n n daher B G H W M 1974, 51 f.: I m Vertrauen auf vorgelegte Bilanzen f ü r f ü n f aufeinander folgende Jahre hatte die K l ä g e r i n das Unternehmen des Beklagten gekauft. Eine Haftung f ü r Sachmängel w a r ausgeschlossen worden. Später stellten sich verschiedene Angaben u n d damit auch die Gewinnzahlen als unzutreffend heraus. Der B G H f ü h r t aus: Die §§ 459 ff. kämen nicht i n Betracht, da die Bilanzen n u r ein M i t t e l seien, u m i n Verbindung m i t anderen Umständen Schlüsse auf die Ertragsfähigkeit zuzulassen. Der Verkäufer habe jedoch Auskünfte i n F o r m von Bilanzen erteilt. F ü r unrichtige u n d manipulierte Bilanzen hafte er wegen Verschuldens bei den Vertragsverhandlungen (c. i. c.). Dieser Anspruch aus Verletzung einer Nebenpflicht verjähre nicht nach § 477, sondern nach § 195. Wie schon das O L G H a m b u r g M D R 1973, 496 i n einer anderen Entscheidung (vgl. dazu V, A n m . 177) versucht auch der B G H den vertraglichen A u s schluß der Sachmängelhaftung durch Bejahung einer H a f t u n g aus c. i. c. zu überspielen. Dadurch k a n n gleichzeitig auch der für den Unternehmenskauf nicht passenden (vgl. A n m . 36) Verjährungsvorschrift des § 477 ausgewichen werden. Das mag zwar i m Einzelfall b i l l i g sein. Trotzdem k a n n dieser Ansicht nicht gefolgt werden, einmal aus systematischen Erwägungen u n d z u m anderen aus Gründen der Rechtssicherheit. M i t der Vorlage v o n B i l a n zen macht der Verkäufer Angaben über die Beschaffenheit des Unternehmens. Diese Angaben werden Geschäftsinhalt u n d führen, w e n n das U n t e r nehmen davon abweichende negative Eigenschaften hat, zu einer H a f t u n g nach §§ 459 ff. F ü r eine H a f t u n g aus c. i. c. ist daneben k e i n Raum, vgl. dazu V, A n m . 173. 34 Während das Reichsgericht ursprünglich auch bei V e r k a u f aller Gesellschaftsanteile das Unternehmen der Gesellschaft nicht als Vertragsgegenstand ansah u n d deshalb auch eine entsprechende A n w e n d u n g der Sachmängelhaftung ablehnte (RG 86, 146), vertrat es später die Ansicht, daß darin auch eine Veräußerung des Unternehmens zu sehen sei; §§ 459 ff. kämen deshalb entsprechend zur Anwendung. I n seinen früheren Entscheidungen stellt das Reichsgericht dabei allein auf den I n h a l t des jeweiligen Vertrages ab (vgl. R G 98, 289, 292; 100, 200, 204). Später betont es stärker die objektive Seite durch Berücksichtigung der Verkehrsauffassung (RG 120, 283, 287; 122, 378, 381). Der Bundesgerichtshof folgt dem Reichsgericht, wobei er die subjektive Seite f ü r entscheidend hält: „Maßgebend ist aber, daß sie die beherrschende Stellung auch i n diesen beiden Unternehmen erlangte u n d daß der Wille der Parteien auch insoweit auf einen Verkauf gerichtet war." (Vgl. B G H W M 1970, 819, 821; auch schon B G H J Z 1969, 336; ähnlich O L G München N J W 1967, 1327, das i m Zweifel nach der Auffassung des Geschäftsverkehrs entscheiden w i l l ) . V o n der L i t e r a t u r w i r d diese Rechtsprechung
71
1. Die Vereinbarung von Eigenschaften
schaftsanteilen R e c h t s k a u f ist, d i e S a c h m ä n g e l v o r s c h r i f t e n aber f ü r d e n S a c h k a u f gelten. A u s dieser r e c h t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n f o l g t
zunächst,
daß d e r V e r k ä u f e r v o n B e t e i l i g u n g e n f ü r n e g a t i v e E i g e n s c h a f t e n des v o n d e r Gesellschaft b e t r i e b e n e n U n t e r n e h m e n s n i c h t h a f t e t 3 5 . W e r d e n d i e Gesellschaftsanteile j e d o c h als A n t e i l e eines U n t e r n e h m e n s besond e r e r Beschaffenheit v e r k a u f t , d a n n k a n n d e r U m s t a n d , daß es sich f o r m a l u m einen Rechtskauf handelt, einer A n w e n d u n g der Sachmäng e l h a f t u n g n i c h t entgegenstehen. Rechtsprechung u n d L i t e r a t u r
wen-
d e n a u f d e n K a u f a l l e r oder fast a l l e r Gesellschaftsanteile, o b w o h l es sich f o r m a l u m e i n e n R e c h t s k a u f h a n d e l t , m i t d e r H i l f s f i g u r des U n t e r n e h m e n s k a u f es die §§ 459 f f . entsprechend an. F ü r d e n K a u f e i n z e l n e r Gesellschaftsanteile k a n n aber nichts anderes gelten, w e n n d i e P a r t e i e n b e s t i m m t e Eigenschaften des U n t e r n e h m e n s , a n d e m d i e B e t e i l i g u n g e n bestehen, z u m G e s c h ä f t s i n h a l t erheben. A u c h h i e r i s t eine A n w e n d u n g der Gewährleistungsvorschriften unterschiedliche
Behandlung
des
sachgerecht 3 6 . V o r Kaufes
einzelner
allem führt gegenüber
eine dem
heute allgemein anerkannt (Kuhn, i n R G R K § 459 A n m . 16; § 433 A n m . 130; § 437 A n m . 9; Soergel / Siebert / Ballerstedt, § 433 Bern. 37; Staudinger / Ostler, § 433 Rdz 31; Erman / Weitnauer, § 433 Rdz 25; Larenz I I , § 45 I, S. 117). Werden nicht alle Gesellschaftsanteile verkauft, so soll d a r i n ein U n t e r nehmenskauf dann liegen, w e n n der fehlende Bruchteil nicht ins Gewicht fällt, der Erwerber also m i t den erworbenen Anteilen die absolute H e r r schaft über das Unternehmen erlangt u n d wirtschaftlich das Unternehmen übertragen werden soll (so B G H W M 1970, 819, 821: fehlende Anteile 0,2 u n d 0,25%; Staudinger / Ostler, a.a.O.; Larenz, a.a.O.; Erman / Weitnauer, a.a.O.; Wiedemann, S. 830 ff.). Demgegenüber w i r d von einem T e i l der Rechtsprechung u n d L i t e r a t u r jede Ausdehnung der Grundsätze über den Unternehmenskauf auf einen Erwerb, der nicht alle Gesellschaftsanteile erfaßt, abgelehnt (so R G DR 1944, 485; R G L Z 1929, 396; L Z 1929, 481 f.; Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 16; § 437 A n m . 9; Schilling, i n Hachenburg, A n m . 8 zu A n h nach § 13; Enneccerus / Lehmann, § 108 I V 2). Der Umstand, daß auf der Verkäufer- oder Erwerberseite mehrere Personen beteiligt sind, soll i m Einzelfall einem Unternehmenskauf nicht entgegenstehen, sofern n u r der Verkauf bis auf etwaige Splitterbeteiligungen alle Anteile erfaßt u n d sich als ein einheitlicher A k t darstellt, was sich etwa daran zeigen kann, daß ein einheitlicher Kaufvertrag besteht (vgl. R G 98, 289, 292; 120, 283, 287; 122, 378, 381; Soergel ! Siebert ! Ballerstedt, § 433 Bern. 37; noch strenger R G L Z 1929 Sp. 396; R G 100, 200, 204; 122, 348). 35 R G 59, 240; 86, 146; 100, 200; 122, 378, 380; R G L Z 1929 Sp. 396, 398; Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 16; Larenz I I , § 45 I ; Enneccerus / Lehmann, § 108 I V 2; Wiedemann, S. 815, 829. 36 Ebenso O L G München N J W 1967, 1327; Palandt / Putzo, v o r § 459 A n m . 3 e; Huber, S. 412 ff.; Heck, § 91, 7; Flume, S. 187 ff.; Erman / Weitnauer, v o r § 459 Rdz 1. Problematisch ist nur, ob sich alle Sachmängelvorschriften sinnvoll auf den Unternehmenskauf bzw. den K a u f von einzelnen Beteiligungen übertragen lassen. Nach der Ansicht v o n Huber müssen die einzelnen Normen d a r aufhin untersucht werden, ob die Voraussetzungen f ü r eine Analogie v o r l i e gen. Huber bejaht eine analoge Anwendung der Minderungsvorschriften, gibt auch den kleinen Schadenersatzanspruch nach § 459 I I i. V. m. § 463, lehnt jedoch grundsätzlich ein Recht auf Wandlung u n d dementsprechend
72 Kauf
I V . Rechtsnatur der Gewährleistung nach geltendem Recht aller
Anteile
z u sachfremden
Differenzierungen
37
.
Auch
beim
K a u f v o n Gesellschaftsanteilen i s t also eine einfache E i g e n s c h a f t s v e r e i n b a r u n g m i t d e r H a f t u n g s f o l g e des § 459 I b z w . eine Z u s i c h e r u n g v o n Eigenschaften m i t der H a f t u n g s f o l g e nach § 459 I I m ö g l i c h . Es k a n n d a m i t festgestellt w e r d e n , daß a l l e d r e i F ä l l e der S a c h m ä n g e l h a f t u n g sich a u f eine v e r t r a g l i c h e V e r e i n b a r u n g g r ü n d e n . D i e H a f t u n g t r i t t e i n , w e i l d i e Sache n i c h t d i e Eigenschaften h a t , die sie n a c h d e m V e r t r a g h a b e n soll. D a m i t i s t d i e F r a g e n a c h d e m R e c h t s g r u n d d e r G e w ä h r l e i s t u n g b e f r i e d i g e n d b e a n t w o r t e t . D i e G e w ä h r l e i s t u n g ist eine S a n k t i o n f ü r n i c h t g e h ö r i g e V e r t r a g s e r f ü l l u n g . auch den großen Schadenersatzanspruch aus § 463 ab, m i t der Begründung, daß ein Recht auf Rückgängigmachung des ganzen Kaufvertrages zu w e i t gehend sei i n Fällen, i n denen sich lediglich die vertraglich fixierte Berechnungsgrundlage f ü r den Kaufpreis nachträglich ändere. N u r w e n n der E r werb infolge der Abweichung der w i r k l i c h e n von der vereinbarten Beschaffenheit des Unternehmens f ü r den Käufer kein Interesse mehr habe, könne m a n die Wandlung u n d den großen Schadenersatzanspruch zubilligen. Die Verjährungsvorschrift des § 477 hält Hub er für unanwendbar, soweit es sich nicht u m Mängel a m sachlichen Substrat des Unternehmens, sondern u m Mängel des Unternehmens als solchem handelt. F ü r die Fälle der Bilanzgarantie, Ertragsgarantie oder der Garantie eines bestimmten Schuldenstandes passe § 477 nicht. (Gegen die Anwendung des § 477 auch schon Heck u n d Hoeniger, vgl. A n m . 21; Enneccerus / Lehmann, § 108 I V 1.) Die Rechtsprechung (OLG München N J W 1967, 1327; R G 63, 57; 98, 289, 292; 100, 201, 203; 138, 354; 146, 121; RG J W 1935, 1558) u n d ein Teil der L i t e r a t u r (Palandt / Putzo, § 477 A n m . 2 a; Erman / Weitnauer, § 477 Rdz 6) wenden § 477 an. Es ist Hub er zuzugeben, daß i n den genannten Fällen eine sechsmonatige V e r j ä h r u n g nicht paßt, w e i l sich i n der Regel erst nach A b l a u f dieser Frist feststellen läßt, ob das Unternehmen tatsächlich die zugesagte Ertragskraft, den zugesagten Bestand an A k t i v e n und Passiven hat. § 477 ist auf körperliche Gegenstände zugeschnitten, die nach der Ablieferung untersucht w e r den können. Andererseits k a n n aber nicht geleugnet werden, daß der § 477 zugrunde liegende Gedanke der Rechtssicherheit beim Unternehmenskauf nicht weniger als sonst zutreffend ist, zumal ein Unternehmen sich innerhalb kurzer Zeit vollkommen i n seinem Wesen verändern k a n n (so m i t Recht R G 138, 354, 358). Weder die Sechsmonatsfrist des § 477 noch die dreißigjährige V e r j ä h r u n g sind i n diesen Fällen angemessen. Wenn Flume, S. 190, v o r schlägt, daß i m Einzelfall die Verjährungsfrist v o m Richter danach zu bemessen ist, w a n n der Mangel v o m Käufer abstrakt bei Anwendung jeder Sorgfalt entdeckt u n d geltend gemacht werden konnte, so mag das zwar eine billige Lösung sein, sie ist jedoch v o m Gesetz nicht gedeckt. Als Ausweg bietet sich i m Einzelfall n u r eine genaue Prüfung der Frage an, ob nicht eine stillschweigende vertragliche Verlängerung der Verjährungsfrist nach § 477 I 2 erfolgt ist (vgl. B G H W M 1971, 798). 37 Macht der Verkäufer von Gesellschaftsanteilen verbindliche Zusagen über die Beschaffenheit des Unternehmens, an dem die Beteiligungen bestehen, so würde beim Verkauf aller Anteile ( = Verkauf des Unternehmens) der Anspruch des Käufers als Gewährleistungsanspruch nach § 477 i n sechs Monaten verjähren, während der Käufer beim Verkauf n u r einzelner Gesellschaftsanteile einen Anspruch aus Garantievertrag hätte (RG 56, 255, 256; 59, 241; 63, 58; 100, 200; 109, 295; 122, 378; 171, 91; R G L Z 1929 Sp. 396, 399; L Z 1929 Sp. 481, 482; RG DR 1944, 485, 486; Kuhn, i n R G R K , § 437 A n m . 9; Wiedemann, S. 829), der erst i n 30 Jahren v e r j ä h r t (RG 100, 200, 204).
1. Die Vereinbarung von Eigenschaften
73
Ein weiteres Beispiel soll zeigen, daß nur diese Begründung i n der Lage ist, alle Fälle der Sachmängelhaftung zu erklären. Verkauft A dem Β ein wertvolles Kunstwerk als Werk eines ganz bestimmten Künstlers, stellt sich jedoch später heraus, daß es die A r beit eines anderen, ebenso berühmten Künstlers ist, der Wert deshalb gleich hoch ist, dann vermag der Gedanke der Äquivalenz, m i t dem die h. L. argumentiert 3 8 , die Sachmängelhaftung nicht zu erklären. Denn dann besteht keinerlei Äquivalenzstörung, die m i t der Sachmängelhaftung auszugleichen wäre. Trotzdem erscheint es auch i n diesen Fällen richtig, daß der Verkäufer haftet, wenn er verbindlich behauptet hat, das Werk stamme von dem bestimmten Künstler. § 459 I 2 steht hier nicht entgegen. Zwar besteht kein Minderwert, doch weicht die Sache i n ihrer Eigenschaft (gemalt von Künstler Y) erheblich von der vereinbarten Eigenschaft (gemalt von Künstler X) ab. Von einer nur „unerheblichen Minderung der Tauglichkeit" kann also keine Rede sein. Welche Eigenschaft bzw. welche Gebrauchstauglichkeit erheblich ist, bestimmt sich nach den Erklärungen der Parteien. Da kein Minderwert vorliegt, kommt als Rechtsbehelf — das folgt aus der Natur der Sache — nur die Wandlung i n Betracht, i m Falle der Zusicherung ein A n spruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung, nicht aber die Minderung. Das gewonnene Ergebnis, Rückabwicklung des Kaufes, ist gerecht. Wer ein B i l d eines bestimmten Malers w i l l , dem soll nicht ein B i l d eines anderen Malers aufgedrängt werden. A u f die Irrtumsproblematik des § 119 I I kann an dieser Stelle nur hingewiesen werden. Ohne näheres Eingehen darauf, ob § 119 I I hier überhaupt Anwendung finden kann, muß doch betont werden, daß eine Lösung über diese Norm nicht befriedigen könnte, da der Käufer gemäß § 122 zum Schadensersatz verpflichtet wäre. e) Die Sachmängelhaftung als dispositives Recht und das Verständnis des § 460
M i t dem gewonnenen Ergebnis läßt sich auch erklären, warum die Sachmängelhaftung mit Ausnahme des § 476 dispositives Recht ist 3 9 . Die Gewährleistung hat ihren Rechtsgrund i n dem Vertrag. Daher ist es selbstverständlich, daß die Haftung durch Vertrag erweitert oder eingeschränkt werden kann. § 476 beschränkt diese Möglichkeit nur soweit, als es zum Schutz des Käufers unbedingt erforderlich ist. Für die h. L. muß der dispositive Charakter der Sachmängelhaftung systemwidrig sein. Denn dient die Sachmängelhaftung einem gerade durch das 38
Vgl. Süß, S. 129 f., 211; Larenz I I , § 41 I I e; Raape, S. 484, 490 f. Vgl. Staudinger / Ostler, vor § 459 Rdz 7; Soergel / Siebert / Ballerstedt, vor § 459 Bern. 22, 24; Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 459 Anm. 2. 39
74
IV.
echtsnatur der Gewährleistung nach geltendem Recht
Gesetz normierten Ausgleich, so kann dieser Ausgleich nicht der Disposition der Parteien unterstehen. Auch § 460 Satz 1 w i r d m i t der vertretenen Ansicht verständlich 40 . Kennt der Käufer beim Kauf einer Spezies den Mangel, so ist seine Erklärung unter objektiven Gesichtspunkten für den Verkäufer nur so zu verstehen, daß er die Sache so kauft, wie sie ist, nämlich fehlerhaft. Die Vereinbarung geht also über die fehlerhafte Sache 41 . Gewährleistung ist ausgeschlossen. Gleiches gilt für § 460 S. 2. Auch hier kann der Verkäufer die Erklärung des Käufers nur dahin verstehen, daß dieser die Sache m i t dem Fehler kaufen wolle. Der Verkäufer n i m m t nämlich berechtigterweise an, der Käufer habe den Mangel entdeckt, was jedoch i n Wirklichkeit infolge der groben Fahrlässigkeit des Käufers nicht der Fall ist. Hat der Verkäufer jedoch die fehlende Eigenschaft zugesichert bzw. den Mangel arglistig verschwiegen, so kann er sich nicht mehr auf die Erklärung des Käufers, wie sie objektiv zu verstehen war, berufen, weil er m i t der Zusicherung einen neuen Haftungstatbestand geschaffen hat bzw. w e i l er i m Falle des arglistigen Verschweigens sich damit i n Widerspruch zu seiner eigenen Handlungsweise stellen würde. Denn die Erklärung des Käufers erfolgte nur deshalb so, w e i l der Verkäufer den Fehler arglistig verschwieg. Wer einen anderen durch arglistiges Verschweigen zur Abgabe einer Erklärung bewegt, kann sich nicht auf diese berufen. Das Verschweigen bezieht sich nur speziell auf den Fehler, die Folge ist daher, daß der Verkäufer daran gehindert ist, sich auf den durch die grobe Fahrlässigkeit bedingten Haftungsausschluß zu berufen. 2. D i e Gewährleistung u n d die Leistungspflicht
M i t der Feststellung, daß die Gewährleistung auch beim Spezieskauf ihren Rechtsgrund i m Vertrag hat, ist zwar ein erster Schritt zu einem neuen Gewährleistungsverständnis getan, doch zu lösen bleibt noch die wichtige Frage nach dem begrifflichen Verhältnis der Gewährleistung zu den vertraglichen Pflichten, insbesondere zur Leistungspflicht. Wenn heute schon weitgehend von der h. L. zugegeben wird, daß die Gewährleistung auch auf dem Vertrag beruht 4 2 , so w i r d doch energisch bestritten, daß sie auf eine Leistungspflicht zurückgeht 43 . 40 Häufig w i r d die Regelung des § 460 als nicht besonders glücklich angesehen, vgl. Süß, S. 63; Erman, JZ 1960, 43. 41 Ä h n l i c h Lobe, i n R G R K 9. Aufl., § 459 A n m . 3 A : Der Käufer habe von vornherein die Absicht gehabt, eine mangelhafte Sache zu erwerben, w e n n er den Mangel kannte. Diese Formulierung ist etwas mißverständlich. Es k o m m t nicht auf die einseitige Absicht an, sondern auf die Vereinbarung. 42 Vgl. die unter I I Anm. 61, 62 genannte Literatur. 43 Vgl. Soergel / Siebert / Ballerstedt, vor § 459 Bern. 10, 11, 13; Larenz I I , § 41 I I e; Raape, S. 482, 484; Flume, S. 35, 36, 41; Enneccerus / Lehmann,
1. Die Vereinbarung von Eigenschaften
75
Die Hypothese, auf der diese Ansicht basiert, nämlich, daß neben der Bestimmung der konkreten Sache eine Eigenschaft nicht vereinbart werden könne, wurde bereits widerlegt 4 4 . I n allen Fällen, die zu einer Gewährleistung führen, liegt eine Vereinbarung über die Eigenschaft vor 4 5 . Die Sachmängelhaftung t r i t t gerade deshalb ein, w e i l eine Sache ohne die vereinbarten Eigenschaften geleistet wurde. Damit drängt sich der Schluß auf, daß die Gewährleistung eingreift, w e i l der Leistungspflicht nicht voll Genüge getan wurde. Unrichtig wäre diese Folgerung nur dann, wenn andere Überlegungen aus der Gesetzessystematik heraus diesem Ergebnis widersprechen würden. Es ist daher eine Auseinandersetzung m i t den Überlegungen erforderlich, die es nach h. L. unmöglich erscheinen lassen, daß sich die Leistungspflicht beim Spezieskauf auch auf die Eigenschaften erstreckt. a) Das Fehlen einer Herstellungspflicht bzw. eines Mängelbeseitigungsanspruchs beim Spezieskauf
Als Hauptargument gegen die Annahme einer Leistungspflicht, die sich auf die Mängelfreiheit erstreckt, w i r d von der h. L. unter Hinweis auf die Motive und Protokolle 4 6 angeführt, es bestehe beim Spezieskauf, von seltenen Ausnahmefällen abgesehen 47 , kein Herstellungs- oder Mängelbeseitigungsanspruch. Ein solcher müsse aber vom Gesetz statuiert sein, wolle man einen Leistungsanspruch auch bezüglich der Sacheigenschaften bejahen 48 . Der Vertrag gehe über eine konkrete Sache. Der Verkäufer könne daher nur m i t dieser Sache erfüllen. Nehme man an, daß die Leistungspflicht auch die Mängelfreiheit m i t einschließe, so müsse der Verkäufer, u m seiner Pflicht nachzukommen, i m Falle eines Mangels zur Beseitigung verpflichtet sein. Es ist richtig, daß der Verkäufer nach der dispositiven Regelung des BGB nicht zur Mängelbeseitigung verpflichtet ist 4 9 . Daraus folgt aber § 108 I ; Esser, § 64 I, anders noch i n der 2. A u f l . § 105,1; Planck / Knoke, § 459 A n m . 1 c; Süß, S. 37; Busbach, S. 48; Fikentscher, § 70 I X 1 u n d I 1; ähnlich Schniewind, S. 55, 56, der eine generelle Garantiepflicht annimmt. 44 Vgl. I I I , 3, e. 45 Vgl. I V , 1. 48 Vgl. Prot. I, S. 697, 698; Mot. I I , S. 227. 47 Vgl. R G 52, 357; 61, 92 ff.; 87, 337. 48 Vgl. Soergel / Siebert / Ballerstedt, vor § 459 Bern. 13 u n d Festschrift Nipperdey, S. 262; Larenz I I , § 41 I I e; Raape, S. 487; Düringer / Hachenburg / Hoeniger V 1, Einl. A n m . 114, 115; Medicus, Festschrift Kern, S. 316; Busbach, S. 49; Süß, S. 59. 49 Unbenommen ist dem Verkäufer das Recht, v o r Übergabe die Sache auszubessern, u m damit der H a f t u n g zu entgehen, vgl. Palandt / Putzo, § 459 A n m . 1; Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 11; Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 459 A n m . 3 Β 1 a. Der Käufer k a n n also nicht Übergabe der mangelhaften Sache verlangen, u m sich die Gewährleistung zu sichern.
76
I V . Rechtsnatur der Gewährleistung nach geltendem Recht
nicht, daß eine Leistungspflicht hinsichtlich der Beschaffenheit der Sache nicht besteht 50 . Zunächst ist festzustellen, daß den Verkäufer keine Herstellung sp flicht trifft. Aus seiner vertraglichen Pflicht, eine mangelfreie Sache zu leisten, ergibt sich diese nicht. Die Kaufvertragsschuld geht nicht auf eine Tätigkeit, sondern auf Leistung eines Gegenstandes 51 . Natürlich ist es möglich, daß der Gesetzgeber einen Beseitigungsanspruch normiert, doch ist dieser nicht notwendige Folge eines Leistungsanspruchs, so daß sein Fehlen keinen Rückschluß zuläßt. Beim Kauf hat das Fehlen eines derartigen Anspruchs seine guten Gründe. Es erschien dem Gesetzgeber 52 nicht sinnvoll, dem Verkäufer die Nachbesserungslast aufzubürden. I n vielen Fällen fehlt es i h m an den nötigen Möglichkeiten dazu 53 . I m Sinne einer einheitlichen Regelung wurde daher generell keine Nachbesserungspflicht normiert. Die Argumentation der h. L. geht fehl. Das Bestehen einer Leistungspflicht hat, wie dargelegt, nicht zwingend zur Folge, daß ein Mängelbeseitigungsanspruch existieren muß. Es ist genauso gut denkbar, daß das Gesetz eine andere Folge normiert. Gerade das ist der Fall. Die Gewährleistung ist die vom Gesetz angeordnete Folge für die nicht gehörige Erfüllung der Leistungspflicht 54 . Der Schluß der h. L., weil eine bestimmte Folge, der Mängelbeseitigungsanspruch, nicht vorliege, könne auch keine Leistungspflicht bezüglich der Eigenschaften bestehen, ist ein Trugschluß, weil unterstellt wird, daß nur diese eine Folge denkbar ist, nicht aber auch eine andere. I n Wirklichkeit aber bestimmt das Gesetz gerade eine andere Folge: die Sachmängelhaftung. Unter Anwendung der Logik der h. L. bestätigt das Vorliegen dieser Folge, daß auch eine Leistungspflicht hinsichtlich der Eigenschaften besteht. I m übrigen bestreitet wohl niemand, daß der Verkäufer die Verpflichtung zur Beseitigung etwaiger Mängel übernehmen kann. Gedanklich setzt eine derartige Vereinbarung voraus, daß eine Verpflichtung zu mangelfreier Leistung möglich ist, denn i n der Mängelbeseitigungsabrede liegt nur die Vereinbarung einer be-
50 So auch Staudinger I Ostler, vor § 459 Rdz 9; Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 3; Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 459 A n m . 3 Β I a u n d 2; Titze, J W 1927, 2964; Graue, S. 211, 288; so auch Flume, S. 35; Flume verneint eine Leistungspflicht hinsichtlich der Eigenschaften, hält jedoch auch das fragliche A r g u ment nicht f ü r stichhaltig. 51 Vgl. Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 11. 52 Vgl. Mot. I I , S. 227 u n d Prot. I, S. 698. 53 Es k a n n zwar Graue, S. 276, nicht widersprochen werden, daß heute oft die Nachbesserung möglich ist, doch m i t Rücksicht auf die Fälle, bei denen das nicht zutrifft, erscheint die geltende Regelung sinnvoll. 54 So auch Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 3.
1. Die Vereinbarung von Eigenschaften
77
sonderen Rechtsfolge, die bei nicht gehöriger Erfüllung der vereinbarten Verpflichtung eingreifen soll. Das Fehlen eines Mängelbeseitigungsanspruchs beim Spezieskauf ist also nicht, wie die h. L. annimmt, geeignet, eine aus der Vereinbarung resultierende Leistungspflicht über die Eigenschaften zu widerlegen. b) Das Fehlen einer gesetzlichen Norm, die den Leistungsanspruch festlegt
Als weiteres Argument führt die h. L. an, das Gesetz bestimme an keiner Stelle, daß der Verkäufer verpflichtet sei, die Sache mangelfrei zu leisten 55 . I n § 433 I, der die Pflichten des Verkäufers festlege, sei keine Rede davon 5 6 . Schlüssig ist diese Ansicht, wenn eine Vereinbarung über die Eigenschaften nicht für möglich gehalten w i r d ; denn fehlt eine Vereinbarung, so läßt sich die Verpflichtung nicht aus dem Vertrag begründen, sie kann sich dann nur aus dem Gesetz ergeben. Nun wurde aber bereits darauf hingewiesen, daß sich die Vereinbarung auf die Eigenschaften erstreckt. Liegt eine Vereinbarung vor, so folgt die Verpflichtung aus dieser. Eine besondere gesetzliche Bestimmung ist unnötig und hat, wenn sie vorliegt, nur deklaratorische Bedeutung. Inkonsequent ist deshalb Flume, der zwar eine Vereinbarung über die Eigenschaften für möglich hält 5 7 , aber trotzdem bei Vorliegen einer Vereinbarung eine entsprechende Leistungspflicht leugnet. Auch Flume geht davon aus, daß die Parteien die Leistung einer fehlerfreien Sache vereinbaren 58 . Jedoch habe diese Vereinbarung nicht zur Folge, daß eine entsprechende Leistungspflicht entstehe, vielmehr greife die Rechtsordnung i n die Vereinbarung ein und bestimme anstelle der vereinbarten Rechtsfolge eine andere Rechtsfolge, die Gewährleistung 59 . Dieser Eingriff erfolge, u m den Verkäufer zu entlasten 60 . Der Verkäufer sei nicht verpflichtet, eine mangelfreie Sache zu leisten 61 . Eine solche Pflicht sei nirgends statuiert 6 2 . Aus § 433 folge lediglich die Pflicht, die Sache i n dem Zustand zu übergeben, i n dem sie sich bei Vertragsschluß befindet 6 3 . A u f Grund der vertraglichen Vereinbar 55 58 57 58 59 60 61 62 63
Flume, S. 39; Oertmann, § 433 A n m . 2 a. Busbach, S. 50; Oertmann, S. 356. Flume, S. 17 ff. u n d A T § 24, 2 b, S. 477. Vgl. dazu I V , 1. Vgl. Flume, S. 48, 52. S. 48. S. 35 f., 39, 41, 48. S. 35 f. S. 39.
78
I V . Rechtsnatur der Gewährleistung nach geltendem Recht
rung habe der Verkäufer eine fehlerfreie Sache versprochen, insoweit stelle die Leistung einer mangelhaften Sache einen Vertragsbruch, eine Nichterfüllung des Vertrages dar 6 4 , ob jedoch eine Leistungspflicht bestehe, dafür sei die Rechtsordnung maßgeblich 65 . Und diese bestimme keine Leistungspflicht, sondern lasse auf Grund der Vereinbarung die Rechtsfolge der Gewährleistung eintreten 6 6 . Die Gewährleistung habe daher ihre Ursache nicht i n der Leistungspflicht, eine solche bestehe nicht, sondern i n dem Vertrag 6 7 , wobei die Haftung nicht vereinbart ist, sondern aus der Vereinbarung einer mangelfreien Leistung kraft Gesetzes folgt 6 8 . Diese Ansicht Flumes kann nicht überzeugen. Während die h. L., von der Hypothese Zitelmanns ausgehend, konsequent ist, ist die Meinung Flumes i n sich nicht schlüssig. Wenn die Parteien vereinbaren, daß eine mangelfreie Sache geschuldet ist — diese Vereinbarung hält Flume für möglich —, so folgt unmittelbar aus der Vereinbarung die entsprechende Leistungspflicht. Flume hat sehr wohl diese Schwäche seiner These erkannt und versucht, der zu erwartenden K r i t i k den Boden zu entziehen: Angesichts der besonderen Regelung der §§ 433 ff. und §§ 459 ff. sei es „unzulässig, aus der allgemeinen obligationsrechtlichen Erwägung, daß Verträge, wie sie vereinbart werden, auch zu erfüllen sind, eine Erfüllungspflicht des Verkäufers zur Leistung der Kaufsache i n sachlich mangelfreiem Zustande anzunehmen" 69 . Diese Argumentation ist aber nicht geeignet, die K r i t i k verstummen zu lassen. So verwundert es nicht, daß Flume selbst von der h. L., die wie er eine Leistungspflicht hinsichtlich der Eigenschaften ablehnt, K r i t i k erfährt. M i t Recht führt z. B. Larenz 70 aus, Nichterfüllung eines Vertrages könne nur heißen: Nichterfüllung der Leistungspflicht; denn Erfüllung bedeute gemäß § 362 Bewirken der geschuldeten Leistung 7 1 . Larenz kommt deshalb zu dem nicht unberechtigten Schluß 72 , daß Flume letztlich den Rechtsgrund der Gewährleistung nicht i n der Nichterfüllung des Vertrages, von einer solchen könne nicht die Rede sein, wenn man wie Flume eine Pflicht zu mangelfreier Leistung verneine, 64 S. 41. I n ähnlicher Weise n i m m t Esser, § 64 I einen Vertragsbruch an, läßt aber die Leistung der fehlerhaften Sache als vorläufige E r f ü l l u n g gelten. 65 S. 41. ββ S. 48. 52. β7 S. 36 ff., 39. 68 S. 50. 69 Vgl. Flume, S. 36. 70 Larenz I I , § 41 I I e, S. 59 F N 1. 71 Ebenso Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 3. 72 Larenz, a.a.O.
1. Die Vereinbarung von Eigenschaften
79
sondern nur i n der Enttäuschung der berechtigten Erwartung des Käufers sehe. Ballerstedt 73 hält die Meinung Flumes für unbefriedigend, w e i l m i t der Vereinbarung eine vertragliche Pflicht geschaffen werde, die gerade dann, wenn sie bedeutsam wäre, von der Rechtsordnung nicht anerkannt, sondern durch andere Rechtsbehelfe ersetzt werde. I n der Tat ist die Ansicht Flumes deshalb wenig einleuchtend, w e i l er die Vereinbarung der Parteien auch auf die Eigenschaften erstreckt, dann aber daraus gerade nicht die einzig einleuchtende Folgerung zieht, nämlich, daß diese Eigenschaften auch geschuldet sind. Wenn dieses Ergebnis m i t der Behauptung gewonnen wird, die Rechtsordnung sei maßgebend, ob eine Pflicht bestehe, so erweist sich dies i n letzter Konsequenz als ebenso wenig stichhaltig wie die Hypothese. I m Vertragsrecht ist i n erster Linie die Vereinbarung maßgeblich. Nicht das Gesetz, sondern die Parteien schaffen die Leistungspflicht. Es ist also gerade umgekehrt, wie Flume annimmt. Daher bedarf es i m Vertragsrecht für die Annahme einer Leistungspflicht nicht einer besonderen gesetzlichen Regelung 74 . Die Leistungspflicht folgt unmittelbar aus der Vereinbarung 7 5 . Daß das Gesetz i n § 433 die Verpflichtung zu mangelfreier Leistung nicht erwähnt, ist also unerheblich 7 6 ' 7 7 . Oertmann 78 meint, daraus, daß i n § 633 I die Verpflichtung zu mangelfreier Leistung vom Gesetz bestimmt sei, i n § 433 I aber nicht, ergebe sich, daß beim Kaufvertrag Mängelfreiheit nicht geschuldet sei. Diese Ansicht übersieht, daß die beiden Normen gar nicht vergleichbar sind. Dem § 633 I entspricht beim Kaufvertrag nicht der § 433 I, sondern der § 459. Die dem § 433 I entsprechende Norm ist beim Werkver78
I n Soergel / Siebert, v o r § 459 Bern. 14. Anders hingegen außerhalb des Vertragsrechts, vgl. z. B. § 823. Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 3; Korintenberg, Spezies, S. 93, 94 u n d ähnlich schon Abschied, S. 76. 76 Vgl. Kuhn, i n R G R K . 77 Teilweise w i r d versucht, das Bestehen einer Leistungspflicht m i t § 36 I I I Vergl. O. zu beweisen (vgl. Schubert, S. 63). Dort heißt es: „ I s t die v o m Gläubiger geschuldete Leistung deshalb nicht als vollständig b e w i r k t anzusehen, w e i l die Leistung mangelhaft ist, s o . . A b g e s e h e n davon, daß aus den schon dargelegten Gründen die Leistungspflicht nicht v o n einer besonderen Normierung abhängig ist, erscheint § 36 I I I Vergl. O. nicht beweiskräft i g (ebenso Flume, S. 36 F N 9 u n d Graue, S. 286). Sprachlich handelt es sich u m einen Konditionalsatz, der gerade auf außerhalb liegende Umstände B e zug n i m m t . W a n n die Leistung einer mangelhaften Sache E r f ü l l u n g bzw. Nichterfüllung darstellt, w i r d i n der N o r m gerade nicht geregelt, vielmehr w i r d n u r gesagt, daß bei Vorliegen einer unvollständigen E r f ü l l u n g bestimmte Rechtsfolgen eintreten. 78 S. 356. 74
75
80
I V . Rechtsnatur der Gewährleistung nach geltendem Recht
trag der § 6311. Deshalb steht § 633 I zu Recht unter der von Schönfelder gegebenen Überschrift „Gewährleistungspflicht des Unternehmers". Gesetzestechnisch stimmt § 633 I vollkommen m i t § 459 überein. Nur formuliert § 633 I zunächst die Pflicht, an deren Nichterfüllung die Rechtsfolge der Gewährleistung anschließt, während § 459 gleich die Haftung anordnet, dabei aber gedanklich von der entsprechenden Verpflichtung ausgeht. Wenn der Gesetzgeber i n § 459 die Gewährleistung als Folge bestimmte, so ging er von der Verpflichtung als U r sache aus 79 . Genau diese Überlegung ist i n § 633 I zum Ausdruck gebracht, ergibt sich aber i n gleicher Weise aus § 459. Daß der Gesetzgeber i n § 633 I die Verpflichtung ausdrücklich formulierte und nicht, wie i n § 459, gleich die Rechtsfolge anordnete, beruht vermutlich auf dem Umstand, daß die Rechtsfolgeregelung i n §§ 633 ff. komplizierter ist als in §§ 459 ff., denn beim Werkvertrag ist der Wandlung und Minderung noch ein Mängelbeseitigungsanspruch vorgeschaltet. Es erschien daher angebracht, zunächst festzulegen, unter welchen Umständen die Sachmängelhaftung eingreift — diesem Zweck allein dient § 633 I —, und daran anschließend die einzelnen Rechtsfolgebestimmungen zu normieren. § 633 I wiederholt nur die Verpflichtung, die sich bereits aus der Vereinbarung ergibt. Schließlich nimmt er ausdrücklich auf die Vereinbarung Bezug, wenn von dem „nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauch" die Rede ist. § 633 I normiert also überhaupt nicht die Leistungspflicht des Werkunternehmers, diese ergibt sich allein aus dem Vertrag, sondern bestimmt lediglich unter Bezugnahme auf die Vereinbarung, wann die Sachmängelhaftung eingreifen soll. Dies w i r d dadurch deutlich, daß alle anschließenden Rechtsfolgenormen auf § 633 I Bezug nehmen. Wenn aber § 633 I gar nicht Rechtsgrund für die Verpflichtung des Unternehmers ist, sondern lediglich eine gesetzestechnisch bedingte Wiederholung der aus der Vereinbarung resultierenden Verpflichtung, dann läßt § 633 I nicht den Schluß zu, daß bei Fehlen einer entsprechenden Norm, wie etwa beim Kaufvertrag, eine derartige Verpflichtung nicht besteht. Bestätigt w i r d dieses Ergebnis durch die Regelung beim Mietvertrag. Dort ist auch nicht ausdrücklich eine Verpflichtung zu mangelfreier Leistung festgelegt, vielmehr n i m m t das Gesetz ausdrücklich auf den Vertrag Bezug, wenn es z. B. i n § 536 bestimmt, daß der Vermieter dem Mieter die Sache i n einem zu dem vertragsmäßigen Gebrauch geeigne79 I n dieser Richtung gehen w o h l auch die Überlegungen von Dörr, L Z 1918, Spalte 888, n u r bedarf es gar nicht erst einer Analogie zum M i e t - u n d Werkvertragsrecht, wie Dörr meint, u m die Verpflichtung zu mangelfreier Leistung zu begründen. Diese folgt vielmehr unmittelbar aus dem Vertrag.
1. Die Vereinbarung von Eigenschaften
81
ten Zustand zu überlassen habe. Die gleiche Bezugnahme findet sich i n § 537, der damit dem § 633 I entspricht. Es kann daher festgehalten werden, daß das Fehlen einer Norm, die ausdrücklich eine Verpflichtung zu mangelfreier Leistung bestimmt, nicht der Annahme einer dahingehenden Leistungspflicht widerspricht. Was Gegenstand der Leistungspflicht ist, ergibt sich aus der Vereinbarung 8 0 . Dies bringen §§ 241 S. 1, 242 eindeutig zum Ausdruck. Der § 362 I und § 294 81 bestätigen das gewonnene Ergebnis. Die Ansicht Flumes ist daher nicht stichhaltig. Natürlich kann das Gesetz i n die vertragliche Vereinbarung eingreifen und der vereinbarten Pflicht die Wirkung nehmen, doch ist dies nur bei Vorliegen einer ausdrücklich darauf gerichteten Norm anzunehmen, vgl. z. B. §§ 134, 135. Ein solches Eingreifen der Rechtsordnung i n die Vereinbarung liegt nicht vor, wenn die Rechtsordnung, wie z. B. i n § 459, gerade i m Anschluß an die Vereinbarung eine bestimmte Rechtsfolge festlegt. Die Rechtsfolge des § 459 baut auf der Vereinbarung auf. Ohne diese besteht sie nicht. Wenn nun Flume das Entstehen einer Leistungspflicht leugnet, w e i l die Rechtsordnung m i t der Gewährleistung i n die Vereinbarung eingreift und eine andere als die vereinbarte Rechtsfolge, nämlich die Gewährleistung, eintreten läßt, so begründet er die Gewährleistung m i t sich selbst. Die Rechtsfolge der Gewährleistung beruht nämlich dann gerade auf der durch die Gewährleistung veränderten vertraglichen Pflicht. Die Inkonsequenz der Ansicht Flumes w i r d offenbar, wenn man die daraus folgenden Ergebnisse gegenüberstellt. Die Sachmängelhaftung beim Kauf kann nur einen Rechtsgrund haben, nur einer Funktion dienen, entweder der restlichen Vertragserfüllung, so, wenn man eine die Eigenschaften einschließende Leistungspflicht bejaht, oder dem Äquivalenzausgleich, so die h. L. unter Ablehnung einer derartigen Leistungspflicht. Nach Flume dagegen hängt die Frage, welcher Funktion die Gewährleistung dient, vom Einzelfall ab, obwohl er ausdrücklich zugibt, daß die Rechtsnatur der Sachmängelhaftung beim Spezies- wie beim Gattungskauf die gleiche ist 8 2 . Beim Gattungskauf vereinbaren die Par80 Schmidt-Rimpler, S. 215: Da die Willenserklärung n u r auf eine Rechtsfolge gerichtet ist, so könne als solche i n der Willenserklärung jedweder denkbare soziale Sachverhalt als gewollt enthalten u n d soweit er es ist, auch i m Sinne des Schuldverhältnisses „gesollt", d. h. v o m Rechte durch Gewähr u n g einer Forderung gewährleistet sein. 81 Vgl. Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 433 A n m . V I I I A a. 82 Flume, S. 42.
6 Herberger
82
I V . Rechtsnatur der Gewährleistung nach geltendem Recht
teien ebenso wie beim Spezieskauf die Eigenschaften, die die Sache haben soll. I n beiden Fällen w i r d diese Vereinbarung gültiger Vertragsbestandteil. Nach Flume folgt jedoch nur beim Gattungskauf eine der Vereinbarung entsprechende Pflicht 8 3 , nicht jedoch beim Spezieskauf, obwohl der Wille der Partei i n beiden Fällen auf das Gleiche gerichtet ist. Beim Gattungskauf würde demnach die Gewährleistung der Erfüllung einer Leistungspflicht dienen, beim Spezieskauf dagegen nicht. Flume kommt damit gerade zu dem Ergebnis, das er an anderer Stelle kritisiert 8 4 , nämlich zu einer Unterscheidung der Gewährleistung i n eine echte und eine unechte 85 . Dabei betont er gerade bei der A b grenzung der Rechtsmängelhaftung zur Sachmängelhaftung, daß der Unterschied darin liege, daß bei der Rechtsmängelhaftung eine Erfüllungspflicht bestehe, bei der Sachmängelhaftung dagegen nur eine Gewährleistungspflicht 86 . Flume räumt also ein, daß die „Erfüllungspflicht" Rechtsinstitute inhaltlich bestimmt. U m so unverständlicher ist es, daß bei dem Institut der Sachmängelhaftung diesem Begriff gerade diese Bedeutung nicht beigelegt wird, vielmehr die Gewährleistungspflicht einmal eine Erfüllungspflicht ist, dann aber wieder keine 8 7 . Selbst innerhalb des Spezieskaufs führt die Ansicht Flumes zu einem systematischen Bruch. Da Flume i m Gegensatz zur h. L. die Vereinbarung über Eigenschaften für zulässig hält, so geht die Verpflichtung des Verkäufers über die Sache m i t den Eigenschaften, die sie bei Kaufabschluß hat 8 8 . Diese bei Vertragsschluß vorhandenen Eigenschaften sind Teil der Leistungspflicht. Leistet der Verkäufer eine nach Einigung fehlerhaft gewordene Sache, so erfüllt er seine Leistungspflicht nicht. Die Gewährleistung dient i n diesem Falle der restlichen Erfüllung. War der Fehler jedoch schon bei Vertragsschluß vorhanden, dann greift die Gewährleistung ein, obwohl keine Pflicht bestand, eine fehlerfreie Sache zu leisten 89 . Würde die Ansicht Flumes zutreffen, daß die Sache so zu leisten ist, wie sie bei Vertragsschluß war, so müßte der Käufer für den Fall, daß die Sache zu diesem Zeitpunkt fehlerhaft war, einen Anspruch 83
Flume, S. 42. Vgl. Flume , S. 40. Vgl. darüber I I , 3. 86 Vgl. Flume, S. 48. 87 Dies kritisiert auch Korintenberg, Spezies, S. 92. 88 So auch schon Kiehl, Gruch. Beitr. 60, 617 ff.; ebenso Schollmeyer, S. 97, 104, wenngleich von seinem Standpunkt aus diese Annahme nicht zwingend ist. 89 Diesen Widerspruch hatte bereits Süß, S. 225, erkannt. Nach seiner A n sicht ist die Sache so zu übergeben, wie sie tatsächlich ist; ebenso Larenz I I , § 41 I I e, S. 58 F N 1. Anders dagegen noch Schollmeyer, S. 97, 104; vgl. dazu I I Anm. 22. 84
85
1. Die Vereinbarung von Eigenschaften
83
darauf haben, daß i h m die Sache m i t dem Fehler geliefert wird, oder, aus der Sicht des Verkäufers gesehen, eine zwischen der Einigung und der Übergabe erfolgte Nachbesserung eine nicht geschuldete Leistung sein, die zu einem Ausgleich, etwa über §§ 812 ff., berechtigt. Der Verkäufer hätte nicht das Recht, den Fehler der Sache vor Übergabe zu beseitigen. Nun hat aber nach einhelliger Ansicht 9 0 der Käufer gerade keinen Anspruch darauf, daß die bei Vertragsschluß vorliegende Fehlerhaftigkeit der Sache erhalten bleibt, u m die Gewährleistungsansprüche zu erlangen. Deshalb erweist sich auch hier die Meinung Flumes als inkonsequent. Ganz offensichtlich ist es Flume nicht gelungen, die vielleicht wichtigste Frage innerhalb des Sachmängelrechts zu lösen, die Frage nach dem Verhältnis der Gewährleistungspflicht zur Leistungspflicht 91 . Ohne Beantwortung dieser Fage ist aber ein Verständnis des Gewährschaftsrechts unmöglich. Es läßt sich daher festhalten, daß die Ansicht Flumes i n sich widersprüchlich und deshalb nicht stichhaltig ist. Weil die Parteien die Eigenschaften, die die Sache haben soll, mit Verpflichtungswillen vereinbaren, entsteht eine der Vereinbarung entsprechende Leistungspflicht. Einer besonderen gesetzlichen Erwähnung dieser Pflicht bedarf es daher nicht. W i r d die Pflicht nicht gehörig erfüllt, so greift die Gewährleistung als vom Gesetz für diesen Fall vorgesehene Rechtsfolge ein 9 2 . Das Gesetz greift also nicht i n die Vereinbarung ein, sondern regelt die Folge, die die mangelhafte Erfüllung der vereinbarten Pflicht haben soll. c) Das Argument aus § 306
Schließlich w i r d von der h. L. noch vorgebracht, eine Leistungspflicht bezüglich der Eigenschaften könne es beim Spezieskauf nicht geben, da sonst i m Falle eines bei Kaufabschluß vorhandenen unbehebbaren Mangels die Verpflichtung auf eine unmögliche Leistung ginge. Gemäß § 306 sei eine solche Verpflichtung nichtig. Wie sich aber aus den §§ 459 ff. ergebe, führe ein unbehebbarer Mangel nicht zur Nichtigkeit. Das zeige, daß die Leistungspflicht sich nicht auf die Eigenschaften erstrecke, w e i l sonst der Vertrag nichtig sein müsse 93 . 90 Vgl. Palandt / Putzo, § 459 A n m . 1; Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 459 A n m . 3 Β I a; Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 11; Korintenberg, Abschied, S. 80. 91 Vgl. Korintenberg, Spezies, S. 92 i n seiner Erwiderung auf die K r i t i k Flumes; vgl. auch I u n d I I I A n m . 11. 92 Deshalb ist es richtig, w e n n Lobe, i n R G R K , 9. Aufl. § 459 A n m . 2 behauptet, die Leistungspflicht sei die Voraussetzung der Gewährleistungspflicht; ebenso Kuhn, i n R G R K , § 459 Anm. 3. 93 Vgl. Larenz I I , 9. Auflage, S. 55 und Geschäftsgrundlage, S. 20 F N 1; Soergel / Siebert / Ballerstedt, vor § 459 Bern. 18; Wolff, S. 5, 6; Düringer l Hachenburg ! Hoeniger V 1, Einl. A n m . 115; ähnlich Süß, S. 48 ff., der aber
6*
84
I V . Rechtsnatur der Gewährleistung nach geltendem Recht
A u f den ersten Blick erscheint dieses Argument der h. L. bestechend. Konsequent n i m m t daher ein Teil der Lehre, die eine Pflicht zur Leistung einer mangelfreien Sache bejaht, Nichtigkeit der Vereinbarung an, wenn die Sache bereits bei Kaufabschluß einen unheilbaren Mangel hatte 9 4 . N u n ist i n diesen Fällen, wie die h. L. richtig ausführt, die Sachmängelhaftung nicht ausgeschlossen. Daher n i m m t diese Ansicht weiter an, daß nach Übergabe die an sich vorhandene Unmöglichkeit nicht mehr geltend gemacht werden kann, was vor der Übergabe möglich gewesen wäre, vielmehr habe der Käufer nun allein die Ansprüche aus der Gewährleistung 95 . Abgesehen davon, daß diese letzte Konstruktion nicht befriedigt, weil sie eine A r t „Heilung" des Vertrages fingiert, die nirgends i m Gesetz festgelegt ist und die nur von der Zufälligkeit der Übergabe abhängt, besteht keine Notwendigkeit, eine Nichtigkeit des Vertrages anzunehmen 96 . § 306 gilt hier nicht. Das Gesetz hat die Rechtsfolge der Gewährleistung für den Fall angeordnet, daß entgegen der Vereinbarung eine fehlerhafte Sache geleistet wird. Es hat dabei bewußt nicht darauf abgestellt, ob der Mangel behebbar ist oder nicht, ob er vor oder nach Kaufabschluß entstanden ist. Damit sind die §§ 459 ff. als Rechtsfolgeregelung auch für den F a l l angeordnet, daß bereits zur Zeit des Vertragsschlusses ein unbehebbarer Fehler vorlag. Die Norm des § 460 beweist, daß ein bei Vertragsschluß vorliegender, unbehebbarer Mangel keine Nichtigkeit gemäß § 306, sondern einen wirksamen Vertrag und damit die Sachmängelhaftung herbeiführt. Es läßt sich unter Hinweis auf § 306 nicht der Schluß ziehen, den die h. L. zieht, daß eine Leistungspflicht hinsichtlich der Eigenschaften nicht besteht. Die §§ 459 ff. sind gegenüber § 306 eine speziellere Rechtsfolgeregelung. Larenz 9 7 wendet dagegen ein, daß §§ 459 ff. zu ihrer Anwendung einen wenigstens vorläufig gültigen Kaufvertrag voraussetzen, dieser § 306 nicht ausdrücklich nennt, sondern von logischer Unmöglichkeit spricht. M i t Recht lehnt Larenz I, § 8 I, S. 84, diese Formulierung ab. Das Gesetz könne auch an eine logisch unmögliche Leistungsvereinbarung Rechtsfolgen knüpfen. 94 Palandt / Putzo, bis 30. Aufl., vor § 459 A n m . 2 a; Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 433 A n m . V I I I A a u n d § 459 A n m . 7 Β b; Kuhn, i n R G R K , § 433 A n m . 172 u n d § 459 A n m . 3. Kiehl, Gruch. Beitr. 60, 614 ff., differenziert nach der A r t der Eigenschaft. 95 Vgl. Palandt ! Putzo, a.a.O.; Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 459 A n m . 7 Β b ; Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 34. A. A. Flume, S. 37 F N 11. Flume bezeichnet diese Annahme als ganz unmöglich. 96 Vgl. Soergel / Siebert / Ballerstedt, v o r § 459 Bern. 18. 97 Larenz, Geschäftsgrundlage, S. 20 F N 1.
1. Die Vereinbarung von Eigenschaften
85
entstehe aber wegen § 306 gar nicht erst, so daß das Argument aus § 459 gar nicht zum Zuge käme. I n der Prüfungsreihenfolge käme § 306 zuerst. Diese Argumentation ist nicht zutreffend und wird, wie gleich noch darzulegen ist, an anderer Stelle vom Gesetz ausdrücklich widerlegt. Nicht nur § 459, sondern auch § 306 setzt einen Vertrag voraus. Der § 306 verhindert also nicht das Entstehen einer Vereinbarung, sondern nimmt der entstandenen Vereinbarung die Wirkung. Die Funktion des § 306 besteht nun darin, eine Rechtsfolge für diese Vereinbarung anzuordnen. Der gleichen Funktion dient auch § 459. I n dem einen Fall ist diese Rechtsfolge die Nichtigkeit, i n dem anderen Fall die Haftung. Daß die Nichtigkeitsfolge bei Vereinbarung einer objektiv unmöglichen Leistung nicht die einzig denkbare Rechtsfolge ist, daß also das Argument, die Leistungsverpflichtung sei schon logisch unmöglich und daher nichtig 9 8 , nicht zutreffend ist, räumt auch Larenz 9 9 ein. Das Gesetz kann die Vereinbarung als gültig behandeln 1 0 0 und bestimmte Haftungsfolgen normieren. Hier haben w i r eine solche vom Gesetz anstelle der Nichtigkeitsfolge angeordnete Haftungsfolge. Larenz geht davon aus, daß § 306 vor § 459 zur Anwendung kommt. Er argumentiert so: a) für § 459: Die Parteien treffen eine Vereinbarung. Es entsteht ein Vertrag. Aus dem Vertrag folgen bestimmte Rechte und Pflichten, u. a. die Gewährleistung für Sachmängel. b) für § 306: Die Parteien treffen eine Vereinbarung. Es entsteht kein Vertrag. Abgesehen von § 307 kommt es zu keinen Folgen. Nun ist aber das Bindeglied „Vertrag" nichts anderes als die Vereinbarung, und die Vertragsfolgen sind die Folgen der Vereinbarung. § 306 kommt überhaupt erst dann zur Anwendung, wenn eine Vereinbarung, ein wenn auch nur hypothetisch gültiger Vertrag zustande gekommen ist. Fehlt es z.B. an einer gültigen Annahmeerklärung, dann fehlt es bereits an einer Vereinbarung. Deshalb spricht § 306 auch vollkommen zu Recht von einem Vertrag. Es ist daher nicht überzeugend, wenn Larenz meint, § 459 könne gar nicht als Argument verwendet werden, weil er einen gültigen Vertrag voraussetze 101 . Sowohl § 306 98 So unzutreffenderweise Süß, S. 49; Wolff, S. 67. Dagegen Graue, S. 271 u n d Korintenberg, Abschied, S. 76, m i t dem Hinweis, daß auch bei der Rechtsmängelhaftung eine logische Unmöglichkeit vorliege, trotzdem aber keine Nichtigkeit gemäß § 306 eintrete. 99 Larenz I, § 8 I, S. 84. 100 Das räumt auch Pisko, S. 16, ein. 101 Daß die Gewährleistung als Rechtsfolge erst m i t dem Gefahrübergang entstehe, vorher also nicht m i t § 306 konkurrieren könne, n i m m t auch Larenz
86
I V . Rechtsnatur der Gewährleistung nach geltendem Recht
wie § 459 setzen zunächst einen hypothetisch gültigen Vertrag voraus. Normalerweise ordnet dann bei objektiver Unmöglichkeit § 306 die Nichtigkeit an. I m speziellen F a l l der Unmöglichkeit einer Eigenschaft dagegen normiert § 459 die Haftung und verdrängt damit die Rechtsfolge des § 306. Diese Behauptung w i r d an anderer Stelle des Gesetzes bestätigt. Gemäß § 437 I haftet der Verkäufer für Rechtsmängel. Auch hier würde, wollte man Larenz folgen, gemäß § 306 gar nicht erst ein Vertrag entstehen und damit auch die Haftung niemals eintreten können. Das gleiche gilt bei § 634 I I . War z. B. eine bestimmte Eigenschaft von Anfang an nicht herstellbar, so kann der Mangel nicht beseitigt werden. Der Werkunternehmer haftet gemäß § 634. Nach Larenz könnte es niemals zu der i n § 634 angeordneten Haftung kommen, weil der Vertrag gemäß § 306 nichtig wäre. Es zeigt sich also, daß der Gesetzgeber i m Falle der objektiven Unmöglichkeit der Leistung der Sache mit den vereinbarten Eigenschaften den § 306 durch Anordnung spezieller Rechtsfolgen verdrängt hat. Dies w i r d verständlich, wenn man sich vor Augen hält, daß § 306 nur den Zweck hat, eine infolge der Unmöglichkeit sinnlose Verpflichtung aufzuheben 102 . I m Falle eines Sachmangels wäre es schwierig, i m Einzelfall festzustellen, ob die Verpflichtung wirklich sinnlos ist. Daher hat der Gesetzgeber dem betroffenen Käufer i n dieser Hinsicht die Entscheidung selbst überlassen. M i t der Wandelung ist dem Käufer die Möglichkeit gegeben, der Vereinbarung die Wirkung zu nehmen, ähnlich wie das § 306 anordnet. Bei einer unerheblichen Minderung des Wertes oder der Tauglichkeit würde das zu weit führen. Der Käufer hat hier keine Sachmängelansprüche (§ 459 I 2). Ist bei einem Grundstückskauf eine bestimmte Größe zugesichert, so kann der Käufer nur Wandelung verlangen, wenn die Erfüllung für i h n kein Interesse hat (§ 468 Satz 2).
nicht an, vgl. Larenz I I , § 41 I I e u n d § 41 I c. Kuhn, i n R G R K § 459 A n m . 3 dagegen meint, die §§ 459 ff. könnten vor Gefahrübergang den § 306 nicht v e r drängen, w e i l die Sonderregelung erst ab Gefahrübergang eingreife. Dies ist nicht überzeugend. Maßgeblich f ü r die Konkurrenzfrage k a n n nicht das tatsächliche Eingreifen einer Rechtsfolge sein. Das wäre bei der Gewährleistung überhaupt erst m i t vollzogener W a n d l u n g oder Minderung der Fall. Entscheidend k a n n n u r sein, ob ein Sachverhalt besonders geregelt sein soll. Daß die Gewährleistung noch das Vorliegen zusätzlicher Umstände, den Gefahrübergang, verlangt, schließt nicht aus, daß sie eine Sonderregel u n g ist, die auch schon v o r E r f ü l l u n g aller Tatbestandsmerkmale den allgemeineren Tatbestand verdrängt. Näheres zur Frage des Entstehens der Gewährleistungsansprüche unten V I . 102 Vgl. Zweigert, SJZ 1949, 415 ff.; Soergel / Siebert / Ballerstedt, vor § 459 Bern. 18.
1. Die Vereinbarung von Eigenschaften
87
Die §§ 459 ff. stellen sich damit als eine speziellere Regelung gegenüber § 306 dar, die nicht pauschal die auf die Leistung einer fehlerfreien Sache gerichtete Verpflichtung als sinnlos und deshalb nichtig betrachtet, sondern i n sehr differenzierter Weise es den Parteien überläßt, die Leistungsstörung zu beseitigen, die durch die Mangelhaftigkeit der Sache eingetreten ist. § 306 läßt also nicht den Schluß zu, daß die Leistungspflicht sich nicht auf die Eigenschaften erstreckt. Dies w i r d bestätigt durch § 437 I und § 634 I I . I n beiden Fällen besteht eine Leistungspflicht bezüglich der Umstände, die zu der Haftung führen. Auch i n diesen Fällen w i r d nicht m i t Rücksicht auf § 306 angenommen, daß eine derartige Leistungspflicht nicht vorliegt. Ebensowenig ist diese Annahme bei der Sachmängelhaftung des Spezieskaufs gerechtfertigt. Vielmehr w i r d § 306 durch die besondere Regelung der §§ 459 ff. verdrängt 1 0 3 . d) Zusammenfassung
Keines der von der h. L . angeführten Argumente vermag das Bestehen einer Leistungspflicht, die sich auch auf die Eigenschaften erstreckt, zu widerlegen. Es kann daher festgestellt werden, daß die Leistungspflicht des Verkäufers auch die Verpflichtung m i t einschließt, eine fehlerfreie Sache zu übergeben 104 .
103 Ebenso R G JW 1918, 221; R G WarnRtspr. 1918 Nr. 185; Flume , S. 107, 108; Adler, Z H R 75, 454; Titze, JW 1927, 2964; Soergel / Siebert / Ballerstedt, vor § 459 Bern. 18; Graue, S. 274 u n d dort F N 41; Erman, JZ 60, 42; Schöller, S. 15; i m Ergebnis auch Schniewind, S. 50 f.; Erman / Weitnauer, v o r § 459 Rdz 35. 104 Diese Ansicht ist langsam i m Vordringen begriffen. Vgl. Adler, Z H R 75, 454; Dörr, L Z 1918, 888; Titze, J W 1927, 2964f.; Schubert, S. 63; Korintenberg, Abschied, S. 79 u n d Spezies, S. 90; Schubiger, S. 22; Staudinger / Ostler, § 433 RZ 100 a; Kuhn, i n R G R K , § 433 A n m . 172 u n d § 459 A n m . 3; Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 433 A n m . V I I I A a u n d § 459 Anm. 2; Graue, S. 211, 288, 289; Erman, JZ 1960, 41 ff.; Palandt / Putzo, § 459 A n m . 1; Emmerich, Schuldrecht, § 4 I 3; Erman / Böhle-Stamschräder, 3. Aufl., § 459 A n m . 3; Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 17, einschränkend allerdings i n Rdz 35: „ . . . w e i l hier (Stückkauf) ein Anspruch auf mangelfreie Leistung jedenfalls nicht besteht, w e n n der Mangel nicht behebbar ist." R G 63, 70 ff.; 66, 76 u n d die oben I I I , 3, c zitierten Entscheidungen. Eine eigenartige, vermittelnde Ansicht zwischen der h. L . u n d der Gegenmeinung v e r t r i t t Fabricius, JZ 1967, 464 ff. E r leitet aus dem Grundsatz von T r e u u n d Glauben (vgl. dazu oben I I , 3, f u n d I I I , 2, b, ff) eine Nebenpflicht, mangelfreie Ware zu liefern, ab. Fabricius leugnet die verpflichtende K r a f t der Eigenschaftsvereinbarung u n d steht d a m i t der h. L . sehr nahe. Konsequent v e r t r i t t er einen objektiven Fehlerbegriff.
y . Aufgabe und Funktion der Gewährleistung — dargestellt am Beispiel des Kaufs 1. Die Elemente der Schuld: Identität und Eigenschaft Wenn die Leistungspflicht, wie w i r behaupten, die Eigenschaften mit erfaßt, so ergibt sich, daß der Verkäufer zweierlei zu leisten hat: zum einen die schuldidentische Sache ( = die Identität), auf die sich die Parteien geeinigt haben, zum anderen die vereinbarte Eigenschaft. M i t Hecht sagt Raape 1 , daß dem Käufer die vertragsmäßige Beschaffenheit der Sache nicht weniger gebühre als die Sache selbst. Das heißt nun nicht, daß zwei verschiedene Leistungspflichten bestehen, eine hinsichtlich der Sache als solcher und eine hinsichtlich der Eigenschaft, es liegt vielmehr nur eine einheitliche Leistungspflicht vor, die jedoch i n zwei Bereiche aufgegliedert ist: die Identität und die Eigenschaft. Es handelt sich dabei u m zwei Denkbegriffe, die naturwissenschaftlich i n dieser Weise nicht begründet sind. Die Sache erhält ihre Identität durch die Eigenschaften. Eigenschaft und Sache lassen sich nicht trennen. Jeden Augenblick verändert sich die Beschaffenheit und damit auch die Sache als solche. Eine Sache ist, naturwissenschaftlich gedacht, niemals m i t sich selbst identisch. „Identität" würde es nicht geben. Doch das Recht muß eigene, vom naturwissenschaftlichen Standpunkt abweichende Denkkategorien schaffen, soweit das für eine sinnvolle Regelung erforderlich ist. U m solche juristischen Begriffe handelt es sich, wenn w i r von „Identität" und „Eigenschaft" sprechen. Unter „Identität" ist die konkrete Sache, so wie sie jeweils ist, zu verstehen, solange sie noch der Substanz nach den Vorstellungen entspricht, die w i r uns von einer Sache solcher A r t machen. Verändert die Sache ihre Substanz, verliert sie also eine Zahl wesensbestimmender Eigenschaften, so w i r d sie zu einer anderen. Sie ist dann nicht mehr identisch m i t der ursprünglichen Sache. Ein Autowrack ist z. B. nicht mehr identisch m i t dem ursprünglichen Auto. Einige Schrammen dagegen verändern noch nicht die Identität 2 . 1
A c P 150, 482. Ebenso Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 5: „ I s t eine bestimmte Sache verkauft, so vermag es an der Identität nichts zu ändern, w e n n die tatsächliche Beschaffenheit von der vereinbarten abweicht." 2
1. Die Elemente der Schuld: Identität u n d Eigenschaft
89
Die „Eigenschaft" dagegen ist eine einzelne Beschaffenheit der Sache. Nach der üblichen Definition sind unter dem Begriff der Eigenschaft alle tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse einer Sache zu verstehen, die entweder ihren physischen Zustand oder ihre Beziehung zu anderen Sachen oder Personen bestimmen 3 » 4 . Das Merkmal einer gewissen Dauer, wie es die Rechtsprechung verlangt 5 , kann für den Eigenschaftsbegriff nicht entscheidend 6 sein. Die Identität ist das statische Moment innerhalb des Rechtsgeschäfts, das überhaupt erst eine Vereinbarung ermöglicht, während die Eigenschaft das dynamische Moment ist, das der dauernden Veränderung einer Sache Rechnung trägt. Ist also eine bestimmte Sache geschuldet, so ist ungeachtet der Veränderung der Sache diese zu leisten. Hat die Sache sich negativ verändert, so findet diese Veränderung allein i m Bereich „Eigenschaft" Berücksichtigung und dementsprechend ist auch die Sanktion. Die „Identität" der Sache bleibt durch eine solche Veränderung unberührt, bedarf daher keiner Sanktion, es sei denn die Sache ist zu einer einer anderen Denkkategorie zugehörigen geworden. Die Unterscheidung der beiden Schuldelemente ist notwendig, u m die Frage nach den Rechtsfolgen zu beantworten, die eintreten, wenn entweder die „Identität" oder die „Eigenschaft" nicht geleistet wird. Sind zwei Elemente Gegenstand der vertraglichen Schuld, so taucht die Frage auf, welche Stellung sie zueinander haben und welche Folgen sich ergeben, wenn ein Element nicht erfüllt w i r d bzw. nicht erfüllt werden kann. Sind beide Elemente gleichwertig, so müssen auch die Rechtsfolgen gleich sein, i m Falle des Vorranges eines Elementes müssen die Rechtsfolgen unterschiedlich sein. Dieses Problem gilt es i m folgenden zu untersuchen, u m die Gewährleistungsregelung, die nach unserer Ansicht eine Rechtsfolgeregelung für die Nichterfüllung des Elementes „Eigenschaft" darstellt, noch verständlicher zu machen. Vereinbaren die Parteien die Leistung „dieses Springpferdes", so ist das konkrete Pferd, aber zugleich mit allen Eigenschaften eines 3 Vgl. Flume, A T , S. 481; Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 14, 17, 24; Staudinger I Ostler, § 459 Rdz 23, 24; Busbach, S. 8. Kegel, S. 360, 361, dehnt den Eigenschaftsbegriff aus. Er w i l l alle beliebigen Tatumstände ausreichen lassen. M i t Recht f ü h r t dagegen Enneccerus / Lehmann, § 186 I I 3 aus, es müsse eine Beziehung zur Sache bestehen. 4 Schon die Atomisten Leukipp u n d Demokrit unterschieden die der Sache unmittelbar anhaftenden Eigenschaften v o n denen, die die Sache erst durch ihre Beziehung zur U m w e l t erhält. N u r die Schwere, die Dichtigkeit u n d die Härte seien primäre, der Sache unmittelbar anhaftende Eigenschaften; alle anderen seien sekundäre Eigenschaften, die der Mensch den Dingen aufgrund seiner Sinne zuschreibe, vgl. Störig, S. 111. 5 B G H 16, 57; R G 64, 269; ebenso Staudinger / Ostler, § 459 Rdz 24; Soergel / Siebert / Hefermehl, § 119 Bern. 32. 6 Busbach, S. 9; Staudinger / Coing, § 119 Rdz 17; Flume, A T , S. 481.
90
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
Springpferdes ausgestattet 7 zu leisten. Ist das Pferd ein Zugpferd, so kann nur eines der beiden Vereinbarungsteile erfüllt werden. Entweder der Verkäufer leistet das konkrete Pferd, dann erfüllt er nicht die vereinbarten Eigenschaften, oder er leistet ein anderes Springpferd, dann erbringt er zwar die Eigenschaften, aber erfüllt nicht seine Verpflichtung, das konkrete Pferd zu leisten. Es fragt sich daher, welche Wege sich zur Lösung dieses Fragenkomplexes anbieten und welchen dieser Wege das Gesetz gegangen ist. a) Das Gesetz könnte der Vereinbarung die Wirkung nehmen. Diesem Zweck dient z. B. § 306. Nun hat aber der Gesetzgeber für den Fall, daß zwar die Identität, nicht aber die Eigenschaft erbracht werden kann, m i t der Gewährleistung eine spezielle Rechtsfolge angeordnet, die § 306 verdrängt 8 . b) Läßt das Gesetz eine Vereinbarung gelten, von der nur der eine oder der andere Teil erfüllt werden kann, so ergeben sich folgende Möglichkeiten. aa) Das Gesetz betrachtet beide Teile als gleichwertige Bestandteile der Schuld. Dann müßte es dem Gläubiger frei stehen, ob er Erfüllung des einen Teils der Schuld oder des anderen Teils der Schuld verlangt. Für den nicht erbringbaren Teil müßte das Gesetz jeweils eine Ausgleichspflicht anordnen. Das würde i n unserem Beispiel bedeuten, daß der Käufer die Wahl hätte, entweder das konkrete Pferd zu fordern oder ein Pferd, das die vereinbarten Eigenschaften hat. Diese Wahlmöglichkeit hat das BGB grundsätzlich nicht vorgesehen. N u r durch besondere Vereinbarung könnte eine solche Regelung getroffen werden. bb) Das Gesetz kann auch einem der Teile ein größeres Gewicht beilegen als dem anderen. 7 Mohnen, S. 29 ff., geht von einer falschen Voraussetzung aus. E r stellt n u r die Frage, ob die E r k l ä r u n g über die Eigenschaft eine individualisierende Aufgabe hat oder nicht. Diene die Eigenschaftsbestimmung nicht der I n d i v i dualisierung, w i e das der F a l l sei, w e n n eine anwesende Sache m i t dem W o r t „dies" gekennzeichnet werde, so handele es sich n u r u m ein Motiv, nicht u m einen T e i l der Erklärung. Diese Überlegung geht fehl. E r k l ä r t jemand „diese goldene U h r " zu kaufen, so erfolgt die Bestimmung „golden" nicht zum Zwecke der Individualisierung, sondern zu dem Zweck festzulegen, was geschuldet ist: Diese U h r als goldene. Daß das „dies" die Identität ausreichend bestimmt, ist dem Erklärenden k l a r ; wenn er trotzdem eine Eigenschaftserklärung abgibt, so geht es dabei u m den Umfang der Schuld, nicht u m die Identität des Schuldgegenstandes. Vgl. dazu I I I , 3, e u n d unten A n m . 23. 8 Vgl. I V , 2, c.
1. Die Elemente der Schuld: Identität u n d Eigenschaft
91
Diesen Weg ist das Gesetz gegangen, indem es der Vereinbarung der Identität den Vorrang eingeräumt hat vor der Vereinbarung der Eigenschaften. Der Schwerpunkt der Vereinbarung liegt i n der Identitätsbestimmung. Darauf beruht z.B. der Gegensatz Spezies-Gattungsschuld. Die Einigung der Parteien auf die konkrete Sache ist notwendiger Bestandteil des Vertrages, während die Eigenschaftsvereinbarung 9 nur im Zusammenhang m i t der Sachvereinbarung getroffen wird. Nur m i t der konkreten Sache kann beim Spezieskauf erfüllt werden. Die Leistung eines aliud bewirkt keine Erfüllung. Den Vorrang der Identitätsvereinbarung bestätigt u. a. auch § 119 I I . I n den Motiven 1 0 zu § 119 I I findet sich ein Gedanke, der auch für den gegenständlichen Fragenkomplex Bedeutung hat: Nicht alle Punkte einer Willenserklärung müßten der Willenswirklichkeit entsprechen. Es wäre von unleidlichen Folgen begleitet, wolle man alle Teile einer Erklärung gleichwertig behandeln und bei I r r t u m über irgendeinen Teil die Anfechtung und damit die Nichtigkeitsfolge zulassen. Es entspreche dem Leben viel mehr, einen nebensächlichen Punkt, obwohl er nicht gewollt ist, i n K r a f t zu erhalten. Nur bei wesentlichen Punkten, wie der Erklärung über den Gegenstand des Geschäftes, erscheine die Anfechtung wegen Irrtums m i t der Nichtigkeitsfolge sinnvoll. Aus diesen Ausführungen, die speziell zur Ablehnung des Eigenschaftsirrtums erfolgten, kann entnommen werden, daß der Gesetzgeber den Unterschied wesentlicher-unwesentlicher Vereinbarungspunkt erkannt und auch der gesetzlichen Regelung zu Grunde gelegt hat, das heißt unterschiedliche Rechtsfolgen festgelegt hat. Die Unterscheidung i n wesentliche-unwesentliche Teile der Schuld findet sich auch an anderen Stellen des Gesetzes z. B. §§ 326, 320. Damit w i r d auch klar, warum der Gesetzgeber, für den Fall, daß die konkrete Sache geleistet werden kann, nicht aber die vereinbarte Eigenschaft, den § 306 nicht zur Anwendung kommen läßt, sondern die Gewährleistung. Die Rechtsfolge der Nichtigkeit erscheint nur dort angebracht, wo der wesentliche Teil einer Vereinbarung von Anfang 9 Ä h n l i c h Medicus, § 15 I I 4; die Sachidentität stehe i m Vordergrund, die Eigenschaften seien n u r das „ B e i w e r k " . Holder, Festschrift Bekker, S. 66 F N 3, leugnet den Vorrang der Identitätsvereinbarung, w e n n er schreibt: „Geradezu verkehrt ist es, einer ,bloßen' Eigenschaft das Individualisierungsmerkmal als etwas Wichtigeres gegenüberzustellen." Zustimmend Staudinger / Riezler, 9. Aufl., § 119 A n m . I I I zu 4, A a. Holder mag zwar Recht haben, daß der W i l l e der Parteien oft intensiver auf die Eigenschaften der Sache gerichtet ist als auf ihre konkrete Substanz, da jedoch eine Eigenschaft nicht ohne Sache, aber eine Sache ohne Eigenschaft geleistet werden kann, gebührt der Vorrang eben doch der Vereinbarung der Sache, es sei denn, m a n gibt den systematischen Gegensatz Spezies-Gattungsschuld auf. 10 Vgl. Mot. I, S. 197.
92
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
an unmöglich ist. Kann ein weniger wichtiger Teil nicht geleistet werden, so läßt das Gesetz die Vereinbarung bestehen. Da jedoch ein Teil der vertraglichen Schuld nicht erfüllt wird, ist ein entsprechender Ausgleich erforderlich. Dieser erfolgt mit der Sachmängelhaftung. War das verkaufte Pferd bereits vor Vertragsschluß verendet, so ist der Vertrag gemäß § 306 nichtig, weil die vertragsgegenständliche Sache, das Pferd, nicht mehr existiert und damit auch nicht mehr geleistet werden kann. Lebt dagegen das Pferd noch, ist es jedoch krank, so ist der Vertrag gültig, der Verkäufer haftet jedoch für den Sachmangel. Das Gesetz macht also einen Unterschied, ob die Identität oder ob die Eigenschaft nicht erbracht werden kann. Zwar ist die Eigenschaft ohne die konkrete Sache nicht denkbar und somit auch nicht Gegenstand einer eigenen Leistungspflicht, doch unterscheidet das Gesetz ganz offensichtlich zwischen Identität und Eigenschaft, und zwar i m Hinblick auf die Sanktionen 11 . Weil das Gesetz die Leistung der individuellen Sache als die wesentliche vertragliche Verpflichtung ansieht, sanktioniert es diese Pflicht m i t den allgemeinen Rechtsbehelfen und läßt, sofern die Leistung der Identität von Anfang an unmöglich ist, Nichtigkeit eintreten. Demgegenüber sanktioniert es die nicht so wesentliche vertragliche Verpflichtung, die Sache m i t bestimmten Eigenschaften zu erbringen, mit spezielleren Normen, der Sachmängelhaftung. Zusammengefaßt ergibt sich damit folgendes Bild: Der Verkäufer einer bestimmten Sache schuldet diese i n fehlerfreiem Zustand. Er hat die konkrete Sache mit den vereinbarten Eigenschaften zu leisten 12 . Der Schwerpunkt der vertraglichen Pflicht ist die Leistung der konkreten Sache. Ist diese Leistung von Anfang an unmöglich, ist der Vertrag gemäß § 306 nichtig. W i r d die Leistung der Sache nachträglich unmöglich, so gelten die §§ 323 ff. 1 3 . Daneben schuldet der Verkäufer aber auch die vereinbarten Eigenschaften. Diese Verpflichtung t r i t t i n ihrer Bedeutung hinter der Hauptverpflichtung zurück und ist deshalb nicht m i t den allgemeinen, sondern mit speziellen Rechtsbehelfen, der Gewährleistung, sanktioniert. Der Grund für diese Stufung und getrennte Sanktionierung der beiden Schuldelemente ist i n folgenden Überlegungen zu sehen. W i r d die Sache nicht geleistet, so erhält der Käufer überhaupt nichts. Bei 11 I n diesem Sinne auch Schubiger, S. 126, u n d Endemann, JW 1920, 706, f ü r den Werkvertrag. A n k l ä n g e dieses Gedankens finden sich auch bei Esser, 2. Aufl., § 107, 4, w e n n es dort heißt, n u r die Sachmängelhaftung nicht aber §§ 323 ff. kämen zur Anwendung, w e n n die gelieferte Sache m i t der geschuldeten identisch sei. 12 Vgl. Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 459 A n m . 2; Kuhn, i n R G R K , § 459 Anm. 3; Schubiger, S. 22; Korintenberg, Abschied, S. 74 ff. 13 Näheres über das Verhältnis der §§ 323 ff. zu den §§ 459 ff. siehe V I , 3.
1. Die Elemente der Schuld: Identität u n d Eigenschaft
93
anfänglicher objektiver Unmöglichkeit erscheint daher die Nichtigkeitsfolge angebracht bzw. bei sonstigen Leistungsstörungen die i n den allgemeinen Normen vorgesehenen Sanktionen. W i r d die Sache geleistet, jedoch ohne die vereinbarten Eigenschaften, so ist zumindest der wesentliche Teil der vertraglichen Schuld geleistet. Dieser Fall kann daher nicht genauso behandelt werden wie der erste. Vielmehr ist eine Sonderregelung angebracht, die die mangelhafte Vertragserfüllung ausgleicht. Liegt bei Vertragsschluß ein unbehebbarer Fehler vor, so hindert das nicht, den Vertrag noch als sinnvoll zu betrachten und ihn, jedenfalls zunächst, d. h. vorbehaltlich der Entscheidung des Käufers, aufrechtzuerhalten, da ja die Leistung der Sache als solcher weiterhin möglich ist. M i t einer mangelhaften Sache erhält der Käufer jedoch nicht das, was i h m nach der vertraglichen Vereinbarung zusteht 14 . Diese mangelhafte Erfüllung könnte i n verschiedener Weise sanktioniert sein: a) Denkbar wäre, daß der Käufer das Recht hätte, auf die Eigenschaften zu klagen, auf Beseitigung des Fehlers bzw. Herstellung der vereinbarten Vorzüge. Eine solche Rechtsfolgeanordnung hätte jedoch verschiedene Nachteile 15 . Aus dem Kaufvertrag ergibt sich kein A n spruch auf ein Tätigwerden des Verkäufers. Dadurch unterscheidet sich der Kauf gerade von anderen Vertragstypen. Die Normierung einer Nachbesserungspflicht würde den Kaufvertrag als Vertragstyp aufweichen und die Abgrenzung zum Werkvertrag i n vielen Fällen noch schwieriger machen. Auch i m Hinblick auf die Erzwingbarkeit erscheint ein Mängelbeseitigungsanspruch als allgemeine Regel nicht sinnvoll. Ein Tätigwerden des Verkäufers könnte nur indirekt durch Beugestrafe oder durch Ersatzvornahme, deren Kosten der Verkäufer zu tragen hätte, erzwungen werden 1 6 . Welchen Sinn aber hätte eine solche Regelung, wenn i n der überwiegenden Zahl der Fälle der Verkäufer tatsächlich gar nicht i n der Lage ist, die erzwungene Handlung vorzunehmen, weil i h m die Möglichkeiten fehlen? Letztlich würde es dazu kommen, daß die Mängelbeseitigung von einem anderen Dritten vorgenommen wird. Der Verkäufer hätte die Kosten dafür zu tragen 1 7 . Angesichts dieser Umstände konnte eine solche Regelung nicht vernünftig erscheinen. Wenn der Verkäufer i n der Regel nicht zur Mängel14 Schubiger, S. 22; Raape, S. 482; Graue, S. 291; Korintenberg, Abschied, S. 74 ff. 15 Solche Überlegungen haben i m common l a w zur grundsätzlichen Verneinung eines Erfüllungsanspruches geführt (vgl. dazu Beß, S. 43 ff., 52 f.). 18 Vgl. z. B. §§ 887, 890 ZPO. 17 Vgl. § 887 ZPO, der jedoch für Fälle gedacht ist, bei denen der Schuldner tatsächlich i n der Lage ist, die Leistung zu erbringen, sich aber weigert.
94
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
beseitigung i n der Lage ist und deshalb nur zur Leistung einer Geldsumme gezwungen werden kann, so ist ein Prozeß über die Mängelbeseitigung sinnlos. b) M i t Recht hat daher das Gesetz an die Nichterfüllung bestimmter Eigenschaften kein Klagerecht geknüpft, sondern allein bestimmte Ausgleichsrechte. Aufgabe der Sachmängelhaftung ist es, i m Falle der durch Leistung einer fehlerhaften Sache bedingten ungenügenden Vertragserfüllung einen Ausgleich unter den Parteien zu schaffen. Ist der Käufer bereit, die Sache zu behalten, so erfolgt der Ausgleich mittels des Minderungsrechts, ist der Käufer dazu nicht bereit, so erfolgt der Ausgleich dadurch, daß das Geschäft rückabgewickelt wird. Die Besonderheit der Gewährleistungsregelung besteht darin, daß sie
eine
spezielle
ausschließliche
Rechtsfolgeregelung
für
den
Fall
darstellt, daß zwar die geschuldete Sache, aber ohne die geschuldeten Eigenschaften geleistet wird. Es handelt sich dabei u m eine besondere, aus der Natur der Sache folgende Sanktion für die Nichterfüllung eines Teiles der vertraglich festgelegten Leistungspflicht. Der Verkäufer ist zwar verpflichtet, die Sache einschließlich der Eigenschaften zu erbringen, leistet er jedoch eine fehlerhafte Sache, so kann der Käufer die restliche Erfüllung aus den angeführten gesetzgeberischen Überlegungen heraus nicht einklagen, er hat nur Ersatzansprüche. Die Gewährleistung steht damit auf einer Linie m i t den an vielen Stellen des BGB angeordneten Ersatzansprüchen i m Falle der Nichterfüllung. Larenz 1 8 spricht i n Fällen dieser A r t , allerdings nicht i m Zusammenhang m i t der Gewährleistung, von einer Zielverfehlung, die eine inhaltliche Änderung des Schuldverhältnisses erforderlich mache. U m eine solche durch die Verfehlung des Leistungszieles bedingte I n haltsänderung aber handelt es sich auch, wenn die Gewährleistung eingreift. A n die Stelle der Pflicht, bestimmte Eigenschaften zu leisten, treten nach Wahl des Käufers bestimmte andere Pflichten. Die Sachmängelhaftung als Ausgleichsregelung greift jedoch nicht ein, wenn und weil die Leistung der Sache m i t den vereinbarten Eigenschaften unmöglich ist 1 9 , sondern, wenn und w e i l die Sache ohne die vereinbarte Eigenschaft geleistet wird. A u f die Möglichkeit, die Sache m i t der geschuldeten Eigenschaft zu leisten, kommt es nicht an. Das Gesetz ist bewußt der Frage, ob die Leistung der Eigenschaft möglich ist oder nicht, ausgewichen, indem es gar nicht erst eine Klage auf
18
Larenz I, 9. Aufl., § 2 V, S. 21. Dies w i r d jedoch angenommen von der unter I I I , A n m . 59 aufgeführten Rechtsprechung u n d Literatur. 19
2. Die Sachmängelhaftung beim Gattungskauf
95
Leistung der vereinbarten Eigenschaft zuließ, sondern dem Käufer allein Ersatzansprüche zur Wahl stellte. 2. D i e Sachmängelhaftung b e i m Gattungskauf
Während bisher versucht wurde, die Sachmängelhaftung vor allem am Beispiel des Spezieskaufs zu erklären, gilt es nun darzulegen, wie es zum Eingreifen der Gewährleistung beim Gattungskauf kommt. Schon oben wurde dargelegt 20 , daß die Haftung beim Gattungskauf nach Hechtsgrund, Aufgabe und Funktion i n gleicher Weise geregelt ist, wie beim Spezieskauf, doch ist dies noch i m einzelnen zu erläutern. Beim Gattungskauf einigen sich die Parteien zunächst nicht auf eine bestimmte Sache. Sie vereinbaren vielmehr, daß eine Sache m i t bestimmten Merkmalen geleistet werden soll. Gekauft w i r d nicht dieses Reitpferd, sondern irgendein Reitpferd. Damit gewinnt die Vereinbarung der Eigenschaften größere Bedeutung als beim Spezieskauf. Während dort der Schwerpunkt i n der Identitätsvereinbarung liegt, fehlt beim Gattungskauf mangels einer individuellen Sache zunächst ein solcher Schwerpunkt. Der geschuldete Gegenstand w i r d durch die Vereinbarung der einzelnen Eigenschaften bestimmbar gemacht. Die Eigenschaftsvereinbarung beim Gattungskauf w i r k t immer identitätsbestimmend. Daraus ergibt sich folgendes. a) Der Nachlieferungsanspruch
Gegenstand der Leistungspflicht des Verkäufers ist eine Sache m i t bestimmten Eigenschaften. Bietet nun der Verkäufer eine Sache an, der eine vereinbarte Eigenschaft fehlt, so ist die angebotene Sache nicht die geschuldete 21 , ihr fehlt die Schuldidentität. Der Verkäufer hat daher das Recht, diese Sache zurückzuweisen und eine andere zu verlangen. Diesen Anspruch normiert § 480 I. Es handelt sich dabei u m eine gesetzliche Wiederholung des ursprünglichen Erfüllungsanspruchs des Käufers, nicht dagegen u m einen sekundären Gewährleistungsanspruch 22 . Der Nachlieferungsanspruch t r i t t nicht an die Stelle eines 20
Vgl. I I I , 1, b. Vgl. Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 459 A n m . 2. B G H JZ 58, 211; N J W 61, 117; Erman / Weitnauer, § 480 Rdz 2; Graue, S. 210; Korintenberg, Erfüllung, S. 89; Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 459 A n m . 2; Kuhn, i n R G R K , § 480 A n m . 8; Soergel / Siebert / Ballerstedt, vor § 459 Bern. 21; Larenz I I , § 41 I I I ; Wolff, S. 70; Oertmann, S. 355; Enneccerus / Lehmann, § 113 I 1; Staudinger / Ostler, § 480 Rdz 10; A.A. Schollmeyer, S. 102, w e i l er die Bedeutung der Konkretisierung nicht erkennt, vgl. A n m . 30. Wie Schollmeyer auch Fischer, Ih. Jb. 51, 214, u n d Endemann, 9. Aufl., § 161, 5 u n d dort F N 62. 21
22
96
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
p r i m ä r e n A n s p r u c h s , er ist der primäre Sache m i t b e s t i m m t e n Eigenschaften.
Anspruch,
g e r i c h t e t a u f eine
U n r i c h t i g w ä r e es, § 480 I h i n s i c h t l i c h des Nachlieferungsanspruchs als S a n k t i o n f ü r die N i c h t e r f ü l l u n g v e r e i n b a r t e r Eigenschaften a n z u sehen. Z w a r l e g t die Tatsache, daß gerade das F e h l e n e i n e r v e r e i n b a r t e n Eigenschaft z u m N a c h l i e f e r u n g s a n s p r u c h f ü h r t , diesen Schluß n a h e ; r i c h t i g gesehen g r e i f t j e d o c h d e r N a c h l i e f e r u n g s a n s p r u c h ein, w e i l eine andere als die geschuldete Sache geleistet w u r d e . D i e Eigenschaftsvere i n b a r u n g b e s t i m m t , w a s f ü r eine Sache geschuldet i s t 2 3 . Das F e h l e n d e r Eigenschaft i s t also z w a r k a u s a l f ü r d e n N a c h l i e f e r u n g s a n s p r u c h , aber n u r m i t t e l b a r . D e r systematische G e d a n k e i s t f o l g e n d e r : L e i s t e t d e r V e r k ä u f e r eine f e h l e r h a f t e Sache, so k a n n d e r K ä u f e r gemäß § 480 I L i e f e r u n g e i n e r m a n g e l f r e i e n Sache v e r l a n g e n . D i e s e r A n s p r u c h i s t d e r ursprüngliche Leistungsanspruch, d e r f o r t b e s t e h t , w e i l die geleistete Sache eine a n dere als d i e geschuldete ist. Z w a r b e w i r k t gerade d e r F e h l e r , daß die geleistete Sache e i n a l i u d ist, das d a r f j e d o c h n i c h t d a r ü b e r h i n w e g t ä u schen, daß d e r N a c h l i e f e r u n g s a n s p r u c h deshalb besteht, w e i l eine andere als d i e geschuldete Sache geleistet w u r d e . N i c h t w e g e n des Fehlers, s o n d e r n wegen des infolge des Fehlers bedingten Andersseins der geleisteten Sache g r e i f t d e r N a c h l i e f e r u n g s a n s p r u c h ein. 23 Vgl. die interessanten Ausführungen v o n Mohnen, S. 51 ff. Mohnen u n tersucht i n seiner Arbeit, welche Angaben f ü r die Individualisierung eines Gegenstandes erforderlich sind. E r k o m m t dabei zu dem Ergebnis, daß f ü r eine anwesende Sache das „dies" genüge (vgl. dazu I I I , 3, e u n d oben A n m . 7), daß bei abwesenden Sachen hingegen alle Eigenschaftsbestimmungen der Individualisierung dienten. Wendet m a n diese Überlegungen hier an, so heißt das, daß alle Eigenschaftsangaben beim Gattungskauf — als K a u f einer abwesenden Sache — die Aufgabe haben, die Sache zu individualisieren. Dieser Feststellung k a n n i n vollem Umfang zugestimmt werden. N u r ist die Eigenschaftsbestimmung nicht allein auf das Ziel gerichtet, die I n d i v i d u a l i sierung zu ermöglichen. Sie hat vielmehr den Hauptzweck, die vertragliche Schuld zu bestimmen. Wer ein „goldenes A r m b a n d " kauft, w i l l m i t seiner E r k l ä r u n g die Individualisierung ermöglichen, u n d er w i l l ein Armband, das golden ist. Die Eigenschaftsvereinbarung ist also keine E r k l ä r u n g allein zum Zwecke der Identitätsbestimmung, sondern zur Bestimmung der gesamten Schuld. N u r fallen bei abwesenden Sachen u n d damit auch beim Gattungskauf Individualisierungs- u n d Schuldbestimmungsaufgabe der Eigenschaftsvereinbarung zusammen. Dies resultiert daraus, daß das I n d i v i d u u m durch die Eigenschaften bestimmt w i r d , eine Individualisierung ohne Eigenschaftsangaben daher nicht möglich ist. Die doppelte Funktion der Eigenschaftsbestimmung beim Gattungskauf w i r d deutlich m i t der Konkretisierung. V o r der Konkretisierung ist eine Sache, die nicht die vereinbarten Eigenschaften hat, eine andere. Es w i r k t sich hier die Individualisierungsaufgabe der Eigenschaftsvereinbarung aus. Die fehlerhafte Sache ist nicht schuldidentisch. N i m m t der Käufer die Sache an u n d konkretisiert er die Schuld auf das angebotene Objekt, so bleibt davon unberührt die Eigenschaftsvereinbarung m i t der Aufgabe, den Schuldumfang festzulegen. H a t die k o n k r e t i sierte Sache daher einen Fehler, so haftet der Verkäufer f ü r die Mangelhaf-
2. Die Sachmängelhaftung beim Gattungskauf
97
Der Unterschied w i r d durch folgende Überlegung deutlich. Die Sachmängelhaftung setzt Gefahrübergang voraus. Gemäß § 446 geht die Gefahr über m i t Übergabe der verkauften Sache, d. h. einer Sache, die die vereinbarten Eigenschaften hat. Da nämlich die Eigenschaften beim Gattungskauf identitätsbestimmend sind, solange noch nicht konkretisiert ist, w i r d durch die Eigenschafts Vereinbarung bestimmt, was verkauft ist. Ist die Sache fehlerhaft, so kann die Gefahr nicht übergehen und damit auch nicht die Sachmängelhaftung eingreifen. Gerade i n diesem Fall aber kommt der Nachlieferungsanspruch des § 480 zum Zuge. Daraus folgt, daß er kein Gewährleistungsanspruch sein kann. Gibt der Käufer sich m i t der fehlerhaften Sache zufrieden, konkretisiert er also die Schuld auf die angebotene Sache, so geht er des Nachlieferungsanspruches verlustig. Wäre der Nachlieferungsanspruch eine Sanktion für fehlerhafte Eigenschaften, so könnte der Käufer, der auf diesen Anspruch m i t der Konkretisierung verzichtet, keinerlei Rechte wegen fehlerhafter Leistung haben, weil er sich ja m i t den Fehlern zufriedengegeben hätte. Dies widerspricht aber dem Gesetz, das den Verkäufer weiterhin haften läßt. Verständlich w i r d dieses Ergebnis, wenn man sich klar macht, daß der Nachlieferungsanspruch keine Sanktion für das Fehlen einer Eigenschaft ist, sondern der Anspruch auf die Sache als solche. M i t der Konkretisierung gibt der Käufer nur zu erkennen, daß er die angebotene Sache als Schuldidentität anerkennt, daß diese Sache als solche fortan die geschuldete sein soll. Unberührt davon bleibt die Vereinbarung der Parteien, daß die Sache bestimmte Eigenschaften haben soll. M i t der Konkretisierung w i r d also nicht eine etwaige Sachmängelhaftung ausgeschlossen. Damit w i r d deutlich, daß der Nachlieferungsanspruch nicht deshalb eingreift, weil die Sache einen Fehler hat, sondern deshalb, w e i l die Sache wegen des Fehlers nicht die geschuldete ist. b) Die Sachmängelhaftung
Während der Nachlieferungsanspruch eingreift, w e i l überhaupt noch keine Sache geleistet wurde, die der geschuldeten entspricht, kommen die Sachmängelansprüche wie beim Spezieskauf zur Anwendung, wenn die konkret geschuldete Sache geleistet wurde, jedoch ohne die vereinbarten Eigenschaften. tigkeit, w e i l die Schuld nicht gehörig e r f ü l l t wurde. Vgl. dazu weiter i m Text. 7 Herberger
98
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
Damit entspricht die Sachmängelhaftung beim Gattungskauf funktionell genau der Haftung beim Spezieskauf. Die Erklärung dafür ist, daß der Gattungskauf vor Eingreifen der Sachmängelhaftung immer zur Speziesschuld wird. Die Sachmängelhaftung setzt eine Konkretisierung der Schuld auf eine bestimmte Sache voraus. aa) Die Konkretisierung und ihre Bedeutung im Verhältnis des Nachlieferungsanspruchs zum Gewährleistungsanspruch Beim Gattungskauf sind zwei Stadien der Schuld scharf voneinander abzugrenzen: das Stadium vor der Einigung der Parteien auf eine bestimmte Sache, also vor der Konkretisierung, und das nach der Konkretisierung. Dementsprechend hat der Gesetzgeber auch die beiden Bereiche getrennt geregelt. Bevor die Parteien eine Sache zum Schuldgegenstand erhoben haben, fehlt überhaupt eine schuldidentische Sache, die Schuld ist noch generell. Daraus resultiert, daß nicht einmal eine teilweise Erfüllung möglich ist, wie etwa beim Spezieskauf, wenn die Sache als solche, jedoch m i t Fehlern behaftet, geleistet wird. Weiterhin folgt daraus — dem trägt das Gesetz auch konsequent i n § 279 Rechnung — daß keine Unmöglichkeit eintreten kann, solange der Schuldner theoretisch noch i n der Lage ist, eine der Vereinbarung entsprechende Sache zu erbringen. W i r d eine vom Verkäufer als Leistung vorgesehene Sache vor der beiderseitigen Konkretisierung zerstört, so kann von einer Unmöglichkeit keine Rede sein 24 . 24 Daß der Verkäufer bei zufälligem Untergang der Sache u. U. gemäß § 243 I I i. V. m. § 275 v o n seiner Schuld frei w i r d , beruht allein auf der Gefahrtragungsregel des § 243 I I . Richtigerweise w i r d von einem T e i l der Lehre, w e n n auch m i t verschiedenen Argumenten angenommen, daß der Schuldner i m Falle des Untergangs der Sache berechtigt ist, anstelle der ausgesonderten Sache eine andere zu leisten (vgl. Enneccerus / Lehmann, § 6 I V 2; Korintenberg, Erfüllung, S. 136, 137; Esser, § 18 I I 3; Blomeyer, § 12 I V 2; Soergel! Siebert / Schmidt, § 243 Bern. 6; R G 91, 110, 112). Dies erscheint aber n u r zulässig, wenn noch keine Speziesschuld entstanden ist. Daß § 243 I I noch keine U m w a n d l u n g i n eine Speziesschuld b e w i r k t , ist darauf zurückzuführen, daß eine solche U m w a n d l u n g n u r durch Einigung möglich ist (vgl. oben I I I A n m . 18). Dementsprechend g i l t die den Schuldner begünstigende Gefahrtragungsregel des § 243 I I nicht, w e n n er nach Aussonderung die Sache schuldhaft zerstört. Es g i l t nicht § 325, sondern § 279 d. h. der Schuldner w i r d von seiner Schuld nicht frei (a. A. Staudinger / Weber, § 243 Rdz 66). Es handelt sich dabei nicht n u r u m ein Recht des Schuldners, die Gattungsschuld Wiederaufleben zu lassen (so etwa Larenz I, § 11 I), v i e l mehr ist eine Speziesschuld noch gar nicht entstanden. Der Schuldner hat also nicht die Wahl, ob er eine andere Sache oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung leistet. Die Unmöglichkeit steht nicht zur Disposition der Parteien. Entweder liegt sie v o r oder nicht.
2. Die Sachmängelhaftung beim Gattungskauf
99
Die Parteien können sich jedoch auf eine Sache einigen. Dies geschieht regelmäßig dadurch, daß der Verkäufer eine Sache anbietet, der Käufer diese Sache als die geschuldete anerkennt. Damit w i r d das Schuldverhältnis auf die Sache konkretisiert 2 5 . Der Inhalt des Vertrages w i r d dahingehend geändert, daß anstelle irgendeiner Sache diese spezielle Sache geschuldet ist. Der Gattungskauf w i r d i n eine Speziesschuld übergeleitet 26 . Die Parteien holen die vorher nicht erfolgte konkrete Bestimmung des Schuldgegenstandes nach. Unberührt von dieser Konkretisierung bleibt die Vereinbarung über die Eigenschaften, die die Sache haben soll 2 7 . War vor der Konkretisierung irgendein Turnierpferd geschuldet, so ist danach dieses Pferd m i t den Eigenschaften eines Turnierpferdes geschuldet. Für die Sachmängelhaftung ist diese Überleitung der Gattungsschuld i n eine Speziesschuld Anwendungsvoraussetzung 28 . Nur eine konkrete Sache kann einen Fehler haben. Demnach kann die Sachmängelhaftung nur i n Frage kommen, wenn eine konkrete Sache Schuldgegenstand ist. Damit w i r d deutlich, daß die Konkretisierung der A k t ist, der den Nachlieferungsanspruch von den Sachmängelansprüchen scheidet. Der Nachlieferungsanspruch kann nur i n Betracht kommen, wenn der Gegenstand des Kaufvertrages noch nicht fixiert ist. Das ist beim Gattungskauf solange der Fall, als die Parteien sich noch nicht auf eine bestimmte Sache geeinigt haben. Liefert der Verkäufer eine mangelhafte Sache, so kann der Käufer sich auf den Standpunkt stellen, daß die angebotene Sache eine andere ist, als die nach dem Vertrag geschuldete. Der Käufer kann daher die Sache zurückweisen. Erfüllung ist nicht eingetreten. Die Leistungspflicht des Verkäufers besteht fort. Der Käufer kann nach wie vor verlangen, daß der Verkäufer i h m eine dem Vertrag entsprechende Sache leistet. Es handelt sich bei diesem Nachlieferungsanspruch u m den ursprünglichen Leistungsanspruch, der nur deshalb besonders normiert ist, w e i l er i m Anschluß an einen Erfüllungsversuch bestimmten Beschränkungen unterworfen ist (§ 480 I 2). Diese Beschränkungen tragen u. a. der Tatsache Rechnung, daß der Verkäufer dem Käufer eine — wenn auch mangelhafte — Sache übergeben hat, und es dem Verkäufer 25
Vgl. Wolff, S. 71 ff.; Medicus, § 13 I I 3 c; Fikentscher, § 70 V I I . Vgl. Korintenberg, Diss. S. 16, 26; Süß, S. 91. Trotzdem w i r d von beiden nicht erkannt, daß dann der Rechtsgrund bei Gattungs- u n d Speziesschuld der gleiche sein muß. 27 Wolff, S. 72. I n diesem Sinne auch Süß, S. 91, der dennoch nicht den Schluß zieht, daß unter diesen Umständen auch beim Spezieskauf eine V e r einbarung über die Eigenschaften möglich sein muß. 28 Vgl. Wolff, S. 70, u n d insbesondere Kreß, § 26 I I Β c. 28
i*
100
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
nicht zuzumuten ist, eine weitere Sache zu leisten, bevor er wenigstens die von i h m geleistete mangelhafte Sache zurückerhält. Auch soll der Verkäufer nicht über einen bestimmten Zeitraum hinaus i m ungewissen darüber bleiben, ob der Käufer die gelieferte Sache als vertragsmäßig anerkennt oder nicht. Das ändert jedoch nichts an der ursprünglichen Verpflichtung des Verkäufers zu mangelfreier Leistung. Hat der Verkäufer eine mangelhafte Sache geliefert, so w i r d dadurch der A n spruch des Käufers nicht zum Erlöschen gebracht. Der Anspruch geht nach wie vor auf eine Sache mittlerer A r t und Güte. Nur kann der Käufer diesen Anspruch nicht durchsetzen, wenn der Verkäufer sich darauf beruft, daß er bereits eine Sache geleistet hat. Der Anspruch ist vielmehr nur Zug um Zug gegen Rückgabe der übergebenen, mangelhaften Sache durchsetzbar (§ 480 I 2 i V m §§ 467 S. 1, 348) 29 . Solange dieser — wenn auch nur unter den Vorausetzungen des § 480 I 2 durchsetzbare — Nachlieferungsanspruch auf eine Sache m i t t lerer A r t und Güte besteht, können die Gewährleistungsansprüche nicht zur Anwendung kommen. Voraussetzung für das Eingreifen der Gewährleistung ist, daß eine bestimmte Sache Schuldgegenstand ist, daß also Konkretisierung eingetreten ist. Der Nachlieferungsanspruch hingegen setzt voraus, daß die Schuld sich noch nicht auf eine bestimmte Sache konkretisiert hat. Nachlieferungsanspruch und Gewährleistungsansprüche sind durch den A k t der Konkretisierung voneinander getrennt. Unzutreffend ist es, wenn behauptet wird, der Nachlieferungsanspruch stehe neben den Gewährleistungsansprüchen 30 . Die beiden A n 29
Vgl. Palandt / Putzo, § 480 A n m . 2 c. So jedoch Süß, S. 106; Korintenberg, Diss. S. 14 u n d Erfüllung, S. 22, 153 F N 6; Schollmeyer, S. 100, 102. Schollmeyer sieht nicht die i n der Erhebung der Sachmängelansprüche enthaltene Konkretisierung (vgl. V, 2, b, cc) u n d k o m m t deshalb zu dem falschen Schluß, der Nachlieferungsanspruch müsse ein Gewährleistungsanspruch sein. Schollmeyer f ü h r t aus, das Gesetz würde nicht zwei verschiedenartige Ansprüche einmal wegen vollständiger Nichterfüllung, einmal wegen t e i l weiser Nichterfüllung nebeneinander normieren. Schollmeyer erkennt zwar, daß die Gewährleistungsansprüche eine K o n k r e tisierung voraussetzen (vgl. S. 100), er übersieht jedoch, daß Nachlieferungsanspruch u n d Gewährleistungsansprüche nicht nebeneinander stehen, weil die Konkretisierung die Ansprüche gerade scheidet. I n d e m Schollmeyer ein Nebeneinander der Ansprüche annimmt u n d deshalb den Nachlieferungsanspruch als Gewährleistungsanspruch ansieht, muß er auch eine K o n k r e t i sierung der Schuld vor Eingreifen des Nachlieferungsanspruchs annehmen. E r erreicht dies dadurch, daß er eine Konkretisierung annimmt, w e n n eine Sache mittlerer A r t u n d Güte geleistet w i r d . Auch eine fehlerhafte Sache könne von mittlerer A r t u n d Güte sein. M i t Leistung einer solchen Sache trete die Konkretisierung ein. Sei diese Sache fehlerhaft, so kämen die Gewährleistungsansprüche, also der Nachlieferungsanspruch, Wandlung oder Minderung zur Anwendung. Die Ansicht Schollmeyers zeigt deutlich, w o h i n es führt, w e n n die K o n k r e tisierung nicht richtig erkannt w i r d . Vgl. auch die K r i t i k Graues, S. 267 ff. 30
101
2. Die Sachmängelhaftung beim Gattungskauf
sprüche bestehen niemals gleichzeitig nebeneinander. Entweder der Käufer lehnt die Sache ab, dann hat er den Nachlieferungsanspruch oder er konkretisiert, dann hat er nurmehr die Sachmängelrechte 31 . Der Käufer hat die Wahl, ob er konkretisiert oder nicht und damit die Wahl zwischen Nachlieferung und Gewährleistung 32 . Doch ist das Verhältnis ein ausschließliches. M i t dem Untergang des Nachlieferungsanspruchs kommt erst eine Anwendung des Gewährleistungsanspruchs i n Frage. Vor der Konkretisierung kommt die Gewährleistung nicht zur Anwendung und nach der Konkretisierung ist der Nachlieferungsanspruch ausgeschlossen. Die Einigung der Parteien auf eine Sache bewirkt eine Vertragsänderung, an die auch der Käufer gebunden ist, m i t der Folge, daß er nun nicht mehr auf den Nachlieferungsanspruch zurückgreifen kann, sondern mit der Sachmängelhaftung vorliebnehmen muß. Bietet der Verkäufer eine Sache an, so bringt er damit zum Ausdruck: Ich möchte m i t dieser konkreten Sache erfüllen. Ist die Sache mangelhaft, so kann der Käufer sich auf den Standpunkt stellen, daß die Sache nicht der Vereinbarung entspricht und eine mangelfreie Sache verlangen. Er kann aber auch das Angebot des Verkäufers annehmen, indem er sich damit einverstanden erklärt, daß die konkrete Sache zum Schuldgegenstand wird. Er hat dann, w e i l die nun zum Schuldgegenstand gewordene konkrete Sache mangelhaft ist, die Gewährleistungsansprüche 33 . Zu klären bleibt die Frage, ob und wielange der Käufer das ius variandi hat, also das Recht, von seiner Entscheidung wieder abzuweichen. Diese Frage läßt sich aus der Vertragsnatur der Konkretisierung beantworten. Indem der Verkäufer eine bestimmte Sache als Erfüllung anbietet, bringt er zum Ausdruck, er wolle diese Sache zum Vertragsgegenstand machen. Der Käufer kann, wenn die Sache mangelhaft ist, dieses Angebot annehmen oder aber Nachlieferung verlangen. Verlangt der Käufer Nachlieferung, so gibt es für den Verkäufer zwei Möglichkeiten: er kann sich damit einverstanden erklären oder er kann sich auf den Standpunkt stellen, die gelieferte Sache sei einwandfrei, es sei damit erfüllt. I m letzteren Falle besteht das Angebot des Verkäufers, das Schuldverhältnis auf die konkrete Sache zu beschränken, fort. Dem Käufer steht es daher frei, von seinem Nachlieferungsbegehren Abstand zu nehmen und auf die Gewährleistungsansprüche überzugehen. Er hat also ein ius variandi.
31 32 33
Vgl. Staub / Könige, 9. Aufl., Exkurs zu § 374 Anm. 42; Wolff, Vgl. Larenz I I , § 41 I I I . Ebenso Kreß, § 26 I I Β c.
S. 75 f.
102
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
Anders verhält es sich, wenn der Verkäufer sich m i t dem Nachlieferungsanspruch einverstanden erklärt. I n diesem F a l l sind sich die Parteien darüber einig, daß die zunächst geleistete Sache nicht Schuldgegenstand werden soll, daß der Verkäufer vielmehr eine andere Sache leisten soll. Das Konkretisierungsangebot des Verkäufers ist hinfällig geworden. Der Käufer kann die Schuld nicht mehr auf die übergebene Sache konkretisieren. Dadurch, daß der Verkäufer sich bereit erklärt, eine andere Sache zu leisten, hat er — man kann sagen — ein Nachlieferungsrecht erlangt. Ohne Zustimmung des Verkäufers hat der Käufer daher kein ius variandi mehr. Gem. § 480 I 2 findet auf den Nachlieferungsanspruch § 465 Anwendung. Verständlich w i r d die A n wendbarkeit des § 465 auf den Nachlieferungsanspruch nur, wenn man der hier vertretenen Ansicht folgt. Für den Bestand des Nachlieferungsanspruchs kann § 465 keinerlei Bedeutung haben, da der Anspruch als ursprünglicher Leistungsanspruch aus dem Vertrag folgt. Bedeutung hat § 465 für den Nachlieferungsanspruch jedoch bezüglich der Frage der Konkretisierung und des ius variandi. Die entsprechende Anwendung des § 465 auf den Nachlieferungsanspruch hat den Sinn, den Käufer an seine Entscheidung zu binden. Anders als bei Wandlung, Minderung oder Schadensersatz, bei denen durch den Vollzug eine Umgestaltung des Schuldverhältnisses herbeigeführt w i r d 8 4 , kommt es bei der Geltendmachung des Nachlieferungsanspruchs zu keiner solchen Umgestaltung, da der Nachlieferungsanspruch der ursprüngliche Leistungsanspruch ist. Die Bedeutung des § 465 für den Nachlieferungsanspruch besteht, wie auch für Wandlung, Minderung oder Schadensersatz, i n der nach Vollzug eintretenden Bindungswirkung. Treffend hat Kreß 35 die eigentliche i n zweierlei Hinsicht entscheidende Bedeutung des § 465 beschrieben: Zum einen bewirkt die entsprechend § 465 vollzogene Vereinbarung, daß das Schuldverhältnis umgestaltet w i r d — Kreß spricht entsprechend der früheren Vorstellung von Aufhebung —, zum anderen führt diese Vereinbarung eine Bindung herbei. „Der Vereinbarung der Wandlung kommt die Doppelbedeutung der Aufhebung des ius variandi (§ 465) und des Schuldverhältnisses (Kaufes) zu." Da eine Umgestaltung des Schuldverhältnisses beim Nachlieferungsanspruch ausscheidet, liegt die Bedeutung des § 465 allein i n der durch die Vereinbarung hervorgerufenen Bindung. Wenn der Verkäufer sich auf Verlangen des Käufers zur Nachlieferung bereiterklärt, so sind beide Seiten daran gebunden. Der Käufer kann nicht mehr das Schuldverhältnis auf die ursprünglich angebotene Sache konkretisieren und die Sachmängelansprüche bezüglich dieser Sache erheben 36 . Auch hier 34 35
Vgl. dazu unten V, 4. Kreß, § 26 I I A e F N 92.
2. Die Sachmängelhaftung beim Gattungskauf
103
zeigt sich, daß die gesetzliche Regelung bei richtiger Auslegung sinnvoll ist. Es wäre i n hohem Maße unbillig, wenn der Käufer, nachdem der Verkäufer Mühe und Kosten für die Beschaffung einer mangelfreien Sache aufgewandt hat, das Schuldverhältnis auf die ursprünglich angebotene Sache konkretisieren könnte, m i t der Folge, daß er dann die Gewährleistungsansprüche hätte. Die Bindung des § 465 w i r k t aber nur solange, bis der Verkäufer erneut eine Sache als Erfüllung anbietet. Ist diese Sache wieder mangelhaft, so steht es dem Käufer frei, das Schuldverhältnis nun auf diese Sache zu konkretisieren und die Sachmängelansprüche geltend zu machen. Er kann jedoch genausogut nochmals Nachlieferung verlangen. Einer Erörterung bedarf noch die Frage, welchen Einfluß es hat, insbesondere auch für die Frage der Konkretisierung, wenn die dem Käufer übergebene, mangelhafte Sache untergeht oder verschlechtert wird. Nach § 480 I 2 i V m § 467 finden bestimmte Vorschriften des Rücktrittrechts Anwendung. Geht die Sache beim Käufer durch Zufall unter, so führt das weder zu einer Konkretisierung, noch zu einem Verlust des Nachlieferungsanspruchs. Da der Käufer sich nicht damit einverstanden erklärt hat, das Schuldverhältnis auf die angebotene mangelhafte Sache zu beschränken, ist eine Konkretisierung nicht eingetreten. Der zufällige Untergang der übergebenen Sache vermag daran nichts zu ändern, da der Käufer dadurch seinen Nachlieferungsanspruch nicht verloren hat (§§ 480 I 2, 467, 350). Der Käufer kann nach wie vor Lieferung einer Sache mittlerer A r t und Güte verlangen. Der durch den Untergang der Sache eingetretene Verlust t r i f f t allein den Verkäufer. Mangels Konkretisierung hat ein Gefahrübergang noch nicht stattgefunden, der Käufer ist also nicht zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet. Anders ist es dagegen, wenn der Käufer den Untergang oder eine wesentliche Verschlechterung oder die anderweitige Unmöglichkeit der Herausgabe der übergebenen mangelhaften Sache i m Sinne des § 351 verschuldet 37 hat. Gem. §§ 480 I 2, 467, 351 ist i n diesem F a l l der Nachlieferungsanspruch ausgeschlossen38. Das hat nun notwendig zur Folge, 36 Ebenso Larenz, a.a.O.; Soergel / Siebert / Ballerstedt, § 480 Bern. 4; so auch B G H N J W 1970, 1502. 37 Es handelt sich dabei u m ein untechnisches Verschulden. M a n könnte von einem F a l l des „venire contra factum p r o p r i u m " sprechen (vgl. Palandt / Heinrichs, § 351 A n m . 2; Enneccerus / Lehmann, § 39 I I l e ) . Ä h n l i c h von Caemmerer, Festschrift Larenz, S. 632 f : Das Risiko müsse beim Käufer bleiben, w e n n die Sache infolge von i n eigenem Interesse getroffenen Dispositionen des Käufers untergeht. Vgl. zu dieser Frage auch Erman / Weitnauer, § 440 Rdz 17 ff. 38 Vgl. B G H N J W 1972, 155 f ü r die Wandlung; Palandt / Heinrichs, § 350 A n m . 1.
104
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
daß das S c h u l d v e r h ä l t n i s
auf
die untergegangene
Sache
beschränkt
w i r d . Z w e c k dieser k r a f t Gesetzes e i n t r e t e n d e n K o n k r e t i s i e r u n g i s t es z u v e r h i n d e r n , daß der V e r k ä u f e r nochmals eine Sache l e i s t e n m u ß , o b w o h l n i c h t er, s o n d e r n d e r K ä u f e r d e n U n t e r g a n g b z w . d i e w e s e n t liche V e r s c h l e c h t e r u n g d e r Sache v e r s c h u l d e t h a t . D u r c h d i e v o m Gesetz angeordnete K o n k r e t i s i e r u n g w i r d d i e u n t e r gegangene m a n g e l h a f t e Sache Schuldgegenstand, d. h. z u r „ v e r k a u f t e n Sache" i m S i n n e des § 446 I 1. Das b e d e u t e t , daß a u f d e n Z e i t p u n k t d e r Ü b e r g a b e r ü c k w i r k e n d d i e G e f a h r a u f d e n K ä u f e r ü b e r g e h t . D i e s e r ist deshalb v e r p f l i c h t e t ,
den vereinbarten
Kaufpreis
z u zahlen. D a
die
Sache jedoch m a n g e l h a f t w a r , k a n n er M i n d e r u n g des K a u f p r e i s e s oder d e n „ k l e i n e n " Schadensersatz v e r l a n g e n , jedoch n i c h t W a n d l u n g oder „ g r o ß e n " Schadensersatz 3 9 , w e i l i n s o w e i t auch h i e r § 351 e n t g e g e n s t e h t 4 0 39
Vgl. V, 4, b, bb. Ebenso Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 45; Huber, S. 418. Nicht zugestimmt werden k a n n daher der Entscheidung B G H N J W 1972, 36 ff. = B G H 57, 137 ff. Der Käufer eines Gebrauchtwagens w a r beim Kaufabschluß von einem Angestellten der Verkäuferfirma darüber arglistig getäuscht worden, daß das Fahrzeug ein Unfallwagen war. Dies erfuhr er erst, nachdem er m i t dem bezahlten u n d übergebenen Wagen einen alleinverschuldeten Totalschaden erlitten hatte. Er focht den Kaufvertrag wegen arglistiger Täuschung an u n d verlangte Rückzahlung des Kaufpreises Zug u m Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugwracks. Der B G H bejaht einmal Ansprüche aus unerlaubter Handlung gegen den Angestellten (§ 823 I I BGB, § 263 StGB u n d § 826 BGB) u n d gegen die F i r m a selbst (§ 831 BGB), indem er einen adäquaten Ursachenzusammenhang zwischen Täuschung u n d Unfallschaden a n n i m m t u n d die Schadensverwirklichung auch noch als innerhalb des Schutzbereichs der verletzten N o r m liegend ansieht: Die Gefahr für einen v o m Käufer nicht verschuldeten Untergang der Kaufsache treffe v o l l den f ü r die Täuschung Verantwortlichen. Bei einem v o m Käufer verschuldeten Untergang der K a u f sache sei dies grundsätzlich nicht anders. Auch hier w i r k e die Täuschungshandlung noch adäquat ursächlich bei der Entstehung des Schadens mit, der Schaden liege ebenfalls noch innerhalb des Norm-Schutzzweckes. Das m i t wirkende Verschulden des Käufers müsse über § 254 Berücksichtigung f i n den. Weiterhin hält der B G H den RückZahlungsanspruch unter dem Gesichtspunkt der ungerechtfertigten Bereicherung f ü r begründet. Nicht die Saldotheorie, sondern die Zweikondiktionentheorie müsse angewendet w e r den, w e n n der Käufer durch arglistige Täuschung zum Vertragsschluß v e r anlaßt worden ist, gleichgültig, ob den Käufer an dem späteren Untergang der Sache ein Verschulden t r i f f t oder nicht. Jedoch findet das Verschulden des Käufers am Untergang der Sache über § 242 (ähnlich dem i m Bereicherungsrecht nicht anwendbaren § 254) Berücksichtigung. Die Entscheidung ist zu Recht überwiegend auf Ablehnung gestoßen (vgl. dazu Medicus § 12 I I 3 c, bb, S. 100; Huber, Jus 1972, 439 ff.; von Caemmerer, Festschrift Larenz, S. 634 ff.; Lieb, JZ 1972, 438 ff.; Honsell, N J W 1973, 350 ff.). Statt wegen arglistiger Täuschung anzufechten hätte der Käufer auch nach § 463 Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen können, u n d zwar, unbeachtet einer möglicherweise vorliegenden Zusicherung der Unfallfreiheit, unter dem Gesichtspunkt des arglistigen Verschweigens der Tatsache, daß der Wagen ein Unfallfahrzeug war. Der Käufer hätte i n diesem F a l l jedoch nach § 467 i. V. m. § 351 (vgl. dazu i m Text) n u r den kleinen Schadensersatzanspruch gehabt. Er hätte auch nicht wandeln können. Die v o l l k o m 40
2. Die Sachmängelhaftung beim Gattungskauf
105
Der Ausschluß des großen Schadensersatzes ergibt sich aus der Überlegung, daß § 351 gerade die ganz oder i n erheblichem Umfang nicht mehr durchführbare Rückabwicklung verhindern will. Zu einer solchen aber würde der große Schadensersatz führen. Neben der Konkretisierung durch die Parteien kann es also durch den über §§ 480 I 2, 467 anwendbaren § 351 zu einer Konkretisierung kraft Gesetzes kommen, m i t der Folge, daß der Verkäufer von der Nachlieferungspflicht frei w i r d und vom Käufer Zahlung des Kaufmene Rückabwicklung wäre i h m also auf jeden F a l l verwehrt gewesen. Es handelt sich dabei u m eine eindeutige gesetzliche Risikoverteilung. U m so mehr muß es erstaunen, daß diese Risikoverteilung unter dem gleichen rechtlichen Aspekt, der arglistigen Täuschung, offenbar nicht gelten soll, w e n n der Käufer nach § 123 anficht. Der B G H ist w o h l der Meinung, daß sich die i n § 351 enthaltene Risikoregelung nicht auf die Bereiche der ungerechtfertigten Bereicherung u n d der unerlaubten Handlung entsprechend übertragen läßt, selbst w e n n die Ansprüche aus einem fehlgeschlagenen gegenseitigen Vertrag resultieren. Dem kann grundsätzlich nicht zugestimmt werden. Es fragt sich nur, wie der Risikogedanke i m Rahmen der ungerechtfertigten Bereicherung u n d der unerlaubten Handlung Berücksichtigung finden kann. F ü r §§ 823 ff. gilt dabei: Ob das Verhalten des Verkäufers als adäquat kausal für den eingetretenen Schaden anzusehen ist, hängt davon ab, auf welchen Vorgang man abstellt. Die Übergabe des Fahrzeugs ist sicher kausal; bei der arglistigen Täuschung, dem Verhalten, das dem Verkäufer vorgeworfen w i r d , mag m a n berechtigte Zweifel haben (Medicus, § 12 I I 3 c, bb u n d Hub er, Jus 1972, 440 verneinen die Adäquanz). Entscheidend ist m. E. ein anderer Gesichtspunkt. Unter den Schutzbereich der §§ 823 ff. können keine Schäden fallen, die nach der gesetzlichen AVertung i n das Risiko des Geschädigten fallen. Bei einem fehlgeschlagenen Vertrag ergibt sich der Risikobereich des Käufers aus einer entsprechenden Anwendung des § 351. Auch w e n n man diese N o r m nicht heranziehen w i l l , muß m a n zu dem gleichen Ergebnis kommen. Nach § 823 I I i. V. m. dem Schutzgesetz sind n u r die Schäden zu ersetzen, die gerade an einem Rechtsgut eintreten, „das die Schutzvorschrift sichern sollte, u n d infolge einer Gefahr, vor der sie schützen sollte" (so B G H N J W 1957, 1763; N J W 1963, 1827). N u n k a n n niemand ernsthaft behaupten, daß § 263 StGB vor Verkehrsunfällen schützen soll. Die N o r m dient dem Schutz des Vermögens. Unfallschäden können daher nicht dem Norm-Schutzbereich zugerechnet werden (ebenso Medicus, a.a.O.; Huber, Jus 1972, 440 f.; von Caemmerer, S. 641; Lieb, JZ 1972, 444; Honseil, N J W 1973, 352 f.; auch Flessner, N J W 1972, 1779). F ü r den Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung gelten ähnliche Überlegungen. Es k a n n nicht darauf ankommen, ob der Vertrag über Rücktrittsrecht (bei Wandlung oder Schadensersatz nach § 463) oder Bereicherungsrecht (im Falle der Anfechtung wegen arglistiger Täuschung) rückabgewickelt w i r d . Stets sind §§ 350, 351 Maßstab der Risikoverteilung (ebenso auch Huber, N J W 1972, 443 ff.; von Caemmerer, S. 634 ff.). Das bedeutet, daß die Saldotheorie u n d nicht die Zweikondiktionentheorie anzuwenden ist, w e n n der Käufer die Verschlechterung etc. der Sache i m Sinne des § 351 „verschuldet" (vgl. dazu A n m . 37) hat. Der Käufer kann daher n u r den Betrag verlangen, der sich aus der Differenz Kaufpreis - Wert der verkauften Sache ergibt (ebenso von Caemmerer, S. 638; Medicus, a.a.O.; Huber, a.a.O.; i m Ergebnis auch Lieb, a.a.O., Honseil, a.a.O. A. A. Flessner, a.a.O., der i n punkto u. B. dem B G H m i t Rücksicht auf die durch §§ 242, 254 ermöglichte Schadensteilung zustimmt).
106
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
preises verlangen kann. Dem Käufer bleibt das Recht, Minderung oder kleinen Schadensersatz zu verlangen. bb) Die Konkretisierung
und die Verjährung
Solange die Gattungsschuld nicht i n eine Speziesschuld umgewandelt ist, kann der Käufer bei Leistung einer fehlerhaften Sache Nachlieferung verlangen. Dies ist auch nach E i n t r i t t der Verjährung möglich, sofern der Verkäufer sich nicht darauf beruft. Gem § 480 I 2 i. V. m. § 477 verjährt der Nachlieferungsanspruch bei beweglichen Sachen innerhalb von 6 Monaten nach der Ablieferung 4 1 . Diese Bestimmung ist nicht nur sinnvoll, sie steht auch i m Einklang m i t der vorgetragenen Ansicht. Ist eine Sache dem Käufer übergeben, so liegt von Seiten des Verkäufers das Angebot vor, die Schuld auf diese Sache zu konkretisieren. Schweigt der Käufer über eine bestimmte Zeit hinaus, so kann es nicht ohne Folge geschehen, denn der Verkäufer rechnet damit, daß der Käufer m i t der Sache zufrieden ist. Ein Schweigen kann zweierlei Bedeutung haben. Es kann sich einmal als Willenserklärung darstellen, zum anderen nur als Folgen begründender Tatbestand 42 . Der Unterschied ergibt sich, je nach dem, ob man aus dem Schweigen verbunden m i t einem bestimmten Verhalten einen objektiven Erklärungstatbestand ableiten kann oder nicht. Generell läßt sich dies niemals sagen. Entscheidend dafür sind die Umstände des Einzelfalls. Was nun die Verjährung des Nachlieferungsanspruchs gemäß § 477 anbelangt, so t r i t t sie nicht ein, w e i l das Gesetz eine Annahme des Konkretisierungsangebots aus dem Schweigen des Käufers fingiert und damit nach Fristablauf eine Konkretisierung herbeiführt 4 3 , sondern deshalb, w e i l der Käufer einen Vertrauenstatbestand gesetzt hat, auf den sich der Verkäufer berufen kann 4 4 . Damit w i r d verständlich, warum der Käufer auch nach Ablauf der Frist des § 477 Nachlieferung verlangen kann, sofern der Verkäufer sich nicht auf die Verjährung beruft. 41 Die Ablieferung ist nicht m i t der Übergabe identisch. Ablieferung ist erfolgt, w e n n der Käufer die Möglichkeit hat, die Sache i n eigenen Gewahrsam zu nehmen u n d zu untersuchen ( B G H B B 1958, 396; Erman / Weitnauer, § 477 Rdz 7). 42 Vgl. B G H 11, 4 ff.; B G H 20, 154; Schlegelberger / Hefermehl, § 346 RZ 128; Soergel / Siebert / Hefermehl, vor § 116 Bern. 10; Erman / Hefermehl, § 147 Rdz 5 ff.; Staudinger / Coing, vor § 116 RZ 6; Lehmann / Hübner, § 30 I I I . 43 So aber Wolff, S. 73. 44 So ist auch § 377 I I H G B zu verstehen; vgl. Schlegelberger / Hefermehl, § 377 RZ 78; Baumbach / Duden, § 377 A n m . 1 C.
2. Die Sachmängelhaftung beim Gattungskauf
107
Unabhängig davon kann jedoch der Käufer jederzeit das Schuldverhältnis auf die angebotene bzw. übergebende Sache konkretisieren, auch durch Schweigen 45 . Dabei handelt es sich aber dann u m eine echte Willenserklärung, nicht nur u m einen durch Schweigen erzeugten Vertrauenstatbestand. M i t der Konkretisierung entsteht eine Speziesschuld und der Nachlieferungsanspruch ist ausgeschlossen, selbst wenn die Verjährungsfrist noch nicht abgelaufen ist. Konkretisierung und Verjährung sind also zwei vollkommen verschiedene Ereignisse. I n diesem Zusammenhang gehört der Fall der aliud-Leistung, nämlich, daß eine Sache aus einer anderen Gattung als der geschuldeten geleistet wird, z. B. Äpfel statt Birnen. Eigene Bedeutung hat dieser Fall überhaupt nur i m Zusammenhang m i t der Verjährungsfrage. Eine Sache, die nicht der Vereinbarung entspricht, gleichgültig, ob sie nur einen Fehler hat oder ob sie einer anderen Gattung angehört, ist nicht Gegenstand des Kaufvertrages und dam i t nicht Schuldobjekt. Der Käufer kann Lieferung einer der Vereinbarung entsprechenden Sache verlangen. War nun die Sache bereits übergeben worden, so geht es u m zwei Fragen: a) Kann der Käufer die Schuld auf die übergebene Sache konkretisieren und die Sachmängelansprüche erheben? b) Verjährt der Nachlieferungsanspruch, innerhalb der Frist des § 477 rügt?
wenn der Käufer
nicht
Z u a) Daß eine Konkretisierung auf die angebotene, einer anderen Gattung zugehörige Sache und damit die Sachmängelhaftung möglich ist, leuchtet ein, da die Parteien ihre Vereinbarung beliebig verändern können. Dabei ist i m Einzelfall jedoch genau zu prüfen, welche Änderung des Vertragsinhalts eingetreten ist. Z u b) Bei der Frage nach der Verjährung dreht es sich dagegen nicht, wie oben ausgeführt, u m die Folge einer Vereinbarung, sondern u m die aus einem erzeugten Vertrauen resultierende Folge. Schweigt der Käufer nach der Sachübergabe über die Frist des § 477 hinaus, so erweckt er beim Verkäufer dann ein schutzwürdiges Vertrauen, wenn die Sache i m Verhältnis zur geschuldeten so geartet ist, daß eine B i l l i gung durch den Käufer nicht ausgeschlossen ist. M i t Recht wendet die h. L. hier § 378 HGB analog an 4 6 , denn diese Norm bringt den gleichen 45
Vgl. Wolf, S. 72. Vgl. Larenz I I , § 41 I I I ; Staudinger/ Ballerstedt, vor § 459 Bern. 35. 46
Ostler, § 459 RZ 18; Soergel / Siebert /
108
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
Rechtsgedanken wie § 377 I I H G B 4 7 zum Ausdruck. Wer zurechenbar Vertrauen hervorruft, hat i n bestimmtem Umfang für sein Verhalten einzustehen. Der Nachlieferungsanspruch verjährt also auch bei Übergabe eines genehmigungsfähigen aliud gemäß § 477 I innerhalb von 6 Monaten. cc) Die Konkretisierung durch Geltendmachung eines Sachmängelanspruchs Oft kommt es vor, daß der Käufer nach der Übergabe einen Fehler entdeckt und deshalb Sachmängelansprüche geltend macht. Ist eine Konkretisierung, wie meist i n diesen Fällen, noch nicht erfolgt, so fragt es sich, ob die Behauptung stichhaltig ist, daß die Sachmängelansprüche erst nach der Konkretisierung eingreifen. Aus dem Gesetz ergibt sich, daß der Käufer das Recht hat, statt Nachlieferung Wandlung, Minderung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen (§ 480 I). Wie verträgt sich diese Regelung mit unserer These? M i t Erhebung der Sachmängelansprüche konkretisiert der Käufer, d. h. nimmt er das Angebot des Verkäufers, die Schuld auf die angebotene Sache zu beschränken, an 4 8 . Der Käufer, der die Sachmängelansprüche geltend macht, gibt mit seiner Erklärung zu erkennen, daß er das Schuldverhältnis auf die angebotene Sache konkretisieren w i l l 4 9 . Die Konkretisierung, die der Sachmängelhaftung vorausgehen muß, t r i t t an sich gleichzeitig m i t der Geltendmachung der Gewährleistungsrechte ein. Doch kann eine Erklärung, die sowohl die Rechtsfolge, wie deren Voraussetzung betrifft, nur so verstanden werden, daß der die Voraussetzung schaffende Teil der Erklärung der Rechtsfolgeerklärung eine logische Sekunde vorangeht. Damit sind die Bedenken beseitigt, daß mangels Gefahrübergang gar keine Sachmängelhaftung möglich ist. M i t der Übergabe einer fehlerhaften Sache ist beim Gattungskauf noch kein Gefahrübergang verbunden, denn verkauft i. S. des § 446 ist eine fehlerfreie Sache. Die Sachmängelhaftung setzt jedoch Gefahrübergang voraus (vgl. § 459 I). 47
Vgl. A n m . 44. Gerade diese Konkretisierung erkennt Schollmeyer nicht u n d k o m m t deshalb zu einem unzutreffenden Ergebnis, vgl. dazu A n m . 30. 49 B G H N J W 67, 33; Enneccerus / Lehmann, § 113 I 2; Medicus, § 13 I I 3 c; Korintenberg, Diss., S. 16. I n diesem Sinne auch Erman / Weitnauer, § 480 A n m . I I I 1: „Die Konzentration t r i t t allerdings r ü c k w i r k e n d auf den Zeitp u n k t der §§ 446, 447 ein, w e n n durch Entscheidung des Käufers für Wandlung, Minderung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung das ius v a r i a n d i u n d damit der Übergang zum Ersatzlieferungsanspruch ausgeschlossen ist; dann hört die Schuld auf, eine Gattungsschuld zu sein, u n d die Regeln des Spezieskaufs finden Anwendung." 48
2. Die Sachmängelhaftung beim Gattungskauf
109
Erhebt nun der Käufer Sachmängelansprüche, so bewirkt die damit verbundene Konkretisierung, daß die übergebene Sache zur geschuldeten, d. h. zur verkauften Sache i. S. des § 446 wird. Die Gefahr geht rückwirkend auf den Käufer über, und zwar als Folge der Konkretisierung, eine logische Sekunde vor der Erhebung der Sachmängelansprüche. Die Voraussetzungen für die Anwendung der Sachmängelhaftung sind damit erfüllt. Die gesetzliche Regelung ist i n sich schlüssig. Die Folge der Konkretisierung ist, wie oben unter bb) ausgeführt ist, daß der Käufer das Recht verliert, Nachlieferung zu verlangen, da nunmehr die konkrete Sache Schuldgegenstand ist. M i t der Konkretisierung hat der Käufer aber noch nicht das ius variandi unter den einzelnen Sachmängelansprüchen verloren. Vielmehr geht der Käufer dieses Rechtes erst verlustig, wenn sich der Verkäufer i m Sinne von § 465 m i t dem vom Käufer gewählten Gewährleistungsanspruch einverstanden erklärt hat 5 0 . Eine Konkretisierung durch Erhebung der Sachmängelansprüche ist denkbar, ohne daß der Käufer sich zunächst auf einen bestimmten Gewährleistungsanspruch festlegt. Der Käufer kann z. B. ganz allgemein erklären, er werde wegen der mangelhaften Leistung Gewährleistung verlangen. Damit bringt er zum Ausdruck, daß er das Schuldverhältnis auf die angebotene Sache konkretisieren w i l l , legt sich aber noch nicht auf Wandlung, Minderung oder Schadensersatz fest. Ein solches Vorgehen ist möglich, w e i l zwischen den einzelnen Gewährleistungsansprüchen elektive Konkurrenz besteht 51 . Der Anspruch auf Gewährleistung ist ein einheitlicher Anspruch, der jedoch i n verschiedene alternative Rechte aufgefächert ist. Macht der Käufer also ohne nähere Angabe nur den allgemeinen Anspruch auf Gewährleistung geltend, so konkretisiert er, ohne sich bezüglich des einzelnen Gewährleistungsanspruchs schon festgelegt zu haben. Dem Käufer steht es frei, Wandlung, Minderung oder Schadensersatz zu wählen; er hat das ius variandi. Erst wenn der Verkäufer sich m i t dem vom Käufer gewählten einzelnen Sachmängelanspruch (Wandlung, Minderung oder Schadensersatz) einverstanden erklärt hat, findet das ius variandi sein Ende 5 0 . dd) Vergleich Gattungskauf
— Spezieskauf
Das gefundene Ergebnis bestätigt, daß die Sachmängelhaftung beim Gattungskauf den gleichen Rechtsgrund, die gleiche Aufgabe und die gleiche Funktion hat wie beim Spezieskauf. 50 51
Vgl. darüber u n t e n V, 4, a. Vgl. Erman / Weitnauer, § 459 Rdz 53; Kreß, § 26 I I A F N 88.
110
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
Die Sachmängelhaftung setzt Gefahrübergang voraus. Die Gefahr geht nur über, wenn die verkaufte Sache übergeben wird. Kaufgegenstand ist beim Spezieskauf die konkrete Sache, beim Gattungskauf eine Sache mittlerer A r t und Güte. Ist beim Gattungskauf die angebotene Sache fehlerhaft, dann kann sie nur dadurch Kaufgegenstand, also verkaufte Sache i m Sinne der §§ 446, 447 werden, daß sich die Parteien auf sie als Schuldgegenstand einigen. Damit w i r d die Gattungsschuld zur Speziesschuld. Die Sachmängelhaftung findet also erst Anwendung, wenn eine Speziesschuld vorliegt. Daraus folgt, daß sie bei Spezies- und Gattungskauf nur einen einheitlichen Rechtsgrund, eine einheitliche A u f gabe und Funktion hat. Der Rechtsgrund liegt i n der Vereinbarung der Beschaffenheit 52 . Die Aufgabe besteht darin, Rechtsfolgen anzuordnen für den Fall, daß zwar die Sache als solche i n ihrer Identität geleistet wird, jedoch ohne bestimmte vereinbarte Eigenschaften. Die Gewährleistung für Sachmängel dient damit der restlichen Vertragserfüllung i n einem besonderen F a l l der unvollständigen Leistung. Ein Unterschied zwischen Gattungskauf und Spezieskauf besteht nur bis zur Konkretisierung. Da die Sachmängelhaftung erst nach diesem Zeitpunkt zur Anwendung kommt, ist sie bei beiden Vertragstypen gleich. Es gelten daher für den konkretisierten Gattungskauf die gleichen Gesichtspunkte wie für den Spezieskauf. Bestimmend für die Frage der jeweiligen Rechtsfolgen bei eintretenden Leistungsstörungen ist allein, welches Element der Schuld von der Störung betroffen ist, die „Identität" oder die „Eigenschaft". Geht die Sache vor Gefahrübergang unter, so erlischt ihre Identität, es gelten die allgemeinen Normen, insbesondere die Unmöglichkeitsregeln, verliert die Sache dagegen nur eine Eigenschaft, so kommt allein die Sachmängelhaftung i n Betracht. Auch beim konkretisierten Gattungskauf sind Identität und Eigenschaft getrennt sanktioniert. I m übrigen kann auf die obigen Ausführungen zum Spezieskauf verwiesen werden. Das dort Gesagte gilt i n gleicher Weise für den konkretisierten Gattungskauf, denn m i t der Konkretisierung ist aus der Gattungsschuld eine Speziesschuld geworden. c) Zusammenfassung
Die Besonderheiten des Gattungskaufes gegenüber dem Spezieskauf liegen außerhalb des Bereiches der Sachmängelhaftung. Vor der Konkretisierung fehlt es an einer schuldidentischen Sache. Die Sachmängel52
Vgl. oben I V , 1.
3. Erfüllungspflicht, Leistungspflicht, Gewährleistungspflicht
111
haftung greift noch nicht ein. Es besteht nur der ursprüngliche Leistungsanspruch, der m i t einer von der Vereinbarung abweichenden Sache nicht, auch nicht teilweise befriedigt werden kann. Sanktionsmäßig gedacht sind beim Gattungskauf drei Bereiche zu unterscheiden: Vor der Konkretisierung: Es fehlt an einer schuldidentischen Sache. Eine fehlerhafte Sache ist nicht die Sache, die nach dem Vertrag geschuldet ist. 1. Der Käufer hat den Nachlieferungsanspruch. Nach der Konkretisierung: Die Schuld hat sich auf eine Sache beschränkt. Der Verkäufer hat diese Sache als solche i n ihrer Identität zu leisten, m i t ihr jedoch die vereinbarten Eigenschaften. 2. W i r d die Sache als solche nicht geleistet, so gelten die allgemeinen Normen. 3. W i r d die Sache i n ihrer Identität, jedoch ohne die vereinbarten Eigenschaften geleistet, so greift die Sachmängelhaftung ein. Beim Spezieskauf gibt es nur die unter 2. und 3. angeführten Sanktionen, jedoch nicht die Sanktion zu 1., da die Identität der Sache bei Vertragsschluß bereits feststeht. Es zeigt sich also, daß nur hinsichtlich des aus der Natur der Sache folgenden Nachlieferungsanspruchs 53 ein Unterschied zwischen Gattungskauf und Spezieskauf besteht. I m übrigen stehen sie systematisch gleich. 3. D i e Begriffe Erfüllungspflicht, Leistungspflicht, Gewährleistungspflicht
Nach den bisherigen Ausführungen erscheint es angebracht, die gefundenen Ergebnisse i n terminologischer Hinsicht zu verdeutlichen. a) Die Erfüllungspflicht
I n der Literatur zur Sachmängelhaftung findet sich häufig der Begriff „Erfüllungspflicht" 5 4 . Es handelt sich dabei u m einen Begriff, der 53
Deshalb ist auch die teilweise zu findende Argumentation, n u r beim Gattungskauf bestehe ein Leistungsanspruch bezüglich der Eigenschaften, w e i l n u r dort ein Nachlieferungsanspruch normiert sei (so z. B. Düringer / Hachenburg / Hoeniger V 1, Einl. A n m . 119), unzutreffend (so auch Graue, S. 216). B e i m Spezieskauf k a n n eine dem § 480 I 1 entsprechende N o r m v e r nünftigerweise gar nicht vorliegen, w e i l die Sache i n ihrer Identität bereits bestimmt ist, also eine andere Sache niemals als Vertragserfüllung i n Frage kommt. Die Existenz des § 480 hat also keinerlei Bedeutung für die Frage, ob die Leistungspflicht sich auch auf die Eigenschaften erstreckt. Diese Frage läßt sich allein aus der Vereinbarung heraus beantworten. Die Ansicht v o n Hoeniger unterstellt als bewiesen das, was es erst zu beweisen gilt, nämlich, daß der Nachlieferungsanspruch der ursprüngliche Leistungsanspruch u n d
112
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
nicht vom Gesetz verwendet wird, sondern von der Literatur geprägt wurde. Das BGB kennt den Anspruch (§ 194), die diesem auf Seiten des Schuldners entsprechende Leistungspflicht 55 und die Erfüllung (§ 362 I), die das Schuldverhältnis zum Erlöschen bringt, wenn die geschuldete Leistung erbracht wurde und der geschuldete Erfolg eingetreten ist. I n § 326 I 2, 2. Halbsatz ist von einem Anspruch auf Erfüllung die Rede. Zu verstehen ist darunter der primäre Leistungsanspruch. Betrachtet man den Begriff Erfüllungspflicht unter diesem Aspekt, so ist er gleichbedeutend m i t dem der Leistungspflicht. I n diesem Sinne w i r d der Begriff auch weitgehend verstanden 56 . Nun gehören die beiden Bestandteile des Begriffs Erfüllungspflicht funktionell verschiedenen Bereichen an: Die Pflicht ist Ausgangspunkt für ein Verhalten, die Erfüllung 1st Rechtsfolge aus einem Verhalten. M i t dem Begriff Erfüllungspflicht werden Pflicht und Rechtsfolge aus dieser Pflicht gemeinsam angesprochen. Dieser Umstand macht verständlich, warum die Erfüllungspflicht nicht immer gleichbedeutend mit der Leistungspflicht verstanden wird. So führt Korintenberg aus 57 , Erfüllung und Leistung sei begrifflich nicht dasselbe. Erfüllung ziele auf den Erfolg, den der Gläubiger bekommen solle, Leistung dagegen auf das vom Schuldner geschuldete Verhalten. Folgerichtig kommt Korintenberg zu dem Schluß, daß die Gewährleistung überall dort zur Erfüllungspflicht gehöre, wo „der Schuldner zur Herbeiführung eines bestimmten Erfolges vertraglich oder gesetzlich verpflichtet ist" 5 8 . Eine solche Erfolgsverpflichtung nimmt er m i t Rücksicht auf die Eigenschaftsvereinbarung bei Gattungskauf und Werkvertrag an, nicht aber beim Spezieskauf. Korintenberg bejaht also eine Erfüllungspflicht nicht schon dann, wenn eine Verpflichtung besteht, sondern erst dann, wenn eine Erfolgsverpflichtung besteht, d. h. wenn der Gläubiger auf den vereinbarten Erfolg klagen kann. Die Konsequenz ist klar: Weil k e i n Gewährleistungsanspruch ist. Dieses Ergebnis läßt sich n u r aus der Vereinbarung heraus gewinnen, nicht aus § 480. 54 Vgl. Schollmeyer, S. 93; Korintenberg, Diss., S. 14 u n d Erfüllung, S. 20; Süß, S. 19, 188 ff.; Staub / Könige, 9. Aufl., Exkurs zu § 374 Anm. 42; Düringer / Hachenburg / Hoeniger V 1, Einl. A n m . 114, 115; Flume, S. 35 ff.; Graue, S. 288, 289; Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 459 A n m . 2. 55 Vgl. BGB, Zweites Buch, Erster Abschnitt, Erster Teil: „Verpflichtung zur Leistung". 58 Vgl. Süß, S. 19, 189; Lobe, i n R G R K , a.a.O.; Hoeniger, a.a.O.; Staub/ Könige, a.a.O. 57 Vgl. Korintenberg, Erfüllung, S. 21. 58 So auch Süß, S. 19.
3. Erfüllungspflicht, Leistungspflicht, Gewährleistungspflicht
113
beim Spezieskauf eine Klage auf eine mangelfreie Sache nicht möglich ist, kann auch keine Erfüllungspflicht vorliegen. I n ähnlicher Weise läßt sich Flume durch den Begriff Erfüllungspflicht beeinflussen. Flume meint, der Käufer einer Speziessache müsse bei Vorliegen einer Erfüllungspflicht bezüglich der Eigenschaften Klage auf eine fehlerfreie Sache erheben können. Wer diese Konsequenz nicht i n Kauf nehme, dürfe keine derartige Erfüllungspflicht annehmen 59 . Die A n nahme einer Erfüllungspflicht, der keine rechtliche Sanktion entspreche, sei eine nutzlose Konstruktion 6 0 . Nun nimmt Flume aber an, daß die Parteien auch beim Spezieskauf eine Vereinbarung über die Eigenschaften treffen. Da er jedoch die genannte — wie er meint — aus dem Erfüllungsanspruch unabweisbar resultierende Konsequenz eines Klaganspruchs auf eine fehlerfreie Speziessache ablehnt, läßt er die Rechtsordnung i n die Parteivereinbarung eingreifen. Die vereinbarte Rechtsfolge, die Verpflichtung des Verkäufers zur Leistung einer Speziessache i n fehlerfreiem Zustand, trete nicht ein, statt dessen kämen die Gewährleistungsansprüche zur Anwendung 6 1 . Ganz offensichtlich hat Flume, ebenso wie Korintenberg, m i t dem Begriff Erfüllungspflicht zwei vollkommen verschiedene Inhalte verbunden: die Pflicht und die aus der Nichterfüllung der Pflicht resultierende Folge. Es muß jedoch deutlich zwischen den beiden Fragen unterschieden werden: Zum einen, ob jemand zur Leistung einer Sache m i t bestimmten Eigenschaften verpflichtet ist, und zum anderen, welche Rechte der andere bei Nichterfüllung dieser Pflicht hat. Flume dagegen versteht unter der Erfüllungspflicht die Verpflichtung und ihre Erzwingbarkeit 6 2 . Weil eine solche Erzwingbarkeit beim Spezieskauf bezüglich der Fehlerfreiheit fehlt, lehnt er eine Erfüllungspflicht ab. Das Beispiel Flumes zeigt, wie irreführend der Begriff Erfüllungspflicht ist, weil er die Frage der Durchsetzbarkeit des primären Leistungsanspruchs m i t i n die Frage hineinzieht, ob ein Leistungsanspruch überhaupt besteht. Die Pflicht und die aus der Nichterfüllung dieser 59 I n diesem Sinne hat auch Schollmeyer den Begriff Erfüllungspflicht geprägt, vgl. Schollmeyer, S. 93. Wolff , S. 4, lehnt den Begriff als wenig glücklich ab. 60 Vgl. Flume, S. 35 f. 61 Vgl. Flume, S. 51. 62 Ebenso Raape, S. 485, 486. So auch Graue, S. 288, 289, w e n n er ausführt, beim Spezieskauf bestehe zwar eine Leistungspflicht des Verkäufers, eine fehlerfreie Sache zu erbringen, aber kein Erfüllungsanspruch des Käufers, d. h. kein Recht des Käufers, die fehlerfreie Leistung zu erzwingen.
8 Herberger
114
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
Pflicht resultierenden Rechtsfolgen sind klar zu trennen 6 3 . Daß der Käufer nicht auf die Sache i n fehlerfreiem Zustand klagen kann, läßt nicht den Rückschluß zu, daß eine Verpflichtung zur Leistung i n fehlerfreiem Zustand nicht besteht. Es wurde bereits oben 64 dargelegt, daß der Gesetzgeber aus gutem Grunde die auf bestimmte Eigenschaften gerichtete Verpflichtung nicht erzwingbar gemacht hat. Er hat statt dessen Ausgleichsrechte normiert, eben die Gewährleistung für Sachmängel. Die Sachmängelrechte des Käufers sind die rechtlichen Sanktionen, deren Fehlen Flume bemängelt. Die Durchsetzbarkeit ist nicht wesensnotwendig m i t dem Anspruch verbunden 6 5 . Anstelle der Durchsetzbarkeit des Anspruchs kann das Gesetz Ausgleichsrechte einräumen, die eingreifen, wenn nicht erfüllt wird. Die Rechtsordnung verändert nicht die Vereinbarung i n ihrem Inhalt, wie Flume annimmt, sondern sie regelt die Rechtsfolgen für den Fall, daß nicht entsprechend der Vereinbarung geleistet w i r d 6 6 . Verfehlt ist die Argumentation von Süß 67 , wenn er meint, i m Falle der Nichterfüllung könne es keine Gleichgewichtsstörung des Vertrages geben, weil an die Stelle des primären ein sekundärer Anspruch trete, beim Sachmangel dagegen bestehe kein solcher sekundärer Anspruch, deshalb würde der Vertrag ins Ungleichgewicht geraten und die Sachmängelhaftung eingreifen. Die Argumentation von Süß bedeutet kurz gefaßt, daß ein Ersatzanspruch (die Gewährleistung) eingreift, weil ein Ersatzanspruch nicht besteht. Warum die Gewährleistungsansprüche nicht wie die übrigen Ansprüche das Eintreten eines Ungleichgewichts verhindern, bleibt unerfindlich. Die Konstruktion von Süß ist überflüssig, wenn man erkennt, daß die Sache i n fehlerfreiem Zustand geschuldet ist, die Sachmängelhaftung sekundäre Ansprüche normiert, die bei Nichterfüllung der geschuldeten Fehlerfreiheit eingreifen. Der Begriff Erfüllungspflicht, der Pflicht und Durchsetzbarkeit dieser Pflicht zusammenfaßt, muß als mißverständlich abgelehnt werden. I m Bereich der Sachmängelhaftung verleitet er zu Fehlschlüssen. Zwar ist eine Leistungspflicht i n den meisten Fällen einklagbar, so daß man dort von einer Erfüllungspflicht sprechen kann. Das Fehlen einer solchen Erfüllungspflicht, d. h. das Fehlen der Erzwingbarkeit, ist jedoch nicht geeignet, auch das Bestehen einer Leistungspflicht zu widerlegen. 63 Vgl. Graue, S. 62 ff.; auch schon Titze, JW 1927, 2964; Korintenberg, Spezies, S. 99 u n d schon Erfüllung, S. 74. Dort zieht jedoch Korintenberg noch nicht die Konsequenz, daß die Gewährleistung eine Rechtsfolge der Nichterfüllung ist. 64 Vgl. I V , 2, a. 65 Larenz I, § 2 I I I . 66 So auch Korintenberg, Spezies, S. 100. 67 Süß, S. 86.
3. Erfüllungspflicht, Leistungspflicht, Gewährleistungspflicht
115
M i t Recht w i r d daher von einem Teil der Literatur 6 8 der Begriff Erfüllungspflicht gar nicht erst verwendet 6 9 , da er nur zu unnötigen Mißverständnissen Anlaß gibt. b) Die Gewährleistung als Regelung sekundärer Ausgleichsrechte
Die Verpflichtung des Verkäufers besteht bei Spezies- und konkretisiertem 7 0 Gattungskauf darin, die konkrete Sache fehlerfrei zu übergeben und dem Käufer Eigentum daran zu verschaffen. Die primäre Leistungspflicht des Verkäufers umfaßt also Leistung der Sache im Zustand der Fehlerfreiheit. W i r d die Sache vom Verkäufer fehlerfrei übergeben und übereignet, so ist der Schuld Genüge getan, das Schuldverhältnis verbraucht 7 1 . Übergibt der Verkäufer die Sache i n fehlerhaftem Zustand, so ist der Kaufvertrag noch nicht v o l l erfüllt 7 2 . Der Pflicht zur Leistung der Sache als solcher ist zwar Genüge getan, ein wesentlicher Teil der Leistungspflicht erfüllt. Unerfüllt dagegen ist die Leistungspflicht bezüglich der geschuldeten Eigenschaft. Wenn die h. L. annimmt, daß der Verkäufer m i t der fehlerhaften Sache voll erfüllt 7 3 , so bleibt unverständlich, wie aus dem Schuldverhältnis noch Rechte für den Käufer erwachsen können. Denn m i t der vollen Erfüllung erlischt das Schuldverhältnis (§ 362 I). Die Leistungsbeziehung hat ihr Ende gefunden 74 . Wenn die h. L. trotzdem dem Käufer Rechte einräumt, so erscheint dies widersprüchlich. Das Eingreifen der Gewährleistung beweist, daß das Schuldverhältnis noch nicht zur Ruhe gekommen ist, daß noch nicht volle Erfüllung eingetreten ist 7 5 . M i t Leistung der schuldidentischen, aber fehlerhaften Sache ist ein wesentlicher Teil der Schuld erfüllt. Ein Rest 76 der Schuld ist unerfüllt. Normalerweise hätte der Käufer die Leistungsklage. Das wäre jedoch 68 Z u m Beispiel spricht Larenz I I , § 41 I I e i m m e r n u r von Leistungspflicht. I n F N 1 auf S. 59 fällt der Begriff Erfüllungspflicht i n einem Zitat Flumes u n d trotzdem greift Larenz i h n nicht auf. 69 Wolff , S. 4, lehnt den Begriff ausdrücklich ab. 70 N u r dann k o m m t überhaupt die Sachmängelhaftung zur Anwendung, vgl. V, 2, b. 71 Vgl. Larenz I, § 2 I, S. 5 ff.; Korintenberg, Erfüllung, S. 115; Graue, S 289 72 Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 3; Adler, Z H R 75, 453. 73 Vgl. Süß, S. 19, 50; Korintenberg, Erfüllung, S. 16 ff.; Larenz I I , § 41 I I e; Schniewind, S. 55. 74 So auch Larenz I, § 2 V u n d § 18 I. 75 Der Widerspruch der h. L. zeigt sich deutlich bei Schniewind, S. 55, der vollständige E r f ü l l u n g m i t einer fehlerhaften Sache eintreten läßt, aber andererseits einräumt, daß der Leistung etwas fehle, vgl. S. 56. 76 Daß es sich dabei nicht u m einen abtrennbaren T e i l der Schuld handelt, wurde bereits festgestellt, vgl. dazu V, 1.
8*
116
V. Aufgabe und F u n k t i o n der Gewährleistung
i n diesem besonderen Fall nicht sinnvoll. Die Eigenschaft kann nicht gesondert geleistet werden, kann nicht gesondert erfüllt werden. Dies ist immer nur i m Zusammenhang m i t Leistung der Sache als solcher möglich. Richtet sich nun die Schuld auf eine konkrete Sache und ist diese Sache geleistet worden, so ist der Schuldner insoweit befriedigt. Da die Eigenschaften nicht gesondert geleistet werden können, ist die restliche Erfüllung, die Leistung der geschuldeten Eigenschaften, nur auf zweierlei Weise möglich: entweder der Käufer kann Nachbesserung verlangen oder er erhält einen sekundären Ausgleichsanspruch. Der Gesetzgeber ist aus praktischen Gründen diesen zweiten Weg gegangen 7 7 und hat dem Käufer bei mangelhafter Erfüllung sekundäre Rechte zur Wahl gestellt: die Sachmängelansprüche 78 . Auch Larenz 7 9 erkennt an, daß es innerhalb des Schuldverhältnisses Pflichten gibt, die nicht Gegenstand der Leistungsklage sind, die vielmehr, wenn sie verletzt werden, nur sekundäre Leistungspflichten nach sich ziehen. Für das Verhältnis von primärer Leistungspflicht und Gewährleistungspflicht ergibt sich damit, daß sie sich i m Anwendungsbereich gegenseitig ausschließen, aber nicht deshalb, weil die Leistungspflicht sich nicht auf die Eigenschaft erstreckt 80 , sondern deshalb, w e i l die Gewährleistung als sekundäre Pflicht an die Stelle der primären Leistungspf licht t r i t t 8 1 . Leistet der Verkäufer überhaupt nicht oder eine andere als die geschuldete Sache, so ist die Leistungspflicht insgesamt nicht erfüllt. Von einer mangelhaften Leistung kann dann keine Rede sein. Es gelten die allgemeinen Normen. Die Sachmängelhaftung kommt nicht i n Betracht.
4. I n h a l t u n d Durchführung der einzelnen Sachmängelansprüche a) Wandlung und Minderung
W i r d dem Käufer eine fehlerhafte Sache übergeben, so kann er normalerweise Wandlung, d.h. Rückabwicklung des Kaufes oder Minderung, d. h. Herabsetzung des Kaufpreises, verlangen (§ 462). 77
Vgl. I V , 2, a. Ebenso Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 459 A n m . 2; Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 3; Staudinger / Ostler, vor § 459 Rdz 3; Korintenberg, Spezies, S. 98 f. u n d Abschied, S. 78; Erman / Bohle-Stamschräder, 3. Aufl., § 459 A n m . 3; Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 35. 79 J Z 1962, 107. 80 So jedoch Korintenberg, Diss., S. 14; Süß, S. 191; Larenz I I , § 41 I I e; Schollmeyer, S. 93 f. 81 Vgl. Graue, S. 62 f. u n d die unter A n m . 78 zitierte Literatur. 78
4. I n h a l t u n d Durchführung der einzelnen Sachmängelansprüche
117
Es handelt sich dabei u m Rechtsbehelfe besonderer A r t , die dem Zweck dienen, die durch die Leistung der mangelhaften Sache bedingte ungenügende Erfüllung nach der einen oder anderen Richtung h i n auszugleichen. Die Wandlung gestaltet das Schuldverhältnis dahingehend um82, daß die primären Leistungspflichten erlöschen, und statt dessen Rückgewährpflichten entstehen (vgl. §§ 462, 465, 467 i V m §§ 346 - 348, 350 - 354, 356), während m i t der Minderung die Leistungspflicht des Käufers zur Kaufpreiszahlung herabgesetzt wird. I n beiden Fällen werden vertragliche Pflichten geändert. Dabei erhebt sich die Frage auf welche Weise dies geschieht. I n der Literatur werden i m wesentlichen drei Theorien vertreten. 1. Die Vertragstheorie räumt dem Käufer zunächst nur einen A n spruch auf Abschluß eines Wandlungs- bzw. Minderungsvertrages ein 8 3 , läßt jedoch die Klage auf Rückerstattung des Kaufpreises verbunden m i t dem Begehren auf Einwilligung i n die Wandlung oder Minderung zu 8 4 . 2. Regelmäßig w i r d der Käufer unmittelbar auf Erstattung des bezahlten Kaufpreises klagen, ohne gleichzeitig den Abschluß eines Änderungsvertrages zu verlangen. I m Gegensatz zur Vertragstheorie ist eine solche Klage nach der modifizierten Vertragstheorie möglich. Der Rückgewähranspruch setzt zwar auch nach dieser Ansicht eine Vereinbarung der Parteien voraus, doch w i r d die Einverständniserklärung des Verkäufers durch das stattgebende Urteil ersetzt. Die Wandlung erfolgt durch richterlichen Gestaltungsakt 85 . 3. Nach der Herstellungstheorie hat der Käufer von Anfang an einen Anspruch auf die Herstellung des der Wandlung oder Minderung entsprechenden Zustandes 86 . Es bedarf danach keines besonderen Vertragsabschlusses, der Käufer kann unmittelbar auf die Leistung klagen. 4. Die Rechtsprechung hat sich nie eindeutig für eine der Theorien entschieden, sondern hat immer die Klage unmittelbar auf Rückzahlung des vollen oder teilweisen Kaufpreises zugelassen 87 . Dem Leistungsurteil w i r d einerseits keine richterliche Gestaltung zugesprochen 88 , so daß die Rechtsprechung insoweit zur Herstellungstheorie ten82 Nicht richtig ist es von einer Auflösung des Kaufvertrages zu sprechen, so aber Bötticher, S. 5, 6. Der Vertrag w i r d n u r umgestaltet, vgl. Larenz I I , § 41 I I a. 83 Vgl. Oertmann, § 465 A n m . 1 d m i t ausführlichen Nachweisen. 84 Oertmann, § 465 A n m . 1 e. 85 Vgl. Larenz I I , § 41 I I a u n d N J W 1951, 498 f.; Bötticher, S. 31 ff.; Flechtheim, Gruch. Beitr. 44, 73 ff.; so auch schon Kreß, § 26 I I A d. 86 Vgl. Erman, JZ 1960, 44 ff.; Enneccerus / Lehmann, § 110 I 2; Staudinger / Ostler, § 462 Rdz 12 ff. m. w. N.; Blomeyer, A c P 151, 97 ff.; Graue, S. 304. 87 Vgl. R G 58, 423; 101, 71; 147, 393; B G H 29, 150; B G H JZ 1960, 59. 88 Vgl. R G 69, 385, 388.
118
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
diert. Andererseits w i r d jedoch auch die Klage auf die Einverständniserklärung zur Wandlung oder Minderung für zulässig erachtet 89 , so daß die Rechtsprechung i n diesem Punkt den Vertragstheorien näher steht. I m Anschluß an das bisher Vorgetragene ergibt sich, daß nur die Vertragstheorie, und zwar aus prozeßökonomischen Gründen i n der modifizierten Form, überzeugen kann. W i r haben dargelegt, daß die Sachmängelansprüche sekundäre Ausgleichsansprüche sind, die zur Wahl des Käufers an die Stelle des ursprünglichen Leistungsanspruchs auf eine mangelfreie Kaufsache treten. Wandlung wie Minderung führen zu einer Inhaltsänderung des Schuldverhältnisses. Eine solche Änderung ist auf dreierlei Weise möglich. aa) Das Gesetz kann unmittelbar an die Stelle des primären A n spruchs einen bestimmten sekundären Anspruch treten lassen (so z. B. bei § 280 I). Das ist hier nicht der Fall, da der Käufer die Wahl unter mehreren sekundären Ansprüchen hat. Mangels Bestimmtheit des sekundären Anspruchs kann nicht die Rede sein von einer inhaltlichen Änderung des Vertrages kraft Gesetzes. bb) Überläßt das Gesetz dem Gläubiger die Wahl unter mehreren sekundären Ansprüchen, so ist es möglich, daß allein schon die Wahl eines Anspruchs durch den Gläubiger die vertragliche Verpflichtung ändert (so z. B. bei § 325). Die Erklärung gestaltet das Schuldverhältnis u m 9 0 . Von diesem Augenblick an besteht es unter den Parteien i n veränderter Form fort. Ein Widerruf der Erklärung ist damit ausgeschlossen91. Nun bestimmt § 465, daß die Wandlung oder die Minderung vollzogen ist, wenn der Verkäufer sich auf Verlangen des Käufers mit ihr einverstanden erklärt. Diese Norm kann nur so verstanden werden, daß die einseitige Erklärung noch keine Veränderung des Schuldverhältnisses bewirkt, daß vielmehr dazu ein Vertrag notwendig ist. Die Herstellungstheorie hingegen w i l l den § 465 nur dahingehend verstehen, daß m i t dem Einverständnis des Verkäufers die Wahl der Wandlung oder der Minderung für den Käufer bindend w i r d 9 2 . Eine solche Interpretation des § 465 geht jedoch fehl. Hält man die einseitige Erklärung des Käufers für die Änderung des Vertrages ausreichend, wie das die Herstellungstheorie vertritt, so ist die einmal abgegebene Erklärung i n 89
R G J W 1913, 736 unter 5.; R G 108, 26. Vgl. Larenz I, § 22 I I a u n d A T § 13 I 7. Vgl. Larenz I, § 22 I I a. 92 Vgl. Erman, J Z 1960, 44; Eccius, Gruch. Beitr. 43, 324f.; Lehmann, § 110 I 2; Staudinger / Ostler, § 462 Rdz 8. 90
91
Enneccerus/
4. I n h a l t u n d Durchführung der einzelnen Sachmängelansprüche
119
jedem Fall bindend, der § 465 wäre i n dieser Hinsicht überflüssig, ja sogar unrichtig. Wenn Graue 93 Wandlung und Minderung als Ansprüche bezeichnet und darin allein schon die Rechtfertigung der Herstellungstheorie findet, so ist das nicht richtig. Das Schuldverhältnis bedarf einer U m gestaltung 94 , sei es durch das Gesetz, sei es durch richterliches Gestaltungsurteil, sei es durch eine der Parteien oder durch beide. Erst m i t der Umgestaltung w i r d der ursprüngliche vertragliche Anspruch durch den sekundären Ausgleichsanspruch ersetzt. Graue überspielt diese Frage. Ungeklärt bleibt, wie es dazu kommt, daß die primäre Leistungspflicht i n eine sekundäre übergeht 95 . Wollte man i n dem Wandlungs- oder Minderungsbegehren nur die Erhebung eines Anspruchs sehen, aber nicht gleichzeitig eine Gestaltung, so bleibt unverständlich, durch welchen A k t das Schuldverhältnis umgewandelt w i r d i n der Weise, daß vom entsprechenden Zeitpunkt ab an Stelle der ursprünglichen Verpflichtung gerade die aus der Gewährleistung resultierende Leistung (Rückgabe der Sache, Rückzahlung des Kaufpreises etc.) geschuldet w i r d 9 6 . Eine Änderung des Schuldverhältnisses ist unerläßlich, denn ein Schuldverhältnis, das auf Übergabe und Übereignung einer Kaufsache zielt, kann nicht damit erfüllt werden, daß eine Rückabwicklung des Kaufes, wie z. B. bei der Wandlung, stattfindet. Die Rückabwicklung dient der Erfüllung einer veränderten Verpflichtung. Zuerst ist die Frage zu klären, wie es überhaupt zu der Veränderung des Schuldverhältnisses kommt, und dann erst kann von den entsprechenden vertraglichen Leistungsansprüchen die Rede sein 97 . Dieses Problem hat auch schon Kreß erkannt und i n dem hier vertretenen Sinne gelöst: „Das Erlöschen der Kauf Wirkungen ist aus der Aufhebung des Kaufes, nicht umgekehrt die Aufhebung des Kaufes aus dem Erlöschen jener Wirkungen abzuleiten 98 ." Die durch die Wandlung (oder Minderung) hervorgerufene Umgestaltung des Vertragsverhältnisses — Kreß spricht hier entsprechend der damaligen Vorstellung von der Aufhebung des Kaufes — führt zum Erlöschen der ursprünglichen Leistungspflichten — nicht aber zum Erlöschen des Schuldverhältnisses; dieses bleibt vielmehr m i t geänder93
Graue, S. 304. Vgl. Larenz I I , § 41 I I a u n d N J W 1951, 499; Bötticher, S. 5, 6. Es ist für die Herstellungstheorie bezeichnend, daß sie diese Frage übergeht. Darauf weist schon Bötticher, S. 5, 6, zu Recht hin. 96 Diese Schwäche der Herstellungstheorie räumen selbst einige Anhänger ein, vgl. Erman, J Z 1960, 44. 07 So auch RG 94, 327, 331; 71, 277; 108, 27. 98 Vgl. Kreß, § 26 I I A e F N 94, ebenso § 4 Nr. 3 a. 94
95
120
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
tem Inhalt bestehen — und zum Entstehen der Rückgewähransprüche, nicht umgekehrt das Erlöschen der primären Leistungspflichten und das Entstehen der Rückgewähransprüche zur Umgestaltung des Kaufs. Die gegenteilige Ansicht verwechselt Ursache und Wirkung. Die sekundären Ansprüche greifen ein, weil die primären Ansprüche ihr Ende gefunden haben, nicht aber finden die primären Ansprüche ihr Ende, w e i l die sekundären Ansprüche eingreifen. Erst m i t dem Ende der primären Leistungspflicht — das ergibt sich z. B. für den ähnlich gelagerten § 326 aus Absatz I S. 2, 2. HS. — ist der Weg für die sekundäre Leistungspflicht frei. Es erhebt sich daher die Frage, welcher Umstand beim Kauf dazu führt, daß z. B. i m Falle der Wandlung die primären Verpflichtungen aus dem Vertrag, eine bestimmte Sache oder eine Sache mittlerer A r t und Güte zu leisten bzw. den Kaufpreis zu bezahlen, durch die sekundären Verpflichtungen zur Rückgewähr des Erhaltenen ersetzt werden. Die Lösung hierfür findet sich i n § 465. So formuliert Kreß treffend: „Der Vereinbarung der Wandlung kommt die Doppelbedeutung der Aufhebung des ius variandi (§ 465) und des Schuldrechtsverhältnisses (Kaufes) zu 9 9 ." N u r daß nach heutiger Auffassung das Schuldverhältnis nicht aufgehoben, sondern umgestaltet wird. Das Schuldverhältnis erlischt nicht, sondern besteht mit verändertem Inhalt fort 1 0 0 . Aufgabe des § 465 ist es, festzulegen, durch welchen A k t die vertraglichen Pflichten inhaltlich geändert werden. Sowohl der Herstellungstheorie wie der Ansicht von Graue ist der V o r w u r f zu machen, daß sie die Frage übergeht, wie es zu der notwendigen Umgestaltung der vertraglichen Pflichten kommt. Ist eine mangelhafte Sache geleistet worden, so stehen dem Käufer die Gewährleistungsansprüche zu. A l l e i n das Bestehen der Ansprüche ändert aber noch nichts an den ursprünglichen Vertragspflichten. Diese gehen nach wie vor auf Leistung der Sache bzw. Zahlung des Kaufpreises, nicht aber auf Rückgewähr der Leistungen. Die Gewährleistungsansprüche geben dem Käufer zwar die Möglichkeit, das Vertragsverhältnis umzugestalten, ihr bloßes Bestehen hingegen verändert bei mangelhafter Leistung noch nicht die ursprünglichen vertraglichen Pflichten. M i t der Feststellung Graues, daß Wandlung und Minderung A n sprüche sind, ist also nichts gewonnen für die Frage, wie es zu der Richtungsänderung der Schuld kommt. V e r t r i t t man die Ansicht, daß die Erhebung einer der Ansprüche die Schuld von sich aus verändert, so ist das Schuldverhältnis damit umgestaltet. Ein Widerruf ist ausgeschlossen. Die Aufgabe des § 465 dann darin zu sehen, daß der Käufer an 99 100
Vgl. Kreß, § 26 I I A e F N 92. Wie hier Weitnauer, S. 92 f. (für den Rücktritt).
4. I n h a l t u n d Durchführung der einzelnen Sachmängelansprüche
121
seine Erklärung gebunden ist, wie das die Herstellungstheorie annimmt, ist widersprüchlich 101 , w e i l bereits die Erklärung des Käufers die Bindung herbeiführt, das Einverständnis des Verkäufers damit aber vollkommen irrelevant ist. cc) Der § 465 läßt also nur den Schluß zu, daß eine Umgestaltung der vertraglichen Pflichten i m Bereich der Sachmängelhaftung mittels Vereinbarung der Parteien — der weiteren Möglichkeit, die zu einer Umgestaltung eines Vertragsverhältnisses führen kann — erfolgt. Die Parteien, die das Schuldverhältnis geschaffen haben, können es auch beliebig verändern. § 465 besagt nun, daß die Wandlung bzw. die Minderung nur i m Wege des Vertrages erfolgt. Der Anspruch des Käufers auf Wandlung und auf Minderung, ist damit ein Anspruch auf Änderung des ursprünglichen Vertrages. Wenn Graue 1 0 2 meint, ein solcher Anspruch sei nicht anzunehmen, so übersieht er, daß das Gesetz gute Gründe gerade für diese Regelung hat. Anstelle des Anspruchs auf Vertragsänderung hätte das Gesetz dem Käufer, wenn man einmal von § 465 absieht, auch ein einseitiges Gestaltungsrecht geben können, wie das die Herstellungstheorie, wenn auch i m Hinblick auf die U n w i derruflichkeit nicht konsequent, annimmt. A l l e i n die Erklärung des Käufers würde i n der Lage sein, den Vertrag zu verändern. Eine solche einseitige Umgestaltung ist jedoch i m Interesse der Verkehrssicherheit nicht sinnvoll. Soll der Kaufpreis sich z. B. u m D M 50 allein durch die Erklärung des Käufers mindern, obwohl der Fehler nur eine Minderung i n Höhe von D M 25 rechtfertigt? Die Minderungserklärung w i r d meist mit der Anführung eines konkreten Minderungsbetrages verbunden sein. Der Käufer w i l l regelmäßig die Minderung i n einer bestimmten Höhe, w i l l aber u. U. die Minderung nicht, sondern dann die Wandlung, wenn der Verkäufer hinsichtlich der Höhe Schwierigkeiten macht. Schon deshalb erscheint eine Umgestaltung mittels Vereinbarung viel sinnvoller als eine einseitige Umgestaltung. Es ist offenbar, daß das Gesetz die Umgestaltung des Vertrages aus praktischen Gründen nicht allein dem Käufer überlassen konnte. Es kann daher nur eine Umgestaltung durch beide Parteien i n Frage kommen. Der Käufer hat einen einklagbaren Anspruch auf die Umgestaltung. Auf diesem Wege w i r d gewährleistet, daß die Änderung der 101
Dieser Widerspruch w i r d von der Herstellungstheorie nicht gesehen, vgl. z.B. Erman, JZ 1960, 44f. Die Herstellungstheorie muß notwendigerweise das Problem der Umgestaltung des Vertrages überspielen, w e i l sonst der Widerspruch zu offensichtlich wäre. Auch E r m a n vermeidet ein Eingehen auf die Frage der Umgestaltung, obwohl er erkennt, daß irgendein Umstand notwendig ist, u m den Zeitpunkt zu bestimmen, von dem ab die Schuld in veränderter Form besteht, vgl. dazu Anm. 96. 102 Graue, S. 304.
122
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
vertraglichen Pflichten nur i n dem Umfang geschieht, i n dem der Verkäufer damit einverstanden ist bzw. nach den gesetzlichen Vorschriften verpflichtet ist, sein Einverständnis zu erteilen. Gegen die Vertragstheorie w i r d vorgebracht, daß eine Klage unmittelbar auf Rückgewähr nicht i n Frage komme, weil es an der den Anspruch begründenden Voraussetzung, dem Wandlungsvertrag fehle 1 0 3 . Nur bereits entstandene Ansprüche seien einklagbar. Dieses Argument ist schon deshalb wenig stichhaltig, weil es auch gegen die Herstellungstheorie verwendet werden kann. Gemäß § 346, der über § 467 entsprechend gilt, entsteht der Rückgewähranspruch erst, wenn die Umgestaltung des Vertragsverhältnisses erfolgt ist 1 0 4 . Da die Herstellungstheorie i m Hinblick auf § 465 eine Bindung des Käufers an seine Erklärung verneint, kann auch noch nicht davon die Rede sein, daß die Umgestaltung des Vertrages erfolgt ist. Die einmal erfolgte Veränderung ist nicht rückgängig zu machen. A n die Stelle des primären Anspruchs ist ein bestimmter sekundärer Anspruch getreten. Das Wahlrecht des Käufers ist erloschen. T r i t t nun noch keine Bindung mit der Erklärung des Käufers ein, wie dies die Herstellungstheorie annimmt 1 0 5 , dann kann folgerichtig die Umgestaltung noch nicht erfolgt sein. Mangels erfolgter Gestaltung besteht gemäß §§ 467, 346 auch noch kein Anspruch. Das gegen die Vertragstheorie vorgebrachte Argument t r i f f t also i n gleicher Weise die Herstellungstheorie. Gegen die Herstellungstheorie läßt sich außerdem noch anführen, daß § 467 ausdrücklich den § 349 ausschließt, was nur bedeuten kann, daß die Durchführung der Wandlung oder Minderung nicht, wie beim Rücktritt, einseitig erfolgt, sondern unter M i t w i r k u n g beider Parteien. Wandlung und Minderung sind danach erst erfolgt, wenn der Vollzug durch Einigung vorliegt 1 0 6 . Das bedeutet, daß erst nach der Einigung der i n Frage stehende Leistungsanspruch (Rückgewähr) endgültig entsteht. Vor einer Einigung wäre der Anspruch entsprechend der Argumentation der Herstellungstheorie auch für diese noch nicht einklagbar, w e i l noch nicht entstanden. Es zeigt sich damit, daß das Hauptargument, das die Herstellungstheorie gegen die Vertragstheorie vorbringt, jene selbst i n gleicher Weise trifft. Damit ist das Problem noch nicht aus der Welt geschafft, 103 Vgl. B G H JZ 1960, 59; Kuhn, i n R G R K , § 465 A n m . 2; Graue, S. 305; Blomeyer, AcP 151, 99. 104 So schon RG 71, 277; 94, 331; 108, 27. 105 Vgl. Enneccerus / Lehmann, § 110 I 2; Staudinger / Ostler, § 462 Rdz 8. Erman, JZ 1960, 41, 44, läßt sogar das ius variandi bis zur erfolgreichen V o l l streckung einer Sachmängelklage zu; ebenso Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 54 f. Ä h n l i c h Eccius, Gruch. Beitr. 43, 331. 106 Vgl. RG 94, 327, 331; Palandt / Putzo, § 465 A n m . 2; Staudinger / Ostler, § 462 Rdz 8.
4. I n h a l t u n d Durchführung der einzelnen Sachmängelansprüche
123
nur ist es als Argument nicht mehr allein zugunsten der Herstellungstheorie verwendbar. Die schwierigen prozeßrechtlichen Fragen i n diesem Zusammenhang abschließend zu erörtern, würde zu weit führen 1 0 7 . Fest steht, daß schon der Gesetzgeber, der ausdrücklich auf Seiten der Vertragstheorie stand 1 0 8 , eine Klage unmittelbar auf Rückgewähr für zulässig h i e l t 1 0 9 . Die Zivilprozeßordnung ist i n dieser Richtung entsprechend zu interpretieren. Soweit das Prozeßrecht nicht i n vollem Einklang m i t dem materiellen Recht steht, gebührt dem materiellen Recht der Vorzug. I n diesem Zusammenhang ist die Theorie des „richterlichen Gestaltungsaktes" 1 1 0 zu sehen, die das nicht ganz i n Übereinstimmung mit dem materiellen Recht stehende Prozeßrecht entsprechend auslegt und dem Leistungsurteil gestaltende Wirkung zukommen läßt (vgl. § 894 ZPO). Die Bedenken aus dem Prozeßrecht können daher nicht durchgreifen. Der Käufer kann den Rückgewähranspruch unmittelbar erheben. M i t der Verurteilung des Verkäufers zur Leistung ist die Wandlung bzw. Minderung vollzogen. Als Ergebnis läßt sich also festhalten, daß die Umgestaltung des Vertrages entsprechend der modifizierten Vertragstheorie mittels Parteivereinbarung erfolgt. Die Herstellungstheorie ist abzulehnen, weil sie nicht nur den §§ 465, 467, 346, 349 widerspricht, sondern außerdem noch i m Hinblick auf die Widerruflichkeit der Erklärung des Käufers inkonsequent ist 1 1 1 . Wandlung und Minderung sind erst erfolgt, wenn die Parteien sich dahingehend geeinigt haben. Diese Auslegung des § 465 führt noch zu einem weiteren bedeutsamen Ergebnis, nämlich zur Anerkennung des ius variandi. V e r t r i t t man, wie die Herstellungstheorie, die Auffassung, daß das Vertragsverhältnis durch die einseitige Erklärung des Käufers umgestaltet wird, so ist konsequenter Weise ein ius variandi nicht denkbar. Eine i n Ausübung eines Gestaltungsrechts abgegebene Erklärung ist nach Zugang (vgl. § 130 I S. 1) unwiderruflich 1 1 2 . V e r t r i t t man jedoch m i t uns die Auffassung, daß eine Umgestaltung nur durch Vereinbarung nach § 465 zustande kommt, dann folgt daraus, daß der Käufer bis zum 107
Vgl. darüber Larenz, NJW 51, 497 ff.; Bötticher, Die Wandlung als Gestaltungsakt, 1938; Flechtheim, Gruch. Beitr. 44, 74 ff.; Kreß, § 26 I I A e u n d dort F N 93.
los vgL P r log V g l > P 110
o t if s 6 7 4 j 6 7 9 j r o t if s > 7 1 0 >
710.
Vgl. die i n A n m . 107 angeführten Ansichten. Angesichts der vielen Angriffspunkte der Herstellungstheorie sucht Blomeyer, A c P 151, 110 die Ansicht als Gewohnheitsrecht zu begründen. Dagegen m i t Recht Larenz, N J W 1951, 497. 112 Vgl. Palandt / Heinrichs, Überblick vor § 104 Anm. 3 d; R G 74, 1, 3; Enneccerus / Nipper dey, § 203 F N 9; Staudinger / Coing, § 144 Rdz 3 für die A n fechtung. 111
124
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
Zeitpunkt der Einigung der Vertragsparteien ein ius variandi hat 1 1 3 . Hat z. B. der Käufer Wandlung verlangt, der Verkäufer dieses Verlangen aber abgelehnt oder sich überhaupt nicht erklärt, dann kann der Käufer ohne weiteres auf Minderung oder Schadensersatz übergehen. Ausgeschlossen ist das ius variandi erst i n dem Augenblick, i n dem der Verkäufer sich mit dem vom Käufer konkret erhobenen Sachmängelanspruch einverstanden erklärt. M i t dem Einverständnis nämlich, also dem Vollzug i m Sinne des § 465, werden die vertraglichen Pflichten umgestaltet, so daß der Käufer seine auf die nun eingetretene Rechtsfolge gerichtete Wahl nicht mehr widerrufen kann 1 1 4 . Macht der Käufer einen Gewährleistungsanspruch i m Wege der Klage geltend, weil die Parteien sich nicht einigen konnten, so w i r d das Schuldverhältnis durch das rechtskräftige Urteil umgestaltet. M i t der Umgestaltung verliert der Käufer das ius variandi 1 1 5 . b) Schadensersatz wegen Nichterfüllung
aa) Anwendungsbereich Hat der Verkäufer eine Eigenschaft zugesichert oder einen Fehler arglistig verschwiegen, so kann der Käufer statt Wandlung oder M i n derung auch Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Beim Spezieskauf ist für diese erweiterte Haftung Voraussetzung, daß die Eigenschaft bereits zur Zeit des Kaufabschlusses fehlte (§ 463) und noch bei Gefahrübergang fehlt, während beim Gattungskauf der Fehler allein bei Gefahrübergang vorliegen muß (§ 480 II). α) Schadensersatz beim Spezieskauf 1. Infolge Zusicherung (§ 463 S. 1) Die Zusicherung ist eine Eigenschaftsvereinbarung mit erweiterter Haftungsfolge. Der Unterschied zur einfachen Vereinbarung von Eigenschaften, besteht i n der Intensität der Erklärung, die eine verschärfte Haftung rechtfertigt 1 1 6 . Durch die Zusicherung erweckt der Verkäufer beim Käufer die sichere Erwartung, die Sache werde m i t den zugesicherten Eigenschaften geleistet. Entsteht durch Leistung der Sache i n mangelhaftem 113 Ebenso Kreß, § 26 I I A d und § 14 Nr. 2 A f.; Erman/Weitnauer, vor § 459 Rdz 53 ff. 114 Ebenso Kreß, § 26 I I A f, dort F N 104; B G H N J W 1971, 622, 623. 115 Ebenso B G H N J W 1971, 623; Kreß, § 26 I I A d; Erman / Weitnauer geht hier weiter; er w i l l das ius variandi auch noch i n der Zwangsvollstreckung geben. 116 Vgl. Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 25; Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 459 Anm. 5 b; Erman / Weitnauer, § 459 Rdz 24; RG 114, 239, 241; R G 161, 336, 337.
4. I n h a l t u n d Durchführung der einzelnen Sachmängelansprüche
125
Zustand ein Schaden, so ist es gerechtfertigt, den Verkäufer dafür auch ohne Verschulden haften zu lassen, wenn die Sache bereits bei Vertragsschluß mangelhaft war. Der Verkäufer ist bei gerechter Abwägung hier näher daran, den durch die mangelhafte Leistung entstandenen Schaden zu tragen. Allgemeine Anpreisungen fallen daher nicht unter den Begriff Zusicherung. Erforderlich ist eine ernstlich gewollte Vereinbarung über Eigenschaften, die nach den gesamten Umständen den Schluß zuläßt, daß der Verkäufer bereit ist, für Schäden infolge der mangelhaften Leistung zu haften 1 1 7 . Anders als die einfache Eigenschaftsvereinbarung, die integrierter Bestandteil der Erklärung ist 1 1 8 , bedarf die Zusicherung immer der vorgeschriebenen Form 119, da sie nicht nur die Verpflichtung zur Leistung einer fehlerfreien Sache schafft, sondern daneben auch noch eine Haftung für Schäden, die über das reine Interesse an der ordnungsgemäßen Erfüllung hinausgehen. Bedarf der Vertrag keiner besonderen Form, so kann die Zusicherung stillschweigend erfolgen 1 2 0 . Gemeinhin w i r d die Zusicherung als ein Fall der Garantie net 1 2 1 . Diese Feststellung bedarf jedoch einer Präzisierung.
bezeich-
Der Begriff der Garantie w i r d i n verschiedener Weise gebraucht. Einmal w i r d er verwendet i n den Fällen, i n denen jemand abweichend vom Verschuldensprinzip ohne Verschulden für ein bestimmtes Verhalten haftet 1 2 2 . I n diesem Sinne kann man die Sachmängelhaftung und damit auch § 463 S. 1 als Garantiehaftung bezeichnen. Von einer Garantie w i r d aber auch gesprochen, wenn jemand für das Eintreten 117 Vgl. B G H 59, 158, 160; Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 25. ne v g l . Flume , S. 82. 119 Vgl. R G 52, 3 ff.; 161, 337; B G H W M 1970, 819; Flume , S. 82 F N 40; Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 6; Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 25; Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 459 A n m . 5 b. 120 Vgl. I V A n m . 28. Entscheidend ist stets, wie der Käufer das Verhalten des Verkäufers nach Treu und Glauben m i t Rücksicht auf die Verkehrssitte verstehen darf (vgl. I V A n m . 26). So sind beim K a u f von F u t t e r m i t t e l n auf G r u n d von § 6 Futtermittelgesetz die handelsübliche Reinheit u n d U n v e r dorbenheit zugesicherte Eigenschaften i m Sinne des § 459 I I , w e n n der V e r käufer keine Angaben über die Beschaffenheit macht (BGH 57, 292). 121 Vgl. Wolff, S. 44, 77; Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 6; Staudingerl Ostler, § 463 Rdz 18; Flume, S. 47, 48, 53 F N 77; Planck I Knoke, § 463 A n m . 1; Korintenberg, Erfüllung, S. 165 F N 33; Kuhn, i n R G R K , § 463 A n m . 2; Larenz I I , § 41 I I c 1; Soergel / Siebert / Ballerstedt, v o r § 459 Bern. 16, 21. A. A. Süß, S. 87, der § 463 S. 1 als H a f t u n g f ü r c. i. c. ansieht. Der Verkäufer, der eine Eigenschaft zusichere, handele wenigstens fahrlässig, w e n n er sich nicht überzeuge, ob die Sache die Eigenschaft auch habe. Gegen diese Ansicht von Süß ist vorzubringen, daß den Verkäufer nicht immer ein Schuldvorwurf treffen muß, daß er aber immer für eine Zusicherung gemäß § 463 S. 1 haftet; so auch Flume, S. 53 F N 77 u n d Lobe, i n R G R K , § 459 A n m . 5 c. Vgl. auch Mot. I I , 228. 122 Vgl. Esser, 3. Aufl., § 8 I 2.
126
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
eines bestimmten Erfolges, also für eine zukünftige Entwicklung, einen künftigen Zustand, verspricht einzustehen 123 . Garantie i m letzteren Sinne ist als Gegensatz zur gewöhnlichen Leistungspflicht zu verstehen. Wer sich zur Leistung verpflichtet, garantiert nicht. Der garantierte Erfolg geht über die bloße Vertragsmäßigkeit einer geschuldeten Leistung hinaus. I n diesem Sinne gebraucht die h. L. den Begriff Garantie bei § 459 I I 1 2 4 . Da sie davon ausgeht, daß beim Spezieskauf keine Vereinbarung über die Eigenschaften möglich ist, weil ein Sein nicht Gegenstand des Willens sein kann 1 2 5 , kommt sie zur Ablehnung einer Leistungspflicht hinsichtlich von Eigenschaften. Dementsprechend kann sie die Schadensersatzhaftung des § 463 S. 1 infolge einer Zusicherung nur dadurch erklären, daß sie annimmt, der Verkäufer garantiere das Vorliegen der Eigenschaften 126 . Wie oben jedoch ausgeführt, ist eine Eigenschaftsvereinbarung und damit eine entsprechende Leistungspflicht möglich. Für die Annahme einer Garantiepflicht i m Sinne der h. L. ist damit kein Raum. Der Verkäufer garantiert nicht das Vorhandensein der Eigenschaften, er verspricht Leistung der Sache m i t den bestimmten Eigenschaften. Von der einfachen Eigenschaftsvereinbarung, die zu einer Haftung nach §§ 459 I, 462 führt, unterscheidet sich die Zusicherung nur durch die Intensität, durch den besonderen Nachdruck, m i t dem der Verkäufer Leistung (der Sache mit) der vereinbarten Eigenschaft versprochen hat 1 2 7 . Fehlte der verkauften Sache bereits bei Vertragsschluß die versprochene Eigenschaft, so erscheint es gerechtfertigt, den Verkäufer für Schäden haften zu lassen, die durch die entgegen der Zusicherung vorhandene Mangelhaftigkeit der Sache eingetreten sind. Die Zusicherung ist deshalb auch keine besondere rechtsgeschäftliche Erklärung neben dem Kaufvertrag 1 2 8 , sondern sie ist 123
Vgl. Staudinger / Ostler, § 459 Rdz 76; Enneccerus / Lehmann, § 197 I I . Abweichend jedoch Süß, S. 87, der die Zusicherung nicht als Garantie betrachtet, vgl. dazu I I I A n m . 27, 29. Süß erkennt, daß bei Annahme einer Garantie W a n d l u n g u n d Minderung i m Anschluß an eine Zusicherung resultierend aus der Garantie Erfüllungsansprüche wären. Nach Süß u n d der h. L. sind Wandlung u n d Minderung aber gerade keine Erfüllungsansprüche, sondern Ansprüche die bestehen, obwohl v o l l erfüllt worden ist. Dieser Umstand veranlaßte Wolff, S. 49, zu unterscheiden zwischen einer Zusicher u n g gemäß § 463, die eine Garantie darstelle und zum Schadensersatz führe, u n d einer Zusicherung gemäß § 459 I I , 462, die n u r ein „ d i c t u m " sei u n d Wandlung u n d Minderung nach sich ziehe. Auch hier zeigt sich offensichtlich, w i e die h. L. zu immer neuen Widersprüchen führt, die m i t wenig überzeugenden Konstruktionen n u r scheinbar überwunden werden. 125 Vgl. I I , 4. 120 Larenz I I , § 41 I I c 1 ; Düringer / Hachenburg / Hoeniger, V 1 Einl. A n m . 118. 127 Leistet der Verkäufer daher die Sache ohne die zugesicherte Eigenschaft, so liegt stets auch ein Fehler i m Sinne des § 459 I vor (so zutreffend Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 6 gegen B G H N J W 1970, 653; vgl. dazu I V A n m . 15). 128 So Flume, S. 43. 124
4. I n h a l t u n d Durchführung der einzelnen Sachmängelansprüche
Bestandteil des eigentlichen Kaufvertrages den Umfang der Leistungspflicht.
129
127
und gestaltet als solche
Daß die Ansicht der h. L. nicht schlüssig ist, ergibt sich aus folgender Überlegung 1 3 0 : Hatte die Sache bei Kaufabschluß die zugesicherte Eigenschaft, fehlt diese jedoch bei Gefahrübergang, so kann der Käufer wegen des Fehlers Wandelung oder Minderung verlangen, jedoch nach einhelliger Meinung 1 3 1 nicht Schadenersatz wegen Nichterfüllung, w e i l § 463 Satz 1 voraussetzt, daß der Sache bei Kaufabschluß die zugesicherte Eigenschaft fehlte. Wäre die Zusicherung eine Garantie für das Vorhandensein der Eigenschaften, so müßte der Verkäufer auch i n dem dargelegten Fall auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung haften 1 3 2 . Daß den Verkäufer nach dem Gesetz eine solche Verpflichtung nicht trifft, zeigt, daß die Zusicherung keine Garantieerklärung ist. Der Verkäufer haftet gemäß § 463 Satz 1 i n verschärfter Form nicht deshalb, w e i l er eine Garantie für den Zustand der Sache übernommen hat, sondern deshalb, weil er seine vertragliche Pflicht zur Leistung einer fehlerfreien Sache nicht erfüllt hat und er mit Rücksicht auf die Eindringlichkeit der Eigenschaftsvereinbarung, auf die der Käufer vertraut, weniger schutzwürdig als dieser erscheint, wenn die Sache bereits bei Vertragsschluß fehlerhaft w a r 1 3 3 . 2. Infolge arglistigen Verschweigens von Fehlern (§ 463 S. 2) Der Verkäufer unterliegt auch der Schadenersatzhaftung, wenn er einen Fehler der Kaufsache arglistig verschweigt 134 . Wie § 463 S. 1 so normiert auch § 463 S. 2 eine Haftung für ungehörige Erfüllung des 129 So das Reichsgericht i n ständiger Rechtsprechung; vgl. R G 52, 3; 54, 223; 67, 87; 95, 120; Gruch. Beitr. 48, 593; Gruch. Beitr. 53, 957; vgl. auch Lobe, i n RGRK, 9. Aufl., § 459 A n m . 5 b. 130 Eine weitere Unstimmigkeit wurde bereits i n Anm. 124 aufgezeigt. 131 So schon Mot. I I , S. 229. 132 "Wenn Larenz I I , § 41 I I c 1 ausführt, die Haftung des Verkäufers aus dem Garantieverspredien werde i n diesem Falle dahingehend abgeschwächt, daß n u r Wandlung oder Minderung verlangt werden könne, so bleibt er eine überzeugende Erklärung schuldig, w a r u m das Garantieversprechen durch den äußeren Umstand, daß die Sache die zugesicherte Eigenschaft bei Vertragsschluß hatte, i n seinem Gehalt verändert w i r d . 133 w e n n Raape, S. 488 i n der Zusicherung eine doppelte E r k l ä r u n g findet, nämlich wie die Sache sein soll u n d w i e sie ist, so k a n n dem nicht gefolgt werden. Erklärungen über das Sein der Sache werden nicht verpflichtender Vertragsbestandteil, es sei denn i m Wege der Garantie. Diese Möglichkeit aber wurde gerade ausgeschlossen. Die verschärfte Erfüllungshaftung des § 463 S. 1 erklärt sich allein aus der Intensität des Leistungsversprechens. 134 Entscheidend ist dabei, ob der Verkäufer gemäß § 242 einen i h m bekannten u n d nach seiner Ansicht dem Käufer unbekannten, aber möglicherweise wesentlichen Umstand offenbaren mußte (vgl. B G H W M 1971, 791; D B 1968, 1119; N J W 1967, 1222; N J W 1965, 34). Auch zur Offenbarung eines Zweifels oder Verdachts k a n n der Verkäufer i m Einzelfall verpflichtet sein, w e n n sich das aus der Treuepflicht ergibt (Erman / Weitnauer, § 460 Rdz 6).
128
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
Vertrages. Der Käufer hat die Sache m i t bestimmten Eigenschaften gekauft. Weil die Eigenschaften fehlen, haftet der Verkäufer. Der Schadenersatzanspruch setzt wie Wandelung und Minderung voraus, daß eine mangelhafte Leistung vorliegt, daß eine fehlerhafte Sache übergeben wurde. § 463 verlangt das Vorliegen sämtlicher Merkmale, die für Wandelung oder Minderung nötig sind 1 3 5 , also Fehlerhaftigkeit der Sache bei Gefahrübergang (§ 459 I), Unkenntnis des Käufers von Fehlern, die bei Kaufabschluß schon vorhanden waren (§ 460) und entsprechende Unkenntnis bei Annahme der Sache (§ 464). Die verschärfte Haftung ist hier gerechtfertigt, w e i l den Verkäufer der Vorwurf einer besonderen Treuewidrigkeit trifft. Deshalb gilt die Verschärfung nicht nur, wenn der Verkäufer einen Fehler arglistig verschwiegen hat, sondern auch dann, wenn er eine Eigenschaft arglistig vorgespiegelt hat 1 3 6 . Obwohl § 463 S. 2 ein Verschulden des Verkäufers voraussetzt, ist der Rechtsgrund der Haftung nicht i n dem schuldhaften Verhalten des Verkäufers, sondern i n der Nichterfüllung der Leistungspflicht zu finden 1 3 7 . Die Haftung beruht also nicht auf einer culpa i n contrahendo. Die h. L. ist gezwungen, § 463 S. 2 i n dieser Weise zu interpretieren 1 3 8 , weil sie eine Leistungspflicht bezüglich der Eigenschaften ablehnt. Doch auch hier erweist sich diese Ansicht als wenig überzeugend. Die Haftung für c. i. c. ist eine Vertrauenshaftung 1 3 9 , die nur auf das Vertrauensinteresse geht 1 4 0 . Demgegenüber ordnet § 463 eine Schadenersatzverpflichtung für Nichterfüllung, also auf das positive Interesse an 1 4 1 . 135
Staudinger / Ostler, § 463 Rdz 4; Kuhn, i n RGRK, § 463 A n m . 1. Das Reichsgericht zieht die Analogie zu Recht: vgl. R G 63, 110; 66, 338; 92, 295; 103, 160. So n u n auch die h. L.: Larenz I I , § 41 I I c 3; Flume , S. 54 f., 131 f.; Palandt / Putzo, § 463 A n m . 3; Kuhn, i n R G R K , § 463 Anm. 6; Enneccerus / Lehmann, § 108 I I I ; Staudinger / Ostler, § 459 Rdz 23; α. Α. Planck/ Knoke, § 463 A n m . 8; Riehl, Gruch. Beitr. 60, 830 ff.; Geppert, Ih. Jb. 64, 458 ff., 469. 137 So auch Flume, S. 54f.; Kuhn, i n R G R K , § 463 A n m . 1, 11; Lobe, i n R G R K , 9. A u f l . § 463 A n m . 1; Erman / Weitnauer, § 463 Rdz 13. 138 Palandt / Heinrichs, § 276 A n m . 6 c; Larenz I I , § 41 I I c 2; Süß, S. 87; Korintenberg, Erfüllung, S. 187; Krückmann, Ih. Jb. 59, 324; Graue, S. 282; R G 95, 60 u n d H R R 1932, 441. Nach Wolff, S. 62 ist § 463 S. 2 eine Garantiehaftung f ü r die eigene Ehrlichkeit. Eine solche Annahme entbehrt jeder Stütze durch das Gesetz. 139 I n Analogie zu §§ 122, 179, 307; vgl. Palandt / Heinrichs, § 276 A n m . 6 a; Larenz I, § 9 I bezeichnet die H a f t u n g f ü r c. i. c. als Gewohnheitsrecht, ebenso Erman / Battes, § 276 Rdz 117. 140 B G H 6, 330 ff., 333, 335; Larenz I, § 9 I 3; Palandt / Heinrichs, § 276 A n m . 6 c. 141 F ü r die h. L. ist daher die Regelung des § 463 verfehlt, vgl. Süß, S. 88 u n d dort F N 1, sowie die i n I I I Anm. 26 aufgeführte Literatur. 136
4. I n h a l t u n d Durchführung der einzelnen Sachmängelansprüche
129
§ 463 S. 2 kann daher nicht als Haftung für culpa i n contrahendo verstanden werden 1 4 2 . 3. § 463 als Gewährleistungsanspruch Wie § 463 S. 1 ist § 463 S. 2 ein sekundärer Ausgleichsanspruch, der dem Käufer neben Wandelung und Minderung zur Wahl steht, w e i l der Verkäufer seiner Leistungspflicht nicht Genüge getan hat 1 4 3 . Die verschärfte Haftung beruht i n beiden Fällen darauf, daß der Verkäufer durch seine Handlungsweise einen Zustand geschaffen hat, der es rechtfertigt, daß ein ohne Verschulden einer Partei entstandener Schaden i h m aufgebürdet wird. Der Verkäufer hat die Sache mit bestimmten Eigenschaften versprochen. Der Käufer hat daher einen Leistungsanspruch auf die Sache i n fehlerfreiem Zustand. Erfüllt der Verkäufer seine Pflicht nicht, so ist der Käufer durch die ungehörige Leistung beeinträchtigt. Er hat nicht vollständig das erhalten, wofür er den Preis versprach. Dementsprechend kann er sich einen Ausgleich m i t Wandelung oder Minderung verschaffen. Oft liegt jedoch die Beeinträchtigung des Käufers nach Empfang einer mangelhaften Sache nicht nur i n dem Minderwert oder i n der minderen Tauglichkeit der Sache. Regelmäßig treten weitere Schäden hinzu. So kann dem Käufer durch die Unverkäuflichkeit der fehlerhaften Ware ein Gewinn entgehen, den er normalerweise gemacht hätte. T r i f f t den Verkäufer keine Schuld 1 4 4 an der Fehlerhaftigkeit der Sache und dem daraus folgenden Schaden, so erscheint es nicht 142 Wenn Larenz, a.a.O. ausführt, die Haftung f ü r c. i. c. gehe bei § 463 S. 2 über das positive Interesse, so widerspricht das den Grundsätzen der H a f tung f ü r c. i. c. Es wäre unverständlich, w a r u m derjenige, der i n Kenntnis der Tatsache, daß die Leistung der Sache als solcher absolut unmöglich ist, einen anderen arglistig zum Vertragsschluß bewegt, nach c. i. c.-Grundsätzen n u r f ü r das negative Interesse einzustehen hat (§ 307 I), während derjenige, der einen Fehler kennt u n d einen anderen unter Verheimlichung des Fehlers zum Vertragsschluß verleitet, für sein Verschulden bei Vertragsschluß auf das positive Interesse haften sollte. Daß das Verschweigen der Unmöglichkeit der Leistung insgesamt schwerer wiegt als das Verschweigen eines Fehlers der i m übrigen möglichen Leistung, dürfte niemand bestreiten w o l len. Es k a n n n u n nicht dem Gesetz unterstellt werden, daß es unter einem vollkommen gleichen Gesichtspunkt, nämlich der Haftung f ü r ein Verschulden bei Vertragsschluß, den schwereren Verstoß m i t einer leichteren Folge (§ 307), den leichteren Verstoß aber m i t einer schwereren Folge (§ 463 S. 2) belegt. Verständlich w i r d diese Regelung nur, w e n n m a n den Rechtsgrund der Haftung als unterschiedlich erkennt. Die H a f t u n g des § 463 S. 2 überzeugt n u r als Erfüllungshaftung. 143 Der Begriff Schadensersatz wegen Nichterfüllung ist daher entgegen der Ansicht der h. L. zutreffend. Ebenso Kuhn, i n R G R K § 459 A n m . 3; Flume , S. 55; Graue, S. 283; Erman, JZ 1960, 43. 144 F ü r Verschulden haftet der Verkäufer unter dem Gesichtspunkt der positiven Vertragsverletzung (vgl. Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 22 ff. u n d unten 4.).
9 Herberger
130
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
billig, i h n für den Schaden haften zu lassen. Er hat daher nur für die ungehörige Erfüllung einzutreten, denn für den vereinbarten Kaufpreis hatte er eine fehlerfreie Sache versprochen. Erfüllt er nicht einwandfrei, wozu er sich verpflichtet hat, so kann der Käufer seine Verpflichtung entsprechend ändern. Anders ist die Situation jedoch, wenn der Verkäufer eine Eigenschaft zusichert, einen Fehler verschweigt oder eine Eigenschaft vorspiegelt. I n diesen Fällen schafft er einen Zustand, der es gerechtfertigt erscheinen läßt, daß er die weiteren Schäden 145 des Käufers infolge der mangelhaften Leistung trägt 1 4 6 . Die Beschränkung der Haftung allein auf den Ausgleich der ungenügenden Erfüllung ist hier nicht angebracht. Vielmehr gebührt hier dem Käufer das volle Erfüllungsinteresse 147 . Der Verkäufer hat also beispielsweise dem Käufer den entgangenen Gewinn zu ersetzen. Dem Käufer fällt damit kein unverdientes Geschenk i n den Schoß, wie teilweise von der h. L. i m Zusammenhang m i t § 463 angenommen w i r d 1 4 8 . Der Käufer hat einen Anspruch auf mangelfreie Leistung. Die fehlerhafte Leistung bewirkt einen Schaden. Diesen Schaden ist der Verkäufer näher daran zu tragen, wenn er arglistig den Käufer zum Kauf bewegte bzw. wenn er durch die Intensität der Eigenschaftsvereinbarung, durch die Zusicherung, i n dem Käufer das Vertrauen erweckte, er werde ganz sicher die Sache m i t den vereinbarten Eigenschaften erhalten. Einer anderen Würdigung muß der Fall unterstellt werden, daß die Sache bei Kaufabschluß tatsächlich die zugesicherten Eigenschaften hatte. K o m m t eine zugesicherte Eigenschaft erst nach Vertragsschluß i n Wegfall, so besteht zwar auf Seiten des Käufers nach wie vor das besondere Vertrauen infolge der Zusicherung, aber dem steht auf Seiten des Verkäufers ein gleich schutzwürdiges Vertrauen gegenüber, er werde wie versprochen die Sache mit den zugesicherten Eigenschaften leisten können. Weil die Sache bei Kaufabschluß die zugesicherte Eigenschaft hatte, durfte der Verkäufer sicher sein, seine Verpflichtung auch erfüllen zu können 1 4 9 . Bei einer derartigen Sachlage hat deshalb der Verkäufer nach der Abwägung des Gesetzes keinen Schadensersatz 145 Umstritten ist, ob hierunter auch der sog. Mangelfolgeschaden fällt d . h . der Schaden, den die Mangelhaftigkeit der Sache an anderen Rechtsgütern des Käufers hervorruft, vgl. dazu unten 4. 146 Ebenso Flume, S. 54 f. 147 So gut wie unstrittig, vgl. Mot. I I , S. 229; kritisch Wolff, S. 57 ff. 148 V g L wolff, S. 58. 149 Wenn Süß, S. 87, § 463 S. 1 als Verschuldenshaftung versteht (vgl. I I I A n m . 27, 29), so ist das zwar nicht ganz zutreffend. Richtig ist jedoch der dahinterstehende Gedanke, daß § 463 die Zurechenbarkeit eines weiteren Schadens von dem Verhalten des Verkäufers abhängig macht, das zwar, dies verkennt Süß, nicht schuldhaft sein muß, jedoch eine Schadenszurechnung rechtfertigt.
4. I n h a l t u n d Durchführung der einzelnen Sachmängelansprüche
131
zu leisten, wenn er die Entstehung des Schadens nicht zu vertreten hat. Der Käufer hat nur die Wahl zwischen Wandlung und Minderung. Der Schadensersatzanspruch des § 463 ist also wie der Anspruch auf Wandlung und Minderung ein Sachmängelanspruch 150 , der als sekundärer Leistungsanspruch dem Käufer neben Wandlung und Minderung zur Wahl steht 1 5 1 . Weil der Verkäufer seine Leistungspflicht nicht gehörig erfüllt hat, haftet er. Dies ist Sinn und Zweck der Gewährleistung für Sachmängel, und diesem Ziel dient auch § 463. 4. Haftungsinhalt und Anspruchskonkurrenz : Mangelfolgeschaden — positive Vertragsverletzung — culpa contrahendo
in
I n der Erörterung wurde eine Frage bisher offengelassen, die i n Rechtsprechung und Literatur breiten Raum einnimmt und heftig umstritten ist, nämlich, welche Schäden von § 463 erfaßt sind. Nicht selten erleidet der Käufer nicht nur einen Schaden, der unmittelbare Folge der mangelhaften Erfüllung ist, sondern einen, u. U. weit über das reine Erfüllungsinteresse hinausreichenden Schaden an seinen anderen Rechtsgütern, der durch die mangelhafte Sache hervorgerufen wird. Das klassische Beispiel ist die Lieferung von giftigem Futter, durch dessen Genuß das gefütterte Vieh des Käufers verendet 1 5 2 . Solche sogen. Mangelfolgeschäden 153 können i n verschiedenster Gestalt auftreten. Gemeinsam ist ihnen, daß es sich u m Schäden handelt, die beim Käufer infolge der Mangelhaftigkeit über das reine Interesse an mangelfreier Leistung hinaus eingetreten sind 1 5 4 . Diese Schäden können an Sachen des Käufers, an seinem Körper oder seiner Gesundheit entstehen. Vermögensschäden kommen als Mangelfolgeschäden nur ausnahmsweise i n Betracht 1 5 5 . 150
Vgl. R G 66, 86; 67, 146. Ebenso Flume , S. 54 f.; Kuhn, i n R G R K , § 463 Anm. 1; Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 463 Anm. 1. 152 Vgl. R G 66, 289 ff. (Lieferung von Mais, vermischt m i t giftigen Rizinussamenkörnern f ü h r t zum Tod der gefütterten Pferde); ebenso B G H 57, 292 ff. (Futtermittel — Kälbertod). 153 So Larenz I I , § 41 I I c 3 u n d die unter A n m . 154 genannte Literatur. Die Terminologie ist jedoch nicht ganz einheitlich. So spricht Esser, § 64 V I 4 von „Integritätsinteresse", Todt, S. 132 von „Begleitschäden", wobei die Begriffsinhalte auch nicht vollkommen identisch sind. 154 Vgl. B G H 50, 200, 202 (Contact-Kleber); Larenz, a.a.O.; Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 47; Soergel / Siebert / Ballerstedt, § 463 Bern. 11; Palandt / Putzo, § 463 A n m . 4; Diederichsen, A c P 165, 150 ff. 155 So f ü h r t B G H 50, 200, 202 die „Trevira"-Entscheidung ( B G H 48, 118 ff.) als Beispiel für eine Entscheidung über Mangelfolgeschäden an. Dort w a r einem Konfektionsbetrieb, der Damenkleider aus einem v o n dem Verkäufer gelieferten mangelhaften Stoff (Trevira) hergestellt hatte, durch Retouren 151
e·
132
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
B e i d e r r e c h t l i c h e n B e u r t e i l u n g dieser Mangelfolgeschäden i m K a u f recht g e h t es d a b e i u m z w e i F r a g e n , d i e eng m i t e i n a n d e r z u s a m m e n hängen. Z u m e i n e n d a r u m , ob die G r u n d s ä t z e der p o s i t i v e n V e r t r a g s v e r l e t z u n g ( p V V ) ü b e r h a u p t n e b e n der S a c h m ä n g e l h a f t u n g z u r A n w e n d u n g k o m m e n oder ob n i c h t § 463 eine speziellere, abschließende Regel u n g e n t h ä l t , u n d z u m a n d e r e n d a r u m , ob § 463 sich auch a u f M a n g e l folgeschäden erstreckt. D i e B e j a h u n g oder V e r n e i n u n g der e i n e n F r a g e f ü h r t n i c h t n o t w e n d i g z u e i n e r g l e i c h l a u t e n d e n E n t s c h e i d u n g f ü r die andere. Es m u ß d a h e r j e d e f ü r sich b e a n t w o r t e t w e r d e n . W i e bereits dargelegt, i s t d e r Schadenersatzanspruch aus § 463 e i n G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r u c h , d u r c h d e n der K ä u f e r Ersatz f ü r d e n Schad e n e r l a n g t , d e r e i n g e t r e t e n ist, w e i l d e r V e r k ä u f e r n i c h t g e h ö r i g e r f ü l l t h a t . V o n d e r gesetzgeberischen Z i e l s e t z u n g h e r schützt Erfüllungsinteresse
des K ä u f e r s 1 5 6 . D e r
§463
Nichterfüllungsschaden
das setzt
sich r e g e l m ä ß i g aus d e m i n der M i n d e r w e r t i g k e i t b z w . der U n t a u g l i c h k e i t der Sache l i e g e n d e n Schaden u n d d e m e n t g a n g e n e n G e w i n n z u s a m m e n 1 5 7 . H i n z u t r e t e n k ö n n e n Schäden, d i e d u r c h d i e N i c h t v e r w e n d b a r k e i t d e r Sache entstehen, u n d d i e K o s t e n e i n e r — v e r g e b l i c h e n — M ä n gelbeseitigung158. seiner Abnehmer ein Schaden entstanden, der sich n u r als Vermögensschaden einstufen läßt. Ob es sich dabei der Sache nach w i r k l i c h u m einen M a n gelfolgeschaden gehandelt hat, w i e B G H 50, 200 annimmt, oder u m einen Nichterfüllungsschaden, erscheint fraglich. Vgl. dagegen B G H N J W 1965, 532, 533 (kritisch dazu Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 47; Todt, S. 102 f.) Todt, S. 124 f ü h r t als Beispiel f ü r Mangelfolge-Vermögensschäden die Vertragskosten u n d Haftpflichtansprüche an. Stets muß es sich u m Schäden handeln, die nicht v o m Erfüllungsinteresse gedeckt sind. 156 Vgl. B G H N J W 1965, 532, 533; s. aber A n m . 158. 157 So schon B G H 35, 130, 132 f. (Wackelspatzen) f ü r den Werkvertrag. iss y g i Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 46, 49. Eine klare Grenzziehung zwischen Mangelfolgeschaden u n d Nichterfüllungsschaden, wie das von B G H N J W 1965, 532, 533 (Sielleitungen) — i n der Sache nicht restlos überzeugend — für möglich gehalten w i r d , ist schwierig, vor allem i m Bereich des V e r mögensschadens. Das Problem stellt sich i n ähnlicher Weise beim W e r k v e r trag; dort ist die Abgrenzung noch schwieriger, w e i l die Hauptleistungspflicht nicht n u r i n einer Sachleistung, sondern auch i n Leistungen tatsächlicher A r t (Erstellung von Bauplänen, Durchführung von Operationen) bestehen kann. Anders als i m Kaufrecht, wo es u m die Einbeziehung der Mangelfolgeschäden unter den Garantietatbestand des § 463, also u m die Frage einer Haftung ohne Verschulden, geht, ist dies f ü r das Werkvertragsrecht ohne Bedeutung, da der Hersteller nach § 635 n u r bei Verschulden schadenersatzpflichtig w i r d . I m Werkvertragsrecht spielt die Abgrenzung Nichterfüllungsschaden — Mangelfolgeschaden n u r eine Rolle f ü r die Anwendung der Ver jährungsVorschrift des § 638 (vgl. dazu Finger, N J W 1973, 81 ff.; D B 1972, 1211 ff.; Laufs / Schwenger, N J W 1970, 1817 ff.; Grimm, N J W 1968, 14 ff.; Schmitz, N J W 1973, 2081 ff.). Während die L i t e r a t u r auch die Mangelfolgeschäden der kurzen V e r j ä h r u n g des § 638 unterwerfen möchte, w i l l der B G H § 638 n u r auf Schäden anwenden, die unter § 635 fallen, wobei er dazu n u r den dem W e r k anhaftenden Minderwert, den entgangenen Gewinn u n d die Folgeschäden, die eng u n d unmittelbar m i t dem Mangel des Werks zusammenhängen, rechnet. F ü r entferntere Mangelfolgeschäden sollen die Regeln
4. I n h a l t u n d Durchführung der einzelnen Sachmängelansprüche
133
Demgegenüber w i r d durch das Institut der pVV nicht das Interesse des Gläubigers an der Erfüllung der Hauptleistungspflicht und der damit zusammenhängende geschäftliche und finanzielle Erfolg geschützt, sondern das davon unabhängige Integritätsinteresse. Dem Gläubiger ist nicht nur an der Vertragserfüllung gelegen, sondern auch daran, bei Abwicklung und Durchführung des Vertrages nicht an seinen sonstigen Rechtsgütern Schaden zu nehmen. Er erwartet daher vom Schuldner — und diese berechtigte Erwartung w i r d durch das Institut der p V V geschützt —, daß dieser seine vertraglichen Verpflichtungen ordentlich erfüllt. Gegen diese Verpflichtung verstößt der Schuldner einmal durch eine mangelhafte, schadenverursachende Leistung, aber auch durch Nichtbeachtung vertraglicher Schutzpflichten. Wie i n jedem Schuldverhältnis treffen den Verkäufer Verhaltenspflichten i n Form verschiedener Sorgfalts- und Obhutspflichten 159 , für deren schuldhafte Verletzung er einzustehen hat. Stellt man die beiden Haftungsbereiche gegenüber, so ist offenbar, daß es sich u m verschiedene Regelungsgegenstände handelt. Selbst wenn man unter Vorgriff auf die nachfolgende Erörterung den Ersatz von Mangelfolgeschäden i n den Schutzbereich des § 463 m i t einbezieht, läßt sich § 463 nicht als Sonderregelung gegenüber der p V V ansehen 160 . Durch die Normierung einer Garantiehaftung, d. h. einer Haftung ohne Verschulden, soll der Käufer gerade besser gestellt werden. Das erhält seine Rechtfertigung i n den von § 463 erfaßten Fällen aus dem besonderen Verhalten des Verkäufers. Dadurch w i r d aber die grundsätzliche Pflicht des Verkäufers bei Durchführung des Vertrages darauf zu achten, daß der Käufer nicht an seinen Rechtsgütern verletzt wird, nicht berührt. Aus der durch § 463 herbeigeführten Erweiterung des Schutzes folgt nicht ein Wegfall der allgemeinen Verpflichtung zu sorgfältiger Leistungsbewirkung. Die Gewährleistungsregelung läßt diesen Grundsatz unberührt, selbst wenn der Schaden gerade infolge Leistung einer mangelhaften Sache entsteht. Ob der Verkäufer den Käufer „ m i t dem verlängerten A r m " einer mangelhaften Sachleistung der p W gelten (BGH 58, 85, 87; B G H N J W 1973, 1752; noch nicht so differenziert B G H 35, 130, 132 — Wackelspatzen). — Teilweise w i r d auch der Versuch gemacht, das Problem durch B i l d u n g verschiedener Schadenstypen zu lösen (vgl. Todt, S. 132 ff.; Ballerstedt, S. 715 ff.). 159 Vgl. dazu Larenz I, § 24 I a. 160 A . A . Stoll, AcP 136, 257, 310, 314 ff.; Medicus, Festschrift Kern, S. 313, 318 f., der unter historischer Sicht § 463 als abschließende Sonderregelung ansieht. Es ist jedoch unwahrscheinlich, daß der Gesetzgeber — wie Medicus meint — das Problem des Mangelfolgeschadens i m Kaufrecht w i r k l i c h gesehen hat. Dafür ist auch das J u l i a n - Z i t a t kein überzeugender Beweis. Das Fehlen eines allgemeinen Tatbestandes f ü r Mangelfolgeschäden spricht eindeutig gegen die Ansicht von Medicus.
134
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
oder i n sonstiger Weise s c h u l d h a f t v e r l e t z t , k a n n k e i n e n U n t e r s c h i e d machen. A u c h der G e s i c h t s p u n k t , daß d e r V e r k ä u f e r nach § 463 Satz 2 n u r b e i A r g l i s t h a f t e t , i s t k e i n G e g e n a r g u m e n t 1 6 1 . N a c h § 463 w i r d das E r f ü l l u n g s i n t e r e s s e ersetzt, also e t w a d e r entgangene G e w i n n , w ä h r e n d unter dem Gesichtspunkt der p W
das r e i n e E r h a l t u n g s i n t e r e s s e
setzt w i r d . D i e D i f f e r e n z i e r u n g i n d e m j e w e i l s e r f o r d e r l i c h e n
er-
Schuld-
v o r w u r f ist d a h e r g e r e c h t f e r t i g t . § 463 l ä ß t also e i n e n A n s p r u c h auf Ersatz eines Mangelfolgeschadens nach d e n G r u n d s ä t z e n d e r p V V u n b e r ü h r t 1 6 2 . D e r V e r k ä u f e r h a t d e n d e m K ä u f e r e n t s t a n d e n e n Schaden z u ersetzen, w e n n i h n der V o r w u r f e i n e r s c h u l d h a f t e n P f l i c h t v e r l e t z u n g t r i f f t 1 6 3 . Das bedeutet, daß i m E i n z e l f a l l stets e i n Pflichtverstoß u n d e i n schuldhaftes Verhalten vorl i e g e n müssen. Diese V o r a u s s e t z u n g e n s i n d n i c h t schon d a n n e r f ü l l t , w e n n der V e r k ä u f e r eine m a n g e l h a f t e Sache ü b e r g i b t . R e g e l m ä ß i g i s t er n i c h t v e r p f l i c h t e t , d e n K a u f g e g e n s t a n d v o r Ü b e r g a b e z u u n t e r s u c h e n oder z u p r ü f e n 1 6 4 , doch k a n n sich aus d e m S c h u l d v e r h ä l t n i s e t w a s anderes ergeben. D e r A n s p r u c h aus p V V r i c h t e t sich i m m e r n u r auf Ersatz des M a n g e l folgeschadens, n i e m a l s a u f das E r f ü l l u n g s i n t e r e s s e 1 6 5 . D e r K ä u f e r k a n n 161 So schon B G H N J W 1965, 532, 533: Der Verkäufer haftet wegen p W nicht n u r bei arglistigem Verschweigen, sondern schon bei einfacher F a h r lässigkeit. A. A. Medicus, a.a.O., S. 318, der als Argument anführt, daß i n § 463 Satz 2 dem Verkäufer das Schweigen zum V o r w u r f gemacht werde. Der gleiche V o r w u r f aber treffe den Verkäufer i m Falle der pVV. Die Annahme, schon eine fahrlässige Verletzung mache ersatzpflichtig, verstoße demnach gegen den W o r t l a u t des § 463 Satz 2. Dieses A r g u m e n t ist jedoch nicht stichhaltig, vgl. dazu weiter i m Text. 162 So zuletzt B G H 60, 9, 12 (Heizungsanlage — erfrorene Blumen): Die verspätete Auswechslung eines fehlerhaften Verbundreglers, zu der der Verkäufer auf G r u n d von § 480 (in Gestalt eines vertraglich modifizierten Ersatzlieferungsanspruchs) verpflichtet war, führte zu Frostschäden i n den Gewächshäusern des Käufers. Der B G H sieht i n der Verletzung der Ersatzlieferungspflicht zugleich eine p W , die dem Käufer Anspruch auf Ersatz des Mangelfolgeschadens gibt. Ebenso schon B G H N J W 1965, 532, 533; B G H 59, 303, 309 (Schmutzwasser — Butterverunreinigung) ; Erman ! Weitnauer, vor § 459 Rdz 23; Esser, § 64 V I 4, S. 58 ff.; Larenz I I , § 41 I I e, S. 59f.; SoergelI Siebert / Ballerstedt, vor § 459 Bern. 33; Palandt / Putzo, vor § 459 A n m . 2 b; Staudinger ! Ostler, vor § 459 Rdz 18. 163 B G H 59, 303, 309 unter Befürwortung einer Beweislastumkehr, w e n n der Käufer bei bestimmungsgemäßer Verwendung eines Industrieerzeugnisses einen Schaden an einem der durch § 823 I geschützten Rechtsgüter erleidet (vgl. dazu B G H 51, 91, 102, 104 ff.). 164 Vgl. Erman ! Weitnauer, v o r § 459 Rdz 24; B G H N J W 1968, 2238, 2239 f ü r einen Zwischenhändler, insbesondere i m Streckengeschäft. Dem w i d e r spricht auch nicht B G H N J W 1969, 1708, 1710, wie Weitnauer, a.a.O. meint, da dort eine p W nicht wegen mangelnder Prüfung des neuen Fahrzeugs, sondern wegen mangelhafter Inspektion bejaht wurde. 165 B G H 35, 130, 132ff. (Wackelspatzen) f ü r den Werkvertrag; Erman! Weitnauer, vor § 459 Rdz 49; das gilt auch beim Gattungskauf. Der Nichterfüllungsschaden w i r d n u r nach § 480 I I ersetzt, nicht dagegen nach p W (Erman ! Weitnauer, § 480 Rdz 15 gegen Staudinger ! Ostler, § 480 Rdz 49).
4. I n h a l t u n d Durchführung der einzelnen Sachmängelansprüche
135
auch nur den Schaden ersetzt verlangen, der i h m selbst entstanden ist, nicht einen Drittschaden 1 6 6 . Da der bei Mangelfolgeschäden den Verkäufer möglicherweise treffende Vorwurf einer schuldhaften Pflichtverletzung darin besteht, daß er eine mangelhafte Sache geliefert hat, hängt die Verpflichtung zum Schadenersatz u. a. vom Nachweis der Mangelhaftigkeit zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs ab. Daraus rechtfertigt sich eine entsprechende Anwendung des § 477 I 1 6 7 , der m i t Rücksicht auf die sichere Ermittlung und Feststellung von Mängeln und dem Zeitpunkt ihres Entstehens die Verjährung nach sechs Monaten eintreten läßt, sofern nicht die Frage der Mangelhaftigkeit unter den Parteien endgültig geklärt ist, sei es durch Vollzug nach § 465 oder durch ein rechtskräftiges Urteil. Aus dem Umstand, daß der Verkäufer dem Käufer für Mangelfolgeschäden aus p V V haftet, folgt nicht, daß ein Ersatz von Mangelfolgeschäden nach § 463 ausgeschlossen ist. Da der Verkäufer bei p V V schon einfache Fahrlässigkeit zu vertreten hat, § 463 i n seiner zweiten A l t e r native aber ein höheres Maß an Verschulden verlangt (arglistiges Vorspiegeln oder Verschweigen), hat die Frage der Einbeziehung von Mangelfolgeschäden nur Bedeutung für den Fall der Zusicherung von Eigenschaften (§ 463 Satz l ) 1 6 8 . Die Zusicherung ist eine Eigenschaftsvereinbarung, die auf Grund der besonderen Intensität des Leistungsversprechens zu einer Haftungserweiterung führt. Daraus ergibt sich zwanglos, daß die Verpflichtung zum Schadenersatz nach § 463 Satz 1 auch Mangelfolgeschäden einschließen muß, wenn die Zusicherung das Ziel verfolgt, den Käufer auch gegen solche Schäden abzusichern 169. Maßgeblich ist, i n 166
B G H 40, 91, 103 ff.; Esser, § 64 V I 4, S. 58 F N 86. So zuletzt B G H 60, 9, 11 f.; aber auch schon B G H NJW 1972, 246; 1971, 654f.; 1967, 1805, 1807; 1965, 148, 150; R G 53, 200, 203; 117, 315, 316; 129, 280, 282; 144, 162; Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 23, 48; Soergel / Siebert / Ballerstedt, § 477 Bern. 6; Palandt / Putzo, § 477 A n m . 1 d; Schmitz, N J W 1973, 2081, 2083; a. A. Enneccerus / Lehmann, § 112 I 3 a. Larenz I I , § 41 I I e, S. 60 F N 2 möchte den L a u f der Verjährungsfrist jedoch erst m i t Schadenseintritt beginnen lassen. Das läßt B G H 60, 9, 13 ausdrücklich dahingestellt. 168 Daß § 463 S. 2 nicht eine H a f t u n g aus p W ausschließt, wurde schon dargelegt. 160 B G H 57, 292 ff. (Futtermittel — Kälbertod); ebenso B G H N J W 1974, 272 für Werkvertrag. So schon grundlegend B G H 50, 200 ff. (Contact-Kleber) unter Verweisung auf B G H 48, 118 (Trevira, vgl. dazu A n m . 155) u n d B G H D B 1966, 147 (Ziegelsteine) gegen die frühere entgegengesetzte Rechtsprechung (OLG K ö l n VersR 1964, 541; O L G Celle D B 1966, 457; O L G Karlsruhe O L G Z 1966, 274ff.). Wie hier auch Larenz I I , § 41 I I c 3; Diederichsen, A c P 165, 150 ff.; Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 49; Todt, S. 151 ff.; Esser, § 64 V I 4, S. 58 ff.; v. Westphalen, B B 1972, 1070, 1071. Dagegen ist die i n der früheren L i t e r a t u r vertretene generelle Einbeziehung aller Mangelfolgeschäden unter § 463 abzulehnen (so jedoch Soergel / Siebert / Ballerstedt, § 463 Bern. 11; Enneccerus / Lehmann, § 108 I I I 2; Staudinger / Ostler, § 463 Rdz 19, 24 a. E.; Heck, S. 275). 167
136
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
welchem Umfang sich aus der Zusicherung eine Risikoübernahme für Schäden ergibt 1 7 0 , die infolge mangelhafter Leistung entstehen. Eine Entscheidung kann dabei nur von Fall zu Fall getroffen werden. Der Verkäufer haftet damit für Mangelfolgeschäden, wenn i h n ein Verschulden trifft, nach den allgemeinen Grundsätzen der pVV, wobei dieser Schadenersatzanspruch nicht vom Bestehen einer Ersatzverpflichtung nach § 463 abhängt und auch neben Wandlung oder Minderung geltend gemacht werden kann 1 7 1 . I m Einzelfall kommt auch eine Schadenersatzverpflichtung ohne Verschulden i n Betracht, nämlich dann, wenn der Verkäufer m i t der Zusicherung von Eigenschaften das Risiko für diese Schäden übernommen h a t 1 7 2 . Die Verjährung der A n sprüche richtet sich stets nach § 477. Ein weiteres i n der Literatur vielfach diskutiertes Problem ist, ob die Haftung aus culpa in contrahendo (c. i. c.) neben der Sachmängelhaftung zur Anwendung kommt, oder ob nicht die §§ 459 ff., insbesondere m i t Rücksicht auf §§ 463, 467 Satz 2, eine abschließende Regelung enthalten. Dabei muß gleich zu Anfang betont werden, daß eine schlagwortartige Lösung i n dem Sinne „Ausschluß,, oder „Nichtausschluß" nicht möglich ist, da der während der Vertragsverhandlungen erfolgte Pflichtverstoß, der dem Verkäufer zum V o r w u r f gemacht wird, i n den verschiedensten Umständen gefunden werden kann. Ein Ausschluß der Haftung für c. i. c. kann überhaupt nur für den Regelungsbereich i n Betracht kommen, auf den sich die Sachmängelhaftung bezieht, das 170 Der Verkäufer, der eine n u r zu einem bestimmten Zweck geeignete Sache unter der Zusicherung ihrer Zwecktauglichkeit verkauft, k a n n sich daher nicht auf eine i n seinen A G B enthaltenen Ausschluß von Schadenersatzansprüchen berufen, w e n n die Sache infolge Zweckuntauglichkeit Mangelfolgeschäden verursacht (so zutreffend B G H 50, 200 ff.; ebenso B G H N J W 1974, 272f.: Soll der Käufer durch die Zusicherung gerade gegen M a n gelfolgeschäden abgesichert werden, dann ist eine formularmäßige F r e i zeichnung unwirksam). Zustimmung verdient auch B G H 59, 158 ff., 162 (Fensterlack — Braunfäule). Danach haftet der Verkäufer, der die Eignung der Kaufsache für einen bestimmten Verwendungszweck uneingeschränkt zugesichert hat, auch f ü r sogen. Entwicklungsschäden, die selbst für den Verkäufer bei Vertragsschluß nicht voraussehbar waren (in diesem P u n k t ablehnend v. Westphalen i n der Urteilsanmerkung D B 1972, 1070 ff.). Die Vorschrift des § 463 dient einer Risikoverteilung wobei die Eigenschaftsvereinbarung Anknüpfungspunkt f ü r die Zurechnung ist. E i n Verkäufer, der uneingeschränkt die Verwendbarkeit zusichert, ü b e r n i m m t das volle Risiko, auch wenn er die Möglichkeit einer solchen Entwicklung überhaupt nicht i n Betracht gezogen hat. 171 Erman / Weitnauer f vor § 459 Rdz 23. 172 Ob der Käufer i n diesem F a l l auch neben Wandlung oder Minderung den Anspruch auf Ersatz des Mangelfolgeschadens hat, erscheint angesichts der gesetzlichen A l t e r n a t i v e fraglich. Vielfach w i r d das jedoch befürwortet (vgl. Ballerstedt, S. 732). A u f jeden F a l l erlangt der Käufer vollen Ausgleich, w e n n er Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangt.
4. I n h a l t u n d Durchführung der einzelnen Sachmängelansprüche
137
ist die Vereinbarung von Eigenschaften und die daraus resultierende Haftung. Damit taucht das Konkurrenzproblem nicht auf bei Verstößen gegen sonstige Verhaltens- und Schutzpflichten, aber auch dann nicht, wenn der Verkäufer eine besondere Beratungspflicht als Nebenverpflichtung übernimmt 1 7 3 . Das Problem konzentriert sich auf die Fälle der fahrlässigen falschen Angaben bzw. Nichtangaben von Sacheigenschaften. Macht der Verkäufer bestimmte Angaben über die Kaufsache, so werden diese angegebenen Eigenschaften, auch wenn sie sich nicht zu einer Zusicherung verdichtet haben, Inhalt des Kaufvertrages. Der Verkäufer schuldet die Sache m i t den angegebenen Eigenschaften. Unabhängig davon, ob die Eigenschaftsangaben durch den Verkäufer fahrlässig erfolgten oder nicht, hat der Käufer i m Falle mangelhafter Leistung die Sachmängelansprüche. W i l l der Käufer m i t Rücksicht auf die Mangelhaftigkeit die Sache nicht behalten, so kann er wandeln. Soweit ein Leistungsaustausch bereits stattgefunden hat, werden die gegenseitigen Leistungen zurückgewährt (§§ 467, 346 Satz 1). Der geleistete Kaufpreis ist dabei vom Empfangszeitpunkt an zu verzinsen (§§ 467, 346 Satz 1, 347 Satz 3 i. V. m. § 246; HGB § 352), während der Käufer nach überwiegender Ansicht zumindest so lange, wie er noch keine Kenntnis von der Mangelhaftig173 Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 26, 27; Staudinger / Ostler, vor § 459 Rdz 19; Kuhn, i n R G R K § 459 A n m . 39; Soergel / Siebert / Ballerstedt, vor § 459 Bern. 32; Diederichsen, B B 1965, 401; B G H N J W 1-962, 1196: Unrichtige Beratung über Aufstellungsmöglichkeit einer Maschine f ü h r t zur Haftung aus c. i. c. B G H N J W 1970, 653, 655 bejaht eine Haftung aus dem Gesichtsp u n k t der c. i. c., w e n n beim Verkauf eines Unternehmens die vor der V e r äußerung erzielten Umsätze verschwiegen werden, obwohl der Käufer seinen Kaufentschluß f ü r den Verkäufer erkennbar von einer bestimmten Höhe der Umsätze abhängig macht. Die Konkurrenzfrage zu §§ 459 ff. taucht hier f ü r den B G H nicht auf: der Umsatz sei keine Eigenschaft des Unternehmens. Dem k a n n nicht zugestimmt werden. Der Umsatz ist eine Eigenschaft. Die Ansprüche des Käufers ergeben sich daher aus §§ 459 ff. (ebenso Putzo i n der Urteilsanmerkung N J W 1970, 653 f.; Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 27; vgl. dazu I V , A n m . 30). B G H W M 1974, 51 f. f ü h r t diese Rechtsprechung fort: Durch die Vorlage von Bilanzen erteilte der Verkäufer eines Unternehmens Auskünfte. F ü r unrichtige u n d manipulierte Bilanzen hafte er wegen V e r schuldens bei Vertragsschluß. Die §§ 459 ff. kämen nicht i n Betracht, da Bilanzen n u r ein M i t t e l sein könnten, u m i n Verbindung m i t anderen U m ständen Schlüsse auf die Ertragsfähigkeit zuzulassen. F ü r den B G H haben Bilanzen also n u r mittelbare Bedeutung neben anderen Umständen, u n d das auch n u r bezüglich der Ertragsfähigkeit. Bilanzangaben werden also nicht als Eigenschaftsangaben anerkannt. Wie unter V, 4, b, aa, α, 4. dargelegt, ist das weder sachgerecht noch überzeugend. Z u r Nebenverpflichtung vgl. auch B G H 47, 312ff. (Betonbereitungsanlage): Infolge mangelhafter A u f k l ä r u n g u n d Unterweisung über die Behandlung u n d erforderliche W a r t u n g v e r krustete die Entlüftungsvorrichtung i n der Dosieranlage der Zementwage. Verletzung einer Nebenverpflichtung bejaht.
138
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
keit und damit von der Möglichkeit zur Wandlung hat, nur nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung haftet (§§ 467, 327 Satz 2 analog) 174 . Außerdem kann der Käufer Ersatz der Vertragskosten 175 , d. h. der Abschlußkosten und der Kosten des dinglichen Vollzugs (Auflassung, Fracht, Montage), verlangen. Statt Wandlung kann der Käufer einen Anspruch auf — großen oder kleinen — Schadenersatz wegen Nichterfüllung geltend machen, wenn der Verkäufer die Eigenschaft arglistig vorgespiegelt oder verschwiegen hat. Die Sachmängelhaftung enthält damit eine i n sich geschlossene Regelung der Möglichkeiten des Käufers, sich von dem Vertrag freizumachen und den Zustand herzustellen, der bestünde, wenn es gar zum Abschluß gekommen wäre. Dem gleichen Zweck würde aber auch die Haftung aus c. i. c. dienen, soweit es u m fahrlässige Angaben von Eigenschaften geht. Der Ersatz des negativen Interesses würde darin bestehen, den Käufer so zu stellen, wie er stünde, wenn er nicht auf die Gültigkeit des Vertrages vertraut hätte, also regelmäßig so, als habe er den Vertrag nicht geschlossen 176 . Aus der Übereinstimmung der Regelungsgegenstände folgt, daß die Sachmängelhaftung als eine i n sich geschlossene Regelung eine Haftung aus c. i. c. wegen fahrlässig falscher Angaben ausschließt 177 . Das gleiche 174 So B G H N J W 1970, 656, 657; O L G K ö l n O L G Z 1970, 1073; R G 116, 380; 130, 123; Palandt / Heinrichs, § 347 Anm. 2; Wolf, AcP 153, 97, 100, aber S. 128; Thielmann, VersR 1970, 1073. Widersprüchlich Larenz: i m Sinne der h. L. Larenz I, § 26 b, S. 298, anders Larenz I I , § 41 I I a, S. 45. A . A . R G 145, 82; Wieling, JuS 1973, 400; Erman / Weitnauer, § 467 Rdz 7 u n d N J W 1970, 637, 639; Soergel / Siebert / Ballerstedt, § 467 Bern. 4. Letztlich spielt der Streit für die hier zu entscheidende Frage keine Rolle. 175 Darunter dürften auch die Kosten für die Tätigkeit eines Maklers fallen (vgl. Staudinger / Ostler, § 467 Rdz 38; Erman / Weitnauer, § 467 Rdz 9), allerdings nur, soweit sie erst durch den Vertragsschluß entstanden sind. 176 B G H W M 1974, 51 f.; Larenz, A T , § 20 I I c; Erman ! Battes, § 276 Rdz 107 ff., 118. 177 R G 135, 339, 346; 148, 286, 296; 161, 193; 161, 330, 337; RG J W 1934, 2906. Der B G H hat die Frage lange Zeit offen gelassen ( B G H N J W 1970, 653, 655 m. w. N.; N J W 1965, 532, 533). B G H 60, 319 ff. n i m m t n u n eindeutig i n dem hier vertretenen Sinne Stellung. Ebenso Erman / Battes, § 276 Rdz 114; Erman J Weitnauer, vor § 459 Rdz 25; Staudinger / Ostler, vor § 459 Rdz 19; Soergel / Siebert / Ballerstedt, vor § 459 Bern. 32; Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 39; Nastelski, i n R G R K , § 276 A n m . 94. A . A . Enneccerus / Lehmann, § 112 I 3, S. 453; Schubert, S. 55, 87; Soergel / Siebert / Schmidt, vor § 275 Bern. 7; Diederichsen, B B 1965, 401 ff.; O L G Hamburg, M D R 1973, 496. Das O L G v e r t r i t t die Ansicht, es handele sich u m verschiedene Tatbestände. Es übernimmt dabei weitgehend die Argumentation von Diederichsen. „ B e i der c. i. c. handelt es sich u m das Verhalten der Parteien vor oder bei dem Vertragsschluß, während die Sachmängelgewährleistung die Rechte des Käufers aus dem bereits geschlossenen Vertrag regelt. Die Verpflichtung der miteinander i n einen geschäftlichen K o n t a k t tretenden Personen zu w a h r heitsgemäßem Verhalten (vorvertraglicher Bereich) steht daher selbständig neben der Verpflichtung des Verkäufers zur Gewährleistung (vertraglicher
4. I n h a l t u n d Durchführung der einzelnen Sachmängelansprüche g i l t aber, w e n n d e r V e r k ä u f e r negative
Eigenschaften
es aus F a h r l ä s s i g k e i t unterläßt,
des Kauf gegenständes
hinzuweisen.
139 auf
Vertrags-
gegenstand ist i n diesem F a l l e eine Sache, d i e k e i n e F e h l e r h a t , die d e n W e r t oder die T a u g l i c h k e i t z u d e m g e w ö h n l i c h e n G e b r a u c h a u f h e b e n oder m i n d e r n . A u c h h i e r h a f t e t der V e r k ä u f e r f ü r die n e g a t i v e n E i g e n schaften n a c h § 459 ff., eine H a f t u n g aus c. i. c. k a n n n i c h t i n B e t r a c h t kommen178. D e n k b a r i s t noch eine d r i t t e F a l l g e s t a l t u n g 1 7 9 : D e r V e r k ä u f e r l ä ß t es, a u f eine n e g a t i v e Eigenschaft d e r Sache h i n z u w e i s e n ,
unteretwa,
w e i l diese Eigenschaft f ü r j e d e n v e r s t ä n d i g e n D r i t t e n i n der S i t u a t i o n des K ä u f e r s e r k e n n b a r ist. D e r K ä u f e r ü b e r s i e h t j e d o c h d i e n e g a t i v e Eigenschaft u n d v e r l a n g t
unter
Berufung
auf die Verletzung
einer
A u f k l ä r u n g s p f l i c h t Ersatz des n e g a t i v e n Interesses aus c. i. c. D i e B e s o n d e r h e i t dieses F a l l e s besteht d a r i n , daß V e r t r a g s g e g e n s t a n d die Sache i n i h r e m f e h l e r h a f t e n Z u s t a n d ist, d e n n d i e E r k l ä r u n g e n des K ä u f e r s w i e des V e r k ä u f e r s k o n n t e n h i e r v o n j e d e m u n b e t e i l i g t e n D r i t t e n n u r d a h i n g e h e n d v e r s t a n d e n w e r d e n , daß eine m i t e i n e m M a n g e l b e h a f t e t e Sache v e r k a u f t w e r d e n s o l l t e 1 8 0 . D e r V e r k ä u f e r h a f t e t h i e r n i c h t f ü r d e n M a n g e l , w i e § 460 Satz 2 a u s d r ü c k l i c h k l a r s t e l l t 1 8 1 . Bereich)." Diese Argumentation erweist sich jedoch als unzutreffend. Wie ausführlich unter I V , 1 dargelegt, beruht die Sachmängelhaftung gerade auf der Eigenschaftsvereinbarung, also auf der konkreten Angabe oder Nichtangabe von Eigenschaften. Die Vereinbarung ist der Rechtsgrund der Sachmängelhaftung. Von ihrem I n h a l t hängt die jeweilige H a f t u n g ab. Zwischen Sachmängelhaftung u n d c. i. c. besteht damit tatbestandliche Deckung. Das w i r d i m übrigen bestätigt durch das Ergebnis der Entscheidung des O L G : Der Käufer erhält über c. i. c. den vollen Kaufpreis gegen Zurverfügungstellung des Fahrzeugs zurück, so, als ob er gewandelt hätte. Damit ist der erste Schritt zur inneren Aushöhlung des Gewährleistungsrechts getan. Wenn B G H W M 1974, 51 f. ein Verschulden bei Vertragsschluß bejaht, w e n n der Verkäufer eines Unternehmens unrichtige u n d manipulierte Bilanzen vorlegt, so widerspricht das zwar nicht B G H 60, 319; der B G H sieht i n den Bilanzangaben keine Angaben von Eigenschaften, so daß f ü r i h n die Gewährleistungsvorschriften der §§ 459 ff. nicht i n Betracht kommen, also eine Konkurrenzsituation ausscheidet. Das ist jedoch v o m Ansatz her unzutreffend. M i t der Vorlage von Bilanzen werden Beschaffenheitsangaben gemacht. Es gelten die §§ 459 ff. Eine Haftung aus c. i. c. ist ausgeschlossen (vgl. V, 4, b, aa, α, 4.). Dagegen bejaht Larenz I I , § 41 I I e, S. 62 eine Haftung aus c. i. c. offenbar n u r für Mangelfolgeschäden. Dem ist ohne Bedenken zuzustimmen (vgl. unten i m T e x t u n d A n m . 183). 178 So auch B G H 60, 319, 322 u n d die i n A n m . 177 zitierte Literatur. 179 E i n derartiger Sachverhalt lag offenbar der Entscheidung B G H 60, 319 ff. zugrunde. 180 Die E r k l ä r u n g des Käufers gilt m i t der Bedeutung, die der Verkäufer auf G r u n d aller i h m erkennbaren Umstände als die v o m Erklärenden gemeinte erkennen mußte. (Vgl. Larenz, A T , § 19 I I a, S. 279). Das bedeutet für unser Beispiel: K a u f der Sache i n ihrem mangelhaften Zustand. 181 Vgl. dazu I V , 1, e.
140
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
Nun ließe sich argumentieren, daß eine Haftung aus c. i. c. i n diesem Falle nicht ausgeschlossen sei, weil die Sachmängelhaftung nicht eingreift. Das wäre jedoch ein Trugschluß. Der Käufer, der sich infolge eigener grober Fahrlässigkeit i n einem I r r t u m über Eigenschaften der Kaufsache befindet, daher seiner vertraglichen Erklärung einen anderen Inhalt zuschreibt, als ihr tatsächlich zukommt, kann dem Verkäufer nicht zum V o r w u r f machen, er habe seine Aufklärungspflicht versäumt, und deshalb Ersatz des negativen Interesses aus c. i. c. verlangen. Auch insoweit enthält das Gewährleistungsrecht i n § 460 eine eindeutige abschließende Regelung. Kennt der Käufer einen Mangel oder hätte er ihn erkennen müssen (grobe Fahrlässigkeit), dann haftet der Verkäufer nur, wenn er die Abwesenheit des Mangels zugesichert hat oder ihn arglistig verschwiegen oder vorgespiegelt hat, denn i n diesen Fällen ist, wie schon oben IV, 1, e dargelegt, eine mangelfreie Sache Vertragsgegenstand. Für eine Haftung aus fahrlässiger Verletzung einer A u f klärungspflicht ist daneben kein Raum 1 8 2 . Es kann damit festgehalten werden, daß fahrlässige Angaben oder Nichtangaben von Eigenschaften keinen Anspruch auf Ersatz des negativen Interesses aus c. i. c. begründen. Ob der Verkäufer für negative Eigenschaften der Kaufsache haftet, oder ob eine derartige Haftung gerade nicht eintritt, richtet sich ausschließlich nach den Sachmängelvorschriften. Diese Feststellung bedarf nur einer Klarstellung. Die Sachmängelhaftung ist eine Ausgleichsregelung für mangelhafte Erfüllung. Das bedeutet, daß Ersatzansprüche für Mangelfolgeschäden grundsätzlich unberührt bleiben. Erleidet der Käufer daher infolge der Mangelhaftigkeit der Sache einen Mangelfolgeschaden, so haftet der Verkäufer unter dem Gesichtspunkt der c. i. c., wenn er den Käufer vor Vertragsschluß schuldhaft nicht auf eine gefahrbringende Eigenschaft der Sache hingewiesen hat 1 8 3 . Dabei ist i m Einzelfall jedoch genau zu prüfen, welche Sorgfaltspflichten den Verkäufer treffen. Auch dieser Anspruch aus c. i. c. verjährt nach § 477 184 .
182 Ebenso i m Ergebnis B G H 60, 319, 322: Die besondere Regelung der §§ 459 ff. schließe auch Schadenersatz wegen fahrlässiger Nichtangabe von Sacheigenschaften, die nicht den gewöhnlichen oder vertraglich vorausgesetzten Gebrauch beeinträchtigen, den Käufer aber aus anderen Gründen v o m K a u f abhalten konnten, aus. 183 Auch B G H 60, 319 ff. schließt den Ersatz von Mangelfolgeschäden nach c. i. c. nicht aus. Ebenso Larenz I I , § 41 I I e, S. 62; Kuhn, i n R G R K , § 459 Anm. 39; a. A. w i e bei p V V Medicus, S. 318 f.; vgl. A n m . 161. 184 R G 129, 280; Soergel / Siebert / Ballerstedt, § 477 Bern. 6; Kuhn, i n R G R K § 459 A n m . 39. Jedoch w i l l Larenz I I , § 41 I I e, S. 62 F N 4 auch hier erst die Frist m i t E i n t r i t t des Schadens beginnen lassen (vgl. Anm. 167).
4. I n h a l t u n d Durchführung der einzelnen Sachmängelansprüche
141
ß) Schadensersatz beim Gattungskauf Da beim Abschluß eines Gattungskaufs noch keine bestimmte Sache Kaufgegenstand ist, kann die Frage der verschärften Haftung nicht davon abhängen, ob die Sache, wie beim Spezieskauf, bei Kaufabschluß die zugesicherte Eigenschaft hatte oder nicht. Auch ein arglistiges Verschweigen eines Fehlers bzw. ein arglistiges Vorspiegeln einer Eigenschaft ist nur bezüglich einer konkreten Sache möglich. Daraus erklärt sich die abweichende Regelung des § 480 I I i m Verhältnis zu §463. Legt man die oben dargelegten Überlegungen zugrunde, so w i r d auch die Regelung des § 480 I I verständlich. Der Verkäufer, der eine Eigenschaft zusichert, schafft ein besonderes Vertrauen beim Käufer. Diesem Vertrauen steht jedoch hier kein gleiches schutzwürdiges Vertrauen auf Seiten des Verkäufers gegenüber, wie etwa beim Spezieskauf, wenn die Sache bei Kaufabschluß die zugesicherte Eigenschaft hatte, denn eine bestimmte Kaufsache liegt gar nicht vor. Der Verkäufer hofft lediglich, eine solche Kaufsache besorgen zu können, so daß er bei dieser Sachlage weniger schutzwürdig erscheint als der Käufer, da er bewußt das Vertrauen des Käufers erzeugt hat, obwohl er u m das Beschaffungsrisiko wußte. Auch i m Falle eines arglistigen Verschweigens bzw. Vorspiegeins kann die Abwägung nur dazu führen, den Verkäufer für den weiteren infolge der mangelhaften Leistung entstandenen Schaden haften zu lassen. Wie § 463 ist § 480 I I ein Sachmängelanspruch, der eingreift, w e i l der Verkäufer zwar die Sache als solche, jedoch nicht m i t der vereinbarten Eigenschaft geleistet hat. Dementsprechend setzt der Anspruch eine Konkretisierung auf die geleistete Sache voraus. Diese erfolgt wie bei Wandlung und Minderung mit Erhebung des Anspruchs bzw. eine logische Sekunde vorher. Damit geht rückwirkend die Gefahr über, wom i t dann die letzte Voraussetzung des Schadensersatzanspruchs erfüllt ist. Gerade das Erfordernis des Gefahrübergangs für den Schadensersatzanspruch nach § 480 I I zeigt, daß der Anspruch ein Sachmängelanspruch ist. Schließen die Parteien einen Gattungskauf über einen Rasenmäher, so ist der Verkäufer verpflichtet, ein der Vereinbarung entsprechendes Gerät zu leisten. Übergibt er ein fehlerhaftes Gerät, so findet kein Gefahrübergang statt. Die Gefahr geht gemäß § 446, 447 nur über, wenn die verkaufte Sache übergeben bzw. dem Versender ausgeliefert wird. Verkauft ist eine fehlerfreie Sache. Mangels Gefahrübergang kommen Wandlung, Minderung und Schadensersatz wegen
142
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
Nichterfüllung nicht i n Betracht. Der Käufer kann die fehlerhafte Sache zurückgeben und eine fehlerfreie verlangen. Er macht damit seinen ursprünglichen Leistungsanspruch geltend (§ 480 I). Er kann sich jedoch auch dazu entschließen, das Schuldverhältnis auf die übergebene Sache zu konkretisieren. M i t der Konkretisierung ist an Stelle irgendeiner Gattungssache die konkrete Sache Schuldgegenstand geworden. Die Gattungsschuld ist zur Speziesschuld geworden. Die Sache ist vom Zeitpunkt der Konkretisierung an die verkaufte. Die Gefahr kann rückwirkend übergehen. Von diesem Augenblick an können Wandlung, Minderung und Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangt werden. Wenngleich die Ansprüche die Konkretisierung und den dadurch herbeigeführten Gefahrübergang voraussetzen, ist es doch regelmäßig so, daß die Konkretisierung dadurch erfolgt, daß der Käufer einen Gewährleistungsanspruch geltend macht. I n der Erhebung des Anspruchs ist immanent die Konkretisierung enthalten. Da der Anspruch die Konkretisierung voraussetzt, geht diese der Anspruchserhebung eine logische Sekunde voraus 1 8 5 . Für den Schadenersatzanspruch des § 480 I I gilt also das gleiche, was auch für Wandlung und Minderimg g i l t 1 8 6 . Das ist auch selbstverständlich, weil es sich um einen Gewährleistungsanspruch handelt. Zwischen dem Schadensersatzanspruch des § 480 I I und dem des § 463 besteht damit systematisch kein Unterschied. Beide Male greift der Anspruch ein, weil die Sache als solche, jedoch m i t Fehlern behaftet, geleistet wurde. bb) Umfang des Anspruchs Anknüpfend an die letzten Ausführungen ist festzustellen, daß bei der Frage nach dem Umfang der Haftung Gattungs- und Spezieskauf nicht getrennt behandelt werden müssen. Da der Schadensersatzanspruch des § 480 I I eine Konkretisierung voraussetzt, m i t der sich die Gattungsschuld i n eine Speziesschuld verwandelt, ist die Sachlage bei Eingreifen des Anspruchs die gleiche wie beim ursprünglichen Spezieskauf, so daß auch der Haftungsumfang gleich sein muß. I n beiden Fällen ist eine konkrete Sache m i t bestimmten Eigenschaften Leistungsgegenstand. I n beiden Fällen greift die Haftung ein, weil die Sache zwar, jedoch i n fehlerhaftem Zustand geleistet wurde. Über den Umfang der Haftung herrscht jedoch weitgehend Streit. 1. Die Rechtsprechung und die h. L. geben dem Käufer die Wahl zwischen großem und kleinem Schadensersatzanspruch 187. Der Käufer 185
186 V
Vgl. dazu V, 2, b, cc.
S. 85. g L Wolff, R G 53, 92; 103, 154ff.; 134, 83, 90; B G H 27, 215, 217; B G H N J W 1959, 620; JZ 1960, 58; N J W 1965, 34; Larenz I I , § 41 I I c 3; Erman / Weitnauer, vor 187
4. I n h a l t u n d Durchführung der einzelnen Sachmängelansprüche
143
kann die fehlerhafte Sache entweder behalten oder zurückgeben. Nach der Wahl richtet sich der Umfang des Anspruchs. Behält er die Sache, so hat er den kleinen Schadensersatzanspruch, gibt er die Sache zurück, dagegen den großen. 2. Ein Teil der Literatur lehnt diese Wahlmöglichkeit ab und gibt dem Käufer regelmäßig nur den kleinen Schadensersatz 188 , billigt den großen hingegen in entsprechender Anwendung des § 325 I 2 dann zu, wenn der Käufer gar kein Interesse an der mangelhaften Sache h a t 1 8 9 . Der Käufer könne nur verlangen, so gestellt zu werden, wie er bei Fehlerlosigkeit der Sache stünde. Er muß deshalb, abgesehen von dem Fall, daß er überhaupt kein Interesse an der fehlerhaften Sache hat, die Sache behalten, wenn er Schadensersatz verlangen will. Für die letztere Ansicht spricht Erhebliches. Die geleistete Sache ist Kaufgegenstand. Ein Fehler macht die Sache nicht zu einem aliud. Die Leistung der Sache kann deshalb niemals vollständige Nichterfüllung sein, sondern nur mangelhafte Erfüllung. Und diese mangelhafte Erfüllung soll der Schadensersatzanspruch ausgleichen. Der Anspruch ist, wie ausgeführt, ein Sachmängelanspruch. Er ist also eine Sanktion für die ungehörige Erfüllung, nicht aber für die vollständige Nichterfüllung. Das Reichsgericht und i h m folgend die h. L. begründen den großen Schadensersatzanspruch damit, daß der Käufer eine mangelhafte Sache als vollständige Nichterfüllung betrachten dürfe 1 9 0 . Dies folge aus der Verwendung des Begriffs „Schadensersatz wegen Nichterfüllung", der innerhalb des BGB immer dann verwendet werde, wenn eine vollständige Nichterfüllung vorliege. Sonst hätte der Gesetzgeber den Ausdruck „Schadensersatz wegen Mangelhaftigkeit der Sache" benützen müssen. Wenngleich diese Argumentation nicht geeignet ist, restlos zu überzeugen, so erscheint sie doch vertretbar. Unverständlich ist aber, wenn m i t dieser Argumentation nicht nur der große Schadensersatz zugelassen wird, sondern daneben wahlweise auch der kleine 1 9 1 . § 459 Rdz 45; Palandt / Putzo, § 463 A n m . 4; Heck, S. 273; Erman, JZ 1960, 43; Enneccerus / Lehmann, § 108 I I I 2; Soergel / Siebert / Ballerstedt, § 463 Bern. 11; Kuhn, i n RGRK, § 463 A n m . 11, 12; Esser, § 64 I I I 3 b. 188 Planck / Knoke, § 463 A n m . 4; Oertmann, § 463 A n m . 5 a; Düringer / Hachenburg / Hoeniger V 1, Einl. Anm. 230 a; Staudinger / Ostler, § 463 Rdz 19; Eccius, Gruch. Beitr. 43, 335, 336; Schollmeyer, S. 98 F N 1; Wolff S. 81 ff., 84, 85; Werner, Recht 1905, 303 ff. 189 Vgl. Staudinger / Ostler, a.a.O.; Planck / Knoke, a.a.O.; Oertmann, a.a.O. 190 Vgl. R G 52, 355. 191 So R G 53, 92.
144
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
Ist die Leistung einer mangelhaften Sache ein Fall der vollständigen Nichterfüllung, so kann der Käufer die Sache niemals behalten, w e i l sie nicht Erfüllungsobjekt ist. Läßt man trotzdem den kleinen Schadensersatz zu, so ist die Begründung des großen Schadensersatzes gerade mit der Interpretation des Begriffs „Schadensersatz wegen Nichterfüllung" nicht mehr beweiskräftig, w e i l dann gerade feststeht, daß der Schadensersatzanspruch auch i m Falle einer mangelhaften Leistung eingreift 1 9 2 . Der Ausgangspunkt des Reichsgerichts, daß eine vollständige Nichterfüllung vorliege und daß der Käufer deshalb den großen Schadensersatzanspruch habe, ist nicht überzeugend. Der Käufer schuldet i n erster Linie die konkrete Sache. W i r d diese Sache geleistet, so kann niemals von einer vollständigen Nichterfüllung die Rede sein. Der Fall, daß der Verkäufer überhaupt nicht leistet, kann nicht gleichgesetzt werden m i t dem Fall, daß der Verkäufer die geschuldete Sache i n fehlerhaftem Zustand leistet. Die Interessenlage ist vollkommen verschieden. Wenn trotzdem i m Ergebnis der h. L. und nicht der Ansicht beigepflichtet wird, die regelmäßig nur den kleinen Schadensersatz zuläßt, so deshalb, w e i l sich das Wahlrecht des Käufers aus der Entstehungsgeschichte der §§ 463, 480 I I ergibt. Der § 385 des I. Entwurfs zum BGB gab dem Käufer den Schadensersatzanspruch neben dem Recht der Wandlung bzw. Minderung 1 9 3 . Dam i t wollte der Gesetzgeber dem Käufer neben den beiden allein dem Vertragsausgleich dienenden Rechten der Wandlung und Minderung i n bestimmten Fällen auch noch einen Ersatzanspruch für die weiteren Schäden geben, die dem Käufer durch die mangelhafte Leistung erwachsen sind. Es sollte dem Käufer nicht nur, wie sonst, der vertragliche Ausgleich gewährt, sondern auch der weitere Schaden ersetzt werden 1 9 4 . Diesen zusätzlichen Ersatzanspruch bezeichnete der Gesetzgeber als Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung. N u n war dieser Begriff schon i n dem Sinne vorgeprägt, daß er nicht nur den Ersatz eines weiteren Schadens umfaßte, sondern das gesamte Erfüllungsinteresse. I m II. E n t w u r f 1 9 5 wurde diese Unstimmigkeit entdeckt. Es gab nun zwei Möglichkeiten. Der Gesetzgeber hätte die Verwendung des Begriffs „Schadensersatz wegen Nichterfüllung" aufgeben können und ihn durch einen anderen Begriff ersetzen können. Diesen Weg ist er 192 193 194 195
So sehr richtig Wolff , S. 80. Vgl. Mot. I I , S. 228, 229. Vgl. Mot. I I , S. 228. Prot. I, S. 686, 687.
4. I n h a l t u n d Durchführung der einzelnen Sachmängelansprüche
145
nicht gegangen. Er hat vielmehr den Begriff beibehalten. Damit der Käufer jedoch nicht zweimal Erfüllung verlangen kann, wurde das Wort „neben" durch „statt" ersetzt 196 . Damit war geklärt, daß der Käufer m i t diesem Anspruch das gesamte positive Interesse erhalten sollte. Der Anspruch galt dem Vertragsausgleich und dem Ersatz des weiteren Schadens. Verdeutlicht man sich, daß nach der I. Fassung des Gesetzes der Käufer neben dem Anspruch auf Ersatz des weiteren Schadens die Wahl haben sollte, entweder die Sache zu behalten und Minderung zu verlangen oder die Sache zurückzugeben gegen Rückzahlung des Kaufpreises (Wandlung), so mußte der Käufer diese Wahlmöglichkeit auch haben, nachdem die Rechte unter dem Begriff „Schadensersatz wegen Nichterfüllung" zusammengezogen worden waren, denn eine Änderung der gesetzgeberischen Absicht war m i t der textlichen Änderung nicht verbunden. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet ist der Schadensersatz wegen Nichterfüllung i m Sinne des § 463 und des § 480 I I ein Anspruch, der sich aus zwei Elementen zusammensetzt, aus Rechten, die allein der Vertragserfüllung dienen entsprechend der Wandlung und Minderung, und aus dem Recht, Ausgleich für den weiteren Schaden zu verlangen 1 9 7 . Daraus folgt, daß der Käufer die Wahl hat, ob er die Sache behalten w i l l oder nicht. Nach der Wahl richtet sich dann der Umfang des Schadensersatzanspruchs. Er ist „groß", wenn die Sache zurückgegeben wird, und „klein", wenn die Sache behalten wird. Die Leistung einer mangelhaften Sache ist keine vollständige Nichterfüllung, sondern ungehörige Erfüllung. Es greifen daher die Sachmängelrechte ein. Der Käufer kann wandeln, mindern oder i n bestimmten Fällen Schadensersatz verlangen. Da der Begriff „Schadensersatz wegen Nichterfüllung" eine Vermengung der ursprünglichen Elemente Wandlung und Minderung m i t dem Anspruch auf Ersatz des weiteren Schadens darstellt, hat der Käufer entsprechend den beiden genannten Elementen die Wahl, die Sache zu behalten oder zurückzugeben. Die Möglichkeit, den großen Schadensersatzanspruch zu erheben, beruht nicht darauf, daß vollständige Nichterfüllung vorliegt, sondern geht darauf zurück, daß der Käufer wegen der mangelhaften Erfüllung das Recht hat, die Sache zurückzugeben und daraus seinen Schaden zu berechnen. Der Käufer kann aber auch die Sache behalten und den kleinen Schadensersatzanspruch geltend machen. Dieses Ergebnis entspricht genau dem i m I. Entwurf zum Ausdruck gelangten Willen des Gesetzgebers. Wer z. B. seinen entgangenen Geΐ9 β vgL 197
P r o t
i9 s
687
I n dieser Richtung auch schon Weitnauer,
10 Herberger
S. 82.
146
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
w i n n ersetzt haben w i l l , den soll nicht m i t dem Anspruch verbunden die Verpflichtung treffen, die Sache zu behalten. Eine solche Koppelung wäre unbillig. Dem Käufer steht einmal ein Ausgleich für die mangelhafte Leistung zu. Er muß dabei das Recht haben, zwischen dem Behalten und der Rückgabe der Sache zu wählen, wie dies auch mit Wandlung und Minderung möglich ist. Zusätzlich aber gebührt dem Käufer der Ersatz des über dieses Ausgleichinteresse hinausgehenden Schadens. Der Ersatz dieses Schadens hat nichts zu tun mit der Frage, wie der Ausgleich i m Hinblick auf die mangelhafte Leistung erfolgt. Dementsprechend hat der Käufer das Recht, Ersatz seines „kleinen" Schadens zu verlangen, wenn er die Sache behält, oder seines „großen" Schadens, wenn er die Sache zurückgibt. Der Umfang des Anspruchs richtet sich jeweils nach der gewählten Möglichkeit. cc) Durchführung
des Anspruchs
I n den Fällen der §§ 463, 480 I I hat der Käufer die Wahl zwischen Wandlung, Minderung und großem bzw. kleinem Schadensersatz wegen Nichterfüllung. A n die Stelle der primären Leistungspflicht t r i t t nach Wahl des Käufers eine sekundäre Leistungspflicht. Es erhebt sich dabei die Frage, auf welche Weise die Umgestaltung der Leistungspflicht erfolgt. Bei Wandlung und Minderung geschieht die Änderung der Leistungspflicht gemäß § 465 mittels Vertrag. A u f den Schadensersatzanspruch n i m m t § 465 keinen Bezug. Aber auch i m Hinblick auf den Schadensersatzanspruch bedarf das Schuldverhältnis einer Umgestaltung. Irgendein Umstand muß bewirken, daß an Stelle der primären Verpflichtung, den Kaufpreis zu bezahlen bzw. die Sache zu übergeben und zu übereignen, bestimmte andere sekundäre Schadensersatzpflichten treten. I n der Regel ist es so, daß die Wahl des Schadensersatzes das Schuldverhältnis umgestaltet 1 9 8 . Vielfach w i r d diese Umgestaltung nicht klar genug erkannt. Das zeigt sich z. B. daran, daß die Wahl des Schadensersatzes nicht für bindend angesehen w i r d 1 9 9 . Begründet w i r d dies damit, daß das Schadensersatzbegehren keine Änderung der Rechtslage herbeiführe 2 0 0 . Diese Behauptung ist unrichtig. T r i t t der Schadensersatzanspruch nicht unmittelbar kraft Gesetzes an die Stelle des primären Anspruchs, so bedarf es noch einer Gestaltung, die die Rechtslage dahingehend verändert, daß nunmehr an Stelle der ursprünglichen 198
So zutreffend Larenz I, § 22 I I a, S. 246 F N 2; E. Wolf, AcP 153, 117 f. R G 107, 348; 109, 186; Planck / Siber, § 325 Anm. 2 b; Enneccerus / Lehmann, § 48 I I I , S. 210 F N 4. 200 v g l die i n A n m . 199 zitierte Literatur. 199
4. I n h a l t u n d Durchführung der einzelnen Sachmängelansprüche
147
Verpflichtung die Verpflichtung zum Schadensersatz besteht 2 0 1 . M i t der Gestaltung geht das ius variandi verloren 2 0 2 . Wie § 465 zeigt, kann die Umgestaltung auch durch Vertrag erfolgen. Es fragt sich daher, ob die Erhebung des Schadensersatzanspruchs aus den §§ 463, 480 I I die Leistungspflicht unmittelbar verändert oder ob dafür ein Vertrag entsprechend § 465 Voraussetzung ist. Praktische Bedeutung hat diese Frage insoweit, als bei Annahme eines Gestaltungsrechts der Käufer mit Erhebung des Anspruchs die Möglichkeit verliert, einen anderen Rechtsbehelf (Wandlung oder Minderung) zu wählen. Geht man jedoch davon aus, daß die Umgestaltung i n entsprechender Anwendung des § 465 durch Vertrag erfolgt, so verliert der Käufer sein Wahlrecht erst m i t der Einverständniserklärung des Verkäufers 2 0 3 . Berücksichtigt man, daß der Schadensersatzanspruch innerhalb des Gewährleistungsrechtes ein Mischtatbestand ist, der die Elemente Wandlung und Minderung tatbestandlich m i t einschließt und dem Käufer ein dementsprechendes Wahlrecht einräumt, so rechtfertigt sich hier die entsprechende Anwendung des § 465 204 . Die gleichen Überlegungen, die den Gesetzgeber veranlaßten für Wandlung und Minderung einen Vertrag zu fordern, gelten auch hier. Wenn der Käufer vor der Wahl steht, die Sache zu behalten oder zurückzugeben, so hängt seine Entscheidung weitgehend davon ab, i n welchem Umfang die Fehlerhaftigkeit der Sache finanziell ausgeglichen w i r d und werden kann. Es ist daher bei dieser Sachlage nicht sinnvoll, eine Gestaltung des Vertrages durch einseitige Erklärung zu normieren. Es ist z. B. denkbar, daß der Käufer die Sache behalten w i l l , wenn er vom Verkäufer, abgesehen vom Ersatz des weiteren Schadens, einen Ausgleich i n Höhe von D M 100 bekommt, daß er die Sache jedoch nicht behalten w i l l , wenn der Ausgleich geringer ist. I n diesen Fällen ist ein Aushandeln des Ausgleichs sinnvoller als eine einseitige Gestaltung. Daß letztlich der Umfang des Ausgleichs von objektiven, durch das 201 Bei einem gesetzlichen Schuldverhältnis, etwa aus unerlaubter H a n d lung, taucht dieses Problem nicht auf, w e i l dort eine primäre Leistungspflicht fehlt. Die Frage nach dem Fortbestand bzw. der Umgestaltung der vertraglichen Pflichten stellt sich hier nicht. M i t der Verletzung des fremden Rechtsgutes entsteht der Schadenersatzanspruch des Verletzten originär. 202 So auch Larenz I, S. 246 F N 2; Wolf, AcP 153, 117 f.; Kreß, § 26 I I A d. 203 Palandt / Putzo, § 463 A n m . 1 u n d Kuhn, i n RGRK, § 463 A n m . 10 führen aus, der Käufer könne von der getroffenen W a h l abgehen, solange der Schadensersatzanspruch noch nicht v e r w i r k l i c h t d. h. v o m Verkäufer anerkannt sei. Diese Behauptung f ü h r t bereits i n die von uns vertretene Richtung. Wie hier schon Kreß, § 26 I I A d. 204 Ebenso Kreß, dort F N 89 u n d § 14 Nr. 2 A f, dort F N 30. Dementsprechend hat der Käufer bis zur E r k l ä r u n g des Einverständnisses durch den Verkäufer das ius variandi, danach hingegen nicht mehr (ebenso Kreß, § 26 I I A d u n d dort F N 89; vgl. i m übrigen dazu oben V, 4, a).
10·
148
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
Gesetz aufgestellten Kriterien abhängt, vermag an dieser Betrachtungsweise nichts zu ändern. Die Frage nach den objektiven Kriterien w i r d erst dann akut, wenn die Parteien sich nicht friedlich einigen, sondern eine Entscheidung des Gerichts begehren. I m Wege der Einigung sind zwar auch die objektiven Ausgleichsgesichtspunkte zu berücksichtigen, doch steht es den Parteien frei, nach ihrem Gutdünken den Ausgleich festzulegen. Deshalb ist der i n § 465 zum Ausdruck gelangte Gesichtspunkt, daß die Parteien die vertraglichen Pflichten nur durch Vereinbarung umgestalten können, durchaus sinnvoll, und zwar auch für den Bereich des Schadensersatzanspruchs, bei dem der Käufer vor der Wahl steht, ob er die Sache behält oder zurückgibt. Eine Bestätigung erhält diese Ansicht aus § 479. Nach § 479 kann der Schadenersatzanspruch auch nach Vollendung der Verjährung aufgerechnet werden, wenn der Käufer vorher eine der i n § 478 bezeichneten Handlungen vorgenommen hat. Gedanklich setzt damit § 479 offenbar voraus, daß vor Ablauf der Verjährungsfrist bereits ein konkreter Leistungsanspruch bestand, daß also das Schuldverhältnis inhaltlich bereits umgestaltet war. I n diesem Falle aber würde sich die Möglichkeit, aufzurechnen, schon aus § 390 Satz 2 ergeben. Die Aufgabe des § 479 bestünde dann nur darin, die Aufrechnungsmöglichkeit davon abhängig zu machen, daß der Käufer innerhalb der Verjährungsfrist eine der i n § 478 bezeichneten Handlungen vorgenommen hat. Eine solche Auslegung des § 479 würde jedoch der Bedeutung der Norm nicht gerecht werden. I n Wirklichkeit stellt sich § 479 nämlich als Normierung einer Einrede dar, die sich gegen eine zwar bestehende 205 , aber m i t Rücksicht auf den Mangel unberechtigte Kaufpreisforderung richtet. § 479 dient dem gleichen Ziel wie § 478. Dem Käufer soll ein Leistungsverweigerungsrecht gegeben werden gegen eine bestehende, aber unberechtigte Forderung, deren inhaltliche Änderung infolge Verjährung des Gewährleistungsanspruchs nicht mehr erzwungen werden kann. N u r so w i r d verständlich, warum entgegen § 390 Satz 2 eine Aufrechnung mit anderen Ansprüchen, die dem Schadenersatzanspruch vor Verjährung gegenüberstanden, ausgeschlossen ist, vielmehr nur eine Aufrechnung m i t der Kaufpreisforderung möglich ist 2 0 6 , und warum § 479 tatbestandlich an § 478 anknüpft. Das Argument, § 479 weiche von § 390 Satz 2 ab, weil der Nachweis eines Fehlers bei Gefahrübergang nach der Frist des § 477 schwierig 205
Eine Umgestaltung der vertraglichen Pflichten erfolgt nach unserer Ansicht erst m i t dem Einverständnis des Verkäufers, das jedoch i n Fällen, die nach § 478, 479 zu beurteilen sind, noch nicht vorliegt. 206 R G 56, 171; B G H N J W 61, 1254; B G H L M Nr. 3 zu § 479; SchlHOLG SchlHA 1957, 178 ff.; Palandt / Putzo, § 479 A n m . 2; Soergel / Siebert / Ballerstedt, § 479 Bern. 1 ; Staudinger / Ostler, § 479 Rdz 4.
4. I n h a l t u n d Durchführung der einzelnen Sachmängelansprüche
149
sei 2 0 7 , überzeugt nicht. Der Nachweis des Fehlers ist i n gleicher Weise schwierig, gleichgültig, ob nun m i t der Kaufpreisforderung oder m i t einer anderen Forderung aufgerechnet wird. Die Schwierigkeit des Fehlernachweises ist vollkommen unabhängig davon, m i t welcher Forderung aufgerechnet w i r d 2 0 8 . Daß der Käufer nur m i t der Kaufpreisforderung aufrechnen darf, w i r d allein verständlich, wenn man § 479 der Sache nach als Einredetatbestand 209 entsprechend § 478 und nicht als Aufrechnungstatbestand anerkennt. Teilt der Verkäufer dem Käufer die Fehlerhaftigkeit der Sache mit und verlangt er Schadensersatz wegen Nichterfüllung, so wandelt sich das Schuldverhältnis damit noch nicht um. Es bestehen nach wie vor die ursprünglichen vertraglichen Pflichten. Der Käufer hat jedoch einen Anspruch auf Abänderung und einen von der Abänderung abhängigen Schadensersatzanspruch. Dieser Unterschied w i r d normalerweise dahingehend formuliert, daß der Käufer einen Anspruch auf Wandlung bzw. Minderung und nach Vollzug einen Anspruch aus Wandlung oder Minderung habe 2 1 0 . Diese Unterscheidung gilt aber auch für den Schadensersatzanspruch. Der Käufer hat einen Anspruch darauf, daß der Verkäufer i n die m i t dem Schadensersatzanspruch (großen oder kleinen) verlangte Änderung der vertraglichen Pflichten einwilligt, und er hat daraus resultierend den Schadensersatzanspruch. Verlangt der Käufer gemäß § 463 bzw. § 480 I I Schadensersatz, so werden die beiden Ansprüche wie bei Wandlung und Minderung i n einem erhoben. Trotzdem sind sie dogmatisch zu trennen. Hat nun der Verkäufer vor Ablauf der Verjährung sein Einverständnis nicht erklärt, so ist es nicht zu einer Umgestaltung der vertraglichen Pflichten gekommen. Der Käufer schuldet nach wie vor den vollen 207
So Staudinger / Ostler, § 479 Rdz 1. Konsequent läßt Larenz I I , § 41 I I d daher die Aufrechnung auch m i t anderen Ansprüchen zu. Wenn man jedoch § 479 als Einrede erkennt, ist f ü r diese, der Absicht des Gesetzgebers widersprechende Ansicht (vgl. R G 56, 171) kein Raum mehr. 209 Vgl. SchlHOLG, SchlHA 1957, 178 ff. So auch der A n t r a g 6 zu dem den §§ 478, 479 vorausgehenden § 397 des I. Entwurfs (vgl. Prot I, S. 674). Danach sollte der Käufer auch hinsichtlich des Schadensersatzanspruchs nach der V e r j ä h r u n g eine Einrede gegen die Kaufpreisforderung des V e r käufers haben. Dieser A n t r a g wurde von der Kommission eingehend beraten (vgl. Prot. I, S. 681) u n d in dieser Form angenommen (vgl. Prot. I, S. 705). Die Kommission lehnte dabei den damals schon erhobenen Einwand, es handele sich hinsichtlich des Schadensersatzspruchs u m eine Aufrechnung, ab. Später setzte sich dann doch die Gegenmeinung durch. Nach unserer Ansicht traf jedoch die ursprüngliche Ansicht der zweiten Kommission zu. Die Annahme einer Aufrechnung ist eine dogmatische Verfälschung. § 479 gibt, w i e die Kommission i n Prot. I, S. 681, 705 zu dem entsprechenden § 397 ausführt, eine Einrede. Die ursprünglich richtige Qualifizierung wurde i m Zuge der Beratungen verwischt. 210 V g l B G H NJW 1958, 418; Larenz I I , § 41 I I d. 208
150
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
Kaufpreis. Hat er jedoch vor der Verjährung den Fehler angezeigt, so hat er gegen die Kaufpreisforderung des Verkäufers die Einreden gemäß §§ 478, 479. Damit w i r d verständlich, warum das Recht aus § 479 nur gegenüber der Kaufpreisforderung w i r k t . Gleichzeitig bestätigt aber diese Regelung des § 479, daß § 465 auch für den Schadensersatzanspruch gilt, daß also nicht schon die Erhebung des Anspruchs das Vertragsverhältnis umgestaltet, sondern daß dafür die Einwilligung des Verkäufers erforderlich ist. Für die Verjährungsfrage gilt daher die gleiche Differenzierung wie bei Wandlung oder Minderung. Hat der Verkäufer sein Einverständnis erklärt, so unterliegt der damit entstandene Anspruch nicht mehr der kurzen Verjährung des § 477 211 . Nur der Anspruch auf das Einverständnis verjährt gemäß § 477, denn nur u m diesen Anspruch geht es, wenn § 477 von der Verjährung des A n spruchs auf Schadensersatz spricht. Haben die Parteien sich einmal geeinigt über die Durchführung des Schadensersatzes, so besteht für die kurze Verjährung keine Veranlassung mehr.
5. Beweislastfragen Wenn der Verkäufer eine fehlerhafte Sache leistet, so fragt es sich, wer den Beweis der Fehlerhaftigkeit i m Einzelfall erbringen muß. Die Frage der Beweislast hat einmal Bedeutung bei der Kaufpreisklage des Verkäufers, zum anderen bei der Gewährleistungsklage des Käufers. a) Macht der Käufer i m Klagewege Sachmängelrechte geltend, so bildet die Fehlerhaftigkeit der Kaufsache den Anspruchsgrund. Die Beweislast t r i f f t i n diesem F a l l immer den Käufer 2 1 2 . b) Erhebt der Verkäufer die Kaufpreisklage, so kann der Käufer sich m i t einer Mängeleinrede zur Wehr setzen. I n diesem Falle ist es umstritten, wer die Beweislast für die Eigenschaften der Kaufsache zu tragen hat, ob der Käufer die Fehlerhaftigkeit oder der Verkäufer die Fehlerlosigkeit der Sache zu beweisen hat. Die Beantwortung der Frage hängt davon ab, ob die Leistungspflicht des Verkäufers sich auf die Eigenschaften der Sache erstreckt. Die h. L., die nur beim Gattungskauf eine derartige Leistungspflicht bejaht, beim Spezieskauf hingegen ablehnt, weil sie dort eine Eigenschaftsvereinbarung nicht für möglich h ä l t 2 1 3 , kommt konsequent zu dem Ergebnis, 211
I n diesem Sinne auch B G H N J W 1958, 418. Unstrittig, vgl. RG 66, 285; 95, 119; B G H L M Nr. 1 zu § 377 H G B ; Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 30; Soergel / Siebert / Ballerstedt, § 459 Bern. 44; Enneccerus / Lehmann, § 63 I ; Graue, S. 216; Oertmann, Recht 1908, 348. 218 Vgl. oben I I , 4. 212
5. Beweislastfragen
151
daß beim Gattungskauf der Verkäufer die Fehlerlosigkeit der Sache 214 , beim Spezieskauf der Käufer die Fehlerhaftigkeit beweisen müsse 215 . Auch hier zeigt sich, daß die h. L. nicht überzeugen kann, denn ein einleuchtender Grund für die unterschiedliche Beweislastverteilung bei Spezies- und Gattungskauf ist nicht zu ersehen. Auch sonst kann das Ergebnis nicht befriedigen. Wie soll der Käufer bei einem Versendungskauf den Beweis erbringen, daß die Sache bereits bei Übergabe an den Transporteur fehlerhaft war und nicht erst auf dem Transport fehlerhaft wurde 2 1 6 ? Nach h. L. würde den Käufer hierfür die Beweislast treffen. Der Verkäufer ist sowohl beim Spezies- wie beim Gattungskauf zur Leistung einer mangelfreien Sache verpflichtet. Er hat deshalb i n beiden Fällen zu beweisen, daß er die Sache i n fehlerfreiem Zustand geleistet hat, wenn der Käufer dies bestreitet 2 1 7 . Eine Umkehr der Beweislast findet gemäß § 363 erst durch Annahme der Sache als Erfüllung statt. § 363 spricht zwar nur von einer aliudbzw. unvollständigen Leistung, doch ist die Norm auf den F a l l der fehlerhaften Leistung entsprechend anzuwenden 218 . Eine entsprechende Anwendung des § 363 kommt nicht i n Betracht, wenn man eine Verpflichtung zu mangelfreier Leistung leugnet. § 363 ordnet die Beweislastumkehr an, wenn der Gläubiger die nicht der Verpflichtung entsprechende Leistung als Erfüllung angenommen h a t 2 1 9 . Besteht keine Verpflichtung zu fehlerfreier Leistung, so liegen die 214 Soergel / Siebert / Ballerstedt, § 459 Bern. 43; Enneccerus / Lehmann, § 63 I ; Korintenberg, Erfüllung, S. 14; Oertmann, Recht 1908, 351. 215 Soergel / Siebert / Ballerstedt, § 459 Bern. 42; Leonhard, Beweislast, 2. Aufl., S. 365 ff.; Oertmann, Recht 1908, S. 347. 216 A u f diese Folge weist auch Oertmann, Recht 1908, 349 hin. E r weicht deshalb der bedenklichen Konsequenz dadurch aus, daß er § 282 entsprechend anwendet. Die Mangelhaftigkeit sei ein F a l l der Unmöglichkeit. Diese Behauptung stimmt jedoch nicht (vgl. unten V I , 3), so daß auch § 282 nicht helfen kann. 217 So auch R G 47, 124; 57, 399; 66, 279, 282; 109, 296; B G H 6, 225; Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 459 A n m . 2; Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 30; Graue, S. 215; Endemann I, § 161 A n m . 31. 218 So schon das Reichsgericht, vgl. RG 57, 400; 66, 279, 282; 109, 296; Soergel I Siebert ! Ballerstedt, § 459 Bern. 42; Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 30; Graue, S. 216. Wenn Korintenberg, Erfüllung, S. 134 die Begriffe unvollständig u n d mangelhaft gleichsetzt u n d demnach § 363 f ü r unmittelbar anwendbar hält, so k a n n das nicht gebilligt werden. 219 Darauf weist auch Graue, S. 214 hin. Insoweit inkonsequent Korintenberg, Erfüllung, S. 134, der § 363 anwenden w i l l , obwohl er eine Verpflichtung zu mangelfreier Leistung beim Spezieskauf verneint. Daß das Reichsgericht § 363 anwendet, zeigt, daß es von einer Verpflichtung zu mangelfreier L e i stung ausgeht, vgl. I I I A n m . 67.
152
V. Aufgabe u n d F u n k t i o n der Gewährleistung
V o r a u s s e t z u n g e n des § 363 n i c h t v o r 2 2 0 . E i n e B e w e i s l a s t u m k e h r
wäre
auch ü b e r f l ü s s i g , w e i l i n d i e s e m F a l l e d e n K ä u f e r sowieso d i e B e w e i s l a s t t r i f f t , sofern n u r d i e Sache als solche geleistet w u r d e .
220 Wesentlich klarer brachte das § 367 S. 1 des I. Entwurfs zum Ausdruck: „ H a t ein Vertragschließender die i h m als E r f ü l l u n g angebotene Leistung als E r f ü l l u n g angenommen, so k a n n er aufgrund der Mangelhaftigkeit der Leistung nicht wegen Nichterfüllung des Vertrages die Gegenleistung v e r weigern, sondern n u r die i h n sonst zustehenden Ansprüche geltend machen." Dieser Passus w u r d e später gestrichen, w e i l eine Entscheidung über die materielle Rechtslage an dieser Stelle nicht tunlich erschien (vgl. Prot. I, S. 637).
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen 1. Grundsätzliche Überlegungen I n der Frage, wie das Verhältnis der Sachmängelnormen zu den allgemeinen Normen, insbesondere zu den §§ 320, 323 ff., 326 und 119 I I zu beurteilen ist, herrscht i n der Literatur und der Rechtsprechung große Uneinigkeit. Einigkeit besteht weitgehend nur darin, daß eine Anwendung der allgemeinen Vorschriften nach Gefahrübergang nicht i n Betracht kommt, soweit dadurch der Anwendungsbereich der Sachmängelhaftung berührt wird. Als Begründung w i r d angeführt, daß die Gewährleistung die allgemeinen Bestimmungen verdränge. Vor Gefahrübergang wendet die Rechtsprechung 1 und der überwiegende Teil der Literatur 2 dagegen die allgemeinen Normen an 3 . Diese Differenzierung beruht auf der Hypothese, daß die Sachmängelansprüche erst mit dem Gefahrübergang zur Entstehung gelangen 4 . Vor Gefahrübergang bestehe noch kein Gewährleistungsanspruch, der die allgemeinen Normen verdrängen könne. Diese Ausgangsüberlegung ist jedoch unzutreffend 5 . Die Ansicht ist deshalb wenig überzeugend 6 . Die Sachmängelansprüche entstehen nicht 1 Vgl. R G 53, 73; 61, 171; 66, 333; 138, 356; Gruch. Beitr. 53, 935 und 940 f.; B G H 34, 34; O L G K ö l n M D R 1958, 160. 2 Vgl. Palandt / Putzo, bis zur 30. Aufl., vor § 459 A n m . 2, 2 a; Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 459 Anm. 3 B I b und A n m . 7; Kuhn, i n R G R K , § 459 Anm. 4, 31 ff.; Staudinger / Ostler, § 459 Rdz 9 ff.; Planck / Flad, § 119 A n m . I V 6 c; Schubert, S. 63, 87; Graue, S. 274, 277, 290. 3 Selbst wenn ausnahmsweise die Gewährleistungsnormen schon vor Gefahrübergang (vgl. unten i m Text) zur Anwendung kommen (so B G H 34, 37; Palandt / Putzo, bis zur 30. Aufl., vor § 459 A n m . 2; Erman / Böhle-Stamschräder, 3. Aufl., § 459 A n m . 5). Α. A. Staudinger / Ostler, v o r § 459 Rdz 16 a u n d 9 a. E. sowie Flume, S. 37 ff., 134, der jedoch i m Unterschied zu Ostler § 119 I I immer, also sowohl vor w i e nach Gefahrübergang, für unanwendbar hält. 4 Vgl. R G 53, 73; Gruch. Beitr. 53, 904 f. und 940 f.; B G H 34, 34; O L G K ö l n M D R 1958, 160; Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 459 A n m . 2; Kuhn, i n RGRK, § 459 A n m . 4, 31 ff.; Enneccerus / Lehmann, § 112 I ; Krüger-Nieland, in RGRK, § 119 A n m . 28. 5 So schon Schollmeyer, S. 95; Eccius, S. 315; Schöller, S. 15; Oertmann, Recht 1909, 623. 6 Vgl. Larenz I I , § 41 I c u n d I I e; Flume, S. 132 ff. M i t vollem Recht f ü h r t Flume, S. 38 aus, eine triftige Begründung, weshalb dem Käufer vor Gefahrübergang die Rechte der §§ 320 ff. zuständen, danach aber nicht mehr, sei bisher nicht angeführt worden u n d könne auch nicht angeführt werden. So n u n auch Palandt / Putzo, ab 31. Aufl., vor § 459 A n m . 2.
154
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen
erst m i t Gefahrübergang. Der Entstehungsgrund der Ansprüche ist der Vertrag. Der Verkäufer ist verpflichtet, eine mangelfreie Sache zu liefern. Erfüllt er diese Verpflichtung nicht, so greift die Sachmängelhaftung als Ausgleichsregelung ein. Die aus der Gewährleistungsregelung resultierenden Ansprüche sind sekundäre Ansprüche, die aus den ursprünglichen vertraglichen Verpflichtungen hervorgegangen sind. Der Käufer hat die Ansprüche nicht deshalb, w e i l die Gefahr übergegangen ist, sondern weil die vertragliche Pflicht nicht gehörig erfüllt wurde. Der Gefahrübergang ist daher nicht Entstehungsgrund, w o h l aber regelmäßig Voraussetzung für das Eingreifen der Sachmängelhaftung 7 . Da die Sachmängelansprüche die mangelhafte Erfüllung ausgleichen sollen, muß ein Erfüllungsversuch m i t der geschuldeten Sache stattgefunden haben. Erst dann ist ein Ausgleich für mangelhafte Erfüllung sinnvoll. Das Gesetz bestimmt diesen Zeitpunkt m i t dem Gefahrübergang. Der Gefahrübergang ist der Zeitpunkt der Abrechnung. Steht der Verkäufer i m Soll, so hat er auf dem Wege der Gewährleistung den Ausgleich zu schaffen, w e i l er nicht ordnungsgemäß erfüllt hat. Die Sachmängelansprüche haben als sekundäre Ausgleichsansprüche ihren Entstehungsgrund i m Vertrag, sie kommen jedoch nicht zur A n wendung, wenn der Verkäufer seiner Leistungspflicht v o l l nachkommt. Maßgeblicher Zeitpunkt hierfür ist der Gefahrübergang. Der Gefahrübergang bringt also die Gewährleistungsrechte nicht erst zum Entstehen 8 . Sie bestehen vielmehr latent vom Vertragsschluß an und greifen ein, wenn i m Zeitpunkt der Abrechnung eine nicht gehörige Erfüllung vorliegt. Ein Abstellen auf diesen Zeitpunkt ist i n den Fällen überflüssig, bei denen schon vor Gefahrübergang feststeht, daß notwendigerweise eine ungehörige Erfüllung erfolgen wird. Hier können die Sachmängelansprüche auch schon vor Gefahrübergang erhoben werden. Der Gefahrübergang ist überflüssig, weil feststeht, daß die Leistung fehlerhaft erbracht werden w i r d 9 . Dies gilt insbesondere, wenn die geschuldete 7 Nicht zu Unrecht w i r d der Gefahrübergang als Rechtsbedingung bezeichnet. Die Nichtbeseitigung des Fehlers bis zum Gefahrübergang sei die Bedingung für das Eingreifen der Ansprüche, die bereits tatbestandsmäßig m i t dem Vorliegen eines Fehlers gegeben seien (vgl. Soergel / Siebert / Ballerstedt, vor § 459 Bern. 19; Süß, S. 234; Busbach, S. 2, 18 ff.). I n ähnlicher Weise spricht Larenz I I , § 41 I c davon, daß die Geltendmachung der m i t dem Fehler entstandenen Sachmängelrechte bis zum Gefahrübergang hinausgeschoben sei. 8 Ebenso Schollmeyer, S. 95, 96; Molitor, Ih. Jb. 85, 305; Flume, S. 134, 38 F N 13; Enneccerus / Lehmann, § 108 I I 1 a; Oertmann, § 459 A n m . 3 m. w. N.; Soergel/ Siebertl Ballerstedt, vor § 459 Bern. 19; Palandt / Putzo, § 459 A n m . 1; Larenz I I , § 41 I c; Süß,, J W 1937, 870; Busbach, S. 18 ff.; Raape, S. 486. 0 Vgl. Eccius, S. 315.
2. Verzug u n d Einrede des nicht erfüllten Vertrages (§§ 320, 326)
155
Speziessache einen unheilbaren Fehler aufweist 1 0 , aber auch dann, wenn der Käufer sich endgültig weigert, den vorhandenen Fehler zu beseitigen 11 . Ein Gefahrübergang ist auch dann entbehrlich, wenn der Käufer die i h m angebotene Sache i n Anbetracht der Fehlerhaftigkeit zurückweist mit dem Bemerken, er verlange wegen des Fehlers Wandlung. Die Entgegennahme der Sache zum Zwecke des Gefahrübergangs wäre hier sinnloser Formalismus 12 . Wenn nun die Sachmängelrechte bereits vor Gefahrübergang bestehen und i n einzelnen Fällen vor Gefahrübergang zur Anwendung kommen, so entfällt damit die Möglichkeit, das Verhältnis der Sachmängelvorschriften zu den allgemeinen Normen vor Gefahrübergang anders zu beurteilen als nach Gefahrübergang. Für die Frage der Konkurrenz bedeutet das, daß die jeweiligen allgemeinen Normen entweder immer neben den Sachmängelrechten gelten oder nie. Dies gilt es i m folgenden zu untersuchen. 2. Verzug und Einrede des nicht erfüllten Vertrages (§§ 320, 326) Der Verkäufer ist verpflichtet, eine mangelfreie Sache zu leisten. Bietet er eine fehlerhafte Sache an, so fragt es sich, ob der Käufer die Sache annehmen muß und auf die Gewährleistungsrechte beschränkt ist 1 3 oder ob er unter Zurückweisung der Sache den Verkäufer i n Verzug setzen kann und gegenüber der Kaufpreisklage die Einrede des nichterfüllten Vertrages erheben kann. Überwiegend w i r d die letztere Ansicht vertreten 1 4 . Dies ist jedoch dann inkonsequent, wenn man die 10
Vgl. Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 19; Raape, S. 486; Erman, JZ 1960, 42; Palandt / Putzo, § 459 A n m . 1; Staudinger / Ostler, § 459 Rdz 6; Süß, S. 235; Kuhn, i n R G R K , § 459 Anm. 12; Molitor, Ih. Jb. 85, 305; Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 459 Anm. 3 Β I b; Graue, S. 213; RG WarnRtspr. 1911, 358 deutete diese Möglichkeit an, RG J W 1911, 539 stellte die Frage noch dahin, endgültig so dann aber RG JW 1912, 461; R G 87, 260; B G H 34, 35. 11 Vgl. Erman, a.a.O.; Staudinger / Ostler, a.a.O.; Palandt / Putzo, a.a.O.; Kuhn, i n RGRK, a.a.O.; Lobe, i n RGRK, 9. Aufl., a.a.O.; Graue, S. 213; B G H 34, 35; R G JW 1912, 461; O L G Hamburg H E Z 1, 271. 12 Ebenso Süß, J W 1937, 870; Flume, S. 38 F N 15; Korintenberg, Erfüllung, S. 178, 179; Eccius, S. 315; Düringer / Hachenburg / Hoeniger V 1, Einl. A n m . 178; Planck / Knoke, § 462 A n m . 1; vgl. auch B G H 34, 35. 13 v g l . Flume, S. 36 ff., 132; Schollmeyer, S. 97; Schniewind, S. 55; Süß, S. 25, 238; Korintenberg, Erfüllung, S. 178. A l l e gehen jedoch davon aus, daß der Verkäufer nicht zur Leistung einer fehlerfreien Spezies verpflichtet ist. 14 Vgl. R G 53, 73; 66, 2811; Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 17; Staub! Könige, 9. Aufl., A n h a n g zu § 374 A n m . 42; Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 433 A n m . V I I I A a u n d § 459 Anm. 3 Β I b; Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 33; Staudinger / Ostler, vor § 459, Rdz 9 u n d § 433 Rdz 100 a, 144; Raape, S. 484; Fabricius, JZ 1967, 464, 472; Emerich, S. 68 f.; Schubert, S. 87; Palandt/ Putzo, vor § 459 A n m . 2; Graue, S. 212 f., 277, 289, 308; Adler, Z H R 71, 481, Z H R 75, 457. A d l e r zieht als Begründung § 367 S. 1 des I. Entwurfs heran, (vgl. dazu V Anm. 220). Niemand habe daran gezweifelt, daß der Gläubiger
156
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen
Ansicht vertritt, der Verkäufer sei nicht zur Leistung einer fehlerfreien Sache verpflichtet 1 5 . Denn wenn der Verkäufer das leistet, wozu er verpflichtet ist, dann kann eine Zurückweisung und ein Leistungsverzug niemals i n Betracht kommen 1 6 . Bei Annahme einer Pflicht zu fehlerfreier Leistung wäre dagegen eine Zurückweisung und damit Verzug des Verkäufers denkbar. Wie sich aber zeigen wird, sind die §§ 320 ff. bei Sachmängeln nicht anwendbar 17 . a) Der Verkäufer ist beim Spezieskauf zur Leistung der konkreten Sache mit bestimmten Eigenschaften verpflichtet. Wesentlicher Teil der Verpflichtung ist die Leistung der schuldidentischen Sache. Darin besteht gerade der entscheidende Unterschied zum Gattungskauf, bei dem zunächst keine bestimmte Sache geschuldet ist. Bietet der Verkäufer die konkrete Sache an, so bietet er an, was geschuldet ist, nämlich diese Sache. Nun schuldet der Verkäufer nicht nur die Sache, sondern die Sache m i t den vereinbarten Eigenschaften. Das Fehlen der Eigenschaften macht die Sache jedoch zu keiner anderen. Der Käufer kann daher die Sache, obwohl sie die vereinbarten Eigenschaften nicht hat, nicht zurückweisen. Dies wäre nur zulässig, wenn die Sache eine andere wäre. Ist die Sache die schuldidentische, so muß der Käufer sie abnehmen, wenn er nicht in Annahmeverzug geraten w i l l . Die Aufgabe der Sachmängelhaftung besteht gerade darin, einen Ausgleich für den Fall zu geben, daß zwar die Sache als solche, jedoch ohne die vereinbarten Eigenschaften geleistet wurde. Daß hierfür besondere Vorschriften bestehen, zeigt, daß ein Unterschied zu machen ist zwischen dem Fall, daß überhaupt nichts geleistet wird, und dem Fall, daß die Sache, jedoch fehlerhaft, geleistet wird. vor Annahme als Erfüllung eine fehlerhafte Sache zurückweisen dürfe u n d die Einrede des nichterfüllten Vertrages erheben könne. Die Streichung dieses Satzes sei n u r aus technischen Gründen erfolgt. Dem k a n n nicht gefolgt werden. Der Gesetzgeber hat die Stelle gestrichen, u m nicht der Regelung des materiellen Rechtes vorwegzugreifen. § 367 S. 1 ist also als Argument für ein Zurückweisungs- u n d Leistungsverweigerungsrecht nicht verwendbar. Nach Gefahrübergang w i r d die Einrede des nichterfüllten Vertrages regelmäßig nicht mehr gewährt (vgl. Erman / Weitnauer, a.a.O. ; Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 33; Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 459 A n m . 3 Β I ; Soergel / Siebert / Ballerstedt, vor § 459 Bern. 31; Staudinger / Ostler, v o r § 459 Rdz 11; R G 66, 333). A.A. Soergel / Siebert / Schmidt, § 320 Bern. 7 u n d Palandt / Putzo, bis zur 30. Aufl., vor § 459 A n m . 2 a: Die Einrede sei bis zur Erfüllungsannahme möglich. Anders als die h. L. w o h l auch R G 66, 280. 15 So etwa Dernburg I I 2, § 185 I ; Raape, S. 484; Soergel / Siebert / Ballerstedt, vor § 459 Bern. 31. A u f diese Inkonsequenz weisen schon Graue, S. 209 ff., 213 u n d Flume, S. 38 F N 12 hin. 10 Vgl. Korintenberg, Erfüllung, S. 178. 17 Die Annahme einer Verpflichtung zu fehlerfreier Leistung hat nicht notwendigerweise zur Folge, daß die §§ 320 ff. zur A n w e n d u n g kommen müssen, wie Flume, S. 37 f. unterstellt. Vgl. dazu Anm. 21.
2. Verzug und Einrede des nicht erfüllten Vertrages (§§ 320, 326)
157
Die Sachmängelnormen wären sinnlos, wenn der Käufer die A n nahme einer fehlerhaften Sache verweigern könnte, denn damit wäre immer der Weg für einen Schadensersatzanspruch gemäß § 326 frei 1 8 , eine Folge, die eindeutig i n Widerspruch steht zu der i n § 463 zum Ausdruck gekommenen gesetzgeberischen Absicht, daß der Verkäufer nur bei Arglist, nicht schon bei einfachem Verschulden zum Schadensersatz verpflichtet sein soll 1 9 . Bei unbehebbaren Mängeln würde die Zurückweisung der fehlerhaften Sache niemals zum Verzug des Verkäufers führen. Verzug kann nur vorliegen, wenn eine mögliche Leistung nicht rechtzeitig erbracht wird. Ist die Leistung, hier einer fehlerfreien Sache, nicht möglich, so scheidet Leistungsverzug aus 20 . Welchen Sinn aber könnte eine Zurückweisung haben, wenn damit der Schuldner nicht i n Verzug käme. Der Käufer könnte nur bei behebbaren Mängeln den Verkäufer i n Verzug setzen. Die Folge wäre eine unterschiedliche Regelung, je nachdem, ob der Fehler behebbar ist oder nicht. Für eine solche unterschiedliche Behandlung von behebbaren und unbehebbaren Fehlern ist aber kein Raum, da das Gesetz bewußt diesen Unterschied nicht macht. Dies zeigt, daß die Vorschriften über den Verzug bei Leistung einer fehlerhaften, schuldidentischen Sache nicht passen 21 , und zwar einfach deshalb, weil der Gesetzgeber den Fall der fehlerhaften Leistung nicht unter die allgemeinen Normen gezogen hat, sondern besonders normiert hat: m i t der Gewährleistung. 18 Diese Konsequenz ziehen Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 459 A n m . 7 a, Adler, ZHR 75, 458 und Erman, JZ 60, 42 f. Erman beschränkt sich auf den Fall, daß eine Sache m i t einem behebbaren Fehler geleistet w i r d . Z u Recht weist Flume, S. 37 darauf hin, daß die Frage, w a n n der Verkäufer einen Verzug zu vertreten habe (vgl. § 285), überhaupt nicht zu entscheiden wäre. 19 Vgl. Wolff, S. 9; Oertmann, Recht 1908, 347 u n d Recht 1909, 621; Staudinger / Ostler, § 433 Rdz 100 a. 20 Vgl. R G 97, 9; Soergel ! Siebert ! Schmidt, § 284 Bern. 1; Nastelski, i n RGRK, § 284 A n m . 3; Larenz I, § 23; Palandt / Heinrichs, § 284 A n m . l a ; Schubiger, S. 23; Busbach, S. 49; vgl. auch Schöller, S. 15 F N 16. 21 So richtig Schubiger, S. 23, 32; ebenso Flume, S. 36 ff., Schollmeyer, S. 97, Düringer / Hachenburg / Hoeniger V 1, Einl. A n m . 115, die jedoch davon ausgehen, daß eine Verpflichtung zu fehlerfreier Leistung beim Spezieskauf nicht besteht. Wenn Flume, S. 37, 38 (ebenso Oertmann, Recht 1908, 347) meint, die §§ 320 ff. müßten zur Anwendung kommen, wenn man eine V e r pflichtung zur Leistung einer fehlerfreien Sache bejahe, u n d er weiterhin die Ablehnung einer derartigen Verpflichtung gerade damit begründet, daß §§ 320 ff. nicht neben den §§ 459 ff. zur Anwendung kommen dürften, so ist das nicht stichhaltig. Die §§ 320 ff. sind Sanktionen f ü r den F a l l einer teilweisen oder vollständigen Nichterfüllung unter Berücksichtigung der Frage der Nachholbarkeit der Leistung. Die Sachmängelhaftung dient einem davon zu unterscheidenden Fall, dem F a l l der mangelhaften Erfüllung, der bewußt nicht auf die Nachholbarkeit der Leistung abgestimmt ist, also schon deshalb nicht unter die allgemeine Regelung paßt. Nach den allgemeinen Normen ist die jeweilige Rechtsfolge von der Frage der Nachholbarkeit der Leistung
158
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen
Wenn der Käufer die Sache nicht zurückweisen darf, es sei denn zum Zwecke der Wandlung 2 2 , so kann er auch nicht die Einrede des nichterfüllten Vertrages erheben 23 . § 320 gibt das Recht, die eigene Leistung solange zurückzuhalten, als die Leistung des Vertragspartners noch nicht erfolgt ist. Ein Urteil i n derartigen Fällen lautet auf Zug u m Zug-Leistung (vgl. § 322). Auch § 320 setzt also voraus, daß die Gegenleistung noch möglich ist 2 4 . Bei einem unbehebbaren Fehler wäre § 320 unanwendbar 2 5 . Es gilt hier das nämliche Argument wie oben. Das Gesetz behandelt behebbare und unbehebbare Fehler generell gleich. Es kann nun aber nicht angenommen werden, daß § 320 nur bei behebbaren Fehlern Geltung haben soll. Ein weiteres Argument zeigt, daß § 320 niemals bei Sachmängeln gilt, auch nicht bei behebbaren Mängeln. Die Leistung einer fehlerhaften Sache kann niemals vollständige Nichterfüllung bedeuten 26 . Schließlich ist die Sache als solche erbracht worden. Die Lieferung einer anderen Sache zum Zwecke der Erfüllung ist nicht möglich. Insoweit ist auch bei Verzug keine Zug u m Zug-Verurteilung zulässig. Man könnte höchstens von teilweiser Nichterfüllung i m Sinne des § 320 I I sprechen. Teilweise Nichterfüllung ist jedoch nur denkbar, wenn die Leistung teilbar ist 2 7 . Denn § 320 I I geht davon aus, daß der nichterfüllte Teil nachgeliefert werden kann, was jedoch nur bei einer teilbaren Leistung i n Frage kommt. Die Eigenschaft der Sache ist kein abtrennbarer Teil, der gesondert erfüllt werden könnte 2 8 . Die Eigenschaft kann nur m i t der Sache geleistet werden. Ist die Sache selbst erbracht, so könnte von einer fehlenden Teilleistung höchstens i m Zusammenhang m i t einer abhängig. Bei Nachholbarkeit gelten die Verzugsnormen, anderenfalls die Normen über die Unmöglichkeit. Beide Bereiche schließen sich gegenseitig aus. Daß die allgemeinen Normen f ü r den F a l l der mangelhaften Leistung nicht gelten, liegt i n der besonderen tatsächlichen Gestalt der Fehlerhaftigkeit, der besonders verknüpften Leistungspflicht von Eigenschaft u n d Identität, nicht aber darin, daß eine Leistungspflicht hinsichtlich der Eigenschaft nicht besteht. 22 Vgl. unter 1. W i l l der Käufer nur mindern, so muß er die Sache abnehmen, vgl. Korintenberg, Erfüllung, S. 178, 179. 23 Vgl. Korintenberg, Erfüllung, S. 179. 24 R G J W 1908, 548, Nr. 7; R G 58, 176; 69, 383; Korintenberg, Erfüllung, S. 177; Düringer / Hachenburg / Hoeniger V 1, Einl. A n m . 115. 25 Vgl. Hoeniger, a.a.O.; Busbach, S. 49; Oertmann, Recht 1909, 620. 26 Vgl. V, 1. 27 Vgl. Soergel / Siebert / Schmidt, § 280 Bern. 3; Staudinger / Werner, § 266 Rdz 2. 28 So auch Erman, JZ 1960, 42, der jedoch i n der Leistung einer fehlerhaften Sache einen F a l l vollständiger Nichterfüllung sieht. Diese Ansicht v e r kennt das besondere Verhältnis zwischen Sache u n d Eigenschaft, vgl. dazu oben V, 1. Eine fehlerhafte Leistung ist nicht gleichzusetzen m i t einer Nichtleistung (vgl. Wolff, S. 79; R G 52, 355). Folglich k a n n eine fehlerhafte L e i stung a u d i keine vollständige Nichterfüllung sein.
2. Verzug u n d Einrede des nicht erfüllten Vertrages (§§ 320, 326)
159
Nachbesserungspflicht des Verkäufers die Rede sein 29 . Das Gesetz ordnet jedoch bewußt keine Nachbesserungspflicht an 3 0 . Worin soll dann aber die ein Zurückhalten des Kaufpreises durch den Käufer rechtfertigende, noch ausstehende Teilleistung des Verkäufers bestehen? Der Verkäufer hat ja nicht einmal das Recht, nach Übergabe der Sache nachzubessern. Ein Nachholen der Leistung ist bei Sachmängeln vom Gesetz nicht vorgesehen. § 320 setzt aber gerade voraus, daß die ursprünglich vereinbarte Gegenleistung noch nachgeholt werden kann 3 1 . Von diesem Umstand geht auch die i n § 322 vorgesehene Zug um ZugVerurteilung aus. Damit ist offensichtlich, daß § 320 i m Falle einer fehlerhaften Leistung nicht zur Anwendung kommt, auch nicht bei behebbaren Fehlern 3 2 . Gegen die Kaufpreisklage des Verkäufers ist der Käufer deshalb noch lange nicht schutzlos. Er kann sich vielmehr m i t den Sachmängeleinreden zur Wehr setzen 33 . § 478 gibt dem Käufer, der die Mängelanzeige rechtzeitig abgesendet hat, nach Vollendung der Verjährung die Möglichkeit, dem vom Verkäufer geltend gemachten Anspruch auf Zahlung des restlichen Kaufpreises die Wandlungs- oder Minderungseinrede entgegenzusetzen. Nach der Formulierung des Gesetzes kann der Käufer „auch nach der Vollendung der Verjährung die Zahlung des Kaufpreises insoweit verweigern, als er auf Grund der Wandlung oder der Minderung dazu berechtigt sein würde" (§ 478 I 1). Bedeutsam ist dabei einmal das „auch", aus dem sich ergibt, daß der Käufer die Mängeleinrede schon vor Vollendung der Verjährung hat. Weiterhin von Bedeutung ist aber auch die Einschränkung „ . . . insoweit verweigern, als . . . " , w e i l sich daraus ergibt, daß der Käufer sich für die Wandlungs- oder Minderungseinrede entscheiden muß, er also keine allgemeine Mängeleinrede hat. Nichts anderes gilt aber für die Sachmängeleinrede vor Vollendung der Verjährung. Auch hier muß der Käufer seinen Einreden einen ein-
29 Korintenberg, Erfüllung, S. 178 F N 1 hält § 320 f ü r anwendbar, wenn der Käufer einen Mängelbeseitigungsanspruch hat, sonst jedoch nicht. 30 Vgl. darüber oben I V , 2, a. 31 Vgl. die unter A n m . 24 genannte Rechtsprechung u n d Literatur. 32 Vgl. Düringer / Hachenburg / Hoeniger V 1, Einl. A n m . 115; Erman, J Z 60, 46; Larenz I I , § 41 I I d. A l l e gehen jedoch davon aus, daß der Verkäufer beim Spezieskauf nicht zu fehlerfreier Leistung verpflichtet ist. 33 Vgl. Erman, JZ 60, 46 ff.; Larenz I I , § 41 I I d und e; Enneccerus / Lehmann, § 110 I 2 f; Larenz, NJW 51, 500; Schöller, S. 15 F N 16; letztlich auch Wolff, S. 10 ff., w e n n auch unklar. Wenn Raape, S. 486 die Einrede aus § 320 deshalb zubilligt, u m dem Käufer ein spatium deliberandi einzuräumen, so ist das abzulehnen. M i t Recht meint Bötticher, S. 49, es bestehe gar k e i n Grund, dem Käufer einen Überlegungszeitraum zuzubilligen. Er habe bis zum Vollzug des Sachmängelrechtes i m m e r noch die Wahl. Vgl. dazu Anm. 35, 36.
160
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen
deutigen Inhalt geben 34 ; er muß entweder die Wandlungs- oder die Minderungseinrede erheben. A l l e i n die Möglichkeit, Wandlung zu verlangen, berechtigt den Käufer nicht dazu, die Sache zurückzuweisen und die Zahlung des Kaufpreises zu verweigern 3 5 . Zweck der Einrede ist es, den Käufer vor der Durchsetzung der noch i n voller Höhe bestehenden Kaufpreisforderung zu schützen, die mit 34 Vgl. Korintenberg, Erfüllung, S. 180 F N 4. So zu § 320 auch das Reichsgericht, R G 58, 176; 69, 383; Warn. Rtspr. 1910, 340. Der Käufer müsse bei Ablehnung der Gegenleistung „seinen Einreden eine derartige Gestalt geben, daß aufgrund derselben eine endgültige Regelung der Rechtsverhältnisse stattfinden" könne (vgl. R G 58, 176). 35 So jedoch Larenz I I , § 41 I I e; Gierke , ZHR 114, 78. Larenz f ü h r t aus, der Verkäufer verlange etwas, was er wieder zurückgeben müsse, w e n n der Käufer Wandlung verlange (ebenso Gierke , a.a.O.). Diese Argumentation k a n n nicht durchgreifen, w e i l noch gar nicht feststeht, ob ein solcher Rückforderungsanspruch jemals zum Entstehen kommt. Arglistig würde der V e r käufer n u r handeln, wenn feststünde, daß der Käufer den Vertrag wandeln w i l l . Mangels Erklärung des Käufers k a n n davon aber nicht die Rede sein. Die Arglisteinrede kann nicht erhoben werden, w e n n zwar die Möglichkeit besteht, daß ein Rückforderungsanspruch zum Entstehen gelangt, w e n n j e doch das Entstehen dieses Anspruchs gar nicht sicher ist. Der Käufer k a n n sich nicht auf Kosten des Verkäufers eine Uberlegungsfrist nehmen. I m übrigen f ü h r t die von Larenz u n d Gierke vertretene Ansicht dazu, dem Käufer eine Einrede der Gestaltbarkeit zu geben, die das Gesetz i n dieser allgemeinen F o r m nicht kennt. Eine Ausnahme bildet § 2083 m i t der Einrede der Anfechtbarkeit. Würde m a n dem Käufer die Möglichkeit einräumen, schon deshalb die Zahlung des Kaufpreises zu verweigern, w e i l er Wandlung verlangen darf, so würde man i h m zwar den Vorteil der Wandlung ( = Wegfall der Zahlungspflicht) zubilligen, ohne daß i h n der Nachteil der vollzogenen Wandlung ( = Rückgewährpflicht) träfe, er könnte sich also w i e Schlosser es zutreffend formuliert, allein den „guten Tropfen" auswählen (vgl. Schlosser, S. 153, 154 u n d dort F N 36; JuS 1966, 257, 267; J Z 1966, 428, 430). E i n solches Ergebnis ist nicht n u r unbillig, w e i l es einseitig die Interessen des Käufers berücksichtigt, sondern auch juristisch fragwürdig, w e i l es eine besondere Einrede der Gestaltbarkeit (hier der Wandelbarkeit) voraussetzt, die es so nicht gibt (Schlosser, S. 155 u n d JuS 1966, 267). Als Gegenargument ist auch nicht § 770 geeignet, der dem Bürgen die Einrede der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit gibt, einhellig aber auch bei sonstigen Gestaltungsrechten des Schuldners entsprechend angewendet w i r d (vgl. Palandt / Thomas, § 770 A n m . 4). Die Situation ist hier vollkommen anders. Der Bürge kann nicht selbst das Gestaltungsrecht ausüben. Deshalb gibt i h m das Gesetz ausdrücklich das Einrederecht. Der Käufer dagegen k a n n Wandlung bzw. Minderung verlangen, also das Schuldverhältnis umgestalten (wobei es nicht darauf ankommt, ob man der Herstellungstheorie oder der Vertragstheorie folgt) u n d m i t Rücksicht auf die nachfolgende Umgestaltung insoweit die Leistung verweigern. F ü r eine Vorschaltung einer besonderen Einrede der Wandelbarkeit ohne Wandlungsverlangen besteht kein Anlaß. Daß der Käufer nach Vollendung der Verjährung die volle Zahlung des Kaufpreises n u r verweigern kann, w e n n er, abgesehen von einer Befreiung nach §§ 350 ff., seinerseits zur Rückgabe bereit ist, andernfalls nur, soweit er zur Minderung berechtigt ist (so Erman / Weitnauer, § 478 Rdz 2; i m Ergebnis ebenso Larenz I I , § 41 I I d), bestätigt n u r die hier vertretene Ansicht, läßt sich dagegen m i t der Gegenansicht schwer i n Einklang bringen. Dabei k a n n es dahingestellt bleiben, ob durch das klagabweisende U r t e i l die Wandlung noch nach Vollendung der V e r j ä h r u n g vollzogen w i r d (dafür Schlosser,
2. Verzug u n d Einrede des nicht erfüllten Vertrages (§§ 320, 326)
161
Rücksicht auf die m a n g e l h a f t e L e i s t u n g n i c h t , z u m i n d e s t n i c h t i n der u r s p r ü n g l i c h e n H ö h e , b e r e c h t i g t ist. D a eine U m g e s t a l t u n g der v e r t r a g l i c h e n P f l i c h t e n e r s t m i t V o l l z u g der W a n d l u n g b z w . d e r e i n t r i t t , d. h. m i t d e r E i n v e r s t ä n d n i s e r k l ä r u n g
Minderung
des V e r k ä u f e r s
(bzw.
m i t R e c h t s k r a f t eines entsprechenden U r t e i l s ) , d e r K ä u f e r aber e i n e n A n s p r u c h a u f d i e U m g e s t a l t u n g h a t , schützt i h n i n d e r Z w i s c h e n z e i t b i s z u m V o l l z u g d i e j e w e i l i g e ( W a n d l u n g s - oder M i n d e r u n g s - )
Einrede.
M i t E r h e b u n g d e r E i n r e d e entscheidet d e r K ä u f e r sich also f ü r
einen
b e s t i m m t e n Sachmängelanspruch. D i e Rechte des K ä u f e r s ergeben sich aus d e m g e w ä h l t e n Rechtsbehelf. E i n e B i n d u n g a n diese W a h l t r i t t j e doch, w i e auch sonst (vgl. o b e n V 4 a), erst ein, w e n n d e r V e r k ä u f e r s e i n E i n v e r s t ä n d n i s e r k l ä r t h a t b z w . dieses E i n v e r s t ä n d n i s d u r c h g e r i c h t liches U r t e i l ersetzt w i r d 3 6 . E r h e b t d e r K ä u f e r d i e W a n d l u n g s e i n r e d e , so ist er w e d e r z u r A b n a h m e noch z u r Z a h l u n g des K a u f p r e i s e s v e r p f l i c h t e t , e r h e b t er d i e M i n d e r u n g s e i n r e d e , so i s t er z u r A b n a h m e n u r
S. 154 F N 36 u n d JZ 1966, 430; auch Larenz, a.a.O., S. 56 F N 2; a. Α. Erman I Weitnauer, § 478 Rdz 2). 36 Vgl. Larenz I I , § 41 I I d, S. 55; Bötticher, S. 49 ff.; ähnlich schon Oertmann, Recht 1909, 625. N u r m i t Rücksicht auf die getroffene W a h l des Sachmängelanspruchs ist der Käufer schutzwürdig. I n diesem Sinne auch Schlosser, S. 154: „ W e n n der Käufer sich schon auf Wandlung berufen w i l l , dann soll er auch den Verlust der Kaufsache riskieren, selbst w e n n aktueller Anlaß hierzu n u r die Klage des Verkäufers auf Zahlung eines verschwindenden Kaufpreisrestes war. Nebeneinanderbestehen von Wandlungsfolgen u n d Kaufvertrag ist einfach ein Unding." Nach der Rechtsprechung (vgl. R G 69, 385; 147, 490; B G H 29, 149 ff.) erstreckt sich die Rechtskraft eines auf der erfolgreichen Geltendmachung einer Mängeleinrede beruhenden teilweise oder ganz abweisenden Urteils nicht auf die Sachmängelrechte. Der Käufer w i r d also durch das U r t e i l nicht an seine E r k l ä r u n g gebunden. Abgesehen davon, daß das Ergebnis nicht befriedigt — die Rechtsprechung (RG 147, 390; B G H 29, 155 f.) h i l f t sich m i t der Einrede „venire contra factum proprium", w e n n der Käufer von seiner W a h l abweichen w i l l —, überzeugt die Ansicht nicht. Eine Klagabweisung ist n u r möglich, w e n n die vertragliche Schuld umgestaltet ist. Die Mängeleinrede dient der Möglichkeit, die Leistung bis zum Vollzug der Wandlung oder Minderung ganz oder teilweise zurückzuhalten. Verweigert der Verkäufer das Einverständnis, so w i r d es m i t dem abweisenden U r t e i l ersetzt; dieses beruht seinerseits i n seinem materiellen Gehalt gerade auf dem Vollzug des Sachmängelrechtes. M i t der Einrede verweigert der Käufer die Leistung. Dieses Recht steht i h m zu, w e i l er m i t der Einrede immanent sein Recht auf Umgestaltung des Vertrages gegenüber dem Verkäufer geltend macht u n d er angesichts der m i t der Umgestaltung verbundenen Rückleistungspflicht des Verkäufers nicht mehr zur Leistung gezwungen werden darf. Die Einrede enthält also notwendigerweise zwei Erklärungen: 1. Ich verlange Wandlung (bzw. Minderung). 2. W e i l ich nach Vollzug der Wandlung (bzw. Minderung) nicht mehr zur Leistung verpflichtet bin, werde ich nicht leisten, w e i l das Geleistete wieder herauszugeben wäre. Gibt das U r t e i l der Einrede statt, so w i r d die Durchführung des Sachmängelanspruchs vollzogen. Das U r t e i l ersetzt das Einverständnis des V e r k ä u fers. D a m i t w i r d das Schuldverhältnis umgestaltet. Die daraus resultierenden Rechte sind entstanden u n d nicht mehr einseitig durch eine Partei aufhebbar. So auch gegen die Rechtsprechung Staudinger / Ostler, § 478 Rdz 21 m. w . N.; Larenz, N J W 1951, 500 sowie Bötticher, S. 49 ff. 11 Herberger
162
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen
gegen Zahlung des geminderten Kaufpreises verpflichtet 3 7 . N u r i n Höhe dieses Betrages kann der Käufer i n Verzug geraten. W i l l der Verkäufer die Sache nicht für den geminderten Kaufpreis dem Käufer übergeben, so gerät dieser nicht i n Annahme- und Leistungsverzug, da er angesichts seines Minderungsanspruchs nicht verpflichtet ist, die fehlerhafte Kaufsache gegen Zahlung des vollen Kaufpreises abzunehmen 3 8 . Für den Schadenersatzanspruch gelten die gleichen Überlegungen 39 . b) Beim Gattungskauf ergibt sich für das Verhältnis der Sachmängelhaftung zu den §§ 320, 326 nichts anderes. Vor der Konkretisierung sind die §§ 320, 326 ohne weiteres anwendbar. Dies berührt jedoch das Verhältnis zu den Sachmängelnormen nicht, w e i l die Gewährleistung überhaupt erst i n Betracht kommen kann, wenn konkretisiert ist 4 0 . Vorher kann mangels Konkretheit der vertraglichen Schuld von einem Fehler keine Rede sein. Leistet der Verkäufer eine fehlerhafte Sache, so ist diese Sache nicht die geschuldete. Der Sache fehlt nicht nur die vereinbarte Eigenschaft, ihr mangelt die Schuldidentität. Der Käufer kann die m i t der geschuldeten nicht identische Sache zurückweisen, Nachlieferung verlangen, den Verkäufer i n Verzug setzen und gegen die Kaufpreisforderung die Einrede des nichterfüllten Vertrages erheben 41 . Konkretisiert der Käufer, erklärt er sich also damit einverstanden, daß die bestimmte Sache Schuldgegenstand wird, so verliert er damit den i n § 480 I geregelten Nachlieferungsanspruch. Er hat nur noch Anspruch auf Leistung dieser Sache. Die Gattungsschuld w i r d zur Spezisschuld, die Sache w i r d zur schuldidentischen. Für die Konkurrenzfragen gelten damit die gleichen Gesichtspunkte wie für den Spezieskauf: Die §§ 320, 326 sind nicht anwendbar, wenn die Sache selbst, jedoch mit Fehlern behaftet, geleistet w i r d 4 2 . 3. Unmöglichkeit (§§ 275 ff., 323 ff.) Wie das Verhältnis zu den §§ 320, 326, so ist auch das Verhältnis der Sachmängelhaftung zu den Normen über die Unmöglichkeit heftig umstritten 4 3 . 37
Vgl. Korintenberg, Erfüllung, S. 179. Vgl. Oertmann, Recht 1909, 622. Vgl. oben V, 4, b, cc. 40 Vgl. oben V, 2, b. 41 Vgl. R G 52, 355; 86, 92; 63, 297 f.; Wolff , S. 84 f.; Schöller, S. 23 F N 26; Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 18. 42 Ebenso Schubiger, S. 31, 32. 43 F ü r die Ansicht, die eine Verpflichtung zu mangelfreier Leistung ablehnt, kann die Frage der Konkurrenz zwischen §§ 459 ff. u n d §§ 323 ff. gar 38
39
3. Unmöglichkeit (§§ 275 ff., 323 ff.)
163
Die überwiegende Meinung macht auch hier für das Verhältnis der Normen zueinander einen Unterschied, ob die Gefahr auf den Käufer schon übergegangen ist oder noch nicht. Vor Gefahrübergang werden regelmäßig die §§ 323 ff. für anwendbar erachtet 44 , während danach nur noch die §§ 459 ff. gelten sollen 4 5 . Gegen diese Differenzierung erheben sich die bereits oben 46 angeführten Bedenken. Daneben erscheint diese Ansicht auch aus anderen Gründen nicht stichhaltig. Von Unmöglichkeit kann überhaupt nur die Rede sein bei unbehebbaren Fehlern 4 7 . Der Fall, daß der unbehebbare Fehler bereits bei Vertragsschluß vorlag, wurde oben schon behandelt 48 . Dort gelangten w i r zu dem Ergebnis, daß bei einem schon m i t Vertragsschluß vorliegenden unbehebbaren Fehler nicht § 306 gilt, sondern die Sachmängelhaftung als besondere Rechtsfolgeregelung. Es ist daher nurmehr der Fall zu untersuchen, daß nach Vertragsschluß, aber vor Gefahrübergang, ein unbehebbarer Fehler entsteht. Das Verhältnis der Gewährleistung zu § 306 hat gezeigt, daß die mangelhafte Leistung vom Gesetz nicht unter dem Gesichtspunkt der Unmöglichkeit geregelt ist. Das Gesetz bedient sich vielmehr eines eigenen Rechtsinstituts, der Sachmängelhaftung. Wenn schon das Vorliegen eines unbehebbaren Fehlers bei Vertragsschluß nicht das Entnicht auftauchen. Die Frage der Unmöglichkeit der Leistung k o m m t n u r i n Betracht, w e n n eine entsprechende Leistungspflicht vorausgesetzt w i r d . Besteht keine Verpflichtung zu mangelfreier Leistung, dann sind die §§ 323 ff. i m Hinblick auf einen Mangel unanwendbar (so konsequent Larenz I I , § 41 I I e; Süß, S. 70 f., 232 f.; Fabricius, J Z 1967, 464, 472; Schniewind, S. 55; Wolff , S. 5 f., 9). Auch Graue, S. 280 weist auf diese Konsequenz hin. N i m m t m a n m i t Flume u n d Schollmeyer an, daß die Sache i n dem Zustand zu leisten ist, i n dem sie sich bei Vertragsschluß befindet (vgl. oben I I , 1 u n d I V , 2, b m i t A n m . 67), so k o m m t eine Konkurrenz der §§ 459 ff. u n d §§ 323 ff. dann i n Betracht, wenn die Sache nach Vertragsschluß unbehebbar fehlerhaft w i r d (so auch konsequent Schollmeyer, S. 104 f. u n d Flume , S. 39 ff., 49 F N 64). Beide halten jedoch m i t Ausnahme des § 323 die Normen über die Unmöglichkeit f ü r unanwendbar. 44 Vgl. Palandt / Putzo bis zur 30. Aufl., vor § 459 A n m . 2 a; Erman, J Z 1960, 43; Oertmann, Recht 1908, 349 f. u n d v o r § 459 A n m . 2; Kiehl, Gruch. Beitr. 60, 618 ff.; Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 35; Windscheid / Kipp, § 395, 2 d; Crome I I , § 220 A n m . 33; Emerich, S. 69; Schöller, S. 20. M i t Ausnahme von Windscheid / K i p p u n d i n eingeschränktem Maße von Schollmeyer w i r d jedoch eine A n w e n d u n g des § 323 abgelehnt. Vgl. dazu A n m . 63. 45 Vgl. RG 57, 400; 88, 105; Soergel / Siebert / Ballerstedt, vor § 459 Bern. 34. Ganz vereinzelt werden die Rechte aus §§ 323 ff. auch nach Gefahrübergang noch gegeben. Vgl. Windscheid / Kipp, a.a.O.; Schollmeyer, S. 109 ff. u n d m i t Einschränkungen auch Staudinger / Ostler, vor § 459 Rdz 13 f. 46 Vgl. dazu V I , 1. 47 Darauf weisen auch h i n : Busbach, S. 49 F N 40; Graue, S. 274; Oertmann, Recht 1909, 621; Flume, S. 49. Vgl. auch R G Gruch. Beitr. 53, 938; dort w i r d darauf hingewiesen, daß Unmöglichkeit nicht schon dann vorliegt, w e n n ein Fehler bei Übergabe vorhanden ist. So auch Krückmann, A c P 101, 172. 48 Vgl. I V , 2, c.
11·
164
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen
stehen einer vertraglichen Verpflichtung zu mangelfreier Leistung verhindert, so kann ein nach Vertragsschluß, aber vor Gefahrübergang entstandener unbehebbarer Fehler diese Verpflichtung auch nicht zum Erlöschen bringen. I n beiden Fällen müssen die gleichen Grundsätze gelten. Wie schon zu § 306 ausgeführt 49 , ist eine Verpflichtung zu einer unmöglichen Leistung nicht logisch unmöglich, m i t der Folge, daß die Verpflichtung bei anfänglicher Unmöglichkeit gar nicht erst entsteht bzw. bei nachträglicher Unmöglichkeit automatisch erlischt, vielmehr ist es ebenso denkbar, daß das Gesetz die Verpflichtung entstehen und bestehen läßt, u m i m Falle der Nichterfüllung eine Haftungsfolge anzuordnen. Diesen zweiten Weg ist das Gesetz gegangen 50 . Die Normen über die Unmöglichkeit sind nicht für den Fall der mangelhaften Leistung vorgesehen 51 . Diese Behauptung gilt es noch zu erhärten. Nach der Unmöglichkeitsregelung des BGB w i r d der Schuldner von seiner primären vertraglichen Verpflichtung befreit, soweit die Leistung unmöglich wird. Unter Umständen t r i t t jedoch, bei gegenseitigen Verträgen nach Wahl des Gläubigers, an die Stelle der primären Leistungspflicht eine sekundäre Verpflichtung, etwa dann, wenn der Schuldner die Unmöglichkeit zu vertreten hat (vgl. §§ 280, 325), aber auch i n anderen Fällen (vgl. §§ 281, 323 II). Sinnvollerweise unterscheidet das Gesetz zwischen vollständiger und teilweiser Unmöglichkeit. Ein Freiwerden von der Verpflichtung t r i t t nur insoweit ein, als die Leistung unmöglich w i r d 5 2 . Teilweise Unmöglichkeit führt nur zu teilweisem Freiwerden 5 3 . Es fragt sich nun, ob sich der Fall der Mangelhaftigkeit m i t dem Begriff der Unmöglichkeit erfassen läßt und ob eine Anwendung der Unmöglichkeitsbestimmungen bei Mangelhaftigkeit i n Betracht kommt. Nach einer Ansicht macht ein vorhandener unbehebbarer Mangel eine mangelfreie Lieferung vollständig unmöglich 5 4 . Mangels Teilbarkeit von Eigenschaft und Sache könne nicht von teilweiser Unmöglichkeit gesprochen werden. Die Leistung des Verkäufers sei, soweit sie i n der Lieferung einer mangelfreien Sache besteht, gänzlich unmöglich 5 5 . 49
Vgl. I V , 2, c. Ebenso Graue, S. 274: Es gelte sinngemäß das gleiche wie bei § 437 I. Z u diesem Ergebnis k o m m t auch die h. L., jedoch aufgrund der H y p o these, daß keine Pflicht besteht, die verkaufte Sache i n mangelfreiem Z u stand zu leisten. Vgl. dazu A n m . 43. 52 Vgl. z. B. § 275 I „ . . . soweit die Leistung . . . unmöglich w i r d " . 53 Vgl. dazu R G 140, 383 u n d R G Warn. Rtspr. 1925 Nr. 21. N u r w e n n dem Gläubiger allein m i t der vollen Leistung gedient ist, k a n n eine teilweise Unmöglichkeit als vollständige Unmöglichkeit behandelt werden. 54 Vgl. Kuhn, i n R G R K , § 459 Anm. 35; α. Α. aber Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 433 A n m . V I I I A. a u n d Nastelski, i n R G R K , § 275 A n m . 41. 55 Gegen diese Argumentation Enneccerus / Lehmann, § 4 I V . 50
51
3. Unmöglichkeit (§§ 275 f f , 323 ff.)
165
Diese Meinung steht nicht i m Einklang m i t der gesetzlichen Regelung. Das Gesetz sieht für den Fall der vollständigen Unmöglichkeit ungeachtet einer u . U . eingreifenden sekundären Pflicht ein Freiwerden von der primären Leistungspflicht vor. I m Falle eines unbehebbaren Mangels ändert sich an der primären Pflicht zur Leistung der Sache nichts. Der Verkäufer schuldet nach w i r vor die konkrete Sache. Der Käufer kann die Übergabe und Übereignung der Sache einklagen. Von einer vollständigen Unmöglichkeit bei einem unbehebbaren Mangel kann also nicht die Rede sein 56 . Bei einem unbehebbaren Mangel kann höchstens teilweise Unmöglichkeit vorliegen. Der Begriff der „teilweisen" Leistung findet sich an verschiedenen Stellen des Gesetzes57. Eine Definition fehlt jedoch. Der Sinngehalt muß daher i m Zusammenhang m i t der jeweiligen Norm ermittelt w e r d e n 5 8 ' 5 9 . Teilweise Unmöglichkeit bedeutet, daß ein gesondert bewertbarer, ein eigenwertiger Teil der Leistung unmöglich wird, während ein anderer ebenfalls eigenwertiger Teil der Leistung möglich bleibt. Die reale Teilbarkeit der Leistung ist nicht notwendig Voraussetzung 60 . Unter diesem Aspekt könnte man bei unbehebbarer Mangelhaftigkeit der geschuldeten Sache von einer teilweisen Unmöglichkeit der Leistung sprechen 61 . Die Eigenschaft ist zwar kein abtrennbarer Leistungsteil, sie ist jedoch i n gewissem Sinne eigenwertig. Darauf baut gerade die gesamte Sachmängelhaftung auf. Daß die Mangelhaftigkeit dennoch kein F a l l der teilweisen Unmöglichkeit ist, ergibt sich letztlich nicht aus dem Begriff „teilweise", sondern aus der Gegenüberstellung der Sachmängelhaftung m i t der Unmöglichkeitsregelung. Gemäß § 275 I w i r d der Schuldner von seiner Verpflichtung frei, soweit die Leistung, ohne daß er es zu vertreten hat, unmöglich wird. Das Gesetz hebt damit unmittelbar die vertragliche Verpflichtung des Schuldners auf. Was m i t der Gegenleistung geschieht, regeln die §§ 323 ff. Hat der Gläubiger die Unmöglichkeit nicht zu vertreten, so 56
So auch Schubiger, S. 22, 31 f. Vgl. §§ 266, 280 I I , 320 I I , 323 I 2, 325 I 2; vgl. auch §§ 420 ff. 58 Vgl. z. B. die Auslegung des Begriffs f ü r § 320 I I unter V I , 2. 59 So auch Coing, SJZ 49, 532 ff.; Planck / Siber, § 266 A n m . 1. 60 So auch Enneccerus / Lehmann, § 4 I V ; Nastelski, i n R G R K § 266 A n m . 2, § 275 A n m . 41. 61 Tatsächlich w i r d i m Falle eines unbehebbaren Fehlers vielfach teilweise Unmöglichkeit angenommen. So etwa von R G 140, 383; Nastelski, i n R G R K , § 275 A n m . 41; Schöller, S. 15 F N 16; Regelsberger, Ih. Jb. 40, 274; Lobe, i n R G R K , 9. Aufl., § 433 A n m . V I I I A a; Coing, SJZ 49, 532 f f ; Schollmeyer, S. 104; Oertmann, Recht 1908, 349; Kohler I I 1, § 26 V I ; Kiehl, Gruch. Beitr. 57
60, 610.
166
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen
w i r d auch er frei. Anderenfalls hat er die Gegenleistung zu erbringen. Würde man bei einem unbehebbaren Mangel, den keine Vertragspartei zu vertreten hat, teilweise Unmöglichkeit annehmen, so hätte das zur Folge, daß unmittelbar durch das Gesetz m i t Entstehen des Mangels die beiderseitigen Leistungspflichten verändert würden. Es fände eine „gesetzliche Minderung" statt. Dementsprechend verweist auch § 323 I 2 auf die §§ 472, 473. Wenn aber das Gesetz unmittelbar die Leistungspflichten verändert, so ist für Wandlung und Minderung, auch nach Gefahrübergang, kein Raum mehr. Gegenüber der Kaufpreisklage hätte der Käufer eine vom Gericht kraft Amtes zu berücksichtigende Einwendung, nicht bloß eine Einrede 62 . Nicht nur die Verjährungsvorschrift des § 477, sondern die gesamte Sachmängelhaftung wäre i n diesem Fall hinfällig 6 3 . Ein solches Ergebnis hat der Gesetzgeber nicht beabsichtigt. Vielmehr zeigt die ausführliche Regelung der Sachmängelhaftung, daß die Fehlerhaftigkeit gerade nicht unter die allgemeinen Normen fallen sollte. Die Sachmängelhaftung ist als eigene, von den allgemeinen Normen vollkommen losgelöste Regelung konzipiert, die gerade nicht auf den dem allgemeinen Teil des Schuldrechts zugrunde liegenden Prinzipien aufbaut 6 4 . I m Gegensatz zu den §§ 323 ff. stellen die §§ 459 ff. nicht auf ein Vertreten-müssen ab. Der Verkäufer hat unabhängig von einem Verschulden immer zu haften, es sei denn, daß die Handlungsweise des Käufers zu einer Haftungsfreistellung führt (vgl. §§ 460, 464). Die Unmöglichkeit, eine fehlerfreie Sache zu leisten, befreit den Verkäufer nicht, vielmehr t r i t t an die Stelle der primären Leistungspflicht eine sekundäre Ausgleichspflicht, die Gewährleistungspflicht. Das Gesetz macht keinen Unterschied zwischen behebbaren und unbehebbaren Fehlern. Für den Bereich der Mangelhaftigkeit sollte gerade die Frage der Unmöglichkeit nicht gestellt werden 6 5 . Deshalb darf nicht nachträglich über eine Anwendung der §§ 323 ff. der Unterschied behebbarer-unbehebbarer Mangel i n den Bereich der fehlerhaften Leistung hineingetragen werden. 82
Vgl. Schniewind, S. 39 f. Angesichts dieser Konsequenz w i r d von der Meinung, die die §§ 323 ff. grundsätzlich für anwendbar hält, der § 323 f ü r unanwendbar erklärt (vgl. A n m . 44). Es geht n u n aber nicht an, daß n u r die Normen angewendet werden, die gerade brauchbar erscheinen. E i n solches Vorgehen ist systematisch höchst fragwürdig. Daß § 323 nicht paßt, zeigt eben, daß die Normen der Unmöglichkeit einen anderen K o m p l e x regeln. I m übrigen taucht das Problem der Umgestaltung der vertraglichen Pflichten nicht n u r bei § 323 auf. Nach dem Gesetz k o m m t eine auf eine unmögliche Leistung gerichtete V e r pflichtung zum Erlöschen u n d an die Stelle dieser Verpflichtung treten nach W a h l des Gläubigers sekundäre Leistungspflichten. F ü r die §§ 324, 325 gelten daher die gleichen Überlegungen hinsichtlich des Verhältnisses zu den §§ 459 ff. w i e für § 323 (vgl. Krückmann, A c P 101, 173). 64 So auch Krückmann, A c P 101, 172 ff.; Schniewind, S. 39 f., 50 ff. 65 Ebenso Graue, S. 274. 63
3. Unmöglichkeit (§§ 275 ff., 323 ff.)
167
Diese Unterschiede zeigen deutlich, daß es sich bei der Mangelhaftigkeit und der Unmöglichkeit u m unabhängige, nicht überschneidende Bereiche handelt 6 6 . Vom Regelungsgegenstand her sind sie vollkommen verschieden. Die Rechtsfolgen für die Mangelhaftigkeit greifen nicht wegen der Unmöglichkeit der Leistung ein, sondern wegen der Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung 6 7 . Von der Zielrichtung her besteht jedoch nahe Verwandtschaft der beiden Normenbereiche: Beide dienen der Lösung von Leistungsstörungen. Aus diesen Überlegungen folgt, daß i m Falle einer unbehebbar mangelhaften Sache keine teilweise Unmöglichkeit vorliegt. Die Unmöglichkeit, die Kaufsache m i t einer bestimmten Eigenschaft zu erbringen, fällt nach der Regelung des BGB nicht unter die teilweise Unmöglichkeit 6 8 , sondern allein unter die Sachmängelhaftung. H ä l t man sich vor Augen, daß gerade i n dem einzigen Fall, bei dem man von einer Unmöglichkeit sprechen könnte, nämlich dem F a l l des unbehebbaren Mangels, die Sachmängelansprüche schon vor Gefahrübergang geltend gemacht werden können 6 9 , so erscheint eine Anwendung der §§ 323 ff. vor Gefahrübergang 70 überflüssig und vom Ergebnis her betrachtet unverständlich. Daß der Käufer vor Gefahrübergang besser gestellt sein soll als danach, erhält durch nichts seine Berechtigung. Die §§ 323 ff., insbesondere § 325 vor Gefahrübergang anzuwenden, hieße eine vom Gesetz nicht vorgesehene Haftungsausweitung befürworten. Z u welchen unsinnigen Unterschieden diese Ansicht führt, soll an Hand eines Beispiels gezeigt werden. W i r d die verkaufte Speziessache vor Gefahrübergang durch ein Verschulden des Verkäufers unbehebbar mangelhaft, so würde der Verkäufer gemäß § 325 zum Schadensersatz verpflichtet sein, solange die Gefahr noch nicht übergegangen ist. Bei der Schickschuld wäre der Schadensersatzanspruch allein davon abhängig, wann der Verkäufer die Sache dem Spediteur übergibt (vgl. § 447). Der Verkäufer könnte sich von der bereits bestehenden verschärften Schadensersatzhaftung dadurch befreien, daß er die Sache dem Spediteur aushändigt. Ein solches Ergebnis ist wenig überzeugend. Dogmatisch ist eine unter66
Ebenso Krückmann, a.a.O. ; Schniewind, S. 50 ff. Vgl. Flume , S. 49, 50. 68 Ebenso Schubiger, S. 22, 31 f.; Schniewind, S. 52; Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 35; Staudinger / Ostler, vor § 459 Rdz 13; Staudinger / Werner, § 275 Rdz 18 u n d vor § 275 Rdz 28. Dabei w i r d dieses Ergebnis jedoch hauptsächlich damit begründet, daß Eigenschaft u n d Sache nicht teilbar seien. 69 Vgl. oben V I , 1. 70 Die A n w e n d u n g der §§ 323 ff. nach Gefahrübergang w i r d heute k a u m mehr vertreten, da die Sachmängelhaftung damit gegenstandslos würde (vgl. dazu A n m . 45). 67
168
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen
schiedliche Bewertung des Verhältnisses der §§ 459 ff. und §§ 323 ff. vor und nach Gefahrübergang unvertretbar. Entweder liegt bei einem unbehebbaren Mangel Unmöglichkeit vor, dann w i r d das Rechtsverhältnis entsprechend den §§ 275, 323 ff. umgestaltet, was jedoch zur Folge hat, daß für die Sachmängelhaftung weder vor noch nach Gefahrübergang mehr Raum bleibt, oder es liegt keine Unmöglichkeit i m Sinne des Gesetzes vor, dann gelten allein die Gewährleistungsvorschriften, und zwar vor wie nach Gefahrübergang 71 . Es kann nicht vor Gefahrübergang eine gesetzliche Umgestaltung der vertraglichen Pflichten stattfinden, die m i t Gefahrübergang gegenstandslos wird, u m einer Umgestaltungsmöglichkeit durch die Parteien Platz zu machen. Die rein faktische Handlung, die zum Gefahrübergang führt, kann nicht eine einmal erfolgte Veränderung der vertraglichen Pflichten rückgängig machen. Damit ist offensichtlich, daß die Normen über die Unmöglichkeit bei einem unbehebbaren Fehler weder vor noch nach Gefahrübergang anwendbar sind. Der Fall, daß zwar die Leistung der verkauften Sache, jedoch nicht eine bestimmte vereinbarte Eigenschaft möglich ist, fällt weder unter den Begriff der vollständigen noch der teilweisen Unmöglichkeit, wie i h n das Gesetz i n den §§ 275 ff., 323 ff. versteht 7 2 . Es handelt sich dabei vielmehr u m einen besonderen Fall, der vom Gesetz i n einer Sonderregelung, der Sachmängelhaftung, erfaßt ist.
4. Zusammenfassung Das Verhältnis der Sachmängelhaftung zu den allgemeinen Normen ist ein ausschließliches. Die allgemeinen Normen regeln den Fall, daß die Sache selbst, i n ihrer Identität 73, nicht geleistet w i r d (§§ 326, 320) bzw. nicht geleistet werden kann (§§ 275 ff., 323 ff.). Die Sachmängelvorschriften regeln den Fall, daß zwar die Sache selbst geleistet wird, jedoch ohne einzelne vereinbarte Eigenschaften, wobei das Gesetz nicht darauf abstellt, ob die Leistung der vereinbarten Eigenschaft überhaupt möglich ist und war oder nicht. Für die Frage, ob i m Einzelfall die allgemeinen Normen oder die Gewährleistungsnormen gelten, ist allein entscheidend, ob es u m die ausgebliebene Leistung der Sache als solcher geht, oder u m die ausgebliebene Leistung einer vereinbarten 71 Deshalb ist es auch systematisch verfehlt, wenn Kohler I I 1, § 26 V I die Sachmängelhaftung bei der Unmöglichkeit behandelt. 72 So sehr richtig Krückmann, AcP 101, 172 ff.; ebenso Schniewind, S. 10 f , 50 ff.; Schubiger, S. 22, 31 f. Die Leistung einer mangelhaften Sache sei eine nicht gehörige Vertragserfüllung, die jedoch nicht den Tatbestand der U n möglichkeit erfülle. 73 Vgl. dazu oben V, 1.
5. Die Anfechtung gemäß § 119 I I
169
Eigenschaft 74. Die Sachmängelhaftung regelt den F a l l der mangelhaften Erfüllung, die allgemeinen Normen hingegen die vollständige bzw. teiweise Nichterfüllung. 5. Die Anfechtung gemäß § 119 I I Das Verhältnis der Sachmängelhaftung (§§ 459 ff.) zur Anfechtung wegen Eigenschaftsirrtum (§119 II) ist eines der am häufigsten erörterten Probleme des BGB. Die Zahl der Monographien und Aufsätze ist unüberschaubar. I m Rahmen dieser Abhandlung können daher nur grundsätzliche Überlegungen angestellt werden. a) Die Ansichten zur Konkurrenzfrage
1. Rechtsprechung und h. L. machen auch hier einen Unterschied, ob die Gefahr gemäß den §§ 446, 447 auf den Käufer übergegangen ist oder nicht. Vor Gefahrübergang sei § 119 I I grundsätzlich anwendbar 7 5 , danach verdrängten die §§ 459 ff. als besondere Regelung den § 119 I I 7 6 . Kämen ausnahmsweise die Gewährleistungsansprüche vor Gefahrübergang zur Anwendung 7 7 , so habe das keinen Einfluß auf die Anwendbarkeit des § 119 I I 7 8 . Der Käufer dürfe m i t der aus der Vorverlegung der Gewährleistungsansprüche resultierenden Vergünstigung nicht sein Anfechtungsrecht verlieren 7 9 . 2. Eine Gegenmeinung lehnt die Anwendung des § 119 I I grundsätzlich, also auch vor Gefahrübergang, ab 8 0 . 74 Bei einer Gattungsschuld f ü h r t erst die durch den Leistungsempfänger vorgenommene Konkretisierung zu einer Individualisierung der Sache. Vor diesem Zeitpunkt sind die allgemeinen Normen anwendbar. Nach der K o n kretisierung finden bei Leistungsstörungen i m Bereich „Eigenschaft" die Sachmängelvorschriften Anwendung, bei Störungen i m Bereich „ I d e n t i t ä t " die allgemeinen Normen; vgl. dazu auch V, 2, b, dd, V, 2, c u n d V I , 2, b. 75 Vgl. H G 74, I f f . ; RG Gruch. Beitr. 53, 940; B G H 34, 32; B G H W M 66, 1185; O L G K ö l n M D R 58, 160; Erman / Böhle-Stamschräder, 3. Aufl., § 459 Anm. 5; Erman / Westermann, § 119 Rdz 22; Staudinger / Ostler, vor § 459 Rdz 9, 16 a; Krüger-Nieland, i n R G R K , § 119 A n m . 28; Kuhn, i n RGRK, § 459 A n m . 31; Palandt / Putzo, bis zur 30. Aufl., vor § 459 A n m . 2 e ; Enneccerus / Lehmann, § 112 I I I 2. 76 R G 61, 175; 70, 429; 97, 351; 135, 340; 138, 356; B G H 16, 57; 60, 319, 320; Raape, S. 499; Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 36; 77 Vgl. oben V I , 1. 78 Vgl. B G H 34, 32 ff.; Erman / Böhle-Stamschräder, 3. Aufl., § 459 A n m . 5; Erman / Westermann, § 119 Rdz 22; Palandt / Putzo, bis zur 30. Aufl., vor § 459 A n m . 2; Lehmann / Hübner, § 34 I I I 1 e; α. Α. Staudinger / Ostler, vor § 459 Rdz 9, 16 a; Soergel / Siebert / Hefermehl, § 119 Bern. 74; Busbach, S. 2 ff. Diese Gegenmeinung hält i n diesem F a l l § 119 I I für unanwendbar. 79 B G H 34, 32 ff. I n der K r i t i k dieses Urteils weist Busbach, S. 2 m i t Recht darauf hin, daß die Vorverlegung der Sachmängelansprüche v o r Gefahrübergang keine Vergünstigung des Käufers darstelle, w e i l der Anspruch bereits v o r Gefahrübergang entstanden sei. Vgl. dazu V I , 1. 80 Vgl. Larenz I I , § 41 I c u n d I I e; Soergel / Siebert / Ballerstedt, vor § 459 Bern. 28; Flume, S. 134 f , 148 und A T § 24, 3 a; Staudinger / Coing,
170
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen b) Grundsätzliche Stellungnahme zu den Ansichten
Die von der h. A. vorgenommene auf den Gefahrübergang abstellende Differenzierung ist i n keiner Weise gerechtfertigt. Es gelten hier die gleichen Argumente, die oben bereits angeführt wurden 8 1 . Der Gefahrübergang ist als Differenzierungskriterium unbrauchbar, da die Sachmängelansprüche nicht erst i n diesem Moment zur Entstehung gelangen. Wie wenig überzeugend die herrschende Ansicht ist, zeigt sich daran, daß der Verkäufer beim Versendungskauf es i n der Hand hätte, dem Käufer die Anfechtungsmöglichkeit gemäß § 119 I I zu nehmen, ohne daß dieser etwas dagegen t u n könnte. Gemäß § 447 geht die Gefahr auf den Käufer über, wenn der Verkäufer die verkaufte Sache der Transportperson zur Beförderung übergeben hat. M i t der Auslieferung des Kaufgegenstandes würde der Käufer sein Anfechtungsrecht verlieren. Wenn aber der Verkäufer beim Versendungskauf jederzeit i n der Lage ist, den Gefahrübergang herbeizuführen und damit dem Käufer die Anfechtungsmöglichkeit gemäß § 119 I I zu nehmen, so vermag das Argument, dem Käufer dürfe das Anfechtungsrecht nicht durch die Vorverlegung der Gewährleistungsansprüche genommen werden, nicht mehr zu überzeugen, w e i l dann offensichtlich ist, daß die Anwendbarkeit des § 119 I I von Fakten abhängt, auf die der Käufer gerade keinen Einfluß hat 8 2 . Die Ansicht der h. M. kann daher nicht geteilt werden. Kommt eine Differenzierung unter dem Gesichtspunkt des Gefahrübergangs nicht i n Betracht und hält man sich vor Augen, daß eine Anfechtung neben der Sachmängelhaftung ausgeschlossen sein muß, w e i l sonst die Verjährungsfrist des § 477 ihren Sinn verliert 8 3 , so folgt daraus, daß § 119 I I niemals anwendbar sein kann, wenn es u m Eigenschaften geht, für die die Sachmängelhaftung i n Betracht kommt. M i t dieser Feststellung ist jedoch dogmatisch noch nichts gewonnen. Zu klären bleibt, warum § 119 I I nicht zur Anwendung kommt. Es bieten § 119 Rdz 32, 33; Brüggemann, i n R G R K — HGB, § 377 Anm. 54, 55; Busbach, S. 55 f.; Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 29 f. 81 Vgl. oben V I , 1. 82 Diese Schwäche der h. L . sieht auch Graue, S. 290. U m dem dargestellten Ergebnis auszuweichen, w i l l er die allgemeinen Normen u n d damit § 119 I I bis zur Annahme als E r f ü l l u n g anwenden. Das hieße jedoch, daß der Käufer das Anfechtungsrecht auch noch nach V e r j ä h r u n g der Sachmängelansprüche hätte, sofern es vor A b l a u f der Verjährungszeit nicht zu einer Erfüllungsannahme gekommen ist. 83 Das ist der Grundgedanke, w a r u m die Anfechtung auf keinen F a l l nach Gefahrübergang gegeben w i r d . Vgl. B G H 34, 34; R G 61, 175; Soergel/Siebert / Hefermehl, § 119 Bern. 74; Wolff, S. 36; Palandt / Putzo, vor § 459 A n m . 2.
5. Die Anfechtung gemäß § 119 I I
171
sich hierbei zwei Möglichkeiten an: Einmal könnten die §§ 459 ff. als leges speciales den § 119 I I verdrängen. Zum anderen wäre es denkbar, daß die §§ 459 ff. und der § 119 I I sich tatbestandlich gegenseitig ausschließen. Überwiegend werden die §§ 459 ff. als Spezialregelung zu § 119 I I bezeichnet 84 . Diese Ansicht setzt voraus, daß die beiden Tatbestände konkurrieren 8 5 . Geht man m i t der h. L. davon aus, daß § 119 I I den Fall regelt, daß der Erklärende sich über das Vorhandensein einer Eigenschaft der Sache, auf die sich die Erklärung bezieht, irrt, so muß man feststellen, daß sich der Anwendungsbereich der §§ 459 ff. m i t dem A n wendungsbereich des § 119 I I i n bestimmten Fällen überschneidet, daß auf keinen Fall aber eine tatbestandliche Deckung besteht 86 . Nur wenn die Sache bereits bei Kaufabschluß fehlerhaft war und es noch bei Gefahrübergang ist, findet eine Überschneidung der beiden Rechtsinstitute statt. Ist die Sache bei Gefahrübergang einwandfrei, so scheidet die Sachmängelhaftung aus, ist die Sache bei Vertragsschluß ohne Mangel, so kann von einem Eigenschaftsirrtum keine Rede sein. Ein I r r t u m i. S. des § 119 II, wie ihn die h. L. versteht, liegt nur vor, wenn dem Vertragsgegenstand bei Vertragsschluß Eigenschaften fehlen, die der Erklärende als vorhanden annimmt. Fehler, die nach Vertragsschluß erst entstanden sind, vermögen nicht Gegenstand eines Eigenschaftsirrtums zu sein, da bei Abgabe der Erklärung die Sache die Eigenschaften hatte, die sich der Erklärende vorstellte 8 7 . Die Wirklichkeit stimmte m i t der Vorstellung überein. Dies spricht bereits gegen die These, daß die §§ 459 ff. Speziairegeln gegenüber § 119 I I sind, da ein Fall der Spezialität nur vorliegt, wenn ein Tatbestand von einem anderen vollständig erfaßt ist 8 8 . Beachtet man weiterhin, daß die Rechtsinstitute der Sachmängelhaftung und der Irrtumsanfechtung vollkommen verschiedene Aufgaben und Funktionen haben, so w i r d offenbar, daß das Verhältnis der §§ 459 ff. zu § 119 I I weder mit dem Satz „lex specialis derogat legi 84 Vgl. B G H W M 66, 185; R G 61, 171; Staudinger / Coing , § 119 Rdz 32; Flume , S. 132 f., 134; Palandt / Putzo, a.a.O.; Soergel / Siebert / Hefermehl, a.a.O. ; Lehmann / Hübner, § 34 I I I 1 e. 85 So die h. L. (vgl. die i n A n m . 1 aufgeführte Literatur). Die Meinung, daß § 119 I I zwar v o r Gefahrübergang anwendbar ist, danach jedoch durch §§ 459 ff. verdrängt werde, basiert zwangsläufig auf der Annahme, daß ein Konkurrenzverhältnis besteht. 86 Vgl. dazu ausführlich Busbach, S. 5 ff.; Süß, S. 203 ff. M i t Recht f ü h r t Süß aus, daß Unkenntnis (der Fehlerhaftigkeit) u n d I r r t u m nicht dasselbe seien. 87 Vgl. Busbach, S. 4; Wolff, S. 38; Lippmann, A c P 102, 339 ff. 88 Vgl. Larenz, Methodenlehre, S. 208.
172
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen
generali" zu lösen ist 8 9 noch m i t der Annahme einer sich überschneidenden Sonderregelung. Die Sachmängelhaftung dient der Vertragsabwicklung, die Anfechtung hat den Zweck, die vertragliche Bindung zu lösen 90 . Die Zielrichtung der beiden Rechtsinstitute ist damit genau entgegengesetzt 91. Dem entspricht eine i m Detail vollkommen unterschiedliche Regelung 92 , insbesondere t r i f f t nur den Anfechtenden die Verpflichtung, dem Vertragspartner den negativen Schaden zu ersetzen (vgl. § 122). U m das Verhältnis der beiden Rechtsinstitute zueinander zu klären, bedarf es einer näheren Untersuchung der Aufgabe und der rechtlichen Funktion des § 119 II. c) Die Rechtsnatur des Eigenschaftsirrtums
aa) Das Verständnis des § 119 II nach der h. L. und nach der Lehre Flumes 1. Nach überwiegender Ansicht ist § 119 I I ein Motivirrtum 93. Wille und Erklärung stimmten überein. Die Sache, auf die sich die Erklärung bezieht, sei jedoch anders, als der Erklärende annehme. Er irre sich über einen Umstand, der für die Willensbildung von Bedeutung sei. Maßgeblich für eine Anwendung des § 119 I I ist also nach h. L. die Divergenz von Vorstellung und Wirklichkeit: Die Sache ist anders, als der Käufer glaubt. 2. Neuerdings i m Vordringen begriffen ist die auf Flume 9 4 zurückgehende Lehre vom geschäftlichen Eigenschaftsirr tum 95. Flume unterscheidet geschäftlchen und außergeschäftlichen Eigenschaftsirrtum. Nur der geschäftliche Eigenschaftsirrtum berechtige gemäß § 119 I I zur Anfechtung. Die Ansicht Flumes beruht auf folgenden Gedanken: 89 Vgl. Larenz, Methodenlehre, S. 208, 209; Larenz I I , § 41 I I e, S. 61 F N 3; Busbach, S. 3; Esser, § 64 V I 3 a; vgl. auch Krückmann, AcP 101, 393 f f , insbesondere S. 393 F N 1. 90 Vgl. Krückmann, AcP 98, 420 ff. u n d A c P 101, 393 ff.; auch Flume, S. 133. 91 Nicht zu Unrecht spricht z. B. Lippmann, AcP 102, 347 v o n einer N o r mendissonanz. I n gewisser Weise r ä u m t dies auch Flume ein (vgl. Flume, S. 133). Trotzdem n i m m t er an, daß die §§ 459 ff. leges speciales zu § 119 I I sind (vgl. S. 134). 92 Vgl. dazu i m einzelnen Busbach, S. 23 ff.; Wolff, S. 35 ff. 93 Vgl. Larenz, A T § 20 I I b u n d Geschäftsgrundlage, S. 20 F N 1; Erman / Westermann, § 119 Rdz 7, 14; Fikentscher, § 70 I I 2 d; Flad, Festschrift Bumke, S. 244. 94 v g l . Flume, S. 70 f , 83 ff. und A T § 24, 2 b. Der eigentliche Begründer dieser Ansicht ist jedoch Adler, ZHR 75, 467. Dort finden w i r schon die gleichen Gedanken w i e bei Flume. 95 Staudinger / Coing, § 119 Rdz 16, 33; Enneccerus / Nipperdey, § 168 I 1; Raape, S. 499 ff.; Kegel, S. 360.
5. Die Anfechtung gemäß § 119 I I
173
Der Käufer könne, entgegen der h. L., m i t dem Verkäufer vereinbaren, welche Eigenschaften die Kaufsache haben solle. Irre der Käufer sich nun über bestimmte Eigenschaften der Kaufsache, so könne dieser I r r t u m nicht schlechthin beachtlich sein. Entscheidend müsse sein, ob der Käufer die vorgestellten Eigenschaften i n die Vereinbarung m i t aufgenommen habe. Liege eine Eigenschaftsvereinbarung vor, so sei der I r r t u m des Käufers über Eigenschaften der Kaufsache ein „geschäftlicher Eigenschaftsirrtum", der gemäß § 119 I I beachtlich sei, fehle es an einer solchen Vereinbarung, so sei der I r r t u m als außergeschäftlicher Eigenschaftsirrtum unbeachtlich 96 . Regelmäßig seien, dafür spreche eine Vermutung i n § 119 II, verkehrswesentliche Eigenschaften auch vereinbart. Der § 119 I I sei also Ausdruck für die Beachtlichkeit des geschäftlichen Eigenschaftsirrtums. Entscheidend für die Möglichkeit einer Anfechtung gemäß § 119 I I ist für Flume die Divergenz von Vereinbarung und Wirklichkeit, nicht das Auseinanderfallen von Vorstellung und Wirklichkeit, wie die h. L . annimmt. Der Käufer kann nicht schon anfechten, wenn die Sache von der Vorstellung abweicht, sondern nur dann, wenn die i r r i g vorgestellte Sache von der Vereinbarung abweicht. bb) Kritik
an der Lehre Flumes
Für Flume ist § 119 I I ein besonderer F a l l der Nichterfüllungsregelung 9 7 . Weil die Sache nicht der Vereinbarung entspricht, kann die Erklärung angefochten werden. Der I r r t u m des Erklärenden bezüglich der Eigenschaften der Sache ist nicht Anfechtungsgrund, sondern Bedingung dafür 9 8 . Nicht w e i l er sich geirrt hat, sondern weil der Leistimgsgegenstand von der Vereinbarung abweicht, kann der Erklärende anfechten. Würde diese Auslegung des § 119 I I stimmen, so wäre die systematische Stellung der Norm vollkommen verfehlt. I n den §§ 116 ff. geht es um das Problem der fehlerhaften Willenserklärung, nicht um das Problem der Nichterfüllung 99. Der Gesetzgeber war sich nun über die Rechtsnatur des § 119 I I nicht ganz sicher 100 , doch herrschte soweit K l a r heit, daß § 119 I I eine echte Irrtumsregelung und nicht eine Nichterfüllungsregelung sein sollte. Das zeigt sich deutlich an der Rechtsfolge96
Flume , S. 70, 83 ff. So auch ausdrücklich Flume , S. 87; Kegel, S. 360; Enneccerus / Nipper dey, § 168 I. 98 Flume, S. 87; Raape, S. 500. 99 Vgl. Schmidt-Rimpler, S. 230 ff.; Soergel ! Siebert ! Hefermehl, § 119 Bern. 29; Larenz, A T , § 20 I I b. 100 Vgl. darüber A n m . 115. 97
174
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen
regelung des § 119 II, die als Nichterfüllungsregelung nicht verständlich wäre. Kann eine bestimmte vereinbarte Eigenschaft nicht erbracht werden (Unmöglichkeit einer vereinbarten Eigenschaft), so erscheinen zwei Rechtsfolgeregelungen möglich und sinnvoll: Die Nichtigkeit der Vereinbarung (vgl. etwa § 306) oder die Haftung bei Geltung der Vereinbarung (vgl. etwa §§ 459 ff.) 1 0 1 . Die Möglichkeit anzufechten, bringt keine gangbare Lösung. Unterläßt der Anfechtungsberechtigte eine unverzügliche Anfechtung, so bleibt die Vereinbarung bestehen, ungeklärt bleibt jedoch, wie das auf die unmögliche Leistung gerichtete Vertragsverhältnis zu Ende geführt w i r d 1 0 2 . Aber auch sonst ist die Anfechtung keine geeignete Möglichkeit, einen Fall der Nichterfüllung zu lösen. Wer ausdrücklich Leistung „dieses goldenen Ringes" vereinbart, der w i r d i n seiner berechtigten Leistungserwartung enttäuscht, wenn der Verkäufer den Ring nur i n vergoldetem Zustand leistet. Eine sinnvolle Lösung kann hier nicht dadurch erfolgen, daß der Käufer seine Erklärung anficht und damit die Vereinbarung beseitigt, sondern nur dadurch, daß der Verkäufer entsprechend der Vereinbarung haftet, w e i l er nicht geleistet hat, was dem Käufer nach der Vereinbarung gebührt 1 0 3 . Die Rechtfolgeregelung des § 119 I I ist der Grundwertung für Fälle der Nichterfüllung genau entgegengesetzt 104 . I n stärkstem Maße bringt das die Schadensersatzregelung des § 122 zum Ausdruck, die die These Flumes als unhaltbar erscheinen läßt 1 0 5 . Nach Flume würde der Käufer nicht nur das nicht erhalten, was i h m zusteht, er müßte außerdem noch, wenn er sich vom Vertrage lösen w i l l , dem mangelhaft leistenden Verkäufer den negativen Schaden ersetzen. Der Käufer würde also noch bestraft, wenn er sich wegen der Vertragswidrigkeit der Leistung von der Vereinbarung löst. Nun versucht Flume dieser untragbaren Konsequenz durch die Annahme auszuweichen, daß die §§ 459 ff. den § 119 I I als Speziairegelung verdrängen 1 0 6 . Obwohl er die grundsätzliche Verschiedenheit der 101
Vgl. dazu oben I V , 2, c. Ebenso Schmidt-Rimpler, S. 228; Larenz, A T , § 20 I I b. 103 So sehr richtig Wolff , S. 40, der jedoch aufgrund dieser Überlegungen zu der nicht zutreffenden Schlußfolgerung kommt, der Käufer könne sich überhaupt nicht über das Sein der Sache irren. Vgl. dazu A n m . 161. 104 So auch Schmidt-Rimpler, S. 230; Süß, S. 206 ff. E i n weiteres Argument, daß die Gegensätzlichkeit der beiden Rechtsinstitute aufzeigt, wurde bereits behandelt: Die Beweislast bei I r r t u m u n d Gewährleistung ist vollkommen verschieden (vgl. oben I I I , 2, b, ff.). 105 Vgl. Schmidt-Rimpler, S. 229. ίο« v g l . Flume , S. 134 u n d A T , § 24, 3 a; zustimmend Raape, S. 499. 102
5. Die Anfechtung gemäß § 119 I I
175
Rechtsinstitute Sachmängelhaftung — Irrtumsregelung sieht 1 0 7 , muß er Zuflucht nehmen zu der dogmatisch hier nicht nur fragwürdigen, sondern einfach unzutreffenden Annahme eines Verhältnisses von Grund- und Sondertatbestand 108 . Betrachtet man zusammenfassend Flumes Lehre vom geschäftlichen Eigenschaftsirrtum, so ergibt sich, daß Flume zunächst die Norm des § 119 I I entgegen der gesetzlichen Regelung auslegt, u m sie dann, weil die Rechtsfolgen auch i h m nicht vertretbar erscheinen, doch nicht anzuwenden. Flumes Lehre führt dazu, § 119 I I so auszulegen, daß er sinnlos ist. Sind Eigenschaften vereinbart, so greift, wenn dem Leistungsgegenstand eine vereinbarte Eigenschaft fehlt, grundsätzlich die Sachmängelhaftung ein. Das gilt auch für atypische Verträge, bei denen die Normen der §§ 459 ff. entsprechend gelten (vgl. § 493). Eine Anwendung des § 119 I I würde i n diesen Fällen immer ausscheiden. Nun kann eine Lehre nicht überzeugen, die eine Norm mittels einer zweifelhaften Konstruktion so auslegt, daß sie zu unbefriedigenden Ergebnissen führen muß, u m dann letztlich dieser Folge dadurch auszuweichen, daß sie die Norm mittels einer ebenso angreifbaren Überlegung für unanwendbar erklärt. Eine derartige Auslegung muß als „contra legem" bezeichnet werden. M i t der Lehre Flumes läßt sich die Rechtsnatur des § 119 I I nicht erfassen 109 . cc) Kritik
an der Ansicht der herrschenden Lehre
Auch gegen die Meinung der h. L., § 119 I I regele einen Fall des Motivirrtums, bestehen erhebliche Bedenken. Grundsätzlich ist der M o t i v i r r t u m unbeachtlich 110 . Das w i r d auch von der h. L. anerkannt 1 1 1 . Die Norm des § 119 I I sei jedoch — so meint die h. L. — eine Ausnahme von diesem Grundsatz. Diese Ansicht kann nicht überzeugen. Der § 119 I I wäre eine unverständliche Durchbrechung eines Grundprinzips, die keinerlei Rechtfertigung findet 1 1 2 . Als M o t i v i r r t u m wäre § 119 I I ein Fremdkörper innerhalb der Irrtumsregelung. Nun kann aber kein Zweifel bestehen, daß der Eigenschaftsirrtum i n gewissem Rahmen i n gleicher Weise Beachtung verdienen muß, wie ein sonstiger Irrtum, so daß die Norm 107
Flume , S. 133. Vgl. oben unter b. 109 w e i t e r e Argumente gegen die Ansicht von Flume finden sich i n A n m . 117. 110 Staudinger / Coing, § 119 Rdz 52; Schmidt-Rimpler, S. 225; Lehmann/ Hübner, § 34 I I I 1 e; Flume, S. 87 u n d A T , § 24, 2 b ; Mot. I, S. 119 und Prot. I, S. 114. 111 Larenz, A T , § 20 I I b. 112 Vgl. Schmidt-Rimpler, S. 225. 108
176
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen
zu Recht besteht. So w i r d i n den Protokollen 1 1 3 einleuchtend ausgeführt, daß ein auf einem Eigenschaftsirrtum beruhendes Geschäft nicht selten nachteiliger sei, als ein Geschäft, bei dem sich der Erklärende über den Geschäftsgegenstand selbst irre. Die Nichtberücksichtigung eines Irrtums über Eigenschaften der Person oder der Sache werde den Bedürfnissen des Verkehrs, der Billigkeit und dem Zuge der modernen Rechtsentwicklung nicht gerecht. Die Annahme, daß eine derartig wichtige und inhaltlich berechtigte Regelung nur unter Durchbrechung des gesetzlichen Systems möglich und auch so erfolgt sein soll, muß daher befremden. Sicherlich fehlte dem Gesetzgeber die letzte Klarheit bei der Normierung des § 119 I I 1 1 4 . Insbesondere stellte der Gesetzgeber für die gesamte Irrtumsregelung des § 119 die psychologische Frage dahin 1 1 5 . Aber daß es sich i n § 119 I und § 119 I I u m i m wesentlichen gleichgeartete Fälle des Irrtums handelt, erschien nicht zweifelhaft. Das zeigt einmal die Bezugnahme des § 119 I I auf § 119 I und zum anderen die Formulierung „Als I r r t u m über den Inhalt der Erklärung gilt auch . . . " . Die von der h. L. vorgenommene, dem § 119 I entgegengesetzte Auslegung des § 119 I I kann daher nicht befriedigen. Geht man der Frage nach, warum § 119 I I gegenüber § 119 I besonders normiert wurde, so findet man als Grund hierfür die Unsicherheit des Gesetzgebers, ob die Eigenschaften einer Sache awch zum Inhalt eines Geschäftes gehören 116. Der Gesetzgeber hätte also den Eigenschaftsirrtum nicht einmal besonders normiert, sondern dafür die Regelung des § 119 I als ausreichend angesehen, wenn er sich dessen sicher gewesen wäre, was w i r i n dieser Abhandlung vertreten, nämlich, daß die Eigenschaft einer Sache zum Inhalt des Geschäfts gehört. Aus dieser Überlegung aber folgt zwingend, daß § 119 I I keine andere Rechtsnatur haben kann als § 119 I. Regelt § 119 I keinen Motivirrtum, so kann auch § 119 I I keinen M o t i v i r r t u m regeln. 113
Prot. I, S. 114. 114 v g l , Enneccerus / Nipperdey, § 168 I. Vgl. Prot. I, S. 108: „Es empfehle sich daher, eine Ausdrucksweise zu wählen, durch welche der i m wesentlichen psychologischen Frage, ob allgemein von Nichtübereinstimn .ung des Willens m i t der Erlärung i n Folge I r r tums, i m Gegensatz zum I r r t u m i m Beweggrunde, gesprochen werden könne, oder ob es sich nicht vielmehr immer n u r u m einen I r r t u m i m Beweggrunde handele, nicht vorzugreifen u n d der Wissenschaft freie H a n d zu lassen." ne v g l Prot. I, S. 114: „Solle aber hiernach der i n Rede stehende (Anm.: Eigenschafts-)Irrtum als Anfechtungsgrund Beachtung finden, so empfehle es sich, dies i m Gesetz zum Ausdruck zu bringen, denn wenn nach den gefaßten Beschlüssen der I r r t u m über den „ I n h a l t " der Willenserklärung als beachtlich bezeichnet werde, so sei die Auslegung nicht ausgeschlossen, daß hierunter der I r r t u m über Eigenschaften, als bloßer I r r t u m i m Beweggrunde, nicht falle." 115
5. Die Anfechtung gemäß § 119 I I
177
Die h. L. hat erhebliche Schwierigkeiten m i t der Anwendung des § 119 I I . Diese resultieren zum großen Teil aus dem Verständnis des § 119 I I als Motivirrtum. Das Motiv ist etwas rein Subjektives, das nichts m i t dem Geschäftsinhalt zu tun hat. N u n kann nicht jedes Motiv berücksichtigt werden, w e i l das das Ende des Vertragsrechts wäre. Trotzdem ist für den Erklärenden jedes Motiv so gut wie ein anderes, so daß kein Grund für eine besondere Behandlung bestimmter M o t i v gruppen besteht. Das Problem, vor dem die h. L. steht, w i r d offensichtlich, wenn man die Regelung des § 119 I I i m einzelnen untersucht. Der § 119 I I läßt die Anfechtung zu bei einem I r r t u m über verkehrswesentliche Eigenschaften. Der Begriff verkehrswesentlich kann nur objektiv verstanden werden 1 1 7 , eine subjektive Auslegung würde den Wortsinn ins Gegenteil verkehren. Damit aber steht dem subjektiven Moment des Motivs das objektive Moment der Verkehrs wesentlichkeit gegenüber. Aus diesem „Gegenüber" rühren die Schwierigkeiten her, die die h. L. bei Anwendung des § 119 I I hat. A u f der einen Seite erscheint es nur sinnvoll, eine Anfechtung bezüglich von Eigenschaften zuzulassen, die für die Erklärung motivierend waren, auf der anderen Seite sind gemäß § 119 I I nur Verkehrs wesentliche Eigenschaften maßgeblich. Das subjektive und das objektive Moment müßten i n gleicher Weise berücksichtigt werden, was jedoch daran scheitert, daß es sich um entgegengesetzte Kräfte handelt, so daß die h. L. vor einem weitgehend unlösbaren Problem steht. Nur wenn beide Bereiche zusammenfallen, wenn also eine verkehrswesentliche Eigenschaft für den Erklärenden motivierend war, ist die Anwendung des § 119 I I für die h. L. problemlos. Alle übrigen Fälle müssen Schwierigkeiten bereiten. Für die h. L. t r i f f t daher i n besonderem Maße die Behauptung Flumes zu, daß das Problem des Eigenschaftsirrtums seine Beschränkung sei 1 1 8 . Das objektive Merkmal „verkehrswesentlich" spricht dagegen, daß § 119 I I einen M o t i v i r r t u m behandet, denn es ist nicht eineuchtend, daß 117 Vgl. Schmidt-Rimpler, S. 223; Soergel / Siebert ί Hefermehl, § 119 Bern. 31; a. A. Flume, S. 133; Kegel, S. 360; Staudinger / Coing, § 119 Rdz 18; Enneccerus / Nipperdey, § 168 I I 2. Die Vertreter der Gegenmeinung sind alle Anhänger der von uns abgelehnten Lehre v o m geschäftlichen Eigenschaftsi r r t u m . Diese Ansicht muß zwangsläufig den Begriff „verkehrswesentlich" subjektivieren, denn n u r der I r r t u m hinsichtlich vereinbarter Eigenschaften soll gemäß § 119 I I zur Anfechtung berechtigen. A u f diese Weise gelingt Flume u n d der i h m folgenden L i t e r a t u r die Deckung des Begriffs „verkehrswesentliche Eigenschaft" m i t dem Begriff „Fehler". Dadurch erreicht Flume, indem er die Sachmängelhaftung als Spezialregelung erklärt, daß er § 119 I I nicht anwenden muß. A u c h hier zeigt sich, daß Flume gegen den eindeutigen Wortlaut des Gesetzes verstoßen muß, u m der A n w e n d u n g der von i h m selbst zunächst unzutreffend ausgelegten N o r m des § 119 I I zu entgehen. (Vgl. dazu V I , 5 c, bb). 118 Vgl. Flume, S. 83; Staudinger / Coing, § 119 Rdz 15.
12 Herberger
178
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen
eine Norm, die subjektive Umstände berücksichtigen w i l l , auf objektive Kriterien abstellt. Da h i l f t auch nicht die Annahme, das Gesetz unterstelle verkehrswesentliche Eigenschaften als Motiv der Erklärung. Die Aufgabe des § 119 I I bestünde dann darin, i n dieser Hinsicht dem Erklärenden den Beweis zu ersparen. Das würde aber bedeuten, daß der M o t i v i r r t u m grundsätzlich beachtlich wäre, nur müßte der Erklärende i m Gegensatz zu § 119 I I dafür den Beweis erbringen, daß das angeführte Motiv für den Geschäftsabschluß bestimmend war. Dieses Ergebnis würde der Überlegung Rechnung tragen, daß jedes erklärungsbestimmende Motiv i n gleicher Weise Beachtung finden muß. Eine solche Annahme würde jedoch eindeutig dem gesetzgeberischen Ziel widersprechen. Betrachtet man die Formulierung des Gesetzes „Als I r r t u m über den Inhalt der Erklärung gilt auch der I r r t u m . . s o kann dies nur so verstanden werden, daß etwas von der Grundwertung her gleiches gleich behandelt werden s o l l 1 1 9 ' 1 2 0 . Das Gesetz würde danach i n § 119 I I von dem Prinzip, daß der M o t i v i r r t u m unbeachtlich ist, abweichen, w e i l der Fall, daß das Motiv gerade i n einer verkehrswesentlichen Eigenschaft des Leistungsgegenstandes besteht, von der Grundwertung her dem I r r t u m nach § 119 I näher steht als dem Motivirrtum. Eine solche besondere Bewertung des Eigenschaftsirrtums gegenüber dem „normalen" M o t i v i r r t u m läßt sich jedoch i n keiner Weise rechtfertigen 121 . Das stärkste Argument gegen die h. L., das i n gleicher Weise auch gegenüber der Ansicht Flumes zutrifft, ergibt sich aus folgenden Überlegungen. Sowohl F l u m e 1 2 2 wie auch die h. L. sehen i n § 119 I I den Fall geregelt, daß die Sache nicht die Eigenschaften hat, die der Erklärende ihr zuschreibt. Der Erklärende befindet sich i n einem I r r t u m bezüglich des „Seins der Sache". Der Erklärungswille und der objektive Erklärungstatbestand stimmen vollkommen überein, die Sache ist jedoch anders als der Erklärende es sich vorstellte. Der Unterschied zwischen der h. L. und der Lehre Flumes besteht nur darin, daß die h. L. den § 119 I I schon anwendet, wenn rücksichtlich verkehrswesentlicher Eigenschaften die Sache nicht der Vorstellung des Erklärenden entspricht, während Flume zusätzlich noch verlangt, daß es zu einer Vereinbarung über die vorgestellten Eigenschaften gekommen ist. Das ändert jedoch nichts daran, daß beide Ansichten auf einen „Seinsirrtum" abstellen, auf die 119
So auch Prot. I, S. 114. Schmidt-Rimpler, S. 226. 121 Ebenso Schmidt-Rimpler, S. 226. 122 V g l > plume, S. 132 ff., 134; Raape, S. 499 ff.; Staudinger / Coing, § 119, Rdz 1 b, 15. Coing spricht von einem Realitäts- oder Wirklichkeitsirrtum. 120
5. Die Anfechtung gemäß § 119 I I
179
irrige Vorstellung des Erklärenden von der Wirklichkeit. Daß eine solche Auslegung des § 119 I I nicht den Kern der Sache trifft, soll ein Beispiel verdeutlichen: Jemand schließt einen Kaufvertrag über ein bestimmtes Pferd ab. Er geht dabei irrtümlich davon aus, daß das Pferd ein Reitpferd ist. Dementsprechend w i r d auch der Vertrag über „dieses Reitpferd" geschlossen. Ganz offensichtlich hat sich der Käufer über Eigenschaften des Pferdes, über das Sein der Kaufsache geirrt. Sowohl nach h. L. wie nach der Ansicht Flumes liegt hier ein F a l l des § 119 I I vor. W i r d nun das Pferd bis zum Übergabetermin eingeritten, so erhält der Käufer zwar, was er haben wollte und was i h m nach dem Vertrag auch gebührt, das kann jedoch nichts daran ändern, daß er sich bei Abgabe der Erklärung i n einem Seinsirrtum befand. Die Tatsache, daß das Pferd nachträglich die vereinbarte Eigenschaft erwarb, kann den einmal vorgelegenen I r r t u m nicht mehr beseitigen. Die Folge wäre, sieht man einmal von der Konkurrenzfrage m i t den §§ 459 ff. ab, daß der Käufer den Vertrag gemäß § 119 I I anfechten könnte, obwohl er das erhält, was er erhalten wollte. Der § 119 I 2. HS vermag hier nicht zu helfen, weil er für die Frage der Anfechtbarkeit auf die Zeit des Irrtums abstellt 1 2 3 , nicht auf einen späteren Zeitpunkt. Bezieht man die Frage der Konkurrenz zu §§ 459 ff. m i t i n die Betrachtung ein 1 2 4 , so ist das Ergebnis i n keiner Weise befriedigender. Nach h. L. ist § 119 I I vor Gefahrübergang ohne weiteres anwendbar. Der Käufer könnte also anfechten, selbst wenn offensichtlich ist, daß der Verkäufer das Pferd bis zum Zeitpunkt der vorgesehenen Übergabe eingeritten haben wird, er könnte anfechten, obwohl feststeht, daß er erhalten wird, was er erhalten wollte. Das Beispiel zeigt, daß das zur Anfechtung berechtigende K r i t e r i u m nicht darin gefunden werden kann, daß die Sache i n verkehrswesentlichen Eigenschaften von der Vorstellung des Käufers bzw. der Vereinbarung abweicht. Ziel und Zweck der Anfechtung ist, die Willenserklärung zu beseitigen, weil sie, so wie sie nach außen in Erscheinung trat, nicht gewollt war. Die Fehlerquelle, der Tatbestand, auf den das Gesetz reagiert, muß i n dem Verhältnis Wille — objektiver Erklärungstatbestand stecken. Nur i n diesem Fall ist die Anfechtung das geeignete Mittel, die eingetretene Störung aufzulösen. Liegt die Fehlerquelle außerhalb der Beziehung Wille — Erklärung, etwa darin, daß die Sache 123
Vgl. § 119 I 2 . . . abgegeben haben würde. Ausdrücklich muß darauf hingewiesen werden, daß regelmäßig die Konkurrenzfrage nicht geeignet ist, die Auslegung einer N o r m zu erleichtern. Oft w i r d eine unzutreffende Interpretation, wie das Beispiel Flumes zeigt, gerade dadurch verdeckt, daß die N o r m infolge einer angenommenen Konkurrenz nicht angewendet w i r d . 124
1
180
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen
andere Eigenschaften hat, als der Erklärende annimmt, so ist die A n fechtung kein geeignetes Mittel, die Störung zu beheben. Das Problem w i r d m i t der Anfechtung nur scheinbar gelöst, indem einfach der Bezugspunkt, der Vertrag, beseitigt wird, nicht aber die Störung ausgeglichen wird. Soll der Verkäufer dieses Reitpferd leisten, so ist die Erwartung des Käufers berechtigterweise auf ein Pferd gerichtet, das zum Reiten geeignet ist. Der Vertrag geht über „dieses Reitpferd". Die Vereinbarung selbst ist i n Ordnung. Hier bedarf es keiner Korrektur durch Anfechtung. Die Vereinbarung entspricht dem Willen des Käufers, so daß i n dieser Hinsicht eine gesetzliche Sanktion überflüssig ist. Die Störung liegt darin, daß der Käufer nicht das erhält bzw. erhalten kann, was er sich erhofft und worauf er nach dem Vertrag einen Anspruch hatte. Dieses Problem kann aber sinnvoll nicht durch die Beseitigung der Willenserklärung gelöst werden, sondern nur durch die Anordnung einer Haftung, wie sie die §§ 459 ff. vorsehen. Die eigentliche Störung des Vertrages, das Abweichen der Sache von der Vereinbarung und die daraus resultierende Beeinträchtigung des Käuferinteresses, w i r d m i t der Anfechtung der Erklärung nicht beseitigt. Es ist möglich, daß die Beeinträchtigung i n Wegfall kommt, wenn etwa i n unserem Beispiel das Pferd durch Einreiten zu einem Reitpferd wird. Bei dieser Sachlage dürfte keine gesetzliche Sanktion mehr anstehen. Wenn trotzdem nach h. L. eine Anfechtung möglich ist, so zeigt das, daß die Auslegung des § 119 I I fehlgeht. Das Sein einer Sache ist nicht Gegenstand des Willens, deshalb kann das Problem des Seinsirrtums nicht dadurch gelöst werden, daß die Willenserklärung mittels Anfechtung beseitigt wird. Die Frage nach dem Sein einer Sache, insbesondere nach der berechtigten oder unberechtigten Leistungserwartung bezüglich eines bestimmten Seins, gehört zum Themenkreis der Erfüllung 1 2 5 , so daß man der Ansicht Flumes, § 119 I I sei eine Nichterfüllungsregelung, zustimmen muß, wenn man den Eigenschaftsirrtum des § 119 I I als Seinsirrtum begreift. Daß eine derartige Annahme der gesetzlichen Regelung genau zuwiderläuft, wurde bereits ausgeführt. Es kann insoweit darauf verwiesen werden 1 2 6 . 125 So schon Krückmann, A c P 101, 396. U n t e r dem Gesichtspunkt der berechtigten bzw. unberechtigten Leistungserwartung versucht Süß, S. 206 ff. das Konkurrenzproblem, § 119 I I — §§ 459 ff. zu lösen. W e n n er § 119 I I dann f ü r anwendbar hält, w e n n der Käufer die Eigenschaft nicht erwarten durfte, u n d §§ 459 ff., w e n n der Käufer die Eigenschaft erwarten durfte, so k o m m t Süß der Lösung des Problems sehr nahe. Es fehlt n u r noch die Erkenntnis, w a r u m der Käufer i n dem einen F a l l berechtigt ist etwas zu erwarten, i n dem anderen F a l l dagegen nicht. N u r w e i l Süß eine Eigenschaftsvereinbar u n g beim Spezieskauf nicht für möglich hält, findet er die Lösung nicht. Die Lösung liegt i n der Vereinbarung begründet. Vgl. dazu weiter i m Text. 126 Vgl. oben V I , 5, c, bb.
5. Die Anfechtung gemäß § 119 I I
181
I n den §§ 116 ff. geht es gerade nicht u m das Problem der mangelhaften Erfüllung, sondern u m das Problem der fehlerhaften Erklärung. I n diesem Zusammenhang, insbesondere i m Zusammenhang mit § 119 I, auf den § 119 I I ausdrücklich Bezug nimmt, kann § 119 I I nur den Fall regeln, daß Wille und Erklärung auseinanderfallen. Analysiert man die h. L., so findet sich die Ursache für die von ihr vertretene Ansicht darin, daß sie beim Spezieskauf eine Vereinbarung über Eigenschaften mit der Folge, daß diese Gegenstand der Schuld werden, nicht für möglich hält. Eigenschaften werden nach dieser A n sicht nur so weit Vertragsbestandteil, als ihre Angabe zum Zwecke der Individualisierung erforderlich ist, etwa u m eine abwesende Sache zu kennzeichnen 127 . Da eine abwesende Sache nicht durch ein dies allein gekennzeichnet werden kann, bedarf es der Umschreibung der Sache m i t Hilfe von Eigenschaftsangaben. Hat z.B. jemand mehrere Uhren, darunter auch mehrere goldene Uhren, so bedarf es zur Identifizierung etwa folgender Erklärung: „Ich kaufe die goldene U h r m i t dem gravierten Sprungdeckel und dem Schlagwerk." Ohne die Eigenschaftsangaben wäre eine Identifizierung des Schuldgegenstandes nicht möglich. Die h. L. betrachtet nun diese Eigenschafts angaben nur als Angaben zum Zwecke der Identitätsbestimmung des Schuldgegenstandes, nicht aber als schuldrechtliche Vereinbarung i n dem Sinne, daß die einwandfrei identifizierte Uhr mit den genannten Eigenschaften geschuldet ist. Daraus resultiert, daß die h. L. die Eigenschaftsangaben nur dann als Vertragsbestandteile behandelt, wenn sie zur Identitätsbestimmung erforderlich sind. Unter diesem Aspekt gesehen, bringen alle Eigenschaftsangaben, die keine Identifizierungsfunktion haben, nur eine Vorstellung des Erklärenden von der Sache zum Ausdruck. Dementsprechend kann der I r r t u m über diese Eigenschaften auch nur als I r r t u m über das Sein der Sache auftreten. Daraus erklärt sich, wie es zu der unzutreffenden Auslegung des § 119 I I kommen konnte. Zu welchen befremdlichen Ergebnissen die Ansicht der h. L. führt, zeigt sich daran, daß hinsichtlich identitätsbestimmender Eigenschaften, die auch nach h. L. Vertragsbestandteile sind, eine Anfechtung gemäß § 119 I möglich ist 1 2 8 , während für sonstige Eigenschaften nur § 119 I I i n Betracht kommt. N u n kann es keinen Unterschied machen, ob der Vertragsgegenstand anwesend ist oder abwesend. Der Käufer w i l l i n beiden Fällen den Gegenstand m i t den angegebenen Eigenschaften. Der Fehler der h. L. besteht darin, daß sie der Eigenschaftserklärung nur 127 Vgl. dazu grundlegend Mohnen, S. 51 ff.; Lehmann / Hübner, § 34 I I I 1 e; Larenz, A T , § 20 I I b. 128 Vgl. Mohnen, S. 54; Larenz, A T , § 20 I I b ; Lehmann / Hübner, § 34 I I I 1 e.
182
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen
eine identifizierende Funktion zuweist. Wer erklärt „Ich kaufe diese goldene U h r " oder „Ich kaufe die goldene Uhr m i t dem Schlagwerk", der w i l l m i t der Eigenschaftsangabe regelmäßig nicht nur die Identität des Schuldgegenstandes festlegen, er w i l l die Verpflichtung des Vertragspartners hinsichtlich dieser Eigenschaften. Diese zweite Funktion der Eigenschaftserklärung w i r d von der h. L. deshalb nicht gesehen, w e i l sie unter Zugrundelegung der Hypothese Zitelmanns, ein Sein könne nicht gewollt werden, eine Verpflichtung zur Leistung der Sache m i t bestimmten Eigenschaften negiert. Nun wurde oben unter Widerlegung der Lehre Zitelmanns bereits festgestellt 129 , daß die Parteien vereinbaren können, welche Eigenschaften die Sache haben soll. Daraus folgt, daß der Eigenschaftserklärung nicht nur eine identifizierende Aussage über das Sein der Sache zukommt, sondern regelmäßig auch eine Aussage über das gesollte Sein der Sache, über die Verpflichtung des Vertragspartners. Hat man aber erst einmal erkannt, daß die Erklärungen der Parteien auf ein Sein-sollen, auf eine Verpflichtung zur Leistung der Sache m i t bestimmten Eigenschaften gerichtet sind, so ergeben sich für die Auslegung und Anwendung des § 119 I I vollkommen andere Gesichtspunkte, die die Norm plötzlich nicht mehr so ungereimt erscheinen lassen. Kann der Käufer die Eigenschaften, die er der Kaufsache zuschreibt, m i t dem Verkäufer vereinbaren, so daß dieser zur Leistung der Sache m i t den Eigenschaften verpflichtet wird, so werden diese Eigenschaften i m Falle einer Vereinbarung zum Geschäftsinhalt. Für § 119 I I bedeutet das, daß der Eigenschaftsirrtum nicht mehr als M o t i v i r r t u m eingestuft werden kann 1 8 0 . Das Motiv ist niemals Geschäftsinhalt 131 . Wer § 119 I I als M o t i v i r r t u m ansieht, muß die Norm anwenden, wenn die Sache anders ist, als der Erklärende sie sich vorgestellt hat. I n keiner anderen Richtung nämlich läßt sich sonst ein Irrtum, eine Divergenz von Vorstellung und Wirklichkeit feststellen, denn Wille und Erklärung decken sich nach dieser Ansicht. Der I r r t u m kann nur darin gefunden werden, daß der Erklärende sich i r r i g Vorstellungen von dem Sein der Sache gemacht hat, daß er sich i n einem Seinsirrtum befindet. Die Annahme, § 119 I I regele einen F a l l des Motivirrtums, hat also notwen129
Vgl. oben I I I , 3, e u n d I V , 1. So auch Staudinger / Coing, § 119 Rdz 16. Interessant ist i n diesem Zusammenhang die auf R G 64, 269 Bezug nehmende Entscheidung B G H 16, 54, 57. Dort ist der Versuch gemacht, § 119 I I gegenüber §§ 459 ff. abzugrenzen, indem § 119 I I n u r herangezogen w i r d , w e n n keine Zusicherung vorliegt. Der § 119 I I k a n n danach n u r angewendet werden, w e n n der Verkäufer keine Verpflichtung hinsichtlich der Eigenschaften eingegangen ist, w e n n also die Eigenschaften der Sache f ü r die E r k l ä r u n g n u r ein M o t i v abgaben. Die Entscheidung ist letztlich i n sich nicht schlüssig. Vgl. dazu weiter i m Text. 130
131
5. Die Anfechtung gemäß § 119 I I
183
digerweise zur Folge, daß § 119 I I immer dann Anwendung finden muß, wenn ein Seinsirrtum vorliegt. Nun ist ein solcher I r r t u m über das Sein der Sache unabhängig von dem Umstand, ob die Parteien die i n Frage stehende Eigenschaft zum Gegenstand der vertraglichen Pflicht gemacht haben oder nicht. Ein Seinsirrtum ist also auch dann möglich, wenn die Parteien die Eigenschaft, um die es geht, vereinbaren. Hält der Käufer das Pferd irrtümlich für ein Reitpferd, so vermag die Tatsache, daß der Vertrag über „dieses Reitpferd" geht, nichts an dem Seinsirrtum des Käufers zu ändern. Nach h. L. müßte daher § 119 I I eingreifen 132 . Nun haben die Parteien die Geeignetheit des Pferdes zum Reiten zum Geschäftsinhalt erhoben, so daß diese Eigenschaft nicht mehr nur als Motiv der Erklärung angesehen werden kann. Das hat zur Folge, daß § 119 II, legt man ihn als M o t i v i r r t u m aus, zur Anwendung kommt, obwohl es nicht mehr allein u m ein Motiv der Vertragserklärung geht, sondern u m das Abweichen der Sache vom Geschäftsinhalt. Zusammengefaßt ergibt sich folgende Gedankenkette. Behandelt man § 119 I I als Motivirrtum, so findet die Norm i n den Fällen des Seinsirrtums Anwendung. Ein Seinsirrtum kann aber auch vorliegen, wenn die Eigenschaft, u m die es geht, von den Parteien vereinbart wurde, die Eigenschaft also nicht mehr nur Motiv der Erklärung ist. I n diesen Fällen nun kann von einem M o t i v i r r t u m keine Rede mehr sein, obwohl tatsächlich ein Seinsirrtum vorliegt und damit nach h. L. § 119 I I zur Anwendung kommen müßte. Das aber hat zur Konsequenz, daß § 119 I I kein M o t i v i r r t u m sein kann 1 3 3 . Räumt man überhaupt die Möglichkeit einer Eigenschaftsvereinbarung ein, so führt die Qualifizierung des § 119 I I als M o t i v i r r t u m — also auf den Seinsirrtum ausgerichtet — notwendigerweise dazu, daß die Norm vielfach dann Anwendung findet, wenn die Eigenschaft gar nicht mehr unter dem Gesichtspunkt des Motivs Berücksichtigung finden kann, w e i l die Parteien die Eigenschaft zum Geschäftsinhalt erhoben haben. Hält man Vereinbarungen über 132 Oben wurde sogar festgestellt, daß § 119 I I nach h. L . selbst dann noch zur Anwendung käme, w e n n die Sache bis zur Übergabe die vereinbarte Eigenschaft erlangt, etwa, w e n n das Pferd eingeritten w i r d . 133 Die Lehre Flumes basiert letztlich auf der gleichen Erkenntnis, w e n n gleich Flume daraus Konsequenzen zieht, die w i r nicht akzeptieren können. Flume sieht wie die h. L. i n § 119 I I die Regelung eines Seinsirrtums (Raape, S. 499 bezeichnet diese A r t des I r r t u m s als „ I r r t u m über die Istbeschaffenheit"). Flume erkennt jedoch, daß § 119 I I als M o t i v i r r t u m i n der dargelegten Weise widersprüchlich ist. Deshalb begrenzt er die Anwendung des § 119 I I auf den Fall, daß die i r r i g vorgestellte Eigenschaft auch vereinbart wurde u n d entgeht dadurch der Widersprüchlichkeit, der die h. L. unterliegt. Flume hat also zwar die Schwäche der h. L. erkannt, muß jedoch zu unzutreffenden Folgerungen gelangen, w e i l er an der Hypothese festhält, daß es beim Eigenschaftsirrtum u m eine Divergenz von vorgestelltem u n d w i r k l i c h e m Sein geht. Siehe darüber weiter i m Text.
184
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen
Eigenschaften generell für möglich, so kann § 119 I I nicht mehr als M o t i v i r r t u m angesehen werden. Daraus ergibt sich, daß die Norm nicht mehr zwangsläufig unter dem Blickwinkel des Seinsirrtums betrachtet werden muß. Der Weg ist frei für ein neues Verständnis des § 119 I I . dd) Darstellung der eigenen Ansicht über die Rechtsnatur des Eigenschaftsirrtums Die §§ 116 ff. behandeln das Problem der fehlerhaften Willenserklärung. Dementsprechend geht es darum, ob ein beachtliches Abweichen des inneren Tatbestandes, des Willens, von der Erklärung vorliegt, wobei die Frage dahingestellt bleiben kann, ob es sich dabei i n den einzelnen Normen u m das Fehlen des Erklärungsbewußtseins oder des Geschäftswillens handelt 1 3 4 . Die vom Gesetz vorgesehenen Rechtsfolgen entsprechen der Problemstellung. Es geht immer u m die Frage, ob der objektiv i n Erscheinung getretene Erklärungstatbestand angesichts des Willensmangels Bestand haben soll oder nicht. Unter diesem Aspekt betrachtet kann § 119 I I auch nur einen F a l l der Nichtübereinstimmung von Wille und Erklärung regeln. Erstreckt ein I r r t u m sich auf Umstände, die das Verhältnis Wille — Erklärung nicht berühren, und damit die Übereinstimmung von subjektivem und objektivem Tatbestand nicht aufheben, so kann § 119 I I , ebenso wie § 119 I, keine Anwendung finden. Unter dem Begriff des Eigenschaftsirrtums lassen sich zwei Fälle erfassen, die jedoch beide den gemeinsamen Ausgangspunkt haben, daß der innere Tatbestand, der Wille, und der äußere Tatbestand, die Erklärung, nicht übereinstimmen. 1. Da der Käufer m i t dem Verkäufer vereinbaren kann, welche Eigenschaften die Kaufsache haben soll, so kann es vorkommen, daß einer der Parteien bei der Erklärung ein I r r t u m unterläuft. Der Käufer verspricht sich, er sagt z. B. aus Versehen statt golden vergoldet oder er verwendet i n Unkenntnis der Begriffsbedeutung den Begriff vergoldet, obwohl er golden sagen w i l l . I n diesen Fällen i r r t sich der Käufer bei der bewußten und gezielten Abgabe einer Eigenschaftserklärung über das, was er objektiv erklärt hat, er unterliegt einem Inhaltsirrtum oder einem Irrtum in der Erklärungshandlung bei Abgabe einer auf eine Eigenschaft bezogenen Erklärung. Weil der I r r t u m dem Erklärenden bei einer Erklärung 134 Vgl. Lehmann / Hübner, § 24 IV. Die Frage ist i m einzelnen strittig. So leugnet z. B. Larenz, A T , § 19 I I I weitgehend die Erheblichkeit des E r k l ä rungsbewußtseins.
5. Die Anfechtung gemäß § 119 I I
185
unterläuft, die auf Festlegung der geschuldeten, der gesollten Eigenschaften zielt, w i r d hier von einem „Irrtum über die Sollbeschaffenheit" gesprochen 135 . Flume und die h. L., soweit sie eine Eigenschaftsvereinbarung für möglich h ä l t 1 3 6 , wenden auf derartige Fälle § 119 I an 1 3 7 . Eine Anwendung des § 119 I I kann weder für Flume noch für die h. L. i n Erwägung kommen, da § 119 I I nach diesen Ansichten den Seinsirrtum regelt, nicht aber einen echten Erklärungsirrtum, wie er bei einem I r r t u m über die Sollbeschaffenheit vorliegt. Vertritt man m i t uns die Meinung, daß § 119 II nur ein besonderer Fall des §1191 ist, daß § 119 I I also wie § 119 I nur den F a l l einer fehlerhaften Willenserklärung normiert, so ist es von der Systematik her nicht erheblich, ob man den I r r t u m über die Sollbeschaffenheit unter § 119 I zieht oder unter § 119 II. Praktische Bedeutung hat die Frage nur insoweit, als eine Anfechtung, zieht man den Fall unter § 119 II, nur bei einem I r r t u m hinsichtlich verkehrswesentlicher Eigenschaften i n Betracht kommt. Gerade i m Hinblick auf diesen Umstand jedoch erscheint es angebracht, § 119 I I und nicht § 119 I anzuwendender § 119 I I ist eine vom Gesetz besonders vorgesehene Regelung, die nicht allein dem noch zu behandelnden besonderen Fall des auf einem Seinsirrtum beruhenden Erklärungsirrtums vorbehalten werden kann 1 3 8 . Der § 119 I läßt die Anfechtung auch nur bei einem I r r t u m hinsichtlich wesentlicher Vertragsbestandteile zu. Nicht jeder beliebige I r r t u m soll zur Vertragsaufhebung führen. I m Zusammenhang gesehen bringt § 119 I I nur eine Präzisierung dieses bereits i n § 119 I enthaltenen Gedankens, so daß es berechtigt erscheint, auf den Eigenschaftsirrtum generell, also auch auf den I r r t u m über die Sollbeschaffenheit, § 119 I I zur Anwendung zu bringen 1 3 9 . 2. Der zweite durch § 119 I I geregelte Fall ist der, daß der Erklärende sich über den Inhalt seiner Erklärung i n der A r t irrt, daß er glaubt, 135
Vgl. Raape, S. 493 f.; Staudinger / Ostler, vor § 459 Rdz 16 a. Vgl. oben I I I , 3 u n d I V , 1. Vgl. Flume , S. 104 ff.; Raape, S. 493 f.; Staudinger / Ostler, vor § 459 Rdz 16 a; Soergel / Siebert / Hefermehl, § 119 Bern. 20, 30; Enneccerus / Nipperdey , § 167 I V 3 u n d § 168 I. Kuhn, i n R G R K , § 459 A n m . 36 läßt die Anfechtung ohne besondere Stellungnahme zu, ob § 119 I oder I I zur Anwendung kommt. Da K u h n diesen F a l l jedoch i m Zusammenhang m i t der Konkurrenzfrage § 119 I I — §§ 459 ff. behandelt, liegt die V e r m u t u n g nahe, daß an eine A n wendung des § 119 I I gedacht ist. 138 A. A. Schmidt-Rimpler, S. 220 ff., der § 119 I I n u r als spezielle Regelung für den i m folgenden unter 2. behandelten F a l l ansieht, hingegen auf den dargestellten F a l l § 119 I anwendet. 139 So schon Kohler I, § 227, S. 506 u n d dort F N 1; Staudinger / Riezler, 9. Aufl., § 119 A n m . I I I zu 4. A a; ähnlich w o h l auch Lehmann / Hübner, § 34 I I I 1 e. 136
137
186
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen
er h ä t t e m i t seiner E r k l ä r u n g d e n V e r t r a g s g e g n e r z u r L e i s t u n g d e r Sache m i t b e s t i m m t e n E i g e n s c h a f t e n v e r p f l i c h t e t , o b w o h l er g e n a u w e i ß , daß er k e i n e a u s d r ü c k l i c h e E r k l ä r u n g ü b e r die b e s t i m m t e n Eigenschaften abgegeben h a t . Es h a n d e l t sich h i e r b e i u m d e n F a l l , daß e i n Seinsirrtum als Erklärungsirrtum i n Erscheinung t r i t t 1 4 0 . Der Käufer
i s t fest d a v o n ü b e r z e u g t , daß das k o n k r e t e
Armband
g o l d e n ist. E r e r k l ä r t j e d o c h n u r , u n d i s t sich dessen auch v o l l b e w u ß t , „dieses A r m b a n d " z u k a u f e n . D e r U n t e r s c h i e d z u m ersten F a l l besteht d a r i n , daß sich der E r k l ä r e n d e keine
besondere
vollkommen darüber
i m klaren
ist,
E r k l ä r u n g ü b e r d i e Eigenschaft abgegeben z u haben.
E r i r r t sich also n i c h t b e i A b g a b e e i n e r E r k l ä r u n g , d i e speziell a u f eine Eigenschaft g e r i c h t e t ist. D e r K ä u f e r i r r t sich ü b e r das S e i n d e r Sache, er b e f i n d e t sich i n e i n e m S e i n s i r r t u m .
Unter
diesem
Gesichtspunkt
w i r d v o n d e r h. L . u n d , b e s c h r ä n k t a u f d e n F a l l , daß eine entsprechende V e r e i n b a r u n g v o r l i e g t , auch v o n F l u m e § 119 I I a n g e w a n d t . D e r Grund, den, daß der
daß § 119 II Anwendung findet, ist jedoch darin zu finSeinsirrtum zu einem Erklärungsirrtum führt 141. Nicht
140 Vgl. Schmidt-Rimpler, S. 220; Soergel / Siebert ! Hefermehl, § 119 Bern. 30. Schon Adler, ZHR 75, 463 ff. unterschied den Seinsirrtum von dem I r r t u m über die Sollbeschaffenheit. Er fand jedoch, daß n u r beim I r r t u m über die Sollbeschaffenheit der Erklärende eigentlich schutzwürdig sei. Adler, S. 467 meint deshalb, § 119 I I könne bei einem Seinsirrtum n u r anwendbar sein, wenn die Parteien auch vereinbart hätten, daß die Sache die bestimmte Eigenschaft haben soll. A d l e r ist damit der eigentliche Begründer der Lehre, die Flume vertritt. 141 Als E r k l ä r u n g s i r r t u m w i r d der Eigenschaftsirrtum auch von der folgenden L i t e r a t u r angesehen: Schmidt-Rimpler, S. 220 ff.; Soergel! Siebert ! Hefermehl, § 119 Bern. 30; Palandt ! Heinrichs (früher ebenso kommentiert von Dankelmann), § 119 A n m . 4; schon Kohler I, § 227, S. 506; teilweise auch Erman I Westermann § 119 Rdz 7. Damit ist noch keine Aussage gemacht, u m welche Alternative des § 119 I es sich handelt. Darauf ist deswegen besonders hinzuweisen, w e i l bedauerlicherweise i n der L i t e r a t u r die Terminologie nicht einheitlich ist. Erklärungsirrtum i n dem hier vertretenen Sinn ist der I r r t u m , der darin besteht, daß der Erklärende objektiv eine andere E r k l ä rung abgibt, als er subjektiv als E r k l ä r u n g abgeben wollte. Beide A l t e r nativen des § 119 I sind Fälle des Erklärungsirrtums (so die zutreffende Terminologie; vgl. Enneccerus / Nipper dey, § 166 I I , § 167; Larenz, A T , § 20 I I a, S. 309; Flume, A T , § 23; Soergel I Siebert ! Hefermehl, vor § 116 Bern. 29). Demgegenüber findet sich bei einem Teil der L i t e r a t u r eine abweichende Terminologie, die die schon bestehenden Schwierigkeiten durch terminologische V e r w i r r u n g n u r noch steigert: Danach w i r d § 119 I, 2. A l t . (Versprechen, Verschreiben) als E r k l ä r u n g s i r r t u m bezeichnet (so etwa Erman! Westermann, § 119 Rdz 8; Krüger-Nieland, i n RGRK, § 119 A n m . 2; Medicus, § 6 I I I 1; Diederichsen, Der Allgemeine T e i l des B G B für Studienanfänger, 1969, S. 158, Nr. 381). Der Unterschied besteht darin, daß nach der hier verwendeten Terminologie der E r k l ä r u n g s i r r t u m ein Oberbegriff f ü r alle Fälle der Divergenz zwischen subjektivem u n d objektivem Erklärungstatbestand ist, während die genannte L i t e r a t u r darunter n u r die Fälle des I r r t u m s i n der Erklärungshandlung (§ 119 I, 2. Alt.) versteht. Wenn daher Palandt I Heinrichs, § 119 A n m . 4, den Eigenschaftsirrtum als I r r t u m über den Erklärungsinhalt (Inhaltsirrtum) nach § 119 I, 1. A l t . bezeichnet, so ent-
5. Die Anfechtung gemäß § 119 I I
187
weil er sich über das Sein der Sache geirrt hat, kann der Käufer anfechten, sondern weil er glaubte, eine Erklärung eines anderen Inhalts abzugeben 142 . Der Unterschied zur Lehre Flumes und zur h. L. ist damit offensichtlich. Nicht der Seinsirrtum ist entscheidend, sondern der Erklärung sir rtum, wobei die Besonderheit des Falls darin besteht, daß der Erklärungsirrtum auf einen Seinsirrtum zurückzuführen ist. Diese Behauptung bedarf einer näheren Erläuterung. M i t der Willenserklärung w i r d ein bestimmter Rechtsfolgewille zum Ausdruck gebracht; es soll eine entsprechende Verpflichtung des Vertragspartners herbeigeführt werden. Wer erklärt „Ich kaufe diesen goldenen Ring", der w i l l als Rechtsfolge, daß i h m der Verkäufer den speziellen Ring i n Gold leistet. N i m m t der Verkäufer an, so kommt ein Vertrag über „diesen goldenen Ring" zustande. Wille und objektiver Erklärungstatbestand auf Seiten des Käufers stimmen überein. Der Verkäufer wurde i n dem Umfang verpflichtet, i n dem der Käufer den Verkäufer verpflichten wollte. Nun genügt es für das Zustandekommen eines Vertrages, daß die Parteien sich über die Sache einigen, etwa über diesen Ring, über dieses Pferd etc. Jede Sache besitzt eine unüberschaubare Zahl von Eigenschaften, die die Parteien niemals alle aufführen können. Die Sache umschließt alle diese Eigenschaften. Die Eigenschaften sind integrierte Bestandteile der Sache. Dementsprechend ist der Bezeichnung der Sache die Bezeichnung aller ihrer Eigenschaften immanent 1 4 3 . Erstreckt sich daher der Rechtsfolgewille auf dieses Pferd, so umfaßt er auch die dem Pferd anhaftenden Eigenschaften; diese sollen auch Gegenstand der Verpflichtung sein. Ist z. B. das verkaufte Pferd ein Reitpferd, so erfüllt der Verkäufer, selbst wenn der Vertrag nur über „dieses Pferd" spricht das der hier vertretenen Ansicht, denn § 119 I, 1. A l t . ist ein F a l l des Erklärungsirrtums. N u r aus Gründen der besseren Verständlichkeit u n d m i t Rücksicht darauf, daß sich zwischen den beiden Alternativen des § 119 I nicht immer eine klare Grenze ziehen läßt (vgl. Erman / Westermann, § 119 Rdz 7; Medicus, § 6 I I I ) — was auch unschädlich ist, da beide gleich behandelt werden —, erfolgt die Subsumtion des Eigenschaftsirrtums nicht unter eine Alternative des § 119 I, sondern unter den Oberbegriff „ E r k l ä r u n g s i r r t u m " . 142 E i n beachtlicher I r r t u m liegt also nicht schon vor, w e n n das, was der Erklärende haben wollte, von dem E r k l ä r t e n abweicht, sondern n u r dann, w e n n der Erklärende etwas anderes erklärt hat, als er erklären wollte (so auch Schmidt-Rimpler, S. 219). Es macht einen Unterschied, ob jemand eine Sache m i t bestimmten Eigenschaften w i l l , dies aber nicht e r k l ä r t u n d seiner E r k l ä r u n g keinen darauf gerichteten I n h a l t zuschreibt, oder ob jemand seiner Erklärung einen derartigen Aussagewert beimißt (vgl. dazu auch unten bei d). 143 So schon Staudinger / Riezler, 9. Aufl., § 119 A n m . I I I zu 4. A a. Riezler k o m m t deshalb wie w i r zu dem Ergebnis, daß § 119 I I n u r eine Präzisierung des § 119 I darstellt. So auch schon Holder, § 119 A n m . 6 u n d Festschrift Bekker, S. 66 F N 3.
188
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen
geht, seine Verpflichtung nicht, wenn das Pferd bis zur Übergabe die Eigenschaften eines Reitpferdes verliert. Obwohl der Vertrag scheinbar nur über dieses Pferd geht, beinhaltet er doch mehr. Nach dem Vertrag ist das Pferd m i t all seinen bei Vertragsschluß vorhandenen wesentlichen Eigenschaften geschuldet, soweit sich nicht aus der Vereinbarung (stillschweigend oder konkludent) etwas abweichendes ergibt. Die Erklärung „dieses Pferd" schafft nicht nur die Verpflichtung zur Leistung der Sache i m jeweiligen Zustand, sondern sie bewirkt auch die Verpflichtung, die Sache m i t den bestimmten Eigenschaften zu leisten. Die auf eine Sache bezogene Willenserklärung erstreckt sich auch ohne ausdrückliche Erklärung auf die Eigenschaften der Sache. Geht nun der Erklärende i n fester Überzeugung davon aus, daß die Sache bestimmte Eigenschaften hat, so glaubt er, wenn er i n seine Erklärung nur die Bezeichnung der Sache aufnimmt und keine Eigenschaften besonders nennt, seine Erklärung beinhalte die vorgestellte Eigenschaft und verpflichte dementsprechend den Vertragspartner zur Leistung der Sache m i t der vorgestellten Eigenschaft 144 . Dies liegt daran, daß Sache und Eigenschaft eine untrennbare Einheit sind. Wer sich bestimmte Eigenschaften bei einer Sache vorstellt, der glaubt, wenn er einen anderen zur Leistung der Sache verpflichtet, diesen auch zur Leistung der vorgestellten Eigenschaften verpflichtet zu haben. Daß der Erklärende die Eigenschaft nicht besonders erwähnt, kann nicht zu der Annahme verführen, er habe keinen derartigen Rechtsfolgewillen 1 4 5 . Wenn der Erklärende davon überzeugt ist, daß die Sache die Eigenschaft hat, so genügt es von seiner Sicht aus gesehen, den Vertragspartner zur Leistung dieser Sache zu verpflichten. Die Angabe der Eigenschaft muß sich bei dieser Sachlage für den Erklärenden als Pleonasmus darstellen. Da die Parteien i n der Lage sind, die Eigenschaften zu vereinbaren, die die Sache haben soll, so kommt der bloßen Bezeichnung der Sache regelmäßig auch ein Erklärungswert hinsichtlich der gesollten Eigenschaft zu. Wer „dieses Pferd" sagt, der w i l l nicht nur das Pferd, wie es gerade immer ist, sondern er w i l l das Pferd mit all den Eigenschaften, die es i m Augenblick der Erklärung hat, und dementsprechend geht, sofern es zu einem Vertragsschluß über dieses Pferd kommt, die Verpflichtung auch über das Pferd mit diesen Eigenschaften. 144 Vgl. Schmidt-Rimpler, S. 220 ff.; Soergel / Siebert / Hefermehl, § 119 Bern. 30. 145 Dies nehmen jedoch Flume , S. 100 f. u n d A T , § 23, 4 c u n d Staudinger / Coing , § 119 Rdz 16 an. Wenn Flume u n d Coing ausführen, der Käufer erkläre nicht X i n der Absicht Y zu erklären, so verkennen sie die besondere Beziehung, die zwischen Eigenschaft u n d Sache besteht. Vgl. darüber weiter i m Text.
5. Die Anfechtung gemäß § 119 I I
189
Daher kommt es zu einem Erklärungsirrtum, wenn der Erklärende bei Abgabe der Erklärung sich i n einem I r r t u m über eine Eigenschaft der Sache befindet. Der Erklärende schreibt seiner Erklärung einen anderen Inhalt zu, als die Erklärung objektiv enthält. Wer „diesen Ring" kauft i n der sicheren Annahme, er sei golden, der glaubt seinen auf „diesen goldenen Ring" gerichteten Rechtsfolgewillen mit seiner Erklärung zum Ausdruck gebracht zu haben, denn wäre der Ring golden, wie es der Erklärende annimmt, so würde die Erklärung „dieser Ring" tatsächlich objektiv so viel bedeuten, wie die Erklärung „dieser goldene Ring", sie wäre also tatsächlich geeignet, den auf „diesen goldenen Ring" gerichteten Rechtsfolge w i l l e n des Erklärenden zum Ausdruck zu bringen. I n unserem Beispiel hat der Erklärende nun objektiv etwas anderes erklärt, als er zu erklären glaubte. Denn objektiv geht die Erklärung über „diesen Ring", also über den Ring, wie er tatsächlich ist, nicht wie ihn sich der Erklärende vorstellt. Damit besteht eine Divergenz zwischen dem subjektiven und dem objektiven Erklärungstatbestand. Der Erklärende glaubte i m Hinblick auf bestimmte Eigenschaften etwas anderes zu erklären, als er tatsächlich erklärt hat. Er befindet sich i n einem Erklärungsirrtum, der gemäß § 119 I I jedoch nur bei einem I r r t u m bezüglich verkehrswesentlicher Eigenschaften zur Anfechtung berechtigt. Diese Einschränkung entspricht i m wesentlichen dem bereits i n § 119 I enthaltenen Gedanken des Verkehrsschutzes. Der I r r t u m über das vorgestellte Sein einer Sache stellt sich damit als Erklärungsirrtum dar und ist nur als solcher beachtlich. Der Seinsi r r t u m selbst ist, sofern er nicht die Erklärung beeinflußt und damit zum Erklärungsirrtum führt, unbeachtlich 146 . Zweifelt der Erklärende z.B. an dem vorgestellten Sein der Sache, so kann von einem Erklärungsirrtum keine Rede sein, denn dann schreibt der Erklärende seiner Erklärung nicht zu, daß sie auch die vorgestellte Eigenschaft notwendigerweise zum Ausdruck bringt. Wer die Möglichkeit sieht, daß die objektive Erklärung u. U. etwas vom Gewollten abweichendes beinhaltet, der unterliegt nicht einem I r r t u m über den objektiven Tatbestand seiner Erklärung. Hier zeigt sich, daß es nicht darauf ankommt, was der Erklärende gewollt hat, sondern darauf, was er als Erklärung gewollt hat147. 146 So auch zutreffend Schmidt-Rimpler, S. 232, 233. Der Seinsirrtum, Schmidt-Rimpler bezeichnet diesen I r r t u m als I r r t u m über die Istbeschaffenheit, falle nicht unter das Irrtumsproblem des BGB. Er ist bedeutungslos. 147 Vgl. Anm. 142; B G H JZ 1969, 337: „ I r r t u m ist die unbewußte U n k e n n t nis v o m wirklichen Sachverhalt; dagegen k a n n sich, w e r die Ungewißheit bewußt i n K a u f n i m m t , nicht auf einen I r r t u m berufen (RGZ 134, 25, 31; B G H N J W 1951, 705)."
190
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen
M i t der Feststellung, daß § 119 I I Fälle des auf Eigenschaften bezogenen Erklärungsirrtums erfaßt, ist die Rechtsfolgeregelung der Norm plötzlich sinnvoll. Der Erklärende kann sich von der irrtümlich abgegebenen Erklärung lösen, hat jedoch dem Erklärungsempfänger den Vertrauensschaden zu ersetzen. Vor allem aber das Verhältnis des § 119 I I zu den Sachmängelnormen w i r d durch diese Auslegung auf einmal verständlich. d) Darstellung der eigenen Ansicht über das Konkurrenzverhältnis der §§ 459 ff. zu § 119 I I
Die Sachmängelnormen greifen ein, wenn der Verkäufer die Kaufsache nicht m i t den Eigenschaften leistet, die vereinbart wurden. Der Inhalt der Vereinbarung ergibt sich aus den übereinstimmenden objektiven Erklärungen 1 4 8 beider Seiten. Die Sachmängelhaftung kommt also immer dann i n Betracht, wenn die Kaufsache anders ist, als sie nach den objektiven Erklärungen sein soll. I m Gegensatz dazu findet § 119 I I Anwendung, wenn der Käufer obj e k t i v etwas anderes erklärt, als er subjektiv erklären wollte. Für den Eigenschaftsirrtum ist also maßgeblich das Abweichen des objektiv Erklärten vom subjektiv als Erklärung Gewollten. Daraus folgt, daß der Anwendungsbereich des § 119 II sich niemals mit dem der §§ 459 ff. überschneiden kann 149. Beide Bereiche schließen sich zwangsläufig gegenseitig aus 1 5 0 . Die Sachmängelhaftung regelt die Rechtsfolgen bei einer Divergenz von Sein und Sollen der Sacheigenschaften, also ein Erfüllungsproblem, der Eigenschaftsirrtum (§ 119 II) betrifft die Nichtübereinstimmung von Wille und Erklärung, also das Problem der fehlerhaften Willenserklärung. 148 Eine Ausnahme bildet n u r der Fall, daß beide Parteien objektiv etwas anderes erklären, als sie erklären wollen, wobei das, was die eine Seite erklären w i l l , m i t dem übereinstimmt, was die andere Seite erklären w i l l . Es handelt sich dabei u m den F a l l der falsa demonstratio. H i e r w i r d Vertragsi n h a l t das, was beide Parteien erklären wollten, nicht das, was sie objektiv erklärt haben. Der objektive Erklärungstatbestand weicht dem subjektiven Erklärungswillen der Parteien, w e i l dem objektiven Tatbestand n u r solange Vorrang gegenüber dem subjektiven gebührt, als der Gedanke des V e r t r a u ensschutzes es erfordert (vgl. dazu R G 99, 147 ff. — Haakjöringsköd). Bei einer derartigen Fallgestaltung ist das, was die Parteien übereinstimmend vereinbaren wollten, Vertragsinhalt (vgl. auch R G 61, 265; 60, 338; J W 1907, 825). Die Sachmängelhaftung greift daher ein, w e n n die Sache i n ihren Eigenschaften von dem abweicht, was die Parteien als Vereinbarung gewollt hatten. Nicht zur A n w e n d u n g kommen die Sachmängelansprüche, w e n n die Sache v o m o b j e k t i v E r k l ä r t e n abweicht, da dies nicht den Vertragsinhalt bestimmt (vgl. R G 99, 147 f.). 149 So v o m Ergebnis her schon Wolff, vgl. dazu A n m . 161. 150 I n dieser Richtung auch schon Krückmann, AcP 98, 420 ff., 422.
5. Die Anfechtung gemäß § 119 I I
191
A n Hand verschiedener Beispiele soll dieses Ergebnis verdeutlicht werden: 1. Der Käufer verspricht sich bei Abgabe der Kauferklärung und erklärt statt „diese goldene U h r " „diese vergoldete Uhr". Der Verkäufer nimmt an. Lösung: Der Vertrag geht über „diese vergoldete Uhr". Liefert der Verkäufer die Uhr i n vergoldetem Zustand, so kommt die Sachmängelhaftung nicht zur Anwendung, weil geleistet ist, was vereinbart worden war. Der Käufer kann jedoch, da er sich versprochen hat, gemäß § 119 I I seine Erklärung anfechten. Das gleiche gilt, wenn der Käufer sich nicht verspricht, sondern sich i n einem I r r t u m über den Inhalt seiner Erklärung befindet, wenn er also glaubt, vergoldet bedeute golden. Auch hier kommt der Vertrag über „diese vergoldete U h r " zustande. Der Käufer kann jedoch seine Erklärung gemäß § 119 I I anfechten. 2. Der Käufer erklärt, „diese goldene U h r " zu kaufen. Der Verkäufer n i m m t an. Die Uhr, u m die es geht, ist vergoldet. Lösung: Der Vertrag kommt zustande über „diese goldene Uhr". Der Käufer hat erklärt, was er erklären wollte. Ein Erklärungsirrtum liegt nicht vor. Der Käufer hat sich zwar über das Sein der Sache geirrt, doch findet der Seinsirrtum als solcher gemäß § 119 I I nicht Beachtung, es sei denn i n der Gestalt eines dadurch bedingten Erklärungsirrtums 1 5 1 . Hier hat jedoch der Käufer den Verkäufer i n dem beabsichtigten Umfang verpflichtet, so daß von einem Auseinanderfallen von Wille und Erklärung keine Rede sein kann. Der § 119 I I greift nicht ein. Der Verkäufer haftet jedoch gemäß §§ 459 ff., da er die U h r nicht m i t der geschuldeten Beschaffenheit geleistet hat. 3. Der Käufer erklärt, „diese U h r " zu kaufen, wobei er der festen Überzeugung ist, die Uhr sei golden, während sie i n Wirklichkeit vergoldet ist. Der Verkäufer n i m m t i n Unkenntnis der Käufervorstellung das Angebot an. Lösung: Der Vertrag kommt zustande über „diese U h r " und zwar i n dem Zustand, i n dem sie sich bei Vertragsschluß befindet. Leistet der Verkäufer die vergoldete Uhr, so erbringt er, was er nach dem Vertrag schuldet. Sachmängelansprüche können nicht eingreifen. Der Käufer schreibt jedoch seiner Erklärung einen anderen Inhalt zu, er glaubt, den Verkäufer zur Leistung einer goldenen U h r verpflichtet zu haben. Subjektiver Erklärungswille und objektiver Erklärungstatbestand gehen auseinander. Der Käufer unterlag bei Abgabe der Erklärung einem 151
Ebenso Schmidt-Rimpler,
S. 232, 233.
192
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen
Erklärungsirrtum. Er kann daher seine Erklärung gemäß § 119 I I anfechten. 4. Der Käufer erklärt, „diese U h r " zu kaufen, wobei er sich nicht sicher ist, ob die Uhr golden oder nur vergoldet ist. Der Verkäufer nimmt an. Die Uhr ist vergoldet. Lösung: Der Vertrag kommt zustande über „diese U h r " und zwar als vergoldete. Der Verkäufer, der die vergoldete Uhr leistet, erfüllt seine vertragliche Verpflichtung i n vollem Umfang. Sachmängelansprüche scheiden aus. Der Käufer kann aber auch nicht wegen Irrtums anfechten, da keine Divergenz von subjektivem Erklärungswillen und objektivem Erklärungstatbestand vorliegt 1 5 2 . Der Käufer hat erklärt, was er erklären wollte, nämlich nur „diese Uhr". Dieser Erklärung schrieb der Käufer nicht den Inhalt „diese goldene U h r " zu, da er gerade m i t der Möglichkeit gerechnet hat, daß die Uhr nicht golden ist. Der Käufer hat hier seiner Erklärung keinen anderen Inhalt beigemessen als sie tatsächlich hatte. Er wollte die Uhr wie sie ist. Zwar hoffte er und „wollte" auch i m weiteren Sinn, daß die Uhr golden ist, doch kommt es für die Frage des Irrtums nicht darauf an, was der Käufer wollte, sondern allein darauf, was er erklären wollte 1 5 3 . I n unserem Beispiel nun wollte der Käufer nur „diese U h r " erklären. Was er erklären wollte, hat er auch erklärt. Ein I r r t u m liegt daher nicht vor. 5. Der Käufer erklärt, eine bestimmte Ladung Haakjöringsköd zu kaufen i n der Annahme, es handele sich dabei u m Walfischfleisch, wobei es sich jedoch u m Haifischfleisch handelt. Der Verkäufer, der dem gleichen I r r t u m unterliegt, nimmt an 1 5 4 . Lösung: Der Vertrag kommt nicht etwa über „diese Ladung Haakjöringsköd", also Haifischfleisch zustande, sondern über „diese Ladung Walfischfleisch". Da beide Parteien dem gleichen I r r t u m unterlagen, gilt nicht, was objektiv erklärt wurde, sondern, was die Parteien subj e k t i v übereinstimmend erklären wollten. Das ist hier „diese Ladung Walfischfleisch". Bei der falsa demonstratio kommt der Vertrag m i t dem Inhalt zustande, m i t dem die Parteien übereinstimmend den Vertrag schließen wollten 1 5 5 . Leistet der Verkäufer nun Haakjöringsköd, also Haifischfleisch, so leistet er die geschuldete Sache nicht i n der geschuldeten Beschaffenheit, er haftet daher gemäß § 459 ff. 152 Ebenso Schmidt-Rimpler, S. 225. Der Käufer darf sich des möglichen Zwiespalts von W i l l e u n d E r k l ä r u n g nicht bewußt sein; vgl. B G H JZ 1969, 337 (s. A n m . 147); Staudinger / Coing, § 119 Rdz 1; Soergel / Siebert / Hefermehl, vor § 116 Bern. 28; Krüger-Nieland, i n RGRK, § 119 A n m . 1. 153 Vgl. dazu A n m . 142. 154 Dieser F a l l lag der Entscheidung R G 99, 147 ff. zugrunde. 155 So auch R G 99, 148; vgl. dazu A n m . 148.
5. Die Anfechtung gemäß § 119 I I
193
Eine Anfechtung nach § 119 I I kann dagegen nicht i n Betracht kommen. Der Käufer hat den Verkäufer mit seiner Erklärung zu dem verpflichtet, zu dem er i h n verpflichten wollte. Zwar weicht der subjektive Erklärungswille vom objektiven Erklärungstatbestand ab, doch ist dies i m Falle der falsa demonstratio irrelevant, w e i l der Vertrag auf Grund des beiderseitigen Irrtums m i t dem Inhalt des übereinstimmend als Erklärung subjektiv Gewollten zustande kommt. Wenn es aber ausnahmsweise einmal nicht auf den objektiven Erklärungstatbestand, sondern auf den subjektiven Erklärungswillen ankommt, so ist das Abweichen der objektiven Erklärung vom subjektiven Tatbestand nicht mehr geeignet, eine Irrtumsanfechtung zu rechtfertigen. Die Anfechtung setzt als Regelfall voraus, daß die Willenserklärung m i t dem Inhalt, der sich objektiv aus dem äußeren Erklärungstatbestand ergibt, wirksam geworden ist. Hat der Erklärende seinen Vertragspartner i n dem beabsichtigten Umfang verpflichtet, so ist für eine Irrtumanfechtung kein Raum mehr 1 5 6 , da dann die Vereinbarung, die m i t der Willenserklärung herbeigeführt werden sollte, tatsächlich auch m i t dem entsprechenden Inhalt herbeigeführt wurde 1 5 7 . Eine Konkurrenz zwischen den Normen der Sachmängelhaftung und der Regelung des Eigenschaftsirrtums nach § 119 I I ist also ausgeschlossen 158. Die Bereiche der beiden Rechtsinstitute überschneiden sich niemals. W i r d die konkret geschuldete Sache i n einem Zustand geleistet, der nicht der Vereinbarung entspricht, so gelten die Vorschriften über die Gewährleistung. Ist dagegen nicht das vereinbart, was der Käufer als vereinbart annimmt, w e i l er seiner Erklärung einen anderen Inhalt zugeschrieben hat, als ihr objektiv zukam, so kann er gemäß § 119 I I anfechten. § 119 I I findet nur Anwendung, wenn eine Eigenschaft, die der Käufer mit seiner Erklärung zum Geschäftsinhalt machen wollte, nicht Geschäftsinhalt wurde. Ist es zu einer entsprechenden Eigenschaftsvereinbarung gekommen, so decken sich Wille und Erklä156
So schon Krückmann, AcP 101, 396; Schmidt-Rimpler, S. 223, 227. So auch das R G 99, 147 ff. Gerade diese Entscheidung legt § 119 I I als E r k l ä r u n g s i r r t u m aus — was vielfach i n der L i t e r a t u r nicht erkannt w i r d —, weshalb sie volle Zustimmung verdient. Das Reichsgericht verneint die Möglichkeit einer Anfechtung nach § 119 I I m i t der Begründung, was gewollt gewesen sei, nämlich Walfischfleisch, sei auch vereinbart worden. Hätte das Reichsgericht den Eigenschaftsirrtum als I r r t u m über das Sein der verkauften Sache verstanden, so hätte es die Anwendbarkeit des § 119 I I bejahen müssen, da der Käufer sich tatsächlich über das Sein der verkauften Schiffsladung geirrt hat. 158 Diese Konsequenz w i r d von Hefermehl (in Soergel / Siebert, § 119 Bern. 72) u n d Heinrichs (in Palandt, § 119 A n m . 4 d) übersehen, obwohl beide — nach der hier vertretenen Ansicht zutreffend — § 119 I I als besonderen F a l l des § 119 I ansehen u n d dementsprechend auch zu einem gegenseitigen tatbestandlichen Ausschluß der §§ 459 ff. gegenüber § 119 I I kommen müßten. 157
13 Herberger
194
V I . Verhältnis der Gewährleistung zu den allgemeinen Normen
r u n g , so daß eine A n f e c h t u n g w e g e n I r r t u m s n i c h t m ö g l i c h i s t 1 5 9 . I s t d i e Sache anders, als d e r K ä u f e r sie sich v o r g e s t e l l t h a t u n d als v e r e i n b a r t w o r d e n ist, so l i e g t n u r e i n u n b e a c h t l i c h e r S e i n s i r r t u m v o r 1 6 0 , dagegen k e i n E r k l ä r u n g s i r r t u m . E i n e B e s e i t i g u n g d e r E r k l ä r u n g d u r c h die Anfechtung k o m m t n u r i n Betracht, w e n n die E r k l ä r u n g „falsch" ist, d. h. s u b j e k t i v e r u n d o b j e k t i v e r E r k l ä r u n g s t a t b e s t a n d d i v e r g i e r e n . I s t d i e Sache dagegen n i c h t v o n d e r Beschaffenheit, w i e sie sein soll, so i s t n i c h t d i e E r k l ä r u n g , s o n d e r n d i e Sache „ f a l s c h " 1 6 1 . I n diesem F a l l h a n d e l t es sich u m e i n spezielles E r f ü l l u n g s p r o b l e m 1 6 2 . D a f ü r g e l t e n die S a c h m ä n g e l v o r s c h r i f t e n . 159 Ebenso Schmidt-Rimpler, S. 223, 227, der zwar auf das Konkurrenzproblem nicht eingeht, der jedoch aus seiner Sicht zwangsläufig ebenfalls zur Ausschließlichkeit der beiden Rechtsinstitute kommen müßte. 160 Vgl. Schmidt-Rimpler, S. 232, 233. 161 Max Wolff , S. 38 ff. hatte also v o m Ansatzpunkt her Recht. Er vertrat die Ansicht, § 119 I I könne nicht m i t den §§ 459 ff. konkurrieren. Wolff begründete dies folgendermaßen: E i n Eigenschaftsirrtum sei n u r möglich, wenn die Eigenschaft bei Vertragsschluß fehle. Die Vorstellung des Käufers von der Sache sei n u n nicht auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses ausgerichtet, sondern auf den Zeitpunkt der Erfüllung, also einen zukünftigen Zeitpunkt. Eine solche auf die Z u k u n f t gerichtete Vorstellung könne nicht als i r r t ü m l i c h i m Sinne des § 119 bezeichnet werden. Der Käufer stelle sich nicht eine gegebene Wirklichkeit vor, er habe den Willen, eine gegebene Vorstellung zu verwirklichen. Deshalb sei, w e n n die Sache fehlerhaft ist, nicht die Vorstellung des Käufers falsch, also irrtumsbefangen, sondern die Sache sei falsch, w e i l sie nicht der Vorstellung entspreche. Daß die Ansicht von W o l f f letztlich nicht überzeugen konnte, lag daran, daß Wolff sich über zwei Fakten nicht k l a r war. Einmal, daß die Parteien Eigenschaften, die die Kaufsache haben soll, vereinbaren können: W e i l die Parteien eine Eigenschaft vereinbart haben, ist — m i t Wolff zu sprechen — die Vorstellung des Käufers richtig u n d die Sache falsch. Zum anderen, daß § 119 I I nicht einen I r r t u m über das Sein der Kaufsache regelt, sondern einen I r r t u m über die Erklärung. Wolff mußte, u m zum Ausschluß des § 119 I I , der auch von i h m als Normierung eines Seinsirrtums angesehen wurde, zu gelangen, unterstellen, daß die V o r stellung des Käufers n u r auf die Z u k u n f t gerichtet sei. Er stellte sich damit i n Widerspruch zu den Tatsachen. Der Käufer k a n n sich durchaus Vorstellungen von der Kaufsache bei Vertragsschluß gemacht u n d insoweit über das Sein der Sache geirrt haben. Hier konnte also die K r i t i k Fuß fassen (vgl. Flume, S. 133, Busbach, S. 6). Erkennt man, daß der Eigenschaftsirrtum kein I r r t u m über das Sein, sondern ein I r r t u m über die E r k l ä r u n g ist, so ist das Problem gelöst. Der Käufer w i l l eine fehlerfreie Sache. K o m m t dies i m objekt i v e n Erklärungstatbestand zum Ausdruck, so hat der Käufer erklärt, was er erklären wollte. E i n beachtlicher I r r t u m liegt nicht vor. Der Käufer hat sich zwar möglicherweise über bestimmte Eigenschaften der Kaufsache geirrt, doch ist ein solcher Seinsirrtum rechtlich irrelevant, es sei denn, er hat sich i n der E r k l ä r u n g als E r k l ä r u n g s i r r t u m ausgewirkt. Das ist jedoch n u r der Fall, w e n n der objektive Erklärungstatbestand nicht die gesollten Eigenschaften zum Ausdruck bringt. Es liegt also dann kein I r r t u m vor, w i e Wolff richtig erkennt, w e n n die Sache „falsch" ist, d. h. w e n n sie nicht der Vereinbarung entspricht. Das muß jedoch — dies verkennt W o l f f — nicht i m m e r der F a l l sein. I r r t der Käufer über das Sein der Kaufsache u n d gibt er deshalb eine m i t seinem W i l l e n nicht übereinstimmende E r k l ä r u n g ab, so ist die E r k l ä r u n g „falsch", nicht die der Vereinbarung entsprechende Sache. I n diesem Falle k o m m t es zur Anfechtung gemäß § 119 I I . 162 So schon Krückmann, AcP 101, 396.
V I I . Die Sachmängelhaftung nach dem Einheitlichen Kaufgesetz Die bisherigen Betrachtungen haben allein der Regelung der Sachmängelhaftung nach dem BGB gegolten. Zum Abschluß ist es interessant, einen kurzen vergleichenden Blick auf das „Einheitliche Gesetz über den internationalen Kauf beweglicher Sachen" von 1964 zu werfen 1 . Durch dieses Gesetz (EKG) wurde eine neue, u. a. auch für das Gebiet der Sachmängelhaftung bedeutsame Entwicklung eingeleitet, die auf die Dauer nicht ohne Einfluß auf das innerstaatliche Recht bleiben kann. Unter diesem Gesichtspunkt ist ein Vergleich zwischen der Sachmängelhaftung des BGB und der Regelung des E K G angebracht. Der Schwerpunkt des Vergleichs w i r d dabei, entsprechend der Zielsetzung dieser Arbeit, auf Fragen der Systematik gelegt. Was die Entwicklung des E K G anbelangt, so ist eine weit zurückreichende Vorgeschichte zu verfolgen, auf deren Darstellung hier verzichtet werden kann 2 . M i t fortlaufender Ausweitung des internationalen Warenverkehrs wuchs das Interesse an einer einheitlichen internationalen Kaufvertragsregelung. Bedingt durch die verschiedenen Rechtssysteme brachte der Versuch einer internationalen Regelung jedoch erhebliche Schwierigkeiten m i t sich. A u f der internationalen Konferenz vom 2. - 25. A p r i l 1964 i n Den Haag, an der 32 Staaten teilnahmen 3 , gelang es trotzdem nach umfangreichen Vorarbeiten, insbesondere auch von Rabel 4 , zu einer weltweiten Einigung zu kommen, die i n dem E K G ihren Niederschlag gefunden hat. 1 I n Ausführung des Haag er Übereinkommens v o m 1. J u l i 1964 zur E i n führung eines Einheitlichen Gesetzes über den internationalen K a u f beweglicher Sachen (vgl. B G B l 1973 I I , S. 885 ff.) hat der Bundestag das EKG (vom 17. J u l i 1973) zusammen m i t dem Einheitlichen Gesetz über den Abschluß von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen verkündet ( B G B l 1973 I, S. 856 ff.). Die beiden Gesetze sind inzwischen m i t den Ubereinkommen (vgl. B G B l 1974 I I , S. 146) f ü r die B R D am 16. A p r i l 1974 i n K r a f t getreten (vgl. B G B l 1974 I, S. 358). 2 Vgl. dazu Weitnauer, S. 71 ff. u n d i n Erman, v o r § 433 Rdz 59 f.; Riese, Rabeis Ζ 29, 1 ff.; Beß, S. 57 ff. 3 Vereinigte Staaten v o n Amerika, Vereinigte Arabische Republik, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Bundesrepublik Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Israel, Italien, Japan, Jugoslawien, Kolumbien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, San Marino, Schweden, Schweiz, Spanien, Türkei, Ungarn, Vatikan. — N u r durch Beobachter vertreten waren Argentinien, Mexiko, Südafrika u n d Venezuela. 4 Das Recht des Warenkaufs, Band 1 (1936), Band 2 (1958).
13»
196
V I I . Die Sachmängelhaftung nach dem Einheitlichen Kaufgesetz
1. Der Geltungsbereich des E K G Das E K G gilt für alle Kaufverträge 5 — d. h. auch für Verträge unter Nicht-Kaufleuten — über bewegliche Sachen6 zwischen Parteien, die ihre Niederlassung oder ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort (Art. 1 II) i m Gebiet verschiedener Vertragsstaaten 7 haben 8 a) wenn nach dem Vertrag die verkaufte Sache zur Zeit des Vertragsabschlusses oder später aus dem Gebiet eines Staates i n das Gebiet eines anderen Staates befördert w i r d oder befördert werden soll; b) wenn die Handlungen, die das Angebot und die Annahme darstellen, i m Gebiet verschiedener Staaten vorgenommen worden sind; c) wenn die Lieferung der Sache i m Gebiete eines anderen als desjenigen Staates zu bewirken ist, i n dem die Handlungen vorgenommen worden sind, die das Angebot und die Annahme darstellen (Art. 1 I). I n gleicher Weise Geltung hat das E K G für Werklieferungsverträge, soweit nicht 9 der Besteller einen wesentlichen Teil der für die Herstellung oder Erzeugung notwendigen Rohstoffe selbst zur Verfügung gestellt hat (Art. 6). Erforderlich für die Anwendbarkeit des E K G ist, daß beide Parteien ihre Niederlassung oder ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort i n einem der Vertragsstaaten 10 haben. A r t . 4 stellt jedoch klar, daß das E K G für Verträge, für die es an sich nicht gelten würde, von den Parteien für anwendbar erklärt werden kann, soweit es nicht i m Widerspruch zu zwingenden innerstaatlichen Normen steht, die anzuwenden wären, wenn die Parteien nicht das E K G für anwendbar erklärt hätten. 5 Ausgenommen sind n u r Verkäufe auf G r u n d gerichtlicher Maßnahmen oder auf G r u n d einer Beschlagnahme (Art. 5 I d). β Nicht hierunter fallen gem. A r t . 5 I Wertpapiere, Zahlungsmittel, eingetragene oder eintragungspflichtige Seeschiffe, Binnenschiffe u n d L u f t fahrzeuge, elektrische Energie. 7 Die B R D hat von der i n A r t . I I I des Übereinkommens zur Einführung eines E K G vorgesehenen Möglichkeit, den Geltungsbereich auf Verträge zwischen Parteien, die ihre Niederlassung i m Gebiet verschiedener Vertragsstaaten haben (ursprüngliche Fassung A r t . 1 I : verschiedene Staaten), zu beschränken, Gebrauch gemacht. 8 Die Staatsangehörigkeit ist unerheblich (Art. 1 I I I ) . 9 M i t der negativen Fassung, i m Gesetz durch „es sei denn, daß" zum Ausdruck gebracht, w i r d demjenigen, der die Anwendbarkeit des E K G bestreitet, die Beweislast aufgebürdet (vgl. Riese, S. 18). 10 Vgl. A n m . 7. Vertragsstaaten sind die Staaten, die das Haager Übereinkommen v o m 1. J u l i 1964 zur Einführung eines E K G ratifiziert haben oder i h m beigetreten sind (Art. 102 Fassung BRD). Das sind bisher neben der B R D nur Belgien, Großbritannien, Italien, Niederlande, San Marino u n d Israel, das jedoch n u r das E K G ratifiziert hat, nicht aber das Gesetz über den Kaufabschluß. Z u r A n w e n d u n g des E K G vgl. Landfermann N J W 1974, 387.
1. Der Geltungsbereich des E K G
197
Soweit danach das E K G Anwendung findet 1 1 , sind die Regeln des internationalen Privatrechts ausgeschlossen (Art. 2). Ausnahmsweise gilt internationales Privatrecht dann, wenn das E K G einen bestimmten Fall dem normalen innerstaatlichen Recht unterwirft, wie das durch A r t . 89 E K G geschieht. Nach A r t . 89 bestimmt sich der Schadensersatz bei absichtlicher Schädigung oder arglistiger Täuschung nicht nach EKG, sondern nach dem jeweils anwendbaren innerstaatlichen Recht. Auch i m Geltungsbereich des E K G gilt Vertragsfreiheit, so daß, wie dies A r t . 3 hervorhebt, die Regelung des E K G ganz oder teilweise ausgeschlossen werden kann, ohne daß die Parteien sich darüber einigen müssen, welches Recht an Stelle des E K G gelten soll 1 2 . Das bestimmt sich dann nach internationalem Privatrecht. 2. Die Rechte des Käufers bei Vorliegen eines Sachmangels nach der Regelung des E K G a) Die vertraglichen Pflichten des Verkäufers
I m Mittelpunkt der Regelung des E K G steht die Vorschrift des A r t . 18, der die Pflichten des Verkäufers regelt. Nach A r t . 18 ist der Verkäufer verpflichtet 1. zur Lieferung der verkauften Sache 2. zur Aushändigung der die Sache betreffenden Urkunden (sofern solche vorhanden sind) 3. zur Verschaffung des Eigentums an der verkauften Sache. Was unter der Lieferung der Sache zu verstehen ist, w i r d durch A r t . 19 I und 33 ff. präzisiert: Lieferung ist die Aushändigung einer vertragsgemäßen Sache. Nach A r t . 20 ff. hat der Verkäufer außerdem die Pflicht der a) Lieferung zur rechten Zeit (Art. 20 - 22, 24, 25, 26 - 29) b) Lieferung am rechten Ort (Art. 23, 24, 25, 30 - 32). Das Gesetz hat i n A r t . 19 und 33 einen bedeutsamen Schritt getan; es hat die Pflicht zu mangelfreier Leistung ausdrücklich festgelegt. Nach A r t . 33 I hat der Verkäufer seine Pflicht zur Lieferung nicht erfüllt a) (bei Quantitätsunterschieden) b) (bei Lieferung eines aliud) c) (bei Abweichung der Sache von einer Probe oder einem Muster) 11
Eine Einschränkung für das E K G findet sich noch i n A r t . 5 I I . Danach bleiben die zwingenden Bestimmungen der innerstaatlichen Rechte z u m Schutze des Abzahlungskäufers unberührt, d. h. für diesen Bereich gilt internationales Privatrecht i n Verbindung m i t innerstaatlichem Recht. 12 Vgl. Riese } S. 16.
198
V I I . Die Sachmängelhaftung nach dem Einheitlichen Kaufgesetz
d) wenn er eine Sache ausgehändigt hat, die nicht die für ihren gewöhnlichen Gebrauch oder ihre kaufmännische Verwendung erforderlichen Eigenschaften besitzt; e) wenn er eine Sache ausgehändigt hat, die nicht die für einen i m Vertrag ausdrücklich oder stillschweigend vorgesehenen besonderen Gebrauch erforderlichen Eigenschaften besitzt; f) i m allgemeinen, wenn er eine Sache ausgehändigt hat, die nicht die i m Vertrag ausdrücklich oder stillschweigend vorgesehenen EigenSchäften und besonderen Merkmale besitzt. Wie sich aus dieser Formulierung des Gesetzes ergibt, ist — das bestätigt auch A r t . 42 I — der Verkäufer immer, also nicht nur beim Gattungskauf, sondern auch beim Spezieskauf, zur Lieferung einer mangelfreien Sache verpflichtet. Das E K G regelt also ausdrücklich, was wir, entgegen der h. L., auch für die Regelung des BGB annehmen: daß der Verkäufer zur Leistung einer mangelfreien Sache verpflichtet ist. Das E K G setzt sich dabei verständlicherweise nicht m i t der i n dieser Abhandlung behandelten Frage auseinander, ob beim Spezieskauf neben der Sachbestimmung noch die Vereinbarung einer bestimmten Eigenschaft möglich ist. Das Gesetz unterstellt diese Möglichkeit. Unsere Abhandlung hat gezeigt, daß diese Unterstellung auch dogmatisch richtig ist. Deutlicher als das BGB bringt das E K G zum Ausdruck, daß die Leistungspflicht sich auf bestimmte Eigenschaften bezieht. Wie w i r unter IV, 1 dargelegt haben, ist demgegenüber die Formulierung des BGB, der Verkäufer (bzw. der Unternehmer) hafte für Fehler, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern (vgl. §§ 459 I, 633 I), unglücklich, denn diese Fassung ist letztlich Ursache dafür, daß die Sachmängelhaftung zu vielen Streitpunkten Anlaß bot. So verführte die Formulierung des BGB das Reichsgericht dazu, stets i n mißverständlicher Weise von einer Gebrauchsvereinbarung, nicht aber von einer Eigenschaftsvereinbarung zu sprechen, was, wie w i r unter I I I , 3, c und IV, 1, b dargelegt haben, einer klaren dogmatischen Einordnung der Sachmängelhaftung i m Wege stand und, wie etwa i n RG 115, 286 ff. (Gemälde von Ostade und Teniers), zu Entscheidungen führte, denen zwar i m Ergebnis zugestimmt werden kann, die aber berechtigte K r i t i k 1 3 i n der Literatur hervorriefen, w e i l sie die Möglichkeit eines bestimmten Gebrauchs i n Fällen annahmen, die sich unter dem Gesichtspunkt des erwünschten Gebrauchs nicht mehr lösen ließen. 13
Vgl. I V , A n m . 11.
2. Die Rechte des Käufers bei Vorliegen eines Sachmangels
199
Auch i n anderer Richtung w i r k t e sich die Formulierung des BGB verhängnisvoll aus. Das Problem der Eigenschaftsvereinbarung wurde nicht gelöst, sondern durch den subjektiven Fehlerbegriff überspielt. Die Erklärungen der Parteien über die Eigenschaften der Sache konnten nicht vollkommen unbeachtet bleiben. Aber statt das Problem i m Bereich der Willenserklärung zu lösen, verlagerte die h. L. — wozu der Wortlaut des Gesetzes geradezu verleitete (vgl. §§ 459 I, 633 I) — das Problem i n den Bereich des Fehlerbegriffs und suchte dort eine Lösung. Der subjektive Fehlerbegriff beim Spezieskauf ist nur die Korrektur der Tatsache, daß die Erklärungen der Parteien über die Eigenschaften der Speziessache nicht zum Geschäftsinhalt gerechnet werden. Unter diesen Gesichtspunkten kann es nur begrüßt werden, daß das E K G i n A r t . 33 nurmehr von Eigenschaften, nicht aber von Fehlern spricht. Auch dem nach der Fassung der §§ 459 I, 633 I, 537 I BGB möglichen Mißverständnis, die Parteien würden sich über den Gebrauch, nicht über eine Eigenschaft einigen, beugt A r t . 33 E K G vor. Nach der Fassung des Gesetzes ist klar, daß der i m Einzelfall vereinbarte Gebrauch einer Sache die Eigenschaften umschreibt, die die Sache haben soll. Nicht die Gebrauchstauglichkeit als solche, sondern die Eigenschaften für einen bestimmten Gebrauch sind geschuldet. Bedeutsam ist diese Unterscheidung nicht nur aus dogmatischen Gründen, sondern auch deshalb, w e i l es Eigenschaften gibt, die keinen besonderen Gebrauch ermöglichen. Dieser besondere F a l l w i r d ausdrücklich durch den allgemein gehaltenen Auffangtatbestand des A r t . 33 I f . geregelt. I m Gegensatz zu A r t . 33 I d und e, die auf eine für einen bestimmten Gebrauch erforderliche Eigenschaft abstellen, verlangt A r t . 33 I f . nur eine i m Vertrag vorgesehene Eigenschaft. A r t . 33 I f. erfaßt damit die Fälle, i n denen eine keinen besonderen Gebrauch m i t sich bringende Eigenschaft vereinbart wurde. Z u denken ist dabei z. B. an die Vereinbarung einer bestimmten Farbe oder einer bestimmten Herkunft einer Sache. M i t A r t . 33 I f E K G wären also die vom Reichsgericht entschiedenen Gemälde-Fälle (z.B. RG 115, 286ff.) problemlos zu entscheiden gewesen. b) Die Sanktionen i m Falle vertragswidriger Lieferung
Nach der Regelung des BGB ist streng zu unterscheiden zwischen den allgemeinen Normen des Schuldrechts und den besonderen Normen der Sachmängelhaftung. Für das BGB ergibt sich dabei folgendes Bild. Die allgemeinen Normen des Schuldrechts greifen ein, wenn die Sache selbst nicht geleistet wird, wobei die Regeln über den Verzug (§§ 284 ff.) gelten, wenn die noch mögliche Leistung nicht rechtzeitig erbracht wird, während die Vorschriften über die Unmöglichkeit ein-
200
V I I . Die Sachmängelhaftung nach dem Einheitlichen Kaufgesetz
greifen, wenn die Leistung unmöglich ist, wobei dabei nochmals zwischen anfänglicher und nachträglicher Unmöglichkeit und anfänglichem und nachträglichem Unvermögen unterschieden wird. Demgegenüber regeln die besonderen Vorschriften der Sachmängelhaftung den Fall, daß zwar die Sache als solche, aber nicht mit den geschuldeten Eigenschaften geleistet wird. Verständlicherweise muß es bei einer solchen Regelung zu Schwierigkeiten kommen, weil die Grenze zwischen den Begriffen „Sache als solcher" und „Eigenschaft" der Sache flüssig ist 1 4 . Die Sache w i r d gerade durch ihre Eigenschaften bestimmt und jede Eigenschaftsveränderung macht sie — naturwissenschaftlich gesehen — zu einer anderen. Auch sonst müssen i m Verhältnis zwischen einer allgemeinen und einer besonderen Regelung Abgrenzungsprobleme auftauchen, wie w i r sie etwa zwischen den §§ 459 ff. und § 119 II, §§ 320 ff. haben. Diesen Schwierigkeiten ist das E K G auf einfache und doch überzeugende Weise aus dem Weg gegangen. aa) Keine Regelung der Unmöglichkeit Zum einen schenkt das E K G der Frage, ob die Leistung der Sache noch möglich ist oder jemals möglich war, keinerlei Beachtung. Das Gesetz verzichtet bewußt auf eine Regelung der Unmöglichkeit. Weder ist der abgeschlossene Vertrag unwirksam, weil er auf eine unmögliche Leistung gerichtet ist, noch w i r d die Leistungspflicht kraft Gesetzes aufgehoben, wenn nach Vertragsschluß die Unmöglichkeit der Leistung eintritt. Der Vertrag und die vertraglichen Pflichten bestehen von Vertragsschluß an, unabhängig davon, ob die vereinbarte Leistung jemals möglich war oder noch möglich ist. Ist eine Leistung unmöglich, so kann sie von der Partei nicht erbracht werden d. h., es kommt notwendigerweise zu einer Nichterfüllung der vertraglichen Pflicht. A l l e i n unter diesem Gesichtspunkt, nicht unter dem der Unmöglichkeit, t r i f f t das E K G nun Sanktionen. Das Gesetz wartet ab, ob es zu einer Nichterfüllung kommt, und sieht erst dann Rechtsfolgen vor, u m die eingetretene Leistungsstörung zu lösen. Eine derartige Regelung hat, vergleicht man sie m i t der Regelung des BGB, verschiedene Vorteile. Zum einen muß die oft gar nicht zu beantwortende Frage, ob und ab wann Unmöglichkeit eingetreten ist, nicht beachtet werden. Gerade diese Frage aber bereitet i n vielen Zivilprozessen erhebliche Schwierigkeiten und ist, wenn der Schuldner die Unmöglichkeit zu vertreten 14
Vgl. dazu V, 1.
2. Die Rechte des Käufers bei Vorliegen eines S a c h m a n g e l s 2 0 1
hat, unwesentlich, weil dieser bei einer derartigen Sachlage — wie i m Falle der Nichterfüllung — gerade nicht frei wird, sondern Schadensersatz zu leisten hat. Diesen letzten Gesichtspunkt haben die Rechtsprechung und ihr folgend die h. L. aufgegriffen, um unnötige, schwierige Beweiserhebungen über die Frage der Unmöglichkeit dann zu umgehen, wenn der Schuldner auf jeden Fall Schadensersatz zu leisten hat. Steht die Unmöglichkeit der Leistung noch nicht endgültig fest, behauptet nur der Schuldner, daß die Leistung unmöglich geworden sei, so läßt die Rechtsprechung und die h. M. ohne Beweiserhebung über die Frage der Unmöglichkeit eine Verurteilung zur Leistung zu, wenn feststeht, daß der Schuldner die Unmöglichkeit bei ihrem tatsächlichen Vorliegen zu vertreten hätte 1 5 . Das bedeutet, daß i n diesem Fall nicht mehr auf die Unmöglichkeit abgestellt wird. Der Gläubiger kann m i t dem Leistungsurteil i m Wege der Zwangsvollstreckung versuchen, die Leistung zu erlangen, was natürlich i m Falle der Unmöglichkeit zu keinem Erfolg führt. Nach erfolgloser Zwangsvollstreckung kann ear dann auf den Schadensersatzanspruch übergehen 16 . So sinnvoll diese von der Rechtsprechung entwickelte Möglichkeit ist, steht sie doch nicht i n Einklang m i t der Regelung des BGB. M i t E i n t r i t t der Unmöglichkeit erlischt nämlich kraft Gesetzes die Leistungspflicht. A n deren Stelle t r i t t eine Schadensersatzpflicht, wenn der Schuldner die Unmöglichkeit zu vertreten hat. Bei dieser Sachlage darf eine Verurteilung zur ursprünglichen Leistung an sich nicht mehr erfolgen, weil der Anspruch darauf nicht mehr besteht 17 . Dieser Fall zeigt, daß die Regelung der Unmöglichkeit i n mancher Hinsicht nicht glücklich ist, daß es vielmehr einfacher und praktikabler sein kann, die Frage nach der Unmöglichkeit unbeachtet zu lassen, und allein auf die Nichterfüllung abzustellen. I m einzelnen müssen dann natürlich, wie es auch das E K G vorsieht, die für die Nichterfüllung vorgesehenen Sanktionen darauf abgestimmt sein, ob und i n welchem Umfang die Nichterfüllung der Leistung dem Schuldner anzulasten ist. Eine weitere Durchbrechung der Unmöglichkeitsregelung ergibt sich aus prozeßrechtlichen Gesichtspunkten. Nach materiellem Recht er15
R G 54, 28; 107, 18; Staudinger / Werner, § 275 Rdz 20. Uber den Schadensersatzanspruch kann i m U r t e i l m i t entschieden w e r den. Der Tenor lautet i n diesem F a l l etwa: „Der Beklagte w i r d verurteilt die . . . (Sache) zu übergeben u n d zu übereignen. Nach erfolgloser Zwangsvollstreckung hat der Beklagte an den Kläger D M . . . zu zahlen." Der Schadensersatzanspruch ist schlüssig, w e i l der Kläger sich den V o r trag des Beklagten, die Leistung sei unmöglich, hilfsweise zu eigen gemacht hat. Bei dieser Sachlage ist der Schadensersatzanspruch kein künftiger A n spruch, sondern ein gegenwärtiger. Nicht der Schadensersatzanspruch, sondern die Vollstreckung des Schadensersatzanspruchs ist von einer Bedingung abhängig, nämlich der erfolglosen Zwangsvollstreckung bezüglich der Sache. 17 So kritisch gegenüber der h. L. auch Palandt / Heinrichs, 30. Aufl., § 275 A n m . 8, Planck / Siber, § 280 A n m . 2 b. 16
202
V I I . Die Sachmängelhaftung nach dem Einheitlichen Kaufgesetz
lischt die Leistungspflicht, wenn die Leistung unmöglich wird. Trägt nun keine der Parteien die Unmöglichkeit vor, so w i r d der Schuldner zur Leistung verurteilt. Da die Zwangsvollstreckung keinen Erfolg haben kann, mündet der Anspruch letztlich i n einen Schadensersatzanspruch nach § 283 BGB. Auch hier kommt es zu einer Lösung nicht durch die Normen über die Unmöglichkeit, sondern erst durch die Norm des § 283, die tatbestandsmäßig nicht auf die Unmöglichkeit abstellt, sondern auf die Nichterfüllung der Leistungspflicht. Unbeachtet der Frage, ob Unmöglichkeit vorliegt oder nicht, kann der Gläubiger gem. § 283 Schadensersatz verlangen, wenn die von i h m m i t einer Ablehnungsandrohung verbundene Frist abgelaufen ist. Noch eine weitere Vorschrift des BGB zeigt, daß die Regelung der Unmöglichkeit nicht immer zu befriedigenden Ergebnissen führt. Bei anfänglicher objektiver Unmöglichkeit ist der Vertrag nach § 306 nichtig. Nach § 307 hat derjenige, der die Unmöglichkeit kannte oder kennen mußte, dem anderen Teil, sofern dieser auf die Gültigkeit des Vertrags vertraut hat, Schadensersatz zu leisten, aber nur i n Höhe des negativen Interesses (§ 307 1 1). §§ 306, 307 gelten nun aber nur für Hauptleistungspflichten, sie greifen beispielsweise nur ein, wenn eine bestimmte Sache überhaupt nicht erbracht werden kann. Kann die Sache zwar, aber nicht m i t den vereinbarten Eigenschaften erbracht werden, so bestimmen sich die Rechtsfolgen nach §§ 459 ff. Das kann zu folgendem unverständlichem Ergebnis führen: Wer infolge Unmöglichkeit überhaupt nichts leistet, haftet unter den Voraussetzungen des § 307 nur i n Höhe des negativen Interesses, wer dagegen immerhin die Sache, jedoch mit nicht behebbaren Fehlern behaftet, leistet, haftet i n Höhe des vollen Interesses 18 , soweit die Voraussetzungen des § 463 BGB vorliegen. Würde man i n diesem Fall als Wertungsgrundlage nicht Vorschriften über die Unmöglichkeit, sondern Vorschriften über die Nichterfüllung der Leistungspflicht heranziehen, so könnte es nicht zu einer solchen Unstimmigkeit kommen. Diese Fälle haben gezeigt, daß es viel für sich haben kann, ohne Berücksichtigung der Unmöglichkeit allein auf die Nichterfüllung der vertraglichen Pflichten abzustellen. Für die Regelung des EKG, das diesen Weg gegangen ist, sprechen daher gute Gründe 1 9 . bb) Das Sanktionssystem
des EKG
Das E K G hat aber nicht nur von einer Regelung der Unmöglichkeit abgesehen, es hat auch darauf verzichtet, die Gewährleistung für Sach18 Vgl. i n diesem Zusammenhang die K r i t i k Weitnauers F N 80) an § 306. 19 Ebenso Weitnauer, S. 109 ff.
(S. 89 ff. u n d dort
2. Die Rechte des Käufers bei Vorliegen eines Sachmangels
203
mängel als besonderes von den allgemeinen Vorschriften zu trennendes Rechtsinstitut zu normieren, wie das i m BGB der Fall ist. Die Sachmängelhaftung des E K G ist vielmehr, abgesehen von einzelnen aus der Natur der Sache folgenden Sonderregelungen, etwa über die Rügepflicht oder über die Ausschlußfrist (Art. 39), i n gleicher Weise wie die sonstigen Leistungsstörungen geregelt, allerdings m i t einer Ausnahme: Neben den bei allen Leistungsstörungen gegebenen Ansprüchen hat der Käufer i m Falle eines Sachmangels noch einen weiteren Anspruch, die Minderung. Da die Sachmängelhaftung i n das allgemeine Sanktionensystem eingebettet ist, ist es für das Verständnis wichtig, zuerst dieses System und dann erst die speziellen Gewährleistungsnormen zu betrachten. Verletzt der Verkäufer eine seiner oben unter 2, a aufgeführten Pflichten, so sieht das E K G grundsätzlich für den Käufer drei Möglichkeiten vor. Er kann Erfüllung des Vertrages verlangen — dieser A n spruch ist, jedenfalls für uns, selbstverständlich, w e i l er unmittelbar aus der vertraglichen Vereinbarung resultiert —, er kann den Vertrag aufheben (in bestimmten Fällen t r i t t auch eine Aufhebung kraft Gesetzes ein, vgl. A r t . 26 I, II, 30 I, II) und er kann, gleichgültig, ob er den Vertrag aufgehoben hat oder nicht, unter zusätzlichen Voraussetzungen, Schadensersatz verlangen. Z u diesen drei Möglichkeiten tritt, wenn die Leistungsstörung auf einem Sachmangel beruht, noch die Möglichkeit hinzu, den Kaufpreis herabzusetzen, also zu mindern. N u n wäre es nicht sinnvoll, wenn der Käufer wegen jeder geringfügigen Leistungsstörung den Vertrag aufheben könnte. Das E K G unterscheidet deshalb bei allen Pflichtverstößen zwischen wesentlichen und unwesentlichen Vertragsverletzungen: i n A r t . 26, 27, 28 für die Pflicht zur Lieferung zu bestimmter Zeit, i n A r t . 30, 31 II, 32 I, I I I für die Pflicht zur Lieferung am bestimmten Ort, i n A r t . 43, 45 I I für die Pflicht zu mangelfreier Leistung, i n A r t . 51 für die Pflicht zur U r kundenaushändigung, i n A r t . 52 I I I für die Pflicht das Eigentum zu übertragen, i n A r t . 55 I für sonstige Pflichten. Das System ist damit denkbar einfach und sinnvoll. Erfüllt der Verkäufer eine seiner vertraglichen Pflichten nicht, so kann der Käufer, wenn es sich u m eine wesentliche Pflichtverletzung handelt, den Vertrag sofort aufheben (vgl. A r t . 26 I, 28, 30 I, 32 I, 43 S. 1, 45 II, 51, 55 Nr. 1 a; i m Falle des A r t . 52 I I I allerdings erst nach Ablauf einer Frist zur Behebung der Beeinträchtigung), wobei es nicht darauf ankommt, ob der Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat 2 0 . 20
Etwas anderes g i l t für den Schadenersatzanspruch, vgl. darüber u n t e r 4.
204
V I I . Die Sachmängelhaftung nach dem Einheitlichen Kaufgesetz
Handelt es sich um eine unwesentliche Pflichtverletzung, so kann der Käufer dem Verkäufer eine Nachfrist setzen (vgl. A r t . 26 IV, 27 I I 2, 31 I I 2, 44 II, 51) und nach Ablauf der Frist den Vertrag aufheben. Das Gesetz betrachtet nämlich die zunächst unwesentliche Vertragsverletzung nach Ablauf der Nachfrist — wie dies ζ. Β. i n A r t . 31 I I 2, 27 I I 2 zum Ausdruck kommt — in der Regel 21 als wesentliche Vertragsverletzung und läßt deshalb nun die Vertragsaufhebung zu. Was i m Einzelfall unter einer wesentlichen Vertragsverletzung zu verstehen ist, umschreibt A r t . 10. Danach liegt eine wesentliche Vertragsverletzung immer dann vor, wenn derjenige, der gegen die Pflicht verstößt, i m Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gewußt hat oder hätte wissen müssen 22 , daß der Vertragspartner, als vernünftige Person gedacht, den Vertrag nicht geschlossen hätte, wenn er die Vertragsverletzung und ihre Folgen vorausgesehen hätte. Vom Wortlaut her findet A r t . 10 nur Anwendung, wenn es u m Vertragspflichten geht, die nicht ausdrücklich von den Parteien zu wesentlichen Pflichten erklärt wurden. Doch es kann kein Zweifel daran bestehen, daß — vor allem und i n erster Linie — gerade die Parteivereinbarung dafür maßgeblich ist, welche Pflichten wesentlich sind 2 3 . Zweck des A r t . 10 ist es nur, i n den Fällen eine Abgrenzung zu ermöglichen, in denen eine Vereinbarung der Parteien gerade fehlt. M i t der Unterscheidung unwesentliche - wesentliche Vertragsverletzung hat das E K G einen bedeutsamen Schritt getan. Während das BGB — ausgedrückt durch die jeweiligen Sanktionen 2 4 — weitgehend selbst wertet, was eine wesentliche und was eine unwesentliche Vertragspflicht ist, überläßt es das E K G ganz den Parteien was sie als wesentliche
und
was sie als unwesentliche
zu
bestimmen,
Vertragspflicht
21 Durchbrochen w i r d dieses Prinzip von A r t . 52 I I I . Besteht an der K a u f sache ein Recht eines Dritten, so k a n n der Käufer nach A b l a u f der dem Verkäufer gesetzten Frist zur Beseitigung dieses Rechts n u r dann den V e r trag aufheben, wenn die Nichtbeseitigung eine wesentliche Vertragsverletzung bedeutet. I n diesem F a l l kann also der Käufer nicht schon allein auf G r u n d des Fristablaufs die Aufhebung des Vertrags erklären, es bedarf vielmehr noch der Feststellung einer wesentlichen Vertragsverletzung. I n der Regel dürfte jedoch die Tatsache, daß die Sache m i t dem Recht eines D r i t t e n belastet ist, sich als wesentliche Vertragsverletzung darstellen. 22 Über die Auslegung dieser Formulierung vgl. unten cc, α. 23 Vgl. Riese, S. 23: „Wenn sie (Anm.: die subjektiven Bewertungen über die Wesentlichkeit der Pflicht) aber zum Vertragsinhalt erhoben worden sind (was sich mangels ausdrücklicher Vereinbarung auch aus den Umständen ergeben kann), so folgt ihre Beachtlichkeit schon aus dem Grundsatz der Maßgeblichkeit des Parteiwillens." 24 I n den Fällen, i n denen das B G B Schadensersatz wegen Nichterfüllung gibt, w i r d eine wesentliche Vertragsverletzung unterstellt.
2. Die Rechte des Käufers bei Vorliegen eines S a c h m a n g e l s 2 0 5
ansehen wollen. Nach der Definition des A r t . 10 ist es nicht einmal nötig, daß die Parteien ausdrücklich vereinbart haben, daß eine bestimmte Verpflichtung wesentlich ist, es reicht aus, daß die Wesentlichkeit der Pflicht für den verpflichteten Vertragsteil unter Anwendung von grobe Fahrlässigkeit ausschließender Sorgfalt erkennbar gewesen ist. Damit berücksichtigt das E K G sogar die, allerdings nur unter objektivierten Gesichtspunkten (Art. 10: „ . . . eine vernünftige Person i n der Lage der anderen Partei . . . " ) beachtliche Motivation der betroffenen Vertragspartei. Gerade i m Bereich der Sachmängelhaftung zeigt sich dabei ein Unterschied zwischen den beiden Gesetzen. Während das BGB dazu tendiert, die mangelhafte Leistung nicht als wesentliche Vertragsverletzung anzusehen 25 , was sich daran zeigt, daß das Gesetz nur unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung gibt (vgl. § 463), richtet sich die Frage nach der Wesentlichkeit einer vereinbarten Eigenschaft i m E K G nach der Parteivereinbarung bzw. dem mutmaßlichen objektiven Willen des Anspruchsberechtigten, des Käufers. Allerdings w i r d dieser Unterschied durch die vom BGB i n § 459 I I vorgesehene Möglichkeit der Zusicherung gemildert. Durch die Zusicherung i m Sinne der §§ 459 II, 537 II, 633 I BGB können die Vertragsparteien eine bestimmte Eigenschaft der Vertragssache zum wesentlichen Vertragsinhalt machen, m i t der Folge, daß der Verkäufer bei mangelhafter Leistung zum Schadensersatz verpflichtet ist. Obwohl damit i n vielen Fällen E K G und BGB zu gleichen Ergebnissen führen dürften, erscheint doch das System des E K G überzeugender, weil es die Wertung, was wesentliche und was unwesentliche Vertragspflicht ist, grundsätzlich nicht selbst vornimmt, sondern den Parteien überläßt. Speziell für die Verpflichtung, die Sache mit bestimmten Eigenschaften zu leisten, hat das E K G damit etwas v e r w i r k licht, was z. B. von Holder 26, allerdings für die Regelung des BGB unzutreffend 2 7 , unter psychologischen Gesichtspunkten vertreten wurde: „Geradezu verkehrt ist es, einer bloßen Eigenschaft das Individualisierungsmerkmal als etwas wichtigeres gegenüberzustellen." Verletzt der Verkäufer eine Vertragspflicht, so ist der Käufer nach dem E K G nicht auf die Möglichkeit beschränkt, den Vertrag aufzuheben, er hat vielmehr — auch neben der Aufhebung — das Recht, Schadensersatz zu verlangen. 25 26 27
Vgl. dazu die Ausführungen oben V, 1. Festschrift f ü r Bekker, S. 66 F N 3. Vgl. dazu V Anm. 9.
206
V I I . Die Sachmängelhaftung nach dem Einheitlichen Kaufgesetz
Das E K G unterscheidet dabei ausdrücklich Schadensersatz i n Fällen, i n denen der Vertrag aufgehoben w i r d (Art. 84 ff.), und Schadensersatz i n Fällen, i n denen der Vertrag bestehen bleibt (Art. 82 f.). Das bedeutet, daß der Käufer nicht vor die Alternative gestellt ist — wie etwa überwiegend i m BGB —, entweder die Aufhebung des Vertrages zu erklären oder Schadensersatz zu verlangen, vielmehr kann der Käufer bei Vorliegen einer wesentlichen Vertragsverletzung den Vertrag aufheben und außerdem noch Schadensersatz verlangen (vgl. A r t . 24 II, 41 II, 51, 52 I I I , 55 I a). Diese Doppelgleisigkeit ist ein für das BGB fremdes Prinzip. Nicht kumulativ sondern alternativ stehen sich gewöhnlich nach dem BGB Vertragsaufhebung und Schadensersatz gegenüber (vgl. z. B. §§ 325, 326). Doch ist, wie Weitnauer 28 an verschiedenen Beispielen überzeugend dargestellt hat, dieser Grundsatz auch i m BGB an mehreren Stellen durchbrochen, insbesondere bei Dauerschuldverhältnissen wie etwa dem Dienst-, Arbeits- oder Mietverhältnis, aber auch i m Werkvertragsrecht 29 . Letztlich ist aber auch der von der Rechtsprechung und der h. L. zugelassene große Schadensersatz bei der Sachmängelhaftung nichts anderes als ein Nebeneinander von Wandlung und Schadensersatz 30 . Gerade die Tatsache, daß die h. L. dem Käufer den großen Schadensersatz zubilligt, zeigt sehr deutlich, daß ein echtes Bedürfnis für ein kumulatives Nebeneinander von Vertragsaufhebung und Schadensersatz besteht. Diesem Bedürfnis nun hat das E K G konsequent Rechnung getragen. Anders als das Recht zur Vertragsaufhebung, das allein von der Nichterfüllung der Vertragspflicht, nicht aber von einem Vertretenmüssen der Nichterfüllung abhängig ist, verlangt der Anspruch auf Schadensersatz nach dem E K G zusätzlich das Vorliegen eines bestimmten Zurechnungstatbestandes, wobei die Besonderheit darin besteht, daß der Anspruchsberechtigte das Vorliegen dieses Zurechnungstatbestandes nicht zu beweisen hat. Das w i r d unterstellt. Dem Verpflichteten obliegt es, den Entlastungsbeweis zu führen (vgl. A r t . 74). Gem. A r t . 74 kann sich die Partei, die eine ihrer Pflichten nicht erfüllt hat, von der Schadensersatzpflicht nur durch den Beweis entlasten, daß die „Nichterfüllung auf Umständen beruht, die sie nach den Absichten der Parteien bei Vertragsschluß weder i n Betracht zu ziehen noch zu vermeiden oder zu überwinden verpflichtet war; i n Ermangelung von 28 29 30
Weitnauer, S. 75 ff. Vgl. dazu i m einzelnen Weitnauer, S. 106 f. Vgl. oben V , 4, b, bb; ähnlich Weitnauer, S. 82.
2. Die Rechte des Käufers bei Vorliegen eines Sachmangels
207
Absichten der Parteien sind die Absichten zugrunde zu legen, die vernünftige Personen i n gleicher Lage gewöhnlich haben". E r f ü l l t der Verkäufer also eine Vertragspflicht nicht, so hat der Käufer — auch neben der Aufhebung — das Recht, Schadensersatz zu verlangen. Dieser Anspruch scheitert nur dann, wenn dem Verkäufer der Entlastungsbeweis nach A r t . 74 gelingt. Die Formulierung des A r t . 74 ist nun so angelegt, daß Hinderungsgründe jeder A r t darunter fallen können, also etwa anfängliche oder nachträgliche Unmöglichkeit oder anfängliches oder nachträgliches Unvermögen genauso gut, wie sonstige anfängliche oder nachträgliche Leistungshindernisse. Maßgeblich ist allein, ob und i n welchem Umfang eine Pflichtverletzung nach den Absichten der Parteien bei Vertragsabschluß dem Verpflichteten zuzurechnen sein sollte. Das bedeutet, daß der Verpflichtete sich nicht entlasten kann, wenn er z. B. versprochen hat, für den E i n t r i t t der Erfüllung unbedingt einzustehen, wie etwa bei Übernahme einer Garantie. Andererseits zwingt A r t . 74 nicht dazu, den Verkäufer i n jedem Fall eines anfänglichen Unvermögens auf Schadensersatz haften zu lassen. Die von der h. L. für das BGB vertretene und speziell i n § 538 zum Ausdruck gekommene Annahme, der Verkäufer übernehme für sein anfängliches Leistungsvermögen eine Garantie, kann i n dieser generellen Form nur als Unterstellung bezeichnet werden 3 1 . Demgegenüber verdient die auf den Einzelfall abstellende Regelung des E K G eindeutig den Vorzug 3 1 . Bemerkenswert ist noch der Umfang und die Begrenzung des Schadensersatzanspruchs. I m Gegensatz zum BGB kennt das E K G den Unterschied zwischen Nichterfüllungsschaden und Mangelfolgeschaden nicht. Der vom Verpflichteten zu ersetzende Schaden umfaßt vielmehr alle auf die Leistungsstörung zurückgehenden Schäden, jedoch nur soweit, als — damit w i r d der Umfang des zu ersetzenden Schadens beschränkt — sie von i h m (als vernünftiger Partei, A r t . 13) bei Vertragsschluß unter Berücksichtigung der Umstände, die er gekannt hat oder hätte kennen müssen, als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen werden mußten (vgl. A r t . 82, 86, 87 EKG). Stellt man diese Schadensersatzregelung des E K G der des BGB gegenüber, so ist offensichtlich, daß das E K G elastischer als das BGB ist 3 2 : einmal deshalb, w e i l es unter Vermeidung starrer Regelungsbereiche, wie etwa Unmöglichkeit, Verzug, allein an die Nichterfüllung anknüpft, zum anderen deshalb, weil es nicht auf bestimmte Schuld31
Ebenso Weitnauer, S. 108, 109. Vgl. Weitnauer, S. 108: „ I m Vergleich zu diesem feinen I n s t r u m e n t a r i u m w i r k e n die Argumente, welche die Motive f ü r die unbedingte Schadenshaftung des Vermieters nach § 538 anführen, fast grobschlächtig." 32
208
V I I . Die Sachmängelhaftung nach dem Einheitlichen Kaufgesetz
elemente, sondern allgemein auf die jeweils vorliegende Zurechenbarkeit abstellt. Maßgeblich für den Umfang des Ersatzanspruchs ist nicht der adäquate Schaden — wie etwa nach dem BGB —, sondern der für den Verpflichteten entsprechend dem jeweils übernommenen Risiko voraussehbare Schaden 33 . Damit w i r d der Haftungsumfang für den Schuldner überschaubar. cc) Die Sanktionen im Falle mangelhafter
Leistung
Nach der allgemeinen Darstellung der Sanktionen des E K G wenden w i r uns nun speziell der Frage zu, wie das E K G die durch Lieferung einer mangelhaften Sache hervorgerufene Leistungsstörung i m Detail behandelt. W i r d dem Käufer eine mangelhafte Sache ausgehändigt, so kann er gem. A r t . 41 1. 2. 3. 4.
Erfüllung des Vertrages verlangen die Aufhebung des Vertrages erklären den Kaufpreis herabsetzen Schadensersatz — auch bei erfolgter Aufhebung — verlangen. α) Die Untersuchungs- und Rügepflicht
Voraussetzung für diese Rechte ist, daß der Käufer seiner Untersuchungs- und Rügepflicht nachgekommen ist. Gem. A r t . 38 I obliegt es dem Käufer, die gelieferte Sache „innerhalb kurzer Frist" zu untersuchen 34 . Findet sich dabei ein Mangel, so muß der Käufer, w i l l er nicht die oben aufgeführten Rechte verlieren, diesen Mangel dem Verkäufer wiederum innerhalb kurzer Frist anzeigen (Art. 39 I 1). Ist die Tatsache, daß der Käufer den Mangel nicht entdeckt hat, auf ein i h m vorwerfbares Verhalten zurückzuführen — das E K G versteht darunter den Fall, daß der Käufer den Mangel bei der Untersuchung „hätte feststellen müssen" —, so kann er sich ebenfalls nicht mehr auf die Vertragswidrigkeit der Sache berufen. Ein Mangel, den der Käufer bei der Untersuchung nicht feststellen mußte, der aber später entdeckt wird, ist ebenfalls innerhalb kurzer Frist nach der Entdeckung anzuzeigen. Wahrt der Käufer diese Frist, so hat er die genannten Rechte. A r t . 39 I 3 sieht jedoch eine Ausschlußfrist von 2 Jahren vor. Der Käufer verliert danach stets das Recht, sich auf die Vertragswidrigkeit 33
Vgl. Weitnauer, S. 75. Nach A r t . 38 I I I erlangt der Käufer ausnahmsweise Aufschub, w e n n die i h m gelieferte Sache ohne Umladung weiter versendet w i r d u n d der Verkäufer bei Vertragsschluß die Möglichkeit der Weiterversendung kannte oder hätte kennen müssen. Der Käufer muß i n diesem F a l l die Sache erst bei ihrem Eintreffen am neuen Bestimmungsort untersuchen. 34
2. Die Rechte des Käufers bei Vorliegen eines Sachmangels
209
der Sache zu berufen, wenn er nicht innerhalb von zwei Jahren nach Aushändigung der Sache den Mangel angezeigt hat. Die Ausschlußfrist gilt nur dann nicht, wenn die Parteien eine längere Garantiefrist vereinbart haben (Art. 39 I 3 a. E.) oder wenn der Verkäufer i h m bekannte oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannte 3 5 Tatsachen verschwiegen hat, auf denen die Vertragswidrigkeit beruht (Art. 40) 36 . Nachzutragen sind noch zwei Definitionen. Unter kurzer Frist ist nach A r t . 11 eine Frist zu verstehen, „die unter Berücksichtigung der Umstände so kurz wie möglich ist und die m i t dem Zeitpunkt beginnt, i n dem die Handlung vernünftigerweise vorgenommen werden kann". Eine vergleichbare Regelung enthält das deutsche Recht nur i n § 377 HGB für den beiderseitigen Handelskauf 37 . Nach § 377 I HGB muß der Käufer die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer untersuchen und ebenso unverzüglich die Mängelanzeige erstatten. Der Maßstab, den das E K G anlegt, ist demgegenüber strenger. Unverzüglich bedeutet nach deutschem Recht: ohne schuldhaftes Zögern (§ 121 I 1 BGB). Das schließt die Berücksichtigung subjektiver Elemente m i t ein und ebenso eine gewisse Bedenkfrist. Unverzüglich heißt „ i n nerhalb angemessener Frist". Das E K G stellt m i t der Normierung einer „kurzen Frist" strengere Anforderungen 3 8 ; einmal ist der Begriff objektiviert zum anderen w i r d der Partei sofortiges Handeln auferlegt, sobald dies vernünftigerweise möglich ist. Gemildert werden die verhältnismäßig hohen Anforderungen der Untersuchungs- und Rügepflicht nur dadurch, daß der Verkäufer, wie i m deutschen Recht beim beiderseitigen Handelskauf (§ 377 I V HGB, § 121 I 2 BGB), das Übermittlungsrisiko für die Mängelrüge zu tragen hat (Art. 39 III). Zur Wahrung der Rechte genügt es, wenn der Käufer die Anzeige der Vertragswidrigkeit rechtzeitig, d.h. innerhalb kurzer Frist, abgesendet hat. Was das E K G sich unter der etwa i n A r t . 39 I 1 verwendeten Formulierung „hätte feststellen müssen" oder ähnlichen Wendungen vorstellt, klärt A r t . 13. Danach ist maßgeblich, was eine vernünftige Person i n 35
Die v o m E K G verwendete Formulierung, Tatsachen, „über die er nicht i n Unkenntnis hat sein können", dürfte dem Begriff der groben Fahrlässigkeit entsprechen; so auch Riese, S. 26. 36 Nicht n u r f ü r diesen Fall, sondern generell unter den genannten Voraussetzungen bestimmt A r t . 40, daß der Verkäufer sich nicht darauf berufen kann, der Käufer habe wegen Verletzung der Untersuchungs- oder Rügepflicht das Recht, die Vertragswidrigkeit der Sache geltend zu machen, gem. A r t . 38, 39 verloren. 37 F ü r den K a u f nach B G B fehlt eine entsprechende Regelung. Das E K G , das auch gilt, w e n n kein Handelskauf vorliegt, ist insoweit strenger, als es die Untersuchungs- u n d Rügepflicht auch einem Nichtkaufmann aufbürdet. 38 Z u m Unterschied „angemessene Frist" — „kurze F r i s t " vgl. Riese, S. 50. ererger
210
V I I . Die Sachmängelhaftung nach dem Einheitlichen Kaufgesetz
der gleichen Lage hätte wissen, tun oder — bei A r t . 39 I 1 — feststellen müssen. Diese Definition des Art. 13 umfaßt jede, also nicht nur grobe Fahrlässigkeit, ist also weiter als der etwa i n A r t . 40 verwendete Begriff „nicht i n Unkenntnis hat sein können" 3 9 . ß) Der Gefahrübergang als Voraussetzung der Rechte des Käufers Hat der Käufer seiner Untersuchungs- und Rügepflicht i. S. d. A r t . 38, 39 genügt, dann kann er die i n A r t . 41 aufgeführten Rechte geltend machen, wenn die Sache mangelhaft ist. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Vertragsmäßigkeit der Sache ist dabei, wie i m deutschen Recht, der Zeitpunkt, i n dem die Gefahr übergeht (Art. 35 11). Gem. A r t . 97 I geht die Gefahr über, wenn der Verkäufer die Sache entsprechend den Bedingungen des Vertrages und des E K G geliefert hat. Das ist der Fall, wenn er entweder dem Käufer (Art. 19 I) oder, i m Falle des Versendungskaufs, dem Transporteur zur Übermittlung an den Käufer (Art. 19 II) eine vertragsmäßige Sache ausgehändigt hat 4 0 . Nun könnte an sich bei Lieferung einer mangelhaften Sache die Gefahr nicht übergehen, der Käufer könnte damit niemals seine Rechte geltend machen. Dieses Problem nun hat A r t . 97 I I ausdrücklich gelöst. Danach geht die Gefahr über, sobald die Sache, abgesehen von ihrer Vertragswidrigkeit, nach den Bedingungen des Vertrags und des E K G dem Käufer ausgehändigt wird. Erklärt der Käufer jedoch die Aufhebung des Vertrages oder verlangt er i m Falle des Gattungskaufs Ersatzlieferung, dann ist ein Gefahrübergang nicht eingetreten (Art. 97 I I a. E.). Hat nun aber auf diese Weise kein Gefahrübergang stattgefunden, so fehlt es an sich an dem für die Beurteilung der Vertragswidrigkeit maßgeblichen Zeitpunkt und damit an einer Voraussetzung der vom Käufer erhobenen Rechte. Diesem Problem nun trägt A r t . 35 I 2 Rechnung. Ist die Gefahr auf Grund der Aufhebung oder des Verlangens nach Ersatzlieferung nicht übergegangen, „so beurteilt sich die Vertragsmäßigkeit nach dem Zu39
Vgl. dazu A n m . 35. Nach A r t . 19 I I I muß der Verkäufer, w e n n die dem Transporteur ausgehändigte Sache nicht deutlich, etwa durch eine Anschrift, als Erfüllungsgegenstand gekennzeichnet ist, eine Versandanzeige u n d u. U. ein die Sache genau bezeichnendes Schriftstück absenden. Wußte der Verkäufer bei Absendung der Versandanzeige bzw. des Schriftstücks, daß die Sache nach der Aushändigung an den Transporteur untergegangen oder verschlechtert w o r den ist, oder hätte er dies wissen müssen, so t r i f f t i h n die Gefahr bis zu dem Zeitpunkt, i n dem er die Anzeige abgeschickt hat (Art. 100). 40
2. Die Rechte des Käufers bei Vorliegen eines Sachmangels
211
stand der Sache i n dem Zeitpunkt, i n dem die Gefahr übergegangen wäre, wenn die Sache vertragsmäßig gewesen wäre". Ein Vergleich m i t dem BGB zeigt, daß es dort das gleiche Problem gibt. Wie nach A r t . 97 I I E K G findet gem. § 446 I 1 BGB ein Gefahrübergang trotz Mangelhaftigkeit der Sache statt. Während sich das aus A r t . 97 I I ausdrücklich ergibt, kann das für § 446 I 1 zweifelhaft sein. Würde man nämlich den von § 446 I 1 verwendeten Begriff „verkaufte Sache" i m Sinne einer dem Vertrag i n allen Punkten entsprechenden Sache verstehen, so könnte es bei Übergabe einer mangelhaften, also dem Vertrag nicht entsprechenden Sache zu keinem Gefahrübergang kommen. Die Folge wäre, daß die Sachmängelhaftung ausgeschlossen wäre, weil diese grundsätzlich Gefahrübergang voraussetzt. Das E K G hat dieses Problem direkt angesprochen: Zwar geht die Gefahr grundsätzlich nur bei i n allen Punkten vertragsmäßiger Lieferung über (Art. 97 I), das Vorliegen eines Sachmangels hindert jedoch bei sonst vertragsmäßiger Lieferung den Gefahrübergang nicht. F ü r § 446 I 1 BGB ergibt sich die Lösung aus der richtigen Auslegung des Begriffs „verkaufte Sache". Darunter ist nicht eine mangelfreie, dem Vertrag voll und ganz entsprechende Sache zu verstehen, sondern nur die schuldgegenständliche Sache, das ist beim Spezieskauf die von Anfang an feststehende, beim Gattungskauf die später durch Konkretisierung bestimmte einzelne Sache. Diese Auslegung ergibt sich aus dem gesetzlichen System. Da der Gefahrübergang grundsätzlich der Sachmängelhaftung vorangehen muß, die Sachmängelhaftung aber gerade Sanktionen für den Fall bringt, daß zwar die Sache als solche, jedoch m i t bestimmten Mängeln behaftet, geleistet wird, kann unter verkaufter Sache i. S. d. § 446 I 1 sinnvollerweise nur die Sache als solche d. h., die Sache i n ihrer Identität verstanden werden. Das bedeutet, daß m i t Übergabe der schuldidentischen Sache, mag sie auch mangelhaft sein, die Gefahr gem. § 446 1 1 BGB auf den Käufer übergeht. Einer näheren Betrachtung bedarf noch die Frage, wie nach den beiden Gesetzen beim Gattungskauf die Gefahr übergeht. Nach A r t . 97 I I E K G geht die Gefahr auf den Käufer m i t Aushändigung der Sache über, wenn dieser nicht Ersatzlieferung verlangt hat. Da die Aushändigung der Sache der für den Gefahrübergang maßgebliche Zeitpunkt ist und das Verlangen nach Ersatzlieferung der Aushändigung — u. U. erst sehr viel später — nachfolgt, könnte das einmal so verstanden werden, daß das Ersatzlieferungsverlangen rückwirkend den bereits eingetretenen Gefahrübergang beseitigt. Man könnte A r t . 97 I I aber auch so verstehen, daß bei Lieferung einer mangelhaften Gattungssache die Gefahr solange nicht übergeht, solange der Käufer Ersatzlieferung verlangen kann, und daß nach Verlust dieses Rechts die Gefahr rückwir4
212
V I I . Die Sachmängelhaftung nach dem Einheitlichen Kaufgesetz
kend auf den Zeitpunkt der Aushändigung als übergegangen angesehen wird. Für diese letztere Auslegung scheint der Wortlaut des Gesetzes zu sprechen, wenn der E i n t r i t t des Gefahrübergangs davon abhängig gemacht wird, daß der Käufer keine Ersatzlieferung verlangt hat. Diese zweite Auslegung würde auch der Regelung nach dem BGB entsprechen. Hat der Verkäufer eine Sache übergeben, die nicht von mittlerer A r t und Güte ist, so findet ein Gefahrübergang zunächst nicht statt. Die übergebene Sache ist, weil sie den Erfordernissen des § 243 I nicht genügt, nicht „verkaufte Sache" i. S. d. § 446 I 1. Der Käufer kann jedoch das Schuldverhältnis auf die angebotene Sache konkretisieren. Damit geht dann rückwirkend auf den Zeitpunkt der Übergabe die Gefahr auf den Käufer über 4 1 . Wie das BGB, so verlangt auch das E K G grundsätzlich als Voraussetzung für das Eingreifen der Rechte des Käufers Gefahrübergang. Dieser Grundsatz w i r d jedoch von A r t . 48 E K G durchbrochen. Danach kann der Käufer schon vor dem vereinbarten Lieferungszeitpunkt die Rechte aus A r t . 43 - 46 ausüben, „wenn offenbar ist, daß die Sache, die ausgehändigt werden soll, vertragswidrig ist". Diese Formulierung des A r t . 48 ist nicht ganz glücklich, denn entscheidend ist nicht, daß die Sache vor dem Lieferungszeitpunkt vertragswidrig ist, sondern, daß feststeht, daß die Sache zum Lieferungszeitpunkt vertragswidrig sein w i r d 4 2 . A r t . 48 E K G normiert damit etwas, was auch für das deutsche Recht von Rechtsprechung und h. L. vertreten wird, nur fehlt i m deutschen Recht eine dem A r t . 48 entsprechende, ausdrückliche Regelung 43 . γ) Die einzelnen Rechte des Käufers Liefert der Verkäufer die verkaufte Sache i n mangelhaftem Zustand, so hat der Käufer die oben unter cc) angeführten Rechte. Der folgende Abschnitt befaßt sich m i t der Frage, wie diese Rechte i m Detail ausgestaltet sind. 1. Der Erfüllungsanspruch Inhalt und Umfang des Erfüllungsanspruchs werden durch A r t . 42 E K G bestimmt. Beim Werklieferungsvertrag hat der Käufer einen Anspruch auf Mängelbeseitigung, allerdings unter der Voraussetzung, daß der Hersteller dazu i n der Lage ist (Art. 42 I a). Beim Spezieskauf kann der Käufer Lieferung der vereinbarten Sache oder des fehlenden Teiles verlangen (Art. 42 I b) d. h., der Käufer hat 41 42 43
Vgl. dazu V, 2, b, cc. Vgl. Riese, S. 60. Vgl. dazu i m einzelnen V I , 1.
2. Die
echte des Käufers bei Vorliegen eines Sachmangels
213
einen Anspruch auf eine mangelfreie Sache; wie sich jedoch aus der Gegenüberstellung m i t A r t . 42 I a ergibt, hat der Käufer keinen Mangelbeseitigungsanspruch. Er kann nur, soweit das möglich ist, Leistung des fehlenden Teiles der Sache verlangen. Eine davon zu trennende Frage ist, ob der Verkäufer ein Recht zur Mängelbeseitigung hat. Ein solches Recht ergibt sich einmal aus A r t . 37. Liefert der Verkäufer die Sache vor dem für die Lieferung bestimmten Zeitpunkt, so hat er bis zum vereinbarten Lieferungstermin das Recht, den Mangel der Sache zu beheben, soweit dem Käufer dadurch keine „unverhältnismäßigen Unannehmlichkeiten oder Kosten" erwachsen 44 . Ein Recht des Verkäufers zur Nachbesserung w i r d aber auch sonst unter den von A r t . 37 genannten Voraussetzungen (keine unverhältnismäßigen Unannehmlichkeiten oder Kosten) zu bejahen sein, wenn der Käufer Erfüllung verlangt. Hat die schuldgegenständliche Sache einen Mangel, so kann die Erfüllung nur dadurch herbeigeführt werden, daß der Mangel behoben wird. Nun sieht A r t . 44 I unter den gleichen Voraussetzungen wie A r t . 37 vor, daß der Verkäufer noch nach dem festgesetzten Lieferungszeitpunkt die Vertragswidrigkeit der Sache beseitigen darf. A r t . 44 gilt i n den Fällen, i n denen der Käufer nicht die A u f hebung des Vertrages gem. A r t . 43 erklären kann, d. h., i n denen nicht sowohl die Vertragswidrigkeit als auch die Verspätung der Lieferung wesentliche Vertragsverletzungen sind. Verlangt der Käufer Erfüllung, so hebt er den Vertrag gerade nicht auf, sondern verlangt Herstellung des vertragsmäßigen Zustands. Es muß daher das gleiche wie i n A r t . 44 I gelten. Die Regelung des E K G zeigt, daß das Vorliegen eines Anspruchs auf eine mangelfreie Sache nicht notwendig einen Anspruch auf Mängelbeseitigung zur Folge haben muß, wie das von der h. L. für das deutsche Recht angenommen w i r d 4 5 . Andererseits räumt das E K G i m Gegensatz zum BGB dem Verkäufer das Recht ein, den Mangel zu beseitigen und so den sonst gegebenen Ansprüchen des Käufers zu entgehen, soweit damit für den Käufer keine unverhältnismäßigen Unannehmlichkeiten oder Kosten verbunden sind. Auch hier zeigt sich wieder, wie das E K G versucht, eine für den Einzelfall möglichst gerechte Lösung zu finden. Es ist nämlich nicht 44 A r t . 37 g i l t i n gleicher Weise auch f ü r Werklieferungsvertrag u n d Gattungskauf, n u r daß dort Nachbesserung bzw. Lieferung einer anderen vertragsmäßigen Sache i n Betracht kommt. A r t . 37 ist also den Rechten des Käufers bei vertragswidriger Lieferung vorgeschaltet. Der Verkäufer ist berechtigt bis z u m vereinbarten Lieferungszeitpunkt nachzubessern, Mängel zu beseitigen oder eine andere Sache zu liefern. Gelingt i h m das, so stehen dem Käufer keine Rechte wegen vertragswidriger Lieferung zu. 45 Vgl. oben I V , 2, a u n d dort A n m . 48.
214
V I I . Die Sachmängelhaftung nach dem Einheitlichen Kaufgesetz
einzusehen, warum der Verkäufer — wie nach deutschem Recht — i n der Lage sein soll, eine Mängelbeseitigung abzulehnen, wenn diese i h n i n keiner Weise belastet. Die Regelung des E K G erweist sich auch hier elastischer als die des BGB. Beim Gattungskauf kann der Käufer, wenn die angebotene Sache mangelhaft ist, Lieferung einer anderen, dem Vertrag entsprechenden Sache verlangen (Art. 42 I c). Dies gilt, wie i n A r t . 25 bei Nichterfüllung der Pflicht hinsichtlich Zeit oder Ort der Lieferung, ausnahmsweise nicht, wenn ein „Deckungskauf den Gebräuchen entspricht" und i n angemessener Weise möglich ist" (Art. 42 I c). I n diesem F a l l ist es Sache des Käufers, sich die Ware anderweitig zu verschaffen. Er hat dann nur einen Anspruch auf Schadensersatz. Wenn das E K G durch A r t . 42 I i n der dargelegten Weise dem Käufer einen Erfüllungsanspruch gibt, so erheben sich zwei Fragen: a) Ob der Käufer auch i n der Lage ist, diesen Anspruch und zu vollstrecken und
einzuklagen
b) wie das Verhältnis dieses Erfüllungsanspruchs zu den sonstigen Rechten des Käufers ist. Beide Fragen lassen sich nicht trennen, sie hängen vielmehr eng miteinander zusammen, denn, wenn der Anspruch nicht einklagbar ist, führt das zwangsläufig immer dazu, daß die Leistungsstörung durch die anderen Rechte ausgeglichen werden muß. M i t der ersten Frage befaßt sich A r t . 16 EKG. Während das angloamerikanische Recht zwar einen Anspruch auf Erfüllung kennt, aber eine Durchsetzung dieses Anspruchs i m Wege der Zwangsvollstreckung gewöhnlich nicht zuläßt, sondern statt dessen einen Schadensersatzanspruch gewährt, knüpft das kontinentale Recht i n der Regel grundsätzlich an den Leistungsanspruch die Möglichkeit, nach entsprechendem Urteil den Anspruch auch i m Wege der Zwangsvollstreckung durchzusetzen. Dieser Gegensatz der beiden Rechtskreise nun konnte auch nicht durch das E K G überwunden werden 4 6 . A r t . 16 E K G i n Verbindung mit A r t . V I I des Übereinkommens vom 1. J u l i 1964 zum E K G bestimmt daher, daß das Gericht nur dann die Zwangsvollstreckung des Erfüllungsanspruchs anordnen darf, wenn dies auch nach dem heimischen Recht bei einem nicht unter das E K G fallenden Vertrag zulässig wäre. Interessant ist diese Regelung des E K G deshalb, weil sie zeigt, daß ein Erfüllungsanspruch nicht notwendig erzwingbar sein muß. H i n sichtlich der Pflicht, eine bestimmte Sache mangelfrei zu leisten, haben 46
Vgl. Riese, S. 29.
2. Die R e t e des Käufers bei Vorliegen eines S a c h m a n g e l s 2 1 5
w i r für das deutsche Recht festgestellt 47 , daß an Stelle der Erzwingbarkeit dieser Pflicht sekundäre Ausgleichsansprüche eingreifen, die Sachmängelansprüche. Unsere Auslegung t r i f f t sich i n diesem Punkt m i t den Vorstellungen des anglo-amerikanischen Rechtskreises, so daß es, sofern es u m einen Sachmangel geht, i m Rahmen des A r t . 16 zu keiner Divergenz kommt. Das Verhältnis des Erfüllungsanspruchs zu den sonstigen Rechten des Käufers ergibt sich aus A r t . 41 II, 42 I I . Wie bereits ausgeführt, hat der Käufer i m Falle eines Schadens Anspruch auf Schadensersatz, gleichgültig, ob der Vertrag aufgehoben w i r d oder fortbesteht. Der Käufer hat also den Anspruch auf Schadensersatz kumulativ neben den sonstigen Ansprüchen (vgl. A r t . 41 II), also auch neben dem Erfüllungsanspruch. Anders verhält es sich zwischen dem Recht, die Aufhebung des Vertrages zu erklären bzw. den Kaufpreis herabzusetzen und dem A n spruch auf Erfüllung. Zwischen diesen Ansprüchen besteht, wie sich aus A r t . 42 I I ergibt, ein echtes alternatives Verhältnis. Der Käufer kann entweder Erfüllung des Vertrages verlangen, d. h. er kann beim Werklieferungsvertrag Nachbesserung, beim Gattungskauf Ersatzlieferung, beim Spezieskauf Lieferung der vereinbarten Sache oder Lieferung des fehlenden Teiles fordern, oder er kann gleich, soweit die Voraussetzungen des A r t . 43 vorliegen, die Aufhebung des Vertrags erklären bzw. den Kaufpreis herabsetzen. Verlangt der Käufer zunächst Erfüllung, so stellt A r t . 42 I I klar, daß der Käufer erst nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist die Rechte aus A r t . 43 - 46 geltend machen kann. Der Käufer muß also, wenn er Erfüllung verlangt hat, zunächst eine angemessene Frist abwarten 4 8 , und kann erst dann 4 9 die Aufhebung des Vertrags erklären bzw. den Kaufpreis herabsetzen 50 . Zwischen dem Erfüllungsanspruch und den Rechten nach A r t . 43 - 46 besteht also ein alternatives, kein kumulatives Verhältnis 5 0 . Die Systematik des E K G entspricht damit i n diesem Punkt der des BGB. Vertragsaufhebung und Herabsetzung des Kaufpreises sind sekundäre Rechte, die der Tatsache Rechnung tragen, daß der ursprüngliche Erfüllungsanspruch nicht v o l l befriedigt wurde 5 1 .
47
Vgl. unter V, 1 a. E. u n d V, 3, a. Die Angemessenheit bestimmt sich nach dem Einzelfall (vgl. Riese, S. 57). 49 Ebenso wie i n A r t . 26 I V bei Nichterfüllung der Pflicht hinsichtlich der Zeit der Lieferung. 50 Vgl. Riese, S. 57; Ficker, S. 138. 51 F ü r die Regelung des B G B vgl. oben V, 3, b. 48
216
V I I . Die Sachmängelhaftung nach dem Einheitlichen Kaufgesetz
2. Die Aufhebung des Vertrags Liefert der Verkäufer eine vertragswidrige Sache und erfolgt die Lieferung außerdem nicht zu dem festgelegten Zeitpunkt, so kann der Käufer den Vertrag gem. A r t . 43 S. 1 E K G aufheben, wenn beide Umstände nebeneinander vorliegen und jeweils für sich betrachtet wesentliche Vertragsverletzungen darstellen. Das Gesetz läßt es also für die Aufhebung des Vertrags nicht genügen, daß nur die Vertragswidrigkeit der Sache eine wesentliche Vertragsverletzung ist, es verlangt zusätzlich, daß auch die Verspätung der Lieferung eine wesentliche Vertragsverletzung bedeutet. Das Gesetz w i l l dadurch dem Verkäufer die Möglichkeit einräumen, i n den nicht unter A r t . 43 fallenden Fällen die Vertragswidrgkeit zu beheben (Art. 44 I). Kann der Käufer nach A r t . 43 S. 1 den Vertrag aufheben, so muß er die Aufhebung innerhalb kurzer Frist 5 2 nach der Anzeige der Vertragswidrigkeit bzw. nach Ablauf der gem. A r t . 42 I I laufenden angemessenen Frist zur Erfüllung erklären, w i l l er nicht das Aufhebungsrecht verlieren 5 3 . Liegt kein Fall des A r t . 43 vor, d. h. stellt nur die Vertragswidrigkeit oder nur die Verspätung der Lieferung oder keine von beiden eine wesentliche Vertragsverletzung dar, so kann der Käufer nicht sofort die Aufhebung des Vertrags erklären. Der Verkäufer hat vielmehr nach A r t . 44 I das Recht die Vertragswidrigkeit zu beheben: beim Spezieskauf durch Mängelbeseitigung, beim Werklieferungsvertrag durch Nachbesserung, beim Gattungskauf durch Lieferung einer anderen mangelfreien Sache. Der Käufer kann jedoch für die Behebung des Mangels bzw. die Nachlieferung eine angemessene F r i s t 5 4 setzen. Ist die Vertragswidrigkeit nach Ablauf dieser Frist nicht behoben, so kann der Käufer nach seiner Wahl Erfüllung 5 5 des Vertrags verlangen, den Kaufpreis herabsetzen oder die Aufhebung des Vertrags erklären (Art. 44 II). Die A u f hebung muß wie i n A r t . 43 innerhalb kurzer Frist erfolgen. Die Folgen der Aufhebung ergeben sich aus A r t . 78 ff. Durch die A u f hebung erlöschen die beiderseitigen Leistungspflichten. Nur etwaige Schadensersatzansprüche bleiben bestehen (Art. 78 I EKG); diese richten sich dann nach A r t . 84 ff. Das Geleistete ist zurückzugewähren. Bet r i f f t das beide Parteien, so hat die Rückgabe Zug u m Zug zu erfolgen (Art. 78 II). 52
Vgl. dazu oben α. Bei Fristversäumung bleiben dem Käufer aber die Rechte auf Erfüllung, Minderung u n d Schadensersatz erhalten (Riese, S. 58). 54 Vgl. dazu A n m . 48. 55 Nach § 326 I 2 B G B ist dagegen der Anspruch auf E r f ü l l u n g nach F r i s t ablauf ausgeschlossen. § 326 gilt allerdings nicht i m Falle der Fehlerhaftigkeit (vgl. V I , 2). 53
2. Die Rechte des Käufers bei Vorliegen eines S a c h m a n g e l s 2 1 7
3. Die Herabsetzung des Kaufpreises Wie i m deutschen Recht kann der Käufer die mangelhafte Sache auch behalten, dafür aber den Kaufpreis herabsetzen. Diese Möglichkeit kommt einmal i n Betracht, wenn die Voraussetzungen für eine Aufhebung nach A r t . 43 nicht vorliegen, aber auch dann, wenn der Käufer von seinem Recht nach A r t . 43, den Vertrag aufzuheben, keinen Gebrauch macht. I m letzteren Fall hat der Käufer sofort das Recht, den Kaufpreis herabzusetzen d. h., er muß nicht erst eine Frist zur Behebung der Vertragswidrigkeit abwarten, denn A r t . 44 gilt nur, wenn die Voraussetzungen des A r t . 43 nicht vorliegen. Sind die Voraussetzungen gegeben, so hat der Verkäufer kein Recht, die Vertragswidrigkeit nach A r t . 44 I zu beheben, damit entfällt auch die i n A r t . 44 I I vorgesehene Frist. Liegt kein F a l l des A r t . 43 vor, so hat der Verkäufer das Recht, die Erfüllung auf die i n A r t . 44 I vorgesehene Weise herbeizuführen. Der Käufer ist erst nach erfolglosem Ablauf der von i h m gesetzten angemessenen Frist berechtigt, den Kaufpreis gem. A r t . 46 herabzusetzen (Art. 44 II). Zusammenfassend ergibt sich damit für A r t . 42 ff. folgendes Bild. Stellt sowohl die Vertragswidrigkeit der Sache wie auch die Verspätung der Lieferung eine wesentliche Vertragsverletzung dar, so kann der Käufer sofort die Aufhebung erklären (Art. 43) oder sofort den Kaufpreis herabsetzen. Der Verkäufer hat kein Recht, die Vertragswidrigkeit irgendwie zu beheben. Der Käufer kann auch Erfüllung verlangen. I n diesem Falle hat der Verkäufer ein Nachlieferungs- bzw. Nachbesserungs-Recht. Stellt nur die Vertragswidrigkeit oder nur die Verspätung der Lieferung oder keine von beiden eine wesentliche Vertragsverletzung dar, dann hat der Verkäufer auch nach dem für die Lieferung festgesetzten Zeitpunkt ein Recht zur Behebung der Vertragswidrigkeit, wenn dadurch dem Käufer keine unverhältnismäßigen Unannehmlichkeiten oder Kosten verursacht werden. Der Käufer kann jedoch eine angemessene Frist setzen und nach fruchtlosem Ablauf der Frist die Aufhebung des Vertrags erklären oder den Kaufpreis herabsetzen. Der Käufer kann aber auch statt dessen weiterhin Erfüllung des Vertrags verlangen.
4. Der Anspruch auf Schadensersatz Neben den bisher genannten Rechten hat der Käufer außerdem einen Anspruch auf Ersatz eines etwaigen Schadens. Wie bereits mehrfach hervorgehoben, hat der Käufer diesen Anspruch kumulativ neben den
218
V I I . Die Sachmängelhaftung nach dem Einheitlichen Kaufgesetz
übrigen Rechten (vgl. A r t . 41 II). Der Anspruch ist von einem Verschulden unabhängig. Ersetzt w i r d grundsätzlich jede A r t von Schaden, also auch der sogenannte Mangelfolgeschaden, nur ist der Schadensersatz abhängig von den i m Einzelfall vorliegenden Zurechnungskriterien, die sich aus A r t . 74 ergeben 56 . Aus diesem System folgt, daß eine besondere Rechtsfolgeregelung für den Fall der Zusicherung einer Eigenschaft, wie w i r sie i n §§ 459 II, 463 haben, unnötig ist 5 7 . Der Verkäufer hat nach dem E K G bei vertragswidriger Lieferung grundsätzlich Schadensersatz zu leisten. Er kann sich jedoch von dieser Verpflichtung befreien, wenn i h m der Entlastungsbeweis nach A r t . 74 gelingt. I m Rahmen des A r t . 74 findet u. a. Beachtung, was die Parteien bei den Vertragsverhandlungen hinsichtlich der Eigenschaft der Sache zum Ausdruck gebracht haben. Je nachdem, ob und i n welchem Umfang nach den Vertragsverhandlungen der Verkäufer ein Schadensrisiko übernommen hat, bestimmt sich dann der Schadensersatzanspruch. Interessant ist, daß der i n A r t . 74 E K G zum Ausdruck gekommene Gedanke sich i n ähnlicher Weise bei einem Teil der deutschen Literatur wiederfindet, nämlich für den Fall des Mangelfolgeschadens. So w i r d z. B. von Diederichsen für die Frage, wann der Verkäufer für einen Mangelfolgeschaden haftet, darauf abgestellt, ob das Verhalten und die Erklärungen des Verkäufers es rechtfertigen, i h m den Mangelfolgeschaden zuzurechnen 58 . Das E K G ist noch einen Schritt weitergegangen, indem es diesen von einem Verschulden losgelösten Zurechnungsgesichtspunkt zum allgemeinen Prinzip erhoben hat. Was vom Verkäufer zu ersetzen ist, hängt von der Frage ab, ob der Vertrag aufgehoben wurde oder nicht. Besteht der Vertrag fort, so richtet sich der Anspruch nach A r t . 82 EKG. Zu ersetzen ist der entstandene Verlust und der entgangene Gewinn, jedoch nur bis zu dem Betrag, mit dem die schädigende Partei bei „Vertragsschluß unter Berücksichtigung der Umstände, die sie gekannt hat oder hätte kennen müssen 59 , als mögliche Folge der Vertragsverletzung" rechnen mußte. Es handelt sich bei dieser Formulierung um eine aus dem common law übernommene eingeschränkte Kausalitätsformel 6 0 , durch die der Umfang des Schadensersatzes begrenzt w i r d 6 1 . Hebt der Käufer den Vertrag auf, so richtet sich der Schadensersatzanspruch nach den A r t . 84 ff. Nach 56 57 58 59 60 81
Vgl. i m einzelnen die Ausführungen zu A r t . 74 oben unter bb) am Ende. Riese, S. 44; Weitnauer, S. 108. Vgl. dazu V, 4, b, aa, α, 4. Als vernünftige Person (Art. 13), vgl. oben a. Vgl. Riese, S. 87. Vgl. dazu i m einzelnen König, Kolloquium, S. 75 ff.
2. Die Rechte des Käufers bei Vorliegen eines S a c h m a n g e l s 2 1 9
Art. 84 kann der Käufer den Differenzbetrag zwischen dem Preis der Sache und dem Marktpreis der Sache am Tage der Aufhebung des Vertrags ersetzt verlangen. Es handelt sich dabei u m eine abstrakte Schadensberechnung, bei der ein Deckungskauf fingiert wird. Dem Käufer steht es aber frei, seinen Schaden konkret zu berechnen, wenn er einen Deckungskauf vorgenommen hat; jedoch muß dieses Geschäft i n „angemessener Weise" vorgenommen werden (Art. 85). Der Ersatz eines sonstigen, d.h. nicht durch ein Deckungsgeschäft hervorgerufenen Schadens richtet sich nach A r t . 86. Auch hier führt die zitierte eingeschränkte Kausalitätsformel zur Begrenzung des Schadensersatzumfanges. Hervorzuheben ist noch die Vorschrift des A r t . 88, nach der der Geschädigte verpflichtet ist, die „angemessenen Maßnahmen" zu treffen, u m den Schaden möglichst gering zu halten, weil der Schädiger sonst Herabsetzung des Schadensersatzes verlangen kann. A r t . 88 entspricht i n etwa der Vorschrift des § 254 I I 1 a. E. BGB. 5. Der Verlust bzw. der Ausschluß der Rechte Hat der Käufer bei Vertragsabschluß die Vertragswidrigkeit gekannt oder über sie nicht in Unkenntnis sein können, d. h. infolge grober Fahrlässigkeit nicht gekannt 6 2 , so haftet der Verkäufer nicht (Art. 36). Eine ähnliche Bestimmung t r i f f t § 460 BGB für das deutsche Recht. Nach A r t . 49 I verliert der Käufer die i n A r t . 41 aufgeführten Rechte ein Jahr, nachdem er gem. A r t . 39 die Vertragswidrigkeit der Sache dem Verkäufer angezeigt hat. Jedoch gilt das nicht, wenn der Käufer infolge einer Täuschung des Verkäufers daran gehindert war, die Rechte geltend zu machen. A r t . 49 I I 1 bestimmt, daß die Ansprüche auch nicht mehr mittels Einrede erhoben werden können. Von diesem Grundsatz macht A r t . 49 I I 2 eine Ausnahme. Hat der Käufer den Kaufpreis noch nicht bezahlt, so kann er der Kaufpreisforderung des Verkäufers das Recht auf Herabsetzung des Kaufpreises oder auf Schadensersatz einredeweise entgegenhalten, sofern er die Vertragswidrigkeit nach A r t . 39 innerhalb kurzer Frist angezeigt hatte. Abgesehen von einer i m Detail anders als in §§ 477, 478, 479 B G B 6 3 gestalteten Regelung unterscheidet sich die Vorschrift des A r t . 49 E K G von § 477 BGB dadurch, daß sie keine Verjährungsfrist, sondern eine Ausschlußfrist normiert 6 4 . 62 63 64
Vgl. A n m . 35. Vgl. dazu oben V, 2, b, bb u n d 4, b, cc. Vgl. Riese, S. 60 f.
220
V I I . Die Sachmängelhaftung nach dem Einheitlichen Kaufgesetz
6. Die Gefahrtragung bei Untergang der übergebenen, mangelhaften Sache Unter ß) haben w i r uns m i t dem Gefahrübergang als Voraussetzung für das Eingreifen der Käuferrechte beschäftigt. Der Gefahrübergang hat nun nicht nur Bedeutung für das Eingreifen der Rechte des Käufers bei vertragswidriger Lieferung, sondern auch für die Frage, wer den Schaden hat, wenn die Sache verschlechtert w i r d oder untergeht. Dieses Problem nun w i r d von A r t . 97 zusammen m i t A r t . 79 geregelt. Hat der Verkäufer eine mangelhafte Sache geleistet und geht diese Sache nach Aushändigung an den Käufer unter, so fragt es sich, wen dieser Schaden trifft. Nach A r t . 97 I I ist ein Gefahrübergang nicht eingetreten, wenn der Käufer die Aufhebung des Vertrags erklärt oder Nachlieferung verlangt hat. Gem. A r t . 79 I verliert der Käufer das Recht, die Aufhebung des Vertrags zu erklären, wenn es i h m unmöglich ist, die Sache i n dem Zustand, i n dem er sie erhalten hat, zurückzugeben, es sei denn, die Verschlechterung oder Veränderung der Sache ist unbedeutend (Art. 79 I I e) oder nicht auf ein Verhalten des Käufers bzw. einer Person, für die er einzustehen hat 6 5 , zurückzuführen (Art. 79 I I d) oder es liegt sonst eine der i n A r t . 79 I I aufgezählten Ausnahmen vor. M i t dem Verlust des Aufhebungsrechts gem. A r t . 79 I steht nach A r t . 97 I I der Gefahrübergang der übergebenen, mangelhaften Sache fest, wobei es nicht darauf ankommt, ob man davon ausgeht, daß nun die Gefahr rückwirkend übergeht oder davon, daß der Gefahrübergang nicht mehr rückwirkend beseitigt werden kann. Das hat zur Folge, daß der Käufer ungeachtet des Untergangs oder der Verschlechterung der Sache zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet ist. Der Käufer verliert jedoch gem. A r t . 79 I nur das Recht zur Aufhebung des Vertrags. Die sonstigen bei vertragswidriger Leistung gegebenen Rechte bleiben i h m erhalten d. h., er kann Minderung und Schadensersatz verlangen. Ist die Verschlechterung oder Veränderung der Sache nur unbedeutend oder beruht die Unmöglichkeit, die Sache überhaupt oder i n dem Zustand, i n dem der Käufer sie erhalten hat, zurückzugeben, nicht auf einem Verhalten des Käufers bzw. seiner Hilfsperson oder liegt sonst ein Ausnahmefall des A r t . 79 I I vor, so verliert der Käufer nicht das Recht, die Aufhebung des Vertrags zu erklären. Macht er von diesem Recht Gebrauch, so ist nach Art. 97 I I ein Gefahrübergang nicht einge65 F ü r welche Personen der Schuldner einzustehen hat, regelt das E K G nicht. Vielmehr w i r d die Entscheidung darüber der Rechtsprechung i m Rahmen des A r t . 74 überlassen (vgl. Riese, S. 48).
2. Die Rechte des Käufers bei Vorliegen eines S a c h m a n g e l s 2 2 1
treten d. h. der Käufer ist trotz Untergang oder Verschlechterung der Sache zur Zahlung des Kaufpreises nicht verpflichtet (vgl. A r t . 96). Während der soeben behandelte Fall sowohl beim Gattungs- wie beim Spezieskauf Bedeutung hat, weil bei beiden eine Vertragsaufhebung i n Betracht kommt, betrifft der zweite i n A r t . 97 I I angesprochene Fall nur den Gattungskauf, weil nur dort vom Käufer Ersatzlieferung verlangt werden kann (vgl. A r t . 42 I c EKG). Nach A r t . 97 I I ist die Gefahr nicht übergegangen, wenn der Käufer Ersatzlieferung verlangt. Gem. A r t . 42 I c kann der Käufer Lieferung einer anderen vertragsmäßigen Sache verlangen, wenn der Verkäufer eine vertragswidrige Sache geliefert hat. Es erhebt sich nun die Frage, ob der Käufer die Nachlieferung auch dann verlangen kann, wenn die i h m ausgehändigte Sache beispielsweise durch sein eigenes Verhalten untergegangen ist. Könnte der Käufer i n diesem F a l l Nachlieferung verlangen, so hätte das zur Folge, daß gem. A r t . 97 I I der Verkäufer die Gefahr zu tragen hätte für die übergebene Sache. Der Käufer wäre nicht verpflichtet, für die untergegangene Sache den Kaufpreis zu bezahlen, vielmehr wäre er erst zur Zahlung verpflichtet, wenn der Verkäufer seiner Nachlieferungspflicht nachkommt und erneut eine Sache liefert. Da eine dem A r t . 79 entsprechende Vorschrift für den Ersatzlieferungsanspruch fehlt, läßt sich das Problem nur durch eine abwägende Betrachtung lösen. Als Wertungsgrundlage bietet sich dabei A r t . 79 an. Die gleichen Gesichtspunkte, die den Gesetzgeber veranlaßt haben, abgesehen von den i n A r t . 79 I I genannten Ausnahmefällen den Verlust des Aufhebungsrechts anzuordnen, treffen auch für den Ersatzlieferungsanspruch zu. Der Käufer soll nicht die Gefahr, die i h n bei mangelfreier Leistung getroffen hätte, nur deshalb auf den Verkäufer abwälzen können, w e i l zufällig die Sache vertragswidrig war. Es handelt sich dabei nur um einen konkreten Ausdruck des Gedankens „venire contra factum proprium". Unter entsprechender Anwendung des A r t . 79 ergibt sich, daß der Käufer Ersatzlieferung nicht verlangen kann, wenn es i h m unmöglich ist, die Sache i n dem Zustand, i n dem er sie erhalten hat, zurückzugeben, es sei denn, daß eine der Ausnahmen des A r t . 79 I I vorliegt, daß also etwa die Verschlechterung oder Veränderung nur unbedeutend ist oder nicht auf einem Verhalten des Käufers bzw. einer Hilfsperson beruht. Hat der Käufer seinen Ersatzlieferungsanspruch verloren, so t r i f f t gem. A r t . 97 I I i h n allein die Gefahr d. h. er muß trotz Untergang bzw. Verschlechterung der Sache den Kaufpreis bezahlen (Art. 96), kann jedoch mindern und Schadenersatz verlangen.
222
V I I . Die Sachmängelhaftung nach dem Einheitlichen Kaufgesetz
Ist allerdings die Beeinträchtigung der Sache nach Gefahrübergang vom Verkäufer bzw. einer Hilfsperson verursacht worden, so haftet der Verkäufer für die Folgen der Vertragswidrigkeit (Art. 35 I I EKG). Stellt man dieses Ergebnis der entsprechenden Regelung des BGB gegenüber, so zeigt sich, daß, abgesehen von kleinen begrifflichen Unterschieden 66 beide Gesetze übereinstimmen. Ein Unterschied ergibt sich nur daraus, daß die Aufhebung nach E K G durch einseitige Erklärung, die Wandlung nach BGB hingegen durch Vereinbarung erfolgt. Die Wandlung ist also selbst nach Abgabe der Wandlungserklärung ausgeschlossen, wenn zwischen Abgabe der Erklärung und Einverständnis des Verkäufers (bzw. Urteil) die Sache infolge eines vom Schuldner i. S. d. § 351 verschuldeten Umstandes untergeht, wesentlich verschlechtert w i r d oder sonst nicht herausgegeben werden kann. Für das E K G t r i t t dieses Problem nicht auf, weil dort die Aufhebung durch die Erklärung bereits erfolgt ist. I m übrigen ergibt sich für das BGB folgendes. M i t der Übergabe der konkret geschuldeten, wenn auch fehlerhaften Sache ist gem. § 446 I 1 die Gefahr auf den Käufer übergegangen 67 . Nach § 467 i. V. m. § 351 verliert der Käufer das Recht Wandlung zu verlangen, wenn er den Untergang, die wesentliche Verschlechterung oder eine anderweitige Unmöglichkeit der Herausgabe der Sache vor Vollzug der Wandlung i. S. d. § 3 5 1 „verschuldet" hat. Das bedeutet, daß i n diesem Fall die Gefahr beim Käufer bleibt 6 8 . Der Käufer ist unbeachtet des Schicksals der Sache zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet. Ist die Sache jedoch durch Zufall untergegangen, so kann der Käufer wandeln d. h. er w i r d von der Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises frei. Der aus dem Untergang bzw. der Verschlechterung der Sache resultierende Schaden t r i f f t allein den Verkäufer. Ähnlich verhält es sich beim Nachlieferungsanspruch. Hat der Verkäufer eine Sache geleistet, die nicht von mittlerer A r t und Güte ist, so ist diese Sache nicht „verkaufte Sache" i. S. d. § 446 I 1 BGB d. h. ein Gefahrübergang hat nicht stattgefunden. 66 Es fragt sich z. B., ob der v o m E K G verwendete Begriff „unbedeutende Verschlechterung" m i t dem v o m B G B verwendeten Begriff der unwesentlichen Verschlechterung gleichbedeutend ist (vgl. §§ 350, 351 BGB). Dagegen ergibt sich kein wesentlicher Unterschied unter dem Gesichtspunkt des Verschuldens. Nach A r t . 79 I I bleibt die Gefahr beim Käufer, w e n n die Verschlechterung etc. auf einem Verhalten des Käufers bzw. einer H i l f s person beruht. E i n Verschulden ist nicht erforderlich. Entsprechendes gilt aber auch f ü r § 351. „Verschulden" bedeutet dort zurechenbares Verhalten (vgl. oben V, 2, b, aa u n d dort A n m . 37; ebenso von Caemmerer, Festschrift Larenz, S. 632 ff.). 67 Vgl. dazu oben I I I , 1, b. 68 Vgl. dazu oben V, 2, b, aa am Ende.
2. Die Rechte des Käufers bei Vorliegen eines S a c h m a n g e l s 2 2 3
Geht die Sache durch Zufall unter, so berührt das weder den Nachlieferungsanspruch, noch die Gefahrtragungslage 69 . K o m m t es jedoch auf Grund „Verschuldens" des Käufers i. S. d. § 351 zum Untergang (o. ä.) der Sache, so verliert er gem. §§ 480 I 2, 467, 351 den Nachlieferungsanspruch d. h. aber, das Schuldverhältnis w i r d kraft Gesetzes auf die übergebene Sache konkretisiert, mit der Folge, daß nun rückwirkend die Gefahr auf ihn übergeht 69 . Der Käufer ist daher zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet, gleichgültig was mit der Sache geschehen ist. I h m verbleibt nur die Möglichkeit, Minderung oder Schadensersatz 69 zu verlangen. 7. Konkurrenzen Da das E K G die Sachmängelhaftung i n das allgemeine Haftungssystem eingegliedert hat, tauchen keine Konkurrenzprobleme innerhalb des E K G auf. Ein Problem könnte sich nur ergeben, wenn die Anfechtung nach dem jeweiligen innerstaatlichen Recht bei Vorliegen eines Sachmangels möglich wäre. Das E K G hat nun dieses Problem dadurch gelöst, daß es neben den Rechten des E K G keine anderen Rechte zuläßt, soweit diese auf die Vertragswidrigkeit der Sache gestützt werden (Art. 34). Damit ist die Anfechtung wegen eines Eigenschaftsirrtums, soweit es sich um einen bloßen M o t i v i r r t u m handelt, ausgeschlossen70. Ein Eigenschaftsirrtum i n der Form eines Erklärungsirrtums, wie i n dieser Abhandlung vertreten, berechtigt dagegen nach wie vor zur Anfechtung, da dafür das E K G keine Regelung enthält (Art. 8, 17 EKG). Unbenommen ist dem Käufer weiterhin das Recht nach § 123 BGB anzufechten, weil sich der Anfechtungsgrund dort nicht aus der bloßen Vertragswidrigkeit der Sache ergibt, sondern aus der Täuschung oder Drohung. I m übrigen erklärt A r t . 89 das jeweilige nationale Recht für anwendbar, wenn es um Ersatz des Schadens aus absichtlicher Schädigung oder arglistiger Täuschung geht. Als Mindestbetrag ist jedoch Ersatz i n der Höhe zu leisten, die sich bei Anwendung des E K G ergeben würde 7 1 . Zweck des A r t . 89 ist es, i n den betreffenden Fällen dem Käufer den nach nationalem Recht gegebenen weiteren Schadensersatzanspruch nicht zu nehmen.
69 70 71
Vgl. dazu i m einzelnen ,V 2, b, aa. Riese, S. 47 ; Erman / Weitnauer, vor § 459 Rdz 29. Riese, S. 90 unter entsprechender Heranziehung des A r t . 17 EKG.
V I I I . Schlußbetrachtung Das E K G stellt sich, das hat dieser kurze Überblick gezeigt, als eine i n sich geschlossene, sinnvolle Regelung dar, die bestens geeignet ist, unter Berücksichtigung aller Begleitumstände eine für den jeweiligen Einzelfall gerechte Lösung herbeizuführen. Erreicht w i r d dieses Ergebnis dadurch, daß das E K G keine starren Wertungen trifft, sondern auf die Sachlage abstellt, wie sie von den Parteien geschaffen wurde. Ganz bewußt schenkt das E K G den Erklärungen, Absichten der Parteien und sonstigen Begleitumständen i n allen Einzelheiten Beachtung. Verglichen m i t der Regelung des BGB erweist sich damit das E K G als sehr viel flexiblere Regelung. Speziell für den Bereich der Sachmängelhaftung, unter diesem Aspekt wurde die Regelung des E K G der des BGB gegenübergestellt, weist das E K G i n eine neue Richtung. Folgt man jedoch der von uns vorgenommenen Auslegung der Sachmängelvorschriften des BGB, so ist der Gegensatz zwischen E K G und BGB i n diesem Bereich nicht so groß: Nach beiden Gesetzen besteht eine Verpflichtung zu mangelfreier Leistung. W i r d diese Verpflichtung nicht erfüllt, so hat der Käufer nach seiner Wahl bestimmte sekundäre Ausgleichsansprüche, die i m BGB als eigene von den allgemeinen Normen verschiedene Ansprüche, die Gewährleistungsansprüche, ausgestaltet sind, während sie i m E K G i n das allgemeine Sanktionensystem wegen Nichterfüllung eingebettet sind. Nach mehr als 2000jähriger Geschichte hat damit die „echte" Gewährleistung des Römischen Rechts ihr Ende gefunden.
Literaturverzeichnis Adler: Der Annahmeverzug des Käufers beim Handelskauf, i n : Z H R 71, 449 ff. — Beiträge zum Rechte der Gewährleistung, i n : Z H R 75, 453 ff. Ballerstedt: Z u r Lehre v o m Gattungskauf, Festschrift f ü r Nipperdey zum 60. Geburtstag, S. 261 ff., B e r l i n 1955 — Z u r Auslegung der §§ 635, 638 B G B bei den verschiedenen Vertragstypen, i n : Festschrift f ü r Larenz zum 70. Geburtstag, München 1973, S. 715 ff. Baumbach / Duden: Handelsgesetzbuch, 20. Aufl., München u n d B e r l i n 1972 Bekker: System des heutigen Pandektenrechtes, 2. Bd., Weimar 1889 Beß: Die Haftung des Verkäufers f ü r Sachmängel u n d Falschlieferungen i m Einheitlichen Kaufgesetz i m Vergleich m i t dem englischen u n d deutschen Recht, Diss. Heidelberg 1971 Blomeyer: Allgemeines Schuldrecht, 4. Aufl., B e r l i n u n d F r a n k f u r t 1969 — Der Anspruch auf Wandlung oder Minderung, i n : AcP 151, 97 ff. von Blume: Der Schadensersatzanspruch des Käufers wegen Lieferung einer mangelhaften Sache u n d seine Verjährung, i n : Ih. Jb. 55, 209 ff. Bötticher: Die Wandlung als Gestaltungsakt, Heidelberg 1938 Busbach: Das Verhältnis der §§ 119 I I , 459 I B G B beim Spezieskauf vor Gefahrübergang u n d bei vertraglichem Ausschluß des Gewährleistungsrechtes, Diss. B o n n 1967 ν . Caemmerer: Falschlieferung, i n : Festschrift f ü r M a r t i n Wolff, Tübingen 1952, S. 1 ff. — „Mortuus redhibetur". Bemerkungen zu den Urteilen B G H Z 53, 144 u n d 57, 137, i n : Festschrift f ü r Larenz, München 1973, S. 621 ff. Canaris: Die Vertrauenshaftung i m deutschen Privatrecht, München 1971 Coing: Z u m Begriff der Teilerfüllung, i n : SJZ 1949, 532 ff. Cosack: Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, 1. Bd., 8. Aufl., Jena 1927 v. Craushaar: Der Einfluß München 1969
des Vertrauens
auf
die
Privatrechtsbildung,
Crome: System des Deutschen Bürgerlichen Rechts, 2. Bd., Tübingen u n d Leipzig 1902 — Die Gewährleistung wegen Abwesenheit vorausgesetzter Vorzüge der veräußerten Sache, i n : AcP 78, 122 ff. Dernburg: Das bürgerliche Recht des Deutschen Reiches u n d Preußens, 2. Bd., 2. Abt., 1. u n d 2. Aufl., Halle 1901; 3. Aufl., Halle 1906 — Über das Rücktrittsrecht des Käufers wegen positiver Vertragsverletzung, i n : D J Z 1903,1 ff. Diederichsen: Schadensersatz wegen Nichterfüllung u n d Ersatz v o n Mangelfolgeschäden, i n : A c P 165, 150 ff. 15 Herberger
226 Diederichsen:
Literaturverzeichnis Die Haftung des Warenherstellers, München 1967
— Das Zusammentreffen von Ansprüchen aus Verschulden bei Vertragsschluß u n d Sachmängelgewährleistung, i n : B B 1965, 401 ff. D ö r r : Die H a f t u n g des Verkäufers f ü r die Fehler der Sache, i n : L Z 1918, 888 ff. Düringer / Hachenburg: Das Handelsgesetzbuch, 1. Bd., 3. Aufl., Mannheim B e r l i n - Leipzig 1930, 3. Bd., Mannheim 1905, 5. Bd., 1. Hälfte, 3. Aufl., M a n n h e i m - B e r l i n - Leipzig 1932 Eccius: Die Gewährleistung wegen Mangel der Sache nach dem BGB, i n : Gruch. Beitr. 43, 305 ff. Emerich: K a u f u n d Werklieferungsvertrag, Jena 1899 Emmerich: BGB-Schuldrecht Besonderer Teil, Reihe Schwerpunkte, K a r l s ruhe 1973 (zit. Schuldrecht) — Grundlagen des Vertrags- u n d Schuldrechts, 5. Kapitel, A t h e n ä u m - Z i v i l recht I, F r a n k f u r t 1972 Endemann: Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, 1. Bd., 8. Aufl., B e r l i n 1903 Enneccerus / Lehmann: R e d i t der Schuldverhältnisse, 15. Aufl., Tübingen 1958 Enneccerus / Nipperdey: Allgemeiner T e i l des Bürgerlichen Rechts, 1. Halbbd., 15. Aufl., Tübingen 1959, 2. Halbbd., 15. Aufl., Tübingen 1960 Erman: Handkommentar z u m Bürgerlichen Münster 1972, 2. Bd., 5. Aufl., Münster 1972
Gesetzbuch, 1. Bd., 5. Aufl.,
— Z u den Rechten des Stückkäufers aus Mängeln der Sache, i n : JZ 1960, 41 ff. Esser: Schuldrecht, 1. Band, 4. Aufl., Karlsruhe 1970, 2. Band, 4. Aufl., Karlsruhe 1971 — Allgemeiner u n d Besonderer Teil, 2. Aufl., Karlsruhe 1960 Fabricius: Schlechtlieferung u n d Falschlieferung beim Kauf, i n : Jus 1964, 1 ff., 46 ff. — Die mangelhafte Lieferung beim K a u f beweglicher Sachen, i n : JZ 1967, 464 ff. — A n m . z u m U r t e i l des Bundesgerichtshofs v o m 16. 4.1969, V I I I ZR 176/66, i n : J Z 1970, 29 ff. Ficker: Die Gefahrtragung i m Haager Einheitlichen Kaufgesetz u n d i m deutschen Schuldrecht, i n : Das Haager Einheitliche Kaufgesetz u n d das deutsche Schuldrecht. K o l l o q u i u m f ü r E. v. Caemmerer, Karlsruhe 1973 Fikentscher: Das Schuldrecht, 4. Aufl., B e r l i n 1973 Finger: Die H a f t u n g des Werkunternehmers f ü r Mangelfolgeschäden, i n : N J W 1973, 81 ff. — Die V e r j ä h r u n g der Ersatzansprüche gegen den Werkunternehmer, i n : D B 1972, 1211 Fischer: Konzentration u n d Gefahrtragung bei Gattungsschulden, i n : Ih. Jb. 51, 159 ff. Flechtheim: Aufhebungsanspruch u n d Einrede, i n : Gruch. Beitr. 44, 65 ff. Flessner: H a f t u n g u n d Gefahrbelastung des getäuschten Käufers, i n : N J W 1972, 1775 ff.
Literaturverzeichnis
227
Flume : Eigenschaftsirrtum u n d Kauf, Münster 1948 (zit. Flume S.) — Allgemeiner T e i l des bürgerlichen Rechtes, 2. Bd., Das Rechtsgeschäft B e r l i n u n d Heidelberg 1965 (zit. A T ) Geppert: Zur Lehre von der Arglist des Verkäufers beim Vertragsschluß, i n : Ih. Jb. 64, 437 ff. von Gierke : Sachmängelhaftung u n d I r r t u m beim Kauf, i n : Z H R 114, 73 ff. Goldschmidt: Über die Statthaftigkeit der aedilitischen Rechtsmittel b e i m Gattungskauf, i n : Z H R 19, 98 ff. Graue: Die mangelfreie Lieferung beim K a u f beweglicher Sachen, Heidelberg 1964 Grimm: Z u r Abgrenzung der Schadenersatzansprüche aus § 635 B G B u n d aus positiver Vertragsverletzung, i n : N J W 1968, 14 ff. Haymann: Die H a f t u n g des Verkäufers f ü r die Beschaffenheit der K a u f sache, B e r l i n 1912 — Anm. zum U r t e i l des Reichsgerichts v o m 11. 3.1932, Az I I 307/31, R G 135, 340 ff., i n : J W 1932, 1862 ff. — Besprechung von Süß, Wesen u n d Rechtsgrund der Gewährleistung f ü r Sachmängel, i n : A c P 135, 228 ff. Heck: Grundriß des Schuldrechts, Tübingen 1929 Holder: Kommentar z u m Allgemeinen T e i l des Bürgerlichen Gesetzbuchs, München 1900 — Z u r Lehre von der Auslegung der Willenserklärungen u n d der Bedeutung des I r r t u m s über ihren Inhalt, i n : Festschrift f ü r Bekker, Weimar 1907 Honsell: Bereicherungsanspruch schung, i n : N J W 1973, 350 ff.
u n d Schadensersatz bei arglistiger
Täu-
Huber: Mängelhaftung beim K a u f von Gesellschaftsanteilen, i n : ZGR 1972, 395 ff. — Der U n f a l l des betrogenen Gebrauchtwagenkäufers — B G H Z 57, 137, i n : Jus 1972, 439 ff. Immenga:
Fehler oder zugesicherte Eigenschaft?, i n : A c P 171, 1 ff.
Kegel: Besprechung v o n Flume, Eigenschaftsirrtum u n d Kauf, i n : AcP 150, 356 ff. Kiehl: V o n der Unmöglichkeit beim Kaufe einer bestimmten Sache, i n : Gruch. Beitr. 60, 609 ff. Kisch: Die W i r k u n g e n der nachträglich eintretenden Unmöglichkeit E r f ü l l u n g bei gegenseitigen Verträgen, Jena 1900 Kluckhohn:
der
Sachmängel u n d Abnahmepflicht, i n : Gruch. Beitr. 59,1038 ff.
König: Voraussehbarkeit des Schadens als Grenze vertraglicher H a f t u n g — zu A r t . 82, 86, 87 E K G —, i n : Das Haager Einheitliche Kaufgesetz u n d das deutsche Schuldrecht, K o l l o q u i u m f ü r E. v. Caemmerer, Karlsruhe 1973 Köhler: Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, 1. Bd., B e r l i n 1906, 2. Bd., 1. Teil, B e r l i n 1906 Korintenberg: Der Mängelbeseitigungsanspruch u n d der Anspruch auf Neuherstellung beim Werkvertrag, Diss. K ö l n 1927 (zit. Diss.) — E r f ü l l u n g u n d Gewährleistung beim Werkverträge, K ö l n 1935 (zit. E r füllung) 15*
228
Literaturverzeichnis
Korintenberg: Abschied von der Gewährleistung, i n : Justizblatt f ü r den O L G - B e z i r k K ö l n 1947, 69 ff. (zit. Abschied) — Die Beschaffenheit der Spezies als Element des Rechtsgeschäftes, K ö l n 1948 (zit. Spezies) Kr ahmer: Gegenseitige Verträge, Halle 1904 Kramer: Die Abgrenzung von Nichterfüllungs- u n d Gewährleistungsfolgen i m A B G B , i n : JB1 1972, 401 ff. Kreß: Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, München 1929 — Lehrbuch des Besonderen Schuldrechts, München, B e r l i n 1934 Kreuzer: Sachmängelhaftung u n d Vertragswidrigkeit i m deutschen Recht u n d i m Einheitlichen Kaufgesetz, i n : Das Haager Einheitliche Kaufgesetz u n d das deutsche Schuldrecht, K o l l o q u i u m für E. v. Caemmerer, K a r l s ruhe 1973 Krückmann: Gewährschaft, Gefahrtragung u n d der E n t w u r f eines einheitlichen Kaufgesetzes, Stuttgart 1936 (zit. Gewährschaft) — Wandlung u n d Anfechtung bei dem Kaufe, i n : A c P 98, 420 ff. — Unmöglichkeit u n d Unmöglichkeitsprozeß, i n : AcP 101, 1 ff. — Die Voraussetzung als v i r t u e l l e r Vorbehalt, i n : A c P 131, 1 ff., 257 ff. — Nachlese zur Unmöglichkeitslehre, i n : Ih. Jb. 59, 20 ff., 231 ff. Larenz: Allgemeiner T e i l des deutschen bürgerlichen Rechts, 2. Aufl., M ü n chen 1972 (zit. A T ) — Lehrbuch des Schuldrechts, 1. Band, 10. Aufl., München 1970 (zit. I), 2. Band, 10. Aufl., München 1972 (zit. I I ) — Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 2. Aufl., Berlin, Heidelberg, New Y o r k 1969 — Geschäftsgrundlage u n d Vertragserfüllung (zit. Geschäftsgrundlage), 3. Aufl., München u n d B e r l i n 1963 — Derogierende K r a f t des Gerichtsgebrauchs?, i n : N J W 51, 497 ff. Landfermann: Neues Recht f ü r den internationalen Kauf, i n : N J W 1974, 385 ff. Laufs / Schw enger: Der Schadensersatzanspruch des Bestellers beim W e r k vertrag: Inhalt, Verjährung, Beweislast, i n : N J W 1970, 1817 ff. Lehmann / Hübner: Allgemeiner T e i l des Bürgerlichen Gesetzbuches, 15. Aufl., B e r l i n 1966 Lenel: Nochmals die Lehre von der Voraussetzung, i n : A c P 79, 49 ff. — Der I r r t u m über wesentliche Eigenschaften, i n : AcP 123, 161 ff. Leonhard: Die Beweislast, B e r l i n 1904 — Allgemeines Schuldrecht des BGB, München u n d Leipzig 1929 (zit. I) — Besonderes Schuldrecht des BGB, München u n d Leipzig 1931 (zit. I I ) Leser: Die Vertragsaufhebung i m Einheitlichen Kaufgesetz, i n : Das Haager Einheitliche Kaufgesetz u n d das deutsche Schuldrecht, K o l l o q u i u m für Ε. v. Caemmerer, Karlsruhe 1973 Lieb: A n m . zum U r t e i l des Bundesgerichtshofs v o m 14.10.1971, V I I ZR 313/69, i n : J Z 1972, 442 ff. Lippmann: Studien zu § 119 Abs. 2 BGB, i n : AcP 102, 283 ff. Locher: Geschäftsgrundlage u n d Geschäftszweck, i n : AcP 121, 1 ff.
Literaturverzeichnis Riehl: Die A r g l i s t beim Vertragsschluß unter besonderer der Arglist der Vertreter, i n : Gruch. Beitr. 60, 790 ff.
Berücksichtigung
Riese: Die Haager Konferenz über die internationale Vereinheitlichung des K a u f rechts v o m 2. bis 25. A p r i l 1964, i n : RabelsZ 29, 1 ff. Riezler: Der Werkvertrag nach dem BGB, Jena 1900 von Savigny: System des heutigen Römischen Rechts, 3. Band, B e r l i n 1840 Schlegelberger: Kommentar z u m H G B , 3. Bd., 4. Aufl., B e r l i n u n d F r a n k f u r t 1965 Schlosser: Gestaltungsklagen u n d Gestaltungsurteile, Bielefeld 1966 — Selbständige peremptorische Einrede u n d Gestaltungsrecht i m deutschen Zivilrecht, i n : Jus 1966, 257 ff. — Peremptorische Einrede u n d „Ausgleichszusammenhänge", i n : JZ 1966, 428 ff. Schmidt, R.: Die Falschlieferung beim Kauf, i n : N J W 1962, 710 ff. Schmidt-Rimpler: Eigenschaftsirrtum u n d Erklärungsirrtum, i n : Festschrift f ü r H. Lehmann, 1. Band, B e r l i n 1956 Schmitz: Die V e r j ä h r u n g von Mängelfolgeansprüchen i m K a u f - u n d W e r k vertragsrecht, i n : N J W 1973, 2081 ff. Schniewind: Verhältnis der Gewährleistungsansprüche aus den §§ 459 ff. B G B u n d der Ansprüche aus den §§ 323 ff. wegen der v o m Käufer nach V e r tragsschluß verschuldeten Mängel, Diss. Heidelberg, Leipzig 1912 Schöller: Die Folgen schuldhafter Nichterfüllung, insbesondere der Schadensersatz wegen Nichterfüllung bei Kauf, Werkvertrag, Miete u n d Dienstvertrag nach dem BGB, i n : Gruch. Beitr. 46, 1 ff., 253 ff. Schollmeyer: Erfüllungspflicht u n d Gewährleistung für Fehler beim Kauf, i n : Ih. Jb. 49, 93 ff. Schubert: Deutsches Kaufrecht, B e r l i n 1937 Schubiger: Verhältnis der Sachgewährleistung zu den Folgen der Nichterfüllung oder nicht gehörigen Erfüllung, Bern 1957 Soergel / Siebert: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 1. Bd., S t u t t gart - B e r l i n 1967, 10. Aufl., 2. Bd., Stuttgart - B e r l i n 1967, 10. Aufl., 3. Bd., Stuttgart - B e r l i n 1969, 10. A u f l . Staub: Kommentar zum Handelsgesetzbuch, 2. Bd., 9. Aufl., B e r l i n 1913 Staudinger: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 1. Bd., 9. Aufl., München - B e r l i n - Leipzig 1925, 2. Bd., 2. Teil, Recht der Schuldverhältnisse, 9. Aufl., München - B e r l i n - Leipzig 1928, 1. Bd., 11. Aufl., B e r l i n 1957, 2. Bd., T e i l 1 c, 10./11. Aufl., B e r l i n 1967, 2. Bd., 2. Teil, 11. Aufl., B e r l i n 1955, 2. Bd., 3. Teil, 11. Aufl., B e r l i n 1958 Störig: Kleine Weltgeschichte der Philosophie, 2. Aufl., Stuttgart 1952 Stoll, Heinrich: Über die Beziehungen der Rechtslehre zur Praxis, i n : AcP 126, 174 ff. — Abschied von der Lehre von der positiven Vertragsverletzung, i n : AcP 136, 257 ff. Süß: Wesen u n d Rechtsgrund der Gewährleistung für Sachmängel, Leipzig 1931 — Besprechung von Schubert, Deutsches Kaufrecht, i n : JW 1937, 869 ff. Titze: Besprechung von Pisco, Gewährleistungs-, Nichterfüllungs- u n d I r r tumsfolge bei Lieferung mangelhafter Ware, i n : J W 1927, 2964 ff.
Literaturverzeichnis Marschall von Bieberstein: Tendenzen zur Erfüllungshaftung bei Sachmängeln (§ 480 Abs. 2 BGB), i n : Das Haager Einheitliche Kaufgesetz u n d das deutsche Schuldrecht, K o l l o q u i u m f ü r E. v. Caemmerer, Karlsruhe 1973 Medicus: Bürgerliches Recht, 6. Aufl., Berlin, Bonn, München 1973 — Vertragliche u n d deliktische Ersatzansprüche für Schäden aus Sachmängeln, i n : Festschrift f ü r Kern, Tübingen 1968, S. 363 ff. Mezger: Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum K a u f recht, i n : WM-Sonderbeilage 1973 Nr. 1 Mohnen: Irrtumsprobleme bei der Doppel-Individualisierung von Personen u n d Sachen, Diss. K ö l n 1939 Molitor: Vertragsauflösung oder Vertragsumgestaltung, i n : Ih. Jb. 85, 283 ff. Nowicki: Wie w e i t ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer die Kaufsache frei von Mängeln u n d Fehlern zu liefern, Diss. Erlangen, Posen 1907 Oertmann: Bürgerliches Gesetzbuch, 2. Buch Recht der Schuldverhältnisse, 5. Aufl., B e r l i n 1929 (zit. Oertmann §) — Erfüllungspflicht u n d Gewährleistungspflicht, in: Der junge Rechtsgelehrte 1935, 353 ff. (zit. Oertmann S.) — Die Geschäftsgrundlage, Leipzig und Erlangen 1921 (zit. Oertmann, Geschäftsgrundlage) — Z u r Lehre von der Beweislast bei Mangelhaftigkeit der K a u f sache, i n : Recht 1908, 345 ff. — Sachmängel u n d Abnahmepflicht, i n : Recht 1909, 617 ff. Palandt: Kommentar zum BGB, 33. Aufl., München 1974 Pisco : Gewährleistungs-, Nichterfüllungs- u n d Irrtumsfolge bei Lieferung mangelhafter Ware, Wien 1921 Planck: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 1. u n d 2. Aufl., B e r l i n 1900, 1. Bd., Allgemeiner Teil, 4. Aufl., B e r l i n 1913, 2. Bd., 1. Hälfte, Recht der Schuldverhältnisse, 4. Aufl., B e r l i n 1914, 2. Bd., 2. Hälfte, 4. Aufl., B e r l i n u n d Leipzig 1928 Raape: Sachmängelhaftung u n d I r r t u m beim Kauf, i n : AcP 150, 481 ff. Raasch: Die Mängelhaftung nach Wesen u n d rechtlichem Grund, i n : Ih. Jb. 87, 1 ff. Rabel: Das Recht des Warenkaufs, 1. Bd., B e r l i n 1936, 2. Bd., B e r l i n - T ü b i n gen 1958 — Z u den allgemeinen Bestimmungen über Nichterfüllung gegenseitiger Verträge, i n : Festschrift f ü r Dolenc, K r e k , Kusej u n d Skerlj, L j u b l j a n a 1937, abgedruckt i n : Gesammelte Aufsätze, Band I I I , Tübingen 1967, S. 138 ff. Regelsberger: Z u r Lehre von der Einrede des nicht erfüllten Vertrags u n d von dem Einfluß der teilweisen Unmöglichkeit der E r f ü l l u n g auf das V e r tragsverhältnis, i n : Ih. Jb. 40, 249 ff. Reichsgerichtsräte: Das Bürgerliche Gesetzbuch, 2. Bd., 9. Aufl., B e r l i n 1939, 1. Bd., 1. Teil, 11. Aufl., B e r l i n 1959, 1. Bd., 2. Teil, 11. Aufl., B e r l i n 1960, 2. Bd., 1. Teil, 11. Aufl., B e r l i n 1959 (zit. RGRK) — Handelsgesetzbuch, 4. Bd., 3. Aufl., B e r l i n 1970 (zit. R G R K HGB) Rhode: Die beiderseitige Voraussetzung als Vertragsinhalt, i n : AcP 124, 257 ff.
Literaturverzeichnis Todt: Schadensersatzansprüche des Käufers, Mieters und Werkbestellers aus Sachmängeln, Heidelberg 1970 Warney er: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 1. Bd., 2. Aufl., T ü bingen 1930 Weitnauer: Vertragsaufhebung u n d Schadensersatz nach dem Einheitlichen Kaufgesetz u n d nach dem geltenden deutschen Recht, i n : Rechtsvergleichung u n d Rechtsvereinheitlichung, Heidelberg 1967 — Besprechung v o n Diederichsen, Die H a f t u n g des Warenherstellers, A c P 168, 207 ff. — Der arglistig getäuschte Käufer, i n : N J W 1970, 637 ff.
in:
Werner: Die Schadensberechnung bei arglistiger Verleitung zum Vertragsschlusse, i n : Recht 1905, 303 ff. Wiedemann: Die H a f t u n g des Verkäufers von Gesellschaftsanteilen f ü r Mängel des Unternehmens, i n : Festschrift f ü r H. C. Nipperdey zum 70. Geburtstag, B a n d 1, S. 815 ff., München, B e r l i n 1965 Windscheid: Die Voraussetzung, i n : A c P 78,161 ff. Windscheid / Kipp: Lehrbuch des Pandektenrechtes, 1. Bd., 9. Aufl., F r a n k f u r t 1906 (zit. PandektenR.) Wolf, Ernst: Rücktritt, Vertretenmüssen u n d Verschulden, i n : AcP 153, 97 ff. Wolff,
M a x : Sachmängel beim Kauf, i n : Ih. Jb. 56,1 ff.
Zitelmann: I r r t u m u n d Rechtsgeschäft, Leipzig 1879 Zweigert: A n m e r k u n g zum U r t e i l des O L G Stuttgart v o m 9. 6. 48, Rev. 49/48, i n : SJZ 49, 412 ff.

![Reise nach Persien und dem Lande der Kurden [1]](https://dokumen.pub/img/200x200/reise-nach-persien-und-dem-lande-der-kurden-1.jpg)
![Reise nach Persien und dem Lande der Kurden [2]](https://dokumen.pub/img/200x200/reise-nach-persien-und-dem-lande-der-kurden-2.jpg)
![Bürgerliches Rechts-Lexikon: Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch, dem Handelsgesetzbuch und sonstigen Reichs- und Landesgesetzen [3., wesentl. verm. und verb. Aufl. Reprint 2018]
9783111600116, 9783111225074](https://dokumen.pub/img/200x200/brgerliches-rechts-lexikon-nach-dem-brgerlichen-gesetzbuch-dem-handelsgesetzbuch-und-sonstigen-reichs-und-landesgesetzen-3-wesentl-verm-und-verb-aufl-reprint-2018-9783111600116-9783111225074.jpg)

![Rechtsfälle nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch: Mit §§-citaten für Übungen und Vorträge und zum Sebststudium [Reprint 2020 ed.]
9783111671468, 9783111286716](https://dokumen.pub/img/200x200/rechtsflle-nach-dem-brgerlichen-gesetzbuch-mit-citaten-fr-bungen-und-vortrge-und-zum-sebststudium-reprint-2020nbsped-9783111671468-9783111286716.jpg)
![Bürgerliches Rechts-Lexikon: (nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch, dem Handelsgesetzbuch und sonstigen Reichs- und Landesgesetzen) [4. durchgearb. und verb. Aufl. Reprint 2019]
9783111471983, 9783111105116](https://dokumen.pub/img/200x200/brgerliches-rechts-lexikon-nach-dem-brgerlichen-gesetzbuch-dem-handelsgesetzbuch-und-sonstigen-reichs-und-landesgesetzen-4-durchgearb-und-verb-aufl-reprint-2019-9783111471983-9783111105116.jpg)
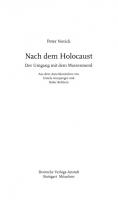
![Die Miete von Wohnungen und anderen Räumen: Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich unter Berücksichtigung der Ausführungsgesetze der deutschen Bundesstaaten [Reprint 2020 ed.]
9783112356562, 9783112356555](https://dokumen.pub/img/200x200/die-miete-von-wohnungen-und-anderen-rumen-nach-dem-brgerlichen-gesetzbuch-fr-das-deutsche-reich-unter-bercksichtigung-der-ausfhrungsgesetze-der-deutschen-bundesstaaten-reprint-2020nbsped-9783112356562-9783112356555.jpg)
![Die Erbenhaftung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch: Band 1 Die Grundsätze der Haftung [Reprint 2018 ed.]
9783111523804, 9783111155388](https://dokumen.pub/img/200x200/die-erbenhaftung-nach-dem-brgerlichen-gesetzbuch-band-1-die-grundstze-der-haftung-reprint-2018nbsped-9783111523804-9783111155388.jpg)
![Rechtsnatur, Aufgabe und Funktion der Sachmängelhaftung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch [1 ed.]
9783428432240, 9783428032242](https://dokumen.pub/img/200x200/rechtsnatur-aufgabe-und-funktion-der-sachmngelhaftung-nach-dem-brgerlichen-gesetzbuch-1nbsped-9783428432240-9783428032242.jpg)