Private und öffentliche Sicherheit [1 ed.] 9783428501694, 9783428101696
Die Diskussion um den "schlanken Staat" hat die Polizei erreicht. Die Staatsaufgabe Sicherheit gilt nach wie v
142 99 88MB
German Pages 673 Year 2000
Polecaj historie
Citation preview
GERHARD NITZ
Private und öffentliche Sicherheit
Schriften zum Öffentlichen Recht Band 831
Private und öffentliche Sicherheit
Von Gerhard Nitz
Duncker & Humblot · Berlin
Gefördert von der Volkswagen-Stiftung Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Nitz, Gerhard:
Private und öffentliche Sicherheit / Gerhard Nitz. - Berlin : Duncker und Humblot, 2000 (Schriften zum öffentlichen Recht ; Bd. 831) Zugl.: Bielefeld, Univ., Diss., 1999 ISBN 3-428-10169-3
Alle Rechte vorbehalten © 2000 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme und Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin Printed in Germany ISSN 0582-0200 ISBN 3-428-10169-3 Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706©
Vorwort Diese Arbeit wurde im Wintersemester 1999/2000 von der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Bielefeld als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur, die mir seit Herbst 1999 zugänglich wurde, konnte nur noch in den Fußnoten nachgewiesen werden; dies gilt etwa für die weiterführende Monographie von Martin Burgi, Funktionale Privatisierung und Verwaltungshilfe. Mein Dank gilt vor allem Herrn Prof. Dr. Christoph Gusy. Er hat nicht nur viel Mühe und Geduld für die Betreuung der Arbeit aufgewendet, sondern mich seit meinem Studium in jeder Hinsicht unterstützt und gefördert. Seine vielseitigen Anregungen, Erklärungen und Aufforderungen wie auch seine Motivationskunst lehrten mich nicht zuletzt, was unter einem akademischen Lehrer zu verstehen ist. Für alles: Danke! Auch Frau Prof. Dr. Gertrude Lübbe-Wolff danke ich sehr herzlich, insbesondere für die rasche Zweitbegutachtung. Teile der Arbeit entstanden im Rahmen eines von der Volkswagen-Stiftung geförderten Forschungsprojekts. Für diese Förderung, die mir unter anderem einen viermonatigen Forschungsaufenthalt an der Michigan State University ermöglichte, möchte ich mich bei der Stiftung bedanken. Vielen meiner Bielefelder Freunde und Bekannten bin ich für Anregungen und sonstige Hilfen dankbar; nennen möchte ich hier insbesondere Dr. Nicole Pippke, Dr. Bernhard W. Wegener, Hans Arnold und Katja Ziegler. Meinen Eltern danke ich herzlich für die Übernahme des Druckkostenzuschusses. Schließlich geht ein besonderer Dank an Dr. Oliver Fahle nicht nur für den Hinweis, in einem Vorwort niemals mehr als drei Personen zu danken. Bielefeld, im März 2000
Gerhard Nitz
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
23
1. Teil Private und öffentliche Sicherheit in Deutschland
§ 1: Das Trennungsmodell als Grundidee der Rechtsordnung A. Entwicklung der Abgrenzung von öffentlicher und privater Sicherheit I. Absolutismus II. Dualismus von Staat und Gesellschaft
26
26 28 28 29
III. Bürgerlich-liberaler Rechtsstaat
31
IV. Demokratischer Rechtsstaat
39
V. Sozialer, demokratischer Rechtsstaat VI. Zusammenfassung
41 43
B. Das Grundmodell der Rechtsordnung
44
I. Schutz öffentlicher Rechtsgüter
46
II. Schutz privater Rechtsgüter III. Überschneidungen zwischen privaten und öffentlichen Rechtsgütern
47 50
1. Interessen als private und öffentliche Rechtsgüter
50
2. Privater Schutz öffentlicher Individualrechtsgüter
52
3. Privater Schutz überindividueller öffentlicher Rechtsgüter
53
8
Inhaltsverzeichnis IV. Zusammenfassung: Grundlinien des Modells privaten und staatlichen Rechtsgüterschutzes
§2: Die aktuelle Situation A. Die tatsächliche Situation I. Schutz öffentlicher Rechtsgüter nach öffentlichem Recht
55
57 57 57
1. Ursprünge und Entwicklung der Einbeziehung Privater in die Polizei
57
2. Schaffung neuer gesetzlicher Grundlagen
60
a) Freiwillige Polizeidienste in Berlin und Baden-Württemberg
60
b) Hilfspolizisten
62
c) Ergebnis
64
3. Die Entwicklung ab Mitte der 1980er Jahre a) Rechtsänderungen
64 64
aa) Ausweitung bestehender gesetzlicher Möglichkeiten
65
bb) Schaffung neuer Rechtsgrundlagen
66
cc) Sicherheitswachten in Bayern und Sachsen
67
b) Nicht rechtlich geregelte Initiativen
69
c) Weitergehende Überlegungen
73
4. Ergebnis II. Schutz privater Rechtsgüter nach Privatrecht 1. Traditioneller privater Schutz privater Rechtsgüter
75 75 75
2. Neue Erscheinungsformen des Schutzes „privater" Rechtsgüter durch Private
81
a) Neue Tätigkeitsfelder privater Sicherheitsunternehmen
81
aa) Tätigkeiten in öffentlich zugänglichen Räumen
81
bb) Eigensicherungsverpflichtungen
86
cc) Weitergehende Überlegungen
88
b) Nicht-gewerbliche private Sicherheitsaktivitäten III. Zusammenfassung und Bezug zur Privatisierungs- und Steuerungsdiskussion
90
93
Inhaltsverzeichnis Β. Diskussion des Verhältnisses privater und öffentlicher Sicherheit in Deutschland I. Grundlinien des Diskussionsverlaufs II. Sicherheit als Ware
98 98 99
III. Ursachen, insbesondere: Sicherheitsbedürfnis und seine Nachfragerichtung
103
IV. Sicherheit als einheitliche, gesamtgesellschaftliche Aufgabe
107
V. Privatisierung des öffentlichen Lebens VI. Zusammenarbeit zwischen Polizei und Privaten VII. Personelle Verflechtungen 1. Nebentätigkeit im privaten Sicherheitsgewerbe
109 113 116 116
2. Grenzen einer Beschäftigung ehemaliger Polizeibeamter im privaten Sicherheitsgewerbe 119 VIII. Gesellschaftliche Folgen der Privatisierungstendenzen
120
IX. Stärkere rechtliche Regulierung
124
X. Befugnisse gegenüber Dritten
126
1. Notwehr
128
(1) Zeitlicher Rahmen der Befugnisse
129
(2) Rechtswidrigkeit des Angriffs
129
(3) Erforderlichkeit
129
(4) Bindung an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
130
(5) Sozialethische Einschränkungen des Notwehrrechts für private Sicherheitsdienste? 133 2. Festnahmerechte
134
3. Sonstige Rechtsgrundlagen
134
4. Exkurs: Führen von Waffen durch Mitarbeiter privater Sicherheitsunternehmen
136
5. Rechtliche Neuregelung der Befugnisse privater Sicherheitskräfte? ... 138
10
Inhaltsverzeichnis XI. Gewährleistung rechtmäßigen Verhaltens
139
1. Gewerbeüberwachung
140
2. Qualifikation des Bewachungspersonals
142
XII. Weitere rechtlich bedingte Unterschiede privater und öffentlicher Sicherheitsgewährleistung 147 1. Handlungsanlässe
147
2. Verfahrensrechtliche Fragen
148
3. Kostenfragen
149
4. Haftungsfragen
151
5. Rechtsschutzfragen
152
XIII. Verfassungsrechtliche Argumentationstopoi
152
2. Teil Private und öffentliche Sicherheit im Ausland
§ 3: Vereinigte Staaten von Amerika
157
157
A. Historische Entwicklung eines amerikanischen Trennungsmodells und seine Wandlungen 159 I. Historische Entwicklung
159
1. Die englische Erfahrung
159
2. Die Entwicklung in den Vereinigten Staaten
161
a) Entstehung und frühe Entwicklung des privaten Sicherheitsgewerbes
162
b) Frühe Entwicklung der staatlichen Polizei
164
II. Das amerikanische Trennungsmodell III. Erste Wandlungen B. Erscheinungsformen privater Sicherheit I. Das private Sicherheitsgewerbe 1. Aufgaben, Struktur und Größe des Sicherheitsgewerbes
165 167 170 170 170
Inhaltsverzeichnis 2. Ausbildung, Training und Berufsperspektiven
175
a) Sicherheitspersonal
175
b) Führungskräfte im privaten Sicherheitsgewerbe
179
II. Polizei und Private
180
1. Special Police Officer
181
2. Nebentätigkeit im privaten Sicherheitsgewerbe
182
3. Private Finanzierung staatlicher Polizeiarbeit
186
4. Zusammenarbeit
188
5. Privatisierung von Polizeiaufgaben
191
III. Nicht-gewerbliche private Sicherheitsaktivitäten 1. Neighborhood Watch im Rahmen des Community Policing
194 194
a) Exkurs: Community Policing
194
b) Nachbarschaftsprogramme
196
2. Bürgerwehren
198
3. Eingefriedete Siedlungen
200
C. Rechtlicher Rahmen I. Gewerberechtliche Anforderungen
209 209
1. Allgemeiner Überblick
209
2. Model Private Security Licensing Statute
214
3. Gesetzgebungsinitiativen auf Bundesebene
217
4. Fallstudien: Kalifornien, New York, Michigan
219
a) Anwendbarkeit
220
b) Voraussetzungen des Gewerbebetriebs
221
c) Anforderungen an die Arbeitnehmer
222
d) Trainingsanforderungen und Waffen
223
e) Anforderungen an den Gewerbebetrieb
224
II. Befugnisse
226
1. Festnahmerecht
227
2. Ingewahrsamnahme durch Händler und ihre Angestellten
230
3. Durchsuchung und Beschlagnahme
231
4. Befragung
232
12
Inhaltsverzeichnis 5. Notwehr a) Verteidigung gegen Angriffe auf die Person
233 234
b) Verteidigung gegen Angriffe auf Eigentum und ähnliche Rechtsgüter 235 6. Besitzkehr
237
7. Problembereiche
238
III. Grundrechtliche Bindungen privater Sicherheitsdienstleistungen
238
1. Problemstellung
238
2. State Action Doctrine
241
3. Public Function Theory
242
4. Staatliche Mitverantwortung für privates Handeln
245
a) Staatliche Mitverantwortung aufgrund rechtlicher Einbindung .... 245 b) Staatliche Mitverantwortung aufgrund tatsächlicher Einbindung .. 247 5. Zusammenfassung
248
IV. Verfassungsrechtliche Privatisierungsgrenzen?
250
D. Ursachen und Diskussion privater Sicherheitsformen
252
I. Wahrnehmung des privaten Sicherheitsgewerbes II. Ursachen des stärkeren Rückgriffs auf private Sicherheit
252 256
1. Eigenverantwortung des Bürgers
256
2. Kriminalität und Sicherheitsgefühl
257
3. Marktabhängige Faktoren
259
4. Privatisierung des öffentlichen Lebens
259
5. Haftungsrecht
260
III. Gewichtsverschiebung von staatlicher zu privater Polizei
262
IV. Problembereiche privater Sicherheit
264
1. Gewaltmonopol?
265
2. Legitimation und Demokratie
267
3. Gleichheit und Gerechtigkeit
269
4. Grundrechte
270
E. Zusammenfassung
271
Inhaltsverzeichnis §4: Frankreich Α. Erscheinungsformen privater Sicherheit I. Entwicklung des privaten Sicherheitsgewerbes II. Polizei und Private
274 275 275 279
1. Beleihung
281
2. Nebentätigkeiten im privaten Sicherheitsgewerbe
281
3. Zusammenarbeit
281
4. Privatisierung von Polizeiaufgaben
282
III. Mobilisierung des Bürgers: Bürgerwehren und/oder Community Policing 284 Β. Ursachen und Diskussion privater Sicherheitsformen I. Einschätzung der Entwicklung und ihre Ursachen II. Wandlungen im Rollenverständnis III. Beurteilungen der Entwicklung C. Rechtlicher Rahmen I. Gewerberechtliche Regelungen II. Befugnisse
285 285 289 292 293 293 297
1. Handeln im Rahmen der Rechtsordnung, insbesondere das Festnahmerecht 297 2. Notwehr
299
3. Notstand
303
III. Grundrechtliche Bindungen privater Sicherheitsdienstleistungen
303
IV. Verfassungsrechtliche Privatisierungsgrenzen
305
D. Zusammenfassung und Fragen an das deutsche Verfassungsrecht
306
14
Inhaltsverzeichnis 3. Teil Verfassungsrechtliche Vorgaben für öffentliche und private Sicherheit
§5: Einzelne verfassungsrechtliche Vorgaben A. Gewaltmonopol I. Staatstheoretische Begründungen des Gewaltmonopols
310
313 313 315
1. Gewaltmonopol als Kennzeichen des souveränen Staates
316
2. Staatsvertragstheoretisch begründetes Gewaltmonopol
318
II. Rechtliche Verankerung des Gewaltmonopols und inhaltliche Implikationen 322 1. Gewaltmonopol als Verfassungsvoraussetzung
323
2. Rechtsstaatliche Verankerung des Gewaltmonopols
324
3. Gewaltmonopol als Element der vom Grundgesetz verfaßten Staatlichkeit 325 III. Bedeutungsvielfalt des Gewaltbegriffs
327
IV. Ergebnis und erste Folgerungen
332
B. Grundrechtliche Schutzpflichten I. Herleitung grundrechtlicher Schutzpflichten
334 336
1. Abwehrrechtliche Konstruktion
337
2. Historisch-teleologische Begründungen
339
3. Im Grundgesetz ausdrücklich genannte Schutzpflichten
344
4. Die Wertordnung des Grundgesetzes
346
5. Schutzpflichten und Sozialstaatsprinzip
349
II. Reichweite staatlicher Schutzpflichten 1. Schutzpflicht zugunsten der Menschenwürde aus Art. 1 I 2 GG 2. Sozialstaatlich fundierte grundrechtliche Schutzpflichten a) Von der Schutzpflicht erfaßte Grundrechtsgüter aa) Schutzpflichten zugunsten grundrechtlicher Freiheit
357 357 359 360 360
Inhaltsverzeichnis bb) Insbesondere: Subjektives Sicherheitsempfinden als grundrechtlich geschütztes Rechtsgut? 362 cc) Schutzpflichten zugunsten grundrechtlicher Gleichheit
365
b) Gefordertes Schutzniveau
368
aa) Maximierung, Optimierung oder Mindestschutz der Grundrechtsgüter? 369 bb) Zum Untermaßverbot (1) Kongruenz von Übermaß- und Untermaßverbot Schutzpflichtendreieck?
373 im
(2) Dogmatischer Gehalt des Untermaßverbots cc) Ansätze zur Konkretisierung des Mindestschutzniveaus
373 375 376
c) Aktivierungsschwelle der Schutzpflichten
381
d) Modalitäten der Erfüllung von Schutzpflichten
384
aa) Rahmenbedingungen der Erfüllung von Schutzpflichten
385
bb) Handlungsinstrumente zur Erfüllung der Schutzverpflichtung
388
cc) Folgerungen und Konkretisierungsansätze
393
C. Art. 33 IV GG I. Privatisierungsgrenze? II. Aufgabenbegriff des Art. 33 IV GG
396 397 399
III. Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse
402
IV. Übertragung „als ständige Aufgabe"
414
V. Das Regel-Ausnahmeverhältnis
417
1. Allgemeines
417
2. Konkretisierung über das Demokratieprinzip
420
a) Legitimationsanforderungen des Demokratieprinzips
420
b) Übertragbarkeit auf das Regel-Ausnahme-Verhältnis des Art. 33 IV GG c) Folgerungen für die Privatisierung von Sicherheitsaufgaben aa) Konkretisierungsansätze
426 427 427
bb) Freiwillige Polizeidienste in Baden-Württemberg und Berlin 429 cc) Sicherheitswachten
430
16
Inhaltsverzeichnis D. Privatisierungsaussagen der bundesstaatlichen Kompetenzordnung I. Gesetzgebungskompetenzen und Staatsaufgaben II. Verwaltungskompetenzen und Staatsaufgaben 1. Staatsaufgabenzuweisungsgehalt
431 432 433 433
a) Art. 8712 GG
433
b) Sicherheitsaufgaben als Bestandteil der Verkehrsverwaltungsaufgaben
434
c) Art. 87a I 1 GG d) Folgefragen 2. Anforderungen an die Aufgabenerfüllung
438 438 440
a) Privatisierungen im Bereich obligatorischer Bundeseigenverwaltung 440 b) Privatisierungen im Bereich fakultativer Bundeseigenverwaltung 443 c) Privatisierungen im Bereich mittelbarer Bundesverwaltung
444
d) Privatisierungen im Bereich der Landesverwaltung
444
e) Privatisierungen im Bereich der Bundeswehr
446
3. Zusammenfassung III. Landesverfassungsrechtliche Vorgaben E. Subsidiaritätsprinzip und Grundrechte I. Grundrechte als Privatisierungsgebote?
447 448 451 452
1. Vorfrage: Reichweite grundrechtlicher Verhaltensfreiheit
452
2. Zur Abgrenzung von Berufs- und allgemeiner Handlungsfreiheit
456
3. Grundrechtliche Privatisierungsgebote in unterschiedlichen Konstellationen 457 II. Verfassungsrechtliches Subsidiaritätsprinzip? III. Fazit
460 464
F. Bürgerbeteiligung als verfassungsrechtlich abgesicherte Betroffenenpartizipation I. Demokratie und Betroffenenpartizipation im Grundgesetz II. Betroffenenpartizipation und öffentliche Sicherheit
464 465 473
III. Exkurs: Private Sicherheit als Unterminierung des Demokratieprinzips? 475
Inhaltsverzeichnis G. Haushaltsverfassungsrechtliche Privatisierungsvorgaben I. Verfassungsrechtliche Verankerung des Wirtschaftlichkeitsprinzips II. Auswirkungen des verfassungsrechtlichen auf Privatisierungen im Sicherheitsrecht
477 478
Wirtschaftlichkeitsprinzips 481
H. Weitere verfassungsrechtliche Aussagen zu privatem und öffentlichem Rechtsgüterschutz 482 I. Verfassungsrechtlich notwendige Justizgewährleistung in bürgerlichrechtlichen Streitigkeiten 484 1. Verfassungsrechtlich unergiebige Ansatzpunkte
484
a) Art. 1011 2, 103 I GG
484
b) Art. 19IVGG
484
aa) Private Sicherheit als Ausübung „öffentlicher Gewalt"?
484
bb) Ausschluß weiterer verfassungsrechtlicher Justizgewährungspflichten? 486 c) Rechtsstaatsprinzip 2. Art. 92 GG und bürgerlich-rechtliche Streitentscheidung
487 487
3. Art. 92 GG und einstweilige Sicherung privater Rechtspositionen .... 491 II. Verfassungsrechtlich notwendige Reichweite des Verbots der Selbsthilfe 494 III. Zusammenfassung
495
IV. Besonderheiten im Rahmen des Art. 19IV GG
497
V. Verfassungsrechtliche Notwendigkeit des Legalititätsprinzips I. Exkurs: Europarechtliche Vorgaben I. Europarecht und Sicherheitsgewerberecht II. Europarecht und Privatisierung von Polizeiaufgaben
502 503 505
1. Fragen
505
2. Polizeiaufgaben als Dienstleistungen
506
3. Grenzen des Privatisierungsgebots
509
4. Ergebnis
512
J. Zusammenfassung in Thesen 2 Nitz
499
512
Inhaltsverzeichnis
18
§ 6: Grundlinien des verfassungsrechtlichen Systems öffentlicher und privater Sicherheit und Darstellung anhand ausgewählter Beispielsfälle 518 A. Grundlinien des verfassungsrechtlichen Systems öffentlicher und privater Sicherheit 518 I. Die Staatsaufgabe Sicherheit - Erfüllungs-, Gewährleistungs- und Auffangverantwortungen des Staates 518 1. Notwendige Staatsauf gäbe Sicherheit
518
2. Fakultative Staatsaufgabe Sicherheit
528
II. Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen des Trennungsmodells
531
1. Zuordnung des Rechtsguts
532
2. Schutz öffentlicher Rechtsgüter
533
3. Schutz privater Rechtsgüter
533
4. Umwidmung öffentlicher in private Rechtsgüter - Aufgabenprivatisierung 535 5. Fazit B. Einzelne Anwendungsfälle I. Einbeziehung Privater in Polizeiarbeit 1. Beleihung: Sicherheitswachten und Freiwillige Polizeidienste 2. Faktische Zusammenarbeit mit Privaten
537 538 538 539 541
a) Sicherheitspartnerschaften
542
b) Doppelstreifen
543
II. Zulässigkeit und Notwendigkeit gesetzlicher Regelungen des privaten Sicherheitsgewerbes 545 1. Befugnisse zur gewaltsamen Rechtsdurchsetzung a) Aktuelle Rechtslage
546 546
aa) Zulässigkeit der begrenzenden Gehalte der Jedermannrechte 546 bb) Zulässigkeit der ermächtigenden Gehalte der Jedermannrechte 547 cc) Gleichbehandlung professioneller Nothelfer und JedermannNothelfer als Verstoß gegen Art. 3 I GG? 550 b) Verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer weiteren Bindung privater Sicherheitsdienstleister an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 551 c) Verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer Befugnis zur Personalienfeststellung 553
Inhaltsverzeichnis 2. Private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum
558
a) Generelle Erwägungen
558
b) Tätigkeitsverbote
561
aa) Verbot der staatlichen Beauftragung privater Sicherheitsdienste 561 bb) Tätigkeitsverbot privat beauftragter dienste c) Befugnisregelungen
privater
Sicherheits562 565
3. Persönliche Anforderungen an das Tätigwerden im privaten Sicherheitsgewerbe 567 a) Verfassungsrechtliche Notwendigkeit weitergehender Regelungen 568 b) Verfassungsrechtliche Zulässigkeit weitergehender Regelungen ... 569 4. Überwachung des privaten Sicherheitsgewerbes
571
III. Grenzen privater Sicherheitsinitiativen
573
IV. In Zukunft Sicherheit nur für Reiche?
574
Schlußwort
576
Literaturverzeichnis
577
Sachverzeichnis
669
Abkürzungsverzeichnis Neben allgemeinverständlichen und üblichen juristischen Abkürzungen1 werden folgende Abkürzungen verwendet: Actes
Actes. Les cahiers d'action juridique
AK
Alternativkommentar
AKIS
Interdisziplinärer Arbeitskreis Innere Sicherheit
AKP
Alternative Kommunalpolitik
Annals, AAPSS
The Annals of The American Academy of Political and Social Science
ARSP
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie
ASIS
American Society for Industrial Security
BDWS
Bundesverband deutscher Wach- und Sicherheitsunternehmen
ΒΚ
Bonner Kommentar
CD
Criminal Digest - Sicherheits-Management
cilip
Bürgerrechte & Polizei - cilip
CMLR
Common Market Law Review
Co.E.S.S.
Confédération Européenne des Services de la Sécurité (Dachverband des Europäischen Sicherheitsgewerbes)
DP
Die Polizei
DSD
Der Sicherheitsdienst (offizielles Organ des BDWS seit 1987)
DSt.
Der Staat
DV
Die Verwaltung
EvStL
Evangelisches Staatslexikon
FJNSB
Forschungsjournal Neue soziale Bewegungen
HdBPolR
Handbuch des Polizeirechts
HdBprSiG
Handbuch des privaten Sicherheitsgewerbes
HdBStR
Handbuch des Staatsrechts
HdBUmwR
Handbuch des Umweltrechts
IHESI
Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure
JhbRsozRth
Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie
KK
Karlsruher Kommentar
KPB1.
Kommunalpolitische Blätter
LK
Leipziger Kommentar
LV
Landesverfassung
NdsVBl.
Niedersächsische Verwaltungsblätter
NKP
Neue Kriminalpolitik
1
Kirchner,
AbkürzungsVerzeichnis.
Abkürzungsverzeichnis
21
Protector
Protector - Die internationale Fachzeitschrift für Sicherheit (Schweiz)
RTD eur.
Revue trimestrielle de droit européen
SK
Systematischer Kommentar
StWStP
Staatswissenschaften und Staatspraxis
team
team - Magazin für Mitarbeiter und Freunde der ADS Unternehmensgruppe
ThürVBl.
Thüringer Verwaltungsblätter
W&S
Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik
W+S-Information
Offizielles Organ des BDWS (bis 1986)
WIK
Zeitschrift für Wirtschaft, Kriminalität und Sicherheit
Einleitung Die „Staatsaufgabe Sicherheit" gilt als Selbstverständlichkeit1. Der Begriff der Sicherheit bedeutet dabei die Unversehrtheit von Rechtsgütern2. Damit bezeichnet das Stichwort „Staatsaufgabe Sicherheit" in erster Linie die Aufgabe, Rechtsgüterschutz zu gewährleisten, indem drohende Beeinträchtigungen von Rechtsgütern abgewehrt werden. Neben diese präventive Komponente tritt das Bemühen um eine Wiederherstellung verletzter Rechtsgüter. In der vorliegenden Arbeit werden Inhalt und Reichweite der Staatsaufgabe Sicherheit näher untersucht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der präventiven Seite des Sicherheitsauftrags. Zur weiteren Eingrenzung wird in erster Linie auf diejenigen Sicherheitsaktivitäten eingegangen, welche zumindest auch von der Polizei im formellen Sinne3 wahrgenommen werden. Dies schließt nicht aus, generalisierende Folgerungen für das allgemeine Ordnungsrecht aufzustellen; diese stehen jedoch nicht im Mittelpunkt des Interesses. Vielmehr geht es um die Frage, welche Sicherheitsaufgaben im Bereich traditioneller polizeilicher Tätigkeit vom Staat wahrgenommen werden müssen (notwendige Staatsaufgaben), welche von ihm wahrgenommen werden können (fakultative Staatsaufgaben) und welche Sicherheitsaufgaben er nicht wahrnehmen darf (verbotene Staatsaufgaben). Aus der Sicht privater Bemühungen um Sicherheit läßt sich eine vergleichbare Kategorisierung vornehmen. Auch sie können verpflichtet, berechtigt oder aber nicht berechtigt sein, Rechtsgüterschutz zu unternehmen. Dabei besteht keine notwendige Komplementarität staatlicher und privater Aufgaben etwa in dem Sinne, daß Private im Bereich notwendiger Staatsaufgaben nicht tätig werden dürfen oder aber Private im Bereich verbotener Staatsaufgaben tätig werden müssen oder zumindest dürfen. Vielmehr lassen sich die genannten Möglichkeiten grundsätzlich beliebig kombinieren. Neben dem Aufgabenträger sind die Rechtsform der Aufgabenerfüllung (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) sowie die handelnden Personen (Private oder staatliche Bedienstete) in den Blick zu nehmen. Auch hier sind beliebige Kombinationen denkbar und zumindest einige anerkanntermaßen zulässig. Diese einleitenden Überlegungen zeigen bereits, daß eine deutliche Abgrenzung staatlicher und privater Tätigkeitsfelder nicht aus dem Postulat einer Staatsaufgabe Sicherheit ι Götz, in: Isensee / Kirchhof, HdBStR III, § 79 Rn. 1 f.; Gusy, StWStP 1994, S. 187, 192; historisch Isensee, Grundrecht auf Sicherheit, S. 15 ff. 2 Statt aller Gusy, Polizeirecht, Rn. 82; zu Begriffsgeschichte und Bedeutungsvielfalt F.-X. Kaufmann, Sicherheit, S. 52 ff.; Preuß, in: Grimm, Staatsaufgaben, S. 523,526 ff. 3 Zu den unterschiedlichen Polizeibegriffen Boldt, in: Lisken/Denninger, HdBPolR, Rn. A 39.
24
Einleitung
folgt. Hierzu bedarf es vielmehr rechtlicher Kriterien, welche in dieser Arbeit vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen erarbeitet werden sollen. Deutlich ist aber bereits die Doppeldeutigkeit des Titels geworden: es geht nicht allein um das Verhältnis von privater zu öffentlicher Sicherheit, sondern auch um die Rolle Privater bei der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit. Begriffliche Mehrdeutigkeiten betreffen weitere Schlüsselwörter. So kann das Wort „öffentlich" einen Bezug zum Staat (öffentlicher Auftraggeber), aber auch einen solchen zur Allgemeinheit beschreiben (öffentliches Interesse) und schließlich eine Offenheit bezeichnen (öffentlicher Raum)4. Hier wird es in allen drei Bedeutungsvarianten verwendet, wobei die konkrete Bedeutung nur dann näher angegeben wird, wenn sie sich nicht aus dem Zusammenhang erschließt. Der Begriff der Privatisierung wird weit verstanden. Ohne näheren Zusatz bezeichnet er eine Entstaatlichung5; die These von Privatisierungstendenzen im Bereich der öffentlichen Sicherheit behauptet also, daß Aufgaben, welche dem Schutz derjenigen Rechtsgüter dienen, die unter den Begriff der öffentlichen Sicherheit fallen, zunehmend weniger vom Staat und stattdessen von Privaten erfüllt werden, unabhängig davon, ob und in welcher Form der Staat sich dieser Agenden entledigt oder ob Private vermehrt aus eigener Initiative im Bereich des Schutzes der öffentlichen Sicherheit tätig werden. Die Untersuchung erfolgt in drei Schritten. Im ersten Teil der Arbeit wird das Verhältnis staatlicher und privater Sicherheitsgewährleistung in Deutschland dargestellt. Er dient der Bestandsaufnahme, der Systematisierung und der Benennung von Problembereichen. Dazu wird zunächst anhand der Wandlungen des Polizeibegriffs der theoretische Hintergrund einer Zuordnung von Sicherheitsaufgaben zum Staat oder aber zu Privaten in Grundlinien nachvollzogen und hierauf fußend die Grundidee der Rechtsordnung als Trennungsmodell beschrieben (§ 1). Sodann wird diese Grundidee mit der aktuellen Situation konfrontiert (§ 2). Dabei zeigen sich zahlreiche unterschiedliche Formen einer Verknüpfung staatlicher und privater Sicherheitsgewährleistung, welche sich nicht nahtlos in das Trennungsmodell einfügen (Α.). Vor dem Hintergrund dieser Bestandsaufnahme folgt eine Darstellung der nicht allein rechtswissenschaftlichen Diskussion um Tendenzen einer Privatisierung der Staatsaufgabe Sicherheit, welche auch die tatsächlichen und rechtlichen Folgen der Entwicklung einbezieht (B.). Der zweite Teil dient der Vertiefung dieser Problemsicht, indem das Verhältnis zwischen staatlicher und privater Sicherheitsgewährleistung im Ausland untersucht wird. Der Schwerpunkt liegt bei den Vereinigten Staaten (§ 3), einem Land, das im Ruf steht, besonders privatisierungsfreundlich zu sein. Zum anderen wird mit Frankreich (§ 4) ein traditionell eher staatszentriertes Land vorgestellt. Vor dem
* Vgl. Martens, Öffentlich als Rechtsbegriff, S. 24 ff., insbes. S. 33; Smend, in: GS W. Jellinek, S. 11 ff. 5 Di Fabio, JZ 1999, S. 585.
Einleitung
Hintergrund der international gesammelten Erfahrungen können dann die Diskussion zusammengefaßt und anhand der aufgezeigten Problembereiche Fragen an das deutsche Verfassungsrecht formuliert werden. Um deren Beantwortung geht es im abschließenden dritten Teil. Hier werden zunächst einzelne verfassungsrechtliche Vorgaben isoliert untersucht (§ 5), um den Blick auf offene und umstrittene verfassungsdogmatische Fragestellungen nicht durch eine Konzentration auf aktuell diskutierte Problembereiche zu verstellen. Sodann werden im abschließenden § 6 diese Aussagen zusammengeführt und der verfassungsrechtliche Spielraum einer Aufgaben- und Arbeitsteilung zwischen dem Staat und Privaten im Bereich der Sicherheitsaufgaben aufgezeigt. Konkrete Antworten auf einige der wichtigsten und praxisrelevantesten der in den ersten beiden Teilen aufgeworfenen Problemkreise verdeutlichen Möglichkeiten und Grenzen einer solchen „neuen Gewaltenteilung".
1. Teil
Private und öffentliche Sicherheit in Deutschland § 1: Das Trennungsmodell als Grundidee der Rechtsordnung Die Untersuchung der Zuordnung von Sicherheitsaufgaben zum Staat oder zu Privaten zielt polizeirechtlich gesprochen auf die Frage, wer Gefahren für Rechtsgüter abwehrt. Dabei sind unter Rechtsgütern rechtlich anerkannte Interessen zu verstehen1. Interessen werden also nur dann durch die Rechtsordnung geschützt, wenn sie rechtlich anerkannt worden sind. Die Einordnung eines Interesses als Rechtsgut obliegt damit allein dem Staat. Er hat als Gesetzgeber das Monopol der Konstituierung von Rechtsgütern. Ob ein Rechtsgut privatem oder öffentlichem Schutz untersteht, ist damit noch nicht festgelegt. Ebensowenig ist damit eine Aussage über die Art und Weise des Schutzes getroffen. Hier sieht die Rechtsordnung zwei Rechtsregimes vor, das öffentlich-rechtliche und das privatrechtliche. Damit kommen vier Schutzmodalitäten in Betracht: Der Staat schützt nach öffentlichem oder nach Privatrecht, Private schützen nach öffentlichem oder nach Privatrecht. Die Abgrenzung dieser Schutzmodalitäten muß sich aus der Rechtsordnung ergeben und damit vom Staat als Rechtsetzer getroffen werden. Er hat dabei verschiedene Abgrenzungsmöglichkeiten: Er kann den Schutz ausschließlich dem Staat oder Privaten zuweisen, er kann differenzieren nach der Art des Schutzes, nach den zeitlichen Anforderungen an den Schutz, also allgemeiner gesprochen: nach Effektivitätsgesichtspunkten, er kann nach der Art des zu schützenden Rechtsguts unterscheiden, nach dessen Bedeutung usw. Hier soll nun nicht nach der „richtigen" Zuordnung gesucht werden, sondern nach derjenigen der Rechtsordnung. Einige einleitende Überlegungen sollen den gedanklichen Rahmen deutlich machen. Das Stich wort „Staatsaufgäbe Sicherheit" könnte zunächst eine ausschließlich staatliche Schutzzuständigkeit nahelegen. Dies würde schon solche privaten Schutzaktivitäten unzulässig machen, die Dritte nicht berühren, wie etwa ein Türschloß. Die grundrechtliche Garantie, zumindest alles das tun und lassen zu dürfen, was andere nicht in ihren rechtlich geschützten Interessen berührt, steht daher dieser ausschließlichen Zuordnung zum Staat entgegen. „Staatsaufgabe Sicherheit" bedeutet damit zumindest nicht, daß allein der Staat Rechtsgüter schützen darf. ι Vgl. nur Röhl, Rechtslehre, S. 260.
§ 1 : Das Trennungsmodell als Grundidee der Rechtsordnung
27
Staatlicher Schutz könnte aufgrund dieser Einschränkung immer dann allein zulässig sein, wenn privater Schutz Rechte Dritter beeinträchtigt. Hierfür spräche das Stich wort „Gewaltmonopol" in seiner umgangssprachlichen Verwendungsweise als Monopolisierung jeglicher Gewalt beim Staat2. Andererseits kennt die Rechtsordnung gewaltsame private Schutzmechanismen, namentlich Notwehr und Besitzschutzrechte. Diese Rechte könnten jedoch Ausnahmefälle darstellen, die sich aus der zeitlichen Nähe der möglichen Verletzung des Rechtsguts erklären. Allein der Staat wäre also zum gewaltsamen Rechtsgüterschutz berufen, Private würden nur in Fällen, in denen staatliche Hilfe nicht rechtzeitig erreichbar ist, Rechtsgüter schützen. Diese Kombination eines weit verstandenen Gewaltmonopols mit Ausnahmen für Eilfälle erklärt zwar durchaus einige Regelungen des Rechtsgüterschutzes nach unserer Rechtsordnung, insbesondere etwa die Subsidiarität der Selbsthilfe nach § 229 BGB. Zweifel kommen aber schon bei der Konsequenz auf, daß der Einzelne hiernach entgegen überwiegender Auffassung 3 Notwehr zugunsten von Rechtsgütern des Staates üben dürfte. Dies verweist auf das Kriterium der Art des Rechtsguts. Rechtsgüter der Allgemeinheit und des Staates könnten allein staatlichem Schutz überantwortet sein, Privaten wäre der Schutz ihrer Individualrechtsgiiter zugewiesen. Für diese Abgrenzung spricht die Subsidiarität polizeilichen Schutzes gegenüber dem Schutz durch die Zivilgerichte, welcher trotz der Einbeziehung des Staates ein dem Privaten zuzurechnender Schutz ist, weil es allein auf dessen Willen ankommt, ob er von den staatlichen Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung Gebrauch macht (Dispositionsmaxime)4. Die Einbeziehung der staatlichen Justiz ließe sich dabei mit dem staatlichen Gewaltmonopol, der Rechtsstaatlichkeit oder Art. 92 GG begründen5. Allerdings widerspricht dieser Zuordnung nach der Art des Rechtsguts zum einen das Jedermann-Festnahmerecht auch bei Straftaten gegen Rechtsgüter des Staates, zum anderen der strafrechtliche Schutz von Individualrechtsgütern wie Leben, Gesundheit und Eigentum, sei er präventiv als Polizeiaufgabe oder repressiv als Strafverfolgungsaufgabe. Diese Durchbrechung des angedeuteten Grundsatzes könnte nun wiederum auf die Bedeutung dieser Individualrechtsgüter zurückzuführen sein6. Hiermit sind einige Gesichtspunkte angesprochen, nach denen die Rechtsordnung die Aufgabe des Rechtsgüterschutzes Privaten oder aber dem Staat zuordnen 2 Näher 3. Teil, § 5 A. 3 Näher unten § 1 B. III. 3. 4
Dies gilt sowohl für das Tätigwerden der Gerichte, vgl. etwa §§ 253, 688 ZPO, als auch für die Vollstreckung des Urteils, vgl. etwa §§ 753 f. ZPO. s Näher 3. Teil, § 5 H. I. 6 Vgl. Leisner, Staat, S. 108, 114 ff., insbes. S. 123.
§ 1 : Das Trennungsmodell als Grundidee der Rechtsordnung
28
kann und teilweise auch zuordnet. Festzuhalten ist an dieser Stelle, daß eine eindeutige und einfache Zuordnung der Sicherheitsaufgaben anhand lediglich eines Kriteriums jedenfalls nicht selbstverständlich ist.
A. Entwicklung der Abgrenzung von öffentlicher und privater Sicherheit Bevor das Grundmodell der gegenwärtigen Rechtsordnung dargestellt wird, soll ein knapper Überblick über die Entwicklung der Abgrenzung zwischen öffentlicher und privater Sicherheit gegeben werden. Die Ausführungen stellen keine Geschichte der Polizei dar. Vielmehr sollen anhand einiger Schlaglichter zentrale Argumentationstopoi aufgezeigt werden, welche die Entwicklung einer Rollenverteilung zwischen Polizei und Privaten im Bereich der Sicherheitsaufgaben prägten und sowohl in der gegenwärtigen Rechtsordnung als auch in der aktuellen Diskussion fortwirken. Aufgrund der lange Zeit engen Verknüpfung von Staatszwecken und Polizeiaufgaben 7 erfolgt dies durch eine am Wandel der Staatslehre orientierten Kategorisierung. Dabei richtet sich der Blick auf denjenigen Teil der Polizeiaufgaben, der heute als Gefahrenabwehr begriffen wird, und blendet damit den weiten Bereich wohlfahrtsstaatlicher - oder modern gesprochen: leistungsstaatlicher - Aufgaben aus, welcher bis weit ins 19. Jahrhundert im Zuge der Gleichsetzung von „Policey" und innerer Verwaltung der Polizei zugeordnet wurde 8.
I. Absolutismus Unabhängig davon, ob man die gängige Auslegung der staatstheoretischen Arbeiten von Bodin oder Hobbes9, die theoretische Diskussion in Deutschland oder das Selbstverständnis der Staatspraxis zugrundelegt, eine staatliche Verpflichtung zur Sicherheitsgewährleistung bestand zumindest seit Herausbildung des neuzeitlichen Staates10. Dieser Staatsaufgabe Sicherheit korrespondierte allerdings auch 7 Dazu Preu, Polizeibegriff, S. 12, und durchgehend; K. Vogel, in: FS Wacke, S. 375 ff.; Gusy /Nitz, in: H.-J. Lange, Staat, Demokratie und Innere Sicherheit, S. 335 ff. 8
Boldt, in: Lisken/Denninger, HdBPolR, Rn. A 15; ausführlich zu den Wurzeln Preu, Polizeibegriff, S. 26 ff.; zu Veränderungen im 19. Jhdt. Stolleis, in: Jeserich/Pohl/v. Unruh, Verwaltungsgeschichte II, S. 54, 86; Rüfner, ebd., S. 470 ff.; von der Groeben, ebd., Bd. III, S. 435,436 ff. 9 Näher dazu unten 3. Teil, § 5 Α. I. 10
Vgl. v. Unruh, in: Jeserich/Pohl/v. Unruh, Verwaltungsgeschichte I, S. 388, 391. - Anders allerdings die „antimodernistischen" (Stolleis, Geschichte II, S. 145) Ausführungen von Carl Ludwig von Haller, Restauration I, der den Staat unter Ablehnung von Staatsvertragslehren (S. 463 ff.) als ein zweckftei entstandenes Herrschaftsverhältnis verstand, das der Fürst unter alleiniger Bindung an göttliche Gesetze wie eine eigene Sache unabhängig verwaltete (S. 470 f.). Damit war Sicherheitsgewährleistung ein mögliches, aber grundsätzlich kein not-
Α. Abgrenzung von öffentlicher und privater Sicherheit
29
während der als absolutistisch bezeichneten Epoche trotz aller „Polizeistaatlichkeit" kein staatliches Sicherheitsmonopol 11. Im vorliegenden Zusammenhang wichtiger ist die dem Anspruch nach bestehende Bindung des absoluten Staates an das Gemeinwohlziel12. Diesem Gemeinwohl wurde dabei jedoch noch kein zu berücksichtigendes Individualwohl gegenübergestellt, es wurde vielmehr umfassend verstanden, der Staat kannte „Zweck und Ziel des menschlichen Daseins am besten" und vermittelte „das irdische Glück" 13 . Die Polizei galt als das Mittel zur Umsetzung des Gemeinwohls als des einzig relevanten Interesses.
II. Dualismus von Staat und Gesellschaft Insofern stellte die Entwicklung einer gedanklichen Trennung von Staat und Gesellschaft 14 eine wesentliche Neuerung dar 15 . Dem das Gesamtinteresse behandelnden staatlichen Bereich wurde nun die Gesellschaft als ein Bereich widerstreitender Individualinteressen gegenübergestellt16. Dies bewirkte aber keine Zurückstufung des Staates zu einer Erscheinungsform gesellschaftlicher Zusammenschlüsse neben anderen. Vielmehr wurde er qualitativ von der Gesellschaft unterschieden: Er stand „über" der Gesellschaft 17. Dementsprechend unterschied sich gesellschaftliches Handeln qualitativ von staatlichem Handeln. Letzteres galt weiterhin als von dem Gemeinwohl, dem „objektiven Willen" (volonté/intérêt générale]) bestimmt und nicht von der Summe der Einzelinteressen, der Einzelwil-
wendiges Staatshandeln. Eine Verpflichtung des Staates, also des Fürsten, zum Rechtsgüterschutz müßte vielmehr göttlich geboten sein. Damit unterschied sich Rechtsgüterschutz durch den Staat nicht von der jedermann erlaubten und - nach Haller - gebotenen Hilfe bei der Verteidigung Angegriffener (S. 414 ff., 426 ff.). Staatlicher Rechtsgüterschutz ergänzte private Sicherungsbemühungen, er war „suppletorisch", S. 420. » Vgl. v. Unruh, in: Jeserich/Pohl/v. Unruh, Verwaltungsgeschichte I, S. 388, 395 ff., 418; Willoweit, DSt., Beih. 2, S. 9, 15 ff. Weder die Beseitigung der tradierten Hoheitsträger aus eigenem Recht (dazu Nachw. unten § 2 Α. I. 1.) noch die staatstheoretisch eingeforderte und vom absoluten Staat angestrebte Monopolisierung gewaltsamer Rechtsdurchsetzung erfolgten während der absolutistischen Epoche, vgl. etwa zur Selbstjustiz noch im Vormärz Liidtke, in: ders., Sicherheit, S. 7, 19. 12 Willoweit, DSt., Beih. 2, S. 9, 13 ff. 13 Willoweit, DSt., Beih. 2, S. 9, 25. 14 Dazu Angermann, ZfΡ 1963, S. 89 ff.; Böckenförde, S. 131, 142 ff.
in: ders., Staat und Gesellschaft,
15 Sie führte überdies zu einer Abkehr von einem Verständnis der Staatsgewalt als sich nur graduell von anderen Rechtsverhältnissen unterscheidend. Wegweisend für die Abkehr vom privatrechtlichen Verständnis hin zu einem „staatsrechtlichen im eminenten Sinne des Wortes" Verständnis des Staates Albrecht, Rezension, S. 3. 16 Vgl. Hegel, Philosophie des Rechts, §§ 182 ff. zur bürgerlichen Gesellschaft, §§ 257 ff. zum Staat. 17 V. Stein, Geschichte der sozialen Bewegung II, S. 49; dazu etwa Grawert, in: Schnur, Staat und Gesellschaft, S. 245, 255 f.; vor v. Stein schon deutlich Albrecht, Rezension, S. 4.
30
§ 1 : Das Trennungsmodell als Grundidee der Rechtsordnung
len (volonté/intérêt de tous) 18 . Staatszweck sollte eine Herrschaft zur Verwirklichung eines sittlichen Reichs 19 und damit der Freiheit von den gesellschaftlichen Antagonismen sein 20 . Polizeilicher Rechtsgüterschutz hatte sich damit nach wie vor ausschließlich am Gemeinwohl zu orientieren, nicht hingegen an den Interessen Einzelner 21. Die Definitionskompetenz hinsichtlich des Gemeinwohls lag dabei in den Händen der staatlichen Organe 22. Dies änderten auch die sich entwikkelnden Theorien des Rechtsstaates nicht notwendig. Zwar sollte polizeiliches Handeln nun rechtlich eingefangen werden, doch orientierte sich diese „Herrschaft des Rechts" nicht an den Interessen der einzelnen Herrschaftsunterworfenen, sondern an über diesen stehenden sittlichen Geboten23. Rechtsnormen forderten ein polizeiliches Handeln im Interesse des Gemeinwohls, die Konkretisierung dieses Erfordernisses im Einzelfall oblag aber der Polizei; insofern handelte sie „schöpferisch"24. Während jedoch im absolutistischen Denken die Interessen des Einzelnen noch unerheblich waren, zeugte diese - nicht notwendig liberal motivierte - Anerkennung einer von Individualinteressen beherrschten gesellschaftlichen Sphäre von deren Beachtlichkeit. Ihr Schutz wurde jedoch nicht der Polizei zugeordnet. Vielmehr wurde die in § 10 Π 17 ALR formulierte Polizeiaufgabe der Abwehr von dem Einzelnen drohenden Gefahren einschränkend interpretiert: Der Einzelne wurde nur geschützt, wenn dies im „öffentlichen Interesse" geboten war. Schutz von Individualinteressen galt damit zwar als eine mögliche Nebenfolge polizeilichen Handelns, nicht aber als selbständige Polizeiaufgabe. Stattdessen wurde der Einzelne auf den gesellschaftlichen Bereich verwiesen. Konsequenterweise wurde privater Rechtsgüterschutz solange als zulässig angesehen wie er öffentliche Interessen nicht beeinträchtigte 25. Aus der möglichen Beeinträchtigung des Gemeinwohls durch private Rechtsdurchsetzung erklärte sich die staatliche Zivilgerichtsbarkeit, die sich mit den Interessenkonflikten innerhalb der gesellschaftlichen Sphäre beschäftigte. Die von diesem Denken vorgenommene Abgrenzung zwischen Polizei und Gerichtsbarkeit war damit eine eindeutige und deckte sich mit derjenigen zwi« Hegel, Philosophie des Rechts, § 258, S. 216; Stahl, Philosophie des Rechts II/1. S. 302. 19 Stahl, Philosophie des Rechts I I / 2 , S. 131; vgl. E.R. Huber, in: ders., Nationalstaat, S. 127, 129. 20
V. Stein, Geschichte der sozialen Bewegung II, S. 48; ders., Gegenwart und Zukunft, S. 291 f.; dazu E.R. Huber, in: ders., Nationalstaat,^. 127, 130 f.; Grawert, in: Schnur, Staat und Gesellschaft, S. 245, 266; ferner v. Sarwey, Öff. Recht, S. 21; Gneist, Verwaltungsgerichte, S. 7 ff. 21 V. Sarwey, Öff. Recht, S. 21, 65; vgl. auch die Terminologie bei Zachariä, Staats- und Bundesrecht II, S. 144 ff., 196. 22 Zu den historischen Wurzeln Willoweit, DSt., Beih. 2, S. 9, 13 ff. 23 Stahl, Philosophie des Rechts I I / 2 , S. 8, 137 f. und öfter; vgl. auch Gneist, Verwaltungsgerichte, S. 246. 24 Stahl, Philosophie des Rechts I I / 2 , S. 587 f. 25 Vgl. Zachariä, Staats- und Bundesrecht II, S. 141 ff.
Α. Abgrenzung von öffentlicher und privater Sicherheit
31
sehen polizeilichem und privatem Rechtsgüterschutz: Die Polizei war für das Gemeinwohl, Bürger und Gerichtsbarkeit waren für das Individualwohl zuständig26.
I I I . Bürgerlich-liberaler Rechtsstaat Ebenfalls in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich ein liberales Verständnis der Trennung von staatlicher und gesellschaftlicher Sphäre. Auch in diesem Gedankenmodell lassen sich Staat und Gesellschaft unterschiedliche Funktionen zuschreiben, in Abgrenzung zu dem vor allem auf Hegel zurückzuführenden Dualismus von Staat und Gesellschaft wird der Staat hier aber nicht als „über" sondern „neben" der Gesellschaft stehend angesehen27. Eine der Ursachen für diesen Unterschied liegt in dem frühliberalen Freiheitsverständnis, nach dem Freiheit die Abwesenheit staatlichen Zwangs bedeutet. Freiheit war damit ein der Gesellschaft zugeordneter Begriff 28 . Dementsprechend ging es darum, staatliche Herrschaft zu beschränken. Das staatliche Handeln galt nicht mehr als frei in Bezug auf die Verwirklichung eines sittlichen Ideals 29 , sondern es war zu begrenzen 30, um die gesellschaftlichen Kräfte mittels der „unsichtbaren Hand" das allgemein Beste verwirklichen zu lassen31. Für polizeilich-gefahrenabwehrendes Handeln hatte dies mehrere Konsequenzen: Zunächst war mit der Begrenzung des Staatszwecks der Umfang des staatlichen Handelns zu beschränken, idealiter auf den Sicherheitszweck32. Durchgesetzt hat sich diese Forderung zu keiner Zeit 3 3 , auch wenn die sog. Wohlfahrtspolizei aus dem Polizeibegriff herausgenommen wurde 34 , insbesondere um sie von gesetzlicher Legitimation abhängig zu machen. Für die Aufgabenabgrenzung zwischen Polizei und Privaten im Bereich des präventiven Rechtsgüterschutzes ist diese Entwicklung jedoch ohne Belang.
26 V. Sarwey, Verwaltungsrecht, S. 63 f.; vgl. v. Gierke , Staatsrecht, S. 108; Pözl, Bay. Verwaltungsrecht, S. 317; Mohn, Preuß. Verwaltungsrecht, S. 86. 27 Hierzu K. Hesse, DÖV 1975, S. 437, 439 f. 28 Vgl. nur Isensee, in: Böckenförde, Staat und Gesellschaft, S. 317, 320 f. 29 So noch Stahl, Philosophie des Rechts II /2, S. 587 f. („schöpferische Tätigkeit" der Polizei). 30 Zachariä, Staats- und Bundesrecht I, S. 41 f., 472. 31 Behr, Staatskunst I, S. XV; III, S. 15 f.; v. Rotteck, Vernunftrecht II, S. 61. 32 V Humboldt, Gränzen der Wirksamkeit, S. 8 f., 44 ff.; Behr, Staatskunst I, S. 55 ff.; vgl. auch v. Rotteck, Vernunftrecht II, S. 58 ff.; Überblick bei K. Vogel, in: FS Wacke, S. 375, 378 ff. 33 Kritisch Zachariä, Staats- und Bundesrecht I, S. 47 f., Bd. II, S. 278 f.; v. Sarwey, Verwaltungsrecht, S. 63 f. 34 Am prominentesten durch das Kreuzberg-Erkenntnis, PrOVGE 9, 353; in PrOVGE 38, 291, 295, 299, als ständige Rechsprechung bezeichnet.
§ 1 : Das Trennungsmodell als Grundidee der Rechtsordnung
Sodann mußte die Reichweite des polizeilichen Handelns begrenzt werden. Stehen die vom Staat verfolgten Interessen nicht mehr notwendig über denjenigen der Bürger 35 , so ist nicht jede polizeiliche Freiheitsbeschränkung gerechtfertigt. Die polizeilichen Befugnisse wurden dementsprechend einschränkend konkretisiert, insbesondere Anforderungen an die Schadenswahrscheinlichkeit36 gestellt und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entwickelt 37 . Dies bewirkte auch, daß sich polizeiliches Handeln an anderen Maßstäben messen lassen mußte als privater Rechtsgüterschutz, etwa wenn sich der Reichsstrafgesetzbuchgeber - anders als das prALR 3 8 - gegen eine Bindung des privaten Notwehrrechts an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entschied39. Schließlich wirkte sich das liberale Denken auf das Verständnis des Verhältnisses von polizeilichem und privaten Handeln aus. Die Trennlinie konnte nicht mehr zwischen einem Handeln im Interesse des Gemeinwohls, verstanden als ein sittlich überhöhtes Ideal, und dem Handeln im Interesse des einzelnen oder mehrerer liegen, wie sie durch das Erfordernis des polizeilichen Handelns im öffentlichen Interesse in dem eben beschriebenen Sinne markiert wurde. Da der Staat insbesondere von frühliberalen Autoren überwiegend über Staatsvertragslehren legitimiert wurde und damit in einem Zusammenschluß der Bürger fußte 40 , verfolgte die Polizei in diesem Modell letztlich immer auch Interessen der Bürger. Dies hieß nicht notwendig, daß staatlich verfolgte Interessen als mit der Summe der Einzelinteressen identisch angesehen wurden, volonté générale und volonté de tous zusammenfielen. Es wurde zumindest von einzelnen Autoren des Rechtsstaats anerkannt, daß der staatliche Zusammenschluß eigenständige „Bedürfnisse dieser Gesammtheit erzeugt" 41. Aber auch diese standen wegen der gesellschaftlichen Wurzeln des Staates in einem Bezug zu den Bürgern. Damit war polizeiliches Handeln zugunsten von Individualinteressen nicht mehr ausgeschlossen. Rechtlich geschützte Einzelinteressen wurden als Schutzgüter der polizeilichen Generalklausel angesehen42, und zwar unab35 So noch v. Sarwey, Öff. Recht, S. 65. 36 Vgl. schon Behr, Staatskunst III, S. 20; v. Rotteck, Vernunftrecht III, S. 294; später PrOVGE 39, 278, 281; SächsOVG, Jhb. 2, 238, 241; 11, 215, 217; Rosin, VerwArch 3 (1895), S. 249, 309 f.; O. Mayer, Verwaltungsrecht, S. 222 ff.; W. Jellinek, Verwaltungsrecht, S. 438 ff. 37 Vgl. schon Behr, Staatskunst III, S. 19 ff.; v. Rotteck, Vernunftrecht III, S. 294; später W. Jellinek, Verwaltungsrecht, S. 437 f.; Hatschek, Verwaltungsrecht, S. 132 ff. 38 Dazu v. Bar, Gesetz und Schuld, S. 132 f. 39 Überblick über diese im 19. Jahrhundert umstrittene Frage bei Schroeder, in: FS Mäurach, S. 127, 128 ff., insbes. 130; v. Bar, Gesetz und Schuld, S. 126 ff., insbes. 135 ff. 40 Amüsante Geschichte vom Urzustand zum Staatsvertrag bei Behr, Staatskunst I, S. 13 ff.; philosophische Staatsvertragslehre etwa bei v. Rotteck, Vernunftrecht II, S. 50 ff. 41 tf M ohi, Polizei-Wissenschaft I, S. 14; zu seinem Verständnis des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft Angermann, v. Mohl, S. 352 ff.; allgemein Enders, DSt. 1996, S. 351, 368 f. 42 V. Mohl, Polizei-Wissenschaft I, S. 12 ff., 30 f.; ders., Präventiv-Justiz, S. 205 f.; Zachariä, Staats- und Bundesrecht II, S. 294 f.; O. Mayer, Verwaltungsrecht, S. 219 f.; aus der
Α. Abgrenzung von öffentlicher und privater Sicherheit
33
hängig davon, ob sie öffentlich-rechtlicher, insbesondere strafrechtlicher, oder ausschließlich privatrechtlicher Natur waren. Deutlich zeigen dies die partielle Einbeziehung des Vermögens als grundsätzlich polizeilich schützbares Individualinteresse 43 und die Gleichsetzung von Gefahren, die dem Einzelnen durch andere Menschen drohen, mit solchen, die von Seiten der Natur kommen 44 . Handelte die Polizei auch in den letzteren Fällen, so ging es nicht mehr um die sittlich motivierte Disziplinierung des Störers und damit um ein allein öffentliches Interesse, das sich lediglich nebenbei auch zugunsten des Betroffenen auswirkt, sondern um den Schutz des individuell Betroffenen. Ein solches individualbezogenes Handeln kollidierte mit dem bürgerlichen Freiheitsideal. Die Optimierung der Individualinteressen erhoffte man sich ja gerade von einem freien Spiel der gesellschaftlichen und individuellen Kräfte. Um den Staat auf Distanz zu halten und ihn nicht die Geschäfte des Einzelnen erledigen zu lassen, mußte eine neue Abgrenzung zwischen staatlicher und privater Sphäre gefunden werden. Diese Funktion übernahmen die Grundrechte 45. Sie bildeten die neue Trennlinie zwischen staatlicher und privater Zuständigkeit46. Ein Handeln des Staates im grundrechtlich definierten privaten Bereich und damit auch das polizeiliche Handeln im Individualinteresse galt weiterhin als grundsätzlich unzulässig47. Individualinteressen wurden zwar jetzt zu den polizeilichen Schutzgütern gezählt. In den Fällen, in denen sie ausschließlich privatrechtlicher Natur waren 48 , postulierte man für sie jedoch eine Subsidiarität zugunsten der Zivilgerichtsbarkeit 49. Da Rspr.: PrOVG 48, 418, 420; für § 14 prPVG v. 1931: Klausener/Kerstiens/Kempner, PolVerwG, § 14 Erl. 8. 43 PrOVGE 4, 417, 418; 7, 374, 377; 15, 427, 433; später 77, 333, 336 f.; näher Rosin, VerwArch 3 (1895), S. 249, 308; Biermann, Privatrecht und Polizei, S. 17 f. 44 Behr, Staatskunst III, S. 172; Rosin, VerwArch 3 (1895), S. 249, 307; Thoma, Polizeibefehl, S. 32. 45 Vgl. nur O. Mayer, Verwaltungsrecht, S. 216 ff. 46 Grimm, Verfassungsgeschichte, S. 31; ders., KritV 1986, S. 38, 41; ders., in: ders., Recht und Staat, S. 308, 315 und öfter; für das Polizeirecht exemplarisch konkretisiert von Thoma, Polizeibefehl, S. 7. 47 Zachariä, Staats- und Bundesrecht I, S. 44 ff.; O. Mayer, Verwaltungsrecht, S. 220; Hatschek, Verwaltungsrecht, S. 129 f.; Schlickau, VerwArch 15 (1907), S. 489,490. 48 Öffentlich-rechtlich und damit vor allem strafrechtlich geschützte Individualinteressen gehören zum primären polizeilichen Aufgabenbereich: Hatschek, Verwaltungsrecht, S. 130. 49 PrOVGE 32, 425, 429; 39, 3%, 400; 42, 353, 355 f.; SächsOVG, Jhb. 2, S. 238, 242; 11, 215 f.; Mohn, Preuß. Verwaltungsrecht, S. 86; dies klingt bereits bei v. Mohl, Polizei-Wissenschaft I, S. 13, 18 f., 20 ff., 37, Präventiv-Justiz, S. 35, 206 ff., 212, an; a.A. noch Behr, Staatskunst III, S. 38 ff.; offengelassen bei v. Rotteck, Vernunftrecht III, S. 414 f., 460 ff.; zahlreiche Beispiele bei Foerstemann, Polizeirecht, S. 6 ff. Dogmatisch wurde dies für § 14 prPVG von 1931 in der Einschränkung der polizeilichen Zuständigkeit auf ein Handeln „im Rahmen der geltenden Gesetze" gestützt: Zu diesen Gesetzen zähle auch § 13 GVG, so daß bürgerliche Rechtsstreitigkeiten grundsätzlich aus dem polizeilichen Aufgabenbereich ausgenommen seien, Franzen, PolVerwG, S. 103, 159; Schäfer /Wichards/Wille, PolVerwG, § 14 Anm. I.l.a); Trubel, PolVerwG, § 14 Anm. 6. 3 Nitz
34
§ 1 : Das Trennungsmodell als Grundidee der Rechtsordnung
im Konstitutionalismus eine unmittelbare Grundrechtsgeltung nicht bestand und Grundrechtsschutz dementsprechend nur nach Maßgabe der Gesetze gewährleistetet war 50 , oblag es jedoch tatsächlich dem einfachen Recht, über die Rechtsbindung der Verwaltung private und staatliche Sphäre voneinander abzugrenzen51. Für die Abgrenzung des privaten vom polizeilichen Rechtsgüterschutz war daher entscheidend, daß aufgrund der gedanklichen Unterscheidung von staatlicher und gesellschaftlicher Sphäre an der Verankerung des Tatbestandsmerkmals des „öffentlichen Interesses" in § 10 I I 17 ALR, später in § 14 prPVG, festgehalten wurde. Dies war dogmatisch nur schwer mit dem Wortlaut des § 10 Π 17 ALR vereinbar, der den Einzelnen neben das Publikum stellte. Zur Begründung wurde auf den Bezug zur „öffentlichen" Sicherheit, Ruhe und Ordnung abgestellt52. Die Generalklausel wurde damit einheitlich verstanden, auch die im zweiten Halbsatz des § 10 I I 17 ALR formulierte Aufgabe der Gefahrenabwehr wurde als „Anstalt zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung" begriffen. In § 14 des preußischen Polizeigesetzes von 1931 schlug sich diese mittlerweile h.M. durch eine Umformulierung der Generalklausel nieder, ohne daß vom überkommenen Inhalt abgewichen werden sollte 53 . Dem öffentlichen Interesse kam allerdings trotz der weitgehend synonymen Verwendung der Begriffe öffentliches Interesse, Gemeinwohl, Interesse der Gesamtheit, der Allgemeinheit oder der Gesellschaft 54 eine Bedeutung zu, welche von der oben II. dargestellten Bedeutung zu unterscheiden ist. Zur Ermittlung des öffentlichen Interesses, in dem die Polizei handeln mußte, sollte nicht mehr nach dem sittlich oder göttlich Gebotenen gefragt werden, sondern wegen des Bezugs der staatlichen zur gesellschaftlichen Sphäre nach den Anschauungen der Allgemeinheit bzw. der Gesellschaft 55. Deutlich wurde dies in der prägnanten Forderung Walter Jellineks: ,»Fragt die Gesellschaft!" 56. In der Praxis änderte sich freilich nichts an der Definitionskompetenz der staatlichen Organe 57: „Was die Be50 Exemplarisch Laband, Staatsrecht I, S. 151; Überblick über den Meinungsstand zeitgenössich bei Giese, Grundrechte, S. 27 ff.; krit m. w. N. Meyer/Anschiitz, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, S. 953 ff. m. Fn. 2; historischer Überblick bei Grimm, in: ders., Recht und Staat, S. 308 ff., insbes. S. 316 ff., 335 ff.; dies gilt eingeschränkt auch noch für die Weimarer Republik, vgl. Gusy, ZNR 1993, S. 163, 167 ff.; ders. WRV, S. 280 ff. 51
Prägnant Thoma, Polizeibefehl, S. 105; O. Mayer, Verwaltungsrecht, S. 215 f.; Pözl, Bay. Verwaltungsrecht, S. 206. 52 Fleiner, Verwaltungsrecht, S. 400; Drews, RuPrVBl. 1931, S. 2; Klausener/Kerstiens/ Kempner, PolVerwG, § 14 Erl. 6; vgl. PiOVGE 48,418,420; SächsOVG, Jhb. 2, 238,241 f. 53 Näher zur Aufhebung der „Zweiteilung" Friedrichs, PolVerwG, § 14 Erl. 1 ff.; Drews, Polizeirecht, S. 7 f. 54
G. Jellinek, System, S. 200 f.; zahlreiche weitere Nachweise bei Heuer, Generalklausel, S. 232 f.; Beispiele für die synonyme Verwendung der Begriffe bei Rosin, Pol VOR, S. 143 ff.; Goldschmidt, VerwStrafR, S. 123, 530 ff., 537. 55 Vgl. Martens, Öffentlich, S. 192 f. 56 W. Jellinek, Gesetz, S. 68 ff., Zitat S. 75. 57 Vgl. dazu Funk, in: Reinke, Sicherheit, S. 56, 63.
Α. Abgrenzung von öffentlicher und privater Sicherheit
35
hörde für das öffentliche Interesse hält, ist im Rechtssinn wirklich das öffentliche Interesse" 58. Festzuhalten bleibt, daß trotz Beibehaltung der Zuordnung Gemeinwohl - Staat und Einzelinteresse - Gesellschaft/Einzelner nun die einzelnen Menschen den Bezugspunkt auch staatlichen Handelns bilden sollten. Dabei lief die Orientierung an den Anschauungen der Allgemeinheit weitgehend leer, weil die Polizei entschied, was zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und Ordnung zu tun war. Immerhin führte die Kreuzberg-Rechtsprechung des Preußischen Oberverwaltungsgerichts dazu, daß wohlfahrtspolizeiliche Maßnahmen einer gesonderten gesetzlichen und damit parlamentarisch legitimierten Grundlage bedurften. Für den hier interessierenden Sicherheitszweck blieb polizeiliches Handeln jedoch aufgrund der Generalklausel zulässig. Dennoch wurden Kriterien entwickelt, anhand derer der Begriff des öffentlichen Interesses konkretisiert werden sollte. Ausgangspunkt war dabei wiederum das liberale Freiheitsverständnis, aus dem ein privater Bereich gefolgert wurde, der dem Staat unzugänglich sei. Dies legte eine räumliche Abgrenzung nahe: Der häusliche Bereich als Kernbereich des Privatlebens sollte der Staatsgewalt entzogen sein 59 ; was im Haus passierte, betraf in erster Linie Individualinteressen. Das Hausrecht nahm damit für den Rechtsgüterschutz durch Private eine zentrale Rolle ein 60 . Die an der besonderen Bedeutung des Hausrechts für privaten Rechtsgüterschutz orientierte Abgrenzung von staatlicher und privater Sicherheitsgewährleistung stieß aber auf Schwierigkeiten, wo der häusliche Bereich nicht mehr klar abgrenzbar war, etwa weil eine Vielzahl von Familien unter einem Dach lebte und damit eine nicht mehr überschaubare Anzahl an Personen das Haus frequentierte. Diese mit den Arbeitersiedlungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verstärkt einsetzende Entwicklung führte dazu, daß etwa eine Treppenhausbeleuchtung als im öffentlichen Interesse geboten angesehen wurde 61 . Folglich wurde konstatiert, daß auch die Reichweite des Privatlebens nach den Anschauungen der Allgemeinheit zu bestimmen und damit wandelbar sei 62 . Eine räumliche Abgrenzung von polizeilicher und privater Zuständigkeit war danach - und ist auch heute - nur eingeschränkt brauchbar. Eine andere Entwicklung verstärkte diese Auflösung der faktischen Trennung zwischen Privatsphäre und öffentlicher Sphäre. Im 19. Jahrhundert verlor der öffentliche Raum zunehmend seine im Zuge der Aufklärung behauptete öffentliche Funktion als Diskursforum 63. Die gegenläufige Tendenz einer Individualisierung 58 W Lauri, Ermessen, S. 66. 59 V Rotteck, Vernunftrecht III, 296; O. Mayer, Verwaltungsrecht, S. 217; Fleiner, Verwaltungsrecht, S. 400 f.; Hatschek, Verwaltungsrecht, S. 129; vgl. Dürr, Generalklausel, S. 42 f. 60 Osenbrüggen, Hausfrieden, S. 23 ff., führt dies bis ins Mittelalter zurück; dabei reichte das Hausrecht zumeist weiter als das außer Haus geltende Notwehrrecht: ebd., S. 18 ff., 22. 61 PrOVGE 12, 390, 393; vgl. PrOVG 39, 396, 399; 42, 353, 355. 62 O. Mayer, Verwaltungsrecht, S. 217; W. Jellinek, Gesetz, S. 73. 63 Vgl. Benevolo, Stadt, S. 202 ff. 3*
36
§ 1 : Das Trennungsmodell als Grundidee der Rechtsordnung
des Lebens ließ ein „Recht, allein gelassen zu werden" 64 , entstehen, welches nun auch in der Öffentlichkeit beansprucht wurde 65 . Wenn die Polizei in der Praxis ihren Tätigkeitsbereich nicht einschränkte, so ließ sich ihr Handeln in jedermann zugänglichen Räumen auf der theoretischen Ebene nicht mehr nur als auf das gesellschaftliche Leben bezogen ansehen, sondern es erhielt einen Individualbezug, der vormals im öffentlichen Raum ausgeblendet war 66 . Lag der Mangel des räumlichen Kriteriums darin begründet, daß sich Privatsphäre nicht mehr strikt von öffentlicher Sphäre trennen ließ, so bot sich eine Abgrenzung nach der Anzahl der betroffenen Personen an. Hierher gehören auch Aussagen, die eine „Ausstrahlung in die Öffentlichkeit" verlangten 67. Die Interessen des Einzelnen wurden danach dann polizeilich geschützt, wenn der Einzelne als Bestandteil des Publikums 68 , also einer unbestimmten Vielzahl von Personen69 betroffen war. Ein öffentliches Interesse konnte schon dann bestehen, wenn eine Mehrzahl von Personen, also nur eine „Teilöffentlichkeit", betroffen war 70 . Desweiteren wurde angenommen, daß die Öffentlichkeit um so eher berührt sei, je bedeutender das betroffene Individualinteresse ist 7 1 . Hiermit sollten insbesondere die Fälle der Selbsttötung erfaßt werden, auch wenn sie nicht in der Öffentlichkeit stattfanden, die Ausstrahlungswirkung also fehlte. Es könne der Gesellschaft nicht gleichgültig sein, was mit dem Leben ihrer Mitglieder geschehe72. Diese Hinwendung zum Einzelnen73 bewirkte einen Überschneidungsbereich zwischen den Aufgaben der Polizei und der Gerichtsbarkeit 14. Individualinteressen wurden nun von der polizeilichen Generalklausel erfaßt und ihr Schutz damit 64 Hiermit ist eher eine moralische Forderung denn ein juristischer Anspruch gemeint. Zu letzterem vgl. etwa BVerfGE 44, 197, 203: Anspruch eines Soldaten in einer Kaserne, „in Ruhe gelassen zu werden". 65 Sennet, Verfall und Ende, benutzt den Begriff der Intimität, vgl. insbes. S. 329 ff. 66 Vgl. Sennet, Verfall und Ende, S. 31 ff. und passim. 67 Fleiner, Verwaltungsrecht, S. 401; O. Mayer, Verwaltungsrecht, S. 217 f.; Hatschek, Verwaltungsrecht, S. 129 f. 68 SächsOVG, Jhb. 11, 215, 216; W Jellinek, Verwaltungsrecht, S. 434; Hatschek, Verwaltungsrecht, S. 135. 69 Rosin, VerwArch 3 (1895), S. 249, 307; ähnlich W. Jellinek, Gesetz, S. 70; ausführlich Koehne, PrVBl. 26 (1904/05), S. 76, 77 f. 70 Deutlich zeigen dies die Ausführungen von Koehne, PrVBl. 28 (1906/07), S. 850, 851 f.; vgl. auch W. Jellinek, Gesetz, S. 71 m. w. N. 71 SächsOVG, Jhb. 11, S. 215, 216; W. Jellinek, Verwaltungsrecht, S. 434 f.; vgl. Häberle, Öffentliches Interesse, S. 266 ff.
72 Etwa Franzen, PolVerwG, S. 161. 73 Sie zeigte sich ferner in der am Beispiel nervöser Menschen geführten Diskussion, inwieweit individuelle Dispositionen zu berücksichtigen seien, vgl. Rosin, VerwArch 3 (1895), S. 249, 310 m. w. N. inFn. 182. 74 Dieser Kompetenzkonflikt ist nicht identisch mit demjenigen in vorabsolutistischer Zeit, der im „Dualismus von Recht und Ordnung" wurzelte, wobei der Polizei die Ordnung, der Justiz das Recht zugeordnet wurde: Willoweit, DSt., Beih. 2, S. 9, 18 ff., 22.
Α. Abgrenzung von öffentlicher und privater Sicherheit
37
grundsätzlich sowohl den Polizeiaufgaben als auch denjenigen der ordentlichen Gerichtsbarkeit zugeordnet. Der Versuch einer Abgrenzung zwischen Polizei und Justiz dahingehend, daß die Polizei präventiv, die Zivilgerichtsbarkeit jedoch erst im Anschluß an eine Rechtsverletzung tätig werde 75 , scheiterte an der Tatsache, daß auch die Gerichte mittels des einstweiligen Rechtsschutzes Gefahrenabwehr betrieben 76. Abgemildert wurde diese Überschneidung der Aufgabenbereiche durch die Postulierung der Subsidiarität polizeilichen Schutzes von privaten Individualrechten. Der Schutz der privaten Rechte wurde der Zivilgerichtsbarkeit zugewiesen, polizeilicher Schutz sollte hier nur in den Eilfällen des sog. polizeilichen Notstandes gewährt werden 77. Dennoch überschnitten sich die Aufgabenbereiche von Polizei und Gerichtsbarkeit, wenn eine hinreichende Anzahl an Individualinteressen betroffen war und damit ein öffentliches Interesse vorlag 78 . Hier war der polizeiliche Schutz der Rechtsgüter dem durch die Gerichte zeitlich vorgeschaltet, der Polizei kam eine justizentlastende Funktion zu 79 . Der Einzelne konnte wegen der Subsidiarität des polizeilichen Handelns im individuellen Bereich seine Rechtsgüter selbständig schützen. Theoretisch wurde seine Freiheit zu entscheiden, wie er dies bewerkstelligt, grundrechtlich fundiert. Zwar stellte der Staat die Zivilgerichtsbarkeit und für Eilfälle des polizeilichen Notstandes die Polizei zur Verfügung. Dies waren jedoch nur Angebote. Der Einzelne konnte sie annehmen, er konnte seine Rechtsgüter jedoch auch ungeschützt lassen oder im Rahmen der Gesetze selber schützen. Dementsprechend bestanden keine grundsätzlichen Beschränkungen des kollektiven Schutzes privater Rechte. In diesem Sinne behandelte bereits Robert von Mohl „Schutzvereinigungen" 80. Er maß ihnen jedoch für die Zukunft kein großes Gewicht bei, weil der polizeiliche Schutz weiterhin bestehe und somit an sich kein Grund für einen Beitritt zu einer solchen Vereinigung ersichtlich sei 81 . Hierbei übersah er, daß der Einzelne möglicherweise 75 So noch Behr, Staatskunst III, S. 242 ff.; v. Mohl, Präventiv-Justiz, S. 10 ff., 23 und öfter. Aus diesem Verständnis erklärt sich auch sein Begriff der „Präventiv-Justiz" für den polizeilichen Rechtsgüterschutz. 76 Thümmel, in: Wieczorek/ Schütze, ZPO V, Rn. 5 vor § 916. Der einstweilige Rechtsschutz („Provisorien") wurde im 19. Jahrhundert jedoch noch selten angewendet, vgl. Leipold, Grundlagen, S. 1. Überblick über die Prozeßordnungen vor Erlaß der ZPO, die z.T. ausdrücklich von der „Abwendung von Gefahren" sprachen, bei Walker, Der einstweilige Rechtssschutz, S. 69 ff. 77 PrOVGE 32,425,429; 38, 291, 299; 39, 278,281; 59,441,447; 77, 333, 337. 78 Vgl. Behr, Staatskunst III, S. 27 f.: „mit und neben der Civil- und Strafrechtspflege". 79 Beispiel bei Schlickau, VerwArch 15 (1907), S. 489,503 ff., 505. so V. Mohl, Präventiv-Justiz, S. 209 ff.; vgl. auch Hatschek, Verwaltungsrecht, S. 125; Pözl, Bay. Verwaltungsrecht, S. 317. 8i V. Mohl, Präventiv-Justiz, S. 210 f. - Seine Ausführungen zu den Grenzen privaten Rechtsgüterschutzes sind inhaltlich hochaktuell: „Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß es dem Bürger nicht gestattet werden mag, sich mit Bewaffneten zu umgeben und seine Wohnung zu befestigen, unter dem Vorwande gegen mögliche Angriffe auf sein Eigenthum. Solche Vorkehrungen könnten theilweise von gewerbmäßigen Übelthätern furchtbar miß-
§ 1 : Das Trennungsmodell als Grundidee der Rechtsordnung
einen privatrechtlichen Anspruch auf Schutz durch die Vereinigung hatte, nicht jedoch einen solchen auf polizeilichen Schutz seiner Individualinteressen. Vielmehr war ein Anspruch auf polizeiliches Einschreiten zugunsten privater Rechte noch nicht anerkannt 82, da die privaten Rechte des Einzelnen nur geschützt werden sollten, wenn und weil hieran ein öffentliches Interesse bestand. Als Zweck polizeilichen Handelns galten zwar die Bürger, jedoch nicht der Einzelne, sondern die Allgemeinheit83. Das hier dargestellte liberal-rechtsstaatliche Modell der Polizeiaufgaben wurde nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Staates wiederaufgenommen 84 . Die Polizei handele wegen der von der staatlichen Sphäre geschiedenen grundrechtlichen Sphäre der Bürger nur im öffentlichen Interesse 85, wobei zur Bestimmung des öffentlichen Interesses auf die erwähnten Kriterien zurückgegriffen wurde 86 : herrschende Anschauungen87, Anzahl der betroffenen Mitglieder der Gesellschaft 88, Ausstrahlung in die Öffentlichkeit 89, Bedeutung des Rechtsguts90. Ein Anspruch des Einzelnen auf polizeiliches Einschreiten zugunsten seiner privaten Rechte wurde zunächst nicht anerkannt, eben weil das polizeiliche Handeln dem öffentlichen Interesse vorbehalten war 91 . Die liberal-rechtstaatliche Tradition wurde unter dem Grundgesetz nicht abgebrochen, sondern durch Neuerungen modifiziert. Daher sind die hier vorgestellten Grundaussagen - von im Folgenden darzustellenden Entwicklungen abgesehen auch heute noch gültig, allerdings wenig ergiebig. Zum einen liegt dies an der Unbestimmtheit des für die Abgrenzung wesentlichen Kriteriums des öffentlichen Interesses. Zum anderen bietet das liberal-rechtsstaatliche Modell keine trennscharfe Unterscheidung zwischen polizeilichem und privatem Rechtsgüterschutz, da die
braucht werden gegen ihre Mitbürger, theils wären sie unvereinbar mit der notwendigen Ueberlegenheit und schnellen Anwendbarkeit der Staatsgewalt. Ritterliche Burgen und befestigte Thürme mögen im Mittelalter an der Stelle gewesen sein... ; allein in einem geordneten Rechtsstaate sind sie undenkbar", ebd., S. 208, Fn. 3. 82
St. Rspr. seit PrOVGE 2, 351, 354; v. Arnstedt, Polizeirecht, S. 429. - Hiervon zu trennen war die umstrittene Frage, ob die Polizei zu einem individualschützenden Handeln verpflichtet sein konnte, bejahend PrOVG, JW 1927, S. 1265, 1266. 83 W. Jellinek, Gesetz, S. 274 ff.; Schäfer/Wichards/Wille, PolVerwG, § 14 Anm. V; Friedrichs, PolVerwG, § 14 Erl. 14; Koehne, Verwaltungs-Polizeirecht, S. 9. 84 Vgl. Werner, DVB1. 1957, S. 806, 808 f.; Berner, DVB1. 1957, S. 810, 813; Baur, JZ 1962, S. 73, 75; H.H. Klein, DVB1. 1971, S. 233, 236; Überblick bei Häberle, Öffentliches Interesse, S. 269 f. 85 86 87 88 89 90
Berner, DVB1. 1957, S. 810, 815 f.; H.H. Klein, DVB1. 1971, S. 233, 236. Überblick bei Martens, DÖV 1976, S. 457,459. H.H. Klein, DVB1. 1971, S. 233, 239. Drews /Wacke, Polizeirecht, S. 44. Drews /Wacke, Polizeirecht, S. 60 f. Drews /Wacke, Polizeirecht, S. 61.
91 Drews/Wacke,
Polizeirecht, S. 44.
Α. Abgrenzung von öffentlicher und privater Sicherheit
39
Aufgabenbereiche sowohl der Polizei als auch Privater eröffnet sind, wenn ein öffentliches Interesse am Schutz eines Individualrechtsguts besteht, öffentliches und privates Interesse also nebeneinander vorliegen 92.
IV. Demokratischer Rechtsstaat Bildet der Tatbestand der Gefahr für die öffentliche Sicherheit, Ruhe und Ordnung, deren Abwehr im öffentlichen Interesse geboten ist, nach dem liberal-rechtsstaatlichen Modell die idealtypische Grenze zwischen polizeilichem und privaten Rechtsgüterschutz, so ist seine Konkretisierung Voraussetzung für eine brauchbare Aufgabenabgrenzung. Einige Konkretisierungsversuche wurden angedeutet, doch offen blieb, wer diese Konkretisierung vorzunehmen befugt war. Damit konnte die handelnde Polizei bzw. das kontrollierende Gericht die Definitionskompetenz etwa hinsichtlich der Anschauungen der Allgemeinheit oder der erforderlichen Anzahl betroffener Individualinteressen in Anspruch nehmen93. Dies mußte sich mit einer zunehmenden Demokratisierung des staatlichen Handelns ändern 94. In diese Richtung kann das Kreuzberg-Erkenntnis des preußischen Oberverwaltungsgerichts gelesen werden 95 , das die Zulässigkeit wohlfahrtspolizeilichen Handelns von einer Ermächtigung durch den Gesetzgeber abhängig machte. Hinsichtlich der gefahrenabwehrenden Tätigkeit wurde die Generalklausel jedoch weiterhin als ausreichende gesetzliche Grundlage betrachtet, unabhängig von der Weite ihrer Auslegungsmöglichkeiten. Doch um die Jahrhundertwende mehrten sich Stimmen, die eine gesetzliche Normierung dessen verlangten, was die öffentliche Ordnung ausmacht 96 . Eine solche rechtliche Anerkennung eines Interesses konstituiert ein Rechtsgut, welches dann Bestandteil der öffentlichen Sicherheit wird. Die Entwicklung der Verrechtlichung ist bekannt97 und führte dazu, daß bis vor kurzem Fälle eines polizeilichen Handelns zum Schutze der öffentlichen Ordnung selten waren 98 , diese Tatbestandsalternative für überflüssig gehalten oder mangels inhaltlicher Bestimmtheit wegen Verstoßes gegen das Rechtsstaats- und/oder Demokratieprinzip für verfassungswidrig gehalten wurde 99 .
92
Zur Verschränkung öffentlicher und privater Interessen Martens, Öffentlich, S. 198 f.; ders., DÖV 1976, S. 457, 461; Baur, JZ 1962, S. 73 ff., insbes. S. 75; Häberle, Öffentliches Interesse, S. 60 ff., 95 ff., 266 ff., und öfter. 93 Denninger, Polizei, S. 13. 94 Vgl. K. Vogel, in: FS Wacke, S. 375, 384 f. 95 Di Fabio, Risikoentscheidungen, S. 31. 96 Dies wurde jedoch überwiegend rechtsstaatlich, nicht demokratisch begründet: vgl. bereits Loening, Verwaltungsrecht, S. 259, 726; O. Mayer, Verwaltungsrecht, S. 215 f.; krit. Hatschek, Verwaltungsrecht, S. 126 f.; unter dem GG etwa Berner, DVB1. 1957, S. 810, 817 f. 97 Statt aller Gusy, StWStP 1994, S. 187, 188 ff.; Denninger, Polizei, S. 22 ff.; Gramm, Privatisierung, Kap. 2.2.5, S. 84 ff. m. w. N. 98 Zur „Renaissance der öffentlichen Ordnung" Stornier, DV 30 (1997), S. 233 ff.
40
§ 1 : Das Trennungsmodell als Grundidee der Rechtsordnung
Die gesetzliche Konkretisierung der rechtlich geschützten Interessen und damit des Inhalts der öffentlichen Sicherheit erhöht die demokratische Legitimation der Polizeiarbeit 100 . Dies allein führt jedoch nicht zu einer klareren Abgrenzung von privater und polizeilicher Schutzzuständigkeit, denn der unbestimmte Begriff des öffentlichen Interesses wird hiervon noch nicht erfaßt. Eine trennschärfere Abgrenzung wird aber dadurch ermöglicht, daß der Gesetzgeber bei der rechtlichen Anerkennung eines Interesses in einer Rechtsnorm ein Rechtsverhältnis beschreibt. Ist an diesem Rechtsverhältnis notwendig der Staat beteiligt, handelt es sich also um eine öffentlich-rechtliche Norm 1 0 1 , so wird das Rechtsgut dem Staat zugewiesen. Dies geschieht aufgrund der Unterscheidung von staatlicher und gesellschaftlich / individueller Sphäre im öffentlichen Interesse. Ein öffentliches Interesse an dem Schutz eines Interesses besteht also dann, wenn es in einer öffentlich-rechtlichen Norm anerkannt worden ist 1 0 2 . Umgekehrt sind privatrechtlich anerkannte Interessen solche, deren Wahrnehmung Privaten überlassen ist. Diese Konkretisierungsmöglichkeit des Tatbestandsmerkmals „öffentliches Interesse" ist im Zuge der demokratisch motivierten zunehmenden rechtlichen Normierung in den Privatschutzklauseln der Polizeigesetze fixiert worden 103 . Auswirkungen auf den tatsächlichen Aufgabenbereich von Polizei und Privaten ergeben sich daraus jedoch nicht notwendig. Vielmehr wird allein die Definitionskompetenz im Hinblick auf das öffentliche Interesse partiell von der Polizei auf den Gesetzgeber verlagert. Die bereits erwähnte Problematik einer Überschneidung privater und polizeilicher Zuständigkeiten bleibt bestehen. Bestand sie im bürgerlich-liberalen Modell dann, wenn es um den Schutz solcher individuellen Rechtsgüter ging, deren Schutz nach Ansicht der Polizei auch im öffentlichen Interesse geboten war, so überschneiden sich die Bereiche jetzt, wenn ein Individualinteresse sowohl in einer privatrechtlichen als auch in einer öffentlich-rechtlichen Norm anerkannt ist. Dies ist bei den zahlreichen Rechtsgütern der Fall, die von sog. pönalisierten Privatrechtsnormen 104 konstituiert werden 105 . w Vgl. Waechter, NVwZ 1997, S. 729 ff.; Denninger, Polizei, S. 32; ders., JZ 1970, S. 145, 148 ff.; ders., in: Lisken/Denninger, HdBPolR, Rn. E 26; Achterberg, in: FS Scupin, S. 9, 27, 29 ff.; Peine, DV 12 (1979), S. 25, 27 ff., 30 ff., insbes. S. 48 f.; Thiele, DVB1. 1979, S. 705, 706 f.; Götz, Polizei- und Ordnungsrecht, Rn. 127; ausführlicher noch in der 5. Aufl., S. 44 ff.; Mussmann, Polizeirecht BW, Rn. 159; JochumlRühle, Polizei- und Ordnungsrecht, Rn. D 24. loo Vgl. Gusy/Nitz, in: H.-J. Lange, Staat, Demokratie und Innere Sicherheit, S. 335, 348. ιοί Vgl. nur Bachof, in: FS BVerwG, S. 1, 7 ff. 102 Baur, JZ 1962, S. 73, 76. !03 Etwa: § 1 II PolGNW; § 1 VII BGSG; vgl. zum Streit, ob diese Normen die polizeiliche Aufgabe des Schutzes von Privatrechtsgütern erst ermöglichen oder aber den von der Generalklausel bereits eröffneten Handlungsraum beschränken v. Hellingrath, JZ 1962, S. 244, 245; Denninger, in: Lisken/Denninger, HdBPolR, Rn. E 7; Robbers, Sicherheit, S. 236 m. w. N.; s.a. unten B. II. (4). 104 Begriff nach Baur, JZ 1962, S. 73, 76. - Zur doppelten Schutz-Zuständigkeit unten B. III. 1; vgl. Denninger, in: Lisken / Denninger, HdBPolR, Rn. E 19; Gusy, Polizeirecht,
Α. Abgrenzung von öffentlicher und privater Sicherheit
41
Zusammenfassend zeigt sich, daß die Entwicklung zum demokratischen Rechtsstaat zwar auf die Polizei zurückwirkte, eine deutlichere Abgrenzung ihrer Zuständigkeiten von denjenigen Privater im Bereich des präventiven Rechtsgüterschutzes ergab sich daraus jedoch nicht. Zu Beginn der neueren Diskussion um das Verhältnis von polizeilichem und privatem Rechtsgüterschutz seit Mitte der 1970er Jahre wurde ausdrücklich das Demokratieprinzip thematisiert. Im Sicherheitsgewerbe wurde eine „latente Bedrohung der Demokratie" gesehen, weil mit ihm ein Machtpotential heranwachse, welches der staatlichen Polizei vergleichbare Möglichkeiten der - auch gewaltsamen - Durchsetzung von Interessen habe, anders als die staatlichen Organe aber nicht demokratisch legitimiert sei 1 0 6 . Die Berechtigung dieser Bedenken ist an dieser Stelle nicht zu überprüfen 107; indem jedoch bestimmte Formen des Rechtsgüterschutzes für demokratisch legitimationsbedürftig angesehen werden, zielt die Kritik auf eine deutlichere Abgrenzung der Zuständigkeiten von Polizei und Privaten. Eine solche wird jedoch nicht angeboten. Vielmehr deuten die Befürchtungen allein auf eine Grauzone zwischen staatlichem und nicht demokratisch legitimiertem privaten Rechtsgüterschutz hin - ein Beleg für die historisch gewachsenen Unsicherheiten bei der Abgrenzung der Zuständigkeiten der Sicherheitsakteure.
V. Sozialer, demokratischer Rechtsstaat Die Verankerung des Sozialstaats im Grundgesetz war eine verfassungsrechtliche Neuerung. Polizeiliches Handeln mußte nun nicht nur rechtsstaatlich und demokratisch, sondern auch sozialstaatlich sein. Die Auswirkung dieses Staatsziels auf das Polizeirecht und die polizeiliche Praxis blieb jedoch gering. Auch theoretisch wurde es nicht auf seine Implikationen für die polizeiliche Tätigkeit befragt 108 . Dennoch lassen sich einige der für das Verhältnis von polizeilichem und Rn. 94 f.; Würtenberger/Heckmann/Riggert, Polizeirecht, Rn. 117; Drews /Wacke /Vogel/ Martens, Gefahrenabwehr, S. 239; H.H. Klein, DVB1. 1971, S. 233, 236; a.A. wohl Rasch, Polizei- und Ordnungsrecht, § 1 MEPolG Rn. 58; R. Krüger, Privatrechtsschutz, S. 60 ff. 105
Hingewiesen sei auf den Umstand, daß die Zunahme strafrechtlich geschützter Rechtsgüter dem Privatisierungstrend nicht notwendig entgegenläuft, weil zum einen der strafrechtliche Schutz nicht umfassend gewährleistet wird (Vollzugsdefizit), zum anderen die strafrechtliche Ahndung durch zunehmende private Konfliktlösung (Täter-Opfer-Ausgleich, Diversion etc.) abgelöst wird, vgl. dazu Naucke, KritVJ 1993, S. 135, 139 ff.; Beste/Voß, in: Institut für Kriminalwiss., Vom unmöglichen Zustand, S. 313, 318 ff. 106 Roßnagel, Radioaktiver Zerfall, S. 138, 196 f.; vgl. ders., ZRP 1983, S. 59, 62; Hoffmann-Riem, ZRP 1977, S. 277, 279; gegen ihn Schwabe, ZRP 1978, S. 165; vorsichtig v. Walsleben, cilip 43 (1992), S. 14. 107 Dazu unten 3. Teil, § 5 F. III. io« Dies gilt auch für diejenigen Literaturstimmen, welche einer in den traditionellen rechtsstaatlichen Bahnen verharrenden Polizei tendenziell kritisch gegenüberstehen. Weder
§ 1 : Das Trennungsmodell als Grundidee der Rechtsordnung
privatem Rechtsgüterschutz relevanten Entwicklungslinien 109 dem Sozialstaatsprinzip zuordnen. Da der Sozialstaat derjenige Staat ist, der in die gesellschaftliche Sphäre interveniert und sich um hilfsbedürftige Einzelne kümmert 110 , liegt die Zulässigkeit eines Handelns zugunsten Einzelner gerade wegen ihrer Interessen nahe. Dies zwingt zwar nicht zur Aufgabe der Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, von öffentlichen und privaten Interessen, relativiert aber die bürgerlich-liberale Trennlinie, indem dem Staat Aufgaben in traditionell zur gesellschaftlichen Sphäre gerechneten Bereichen entstehen111. Der polizeiliche Aufgabenbereich wird damit erweitert 112 , ohne daß dieser Entwicklung eine Beschränkung der Zulässigkeit privaten Rechtsgüterschutzes notwendig korrespondiert 113. In diesen Zusammenhang läßt sich auch die Entwicklung eines Anspruchs auf polizeilichen Schutz stellen 114 . Ein solcher wurde zwar zunächst insbesondere verwaltungsrechtlich unter Einbeziehung der Grundrechte begründet und erst später über die Lehre von den grundrechtlichen Schutzpflichten fundiert 115 , führt im Ergebnis aber ebenfalls dazu, daß die Polizei sich um rechtlich anerkannte Interessen Einzelner zu kümmern hat. Ob man diese Entwicklung so zu interpretieren hat, daß der Einzelne um seiner Individualinteressen willen geschützt wird oder aber ein öffentliches Interesse an diesem Individualschutz besteht, soll hier offen bleiben. Ebenso wenig ist der Erörterung verfassungsrechtlicher Fragen im 3. Teil vorzugreifen und daher die Berechtigung dieser Entwicklungen sowie ihrer Begründungen nicht näher zu untersuchen. Vielmehr soll allein festgehalten werden, daß H. Wagner, AK-PolG, noch Lisken/Denninger, HdBPolR, oder Busch/Funk/Kauß/Narr/ Werkentin, Polizei, erwähnen das Sozialstaatsprinzip. - Vgl. aber auch Erbel, DVB1. 1972, S. 475,479, der den polizeilichen Schutz der öffentlichen Ordnung aus einer sozialstaatlichen Pflicht zur Durchsetzung gesellschaftlicher Interessen begründet. 109 Überblick bei Gusy /Nitz, in: H.-J. Lange, Staat, Demokratie und Innere Sicherheit, S. 335, 348 ff. 110 Jarass/Pieroth, GG, Art. 20 Rn. 74 m. w. N.; näher zum Sozialstaatsprinzip unten 3. Teil § 5 Β. 1.5. 111 Dementsprechend wird heute weniger von einer Trennung zwischen Staat und Gesellschaft, als vielmehr von einer Unterscheidung gesprochen, vgl. nur Böckenförde, in: ders., Staat und Gesellschaft, S. 395; K. Hesse, DÖV 1975, S. 437, 438; Rupp, in: Isensee/ Kirchhof, HdBStR I, § 28 Rn. 17. 112 Vgl. kritisch K. Vogel, in: FS Wacke, S. 375, 389; H.A. Hesse, Schutzstaat, S. 17 ff., 25 f. h 3 In der Konsequenz dieser Entwicklung liegt es, wenn über die Notwendigkeit eines Festhaltens am Erfordernis polizeilichen Handelns im öffentlichen Interesse diskutiert wurde. Dazu Martens, JuS 1962, S. 245, 249; Frotscher, DVB1. 1976, S. 695, 698; Leisner, Staat, S. 108 ff.; Robbers, Sicherheit, S. 238 f. 114 Grundlegend BVerwG 11, 95 = DVB1. 1961, S. 125, 126 f. m. Anm. Bachof, S. 128, 129 f.; Witten, NJW 1961, S. 753, 755; Martens, JuS 1962, S. 245 ff., insbes. S. 248; Henke, DVB1. 1964, S. 649 ff., insbes. S. 653 ff.; Frotscher, DVB1. 1976, S. 695, 703; Ule/Rasch, Polizei- und Ordnungsrecht, § 14 PrPVG Rn. 68. us Stellvertretend für viele Isensee, Grundrecht auf Sicherheit, S. 52 f.; Robbers, Sicherheit, S. 228 ff.; di Fabio, Risikoentscheidungen, S. 17.
Α. Abgrenzung von öffentlicher und privater Sicherheit
43
die brüchige Trennlinie zwischen privatem und staatlichem Rechtsgüterschutz, wie sie sich im Zuge der Entwicklung zum Rechtsstaat herausbildete, unter der Verfassung des sozialen und demokratischen Rechtsstaates des Grundgesetzes weiter aufgelöst wurde.
VI. Zusammenfassung Die unterschiedlichen Staatstheorien, Staatszwecke und Staatsformen beeinflußten das Verhältnis von privatem und staatlichen Rechtsgüterschutz. Zwar läßt sich als Konstante festhalten, daß polizeilicher Rechtsgüterschutz als dem Gemeinwohl und damit dem öffentlichen Interesse verpflichtet angesehen wurde, dessen Verständnis wandelte sich jedoch. Idealtypisch läßt sich eine Entwicklung vom polizeilichen Schutz „über" den Bürgerinteressen stehender sittlicher Ideale über den Schutz aller derjenigen Rechtsgüter, an denen ein öffentliches Interesse besteht, hin zu einem sozialstaatlich motivierten Schutz grundsätzlich aller Rechtsgüter einschließlich anerkannter Individualinteressen feststellen. In keinem dieser Modelle vermochte die enge Verknüpfung von Polizeiaufgaben mit Staatszwecken und Verfassungsrecht eine trennscharfe Abgrenzung zu den Zuständigkeiten Privater zu begründen. Zwar ermöglichte das Auftreten einer Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft eine abstrakte Zuordnung je nachdem, ob im öffentlichen Interesse oder aber im Privatinteresse geschützt wurde. Aufgrund der zahlreichen Fälle einer Kumulierung von öffentlichem Interesse und Privatinteresse grenzt dieses Kriterium die Aufgabenbereiche Privater und der Polizei jedoch nicht eindeutig voneinander ab 1 1 6 . Zu dem rechtsstaatlichen Denken später hinzutretende demokratische und sozialstaatliche Anforderungen klären diese Zuordnungsprobleme jedenfalls nicht auf einen ersten Blick, vielmehr scheinen sie tendenziell zu weiteren Abgrenzungsschwierigkeiten zu führen. Diesen verfassungsrechtlichen Anforderungen ist später detailliert nachzugehen, an dieser Stelle bleibt es bei dem Fazit, daß sich theoriegeschichtlich eine am Vorliegen eines öffentlichen Interesses orientierte, aber nicht trennscharfe Abgrenzung zwischen öffentlicher und privater Sicherheit ergeben hat. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung wird im Folgenden das Grundmodell der Rechtsordnung nach der ihr zugrundeliegenden Idee skizziert (B.), bevor dieses Modell mit der aktuellen Situation des Verhältnisses von privatem und staatlichem Rechtsgüterschutz konfrontiert wird (§ 2).
π* Vgl. nochmals Martens, Öffentlich, S. 198 f.; ders., DÖV 1976, S. 457, 461; Baur, JZ 1962, S. 73 ff., insbes. S. 75; Häberle, Öffentliches Interesse, insbes. S. 266 ff.
44
§ 1 : Das Trennungsmodell als Grundidee der Rechtsordnung
B. Das Grundmodell der Rechtsordnung Der Überblick über die Entwicklung des Verhältnisses von privatem und staatlichem Rechtsgüterschutz zeigte als wichtigstes Kriterium der Zuordnung von Sicherheitsaufgaben zum Staat das Vorliegen eines öffentlichen Interesses an dem Schutz des jeweiligen Rechtsguts auf. Umgekehrt wurde der Schutz allein privater Interessen den Privaten überantwortet. Die damit aufgeworfene Frage, wer über das Vorliegen eines öffentlichen Interesses entscheidet, wurde unterschiedlich beantwortet, wobei ein Trend von einer polizeilichen und damit exekutivischen Beurteilungskompetenz hin zu einer gesetzlichen und damit legislativen Fixierung des Schutzinteresses zu verzeichnen war. Die gesetzliche Zuordnung eines Rechtsguts zu einem Schutzregime wird regelmäßig nicht ausdrücklich normiert, sondern ist durch Auslegung zu ermitteln. Nicht weiterführend ist dabei ein Abstellen auf das geschützte Interesse in dem Sinne, daß ein öffentliches Interesse am Schutz eines Rechtsguts allein dann besteht, wenn nicht ein Individuai-, sondern ein überindividuelles oder staatliches Interesse 117 rechtlich anerkannt wird. Dies zeigt sich einerseits bei strafrechtlich konstituierten Individualrechtsgütern, welche staatlichem Schutz überantwortet sind, andererseits bei solchen öffentlich-rechtlichen Normen, die nach der Schutznormtheorie subjektiv-öffentliche Rechte begründen. Der Staat muß die in diesen Normen zum Ausdruck kommenden Interessen Privater berücksichtigen, also nach Möglichkeit verwirklichen und somit vor Einbußen schützen. Der Private ist hieran nur insoweit beteiligt, als er über die mit der Begründung eines subjektiven Rechts verbundene Möglichkeit der gerichtlichen Durchsetzung seines Interesses entscheidet118. Diese Beispiele zeigen eine staatliche Schutzzuständigkeit im Bereich öffentlich-rechtlich anerkannter Individualinteressen. Ergiebiger ist die bereits angeklungene119 Zuordnung nach dem Rechtscharakter der ein Interesse rechtlich anerkennenden Norm: Ist an einem von einer Rechtsnorm beschriebenen Rechtsverhältnis der Staat beteiligt, so ist er für den Schutz der in diesem Rechtsverhältnis betroffenen Interessen zuständig, unabhängig davon, ob es sich um staatliche Interessen, Allgemein- oder Individualinteressen handelt. Eine Abkoppelung von dem Charakter des geschützten Interesses ist auch deswegen nötig, weil der Staat immer nur im „öffentlichen" Interesse handeln darf 120 . Auch die Anerkennung eines „privaten" Interesses erfolgt also letztlich im „öffentlichen" Interesse, insbesondere etwa um mit der Begründung der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte Selbstjustiz zu verhindern. Die staatliche Zuständig117 Ob und inwiefern sich staatliche und überindividuelle Interessen unterscheiden, kann hier dahinstehen. 118 Vgl. zu subjektiven Rechten als rechtlich anerkannte und gerichtlich durchsetzbare Interessen den Überblick bei Röhl, Rechtslehre, S. 345 ff. 119 Oben Α. IV.
120 Dementsprechend ist ein Zusatz zur polizeilichen Generalklausel, nach dem der polizeiliche Aufgabenbereich nur eröffnet ist, „soweit es im öffentlichen Interesse geboten ist" so § 112 SächsPolG - überflüssig.
Β. Das Grundmodell der Rechtsordnung
45
keit für den Schutz der in einem Rechtsverhältnis unter seiner Beteiligung betroffenen Interessen ist aber auch unabhängig davon, ob der Staat durch die das Rechtsverhältnis regelnden Normen berechtigt oder verpflichtet wird. Die Verpflichtung des Staates zur Berücksichtigung von Individualinteressen obliegt ihm auch dann, wenn der Träger des Individualinteresses von seinem subjektiven Recht keinen Gebrauch macht. Rechtsverhältnisse, an denen notwendig der Staat als Hoheitsträger beteiligt ist, sind öffentlich-rechtlich geregelte Rechtsverhältnisse 121. Mithin ist der Staat für den Schutz solcher Interessen zuständig, die durch öffentlich-rechtliche Normen anerkannt werden. Der Gesetzgeber drückt sein Urteil über die Frage nach einem staatlichen Schutz erforderlich machenden öffentlichen Interesse dadurch aus, daß er das Intersse in einer öffentlich-rechtlichen Norm als Rechtsgut konstituiert. Umgekehrt obliegt den Privaten der Schutz der durch Privatrechtsnormen konstituierten Rechtsgüter. An diesen Rechtsverhältnissen ist der Staat nicht - jedenfalls nicht notwendig - beteiligt, er kann die beteiligten Interessen demnach zumindest nicht unmittelbar schützen. Er soll sie grundsätzlich auch nicht schützen, vielmehr ist jeder im Rahmen der Privatautonomie für die Durchsetzung und Bewahrung seiner rechtlich anerkannten Interessen selber zuständig. Diese Aufteilung der Schutzzuständigkeit nach dem Rechtscharakter der das Interesse schützenden Norm hat im Grundsatz zur Folge, daß es keine parallele Zuständigkeit von Staat und Privaten gibt. Die Zuständigkeiten sind vielmehr aufgeteilt. Diese Trennung von staatlicher und privater Schutzzuständigkeit möchte ich im folgenden Trennungsmodell nennen. Rechtsgüter, für deren Schutz hiernach der Staat zuständig ist, sollen im weiteren wegen ihrer öffentlich-rechtlichen Begründung öffentliche Rechtsgüter genannt werden. Damit ist nicht ausgesagt, daß es sich um anerkannte staatliche oder Allgemeininteressen handelt, vielmehr fallen hierunter auch solche Individualinteressen, die der Gesetzgeber für öffentlich-rechtlich anerkennungswürdig gehalten hat. Umgekehrt werden privatrechtlich anerkannte Interessen als private Rechtsgüter bezeichnet. Aus dem erwähnten Monopol des Staates, Rechtsgüter zu konstituieren, folgt, daß der Gesetzgeber entscheidet, wer zum Schutz eines Rechtsguts berufen ist. Er vollzieht diese Entscheidung durch die Wahl zwischen öffentlichem und Privatrecht. Gesichtspunkte, die diese Entscheidung lenken, sind insbesondere die beteiligten Interessen. In einer die Privatautonomie in den Vordergrund rückenden Rechtsordnung werden Individualinteressen überwiegend den privaten Interessensträgern zugeordnet, Individualinteressen also als private Rechtsgüter anerkannt. Dies ist aber nicht durchgängig so. Vereinfacht läßt sich sagen, daß je mehr Interessen in einem zu regelnden Rechtsverhältnis betroffen sind, desto wichtiger wird ein von Privatinteressen unabhängiger, staatlicher Schutz. Gleiches wird sich tendenziell auch für die Bedeutung eines Interesses sagen lassen. Je höherrangig ein 121 Vgl. statt aller Bachof, in: FS BVerwG, S. 1,7 ff.
46
§ 1 : Das Trennungsmodell als Grundidee der Rechtsordnung
Interesse, desto eher wird dies staatlichem Schutz zugewiesen. Auch werden Rechtsverhältnisse, die anders kaum zu gewährleistende überindividuelle Interessen berühren, regelmäßig einem öffentlich-rechtlichen Regime unterstellt. Hier ist etwa an den sog. öffentlichen Raum 1 2 2 zu denken, der zum Erhalt seiner Funktionen für Jedermann privaten Interessensträgern entzogen werden soll. Aber auch hier sind Ausnahmen denkbar. In einem Rechtsverhältnis mögen neben Individualinteressen auch Allgemeininteressen betroffen sein, dennoch kann ein privates Rechtsregime unter Billigung der damit möglicherweise negativ berührten Allgemeininteressen angeordnet werden. Die eingangs angestellten Überlegungen 123 über Möglichkeiten einer Abgrenzung privaten und staatlichen Schutzes spielen hier eine Rolle. Festzuhalten ist jedoch, daß die Entscheidung des Gesetzgebers eine rechtspolitische Entscheidung darstellt, solange sie nicht durch höherrangiges Recht determiniert wird. Im Rahmen der noch näher zu erörternden Vorgaben von Verfassung und Europarecht 124 ist der Gesetzgeber frei, Interessen privatem oder staatlichem Schutz dadurch zu überantworten, daß er sie in öffentlich-rechtlichen oder aber privatrechtlichen Normen anerkennt.
I. Schutz öffentlicher Rechtsgüter Die vom Staat bei der Zuordnung von Interessen entweder zu Privaten oder aber zum Staat verfolgten unterschiedlichen Zielrichtungen drücken sich auch in der Ausgestaltung des Schutzes aus. Der Staat schützt die zu öffentlichen Rechtsgütern erklärten Interessen anders als Private ihre Interessen schützen, wobei in diesen einführenden Darlegungen nur auf die schützenden Personen sowie grundrißartig auf deren Handlungsmöglichkeiten eingegangen sei 1 2 5 . Erfolgt der Schutz öffentlicher Rechtsgüter grundsätzlich durch den Staat und im öffentlichen Interesse, so liegt es nahe, den Schutz durch Personen ausüben zu lassen, die unabhängig von den beteiligten individuellen Interessen handeln. Diese Personen sind nach der Idee des Art. 33 IV, V GG in erster Linie Beamte 126 . Im Hinblick auf die Handlungsmodalitäten gilt, daß öffentliche Rechtsgüter nach öffentlichem Recht geschützt werden. Dies geschieht mittels des allgemeinen und besonderen Polizei- und Ordnungsrechts. In der Regel ergibt sich daraus folgender Schutzmechanismus: (1) Verbot der Beeinträchtigung eines öffentlichen Rechtsguts, (2) Feststellen einer Gefahr für ein öffentliches Rechtsgut, 122 Dazu näher unten § 2 Β. V. 123 Vor § 1. !24 Dazu im 3. Teil. 125 Näher unten § 2 Β. XII.; vgl. zum Grundmodell auch Wahl, in: Hoffmann-Riem/ Schmidt-Aßmann/Schuppert, Reform, S. 177, 192 ff. 126 Näher zu Art. 33 IV GG im 3. Teil, § 5 C.
Β. Das Grundmodell der Rechtsordnung
47
(3) Erlaß eines gefahrenabwehrenden Verwaltungsakts gegen den Störer, (4) sofern erforderlich: Vollstreckung des Verwaltungsakts. Ist bereits eine Störung eingetreten, so können nach Polizeirecht grundsätzlich dieselben Maßnahmen gegen den Störer zur Störungsbeseitigung getroffen werden. Liegt mit der Rechtsgutsbeeinträchtigung zugleich eine Straftat vor, so kommen daneben noch repressive Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden in Betracht, welche auf der Grundlage eines generalpräventiven Verständnisses des Strafrechts ebenfalls mittelbar dem Schutz der öffentlichen Rechtsgüter dienen. Die den staatlichen Schützern zustehenden Befugnisse sind dabei so ausgestaltet, daß sie unabhängig von den beteiligten privaten Interessen eine Durchsetzung der öffentlichen Interessen fördern. Diesem Zweck dient insbesondere das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Es geht danach nicht um einen Schutz der Rechtsgüter „um jeden Preis", sondern um die Herstellung eines optimalen Ausgleichs der zu berücksichtigenden öffentlichen Interessen.
II. Schutz privater Rechtsgüter Der Schutz privater Rechtsgüter durch die hieran interessierten Privaten ist demgegenüber prinzipiell den privaten Rechtsgutsträgern bzw. ihren Hilfspersonen, etwa Besitzdienern, überantwortet. Sie handeln dabei zur Durchsetzung ihrer Interessen, unabhängig von eventuell gegenläufigen öffentlichen Interessen. Dementsprechend sind auch ihre privatrechtlichen Handlungen beim Schutz ihrer Rechtsgüter grundsätzlich nicht an das Verhältnismäßigkeitsprinzip gebunden. So können sie etwa ihre Rechtsgüter präventiv durch die Errichtung eines Zaunes unabhängig von dem Wert des eingefriedeten Gegenstandes schützen. Auch die repressive gerichtliche Durchsetzung ihres Rechtsgüterbestandes ist grundsätzlich unabhängig von dem Gewicht der Interessen der Gegenpartei 127. Eine Ausnahme macht die Rechtsordnung lediglich für die gewaltsame Durchsetzung des privaten Rechtsgüterschutzes, welche teilweise 128 an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gebunden ist; hier sei nur auf die Notstandsregeln verwiesen. Grundsätzlich lassen sich vier Formen des Schutzes privater Rechtsgüter unterscheiden: - Der Schutz privater Rechtsgüter vollzieht sich zunächst durch gewaltlose, private Prävention, etwa durch Türschlösser oder den erwähnten Zaun, also physisch und /oder psychisch wirkender Barrieren gegen Rechtsgutsverletzungen. 127 Allerdings gilt im Zwangsvollstreckungsrecht das Übermaßverbot. Dies beschneidet den Kläger jedoch nicht in der gerichtlichen Geltendmachung seines Begehrens nach Rechtsgüterschutz. 128 Zur Bindung von Notwehr und Nothilfe an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz s. unten § 2 Β. X.
§ 1 : Das Trennungsmodell als Grundidee der Rechtsordnung
48
- Solche Maßnahmen vermögen jedoch Rechtsgutsverletzungen nicht immer zu verhindern. Hier bieten sich dann zwei Möglichkeiten des privaten Schutzes an. Zum einen könnte die Rechtsgutsbeeinträchtigung gewaltsam verhindert werden. Dieser Weg ist aber durch zahlreiche Normen, welche gewaltsamen privaten Rechtsgüterschutz als subsidiär zu staatlichem Schutz ausgestalten, abgeschnitten. Zum anderen und in erster Linie vollzieht sich der Schutz hier durch den Staat mittels der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Als Korrelat des Verbots gewaltsamen Eigenschutzes besteht der Justizgewährungsanspruch des Einzelnen 1 2 9 . Mittels seiner kann präventiver Schutz durch Unterlassungsklagen oder repressiver Schutz durch die notfalls staatlich durchgesetzte Wiederherstellung des zu schützenden Zustands gewährt werden. Der Schutz bleibt hier trotz der Einbeziehung des Staates ein dem Privaten zuzurechnender Schutz, weil es allein auf seinen Willen ankommt, ob er von den staatlichen Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung Gebrauch macht (Dispositionsmaxime)130. Hier zeigt sich die bereits im theoriegeschichtlichen Überblick angeklungene Parallelität von privatem Rechtsgüterschutz und der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte. - Dieser Schutz privater Rechtsgüter ist jedoch in einer Reihe von Fällen nicht ausreichend, um Rechtsgutsbeeinträchtigungen effektiv zu verhindern. Auch kommt eine nachträgliche Herstellung des zu schützenden Zustandes nicht immer in Betracht. Zu denken ist etwa an nicht restitutionsfähige private Rechtsgüter wie das Leben oder aber die Unwahrscheinlichkeit der Möglichkeit einer Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes im Falle eines unbekannten Diebes. Schließlich erscheint eine zeitweilige Beeinträchtigung des Rechtsguts nicht zumutbar oder aber wird jedenfalls nicht wehrlos hingenommen (etwa: Körperverletzung). Um einen Schutz des privaten Rechtsguts auch in diesen Fällen zu ermöglichen, bestehen die Notwehr-, Notstands- und Besitzschutzrechte. Sie geben dem Privaten die Möglichkeit, seine privaten Rechtsgüter unter näher bestimmten Voraussetzungen hinreichend wirksam zu schützen. - Bei konsequenter Umsetzung des Trennungsmodells dürfte es keinen Schutz privater Rechtsgüter durch die Polizei geben. Dennoch werden unter dem polizeilichen Schutzgut der öffentlichen Sicherheit überwiegend 131 alle individuellen Rechtsgüter sowie die gesamte Rechtsordnung subsumiert, so daß es zunächst scheint, als sei die Polizei auch für den Schutz privater Rechtsgüter zuständig. Dieses weite Verständnis der öffentlichen Sicherheit erfährt jedoch eine Einschränkung durch die Subsidiarität des polizeilichen Schutzes zugunsten der zivilrechtlichen Rechtsschutz- und Vollstreckungsmöglichkeiten, die neben ihrer 129
Zum Verhältnis von Selbsthilfeverbot und Justizgewähranspruch 3. Teil, § 5 H. II. 130 Dies gilt sowohl für das Tätigwerden der Gerichte, vgl. etwa §§ 253, 688 ZPO, als auch für die Durchsetzung des Urteils, vgl. etwa §§ 753 f. ZPO. 131 Waechter, NVwZ 1997, S. 729, 733; Götz, Polizei- und Ordnungsrecht, Rn. 91 \Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rn. 73; Vahle, VR 1991, S. 200, 201; Kay, DP 1981, S. 369, 370; Frotscher, DVB1. 1976, S. 695,698; Erichsen, VVDStRL 35 (1977), S. 171,187 m. w. N. in Fn. 104.
Β. Das Grundmodell der Rechtsordnung
49
zumeist ausdrücklichen Normierung, etwa in § 1 I I PolGNW, aus dem Erfordernis eines Handelns im Rahmen der Gesetze und mithin auch der diese Aufgaben dem ordentlichen Rechtsweg zuweisenden Zuständigkeitsordnung gefolgert wird 1 3 2 . Somit kommt es nicht darauf an, ob das polizeiliche Schutzgut der öffentlichen Sicherheit als die gesamte Rechtsordnung umfassend begriffen wird oder aber auf diejenigen Rechtsgüter beschränkt wird, die durch öffentlichrechtliche Normen konstituiert werden 133 , also öffentliche Rechtsgüter. Polizeilicher Schutz gegen „ausschließlich privatrechtswidrige" Gefahren ist nach beiden Begriffsverständnissen subsidiär 134 . Damit konkurriert polizeilicher Schutz nicht mit privatem Schutz privater Rechtsgüter, vielmehr ordnet sich der polizeiliche Schutz der im Privatrecht geltenden Dispositionsfreiheit unter, so daß konsequenterweise der polizeiliche Schutz privater Rechtsgüter eines Antrags seitens des Betroffenen bedarf 135 oder aber zumindest nicht gegen seinen Willen erfolgen darf 136 . Die Möglichkeit polizeilichen Handelns stellt sich also als Reservekompetenz dar, die nicht die private Schutzzuständigkeit überspielen will, sondern dazu dient, in Eilfällen die ansonsten nicht gegebene Möglichkeit privaten Rechtsgüterschutzes durch die ordentlichen Gerichte sicherzustellen. Dementsprechend ist die Polizei in diesen Fällen auch nur befugt, vorläufige Maßnahmen zur Sicherung der privaten Ansprüche zu treffen, nicht aber den Anspruch durchzusetzen 137. Der Schutz privater Rechtsgüter durch die Polizei widerspricht also nicht der Trennungsthese, vielmehr unterstreicht die konkrete Ausgestaltung des polizeilichen Tätigwerdens in diesem Bereich die Zuständigkeit des Privaten zum Schutz seiner Rechtsgüter. Die Möglichkeit eines polizeilichen Handelns zugunsten privater Rechtsgüter erklärt sich dabei aus der Unerwünschtheit gewaltsamer privater Rechtsdurchsetzung oder zumindest Rechtssicherung 138. So geht gerichtlicher Rechtsschutz nach § 1 I I PolGNW polizeilichem Schutz vor, nicht aber gewaltsame Selbsthilfe i.S.v. § 229 BGB, da nach dieser Vorschrift Selbsthilfe nur dann zulässig ist, wenn obrigkeitliche Hilfe, also auch polizeiliche Hilfe nicht rechtzeitig erreichbar ist 1 3 9 . 132 Drews/ Wacke/ Vogel /Martens, Gefahrenabwehr, S. 237; Keil, Subsidiarität, S. 17; Frotscher, DVB1. 1976, S. 695, 699; Martens, DÖV 1976, S. 457,459 f. 133 In diese Richtung Gusy, Polizeirecht, Rn. 84; Wagner, AK-PolG, § 1 Rn. 49 ff.; wohl auch Rasch, Polizei- und Ordnungsrecht, § 1 MEPolG Rn. 33 - 37, der bei der Auflistung der unter den Begriff der öffentlichen Sicherheit fallenden Rechtsgüter nicht die gesamte Rechtsordnung erwähnt. 134 Vgl. nur Götz, Polizei- und Ordnungsrecht, Rn. 96; Denninger, in Lisken / Denninger, HdBPolR, Rn. E 7; Robbers, Sicherheit, S. 236 m. w. N. 135 So ausdrücklich § 2 II BWPolG; § 2 II SächsPolG. 136 Gusy, Polizeirecht, Rn. 96; Kay, DP 1981, S. 369, 371; Λ Krüger, Privatrechtsschutz, S. 37 f. 137 Vgl. nur Kay, DP 1981, S. 369; 371 f.; Martens, DÖV 1976, S. 457,460. 138 Arzt, in: FS Schaffstein, S. 77, 79 ff. 139 Baur, JZ 1962, S. 73, 74; Werner, in: Staudinger, BGB, § 229 Rn. 10; Robbers, Sicherheit, S. 242 m. w. N.; a. A. offenbar Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rn. 98. 4 Nitz
§ 1 : Das Trennungsmodell als Grundidee der Rechtsordnung
Für den Schutz privater Rechtsgüter hält die Rechtsordnung ein vierstufiges System vor: (1) Gewaltloser, präventiver Schutz durch Private, (2) Schutz durch die ordentliche Gerichtsbarkeit nach Maßgabe des Willens des privaten Rechtsgutträgers, (3) Polizeiliche Sicherung der privaten Rechtsdurchsetzung nicht gegen den Willen des Rechtsgutträgers, (4) gewaltsame private Rechtsdurchsetzung im Rahmen der Not- und Selbsthilferechte.
I I I . Überschneidungen zwischen privaten und öffentlichen Rechtsgütern Zur Überprüfung des skizzierten Trennungsmodells der Rechtsordnung werden im Folgenden drei Fallgruppen dahingehend überprüft, ob in ihnen Überschneidungen der Schutzzuständigkeiten bestehen und diese das Modell modifizieren.
1. Interessen als private und öffentliche
Rechtsgüter
Fälle, in denen ein Schutz privater Rechtsgüter mittels der ordentlichen Gerichtsbarkeit oder durch vorläufige polizeiliche Sicherung nicht hinreichend effektiv sichergestellt werden kann, treten häufig auf. Die Anzahl der zur Verteidigung privater Rechtsgüter notwendigen Selbsthilfehandlungen könnte daher einen Umfang annehmen, der der zumeist mit dem Stichwort Gewaltmonopol in Zusammenhang gebrachten Unerwünschtheit privater Gewaltanwendung zuwiderlaufen würde 1 4 0 . Dies legt es nahe, neben dem privaten Schutz einen staatlichen Schutz zu errichten. Hierfür sprechen zwei weitere Gedanken. Zum einen ist nicht jeder Private faktisch in der Lage, seine Rechtsgüter mittels der Notrechte zu schützen, ein privater Schutz privater Rechtsgüter läuft in diesen Fällen leer. Zum anderen haben einige private Rechtsgüter eine Bedeutung, die einen Angriff auf diese Rechtsgüter auch von nicht Betroffenen als Bedrohung empfinden läßt. Die Bedeutung eines Rechtsguts folgt dabei nicht allein aus seinem - etwa verfassungsrechtlich begründeten - „Rang", sondern auch aus der Anzahl in ihm anerkannter und an ihm bestehender Interessen. Diese drei Gesichtspunkte begründen ein über das private Interesse am Rechtsgüterschutz hinausgehendes öffentliches Interesse an einem wirksamen Schutz privater Rechtsgüter. Um dem gerecht zu werden, werden bestimmte Interessen nicht nur als private, sondern auch als öffentliche Rechtsgüter anerkannt. Dies geschieht insbesondere durch das Strafrecht. Diese Anerkennung wo Ausführlich Arzt, in: FS Schaffstein, S. 77, 79 ff.
Β. Das Grundmodell der Rechtsordnung
51
in Normen des öffentlichen Rechts macht die jeweiligen Interessen zwar zu öffentlichen Rechtsgütern und unterstellt sie damit polizeilichem Schutz 141 ; sie unterscheiden sich aber in ihrer Substanz nicht von den privaten Rechtsgütern, die einer privaten Schutzzuständigkeit unterliegen. Mithin kommt es hier zu einer doppelten Schutzzuständigkeit142. In der Praxis wird dies zumeist nicht relevant, da der Polizei im Bereich des präventiven Rechtsgüterschutzes ein Ermessensspielraum eingeräumt ist, der sie nicht bei jeder Gefahr handeln läßt. Vielmehr differenziert die Polizei nach Art und Bedeutung des gefährdeten Rechtsguts sowie der Nähe des möglichen Schadenseintritts und wird daher häufig erst zu einem späteren Zeitpunkt schützend tätig als der Rechtsgutsträger. Dies muß aber nicht so sein. Im Ergebnis entscheidet damit die Polizei im Rahmen ihrer Ermessenserwägungen auch darüber, wer in diesen Fällen einer doppelten Zuständigkeit schützt. Das sich mit der Zuordnung von Schutzaufgaben befassende Trennungsmodell wird hierdurch jedoch nicht berührt, weil die Schutzzuständigkeit sowohl des Staates als auch des privaten Rechtsgutsträgers eröffnet sind. Rechtlich wird diese Konkurrenz nicht im Sinne der Subsidiarität einer Schutzzuständigkeit gelöst, vielmehr besteht eine Parallelität des Schutzes. So ist es Aufgabe der Polizei nach § 11 PolGNW, präventiven Schutz des Eigentums der Bürger vor Diebstählen zu gewährleisten, ohne daß dies Schutzvorkehrungen des Privaten zugunsten seines Eigentums ausschließen würde. Lediglich hinsichtlich der Gewaltanwendung ist der private Schutz - wie gesehen - nachrangig. Ist es zu einer Rechtsgutsverletzung gekommen, so stehen wiederum staatliches Handeln im Wege polizeilicher Störungsbeseitigung sowie repressiver Strafverfolgung wegen Diebstahls und privates Handeln, etwa im Wege einer auf § 823 I, Π BGB oder/ und § 985 BGB gestützten zivilrechtlichen Klage, nebeneinander. Privates und staatliches Schutzverhalten bewirken hier zwar letztlich in beiden Fällen zumindest auch den Schutz der privaten Herrschaft über eine Sache, ihre Zielrichtung ist jedoch unterschiedlich. Der Private schützt sein Eigentum allein aufgrund seines privaten Interesses an dem Erhalt seiner Rechtsposition, der Staat schützt es in erster Linie wegen des öffentlichen Interesses an der Stabilität der Rechtsordnung. Diese unterschiedliche Zielrichtung des Schutzes begründet eine theoretisch klare Trennlinie zwischen staatlichem und privatem Rechtsgüterschutz, so daß trotz beiderseitiger Schutzzuständigkeit kein Kompetenzkonflikt entsteht. Es bleibt bei der vom Trennungsmodell implizierten Einteilung in eine private Schutzzuständigkeit zugunsten privater Rechtsgüter und eine staatliche Schutzzuständigkeit zugunsten öffentlicher Rechtsgüter. 141
Zum Teil normiert, etwa in § 1 I 2 PolG NW, ansonsten ganz h.M.: vgl. nur Götz, Polizei- und Ordnungsrecht, Rn. 96; Denninger, in: Lisken / Denninger, HdBPolR, Rn. E 19; Würtenberger/Heckmann/Riggert, Polizeirecht, Rn. 117; Drews /Wacke/ Vogel ! Martens, Gefahrenabwehr, S. 239; H.H. Klein, DVB1. 1971, S. 233, 236; a.A. wohl Rasch, Polizei- und Ordnungsrecht, § 1 MEPolG Rn. 58; R. Krüger, Privatrechtsschutz, S. 60 ff. 142 Ähnlich Frotscher, DVB1. 1976, S. 695, 703. 4*
52
§ 1 : Das Trennungsmodell als Grundidee der Rechtsordnung
2. Privater Schutz öffentlicher
Individualrechts guter
Diese hier bestehende Parallelität zwischen privatem Schutz privater Rechtsgüter und staatlichem Schutz öffentlicher Rechtsgüter könnte allerdings durch die Jedermann-Notrechte überspielt werden, welche nicht nur im Privatrecht, sondern auch im Strafrecht normiert sind. Ist der Private nach §§ 32, 34 StGB zum Schutz seiner durch die Strafrechtsnormen geschützten Individualrechtsgüter befugt, so schützt er öffentliche (Individual-)Rechtsgüter. Diese scheinbare Abweichung vom Trennungsmodell läßt sich auf mehrerlei Weisen deuten. Zunächst ließe sich die Abweichung mit einer individualistischen Notrechtsbegründung abstreiten 143: Die Verteidigungshandlung des Privaten diene nicht der Verhinderung einer Beeinträchtigung der Rechtsordnung, sondern allein dem Schutz des Individualrechtsguts. Da diese Rechtsgüter aber auch privatrechtlich geschützt sind, ließen sich die Notrechte als strafrechtliches Korrelat der privatrechtlichen Notrechte begreifen. Der Private würde demnach nicht ein öffentliches Rechtsgut verteidigen, sondern lediglich von strafrechtlichen Konsequenzen für den privaten Schutz privater Rechtsgüter freigestellt. Diese Sichtweise ist zumindest zweifelhaft, da die Normierung der strafrechtlichen Notrechte überflüssig erscheint, wenn man ein privatrechtlich als rechtmäßig eingestuftes Verhalten mit dem Argument der Einheit der Rechtsordnung auch für strafrechtlich nicht rechtswidrig ansieht 144 . Näherliegend ist eine Sichtweise, nach der der private Notrechtsübende nicht nur private Rechtsgüter, sondern strafrechtlich anerkannte Interessen, also öffentliche Rechtsgüter schützt. Dieses Ergebnis ist dabei unabhängig davon, ob man die Notrechte überindividuell im Sinne eines Schutzes der Rechtsordnung oder individualistisch im Sinne eines Schutzes öffentlicher Individualrechtsgüter begründet. Diese Durchbrechung des Trennungsmodells erklärt sich daraus, daß die im Strafrecht normierten Individualrechtsgüter solche ansonsten privatem Schutz unterliegenden Interessen betreffen, die insbesondere wegen ihrer Bedeutung auch öffentlichem Schutz unterstellt werden. Gerade diese Bedeutung ist es, die einen Schutz auch dann einfordert, wenn der primär für den Schutz öffentlicher Rechtsgüter zuständige Staat nicht schutzfähig ist, meist mangels Präsenz. Umgekehrt relativiert dieser Grund die Durchbrechung des Trennungsmodells. Private dürfen öffentliche Individualrechtsgüter allein dann schützen, wenn der Staat nicht schutzfähig ist. Anderenfalls ist eine Berufung auf die Notrechte unstatthaft, eine Verteidigung nach § 32 StGB also zum Beispiel nicht „erforderlich" 145 . Es bleibt somit in Einklang mit der Trennungsthese bei einer primären Zuständigkeit staatlichen 143 Überblick zu den unterschiedlichen Notwehrbegründungen bei H. Wagner, Notwehrbegründung; Samson, in: SK-StGB, § 32 Rn. 2 ff. 1 44 Vgl. zum Verhältnis zivilrechtlicher Rechtmäßigkeit und strafrechtlicher Beurteilung nur Günther, in: SK-StGB, Rn. 60 vor § 32 m. w. N. 145 Vgl. Roxin, Strafrecht-AT I, § 15 Rn. 48; Kunz, ZStW 95 (1983), S. 973, 975; Seier, NJW 1987, S. 2476; Lenckner, in: Schönke/Schröder, StGB, § 32 Rn. 41; Lackner/Kühl, StGB, § 32 Rn. l l a m . w. N.
Β. Das Grundmodell der Rechtsordnung
53
Schutzes öffentlicher Rechtsgüter, privater Schutz ist subsidiär. Insofern unterscheidet sich die Rechtslage vom privaten Schutz privater Rechtsgüter, welcher auch bei Einschaltung staatlicher Organe stets vom Willen der Privaten abhängig ist, diesen also mit der Entscheidung über das „Ob" des Schutzes die primäre Schutzzuständigkeit zugewiesen ist. Festgehalten werden kann demnach: Individualrechtsgüter können auch dann von Privaten gewaltsam geschützt werden, wenn sie strafrechtlich als öffentliche Rechtsgüter anerkannt sind. Anders als bei privaten Rechtsgütern, für deren Schutz primär Private zuständig sind, ist hier staatlicher Schutz vorrangig.
3. Privater Schutz überindividueller
öffentlicher
Rechtsgüter
Eine weitere Durchbrechung des Trennungsmodells könnte in der Zulässigkeit privaten Schutzes zugunsten des Staates liegen, genauer: in privatem Schutz solcher öffentlichen Rechtsgüter, die nicht Individualrechtsgüter sind. Ist Notwehr nach dem Wortlaut des § 32 I I StGB zugunsten „anderer" möglich, so schließt der Wortlaut zumindest nicht aus, daß dieser andere der Staat ist. Damit wären dann zumindest solche Rechtsgüter auch durch Private im Wege der Nothilfe schützbar, die dem Staat zustehen, unabhängig davon, ob sie als private Rechtsgüter dem „Fiskus" oder als öffentliche Rechtsgüter dem Staat als „Hoheitsträger" zustehen. Diese Auslegung hätte zur Konsequenz, daß jeder Private in den zeitlichen Grenzen der Notwehrlage Gefahren oder Störungen der öffentlichen Sicherheit abwehren könnte, Private somit ohne staatliche Bestellung als „Hilfspolizisten" 146 agieren könnten. Um diese Konsequenz zu vermeiden, wird zumeist auf die primäre Schutzzuständigkeit und -fähigkeit des Staates abgestellt und daraus eine Subsidiarität der Staatsnothilfe abgeleitet 147 . Diese Auslegung begründet jedoch keine Einschränkung der privaten Schutzmöglichkeiten, denn bei gegebener Selbstschutzmöglichkeit eines Privaten ist aufgedrängte Nothilfe mangels Erforderlichkeit der Verteidigungshandlung grundsätzlich ebenfalls unzulässig148. Andere Einschränkungsversuche beschränken Staatsnotwehr auf „vitale Lebensinteressen des Staates" 1 4 9 , etwa bei Angriffen auf die Verfassung oder Gebietsteile des Staates150. Unklar bleibt jedoch, wann ein öffentliches Rechtsgut des Staates ein „vitales Lebens146 Lenckner, in: Schönke/Schröder, StGB, § 32 Rn. 7. 147 Lenckner, ebd.; Maurach/Zipf, Strafrecht-AT, § 26 Rn. 54, S. 372; Larenz/Wolf, gemeiner Teil, § 19 Rn. 7.
All-
148 Statt aller Roxin, Strafrecht-AT I, § 15 Rn. 97 ff.; Samson, in: SK-StGB, § 32 Rn. 59 m. w. N. 149 RGSt 64, 215,220; Spendel, in: LK-StGB, § 32 Rn. 196; Lenckner, in: Schönke/Schröder, StGB, § 32 Rn. 6; Werner, in: Staudinger, BGB, § 227 Rn. 16; Jauernig, in: ders., BGB, § 227 Anm. 2b). 150 V. Feldmann, in: MünchKomm-BGB, § 227 Rn. 8; vgl. auch Spendel, in: LK-StGB, § 32 Rn. 162.
54
§ 1 : Das Trennungsmodell als Grundidee der Rechtsordnung
interesse" darstellt, sowie zudem, wie diese Einschränkung mit § 32 StGB in Einklang gebracht werden soll, dessen Wortlaut eine Differenzierung nach der Bedeutung der angegriffenen Rechtsgüter nicht erkennen läßt. Will man vermeiden, daß jedermann Nothilfe zugunsten des Staates immer dann ausüben kann, wenn dieser nicht zum Selbstschutz in der Lage ist, etwa bei einem Angriff auf die Bundesflagge, so verbleibt nur der Weg, öffentliche Rechtsgüter des Staates nicht als notwehrfähig zu betrachten 151. Dies setzt voraus, daß er nicht „anderer" i.S.v. § 32 I I StGB ist. Hiergegen wird zwar angeführt, daß auch der Staat eine (juristische) Person ist 1 5 2 . Jedoch geht es bei einer Zuordnung von Interessen zum Staat anders als bei Individualrechtsgütern nicht - zumindest auch - um einen Schutz der Interessen des Rechtsgutsträgers, sondern allein um einen Schutz der Interessen aller, verkörpert durch den Staat 153 . Vor diesem Hintergrund überzeugt eine Trennung zwischen notwehrfähigen Rechtsgütern des Staates und nicht notwehrfähigen Rechtsgütern der Allgemeinheit 154 nicht. Vielmehr geht es in beiden Fällen um Interessen der Allgemeinheit. Damit dient die Verteidigung in den Fällen der Staatsnothilfe aber nicht mehr einem „anderen", sondern allen; letzteres ist nicht durch das Notwehrrecht gedeckt 155 . Nothilfe ist also nur dann zugunsten des Staates zulässig, wenn der Angreifer „zugleich als solche geschützte Individualinteressen angreift" 1 5 6 . In diesen Fällen handelt es sich aber nicht mehr um Nothilfe zugunsten des Staates, sondern um privaten Schutz öffentlicher Individualrechtsgüter. Anders als im Rahmen der Notwehr wird zum Teil jedes Rechtsgut als i.S.v. § 34 StGB notstandsfähig betrachtet, also nicht nur Individualrechtsgüter, sondern auch öffentliche Rechtsgüter des Staates und der Allgemeinheit 157 . Danach wäre in einer Notstandslage jeder Private zum Schutz aller Rechtsgüter befugt. Diese Abweichung von der Interpretation des § 32 StGB überzeugt jedoch schon deswegen nicht, weil der Wortlaut in beiden Fällen von einem „anderen" spricht, ein abweichendes Verständnis somit begründungsbedürftig ist. Nicht überzeugend erscheint hier eine Berufung auf das „Wesen des Notstandes"158. Um ein Ausufern der Notstandshilfe zugunsten der Allgemeinheit zu verhindern, wird zudem zumeist eine Konkretisierung der Allgemeininteressen gefordert 159 , wobei offen bleibt, wann 151 So Rupprecht, in: FS Geiger zum 65., S. 781, 792, Fn. 62; Roxin, Strafrecht-AT I, § 15 Rn. 40; Samson, in: SK-StGB, § 32 Rn. 18. 152 Etwa Spendet, in: LK-StGB, § 32 Rn. 152,196. 153 Roxin, Strafrecht-AT I, § 15 Rn. 40. 154 Ganz h.M., vgl. nur BGHZ 64, 178, 179; Spendel, in: LK-StGB, § 32 Rn. 195; Lenckner, in: Schönke/Schröder, StGB, § 32 Rn. 8; Roxin, Strafrecht-AT I, § 15 Rn. 35; v. Feldmann, in: MünchKomm-BGB, § 227 Rn. 8; Heinrichs, in: Palandt, BGB, § 227 Rn. 3; Hefermehl, in: Erman, BGB, § 227 Rn. 7. 155 Ähnliche Argumentation bei Haas, Notwehr und Nothilfe, S. 312. 156 BGHZ 64, 178, 180. 157 BGH, StV 1988, S. 432, 433: private Bekämpfung der Betäubungsmittel-Kriminalität; Maurach/Zipf, Strafrecht-AT, § 27 Rn. 14, S. 378. 158 BGH, StV 1988, S. 432,433.
Β. Das Grundmodell der Rechtsordnung
55
ein Allgemeininteresse hinreichend konkretisiert ist, um eine Notstandshandlung zu rechtfertigen. Aber auch wenn man dieser Auffassung folgen sollte 160 und grundsätzlich alle öffentlichen Rechtsgüter als notstandsfähig betrachtet, so wird es wegen der engeren Voraussetzungen der Notstandshilfe im Vergleich zur Nothilfe im Regelfall nicht zu einer Rechtfertigung kommen, sei es weil es sich um eine abstrakte, nicht aber um eine gegenwärtige, konkrete Gefahr handelt, sei es weil die Notstandslage mittels staatlichen Handelns anders abwendbar ist 1 6 1 . Abweichendes gilt jedoch im Rahmen des Festnahmerechts Privater nach § 1271 1 StPO. Hier wird der Private im öffentlichen Interesse an einer wirksamen Strafverfolgung tätig und erfüllt eine öffentliche Aufgabe 162 . Dementsprechend ist unerheblich, welcher Straftat der Festgenommene verdächtig ist, es kommen auch solche Strafvorschriften in Betracht, die ausschließlich Allgemeininteressen schützen 1 6 3 . Dient das Handeln des Privaten hier der Ermöglichung der Strafverfolgung 164 , schützt der Private eben dieses öffentliche Rechtsgut, nicht aber - zumindest nicht in erster Linie - die durch das Strafrecht geschützten Individualinteressen. Festgehalten werden kann, daß es mit Ausnahme des Jedermann-Festnahmerechts nach § 127 11 StPO keine praktisch relevanten Fälle gibt, in denen nach der Rechtsordnung Private öffentliche Rechtsgüter schützen dürfen, die nicht zugleich Individualrechtsgüter sind.
IV. Zusammenfassung: Grundlinien des Modells privaten und staatlichen Rechtsgüterschutzes Die in der theoriegeschichtlichen Entwicklung angelegte und von der Rechtsordnung verfolgte Grundidee einer Differenzierung zwischen privatem und staatlichem Rechtsgüterschutz läßt sich demnach wie folgt zusammenfassen: Der Gesetzgeber entscheidet darüber, welche Interessen schützenswert sind. Indem er die Interessen in öffentlich-rechtlichen oder aber in privatrechtlichen Normen anerkennt, entscheidet er weiterhin, wer für den Schutz dieser Interessen primär zustän159 Maurach/Zipf, Strafrecht-AT, § 27 Rn. 14, S. 379; Hirsch, in: LK-StGB, § 34 Rn. 23. 160 Wie hier a.A. etwa Seelmann, ZStW 95 (1983), S. 797, 809; Bueß, Sicherheitsdienste, S. 75. 161 Hirsch, in: LK-StGB, § 34 Rn. 23; vgl. auch Lenckner, in: Schönke/Schröder, StGB, § 34 Rn. 10; Haas, Notwehr und Nothilfe, S. 313 f.; dementsprechend kommt auch der BGH in der angeführten Entscheidung nicht zu einer Rechtfertigung, StV 1988, S. 432,433. 162 Roxin, Strafverfahrensrecht, § 31 Rn. 4. 163 Wendisch, in: Löwe / Rosenberg, StPO, § 127 Rn. 26; Boujong, in: KK-StPO, § 127 Rn. 20; Kleinknecht/Meyer-Goßner, StPO, § 127 Rn. 7; Roxin, Strafverfahrensrecht, § 31 Rn. 4; auch die den Tatbegriff eingrenzende Auslegung von Marxen, in: FS Stree/Wessels, S. 705, 714 ff., verneint dies nicht. 164 Krause, in: AK-StPO, § 127 Rn. 3 m. w. N.
§ 1 : Das Trennungsmodell als Grundidee der Rechtsordnung
dig ist, Private oder der Staat. Danach lassen sich private und öffentliche Rechtsgüter unterscheiden. Diese grundlegende Idee der Rechtsordnung läßt sich als Trennungsmodell kennzeichnen: In privatrechtlichen Normen anerkannte private Rechtsgüter unterliegen privatem, in öffentlich-rechtlichen Normen anerkannte Interessen staatlichem Schutz. Bei der Beurteilung der Frage, wem der Schutz eines rechtlich anerkannten Interesses zuzuordnen ist, ist der Gesetzgeber grundsätzlich frei; wichtigste Zuordnungskriterien sind Art, Bedeutung und Anzahl der betroffenen Interessen. Rechtlich relevante Bindungen ergeben sich allein aus der Verfassung sowie evtl. dem Europarecht. Private Rechtsgüter werden grundsätzlich durch den privaten Rechtsgutsträger geschützt. Der Staat wird hier hilfsweise und abhängig vom Willen des Privaten tätig, sei es über die Gewähr gerichtlichen Rechtsschutzes oder aber über die vorläufige polizeiliche Sicherung eines privaten Rechts. Lediglich soweit zum Schutz des Rechtsguts Gewalt notwendig wird, tritt privater Schutz hinter die weiterhin vom Willen des Privaten abhängige staatliche Hilfe zurück. Öffentliche Rechtsgüter werden grundsätzlich ausschließlich vom Staat geschützt. Eine Ausnahme bilden das Jedermann-Festnahmerecht nach § 127 I 1 StPO und öffentliche Individualrechtsgüter, für deren Schutz Private subsidiär zuständig sind. Dieses Trennungsmodell erscheint gerade deswegen vergleichsweise einfach, weil es grundsätzlich eine eindeutige Zuordnung einer Schutzaufgabe zum Staat oder aber zu Privaten ermöglicht. Vor diesem Hintergrund erscheint es fast schon überraschend, wie intensiv über eine Privatisierung der öffentlichen Sicherheit sowie das Verhältnis privater und öffentlicher Sicherheit gestritten wird 1 6 5 . Freilich liegen die Dinge nicht so einfach, wie im folgenden § 2 zu zeigen ist.
165 Vgl. etwa die Ausführungen von Götz, NVwZ 1998, S. 679, 680, die das Trennungsmodell zugrundelegen; s. dazu auch Voß, JhbRsozRth XV, S. 81, 84 f.
§ 2: Die aktuelle Situation Im Folgenden wird zunächst die tatsächliche Situation dargestellt (Α.). Dabei wird sich zeigen, daß zwei Grundtendenzen zu einer Privatisierung vormals staatlicher Sicherheitsaufgaben führen. Zum einen ist sie Folge einer staatlichen Privatisierungspolitik, zum anderen drängen Private in von der staatlichen Schutzaufgabe bislang erfaßte Aufgabenbereiche vor. Im Ergebnis wird eine Zuordnung entsprechend den Vorgaben des Trennungsmodells in zunehmendem Maße erschwert. Wie und anhand welcher Kriterien dieser Befund bewertet wird, zeigt der anschließende Überblick über die deutsche Diskussion (B.).
A. Die tatsächliche Situation Die Darstellung der tatsächlichen Situation erfolgt vor dem Hintergrund des Trennungsmodells, um so bestehende Friktionen herauszuarbeiten.
I. Schutz öffentlicher Rechtsgüter nach öffentlichem Recht Auch wenn immer häufiger Privatisierungstendenzen im Bereich der öffentlichen Sicherheit beschrieben werden, gilt festzuhalten, daß sich der Schutz öffentlicher Rechtsgüter auch heute noch überwiegend in den oben beschriebenen Bahnen vollzieht, also durch Beamte der Polizei- und Ordnungsbehörden. Hier interessieren vor allem Abweichungen von diesem Grundsatz sowie ihre jeweilige Motivation. 1. Ursprünge und Entwicklung der Einbeziehung Privater in die Polizei Die Erfüllung polizeilicher Aufgaben durch andere Personen als Polizeivollzugsbeamte blickt auf eine lange Tradition zurück 1. In Preußen wurden schon 1792 die Gebühreneinnehmer und Straßenwärter der privaten „Kunststraßen"-Gesellschaften mit polizeilichen Aufgaben betraut, 1812 die Hüttenbesitzer entlegener Hütten2. Damit zeigen sich Privatisierungsformen bereits zu einer Zeit, in der das staat1 Zum folgenden auch Ungerbieler, DVB1. 1980, S. 409,410 f. 2 Nachw. bei Ungerbieler, DVB1. 1980, S. 409,410, Fn. 18 f.
58
§ 2: Die aktuelle Situation
liehe Bemühen noch auf die Durchsetzung eines staatlichen Polizeimonopols gerichtet war 3. Im Unterschied zu Hoheitsträgern aus eigenem Recht wurden diese „Privaten" in Abhängigkeit vom Staat tätig 4 . Motiviert waren diese und andere Aufgabenübertragungen insbesondere durch die abgelegene örtliche Lage sowie eine relativ seltene Inanspruchnahme der Polizeikräfte, was den Einsatz hauptamtlicher staatlicher Polizeikräfte jeweils nicht sinnvoll erscheinen ließ. Vergleichbare Gründe rechtfertigen zahlreiche heute noch bestehende spezialgesetzliche Beleihungen Privater mit Polizeiaufgaben und -befugnissen, insbesondere etwa Kapitäne von Seeschiffen oder Flugzeugen sowie Jagdaufseher und Jagdausübungsberechtigte 5. Charakteristisch für diese Aufgabenübertragung ist, daß die Privaten die ihnen übertragenen Polizeiaufgaben hoheitlich und selbständig, also weisungsfrei wahrnehmen, sie werden nicht unmittelbar in die Polizei eingegliedert. Das preußische Polizeigesetz von 1850 löste die Spannung zwischen dem Bemühen um eine Monopolisierung der Polizeigewalt beim Staat und der praktischen Unmöglichkeit, überall und immerzu mit eigenem Personal präsent zu sein, durch das Erfordernis einer Bestätigung polizeilich tätig werdender kommunaler Beamte durch die Staatsregierung 6. Auf diese Weise schien die staatliche Verantwortung für die Wahrnehmung der Polizeiaufgaben gewahrt. Diese Bestätigungspflicht wurde vom preußischen Polizei Verwaltungsgesetz von 1931 auf alle Personen - also auch Private - ausgeweitet, die mit der Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben betraut wurden 7. Wenn auch zunächst nicht unbestritten, so wurde in dieser Regelung die Grundlage für die Übertragung einzelner Polizeiaufgaben auf Private gesehen8. Grundsätzlich jeder konnte zu einem Hilfspolizisten bestellt werden. Praktisch wurde diese Vorschrift jedoch nur für solche Staatsbedienstete, die keine Polizeivollzugsbeamten waren - also insbesondere Mitarbeiter der Ordnungsbehörden - , sowie in seltenen Fällen einer Beleihung Privater, wenn eine spezialgesetzliche Grundlage fehlte. Nach dem 2. Weltkrieg wurde diese Bestätigungsregel - zum Teil modifiziert in die neu entstehenden Polizeigesetze der Länder übernommen. Sieht man in ihr 3 Ausführlich Funk, Polizei und Rechtsstaat; ders, in: Reinke, Sicherheit, S. 56 ff.; Lüdtke, ebd., S. 35 ff.; Willoweit, DSt., Beiheft 2, S. 9 ff. 4 Vgl. Gusy/Nitz, in: H.-J. Lange, Staat, Demokratie und Innere Sicherheit, S. 335, 339 m. w. N. 5 §§ 106 SeemG, 29 III LuftVG, 25 I, II BJagdG. Zum Ganzen näher und mit weiteren Beispielen bis hin zu Bisamrattenfängern Bracher, Gefahrenabwehr, S. 26 ff.; s.a. F. Huber, Gefahrenabwehr, S. 51 f. 6 § 4 II des PVG v. 11. 3. 1850, PrGS, S. 265; dazu Drews /Lassar, in: v. Brauchitsch, Preuß. Verwaltungsgesetze I, S. 293; historischer Überblick bei Granzau, Verstaatlichung, insbes. S. 22 ff., 68 ff., 88 ff., 101 ff. 7 § 13 PrPVG v. 1. 6. 1931, PrGS, S. 77; dazu Drews /Wacke, Polizeirecht, S. 487. 8 Klausener/Kerstiens/Kempner, nungsrecht, S. 37 ff.; Drews /Wacke, DVB1. 1980, S. 409, 411, Fn. 35 ff.
PolVerwG, § 13 Erl. IV; Ule/Rasch, Polizei- und OrdPolizeirecht, S. 488; weitere Nachw. bei Ungerbieler,
Α. Die tatsächliche Situation
59
eine Grundlage zur Bestellung von Privaten zu Hilfspolizisten, so ist sie mangels weiterer Voraussetzungen sehr weitgehend. In einem Runderlaß des Innenministeriums von Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 19549 wurde die Möglichkeit der Bestellung Privater zu Hilfspolizisten daher eingegrenzt: • Beschränkung der Bestellung Privater auf Fälle, in denen nicht genügend Polizeivollzugsbeamte zur Verfügung stehen, • Bestellung von zuverlässigen, nicht vorbestraften Deutschen, die älter als 25 Jahre sind, • örtliche, zeitliche und sachliche Beschränkung der Aufgaben, • Bewaffnung nur im Rahmen des Waffenrechts sowie • Belehrung der Privaten über die ihnen zustehenden Befugnisse und ihre besondere Verantwortung. Allerdings wurde von der Möglichkeit einer Einbeziehung Privater in die polizeiliche Tätigkeit über die bereits genannten Fälle einer spezialgesetzlich geregelten Beleihung kein Gebrauch gemacht, die Bestätigungsregel lief praktisch leer. Dementsprechend wurde sie vom neuen nordrhein-westfälischen Polizeigesetz im Jahr 1982 nicht übernommen. Eine bedeutende Ausnahme von dieser praktischen Bedeutungslosigkeit des Einsatzes Privater zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben stellt die Vergabe von Aufträgen für die Bewachung militärischer Anlagen an Private dar, welche in die Zeit der Weimarer Republik zurückreicht. Damals sollte die aufgrund des Versailler Vertrages auf 100.000 Mann beschränkte Reichswehr nicht mit Wachaufgaben belastet werden 10. Heute gestattet § 1 ΠΙ UZwGBw für den Bereich der Bundeswehr die Bestellung ziviler Wachpersonen, wenn diese zwischen 20 und 65 Jahre alt sind, persönlich zuverlässig und körperlich geeignet sind, eine Vorbildung für den Wachdienst haben sowie gute Kenntnisse des UZwGBw vorweisen können11. Die Wachdienste haben in vollem Umfang die Befugnisse nach dem UZwGBw, also auch die Befugnis zum Schußwaffengebrauch 12. Erfaßt werden allein stationäre Wach-, nicht aber umfassend Sicherheitsaufgaben, so daß eine Beleihung Privater mit Aufgaben des Transport- oder Personenschutzes nicht in Betracht kommt 13 . 9 Runderlaß v. 7. 9. 1954, MB1. Sp. 1717. 10 Olschok-Tautenhahn, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. A 14; Schnekenburger, Rechtsstellung, S. 14. h Näher zu § 1 III UZwGBw Großmann, Bundeswehrsicherheitsrecht, III, § 1 Rn. 86 ff.; Schnekenburger, Rechtsstellung, S. 112 ff. 12 Aufgrund der Zentralen Dienstvorschrift 14/9 des BMV ist ihnen jedoch die Anwendung von Reizstoffen und Explosivmitteln untersagt, zit. n. Gramm, VerwArch 90 (1999), S. 329, 355 f., Fn. 65, der eine verfassungskonforme Reduktion des § 1 II UZwGBw fordert, ebd., S. 356 f. 13 Näher Lingens, UZwGBw, S. 4; Großmann, Bundeswehrsicherheitsrecht, III, § 1 Rn. 91, 41 ff.
60
§ 2: Die aktuelle Situation
Von § 1 ΙΠ UZwGBw wird in weitem Umfang Gebrauch gemacht. Vergleichbar der Motivation in den 1920er Jahren scheinen Bewachungsaufgaben auf professionelle, private Wachunternehmen um so häufiger übertragen zu werden, je geringer die Personalstärke der Bundeswehr ist. Private bewachen mittlerweile die meisten Bundeswehrflughäfen, Munitions- und Waffendepots. Nach Angaben der Bundesregierung 14 sind in diesem Rahmen Bewachungsaufträge an über 100 private Wachunternehmen vergeben worden, die in diesem Bereich über 7000 Personen beschäftigen und den Bund 1992 über 500 Mill. DM kosteten. Anderen Angaben zufolge erwirtschaften die Bewachungsunternehmen mit 13% ihres Personals15 im Bereich militärischer Anlagen 30% des Umsatzes16.
2. Schaffung neuer gesetzlicher Grundlagen Wurden bis in die 1960er Jahre - mit Ausnahme des militärischen Wachdienstes - polizeiliche Aufgaben nur vereinzelt aus Praktikabilitätserwägungen auf Private übertragen, so erweiterte sich ihr Einsatzbereich in der Folgezeit durch die Schaffung neuer gesetzlicher Grundlagen.
a) Freiwillige Polizeidienste in Berlin und Baden-Württemberg Als erstes wurde 1961 Berlin aktiv 17 . In Anbetracht des sich verschärfenden OstWest-Konflikts beschloß Berlin noch vor dem Mauerbau die Gründung einer freiwilligen Polizei-Reserve (FPR), um kommunistischen Sabotageakten besser vorbeugen zu können 18 . Dementsprechend wurde der Aufgabenbereich der Polizeireserve zunächst auf den Objektschutz beschränkt und den Privaten nicht alle, sondern nur diejenigen polizeirechtlichen Befugnisse übertragen, die im Rahmen des Objektschutzes relevant werden, insbesondere aber auch die Anwendung unmittelbaren Zwangs 19 . Die Freiwilligen - seit 1999 heißen sie Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes20 - absolvieren einen zweiwöchigen, ganztägigen Grundlehrgang, in dem theoretische Kenntnisse (Polizeiorganisation, Polizeirecht, Strafrecht) w BT-Drs. 12/5246, S. 5, 9 f.; vgl. W. Richter, WIK 1/1994, S. 23; N.N., WIK 1/1994, S. 25. 15 BDWS, Stand 1. 3. 1998, Nach Olschok-Tautenhahn, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. A 18, waren es 1994 nur 6,66%. 16 Angaben des BDWS, nach: N.N., WIK 5/1993, S. 70, 72; auch: W. Richter, WIK 1/ 1994, S. 23; N.N., WIK 1 /1994, S. 25; N.N., Sicherheits-Markt 2/1993, S. 30, 31. 17 Gesetz über die Freiwillige Polizeireserve v. 25. 5. 1961, GVB1., S. 671, i.d.F. v. 12. 12. 1962, GVB1., S. 1285; Überblick zum Folgenden auch bei Keim, in: GS Jeand'Heur, S. 111, 112 ff. is Grünst, DP 1966, S. 310. ι 9 Zu späteren Änderungen unten 3. a) aa). 20 Gesetz über den Freiwilligen Polizeidienst v. 11. 5. 1999, GVB1., S. 165 ff.
Α. Die tatsächliche Situation
61
und praktische Fähigkeiten (Polizeiverhalten, Waffengebrauch, Selbstverteidigung) vermittelt werden 21. Ein- bis zweimal pro Jahr haben sie sich zu fünftägigen Auffrischungslehrgängen einzufinden 22. Verdienstausfall und Vertretungskosten werden ersetzt, Dienst in der Freizeit wird mit derzeit 8,-DM/Std ausgeglichen. Zu „richtigen Einsätzen" kam es jedoch zunächst nicht 23 . Erst Mitte der 1970er Jahre wurde anläßlich der Lorenz-Entführung bei der Polizei ein Entlastungsbedarf gesehen. Zeitweise wurden ihr pro Jahr über 100.000 Mannstunden abgenommen24. 1979 wurden die Einsätze der Polizeireserve jedoch vorerst wieder eingestellt25, unmittelbar vor der deutschen Vereinigung plante die rot-grüne Regierungskoalition, die Freiwillige Polizeireserve aufzulösen 26. Ihr zumindest vorübergehender Bedeutungsverlust zeigt sich an der abnehmenden Personalstärke, welche Mitte der 1970er Jahre 4.000 betrug 27 , heute hat die Freiwillige Polizeireserve ungefähr 2.000-2.500 Mitglieder 28 , welche gemäß § 17 FPG grundsätzlich in den die Polizeireserve 1999 ablösenden Freiwilligen Polizeidienst übernommen werden 29. Eine vergleichbare Entwicklung nahm die 1963 in Baden-Württemberg auf der Grundlage des FPolDG 30 gegründete Polizeireserve 31. Das umstrittene Projekt wurde zum einen mit Personalmangel begründet, der wegen der Dauer der Ausbildung von Polizei voll zugsbeamten die Schaffung einer schnell verfügbaren Reserve verlange, zum anderen mit der Möglichkeit einer inneren oder wegen des OstWest-Konflikts einer äußeren Notstandslage32. Der Freiwillige Polizeidienst (FPD) besteht aus Deutschen zwischen 18 und 60 Jahren, die persönliche Voraussetzungen wie zum Beispiel einen guten Ruf sowie gute Gesundheit erfüllen müssen und sich freiwillig melden. Sie erhalten eine Grundausbildung, nehmen an Fortbildungsveranstaltungen teil und werden bei Aufruf durch den örtlichen Polizeidienst in der Regel tätig zur • Sicherung von Gebäuden und Anlagen, • Sicherung und Überwachung des Straßenverkehrs, 21 Jetzt normiert in § 2 III FPG. 22 Grünst, DP 1966, S. 310, 312; seit 1999 normiert § 3 III 2 FPG, daß die Fortbildung i.d.R. einmal jährlich in einem einwöchigen Lehrgang stattfindet. 23 24 25 26 27
Grünst, DP 1966, S. 310, 313. B. Walter, DP 1989, S. 41,42. AUV., cilip 13 (1982), S. 41,43. Tielemann, cilip 52 (1995), S. 37,41. N.N., cilip 13 (1982), S. 41,42.
28 Tielemann, cilip 52 (1995), S. 37, 38. 29 Dazu unten 3. a) aa). 30 Gesetz über den Freiwilligen Polizeidienst v. 18. 6. 1963, GVB1., S. 75, i.d.F.v. 12. 4. 1985, GVB1., S. 129, geänd. durch G.v. 22. 10. 1991, GVB1., S. 625. 31 Dazu Stümper, DP 1964, S. 196 ff.; Kloesel, DP 1964, S. 6 ff.; Kienle, DP 1966, S. 278 ff.; N.N., cilip 13 (1982), S. 41,44. 32 Kloesel, DP 1964, S. 6 f.
62
§ 2: Die aktuelle Situation
• Streifendienst, • Kraftfahr- und ähnliche technische Dienste. Voraussetzung eines Aufrufs ist, daß die Polizei mit den vorhandenen Beamten ihre Aufgaben vorübergehend nicht erfüllen kann. Dritten gegenüber haben die Mitglieder des FPD anders als in Berlin uneingeschränkt die Stellung von Polizeibeamten, Pistolen werden jedoch nur dann ausgegeben, wenn ausreichende Schießergebnisse sowie Kenntnisse über die Zulässigkeit des Schußwaffengebrauchs nachgewiesen werden. Ihre Dienstbekleidung ist von derjenigen der Polizeibeamten kaum unterscheidbar. Die Freiwilligen werden - wie in Berlin - durch ihren Einsatz als Polizeireserve nicht zu Polizeibeamten, vielmehr stehen sie in einem „öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis besonderer Art", auf das einige beamtenrechtliche Regelungen Anwendung finden, so etwa die Pflichten zu Treue und Verschwiegenheit. Die Stärke des FPD darf 50% des uniformierten Polizeidienstes nicht überschreiten. Tatsächlich hatte der FPD zunächst Konjunktur, für 1966 wird das Zahlenverhältnis mit ungefähr 13.000 Polizeibeamten und 4.300 Freiwilligen angegeben. Der Freiwillige Polizeidienst leistete 1965 über 270.000 Dienststunden, insbesondere bei Fußball- und Eishockeyspielen sowie anderen Großveranstaltungen, aber auch im Streifendienst oder zur Revierverstärkung 33. Seine Bedeutung nahm im Laufe der Zeit zunehmend ab, 1997 standen 23.000 Polizeibeamten 1.250 Angehörige des FPD gegenüber 34. 1972 in Nordrhein-Westfalen angestellte Überlegungen, eine vergleichbare Polizeireserve zu gründen, scheiterten am massiven Widerstand der Gewerkschaft der Polizei 35 .
b) Hilfspolizisten War die Schaffung der Freiwilligen Polizeireserve in Berlin eine Reaktion auf den Ost-West-Konflikt, so reagierte Hamburg 1966 auf die Flutkatastrophe von 1962 mit der Schaffung einer rechtlichen Grundlage für die Bestellung von Hilfspolizisten 36. Nach § 29 HHSOG kann die Behörde Personen mit deren Einwilligung zur Überwachung und Regelung des Straßenverkehrs sowie zur Unterstützung der Vollzugspolizei bei Notfällen, Naturereignissen, Explosionen und vergleichbaren Ereignissen bestellen. Die Hilfspolizisten haben während ihres Einsatzes die Befugnisse eines Polizeivollzugsbeamten mit Ausnahme des Waffengebrauchs. Ihre Bestellung ist widerruflich, eine gesonderte Ausbildung nicht 33 Kienle, DP 1966, S. 278, 280; vgl. auch Stümper, DP 1964, S. 196, 198 f.; Kloesel, DP 1964, S. 6, 9; N.N., cilip 13 (1982), S. 41,44; B. Walter, DP 1989, S. 41 ff. 34 N.N., DP 1997, S. 208; vgl. B. Walter, DP 1989, S. 41, 42; Mussmann, Polizeirecht, Rn. 61 \Peilert, Recht des Auskunftei- und Detekteigewerbes, S. 43. 35 N.N., cilip 13 (1982), S. 41. 36 Gesetz v. 14. 3. 1966, GVB1., S. 77.
63
Α. Die tatsächliche Situation
vorgesehen. Die Hamburger Regelung zielt also nicht auf die Aufstellung einer ständig verfügbaren, ausgebildeten Polizeireserve, sondern auf die Möglichkeit spontaner Heranziehung Privater in Ausnahmesituationen. Während diese aus Preußen bekannte Möglichkeit der Einbeziehung Privater in Polizeiarbeit in Nordrhein-Westfalen leerlief und später aufgegeben wurde 37 , hatte Hamburg sie wiederbelebt. Allerdings erlangte auch sie keine praktische Relevanz38. Vergleichbare Bestimmungen über die Möglichkeit einer Bestellung Privater zu Hilfspolizisten in anderen Bundesländern fristeten zunächst ebenfalls ein Schattendasein39. Hilfspolizisten kennen mit Ausnahme Brandenburgs, Mecklenburg-Vorpommerns, Thüringens, Bayerns und Nordrhein-Westfalens alle Landespolizeigesetze. Aufgaben und Befugnisse der Hilfspolizeibeamten sind zum Teil beschränkt. So ist etwa in Sachsen-Anhalt (§ 83 SOG) wie in Hamburg eine Bestellung nur zur Überwachung und Regelung des Straßenverkehrs sowie zur Unterstützung der Polizei bei Notfällen möglich, die Hilfspolizeibeamten haben keine Befugnis zum Schußwaffengebrauch. Im Saarland (§ 84 PolG) besteht keine Aufgabenbegrenzung, jedoch ist hier nicht nur der Gebrauch von Waffen, sondern sämtlicher Hilfsmittel der körperlichen Gewalt ausgeschlossen. Keine Beschränkungen, weder hinsichtlich der zu übertragenden Aufgaben noch hinsichtlich der polizeilichen Befugnisse, sieht das neue Niedersächsische Gefahrenabwehrgesetz vor (§ 95). Hilfspolizeibeamte, die nicht dem öffentlichen Dienst angehören, sind nach einem Runderlaß des niedersächsischen Innenministeriums „durch Handschlag zu verpflichten", ihre Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen 40 . Die Ermächtigung zum Gebrauch von Waffen soll nur „unter Anlegung eines strengen Maßstabes" erteilt werden 41. Eine vergleichbare Rechtslage findet sich in Hessen (§ 99 HessSOG). In die Reihe dieser Regelungen gehörte schließlich § 47 II, III BGSG a.F.42, der die Möglichkeit vorsah, an einzelnen Grenzübergangsstellen Hilfspolizisten mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs zu betrauen. Auch sie hatten dabei die Befugnisse der BGS-Beamten mit Ausnahme des Einsatzes von Schußwaffen und Explosivmitteln. Diese Normen zielen bzw. zielten auf die Möglichkeit, in Extremsituationen die Polizei verstärken zu können. Anders als bei den Polizeireserven in Berlin oder Baden-Württemberg erfolgt jedoch keine vorherige Ausbildung, so daß die Weite der Ermächtigungsgrundlagen, insbesondere die in einigen Ländern mögliche Befugnis zum Schußwaffengebrauch bedenklich erscheinen mag. Andererseits ist es zu Einsätzen Privater aufgrund dieser Vorschriften lange Zeit nicht gekommen. So scheinen die Vorschriften auch in der Praxis als „Notanker" gesehen zu werden 43. 37 38 39 40
1. Ungerbieler, DVB1. 1980, S. 409, 411. Dazu Peilert, Recht des Auskunftei- und Detekteigewerbes, S. 45 ff. Nr. 6 des Runderlasses v. 6. 9. 1982, NdsMBl., S. 1393. S.O.
Ebd. 42 Gesetz v. 18. 8. 1972, BGBl. I, S. 1834; näher Einwag/Schoen,
BGSG, § 47 Rn. 6 ff.
64
§ 2: Die aktuelle Situation
c) Ergebnis Vom Grundsatz, daß öffentliche Rechtsgüter nach öffentlichem Recht durch staatliche Bedienstete geschützt werden, wurde lange Zeit nur in zwei Fällen praxisrelevant abgewichen: zum einen beim Wachdienst der Bundeswehr, zum anderen in Baden-Württemberg im Rahmen des Freiwilligen Polizeidienstes.
3. Die Entwicklung ab Mitte der 1980er Jahre Ungefähr ab Mitte der achtziger Jahre verstärkte sich die Diskussion um die innere Sicherheit in Deutschland. Motiviert scheint dies nicht allein durch einen Anstieg der Alltagskriminalität, sondern zumindest auch durch eine zunehmende Bedeutung der organisierten Kriminalität und einen Rückgang des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung 44. Die Polizei beklagte verstärkt ihre Personalknappheit45, und so rückte die Möglichkeit eines verstärkten Rückgriffs auf Private bei der Erfüllung polizeilicher Aufgaben in den Blick.
a) Rechtsänderungen Hierauf bezogene Änderungen des Polizeirechts sind nur wenige zu verzeichnen. Dabei sind Mittel zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität hier nicht weiter zu erörtern, wie sie etwa V-Leute darstellen, deren auch präventiver Einsatz zur „vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten" ( § 1 1 2 PolGNW) in den Polizeigesetzen der Länder normiert wurde 46 . 43 Anwendung finden diese Vorschriften jedoch in einigen Ländern auf Angestellte oder Arbeiter des öffentlichen Dienstes aufgrund Besonderheiten der Behördenorganisation oder aber des Fehlens spezialgesetzlicher Ermächtigungen. Insbesondere kommunale Bedienstete erfüllen - zumeist neben ihrer regulären Tätigkeit - polizeiliche Aufgaben oder überwachen den ruhenden Verkehr. Speziell für diesen Bereich enthalten die Polizeigesetze Baden-Württembergs (§ 80, dazu Krüger, BWVPr. 1980, S. 7 ff.; Reichert/Ruder, Polizeirecht, Rn. 90 ff.) und Sachsens (§ 80) das Institut der gemeindlichen Vollzugsbeamten. Neben kommunalen Bediensteten finden sich Hilfspolizisten aus dem Bereich der Ordnungsverwaltung, etwa Bedienstete der Forstämter, Talsperrenmeister, Deichvoigte etc. (Ungerbieler, DVB1. 1980, S. 409, 413). Im Bereich des Bundesgrenzschutzes bestehen Bestellungen von Bundeswehrsoldaten zu Hilfspolizisten auf kleinen Bundeswehrflughäfen mit Auslandskontakt (vgl. BTDrs. 6/2886, S. 39). In dieser Fallgruppe kehrt der eingangs dargestellte Gedanke wieder, Polizeiaufgaben auf nicht im Polizeivollzugsdienst stehende Personen zu übertragen, wenn eine polizeiliche Wahrnehmung sachfern erscheint. 44 Dazu Feltes, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. E 1 ff.; weitere Nachw. unten bei B. III. 45 Feltes, ebd., Rn. E 45. 46 Etwa § 19 PolGNW; zur Problematik vgl. nur Geißdörfer, Kriminalistik 1993, S. 679 ff.; Scherp, Kriminalistik 1993, S. 65 ff.; Schomburg, Kriminalistik 1992, S. 679 ff.; Weihmann, Kriminalistik 1992, S. 309 ff.; Boll, Kriminalistik 1992, S. 66, 69 f.
Α. Die tatsächliche Situation
65
aa) Ausweitung bestehender gesetzlicher Möglichkeiten Das neue Bundesgrenzschutzgesetz von 1994 erweitert in § 63 BGSG den möglichen Einsatzbereich der Hilfspolizeibeamten, unter anderem um den Schutz von Verfassungsorganen des Bundes und der Bundesministerien sowie zur Sicherung eigener Einrichtungen. Die Bundesministerien setzen in unterschiedlichem Umfang private Sicherheitsdienste ein 47 . Der Tätigkeitsbereich der Freiwilligen Polizeireserve in Berlin, deren Aufgabenbereich auf den Objektschutz beschränkt war, wurde auf die Felder ausgeweitet48, auf denen im wesentlichen auch der Baden-Württembergische Freiwillige Polizeidienst tätig ist, umfaßt nun also neben dem Objektschutz auch die Sicherung und Überwachung des Straßenverkehrs, technische Dienste wie den Kraftfahrdienst sowie den Streifendienst. Mit der Erweiterung der Aufgabenfelder wurden auch die Befugnisse der Freiwilligen Polizeireserve erweitert. Ihnen stehen jetzt alle wesentlichen polizeilichen Befugnisse zu, insbesondere auch zum Schußwaffengebrauch. Nichtsdestoweniger blieb der Einsatz der Freiwilligen Polizeireserve selten und umfaßt insbesondere Streifengänge in Parkanlagen. Die Zurückhaltung wird dabei trotz eines zum Teil positiven Echos in der Literatur 49 vor allem mit einer noch nicht hinreichend gewährleisteten Akzeptanz seitens der Bevölkerung erklärt 50 . Anfang der 1990er Jahre gerieten zahlreiche Mitglieder der Polizeireserve in den Verdacht des Rechtsextremismus. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuß wurde eingesetzt51. Von in diesem Zusammenhang überprüften 2.210 Mitgliedern lagen in 515 Fällen polizeiliche Erkenntnisse vor, darunter 109 rechtskräftige Verurteilungen, überwiegend wegen Verkehrsdelikten, in keinem Fall jedoch wegen eines Vergehens im Rahmen der Tätigkeit als Polizeireservist 52. Seit 1993 werden die Angehörigen der Polizeireserve alle zwei Jahre überprüft 53. Trotz dieser Probleme und gegen massiven Widerstand insbesondere von Seiten der Polizeigewerkschaften ist die Polizeireserve 1999 in den Freiwilligen Polizeidienst überführt und - zumindest rechtlich - gestärkt worden. Das neue Gesetz verzichtet auf die Subsidiaritätsklausel des § 2 FPRG, nach der eine Heranziehung der Polizeireserve nur erfolgen sollte, wenn die vorhandenen Polizeidienstkräfte für die ihnen gestellten Aufgaben nicht ausreichten oder nicht ständig dafür eingesetzt werden konnten54. Daß der Berliner Gesetzgeber auf den Freiwilligen Polizeidienst ver47 Zahlen in BT-Drs. 12/5246, S. 9. 48 Gesetz über die Freiwillige Polizei-Reserve v. 23. 6. 1992, GVB1., S. 198; dazu Verordnung v. 28. 12. 1992, GVB1. 1993, S. 10. 49 Etwa Blum, protector 8/1993, S. 11, 17. 50
Telefonat mit Herrn Hinkelmann im Sommer 1995. 51 Berl.AbgH-Drs. 12/5187; dazu Tielemann, cilip 52 (1995), S. 37 ff. 52 Berl.AbgH-Drs. 12/5187, S. 12, 17. 53 Tielemann, cilip 52 (1995), S. 37, 41, unter fälschlicher Berufung auf Berl.AbgH-Drs. 12/5187, Anlage 1. 54 Hieraus dürfte sich auch die Umbenennung von Polizeireserve in Polizeidienst erklären. 5 Nitz
66
§ 2: Die aktuelle Situation
stärkt zurückgreifen will, zeigt etwa auch § 13 I I 1, ΠΙ FPG, nach dem die Aufnahme in den Freiwilligen Polizeidienst unter anderem widerrufen werden kann, wenn nicht mindestens zweimal jährlich Dienst geleistet wird. Andererseits sind die persönlichen Anforderungen an die Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes erhöht worden, § 4 FPG. 1994 konnte sich die hessische, 1996 die mecklenburg-vorpommersche CDU mit dem Vorschlag eines freiwilligen Polizeidienstes nicht durchsetzen55. Nach dem Regierungswechsel in Hessen plant die CDU nun jedoch die Einführung eines freiwilligen Polizeidienstes, in dessen Rahmen die Befugnisse Privater im Gegensatz zu Baden-Württemberg jedoch beschränkt sein sollen 56 . In Baden-Württemberg soll wieder verstärkt vom Freiwilligen Polizeidienst Gebrauch gemacht werden 57 . bb) Schaffung neuer Rechtsgrundlagen Prominentestes Beispiel neuer Rechtsgrundlagen für die Übertragung (sonder-) polizeilicher Aufgaben auf Private stellt die Flugsicherheit dar. Neben der Normierung von Eigensicherungspflichten der Flughafenunternehmer und Luftfahrtunternehmen in §§ 19b, 20a LuftVG 5 8 wurde zum einen mit der Änderung des Art. 87d I 2 GG eine Organisationsprivatisierung der Flugsicherheit nach §§ 27c, 27d, 31b LuftVG, zum anderen in § 29c I 3 LuftVG eine Einbeziehung Privater in die Fluggastkontrolle ermöglicht. Nach dieser Norm können die Luftfahrtbehörden für die Durchsuchung von Personen und die Durchsuchung, Durchleuchtung oder sonstige Überprüfung von Gegenständen auf Flughäfen private Sicherheitsdienste einsetzen. In der Praxis wird von dieser Möglichkeit der Fluggastkontrolle durch Private reger Gebrauch gemacht, wobei die Privaten weitgehend selbständig tätig werden 59 . Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Praxis weckt der Wortlaut der Norm, welcher eine Tätigkeit „als Hilfsorgan", die „unter Aufsicht" der Luftfahrtbehörden erfolgt, beschreibt. Während dieser Wortlaut allein Verwaltungshilfe zuläßt, wird die Norm in der Praxis wie eine Beleihungsgrundlage gehandhabt60. Selbst wenn 55 N.N., Frankfurter Rundschau v. 15. 12. 1994, S. 26; N.N., Süddeutsche Zeitung v. 28./ 29. 12. 1996, S. 5. 56 Bartsch, Frankfurter Rundschau v. 6. 3. 1999, S. 27; N.N., Süddeutsche Zeitung v. 6./ 7. 3. 1999, S. 7; Zips, Süddeutsche Zeitung v. 26. 8. 1999, S. 6; Greiner, DP 1999, S. 268, 269. 57 N.N., DP 1997, S. 208; N.N., DP 1998, S. 130. 58 Dazu knapp unten II. 2. a) bb); ausführlich Czaja, Eigensicherungspflichten, passim; Bracher, Gefahrenabwehr, S. 47 f. 59 Vgl. Boetcher, W+S-Information 1980, S. 12, 13; Schnekenburger, Rechtsstellung, S. 42 f. 60 Vgl. Giemulla/ Schmid, LuftVG, § 29c Rn. 18; F. Huber, Gefahrenabwehr, S. 78; Schnekenburger, Rechtsstellung, S. 114 f.: Beleihung; dagegen Gramm, VerwArch 90 (1999), S. 329, 333 ff.; ders., Privatisierung, Kap. 5.2.1, S. 382 ff. m. w. N.; zur Praxis U. Martens, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. L 25; Flottau, Süddeutsche Zeitung v. 3. 7. 1997, S. 17.
Α. Die tatsächliche Situation
67
man in ihr eine taugliche Rechtsgrundlage für die Beleihung Privater sieht, so weicht diese Übertragung hoheitlicher Aufgaben und Befugnisse doch von den klassischen Fällen der Beleihung insofern deutlich ab, als das öffentlich-rechtliche Handeln der Privaten hier nicht mehr nur einen untergeordneten Teilbereich ihrer im übrigen privatrechtlichen Tätigkeit darstellt, sondern zur Hauptaufgabe geworden ist. Die Beliehenen sind Vollzeit-Hilfspolizisten. Der Rückgriff auf die Privaten statt des Einsatzes von Beamten beruht nicht mehr auf Praktikabilitätserwägungen, sondern dient finanziellen Einsparungen. cc) Sicherheitswachten
in Bayern und Sachsen
Eine inhaltlich neue Möglichkeit der Einbeziehung Privater in den öffentlichrechtlichen Schutz öffentlicher Rechtsgüter stellen die Sicherheitswachten in Bayern 61 und Sachsen62 dar. Bürger patrouillieren in ihrer Freizeit bis zu 15 Stunden monatlich (in Sachsen: bis zu 40 Stunden) in Wohnvierteln, Parkanlagen, in der Umgebung von Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel, Asylbewerber-Sammelunterkünften und Gebäuden, die häufig mit Graffitis verunstaltet werden 63. Die Auswahl der sich freiwillig meldenden, ehrenamtlich tätigen Bürger erfolgt anhand der auch bei den freiwilligen Polizeireserven angewendeten Kriterien. Eine hauptberufliche Tätigkeit in einem privaten Sicherheitsunternehmen stellt einen Ausschlußgrund dar. Die Mitglieder der Sicherheitswacht erhalten eine Grundausbildung (Bayern: 40 Stunden64, Sachsen: 60 Stunden), welche mit einem 15-minütigen Prüfungsgespräch abschließt, zusätzlich achtmal zweistündige Fortbildungen pro Jahr. Die Aufwandsentschädigung beträgt in Bayern 12,-DM/h, in Sachsen: 10,-DM/h. SicherheitswachterprobungsG v. 24. 12. 1993, GVB1., S. 1049; zur dauernden Einrichtung überführt durch Gesetz v. 27. 12. 1996, GVB1., S. 539; heute i.d.F.d.Bek. v. 28. 4. 1997, GVBl., S. 88. 62 SächsSWEG v. 12. 12. 1997, S. 647; ohne relevante Änderungen unter dem Titel Sächsisches Sicherheitswachtgesetz - SächsSWG - zur dauernden Einrichtung überführt durch Gesetz v. 16. 4. 1999, GVBl., S. 186; vgl. N.N., DP 1998, S. 98; Honnigfort, Frankfurter Rundschau v. 3. 2. 1997, S. 4. 63 Die folgende Darstellung basiert auf den Darstellungen von Spörl, DP 1997, S. 33 ff.; Hitzler/Göschl, in: Frehsee/Löschper/Smaus, Konstruktion der Wirklichkeit, S. 134, 144 ff.; Behring/Göschl/Lustig, Kriminalistik 1996, S. 49 ff.; Lustig, ansprüche 3/1996, S. 9 ff.; dies., Sicherheitswacht; Bayer. Staatsministerium des Innern, Sachstand, S. 7 ff.; Hitzler, cilip 48 (1994), S. 67 ff.; Behring, in: Hornbostel, Verunsicherung, S. 136 ff.; Göschl/Lustig, ebd., S. 143 ff.; v. Klitzing, BayBgm. 1994, S. 85 ff.; Roos, Kriminalistik 1994, S. 287 ff.; Rathmann, in: Süddeutsche Zeitung v. 19./20. 8. 1995, S. 53; Spörrle, jetzt v. 31. 7. 1995, S. 14; N.N., Süddeutsche Zeitung v. 21. 7. 1995, S. 16. - Zudem beruht die Darstellung auf einem Vortrag von POR Benisch, Polizei Nürnberg, gehalten am 5. 6. 1997 im IBZ Schloß Gimborn; vgl. auch dens., zit. n. Brauser-Jung, DP 1998, S. 326, 328, und M. Müller, DVB1. 1999, S. 451, 453; Sächsische Erfahrungen in LT-Drs. 2110835, sowie Bartl/ Seidel/Richter/Hardraht, SächsLT-Protokoll 2, S. 7199 ff. 64 Bericht über die Schulung der Nürnberger Sicherheitswacht bei M. Schneider, Polizeiruf 110 2/1994, S. 25. 5*
68
§ 2: Die aktuelle Situation
Die bayerische Sicherheitswacht rekrutiert sich aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Ein Fünftel der Mitglieder sind Frauen, ferner patrouillieren einige Ausländer. Untersuchungen über die Motivation der Bürger zeigen eine weite Bandbreite von zivilgesellschaftlichem Engagement bis hin zu einem willkommenen Anlaß für bezahlte Spaziergänge. Von Seiten der Initiatoren bezweckt die Sicherheitswacht einen Bewußtseinswandel in der Bevölkerung „weg von der Unkultur des Wegschauens hin zur Kultur des Hinsehens" und damit die Übernahme von Verantwortung durch die Bürger für die als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begriffene innere Sicherheit. Konkreter zielen die Sicherheitswachten auf eine Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls und eine Verminderung von Straftatgelegenheiten durch uniformierte Präsenz 65. Gleichzeitig soll Bürgerwehren die Grundlage entzogen werden, privates Engagement für Sicherheit in die staatliche Polizei integriert werden. Diese Ziele zeigen, daß es anders als bei den Polizeireserven um eine Ergänzung der Polizei, nicht aber um eine Entlastung der Polizei durch partielle Ersetzung geht. Im Einklang mit diesen Zielen patrouillieren die Bürger nicht in Polizeiuniform, sondern in Zivilkleidung und sind lediglich durch eine Armbinde gekennzeichnet (Sachsen: mit einheitlicher Jacke). Bei Zwischenfällen greifen sie grundsätzlich nicht selbst ein, sondern informieren die Polizei über mitgeführte Funkgeräte sowie nach Dienstschluß über allgemeine Beobachtungen zur Sicherheitslage. In Prozessen sollen sie später als „qualifizierte Zeugen" zur Verfügung stehen. Auch stehen ihnen nicht in vollem Umfang die polizeilichen Befugnisse, sondern lediglich die Befugnisse zur Befragung, Identitätsfeststellung und Platzverweisung zu. Weiter als die bayerische Regelung geht insofern der sächsische Modellversuch, dessen Mitglieder zusätzlich die Befugnisse zum Verbringen zur Polizeidienststelle zwecks Identitätsfeststellung, zur Sicherstellung einer Sache zum Schutz des Eigentümers oder Besitzers und zur Anwendung unmittelbaren Zwangs in Form einfacher körperlicher Gewalt haben. Aufgrund ihres hoheitlichen Tätigwerdens sind alle Sicherheitswachtangehörigen an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gebunden. Zu einer Anwendung der polizeilichen Befugnisse kommt es erfahrungsgemäß alle 250 Einsatzstunden. Das Mitführen von Schuß-, Hieb- und Stoßwaffen ist untersagt, vielmehr sind die Angehörigen der Sicherheitswacht neben dem Funkgerät mit einem Reizstoffsprühgerät und einer Signalpfeife ausgerüstet. Werden nach der rechtlichen Konstruktion die Bürger hier in erster Linie im Vorfeld der polizeilichen Aufgabe der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit tätig, deutet das Selbstverständnis einiger Angehöriger der Sicherheitswacht allerdings eher auf ein Tätigwerden zum Schutz einer selbst definierten öffentlichen Ordnung hin. Der auch deswegen von vielen zunächst skeptisch beur65
Sachsens Innenminister Hardraht: „Unser Hauptanliegen ... ist die präventive Verhinderung von Vergehen leichter Art in dicht bewohnten Siedlungsgebieten durch eine Erhöhung der Präsenz", LT-Protokoll 2, S. 7202.
Α. Die tatsächliche Situation
69
teilte 66 dreijährige Modellversuch in Bayern wurde im nachhinein überwiegend neutral oder positiv bewertet, die Sicherheitswacht zur Dauereinrichtung in mittlerweile 40 Städten mit 420 Mitgliedern 67 . Auch in Sachsen soll die Sicherheitswacht im Laufe des Jahres 2000 flächendeckend in allen Polizeirevieren eingeführt werden und ab 2001 ca. 400 Freiwillige umfassen 68. Die CSU forderte eine bundesweite Übernahme des Modells 69 , die nordrhein-westfälische CDU plant sie für den Fall eines Regierungswechsels in Düsseldorf 70. Tatsächliche Erfolge bei der Kriminalitätsbekämpfung wurden zwar kaum erzielt, das nach Umfragen überwiegend positve Echo in der Bevölkerung jedoch als Indiz für ein gestiegenes Sicherheitsgefühl gewertet. Ob sich aus der Tätigkeit der Sicherheitswachten eine personelle Entlastung der Polizei von in den letzten Jahren zunehmend als wichtig erkannter, aber zeitaufwendiger Streifentätigkeit 71 ergibt, oder aber umgekehrt die Polizei durch zahlreiche von den Bürgern gewonnener Informationen eine Zusatzbelastung zu verzeichnen hat, wird unterschiedlich beurteilt 72 . Ebenso erscheint offen, ob sich dauerhaft genügend Freiwillige zum Dienst in der Sicherheitswacht bereit erklären 73. b) Nicht rechtlich geregelte Initiativen Eine ähnliche Zielrichtung wie die Sicherheitswachten verfolgt das Modell Sicherheitspartner in Brandenburg 74. Die als Sicherheitspartner patrouillierenden Bürger werden dort jedoch im Gegensatz zu Bayern nicht mit polizeilichen Aufgaben und Befugnissen beliehen, sondern werden mit Unterstützung der Polizei privatrechtlich tätig. Vor dem Hintergrund des Trennungsmodells wäre zu vermuten, daß aufgrund des privatrechtlichen Tätigwerdens der Sicherheitspartner kein Schutz öffentlicher Rechtsgüter erfolgt. Ob dies in der Praxis zutrifft oder aber eine Abweichung vom Trenriungsmodell vorliegt, soll hier offenbleiben. Vergleichbare Probleme treten in zahlreicher werdenden Fällen auf, in denen Kommunen Sozialhilfeempfänger und Langzeitarbeitslose auf Streife im öffentlichen Raum schikken 75 . So setzt zum Beispiel die Stadt Stuttgart sog. „gelbe Engel" im Rahmen der 66
Stellvertretend etwa für die Gewerkschaft der Polizei Freiberg, Sicherheit, S. 5. 67 N.N., DP 1999, S. 242. 68
Telefonische Auskunft von Herrn Karg, Sächs. Innenministerium, am 4. 2. 2000. 69 N.N., Süddeutsche Zeitung v. 31. 7. 1997, S. 5; vgl. auch Pitschas, DÖV 1997, S. 393, 400. 70 Schumacher, Neue Westfälische v. 20. 5. 1999, S. 2. 71 Kritisch dazu Diederichs, cilip 51 (1995), S. 23 ff., der die Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung m.E. nicht hinreichend würdigt. 72 Keinen Entlastungseffekt erwartet Hitzler, in: Hornbostel, Verunsicherung, S. 15,22. 73 Vgl. N.N., Süddeutsche Zeitung v. 21. 5. 1997, S. 38: fünf der 12 örtlichen Sicherheitswächter hätten aus privaten Gründen den Dienst quittiert, ohne daß sich genügend neue Bewerber gemeldet hätten. 74 Dazu unten II. 2. b.
70
§ 2: Die aktuelle Situation
Initiative „Sicheres und sauberes Stuttgart" ein 76 , die Stadt Frankfurt/M. plant Gleiches auf Friedhöfen 77. Desweiteren finden sich zahlreiche Beispiele eines Einsatzes privater Sicherheitsunternehmen aufgrund von Ortssatzungen78. Auch diese Praxis wirft im Hinblick auf das Trennungsmodell Probleme auf. Können kommunale Satzungen den Privaten keine öffentlich-rechtlichen Handlungsbefugnisse verleihen, so können öffentliche Rechtsgüter und damit die öffentliche Sicherheit durch die Privaten nicht geschützt werden 79. Sie könnten vielmehr allenfalls als Verwaltungshelfer qualifiziert werden, können dann jedoch mangels präsenten staatlichen Weisungspersonals nicht in Rechte Dritter eingreifen 80. Dennoch geht es den Gemeinden um einen Beitrag zur öffentlichen Sicherheit 81. Durch die Präsenz dem Staat zugeordneten Personals soll jedenfalls zumindest das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt werden. Ebenfalls zur Verstärkung des Kontakts zwischen Polizei und Bevölkerung sind in zahlreichen Bundesländern auf kommunaler Ebene Einrichtungen geschaffen worden, in welchen Vertreter unterschiedlichster Interessengruppen - in Schleswig-Holstein einschließlich des privaten Sicherheitsgewerbes 82 - sicherheitsrelevante Themen in regelmäßigen Abständen erörtern. Diese zuerst in Schleswig-Holstein als kriminalpräventive Räte geschaffenen Gremien 83 werden damit insbesondere im Vorfeld polizeilicher Ermessensbetätigung tätig. Umfassende Strategien firmieren heute unter dem Namen „City-Security-Management" 84. Vergleichbare Zielsetzungen verfolgen die nordrhein-westfälischen Ordnungspartnerschaften, auch wenn hier Bürger in geringerem Maße eingebunden werden und stattdessen 75 Zu Iserlohn und Harsewinkel Zelenka, Neue Westfälische v. 21. 4. 1999, S. 7. 76 Witte, DSD 2/1998, S. 11, 12. 77 Wackerhagen, DSD 2/1998, S. 4. 78 BDWS, DSD 2/1997, S. 3,4; vgl. Voß, JhbRsozRth XV, S. 81, 90: Frankfurt/M. 79 Zu einzelnen Rechtsfragen noch näher im Rahmen dieser Arbeit, vgl. hier nur Gramm, VerwArch 90 (1999), S. 329, 346 ff. 80 Statt aller Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, § 9 Rn. 5; Maurer, Verwaltungsrecht, § 23 Rn. 60; vgl. auch Ehlers, Verwaltungshelfer, S. 16 ff. - Anders etwa das Modell der Bielefelder Stadtwache, in denen Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf der Grundlage des OBGNW zusammen mit Polizisten Streife gehen, dazu Kubera, DP 1999, S. 51 ff.; Maschmeier, DVP 1999, S. 510 ff. 81 Kritisch H.-M. Zimmermann, DP 1994, S. 60, 62. 82 Wackerhagen, DSD 2/1998, S. 4, 6; dafür Rupprecht, DSD 2/1999, S. 20,21. 83 Vgl. U. Volkmann, NVwZ 1999, S. 225, 232; Peilert, Kriminalistik 1999, S. 616 ff.; Schürholz, DP 1999, S. 193 ff.; Rupprecht, DSD 2/1999, S. 20 ff.; N.N., KPB1. 1997, S. 582 ff.; Pütter/Diederichs, cilip 57 (1997), S. 47 ff.; Gutt, DP 1997, S. 189 ff.; Bull, RuP 1995, S. 9, 13; Lentze, der überblick 1 /1998, S. 31, 32; Langenbrink, NWVB1. 1995, S. 285, 288; Narr, cilip 51 (1995), S. 6, 14; Boers, NKP 1 /1995, S. 16, 17 ff.; Stokar, cilip 51 (1995), S. 57 ff.; dies., A KP 4/1995, S. 35 ff.; Jäger, Kriminalistik 1994, S. 298, 301; Feltes, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. E 47 ff.; Baier/Feltes, Kriminalistik 1994, S. 693 ff.; Koetzsche, Kriminalistik 1992, S. 121 ff.; krit. Gössner, Zwielicht, S. 237 f.; Gössner, A KP 4/1995, S. 32, 35. 84 Rupprecht, DSD 2/1999, S. 20, 21.
Α. Die tatsächliche Situation
71
insbesondere kommunale Ämter mit der Landespolizei kooperieren 85. Im April 1999 wurde zur Bündelung der zahlreichen Initiativen auf Bundesebene das durch vier Mitarbeiter aufzubauende „Deutsche Forum für Kriminalprävention" eingerichtet86. Während Private bei diesen Modellen im Vorfeld gefahrenabwehrender Handlungen in Polizeiarbeit einbezogen werden, finden sich auch Beispiele einer aufeinander abgestimmten, ineinandergreifenden Funktionsteilung87. Eine solche Zusammenarbeit kollidiert notwendig mit dem Trennungsmodell. Sie wird allerdings häufiger diskutiert als praktiziert 88 . Beispiele einer Zusammenarbeit finden sich insbesondere bei Großveranstaltungen, bei der Erfüllung gesetzlicher Eigensicherungsverpflichtungen im Bereich der Kernkraftwerke oder des Flughafenbereichs 89 sowie im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs. So werden in Hamburg die Einsatzkonzepte zwischen den privaten Sicherheitsdiensten und der Polizei abgesprochen 90, die City-Streifen im Frankfurter U-Bahn-Bereich von der Polizei ausgebildet 91 , in der Münchener U-Bahn 92 und seit 1981 in Berlin bestehen gemischt hoheitlich-private Streifen, um gleichzeitig Haus- und Hoheitsrechte ausüben zu können 93 . Zunehmend gefordert wird die Übernahme einer Meldefunktion durch private Sicherheitsdienste94. Sie ist in Düsseldorf im Rahmen einer Sicherheitspartnerschaft vereinbart worden 95 . In Frankfurt a.M. bündelt eine Zentralstelle der Sicherheitsunternehmen - vergleichbar dem Verfahren mit Taxiunternehmen - verdächtige Wahrnehmungen und leitet sie an die Polizei weiter 96 . Angedacht werden 85 Vgl. Ministerium für Inneres und Justiz NRW, Pressemitteilung 98/617; N.N., DP 1999, S. 156; Kant/Pütter, cilip 59 (1998), S. 70, 75 ff. m. w. N.; exemplarisch für Bielefeld: Kubera, DP 1999, S. 51 ff.; Maschmeier, DVP 1999, S. 510 ff.; vgl. Kruse, Verbrechensbekämpfung. Bei diesen Modellen geht es nicht um eine Privatisierung der öffentlichen Sicherheit, sondern um eine partielle (Re-)Kommunalisierung einzelner Sicherheitsaufgaben. 86 Peilen, Kriminalistik 1999, S. 616, 617; vgl. Schily, RuP 1998, S. 174, 176. - Diese Präventionsräte sind nicht mit den in Nordrhein-Westfalen bestehenden Polizeibeiräten (vgl. §§ 15 ff. POG) zu verwechseln, welche sich stärker auf das „Wie" der polizeilichen Arbeit konzentrieren und etwa an die Polizei gerichtete Beschwerden, die im öffentlichen Interesse liegen, beraten sollen; dazu H.-J. Lange, Innere Sicherheit, S. 234 ff. 87 Peilen, DVB1. 1999, S. 282, 283. 88 Vgl. Steinke, W&S 1995, S. 121, 122; eine Ausnahme dürfte es darstellen, wenn die Cottbusser Polizei nachts Mitarbeiter privater Sicherheitsunternehmen zur Unterstützung anfordert, N.N., team, S. 24 f. 89 Peilen, DVB1. 1999, S. 282, 283; Wadle, DSD 2/1997, S. 15 f. 90 Paltian, zit. n. Brauser-Jung, DP 1998, S. 326, 327; Wadle, DSD 2/1997, S. 15,16. 91 N.N., Weisser Ring 4/1991, S. 16. 92 Glavic, DP 1994, S. 36, 39; Schulte, DVB1. 1995, S. 130, 135; Willke, tung v. 27. 4. 1999, S. 43; Wadle, DSD 2/1997, S. 15, 16.
Süddeutsche Zei-
93 Pütter, cilip 43 (1992), S. 32; vgl. Eick, cilip 51 (1995), S. 30 ff.; zur rechtlichen (Un)Zulässigkeit Peilen, DVB1. 1999, S. 282, 287; vgl. unten 3. Teil, § 6 Β. I. 2. b). 94 Vgl. Steffenhagen, DSD 16 (1995), S. 18, 22; H.-M. Zimmermann, DP 1994, S. 60, 62; Reinstädt, Kriminalitätskontrolle. 95 Näher N.N., DSD 4/1999, S. 15 f.
72
§ 2: Die aktuelle Situation
ferner gemeinsame Ausbildungs- und Informationsveranstaltungen von Bahnpolizei und Führungskräften der S-Bahn-Wachen97. Eine unmittelbare Einbeziehung privaten Sicherheitspersonals in die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung des Schutzes öffentlicher Rechtsgüter erfolgt schließlich über die Rechtsfigur des Verwaltungshelfers 98. Von dieser auch ohne ausdrückliche rechtliche Normierung zulässigen Möglichkeit wird in zunehmendem Umfang Gebrauch gemacht. Aufsehen erweckte insbesondere die Heranziehung Privater in Abschiebehaftanstalten 99. Eine neuere, rechtlich noch kaum diskutierte Variante stellt die Beschäftigung Privater im Wege der Arbeitnehmerüberlassung dar 1 0 0 . Auch hier soll für eine rechtmäßige Wahrnehmung der staatlichen Aufgaben eine enge physisch-räumliche und organisatorische Einbindung in die Verwaltung erforderlich sein; die dem Direktionsrecht der Verwaltung unmittelbar unterstellten Leiharbeitnehmer bedürfen jedoch bei der Erfüllung ihrer Aufgabe vor Ort keiner Anleitung durch präsente Polizisten 101 . Praktisch werden diese Bemühungen um eine verstärkte Heranziehung Privater insbesondere im Bereich der Ermittlung von Verkehrsverstößen. In der Vergangenheit wurden die Privaten hier jedoch teilweise selbständig im Rahmen von Ordnungswidrigkeitenverfahren und damit repressiv-polizeilich tätig, ohne daß eine gesetzliche Beleihungsgrundlage vorhanden ist 1 0 2 . Diese rechtswidrige Praxis scheint mittlerweile weitgehend eingestellt worden zu sein, Private werden lediglich als Polizisten unterstützende Verwaltungshelfer oder aber als Leiharbeitnehmer tätig. Eine Ausnahme hiervon machen einige hessische Kommunen, in denen Angestellte privater Sicherheitsdienste im Wege der Arbeitnehmerüberlassung selbständig Parkverstöße registrieren 103. Gestützt wird diese Praxis auf die von 96 Zips, Süddeutsche Zeitung v. 19./20. 6. 1999, S. 16; N.N., DSD 3/1999, S. 9 f.; N.N., Kriminalistik 1999, S. 482. 97 Schelter (BMI), zit. η. N.N., WIK 4/1995, S. 22. 98 Statt aller Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, § 9 Rn. 5.; umfassend Burgi, Verwaltungshilfe. Ehlers, Verwaltungshelfer, S. 16 ff. 99 Voss, Frankfurter Rundschau v. 8. 1. 1994, S. 7; K. Maier, DSD 3/1997, S. 15; Wadle, DSD 2/1997, S. 15, 16; zu rechtlichen Problemen Gramm, VerwArch 90 (1999), S. 329, 339 ff.; ders., Privatisierung, Kap. 5.2.2, S. 390 ff. 100 Rupprecht, DSD 2/1999, S. 20, 23; Göpfert, Frankfurter Rundschau v. 30. 9. 1999, S. 23; N.N., DP 1998, S. 143. ιοί So das BayObLG, NJW 1999, S. 2200, 2201 m. Anm. Vahle, DVP 1999, S. 439 f. 102 Vgl. zur Parkraumüberwachung BayObLG, NZV 1997, S. 486; KG, NZV 1997, S. 48; AG Berlin-Tiergarten, DAR 1996, S. 326; zur Geschwindigkeitskontrolle BayObLG, NJW 1999, S. 2200, NZV 1997, S. 276; AG Freising, DAR 1997, S. 31; OLG Frankfurt, NJW 1995, S. 2570; AG Alsfeld, NJW 1995, S. 1503. Zu Rechtsfragen aus jüngerer Zeit ausführlich Schnekenburger, Rechtsstellung, S. 116 ff., 201 ff.; Gramm, Privatisierung, Kap. 5.2.5., S. 401 ff.; ders., VerwArch 90 (1999), S. 329, 348 ff.; Nitz, NZV 1998, S. 11 ff.; Waechter, NZV 1997, S. 329 ff.; Ronellenfitsch, DAR 1997, S. 147 ff.; Steiner, DAR 1996, S. 272 ff.; Radtke, NZV 1995, S. 428 ff.; Scholz, NJW 1997, S. 14 ff.; gegen ihn Steegmann, NJW 1998, S. 237 ff., und Kutscha, NJ 1997, S. 393 ff.
Α. Die tatsächliche Situation
73
§ 99 HessSOG eröffnete Möglichkeit einer Bestellung von Hilfspolizisten und damit auf eine präventiv-polizeiliche Grundlage, welche die getroffenen repressivpolizeilichen Maßnahmen allerdings nicht deckt 104 . Der gleiche Einwand verhindert eine Entlastung der Berliner Polizei durch den Einsatz des Freiwilligen Polizeidienstes bei der Parkraumüberwachung, nachdem das sog. Berliner Parkraumüberwachungskonzept der Übertragung auf private Sicherheitsunternehmen für rechtswidrig erklärt wurde 105 .
c) Weitergehende Überlegungen Anknüpfend an die von den Gerichten zutreffend verwehrte Möglichkeit einer Übertragung selbständiger hoheitlicher Tätigkeiten auf Private im Rahmen der Verkehrsüberwachung 106 hat das Land Berlin eine Gesetzesinitiative im Bundesrat eingebracht, welche die notwendige Beleihungsgrundlage für die Parkraumkontrolle in § 26 StVG verankert hätte 107 . Auch hier würden die Privaten nicht mehr nur für einen Randbereich ihrer Tätigkeit mit hoheitlichen Befugnissen beliehen, sondern zu Vollzeit-Hilfspolizisten bestellt. Aufgrund verfassungsrechtlicher und verfassungspolitischer Bedenken des Rechtsausschusses ist von diesem Vorhaben zunächst jedoch Abstand genommen worden 108 . Forderungen nach einer Beleihungsgrundlage sind damit aber noch nicht vom Tisch 109 . Auf eine interessante Neuerung zielte eine Bundesratsinitiative Baden-Württembergs, die einen Sicherheitshilfsdienst einrichten wollte 1 1 0 . Im Rahmen des Sicherheitshilfsdienstes würden junge Wehrpflichtige eine der Dauer des Wehrdienstes entsprechende Zeit polizeilich tätig. Nach einer dreimonatigen Grundausbildung würden sie unterstützend in wenig eingriffsintensiven Tätigkeitsfeldern wie dem Objektschutz, bei Großveranstaltungen, der Verkehrsüberwachung, zu technischen 103 Göpfert, Frankfurter Rundschau v. 21. 12. 1995, S. 19, ders., Frankfurter Rundschau v. 27. 3. 1996, S. 23 f.: Frankfurt/M.; Frankfurter Rundschau v. 9. 8. 1996, S. 20: Dreieich. Nach Göpfert, Frankfurter Rundschau v. 30. 9. 1999, S. 23, soll diese Praxis aus Rentabilitätserwägungen eingestellt werden. 104 Näher zur Praxis Rupprecht, DSD 2/1999, S. 20, 23; zur Rechtslage i.E. zutreffend Hornmann, DAR 1999, S. 158 ff.; knapper Nitz, NZV 1998, S. 11, 14; Bernstein, NZV 1999, S. 316, 321. 105 KG, NZV 1997, S. 48; AG Berlin-Tiergarten, DAR 1996, S. 326. 106 Überblick bei Gramm, VerwArch 90 (1999), S. 329, 348 ff.; Nitz, NZV 1998, S. 11 ff.; Waechter, NZV 1997, S. 329 ff.; Steegmann, NJW 1997, S. 2157 ff.; Ronellenfitsch, DAR 1997, S. 147 ff.; Scholz, NJW 1997, S. 14 ff.; Steiner, DAR 1996, S. 272 ff. 107 BR-DRs. 691/96. io» BR-Drs. 691 / 1 /96; vgl. Scholz, NJW 1997, S. 14 ff. 109 Differenzierend Rupprecht, DSD 2/1999, S. 20, 24 f.; im Hinblick auf Geschwindigkeitskontrollen vom bayerischen Gemeindetag, Pressemitteilung Nr. 7/99 v. 22. 2. 1999, zit. in DVB1. 6/1999, S. A 87. no BR-Drs. 536/94; dazu: M. Schneider, Polizeiruf 110 2/1994, S. 24, 25.
74
§ 2: Die aktuelle Situation
Diensten oder aber zu Bürotätigkeiten eingesetzt. Diese Tätigkeit würde sie entsprechend dem ehrenamtlichen Dienst als Helfer im Zivil- oder Katastrophenschutz bzw. im Entwicklungshilfedienst von der Heranziehung zum Wehrdienst befreien (§§ 13a f. WPflG). Geäußerte Bedenken111 gegen die Vereinbarkeit dieser Gesetzesinitiative mit Art. 12a GG sowie Zweifel an einem tatsächlichen Entlastungseffekt für die Polizei ließen Baden-Württemberg jedoch von diesem Vorhaben Abstand nehmen 112 . In die gleiche Richtung gehen Überlegungen, polizeiliche Doppelstreifen mit einem Beamten und einem Freiwilligen zu besetzen113. Desweiteren wird diskutiert, ob neben einer verstärkten Übertragung von Polizeiaufgaben auf Angestellte des öffentlichen Dienstes oder aber auf Polizeibeamte im Rahmen von Überstunden pensionierte Polizeibeamte für Präsenzdienste in der Öffentlichkeit eingesetzt werden sollten 114 . Schließlich finden sich in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen Überlegungen zum Einsatz privater Wachleute im regulären Strafvollzug 115 . Inwieweit hier an Verwaltungshilfe oder aber eine Beleihung aufgrund von § 155 I 2 StVollzG gedacht ist, ist noch nicht ausdiskutiert 116. Hingegen soll es sich vermutlich um Verwaltungshilfe handeln, wenn in Bremen Abschiebungen durch eine Privatfirma erfolgen sollen 117 . Auch wenn einige Projekte zurückgezogen wurden, so zeigen diese Beispiele aus der aktuellen Diskussion, daß weitere Fälle einer Übertragung öffentlich-rechtlichen Schutzes öffentlicher Rechtsgüter auf Private zu erwarten sind.
m Wik, BR-Sten.Ber. 1994, S. 347; auch Freiberg (GdP), Sicherheit, S. 6. h 2 Telefonat mit Herrn Lay im Sommer 1995; Der damalige Bundesinnenminister Kanther hielt hingegen an diesen Plänen fest, zit. η. N.N., Süddeutsche Zeitung v. 22./ 23. 11. 1997, S. 6. 113 Kanther, zit. η. N.N., WIK 6/1994, S. 24. 114 T. Schäuble, BR-Sten.Ber. 1994, S. 346, 347, mit weiteren Beispielen. us Für Hessen: N.N., Süddeutsche Zeitung v. 3. 2. 2000, S. 6; Kruis, ZRP 2000, S. 1 ff.; für Thüringen: Krölls, GewArch 1997, S. 445; für Nordrhein-Westfalen N.N., Süddeutsche Zeitung v. 22. 5. 1998, S. 6, v. 8. 10. 1998, S. 26; von diesen Plänen ist aufgrund des Widerstands der Strafvollzugsbeamten zwischenzeitlich Abstand genommen worden, N.N., Neue Westfälische v. 5. 2. 1999, S. 1. - Allgemein zur Privatisierung des Strafvollzugs M. Walter, in: Pitschas/Stober, Quo vadis, S. 65 ff.; Braum/Varwig/Bader, ZfStrVo 1999, S. 67 ff.; Maelicke, ZfStrVo 1999, S. 73 ff.; Haneberg, ZfStrVo 1993, S. 289 ff. 116 Zum Problem Gusy/Lührmann, Der Vollzugsdienst 3/1999, Beilage, S. 1 ff. m. w. N., die eine Anwendung von § 155 I 2 StVollzG ablehnen, weil „besondere Gründe" im Sinne dieser Vorschrift nur vorlägen, wenn die herangezogenen Privaten Fachpersonal für die Durchführung des Behandlungsvollzugs seien, was bei Beschäftigten von privaten Sicherheitsunternehmen nicht der Fall sei; vgl. auch Kruis, ZRP 2000, S. 1 ff.; Gramm, VerwArch 90 (1999), S. 329, 339 ff., insbes. S. 343; ders., Privatisierung, Kap. 5.2.2.2, S. 394 f.; Braum/Varwig/Bader, ZfStrVo 1999, S. 67,68; Hoffmann-Riem, JZ 1999, S. 421,428. i n Vgl. BT-Drs. 13/4257; Ulrich, Süddeutsche Zeitung v. 13./14. 7. 1996, S. 5; N.N., ebd. v. 8. 7. 1996, S. 5; v. 15. 7. 1996, S. 5; dazu Gramm, Privatisierung, Kap. 5.2.2, S. 390 ff.
Α. Die tatsächliche Situation
75
4. Ergebnis Der öffentlich-rechtliche Schutz öffentlicher Rechtsgüter durch Private wird über die traditionellen Fälle der Beleihung auf vier - nicht überschneidungsfreie Fallgruppen ausgedehnt118: (1.) Übertragung von weniger zentralen Polizeiaufgaben auf Private, um eine personelle Entlastung herbeizuführen, welche den Polizeivollzugsbeamten eine stärkere Konzentration auf die als Kernaufgaben angesehenen Tätigkeiten, insbesondere der Verbrechensbekämpfung ermöglichen soll; (2.) Übertragungen hoheitlicher Aufgaben und Befugnisse auf Private über die traditionellen Beleihungsfälle hinaus nicht allein in Fällen, in denen die Aufgabe mit eigenem polizeilichen Personal nicht sinnvoll wahrgenommen werden kann, sondern aufgrund finanzieller Erwägungen im vollen Umfang eines Tätigkeitsbereichs; (3.) Einsatz Privater zu streifendienstähnlichen Tätigkeiten, deren Ziel weniger eine personelle Entlastung der Polizei ist, sondern die Verringerung von Tatgelegenheiten und eine Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung. (4.) Ferner finden sich zunehmend Fälle privater Verwaltungshilfe und eine mehr oder weniger informelle Einbeziehung Privater im Vorfeld gefahrenabwehrender Tätigkeit.
Π. Schutz privater Rechtsgüter nach Privatrecht 1. Traditioneller
privater Schutz privater Rechtsgüter
Privater Schutz von Rechtsgütern ist eine historische Selbstverständlichkeit, welche sich etwa auch in der Behauptung ausdrückt, das Notwehrrecht sei kein staatlich verliehenes Recht der Selbstverteidigung, sondern ein vorrechtliches „Urgrundrecht" 119 . Tatsächlich kennen alle bekannten Rechtsordnungen, wenn auch in unterschiedlicher Ausgestaltung, ein Notwehrrecht 120. Wenn heute privater Rechtsgüterschutz problematisiert wird, so wendet sich dies nicht allgemein gegen die Existenz von Jedermannrechten oder das Gebrauchmachen der Bürger von diesen 118
Ob diese Fälle unter den Begriff der Beleihung zu fassen sind, ist umstritten und hängt letztlich vom Begriffsverständnis ab. Krölls, GewArch 1997, S. 445, 446, qualifiziert etwa die Polizeireservisten als Verwaltungshelfer, weil sie weitgehend unselbständig tätig werden, und grenzt sie von der schlichten Verwaltungshilfe ab, bei der keine hoheitlichen Befugnisse übertragen werden. Im Ergebnis handelt es sich jedoch allein um terminologische Unterschiede; vgl. auch die terminologische Differenzierung von Götz, in: Pitschas / Stober, Quo vadis, S. 235, 241 f.; ausführlich Burgi, Verwaltungshilfe, S. 100 ff., insbes. S. 152 ff. »» Deutlich etwa Klose, ZStW 89 (1977), S. 61 ff. 120 Vgl. die Darstellungen bei Schroeder, in: FS Maurach, S. 127, 128 ff.; v. Bar, Gesetz und Schuld, S. 126 ff.
76
§ 2: Die aktuelle Situation
Schutzmöglichkeiten, sondern insbesondere gegen ihre professionelle Anwendung durch gewerbliche Sicherheitsunternehmen. Daher erscheint ein kurzer Überblick über Tätigkeiten und Entwicklung des Gewerbes angezeigt. Als erstes Unternehmen wird für Deutschland das „Hannoversche Wach- und Schließinstitut" genannt, welches 1901 gegründet wurde 121 . Zahlreiche Unternehmensgründungen folgten, ein erster regionaler Dach verband wurde 1904 gegründet. Der „Reichsverband des Bewachungsgewerbes e.V. Berlin" zählte 1933 etwa 120 Mitglieder 122 . Kritiker meldeten sich bereits in diesen Anfangsjahren. Das Gewerbe beschäftigte vorbestrafte Personen, es kam zu zahlreichen Übergriffen bei der Gewerbeausübung, Uniformierungen zielten auf eine hoheitliche Autorität 123 . Reagiert wurde auf diese Zwischenfälle mit dem Erlaß des § 34a GewO im Jahr 1927 124 . Eine Professionalisierung des Gewerbes wurde mit der Gründung eines Dachverbandes im Jahre 1948 angestrebt. Aus ihm ging der heutige Bundesverband Deutscher Wach- und Sicherheitsunternehmen (BDWS) hervor 125 . Ihm gehörten 1998 410 der ungefähr 2000 Bewachungsunternehmen an, welche jedoch drei Viertel des Branchenumsatzes und der Beschäftigten binden 126 . Fast 50% der Unternehmen sind Ein-Mann- oder Kleinstbetriebe mit weniger als 250.000 DM Jahresumsatz, welche überwiegend nicht im Bundesverband organisiert sind 127 . Insgesamt werden für das Jahr 2000 130.000 Beschäftigte im Sicherheitsgewerbe erwartet 128 . Hinzu kommen kurzzeitig Beschäftigte, deren Anzahl auf 50-60.000 geschätzt wird 1 2 9 . Unter Einbeziehung des Werkschutzes reichen Schätzungen der Gesamtzahl der mit Bewachungsaufgaben Beschäftigten bis zu 270.000 Personen 1 3 0 , womit die Personalstärke von Bundes- und Landespolizeien erreicht würde.
121 Olschok-Tautenhahn, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. A 24; Κ. H. Schmidt, W+S-Information 1980, S. 155; Diederichs, cilip 43 (1992), S. 24; Wackerhagen/Olschok, in: Ottens/Olschok/Landrock, Europa, Rn. C 19 ff.; ausführlich zur Geschichte des Bewachungsgewerbes Nelken, Bewachungsgewerbe; F. Huber, Gefahrenabwehr, S. 31 ff.; Schnekenburger, Rechtsstellung, S. 11 ff. 122 Olschok-Tautenhahn, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. A 26 ff., insbes. 29, 34. 123 Näher Honigl, Tätigwerden von Privaten, S. 17 ff. 124 RGBl., S. 57. 125 Zur Verbandsgeschichte Schammert, DSD 3-4/1998, S. 38,40 ff. (=W+S-Information 1986, S. 12 ff.). 126 N.N., DSD 3-4/1998, S. 36 f. 127 Olschok-Tautenhahn, DP 1994, S. 31, 33 = DSD 14 (1994), S. 13, 14. 128 Olschok, DSD 4/1999, S. 3; ältere Zahlen bei Statistisches Bundesamt, zit. in: DSD 1/1998, S. 12; zu den unterschiedlichen Zahlenangaben m. w. N. Schnekenburger, Rechtsstellung, S. 20 f. 129 Olschok, DSD 2/1997, S. 6, 7; Pitschas, in: Schuppert, Jenseits von Privatisierung, S. 135, 138. 130 Hitzler, FJNSB 3-4/1993, S. 16, 19; vgl. Pitschas, in: Schuppert, Jenseits von Privatisierung, S. 135, 138; Voß, NKP 2/1993, S. 39,40 m.N.
Α. Die tatsächliche Situation
77
Innerhalb der letzten 15 Jahre verzeichnete das Sicherheitsgewerbe jährliche Zuwachsraten im Personalbestand und im Umsatz von durchschnittlich 10%, was mehr als eine Verdreifachung bedeutet131. Ein Teil des überdurchschnittlichen Zuwachses ist dabei auf die Vereinigung Deutschlands zurückzuführen 132. Ein weiteres Wachstum in diesen Dimensionen wird nicht erwartet 133 und von einer Fortsetzung des Konzentrationsprozesses 134 bei unterschiedlichen Marktentwicklungen in den einzelnen Dienstleistungsbereichen ausgegangen135. Traditionelles Tätigkeitsfeld der Unternehmen war der betriebsbezogene Wachund Schließdienst, also vor allem die nächtliche Verschlußkontrolle auf einem oder meist mehreren Werksgeländen. Daneben zählten bereits während der Weimarer Republik der Personenschutz und der Geld- und Werttransport zu den Aufgabenfeldern privater Sicherheitsunternehmen. Diese Tätigkeiten machen auch heute noch den Kernbestand der Dienstleistungen privater Sicherheitsunternehmen aus 136 Wichtigster Bereich ist trotz stagnierender Umsätze 137 der Betriebs-, Werk- und Objektschutz einschließlich Revier- und Streifendienst, in dem über 60% des Personals der privaten Sicherheitsunternehmen tätig sind 138 . Die vielfältigen Tätigkeiten dienen der Sicherheit des Betriebes gegen Störungen von innen und außen. Im Einzelnen zählen hierzu etwa Pforten- und Empfangsdienste, Kontroll- und Streifendienste, Zutritts- und Ausgangskontrollen sowohl für Betriebsangehörige als auch für Außenstehende, die Kontrolle des Waren- und Güterverkehrs, die Verwaltung der Schließanlage, Dienst in etwa bestehenden Sicherheitszentralen, die Über-
131 Vgl. die Aufstellungen bei Mauersberger, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. W 15, 18. 132 Feuerstein, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. X 5, weitere Gründe ebd. Rn. 4 ff. 133 N.N., W&S 1995, S. 278, der allerdings Zuwachsraten von zum Teil unter 10% als den Markt verlassende Dynamik beklagt; vgl. auch N.N., WIK 4/1995, S. 12, 13. 134 Glavic, in: ders., HdBprSiG, Rn. Ζ 34 ff.; zu den einzelnen Wettbewerbsfaktoren Feuerstein, ebd. Rn. X 9 ff. - Dabei mehren sich internationale Unternehmenszusammenschlüsse. Das schwedische Unternehmen Securitas, mit 9% Marktanteil Marktführer in Europa und Deutschland (Raab-Karcher), übernimmt nun die Nr. 2 der USA Pinkerton (Marktanteil in den USA: 6%), N.N., DSD 2/1999, S. 37. 135 Ausführlich Glavic, in: ders., HdBprSiG, Rn. Ζ 6 ff. 136 Zum hier ausgeklammerten Markt der Sicherheitstechnik vgl. N.N., W&S 1995, S. 828 f. 137 Umfragenachweise bei N.N., WIK 4/1995, S. 33, 35. 138 BDWS, Stand 1. 3. 1998, ältere Daten bei Olschok-Tautenhahn, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. A 18; einen noch höheren Anteil legen die Daten bei N.N., Mittelständische Wirtschaft 6/1997, nahe. - Eine quantitaiv bedeutende (5,5% der Beschäftigten, BDWS, Stand 1. 3. 1998, ältere Daten bei Olschok-Tautenhahn, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. A 18), rechtlich jedoch weitgehend unproblematische und deshalb hier nicht vertiefte Aufgabe erfüllen Sicherungsposten, welche insbesondere Gleisbauarbeiten gegen herannahende Züge absichern. Dieser Anteil dürfte durch die Schaffung des bahneigenen Sicherheitsdienstes Bahnschutz GmbH demnächst zurückgehen, vgl. dazu N.N., WIK 4/1995, S. 22; WIK 5/1993, S. 31; zu den Tätigkeiten der Sicherungsposten näher Kötter, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. Κ 45 ff.
78
§ 2: Die aktuelle Situation
wachung und Kontrolle von Sicherheitseinrichtungen, aber auch vorbeugender Brandschutz, Parkplatzüberwachung oder Kontrollen im Bereich der Arbeitssicherheit 139 . Die unter den Begriffen Betriebs- und Werkschutz zusammengefaßten Tätigkeiten unterscheiden sich somit in mehreren Hinsichten 140 . Sie umfassen Einwirkungen auf Sachen des Vertragspartners der Sicherheitsunternehmen, aber auch Tätigkeiten, bei denen der Betriebs-/Werkschützer mit Personen in Kontakt tritt und eventuell gewaltsame Rechtsdurchsetzungen in Betracht kommen. Solche Maßnahmen richten sich zum einen gegen Mitarbeiter des Betriebs, bleiben also regelmäßig, aber nicht notwendig im Rahmen arbeitsrechtlicher Vertragsbestimmungen. Dies ist freilich nicht immer unproblematisch und wird seit langem unter dem Stichwort „Betriebsjustiz" diskutiert 141 . Zum anderen können sich Maßnahmen des Betriebs-/Werkschutzes gegen Dritte richten, welche den betriebsinternen Regelungen regelmäßig nicht vertraglich unterworfen sind. Gemeinsam ist jedoch allen Tätigkeiten in diesem Aufgabenfeld, daß sie auf den privaten Grundstücken ihres Vertragspartners stattfinden. Nicht ebenso unproblematisch sind Objektschutzaufgaben im Hinblick auf öffentliche Gebäude. Für das Sicherheitsgewerbe handelt es sich um „normale" Fälle des privaten Objektschutzes, welche ebenfalls eine lange Tradition aufweisen. Berücksichtigt man den bereits bestehenden Anteil öffentlicher Auftraggeber am Gesamtumsatz des Gewerbes von 25% 1 4 2 sowie die Tatsache, daß auch heute noch zahlreiche Polizisten mit Objektschutzaufgaben befaßt sind - in Nordrhein-Westfalen über 1183 Stellen-Äquivalente, in Hessen ca. 600 1 4 3 - , so liegt die wirtschaftliche Bedeutung dieser Aufgabe auf der Hand. Objektschutzaufgaben übernehmen private Sicherheitsdienste mittlerweile für nahezu alle Typen von Verwaltungsgebäuden bis hin zu Polizeidienststellen144, dem Bundeskriminalamt 145 oder Asylbewerberunterkünften 146. Um privaten Schutz privater Rechtsgüter handelt es sich 139
Vgl. die weitere Tätigkeiten nennenden Darstellungen bei Kotier, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. Κ 3 ff.; Ehses, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. Ο 15 ff.; vgl. auch Seysen, KrimJ 1992, 4. Beih., S. 179, 183 ff. - Die Informationen der Bundesanstalt für Arbeit von 1981 stellen in ihrem Beitrag von 1981 noch ausschließlich auf diese Tätigkeiten ab, abgedruckt bei N.N., W+S-Information 1981, S. 69 ff. 140 Zum Trend des Outsourcing von Werkschutzdienstleistungen Bericht bei Bormann, protector 8/1993, S. 51, 52 ff. 141
Nur jede sechste betriebsinterne Straftat wird den Strafverfolgungsbehörden gemeldet: Feest/Krautkrämer, in: Kaiser/ Metzger-Pregizer, Betriebsjustiz, S. 130; dazu jünger Schuster, DSD 2/1988, S. 15, 18; ders., DP 1989, S. 5, 7. Landrock, DSD 2/1998, S. 21; Olschok, DSD 2/1997, S. 6; andere Angaben sprechen von 50%: Jeand'Heur, AöR 119 (1994), S. 107, 108. 1 43 Schaef, DSD 2/1998, S. 39. 1 44 Vgl. Glavic, DP 1994, S. 36, 39; Münster, Süddeutsche Zeitung v. 12./13. 8. 1995, S. 52: München. ™ Kirbach, Die Zeit v. 20. 5. 1998, S. 23. 146 Zur Bespitzelung von Asylbewerbern" zwecks Überführung von Schwarzarbeitern durch private Sicherheitskräfte in Landsberg /Oberbayern vgl. Schwaderer, Süddeutsche Zei-
Α. Die tatsächliche Situation
79
dabei insoweit, als die geschützten Rechtsgüter privatrechtlich konstituiert sind. Im Hinblick auf das Eigentum an öffentlichen Gebäuden ist dies weitgehend unproblematisch 147 . Schwieriger in der Zuordnung, aber seltener in der Praxis sind Tätigkeiten, die über den Objektschutz hinausgehen und sich auf Zugang und Nutzung öffentlicher Gebäude erstrecken. Zu nennen ist etwa der Einsatz eines privaten Wachmannes im Sozialamt Schorndorf an Zahltagen 148 . Juristisch geht es dabei um die umstrittene rechtliche Konstruktion des Hausrechts an öffentlichen Sachen149. Geklärt sein dürfte, daß Zugangskontrollen im Hinblick auf öffentlich-rechtlich geregelte Zugangsansprüche als Schutz öffentlicher Rechtsgüter zu qualifizieren sind und damit private und öffentliche Rechtsgüter parallel geschützt werden. Vergleichbare Tätigkeiten übernehmen private Sicherheitsunternehmen als Ordnungsdienst auf Messen, Konferenzen und sonstigen Veranstaltungen, also etwa Popkonzerten, politischen Versammlungen oder Fußballspielen150. Im Unterschied zum Betriebs- oder Werkschutz findet die Tätigkeit hier jedoch zum Teil im „öffentlichen" Raum statt, insbesondere bei der Regelung des Anfahrtverkehrs. Zudem steht der Kontakt zu und die Beobachtung von externen Personen im Vordergrund und insbesondere bei Massenveranstaltungen ist mit häufigeren Einsätzen wegen Störungen des Veranstaltungsablaufs zu rechnen. In diesem Aufgabenfeld sind 12% der Beschäftigten privater Sicherheitsunternehmen tätig 1 5 1 . Gewerblicher Transport, Verwahrung und Bearbeitung von Geld und wertvollen Gütern blicken auf eine lange Tradition zurück, die vor die Gründung des ersten Sicherheitsunternehmens zurückreicht 152 . Im Mittelpunkt des Interesses steht zumeist der Transport dieser Güter, was sich zum einen aus der hohen Schadensneigung erklärt - jährlich über 500 Raubüberfalle 153 auf Geld- und Werttransporte mit Schäden von 5 bis 20 Mio. D M 1 5 4 - , zum anderen aus der Bewaffnung des Geld- und Werttransportpersonals. Im Bereich der Aufbewahrung und Bearbeitung der Güter werden private Sicherheitsunternehmen zunehmend tätig und sehen hier aufgrund ihrer zumeist größeren Flexibilität, insbesondere der Möglichkeit, rund um die Uhr Banken und Geldausgabeautomaten versorgen zu können, einen Wachstumsbereich 155. tung v. 4. 1. 1996, S. 36; N.N., Frankfurter Rundschau v. 6. 1. 1996, S. 4; Kuhn/Mika, taz v. 3. 1. 1996; dies., taz v. 4. 1. 1996; Siegler, taz v. 5. 1. 1996, S. 3; N.N., taz v. 6. 1. 1996, S. 2. 147 Vgl. Papier, Recht der öffentlichen Sachen, S. 5 ff.; Papermann/Lohr/Andriske, Recht der öffentlichen Sachen, S. 15 ff. 148 K. Maier, DSD 3/1997, S. 15. 149 Vgl. Pappermann/Lohr/Andriske,
Recht der öffentlichen Sachen, S. 162 ff. m. w. N.
150 Vgl. dazu Kotier, in: HdBprSiG, Rn. Κ 28 ff. 151 BDWS, Stand 1. 3. 1998, ältere Daten bei Olschok-Tautenhahn, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. A 18. 152 Bachem, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. M 1 ff. 153 Bundeskriminalamt, zitiert nach Bachem, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. M 10. 154 Bachem, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. M 9. 155 N.N., W&S 1995, S. 280, 282.
80
§ 2: Die aktuelle Situation
Ebenfalls zu den klassischen Sicherheitsdienstleistungen werden die Tätigkeiten der Notruf- und Serviceleitstellen gerechnet 156. An Bedeutung haben sie jedoch erst mit den technischen Fortschritten im Bereich der elektronischen Sicherungstechnik 157 in den letzten Jahrzehnten gewonnen. Heute wird das Geschäft mit Alarmaufschaltung und Videobildübertragung als Markt der Zukunft betrachtet 158. Grund hierfür dürfte zum einen die Erschwerung der Alarmaufschaltung bei der Polizei sein, die diese wegen der hohen Fehlalarmquote von 95% betreibt 159 . Zum anderen werden elektronische Sicherungstechniken billiger und damit einer breiteren Bevölkerungsschicht zugänglich. Die privaten Alarmzentralen handeln im Alarmfall nach den vom Kunden festgelegten Anweisungen. Neben der Informierung einer Bezugsperson stehen so mehrere Möglichkeiten offen, insbesondere die Alarmverfolgung mit Schlüsseln und Plänen des Objekts und/oder die Alarmierung von Polizei bzw. Feuerwehr. Da die Polizei in Anbetracht der hohen Fehlalarmquote neuerdings verstärkt Polizeikosten für Einsätze bei Fehlalarmen erhebt 160 , ist die Alarmierung der Polizei nicht immer vom Kunden vorgesehen. Um so bedeutender wird die private Alarmverfolgung, bei der zwar regelmäßig keine Schußwaffen mitgeführt werden, jedoch ein Kontakt mit einem Straftäter einkalkuliert wird. Hier liegt also ein weites Anwendungsfeld der Jedermannrechte. Dennoch werden im Bereich des Objektschutzes tätige Bedienstete eingesetzt, die im Alarmfall von ihrer Kontrollroute abweichen 161 . Zu erwähnen sind schließlich Bewachungsfachkräfte im Einzelhandel, welche trotz ihrer Bezeichnung als Laden-Detektive zum Bewachungsgewerbe, nicht aber zum in Deutschland seit 1861 gewerblich betriebenen und bereits 1870 in der Gewerbeordnung geregelten Detekteigewerbe 162 gehören, da ihre Tätigkeit nicht auf die Ermittlung von Informationen gerichtet ist, sondern dem Schutz von Waren gegen Diebstahl dient 1 6 3 . Diese traditionellen Aufgabenfelder des privaten Sicherheitsgewerbes fügen sich weitgehend bruchlos in das Trennungsmodell ein. Ist die Zuordnung der Schutzzuständigkeit zu Privaten oder aber dem Staat nach der historischen Rechtsentwicklung vom Vorliegen eines öffentlichen Interesses abhängig, welches insbesondere nach der Anzahl der betroffenen Personen oder aber der Ausstrahlungswir156 Kötter, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. Κ 54 ff. 157 Dazu Merkel/Künzel/Brauer, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. Ρ 1 ff. 158 Walpurgis, zit. η. N.N., WIK 4/1995, S. 66. 159 Dazu Haeusler, DP 1995, S. 59 ff.; s.a. N.N., WIK 4/1994, S. 27 ff. 160 Für Niedersachsen beispielsweise 140,-DM pro eingesetztem Fahrzeug, Nr. 52.5.2.1 A11GO, Anlage 2; vgl. BayVGH, BayVBl. 1999, S. 277 ff.; Gusy, Polizeikosten, S. 17 ff. 161 Beispiel bei N.N., team, S. 24 f. 162 Überblick zum Detektivgewerbe bei Kocks, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. Ν 1 ff.; umfassend Peilert, Recht des Auskunftei- und Detekteigewerbes, S. 73 ff., dort, S. 537 ff., eine nach Tätigkeiten differenzierende Einordnung der Ladendetektive. 163 Vgl. OVG Lüneburg, GewArch 1999, S. 415 f.; BVerwG, GewArch 2000, S. 67; näher Krupp, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. Ν 35 ff.
Α. Die tatsächliche Situation
81
kung in die Öffentlichkeit bestimmt wurde, so liegt für die genannten Tätigkeiten eine Zuordnung zu privatem Schutz nahe. Die Aufgaben werden regelmäßig auf privaten Grundstücken wahrgenommen und betreffen fast ausschließlich solche Dritte, die in einer vertraglichen oder zumindest vorvertraglichen Vertrauensposition zum Rechtsgutsträger stehen. Tendenziell Gegenteiliges ließe sich für den Transport von Geld- und Wertgegenständen annehmen, da er im öffentlichen Raum erfolgt und dem Schutz bedeutender - und deswegen auch strafrechtlich geschützter - Rechtsgüter dient. Doch betreffen die Schutzhandlungen hier jeweils einem konkreten Rechtsgutsträger zugeordnete Interessen, und Maßnahmen zur Durchsetzung des Schutzes lassen sich in ihren Auswirkungen relativ zielgenau auf die Störer beschränken. Größere Probleme der Begründung privaten Schutzes nach dem Trennungsmodell bereiten vor dem Hintergrund seiner Motivation Ordnungsdienste bei Massenveranstaltungen, soweit sie sich auf den öffentlichen Raum erstrecken, sowie über den Objektschutz hinausgehende Schutzaufgaben an öffentlichen Gebäuden. Doch hat sich in diesen Bereichen die historisch gewachsene Aufgabenteilung zwischen Polizei und privaten Ordnungsdiensten erst in den letzten Jahren tendenziell zu den privaten Sicherheitsdiensten verschoben.
2. Neue Erscheinungsformen des Schutzes „privater" Rechts guter durch Private Dieser Tendenz einer schwerer werdenden Begründung privater Schutzzuständigkeiten aus einem fehlenden öffentlichen Interesse soll im weiteren anhand neuerer Tätigkeitsfelder privater Sicherheitsunternehmen sowie nicht gewerblicher privater Sicherheitsinitiativen nachgegangen werden.
a) Neue Tätigkeitsfelder privater Sicherheitsunternehmen Auch wenn das beträchtliche Wachstum der Sicherheitsbranche in den letzten Jahrzehnten insbesondere auch auf eine Ausweitung der traditionellen Tätigkeiten zurückzuführen ist, so haben sich die Unternehmen neue Tätigkeitsfelder erschlossen. Für die Sicherheitsbranche bedeutsam sind Beratungstätigkeiten 164 und im Zusammenhang mit der Informationstechnologie stehende Sicherheitsaufgaben 165. Diese werden hier nicht weiter verfolgt. aa) Tätigkeiten
in öffentlich
zugänglichen Räumen
Während Bewachungsfachkräfte im Einzelhandel in einem Unternehmen arbeiten und ihre Kenntnisse über Straftäter damit allein einem Unternehmen zugute 164 Dazu v. zur Mühlen, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. J 1 ff. 165 Dazu Siegesmund, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. I 51 ff.; N.N., W&S 1994, S. 800 ff. 6 Nitz
82
§ 2: Die aktuelle Situation
kommen, reagieren City-Detektive 166 auf die Tatsache, daß Ladendiebstähle in zunehmendem Maße nicht nur von Einzelfalltätern begangen werden, sondern durch organisierte Banden, welche zahlreiche Geschäftsleute gleichermaßen gefährden. Die City-Detektive arbeiten ladenübergreifend für mehrere Auftraggeber, vermitteln Informationen zwischen den Geschäften und observieren Tätertreffpunkte, Umschlagplätze und Warenlager der Diebstahlsszene. Damit werden sie im Gegensatz zu klassischen Ladendetektiven zunehmend auch im öffentlichen Raum tätig, wo insbesondere vorläufige Festnahmen gemäß § 127 I 1 StPO in Betracht kommen. Das höhere Konfliktpotential drückt sich auch darin aus, daß regelmäßig Doppelstreifen eingesetzt werden. Überwiegend wird eine Reduzierung der Ladendiebstähle festgestellt 167. Eine moderne Variante der City-Detektive stellen Motorradstreifen dar. Über die in diesen Fällen bezweckte Vermeidung von Ladendiebstählen gehen Initiativen von Geschäftsleuten hinaus, die private Sicherheitsdienste im (dem Gemeingebrauch gewidmeten) öffentlichen Straßenraum patrouillieren lassen. Die Privaten schützen hier keine Rechtsgüter der Auftraggeber, sondern sollen durch ihre Präsenz das Sicherheitsgefühl potentieller Kunden und damit das rechtlich nicht geschützte Umsatzinteresse erhöhen 168 . Beispielhaft sei die Friedrichstraße in Westerland erwähnt, wo Obdachlose und Punker im Auftrag der privaten Gewerbetreibenden von einer privaten Doppelstreife „in konsumorientierter freundlicher Weise" aufgefordert wurden, die Eingänge freizugeben, was innerhalb weniger Tage erfolgreich abgeschlossen war 1 6 9 . Noch weitergehend wurde ein Kaufhaus-Sicherheitsdienst in Hannover beauftragt, mittels Videokameras mutmaßliche Rauschgifthändler und -konsumenten rund um das Kaufhaus zu filmen, um sie danach festzunehmen und samt Videomaterial und Strafanzeige der Polizei zu übergeben 170 . Zwar können Private aufgrund von § 127 11 StPO Dritte auch dann vorläufig festnehmen, wenn strafrechtlich geschützte Rechtsgüter verletzt worden sind, die zu ihnen keinen Bezug haben 171 . Hier ist aber zumindest die rechtliche 166 Dazu Krupp, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. Ν 35 ff., insbes. 59 f.; Mauersberger, DSD 4/ 1999, S. 11, 12 f.; Kirbach, Die Zeit v. 20. 5. 1998, S. 23. 167 Für Bielefeld: N.N., Neue Westfälische v. 23. 7. 1997; für Osnabrück: N.N., Weserkurier v. 3. 3. 1997. 168 Beispiele: Berlin, Kurfürstendamm: Eick, cilip 51 (1995), S. 30 ff.; Schur, Lübecker Nachrichten v. 22. 11. 1997; Königsallee Düsseldorf: N.N., Sicherheitsberater 1994, S. 261 f.; Meiningen/Thüringen: N.N., Süddeutsche Zeitung v. 20. 11. 1996, S. 13; vgl. Kirbach, Die Zeit v. 13. 10. 1995, S. 64; Osnabrück: N.N., Weser-Kurier v. 3. 3. 1997; Frankfurt/M.: Biedermann, Frankfurter Rundschau v. 4. 10. 1993, S. 13. 169 Wackerhagen, W&S 1995, S. 833, 834. 170 Beispiel nach Weichen, in: Gössner, Mythos Sicherheit, S. 263. 171 Wendisch, in: Löwe/Rosenberg, StPO, § 127 Rn. 26; Boujong, in: KK-StPO, § 127 Rn. 20; Kleinknecht/Meyer-Goßner, StPO, § 127 Rn. 7; Roxin, Strafverfahrensrecht, § 31 Rn. 4; im vorliegenden Beispiel würde auch die den Tatbegriff am weitesten eingrenzende Auslegung von Marxen, in: FS Stree/Wessels, S. 705, 714 ff., zu einem Festnahmerecht führen.
Α. Die tatsächliche Situation
83
Zulässigkeit der Videoüberwachung zweifelhaft 172 . Unabhängig von der Frage nach einem Rechtsverstoß belegt dieses Beispiel, daß Private zunehmend im öffentlichen Raum polizeiähnliche Aufgaben übernehmen. Sie schützen die öffentlichen Rechtsgüter allerdings nicht im öffentlichen, sondern in ihrem privaten Interesse an einem „Umsatzklima", welches nicht durch mißliebige Personen beeinträchtigt werden soll 1 7 3 . Weniger problematisch ist demgegenüber der bereits erwähnte Einsatz von CityStreifen im Auftrag der Kommunen 174 . Aber auch hier gilt, daß Private ohne öffentlich-rechtliche Befugnisse den öffentlichen Raum bestreifen, um öffentliche Interessen wahrzunehmen. Die Entwicklung von einzelnen Auftraggebern zugeordneten und auf einzelnen Privatgrundstücken tätig werdenden Ladendetektiven und Objektschützern hin zu im öffentlichen Raum agierendem Sicherheitspersonal zeigt sich in zahlreichen Bereichen 175 . Zu nennen sind zunächst Tätigkeiten in Einkaufszentren und Ladenpassagen176. In beiden Fällen handelt es sich aus juristischem Blickwinkel vordergründig um mit den traditionellen Aufgaben in Kaufhäusern identische Tätigkeiten, insbesondere zur Durchsetzung des privaten Hausrechts. Dennoch werden diese Räumlichkeiten möglicherweise von der Bevölkerung im Gegensatz zu räumlich klarer abgegrenzten Geschäften als „öffentlich" qualifiziert, weil eine größere Anzahl an Personen und Interessen betroffen ist, was wiederum ein öffentliches Interesse und damit nach der Grundidee des Trennungsmodells eine Zuständigkeit der Polizei begründen könnte 177 . Weitgehend ausschließlich im öffentlichen Raum werden Wohngebietsstreifen tätig. Diese wegen möglicher Akzeptanzprobleme auch innerhalb der Sicherheitsbranche umstrittene Aufgabe 178 , welche derzeit unter einem Prozent des Umsatzes der Sicherheitsbranche ausmacht179, gilt dennoch als zukunftsträchtig, wenn die 172 Zu den Grenzen einer Videoüberwachung öffentlicher Zugangswege aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht BGH, NJW 1995, S. 1114 ff.; Kloepfer/Breitkreutz, DVB1. 1998, S. 1194 ff.; Porwitzki-Kotter, WIK 1 /1998, S. 12 ff.; Salvert, WIK 2/1997, S. 40. 173 Vgl. Voß, JhbRsozRth XV, S. 81, 99; ders., Ν KP 2/1993, S. 39 f.; Eick, cilip 51 (1995), S. 30, 34; schärfere Formulierungen bei Beste, in: Bussmann/Kreissl, Kritische Kriminologie, S. 311, 326. 174 BDWS, DSD 2/1997, S. 3,4; vgl. Voß, JhbRsozRth XV, S. 81,90: Frankfurt/M.; Wakkerhagen, DSD 2/1998, S. 4: private Fahrradstreifen im Auftrag der Stadt Darmstadt. 175 Nur hingewiesen sei auf die rechtswidrige Praxis der sog. Schwarzen Schatten, dazu LG Leipzig, NJW 1995, S. 3190; hierzu und zu anderen Formen privater Schuldeintreibung zivilrechtlich Edenfeld, JZ 1998, S. 645 ff.
176 In diesem Aufgabenbereich wünscht sich der Deutsche Städtetag ein stärkeres Zurückgreifen auf private Sicherheitsdienste, Witte, zit. n. Brauser-Jung, DP 1998, S. 326, 327. 177 Näher hierzu unten Β. V. sowie mit Untersuchungen aus Kanada im 2. Teil, § 3 D. II. 4. 178 Etwa Röder, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. L 63. 179 Olschok, DSD 2/1997, S. 6. 6*
84
§ 2: Die aktuelle Situation
Mitarbeiter einer auf die Besonderheiten des öffentlichen Raums bezogenen Qualifizierung unterzogen werden. Prominentestes Beispiel dieser Bewachungsaufgabe sind in Köln-Hahnwald eingesetzte Doppelstreifen - unbewaffnet, teilweise mit Hund - , welche fast rund um die Uhr patrouillieren 180 . Geschätzt werden mittlerweile 20 Anwohnerinitiativen in Deutschland, welche gegen einen Monatsbeitrag von etwa 100,- D M je Haushalt private Sicherheitsdienste beschäftigen 181. Bislang eine seltene Ausnahme stellt die Beschäftigung eines privaten Sicherheitsdienstes in einem als sozialer Brennpunkt bekannten Hochhausviertel von Dietzenbach durch die Vermieter dar 1 8 2 . Das Tätigwerden im öffentlichen Raum verhindert dabei nicht die Zuordnung zum privaten Schutz privater Rechtsgüter der Vertragspartner, sofern der öffentliche Raum allein zur Fortbewegung genutzt wird. Bedenken entstehen jedoch, wenn sich das Bewachungsgewerbe hier in einer die Polizei ergänzenden Rolle sieht 183 und dies von den Auftraggebern bezweckt wird. So haben beispielsweise Anwohner einen privaten Sicherheitsdienst mit der Beobachtung der Drogenszene beauftragt 184. Im Bereich der Eisenbahnen wurden traditionell vor allem die Sicherungsposten bei Gleisarbeiten tätig. Seit dem Übergang der Bahnpolizei auf den Bundesgrenzschutz übernehmen private Sicherheitsdienste zunehmend auch Sicherheits- und Ordnungsdienste. Hierzu hat die Deutsche Bahn AG eine eigene Bahn Schutz & Service GmbH gegründet, welche wegen Personalreserven der Bahn AG aus der Reichsbahn kostengünstiger arbeiten kann als private Sicherheitsunternehmen 185. Damit kommt es auf Bahnhöfen zu einem Nebeneinander mehrerer Sicherheitsakteure 186 : Polizei, Bundesgrenzschutz, Mitarbeiter der Bahnschutz-Gesellschaft sowie anderer privater Sicherheitsunternehmen. Der private Rechtsgüterschutz betrifft hier zwar immer noch privatrechtlich geregelte Rechtsverhältnisse, er berührt jedoch das öffentliche Interesse in größerem Maße als im Rahmen traditioneller Betriebsschutzaufgaben 187. Zum einen handelt es sich um jedermann zugängliche und in diesem Sinne öffentliche Räume, zum anderen können sich Vertragspartner
180 Lüttke, Polizeiruf 110 5/1993, S. 31, 33; N.N., Der Spiegel 46/1996, S. 30, 31. 181 Lüttke, Polizeiruf 110 5/1993, S. 31, 33; vgl. auch Alsen, Die Welt v. 21. 1. 1994; Klingst, Die Zeit v. 9. 4. 1993, S. 13, 14; Olschok, DSD 16 (1995), S. 25, 27; F. Huber, Gefahrenabwehr, S. 35. 182 Feldmann, Frankfurter Rundschau v. 3. 7. 1996, S. 22. 183 Röder, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. L 54. 184 Kölner Stadtanzeiger v. 29. 12. 1994, S. 12, zit. n. Langenbrink, NWVB1. 1995, S. 285, 289. 185 Vgl. N.N., Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung v. 4. 5. 1997; Krakow, in: Weiß/ Plate, Privatisierung, S. 63 ff. 186 vgl. für Frankfurt/M. Beste, in: Gusy, Privatisierung, S. 180, 181 ff. 187 Nach Krakow, zitiert von N.N., Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung v. 4. 5. 1997, wurden allein im Februar 1997 im Frankfurter Hauptbahnhof durch Mitarbeiter des privaten Bahnschutzes 23.000 (!) Hausverweise und Bahnhofsverbote ausgesprochen und durchgesetzt.
Α. Die tatsächliche Situation
85
der Bahn AG aufgrund deren faktischen Monopols den privaten Sicherheitsmaßnahmen nicht durch Bevorzugung eines Wettbewerbers entziehen. Schwierigkeiten einer Zuordnung zum Schutz privater Rechtsgüter ergeben sich schließlich bei Sicherungsaufgaben in Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs. Hierbei handelt es sich nicht allein um jedermann zugängliche und insofern öffentliche Räume, ihr Nutzungsregime ist zudem aufgrund des Auftrags zur kommunalen Daseinsvorsorge öffentlich-rechtlich überlagert. Dennoch sind die zu schützenden Rechtsgüter der Verkehrsbetriebe traditionell privatrechtlich ausgestaltet, im Sinne des Trennungsmodells handelt es sich damit um den Schutz privater Rechtsgüter 188. Friktionen ergeben sich jedoch aus dem Umstand, daß die privaten Sicherheitskräfte nicht allein zum Schutz der Einrichtungen und Gegenstände der Verkehrsbetriebe, der Hausordnung sowie der Fahrpreisansprüche eingesetzt werden, sondern insbesondere zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Fahrgäste 189. Deren Ängste beziehen sich auf ihre Individualrechtsgüter, welche die Sicherheitskräfte im Wege der Nothilfe verteidigen sollen. Damit geht es um den Schutz von privat- und öffentlich-rechtlich geschützten Interessen nicht nur des Auftraggebers, sondern einer großen Anzahl von Nutzern, so daß nach der Idee des Trennungsmodells eine Zuweisung der Schutzaufgabe zum Staat naheliegt. Faktisch ist dieser Aufgabenbereich in den letzten Jahren stark angewachsen190. Im Berliner U-Bahnbereich waren 1993 350 Wachmänner und -frauen mit 90 Hunden, im Frankfurter U-Bahnbereich werden 150 Personen eingesetzt191, nach 21 Uhr wird jede, vorher jede zweite Frankfurter S-Bahn von Mitarbeitern privater Sicherheitsunternehmen begleitet 192 . Die Konfliktträchtigkeit der Aufgabe zeigt sich am Beispiel der Berliner Verkehrsbetriebe, in deren Bereich innerhalb der ersten neun Monate des Jahres 1992 über 167.000 Einsätze gemeldet wurden 193 oder aber in Hannover, wo innerhalb eines Jahres 228 vorläufige Festnahmen erfolgten, allerdings „nur" 90 Strafanzeigen /-anträge gestellt wurden 194 . Im Gegensatz zum Großteil der Mitarbeiter privater Sicherheitsunternehmen werden die im öffentlichen Personennahverkehr eingesetzten Ordnungsdienste regelmäßig geschult. Für Frankfurt/M. werden 470 Stunden Vorbereitung und weitere 426 Stunden dienstbegleitende Nachschulung angegeben195.
iss Peilen, DVB1. 1999, S. 282, 285. 189 N.N., Sicherheits-Berater 1994, S. 354 ff. 190 Hugo, WIK 4/1995, S. 19, 20. 191 Klingst, Die Zeit v. 9. 4. 1993, S. 13, 14. 192 Kurth, DSD 2/1998, S. 7, 9. 193 Darunter: 35.300 Fälle des Beförderungsausschlusses wegen Alkoholgenusses, 46.000 Hausverweise, 25.000 Ordnungsrufe gegenüber Obdachlosen, 15.653 Fälle des Einschreitens gegen lautstarke Jugendliche, 38 Fälle des unerlaubten Mitführens von Schußwaffen, 6439 mal wurde gegen Raucher, 1637 mal gegen Musikanten, 3115 mal gegen Bettler eingeschritten, Zahlen nach Pütter, cilip 43 (1992), S. 32, 35; vgl. dazu auch Beste/Voß, in: Sack/Voß/ Frehsee/Funk/Reinke, Privatisierung, S. 219, 228 ff. 194 Hugo, WIK 4/1995, S. 19, 20.
86
§ 2: Die aktuelle Situation
Nicht immer werden private Sicherheitsunternehmen mit der Bestreifung öffentlicher Räume beauftragt, teilweise werden die Kommunen selber tätig 1 9 6 . Eine Mischform stellt die Gründung einer privaten Gesellschaft durch die Stadt Dresden dar. In Absprache mit der Polizei übernehmen die Mitarbeiter dieser Gesellschaft nicht-hoheitliche Sicherheits- und Kontrollaufgaben im öffentlichen Raum, die Stadt handelt als öffentlicher Auftraggeber und - mittelbar - als privater Auftragnehmer 197 . Mit dem Vordringen privater Sicherheitskräfte in den öffentlichen Raum korreliert regelmäßig eine Privatisierung staatlichen Schutzes im weiten Sinne der Entstaatlichung. Auch ohne eine rechtliche Umwidmung von öffentlichen in private Rechtsgüter weitet sich das Tätigkeitsfeld der Privaten zu Lasten des Staates aus. Aus der Perspektive des Trennungsmodells ist Hintergrund dieser Entwicklung der Umstand, daß Interessen als private und öffentliche Rechtsgüter konstituiert sein können und das Interesse damit privatem und staatlichem Schutz zugeordnet ist 1 9 8 . Das Vordringen der Privaten resultiert damit zumindest auch aus dem Umstand, daß die Polizei den ihr eingeräumten Ermessensspielraum dazu nutzt, sich aus dem präventiven Schutz der öffentlichen Rechtsgüter in einem Maße zurückzuziehen, das die privaten Rechtsgutsträger zu verstärkten Bemühungen um einen eigenen Schutz veranlaßt. Auch wenn das Trennungsmodell nicht verletzt wird, weil weiterhin Private für den Schutz privater Rechtsgüter und der Staat für den Schutz öffentlicher Rechtsgüter zuständig sind, kommt es zu einer Privatisierung, weil das dem Rechtsgut zugrundeliegende identische Substrat nun als privates und nicht mehr als öffentliches Rechtsgut geschützt wird. bb) Eigensicherungsverpflichtungen Die genannten Tätigkeiten der privaten Sicherheitsunternehmen gehen auf die Initiative privater oder öffentlicher Auftraggeber zurück, welche ihre privaten Rechtsgüter geschützt wissen wollen. Dieses freiwillige Schutzbegehren fehlt bei einer gesetzlichen EigensicherungsVerpflichtung. Praktische Bedeutung199 erlangten dabei insbesondere Eigensicherungspflichten der Flughafenunternehmer und Luftfahrtunternehmen nach §§ 19b, 20a LuftVG 2 0 0 , welche nur durch den Einsatz 195 N.N., WIK 5/1993, S. 31, 32; vgl. zur Situation in Frankfurt auch Bernhardt, DP 1994, S. 55, 56. 196 Dazu kritisch H.-M. Zimmermann, DP 1994, S. 60, 62. 197 Dazu Krölls, GewArch 1997, S. 445,447; ders., GewArch 1995, S. 129, 130, 135; Peilen, DVB1. 1999, S. 282, 285 f.; Wadle, DSD 2/1997, S. 15, 16; vgl. N.N., Der Spiegel 22/ 1994, S. 34 ff. 198 Vgl. oben § 1 B. III. 1. 199 Weitere Beispiele und ausführliche, teilweise abweichende Darstellung des Folgenden bei Schnekenburger, Rechtsstellung, S. 95 ff. 200 Dazu ausführlich Czaja, Eigensicherungspflichten, passim; Überblick bei Bracher, Gefahrenabwehr, S. 47 f.
Α. Die tatsächliche Situation
87
von Sicherheitspersonal erfüllbar sind. Daneben sind das Betreiben eines Kernkraftwerks, das Befördern, Aufbewahren, Bearbeiten, Verarbeiten und sonstige Verwendungen von Kernbrennstoffen nach §§ 4 Π Nr. 5, 6 Π Nr. 4, 7 Π Nr. 5, 9 Π Nr. 5 AtG nur zulässig, wenn der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter gewährleistet ist. Vergleichbares gilt nach der Störfall-Verordnung für den Schutz sicherheitstechnisch bedeutsamer Anlagenteile, § 4 Nr. 5 i.V.m. § 3 Π Nr. 3 der 12. BImschV 201 . Auch diese Pflichten sind bei praxisnaher Betrachtung allein durch den Einsatz eines Werkschutzes erfüllbar 202 . Im Atomrecht kann der Einsatz eines mit Faustfeuerwaffen bewaffneten Werkschutzes zur Auflage im Rahmen einer atomrechtlichen Genehmigung zum Betrieb eines Kernkraftwerks gemacht werden 203 . Im Unterschied zu den traditionellen Formen des Werkschutzes besteht damit für bestimmte Industrieanlagen eine öffentlichrechtliche Verpflichtung zum Werkschutz. Diese öffentlich-rechtliche Verpflichtung spiegelt ein öffentliches Interesse am Schutz der genannten Anlagen und Verhaltensweisen vor Angriffen Dritter wieder und konstituiert damit ein öffentliches Rechtsgut. Nichtsdestotrotz hat der Gesetzgeber allein die Schutzverpflichtung der Privaten öffentlich-rechtlich ausgestaltet. Die zu schützenden Anlagen bzw. Verhaltensweisen bleiben privatrechtlich konstituierte Rechtsgüter, so daß sich die privatrechtliche Ausgestaltung der Schutzaktivitäten in das Trennungsmodell einfügen läßt 2 0 4 . Dennoch wird eine Verpflichtung zur privaten Gefahrenabwehr teilweise für unzulässig gehalten 205 . Auf der Grundlage des Trennungsmodells lassen sich die Bedenken dahingehend zusammenfassen, daß der Gesetzgeber mit der Eigensicherungsverpflichtung einen Schutzbedarf für die betroffenen Rechtsgüter öffentlichrechtlich anerkenne und dementsprechend selber schützen müsse 206 . Dem wird entgegengehalten, daß allein das Bestehen einer Atomanlage noch keine konkrete Gefahr, etwa eines terroristischen Anschlags, begründe und die Polizei schon aus Kapazitätsgründen nicht umfassend Gefahrenvorsorge betreiben könne. Hinzu 201 Dazu Roßnagel, in: Koch/Scheuing, GK-BImschG, § 5 Rn. 271 ff.; Wietfeldt/Czajka, in: Feldhaus, BImschR II, Β 2.12, § 4 Rn. 67; Hansmann, in: Landmann / Rohmer, UmwR II, 2.12, § 3 Rn. 19, § 4Rn. 8, jeweils m. w. N. 202 Wietfeldt/Czajka, in: Feldhaus, BImschR II, Β 2.12, § 4 Rn. 67; Roßnagel, in: Koch/ Scheuing, GK-BImschG, § 5 Rn. 275. 203 BVerwGE 81, 185 ff. = DVB1. 1989, S. 517 m. abl. Anm. Bracher, DVB1. 1989, S. 520 ff.; zustimmend dagegen Tiinnesen-Harmes, in: Himmelmann/Pohl/Tünnesen-Harmes, HdBUmwR, B.6 Rn. 36; vgl. auch BVerwG, NWVB1. 1993, S. 46 ff., zur Anordnung, den Objektsicherungsdienst eines Forschungszentrums, in dem eine kerntechnische Anlage betrieben wird, mit Gaspistolen auszustatten; ferner Ehlers, in: FS Lukes, S. 337, 346 ff. 204 So implizit BVerwG, DVB1. 1989, S. 517, mit dem Hinweis, daß es nicht um die Übertragung polizeilicher Aufgaben gehe, sondern allein um eine Sicherung bis zum Eintreffen der Polizei, ebd., S.518. 205 Insbesondere Bracher, Gefahrenabwehr, S. 154 ff.; ders., DVB1. 1989, S. 520, 521; vgl. zum Ganzen unten 3. Teil, § 6 Α. II. 4. 206 Vgl. auch die scharfe Kritik von Roßnagel, ZRP 1983, S. 59, 62 ff.
§ 2: Die aktuelle Situation
88
komme eine größere Sachnähe und Sachkompetenz der Eigensicherungsverpflichteten 207 . Lediglich hingewiesen sei auf weitere Probleme im Hinblick auf die Zulässigkeit eines Gebrauchmachens von den Jedermannrechten bei staatlicher Veranlassung des Schutzes sowie auf die Möglichkeit einer Verpflichtung zum nicht ungefährlichen Gebrauchmachen von den Jedermannrechten 208. cc) Weitergehende
Überlegungen
Eine weitere Ausdehnung der Tätigkeitsfelder privater Sicherheitsdienste ist zwar auch innerhalb des Sicherheitsgewerbes nicht unumstritten, dennoch zielt der BDWS auf eine Übernahme zahlreicher Tätigkeiten, welche bisher von der Polizei (mehr oder weniger intensiv) wahrgenommen wurden. Dabei handelt es sich nicht durchweg um öffentlich-rechtlich ausgestalteten Rechtsgüterschutz, vielmehr fallen zahlreiche Tätigkeiten aufgrund der Anerkennung der geschützten Interessen als private und öffentliche Rechtsgüter auch in den Bereich des Schutzes privater Rechtsgüter. Dies erschwert eine Zuordnung der Tätigkeiten. Beispielhaft sei die Begleitung von Schwertransporten genannt, an der sowohl ein öffentlich-rechtlich konstituiertes Interesse als auch ein privates Interesse des Transporteurs bestehen. Eine Einteilung läßt sich daher am ehesten nach dem - teilweise für die Zukunft nur zu vermutenden - Rechtsregime des Tätigwerdens vornehmen 209. Als angestrebte oder auszubauende privatrechtliche Tätigkeitsfelder werden genannt: • verstärkte U-, S-Bahn-Begleitung, • Absicherung von Ladenpassagen, • Wohnviertelbestreifiing, • Veranstaltungsschutz, • verstärkte Sicherung staatlicher Objekte, • Sicherheitsdienste in Schulen, Krankenhäusern, Bädern, • Bewirtschaftung öffentlicher Erholungsgebiete (Parks, Badeseen, Erholungsgebiete),
207 Dazu BVerwG, DVB1. 1989, S. 517 f.; Ehlers, in: FS Lukes, S. 337, 347; Bracher, DVB1. 1989, S. 520,521. 208 Dazu Gramm, Privatisierung, Kap. 5.2.7, S. 411 ff.; Ehlers, in: FS Lukes, S. 337, 348; Roßnagel, ZRP 1983, S. 59,61. 209 Vgl. die teilweise detaillierten Aufgabenkataloge bei BDWS, DSD 2/1997, S. 3, 4; Wackerhagen/Olschok, in: Ottens/Olschok/Landrock, Europa, Rn. C 58; Olschok, DSD 2/ 1997, S. 6, 8 f.; ders., in: Pitschas/Stober, Quo vadis, S. 91, 102; Steinke, W&S 1995, S. 121 ff.; Glavic, in: ders., HdBprSiG, Rn. Ζ 27; Theiß, W&S 1995, S. 838; Neuhardt, DSD 14 (1994), S. 11 f.; Blum, W+S-Information 1985, S. 11; kritisch Lutz, Verhältnis, S. 4 f.; s.a. Schnekenburger, Rechtsstellung, S. 49.
Α. Die tatsächliche Situation
89
• Begleitung von Schwertransporten, • Begleitung von Geldtransporten der Bundesbank, • Aufnahme und Beweissicherung von Bagatellfällen 2 1 0 , • Gebühreneinnahmen an zukünftigen „Maut-Stationen". Demgegenüber dürfte in folgenden angestrebten Tätigkeitsfeldern von einem öffentlich-rechtlichen Tätigwerden auszugehen sein: • Gefangenentransporte, • Abschiebung abgelehnter Asylbewerber, • Einziehung und Entstempelung von Führerscheinen, • Überwachung des ruhenden Verkehrs, • Geschwindigkeitsmessungen und Rotlichtüberwachung, • Überwachung der Preisauszeichnung, ζ. B. auf Wochenmärkten. Bei zahlreichen dieser Tätigkeiten wird eine Übertragung auf Private zur Entlastung der Polizei auch von staatlicher Seite angedacht. Betroffen sind insbesondere die Begleitung von Schwertransporten, Veranstaltungsschutz und die Sicherung im öffentlichen Personennahverkehr 211. Schließlich ist auf die in den Stichworten „Absicherung von Ladenpassagen" und „Wohnviertelbestreifung" mitgedachten Tätigkeiten hinzuweisen, welche sich aus Privatisierungen des öffentlichen Raums, genauer: aus der Entwidmung dem Gemeingebrauch gewidmeter Flächen, ergeben können. In den Blick genommen werden hier insbesondere Parkanlagen, Fußgängerzonen sowie Grundstücke, die traditionell zum Bahnhofsbereich zählen (Bahnhof, Vorplatz, unterirdische Zugänge) 212 , um sie einem Nutzungsregime privater Pächter zu überantworten 213.
210 Dazu befürwortend Kanther, zit. η. N.N., WIK 6/1994, S. 24; ablehnend Kniola, ADAC motorweit 3/1997, S. 48; Blum, protector 8/1993, S. 11, 18; Κ Redeker, DP 1997, S. 75 f. 211 Vgl. nur Rupprecht, zit. η. N.N., WIK 4/1995, S. 12, 13, i.ü. oben bei den einzelnen Tätigkeitsfeldern. 212 Dazu Wolf, Recht des Lebens auf der Straße, S. 19, 21 ff.; vgl. BVerwG, UPR 1997, S. 150. 213 Überblick zuletzt bei Krölls, NVwZ 1999, S. 233; Wolf, Recht des Lebens auf der Straße, S. 19 f., 28 ff.; vgl. auch Beste/Voß, in: Sack/Voß/Frehsee/Funk/Reinke, Privatisierung, S. 219, 230 f.; zum Frankfurter Verein „Zeil aktiv e.V." K. Zimmermann, Süddeutsche Zeitung v. 22./23. 6. 1996, SZ am Wochenende, S. III; vgl. auch Haarhoff, taz Hamburg v. 17. 7. 1997, S. 17: Überlegungen der Hamburger SPD, den Sternschanzenpark zu privatisieren, um über privates Hausrecht die Drogenszene zu vertreiben.
90
§ 2: Die aktuelle Situation
b) Nicht-gewerbliche private Sicherheitsaktivitäten Private Sicherheitsunternehmen werden mit Gewinnerzielungsabsicht tätig. Daneben bestehen jedoch zahlreiche ehrenamtliche Initiativen, sei es aus allgemeiner Sorge um die Sicherheit, sei es aufgrund fehlender finanzieller Mittel, um gewerbliche Sicherheit zu bezahlen. Interessanter als Maßnahmen des individuellen Eigenschutzes - wie etwa das Türschloß - sind dabei kollektive Tätigkeiten. Sie lassen sich idealtypisch in vier Kategorien einteilen: (1) Zunächst können Bürger in Anlehnung an das amerikanische Konzept des Community Policing „offene Augen und Ohren" praktizieren 214, also Rechtsgutsverletzungen oder -gefährdungen wahrzunehmen versuchen, um dann staatliche Hilfe herbeizuholen. Hierbei wird bewußt auf die private Durchsetzung der Rechtsordnung verzichtet. Ebenfalls „eingriffsneutral" verhalten sich im Vorfeld von Gefahren tätig werdende Initiativen, welche zum Beispiel auf Sicherheitsprobleme oder die sozialen Voraussetzungen von Kriminalität aufmerksam machen wollen. (2) Sodann können Private aufgrund eigener Initiative zum Schutz ihrer privaten Rechtsgüter einschreiten. (3) Über den privaten Schutz privater Rechtsgüter gehen Versuche hinaus, die Rechtsordnung insgesamt aufrechtzuerhalten. Sie erfassen auch die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Private setzen sich an die Stelle der Polizei. (4) Schließlich können Private versuchen, eine selbstdefinierte öffentliche Ordnung durchzusetzen. Eine Zuordnung der in den letzten Jahren zunehmenden privaten Sicherheitsbemühungen zu diesen Kategorien fällt jedoch schwer, da Anspruch und Wirklichkeit nicht selten auseinanderfallen. Die Einteilung zeigt aber, daß das private Engagement nicht immer auf den Schutz privater Rechtsgüter abzielt. Dennoch vollzieht es sich auf der Grundlage des Privatrechts. Friktionen mit dem Trennungsmodell sind damit vorgezeichnet. In den unproblematischen ersten Bereich gehören Präventionsvereine, welche zum Beispiel in Osnabrück in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Behörden Präventionsforschung betreiben und unterstützen, Opferbefragungen durchführen, soziale Brennpunkte untersuchen, Integrationsprojekte unterstützen etc. 215 . Diese Tätigkeiten zielen auf eine Verbesserung der öffentlichen Sicherheit. Sie verbleiben jedoch im Vorfeld der Gefahrenabwehr, ein unmittelbarer Schutz öffentlicher Rechtsgüter erfolgt nicht, so daß eine Spannung zum Trennungsmodell nicht auftritt.
214 Dazu näher unten 2. Teil, § 3 B. III. 1. 215 Hunsicker, Kriminalistik 1998, S. 590 ff.; zu Gießen Schneider/Stock, vention.
Kriminalprä-
Α. Die tatsächliche Situation
91
Dies kann bei Nachbarschaftsinitiativen, welche aufgrund freiwilligen Zusammenschlusses - zumeist nächtliche - Patrouillien innerhalb des eigenen Wohngebietes durchführen, anders sein 216 . Soweit die Mitglieder allein einen Schutz ihrer privaten Rechtsgüter bezwecken und im Falle einer Gefahr oder eines Gefahrenverdachts die Polizei rufen, fügt sich ihre Tätigkeit in das Trennungsmodell ein. Die Grenzen zu Bürgerwehren im Sinne der dritten oder vierten der genannten Kategorien sind allerdings fließend 217 , zumal die Maßstäbe des privaten Handelns zumeist von demjenigen der Polizei abweichen. So melden die freiwillig patrouillierenden Bürger von Großhansdorf bereits nächtlich parkende Autos „mit drei dunkelhaarigen Männern" der Polizei 218 . Eine Gemengelage von privatem und öffentlichem Rechtsgüterschutz findet sich auch im Beispiel Dietzenbach bei Frankfurt. Der örtliche Verein mit 30 Mitgliedern, von denen 15 aktiv mitarbeiten, bestreift nachts - teilweise mit Hund - ein sozial schwaches Hochhaus viertel 219 . Schließlich sei eine Inititiative von 42 Männern aus Wilhelmshorst/Brandenburg angeführt, deren nächtliche Streifen nach eigenem Bekunden „die älteren Bürger, die Frauen, die Geschäfte und das kommunale Eigentum (!)" schützen wollen 220 . Während diese Bürger ihre Aufgabe im Beobachten sehen und daher mit Funk, aber unbewaffnet agieren, haben sich Bürger in Jacobsdorf/Brandenburg mit Knüppeln bewaffnet. Hier soll der Rechtsgüterschutz offensichtlich eigenhändig durchgesetzt werden 221 . Bemühungen um privaten Rechtsgüterschutz werden vollends zum sekundären Ziel bei Bürgerwehren in Brandenburg, die an der Grenze zu Polen illegale Grenzübertritte verhindern wollen 222 . Schließlich sei auf Versuche hingewiesen, das amerikanische Modell der Guardian Angels zu übernehmen 223. Die genannten Beispiele unbezahlten und kollektiven Rechtsgüterschutzes durch Private gehen auf die Eigeninitiative der Bürger zurück. Hiervon zu unterscheiden sind staatlich veranlaßte Sicherheitsbemühungen der Bürger. Im Gegensatz zu den Fällen der Beleihung oder der Verwaltungshilfe, in denen die Bürger in den staatlichen Handlungsraum einbezogen und öffentliche Rechtsgüter geschützt werden, handeln die Privaten hier privatrechtlich. Nach dem Trennungsmodell hieße dies, daß sie allein private Rechtsgüter schützen. Darf der Staat aber allein im öffentlichen Interesse handeln, so wird die staatliche Veranlassung des privaten Rechtsgü216 Überblick bei N.N., Der Spiegel 46/1996, S. 30 ff.; vgl. neben den folgenden Nachweisen noch Riedl, Süddeutsche Zeitung v. 22./23. 6. 1996, S. 37: Aufruf zur Bürgerwehr in Würzburg. 217 Krit. - auch zu den rechtlichen Grenzen von Bürgerwehren - Ostendorf, RuP 1982, S. 139 ff.; J. Stock, Kriminalistik 1994, S. 183, 190. 218 Maußhardt, Die Zeit v. 26. 7. 1996, S. 53. 219 Feldmann, Frankfurter Rundschau v. 2. 9. 1993, S. 25. 220 Frings, Frankfurter Rundschau v. 29. 9. 1993, S. 6. 221 Frings, Frankfurter Rundschau v. 29. 9. 1993, S. 6. 222 Mück-Raab, Süddeutsche Zeitung v. 27. 3. 1998, S. 10. 223 Dazu Wilmes, cilip 43 (1992), S. 38 ff.; Schwindt, Kriminalistik 1992, S. 651 ff.; näher zum amerikanischen Vorbild unten 2. Teil, § 3 B. III. 2.
92
§ 2: Die aktuelle Situation
terschutzes ebenso problematisch wie im Rahmen der gesetzlichen Eigensicherungsverpflichtungen. Während es den veranlassenden staatlichen Organen um den Schutz öffentlicher Rechtsgüter gehen sollte, sind die veranlaßten Privaten allein zum Schutz privater Rechtsgüter berufen. Diese Friktion wird zumeist dadurch überspielt, daß solche Interessen geschützt werden, welche sowohl als private als auch als öffentliche Rechtsgüter konstituiert wurden 224 . Zurückverfolgen läßt sich die Aktivierung der Bürger durch den Staat zur Gewährleistung von Sicherheit auf die staatliche Unterstützung oder Anordnung von Nachtwachen und Sicherheits-Vereinen zur Aufrechterhaltung der örtlichen Ordnung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 225. Mit der Monopolisierung der Polizeigewalt traten solche Formen privater Sicherheitsgewährleistung jedoch in den Schatten des sich für Sicherheit und Ordnung nebst ihrer näheren Definition zuständig erklärenden Staates. Lediglich in der Revolutionszeit 1918/19 wurden Bürgerwehren teilweise von staatlichen Organen gefördert 226. So erscheint heute das Verhalten einer sächsischen Gemeinde, die den örtlichen Karateklub anheuerte und für nächtliche Patrouillen einen Zuschuß in die Vereinskasse zahlt, zumindest bizarr 227 . Bedeutendstes Projekt war der in Brandenburg mittlerweile abgeschlossene Modellversuch „Sicherheitspartner in Brandenburg" 228, welcher vom Innenministerium in Zusammenarbeit mit der Polizei initiiert wurde und heute in 70 Orten Brandenburgs fortgeführt wird 2 2 9 . Die Zielsetzung dieses Modells ist der bayerischen und sächsischen Sicherheitswacht vergleichbar. Auch in Brandenburg soll die Bevölkerung insbesondere durch ihre Präsenz auf den Straßen in kriminalitätsbezogene Arbeit einbezogen werden, um einerseits das Sicherheitsgefühl zu erhöhen, andererseits potentielle Straftäter abzuschrecken. Als weiteres Motiv dürfte hinzukommen, bestehende Bürgerwehren über das Konzept der Sicherheitspartner in einen staatlichen Zusammenhang einzubinden und derart zu mäßigen 230 . Während sich in Bayern und Sachsen die Angehörigen der Sicherheitswachten freiwillig melden und sodann hoheitlich bestellt werden, werden in Brandenburg die Sicherheitspartner auf sog. Sicherheitsversammlungen, Vollversammlungen der Einwohner einer Gemeinde, gewählt. Grundlage des Modellversuchs war die Idee des ,»runden Tisches". Nicht immer fanden sich jedoch genügend Freiwillige, teilweise waren bei den Bürgerversammlungen mehr Medienvertreter als Bürger zugegen. 224 Dazu oben § 1 B. III. 225 Mehrere Quellen von 1830, 1833 bei v. Rönne/Simon, Polizeiwesen I, S. 83 f. 226 Vgl. dazu Leßmann-Faust, PFA 4 / 1 9 9 7 - 1 /1998, S. 9, 12 f. 227 N.N., Der Spiegel 46/1996, S. 30, 31. 228 Die folgende Darstellung speist sich aus Bbg. Ministerium des Innern, Sicherheitspartner; Korfes/Sassar, in: Ortner/Pilgram/Steinert, Null-Lösung, S. 211 ff.; Newiger, A K P 4 / 1995, S. 37 ff.; dies., cilip 51 (1995), S. 50 ff.; W. Müller, RuP 1995, S. 106 ff.; Lentze, der überblick 1 /1998, S. 31 f.; Menge, Die Zeit v. 25. 8. 1995, S. 13. 229 Peilert, Kriminalistik 1999, S. 616,618. 230 Vgl. Mück-Raab, Süddeutsche Zeitung ν. 21. 3. 1998, S. 10.
Α. Die tatsächliche Situation
93
Unter Leitung des Revierpolizisten erörtern die Bürger auf diesen Versammlungen die Sicherheitslage, erhalten Tips zur Eigensicherung und werden über das geplante Modell informiert, um schließlich Bürger ihres Vertrauens zu Sicherheitspartnern zu wählen. Diese Legitimation soll die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhen. Da die Sicherheitspartner aber Bürger unter Bürgern bleiben sollen, werden ihnen keine hoheitlichen Befugnisse übertragen. Dementsprechend bestehen keine besonderen rechtlichen Regelungen, den Privaten stehen allein die Jedermann-Notrechte zur Verfügung. Unterstützt werden die privaten Streifen der Sicherheitspartner von der Polizei insbesondere durch eine rechtliche und taktische Einweisung. Sie werden mit einem Mobiltelefon ausgestattet, auf Antrag auch mit Taschenlampe, Kamera etc., und erhalten auf Antrag für 10-15 Stunden Tätigkeit pro Monat eine Entschädigung von 50,-DM sowie einen Schutz gegen alle Haftpflicht- und Körperschadensfälle zugesichert. Die Auswertung des Modellversuchs zeigte, daß das Modell auf dörfliche Verhältnisse zugeschnitten ist, in denen Nachbarschaftshilfe mangels Anonymität noch realistisch erscheint. Schon in einer Stadt mit 20.000 Einwohnern bestanden Rekrutierungsprobleme. In erster Linie richteten sich die Bemühungen der Sicherheitspartner auf kommunale Probleme wie Ausländerintegration, Straßenbeleuchtung etc. Umgekehrt wird auch von fremdenfeindlichen Motivationen berichtet 231 . In den Versuchsgemeinden ist zumeist ein Rückgang an Straftaten zu verzeichnen. Zusammenfassend zeigen auch die an Anzahl zunehmenden nichtgewerblichen privaten Sicherheitsbemühungen Brüche im Trennungsmodell. Immer häufiger zielen diese Initiativen auf den Schutz dem Staat zugeordneter Rechtsgüter. Dies mag man als zivilgesellschaftliches Engagement für das „Öffentliche" ansehen und begrüßen. Nahe liegen jedoch auch Erklärungen, die in dieser Entwicklung eine Reaktion auf dahinschwindendes Vertrauen der Bürger in die staatliche Fähigkeit, ihm zugeordnete Aufgaben zufriedenstellend zu erfüllen, sehen, und die Gefahr eines „neuen Vigilantismus" konstatieren 232.
I I I . Zusammenfassung und Bezug zur Privatisierungs- und Steuerungsdiskussion In § 1 wurde entwickelt, daß sich historisch eine am Vorliegen eines öffentlichen Interesses orientierte, aber nicht trennscharfe Abgrenzung zwischen öffentlicher und privater Sicherheit ergeben hat, welche sich rechtlich als Trennungsmodell beschreiben läßt. Die Analyse der tatsächlichen Situation hat nun gezeigt, daß zwar der größte Teil der zu schützenden Rechtsgüter nach wie vor in den Bahnen dieses Trennungsmodells geschützt wird, aber eine zunehmende Auflösung der Trennlinien zu verzeichnen ist 2 3 3 . Dies betrifft mehrere Punkte: 231 Vgl. Newiger, A KP 4/1995, S. 37, 38, 39 m. w. N. 232 So Hitzler, FJNSB 3-4/1993, S. 16, 21; ders./Göschl, in: Frehsee/Löschper/Smaus, Konstruktion der Wirklichkeit, S. 134, 142; vgl. bereits Arzt, in: FS Schaffstein, S. 77, 86 ff.
94
§ 2: Die aktuelle Situation
(1) Öffentliche Rechtsgüter werden in wachsendem Umfang von Privaten als Beliehene geschützt. (2) Staat und Gemeinden setzen zunehmend Verwaltungshelfer - überwiegend im Vorfeld gefahrenabwehrender Maßnahmen - ein. (3) Zwischen privaten und staatlichen Sicherheitsakteuren wird ohne Änderung des Rechtsregimes zusammengearbeitet. (4) Vormals öffentliche Rechtsgüter werden privatisiert und somit einem obligatorischen oder fakultativen privaten Schutz in den Bahnen des Privatrechts unterstellt, ohne daß für betroffene Bürger immer ersichtlich wäre, nach welchem Rechtsregime sich der Schutz vollzieht. (5) Private werden in zunehmendem Umfang in Bereichen tätig, in denen es nicht allein um den Schutz privater Rechtsgüter geht. Dem Verschwimmen der Grenzen zwischen staatlichem und privatem Handeln steht dabei eine klare rechtliche Trennung zwischen zwei Rechtsregimen gegenüber. Zwar lassen sich die - rechtmäßigen 234 - Tätigkeiten nach ihrem Rechtsregime in das Trennungsmodell einordnen, dessen historisch gewachsene Motivation ist jedoch bei zahlreichen der angeführten Tätigkeitsbereiche durchbrochen. Wurden traditionell solche Rechtsgüter einem öffentlich-rechtlichen Schutz unterstellt, an deren Erhaltung ein öffentliches Interesse bestand, so bedeuten die Privatisierungen eine Zurückstellung dieser öffentlichen Interessen. Dies gilt insbesondere für den Rechtsgüterschutz im öffentlichen Raum, wo die große Anzahl betroffener Interessen eine staatliche Schutzzuständigkeit begründen ließ. Eine Privatisierung bewirkt hier die Substitution des öffentlichen Interesses durch das private Interesse des Hausrechtsinhabers. Neben diesem Bruch mit der Motivation des Trennungsmodells wird zunehmend von seinem Grundsatz abgewichen, daß staatlicher Rechtsgüterschutz durch staatliches Personal erfolgt. Diese Relativierungen des Trennungsmodells als Folgen staatlicher Privatisierungspolitik werden durch ein Vordringen Privater in von der staatlichen Schutzaufgabe erfaßte Aufgabenbereiche verstärkt 235 . Ermöglicht wird dies durch die von der Rechtsordnung zugelassene Doppelzuständigkeit für den Schutz solcher Interessen, welche nicht nur als privates Rechtsgut konstituiert, sondern aufgrund eines besonderen öffentlichen Interesses auch der staatlichen Schutzzuständigkeit 233 Vgl. Gusy, in: Hoffmann-Riem / Schmidt-Aßmann, Effizienz, S. 175, 181 ff. 234 Soweit Private aus eigener Initiative öffentliche Rechtsgüter schützen, indem sie etwa in dem Gemeingebrauch gewidmeten Räumen „Platzverweise" aussprechen, ist ihr Handeln schlicht rechtswidrig. 235 Eine sowohl auf privater als auch staatlicher Initiative beruhende Entwicklung beobachten auch Gusy, in: Schuppert, Jenseits von Privatisierung, S. 115, 116 f.; Beste, in: Bussmann / Kreissl, Kritische Kriminologie, S. 311, 316; Jeand'Heur, AöR 119 (1994), S. 107, 109.
Α. Die tatsächliche Situation
95
unterworfen wurden. Während diese Interessen früher faktisch allein vom Staat geschützt wurden, übernehmen Private diesen Schutz nun insbesondere aufgrund der als nicht ausreichend angesehenen staatlichen Schutzmaßnahmen und verdrängen den Staat teilweise. Die Entwicklung erinnert dabei an die Frage nach der Henne und dem Ei: Zieht sich die Polizei zurück, weil Private in ihre Aufgabenfelder vordringen, oder aber stoßen die Privaten in eine vom Staat offengelassene Schutzlükke vor? Unabhängig von der Ursächlichkeit gilt aber, daß die mit der Zuordnung zum Staat beabsichtigte Wahrung öffentlicher Interessen partiell überspielt wird. Freilich machen diese Brüche die beschriebene Entwicklung nicht rechtswidrig, handelt es sich bei dem Trennungsmodell doch allein um eine Beschreibung des Grundgedankens der Rechtsordnung, ohne daß ihm seinerseits normativer Charakter zukäme. Sie zeigen jedoch, daß die dem Trennungsmodell verhafteten Regelungen der Rechtsordnung im Hinblick auf andere Problemlagen konzipiert wurden. Die Rechtsordnung gibt so teilweise Antworten auf Fragen, welche sich heute anders stellen. Beispielhaft seien hier die Jedermannrechte genannt, welche zwar auf ein professionelles Tätigwerden Privater im öffentlichen Raum anwendbar sind 2 3 6 ; die in ihnen verankerte Interessenabwägung betraf jedoch andere Fallkonstellationen. Insofern indizieren die Brüche mit dem Trennungsmodell rechtspolitischen Diskussionsbedarf. Das hiermit aufgeworfene Problem stellt sich nicht allein im Bereich des Sicherheitsrechts. Vielmehr hat die seit ungefähr zwei Jahrzehnten intensiv geführte Privatisierungsdiskussion versucht, ein dogmatisches System bereitzustellen, welches auf mit der Entwicklung verbundene besondere Problemlagen reagiert. Daher liegt es nahe, die beschriebenen Abweichungen vom Trennungsmodell den entwickelten Privatisierungskategorien zuzuordnen 237. Dies ist durch eine Bezeichnung der Handlungsformen etwa als Beleihung oder Verwaltungshilfe bereits schlagwortartig geschehen. Eine nähere Auseinandersetzung kann jedoch an dieser Stelle unterbleiben, weil der Ertrag der Privatisierungsdiskussion neben der die Rechtsanwendung erleichternden Kategorisierung in der hierauf bezogenen Benennung der (insbesondere verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen besteht 238 , welche hier für das Sicherheitsrecht erst im 3. Teil erarbeitet werden. Vergleichbares gilt für die jüngere verwaltungswissenschaftlich 239 orientierte Diskussion, welche staatliche Verantwortlichkeiten im Hinblick auf Steuerungsbe236 Dazu unten Β. X. 237 Darstellung zuletzt bei Ziekow, in: Meyer-Teschendorf/ Föttinger, Neuausrichtung, S. 132, 136 ff.; vgl. ferner v. Hagemeister, Privatisierung; v. Heimburg, Verwaltungsaufgaben; Osterloh, VVDStRL 54 (1995), S. 204 ff.; Bauer, VVDStRL 54 (1995), S. 243 ff.; Krölls, GewA 1995, S. 129 ff.; Bull, VerwArch 86 (1995), S. 621 ff.; Schoch, DVB1. 1994, S. 962 ff.; Schuppert, StWStP 1994, S. 541 ff.; König, VerwArch 79 (1988), S. 241 ff. 238 Überblick über die Diskussion zur Aufgabe der Privatisierungsdiskussion jüngst von Lee, Privatisierung, S. 4 ff. m. w. N.; wie hier Gramm, VerwArch 90 (1999), S. 329, 331. 239 Ellwein, in: ders./Hesse, Staatswissenschaften, S. 99, 103 f.; vgl. aber bereits Peters, in: FS Nipperdey II, S. 877, 878 f.
96
§ 2: Die aktuelle Situation
darf und -möglichkeiten herausarbeitet. Sie basiert nicht mehr wie noch das Trennungsmodell auf der These eines engen Zusammenhangs zwischen staatlicher Aufgabe und staatlicher Wahrnehmung dieser Aufgabe, sondern differenziert vor dem Hintergrund der Verwaltungswirklichkeit unter anderem zwischen Rahmen-, Grund-, Erfüllungs-, Überwachungs-, Beobachtungs-, Förderungs-, Finanzierungs-, Beratungs-, Organisations-, Privatisierungsfolgen-, Regelungs-, Gewährleistungs-, Koordinations- und Einstandsverantwortungen 240. Mittlerweile scheint die Fülle der möglichen Verantwortungen des Staates sinnvoll in drei Grundverantwortungen ausdifferenziert zu sein 241 , welche der Arbeit im Folgenden terminologisch zugrundegelegt werden. Die Erfüllungsverantwortung beschreibt die notwendige Erfüllung bestimmter Aufgaben durch den Staat mit eigenen Mitteln und eigenem Personal in Eigenregie. Die Gewährleistungsverantwortung ist demgegenüber ein Sammelbegriff für gänzlich unterschiedliche Handlungen des Staates. Ihr geht es nicht um das „Wie" der Erfüllung einer Staatsaufgabe, sondern allein um das Ergebnis, welches im Idealfall nicht vom Staat selbst, sondern von gesellschaftlichen Kräften erreicht wird. Die Aufgabe des Staates beschränkt sich im wesentlichen auf die Wahrnehmung der Unterkategorien der Regulierungs- und der Überwachungsverantwortung. Der Staat beschreibt mittels des Steuerungsmediums des Privat- oder öffentlichen Rechts 242 den Rahmen der privaten Aufgabenerfüllung, ohne notwendig bestimmte Handlungsformen vorzuschreiben. Daneben überwacht er durch präventive und reaktive Kontrollmechanismen die private Aufgabenerfüllung im Interesse der Sicherstellung des von ihm zu gewährleistenden Ergebnisses. Schließlich findet sich als dritte Kategorie die Auffangverantwortung, welche den Staat verpflichtet, bei einem Verfehlen des zu erreichenden Ergebnisses dieses selbst herzustellen. Die Auffangverantwortung ist so eine in der Reserve lauernde „latente Erfüllungsverantwortung" 243. Nach dem Trennungsmodell oblag dem Staat für den Schutz öffentlicher Rechtsgüter eine Erfüllungsverantwortung. Die Entwicklung der Privatisierung von Aufgaben der öffentlichen Sicherheit hat jedoch gezeigt, daß er dieser zunehmend nicht mehr nachkommt, der Staat sich vielmehr immer häufiger auf die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit beschränkt, allerdings eine verbeamtete Polizei zur Erfüllung der Auffangverantwortung in der Reserve hält. Im Bereich des privaten Rechtsgüterschutzes entstand eine staatliche Aufgabe erst nach einer Initiative des Rechtsgutsträgers zum Schutz seines Rechtsguts. Hier konnte den Staat eine 2*0 Begriffssammlung nach Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee, Rn. 3/89 ff. 241 Zum Folgenden stellvertretend m. w. N. Schupperl, DV 31 (1998), S. 415, 423 ff.; knapper ders., DÖV 1998, S. 831, 834 f.; ähnlich Hoffmann-Riem, DÖV 1997, S. 433,440 ff.; ders., DVB1. 1996, S. 225, 230 ff.; vgl. bereits Schmidt-Aßmann, in: Hoffmann-Riem/ Schmidt-Aßmann / Schuppert, Reform, S. 11,43 ff. 242
Vgl. die Beiträge in Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann, Auffangordnungen; zahlreiche Beispiele etwa bei di Fabio, ebd., S. 143 ff.; Trute, ebd., S. 167, 183 ff.; Voßkuhle, in: Schuppert, Jenseits von Privatisierung, S. 47, 68 ff. 243 Hoffmann-Riem, DÖV 1997, S. 433,442.
Α. Die tatsächliche Situation
97
Erfüllungsverantwortung für den gerichtlichen Rechtsschutz sowie im Falle gewaltsamen Rechtsgüterschutzes treffen. Dies hat sich nicht grundsätzlich gewandelt, allerdings zeigten die Entwicklung des privaten Sicherheitsgewerbes sowie einzelner Bürgerinitiativen Tendenzen zum Absehen der Einschaltung des Staates, so daß dessen Erfüllungsverantwortung zwar nicht entfällt, aber nicht aktiviert wird. Auch hier gilt jedoch, daß den Verantwortungsstufen keine normative Bedeutung zukommt. Die eingeführten Differenzierungen liefern keine Argumente für oder gegen das Bestehen bestimmter Staatsaufgaben 244. Dementsprechend helfen sie nicht bei der Begründung der „Staatsaufgabe Sicherheit" und der rechtlichen Beurteilung der beschriebenen Entwicklung. Die Bedeutung dieser Diskussion für die Rechtswissenschaft liegt vielmehr darin, ein Begriffsinstrumentarium bereitzustellen, welches ermöglicht, zwischen unterschiedlichen Handlungsmodalitäten des Staates im Hinblick auf einen Aufgabenkomplex zu unterscheiden und damit die rechtlichen Vorgaben entsprechend differenziert zu behandeln245. Ansätze einer Anwendung im Sicherheitsrecht sind bereits vorhanden. Wahrend das Trennungsmodell mit einer staatlichen Sicherheitsaufgabe eine umfassende Erfüllungsverantwortung korrelieren ließ, wird heute die Auffassung vertreten, statt eines staatlichen Sicherheitsmonopols bestehe eine staatliche Gewährleistungsverantwortung 2 4 6 , dem Staat komme letztlich allein eine Reservefunktion zu 2 4 7 . Einen ebenfalls deutlich hinter dem Trennungsmodell zurückbleibenden, aber dennoch anderen Akzent setzt die These einer staatlichen „Pflicht zur sicherheitsrechtlichen Grundversorgung" 248, welche sich abhängig vom Rang eines Rechtsguts sowie dem drohenden Schadensumfang zur staatlichen Handlungspflicht verdichte 249 ; daneben bestehe eine staatliche Regulierungs- mit Vollzugsverantwortung 250. Eine begründete Stellungnahme setzt voraus, daß zum einen die an der Verwaltungswirklichkeit orientierten Probleme der Privatisierungstendenzen herausgearbeitet (dazu sogleich B.) und zum anderen die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen des Sicherheitsrechts geklärt sind (dazu § 5).
244 Mißverständlich Stober, DSD 2/1998, S. 28 f., der sein Konzept der Sicherheit „zwischen Staat und Privat" auf die These einer gesamtgesellschaftlichen Sicherheitsverantwortung stützt; richtig Trute, in: Schuppert, Jenseits von Privatisierung, S. 13; Gusy, ebd., S. 115, 125; Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee, Rn. 3/77; ders., in: Hoffmann-Riem /Schmidt-Aßmann, Auffangordnungen, S. 7, 29. 245 Vgl. Gramm, Privatisierung, Kap. 3.6. 246 Stober, DSD 2/1998, S. 28 ff.; ders., NJW 1997, S. 889 ff.; differenzierter Pitschas, DÖV 1997, S. 393, 397 f.; ders., in: Schuppert, Jenseits von Privatisierung, S. 135,150. 247 Pitschas, DÖV 1997, S. 393, 398. 248 Gusy, StWStP 1994, S. 187, 204; Peilert, DVB1. 1999, S. 282,284 f. 249 Gusy, StWStP 1994, S. 187, 205 f. 250 Gusy, in: Schuppert, Jenseits von Privatisierung, S. 115, 127 ff.; ders., in: HoffmannRiem / Schmidt-Aßmann, Effizienz, S. 175, 190 ff. 7 Nitz
98
§ 2: Die aktuelle Situation
B. Diskussion des Verhältnisses privater und öffentlicher Sicherheit in Deutschland Eine umfassende Darstellung der Diskussion der beschriebenen Privatisierungstendenzen gibt es bislang nicht und soll auch hier nicht versucht werden. Sie würde den Rahmen einer juristischen Arbeit sprengen und insbesondere ökonomische und soziologische Aussagen zu treffen haben. Zudem ist der Forschungsstand noch als bescheiden zu bezeichnen251. Zahlreiche Abhandlungen arbeiten eher mit Behauptungen denn mit Argumenten. Statt diese Lücke zu füllen, werden im Folgenden lediglich die Grundlinien der Diskussion sowie die am häufigsten vorgetragenen Thesen - ohne eingehende Kritik - wiedergegeben. Dieses Vorgehen rechtfertigt sich auch aus der Tatsache, daß es weniger auf die Erarbeitung einer eigenen Wertung ankommt, als vielmehr auf eine Sammlung von Gesichtspunkten, welche im 3. Teil auf ihre verfassungsrechtliche Relevanz für das System privater und öffentlicher Sicherheit untersucht werden sollen. I. Grundlinien des Diskussionsverlaufs Nach einer ersten kritischen Diskussion über das private Sicherheitsgewerbe, welche 1927 zur Einfügung des § 34a GewO führte 252 , wurde das Thema erst wieder in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre aufgegriffen und äußerst kontrovers bis Anfang der 1980er Jahre diskutiert. Zwei Dissertationen von 1988 bereiten diese Diskussion - ebenso kontrovers - juristisch auf 2 5 3 . Der Schwerpunkt dieser Auseinandersetzungen lag auf der Beurteilung des Wachstums des privaten Sicherheitsgewerbes. Nach einer Beruhigung wurde das Thema in den 1990er Jahren wieder aufgegriffen 254, wobei nun die Bemühungen um einen „schlanken Staat" auch den Sicherheitsbereich erreicht hatten, und die Diskussion Polizei und private Sicherheit in den Blick nahm. Ausgangspunkt der Diskussionen waren unversöhnliche Sichtweisen auf das private Sicherheitsgewerbe. Einerseits wurde in Anlehnung an Orwells „großen Bruder" befürchtet, es könne „in der Zukunft eine »große Familie4 privater Sicherheitsunternehmen geben, einen ,Clan\ der Schutz verspricht, aber Macht meint" 2 5 5 . 251
Gusy, in: Schuppert, Jenseits von Privatisierung, S. 115. - Einer der aktivsten Teilnehmer an der Diskussion wirft dieser nicht zu Unrecht „geringen Tiefgang" vor: Stober, zit. n. Brauser-Jung, DP 1998, S. 326, 330; vgl. dens. y in: Pitschas/Stober, Quo vadis, S. 35, 37 ff. 252 Dazu Graf, § 34a GewO, S. 3 ff. 253 Während Bracher, Gefahrenabwehr, das Vordringen Privater in traditionell polizeiliche Tätigkeitsfelder im Hinblick auf Art. 33 IV GG kritisch sieht, argumentiert Mahlberg, Gefahrenabwehr, auf der Grundlage eines verfassungsrechtlichen Subsidiaritätsprinzips für einen Vorrang privater Sicherheit. 254 Die Diskussionswellen zeigen sich etwa auch an der Durchführung von themenbezogenen Seminaren an der Polzei-Führungsakademie, welche in den Jahren 1976/1977 und 1980 stattfanden, dann erst wieder 1993; vgl. Schuster, DSD 2/1988, S. 15; ders., DP 1989, S. 5.
Β. Verhältnis privater und öffentlicher Sicherheit in Deutschland
99
Dementsprechend wurde die Entwicklung aus juristischer Perspektive auch als „latente Bedrohung der Demokratie" problematisiert 256. Die Gegenposition verneinte das Entstehen von „Privatarmeen" mit dem Argument, daß der Wettbewerb dies verhindere 257 , war aber ihrerseits nicht um Bedrohungsszenarien verlegen: Private Sicherheit sei die Alternative zu einem Ausbau der Polizei, welcher in einen „Überwachungsstaat" zu führen drohe 258 . Grundlage auch dieser Extrempositionen sind unterschiedliche Prämissen. Das private Sicherheitsgewerbe und ihm nahestehende Autoren argumentieren zentral mit der Sicherheitsfunktion: Es gehe um die Verhinderung von Rechtsgüterverletzungen durch Bürger. Ordnet man demgegenüber die Schutzfunktion allein der Polizei zu, dann erscheint nicht mehr nur der Bürger als (potentieller) Störer, sondern auch der Sicherheitsdienstleister, gegen den das Recht durch Regulierungen schützen müsse, anstatt ihm „ironischerweise" aufgrund bürgerlicher Freiheiten Eingriffsbefugnisse in Form der Jedermannrechte zuzugestehen259. Dementsprechend liefen die Argumentationen häufig aneinander vorbei. Typisch hierfür ist etwa die Verwendung des Subsidiaritätsgedankens. Wer die Bedrohung im privaten Sicherheitsgewerbe sah, blickte auf ihre Gewaltbefugnisse und betonte deren in den Selbsthilferechten verankerte Subsidiarität gegenüber staatlichem Handeln 260 . Wer hingegen die schützende Aufgabe in den Blick nahm, konnte eine Subsidiarität staatlichen Handelns fordern 261 .
II. Sicherheit als Ware Heute scheint sich die Diskussion versachlicht zu haben. Wichtiger ist jedoch die Feststellung, daß die Legitimität privater Sicherheit und des Sicherheitsgewerbes im Besonderen nicht mehr generell in Frage gestellt wird. Zwar wird im Rahmen allgemeiner Privatisierungserwägungen der Bereich des Sicherheitsrechts häufig als privatisierungsfest dargestellt 262, sobald die öffentliche Sicherheit jedoch näher in den Blick genommen wird, werden auch hier Privatisierungsspielräume festgestellt. Statt um das „Ob" privater Sicherheit wird heute über deren 255 Hoffmann-Riem, ZRP 1977, S. 277, 279. 256 Roßnagel, Radioaktiver Zerfall, S. 138, 196 f.; vgl. ders., ZRP 1983, S. 59, 62; Hoffmann-Riem, ZRP 1977, S. 277, 279; vorsichtig v. Walsleben, cilip 43 (1992), S. 14; Bull, Staatsaufgabe Sicherheit, S. 30; Stacharowsky, KrimJ 17 (1985), S. 228, 232; dagegen etwa Mahlberg, KrimJ 1992, 4. Beih., S. 209, 211. 257 Statt aller Schweinoch, W+S-Information 1983, S. 73, 74; Schriml, W+S-Information 1980, S. 8, 9 f.; jünger Falck, DSD 17 (1995), S. 73,75. 258 Schriml, W+S-Information 1980, S. 8, 10. 259 Voß, JhbRsozRth XV, S. 81, 91. 260 Hoffmann-Riem, ZRP 1977, S. 277,281; vgl. Roßnagel, ZRP 1983, S. 59,62. 261 So insbesondere Mahlberg, Gefahrenabwehr, S. 58 ff.; ders., KrimJ 1992, 4. Beih., S. 209, 210. 262 Etwa Meyer-Teschendorf/Hofmann, DÖV 1997, S. 268, 270 f.; Ossenkamp, ZG 1996, S. 160, 162; Osterloh, VVDStRL 54 (1995), S. 204, 207. 7*
100
§ 2: Die aktuelle Situation
„Wie" und „Wo" gestritten 263 , wenn sich Kritiker gegen jede Übertragung hoheitlicher Befugnisse auf Private 264 oder aber gegen einen verstärkten Einsatz privater Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum wenden 265 . Auch die Forderung, private Sicherheitskräfte auf eine Meldefunktion in Abhängigkeit von der Polizei zu verweisen 266 , setzt ihre Existenz voraus und ordnet ihnen eine bestimmte Rolle im Rahmen der Herstellung von Sicherheit zu. Diese Anerkennung gewerblicher privater Sicherheit zeugt dabei nicht bloß von einer pragmatischen Sicht auf die Realität, sondern hat durchaus fundamentale Bedeutung. Rechtsgüterschutz ist als marktfähiges Gut grundsätzlich anerkannt 267. „Innere Sicherheit" ist nicht (mehr) unteilbar 268 und allein dem Staat zugewiesen, sondern eine „gesamtgesellschaftliche Aufgabe" 269 auch dann, wenn den Privaten bestimmte Sicherheitsaufgaben vorenthalten werden. Der Gegenposition, die sich auf das staatliche Gewaltmonopol als Argumentationstopos berufen hatte, wird heute nahezu einhellig entgegengehalten, daß der Staat zwar das Gewaltmonopol habe, nicht jedoch das Sicherheitsmonopol 270 . Das mag als ein Spiel mit Worten erscheinen, entscheidend sind die Folgen des Prämissenwechsels. Ist Sicherheit eine Ware, dann unterliegt ihre Produktion den Gesetzen des Marktes. Ganz in diesem Sinne argumentiert das Sicherheitsgewerbe heute nicht mehr zentral mit der Kriminalitätsbelastung, der die Polizei nicht alleine Herr werden könne 271 , sondern betont seine geringeren Kosten 263 Lützenkirchen/Nijenhuis, Sicherheitsdienste, S. 28; Köhler, DP 1994, S. 49, 54; vgl. zur Entwicklung Gusy, in: Hoffmann-Riem / Schmidt-Aßmann, Effizienz, S. 175, 177 f. 264 Etwa: Schnoor, zit. η. N.N., W&S 1994, S. 1314, 1316. 265 Aus Polizeisicht H.-M. Zimmermann, DP 1994, S. 60, 63; noch kritischer Bernhardt, DP 1994, S. 55, 56 ff.; vgl. auch AKIS, Memorandum, S. 50, die von einem „Sicherheitsmonopol der Polizei im öffentlichen Raum" ausgehen. 266 Schöpflin, Kriminalistik 1993, S. 689, 691. 267 Kurth, DSD 2/1998, S. 7; deutlich auch F. Eben, Detektiv-Kurier 1 /1999, S. 16 ff.; vgl. kritisch Gusy, in: Hoffmann-Riem / Schmidt-Aßmann, Effizienz, S. 175, 177; Hetzer, ZRP 2000, S. 20 ff. 268 So noch Schweinoch, W+S-Information 1983, S. 73, 76; Schuster, DSD 2/1988, S. 15,
22.
269 Statt (fast) aller Zuber, DSD 3-4/1998, S. 3,4; Rupprecht, Handelsblatt v. 25. 5. 1998, S. 53; Herzberg, DSD 13 (1993), S. 178 f.; vgl. Stober, in: Pitschas/ Stober, Quo vadis, S. 35, 45. 270 Gramm, VerwArch 90 (1999), S. 329, 330; Peilen, DVB1. 1999, S. 282, 284; Stober, in: Pitschas/Stober, Quo vadis, S. 35, 47 ff.; ders., NJW 1997, S. 889, 892 f.; Zuber, DSD 3-4/1998, S. 3, 4; Kanther, DSD 3-4/1998, S. 5; Lutz, DSD 2/1998, S. 23; Lützenkirchen/Nijenhuis, Sicherheitsdienste, S. 132; Gusy, in: Hoffmann-Riem / Schmidt-Aßmann, Effizienz, S. 175, 181; Steffenhagen, DSD 16 (1995), S. 18, 20; Rupprecht, in: Weiß/Plate, Privatisierung, S. 45, 46; Raber, DSD 16 (1995), S. 11; Wackerhagen, W&S 1995, S. 833, 835; Schnoor, zit. η. N.N., W&S 1994, S. 1314, 1316; H.-M. Zimmermann, DP 1994, S. 60, 61; Eick, W+S-Information 1985, S. 16, 19; inhaltlich identisch, aber weniger prägnant bereits Rupprecht, FS Geiger, S. 296, 300; krit. Pitschas, DÖV 1997, S. 393, 397; genauer ders., Kriminalistik 1999, S. 153 f. 271 Zu diesem seit langem vorgetragenen Argument Glavic, DP 1994, S. 36, 38; Loyo, DSD 7/1990, S. 48,49; Steinke, W&S 1995, S. 121.
Β. Verhältnis privater und öffentlicher Sicherheit in Deutschland
101
der Bereitstellung von Sicherheitsdienstleistungen 272. Es sei eine Verschwendung gesellschaftlicher Ressourcen, wenn gut ausgebildete und dementsprechend teure Polizisten einfache Aufgaben des Objektschutzes übernähmen 273. Der häufig beklagte niedrige Ausbildungsstand im Sicherheitsgewerbe 274 wendet sich so zum Verkaufsargument. Dieses Denken ist bei der Polizei und anderen staatlichen Vertretern angekommen275. Die Polizei soll sich als „kundenorientierter Dienstleister" verstehen 276 und bemüht sich um ein ,,New Public Management"277. Aber auch innerhalb einer Kostendiskussion muß als unklar gelten, ob und inwieweit private Sicherheit tatsächlich volkswirtschaftlich billiger ist 2 7 8 . So ist ungeklärt, wieviel Personal durch eine Übertragung polizeifremder Aufgaben auf Private freigesetzt werden kann 2 7 9 . Untersuchungen in Berlin, ob durch die Polizeireserve oder eine Übertragung von Aufgaben auf private Sicherheitsunternehmen ein Einspareffekt erreicht werden kann, erbrachten keine klaren Ergebnisse 280. Es könnte durchaus sein, daß durch private Schutzkräfte keine Entlastung der Polizei eintritt, da sie der Polizei auch zusätzliche Arbeit verschaffen 281. Dementsprechend sind Vergleiche, welche unter Einbeziehung der Kosten für Ausbildung, Ausrüstung und Lebensarbeitszeit zu Stundenkosten für einen Polizeibeamten von 100,- DM im mittleren, 120,- DM im gehobenen Dienst, aber nur 41,14 DM für eine IHK-geprüfte Werkschutzfachkraft gelangen 282 , mit Vorsicht zu genießen283.
272 273 274 275
Nogala, in: Hitzler/Peters = DSD 1 /1999, S. 11, 12 m. w. N. Glavic, DP 1994, S. 36, 38. Dazu näher unten XI. in Bezug auf den Objektschutz Schaef, DSD 2/1998, S. 39 ff.
276 Schily, RuP 1998, S. 174, 175; Heuer, zit. n. Spörrle, Die Woche v. 12. 9. 1997, S. 37; nach Ansicht des ehem. New Yorker Polizeichefs Bratton sei ein Polizeiapparat wie eines McDonalds zu managen, wiedergegeben bei Ortner/Pilgram, in: dies. / Steinert, Null-Lösung, S. 9, 10. 277 Etwa: Weidmann, DP 1998, S. 357 ff. 278 Vgl. Paltian, zit. η. M. Müller, DVB1. 1999, S. 451, 453. - Auf den ersten Blick fernliegend erscheint ein Verweis auf die Kosten der - auch aus Unsicherheitsgefühlen motivierten - Hundehaltung in den USA, welche Mitte der sechziger Jahre in etwa den Verlusten entsprach, die die Geschäftswelt durch Diebstahl und Raub erlitt, Arzt, Recht und Ordnung, S. 47. 279 Skeptisch H M. Zimmermann, CD 3/1995, S. 11, 18. 280 Berl.AbgH-Drs. 12/5187, S. 17 f.; Tielemann, cilip 52 (1995), S. 37, 40; nach Gaserow, Die Zeit v. 9. 4. 1993, S. 16, sind täglich 50 Reservisten unterwegs. Die Kosten der Polizeireserve entsprächen jedoch den Kosten von 220 Polizisten. Zudem bänden die Reservisten 30 Beamte, welche ihre Einsätze betreuen und koordinieren. 281 Helmers/Murck, DP 1994, S. 64,67. 282 Kienbaum-Gutachten für die nordrhein-westfälische Polizei, zit. bei Rupprecht, DSD 2/1999, S. 20, 22; vgl. auch N.N., DP 1996, S. 135. 283 Die Stadt Frankfurt/M. setzt demnächst ihrer fiskalisch motivierten Parkraumüberwachung durch Mitarbeiter privater Sicherheitsunternehmen ein Ende, weil eine Überwachung durch Beamte wirtschaftlicher sei, Göpfert, Frankfurter Rundschau v. 30. 9. 1999, S. 23.
102
§ 2: Die aktuelle Situation
Selbst wenn private Sicherheit billiger wäre, folgte hieraus allerdings nicht eine generelle Ersetzbarkeit der Polizei. Auch das Trennungsmodell sieht privaten Schutz privater Rechtsgüter vor und äußert sich nicht gegen dessen Marktfähigkeit. Aus der Anerkennung des Dienstleistungscharakters polizeilichen Handelns folgt keinesfalls, daß nicht bestimmte Sicherheitsaufgaben weiterhin exklusiv dem Staat vorbehalten sein können oder gar müssen. Bedeutsam ist dieser Bewußtseinswandel aber zum einen im Hinblick auf das gesellschaftliche Ansehen des Sicherheitsgewerbes, zum anderen - und wichtiger - für die Rechtfertigungslast. Nun ist anerkannt, daß der Staat sich für die exklusive Wahrnehmung von Polizeiaufgaben rechtfertigen muß. Deutlich wird dies in der These, daß heute eine generelle Skepsis gegen Monopole jeglicher Art und damit auch gegen das staatliche Gewaltmonopol bestehe284. Zu berücksichtigen sei, daß Private „unbürokratischer, flexibler und schlagkräftiger" 285 seien. Andererseits finden sich auch skeptische Stellungnahmen. Die Konvertierung zum marktrelevanten Gut berge die Gefahr einer reinen Effizienzdiskussion in sich, die das Gespür für grundlegende Verfassungsmotive verloren gehen ließe 286 . Schon generell gelte, daß die „Produktorientierung einer marktmäßigen Modernisierung der Verwaltung strukturell die Gefahr" mit sich bringe, daß die als Mittel der Gemeinwohlerzielung anzusehenden Produkte sich zum Ziel verselbständigen und so das Gemeinwohlziel aus dem Blick gerate 287 . Erst recht könne der Staat die den historischen Kern seiner Staatsgewalt darstellende Gewährleistung rechtlich geordneten Schutzes nicht einfach aufgeben 288. In Anklang an die Trennungsthese finden sich so auch heute noch Stimmen, die hervorheben, daß innere Sicherheit die Sicherheit der Allgemeinheit und damit die öffentliche Sicherheit sei, private Sicherheitsunternehmen aber allein einzelne private Auftraggeberinteressen schützen sollten 289 . Als weitgehend konsentierte Ausgangsposition kann festgehalten werden: Rechtsgüterschutz ist eine zumindest teilweise marktfähige Dienstleistung, welche grundsätzlich auch von Privaten wahrgenommen werden kann. Bestimmte Sicherheitsaufgaben sind jedoch aus öffentlichen Interessen dem Staat vorzubehalten.
Stober, NJW 1997, S. 889, 891; ders., in: Pitschas/Stober, Quo vadis, S. 35,43 f. 285 Bleck, zit. n. Helmers/Murck, DP 1994, S. 64, 67; vorsichtiger Stümper, Kriminalistik 1975, S. 193,194; dagegen Helmers/Murck, ebd., dies stelle die Idee des staatlichen Gewaltmonopols auf den Kopf. 286 Lützenkirchen/Nijenhuis, Sicherheitsdienste, S. 27 f.; Nogala, cilip 43 (1992), S. 18 f.,
22.
287 288 289 Voß,
Penski, DÖV 1999, S. 85, 94 f. Gusy, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann, Effizienz, S. 175, 176. Götz, in: Pitschas/Stober, Quo vadis, S. 235, 237; ders., NVwZ 1998, S. 679, 680; vgl. JhbRsozRth XV, S. 81,84 f.
Β. Verhältnis privater und öffentlicher Sicherheit in Deutschland
103
ΙΠ. Ursachen, insbesondere: Sicherheitsbedürfnis und seine Nachfragerichtung Der hier beschriebene Meinungsstand beruht sicherlich auch auf einer erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit des Bundesverbandes Deutscher Wach- und Sicherheitsunternehmen 290. Daneben werden jedoch weitere Ursachen für das Wachstum des privaten Sicherheitsgewerbes und die zunehmenden Privatisierungsbemühungen auf staatlicher Seite diskutiert. Immer wieder genannt werden ein Anstieg der statistisch ausgewiesenen Kriminalität, die Zunahme gesellschaftlicher Gefahrenpotentiale sowie mit beiden Aspekten zusammenhängend eine Überlastung der Polizei und ein schwindendes Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung, schließlich die allgemeine Privatisierungsdebatte 291. Diese Gesichtspunkte sind sicherlich zutreffend beobachtet, über ihre richtige Gewichtung besteht jedoch keine Klarheit. In der Diskussion scheint insbesondere die Kriminalitätsbelastung überbewertet zu werden. Zwar mag es zutreffen, daß bei finanziell begrenzten staatlichen Sicherungsmöglichkeiten eine Verfassungspflicht zur Konzentration auf die Bekämpfung von (Schwer)Kriminalität besteht 292 , ob die Polizei in absehbarer Zeit jedoch tatsächlich gezwungen sein wird, das übrige Feld privaten Sicherheitskräften zu überlassen, muß bezweifelt werden. Das Sicherheitsgefühl dürfte für die Entwicklung des Sicherheitsgewerbes einen bedeutsameren Faktor darstellen 293 . Kriminologisch ist - trotz unterschiedlicher Forschungsergebnisse im Detail - geklärt, daß die subjektive Verbrechensfurcht in keinem ersichtlichen Zusammenhang zur Entwicklung der (registrierten) Kriminalität steht 294 , vielmehr stärker durch die allgemeine Sicherheitslage, persönliche 290 Dazu Nogala, in: Hitzler/Peters = DSD 1 /1999, S. 11, 12 m. w. N. - Exemplarisch sei auf Mauersberger, DSD 15 (1994), S. 59 f., verwiesen. Ziele der Verbandsarbeit seien „Imageverbesserung, weg vom Klischee vom »Schwarzen Sheriff* bzw. der »Privatarmee4, weg vom ,Nachtwächter-Image', Darstellung der Leistungsfähigkeit" und „Agieren anstatt reagieren", Mittel unter anderem laufende Pressearbeit zu Aktuellem und „Standard-Themen wie ... Gewaltmonopol, Sicherheit im öffentlichen Raum,..., »Privatarmee 4". 291 Vgl. nur die unterschiedliche Grundpositionen vertretenden Autoren Rupprecht, DSD 2/1999, S. 20; Loyo, DSD 7/1990, S. 48, 49; Beste/Voß, in: Sack/Voß/Frehsee/Funk/ Reinke, Privatisierung, S. 219 ff. 292 so Stober, NJW 1997, S. 889, 892. 293 Vgl. etwa Schily, RuP 1998, S. 174; Gramm, Privatisierung, Kap. 5.1.1.3, S. 361 ff.; AKIS, Memorandum, S. 40 ff. -Aulehner, Informationsvorsorge, S. 283 ff., geht im Anschluß an Luhmann davon aus, daß es „objektive44 Sicherheit nicht geben könne, Sicherheit vielmehr immer erst ein kommunikativ hergestelltes Konstrukt sei. Deutlich ebd., S. 284: „ . . . sicher ... ist, was in der zwischenmenschlichen Kommunikation als sicher... behandelt wird 44. Das mag so sein. Dennoch unterscheidet auch die Alltagskommunikation zwischen „objektiver Sicherheit44 und „subjektivem Sicherheitsgefühl". 294 Zur Kriminalitätsfurcht anhand zahlreicher Untersuchungen ausführlich Kury/Obergfell-Fuchs, Kriminalistik 1998, S. 26 ff.; Burgheim, DP 1999, S. 41 ff., jeweils m. w. N.; vgl. auch Diederichs, cilip 57 (1997), S. 18 ff.; R. Müller/Braun, Kriminalistik 1993, S. 623 ff.; Hornbostel, in: ders., Verunsicherung, S. 3,8 ff. m. w. N.
104
§ 2: Die aktuelle Situation
Zufriedenheit, berufliche Sicherheit, „allgemeine Lebensangst" und die „Ordnung" i m Gemeinwesen beeinflußt w i r d 2 9 5 . Gerade letzterer Punkt rückt in zunehmendem Maße in den Blick, wenn in Einklang mit der sog. Broken-Windows-Theorie296 „Verwahrlosung und Verschmutzungen i m öffentlichen R a u m " 2 9 7 als Ursache des schwindenden Vertrauens in die staatlich gewährleistete Sicherheit bezeichnet w e r d e n 2 9 8 . Damit zusammenhängen dürfte, daß heute Überwachungskameras 2 9 9 zunehmend weniger als Einengung der persönlichen Freiheit denn als Plus an Sicherheit empfunden w e r d e n 3 0 0 und eine Erhöhung der Polizeipräsenz befürwortet w i r d 3 0 1 , obwohl davon auszugehen ist, daß sie sich - zumindest langfristig - nicht auf die Kriminalitätsrate a u s w i r k t 3 0 2 . Auffallend ist etwa, daß die eigene Nachbarschaft als sicher empfunden wird und steigende Kriminalitätsraten eher in anderen Gebieten vermutet werden: Feltes, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. E 7; S. Simon, Süddeutsche Zeitung v. 25. 9. 1998, S. 47; ausführlich zur Münchener Untersuchung Schmalzl, DP 1999, S. 44 ff. Vgl. ferner den Bericht über ein internationales Forschungsprojekt bei Murck Kriminalistik 1994, S. 447, 449; Lützenkirchen/Nijenhuis, Sicherheitsdienste, S. 32 ff.: über die Hälfte der Bundesbürger (im Westen 55,7%, im Osten 80,5%) sind etwas oder sehr besorgt, in der nahen Zukunft Opfer einer Straftat zu werden, wogegen fast 80% angaben, innerhalb der letzten zwei Jahre nicht Opfer einer Straftat geworden zu sein. Auffallend war zudem, daß in den Niederlanden die höchste Viktimisierungsrate, dennoch aber das geringste Unsicherheitsgefühl festgestellt wurde. 295 Feltes, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. E 16 f.; vgl. Kury/Obergfell-Fuchs, Kriminalistik 1998, S. 26, 28 ff.; Burgheim, DP 1999, S. 41, 43 f.; Hitzler, in: Hornbostel, Verunsicherung, S. 15 f. 296 Wilson/Kelling, KrimJ 1996, S. 121 ff.; vgl. dazu etwa U. Volkmann, NVwZ 1999, S. 225 ff.; Hess, KJ 1999, S. 32 ff.; AKIS, Memorandum, S. 40 ff.; Hecker, KJ 1997, S. 395 ff.; Darnstädt, Der Spiegel 28/1997, S. 48 ff.; Neffe, Der Spiegel 29/1997, S. 126 ff.; Sack, Der Spiegel 32/1997, S. 54 ff.; Schenk, Der Spiegel 40/1997, S. 70 ff.; Alberts, Süddeutsche Zeitung v. 23./24. 5. 1998, SZ am Wochenende S. III; Schnelten, Die Zeit v. 28. 3. 1997, S. 7. - auch die amerikanische Polizeiwissenschaft relativiert zum einen die Erfolge der New Yorker Polizei und führt sie zum anderen auf weitere Ursachen zurück, so Greene und Wasserman, in: F.-E.-Stiftung, New York, S. 49 ff., bzw. S. 67 ff. 297 R, Schulte, DP 1998, S. 329. 298 Hinzu dürfte treten, daß Äußerungen wie diejenige des ehemaligen Berliner Innensenators Schönbohm: „Wo Müll ist, kommen die Ratten. Und wo Verwahrlosung herrscht, ist auch Gesindel", verbreitete Empfindungen nicht nur beschreiben, sondern ihrerseits das Sicherheitsgefühl negativ beeinflussen. Die Äußerung wird von der Beigeordneten des Deutschen Städtetages Witte, DSD 2/1998, S. 11, zustimmend zitiert; in der Tendenz ähnlich Kanther, zit. η. N.N., Süddeutsche Zeitung v. 22./23. 11. 1997, S. 6. 299 Zur Praxis und Erfahrungen in Leipzig R. Müller, DP 1998, S. 114 ff.; Hessen plant dies, vgl. Zips, Süddeutsche Zeitung v. 26. 8. 1999, S. 6. 300 N.N., Neue Züricher Zeitung v. 22. 11. 1997. 301 Nach Reuband, DP 1999, S. 112, 114, legen Bevölkerungsumfragen den Schluß nahe, daß die vermehrte Wahrnehmung von Polizeistreifen im eigenen Wohnviertel das Sicherheitsgefühl der Bewohner zwar grundsätzlich erhöht, jedoch bei (fast) täglicher Präsenz der Polizei wieder abnimmt. Das höchste Sicherheitsgefühl ergab sich bei einer einmaligen Wahrnehmung polizeilicher Streifen pro Woche. 302 Bull, Staatsaufgabe Sicherheit, S. 22 f.
Β. Verhältnis privater und öffentlicher Sicherheit in Deutschland
105
Aus der Feststellung eines sinkenden Sicherheitsgefühls folgt jedoch nicht, daß auf private, insbesondere gewerbliche Sicherheitsbemühungen zurückgegriffen werden müßte. Relevant wird diese Entwicklung zum einen aufgrund der weitgehend unbestrittenen Annahme, daß die Polizei außerstande ist, das Sicherheitsbedürfnis in hinreichendem Maße zu befriedigen. Auch wenn sich die Polizei in jüngerer Zeit um eine vermehrte Streifentätigkeit bemüht und sich in kriminalpräventiven Räten mit anderen Aufgabenträgern um eine verbesserte Bekämpfung der Kriminalitätsursachen bemüht, so werden doch diese Anstrengungen in ihrer Summe als nicht ausreichend angesehen. Unabhängig davon, ob die Überlastung der Polizei aus ihren wachsenden Aufgaben 303 oder aber zumindest auch aus der Ausdehnung des Anspruchs an die Polizei 304 resultiert, verbleibt eine Sicherheitslücke, welche nach Meinung Einzelner im Hinblick auf „Europäisierung und Globalisierung der Kriminalität" sowie neue Kriminalitätsformen in der Zukunft wachsen wird 3 0 5 . Zum anderen führt diese Entwicklung nur dann zu einem Wachstum des privaten Sicherheitsgewerbes, wenn ihm zugetraut wird, die Sicherheitslücke angemessen zu füllen. Dementsprechend ist das Sicherheitsgewerbe bemüht, die Notwendigkeit seiner Dienstleistungen zu unterstreichen und sein Ansehen in der Bevölkerung zu verbessern 306. Letztlich wohl auch zu diesem Zweck sowie zur Beeinflussung des politischen Bereichs über einen Dialog mit der Wissenschaft, sponsert die deutsche Filiale des weltweit größten Sicherheitsunternehmens in großzügigem Umfang eine Forschungsstelle Sicherheitsgewerbe an der Universität Hamburg 307 . Insgesamt dürfte das Selbstbild des Sicherheitsgewerbes jedoch nach wie vor von seinem Image in der Bevölkerung abweichen308. Schlink/Popp haben dies in ihrem Roman „Selbs Justiz" treffend beschrieben: „Danckelmann stand es auf der Stirn geschrieben, daß er darunter litt, kein richtiger Polizist, geschweige denn ein richtiger Geheimdienstler zu sein. Das ist mit allen Werkschutzleuten dasselbe. Noch ehe ich ihm meine Fragen stellen konnte, hatte er mir erzählt, daß er 303 Schöpflin, Kriminalistik 1993, S. 689, 691; noch weitergehend Eberstein, BB 1980, S. 863, 868. 304 Vgl. Gusy/Nitz, in: H.-J. Lange, Staat, Demokratie und Innere Sicherheit, S. 335, 348 ff.; Lützenkirchen/Nijenhuis, Sicherheitsdienste, S. 37. 305 Stümper, Detektiv-Kurier 3/1998, S. 5, 9; Graf von Arnim, DSD 3/1997, S. 8, 10; vgl. Nitschke, zit. η. N.N., WIK 4/1995, S. 14. 306 Nachdem ein Wachmann in der ARD-Sendung „Alles oder Nichts" am 2. 7. 1985 gegen eine Abiturientin zum Thema „Napoleon" gewann, gratulierte ihm sein Arbeitgeber: „Sie haben bewiesen und allen Leuten gezeigt, daß es den angeblich ,dummen und einfältigen Wachmann4 nicht geben muß, wenn er nur gewillt ist, allein seine wachfreie Zeit mit einer sinnvollen Beschäftigung zu verbringen.", zit. η. N.N., W+S-Information 1985, S. 80. 307 Vgl. Peilert, Die Welt v. 18. 8. 1999, S. 15. Inwieweit die vielfach betonte Unabhängigkeit der Forschungsstelle tatsächlich gewährleistet ist, werden die zukünftigen Publikationen zeigen müssen. 308 Vgl. etwa H.-J. Lange, in: Gusy, Privatisierung, S. 215, 229; Wackerhagen/Olschok, in: Ottens/Olschok/Landrock, Europa, Rn. C 71.
106
§ 2: Die aktuelle Situation
bei der Bundeswehr nur aufgehört hatte, weil sie ihm zu lasch war." Kurz darauf äußert ein Werkschützer: „Wissen Sie, man hält den Werkschutz immer noch für eine Ansammlung pensionierter oder, schlimmer noch, gefeuerter Polizeibeamter, die zwar den Schäferhund auf jemanden hetzen können, der über den Betriebszaun klettert, aber nichts im Kopf haben. Dabei sind wir heute Fachkräfte in allen Fragen betrieblicher Sicherheit, vom Objektschutz bis zum Personenschutz und eben auch bis zum Datenschutz. Wir richten gerade an der Fachhochschule Mannheim einen Studiengang ein, der zum Diplom-Sicherheitswart ausbilden wird" 3 0 9 .
Zum Beleg einer zunehmenden Akzeptanz gewerblicher privater Sicherheitsdienstleistungen bedient sich der Bundesverband des deutschen Wach- und Sicherheitsgewerbes auch demoskopischer Mittel. Seine Auftragnehmer ermitteln in der Bevölkerung eine breite Zustimmung für das private Sicherheitsgewerbe 310. So halten 84% die These, das private Sicherheitsgewerbe erfülle eine wichtige Funktion, weil es die Polizei von vielen Aufgaben entlaste, für zutreffend. 75% meinten, die Eigenverantwortung des Bürgers müsse auch in Sicherheitsfragen mehr gefordert werden, und 70% stimmten der These zu, daß private Sicherheitsdienste unverzichtbar seien, weil die Polizei der Kriminalität nicht mehr allein Herr werden könne. Ferner sei es 65% der Befragten im Westen und 70% in den neuen Bundesländern gleichgültig, ob private Wachmänner oder Polizisten den Streifendienst ausüben. Und schließlich sei über die Hälfte der Bevölkerung bereit, für mehr Sicherheit auch mehr zu bezahlen311. Ein anderes Bild ergeben Umfragen von Kriminologen 312 oder aber durch die Polizei selbst, welche in letzter Zeit in zunehmendem Maße als Mittel angesehen werden, eine bürgernahe Polizeiarbeit zu ermöglichen 313 . Nach einer 1996 durchgeführten Untersuchung der Polizeiinspektion Neumünster 314 waren 97,7% der Bevölkerung der Ansicht, daß es „ohne Polizei nicht geht", 75% hielten die Aussage für völlig falsch, daß die meisten Aufgaben, die die Polizei erfüllt, auch von privaten Sicherheitsdiensten erledigt werden könnten 315 . Bei einer Befragung durch die Polizei in Eckernförde nannten
309 Schlink/Popp, Selbs Justiz, S. 19, 20 f. - Zwölf Jahre nach der Fiktion eines Fachhochschul-Studiengangs ist er heute an der Verwaltungsfachhochschule Altenholtz Wirklichkeit geworden. Allerdings ist man in der Bezeichnung des Abschlusses anspruchsvoller geworden: „Sicherheitsmanager". 310 Stumpf (Marplan), DSD 2/1998, S. 10; vgl. auch Olschok, DSD 16 (1995), S. 25,28. 311 Angaben des Meinungsforschungsinstituts Marplan, zit. v. N.N., WIK 4/1995, S. 14; N.N., Sicherheits-Berater 12/1995, S. 195 f. 312 Obergfell-Fuchs, in: Weiß/Plate, S. 131 ff. 313 Dazu H.-R. Volkmann, DP 1998, S. 293 ff.; vgl. N.N., Göttinger Tageblatt v. 17. 10. 1998, S. 15; N.N., Süddeutsche Zeitung v. 1. 12. 1998, S. 5. - Einen anderer Weg der Kommunikation mit den Bürgern stellt es dar, wenn das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt unter dem Titel „Sicher leben mit ihrer Polizei" eine achtseitige Zeitung in einer Auflage von 2 Millionen verteilt. 314 Lutz, DSD 2/1998, S. 23, 24. 315 Vgl. auch das Ergebnis einer Befragung zur Inneren Sicherheit in Bremen bei N.N., DP 1998, S. 295: 75% der Befragten waren mit der Arbeit der Polizei (sehr) zufrieden, wäh-
Β. Verhältnis privater und öffentlicher Sicherheit in Deutschland
107
auf die Frage, wie die Kriminalität verringert werden könne, 58% eine Verstärkung der Polizei, hingegen nur 10% einen verstärkten Einsatz privater Sicherheitsdienste 316 . Nach einer Umfrage in Wuppertal fühlten sich 77% von der Polizei und nur 2% von privaten Wach- und Sicherheitsdiensten besser geschützt317. Schließlich nannten auf die Frage, welche staatlichen Maßnahmen das Sicherheitsgefühl erhöhen würden, nur 43% mehr private Wachdienste, welche damit hinter Beleuchtung/Belebung des öffentlichen Raums (88%), mehr polizeilichen Streifendienst (86%), schärferen Gesetzen (58%) und dem Vorschlag, Wehrpflichtige zur Polizei zuzulassen (45%) eine niedrige Priorität einnahmen318. Diese Umfrageergebnisse dürften den Schluß zulassen, daß private Sicherheit nur mangels polizeilicher Alternative zur Verbesserung der (subjektiven) Sicherheitslage begrüßt wird 3 1 9 . Umgekehrt liegt die Vermutung nahe, daß eine Imageverbesserung des privaten Sicherheitsgewerbes seine Umsatzchancen wachsen lassen würde. Eine weitere Strategie des Sicherheitsgewerbes bemüht in jüngerer Zeit ganz im Einklang mit dem Warencharakter der Sicherheitsdienstleistung Radio- und Fernsehwerbung, wobei vorhandene Ängste und Befürchtungen in der Bevölkerung gezielt angesprochen werden 320 ; Kritiker sprechen von einem Anheizen des »Angstmarktes" 321 , aber auch besonnenere Stimmen sprechen von einem „grundlegenden Interesse [des Sicherheitsgewerbes] an einem gewissen Kriminalitätsbestand", ,»Delikte an Nichtkunden" seien „eine Art Werbefaktor" 322.
IV. Sicherheit als einheitliche, gesamtgesellschaftliche Aufgabe Neben diesen Erklärungen anhand tatsächlicher Entwicklungen - Marktfähigkeit von Sicherheitsdienstleistungen, Sicherheitslage und polizeiliche Kapazitäten, Sicherheitsgefühl, Vermarktungsstrategien - stehen Rechtfertigungen der Privatirend nur 17% ebenso über private Sicherheitsdienste urteilten. Allerdings antworteten 75% in Bezug auf das private Sicherheitsgewerbe, sie könnten dies nicht beurteilen. 316 N.N., DP 1998, S. 297. 317 Walmeroth, Praktische Erfahrungen, S. 5. 318 Die Woche v. 11. 8. 1994, zit. n. Lützenkirchen/Nijenhuis, Sicherheitsdienste, S. 52. 319 So auch Obergfell-Fuchs, in: Weiß/Plate, S. 131,136. 320 Nogala, in: Hitzler/Peters, insbes. S. 3 ff. des Manuskripts; Biedermann, Frankfurter Rundschau v. 4. 10. 1993, S. 13; vgl. auch die Überschrift „Verbrechen zahlt sich doch aus", in: N.N., Süddeutsche Zeitung v. 30. 9. 1997, S. 27. 321 Beste, in: Bussmann/Kreissl, Kritische Kriminologie, S. 311, 324; Voß, NKP 2/1993, S. 39, 40; Nogala, KrimJ 1993, S. 228, 233; Narr, cilip 43 (1992), S. 6, 8; vgl. Arzt, Recht und Ordnung, S. 51 f.; Schuster, DP 1989, S. 5, 7; Hoffmann-Riem, ZRP 1977, S. 277, 279; vgl. auch Heitmeyer, zit. v. Orzessek, Süddeutsche Zeitung v. 13. 10. 1998, S. 16: die „Durchmarktung der inneren Sicherheit" führe dazu, daß Gewaltkriminalität ein selbsttragender, innovativer Faktor in der Dienstleistungsgesellschaft werde. 322 Gramm, Privatisierung, Kap. 3.4.1, S. 225, auch Kap. 5.1.2.3, S. 372; vgl. auch Roßnagel, Radioaktiver Zerfall, S. 195; dagegen Ottens, DSD 2/1999, S. 11, 12.
108
§ 2: Die aktuelle Situation
sierungstendenzen, welche einen Bewußtseinswandel nach sich ziehen (sollen) und damit ihrerseits Privatisierungsbemühungen fördern. Ihr regelmäßiger Anknüpfungspunkt ist das auch auf Polizeiseite übernommene Stichwort der „gesamtgesellschaftlichen Sicherheitsaufgabe" 323. Gebe es „keinen allumfassenden Versorgungsstaat"324, so sei nicht allein der Staat mittels seiner Polizei für den Rechtsgüterschutz zuständig. Vielmehr bestehe eine Eigen- und Mitverantwortung des Bürgers 325 , Eigenschutz sei in einer freiheitlichen Gesellschaft Bürgerpflicht 326 . Könne der Staat die Kriminalität alleine nicht mehr hinreichend wirksam bekämpfen, so müsse im Interesse einer „effizienteren Gefahrenabwehr" 327 ein „ganzheitliches Sicherheitssystem" aus Polizei, Bürgern und privaten Sicherheitskräfte entstehen 328 : „Die Polizei braucht Freund und Helfer" 329 . Ist der Ausgangspunkt dieses Gedankengangs, es bestehe keine Allzuständigkeit des Staates für den Rechtsgüterschutz, noch mit der Trennungsthese konform, so ebnen die weiteren Folgerungen die Differenzierungen des Trennungsmodells nach der Art des zu schützenden Rechtsguts ein. Dementsprechend wird nicht nur konstatiert, daß sich die Aufgaben von Polizei und Privaten „vermischen" und keine konturenscharfen Abgrenzungen mehr möglich seien 330 , vielmehr wird dies über Formulierungen einer (Sicherheits-)Partnerschaft 331, einer neuen Arbeitsteilung 332 , einem privaten Beitrag zur Inneren Sicherheit 333 als selbstverständlich angesehen; „gemeinsames Ziel: Sicherheit" 334 . Mahnungen, Polizisten und Private könnten „keine Kollegen" sein, weil die Polizei das Gemeinwohl, Private hingegen betriebswirtschaftliche Interessen verfolgten 335 , sind seltener geworden. Überwiegend wird der Trend einer 323
Diese oder ähnliche Formulierungen etwa bei Schily, RuP 1999, S. 1, 2 f.; Rupprecht, Handelsblatt v. 25. 5. 1998, S. 53; Zuber, DSD 3-4/1998, S. 3, 4; Kanther, W&S 1994, S. 919; Herzberg, DSD 13 (1993), S. 178, 179; Loyo, DSD 7/1990, S. 48, 49; F. Zimmermann, W+S-Information 1984, S. 83, 84; Stüllenberg, W+S-Information 1982, S. 81, 84. 524 Loyo, DSD 5 /1989, S. 66, auch ders., DSD 5 /1989, S. 54. 3 25 Olschok, DSD 2/1997, S. 6, 8; Stober, DSD 2/1998, S. 28 ff. 326 Glavic, DP 1994, S. 36, 38; Eberstein, BB 1980, S. 863, 868; ähnlich Köhler (BKA), DP 1994, S. 49, 52; Stümper, Kriminalistik 1975, S. 193, 194. 327 Kanther, DSD 3-4/1998, S. 5. 328 w. Hoffmann, DSD 2/1998, S. 16, 20. 329 Holz, DSD 13 (1993), S. 188; zum Einstellungswandel bei der Polizei auch Korell, cilip 51 (1995), S. 17, 18. 330 Thieme, W+S-Information 1985, S. 20. 331 Pitschas, DÖV 1997, S. 393, 397; ders., Kriminalistik 1999, S. 153, 154; ders., in: Schuppert, Jenseits von Privatisierung, S. 135, 142 ff.; Steinke, W&S 1995, S. 121, 122; HM. Zimmermann, CD 3/1995, S. 11, 12; Köhler, DP 1994, S. 49, 54; Thieme, W+S-Information 1985, S. 71, 79. 332 Stober, DSD 2/1998, S. 28 ff.; Gramm, VerwArch 90 (1999), S. 329, 331, der allerdings zutreffend eine „Restdifferenz zwischen Staat und Gesellschaft" betont, ebd., S. 360. 333 BDWS, DSD 2/1997, S. 3, 5. 334 Mauersberger, DSD 13 (1993), S. 176, 177. 335 ßeese, CD 5/1994, S. 70, 72, 74; ähnlich Bull, in: Bizer/Koch, Sicherheit, S. 13, 17; Freiberg, Kriminalistik 1999, S. 362, 364 f.; Steffenhagen, DSD 16 (1995), S. 18, 21 f.;
Β. Verhältnis privater und öffentlicher Sicherheit in Deutschland
109
zunehmenden Einbeziehung des Bürgers in vormals staatliche Sicherheitsaufgaben damit in den breiteren Diskussionszusammenhang des Funktionswandels des „überforderten" Staates gestellt und häufig in Anklang an kommunitarische Thesen begrüßt. Ganz im Gegensatz zu dieser Beurteilung des privaten Engagements als Bürgertugend wird in ihm von wenigen Autoren ein Indiz für eine auseinanderfallende Gesellschaft gesehen: Das Grundeinverständnis mit bislang anerkannten (politischen) Institutionen löse sich zunehmend auf und „entgrenze" den Bereich des Politischen. Der damit politisierte Alltag werde zunehmend unübersichtlicher, was letztlich zu einer „privatistischen" Mobilisierung des Bürgers in zahlreichen Bereichen führe. Es entstünden „Wagenburg-Mentalitäten", die Menschen schlössen sich mit ihresgleichen zu „Schutzgemeinschaften" zusammen und sanktionierten nicht nur Verstöße gegen die legale, sondern auch gegen die von ihren Mitgliedern als legitim betrachtete Ordnung 336 .
V. Privatisierung des öffentlichen Lebens Die dargestellten Beschreibungen betrachten die Zunahme privater Sicherheitsbemühungen als weitgehend einheitliche Entwicklung. Während der Staat insbesondere aus Gründen der Finanzknappheit seinen Sicherheitsauftrag durch eine verstärkte Einbeziehung Privater zu erfüllen trachtet, werden die Bürger wegen einer nicht ausreichenden Befriedigung ihres Sicherheitsbedürfnisses entweder selber aktiv oder greifen auf gewerbliche Sicherheitsdienstleistungen zurück. Weniger diskutiert sind Ursachen, die sich auf einzelne Formen privaten Rechtsgüterschutzes beziehen. Hier wäre etwa näher zu untersuchen, ob und inwieweit trotz der Bevorzugung polizeilichen Schutzes durch die Mehrheit der Bevölkerung für bestimmte Auftraggebergruppen das Sicherheitsgewerbe die erwünschte Dienstleistung besser zu erbringen vermag. Diese Vermutung liegt insbesondere für die Bewachung und Bestreifung einem privaten Nutzungsregime unterliegender faktisch öffentlicher Räume nahe, weil die „Betreiber des öffentlichen Lebens" andere Ordnungsvorstellungen haben können, als sie in dem polizeilichen Schutzgut der öfV. Walsleben, cilip 43 (1992), S. 14, 16; vgl. auch die scharfen Formulierungen von Harzer, Jura 1995, S. 208, 210 f. 336 Hitzler, Ästhetik & Kommunikation 85/86 (1994), S. 55 ff. Er faßt zusammen: „Es sieht so aus, als verlagere sich die politische Gestaltungsmacht von der Dominanz vielfältiger Expertokratien zur moralischen Omnipräsenz von technophoben Jammergemeinschaften, therapeutischen Selbstsuchern und ideologischen Heilsfindern, professionellen Benachteiligtensprechern und emanzipativen Klagevirtuosen zum einen und zur alltäglichen Selbstverteidigungs und Wehrbereitschaft sowie zur gar nicht mehr so unterschwelligen Rückkehr eines »gesunden Volksempfindens 4 bzw. zu den intellektuellen Sympathisanten und den gewalttätigen Terror-Kadern desselben zum anderen, die sich in immer neuen Destruktions- und Verhinderungskoalitionen zu punktuellen und situativen Widerständen gruppieren/ 4, ebd., S. 61; ähnlich ders., in: Hornbostel, Verunsicherung, S. 15, 17 ff.; Kreissl, Süddeutsche Zeitung v. 14. 10. 1997, S. 13; Nogala, in: Hitzler/Peters, S. 15 des Manuskripts; vgl. bereits Arzt, in: FS Schaffstein, S. 77, 86 ff.
110
§ 2: Die aktuelle Situation
fentlichen Sicherheit und Ordnung enthalten sind 337 . Zum anderen erscheint ein Rückgriff auf private Sicherheit für die Auftraggeber wegen ihres privatrechtlichen Anspruchs auf ein Tätigwerden der beauftragten Sicherheitsdienstleister erfolgversprechender. Trotz der Subjektivierung der polizeilichen Privatschutzklauseln 338 (etwa § 1 I I PolGNW) besteht bei den bedrohten Hausrechtsinteressen regelmäßig kein Anspruch auf ein bestimmtes polizeiliches Einschreiten. Zu diesem unter dem Stichwort »Privatisierung oder Funktionswandel des öffentlichen Raums4 erörterten Themenkomplex finden sich zwar zahlreiche plausible Thesen, jedoch wenig wissenschaftlich fundierte Aussagen339. Schwierigkeiten ergeben sich bereits aus einer Verwendung unklarer Begriffe wie ,semi-' oder ,halb-öffentlicher 4 und »nichtöffentlicher öffentlicher Raum t 3 4 0 . Ich schlage vor, vier Arten öffentlicher Räume zu unterscheiden: (1) in Privateigentum stehende Räume, welche als solche erkennbar sind und einem Privaten zugeordnet werden, aber dem allgemeinen Verkehr geöffnet sind (Kaufhaus); (2) in Privateigentum stehende Räume, die äußerlich kaum abgegrenzt sind und nach den sozialen Anschauungen als öffentlicher Raum qualifiziert werden (Ladenpassage); (3) öffentlich zugängliche Räume, in denen zwar privates Hausrecht gilt, dieses jedoch öffentlich-rechtlich überlagert ist (U-Bahn-Station); (4) unabhängig von den Eigentumsverhältnissen öffentlich-rechtlich dem Gemeingebrauch gewidmete Räumlichkeiten (Fußgängerzone). Der Umfang und die rechtlichen Möglichkeiten eines Einsatzes privater Sicherheitskräfte sind in diesen Bereichen unterschiedlich. Sie agieren jedoch in allen vier Arten öffentlicher Räume im privaten Interesse ihrer Auftraggeber 341. Nach Angaben des Sicherheitsgewerbes werden 10% der privaten Sicherheitskräfte im öffentlich-rechtlichen Hausrechtsbereich und 5% im öffentlichen Bereich, insbesondere im Öffentlichen Personennahverkehr, tätig 3 4 2 . Dabei wird ihr Einsatz innerhalb der unter (1) beschriebenen Räume weitgehend als selbstverständlich hingenommen. Dies ist jedoch durchaus nicht zwingend, weil die allgemeine Zugänglichkeit auch für die Polizei gilt. Werden private Sicherheitskräfte insbesondere 337 Vgl. Feltes, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. E 35 ff.; Langenbrink, NWVB1. 1995, S. 285, 290; vgl. Voß, JhbRsozRth XV, S. 81, 92 f. 338 Grundlegend BVerwG 11, 95 = DVB1. 1961, S. 125, 126 f., m. Anm. Bachof, S. 128, 129 f.; Martens, JuS 1962, S. 245 ff., insbes. S. 248; Henke, DVB1. 1964, S. 649 ff., insbes. S. 653 ff.; Frotscher, DVB1. 1976, S. 695, 703; Gusy, Polizeirecht, Rn. 311. 339 Vgl. Gusy, in: Schuppert, Jenseits von Privatisierung, S. 115,119 f. 340 Lutz, Zusammenarbeit, S. 4. 341 Oben A. II. 2. a) aa). 342 BDWS, DSD 2/1997, S. 3; Olschok, DSD 2/1997, S. 6; ders., in: Pitschas/Stober, Quo vadis, S. 91, 100.
Β. Verhältnis privater und öffentlicher Sicherheit in Deutschland
111
zum Schutz gegen Ladendiebstähle und Hausrechtsverstöße eingesetzt, so schützen sie Rechtsgüter, welche auch öffentlich-rechtlich konstituiert sind und damit einen polizeilichen Schutz ermöglichen 343 . Ist die Substitution staatlicher durch private Sicherheitskräfte nicht zwingend, drängt sich erneut die ungeklärte Frage nach ihren Ursachen auf: Verdrängen die Privaten die Polizei oder füllen sie eine von der Polizei nach deren Rückzug offengelassene Lücke 344 ? Unabhängig von diesen Überlegungen wird konstatiert, daß unser Leben in zunehmendem Maße in öffentlich zugänglichen, aber in Privateigentum stehenden Räumlichkeiten stattfindet 345 . Eingebettet sei diese fortschreitende Entwicklung in die Tendenz einer zunehmenden Differenzierung der Funktionen bestimmter Flächen innerhalb der Stadt, welche eine früher bestehende funktionale Einheit des öffentlichen Raums einer Stadt auflöse und etwa als „Atomisierung der Stadt" 346 beschrieben, zumeist kritisiert wird 3 4 7 . Das Verhalten privater Sicherheitsdienste gerät dann in den Blick, wenn es im Rahmen eines privaten Hausrechts privat gesetzte Ordnungen durchsetzt. Das Tätigwerden privater Sicherheitskräfte zur Durchsetzung dieser privaten Ordnungen unterliegt dabei jedoch den Marktgesetzen, womit nicht nur formale Abweichungen vom öffentlich-rechtlich organisierten Rechtsgüterschutz impliziert sind 3 4 8 : Private Ordnungen funktionieren weitgehend konfliktfrei im Rahmen stabiler sozialer Beziehungen zwischen den Beteiligten. Diese wiederum ergeben sich insbesondere aus der Möglichkeit der Beteiligten, am Markt teilzunehmen. Fehlen diese Voraussetzungen in Bezug auf bestimmte Bevölkerungsgruppen, so wird der Markt auf deren Interessen keine Rücksicht nehmen, eine durch den Markt gesteuerte Normbefolgung scheitert. Angewendet auf die überwiegend zum Konsumieren dienenden öffentlichen Räume liegen damit Konflikte nahe. Die Geschäftsleute haben kein Interesse an einer Berücksichtigung von Verhaltenspräferenzen sozial schwacher Bevölkerungsgruppen, 343 Vgl. oben Α. II. 2. a) aa), III. 344 Vgl. bereits oben A. III. 345 Bereits thematisiert und rechtlich eingeordnet bei Greifeid, DÖV 1981, S. 906, 909. 346 Sennett, Tyrannei der Intimität, etwa S. 375; im Hinblick auf weitgehend abgegrenzte Tätigkeitsfelder privater Sicherheitsdienste und der Polizei spricht H.-J. Lange, in: Gusy, Privatisierung, S. 215, 230 f., von „Inseln". 347 Vgl. AKIS, Memorandum, S. 40 f. - Allgemein zur Entwicklung des Verhältnisses von Privatheit und Öffentlichkeit wissenschaftliche Überblicke bei Ariès, in: Ariès / Chartier, Geschichte des öffentlichen Lebens III, S. 7 ff., insbes. S. 16, 18 f., Chartier, ebd., S. 23 ff., 407 ff., und Prost, in: ders. /Vincent, Geschichte des öffentlichen Lebens V, S. 15, insbes. S. 118 ff. Speziell am Beispiel Einkaufszentrum kritisch Hoffmann-Axthelm, in: Fuchs/Moltmann/ Prigge, Mythos Metropole, S. 63 ff.: Einkaufszentren seien „geschützte, geschlossene Behälter, in denen Stadterlebnis inszeniert wird", S. 66, und die Forderung, Orte zu schaffen, an denen „Gesellschaft nicht gespielt wird, sondern tatsächlich geschieht... Die Regie müßte wieder fallen, Autonomie eingeräumt werden", S. 71. 348 Zum Folgenden Gusy, StWStP 1994, S. 187, 193 ff., im Anschluß an Baurmann, Tugend, insbes. S. 310 ff., 499 ff., 514 ff., 546 ff.; vgl. auch Gramm, Privatisierung, Kap. 3.4.4, 3.4.5, S. 232 ff.
112
§ 2: Die aktuelle Situation
diese wiederum haben keinen Anreiz, sich „konsumfreundlichen" Verhaltensweisen anzupassen. Damit werden die dort geltenden privaten Ordnungen teilweise bestimmte Bevölkerungsgruppen, zumindest aber bestimmte Verhaltensweisen aus dem öffentlichen Raum ausschließen, welche zwar nicht gegen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung verstoßen, aber privat als deviant definiert wurden. Am Beispiel: Die Hausordnung im CAP Kiel (einem an den Hauptbahnhof angeschlossenen Vergnügungszentrum mit Kinos, Restaurants und Cafés) verbietet das „Mitführen von Hunden", das Konsumieren „mitgebrachter Getränke", das „Betteln und Hausieren sowie das Verteilen von Handzetteln". Ferner heißt es dort: „Vermeiden Sie Belästigungen und Verschmutzungen" sowie abschließend: „Jeder Besucher im CAP hat sich so zu verhalten, daß er keinen Anstoß erregt" 349 . Im Ergebnis führt diese Privatisierung der Sozialkontrolle 350 nach Ansicht ihrer Kritiker 3 5 1 dazu, daß grundrechtlich geschütztes Verhalten durch die Privatisierung des öffentlichen Lebens in zunehmenden Teilbereichen erschwert wird 3 5 2 . Stellt sich die Normbefolgung hier nicht bei allen Bevölkerungsgruppen aufgrund paralleler Interessenstrukturen ein, so bleibt die Tätigkeit der privaten Sicherheitskräfte nicht auf Prävention beschränkt. Dementsprechend erkennt auch das Sicherheitsgewerbe eine erhöhte Wahrscheinlichkeit des Gewalteinsatzes bei Tätigkeiten im öffentlichen Raum 353 . Um den hier angesprochenen Tendenzen zu entgehen, werden Einschränkungen privater Ordnungsmöglichkeiten gefordert, durch welche dann das die privaten Ordnungen durchsetzende Sicherheitspersonal in seinen Handlungsmöglichkeiten beschränkt würde 354 . Anzumerken ist, daß diesen zumeist nur im Hinblick auf das Verhalten sog. Randgruppen wie Wohnsitzlosen, Punks oder Drogenabhängigen beschriebenen Tendenzen eine darüber hinausgehende Bedeutung zukommen dürfte, weil die eng 349 Immerhin hing die Hausordnung dort - am 10. 9. 1999 - so aus, daß sie einem Kunden in den Blick fällt. 350 Voß, NKP 2/1993, S. 39. 351 Beste/Voß, in: Sack/Voß/Frehsee/Funk/Reinke, Privatisierung, S. 219, 231: „selektive Ausgrenzungsstrategien"; allgemeiner dies., in: Institut für Kriminalwiss., Vom unmöglichen Zustand, S. 313, 325 ff.; Beste, in: Bussmann/ Kreissl, Kritische Kriminologie, S. 311, 326; zum folgenden auch Weichert, in: Gössner, Mythos Sicherheit, S. 263, 264, 268; weniger kritisch Lützenkirchen/Nijenhuis, Sicherheitsdienste, S. 42. 352 Nach Pütter, cilip 43 (1992), S. 32, 37, liegt der Schwerpunkt des Einschreitens privater Sicherheitskräfte in Räumlichkeiten des öffentlichen Personennahverkehrs nicht bei Handlungen zugunsten von Leib oder Leben der Fahrgäste, sondern richtet sich gegen Störungen einer privat gesetzten Ordnung. 353 Raber, DSD 16 (1995), S. 11, 12. 354 Vgl. Beste/Voß, in: Sack/Voß/Frehsee/Funk/Reinke, Privatisierung, S. 219 ff.; dies., in: Institut für Kriminalwiss., Vom unmöglichen Zustand, S. 313, 325 ff.; Beste, in: Bussmann / Kreissl, Kritische Kriminologie, S. 311, 326; Weichert, in: Gössner, Mythos Sicherheit, S. 263, 264, 268. Nach Sonntag-Wolgast, Innere Sicherheit, S. 3, gehört die Bestreifung des öffentlichen Verkehrsraums zu den nicht privatisierungsfähigen Kernaufgaben des Staates.
Β. Verhältnis privater und öffentlicher Sicherheit in Deutschland
113
definierten Ordnungen für das Verhalten der gesamten Bevölkerung gelten, welche sich hieran weitgehend anpaßt und diese Ordnungsvorstellungen zumindest teilweise internalisiert. Dies kann zur Folge haben, daß der durch private Ordnungen bewirkte Konformitätsdruck auf die allgemeinen Ordnungsvorstellungen rückwirkt und sich so das Maß an akzeptierter Pluralität verringert. Dies wiederum kann dazu führen, daß so unbestimmte Gebote wie dasjenige der zitierten Hausordnung, sich so zu verhalten, daß man „keinen Anstoß erregt", zunehmend enger ausgelegt werden. Darüber hinaus erweitern sich möglicherweise die als unabdingbar angesehenen sozialen Verhaltensstandards, welche vom polizeilichen Schutzgut der öffentlichen Ordnung erfaßt werden 355 . Forschungsarbeiten, welche diese Zusammenhänge näher untersuchen, sind jedoch nicht ersichtlich 356 . Die hier ansatzweise beschriebene Problematik scheint allerdings weitere Bemühungen um eine Privatisierung des öffentlichen Raums und einen verstärkten Einsatz privater Sicherheitskräfte nicht zu verhindern 357 .
VI. Zusammenarbeit zwischen Polizei und Privaten Ein weiterer Problembereich wird in einer Zusammenarbeit zwischen staatlichen und privaten Sicherheitskräften gesehen. Sinnervollerweise ist hierunter nicht jedes gleichzeitige Handeln von Polizei und Privaten zu verstehen, wie es aufgrund der Parallelität der Schutzzuständigkeiten bei öffentlichen und privaten Rechtsgütern häufig vorkommt, sondern allein eine aufeinander abgestimmte, ineinandergreifende Funktionsteilung 358 . Der Grundtenor der Diskussion hat sich in dieser Frage ebenfalls zugunsten des privaten Sicherheitsgewerbes verschoben. Mittlerweile werden nicht mehr nur von privater Seite 359 ein „vertrauensvolles Mit- statt Gegeneinander" 360, eine „gedeihliche Zusammenarbeit" 361, „Kooperation" und 355 Krit. Volkmann, NVwZ 1999, S. 225, 228 f. 356 Theoretische Ansätze ohne empirische Unterfütterung bei Beste, in: Frehsee/Löschper/Smaus, Konstruktion der Wirklichkeit, S. 183 ff. 357 Vgl. etwa die Forderung des damaligen nordrhein-westfälischen Ministers Hombach, der öffentliche Raum (hier: Bahnhöfe) solle durch den Einsatz privater Sicherheitskräfte „zurückerobert" werden, zit. n. von Schoenebeck, Neue Westfälische v. 19. 9. 1998; krit.: Kreissl, Süddeutsche Zeitung v. 8. 7. 1997, S. 11; weitere Beispiele bei Krölls, NVwZ 1999, S. 233; vgl. auch Beste/Voß, in: Sack/Voß/Frehsee/Funk/Reinke, Privatisierung, S. 219, 230 f. 358 Beispiele oben Α. I. 3. b). 359 BDWS, DSD 2/ 1997, S. 3, 5; Wackerhagen, DSD 2/1998, S. 4, 6; Ottens, DSD 2/ 1999, S. 11, 16. 360 Mahlberg, Gefahrenabwehr, S. 255; ähnlich Kanther, DSD 13/1993, S. 173; Lutz, DSD 2/1998, S. 23. 361 Unter Berufung auf Ahegg auch Schuster, DSD 2/1988, S. 15, und Boetcher, W+S-Information 1980, S. 12, 13; Abeggs Zitat ist wiedergegeben bei Olschok-Tautenhahn, DP 1994, S. 31 = DSD 14 (1994), S. 13. 8 Nitz
§ 2: Die aktuelle Situation
114
„Partnerschaft" gefordert 362 , noch moderner finden sich Forderungen nach einer „Police-Private-Partnership" 363. Kritische Stimmen, welche eine Distanz zwischen privaten Sicherheitsunternehmen und der Polizei fordern, weil das polizeiliche Berufsethos unmittelbar auf das Gemeinwohl, das privatwirtschaftliche hingegen auf eigene betriebswirtschaftliche Interessen ziele 364 , finden sich seltener. Sieht man die Frage nach der Notwendigkeit einer Zusammenarbeit zwischen Privaten und der Polizei als von der Realität bereits positiv beantwortet an und fragt daher allein nach dem „Wie" und „Wo" einer Zusammenarbeit 365, finden sich bescheidenere Antworten. Eine verstärkte Zusammenarbeit wird insbesondere in den Bereichen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Veranstaltungsschutzes gefordert 366 , also in Bereichen, in denen bereits kooperiert wird. Damit zielen die Forderungen weniger auf Neuerungen, als vielmehr auf die Beseitigung bestehender Barrieren, welche in mangelnder Professionalität einiger privater Sicherheitsdienste und Unverständnis für die jeweils andere Handlungsrationalität gesehen werden; Private würden rechtsstaatliche Bindungen der Polizei teilweise als zeitraubenden Bürokratismus verkennen 367 . Inhaltlich beziehen sich die Zusammenarbeitsforderungen zumeist auf einen verstärkten Informationsaustausch 368. Während einerseits in einer verbesserten Zusammenarbeit eine Chance auch zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität gesehen wird 3 6 9 , werden andererseits Bedenken im Hinblick auf die polizeiliche Neutralität und den Datenschutz geltend gemacht 370 . So käme eine Zusammenarbeit im Sinne eines gleichberechtigten Geben und Nehmens nicht in Betracht. Vielmehr könnten die Privaten im öffentlichen Raum allenfalls Melderfunktionen überι
nehmen
ITO
, wie sie bereits von Taxi-Fahrern übernommen werden
.
362 So auch die Einschätzung von Peilert, DVB1. 1999, S. 282; vgl. N.N., Handelbslatt v. 19. 5. 1998, S. 4; Bökel, zit. η. N.N., DP 1999, S. 62; H.-M. Zimmermann, CD 3/1995, S. 10, 12 m. w. N. 363 Stober, DÖV 2000, S. 261 ff.; ders., in: Pitschas/Stober, Quo vadis, S. 35, 58 ff.; ders., NJW 1997, S. 889; ihm terminologisch folgend Peilert, DVB1. 1999, S. 282; Schnekenburger, Rechtsstellung, S. 266 ff.; vgl. Wadle, DSD 2/1997, S. 15 ff. 364 ßeese, CD 5/1994, S. 70, 72, 74; ähnlich Steffenhagen, DSD 16 (1995), S. 18, 21 f.; Murck, in: Weiß/Plate, Privatisierung, S. 119, 125 f.; vgl. auch die terminologische Differenzierung bei K. Maier, DSD 3/1997, S. 15,18: keine „Partnerschaft", weil diese Gleichrangigkeit voraussetze, sondern „Kooperation". 365 Lützenkirchen/Nijenhuis, Sicherheitsdienste, S. 20 f.; Peilert, DVB1. 1999, S. 282 f.; Glavic, DP 1994, S. 36, 38. 366 Hugo, WIK 4/1995, S. 20; Herzberg, DSD 13 (1993), S. 178, 180. 367 Lützenkirchen /Nijenhuis, Sicherheitsdienste, S. 20. 368 BDWS, DSD 2/1997, S. 3, 5; früher bereits Geerds, W+S-Information 1980, S. 171, 173 ff. 369 Sieber, JZ 1995, S. 758,767. 370 Dazu Peilert, DVB1. 1999, S. 282, 287, 288 ff.; Weichert, DP 1994, S. 313 ff., insbes. S. 315 f.; Helmers/Murck, DP 1994, S. 64, 67; vgl. die Diskussionswiedergabe bei BrauserJung, DP 1998, S. 326, 327.
Β. Verhältnis privater und öffentlicher Sicherheit in Deutschland
115
Datenschutzrechtliche Bedenken werden auch im Hinblick auf gemischt polizeilich-private Doppelstreifen geltend gemacht 373 . Diese Zusammenarbeitsform wirft zudem Probleme bei der Suche nach dem anwendbaren Recht auf 3 7 4 . Zutreffend ist zunächst, daß sich die Polizei ihrer öffentlich-rechtlichen Bindungen nicht dadurch entledigen darf, daß sie die ihr verwehrten Handlungen von den Privaten ausführen läßt 3 7 5 . Schwieriger zu beurteilen ist jedoch, ob sich eine einheitliche Handlung wie etwa das Festhalten eines Störers in einen öffentlich-rechtlichen und einen privatrechtlich zu beurteilenden Teil aufspalten läßt. Dies wird überwiegend abgelehnt, ein gemeinsames Handeln sei daher unzulässig376, zumindest jedoch nicht wünschenswert 377. Die Kritiker übersehen dabei jedoch, daß in den Doppelstreifen auch die Privaten in den praxisrelevanten Bereichen der kommunalen Daseinsvorsorge dem Verwaltungsprivatrecht unterliegen, so daß ihre Befugnisse einerseits nicht weiterreichen als diejenigen der Polizei 378 , der Staat sich also durch eine Zusammenarbeit mit den Privaten nicht seiner öffentlich-rechtlichen Bindungen entledigt, und andererseits ein Rückgriff auf die Jedermannrechte aufgrund deren Subsidiarität regelmäßig nicht in Betracht kommt, eine Notwehrhandlung also etwa nicht erforderlich i.S.v. § 32 Π StGB, § 227 I I BGB ist 3 7 9 . Ohne hier die rechtlichen Rahmenbedingungen näher zu überprüfen 380, kann festgehalten werden, daß rechtliche Grenzen einer Zusammenarbeit von Polizei und Privaten bestehen und eine Zusammenarbeit damit insbesondere im Vorfeld der Gefahrenabwehr in Betracht kommt. Dies wird mittlerweile auch von Polizeiseite für notwendig gehalten 381 . Angeführt werden der Ausbildungs- und Fortbildungsbereich, ein Abstimmen des Einsatzes bei Großveranstaltungen sowie im 371 Steffenhagen, DSD 16 (1995), S. 18, 22; H.-M. Zimmermann, DP 1994, S. 60, 62; in Frankfurt a.M. wird dies neuerdings praktiziert, vgl. oben Α. I. 3. b), Zips, Süddeutsche Zeitung v. 19./20. 6. 1999, S. 16; N.N., DSD 3/1999, S. 9 f. 372 Reinstädt, Kriminalitätskontrolle; vgl. Jungmann, Saarbrücker Zeitung v. 20. 12. 1997. 373 Vgl. die Diskussionswiedergabe bei Brauser-Jung, DP 1998, S. 326, 327, und M. Müller, DVB1. 1999, S. 451,452; ausführlich Weichen, DP 1994, S. 313 ff., insbes. S. 315 f. 374 Vgl. etwa Schily, DSD 3-4/1998, S. 6, 7: keine Zusammenarbeit im unmittelbaren Zuständigkeitsbereich der Polizei, da Private ,4m öffentlichen Raum keine Befugnisse" (sie!) haben. 375 Gramm, Privatisierung, Kap. 5.2.3, S. 398 f.; ders., VerwArch 90 (1999), S. 329, 345 ff.; Schulte, DVB1. 1995, S. 130, 135; Steffenhagen, DSD 16 (1995), S. 18, 19; anders aber Pitschas, DÖV 1997, S. 393, 400 f.: ein Verbot von Mischformen staatlichen und privaten Handelns überzeuge nicht. 376 Schulte, DVB1. 1995, S. 130, 135; ähnlich Reinstädt, Kriminalitätskontrolle; vgl. Peilen, DVB1. 1999, S. 282, 287; Götz, in: Weiß /Plate, Privatisierung, S. 39,42. 377 Lutz, Verhältnis, S. 6; Steffenhagen, DSD 16 (1995), S. 18, 22. 378 Vgl. statt aller Erichsen, Kommunalrecht, S. 42, 252. 379 Vgl. oben § 1 Β. II. und unten X. 380 Dazu insbesondere Peilen, DVB1. 1999, S. 282, 289 f.; Gramm, VerwArch 90 (1999), S. 329, 345 ff.; näher unten 3. Teil, § 6 Β. I. 2. b). 381 Lutz, Verhältnis, S. 6; restriktiver Bernhardt, DP 1994, S. 55,58. *
116
§ 2: Die aktuelle Situation
Rahmen privater Eigensicherungsverpflichtungen, ferner ein allgemeiner Informationsaustausch im Rahmen kommunaler Sicherheits- und Ordnungspartnerschaften, welche allerdings nicht allein das private Sicherheitsgewerbe, sondern die Bürger allgemein umfassen. Ob es sich in Anbetracht dieses Befundes lohnt, von einer Police-Private-Partnership zu sprechen, wird teilweise bezweifelt, weil der Begriff eine gleichberechtigte Partnerschaft suggeriere, die aber im Hinblick auf das „staatliche Gewaltmonopol" nicht möglich sei. Vielmehr diene der Begriff allein dem Image der Privaten 382 . Eine andere Beurteilung ergibt sich jedoch dann, wenn man die Partnerschaft zwischen Polizei und privatem Sicherheitsgewerbe über das Rechtsinstitut der Beleihung verwirklichen w i l l 3 8 3 , die kooperierenden Privaten also in den staatlichen Handlungs- und Weisungszusammenhang einbettet.
V I I . Personelle Verflechtungen Ein wenig diskutierter Gesichtspunkt sind bestehende personelle Verflechtungen von Polizei und privatem Sicherheitsgewerbe. Diese können sich in mehreren Konstellationen ergeben. Zunächst können informelle Kontakte zwischen Mitarbeitern des privaten Sicherheitsgewerbes und Polizisten bestehen. Sie werden im Bewachungsgewerbe unverhohlen als Vorteil angesehen384, sind jedoch in Anbetracht unterschiedlicher datenschutzrechtlicher Bindungen keineswegs unproblematisch, allerdings kaum kontrollierbar. Daneben können aktive Polizisten nebenberuflich einer privaten Sicherheitstätigkeit nachgehen (dazu 1.) oder aber nach ihrer aktiven Laufbahn ins Bewachungsgewerbe wechseln (dazu 2.). Die hiermit verbundenen rechtlichen Fragestellungen sind bislang nicht behandelt worden und werden deshalb hier knapp aufgezeigt 385 .
1. Nebentätigkeit im privaten Sicherheitsgewerbe Eine in Deutschland wenig beachtete, hier aber wegen der in den Vereinigten Staaten verbreiteten Praxis zu erörternde Frage ist, ob und inwieweit Polizisten einer Nebentätigkeit im privaten Sicherheitsgewerbe nachgehen dürfen. Beispiele aus der Praxis sind nur wenige belegt 386 . So betrieb ein Polizist jahrelang ohne Kenntnis des Dienstherrn ein Unternehmen, dessen Zweck es war, Schießstätten 382
Lützenkirchen/Nijenhuis, Sicherheitsdienste, S. 69. 383 Stober, DÖV 2000, S. 261, 268 f.; ders., NJW 1997, S. 889, 895 f.; vgl. Lützenkirchen/Nijenhuis, Sicherheitsdienste, S. 69, 135 f.; Helmers/Murck, DP 1994, S. 64, 67. 384 Vgl. die rechtlich unbedarften Ausführungen des ehemaligen GSG-9 Ausbilders und heutigen Leiters des Personenschutzes eines großen Sicherheitsunternehmens T. Fischer, WIK 2/1997, S. 60,61. 385 Vgl. jetzt - noch knapper - F. Huber, Gefahrenabwehr, S. 323 ff. 386 s. aber etwa OVG Schleswig, ZBR 1992, S. 95.
Β. Verhältnis privater und öffentlicher Sicherheit in Deutschland
117
und einen privaten Sicherheitsdienst zu betreiben 387. Berichtet wird ferner von Kriminalbeamten, die nebenberuflich in Detektivbüros arbeiten und dabei dienstlich erlangte Informationen verwenden 388 . Soweit diese Nebentätigkeiten thematisiert werden, sind die Äußerungen durchweg kritisch, weil eine „starke Interessenkollision mit den Aufgaben des Polizeibeamten" befürchtet wird 3 8 9 . Rechtlich ist eine Nebentätigkeit eines Polizisten im Sicherheitsgewerbe nach den Grundsätzen des § 42 I BRRG 3 9 0 genehmigungspflichtig. Die Genehmigung ist nach Abs. 2 zu versagen, wenn „zu besorgen ist, daß durch die Nebentätigkeit dienstliche Interessen beeinträchtigt werden". Umgekehrt gilt, daß die Genehmigung wegen der grundrechtlichen Freiheit des Beamten, seine Arbeitskraft entgeltlich anzubieten, zu erteilen ist, wenn keine dienstlichen Interessen entgegenstehen 391 . Eine Versagung aufgrund Konkurrenzdenkens zwischen Polizei und Sicherheitsgewerbe wäre dementsprechend ebenso unzulässig wie eine Versagung, um zu verhindern, daß die Polizisten aufgrund ihrer polizeilichen Ausbildung und Praxiserfahrung auf dem Sicherheitsarbeitsmarkt „unfaire" Wettbewerbsvorteile genießen392. Die Genehmigungsbehörde muß hiernach eine einzelfallbezogene Prognoseentscheidung treffen, wobei auf allgemeine Erfahrungssätze zurückzugreifen ist 3 9 3 . Rechtsprechung und Literatur legen die Versagungstatbestände dabei tendenziell weit aus und lassen jeden vernünftigen Grund zur Befürchtung einer Beeinträchtigung dienstlicher Interessen ausreichen 394. Demzufolge läßt sich hier zwar keine generelle Aussage über die Zulässigkeit einer Nebentätigkeit im Sicherheitsgewerbe treffen, dennoch dürften die Versagungstatbestände zumindest in den meisten Fällen zu einer zwingenden Untersagung der Nebentätigkeitserlaubnis führen 395 . § 42 Π 2 BRRG spezifiziert einige Versagungsgründe. Zunächst wird die zulässige
387 Kostrzewa, Frankfurter Rundschau v. 18. 1. 1996, S. 7. 388 ßeese, CD 5/1994, S. 70; vgl. auch den Sachverhalt in BayObLG, NJW 1999, S. 1727 f.: ein Polizeibeamter leitete KfZ.-Halterdaten an einen privaten Sicherheitsdienst weiter, bei dem er nebenberuflich beschäftigt war. 389 Rungwarth, zit. n. Kostrzewa, Frankfurter Rundschau v. 18. 1. 1996, S. 7; Η-M. Zimmermann, DP 1994, S. 60, 62; Helmers/Murck, DP 1994, S. 64, 68; Munck, in: Weiß/Plate, Privatisierung, S. 119, 126. 390 Die Vorschrift ist in den Beamtengesetzen der Bundesländer - etwa: §§79 HessBG, 73 NdsBG; 68 NWLBG - sowie in § 65 BBG weitgehend wortlautidentisch übernommen. 391 Kümmel, Beamtenrecht Nds., § 73 Anm. 8.1 ff.; Keymer/Kolbe/Braun, Nebentätigkeitsrecht, § 65 BBG Rn. 14. 392 Zu diesem Argument in der amerikanischen Diskussion unten 2. Teil, § 3 Β. II. 2. 393 Näher v. Roetteken, in: Maneck/Schirrmacher, Hess. Beamtenrecht, § 79 Rn. 56. 394 Vgl. die Formulierungen in BVerwGE 31, 241; 39, 304; BayVGH, in: E. Schütz, Entscheidungssammlung, BI 2.6, Nr. 7; Schmiermann, in: E. Schütz, Beamtenrecht, § 68 LBG NW Rn. 8c; Kümmel, Beamtenrecht Nds., § 73 Anm. 8.1 m. w. N. 395 Vgl. etwa die weite Auslegung des Versagungstatbestands durch das OVG Schleswig, ZBR 1992, S. 95.
118
§ 2: Die aktuelle Situation
Nebentätigkeit durch § 42 Π 2 Nr. 1 i.V.m. S. 3 BRRG 3 9 6 umfangmäßig auf in der Regel ca. 8 Stunden wöchentlich begrenzt. Im vorliegenden Zusammenhang relevanter sind die folgenden, sich inhaltlich überschneidenden Versagungstatbestände. Zugunsten der Genehmigungsfähigkeit einer Nebenbeschäftigung im privaten Sicherheitsgewerbe ließe sich das Argument andenken, Polizei und privates Sicherheitsgewerbe erfüllten - wenn auch auf unterschiedlicher Rechtsgrundlage - die „gemeinsame Aufgabe Sicherheit", so daß die von der Polizei verfolgten dienstlichen, notwendig öffentlichen Interessen mit den privaten Interessen des Sicherheitsgewerbes nicht konfligierten, sondern im Gegenteil kongruent seien. Ob diese Betrachtungsweise in einigen Fällen zutrifft, kann offenbleiben, sie läßt sich jedenfalls nicht auf alle relevanten Tätigkeiten übertragen. Zu beachten ist zunächst, daß die Art und Weise des Schutzes privater Rechtsgüter durch das Sicherheitsgewerbe im Rahmen der rechtlichen Grundlagen vom Auftraggeber frei bestimmt werden kann. Dementsprechend lenkt der Auftraggeber die „Ermessens"betätigung der privaten Sicherheitskraft. So mag es etwa zweckmäßig erscheinen, eine Straftat nicht immer anzuzeigen, sondern vielmehr mit dem Straftäter die Konsequenzen des Vorfalls auszuhandeln; zu denken ist hier insbesondere an Fangprämien. Eine solche Praxis kollidiert mit den dienstlichen Pflichten des Polizeibeamten aus §§ 152 Π, 163 I StPO, welche die Polizei dem Legalitätsprinzip unterwerfen und damit grundsätzlich Absprachen mit Beteiligten ausschließen397. Inwieweit die Strafverfolgungspflicht der Polizei auch in der Freizeit erlangte Kenntnisse erfaßt, ist zwar umstritten 398 , hier aber irrelevant, da es im Nebentätigkeitsrecht allein auf den möglichen Konflikt mit dienstlichen Interessen ankommt. Ferner kommt der Versagungsgrund des § 42 I I 2 Nr. 4 BRRG in Betracht, wenn die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit des Beamten beeinflußt wird. Hier ist zumindest nicht generell auszuschließen, daß die in der Nebenbeschäftigung angewendeten Ordnungs- und Regelvorstellungen auch das dienstliche Verhalten des Beamten beeinflussen. Somit würde das polizeiliche Ermessen nicht mehr am öffentlichen Interesse ausgerichtet, sondern zumindest auch an insoweit nicht zu berücksichtigenden privaten Interessen. Desweiteren kommt bei zahlreichen Schutzaufgaben im Rahmen einer Tätigkeit im privaten Sicherheitsgewerbe hinzu, daß sie in einer Angelegenheit ausgeübt werden, in der die Polizei ebenfalls tätig werden könnte. Auch diese Möglichkeit verpflichtet zur Versagung der Nebentätigkeitserlaubnis, § 42 I I 2 Nr. 3 BRRG 3 9 9 .
396 Näher Keymer/Kolbe/Braun, Nebentätigkeitsrecht, § 65 BBG Rn. 16 ff. 397 Schoreit, in: KK-StPO, § 152 Rn. 13a. 398 Schöch, in: AK-StPO, § 160 Rn. 8 ff.; Schoreit, in: KK-StPO, § 152 Rn. 29, jeweils m. w. N. 399 Keymer/Kolbe/Braun, Nebentätigkeitsrecht, § 65 BBG Rn. 23 ff.
Β. Verhältnis privater und öffentlicher Sicherheit in Deutschland
119
Vom Nebentätigkeitsrecht zu vermeidende Interessenkonflikte lassen sich dabei bei nahezu allen Tätigkeiten des privaten Sicherheitsgewerbes ausmachen. So bestehen insbesondere Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der polizeilichen Datenverarbeitung. Die Datenschutzbestimmungen des BDSG und der Polizeigesetze verbieten dem Beamten die Weitergabe bestimmter Daten an Stellen außerhalb der Verwaltung. Damit dürfen diese Daten auch nicht dem privaten Sicherheitsgewerbe zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Anstellung eines solche Daten kennenden Polizeibeamten befindet sich dieser folglich in einem Interessenkonflikt, welches das Nebentätigkeitsrecht gerade ausschließen will, unabhängig von der Frage, ob der Beamte seine Kenntnisse bewußt oder unbewußt verwertet 4 0 0 . Zur Vermeidung dieser Konsequenz ließe sich an eine Zuweisung eines dienstlichen Aufgabenfeldes denken, in dem der Polizist nicht mit Vorfällen beschäftigt oder mit Datenkenntnissen und -Zugangsmöglichkeiten versehen ist, die sich mit den Interessen seiner privaten Nebentätigkeit überschneiden. Dies würde jedoch die dienstliche Verwendbarkeit des Beamten einschränken 401, so daß der Versagungstatbestand des § 42 I I 2 Nr. 5 BRRG greift. Schließlich liegt auch der Verbotstatbestand des § 42 I I 2 Nr. 6 BRRG unter dem Gesichtspunkt vor, daß die vorliegend beschriebenen möglichen Interessenkonflikte Zweifel an der Unparteilichkeit des polizeilichen Handelns hervorrufen und damit dem Ansehen der Polizei in der Öffentlichkeit abträglich sein können 402 .
2. Grenzen einer Beschäftigung ehemaliger Polizeibeamter im privaten Sicherheitsgewerbe Aus den vorstehenden Ausführungen wird deutlich, warum in Deutschland das in den Vereinigten Staaten verbreitete „moonlighting" von Polizisten zumindest nicht im dortigen Umfang bekannt ist 4 0 3 . Dennoch besteht eine personelle Verknüpfung zwischen Polizei und Sicherheitsgewerbe auch hier. Dies ergibt sich insbesondere aufgrund der Beliebtheit polizeilich ausgebildeten Personals im Sicherheitsgewerbe 404. Daneben halten Ruhestandsbeamte Vorträge und bilden aus 405 . 400 V. Roetteken, in: Maneck/Schirrmacher, Hess. Beamtenrecht, § 79 Rn. 65. 401 Zur weiten Auslegung dieser Norm vgl. OVG Koblenz, ZBR 1993, 340; Keymer/Kolbe/Braun, Nebentätigkeitsrecht, § 65 BBG Rn. 13, 27. 402 Zur Auslegung dieser Vorschrift BVerwGE 67, 287, 298; v. Roetteken, in: Maneck/ Schirrmacher, Hess. Beamtenrecht, § 79 Rn. 69; Keymer/Kolbe/Braun, Nebentätigkeitsrecht, § 65 BBG Rn. 20 ff.; Anwendung bei OVG Schleswig, ZBR 1992, S. 95. 403 Vgl. 2. Teil, § 3 Β. II. 2: Insgesamt wird geschätzt, daß über 20% der amerikanischen Polizisten regelmäßig einer Nebenbeschäftigung im privaten Sicherheitsgewerbe nachgehen. 404 Vgl. Beese, CD 5/1994, S. 70, 72; H.-M. Zimmermann, DP 1994, S. 60, 62; Wadle, DSD 2/1997, S. 15, 17. - Auch der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes und des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hellenbroich wurde Geschäftsführer eines privaten Sicherheitsunternehmens, Mlodoch, Weser-Kurier v. 15. 6. 1996, S. 3. 405 Beese, CD 5/1994, S. 70, 72.
120
§ 2: Die aktuelle Situation
Das Land Hamburg will pensionierten Polizisten eine Tätigkeit für private Sicherheitsunternehmen innerhalb der ersten fünf Jahre verbieten 406 . Auch hier folgen Grenzen der Beschäftigung aus dem Beamtenrecht, welches Konflikte zwischen dienstlichen und privaten Interessen auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses in § 42a BRRG auszuschließen versucht, indem § 42a I BRRG für einen Zeitraum von fünf - bzw. ab dem 65. Lebensjahr von drei Jahren eine Anzeigepflicht für solche Tätigkeiten statuiert, die mit der dienstlichen Tätigkeit in den letzten fünf Jahren in Zusammenhang stehen und durch die dienstliche Interessen beeinträchtigt werden können. Wegen der Überschneidung der Tätigkeitsbereiche von Polizisten und Sicherheitspersonal im Bereich des präventiven und repressiven Rechtsgüterschutzes und der danach bestehenden Möglichkeit, „dienstliche Kenntnisse, Kontakte, erlangte Fähigkeiten und erlangtes Wissen einzusetzen"407, besteht eine solche Anzeigepflicht für ehemalige Polizeibeamte. Zu untersagen ist eine solche Beschäftigung, wenn zu besorgen ist, daß durch sie dienstliche Interessen beeinträchtigt werden, § 42a I I BRRG. Hier kommen nun anders als bei aktiven Polizisten Beeinflussungen polizeilicher Tätigkeiten als Versagungsgründe allenfalls noch unter dem Gesichtspunkt der Beeinflussung ehemaliger Kollegen in Betracht. Da aber auch nach dieser Vorschrift die weit verstandene Wahrscheinlichkeit der Beeinträchtigung dienstlicher Interessen zur zwingenden Untersagung der Tätigkeit genügt 408 , dürfte eine Beschäftigung in den ersten fünf/ drei Jahren nach Beendigung des Beamten Verhältnisses in der Regel unzulässig sein. Die Praxis scheint dieser Auslegung nicht zu folgen, nehmen zahlreiche Polizisten doch unmittelbar nach ihrem Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis eine Tätigkeit im privaten Sicherheitsgewerbe auf 4 0 9 .
V I I I . Gesellschaftliche Folgen der Privatisierangstendenzen Eine Beurteilung der Zulässigkeit der Privatisierungstendenzen hat desweiteren die Folgen der beschriebenen Entwicklung in den Blick zu nehmen. Diese sind empirisch ungeklärt, werden aber um so heftiger diskutiert. Wird die Polizei durch private Sicherheitsunternehmen lediglich ergänzt und entlastet 410 oder sind die Privaten ein Polizeiersatz 411, gar eine „Privatpolizei für Leute, die sich deren Dienste leisten können" 412 , und als „parastaatliche Ordnungsmacht ( . . . ) de facto hoheitli406 Freiberg, Sicherheit, S. 10. 407 Keymer/Kolbe/Braun, Nebentätigkeitsrecht, § 69a BBG Rn. 10. 408 Näher BVerwG, ZBR 1977, 27; Keymer/Kolbe/Braun, Nebentätigkeitsrecht, § 69a BBG Rn. 13 ff. 409 Interview mit Knollmann, ADS-Sicherheit, am 1. 12. 1995 in Bielefeld. 410 Olschok, DSD 2/1997, S. 6, 8. 411 Thieme, W+S-Information 1985, S. 71, 78.
Β. Verhältnis privater und öffentlicher Sicherheit in Deutschland
121
che Funktionen und Aufgaben wahrnimmt" 413 ? Sicherlich unzutreffend ist jedoch die Vermutung, die Polizei solle überflüssig gemacht werden 414 . Die Beantwortung der Fragen muß jedenfalls den häufig erhobenen Einwand berücksichtigen, mit der Unterwerfung des Rechtsgüterschutzes unter die Gesetze des Marktes gehe eine nach der Marktfähigkeit der Bürger differenzierte Verteilung der Sicherheitsgüter einher. Die (zunehmende) soziale Spaltung der Gesellschaft erfasse damit nicht allein die Verteilung von Luxusgütern, sondern auch fundamentale Sicherheitsbedürfnisse der Menschen 415 . Reiche würden sich mittelfristig anders sichern als Arme 4 1 6 . Die Privatisierung des öffentlichen Raums und damit zusammenhängend die Durchsetzung nicht gemeinwohlgebundener privater Ordnungen bewirke ferner eine räumliche Spaltung der Gesellschaft 417. Insgesamt begründe die Käuflichkeit von Sicherheit damit die Gefahr einer „Refeudalisierung der Gesellschaft" 418, was als Verstoß gegen das Sozialstaatsprinzip oder zumindest als „Verhöhnung" desselben anzusehen sei 4 1 9 . Unabhängig hiervon entwickele sich jedenfalls eine verstärkte Sozialkontrolle, zum einen weil neben die staatlich kontrollierte Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nun die Überwachung privater Ordnungsmodelle trete 420 , zum anderen aufgrund des Bemühens der privaten Sicherheitsdienste, ihren Auftraggebern „Erfolgsnachweise" zu liefern 421 . Letztlich könne eine weitere Privati412 Stüllenberg, Kriminalistik 1987, S. 616, 617, der weiter schreibt: „Die Vorstellung, eine Verbrecherorganisation könnte sich über eine schlichte Gewerbeerlaubnis eine bewaffnete »Schutz- und Trutztruppe ' schaffen, ist nicht gerade erhebend". 413 Beste, in: Bussmann/Kreissl, Kritische Kriminologie, S. 311, 322. Stacharowsky, KrimJ 17 (1985), S. 228, 232. 4 15 Narr, cilip 43 (1992), S. 6, 11; Freiberg, Kriminalistik 1999, S. 362, 365; Gusy, StWStP 1994, S. 187, 203 f.;AKIS, Memorandum, S. 41 f. 416 Mergen, CD 3/1995, S. 4 ff. 4 17 Voß, NKP 2/1993, S. 39, 41; vgl. Gusy, StWStP 1994, S. 187, 204; Kreissl, Süddeutsche Zeitung v. 8. 7. 1997, S. 11; Beste/Voß, in: Sack/Voß/Frehsee/Funk/Reinke, Privatisierung, S. 219, 231; dies., in: Institut für Kriminalwiss., Vom unmöglichen Zustand, S. 313, 325 ff.; Zivier, in: Butterwegge/ Kutscha /Berghahn, Herrschaft des Marktes, S. 85, 86 f., 92; Lützenkirchen/Nijenhuis, Sicherheitsdienste, S. 42. 4
18 Murck, zit. n. H.-M. Zimmermann, CD 3/1995, S. 11, 14, und DP 1994, S. 60, 63; Kutscha, in: Butterwegge/ Kutscha /Berghahn, Herrschaft des Marktes, S. 93, 102; Hitzler/ Göschl, in: Frehsee/Löschper/Smaus, Konstruktion der Wirklichkeit, S. 134, 142; vgl. Helmers/Murck, DP 1994, S. 64, 67: „Refeudalisierung der öffentlichen Sicherheit"; vorsichtiger Murck, in: Weiß/Plate, Privatisierung, S. 119, 124; ähnlich Siekmann, in: FS Stern, S. 341,357. 41
9 Bull, Staatsaufgabe Sicherheit, S. 30; Schuster, DP 1989, S. 5, 7; Hoffmann-Riem, ZRP 1977, S. 277, 278 f., 280; Arzt, Recht und Ordnung, S. 39, 53; vorsichtiger Köhler, DP 1994, S. 49, 54; Schnoor, zit. η. N.N., W&S 1994, S. 1314,1316. 420 H. Jung, in: Kaiser/ Kerner/Sack/Schellhoss, Kriminologisches Wörterbuch, S. 409, 413; Voß, JhbRsozRth XV, S. 81,92 ff.; ders., NKP 2/1993, S. 39. 42 1 Beste/Voß, in: Sack/Voß/Frehsee/Funk/Reinke, Privatisierung, S. 219, 224; anders aber Reinstädt, Kriminalitätskontrolle: Private Sicherheitskräfte im öffentlichen Raum
122
§ 2: Die aktuelle Situation
sierung des Rechtsgüterschutzes das Gemeinwohlziel gefährden 422. Auch wenn man diese Gefahr nicht für aktuell hält, so läßt sich die Kritik dahingehend zusammenfassen, daß die unterschiedlichen Antriebsmotive privaten und staatlichen Rechtsgüterschutzes unterschiedliche Auswirkungen auf das Sicherheitsniveau einzelner Bevölkerungsteile haben. Statt eines Kampfes gegen die Kriminalität bewirke Privatisierung einen Kampf um die Verteilung der Kriminalität 423 . Exemplifiziert wird diese These regelmäßig an dem in der Praxis noch seltenen Anwendungsfall zusätzlicher privater Streifen in Wohnvierteln Wohlhabender. Hierdurch erhöhe sich nicht allein das Sicherheitsniveau der kaufkräftigen Bewohner, es komme zudem zu einer Verdrängung von Kriminalität. Damit bewirke private Sicherheit eine Verschiebung der Viktimisierungswahrscheinlichkeiten zu Lasten sozial schwacher Bevölkerungsteile 424. Inwieweit eine solche Verdrängung tatsächlich besteht, ist empirisch ungeklärt 425 . Immerhin liegen Daten aus Ratingen-Hösel vor: Dort wurde eine Wohngebietsstreife beauftragt, nur auf Einbrüche in Häuser zu reagieren, deren Bewohner die Streifentätigkeit finanzieren. Die Anzahl der Einbrüche stieg trotz der privaten Bestreifung an, traf allerdings nur noch einmal ein bewachtes Haus 426 . Die Gegenposition bezeichnet die Verlagerungsthese als „Glaubensbekenntnis"427 und wendet ein, daß die Polizei durch zusätzliche private Streifen entlastet werde und damit Kapazitäten für einen verstärkten Schutz der sozial Schwächeren frei würden, was vor dem Hintergrund des Sozialstaatsprinzips gerade erwünscht sei 4 2 8 . Ob die Dinge so einfach liegen, erscheint zweifelhaft. Zunächst können die privaten Sicherheitskräfte der Polizei auch zusätzliche Arbeit erzeugten ein „trügerisches Sicherheitsgefühl", da Randgruppenangehörige um die begrenzten Befugnisse der privaten Sicherheitskräfte wüßten und die Bürger daher tatsächlich nicht geschützt seien. 422 Nogala, in: Hitzler /Peters, S. 15 des Manuskripts; Beste, in: Bussmann/Kreissl, Kritische Kriminologie, S. 311, 323; vgl. Voß, JhbRsozRth XV, S. 81, 92 f. 423
Arzt, Recht und Ordnung, S. 53; vgl. Nogala, in: Hitzler/Peters, S. 15 des Manuskripts; zurückhaltender Seysen, KrimJ 1992,4. Beih., S. 179,191; vgl. Nitschke, zit. η. N.N., WIK 4/1995, S. 14. 424 Hoffmann-Riem, ZRP 1977, S. 277, 280; Schuster, DSD 2/1988, S. 15, 18 f.; ders., DP 1989, S. 5, 7; Lock, der überblick 1 /1998, S. 33, 35; H.-M. Zimmermann, CD 3/1995, S. 11, 14; ders., DP 1994, S. 60, 63; Holecek (GdP), zit. n. Kirbach, Die Zeit v. 20. 5. 1998, S. 23, 25; Willenbrock, Süddeutsche Zeitung Magazin v. 28. 4. 1995, S. 28, 29; a.A. Blum, protector 8/1993, S. 11, 12: „statistisch widerlegt"; anders aber ders., W+S-Information 1985, S. 11, 14. 42 5 Schuster, DP 1989, S. 5, 7; vgl. aber Arzt, Recht und Ordnung, S. 49 f. 426
Walmeroth, Praktische Erfahrungen, S. 7 f.; vgl. zu den nur scheinbaren Erfolgen in Köln-Hahnwald Steffenhagen, DSD 16 (1995), S. 18,19. 42 ? Schuster, DSD 2/1988, S. 15, 18; ders., DP 1989, S. 5, 7. 42 « Peilert, Recht des Auskunftei- und Detekteigewerbes, S. 229 f.; F. Huber, Gefahrenabwehr, S. 165 f.; Krey, Problematik privater Ermittlungen, S. 38; Engelhardt, in: Pitschas/ Stober, Quo vadis, S. 153, 168; Falck, DSD 17 (1995), S. 73, 75; Rupprecht, DP 1994, S. 46,47; Mahlberg, Gefahrenabwehr, S. 93 f.; ders., KrimJ 1992, 4. Beih., S. 209, 211; Schwabe, ZRP 1978, S.165.
Β. Verhältnis privater und öffentlicher Sicherheit in Deutschland
123
verschaffen 429. Jedenfalls ist aber in Anbetracht leerer öffentlicher Kassen davon auszugehen, daß eventuell frei werdende Polizeikapazitäten eingespart und nicht verstärkt zugunsten sozial Schwächerer eingesetzt werden. Immerhin dürfte ein bestehender Verdrängungseffekt durch eine teilweise erfolgende Aufgabe des Tatplans gemindert werden, so daß zusätzliche private Sicherheit insgesamt einen Sicherheitsgewinn zu bewirken vermag 430 . Damit ist jedoch die Verteilungsfrage nicht geklärt 431 . Argumentationen, die eine Umverteilung mit dem Hinweis billigen, daß sich Reiche in einer Wettbewerbsgesellschaft mehr leisten könnten 432 oder aber eine Kriminalitätsumlenkung nicht auf sozial Schwache, sondern auf unzureichend gesicherte Objekte vorliege 433 , basieren dabei nicht allein auf dem Gedanken der „Sicherheit als Ware", sondern negieren einen eventuell besonderen Charakter des Gutes „Sicherheit". Häufiger wird daher darauf verwiesen, daß mit einem größeren Vermögen eine größere Gefährdung einhergehe, welche vor dem Hintergrund der Sozialbindung des Eigentums eine Verpflichtung zum Selbstschutz begründe 4 3 4 . Neben diesem Verteilungsproblem werfen Kritiker die Frage nach der Kontrolle von Machtpotentialen auf. Einige befürchten das Entstehen schlagkräftiger privater Einheiten, die zu politischen Zwecken mißbraucht werden könnten 435 , andere halten unabhängig von der Zielrichtung der Aktivitäten das „Ausgeliefertsein an eine mächtigere Instanz" für problematisch 436. Der Staat könne nicht dulden, daß ein erhebliches Potential an Macht und möglicher Gewaltausübung unkontrolliert entstehe 437 . Bei nüchterner Betrachtung laufen diese Bedenken auf die Forderung nach verstärkter Kontrolle des Sicherheitsgewerbes hinaus.
429 Helmers/Murck, DP 1994, S. 64, 67. 430 Vgl. Peilert, Recht des Auskunftei- und Detekteigewerbes, S. 230 f.; Schnekenburger, Rechtsstellung, S. 215 f.; Rupprecht, DP 1994, S. 46, 47; weniger differenziert auch Mahlberg, KrimJ 1992,4. Beih., S. 209, 211; Schwabe, ZRP 1978, S. 165. 431 Vgl. Gramm, Privatisierung, Kap. 5.2.8.2, S. 416 f. 432 Blum, W+S-Information 1985, S. 11, 15; ähnlich Rupprecht, DP 1994, S. 46,47; Eberstein, BB 1980, S. 863, 868; vgl. die Spekulationen von Schnekenburger, Rechtsstellung, S. 219 f. 433 Bueß, Sicherheitsdienste, S. 49. 434 Peilert, Recht des Auskunftei- und Detekteigewerbes, S. 229 f.; F. Huber, Gefahrenabwehr, S. 165 f., 345; Glavic, DP 1994, S. 36, 40; Schweinoch, W+S-Information 1983, S. 73, 74; Eberstein, BB 1980, S. 863, 868; in diese Richtung auch Sonntag-Wolgast, Innere Sicherheit, S. 3. 435 Stacharowsky, KrimJ 17 (1985), S. 228, 232; vorsichtiger Stümper, Kriminalisitk 1975, S. 193, 195. 436 Η. Jung, in: Kaiser/ Kerner/Sack/Schellhoss, Kriminologisches Wörterbuch, S. 409, 414; vgl. Narr, cilip 43 (1992), S. 6,11 f. 437 Bull, Staatsaufgabe Sicherheit, S. 30; Schuster, DP 1989, S. 5, 6; Roßnagel, ZRP 1983, S. 59, 62; Stacharowsky, KrimJ 17 (1985), S. 228, 232; vgl. Hitzler, Ästhetik & Kommunikation 85/86 (1994), S. 55 ff.; Harzer, Jura 1995, S. 208, 211, meint, eine Anerkennung priva-
§ 2: Die aktuelle Situation
124
IX. Stärkere rechtliche Regulierung In Anbetracht der zahlreichen Kritikpunkte überraschen Forderungen nach einer verstärkten rechtlichen Regulierung insbesondere des Sicherheitsgewerbes nicht. Auch vor dem Hintergrund der Privatisierungs- und Steuerungsdiskussion liegt es nahe, eine staatliche Regulierungsverantwortung als Konsequenz von Privatisierungen anzunehmen und dementsprechend zu fordern, daß die Einbeziehung Privater in die Wahrnehmung staatlicher Sicherheitsaufgaben, die Festlegung der erforderlichen Qualifikation, die Befugnisse der Privaten sowie die Sicherstellung des öffentlichen Auftrags rechtlich geregelt und tatsächlich hinreichend effektiv arbeitende Aufsichtskapazitäten geschaffen werden 438 . In der letzten Legislaturperiode forderte die SPD-Bundestagsfraktion die Regierung zur Vorlage eines Gesetzentwurfs über „Rechte, Pflichten und Aufgabengebiete privater Sicherheitsunternehmen auf 4 3 9 . Während dieses Begehren auf Länderebene von den Innenministerien überwiegend begrüßt wird, zeigten sich die Wirtschaftsministerien skeptisch. Auch der BDWS hält eine Neuregelung im Interesse der Rechtsklarheit für grundsätzlich wünschenswert 440. Der Antrag blieb zwar nach kontroverser Diskussion im Innenausschuß folgenlos, doch wurde für die laufende Legislaturperiode aufgrund der Koalitionsvereinbarung von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ein Gesetz angekündigt 441 . Von diesem Vorhaben scheint jedoch wieder Abstand genommen wor1
· 442
den zu sein Zentrale Diskussionsgegenstände sind Ausbildung und Befugnisse des Sicherheitsgewerbes. Diese Punkte werden daher eingehender weiter unten betrachtet 443. Ferner betrifft die Diskussion insbesondere Grundsatzfragen. Neben der Forderung einer Einbeziehung des Werkschutzes in die Anforderungen nach § 34a GewO 4 4 4 ter Sicherheitsdienste als „Quasipolizei" führe dazu, „daß die Gemeinschaft des staatlichen Zustandes den Rückweg in den Naturzustand beginnt". 4 38 Gusy, in: Schuppert, Jenseits von Privatisierung, S. 115, 132 f. 439 BT-Drs. 13/3432; darauf folgend eine Sachverständigenanhörung am 10. 3. 1997 im BT-Innenausschuß, Ausschuß-Drs. 13/95. 440 BDWS, DSD 2/1997, S. 3, 4; Wackerhagen/Olschok, in: Ottens/Olschok/Landrock, Europa, Rn. C 86. 441 SPD/B'90-Die Grünen, Koaltionsvereinbarung, S. 49 (sub IX.9.); vgl. Schily, RuP 1998, S. 174, 180. 442
Nach Fuchs, GewArch 1999, S. 369, 370, sieht der Bund-Länder-Ausschuß Gewerberecht trotz der Tatsache, daß die Mehrheit der Innenministerien der Länder weiterhin eine gesetzliche Neuregelung für notwendig hält, gegenwärtig keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf, insbesondere weil sich das Unterrichtungsverfahren bewährt habe. Die Gewerkschaft der Polizei fordert demgegenüber nach wie vor eine gesetzliche Neuregelung, vgl. N.N., Neue Westfälische v. 28. 12. 1999, S. 2; zur Haltung der Innenminister N.N., Süddeutsche Zeitung v. 19. 1. 2000, S. 5. 443 Dazu sogleich unter X. und XI. 444 Schenkelberg, Streife 6/1995, S. 10, 12; Pitschas, in: Schuppert, Jenseits von Privatisierung, S. 135, 149; Roßnagel, ZRP 1983, S. 59, 61.
Β. Verhältnis privater und öffentlicher Sicherheit in Deutschland
125
betreffen zahlreiche Stellungnahmen eine Regelung der Aufgaben, die das Sicherheitsgewerbe wahrnehmen darf 4 4 5 . Wenn eine Benennung der einzelnen Tätigkeitsbereiche nicht möglich sei 4 4 6 , solle zumindest ein „Negativkatalog" 447 verbotener Tätigkeitsfelder festgelegt werden. Hierbei betreffen die Überlegungen insbesondere Tätigkeiten im öffentlichen Raum 448 . Während einige an ein generelles Tätigkeitsverbot im öffentlichen Raum denken 449 , halten andere das Agieren Privater im (faktisch) öffentlichen Raum ganz im Sinne des Trennungsdenkens solange für unbedenklich und nicht regelungsbedürftig wie privates Hausrecht gilt 4 5 0 . Überwiegend wird ein mittlerer Weg vorgeschlagen 451, der gesteigerte Anforderungen an das im - zumeist nicht näher spezifizierten - öffentlichen Raum tätigwerdende Personal stellt. Regelungsgegenstände könnten etwa eine nur bei nachgewiesenem Bedürfnis erteilte Genehmigung, ein besonderer Fachkundenachweis, eine Abstimmung von Auftrag, Einsatzraum und -zeit mit der Polizei sowie die Pflicht sein, durch Kommunikationsmittel ein sofortiges Herbeirufen der Polizei zu ermöglichen 452 . Als weiterer Abgrenzungsvorschlag ist eine Aufgabenteilung von Polizei und Privaten dahingehend vorgeschlagen worden, die Gefahrenabwehr der Polizei vorzubehalten, im Vorfeld der Gefahren jedoch private Sicherheitsunternehmen einzusetzen 453 . Er sieht sich jedoch dem Einwand ausgesetzt, daß beide Bereiche nicht scharf abgrenzbar seien 454 und auch Prävention Polizeiaufgabe sei 4 5 5 . Weitergehend ist der Vorschlag, allein die Verfolgung kriminellen Unrechts als nicht privatisierungsfähig anzusehen, im Bereich der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und der Gefahrenabwehr hingegen über das Rechtsinstitut der Beleihung den Einsatz Privater in weitem Umfang zu ermöglichen 456 . Damit würde die Figur des Be445 Pitschas, DÖV 1997, S. 393, 400; Schenkelberg, in: Weiß/Plate, Privatisierung, S. 51, 52 ff.; Zuber, DSD 3-4/1998, S. 3, 4; vgl. HB, W&S 1995, S. 380; ähnlich Röder, in: Glavic, HdBprSiG, Rn. L 62. 446 Schenkelberg, Streife 6/1995, S. 10, 12; ders., Frankfurter Rundschau v. 18. 10. 1996, S. 18. 447 Steffenhagen,
DSD 16 (1995), S. 18, 23; Lutz, Verhältnis, S. 9.
448 H.-J. Lange, in: Gusy, Privatisierung, S. 215, 233 f. 449 in diese Richtung Weichen, DP 1994, S. 313, 318. 450 Rupprecht, DP 1994, S. 46. 451 Schenkelberg, Streife 6/1995, S. 10, 12. 452 Bernhardt, DP 1994, S. 55, 58; ders., in: Weiß/Plate, Privatisierung, S. 57, 60 f. 453 Schweinoch, W+S-Information 1983, S. 73, 74, 76; N.N., W+S-Information 1981, S. 60,61. 454 Gemmer, W+S-Information 1982, S. 170, 173 f.; Finnberg, W+S-Information 1982, S. 112, 113; BMI, W+S-Information 1982, S. 112, 118. 455 Seysen, KrimJ 1992,4. Beih., S. 179. 456 Stober, im Rahmen der Diskussion auf den vom BDWS organisierten 4. Bad Homburger Sicherheitsgesprächen am 31. 3. 1998, sowie zit. b. Brauser-Jung, DP 1998, S. 326, 330, und bei M. Müller, DVB1. 1999, S. 451, 453 f.; ihm folgend Graf von Arnim, zit. n. BrauserJung, DP 1998, S. 326, 330.
126
§ 2: Die aktuelle Situation
liehenen, welche traditionell auf Private zugeschnitten war, die in Randbereichen ihrer Tätigkeit hoheitliche Befugnisse ausüben können sollten 457 , nun zur Grundlage umfassender Bestellungen Privater zu „Vollzeit-Hilfspolizisten". Schließlich wird ein „Sicherheitskooperationsrecht" für eine Zusammenarbeit von Polizei und Privaten gefordert 458 . Wahrend jedoch einige eine „normative Distanz" aufrechterhalten wollen 4 5 9 , fordern andere, das faktische Miteinander rechtlich zu „umhegen" 460 . Dabei könnte eine verstärkte Kooperation von einer angemessenen Qualifikation der Privaten abhängig gemacht werden 461 .
X. Befugnisse gegenüber Dritten Die Tendenzen einer Auflösung der klaren Trennung zwischen dem Schutz privater und öffentlicher Rechtsgüter und das Vordringen privater Sicherheitsmaßnahmen wurden bislang insbesondere vor dem Hintergrund einer für Private fehlenden Pflicht zur Berücksichtigung öffentlicher Interessen problematisiert. Einen weiteren zentralen Diskussionspunkt stellt die unterschiedliche rechtliche Ausgestaltung der Schutzmodalitäten dar, wobei im Schwerpunkt die Gewaltbefugnisse gegenüber Dritten thematisiert werden. Für die Bereiche, in denen Private funktional polizeiliche Aufgaben erfüllen, liegt die Forderung nahe, ihnen zwar nicht notwendig identische, aber doch vergleichbare Befugnisse zuzugestehen. Diesen Schritt ist die Rechtsordnung indessen (noch) nicht gegangen. Soweit sich das Handeln der privaten Sicherheitsdienste als privater Rechtsgüterschutz qualifizieren läßt, können sie wie jeder andere Bürger auf die Jedermannrechte zurückgreifen. Die Einschätzungen dieser Rechtslage gehen jedoch weit auseinander. Während das Sicherheitsgewerbe betont, daß ihm deutlich weniger Befugnisse zuständen als der Polizei, kritisiert die Gegenseite die „ominösen" Jedermannrechte 462 aufgrund ihrer über die Befugnisse der Polizei hinausgehenden Reichweite. Gerade dieses Argument macht es erforderlich, vor einer Darstellung der Diskussion über die Notwendigkeit einer rechtlichen Neuregelung der Befugnisse privater Sicherheitskräfte (unter 5.) zunächst polizeiliche und private Rechtsgrundlagen zu verglei-
457 Vgl. oben Α. I. 1. 458 Pitschas, zit. η. M. Müller, DVB1. 1999, S. 451, 452; vgl. ders., DÖV 1997, S. 393, 398; ders., Kriminalistik 1999, S. 153, 158; Köhler, DP 1994, S. 49, 54; vgl. Κ Maier, DSD 3/1997, S. 15, 18. 459 Rupprecht, in: Weiß/Plate, S. 45, 49; Olschok, DSD 2/1997, S. 6, 12; vgl. auch Brauser-Jung, DP 1998, S. 326, 327; eine klare rechtliche Abgrenzung von polizeilichem und privatem Aufgabenbereich zumindest im öffentlichen Raum fordern Witte, zit. n. Brauser-Jung, DP 1998, S. 326, 327; Steffenhagen, DSD 16 (1995), S. 18, 22. 460 Pitschas, DÖV 1997, S. 393, 397. 461 Bökel, zit. η. N.N., DP 1999, S. 62. 462 Beste, in: Bussmann/Kreissl, Kritische Kriminologie, S. 311, 322.
Β. Verhältnis privater und öffentlicher Sicherheit in Deutschland
127
chen. Ein solcher Vergleich ist bereits geleistet worden 463 , so daß die Unterschiede lediglich summarisch dargestellt werden 464 . Zunächst gilt festzuhalten, daß die Jedermannrechte allein für eine rein privatrechtlich zu beurteilende Tätigkeit Privater Anwendung finden. Die wachsende Zahl Beliehener im Sicherheitsrecht unterliegt damit nicht nur den öffentlichrechtlichen Bindungen insbesondere des Verhältnismäßigkeitsprinzips, sondern ist zudem nur insoweit zu Eingriffen in die Freiheitssphäre Dritter befugt, als ihnen diese Befugnisse ausdrücklich verliehen wurden. So sind etwa die Angehörigen der bayerischen Sicherheitswacht allein zur Befragung, Identitätsfeststellung und Platzverweisung ermächtigt. Ihre Befugnisse bleiben damit in jedem Falle hinter den polizeilichen zurück. Sodann gelten die Jedermannrechte nicht in vollem Umfang für Private, die aufgrund Verwaltungsprivatrechts tätig werden. Sicherheitsdienste, welche in der Daseinsvorsorge dienenden öffentlichen Räumen wie etwa U-Bahn-Stationen tätig werden, handeln folglich grundrechtsgebunden und unterliegen den Anforderungen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 465. Ein genereller Ausschluß der Anwendbarkeit der Jedermannrechte folgt aus der öffentlich-rechtlichen Bindung indes nicht 4 6 6 . Etwas anderes gilt für die Fälle, in denen private Sicherheitskräfte die Räumlichkeiten mit Polizisten gemeinsam bestreifen 467. Hier ist zwar die Anwendbarkeit der Jedermannrechte nicht deswegen ausgeschlossen, weil das Handeln der Privaten dem Staat aufgrund seiner polizeilichen Präsenz zuzurechnen sei 4 6 8 , die Verteidigungshandlung ist jedoch wegen der Anwesenheit staatlichen Sicherheitspersonals regelmäßig nicht erforderlich im Sinne der § 32 Π StGB, § 227 I I BGB 4 6 9 . Darüber hinausgehend wird teilweise eine Anwendung der Jedermannrechte auf private Sicherheitsdienste generell abgelehnt470. Ausgangspunkt ist die Überlegung, daß die polizeirechtlichen Ermächtigungsgrundlagen positive Eingriffsbe463 Insbesondere von Bueß, Sicherheitsdienste, S. 52-178; Peilert, Recht des Auskunfteiund Detekteigewerbes, S. 461 -501. 464 Im Gedankengang der folgenden Darstellung ähnlich, im Ergebnis jedoch restriktiver Schnekenburger, Rechtsstellung, S. 134 ff. Vgl. statt aller BGH, NJW 1961, S. 308 f.; Erichsen, Kommunalrecht, S. 42, 252; unzutreffend Gramm, VerwArch 90 (1999), S. 329, 346 i.V.m. S. 341, mit dem Argument, per privatrechtlichem Vertrag könne das Strafrecht nicht außer Kraft gesetzt werden. Dies stimmt zwar, betrifft aber allein die strafrechtliche Verantwortlichkeit.
So aber Greifeid, DÖV 1981, S. 906, 912; vgl. jetzt - abweichend - Burgi, Verwaltungshilfe, S. 124 ff., 351 f. 467 Beispiele oben Α. I. 3. b). So aber Schulte, DVB1. 1995, S. 130, 135; Peilert, DVB1. 1999, S. 282, 285, 287; Götz, in: Weiß/Plate, Privatisierung, S. 39, 42; dagegen - und insoweit zutreffend - Gramm, VerwArch 90 (1999), S. 329, 341. «» Peilert, DVB1. 1999, S. 282, 286. 4 ?o Jeand'Heur, AöR 119 (1994), S. 107, 128 f.; 132 f.; Braum, in: Butterwegge/Kutscha/Berghahn, Herrschaft des Marktes, S. 133, 140 ff.; Schnoor, zit. η. N.N., W&S 1994,
128
§ 2: Die aktuelle Situation
fugnisse verleihen, wohingegen die im Strafrecht normierten Jedermannrechte allein von Strafe freistellen. Die professionellen Privaten würden aber wie die Polizei planmäßig und professionell von ihnen Gebrauch machen. Eine Anwendung der Jedermannrechte würde daher diese in positive Befugnisse umwandeln, ohne daß die hierfür grundrechtlich geforderten Verpflichtungen zur Berücksichtigung der Freiheit Dritter vorhanden wären 471 . Dieser Einwand übersieht jedoch den in Art. 1 I I I GG verankerten Grundgedanken der Rechtsordnung, daß staatliches Handeln grundrechtsverpflichtet, privates Handeln - und damit auch dasjenige der privaten Sicherheitsunternehmen - grundrechtsberechtigt ist. Vom Standpunkt der einfachen Rechtsordnung aus bedarf das Handeln privater Sicherheitskräfte folglich ebenso wie dasjenige jedes anderen Privaten keiner ausdrücklichen Ermächtigungsgrundlage. Die Jedermannrechte sind grundsätzlich anwendbar, auch wenn man dies im Hinblick auf die zunehmende Auflösung des Trennungsmodells als inadäquat ansieht 472 . Hinzuweisen ist jedoch auf den Umstand, daß damit weder einschränkende Auslegungen der Jedermannrechte noch eine aus Verfassungsrecht folgende Verpflichtung des Staates zur Regelung der Befugnisse privater Sicherheitskräfte 473 ausgeschlossen sind. 1. Notwehr Die privaten Notwehrbefugnisse würden über die polizeilichen Befugnisse jedenfalls nicht hinausgehen, wenn auch die Polizei ihre Handlungen auf §§32 StGB, 227 BGB stützen könnte. Dies ist jedoch nicht der Fall 4 7 4 , weil das Notwehrrecht ein Rechtfertigungsgrund, nicht jedoch eine Ermächtigungsgrundlage ist. Hintergrund der sich daraus ergebenden Differenzierung zwischen privaten und staatlichen Handlungen ist der Vorbehalt des Gesetzes für grundrechtswesentliche Handlungen des Staates, welcher eine ausdrückliche Ermächtigungsgrundlage verlangt 475 . Die Polizei kann sich für ihre Maßnahmen der Gefahrenabwehr folglich S. 1314, 1316, 1317; H.-M. Zimmermann, CD 3/1995, S. 11, 15, 17; Steffenhagen, DSD 16 (1995), S. 18, 23; Lutz, Verhältnis, S. 9; krit. auch Hueck, DSt. 36 (1997), S. 211, 219 f.; Pitschas, DÖV 1997, S. 393, 396 f. 471 Hoffmann-Riem, ZRP 1977, S. 277, 280, 281 ff.; Stacharowsky, KrimJ 17 (1985), S. 228, 233; Jeand'Heur, AöR 119 (1994), S. 107, 128; Steffenhagen, DSD 16 (1995), S. 18, 23. 472 So Gusy, StWStP 1994, S. 187, 202 f.; Roßnagel, ZRP 1983, S. 59, 62; anders Peilert, Recht des Auskunftei- und Detekteigewerbes, S. 467 f. 473 Dazu unten 3. Teil, § 6 Β. II. 474 Anders immer noch die überwiegende strafrechtliche Literatur: Spendel, JR 1991, S. 250; Lenckner, in: Schönke/Schröder, StGB, § 32 Rn. 42b f.; Kühl, Jura 1993, S. 233, 236 ff. m. w. N.; a.A. aus strafrechtlicher Sicht etwa Samson, in: SK-StGB, § 32 Rn. 61; Haas, Notwehr und Nothilfe, S. 319 ff.; umfassender Überblick über den Diskussionsstand bei Rogali, JuS 1992, S. 551, 556 ff. m. w. N. 475 Ähnlich Seelmann, ZStW 95 (1983), S. 797, 811; Günther, in: SK-StGB, Rn. 70 vor § 32; Greifeid, DÖV 1981, S. 906, 912; Ρ Kirchhof, NJW 1978, S. 969 f.; Rogali, JuS 1992, S. 551,559 m. w. N.
Β. Verhältnis privater und öffentlicher Sicherheit in Deutschland
129
nur auf die Ermächtigungsgrundlagen im Polizei- und Strafprozeßrecht, nicht aber auf Notwehr berufen 476 . Dies gilt selbstverständlich auch dann, wenn sie mit Privaten eine Doppelstreife bildet 4 7 7 . Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede zwischen polizeilicher Gefahrenabwehr und privatem Notwehrrecht 478 ergeben sich auf mehreren Ebenen. (1) Zeitlicher Rahmen der Befugnisse Die Polizei kann eingreifende Maßnahmen bereits bei Vorliegen einer Gefahr vornehmen, Private dürfen Notwehrhandlungen erst dann ergreifen, wenn die Rechtsgütereinbuße unmittelbar bevorsteht, in Anlehnung an polizeirechtliche Formulierungen also erst bei einer gegenwärtigen Gefahr. Der polizeiliche Handlungsraum ist früher eröffnet 479 . (2) Rechtswidrigkeit des Angriffs Ein weiterer Unterschied zwischen polizeilichen und privaten Befugnissen ergibt sich aus der polizeilichen Möglichkeit, Nichtstörer in Anspruch zu nehmen. Privaten ist dies im Rahmen des Notwehrrechts verwehrt 480 , und das Notstandsrecht zieht engere Grenzen. (3) Erforderlichkeit Im Erforderlichkeitskriterium ist der grundsätzliche Nachrang der Notwehr gegenüber staatlicher Gefahrenabwehr verankert 481 . Diese Subsidiarität 482 greift al476 Für den Notrechtsvorbehalt in den Polizeigesetzen, etwa in § 57 II PolGNW, verbleibt demnach ein Anwendungsbereich insofern, als das Handeln des Polizeibeamten in Notwehr keine strafrechtlichen Konsequenzen für ihn nach sich zieht. Nur dies stellt entgegen der häufigen Berufung auf dieses Urteil das BayObLG, JZ 1991, S. 936 f., fest; so auch Schmidhäuser, JZ 1991, S. 937, 938. 477 Peilert, DVB1. 1999, S. 282, 287; Gramm, VerwArch 90 (1999), S. 329, 345 ff.; Götz, in: Weiß/Plate, Privatisierung, S. 39,42. 478 Für die Besitzwehr gemäß § 859 I BGB gelten die folgenden Ausführungen entsprechend, vgl. Joost, in: MünchKomm-BGB, § 859 Rn. 2; näher Bund, in: Staudinger, BGB, § 859 Rn. 7 ff. 479 So auch P. Kirchhof, NJW 1978, S. 969, 970; Peilert, Recht des Auskunftei- und Detekteigewerbes, S. 471; Bueß, Sicherheitsdienste, S. 78. 480 R Kirchhof, NJW 1978, S. 969, 970; Bueß, Sicherheitsdienste, S. 78 f. 481 Vgl. oben § 1 Β. II.; Wagner, Notwehrbegründung, S. 61 m. w. N. 482 Das Erfordernis, polizeiliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, soll dabei nach BGHSt 39, 133, 137 f. (zustimmend Roxin, NStZ 1993, S. 335, 336; vgl. auch Horn, in: SK-StGB, § 240 Rn. 46), so weit gehen, daß schon bei einer sich abzeichnenden Notwehrlage die Polizei herbeigerufen werden muß, private Präventivnotwehr ist ansonsten verwerflich i.S.v. § 240 II
9 Nitz
130
§ 2: Die aktuelle Situation
lerdings nur, wenn bei Vorliegen eines gegenwärtigen Angriffs noch Zeit ist, auf polizeiliche Hilfe zurückzugreifen 483. Dies dürfte wegen der engen Grenzen des Gegenwärtigkeitsbegriffs faktisch nur der Fall sein, wenn ein Polizist danebensteht. Im Ergebnis läuft diese Einschränkung damit wegen der zeitlichen Anwendungsgrenzen des Notwehrrechts praktisch leer. Desweiteren ist für einen Vergleich zwischen den Befugnisen der Polizei und des privaten Sicherheitsgewerbes von Bedeutung, daß bei der Beurteilung der Frage, ob die Verteidigungshandlung das mildeste unter mehreren möglichen Mitteln einer effektiven Angriffsabwehr darstellt, auf die Möglichkeiten des konkreten Verteidigers abzustellen ist 4 8 4 . Damit differenziert die Rechtfertigung grundsätzlich zwischen professionell ausgebildeten Sicherheitskräften und anderen Bürgern, die mangels individueller Verteidigungsfähigkeiten möglicherweise gezwungen sind, unmittelbar auf eingriffsintensivere Verteidigungsmittel zurückzugreifen. Ob hierdurch die Reichweite der Notwehrbefugnisse privater Sicherheitsdienste generell angemessen begrenzt ist 4 8 5 . erscheint jedoch zweifelhaft, da diese Begrenzung der Verteidigungsmittel bei schlecht ausgebildeten Sicherheitskräften nicht greift. (4) Bindung an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Eine Bindung der Notwehr an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz i.e.S. besteht nach einmütiger Rechtsprechung nicht 4 8 6 . Demgegenüber ist polizeiliches Handeln diesem Grundsatz unterworfen. Der Notwehrübende muß also im Gegensatz zur Polizei die kollidierenden Rechtsgüter nicht gegeneinander abwägen und damit prüfen, ob die Beeinträchtigung von Rechtsgütern des Angreifers nach ihrem Rang und der Intensität der Betroffenheit noch im Verhältnis zu Rang und Betroffenheit der bedrohten Rechtsgüter steht 487 . So unumstritten diese Aussage in der Rechtsprechung auch ist, so umstritten ist sie insbesondere in dem Schrifttum, das sich
StGB. Diese Unterstreichung des Ausnahmecharakters gewaltsamer privater Gefahrenabwehr ändert aber nichts an der Erforderlichkeit der Verteidigung, wenn es nach Versäumen des Herbeirufens der Polizei zu einer Notwehrlage kommt. 483 Usch, StV 1993, S. 578, 582; Wagner, Notwehrbegründung, S. 61 f.; Werner, in: Staudinger, BGB, § 227 Rn. 22. 484 Kühl, Jura 1993, S. 233, 235; Spendel, in: LK-StGB, § 32 Rn. 224; im Hinblick auf private Sicherheitskräfte Bueß, DSD 4/1997, S. 9, 13; Vahle, Detektiv-Kurier 1 /1998, S. 7, 8; Schulte, DVB1. 1995, S. 130, 134; Ehlers, in: FS Lukes, S. 337, 353; Heyde, CD 3/1995, S. 33, 38. 485 So Peilert, Recht des Auskunftei- und Detekteigewerbes, S. 471 f.; BMI, W+S-Information 1982, S. 112, 121; Schuster, DSD 2/1988, S. 15, 22. 486 Vgl. nur BGH, NStZ 1996, S. 29; s.a. Heinrichs, in: Palandt, BGB, § 227 Rn. 7; für die Besitzwehr Bund, in: Staudinger, § 859 Rn. 9; krit. Lührmann, Tótungsrecht, insbes. S. 72 ff. 487 Statt aller Tröndle!Fischer, StGB, § 32 Rn. 17.
Β. Verhältnis privater und öffentlicher Sicherheit in Deutschland
131
mit den Befugnissen des privaten Sicherheitsgewerbes auseinandersetzt488. Dabei ist zwischen drei Einschränkungsvarianten zu unterscheiden. Zunächst könnte sich eine Beschränkung aller Notwehrhandlungen auf verhältnismäßige Verteidigungsmaßnahmen aus der Begründung der Notwehr ergeben 489. Sieht man mit einer überindividualistischen Notwehrbegründung den Grund der Rechtfertigung in der durch die Notwehr bewirkten Verteidigung der Rechtsordnung, so handelt der Notwehrübende an der Stelle des eigentlich zuständigen Staates. Dementsprechend habe er sich bei der Ausübung der Notwehr am Gemeinwohl zu orientieren 490 . Hier wird die Notwehrausübung „als eine Art ,3eleihung" des Bürgers" 491 begriffen und folgerichtig der Satz angewendet, daß der Staat nicht mehr Rechte übertragen kann, als er selber innehat. In der Tat würde also der Notwehrübende dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz unterliegen, wenn sein Handeln als hoheitlich zu begreifen ist. Dies ist jedoch nicht der Fall, denn aus der Übertragung eines Rechts auf den Bürger folgt nicht, daß der Staat sich die Ausübung dieses Rechts durch den Bürger zurechnen lassen muß 492 . Auch eine überindividuelle Notwehrbegründung erzwingt damit nicht die Bindung an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Sie könnte jedoch unmittelbar in § 32 StGB verankert sein, insbesondere im Erfordernis der Gebotenheit. Jedoch spricht gegen eine Verankerung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes in dieser Norm, daß in § 34 StGB ausdrücklich eine Proportionalität der Zweck-Mittel-Relation gefordert wird. Zudem ist die Entstehungsgeschichte493 eindeutig: Das StGB entschied den im 19. Jahrhundert geführten Streit um die Verhältnismäßigkeit im Gegensatz etwa zum preußischen Allgemeinen Landrecht bewußt zugunsten einer Freistellung vom Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Dies macht durchaus Sinn, da sich der Notwehrübende regelmäßig in einer für ihn ungewohnten Bedrängnis befindet, auf die er weder psychisch noch physisch vorbereitet ist. In einer solchen Situation eine Güterabwägung zu fordern, würde regelmäßig Unmögliches verlangen, so daß ein Bemühen um rechtmäßiges Verhalten regelmäßig zu einer Hinnahme von Rechtsverletzungen führen würde 494 . Konsequenterweise wird eine Einschränkung des Notwehrrechts daher 488 Mahlberg, KrimJ 1992, 4. Beih., S. 209, 212 f.; ausführlich ders., Gefahrenabwehr, S. 111 ff. - Im Schrifttum des privaten Sicherheitsgewerbes wird häufig eine Bindung an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz postuliert, ohne daß klar wäre, ob hiermit Verhältnismäßigkeit im Sinne von Erforderlichkeit der Verteidigungshandlung oder aber Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne gemeint ist, vgl. etwa Stoike, DSD 1 /1999, S. 23. 489 Vgl. zum Streit um überindividualistische und individualistische Notwehrbegründungen, welche zumeist kumuliert werden, nur Lenckner, in: Schönke / Schröder, StGB, § 32 Rn. 2 m.z.N. 4 90 Schwabe, NJW 1974, S. 670, 671; Wagner, Notwehrbegründung, S. 27; vgl. auch Schroeder, in: FS Maurach, S. 127,138 ff. 491
Wagner, Notwehrbegründung, S. 27. Zutreffend Seelmann, ZStW 89 (1977), S. 36,57. 493 Dazu Schroeder, in: FS Maurach, S. 127, 128 ff.; v. Bar, Gesetz und Schuld, S. 126 ff.; Arzt, in: FS Schaffstein, S. 77. 492
494
*
Vgl. nur Wagner, Notwehrbegründung, S. 32.
132
§ 2: Die aktuelle Situation
allein für solche Fälle angenommen, in denen offensichtlich ein unerträgliches Mißverhältnis zwischen der Bedrohung und den Folgen der Verteidigungshandlung vorliegt 495 . Der Gesichtspunkt der psychischen Ausnahmesituation wird für eine Einschränkung allein der NotA///
![Pflicht zur Sicherheit: Öffentlich-rechtliche Anforderungen an private Großveranstalter und die Legalisierungswirkung von Genehmigungen [1 ed.]
9783428556779, 9783428156771](https://dokumen.pub/img/200x200/pflicht-zur-sicherheit-ffentlich-rechtliche-anforderungen-an-private-groveranstalter-und-die-legalisierungswirkung-von-genehmigungen-1nbsped-9783428556779-9783428156771.jpg)

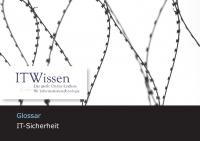




![IT-Sicherheit: Methoden und Schutzmaßnahmen für Sichere Cybersysteme [2., aktualisierte und erweiterte Auflage]
9783110767186, 9783110767087](https://dokumen.pub/img/200x200/it-sicherheit-methoden-und-schutzmanahmen-fr-sichere-cybersysteme-2-aktualisierte-und-erweiterte-auflage-9783110767186-9783110767087.jpg)
![Praxishandbuch Traumapädagogik: Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche [3 ed.]
9783666402456, 9783525402450, 9783647402451](https://dokumen.pub/img/200x200/praxishandbuch-traumapdagogik-lebensfreude-sicherheit-und-geborgenheit-fr-kinder-und-jugendliche-3nbsped-9783666402456-9783525402450-9783647402451.jpg)
![Netzwerktechnik-Fibel: Grundlagen, Übertragungstechnik und Protokolle, Anwendungen und Dienste, Sicherheit [1., Aufl.]
3833416815, 9783833416811](https://dokumen.pub/img/200x200/netzwerktechnik-fibel-grundlagen-bertragungstechnik-und-protokolle-anwendungen-und-dienste-sicherheit-1-aufl-3833416815-9783833416811.jpg)
![Private und öffentliche Sicherheit [1 ed.]
9783428501694, 9783428101696](https://dokumen.pub/img/200x200/private-und-ffentliche-sicherheit-1nbsped-9783428501694-9783428101696.jpg)