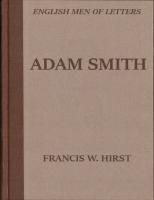Politischer und wirtschaftlicher Liberalismus. Das Staatsverständnis von Adam Smith 9783832974022, 9783845239286
292 45 2MB
German Pages 233 [232] Year 2019
Polecaj historie
Citation preview
Wissenschaftlicher Beirat: Klaus von Beyme, Heidelberg Horst Bredekamp, Berlin Norbert Campagna, Luxemburg Wolfgang Kersting, Kiel Herfried Münkler, Berlin Henning Ottmann, München Walter Pauly, Jena Volker Reinhardt, Fribourg Tine Stein, Göttingen Kazuhiro Takii, Kyoto Pedro Hermilio Villas Bôas Castelo Branco, Rio de Janeiro Loïc Wacquant, Berkeley Barbara Zehnpfennig, Passau
Staatsverständnisse herausgegeben von Rüdiger Voigt Band 135
Hendrik Hansen | Tim Kraski [Hrsg.]
Politischer und wirtschaftlicher Liberalismus Das Staatsverständnis von Adam Smith
© Titelbild: Joseph Wright of Derby: The Iron Forge, 1772
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN 978-3-8329-7402-2 (Print) ISBN 978-3-8452-3928-6 (ePDF)
1. Auflage 2019 © Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2019. Gedruckt in Deutschland. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Editorial
Das Staatsverständnis hat sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder grundlegend gewandelt. Wir sind Zeugen einer Entwicklung, an deren Ende die Auflösung der uns bekannten Form des territorial definierten Nationalstaates zu stehen scheint. Denn die Globalisierung führt nicht nur zu ökonomischen und technischen Verände‐ rungen, sondern sie hat vor allem auch Auswirkungen auf die Staatlichkeit. Ob die »Entgrenzung der Staatenwelt« jemals zu einem Weltstaat führen wird, ist allerdings zweifelhaft. Umso interessanter sind die Theorien der Staatsdenker, deren Modelle und Theorien, aber auch Utopien, uns Einblick in den Prozess der Entstehung und des Wandels von Staatsverständnissen geben, einen Wandel, der nicht mit der Glo‐ balisierung begonnen hat und nicht mit ihr enden wird. Auf die Staatsideen von Platon und Aristoteles, auf denen alle Überlegungen über den Staat basieren, wird unter dem Leitthema »Wiederaneignung der Klassiker« im‐ mer wieder zurück zu kommen sein. Der Schwerpunkt der in der Reihe Staatsver‐ ständnisse veröffentlichten Arbeiten liegt allerdings auf den neuzeitlichen Ideen vom Staat. Dieses Spektrum reicht von dem Altmeister Niccolò Machiavelli, der wie kein Anderer den engen Zusammenhang zwischen Staatstheorie und Staatspraxis verkörpert, über Thomas Hobbes, den Vater des Leviathan, bis hin zu Karl Marx, den sicher einflussreichsten Staatsdenker der Neuzeit, und schließlich zu den Wei‐ marer Staatstheoretikern Carl Schmitt, Hans Kelsen und Hermann Heller und weiter zu den zeitgenössischen Theoretikern. Nicht nur die Verfälschung der Marxschen Ideen zu einer marxistischen Ideolo‐ gie, die einen repressiven Staatsapparat rechtfertigen sollte, macht deutlich, dass Theorie und Praxis des Staates nicht auf Dauer von einander zu trennen sind. Auch die Verstrickungen Carl Schmitts in die nationalsozialistischen Machenschaften, die heute sein Bild als führender Staatsdenker seiner Epoche trüben, weisen in diese Richtung. Auf eine Analyse moderner Staatspraxis kann daher in diesem Zusam‐ menhang nicht verzichtet werden.
5
Was ergibt sich daraus für ein zeitgemäßes Verständnis des Staates im Sinne einer modernen Staatswissenschaft? Die Reihe Staatsverständnisse richtet sich mit dieser Fragestellung nicht nur an (politische) Philosophen, sondern vor allem auch an Stu‐ dierende der Geistes- und Sozialwissenschaften. In den Beiträgen wird daher zum einen der Anschluss an den allgemeinen Diskurs hergestellt, zum anderen werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse in klarer und aussagekräftiger Sprache – mit dem Mut zur Pointierung – vorgetragen. So wird auch der / die Studierende unmit‐ telbar in die Problematik des Staatsdenkens eingeführt. Prof. Dr. Rüdiger Voigt
6
Inhaltsverzeichnis
Hendrik Hansen / Tim Kraski Einleitung
I.
9
Das Staatsverständnis von Smith
Hendrik Hansen Autonomie gesellschaftlicher Prozesse versus Teleologie – Smith’ Verständnis von Politik und Ökonomie in Abgrenzung von Aristoteles
19
Christel Fricke Adam Smith und die moralischen Grundlagen von Recht und Gerechtigkeit
43
Heinz D. Kurz Adam Smith über das Merkantil- und das Agrikultursystem
67
Bastian Ronge Die Aufgaben des Staates bei Adam Smith
93
II.
Die Rezeption des Staatsverständnisses von Smith im 18. und 19. Jahrhundert
Michael Hochgeschwender Das Staatsverständnis des Adam Smith in der politischen Ideengeschichte der frühen USA, 1776-1815
111
Birger P. Priddat Adam Smith im Spiegel der deutschen Ökonomie um 1800: die fundamentale Differenz in der Staatsauffassung
127
Hendrik Hansen / Tim Kraski Von Smithʼ Kapitalismuskonzeption zu Marxʼ Kapitalismuskritik – oder: wie marxistisch ist Adam Smith?
147
7
III.
Smith und die Veränderung des Staatsverständnisses in der Globalisierung
Richard Sturn Smith und der Wirtschaftsliberalismus der Gegenwart
167
Michael S. Aßländer Adam Smith und die Soziale Marktwirtschaft: Die Frage nach den Funktionsbedingungen der liberalen Ordnung
195
Rolf Steltemeier / Tobias Knobloch Das Freiheitsverständnis von Adam Smith. Über die Haltbarkeit eines zentralen sozialphilosophischen Versprechens im Digitalzeitalter
215
Nachruf für Tim Kraski
231
Verzeichnis der Autoren
233
8
Hendrik Hansen / Tim Kraski Einleitung
Adam Smith ist bekannt für seine Metapher von der unsichtbaren Hand, die die Handlungen der eigennutzorientierten Individuen so lenkt, dass sie – ohne es zu be‐ absichtigen – das Wohl aller fördern. Diese Metapher spricht vor allem Ökonomen an, die darin eine geniale Beschreibung des freien Wettbewerbs in der Marktwirt‐ schaft sehen. Die Adam-Smith-Forschung hat in den letzten Jahrzehnten seit dem 200. Jahrestag der Erstausgabe des „Wohlstands der Nationen“ einen erheblichen Beitrag zur Differenzierung der Deutung von Adam Smith geleistet und dabei u. a. verdeutlicht, dass Adam Smith ein wesentlich komplexeres Menschenbild hatte, als es die Metapher von der unsichtbaren Hand suggeriert: Der Mensch ist nach Smith nicht nur eigennützig, sondern auch fähig, sich in andere Menschen hineinzuverset‐ zen und aus Sympathie zu anderen zu handeln. Doch Smith bezog seinen Optimismus, dass die Handlungen der Menschen, so wie sie sind, zu einem harmonischen Ausgleich führen, nicht nur auf die Bereiche der Ethik und der Ökonomie, sondern auch auf die Politik und auf das Recht. Dieser Aspekt seines Werkes, d. h. der Beitrag von Smith zur Staatstheorie, steht im Zen‐ trum des vorliegenden Bandes der Reihe „Staatsverständnisse“. Die Aufsätze in die‐ sem Band verdeutlichen, dass Smith sich eher als Moralphilosoph und Staatswissen‐ schaftler verstand, denn als Moralphilosoph und Ökonom: Seine Befassung mit öko‐ nomischen Fragen im „Wohlstand der Nationen“ (im folgenden WN) dient der Be‐ stimmung der Aufgaben des Staates; seine „Theorie der ethischen Gefühle“ (im fol‐ genden: TEG) enthält zugleich eine Theorie der Entstehung des Rechts und des Zu‐ sammenhangs von Recht und Moral; seine „Lectures on Jurisprudence“ sind ein klassisch staatswissenschaftliches Werk, das den Zusammenhang von Politik, Recht, Ethik und Ökonomie entfaltet. Die freiheitliche Gesellschaft kann nach Smith nicht mit einem Nachtwächterstaat auskommen, sondern bedarf einer Regierung, die die Rahmenordnung schafft, aber sich in der Regulierung der einzelnen Wirtschaftsbe‐ reiche beschränkt. Dieses Staatsverständnis wird sich gemäß der Geschichtsphiloso‐ phie von Smith im Laufe der Geschichte quasi automatisch durchsetzen, ähnlich wie die Republik und der ewige Frieden in der Staatstheorie von Immanuel Kant. Das Staatsverständnis von Adam Smith ist für das politische Selbstverständnis der Moderne von Bedeutung, weil er wie kaum ein anderer Autor die optimistische Idee entwickelt hat, dass eine freiheitliche politische Ordnung den harmonischen Ausgleich individueller Interessen ermöglicht. An seinem Werk lässt sich unter‐
9
suchen, von welchen Voraussetzungen eine solche Ordnung abhängt – einschließlich der Voraussetzungen, die Smith selbst nicht hinreichend expliziert hat. Der Band un‐ tersucht deshalb nicht nur die ideengeschichtliche Frage nach dem Staatsverständnis von Smith, sondern auch die gegenwartsbezogene Frage: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit sich eine freiheitliche Ordnung entwickeln kann, und wel‐ ches sind die Funktionsbedingungen einer solchen Ordnung? Der erste Teil des vorliegenden Bandes setzt sich mit dem Staatsverständnis von Adam Smith auseinander und verfolgt dabei in Teilen einen komparativen Ansatz, indem untersucht wird, wie es sich von dem anderer wichtiger Autoren der Ideenge‐ schichte bzw. seiner Zeit unterscheidet. Wenig bekannt, aber von zentraler Bedeu‐ tung für das Verständnis von Smith, ist seine Bezugnahme auf und seine Abgren‐ zung von Aristoteles. Insbesondere die ersten sieben Kapitel des WN beziehen sich an zahlreichen Stellen auf die ökonomische und politische Theorie von Aristoteles und formulieren eine Gegenposition, die sich begrifflich mit dem Gegensatz „Teleo‐ logie versus Autonomie gesellschaftlicher Prozesse“ auf den Punkt bringen lässt (vgl. den Beitrag von Hendrik Hansen). Aristoteles kritisiert das grenzenlose Streben nach Erwerb zum einen aus einer ethischen Perspektive: Wer Reichtum um seiner selbst willen anstrebt, verfehlt dessen Zweck, Mittel für ein gutes Leben im ethi‐ schen Sinne zu sein. Zum anderen zeigt er, dass das schrankenlose Streben nach Reichtum zur gesellschaftlichen Spaltung in zwei Klassen führt, Arme und Reiche, und dass diese Spaltung die Stabilität der Gesellschaft gefährdet. Diese Entwicklung lässt sich nur vermeiden, indem die Bürger zu einem tugendhaften Leben und zum Maßhalten – u. a. mit Blick auf das Streben nach Reichtum – angehalten werden. Gegen diese teleologische Deutung von Politik und Ökonomie setzt Smith seine Vorstellung, dass die gesellschaftlichen Prozesse gewissermaßen automatisch einen Ausgleich der individuellen Bestrebungen herbeiführen: Nicht Tugend und Maßhal‐ ten sind die Grundlage des gesellschaftlichen Zusammenhalts, sondern die gesell‐ schaftlichen Mechanismen, die im Bereich der Ökonomie auf dem Eigennutzstre‐ ben, im Bereich von Politik und Gesellschaft auf der Fähigkeit der Menschen zur Sympathie beruhen. Erst in der Abgrenzung von Aristoteles wird dieser Kern der ökonomischen und politischen Theorie von Adam Smith hinreichend deutlich. Der folgende Beitrag von Christel Fricke wendet sich den Grundlagen der Rechtsphilosophie von Adam Smith zu und zeigt, wie die Moralphilosophie der TEG seiner Theorie des Rechts und der Gerechtigkeit zugrunde liegt. Fricke erläu‐ tert zunächst das „Sympathieverfahren“, das den Kern der TEG bildet, und zeigt dann, wie dieses Verfahren einen Maßstab zur moralischen Beurteilung von Hand‐ lungen liefert (moralische Gerechtigkeit) und zudem geeignet ist, die moralische Rechtfertigung von Gesetzen im Gesetzgebungsverfahren zu beurteilen (politische Gerechtigkeit). Politische Gerechtigkeit beruht zu einem erheblichen Teil auf mora‐ lischer Gerechtigkeit, deren oberstes Prinzip das Verbot der Schädigung von Un‐
10
schuldigen bzw. Unbeteiligten ist. Ein wesentliches Ergebnis der Analyse von Fricke ist, dass die moralische Beurteilung von Handlungen durch unparteiische Zuschauer im Sympathieverfahren auf der Annahme eines Egalitarismus beruht: Zum einen werden die Meinungen aller unparteiischen Zuschauer als gleichrangig angesehen, d. h. Smith lässt bei den unparteiischen Zuschauern keine Unterschiede hinsichtlich des Standes oder der Bildung gelten; zum anderen sieht der unparteiische Zuschauer sich selbst als ebenso verletzlich wie der Betroffene an, dessen Schädigung er beur‐ teilt. Politisch folgt daraus das konsequente Eintreten von Smith für die Idee der Rechtsstaatlichkeit: Nur auf der Grundlage eines gleichen Rechts für alle lässt sich durchsetzen, dass der moralisch legitime Wunsch nach Vergeltung einer Schädigung durch juristische Verfahren der Verurteilung und Bestrafung des Täters abgelöst wird. Nach der Analyse des Zusammenhangs von Ethik und Rechtsphilosophie wendet sich der Beitrag von Heinz D. Kurz der Wirtschaftspolitik zu und analysiert die Ab‐ grenzung von Adam Smith gegenüber den Merkantilisten und den Physiokraten im vierten Buch des WN. Kurz zeigt in seiner Analyse von Smith’ Kritik an diesen bei‐ den wirtschaftspolitischen Konzeptionen, dass die Auseinandersetzung mit der Ar‐ gumentation in Buch IV einige wichtige Präzisierungen von Smith’ wirtschaftslibe‐ raler Position erlaubt. So betont er in der Kritik des Merkantilismus das ständige Be‐ streben von Unternehmern und Kaufleuten, staatliche Beschränkungen des Wettbe‐ werbs durchzusetzen und zeigt damit eine der Gefahren des Systems der freien Marktwirtschaft auf: ihre Selbstaufhebung aufgrund der Durchsetzung merkantiler Sonderinteressen. Entsprechend folgert Kurz, dass Smith nicht ein System der völli‐ gen Marktfreiheit befürwortet, sondern vielmehr für ein System plädiert, in dem die unsichtbare Hand des Marktes politisch unterstützt wird. Dem Staat kommt u. a. die Aufgabe zu, im Fall von Marktversagen regulierend einzugreifen und zu verhindern, dass einzelne politisch einflussreiche Gruppen besondere Privilegien durchsetzen. Zudem ist der gesellschaftliche Ausgleich relevant, um die Stabilität von Staat und Gesellschaft zu sichern. In der Analyse von Smith’ Kritik der Physiokratie kommt Kurz zu dem überraschenden Ergebnis, dass seine Argumentation agrozentrischer sei als die von François Quesnay: Zwar kritisiert Smith – wie allgemein bekannt – dass Quesnay die Handwerker als unproduktiv ansieht. Doch während Quesnay in seinem „Tableau économique“ zeigt, dass Landwirtschaft und produzierendes Ge‐ werbe letztlich aufeinander angewiesen sind, weil sie beide Vorleistungen des je‐ weils anderen Sektors beziehen, sieht Smith eine „produktionstechnische Hierar‐ chie“ (Kurz), bei der die Landwirtschaft die Basis für alle anderen Industriezweige bildet. Der Beitrag von Kurz leitet über zu dem Thema des vierten Beitrags in diesem Teil: Bastian Ronges Auseinandersetzung mit Smith’ Theorie der Staatsaufgaben. Ronge stellt zunächst die „Standardinterpretation“ dar, nach der Smith den Staat auf
11
drei Aufgaben reduziert: die Landesverteidigung, ein funktionierendes Rechtssystem und die Bereitstellung von Infrastruktur („öffentliche Bauwerke und bestimmte öf‐ fentliche Einrichtungen“, so Smith am Ende des vierten Teils des WN). Die Autoren, die die Standardinterpretation vertreten, gehen davon aus, dass das System der na‐ türlichen Freiheit ein normatives Ideal mit überzeitlichem Geltungsanspruch sei – Smith aber stellt nach Ronge in seinem Werk an verschiedenen Stellen klar, dass es in der Welt der Wirtschaftspolitik keine überzeitlichen Werte gibt, weil die Ökono‐ mie stets zeitlich gebunden und von den jeweiligen historischen Bedingungen ge‐ prägt ist. Demzufolge steht Smith seinen ersten deutschen Rezipienten, die Birger Priddat im zweiten Teil dieses Bandes behandelt, wesentlich näher, als es gemeinhin angenommen wird. Ronge zeigt in seinem Beitrag ein zentrales Versäumnis der Standardinterpretation von Smith auf, das darin besteht, dass wichtige Staatsaufga‐ ben übersehen werden: neben den drei oben genannten Aufgaben hat der Staat auch die Aufgaben, ein allgemeines Bildungsniveau zu sichern; sich selbst angemessen, mit gebührender Würde, zu repräsentieren; die Staatsfinanzen (Einnahmen und Aus‐ gaben) zu verwalten und durch wirtschaftspolitische Eingriffe die Funktionsfähig‐ keit der Wettbewerbsordnung zu sicher. Letztere Aufgabe könne, so Ronge, sehr ex‐ tensiv ausgelegt werden, so dass der WN sich aus seiner Sicht nicht nur für die Legi‐ timation eines wirtschaftsliberalen Systems eignet. Der zweite Teil des Bandes setzt sich mit der Rezeption von Smith im 18. und 19. Jahrhundert auseinander und wendet sich zunächst der Rezeption in den USA und in Deutschland zu. Erwarten würde man eine eher positive, zustimmende Rezeption in den USA und eine kritische Rezeption in Deutschland – tatsächlich ist es aber gera‐ de umgekehrt. Michael Hochgeschwender zeigt, wie kritisch u.a. Alexander Hamil‐ ton Smith und der Idee des Freihandels gegenüberstand, während Birger Priddat ver‐ deutlicht, wie wohlwollend u. a. Sartorius Smith rezipierte. Michael Hochgeschwender stellt zunächst fest, dass sich die Rezeption von Smith in den USA im wesentlichen auf den „Wohlstand der Nationen“ beschränkte: Die „Theorie der ethischen Gefühle“ spielte dort eine geringe Rolle, weil sie sich durch einen geringeren Grad an Originalität auszeichnete und weniger intensiv rezipiert wurde. Relevant waren für die U.S.-amerikanischen Rezipienten einerseits das Bild von der unsichtbaren Hand und die Lehre vom freien Wettbewerb und vom Freihan‐ del, andererseits die aus der Physiokratie (bei aller Kritik von Smith an Quesnay) übernommene Wertschätzung der Landwirtschaft. In seiner Analyse der Rezeptions‐ bedingungen des Bildes von der unsichtbaren Hand geht Hochgeschwender auf den ideengeschichtlichen Kontext des Bildes ein: Es entspricht dem zu Smith’ Zeit ver‐ breiteten Deismus, der davon ausgeht, dass Gott die Welt mit einer prästabilierten Harmonie eingerichtet hat. Die Idee der prästabilierten Harmonie wurde von Alexander Hamilton zumindest in Bezug auf die Ökonomie abgelehnt. Als Mitautor der „Federalist Papers“ und Finanzminister unter George Washington stritt er gegen
12
die Idee des Freihandels und trat stattdessen für eine Wirtschaftspolitik ein, die mit Hilfe von Schutzzöllen den Aufbau einer starken U.S.-amerikanischen Industrie för‐ dert. Positiv bezogen sich Hamiltons politische Gegner Thomas Jefferson und James Madison auf Smith, die aber die Idee der unsichtbaren Hand nicht mit moderner In‐ dustrie und weltweitem Handel verbanden, sondern als „agrarians“ eine landwirt‐ schaftlich orientierte Wirtschaft favorisierten, weil nur sie die moralischen Grundla‐ gen der Gesellschaft langfristig sichern könne. Für Industrialisierung und Freihandel tritt die Wirtschaftspolitik der USA tatsächlich erst ein, seit die U.S.-amerikanische Wirtschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine international wettbewerbsfähige Wirtschaft hat. In Deutschland wurden mit der Rezeption von Adam Smith von Beginn an die Besonderheiten der deutschen Nationalökonomie sichtbar, die sich im 19. Jahrhun‐ dert herausbildeten. Birger Priddat setzt sich in seinem Beitrag ausführlich mit den ersten Smith-Rezipienten in Deutschland auseinander, unter anderem mit dem Göt‐ tinger Philosophen Johann G. H. Feder und seinem Schüler Georg Sartorius. Beide bereiteten mit ihrer Smith-Rezeption die Abkehr vom Kameralismus vor sowie die Entwicklung der deutschen Nationalökonomie des 19. und 20. Jahrhunderts, wobei sie in der Konzeption des Staates entscheidend von Smith abwichen. Das Ziel von Sartorius als dem bedeutendsten deutschen Smith-Rezipienten dieser Zeit war es, zwischen absoluter wirtschaftlicher Freiheit und staatlicher Zwangspolitik zu ver‐ mitteln. Entscheidend ist dabei die Theorie des Privateigentums. Nach Sartorius kann – anders als Smith es postuliert hat – ein natürliches Recht auf Eigentum nicht bewiesen werden, so dass das Eigentum den Regeln der staatlichen Verfassung un‐ terliegt. Der sich selbst regulierende Wettbewerb besteht nicht von Natur aus, son‐ dern erhält vom Staat seine Rechtsform und seine Legitimation. Wenn der Markt nicht zum Ausgleich der Interessen und zur Förderung des Volkswohlstands führt, ist der Staat damit zum Eingriff legitimiert. Sartorius betont die große Zahl an Aus‐ nahmefällen, in denen letzteres der Fall ist – der Katalog an Ausnahmen liest sich wie eine frühe Theorie des Marktversagens. Er strebt mit seiner Argumentation aber nicht eine Fundamentalkritik von Smith an, sondern nur dessen Einordnung: Smith’ Argumentation gelte für hochentwickelte Gesellschaften; in Deutschland hingegen, wo der entsprechende Handelsgeist weniger ausgeprägt sei und die Menschen weni‐ ger wohlhabend seien, könne Smith’ Modell nicht ohne substantielle Anpassungen angewandt werden. Birger Priddat arbeitet sehr klar heraus, wie in dieser frühen Smith-Rezeption die historische Schule der Nationalökonomie angelegt ist, die sich in den Jahrzehnten nach Sartorius entwickelt. Ebenfalls wird in seinem Beitrag deut‐ lich, dass Sartorius die besondere Berücksichtigung der institutionellen Rahmenord‐ nung in der deutschen Ökonomie vorbereitet. Der letzte Beitrag des zweiten Teils wendet sich dem ambivalenten Verhältnis von Karl Marx zu Adam Smith zu. Hendrik Hansen und Tim Kraski zeigen, dass
13
Marx zunächst auf verschiedenen Ebenen Gegenthesen zu Adam Smith formuliert: Der Wettbewerb führt nach Marx nicht zur Harmonie in der Gesellschaft, sondern zu einem existenziellen Klassenkampf, in dem entweder beide Klassen, Proletarier und Kapitalisten, untergehen, oder die Proletarier allein siegreich sein werden; Politik und Ethik stehen nicht unabhängig neben der Ökonomie, sondern werden von der Ökonomie determiniert; der Mensch ist nicht frei in der Gestaltung seiner wirt‐ schaftlichen, sozialen und politischen Bezüge, sondern Objekt der Gesetze des histo‐ risch-dialektischen Materialismus. Doch trotz dieser offenkundigen Gegensätze gibt es bei Smith eine Reihe von Argumenten, die die radikalen Schlussfolgerungen von Karl Marx bereits nahelegen: Smith erläutert die Arbeitswertlehre und stellt sowohl die Kapitalisten als auch die Grundeigentümer als Vertreter von Klassen dar, deren Einkommen nur eine eingeschränkte Berechtigung haben – hier liegt der Gedanke nahe, dass die Aneignung eines Teils der Produktion durch die Kapitalisten und Grundeigentümer ungerecht ist; in der Analyse der Arbeitskämpfe in Buch I, Kapitel 8 des WN werden diese als Klassenkämpfe dargestellt, die zumeist zugunsten der Kapitalisten ausgehen, weil sie die Stärkeren sind; und in seiner Geschichtsphiloso‐ phie argumentiert Smith mit ökonomischen Gesetzmäßigkeiten, die im Laufe der Zeit zur Durchsetzung der fortschrittlicheren Gesellschaft führen. Im Ergebnis zeigt der Beitrag, dass es zwischen Smith und Marx neben aller Gegensätzlichkeit eine Reihe von Verbindungen gibt. Die Widersprüchlichkeit mancher Argumente von Smith und seine Neigung zur ökonomischen Interpretation des Menschen (z. B. in seiner Bestimmung des Menschen durch die Neigung zum Tausch) öffnet der Kapi‐ talismuskritik von Marx Tür und Tor. Daraus folgt, dass der Untergang der kommu‐ nistischen Systeme in Ostmitteleuropa vor dreißig Jahren nicht mit einem Sieg des Kapitalismus im Sinne von Smith gleichgesetzt werden darf: Die Widersprüche des Kapitalismus sind mit dem Untergang des Marxismus-Leninismus nicht überwunden und können jederzeit zum Wiedererstarken einer neuen radikalen Systemkritik füh‐ ren. Der dritte Teil des vorliegenden Bandes stellt schließlich den Bezug der politi‐ schen Theorie von Smith zu Theoriedebatten und politischen Herausforderungen der Gegenwart her. Hier erfolgt zunächst eine Analyse des Verhältnisses von Smith zum modernen Wirtschaftsliberalismus. Richard Sturn systematisiert die wirtschaftslibe‐ ralen Positionen anhand eines dreidimensionalen Koordinatensystems. Demnach las‐ sen sich die Positionen danach unterscheiden, (1) ob sie mehr oder weniger „markt‐ optimistisch“ sind und die Grenzen der Funktionsfähigkeit von Märkten mehr oder weniger eng ziehen, (2) welche Bedeutung Kollektiventscheidungen beigemessen wird und (3) welchen Grad an Zentralisierung politische Institutionen aufweisen sol‐ len. In der Rezeption durch Autoren wie Friedrich August von Hayek erscheint Adam Smith als ein sehr „marktoptimistischer“ Autor, der Kollektiventscheidungen äußerst skeptisch gegenübersteht und die wenigen, die er befürwortet, möglichst de‐
14
zentral organisieren möchte. Dagegen zeigt Sturn, dass die Leistung von Adam Smith gerade darin lag, nicht einseitig auf den Markt zu vertrauen, sondern die Be‐ deutung der Politik differenziert zu analysieren. Smith steht für eine „gute Sozial‐ theorie“, die bemüht sein wird, „die möglichen Funktionen, Koordinationsleistungen und Grenzen des Marktes möglichst prägnant herauszuarbeiten, aber gleichzeitig auch die Formen, Funktionen und Grenzen von Regulierung und nichtmarktförmi‐ gen Institutionen und deren mögliche Weiterentwicklung im Blick [zu] behalten.“ Michael Aßländer analysiert im folgenden Beitrag das Verhältnis von Adam Smith zum Staatsverständnis einer gerade im deutschsprachigen Raum besonders wichtigen Variante des Wirtschaftsliberalismus: dem Ordoliberalismus. Aßländer untersucht, inwiefern bereits Smith die Frage nach den Funktionsbedingungen der Marktwirtschaft aufwirft, die für die ordoliberalen Vordenker des Konzepts der So‐ zialen Marktwirtschaft eine so zentrale Bedeutung hatte; damit schließt sein Beitrag unmittelbar an dem Ergebnis von Sturn an. Die Parallele zwischen Smith und dem Ordoliberalismus wird an drei Punkten aufgezeigt: Erstens gehen beide davon aus, dass das Streben nach Gewinn und Nutzen einer Mäßigung bedarf. Bei Smith lenkt zum einen die unsichtbare Hand das individuelle Streben nach Wohlstand so, dass es der Gemeinschaft zugute kommt; zum anderen dämpft der unparteiische Beobachter, den Smith in seiner Ethik zur zentralen Figur seiner Moraltheorie macht, den Egois‐ mus. Auch bei Vertretern des Ordoliberalismus wie Walter Eucken und Wilhelm Röpke spielt die Individualmoral eine wichtige Rolle. Zweitens zeigt Aßländer, dass für beide Positionen die Freiheit nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine mo‐ ralische Bedeutung hat: Wirtschaftliche Freiheit wird nicht nur geschützt und geför‐ dert, weil sie dem Wirtschaftswachstum dient, sondern weil sie dem Einzelnen das Recht gibt, seine individuellen Kräfte nach eigenen Vorstellungen einzusetzen. Bei‐ de verbinden jedoch das Recht auf Freiheit mit der Idee der Verantwortung. Drittens ist es sowohl Smith, als auch dem Ordoliberalismus ein zentrales Anliegen, die Frei‐ heit mit dem Ziel der sozialen Gerechtigkeit zum Ausgleich zu bringen. Für die Ordoliberalen stand die soziale Frage vor dem Hintergrund der Erfahrung der Welt‐ wirtschaftskrise im Zentrum ihrer Überlegungen; doch auch Smith stellt, wie Aßlän‐ der überzeugend zeigt, klar, dass Märkte staatlich reguliert werden müssen, wenn die Marktergebnisse zu sehr gegen das Gerechtigkeitsempfinden verstoßen. Im Ergebnis zeigt der Beitrag, dass Smith alles andere als ein Vertreter einer Theorie des Mini‐ malstaats war, sondern seine Theorie vielmehr auf die Begründung eines differen‐ zierten Systems der ökonomischen und politischen Freiheit in Verbindung mit einer minima moralia zielt. Im abschließenden Beitrag untersuchen Rolf Steltemeier und Tobias Knobloch, welche Bedeutung das Freiheitsverständnis von Adam Smith im Digitalzeitalter hat. Sie analysieren zunächst das Freiheitsverständnis von Smith. Aus ihrer Sicht steht er für die Begründung des engen Zusammenhangs von Aufklärung und Bildung, Un‐
15
ternehmertum, Eigentum, Privatautonomie sowie einer eingeschränkten, aber gleich‐ zeitig rigorosen Staatstätigkeit. Im Wechselspiel dieser Kräfte konstituiert sich für Smith individuelle Freiheit im modernen Staat immer wieder neu. Was über Jahr‐ hunderte ein guter ordnungspolitischer Kompass und eine solide Grundlage für die Balance privaten und staatlichen Handelns gewesen ist, braucht im Zeitalter der um‐ fassenden Digitalisierung eine Erneuerung in zwei Bereichen, die für Smith zum Kern staatlicher Aufgaben zählen: Bildung und Wettbewerbspolitik. Im Zeitalter von Unternehmen wie Google und Amazon wird die Freiheit an diesen beiden Fronten entweder erfolgreich verteidigt – dann wird Adam Smith auch im 21. Jahrhundert ein aktueller Denker bleiben. Oder sie wird sukzessive verloren gehen – und damit würde auch die Relevanz von Adam Smith (und anderen klassischen Vordenkern der Freiheit) verschwinden.
16
I. Das Staatsverständnis von Smith
Hendrik Hansen Autonomie gesellschaftlicher Prozesse versus Teleologie – Smith’ Verständnis von Politik und Ökonomie in Abgrenzung von Aristoteles
Im Zentrum der politischen und ökonomischen Theorie von Smith steht die These, dass es in ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Prozessen aufgrund der natürlichen Anlagen der Menschen zu einem automatischen Ausgleich ihrer Interes‐ sen und Bestrebungen kommt. Deshalb ist es nach Smith die vordringliche Aufgabe der Politik, das System der natürlichen Freiheit herzustellen, das die Entfaltung die‐ ser Anlagen ermöglicht. Mit dieser These wendet sich Smith gegen die traditionelle, noch von der Scholastik geprägte politische Philosophie, nach der nur eine teleologi‐ sche Ordnung der Gesellschaft und eine entsprechende Erziehung der Bürger zum tugendhaften Verhalten den Ausgleich in der Gesellschaft herstellen und den not‐ wendigen Zusammenhalt gewährleisten kann. Einer der bedeutendsten Vertreter einer teleologischen Philosophie der Politik ist Aristoteles; zur Zeit von Smith zähl‐ ten seine Hauptwerke der praktischen Philosophie, die „Politik“ und die „Nikoma‐ chische Ethik“, zur Standardlektüre in den entsprechenden universitären Lehrveran‐ staltungen. So verwundert es nicht, dass Smith sich im „Wohlstand der Nationen“ (im folgen‐ den: WN1) intensiv mit Aristoteles auseinandersetzt. Gerade die ersten sieben Kapi‐ tel des ersten Teils, die die Grundlagen der ökonomischen Theorie von Smith entfal‐ ten, lesen sich wie eine durchgehende Auseinandersetzung mit – und Abgrenzung von – der „Politik“ von Aristoteles.2 Will man das Staatsverständnis von Smith er‐ fassen, so ist es erforderlich, diese Auseinandersetzung nachzuvollziehen und die Unterschiede zwischen Smith und Aristoteles, aber auch ihre Gemeinsamkeiten, zu analysieren. Dieser Zusammenhang wird in der Literatur zumeist übersehen, weil Smith Aris‐ toteles namentlich kaum und nur an unbedeutenden Stellen erwähnt.3 Wenn Smith aus seiner Abgrenzung von bedeutenden konkurrierenden Positionen heraus gedeu‐ 1 Der „Wohlstand der Nationen“ wird im folgenden nach der deutschen Übersetzung von H. C. Recktenwald zitiert; zusätzlich werden das Buch des WN, das Kapitel und der Absatz nach der „Glasgow Edition of the Works and Correspondance of Adam Smith“ (Bd. 2) angegeben. 2 Aristoteles wird in diesem Teil des WN jedoch nicht namentlich genannt. 3 Die Bezugnahme von Smith auf Aristoteles wird z. B. von Waibl 1984, Immler 1985 und Denis 1993, S. 1 f., erwähnt. Fitzgibbons 1995, S. 15 f. und 156, betont an verschiedenen Stellen, dass Smith seine Ethik und seine ökonomische Theorie in Abgrenzung zu Aristoteles entwickelt ha‐ be. Ähnlich Bien 1990, Koslowski 1993, S. 67-79.
19
tet wird, so denkt man zunächst an den Merkantilismus und an die Physiokratie, die in der Tat die konkurrierenden Positionen in der zeitgenössischen Wirtschaftspolitik waren. Für das Verständnis der paradigmatischen Grundposition eines Autors ist es jedoch notwendig, ihn in einen größeren Zusammenhang zu stellen und seine Aus‐ einandersetzung mit Grundpositionen der politischen Philosophie in der Ideenge‐ schichte zu analysieren. Ein Vergleich des WN mit dem Merkantilismus kann auf‐ zeigen, worin die Spezifika der wirtschaftspolitischen Theorie von Smith liegen – der Vergleich mit Aristoteles hingegen ermöglicht es, seine politische Theorie vom Grund der gesellschaftlichen Ordnung und vom Verhältnis von Politik, Ökonomie und Ethik in seinem Werk her zu verstehen. Dieser Vergleich von Smith mit Aristoteles ist Gegenstand des vorliegenden Bei‐ trags. In Abschnitt 1 wird zunächst die ökonomische und politische Theorie von Aristoteles zusammengefasst, auf die Smith in seinem Werk zurückgreift. Ab‐ schnitt 2 untersucht, wie Smith seine ökonomische Theorie in Abgrenzung von Aris‐ toteles entwickelt und welches Verständnis des Zusammenhangs von Ökonomie und Politik dem WN zugrunde liegt. Dabei wird nicht nur auf die Unterschiede zwischen beiden Denkern, sondern auch auf die Gemeinsamkeiten zwischen ihnen einzugehen sein. Im dritten Abschnitt wird schließlich gezeigt, dass die Prinzipien des Aus‐ gleichs und der Autonomie der gesellschaftlichen Prozesse, die im WN dargelegt werden, auch der Ethik von Smith zugrunde liegen.
1. Aristoteles 1.1. Teleologie Aristoteles steht ideengeschichtlich für ein teleologisches Verständnis von Politik und Ökonomie: die politische Gemeinschaft dient dem guten Leben im Sinne einer eudämonistischen Ethik, d. h. der Verwirklichung der menschlichen Anlage zu Ver‐ nunft und Tugendhaftigkeit. Die Funktion der Ökonomie ist es, die Mittel für das gute Leben des einzelnen sowie für die Gemeinschaft in Haus und Staat bereitzustel‐ len; sie ist damit der Politik und der Ethik der Sache nach untergeordnet. Mit dieser Konzeption der Politik und des Staates wendet Aristoteles sich zum einen gegen die Sophistik, die die politische Gemeinschaft allein aus einem subjekti‐ ven Nutzenkalkül begründen will, und zum anderen gegen Platon, dessen Staatskon‐ zeption er für kollektivistisch hält. Während die Kritik des Kollektivismus im zwei‐ ten Buch der „Politik“ im Zusammenhang mit der Rechtfertigung des Privateigen‐ tums gegen (vorgeblich) kollektivistische Positionen erfolgt, dient die knappe Skizze der teleologischen politischen Philosophie zu Beginn der „Politik“ vor allem der Zu‐
20
rückweisung individualistischer Positionen.4 Der Staat, so Aristoteles, dient nicht al‐ lein dem Überleben und dem individuellen Nutzen der Bürger, sondern in erster Li‐ nie dem höchsten und „allervornehmsten“ der Güter: dem guten Leben. Der Staat ist „um des Lebens willen entstanden [...] und [besteht] um des vollkommenen Lebens willen.“5 Das gute Leben, dem der Staat dient, wird zunächst formal als das Ziel charakte‐ risiert, das in der Entwicklung der Gemeinschaften (Haus, Dorf) bereits angelegt ist, aber erst im Staat verwirklicht werden kann. Für die inhaltliche Bestimmung dieses Ziels greift Aristoteles auf seine Anthropologie zurück. Ziel des Lebens ist es, die spezifisch menschliche Fähigkeit des lógos (= Sprache, Vernunft) zu entwickeln, die den Menschen vom Tier unterscheidet. Das Tier kann mit der Stimme Lust und Schmerz mitteilen;6 Sprache und Vernunft hingegen ermöglichen dem Menschen die Reflexion und Begründung der Maßstäbe seines Handelns: „Das Wort aber oder die Sprache ist dafür da, das Nützliche und das Schädliche und so denn auch das Ge‐ rechte und das Ungerechte anzuzeigen. Denn das ist den Menschen vor den anderen Lebewesen eigen, dass sie Sinn haben für Gut und Böse, für Gerecht und Ungerecht und was dem ähnlich ist. Die Gemeinschaftlichkeit dieser Ideen aber begründet die Familie und den Staat.“7 Die politische Gemeinschaft dient also – anders als in individualistischen Gesell‐ schaftskonzeptionen – nicht dazu, das, was die Menschen für nützlich halten (ihre Interessen), einfach durchzusetzen, sondern das Gespräch zu führen über die Maß‐ stäbe, die bei der Formulierung des Nützlichen bzw. der Interessen zugrunde gelegt werden. Ein solches Gespräch kann selbst schon als entscheidendes Kennzeichen ei‐ nes guten Lebens angesehen werden, denn in ihm drückt sich in vollkommener Wei‐ se die geistige Selbständigkeit eines Menschen aus. Das Gespräch über das Gute und das Gerechte kann der Mensch nur in der Ge‐ meinschaft mit anderen führen. Voraussetzung für das Gespräch ist, dass der Bürger zumindest partiell der Sorge um die ökonomischen Grundlagen seiner Existenz ent‐ hoben ist – dies ist aber erst im Staat und nicht in den kleineren Gemeinschaften (Haus, Dorf) der Fall. Deshalb ist „der Mensch von Natur ein staatliches Wesen“,8 und der Staat besteht von Natur aus und nicht durch Übereinkunft (Vertrag). Indivi‐ dualistische Theorien, wie sie in der Sophistik von Protagoras9 vertreten wurden und in der Neuzeit z. B. von Thomas Hobbes, gehen davon aus, dass der einzelne aus sich selbst heraus bestimmt, was er als Inbegriff des glücklichen Lebens ansieht. Der individualistische Ansatz wird von Aristoteles zurückgewiesen, ebenso wie die kol‐ 4 5 6 7 8 9
Aristoteles Politik, I 2. Ebd., 1253 a 27-30. Ebd., 1253 a 9-11. Ebd., 1253 a 14-18. Ebd., 1253 a 2 f. Vgl. z. B. Hansen 2019.
21
lektivistische Gegenreaktion: Die Gemeinschaft ist für den einzelnen notwendig, weil er für die Reflexion auf das Gespräch mit anderen angewiesen ist; doch die ei‐ gentliche Reflexionsleistung wird immer von den einzelnen Personen erbracht.
1.2. Ökonomische Theorie Auf die knappe Skizze der Grundlagen der aristotelischen Staatstheorie in den ersten beiden Kapiteln der „Politik“ folgt zunächst die Behandlung der Ökonomie als der Lehre von der Familie und der Haushaltung (oikos). Die prominente Platzierung des Themas am Anfang der „Politik“ hat drei Gründe: •
•
•
Erstens folgt der Gedankengang in der „Politik“ der Genealogie der menschli‐ chen Gemeinschaften, die Aristoteles im zweiten Kapitel des ersten Buches schildert. Der oikos ist dieser Genealogie zufolge die Urform der menschlichen Gemeinschaft. Zweitens ist die Befreiung von der Sorge um die ökonomischen Grundlagen des guten Lebens – und damit die Gewährleistung der Muße als Freiheit zur geisti‐ gen Betätigung – die Voraussetzung für das gute Leben i. S. der Verwirklichung von Tugendhaftigkeit und Vernünftigkeit. Drittens ist die Kritik der Chrematistik, also des maßlosen Gewinnstrebens, von zentraler Bedeutung für die Verfassungsanalyse in den Büchern III bis V, weil sie die wesentliche Ursache für die Instabilität von Verfassungen darstellt.
Aristoteles unterteilt die oikonomía, die Lehre von der Hausverwaltung, in die Be‐ handlung des Besitzes und der Familienangehörigen (Herrschaft des Mannes über die Frau und Herrschaft der Eltern über die Kinder). Den weitaus größten Teil von Buch I nimmt die Lehre vom Besitz ein, die wiederum in die Lehre vom belebten Besitz (Sklaven) und vom unbelebten Besitz (dinglicher Reichtum) unterteilt ist. Zu letzterer zählt die Lehre vom Erwerb – jedoch nicht, wie Aristoteles betont, die ge‐ samte Lehre vom Erwerb, sondern nur die vom naturgemäßen Erwerb. Der naturge‐ mäße Erwerb zeichnet sich dadurch aus, dass er eine Mittelfunktion hat: „Denn kein Werkzeug irgendeiner Kunst ist nach Menge oder Größe unbegrenzt. Der Reichtum aber ist nichts anderes als eine Menge von Werkzeugen für die Haus- oder Staatsver‐ waltung.“10 Die vorherrschende Praxis seiner Zeit, so Aristoteles, sei es hingegen, ohne jede Grenze nach Erwerb zu streben11 – und diese Haltung zum Erwerb bezeichnet er als
10 Aristoteles Politik I 8, 1256 b 35-37. 11 Ebd. I 9, 1257 b 32-34.
22
widernatürliche Erwerbskunst, als chrematistiké.12 Wo liegt nun die Grenze zwi‐ schen natürlicher und widernatürlicher Erwerbskunst? Die Abgrenzung der beiden Formen des Erwerbs, die Gegenstand von „Politik“ I 9 ist, leitet Aristoteles mit der Unterscheidung von zwei Arten der Verwendung von Gütern ein, die auch bei Smith und Marx eine zentrale Rolle spielt: die Verwendung als Gebrauchs- und als Tauschobjekt. Die erste Verwendung sei dem Ding „eigen‐ tümlich“, die zweite hingegen nicht: Wenn jemand z. B. einen Schuh gegen Geld tauscht, so gebraucht er „den Schuh als Schuh, nur nicht nach dem ihm eigentümli‐ chen Gebrauch, da er ja nicht des Tausches wegen gemacht worden ist.“13 Die Un‐ terscheidung impliziert an dieser Stelle keine Wertung, sondern verdeutlicht ledig‐ lich eine Abhängigkeit: Ein Gut kann nur getauscht werden und einen Tauschwert haben, wenn ihm ein Gebrauchswert zukommt. Die Entwicklung des Tausches wird als ein Prozess in fünf Stufen dargestellt, bei dem die entscheidende Frage lautet, an welcher Stelle der Umschlag von der natürli‐ chen Erwerbskunst zur Chrematistik erfolgt. Zur Kennzeichnung der Stufen lässt sich auf die von Marx verwendete Notation zurückgreifen, bei der „W“ für „Ware“ und „G“ für „Geld“ steht:14 1. Kein Tausch: Am Anfang der Entwicklung der menschlichen Gemeinschaften „bedurfte es natürlich eines Tauschhandels nicht“,15 die benötigten Güter wurden unmittelbar aus der Natur gewonnen und innerhalb des Haushalts zugeteilt. 2. W–W’: Erst in größeren Gemeinschaften wurde der Tausch „zur Notwendig‐ keit“16, weil die Menschen bzw. Haushalte von den einen Gütern mehr, von den anderen weniger hatten, als sie brauchten.17 Dieser Naturaltausch dient nur der Deckung des Bedarfs und ist unproblematisch. 3. W–G–W’: Zur Erleichterung des Tausches entwickelte sich in der Folge durch Übereinkunft das Geld und damit auch der Gelderwerb. Das Geld diente zu‐ nächst der Erleichterung des Fernhandels18, weil der Naturaltausch einen zu ho‐ hen Transportaufwand verursacht hätte19. Auch dieser Tauschhandel ist nicht wi‐ dernatürlich, weil das Geld lediglich der Erleichterung des Tauschs dient.
12 Ebd. I 9, 1256 b 40 f. 13 Ebd. I 9, 1257 a 10-13. 14 Marx 1962, S. 120. Die Anwendung dieser Notation auf Aristoteles’ Analyse der Chrematistik findet sich bei Marx ebd., S. 179 und Marx 1961, S. 115. Anders als bei Meikle 1979; 1995 (Kapitel 3) soll hier mit der Marxschen Notation nicht auch dessen Interpretation der fünf Ent‐ wicklungsstufen des Tauschs übernommen werden. 15 Aristoteles Politik I 9, 1257 a 19 f. 16 Ebd. I 9, 1257 a 21-25. 17 Ebd., 1257 a 14-17. 18 Ebd. ,1257 a 32 f. 19 Ebd., 1257 a 34.
23
4. G–W–G’: Nach Einführung des Geldes kommt es zur Entstehung des Handels.20 Das Handelsgewerbe gehört nicht von Natur zur Kunst des Gelderwerbs;21 son‐ dern stellt eine neue Qualität dar. Der Gelderwerb wird hier zum Selbstzweck, weil der Handel auf den bloßen Gewinn zielt. 5. G–G’: Die letzte Stufe der Entwicklung ist die Entstehung des Kreditgewerbes.22 Im Verleih von Geld gegen Zinsen sieht Aristoteles die logische Weiterentwick‐ lung und Steigerung des unbegrenzten Strebens nach Gelderwerb. Deshalb wird der „Wucher“ von Aristoteles besonders scharf verurteilt.23 Im Übergang von der dritten zur vierten Stufe erfolgt der Umschlag von der natürli‐ chen zur widernatürlichen Erwerbskunst.24 Während auf der dritten Stufe der Handel der Verbesserung der Versorgung mit notwendigen Gütern dient, verselbständigt sich auf der vierten Stufe das Streben nach Gewinn. Nach Aristoteles ist somit die Inten‐ tion der entscheidende Maßstab bei der Beurteilung der Erwerbstätigkeit: Solange der Erwerb nicht maßlos ist, sondern dem Ziel dient, die Mittel für das gute Leben zu erwirtschaften, ist er naturgemäß; die widernatürliche Erwerbskunst (Chrematis‐ tik) beginnt dort, wo das richtige Ziel aus dem Auge verloren wird. Jedoch offenbart die kategorische Verurteilung des Handels und des Zinses, dass Aristoteles das teleologische Kriterium zur Unterscheidung von natürlichem und wi‐ dernatürlichem Erwerb selbst nicht konsequent angewandt hat. Offensichtlich geht es ihm in seiner Kritik der Chrematistik nicht allein darum, die ökonomische Ratio‐ nalität durch deren Ausrichtung auf das Ziel des guten Lebens zu mäßigen, sondern er scheint eine Abneigung gegen diese Rationalität als solche zu haben.25 Die Chrematistik lehnt Aristoteles aus ethischen und aus politischen Gründen ab. Im Bereich der Ethik liegt die Ursache der widernatürlichen Erwerbskunst im fal‐ schen Verständnis des guten Lebens.26 Wer maßlos nach Gelderwerb strebt, sieht das gute Leben entweder als das Leben der Lust an, für das er grenzenlos Konsumgüter braucht, oder er strebt nach einem Maximum an Sicherheit, indem er seine soziale Position durch Vermögensbildung abzusichern bestrebt ist. Diese Ziele lenken den Menschen von dem ab, was eigentlich das Ziel eines Menschen sein sollte, nämlich die Verwirklichung seiner spezifisch menschlichen Anlagen: der ethischen (sittli‐ chen) und der dianoetischen (Verstandes-) Tugenden.27 Aus der Argumentation von Aristoteles folgt, dass diejenigen, die das maßlose Erwerbsstreben praktizieren, die 20 21 22 23 24
Ebd., 1257 b 1 f. Ebd., 1257 a 17 f. Ebd. I 10, 1258 a 39-b8. Ebd., 1258 b 2 f. Zur Diskussion der Frage, an welcher Stelle in der Genealogie des Tauschs der Umschlag zur Chrematistik erfolgt, in der Literatur vgl. ausführlich Hansen 2008, S. 333-336. 25 Vgl. dazu ausführlicher: Hansen 2008, S. 336 f. 26 Aristoteles Politik I 9, 1257 b 40 – 1258 a 14. 27 Aristoteles Nikomachische Ethik, I 3.
24
ersten sind, die darunter leiden, weil sie das gute Leben verfehlen – der marxisti‐ schen Vorstellung, dass in einem Ausbeutungsverhältnis primär der Ausgebeutete das Opfer ist, würde Aristoteles auf der Grundlage seiner teleologischen Theorie der Ökonomie widersprechen. Im Bereich der Politik liegt die Bedeutung der Auseinandersetzung darin, dass die Chrematistik durch die mit ihr verbundene Ausbeutung die Spaltung der Gesell‐ schaft in Arme und Reiche fördert und damit zur Instabilität der Verfassung beiträgt; dieser Zusammenhang ist im folgenden Abschnitt näher zu betrachten.
1.3. Chrematistik als Ursache der Instabilität der Verfassungen Hinsichtlich der Staatsverfassungen unterscheidet Aristoteles bekanntlich drei gute und drei entartete Verfassungen, wobei die guten Verfassungen sich dadurch aus‐ zeichnen, dass die Regierenden ihre Regentschaft um des Gemeinwohls willen aus‐ üben, während die Regierenden in den schlechten Verfassungen nur ihren Eigennutz im Blick haben.28 Sein besonderes Augenmerk auf Seiten der schlechten Verfassun‐ gen gilt der Oligarchie und der Demokratie: In der Oligarchie herrschen die Reichen zum Schaden der Armen und versuchen, ihre Besitzstände abzusichern und zu er‐ weitern; in der Demokratie herrschen die Armen zum Schaden der Reichen, d. h. sie zielen auf die Umverteilung ihres Reichtums.29 Aus diesen Bestrebungen der Rei‐ chen und der Armen, in der Terminologie von Aristoteles: der Oligarchen und der Demokraten, resultiert die politische Instabilität einer Polis.30 Aristoteles präzisiert, dass es ursprünglich die Maßlosigkeit und die Habsucht der Oligarchen ist, die die Begehrlichkeiten der Armen zur Folge hat.31 Das aber bedeu‐ tet, dass die eigentliche Ursache politischer Instabilität das Streben nach schranken‐ loser Vermehrung von Reichtum, d. h. die Chrematistik, ist. Folglich muss die Chre‐ matistik nicht nur um des guten Lebens willen, sondern auch um der Stabilität der Polis willen überwunden werden. Diese Überwindung erfolgt in der Politie als der zweitbesten Verfassung durch eine Stärkung des Mittelstandes,32 in der besten Verfassung hingegen durch die Er‐ ziehung der Bürger.33 In den Ausführungen zur besten Verfassung in den Büchern VII und VIII wird deutlich, dass die Erziehung zur maßvollen Ökonomie durchaus
28 29 30 31
Aristoteles Politik, III 6-7. Ebd., III 8. Z. B. ebd., IV 12, 1297 a 7-12. Ausführlich dazu: Hansen 2008, S. 343-353. Z. B. Aristoteles Politik V 3, 1302 b 5-10. Der Begriff der Pleonexia, den Aristoteles an dieser Stelle verwendet, wird weiter verstanden als der der Chrematistik, weil er auch die Habgier in Bezug auf Macht und Ehre umfasst (ebd., 1302 b 10-14). 32 Ebd., IV 11. 33 Ebd., Bücher VII und VIII.
25
mit einer wohlhabenden Polis vereinbar ist, denn die Bildungseinrichtungen und die kulturellen Einrichtungen, die Aristoteles vorschweben, setzen durchaus einen öko‐ nomisch starken Staat voraus. Fasst man die Überlegungen von Aristoteles in moderner Begrifflichkeit zusam‐ men, so sieht er als das Hauptproblem für die politische Stabilität eines Staates den Klassenkampf zwischen den reichen Oligarchen und der Masse der Armen. Dieser Klassenkampf entsteht ursprünglich aus dem Streben der Reichen nach schrankenlo‐ ser Akkumulation. Der Schlüssel zur Überwindung des Klassenkampfes liegt jedoch nicht in einer revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft – die Aufhebung des Privateigentums würde aus der Sicht von Aristoteles zu schlimmeren Folgen führen als sie vom Privateigentum selbst hervorgerufen werden34 – sondern in der Förde‐ rung des Mittelstandes und in der Erziehung der Bürger zur Tugend und zum Maß‐ halten.
2. Smith: ökonomische und politische Theorie Adam Smith formulierte sein Konzept der Autonomie gesellschaftlicher Prozesse in kritischer Abgrenzung von der aristotelischen Teleologie und der mit ihr verbunde‐ nen Tugendlehre. Die „unsichtbare Hand“ regelt sowohl die wirtschaftlichen als auch die gesellschaftlichen und politischen Prozesse und führt langfristig zu einem umfassenden Interessenausgleich. Dieser Ausgleich wird nicht durch die Erziehung der Bürger herbeigeführt, sondern durch die freie Entfaltung ihrer natürlichen Anla‐ gen. Im folgenden Unterabschnitt soll zunächst gezeigt werden, wie Smith seine ökonomische und politische Theorie in bewusster Abgrenzung von Aristoteles for‐ muliert, bevor anschließend auf seine Ethik eingegangen wird.
2.1. Ökonomische Theorie Der Unterschied zwischen Smith und Aristoteles wird bereits in der Einleitung des WN deutlich. Mit der These, dass die „jährliche Arbeit eines Volkes […] die Quelle [ist], aus der es ursprünglich mit allen notwendigen und angenehmen Dingen des Lebens versorgt wird“35, formuliert Smith das zentrale Thema seines Werkes, näm‐ lich die Frage nach den Mechanismen der Vermehrung des Reichtums. Die Frage nach der Grenze des naturgemäßen Reichtums spielt hier keine Rolle mehr; ein sol‐ cher ethischer Zugang zur Ökonomie, der (anknüpfend an Aristoteles) die politische Philosophie der Scholastik und auch noch der frühen Neuzeit prägte, wird im WN 34 Vgl. ebd., II 5. 35 Smith WN, S. 3.
26
nicht einmal mehr erwähnt, obwohl Smith sich – wie im nächsten Unterabschnitt noch zu zeigen sein wird – durchaus kritisch gegenüber dem schrankenlosen Streben nach Reichtum zeigt. Das hängt auch damit zusammen, dass Smith die Skepsis von Aristoteles in Be‐ zug auf die Gefährdung der Stabilität der Polis durch die Chrematistik nicht teilt. Im Gegenteil: Das grenzenlose Erwerbsstreben, das Aristoteles als Habgier kritisiert, fördert den Volkswohlstand, und davon profitieren auch die Armen. In einem rei‐ chen Staat mit hoher Arbeitsproduktivität kann ein „Arbeiter der untersten und ärmsten Schicht, sofern er genügsam und fleißig ist, […] sich mehr zum Leben not‐ wendige und angenehme Dinge leisten, als es irgendeinem Angehörigen eines primi‐ tiven Volkes möglich ist.“36 Wachstumspolitik ist also nach Smith auch eine Maß‐ nahme zur Förderung der Stabilität des Staates. Die Bezugnahme von Adam Smith auf Aristoteles zeigt sich deutlich in den ers‐ ten sechs Kapiteln des WN, in denen er die Begriffe der ökonomischen Theorie von Aristoteles übernimmt und im Sinne seiner eigenen ökonomischen Theorie umdeu‐ tet: (1) Anthropologie: Aristoteles bezeichnet den Menschen als politisches Wesen, das sich gegenüber dem Tier durch Sprache und Vernunft (lógos) auszeichnet. Smith übernimmt diese Definition des Menschen, doch aus seiner Sicht ist das Besondere, was daraus folgt, nicht die Fähigkeit des Menschen zur Gründung von Staaten, son‐ dern seine Neigung zum Tausch. Die Arbeitsteilung entsteht aus der „natürlichen Neigung des Menschen, zu handeln und Dinge gegeneinander auszutauschen.“37 Seiner Mutmaßung nach ist diese natürliche Neigung nicht angeboren, sondern „not‐ wendige Folge der menschlichen Fähigkeit, denken und sprechen zu können“.38 Den Zusammenhang zwischen der Fähigkeit zu sprechen und zu denken einerseits und der Neigung zum Tausch andererseits erklärt Smith mit dem Verweis auf die Tier‐ welt: Beide Eigenschaften gibt es in der Tierwelt nicht. Ein junger Hund kann seine Mutter oder seinen Herrn umschmeicheln, Hunde werden aber nie in der Lage sein, ihr Wohlergehen durch Tauschgeschäfte zu verbessern. Der Mensch hingegen kann zwar seine Ziele auch mit Schmeicheleien erreichen; effizienter ist jedoch der Tausch. In Buch III, Kapitel 4 des WN verdeutlicht Smith, dass aus diesem Grund die feudale Gesellschaft der liberalen Marktgesellschaft unterlegen ist: Im Feudalis‐ mus spielt die Schmeichelei eine zentrale Rolle bei der Koordination der individuel‐ len Entscheidungen, während die liberale Marktgesellschaft das Prinzip des Tauschs entwickelt.
36 Ebd. 37 Smith WN I.ii.2, S. 16. 38 Ebd. Smith ist mit seiner Einschätzung vorsichtig und schreibt lediglich, dass letzteres „wahr‐ scheinlicher“ sei.
27
(2) Gleichheit der Menschen: Aristoteles geht davon aus, dass es eine natürliche, angeborene Ungleichheit unter den Menschen gibt. Von Natur aus Herrschender ist, wer „dank seinem Verstande vorzusehen vermag“; wer „dagegen mit den Kräften seines Leibes das so Vorgesehene auszuführen imstande ist“, ist von Natur ein Be‐ herrschter.39 Die Arbeitsteilung folgt für Aristoteles aus der Unterschiedlichkeit der Begabungen. Für Smith hingegen ist die Arbeitsteilung nicht Folge, sondern eher Ursache der Unterschiede zwischen den Menschen: „Der Unterschied in den Bega‐ bungen der einzelnen Menschen ist in Wirklichkeit weit geringer, als uns bewußt ist, und die verschiedenen Talente, welche erwachsene Menschen unterschiedlicher Be‐ rufe auszuzeichnen scheinen, sind meist mehr Folge als Ursache der Arbeitsteilung. So scheint zum Beispiel die Verschiedenheit zwischen zwei auffallend unähnlichen Berufen, einem Philosophen und einem gewöhnlichen Lastenträger, weniger aus Veranlagung als aus Lebensweise, Gewohnheit und Erziehung entstanden.“40 (3) Die ideale Gesellschaft: Nach Aristoteles ist die ideale Polis eine, in der die Bürger von der Sorge um die Ökonomie befreit sind, so dass sie sich uneinge‐ schränkt der Verwirklichung der Tugenden (v. a. der praktischen) zuwenden können. Das Idealbild, das Smith demgegenüber zeichnet, ist das einer Gesellschaft, in der jeder Bürger ein Kaufmann geworden ist: „Hat sich die Arbeitsteilung einmal weit‐ hin durchgesetzt, (…) [s]o lebt eigentlich jeder vom Tausch, oder er wird in gewis‐ sem Sinne ein Kaufmann, und das Gemeinwesen entwickelt sich letztlich zu einer kommerziellen Gesellschaft.“41 Wenn der Mensch das Wesen ist, das dank Vernunft und Sprache die Neigung zum Tausch hat, dann ist die „kommerzielle Gesellschaft“, also eine Gesellschaft von Kaufleuten, der gesellschaftliche Idealzustand. (4) Unterscheidung von Gebrauchs- und Tauschwert: Besonders deutlich bezieht Smith sich an der Stelle auf die „Politik“ von Aristoteles, an der er dessen Unter‐ scheidung von Tausch- und Gebrauchswert („value in use“ und „value in exchange“) übernimmt.42 Für Aristoteles ist der Gebrauchswert maßgebend, weil auf ihm der wahre Reichtum beruht: Erst durch die Verwendung von Gütern für das gute Leben werden sie zu Reichtum. Die Unterscheidung von Tausch- und Gebrauchswert nimmt Aristoteles vor, um zu analysieren, an welchem Punkt der Tauschwert sich soweit verselbständigt hat, dass das Ziel des Wirtschaftens nicht mehr der richtige Gebrauch ist. Smith verfolgt mit der Unterscheidung hingegen ein ganz anderes In‐ teresse: Ihn interessieren die Mechanismen, wie der Tauschwert zustande kommt, und wie er auf den Märkten zu einem Ausgleich der Interessen führt. Die Analyse, wie sich der Tauschwert, d. h. der Preis, auf den Märkten bildet, ist Gegenstand der 39 40 41 42
28
Aristoteles Politik I 2, 1252a31-34. Smith WN I.ii.4, S. 18. Ebd. I.iv. 1, S. 22 f. Ebd. I.iv. 13, S. 27; vgl. Aristoteles Politik I 9, 1257a5-15. Marx bezieht sich explizit auf die aristotelische Unterscheidung von Gebrauchs- und Tauschwert, z. B. Marx 1962, S. 100; vgl. dazu Hansen 2014, S. 240-242.
Politischen Ökonomie; sie ist völlig getrennt von der Analyse des Gebrauchswerts, die Smith in seiner Ethik vornimmt und in der er sich insbesondere mit der Neigung von Menschen auseinandersetzt, scheinbar nützliche, doch in Wahrheit unnütze Din‐ ge besitzen zu wollen.43 (5) Ausgleich durch Tugend oder durch den Marktmechanismus: Wie im ersten Abschnitt gezeigt wurde, entwickelt Aristoteles aufbauend auf der Unterscheidung von Gebrauchs- und Tauschwert seine Kritik der Chrematistik. Sie gefährdet die Sta‐ bilität der staatlichen Gemeinschaft, weil sie die Spaltung in Arme und Reiche ver‐ stärkt. Einen Ausgleich kann es nur geben, wenn die Bürger maßvoll nach Reichtum streben. Smith hingegen nimmt die Unterscheidung von Gebrauchs- und Tauschwert als Ausgangspunkt einer detaillierten Analyse, wie der Tauschwert (d. h. der Markt‐ preis) das Ergebnis eines Interessenausgleichs zwischen Angebot und Nachfrage ist und wie der Wettbewerb dazu führt, dass sich der gesellschaftlich optimale, wohl‐ fahrtsmaximierende Marktpreis bildet. Smith will damit – gegen ethische Betrach‐ tungen der Ökonomie wie in der „Politik“ von Aristoteles – zeigen, dass die Markt‐ akteure ihr Eigennutzstreben und Streben nach Reichtum nicht beschränken müssen, sondern es sich im Gegenteil frei von staatlicher Beschränkung entfalten soll, damit es zu einem umfassenden Ausgleich der ökonomischen Interessen kommt. Nicht die Maßlosigkeit der Bürger verhindert den Ausgleich, sondern vor allem der Eingriff des Staates in den freien Wettbewerb, wenn er Kartell- und Monopolstrukturen be‐ günstigt.44
2.2. Politische Theorie Smith vermittelt dem Leser zwar immer wieder seinen Optimismus, dass die Ver‐ wirklichung des natürlichen Systems der Freiheit zu einem allgemeinen gesellschaft‐ lichen Ausgleich führt, doch er befürchtet zugleich, dass die mit der Marktgesell‐ schaft verbundene Ungleichheit zu Herrschaftsstrukturen führt, die missbraucht wer‐ den können. Wie sind der Optimismus einerseits und die Sorge vor dem Missbrauch von Herrschaft andererseits im Werk von Smith vereinbar? Die Antwort lautet: in‐ dem im System des freien Wettbewerbs die persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse, die den Feudalismus auszeichnen, aufgelöst werden in gegenseitige und unpersönli‐ che Abhängigkeitsverhältnisse. Die Aufhebung der persönlichen Abhängigkeitsver‐ hältnisse des Feudalismus erfolgt im Laufe der Geschichte durch einen Automatis‐ mus, den Smith im dritten Buch des WN beschreibt, in dem er zeigt, wie der Nieder‐ gang des Feudalwesens erfolgt.45 43 Vgl. Smith Theorie der ethischen Gefühle (TEG) IV.1., S. 307-320. 44 Smith WN I.vii.26-29, S. 54. 45 Ebd. III.iv., S. 334-344.
29
Die Herrschaft der Grundeigentümer im Feudalismus beruht nach Smith auf der persönlichen Abhängigkeit der Pächter, der Leibeigenen und des Gesindes von den Grundeigentümern. Im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs der Städte werden die Grundeigentümer von dem neuen Luxus, den sie dort erwerben können, verführt und reduzieren, um ihn sich leisten zu können, die Zahl der von ihnen Abhängigen: „Sie verschacherten zusehends ihre ganze Macht und Autorität gegen die kindischs‐ ten, minderwertigsten und schmutzigsten Nichtigkeiten.“46 In der Folge sinkt die Zahl derer, die in einem persönlichen Abhängigkeitsverhältnis stehen, während die Zahl derer, die als freie Arbeiter, Handwerker oder Händler tätig sind, zunimmt. „Obwohl Handwerker und Arbeiter von allen Reichen leben, bleiben sie doch vom einzelnen mehr oder weniger unabhängig, da sie durchweg auch ohne ihn ihren Le‐ bensunterhalt verdienen können.“47 Auf diese Weise bildet sich schrittweise eine freie Gesellschaft heraus, in der die Reichen, ohne es zu intendieren, durch den Er‐ werb von Luxusgütern „für den Lebensunterhalt vieler Menschen“ sorgen.48 Dies löst eine „Revolution von größter Bedeutung für die Wohlfahrt aller“ aus.49 Um zu vermeiden, dass im Zuge dieser Revolution die freie Marktwirtschaft durch den Monopolgeist der Kaufleute und Fabrikanten eingeschränkt wird und da‐ durch ähnliche Abhängigkeitsverhältnisse entstehen wie im Feudalismus, bedarf es der Aufklärung über die schädlichen Wirkungen des Merkantilismus, der Ausdruck dieses Monopolgeistes ist. Der logische Ausgangspunkt von Smith’ Plädoyer für den Wettbewerb ist also die Kritik des Missbrauchs unkontrollierter Herrschaft; die Kon‐ trolle der Herrschaft soll durch den Wettbewerb erfolgen.
3. Smith: Ethik Die Konzentration der Rezeption von Smith auf den WN führt zu einem einseitigen Bild.50 Smith wird tendenziell als ein Autor wahrgenommen, der in prägnanter Wei‐ se dafür plädiert, dass die Menschen ihrem Eigennutzstreben freien Lauf lassen kön‐ nen und gerade dies zu gesellschaftlicher Harmonie führt. Damit wird aber nur eine Seite der politischen Philosophie von Smith wahrgenommen. Seine These lautet, dass die natürlichen Anlagen des Menschen in einem System der umfassenden Frei‐ heit zur Herausbildung einer harmonischen Ordnung führen; doch dabei sind zwei Anlagen von entscheidender Bedeutung: neben dem Eigennutzstreben der Menschen auch die natürliche Moral. Der WN baut auf der „Theorie der ethischen Gefühle“
46 47 48 49 50
30
Ebd. III.iv. 10, S. 338. Ebd. III.iv. 11, S. 338 f. Ebd. III.iv. 16, S. 340. Ebd. III.iv. 17, S. 340. Vgl. dazu z. B. Meyer-Faje/Ulrich 1991.
(im folgenden: TEG51) auf, in der gezeigt wird, wie sich aus dem natürlichen Gefühl der Sympathie sowohl die Moral als auch die Rechts- und Gesellschaftsordnung ent‐ wickeln. Die Moral und der Respekt der Bürger gegenüber dem Recht werden im WN implizit vorausgesetzt, jedoch ohne erwähnt zu werden, so dass der einseitige Blick der Rezeption auf das Werk von Smith auch eine Folge seiner eigenen schar‐ fen Trennung von Ökonomie und Ethik ist. Zudem geht Smith an keiner Stelle auf mögliche Konflikte zwischen dem Eigennutzstreben und der Sympathie ein. Smith folgt in seiner Ethik der schottischen Moralphilosophie, wenn er annimmt, dass die Moral weder in der Vernunft gründet (wie dies wenig später Kant formu‐ liert) noch in einem Nutzenkalkül (wie dies verschiedene Varianten des Utilitarismus unterstellen), sondern in der natürlichen Fähigkeit des Menschen, sich in andere hin‐ einzuversetzen und an ihren Gefühlen Anteil zu nehmen. Zu Beginn der TEG ent‐ wickelt Smith das grundlegende Modell, wie die natürliche Sympathie zu gesell‐ schaftlicher Harmonie führt (Abb. 1); dieses Grundmodell wird im folgenden in der TEG auf verschiedene Bereiche der Gesellschaft angewandt. Ausgangspunkt für die Entwicklung des Modells ist die Überlegung, dass ein Mensch, dem etwas positives oder negatives widerfährt, darauf mit einem Affekt re‐ agiert. Maßstab für die moralische Beurteilung dessen, was dem Betroffenen wider‐ fahren ist, ist nicht sein eigenes persönliches Gefühl, sondern die Sympathie eines unparteiischen Zuschauers, der mit dem Betroffenen mitfühlt. Beide Gefühle, der Affekt des Betroffenen und die Sympathie des unparteiischen Zuschauers, regulieren sich gegenseitig: Der unparteiische Zuschauer empfindet mit dem Betroffenen mit und bewertet zugleich dessen Affekt. Wurde der Betroffene z. B. durch einen Dritten mutwillig geschädigt, so empfindet der unparteiische Zuschauer einerseits Mitgefühl mit dem Betroffenen, andererseits beurteilt er das Vergeltungsbedürfnis des Betrof‐ fenen nach dem Maß seines Mitgefühls als angemessen oder überzogen. Der Betrof‐ fene antizipiert die Beurteilung durch den unparteiischen Zuschauer und mäßigt ent‐ sprechend sein Vergeltungsgefühl; der unparteiische Zuschauer hingegen antizipiert die Beurteilung der Angemessenheit seiner Sympathiebekundung durch den Betrof‐ fenen und wird diese entsprechend steigern. Im Ergebnis kommt es dadurch zu einer harmonischen Übereinstimmung von Affekt und Mitgefühl: „Um diese Harmonie zustande zu bringen, hat die Natur die Zuschauer gelehrt, sich in Gedanken in die Lage des zunächst Betroffenen zu versetzen, und ebenso hat sie diesen letzteren ge‐ lehrt, sich wenigstens bis zu einem gewissen Grade in jene der Zuschauer hineinzu‐ denken.“52
51 Die „Theorie der ethischen Gefühle“ wird im folgenden nach der deutschen Übersetzung von Walther Eckstein zitiert; zusätzlich werden der Teil der TEG, der Abschnitt, das Kapitel und der Absatz nach der „Glasgow Edition of the Works and Correspondance of Adam Smith“ (Bd. 1) angegeben. 52 Ebd. I.i.4.8, S. 25.
31
Abb. 1: Das Grundmodell der Sympathie53 Betroffener:
Zuschauer:
Affekt
Mitgefühl (Sympathie), Beurteilung des Affekts (Differenz von Mitgefühl und Affekt)
Beurteilung des Mitgefühls und Antizipation der Beurteilung des Affekts
Antizipation der Beurteilung des Mitgefühls
Selbstbeherrschung (Affekt wird gemildert)
Feinfühligkeit (Mitgefühl wird gesteigert) Harmonie der Gesellschaft
Die Übereinstimmung von Affekt und Mitgefühl ist nach Smith die Grundlage eines jeden moralischen Urteils. Quelle der moralischen Urteile ist somit das Gefühl der Sympathie, doch es bedarf der Vervollkommnung dieses Gefühls durch die Entwick‐ lung der Feinfühligkeit, die aus der erwähnten Antizipation der Beurteilung des un‐ parteiischen Beobachters durch den Betroffenen resultiert. Die Fähigkeit des Menschen, sich in andere hineinzuversetzen, und sein Wunsch, dass andere sich in ihn hineinversetzen mögen, ist nun nicht nur die Grundlage der Moral, sondern der gesellschaftlichen Ordnung überhaupt. Smith führt die gesamte soziale, rechtliche und wirtschaftliche Ordnung auf diese Anlage des Menschen zu‐ rück und zeigt, wie ihre freie Entfaltung zu Ordnung und Harmonie führt. Das wird in der TEG neben der Moral für drei weitere Bereiche dargelegt (vgl. Abb. 2): (1) Entstehung sozialer Ordnung: Den Ausgangspunkt zur Erklärung der Entste‐ hung sozialer Ordnung bildet folgende Feststellung von Smith: „Weil die Menschen geneigt sind, aufrichtiger mit unserer Freude zu sympathisieren als mit unserem Leid, pflegen wir gewöhnlich mit unserem Reichtum zu prunken und unsere Armut zu verbergen.“54 Es gibt im Menschen einerseits ein natürliches Streben nach sozia‐ ler Anerkennung und andererseits eine natürliche Anteilnahme an der Freude ande‐ rer. Bezogen auf gesellschaftliche Schichten bedeutet dies, dass die oberen Schich‐ ten danach streben, Anerkennung von den anderen zu bekommen, während die unte‐ ren Schichten dazu neigen, intensiv am Schicksal der Reichen und Herrschenden Anteil zu nehmen. Letztere sympathisieren mit den Reichen und Erfolgreichen; ers‐ tere streben nach dieser Sympathie und Anteilnahme. Das Streben der oberen Schichten zielt somit nicht auf eine Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse, sondern darauf, dass „man uns bemerkt, dass man auf uns Acht hat, dass man mit Sympathie, Wohlgefallen und Billigung von uns Kenntnis nimmt“.55
53 Eigene Darstellung (aufbauend auf Smith TEG I.1.1-5, S. 1-32). 54 Ebd. I.iii.2.1, S. 70. 55 Ebd., S. 71.
32
33
Individuelle Ebene
Gesamtgesellschaftliche Ebene
Investition
Freude am Besitz
Reicher:
Wachstum des allgemeinen Wohlstands
Lohneinkommen dank der Investition
Bewunderung der Schönheit und Anteilnahme an der Freude am Besitz
Armer:
Harmonie der Gesellschaft (formale Ebene)
Mitgefühl, Beurteilung des Vergeltungsgefühls
Vergeltungsgefühl Mäßigung
Streben nach Konsum; N beurteilen das Angebot
Nachfrager (N):
Harmonie der Gesellschaft (materielle Ebene)
Streben nach Gewinn; A wollen „Zustimmung“ der N
Anbieter (A):
Mechanismus: Preisbildung bei freiem Wettbewerb
Mechanismus: Zuschauer:
Maßstab für den Ausgleich: Marktpreis entspricht dem natürlichen Preis (vgl. WN I.6)
Maßstab für den Ausgleich: Prüfung, ob ein unparteiischer Zuschauer den Maximen unseres Verhaltens zustimmen kann
Geschädigter:
Ziel: ökonomischer Ausgleich individueller Interessen (WN I.1-7)
Ziel: Gerechtigkeit, Ausgleich der Rechtsansprüche (S. 115-136)
List der Natur: der Reiche strebt nur nach seinem Vorteil, der aber nur ein List der Natur: allen geht es nur um das Schicksal der Herrschenden, doch deren scheinbarer Vorteil ist (S. 317); in Wahrheit erliegt er einer Täuschung und Nutzen ist ein scheinbarer; der wirkliche Vorteil ist die Ordnung der Gesellschaft sein Streben dient dem allgemeinen Wohlstand.
Ordnung der Gesellschaft
Unterwürfigkeit (S. 75)
Anteilnahme am Schicksal der Herrschenden, Neid (S. 72f.)
Streben nach Anerkennung
Adel: feine Sitten; Aufsteiger: Tugend, Machtkalkül (S. 78f.)
Beherrschte („Zuschauer“):
Mechanismus: Freude am Besitz (am möglichen Nutzen der Dinge; S. 308)
Mechanismus: Streben nach Anerkennung („vanity“)
Herrschende („Betroffene“):
Ziel: allgemeiner Wohlstand der Gesellschaft (S. 315-317)
Ökonomie
Ziel: Ordnung der Gesellschaft (S. 70-86)
Politik
Abb. 2: Gesellschaftliche Ordnung, Wohlstand und Harmonie als Folge von Sympathie und Eigennutzstreben (Seitenzahlen beziehen sich auf Smith, TEG)
Der „Endzweck von Habsucht und Ehrgeiz“, der „Jagd nach Reichtum, Macht und Vorrang“56 ist somit nicht das Streben nach Bedürfnisbefriedigung, sondern: „Es ist die Eitelkeit, nicht das Wohlbefinden oder das Vergnügen, was uns daran anzieht. Eitelkeit aber beruht immer auf der Überzeugung, dass wir der Gegenstand der Auf‐ merksamkeit und Billigung sind.“57 Aus der Eitelkeit entsteht in den oberen Schich‐ ten eine Konkurrenz um Aufmerksamkeit, während die unteren Schichten am Schicksal der oberen Schichten Anteil nehmen.58 Die Konkurrenz fördert beim eta‐ blierten Adel die feinen Sitten und bei den Aufsteigern die Tugendhaftigkeit und den Selbstdurchsetzungswillen;59 die Anteilnahme am Schicksal der oberen Schichten fördert hingegen die Unterwürfigkeit der Armen.60 Daraus resultiert im Ergebnis die Ordnung der Gesellschaft: „Auf dieser Neigung der Menschen, für alle Affekte der Reichen und Mächtigen Teilnahme zu hegen, beruht (…) die Unterscheidung der Stände und die Ordnung der Gesellschaft.“61 (2) Entwicklung von Rechtsnormen: Auf der Grundlage der moralischen Normen, die aus dem Gefühl der Sympathie entstehen, bilden sich auch die Rechtsnormen. Die wesentliche Aufgabe des Rechts ist die Vergeltung des Schadens eines Geschä‐ digten.62 Das Recht setzt Maßstäbe für die Bestimmung, wann eine Schädigung vor‐ liegt und welche Vergeltung angemessen ist. Diese Maßstäbe kommen aus der Beur‐ teilung des Vergeltungsgefühls eines Geschädigten durch einen unparteiischen Zu‐ schauer. (3) Förderung des Wohlstands durch Freude am Besitz: Nicht nur die Reichen ha‐ ben aus der Sicht von Smith eine natürliche Freude am Besitz, sondern auch die Ar‐ men. Nach Besitz strebt der Mensch nicht, weil die Gegenstände, die einer besitzt, tatsächlich nützlich sind, sondern weil die Nützlichkeit eines Gegenstandes die Men‐ schen „beständig an das Vergnügen und die Bequemlichkeit erinnert, die der Gegen‐ stand zu fördern geeignet ist“.63 Dieses Vergnügen ist von weit größerer Bedeutung als der konkrete Zweck, dem ein Gegenstand dienen kann. Mit dem Streben nach Reichtum und Luxus jagt der Mensch „dem Bild einer gewissen künstlichen und vornehmen Ruhe hinterher, die er vielleicht niemals erreichen wird“ und der er das wahre Glück, nämlich die „wirkliche Seelenruhe opfert, die zu erwerben jederzeit in seiner Macht steht“.64 Dass der Reiche nach Reichtum strebt und der Arme ihn für seinen Reichtum bewundert, beruht somit auf einer „Täuschung“65, denn der ganze 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
34
Ebd. Ebd. Ebd. I.iii.2.1, S. 72 f. Ebd. I.iii.2.5, S. 79. Ebd. I.iii.2.3, S. 75. Ebd. Ebd. II.ii.1.10, S. 121. Ebd. IV.1.2, S. 308. Ebd. IV.1.8, S. 311. Ebd. IV.1.10, S. 315.
Reichtum und Luxus ist in Wahrheit ziemlich nutzloser Tand. Doch diese Täuschung ist eine List der Natur, die Smith am Beispiel eines reichen und gefühllosen Grund‐ besitzers erläutert: Dieser Mann lässt seinen Blick über seine Felder schweifen, ohne dabei an den Hunger der Armen zu denken. Doch sein Auge kann mehr fassen als der Magen, und so kommt der Großteil des Weizens, den er anbaut, anderen zugute, die ihr Einkommen wiederum direkt oder indirekt von ihm beziehen, denn er ist für das Bestellen der Felder auf die Unterstützung vieler Arbeiter angewiesen.66 Smith folgert: „Von einer unsichtbaren Hand werden sie [die Beteiligten] dahin geführt, beinahe die gleiche Verteilung der zum Leben notwendigen Güter zu verwirklichen, die zustandegekommen wäre, wenn die Erde zu gleichen Teilen unter alle ihre Be‐ wohner verteilt worden wäre.“67 Kurzum: das Streben nach Reichtum nutzt dem Reichen nur scheinbar, in Wahrheit nutzt es der Harmonie der Gesellschaft. Das ent‐ scheidende Zitat von der „unsichtbaren Hand“, die den allgemeinen Wohlstand der Gesellschaft fördert, findet sich an dieser Stelle in der TEG – und zwar in Verbin‐ dung mit einer Bewertung des Strebens nach Reichtum, die man von dem Autor des „Wohlstands der Nationen“ nicht vermuten würde. Wie der allgemeine Wohlstand durch das individuelle Streben nach Reichtum gefördert wird, zeigt Smith dann aus‐ führlich im WN. (4) Ökonomischer Ausgleich individueller Interessen: Der ökonomische Interes‐ senausgleich auf Märkten ergänzt logisch die drei anderen Ebenen des Ausgleichs und der Herstellung von Harmonie. So wie Smith auf der politischen Ebene zeigt, dass die natürlichen Anlagen des Menschen quasi automatisch gesamtgesellschaft‐ lich zu einer stabilen Ordnung und beim Ausgleich individueller Rechtsansprüche zu einem gerechten Ausgleich führen, so zeigt er auch auf der ökonomischen Ebene, dass es gesamtgesellschaftlich in einer freien Gesellschaft eine Tendenz zur Steige‐ rung des wirtschaftlichen Wohlstands gibt und dass auf den Märkten der Wettbewerb einen Ausgleich der ökonomischen Interessen bewirkt. Letzteres ist aber, wie oben bereits gezeigt wurde, nicht Thema der Ethik, sondern des WN. Der Überblick über die Argumentation von Smith in der TEG zeigt, dass er nicht nur auf der ökonomischen Ebene die Gegenthese zu Aristoteles vertritt, sondern auch im Bereich der Ethik. Der Unterschied zu Aristoteles besteht aber nicht in einem einseitigen Lob des Eigennutzstrebens (das im Gegensatz zu Aristotelesʼ Kri‐ tik der Chrematistik stände), sondern in der These, dass die Summe der natürlichen Bestrebungen der Menschen automatisch zu einem gesellschaftlichen Ausgleich, zur harmonischen Ordnung des Ganzen führen. Diese Ordnung wird nicht durch einen Plan geschaffen, sondern sie entsteht, wie als wenn eine unsichtbare Hand die Hand‐ lungen der Individuen auf das Gemeinwohl ausrichten würde.
66 Ebd. IV.1.10, S. 316. 67 Ebd.
35
Aristoteles sah das Hauptproblem für die politische Stabilität eines Staates im Klassenkampf zwischen den Reichen (den Oligarchen) und den Armen (den Demo‐ kraten). Der Klassenkampf entsteht aus seiner Sicht aus dem maßlosen Streben der Oligarchen nach schrankenloser Akkumulation und nach politischer Macht zur Ab‐ sicherung der Akkumulationsbedingungen. Dieses Problem lässt sich nur überwin‐ den, wenn die Bürger zur Tugend und zum Maßhalten erzogen werden. Smith hinge‐ gen geht einen anderen Weg, jenseits von Aristotelischer Tugendethik und Marx‐ scher Revolutionstheorie: er geht davon aus, dass die Missstände auf einen Mangel an gesellschaftlicher Freiheit zurückzuführen sind und die freie Entfaltung der Anla‐ gen der Menschen ihre Überwindung ermöglichen wird.
4. Die Ambivalenz des Verhältnisses: Aristoteles als Vordenker von Smith In der ideengeschichtlichen Literatur wird verschiedentlich darauf hingewiesen, dass Smith nicht nur eine Gegenthese zu Aristoteles formuliert hat, sondern in gewisser Weise an seinen theoretischen Ansätzen anknüpft und sie fortführt.68 Denn auch wenn Aristoteles der Ökonomie gegenüber eine sehr kritische Haltung hatte, die sich u. a. an seiner fast schon irrational apodiktischen Kritik des Handels zeigt,69 wendet er an anderen Stellen eine durchaus ökonomische Argumentation an. Das sei an zwei Beispielen erläutert, die Adam Smith als Anknüpfungspunkt dienen konnten (auch wenn er sich nicht explizit auf sie bezieht): •
Gerechtigkeitsverständnis: In der Darlegung der teleologischen Staatslehre zu Beginn der „Politik“ stellt Aristoteles – wie oben in Abschnitt 1.1. erläutert – das gute Leben als Ziel der politischen Gemeinschaft dar. Zur Verwirklichung des guten Lebens gehört das Bemühen der Bürger um die Tugend der Gerechtigkeit; die Ökonomie soll diesem Bemühen dienen. In Buch V der „Nikomachischen Ethik“ zeigt sich jedoch, dass Aristoteles die Gerechtigkeit selbst durchaus öko‐ nomisch versteht: als ein Verhältnis der Reziprozität. Bekanntlich unterscheidet er zwei Arten der Gerechtigkeit: Bei der distributiven Gerechtigkeit (Verteilungs‐ gerechtigkeit) geht es um die Frage, wem auf der gesellschaftlichen Ebene in Abhängigkeit von seinem sozialen Status was zusteht; bei der kommutativen Ge‐ rechtigkeit (ausgleichenden Gerechtigkeit) geht es darum, unter welchen Bedin‐ gungen ein Tausch als gerecht bezeichnet werden kann. Während in der teleolo‐ gischen Staatslehre der Eindruck einer scharfen Trennung zwischen der Ökono‐ mie einerseits und dem tugendhaften Leben andererseits entsteht, zeigt sich in der Ethik, dass zumindest die Gerechtigkeit durchaus ökonomisch verstanden
68 Vgl. z. B. Wicksteed 1933, S. 776, 779; Priddat/Seifert 1987. 69 Aristoteles Politik I 9, 1257b1-4.
36
•
wird. Da ist es nur konsequent, wenn einzelne Ökonomen in der aristotelischen Lehre von der Gerechtigkeit einen Vorläufer der Rational Choice Theorie se‐ hen.70 Rechtfertigung des Privateigentums: Aristoteles formuliert im zweiten Buch der „Politik“ eine Reihe von Argumenten zur Verteidigung des Privateigentums. Das ökonomische Argument, dass es ohne Privateigentum keinen Anreiz zum effizi‐ enten Wirtschaften gibt, ist mit seiner Lehre von der Ökonomie durchaus verein‐ bar.71 Doch schon das ethische Argument, demzufolge das Privateigentum eine wesentliche Voraussetzung für ein tugendhaftes Leben ist, weil man ansonsten die Tugend der Freigebigkeit nicht verwirklichen könne,72 verwundert – wenn das stimmt, konnten „maßgebende Menschen“73 wie Sokrates und Jesus, die nach eigenem Bekunden in relativer Mittellosigkeit lebten, nicht in vollem Um‐ fang tugendhaft sein. Gänzlich unvereinbar mit der Deutung der Ökonomie als Lehre vom Erwerb der „Werkzeuge“ (organon) für das gute Leben74 ist das drit‐ te, eudämonistische Argument für das Privateigentum, das Aristoteles in die Worte fasst: „Es ist auch mit Worten nicht zu sagen, welche eigenartige Befriedi‐ gung es gewährt, wenn man etwas sein eigen nennen kann.“75 Wenn der Besitz tatsächlich nur ein Werkzeug ist, bezieht sich die Freude auf die Erreichung des Ziels, für das man das Werkzeug verwendet, und nicht auf den Besitz.
Die zwei Beispiele verdeutlichen, dass Smith nicht nur einzelne Begriffe der ökono‐ mischen Theorie von Aristoteles übernehmen und umdeuten kann, sondern dass sein optimistischer Blick auf das Privateigentum und den Wettbewerb an Aristotelesʼ Lob des Privateigentums und an seinem Verständnis der Gerechtigkeit als Tausch anknüpfen kann. Die Verselbständigung der Ökonomie und die Betonung des Eigen‐ werts der Ökonomie sind bei Aristoteles bereits angelegt und zeigen die Ambivalenz seiner ökonomischen Theorie.
5. Fazit: Teleologie versus Autonomie gesellschaftlicher Prozesse Die Geistesgeschichte ist gekennzeichnet von Paradigmen des ökonomischen und politischen Denkens, die zwar in einer bestimmten Zeit formuliert werden und von dieser Zeit geprägt sind, aber zugleich eine grundsätzliche Aussage über das Verhält‐ 70 71 72 73 74 75
Vgl. Priddat/Seifert 1987. Aristoteles Politik II 5, 1263 a 26-30. Ebd., 1263 b 11. Jaspers 1997. Ebd. I 8, 1256 b 35. Ebd. II 5, 1263 a 40 f.; zu dieser Äußerung passt auch die Bemerkung von Aristoteles, dass Pla‐ ton in der „Politeia“ den Wächtern mit dem Privateigentum das „Lebensglück“ entziehe (ebd., 1264 b 16).
37
nis von Politik und Ökonomie enthalten, die überzeitlich relevant ist. Aristoteles und Smith stehen für zwei solche Paradigmen; Marx vertritt ein drittes Paradigma, das in Teil II dieses Bandes noch thematisiert wird. Im Vergleich mit Aristoteles werden zunächst die besonderen Eigenheiten des Verständnisses von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft bei Smith deutlich. Aristote‐ les betont in der „Politik“ immer wieder die Notwendigkeit eines Verantwortungsbe‐ wusstseins der Bürger: in Bezug auf die Ökonomie soll das maßlose Erwerbsstreben durch eine Konzentration auf das Telos des Wirtschaftens überwunden werden; die‐ ses Telos wird in der staatlichen Gemeinschaft verwirklicht, die dem ethischen Ge‐ spräch über das Gute und das Gerechte dient. Der Mensch als politisches Wesen braucht die staatliche Gemeinschaft als Gemeinschaft der Bürger für die Entfaltung seiner Anlage zur Tugend; neben einer guten Staatsverfassung bedarf es dazu eines entsprechenden Bildungssystems.76 Demgegenüber lautet die zentrale Aussage von Adam Smith, dass der Mensch, so wie er ist, fähig ist, in einer harmonischen, auf Ausgleich der Interessen zielenden Gesellschaft zu leben. Die natürliche Anlage zum Mitgefühl (Sympathie) ist sowohl die Grundlage der Moral und der Rechtsordnung als auch der Ordnung der Gesell‐ schaft in Herrschende und Beherrschte; das Eigennutzstreben führt dank des Wettbe‐ werbs von Anbietern und Nachfragern zu einem ökonomischen Ausgleich unter den Bürgern. Voraussetzung für die Verwirklichung der Harmonie ist die Überwindung der persönlichen Abhängigkeiten aus der Zeit des Feudalismus und die Durchset‐ zung des „Systems der natürlichen Freiheit“.77 Doch diese Entwicklung setzt nicht eine besondere Tugend voraus, sondern erfolgt im Laufe der Geschichte gewisser‐ maßen automatisch; ähnlich wie wenig später Kant setzt er auf einen Mechanismus in der Geschichte, der zur Durchsetzung einer freien Gesellschaftsordnung führt.78 An die Stelle der teleologischen Ausrichtung des Bürgers auf das Ziel des guten Le‐ bens und die Verwirklichung der Tugend setzt Smith den automatischen Ausgleich zwischen den Menschen durch ihre natürlichen Anlagen. Auf den zweiten Blick wird jedoch deutlich, dass das Bild komplexer ist. Aristo‐ teles vertraut in seinen Überlegungen zur Staatsverfassung weniger auf die Tugend der Bürger als vielmehr auf institutionelle Anreize, die per se am Eigennutzstreben der Bürger ansetzen.79 Zudem ist seine Haltung zur Ökonomie durchaus ambivalent: Wie oben gezeigt wurde, gibt es neben der geradezu irrational scharfen Kritik des Handels eine bemerkenswerte Wertschätzung des Privateigentums und ein Verständ‐ nis der Gerechtigkeit als Tausch, das dem von Smith sehr nahe steht. Während Aris‐ toteles also in seiner Argumentation Smith näher steht, als es zunächst scheint, er‐ 76 77 78 79
38
Vgl. zur Bedeutung der Bildung die Bücher VII und VIII der „Politik“. Smith WN IV.ix.51, S. 582. Vgl. Kant 1983 a und 1983 b. Vgl. z. B. Piepenbrink 2014.
weckt Smith an verschiedenen Stellen in seinem Werk Zweifel, wie sehr er von sei‐ ner optimistischen Theorie des automatischen Ausgleichs in der Gesellschaft über‐ zeugt ist. In Bezug auf die Kapitalisten beruht das Wirtschaftssystem auf einer Täu‐ schung („deception“): Die Kapitalisten streben nach einem Vorteil, der in Wahrheit keiner ist.80 Auf der anderen Seite erweist sich aber auch der Vorteil der Arbeiter in der Gesellschaft als fragwürdig, denn Smith zeigt im WN, dass sie nur vom Wohl‐ stand der Gesellschaft profitieren, wenn die Wirtschaft sich in einer Wachstumspha‐ se befindet.81 Das aber ist dauerhaft nicht möglich, weil das Wachstum irgendwann eine natürliche Grenze findet, jenseits derer die Arbeiter nur einen Lohn in der Höhe des Existenzminimums erhalten. Zugespitzt formuliert erweist sich bei Smith der Kapitalismus als ein System, in dem die Kapitalisten auf das wahre Glück der See‐ lenruhe („peace of mind“82) verzichten, um das Wirtschaftswachstum zu fördern, und in dem die Arbeiter langfristig gerade einmal ihr Existenzminimum sichern kön‐ nen. Smith legt somit an einigen Stellen die Marxsche Schlussfolgerung nahe, dass der Kapitalismus nicht zur Harmonie führt, sondern sowohl für die Arbeiter als auch für die Kapitalisten negative Konsequenzen hat (vgl. dazu den entsprechenden Bei‐ trag in Teil II dieses Bandes). Die Paradigmen von Politik und Ökonomie stehen somit nicht einfach als Gegen‐ sätze nebeneinander. Vielmehr gibt es zwischen ihnen ein dynamisches Verhältnis: die Folgerungen von Smith aus Aristoteles (Autonomie gesellschaftlicher Prozesse statt Teleologie) sind bei Aristoteles bereits angelegt, ebenso wie die Folgerung von Marx aus Smith (Klassenkampf statt Harmonie) bei Smith angelegt ist (siehe dazu den Beitrag von Hansen/Kraski in diesem Band). Die Auseinandersetzung mit Smith in der ökonomischen und politischen Ideengeschichte legt den Schluss nahe, dass der Glaube an die Autonomie und damit an den automatischen Ausgleich von Inter‐ essen in Politik, Gesellschaft und Ökonomie zu optimistisch war.83 Zur Beantwor‐ tung der Frage, wie eine politische und wirtschaftliche Ordnung begründet werden kann, die nicht zu optimistisch auf die Idee des automatischen Ausgleichs setzt, könnte es sinnvoll sein, sich auf die Teleologie von Aristoteles zu besinnen, sie aber ernster zu nehmen, als er es selbst getan hat.
Literatur Aristoteles, 1894: Ethica Nichomachea. Oxford. Dt.: Nikomachische Ethik. Hamburg, 1985. – 1957: Politica, Oxford. Dt.: Politik. Hamburg, 1981.
80 81 82 83
Smith TEG IV.1.10, S. 315. Smith WN I.ix.14, S. 82. Smith TEG IV.1.10, S. 317. Vgl. z. B. die Kritik von Walter Eucken am Laissez-faire-Liberalismus: Eucken 1990, S. 26-55.
39
Bien, Günther, 1981: Aristotelische Ethik und Kantische Moraltheorie. In: Freiburger Univer‐ sitätsblätter, Heft 1973, S. 57-74. – 1990: Die aktuelle Bedeutung der ökonomischen Theorie des Aristoteles. In: Bernd Bier‐ vert, Martin Held und Joseph Wieland (Hrsg.): Sozialphilosophische Grundlagen ökonomi‐ schen Handelns, Frankfurt a. M., S. 33-63. – 1995: Gerechtigkeit bei Aristoteles (EN V). In: Otfried Höffe (Hrsg.): Aristoteles, Nikoma‐ chische Ethik, „Klassiker Auslegen“ Bd. 2, Berlin, S. 135–164. Denis, Henri, 1993: Histoire de la pensée économique, Paris (10., aktualisierte Auflage). Eucken, Walter, 1990: Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Tübingen. Fitzgibbons, Athol, 1995: Adam Smith’s System of Liberty, Wealth, and Value. The Moral and Political Foundations of the „Wealth of Nations“, Oxford. Hansen, Hendrik, 2008: Politik und wirtschaftlicher Wettbewerb in der Globalisierung. Kritik der Paradigmendiskussion in der Internationalen Politischen Ökonomie, Wiesbaden. – 2014: Karl Marx: ein Aristoteliker? Marxʼ Rezeption der Politik von Aristoteles. In: Zehn‐ pfennig, Barbara (Hrsg.): Die „Politik“ des Aristoteles, Baden-Baden, 2., unveränd. Aufl., S. 235-262. – 2019: Sophistische Vertragstheorie: Protagoras. In: Zehnpfennig, Barbara (Hrsg.): Die So‐ phisten. Ihr politisches Denken in antiker und zeitgenössischer Gestalt, Baden-Baden, S. 123-142. Hobbes, Thomas, 1984: Leviathan, Frankfurt a. M. Immler, Hans, 1985: Natur in der ökonomischen Theorie. Teil 1: Vorklassik – Klassik – Marx, Teil 2: Naturherrschaft als ökonomische Theorie – Die Physiokraten, Opladen. Jaspers, Karl, 1997: Die maßgebenden Menschen. Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus. Mün‐ chen. Kant, Immanuel, 1983 a: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. In: ders.: Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik, Wer‐ ke Bd. VI, Darmstadt, S. 31-50. – 1983 b: Zum ewigen Frieden. In: ders.: Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik, Werke Bd. VI, Darmstadt, S. 193-251. Koslowski, Peter, 1993: Politik und Ökonomie bei Aristoteles, Tübingen (3., durchges. u. erg. Aufl.). Marx, Karl, 1961: Zur Kritik der Politischen Ökonomie. In: Marx-Engels-Werke, Bd. 13, S. 3-160. – 1962: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Marx-Engels-Werke, Bd. 23, Berlin. Meyer-Faje, Arnold/Ulrich, Peter (Hrsg.), 1991: Der andere Adam Smith. Beiträge zur Neu‐ bestimmung von Ökonomie als Politischer Ökonomie, Bern. Meikle, Scott, 1979: Aristotle and the Political Economy of the Polis. In: Journal of Hellenic Studies, Bd. 99, S. 57-73. – 1995: Aristotle’s Economic Thought. Oxford: Clarendon Press. Patzen, Martin, 1991: Zur Diskussion des Adam-Smith-Problems – ein Überblick. In: MeyerFaje/Ulrich (Hrsg.), S. 21–54.
40
Piepenbrink, Karen, 2014: Politische Institutionen in der Politik. In: Zehnpfennig, Barbara (Hrsg.): Die „Politik“ des Aristoteles, Baden-Baden, 2., unveränd. Aufl., S. 144-157. Platon, 1990: Politeia.Werke in acht Bänden (gr.-dt.), übersetzt von Friedrich D. Schleierma‐ cher, hg. von Gunther Eigler, Bd. 4. Darmstadt. Priddat, Birger P./Seifert, Eberhard K. 1987: Gerechtigkeit und Klugheit – Spuren aristoteli‐ schen Denkens in der modernen Ökonomie. In: Biervert, Bernd/Held, Martin (Hrsg.): Öko‐ nomische Theorie und Ethik, Frankfurt a. M., S. 51–77. Smith, Adam, 1976 a: The Theory of Moral Sentiments. The Glasgow Edition of the Works and Correspondance of Adam Smith, Bd. I, Oxford, 1976 (dt.: Die Theorie der ethischen Gefühle. Übersetzt von Walther Eckstein, Hamburg: Meiner, 1994). – Zitiert als TEG (An‐ gabe des Teils, Kapitels, Abschnitts, Absatzes nach der Glasgow-Ausgabe, Seitenangabe der deutschen Ausgabe). – 1976 b: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. The Glasgow Edi‐ tion of the Works and Correspondance of Adam Smith, Bd. II, Oxford (dt.: Der Wohlstand der Nationen, übersetzt von Horst Claus Recktenwald, München, 1978). – Zitiert als WN (Angabe des Buches, Kapitels, Abschnitts, Absatzes der Glasgow-Ausgabe, Seitenangabe der deutschen Ausgabe). – 1978: Lectures on Jurisprudence. The Glasgow Edition of the Works and Correspondance of Adam Smith, Bd. V, Oxford. Waibl, Elmar, 1984: Ökonomie und Ethik. Stuttgart/Bad Cannstatt. Wicksteed, Philip H., 1933: The common sense of political economy and selected papers and reviews on economic theory. London.
41
Christel Fricke Adam Smith und die moralischen Grundlagen von Recht und Gerechtigkeit
1. Einleitung Adam Smith hat zu seinen Lebzeiten, neben mehreren kürzeren Schriften zu ver‐ schiedenen Themen, zwei umfangreiche Bücher veröffentlicht: The Theory of Moral Sentiments (1759, 6., teilweise veränderte, Auflage 1790, abgekürzt als „TMS“) und den Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776, abgekürzt als „WN“). Im letzten Abschnitt der TMS, schon in der ersten Auflage von 1759, erwähnt er eine andere, noch zu schreibende Abhandlung, in der es um die „general principles of law and government“ gehen soll, und zwar insbesondere um die „diffe‐ rent revolutions they have undergone in the different ages and periods of society, not only in what concerns justice, but in what concerns police, revenue, arms, and what‐ ever else is the object of law“.1 Der letzte Teil dieser geplanten Abhandlung, die Un‐ tersuchung von „police, revenue, and arms“ ist in den WN eingegangen. Den Rest dieses Projekts hat Smith nie zum Abschluss gebracht. Ein Manuskript, das aller Wahrscheinlichkeit nach diesem Thema gewidmet war, wurde nach Smiths Tod und auf dessen Wunsch hin vernichtet. Was uns jedoch geblieben ist, sind studentische Nachschriften von Vorlesungen, die Lectures on Jurisprudence (abgekürzt „LJ“). Die diesen Nachschriften zugrunde liegenden Vorlesungen hat Smith zwischen 1763 und 1766 an der Universität in Glasgow gehalten. Sie wurden erstmals 1978 veröf‐ fentlicht. Thema dieser Vorlesungen sind die „general principles of law and govern‐ ment“, entsprechend der Ankündigung in den TMS. Dass Smith sein Projekt, die allgemeinen Prinzipien der Gesetzgebung darzule‐ gen, niemals zum Abschluss gebracht hat, hat verschiedene Smith-Experten veran‐ lasst zu fragen, ob dieses Projekt überhaupt zu realisieren gewesen wäre. Lassen sich Smiths Moralphilosophie (wie in der TMS entwickelt) und seine Theorie der Natio‐ nalökonomie (wie im WN entwickelt) überhaupt mit einer Theorie der natürlichen Gesetzgebung, wie er sie 1759 plante, zu einem kohärenten philosophischen System vereinigen? Insbesondere Charles Griswold hat Bedenken geäußert: Ist nicht Smiths These, dass eine Theorie der natürlichen Gesetzgebung im Ausgang von den ver‐ schiedenen Formen politischer Herrschaft, wie sie in kontingenten historischen Pro‐ 1 TMS VII.iv. 37, S. 342.
43
zessen entstanden sind, zu entwickeln sei, inkompatibel mit dem Projekt einer nor‐ mativen, moralischen Begründung dieser Gesetzgebung? Samuel Fleischacker hat sich diesen Bedenken angeschlossen.2 Allerdings fürchtet Fleischacker nicht so sehr die Gefahr eines naturalistischen Fehlschlusses. Seine Frage ist vielmehr, ob die mo‐ ralischen Prinzipien, die Smith für grundlegend und historisch unveränderlich hält, hinreichend präzise sind, um einem Gesetzgeber moralisch begründeten Einhalt zu gebieten, der im Begriff ist, im Namen des Gemeinwohls die Freiheiten seiner Bür‐ ger über ein tatsächlich erforderliches Maß hinaus einzuschränken.3 Knud Haakons‐ sen dagegen entwirft ein einheitliches Bild von Smiths Moraltheorie und seiner poli‐ tischen Philosophie.4 Und auch Eric Schliesser spricht von einem „System“ der Smithʼschen Philosophie.5 Beide betonen die interne Kohärenz des Smithʼschen Systems, ohne sich allerdings ausdrücklich mit der Frage nach der moralischen Be‐ gründung von Recht und Gerechtigkeit bei Smith zu beschäftigen. Die Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis von Smiths Moralphilosophie zu seiner Theorie der natürlichen und politischen Gesetzgebung hängt wesentlich da‐ von ab, wie seine Moraltheorie und seine politische Philosophie gelesen werden.6 Ich werde im Folgenden eine Lesart dieser Theorien präsentieren, die die Bedenken, die Griswold und Fleischacker vorgebracht haben, zu entkräften sucht. Meine These ist jedoch nicht nur, dass sich die verschiedenen Teile von Smiths philosophischem Projekt zu einem kohärenten Ganzen verbinden lassen; meine These ist vielmehr, dass Smith mit seiner Moralphilosophie eine normative Grundlage für seine politi‐ sche Theorie von Recht und Gerechtigkeit entwickelt, ohne sich dabei eines natura‐ listischen Fehlschlusses verdächtig zu machen, und dass er, statt inhaltlich bis ins Detail präzisierte Vorgaben für eine politische Gesetzgebung zu machen, ein Verfah‐ ren bereitstellt, das es erlaubt, bestimmte Gesetze auf ihre moralische Rechtfertigung zu überprüfen. Dies ist das so genannte Sympathieverfahren, ein Prozess morali‐ scher Kommunikation zwischen verschiedenen Beteiligten, die entweder die Rolle von (mutmaßlichen) Tätern, die Rolle von deren (mutmaßlichen) Opfern, oder die Rolle unbeteiligter und potentiell unparteiischer Zuschauer des entsprechenden Handlungsgeschehens einnehmen. Mit der erklärten Absicht, sich mit „law and government, and ... the different re‐ volutions they have undergone in the different ages and periods of society“ zu be‐ schäftigen, kündigt Smith eine deskriptive historische Untersuchung an, keine aus‐ drücklich normative politische Theorie von Recht und Gerechtigkeit, die von der Moral unabhängige Quellen normativer Autorität für die politische Gesetzgebung entwickelt. Smiths normative Begründung von Recht und Gerechtigkeit ist ihren 2 3 4 5 6
44
Griswold 1999, S. 257 und Fleischacker 2004, S. 147. Fleischacker 2004, S. 153. Haakonssen 1981. Schliesser 2017. Siehe dazu auch Winch 1978, S. 23.
Grundlagen nach moralisch. Wenn er den jeweils Herrschenden dennoch so etwas wie politische Autorität zugesteht, die nicht auch moralisch begründet ist, dann nur aus funktionalen oder pragmatischen Gründen. Tatsächlich gilt Smiths Interesse, wenn er sich mit den verschiedenen Arten von Regierungen und politischer Gesetz‐ gebung, wie sie zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten existierten, be‐ schäftigt, nicht der Frage, ob die entsprechenden Regierungen ihre Autorität einem Sozialvertrag verdanken. Seine Antwort auf die Frage, wie es dazu kam, dass so vie‐ le Leute gewillt waren, sich der Herrschaft so weniger Leute zu beugen, ist histo‐ risch und naturalistisch.7 Für ihn ist dies nur die Frage danach, welche natürlichen Prozesse zur Etablierung einer bestimmten Regierung geführt haben und mit wel‐ chen Anforderungen sich die Gesellschaft zu dieser Zeit konfrontiert sah. Dieser Frage liegt die eigentlich soziologische Hypothese zugrunde, dass die Herrschafts‐ formen und Gesetze einer Gesellschaft Rückschlüsse auf diese Anforderungen zulas‐ sen: (...) I endeavoured to explain to you the origin and something of the progress of govern‐ ment. How it arose, not as some writers imagine from any consent or agreement of a number of persons to submit themselves to such or such regulations, but from the natural progress which men make in society.8
Smith geht es in den LJ nicht um die Frage nach der Legitimation der verschiedenen Formen politischer Herrschaft, die es in der Geschichte der Zivilisation gegeben hat. Für ihn ist politische Herrschaft absolutistisch, aristokratisch, oder republikanisch (demokratisch)9, je nachdem, was die sozio-kulturellen Umstände begünstigten. Sein Verständnis von Regierungen und ihrem Zustandekommen ist funktional. Die wich‐ tigste Aufgabe einer Regierung ist, Recht und Gerechtigkeit durchzusetzen und da‐ mit den inneren Frieden einer Gesellschaft aufrecht zu erhalten; sie muss dafür sor‐ gen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger nicht gegenseitig schaden; vor allem geht es darum, Übergriffen auf privates Eigentum vorzubeugen. Außerdem sollte sich eine Regierung bemühen, den allgemeinen Wohlstand zu vermehren, sie sollte Steu‐ ern erheben, um von diesen die öffentlichen Ausgaben zu bestreiten, und schließlich sollte sie alle Maßnahmen ergreifen, die erforderlich dafür sind, das Staatsgebiet ge‐ gen Angreifer von außen zu verteidigen.10 Nur wenn eine Regierung diesen Aufga‐ ben nachkommt, bereitet sie dem „natürlichen Fortschritt“ den Weg. Dieser Fortschritt ist jedoch in erster Linie nicht normativ oder moralisch, son‐ dern ökonomisch. Wie sich aus Smiths bekannter Unterscheidung zwischen vier zi‐
7
Diese Frage wird von Hume in seiner Abhandlung Of the First Principles of Government (Hu‐ me 1987, S. 32 f.) gestellt. Paul Sagar zufolge ist dies die zentrale Frage der politischen Theori‐ en der Aufklärung (Sagar 2018). 8 LJ iv. 19, S. 207. 9 LJ iv. 1.2-5, S. 200 f. 10 LJ i.1-9, S. 5-7.
45
vilisatorischen Phasen (Jäger und Sammler; Gesellschaften, die von Viehzucht le‐ ben; Gesellschaften, die Ackerbau betreiben; kapitalistische oder Handelsgesell‐ schaften)11 ablesen lässt, ist die treibende Kraft zivilisatorischer Veränderungen nicht das Bemühen um mehr Gerechtigkeit, sondern das Bemühen um mehr Wohl‐ stand.12 Das gilt auch für politische Veränderungen. Was für eine Art der Regierung eine Gesellschaft hat und welche Gesetze diese erlässt, hängt nicht zuletzt davon ab, auf welche Weise ihre Mitglieder ihren Lebensunterhalt erwirtschaften. Die ökono‐ mische Entwicklung hängt von vielen kontingenten Faktoren ab, u. a. von den natür‐ lichen Gegebenheiten, von den jeweils zur Verfügung stehenden technischen Kennt‐ nissen und von der äußeren Bedrohung. Diese Faktoren bestimmen auch die Arten von Konflikten, die in einer Gesellschaft entstehen und die zu verhindern oder zu entschärfen die Aufgabe des jeweiligen Gesetzgebers ist. In vielen Fällen erwachsen diese Konflikte aus sozioökonomischen Unterschieden innerhalb einer Gesell‐ schaft.13 Der normative Gehalt der „Gerechtigkeit“, die durchzusetzen und zu erhalten die wichtigste Aufgabe einer Staatsmacht oder Regierung ist, ist seinem Ursprung nach moralisch. Zwar ist auch die moralische Richtigkeit politischer Gesetze dem gesell‐ schaftlichen und ökonomischen Fortschritt der jeweiligen Gesellschaft förderlich. Das Bemühen um dieselbe ist aber weder Antrieb, noch notwendige Bedingung da‐ für, dass ein solcher Fortschritt erreicht wird. Auch im politischen Kontext bedeutet „Gerechtigkeit“ mehr als nur das Durchsetzen der positiven Gesetze, die der Herr‐ scher und Gesetzgeber erlassen hat. „Gerechtigkeit“ hat für Smith sowohl eine mo‐ ralische, als auch eine politische Dimension, und beide Dimensionen sind nicht scharf voneinander zu trennen.14 Politische Gerechtigkeit ist – zumindest zu einem erheblichen Teil – die moralische Gerechtigkeit, insofern ihr durch politische Institu‐ tionen zusätzliche Durchsetzungskraft verschafft wird. Das oberste und allgemeinste Prinzip der moralischen und politischen Gerechtigkeit ist das Prinzip, das jede Ver‐ letzung oder sonstige Schädigung von Unschuldigen untersagt. Die Frage ist, ob die‐ ses kommutative Verständnis von Gerechtigkeit für die Begründung einer normati‐ ven Theorie von Recht und Gerechtigkeit im politischen Sinne ausreicht.15
11 LJ i.27, S. 14. 12 Das Bemühen um mehr Wohlstand lässt sich aus der Selbstliebe und dem Eigeninteresse eines Menschen erklären. Siehe dazu Hill 2016, S. 327. 13 Dass zivilisatorische Entwicklung vor allem von dem Wunsch nach mehr Wohlstand getrieben wird, schließt nicht aus, dass sich mit steigendem Wohlstand auch die Bedingungen für einzel‐ ne Bürgerinnen und Bürger verbessern, sich zu moralisch verantwortungsvollen Personen zu entwickeln. Siehe WN, Buch V. 14 Siehe TMS III.5.6, S. 165 f. und dazu Fleischacker 2004, S. 148. 15 Smith bekennt sich ausdrücklich zu einem kommutativen Verständnis von Gerechtigkeit; siehe TMS VII.ii.1.10, S. 269 und Appendix II, S. 390. Siehe dazu auch Winch 1978, S. 11 und Brown 1994, S. 104 f.
46
Ich werde im Folgenden zunächst die Grundzüge der Smith’schen Begründung dieses Prinzips darlegen, wobei mein besonderes Augenmerk dem Sympathieverfah‐ ren und der Figur des unparteiischen Zuschauers gilt. Meine These ist, dass dieses Verfahren erlaubt, Konflikte zu entschärfen und ein Verständnis dafür zu entwickeln, welche Gesetze erlassen werden sollten, um dem Entstehen ähnlicher Konflikte vor‐ zubeugen. Dieses Verfahren lässt sich in jeder Phase eines zivilisatorischen Prozes‐ ses anwenden, unabhängig von der jeweiligen Regierungsform. Jede Regierung wä‐ re gut beraten, sich von der Stimme des unparteiischen Zuschauers anleiten zu las‐ sen, denn er spricht im Namen der Moral. Aber wie ich darlegen werde, macht Smith sich keine Illusionen darüber, wieviel Autorität diese Stimme in der wirkli‐ chen Welt tatsächlich hat. Seine Meinung über Politiker ist geprägt von Nüchtern‐ heit, wenn nicht gar Zynismus. Aber um das moralisch Richtige kann sich jede und jeder Einzelne bemühen, ganz unabhängig davon, wessen Staates Bürger er oder sie ist, zumindest dann, wenn die Sorge um das tägliche Brot nicht alle Zeit und Kraft kostet.
2. Das Sympathieverfahren 2.1. Die Struktur des Sympathieverfahrens Smith ist ein moralischer Sentimentalist. Er ist der Auffassung, dass Menschen Din‐ ge und Ereignisse danach bewerten, wie sie auf diese emotional reagieren. Das gilt auch für moralische Bewertungen von Personen und ihren Handlungen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Smith Opfern und den Gefühlen, mit denen sie auf die je‐ weiligen Täter reagieren, eine besondere Bedeutung zuspricht. Menschen werden zu Opfern, weil sie verletzlich sind. Smith unterscheidet verschiedene Dimensionen der menschlichen Verletzlichkeit: Sie sind verletzlich an Leib und Leben, in Bezug auf ihren Besitz, der gestohlen oder zerstört werden kann, und sie können gekränkt wer‐ den, d. h., sie sind verletzlich in Bezug auf ihren sozialen Status als Menschen, die der Anerkennung ihrer Position in den verschiedenen sozialen Zusammenhängen, in denen sie leben, bedürfen.16 Moralische Urteile über Handelnde beruhen auf gefühlsmäßigen Reaktionen der‐ jenigen, die von den Konsequenzen dieser Handlung betroffen sind. Betroffene re‐ agieren mit positiven oder negativen Gefühlen, mit Dankbarkeit („gratitude“) oder mit Groll („resentment“). Nun muss sich jeder Vertreter einer sentimentalistischen Moraltheorie die Frage stellen, wie spontane Gefühle von Opfern als Evidenz für Urteile dienen können, die
16 Siehe TMS II.ii.2.2, S. 84 und LJ i.12-16, S. 8-10, und Haakonssen 1981, S. 100.
47
zu Recht Anspruch auf Wahrheit bzw. Richtigkeit erheben und daher die Beipflich‐ tung aller verdienen. Zur Beantwortung dieser Frage entwickelt Smith das Sympa‐ thieverfahren und insbesondere die Figur des unparteiischen Zuschauers. Seine The‐ se ist, dass die gefühlsmäßige Reaktion eines Betroffenen auf die Handlung einer Person nur dann als Evidenz für ein moralisches Urteil über diese Person dienen kann, wenn diese Reaktion von einem unparteiischen Zuschauer sympathisch nach‐ empfunden und damit gebilligt werden kann. Um zu prüfen, ob eine gefühlsmäßige Reaktion diese Bedingung erfüllt, muss sich der oder die Betroffene auf ein Sympa‐ thieverfahren einlassen, auf einen Prozess der Kommunikation mit einem Zuschauer, der an dem Handlungsgeschehen nicht beteiligt ist, aber etwas darüber weiß. Das kann ein Augenzeuge sein, aber auch jemand, der oder die aus anderen Quellen von dem Konflikt zwischen Täter und Betroffenem erfahren hat. Ein zusätzliches Prob‐ lem dabei ist, dass ein Außenstehender allein deshalb, weil er von den Konsequen‐ zen einer Handlung nicht betroffen ist, nicht auch schon unparteiisch ist. Was er Tä‐ ter, Opfer und Nutznießer voraus hat, ist lediglich, dass sein Blick auf die Hand‐ lungssituation nicht durch eigene Interessen getrübt wird, die auf dem Spiel stehen. Damit ist aber weder garantiert, dass er alles über die Handlungssituation weiß, was für die moralische Beurteilung des Täters relevant ist, noch, dass er keine persönli‐ chen Vorlieben oder Abneigungen in Bezug auf Täter, Opfer oder Nutznießer hegt, die einen unparteiischen Blick unweigerlich verstellen würden. Das Sympathiever‐ fahren, wie Smith es entwickelt hat, bietet Lösungsstrategien für alle diese Probleme an. Wie sollten wir uns die Struktur eines Sympathieverfahrens vorstellen? Zunächst ist daran zu erinnern, dass Smith seine TMS mit der These beginnt, dass alle Men‐ schen, zumindest alle die, die hinreichend gesund auf die Welt kamen, von Natur aus nicht nur mit dem Vermögen der Selbstliebe ausgestattet sind, sondern auch mit einem zweiten emotionalen und motivationalen Vermögen, das Smith „Sympathie“ nennt. How selfish soever man may be supposed, there are evidently some principles in his na‐ ture, which interest him in the fortune of others, and render their happiness necessary to him, though he derives nothing from it except the pleasure of seeing it. Of this kind is pity or compassion, the emotion which we feel for the misery of others, when we either see it, or are made to conceive it in a very lively manner.17 Pity and compassion are words appropriated to signify our fellow-feeling with the sorrow of others. Sympathy, though its meaning was, perhaps, originally the same, may now, however, without much impropriety, be made use of to denote our fellow-feeling with any passion whatsoever.18
17 TMS I.i.1.1, S. 9. 18 TMS I.i.1.5, S. 10.
48
„Sympathie“ ist für Smith ein terminus technicus; für jemanden Sympathie zu emp‐ finden heißt nicht, diesen zu mögen oder ihn nett zu finden. Wer Sympathie hat, hat eine natürliche Disposition, an dem Wohl und Wehe anderer teilzunehmen. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, den Hilfsbedürftigen zu Hilfe zu kommen; Sym‐ pathie ist für Smith nicht in erster Linie motivational wirksam. Vielmehr geht es beim Sympathieempfinden darum, sich in andere hineinzuversetzen, um zu verste‐ hen, wie sie sich fühlen, und um zu beurteilen, ob diese Gefühle angemessene Reak‐ tionen sind auf das, was sie hervorgerufen hat. Alle Beteiligten an dem Sympathie‐ verfahren müssen sich im Verlauf dieses Verfahrens ihrer Sympathie bedienen. Im Folgenden werde ich mich in erster Linie mit Opfern von Tätern beschäftigen, die gegen den Täter Groll empfinden. Dies ist nicht nur der Einfachheit geschuldet. Denn konfliktträchtige Handlungen, in denen Täter Opfer schädigen, sind eher ge‐ eignet, normative Fragen nach dem moralisch Richtigen zu provozieren, als einver‐ nehmliche oder großzügige Handlungen. Zunächst wendet sich das Opfer eines Konflikts sympathieheischend an den un‐ beteiligten Zuschauer. Denn das Sympathievermögen lässt ein Bedürfnis nach dem Mitfühlen anderer in uns entstehen, das Bedürfnis nach einem Zustand gegenseitiger Sympathie: (…) nothing pleases us more than to observe in other men a fellow-feeling with all the emotions of our own breast; nor are we ever so much shocked as by the appearance of the contrary.19
Allerdings ist der unbeteiligte Zuschauer nicht bedingungslos bereit, diesem Wunsch des Opfers zu entsprechen. Vielmehr macht er seine Bereitschaft, den Groll des Op‐ fers nachzuempfinden und mitzufühlen, davon abhängig, ob ihm dieses Gefühl eine angemessene Reaktion zu sein scheint auf das, was der Täter dem Opfer angetan hat. Dazu muss er die gesamten Umstände, unter denen der Täter gehandelt hat, berück‐ sichtigen: Sympathy, therefore, does not arise so much from the view of the passion, as from that of the situation which excites it.20
Der Zuschauer verfährt nun in drei Schritten: Erst einmal versetzt er sich in die Lage des Opfers und versucht sich vorzustellen, wie er selbst sich gefühlt hätte, wenn er statt des Opfers selbst von dem Täter verletzt oder anderweitig geschädigt worden wäre. Dies geschieht in einem ersten Akt des sympathischen Mitempfindens. Dann versetzt sich der Zuschauer direkt in das Opfer, berücksichtigt also nicht nur dessen Lage, sondern auch dessen spezifische persönliche Befindlichkeit oder dessen spezi‐ fische Verletzlichkeit; dabei achtet er auf den Gesichtsausdruck des Opfers und sons‐
19 TMS I.i.2.1, S. 13. 20 TMS I.i.1.10, S. 12.
49
tige Anzeichen dafür, wie sich das Opfer selbst tatsächlich fühlt. Dies geschieht in einem zweiten Akt des sympathischen Mitempfindens. In einem dritten Schritt ver‐ gleicht der Zuschauer dann das erste mit dem zweiten sympathischen Mitempfinden. Und dies geschieht in einem dritten Akt der Sympathie, in dem die Sympathie zu einer Sympathie zweiter Stufe wird. Allerdings kann der Zuschauer in diesem dritten Akt entweder Sympathie oder Antipathie empfinden.21 Sympathie zweiter Stufe empfindet er, wenn er feststellt, dass das erste dem zweiten sympathischen Mitemp‐ finden gleich oder wenigstens sehr ähnlich ist, Antipathie dagegen, wenn beide deut‐ lich und nicht nur dem Grad nach verschieden voneinander sind: When the original passions of the person principally concerned are in perfect concord with the sympathetic emotions of the spectator, they necessarily appear to this last just and proper, and suitable to their objects; and, on the contrary, when, upon bringing the case home to himself, he finds that they do not coincide with what he feels, they necessa‐ rily appear to him unjust and improper, and unsuitable to the causes which excite them. To approve of the passions of another, therefore, as suitable to their objects, is the same thing as to observe that we entirely sympathize with them.22
Zwei wichtige Elemente des Sympathieverfahrens werden hier von Smith deut‐ lich angesprochen: Zum einen sagt Smith, dass der Zuschauer seine eigene – vorge‐ stellte – Gefühlsreaktion zum Maßstab der angemessenen Reaktion macht. Und zum anderen vertritt er die These, dass eine Gefühlsreaktion auf eine Handlung dann an‐ gemessen ist, wenn sie zu dieser Handlung passt. M. a. W., eine Handlung verdient bestimmte Arten der gefühlsmäßigen Reaktion. Im Licht dieser beiden Thesen kann man Smith eine relationale und reaktionsabhängige Auffassung des moralisch Rich‐ tigen und Falschen zuschreiben: Eine Handlung ist moralisch schlecht, wenn die an‐ gemessene Reaktion auf sie ein Gefühl des Grolls ist, und moralisch gut (oder we‐ nigstens nicht zu beanstanden), wenn Groll als Reaktion auf sie nicht angemessen wäre. Dahinter steckt bei Smith aber kein moralischer Realismus; Handlungen sind nicht als solche moralisch gut oder schlecht; sie sind gut oder schlecht aufgrund der verletzenden Wirkung, die sie auf Betroffene haben oder nicht haben. Dabei können die von einer Handlung Betroffenen nicht willkürlich bestimmen, wann sie mit Groll reagieren und wann nicht. Nicht jede Grollempfindung ist eine angemessene Gefühlsreaktion. Nur diejenige Grollempfindung ist eine für ein Opfer angemessene Gefühlsreaktion auf einen Täter und dessen Handlung, die der unpar‐ teiische Zuschauer billigt. Dahinter steckt die Beobachtung, dass die gefühlsmäßi‐ gen Reaktionen von Opfern auf ihre Täter nicht allein von dem bestimmt werden, was dem Opfer faktisch zustößt oder angetan wird, sondern auch davon, wie sich das Opfer im Verhältnis zu anderen sieht, was das Opfer über den Täter und die 21 Siehe TMS II.i.5.4, S. 75. Zur weiteren Analyse des Smith’schen Sympathieverfahrens und sei‐ ner Funktion siehe auch Fleischacker 2012 und Fricke 2012. 22 TMS I.i.3.1, S. 16.
50
Handlungssituation weiß und was für Vorurteile es bezüglich des Täters und seiner Tat hegt. Viele Opfer neigen dazu, sich selbst für wichtiger zu halten als alle anderen und daher die Schädigung, die sie erfahren haben, überzubewerten. Was das Opfer über den Täter und über dessen Handlung und die entsprechenden Handlungsum‐ stände zu wissen glaubt, kann falsch oder zumindest unvollständig sein. Und das Opfer kann Vorurteilen anhängen, die es entweder für oder gegen den Täter einge‐ nommen sein lassen oder die es dazu bewegen, eine moralisch falsche Handlung nicht als solche zu empfinden, weil es sich nicht in die Rolle eines Opfers begeben will.23 Wie aber kann der Zuschauer solche Fehleinschätzungen des Opfers korrigieren? Und was kann er selbst zu der Bestimmung dessen beitragen, was die dem Täter und seiner Handlung angemessene Gefühlsreaktion wäre? Dass er seine eigene – imagi‐ nierte – Reaktion zum Maßstab der richtigen Reaktion macht, scheint nicht hilfreich zu sein, denn es ist keineswegs sicher, dass diese Reaktion dem Täter und seiner Handlung angemessen ist. Sie kann ebenso unangemessen sein wie die des Opfers. Dass sich der Zuschauer selbst zum Maßstab für richtige gefühlsmäßige Reaktionen auf Täter macht, ist aber nicht nur vermessen. Es impliziert auch eine Haltung dem oder der Anderen gegenüber, die für die Begründung der Moral von zentraler Be‐ deutung ist: Der Zuschauer unterstellt, dass das Opfer so ist wie er selbst, dass es insbesondere so verletzlich ist wie er selbst. In dieser Anerkennung des Anderen als eines Gleichen, als eines gleich Verletzlichen, liegt der Schlüssel zum Begründungs‐ potential des Sympathieverfahrens. Denn eine Einigung zwischen Opfer und Zu‐ schauer darüber, welche Gefühlsreaktion ein Täter verdient, kann nur dann als ge‐ rechtfertigt angesehen werden, wenn beide einander als verletzliche Wesen anerken‐ nen und wenn der Zuschauer sich nicht anmaßt, allein darüber zu bestimmen, wie ein Opfer auf einen Täter reagieren soll. Andernfalls könnte der Zuschauer einem Opfer jede Verletzlichkeit oder gar seine oder ihre Menschlichkeit willkürlich ab‐ sprechen. Ein Zuschauer, der sich selbst zum Maßstab macht, vertraut darauf, moralisch kompetent zu sein und in der Lage, die moralische Qualität von Handlungen richtig zu beurteilen. Er erwartet daher aus epistemischen Gründen, dass seine eigene ima‐ ginierte Gefühlsreaktion mit dem, was das Opfer tatsächlich fühlt, weitgehend über‐ einstimmt. Und er ist entsprechend überrascht, wenn nicht sogar enttäuscht, wenn er 23 Eine in dieser Weise unangemessene Reaktion eines Opfers auf einen Täter ist nicht unge‐ wöhnlich. Verschiedene Sozialpsychologen haben in umfangreichen Beobachtungen belegt, dass Opfer von Vergewaltigungen und anderen Formen schwerer Nötigung oder Kränkung sich oft selbst beschuldigen, nicht aber den Täter (siehe Lerner 1980, Janoff-Bulman 1992 und Lamb 1996). Dieses unangemessene Opferverhalten wird mit dem Wunsch des Opfers erklärt, seinen Glauben an eine gerechte Welt auch dann noch zu verteidigen, wenn es sehr starke Evi‐ denzen dafür gibt, dass dieser Glaube illusorisch ist. Wer allerdings diesen Glauben verliert, verliert damit auch das Vertrauen darauf, sich in der Welt gefahrlos bewegen zu können und sich erfolgreich um die Befriedigung seiner eigenen Bedürfnisse kümmern zu können.
51
feststellen muss, dass das nicht der Fall ist. Der Mangel an Übereinstimmung ist Symptom eines Irrtums, den mindestens eine der beiden Parteien gemacht hat; denn beide vertrauen darauf, dass es in Sachen moralischer Urteile richtige und falsche Urteile gibt, die für alle Urteilenden gleichermaßen gelten. Daher nehmen sowohl der Zuschauer als auch das Opfer einen solchen Mangel an Übereinstimmung zum Anlass, der Frage nachzugehen, welche ihrer beiden Gefühlsreaktionen der Hand‐ lung des Täters unangemessen war. Um diese Frage zu beantworten, tauschen beide ihre Rollen: Opfer und Zuschauer werden zu Zuschauern ihrer selbst, und dabei ler‐ nen sie voneinander. U. a. lernen sie, die tatsächlichen Umstände, unter denen der Täter gehandelt hat, genauer zu berücksichtigen, eventuelle kognitive Irrtümer zu korrigieren oder Wissenslücken zu füllen. Außerdem lernen sie, ihre jeweiligen Vor‐ urteile zu identifizieren und deren Einfluss auf ihre gefühlsmäßige Reaktion auf den Täter zu beschränken. Zu diesem Zweck können und sollen sie auch weitere Zu‐ schauer heranziehen; schließlich können Opfer und ihre Zuschauer denselben Vorur‐ teilen anhängen; zu deren Identifikation sind sie auf die Hilfe weiterer Zuschauer an‐ gewiesen. Hinter diesem Verfahren des Rollentauschs steckt die allgemein bekannte Ein‐ sicht, dass vier Augen mehr sehen als zwei, und sechs Augen mehr sehen als vier, und dass jede und jeder gut beraten ist, einen Sachverhalt aus möglichst vielen un‐ terschiedlichen Perspektiven zu betrachten, bevor sie oder er sich eine Meinung da‐ rüber bildet. Mit der Bereitschaft, sich auf einen solchen Rollentausch einzulassen, signalisieren beide ihre Bereitschaft, ihre ursprüngliche Gefühlsreaktion – direkt empfunden oder imaginiert – gegebenenfalls zu korrigieren. Allerdings können meh‐ rere Runden des Rollentauschs erforderlich sein, bevor Opfer und Zuschauer sich darauf einigen können, welche gefühlsmäßige Reaktion eine Handlung verdient und wie der Täter moralisch zu beurteilen ist. Eine Frage, die Opfer und Zuschauer klären müssen, bevor sie bestimmen kön‐ nen, welche Gefühlsreaktion angemessen ist, ist die Frage danach, ob der Täter aus bösem Willen gehandelt hat, oder ob er dem Opfer unabsichtlich Schaden zugefügt hat; schließlich könnte dieser Schaden der unvermeidliche Preis zur Erreichung ei‐ nes anderen Ziels gewesen sein, dessen Verfolgung der unparteiische Zuschauer nicht beanstandet: (…) wherever the conduct of the agent appears to have been entirely directed by motives and affections which we thoroughly enter into and approve of, we can have no sort of sympathy with the resentment of the sufferer, how great soever the mischief which may have been done to him. When two people quarrel, if we take part with, and entirely adopt the resentment of one of them, it is impossible that we should enter into that of the other. Our sympathy with the person whose motives we go along with, and whom therefore we
52
look upon as in the right, cannot but harden us against all fellow-feeling with the other, whom we necessarily regard as in the wrong.24
Hier wird deutlich, dass sich der Zuschauer auch auf ein Sympathieverfahren einlas‐ sen muss, in dem sein Kommunikationspartner nicht das Opfer, sondern der Täter ist. Auch der Täter hat nicht nur aus Überlegungen, sondern auch aus Gefühlen he‐ raus gehandelt. Und der Zuschauer muss sich in den seine Handlung planenden Tä‐ ter hineinversetzen, um feststellen zu können, ob der Täter aus bösem Willen gehan‐ delt hat, oder ob er eine entlastende Erklärung für sein Verhalten vorbringen kann. Nur wenn der Täter dem unschuldigen Opfer ausdrücklich schaden wollte oder des‐ sen Schädigung mutwillig in Kauf genommen hat, ist ihm böser Wille anzulasten, nur dann ist er moralisch zu verurteilen, und nur dann ist der Groll des Opfers als eine angemessene Reaktion anzusehen, als eine Reaktion, die der Täter verdient. Hier zeigt sich, dass für Smith die Absicht des Täters für die Beurteilung seiner Handlung mindestens ebenso wichtig ist wie deren Konsequenzen für Betroffene. Allerdings macht sich Smith, wenn er vom Zuschauer fordert, sich auf ein Sympa‐ thieverfahren nicht nur mit dem Opfer einer Handlung, sondern auch mit dem Täter einzulassen, einer zirkulären Erklärung schuldig: Nur die Handlungen, die ein Täter aus böser Absicht unternahm, verdienen den Groll des Opfers; und nur die Handlun‐ gen verdienen den Groll des Opfers, die ein Täter aus böser Absicht unternahm.25
2.2. Die Funktion des Sympathieverfahrens: Die Genese moralischer Urteile Ziel des Sympathieverfahrens ist es sowohl für den Zuschauer als auch für das Opfer einer Handlung, einen Zustand gegenseitiger Sympathie herzustellen. Ein solcher Zustand signalisiert Übereinstimmung in der Auffassung dessen, was für eine Ge‐ fühlsreaktion des Opfers auf den Täter angemessen ist, und damit eine Übereinstim‐ mung in der moralischen Beurteilung des Täters. Die moralischen Urteile, auf die sich die Beteiligten an einem solchen Verfahren einigen, sind partikular; es sind Ur‐ teile über einzelne Handlungen, die einzelne Täter in spezifischen Situationen unter‐ nommen haben. Diese Urteile sind mehr oder weniger gerechtfertigt. Der Grad ihrer Rechtfertigung hängt davon ab, wie viele Zuschauer an dem Verfahren beteiligt wa‐ ren. Je mehr Zuschauer beteiligt waren, desto besser ist das Urteil gerechtfertigt, auf das sie sich in dem Sympathieverfahren geeinigt haben. Letztlich sollte die Teilnahme an einem solchen Verfahren allen denen offenste‐ hen, die meinen, etwas Fruchtbares zur Klärung der Frage beitragen zu können, wel‐ che gefühlsmäßige Reaktion auf eine Handlung dieser Handlung angemessen ist. 24 TMS II.i.3.3, S. 72. 25 Siehe TMS II.i.4.3-4, S. 73 f. Ich kann der Frage, ob es für Smith einen Ausweg aus diesem Zirkel gibt, hier nicht nachgehen.
53
Insbesondere sind die Perspektiven all derer zu berücksichtigen, die von einer Hand‐ lung betroffen waren, also alle, die der Täter zu Opfern oder Nutznießern gemacht hat. Diese Forderung ist nicht nur eine Sache der Zeugengerechtigkeit („testimonial justice“), wie Miranda Fricker sie gefordert hat.26 Dass jede und jeder mit ihrem oder seinem Beitrag in einem Sympathieverfahren willkommen ist, ist nicht nur eine moralische Forderung. Es ist auch und in erster Linie eine epistemische Forderung, die sich aus dem Wahrheitsanspruch erklärt, der mit jedem moralischen Urteil erho‐ ben wird. Wer einen Wahrheitsanspruch verteidigen will, kann sich nicht leisten, ir‐ gendjemanden von dem Prozess der Wahrheitsfindung willkürlich auszuschließen oder irgendwelche Einwände zu ignorieren, ganz unabhängig davon, wer sie vor‐ trägt. Andernfalls liefe er Gefahr, gerade auf diejenigen nicht zu hören, die über für die Wahrheitsfindung relevante Informationen verfügen.27 Was gewinnen Opfer und ihre Zuschauer und Täter, wenn sie sich auf ein solches Sympathieverfahren einlassen? Zum einen ist das Sympathieverfahren ein Verfahren zur Rechtfertigung einzelner moralischer Urteile, d. h. moralischer Urteile über ein‐ zelne Täter und bestimmte Handlungen, die sie zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort ausgeführt haben. Grundgedanke dieser Rechtfertigung ist, dass die Frage, wie eine Handlung moralisch zu bewerten ist, auf der Grundlage einer größt‐ möglichen Anzahl verschiedener Perspektiven auf diese Handlung beantwortet wer‐ den kann; aus jeder dieser Perspektiven kommt sowohl ein kognitiver als auch ein evaluativer Beitrag. Es geht darum, alle verfügbaren Kräfte zu bündeln, um die Handlung angemessen zu beschreiben, die Motive des Täters zu eruieren, und die Bewertungen aller Betroffenen zu sammeln und sich auf dieser Grundlage auf die moralische Bewertung der Handlung zu einigen. Darüber hinaus kann jedes einzelne moralische Urteil, das auf diese Weise gerechtfertigt wurde – zusammen mit hinrei‐ chend vielen anderen solcher Urteile – als Grundlage dafür dienen, durch Induktion zu allgemeinen moralischen Verhaltensregeln zu kommen. Die Induktionsbasis gibt dabei ihren Begründungsstatus an die allgemeinen Regeln weiter: The general maxims of morality are formed, like all other general maxims, from experi‐ ence and induction. We observe in a great variety of particular cases what pleases or dis‐ pleases our moral faculties, what these approve or disapprove of, and, by induction from this experience, we establish those general rules.28
Das Sympathieverfahren erlaubt den daran Beteiligten auch, Streitigkeiten darüber zu schlichten, wie eine bestimmte Handlung moralisch zu beurteilen sei. Allerdings
26 Fricker 2007. 27 Diese Offenheit des Sympathieverfahrens betont Amartya Sen in seinem Vergleich des Smith’schen Sympathieverfahrens mit dem Rawls'schen Verfahren, in dem sich die Bürgerin‐ nen und Bürger eines Staates unter einen virtuellen „Schleier des Nichtwissens“ begeben. Siehe Sen 2009, S. 124-152. 28 TMS VII.iii.2.6, S. 319.
54
müssen die Beteiligten damit rechnen, dass, bevor ein Konsens hergestellt werden kann, verschiedene Runden des Rollentauschs von Opfer und Zuschauer oder Zu‐ schauern erforderlich sind, wobei beide Seiten in jeder Runde dazulernen und ihre Haltung gegebenenfalls korrigieren. Besonders wichtig ist dabei, dass die Beteilig‐ ten im Rahmen eines solchen Sympathieverfahrens lernen, sich aus der Perspektive ihrer eigenen Zuschauer zu betrachten, und das bedeutet, dass sie ihr moralisches Gewissen entwickeln.29 Alle Beteiligten lernen durch das wiederholte Teilnehmen am Sympathieverfahren, wie sie aus einer Perspektive der Parteilichkeit schrittweise zu einer Perspektive der Unparteilichkeit gelangen bzw. sich einer solchen annähern. Unparteilichkeit erfordert umfangreiches Wissen und die Freiheit von Vorurteilen. Sie ist ein Ideal, und kein Mensch wird es schaffen, diesem Ideal vollkommen ge‐ recht zu werden. Menschliches Wissen ist immer endlich und nie frei von Irrtümern. Aber Parteilichkeit lässt verschiedene Grade zu, und wenn es um moralische Urteile geht, ist es immer besser, weniger als mehr Parteilichkeit zu zeigen. Ein letztes Resultat von Sympathieverfahren ist im Hinblick auf das oberste Prin‐ zip der Gerechtigkeit von besonderer Bedeutung: Die Frage, was als Schädigung oder Verletzung eines unschuldigen Opfers gilt, ist am Anfang eines Sympathiever‐ fahrens noch offen. Zwar signalisiert ein Opfer mit seiner oder ihrer Grollempfin‐ dung, dass es sich geschädigt oder verletzt fühlt. Aber diese Empfindung kann allein kein Maßstab für das sein, was allgemein als Schädigung oder Verletzung gelten soll – andernfalls müsste man Smith unterstellen, einem Diktat der – weiblichen und männlichen – Zicken das Wort zu reden. Wie oben schon festgestellt, kann es sich zum einen herausstellen, dass das Opfer mehr Groll empfindet, als angesichts des‐ sen, was ein Täter ihm oder ihr angetan hat, angemessen gewesen wäre. Zum ande‐ ren kann sich aber auch herausstellen, dass eine Person, die tatsächlich geschädigt und damit zum Opfer gemacht wurde, keinen Groll gegen den Täter empfindet, son‐ dern diesen gegen sich selbst richtet. In einem Sympathieverfahren kann ein solches Opfer lernen, dass Groll gegen den Täter angemessen wäre, dass es selbst nicht die Rolle des Täters übernehmen sollte, und dass die richtige Ausrichtung seines oder ihres Grolls für die angemessene Beurteilung – und Bestrafung – dessen, was der Täter ihm oder ihr angetan hat, eine zentrale Rolle spielt.30 Standards zur moralischen Beurteilung von Handlungen und zur Beurteilung des‐ sen, was als Schädigung gilt, sind, wenn sie durch Sympathieverfahren konstruiert werden, unweigerlich geprägt von den Konflikten, die zwischen den Mitgliedern einer Gesellschaft entstehen. Jede Gesellschaftsform bringt ihre eigenen Konflikte hervor. Worüber Menschen miteinander in Streit geraten und was sie einander antun, unterliegt historischem Wandel. Steven Pinker hat aufgezeigt, dass im Laufe des Zi‐ vilisationsprozesses die Bereitschaft zur körperlichen Gewalt, zu Mord, Totschlag 29 Zu Smiths Theorie des Gewissens siehe Fricke 2013. 30 Siehe oben, Fußnote 23.
55
und schwerer Körperverletzung abgenommen hat.31 Eigentumsdelikte und persönli‐ che Kränkungen stehen an erster Stelle dessen, was Menschen einander antun, wenn sie auf die Anwendung von Gewalt verzichten. Smiths Konzept des moralischen Ur‐ teils trägt dem Umstand Rechnung, dass das, was als Schädigung eines unschuldigen Opfers gilt, historischem Wandel unterliegt.32 Insbesondere gilt dies für Schädigun‐ gen in Form von Kränkungen. Das bedeutet, dass die allgemeinen moralischen Re‐ geln, die die Menschen konstruieren, zwar gerechtfertigt sind, aber keine absolute Gültigkeit beanspruchen können. Sie sind und bleiben Resultate kontingenter histo‐ rischer Prozesse, und es ist nicht ausgeschlossen, dass die jeweils erreichten Regeln weiterer Revision bedürfen.
3. Die heiligsten Gesetze der Gerechtigkeit Es gibt, so Smith, nur einige wenige Regeln, die nicht nur gerechtfertigt sind, son‐ dern absolute Autorität beanspruchen können, weil sie niemals revidiert werden können, und das sind die „most sacred laws of justice“33 bzw. die „most sacred rules of justice“34 oder die „rules of morality“35. Diese Regeln oder Gesetze (…) guard the life and person of our neighbour … his property and possessions; and … his personal rights.36
Zwar sagt Smith über diese Regeln, dass sie „accurate in the highest degree“ seien.37 Aber mit „accurate“ meint er vor allem, dass sie keinerlei Ausnahmen oder alternati‐ ve Interpretationen zulassen. Diese Regeln gelten absolut, für alle Menschen zu aller Zeit. Wer diesen Regeln folgt, tut der kommutativen Gerechtigkeit genüge. Sie kön‐ nen als die allgemeinsten moralischen Regeln angesehen werden, denn sie schreiben vor, niemals einer oder einem Unschuldigen mutwillig zu schaden. Absolut gültig können diese Regeln, im Unterschied zu induktiv erschlossenen moralischen Re‐ geln, nur deshalb sein, weil sie ganz allgemein sind und nur die drei allgemeinen Hinsichten unterscheiden, in denen Menschen verletzlich sind. Ihr absoluter Gel‐ tungsstatus lässt sich aus dem Sympathieverfahren erklären: Der Prozess der Recht‐ fertigung eines moralischen Urteils ist ein Prozess, in dessen Verlauf sich die Betei‐ ligten schrittweise darauf einigen, ob eine Handlung Unschuldigen Schaden zuge‐ fügt hat und ob der entsprechende Täter dies mutwillig, mit böser Absicht, getan hat. 31 Pinker 2011. 32 Ein Beispiel dafür, dass aktuell viel Aufmerksamkeit erfährt, ist das Delikt des „harassment“ oder des „mobbing“. Siehe dazu Fricker 2007. 33 TMS II.ii.2.2, S. 84. 34 TMS VI.iii.11, S. 241. 35 TMS VII.iii.4.1, S. 327. 36 TMS II.ii.2.2., S. 84. 37 TMS III.6.10, S. 175.
56
Keiner, und insbesondere kein von der Handlung des Täters Betroffener darf von der Teilnahme an diesem Verfahren ausgeschlossen werden. Und da alle Menschen von Natur aus daran interessiert sind, nicht geschädigt oder verletzt zu werden, kann ein unschuldiges Opfer niemals die Handlung gutheißen, mit der ein Täter ihm mutwil‐ lig geschadet hat. Ein moralisches Urteil, das diesen Regeln widerspricht, wäre nicht konsensfähig. Wer an einem Sympathieverfahren teilnehmen will, muss diese Re‐ geln nicht kennen. Aber er oder sie muss alle anderen Teilnehmer als epistemisch gleichberechtigte Gesprächspartner und Sympathieträger respektieren, und dazu ge‐ hört auch die Bereitschaft, nach einer gewaltlosen Lösung für einen Konflikt zu su‐ chen, der einen Täter zum Täter und ein Opfer zum Opfer hat werden lassen. Wer sich aber zur Gewaltlosigkeit bereitfindet, folgt den Grundregeln der kommutativen Gerechtigkeit.38 In ihrer Allgemeinheit sind diese obersten Regeln oder Prinzipien der Gerechtig‐ keit sehr unspezifisch. Das ist der Grund, warum Fleischacker sie für unzureichend hält, einem Gesetzgeber im Namen der Gerechtigkeit hinreichende Grenzen zu set‐ zen. Dabei übersieht Fleischacker, dass Smith neben diesen allgemeinen Prinzipien auch das Sympathieverfahren anbietet, das es erlaubt, jede bestimmte Handlung und auch jeden Akt der Gesetzgebung auf moralische Richtigkeit zu prüfen.39 Im Vorder‐ grund von Smiths sentimentalistischer Moralphilosophie steht die prozedurale Rechtfertigung einzelner moralischer Urteile. Der deontologische Gedanke, dass richtiges Handeln eine Sache der Befolgung von moralischen Regeln sei, ist in Smiths Auffassung der Moral zweitrangig. Allerdings ist dieser deontologische Gedanke nur so lange zweitrangig, wie Smith davon absieht, welche kognitiven und emotionalen Schwächen Menschen haben. Das Sympathieverfahren, wie Smith es beschreibt, ist Gegenstand eines Gedanken‐ experiments. Im Rahmen dieses Experiments unterstellt Smith, dass die Teilnehme‐ rinnen und Teilnehmer an diesem Verfahren einander als gleichberechtigte Teilneh‐ mer respektieren und dass es ihnen tatsächlich nur darum geht herauszufinden, wel‐ che gefühlsmäßige Reaktion und moralische Beurteilung eine bestimmte Handlung verdient. Damit schließt er aus, dass die Teilnehmenden einander zu übervorteilen versuchen, dass sie lügen, um einem anderen zu schaden oder um sich selbst vor Kritik zu schützen; keiner versucht, sich auf Kosten anderer einen Vorteil zu ver‐ schaffen. Metaphorisch gesprochen kann man sagen, dass das Sympathieverfahren in einem künstlich geschützten Raum stattfindet; wer diesen Raum betritt, lässt seine parteiischen Interessen und seinen sozioökonomischen Status ebenso zurück wie eventuelle Defizite seiner Kommunikationsfähigkeit und Bildung. Denn das Sympa‐ thieverfahren setzt voraus, dass alle Beteiligten vergleichbare emotionale, intellektu‐ elle und kommunikative Fähigkeiten haben. 38 Siehe Fricke 2011. 39 Siehe zur Rolle des Sympathieverfahrens in Smiths Moraltheorie auch Sen 2009, S. 44ff.
57
Außerhalb dieses geschützten Raums, in der wirklichen Welt, kann man nicht da‐ mit rechnen, dass Menschen ihre egoistischen Neigungen hinreichend beherrschen oder sich im Konfliktfall auf ein Sympathieverfahren einlassen. Deshalb rät Smith allen, sich doch an die etablierten Regeln und Gesetze zu halten, seien diese nun ge‐ schrieben oder ungeschrieben.40 Er traut dem Durchschnittsmenschen ohnehin nicht zu, sich auf virtuelle oder tatsächliche Sympathieverfahren einzulassen und dabei zu moralisch richtigen Ergebnissen zu kommen. Zu stark ist die menschliche Neigung zur Selbsttäuschung und dazu, sich auf Kosten anderer Vorteile zu verschaffen in der fälschlichen Annahme, besser, wichtiger oder verdienstvoller zu sein als die ande‐ ren.41
4. Von der moralischen zur politischen Gerechtigkeit Der berechtigte Groll, den ein Opfer gegen einen Täter hegt, und die entsprechende moralische Verurteilung des Täters sollen, so Smith, nicht folgenlos bleiben. Ohne‐ hin hat der Groll des Opfers auch eine motivationale Funktion: Das Opfer will dem Täter seine Tat heimzahlen, Rache an ihm üben bzw. Schädigung mit Schädigung vergelten: Resentment seems to have been given us by nature for defence, and for defence only. It is the safeguard of justice and the security of innocence. It prompts us to beat off the mi‐ schief which is attempted to be done to us, and to retaliate that which is already done; that the offender may be made to repent of his injustice, and that others, through fear of the like punishment, may be terrified from being guilty of the like offence.42
Die Absicht, Vergeltung zu üben, ist nicht nur rückwärtsgewandt. Sie hat auch die Funktion, sowohl den Täter als auch mögliche Nachahmer abzuschrecken, sie davon abzuhalten, in Zukunft ähnlich verwerfliche Handlungen zu begehen. Allerdings kommt es auch bei der Vergeltung auf die Billigung durch einen unparteiischen Zu‐ schauer an. Ebenso wie ein spontan empfundener Groll kann auch die Rache, die ein Opfer an dem Täter zu nehmen vorhat, der erfahrenen Schädigung und der Motivati‐ on des Täters unangemessen sein. Nur wenn ein Akt der Vergeltung dem Täter und dem, was er aus böser Absicht dem unschuldigen Opfer angetan hat, angemessen ist, kann er als legitime Bestrafung des Täters gelten. Von einer Bestrafung darf nie‐ mand anderes als der Täter betroffen sein, und ein Täter verdient seine Bestrafung nur dann, wenn er aus böser Absicht gehandelt hat.43 Vor allem aber muss die Strafe, um die Billigung des unparteiischen Zuschauers zu verdienen, ihrer Art und ihrem 40 41 42 43
58
Siehe TMS III.5.11-2, S. 161-3. Siehe TMS III.4.6, 158 und II.ii.2.1, S. 83. TMS II.ii.1.4, S. 79. TMS II.ii.1.4, S. 79.
Umfang nach in einem angemessenen Verhältnis zu der Schädigung stehen, die das Opfer erlittenen hat: Such actions [hurtful actions done from improper motives] seem to deserve, and … call aloud for, a proportionable punishment; and we entirely enter into, and thereby approve of, that resentment which prompts to inflict it.44
Täter, die aus böser Absicht Unschuldigen Schaden zufügen, verstoßen gegen das Prinzip der Gerechtigkeit. Opfer, die aus berechtigtem Groll nach einer Bestrafung der Täter verlangen, können sich auf dieses Prinzip berufen. Strafen, die Täter ver‐ dienen, dienen der Durchsetzung von Recht und Gerechtigkeit und damit dem Zu‐ sammenhalt einer Gesellschaft: Though man … be naturally endowed with a desire of the welfare and preservation of society, yet the Author of nature has not entrusted it to his reason to find out that a certain application of punishments is the proper means of attaining this end; but has endowed him with an immediate and instinctive approbation of that very application which is most proper to attain it.45
Nicht in der TMS, aber in den LJ spricht Smith auch von natürlichen Rechten („na‐ tural rights“46) jeder Person; dabei meint er das Recht jeder Person auf körperliche Unversehrtheit, auf seinen oder ihren Besitz, und darauf, keine Kränkungen zu er‐ fahren. Damit fügt er der Grundlage der Moral, wie er sie in der TMS präsentiert hatte, jedoch nichts wesentlich Neues hinzu. Das Interesse aller Menschen daran, keine Schädigung zu erfahren, hat seinen natürlichen Ursprung in ihrer Verletzlich‐ keit und Empfindlichkeit. Darüber hinaus ist keine und keiner von Natur aus wichti‐ ger oder weniger wichtig als jede und jeder andere. Die mutwillige Schädigung Un‐ schuldiger ist nicht zu entschuldigen, denn keine Unschuldige und kein Unschuldi‐ ger kann ihre oder seine Schädigung billigen; andernfalls würde sie oder er sich vor dem Täter erniedrigen, dem diese Schädigung – wie mittelbar auch immer – von Nutzen ist. Diesem Argument kann die Rede von natürlichen Rechten nichts We‐ sentliches hinzufügen. Der unparteiische Zuschauer, der im Namen der Moral urteilt, ist die Quelle poli‐ tischer Autorität; seine Billigung bestimmter Gesetze verleiht diesen normative Au‐ torität. Diese Autorität ist nicht absolut im räumlichen und zeitlichen Sinn. Sie gilt aber ausnahmslos und gleichermaßen für alle Bürgerinnen und Bürger einer be‐ stimmten Gesellschaft. Der unparteiische Zuschauer ist jedoch nicht die einzige Quelle von ausnahmslos und für alle gleichermaßen geltenden Gesetzen. Smith spricht dem Herrscher eines Staates auch eine von der Moral – und damit vom un‐ parteiischen Zuschauer – unabhängige Autorität zu, seine Untertanen zum Gehorsam 44 TMS II.i.4.4, S. 74. 45 TMS II.i.5.10, S. 77, Fußnote. 46 LJ i.24, S. 13.
59
zu verpflichten: Er kann Gesetze erlassen, die zu befolgen nicht zu den Forderungen eines unparteiischen Zuschauers gehören. Dabei ist ein Herrscher aber, so Smith, gut beraten, in seiner Gesetzgebung keine Willkür walten zu lassen, sondern sich an den kommutativen Prinzipien der Gerechtigkeit und an den spezifischeren moralischen Regeln zu orientieren, die auf induktiven Verallgemeinerungen berechtigter einzel‐ ner moralischer Urteile beruhen: When the sovereign commands what is merely indifferent, and what, antecedent to his orders, might have been omitted without any blame, it becomes not only blamable but punishable to disobey him. When he commands, therefore, what, antecedent to any such order, could not have been omitted without the greatest blame, it surely becomes much more punishable to be wanting in obedience. Of all the duties of a law-giver, however, this, perhaps, is that which it requires the greatest delicacy and reserve to execute with propriety and judgment. To neglect it altogether exposes the commonwealth to many gross disorders and shocking enormities, and to push it too far is destructive of all liberty, security, and justice.47 Every system of positive law may be regarded as a more or less imperfect attempt towards a system of natural jurisprudence, or towards an enumeration of the particular rules of justice. As the violation of justice is what we will never submit to from one ano‐ ther, the public magistrate is under a necessity of employing the power of the common‐ wealth to enforce the practice of this virtue.48
Alle Menschen neigen aufgrund einer natürlichen Disposition dazu, sich selbst wichtiger zu nehmen als alle anderen; wenn sie Groll empfinden und nach Vergel‐ tung verlangen, nehmen sie sich oft nicht die Zeit, erst einmal den unparteiischen Zuschauer zu konsultieren, wenn sie nicht ohnehin die Notwendigkeit einer solchen Konsultation übersehen. Und selbst wenn sie den virtuellen unparteiischen Zuschau‐ er, nämlich ihr Gewissen, befragen, neigen sie dazu, sich dabei zu betrügen – natür‐ lich zu ihren eigenen Gunsten. Smith betont, wie sehr Selbstbetrug einem angemes‐ senen moralischen Empfinden und Urteilen im Weg steht: This self-deceit, this fatal weakness of mankind, is the source of half the disorders of hu‐ man life. If we saw ourselves in the light in which others see us, or in which they would see us if they all knew all, a reformation would generally be unavoidable. We could not otherwise endure the sight.49
So wie Smith allen Menschen dazu rät, sich bei der moralischen Beurteilung ihrer selbst und bei der Planung ihrer Handlungen an allgemeinen moralischen Regeln zu orientieren, um der Gefahr des Selbstbetrugs vorzubeugen, so rät er auch allen Bür‐ gerinnen und Bürgern eines Staates dazu, sich an dessen Gesetze zu halten. Zu Opti‐ mismus, wie ihn ein Revolutionär für sich beanspruchen muss, zu dem Glauben da‐ 47 TMS II.ii.1.8, S. 81. 48 TMS VII.iv. 36, S. 340. 49 TMS III.4.7, S. 158 f.
60
ran, besser als alle anderen zu wissen, welche Gesetze zu erlassen seien und wie das Gemeinwohl am besten zu befördern sei, gibt es keinen Anlass. Diese Überzeugung Smiths kommt in seiner Kritik an dem „man of system“ zum Ausdruck, der von sei‐ nen eigenen Vorstellungen einer idealen Gesellschaft und eines idealen politischen Systems begeistert ist und in seiner Arroganz auch berechtigten Einwänden gegen diese Vorstellungen kein Gehör zu schenken bereit ist.50 Ein solcher „man of sys‐ tem“ kann eine Gesellschaft nur in die Irre führen, nicht zuletzt deshalb, weil er der „invisible hand“ misstraut, den Kräften zur Gestaltung und Entwicklung, die eine Gesellschaft unweigerlich freisetzt, insbesondere den Kräften eines freien Marktes.51 Eine vergleichbare „Arroganz“ wirft Smith souveränen Herrschern vor. Die Selbstüberschätzung in Sachen moralischer und politischer Gesetzgebung, zu der al‐ le Menschen wegen ihrer begrenzten Kenntnisse und Vorurteile neigen, wird bei de‐ nen, die in der Position eines souveränen Herrschers sind, zur echten Gefahr: (…) of all political speculators, sovereign princes are by far the most dangerous.52
Das ideale politische System wäre eines, in dem alle Gesetze moralisch gerechtfer‐ tigt sind, ein System, gegen das ein unparteiischer Zuschauer keinerlei Einwände hätte. In einer idealen moralischen Gesellschaft würden sich alle immer an diese Ge‐ setze halten, und auch der Herrscher würde sich nicht über diese stellen. Ein solches System ist nicht zu verwirklichen. Denn in der wirklichen Welt liegt es in der Hand von normalen Menschen, wie sie ihr Zusammenleben gestalten, und die sind in ihren intellektuellen und emotionalen Möglichkeiten zu beschränkt, um die Bedingungen eines idealen gesellschaftlichen Systems auch nur zu verstehen. Die jeweiligen Herr‐ scher sind auch nur Menschen. Diese Kritik darf aber nicht als Einladung zum Ver‐ stoß gegen die Gesetze eines Staates verstanden werden. Die Bürgerinnen und Bür‐ ger eines Staates sind zu ausnahmsloser Gesetzestreue verpflichtet, denn alles andere würde dem sozialen Unfrieden den Weg bereiten und wäre damit der zivilisatori‐ schen Entwicklung unzuträglich. Smiths Haltung zu politischer Herrschaft, wie es sie zu den verschiedenen Zeiten gegeben hat, und zu jedem aktuellen politischen System ist daher ambivalent. Zum einen spricht er sich dafür aus, dass ein Herrscher eine moralische Vision von einer Gesellschaft und ihren Gesetzen haben sollte: Some general, and even systematical, idea of the perfection of policy and law, may no doubt be necessary for directing the view of the statesman.53
Unabhängig von dem Inhalt der positiven Gesetze, die ein Herrscher erlässt, sollte er sich aber auf jeden Fall dem Prinzip eines Rechtsstaats verpflichtet fühlen, d. h., er 50 51 52 53
Siehe TMS VI.ii.2.17, S. 233 f. TMS IV.1.10, S. 184. TMS VI.ii.2.18, S. 234. TMS VI.ii.2.18, S. 234.
61
sollte jeden Gesetzesverstoß ahnden, unabhängig davon, wer ihn begangen hat. Denn es obliegt der Regierung eines Staates, dem Drang nach Rache Einhalt zu ge‐ bieten, den jede und jeder, die oder der sich unschuldig geschädigt fühlt, unweiger‐ lich verspürt. Smith spricht damit dem Herrscher und seinen politischen Institutio‐ nen das Gewaltmonopol zu; so heißt es an der bereits zitierten Stelle der TMS wei‐ ter: (…) the public magistrate is under a necessity of employing the power of the common‐ wealth to enforce the practice of this virtue. Without this precaution, civil society would become a scene of bloodshed and disorder, every man revenging himself at his own hand whenever he fancied he was injured.54
Normative, moralische Unzulänglichkeiten eines politischen Systems sind unver‐ meidbar. Aber daraus erwächst, so Smith, kein Recht der Bürgerinnen und Bürger des Staates, sich nicht an dessen Gesetze zu halten. Die uneingeschränkte Autorität politischer Gesetze begründet Smith nicht moralisch, sondern funktional: Jede politi‐ sche Ordnung, solange sie nur rechtsstaatlich ist, ist besser als gar keine politische Ordnung, denn sie ist eine notwendige Bedingung für zivilisatorischen und ökono‐ mischen Fortschritt.
5. Fazit Smiths Moralphilosophie redet zwei allgemeinen Prinzipien das Wort: Dem Prinzip, das verbietet, Unschuldigen zu schaden, und dem Prinzip der Gleichheit aller Men‐ schen. Das erste Prinzip offenbart sein kommutatives Verständnis von Gerechtigkeit. Das zweite Prinzip ist kein eigentlich moralisches Prinzip, denn seine Begründung ist epistemisch. Jeder Handelnde, sofern er überhaupt die intellektuellen und emotio‐ nalen Bedingungen dafür erfüllt, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, muss bereit sein, sich in einem Sympathieverfahren seinen Kritikerinnen und Kriti‐ kern – tatsächlichen und vermeintlichen Opfern und Zuschauern – zu stellen. Das bedeutet nichts anderes, als dass er bereit sein muss, sich gegenüber anderen zu ver‐ antworten. Dabei darf er nicht selektiv sein und bestimmten Personen eine Teilnah‐ me am Sympathieverfahren verweigern. Der Wahrheitsanspruch, der mit jedem mo‐ ralischen Urteil verbunden wird, ist nicht relativ, er ist nicht eingeschränkt auf be‐ stimmte Personen oder Gruppen, die bestimmte kulturelle Gemeinsamkeiten und Vorurteile miteinander verbindet. Smith gesteht dem Herrscher eines Staates zu, Gesetze zu erlassen und deren Be‐ folgung allen Bürgerinnen und Bürgern aufzuerlegen. Dabei ist der Gesetzgeber gut beraten, aber nicht absolut verpflichtet, sich nach dem moralischen Urteil des unpar‐ 54 TMS Vii.i.v. 36, S. 340.
62
teiischen Zuschauers zu richten. Fleischackers Bedenken, Smiths würde mit seiner Moraltheorie einem politischen Herrscher und Gesetzgeber keine hinreichend engen moralischen Grenzen setzen, sind also naheliegend. Es wäre aber ein Irrtum, Smith zu unterstellen, mit seiner Anerkennung gesetzgeberischer Autorität auch jenseits der Moral politischer Willkür Tür und Tor zu öffnen. Denn man muss Smiths Moral‐ theorie im Zusammenhang mit seiner Beschreibung zivilisatorischer Entwicklungs‐ prozesse und historischer Herrschaftsformen sehen. Da der Motor dieser histori‐ schen Prozesse in der menschlichen Selbstliebe und in ihrem Wunsch nach ständig steigendem Wohlstand liegt, nicht aber in ihrem Streben nach mehr politischer Ge‐ rechtigkeit, kann er dem unparteiischen Zuschauer, der mit der Stimme der Moral spricht, nur eine Funktion kritischer Beratung zugestehen. Darüber hinaus vertraut Smith auf die normative Kraft des Faktischen, insbesondere der faktischen zivilisa‐ torischen Entwicklung. Diesem Vertrauen liegt jedoch kein naturalistischer Fehl‐ schluss zugrunde. Denn er hält das Faktische nicht als solches für eine Quelle legiti‐ mer Autorität. Ebenso wenig versteht er das Faktische als etwas, das jeder politi‐ schen Veränderung und Verbesserung beharrlichen Widerstand leistet; sondern er versteht es als etwas, das eine Eigendynamik entfaltet, als Ursprung einer Kraft zur Veränderung. Denn zu dem Faktischen gehören alle Menschen mit ihren eigenen In‐ teressen, und die werden sich langfristig keinem politischen System unterwerfen, dass dem zivilisatorischen Fortschritt entgegensteht. Das Ziel dieser Veränderung ist nicht die ideale moralische Gesellschaft; aber ihre Kraft setzt willkürlicher Gesetz‐ gebung durch einen Herrscher, der nicht auf die Stimme des unparteiischen Zu‐ schauers hört, gewisse Grenzen. Und innerhalb dieser Grenzen kann und wird auch der unparteiische Zuschauer Gehör finden. Schließlich liegt die Moral, die zu be‐ rücksichtigen er vom Gesetzgeber fordert, im Interesse aller Menschen. In diesem Zusammenhang ist Smiths Kritik an der Sklaverei besonders interes‐ sant.55 Fleischacker wirft Smith vor, sich zwar gegen die Institution der Sklaverei ausgesprochen zu haben, diese aber nicht aus moralischen, sondern aus ökonomi‐ schen Gründen abzulehnen.56 Dass Smith ökonomische Gründe gegen die Sklaverei geltend macht, bedeutet jedoch nicht, dass er sie nicht auch moralisch verurteilt. Schließlich kann kein Sklavenhalter einen unparteiischen Zuschauer davon überzeu‐ gen, dass Sklaverei einem Menschen zuzumuten sei. Ein Unparteiischer muss auch im Namen der Sklaven sprechen. Auch für Sklaven gilt, dass materielle Sorglosig‐ keit und Freiheit für das Glück eines Menschen unverzichtbar sind.57 Wenn Smith Einwände gegen die Sklaverei erhebt, dann spricht er nicht als Moralphilosoph, son‐ dern als moralisch versierter politischer Berater. Ein solcher Berater weiß, was die 55 LJ iii.105-117, S. 183-7. 56 Siehe Fleischacker 2004, S. 158-61. 57 Siehe LJ iii.111, S. 185: „Opulence and freedom, the two greatest blessings men can pos‐ sess ...“.
63
Menschen wirklich bewegt, nämlich der sozio-ökonomische Fortschritt. Wenn er al‐ so darauf hinweist, dass Sklaverei aus ökonomischen Gründen abzulehnen sei, dann kann er damit rechnen, nicht nur bei den Sklaven, sondern auch bei den Sklavenhal‐ tern Gehör zu finden. Um die Zustimmung der Sklaven braucht er sich nicht zu sor‐ gen, aber diejenigen, um deren ökonomische Interessen es geht, sind eher mit öko‐ nomischen als mit moralischen Argumenten zu überzeugen.
Literatur Brown, Vivienne, 1994: Adam Smith’s Discourse. Canonicity, commerce and conscience. London/New York. Fleischacker, Samuel, 2004: On Adam Smith’s “Wealth of Nations”. Princeton/Oxford. Fleischacker, Samuel, 2012: Sympathy in Hume and Smith: A Contrast, Critique, and Re‐ construction. In: Fricke, Christel / Føllesdal, Dagfinn (Hrsg.): Intersubjectivity and Objec‐ tivity in Adam Smith and Edmund Husserl. A Collection of Essays. Frankfurt usw., S. 271-309. Fricke, Christel, 2011: Adam Smith and the Most Sacred Rules of Justice. In: The Adam Smith Review 6, S. 46-74. Fricke, Christel, 2012: Overcoming Disagreement: Adam Smith and Edmund Husserl on Strategies of Justifying Descriptive and Evaluative Judgments. In: Fricke, Christel / Følles‐ dal, Dagfinn (Hrsg.): Intersubjectivity and Objectivity in Adam Smith and Edmund Hus‐ serl. A Collection of Essays. Frankfurt usw., S. 171-241. Fricke, Christel, 2013: The Sympathetic Process and the Origin and Function of Conscience. In: Berry, Christopher / Smith, Craig / Paganelli, Maria Pia (Hrsg.): The Oxford Handbook of Adam Smith. Oxford, S. 177-200. Fricker, Miranda, 2007: Epistemic Injustice. Power and the Ethics of Knowing. Oxford. Griswold, Charles L., 1999: Adam Smith and the Virtues of Enlightenment. Cambridge. Haakonssen, Knud, 1981: The Science of a Legislator. The Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith. Cambridge. Hill, Lisa, 2016: Adam Smith and Political Theory. In: Hanley, Ryan Patrick (Hrsg.) Adam Smith. His Life, Thought, and Legacy. Princeton/Oxford. Hume, David, 1987: Of the First Principles of Government. In: Miller, E. F. (Hrsg.): David Hume, Essays Moral, Political and Literary. Indianapolis. Janoff-Bulman, Ronnie, 1992: Shattered Assumptions: Towards a New Psychology of Trau‐ ma. New York. Lamb, Sharon, 1996: The Trouble with Blame. Cambridge (Mass.)/London. Lerner, Melvin, 1980: The Belief in a Just World. A Fundamental Delusion. New York/ London. Pinker, Steven, 2011: The Better Angels of our Nature. Why Violence has Declined. London. Sagar, Paul, 2018: The Opinion of Mankind. Sociability and the Theory of the State from Hobbes to Locke. Princeton/Oxford. Schliesser, Eric, 2017: Adam Smith. Systematic Philosopher and Public Thinker. Oxford.
64
Sen, Amartya, 2009: The Idea of Justice. London. Smith, Adam, 1759/1790/1976: The Theory of Moral Sentiments. Indianapolis. Smith, Adam, 1776/1982: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Indianapolis. Smith, Adam, 1982: Lectures on Jurisprudence. Indianapolis. Winch, Donald, 1978: Adam Smith’s Politics. Cambridge.
65
Heinz D. Kurz Adam Smith über das Merkantil- und das Agrikultursystem*
Politische Ökonomie, als Teil der Kunst des Staatsmannes oder Gesetzgebers verstanden, ... setzt sich zum Ziel, sowohl die Bevölkerung als auch den Herrscher reicher zu machen. (WN IV.1)
1. Einführung Das in neun Kapitel unterteilte Buch IV von Adam Smiths magnum opus, An In‐ quiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations ([1776] 1976 b), ist den alternativen „Systemen der politischen Ökonomie“ gewidmet.1 Es umfasst 261 Sei‐ ten (WN S. 428-688) und ist damit fast gleich lang wie das der theoretischen Grund‐ legung seiner Auffassung gewidmete Buch I (WN S. 13-275) und das den Staatsfi‐ nanzen gewidmete Buch V (WN S. 689-947). Es ist mehr als zweieinhalb Mal so lang wie Buch II (WN S. 276-375), das sich mit der Kapitalakkumulation befasst, und annähernd fünf Mal so lang wie Buch III (WN S. 376-427), das ausgewählte Kapitel der Wirtschaftsgeschichte diskutiert. Wenn die Länge eines Buches die Be‐ deutung der darin behandelten Sache widerspiegeln sollte, dann verdient Buch IV große Aufmerksamkeit. Dies bestätigt sich im vorliegenden Fall.2 Smith kennt im Wesentlichen nur zwei alternative Systeme der politischen Öko‐ nomie – das Kommerz- oder Merkantilsystem und das physiokratische oder Agrikul‐
* Ich greife im vorliegenden Aufsatz wiederholt auf alleine von mir oder zusammen mit Richard Sturn verfasste bzw. von mir edierte Arbeiten zurück; vgl. Kurz 1991, 2015, 2016 b und Kurz/ Sturn 2013 a, 2013 b. Zur Würdigung des Smithʼschen Werkes vgl. unter anderem Aspromourgos 2009. Zur Einordnung des Smithʼschen Werks in einen größeren theoriegeschichtlichen Zusammenhang vgl. Aspromourgos 1996 und Kurz 2016 a. Hendrik Hansen und Tim Kraski danke ich für die Durchsicht des Manuskripts und nützliche Anmerkungen. 1 Die Smithʼschen Werke werden hier nach der Glasgow Edition of the Works and Correspon‐ dence of Adam Smith zitiert (Smith 1976 a, b und c). Die deutschen Übersetzungen der zitierten Stellen aus dem WN stammen von Monika Streissler (siehe Smith 1999). 2 Zahlreiche der im Wealth und so auch in Buch IV zu findenden Aussagen werden in den Lec‐ tures on Jurisprudence (LJ) (Smith 1976 c), einige auch in der Theory of Moral Sentiments (TMS) (Smith 1976 a) antizipiert. Vgl. hierzu auch Campbell/Skinner 1976.
67
tursystem. Von den neun Kapiteln beziehen sich acht auf das erste und nur eines auf das zweite. Buch IV hat vor allem folgende Aufgaben: 1. Es konfrontiert das Smithʼsche System mit den von ihm wahrgenommenen alter‐ nativen Systemen und notiert Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Smith misst die anderen Systeme mit der Elle des eigenen, die er als richtig geeicht unter‐ stellt. Große Teile seiner Ausführungen sind daher der Rekapitulation und Poin‐ tierung wichtiger Sätze des eigenen Systems und deren Konfrontation mit den korrespondierenden Sätzen der anderen Systeme gewidmet. Buch IV enthält ei‐ nige der berühmtesten Passagen des Wealth, darunter jene über die Wirkungswei‐ se der „unsichtbaren Hand“. 2. Es bleibt nicht bei einer Konfrontation unterschiedlicher theoretischer Ansätze. Buch IV versucht auch, die aus den verschiedenen Lehren abgeleiteten Wirt‐ schafts-, Handels- und Steuerpolitiken nach ihren jeweiligen Wirkungen zu beur‐ teilen, um abzuschätzen, wie nützlich bzw. schädlich sie sind. Gleich zu Beginn des vierten Buches benennt Smith die Kriterien seiner diesbezüglichen Beurtei‐ lung: „Politische Ökonomie, als Teil der Kunst des Staatsmannes oder Gesetzge‐ bers verstanden, setzt sich zwei verschiedene Ziele: Erstens der Bevölkerung reichliches Einkommen oder reichlichen Unterhalt zu verschaffen oder, genauer gesagt, es ihr zu ermöglichen, sich selbst ein solches Einkommen oder einen sol‐ chen Unterhalt zu verschaffen, und zweitens, für den Staat oder das Gemeinwe‐ sen ein Einkommen zu schaffen, das ausreicht, um die öffentlichen Dienstleis‐ tungen zu bestreiten. Sie setzt sich zum Ziel, sowohl die Bevölkerung als auch den Herrscher reicher zu machen.“3 Das Ausmaß, in dem dies gelingt oder miss‐ lingt, fällt das Urteil über die Güte des zugrundeliegenden Systems der politi‐ schen Ökonomie. 3. In letzter Instanz dient das Buch dem Nachweis der Überlegenheit des Smithʼschen Systems, wobei er das Merkantilsystem in beinahe jedweder Bezie‐ hung für falsch erachtet, das Agrikultursystem indes für zwar „sehr geistvoll“ (very ingenious)4, aber sowohl einseitig als auch unvollständig. Das eigene System entwickelt Smith in den Büchern I, II und V. Die Struktur des Wealth überrascht insofern, als man erwarten könnte, dass Buch IV erst im An‐ schluss an die genannten Bücher und vor dem der Wirtschaftsgeschichte gewidme‐ ten Buch III zu liegen kommt. Da jedoch alle der von Smith für besonders bedeu‐ tend gehaltenen Sätze in immer neuen Formulierungen und Zusammenhängen über den gesamten Wealth hinweg wiederkehren, stellt die eigenwillige Architektur seines Werks kein wirkliches Problem dar.
3 WN IV.1; Hervorhebung HDK. 4 WN IV.ix.2.
68
Wir beginnen mit einer kurzen Darstellung der im vorliegenden Zusammenhang besonders wichtigen Sätze seines theoretischen Systems – seines „Modells“, so Campbell und Skinner, die schreiben: „The components of the ‘model’ are of course the sectors, the classes, and the individuals whose pursuit of gain contributes to the effective working of the whole.“5 Abschnitt 2 behandelt Smiths Sicht der verschie‐ denen Typen von Akteuren und gesellschaftlichen Klassen. Abschnitt 3 wendet sich seiner Vorstellung von der unterschiedlichen Wertschöpfungskapazität der verschie‐ denen Wirtschaftssektoren zu. Abschnitt 4 befasst sich näher mit seiner Kritik des Merkantilsystems, dessen hauptsächliche Architekten selbstsüchtige Kaufleute und Handeltreibende sind. Abschnitt 5 wirft einen kurzen Blick auf seine Sicht des Agri‐ kultursystems. Abschnitt 6 enthält eine Schlussbemerkung.
2. Smiths System als Norm (I): Akteure und Klassen Smith dient das eigene System als Norm sowohl bei der Einschätzung der theoreti‐ schen Sätze der alternativen Entwürfe als auch der daraus abgeleiteten Wirtschafts‐ politiken. Dabei lässt er von Anbeginn seiner Auseinandersetzung an keinen Zweifel daran, dass die alternativen Entwürfe, insbesondere das Merkantilsystem, irrefüh‐ rend und unvollständig sind, es ihnen an Kohärenz mangelt und zahlreiche der wirt‐ schaftspolitischen Maßnahmen einer tieferen und schlüssigen Begründung entbeh‐ ren. Diese Systeme bedienen vor allem Partikularinteressen, geben sich aber in irre‐ führender Weise als im Allgemeininteresse stehend aus. Eine der vornehmsten Auf‐ gaben der politischen Ökonomie ist die Entlarvung derartiger Täuschungsversuche, und so sehen wir Adam Smith mit gelegentlich fast kriminalistischer Energie am Werk. Was aber sind die wichtigsten Postulate des Smithʼschen Systems bzw. welche Postulate werden gemeinhin dafür gehalten, und stimmen die beiden Versionen mit‐ einander überein? Smiths Analyse, heißt es, basiert zu allererst auf dem Satz: 1. Der einzelne Akteur weiß im Allgemeinen besser als irgendjemand anderes, ein‐ schließlich des Staates und seiner Organe, was ihm gut tut und was nicht, was ihn reicher macht und was ärmer. Nur der Einzelne sollte daher grundsätzlich be‐ fugt sein, sein Schicksal zu bestimmen, indem er sein Eigeninteresse verfolgt. (Offensichtliche Ausnahmen sind noch nicht oder nicht mehr Zurechnungsfähi‐ ge.) Das „System der natürlichen Freiheit“ hat diese Möglichkeit zu sichern. Das Haupt‐ augenmerk gilt dabei dem Aktionsraum und Handlungen der aufstrebenden Klasse der Eigentümer von Real-, Handels- und Geldkapital. Im vorliegenden Zusammen‐ 5 Campbell/Skinner 1976, S. 34.
69
hang kreist Smiths Denken vor allem um diese Klasse. Der Grund liegt auf der Hand: Sie sind zum einen das Treibrad des Neuen und der sozio-ökonomischen Ent‐ wicklung, zum anderen gefährden sie auf Grund ihrer Selbstsucht und Gewinngier eine allseits gedeihliche gesellschaftliche Entwicklung. Sie stehen hinter der von Smith für äußerst schädlich gehaltenen Merkantilpolitik, sind im Verbund mit Politi‐ kern und Beamten dessen Architekten, und einzelne unter ihnen profitieren von ihr auf Kosten des Rests der Gesellschaft. Sie steigern ihre Gewinne nicht so sehr über „Verbesserungen“ (improvements), das heißt Innovationen, sondern über das Ergat‐ tern von Privilegien und Monopolpositionen. Durch sie steht ein grundsätzlich wachsende Summen – ein steigendes Sozialprodukt pro Kopf – aufweisendes „Spiel“ in Gefahr, zu einem Nullsummenspiel zu degenerieren. Merkantile Be‐ schränkungen und Förderungen verfolgen die Absicht, das Kapital eines Landes in andere Bahnen zu lenken als jene, die zahlreiche seiner Eigentümer vorziehen wür‐ den. Dies aber beinhaltet eine Wissensanmaßung, denn wo das Kapital am günstigs‐ ten anzulegen ist, „kann offensichtlich jeder einzelne an seinem Platz viel besser be‐ urteilen, als ein Staatsmann oder Gesetzgeber das für ihn tun könnte.“6 Und an ande‐ rer Stelle heißt es: „Keine menschliche Weisheit oder Wissen könnten jemals ausrei‐ chen, um Fleiß und Geschäftssinn von Privatpersonen zu überwachen und sie in jene Beschäftigungen zu lenken, die am günstigsten für das Interesse der Gesellschaft sind.“7 Was der Staatsmann jedoch tun kann und tun sollte, ist den Einfluss der Kaufleute und Handeltreibenden auf die Gesetzgebung zu verringern, denn deren Sehnen und Trachten gelte der Einschränkung der Konkurrenz und der Bildung von Monopolen. Satz 1 ist von den späteren Vertretern einer ultraliberalen Auffassung mit einem im letzten Zitat bereits anklingenden Postulat Smiths verknüpft worden, bekannt als Lehre vom Wirken einer „Unsichtbaren Hand“. Diese besagt in der von Vertretern dieser Auffassung verbreiteten Version: 2. In Verfolgung ihrer Interessen sorgen die Akteure nicht nur bestmöglich für ihr eigenes Wohl, sondern befördern auch, ohne es zu beabsichtigen und zu wissen oder überhaupt wissen zu können, das Gemeinwohl. Oder, wie Schotter schreibt, „nothing but selfishness is necessary to yield socially beneficial outcomes.“8 So lautet die vorherrschende Deutung Smiths. Aber trifft sie zu? Nein. Den genauen Wortlaut dessen, was Smith sagt, gilt es zu beachten. Tatsächlich lesen wir im Wealth unter expliziter Bezugnahme ausschließlich auf die Handlungen der Klasse der Kapitaleigner und Investoren Folgendes. Nachdem er erläutert hatte, dass das Risiko der Kapitalanlage mit der Entfernung zur Heimat überproportional ansteigt 6 WN IV.ii.10. 7 WN IV.ix.51; Hervorhebung HDK. 8 Schotter 1985, S. 2.
70
und deshalb die Anlage daheim im Allgemeinen vorzuziehen sei, schreibt Smith: „Da also jeder einzelne danach trachtet, sein Kapital möglichst im heimischen Ge‐ werbe einzusetzen, und dieses Gewerbe so auszurichten, daß die größte Wertschöp‐ fung erfolgt, arbeitet jeder einzelne notwendigerweise darauf hin, das jährliche Volkseinkommen möglichst groß zu machen.“ Dabei gehe es dem Investor nur „um seine eigene Sicherheit“ und „um seinen eigenen Vorteil“. Aber dadurch, dass er die Wertschöpfung eines Landes steigert, „wird er, wie in vielen anderen Fällen auch, von einer unsichtbaren Hand geleitet, einem Zweck zu dienen, der nicht in seiner Absicht lag.“ Smith fährt fort: „Indem er sein eigenes Interesse verfolgt, fördert er häufig das der Gesellschaft wirksamer, als wenn er sich wirklich vornimmt, es zu fördern.“9 Die gängige Deutung übersieht die hervorgehobenen Passagen im Zitat. Diese machen darauf aufmerksam, dass der positive Zusammenhang von Einzel- und All‐ gemeininteresse nicht immer gilt. Weit wichtiger noch: Sie übersieht die implizite Prämisse des Smithʼschen Arguments, die lautet, dass die „häufige“ Konkordanz der beiden nur in einer wohl geordneten und „gut regierten Gesellschaft“10 zu erwarten ist. Wenn aber selbst auf eine solche Gesellschaft die gängige Deutung nicht voll‐ kommen zutrifft, um wie viel schlechter muss es dann um deren Gültigkeit bestellt sein, wenn die Gesellschaft schlecht regiert wird! Offenbar gar nicht oder nur aus‐ nahmsweise. Dies wird gemeinhin übersehen. Das Konzept der „gut regierten Ge‐ sellschaft“ begegnet dem Leser dabei gleich zu Beginn des Wealth, und Smith betont ausdrücklich, dass die „science of the legislator“ – die politische Ökonomie – den vielleicht bedeutendsten wissenschaftlichen Beitrag zu leisten hat, um eine die je‐ weiligen historischen Umstände und Erfahrungen berücksichtigende Konzeption gu‐ ter Regierung zu definieren. Wir werden weiter unten sehen, dass es sich hierbei um ein Unterfangen handelt, das alles andere als trivial ist, gerade weil die Selbstsucht Einzelner immer und überall bestrebt ist, sich durchzusetzen und zu diesem Zweck alle Register zieht und erfinderisch macht. Ihre dunklen Seiten zu bändigen, ist da‐ her keine ein für alle Mal zu erledigende Aufgabe, sondern beständige Herausforde‐ rung: Sie muss auf immer neue Tricks und Schliche selbstsüchtiger und rücksichts‐ loser Akteure reagieren und kann sich daher nie zur Ruhe setzen. Smith wird folglich völlig zu Unrecht in der zitierten Weise gedeutet, und zwar sowohl von zahlreichen seiner Anhänger als auch seiner Kritiker.11 Die Sätze 1 und 2 sind die Kernsätze aller wirtschaftsliberalen bis libertären Auffassungen. Wel‐ che Rolle könnte der öffentlichen Hand noch zukommen, sollten sie sich als zutref‐ fend erweisen? Offenbar gar keine. Tatsächlich hätte sich Smith die Mühe der Ab‐ fassung des Wealth ersparen können – einer Wissenschaft für den Gesetzgeber be‐ 9 WN IV.ii.9; Hervorhebungen HDK. 10 WN I.i.10. 11 Vgl. z. B. Foley 2006.
71
darf es nicht, denn es gibt nichts zu regeln, zu lenken, zu steuern, zu fördern und zu verhindern. Die Wirtschaft ist dieser Sicht zufolge ein sich in optimaler Weise selbst steuerndes System. Die gängige Deutung führt das Smithʼsche Forschungsprogramm ad absurdum und läuft letztlich auf die These hinaus, die politische Ökonomie sei (oder werde) überflüssig. Allein, die Deutung ist nicht haltbar. Die Wirtschaft erzeugt nicht unter allen Umständen gesamtgesellschaftlich zufriedenstellende oder gar optimale Ergeb‐ nisse. Insbesondere sind die erzielten Resultate nicht notwendigerweise gerecht, sondern benachteiligen Gruppen oder ganze Klassen der Gesellschaft. Wie Smith nicht müde wird zu betonen, kommt eine Gesellschaft auf Dauer nicht ohne ein ge‐ wisses Maß an Gerechtigkeit aus, welches Voraussetzung gesellschaftlicher Stabili‐ tät ist. Eine gute Gesellschaft verwirklicht die Grundsätze von „Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit“12. Das Merkantilsystem aber verstößt gegen diese Grundsätze. Es verstößt gegen den Grundsatz der Gleichheit, indem es einige Akteure privile‐ giert und mit Sonderrechten ausstattet, gegen den Grundsatz der Freiheit, indem es den Akteuren ihre Handlungsoptionen willkürlich beschneidet, und gegen den Grundsatz der Gerechtigkeit, indem es eine Verteilung von Einkommen, Vermögen und Lebenschancen allgemein bewirkt, die zum Nachteil bedeutender Gruppen der Gesellschaft sind. Es verlangsamt den Prozess des Wachstums des Reichtums einer Gesellschaft und verteilt das kleinere Produktionsergebnis in ungerechter Weise. Smiths tiefe Gegnerschaft gegen das Merkantilsystem und dessen etatistische Orien‐ tierung bedarf danach, so scheint es, keiner weiteren Erklärung. Aber bedeutet sie auch die Ablehnung des Staates als bedeutendem Akteur in der modernen Gesell‐ schaft, wie es die Smith gleichfalls zugeschriebene Idee eines minimalen oder „Nachtwächterstaates“ nahelegt? Offenbar nein. Smith wünscht sich einen anderen Staat, keinen Obrigkeitsstaat, sondern einen modernen Rechts- und Leistungsstaat.13 Die bisherige Diskussion sollte klar gemacht haben, dass die Interpretation gewis‐ ser, besonders hervorstechender Passagen im Wealth vernünftigerweise nur vor dem Hintergrund des ganzen Werks oder jedenfalls größerer Teile desselben möglich ist. Andernfalls kann einem der Vorwurf selektiver Wahrnehmung nicht erspart werden, und tatsächlich ist er dem Gros der Rezipienten von Adam Smith zu machen. Kurz gesagt: Weder vertritt Smith die Auffassung, wie wir gleich sehen werden, dass alle Akteure ihre Interessen kennen, noch dass sie diese, sollte es sich anders verhalten, immer erfolgreich zu verfolgen imstande sind, noch dass das Zusammenspiel eigen‐ interessierter Akteure immer ein gesellschaftlich vorteilhaftes Resultat zeitigt. Um dies zu sehen, müssen wir uns den Individuen zuwenden. Diese sind, so Smith, über Herkunft, Umgang, Ausbildung usw. sozial konditioniert und können nach Maßgabe ihrer Informiertheit und ihres Wissens sowie der Fähigkeit, dieses zu nutzen, in drei 12 WN IV.iv. 13 Kurz/Sturn 2013 a, S. 152-161.
72
Klassen eingeteilt werden. Diese Einteilung entspricht bemerkenswerterweise weit‐ gehend derjenigen nach ihrem Vermögen – den Grund und Boden, Bergwerke, Wäl‐ der und Teiche besitzenden Feudalherren, den physisches, Geld- oder Handelskapital besitzenden Kapitaleignern und den im Wesentlichen nur ihre Arbeitskraft besitzen‐ den Arbeitern.14 Zunächst zur weitaus größten Klasse der Gesellschaft, den „sich abrackernden Armen“, den Arbeitern. Können sie in dem von Smith propagierten „System der na‐ türlichen Freiheit“ ihre Interessen wirksam vertreten? Nur wenn dies der Fall ist und sich ihre Lage verbessert, kann von gesellschaftlichem Fortschritt gesprochen wer‐ den. Denn das Interesse der Arbeiter, betont Smith, ist „eng mit dem Interesse der Gesellschaft verbunden.“15 Aber versteht der Arbeiter überhaupt, was sein Interesse ist, und wenn ja, ist er imstande es erfolgreich zu vertreten? Smith verneint beide Teilfragen: „Seine Lage lässt ihm [dem Arbeiter] keine Zeit, sich das nötige Wissen anzueignen, und seine Bildung und Gewohnheiten sind üblicherweise so, dass er zu einem Urteil auch dann unfähig wäre, wenn er all dieses Wissen hätte.“ Smith schließt: „In öffentlichen Beratungen wird daher seine Stimme wenig gehört und noch weniger beachtet, außer bei ganz bestimmten Gelegenheiten, wenn ihn seine Arbeitgeber in seinen Klagen aneifern, bestärken und unterstützen – nicht für seine, sondern für ihre eigenen und besonderen Zwecke.“16 Der Arbeiter, so Smiths Be‐ fürchtung, ist ständig in Gefahr, manipuliert zu werden. Wenn sich der Arbeiter im System der natürlichen Freiheit gleichwohl im Allgemeinen besser stellt als in ande‐ ren Systemen, dann wegen des systemischen Gesamtzusammenhangs und dessen dynamischen Eigenschaften. Diese beinhalten eine vergleichsweise hohe Akkumula‐ tionstätigkeit der Kapitaleigner, damit einen Bedarf an „Händen“, der schneller wächst als die Bevölkerung, und infolgedessen steigende Reallöhne. Die Funktions‐ logik des Systems verhindert, dass den Arbeitern ihr Mangel an Verständnis und Durchsetzungsvermögen nicht noch stärker zum Verhängnis wird. Die Grundeigentümer, schreibt Smith, ein Bibelwort zitierend, „ernten [wie die Vögel], wo sie nie gesät haben.“17 Angesichts des stark konzentrierten Bodeneigen‐ tums nennt er die Rente einen „Monopolpreis“. Da mit der wirtschaftlichen Ent‐ wicklung die relative Knappheit des Bodens zunimmt, tendiert die reale Bodenrente dazu zu steigen. Das Interesse der Grundherren, so Smith, ist damit ähnlich wie das der Arbeiter eng mit dem allgemeinen Interesse der Gesellschaft verbunden. Aber den Bodenbesitzern entgeht dieser Umstand. Sie wären zwar auf Grund ihrer Bil‐ dung, ihres gesellschaftlichen Umgangs und ihrer politischen Stellung grundsätzlich dazu geeignet, ihre eigenen Interessen und diejenigen des Gemeinwesens zu begrei‐ 14 15 16 17
Vgl. zum Folgenden auch Kurz 2015 und 2016 b. WN I.xi.p.9. WN I.xi.p.9. WN I.vi.8.
73
fen. Aber wem sein Einkommen „gleichsam von allein zufällt“, wird träge und schließlich „unfähig zu der geistigen Anstrengung, die notwendig wäre, um die Fol‐ gen einer staatlichen Maßnahme vorherzusehen und zu verstehen.“18 Vermögend wie sie sind, könnten sie zwar sparen und investieren sowie technische und organisa‐ torische Neuerungen durchführen, aber nur die wenigsten tun dies. Die meisten sind feudalen Lebensformen verhaftet und wetteifern mittels Formen auffälligen Kon‐ sums miteinander: Sie verprassen die Grundrente allein oder mit ihresgleichen. Sie sind nicht Förderer, sondern Nutznießer des Fortschritts von Wirtschaft und Gesell‐ schaft und stehen damit in einem Spannungsverhältnis zu den beiden anderen Klas‐ sen der Gesellschaft. Schließlich die aufstrebende Klasse der Kaufleute, Fabrikherren und Geldbesitzer (Bankleute und Financiers). Smiths Urteil über sie ist ambivalent. Zwar kennen sie ihre Interessen weit besser als die Grundherren und erst recht die Arbeiter die ihri‐ gen. Ein ganzes Leben lang damit beschäftigt, „Pläne und Projekte“ zu schmieden, sind ihr Verstand und analytischer Sinn geschärft, und ihre Durchsetzungskraft er‐ laubt es ihnen, die eigenen Interessen wirksam zu verfolgen. Schlau und gewitzt wie sie sind, gelingt es ihnen immer wieder, ihre Partikularinteressen als im Allgemein‐ interesse stehend auszugeben und so auch die Unterstützung von Mitgliedern der an‐ deren Klassen zu erhalten. Wie schon Thomas Hobbes betonte, steigt die Macht einer Person mit der Zahl derer, die deren Sache zu der ihren machen. Aber, warnt Smith, das Interesse der Kaufleute und Fabrikherren ist demjenigen der Gesellschaft insgesamt häufig „entgegengesetzt“. Beseelt vom „elenden Monopolgeist“ seien die „Masters“ darauf aus, den Wettbewerb einzuschränken – zum eigenen Vorteil und zum Nachteil aller anderen. Ihren wirtschaftspolitischen Empfehlungen sei daher mit Misstrauen zu begegnen: „Jeder Vorschlag einer neuen Vorschrift oder Maßnahme im Handel, der von dieser Klasse kommt, sollte stets mit großer Vorsicht angehört werden und nie ohne lange und sorgfältige Prüfung – nicht nur mit gewissenhaftes‐ ter, sondern mit argwöhnischer Aufmerksamkeit – angenommen werden.“ Denn, so Smith weiter, „er kommt von einer Klasse von Personen, deren Interesse niemals ge‐ nau das gleiche wie das Allgemeininteresse ist, Personen, die in der Regel ein Inter‐ esse haben, die Allgemeinheit zu täuschen und unter Druck zu setzen, und sie dem‐ entsprechend auch bei vielen Gelegenheiten sowohl getäuscht als auch unter Druck gesetzt haben.“19 Dieses harsche Urteil wird im Wealth durch eine Fülle von Hinweisen auf die selbstsüchtigen Handlungen dieser Klasse von Menschen belegt. Tatsächlich begreift Smith sie als die „bei weitem wichtigsten Architekten“ des Merkantilsystems.20 Sie wirken auf die Politik im Sinne ihrer Partikularinteressen ein und haben sich in zahl‐ 18 WN I.xi.p.8. 19 WN I.xi.p.10. 20 WN IV.viii.54.
74
reichen Ländern die öffentliche Hand dienstbar gemacht. Von ihnen geht eine ständi‐ ge Gefahr aus. Ihre Bekenntnisse zu Markt und Konkurrenz sind heuchlerisch – denn tatsächlich sind sie vom elenden Monopolgeist beseelt. Unaufhörlich streben sie danach, den Wettbewerb einzuschränken, Privilegien vom Gesetzgeber zugespro‐ chen zu bekommen und dauerhaft abzusichern und sich mittels geheimer Abspra‐ chen auf Kosten anderer zu bereichern. „Wir hören“, schreibt Smith, „selten von Absprachen der Arbeitgeber, hingegen häufig von denen der Arbeiter. Wer aber deshalb glauben wollte, daß Arbeitgeber sich selten absprechen, weiß über die Welt sowenig Bescheid wie über dieses Thema. Arbeitgeber befinden sich immer und überall in einer Art stillschweigender, aber fortwährender und gleichbleibender Absprache, die Arbeitslöhne nicht [zu erhöhen]. ... Selten freilich hören wir von einer derartigen Abspra‐ che; denn sie ist der übliche und sozusagen natürliche Zustand der Dinge, von dem nie‐ mand je etwas hört.“21
Absprachen der genannten Art, fügt Smith hinzu, „werden immer in größter Stille und Heimlichkeit betrieben.“22 Smiths großes Sittenbild der Gesellschaft ergibt Folgendes: Die Arbeiter, die den bei weitem größten Teil der Bevölkerung ausmachen, kennen ihre eigenen Interessen nur ungenügend und sind auch aus diesem Grund nicht wirklich imstande, sie er‐ folgreich durchzusetzen; sie sind leichtgläubig und verführbar und werden wieder‐ holt von Angehörigen vor allem der dritten Klasse für deren Zwecke instrumentali‐ siert.23 Unfähig, ihre eigenen Belange erfolgreich zu regeln, sind die Arbeiter auf die Unterstützung durch Dritte und speziell die öffentliche Hand angewiesen. Aber diese ist nicht leicht zu haben, im Gegenteil. Wie Smith in Buch V feststellt: „Soweit der Privatrechte sichernde Staat der Sicherung von Eigentum dient, dient er in Wirklich‐ keit dem Schutz der Reichen vor den Armen – oder derjenigen, die etwas Eigentum besitzen, vor denen, die nichts haben.“24 Vonnöten wäre indes ein Schutz der Armen vor den Reichen. Die politische Macht lag zur Zeit Smiths noch immer in beträchtlichem Umfang in den Händen der landed gentry – der Klasse der Grundbesitzer. Wie wir jedoch be‐ reits gehört haben, fehlt diesen auf Grund ihrer Indolenz das Interesse an einem tie‐ feren Verständnis der öffentlichen Belange und der Folgen politischer Maßnahmen. Darüber hinaus sind auch sie leicht verführbar. Tatsächlich, so Smiths Spekulation über den allmählichen Verlust ihrer Macht und ihres Einflusses in Buch III des Wealth, sind sie ein Opfer ihres Verlangens nach „Befriedigung der kindischsten, ge‐
21 WN viii.13; Hervorhebung HDK. 22 WN viii.13. Der Umstand, dass man von ihren Machtspielen wenig hört, heißt nicht, dass diese nicht stattfinden. Wirtschaftliche Macht bewegt sich auf leisen Pfoten. Vgl. Kurz 2018. 23 Politische Entwicklungen in den USA und andernorts belegen die Richtigkeit und Bedeutung von Smiths obiger Diagnose für die heutige Zeit. 24 WN V.i.b.12.
75
wöhnlichsten und niedrigsten aller Eitelkeiten.“25 Die importierten oder vom heimi‐ schen Manufaktursektor bereitgestellten Luxusgüter „lieferten den großen Grundeigentümern allmählich Dinge, gegen die sie den gesamten Ertragsüberschuß ihrer Ländereien eintauschen konnten und die sie selbst konsumieren konnten, ohne sie mit ihren Pächtern und Dienstmännern teilen zu müssen. Alles für uns und nichts für die anderen, dürfte immer und überall der üble Leitsatz der Herren der Menschheit gewesen sein. ... Für ein paar diamantene Schnallen etwa oder etwas ebenso Läppisches und Unnützes gaben sie ... das ganze Gewicht und Ansehen [hin].“26
An anderer Stelle spricht Smith zutreffend von einer „parade of riches“, einem Lauf‐ steg der Eitelkeiten. Thorstein Veblen griff die Idee auf und prägte den Begriff der „conspicuous consumption“27. Das Medium des gesellschaftlichen Aufstiegs der bürgerlichen und des Abstiegs der feudalen Klasse sind die Verlockungen der vom Manufaktursektor bereitgestell‐ ten Luxusgüter. Aber weder der einen noch der anderen Klasse ist das Los der Ar‐ beiterschaft ein wirkliches Anliegen. Beiden sind die Arbeiter vor allem Mittel zum Zweck, der ersten, um möglichst hohe Profite zu erzielen und abstrakten Reichtum anzuhäufen, der zweiten, um ihrer Eitelkeit zu frönen und über ihre Dienerschaft konkretes Wohlergehen zu erfahren. Der ersten geht es um die Tauschwerte der Wa‐ ren und die über deren Verkauf zu erzielenden Gewinne sowie die Akkumulation von Kapital, der zweiten um die Gebrauchswerte eines Segments der Waren, den Konsum und die Befriedigung schnöder Bedürfnisse. Von diesem Aspekt des gesell‐ schaftlichen Wandels, der Zirkulation von Eliten, haben die Arbeiter also nichts merklich Gutes zu erwarten. Das Wohlwollen der Reichen – egal ob Feudal- oder Fabrikherren – ist ihnen nicht gewiss. Aber während die Feudalherren den ihnen in Gestalt der Grundrente zufließenden Teil des gesellschaftlichen Überschussprodukts verprassen, sparen und investieren (das heißt akkumulieren) die Kapitaleigner in großem Umfang den ihnen in Gestalt von Profit und Zins zufließenden Teil. Die Ak‐ kumulation von Kapital vergrößert aber die Märkte und gestattet somit eine tiefere Gliederung der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit und damit eine Steigerung von deren Produktivität, ein steigendes Nationaleinkommen, weitere Kapitalakkumulati‐ on und so fort, und erhöht progressiv die „Nachfrage nach Händen“. Für ein gegebe‐ nes generatives Verhalten der Bevölkerung steigt die Wahrscheinlichkeit, dass über eine das Angebot an Händen hinausgehende Nachfrage danach eine Konkurrenz der Kapitaleigner um Arbeitskräfte auslöst, die den Reallohn in die Höhe treibt und so auf vermittelte Weise der Arbeiterschaft zum Vorteil gereicht. Das auf unterschiedli‐ che Weise selbstsüchtige Verhalten der Angehörigen der beiden besitzenden Klassen – der Reichtumsmaximierung der Kapitaleigner und der Genussmaximierung der 25 WN III.iv. 10. 26 WN III.iv. 10. 27 Veblen 1899.
76
Grundbesitzer – hat als unbeabsichtigtes Resultat die Verbesserung der Lebensbe‐ dingungen der besitzlosen Klasse zur Folge. Der geschilderte circulus virtuosus ist allerdings an Bedingungen geknüpft, die nicht automatisch gegeben sind, sondern ständig aufs Neue erstritten werden müs‐ sen. Sie sind jederzeit in Gefahr, von der umtriebigen Selbstsucht der Besitzenden, ihrer Verschwendungssucht einerseits und ihres Monopolgeistes andererseits, unter‐ miniert zu werden, mit der Folge einer Lähmung der Wachstumskräfte der Wirt‐ schaft und gegebenenfalls der Herbeiführung eines „declining state [of society]“28. Dieser aber gereicht vor allem der Arbeiterschaft zum Nachteil in Gestalt sich ver‐ schlechternder Beschäftigungsmöglichkeiten und sinkender Reallöhne. Smith ist zwar insgesamt optimistisch, dass eine wachsende Einsicht in die dyna‐ mischen Eigenschaften des Systems einen immer besseren Schutz vor dem Abglei‐ ten in unerwünschte gesellschaftliche Zustände bietet, aber das System der natürli‐ chen Freiheit ist permanent in Gefahr und muss gehegt und gepflegt werden. Die po‐ litische Ökonomie, der vielleicht wichtigste Zweig einer Wissenschaft der Staats‐ kunst, hat die Aufgabe, die fragliche Einsicht zu befördern und Irr- und Aberglaube zu bekämpfen. Was aber sind Irr- und Aberglaube, was ist verlässliches Wissen in der Sache? Dies bringt uns zur dritten Komponente seines „Modells“ – seiner Vorstellung von der Bedeutung der verschiedenen Sektoren der Wirtschaft und deren Förde‐ rungswürdigkeit. Die Rede ist von Landwirtschaft, verarbeitendem Gewerbe, Bin‐ nenhandel und Fernhandel. Das Hauptaugenmerk liegt auf den beiden erstgenannten Sektoren.
3. Smiths System als Norm (II): Wirtschaftliche Sektoren und deren Produktivität Für Smith weist die Landwirtschaft unter allen Sektoren die höchste Produktivität und somit Wertschöpfungskapazität je beschäftigter Person auf, weil in ihr die Na‐ turkraft der menschlichen Arbeitskraft kostenlos zur Seite steht und deren Wirkungs‐ grad erhöht. „Herr Quesnai“, der „sehr geistvolle und scharfsinnige Verfasser“ des Agrikultursystems29 – Smith trägt sich zweitweise mit dem Gedanken, diesem den Wealth zu widmen –, habe jedoch fälschlich „die Klasse der Handwerker, Gewerbe‐ treibenden und Kaufleute als völlig unfruchtbar und unproduktiv dargestellt“30. Dies aber sei sie nicht und ihre „demütigende Bezeichnung“31 sei ganz und gar unange‐ bracht. Auch diese Klasse sei produktiv, weil sie periodisch das sie unterhaltende 28 29 30 31
WN I.viii.43. WN IV.ix.27. WN IV.ix.29. WN IV.ix.5.
77
Kapital, bestehend aus Produktions- und Unterhaltsmitteln der von ihr Beschäftigen, reproduziert und Profit auf das eingesetzte Kapital abwirft. Richtig ist aber auch, dass „die Arbeit der Pächter und Landarbeiter sicherlich produktiver ist als die der Kaufleute, Handwerker und Gewerbetreibenden. Aber der größere Ertrag der einen Klasse macht die andere nicht unfruchtbar oder unproduktiv.“32 Die Produktivität dieser Klasse zeigt sich auch darin, dass sich deren Arbeit in „marktgängiger“ Ware „verfestigt und verwirklicht“33 – anders als im Fall häuslicher Dienstboten, bei de‐ nen dies nicht der Fall ist.34 Schließlich sei es irreführend zu behaupten, die Arbeit dieser Klasse erhöhe nicht das Realeinkommen der Gesellschaft. Tatsächlich ist ins‐ besondere das verarbeitende Gewerbe für eine immer tiefere Gliederung der Arbeit empfänglich und weist die höchste Steigerungsrate der Produktivität auf. Smith be‐ tont: „Der jährliche Ertrag von Boden und Arbeit einer Gesellschaft läßt sich nur auf zwei Ar‐ ten vergrößern: entweder, erstens, durch Steigerung der Produktivität der in ihr tatsäch‐ lich unterhaltenen nützlichen Arbeitskräfte oder, zweitens, durch Vermehrung der Zahl dieser Arbeitskräfte selbst. ... Da sich aber die Arbeit von Handwerkern und Gewerbe‐ treibenden weiter unterteilen ... läßt als die von Pächtern und Landarbeitern, ist sie diesen zwei Arten von Verbesserungen in viel höherem Maße zugänglich. In dieser Hinsicht kann die Klasse der Landwirte daher keinerlei Vorteil gegenüber der der Handwerker und Gewerbetreibenden haben.“35
Während also die Landwirtschaft angeblich die höchste Produktivität aufweist, weist die Industrie die höchste Wachstumsrate der Produktivität auf. Die Frage drängt sich auf, ob die Rangfolge der Sektoren nach ihrer Wertschöpfung je Arbeitskraft sich nicht irgendwann einmal umkehrt und die Industrie von da an die vormalige Rolle der Landwirtschaft übernimmt. Aber Smiths Argument ist nicht nur in dieser Hin‐ sicht problematisch und unhaltbar. Auch seine These von der Mitarbeit der Natur ist höchst naiv, so als ob es die industriell gebändigte und gebündelte Naturkraft mittels der von seinem Kollegen an der Universität Edinburgh erfundenen Dampfmaschine nicht gäbe und so als ob der Wind nicht die Segel der Handelsflotte blähte. Smith lässt zwar einen Aspekt der agrozentrischen Sicht der Physiokraten hinter sich, ver‐ stärkt diese aber in anderer Hinsicht. Es sind insbesondere zwei gravierende Missverständnisse, die seine Sicht der Dinge überschatten. Erstens deutet er die Grundrente als „Monopolpreis“, die den Eigentümern des sich in konzentriertem Besitz befindlichen Grund und Bodens zu‐ fällt, und begreift ihre Höhe als Ausdruck des Grads der Freigebigkeit der Natur. Ri‐ 32 WN IV.ix.30. 33 WN IV.ix.31. 34 Dienstleistungen sind Smith zufolge unproduktiv, weil sie im Augenblick ihrer Erbringung verschwinden und sich nicht in akkumulierbaren Waren vergegenständlichen. Wir gehen auf die Problematik seiner Sicht nicht näher ein. 35 WN IV.ix.35.
78
cardo sollte ihm schon bald zu Recht vorhalten, dass die Grundrente als Differential‐ rente kein Ausdruck der Freigebigkeit, sondern des „Geizes der Natur“ ist. Gäbe es fruchtbaren Boden in Hülle und Fülle, so gäbe es keine Grundrente, weil dieser und seine besonderen Eigenschaften nicht knapp wären und daher für seine Leistungen nichts bezahlt werden müsste, da die Bodenbesitzer auf der Suche nach Pächtern die Pacht gegen Null hinunter konkurrieren würden.36 Zweitens verkennt Smith die Rolle der Industrie als Wachstumsmotor. Die Getrei‐ de produzierende Landwirtschaft erhält bei ihm deshalb eine herausragende Bedeu‐ tung zugewiesen, weil sie ein Produkt hervorbringt – Korn – das in allen Sektoren der Wirtschaft als Input unverzichtbar ist, während angeblich für keines der in den nicht-landwirtschaftlichen Sektoren erzeugten Produkte Gleiches gesagt werden könne. Korn kommt als unverzichtbares Lebensmittel überall zum Einsatz, weil überall Arbeit benötigt wird, und es wird in zahlreichen Wirtschaftszweigen als Pro‐ duktionsmittel benötigt, so zum Beispiel in der Erzeugung von Luxusgütern wie Whiskey. Industrieprodukte hingegen sind Smiths Vorstellung zufolge entweder selbst Luxusprodukte oder Produkte, die in der Erzeugung von Luxusprodukten ein‐ gesetzt werden. Dieser „große und wesentliche Unterschied, der von Natur aus zwi‐ schen Korn und so gut wie jeder anderen Art von Gütern besteht“37, werde jedoch häufig übersehen. „Nicht Tuch oder Leinwand [zwei Industrieprodukte] ist die maß‐ gebliche Ware anhand deren der reale Wert letztlich aller anderen Waren gemessen und bestimmt wird. Korn ist es.“38 In der Begrifflichkeit Piero Sraffas ist Korn das einzige „Basisprodukt“ des Sys‐ tems, da es direkt oder indirekt in die Erzeugung aller Produkte eingeht, während In‐ dustriewaren „Nichtbasisprodukte“ sind, für die dies nicht gilt.39 Smith fällt damit, so könnte man streng sagen, hinter die Auffassung der Physiokraten zurück, die zum Beispiel die Verwendung von im Manufaktursektor erzeugten Pflügen in der Land‐ wirtschaft berücksichtigen und damit zirkuläre Produktion unterstellen. Bei genaue‐ rer Hinsicht tut dies Smith auch, aber er war wohl der Auffassung, dass die Industrie vornehmlich gefälligen Tand für die Oberschicht liefert, der dieser die Sinne ver‐ dreht. Jedenfalls vernachlässigt er den produktiven Input der Industrie in die anderen Sektoren und verbaut sich damit die Möglichkeit, die Schwungkraft der von ihm konstatierten dynamisch steigenden Skalenerträge über eine sich vertiefende Ar‐ beitsteilung im verarbeitenden Gewerbe auf die Wirtschaft insgesamt zu sehen. Die Industrie als „engine of growth“ findet man bei ihm nur im Ansatz, der jedoch sofort von seinem physiokratischen Vorurteil erstickt wird.
36 37 38 39
Vgl. Kurz 2016 a, Kapitel 2. WN IV.v.a.23. WN IV.v.a.23. Sraffa 1960, S. 8.
79
Wir können die Smithʼsche Sicht in einem einfachen Rahmen formalisieren. Für ein gegebenes System der Produktion als Ausdruck des Entwicklungsstands der Ökonomie, das heißt des erreichten Grads der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit, und unterstellter freier Konkurrenz, das heißt einer tendenziell uniformen Profitrate, lassen sich die beiden Sektoren Agrikultur (a) und Manufakturwesen (m) wie folgt repräsentieren: (1)
Apa = (1 + r)Aaapa + qBa
(2)
Mpm = (1 + r)Amapa
Hierbei ist A der Gesamtoutput an Korn und M der an Manufakturwaren, Aaa der In‐ put an Korn in der Kornproduktion bestehend aus Produktionsmitteln (Saatgut und gegebenenfalls Futter für Zugtiere) sowie den Unterhaltsmitteln für die beschäftig‐ ten Arbeiter zu gegebenem Real- bzw. Kornlohnsatz, Ama der korrespondierende In‐ put von Korn im Manufaktursektor, bestehend aus dem von der Landwirtschaft ge‐ lieferten Rohstoff (Korn) sowie den Unterhaltsmitteln (Reallohn) für die dort be‐ schäftigten Arbeiter, und Ba der in der Landwirtschaft insgesamt bewirtschaftete Bo‐ den; im Manufakturwesen wird vom Bodeneinsatz der Einfachheit halber abgese‐ hen. Die konkurrenzwirtschaftlich uniforme Profitrate wird durch r gegeben, die Rente je Hektar durch q, der Preis von Korn durch pa und derjenige vom Manufak‐ turprodukt durch pm. Setzen wir den Preis von Korn gleich 1, das heißt nehmen wir Smith folgend Korn als Wertmaß, (3)
pa = 1,
so drücken wir alle Wertgrößen im System in Korneinheiten aus. Für eine gegebene Höhe des Rentsatzes (in Korn), q, kann die allgemeine Profitrate ausschließlich auf Basis von Gleichung (1) bestimmt werden. Wir erhalten (4)
𝑟
.
Die Profitrate ist rein auf der Grundlage der Verhältnisse im landwirtschaftlichen Sektor zu bestimmen, und sie ist positiv, vorausgesetzt der Ausdruck im Zähler ist positiv, das heißt der Rentsatz ist kleiner als (A – Aaa)/Ba. Der von Smith betonte In‐ teressensgegensatz zwischen Grundeigentümern und Kapitaleignern zeigt sich: Je höher q, desto niedriger r. Das ermittelte r kann dann in die Gleichung (2) eingesetzt und zur Bestimmung des Preises des „realen“, in Korn ausgedrückten Werts des ge‐ werblichen Produktes, pm, genutzt werden. Die dem Agrikultursektor untergeordnete Bedeutung des Manufaktursektors zeigt sich jetzt darin, dass eine Verringerung der Produktionskosten in letzterem infolge
80
einer immer tieferen Gliederung der Arbeit zwar den Preis des Manufakturproduktes senkt, aber nicht auf den Agrikultursektor durchschlägt, in dem alleine die allgemei‐ ne Profitrate bestimmt wird. Kommt es hingegen zu „Verbesserungen“ im Agrikul‐ tursektor, so hat dies für einen zunächst gegebenen Reallohnsatz folgende Effekte: 1. Zur Erzeugung von netto einer Tonne Korn wird direkt und indirekt weniger an Korn als Input benötigt. 2. Gemessen in der dafür aufzuwendenden direkten und in‐ direkten Arbeit pro Doppelzentner wird Korn billiger.40 3. Auch das Manufakturpro‐ dukt wird wegen der Verbilligung des Korns, das es als Input nutzt, gemessen so‐ wohl am direkt und indirekt zu seiner Erzeugung aufzuwendenden Korn als auch an Arbeit billiger. 4. Der Überschuss im kornproduzierenden Sektor wird größer und erlaubt eine höhere Profitrate r und/oder einen höheren Rentsatz q (gegebenenfalls auch einen höheren Reallohnsatz). 5. Die Akkumulations- und Wachstumsrate des Systems erhöht sich bei steigender Profitabilität. Smith erkennt damit, dass technischer Fortschritt in den Basissektoren einer Öko‐ nomie – er kennt nur einen: die Landwirtschaft – das System insgesamt voranbrin‐ gen, während die mit technischem Fortschritt in den Nichtbasissektoren verbunde‐ nen Wirkungen von begrenzter Reichweite sind. Dies ist ein überaus bedeutender Fund und wird von ihm im Wealth in verschiedenerlei Hinsichten ausgeleuchtet. Sein Fehler war, die Industrie zu letzteren gezählt zu haben. Während er empirisch einem beachtlichen Irrtum aufgesessen ist, verdanken wir ihm analytisch einen merklichen Fortschritt gegenüber früheren Auffassungen. Dieses sektoral-differenzierte Modell bildet die analytische Grundlage für Smiths Beurteilung alternativer Systeme der politischen Ökonomie und insbesondere des Merkantilsystems. Dieses ist vor allem durch eine Förderung des Manufaktursektors und der Städte, dem hauptsächlichen Standort des Sektors, gekennzeichnet. Dabei würde eine Förderung der Landwirtschaft Smith zufolge Entwicklung und Wachs‐ tum beschleunigen. Die merkantile Wirtschafts-, Innovations- und Strukturpolitik vergibt seiner Überzeugung nach Chancen zur schnelleren Entwicklung der Wirt‐ schaft. Wenn aber, wie gezeigt, Smiths Verständnis der Rolle der Industrie im zeitge‐ nössischen System der Produktion fragwürdig ist, dann sollte sein Angriff auf das Merkantilsystem und der darauf basierenden Politiken mit Vorsicht beurteilt werden.
40 Angenommen, zur Erzeugung von 100.000 t Korn werden 30.000 t als Saatgut und Futter für Zugtiere sowie 50.000 Arbeiter für je ein Jahr benötigt. Der Jahresreallohn betrage eine t je Arbeiter. Dann erzeugen 50.000 Mannjahre an Arbeit netto 20.000 t Korn, die in Form von Profit oder Rente verteilt werden können. Ein Mannjahr erzeugt demnach 0.4 t netto an Korn. Sollten die beiden Inputs infolge technischen Fortschritts bei gleichem Output auf 20.000 t Saatgut und Futtermittel und 40.000 Mannjahre bei gleichem Reallohnsatz je Arbeiter sinken, dann betrüge das Nettoprodukt 40.000 t Korn und ein Mannjahr produzierte 1 t netto – eine Steigerung der Nettoproduktivität der Arbeit auf das Zweieinhalbfache.
81
4. Das System der „kleinen Krämer“ Das System des Merkantilismus basiert Smith zufolge auf den folgenden beiden Pfeilern: Erstens, der Reichtum einer Person ebenso wie derjenige einer Nation be‐ steht in Geld.41 Folglich ist alles, was den Geldbesitz steigert, von Vorteil. Die Meh‐ rung der in der Schatzkammer eines Landes gespeicherten Edelmetallmenge stellt überdies eine finanzielle Vorkehrung gegen die Gefahr ausbrechender Kriege zwi‐ schen den sich auf Kollisionskurs befindlichen, ihre Einflusszonen ausweitenden Nationalstaaten dar. Zweitens, Länder ohne nennenswerte heimische Edelmetallvor‐ kommen gelangen an das Edelmetall – das „Gut der Güter“ – über eine Politik der Ausfuhrförderung und Einfuhrbeschränkung – den beiden „starken Antriebsmaschi‐ nen“ des Reichtums einer Nation. Diese Politik wird gegebenenfalls ergänzt (so im Falle Englands vor allem unter Königin Elisabeth I.) durch staatlich insgeheim ge‐ billigte Piraterie von mit Edelmetall aus Meso- und Südamerika beladenen spani‐ schen Schiffen. Das Buch von Thomas Mun, England’s Treasure by Foreign Trade (1664), so Smith, wurde „zu einer Maxime der Politischen Ökonomie nicht nur in England.“42 Smith hält beide Pfeiler für nicht tragfähig. Die Sorge um eine zu knappe Geld‐ versorgung sei unbegründet, da das ökonomische System aus sich heraus, endogen, für eine hinreichend große Liquidität sorgt. Überdies habe mit der Einführung von Papiergeld das Edelmetall im Binnenhandel seine ehedem überragende Rolle verlo‐ ren. Obgleich das Papiergeld große Gefahren beinhaltet, stellt es doch eine gewaltige ressourcensparende Innovation dar. Nicht Gold und Silber, sondern die Größe des Sozialprodukts entscheiden über Reichtum und Wehrfähigkeit einer Nation. Merkantile Beschränkungen verfolgen grundsätzlich die Absicht, das Kapital und die Beschäftigten eines Landes in andere Wirtschaftszweige zu lenken als jene, die von den Kapitaleignern andernfalls gewählt werden würden. Dies aber beinhalte, wie oben gesehen, eine Wissensanmaßung. Einfuhrbeschränkungen begründen mo‐ nopolistische Verzerrungen auf dem Inlandsmarkt. Von ihnen profitieren nur einige Kaufleute und Gewerbetreibende, während die restliche Gesellschaft Nachteile in Gestalt geringerer Realeinkommen und einer schwächeren wirtschaftlichen Dyna‐ mik hat. Die „zwei größten und bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte der Mensch‐ heit“ sind Smith zufolge nicht etwa die Entdeckung des Feuers, des Rades, der Schrift usw., wie u.a. Montesquieu gemeint hatte, sondern die Entdeckung Amerikas 41 Nicht alle als Merkantilisten gehandelten Autoren verwechselten Reichtum mit Geld (vgl. Ma‐ gnusson 2015, S. 103), aber Smiths Deutung war lange Zeit hindurch äußert erfolgreich und hat das Bild vom ökonomischen Denken in der merkantilen Periode nachhaltig geprägt. Eine Politik der Exportüberschüsse, so die Einsicht der Merkantilautoren, war überdies Beschäfti‐ gungspolitik und verfolgte eine beggar-my-neighbour-Strategie. 42 Vgl. WN IV.i.7 sowie LJ (A) v. 75-6.
82
und die einer Route nach Ostindien um das Kap der Guten Hoffnung. Als Begrün‐ dung führt er an, dass sie auf allen beteiligten Seiten zu einem bisher nie beobachte‐ ten Innovationsschub geführt hätten. Er verweist dazu auf Demonstrationseffekte, wie sie schon unter anderem von David Hume erörtert worden sind.43 Man lernt neue Genüsse und die Güter zu ihrer Befriedigung kennen, neue Techniken, Produk‐ tions- und Arbeitsverfahren sowie neue Organisationsformen in Produktion und Handel. Die Menge an nützlichem Wissen erhöht sich auf allen Seiten. Und die Grö‐ ße des Marktes nimmt zu – Voraussetzung für eine tiefere gesellschaftliche und weltweite Arbeitsteilung und über diese, wie man heute sagt, dynamisch steigende Skalenerträge.44 Das ganze Ausmaß der dadurch ausgelösten Folgen ist schon des‐ halb nicht absehbar, weil es sich um einen einmal angestoßenen, aber immer weiter laufenden Prozess handelt. Dessen faktischer Verlauf, konstatiert Smith, weist neben offensichtlichen positiven Effekten jedoch auch merkliche negative auf: Eine Ent‐ wicklung, die grundsätzlich „allen Gutes hätte bringen können“, habe wegen der „barbarischen Untaten der Europäer“ vielerorts nur „Verderb und Vernichtung“45 er‐ zeugt, klagt Smith. Er wiederholt damit aufs Neue eine zentrale Botschaft des Wealth – selbstsüchtiges Verhalten generiert nicht immer und überall gesamtgesell‐ schaftlich vorteilhafte Resultate, sondern kann für die Bevölkerungen ganzer Länder und sogar Kontinente Elend und arge Not bis hin zu Versklavung und Tod bedeuten. Der von Smith glühend propagierte Freihandel wird von der Merkantilpolitik mit ihren Handelsmonopolen, ihrer Kolonialpolitik und Herrschaftsausübung pervertiert und führt zur Unterdrückung und Ausbeutung von Völkern zugunsten einer kleinen Klasse von Profiteuren. Die Spezialisierung der Länder, so Smith, richtet sich grundsätzlich nach deren absoluten Kostenvorteilen: Wenn eine bestimmte Ware in einem Land zu niedrige‐ ren Kosten hergestellt werden kann als in anderen Ländern, und wenn die Transport‐ kosten den Kostenvorteil nicht aufwiegen, dann wird sich das Land bei Freihandel auf die Produktion dieser Ware spezialisieren und Teile des Produktionsergebnisses exportieren. Es wird andererseits jene Waren importieren, die im Ausland billiger produziert werden können als im Inland.46 Smith spricht immer dann von einem Monopol, wenn der Marktpreis dauerhaft über dem „natürlichen Preis“ gehalten wird und so laufend Extraprofite bzw. eine 43 Vgl. Humes Essay „On the Jealousy of Trade“ (Hume [1752] 1985, S. 327-331); siehe auch die Diskussion der Humeʼschen Ökonomik in Kurz 2011. 44 Allyn Young (1928) und später Nicholas Kaldor in mehreren Veröffentlichungen haben Smiths dynamische Sicht gewürdigt und weiterentwickelt, wobei sie dem Verarbeitenden Gewerbe eine Schlüsselrolle für das endogene Wachstum des ökonomischen Systems zuweisen – ganz im Gegensatz zu Smith selbst. Negishi 1993 formalisiert einige der Smithʼschen Ideen. 45 WN IV.i.32. 46 Smith argumentiert mit absoluten Kostenvorteilen. Ricardo hat Smiths Argument bekanntlich für stark ergänzungsbedürftig erachtet und die Theorie der komparativen Kostenvorteile ent‐ wickelt (vgl. Kurz 2017).
83
überdurchschnittliche Profitrate erzielt werden. Dazu muss der Markt „beständig un‐ terversorgt“ sein, das heißt „die effektive Nachfrage nie vollständig befriedigt wer‐ den“47. Die effektive Nachfrage definiert Smith als jene, die sich bei Geltung des na‐ türlichen Preises ergeben würde. Kern des von Smith propagierten „Systems der natürlichen Freiheit“ ist die freie Konkurrenz (nicht zu verwechseln mit vollkommener Konkurrenz), das heißt die Abwesenheit merklicher Markteintritts- und Marktaustrittsbeschränkungen. Aber unter gewissen Umständen sind Abweichungen hiervon nicht nur nicht zu beanstan‐ den, sondern gegebenenfalls sogar zu befürworten. In der Mehrzahl der von Smith betrachteten Fälle sind Abweichungen vom Ideal indes Ausfluss der schädlichen Merkantilpolitik und deren „alleinigem Motor“ – künstlichen Monopolen. In gewissen eng begrenzten Fällen seien grundsätzlich temporär einzurichtende und streng zu überwachende Monopole zulässig. Eine Ausnahme ist die Landesver‐ teidigung. Die Navigationsakte Großbritanniens, die den Handel des Landes aus‐ schließlich heimischen Schiffen und Seeleuten einräumt, ist Smith zufolge die viel‐ leicht „weiseste aller handelsrechtlichen Maßnahmen Englands“. Als Grund nennt er: „Defence is more important than opulence“48 – (Selbst-)Verteidigung ist wichti‐ ger als Überfluss. Ein zeitweise einzurichtendes legales Monopol ist auch bei beson‐ ders riskanten und viel Kapital erfordernden Unternehmungen wie dem Überseehan‐ del geboten. Dieser verlangt häufig die Errichtung von Handelsposten und Garniso‐ nen und bringt die öffentliche Hand zur Absicherung privatwirtschaftlicher Aktivitä‐ ten ins Spiel. Das schädliche und schändliche Wirken der „East India Company“ zei‐ ge jedoch, so Smith, wie gefährlich derartige Monopole werden können, wenn sie nicht effektiver Regulierung und Kontrolle unterliegen. Mit der Gewährung eines legalen Monopols ist es häufig nicht getan, es müssen auch Vorkehrungen dafür getroffen werden, dass es durchgesetzt werden kann. Dies aber sei in vielen Fällen alles andere als einfach. So ist die Bekämpfung von Schmuggel vielfach eine höchst kostspielige und nur wenig erfolgreiche Angelegen‐ heit. Eine große Entfernung zwischen Mutterland und Kolonie sowie lange, schwer kontrollierbare Küsten liefern einen starken Anreiz für das überaus profitable Ge‐ schäft des Schmuggels. Dessen Bekämpfung läuft häufig auf wenig mehr als eine gewaltige Vergeudung von Ressourcen hinaus. Das gesetzliche Verbot der Produkti‐ on und des Erwerbs von gewissen Gütern im Inland, zum Beispiel Schnaps, ermun‐ tert den Schmuggel und treibt so manchen rechtschaffenen Bürger in den Rechts‐ bruch, seufzt Smith. Das „üble Monopoldenken“ drücke sich insbesondere in der Befürwortung von Importbeschränkungen aus. Diese dienen Partikularinteressen, welche allerdings mittels allerlei Sophistereien als Allgemeininteresse ausgegeben werden. So ist das 47 WN I.vii.26. 48 WN IV.ii.30.
84
Argument, derartige Beschränkungen seien im Interesse der Verbesserung der Han‐ delsbilanz mit einzelnen Ländern geboten, barer Unsinn, da nur die Handelsbilanz mit dem gesamten Ausland von Bedeutung ist. Die Merkantilpolitik, zürnt Smith, er‐ höht „die Schliche kleiner Krämer“ („the sneaking arts of underling tradesmen“49) zur wirtschaftspolitischen Doktrin ganzer Nationen.50 Sie basiere auf unhaltbaren Prämissen und Argumenten, die den Leuten die Sinne vernebeln und sie glauben machen, es sei im nationalen Interesse, „alle ihre Nachbarn an den Bettelstab zu bringen.“ Das Gegenteil treffe zu. Der Handel, der zwischen Völkern sowie Einzel‐ personen ein Freundschaftsband hätte knüpfen können, ist so „zur ergiebigsten Quel‐ le von Zwietracht und Hass geworden.“ Mittels des Kommerzsystems haben sich die von „schamlosem Neid“ und „gemeiner Habsucht“ geleiteten Kaufleute und Händler zu „Beherrschern der Menschheit“ aufgeschwungen.51 Der Reichtum eines Nachbar‐ landes sei jedoch für das eigene Land nicht von Nachteil, ganz im Gegenteil. Reiche Nachbarn entfalten eine große Nachfrage nach den eigenen Produkten, und man kann von ihnen lernen – eine Auffassung die bereits Hume vertreten hatte. Smiths diesbezügliche Ausführungen lesen sich wie ein Kommentar zur gegenwärtigen han‐ delspolitischen Lage in der Welt. Kaufleute streben nicht nur ein Monopol im Inland an, sie möchten ihre Waren auch im Ausland möglichst gewinnbringend absetzen. Sie verlangen deshalb von der Regierung die Rückerstattung aller Zölle, Verbrauchsteuern und sonstigen Abgaben sowie die im Inland eingehobenen Abgaben auf wieder ausgeführte ausländische Waren mit dem Argument, ihre Wettbewerbsfähigkeit nehme ansonsten Schaden. Ausfuhrsubventionen würden häufig gerade auch von sich im Niedergang befinden‐ den Wirtschaftszweigen gefordert. Sie führen zu einer Fehllenkung von Kapital und Arbeitskräften und sind Smith zufolge abzulehnen. Besonders kritisch sieht Smith die Förderung des Exports von Korn wegen der zentralen Bedeutung, die dieses Gut in seinem System der Produktion und Vertei‐ lung einnimmt. Eine Exportförderung belastet die Bevölkerung in doppelter Weise: durch die Steuer zu ihrer Finanzierung und durch die Preissteigerung beim Korn. Diese Preissteigerung aber bewirkt über kurz oder lang einen Anstieg des Geldlohn‐ satzes, und über diesen einen solchen aller Preise, denn Korn ist das Hauptunter‐ haltsmittel der Arbeiter und ihrer Familien. Und da über die geleistete Arbeit Korn in die Erzeugung aller Waren eingeht, nimmt es als Kostenelement Einfluss auf alle Preise und auch auf die allgemeine Profirate: „[D]er Geldpreis von Korn bestimmt den aller anderen Waren aus heimischer Erzeugung.“52 Exportsubventionen bezüg‐ 49 WN IV.iii.c.8. 50 Smiths Attacke auf „kleine Krämer“ hat heute insbesondere ein Gesicht: Donald Trump. Des‐ sen Handelspolitik und seine Betonung bilateraler „Deals“ wären von Smith gewiss schwer ge‐ geißelt worden. 51 WN IV.iii.c.9. 52 WN IV.v.a.11.
85
lich anderer Produkte erhöhen hingegen nur die Preise der betroffenen Produkte und treffen daher nicht die Wirtschaft insgesamt. Das dem Gesetz über die Subventionie‐ rung der Ausfuhr von Korn gespendete Lob sei daher „völlig unverdient“53. Sieht man von außergewöhnlich schlechten Ernten ab, so sei der wirkliche Grund für eine Kornknappheit bis hin zur Hungersnot Smith zufolge „der gewaltsame Ver‐ such des Staates, [Preissteigerungen] mit untauglichen Mitteln zu bekämpfen“54. Der dabei aufflammende Zorn der Menschen richtet sich häufig zu Unrecht gegen die Händler, obgleich deren Getreidespekulation stabilisierend wirkt, da sie die Preisbe‐ wegung verstetigt. Smith vergleicht das Getreidegesetz mit den die Religion betref‐ fenden Gesetzen und drückt damit ein gewisses Verständnis für staatliche Reaktio‐ nen aus: „Die Menschen fühlen sich in Bezug auf alles, was entweder mit ihrem Un‐ terhalt im irdischen oder ihrer Seligkeit in einem zukünftigen Leben zu tun hat, so interessiert, dass der Staat ihren Vorurteilen stattgeben und um der Erhaltung der öf‐ fentlichen Ruhe willen dasjenige System einführen muss, mit dem sie einverstanden sind.“55 Aber die Unvernunft der Menschen werde erfreulicherweise vom „natürli‐ che Bestreben jedes einzelnen, seine Lage zu verbessern,“ in Schranken gehalten. Dieses Bestreben sei „ein so mächtiges Prinzip, dass es allein und ohne jede Hilfe nicht nur die Gesellschaft zu Reichtum und Wohlstand führen kann, sondern auch hundert unnötige Hindernisse zu überwinden vermag, die ihm die Torheit menschli‐ cher Gesetze nur zu oft in den Weg legt.“56 Die Merkantilpolitik vergibt zwar Chan‐ cen zur Wohlstandssteigerung, ist aber im Allgemeinen nicht imstande, diese gänz‐ lich zunichte zu machen. Handelsverträge räumen einzelnen Ländern entweder das ausschließliche Recht ein, das Inland mit gewissen Waren zu beliefern, oder es werden darauf keine Zölle erhoben. Solche Verträge sind zwar von Vorteil für die Kaufleute und Gewerbetrei‐ benden des begünstigten, aber von Nachteil für die des begünstigenden Landes, da sie den Wettbewerb einschränken und so unerwünschte Allokations- und Vertei‐ lungswirkungen zeitigen. Über den berühmten und gelobten Methuen-Vertrag zwi‐ schen England und Portugal aus dem Jahr 1703 äußert sich Smith überaus kritisch. Mit ihm hob Portugal seine Diskriminierung englischer Wollwaren auf. Im Gegen‐ zug belegte Großbritannien portugiesische Weine mit einem geringeren Zoll als französische. Der Vertrag, so Smith, nütze Portugal und schade Großbritannien, nicht zuletzt weil französischer Wein, so der schottische Connaisseur, besser als der portugiesische sei. Aus Smiths Sicht war die Gründung von Kolonien in Amerika und Westindien wegen des Transfers technologischen, organisatorischen und institutionellen Wissens 53 54 55 56
86
WN IV.v.b.1 WN IV.v.b.5. WN IV.v.b.40. WN IV.v.b.43.
prinzipiell von großem Nutzen, weil er Lern- und Aufholprozesse induzierte. Die Kolonien waren damit grundsätzlich in der Lage, den bestehenden Abstand im durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen zum Mutterland zu verringern. Aber wie‐ derum wurden diese grundsätzlich allseits vorteilhaften Möglichkeiten vielfach vor allem durch merkantile Praktiken pervertiert. Zieht man alle dem Mutterland entste‐ henden Kosten der Kolonialpolitik in Betracht und stellt sie deren Nutzen gegen‐ über, dann ergibt sich für das Mutterland eine negative Bilanz. Smith empfiehlt da‐ her, Großbritannien möge seine Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen. Kulturelle, religiöse und politische Momente nehmen merklichen Einfluss auf die sozio-ökonomische Dynamik, beschleunigen oder verlangsamen sie und lenken sie in mehr oder weniger erfreuliche Bahnen. Die Sklaverei und das indische Kastenwe‐ sen seien nicht nur aus moralischen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen ab‐ zulehnen. Nur von „freien Männern“ seien Erfindungen und technische und organi‐ satorische Fortschritte zu erwarten. Besonders hart attackiert Smith die englische „East India Company“. Das ihr ein‐ geräumte Monopol habe zur rücksichtslosen Ausplünderung der von ihr beherrsch‐ ten Länder geführt. „Solche Gesellschaften sind stets und unablässig bestrebt, ihre eigene Profitrate so hoch wie möglich zu schrauben und den Markt für die Güter, die sie exportieren, ebenso wie den Markt für die, die sie importieren, möglichst unter‐ versorgt zu halten.“57 Sie versuchen nicht nur „den Wert des Ertragsüberschusses der Kolonie zu drücken, sondern in vielen Fällen auch dessen natürliche Vergrößerung zu bremsen und aufzuhalten.“ Zu diesem Zweck wurden Ernten teilweise vernichtet und der Anbau gewaltsam begrenzt. Smiths Betrachtungen kulminieren im vernich‐ tenden Urteil: „Von allen Maßnahmen, die man sich ausdenken kann, um das natür‐ liche Wachstum einer neuen Kolonie zu beschneiden, ist die Einrichtung einer privi‐ legierten Gesellschaft zweifellos die wirkungsvollste.“58 Eine Gesellschaft von Kaufleuten, diagnostiziert der Schotte, „ist anscheinend un‐ fähig zur Herrschaft.“59 Das Interesse des Kaufmanns ist dem Interesse des erober‐ ten wie auch des Mutterlandes „genau entgegengesetzt“60. Und in Bezug auf Indien ergänzt er: „Wenn aber der Geist einer solchen Herrschaft, schon was die Direktion in Europa angeht, von Grund auf und wohl unverbesserlich schlecht ist, so ist es die ihrer Verwaltung in Indien noch viel mehr“61. Diese besteht aus Kaufleuten, einer der unteren Kasten Indiens. Gehorsam können sie nur militärisch erzwingen, „und deshalb ist ihre Herrschaft notwendigerweise militärisch und despotisch“.62 Die An‐ gehörigen der Verwaltung machen zum eigenem Vorteil Geschäfte und verfolgen 57 58 59 60 61 62
WN V.i.e.10. WN IV.vii.b.22. WN IV.vii.c.103. WN IV.vii.c.103. WN IV.vii.c.104. WN IV.vii.c.104.
87
ihre partikulären Interessen mit aller Härte und ohne Bedacht auf Land und Leute. Ihr verderbter Charakter und schändliches Tun sind die Folge des installierten „Herr‐ schaftssystems“. „Solche privilegierten Gesellschaften sind also in jeder Hinsicht ein Übel; immer mehr oder weniger unbequem für die Länder, in denen sie errichtet werden, und verheerend für diejenigen, die das Unglück haben, unter ihre Herrschaft zu geraten.“63 Nach dieser desaströsen Bilanz drängt sich die Frage auf: Warum ist das Merkan‐ tilsystem nicht schon viel früher als Irrlehre erkannt worden? Smith erklärt sich dies mit einer fatalen Fehlinterpretation des oben angesprochenen Ereignisses von welt‐ historischer Bedeutung: Der durch die Entdeckung der neuen Welten ausgelöste In‐ novationsschub sei völlig zu Unrecht der Merkantilpolitik gut geschrieben worden und habe dieser „in einem Maße zu Glanz und Glorie“ verholfen, „wie es sie andern‐ falls nie erreicht hätte“64. Jetzt wird auch klar, warum Smith bereits in Buch I vor den wirtschaftspoliti‐ schen Vorschlägen der Kaufleute, Handel- und Gewerbetreibenden glaubte derart eindringlich warnen zu müssen. Sie sind seiner Sicht zufolge hauptverantwortlich für „die Torheit eines Systems, die durch schicksalsschwere Erfahrungen bereits hin‐ länglich dargetan ist“65. Das Agrikultursystem, dem wir uns jetzt kurz zuwenden, kommt merklich besser davon.
5. Das System des „Herrn Quesnai“66 Das System des „scharfsinnigen“ François Quesnay habe der Politik der „Beschrän‐ kungen und Verordnungen“ von Minister Colbert die „liberalen Vorstellungen von Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit“67 entgegengestellt. Während Colbert das Wachstum des Reichtums der Nation durch die Förderung von Gewerbe, Handel und der Städte zu beschleunigen versuchte, begriff Quesnay die Landwirtschaft bzw. Ur‐ produktion als dessen alleinige Quelle. Wir haben bereits gesehen, wie problema‐ tisch Smiths diesbezügliche Sicht der Dinge ist. Die in Industrie und Handel Tätigen seien nicht „unfruchtbar“, was sich schon da‐ ran zeige, dass das Verarbeitende Gewerbe in viel höherem Maße Verbesserungen zugänglich ist als die Landwirtschaft. Auf das Spannungsverhältnis zwischen der Behauptung einer höheren Produktivität in der Landwirtschaft einerseits und einer höheren Wachstumsrate der Produktivität in der Industrie geht Smith jedoch nicht wirklich ein. Er trägt auch nicht jenen Einwand vor, der die physiokratische Vorstel‐ 63 64 65 66 67
88
WN IV.vii.c.108. WN IV.vii.c.81. WN IV.viii.15. „Mr. Quesnai“ (so z. B. WN IV.ix.27). WN IV.ix.3.
lung von der ausschließlichen Produktivität der Landwirtschaft sofort als unhaltbar ausweist. Im Tableau Économique bezieht die Industrie von der Landwirtschaft Roh‐ stoffe und Unterhaltsmittel, die Landwirtschaft von der Industrie Werkzeuge (Pflü‐ ge, Sensen, Fuhrwerke usw.). Die Landwirtschaft könnte ohne die Vorleistungen der Industrie ebenso wenig existieren, wie die Industrie ohne die der Landwirtschaft. Die Sektoren sind interdependent und entweder insgesamt produktiv, das heißt im‐ stande ein produit net, einen Surplus, zu erzeugen, oder nicht. Smiths agrozentri‐ sches Vorurteil steht dieser Einsicht im Wege. Die im Tableau zum Ausdruck kommende Vorstellung zirkulärer produktions‐ technischer Verhältnisse wird von Smith nur partiell, für die Landwirtschaft intern, übernommen, zwischen Landwirtschaft und Industrie unterstellt er hingegen eine unidirektionale Beziehung: Während landwirtschaftliche Produkte in die Erzeugung aller Produkte und Wirtschaftszweige als notwendige Inputs (Rohstoffe und Unter‐ haltsmittel, „Korn“) eingehen, tun dies Industrieprodukte annahmegemäß nicht. Der Vergleich der Systeme von Smith und Quesnay führt daher zu einem überraschenden Ergebnis: Wo bei Smith produktionstechnisch Hierarchie und Dependenz herrschen, sind es bei Quesnay Gleichrangigkeit und Interdependenz. Smiths Sicht war inso‐ weit noch weit agrozentrischer als Quesnays. Er war, könnte man sagen, ein Reprä‐ sentant des Zeitalters von Korn und Tand. „Die Herstellung vollkommener Gerechtigkeit, vollkommener Freiheit und voll‐ kommener Gleichheit ist das sehr einfache Geheimmittel, um allen drei Klassen am wirksamsten ein Höchstmaß an Wohlstand zu sichern.“68 Ein Regime „vollkomme‐ ner Handelsfreiheit“ sei der Entwicklung der heimischen Industrie eines noch rück‐ ständigen Landes und damit der Substitution von Importen durch heimisch erzeugte Produkte nicht hinderlich. Friedrich List sollte diese Auffassung auf das Heftigste bestreiten und Importzölle sowie andere Maßnahmen vorschlagen, um die heimische Industrie vor der noch übermächtigen ausländischen Konkurrenz zu schützen.69 List zufolge beruht das von Smith propagierte „liberale und großzügige System“ auf einer groben Fehleinschätzung. Schutzzölle, so Smith, könnten zwar den Aufbau einer Industrie fördern, würden aber Ressourcen absorbieren, die besser eingesetzt werden könnten. Schutzzölle schadeten dem Inland doppelt: Importe, ausgedrückt in dafür hingegebenem inländischen Produkt, würden teurer und heimische Firmen er‐ hielten im geschützten Sektor eine Monopolposition mit außergewöhnlichen Profi‐ ten. Dies aber entzöge der Landwirtschaft Kapital und verlangsame die Entwick‐ lung. Wieder ist es die Landwirtschaft, um die sich alles dreht, und nicht die Indus‐ trie, deren zentrale Bedeutung für den Entwicklungsprozess er vollkommen ver‐ kennt.
68 WN IV.ix.17. 69 List [1841] 1930.
89
Jede Beschränkung der „natürlichen Freiheit“ werde mit Verlusten an Einkom‐ men und Wachstum bezahlt. Wie gut, dass die Gesellschaft eine fehlerhafte Politik ähnlich wie der einzelne Mensch eine ungesunde Lebensweise aufgrund eines uns „unbekannten Selbsterhaltungsprinzips“ bis zu einem gewissen Grad verkraften kann: „Könnte ein Volk nicht auch ohne vollkommene Freiheit und vollkommene Gerechtigkeit gedeihen, so gäbe es auf der ganzen Welt kein Volk, das jemals hätte gedeihen können. Glücklicherweise aber hat die Weisheit der Natur reichlich Vorkehrungen getroffen, um vom Staatskörper viele der schädlichen Auswirkungen der Torheit und Ungerechtigkeit der Menschen abzuwenden, ebenso wie vom Menschen die seiner Trägheit und Unmä‐ ßigkeit.“70
Smiths Erörterung gipfelt in einer der berühmtesten und am häufigsten zitierten Pas‐ sagen des Wealth: „Hebt man alle Systeme einer Förderung vollständig auf, so wird sich das naheliegende und einfache System natürlicher Freiheit von selbst einstellen. Solange er nicht gegen Gesetz und Recht verstößt, steht es jedermann vollkommen frei, sein eigenes Interesse auf seine eigene Weise zu verfolgen und einerseits mit seiner Arbeit, andererseits mit sei‐ nem Kapital einem anderen – oder einem anderen Stand von Leuten – Konkurrenz zu machen.“71
6. Schlussbemerkung Für sich genommen könnte die zuletzt zitierte Passage als wortgewaltiges Plädoyer für eine starke Zurückdrängung des öffentlichen zugunsten des privaten Sektors ge‐ deutet werden. Aber der Blick auf sein Werk als Ganzes und sein Verständnis der politischen Ökonomie als „Wissenschaft des Staatsmanns“ zeigt, wie gesehen, etwas anderes. Gesetz und Recht und deren Durchsetzung sind wichtig, denn sie haben das Eigeninteresse so zu lenken, dass das Allgemeininteresse nicht unter die Räder kommt. Smiths „Unsichtbare Hand“ ist auf politische Unterstützung angewiesen. Ihre vorteilhaften Wirkungen entfaltet sie nur unter gewissen Bedingungen, die eine kluge, umsichtige Politik zur Voraussetzung haben. Märkte dürfen nicht von über‐ mäßiger Macht und Privilegien kontaminiert sein. Leistungsfähige Institutionen müssen für faire und gerechte Rahmenbedingungen der Wirtschaftstätigkeit sorgen. Informationsasymmetrien der Akteure müssen, so gut es geht, bekämpft werden, um die Gelegenheit für Betrug und Täuschung zu verringern. Und das Gefahrenpotenti‐ al, das von einer zunehmenden Wissensfragmentierung infolge voranschreitender Spezialisierung und gesellschaftlicher Arbeitsteilung sowie einem immer komplex‐ 70 WN IV.ix.28; Hervorhebung HDK. 71 WN IV.ix.51.
90
eren Netz an Marktbeziehungen ausgeht, muss wirksam kontrolliert werden. Nicht umsonst plädiert Smith für eine allgemeine, wenngleich nur elementare Schulbil‐ dung, die Bereitstellung einer die Produktion und Warendistribution erleichternden Infrastruktur sowie die Schaffung zahlreicher weiterer Voraussetzungen einer ge‐ deihlichen Entwicklung. Diese Voraussetzungen sind zu einem beträchtlichen Teil öffentliche Aufgaben. Und, mahnt Smith wiederholt: Wie könnte eine, wie man heu‐ te sagen würde, nicht-inklusive Entwicklung auf Dauer stabile Verhältnisse garantie‐ ren? Was wären das für Zustände, wenn diejenigen, die die ganze Welt ernähren und kleiden, selbst in Lumpen daherkommen? Smith setzt sich für einen grundlegenden Umbau des öffentlichen Sektors ein. Der alte Gunst- und Gönnerstaat mit seinen Pri‐ vilegien und exzessiven Regulierungen zugunsten gewisser Interessengruppen auf Kosten der Allgemeinheit ist abzuschaffen. Nicht Deregulierung schlechthin ist die Devise, sondern der Ersatz von Regulierungen, die Einzelne bevorteilen, durch sol‐ che, die allgemein von Vorteil sind, weil sie die dunklen Seiten des Selbstinteresses bändigen und die hellen fördern. Kurzum: Es geht um die Herausbildung eines Rechts- und Leistungsstaates, der auf die sich wandelnden Herausforderungen der Zeit in adäquater Weise zu reagieren imstande ist und dabei, wie Smith schreibt, „so‐ wohl die Bevölkerung als auch den Herrscher reicher macht“72.
Literatur Aspromourgos, Tony, 1996: On the Origins of Classical Economics: Distribution and Value from William Petty to Adam Smith. London/New York. Aspromourgos, Tony, 2009: The Science of Wealth: Adam Smith and the Framing of Political Economy. London. Campbell, R. H./Skinner, Andrew S. 1976: General Introduction. In: Smith, Adam, 1976 b, S. 1-66. Foley, Duncan K., 2006: Adam’s Fallacy. A Guide to Economic Theology. Cambridge, MA/ London. Hume, David, [1752] 1985: Of the Jealousy of Trade. In: Essays Moral Political and Literary. Hrsg. von Eugene F. Miller. Indianapolis, S. 327-331. Kurz, Heinz D. (Hrsg.), 1991: Adam Smith (1723-1790). Ein Werk und seine Wirkungsge‐ schichte. Marburg. Kurz, Heinz D., 2011: David Hume. Von der „Natur des Menschen“ und der kommerziellen Gesellschaft“. Oder: Über „Nebenwirkungen“ und „wirkliche Ursachen“. In: Aufklärung und Kritik. Zeitschrift für freies Denken und humanistische Philosophie, Band 18, Heft 1, S. 100-126. Kurz, Heinz D., 2015: Adam Smith on Markets, Competition and Violations of Natural Liber‐ ty. In: Cambridge Journal of Economics 40(2), S. 615-638. 72 Vgl. WN IV.1.
91
Kurz, Heinz D., 2016 a: Economic Thought: A Brief History. New York. Kurz, Heinz D., 2016 b: Zur Politischen Ökonomie des homo mercans. Adam Smith über Märkte. In: Schmidt am Busch, Hans-Christoph (Hrsg.), 2016: Deutsches Jahrbuch Philo‐ sophie Bd. 7, Hamburg, S. 23-48. Kurz, Heinz D., 2017: A Plain Man’s Guide to David Ricardo’s Principle of Comparative Ad‐ vantage. In: Senga, Shigeyoshi/Fujimoto, Masatomi/Tabuchi, Taichi (Hrsg.), 2017: Ricar‐ do and International Trade, London, S. 9-19. Kurz, Heinz D., 2018: Power – The Bête Noire in Much of Modern Economics. In: Artha Vi‐ jnana, 69(4), S. 319-376. Kurz, Heinz D./Sturn, Richard, 2013 a: Die größten Ökonomen: Adam Smith. Konstanz. Kurz, Heinz D./Sturn, Richard, 2013 b: Adam Smith für jedermann: Pionier der modernen Ökonomie. Frankfurt am Main. List, Friedrich, [1841] 1930: Das nationale System der politischen Ökonomie. Werke. Schrif‐ ten. Reden. Briefe in 10 Bänden (hrsg.von Erwin von Beckenrath et al.) Band 6, Berlin. Magnusson, Lars, 2015: The Political Economy of Mercantilism. London/New York. Negishi, Takashi, 1993: A Smithian Growth Model and Malthus’s Optimal Propensity to Sa‐ ve. In: The European Journal of the History of Economic Thought, Bd. 1, S. 1-9. Schotter, Andrew, 1985: Free Market Economics: A Critical Appraisal. New York. Smith, Adam, [1759] 1976 a: The Theory of Moral Sentiments. In: Raphael, David D./Macfie, Alec Lawrence (Hrsg.), 1976: The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, Oxford (Kurzzitat: TMS). Smith, Adam, [1776] 1976 b: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. In: Campbell, R. H./Skinner, A. S. (Hrsg.), 1976: The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, zwei Bde, Oxford (Kurzzitat: WN, Buchnummer, Kapi‐ telnummer, Abschnittsnummer, Passagennummer). Smith, Adam, 1976 c: Lectures on Jurisprudence. In: Meek, Ronald L./Raphael, David D./ Stein, Peter G. (Hrsg.), 1976: The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, Bd. 5, Oxford (Kurzzitat: LJ). Smith, Adam, 1999: Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker. Hrsg. und eingeleitet von Streissler, Erich W., übersetzt von Streissler, Monika. 2 Bde., Düsseldorf. Sraffa, Piero, 1960: Production of Commodities by Means of Commodities. Cambridge, UK. Veblen, Thorstein, 1899: The Theory of the Leisure Class. An Economic Study in the Evoluti‐ on of Institutions. New York. Young, Allyn A., 1928: Increasing Returns and Economic Progress. In: The Economic Jour‐ nal, 38 (152), S. 527-542.
92
Bastian Ronge Die Aufgaben des Staates bei Adam Smith
Kaum ein anderer Name ist so eng mit dem Begriff des Liberalismus verknüpft wie derjenige von Adam Smith. Wann immer in der Öffentlichkeit über die Vor- und Nachteile des liberalen Gesellschaftsmodells gestritten wird, fast immer geschieht dies mit Verweis auf Adam Smith. Der schottische Aufklärer ist zur Spielmarke in der politischen Auseinandersetzung geworden. Eine vorurteilsfreie Begegnung mit ihm und seinem Werk ist kaum möglich; zu sehr haben wir uns daran gewöhnt, mit seinem Namen eine Position zu markieren, statt uns mit seiner Position auseinander‐ zusetzen. Betroffen hiervon ist auch und insbesondere die Frage nach den Aufgaben des Staates bei Adam Smith. Wie weit der Einfluss staatlichen Handelns reichen darf und soll, gehört schließlich zu jenen Fragen, an denen sich die Debatte zwischen Vertretern und Kritikern des Liberalismus immer wieder entzündet. Für die Verfech‐ ter des freien Marktes steht fest, dass Staatlichkeit und Wirtschaftsfreiheit in einem grundsätzlichen Spannungsverhältnis zueinander stehen: Je mehr Staat existiert, des‐ to weniger Entfaltungsmöglichkeiten besitzt der Markt und mit ihm die Individuen, deren Freiheit von Anhängern des Liberalismus in erster Linie als ökonomische Freiheit verstanden und ausbuchstabiert wird. Folglich sind sie sich darin einig, dass weniger Staat immer besser als zu viel Staat ist.1 Kontrovers diskutiert wird die Fra‐ ge nach dem konkreten Ausmaß des Rückzugs des Staates. Während Vertreter und Vertreterinnen eines libertären Liberalismus davon überzeugt sind, dass der Staat auf einen absoluten Nullpunkt reduziert werden kann und soll, gehen Anhänger und An‐ hängerinnen gemäßigter Spielarten des Liberalismus (wie beispielsweise des Ordoli‐ beralismus) davon aus, dass ein Mindestmaß an Staatlichkeit unvermeidbar und so‐ gar notwendig ist, um den freien Markt zu ermöglichen und zu erhalten. Die Frage nach dem (Aus-)Maß der Staatsaufgaben scheidet somit nicht nur liberale und nichtliberale Geister voneinander, sondern auch die liberalen Geister selbst. Umso inter‐ essanter ist die Frage, wie der vermeintliche Gründervater des Liberalismus diese Schlüsselfrage beantwortet. Im Folgenden werde ich die Smithʼsche Antwort rekonstruieren, indem ich zu‐ nächst in kritischer Absicht die Standardinterpretation präsentiere, der zufolge Smith im Wohlstand der Nationen eine Art Minimalstaat propagiert (1. Teil). Anschließend 1 Michel Foucault hat in seinen Untersuchungen zur Gouvernementalität herausgearbeitet, dass die Durchsetzung von ökonomischer Freiheit nicht ein Weniger, sondern ein Mehr an Staatlich‐ keit verlangt (vgl. Foucault 2006 b, S. 102-105.).
93
werde ich ein vollständige(re)s Bild von Smiths Theorie der Staatsaufgaben zeich‐ nen (2. Teil), bevor ich abschließend die Ergebnisse meiner Argumentation zusam‐ menfasse (3. Teil).
1. Die Standardinterpretation: Die drei Aufgaben des Staates Die von vielen Forschern und Forscherinnen vertretene Standardinterpretation be‐ sagt, dass Smith im Wohlstand der Nationen das Ideal eines minimalen Staates ent‐ wirft, der nur drei Aufgaben zu erfüllen hat.2 Er soll sich erstens um die Landesver‐ teidigung kümmern (Sicherheit nach außen), zweitens ein funktionierendes Rechts‐ system bereitstellen (Sicherheit nach innen) und drittens „für öffentliche Bauwerke und öffentliche Einrichtungen“3 sorgen. Diese Interpretation kann sich insbesondere auf eine Passage am Ende des vierten Teils des Wohlstands der Nationen stützen, wo Smith scheinbar apodiktisch konstatiert: „Im System natürlicher Freiheit hat der Landesherr nur drei Pflichten zu erfüllen, drei Pflichten von großer Bedeutung freilich, die aber auf der Hand liegen und dem gewöhnli‐ chen Verstand zugänglich sind: Erstens, die Pflicht, die Gesellschaft vor Gewalttaten und Angriffen anderer unabhängiger Gesellschaften zu schützen; zweitens die Pflicht, jedes Mitglied der Gesellschaft soweit wie möglich gegen Ungerechtigkeit oder Unterdrückung seitens jedes anderen Mitgliedes zu schützen, also die Pflicht, eine verläßliche Rechts‐ pflege einzurichten: und drittens die Pflicht, bestimmte öffentliche Bauwerke und be‐ stimmte öffentliche Einrichtungen zu schaffen und instand zu halten [...].“4
Viele Interpreten lesen diese Passage so, als ob Smith hier den Drei-Pflichten-Staat zu einem überzeitlichen, normativen Ideal erklärt. Was sonst soll mit der Rede vom System natürlicher Freiheit gemeint sein, wenn nicht derjenige Gesellschaftszu‐ stand, der am meisten mit der Natur des Menschen als einem freien Wesen überein‐ stimmt und daher unbedingt wünschenswert ist? Diese Interpretation entspricht ganz der Smithʼschen Wirkungsabsicht. Tatsäch‐ lich will Smith die Lesenden von der normativen Überlegenheit des Systems natürli‐ cher Freiheit überzeugen und zwar gegenüber dem System des Merkantilismus, das Smith im vierten Teil des Wohlstands der Nationen rigoros kritisiert. 2 Diese Interpretation findet sich prominent bei George Stigler (Stigler 1971, S. 1) und Milton Friedman (Friedman 1978, S. 7; S. 17), aber auch bei zahlreichen anderen Autoren. Samuels und Medema bezeichnen diese Sichtweise treffenderweise als „minimalist view“, vgl. hierzu: „That Adam Smith stands for the themes of laissez-faire, noninterventionalism, and minimal go‐ vernment is a dominant theme in economics and elsewhere – including among those critical of the laissez-faire position. Innumerable examples of this view – which we shall call the "minima‐ list" view of Smith – appear in the economics literature past and present." (Samuels/Medema 2005, S. 219). 3 Smith 2005, S. 698. 4 Smith 2005, S. 671 f.
94
Der Merkantilismus ist die bis dahin dominierende (wirtschafts-)politische Dok‐ trin in den meisten europäischen Staaten. Sie besagt, dass der Wohlstand einer Ge‐ sellschaft in der größtmöglichen Ansammlung von Gold und Geld besteht. Folglich setzt die merkantilistische Wirtschaftspolitik alles daran, möglichst viel Gold und Geld ins Land zu holen, indem sie Exporte heimischer Waren in fremde Länder sub‐ ventioniert und Importe ausländischer Produkte erschwert. Für Smith ist der Mer‐ kantilismus nichts anderes als Staatsräson gewordenes Partikularinteresse. Die einzi‐ gen Nutznießer dieser (Wirtschafts-)Politik sind die einheimischen Hersteller und Händler, die sich dank der Exportsubventionen und Importbeschränkungen eine gol‐ dene Nase verdienen und zwar auf Kosten der Bevölkerung, die dazu gezwungen ist, ausländische Waren zu überteuerten Preisen zu kaufen oder mit den heimischen, künstlich konkurrenzfähig gemachten Produkten vorlieb zu nehmen. Laut Smith hat der Merkantilismus in Großbritannien zu einer Verzerrung der ge‐ samten Wirtschaftsordnung geführt, die unbedingt überwunden werden muss, wenn die nationale Wirtschaft wieder prosperieren und die dramatische Staatsschuldenkri‐ se überwunden werden soll, die den britischen Staat in seinem Bestand bedroht. Ne‐ ben sachlichen Argumenten gegen die merkantilistische Wirtschaftspolitik (und für eine agrarkapitalistische Wende) greift der ehemalige Rhetoriklehrer Smith auch im‐ mer wieder auf rhetorische Strategien zurück, um die Leser von der Richtigkeit sei‐ ner Argumentation zu überzeugen. Dazu zählt nicht nur die berühmte Metapher von der „unsichtbaren Hand“5, sondern auch der nur selten zitierte Vergleich des mer‐ kantilistischen Plädoyers für die Ansammlung von Gold und Silber im Staatshaus‐ halt mit der unnötigen Anhäufung von Töpfen und Pfannen im Privathaushalt6, wie auch die Rede vom natürlichen, deswegen besseren System der Freiheit mit ihrer stillschweigenden Entgegensetzung gegen das künstliche, deswegen schlechtere Sys‐ tem des Merkantilismus. Smith vermeidet es, den Lesenden direkt zu sagen, wofür die Rede vom natürli‐ chen System der Freiheit eigentlich steht, nämlich für eine am Primat des landwirt‐ schaftlichen Sektors ausgerichtete Wirtschaftsordnung. Smith sieht in der Landwirt‐ schaft – hierin den Physiokraten folgend – die wichtigste Quelle für den Wohlstand einer Gesellschaft.7 Als empirischer Beleg dienen ihm die nordamerikanischen Ko‐ lonien. Dort kann jeder Bürger sein eigenes Stück Land erwerben und bebauen, so 5 Smith 2005, S. 467. 6 Vgl. hierzu Smith 2005, S. 453. 7 „Kein Kapital gleicher Größe setzt mehr produktive Arbeit in Gang als das des Landwirts. Nicht nur sein Gesinde, sondern auch seine Arbeitstiere sind produktive Arbeitskräfte. In der Land‐ wirtschaft arbeitet mit dem Menschen auch die Natur. [...] Das in der Landwirtschaft verwendete Kapitel setzt nicht nur eine größere Menge produktiver Arbeit in Gang als ein gleich großes in der gewerblichen Produktion eingesetztes Kapital, sondern es fügt auch dem jährlichen Ertrag von Boden und Arbeit des Landes, dem wirklichen Reichtum und Einkommen seiner Einwoh‐ ner, einen – im Verhältnis zur Menge der produktiven Arbeit, die es beschäftigt – viel größeren Wert hinzu. Von allen Arten der Kapitalverwendung ist diese für die Gesellschaft bei weitem die
95
dass die Wirtschaftskraft der Individuen in den volkswirtschaftlich wichtigsten Sek‐ tor fließt.8 Smith beschreibt dieses nordamerikanische Wirtschaftsmodell als ein na‐ türliches System der Freiheit, in dem individuelles Interesse und gesellschaftliches Allgemeinwohl ineinandergreifen (eben so, als ob sie von einer unsichtbaren Hand vermittelt werden) und hebt es somit zugleich vom künstlichen, widernatürlichen Wirtschaftssystem des Merkantilismus ab, in welchem die natürliche Wirtschaftsord‐ nung so korrumpiert ist, dass eigennütziges Verhalten die ohnehin schon verzerrte Volkswirtschaft noch weiter verzerrt.9 Smiths rhetorisches Kalkül geht auf. Die meisten seiner Zeitgenossen und Gene‐ rationen von Interpreten übersehen, dass die Rede vom natürlichen System der Frei‐ heit integraler Bestandteil von Smiths „very violent attack upon the whole commer‐ cial system of Great Britain“10 ist. Stattdessen erkennen sie darin, wie von Smith be‐ absichtigt, ein normatives Ideal mit überzeitlichem Geltungsanspruch und das, ob‐ wohl Smith im Laufe seines Buches immer wieder klarstellt, dass es in der Welt der Wirtschaftspolitik keine überzeitlichen Werte geben kann. Denn: Das Ökonomische besitzt eine eigene Historizität, die jede Möglichkeit eines radikalen Neuanfangs ausschließt. Bei aller Kritik an der ökonomischen (Un-)Ordnung seiner Gegenwart warnt Smith energisch davor, die dringend notwendige Restrukturierung der Volks‐ wirtschaft im Modus der Revolution durchzuführen.11 Radikale wirtschaftspolitische Maßnahmen können nur zu weiteren Verwerfungen führen; selbst wenn sie der Sa‐ che nach richtig sind und nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt werden. Entsprechend kann auch der Agrarkapitalismus der nordamerikanischen Kolonien nicht als Blaupause für die britische Wirtschaft dienen, sondern bestenfalls als Kon‐ trastfolie, um den Zeitgenossen die Schattenseiten des merkantilistischen Wirt‐ schaftssystems vor Augen zu führen und dem Gesetzgeber ein Vorbild zu geben, an dem er sich bei den wirtschaftspolitischen Reformen orientieren kann.12 Wenn Smith am Ende des vierten Buches – sprich am Ende jenes Teils des Wohlstands der Natio‐ nen, der darauf abzielt, die Wirtschaftspolitik des Merkantilismus zu dekonstruieren –, davon spricht, dass „[i]m System natürlicher Freiheit [...] der Landesherr nur drei Pflichten zu erfüllen“13 hat, dann soll dies in erster Linie deutlich machen, dass sich
8 9 10 11 12 13
96
vorteilhafteste.“ (Smith 2005, S. 391). Im Unterschied zu den Physiokraten erkennt Smith aber durchaus auch die volkswirtschaftliche Bedeutung des Gewerbes und des Handels an. Zu Smiths Auseinandersetzung mit den Physiokraten insgesamt, vgl. Smith 2005, S. 650-672, sowie den Beitrag von Kurz in diesem Band (insb. Abschnitt 3). Vgl. hierzu Smith 2005, S. 405 f. sowie insbesondere S. 437 f. Vgl. hierzu Ronge 2015, S. 284-292. Smith 1987, S. 251. Vgl. hierzu Smith 2005, S. 478-481, und in der Sekundärliteratur Blaug 1998, S. 56 sowie Sa‐ muels/Medema 2005, S. 223. Vgl. hierzu auch die Einschätzung von John Dwyer: „One of Adam Smith's chief aims, I would suggest, was to redress the balance in favour of agriculture, whose independent pro‐ prietors were both the economic and ethical backbone of the nation.“ (Dwyer 1998, S. 69). Smith 2005, S. 671.
der merkantilistische Staat mit seiner Vielzahl an wirtschaftspolitischen Aktivitäten viel zu viele Aufgaben anmaßt, „für deren angemessene Erfüllung keine menschli‐ che Weisheit oder Wissenschaft jemals ausreichen könnte“14. Die Reduktion der (merkantilistischen) Staatsaufgaben gehört zweifellos zu jenem wirtschaftspoliti‐ schen Reformprozess, den Smith mit seinem Buch initiieren und befördern will – ein Reformprozess, der nicht nur deswegen geboten ist, weil der Merkantilismus unver‐ hohlene Klientelpolitik auf Kosten der Bevölkerung betreibt, sondern auch, weil nur auf diese Weise die bereits erwähnte Staatsschuldenkrise bewältigt werden kann, die wie ein Damoklesschwert über Großbritannien schwebt. Tatsächlich ist der „Wohl‐ stand der Nationen“ nicht nur ein rhetorisch brillanter Angriff auf den Merkantilis‐ mus, sondern kann zugleich auch als Verteidigungsschrift für einen in seiner Exis‐ tenz bedrohten Staat gelesen werden. Dieser Aspekt wird häufig übersehen, obwohl ihn Smith selbst in seiner Definition von Politischer Ökonomie benennt: „Politische Ökonomie, als Teil der Kunst des Staatsmannes oder Gesetzgebers versanden, setzt sich zwei verschiedene Ziele: Erstens, der Bevölkerung reichliches Einkommen oder reichlichen Unterhalt zu verschaffen oder, genauer gesagt, es ihr zu ermöglichen, sich selbst ein solches Einkommen oder einen solchen Unterhalt zu verschaffen, und zweitens, für den Staat oder das Gemeinwesen ein Einkommen zu schaffen, das aus‐ reicht, um die öffentlichen Dienstleistungen zu bestreiten. Sie setzt sich zum Ziel, sowohl die Bevölkerung als auch den Herrscher reicher zu machen.“15
Die Bevölkerung reicher zu machen setzt voraus, die merkantilistische Wirtschafts‐ politik zu überwinden und durch eine Wirtschaftspolitik zu ersetzen, in welcher hei‐ mische Produzenten und Händler sich nicht mehr auf Kosten der Bevölkerung berei‐ chern können. Den Staat reicher zu machen bedeutet, ihm so viele Steuereinnahmen zu ermöglichen, dass er seinen Pflichten und Aufgaben nachkommen kann. In Zei‐ ten jener „ungeheuren Schulden, die alle großen Völker Europas gegenwärtig drü‐ cken und langfristig wahrscheinlich zugrunde richten werden“16, bedeutet dies, dass „die Staatseinnahmen sehr erheblich vergrößert oder die Staatsausgaben ebenso er‐ heblich gesenkt werden“17 müssen. Nur durch diese Doppelbewegung – Erhöhung des Steueraufkommens und Reduktion der Ausgaben – lässt sich die Schuldenkrise lösen. Wenn sich Smith im fünften und letzten Buch des Wohlstands der Nationen den „Finanzen des Herrschers oder des Gemeinwesens“18 zuwendet, dann mit der Ab‐ sicht, den Lesenden mit dieser Doppelbewegung vertraut zu machen und realistische Szenarien zu entwerfen, wie die Staatsschuldenkrise gelöst werden kann, ohne dass
14 15 16 17 18
Smith 2005, S. 671. Smith 2005, S. 443. Smith 2005, S. 865. Smith 2005, S. 865. Smith 2005, S. 673.
97
dafür Abstriche bei den vom Staat zu erfüllenden Mindest-Pflichten gemacht werden müssen. Das fünfte Buch gliedert sich insgesamt in drei Kapitel: Im ersten Kapitel behandelt Smith die „notwendigen Ausgaben des Herrschers oder des Gemeinwe‐ sens“19, sprich die Frage, wie sich die Ausgaben des Staatshaushaltes reduzieren las‐ sen. Er gliedert seine Ausführungen entsprechend der bereits erwähnten Pflichten in einen Abschnitt über die notwendigen Ausgaben für die „Landesverteidigung“20, für die „Rechtspflege“21 und „für öffentliche Bauwerke und öffentliche Einrichtun‐ gen“22. Nachdem Smith im ersten Kapitel die Ausgabenseite des Staates analysiert hat, wendet er sich im zweiten Kapitel den „Quellen der öffentlichen oder Staatsein‐ nahmen“ zu und diskutiert Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten der Steuererhebung.23 Im dritten und letzten Kapitel des fünften Buches wendet sich Smith dem Problem der „Staatsschulden“ zu und skizziert mögliche Szenarien, wie die Staatsschuldenkrise der Gegenwart überwunden werden kann.24 Smith themati‐ siert somit erst am Ende des fünften Buches, was seine Überlegungen vom ersten Kapitel an motiviert. Ihn interessiert die Frage der Staatsausgaben (ebenso wie die Frage der Staatseinnahmen) nicht aus rein theoretischer Neugierde. Er untersucht die notwendigen Staatsaufgaben nicht, weil es zur politischen Philosophie gehört, die Frage zu klären, welche staatlichen Eingriffe in den Gesellschaftskörper aus welchen Gründen gerechtfertigt sind und welche nicht. Er interessiert sich für die Frage, weil die „Erfüllung dieser verschiedenen Herrscherpflichten [...] gewisse Ausgaben“25 er‐ fordert, das heißt, weil sie Kosten verursachen, die bei der Überwindung der Staats‐ schuldenkrise berücksichtigt werden müssen. Die Anhänger und Anhängerinnen der Standardinterpretation haben also durchaus Recht, wenn sie behaupten, dass Smith im fünften Buch des „Wohlstands der Natio‐ nen“ das Programm einer minimalen Staatlichkeit entwirft. Sie übersehen dabei al‐ lerdings den Kontext, in dem dieses Programm steht. Smith spricht sich für die Re‐ duktion der Staatlichkeit auf drei Staatsausgaben nicht aus, weil er den Minimalstaat für ein normatives Ideal hält, sondern weil die Reduktion der Staatspflichten unaus‐ weichlich ist, um den Staat vor dem drohenden Bankrott zu bewahren. Pointiert for‐ muliert: Die Standardinterpretation übersieht, dass die Reduktion der Staatlichkeit im Zeichen der Rettung eines bedrohten Staatswesen steht. Ob Smith einem prospe‐ rierenden Staat ebenfalls nur drei Staatspflichten auferlegen würde, kann aus der Tatsache, dass er dem fast bankrotten britischen Staat eine Reduktion der Staatsauf‐ gaben anempfiehlt, nicht geschlussfolgert werden. Und auch der Verweis auf die ein‐ 19 20 21 22 23 24 25
98
Smith 2005, S. 672, Hervorhebung B. R. Vgl. hierzu Smith 2005, S. 673-687. Vgl. hierzu Smith 2005, S. 688-698. Vgl. hierzu Smith 2005, S. 698-776. Vgl. hierzu Smith 2005, S. 779-860. Vgl. hierzu. Smith 2005, S. 861-897. Smith 2005, S. 672.
gangs zitierte Passage, in der Smith den 3-Pflichten-Staat zum überzeitlich-normati‐ ven Ideal erklärt, verfängt nicht, da diese Formel Smiths grundlegender Überzeu‐ gung von der Historizität des Ökonomischen widerspricht und daher nicht als Argu‐ ment, sondern als rhetorische Figur interpretiert werden muss.26 Schließlich zeigt eine genauere Textanalyse, dass das Bild von den drei Staatspflichten ohnehin un‐ vollständig ist, insofern die drei explizit genannten Pflichten des Staates unter Smiths Hand (besser gesagt: unter Smiths Schreibfeder) zu fünf Pflichten anwach‐ sen, die zudem um zwei weitere, implizite Pflichten ergänzt werden müssen, wenn man ein vollständiges Bild von den Staatsausgaben bei Smith erhalten will.
2. Das vollständige Bild: Die sieben Aufgaben des Staates Drei Pflichten führen zu unbedingt „notwendigen Ausgaben des Herrschers oder des Gemeinwesens“27: Die Pflicht zur Landesverteidigung, die Pflicht für eine funktio‐ nierende Rechtsprechung zu sorgen und die Pflicht, die notwendige Infrastruktur be‐ reitzustellen, um Handel und Bildung zu verbessern. Smith widmet (im ersten Kapi‐ tel des fünften Buchs) jeder Pflicht einen eigenen Abschnitt, wobei er auf die von ihm entwickelte 4-Stadien-Theorie zurückgreift, um die Kostenentwicklung der ein‐ zelnen Staatspflichten im historischen Längsschnitt darzustellen.28 Die 4-Stadien-Theorie besagt, dass sich die menschliche Gesellschaft in vier Sta‐ dien entwickelt hat: In der ursprünglichen Epoche der Jagdgesellschaft (Age of Hun‐ ters) lebten die Menschen in kleinen Gruppen zusammen. Diese Epoche zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es zu diesem Zeitpunkt noch kein Privateigentum gibt. Die Jagdbeute wird gleichmäßig unter den Mitgliedern der Gruppe verteilt und verzehrt. Folglich besteht in diesen Gesellschaften auch keine Notwendigkeit, Rechts- und Regierungsverhältnisse zu etablieren. In der darauffolgenden Epoche der Hirtengesellschaft (Age of Shepards) ändert sich dies. Hier entstehen die ersten und zugleich sehr dramatischen Vermögensunterschiede: Während dem jeweiligen 26 Dass der Staat im natürlichen Zustand der Freiheit vermeintlich nur drei Staatsaufgaben zu er‐ füllen hat, die ausgerechnet jene sind, die selbst ein fast bankrotter Staat noch erfüllen muss, beweist ein weiteres Mal die Brillanz der Smith’schen Überzeugungskunst. Zunächst inszeniert er die von ihm politisch gewollte agrarkapitalistische Wende als normativ wünschenswert (nämlich als den natürlichen Zustand der Freiheit), bevor er sie zu einem späteren Zeitpunkt als politisch notwendig ausweist, um dem Staatsbankrott zu entgehen. 27 Smith 2005, S. 672. 28 Die Historisierung der Gesellschaft bzw. die Periodisierung der Geschichte anhand gesell‐ schaftlicher Entwicklungsstufen gehört zum Allgemeingut des Aufklärungsdenkens und findet sich unter anderem bei Turgot, Ferguson oder James Steuart. Selbst die Periodisierung in die genannten vier Stadien findet sich bei zahlreichen (schottischen) Aufklärern wie beispielsweise John Dalrymple, Lord Kames, William Robertson oder John Millar (vgl. Meek 1976, 99ff.). Gleichwohl gibt es Grund zur Annahme, dass Smith als erstes diese Theorie entwickelt hat (vgl. hierzu Meek 1971, S. 20ff.; Meek 1976, S. 111 f.; Liebermann 2006, S. 225).
99
Häuptling die ganze Herde gehört, besitzen die anderen Mitglieder des Stamms we‐ nig bis gar nichts. Der Häuptling schützt sein Vermögen mit Hilfe der Gruppe der Wenig-Vermögenden und ahndet jedes Eigentumsdelikt auf drakonische Weise. Die Epoche der Agrargesellschaft (Age of Agriculture) ist dadurch gekennzeichnet, dass die Menschen sesshaft werden und damit beginnen, Landwirtschaft zu betreiben. Die Vermögensunterschiede innerhalb der Gesellschaft normalisieren sich. Mit der vierten Phase – der Epoche der kommerziellen bzw. bürgerlichen Gesellschaft (Age of Commercial Society) – sind wir in der Gegenwart des 18. Jahrhunderts angekom‐ men. Diese Gesellschafsformation ist laut Smith durch ein hohes Maß an gesell‐ schaftlicher Arbeitsteilung gekennzeichnet, die für den unglaublichen gesellschaftli‐ chen Wohlstand (im Vergleich zu früheren Gesellschaftsepochen) verantwortlich ist. Zugleich findet hier eine weitreichende Entfaltung der politischen und rechtlichen Institutionen statt (z. B. Trennung von Exekutive und Judikative). Smith benutzt die 4-Stadien-Theorie gern und häufig, um historische Prozesse zu analysieren – wobei nicht klar zwischen spekulativer und empirisch gestützter Theo‐ riebildung getrennt werden kann.29 Auch bei der Analyse der verschiedenen Staats‐ aufgaben bzw. der mit ihnen verbundenen Kosten greift Smith auf dieses Schema zurück. So stellt er fest, dass die Kosten für die Landesverteidigung je nach Gesell‐ schaftsformation stark variieren. In Jagd- und Hirtengesellschaften fallen noch gar keine Kosten für die Landesverteidigung an, weil alle Gesellschaftsmitglieder durch ihre alltäglichen Praktiken in der Kriegskunst geübt sind und sich im Verteidigungs‐ fall der gesamte Gemeinschaftskörper in eine schlagkräftige Quasi-Armee verwan‐ delt.30 Ganz anders stellt sich die Situation in der Epoche der bürgerlichen Gesell‐ schaft dar. Ausgerechnet jene Gesellschaften, die aufgrund ihres Wohlstandes am wahrscheinlichsten von anderen Gesellschaften überfallen werden, können sich am schlechtesten verteidigen.31 Die Gesellschaftsmitglieder sind so sehr in ihre speziali‐ sierten Beschäftigungen eingebunden, dass sie keine Zeit und Gelegenheit mehr ha‐ ben, sich in kriegerischen Tugenden zu üben. Zudem können sie es sich schlicht fi‐ nanziell nicht leisten, in den Krieg zu ziehen, weil jeder Tag fern des Arbeitsplatzes einen realen Einkommensverlust mit sich bringt. Kurzum: In der bürgerlichen Ge‐ sellschaft müssen die Regierenden finanzielle Mittel aufwenden, um ihrer Pflicht zur Landesverteidigung nachzukommen. Sie müssen ein stehendes Heer unterhalten, wobei die damit verbundenen Kosten mit fortschreitender Waffen- und Militärtech‐ nik immer weiter steigen.32 Auch die zweite Pflicht des Staates – die Rechtspflege – unterliegt historischen Transformationsprozessen. Solange es noch kein Privateigentum gibt, kommen 29 Zur Bedeutung dieser „konjekturalen“ Art von Geschichtsschreibung in der (schottischen) Aufklärung vgl. unter anderem Hopfl 1978, Wokler 1995 und Phillips 2000. 30 Vgl. hierzu Smith 2005, S. 674 f. 31 Vgl. hierzu Smith 2005, S. 679; S. 751. 32 Vgl. hierzu Smith 2005, S. 687.
100
Rechtsverletzungen eher selten vor, so dass es noch keiner institutionalisierten Rechtsprechung bedarf. Erst mit der Entstehung des Privateigentums und den damit einhergehenden sozialen Ungleichheiten werden juridische und polizeiliche Institu‐ tionen notwendig. In der Hirtengesellschaft vereint der Häuptling legislative und exekutive Gewalt in seiner Person. Die Rechtsprechung kostet zu diesem Zeitpunkt noch kein Geld, sondern stellt für den regierenden Häuptling sogar eine Geldeinnah‐ mequelle dar, da er sich seine richterlichen Entscheidungen von den klageführenden Parteien bezahlen lässt. Mit der Zunahme der ökonomischen Aktivitäten innerhalb der Gesellschaft muss die Regierung schließlich die „Trennung der richterlichen von der vollziehenden Gewalt“33 vornehmen: Der Bedarf nach Rechtsprechung wird so groß und die Rechtsprechung selbst so kompliziert und zeitaufwendig, dass dafür ein eigener Berufsstand geschaffen werden muss. Damit die Richter unabhängige Urtei‐ le fällen können, ist es laut Smith entscheidend, dass ihr Einkommen „nicht vom gu‐ ten Willen, ja nicht einmal vom guten Wirtschaften“34 der Regierung abhängt. Folg‐ lich müssen die Richter aus dem Staatshaushalt finanziert werden und zwar unab‐ hängig von der jeweiligen Haushaltslage. Gleichwohl weist Smith darauf hin, dass es durchaus legitim und zweckdienlich sein kann, Gerichtsgebühren einzuführen, um einem allzu leichtfertigen Gebrauch der rechtlichen Institutionen seitens der Bür‐ ger entgegenzuwirken und zugleich die Ausgabenlast auf Seiten des Staates zu redu‐ zieren.35 Die „dritte und letzte Pflicht des Herrschers oder des Gemeinwesens“ besteht da‐ rin, für „öffentliche Bauwerke und öffentliche Einrichtungen“36 zu sorgen. Smith fasst darunter zwei sehr unterschiedliche Bereiche, nämlich die Infrastruktur, die für den Handel wichtig ist (Straßen, Brücken, Sicherung der Handelswege etc.) und Ein‐ richtungen, die für die Bildung der Bevölkerung (Schulen, Universitäten, religiöse Einrichtungen etc.) notwendig sind. Auch in diesem Fall verändert sich zwar die fi‐ nanzielle Belastung des Staatshaushaltes im Laufe der Geschichte. Allerdings inter‐ essiert sich Smith an dieser Stelle ausschließlich für die anfallenden Kosten in der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung. Bei den wirtschaftlich notwendigen Infrastrukturen unterscheidet er dabei zwi‐ schen den Ausgaben für die Unterstützung des Handels im Allgemeinen und jenen Kosten, die dem Staat entstehen, weil er bestimmte Handelszweige schützen muss. Smith hat dabei vor allem die Aufwendungen für den Schutz des Außenhandels im Blick, sprich die Finanzierung von militärischen Stützpunkten und diplomatischen Vertretungen im Ausland. Es mutet einigermaßen seltsam an, dass ausgerechnet Smith als erklärter Gegner der merkantilistischen Wirtschaftspolitik und ihrer Sub‐ 33 34 35 36
Smith 2005, S. 698. Smith 2005, S. 698. Vgl. hierzu Smith 2005, S. 694. Smith 2005, S. 698.
101
ventionierung des Außenhandels für dessen staatlichen Schutz eintritt. Das Rätsel dieses Plädoyers löst sich auf, wenn man zur Kenntnis nimmt, wie stark Smiths Vor‐ behalte gegenüber dem staatlich nicht regulierten Kolonialhandel sind. Wenn die Handelskompanien selbst ihren Handel schützen und ihre Handelsinteressen in fremden Ländern durchsetzen, hat dies meist verheerende Folgen für die fremden Bevölkerungen.37 Um dies zu verhindern, muss der Staat den Schutz des Außenhan‐ dels übernehmen, wobei die dafür anfallenden Kosten laut Smith durchaus durch die Besteuerung der entsprechenden Handelswaren gegenfinanziert werden sollten.38 Eine solche Gegenfinanzierung hält Smith auch bei der staatlichen Pflicht zur Bil‐ dung der Bevölkerung für legitim. Tatsächlich können Studiengebühren sogar zur Verbesserung der Bildung beitragen, wie Smith mit Hinweis auf die antike Philoso‐ phie argumentiert. Im antiken Griechenland wurden die Philosophen nicht vom Staat bezahlt, sondern von ihren Hörern. Dies entfachte einen Wettbewerb unter ihnen, der laut Smith maßgeblich zur Verbesserung ihrer pädagogischen Fähigkeiten und der Relevanz ihrer Lehre beitrug. Heutzutage vermitteln hingegen staatlich bezahlte Lehrer und Professoren veraltete Lehrinhalte auf veraltete Weise.39 Trotz dieses Plä‐ doyers für die private Finanzierung von Bildungsangeboten lässt Smith keinen Zweifel daran, dass die Bildung der Bevölkerung insgesamt zu den Staatsaufgaben zählt. Auch sie besitzt einen historischen Index: In früheren Gesellschaftsperioden sorgten die Alltagspraktiken dafür, dass die Menschen in ihrem Denken und ihrer Urteilsfähigkeit geschult werden. Sie wurden vor komplexe Aufgaben gestellt, die sie eigenständig erfassen und lösen mussten.40 In der bürgerlichen Gesellschaft ist dies anders: Die fortgeschrittene Arbeitsteilung bringt für die überwiegende Mehr‐ heit der Bevölkerung eine ungeheure Trivialisierung ihrer Tätigkeiten mit sich. Insbesondere die unteren Gesellschaftsschichten sind davon betroffen. In der Fol‐ ge sind sie „nicht nur unfähig an einem vernünftigen Gespräch Gefallen zu finden und teilzunehmen“, sondern auch außerstande, vernünftige Urteile „über viele alltäg‐ liche Aufgaben des Privatlebens“41 und das politische Leben zu fällen. Gerade in de‐ mokratischen Gesellschaften, „in denen die Sicherheit der Regierung sehr stark vom günstigen Urteil des Volkes über ihr Verhalten abhängt, muß es [...] von größter Be‐ deutung sein, daß dieses nicht voreilig oder leichtfertigt urteilt“42. Es ist daher im ureigenen Interesse der Regierung, den mit der Arbeitsteilung einhergehenden ko‐ gnitiven Kollateralschäden entgegenzuwirken. Eine gebildete Bevölkerung ist nicht nur gesetzestreuer, sondern lässt sich auch weniger „durch Schwärmerei und Aber‐
37 38 39 40 41 42
102
Vgl. hierzu Smith 2005, S. 726 f. Vgl. hierzu Smith 2005, S. 707. Vgl. hierzu Smith 2005, S. 747. Smith 2005, S. 748. Smith 2005, S. 748. Smith 2005, S. 753.
glauben verführen“43 und somit gegen die Regierung aufstacheln. Ein hohes gesell‐ schaftliches Bildungsniveau ist für Smith aber auch deswegen wichtig, weil die Menschen dadurch in die Lage versetzt werden, die jeweiligen politischen und öko‐ nomischen Interessen der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu durchschau‐ en und ihrer politischen Durchsetzung unter dem falschen Namen des Allgemein‐ wohls entgegenzutreten.44 Smith fordert daher sowohl die Einführung einer allge‐ meinen Schulpflicht als auch den Ausbau von Gemeindeschulen. So können bei al‐ len Kindern „die Grundvoraussetzungen der Bildung – Lesen, Schreiben und Rech‐ nen“45 gelegt werden, wodurch das zukünftige Bildungsniveau der Bevölkerung si‐ gnifikant gehoben wird. Überraschenderweise sieht Smith den Staat nicht nur bei der Bildung von Kin‐ dern und Jugendlichen in der Pflicht, sondern verlangt von ihm auch, „Bildungsein‐ richtungen für alle Altersstufen“ einzurichten, sprich sich um die „religiöse Unter‐ weisung“46 der Bevölkerung zu kümmern. Allerdings scheint sich diese Pflicht aus‐ schließlich auf die Finanzierung der entsprechenden Infrastruktur zu erstrecken. Eine staatliche Bezahlung der Religionsvertreter lehnt Smith nämlich ausdrücklich ab und widerspricht damit seinem Freund David Hume. Dieser hatte in seiner „History of England“ argumentiert, dass Pfarrer und Prediger staatlich besoldet wer‐ den sollen, weil eine solch leistungsunabhängige Bezahlung dazu führen würde, dass ihr religiöser Eifer erlahmt und somit langsam, aber sicher die Macht der Kirche über die Herzen der Menschen schwindet.47 Smith teilt zwar die Einschätzung Hu‐ mes, dass die Kirche eine ernstzunehmende Konkurrenz für die staatliche Autorität ist und somit ein nicht unerhebliches politisches Risiko darstellt, doch hält er die staatliche Alimentierung der Kirchenmänner für den falschen Weg, um dieses Prob‐ lem zu lösen. Der Staat sollte den religiösen Eifer gerade nicht dämpfen, sondern ihn durch Nicht-Einmischung gewähren und intensiver werden lassen. Der Wettbewerb zwischen den religiösen Wortführern wird ihr rhetorisches Geschick steigern (ähn‐ lich wie bei den antiken Philosophen), doch diese Steigerung ihrer Überzeugungs‐ kraft muss man zulassen, weil sie auf lange Sicht immer neue häretische Abspaltun‐ gen bewirken wird, wodurch die Anzahl der Religionsgemeinschaften steigt und so‐ mit das politische Störpotenzial jeder einzelnen Gruppierung sinkt. Die Macht der Religionsführer über die Herzen der Menschen ist nur politisch riskant, solange die Religionsführer über viele Herzen herrschen. Im Gewirr der religiösen Stimmen löst sich das politische Risikopotenzial der Religion auf.
43 44 45 46 47
Smith 2005, S. 752. Vgl. hierzu Smith 2005, S. 752 f. Smith 2005, S. 750. Smith 2005, S. 753. Vgl. hierzu Hume 1983, S. 136.
103
Die von Smith vorgeschlagene Lösung des politischen Problems der Religion weist deutliche Parallele zur Laissez-Faire-Lösung des Kornmangels auf.48 Ebenso wie sich der Staat nicht in den Kornhandel einmischen darf, wenn er die drohende Gefahr einer Kornknappheit effektiv bekämpfen will, darf er sich nicht in die Fragen der religiösen Unterweisung einmischen, wenn er das Problem der religiösen Herr‐ schaft über die Herzen der Menschen aus der Welt schaffen will. Und ebenso wie der Staat das kurzfristige Steigen der Kornpreise zulassen muss, um das ökonomi‐ sche Problem der Kornknappheit zu lösen, muss die Regierung das religiöse Wettei‐ fern zulassen, um die politische Problem der Religion zu lösen. Smith ist also durch‐ aus mit der Logik des Prinzips des Laissez-Faire vertraut. Hier wie dort muss die Regierung für kurze Zeit auf die Katastrophe zu steuern, um sie letztlich zu vermei‐ den. Umso deutlicher fällt ins Auge, dass er mit Blick auf die Frage der Staatsaufga‐ ben offensichtlich keine Position des Laissez-Faire vertritt. Der Staat soll sich durch‐ aus in die Gesellschaft einmischen und zwar hinsichtlich der genannten Bereiche der Landesverteidigung, des Justizwesens und der ökonomischen bzw. pädagogischen Infrastruktur, wobei der letzte Punkt sinnvollerweise als zwei getrennte Pflichten be‐ handelt werden sollte, nämlich als Pflicht zur Erhaltung der wirtschaftlichen Infra‐ struktur und als Pflicht zur Bildung der Bevölkerung. Hinzu kommt eine fünfte Pflicht, die Smith zu Beginn seiner Ausführungen uner‐ wähnt lässt. Es handelt sich um die Pflicht des Staates zur Repräsentation, die Smith im letzten, sehr kurzen Teil des fünften Buches abhandelt.49 Neben den Ausgaben, die der Staat aufbringen muss, um „seinen verschiedenartgien Pflichten nachzukom‐ men“, muss er auch Geld bereitstellen, „um seine Würde zu erhalten“50. Auch diese Ausgaben nehmen im Laufe des geschichtlichen Fortschritts zu. Denn je mehr die „verschiedenen Volksschichten von Tag zu Tag [...] für ihre Häuser, Einrichtung, Ta‐ fel, Kleidung und Ausstattung aufwenden“, desto mehr Geld muss auch der Souve‐ rän „für alle diese verschiedenartigen Posten“51 aufwenden. „Seine Würde scheint das nachgerade zu verlangen“.52 Die Ausgaben für die politische Repräsentation sind mithin notwendige Ausgaben, woraus sich wiederum schließen lässt, dass es sich bei der politischen Repräsentation um eine Pflicht des Staates handelt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Smith dem Staat explizit drei Pflichten zuschreibt, die sich im Laufe seiner Darstellung als fünf Pflichten erweisen: Der Staat muss für die Landesverteidigung, ein funktionierendes Justizwesen, die Bereit‐ stellung der ökonomisch notwendigen Infrastruktur, die Bildung der Bevölkerung und seine angemessene Repräsentation sorgen. Darüber hinaus gibt es noch zwei im‐ plizite Pflichten, die Smith zwar nicht expressis verbis als Staatsaufgaben benennt, 48 49 50 51 52
104
Vgl. hierzu Foucault 2006 a, S. 52-79. Vgl. Smith 2005, S. 776. Smith 2005, S. 776. Smith 2005, S. 776. Smith 2005, S. 776.
von denen aber unmittelbar klar ist, dass es sich bei ihnen um Staatsaufgaben han‐ delt: Die Aufgabe der Steuererhebung und der Gestaltung der Wirtschaftspolitik. Da die von Smith explizit genannten Staatsaufgaben finanziert werden müssen, ist es offensichtlich, dass die Steuererhebung eine weitere Aufgabe des Staates dar‐ stellt. Tatsächlich behandelt Smith die Fragen der effizienten und gerechten Besteue‐ rung ausführlich im zweiten Kapitel des fünften Buches, das den Titel „Die Quellen der öffentlichen oder Staatseinnahmen“53 trägt. Welche Besteuerungspraxis Smith aus welchen Gründen für besser bzw. schlechter hält, muss uns an dieser Stelle nicht weiter interessieren.54 Für unsere Fragestellung ist nur relevant, dass Smith am Ende seiner Überlegungen zu der Einsicht kommt, dass eigentlich nur die Staatspflicht zur Landesverteidigung und zur Repräsentation vollständig aus Steuermitteln finanziert werden müssen. Alle anderen Staatspflichten können entweder ganz oder teilweise mit Hilfe von Nutzungsgebühren (Mautgebühren, Studiengebühren, Lehrgeld etc.) finanziert werden, wodurch die allgemeine Steuerlast reduziert werden kann bzw. die Steuereinnahmen zur Tilgung der Staatschulden verwendet werden können. Schließlich gibt es noch eine letzte, von Smith nicht expressiv verbis als Pflicht benannte Aufgabe des Staates: Er ist für die rechtlichen Rahmenbedingungen zu‐ ständig, in denen sich die Volkswirtschaft entwickelt. Im Grunde ist der ganze Wohl‐ stand der Nationen nichts anderes als eine großangelegte Untersuchung über diese herausgehobene Aufgabe des Staates: Die scharfe Kritik an der merkantilistischen Wirtschaftspolitik, die Sympathiebekundungen für die wirtschaftspolitische Vorstel‐ lung der Physiokraten, die Inszenierung der nordamerikanischen Kolonien als Blau‐ pause für die notwendigen wirtschaftspolitischen Reformen im eigenen Land – all dies zielt darauf ab, die Pflicht der Staates zur wirtschaftspolitischen Gesetzgebung in ihrer Komplexität sichtbar zu machen und den Lesenden (und Regierenden) eine Vorstellung von ihrer wünschenswerten bzw. nicht-wünschenswerten Verwirk‐ lichung zu geben. Einen radikalen Neuanfang kann es aufgrund der Historizität des Ökonomischen nicht geben; nur den Versuch des Gesetzgebers, durch maßvolle Ein‐ griffe die sich durch die Aktivitäten der ökonomischen Akteure ständig wandelnde Wirtschaft in die richtige Richtung zu lenken. Der Erfolg dieser Regierungskunst hängt davon ab, ob die Regierenden in der Lage sind, das ökonomische Geschehen genau zu beobachten und sich nicht von Reformwünschen und Gesetzesvorschlägen täuschen zu lassen, die in Wirklichkeit nichts anderes als Ausdruck der partikularen Wirtschaftsinteressen einzelner gesellschaftlicher Gruppen sind.55
53 Smith 2005, S. 779. 54 Vgl. hierzu Ronge 2015, S. 346-365. 55 An dieser Kompetenz fehlt es laut Smith sowohl den Mitgliedern der arbeitenden Klasse als auch den Großgrundbesitzern, vgl. hierzu Smith 2005, S. 300-303.
105
3. Fazit Es ist hoffentlich deutlich geworden, dass die Frage nach den Staatsaufgaben bei Adam Smith komplizierter und komplexer ist, als es die Standardinterpretation na‐ helegt, und auch die Vereinnahmung Smiths für das politische Projekt des Liberalis‐ mus schwerer zu bewerkstelligen ist, als seine Verfechter glauben. Denn: Smith zum Vertreter einer radikalen, libertären Position zu machen, die von der restlosen Re‐ duktion des Staates träumt, ist unmöglich – zumindest, wenn die Referenz auf den Namen Adam Smith noch irgendetwas mit dem zu tun haben soll, was der histo‐ rische Adam Smith geschrieben hat. Aber auch für einen gemäßigten Liberalismus fällt die Indienstnahme Smiths schwerer als gedacht. Natürlich stimmt es, dass Smith im Wohlstand der Nationen das Programm einer Minimal-Staatlichkeit skiz‐ ziert. Aber erstens ist der Umfang der Minimal-Staatlichkeit größer als die plakative Rede von den drei Staatspflichten insinuiert, insofern sich die drei explizit genann‐ ten Staatsaufaufgaben als fünf Staatsaufgaben entpuppen, die um zwei weitere, im‐ plizite Staatsaufgaben ergänzt werden müssen, wenn man ein vollständiges Bild von Smiths Auffassung der Staatsaufgaben bekommen will. Und zweitens steht Smiths Plädoyer für die Minimal-Staatlichkeit in einem konstitutiven Zusammenhang mit seinen Überlegungen zur Überwindung der Staatsschuldenkrise seiner Zeit. Er fragt nach den unbedingt notwendigen Pflichten des Staates, weil ihn die unbedingt „not‐ wendigen Ausgaben des Herrschers oder des Gemeinwesens“56 interessieren, die selbst ein zum Sparen gezwungener Staat nicht aufgeben kann. Ob Smith einen prosperierenden Staat ebenfalls auf solch eine Minimal-Staatlichkeit vereidigen wür‐ de, lässt sich dem Text selbst nicht entnehmen.
Literatur Blaug, Mark, 1998: Economic Theory in Retrospect. Cambridge. Dwyer, John, 1998: The Age of the Passions. An Interpretation of Adam Smith and Scottish Enlightenment Culture. East Linton. Foucault, Michel, 2006 a: Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Geschichte der Gouverne‐ mentalität I. Frankfurt am Main. Foucault, Michel, 2006 b: Die Geburt der Biopolitik. Geschichte der Gouvernementalität II. Frankfurt am Main. Friedman, Milton, 1978: Adam Smith’s Relevance for 1976. In: Glahe, Fred (Hrsg.), 1978: Bicentennial Essays, Colorado, S. 7-20. Hopfl, H. M., 1978: From Savage to Scotsman: Conjectural History in the Scottish Enlighten‐ ment. In: The Journal of British Studies, H.17(2), S. 19-40.
56 Smith 2005, S. 672; Hervorhebung B. R.
106
Hume, David, 1983: The History of England. From the Invasion of Julius Caesar to the Revo‐ lution in 1688. Indianapolis. Lieberman, David, 2006: Adam Smith on Justice, Rights, and Law. In: Haakonssen, Knud (Hrsg.), 2006: The Cambridge Companion to Adam Smith, Cambridge, S. 214–245. Meek, Ronald L., 1971: Smith, Turgot and the Four Stages Theory. In: History of Political Economy, H.3(1), S. 9-27. Meek, Ronald L., 1976: Social Science and the Ignoble Savage. Cambridge. Phillips, Mark Salber, 2000: Society and Sentiment: Genres of Historical Writing in Britain, 1740-1820. Princeton. Ronge, Bastian, 2015: Das Adam-Smith-Projekt. Zur Genealogie der liberalen Gouvernemen‐ talität. Wiesbaden. Samuels, W.J./Medema, S.G., 2005: Freeing Smith from the “Free Market”: On the Misper‐ ception of Adam Smith on the Economic Role of Government. In: History of Political Economy, H. 37(2), S. 219-226. Smith, Adam, 1987: Correspondence of Adam Smith. Oxford. Smith, Adam, 2005: Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker. Tü‐ bingen. Stigler, George, 1971: Smith’s Travels on the Ship of State. In: History of Political Economy, H. 3(2), S. 265-277. Wokler, Robert, 1995: Anthropology and Conjectural History in the Enlightenment. In: Fox, Christopher/Porter, Roy/Wokler, Robert (Hrsg.), 1995: Inventing Human Science. Eigh‐ teenth-Century Domains, Berkeley, S. 31-52.
107
II. Die Rezeption des Staatsverständnisses von Smith im 18. und 19. Jahrhundert
Michael Hochgeschwender Das Staatsverständnis des Adam Smith in der politischen Ideengeschichte der frühen USA, 1776-1815
1. Vorbemerkung: Wie lässt sich Smithʼ Einfluss auf die Gründerjahre der USA untersuchen? Die Frage nach dem Einfluss des Staatsdenkens von Adam Smith auf das ideell-poli‐ tische Selbstverständnis der Vereinigten Staaten wirft im Vorausgang, gerade in An‐ betracht der notorischen Ambivalenzen und Ambiguitäten von Smithʼ politischer Ökonomie und Staatstheorie, eine zentrale methodische Frage auf: Von welchem Adam Smith reden wir? Seitdem die Forschung sein 1759 erschienenes und im spä‐ ten 18. Jahrhundert weit verbreitetes Hauptwerk A Theory of Moral Sentiments (TMS)1 wieder verstärkt in die Interpretation einbezogen hat, haben sich die Para‐ meter der traditionell von An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (WN,1776)2 beherrschten Sicht auf Smith deutlich verschoben.3 Aus dem Theoretiker der unsichtbaren Hand und der freien Märkte, dessen Menschenbild of‐ fenbar vom Primat utilitaristischer Kosten-Nutzenkalküle und egoistischer Profitma‐ ximierung beherrscht schien, wurde mehr und mehr ein, trotz seiner unbestreitbaren Nähe zur Skepsis David Humes, „typischer“ Aufklärer mit einem solide optimisti‐ schen, auf wechselseitigen, natürlichen Sympathien beruhenden Menschenbild, einer Anthropologie also, die sich dramatisch sowohl vom tiefen Pessimismus eine Thomas Hobbes, als auch – in deutlich geringerem Ausmaß – vom liberalen Opti‐ mismus John Lockes unterschied. Die Kombination von TMS und WN befreite Smithʼ Denken vom einseitigen Interpretationsmonopol libertär-wirtschaftsliberaler Philosophien und machte ihn für Teile des gegenwärtigen angelsächsischen Libera‐ lismus wieder anschlussfähig. Damit ist aber noch nicht die Frage beantwortet, welcher Adam Smith für eine Analyse seines möglichen Einflusses auf das Staatsverständnis der USA herangezo‐ gen wird, zumal Smith in seinen Werken ja keine systematische Staatstheorie bietet, sondern in WN eine politische Ökonomie des Verhältnisses von profitmaximieren‐ den homines oeconomici zum Staat und in der TMS eine gleichfalls vom Individuum ausgehende, aber auf das bonum commune auf der Basis wechselseitiger Sympathien 1 Smith 1985. 2 Smith 2012, vgl. O’Rourke 2008. 3 Vgl. dazu McLean 2006, s. a. Farina 2015.
111
bezogene moralphilosophische Fundamentalanthropologie, die bestenfalls erste Hin‐ weise auf ein daraus resultierendes Staatsverständnis, aber gleichfalls keine Syste‐ matik bietet. Am ehesten kann man Smithʼ Ideen über den Staat aus den beiden ers‐ ten Kapiteln des fünften Buches des WN erschließen, die von den notwendigen Aus‐ gaben und – beschränkten – Steuereinnahmen des Staates handeln, und diese Ideen als Ansatzpunkt für die Analyse von Smithʼ Einfluss auf die Debatten in den USA verwenden. Ein weiterer möglicher Ansatz bestünde in einem Rückgriff auf die zeitgenössi‐ schen Stellungnahmen von Smith zur Amerikanischen Revolution, die er im Laufe der Steuerkrise der 1760er und der revolutionären Ereignisse der 1770er Jahre abge‐ geben hat, die sich indes weitgehend mit seinen theoretischen Ansätzen decken: Ähnlich wie der damals noch radikale Whig Edmund Burke – ein politischer Gegner von Smith, der dann erst im Zuge der Französischen Revolution zu einem frühen Theoretiker des europäischen Konservativismus wurde, zeigte der im Vergleich mo‐ derate Country Whig Smith durchaus Sympathien für die Forderung der amerikani‐ schen Kolonisten nach mehr Partizipation bei der Steuergesetzgebung, obwohl vie‐ les darauf hindeutet, dass die Kolonisten dies nicht wirklich ernst meinten, da sie im Grunde am überkommenen Zustand, nämlich außer Zöllen überhaupt keine Abgaben an das Empire leisten zu müssen, festhalten wollten. Nach dem Unabhängigkeits‐ krieg sollte sich zeigen, wie wenig die neuen US-Amerikaner bereit waren, sogar Steuern für den Erhalt ihrer jungen Nation zu zahlen. Ganz anders sah es bei Smith aus, wenn es um finanzielle Lasten der Kolonisten für die Verteidigung des Empire ging, die er, gleichfalls der argumentativen Linie von WN folgend, nachdrücklich befürwortete. Schließlich darf in diesem praktischen Zusammenhang seine zeitweili‐ ge Nähe zu dem 1767 verstorbenen Charles Townshend4 nicht außer Acht gelassen werden, der ja einer der Hauptverantwortlichen für die Steuerpläne der britischen Regierung und des britischen Parlaments gewesen war. Nicht zuletzt war Smith ein loyaler Monarchist, kein Republikaner und gerade kein Radikaler. Er zählte zum Mainstreamestablishment der zersplitterten und streitsüchtigen Whig-Fraktionen. Am ehesten verband ihn seine lockere Anhänglichkeit an die Country Ideology, den (nicht antimonarchistischen, sondern auf bonum commune und Bürgertugenden re‐ kurrierenden) klassischen Republikanismus des frühen Tories Lord Bolingbroke mit den Ideen und Idealen zumindest von Teilen der kolonialen revolutionären Oligar‐ chie.5 Freilich waren der Tugendrepublikanismus und die country ideology inhaltlich höchst unbestimmt. Sowohl der radikale Revolutionär Thomas Jefferson, als auch König Georg III. galten als Anhänger dieser Weltanschauung. Daher bietet das un‐ 4 Zur Biographie vgl. z. B. Streminger 2017, der überdies eine plausible, kapitalismuskritische In‐ terpretation des Werks von Smith anbietet, sowie Buchan 2006 und Philippson 2012. 5 Zu den ideellen Dispositionen der transatlantischen Whigkultur s. Hochgeschwender 2016, S. 75-101.
112
mittelbar politische Handeln von Smith wenig Anhaltspunkte für Einflüsse auf die frühen USA, die über die etablierten Gemeinsamkeiten der transatlantischen WhigKultur – den lockeanischen Protoliberalismus und den Tugendrepublikanismus so‐ wie das Beharren auf den traditionellen Rechten freier Engländer – hinausgehen würden. Es bleibt also, den Einfluss von Smith anhand seiner veröffentlichten Werke zu bestimmen. Dies macht umso mehr Sinn, als zumindest in der Gründervätergenerati‐ on WN viel gelesen wurde. Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, James Madison, George Washington und Samuel Adams besaßen Exemplare von WN oder hatten wenigstens Teile des Werkes gelesen; Benjamin Franklin war mit Smith persönlich bekannt, obwohl dessen Freundschaft mit dem berühmten Juristen Alexander Wed‐ derburn, der in einer Sitzung des Privy Council 1774 Franklin, der damals Pennsyl‐ vania als Lobbyist in London vertrat, persönlich als Verräter angegriffen und damit wohl endgültig in das Lager der Revolutionäre getrieben hatte, kaum dazu geeignet war, das beiderseitige Verhältnis zu intensivieren. Die Whig-Öffentlichkeit in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war noch wenig abstrakt, sondern intensiv von persönlichen Freundschaften und Loyalitäten gekennzeichnet. Während also WN in der kolonialen Oligarchie bekannt war und einigermaßen intensiv diskutiert wurde, ist es um unsere Kenntnis der amerikanischen Rezeption von TMS im Zeitalter der Revolution weniger gut bestellt. Allerdings ist dies weniger relevant, weil TMS deutlich mehr als WN von der weithin bekannten und intensiv rezipierten, konven‐ tionellen angloschottischen, aufgeklärten Moralphilosophie, der Smith sich zugehö‐ rig wusste, abhängig und mithin weniger originell war als WN. Außerdem bot die TMS aufgrund ihrer antirationalen, emotivistisch-sentimental anmutenden Normbe‐ gründung wenig Spielraum für eine transsubjektive Verbindlichkeit sozialer Gel‐ tungsansprüche, was sie für die Interessenlage der revolutionären Kolonialoligarchie wenig attraktiv erschienen ließ. Selbst gegenüber dem objektivierbaren utilitaristi‐ schen Kosten-Nutzen-Kalkül seines akademischen Lehrers Francis Hutchinson ver‐ hielt sich Smith bestenfalls ambivalent, ansonsten basierte seine Ethik in erster Linie auf Sympathetik und Sentiment.6 Noch weniger Relevanz dürften die Lectures on Jurisprudence von 1763 (LJA) und 1764 (LJB) gehabt haben, die weder veröffent‐ licht waren und wohl auch nicht informell in den Whigsalons des neuen Kontinents kursierten.7 Zudem waren sie bei weitem weniger originell, als Smith es für sich in Anspruch nahm. Sie zeugten vor allem von einer höchst dürftigen Kenntnis der klas‐ sischen Naturrechtstradition aristotelisch-thomistischer Provenienz, wie sie für die Aufklärung insgesamt typisch war, legten aber ansonsten vorrangig Wert auf die Ide‐ en der Unantastbarkeit und Unverfügbarkeit menschlichen Lebens und des als Ei‐ 6 Vgl. dazu die kritischen Stellungsnahmen von Irwin 2014, S. 678-713 und Copleston SJ 1994, S. 354-61. 7 Smith 1982.
113
gentum aufgefassten Körpers, des Privateigentums als solchem und die Gültigkeit und Freiheit von Verträgen sowie ein anthropologisch optimistisches Fortschritts‐ denken – allesamt, allerspätestens seit Locke, nachgerade nicht mehr hintergehbaren Topoi des Protoliberalismus.8
2. Die Unsichtbare Hand in der zeitgenössischen Rezeption: die Bedeutung des Deismus Wenn aber somit notwendig die Rezeption von WN im Vordergrund unserer Frage‐ stellung stehen muss, relativiert sich automatisch eine in der gegenwärtigen For‐ schung zentrale Diskussion, diejenige nach dem Verhältnis von, wie beispielsweise Iain McLean es formuliert, der invisible hand des Marktes und der helping hand des Staates.9 Letztere Idee ergibt sich aus der Lektüre von TMS und stellt eine Grundla‐ ge für eine New Deal-konforme Smith-Rezeption dar, die allerdings für das späte 18. und frühe 19. Jahrhundert, also die formative Phase der US-amerikanischen Verfas‐ sungsentwicklung, noch keine unmittelbare Relevanz besitzen konnte und dement‐ sprechend nicht vorausgesetzt werden darf. Dennoch verweist die neuere Diskussion auf ein Problem, das sich bereits den damaligen Zeitgenossen stellte. Was genau meinte Adam Smith mit der invisible hand und welche Auswirkungen hatte sein Verständnis der Unsichtbaren Hand auf seine Idee des Staates und wie wurde diese Frage in den frühen USA verstanden? Die Diskussionen unserer Tage gründen auf der Erkenntnis, wie quantitativ unbedeutend die Lehre von der Unsichtbaren Hand im Gesamtwerk von Smith war und wie sehr er von traditionalen philosophischen Diskursen, die bis in die Antike und das Mittelalter zurückreichten, in seiner zwi‐ schenzeitlich ganz auf ihn und seine Ideen zurückgeführten Begrifflichkeit war. Tat‐ sächlich, um mit dem Aspekt der Quantität zu beginnen, benutzte Smith den Begriff invisible hand in seinem Gesamtwerk dreimal, davon zweimal außerhalb von WN, einmal in einem physikalischen Zusammenhang und einmal in TMS in einer Art, die auf WN vorausweist, indem er die Unsichtbare Hand selbst – der egoistischen Natur eines geizigen Großbauern ähnlich – dafür verantwortlich macht, just aus Eigennutz für eine Mindestversorgung der Pächter mit Nahrungsmitteln Sorge zu tragen, um die Produktivität aufrechtzuerhalten.10 Im zweiten Kapitel des vierten Buches von WN findet sich dann die bis heute einschlägige Stelle, in welcher die invisible hand dafür verantwortlich gemacht wird, selbst im Falle rein profitorientierter und egois‐ tisch motivierter Kapitalinvestitionen im Ausland gesamtgesellschaftlichen Nutzen zu generieren. Von einer ausgearbeiteten Theorie der Unsichtbaren Hand kann man 8 Vgl. dazu ausführlich Ballestrem 2001, S. 95-134 und Röd 1984, S. 348-61. 9 McLean 2006. 10 McLean 2006, S. 82-99.
114
dementsprechend bei Smith keineswegs reden. Nirgendwo entwickelt er eine umfas‐ sende Systematik des Konzepts, das eher nebenbei, in Gestalt lediglich eines obiter dictum eingeführt und dann nicht mehr in irgendeiner Weise entfaltet oder argumen‐ tativ genutzt wird. Etwas boshaft formuliert wurde Smith für eine Theorie berühmt, die er weder erfunden noch je ausformuliert hat, der klassische Fall einer Rezeption durch Nichtlektüre. Dass er dennoch gerade aufgrund dieser kurzen Passage und des Anfangs von WN, in dem es um eine Theorie der Arbeitsteiligkeit geht, so berühmt wurde, zwingt dazu, sich mit den zeitgenössischen Rezeptionsbedingungen auseinanderzusetzen. Dann aber erledigt sich die Interpretation William Farinas, der die Einführung der invisible hand für reine Ironie eines gebildeten und witzigen Schotten hält, von selbst.11 Zum einen galt Smith nicht gerade als Ironiebündel, wenn man Dr. Samuel Johnson, einem der großen Ironiker des späten 18. Jahrhunderts, der ihn als eher tro‐ cken und langweilig beschreibt, Glauben schenken darf.12 Zum anderen, und das ist das entscheidende Argument, evozierte der Verweis auf die Unsichtbare Hand gera‐ de im Zeitalter der Aufklärung selbst dann, wenn sie nicht eigens theoretisiert wur‐ de, eine ganze Kette von fast automatischen Assoziationen, die für die Rezeption wesentlich waren. Bereits der Naturbegriff, der mit der Unsichtbaren Hand, die ja als Funktion der Natur konzipiert war, parallel ging, verwies auf religiöse Ursprünge. Heutige Anhänger von Smith betonen durchaus zu Recht den durchweg säkularen Charakter seiner Ausführungen, das ändert aber nichts am religiösen, wenngleich nicht-theistischen Horizont seiner Sprache. In Smithʼ Naturbegriff klang demnach einerseits Baruch de Spinozas pantheistisches Diktum deus sive natura durch, ande‐ rerseits die ästhetische Qualität des Sublimen in der Naturbetrachtung, die dann bei Burke und später in der Romantik noch weiter ausgefaltet werden sollte. Hinzu kam eine weitere doppelte religiöse Rahmung, die das Konzept der Unsichtbaren Hand in der Natur als solcher intelligibel machte. Im nichttheistischen Deismus, der in der britischen und gerade auch der amerikanischen kolonialen Elite seit dem ausgehen‐ den 17. Jahrhundert in ganz unterschiedlichen Gestalten an Anhängerschaft gewon‐ nen hatte, war der Gedanke unmittelbar einsichtig, da der deistische Gott, ein deus otiosus, die Welt als rationale Maschine mitsamt eingebauter prästabilisierter Har‐ monie eingerichtet hatte.13 In diese Naturmaschine, in welche der Mensch, zumin‐ dest seiner körperlichen Natur nach, eingeordnet war, sollte so wenig wie möglich eingegriffen werden, da sie ja bereits a priori vollkommen war. Erst in der Kombina‐ tion dieser deistischen These mit Smithʼ obiter dictum wird überhaupt nachvollzieh‐ 11 Farina 2015, S. 6. 12 Farina 2015, S. 29. Allerdings stand Johnson politisch im Lager der Tories, was eine Attacke erklären kann. 13 Zum Deismus vgl. u.a. Röd 1984, S. 149-62; jetzt v. a. Dreisbach/Hall 2014, wo durchweg die Vielgestaltigkeit und der Facettenreichtum des Phänomens Deismus als Religionsform einer elitär-aufgeklärten Oberklasse betont wird.
115
bar, warum die Idee der Unsichtbaren Hand eine derartige Wirkungsgeschichte ent‐ falten konnte. Aber selbst im Theismus des späten 18. Jahrhunderts fanden sich derartige An‐ knüpfungspunkte, etwa in der Naturtheologie William Paleys, an der sich rund 50 Jahre später Charles Darwin kritisch abzuarbeiten begann.14 Paley gilt nicht zu Un‐ recht als Begründer der Lehre vom Intelligent Design, die heute in Teilen des protes‐ tantischen Fundamentalismus wieder aufgetaucht ist. Demnach hatte Gott unmittel‐ bar – und nicht wie in der aristotelisch-thomistischen Scholastik des Hochmittelal‐ ters mit Hilfe natürlicher causae secundae – die Komplexität der natürlichen Dinge kreiert. Die Natur war demnach ebenso unmittelbar ein Buch, aus dem man Gott er‐ kennen konnte. Die Sprache der Natur war die Sprache Gottes. Zwischen dem Theismus Paleys und dem Deismus der Aufklärung lassen sich mithin deutliche Überschneidungen feststellen, die allesamt dazu beitragen, die Re‐ de vom Wirken der natürlichen Unsichtbaren Hand verständlich werden zu lassen. Smith konnte problemlos auf diese fest etablierten Wissens- und Verständnisbestän‐ de zurückgreifen, auch bei den Gründervätern der USA, die sich wie selbstverständ‐ lich im identischen Diskursraum bewegten. Vor diesem Hintergrund machte der knappe Verweis Sinn und bedurfte keiner weiteren Ausführungen. Nur so ist auch verständlich, warum eine derart kurze Andeutung einer Theorie langfristig eine sol‐ che Wirkungsgeschichte haben konnte. Neben der religiösen Wurzel wäre überdies der Gedanke an eine natürliche Selbstorganisation, der im späten 18. Jahrhundert in materialistischen Kreisen um sich griff, als Wurzel der invisible hand denkbar, aber bei aller empiristischen Herangehensweise und bei allem säkularen Anspruch sowie bei aller Nähe zur Skepsis Humesʼ lässt sich ein radikal aufgeklärter Materialismus in das eher moderate Werk des Schotten nicht hineinlesen.
3. Der Einfluss von Smith auf die Verfassungsdebatte in den USA Fasst man die bisherigen Ergebnisse zusammen, so überrascht es kaum, wie ver‐ gleichsweise gering der Einfluss von Smith auf die amerikanische Verfassungsge‐ bung und damit das Staatsverständnis im engeren Sinn war. In den Dokumenten zur Diskussion um die Verfassung wird er nur im Zusammenhang mit der Religionsfrei‐ heit im ersten Zusatzartikel als Autorität in Anspruch genommen.15 Alle anderen zentralen Errungenschaften der US-Verfassung – das Prinzip der Gewaltenteilung, der föderale Ausgleich zwischen großen und kleinen Staaten und vor allem die revo‐ lutionäre Idee der Volkssouveränität, an die Smith, der stets ein Verfechter der briti‐ 14 McLean 2006, 86. 15 Vgl. den Index zu Kurland/Lerner 1987. Im weiterhin unübertroffenen Standardwerk zur Ver‐ fassungsdebatte von Heideking 1988 taucht Adam Smith überhaupt nicht auf.
116
schen Whig-Tradition war, wonach die Souveränität beim king in parliament, also gemeinsam beim Monarchen und dem imperialen Westminsterparlament, lag, nie geglaubt hat – entstammten wohl überwiegend dem Denken der Whigs, wurden aber auf andere philosophische Traditionen zurückgeführt. Nun hatte die Stärke des Werkes von Smith auch nie in diesem Bereich gelegen. Vielmehr hatte er ein, trotz der unbestreitbar religiösen Hintergründe der Idee der Unsichtbaren Hand, die aber dank der Formulierung bereits in ähnlichem Ausmaß säkularisiert war, wie später das Transzendentale Ego Immanuel Kants oder das Ab‐ solute Ich Johann Gottlieb Fichtes, zutiefst säkulares, empirisch gesättigtes Werk zur Politischen Ökonomie vorgelegt. Gerade auf diesem Feld des amerikanischen Staatsverständnisses, auf dem man zu Recht, wenn überhaupt, einen tieferen Ein‐ fluss von Smith vermuten darf, blieb ausgerechnet die Verfassung der USA eher schweigsam. Im Gegensatz zu den Articles of Confederation und ganz im Einklang mit WN räumte sie der Bundeslegislative das Recht ein, direkte und später auch in‐ direkte Steuern sowie Zölle zu erheben, um den Staatsaufgaben im engeren Sinn nachzukommen, und das Recht, den zwischen-staatlichen und internationalen Han‐ del zu regulieren, eine Maßgabe, die dem Freihandels- und laissez faire-Gedanken in WN diametral widersprach (Art. I, sec. 1 und 8, 16. Amendment16), und führte das Münzrecht (Art. I, sec. 10) ein. Schließlich übernahm der Bundesstaat die nunmehr konsolidierten Schulden der Einzelstaaten aus der Ära vor der Verfassung (Art. VI). Im vierten Zusatzartikel wurde der Eigentumsschutz, ein Zentraldogma des lockea‐ nischen Protoliberalismus und der Whigtradition, explizit festgelegt. Die eigentliche Sprengkraft der Regulationsbefugnisse des neuen amerikanischen Staates verbarg sich in einer unschuldig anmutenden Klausel am Ende von Art. I section 8, welche dem Bundesstaat die Befugnis übertrug: „To make all Laws which shall be necessary and proper (Hervorhebung M.H.) for carrying into Execution the forgoing Powers, and all other Powers vested by this Constitution in the Government of the United States, or any Department or Office thereof.“ In dieser necessary and proper-clause verbarg sich letztlich zumindest potentiell der Ansatz für einen akti‐ ven Regulations- und Interventionsstaat, wie er bereits in der Gründerzeit einigen Politikern vorschwebte, und wie er dann im 20. Jahrhundert in der Ära von New Deal und Great Society in einer, verglichen mit dem europäischen Wohlfahrtsstaat, moderaten Variante Wirklichkeit wurde. Allerdings fehlte dieser wohlfahrtsstaatliche Aspekt in der Frühen Republik bei sämtlichen amerikanischen Vordenkern von Staatlichkeit. Soziale Anliegen blieben im Wesentlichen den Kirchen vorbehalten, von denen sich seit den 1820er Jahren besonders die postmillenaristischen Evangeli‐ kalen, mitunter im Bündnis mit liberalen Philanthropen, reformpolitisch besonders hervortaten. Man denke an die Sabbathobservanzbewegung, den Abolitionismus, die
16 Das 16. Amendment wurde jedoch erst später eingeführt (ratifiziert am 3. Februar 1913).
117
Einrichtung öffentlicher Schulen (mit der King James Version der Bibel als zentra‐ lem Lesestoff), die Antialkoholbewegung, die Gefängnisreformbewegung und die Frauenbewegung. Es ist unmittelbar ersichtlich, wie wenig Smithʼ Forderung nach einem staatlichen Schulsystem vor dem Entstehen der evangelikal-liberalen Reform‐ koalition der Whigs der 1830er Jahre im neuenglischen Raum in den USA beachtet worden ist. Freilich verfügten die USA, gerade im Norden, über eine, bezogen auf Europa, vergleichsweise hohe Zahl von zumindest lesefähigen Personen, was mit dem Erbe des Protestantismus und seinem Prinzip sola scriptura zu tun hatte. Die anderen ordnungspolitischen Artikel der Verfassung verdankten sich eben‐ falls weniger theoretischen Vorgaben, sondern waren Resultat teilweise langanhal‐ tender Praxis oder der Erfahrung eines dysfunktional schwachen Staates unter den Articles of Confederation. Letzteres betraf die Steuerhoheit und den gesamtstaatli‐ chen Schuldendienst, aber auch die Interstate Commerce Clause sowie die necessary and proper-clause. Der Primat des Eigentumsrechts in Verbindung mit einem ausge‐ prägten Denken in Kategorien der rule of law hing wiederum mit der nahezu unein‐ geschränkten Übernahme des britischen common law und der von Whigs und Tories im Westminsterparlament gleichermaßen gepflegten Tradition der Heiligkeit des Pri‐ vateigentums. Immerhin vertraten beide Fraktionen mehrheitlich die Interessen der besitzenden Klassen, da nur diesen das Wahlrecht zustand. In den USA wurde dieses Denken anfangs auf erweiterter Basis weitergeführt. Insbesondere die Federalists und dann bis etwa 1835 die Whigs standen dem demokratischen, egalitären Wahl‐ recht zutiefst misstrauisch gegenüber, da sie fürchteten – ein Gedanke, der sich in WN ebenfalls findet, aber zum Gemeingut whiggistischer Ideologie zählte – die är‐ meren Klassen würden ihre Mehrheit ausnutzen, um die Eigentümer zu enteignen. Erst als sie erkannten, dass auch die Besitzlosen in erster Linie nach legalem Eigen‐ tum im Rahmen des etablierten Rechts strebten, gaben die Whigs ihre Opposition gegen das allgemeine Wahlrecht auf. Der Gedanke der Praxisbezogenheit der Verfassungsdiskussion ist für unseren Zusammenhang unbedingt wichtig. Die Gründerväter der amerikanischen Republik waren keine politischen Amateure. Sie waren allesamt bereits vor der Revolution in lokalen und kolonialen Vertretungen, den assemblies, aktiv gewesen oder hatten zu‐ mindest Verwaltungsposten innegehabt. Daher konnten sie wahlweise auf etablierte britische Traditionen oder inzwischen gewachsene Praktiken zurückgreifen.
118
4. Die Bedeutung von Smith für die wirtschaftspolitischen Debatten der Frühen Republik 4.1. Der Grundzug des politischen Denkens der Frühen Republik: die Staatsskepsis Smith war demnach von einem gewissen Interesse, wenn es darum ging, die vagen wirtschaftspolitischen Aussagen der Verfassung von 1787 mit politischem und recht‐ lichem Leben zu füllen und sich darüber klar zu werden, welchen Charakter das nordamerikanische Staatswesen in ökonomischer Hinsicht annehmen würde.17 Um seinen Einfluss auf dieser weiteren Ebene des Staats- und Freiheitsverständnisses der USA aber präzise deutlich machen zu können, ist es notwendig, sich zu verge‐ genwärtigen, in welche sozioökonomischen und kulturellen Pfadabhängigkeiten hin‐ ein Smithʼ Einfluss zur Geltung kommen konnte. Neben dem whiggistischen Dogma von der Heiligkeit und Unantastbarkeit des Privateigentums, auf dem sowohl der Fortbestand der Sklaverei im Süden der USA als auch, wenigstens bis zu den demo‐ kratisierenden, freilich das Rasseprinzip anstelle der Eigentumsvoraussetzungen set‐ zend, Reformen der 1810er Jahre, das Wahlrecht als Zensuswahlrecht beruhten,18 zählte der Unwille, Abgaben jeglicher Art zu leisten, zu den Grundvoraussetzungen der Amerikanischen Revolution und der nachrevolutionären politischen Kultur der Frühen Republik. Seit dem Navigation Act von 1660 und dem Staples Act von 1663 hatte es zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der kolonialen Oligarchie ge‐ zählt, selbst die als legal betrachteten Handelsregulationen des imperialen Parla‐ ments durch Zölle mit Hilfe ausgedehnten Schmuggels zu umgehen. Selbst während des Siebenjährigen Krieges wurden jährlich Dutzende amerikanischer Schiffe in französischen, also feindlichen Häfen gesichtet und der britische Kampf gegen den Schmuggel in den 1760er Jahren hatte zu den zentralen Auslösern der Revolution gezählt. Dabei hielten es die Amerikaner nicht unbedingt für nötig, diese Praxis theoretisch zu legitimieren, indem man auf die Wohltaten des Freihandels verwies. Dies haben erst spätere Historiker getan. Dennoch gaben das Ringen um den Schmuggel und gegen britische Beschränkungen des Landerwerbs im Westen, die sich primär aus der – berechtigten – Furcht vor weiteren Indianerkriegen nach dem Pontiacaufstand von 1763 speisten, der Auffassung Nahrung, ein guter Amerikaner sei per se staatsskeptisch. Dies galt vor allem für die westlichen Grenzgebiete, wo sich bereits in den 1760er Jahren erhebliches Spannungspotential zwischen den Kleinbauern an der frontier und der Großgrundbesitzeroligarchie an der Ostküste aufgebaut und – etwa im Regulatorenaufstand in den Carolinas zwischen 1765 und 1772 oder den mörderischen Mobaktionen der Paxton Boys 1763/64 gegen In‐ dianer im Westen Pennsylvanias – gewaltsam entladen hatten. Diese Klassendiffe‐ 17 Siehe dazu Priest 2008, S. 400-41. 18 Eine umfassende Darstellung bietet Keyssar 2009, S. 43-49.
119
renzen, die teilweise dazu führten, dass sich Kleinbauern aus den Appalachen im Revolutionskrieg auf die Seite der Krone gestellt hatten, hielten nach dem Krieg bis weit in die 1790er Jahre an. War es schon im Krieg zu Steuer- und Hungerrevolten gegen die Konföderation gekommen, so setzten sich diese Unruhen, in denen es im‐ mer um Landrechte und Steuern beziehungsweise Abgaben ging, in der WhiskeyRebellion und dem Veteranenaufstand von Shays’ Rebellion fort. Im Hudsontal kam es wiederholt zu Konflikten zwischen landsuchenden Kleinbauern und feudalaristo‐ kratischen Großgrundbesitzern wie den van Rensselaers, die bis in die 1840er Jahre Landbesitz in der Größe des Saarlandes als Manorlords verwalteten. In den Augen weiter Teile der Ostküstenoligarchie waren diese libertär-anarchistischen Strömun‐ gen und Revolten kontraproduktiv, dennoch trugen sie dazu bei, in Teilen der Bevöl‐ kerung der jungen Republik eine staatskritische Grundhaltung zu begründen, die bis heute wirksam geblieben ist.19 Neben dem konfliktreichen Umgang mit den Folgen der Französischen Revoluti‐ on waren die hochgradig kontroversen Debatten um die Verfassung und das sozio‐ ökonomische Staatsverständnis maßgeblich für das Entstehen eines pluralistischen Parteisystems in den USA. Und genau hier war der Ort, an dem man sich der Werke von Adam Smith argumentativ bediente, wenn auch eigentlich nie in Reinform. Im‐ merhin aber trug die Auseinandersetzung gerade mit WN dazu bei, das sozioökono‐ mische Selbstverständnis der frühen amerikanischen Parteien und damit ihre Stel‐ lung zu Staat und Staatlichkeit zu klären.20
4.2. Hamilton als Gegner des Prinzips der Unsichtbaren Hand Der intellektuell führende und gleichzeitig wohl kritischste Kopf der nordamerikani‐ schen Smithrezeption war zweifellos Alexander Hamilton, lange der wohl am meis‐ ten unterschätzte, oft als Kryptomonarchist geschmähte Gründervater der Union und Kopf der liberal-konservativen High Federalists.21 Von allen frühen Politikern der USA hatte er die tiefsten ökonomischen Kenntnisse, selbst wenn seine Handlungen und Pläne nicht immer frei von eigennützigen Motiven waren. Insofern könnte er nachgerade als Paradebeispiel für das Konzept der Unsichtbaren Hand dienen. Dank seiner Hochzeit mit Elisabeth Schuyler, der Tochter eines ungemein reichen Groß‐ grundbesitzers im Hudsontal, war der uneheliche Sohn einer relativ armen Witwe aus der Karibik zu Wohlstand und Einfluss gelangt. Seine wirtschaftspolitischen Vorstellungen dienten allzu oft offenkundig den Interessen der Börsenspekulanten an 19 Die staatskritische Tradition hat McNichol Stock 1997 konzis beschrieben. 20 Vgl. u. a. Elkins/McKittrick 1993 und Wood 1993 sowie ders. 2009. 21 Zur Biographie siehe Chernow 2005. Zu den wirtschafts- und ordnungspolitischen Vorstell‐ ungen Hamiltons siehe McGraw 2012 sowie Cohen/DeLong 2016.
120
der Wall Street, zu denen er als Bankier selbst zählte, was unter anderem dazu führ‐ te, dass sich sein einstiger Parteifreund und Gefolgsmann James Madison im Laufe der Diskussionen um die Verfassung von 1787 von ihm lossagte und sich den AntiFederalists um Thomas Jefferson anschloss. Trotz seiner unbestreitbar egomanen In‐ teressenpolitik besaß Hamilton ein klares und visionäres Verständnis von Wirt‐ schaftspolitik, das die USA auf dieser Ebene maßgeblich, wenngleich eher kritisch gegenüber Smith prägen sollte. Vor allem lehnte Hamilton den von Smith und seinen französischen Vorbildern, den Physiokraten um Quesnay, propagierten Primat der Landwirtschaft ebenso ab wie die Idee der Unsichtbaren Hand. Für die Zukunft sah er die Notwendigkeit und Unabänderlichkeit einer am englischen Vorbild ausgerich‐ teten raschen Industrialisierung mitsamt großen Städten und abstrakten kapitalisti‐ schen Märkten (im Unterschied zu traditionellen städtischen oder dörflichen Märk‐ ten mit face-to-face-Kommunikation) voraus, die dann durch große Banken und einen starken Staat geordnet werden sollten. Insbesondere kam dem Staat die Aufga‐ be zu, eine Zentralbank nach dem Vorbild der Bank of England einzurichten, um so‐ wohl eine geordnete Geldpolitik zu initiieren als auch die Sicherheiten für investive Kredite zu bieten. Kreditpolitik und aktive Infrastrukturpolitik gingen für Hamilton Hand in Hand. Dazu war die Konsolidierung der Staatsschulden auf Unionsebene unbedingt notwendig. Gleichzeitig galt es, die amerikanischen Märkte im Interesse der aufstrebenden nationalen Industrien durch Schutzzölle vor der Einfuhr billiger Waren gerade aus britischer Produktion, aber auch vor Luxusimporten aus Frank‐ reich zu schützen. Über das gesamte 19. Jahrhundert beherrschte der Streit um Schutzzölle zugunsten der Industrieproduzenten in den Neuenglandstaaten und dann in den Industrierevieren des Mittelwestens die amerikanische Parteipolitik. Erst Ha‐ milton und dann sein geistiger Erbe, der Whig Henry Clay, legten die Grundlage da‐ für, die USA auf der Basis solider und nach außen abgesicherter Grundlagen zu in‐ dustrialisieren, diese Industrialisierung durch ein leistungsfähiges Bankensystem und einen starken Staat abzusichern und sich erst dann allmählich in eine globali‐ sierte, abstrakte Marktwirtschaft einzupassen. Gerade im Norden und Mittelwesten wurde auf diese Weise der Aufbau der Infrastruktur vom Staat, oft in Partnerschaft mit britischen Investoren, aber auch mit der heimischen Privatwirtschaft, aufgebaut. Gegenüber der These von der Unsichtbaren Hand wies Hamilton – hierin ganz ein früher Konservativer – auf die von Smith schlicht übersehene Bedeutung von Sitten, Gewohnheiten, Traditionen und Gebräuchen hin.22 Diese schränkten das Prinzip der Unsichtbaren Hand in einer Weise ein, die es für eine rationale Wirtschaftspolitik na‐ hezu unbrauchbar machten. Dabei lehnte Hamilton Privateigentum, Privatwirtschaft und Privatinitiative in keiner Weise ab, ganz im Gegenteil. Aber ähnlich wie später der Bankier John Pierrepoint Morgan, der hinter den Mergerwellen und damit den
22 Elkins/McKittrick 1993, S. 259-61.
121
Oligopolen, Trusts und Großkonzernen des ausgehenden 19. Jahrhunderts steckte, misstraute er dem ungeordneten und damit ineffizienten Markt. Markt und Ordnung bedurften einander und der Staat, genauer: der Bundesstaat, war der zentrale Ord‐ nungsfaktor – gemeinsam mit den Banken. Vollkommen einverstanden war Hamil‐ ton hingegen mit dem Prinzip der Arbeitsteiligkeit, zumal in seiner Vision die USA sich ja am globalen Handel als gleichberechtigter, wenn nicht gar federführender Partner beteiligen würden. Arbeitsteiligkeit als globales Prinzip ging indes bei ihm nicht notwendig mit Freihandel einher. Dafür war sie im Binnenbereich der Industrie absolut unabdingbar, bedurfte dann aber hinreichender Ordnungsfaktoren.
4.3. Jefferson und Madison: Smithianer als Folge eines Missverständnisses Hamiltons Gegenspieler waren Thomas Jefferson und James Madison.23 Auf den ersten Blick schienen sie die treueren Gefolgsleute von Smith zu sein, auf den sie sich ebenso beriefen wie der kritische Hamilton, allerdings wohl vollkommen zu Unrecht. Ihre Smithrezeption war wesentlich die Folge eines Missverständnisses. Gewiss, sie teilten die Vorstellung vom langfristigen Primat der Landwirtschaft und verteidigten das Ideal der Unsichtbaren Hand, aber in einem komplett anderen Hori‐ zont – ökonomisch, sozial und politisch – als bei Smith. Ihnen ging es nicht in erster Linie um eine moderne, empirisch grundgelegte Politische Ökonomie, sondern um eine zutiefst traditionale Moralische Ökonomie. Hierin folgten sie Bolingbrokes country ideology sehr viel radikaler als Smith es jemals getan hatte. Vor allem für Jefferson waren urbane Industriezentren Horte des Übels, der Amoral und der Tu‐ gendlosigkeit, am schlimmsten aber waren Banken und Bankiers. Sie alle, Orte wie Personen, bedrohten objektiv die Freiheiten einfacher weißer Männer. Der wohl fa‐ natischste Erbe Jeffersons in dieser Hinsicht war Andrew Jackson, später sollte der Populist William Jennings Bryan diese Ideale des common man wortgewaltig auf‐ greifen. Dabei war es weder für Jefferson noch für Madison ein Widerspruch, ihr Freiheitspathos mit ihrer Situation als Sklavenhalter zu vereinbaren. Zum einen mut‐ maßten sie, ganz im Sinne von Smith, die Sklaverei würde über einen mehr oder minder absehbaren Zeitraum sowieso infolge mangelnder ökonomischer Effizienz verschwinden, zum anderen folgten sie der lockeanischen Tradition, wonach nichtef‐ fiziente Mitglieder des Menschengeschlechts (Frauen, Kinder, Wahnsinnige und Wilde) nicht unter dem unmittelbaren Schutz des Gesellschaftsvertrags standen. Schließlich kam bei Jefferson mit zunehmendem Alter ein in der Aufklärungstraditi‐ on stehender, fanatischer Rassismus gegenüber Schwarzen hinzu.
23 Zur wirtschaftspolitischen Weltanschauung der Demokraten in der Tradition Jeffersons siehe Ashworth 1995-2007, s. a. Hochgeschwender 2006.
122
Ordnungspolitisch verfolgten Jefferson, Madison und die Anti-Federalists sowie dann die Democratic Republicans die Idee einer kleinagrarischen Utopie, in der freie Kleinbauern politisch das Rückgrat der Republik darstellten und ökonomisch als Kleinproduzenten, vermittelt über lokale Kleinhändler, im ständigen Austausch mit gleichfalls lokalen Kleinkonsumenten faire und gerechte Preise aushandelten. Im Grunde handelte es sich um das Ideal einer traditionalen, ruralen face-to-face-socie‐ ty, in der Industrialisierung und Urbanisierung ebenso wenig vorgesehen waren wie Banken, abstrakte Märkte und Globalisierung des Handels. Letztlich sollte dies der Freiheit und Gleichheit tugendhafter und wehrfähiger republikanischer Bürger die‐ nen, denen die eigene Scholle die Basis ihrer Existenz war. Eine arbeitsteilige Ge‐ sellschaft war auf dieser Ebene nicht vorgesehen. Demgegenüber wurde die kapita‐ listische Marktwirtschaft mit ihren Mechanismen als Garant für unerwünschte Fol‐ gen und soziokulturelle Kollateralschäden angesehen, nämlich Ungleichheit, Sozial‐ neid und Repression durch Zinsknechtschaft und Polizeigewalt sowie Militärdespo‐ tie. Wie bei Hamilton handelte es sich keinesfalls um eine Kritik von Privateigentum als solchem, das wie selbstverständlich als Dogma angesehen wurde. Aber, anders als in der Vision Hamiltons, bedurfte es keines starken Staats als Ordnungsfaktor oder gar als Korrektiv, sondern freie Bürger würden ihre Belange selbst regeln. So‐ gar die äußere Sicherheit sollte in der Utopie Jeffersons den freien Wehrbauern an‐ heimgestellt werden, bevorzugte er doch, ganz im Sinne Bolingbrokes, ein auf be‐ waffnete und waffenfähige Bauern gegründetes Milizsystem gegenüber einem pro‐ fessionellen Heer, wie es Hamilton (und wohl auch Smith) vorschwebte. Im Gegen‐ zug würden die Steuern und Abgaben auf ein absolutes Mindestmaß gesenkt wer‐ den, da der Staat nicht einmal, was Smith gleichfalls widersprach, für das Bildungs‐ wesen zuständig war.24 In der politischen Praxis ließ sich dieses Programm nicht durchführen. Paradoxer‐ weise profitierten die USA industriell im Nordosten gerade in der Präsidentschaft Jeffersons von der napoleonischen Kontinentalsperre und den Folgen der europä‐ ischen Kriege nach der Französischen Revolution. Jefferson behinderte diesen Pro‐ zess nicht, verzichtete aber auch auf flankierende Maßnahmen im Sinne der Ideolo‐ gie Hamiltons und Clays. Dennoch wurde auch unter der Herrschaft der Demokraten im frühen 19. Jahrhundert der Staat einflussreicher als anfänglich gedacht, aber we‐ niger auf der Unionsebene, sondern in den Einzelstaaten, die zum Teil deutlich regu‐ lierend in das Wirtschaftsleben eingriffen und insgesamt sehr viel mächtiger wurden, als Jefferson und Madison es jemals gedacht hätten.25 In einem Punkt aber bleiben sie konsequent auf Smithʼ Kurs: Trotz der Opposition gegenüber Globalisierung, ab‐ strakten Märkten und nationalen oder gar internationalen Bankensystemen und Bör‐ 24 Zu den Staatsausgaben (insb. für Bildung und ein stehendes Heer) vgl. den Beitrag von Bastian Ronge in diesem Band. 25 Vgl. dazu Balogh 2009 und Gerstle 2015.
123
sen, plädierten sie durchweg für den Freihandel und gegen Zölle. Im Hintergrund stand die weltanschauliche Skepsis gegenüber einem autarken Staat mit eigenen fi‐ nanziellen Grundlagen, das heißt wieder der Topos vom (eigenen) Staat als Gefahr für die Freiheit der Bürger. Ronald Reagans Diktum vom Staat, der nicht die Lösung der Probleme, sondern Teil des Problems sei,26 klingt hier bereits vage an. Mindes‐ tens ebenso wichtig wie die ideelle Ebene aber war, wie bei Hamilton, die Ebene persönlichen Interesses beziehungsweise des Klasseninteresses. Die Sklavenhalter des Südens, zu denen die Vordenker der Democratic Republicans zählten oder mit denen sie durch Heirat verbandelt waren, profitierten unmittelbar von Exporten auf die imperialen und globalen Märkte Großbritanniens und Frankreichs, wo ihre Roh‐ stoffe weiterverarbeitet wurden. Im Gegenzug importierten sie europäische industri‐ elle Massenware oder Luxusgüter. Jede Unterbrechung des Freihandels betraf dem‐ nach unmittelbar ihre Eigeninteressen.27
5. Ausblick: Fortsetzung und Grenzen der Smith-Rezeption in den USA Es zeigt sich, wie beschränkt und selektiv die Rezeption von Smith und WN war. Dies mindert indes nicht ihre Folgen. Obwohl eher der Mythos Smith als seine tat‐ sächlichen Werke die Diskussionen um die ordnungspolitische und ökonomische Ausrichtung der jungen USA beherrschten, blieben die beiden geschilderten Rezep‐ tionsweisen in ihrer ganzen Einseitigkeit und Reduktion argumentativer Komplexität bis heute maßgeblich. Was sich indes geändert hat, sind die damit jeweils verknüpf‐ ten politischen Konnotationen. Nachdem die Demokraten sich im Zuge der Progres‐ siven Ära (1890 bis 1920), im New Deal (1933-1941) und in der Great Society Lyn‐ don B. Johnsons in den 1960er Jahren massiv von den Idealen Thomas Jeffersons abgewandt und der Idee des interventionistischen Wohlfahrtsstaates zugewandt hat‐ ten, mutierte die Smithrezeption für geraume Zeit zu einem Signum eines Konserva‐ tismus, der mit den Visionen Alexander Hamiltons, allen Lippenbekenntnissen zum Trotz, immer weniger zu tun hatte, sondern in wachsendem Maße neoliberal bezie‐ hungsweise libertär überformt wurde. Erst in jüngster Zeit ist es zu einer re-lecture sowohl von Smith als auch von Hamilton gekommen, nach der insbesondere Smith eben auch als Kritiker des globalisierten, radikalen Marktkapitalismus gelesen wer‐ den kann. Im 20. und 21. Jahrhundert aber waren praktisch andere ökonomische Theoretiker bedeutsam, so John Maynard Keynes und John Kenneth Galbraith für die liberals oder Murray Rothbard, Ludwig von Mises, Milton Friedman und Fried‐ 26 Siehe u. a. Rodgers 2011, der eine subtile Analyse der Rhetorik Reagans bietet, sowie zum all‐ gemeinen Kontext Wilentz 2008. 27 Vgl. etwa Beckert 2014. Die persönlichen ökonomischen Interessen von Thomas Jefferson, der übrigens permanent überschuldet war, was seine Abneigung gegen Banken partiell erklären mag, hat Wienczek 2012 deutlich gemacht.
124
rich August von Hayek für conservatives und libertarians. Ob Smith da, im Sinne eines Ausgleichs, wirklich Relevanz gewinnen kann, ist zum Mindesten zweifelhaft, was insbesondere an der inhaltlich schwachen Begründung ethischer Normen in TMS liegt.
Literatur Ashworth, John, 1995-2007: Slavery, Capitalism, and Politics in the Antebellum Republic. 2 Vols. Cambridge. Ballestrem, Karl Graf, 2001: Adam Smith. München. Balogh, Brian, 2009: Government out of Sight. The Mystery of National Authority in Nine‐ teenth-Century America. Cambridge. Beckert, Sven, 2014: King Cotton. Eine Globalgeschichte des Kapitalismus. München. Buchan, James, 2006: The Authentic Adam Smith. His Life and Ideas. New York. Chernow, Ron, 2005: Alexander Hamilton. New York. Cohen, Stephen S./DeLong, James B., 2016: Concrete Economics. The Hamiltonian Appeal to Economic Growth and Policy. Boston. Copleston, P. Frederick SJ, 1994: A History of Philosophy. Vol. V. The British Philosophers from Hobbes to Hume. New York. Dreisbach, David/Hall, Mark D. (Hrsg.), 2014: Faith and the Founders of the American Repu‐ blic. New York. Elkins, Stanley/McKittrick, Eric, 1993: The Age of Federalism. The Early American Repu‐ blic, 1788-1800. New York. Farina, William, 2015: The Afterlife of Adam Smith. The Influence, Interpretation, and Mis‐ interpretation of His Economic Philosophy, 1760 s to 2010 s. Jefferson. Gerstle, Gary, 2015: Liberty and Coercion. The Paradox of American Government from the Founding to the Present. Princeton. Heideking, Jürgen, 1988: Die Verfassung vor dem Richterstuhl. Vorgeschichte und Ratifizie‐ rung der amerikanischen Verfassung, 1787-1791. New York. Hochgeschwender, Michael, 2006: Wahrheit, Einheit, Ordnung. Die Sklavenfrage und der amerikanische Katholizismus. Paderborn. Hochgeschwender, Michael, 2016: Die Amerikanische Revolution. Geburt einer Nation, 1763-1815. München. Irwin, Terence, 2014: The Development of Ethics: A Historical and Critical Survey. Vol. II. From Suarez to Rousseau. Oxford. Keyssar, Alexander, 2009: The Right to Vote. The Contested History of Democracy in the United States. New York. Kurland, Philip B./Lerner, Ralph (Hrsg.), 1987: The Founders' Constitution. 5 Vols. Chicago. McGraw, Thomas K., 2012: The Founders and Finance. How Hamilton, Gallatin, and other Immigrants Forged a New Economy. Cambridge.
125
McLean, Iain, 2006: Adam Smith, Radical and Egalitarian. An Interpretation for the TwentyFirst Century. Edinburgh. McNichol Stock, Catherine, 1997: Rural Radicals. From Bacon's Rebellion to the Oklahoma City Bombing. New York. O‘Rourke, P.J, 2008: Über Adam Smith. Vom Wohlstand der Nationen. München. Philippson, Nicholas, 2012: Adam Smith. An Enlightened Life. New Haven. Priest, Claire, 2008: Law and Commerce. In: Grossberg, Michael/Tomlins, Christopher (Hrsg.), 2008: The Cambridge History of Law in America. Vol. I. Cambridge, S. 400-41. Rodgers, Daniel T., 2011: Age of Fracture. Cambridge. Röd, Wolfgang, 1984: Philosophie der Neuzeit. Band 2. München. Smith, Adam, 1982: The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith. Vol. V: Lectures of Jurisprudence. R.L. Meek (Hrgs.). Oxford. Smith, Adam, 1985: Theorie der ethischen Gefühle. Walter Eckstein (Hrsg.). Hamburg. Smith, Adam, 2012: Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker. Erich W. Streissler (Hrsg.). Tübingen. Streminger, Gerhard, 2017: Adam Smith. Wohlstand und Moral. Eine Biographie. München. Wienczek, Henry, 2012: Master of the Mountain. Thomas Jefferson and His Slaves. New York. Wilentz, Sean, 2008: The Age of Reagan. A History, 1974-2008. New York. Wood, Gordon S., 1993: The Creation of the American Republic, 1776-1787. New York. Wood, Gordon S., 2009: Empire of Liberty. A History of the Early Republic, 1789-1815. New York.
126
Birger P. Priddat Adam Smith im Spiegel der deutschen Ökonomie um 1800: die fundamentale Differenz in der Staatsauffassung
Adam Smith ist in Deutschland für längere Zeit kaum angenommen worden.1 Selbst um 1800 dominierte noch die kameralistische Doktrin,2 neben der, wenn auch schwach ausgeprägten, physiokratischen Ökonomie.3 Adam Smith wird zwar in Deutschland früh rezensiert,4 und noch früher, im gleichen Jahr des Erscheinens der englischen Ausgabe, 1776 übersetzt.5 Doch wird Smith erst durch Kraus in Königs‐ berg und Sartorius in Göttingen für die ökonomische Theorie aufbereitet und ver‐ wendet.6 Neben Jakob Chr. Kraus,7 Ludwig H. von Jakob,8 Friedrich E. Lotz,9 Au‐ gust F. Lueder10 u.a.m. gehört Georg Sartorius in die erste Reihe der Smith-Epitoma‐ 1
Gottlieb Hufeland notiert noch 1815, achtunddreißig Jahre nach der ersten Übersetzung: „der mit Recht gerühmte, aber wenig befolgte Smith“ (Hufeland 1815, S. IX). 2 Priddat 2008; Wakefield 2009, 2014; Meineke/Priddat 2018. 3 Priddat 2001; Priddat 2000. 4 Feder 1777 a und b; Px 1777; anonym 1777 (vermutlich I. Iselin); Kr 1777; Kr 1779; Sartorius 1793 b und 1794 a. Vgl. dazu ausführlicher Tribe 1988, S. 144ff. 5 Durch J.F. Schiller; 1776 der Bd. 1, bis 1778 Bd. 3 (Smith 1776-1778). Zur Smith-Rezeption Tribe 1988 und 1995 b, S. 26ff. Zu den verschiedenen Auflagen der ersten Ausgaben vgl. die Liste in Hagemann 2017. 6 Vgl. Kraus 1808-11 und Sartorius 1797. 7 Der Philosoph und Nationalökonom Christian Jakob Kraus (1753-1807) absolvierte ein huma‐ nistisches, mathematisches und philosophisches Studium in Königsberg, Göttingen und Halle. 1780 wurde er in Königsberg Professor für Philosophie und Kameralwissenschaften. Er war ein enger Freund Immanuel Kants. Als Anhänger Adam Smiths setzte er sich für ökonomi‐ schen Liberalismus ein und forderte die Abschaffung feudaler Wirtschaftsreglementierung und die Durchführung der Bauernbefreiung (vgl. dazu Winkel 1986; Deecke 2015, Kap. 2.2.2.1). 8 Der Philosoph und Nationalökonom Ludwig Heinrich von Jakob (1759-1827) war einer der Begründer der Volkswirtschaftslehre, insbesondere der Finanzwissenschaft in Deutschland. Er hatte in Halle zunächst eine Professur für Philosophie, dann für Staatswirtschaft. Von 1807 bis 1816 lehrte er beide Fächer im russischen Charkow und kehrte danach wieder nach Halle zurück. Als Anhänger Adam Smiths trat von Jakob entschieden für die Ideen des wirtschaftli‐ chen Liberalismus ein. 1807 übersetzte er Jean Baptiste Says Hauptwerk Traité dʼéconomie po‐ litique ins Deutsche. 9 Der Jurist und Nationalökonom Johann Friedrich Eusebius Lotz (1771-1838) schlug eine Lauf‐ bahn als höherer Verwaltungs- und Regierungsbeamter der Herzogtümer Sachsen und Koburg ein, während der er auch als wissenschaftlicher Autor in der Tradition Adam Smiths auftrat, unter anderem als Verfasser einer vierbändigen „Nationalwirthschaftslehre“ (1811-14) und einer dreibändigen „Staatswirthschaftslehre“ (1821-22). 10 Der Nationalökonom August Ferdinand Lueder (1760-1819) lehrte Geschichte und Philoso‐ phie in Braunschweig und Göttingen. Seine ersten Arbeiten, darunter einige Übersetzungen, waren geographisch-statistischen Inhalts. Lueders dreibändiges ökonomisches Hauptwerk „Über Nationalindustrie und Staatswirthschaft“ (1800-04) ist eng an Adam Smith angelehnt.
127
toren der deutschen Ökonomie, die nach 1800 die Abkehr von der vorherrschenden kameralistischen Doktrin durch die Rezeption und Kommentierung von Adam Smiths Wealth of Nations betrieben.11 Sie gelten als die eigentlichen Modernisierer, die den Übergang vom Kameralismus zur Nationalökonomie vorbereiteten. Sartorius fällt in dieser Reihe besonders dadurch auf, dass seine anfängliche Apologie Smiths12 1806 in eine Kritik wichtiger Aspekte der englischen Lehre mündet, vor‐ nehmlich der Smithʼschen Konzeption des Staates.13 Er ist nicht der einzige kriti‐ sche Rezipient: so wie Sartorius Smiths Staatsauffassung kritisiert, wendet sich Gottlieb Hufeland gegen Smiths Arbeitswertlehre.14
1. Die erste Smith-Rezeption: Der Philosoph J.H.G. Feder Die hannöversch-englische Universität Göttingen war in der Spätaufklärung angese‐ hen als „kontinentaler Vorposten englischer Geisteskultur in Deutschland“15. Aus diesem Grunde war es nicht zufällig, dass der Göttinger Philosoph Johann G. H. Fe‐ der (1740 - 1821) eine der ersten deutschen Rezensionen von Adam Smiths Inquiry into the Wealth of Nations schrieb. Smiths Hauptwerk erschien 1776 in England, aber bereits im gleichen Jahr gab es eine deutsche Übersetzung (von Johann F. Schiller, einem Vetter des Dichters (Smith 1776-1778). Sie galt als ungenau und we‐ nig gelesen, doch kann dieses Urteil nicht aufrecht erhalten bleiben;16 1793 aller‐ dings fühlte sich Sartorius in einer Rezension des dritten Bandes dieser Edition noch genötigt, den Buchhändlern zu verheißen, dass Smith kein „Ladenhüter“ wird, „denn die Vernunft behält am Ende ihr Recht.“17 Johann H. G. Feders Rezension von 1777 lobt das Smith’sche Oeuvre – er nennt es gleich schon hellsichtig ein „classisches Buch“18 – und gibt eine ausführliche Darstellung der Smithschen Argumentation, merkt aber bereits einige Kritikpunkte an, so einen Zweifel am Prinzip der „uneingeschränkten Concurrenz“19, Smiths zu 11 Roscher 1867; Grünfeld 1913; Hasek 1925; Graul 1928; Treue 1951; Palyi 1966; Winkel 1986; Tribe 1988; Scheer 1975, 63-69, 80-85; Waszek 1992; Tribe 1995 b, S. 26ff.; Nahrgang 1934. 12 Sartorius 1797; Sartorius 1806 a. 13 Sartorius 1806 b, Abh. 4. 14 Brodbeck 2014, S. 237 f.; Hufeland 1815. 15 Graul 1928, S. 33. 16 „It is sometimes suggested that Johann Friedrich Schillerʼs original translation was inferior to that of Garve and Dörrien (der zweiten deutschen Smith-Übersetzung; B.P.) and that this there‐ fore accounts at least in part for the delayed reception. Comparison of the two translations with the original reveals however no such substantial deficiencies; and indeed Garve noted in his introduction that, having read Wealth of Nations in the original only after having first read Schillerʼs translation, he discovered nothing substantive that had been hithero concealed from him by the translation“ (Tribe 1995 b, S. 26, Fn. 31; vgl. Garve 1794). 17 Sartorius 1793 b, S. 1662. 18 Feder 1777 a, S. 234. 19 Feder 1777 a, S. 237.
128
vorschnelles, „hitziges“ Urteil über die unproduktiven Arbeiten der Könige und Staatsminister,20 und weitet das Urteil aus: „überhaupt dürfen viele Sätze des Verf. in die allgemeine Politik nicht aufgenommen werden; sondern sind nur bey einer ge‐ wissen Stufe der Industrie, des Reichthums und der Aufklärung richtig“21, was ein paar Zeilen vorher damit begründet ward, dass Smith „zu sehr auf die, durch ihr ge‐ meinschaftliches Resultat, natürlicher Weise das gemeine Wohl befördernden Be‐ strebungen des Eigennutzes der Einzelnen“22 rechne. Diese wenigen, aber grundsätzlichen Einwendungen in einer der ersten deutschen Rezensionen Smiths enthalten bereits die Schwerpunkte der Kritik am englischen System, wie sie in der deutschen Nationalökonomie des 19. Jahrhunderts virulent bleiben werden.23 Daneben entsteht bei Feder – aber auch anderen Rezensenten24 – der Eindruck, Adam Smith sei letztendlich, wenn auch mit starken Abweichungen, ein Physiokrat.25 Erst einmal wird damit nur der Unterschied zum gewohnten kameralistischen Lehrsystem zum Ausdruck gebracht: ein geschlossenes Allokationsmodell der Wirt‐ schaft, wie Smith es in seinem „natural system of liberty“ darbietet, erscheint den Deutschen zum Ende des 18. Jahrhunderts noch sehr verwandt mit dem einzigen Versuch dieser Art, den sie kennen: mit dem physiokratischen.26 Adam Smiths Ökonomie wurde in Deutschland modifiziert rezipiert:27 das Er‐ gebnis war ein spezifischer „gemäßigter Smithianismus“.28 Smiths Grundkonzeption lautet kurz wie folgt. Gegebene unterschiedliche Mengen von Gütern sollen so al‐ loziiert und produziert werden, dass im Resultat mehr der gleichen Güter erhalten werden, um einen Überschuss zu maximieren, der gespart und reinvestiert, einen Wachstumsprozess unterhält. In Smiths Konzeption der Kapitalakkumulation be‐ kommt der freie Marktwettbewerb die Rolle zugeschrieben, die erwirtschafteten Überschüsse (surplus) so auf den Kapitalstock zu verteilen, dass die größtmögliche Menge an produktiver Arbeit in Bewegung gesetzt wird.29 Im Verlauf dieser Entwicklung würden auch die Lohneinkommen steigen (wenn die Klasse der Arbeiter ihre Zeugungsrate nur unterproportional ansteigen ließe). Smiths Fortschritt gegenüber den Physiokraten bestand darin, die Kapitalakkumula‐ tion nicht nur auf den agrarischen surplus begrenzt zu sehen; er weitet die Dimen‐ sion der productive labour auf die industriellen Tätigkeiten aus, während die politi‐ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Feder 1777 a, S. 239. Feder 1777 b, S. 219 f. Feder 1777 b, S. 215. Winkel 1986, S. 91. Px 1777; Kr 1779; vgl. dazu Tribe 1988, S. 144 f. und: Tribe 1995 b, S. 26 f. Winkel 1986, S. 90 f.; Tribe 1988, S. 144. Vgl. ähnlich auch: Tribe 1995 b, S. 26. Tribe 1988, S. 168. Scheer 1975, S. 80. Walsh/Gram 1978, S. 63.
129
schen und akademischen Beschäftigungen wie die Diener und Tänzerinnen zum un‐ produktiven Dienstleistungsgewerbe zählen, dessen Einkommen einen Abzug des jährlich gestiegenen Reichtums der Nation bewirke. Die Idee, durch Sparen, d. h. Nicht-Konsum und Investition in eine arbeitsteilig ausdifferenzierende kapitalisti‐ sche Produktion, die Beschäftigungs- und zukünftigen Einkommens- und Konsum‐ möglichkeiten zu steigern, zeigt historisch bisher ungeahnte Wachstumspotenziale auf, die den Reichtum nicht mehr als moralisch verwerflichen Vorteil einzelner, son‐ dern als allgemeinen Wohlstand der Nationen auszeichnet, ohne dass der (kamera‐ listische) Staat ihn fürsorglich regulieren muss. Im Gegenteil: seine Interventionen würden vielmehr diese Wachstumsmöglichkeiten behindern. Die Einwände Feders beruhen auf dem Eindruck, dass Smith ein sehr viel entwic‐ kelteres wirtschaftliches System beschreibt, als man es in Deutschland zu dieser Zeit kennt und sich vorstellen kann. Wir werden diesen Einwand bei Sartorius, bei K.H. Rau und bei F. List später wiederfinden.30 Auch die „historische Schule“ der Natio‐ nalökonomie des 19. Jahrhunderts wird methodisch auf die Differenz der verschie‐ denen natürlichen und kulturellen Bedingungen der Nationen insistieren.31 Feders Einwände versuchen, den kameralistischen Interventionsbedarf an einigen ausgesuchten Beispielen weiterhin für legitim zu halten. Smiths Plädoyer für unein‐ geschränkte Konkurrenz auf den Märkten und sein Invisible Hand-Theorem ließen ihn die vernünftigen Gründe einer staatswirtschaftlichen Lenkung übersehen. Eben diese staatswirtschaftliche Tendenz wird bald die deutsche Kritik des englischen Systems bestimmen, dessen theoretische Grundsätze zwar allgemein übernommen werden, dessen staatswirtschaftliche Konsequenzen und wirtschaftspolitische Zu‐ rückhaltung aber nicht nur den kameralistischen Gewohnheiten und Erfahrungen zu sehr widersprechen, sondern auch der grundsätzlichen Staatsauffassung. Feders Re‐ zensionen, wenn sie auch für die Theoriegeschichte der Ökonomie im engeren Sinne nichts erbringen mögen, markieren den theoriegeschichtlichen Wendepunkt, an dem die der deutschen Nationalökonomie eigentümliche Kontradiktion von Markt und Staat erstmals – mit wachem, wenn auch noch nicht besonders begründetem Vorbe‐ halt – artikuliert wird. Sartorius wird später, 1806 – nach einer ersten emphatischnüchternen Smithrezeption – diesen kritischen Nukleus seines Lehrers Feder weiter ausdifferenzieren und fundieren.32
30 Zu Rau und List siehe die Kapitel 6 und 8 in Priddat 1998. 31 Vgl. Priddat 1998. 32 Sartorius 1806 b. Vgl. Grünfeld 1913, Kap. 2, § 1; Graul 1928, S. 55-61; Winkel 1986, S. 96-98.
130
2. Die zweite Smith-Rezeption: Der Ökonom G. Sartorius In seinen Vorlesungen behandelt Sartorius33 Smith seit 1792 34 im Rahmen der „Poli‐ tik“ unter der Überschrift „Wohlfahrt“.35 Der Streit darüber, ob er oder J. Chr. Kraus in Königsberg als erster Smith in die ökonomischen Vorlesungen gebracht hat,36 ist ebenso müßig wie bezeichnend für die damit ausgelösten Wirkungen. Auf jeden Fall war Sartorius der erste, der in seinem „Handbuch“ von 1796 Smiths Ökonomie kompilierte und kommentierte. In diesem Buch wie in der veränderten 2. Auflage von 1806, den „Elementen“, tritt Sartorius als ein bedachter Smith-Kompilator in Erscheinung, der nichts anderes als ein Lehrbuch zur Vorlesungsbegleitung bieten will, der in der Art und Weise der Zusammenstellung des Smith’schen Textes und seines Kommentars aber bereits zeigt, dass er die Kritiken Pownalls und Hamiltons sehr wohl kennt.37 1794 konstatiert Sartorius in einer Rezension, dass Smith „auf Veränderung der Doctrin der Staatswirthschaft in unserem Vaterlande [...] noch gar keinen Einfluß gehabt“ habe.38
Sein eigenes Wirken will dem entgegenstehen; zu seinen Schülern zählten u.a. Hufe‐ land, Fulda, Lueder und Thünen, die später selber als Nationalökonomen Bedeutung erlangten. Sartorius „scheint in seiner akademischen Thätigkeit, obschon derselben mancherlei Züge komischer Eitelkeit nachgesagt wurden, mehr, denn als Schriftstel‐ ler gewirkt zu haben.“39 In zwei Selbstanzeigen seiner Bücher geht Sartorius auf eine bestimmte Distanz zu Smith, obschon er dessen Wealth of Nations weiterhin noch für ein „unsterbliches Werk“40 hält. Wie auch bereits im Vorwort zu den „Elementen“ betont Sartorius, dass er in vielem anderer Meinung sei als Smith. Diese seine eigenen Vorstellungen rezensiert er 1807 selber für sein zweites Buch von 1806, die „Abhandlungen“, die
33 Georg Sartorius kam 1765 in Kassel zur Welt. Nach einem 1783 begonnenen Studium der Theologie und Geschichte in Göttingen war er seit 1786 an der Göttinger Universitätsbiblio‐ thek als Kustos angestellt, von 1794 an zudem dort als Privatdozent lehrend. 1797 wurde in Göttingen außerordentlicher Professor für Philosophie, 1802 Ordinarius, später – 1814 – für Politik. Einen Ruf an die Berliner Universität auf den Lehrstuhl für Statistik und Kameralwis‐ senschaften hat er abgelehnt. Er vertrat Sachsen-Weimar 1814 auf dem Wiener Kongress. Von 1815 bis 1817 gehörte er der Hannoverschen Ständeversammlung an. 1827 wurde er zum Frei‐ herren von Waltershausen geadelt. Er starb 1828 in Göttingen. Sartorius war im Übrigen mit Goethe befreundet; für dessen „Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung“ schrieb er ihm die ökonomischen Rezensionen. Goethes ökonomische Vorstellungen liefen denen Sartoriusʼ kon‐ form (ausführlich über Goethe und die Ökonomie seiner Zeit Brodbeck 2014; auch Wild 1991). 34 Winkel 1986, S. 96. 35 Sartorius 1793 b und 1794 b; vgl. dazu: Tribe 1988, S. 164 f. 36 Graul 1928, S. 56 f. 37 Tribe 1988, S. 165. 38 Sartorius 1794 a, S. 1903. 39 Roscher 1867, S. 35. 40 Sartorius 1807, S. 81.
131
sich gegen Smiths Arbeitswertlehre41 kritisch äußern, sich für Lauderdales42 SmithKritik am Sparen und Kapitalbildungsprozess engagieren43 und die „practische“ Fra‐ ge aufwerfen: „In wie fern die oberste Staatsgewalt zur Beförderung des Natio‐ nal=Reichthums mitwirken könne und solle?“.44 Die Staatsgewalt sei „gegen Smithʼs und Andere unbedingte Freyheit, so wie gegen das passive Verhalten der obersten Gewalt in dieser Hinsicht, gerichtet, jedoch ohne die unglückselige Thätig‐ keit und das unaufhörliche Regulieren und Reglementieren in Schutz zu nehmen.“45 Hier wird vornehmlich Adam Smiths Minimierung der staatswirtschaftlichen In‐ tervention ins Visier der Kritik genommen, ohne allerdings – und darauf besteht Sartorius vehement – wieder den kameralistischen Usancen zu verfallen. Es gelte, hebt Sartorius in einer Rezension von Sismondis „Nouveaux Principes“ hervor, zwi‐ schen den beiden Gegensätzen: absoluter wirtschaftlicher Freiheit und staatlicher Zwangspolitik zu vermitteln: „Zwischen beiden wird man schwanken, aber in der Mitte liegt das Rechte.“46
Wir haben es bei Sartorius im Unterschied zu Smith mit einer anderen Begründung der Staatswirtschaft zu tun. Roscher jedenfalls sieht es 1867 für erwiesen an, dass Sartorius das „formale[…] Verdienst“ erworben habe, die Volkswirtschaft von der Staatswirtschaft gesondert zu haben,47 d.h. die von K.H. Rau später kodifizierte Trennung von „Volkswirthschaftslehre“ und „Volkswirthschaftspolitik oder Volks‐ wirthschaftspolizei“.48 Was Sartorius 1796 mit der Einführung von „Staatszwecken“ in die Smith-Kompilation betrieb, 1806 (genauer: 1806 a) zurücknahm, bricht im dritten Werk zur Ökonomie explizit durch. Sartorius schreibt seine Abhandlungen (1806 b) in einem von Smith unabhängigen, kritischen Stil.
41 Sartorius kritisiert an Smiths Arbeitswertlehre, dass der Wert der Arbeit „dreyfach geschätzt“ werde: 1. „nach dem Nutzen oder Gebrauch, den sie gewährt“, 2. „nach den Kosten, die ihre Hervorbringung veranlaßt“ und 3. „nach dem Vermögen, das ihr Besitz gewährt“. Alle drei Faktoren sind veränderlich (Sartorius 1806 b, S. 29-31). Es gäbe keinen einheitlichen Maßstab der Arbeit. 42 Der schottische Grundbesitzer und Nationalökonom James Maitland Lauderdale (1759-1839) war Mitglied des britischen Oberhauses. Sein Hauptwerk „An Inquiry into the Nature and Ori‐ gin of Public Wealth“ (1804) orientierte sich, wie schon der Titel erkennen lässt, an der Lehre seines Zeitgenossen und Landsmanns Adam Smith. Lauderdale arbeitete später vorwiegend auf geldtheoretischem Gebiet. 43 Sartorius nimmt die Kritik so auf: Nicht allein Arbeit und Sparsamkeit, sondern auch die natür‐ liche Fruchtbarkeit, das Klima, die Lage des Landes und die ganze Organisation des Staates sind „mitwirkende Kräfte“ (Sartorius 1806 b, S. 34 f.; zur „Organisation des Staates“ macht er die einschränkende Bemerkung, dass der Staat nichts „schafft, sondern erhält“, dito, S. 37). 44 Sartorius 1806 b, Kap. V. 45 Sartorius 1807, S. 83. 46 Sartorius 1820. 47 Roscher 1867, S. 35. 48 Vgl. dazu das Kapitel zu Rau in Priddat 1998, Kap. 6, und den Text und Kommentar zu Rau in: Burkhardt/Priddat 1998. Aber auch Priddat 1997 b.
132
Die dortige vierte Abhandlung „Von der Mitwirkung der obersten Gewalt im Staate zur Beförderung des National=Reichthums“49 beginnt mit einer Wiederho‐ lung der Kritik der Physiokraten, die zwar den „freyen Gebrauch“ des Privateigen‐ tums als „das höchste und erste Recht“ verteidigen, dem „alles untergeordnet seyn muß“,50 aber ihr „Beweis eines ausschließenden Eigenthums auf die Materie, ohne Vertrag, ohne Staat“51 sei verfehlt, weil die Konflikte über die Verteilung unreguliert blieben. Ein natürliches Recht auf Eigentum könne nicht bewiesen werden, folglich unterliegt es den Regeln einer Verfassungsbestimmung. Der Staat muss „dieser ewi‐ gen Fehde“ ein Ende machen.52 Das „öffentliche Gesetz“ kann die Freiheit des Er‐ werbs nur in Verbindung mit einer Beschränkung der Verwendung des Erworbenen realisieren: „Wo einmahl Privat= und Erbeigenthum besteht, da muß die Freyheit in der Erwerbung und Verwendung desselben doch beschränkt gedacht werden durch das ursprüngliche Recht aller auf ihre Persönlichkeit, durch die ursprünglichen Ansprüche aller auf die Ma‐ terie, durch die Befriedigung der Bedürfnisse, ohne welche die Menschen gar nicht leben können. Das öffentliche Gesetz muß diese Bedingung enthalten, d.h. es muß durch das‐ selbe die Freyheit der Erwerbung und die Verwendung des Erworbenen beschränkt wer‐ den.“53
Sartorius’ Maßstab ist die Staatsrechtstheorie, die die Grundsätze der Wirtschaftspo‐ litik zu bestimmen hat. Smith kann er deshalb vorhalten, dass dessen Behauptung, „daß die freye Concurrenz den National=Wohlstand am meisten befördere“ mehr auf politischen denn auf rechtlichen Gründen beruhe.54 Es geht Sartorius um eine neue Begründung der rechtlichen Voraussetzungen der Ökonomie. Immer dann, wenn durch den freien Wettbewerb das Ziel, die Vergrößerung des Nationalreichtums, gefährdet oder nicht erreicht wird, darf der Staat, nach Sartoriusʼ Lesart von Smith, intervenieren: „Daß Recht der obersten Staatsgewalt, sich in die Leitung der National=Industrie zu mi‐ schen, scheint er weniger zu bezweifeln, und Ausnahmsweise gesteht er selbst eine direc‐ te und indirecte Einmischung der Art der Regierung zu. In der That ist dieß auch der rich‐ tigere Gesichtspunct.“55
Wir haben es bei Sartoriusʼ Kritik des Smithʼschen Systems – neben der Kritik an der Wertlehre (1. Abhandlung in: Sartorius 1806 b) und an der Kapitaltheorie (2. und 3. Abhandlung in: Sartorius 1806 b) – mit einer Kritik der Institution der Markt‐ verfassung zu tun; für die deutschen Verhältnisse will er eine andere, an den Rechts‐ 49 50 51 52 53 54 55
Sartorius 1806 b, S. 199ff. Dito, S. 200. Dito, S. 201. Dito, S. 202. Dito, S. 203 f. Dito, S. 205. Dito, S. 209.
133
gewohnheiten des bonum commune orientierte ökonomische Rechtsverfassung ge‐ wählt wissen. Die Kritik der freien Konkurrenz steht im Mittelpunkt des Sartoriusʼschen Kom‐ mentars.56 Smiths Grundsatz, „daß jeder, indem er seinem Privatvortheile nachjage, den Vortheil des Ganzen befördern müsse“57, sei allerdings durch Ausnahmen relati‐ viert – durch die reinen öffentlichen Güter des militärischen Schutzes, der Rechts‐ pflege, der Verkehrsinfrastrukturinvestitionen, der Aufhebung von Handelsmonopo‐ len.58 Im Prinzip teilt Sartorius Smiths Grundkonzept: „Man kann im allgemeinen mit dem Grundsatz einverstanden sein, daß, wenn einmahl Privat=Eigenthum eingeführt ist, die freye Erwerbung und die freye Anwendung von Fleiß und Kapital im Ganzen dem Gedeihen des Wohlstandes einer Nation am zuträg‐ lichsten sein werde. Es ist gewiß, daß eine Regierung, welche die Anwendung nach ihrem Ermessen im Einzelnen vortheilhafter zu leiten gedenkt, als die Privaten es vermö‐ gen, die direct oder indirect jenen oder diesen Zweig des Industrie emporbringen will, weil sie daß, was dem Einzelnen frommt, an besten einzusehen vorgibt, es ist sicher ge‐ wiss, daß dieses Verfahren einer Regierung, der Regel nach, von verderblichen Folgen begleitet seyn wird. [...] Allein die unbedingte Freyheit würde fürwahr auch nicht ohne nachtheilige Folgen seyn.“59
Was aber „in der Regel“ gelten mag, ist in vielen Fällen nicht opportun, leitet Sarto‐ rius seine Kritik ein: „Jene Behauptung, daß jeder, indem er seinem Privatvortheil nachginge, den Vortheil des Ganzen nothwendig befördern müsse, und daß dies Streben der Einzelnen in allen Fällen hinreichend sey, um den Nationalwohlstand zur größtmöglichen Vollkommenheit zu bringen ist [...] durchaus unhaltbar.“60
Im Prinzip sei bei Smith der „richtigere Gesichtspunct“ vorhanden, aber dennoch kann „auf jeden Fall alles Privat=Eigenthum und dessen freyer Gebrauch nur in so fern recht‐ lich begründet angesehen werden, als dadurch die Möglichkeit den Anderen nicht be‐ nommen wird, gleichfalls zu erwerben.“61
56 Roscher 1867, S. 36-38; Grünfeld 1913, 2. Kap. § 1; Graul 1928, S. 5-63. 57 Dito, S. 207 f. 58 Sartorius 1806 b, S. 208 f.; vgl. auch 498: „Canäle, Heerstraßen, Posten,. Brücken u.d.g.“; ne‐ ben den klassischen deutschen „Polizei-Aufgaben“: Kontrolle gewisser Gewerbe, Aufsicht auf Güter und Verkauf, die die Gesundheit schädlich sein könnten; Kontrolle der Warengüte, Ruhe und Ordnung, Sicherheit, Schutz gegen Feuersgefahr, Unfälle, Erhaltungen guter Sitten etc. (dito, S. 488ff.). 59 Sartorius 1806 b, S. 211 f. 60 Sartorius 1806 b, S. 218. 61 Sartorius 1806 b, S. 210; „Der Gebrauch der äußeren Freyheit der Einen muß immer durch den der anderen bedingt gedacht werden, und die allgemeinen, öffentlichen Gesetze müssen diese Bestimmungen und Bedingungen enthalten“, schreibt Sartorius zuvor.
134
Diese rohe Paretoregel62 klärt die rechtlichen Voraussetzungen jeder freien Markt‐ konkurrenz, und Smith ist darin zuzustimmen, wenn er davon ausgeht, dass unter der Bedingung, dass alle in der Lage sind zur „freyen Anwendung ihres Fleißes und ihres Capitals“, der allgemeine Wohlstand gefördert werde. Gelten aber diese idea‐ len Bedingungen per se? Sartorius kritisiert den Allgemeinheitsgrad der Smithʼschen Aussage. Das Motiv, den größten Gewinn zu machen, falle nicht „immer“ und auf jeden Fall mit dem „Vortheile aller zusammen“63. Nach einer Missernte kann es durchaus im Interesse der Händler liegen, durch Kornexport ihre Landsleute in „Theurung“ und „Hun‐ gersnoth“ zu bringen.64 In der Manier kameralistischer Fallbeispiele geht Sartorius verschiedene Situationen durch, die dem Nachweis von Fehlallokationen durch freie Marktkonkurrenz dienen, und weist insbesondere darauf hin: • • • • •
•
•
dass die „größeren Capitalisten“ die kleineren „gänzlich aus dem Felde schla‐ gen“,65 dass die freie Verfügung Einzelner über Grund und Boden allein schon wegen dessen Unvermehrbarkeit bedenklich sei,66 dass es diplomatische und militärstrategische Gründe für die Bevorzugung des Außenhandels mit bestimmten Nationen gäbe,67 dass es die fatale Konkurrenz großer Nationen gegen kleinere gäbe,68 dass die Zerstückelung der Welt in viele Staaten überhaupt Ausnahmen von der Regel der Handelsfreiheit bedinge,69 weshalb Sartorius die Schutzzölle stärker favorisiert als es bei Smith angedeutet wird,70 dass die Freiheit „moralischer Personen“ bzw. der „todten Hand“ – d. h. juristi‐ scher Personen oder Kooperationen –beschränkt werden müsse, da sie den „phy‐ sischen Personen“ Erwerbsmöglichkeiten nehme,71 dass die vorzeitige Aufhebung von „Frohnden“ dagegen die nationale Faulheit fördere,72 während der Nutzen von „Weideservituten“ (ein Gemeinrecht an Wei‐ deflächen) nicht aufgegeben werden dürfe,73
62 D. h. nach der Regel, dass niemandes Vorteil auf Kosten jemandes Nachteil erlangt werden dürfe (vgl. die Sartoriusʼsche Definition in Sartorius 1806 b, S. 209 f., 231 f. u.a.m.). 63 Dito, S. 213 f. 64 Dito, S. 214 f. 65 Dito, S. 216. 66 Dito, S. 217. 67 Dito, S. 237ff. 68 Dito, S. 248ff. 69 Dito, S. 268. 70 Dito, S. 271ff.. 71 Dito, S. 288 f. 72 Dito, S. 375. 73 Dito, S. 377.
135
•
dass vor allem der laisser-faire des Kornhandels gründlich und kritisch analysiert werden müsse,74 etc.
Sartorius zeigt eine Menge von Ausnahmen und von Fällen des Marktversagens, die die Allgemeingültigkeit der Smith’schen Wohlfahrtsmaxime in Frage stellen sollen und eine wirtschaftspolitische oder staatsrechtliche Intervention zulassen, die weit über das Smith’sche Grundprinzip hinausgeht. Er weiß um die Idee Smiths, dass „wenn alle Monopole im Ganzen wegfallen, so scheint in solchem Zustande das Vorhan‐ dene und zu Producirende, bey persönlicher Freyheit, gleichsam ein gemeinschaftliches Gut zu seyn, das nach Maßgabe des Fleißes, der Geschicklichkeit, des Talents, der Spar‐ samkeit, aber auch freylich des Glücks und des Zufalls vertheilt wird.“75
Doch sind die Bedingungen hier in jedem Falle zu sichern und herzustellen, um den Nachteil der „übrig bleibenden Gebrechen“ zu kurieren.76 Er moniert an Smith, dass die „positive Einmischung der Regierung in die Verwendung von Fleiß und Capital der Pri‐ vaten [...] mehr Ausnahme denn Regel zu seyn“ scheint.77
Sartorius schließt daraus, „wo einzelnes Streben aber Nachtheile den meisten Anderen bringt, (es) Befugniß und Pflicht der Regierung (sei), dem entgegenzutreten“.78
Etwas später präzisiert Sartorius seine Interventionslegitimation. Nachdem er die Smith’schen Grundprinzipien eines freien Wettbewerbs aufgelistet hat,79 fährt er fort: „[...]; so bleibt doch nicht weniger gewiß, daß die oberste Gewalt das Recht und die Pflicht habe, das unbedingt freye Bestreben der einzelnen nach ihrem Vortheile einzu‐ schränken, wenn daraus der Nachtheil Aller, der der Mehrsten entstehen kann, und wenn diesem nachtheiligen Streben nach einseitigem Vortheile, nicht durch das Streben anderer nach dem ihrigen abgeholfen werden kann.“80
Sartorius leitet die wirtschaftliche Intervention des Staates aus einem Wettbewerbs‐ versagen ab – die klassische Form des Marktversagens. Ganz Smithianer, definiert Sartorius: Die symmetrische Koordination von eigenen Vorteil suchenden Akteuren ist legitim, aber sie verliert ihre Legitimation, wenn sie die koordinative Symmetrie nicht stabilisieren kann und wenn die ausgleichende Funktion des Wettbewerbs ent‐
74 75 76 77 78 79 80
136
Dito, S. 387-467; vgl. auch schon 206 f. Dito, S. 288. Dito, S. 288. Dito, S. 207. Dito, S. 221. Dito, S. 231. Dito, S. 231 f.
fällt. An Smith imponiert Sartorius die dem Marktwettbewerb implizite ausgleichen‐ de Gerechtigkeit – durch wechselseitige Vorteilnahme. Entfällt sie, hat der Staat die Pflicht, in den Markt einzugreifen, um seine rechtliche Normalität und Legitimität wiederherzustellen. Der selbstregulierende Wettbewerbsmarkt hat, wenn man Sart‐ oriusʼ Analyse reflektiert, eine vom Staat verliehene Rechts- und legitimatorische Form, die der Staat in dem Moment zurücknimmt, wenn der Markt diese Rechtsqua‐ lität nicht mehr halten kann. Prototypisch für die staatsrechtliche Orientierung der jungen deutschen National‐ ökonomie – eine Tendenz, die im Laufe des Jahrhunderts zunimmt – ist Sartoriusʼ Begründung: „Das Recht, die Befugniß kann der obersten Staatsgewalt nicht abgesprochen werden, durch Statute die freye Erwerbung und die freye Anwendung des Erworbenen und des Fleißes zu eigenem Vortheile zu beschränken, wenn die gerechten Ansprüche anderer, durch jene unbedingt freye Anwendung zu eigenem Vortheile, gekränkt würden, und wenn den Nachtheilen, die aus dem einseitigen Verfolgen des Vortheils der Einen entste‐ hen, nicht durch das Widerstreben der Anderen von selbst abgeholfen werden kann.“81
Das Staatsrecht definiert den Spielraum der Privat- oder Verkehrswirtschaft, nicht den Reichtumskalkül des ‚Wohlstandes der Nationen‘. Die individuellen wirtschaft‐ lichen Handlungen der Bürger können privaten Neigungen folgen, wenn die rechtli‐ che Verfassung der Ökonomie ausgebaut und stabil ist. Zwischen Spielzügen und Spielregeln der Wirtschaft wird scharf getrennt; die Ökonomie habe beide Aspekte gleichberechtigt zu untersuchen. Dabei werden die ‚Spielregeln‘ in der Theorie der Wirtschaftspolitik analysiert, deren Interventionen, Ge- und Verbote etc. die Spiel‐ räume des wirtschaftlichen Handelns bestimmen. L. H. von Jakobs82 Darlegungen sind von derselben Art: „Die Gründe, welche die Nothwendigkeit der unbeschränkten Handelsfreyheit aus dem Begriffe der Gerechtigkeit beweisen sollen, sind sehr schwach. Die Einführung des Eigenthumsrechtes gründet sich nur auf den gemeinsamen Nutzen, und inwiefern dieser nach einer allgemeinen Regel verletzt wird, muß dasselbe jederzeit durch ein Gesetz ein‐ geschränkt werden. Daß kein Recht auf eine absolute Freyheit und kein unbeschränktes Eigenthumsrecht in der Vernunft gegründet sey, ist schon an mehreren Stellen des Wer‐ kes bewiesen worden. Die Freyheit eines jeden ist nicht nur durch die Freyheit anderer beschränkt, sondern so wie sich die Menschen zu einer Gesellschaft vereinigen, setzten auch die gemeinsamen Zwecke dieser Gesellschaft der Freyheit jedes einzelnen Schran‐ ken. Insbesondere aber ist das Eigenthumsrecht nie ein absolutes Recht; es muß durch die wichtigeren gemeinsamen Zwecke, wozu das Eigenthum nur Mittel ist, stets einge‐ schränkt werden, und wo der Privatvortheil nicht von selbst antreibt, diese Schranken zu beobachten, da muß es durch Gesetze geschehen. Das Rechtsprinzip ist daher: Der Staat
81 Dito, S. 210. 82 Zu von Jakob vgl. Fn. 8.
137
ist befugt, dem Gebrauche des Eigenthums alle diejenigen Schranken zu setzen, ohne welche wichtige gemeinsame Zwecke der Staatsbürger nicht erreicht werden könnten.“83
Sartoriusʼ Argumentation baut im Engeren auf zwei grundlegende Einwände: zum einen „was England in dieser Hinsicht ziemt und frommt, das ziemt nicht allen Län‐ dern“,84 und zum anderen dass die im Prinzip richtige Einsicht Smiths in die Effizi‐ enz privater Handlungs- und Investitionsfreiheit und die Ungerechtigkeiten ausglei‐ chende Konkurrenz nur pro forma gelte, faktisch aber nicht alle Wirtschaftssubjekte in der Lage seien, aus ihren individuellen Bestrebungen den Nutzen zu ziehen, der nicht nur ihnen, sondern allen Vorteile bringe. Es wird folglich notwendig sein, „daß die Regierung durch Palliative auf kurze Zeit oft eingreife, weil zwar auf die Dauer, so gut als immer, dieß Streben und Widerstreben der Einzelnen diesen Zweck wird errei‐ chen lassen, aber bis daß dieß gelinge – und es kann oft lange dauern, bevor dieß ge‐ schieht – eine bestimmte Hilfe erfordert wird.“85
Beide Einwände haben ihre besondere Bedeutung darin, dass sie – in dieser oder an‐ derer Form – die deutsche Nationalökonomie des 19. Jahrhunderts bestimmen oder zumindest gewichtig begleiten werden. Der zweite Einwand beruht auf einer Ein‐ sicht in die historisch nicht überall gleich ausgebildete Kompetenz der Wirtschafts‐ subjekte, frei handeln und eigene Initiativen übernehmen zu können. In Erörterung der englischen Initiativen Privater zur Produktion öffentlicher Güter wie Straßen, Kanäle, Brücken, Postanstalten etc., die Smith in seiner Darlegung der Konzeption öffentlicher Güter benennt, fragt sich Sartorius in Hinblick auf die kontinentalen Länder: „Wie lange würde man auf die Entstehung dieser Anstalten hoffen müssen, wenn man in anderen Ländern (als in England; B.P.) erst die dazu erforderliche Wohlhabenheit Einzel‐ ner, ihre Ueberzeugung von der Wohlthätigkeit dieser Institute, und ihren freyen Verein zu diesen Zwecken abwarten wollte!“86
Hier haben wir den Grundgedanken vorgeführt bekommen, an dem später Friedrich List seine weitergehende Kritik der englischen „klassischen“ Ökonomie entfalten wird87: Dass der Staat Struktur- und Entwicklungspolitik betreiben müsse, damit die Wirtschaftssubjekte in die Lage kommen, die bei Smith bereits vorausgesetzten Handlungsbedingungen überhaupt erfüllen zu können.88 83 Jakob 1809, S. 547 f.; vgl. aber z.B. auch Ludens Legitimation des zwangsweisen Eingreifens der Regierung (Gehrig 1914, S. 225) und Ähnliches bei Lotz, Hufeland, von Soden, von Cölln etc. (Gehrig 1914, S. 225ff.). 84 Sartorius 1806 b, S. 494 und ff. 85 Sartorius 1806 b, S. 232; vgl. auch 499; so sei es Aufgabe der Regierung, „das Volk gegen Mangel des dringensten Bedürfnisses zu schützen“ (dito, S. 466). 86 Dito, S. 499. 87 Vgl. dazu den Text zu List in Priddat 1998, Kap. 8. 88 Tribe 1988, S. 167; Winkel 1986, S. 97.
138
Sartoriusʼ Argumentation läuft wie folgt: Indem England ein Modell für eine an‐ dere, höchst effiziente Verfassung der ökonomischen Ordnung bietet, bedarf es der Einsicht der „obersten Gewalt“, diese Institutionen schnellstmöglich auch in den an‐ deren Gesellschaften einzuführen, in denen „dieser Geist nicht herrscht, (und) des‐ sen einzelne Glieder nicht so wohlhabend sind“89, und nicht auf den Gang der Zi‐ vilisation nur zu warten. Diese Argumentation ist ganz und gar auf Smiths Konzeption der öffentlichen Güter (publick works and publick institutions) begründet,90 die Sartorius zum Mo‐ dell nimmt für die staatliche Wirtschaftspolitik überhaupt, d. h. für alle Fälle, in de‐ nen Smiths invisible hand den gesellschaftlichen Wohlstand nicht oder nur auf unge‐ rechte Weise befördert – gleichsam die klassische Begründung der öffentlichen Gü‐ ter aus dem Marktversagen der normativen Finanzwissenschaft unserer Zeit. Sartorius weiß wohl, dass hier keine allgemeine Regel für alle Fälle eruiert wird,91 sondern er leitet ein in die später so genannte „historische Methode der Na‐ tionalökonomie“92, die für jede Wirtschaftspolitik die besonderen historischen und national-kulturellen Umstände zu prüfen haben wird. „Insofern ist also Sartorius ein Vorläufer der deutschen historischen Schule der Nationalökonomie, als welcher er auch in seiner Politik (1793) erscheint. (Politik ist ihm eine Erfahrungswissenschaft; alles in der politischen Wirklichkeit erscheint ihm nach Zeit, Lage, Klima und ande‐ ren einflußreichen Faktoren verschieden und modifizierbar).“93 Auch weitet er seine staatswirtschaftliche Theorie der Produktion öffentlicher Güter bereits – wie auch schon der Kameralist Joh. F. Pfeiffer94 – auf die staatliche Aufsicht und Initiative von Sach- und Personenversicherungen aus, was besonders für die Institute gilt, die für die Armen eingerichtet sind.95 Gerade wenn ein Volk zu großem Reichtum komme und dabei ein großer Teil des Volkes sich in tiefer Armut befinde, sei der Staat in größter Gefahr, wenn die Armen „zum Bewußtsein ihrer Stärke gelangen, und verwegene Führer sich an ihre Spitze stellen, die den gänzli‐ chen Umsturz des Staats bewirken können.“96 Dann sei es angebracht, darüber zu rä‐ sonieren, wie „der großen Ungleichheit der Güter vorgebaut, und eine größere Gleichheit erhalten werden“97 könne. Das sind später im 19. Jahrhundert wichtige Topoi der Lösung der „socialen Frage“.
89 90 91 92 93 94 95 96 97
Sartorius 1806 b, S. 496. Dito, S. 496 f. Sartorius 1806 b, S. 496. Vgl. Priddat 1995. Gehrig 1914, S. 224, Fn. 1. Napp-Zinn 1921, S. 56 f. Sartorius 1806 b, S. 508. Dito, S. 280. Dito, S. 282.
139
Anders als Smith plädiert Sartorius für öffentliche, d.h. steuerfinanzierte Sozial‐ hilfeinstitutionen.98 „Nur der Gefühlloseste“, begründet Sartorius diese benevolente Haltung, „kann sagen: es wird sich alles von selbst zum beßten schon finden. Aller‐ dings wird dieß geschehen, aber vorläufig sterben die Unglücklichen den Hunger‐ tod.“99 In solchen Äußerungen ist zwar nicht der „soziale Prozeß der Proletarisierung der Massen“100 zu sehen, sondern eher das Bildungswissen der antiken politischen Phi‐ losophie, das unter dem Eindruck der französischen Revolution aktualisiert worden ist. Aber wenn wir Sartorius unter der Perspektive einer Programmschrift der The‐ men der deutschen Nationalökonomie des 19. Jahrhunderts betrachten, sehen wir hier in der ersten schärferen Differenz zu Smith alle späteren Themen zumindest an‐ gesprochen.
3. Die Differenz zu Adam Smith: der notwendige Staat Sartoriusʼ Kritik findet sich ebenso bei anderen Smithianern, so bei Ludwig H. von Jakob 1809: „Der Staat ist befugt, dem Gebrauche des Eigentums alle diejenigen Schranken zu setzen, ohne welche wichtige gemeinsame Zwecke der Staatsbürger nicht erreicht werden kön‐ nen.“101
Diese staatsrechtliche Disposition bleibt in der deutschen Ökonomie des 19. Jahr‐ hunderts vorherrschend;102 sie beruht, wie es der Rechtstheoretiker und Hegelschü‐ ler Eduard Gans 1832 feststellt, auf dem Prinzip eines „vormundschaftlichen Staa‐ 98
Sartorius begründet die soziale Wohlfahrt als öffentliches Gut, und zwar aus dem Fehlen (bzw. der Unmöglichkeit) von Wirtschaftspolitik, die er als Smithianer ausschließen muß: „Da aber diese Concurrenz, der daraus entstehende Wechsel in den Gewerben, der für manche schwere Uebergang von dem einen zu dem anderen, der Mangel an Absatz in dem bisher ge‐ wohnten, und von so vielen Zufälligkeiten manche in das Verderben stürtzen, so ist es auch Pflicht, daß für diese gesorgt werde. Das Privat= und Erbeigenthum ist einmahl, als nothwen‐ dig erachtet worden, eine mögliche freye Concurrenz in den Gewerben ist erforderlich, damit die Thätigkeit erhalten und die Gebrechen, die mit der ungleichen Erwerbung verbunden sind, nicht zu groß werden: somit scheinen, [...], da die Regierung unmöglich Mittel hat, Nachfrage und Absatz zu regulieren, kaum andere Hülfsmittel, als öffentliche Armenanstalten, für die leidenden Theile, übrig zu bleiben“ (dito, S. 483 f.). Private Wohltätigkeit hat nicht immer die „nöthige Kenntniß der Armen, ihrer Bedürfnisse, ihres Zustandes“ (dito, S. 486). Die Armen‐ pflege ist eine öffentliche Aufgabe und „die Bedingung, unter welcher die Wohlhabenderen ihr Eigenthum ruhig besitzen können“ (dito, S. 487). 99 Sartorius 1806 b, S. 491. „Noch einmahl, die möglichst freye Concurrenz ist nicht ohne alle gebrechen, die Unglücklichen, die ein Opfer derselben, ohne ihre Schuld, werden, verdienen Unterstützung“ (dito, S. 492). 100 Graul 1928, S. 60. 101 Jakob 1809, S. 545; vgl. auch: Scheer 1975, S. 83 f. 102 Priddat 1995.
140
tes“, wonach der Bevormundete eigentlich selbst handeln könne, da er es aber nicht tut, es für ihn getan werden müsse.103 Das bleibt fortan das kameralistische Erbe, durch neue staatsrechtliche Begründungen modernisiert.104 Die Smith-Rezeption in Deutschland war demnach kein Paradigmenwechsel, son‐ dern eher nur eine neue Begründung der Markt- und Preistheorie (in der Abteilung ‚Volkswirtschaftstheorie’), die die staatswirtschaftliche Komponente der kameralisti‐ schen Tradition nicht abschaffte, sondern nunmehr neu zu begründen zwang (in der Abteilung ‚Volkswirtschaftspflege’ oder -‚politik’). Paul Silverman redet von einem „Smithian cameralism“105. Überhaupt war die Schnelligkeit, mit der Smith nach 1800 als führender Theoretiker der Ökonomie anerkannt wurde, nicht allein dem Verdienst seines Werkes zuzuschreiben, sondern vorbereitet durch eine eigenständi‐ ge Kritik der taxonomisch-eklektizistischen Kameralistik, die auf neuere Natur‐ rechtsgrundsätze aufbaute106 und auf die kritische Aufklärungsphilosophie, beson‐ ders die Immanuel Kants;107 dazu gehören solche Ökonomen wie J. A. Völlinger, F. L. Walther, P.E. Klipstein, F. K. Gavard, C. D. H. Bensen, F. B. Weber, F. Cölln, aber auch die bekannteren G. Hufeland und L. H. v. Jakob.108 Im Transformationsprozess der Kameralökonomie zur Volkswirtschaftslehre war Smiths Wealth of Nations nur ein, wenn auch ein hochbedeutsames, agens movens, neben dem Werk eines anderen Schotten (und Antipoden Smiths): James Steuart, dessen Wirkung auf die frühe deutsche Volkswirtschaftslehre noch kaum untersucht ist.109 Sartorius war allerdings der erste, der die spezifische staatswirtschaftliche Ten‐ denz der deutschen Nationalökonomie des 19. Jahrhunderts zu benennen und zu be‐ gründen versuchte – und zwar nicht in der kameralistischen Selbstverständlichkeit, sondern in Kritik der modernsten Ökonomie seiner Zeit, der Smithʼschen. Karl Knies thematisiert es später rückblickend so: „In der wissenschaftlichen Bestimmung und Abgrenzung der Nationalökonomie und in dem methodischen Aufbau der systematischen Gliederungen ist die deutsche Wissen‐ schaft allen übrigen Ländern weit vorausgeeilt. Der Begriff des Reichthums ist ungemein erweitert, und die Inbetrachtnahme der Vertheilung und Verzehrung der Güter weit aus‐ gedehnt worden. Man erkannte bereitwillig an, daß Adam Smith ein zu großes Gewicht auf die Aufhäufung der Tauschwerthe legte, mit Unrecht indirect dieses als die letzte Aufgabe aller Maßregeln der Volkswirthschaftspflege aufstellte, und daß statt derselben vielmehr der Nationalwohlstand sich als Ziel darbiete, der keine mit Naturnothwendig‐ keit aus dem Gehenlassen der Privatwirthschaften sich ergebende Frucht sei. Gerade an 103 104 105 106 107 108 109
Gans 1832, S. 471-473. Vgl. Hufeland 1815. Silverman 1989, S. 7. Vgl. Meineke/Priddat 2018. Scheer 1975, S. 70-75; Tribe 1988, Kap. 8; auch Priddat 2017. Tribe 1988, Kap. 8. Steuart 1769ff.; vgl. Tribe 1988, S. 134-140, S. 169; vgl. Chamley 1963.
141
diesem Punkte zeigt sich der [...] durchgreifende Gegensatz der deutschen Schule Adam Smithʼs zu dem Meister selbst. Die hervorragendsten Vertreter der Erstern haben die Nothwendigkeit einer Einwirkung der allgemeinen Gewalt der Staatsregierung auf die wirthschaftlichen Verhältnisse nicht nur niemals in Abrede gestellt, sondern sogar für die Auseinandersetzung und Feststellung dieser erforderlichen Einwirkungen einen eigenen Theil der Nationalökonomie bewahrt.“110
An der Frage des Staates bricht sich der Einfluss der englischen ‚Klassik‘: „Es muß hier hervorgehoben werden, daß sich die deutsche Schule Adam Smithʼs gerade durch ihre Hervorhebung der Nothwendigkeit einer Volkswirthschaftspflege durch die allgemeine Staatsgewalt in einem nicht zu vermittelnden Widerspruche mit einer Grundanschauung Adam Smithʼs befindet [...] das Axiom von der gemeinnützigen Wirk‐ samkeit des Privategoismus“111 Kraus und Hufeland z. B. nennen ihre Bücher über Wirt‐ schaft pointiert Bücher zur ‚Staatswirtschaft’.112
Das englische politische System wie auch das Rechtssystem, das Adam Smith gleichsam als natürliche Voraussetzung seiner Ökonomie ansah, ließ sich nicht über‐ tragen auf die deutschen Verhältnisse, für die Sartorius, ebenso wie die anderen deutschen Sympathisanten, nun eine eigene moderne, nicht mehr kameralistische Volkswirtschaftstheorie entwerfen mussten. Was blieb ihnen übrig, als ihre deutsche historische und politische Lage einzuschätzen, um – kontextuell und kulturell be‐ dingt – zu anderen Schlussfolgerungen zu kommen. Was man im 19. Jahrhundert später die ‚historische Methode’ der Nationalökonomie nannte, ist in Sartorius’ Smith-Rezeption und -kritik bereits vorbereitet worden – eine deutsche bzw. konti‐ nentale Ökonomie mit besonderer Berücksichtigung institutioneller Rahmen und Ordnungen.113
Literatur anonym 1777: Rezension von Adam Smiths „Untersuchungen der Natur und Ursachen von Nationalreichtümern“. In: Ephemeriden der Menschheit, 4. Stk. (2. Theil), S. 61ff. (der Re‐ zensent ist anonym, sehr wahrscheinlich aber der Herausgeber Isaak Iselin).
110 111 112 113
142
Knies 1853, S. 142. Dito. Kraus 1808-1811; Hufeland 1815. Diese Line lässt sich auch bei Hegel in seiner ‚Rechtsphilosophie’ verfolgen (Priddat 1990); zur starken Fundierung der institutionellen Bedingungen der Ökonomie bei Hegel vgl. Herr‐ mann-Pillath / Boldeyrev 2015. Thomas Petersen stellt die Differenz der Grundordnungen zwischen Hegel und James Buchanan, als Repräsentant moderner Ökonomik, heraus (Peter‐ sen 1996).
Binswanger, Hans Christoph, 1986: J.G. Schlossers Theorie der imaginären Bedürfnisse. Ein Beitrag zur deutschen Nationalökonomie jenseits von Physiokratie und Klassik. In: Harald, Scherf (Hrsg.), 1986: Studien zur Entwicklung der ökonomischen Theorie V, Berlin 1986, S. 9ff. Brodbeck, Karl-Heinz, 2014: Faust und die Sprache des Geldes. Denkformen der Ökonomie – Impulse aus der Goethezeit. Freiburg/München. Burkhardt, Johannes/Priddat, Birger P. (Hrsg.), 1998: Klassiker der deutschen Ökonomie. Frankfurt a. M. Chamley, Paul, 1963: Economie politique et philosophie chez Steuart et Hegel. Paris. Deecke, Klara, 2015: ‚Staatswirtschaft vom Himmel herabgeholt’. Konzeptionen liberaler Wirtschaftspolitik in Universität und Verwaltung 1785-1845. Frankfurt a. M. Feder, Johann Georg Heinrich, 1777 a: Renzension von Adam Smiths „Wealth of Nations“. In: Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen 30. Stk., 10.3, S. 213ff. Feder, Johann Georg Heinrich, 1777 b: Rezension des 2. Bandes von Smiths „Wealth of Na‐ tions“. In: Zugabe zu den Göttingischen gelehrten Anzeigen, 14. Stk., 5.4, S. 213ff. Gans, Eduard, 1832: Beiträge zur Revision der preußischen Gesetzgebung. Berlin. Garve, Christian, 1794: Vorrede des Übersetzers. In: Adam Smith, 1794: Untersuchung über die Natur und Ursachen des Nationalreichthums, Bd. 1, Breslau. Gehrig, Hans, 1914: Die Begründung des Prinzips der Sozialreform. Jena. Graul, Herbert, 1928: Das Eindringen der Smithschen Nationalökonomie in Deutschland und ihre Weiterbildung bis zu Hermann. Halle-Saale. Grünfeld, Judith, 1913: Die leitenden sozial- und wirtschaftsphilosophischen Ideen in der deutschen Nationalökonomie. Wien. Hagemann, Harald, 2017: German Editions of Adam Smith’s Wealth of Nations. In: Cardoso, Jose Luis/Kurz, Heinz D./Steiner, Phillippe (Hrsg.), 2017: Herrmann-Pillath, Carsten/Boldyrev, Ivan A., 2014: Hegel, Institutions and Economics: Per‐ forming the Social, Oxford: Routledge Hufeland, Gottlieb, 1815: Neue Grundlegung der Staatswirthschaft, Wien (2. Aufl.). Hasek, Cecil W., 1925: The Introduction of Adam Smithʼs Doctrines into Germany, Diss. Co‐ lumbia University, New York/London. Jakob, Ludwig Heinrich von, 1809: Grundsätze der National=Oekonomie oder Natio‐ nal=Wirthschaftslehre, Halle/Leipzig/Charkow (2. Aufl.). Knies, Karl, 1853: Die politische Ökonomie vom Standpunkte der geschichtlichen Methode. Braunschweig. Kr. (anonym), 1777: Rezension von Adam Smiths „Untersuchung der Natur und Ursachen von Nationalreichthümern“ Bd. I. In: Allgemeine Deutsche Bibliothek, Bd. 31, 2. Stk, S. 588ff. Kr. (anonym), 1779: Rezension von Adam Smiths „Untersuchung der Natur und Ursachen von Nationalreichthümern“ Bd. II. In: Allgemeine Deutsche Bibliothek, Bd. 38, 1. Stk, S. 297ff. Kraus, Christian Jakob, 1808-1811: Staatswirtschaft, hrsg. v. H. v. Auerswald, 5 Bde., Kö‐ nigsberg.
143
Meineke, Christoph/Priddat, Birger P., 2018: Ökonomie. In: Theis, R./Aichele, A. (Hrsg.), 2018: Handbuch Christian Wolff, Wiesbaden 2018, S. 291-314. Nahrgang, Adolf, 1934: Die Aufnahme der wirtschaftspolitischen Ideen von Adam Smith in Deutschland zu Beginn des XIX. Jahrhunderts. Frankfurt a. M. Napp-Zinn, Anton Felix, 1921: Joh. Fried. Pfeiffer und die Kameralwissenschaft in Mainz. Wiesbaden. Palyi, Melchior, 1966: The Introduction of Adam Smith on the Continent. In: Clark, John M. et al.: Adam Smith 1776-1926, New York (reprint von 1928). Petersen, Thomas, 1996: Individuelle Freiheit und allgemeiner Wille: Buchanans politische Ökonomie und die politische Philosophie, Tübingen Priddat, Birger P., 1990: Hegel als Ökonom, Berlin. Priddat, Birger P., 1995: Die andere Ökonomie. Über G. v. Schmollers Versuch einer ‚ethischhistorischen‘ Ökonomie im 19. Jahrhundert. Marburg. Priddat, Birger P., 1997 a: Wert, Meinung, Bedeutung. Die Tradition der subjektiven Wertleh‐ re in der deutschen Nationalökonomie vor Menger. Marburg. Priddat, Birger P., 1997 b: Volkswirthschaftspolizei bzw. -politik als Kunstlehre der BeamtenJuristen. Zur Theorie und Praxis der ‚angewandten Volkswirthschaftslehre‘ im frühen deut‐ schen 19. Jahrhundert. In: Studien zur Entwicklung der ökonomischen Theorie, Schriften‐ reihe des ‚Dogmenhistorischen Ausschusses‘ des Vereins für Socialpolitik (Hrsg. v. E. W. Streissler), Bd. XVI, S. 17-42. Priddat, Birger P., 1998: Produktive Kraft, sittliche Ordnung und geistige Macht. Denkstile der deutschen Nationalökonomie im 18. und 19. Jahrhundert. Marburg. Priddat, Birger P., 2000: Joh. G. Schlosser: der Antiphysiokrat. In: U. Klump (Hrsg.) 2000: Joh. G. Schlosser: Xenocrates oder die Abgaben. Marburg 2000, S. 113-146. Priddat, Birger P., 2001: ‚Le concert universel‘. Die Physiokratie. Eine Transformationsphilo‐ sophie des 18. Jahrhunderts. Marburg. Priddat, Birger P., 2008: Kameralismus als paradoxe Konzeption der gleichzeitigen Stärkung von Markt und Staat. Komplexe Theorielagen im deutschen 18. Jahrhundert. In: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte, H. 3 / Jg. 31, 2008, S. 249-263. Priddat, Birger, P., 2017: Deutsche Ökonomen um 1800. Die philosophischen Anflüge, Vor‐ trag auf einer Konferenz zur Philosophie der Ökonomie (Prof. Hoffmann, Univ. Hagen, 5.-7.12.2017) [Planung einer Veröffentlichung 2019]. Px, 1777: Rezension von Adam Smith, Untersuchung der Natur und Ursachen von National‐ reichthum, Bd. 1. In: Allgemeine deutsche Bibliothek, Bd. 31, 2. Th., S. 588ff. Roscher, Wilhelm, 1867: Die Ein- und Durchführung des Adam Smithʼschen Systems in Deutschland. In: Berichte über die Verhandlungen der königlich sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-Historische Classe, 19 (1867), S. 1-74. Sartorius, Georg, 1793 a: Einladungs-Blätter zu Vorlesungen über die Politik. Göttingen. Sartorius, Georg, 1793 b: Rezension Adam Smiths „Untersuchung der Natur und Ursachen von Nationalreichthümern“ (3. Bd., 1. Abthl.) In: Göttingischer Anzeigen von gelehrten Sachen, 166. Stk, 19.10, S. 1660ff. Sartorius, Georg, 1794 a: Rezension der Garveschen Übersetzung v. Adam Smith. In: Göttin‐ gische Anzeigen von gelehrten Sachen, 190. Stk, 2.11, S. 1901ff.
144
Sartorius, Georg, 1794 b: Grundriß der Politik zum Gebrauch bey seinen Vorlesungen. Göttin‐ gen Sartorius, Georg, 1797: Handbuch der Staatswirthschaft zum Gebrauch bey academischen Vorlesungen nach Adam Smithʼs Grundsätzen ausgearbeitet. Berlin. Sartorius, Georg, 1806 a: Von den Elementen des Nationalreichthums und der Staatswirth‐ schaft nach Adam Smith. Göttingen (2., veränderte Aufl. des Buches von 1797). Sartorius, Georg, 1806 b: Abhandlungen, die Elemente des Nationalreichthums und die Staatswirthschaft betreffend. Göttingen (nur Bd.1). Sartorius, Georg, 1807: Rezension seiner beiden Werke von 1806. In: Göttingische gelehrte Anzeigen, 9. Stk., 15.1., S. 81ff. (vermutlich eine Selbstanzeige. In dem Exemplar der Göt‐ tinger Universitätsbibliothek ist handschriftlich "Sartor." nachgetragen). Sartorius (G.S.), 1820: Rezension von J. C. L. Simonde de Sismondi: Nouveaux principes dʼéconomie politique. In: Göttingische gelehrte Anzeigen, S. 1703 f. Scheer, Christian, 1975: Sozialstaat und öffentliche Finanzen. Köln. Silverman, Paul, 1989: The Cameralistic Roots of Mengerʼs Achievement. Duke University Program in Political economy, Working Paper Nr. 65, Universität Wien, Wirtschaftswis‐ senschaftliche Fakultät. Smith, Adam, 1776-1778: Untersuchung über die Natur und Ursachen des Nationalreichth‐ ums. Leipzig, übersetzt von J. F. Schiller. Smith, Adam, 1776: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Edin‐ burgh. Smith, Adam, 1794: Untersuchung über die Natur und Ursachen des Nationalreichthums, Bd. 1, Breslau, übersetzt von C. Garve und Dörrien. Stavenhagen, Gerd, 1957: Geschichte der Wirtschaftstheorie. Göttingen Steuart, James, 1769ff.: Untersuchung der Grundsätze der Staats-Wirthschaft, 2 Bde., Ham‐ burg 1769-70 (parallel dazu eine andere Ausgabe, 6 Bde., Tübingen 1769-72; zuerst in England 1767). Treue, Werner, 1951: Adam Smith in Deutschland. Zum Problem des „Politischen Professors“ zwischen 1776 und 1810. In: Deutschland und Europa. Festschrift für Hanns Rothfels, Düsseldorf, S. 101ff. Tribe, Keith, 1988: Governing Economy. The Reformation of German Economic Discourse 1750-1840. Cambridge. Tribe, Keith, 1995 a: Cameralism and the science of government. In: Tribe 1995 c, S. 8ff. Tribe, Keith, 1995 b: Strategies of Economic Order. German economic discourse, 1750-1950. Cambridge. Wakefield, Andre, 2009: The Disordered Police State: German Cameralism as Science and Practice. University of Chicago Press. Wakefield, Andre, 2014: Cameralism: A German Alternative to Mercantilism. In: Stern, Philip J./Wennerlind, Carl (Hrsg.), 2014: Mercantilism Reimagined. Oxford 2014, S. 134-152. Walsh, Vivienne/Gram, Herbert, 1978: Menger and Jevons in the Setting of Post - von Neu‐ mann-Sraffa Economics. In: Atlantic Economic Journal, vol. VI, No. 3, S. 46ff. Waszek, Norbert, 1992: Adam Smith in Germany, 1776-1832. In: Mizuta, H. (Hrsg.): Procee‐ dings of the Nagoya Symposium to Commenmorate the Bicentary of the Death of Adam Smith, London, S. 163-180.
145
Wild, Gerhard, 1991: Arbeit und Ökonomie – Adam Smith und Georg Sartorius. In: Wild, Gerhard: Goethes Versöhnungsbilder, Stuttgart, S. 32-41. Winkel, Harald, 1986: Adam Smith und die deutsche Nationalökonomie 1776 - 1820. In: Scherf, Harald (Hrsg.) 1986: Studien zur Entwicklung der ökonomischen Theorie V, Berlin 1986, S. 81-109.
146
Hendrik Hansen / Tim Kraski Von Smithʼ Kapitalismuskonzeption zu Marxʼ Kapitalismuskritik – oder: wie marxistisch ist Adam Smith?
Smith wurde im 19. Jahrhundert nicht nur, wie im vorherigen Beitrag thematisiert, von Liberalen rezipiert, sondern auch von den sozialistischen Kritikern der Entwick‐ lung des Kapitalismus, namentlich von Karl Marx. Den Ausgangspunkt der politi‐ schen Philosophie von Marx bildet die Hegelkritik, die im Mittelpunkt seines Früh‐ werks steht. Sein Weg zur Auseinandersetzung mit Smith führt über die Entdeckung des Materialismus, der ihm als Grundlage für eine fundamentale Kritik an Hegel dient. Marx setzte sich während seines Studiums in Berlin (1836-1841) intensiv mit He‐ gel und den Hegelianern auseinander, die die philosophische Diskussion der damali‐ gen Zeit – zumal in Berlin – dominierten.1 Hegel stellte seine Nachfolger vor ein Problem: Er hatte die gesamte sichtbare und unsichtbare Welt in ein System gefasst; wer nach ihm noch philosophieren wollte, musste entweder ein ähnlich umfassen‐ des, aber gänzlich verschiedenes System schaffen oder sich mit der Ausarbeitung ei‐ nes Aspekts seiner Philosophie begnügen. „So also stellte sich die Alternative für Marx dar, Prometheischer Himmelsstürmer oder Gipsstukkateur zu werden.“2 Marx’ Ehrgeiz ließ nur Ersteres zu,3 und den Schlüssel für den Angriff gegen Hegel fand er in der griechischen Antike: in der materialistischen Reaktion von Epikur auf Aristo‐ teles’ Metaphysik. Die Auseinandersetzung mit dem Materialismus der Antike machte Marx zum Thema seiner Dissertation;4 die materialistische Umdeutung der Hegelschen Philosophie wurde zu seinem Lebensprojekt. Dieser Ausgangspunkt verdeutlicht, dass es Marx nicht um die Lösung der sozialen Frage ging, als er sich der Ökonomie zuwandte. Die Ausarbeitung seiner materialistischen Geschichtsphilosophie erfolgte haupt‐ sächlich während der Pariser Zeit (1843-1845), in der Marx sich einerseits mit ande‐
1 Zehnpfennig 2005, S. XIII-XVIII. 2 Ebd., S. XIIIf. 3 Bezeichnend für diesen Ehrgeiz ist der Brief an seinen Vater vom 10.11.1837 (MEW 40, S. 3-12); siehe dazu: Raddatz 1975, S. 41 f.; Zehnpfennig 2005, S. XIV. – Der Übersichtlichkeit halber werden die Werke von Smith und Marx mit Kurztitel und im Fall von Marx mit Angabe des Bandes von Marx-Engels-Werke (MEW, Berlin (Ost), 1956ff.) zitiert. 4 Der Titel der Dissertation lautet: „Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilo‐ sophie“ (Jena 1841, in: MEW Bd. 40, S. 257-373).
147
ren Vertretern des Materialismus auseinandersetzte (z. B. Feuerbach5) und anderer‐ seits der klassischen Nationalökonomie (Smith, Ricardo etc.) zuwandte. Von zentra‐ ler Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ von 1844 (erstmals veröffentlicht 1932). Sie entwickeln den Zusam‐ menhang zwischen den verschiedenen Ebenen des Marxschen Systems: der Kapita‐ lismuskritik, der Theorie der Entfremdung und dem Geschichtsprozess.6 Das erste Manuskript ist in weiten Teilen ein Exzerpt des „Wohlstands der Nationen“ (im fol‐ genden: WN) von Smith, in dem Marx seine Kapitalismuskritik aus (tatsächlichen und vermeintlichen) Widersprüchen im WN herleitet. Trotz seiner Kritik an Smith – insbesondere der Ablehnung seines Optimismus, dass es ein System der natürlichen Freiheit gäbe, welches zur allgemeinen gesell‐ schaftlichen Harmonie führe – begegnet Marx ihm mit großem Respekt. Deutlich wird dies z. B. in der von Engels übernommenen Formulierung, dass Smith „der na‐ tionalökonomische Luther“ sei,7 sowie in der Übernahme zahlreicher Elemente der ökonomischen Theorie von Smith (wie z. B. der Arbeitswertlehre), die Marx jedoch radikal umdeutet. Dieses ambivalente Verhältnis von Marx zu Smith deutet darauf hin, dass es zwi‐ schen dem Eintreten für den Kapitalismus durch Smith (der freilich diesen Begriff noch nicht verwendete) und der radikalen Kapitalismuskritik von Marx nicht nur Gegensätze gibt, sondern auch Gemeinsamkeiten. Deshalb stellt sich hinsichtlich der Smith-Rezeption von Marx die Frage: Wieviel Smith steckt in Marx? Und umge‐ kehrt: wie marxistisch war Adam Smith, d. h. inwieweit ist die Marxsche Kapitalis‐ muskritik in Smith bereits angelegt?8 Um diese Fragen zu beantworten, werden im folgenden zunächst die Unterschiede zwischen Smith und Marx behandelt, bevor die Gemeinsamkeiten im Bereich der ökonomischen Theorie und der politischen Philo‐ sophie analysiert werden.
1. Der Gegensatz von Smith und Marx Der Gegensatz von Smith und Marx wird offenkundig, wenn man ihre Analysen der freien Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus vergleicht. Smith vertritt die These, dass die inneren Gesetzmäßigkeiten einer freien Gesellschaft automatisch zu einer harmonischen Ordnung führen, während Marx die liberale und kapitalistische Ge‐ sellschaft als ein System charakterisiert, das von einem unerbittlichen Klassenkampf 5 6 7 8
Vgl. Marx Thesen über Feuerbach, MEW Bd. 3, S. 533-535. Vgl. dazu ausführlich Zehnpfennig 2005 sowie Hansen 2002. Marx Manuskripte, S. 79. Für die Zuspitzung der Frage wurde in dieser Formulierung die Unterscheidung von Marx und Marxismus vernachlässigt, deren Notwendigkeit damit aber ansonsten nicht in Frage gestellt werden soll. Vgl. auch Kraski 2015.
148
geprägt ist. Drei Aspekte der Gegensätzlichkeit von Smith und Marx sollen hier her‐ vorgehoben werden: die Beurteilung des wirtschaftlichen Wettbewerbs, das grund‐ sätzliche Verhältnis von Politik und Ökonomie sowie die Frage nach der Freiheit des Menschen.
1.1. Harmonie vs. Klassenkampf als Folge des Wettbewerbs Smith zufolge bewirkt der freie Wettbewerb auf den Märkten den automatischen Ausgleich der Interessen von Anbietern und Nachfragern.9 Zudem führen freie Märkte zu wirtschaftlichem Wachstum, von dem gerade die Schwächsten am meis‐ ten profitieren: die Armen in einer reichen Gesellschaft, so heißt es gleich im Vor‐ wort zum WN, leben deutlich besser als die Reichsten in einer armen Gesellschaft.10 Diese These, dass freier Wettbewerb die Harmonie in der Gesellschaft befördert, weist Marx in aller Schärfe zurück: die Gesetze des Marktes führen nicht zum Aus‐ gleich, sondern zur Ausbeutung. Unter Ausbeutung versteht Marx nicht die Zahlung zu geringer Löhne, sondern die Existenz der Lohnarbeit als solcher. Auch bei hohen Löhnen werden die Arbeiter ausgebeutet, solange Arbeit und Kapital getrennt sind.11 Der Grund für diese Sicht liegt in der Arbeitswertlehre:12 Da die Wertschöpfung nach Marx allein auf die Arbeit zurückzuführen ist, besteht die Ausbeutung nicht da‐ rin, dass die Kapitalisten sich einen zu hohen Teil des Mehrwerts aneignen, sondern darin, dass sie aufgrund der Trennung von Arbeit und Kapital überhaupt einen Teil des Mehrwerts erhalten.13 Dem Klassenkampf können die Menschen somit nicht durch eine Reform des Ka‐ pitalismus entrinnen: Abgesehen davon, dass der Mensch die ökonomischen Gesetze nicht beeinflussen kann (wie unten in diesem Beitrag in Abschnitt 1.3. noch gezeigt wird), würde eine Reform des Kapitalismus das Grundübel der Ausbeutung nicht be‐ seitigen. Eine Erhöhung der Löhne über das Existenzminimum hinaus ist aufgrund der Gesetzmäßigkeiten des Marktes nicht möglich, weil sie im Arbeiter lediglich „die Bereicherungssucht des Kapitalisten“ erwecken würde, „die er aber nur durch Aufopferung seines Geistes und seines Körpers befriedigen kann.“14 Die Vorstellung einer Reform des Kapitalismus durch eine Regulierung der Löhne lehnte Marx be‐
9 10 11 12 13 14
Smith WN I.7, S. 48-56. Smith WN, S. 3. Marx Manuskripte, S. 6-10. Vgl. Marx Kapital Bd. I, MEW Bd. 23, S. 49-55. Marx Kapital Bd. 3, MEW Bd. 25, S. 221-241. Marx Manuskripte, S. 9. Der Gedanke, dass es dem Arbeiter selbst bei guter Bezahlung schlecht geht, findet sich bereits bei Smith: „gut bezahlte Akkordarbeiter neigen häufig sehr dazu, sich zu überanstrengen und ruinieren dadurch ihre Gesundheit in wenigen Jahren.“ (Smith WN I.viii.44, S. 71).
149
reits in seinem Frühwerk ab;15 in seinem Spätwerk trennt ihn diese Frage von der deutschen Sozialdemokratie.16
1.2. Autonomie der Ökonomie und der Politik vs. ökonomischer Materialismus Für die Herausbildung des Systems der natürlichen Freiheit und der harmonischen Ordnung sind nach Smith zwei Anlagen des Menschen von entscheidender Bedeu‐ tung: neben dem Eigennutzstreben auch die natürliche Moral.17 Der WN baut auf der „Theorie der ethischen Gefühle“ (im folgenden TEG) auf, in der gezeigt wird, wie sich quasi automatisch aus dem natürlichen Gefühl der Sympathie die Moral, die Rechtsordnung und die ständische Ordnung der Gesellschaft entwickeln. Die Moral und der Respekt gegenüber dem Recht werden im WN implizit vorausgesetzt, denn dort wird angenommen, dass die Wirtschaftssubjekte im allgemeinen die Rechtsnormen respektieren. Doch abgesehen von dieser Verbindung der ökonomi‐ schen Theorie von Smith mit der TEG sind die Ökonomie einerseits und die Rechts‐ ordnung bzw. die Politik andererseits zwei nebeneinander stehende, unabhängige Systeme. Für die relative Unabhängigkeit der TEG und des WN spricht auch, dass Smith im WN an keiner Stelle auf die TEG Bezug nimmt, während umgekehrt der WN in der TEG nur im Vorwort zur sechsten Auflage von 1790 erwähnt wird. Marx hingegen sieht die Ökonomie und das Recht bzw. die Politik nicht als unab‐ hängige Systeme, sondern deutet sie nach dem Basis-Überbau-Schema: die Ökono‐ mie bestimmt das Recht und die Politik. Schon in der frühen Schrift „Zur Judenfra‐ ge“ wird in Bezug auf die „sogenannten Menschenrechte“ behauptet, dass sie allein den Interessen der Kapitalisten dienen. Die Freiheit, die die Menschenrechte schüt‐ zen, ist die Freiheit der Kapitalisten; das Menschenrecht der Freiheit sei das Men‐ schenrechte des Privateigentums.18 Die Vorstellung der Determination aller politi‐ schen, gesellschaftlichen und kulturellen Prozesse durch die Produktionsverhältnisse fasst Marx in der „Kritik der Politischen Ökonomie“ von 1858/59 in das Basis-Über‐ bau-Schema: „Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomi‐ sche Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und poli‐ tischer Überbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsfor‐ men entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozia‐
15 Ebd., S. 12. 16 Vgl. insb. die „Kritik des Gothaer Programms“, in der Marx sich vehement gegen die Aussage im Parteiprogramm der SPD wendet, dass das Ziel der Politik eine „gerechte Verteilung“ sein müsse (Marx Kritik des Gothaer Programms, MEW Bd. 19, S. 21 f.). Diese Differenz besteht bis heute und macht sozialdemokratische und kommunistische Positionen unvereinbar. 17 Vgl. dazu ausführlich den Beitrag des Verfassers „Autonomie gesellschaftlicher Prozesse ver‐ sus Teleologie“ im vorliegenden Band. 18 Marx Zur Judenfrage, MEW Bd. 1, S. 362-364.
150
len, politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt.“19 Marx geht damit in Bezug auf das Verhältnis von Politik und Ökonomie von einer Determination der politischen durch die ökonomischen Verhältnisse aus. Deshalb lehnt er auch den Parlamentarismus als das dem Kapitalis‐ mus entsprechende politische System ab und beansprucht, die gesamte Rechtsord‐ nung des Kapitalismus als Ausdruck der Interessen der Besitzenden zu entlarven.20
1.3. Individuelle Freiheit vs. geschichtliche Determination Die Mechanismen, die nach Smith bewirken, dass sich aus dem natürlichen Gefühl der Sympathie die Moral und die Rechtsordnung entwickeln und dass der Eigennutz im Wettbewerb zum Ausgleich der wirtschaftlichen Interessen führt, nehmen den Menschen nicht ihre individuelle Freiheit. Dass der Mensch seine natürlichen Anla‐ gen zur Sympathie und zum Tausch entfaltet und auf Anreize reagiert, ermöglicht Voraussagen über sein Verhalten, ohne die Entscheidungsfreiheit zu negieren. Die Freiheit zeigt sich bei Smith insbesondere darin, dass der Mensch fähig ist einzuse‐ hen, dass das Streben nach Reichtum aus individueller Perspektive ein letztlich sinn‐ loses Streben ist, ein Streben nach Akkumulation von nutzlosem Tand.21 Dieses Streben hat vor allem eine gesellschaftliche Funktion: Es schafft Arbeitsplätze, för‐ dert das Wachstum und dient damit den Armen. Ein Mensch mit entsprechend philo‐ sophischer Natur kann jedoch die aus gesellschaftlicher Perspektive nützliche Täu‐ schung, der die Reichen erliegen, durchschauen und das wahre Glück anstreben, dass darin besteht, den Seelenfrieden zu erlangen, den der Reiche mit seinem ständi‐ gen Mehr-Haben-Wollen nie bekommen wird.22 Eine solche Freiheit gibt es bei Marx nicht: der Mensch ist vollständig von den ökonomischen Gesetzlichkeiten determiniert; im Kapitalismus ist er dazu verdammt, eine unmenschliche – oder, wie er auch schreibt, „entmenschte“ – Existenz zu füh‐ ren.23 Das Glück kann er erst im vollendeten Kommunismus erreichen, wenn er sich nicht mehr als vereinzeltes Individuum, sondern als Exemplar der Gattung Mensch 19 Marx Zur Kritik der Politischen Ökonomie, MEW Bd. 13, S. 8 f. 20 In der „Kritik des Gothaer Programms“ kritisiert Marx deshalb vehement, dass die deutsche Sozialdemokratie sich zu sehr auf die bestehende Staatsform eingelassen hat und nur fordert, sie durch Reformen in einen „freien Staat“ umzuwandeln; damit negieren die Sozialdemokra‐ ten, dass „zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft […] die Peri‐ ode der revolutionären Umwandlung der einen [Staatsform, H.H. / T.K.] in die andre“ liegt, nämlich: die „Diktatur des Proletariats“ (MEW Bd. 19, S. 28). Vgl. auch Marxʼ Kritik des Par‐ lamentarismus in „Der Bürgerkrieg in Frankreich“, MEW Bd. 17, S. 340. 21 Smith TEG IV.i.10, S. 315-317. 22 Ebd., S. 317. 23 Marx Manuskripte, S. 72.
151
versteht.24 Als Gattungswesen soll der Mensch im Kommunismus seine menschli‐ chen Eigenschaften verwirklichen, insbesondere seine Fähigkeit zur Transformation der Natur im Akt der Produktion,25 aber diese schöpferische Tätigkeit wird nicht als individuelle, sondern als eine kollektive Tätigkeit verstanden. Deshalb ist diese Tätigkeit auch nicht mit individueller, und schon gar nicht mit geistiger Freiheit verbunden: Der Mensch soll im Kommunismus arbeiten, aber nicht über das Leben nachdenken. Wenn er anfängt, das kommunistische Selbstver‐ ständnis des Menschen zu hinterfragen, demzufolge er Schöpfer seiner selbst ist – Marx spricht vom „Durchsichselbstsein“ des Menschen26 – wird er scharf zurecht gewiesen: „Denke nicht, frage mich nicht, denn sobald du denkst und fragst, hat dei‐ ne Abstraktion von dem Sein der Natur und d[es] Menschen keinen Sinn. Oder bist du ein solcher Egoist, daß du alles als Nichts setzt und selbst sein willst?“27 Wer die zentrale philosophische Frage nach der letzten Ursache stellt, setzt seinen Geist und dessen Abstraktionen über die Wirklichkeit der Natur und ist damit ein Egoist. Voe‐ gelin hat zurecht bemerkt, dass in diesem Denk- und Frageverbot der totalitäre Cha‐ rakter des Marxschen Denkens besonders deutlich zutage tritt. Die Systeme von Smith und Marx bilden in dieser Hinsicht klare Gegensätze: hier die Harmonie durch den Ausgleich der Interessen, dort die Diagnose des unerbittli‐ chen Klassenkampfes; hier die Autonomie der Politik gegenüber der Ökonomie, dort die Abhängigkeit der Politik von der Ökonomie nach dem Basis-Überbau-Schema; hier die Verwirklichung der individuellen Freiheit des Menschen, dort die funda‐ mentale Kritik des Liberalismus und des Individualismus und das Versprechen der Befreiung des Menschen durch eine mit Revolution und Diktatur durchgesetzte kol‐ lektivistische Gleichheit, die auf die Ausmerzung jeglicher Individualität zielt. Doch dieser Gegensatz ist nur eine Seite des komplexen Verhältnisses von Smith und Marx: die Analyse der Gemeinsamkeiten im nächsten Abschnitt wird zeigen, dass das Verhältnis wesentlich ambivalenter ist, als es hier zunächst erscheint.
2. Gemeinsamkeiten von Smith und Marx 2.1. Ökonomie und Politik „Wird also eine Regierungsgewalt zu dem Zwecke eingerichtet, das Eigentum zu si‐ chern, so heißt das in Wirklichkeit nichts anderes, als die Besitzenden gegen Über‐ griffe der Besitzlosen zu schützen.“ Das scheint ein typisches Zitat von Marx zu sein 24 25 26 27
152
Ebd., S. 90. Ebd., S. 63. Ebd., S. 97. Ebd., S. 98. Zum Frageverbot vgl. Voegelin 2000, S. 262-265.
– tatsächlich aber ist es ein Satz von Smith, zitiert aus dem fünften Buch des WN.28 Die Aussage passt nicht ganz zur Theorie des umfassenden Ausgleichs aller Interes‐ sen im System der natürlichen Freiheit, fügt sich aber in eine Reihe anderer Stellen in der ökonomischen Theorie von Smith ein, die in Widerspruch zu seiner Harmo‐ nie-These stehen und die die Marxsche Schlussfolgerung, dass der Kapitalismus nicht zur Harmonie, sondern zum Klassenkampf führt, nahelegen: •
Wertlehre: Smith vertritt (im Anschluss u. a. an John Locke) eine Variante der Arbeitswertlehre, derzufolge der Wert der Güter in der Arbeit besteht, die für ihre Produktion erforderlich ist. In Buch I, Kapitel 6 des WN schreibt er: „Auf der untersten Entwicklungsstufe [eines Landes, H.H./T.K.] gehört der gesamte Ertrag der Arbeit dem Arbeiter, und die Menge Arbeit, die gemeinhin geleistet wird, um ein Gut zu erwerben oder zu erzeugen, ist das einzige Richtmaß, nach dem man die Menge Arbeit bestimmen kann, gegen die es üblicherweise gekauft, beansprucht oder getauscht werden soll.“29 Ursprünglich sieht er damit allein die Arbeit als wertschöpfend an, obwohl genau genommen der Arbeiter auf dieser Entwicklungsstufe im Zweifel Besitzer seiner Werkzeuge und somit Arbeiter und Kapitalist (im Sinne eines Besitzers von Produktionsmitteln) in einer Person ist. Mit der weiteren Entwicklung der Gesellschaft kommt es zur Unterscheidung von Arbeiter und Kapitaleigentümer, und letzterer muss einen Anteil am Produkt erhalten (den Gewinn). Der Gewinn wird von Smith allein funktional begründet: Wenn es keinen Gewinn gibt, hat der Kapitalbesitzer keinen Anreiz, sein Kapital zu investieren.30 Er wird aber nicht als Belohnung für eine spezifische Leistung angesehen (wie z. B. unternehmerische Findigkeit, Risikobereitschaft o. ä.), so dass der Gedanke naheliegt, den Gewinn als ungerechtfertigtes Einkommen zu bezeichnen, das nur akzeptiert wird, weil das System ansonsten nicht funktio‐ niert. Noch schärfer urteilt Smith über den Stand der Grundeigentümer: „Sobald in einem Land aller Boden Privateigentum ist, möchten auch die Grundbesitzer, wie alle Menschen, dort ernten, wo sie niemals gesät haben.“31 Bei der Grund‐ rente bemüht Smith sich noch nicht einmal, sie als legitim erscheinen zu lassen. Marx braucht dieser Analyse nicht viel hinzuzufügen, um die Schlussfolgerung zu ziehen, dass der Abzug des Gewinns und der Grundrente vom Produkt der Ar‐ beit eine Ausbeutung der Arbeiter darstellt: in der entscheidenden Annahme, dass nur die Arbeit wertschöpfend ist, stimmen beide überein, wenngleich Marx diese Aussage wesentlich radikaler zu begründen versucht.32
28 Smith WN V.i.b.12, S. 605 (im englischen Original klingt es noch schärfer: „civil government [is, H.H.]… in reality instituted for the defence of the rich against the poor“). 29 Smith WN I.vi.4, S. 42 f. 30 Ebd., I.vi.5 f., S. 43. 31 Ebd., I.vi.8, S. 44. 32 Vgl. dazu den Abschnitt über die entfremdete Arbeit in Hansen 2002, S. 160-163.
153
•
•
•
Klassenkämpfe auf den Arbeitsmärkten: Auch die Charakterisierung der Arbeits‐ märkte durch Adam Smith lässt Zweifel daran aufkommen, dass der freie Wett‐ bewerb stets zum Ausgleich der Interessen führt. Smith beschreibt anschaulich, wie die Arbeiter sich immer wieder zusammenschließen, um Lohnforderungen durchzusetzen. Sie „machen stets ein großes Geschrei“, „schrecken gelegentlich auch nicht vor roher Gewalt und grober Beleidigung zurück“ und „handeln mit der ganzen Torheit und Maßlosigkeit von Menschen, die entweder am Verhun‐ gern sind oder ihre Arbeitgeber in Furcht und Schrecken versetzen müssen, da‐ mit ihre Forderungen sofort erfüllt werden.“33 Doch die Arbeiter sind mit diesem Vorgehen nur selten erfolgreich, weil „die Unternehmer den längeren Atem ha‐ ben“ und mit der Unterstützung der Obrigkeit die Rädelsführer bestrafen.34 Was hier beschrieben wird, ist nicht ein harmonischer Ausgleich von Angebot und Nachfrage, sondern ein Kampf. Langfristige Perspektive der Arbeiter: Smith sieht die Arbeitskämpfe als unpro‐ blematisch an, weil der Lohn sich am Ende aus der Situation von Angebot und Nachfrage ergibt, die ihrerseits wesentlich davon abhängt, ob die Gesellschaft sich in einer Rezession, Stagnation oder Wachstumsphase befindet. Solange die Gesellschaft wächst, liegen die Löhne über dem Existenzminimum, so dass es den Arbeitern gut geht. Die Durchsetzung des Systems der natürlichen Freiheit führt zunächst zu Wachstum, aber das verbessert die Lage der Arbeiter nur be‐ dingt: kurzfristig besteht die Gefahr, dass hohe Löhne vor allem bei Akkordar‐ beitern zu Überarbeitung führen;35 langfristig gesehen hat das Wachstum eines jeden Landes nach Smith eine durch das Klima und den Bodenertrag vorgegebe‐ ne natürliche Grenze, bei der das Höchstmaß des Reichtums erreicht sein wird, so dass die Entwicklung vom wachsenden in einen stationären Zustand überge‐ hen wird.36 Dann tritt eine Phase der Stagnation ein, in der der Lohn der Arbeit nur auf dem Niveau des Existenzminimums liegen wird.37 Die freie Marktwirt‐ schaft eröffnet der Arbeiterklasse Smith zufolge also nicht dauerhaft eine Per‐ spektive auf Teilhabe am Wohlstand. Politische Umsetzung des Systems der natürlichen Freiheit: Der freie Wettbe‐ werb verspricht den Arbeitern also nur begrenzte und temporäre Vorteile. Hinzu kommt, dass es nach Smith schwer ist, eine Wirtschaftspolitik durchzusetzen, die den freien Wettbewerb fördert, denn es gibt keine Klasse, die sowohl die Fähig‐ keit als auch den Willen hat, eine solche Politik zu verwirklichen. Die Arbeiter scheiden dafür aus, weil sie weder die Zeit haben, sich über Politik zu informie‐ ren, noch die Bildung, um die Lage des Landes und ihre eigenen Interessen zu
33 34 35 36 37
154
Smith WN I.viii.13, S. 59. Ebd. Vgl. oben, Fußnote 14. Smith WN I.ix.14, S. 82; vgl. auch ebd., I.viii.43, S. 70. Ebd., I.viii.24, S. 62.
•
38 39 40 41 42 43
beurteilen.38 Die Grundeigentümer sind theoretisch dazu geeignet, weil ihre öko‐ nomischen Interessen mit denen der Gesellschaft gleichgerichtet sind und sie „von allen Leuten am wenigsten von dem erbärmlichen Monopoldenken be‐ herrscht sind.“39 Allerdings verleitet die Tatsache, dass die Grundeigentümer ein Einkommen beziehen, ohne dafür eine Leistung zu erbringen, sie zu Trägheit und Nachlässigkeit, so dass ihnen häufig die erforderlichen Kenntnisse und die Ur‐ teilskraft fehlen, um (wirtschafts-)politische Fragen zu entscheiden. Die Kapita‐ listen wiederum sind aufgrund ihrer kaufmännischen Unternehmungen in der Ur‐ teilskraft am besten geschult, doch die überlegenen Fähigkeiten setzen sie zur Durchsetzung von Wettbewerbsbeschränkungen und nicht zur Verwirklichung des freien Wettbewerbs ein. Kaufleute und Kapitalisten sind, so betont Smith im‐ mer wieder, „in der Regel […] daran interessiert […], die Allgemeinheit zu täu‐ schen, ja, sogar sie zu mißbrauchen.“40 Smith bleibt bei dieser Diagnose stehen, die mit seiner These von der Harmonie in der Gesellschaft schwer zu vereinbaren ist; Marx zieht aus ihr die radikale Konsequenz und folgert, dass die Entmach‐ tung der Kapitalisten die Voraussetzung für eine gute Gesellschaft ist. Absicherung des Reichtums als Grundlage der Politik: Die pessimistische Sicht auf die Politik wird an den Stellen verstärkt, an denen Smith sich mit der Entste‐ hung politischer Herrschaft befasst. Aus seiner Sicht führte das menschliche Be‐ sitzstreben zu ökonomischer Ungleichheit, die wiederum Begehrlichkeiten und Neid aufkommen ließen. Die daraus entstehenden Konflikte führten zur Notwen‐ digkeit, eine Regierung, Gesetze und staatliche Institutionen einzuführen, die das Eigentum schützen.41 In den „Lectures on Jurisprudence“ von 1762-63 (im fol‐ genden zitiert als LJA) spitzt Smith die These, dass die Einsetzung einer Regie‐ rung der Absicherung der Interessen der Reichen dient, in folgenden Worten zu: „Laws and government may be considered in this and indeed in every case as a combination of the rich to oppress the poor, and preserve to themselves the ine‐ quality of the goods which would otherwise be soon destroyed by the attacks of the poor, who if not hindered by the government would soon reduce the others to an equality with themselves by open violence.“42 Die Rechtsordnung entsteht folglich aufgrund der Furcht der Reichen vor dem Neid der Armen und dient der Durchsetzung der Interessen der Reichen.43 Damit ist Smith nicht weit entfernt von der Marxschen Deutung von Politik und Staat als Instrument der herrschen‐ den Klasse im Klassenkampf.
Smith WN I.xi.p.9, S. 212. Smith WN IV.ii.21, S. 376. Smith WN I.xi.p.10, S. 213; vgl. auch I.x.27, S. 112, und IV.ii.43, S. 385 f. Ballestrem 2001, S. 107. Smith LJA iv. 23, S. 208; vgl. Ballestrem 2001, S. 110. Ballestrem 2001, S. 114.
155
•
Das Leid der Kapitalisten im Kapitalismus: Auch in der Beurteilung der Situati‐ on der Kapitalisten steht Smith Marx erstaunlich nahe. Marx betont immer wie‐ der, dass die Kapitalisten unter dem Druck der ökonomischen Verhältnisse han‐ deln und nicht, weil sie im moralischen Sinne böse sind.44 Die Kapitalisten sind ähnlich wie das Proletariat Opfer der ökonomischen Verhältnisse. Die Argumen‐ tation von Smith lässt sich in eine ganz ähnliche Richtung deuten, denn von dem schrankenlosen Streben nach Wohlstand profitiert der Kapitalist letztlich gar nicht, wie oben in 1.3. bereits gezeigt wurde. Das Streben nach Reichtum dient der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, nicht aber dem einzelnen Rei‐ chen, der vielmehr sein Seelenheil (den „peace of mind“) dem allgemeinen Wohl opfert.
2.2. Menschenbild und Geschichtsphilosophie Marxʼ Kritik an Smith, dass das System der natürlichen Freiheit zum Klassenkampf führt, ist also an verschiedenen Stellen bei Smith angelegt: Bereits letzterer beurteilt die Lage der Arbeiter am Arbeitsmarkt kritisch, sieht die langfristige Entwicklung ihrer Einkommenssituation skeptisch und kann nicht die Frage beantworten, welche Klasse fähig und willens ist, eine liberale Wirtschaftspolitik zu verwirklichen. Marx muss also nicht als Gegenthese zu Smith gedeutet werden; vielmehr kann man ihn auch so interpretieren, dass er die gelegentliche Skepsis von Smith gegenüber den Kapitalisten und dem freien Wettbewerb aufgreift und daraus seine eigenen – frei‐ lich ungleich radikaleren – Konsequenzen zieht. Diese Konsequenzen sind auch auf einer grundlegenderen Ebene bei Smith angelegt, denn sowohl das ökonomische Menschenbild als auch die deterministische Geschichtsphilosophie von Marx zeich‐ nen sich bei Smith bereits ab. Hinsichtlich des Menschenbildes definieren Smith und Marx den Menschen über‐ einstimmend als ein ökonomisches Wesen. Smith nennt als entscheidende Fähigkeit, die allen Menschen gemeinsam ist, die Fähigkeit zum Tausch, die die unmittelbare Folge der menschlichen Denk- und Sprachfähigkeit ist („reason and speech“).45 Kein Tier ist dazu fähig, einem anderen Tier einen Tausch anzubieten. Damit charak‐ terisiert Smith den Menschen – vermutlich in bewusstem Gegensatz zu Aristoteles46 – durch eine ökonomische Eigenschaft: Der Mensch ist primär ein ökonomisches,
44 Vgl. z. B. Marx Kapital Bd. 1, MEW Bd. 23, S. 16. Marx hält diese Argumentation aber nicht konsequent durch, denn er bezichtigt immer wieder die Kapitalisten der Habsucht (vgl. Marx Manuskripte, S. 9 und Anm. 30). 45 Smith WN I.ii.2, S. 16. 46 Vgl. dazu Abschnitt 1.1. im Beitrag des Verfassers „Autonomie gesellschaftlicher Prozesse und Teleologie“ in diesem Band.
156
nämlich tauschendes Wesen; die Politik dient – zumindest ursprünglich, wie oben gezeigt wurde – der Absicherung des im Tausch erworbenen Besitzes. Die Bestimmung des Menschen durch die Neigung zum Tausch ist mit der Posi‐ tion von Marx nicht vereinbar, weil der Tausch Ausdruck einer Klassengesellschaft ist, in der Arbeit und Kapital getrennt sind und in der die Arbeit entfremdet ist. Doch auch er definiert den Menschen als ein ökonomisches Wesen, nämlich über die Ar‐ beit. Smith ist für ihn der Ökonom, der erkannte, dass das Wesen des Reichtums nicht in der äußeren Welt, im Privateigentum, zu finden ist, sondern im Inneren des Menschen: Das Eigentum wird vom Menschen in der Arbeit geschaffen.47 In diesem Zusammenhang verwendet Marx die in der Einleitung zu diesem Beitrag bereits zi‐ tierte Formulierung, dass Smith der „nationalökonomische Luther“ sei.48 Doch die Arbeit bekommt bei Marx einen ganz anderen Stellenwert als bei Smith. In ihr ver‐ wirklicht sich der Mensch, denn die bewusste Produktionstätigkeit unterscheidet den Menschen vom Tier. Der Zweck der Produktion besteht darin, dass der Mensch die Natur nach seinem Maß transformiert und „sich selbst daher in einer von ihm ge‐ schaffenen Welt anschaut“.49 Dies ist jedoch nur möglich, wenn der Mensch „frei vom physischen Bedürfnis produziert“.50 Ebendiese Freiheit ist dem Menschen in einer auf Tausch beruhenden Gesellschaft genommen, weil er dann um der Siche‐ rung der Subsistenz und des Erwerbs willen produziert und die Arbeit entfremdet ist.51 Wenngleich der Mensch damit ganz anders als bei Smith verstanden wird, be‐ steht doch in Abgrenzung zu Aristoteles die Gemeinsamkeit, dass beide, Smith und Marx, den Menschen als ein von der Ökonomie her definiertes Wesen auffassen. Hinsichtlich der Geschichtsphilosophie vertraut Adam Smith beim Übergang der Gesellschaft von einer Entwicklungsstufe zur nächsten ebenso auf Mechanismen wie beim Wettbewerb auf Märkten und der Herausbildung der Moral und der Rechtsordnung. Im dritten Buch des WN beschreibt er den Mechanismus, der den Niedergang des Feudalwesens herbeiführt. Die Herrschaft der Grundeigentümer be‐ ruht auf der persönlichen Abhängigkeit der Pächter, der Leibeigenen und des Gesin‐ des. Im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs der Städte werden die Grundeigen‐ tümer von dem neuen Luxus, den sie dort erwerben können, verführt und reduzieren, um ihn sich leisten zu können, die Zahl der Abhängigen: „Sie verschacherten zuse‐ hends ihre ganze Macht und Autorität gegen die kindischsten, minderwertigsten und schmutzigsten Nichtigkeiten.“52 In der Folge sinkt die Zahl derer, die in einem per‐ sönlichen Abhängigkeitsverhältnis stehen, während die Zahl derer, die als freie Ar‐ beiter, Handwerker oder Händler tätig sind, zunimmt. „Obwohl Handwerker und Ar‐ 47 48 49 50 51 52
Marx Manuskripte, S. 79 f. Ebd., S. 79. Ebd., S. 63. Ebd. Ebd., S. 56-59. Smith WN III.iv. 10, S. 338.
157
beiter von allen Reichen leben, bleiben sie doch vom einzelnen mehr oder weniger unabhängig, da sie durchweg auch ohne ihn ihren Lebensunterhalt verdienen kön‐ nen.“53 Auf diese Weise bildet sich schrittweise eine freie Gesellschaft heraus, in der die Reichen, ohne es zu intendieren, durch den Erwerb von Luxusgütern „für den Lebensunterhalt vieler Menschen“ sorgen.54 Dies löst eine „Revolution von größter Bedeutung für die Wohlfahrt aller“ aus.55 Am Ende bildet sich eine Gesellschaft he‐ raus, in der jeder Mensch ein Kaufmann und die Welt ein großer Markt ist. Der Weg zu dieser liberalen Utopie wird von Smith im WN nur angedeutet; in den LJ geht er genauer darauf ein. Dort zeichnet er die Entwicklung der Mensch‐ heitsgeschichte in vier Stufen nach:56 1. Im Zeitalter der Jäger und Sammler gibt es weder eine Eigentumsordnung noch eine Regierung, weil beides nicht erforderlich ist. 2. Im Zeitalter der Hirten müssen die Weidegründe als überlebensnotwendiges Ei‐ gentum vor Übergriffen geschützt werden. Damit wird eine Festlegung der Ei‐ gentumsrechte erforderlich sowie die Einsetzung einer Regierung, die diese Rechte durchsetzt. Der Übergang vom Zeitalter der Jäger und Sammler zu dem der Hirten folgt einer ökonomischen Notwendigkeit: The „hunters […] would find the chase too precarious for their support.“57 3. Das Zeitalter der Landwirtschaft entsteht, wenn durch das fortschreitende Wachstum der Bevölkerung die Versorgungslage erneut prekär wird und neue Techniken für die Sicherung des Überlebens erforderlich werden.58 4. Der Übergang zum Zeitalter des Handels erfolgt, wenn der Tausch auf der vor‐ hergehenden Stufe sich weiter entwickelt und der zwischenstaatliche Handel ent‐ steht.59 Dies entspricht dem oben dargestellten Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus, den Smith im WN beschreibt. Die Eigentumsrechte entsprechen auf jeder Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung dem Stand der Produktionstechnik: „It is easy to see that in these severall ages of society, the laws and regulations with regard to property must be very different.“60 Der Übergang von einer Stufe zur nächsten folgt ökonomischen Gesetzmäßigkeiten, doch er wird von Smith nicht als deterministischer Prozess gedacht, sondern als ein idealtypischer Ablauf, von dem die Geschichte regelmäßig abweicht. Dies zeigt sich z. B. innerhalb des Zeitalters des Handels: Während der Übergang vom Feudalismus
53 54 55 56 57 58 59 60
158
Ebd., III.iv. 11, S. 338 f. Ebd., III.iv. 16, S. 340. Ebd., III.iv. 17, S. 340. Smith LJA i.27, S. 14; vgl. Ballestrem 2001, S. 106-108. Smith LJA i.28, S. 14. Ebd., i. 30, S. 15. Ebd., i.31 f., S. 15 f. Ebd., i.32 f., S. 16.
zum Kapitalismus (wie oben geschildert) automatisch erfolgte, lässt sich die Fehl‐ entwicklung des Merkantilismus offensichtlich nur durch aktive politische Maßnah‐ men korrigieren, für deren Durchsetzung es einer entsprechenden Einsichtsfähigkeit der Regierenden bedarf. Sie zu fördern, ist ganz offensichtlich ein primäres Ziel des WN. Geschichtsphilosophisch vertritt Smith damit einen schwachen Determinismus: Im Gang der Geschichte fördern die Mechanismen die Durchsetzung der „commer‐ cial society“, doch es gibt eine Reihe historischer Kontingenzen und Handlungs‐ spielräume, die den Prozess verlangsamen, aufhalten oder auch beschleunigen kön‐ nen. Dennoch spielen sie in Smithʼ Analyse der Geschichte eine wesentliche Rolle, und darin liegt die Gemeinsamkeit mit der Geschichtsphilosophie von Marx. Letzte‐ rer unterstellt jedoch einen ‚starken‘ Determinismus, bei dem nur temporäre Verzö‐ gerungen des Geschichtsprozesses möglich sind.
3. Schlussfolgerung Der Zusammenhang, der sich somit zwischen Smith und Marx offenbart, hat eine grundlegende Bedeutung. Smith geht davon aus, dass die Gesellschaft sich mit den Menschen, so wie sie sind, zum Besseren hin entwickelt. Die gelegentliche Skepsis gegenüber seinem eigenen Optimismus, die vor allem an den Stellen aufkeimt, an denen er sich über den politischen Einfluss von Kapitalisten äußert, ändert nichts da‐ ran, dass die Verwirklichung der liberalen Utopie nicht die Folge einer individuellen Anstrengung der Menschen, sondern Ergebnis von Gesetzmäßigkeiten im menschli‐ chen Verhalten ist. Hierin stimmt Smith mit Marx überein, der den Gedanken jedoch wesentlich radi‐ kaler fasst: Auch bei Marx muss der Mensch die ideale Gesellschaft nicht durch eine eigene willentliche Anstrengung verwirklichen, sondern nur abwarten, dass die öko‐ nomischen Gesetze von allein zur Selbstzerstörung des Kapitalismus und seiner Ur‐ sache, dem Privateigentum an Produktionsmittelns, führen. Wenn (zugespitzt formu‐ liert) das Böse sich selbst vernichtet hat, kann der Mensch das in ihm angelegte Gute schrittweise entfalten – jedoch erst, nachdem in der Diktatur des Proletariats eine in‐ nere Reinigung des Menschen von den Überresten der Prägung durch den Kapitalis‐ mus vollzogen wurde. Mit Smith teilt Marx folglich die Ablehnung der Vorstellung, dass eine gerechte politische Ordnung mindestens eine bewusste, willentliche Mäßigung des Egoismus, wenn nicht gar dessen Überwindung, voraussetzt. Bei Smith wird der Egoismus von innen durch die natürliche Anlage des Menschen zum Mitgefühl und von außen durch den Wettbewerb und die Marktgesetze gemäßigt; bei Marx ist der Egoismus
159
die Folge falscher gesellschaftlicher Verhältnisse und wird mit deren revolutionärer Umgestaltung notwendig verschwinden. Das Vertrauen auf Mechanismen, die den Ausgleich zwischen den Menschen be‐ wirken, ist in dreifacher Hinsicht eine Schwäche des wirtschaftlichen und politi‐ schen Liberalismus, für den Smith exemplarisch steht: •
•
•
Erstens führt die Tatsache, dass der Ausgleich auf Märkten ebenso wie im Sozia‐ len regelmäßig nicht zustande kommt, zu Instabilitäten. Smith selbst beschreibt, wie brutal die Kapitalisten („masters“) sich zuweilen in Arbeitskämpfen gegen‐ über den Arbeitern durchsetzen61 und wie sie im Merkantilismus ihre Privilegien politisch absichern. Die Herausbildung oligarchischer Strukturen in einer libera‐ len Ordnung begründet aber eine Gefahr für deren Legitimationsgrundlage und bewirkt mittel- und langfristig deren Delegitimierung. Zweitens öffnet eine liberale Ordnung, insofern sie sich auf Smith bezieht, der Marxschen Kritik Tür und Tor, weil sie ein Versprechen der Gleichheit impli‐ ziert, das sie nicht einlösen kann. Bei Smith zeigt sich das u. a. daran, dass er in der Einleitung zum WN und bei der Andeutung des Ideals der „commercial so‐ ciety“ die Perspektive eines „Wohlstands für alle“ vermittelt,62 im Kapitel über den Arbeitsmarkt aber schreibt, dass die Arbeiter langfristig nur mit Löhnen in Höhe des Existenzminimums rechnen können. Zudem kann der kritische, mar‐ xistisch orientierte Leser fragen, wie es gerechtfertigt sein kann, dass es in der „commercial society“ offensichtlich eine erhebliche Ungleichheit gibt, wenn die Menschen doch von Geburt alle sehr ähnliche Begabungen haben.63 Diese Wi‐ dersprüche provozieren eine Kritik, wie sie in der Gegenwart von Linksextremis‐ ten gegenüber der wirtschaftlichen und politischen Ordnung der Bundesrepublik vorgebracht wird. Drittens bewirkt die bei Smith angelegte und von Marx radikalisierte Reduktion des Menschen auf die Ökonomie als Gegenreaktion die Reduktion des Menschen auf den reinen Willen, dessen Äußerung der Kampf ist. Diese Gegenposition wurde in der politischen Ideengeschichte mit besonderer Prägnanz von Nietzsche formuliert;64 politisch wird sie in der Gegenwart insbesondere im Rechtsextre‐ mismus vertreten, der – bei allen Differenzen zwischen unterschiedlichen Varian‐ ten – Politik auf einen Überlebenskampf oder auf einen Kampf um Über- und Unterordnung zwischen Völkern bzw. Nationen reduziert. Der Rechtsextremis‐
61 Z. B. Smith WN I.viii.13, S. 58 f. 62 Vgl. zu der Formulierung Erhard 1964. Die Gründerväter der sozialen Marktwirtschaft haben ihre wirtschaftspolitischen Vorstellungen freilich in Abgrenzung vom laissez-faire-Kapitalis‐ mus entwickelt (siehe z. B. Eucken 1990, S. 26-55 sowie Hansen 2018, S. 341 f.). 63 Vgl. dazu Smith WN I.ii.4, S. 18. 64 Vgl. Nietzsche 1988 („Zur Genealogie der Moral“) sowie Kast 2019.
160
mus reagiert damit auf den Ökonomismus sowohl des Liberalismus als auch des Marxismus. Eine freiheitliche Ordnung muss zur Vermeidung solcher Reaktionen, die ihren Be‐ stand dauerhaft gefährden können, zum einen die ökonomistische Reduktion des Menschen vermeiden (die sich aus Smith auch nur ergibt, wenn man ihn einseitig interpretiert), zum anderen darf sie nicht auf die Vorstellung eines automatischen Ausgleichs setzen. Vielmehr ist die Schaffung und Erhaltung einer guten politischen und wirtschaftlichen Ordnung eine Aufgabe, die die Bürger aktiv bewältigen müs‐ sen.65 Das setzt seitens der Bürger eine entsprechende politische Bildung und ein Verantwortungsbewusstsein für die res publica als Ganzes voraus. Will man die Wi‐ dersprüche im politischen und wirtschaftlichen Denken von Smith überwinden, die die Marxsche Reaktion geradezu hervorrufen, dann gelingt dies nur über eine Rück‐ besinnung auf die Verbindung der Politik mit Bildung und Tugend, wie sie in der griechischen Antike vorgedacht wurde.66
Literatur Ballestrem, Karl Graf, 2001: Adam Smith. München. Erhard, Ludwig, 1964: Wohlstand für alle. Bonn (https://www.ludwig-erhard.de/wp-content/u ploads/wohlstand_fuer_alle1.pdf, zuletzt aufgerufen am 22.8.2019). Eucken, Walter, 1990: Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Tübingen. Fay, Margaret A., 1986: Der Einfluss von Adam Smith auf Karl Marx’ Theorie der Entfrem‐ dung: eine Rekonstruktion der ökonomisch-philosophischen Manuskripte aus dem Jahr 1844. Frankfurt am Main. Fitzgibbons, Athol, 1995: Adam Smith’s System of Liberty, Wealth, and Virtue. The Moral and Political Foundations of „The Wealth of Nations“. Oxford. Hansen, Hendrik, 2002: Karl Marx: Humanist oder Vordenker des GULag? In: Ballestrem, Karl Graf/ Gerhardt, Volker/Ottmann, Henning/Thompson, Martyn P. (Hrsg.): Politisches Denken – Jahrbuch 2002. Stuttgart/Weimar, S. 152-174. – 2006 a: Verbände als Speerspitze des Klassenkampfes: Karl Marx (1818 – 1883). In: Se‐ baldt, Martin/Straßner, Alexander (Hrsg.): Klassiker der Verbändeforschung. Theorie und Empirie einer Forschungstradition, Wiesbaden, S. 145-165. – 2006 b: Adam Smith: Der Wohlstand der Nationen. In: Brocker, Manfred (Hrsg.): Geschich‐ te des Politischen Denkens – Ausgewählte Werkanalysen, Frankfurt am Main, S. 318-333. – /Kainz, Peter (2007): Radical Islamism and Totalitarian Ideology: a Comparison of Sayyid Qutb’s Islamism with Marxism and National Socialism. In: Totalitarian Movements and Political Religions Bd. 8 (1), S. 55-76.
65 Vgl. z. B. Eucken 1990, S. 325-368; Hansen 2018, S. 349-351. 66 Vgl. Kraski 2017 a und 2017 b.
161
– 2014: Karl Marx – ein Ideologe? In: Kroll, Frank-Lothar / Zehnpfennig, Barbara (Hrsg.): Ideologie und Verbrechen. Kommunismus und Nationalsozialismus im Vergleich, Mün‐ chen, S. 41-65. – 2018: Walter Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik (1952). In: Brocker, Manfred (Hrsg.): Geschichte des politischen Denkens. Das 20. Jahrhundert, Berlin, S. 338-354. Held, David, 1984: Beyond liberalism and Marxism? In: McLennan, Gregor/Held, David/ Hall, Stuart (Hrsg.): The Idea of the Modern State, Milton Keynes (UK)/Philadelphia. Hollander, Samuel, 1973: The economics of Adam Smith. London usw. Immler, Hans, 1985: Natur in der ökonomischen Theorie. Teil 1: Vorklassik – Klassik – Marx, Teil 2: Naturherrschaft als ökonomische Theorie – Die Physiokraten. Opladen. Kast, Christina, 2019: Friedrich Nietzsches Ja zum Leben. Eine philosophische Interpretation. Würzburg. Kraski, Tim, 2015: Der Klassenkampf bei Adam Smith. Oder: Wie marxistisch ist Adam Smith? In: Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik / EBEN Deutschland e.V. (Hrsg.): Forum Wirtschaftsethik, Ausgabe 2/2015, S. 12-15. – 2017 a: Adam Smith (1723-1790): Das Verhältnis von Politik, Ökonomie und Bildung. In: Gloe, Markus / Oeftering, Tonio (Hrsg.): Politische Bildung meets Politische Theorie, Ba‐ den-Baden, S. 47-61. – 2017 b: „Man kippt oben Eigeninteresse hinein – und schwups, kommt unten Gemeinwohl heraus.“ Zerrbilder in der Adam-Smith-Rezeption und die Frage nach dem Verhältnis von politischer und ökonomischer Bildung. In: Engartner, Tim / Krisanthan, Balasundaram (Hrsg.): Wie viel ökonomische Bildung braucht politische Bildung? Schwalbach/Ts., S. 86-93. Lange, Ernst Michael, 1995: Karl Marx. In: Höffe, Otfried (Hrsg.): Klassiker der Philosophie. Band II: Von Kant bis Sartre. München (3., überarb. Auflage), S. 168-186. Marx, Karl: Aus der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. In: MEW Bd. 1, S. 201-333. – Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. In: MEW Bd. 1, S. 378-391. – Zur Judenfrage. In: MEW Bd. 1, S. 347-377. – Thesen über Feuerbach. In: MEW Bd. 3, S. 533-535. – Manifest der Kommunistischen Partei. In: MEW Bd. 4, S. 459-493. – Zur Kritik der Politischen Ökonomie. In: MEW Bd. 13, S. 3-160. – Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEW Bd. 17, S. 313-365. – Kritik des Gothaer Programms. In: MEW Bd. 19, S. 11-32. – Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. MEW Bd. 23. – Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band. MEW Bd. 25. – Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie nebst einem Anhange (Doktordissertation, Jena 1841). In: MEW Bd. 40, S. 257-373. – Ökonomisch-philosophische Manuskripte. Hrsg. von Zehnpfennig, Barbara. Hamburg, 2005. McCarthy, George E. (Hrsg.), 1992: Marx and Aristotle. Nineteenth-century German Social Theory and Classical Antiquity. Savage (Maryland). Meyer-Faje, Arnold/Ulrich, Peter (Hrsg.), 1991: Der andere Adam Smith. Beiträge zur Neu‐ bestimmung von Ökonomie als Politischer Ökonomie. Bern/Stuttgart.
162
Nietzsche, Friedrich, 1988: Jenseits von Gut und Böse. Zur Genealogie der Moral. Kritische Studienausgabe Bd. 5. München. Raddatz, Fritz J., 1975: Karl Marx. Eine politische Biographie. Hamburg. Recktenwald, Horst Claus (Hrsg.), 1985: Ethik, Wirtschaft und Staat. Adam Smiths politische Ökonomie heute. Darmstadt. Reich, Hermann, 1991: Eigennutz und Kapitalismus. Die Bedeutung des Gewinnstrebens im klassischen ökonomischen Denken. Berlin. Ross, Ian Simpson, 1998: Adam Smith. Leben und Werk. Düsseldorf. Skinner, Andrew S., 1979: A System of Social Science. Papers Relating to Adam Smith. Ox‐ ford. – /Wilson, Thomas (Hrsg.), 1975: Essays on Adam Smith. Begleitband zur „Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith“. Oxford. Smith, Adam, 1976 a: The Theory of Moral Sentiments. Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith. Oxford. Dt.: Die Theorie der ethischen Gefühle. Ham‐ burg, 1994. – 1976 b: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, 2 volumes. Oxford. Dt.: Der Wohlstand der Nationen. München, 1978. – 1978: Lectures on Jurisprudence. Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith. Oxford. Trapp, Manfred, 1987: Adam Smith – politische Philosophie und politische Ökonomie. Göt‐ tingen. Voegelin, Eric, 2000: Science, Politics, and Gnosticism. In: ders.: Modernity without Res‐ traint, The Collected Works of Eric Voegelin, Vol. 5, Columbia, S. 243-313. Waibl, Elmar, 1992: Ökonomie und Ethik. Stuttgart/Bad Cannstatt (3., unveränderte Aufl.). Zehnpfennig, Barbara, 1990: Das Ideal der kommunistischen Gesellschaft – Die Utopie eines vollendeten Humanismus. In: Evangelischen Akademie Bad Boll (Hrsg.): Ist der Sozialis‐ mus am Ende? Karl Marx – wieder gelesen, neu gelesen, Protokolldienst der Evangeli‐ schen Akademie Bad Boll 19, S. 21-35. – 2000: Hitlers „Mein Kampf“. Eine Interpretation. München. – 2005: Einleitung. In: Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte, Hamburg, S. VII-LXXV. – 2009: Essay: Stalin hat den Marxismus nicht allein ruiniert. In: Die Welt, 20. August 2009, S. 7.
163
III. Smith und die Veränderung des Staatsverständnisses in der Globalisierung
Richard Sturn1 Smith und der Wirtschaftsliberalismus der Gegenwart
1. Einleitung Der Wirtschaftsliberalismus der Gegenwart bildet einen vielfältig ausdifferenzierten Komplex von Ideen und Strömungen. Art und Grad dieser Ausdifferenzierung be‐ kommt man in den Blick, wenn man ein dreidimensionales Koordinatensystem in Betracht zieht. Koordinate 1 bezieht sich auf den Grad dessen, was wir etwas salopp „Marktoptimismus“ nennen können. Verkürzt formuliert: Wie „optimistisch“ wird die Leistungsfähigkeit des Marktes bewertet? Genauer gesagt, welche Reichweite wird dem Markt im Hinblick auf seine Eignung zur Vermittlung sozialer Interdepen‐ denzen und als Medium der Koordination im Kontext moderner Arbeitsteilungsdy‐ namik zugeschrieben? Oder von der anderen Seite her betrachtet: Wo (wenn über‐ haupt) werden die Grenzen des Marktes verortet? Kann man „Gott und die Welt“2 durch passende Preissysteme bzw. marktförmige Bewertungen so zueinander in Be‐ ziehung setzen, dass die Wohlfahrt der Menschen optimiert wird – oder gibt es Grenzen des marktförmig Vermittelbaren – und wenn ja, wo liegen sie? Die beiden anderen Koordinaten spiegeln jeweils unterschiedliche Aspekte möglicher nichtmarktförmiger Koordination wider. Sie bilden den Stellenwert expliziter Kollektiv‐ entscheidungen (Koordinate 2) und den Zentralisierungsgrad (Koordinate 3) von Kollektiventscheidungen ab. Mit den Koordinaten 2 und 3 hängen der Grad und die Hintergründe der Politikskepsis (bzw. die Perspektiven hinsichtlich „Staatsversagen“ und der Grenzen des Staats) zusammen, die für manche Wirtschaftsliberale mitunter mindestens so viel wie ihr „Marktoptimismus“ zur Begründung der Vorzugswürdig‐ keit von Marktlösungen beitragen. Vor allem aber sind diese beiden Koordinaten ge‐ eignet, die unterschiedlichen Konzeptionen vergleichend zu verorten, anhand wel‐ cher wirtschaftsliberale Strömungen die institutionellen Voraussetzungen oder Rah‐ menbedingungen marktförmiger Mechanismen thematisieren. Die reiche Ausdiffe‐ renzierung des Spektrums der Varianten des zeitgenössischen Wirtschaftsliberalis‐ mus dürfte viel zu dessen Resilienz als wirkmächtiger politischer Faktor beitragen.
1 Ich danke Hendrik Hansen für wertvolle Anregung und Irene Ploder für Korrekturen. Verbleibende Unzulänglichkeiten gehen zu meinen Lasten. 2 Diesen bemerkenswerten Anspruch formulierte ein mathematischer Finanzmarkt-Ökonom an‐ lässlich eines in Kitzbühel abgehaltenen Privatissimums für Doktoranden der Universität Graz in den 1990er Jahren.
167
Diese Varianten sind kaum aussagekräftig zu verorten, wenn nicht (über den Grad des Marktoptimismus hinaus) die beiden weiteren Koordinaten herangezogen wer‐ den. Die Begriffe Marktradikalismus oder Marktfundamentalismus sind wenig treff‐ sicher und oberflächlich, weil sie keinerlei Hinweise auf eine mögliche Relevanz weiterer Koordinaten enthalten. Analoges gilt auch für Adam Smith, den ja ganze Epochen der nationalökonomischen Dogmengeschichte ganz oberflächlich unter das Rubrum Laisser-faire einordneten. Dabei ist eines festzuhalten: Smiths sozialtheoretisches Räsonnement besitzt einen überaus interessanten und theoriegeschichtlich originellen „marktoptimisti‐ schen“ Kern, der mit dem großen Thema der einleitenden Kapitel von Smiths Wealth of Nations (WN) zusammenhängt – nämlich der Arbeitsteilung. Im Fokus stehen da‐ bei nicht die altbekannten statischen Vorzüge der Arbeitsteilung, sondern ein dyna‐ mischer Prozess der Spezialisierung und Ausdifferenzierung mit kumulativen Verur‐ sachungsketten. Mit starken, geradezu emblematischen Formulierungen werden Tauschprozesse und die „Reichweite des Marktes“ bei Smith als Dreh- und Angel‐ punkt dieser Dynamik charakterisiert: Die gesellschaftliche Arbeitsteilung ermög‐ licht den Wandel einzelwirtschaftlicher Produktionsprozesse und Organisationsfor‐ men mit Folgewirkungen wie Routinisierung und Maschinisierung3 und findet eine Grenze nur im „extent of the market“4; eines Marktes, der die von der Arbeitsteilung bedingten Interdependenzen tauschförmig vermittelt. Mehr noch: Weil die Perspekti‐ ve tauschförmiger Vermittlung den Akteuren präsent ist, stellt sie ein dynamisieren‐ des Element im Gesamtprozess dar. Menschen lassen sich auf Spezialisierungspro‐ zesse ein, weil sie auf marktförmige Tauschnetzwerke bauen können. Der Markt hängt somit auf komplexe Weise mit der ungeplanten und unplanbaren gesellschaft‐ lichen Arbeitsteilungsdynamik der Moderne zusammen, unter deren Triebkräften das Eigeninteresse der wirtschaftlichen Akteure eine zentrale Rolle spielt. Dem Markt wird bei Smith eine Eigendynamik zugeschrieben, die sich von den ursprünglichen Intentionen der Akteure löst. Diese Eigendynamik birgt Risiken, wie Smith sehr wohl bewusst ist,5 aber in den einleitenden Abschnitten des Wealth be‐ tont Smith vor allem die Chancen, die sich aus dieser Entwicklung ergeben. Und diese Dynamik ist es, die den theoretischen Hintergrund für den libertären Schwung Smithscher Rhetorik bildet, der ihn zur Leitfigur des Wirtschaftsliberalismus und zur Integrationsfigur seiner unterschiedlichen, teils auch disparaten Strömungen macht. Marktoptimistische Parolen, die ihres prozesstheoretischen, dynamischen, aber auch reflexiven Hintergrunds entkleidet waren und Smiths (von seinem ersten Bio‐ graphen Dugald Stewart in seinem Account of the Life and Writings of Adam Smith, LL.D., EPS S. 265ff zurecht gerühmten) „qualified conclusions“ vergessen ließen, 3 Vgl. Smith WN, I.ii. 4 Smith WN, I.iii. 5 Vgl. Smith WN, V.
168
bestimmten weithin die Smith-Rezeption, zumal im 19. Jahrhundert. Dies betrifft nicht nur die Apologeten von Laisser-faire, bei denen die ideologische Überhöhung der segensreichen invisible hand mitunter bizarre Blüten trieb (vgl. beispielsweise Kurz/Sturn 2013,: S. 7),6 sondern auch Kritiker etwa aus interventionsfreundlicheren Strömungen der Historischen Schule. Schon Jacob Viner (1927) zeigte indes, dass Smith auch über die grundlegenden Ordnungsfunktionen des Staates (Durchsetzung von Privateigentum und Vertragsrecht sowie Landesverteidigung) hinaus für relativ viele Bereiche die Vorteilhaftigkeit öffentlicher Regulierung (etwa am Kapitalmarkt) und teilweise auch staatliche Finanzierung von Leistungen (etwa im Bildungsbe‐ reich) betonte. Zudem problematisierte er Machtasymmetrien am Arbeitsmarkt und befürwortete eine Modifikation einschlägiger Normen, welche die Verhandlungspo‐ sition der Arbeiter verbessern würde. Sieht man die emblematischen „marktoptimis‐ tischen“ Formulierungen Smiths zusammen mit ihrem prozesstheoretischen Kern, dann besteht im Dualismus von Marktoptimismus und der Betonung unabweisbarer politischer Gestaltungsaufgaben nicht notwendigerweise ein Widerspruch oder eine Inkonsistenz. Im Gegenteil: Gute Sozialtheorie wird bemüht sein, die möglichen Funktionen, Koordinationsleistungen und Grenzen des Marktes möglichst prägnant herauszuarbeiten, aber gleichzeitig auch die Formen, Funktionen und Grenzen von Regulierung7 und nicht-marktförmigen Institutionen und deren mögliche Weiterent‐ wicklung im Blick zu behalten. Ein besonders schwieriger Aspekt dieser Thematik betrifft die Frage, inwiefern der Marktliberalismus selbst als politisches Projekt verstanden wird bzw. unter wel‐ chen Prämissen und mit welchen Implikationen er so behandelt werden kann, als ob er Ausdruck des natürlichen Laufs der Dinge sei. Smiths Aussagen zum system of natural liberty sind gelegentlich so interpretiert worden, als ob die liberale Ordnung nicht der pro-aktiven Gestaltung staatsförmiger Institutionen bedürfte. Sieht man diese Aussagen zusammen mit seinen Ausführungen über improvements, dann ergibt sich jedoch eher ein Katalog von Aufgaben, Regeln und Grenzen politischer Gestal‐ tung, welcher eine anstehende Transformation der politisch-wirtschaftlichen Ord‐ nung im Sinne des system of natural liberty anleitet. Der Beitrag ist wie folgt gegliedert: Nach der Einleitung (1.) wird im 2. Abschnitt das angekündigte dreidimensionale Koordinatensystem zur Verortung unterschiedli‐ cher Strömungen des Wirtschaftsliberalismus entfaltet. Erste Ansätze einer verglei‐ 6 Vgl. beispielsweise Kurz/Sturn 2013, S. 7. 7 Vgl. dazu Benthams kritischen Kommentar zu Smiths Position zur Finanzmarktregulierung (Corr. App. C). Dieser ist insofern interessant, als Bentham Smiths mikroökonomisch begründe‐ te Argumentation für Finanzmarktregulierung anscheinend nicht versteht und daher die Rolle des liberalen Deregulierungsökonomen spielt, obwohl er im Allgemeinen viel weniger skeptisch gegenüber der Möglichkeit einer unmittelbaren politischen Umsetzung seiner weitgehenden uti‐ litaristisch fundierten Reformpläne ist, als Smith es wäre. Man könnte dies wir folgt zusammen‐ fassen: Smith entwickelte im Vergleich zu Bentham sowohl in puncto „Marktversagen“ als auch in puncto „Staatsversagen“ das schärfere theoretische Sensorium.
169
chenden Verortung werden skizziert. In den weiteren Abschnitten wird zunächst je‐ weils die Smithsche Position etwas genauer dargestellt und im Anschluss gefragt, in‐ wieweit und in welcher Weise diese Position von „neoliberalen“8 Strömungen aufge‐ griffen wird bzw. wo markante Differenzen bestehen. Wir beginnen mit jenen Rudi‐ menten, aus denen man die Grundperspektiven der (nicht ausgeführten) Smithschen Staatstheorie erschließen kann. Auf dieser Ebene ergeben sich gewisse Parallelen am ehesten zum Ordoliberalismus, wobei jedoch ein direkter Einfluss Smiths äußerst unwahrscheinlich ist, denn die Smith-Rezeption der deutschsprachigen Ökonomik war lange Zeit relativ eng (Abschnitt 3). In Abschnitt 4 ist jener Prozess der Trans‐ formation von Staatlichkeit zu beleuchten, der mit Smiths bekannter Merkantilis‐ mus-Kritik verbunden ist. Gerade hierbei stellt sich die Frage: Inwiefern sind neuere wirtschaftsliberale Perspektiven des market making mit der Transformation von Staatlichkeit à la Smith (zur Überwindung der merkantilistischen Privilegienwirt‐ schaft) vergleichbar? In Abschnitt 5 gehen wir darauf ein, wie Smith in diesem Kon‐ text die Lehre von den Staatsauf- und -ausgaben sowie finanzwissenschaftliche Per‐ spektiven auf die Staatseinnahmen entfaltet. Diese Perspektive wird von einer be‐ deutenden und breit gefächerten Strömung des ökonomischen Liberalismus aufge‐ griffen, die unter Ökonomen bzw. Finanzwissenschaftlern verbreitet ist. In Ab‐ schnitt 6 werden weitere Aspekte der Politischen Ökonomik diskutiert. Abschnitt 7 fasst einige Punkte mit Blick auf kontroverse Smith-Interpretationen zusammen.
2. Drei Koordinaten zur Verortung wirtschaftsliberaler Positionen Als Koordinate 1 bezeichnen wir (wie eingangs angedeutet) den Grad des „Marktop‐ timismus“. Dieser kann unterschiedliche theoretische Hintergründe haben (statischallokationstheoretische oder dynamisch-prozesstheoretische), deren genauere Aus‐ führung hier nicht erforderlich ist. Um die unterschiedlichen Ausprägungen nichtmarktförmiger Koordination als Hintergrundfolie für die Verortungen unterschiedli‐ cher Spielarten des Liberalismus in den Blick zu bekommen, ist es notwendig, den funktionalen Kern nicht-marktförmiger Koordination zu erfassen. Dabei handelt es 8 „Neoliberalismus“ ist ein schillernder Begriff. Neoliberalismus im ideengeschichtlich engeren Sinn ist eine in den 1930er Jahren v.a. in Frankreich und Deutschland (z.B. von Pierre Flandin und Alexander Rüstow) vorgeschlagene Bezeichnung für das Projekt einer „Renovation des Li‐ beralismus“, die sich dezidiert vom „Manchester-Liberalismus“ des 19. Jahrhunderts durch einen problembezogen-aktiven politischen Ansatz unterscheiden wollte und 1938 in der ein‐ drucksvollen internationalen Zusammenkunft des Pariser „Colloque Walter Lippmann“ ange‐ sichts von Krise und Kriegsgefahr eine „Agenda des Liberalismus“ lancierte. Heute bezieht sich „Neoliberalismus“ jedoch sowohl im politischen Diskurs wie auch in der Neoliberalismus-For‐ schung auf ein sehr breites Spektrum von Tendenzen, die von Formen des Marktfundamentalis‐ mus (die durchaus quer zum Projekt des Neoliberalismus von 1938 liegen) zu verschiedenen Mainstream-Ausprägungen von Wirtschaftsliberalismus reichen.
170
sich um jene Koordinationsprobleme und sozialen Dilemma-Strukturen, die aus‐ schließlich oder am besten mittels kollektiver Institutionen „gelöst“ werden können. Der funktionale Kern nicht-marktförmiger Koordination bezieht sich nach dieser Lo‐ gik auf jene Felder bzw. Ebenen des sozialen Lebens, in denen aus technischen bzw. logischen Gründen für alle Mitglieder eines Kollektivs nur ein einziges kollektiv verbindliches Arrangement existieren kann. Die Ökonomen fassen solche Fälle mit dem Begriff des „öffentlichen Gutes“ zusammen. Im Hinblick auf solche „öffentli‐ chen Güter“ ist es technisch bzw. logisch unmöglich, Outcomes nach Menge bzw. Qualität in ähnlicher Weise zu individualisieren, wie dies bei privaten Gütern durch individuelle Kaufentscheidungen der Fall ist. Bei privaten Gütern kann ich je nach meinen Vorlieben und Bedürfnissen viel, wenig oder gar nichts kaufen. Bei öffentli‐ chen Gütern „nutzen“ alle nolens volens dieselbe Menge/Qualität, die (als Outcome welcher Entscheidungsprozesse auch immer) bereitsteht. Dies trifft etwa auf öffentli‐ che Umweltgüter wie die Luftqualität in einem urbanen Großraum zu, auf Arrange‐ ments zur Landesverteidigung oder Seuchenprävention, aber auch auf zentrale ord‐ nungspolitische Weichenstellungen: Es ist in einem integrierten politischen Gebilde schwerlich möglich, gleichzeitig eine monarchische und eine republikanische Ver‐ fassung zu realisieren, oder zugleich eine laxe und eine scharfe Wettbewerbspolitik, oder die Zulassung und das Verbot von Sklaverei. Auch die rule of law ist in diesem Sinn unteilbar. Sie wird kompromittiert, wenn ein Regime in Richtung der von Smith verdammten Privilegienwirtschaft degeneriert, in der irgendwelchen Günstlin‐ gen gleichsam auf Zuruf Monopolpositionen zugeschanzt werden, wohingegen an‐ dere Marktteilnehmer bei Strafe des Untergangs der unbarmherzigen Wettbewerbs‐ logik ausgesetzt sind. In diesem Sinne handelt es sich bei Entscheidungen über sol‐ che Gegenstandsbereiche in einem technischen Sinn immer um „Kollektiventschei‐ dungen“, und zwar unabhängig davon, ob und inwiefern die entsprechenden Ent‐ scheidungsprozesse „demokratischen“ Ansprüchen genügen. Das Spektrum von un‐ terschiedlichen Formen dieser Entscheidungsprozesse reicht von expliziten (vor‐ zugsweise demokratischen) Kollektiventscheidungen zu rein impliziten Kollektiv‐ entscheidungen. Implizite Kollektiventscheidungen liegen etwa vor, wenn spontan entstandene Normen und Institutionen bzw. tradierte Autoritäten eine große Rolle spielen. In diesem Sinne reflektiert Koordinate 2 die Bedeutung expliziter vs. impli‐ ziter Kollektiventscheidung. Politikskepsis geht typischerweise einher mit der Beto‐ nung von Defiziten expliziter Kollektiventscheidungs-Mechanismen, zum Teil aber auch mit einer emphatischen Sicht impliziter Kollektiventscheidungen, wie sie etwa in Friedrich Hayeks überhöhenden Perspektive auf spontane Ordnungen oder Lud‐ wig Mises‘ These zur überlegenen demokratischen Qualität marktförmiger Abstim‐ mungsprozesse souveräner Konsumenten zum Ausdruck kommt. Eine kritische Sicht allzu rationalistischer Perspektiven kann aber auch mit der Betonung der Vorzüge von Dezentralisierung verbunden sein. Diese kommt durch‐
171
aus als Gegenmittel gegen die Probleme expliziter Kollektiventscheidungen in Fra‐ ge: einerseits, weil kleinere Einheiten weniger heterogen sein werden (bestimmte Formen von Heterogenität machen rationale, konsistente Kollektiventscheidungen weniger wahrscheinlich und beeinträchtigen in diesem Sinn die Leistungsfähigkeit demokratischer Mechanismen); andererseits, weil kleinere Einheiten eine Art „Wett‐ bewerb als Entdeckungsverfahren“ für unterschiedliche Problemlösungen ermögli‐ chen. Somit ist es nachvollziehbar, dass es unterschiedliche Vorstellungen über den wünschenswerten Zentralisierungsgrad kollektiver Institutionen gibt: Während man‐ chen Liberalen ein dezentral organisierter bzw. funktional ausdifferenzierter, jeden‐ falls aber reich gegliederter Komplex kollektiver Institutionen unterschiedlicher Reichweite und unterschiedlicher Genese vorschwebt (Varianten ökonomisch-mo‐ delltheoretischer Ausformulierungen finden sich bei Elinor Ostrom und Charles Tie‐ bout), existieren innerhalb des Liberalismus durchaus auch vergleichsweise zentra‐ listische Traditionen, welche liberale Modernisierungsprozesse bzw. Deregulierung im Kontext der Überwindung von Partikularismen sehen. So war auch der marktli‐ berale Umbau Großbritanniens unter Thatcher von stark zentralistischen Zügen durchsetzt. Koordinate 3 ordnet also unterschiedliche Auffassungen im Hinblick auf den zweckmäßigen bzw. wünschenswerten Dezentralisierungsgrad kollektiver Insti‐ tutionen. Insgesamt kann man die im 20. Jahrhundert entwickelten Varianten des Wirt‐ schaftsliberalismus als Cluster von Positionen in ganz unterschiedlichen Regionen des so entstehenden dreidimensionalen Koordinatensystems darstellen. Gemeinsa‐ mer Nenner ist einzig und allein, dass in allen Varianten dem Markt eine bedeutende Rolle als Koordinations- und Allokationsmechanismus zukommt. Neben Vertretern, deren Marktoptimismus die Voraussetzungen für einen fließenden Übergang zum Marktanarchismus bietet, gab und gibt es auch gerade unter liberalen Ökonomen eine starke Gruppe, deren Marktversagenstheorie sie zu dezidierten Vertretern der gemischten Wirtschaft macht. Der Staat funktioniert in diesem Kontext als Maschi‐ nerie zur Stabilisierung bzw. zur Umsetzung einer liberal-individualistisch ausbuch‐ stabierten Allokationseffizienz im Öffentlichen Sektor.9 Prominente Vertreter dieser Richtung sind Kenneth Arrow, Lujo Brentano, John Maynard Keynes, Richard Mus‐ grave, Arthur C. Pigou, Paul Samuelson, Abba Lerner10 und Joseph Stiglitz. Maria‐ na Mazzucato (2013) ergänzt die modernen Staatsfunktionen in dynamischer Rich‐ tung der pro-aktiven Gestaltung von Wandel. All diese Ansätze stehen in der pro‐ gressiv-aufklärerischen Tradition expliziter demokratischer Kollektiventscheidun‐ gen. Sie unterscheiden sich jedoch in ihren „Dezentralisierungsvorstellungen“. Zur politischen Dezentralisierung gehören auch, aber nicht nur, föderale Strukturen. So entwickelten beispielsweise Keynes und Lujo Brentano eine Affinität zur Dezentra‐ 9 Vgl. Foley 1967. 10 Vgl. programmatisch u.a. Lerner 1972.
172
lisierung nicht so sehr im Sinne des Föderalismus, sondern einer Auslagerung be‐ stimmter öffentlicher Aufgaben in intermediäre Verbände öffentlichen Rechts („zwi‐ schen Markt und Staat“). Unter den in der Mont Pèlerin-Gesellschaft versammelten (in sich sehr heterogenen) wirtschaftsliberalen Strömungen sind im Hinblick auf ihre Dezentralisierungsvorstellungen am ehesten Teile der deutschen Ordoliberalen ähn‐ lich zu verorten. Allerdings sind letztere etwas skeptischer im Hinblick auf die wün‐ schenswerte Reichweite der Agenda, die im Wege expliziter Kollektiventscheidun‐ gen bearbeitet werden. In besonders pointierter Form kommt dies bei Ordoliberalen wie Wilhelm Röpke zum Ausdruck, der in kleineren, intermediären Sozialgebilden bis hin zur Stärkung der ökonomischen Basis von Familien die Lösung für die Risi‐ ken und Entwurzelungstendenzen des modernen Kapitalismus sieht, also stark in Richtung tradierter, spontan gewachsener, eher kleinteiliger Institutionen tendiert. Die Rolle von spontan entstandenen Institutionen wird bei Friedrich August Hayek besonders betont, der seine Planwirtschafts- und Interventionismuskritik der 1930er Jahre zu einer allgemeineren Kritik des arrogant-technokratischen Rationa‐ lismus und „falschen“ Individualismus weiterentwickelte, welche in Unterschätzung der Komplexität moderner Gesellschaften zu ökonomisch verfehltem und freiheits‐ zerstörendem „Konstruktivismus“ führe. Letzterer beruhe auf dem Fehlschluss, die Einsichten der Sozialwissenschaften über die Funktionsweise von Gesellschaften würden es ermöglichen, Institutionen nach demokratischen oder anderweitig norma‐ tiven Vorgaben völlig neu zu gestalten. Zur Abrundung dieses Bildes ist schließlich noch der autoritäre Liberalismus ein‐ zuordnen (um einen von Hermann Heller 1933 vorgeschlagenen Terminus zu ver‐ wenden). Motive aus dieser Richtung sind unter manchen Strömungen des Wirt‐ schaftsliberalismus (auch solchen, die in der Mont Pèlerin Gesellschaft vertreten sind) in unterschiedlichen Akzentuierungen bis zu einem gewissen Grad akzeptiert. Dies beruht in erster Linie auf einer Skepsis gegenüber den Eigenschaften demokra‐ tischer Kollektiventscheidungsmechanismen, denen eine Tendenz zur Relativierung von Eckpfeilern der liberalen Ordnung zugeschrieben wird. Eine starke und eigen‐ ständige Rolle intermediärer Verbände und dezentraler Strukturen steht ebenfalls eher in einem Spannungsverhältnis zum autoritären Liberalismus, der die Kombina‐ tion: „freie Wirtschaft – starker Staat“ auf seine Fahnen schreibt. Der starke Staat muss ein schlanker Staat sein. Und er darf Partikularismen aller Art keinen Platz ge‐ ben. Nach diesem kurzen Tour d’Horizon durch jene Koordinaten, die unterschiedliche Strömungen des Wirtschaftsliberalismus in ihrem Verhältnis zu Markt, Staat, Demo‐ kratie, der Gliederung öffentlicher Institutionen und der Rolle intermediären Institu‐ tion verorten, halten wir fest: Aus einer Doktrin, die ein breites Spektrum von Marktversagen und Marktunvoll‐ kommenheiten kennt, ist noch nicht unmittelbar ein entsprechend breites Spektrum
173
von Staatsaufgaben auf der Basis expliziter politischer Kollektiventscheidungen ab‐ zuleiten. Vielmehr tun sich in den unterschiedlichen liberalen Strömungen intellek‐ tuelle Ressourcen auf, die diverse Vorbehalte gegenüber gerade auch typisch moder‐ nen Formen von Staat und Politik nahelegen, sei es wegen der inhärenten Probleme der politischen Mechanismen expliziter Kollektiventscheidungen, sei es wegen der Vorzugswürdigkeit alternativer nicht-marktförmiger Institutionen „jenseits von Markt und Staat“. Sowohl die Rolle des Marktes als auch das Profil nicht-marktför‐ miger Institutionen und speziell des Staats ist jedenfalls nur auf der Basis aller drei hier explizierten Koordinaten zu verorten – und nicht etwa nur aufgrund der Achse des „Marktoptimismus“. Denn durch die einseitige Fixierung auf den Markt bzw. eine Markt-Staat (bzw. market-government)-Dichotomie wird nicht-marktförmige Koordination oft als black box behandelt. Dazu tendieren nicht zuletzt jene Perspek‐ tiven, die von der ökonomischen Theorie des Marktversagens inspiriert sind. Wie passt nun Adam Smith in dieses Bild? Er ist gewiss nicht an einem der Eck‐ punkte des einleitend aufgespannten dreidimensionalen Koordinatensystems zu ver‐ orten – und auch nicht an einem der Extrempunkte einer der drei Koordinaten. Ganz klar und weithin bekannt ist dies im Hinblick auf den Grad seines Marktoptimismus: Smith war trotz seiner prägnanten Formulierungen zum system of natural liberty al‐ les andere als ein Marktanarchist oder Marktfundamentalist, sondern schrieb sowohl staatsförmigen als auch nicht-marktförmigen Institutionen im sozialen Nahbereich (wie der Familie) wichtige Funktionen zu. Er sah die Entstehung der Voraussetzun‐ gen der modernen Marktwirtschaft als komplexen Prozess, in dem (i) spontane Ele‐ mente, (ii) eine teils durch geänderte ökonomische Rahmenbedingung konditionierte Transformation von Staatlichkeit und (iii) politische Gestaltung von improvements ineinanderwirken und in diesem Zusammenwirken die Qualität der marktförmigen Ordnung des system of natural liberty bestimmen. Smith war überdies gleichzeitig Gleichgewichtstheoretiker und Prozesstheoretiker. Nicht nur in seiner Preistheorie, sondern auch in seiner Moraltheorie und seiner conjectural history institutionellen Wandels bzw. seinen Ansätzen zur Erklärung unterschiedlicher Normen11 spielen komparativ-statische Gleichgewichtsüberlegungen eine große Rolle im Hinblick auf seinen Anspruch, sozio-ökonomische Wechselwirkungen trotz ihrer Komplexität und vielfältigen Kontingenzen „theoriefähig“ zu machen. Diese Gleichgewichtsme‐ thodik wird indes bei Smith an keiner Stelle dazu verwendet, das Modell einer span‐ nungsfreien Moderne zu konstruieren. Der Prozess der Arbeitsteilung und Speziali‐ sierung erzeugt vielmehr neue Herausforderungen, die neue Aufgaben und Funktio‐ nen für öffentliche Institutionen mit sich bringen (vgl. dazu unten Abschnitt 5). 11 So werden sich gemäß Smith in einem Land mit dichten kommerziellen Beziehungsnetzen wie Holland im Gleichgewicht bessere Ehrlichkeits-Normen durchsetzen als in einem Land mit dünnem kommerziellem Verkehr, wie in den Lectures on Jurisprudence (Smith 1978, S. 538-539) ausgeführt wird.
174
Die bedeutendsten Unterschiede zwischen Smith und mehreren Varianten des Wirtschaftsliberalismus der Gegenwart sind wohl in einem Bereich zu finden, der die langfristige Perspektive der Marktgesellschaft betrifft: Liberale Strömungen fol‐ gen oft (mehr oder minder explizit) der Idealvorstellung, man sollte durch resolute Reformen geeignete Spielregeln schaffen, die dann ein für alle Mal den Staat von weiteren diffizilen und konfliktträchtigen Aufgaben entlasteten.12 Entweder ist dies mit einem Modell einer weitgehend spannungsfreien Moderne verbunden (v.a. bei Liberalen wie jenen der Chicago-Schule, die stark im ökonomischen Gleichge‐ wichtsdenken verwurzelt sind) – oder wie bei Hayek mit der Vorstellung, gewisse Spannungen blieben zwar bestehen, aber der Mensch der Moderne müsse eben ler‐ nen, mit solchen Spannungen umzugehen. Im Hinblick auf die Wahrnehmung der krisenanfälligen Dynamik der Moderne (insbesondere auch des Prozesses der Ar‐ beitsteilung, Spezialisierung, Maschinisierung und Urbanisierung) als spannungsvol‐ ler Prozess kommen indes einige französische Teilnehmer des Colloque Walter Lippmann, Walter Lippmann selbst, sowie der deutsche Ordoliberalismus mit seinen kulturkritischen Tendenzen Smith nahe: Bei Ordoliberalen wie Rüstow und Röpke (1942) wird eine „Gesellschaftskrisis der Gegenwart“ diagnostiziert. Diese Krisis ist in den Grundlagen der modernen Marktgesellschaft angelegt und nicht etwa durch operative Entfernung sekundärer Auswüchse nachhaltig zu beseitigen. Marktwettbe‐ werb droht ständig zu degenerieren, ist er doch für Röpke ein „Moralzehrer“: Die Wettbewerbs-Ordnungspolitik ist daher dauernde Aufgabe und bedarf bei Rüstow (sinngemäß auch bei Röpke) der Ergänzung durch eine „Vitalpolitik“, welche für die ansonsten besonders in den Krisen der Moderne gefährdete sozio-kulturelle Repro‐ duktion jener Zivilisation zu sorgen hat, welche die Marktwirtschaft trägt.13 Dezi‐ diert nicht-marktförmige Gestaltungen (die bei Röpke plastisch ausgeführt werden und in ihrer Konkretisierung und auch Politisierung deutlich über Smiths Hinweise auf die Bedeutung des sozialen Nahbereichs hinausgehen) sind als Antwort auf der‐ artige Herausforderungen unentbehrlich.
3. Staatstheorie bei Smith und im Wirtschaftsliberalismus: das Verhältnis von Staat und Eigentum Die Bedeutung mannigfacher Formen nicht-marktförmiger Institutionen bei Adam Smith sollte indes nicht den Blick darauf verstellen, dass der Staat bzw. „govern‐ ment“ eine besondere Rolle einnimmt. Adam Smith14 schrieb am 1. November 1785 an den Duc de la Rochefoucauld, er habe „a sort of theory and history of Law and 12 Vgl. dazu auch Lerner 1972. 13 Vgl. Sturn 2016. 14 Smith Corr, S. 286.
175
Government“ auf dem Amboss. Das einschlägige Material sei schon größtenteils ge‐ sammelt, und Teile des Manuskripts seien in „tolerably good condition“. Bedauerli‐ cherweise fielen diese dennoch der Vernichtungsaktion anheim, welche die nicht pu‐ blizierten Werke Smiths (mit Ausnahme der postum publizierten Essays on Philoso‐ phical Subjects, also im Wesentlichen der History of Astronomy15); der Nachwelt entzog. Rückschlüsse auf Smiths Verständnis von Staat und Politik sind deswegen vor allem aus drei Quellen zu erlangen. Erstens aus seinen Ausführungen über den „statesman“ bzw. den „legislator“, die schon in der Theory of Moral Sentiments (TMS) einen beachtlichen Platz einnehmen. Zweitens aus seiner Abhandlung über Staatsaufgaben („duties of the sovereign“) und Steuerprinzipien im V. Buch des Wealth of Nations (WN), sowie drittens aus den grundlegenden Überlegungen, die er vor allem in den Lectures on Jurisprudence (LJ) anstellt. Zunächst wollen wir unsere Aufmerksamkeit auf Smiths in den Lectures skizzier‐ te alternative Erklärung des Staats lenken, für welche Ungleichheiten in Besitz und Eigentum eine wichtige Rolle spielen. Dies impliziert eine Zurückweisung einer Kontrakttheorie des Staats à la Hobbes, wobei freilich eine Auseinandersetzung nur andeutungsweise stattfindet. Hier tut sich ein beachtenswerter Gegensatz im Hin‐ blick auf eine in der sozio-ökonomischen Theoriebildung immer wieder theoriestra‐ tegisch bedeutsame Annahme auf, nämlich in Hinblick auf das, was Joseph Schum‐ peter „analytische Gleichheit“ nennt: Auf der übergeordneten Ebene der Theorie so‐ zio-ökonomischer Entwicklung nimmt Smith analytische Gleichheit an: Ungleich‐ heit ist ein endogener Effekt der sozio-ökonomischen Entwicklung. Smith geht also in seiner Prozesstheorie der Arbeitsteilung von der Annahme der (Quasi-)Gleichheit der Menschen aus. Von ihren natürlichen Anlagen her unterscheiden sich laut Smith der Philosoph und der Lastenträger nicht allzu sehr, sondern ihre unterschiedlichen Fähigkeiten sind im wesentlichen Resultat ungeplanter gesellschaftlicher Speziali‐ sierungsprozesse. Indes betont er für eine spezifische Entwicklungsphase den Zu‐ sammenhang der Herausbildung des Staats und historisch gewachsener Ungleich‐ heit. Insbesondere ist dies in Zusammenhang mit den Implikationen zu sehen, die die LJ für die immer noch umstrittene Frage aufwerfen, wie Smith das Verhältnis von Privatwirtschaft und öffentlicher Ordnung sieht. Ein auf den ersten Blick unspekta‐ kulärer Unterschied in der Anordnung des Inhalts zwischen den beiden Versionen A und B führt zum Interessantesten, was die LJ im Hinblick auf die Schlüsselfrage zu bieten haben: In welchem Verhältnis stehen die Institutionen von Privateigentum, Markt und Staat zueinander? In LJ (B, 11) findet sich hierzu eine entscheidende Stelle: Eigentum und government hängen in hohem Maß wechselseitig voneinander ab, sagt Smith. Und weiter: „the state of property must always vary with the form of
15 Vgl. Smith EPS.
176
government“. In diesem Zusammenhang räsoniert er über die angemessene Struktur einer Rechts- und Staatstheorie: Die civilians (kontinentaleuropäische Rechtstheore‐ tiker) begännen ihre Darstellung mit dem Staat und behandelten im Anschluss das Eigentum und andere Rechte. „Andere“ (dazu gehören u.a. Hutcheson und wohl auch Smith selbst in früheren Versionen der Lectures) gingen umgekehrt vor. Alles in allem sei die von den civilians gewählte Struktur vorzuziehen.16 Dies alles ist deshalb interessant, weil es eine bemerkenswerte Entwicklung in Smiths Denken im Hinblick auf die Basisinstitutionen moderner Gesellschaften er‐ kennen lässt: Smiths Überlegungen entwickeln sich quer zu zwei wichtigen briti‐ schen Traditionen und offenbaren seine Sicht der Beziehung zwischen öffentlichem und privatem Sektor in modernen Gesellschaften. Jene britischen Traditionen sind stark durch Konzepte geprägt, in welchen diese Beziehung im Wesentlichen jeweils eine Richtung aufweist: Bei Locke ist der Staat im Prinzip nur ein Instrument zur besseren Durchsetzung privater Eigentumsrechte, deren Inhalt und Reichweite unab‐ hängig von Politik und Staat bestimmt werden. Bei Hobbes hingegen sind private Eigentumsrechte ein Instrument zur besseren Umsetzung einer politischen Aufgabe, nämlich der Friedenssicherung in der Gesellschaft. Smiths Idee der Interdependenz von Staat und Eigentum – das Grundmotiv erinnert an entsprechende Überlegungen Kants – steht in Zusammenhang mit jenen Stellen im WN V, wo Smith dem öffentli‐ chen Sektor eine integrative Rolle im Kontext einer durch Märkte und Preise vermit‐ telten Arbeitsteilungsdynamik zuweist. Die sich wandelnde funktionale Rolle des Staats ist systematisches Ergebnis von Prozessen, denen jene Interdependenz zu Grunde liegt. Smiths Überlegungen zu Staat und Recht in den LJ (B) erinnern an Vorstellungen von der funktionalen Komplementarität von Markt und öffentlichen Institutionen im Entwicklungsprozess, wie sie sonst eher in kontinentaleuropäischen Traditionen zu finden sind.17 Parallelen ergeben sich folglich am ehesten zu jenen Vertretern des Ordoliberalismus, welche die „Interdependenz der Ordnungen“ hochhalten. Eine spezifisch politikrelevante Schnittstelle zwischen Smith und dem Ordoliberalismus ergibt sich dabei, wie schon angedeutet, im Hinblick auf das Machtproblem im Ka‐ pitalismus. Der Ordoliberalismus gehört (wie auch die meisten marktliberalen Ver‐ treter einer gemischten Wirtschaft) zu den Befürwortern einer pro-aktiven Wettbe‐ 16 „That a person has a right to have his body free from injury, and his liberty free from infringe‐ ment unless there be a proper cause, no body doubts. But acquired rights such as property re‐ quire more explanation. Property and civil government very much depend on one another. The preservation of property and the inequality of possession first formed it, and the state of pro‐ perty must always vary with the form of government. The civilians begin with considering go‐ vernment and then treat of property and other rights. Others who have written on this subject begin with the latter and then consider family and civil government. There are several advanta‐ ges peculiar to each of these methods, tho’ that of the civil law seems upon the whole prefera‐ ble.“ (Smith, Lectures on Jurisprudence (B), Pt 1,11.) 17 Vgl. Sturn 2006; 2010.
177
werbspolitik als dauernde Aufgabe, welche sowohl im Wirtschaftsliberalismus der Chicago-Schule im Anschluss an Ökonomen wie Milton Friedman und Arnold Har‐ berger wie auch von der vor allem in den USA wirkenden Austrian School of Econo‐ mics bekämpft wird. Spiegelbildlich dazu verhalten sich die Auffassungen zur Rolle des Privateigentums: Für die beiden letztgenannten Traditionen ist das Privateigen‐ tum der vorpolitische, natürliche und unverrückbare Ausgangspunkt der marktwirt‐ schaftlichen Ordnungen (Wettbewerbspolitik kompromittiert Privateigentum, weil es die eigentumsrechtliche Dispositionsfreiheit von Monopolisten und Oligopolisten einschränkt), wohingegen die obigen Smith-Passagen institutionelle und ökonomi‐ sche Kontingenzen betonen, welche die Konkretisierung eigentumsrechtlicher Ver‐ fügungsansprüche immer beeinflussen. Man könnte auch sagen: Smith, die Ordoli‐ beralen und die oben erwähnten Ökonomen im Mainstream der MarktversagensTheorie sind eher Wettbewerbs-Liberale, wohingegen die ebenfalls erwähnte Chica‐ go-Tradition und die Austrians Privateigentums-Liberale sind.
4. Die Theorie der Transformation der Staatlichkeit: Entwicklung des Verhältnisses von Politik und Markt Bevor wir darauf eingehen, wie in diesem Kontext die Lehre von den Staatsauf- und ‑ausgaben wie auch finanzwissenschaftliche Perspektiven auf die Staatseinnahmen entfaltet werden, ist jener Prozess der Transformation von Staatlichkeit zu beleuch‐ ten, der eng mit Smiths bekannter Merkantilismus-Kritik verbunden ist. Die Frage hierbei ist: Inwiefern sind wirtschaftsliberale Perspektiven des market making mit jener Transformation von Staatlichkeit à la Smith vergleichbar, die die Überwindung des Merkantilsystems im Blick hat und in deren Rahmen er der Politischen Ökono‐ mie als „science of the legislator“ eine wesentliche Rolle zuweist? „To enlighten and reform the commercial policy of Europe“ sei Smiths Bestimmung gewesen, schreibt Dugald Stewart in seinem Account of the Life and Writings of Adam Smith, LL.D.18 Smith selbst ist etwas bescheidener, spricht er doch vom WN (dessen Bücher III – V Wirtschaftspolitik und Institutionen zum Gegenstand haben) als „the very violent at‐ tack I have made upon the whole commercial system of Great Britain”19. In der Tat ist Smiths ganzes Werk durch ein Bündel politischer Fragen motiviert. Welches sind öffentliche Aufgaben in der sich fortentwickelnden Marktgesellschaft? Wie sind sie zweckmäßig und unter Beachtung von Gerechtigkeitsprinzipien wahr‐ zunehmen? Grundlegende theoretische Erwägungen werden von Smith immer wie‐ der mit solchen Fragen in Verbindung gebracht und auf unterschiedlichen Ebenen und mit unterschiedlicher Reichweite durchexerziert. Ein paar Beispiele mögen dies 18 Smith EPS, S. 270. 19 Smith Corr, S. 251.
178
illustrieren: Ein Problem, über das Smiths schottische Zeitgenossen viel diskutieren, betrifft die Frage „Miliz vs. stehendes Heer“. Fragen mit gesamtbritischem Hinter‐ grund betreffen die Kolonial- und Amerikapolitik sowie die Problematik der Staats‐ schulden. Fragen mit europäischem Hintergrund – wenn auch gefärbt durch britische und schottische Spezifika – betreffen die Transformationen im Verhältnis Privatwirt‐ schaft–Staat am Vorabend der Entwicklung des modernen Marktkapitalismus und der Industriellen Revolution. Die Änderungen, welche sich hieraus für Formen und Funktionen privater und öffentlicher Institutionen ergeben, sind im 18. Jahrhundert nicht nur für Smith und nicht nur für die Briten eine zentrale Herausforderung. Was die zentrale Frage über das Verhältnis von staatlicher Aktivität, öffentlicher Regulierung und privatem Gewinnstreben betrifft, wurde aus Smith schon Verschie‐ denstes herausgelesen. Dabei ist seine Position klar, wenn man zweierlei berücksich‐ tigt: erstens seine Position zu den Grundproblemen moderner Politik und zweitens den Hintergrund jener zeitbedingten Fragen, auf die Smith sich bezieht – also vor allem seine Kritik am fehl- und überregulierten commercial system seiner Zeit und auch auf die eher spezifischen Fragen, die etwa Donald Winch (1978) in den Mittel‐ punkt seiner Diskussion stellt. Damit lassen sich die mitunter scheinbar wider‐ sprüchlichen Positionen Smiths – wirtschaftsliberale Forderungen nach Deregulie‐ rung im Sinne seines systems of natural liberty wechseln mit Plädoyers für eine stär‐ kere Rolle des Staats – in ein kohärentes Ganzes einordnen. Smith geht es primär um eine Neuausrichtung von Politik und ihrer Aufgaben. Die herrschenden Monopole, Privilegien und Beschränkungen dienen den partikula‐ ristischen Zwecken mächtiger Interessengruppen und schaden der Gesamtentwick‐ lung des Wohlstands der Nation. In diesem Sinn schließt WN IV mit einer Kritik an Systemen, welche den ökonomischen Prozess durch unnatürlichen, effizienzschädli‐ chen, privilegiengetriebenen Interventionismus zu steuern suchen. Dem wird der systematische Gegenentwurf des WN gegenübergestellt: The System of Natural Li‐ berty. Und natürlich steht hier zunächst Deregulierung auf der Agenda,20 ohne Wenn und Aber. Das Prinzip dieser Deregulierung ist zwar einfach (obvious and simple), aber das heißt nicht, dass sie sich in der Praxis naturwüchsig durchsetzt. Die Durch‐ setzung bedarf vielmehr einer Neukonzeption von Politik – einer Neukonzeption, die keinesfalls mit einer bloßen Minimierung des öffentlichen Sektors gleichzuset‐ zen ist. Smith betont die Grenzen der Aufklärung und der wissenschaftlichen Politikbera‐ tung. Staat und Politik haben also wichtige Funktionen und unterliegen in der Mo‐ derne einer Transformation. Was aber lässt sich über den Stil und die Voraussetzun‐ gen von Politik in einer pluralistisch gegliederten Marktgesellschaft sagen, die von einer Modernisierungsdynamik erfasst ist? Schon in der TMS erläutert Smith seine
20 Smith WN, IV.ix.
179
diesbezügliche Konzeption: Politik soll durchaus wissenschaftlich fundierte Kon‐ zepte nutzen, aber sie muss sich vor den Gefahren und Illusionen eines technokrati‐ schen Perfektionismus hüten. Dessen Politikstil nach Geschmack des „man of sys‐ tem“ führt letztlich zum „highest degree of disorder“21. Nachhaltig erfolgreiche Poli‐ tik reflektiert Vielgestaltigkeit und Prozesshaftigkeit, die Bedingungen und Be‐ schränkungen der nicht-idealen Welt, in der sie unvermeidlich zu agieren hat. Es ist aufgrund dieser nicht-idealen Bedingungen typischerweise eine Politik der zweitbes‐ ten Lösungen, wie Smith in TMS VI mit Bezug auf Solon ausführt – und schon des‐ halb nicht eine Politik, welche Probleme ein- für allemal löst. Aus Smiths viel‐ schichtigem anti-technokratischen Räsonnement sei jene Passage ausführlich zitiert, auf die Wirtschaftsliberale von Hayek bis Deirdre McCloskey typischerweise refe‐ rieren. Wie Smith in TMS22 ausführt, geht man in einer modernen großen Gesell‐ schaft in die Irre, wenn man Akteure im politischen Feld als Figuren auf einem Schachbrett behandelt: „The man of system, on the contrary, is apt to be very wise in his own conceit; and is often so enamoured with the supposed beauty of his own ideal plan of government, that he cannot suffer the smallest deviation from any part of it. He goes on to establish it com‐ pletely and in all its parts, without any regard either to the great interests, or to the strong prejudices which may oppose it. He seems to imagine that he can arrange the different members of a great society with as much ease as the hand arranges the different pieces upon a chess-board. He does not consider that the pieces upon the chess-board have no other principle of motion besides that which the hand impresses upon them; but that, in the great chess-board of human society, every single piece has a principle of motion of its own, altogether different from that which the legislature might chuse to impress upon it. If those two principles coincide and act in the same direction, the game of human society will go on easily and harmoniously, and is very likely to be happy and successful. If they are opposite or different, the game will go on miserably, and the society must be at all times in the highest degree of disorder.”
Diese Kritik am man of system wird nicht selten (etwa von F.A. Hayek) als pauscha‐ le Kritik an der Aufklärungsidee gezielter Verbesserungen des Gefüges sozialer In‐ stitutionen gelesen. Die von Smith dargelegten Voraussetzungen seines eigenen Sys‐ tems der natürlichen Freiheit und der Gestus seiner Darstellung zeigen jedoch, dass das System der natürlichen Freiheit nicht ohne bewusstes politisches Handeln zu realisieren ist. Smith ist ein Vertreter gezielter Reformen, aber er ist skeptisch gegen‐ über Versuchen, umfassende Reformdesigns rücksichtslos und naiv (ohne umfassen‐ de sozialtheoretische Betrachtung der mannigfachen Wechselwirkungen) umzuset‐ zen. Die diesbezüglichen Unterschiede zu Hayek, der in hohem Maße durch Smith und die schottische Aufklärung inspiriert wurde und von allen hier betrachteten libe‐
21 Smith TMS, VI.ii.2.17. 22 Smith TMS, VI.ii.2.17.
180
ralen Strömungen den anti-technokratischen Smith wohl am intensivsten rezipierte, sind gleichermaßen subtil wie interessant. Sie werden in jenen Erörterungen sicht‐ bar, die die folgenden drei Aspekte betreffen. (1.) Smith23 betont die Politik nicht perfekter „Zweitbester Lösungen“, wohingegen prononciert anti-interventionistische Wirtschaftsliberale oft einen geradezu entgegengesetzten Argumentationsmodus pflegen, indem sie bei Schwierigkeiten bzw. Krisen von Deregulierungs- und Priva‐ tisierungspolitiken behaupten, die liberalen Prinzipien seien nicht hinreichend kon‐ sequent umgesetzt worden. Abweichungen vom Idealmodell werden eher als slippe‐ ry slope in den Niedergang wahrgenommen – und nicht als Modifikation, die unter unvermeidlich schwierigen Umweltbedingungen im Sinn der Theorie des Zweitbes‐ ten erforderlich sind, um jenen Grundanliegen möglichst gut gerecht zu werden, die aus dem liberalen Ideal folgen. Zu jener slippery slope Sicht tendiert auch Hayek (1944) im Anschluss an Mises‘ Interventionismus-Kritik. (2.) Smith betont explizit, dass das Technokratie-Problem alle Reformen betrifft. Gerade auch liberale Refor‐ men sind davon nicht ausgenommen. (3.) Smith hat eine deutlich geringere Neigung als Hayek zur Glorifizierung der spontanen Ordnung. Anders gesagt: Smith nutzt den Argumentationshintergrund spontaner Ordnungen weniger als Hayek zur Grun‐ dierung eines konservativen Anti-Interventionismus. Gleichzeitig betont er aber in höherem Maße, dass die Komplexität und Pluralität moderner Gesellschaften auch für liberale Reformen implizieren, dass es problematisch ist, sie am theoretischen Reißbrett zu entwerfen und dann gegen alle Widerstände technokratisch umzusetzen. Smith wäre das Politikverständnis mancher „Neoliberaler“, in deren mentalen Modellen liberale Big Bang Reformen durchaus eine erhebliche Rolle spielen, fremd. Smithianisch sind dennoch jene Aspekte der Hayekschen Theorie, in der die Rolle spontaner Ordnungen und komplexer Systeme und daraus sich ergebende Grenzen in der Reichweite der Gestaltung betont werden. Treffsicher zitiert Hayek in diesem Zusammenhang die prägnantesten Passagen aus jenem Abschnitt der Theory of Moral Sentiments,24 der jenen politischen Tugenden gewidmet ist, die the statesman unter modernen Verhältnissen entwickeln sollte. Wie ist es nun zu erklä‐ ren, dass Hayek (der doch in vielem Smithschem Denken durchaus nahe ist) die be‐ treffenden Einsichten Smiths für wirtschaftsliberale Reformprozesse des letzten Drittels des 20. Jahrhunderts nur partiell aktiviert? Denn nach der hier vorgeschlage‐ nen Lesart wären die wirtschaftsliberalen Reformen unter Pinochet wie auch zumin‐ dest der marktradikal-aktivistische Gestus, mit dem die Reformen unter Thatcher be‐ trieben wurden, aus Smithscher Perspektive im Hinblick auf den politischen Modus der Umsetzung zutiefst problematisch. Die Antwort darauf kann hier nur skizziert werden: In den unterschiedlichen Strömungen des in den 1930er Jahren entstehen‐ den Neoliberalismus wird die liberale Ordnung mehr oder weniger als dezidiert poli‐ 23 Smith TMS, VI.ii.2.16. 24 Smith TMS, VI.ii.2.17.
181
tische Veranstaltung gesehen. Das ist der gemeinsame Nenner im Colloque Walter Lippman und ist auch in der Mont Pèlerin-Gesellschaft stark präsent. In der im wei‐ teren Sinn neoliberalen Epoche seit den 1980er Jahren wurde darüber hinaus der Staat auf unterschiedlichen Ebenen zum Instrument des market making bzw. der Re‐ duzierung der Reichweite politischer Kollektiventscheidungen in Bereichen, in de‐ nen diese als störend angesehen werden. Im Hinblick auf Smith besteht das Problem einer Gegenüberstellung von Alt- oder Paläoliberalismus und Neoliberalismus in Smiths Vielschichtigkeit. Vor allem ist Smith gar kein Verfechter des dem Altlibera‐ lismus zugeschriebenen absoluten Laisser-faire basierend auf der natürlichen Ord‐ nung. Vielmehr sind die unsichtbare Hand und das system of natural liberty durch‐ aus auf die Mithilfe politikförmig agierender Akteure angewiesen. Mehr noch, diese Akteure sollten die Einsichten der science of the legislator (als solche hat er wie er‐ wähnt die Politische Ökonomie im Blick) verarbeitet haben und umsichtig-selbstkri‐ tisch nutzen! Gerade für den Prozess der politischen Gestaltung macht er jedoch erstrangige Herausforderungen aus, da er weder ein emphatisch-optimistisches Bild von der Politik noch von einer wissenschaftlich gestützten Technokratie hat. Für Smith ist die Entwicklung einer liberalen Ordnung ein politischer Prozess – und die zentrale Herausforderung ist es, diesen politischen Prozess in einer der Komplexität der zugrundeliegenden sozio-ökonomischen Strukturen gerecht werdenden Weise zu formen und zu hegen. Einschlägige Herausforderungen bzw. Ambivalenzen einer politisch rücksichtslos forcierten Liberalisierung wurden bis zur jüngst in den Mittelpunkt der Diskussion gerückten „Krise des Liberalismus“ nur relativ von wenigen Denkern im Umfeld des neueren Wirtschaftsliberalismus zureichend wahrgenommen, etwa von Michael Oa‐ keshott, John Gray25und Viktor Vanberg. Bei Ludwig von Mises hingegen werden sie von der alles überschattenden zivilisatorischen Entscheidung zwischen Markt‐ wirtschaft und sozialistischer Planwirtschaft völlig in den Hintergrund gedrängt. Hayek selbst reflektiert sie nur sehr partiell – und den Ökonomen der Chicago-Schu‐ le von Milton Friedman bis Robert Lucas ist sie angesichts einer Kombination von Individualismus und sehr weitgehenden Machbarkeitsperspektiven weitgehend fremd. Robert Lucas stellt in seinem nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007 oft kritisch zitierten Aufsatz26 makroökonomische Krisen als (aufgrund der gewachse‐ nen Kompetenz ökonomischer Politikberatung) überwundene historische Reminis‐ zenz dar, sodass alles Augenmerk auf die effizienzfreundliche Perfektionierung in‐ stitutionalisierter Anreizmechanismen gelenkt werden kann. 25 Gray wurde nicht nur von Hayek, sondern auch von Isaiah Berlin, einem bedeutenden liberalen Theoretiker der Ambivalenzen und Krisenträchtigkeit der Moderne insgesamt, beeinflusst. Es scheint kein Zufall zu sein, dass Amartya Sen, der ebenfalls mit Berlins Denken vertraut ist, eine moderne Form eines sozialen Liberalismus entwickelte, die auch an hier betonte Einsich‐ ten Adam Smiths anknüpft. 26 Lucas 2003.
182
Es folgen nun Illustrationen im Hinblick auf Smiths differenziert-skeptisches Po‐ litikverständnis. Vor dem Hintergrund der Komplexität historisch gewachsener Ord‐ nungen, des Eigensinns der politischen Akteure in großen, inhomogenen Gesell‐ schaften und seiner angedeuteten Vorstellung von wissenschaftlicher Politikberatung auf Basis der „virtues of the statesman“ werden jene Ressourcen deutlich, die Smiths Denken sowohl im Hinblick auf die Problematik von Technokratie als auch von Populismus bereithält. Gerade die beiden in den eingangs erwähnten Passagen aus dem WN IV.vii zur Diskussion gestellten konträren Optionen britischer Ameri‐ kapolitik zeigen, dass Smith keinesfalls einem politischen Attentismus oder bloßem Fortwursteln das Wort redet – und insbesondere auch nicht jene wichtige, tendenzi‐ ell konservative „hayekianische“ Einsicht absolut setzt, die er selbst in einem Brief an Graf Joseph Niclas Windischgrätz prägnant in einer Weise zusammenfasst, die entsprechende Hayeksche Formulierungen zu antizipieren scheint: Bestimmte Rechtsnormen beruhten auf der „Weisheit und Erfahrung vieler … Generationen“27. Diese Formel ist für ihn ein kontextabhängig wichtiger Aspekt, aber kein zentrales Axiom für moderne Politik. In der Amerika-Frage etwa zeichnen sich beide von Smith in den Raum gestellten Optionen dadurch aus, dass sie relativ radikale Ände‐ rungen bedeuten. Sowohl die freiwillige Trennung von den Kolonien (vorzugsweise verbunden mit einem Handelsabkommen) als auch eine politische Union mit parla‐ mentarischer Vertretung sind weitgehende konstitutionelle Innovationen, die damals kaum auf breite Unterstützung des politisch-intellektuellen Establishments zählen können – dessen Politik dem Fortwursteln viel näher ist.28 Gleichzeitig wird in die‐ sen Passagen klar, dass für Smith die Frage des wünschenswerten Zentralisierungs‐ grades politischer Autorität kontextabhängig und nicht aufgrund oberster Prinzipien zu beantworten ist – und überdies mehrere potentiell funktionierende „Lösungen“ zulässt. Allerdings gibt es Lösungen, die nicht dauerhaft funktionieren können, weil sie der Logik unaufhaltsamer Entwicklungen entgegengesetzt sind. An dieser Stelle ist es interessant, auf Smiths Diagnose der Triebkräfte der amerikanischen Unabhän‐ gigkeitsbestrebungen etwas einzugehen, aufgrund derer das auch bei Smith relevante Prinzip „no taxation withouth representation“ historisch wirkmächtig werden muss‐ te. Diese stehen in engem Zusammenhang mit politischen Ansprüchen, die einer mehr und mehr von individualistischen Normen geprägten commercial society unab‐ weisbar werden. Smith schreibt über die Perspektive der Vertretung amerikanischer Abgeordneter im britischen Parlament:
27 Smith artikuliert diese zentrale Formel des Hayekschen Liberalkonservatismus aus Anlass ei‐ nes von Windischgrätz ausgelobten Preises für ein vollständiges und widerspruchsfreies Nor‐ mensystem more geometrico für Eigentumsübertragung, das kostspielige Rechtsstreitigkeiten überflüssig machen sollte (vgl. Ross 1995, 367ff.). Smith ist in der Sache skeptisch, findet aber Windischgrätz’ Wettbewerb doch irgendwie interessant. 28 Vgl. Winch 1978.
183
„Unless this or some other method is fallen upon, and there seems to be none more ob‐ vious than this, of preserving the importance and of gratifying the ambition of the leading men in America, it is not very probable that they will ever voluntarily submit to us; and we ought to consider, that the blood which must be shed in forcing them to do so, is, every drop of it, the blood either of those who are, or of those whom we wish to have for our fellow citizens. They are very weak who flatter themselves that, in the state to which things have come, our colonies will be easily conquered by force alone. The persons who now govern the resolutions of what they call their continental congress, feel in themsel‐ ves at this moment a degree of importance which, perhaps, the greatest subjects in Euro‐ pe scarce feel. From shopkeepers, tradesmen, and attorneys, they are become statesmen and legislators, and are employed in contriving a new form of government for an extensi‐ ve empire, which, they flatter themselves, will become, and which, indeed, seems very likely to become, one of the greatest and most formidable that ever was in the world.“.29
Dieser Abschnitt ist vor allem zusammen zu sehen mit jener Passage aus dem für die letzte zu Smiths Lebzeiten erschienene (6.) Auflage neu konzipierten VI. Buch der Theory of Moral Sentiments, auf die oben schon ausführlich Bezug genommen wur‐ de. Die hier genannten shopkeepers werden von Smith in ihrer Rolle als politische Akteure keineswegs idealisiert: Ob deren common sense im Sinne des Gemeinwohls Positives oder Negatives bewirkt, hängt im Allgemeinen ganz vom Entscheidungs‐ kontext ab. Eine undifferenziert positive Sicht liefe der ansonsten im Wealth anzu‐ treffenden nüchtern-skeptischen Einschätzung der politischen Fähigkeiten der unter‐ schiedlichen Klassen von Akteuren zuwider. Es geht bei Smith keineswegs darum, dass die shopkeepers in politics die Beschränkungen von Stand und Beruf hinter sich lassen und zu aufgeklärten Citoyens werden. Dies anzunehmen, läge ihm fern. Aber auch wenn dies nicht der Fall ist, ist man gut beraten, ihre Antriebe und Handlungs‐ logik realistisch in Rechnung zu stellen.
5. Staatsaufgaben und öffentliche Finanzen Im Hinblick auf die finanzwissenschaftlichen Pionierleistungen Smiths sind jene Va‐ rianten des Wirtschaftsliberalismus als Erben Smiths zu betrachten, die eng mit der heutigen Mainstream-Finanzwissenschaft verknüpft sind und als Vertreter der mixed economy gelten können. Smiths Prinzipien für die öffentliche Finanzwirtschaft spiegeln einen in Britanni‐ en und Holland zum damaligen Zeitpunkt schon deutlich sichtbaren und recht weit gediehenen Prozess wider, in dem der Staatshaushalt sukzessive zur öffentlichen An‐ gelegenheit und zum öffentlichen Haushalt wird und nicht mehr primär als Haushalt des Herrschers gilt.30 In Bezug auf diese Teile seines Werks sind die moderne Fi‐ 29 Smith WN, IV.vii. 30 Vgl. Goldscheid 1976; Schumpeter 1976.
184
nanzwissenschaft einerseits und progressiv-liberale Protagonisten einer gemischten Wirtschaft andererseits die wichtigsten Hüter des Smithschen Erbes. Der Titel der gesammelten Aufsätze Richard Musgraves (1986) „Public finance in a democratic society“ spiegelt die Bedeutung wider, welche expliziten Kollektiventscheidungen in diesem Kontext zukommt. Allerdings wurde dieser Aspekt – und die damit ver‐ bundenen Probleme politischer Kollektiventscheidungen – in Teilen der Disziplin verdrängt und durch ein technokratisches Modell des „wohlwollenden Planers“ er‐ setzt. In anderen Teilen wurde sie allerdings besonders betont: Knut Wicksell, Ken‐ neth Arrow, James Buchanan und Richard Musgrave sind diesbezüglich zu nennen. Öffentliche Aufgaben. Die moderne Finanzwissenschaft à la Musgrave geht von einem weitgehend fixen Katalog von Staatsaufgaben aus, deren Legitimation durch eine Kombination von demokratischen Prozessen und effizienztheoretischen Kalkü‐ len bewerkstelligt wird. Der Katalog selbst hat über weite Strecken Smithsche Wur‐ zeln. Funktional motivierte Staatsaufgaben nehmen laut Smith im Zuge des wirt‐ schaftlichen Fortschritts und der Entwicklung der Arbeitsteilung an Bedeutung und Umfang zu. Die allgemeine Formulierung, mit der Smith eine Art Ko-Evolution von Privatwirtschaft und öffentlichem Sektor andeutet, lautet31: Die entsprechenden öf‐ fentlichen Ausgaben ändern sich je nach gesellschaftlicher Entwicklungsstufe. Vor allem anhand des Militärwesens demonstriert er, dass technischer Fortschritt, Spe‐ zialisierung, Arbeitsteilung und die notwendige Professionalisierung im heute zu überblickenden Fortschritt der Zivilisationsstufen zu höheren Kosten für den Staat führen, da der Schutz der Gesellschaft nicht mehr ohne professionalisiertes stehen‐ des Heer zu leisten ist.32 Dies hat kritische Implikationen für die in Schottland heiß diskutierte Milizfrage, welche Adam Ferguson, dem eifrigen Streiter für die Sache der Milizen, missfallen. Smith räumt indes durchaus Vorteile von Milizen ein: Sie sind im Hinblick auf Machtballungen weniger problematisch (eventuell sogar ein Gegenmittel) und heben die allgemeine Wehrtüchtigkeit. Gerade diese Stellen fügen sich in das Gesamtbild ein, das Smith von den Potentialen, Problemen und Heraus‐ forderungen moderner Spezialisierungsdynamiken zeichnet. Auch die Rechtspflege kann im Rechtsstaat einer Marktgesellschaft nicht mehr sinnvoll von jenen Schichten nebenher ausgeübt werden, die dies in früheren Ent‐ wicklungsstadien machten – schon gar nicht von jenen Personen, welche im Staat exekutive Funktionen wahrnehmen. Dafür braucht es eigene Funktionsträger, die ex‐ tra entlohnt werden müssen. In den Bereich von Justice fallen übrigens auch zuneh‐ mend „moderne“ Funktionen einer regulierenden Ordnungspolitik. Wie Smith im Kontext der Darstellung der entsprechenden Märkte ausführt, entstehen diese auf‐ grund von Informations- und Machtasymmetrien und der steigenden Komplexität dynamischer Wirtschaften. Deren Geld- und Finanzsektor hat sich ja mitentwickelt 31 Smith WN, V.i.b. und c. 32 Smith WN, V.i.a.
185
und ausdifferenziert, wie im Großbritannien des 18. Jahrhunderts gut zu beobachten ist. Asymmetrien können etwa dazu führen, dass Wettbewerb zu einer Negativausle‐ se (im Ökonomenjargon: adverse selection) führt. Deswegen plädiert Smith etwa für Zinsregulierung und sieht die Notwendigkeit einer spezifischen ordnungspolitischen Einbettung des Geld- und Finanzsektors. Steuerfinanzierte Leistungen werden in Bereichen zunehmend notwendig, etwa im Bereich elementarer Bildung, wo sie früher verzichtbar waren. Besonders interes‐ sant sind die Argumente, mit denen Smith den steigenden öffentlichen Bildungsbe‐ darf begründet. Denn dabei kommt er wieder auf die Schattenseiten von Arbeitstei‐ lung zu sprechen. Smith erkennt, dass Bildungsprozesse in spezifischer Weise von der Arbeitsteilungsdynamik in Mitleidenschaft gezogen werden. Kehrseite der Spe‐ zialisierung ist die einseitige Entwicklung individueller Fähigkeiten. Arbeitsteilung und -zerlegung impliziert, dass Körperkraft nicht mehr Voraussetzung für einfache, ungelernte Arbeit ist. Daher entstehen allerlei marktvermittelte, jedoch gänzlich ein‐ seitige, nicht in natürliche Lernprozesse integrierbare Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder. Die gebotene Entlohnung sorgt dafür, dass sie zu wenig Zeit für direkt oder indirekt bildende Tätigkeiten verwenden; anders gesagt, die Opportunitätskos‐ ten der Bildung für Heranwachsende steigen. Öffentlich finanzierte Bildungsmaß‐ nahmen sind unter diesen Umständen legitim und erforderlich, weil breite Teile der Bevölkerung ansonsten kaum mehr jene staatsbürgerlichen Fähigkeiten entwickeln können, die es für ein Gemeinwesen braucht: Mindeststandards an Wehrtüchtigkeit und politischer Urteilsfähigkeit. Auch „Publick works and institutions for facilitating the commerce of society“33, zumal Infrastrukturleistungen im Bereich des Verkehrs, gehören in Smiths System in den Bereich funktionaler Staatstätigkeit, der angesichts der steigenden Reichweite von Markt und Kommerz bedeutender wird. Maßnahmen zur Markterschließung im Fern- und Kolonialhandel werden anschließend Gegenstand differenzierter Diskus‐ sionen, bei denen es um Gefahren von Monopolen und Interessengruppen geht. Jene Diskussion ist auch im Lichte der folgenden imperialen Entwicklung Britanniens zu sehen, welche die Handelsexpansion des 19. Jahrhunderts begleiten sollte. Öffentliche Finanzen. Auch die Finanzierung, die Einnahmeseite eines öffentli‐ chen Sektors, der kein Fremdkörper im Prozess von Arbeitsteilung und Wachstum sein soll, hat gewissen Prinzipien zu genügen, die auch heute noch für eine Finanz‐ wissenschaft à la Musgrave prägend sind. Es sind dies Prinzipien der Rechtsförmig‐ keit und der gesamtwirtschaftlichen Zweckmäßigkeit. Einnahmenseitig bietet Smith zum einen eine problemorientierte und differenzierte Erörterung der Gebührenfinan‐ zierung. Deutlich werden die Vorzüge der Logik von Leistung und Gegenleistung herausgearbeitet, aber auch mögliche Fehlanreize und Grenzen der Gebührenfinan‐
33 Smith WN, V.i.d
186
zierung. Zum anderen stellt er bezüglich der Steuerfinanzierung vier Steuerprinzipi‐ en auf, die in der Finanzwissenschaft klassisch geworden sind und normativen Vor‐ gaben eines individualistischen Liberalismus entsprechen:34 • • • •
Proportionale Gleichheit Bestimmtheit (Vermeidung von Willkür) Bequemlichkeit für den Steuerzahler (z.B. in der zeitlichen Struktur von Steuer‐ zahlungsterminen) Vermeidung von Zusatzlasten
Die Vermeidung von Zusatzlasten schließt in der Smithschen Formulierung vier As‐ pekte ein: (1) möglichst kostengünstige Steuerverwaltung, (2) möglichst wenig psy‐ chische Kosten durch odious examination of tax-gatherers, (3) möglichst geringe volkswirtschaftliche Kosten durch Steuerhinterziehung und die entsprechenden Sanktionsmechanismen und (4) möglichst geringe soziale Kosten durch Anreizver‐ zerrung: Steuern sollten die Leute nicht entmutigen (discourage), ihren Fleiß (indus‐ try) auf volkswirtschaftlich wertvolle produktive Aktivitäten zu verwenden. Im heu‐ tigen Ökonomen-Jargon ausgedrückt: Ein gutes Steuersystem sollte unerwünschte steuerinduzierte Substitutionseffekte bzw. Fehlanreize tunlichst vermeiden. Eine sol‐ che Betrachtung liegt allen neueren wirtschaftsliberalen Steuerreformen zu Grunde, die insbesondere seit den Reaganschen Steuerreformen in den 1980er Jahren um eine Senkung der Grenzsteuersätze v.a. im Bereich der Einkommensteuer und um eine Senkung der Unternehmenssteuern bemüht waren. Auch die Implementation moderner Steuersysteme in den postkommunistischen Reformländern (Stichwort flat tax) war weithin von solchen Überlegungen geprägt. Was wir oben unter dem Titel proportionale Gleichheit zusammenfassen, enthält Smiths normative Begründung für eine höhere Steuerzahllast der Reichen. Seine ge‐ nauere Begründung enthält Formulierungen, welche das Leistungsfähigkeitsprinzip (ability-to-pay) vorwegnehmen. Smith hebt wörtlich auf die Fähigkeit (ability) zur Steuerzahlung in Proportion zur revenue ab. Für ihn zeigt die Höhe der revenue in‐ des auch die Größe der individuellen Vorteile aus der Staatstätigkeit an. Damit ist auch das tendenziell wirtschaftsliberale Äquivalenzprinzip in seiner Vorstellung von proportionaler Gleichheit enthalten. Ausführlich werden im WN35 schließlich auch die Staatsschulden behandelt, die im Britannien des 18. Jahrhunderts ein großes Thema sind.36 Die öffentliche Schuld war einerseits ein Motor von Innovationen im Finanzsektor (financial revolution) und andererseits Gegenstand theoretischer Debatten um ihre realwirtschaftlichen Auswirkungen und die Reichweite der Analogie zur privaten Verschuldung. Ein er‐ 34 Smith WN, V.ii.b. 35 Smith WN, V.iii.47ff. 36 Winch 1978, Kapitel 6.
187
heblicher Teil der Koordinaten der Diskussion war schon vor Smith bekannt. Schon Autoren wie J.F. Melon und David Hume äußerten sich zu den seither immer wie‐ derkehrenden Themen: Dabei ging es um den Vergleich zwischen Staatsschulden und Steuern, die politisch-ökonomischen Gefahren öffentlicher Verschuldung und eventuelle wachstumspolitische Vor- und Nachteile. Im Spektrum der damaligen Po‐ sitionen betont Smith wie sein Freund Hume zwar durchaus die Probleme der Staats‐ verschuldung. Wie Donald Winch37 schreibt, entdeckt man bei ihm jedoch kaum „any fundamental disquiet … concerning the political strains created by the public debt.” WN V ist beispielgebend für eine in die Politische Ökonomie integrierte Finanz‐ wissenschaft, die liberalen Prinzipien folgt, im Unterschied zur institutionell abge‐ grenzten Finanzwissenschaft in kameralistischer Tradition. Es ist aber auch eine Fi‐ nanzwissenschaft mit ordnungspolitischem Horizont und dem Blick auf längerfristi‐ ge Dynamiken, wie sie in Deutschland im 19. Jahrhundert unter der Ägide von Öko‐ nomen wie Adolph Wagner entstehen wird. Dem Deregulierungsprogramm, das Smiths WN IV motiviert und abschließend auf den Punkt bringt, folgt in WN V die Skizze einer Modernisierung von Staatlichkeit. Diesem Kapitel stellt Smith eine ökonomische Begründung der Ausgabenseite voran: Elementare öffentliche Funktio‐ nen sind militärischer Schutz, Recht und Ordnung und – nach konkreten Umständen und Aufgabenstellung unterschiedlichen Institutionen und Gebietskörperschaften zu‐ kommend − die öffentliche Infrastruktur (z.B. im Transportwesen). Es folgen die wesentlichen Instrumente der Finanzierung: Staatsschulden, Gebühren und Steuern, wobei vier Steuerprinzipien Gesichtspunkte der Gerechtigkeit und der Zweckmäßig‐ keit zusammenfassen. Insgesamt verändern die Gravitationskräfte des wirtschaftli‐ chen Fortschritts langfristig den Charakter von Staatlichkeit: Weg von einem Macht‐ staat, der wenig mehr ist als eine Agentur von ständisch-feudal-korporativ geprägten Partikularinteressen, hin zu einem Rechts- und Leistungsstaat, der füglich als „öf‐ fentlicher Sektor“ angesprochen werden kann. Smiths vehemente Angriffe gegen das Merkantilsystem sind im Kontext eines entsprechenden Reformprogramms des notwendigen grundlegenden Umbaus von Staatlichkeit zu sehen – und nicht eines unqualifizierten Laisser-faire oder einer unqualifizierten Geringschätzung des öf‐ fentlichen Sektors.
6. Ko-Evolution von Ökonomie und Politik Das in den Abschnitten II. – V. Ausgeführte ist in Zusammenhang mit den langfristi‐ gen Entwicklungsperspektiven der Marktgesellschaft zu sehen. Von Montesquieu bis
37 Winch 1978, S. 138.
188
Schumpeter (1942) und darüber hinaus steht ein Fragenkomplex auf der Agenda, welcher die Ko-Evolution von Politik und Ökonomie betrifft. So auch bei Smith. Die Frage lautet: Wie wirkt die Logik und Dynamik ökonomischer Entwicklung auf das politische System und die Qualität politischer Prozesse? Fördert zunehmender Handel und Wandel eine bessere, eine rationale und lösungsorientierte Politik? Oder birgt diese Entwicklung im Gegenteil sogar Gefahren für die Politik? Kann man da‐ von ausgehen, dass politisches System und politische Eliten sich spontan so entwi‐ ckeln werden, dass die skizzierten Funktionen gut wahrgenommen werden? Führt möglicherweise eine in der marktwirtschaftlichen Dynamik angelegte List der Ver‐ nunft und Harmonie der Interessen dazu, dass diese Funktionen zu einem trivialen Residuum werden, wie manche Liberale hoffen? So trivial, dass politische Tugenden nicht mehr gebraucht werden und dieser Frage kein besonderes Augenmerk ge‐ schenkt werden muss? Oder aber bleibt die Entwicklung einer problemorientierten Politik eine Herausforderung, weil auch die moderne Entwicklung immer wieder en‐ dogen Monopole, Machtasymmetrien und Interessenskonflikte entstehen lässt? Zwei wichtige Aspekte der Smithschen Behandlung des öffentlichen Sektors be‐ sitzen bei Musgrave und den anderen Vertretern der modernen Finanzwissenschaft nur eine untergeordnete Bedeutung, nämlich die historische Ko-Evolution von Markt und politischen Prozessen,38 und die Ko-Evolution von Markt und öffentli‐ chen Aufgaben. Im Sinne dessen, was oben schon argumentiert wurde, zeigt Donald Winch (1978), dass Smith eine Deutung von Aufgaben und Herausforderungen für Politik und öffentlichen Sektor vertritt, die nicht auf deren Marginalisierung hinaus‐ laufen. Dessen Aufgaben sind nicht trivial – und sie bleiben es, ändern sich aber im Laufe der wirtschaftlichen Entwicklung. Ein öffentlicher Sektor auf der Höhe seiner Zeit ist also nicht ohne Augenmaß, Urteilskraft und umsichtige Nutzung der Wirt‐ schaftstheorie zu haben. Als Autor des obvious and simple system of natural liberty wirkt er gegen das Merkantilsystem und als Protagonist des Wirtschaftsliberalismus. Dessen Entwicklung ist weder als Big-Bang-Reform aussichtsreich, wie manche Vertreter einer idealerweise ins Laisser-faire mündenden Deregulierung sich dies vorstellen, noch kommt sie von selbst. Reformen sollten schrittweise und mit Au‐ genmaß erfolgen – aber die Pointe ergibt sich aus der Betrachtung der Prozessaspek‐ te moderner Entwicklung: Die Gestaltung der marktwirtschaftlichen Rahmenord‐ nung bleibt eine permanente politische Aufgabe und erfordert immer wieder pro‐ blemorientierte Analysen (vgl. oben Abschnitt V), denn Regulierung ist in einer dy‐ namischen Welt kein einmaliger Akt. Smith ist letztlich der Theoretiker einer Politi‐ schen Ökonomie, in der nicht nur Markt und Staat, sondern auch intermediäre Insti‐ tutionen ihren Platz haben. Hintergrund dieser Sichtweise ist die Interdependenz von
38 Vgl. dazu aber Schumpeter 1942; 1976.
189
Macht und Verteilung, Wettbewerb, Klasseninteressen und Rent-seeking sowie Ak‐ kumulation.39 Politische Aufgaben werden also im Laufe der Entwicklung nicht zu Randphäno‐ menen. Im Hinblick auf die Ko-Evolution moderner Märkte und politischer Prozes‐ se ist all dies indes unter einer säkularen Perspektive zu sehen, welche Smiths vor‐ sichtig optimistische Ambivalenz im Hinblick auf Modernisierungsprozesse reflek‐ tiert. Smith teilt nicht den Optimismus eines Montesquieu oder eines James Steuart, welche auf die positiven rationalisierenden Tendenzen gesetzt hatten, die von der Entwicklung der Marktgesellschaft ausgehen: Demzufolge würde die Logik der marktwirtschaftlichen Entwicklung tendenziell eine vernünftige Wirtschaftspolitik erzwingen. Für Smith ist dies alles andere als eine ausgemachte Sache. Zu komplex sind die Aufgaben, zu tief ist der wretched spirit of monopoly mit den Praktiken der Marktgesellschaft verwoben, zu ausgeprägt ist die Tendenz ihrer Protagonisten, sich immer wieder gegen das Gemeinwohl zu „verschwören“, wie er es formuliert. Dage‐ gen gibt es kein Patentrezept. Keine Revolution und keine Konstitution kann dieses Problem ein für alle Mal lösen. Nicht nur die Aufgaben der Politik, sondern auch die politischen Mechanismen ihrer Bewältigung bleiben eine dauernde Herausforderung, welche die moderne Gesellschaft nicht nur unter Spannung hält, sondern bei allen „improvements“ für prekäre Konstellationen sorgt – weil (wie auch immer ko-evolu‐ tiv konditionierte) Risiken in der Entwicklung der politischen Mechanismen die Lösbarkeit unabweisbarer Aufgaben in Frage stellt. Die Frage ist letztlich, ob das politische System sich so entwickelt, dass es auf der Höhe seiner Zeit und ihrer Aufgaben ist. Unter den Wirtschaftsliberalen des 20. Jahrhunderts wird diese Problematik explizit etwa von Joseph Schumpeter (1942) reflektiert und ansatzweise bearbeitet. Dagegen können Aktivitäten wie die Grün‐ dung der Mont Pèlerin-Gesellschaft (motiviert durch die Wahrnehmung einer Zivili‐ sationskrise) als performative Reaktion im Sinne dieser Problematik interpretiert werden. Dabei dominiert jedoch (in gewissem Sinn paradoxerweise) die Tendenz, den Kern der angestrebten politischen Liberalisierungsmaßnahmen als dauerhafte konstitutionelle Lösung anzusehen, die (wenn hinreichend perfektioniert) letztlich eine Trivialisierung politischer Aufgaben und insgesamt eine Marginalisierung des Politischen erlauben.
7. Schlussbemerkung Emma Rothschild (2001) betont zutreffend, dass Smith weder ein marktfundamenta‐ listischer Liberaler noch ein Konservativ-Liberaler à la Hayek war. In Bezug auf die
39 Z.B. Smith WN, IV.vii.2.
190
Politische Ökonomie des Staats ist etwa die moderne Finanzwissenschaft mit ihrem problemorientiert-kasuistischen Zugang die legitime Erbin Smiths, sofern man vom technokratischen Politikverständnis mancher ihrer Vertreter abstrahiert. Allerdings ist er auch kein progressiver Wirtschaftsliberaler in der Nachbarschaft Condorcets (wie sie gleichzeitig nahelegt) – und zwar nicht nur deshalb nicht, weil sowohl Hayek als auch tendenziell eher konservative Ordoliberale füglich bestimmte Aspek‐ te des Smithschen Erbes beanspruchen können. Bei Smith finden sich prägnante Passagen zu Marktoptimismus und Politikskepsis, die seiner aufklärerischen Grund‐ haltung eine ganz spezifische Note verleihen. Diese stellen weder Marginalien noch einen leicht subtrahierbaren ideologischen Überbau eines ansonsten großartigen auf‐ klärerischen Gedankengebäudes dar, das gleichzeitig Architektur und Prinzipien für eine ganze wissenschaftliche Disziplin bot. Vielmehr sind diese marktoptimistischen und politikskeptischen Aspekte seines Werks (gerade in ihren oben skizzierten theo‐ retischen Spezifika, die freilich mit landläufigen oder gar ideologisch enggeführten Versionen von Marktoptimismus und Anti-Politik wenig gemeinsam haben) eng mit seiner Sicht der komplexen Dynamik moderner Gesellschaften verbunden. Nicht nur diesbezüglich ergeben sich gewisse Parallelen zu manchen „neoliberalen Richtun‐ gen“, die sich in den Diskursen des Colloque Walter Lippman 1937 Aufmerksamkeit verschafften und auf die Begründung eines neuen Liberalismus jenseits von Laisserfaire abzielten. Nicht zuletzt sind es die deutschen Ordoliberalen, deren Positionen gewisse Analogien zu Smith aufweisen. Emma Rothschild (2001) und Amartya Sen (2009) sind die prominentesten Smith-Interpretatoren, welche die Kaperung Adam Smiths durch marktfundamenta‐ listische und „konservative“ Spielarten des Liberalismus bzw. „conservative econo‐ mics“40 kritisieren. Gemeint sind damit vor allem Spielarten des Liberalismus, die in Machtasymmetrien und beliebig starken Divergenzen in der Vermögensentwicklung kein Problem sehen. Smith war in der Tat ein Liberaler, für den die Probleme von Vermachtung und Verteilung, insbesondere das Schicksal der labouring poor wichti‐ ge politische Herausforderung darstellten – mit (gerade auch im Vergleich zu neue‐ ren Spielarten des Wirtschaftsliberalismus) bedeutenden Implikationen für die Rolle von Staat und Politik in der modernen Dynamik von Spezialisierung und Arbeitstei‐ lung. Insofern treffen Sen und Rothschild einen wichtigen und überaus problemati‐ schen Aspekt der Smith-Rezeption. Allerdings ist Smith ein überaus facettenreicher und komplexer Denker, der aus ganz verschiedenen Quellen schöpfte, dessen Hoch‐ schätzung rhetorischer Dimensionen41 der Präsentation von Ideen auch manche Doppelbödigkeiten mit sich brachten – und aus dem ganz unterschiedliche Strömun‐ gen Inspiration bezogen und beziehen. Dazu gehören durchaus auch Strömungen, die einzelnen Aspekten und Punkten der Smithschen Agenda diametral entgegenge‐ 40 Rothschild 2001, S. 52ff. 41 Vgl. Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (Smith 1978).
191
setzt sind – oder die mit bestimmten Ebenen seines komplexen Denkens (namentlich aufgrund ihrer partikularen Interessen, der Perspektive ihrer Ideologien oder der Be‐ grenztheit ihrer eigenen Modellierungen) nichts anfangen können. Auch das gehört – auf einer anderen (epistemischen) Ebene – zu den Spannungen der Moderne.
Literatur Foley, Duncan K., 1967: Resource Allocation and the Public Sector. In: Yale Economic Es‐ says, Vol. 7, Nr. 1, S. 45-98. Goldscheid, Rudolf, 1976: Staat, öffentlicher Haushalt und Gesellschaft. Wesen und Aufgabe der Finanzwissenschaft vom Standpunkte der Soziologie. In: Hickel, Rudolf (Hrsg.): Ru‐ dolf Goldscheid, Joseph Schumpeter. Die Finanzkrise des Steuerstaats. Beiträge zur politi‐ schen Ökonomie der Staatsfinanzen, Frankfurt am Main, S. 253-316. Hayek, Friedrich August, 1944: The Road to Serfdom. London. Heller, Herrmann, 1933: Autoritärer Liberalismus? In: Die Neue Rundschau 44, S. 289–298. Kurz, Heinz D./Sturn, Richard, 2013: Adam Smith – Pionier der modernen Ökonomie. Frank‐ furt a. M. Lerner, Abba P., 1972: The Economics and Politics of Consumer Sovereignty. In: The Ameri‐ can Economic Review, 62, 1/2, S. 258-266. Lucas, Robert, 2003: Macroeconomic Priorities. In: The American Economic Review, 93/1, S. 1-14. Mazzucato, Mariana, 2013: The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Myths, London u. New York. Musgrave, Richard Abel, 1986: Public Finance in a Democratic Society: Collected Papers of Richard A. Musgrave. New York. Röpke, Wilhelm, 1942: Gesellschaftskrisis der Gegenwart. Erlenbach-Zürich. Ross, Donald, 1995: The Life of Adam Smith. Oxford. Rothschild, Emma, 2001: Economic Sentiments. Cambridge, Mass. Schumpeter, Joseph, 1942: Capitalism, Socialism, and Democracy. New York. Schumpeter, Joseph, 1976: Die Krise des Steuerstaats. In: Hickel, Rudolf (Hrsg.): Rudolf Goldscheid, Joseph Schumpeter. Die Finanzkrise des Steuerstaats. Beiträge zur politischen Ökonomie der Staatsfinanzen, Frankfurt am Main, S. 329-379. Sen, Amartya, 2009: The Idea of Justice, Cambridge, Mass. Smith, Adam, 1976 a: The Theory of Moral Sentiments. In: Raphael, D.D. und Macfie, A.L. (Hrsg.), Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, Bd. 1, Ox‐ ford. Kurzzitat: TMS. Smith, Adam, 1976 b: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. In: Campbell, R.H. und Skinner, A.S. (Hrsg.), Glasgow Edition of the Works and Correspon‐ dence of Adam Smith, Bd. 2, Oxford. Kurzzitat: WN. Smith, Adam, 1977: Correspondence of Adam Smith. In: Mossner, E.C. und Ross, I.S. (Hrsg.), Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, Bd. 6, Ox‐ ford. Kurzzitat: Corr.
192
Smith, Adam, 1978: Lectures on Jurisprudence. In: Meek, R.L., Raphael, D.D. und Stein, P.G. (Hrsg.), Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, Bd. 5, Ox‐ ford. Kurzzitat: LJ. Smith, Adam, 1980: The History of Astronomy. In: Wightman, W.P.D und Bryce, J.C. (Hrsg.), Essays on Philosophical Subjects, Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, Bd. 3, Oxford. Kurzzitat: EPS. Smith, Adam, 1983: Lectures on Rhetoric and Belles Lettres. In: Bryce, J.C. (Hrsg.), Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, Bd. 4, Oxford. Kurzzitat LRBL. Sturn, Richard, 2006: Subjectivism, Joint Consumption and the State: Public Goods in Staats‐ wirtschaftslehre. In: The European Journal of the History of Economic Thought, 13, 1, S. 39-67. Sturn, Richard, 2010: Public goods‘ before Samuelson: Interwar Finanzwissenschaft and Musgrave’s Synthesis. In: The European Journal of the History of Economic Thought, 17, 2, S. 279-312. Sturn, Richard, 2016: „Sozialpolitik und Identität: Die liberale Meritorik Alexander Rüs‐ tows“. In: Dörr, Julian/Goldschmidt, Nils/Kubon-Gilke, Gisela/Sesselmeier, Werner (Hrsg.), Vitalpolitik, Inklusion und der sozialstaatliche Diskurs: Theoretische Reflexionen und sozialpolitische Implikationen, Münster, S. 185-198. Viner, Jacob, 1927: Adam Smith and Laissez Faire. In: Journal of Political Economy 35:2, S. 198-232. Winch, Donald, 1978: Adam Smith’s Politics. Cambridge.
193
Michael S. Aßländer Adam Smith und die Soziale Marktwirtschaft: Die Frage nach den Funktionsbedingungen der liberalen Ordnung
1. Einleitung Auf den ersten Blick scheinen der „Wealth of Nations“, das wohl bekannteste Buch Adam Smiths, und das Konzept der sozialen Marktwirtschaft nur wenig miteinander gemein zu haben. So gilt vielen heutigen Ökonomen Adam Smith vor allem als Apologet des Freihandels und als Vertreter eines frühen Wirtschaftsliberalismus.1 Dabei sind es vor allem die Vertreter der so genannten Chicago School und des Neo‐ liberalismus, die sich bei ihren Forderungen nach Freihandel und staatlicher Deregu‐ lierung auf Adam Smith berufen zu können glauben. Zentrales Argument für derarti‐ ge Forderungen ist die von Smith in die Metapher der invisible hand2 gekleidete An‐ nahme, dass ein sich selbst überlassener Markt stets das bestmögliche Ergebnis her‐ vorbringe. So beschreibe die invisible hand einen der Wirtschaft selbst innewohnen‐ den Mechanismus, der stets dazu führe, dass die scheinbar widerstreitenden Interes‐ sen der unterschiedlichen Wirtschaftsakteure zum Ausgleich gebracht werden und ihr rein egoistisches Streben zum Wohle aller wirksam werde. Jedes Eingreifen des Staates, so die Schlussfolgerung des Neoliberalismus, würde diesen Mechanismus hemmen und so das Marktergebnis verzerren. Da der Allokationsmechanismus der Märkte aber generell zu besseren Ergebnissen führe, als dies durch das Eingreifen staatlicher Instanzen erreicht werden könne, müssen wir mitunter auch Marktergeb‐ nisse akzeptieren, die uns unter sozialpolitischen Gesichtspunkten bedenklich er‐ scheinen.3 Nicht zuletzt mit Berufung auf Adam Smith fordert der Neoliberalismus daher die Deregulierung von Märkten, den Abbau von Marktzugangsbeschränkun‐ gen, die Aufhebung kartell- und arbeitsrechtsrechtlicher Bestimmungen und eine möglichst zurückhaltende staatliche Wirtschaftspolitik. Demgegenüber steht das Konzept der sozialen Marktwirtschaft, das sich explizit als Dritter Weg zwischen sozialistischer Planwirtschaft und Laissez-Faire Kapitalis‐ mus versteht und der seitens des Liberalismus postulierten segensreichen Wirkung sich selbst überlassener Märkte zutiefst misstraut.4 Allerdings gilt es zu beachten, 1 2 3 4
Hill 2016, S. 321. Smith 2005, S. 371. Hayek 1994, S. 11ff. Aßländer 2009, S. 228 f.
195
dass das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft selbst kein geschlossenes Theorien‐ gebäude darstellt, sondern durch Beiträge unterschiedlicher Autoren geformt wur‐ de.5 Einigkeit unter den Autoren besteht jedoch darüber, dass das Konzept der So‐ zialen Marktwirtschaft nicht ausschließlich als Theorie einer Wirtschaftsordnung zu sehen sei, sondern zugleich auch als ein Gesellschaftsentwurf verstanden werde müsse, der die Elemente Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Eigenverantwortung miteinander in Einklang zu bringen sucht. Letztlich, so die dieser Vorstellung zu‐ grunde liegende Annahme, sei eine lebensdienliche Wirtschaftsordnung ohne ihre Einbettung in ein gesellschaftliches Ganzes nicht denkbar.6 Da sich selbst überlasse‐ ne Märkte dazu tendieren, schwächere Marktteilnehmer zu benachteiligen und Mo‐ nopolisierungstendenzen Vorschub zu leisten und so den Wettbewerb aufzuheben, wird der Gedanke eines geordneten Wettbewerbs zum zentralen Element innerhalb der Theorie der Sozialen Marktwirtschaft. Um zum Wohle aller zu wirken, bedürften die Märkte einer Wettbewerbsordnung, die zum einen die negativen Auswirkungen der Konkurrenz dämpft, zugleich aber das Marktsystem vor seiner selbstzerstöreri‐ schen Kraft schützt.7 So gesehen scheinen beide wirtschaftstheoretische Konzepte nur wenig miteinan‐ der gemein zu haben. Während Adam Smith scheinbar davon ausgeht, dass eine dem Marktgeschehen selbst innewohnende prästabilierte Harmonie dieses stets zum Wohle aller wirksam werden lässt, äußern die Theoretiker der Sozialen Marktwirt‐ schaft grundsätzliche Zweifel an dieser Wirkung und plädieren für eine staatliche Ordnung und einen gezügelten Wettbewerb. Jedoch offenbart eine genauere Analy‐ se, dass auch Adam Smith nur bedingt an die segensreiche Wirkung einer sich selbst überlassenen Ökonomie glaubt. Für ihn bedarf es grundsätzlich einer moralischen Steuerung menschlichen Verhaltens, auch in wirtschaftlichen Belangen. Grundsätze der Gerechtigkeit und des fairen Wettbewerbs bilden für ihn die unabdingbare Grundvoraussetzung des Wirtschaftens. Nicht zu Unrecht wählt Gerhard Streminger für seine 2017 neu erschienene Adam Smith Biographie den Untertitel „Wohlstand und Moral“ und kommt zu dem Schluss: „Wenn man schon eine Schubladisierung versucht, dann war Smith liberal im Sinne der sozialen Marktwirtschaft und nicht im Sinne des neoliberalen Gesellschaftsverständnisses, das große Teile der heutigen Wirtschaftspolitik bestimmt“8. Wenn es im Folgenden also darum gehen soll, das Thema „Adam Smith und die Soziale Marktwirtschaft“ zu behandeln, ist es nicht das Anliegen dieses Beitrages, Adam Smith als „Vordenker“ einer sozialen Marktwirtschaft zu präsentieren. Viel‐ mehr soll es darum gehen, die sowohl für Adam Smith als auch für die ordoliberalen 5 6 7 8
Ulrich 2009, S. 352-365. Röpke 1979 a, S. 161 f.; Müller-Armack 1948 a, S. 104; Eucken 1990, S. 338. Barry 1989, S. 114 f. Streminger 2017, S. 188.
196
Vordenker des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft zentrale Frage nach den Funktionsbedingungen einer liberalen Wirtschaftsordnung zu beantworten. Im Fokus stehen dabei zum ersten die Moral der Wirtschaftsakteure als grundsätzliche Vorbe‐ dingung einer Wettbewerbswirtschaft, zum zweiten die Frage von Freiheit und Wett‐ bewerb und zum dritten schließlich das Problem der sozialen Gerechtigkeit. Hierbei zeigt eine genauere Analyse, dass die Vorstellungen Adam Smiths keineswegs einem kruden Laissez-Faire Kapitalismus Vorschub leisten, sondern durchaus vieles mit den Vorstellungen des Ordoliberalismus und der Vordenker einer sozialen Markt‐ wirtschaft gemeinsam haben.
2. Moral als Grundlage der Wirtschaft Für Smith ist der Mensch ein von Natur aus moralfähiges Wesen, das ein grundsätz‐ liches Interesse am Wohlergehen seiner Mitmenschen hat: „Man mag den Menschen für noch so egoistisch halten, es liegen doch offenbar gewisse Prinzipien in seiner Natur, die ihn dazu bestimmen, an dem Schicksal anderer Anteil zu nehmen, und die ihm selbst die Glückseligkeit dieser anderen zum Bedürfnis machen, obgleich er keinen anderen Vorteil daraus zieht, als das Vergnügen, Zeuge davon zu sein“.9
Da wir von Natur aus dazu befähigt sind, uns in die Lage unserer Mitmenschen hin‐ einzuversetzen, sind wir auch in der Lage, unser Verhalten an der Reaktion aller an‐ deren zu messen und auf seine Akzeptanz hin zu überprüfen. Mit der Figur des im‐ partial spectator führt Adam Smith die Denkfigur eines idealen, neutralen, inneren „Richters“ ein, mit dessen Hilfe jeder Einzelne selbst dazu in die Lage versetzt wird, sein Verhalten im Spiegel des Urteils der anderen zu beurteilen.10 Im Prozess einer idealen Rollenübernahme schlüpft der Mensch gleichsam selbst in die Rolle des Richters und überprüft die Angemessenheit einer Handlung aus Sicht seiner Mit‐ menschen.11 Diese neutrale Instanz des inneren Richters, so glaubt Adam Smith, er‐ laubt es uns, uns so zu verhalten, dass dieses Verhalten von allen anderen gebilligt werden kann. Dennoch betrachtet Smith den Menschen nicht als reinen Altruisten, der stets nur am Wohle seiner Mitmenschen interessiert ist. Selbstliebe und das Streben nach ma‐ teriellem Wohlergehen erweisen sich als durchaus ebenso starke Triebfedern für menschliches Verhalten,12 wie das Interesse am Wohlergehen anderer. Allerdings sorge der unparteiische Zuschauer eben dafür, dass wir unsere egoistischen Neigun‐ 9 10 11 12
Smith 2004, S. 1. Smith 2004, S. 166ff. Smith 2004, S. 170 f. Smith 2004, S. 310-315; 2005, S. 283.
197
gen zügeln, da diese von der Gesellschaft nur bis zu einem gewissen Grade toleriert werden. So ist es letztendlich die Furcht vor Missbilligung, die unser selbstsüchtiges Verhalten in die Schranken weist13: „Mag es darum auch wahr sein, dass jedes Individuum in seinem Herzen naturgemäß sich selbst der ganzen Menschheit vorzieht, so wird es doch nicht wagen, den anderen Menschen in die Augen zu blicken und dabei zu gestehen, dass es diesem Grundsatz ge‐ mäß handelt. Jeder fühlt vielmehr, dass die anderen diesen seinen Hang, sich selbst den Vorzug zu geben, niemals werden nachfühlen können…“.14
Doch trotz dieser generellen Absage an rein eigennützig motiviertes Handeln ent‐ wirft Adam Smith bereits in seiner „Theory of Moral Sentiments“ eine Moral, die das Eigeninteresse der Kaufleute als Motor wirtschaftlichen Handelns durchaus po‐ sitiv konnotiert,15 zugleich jedoch darum bemüht ist, Selbstliebe nicht zu Egoismus verkommen zu lassen. Er erkennt, dass das Streben nach eigenen Vorteilen ein star‐ kes Handlungsmotiv ist. Dank einer geschickten Täuschung der Natur führe dieses Streben des Einzelnen nach Reichtum und Wohlstand jedoch dazu, dass dieser sich zum Wohle der Gemeinschaft anstrengt, während er glaubt, nur seinem eigenen Wohl zu dienen: „Denn diese Täuschung ist es, was den Fleiß der Menschen erweckt und in beständiger Bewegung erhält. Sie ist es, was sie zuerst antreibt, den Boden zu bearbeiten, Häuser zu bauen, Städte und staatliche Gemeinwesen zu gründen, alle die Wissenschaften und Künste zu erfinden und auszubilden, die das menschliche Leben veredeln und verschö‐ nern…“.16
Diese Vorstellung einer Täuschung der Natur kleidet Smith in die berühmt geworde‐ ne Metapher der invisible hand, die quasi als Automatismus die egoistischen Bestre‐ bungen aller Einzelnen in die richtigen Bahnen lenke. Als sozialer Ausgleichsme‐ chanismus sorgt sie dafür, dass dank der Launen der Reichen Wohlstand erzeugt wird und dieser gerecht verteilt wird;17 als ökonomischer Ausgleichsmechanismus führt sie dazu, dass das Streben nach individuellem ökonomischen Erfolg zur opti‐ malen Ressourcenallokation und damit zum Wohle der Gemeinschaft beiträgt.18 Für Adam Smith sind es somit zwei natürliche Mechanismen, die das egoistische Vorteilsstreben des Einzelnen regulieren: Zum einen ist dies der impartial spectator, der dafür Sorge trägt, dass wir unseren Egoismus auf ein gesundes Maß dämpfen, da wir die Achtung unserer Mitmenschen nicht verlieren wollen; zum anderen ist es der Mechanismus der invisible hand, der unsere Anstrengungen zur Verbesserung des 13 14 15 16 17 18
198
Aßländer 2007, S. 141 f. Smith 2004, S. 123. Mehta 2006, S. 250 f. Smith 2004, S. 315. Smith 2004, S. 315ff. Smith 2005, S. 370 f.
eigenen Wohlergehens stets auch für die Gemeinschaft wirksam werden lässt.19 So sind es für Smith also die Fähigkeit zur Sympathie und das Streben des Menschen nach Wohlstand, die als zwei sich ergänzende Grundprinzipien die gesellschaftliche Ordnung im Gleichgewicht halten.20 Einem rein auf materiellem Vorteilsstreben ba‐ sierenden Wirtschaftssystem erteilt Smith hingegen eine klare Absage.21 Letztlich kann für ihn eine Ökonomie nur auf Grundlage moralischer Tugenden gedeihen und nicht umgekehrt.22 Trotz der Beobachtung, dass Menschen nach ihrem eigenen Vor‐ teil streben, sieht Smith ein derartiges Verhalten moralisch daher nur in gewissem Maße gerechtfertigt: „Das Glück eines anderen zerstören, nur weil es unserem eigenen im Wege steht, ihm zu nehmen, was ihm wirklich nützlich ist, nur weil es für uns ebenso nützlich oder noch nützlicher sein kann, das wird kein unparteiischer Zuschauer gutheißen können – er wird es so wenig gutheißen können, wie jede andere Handlung, bei der sich der Mensch jenem natürlichen Hange hingibt, sein eigenes Glück dem Glück aller anderen vorzuziehen und auf deren Kosten zu befriedigen“.23
In der Vorstellungswelt der ordoliberalen Vordenker der Sozialen Marktwirtschaft ist Wirtschaft Teil der Gesellschaft und muss mit dieser zusammengedacht werden. Wilhelm Röpke24 spricht hier von einem der Wirtschaft „widergelagerten Gesell‐ schaftssystem“, in dem zentrale ethische Grundwerte, wie Freiheit, soziale Gerech‐ tigkeit und Eigenverantwortung, zur Geltung gebracht werden.25 Dabei ist die wirt‐ schaftliche Ordnung stets auf eine vorgängige Moral der Wirtschaftsakteure ange‐ wiesen. Moralische Werte können von der Wirtschaft selbst nicht hervorgebracht werden und müssen daher der Wirtschaft von außen vorgegeben werden.26 „Menschen, die auf dem Markte sich miteinander im Wettbewerb messen und dort auf ihren Vorteil ausgehen, müssen umso stärker durch die sozialen und moralischen Bande der Gemeinschaft verbunden sein, andernfalls auch der Wettbewerb aufs schwerste entar‐ tet“.27
Da sich das Wirtschaftsleben nicht im moralischen Vakuum abspielt,28 sind morali‐ sche Werte unerlässlich für das Funktionieren eines Wirtschaftssystems. Jedoch le‐ gen die Väter der Sozialen Marktwirtschaft kein geschlossenes System der Moral‐ philosophie vor. Vielmehr rekurrieren sie auf gesellschaftlich allgemein anerkannte 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Streminger 2017, S. 80 f. Berry 2006, S. 125 f. Smith 2004, S. 510-523. Aßländer 2006, S. 215. Smith 2004, S. 122. Röpke 1979 b, S. 85. Aßländer 2011, S. 206. Müller-Armack 1948 a, S. 104. Röpke 1979 a, S. 146. Röpke 1979 a, S. 184.
199
Wertvorstellungen, die die „bürgerliche Grundlage der Marktwirtschaft“29 bilden sollen: „Selbstdisziplin, Gerechtigkeitssinn, Ehrlichkeit, Fairness, Ritterlichkeit, Maßhalten, Ge‐ meinsinn, Achtung vor der Menschenwürde des anderen, feste sittliche Normen – das al‐ les sind Dinge, die die Menschen bereits mitbringen müssen, wenn sie auf den Markt ge‐ hen und sich im Wettbewerb miteinander messen“.30
Zwar ist das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft auch als Versuch zu sehen, der mangelnden Moral der Wirtschaftsakteure durch die Ausgestaltung einer entspre‐ chenden rechtlichen Rahmenordnung des Wirtschaftens entgegenzuwirken. So etwa soll eine gerechte Einkommensverteilung nicht primär dem Wohlwollen der einzel‐ nen Gesellschaftsmitglieder anheimgestellt sein, sondern mittels der Ausgestaltung eines entsprechenden Steuerrechts, das von selbst für eine gewisse Umverteilung der Vermögen sorgt, durchgesetzt werden.31 Doch selbst Walter Eucken, der weit mehr als andere Vertreter des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft auf die Steuerungs‐ funktion der Wettbewerbsordnung vertraut, bleibt gegenüber einer moralfreien Wirt‐ schaft skeptisch. So dürfe sich der Einzelne auch in wirtschaftlichen Belangen nicht ausschließlich egoistisch verhalten, da dies die Gemeinschaft schädige.32 Allerdings seien wirtschaftliches Prinzip und eigennütziges Verhalten strikt voneinander zu un‐ terscheiden: „Die dauernde Vermischung von ‚Egoismus’ und ‚wirtschaftlichem Prinzip’ ist der Krebsschaden der ganzen Diskussion über diesen wichtigen Pro‐ blemkomplex“33. Ähnlich wie auch Adam Smith sehen also die Väter der sozialen Marktwirtschaft, dass sich das egoistische Verhalten in wirtschaftlichen Belangen als schädlich für die Gesellschaft erweisen kann und daher der Moral auch im Wirtschaftsleben eine zen‐ trale Bedeutung zukommt. Doch während Smith hier – vielleicht etwas zu optimis‐ tisch – auf die affektdämpfende Wirkung des impartial spectator vertraut, setzt Wil‐ helm Röpke auf die Gesinnungsethik einer nobilitas naturalis, die als gesellschaftli‐ ches Vorbild zu dienen habe: „Von entscheidender Bedeutung (…) ist es, dass es in der Gesellschaft eine wenn auch kleine, so doch tonangebenden Gruppe von Führenden gibt, die sich im Namen des Gan‐ zen für die unantastbaren Normen und Werte verantwortlich fühlen und selber diese Ver‐ antwortung aufs strengste nachleben. Was wir (…) heute (…) dringender denn je brau‐ chen, ist eine echte Nobilitas naturalis (…), eine Elite, die ihren Adelstitel nur aus höchs‐ ter Leistung und unübertrefflichem moralischen Beispiel herleitet…“.34
29 30 31 32 33 34
200
Röpke 1979 a, S. 154. Röpke 1979 a, S. 186. Eucken 1949, S. 72 f.; Eucken 1990, S. 300 f. Eucken 1990, S. 354. Eucken 1990, S. 352. Röpke 1979 a, S. 192
Wenngleich die Vorstellung derartiger „Aristokraten des Gemeinsinns“35 wohl schon zu der Zeit, zu der sie formuliert wurde, als überholt gegolten haben dürfte, zeigt sie doch die zentrale Bedeutung, die Röpke und andere Vordenker der Sozialen Markt‐ wirtschaft der Individualmoral beimessen. So betont auch Alfred Müller-Armack, dass zwar die wirtschaftliche Sphäre eigenen Gesetzmäßigkeiten folge, dass damit aber nicht „die Notwendigkeit eines übergreifenden Rechts sozialer, staatlicher und geistiger Werte entfiele“36. Trotz der weitgehend positiven Sicht des Wettbewerbes als bestes Mittel, nicht nur den „Wohlstand der Nationen“37 zu fördern, sondern „Wohlstand für alle“38 zu schaffen, bleibt dieses Mittel auf die Moral der Wirt‐ schaftsakteure angewiesen, um seine positive Wirkung zu entfalten. „Die Wahrheit ist eben, dass derselbe Wettbewerb, den wir zur Regulierung einer freien Wirtschaftsordnung voraussetzen, nach allen Seiten an einen Rand stößt, dessen Über‐ schreitung wir nicht wünschen können. Er bleibt eine moralisch und sozial gefährliche Weise des Verhaltens, die nur in einer gewissen Maximaldosierung und mit Dämpfungen und Moderierungen aller Art verteidigt werden kann“.39
3. Freiheit und Wettbewerb Das Thema der bürgerlichen Freiheit stellt sowohl im Bereich der Politik als auch im Bereich der Ökonomie eines der zentralen Themen der Aufklärung dar.40 Smiths Ruf als Vordenker eines Wirtschaftsliberalismus begründet sich dabei vor allem durch seine Kritik an der zu seiner Zeit vorherrschenden Wirtschaftspolitik des Merkanti‐ lismus und der damit einhergehenden Beschränkungen des Handelsverkehrs. Das Ziel des Merkantilismus, mittels gezielter Exportförderung und Importbeschränkun‐ gen möglichst viel Geld ins eigene Land fließen zu lassen, hält Smith für unsinnig.41 Dies führe letztlich dazu, dass Waren im Inland teurer hergestellt werden müssen als sie aus dem Ausland hätten bezogen werden können. Eine derartige Wirtschaftspoli‐ tik fördere so nicht den allgemeinen Wohlstand, sondern diene allenfalls den Parti‐ kularinteressen der inländischen Produzenten. Sarkastisch bemerkt Smith: „In Treibhäusern, Mistbeeten und mit erwärmtem Mauerwerk lassen sich auch in Schott‐ land recht gute Trauben ziehen und daraus auch sehr gute Weine keltern, nur würden sie etwa dreißigmal so viel kosten wie ein zumindest gleich guter aus dem Ausland. Wäre es
35 36 37 38 39 40 41
Röpke 1979 a, S. 193. Müller-Armack 1948 a, S. 86. Smith 2005. Erhard 1957. Röpke 1979 a, S. 189. Aßländer 2008. Smith 2005, S. 366 f.
201
also sinnvoll, jegliche Einfuhr von ausländischem Wein durch Gesetz zu verbieten, nur um den Anbau von Klarett und Burgunder in Schottland anzuregen?“.42
In der Beschränkung des Handels sieht Smith eine der größten Bedrohungen für den Wohlstand der Nationen. Zum einen deshalb, da Handelsbeschränkungen dazu füh‐ ren, inländische Waren zu verteuern; denn, wenn diese im Inland billiger als im Aus‐ land hergestellt werden könnten, würde man nicht importieren; würden Waren je‐ doch im Ausland billiger erzeugt, führten Einfuhrbeschränkung zu einer unbilligen, künstlichen Verteuerung dieser Waren im Inland.43 Zum anderen geht Smith davon aus, dass eine arbeitsteilig organisierte Produktion produktiver ist, so dass Waren tendenziell billiger angeboten werden können. Dabei hängt der Grad der möglichen Arbeitsteilung und Spezialisierung jedoch von der Größe der Absatzmärkte ab, da eine gewerbliche Spezialisierung nur bei entsprechend großer Nachfrage Sinn macht.44 Es gelte mithin, Handelshemmnisse, die einer Vergrößerung der Märkte und damit der Ausweitung arbeitsteiliger Produktion entgegenstehen, abzubauen und internationalen Wettbewerb im Handel zuzulassen. Doch auch gegenüber den zahlreichen Einzelbeschränkungen des Wirtschaftens, wie etwa eine Armengesetzgebung, die eine Wiederaufnahme von Beschäftigung eher behindert als fördert,45 oder ein Zunftwesen, dass durch künstliche Zulassungs‐ beschränkungen eine freie Berufswahl einengt und so Wettbewerb verhindert,46 äu‐ ßert Smith heftige Kritik: „Das Eigentum, das jeder Mensch an seiner Arbeit besitzt, ist in höchstem Maße heilig und unverletzlich, weil es im Ursprung alles andere Eigentum begründet. Das Erbe eines armen Mannes liegt in der Kraft und in dem Geschick seiner Hände, und ihn daran zu hindern, beides so einzusetzen, wie er es für richtig hält, ohne dabei seinen Nachbarn zu schädigen, ist eine offene Verletzung dieses heiligen Eigentums, offenkundig ein Über‐ griff in die wohlbegründete Freiheit des Arbeiters und aller anderen, die bereit sein mö‐ gen, ihn zu beschäftigen“.47
Freihandel, der Abbau des Zunftwesens, die Gewährung von Freizügigkeit und frei‐ er Berufswahl sowie Ermöglichung freier Preisbildung sind für Smith die Vorausset‐ zungen eines funktionsfähigen Wettbewerbs. Die zahlreichen Eingriffe der merkanti‐ len Politik führen jedoch dazu, dass in einzelnen Gewerben die Konkurrenz nahezu aufgehoben wird, in anderen Bereichen künstliche Konkurrenz geschaffen wird und durch die Beschränkung der Berufswahl und der Freizügigkeit künstliche Arbeitslo‐ sigkeit erzeugt wird.48 Doch sind es nicht nur die ökonomischen Nachteile derartiger 42 43 44 45 46 47 48
202
Smith 2005, S. 373. Smith 2005, S. 371. Smith 2005, S. 19. Smith 2005, S. 117ff. Smith 2005, S. 104ff. Smith 2005, S. 106. Smith 2005, S. 103-125.
Beschränkungen, die Smiths Empörung hervorrufen. Das Recht des Einzelnen, seine Kräfte so zu gebrauchen, wie es ihm am sinnvollsten erscheint, und sein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten, ist für Smith auch ein moralisches Recht, dass er dem Recht auf freie Religionsausübung gleichstellt, da es im Interesse jedes einzelnen Menschen liege, sich um sein diesseitiges und sein jenseitiges Glück zu sorgen.49 Daher sind es für Smith nicht zuletzt auch moralische Gründe, die sich ge‐ gen Handelsbeschränkungen und Zunftverordnungen anführen lassen: „Einen Landwirt daran zu hindern, seine Erzeugnisse jederzeit auf den günstigsten Markt zu bringen, heißt augenscheinlich außerdem, das allgemein gültige Gesetz der Gerechtig‐ keit einer Idee der Gemeinnützigkeit, einer Art Staatsräson zu opfern. Es handelt sich um einen Akt gesetzgebender Gewalt, die nur in äußersten Notfällen ausgeübt werden sollte und auch nur dann entschuldbar ist“.50
Das moralisch und das ökonomisch Beste für die Gesellschaft eines Landes lässt sich in den Augen Smiths daher am ehesten innerhalb einer Ordnung der natürlichen Freiheit verwirklichen. Aus ökonomischer Sicht spricht hierfür, dass jede Beschrän‐ kung der Wirtschaft tendenziell mehr Schaden anrichtet als Nutzen stiftet, und aus moralischer Sicht scheint Wirtschaftsfreiheit gerade deshalb geboten, da es das Recht des Einzelnen garantiert, seine Kräfte nach bestem Wissen und Gewissen zum eigenen Vorteil zu gebrauchen. Allerdings ist die Ausübung dieses moralischen Rechts der persönlichen Freiheit begrenzt durch die Billigung der Gesellschaft und des impartial spectator: „In dem Wettlauf nach Reichtum, Ehre und Avancement, da mag er rennen, so schnell er kann und jeden Nerv und jeden Muskel anspannen, um all seine Mitbewerber zu überho‐ len. Sollte er aber einen von ihnen niederrennen oder zu Boden werfen, dann wäre es mit der Nachsicht der Zuschauer ganz und gar zu Ende. Das wäre eine Verletzung der ehrli‐ chen Spielregeln, die sie nicht zulassen können. Der andere ist für sie in jeder Hinsicht so gut wie dieser; sie stimmen jener Selbstliebe nicht zu, in der er sich selbst zu hoch über den anderen stellt, und sie können die Motive nicht nachfühlen, die ihn bewogen, den an‐ deren zu Schaden zu bringen“.51
Auch für die Väter der Sozialen Marktwirtschaft stellt Freiheit ein zentrales Thema in ihrer ordnungspolitischen Konzeption dar. Dabei sehen sie die Freiheit in wirt‐ schaftlichen Belangen nicht durch eine merkantilistische Politik bedroht, sondern vor allem durch die nicht minder schädlichen Versuche einer staatlich gelenkten Zentralwirtschaft, wirtschaftliche Allokationsprobleme mittels staatlicher Planung zu lösen. Zentrale Planung führe jedoch notwendig zur Aufhebung wesentlicher wirtschaftlicher Freiheitsrechte, wie Gewerbefreiheit, Freizügigkeit oder freier Be‐ rufswahl. Vor diesem Hintergrund betrachten die Väter der Sozialen Marktwirtschaft 49 Smith 2005, S. 451. 50 Smith 2005, S. 451. 51 Smith 2004, S. 124.
203
die Marktwirtschaft als bestgeeignetstes Instrument, um eine möglichst optimale Güterversorgung mit dem Imperativ wirtschaftlicher Freiheit in Einklang zu brin‐ gen.52 Auch in dieser Konzeption wird Freiheit zu einem moralischen Recht, dem im Zweifel Vorrang vor ökonomischen Zielsetzungen wie Wirtschaftswachstum oder Vollbeschäftigung einzuräumen ist.53 „Es hat sich herausgestellt, dass wir Menschen des Abendlandes nicht die Freiheit haben, uns für ein kollektivistisches System zu entscheiden, da es kein funktionierendes Ord‐ nungs- und Antriebssystem verbürgt, das mit Freiheit und internationaler Gemeinschaft vereinbar wäre. Es bleibt uns nur die Marktwirtschaft“.54
Da Freiheit in den Augen der ordoliberalen Denker einen gesellschaftlichen Wert an sich darstellt, der vorgängig zur Ausgestaltung der ökonomischen Ordnung existiert, und den es unter allen Umständen zu verteidigen gilt, wäre ein Wirtschaftssystem, das auf den Grundsätzen von Eigeninitiative, freier wirtschaftlicher Betätigung und Eigenverantwortung der Marktakteure aufbaut, selbst dann vorzugswürdig, wenn es sich hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit als der Planwirtschaft unterlegen erweisen würde. Freiheit wird so in den Augen der Väter der Sozialen Marktwirtschaft zu einem wirtschaftlichen Grundrecht, da nur ein System weitge‐ hend freier Märkte der Aufrechterhaltung eines leistungsbezogenen Wettbewerbs, als wichtigsten Garanten des wirtschaftlichen Fortschritts, aber auch der Planungs‐ autonomie der Haushalte und Unternehmen dienen könne.55 „Konsumfreiheit und die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung müssen in dem Be‐ wusstsein jedes Staatsbürgers als unantastbare Grundrechte empfunden werden. Gegen sie zu verstoßen, sollte als ein Attentat auf unsere Gesellschaftsordnung geahndet wer‐ den“.56
Allerdings birgt die Garantie der Wirtschaftsfreiheit das Problem, dass diese dazu missbraucht werden kann, die Freiheitsrechte anderer durch ökonomische Machtaus‐ übung zu beschränken und dies vor allem zu Lasten schwächerer Marktteilnehmer gehe.57 Freiheit bedarf daher auch einer gewissen Ordnung, die verhindert, dass Freiheitsrechte einseitig ausgenutzt und so die Freiheit der anderen beschnitten wird. Während es dem Ordoliberalismus also zum einen darum geht, Freiheit als gesell‐ schaftlichen Wert gegen zentralistische Systeme zu verteidigen, sehen seine Vertre‐ ter zum anderen die Gefahr, dass die Gewährung absoluter wirtschaftlicher Freiheit im Sinne eines Laissez-Faire Kapitalismus mangels staatlicher Kontrolle mitunter zu sozial nicht erwünschten Ergebnissen führt. Es bedarf daher eines Ordnungsrah‐ 52 53 54 55 56 57
204
Röpke 1994, S. 331 f.; Müller-Armack 1948 b, S. 86. Müller-Armack 1962, S. 20. Röpke 1994, S. 329. Vgl. Eucken 1949, S. 22 f.; Eucken 1990, S. 245 f. Erhard 1957, S. 14. Eucken 1949, S. 5ff.
mens, der dazu dient, die Ausübung wirtschaftlicher Freiheit zu kontrollieren, schwächere Marktteilnehmer gegen die Marktmacht stärkerer Marktteilnehmer zu schützen und im Zweifel mittels staatlicher Ausgleichsmechanismen sozial uner‐ wünschte Fehlallokationen auf Märkten zu korrigieren. „Wie der Rechtsstaat, so soll auch die Wettbewerbsordnung einen Rahmen schaffen, in dem die freie Betätigung des einzelnen durch die Freiheitssphäre des anderen begrenzt wird und so die menschlichen Freiheitsbereiche ins Gleichgewicht gelangen“.58
Nur mittels einer Wettbewerbsordnung sei es möglich, „soziale Anliegen“, wie Schutz vor wirtschaftlicher Benachteiligung, Vermeidung unbilliger wirtschaftlicher Härten etc., innerhalb einer Marktwirtschaft zur Geltung zu bringen. Aufgabe staatli‐ cher Ordnungspolitik sei es daher, den Wettbewerb als effizienten Verteilungsmecha‐ nismus aufrecht zu erhalten, zugleich aber dort regulierend einzugreifen, wo der Wettbewerb zu sozial unerwünschten Ergebnissen führen muss. Damit grenzt sich der Ordoliberalismus deutlich von den wirtschaftsliberalen Vorstellungen des Neoli‐ beralismus ab, der wirtschaftliche Freiheitsrechte auch dort verteidigt, wo diese zu sozial unerwünschten Ergebnissen führen. Obwohl sowohl Adam Smith als auch die Vordenker der Sozialen Marktwirt‐ schaft Wirtschaftsfreiheit als ein Grundrecht verteidigen und dabei sowohl ökonomi‐ sche als auch moralische Argumente ins Feld führen, vertreten weder Smith noch die ordoliberalen Denker der Sozialen Marktwirtschaft wirtschaftliche Freiheit als Selbstzweck. So warnt Wilhelm Röpke ausdrücklich vor einer „Ökonomokratie“59, in der die Wirtschaft, mit Verweis auf ökonomische Freiheitsrechte, Politik und Ge‐ sellschaft nach ihren Zwecken auszugestalten beginne. Die Gewährung wirtschaftli‐ cher Freiheit fördere zwar Eigeninitiative und wirtschaftlichen Leistungswillen, zu‐ gleich aber bedürfe es eines ordnenden Rahmens, der dafür Sorge trage, dass die freie wirtschaftliche Betätigung auch den sozialen Zielsetzungen der Gesellschaft diene. Wesentlich stärker als Adam Smith sehen die Vertreter des Ordoliberalismus die Notwendigkeit, die Ausübung wirtschaftlicher Freiheitsrechte einer Rahmenord‐ nung zu unterstellen, die diese Freiheitsrechte zwar garantiert, zugleich aber dafür Sorge trägt, dass diese nicht missbraucht werden. Smith hingegen bleibt Optimist. Obwohl er an der moralischen Integrität von Kaufleuten grundsätzlich gewisse Zweifel hegt und durchaus eine Tendenz der commercial society erkennt, aus ge‐ schäftlichem Interesse Einfluss auf Politik und Gesetzgebung zu nehmen,60 glaubt er doch auch hier an die moralische Kraft des impartial spectator, die die gewährten Freiheiten in die Bahnen eines fairen Wettbewerbs lenken würde. So ist der Mensch in den Augen Smiths gerade deshalb dazu befähigt in Freiheit zu leben, weil er
58 Eucken 1990, S. 250. 59 Röpke 1979 a, S. 214. 60 Smith 2005, S. 112, 407ff.
205
durch seine Fähigkeit zum Respekt gegenüber anderen und seine Anteilnahme am Wohle der anderen hierfür disponiert ist.61
4. Gerechtigkeit und sozialer Ausgleich Gerechtigkeit ist in den Augen Adam Smiths die zentrale Säule einer jeden Gesell‐ schaft. So mag eine Gesellschaft ohne Nächstenliebe und Wohlwollen existieren können, wie dies beispielsweise bei den Zusammenschlüssen von Kaufleuten der Fall sei, die vor allem vom Kalkül wechselseitiger Nützlichkeit zusammengehalten würden. Das Fehlen jedweder Grundsätze der Gerechtigkeit aber würde zwangsläu‐ fig zur Auflösung der Gesellschaft führen:62 „Wenn es eine Gesellschaft zwischen Räubern und Mördern gibt, dann müssen sie, einem ganz alltäglichen Gemeinplatz zufolge, sich wenigstens des Raubens und Mordens unter‐ einander enthalten. Wohlwollen und Wohltätigkeit ist daher für das Bestehen der Gesell‐ schaft weniger wesentlich als Gerechtigkeit. Eine Gesellschaft kann ohne Wohltätigkeit weiter bestsehen, wenn auch freilich nicht in einem besonders guten und erfreulichen Zu‐ stande, das Überhandnehmen der Ungerechtigkeit dagegen müsste sie ganz und gar zer‐ stören“.63
Während Smith in seiner „Theorie der ethischen Gefühle“ vor allem über unseren Gerechtigkeitssinn reflektiert, zieht er im „Wohlstand der Nationen“ weitaus prakti‐ schere Schlussfolgerungen. Hier ist es die Aufgabe des Staates, Ungerechtigkeiten unter allen Umständen zu verhindern,64 da Gerechtigkeit die Grundvoraussetzung für Prosperität und Wohlstand ist. Smith betrachtet den Begriff der Gerechtigkeit dabei auf unterschiedliche Weise. Als moralische Größe ist Gerechtigkeit verknüpft mit unserem Gefühl von Fairness und Billigkeit und beschreibt, was unter gegebenen Umständen allgemein als ange‐ messene Behandlung anzusehen ist. Verbunden damit ist das Schuldgefühl, das dem eigenen Fehlverhalten folgt und damit auch das zu erduldende Strafmaß als gerecht erscheinen lässt.65 Auf Ebene der staatlichen Ordnung hingegen geht es um die Wahrung der Gerechtigkeit mittels Gesetzgebung und Rechtsprechung. Insbesondere in seinen Vorlesungen zur Jurisprudenz als Professor für Moralphilosophie in Glas‐ gow entwickelt Smith eine systematische Sicht auf die Entstehung und auf unter‐ schiedliche Arten des staatlichen und internationalen Rechts.66
61 62 63 64 65 66
206
Ballestrem 2001, S. 33 f. Smith 2004, S. 128. Smith 2004, S. 128. Smith 2005, S. 582. Smith 2004, S. 129. Smith 1996.
Aus wirtschaftlicher Sicht dient die Herstellung von Gerechtigkeit vor allem der Absicherung ökonomischer Freiheitsrechte sowie der Rechtsgarantie in Produktion und Handel. Dies bildet für Smith die Grundlage, ohne die auch eine Wirtschaftsge‐ meinschaft nicht bestehen und gedeihen kann. „Die Herstellung vollkommener Gerechtigkeit, uneingeschränkter Freiheit und weitge‐ hender Gleichheit ist ganz einfach das Geheimnis, das allen (...) Klassen höchsten Wohl‐ stand am wirksamsten sichert“.67
Bereits vor Abfassung des „Wohlstands der Nationen“ hat Smith diese Überzeugung in seinen Vorlesungen und auf öffentlichen Vorträgen vertreten. Der Mensch sei eben nicht „Gegenstand einer politischen Mechanik“ und damit in politischen und ökonomischen Dingen durch eine Obrigkeit steuerbar. Da der Einzelne selbst an der Verbesserung seiner Lage interessiert sei, müsse die Regierung nichts weiter tun, als den Frieden zu wahren, Gerechtigkeit zu garantieren und die Abgaben- und Steuer‐ lasten auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, um einen Staat aus dem Zustand tiefs‐ ter Barbarei zu Wohlstand und Reichtum zu führen.68 Allerdings scheint Adam Smith keineswegs der Ansicht gewesen zu sein, dass Gerechtigkeit rein auf der Gewährung von Rechtssicherheit beruhe. Vielmehr ver‐ steht er Gerechtigkeit auch im Sinne einer sozialen Gerechtigkeit, der zufolge allen ein gerechter Anteil am Wohlstand der Nationen zukomme.69 Smith tritt daher durchaus auch für staatliche Umverteilungs- und Schutzmaßnahmen ein. So betrifft sein Eintreten für mäßige Steuerlasten70 vor allem die Reduktion der Abgabenlasten der ärmeren Bevölkerungsschichten, die auch hinsichtlich anderer Abgaben, wie et‐ wa Wegezölle, entlastet werden sollen.71 Zudem ist es Aufgabe des Staates, Schulen für die ärmeren Bevölkerungsschichten aus öffentlichen Mitteln zu unterhalten.72 Auch müsse der Staat mittels Gesetzgebung einen fairen Wettbewerb und ein gewis‐ ses Maß an Chancengleichheit garantieren.73 Immer wieder tritt Smith für eine gerechte und faire Behandlung der ärmeren Be‐ völkerungsschichten ein und beklagt herrschende Ungerechtigkeiten: „Und ganz sicher kann keine Nation blühen und gedeihen, deren Bevölkerung weithin in Armut und Elend lebt. Es ist zudem nicht mehr als recht und billig, wenn diejenigen, die alle ernähren, kleiden und mit Wohnung versorgen, soviel vom Ertrag der eigenen Arbeit bekommen sollen, dass sie sich selbst richtig ernähren, ordentlich kleiden und anständig wohnen können“.74 67 68 69 70 71 72 73 74
Smith 2005, S. 566. Stewart 1982, S. 321ff.; Rae 1895, S. 62. Anderson 2016, S. 159 f. Smith 2005, S. 703ff. Smith 2005, S. 614. Smith 2005, S. 662-665. Streminger 2017, S. 86. Smith 2005, S. 68.
207
Wenn also die Gewährung von Freiheitsrechten und der „natürliche Gang der Din‐ ge“ zu Ergebnissen führen, die mit unserem Gerechtigkeitsempfinden nicht verein‐ bar sind, müssen diese durch entsprechende menschliche Gesetze, als Ausdruck die‐ ses Gerechtigkeitsempfindens, korrigiert werden. „So wird der Mensch durch die Natur selbst angeleitet, jene Verteilung der Dinge in gewissem Maße zu verbessern, die sie selbst sonst vorgenommen hätte“.75 Aufgabe von Politik und Gesetzgebung ist es, die Entfaltungsmöglichkeiten der Bürger zu befördern und dort einzugreifen oder gegenzusteuern, wo ein Zuviel oder ein Zuwenig an Freiheit zu sozialen Unge‐ rechtigkeiten führen würde, um so „unabhängig von Marktverhältnissen die humane Existenz der Menschen zu sichern“76. Explizites Anliegen der Sozialen Marktwirtschaft ist es, Freiheit im Wettbewerb mit den Prinzipien einer sozialen Gerechtigkeit zum Ausgleich zu bringen. Zum einen solle daher eine Wettbewerbsordnung das Fair Play im Wettbewerb garantie‐ ren, zum anderen aber der Staat mittels sozialer Ausgleichsmechanismen und einer aktiven Wirtschaftspolitik sozialer Ungleichheit entgegenwirken. Dabei stellt soziale Gerechtigkeit ebenso wie Solidarität oder Eigenverantwortung einen dem Wirt‐ schaftssystem vorgelagerten gesellschaftlichen Wert dar, den es auch innerhalb der Wirtschaftsordnung zu verwirklichen gilt. Nur dann, wenn es der Wirtschaft gelingt, den gesellschaftlichen Anliegen zu dienen, hat sie ihre Berechtigung: „Die Marktwirtschaft ist ein Instrument, ein Organisationsmittel, nicht ein Selbstzweck und daher noch nicht Träger bestimmter Werte. So ist eine letzte Entscheidung über sie nur möglich, wenn wir gewiss sein dürfen, die Ideale und Werte einer von uns angestreb‐ ten Gesamtlebensordnung durch sie verwirklicht zu sehen“.77
Gerechtigkeitsaspekte sollen daher bereits in der Ausgestaltung einer Wirtschafts‐ ordnung ihren Niederschlag finden. So etwa gelte es, den Missbrauch von Eigen‐ tumsrechten zu verhindern, durch eine progressive Besteuerung zu einer Anglei‐ chung der Vermögen beizutragen oder der Machtagglomeration auf Märkten durch eine Monopolaufsicht entgegenzuwirken. Auch müsse der Staat vorhersehbare Fehl‐ allokationen auf Märkten verhindern und so beispielsweise durch die Garantie von Mindestlöhnen das Existenzminimum lohnabhängig Beschäftigter sicherstellen.78 Ziel dieser wirtschaftlichen Rahmenordnung ist es, den Wettbewerb in sozial ver‐ trägliche Bahnen zu lenken. Es ist die Überzeugung der Väter der Sozialen Markt‐ wirtschaft, dass eine derart ausgestaltete, durch eine Wettbewerbsordnung geregelte Marktwirtschaft am besten den gesellschaftlichen Vorstellungen von Demokratie und Gerechtigkeit entspreche, da sie darauf ausgelegt sei, Machtagglomeration und den Missbrauch wirtschaftlicher Macht zu verhindern: „Ihr Prinzip ist, von vornhe‐ 75 76 77 78
208
Smith 2004, S. 254. Streminger 2017, S. 151. Müller-Armack 1948 a, S. 103. Eucken 1949, S. 1990.
rein wirtschaftliche Übermacht aufzulösen, so dass es keinem einzelnen möglich ist, schlechthin die Herrschaft über den Menschen zu erlangen“79. In einem zweiten Schritt sei es dann Aufgabe des Staates, die mit dem Marktge‐ schehen einhergehenden sozialen Härten auszugleichen und die Lebensbedingungen jener, die auf den Märkten keine oder nur wenige Waren oder Dienstleistungen anzu‐ bieten haben, im Rahmen einer zweiten Einkommensverteilung aufzubessern. „Im Endeffekt soll also der sozialen Gerechtigkeit auf zweifache Weise gedient werden: einmal durch die Sozialfunktion des Marktes, sodann durch die Sozialkorrektur der nicht befriedigenden Marktergebnisse durch den Staat“.80 Dabei sollen korrigierende staatliche Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen stets mit „marktkonformen Mitteln“ erfolgen, um so Wettbewerbsverzerrungen zu ver‐ meiden.81 Allerdings gingen die Meinungen hinsichtlich der Fragen, wieviel Einmi‐ schung des Staates zulässig sei und welche Mittel zur sozialen Umverteilung unter Wettbewerbsgesichtspunkten erlaubt seien, unter den Vertretern der Sozialen Markt‐ wirtschaft weit auseinander. So etwa sieht Alfred Müller-Armack es durchaus als Aufgabe des Staates an, mittels staatlicher Unterstützungszahlungen und weitrei‐ chender Sozialpolitik soziale Härten auf direktem Wege mittels Transferzahlungen auszugleichen: „Der Staat hat vielmehr die unbestrittene Aufgabe, über den Staatshaushalt und die öf‐ fentlichen Versicherungen die aus dem Marktprozess resultierenden Einkommensströme umzuleiten und soziale Leistungen, wie Kindergeld, Mietbeihilfen, Renten, Pensionen, Sozialsubventionen usw., zu ermöglichen. Das alles gehört zum Wesen dieser Ord‐ nung…“.82
Demgegenüber bleiben eher konservative Vertreter des Ordoliberalismus skeptisch gegenüber dieser Art des „Fiskalsozialismus“83. Weder könne es im System der So‐ zialen Marktwirtschaft darum gehen, eine größtmögliche Gleichheit der Einkommen und Vermögen herzustellen,84 noch dürfte eine staatliche Sozialpolitik mit umfang‐ reichen sozialen Transferleistungen dazu führen, dass hierdurch die Eigeninitiative der Wirtschaftsbürger gelähmt werde.85 Hier zeigen sich zwei unterschiedliche Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit. So plädieren die „konservativen Vertreter“ der Sozialen Marktwirtschaft vor allem dafür, die Eigeninitiative der Wirtschaftsbürger zu fördern. Dies schließt durchaus auch staatliche Eingriffe zur Herstellung einer gewissen „Startgerechtigkeit“86 mit 79 80 81 82 83 84 85 86
Müller-Armack 1948 a, S. 64. Zsifkovits 1994, S. 106. Röpke 1979 b, S. 77 f.; Müller-Armack 1948 a, S. 109. Müller-Armack 1962, S. 26. Röpke 1979 a, S. 53. Röpke 1979 a, S. 232. Erhard 1957, S. 257. Rüstow 1949, S. 49-54.
209
ein, um so erst einen fairen Leistungswettbewerb zu ermöglichen. Nur bei annä‐ hernd gleichen Bildungschancen und nicht allzu gravierenden Vermögensunterschie‐ den sei ein Leistungswettbewerb überhaupt möglich. Hier ist es Aufgabe des Staa‐ tes, Bildung für alle verfügbar zu machen und mittels progressiver Erbschaftsbe‐ steuerung die Ansammlung allzu großer Vermögen zu verhindern.87 Sozial gerecht wird hier also verstanden als eine Art „Chancengleichheit“, die einen fairen Wettbe‐ werb überhaupt erst ermöglicht. Demgegenüber betonen die Vertreter des „sozialen Flügels“ der Sozialen Marktwirtschaft vor allem den Ausgleich sozialer Härten mit‐ tels staatlicher Umverteilungspolitik als wesentliches Element „sozialer Gerechtig‐ keit“. Einigkeit besteht jedoch dahingehend, dass eine rein formale Gewährung glei‐ cher Rechte, beispielsweise hinsichtlich des Zugangs zu Bildungseinrichtungen, nicht ausreiche, um tatsächlich Chancengleichheit herzustellen; es bedarf auch der finanziellen Mittel, um diese Chancen ergreifen können. „Soziale Gerechtigkeit“ er‐ fordere daher auch eine Einkommensumverteilung zugunsten der materiell schlech‐ ter gestellten. Sowohl für Adam Smith als auch für die Vertreter der Sozialen Marktwirtschaft ist soziale Gerechtigkeit ein Leitmotiv bei der Beurteilung eines Wirtschaftssystems. Obwohl Wettbewerb und eine freiheitliche Marktwirtschaft generell zu einer Verbes‐ serung der materiellen Lage der Bevölkerung beitragen, führen sich selbst überlasse‐ ne Märkte mitunter zu sozial unverträglichen Ergebnissen, die mittels einer voraus‐ schauenden Gesetzgebung im Vorfeld verhindert oder durch staatliches Eingreifen im Nachhinein korrigiert werden müssen.
5. Adam Smith und die Soziale Marktwirtschaft Geht es also um die Frage nach den Funktionsbedingungen einer liberalen Wirt‐ schaftsordnung, so herrscht – sieht man von dem je unterschiedlichen zeitlichen Kontext der jeweiligen Autoren einmal ab – weitgehende Einigkeit hinsichtlich drei‐ er zentraler Elemente, die die Voraussetzung einer liberalen Wirtschaftsordnung und eines fairen Leistungswettbewerbs bilden. Zum ersten ist eine Wirtschaft ohne grundlegende moralische Werte der Marktteilnehmer nicht denkbar. Moral kann durch ein Wirtschaftssystem nicht „erzeugt“, sondern allenfalls gefördert werden. Es ist daher Aufgabe der Gesellschaft, diese Moral durch Erziehung, moralisches Vor‐ bild und nötigenfalls durch Gesetze sicherzustellen und zu überwachen. Zum zwei‐ ten ist Wettbewerb ohne Freiheit nicht denkbar. Allerdings muss die Ausübung der Freiheit verantwortungsbewusst gestaltet werden, sei dies auf dem Wege der morali‐ schen Selbstbindung oder durch staatliche Maßnahmen, die den Missbrauch von
87 Maier-Rigaud und Maier-Rigaud 2009, S. 75ff.
210
Freiheitsrechten verhindern. Drittens schließlich ist die Wirtschaft kein Selbstzweck. Sie muss sich an den Grundsätzen einer sozialen Gerechtigkeit messen lassen. Hier bedarf es steuernder Eingriffe des Staates, um den Einzelnen durch Bildung und eine materielle Grundsicherung „wettbewerbstauglich“ zu machen, um eine an den Grundbedürfnissen der Haushalte orientierte Entlohnung zu sichern oder um mittels staatlicher Sozialpolitik Benachteiligungen auszugleichen. So ist Gerhard Stremin‐ ger durchaus Recht zu geben, wenn er über die „ökonomischen Vorstellungen“ Adam Smiths schreibt: „Weil Smith unparteiisch zu urteilen vermochte, vertrat er nicht die Meinung, dass der Markt als solcher das Gemeinwohl befördere. Vielmehr sei dazu nur ein geregelter Markt imstande, in dem sich die Marktteilnehmer wie faire Sportler verhalten, in dem es Ar‐ beitsorganisationen gibt, in dem der Staat auch für Infrastruktur und aufgeklärte Bildung Sorge trägt. (…) Allein ein Markt, dem ein legislatives Korsett angelegt wurde, ist der Gesellschaft nützlich“.88
Insgesamt sind Smiths Vorstellungen wohl in der Tat weit weniger marktliberal als dies seitens der Apologeten des Neoliberalismus gerne gesehen wird. So ist Smith durchaus der Meinung „dass der Staat nicht nur den Interessen des Besitzbürgertums und des Wettbewerbs (...) zu dienen habe, sondern dass ihm all jene Aufgaben zukä‐ men, die der Markt im Interesse der Gemeinschaft nicht zu lösen imstande sei“89. Auch ist der Mensch für ihn kein homo oeconomicus, der ausschließlich nach Nut‐ zenerwägungen handelt und nur auf materielle Anreize reagiert. Vielmehr ist der Mensch in seinen Augen ein moralfähiges Wesen, das mit seinen Mitmenschen mit‐ zufühlen in der Lage ist und sich an Grundsätzen der Gerechtigkeit und des FairPlays orientiert. Mag es daher auch wahr sein, dass wir das, was wir zum Essen brauchen, nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten, so erwarten wir doch die Einhaltung moralischer Grundsätze und ein gewisses FairPlay im Umgang miteinander. Ohne diese minima moralia ist eine liberale Wirt‐ schaft im Sinne Smiths nicht denkbar.
Literatur Anderson, Elizabeth, 2016: Adam Smith on Equality. In: Hanley, Ryan Patrick (Hrsg.): Adam Smith – His Life, Thought, and Legacy, Princeton, S. 157-172. Aßländer, Michael S., 2006: Vom „klassischen Irrtum“ der Neoklassik – Kritische Anmerkun‐ gen zur Klassikeradaption im modernen Ökonomieverständnis. In: Zeitschrift für Wirt‐ schafts- und Unternehmensethik, 7(2), S. 206-222. Aßländer, Michael S., 2007: Adam Smith zur Einführung. Hamburg. 88 Streminger 2017, S. 176. 89 Meyer-Faje 1991, S. 316.
211
Aßländer, Michael S., 2008: Von der Moralphilosophie zur ökonomischen Wissenschaft. Die philosophischen Grundlagen der (neo)klassischen Ökonomie. In: Kersting, Wolfgang (Hrsg.): Moral und Kapital – Grundfragen der Wirtschafts- und Unternehmensethik, Pader‐ born, S. 77-105. Aßländer, Michael S., 2009: Wohlstand für alle? Die Soziale Marktwirtschaft vor der globalen Herausforderung. In: Aßländer, Michael S./Ulrich, Peter (Hrsg.): 60 Jahre Soziale Markt‐ wirtschaft – Illusionen und Reinterpretationen einer ordnungspolitischen Integrationsfor‐ mel, Bern/Stuttgart, S. 223-255. Aßländer, Michael S., 2011: Totgesagte leben länger – Die Wiedergeburt der Sozialen Markt‐ wirtschaft angesichts der globalen Wirtschaftskrise? In: Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, 12(2), S. 200-221. Ballestrem, Karl Graf, 2001: Adam Smith. München. Barry, Norman P., 1989: Political and Economic Thought of German Neo-Liberals. In: Pea‐ cock, Alan T./Willgerodt, Hans (Hrsg.): German Neo-Liberals and the Social Market Economy, London, S. 105-124. Berry, Christopher J., 2006: Smith and Science. In: Haakonssen, Knud (Hrsg.): The Cam‐ bridge Companion to Adam Smith, Cambridge, S. 112-135. Erhard, Ludwig, 1957: Wohlstand für alle. Düsseldorf. Eucken, Walter, 1949: Die Wettbewerbsordnung und ihre Verwirklichung. In: Eucken, Walter/ Böhm, Franz (Hrsg.): Ordo – Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, Bd. 2, Würzburg, S. 1-99. Eucken, Walter, 1990: Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Tübingen. Hayek, Friedrich August von, 1994: Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. In ders.: Freiburger Studien, Tübingen, S. 1-17. Hill, Lisa 2016: Adam Smith and Political Theory. In: Hanley, Ryan Patrick (Hrsg.): Adam Smith – His Life, Thought, and Legacy, Princeton, S. 321-339. Maier-Rigaud, Frank P./Maier-Rigaud, Remi, 2009: Rüstows Konzept der Sozialen Markt‐ wirtschaft – Soziale und wettbewerbspolitische Dimensionen einer überwirtschaftlichen Ordnung. In: Aßländer, Michael S./ Ulrich, Peter (Hrsg.): 60 Jahre Soziale Marktwirtschaft – Illusionen und Reinterpretationen einer ordnungspolitischen Integrationsformel, Bern/ Stuttgart, S. 69-94. Mehta, Pratap Bhanu, 2006: Self-Interest and Other Interests. In: Haakonssen, Knud (Hrsg.): The Cambridge Companion to Adam Smith, Cambridge, S. 246-269. Meyer-Faje, Arnold, 1991: Adam Smiths politökonomisches System – eine Antwort auf die Gefährdung der Conditio humana. In: Meyer-Faje, Arnold/ Ulrich, Peter (Hrsg.): Der ande‐ re Adam Smith – Beiträge zur Neubestimmung von Ökonomie als Politischer Ökonomie, Bern/Stuttgart, S. 303-340. Müller-Armack, Alfred, 1948 a: Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft. Hamburg. Müller-Armack, Alfred, 1948 b: Das Jahrhundert ohne Gott. Münster. Müller-Armack, Alfred, 1962: Das gesellschaftspolitische Leitbild der Sozialen Marktwirt‐ schaft. In: Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität Köln (Hrsg.): Wirtschaftspoliti‐ sche Chronik, Köln, S. 7-28. Rae, John, 1895: The Life of Adam Smith. London. Röpke, Wilhelm, 1979 a: Jenseits von Angebot und Nachfrage. Bern/Stuttgart.
212
Röpke, Wilhelm, 1979 b: Civitas humana. Bern/Stuttgart. Röpke, Wilhelm, 1994: Die Lehre von der Wirtschaft. Bern/Stuttgart. Rüstow, Alexander, 1949: Zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Godesberg. Smith, Adam, 1996: Vorlesungen über Rechts- und Staatswissenschaften. Sankt Augustin. Smith, Adam, 2004: Theorie der ethischen Gefühle, hrsg. von Walther Eckstein. Hamburg. Smith, Adam, 2005: Der Wohlstand der Nationen, hrsg. von Horst Claus Recktenwald. Mün‐ chen. Streminger, Gerhard, 2017: Adam Smith – Wohlstand und Moral. München. Stewart, Dugald, 1982: Account of the Life and Writings of Adam Smith. In: Smith, Adam: Essays on Philosophical Subjects. The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith. Bd. 3, hrsg. von William P. D. Wightman und J. C. Bryce, Nachdruck, Indianapolis. Ulrich, Peter, 2009: Marktwirtschaft in der Bürgergesellschaft – Die Soziale Marktwirtschaft vor der nachholenden gesellschaftspolitischen Modernisierung. In: Aßländer, Michael S./ Ulrich, Peter (Hrsg.): 60 Jahre Soziale Marktwirtschaft – Illusionen und Reinterpretationen einer ordnungspolitischen Integrationsformel, Bern/Stuttgart, S. 349-380. Zsifkovits, Valentin, 1994: Wirtschaft ohne Moral?. Innsbruck.
213
Rolf Steltemeier / Tobias Knobloch Das Freiheitsverständnis von Adam Smith. Über die Haltbarkeit eines zentralen sozialphilosophischen Versprechens im Digitalzeitalter
1. Smiths Freiheitsbegriff Das neuzeitliche Demokratieverständnis und die Marktwirtschaft, der in Deutsch‐ land gerne das Attribut „sozial“ vorangestellt wird, haben sich seit dem 17. Jahrhun‐ dert nicht zufällig parallel entwickelt.1 Nach unserem heutigen Verständnis sind ge‐ sellschaftliche Inklusion und die Autonomie politischer Willensbildung Vorausset‐ zungen dafür, dass eine Person in ökonomischen Zusammenhängen als willensfreie Vertragspartnerin auftreten kann. Demokratische Institutionen sind die Basis erfolg‐ reichen Wirtschaftens. Das war nicht immer so. In der Antike war es gerade anders‐ herum, nämlich dass allein die aus wirtschaftlichen Zusammenhängen nahezu voll‐ ständig herausgenommenen Personen (freie, männliche Bürger mit einem funktio‐ nierenden Oikos, um den sich Frauen und Sklaven kümmerten) als für politisches Handeln fähig erachtet wurden.2 Adam Smith hat dieser Vorstellung seine Vierstadi‐ entheorie der gesellschaftlichen Entwicklung entgegengesetzt. „In der vierten Phase von Smiths Vierstadientheorie, der Handelsgesellschaft, wird Freiheit geschaffen, in‐ dem Abhängigkeiten, wie sie noch in der feudalen Agrargesellschaft gegeben sind, aufgehoben sind. Persönliche Freiheit und individuelle Selbstentfaltung sorgen für die größtmögliche Effizienz, ein nach freiem Ermessen einsetzbares Privateigentum garantiert die bestmögliche Nutzung von Ressourcen“.3 Doch der Mensch handelt in Smiths Vorstellung nicht nur aus Eigeninteresse. Je‐ der Mensch – egal wie egoistisch – nimmt Anteil am Schicksal seiner Mitmenschen, ohne daraus eigene Vorteile beziehen zu wollen. Das ist die Grundthese der 1759 er‐ schienen „Theorie der ethischen Gefühle“, auf die in „Wealth of Nations“ von 1776 zwar kaum explizit Bezug genommen wird4, die aber eine zentrale Basis der dorti‐ gen Analysen ist. Smith bezeichnet die Anteilnahme mit dem Schicksal von Mit‐ menschen als „Sympathie“, was ganz wörtlich als „Mitfühlen“ zu verstehen ist, als eine Fähigkeit sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Das ist für den Schotten der soziale Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Und diese Vermittlung von per‐ 1 2 3 4
Steltemeier (2015) zeichnet diese Entwicklung detailliert nach. Vgl. Berry 2010 S. 3. Steltemeier 2015, S. 121. Vgl. Nutzinger 1991, S. 85.
215
sönlicher Freiheit und sozialer Koexistenz ist auch die Grundlage der uns inzwi‐ schen selbstverständlich gewordenen (sozialen) Marktwirtschaft. Man kann Smiths Gesellschaftsverständnis mit Christopher Berry zusammenfas‐ sen, der treffend von einer „moral economy“5 spricht. Smiths Weltsicht ist eine mo‐ ral-ökonomische. Als Begründer der Ökonomie als Wissenschaft gilt Adam Smith gerade, weil er mit Produktion und Handel einen gesamtgesellschaftlichen Stand‐ punkt verband. Seiner Auffassung nach wird das gesellschaftliche Wohl dadurch maximiert, dass jeder sein individuelles Glück verfolgt – beziehungsweise das, was er dafür hält. Hans Nutzinger geht so weit, Smiths an zwei stoische Grundüberzeu‐ gungen anknüpfende Theorie über die gesellschaftlichen Makro-Effekte des menschlichen Mikroverhaltens als „nützliche Täuschung, die gesellschaftliche Wohlfahrt erst ermöglicht“6 zu bezeichnen. Maßloses materielles Streben, das bei nüchterner Betrachtung als irrational gekennzeichnet werden muss, sichert eine Ge‐ samtmenge an Gütern und Innovationen, die letztlich allen, auch den weniger Pro‐ duktiven und Innovativen zugutekommt. Freiheit ist die wesentliche Voraussetzung dieses Einzelstrebens, das am Ende al‐ len nützt. Es muss im Ermessen des Einzelnen liegen, auch noch für den siebten Sportwagen Umsätze und Einkünfte zu erstreben, um den gesellschaftlich wün‐ schenswerten Gesamteffekt hervorzubringen.7 Die staatstheoretisch logische Folge ist ein bürgerlicher Rechtsstaat, der keine eigenen Interessen verfolgt, sondern nur für die Rahmenbedingungen sorgt. In drei Kernbereichen ist der Staat gefragt, aus allen anderen hat er sich herauszuhalten: äußere Sicherheit, öffentliche Güter (darun‐ ter, ganz wichtig, Bildung) und „an exact administration of justice“8. Solange die Staatsbürger das Recht nicht verletzen, also die Spielregeln einhalten, müssen sie vom Staat vollständig in Ruhe gelassen werden, damit sie ihre Interessen verfolgen können. Diese Freiheit ist eine inklusive Freiheit, was bedeutet, dass sie jedem glei‐ chermaßen zusteht. Die Herrschaft des Rechts oder – mit einem uns heute geläufige‐ ren Begriff – die Rechtstaatlichkeit ist die Grundlage für ein „obvious and simple system of natural liberty“ (ebd.). Anders ist eine funktionierende Handelsgesellschaft (für uns heute wiederum ge‐ läufiger: Marktwirtschaft) gar nicht vorstellbar, schließlich müssen sich darin regel‐ mäßig Fremde vertrauen, was schon beim Prinzip der Arbeitsteilung beginnt.9 Den‐ 5 Berry 2010, Titel 6 Nutzinger 1991, S. 89. 7 Dass das in Wahrheit natürlich ein sehr viel komplexerer Vorgang mit zahlreichen Voraussetzun‐ gen (und z.T. Fallstricken, die Smith nicht gesehen hat) ist, hat Heinz Kurz in „Adam Smith on markets, competition, and violations of natural liberty“ gezeigt. Es ist bemerkenswert, wie Kurz in diesem Papier dennoch zu dem Schluss kommt, „that the ideas of Adam Smith still may reso‐ nate and illuminate the problems of today“ (Kurz 2016, S. 637). 8 Smith 2008, IV.ix.51/687. 9 Jemand, der nur Knöpfe herstellt, muss sich darauf verlassen, dass ein anderer Röcke schneidert, andernfalls er frieren würde.
216
noch ist aus historischer Sicht die Neuerung herauszustreichen, die das Denken Smiths bedeutete: „The rule of law embodies a distinctively modern view of liber‐ ty“10. In einer aus freien, durch das Recht geschützten Individuen bestehenden Han‐ delsgesellschaft hat jeder jederzeit die Möglichkeit, einer anderen Geschäftsmög‐ lichkeit zu folgen und sich selbst gewissermaßen neu zu erfinden, was nicht von un‐ gefähr an das US-amerikanische Traumversprechen erinnert. Hans Nutzinger hat gut zusammengefasst, wie sehr diese Auffassung an idealisierte Annahmen über das na‐ türliche Gleichgewicht von Märkten und die dementsprechend geringe notwendige Eingriffstiefe des Staates gebunden ist: „Man kann also sagen, daß Smith mit seiner Vermutung über die Wohlfahrtseigenschaften eines ‚Systems der natürlichen Frei‐ heit’ durchaus etwas Richtiges gesehen hat. Allerdings ist die Richtigkeit seiner Ver‐ mutung an derart einschränkende Voraussetzungen gebunden, daß sie nur als Refe‐ renzrahmen für staatliche Wirtschaftspolitik gelten kann, nicht aber als deren Er‐ satz“11. Diese Aussage stammt vom Anfang der 1990er Jahre. Spätestens in einer Zeit ei‐ nes rasanten digitalen Wandels und eines gleichzeitig (teils aufgrund der technologi‐ schen Sprünge) sagenhaft um den Globus vagabundierenden Kapitals12, gepaart mit einer bereits großen und weiterwachsenden Vermögensungleichheit,13 scheint das Smithsche Versprechen allerdings kaum mehr einlösbar zu sein. Wo sich sogenannte Clickworker permanent in schlecht bezahlten und über das Internet spontan organi‐ sierten Jobs befinden14 und nicht mehr nur einfache Fertigungsjobs, sondern auch der Dienstleistungssektor massenhaft von Automatisierung bedroht ist,15 da scheint die Form wirtschaftlicher Freiheit, die Adam Smith und nach ihm im Grunde jeder Vordenker des liberalen Verfassungsstaates im Sinn hatte, nicht mehr ohne Weiteres gegeben zu sein. Das trifft auf individueller Ebene ebenso zu wie auf der Konzern‐ ebene. Je ein Beispiel von beiden Ebenen: Im heutigen Null-Zins-Zeitalter kann je‐ mand, der über ein entsprechendes Vermögen bereits verfügt, ohne den Einsatz eige‐ nen Geldes aus dem Stand auf dem Immobilienmarkt durch Kauf und Vermietung Geld verdienen; jemand ohne eigenes Vermögen kann dies wegen der fehlenden Si‐ cherheiten nicht, selbst wenn er in gleicher Weise Chancen sieht und geschäftstüch‐ tig ist. Google und Facebook halten gemeinsam das Monopol auf dem Online-An‐ zeigenmarkt. Niemand, der online Geschäfte tätigt, kommt an diesen beiden Platt‐
10 Berry 2010, S. 6. 11 Nutzinger 1991, S. 85. 12 Laut Rana Foroohar (2016) sind nur noch 15 Prozent dieser Kapitalströme mit der sogenannten Realwirtschaft verbunden, indem sie sich irgendwann in Gegenständen oder Dienstleistungen materialisieren. 13 Vgl. World Inequality Lab 2017. 14 Vgl. Hill 2017. 15 Vgl. Etspüler/Lorenz 2017.
217
formen, die ihre Geschäftsbedingungen ebenso einseitig diktieren wie Amazon im Online-Handelsbereich, heute noch vorbei.16
2. Marktdynamik im Digitalzeitalter: das Individuum und seine Daten als Produkt Adam Smith verficht, wie oben dargestellt, einen starken, gleichzeitig aber sehr be‐ grenzten Staat. Die Verhinderung von Monopolen gehört dazu, weil diese das Wohl stiftende Walten der unsichtbaren Markthand stören und im Ergebnis aus dem Vor‐ teil aller einen Vorteil weniger machen. Schon bezüglich der vergleichsweise einfa‐ chen ökonomischen Welt, von der Adam Smith ausging, ist später gezeigt worden, dass seine Annahmen nur unter sehr idealisierten Bedingungen zutreffen, die schwer herzustellen und – nur durch sehr viel intensivere staatliche Eingriffe, als Smith an‐ nahm – zu bewahren sind.17 In einem tatsächlichen Konkurrenzgleichgewicht befin‐ den sich reale Märkte von sich aus selten. Nun aber weisen, wie wir in der heutigen Zeit wiederum schon länger wissen, mehrseitige Plattform-Märkte der Internetöko‐ nomie Winner-takes-most-Effekte auf und neigen damit von sich aus zu monopolar‐ tigen Strukturen.18 Mit anderen Worten: Konkurrenz und Wettbewerb, die es durch‐ aus intensiv gibt, wirken sich hier nicht mehr belebend aus, sondern bleiben für die Marktstruktur an sich weitgehend wirkungslos, weil Netzwerkeffekte die bereits Etablierten so gut wie unantastbar machen. „Eine so starke Machtkonzentration ist jedoch in mehrfacher Hinsicht problematisch. Die Betreiber unserer wichtigsten In‐ frastrukturen sind uns nicht rechenschaftspflichtig. Ihre Anreize laufen unseren In‐ teressen zuwider (wir sind nämlich nicht Kunden dieser Unternehmen, sondern eine Ware, die von ihnen verkauft wird)“19. Wie der intime Kenner und Kritiker des Plattformkapitalismus Frank Pasquale schreibt, agieren die Betreiber großer Plattformen wie Regierungen in einem be‐ stimmten Marktsegment, indem sie nicht nur Preise diktieren, sondern auch Gebüh‐ ren erheben und die Spielregeln bestimmen: „A platform acts as the government of a certain market, and its fees are the taxes on the participants to whom it provides or‐ der“20. Doch wie konnten einzelne Unternehmen eine solche Marktmacht erlangen? Ganz kurz zusammengefasst ist das eine Folge der Datensammlung und -verwertung mittels avancierter Technologien im ganz großen Stil, dem über einen relativ langen Zeitraum kein wirksames Regulierungsmodell gegenüberstand und in weiten Teilen 16 Vgl. Ghosh/Scott 2018. 17 Nutzinger 1991, S. 84. 18 Vgl. schon Economides 2004. Noch älter ist dieser Befund: „In network markets, the addition of new competitors, say under conditions of free entry, does not change the market structure in any significant way once few firms are in operation.“ (Economides 2001, S. 10). 19 Mulgan 2017, S. 31. 20 Pasquale 2017.
218
heute noch immer nicht gegenübersteht. Obwohl die nicht nur ökonomische, son‐ dern auch gesellschaftspolitische Macht der größten Technologie-Unternehmen seit langem kein Geheimnis mehr ist, haben sich in den Vereinigten Staaten erst seit der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten ernsthaft kritische politische Stimmen zu Wort gemeldet. Der Wind hat sich seither gedreht: Wenn Facebook-Gründer Zucker‐ berg auf Imagekampagnentour geht, dann ist im Silicon-Valley-Wasser Blut – und die Washingtoner Politik-Haie haben längst Witterung aufgenommen.21 Wie der schon zitierte Frank Pasquale richtig schreibt, ist „the data-hoarder’s holy grail: perfected profiles of any person or entity“22. Die Praxis des individuellen Sco‐ rings zum Zwecke des Schlussfolgerns auf das Verhalten von Gruppen und zum Zwecke der Verhaltenssteuerung auf Individual- und Gruppenebene ist eine große Gefahr unserer Zeit für die menschliche Freiheit. Mit den in Europa zuletzt forcier‐ ten Bemühungen um die Verschärfung des Datenschutzes23 kann sie nicht effektiv eingedämmt werden, weil der Datenschutz, der ja recht verstanden ein Personen‐ schutz sein sollte, im Kern auf der kaum mehr haltbaren Dichotomie Personenbezug/ kein Personenbezug sowie auf den obsoleten Prinzipien Datensparsamkeit und Zweckbindung beruht.24 Das liegt auch an Dynamiken, die auf datengetriebenen Verbrauchermärkten generell zu beobachten sind, etwa dem De-facto-Zwang zur Datenpreisgabe, der dadurch entsteht, dass Individuen ökonomische Nachteile für sich vermeiden wollen. Die zuletzt als Lösungsoption erwogene Einführung eines Eigentumsrechts an Daten würde diesem Effekt eher Auftrieb geben statt ihn aufzu‐ halten.25 Dennoch muss man sagen, dass die Politik das Problem nicht nur theoretisch er‐ kannt hat26, sondern es inzwischen auch ganz praktisch angeht, indem kartellrecht‐ lich gegen übermächtige Tech-Riesen vorgegangen wird27. Dies scheint auch der einzig sinn- und wirkungsvoll ansetzbare Hebel zu sein. Es deutet sich an, dass die Bundesregierung die Traktierung der datenanalytisch induzierten Marktschieflagen weiter priorisieren wird. Darauf deutet jedenfalls die Bündelung von Kompetenzen beim BSI, beim Bundeskartellamt und beim Bundeskanzleramt hin. Adam Smith hätte dies im Sinne der von ihm dem Staat zugeschriebenen, essentiellen Ordnungs‐ funktion begrüßt. Die Frage ist erstens, ob diese Maßnahmen rechtzeitig kommen, und zweitens, ob sie weit genug gehen. Beides kann man mit guten Gründen an‐ zweifeln. Es liegt die Befürchtung nahe, dass die Politik hier zu lange auf Zeit ge‐ spielt hat. Wenn der ehemalige Unionsfraktionschef Volker Kauder etwa im Jahr 21 22 23 24 25 26 27
Vgl. Smith 2017. Pasquale 2017. Vgl. Datenschutzgrundverordnung und ePrivacy-Verordnung. Vgl. Manske/Knobloch 2017. Sehr aufschlussreich dazu auch Jentzsch (2018). Vgl. BMWi 2017. Vgl. Kartellamt 2017.
219
2018 konstatierte, Digitalisierung sei für ihn „das Megathema der kommenden Jah‐ re“28, dann macht das schon ein wenig sprachlos. Im Jahr 2000, als die so genannte Web 1.0-Blase gerade geplatzt war, wäre diese Aussage, mit einem eingefügten „dennoch“ geradezu kassandrisch gewesen. Heute jedoch zeugt sie eher von Hilflo‐ sigkeit. Aber damit nicht genug. Aus Sicht des Individuums und Konsumenten gibt es ein weiteres Problem, das politisch noch sehr viel schwieriger in den Griff zu bekom‐ men ist, weil es sich um ein evolutionär-kulturhistorisches Phänomen handelt. Vor‐ weggenommen sei, dass dies – im Verbund mit den oben schon genannten Aspekten – zu einem eher pessimistischen Befund führen wird, was die Anwendbarkeit von Smiths Freiheitsbegriff heute in wirtschaftspolitischer Hinsicht angeht. Dass der Mensch immer schon mehr war als ein egoistisch-rationaler Nutzenopti‐ mierer, wissen wir seit langem. Auch Adam Smith hat diesem Umstand durchaus schon Rechnung getragen, indem er ein irrationales Streben nach Besitz und Reich‐ tum annahm.29 Ja, der Theorie Smiths zufolge ist es gerade diese Maßlosigkeit, die letztlich allen, auch den Ärmsten, den Lebensunterhalt sichert. Würde sich jeder mit der Befriedigung seiner unmittelbaren Bedürfnisse zufriedengeben, funktionierte das nicht. Dennoch ist der Mensch bei Smith ein zum Mitfühlen begabtes Wesen, das sich trotz wirtschaftlicher und Klassenunterschiede auf einer einheitlichen Stufe, zu‐ sammen mit allen anderen Menschen an einer bestimmten Position im Kosmos, wähnt. Doch selbst dieser humanistische Grundkonsens, nach dem der Mensch das Maß ist, löst sich im Zeitalter der vierten industriellen Revolution allmählich auf, wie der israelische Philosoph Yuval Harari in seinem Buch „Homo Deus“ eingängig nachzeichnet: Es beginnt mit einer quasi-religiösen Verehrung des Niemals-Ab‐ reißens digitaler Datenströme, entwickelt sich fort zur Überlegenheit technologisch optimierter Menschen und wird – vielleicht – enden mit der Verdrängung von Homo Sapiens durch Homo Deus.30 Als Fazit ist zu sagen, dass sich Smiths Freiheitsbegriff in der Wirtschaftswelt, wie sie sich aktuell darstellt, ohne Modifikationen nicht mehr ohne weiteres an‐ wendbar ist. Menschen sind immer mehr ihre digitalen Daten, aber über diese Daten haben sie momentan so gut wie keine Verfügungsgewalt, während wenige Firmen damit immer größeren Reichtum und immer mehr Macht akkumulieren. Deshalb können Menschen heute insgesamt weniger leicht als in früheren Zeiten als autono‐ me Wirtschaftssubjekte in Erscheinung treten. Auf der Makro-Ebene zeigen sich die oben geschilderten Veränderungen hin zu einer Kontraktion von Märkten und einer Monopolisierung von Schlüsseltechnologien wie der Künstlichen Intelligenz.31 Die‐ 28 29 30 31
220
Kauder 2018. Vgl. z.B. Smith 1853 IV.1.10. Vgl. Harari 2016, besonders S. 497-537. Vgl. Morozov 2018.
se Tendenzen sind so stark und mit einer solchen wirtschaftlichen Potenz verbun‐ den,32 dass sie regulatorisch zumindest nicht kurzfristig in den Griff zu bekommen sein werden. Wo aber der Staat seiner – von Smith als einem der ersten richtiger Weise zuerkannten – Kontroll- und Rahmengebungsfunktion nicht mehr nachkom‐ men kann, da sind die Individuen auf sich gestellt und müssen neue Formen sponta‐ ner Ordnung finden. Damit ist keine Rückkehr in den Hobbesschen Dschungel ge‐ meint. Es beginnt vielmehr bei einem erwachenden digital-ökologischen Bewusst‐ sein in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen33 und endet bei Kollektiven, die neue Technologie dazu nutzen, um sich von den durch neue Technologien auferlegten Re‐ striktionen zu befreien.34 Das muss am Ende keine schlechtere Ordnung sein, so wie eine Demokratie ohne Parteien nicht notwendig eine schlechtere Demokratie sein muss. Aber dieses Bild entspricht aktuell nicht mehr der Rahmenordnung, die Adam Smith für die bestmögliche Entfaltung der menschlichen Freiheit vorgesehen hat.
3. Notwendige Updates in der Bildungspolitik Betrachten wir einen weiteren Bereich, der für die Konstitution nicht nur des Smith‐ schen, sondern für das Freiheitsverständnis eines jeden Liberalen zentral ist: die Bil‐ dung. Im Gegensatz zum Menschenbild des Hobbesschen Dschungels steht Smith für eine positive Auffassung vom Menschen. Als Moralphilosoph glaubt er an die Wirksamkeit der Erziehung, als Aufklärer „an den Zusammenhang von empirischem Wissen, Verfeinerung moralischen Empfindens und persönlichem Glück des grund‐ sätzlich geselligen Menschen“35. Selbst wenn der Gesellschaft durch die Bildung ihrer Bürger kein Nutzen entstünde – für Smith ist das Gegenteil richtig und der Nutzen einer gebildeten Bevölkerung erheblich – ist es daher dennoch ein wichtiger staatlicher Auftrag dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung nicht ungebildet ist.36 Durch staatliche Bildungsangebote wird auch dem in einfachen Verhältnissen Gebo‐ renen gesellschaftlicher Aufstieg durch eigenen Fleiß ermöglicht. „[D]as Postulat einer Gesellschaft der Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit ist nur durch universel‐ le Verwirklichung individueller Autonomie durch Bildung zu verwirklichen“37. Die‐ ses Versprechen ist zentraler Baustein der liberalen Bürgergesellschaft und ein we‐ sentliches Element im Denken jedes liberalen Theoretikers: Jeder, der will, kann
32 Allein die Industrie der sogenannten Datenhändler sieht in diesem Jahr einem Umsatz von rund 250 Milliarden US-Dollar Umsatz entgegen (vgl. Madsbjerg 2017). 33 Vgl. Wilkens 2015. 34 Beispiele sind Bürgerplattformen wie „Peerby“ (https://www.peerby.com/) oder die afrikani‐ sche Krisenreaktionsplattform „Ushahidi“ (https://www.ushahidi.com/). 35 Streminger 1988, S. 76. 36 Vgl. Smith 2008, V.i.Art. 2.61/S. 788. 37 Steltemeier 2015, S. 133.
221
sich – durchschnittliche Befähigung vorausgesetzt – aus eigener Kraft ein Leben in relativem Wohlstand und Handlungsautonomie erarbeiten. Nicht zufällig besteht in Deutschland eine Korrelation zwischen einem guten Bildungssystem und einer funk‐ tionierenden sozialen Marktwirtschaft. Nun sind für normale Menschen die Zusammenhänge der digitalen Welt und ihre Innovationen in rascher Folge kaum noch zu durchschauen. Nur ein Beispiel von vielen möglichen sind die zahlreichen, in jüngerer Zeit auch der breiteren Gesell‐ schaft vertrauten Kryptowährungen und die Tatsache, dass sich darüber inzwischen zahlreiche Technologie-Startups mit Kapital versorgen.38 Blockchain, Internet der Dinge, Social Bots, Smart Home, Internet Governance – all das sind für Otto Nor‐ malverbraucher böhmische Dörfer. Und doch bestimmen die damit bezeichneten Sachverhalte und Entwicklungen immer mehr die Welt, in der wir leben. Damit ha‐ ben sich auch die Anforderungen an Bildung und Ausbildung stark verändert. Mo‐ mentan hat es nicht den Anschein, als könnte der Staat seinem Bildungsauftrag heu‐ te noch ohne weiteres gerecht werden und damit eine der wichtigsten Grundlagen für individuelle Freiheit und gesellschaftliche Teilhabe schaffen. Johnny Häusler, bekannter Blogger unter „spreeblick.com“, konstatierte Ende 2017, an deutschen Schulen verstaubten die digitalen Whiteboards unter maroden Dächern, weil sie niemand bedienen könne.39 Weiter vertritt er in dieser emotionalen und gleichzeitig kenntnisreichen Generalabrechnung mit der deutschen Digitalbil‐ dungspolitik: „Der Staat kommt seinen Aufgaben und Pflichten nicht nach. Seit vie‐ len Jahren gibt es zu wenig Personal an Schulen und nicht genug Fortbildung für die völlig überlasteten Lehrkräfte, die immer mehr Aufgaben in immer kürzerer Zeit leisten sollen. Es gibt keine ausreichende technische Infrastruktur, manchmal nicht einmal Internetzugang an Schulen“ (ebd.). Zwar hat die Kulturministerkonferenz mit der 2016 verabschiedeten und ab 2018 greifenden Strategie „Bildung in der digitalen Welt“40 einen wichtigen ersten Schritt gemacht, aber dennoch kann man dieser Fest‐ stellung nicht viel entgegenhalten. Und das Problem geht viel weiter, reicht tief in die Aus- und Fortbildungsstrukturen ganzer Bereiche hinein, wie Thomas Langka‐ bel, Chief Technology Officer bei Microsoft Deutschland, für den öffentlichen Dienst aufgezeigt hat.41 Um es zuzuspitzen: Während Software die Welt förmlich frisst,42 sind weite Teile der Bevölkerung völlig ahnungslos hinsichtlich der techni‐ schen, sozialen, mikro- und makroökonomischen Strukturen der Welt, in der sie le‐ ben. Das kann auf Dauer weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich gut gehen, des‐ halb gibt es unterschiedliche Lösungsvorschläge, um die offenkundigen Bildungsde‐ fizite zu beheben. 38 39 40 41 42
222
Vgl. ÖFIT 2018. Vgl. Häusler 2017. KMK 2016. Vgl. Langkabel 2017. Vgl. Andreessen 2011.
Manche Einzelpersonen und Gruppierungen vertreten die Meinung, man müsse nur Informatik zu einem Pflichtfach an Schulen machen, dann werde auf lange Sicht schon alles gut. Dem hat Julia Manske überzeugend entgegengehalten, dass ein sol‐ ches Schulfach umfassender aufgebaut und viel mehr vermitteln müsse als Grund‐ kenntnisse im Programmieren: „Programmieren als zweite Fremdsprache einzufüh‐ ren, wird dem fundamentalen Wandel, den unsere Gesellschaft erfährt, allerdings nicht gerecht. Denn um diesem zu begegnen, reicht es nicht, eine weitere Sprache zu sprechen. Wenn das Bildungssystem einen Beitrag dazu leisten will, dass junge Menschen der digitalen Wende als mündige Bürger begegnen, muss es digital skills building breiter verstehen. Wir brauchen ein Schulfach – nennen wir es Digitalkunde – in dem alle Dimensionen der Digitalisierung – das sind neben den technischen eben auch unternehmerische, ethische und gesellschaftliche Aspekte – adressiert werden“43. Beide Seiten haben im Grunde recht. Einerseits darf heute natürlich nie‐ mand mehr die Schule verlassen, der nicht mindestens für einfache Fälle den grund‐ legenden Zusammenhang von Code und Funktionalität durchdrungen hat. Auf der anderen Seite beruhen die auf gesellschaftlicher Ebene relevanten Umwälzungen durch Big Data Analytics, Algorithmen und Künstliche Intelligenz eher auf mathe‐ matischen Prinzipien der Statistik und Mengenlehre statt auf Programmierfähigkei‐ ten. Ganz zuletzt geht es, auf noch höherer Ebene, um das, was der Siegeszug digita‐ ler Technologien mit unserem Denken, Arbeiten und Leben macht. Viel wichtiger als spezifische technische Fertigkeiten und Kenntnisse (die schnell veralten und au‐ ßerdem immer stärker wiederum an Technik delegiert werden) zu vermitteln sei es daher, so Geoff Mulgan, Geschäftsführer der britischen Innovationsstiftung Nesta, „digitales Denken und Handeln zu erlernen“44. Was das bedeutet, lässt sich gut an der zentralen Arbeitsweise in der Software-Entwicklung verdeutlichen. Das agile Arbeiten in kleinen Teams, die schmale (engl. lean) Erstentwicklung neuer Produkte und das konsequente Denken von der Anwendbarkeit und dem Nutzen des Produ‐ zierten her (Design Thinking) haben längst Einzug in Bereiche gehalten, die weit jenseits des Programmierens liegen, und zählen zu den Top-Management-Fortbil‐ dungen.45 In Sachen Schulbildung und Berufsausbildung im Digitalzeitalter anzu‐ kommen, bedeutet auch, diese neuen Formen des Produzierens und Wirtschaftens in einem gewissen Maß in das Lernen zu integrieren. Dass wirtschaftliche, vom Profit‐ streben getriebene Entitäten mit solchen Adaptionen schneller sind, als staatliche oder parastaatliche, sollte uns dabei nicht entmutigen. Während uns das Ausland mit staatlichen Innovationsagenturen und ähnlichen Formaten diesbezüglich voraus ist, gibt es auch hierzulande vielversprechende An‐ 43 Manske 2014, S. 2. 44 Mulgan 2017, S. 19. 45 Vgl. z.B. Bathen 2018.
223
sätze. So hat etwa das Institut METIS (Europa-Institut für Erfahrung und Manage‐ ment) der Rheinischen Fachhochschule Köln ein Reverse-Mentoring-Programm ent‐ wickelt. In Kooperation mit etablierten Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ist es das Ziel des Programms, Digitalkompetenzen von den jüngs‐ ten (und in der Hierarchie weit untenstehenden) Unternehmensmitgliedern (soge‐ nannte „Digital Natives“ der Generationen Y und Z) auf gestandene Manager in Führungspositionen zu transferieren.46 Wenn wir die Herausforderungen, vor die uns der technologische Wandel stellt und stellen wird, meistern und die Freiheit des Menschen als eines moralischen und sich wirtschaftlich entfaltenden Wesens im Smithschen Sinne auch in Zukunft bewahren wollen, dann brauchen wir mehr von solch durchdachten und gleichzeitig pragmatischen Formaten.
4. Zur (möglichen) Aktualität von Smiths Freiheitsverständnis Der Mensch handelt zwar grundsätzlich nur aus Eigeninteresse, aber er ist auch fä‐ hig, Sympathie zu empfinden – so lassen sich die beiden Säulen des Smithschen Menschenbildes und seines Theoriegebäudes zusammenfassen. Das in jedem Men‐ schen angelegte Prinzip der Sympathie stellt gewissermaßen eine natürliche Begren‐ zung des ebenso natürlichen Egoismus dar. Das Menschen- und Weltbild des Schot‐ ten ist durch die Anerkennung dieser anthropologischen Konstanten ein realistisches – nicht zuletzt auch dadurch, dass es die Stärke wirtschaftlichen Gewinnstrebens als bisweilen leitendes Handlungsmotiv anerkennt. Eben deshalb tritt er für die Kodifi‐ zierung ethischer Normen in Gestalt von Gesetzen ein und sieht es als eine zentrale staatliche Aufgabe an, im Zweifel für einen Ausgleich von Interessen zu sorgen. Die sich heute, im Zeitalter von Automation und Vernetzung, abzeichnende wirt‐ schaftliche Situation, die von der Marktdominanz einzelner Unternehmen, von lo‐ cked-in-Effekten (sowohl bei Verbrauchern als auch bei Firmenkunden) und von un‐ zureichend regulierten Innovationsbereichen (z.B. Big Data Analytics, Blockchain, Internet of Things) gekennzeichnet ist, würde Adam Smith als unnatürlich ablehnen, weil sie auf einem Menschenbild basiert, das kein Mitgefühl und keine ethischen Regeln erkennen lässt, und weil sie auf ein Defizit an staatlicher Handlungsfähigkeit hindeutet. Smith war nämlich keineswegs, wie man immer wieder liest und hört, ein Minimalstaatstheoretiker. Wahre Freiheit ist immer irgendwo zwischen Anarchie und Zwang angesiedelt. Den genauen Ort handeln wir permanent aus, er bleibt nie derselbe. Freiheit als Wert ist uns neben anderen (z.B. Sicherheit, Gesundheit, Wohlstand) heute fast selbstver‐ ständlich geworden. Mehr um Freiheit als Idee geht es daher darum, wie sie in der
46 Vgl. METIS 2017.
224
sozialen, staatlich organisierten Welt konkret umsetzbar ist. Strikte Rechtstaatlich‐ keit und wirksame Mechanismen der Machtbegrenzung – sei es auf staatlicher oder privatwirtschaftlicher Seite – spielen dabei eine entscheidende Rolle.47 Gerade in Zeiten technologischer Sprünge48 hinkt das Recht aus gutem Grund bisweilen hin‐ terher; das können wir momentan gut am Bemühen in Europa ablesen, PlattformMärkte und künstlich intelligente Systeme angemessen zu regulieren. Manche der damit einhergehenden Fragen erscheinen auch deshalb vertrackt, weil unser mensch‐ liches Selbstverständnis und Selbstbild damit verbunden sind. Manche, wie der be‐ reits erwähnte Philosoph Yuval Harari, sehen den Homo Sapiens (mit mehr oder we‐ niger Schrecken) sich abschaffen und das Anthropozän dem Ende entgegengehen. Manch andere, wie die sogenannten Transhumanisten,49 fordern das gerade lautstark ein und beschwören es emphatisch herauf, weil sie nur durch eine Verschmelzung des Menschen mit Technik ihrer individuellen Vergänglichkeit und der Bedrohung der Spezies Mensch als ganzer entgegenwirken zu können glauben.50 Unabhängig davon, wie diese Fragen am Ende – intellektuell oder faktisch – ent‐ schieden werden, tun wir gut daran, unser bewährtes Orientierungswerkzeug zwi‐ schenzeitlich nicht kopflos über Bord zu werfen, weil wir uns in einem Sturm der Veränderung wähnen. Essentiell dazu zählt die Menschenwürde, verstanden als An‐ spruch des Menschen auf Achtung als Mensch. Das widerspricht keineswegs sämtli‐ chen Formen der Ausprägung von Individualität oder spezifischen Gruppeneigen‐ schaften. Und es kommt uns manchmal wie eine Zumutung vor, denn den gleichen Anspruch auf Achtung als Mensch haben auch politisch weniger gut Informierte, die eigene Gesundheit nicht Pflegende und auf ökologische Aspekte Pfeifende. Wie Joa‐ chim Fetzer in der lesenswerten Analyse für die Konrad-Adenauer-Stiftung „Men‐ schenwürde als Leitmotiv der Digitalisierung“ richtig feststellt, gehört ordnungspoli‐ tisches Denken „zu einer Politik der Menschenwürde und muss für die Digitalisie‐ rung neu konkretisiert werden“51. Was das für die Kerngedanken des Ur-Wirt‐ schaftswissenschaftlers Adam Smith bedeutet, ist für Fetzer unzweifelhaft: „Zumin‐ dest als regulative Idee bleibt die Marktform der vollständigen Konkurrenz wichtig, weil so weder Anbieter noch Nachfrager über die Macht verfügen, die Freiheit des jeweils anderen wirksam einzuschränken. (...) Erst der Wettbewerb ermöglicht die 47 Vgl. Steltemeier 2015, S. 511. 48 Unsere heutige Zeit wird mit dem verbreiteten Übergang zu vernetzter Automation und Big Data Analytics gerne als vierte industrielle Revolution bezeichnet. 49 Einer der bekanntesten Vertreter ist Googles Technologie-Chef Ray Kurzweil. 50 Eine Variation dieses Glaubens ist die Vision der Marsbesiedlung des US-Unternehmers Elon Musk, der mit seiner Firma SpaceX in diese Richtung strebt. Die dahinterstehende, intensiv auf die Macht von Technik bauende Grundeinstellung nennt man „Solutionism“: Wir sind sterblich und unser Planet droht zu kollabieren. Also speichern wir unseren Gehirn-Inhalt, frieren unsere Körper ein und besiedeln einen anderen Planeten (je nachdem, welche Bedrohung sich zuerst aktualisiert). 51 Fetzer 2017, S. 11.
225
freiheitliche Gestaltung wechselseitiger Abhängigkeit. Insofern ist der Wettbewerb Ausdruck eines qualitativen Freiheitsverständnisses und der Menschenwürde“ (ebd.). Wie oben gezeigt, ist die Umsetzung dessen unter den gegebenen Vorzeichen nicht leicht, weshalb umso größere Anstrengungen nötig sind. Menschenwürde im‐ pliziert nun allerdings auch ein Entfaltungsrecht, und unter diesem Aspekt ist Bil‐ dung wiederum eine zentrale gesellschaftspolitische Aufgabe. Oben haben wir erör‐ tert, dass dieser Tage auch hier erhebliche Anstrengungen und teils Neuorientierun‐ gen nötig sind, um dem in der Menschenwürde implizierten Entfaltungsrecht von Personen zur Geltung zu verhelfen. Wenn wir uns dem Erbe Adam Smiths – das ja im Grunde nichts weniger als die Grundlegung der sozialen Marktwirtschaft ist – verpflichtet fühlen, dann müssen wir uns diese an den Anfang unserer Überlegungen anknüpfende Frage stellen: Was ist in den beiden hier als wesentlich erachteten Politikfeldern Wirtschaft und Bildung zusammengefasst zu tun, um Smiths Freiheitsverständnis auch im 21. Jahrhunderts Sinn abgewinnen zu können? Die Antworten sind leichter gegeben als umzusetzen. Erstens muss uns im Zeitalter daten- und algorithmengetriebener Geschäftsmodelle eine den Namen verdienende Wirtschaftsordnungspolitik gelingen. Das verlangt ne‐ ben einer effektiven Wettbewerbssicherung im Technologiebereich, zu der sich die neue Bundesregierung laut Koalitionsvertrag etwa durch eine Stärkung der Kartel‐ laufsicht bekennt,52 heute vor allem auch nach einer Datenordnungspolitik.53 Zwei‐ tens müssen wir für die Masse der Bevölkerung Bildung, Aus- und Fortbildung so organisieren, dass sie für das Leben in der heutigen Welt ertüchtigt und auf das Le‐ ben von morgen und übermorgen vorbereitet. Ganz zum Schluss noch eine weitere, mehr auf das große Ganze des liberalen Ge‐ dankengebäudes abzielende Anregung: In der jüngeren Vergangenheit ist von Perso‐ nen aus ganz verschiedenen Lagern die Notwendigkeit eines neuen (digitalen) Ge‐ sellschaftsvertrags (mit oder ohne Versionsnummer 4.0) ins Gespräch gebracht wor‐ den.54 In diesen Stellungnahmen tauchen etliche der hier verhandelten Themen und Stichworte und dazu natürlich viele weitere Schlag- und Reizworte des Digitalisie‐ rungsdiskurses auf. Zum Teil mag man diese gar nicht mehr hören, geschweige denn selbst weiterverbreiten. Interessant wird es jedoch dann, wenn man die Rede vom Gesellschaftsvertrag ideengeschichtlich ernst nimmt und sich parallel die technolo‐ gisch-wirtschaftliche Entwicklung und die politikphilosophische Reflexionsbewe‐ gung dazu anschaut:
52 CDU/CDU, SPD 2018, S. 44 u. 61. 53 „Data Governance“, vgl. Knobloch/Jentzsch 2017. 54 Vgl. exemplarisch Bildt 2016.
226
Tabelle 1: Die Parallelen von Wirtschafts- und Technikentwicklung und liberaler politischer Theorie/Vertragstheorien. Zeit
Technik- u. Wirtschaftsentwicklung
Vertragstheorien / liberale politische Theorie
16. & 17. Jh.
(Landwirtschaft, Handel, Handwerk)
1.0 Klassiker Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu: der moderne Staat formiert sich (staatl. Gewaltmo‐ nopol u. Gewaltenteilung)
18. & 19. Jh.
Dampfmaschine u. industrielle Fertigung
2.0 Aufklärung: Stärkung des Indivi‐ duums gegen hergebrachte politische Ordnung
19. & 20. Jh.
Elektrifizierung u. Automation
(konserv. Rollback, Nationalismen, Weltkriege)
20. Jh. (2. Hälfte)
Digitalisierung u. Automation
3.0 Neue Vertragstheorie (Rawls et al.): Chancengerechtigkeit, soziale Marktwirtschaft („rheinischer Kapita‐ lismus“)
21. Jh.
Vernetzung (vgl. „Industrie 4.0“, Plattformökono‐ mie etc.)
4.0 ? – Was ist das Alternativmodell zum „kalifornischen Kapitalismus“?
Quelle: Knobloch 2016: 122 (für diese Verwendung leicht modifiziert).
Mit Ausnahme des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts sehen wir leicht zeitver‐ setzte Entsprechungen zwischen der einen und der anderen Seite. So ist es keines‐ wegs ein Zufall, dass beispielsweise die Teilung der staatlichen Gewalten und damit eine klare Aufwertung der bürgerlichen Freiheiten zu einer Zeit vorgenommen wur‐ den, als landwirtschaftliche und handwerkliche Betriebe sowie der Handel in Blüte kamen. Auch danach hat es stets eine Art nachholende Modernisierung im Reich der (gesellschaftspolitischen) Ideen als Reaktion auf einen technologisch-wirtschaftli‐ chen Schub gegeben. Allein die Position der politischen Theorie im 4.0-Zeitalter der allumfassenden Datafizierung und Vernetzung ist noch unbesetzt. Hier sind wir auf‐ gefordert, Antworten auf folgende Frage zu suchen: Was für eine datengetriebene, durch und durch digitalisierte Gesellschaft wollen wir sein? Es ist unser aller Aufga‐ be, diese Leerstelle mit etwas zu füllen, das unsere Freiheit dauerhaft zu sichern hilft. Sämtliche technischen Neuerungen mit „Ethik der...“ zu apostrophieren, bringt uns dabei nicht wesentlich weiter. Es geht weniger darum, bestimmte algorithmische Analyse- und Entscheidungssysteme mit einem Unbedenklichkeitsstempel zu verse‐ hen, sondern um eine prinzipielle Positionierung zu neuen Phänomenen - beispiels‐ weise zu der Tatsache, dass Korrelationsanalysen zunehmend die Aufdeckung von Kausalzusammenhängen verdrängen. Das Handeln nach insgesamt unverstandenen, lediglich technisch aufgedeckten Zusammenhängen hält nämlich nicht dem hohen
227
Anspruch stand, den wir als Menschen an freies verantwortliches Verhalten anlegen. Doch eben diesen Anspruch sollten wir nicht aufgeben, wenn uns an einer men‐ schenfreundlichen Zukunft gelegen ist. Adam Smith kann an diesem Vorhaben durch die Schriften und Gedanken, die er uns hinterlassen hat, nur noch indirekt mitwir‐ ken. Aber wir können sicher sein, dass er als Optimist, Menschenfreund und Frei‐ heitsliebender seine Freude daran hätte.
Literatur Andreessen, Marc, 2011: Why Software Is Eating The World. In: The Wall Street Journal am 20.8.2011. Unter: http://www.wsj.com/articles/SB10001424053111903480904576512250 915629460, Download am 09.07.2018. Bathen, Dirk, 2018: Lean Startup, agile Entwicklung, Design Thinking: Die Gemeinsamkei‐ ten hinter den Schlagworten. Blog „Komfortzonen“ am 11.1.2018. Unter: http://komfortzo nen.de/lean-startup-agile-entwicklung-design-thinking-gemeinsamkeiten-prinzipien/, Download am 09.07.2018. Berry, Christopher J., 2010: Adam Smith’s Moral Economy. In: The Kyoto Economic Review 79, H.1, S. 2-15. Bildt, Carl, 2016: Wir brauchen einen neuen Gesellschaftsvertrag. FAZ.net am 22.6.2016. Un‐ ter: http://www.faz.net/aktuell/politik/sicherheit-im-internet-durch-neues-regelsystem-143 00011.html, Download am 09.07.2018. BMWi, 2017: Weißbuch Digitale Plattformen. Digitale Ordnungspolitik für Wachstum, Inno‐ vation, Wettbewerb und Teilhabe. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie am 20.3.2017. Unter: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/weiss buch-digitale-plattformen.html, Download am 09.07.2018. CDU/CSU, SPD, 2018: Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. Berlin, 7.2.2018. Economides, Nicholas, 2001: The Impact of The Internet on Financial Markets. Unter: http:// www.stern.nyu.edu/networks/The_impact_of_the_Internet_on_financial_markets.pdf, download am 09.07.2018. Economides, Nicholas, 2004: Competition Policy In Network Industries: An Introduction. Unter: http://econwpa.repec.org/eps/io/papers/0407/0407006.pdf, Download am 09.07.2018. Etspüler, Monika/Lorenz, Philippe, 2017: Dienstleistung im toten Winkel. Interview mit VDI Nachrichten, Nr. 35 vom 31.8.2017. Unter: https://www.vdi-nachrichten.com/Gesellschaft/ Dienstleistung-im-toten-Winkel, Download am 09.07.2018. Fetzer, Joachim. 2017: Menschenwürde als Leitmotiv der Digitalisierung. Analysen & Argu‐ mente der Konrad-Adenauer-Stiftung, Nr. 284, erschienen im November 2017. Unter: http://www.kas.de/wf/doc/kas_50871-544-1-30.pdf?171129100653, Download am 09.07.2018. Foroohar, Rana, 2016: Makers and Takers: How Wall Street Destroyed Main Street. New York.
228
Ghosh, Dipayan/Scott, Ben, 2018: #DIGITALDECEIT. The Technologies Behind Precision Propaganda on the Internet. New America Foundation & Harvard Kennedy School. Unter: https://na-production.s3.amazonaws.com/documents/digital-deceit-final-update1.pdf, Download am 09.07.2018. Harari, Yuval N., 2016: Homo Deus. München. Häusler, Johnny, 2017: Digitale Bildungspolitik: Der Staat kommt seinen Aufgaben und Pflichten nicht nach. Blog „Spreeblick“ im November 2017. Unter: http://www.spreeblick. com/blog/2017/11/03/digitale-bildungspolitik-der-staat-kommt-seinen-aufgaben-und-pflic hten-nicht-nach/, Download am 09.07.2018. Hill, Steven, 2017: Die Start-up-Illusion. Wie die Internet-Ökonomie unseren Sozialstaat rui‐ niert. München. Jentzsch, Nicola, 2018: Dateneigentum – Eine gute Idee für die Datenökonomie? Reihe Im‐ pulse der Stiftung Neue Verantwortung, erschienen am 30.1.2018. Unter: https://www.stift ung-nv.de/de/publikation/dateneigentum-eine-gute-idee-fuer-die-datenoekonomie, Download am 09.07.2018. Kartellamt, 2017: Vorläufige Einschätzung im Facebook-Verfahren: Das Sammeln und Ver‐ werten von Daten aus Drittquellen außerhalb der Facebook Website ist missbräuchlich. Meldung vom 19.12.2017. Unter: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/ DE/Pressemitteilungen/2017/19_12_2017_Facebook.html, Download am 09.07.2018. Kauder, Volker, 2018: Deutschland braucht einen Digitalrat. Gastbeitrag in der WELT vom 28.1.2018. Unter: https://www.welt.de/debatte/kommentare/article172922212/GastbeitragDeutschland-braucht-einen-Digitalrat.html, Download am 09.07.2018. KMK, 2016: Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz. Unter: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2016/Bildung_digitale_ Welt_Webversion.pdf, Download am 09.07.2018. Knobloch, Tobias, 2016: Universelle Datafizierung und die Notwendigkeit eines Gesell‐ schaftsvertrags für die Netzwerkgesellschaft. In: Torhauer, Y./Kexel, C.A. (Hrsg.), 2016: Face-to-Interface. Werte und ethisches Bewusstsein im Internet, Wiesbaden, S. 115-127. Knobloch, Tobias/Jentzsch, Nicola, 2017: Data Governance – Ein neuer datenpolitischer An‐ satz. Reihe Impulse der Stiftung Neue Verantwortung vom 6.10.2017. Unter: http://www.st iftung-nv.de/datagov, Download am 09.07.2018. Kurz, Heinz D., 2016: Adam Smith on Markets, Competitions and Violations of Natural Li‐ berty. In: Cambridge Journal of Economics, H.40, S. 615-638. Langkabel, Thomas, 2017: Die blinden Stellen bei der Suche nach der Digitalen Verwaltung. Blog langkabel.de vom 30.09.2017. Unter: http://www.langkabel.de/die-blinden-stellen-be i-der-suche-nach-der-digitalen-verwaltung-teil-1/, Download am 09.07.2018. Madsbjerg, Saadia, 2017: It’s Time to Tax Companies for Using Our Personal Data. The New York Times (online) am 14.11.2017. Unter: https://www.nytimes.com/2017/11/14/business /dealbook/taxing-companies-for-using-our-personal-data.html, Download am 09.07.2018. Manske, Julia, 2014: Ein Code erklärt noch nicht die Welt. Warum es noch nicht damit getan ist, Programmieren als Schulfach einzuführen. Ein Plädoyer für das Fach „Digitalkunde“. Reihe Impulse der Stiftung Neue Verantwortung, Oktober 2014. Unter: http://www.stiftung -nv.de/publikation/ein-code-erklärt-noch-nicht-die-welt, Download am 09.07.2018.
229
Manske, Julia/Knobloch, Tobias, 2017: Datenpolitik jenseits von Datenschutz. Reihe Policy Brief der Stiftung Neue Verantwortung, erschienen am 02.11.2017. Unter: https://www.stif tung-nv.de/de/publikation/datenpolitik-jenseits-von-datenschutz, Download am 09.07.2018. METIS, 2017: METIS ausgezeichnet vom Stifterverband. Meldung vom 15.12.2017. Unter: http://www.rfh-koeln.de/aktuelles/meldungen/2017/metis_ausgezeichnet_vom_stifterverba nd/index_ger.html, Download am 09.07.2018. Morozov, Evgeny, 2018: Die Menschen müssen die Daten der Internet-Giganten zurücker‐ obern. Süddeutsche Zeitung (online) vom 19.1.2018. Unter: http://www.sueddeutsche.de/d igital/digitale-abhaengigkeit-die-menschen-muessen-die-daten-der-internet-giganten-zurue ckerobern-1.3828542, Download am 09.07.2018. Mulgan, Geoff, 2017: Digital: Growing The Best, Not The Worst. Reihe „Politik Denken“ der Konrad-Adenauer-Stiftung, Band 2, erschien im Mai 2017. Unter: http://www.kas.de/wf/d oc/kas_49034-544-1-30.pdf?170529155039, Download am 09.07.2018. Nutzinger, Hans G., 1991: Das System der natürlichen Freiheit bei Adam Smith und seine ethischen Grundlagen. In: Jahrbuch Ökonomie und Gesellschaft, Band 9 (Adam Smiths Beitrag zur Gesellschaftswissenschaft), Frankfurt a.M./New York, S. 79-100. ÖFIT (Kompetenzzentrum Öffentliche IT), 2018: Initial Coin Offering ICO. ÖFIT-Trend‐ schau, Trendthema 51, erschienen im Januar 2018. Unter: http://www.oeffentliche-it.de/-/i nitial-coin-offering-ico, Download am 09.07.2018. Pasquale, Frank, 2017: Will Amazon Take Over The World? Boston Review am 20.7.2017. Unter: http://bostonreview.net/class-inequality/frank-pasquale-will-amazon-take-over-worl d, Download am 09.07.2018. Smith, Adam, 1853: The Theory of Moral Sentiments. London. Smith, Adam, 2008: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Oxford. Smith, Ben, 2017: There’s Blood in the Water in Silicon Valley. The Bad New Politics of Big Tech. Buzzfeed am 12.9.2017. Unter: https://www.buzzfeed.com/bensmith/theres-blood-in -the-water-in-silicon-valley, Download am 09.07.2018. Steltemeier, Rolf, 2015: Liberalismus. Ideengeschichtliches Erbe und politische Realität einer Denkrichtung. Baden-Baden. Streminger, Gerhard, 1988: Adam Smiths Gerechtigkeitskonzeption. In: Schramm, Alfred (Hrsg.): Philosophie des Rechts, der Politik und der Gesellschaft, Wien 1988, S. 67-76. Wilkens, Andre, 2015: Analog ist das neue Bio. Berlin. World Inequality Lab, 2017: Bericht zur weltweiten Ungleichheit 2018. Kurzfassung, Deutsch. Unter: http://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-german.pdf, Download am 09.07.2018.
230
Nachruf für Tim Kraski
Tim Kraski, Mitherausgeber und Mitautor des vorliegenden Bandes, ist am 21. Mai 2019 im Alter von 36 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Er war Doktorand im binationalen Promotionsprogramm der Andrássy Universität Budapest (AUB) und der Universität Passau; zudem war er von November 2012 bis Juni 2017 wis‐ senschaftlicher Mitarbeiter an meinem Lehrstuhl für europäische und internationale Politik an der AUB. Mit Tim Kraski verliert die wissenschaftliche Gemeinschaft einen jungen Wissen‐ schaftler, der sich durch eine außergewöhnliche intellektuelle und akademische Be‐ gabung auszeichnete, und einen hochgeschätzten und angesehenen Kollegen. Im binationalen Doktoratsprogramm hat Tim Kraski an seiner Dissertation zum Thema „Das politische Denken von Adam Smith und Karl Marx: Eine vergleichende Analyse“ gearbeitet. Die Dissertation befasste sich mit den Grundlagen des wirt‐ schaftlichen und politischen Liberalismus am Beispiel der Position von Adam Smith und mit der radikalen Kritik von Karl Marx am Liberalismus. Das Anliegen von Tim Kraski war es, in der Auseinandersetzung mit zentralen Positionen der Ideenge‐ schichte die Grundlagen unserer politischen und ökonomischen Ordnung zu erfas‐ sen. Aufgrund seiner Erkrankung konnte er die Arbeit leider nicht vollenden. Der vorliegende Band steht in unmittelbarem Zusammenhang zu seinem Promotionsvor‐ haben und Tim Kraski hat trotz seiner Erkrankung mit großem Einsatz und Engage‐ ment daran mitgewirkt, die Beiträge zu redigieren. Meine Zusammenarbeit mit Tim Kraski als wissenschaftlichem Mitarbeiter war außergewöhnlich. Wir haben gemeinsam u.a. zahlreiche Tagungen und Exkursionen organisiert sowie das binationale Promotionsprogramm und das Doppelmasterpro‐ gramm „Governance in Mehrebenensystemen – Internationale Beziehungen/Staats‐ wissenschaften“ der Andrássy Universität Budapest und der Universität Passau kon‐ zipiert und umgesetzt. Stets hat er die Aufgaben mit großem Engagement, außeror‐ dentlichem Geschick und beeindruckender Eigenständigkeit ausgeführt. Auch bei den Studenten war Tim Kraski ein beliebter und engagierter Dozent. Seine Lehrver‐ anstaltungen waren nicht nur konzeptionell und organisatorisch perfekt vorbereitet, sondern fanden dank seines freundlichen, zugewandten und humorvollen Wesens in einer wunderbaren Atmosphäre statt. Neben der Arbeit an seiner Dissertation zeigte Tim Kraski ein ausgeprägtes Inter‐ esse an aktuellen politischen Fragen. Ein besonderer Interessensschwerpunkt lag da‐ bei im Bereich der politischen Bildung. Es war ihm sehr bewusst, dass eine freiheit‐ liche und demokratische politische Ordnung von der politischen Bildung ihrer Bür‐
231
ger abhängt. Von seinem großen wissenschaftlichen Interesse zeugen unter anderem auch seine zahlreichen Publikationen und Konferenzvorträge der letzten Jahre. Mit Tim Kraski verliert die Politikwissenschaft einen überaus engagierten und be‐ gabten jungen Mann, der mit seinem Einsatz und seinen Fähigkeiten noch viel für sein Fach und für die politische Bildungsarbeit hätte leisten können. Die Mitarbeite‐ rinnen und Mitarbeiter der AUB verlieren einen Kollegen und Mitstreiter, der inner‐ halb der AUB und im Kontakt mit Partnerorganisationen wie Partneruniversitäten, politischen Stiftungen und den Kulturabteilungen der deutschen, österreichischen und polnischen Botschaft eine große Fähigkeit zur fruchtbaren Zusammenarbeit be‐ wies und für sein freundliches Auftreten, seine Zuvorkommenheit und seine kolle‐ giale Zugewandtheit allseits hochgeschätzt wurde. Persönlich verliere ich einen Doktoranden, Kollegen und Freund, der mir ein besonders wichtiger Gesprächspart‐ ner war. Tim Kraski starb viel zu jung, aber er wird in Gedanken bei uns bleiben. Meine Gedanken sind bei seinen engsten Angehörigen – seiner Frau, seinen Eltern und sei‐ ner Schwester –, denen meine aufrichtige Anteilnahme gilt. Hendrik Hansen
232
Verzeichnis der Autoren
Aßländer, Michael, Prof. Dr. Dr., Lehrstuhl für Sozialwissenschaften am Internatio‐ nalen Hochschulinstitut Zittau. Fricke, Christel, Prof. Dr., Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, Universität Oslo. Hansen, Hendrik, Prof. Dr., Inhaber der Professur für politischen Extremismus und politische Ideengeschichte am Fachbereich Nachrichtendienste der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Hochgeschwender, Michael, Prof. Dr., Inhaber der Professor für Nordamerikanische Kulturgeschichte, Empirische Kulturforschung und Kulturanthropologie am Ameri‐ ka-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München. Knobloch, Tobias, Dr., Managing Analyst Public Sector bei der Capgemini Deutsch‐ land GmbH. Kraski, Tim, Dipl.-Kulturwirt, Lic., M.A., war wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Lehrstuhl für europäische und internationale Politik der Andrássy Universität Budapest. Kurz, Heinz D., em. o. Univ.-Prof. Dr., Universität Graz, Fellow des Graz Schumpe‐ ter Centre. Priddat, Birger, Prof. Dr., Seniorprofessur für Wirtschaft und Philosophie an der Universität Witten/Herdecke. Ronge, Bastian, Dr., Lehrstuhl für Praktische Philosophie und Sozialphilosophie an der Humboldt Universität zu Berlin. Steltemeier, Rolf, PD Dr., Ministerialdirigent im Bundesministerium für wirtschaftli‐ che Zusammenarbeit und Entwicklung. Sturn, Richard, Prof. Dr., Leiter des Instituts für Finanzwissenschaft und Öffentliche Wirtschaft sowie des Graz Schumpeter Centres, Universität Graz.
233