Musik in der Moderne: Music and Modernism 9783205791621, 9783205774389
169 4 7MB
German Pages [382] Year 2011
Polecaj historie
Citation preview
WIENER VERÖFFENTLICHUNGEN ZUR MUSIKGESCHICHTE 9 Herausgegeben von Markus Grassl und Reinhard Kapp
FEDERICO CELESTINI · GREGOR KOKORZ · JULIAN JOHNSON (HG.)
Musik in der Moderne Music and Modernism
Böhlau Verlag Wien · Köln · Weimar
Gedruckt mit der Unterstützung durch das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung Wien, die Universität Graz – SFB Moderne, die Steiermärkische Sparkasse
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar ISBN 978-3-205-77438-9
Coverillustration: Ausschnitt aus Gustav Klimt, Beethovenfries: Diesen Kuss der ganzen Welt Secession Wien/Österreichische Galerie Belvedere
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. © 2011 by Böhlau Verlag Ges. m. b. H. und Co. KG, Wien · Köln · Weimar www.boehlau-verlag.com Gedruckt auf umweltfreudlichem, chlor- und säurefrei gebleichtem Papier. Satz: Zwiebelfisch – Lektorat und Layout Druck: Prime Rate kft., Budapest
Inhalt
1
Inhaltsverzeichnis
Vorwort ................................................................................................................... 5 Preface . .................................................................................................................. 7 Federico Celestini / Gregor Kokorz Musik in der Moderne. Einige Vorbemerkungen . ................................................ 9
Identität und Differenz Albrecht Riethmüller Der Deutschen Glauben an musikalische Überlegenheit .................................... 17 Barbara Boisits Monumentales Gedächtnis und kulturelle Identität. Die Wiener Beethoven-Feier von 1870 ................................................................ 37 James Deaville Cakewalk contra Walzer: Negotiating Modernity and Identity on Jahrhundertwende Vienna’s Dance Floors .............................................................. 55 Peter Franklin The Politics of Distance in Mahler’s Musical Landscape ..................................... 69 Julian Johnson Identity and Voice in the Music of Gustav Mahler .............................................. 79 Jeremy Barham “Made in Germany”: Mahler, Musicological Imperialism and the Decentred Self . .............................................................................................. 91 Philip V. Bohlman Rückkehr in die Zukunft – Die antike Moderne der jüdischen Musik .............. 105
2
Inhalt
Eva Maria Hois Der Erste Weltkrieg und die Musikhistorische Zentrale beim k. u. k. Kriegsministerium ........................................................................ 123 Sylwia Zabieglińska Schönberg and Kandinsky: Artistic Ideals and the Question of Identity .......... 145
Wahrnehmung und Alterität Christian Kaden Wie neu, als sie neu war, war die Neue Musik? Aspekte eines Modernisierungsprozesses .......................................................... 163 Tomasz Baranowski Scriabin and the Modernist Idea of Correspondance des arts ............................... 179 Elfriede Wiltschnigg „Bedrohung“ und „Erlösung“ des männlichen Ich. Die bildliche Umsetzung und Interpretation von Beethovens Neunter Symphonie durch Gustav Klimt im Beethovenfries ................................... 187 Georg Beck Die Moderne im Musikdenken Guido Adlers . .................................................. 203 Reinhard Kapp Zwei Wiener Schulen: Freud und Schönberg . ................................................... 221 Arndt Niebisch The Psychophysics of Luigi Russolo’s intonarumori . .......................................... 243 Martin Eybl Hören und Gedächtnis in Schönbergs Ästhetik. Begriffs- und ideengeschichtliche Vorüberlegungen . ....................................... 263 Kordula Knaus Medialisierung eines Mythos: das Bild Lulus bei Alban Berg ........................... 275
Inhalt
3
Moderne und Postmoderne Ulrike Kienzle Entropie der Erinnerung. Der Komponist Giuseppe Sinopoli und die Wiener Moderne . ................................................................................. 287 Nikolaus Urbanek (Wie) Ist Musikästhetik heute noch möglich? Unzeitgemäße Notizen zu einer zeitgemäßen Beantwortung einer zeitlosen Frage .......................................................................................... 305 Dominik Schweiger Die Wiener Schule und das Postmoderne . ........................................................ 327 Regina Busch Dasselbe immer anders. Über Variationen, Reprisen und Ähnliches ............... 339 Susanne Kogler „Réécrire la modernité“? Überlegungen zum Wandel des Werkbegriffes in der aktuellen musikalischen Produktion ....................................................... 351
Abstracts English Abstracts of the German Essays ............................................................ 371
4
Inhalt
Vorwort
5
Vorwort
Der vorliegende Band versammelt die Beiträge des Symposions Musik in der Moderne/Music and Modernism, das im Rahmen des Spezialforschungsbereichs (SFB) Moderne – Wien und Zentraleuropa um 19001 im Sommer 2004 in Graz veranstaltet wurde. Dieses interdisziplinäre Forschungsprojekt, dem HistorikerInnen, PhilosophInnen, SoziologInnen, KunsthistorikerInnen, GermanistInnen und MusikwissenschafterInnen angehörten, befasste sich mit den Modernisierungsprozessen in der zentraleuropäischen Region, wobei insbesondere die Koexistenz von politischen und kulturellen Konflikten, der Krise der individuellen und kollektiven Identitäten sowie der außergewöhnlichen Kreativität dieses Raumes thematisiert wurde. Die Heterogenität von Traditionen, die kulturelle Pluralität und die Mehrsprachlichkeit in der Region, zusätzlich geschärft durch die Modernisierungs- und Urbanisierungsprozesse, erschien bald sowohl für die Destabilisierung als auch für die künstlerische Kreativität verantwortlich zu sein. Wien und Zentraleuropa um 1900 wurden innerhalb der Arbeit des Spezialforschungsbereiches jedoch nicht nur zum Gegenstand historischer Forschung, sondern avancierten zum Labor für aktuelle Entwicklungen in einer globalisierten Welt. Der vergleichende Blick auf die Jahrhundertwende und auf die zeitgenössischen Prozesse etablierte sich als wichtige Forschungsperspektive, die Thesen Jean-François Lyotards und Wolfgang Welsch’ über die Geburt der postmodernen Philosophie aus dem Geist der modernen Kunst wurden ausführlich diskutiert. Weitere wesentliche Impulse kamen aus den Postcolonial Studies und aus Homi Bhabhas Konzept kultureller Hybridität. Vor diesem theoretischen Hintergrund zielte das Grazer musikwissenschaftliche Symposion darauf, die musikwissenschaftliche Forschung über die Musik der Jahrhundertwende um 1900 mit der interdisziplinären Forschung zur europäischen Moderne zu konfrontieren. Zu diesem Zweck wurden drei thematische Bereiche aus der interdisziplinären Forschung aufgenommen und als Perspektive für die musikwissenschaftliche Reflexion formuliert, die sich auch in der inhaltlichen 1 Ausführliche Information zu diesem zehnjährigen Forschungsprojekt sind über den folgenden WebLink zu beziehen: http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/moderne/. Die musikwissenschaftlichen Projekte sind gelistet in: http://www-classic.uni-graz.at/muwi2www/SFB/Index.html. Siehe auch: Newsletter Moderne, http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/moderne/dok.htm sowie Moritz Csáky, Astrid Kury, Ulrich Tragatschnig (Hrsg.), Kultur-Identität-Differenz. Wien und Zentraleuropa in der Moderne, Innsbruck 2004 (Gedächtnis-Erinnerung-Identität 4).
6
Vorwort
Gliederung des vorliegenden Bandes spiegeln: Die erste Sektion kreist um die Frage nach Identitäten und Differenzen, in der zweiten werden Wahrnehmung und Alterität thematisiert, während die dritte Sektion das Verhältnis zwischen Moderne und Postmoderne in der Musik untersucht. Nicht nur die Struktur des Symposions wurde im vorliegenden Band unverändert übernommen, sondern auch die Sprachen der Vorträge (Deutsch und Englisch) beibehalten. Die deutschen Beiträge wurden dabei um englische abstracts ergänzt, die sich am Ende des Bandes befinden. In diesem Zusammenhang gilt unser besonderer Dank Julian Johnson, der sich freundlicherweise bereit erklärt hat, die Redaktion dieser Abstracts und der englischsprachigen Beiträge zu übernehmen. Weiterer Dank gebührt Reinhard Kapp und Markus Grassl für die Aufnahme des Bandes in die von ihnen herausgegebenen Reihe Wiener Veröffentlichungen zur Musikgeschichte, Elisabeth Klöckl-Stadler für das Layout sowie den nachfolgenden Institutionen, die durch ihre großzügige finanzielle Unterstützung sowohl das Symposium als auch die vorliegende Veröffentlichung ermöglicht haben: der Spezialforschungsbereich Moderne – Wien und Zentraleuropa um 1900, die Steiermärkische Sparkasse, das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, die Stadt Wien und die Stadt Graz. Graz, Februar 2011
Federico Celestini, Gregor Kokorz
Vorwort
7
Preface
This volume presents a collection of papers given at the musicological symposium Music and Modernism held in Graz in 2004 as part of the interdisciplinary research project Modernity: Vienna and Central Europe around 1900. This trans-disciplinary collaboration between historians, philosophers, sociologists, art-historians, philologists and musicologists focused on processes of modernization in Central Europe; in particular, on the co-existence of historical conflicts, individual and collective destabilization and enormous creativity in the region. The research project identified the heterogeneity of traditional ethnic, cultural and linguistic plurality in the region, further augmented by processes of modernization and urbanization, to be crucial for understanding both destabilization and creativity. These processes of pluralization and differentiation were not analyzed from a purely historical perspective however, as the Habsburg Empire may be seen to be a kind of historical laboratory for present-day developments in a globalized world. Parallels between historical and contemporary developments thus became a focus of theoretical discourse, where hypotheses such as those by Jean-François Lyotard and Wolfgang Welch on the birth of postmodern philosophy out of the spirit of modern arts were discussed. The postcolonial discourse and Homi Bhabha’s concept of hybridity were used as theoretical frameworks for the understanding of historical developments.1 Against this general background, the musicological symposium of 2004 was planned to connect trans-disciplinary research on modernism with musicological research on the period around 1900. For this purpose, three central aspects of trans-disciplinary research on modernism were adopted as guidelines for the three sections of the symposium, reflected (with only minor changes) in the present publication. The first section deals with questions of identity and difference, the second focuses on aspects of perception and otherness, while the third discusses the relationship between modernity and post-modernity in music. 1 For further information on this research project please refer to: http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/ moderne/. Musicological projects are listed under: http://www-classic.uni-graz.at/muwi2www/SFB/ Index.html. Further publications are: Newsletter Moderne, http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/moderne/dok.htm and Moritz Csáky, Astrid Kury, Ulrich Tragatschnig [Eds.], Kultur-Identität-Differenz. Wien und Zentraleuropa in der Moderne. Innsbruck 2004 (= Gedächtnis-Erinnerung-Identität 4).
8
Preface
Just as the structure of the material remains unchanged, so too do the languages of the individual presentations, which were originally given either in English or German. English abstracts of the German-language essays may be found in an appendix. We extend particular thanks to our dear colleague Julian Johnson for editing these abstracts and the English articles. Furthermore, we would like to thank Reinhard Kapp and Markus Grassl for publishing this book in their series Wiener Veröffentlichungen zur Musikgeschichte, Elisabeth Stadler for her assistance with correction and layout, and the following institutions for their financial support, without which the symposium and publication of this volume would have been impossible: Spezialforschungsbereich Moderne – Wien um 1900, Steiermärkische Bank, Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Stadt Wien. Graz, February 2011
Federico Celestini, Gregor Kokorz
Einleitung
9
Federico Celestini/Gregor Kokorz Musik in der Moderne. Einige Vorbemerkungen
Es mag widersprüchlich erscheinen, das letzte Symposium eines fachübergreifenden Spezialforschungsbereichs mit einem musikwissenschaftlichen Thema und mit einer überwiegenden Anzahl der Referentinnen und Referenten, die aus der musikwissenschaftlichen Disziplin stammen, zu bestreiten. Neben der unwiderstehlichen Versuchung, drei Tage lang ein kleines Fach wie unseres ins Zentrum der akademischen Öffentlichkeit zu setzen, sind freilich weitere Gründe zu nennen, die uns zu dieser Idee gebracht haben. Wir sind von der Überzeugung ausgegangen, dass Interdisziplinarität im Rahmen eines Symposiums nicht bloß durch die Nebeneinanderreihung von Vorträgen aus unterschiedlichen Disziplinen erreicht werden kann, sondern dass sie in der Formulierung der Fragestellung impliziert werden muss. Demzufolge haben wir drei Themenschwerpunkte ausgewählt, die sich im Laufe der zehnjährigen Forschungsarbeit des Spezialforschungsbereichs Moderne als Leitlinien herauskristallisiert haben. Damit verfolgen wir das Ziel, die musikwissenschaftliche Forschung an die interdisziplinäre Moderne-Forschung anzubinden und dadurch Automatismen und Selbstreferenzialität aufzubrechen. Die Referentinnen und Referenten, die an dem Symposium Musik in der Moderne teilnahmen, haben mit ihren Vorschlägen auf eine inhaltliche Vorlage reagiert, in die die Ergebnisse einer fachübergreifenden Moderneforschung eingeflossen und speziell auf die Musik gerichtet worden sind.
Zur Frage der Identität und Differenz Die Frage, die um Identität und Differenz kreist, stellt den ersten thematischen Schwerpunkt des Symposiums dar. Die von Charles Baudelaire in der Großstadt Paris zuerst thematisierte Erfahrung der Fragmentierung der Wirklichkeit in der Wahrnehmung wurde in der Habsburgischen Monarchie weniger durch die Wirkung einer verspäteten Modernisierung als durch eine im europäischen Kontext außergewöhnliche Heterogenität der Sprachen, der kulturellen Horizonte und der politisch-nationalen Konzepte herbeigeführt. Dass in einer solchen Situation die Identitätsfrage besonders virulent ausbrach, ist nicht verwunderlich und in der Moderneforschung entsprechend ausführlich behandelt. Diese Frage lässt sich
10
Federico Celestini/Gregor Kokorz
aber in der Musikproduktion, -rezeption und -reflexion nicht lediglich auf der biografischen Ebene der verwickelten Akteure untersuchen – wo sie bestimmt eine wichtige Rolle spielt –, sondern wird in der Musik und durch die Musik selbst thematisiert. Auf diesen letzten Aspekt richtet sich unsere Aufmerksamkeit. Das Thema Identität und Differenz in der Musik kann sowohl von der Perspektive der ästhetischen Subjektivität als auch von jener der Objektivität, des musikalischen „Textes“ angegangen werden. Diese beiden Perspektiven scheinen zunächst verschieden zu sein, erweisen sich jedoch im Zuge einer eingehenden Untersuchung als miteinander verbunden. Die Betrachtungsweise, die vom Subjekt ausgeht, hat in der ästhetischen Reflexion eine lange Tradition, die auf die Antike zurückreicht: Plato zufolge erzeugt die Kunst einen Schein, in dem der Künstler außer sich gerät und von den eigenen Bildern beherrscht wird. Am Beispiel des Rhapsoden erläutert Plato, dass die Dichtung eine autonome Macht freisetzt, die darin besteht, die identifikatorischen Grenzen zu überschreiten (Ion, 534b). Dadurch stellt er eine Verbindung zwischen ästhetischem Schein und Selbstvergessenheit her, die ihn dazu führt, die Kunst wegen ihres subversiven Potenzials aus dem Staat zu verbannen. Diese Verbindung zwischen Kunst und Negation der Identität steht im Zentrum der Überlegungen Nietzsches um das Dionysische und somit der ästhetischen Debatte in der Jahrhundertwende. Aus dieser Betrachtungsperspektive erweist sich die Kunst der Moderne und im Besonderen die Musik der Wiener Moderne als ein Ort der De-Identifikation, in dem das Subjekt sich einer radikalen Erfahrung der Andersheit eröffnet. Das symphonische Werk Gustav Mahlers bietet ein kolossales Beispiel für die Vervielfältigung ästhetischer Subjektivität. In seinen Symphonien erklingt eine irreduzible Pluralität der Stimmen, der Stile und der Idiome. Der mehrstimmige Satz, gewöhnlich seriöses Moment der Gelehrtheit und der Huldigung an die Tradition, wird bei Mahler zum erstaunlichen Mittel für die Zusammenfügung des Disparaten. Wenn Michail Bachtin auf die musikalische Metapher der Polyfonie für die Bezeichnung der stilistischen Vielfalt im Roman zurückgreift, dann liefert die Symphonik Mahlers die klangliche Evidenz für dieses Phänomen. Das Romanhafte an der symphonischen Musik und das Polyfonische am Roman sind gegenseitig aufeinander verweisende Momente ästhetischer Pluralität. Das Andere des Subjekts ist aber nicht nur ein anderes Subjekt, in das man sich mimetisch einfühlen kann, sondern auch etwas anderes als das Subjekt, nämlich das Unbewusste, der gemeinsame Nenner in der Musik der Wiener Moderne und zugleich das Andere der Vernunft. Die Frage nach Identität und Differenz betrifft aber auch den musikalischen „Text“ selbst. Hier bietet sich die Adorno’sche Denkfigur des Nicht-Identischen an. Bereits Nietzsche leitet den Gedanken ein, dass das ästhetische Zeichen überschüssig sei und dadurch auf keinen eindeutigen Sinn festzulegen. Von Ador-
Einleitung
11
no – wie Nietzsche ein Sprachkünstler – stammt die fulminante Formulierung, das Kunstwerk sei mit sich selbst nicht identisch. Die Verbindung zwischen Infragestellung der subjektzentrierten Identität und Subversion der Eindeutigkeit der Sinnbezüge wird in der musikalischen Moderne offengelegt. Diese ermöglicht es, Betrachtungsweisen von Musik, die traditionell als unvereinbar gelten, miteinander in Zusammenhang zu bringen. Bereits bei Plato weist die Feststellung des de-identifikatorischen Potenzials von Kunst auf eine gesellschaftliche Dimension hin und wird demgemäß in einem „politischen“ Werk, der Politeia, behandelt. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit betrifft hingegen eine spefizifisch ästhetische Ebene der Analyse. Beide Richtungen sind aufeinander bezogen, und zwar in einer Weise, welche moderne Musik als Unterminierung der alltäglichen Subjekt-ObjektRelation, das heißt der alltäglichen Wahrnehmungsweise, erscheinen lässt.
Zum Wahrnehmungswandel in der Moderne Die Infragestellung von Identität und der Verlust der Eindeutigkeit von Sinnbezügen ist jedoch wesentlich an das Phänomen der Wahrnehmung gekoppelt. Im Zeitraum der Moderne lässt sich sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf künstlerischer Ebene eine zunehmend intensivere Auseinandersetzung mit Fragen von Wahrnehmung beobachten, wodurch sich bezogen auf die Musik Betrachtungsweise und Wahrnehmung derselben stark verändern und bis dahin selbstverständliche Vorstellungen von Musik infrage gestellt werden. Die klare Unterscheidung, die beispielsweise Hermann von Helmholtz in seiner 1862 veröffentlichten Lehre von den Tonempfindungen zwischen Klang und Geräusch vornehmen konnte, indem er den musikalischen Klang als geordnete Schwingungsform von der ungeordneten, chaotischen Welt der Geräusche schied, behält zwar als physikalische Aussage auch bei der 1912 posthum veröffentlichten 6. Auflage ihre Gültigkeit, die implizit vorhandene ästhetische Wertung, wonach Klänge als musikalisches Material verwendbar sind, Geräusche jedoch nicht, hat ihre Gültigkeit eingebüßt. Es ist nicht nur Luigi Russolo, der mit seinen Intonarumori den „engen Kreis der reinen Töne um die unendliche Vielfalt der Geräusche“ zu erweitern sucht, sondern die intensive Auseinandersetzung mit Fragen der Klanglichkeit unter Einbezug geräuschhafter Komponenten lässt sich auch in den Kompositionen Gustav Mahlers oder Anton Weberns beobachten. Mit diesem Einsatz von Geräuschen als musikalischem Gestaltungsmittel wird nicht nur eine bis dahin in der europäischen Kunstmusik geltende Unterscheidung zwischen Klang und Geräusch aufgehoben, sondern diese Transformation von Geräuschen zu einem ästhetischen Klangerlebnis setzt auch
12
Federico Celestini/Gregor Kokorz
eine Transformation der Wahrnehmung voraus und fordert vom Hörer eine andere Art des Hörens. Gründe für diese veränderte Form der Wahrnehmung und Bewertung können zum einen im generellen Modernisierungsprozess und der technischen Innovation gesehen werden. Für die Futuristen führt zweifellos die lärmende Atmosphäre der modernen Großstadt mit all ihren Maschinen und Motoren dazu, dass das Ohr, das durch diese an verschiedensten Geräuschen so überreiche Schule des modernen Lebens gegangen ist, zu einer veränderten Wahrnehmung gelangt. Insgesamt bedingen die technischen Innovationen der Moderne wie die Erfindung der Fotografie, des Films oder des Phonographen, der das Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit von Musik einleitet, ein verändertes Wahrnehmungsverhalten. Die in der Moderne beobachtbaren Wahrnehmungsveränderungen und der damit einhergehende Verlust an Eindeutigkeit und Selbstverständlichkeit sind jedoch maßgeblich auch durch die Erfahrung von Alterität geprägt. Diese Alteritätserfahrungen ereignen sich in der Moderne in verschiedenen Bereichen und haben gerade für den von einer starken ethnischen und kulturellen Pluralität gekennzeichneten zentraleuropäischen Raum eine große Bedeutung. Wien wird durch die im Zusammenhang mit dem Modernisierungsprozess einsetzende Zuwanderung aus den nichtdeutschsprachigen Kronländern der Monarchie zu einem Ort, an dem eine Vielzahl von kulturellen Milieus, Sprachgemeinschaften und Volksgruppen aufeinandertreffen. Die Stadt im Allgemeinen wird nicht nur zum Inbegriff der Moderne, sondern, wie es Georg Simmel beschreibt, gleichzeitig auch zum paradigmatischen Ort der Begegnung mit dem Fremden, an dem unterschiedliche Wirklichkeiten aufeinandertreffen. Im Bereich der Musik ergibt sich eine Verbindung zwischen Wahrnehmungsfragen und Alteritätserfahrung vor allem durch die Untersuchung fremder Musikkulturen. Der expandierende Kolonialismus, die verbesserten Verkehrswege und intensivierte Handelsbeziehungen, nicht zuletzt aber der Aufschwung der Weltausstellungen und Völkerschauen führen dazu, dass man in Europa in einem bis dahin noch nie dagewesenen Ausmaß mit Produkten und Menschen außereuropäischer Länder in Berührung kommt und dass im Zuge dieses Prozesses schließlich auch die Musik zum Gegenstand des Interesses wird. Auffällig aber keineswegs zufällig ist, dass sich dieses Interesse im Rahmen der Wahrnehmungsforschung vollzieht, wodurch es in den frühen Arbeiten der vergleichenden Musikwissenschaft zu einer Koinzidenz von Wahrnehmungsforschung und Musikethnologie kommt. Die Auseinandersetzung mit Wahrnehmungsprozessen führt, wie beispielsweise im Fall von Carl Stumpf, zu einem Interesse an außereuropäischer Musik, wobei die aus den tonpsychologischen Untersuchungen gewonnenen Erfahrungen, das Wissen um die Komplexität von Hörprozessen, bedingt durch eine kritische Reflexion
Einleitung
13
des eigenen Hörurteils zu einer veränderten Herangehensweise führen, wodurch letztendlich die Anerkennung von von eigenen Vorstellungen abweichenden Musikformen ermöglicht wird. Das Wissen um Wahrnehmungsprozesse verändert den Zugang zu Fremden, und die Konfrontation mit alteritären Formen führt zu einer Veränderung der eigenen Wahrnehmungsweise. Die heftige Debatte um die Bewertung dieser Musik, die Frage, ob es sich dabei tatsächlich um Musik oder doch eher um eine primitive Vorstufe oder ganz einfach um Lärm handle, die Diskussion um Tonhöhen und Skalen und die Frage der universellen Gültigkeit der Dur-Moll-Tonalität belegen, dass diese Konfrontation mit Alterität keinesfalls unproblematisch verlaufen ist, weil dadurch eigene Vorstellungen und als selbstverständlich erachtete Grundlagen der Musik und der Wahrnehmung infrage gestellt werden. Die Anerkennung von Differenz, die Akzeptanz von Musik, die nicht den eigenen Vorstellungen und Hörgewohnheiten entspricht, führt zwangsläufig zu einem Verlust an Selbstverständlichkeit, der jedoch auch neue Möglichkeiten eröffnet. In dem Moment, in dem die Grundlagen des eigenen Schaffens den Charakter universell gültiger Gesetzmäßigkeit verlieren und als kulturelle Setzungen erkannt werden, die durch andere Setzungen abgelöst werden können, eröffnet sich eine Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten. Die intensive Auseinandersetzung mit Geräuschen gehört dazu ebenso wie das Experimentieren mit Mikrointervallen oder die von der Zweiten Wiener Schule erzielte Überwindung der funktionsharmonischen Tonalität. Was für den Komponisten durch die vielfältigen neuen Möglichkeiten als Befreiung erscheint, erweist sich jedoch andererseits für den Hörer häufig als Krise der Wahrnehmung, wobei Musik, die nicht mehr auf den gewohnten Hörtraditionen basiert, selbst zum Alteritätserlebnis wird.
Zum Verhältnis von Moderne und Postmoderne Die Dialektik von Fortschritt und Regression, in der auch die Verflechtung von Moderne und Postmoderne eingeschrieben ist, kommt in der atonalen Phase der Wiener Schule unverkennbar zum Tragen. In der konsequent durchgeführten Abschaffung historisch sedimentierter kompositorischer Normen ist nämlich ein kulturfeindliches, regressives Moment wirksam, welches zugleich die Fortschrittlichkeit dieser Musik ausmacht. Die lineare Zeit, welche sowohl den teleologischen geschichtsphilosophischen Konstruktionen des 19. Jahrhunderts als auch der modernistischen Vorstellung des atemberaubenden Fortschritts zugrunde liegt, wird in der modernen Kunst genauso verwirklicht wie zerbrochen. Die Möglichkeit
14
Federico Celestini/Gregor Kokorz
selbst einer nicht linearen Zeitlichkeit ist zunächst nur ästhetisch denkbar. Es ist insofern bezeichnend, dass Nietzsche, wenn er in Also sprach Zarathustra den Versuch unternimmt, die Intuition einer zirkulären Zeitlichkeit darzustellen, auf eine dichterische Sprache jenseits der diskursiven Begrifflichkeit zurückgreift. Gleichfalls ästhetisch geprägt ist die messianische Geschichtsphilosophie Walter Benjamins. Er erkennt in einem Bild Paul Klees das Gleichnis einer Geschichtsauffassung, die sich vom teleologischen Gedanken losgelöst hat. Benjamins Engel der Geschichte strebt nicht in die Zukunft hinein, sondern wird in diese getrieben und kehrt ihr den Rücken, um sich dem Trümmerhaufen zuzuwenden, der an seinen Füßen wächst. Aus der modernen Malerei liest Benjamin die postmoderne Historie ab. In der gesamten Symphonik Mahlers und in den späten, durch den Rückgriff auf die Charaktere geprägten atonalen Werken der Wiener Schule wird das Benjamin’sche Bild eines Scherbenhaufens der musikalischen Vergangenheit klanglich beschworen. Indem defunktionalisierte Überreste vergangener Konventionen aufgenommen werden, öffnet sich der sonst auf Unmittelbarkeit gerichtete musikalische Ausdruck einer geschichtlichen Dimension, die seine modernistische Strenge prismatisch in alle Richtungen sprengt. Wie Schönbergs Pierrot lunaire exemplifiziert, wird die expressionistische Utopie der Identität von Klang und Sinn in einen Überschuss umgewandelt, der es unmöglich macht, Subjekt und Objekt der Aussage aufeinander zu beziehen. Im de-identifikatorischen Potenzial der modernen Kunst ist auch ihre postmoderne Antizipation mit einbezogen.
Der Deutschen Glauben an musikalische Überlegenheit
17
Albrecht Riethmüller Der Deutschen Glauben an musikalische Überlegenheit
1
Zum Geburtstag seines Monarchen am 12. Februar 1797 schrieb Haydn ein schlichtes Klavierlied auf den Text „Gott! erhalte Franz den Kaiser“. Einem Kenner wie Charles Burney konnte es nicht entgehen, dass es dem englischen „God save great George our King“ nachgebildet ist, und Burney zögerte nicht, dieses dem Autor mitzuteilen (Haydn: 1965, 335). In einer von Haydn gleichzeitig hergestellten Orchesterfassung seines Kaiserliedes ist es mit „Volck‘s-Lied“ überschrieben. In seinen reifen Jahren höchst erfahren und überaus erfolgreich im Kalkulieren von Erfolgsstücken konnte er darauf hoffen, dass das für seinen Landesvater bestimmte Geburtstagslied die Chance haben würde, zum Nationallied, zur Nationalhymne der Habsburgischen Monarchie zu werden. Aber er konnte nicht voraussehen, welche verworrene Geschichte das sich formierende Genre der Nationalhymnen in vielen Ländern einmal nehmen würde; denn mit jedem politischen Umschwung, erst recht dem Wechsel der Staatsform können Texte verändert und/oder Melodien ausgetauscht werden. Er konnte so wenig wissen, dass die Melodie von „God save the King“ dereinst in den USA erstmals auf einen demokratisch verfassten Staat übergehen würde, wie er vorhersehen konnte, dass seiner eigenen Melodie ein Text angedichtet werden würde, dessen Beginn lautet: „Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt“. Hoffmann von Fallersleben verfasste 1841 sein „Lied der Deutschen“ und wünschte, dass es zusammen mit Haydns Melodie in Deutschland gesungen werde. Es dauerte lange, bis daraus Wirklichkeit im Land geworden ist. Das deutsche Kaiserreich ab 1871 hegte keine Sympathie für ein Produkt, dessen Autor ihm politisch suspekt blieb. Die von Hoffmann und seinen Kameraden ersehnte Einheit des deutschen Reiches war zwar in gewisser Weise erreicht, aber die republikanische Gesinnung, aus der das Lied ebenfalls hervorgegangen war, machte es für das Reich untragbar. Das Kaiserreich begnügte sich damit, die preußische Hymne mit den Worten „Heil dir im Siegerkranz“ zur Melodie von „God save the King“ 1 Eine etwas andere Version ist auf Englisch als “Is that Not Something for Simplicissimus?!” The Belief in Musical Superiority, in: Music and German National Identity erschienen (Applegate/Potter: 2002, 288–304).
18
Albrecht Riethmüller
anstimmen zu lassen. Das änderte sich mit dem Zusammenbruch der mitteleuropäischen Monarchien am Ende des Ersten Weltkriegs. Das, was vom Habsburgerreich als österreichische Republik übrig geblieben war, verzichtete auf seine bisherige Kaiserhymne und damit auch auf Haydns Melodie. Umgekehrt wurde Haydns Melodie nun in Deutschland eingeführt und in den demokratischen Staatsdienst gestellt: Am Beginn der Weimarer Republik ging unter deren erstem Präsidenten Friedrich Ebert Hoffmanns Wunsch endlich in Erfüllung. Kurz darauf war im Dritten Reich 1933 – anders als im Kaiserreich nach 1871 – keine Berührungsangst vor dem „demokratischen“ Lied mehr zu erkennen. Nur allzu gut ließ sich der Text mit der nun herrschenden Ideologie verbinden; um freilich auch die Ansprüche der sie tragenden Partei der Braunhemden zur Geltung zu bringen, wurde ein Parteilied, das „Horst-Wessel-Lied“, hinzugefügt. Es war Kanzler Konrad Adenauer, der darauf drängte, Hoffmann-Haydns „Deutschlandlied“ für die 1949 gegründete Bundesrepublik Deutschland beizubehalten, und so blieb, ohne dass das Parlament damit befasst worden wäre, „Deutschland, Deutschland über alles“ Nationalhymne. Da man wusste, dass die Welt im Angesicht des Holocaust und infolge der verheerenden Niederlage im Zweiten Weltkrieg diese Worte nur noch mit Schaudern hätte hören können, wurde eine kleine Einschränkung gemacht: „Bei staatlichen Anlässen soll die dritte Strophe gesungen werden“2. Kanzler Adenauer musste zuerst den Widerstand des liberaldemokratischen Präsidenten der Republik Theodor Heuß brechen, der die Assoziation mit dem „Horst-Wessel-Lied“ (1950 lebendig, 2000 vergessen) für unselig und den Text für überholt hielt. Heuß war beileibe nicht der Erste, der Vorbehalte gegen die Hymne anmeldete. In einer ganz anderen historischen Situation befand Nietzsche schon vor 1890 den Text „Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt“ für „vielleicht die blödsinnigste Parole, die je gegeben worden“ sei (Nietzsche: 1999, 77). Dies wird gerne als Ausdruck antidemokratischer Einstellung erklärt. Aber der vormalige Journalist Heuß und der vormalige Philologe Nietzsche haben vielleicht einfach nur verstanden, was die widerlogische Parole ihnen unmissverständlich – moralisch – zurief: Ihr seid besser als die andern, als alle andern.
2 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung [Bonn] vom 6. Mai 1952 (Nr. 51, 537).
Der Deutschen Glauben an musikalische Überlegenheit
19
1. Die Bewahrer des heiligen Feuers In guten wie in schlechten Zeiten und mit einer gewissen Gleichgültigkeit demgegenüber, wie es sich in Wirklichkeit verhalten hat, ist die Botschaft, den anderen Ländern wenn nicht als realpolitische Macht, so doch kulturell und insbesondere musikalisch überlegen zu sein, in Deutschland verbreitet und gehört worden. Ob die Botschafter dabei Politiker oder Künstler, Journalisten oder Wissenschaftler sind, ist nicht ausschlaggebend. Denn die Botschaft als solche ist eine Einbildung (im vielfachen Sinn von „imprint“ bis „idea“, von „imagination“ bis „fantasy“), sie beruht auf einem Gefühl, setzt einen entsprechenden Glauben voraus, gehört ins Reich der Meinungen und Überzeugungen. Es bleibt gleichgültig, wo man ihr begegnet, entscheidend ist, dass sie zirkuliert, sich ins Bewusstsein gräbt. Dieses geschieht weniger in theoretischen oder definitorischen Kontexten, gar in Traktaten, als vielmehr in alltäglicher Rede, als Text genauso wie als Subtext. Auch auf allen Kanälen der Musikvermittlung wird diese Botschaft transportiert, ob nun im Hörsaal oder im Feuilleton, in Programmheften oder im Schulbuch der Musik, in Musikmagazinen im Radio, im Internet oder in der gelehrten Musikgeschichte, wobei zwischen den Kanälen kein wesentlicher Unterschied besteht. Der Glaube an diese Überlegenheit begegnet unabhängig von politischen Parteiungen oder ideologischen Richtungen, aber auch unabhängig von der musikalischen Erfahrung. Er ist bei Rechten nicht weniger zu beobachten als bei Linken, bei genuinen Musikern nicht weniger als bei Dilettanten. Ein Versuch, eine Überlegenheit dessen, was man für „deutsche Musik“ hält, mithilfe musiktheoretischer Mittel zu „beweisen“, gliche etwa dem Versuch des versierten Physikers Philipp Lenard, eine gegen Albert Einsteins Theoreme gerichtete „deutsche Physik“ zu proklamieren, durch die der Gelehrte (nicht zuletzt antisemitische) Ideologie wissenschaftlich drapiert hat. Im Folgenden wird keineswegs danach gefragt, was „das Deutsche in der Musik“ sein könnte, sondern allein nach jener deutschen Einbildung, in der Musik überlegen zu sein. Sie lässt sich zunächst aus einigen Zitaten entfalten. 1817. In der Einleitung seiner Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie impft Hegel seine Hörer mit einem Serum, das die Hegelianer – und nicht nur diese – auf Generationen hinaus wirksam davon abgehalten hat, fremde Gedanken als ebenbürtig oder gleichrangig anzusehen. In den anderen europäischen Ländern, so lässt er sie wissen, ist die Philosophie „bis auf die Erinnerung und Ahnung verschwunden und untergegangen“, während sie „in der deutschen Nation als eine Eigentümlichkeit sich erhalten“ hat: „Wir haben den höheren Beruf von der Natur erhalten, die Bewahrer dieses heiligen Feuers zu sein“ (Hegel: 1971, 12). Zwar meint er mit „wir“ wohl zuallererst sich selbst als Träger jenes olympischen Feuers,
20
Albrecht Riethmüller
das im Staffellauf der Geschichte einmal Platon und Aristoteles in sich hatten, aber er zielt zugleich und kollektivierend auf nationalen Vorrang, und die Berufung auf die Natur für die Zwecke der Geschichte ist für eine solche Absicht eines der ältesten suggestiven Mittel. Lineare, national verengende Geschichtsauffassungen begegnen auch hinsichtlich der Musik, wenn deren Entwicklung in der Neuzeit mit einem Baby verglichen wird, das von einer niederländischen Amme versorgt wird und nach einer Periode in italienischer Pension seit Mitte des 18. Jahrhunderts in Deutschland „als schöner und starker Jüngling“ seine Heimstatt gefunden habe (Pfitzner: 1926, 193). Grosso modo spiegelte sich diese Sicht noch bis vor Kurzem in der deutschen Musikgeschichtsschreibung. Die Linie von Land zu Land mündet dann in eine Perlenschnur der Komponisten von Schütz und Bach über Beethoven und Schumann, Wagner und Brahms, Schönberg und Webern bis – je nach Einstellung – Stockhausen (die Aszendenz kann bei der Annäherung an die jeweilige Gegenwart in Deszendenz umschlagen). Ausländische Komponisten lagern allenfalls am Wegesrand dieser eigentlichen Musikgeschichte, die quasi allein wirkliche Tradition stiftet und garantiert. Das von Hegel eingefügte „heilig“ wiederum war gerade in jenen Jahren der Säkularisierung ein Modewort. Auch die Tonkunst war damals – sozusagen natürlich – „heilig“, jedoch nicht so sehr als Kirchenmusik, sondern ebenfalls in säkularer Form. Die „heilige Tonkunst“ als Kern kunstreligiöser Haltung und Überzeugung ist bis heute eine Spezialität des deutschsprachigen Raumes geblieben, die als Einstellung gegenüber Musik in den süd- und westeuropäischen, also „abendländischeren“ Kulturräumen wenn überhaupt, dann viel geringer ausgeprägt anzutreffen ist. Die kunstreligiösen Exerzitien, durch die der Musik in einer (notwendigerweise pseudo-religiösen) Andacht begegnet wird, scheinen aber nicht nur Kennzeichen eines bürgerlichen Zugangs zur Musik, sondern auch dazu angetan zu sein, die Musik ebenso für die Nation zu vindizieren, wie Hegel es für die Philosophie getan hat. 1846. Bei Behandlung des 16. Jahrhunderts wirft der Historiker Droysen einen Seitenblick auf die Musik. Während im katholischen Italien hinsichtlich der Musik „der alte falsche Dualismus von Kirche und Welt erneuert“ worden sei, „führte in Deutschland die Reformation vor Allem das Volkslied in die Kirchen ein und der Choral der Gemeinde ward der Stamm, an dem sich die Kunst der deutschen Musik, die deutscheste Kunst emporrankte“ (Droysen: 1846, 112). Es hieße, Droysen zu nahe zu treten, wollte man ihm unterstellen, dass er damit schon jene ebenso abenteuerliche wie unsinnige Formel meint, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vermehrt in Umlauf geriet und die Thomas Mann in seinem 1949 erschienenen Roman eines Romans Die Entstehung des Doktor Faustus aufgespießt hat, derzufolge Musik die „deutscheste Kunst“ sei; er tat es mit zwiespältigen Gefühlen, weil auch er wie unendlich viele andere einmal so gedacht hatte und es ihm schwer
Der Deutschen Glauben an musikalische Überlegenheit
21
fiel umzudenken. Durch Pamela Potter wurde die Formel 1998 sogar zum Buchtitel (Potter: 1998),3 zu dem sich die Frage im Aufsatztitel von Celia Applegate „How German Is It?“ wie eine Ergänzung liest (Applegate: 1998). In der Emphase seines Sprechens sagt Droysen freilich nur, dass das auf dem Volkslied fußende Kirchenlied der Bezugspunkt und Halt für die Kunstmusik bzw. Tonkunst geworden sei. „Deutsche Musik“, ja „deutscheste Kunst“ sei aus dem Kirchenlied hervorgegangen. Er will nicht die Musik zur deutschesten Kunst erklären, sein deutlich formuliertes Anliegen ist es vielmehr, das evangelische Kirchenlied zum Ausgangspunkt nationaler Kunst zu erklären, zum Steigbügelhalter der „Kunst der deutschen Musik“, ja sogar der „deutschesten Kunst“ zu machen, wie es in rhetorischer Steigerung heißt, und dies vermutlich noch mehr um der Religion als um der Musik willen. Dem protestantischen Historiker war dies offenbar eine Herzensangelegenheit; und das Erklärungsmuster, die Tonkunst aus dem Lied – ob nun Volks- oder Kirchenlied – abzuleiten, war damals gängig. Luther, der die Bibel eingedeutscht hat, ist zur Schlüsselfigur auch der Eindeutschung der Musik geworden. Das Bild aus Stamm und Ranken, in das Droysen seinen Gedanken kleidet, ist allerdings zweideutig. Man könnte aus ihm – gewiss gegen die Intention des Autors – herauslesen, dass die Kunst gar nicht zum Liedbaum gehört, sondern eine schmarotzende Pflanze ist. Das etwas Lallende, das man an seiner gesteigerten Ausdrucksweise wahrnehmen mag, ist für chauvinistische Diskurse ebenso charakteristisch geworden wie der herabschauende Blick auf Italien. Man mochte wie zu Goethes Zeiten mit Begeisterung nach Italien fahren und sich der dortigen Kunst erfreuen – es waren Reisen in die Vergangenheit –, aber Zweifel daran, dass man kulturell besser sei, kamen immer weniger auf, am allerwenigsten in der Musik. 1851. Der einflussreiche Musikjournalist Franz Brendel liefert in seiner erstmals 1851 erschienenen Geschichte der Musik in Italien, Deutschland und Frankreich ein Potpourri aus willkürlichen Annahmen, dreister Rechtssprechung und auffälligen Verstößen gegen Verstand und Vernunft – kurzum aus allen Ingredienzien, an denen die Kurzsichtigkeit nationalistischer Verlautbarungen auch im Blick auf Musik stets abgelesen werden kann: „Deutschlands Kunst nimmt in Beethoven die Rückwendung zum Geist, damit zugleich zum Vaterländischen im engeren Sinne.“ Die allgemeine geschichtliche Stellung Beethovens fasst Brendel zusammen, indem er auf „das Nationale“ abhebt: „jetzt tritt es auf, gehoben durch die Errungenschaften Mozart’s, gesteigert durch diesen Durchgangspunct, als das Allein Herrschende und Berechtigte“ (Brendel: 1875, 299). Damit ist der Nationalist Beethoven gekürt. Nur noch er, das wird ausdrücklich vermerkt, ist rechtens. Bezogen sind diese Behauptungen keineswegs allein auf das animal sociale Beethoven und dessen po3 Etwas anders interpunktiert bei Riethmüller Musik, die „deutscheste“ Kunst (Riethmüller:1995)
22
Albrecht Riethmüller
litische Rolle, sondern ebenso auf seine Musikwerke, derentwegen die Menschen seinen Namen im Gedächtnis behalten. Tatsächlich blieb Beethoven – noch vor Bach und zweifellos vor dem stets umstrittenen Wagner – die umschwärmte Primadonna auf der Bühne im Nationaltheater musikalischer Überlegenheit. 1907. Der Pianist Egon Petri, damals 26 Jahre alt, hatte ein Erlebnis, von dem sein Lehrer und Freund Ferruccio Busoni seiner Frau Gerda folgendermaßen in einem Brief von Berlin nach Drottningholm berichtet: Als Egon über die deutsche Grenze kam hatte er Beethovens Sonaten im Koffer, die beim Zollamt herausgeangelt wurden. „Was ist das?“ sagt der Zollbeamte. „Das sind Noten. Beethovens Sonaten.“ „Ach, das sind Beethovens Sonaten“, sagt darauf der Zollbeamte und blättert sie durch. „In der Auffassung“ sagt er noch (indem er den Band zurückgibt) „ist das das Schwerste“. „Und“ (fügt er noch hinzu, da er Egon für einen Engländer hält) „ein Ausländer kann das nicht fertig bringen; dazu gehört schon ein Deutscher“. Ist das nicht für Simplicissimus?! – (Busoni: 1935, 136).
Das Milieu des Zollhauses ist nicht das Podium, auf dem Beethovens Sonaten gewöhnlich dargeboten werden, subalterne Beamte sind normalerweise nicht ihre Sachwalter. Der Zöllner hält die Sonaten einerseits für das Anspruchsvollste zum Hören (was auf den Gipfel der Tonkunst zielt, aber auch Überforderung einschließen mag), andererseits legitimiert er diesen musikalischen Gipfel nicht durch das schaffende Individuum, sondern durch die nationale Herkunft. Mit dem Hinweis auf die satirische Zeitschrift Simplicissimus weist Busoni dieser Begebenheit präzise den ihr gebührenden Ort an, die Musikzöllner nannte er später, wiederum im Blick auf Beethoven, die deutsche Musik-Polizei. Neben Ignoranz gehört Borniertheit, so lehrt die kleine Geschichte, zum unverzichtbaren Arsenal der nationalen oder – gleichviel – der rassischen Suprematisten, wie jeder Blick in ein Pamphlet der White Aryan Supremacy auch heute lehren kann. 1935. „Richard Wagners Musik eroberte die Welt, weil sie bewusst deutsch war und nichts anderes sein wollte.“ In großen Buchstaben wartet die nazistisch gewordene Zeitschrift Die Musik nach 1933 immer wieder mit Aussprüchen, quasi Urworten, der neuen Staatsherren auf, in diesem Falle ist das Wort dem Staatsminister für Volksaufklärung und Propaganda Joseph Goebbels zugeschrieben (Anonymus: 1935/36, 721). Er bezieht sich dabei womöglich weniger auf den Gegenstand, Wagners Musik, als vielmehr auf seinen Führer und dessen politische Absichten. Wie alle bisherigen Welteroberungspläne sind seine glücklicherweise gescheitert. Stets dabei, sich und andere der nationalen Identität als des A und O zu versichern – und dies sollte uns ein mahnendes Beispiel bei der Suche nach Identitäten sein –, spielt die Bemerkung mit einem Dilemma, in das alle Suprematisten geraten:
Der Deutschen Glauben an musikalische Überlegenheit
23
Denn einerseits ruht die Begründung isolationistisch in sich selbst, andererseits bedarf es neben dem Erfolg im Innern auch des Siegeszugs draußen, der erst dadurch gekrönt wird, dass andere akzeptieren oder sich unterwerfen, dass die Welt erobert oder unterworfen wird. Das geflügelte Wort, dass am deutschen Wesen die Welt genesen solle, drückt in milderer Form dasselbe aus und gehört ebenfalls zum bewussten oder unbewussten Grundbestand der Überzeugung kultureller Überlegenheit. In den Jahren des Ministers Goebbels, dieses Meisters der Lügenrede, war der Zenith schon überschritten, die „Weltgeltung der deutschen Musik“ schon dahin, wenn man dem seinerzeit mächtigen Musikkritiker Paul Bekker folgt. Er erblickte für alle Völker den Höhepunkt des Nationalistischen in der Musik in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und in diesem Höhepunkt den Grund, warum damals „die ausgleichende Wirkung der Musik unter den Völkern“, zu der sie sonst fähig ist, suspendiert gewesen sei (Bekker: 1920, 38). Das schrieb er 1920. Die Diagnose des geschichtlichen Wendepunktes um 1918 war hellsichtig und damals alles andere als alltäglich. Nicht wissen konnte Bekker freilich, dass es in kaum mehr als einem Jahrzehnt noch schlimmer kommen und er vom deutschen Staat aus dem eigenen Lande gejagt würde. 1991. Es handelt sich um einen Zufallsfund im Feuilleton jener Zeitung, die für sich in Anspruch nehmen kann, diejenige zu sein, der inner- und außerhalb Deutschlands die größte Aufmerksamkeit vor allem der Eliten zuteil wird. In der Besprechung einer Schallplatte mit Klaviersonaten von Copland, Ives, Carter und Barber wird an Tadel für die Werke nicht gespart. Da ist die Rede von „viel musikalischem Leerlauf und schierem Tastengeprotze“ (über Carter) sowie von „spätromantischem Epigonentum“ (über Barbers op. 26). Das Eigentliche steht jedoch in folgendem Satz: „Trotz der Vorbehalte bleibt die Einspielung als Dokument der letztlich vergeblichen Suche nach der eigenen Identität amerikanischer Komponisten in einer ihnen fremden Form äußerst verdienstvoll“ (FAZ: 1991). Als einziges Verdienst gilt hier die Dokumentation eines angeblichen Scheiterns, man hört förmlich das befriedigte Aufatmen darüber. Wie viel Realitätsverlust erfordert es, wie stark muss die ideologische Blendung sein, wie tief müssen die Vorurteile stecken, wenn jemand am Ende des 20. Jahrhunderts noch immer glauben kann, jemandem in oder aus Philadelphia und New York sei die Sonatenform fremder als jemandem in oder aus Sondershausen oder Donaueschingen? „In einer ihnen fremden Form […]“: 50 Jahre zuvor waren die deutschen Blätter voll davon, jüdischen Komponisten zu attestieren, dass ihnen dieses und jenes Substanzielle in der Musik fremd sei, nach 1945 musste das Feindbild unter dem Druck der Ereignisse geändert werden. Ein neues ist, wie man sieht, gefunden (dass unter den amerikanischen Komponisten viele jüdisch sind, macht die Sache zusätzlich pikant). Nun beruft sich der Zeitungsrezensent nicht etwa auf Deutschland versus
24
Albrecht Riethmüller
Amerika, sondern er gibt sich zeitgemäß und beruft sich auf Europa, und wenigstens einstweilen ist darin unschwer eine Variation des uralten Konflikts zwischen Mutterland und Kolonie zu erkennen; gleich zu Beginn statuiert er, „dass amerikanische Komponisten bei ihrer Auseinandersetzung mit den tradierten Formen und Kompositionsprinzipien der europäischen Musik nicht besonders erfolgreich waren und sind“. Ob die bisher dominierenden einzelnen Chauvinismen sich zu einem Eurochauvinismus bündeln werden, wird die Zukunft weisen. Alt hingegen ist die Taktik, Europa oder auch „Abendland“ zu sagen, aber nur das eigene Land oder gar die eigene Provinz im Sinn zu haben.4 Das Beispiel aus der Zeitung ist zwar wie die vorangegangenen beliebig herausgegriffen, aber es ist typisch in dem Sinne, dass solche Meinungen auch in den letzten Jahrzehnten begegnen, wo immer über Musik geredet und geschrieben wird. Die sprachliche Vermittlung prägt dabei das Bewusstsein von Musik bestimmt in demselben Maße wie die Töne beziehungsweise Musikwerke selbst. Dafür genügen Bemerkungen, oft Andeutungen, sie enthalten den Code. Erscheinen sie auch nur gelegentlich wiederholt, so nisten sie sich ein, ohne dass darüber diskutiert werden müsste. Es kennzeichnet sie gerade, dass sie zumeist unanalysiert bleiben und nicht weiter über sie nachgedacht wird. Sie sind einfach da, und sie werden geglaubt. Das tradierte Vorurteil musikalischer Überlegenheit speist sich aus kollektivem Einverständnis.
2. Erfolg und Abgrenzung Die Musik ist nicht das einzige Gebiet, aber gewiss ein Zentrum, auf dem hegemoniale Gelüste angesiedelt sind. Schon im 19. Jahrhundert ist gemutmaßt worden, dass die Nation, die sich gerne in der zum Sprichwort gewordenen Vorstellung eines „Lands der Dichter und Denker“ spiegelt, sich weniger aus Kunstinteresse als in Ermangelung einer den Mächten wie Frankreich oder England vergleichbaren politisch erfolgreichen Geschichte auf Literaturgeschichte verlegt habe. Aber nicht nur der so mühselige politische Einigungsprozess im 19. Jahrhundert, sondern vor allem auch die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für Deutschland so desaströs verlaufene Geschichte mag es plausibel erscheinen lassen, dass nach 1945 – erneut in Ermangelung politischer Macht – Surrogate wie „Made in 4 Vor einem längeren Aufenthalt in Nordamerika verabschiedete ich mich Anfang 2000 telefonisch von einem etwa 65 Jahre alten deutschen Musikhistoriker und Musiker. Er hegte die Erwartung, dass wir wieder in Kontakt träten, sobald ich „ins Abendland zurückgekehrt“ sei, und schien verblüfft zu hören, dass ich nicht den Eindruck hätte, es überhaupt zu verlassen.
Der Deutschen Glauben an musikalische Überlegenheit
25
Germany“, die Deutschmark oder der Mercedesstern dazu dienten, das historischpolitisch gänzlich korrumpierte Überlegenheitsgefühl zu kompensieren. Für die Annahme eines (kulturellen) Supremats blieb die Musik ein unverdächtiger und krisenfester Garant. In anderen kulturellen Bereichen – in der Literatur etwa gegenüber Frankreich – ließen sich zwar Über- und Unterordnungsversuche inszenieren und Rivalitäten austragen, aber die Tendenz, sich allen anderen überlegen zu fühlen, ließ sich nicht generell und krass formulieren, wenn man nicht ganz borniert war oder unglaubwürdig erscheinen wollte. Im Hinblick auf die Gefühlskunst Musik konnte jenes Gefühl hingegen weiter internalisiert bleiben. Die eminenten Leistungen der Musiker in Deutschland, voran die Erfolge der Komponisten insbesondere seit der Zeit Johann Sebastian Bachs sind überall anerkannt. Sie können nicht geschmälert werden. Gewiss gab es durch die Geschichte hindurch immer einmal auch Attacken gegen das Germanische oder Teutonische in der Musik, am lautesten in den Jahren vor und im Ersten Weltkrieg und vor allem aus Frankreich. Debussy war nicht frei davon. Aber sie blieben marginal, behinderten weder den Erfolg noch konnten sie das Ansehen untergraben. Die Festigung des weltweiten Prestiges der Musik aus Deutschland fällt zeitlich mit zweierlei ungefähr zusammen: zum einen mit dem seit Mitte des 19. Jahrhunderts hitzigen Nationalismus, dessen deutsche Variante in den hundert Jahren, die kommen sollten, der Welt nur allzu gut bekannt sind, zum anderen mit der Herausbildung eines Kanons an Werken – modellhafter noch in Orchester- bzw. Symphoniekonzerten als im Opernrepertoire (vgl. Gerhard: 2000). Während dieses auch in Deutschland international gemischt blieb, dominierte im Konzertrepertoire das Heimische, seit 1945 allerdings sichtlich abgeschwächt. Mochte man theoretisch zwar der Auffassung huldigen, dass Musik eine überall verständliche „Sprache“ sei, so konnte man sich zugleich sicher glauben, dass sie keineswegs ein Esperanto, sondern deutsch ist. La musique – elle parle allemande. Wo sie es nicht tut, steht ihr Rang in Zweifel. Den Erfolgen draußen entsprach die Selbstgenügsamkeit im Innern. Und es ist auffällig, dass die Kenner und Bildungseliten selbst nach 1945 weitaus besser an solchen Auffassungen qualitativer Überlegenheit der heimischen Musikproduktion festzuhalten schienen als das Publikum, das – wie sich an Wunschkonzerten ablesen ließ – nicht weniger nach dem Capriccio italien verlangte als nach der Ouvertüre zu Euryanthe; es waren die ethisch rigorosen Fachleute, die jenen dicken Trennungsstrich zogen, den sie für die Demarkation zwischen Geschmack und Geschmacklosigkeit bereithielten. Noch in den letzten Jahrzehnten wird im Blick auf die Musik des 19. Jahrhunderts in Lehrbüchern und Nachschlagewerken von „nationalen Schulen“ gesprochen, die einzeln abgehandelt werden. Auffälligerweise ist darunter in der Regel keine deutsche vertreten,
26
Albrecht Riethmüller
wodurch bei den Lernbegierigen der Eindruck erweckt wird, dass es einerseits Musik, andererseits solche nationalen Schulen gebe. Dabei ist die Konstellation aus internationaler Verbreitung, Kanonbildung und Nationalismus nur ein Indiz, das zwar zu dem hegemonialen Glauben beigetragen hat, ihn aber keinesfalls zureichend erklärt. Überhaupt sind in dem vorurteilsgeladenen Feld, auf dem wir uns thematisch bewegen, nur Einzelbeobachtungen möglich. Es lädt zu vorschnellen Theorien ein und verleitet zum Verweilen bei der Frage, was eigentlich deutsch sei, über die nicht nur in Deutschland unablässig gerätselt wird. Daran können und wollen wir uns nicht beteiligen, weder anthropologisch noch musikalisch. Wir wollen nicht spekulieren – nicht im Überlegenheitsgefühl den Rest eines kulturellen Inferioritätskomplexes erblicken –, sondern in erster Linie beobachten und aufzeigen, also epideiktisch verfahren. Schon die einfachsten Fragen sind kaum zuverlässig zu beantworten, beispielsweise wo das Überlegenheitsgefühl historisch und sachlich beginnt und wie weit der Glaube an die Überlegenheit in der Musik zurückreicht. Hier ist eine Suspension des Urteils angebracht, schon um nicht der derzeit modischen Versuchung zu erliegen, Ideologeme des 20. Jahrhunderts, voran nazistische, möglichst weit in die Geschichte zurückzuverlegen. Es genügt festzuhalten, dass der Glaube an die musikalische Überlegenheit Mitte des 19. Jahrhunderts voll ausgebildet war. Dazu kommt, dass es sich bei den sprachlichen Mitteln, die für den Transport des Glaubens sorgen und mit denen er kommuniziert wird, meist um kaum definierte oder schlecht definierbare Kategorien handelt, die umso wirkungsvoller sind, je unspezifischer sie sind. Dadurch setzen sich die Unschärfen fort, die beim Wort „deutsch“ selbst beginnen. Das Sprachgitter ergibt sich angesichts von Musik aus Ausdrücken wie dem „Symphonischen“ (der „Symphonie“), dem „Geistigen“, der „musikalischen Logik“, der „thematischen Arbeit“, der „Kontrapunktik“/„Polyfonie“, des „Ernstes“ (der „ernsten Musik“), der „Tiefe“, der „Innerlichkeit“ („Innigkeit“, aber nicht etwa als „Kitsch“, sondern als dessen Gegenteil imaginiert), der „reinen Musik“, der „absoluten Musik“ und anderen, die – ohne es zu sein – national vindiziert und konnotiert werden und in die Nähe von Synonymen für das „Deutsche“ in der Musik rücken. Alles zusammen bildet – als Konfiguration – ein Geflecht, das im Ganzen oder in Teilen die musikalische Überlegenheit suggeriert und den Glauben daran füttert, dass die Musik die „deutscheste Kunst“ sei, dass das Abendland sich in der Musik in Germanien erfülle und so weiter. Die Kehrseite davon darf nicht übersehen werden. Sie ergibt sich extern aus der implizierten Unterstellung, dass nicht-deutscher bzw. ausländischer Musik solche als wesentlich angesehenen Ingredienzien fehlen, intern wiederum durch Abgrenzung von un-deutscher Musik mithilfe eines auch aus offen oder versteckt antisemitischen Klischees bestehenden zweiten Sprachgitters, das sich seit der Mitte des
Der Deutschen Glauben an musikalische Überlegenheit
27
19. Jahrhunderts gut verfolgen lässt und aus Attributen wie „glatt“, „schlau“, „unschöpferisch“, „sentimental“ oder „kitschig“ besteht, die natürlich nicht an sich antisemitisch sind, sich aber durch den Kontext, in dem sie erscheinen, in diesem Horizont oft leicht erkennen lassen. Die Konsequenzen sind nicht zu unterschätzen. Wenn sich in jemandem etwas dagegen sträubt, die Musik Mendelssohns auf eine Stufe mit der Schumanns zu stellen, dann könnte es eine Spätfolge der beiden Sprachgitter sein. Es liegt auf der Hand, dass Komponisten und ihre Musik besonders hart davon getroffen sind, die den „Ernst“ der Musik nicht so bierernst nehmen. In den ufer- und heillosen Versuchen, das Unbestimmbare in der Musik zu bestimmen, nämlich das „Deutsche“ – wie klingt ein „deutscher Ton“? –, wetterleuchtet stets wieder die Gedankenfigur, dass der „deutsche Stil“ (oder auch „gout“) im Unterschied zum italienischen oder französischen „vermischt“ sei (vgl. Sponheuer: 2002). Wer immer damit im 18. Jahrhundert welche Vorstellungen verbunden hat, ist das eine, das andere hingegen, in welcher Absicht und Taxierung es später geschieht (was nicht dasselbe sein muss). Der springende Punkt ist hier das Verständnis jener Opposition von Mischung und Reinheit, die – schon wegen des ewigen Panschens in den Mischkrügen – früh die Aufmerksamkeit etwa von Platon fand, um die philosophische Seite des Problems zu beleuchten. In Zeiten, in denen alles auf Reinheit der Musik (reine Musik, dann aber auch Reinheit des Blutes, der Rasse usw.) abgestellt war, mag „vermischter Stil“ schlüpfrig geklungen haben. Zu retten war das Unreine dann nur dadurch, dass man das „Vermischte“ als etwas Besseres betrachtet, das über dem steht, woraus es gemischt ist, als eine höhere Synthese. Auch die akademische Musikgeschichtsschreibung war nicht darum verlegen, Varianten davon zu bilden, wenn es etwa in Bezug auf Beethoven heißt: „Nur ein deutscher Musiker war zu einer solchen Synthese der Stile fähig, wie sie sich im Allegretto der Siebenten zeigt: Sonatenform, obligates Accompagnement, Fugen- und Passacaglienelemente werden miteinander zu einer unauflöslichen Einheit verschmolzen; die großen Geister zweier Jahrhunderte deutscher Instrumentalmusik werden hier heraufbeschworen“ (Schmitz: 1927, 105). Der zweite Satz legt sogar nahe, dass ohnehin alles in diesem Amalgam von sich aus rein deutsch sei, also in dem, worauf es ankommt, gar keine Kreuzung geschieht. Ist das nicht für Simplicissimus? Man bewegt sich auf einer Ebene, die sehr viel mit Sprachstrategie und Sprachpsychologie, wenig mit den Tönen und der Musik zu tun hat. Dabei ist das Schrifttum einschlägiger völkischer oder nationalistischer Kreise noch nicht einmal am interessantesten. In dessen Pamphleten wird „deutsch“ selbstverständlich als raison d’être schlechthin angesehen – auch im Musikschrifttum. Erst recht gilt dies für die Musikfunktionäre der Nazizeit. Das heißt keineswegs, dass sie wirkungslos waren.
28
Albrecht Riethmüller
Aber ebenso wirksam waren und, wo es sie noch gibt, sind die subtileren Einflüsterungen an Stellen wie der, an der Beethoven zur deutschen Summe der Stile stilisiert wird. Oft ist es – zumal im Blick auf die internationale Verständigung – sogar erforderlich, zuerst zu rekonstruieren, was die Wörter bedeutet haben, um überhaupt sehen zu können, wie sie eingesetzt worden sind. In der von Horkheimer und Adorno deutsch verfassten, 1944 in New York und 1947 in Amsterdam erschienenen Dialektik der Aufklärung trägt einer der Teile die Überschrift „Kulturindustrie“ (Adorno/Horkheimer: 1981, 141). Dafür hat dessen Autor Adorno – das Buch wurde im Exil geschrieben – auf im Englischen längst gebräuchliche Ausdrücke wie „movie industry“ zurückgreifen können. Er weist gleich zu Beginn auch darauf hin. Die Schrift fand zunächst eher bescheidene Verbreitung, wurde jedoch um und nach 1968 zum Kultbuch von Studenten und Scholaren. „Kulturindustrie“ wurde nun zum Schlagwort, einerseits zum Gegenbegriff von Kultur unter der Herrschaft von Kommerz und Kapital, andererseits pauschal als amerikanisches Gegenstück zur heimischen, deutschen oder europäischen Kultur und Kunst. In Zusammenhang von Kunst und vor allem von Musik vor dreißig Jahren in Deutschland von „Industrie“ zu sprechen, war ein Sakrileg. Der Autor wusste wohl, welche Provokation er durch die Transplantation von „Kulturindustrie“ in den völlig verschieden funktionierenden Sprachraum begehen würde und mag sich gewundert haben, warum es zwanzig Jahre gedauert hat, bis die Lunte den Sprengsatz gezündet hat. Die Kritik der „Kulturindustrie“, durch die „Kritik des ‚Amerikanismus‘ in den zwanziger Jahren vorweggenommen“ (Schubert: 1998, 83), erfuhr ihren Auftrieb in einem von weiteren Kampfworten wie „Imperialismus“ und „Kapitalismus“ durchzogenen Gesprächsklima. Auch diese Wörter fanden Eingang in die Diskurse über Musik, selbst in seriösere. Dort musste „Kapitalismus“ ebenso wie „Kulturindustrie“ schon deshalb Abscheu erregen, weil die selbst- und brotlose Musik, mit der wenige so sehr viel Geld verdienen, mit dem als schnöde dargestellten Bereich von Kommerz und Mammon verbunden wird, während die Geißelung des „Imperialismus“ im Kontext von Musik eine ganz besonders abstruse Einbildung war; zwar dachte man an die Politik fremder Mächte, tat es aber in einem Zusammenhang, in dem man selbst hegemonial dachte. Welche Emotionen sich hinter der Wortwaffe „Kulturindustrie“ um und nach 1970 verbargen, wird nicht jedem nordamerikanischen Leser klar sein, wenn er heute die Zeitung aufschlägt und in einem Artikel zum 100. Geburtstag von Richard Strauss den ganz nüchternen und unbefangenen Satz findet: „In the past few years, the German culture industry has been analyzed sector by sector, from film […] to classical music“ (Green: 1999). Der Autor bezieht sich auf die 1930erJahre; es wäre vorteilhaft, wenn sein Statement im Musiksektor auch für frühere Zeiten gälte. Es ist kaum zu übersehen, dass die Musikindustrie in Deutschland –
Der Deutschen Glauben an musikalische Überlegenheit
29
gerade in ihrer Effizienz und ihren Erfolgen – nicht nur der Vorläufer, sondern geradezu das Modell für das bildet, was man „Kulturindustrie“ nennen kann. Die Pflege der Vielzahl an Orchestern und Opernhäusern (es ist immer noch Geld, auch wenn es vom Staat kommt) gehört dazu, aber vor allen Dingen eine über die Maßen reiche, international abstrahlende Tätigkeit der Musikverlegerindustrie im Laufe des 19. Jahrhunderts hat dazu beigetragen. Zusätzlich gestützt auf protektionistisches Verhalten, beflügelt einerseits von der schöpferischen Potenz im Lande, andererseits vom grassierenden Nationalismus, interessiert am eigenen Profit und eifrig im Dienst für das nationale Prestige, zu dessen Beförderung zu guter Letzt im Ausgang von Bach und (repatriierend) Händel die repräsentativen Komponisten-Gesamtausgaben beitrugen, entwickelte sich im 19. Jahrhundert ein Musiktrust, in dem man der Konkurrenz voraus und überlegen war. Anders als die Literaturverlage, die ans ständige Übersetzen gebunden blieben, konnten die Musikverlage mühelos international vermarkten. Sie nutzten dies über Filialen geschickt, bei der Durchsetzung von „deutsch“ als trademark von Musik, und zwar in den für das Prestige entscheidenden Marktsegmenten der U music (U = upper class). Der Erfolg der non-U music (popular culture) war hingegen bescheidener und ist, wenn nicht alles täuscht, im 20. Jahrhundert im internationalen Maßstab vollends zur schieren Bedeutungslosigkeit abgesunken. Im gut gefüllten Arsenal zum Erzeugen des Gefühls musikalischer Überlegenheit gehört zu den Rüstungen aber nicht allein die Wertschätzung des Heimischen, sondern am meisten die Geringschätzung des Fremden. Umrunden wir, sehr abgekürzt, Deutschland irgendwann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Skandinavien wird nach wie vor hauptsächlich als Außenstelle des Leipziger Konservatoriums angesehen und sonst kaum wahrgenommen; Sibelius steht im Verdacht, allenfalls drittklassige Symphonien zu produzieren; der gesamte slawische Raum wird durch die Einteilung in Herren- und Untermenschen belastet, es wird diskutiert, ob Musik aus diesen Ländern überhaupt (europäische) Musik sei; Bartók wäre fast zu naturalisieren, wenn die Folklore in seiner Musik fehlte; mit Puccini hat die Kunst in Italien sich endgültig in Kitsch verwandelt; Spanien scheint auf der Landkarte zu fehlen; in Frankreich ziehen wir Baudelaire und Valéry entschieden Debussy und Ravel vor; eine Beschäftigung mit Musik aus England wäre Zeitverschwendung; in Amerika – nun kommt eine andere Hautfarbe ins Spiel – verdient der Jazz Kritik und ist Musik per se durch „Kulturindustrie“ ersetzt. Das Szenario ist fiktiv. Es spiegelt nicht das Repertoire von Konzertsälen und Opernbühnen im damaligen Deutschland wider. Es ist indessen ein Eindruck, wie er ungefähr aus der Lektüre der in der Musikszene und darüber hinaus so einflussreichen musikalischen Schriften von Adorno entsteht (in den letzten Jahren vor seinem Tod 1969 zeigen sie ein etwas lichteres Bild vielleicht nur, soweit aktu-
30
Albrecht Riethmüller
elle Kompositionen angesprochen sind). Aus unerschöpflichem Material müssen hier zwei Stellen genügen. 1940 heißt es in einer Rezension: „Eine Psychologie, die sich Bewusstseinsdimensionen in Beethovens Musik à la Tschaikowsky vorstellt […], ist nur noch komisch“ (Adorno: 1984, 381). Und in der ebenfalls noch in der Emigration begonnenen Philosophie der neuen Musik dient eine der umfangreichen Textanmerkungen – die dritte im Schönbergteil des Buches – dazu, Janáček zu loben und ihm das Privileg zu erteilen, nicht atonal zu schreiben und dennoch zur Avantgarde zu gehören; der Preis dafür ist, dass seine Musik aus der „okzidentalen“ ausgegrenzt und, um sie nicht entweder slawisch oder gleich orientalisch nennen zu müssen, als „exterritorial“ bezeichnet und im gleichen Zusammenhang auf unterentwickelte Gebiete im Südosten Europas verwiesen wird (Adorno: 1949)5. Janáček war in der Hauptstadt Mährens zu Hause. Sie liegt bekanntlich einige Autostunden nördlich von Wien.
3. Die Weitergabe des olympischen Feuers Und so hat die Musik sich in der deutschen Nation als Eigentümlichkeit erhalten, indem „wir“ – das könnte nun heißen: Adorno und die, die er im Auge hatte – am meisten Beethoven und Schönberg – von der Natur den höheren Auftrag erhalten zu haben scheinen, Träger dieses heiligen Feuers zu sein. Man muss einfach daran glauben. Stark konnte der Glauben in Deutschland bleiben, weil er von außen weitgehend zugestanden worden ist und Einwände gegen ihn kaum erhoben wurden, schon gar nicht im Land selbst. Die Vorstellung musikalischer Überlegenheit ist, wie zu zeigen versucht wurde, etwas Stimmungs- und Gefühlsmäßiges, das weniger von der Musik selbst ausgelöst, als vielmehr in sie projiziert wird. Sie wird selten in Deklarationen propagiert, sie ist – erst recht seit 1945 – kein Lehrstoff, die musikwissenschaftliche Literatur hat ihr nie eigene Aufmerksamkeit geschenkt. Und doch ist sie gegenwärtig, wobei der Suggestion eine viel größere Bedeutung zukommt als der – letzten Endes ohnehin unmöglichen – Begründung. Das erlaubt es, die oben gegebene Reihe von Zitaten mit einer Auswahl dreier Situationen 5 Dem Schönberg-Monografen Adorno konnte es kaum entgangen sein, dass umgekehrt dem auf die Wahrung der Hegemonie der deutschen Musik so sehr bedachten Schönberg 20 Jahre zuvor von Heinrich Berl (Berl: 1926, 174) positiv bescheinigt worden war, dass seine Musik „die orientalische Wendung der Musik, die Lösung der europäischen Krisis, die in Wahrheit eine asiatische ist“, vollziehe und gerade er diese Wende, „dank seiner Blutsverbundenheit mit dem Judentum, zum sinnfälligen Austrag gebracht“ habe (ausgelöst ist dieser Diskurs wohl durch die Frage nach der kulturellen beziehungsweise musikalischen Identität im Umkreis des Zionismus).
Der Deutschen Glauben an musikalische Überlegenheit
31
abzurunden, deren Zeuge der Verfasser dieser Zeilen geworden ist. Blitzlichtartig lassen sie erkennen, wie fest verwurzelt die Überzeugung ist: Um 1960. Im Musikunterricht des humanistischen Gymnasiums wurde der Freischütz durchgenommen, und er war zusammen mit der Zauberflöte und dem Lohengrin damals, und noch auf Jahrzehnte hinaus, die einzige Oper, die im Schulunterricht behandelt werden musste, weshalb meist auch nur diese drei de facto die gesamte Opern- als Werkgeschichte repräsentierten. Der Studienrat, der zugleich Sport unterrichtete und auch im Dirigieren von Werksorchestern und -Chören erfolgreich tätig war, erläuterte die Kavatine der Agathe und äußerte über deren Kadenzschluss – wenige Noten einer Koloratur-Andeutung in den Takten 11 bis 8 vor Schluss –, dass er für eine so tief gefühlte Linie wie diese alle italienischen Koloraturarien hergebe. Es blieb seither genug Zeit zu rätseln, warum ein paar koloraturartige Töne allen anderen Koloraturen vorzuziehen, warum die eine Linie gefühlstief sein soll, alle anderen aber an der Oberfläche bleiben. Der Studienrat wusste genau, welches Spiel er mit den wie Schwämmen begierigen Schülern trieb, indem er ihre Urteilskraft manipulierte. 1991. Nach einem Konzert in einer süddeutschen Kleinstadt gab es einen Empfang der örtlichen Honoratioren. Einer von ihnen war verschlagen genug, seine Irritation von ausländischer Musik – er hatte neben Mozart und Brahms Debussy und Prokofjew über sich ergehen lassen müssen – nicht direkt zu formulieren, sondern elegant in einem positiven Statement unterzubringen, indem er unter Kopfnicken der anderen Stützen seines Städtchens verkündete: „Wir hier lieben unsere romantischen Meister Mozart, Haydn, Bach, Schubert.“ Die Kenner der Musik sollten diese Auffassung nicht schon deshalb als befremdlich beiseite schieben, weil sie die ihnen geläufige Epocheneinteilung so auffällig durcheinander bringt. Immerhin hatte Hegel in seiner Ästhetik gelehrt, dass Musik als solche eine romantische Kunstform sei, aber niemand muss Hegel gelesen haben oder Hegelianer sein, um dasselbe zu fühlen oder auszusprechen. Die ästhetische Position, die jener selbstbewusste Musikliebhaber vertritt, ist das eine, das andere jedoch der unausgesprochene, von Einverständnis getragene und es erheischende xenophobe Reflex. 1998. In einem bayerischen Internat nahe der österreichischen Grenze waren die Schüler in die Sommerfrische entlassen. Während dieser Zeit wurde das Internat für internationale Gruppen hochbegabter Studenten aus allen Fächern genutzt, unsere Gruppe widmete sich einem Thema aus dem Bereich der Musik und war deshalb im Musiksaal des Gymnasiums untergebracht. Während einer Mittagspause wollte ich sehen, über welche Notenbestände ein solches Gymnasium in idyllischer Gegend verfügt. Mir kam ein Verdacht: Ich legte die Noten in zwei Stapeln aufeinander. Bald war der eine Stapel über einen Meter hoch, der andere
32
Albrecht Riethmüller
blieb bis zum Ende dabei, fünf oder sechs Zentimeter zu messen. Er bestand aus zweieinhalb Heften Klaviermusik von Chopin. Der große Stapel hingegen enthielt unterschiedliche Werke vieler Autoren, doch hatten die Musikalien des riesigen Stapels eines gemeinsam: Sie enthielten nur Kompositionen deutscher Komponisten. Es war der ganze Vorrat der Schule. In diesem Stapel war einerseits nichts vertreten, was nach dem Ersten Weltkrieg komponiert worden wäre, andererseits nichts Ausländisches, nichts Slawisches, aber auch kein Stück eines jüdischen Komponisten. Es war eigenartig. In einem Schulungsheim der völkischen Bewegung vor dem Ersten Weltkrieg hätte eine solche Auswahl vielleicht erwartet werden können, in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts ist sie in einem Internat, in dem junge Leute das Abitur erreichen, die danach in den ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts einmal zur geistigen Elite des Landes werden sollen, geradezu grotesk. Das einzig Ermunternde, wenngleich über diese Kapriole des Musikunterrichts in Gymnasien nicht Hinwegtröstende ist, dass die Schüler in ihren Sommerferien vermutlich ihren eigenen, ganz anderen musikalischen Geschmack mit Pop, Rap und Rock auslebten. In der Haltung der Schulleitung oder des Musiklehrers, die kein Einzelfall sein dürfte, wird hier ein zäh überlebender Chauvinismus auffällig. Noch beklagenswerter ist allerdings der Bärendienst, den die für die Ausbildung Verantwortlichen auf diese Weise der Sache der modernen klassischen Musik erweisen. Wenige Kilometer entfernt, jenseits der Grenze, wirbt die Tourismus-Industrie seit Längerem für Österreich als „Land der Musik“. Bescheidenheit kann von Natur aus nicht die Tugend jener Propaganda sein, die heute Werbung heißt. Man denkt unwillkürlich ans Gegenteil, an den Slogan „land without music“, der früher einmal – sei es als Understatement, sei es melancholisch – in England zirkulierte. In Österreichs Zweiter Republik wird einmal mehr der Mangel an politischer Macht und ökonomischer Stärke in musikalische Superiorität umgemünzt, die wie ein Stern (ohne Mercedes) weltweit strahlen soll. Auch die Musikfachleute haben sich in den letzten Jahren daran gemacht, eine von der deutschen unterschiedene, ja gegen sie gerichtete eigene österreichische Identität der Musik herzustellen, um die Juwelen der Musikgeschichte in eine neue nationale Fassung zu bringen, ohne die sie freilich genau so hell funkeln würden wie ohne die alte. Der Vorgang zeigt nebenbei, wie weit man noch immer von einer europäischen Identität in der Musik entfernt ist, obwohl das „Abendland“ im Umkreis der Musik – wie übrigens auf kaum einem anderen Gebiet mehr – unverdrossen beschworen wird. Das gilt keineswegs nur für Österreich, wo vor allem im Osten und Südosten die Erinnerung an die türkische Belagerung, also an die Kultur- und Religionsgrenze noch eigenartig gegenwärtig ist. Der Weg von der „deutschesten Kunst“ nach Österreich als dem „Land der Musik“ ist indessen nicht weit. Die veränderte Identität, die man der Musik auf diese
Der Deutschen Glauben an musikalische Überlegenheit
33
Weise zuschreiben will, ist ein Reflex des politischen Selbstverständnisses. Unter Ausblendung ihrer eigenen historischen Tradition half nicht zuletzt die Österreichische Volkspartei dabei, jenes Gefühl einer neuen österreichischen Identität zu erzeugen, von der man wollte, dass man sie „als weit entfernt vom Pangermanismus angesiedelt sah“, der vor und nach 1938 Konjunktur hatte (Kater: 2000). So unterscheidbar die regionalen musikalischen Verschiedenheiten sein mögen – womöglich vom einen Bergtal zum anderen –, so nebulös bleibt es, nationale Charakteristika von Musik aus der Musik heraus bestimmen zu wollen. Musik wird wahrscheinlich auch deshalb so gerne in die nationalen, patriotischen und chauvinistischen Diskurse einbezogen, weil solche Charakteristika ihr beziehungsweise den Tönen erst von außen aufgeklebt werden müssen, weil sie aus kaum mehr als Klischees bestehen, weil sie unüberprüfbar sind, vor allem jedoch weil sie mit Tonqualitäten verwechselt werden. Noch eklatanter ist freilich der wundersame Austausch der nationalen Identitäten selbst. Dieselbe Musik, die wie die „Wiener Klassik“ früher nicht deutsch genug sein konnte, soll nun gerade umgekehrt nur noch österreichisch sein. 1891 war das noch ganz anders. Für den Bruckner-Commers in Wien plante August Göllerich eine Festrede über den in unseren Tagen als besonders österreichisch ausgegebenen Komponisten, den er zum Mittelpunkt seines forschenden Lebens gemacht hat. In einer sogar grammatisch ziemlich schwachen deutschen Prosa, die für derlei Panegyrica damals typisch war und für spätere nationalistische Elogen typisch geblieben ist, ruft er aus: Auf dem Felde deutschester Bethätigung, im Reiche der Musik, hat er gerungen und erreicht, ein Befestiger eigenst deutschen Fühlens, ein Prediger echtest deutschen Glaubens, der immerdar der Welt verkündet, daß das Edle, Schöne nicht um des Ruhmes und Vor theiles wegen in die Welt tritt, sondern daß es deutsch sei, eine Sache, die man treibt um ihrer selbst willen und aus Freude an ihr zu treiben.6
Als Göllerichs Witwe 1937 dem Bayerischen Ministerpräsidenten dafür dankte, zur Einweihung der Büste Bruckners in der Walhalla bei Regensburg eingeladen worden zu sein, unterschrieb sie ihren Brief mit „Heil Hitler!“,7 sie tat es ohne Not, denn sie schrieb die Grußformel aus jener österreichischen Republik, von der aus überhaupt der Vorschlag stammte, Bruckners Büste dem deutschen Ehrentempel Walhalla einzuverleiben. 6 Veröffentlicht in: Deutsches Volksblatt, 13. und 15. Dezember 1891, zit. Nach: Brüstle: 1996, 33. 7 Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München, StK 107476.
34
Albrecht Riethmüller
Es drängt sich angesichts der beiden Länder mit derselben Sprache eine ganz andere Vermutung auf: Die österreichische Identität der Musik könnte gerade nicht, wie es auf den ersten Blick scheint, eine multikulturelle Vision sein, sondern die verklärende Erfüllung der „deutschesten Kunst“ in ihrer Reinheit und damit die Spitze des Überlegenheitsgefühls im „Land der Musik“. Keine Vermutung hingegen, sondern evident ist es, dass der offenbar so bequem mögliche Transfer der nationalen Identitäten auf die Beliebigkeit aller solcher Annahmen schließen lässt. Er wirft zudem – landesunabhängig – kein günstiges Licht auf die Glaubwürdigkeit der Versuche nationaler Identitätsstiftungen durch Musik überhaupt. „Austrians, it is said, have convinced themselves that Hitler was a German and Beethoven was an Austrian“ (Cohen: 2000). Die Einbildungen gehen weiter.
Literatur Theodor W. Adorno, Philosophie der neuen Musik (1949), Frankfurt a. M. 1975 (Gesammelte Schriften, 12). Theodor W. Adorno/Max Horkheimer, Dialektik der Aufklärung (1944), Frankfurt a. M. 1981 (Gesammelte Schriften, 3). Theodor W. Adorno, Rezension der „Psychology of Music“ von C. E. Seashore, in: Musikalische Schriften VI, Frankfurt a. M. 1984 (Gesammelte Schriften, 19), 375–381. [Anonymus], [ohne Titel], in: Die Musik 28 (1935/36), 721. Celia Applegate, How German Is It? Nationalism and the Idea of Serious Music in the Nineteenth Century, in: Nineteenth Century Music 21 (1998), 274 –298. Celia Applegate/Pamela Potter (Hrsg.), Music and German National Identity, Chicago, London 2002. Paul Bekker, Die Weltgeltung der deutschen Musik, Berlin 1920. Heinrich Berl, Das Judentum in der Musik, Leipzig, Berlin 1926. Franz Brendel, Geschichte der Musik in Italien, Deutschland und Frankreich, 5. Aufl. Leipzig 1875. Christa Brüstle, Musik für Verehrer. Ein Beitrag zur Geschichte der frühen BrucknerRezeption, in: Österreichische Musikzeitung 51 (1996), 33–41. Ferruccio Busoni, Briefe an seine Frau, hrsg. von Friedrich Schnapp, Zürich, Leipzig 1935. Roger Cohen, A Haider in the Future, in: The New York Times, 29. April 2000. FAZ, Unterwegs. Klaviersonaten aus Amerika, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8. August 1991. Johann Gustav Droysen, Vorlesungen über die Freiheitskriege, Teil 1, Kiel 1846. Anselm Gerhard, Kanon in der Musikgeschichtsschreibung. Nationalistische Gewohnheiten nach dem Ende der nationalistischen Epoche, in: Archiv für Musikwissenschaft 57 (2000), 18–30.
Der Deutschen Glauben an musikalische Überlegenheit
35
Robert Everett Green, Musical God or Monster?, in: The Globe and Mail, Toronto, 4. September 1999. Joseph Haydn, Gesammelte Briefe und Aufzeichnungen, hrsg. von Dénes Bartha, Kassel 1965. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, Frankfurt a. M. 1971 (Werke in 20 Bänden, 18). Michael H. Kater, Paul Celans Todesfuge und die Paradigmen der Kontinuität in Deutschland und Österreich, in: Hubert Gaisbauer/Bernhard Hain / Erika Schuster (Hrsg.), Unverloren. Trotz allem. Paul Celan Symposion Wien 2000, Wien 2000, 15–41. Friedrich Nietzsche, Nachlaß 1884–1885, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Neuausgabe München 1999 (Kritische Studienausgabe, 11). Hans Pfitzner, Futuristengefahr (1917), in: Gesammelte Schriften, Bd. I, Augsburg 1926, 185–223. Pamela Potter, Most German of the Arts. Musicology and Society from the Weimar Republic to the End of Hitler’s Reich, New Haven, London 1998. Albrecht Riethmüller, Musik, die „deutscheste“ Kunst, in: Joachim Braun/Heidi Tamar Hoffmann/Vladimir Karbusicky (Hrsg.), Verfemte Musik. Komponisten in den Diktaturen unseres Jahrhunderts, Frankfurt a. M. 1995, 91–103. Albrecht Riethmüller, „Is that Not Something for Simplicissimus?!“ The Belief in Musical Superiority, in: Celia Applegate/Pamela Potter (Hrsg.), Music and German National Identity, Chicago, London 2002, 288–304. Arnold Schmitz, Beethoven, Bonn 1927. Giselher Schubert, „Amerikanismus“ und „Americanism“. Hindemith und die Neue Welt, in: Hindemith-Jahrbuch 27 (1998), 80–111. Bernd Sponheuer, Reconstructing Ideal Types of the „German“ in Music, in: Celia Applegate/Pamela Potter (Hrsg.), Music and German National Identity, Chicago, London 2002, 36–58.
36
Albrecht Riethmüller
Monumentales Gedächtnis und kulturelle Identitat
37
Barbara Boisits Monumentales Gedächtnis und kulturelle Identität. Die Wiener Beethoven-Feier von 1870
Zu den zentralen kulturwissenschaftlichen Leitbegriffen zählt seit den 1980er-Jahren der des „kulturellen Gedächtnisses“. Dieses verweist auf die soziale Dimension des Erinnerns, das sich bestimmter Überlieferungsformen (Texte, Bilder, Riten) bedient, um kollektive Identität (zum Beispiel einer Nation) zu sichern. Mittels dieser Überlieferungsformen wird Vergangenheit (re-)konstruiert, um sie einem bestimmten, in der Gegenwart liegenden Zweck dienstbar zu machen. Untersuchungen zu nationalen und transnationalen Gedächtnisorten in Frankreich, Deutschland und Zentraleuropa (Nora: 1984–1992; François/Schulze: 2001; Csáky: 2000–2002; Csáky: 2002ff.) haben in den letzten Jahren gezeigt, in welchem sozialen und politischen Spannungsfeld solche „lieux de mémoire“ als Symbole kollektiver Identität generiert werden. Als soziale Konstrukte unterliegen sie meist einem Wandlungsprozess. Der Begriff „Gedächtnisort“ beziehungsweise „Erinnerungsort“ ist dabei im wörtlichen wie übertragenen Sinn zu verstehen, das heißt neben Gebäuden und Denkmälern umfasst er auch Personen, Ereignisse oder Kunstwerke. Zu den musikalischen Gedächtnisorten,1 die in den drei Bänden der Deutschen Erinnerungsorte besprochen werden, zählt auch die Neunte Beethovens (Buch: 2000 und 2001). Der Autor, Esteban Buch, verweist auf die zum Teil heftig untereinander konkurrierenden Mehrfachkodierungen, denen dieser „Gedächtnisort“ seit seiner Uraufführung am 7. Mai 1824 im Wiener Kärntnertortheater unterworfen war und ist. Einige, auch von Buch angeführte Beispiele seien in aller Kürze erwähnt, um an die Dimensionen solcher „Inbesitznahmen“ zu erinnern, bevor am Beispiel der Wiener Beethovenfeier zum 100. Geburtstag im Dezember 1870 die Bedeutungszuschreibungen speziell in dieser Stadt gezeigt werden sollen. Wie kaum ein anderes musikalisches Kunstwerk wurde die Neunte Beethovens im Laufe ihrer Rezeption „eine Art musikalischer Fetisch des Abendlands“ (Buch: 2001, 680). Verschiedene nationale (keineswegs nur deutschnationale) Vereinnahmungen konkurrierten mit universalistischen Deutungen beziehungsweise Kombinationen aus beiden („das wahre Deutsche ist zugleich das Allgemeingültige“ 1 Behandelt werden die Bereiche Hausmusik, Schlager, Bach, Gesangverein, Richard Wagner, Nationalhymne, Beethovens Neunte.
38
Barbara Boisits
und Ähnliches). Bereits die Vorgeschichte der Uraufführung ist vom patriotischen Versuch geprägt, den Komponisten, der – gekränkt wegen des Rossini-Kultes – durchaus geneigt war, das Werk außerhalb Wiens erstaufführen zu lassen, für jenes Land zu reklamieren, in dem er seit Langem seine Wirkungsstätte gefunden hatte. In einem Aufruf seiner „Bewunderer“ heißt es: Vorzüglich sind es die Wünsche vaterländischer Kunstverehrer, die wir hier vortragen, denn ob auch Beethoven’s Name und seine Schöpfungen der gesammten Mitwelt und jedem Lande angehören, wo der Kunst ein fühlendes Gemüth sich öffnet, darf Oestreich ihn doch zunächst den Seinigen nennen. Noch ist in seinen Bewohnern der Sinn nicht erstorben für das, was im Schooße ihrer Heimath Mozart und Haydn Großes und Unsterbliches für alle Folgezeit geschaffen, und mit freudigem Stolze sind sie sich bewußt, daß die heilige Trias, in der jene Namen und der Ihrige als Sinnbild des Höchsten im Geisterreich der Töne strahlen, sich aus der Mitte des vaterländischen Bodens erhoben hat (Schindler: 1871, 64).
Reklamieren hier Vertreter eines deutsch-österreichischen Patriotismus, wie er im Gefolge der napoleonischen Kriege „in Mode“ gekommen war, Beethoven für ihre Zwecke, so vereinnahmten ihn auf deutschem Boden deutschnationale beziehungsweise liberale Kreise für ihre zunächst vor allem demokratisch-republikanischen,2 später überwiegend nationalistischen Anliegen. Bekannt ist Richard Wagners Beet hoven-Aufsatz aus dem Jahre 1870, in dem er den Komponisten massiv für einen gegen Frankreich gerichteten Nationalismus instrumentalisiert (Wagner: 1873). In Frankreich selbst wird mitunter aus der Neunten die dreifache Devise der Revolution von 1789 herausgehört; Madame Assaki-Quinet, die Witwe des republikanischen Politikers, Historikers und Philosophen Edgar Quinet, hat den Schlusssatz gar als „Marseillaise der Menschheit“ (Buch: 2000, 207) bezeichnet. Die Ode wird zur „Hymne der Befreiung, der wiedergeborenen Freiheit, des regenerierten Frankreich, die Hymne einer unerschütterlichen Republik, die alle Franzosen in ihrer unendlichen Vaterlandsliebe verbindet“ (Buch: 2000, 206f.). Konkreter deutet übrigens dieselbe Autorin das Finale der Fünften Beethovens, in dem sie „so etwas wie eine Rückkehr Elsaß-Lothringens ins Vaterland“ vernimmt (Quinet: 1893, 403, zit. nach Buch: 2001, 672). 2 So wird in Robert Griepenkerls 1838 erstmals erschienenem Roman Das Musikfest oder die Beethovener zum ersten Mal der Gedanke geäußert, dass die Ode an die Freude als eine an die Freiheit gedeutet werden müsse. Ähnlich äußert sich zehn Jahre später auch ein Autor in der Neuen Zeitschrift für Musik: „Wenn er [Beethoven] in gewichtigen Accorden singt: ‚Seid umschlungen Millionen, diesen Kuß der ganzen Welt!‘ erkennen Sie in solchen Stimmungen keinen Zusammenhang mit den Ideen der modernen Demokratie, mit den Ideen der Freiheit, Gleichheit, Bruderliebe?“ (Gottschald: 1848, 299).
Monumentales Gedächtnis und kulturelle Identitat
39
Besonders heiß umkämpft war der „Gedächtnisort“ Neunte in Kriegszeiten. So formulierte der französische Kritiker Camille Mauclair während des Ersten Weltkrieges: Die Ode an die Freude ist die einzige Hymne der Alliierten, das Credo all unserer gerechten Hoffnungen, und man müßte dem verbrecherischen Deutschland ein für allemal verbieten, auch nur einen Takt davon zu spielen (Mauclair: 1927, zit. nach Buch: 2000, 220).3
Die mittlerweile weit verbreitete universalistische Deutung als Charta der Freiheit für die ganze Menschheit musste mitunter ideologiekonform zurechtgedreht werden. So erklärte 1941 der Musikhistoriker und damalige Goebbels-Mitarbeiter Hans-Joachim Moser : Sein „Diesen Kuß der ganzen Welt“ bedeutete alles andere als ein Fraternisierenwollen mit Hinz und Kunz (wie man es nachmals in Deutschlands roten Jahren allzu gern missverstanden hat), vielmehr ein glühendes Sichhingeben an die Vorstellung, den Wunschtraum, die Idee einer Menschheit schlechthin – und das war so deutsch wie möglich gedacht (Moser: 1941, zit. nach Schröder: 1986, 197).
Aber auch 1971, als der Europarat die Ode zur Europahymne wählte (vgl. Buch: 2003), war der Text mit seiner die ganze Menschheit verbindenden Aussage ein Problem. So heißt es in einem Kommissionsbericht: Was den Text für eine solche Hymne anbelangt, wurden gewisse Vorbehalte, zunächst hinsichtlich des aktuellen Wortlauts der Ode an die Freude, geäußert, der kein spezifisch europäisches Glaubensbekenntnis darstellt, sondern ein universelles (Radius: 1971, zit. nach Buch: 2001, 678f.).
Das Problem wurde gelöst, indem man auf jeglichen Text verzichtete und damit „die Europäer mit einem Mittel ausgestattet [habe], ihren Glauben jenseits der Spracheigenheiten auszudrücken“ (Anonym: 1973, zit. nach Buch: 2001, 679). Mittlerweile wurde unter anderem auch von österreichischer Seite ein Vorschlag gemacht, die bisherige „Hymne ohne Text“ mit einem solchen zu versehen, und zwar mit einem lateinischen („Est Europa nunc unita“).4 3 Die Textstelle wurde während des Krieges verfasst. 4 Der Text stammt von Peter Roland, dem Inhaber einer Wiener Maturaschule. Die Idee wurde bereits von offizieller (österreichischer wie europäischer) Seite aufgegriffen (vgl. Scheidl: 2004, 8). Der Text lautet: „Est Europa nunc unita / et unita maneat; / una in diversitate / pacem mundi augeat. //
40
Barbara Boisits
In der Folge bewährte die Ode ihre Eignung zur Hymne (zum Beispiel: Rhodesien 1974, Europäische Gemeinschaft 1985; bereits 1929 Hymne der Paneuropa-Bewegung), und das ganze Werk wird weiterhin als mustergültiger Ausdruck großer historischer Ereignisse verstanden.5 Im Jahre 2001 wurde das Autograf der Symphonie zudem von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt. Auch die Wiener Beethovenfeier 1870, die größte auf dem Gebiete der Habsburgermonarchie,6 steht in dieser Tradition pathetischer Aneignung des Komponisten und seines Werks zum Zwecke kulturell-politischer Repräsentation. Sie war geplant als „das schöne Unternehmen einer allgemeinen nationalen Feier des gewaltigsten aller deutschen Tondichter an der Stätte, wo dessen unsterbliche Werke hervorgeblüht sind“ (Schelle: 1870a, 1). Die Initiative ging von der Gesellschaft der Musikfreunde aus. Am 19. Dezember 1868 wurde in der Generalversammlung von Dr. Emil Hardt ein Antrag, betreffend die Vorbereitung einer BeethovenSäkularfeier, eingebracht (GdM: 1868, 47f.; Perger/Hirschfeld: 1912, 134).7 Ein Festkomitee wurde gegründet, das aus Repräsentanten der Gesellschaft sowie weiteren Persönlichkeiten des Wiener Kultur- und Geisteslebens bestand, darunter Eduard Hanslick und Franz Grillparzer. In dem Text heißt es (GdM: 1870, Hervorhebung original): Den hundertsten Geburtstag Beethovens in einer der Bedeutung des Meisters würdigen und der Stellung, welche Wien in der Musikwelt einnimmt, entsprechenden Weise zu feiern, haben sich die Vertreter der künstlerischen und wissenschaftlichen Corporationen Wien’s zu einem Festausschuße vereinigt, welcher das Festprogramm entworfen und die Genehmigung desselben an maaßgebender Stelle eingeholt hat. […] Die hervorragendsten musikalischen Kräfte Deutschlands werden zu den Concertproductionen, die anerkanntesten Meister als Festdirigenten eingeladen werden. Um dem Feste einen großartigen repraesentativen Character durch zahlreiche Betheiligung der Verehrer des großen Tonmeisters zu verleihen, hat Semper regant in Europa / fides et iustitia / et libertas populorum / in maiore patria. // Cives, floreat Europa, / opus magnum vocat vos. / Stellae signa sunt in caelo / aureae, quae iungant nos.“ Übersetzung: „Europa ist nun vereint / und vereint möge es bleiben; / in Vielfalt geeint / möge es den Weltfrieden stärken. // Immer mögen in Europa herrschen / Vertrauen und Gerechtigkeit / und die Freiheit seiner Völker / in einem größeren Vaterland. // Bürger, Europa möge blühen, / eine große Aufgabe ruft euch. / Goldene Sterne am Himmel / sind die Symbole, die uns verbinden.“ 5 Etwa zum Fall der Berliner Mauer 1989 unter dem Dirigat von Leonard Bernstein, der bei diesem Anlass wiederum die „Freude“ durch „Freiheit“ ersetzte, 1996 in Sarajevo unter Yehudi Menuhin oder im Jahre 2000 als Gedenkveranstaltung zum 55. Jahrestag der Befreiung von Mauthausen mit den Wiener Philharmonikern unter Simon Rattle. 6 Beethovenfeiern wurden in diesem Jahr mit Ausnahme von Paris, das wegen des Krieges auf eine Feier verzichtete, in ganz Europa, aber auch in New York abgehalten (Buch: 2000, 191f.). 7 Die Gemeinde Wien gab allerdings gleich zu verstehen, dass mit einer größeren Unterstützung ihrerseits nicht zu rechnen sei (GdM: 1871, 6).
Monumentales Gedächtnis und kulturelle Identitat
41
das Festcomité die Constituirung einer eigenen Festgenossenschaft zur Saecularfeier Beethovens in Wien beschlossen, von welcher die Begehung dieses Festes unter Leitung des unterzeichneten Festcomité’s ausgehen soll. […] Das Reinerträgniß der Festfeier wird einem „Beethovenfonde“ zur Unterstützung dürftiger Tonkünstler und einem Beethoven=Denkmalfonde gewidmet werden. Demnach ladet der Festausschuß hiemit alle Verehrer Beethovens zum Eintritt in diese Festgenossenschaft ein.
Der Reinertrag sollte also für einen Denkmalfonds,8 ein Beethoven-Stipendium sowie zur Unterstützung notleidender Verwandter Beethovens verwendet werden. Der ursprüngliche Plan war ehrgeizig: Man konzipierte das Fest als internationales Ereignis, lud Richard Wagner und Franz Liszt als Vertreter der „neudeutschen Schule“ auf der einen, Clara Schumann, Joseph Joachim und Franz Lachner als Brahms-Anhänger auf der anderen Seite ein.9 Als die einen von der Einladung an die anderen erfuhren, zogen alle ihre Teilnahme zurück (Schelle: 1870a, 1; Helm: 1915, 435; Messing: 1991, 59–62; Buch: 2000, 194f.).10 Wagner verzichtete gar auf eine persönliche Absage an das Komitee, da er keinen direkten Kontakt mit seinen Kritikern Eduard Hanslick und Eduard Schelle wünschte, die als Mitglieder des Beethoven-Komitees im Einladungsbrief von Franz Egger, dem Präsidenten der Gesellschaft der Musikfreunde, genannt waren (Glasenapp: 1908, 325f.). Am 25. Mai 1870 schrieb Wagner an Hans Richter: Suchen Sie doch den Herrn Dr. Egger (Mitvorstand des Wiener Beethovenfest-Comité’s) auf, und richten Sie ihm in meinem Namen recht freundlich aus, daß, wenn er und manche ehrenwerte Männer mich zur Direction eines speziellen Theiles des projectirten Beethovenfestes hätten bestimmen wollen, man gut gethan haben würde, mir nicht die Liste der Mitglieder des Vorstandes einzusenden. Auf irgend eine Einladung, bei welcher die Herren 8 Es handelt sich dabei um das Beethovendenkmal von Caspar von Zumbusch (1830–1915), das am 1. Mai 1880 am Beethovenplatz (Wien I) enthüllt wurde (Czeike: 1992, 304, vgl. auch Perger/ Hirschfeld: 1912, 195). 9 Wagner sollte Beethovens Neunte, Liszt die Missa solemnis, Lachner den Fidelio, Clara Schumann ein Klavierkonzert unter Wagners Leitung und Joachim die erste Violine im Streichquartett op. 131 spielen (Buch: 2000, 195; Messing: 1991, 59). Im Gespräch war auch der Geiger Ferdinand Laub (Schelle: 1870a, 1). 10 Was das Komitee zu dieser Zusammenstellung ermutigt haben mag, wo sich doch zu diesem Zeitpunkt der Parteien-Streit bereits zugespitzt hatte, geht aus den bis jetzt eingesehenen Dokumenten und Briefen nicht klar hervor (vgl. auch Messing: 1991, 59). Ein gewisser blauäugiger Idealismus, der sich ganz auf die Zugkraft Beethovens und der „Musikstadt“ Wien verließ, war wohl am Werk, wie auch Schelle einbekannte: „Uns Wiener kann die Schmach nicht treffen. Man wird uns höchsten thöricht nennen, daß wir wagten, eine Idee, würdig der Größe des Tondichters, aufzustellen“ (Schelle: 1870a, 1). Dazu mag auch das Kalkül gekommen sein, im Falle des Gelingens des Respekts der Musikwelt sicher zu sein.
42
Barbara Boisits
Hanslick und Schelle mitbetheiligt seien, nur zu antworten, sei mir unmöglich (Karpath: 1924, 64f.; vgl. auch Wagner: 1976, 234).
Einen ähnlichen Brief richtete er dann an Nikolaus Dumba, den Vizepräsidenten der Gesellschaft, nicht hingegen an das ihn einladende Komitee (Schelle: 1870a, 1). Schelle reagierte auf Wagners Absage mit einem Feuilleton in der Presse unter dem Titel Das Musikantenthum in der Musik, in dem er die Großherzigkeit des Komitees, das Wagner gewählt hatte – Hanslick war der Abstimmung fern geblieben – Wagners „erbärmlich kleine[m] Charakter“ gegenüberstellte (Schelle: 1870a, 1).11 Liszt sagte zunächst mit Hinweis auf seine Zurückgezogenheit ab, nach einer erneuten Anfrage stellte er eine Teilnahme in Aussicht, machte diese jedoch vom Termin der Budapester Beethoven-Feier abhängig, bei der er seine 2. BeethovenKantate sowie das Violinkonzert und die Neunte Symphonie Beethovens dirigieren sollte. Da diese aber nicht mehr verschoben werden konnte, nahm auch Liszt an der Wiener Feier nicht teil (Legány: 1984, 170–173). Diese zweite Einladung vom 12. Oktober 1870, die von Salomon Hermann Mosenthal, Nikolaus Dumba und Joseph Unger im Namen des Beethoven-Komitees unterzeichnet war, spielt auch auf innenpolitische Spannungen und Liszts Vorliebe für Ungarn an: „Sie haben für Weimar, das Sie eine Zeit lang den Seinen nannte, das Opfer gebracht, aus Ihrer Zurückgezogenheit hervorzutreten; dürfen wir Sie nicht mit grösserem Recht den Unsern nennen? Oder hätte die Leitha auch eine Grenze durch Ihr Herz gezogen?“ (La Mara: 1895, 350). Der Entwurf jenes Briefes vom 9. Juni 1870, den man an Clara Schumann schickte, hat sich noch erhalten (GdM: 1870): Hochverehrte Frau! Der ergebenst unterzeichnete Ausschuß, gewählt von den künstlerischen und wissenschaftlichen Korporationen Wiens, das Säkularfest Beethovens […] in würdevoller und glänzender Weise zu gestalten, erfüllt eine seiner ehrenvollsten Aufgaben, indem er Sie, die hochbedeutende Interpretin der Inspirationen des großen Tonmeisters, dem die Feier gilt, die edle Künstlerin und Trägerin eines Namens, der zu den schönsten Zierden deutscher Tondichtkunst zählt, zur werkthätigen Theilnahme an diesem Feste einlädt. Das Comite [sic], von dem Wunsche geleitet, bei dieser Gelegenheit jeder der Richtungen nach welchen Beethovens Genius seine Strahlen warf, durch die besten Künstler repräsentirt zu sehen, hätte, ebensowenig als nebst dem Symphoniker und Dramatiker Beethoven, der Claviercomponist in dem Programm der Festproductionen unvertreten bleiben könnte, 11 Wagner berichtet im Vorwort seiner Beethoven-Schrift von 1870, dass seine Abhandlung von der Vorstellung geprägt sei, er halte eine Festrede bei einer idealen Feier des großen Meisters, da ihm keine würdige Feier angeboten worden sei (Wagner: 1873, 77). Diese Stelle könnte eine Anspielung auf das Wiener Fest enthalten (vgl. auch Messing: 1991, 63, Anm. 13 sowie Buch: 2000, 195).
Monumentales Gedächtnis und kulturelle Identitat
43
eine [gemeint: keine] natürlichere Wahl […] treffen können, als Sie, hochverehrte Frau, einzuladen, Ihr hohes Talent der weihevollen Verdollmetschung einer der Schöpfungen der letztern Richtung widmen zu wollen. Demgemäß erlauben wir uns und zugleich im Namen der zahlreichen Kunstfreunde, die ihre Theilnahme für das Beethoven-Säcularfest von allen Seiten bestätigen, die angelegentliche Bitte, daß Sie Ihre Mitwirkung in der angedeuteten Weise gütigst zusagen und uns baldigst in die Lage setzen möchten, diese kostbare Errungenschaft der Festgenossen endgültig kundgeben zu können. Ihre anerkannte Begeisterung für den unsterblichen Tonmeister wird etwaige Hinderniße zu besiegen, so wie das Comité jedem Ihrer Wünsche mit größter Hingebung zu entsprechen wissen.
Dazu notierte Clara Schumann Folgendes in ihr Tagebuch (Litzmann: 1909, 240): Juni 1870. Mit kam eine Einladung von Herbeck im Namen des Beethoven-Comitees in Wien bei dem Beethovenfest […] mitzuwirken, da aber wie ich gehört Wagner und Liszt dasselbe dirigieren sollten, so konnte ich ebenso wenig als Joachim zusagen […] Da aber hörte ich von Johannes [Brahms] […] dass es mit Wagner und Liszt noch nicht entschieden sei, so schrieb ich an Herbeck, dass ich mit größter Freude bei dieser Gelegenheit mitwirken werde, aber meine definitive Entscheidung mir noch vorbehielte, bis er mir mitgetheilt, wer das Fest dirigieren werde […].12
Joseph Joachim schrieb am 24. Mai 1870 folgenden entrüsteten Brief an Brahms (Moser: 1912, 61f.): Lieber Johannes, Soeben habe ich an den Vorstand für die Beethoven-Feier geschrieben, um meine Mitwirkung abzulehnen. Man möchte schamrot werden – Männer wie Grillparzer, Karrajahn [Theodor Georg von Karajan]13 an der Spitze der Wiener Kunst- und Wissenschaftsgenossen, Leute, die doch wohl wissen, was der einsame, heilige Beethoven zu bedeuten hatte – und der Abbé Liszt als Dirigent der Missa solemnis von ihnen gewählt! Der Rossini-Kultus zu Beethovens Lebzeiten, der ihn verbittert haben soll zuzeiten, ist nichts gegen diese frivole Komödie. Ich hoffe, Du hast nie anderes erwartet, als dass ich fernbleiben würde […]. Ich hatte Mühe, maßvoll zu bleiben, und habe den Brief ans Komitee dreimal abgeschwächt in 12 Clara Schumann hoffte zu dieser Zeit noch, dass Brahms nach Herbeck die Leitung der Gesellschaftskonzerte übernehmen und damit auch die Beethoven-Feier dirigieren werde (Litzmann: 1927, 625f.). Die Gesellschaft entschied sich aber für die Saison 1870/71 zugunsten von Josef Hellmesberger, im Jahr darauf für Anton Rubinstein. Brahms dirigierte die Gesellschaftskonzerte dann von 1872 bis 1875 (Böhm: 1908, 163–167; Perger/Hirschfeld: 1912, 320; Kalbeck: 1921, 341f.). 13 Theodor Georg Ritter von Karajan (1810–1873), der Urgroßvater Herbert von Karajans, war Hofbibliothekar und Historiker.
44
Barbara Boisits
immer neuen Abschriften. Es ist aber schließlich der auch in seiner milden Fassung noch verständliche Satz stehengeblieben: daß mir persönlich durch die Berufung der beiden berühmten Männer [Wagner und Liszt] das Bild von der hehren, einfachen Größe Beethovens gestört wird, welche sich in schlichter, sittlicher Majestät nach und nach den Erdkreis unterworfen hat, und daß ich deshalb wegbleibe, um den Einklang des Jubels nicht zu stören.
Die kumulative Absage der Eingeladenen14 quittierte Schelle mit der Bemerkung, dass „das krähwinkelhafte, rechthaberische Musikantenthum unserer Zeit der natürliche Feind einer solchen nationalen Idee ist“ (Schelle: 1870a, 1). Der Ausbruch des deutsch-französischen Krieges tat noch ein Übriges, und so musste man bei der Ausführung letztlich ausschließlich auf einheimische Künstler zurückgreifen, wobei man aber aus dieser Not sogleich eine Tugend machte: [...] wir empfinden eine Art stolzer Genugthuung darüber, dass die ‚Stadt der Phäaken‘ das glänzendste all der Feste [,] welche in deutschen Landen den Manen des Unsterblichen gefeiert werden, aus ihrem eigenen Fleisch und Blut erschaffen, mit ihrem eigenen Herzblut nähren wird (Beck: 1872, 389).
Die Idee der Programmgestaltung ging dahin, jede musikalische Gattung in ausgewählten Beispielen zu präsentieren: So wurde am 16. Dezember 1870 Fidelio gegeben, am 17. folgten das Es-Dur-Klavierkonzert op. 73 und die Neunte, am 18. die Missa solemnis, am 19. mittags zunächst Kammermusik und Lieder, am Abend dann Goethes Egmont mit Beethovens Schauspielmusik (Abbildung 1).15 Die drei führenden Wiener Dirigenten Otto Dessoff, Johann Ritter von Herbeck und Joseph Hellmesberger leiteten schließlich die Aufführungen. Die Vorberichterstattung war hymnisch. Einwände, dass angesichts des deutschfranzösischen Krieges eine solche monumentale Feier den Wienern als unmoralische Sorglosigkeit ausgelegt werden könnte, wurden mit dem Hinweis darauf, dass ein solches Fest geradezu die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln sei, abgetan. So schrieb Eduard Schelle in der Presse: Man darf es uns nicht als Frivolität auslegen, wenn wir angesichts des noch immer fortwüthenden Krieges und der großen Zeitfragen diese denkwürdigen Tage durch eine Festfeier hervorheben, denn sie gilt ja nicht einem berühmten Musiker, der zur Unterhaltung der Menschheit eine reichliche Beisteuer geliefert hat, sie gilt vielmehr einem gewaltigen Tondichter, in dessen Gebilden der Deutsche den Herzschlag seiner ureigensten Natur, 14 Bezüglich weiterer Briefstellen siehe Messing: 1991. 15 Das Programm ist abgedruckt bei Landau: 1872, 390f. Exemplare davon finden sich noch im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde (GdM: 1870).
Monumentales Gedächtnis und kulturelle Identitat
45
und diese in reinster, idealster Verklärung wahrnimmt. Da stehen die neun Symphonien, „Fidelio“, die hohe Messe, diese unvergänglichen Denkmale, geschnitten aus dem Kernholz deutschen Geistes und verkündend die Freiheit des deutschen Genius von allen Einflüssen eines fremden Geschmacks oder höfischer Mode. [...] Eine solche mächtige Kraft zeugt zugleich für die Größe und Macht des Volkes, das sie geboren, und der Deutsche ehrt sich nur selbst, wenn er Beethoven als den seinigen feiert; wir Wiener haben aber vor allen Städten die Pflicht, an diesem Gedenktag den Manen des Meisters ein festliches Opfer darzubringen, denn, hat ihm Bonn das Leben gegeben: der Künstler ist auf unserm Boden gewachsen und gereift (Schelle: 1870b, 1).
Anders als durch die euphorische Berichterstattung in der Presse16 und in einigen nachträglichen Darstellungen17 vermittelt wird, ergibt eine genauere Lektüre dieser und weiterer Berichte, dass die Beethovenfeier keineswegs die mit ihr verknüpften Erwartungen erfüllt hat. Zunächst brachte das Fest allein in künstlerischer Hinsicht kein befriedigendes Ergebnis. Dies hing wesentlich mit der oben erwähnten Absage einer Reihe namhafter Künstler zusammen. Eduard Hanslick erklärte diesen Umstand in der Neuen Freien Presse aber auch freundlich-distanziert mit der monumentalen Anlage des Ganzen und dessen Zuspitzung auf die Verehrung eines Musik-Heros: [...] der festliche Apparat erhöht unsere Stimmung, aber er zerstreut unsere Aufmerksamkeit. Zunächst die Äußerlichkeiten: die ungewohnte Beleuchtung, das geputzte Publicum, die Festflaggen und lorbeerbekränzten Büsten, die Prologe und Festspiele. Sodann auch die unleugbare innere Pression, die wir empfinden, indem unsere Gedanken fortwährend nachdrücklich von dem Kunstwerke auf dessen Großen Autor abgelenkt werden. [...] Es ist die erhabenste Zerstreuung, wenn wir bei Beethovens Musik immer wieder an seine Person denken müssen, aber doch eine Zerstreuung (Hanslick: 1870, 1).
16 Über diese Rolle der Presse bei der Feier machte sich das satirische Blatt Der Floh lustig. In der Ausgabe vom 11. Dezember 1870 wird ein Besuch Beethovens bei verschiedenen Wiener Musikkritikern (Ludwig Speidel, Hanslick, Schelle, Beck, Rudolph Hirsch, Wilhelm Frey) imaginiert, der vor allem deren Eitelkeiten aufzeigt. Am Titelblatt erschien übrigens die Karikatur einer Beethoven-Büs te, umringt von aufblickenden Komponisten und Dirigenten (Jacques Offenbach, Johann Herbeck, Franz Liszt, Johann Strauß Sohn, Richard Wagner), im Blattinneren noch eine Spitze gegen das Beethoven-Komitee, das mit der Beethoven-Feier in erster Linie sich selbst zu huldigen wünschte (Anonym: 1870a). 17 Wie etwa jene von Hermann Joseph Landau 1872. Zur Erinnerung an die Feier erschien auch eine Lithografie, in der die Ehrung Beethovens sowie die Huldigung seines Werks in allegorischer Darstellung noch einmal zusammengefasst wurden (Salmen: 1979, 107).
46
Barbara Boisits
Abbildung 1: Das Programm der Wiener Beethoven-Feier 1870
Monumentales Gedächtnis und kulturelle Identitat
47
48
Barbara Boisits
Diese Umstände schienen verschiedentlich auch die ausübenden Künstler zu irritieren, so dass sich die erwarteten Spitzenleistungen keineswegs einstellten.18 Künstlerisch nur wenig befriedigten ferner zwei eigens zu diesem Festanlass geschriebene Werke: ein vom seinerzeit viel gespielten Schriftsteller Salomon Hermann Mosenthal verfasstes szenisches Vorspiel mit Musik aus den Ruinen von Athen am ersten und ein von Josef Weilen gedichteter Prolog am zweiten Tag. In Mosenthals Werk, aufgeführt in der Hofoper vor dem Hauptwerk des Abends (Fidelio), erscheint die Muse der Tonkunst – dargestellt von Charlotte Wolter – im griechischen Gewand und mit einer Lyra in der Hand, um Werk und Komponist zu preisen und seine Büste mit einem Lorbeerkranz zu schmücken.19 In einer hymnischen Beschreibung heißt es (Landau: 1872, 397): [...] mit rauschendem Jubel begrüsst, zeigte sich den Blicken des Publicums die von elektrischem Lichte beleuchtete Kolossalbüste Beethoven’s [...]. Ueber die Büste war ein Strahlenbogen ausgespannt und in goldenen Lettern leuchtete der Name des grossen Meisters. Aus dem Haine traten griechische Jungfrauen, [...] und während sie in feierlicher Weise den Umzug um die Büste hielten, stieg Frl. Wolter die Stufen zum Tempel hinan und drückte unter dem donnernden Jubelrufe des ganzen Hauses den Lorbeer auf die Stirne des Unsterblichen. [...] In diesem feierlichen Momente applaudirte Alles, selbst ernste und strenge Kritiker, die sonst nie ein Zeichen des Beifalles von sich geben, stimmten in den allgemeinen Beifall ein.
Einer von ihnen – Eduard Hanslick – meinte allerdings lakonisch dazu: „Allegorische Festspiele mit einer kranzaufsetzenden Muse als Mittelpunkt sind meistens schon im Keim abgedroschene Gewächse“ (Hanslick: 1870, 1).20 Scharfe Kritik erfuhr auch Weilens am nächsten Tag von Josef Lewinsky gesprochener Festprolog.21 Darin wird unter anderem in folgenden Versen Beethovens Gabe, der Natur ihre „tönenden Räthsel“ zu entlocken, besungen (Abbildung 2):
18 Vgl. Anonym: 1870b, 5 und Nohl: 1871, 89–95. 19 Der Text ist u.a. bei Landau: 1872, 400f. wiedergegeben. 20 Bei Hanslick: 1886, 4 heißt es „verwitterte Gewächse“. Hanslick mag sie als überflüssig angesehen haben, sie waren allerdings in diesem Jubiläumsjahr gang und gäbe, auffallend oft übrigens zur Musik der Ruinen von Athen. Die Dresdener Beethoven-Feier versuchte noch dadurch eine Steigerung zu erzielen, dass der Lorbeerkranz auf dem Schlachtfeld geflochten und von der Muse Polyhymnia anschließend der Büste Beethovens aufgesetzt wurde (Anonym: 1870d, 2f., vgl. auch Buch: 2000, 192). 21 Der Text ist in Anonym: 1870, 2 und bei Landau: 1872, 402–404 wiedergegeben.
Monumentales Gedächtnis und kulturelle Identitat
49
Abbildung 2: Der Festprolog von Josef Weilen zur Wiener Beethoven-Feier 1870
Er hört: wie Farben durcheinander fliessen, Wie Blüthen klingend in die Knospen schiessen, Wie Düfte rieselnd aus den Kelchen steigen, Wie Herzen rhythmisch sich zu Herzen neigen, Wie sich in Klänge kleidet Lust und Qual, Wie Sehnsucht zittert in dem Mondesstrahl, Wie Sterne singend durch einander schweben, Wie Sonnen schallend sich aus Nächten heben, Wie Welten selbst im Feuerhymnus gleiten, Mit Orgeltönen durch Unendlichkeiten! –
Solche Fähigkeit hat natürlich ihren Preis und fordert die Rache der Natur heraus. In Anspielung an Beethovens Taubheit heißt es nämlich weiter:
50
Barbara Boisits
Doch wo er geht folgt ihm das Missgeschick. Als Feind weicht selbst die Luft vor ihm zurück, Trägt keinen Laut mehr an sein lechzend Ohr.
Bissig kommentierte Daniel Spitzer in der Presse solche poetische Kunst und übte gleichzeitig Kritik an den überhöhten Eintrittspreisen: Und obwol das Beethoven-Comité die so wünschenswerthe ungehemmte Circulation im Musikvereinssaale herzustellen bemüht war, indem es durch hohe Preise das Kommen zu erschweren und durch einen Prolog Weilen’s das Gehen zu erleichtern suchte, war der Saal dennoch zum Ersticken überfüllt (Spitzer: 1870, 1).
Die Wahl Weilens und Mosenthals ist wohl aus einer Notlage heraus geschehen. Denn „sowie die heiligen Nothhelfer in Feuer- und Wassernöthen von den nicht assecurirten Angehörigen der katholischen Kirche angerufen werden,“ seien auch „die von Festnöthen heimgesuchten Comité-Mitglieder“ gezwungen gewesen, „zu diesen dichterischen Nothhelfern [...] ihre Zuflucht zu nehmen. Daher rührt es ja, dass der poetische Schnittlauch dieses Dioskurenpaares auf allen Festsuppen zu finden ist [...]“ (Spitzer: 1870, 1). Das abschließende Festbankett bewies, dass auch auf der Ebene politisch-kultureller Repräsentanz die Erwartungen nicht erfüllt werden konnten. Zunächst hatten hohe Preise viele Besucher abgeschreckt, sodass primär nur die geladenen Festgäste übrig blieben (Anonym: 1870e, 2f.). Doch auch von diesen gab es empfindliche Absagen: so etwa des Generalintendanten der kaiserlichen Hoftheater, Graf Rudolf Eugen Wrbna-Freudenthal, und des Obersthofmeisters, Konstantin Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfürst, in allerletzter Minute auch des Bürgermeisters Cajetan Felder. Nach Theodor Helm trug das Arrangement „ein so kleinliches, spießbürgerliches Gepräge, daß sich sofort das Witzwort verbreitete, die Soiree wäre richtiger ‚Beethoven-Festkomiteebankett‘ genannt worden“ (Helm: 1915, 437). Während des Festessens spielte die Kapelle Eduard Strauß, die auch die anschließenden Toasts musikalisch abrundete (Kaiserhymne nach dem Trinkspruch auf den Kaiser, Donauwalzer im Anschluss an den Toast auf die Stadt Wien).22
22 Auch die Trinksprüche entbehrten nicht des Peinlichen, etwa als der russische Staatsrat und Beethoven-Biograf Wilhelm von Lenz (1804–1883) im Bemühen, Beethovens monumentale Größe zu beschreiben, diesen mit einem Elefanten verglich oder Johann Herbeck zu ähnlichem Zweck den Text des Derwisch-Chores aus den Ruinen von Athen zitierte und seine Beethoven-Lobrede mit den Worten schloss: „großer Prophet! Kaaba! Kaaba! Kaaba!“ (Helm: 1915, 438).
Monumentales Gedächtnis und kulturelle Identitat
51
Das bei Weitem nicht so reibungslos abgelaufene Fest verhinderte natürlich nicht, dass es retrospektiv als überaus gelungenes Manifest politischer, speziell deutschnationaler Demonstration gesehen werden konnte. So war sich der Prager Schriftsteller Hermann Joseph Landau sicher, dass „für unsere späteren Geschlechter [...] die ‚Beethovenfeier‘ nicht nur einen Ehrenplatz in der deutschen Kunstgeschichte ausfüllen, sondern auch, und speciell für uns Deutsch-Oesterreicher, ein ehrendes Zeugniss für unsere politische Gesinnung abgeben wird!“ Denn Beethoven’s Schöpfungen [sind] im Grunde nicht weniger Schöpfungen für sein Volk [...], als die Schöpfungen Schiller’s – Schiller’s, des Lieblingsdichters der deutschen Nation! Beet hoven brachte wie Schiller eben so aus bewegtem, überströmendem Herzen seine Gefühle, sein Träumen und Leiden, so echt deutsch zum Ausdruck, wie kein deutscher Componist vor ihm und bis jetzt auch keiner – nach ihm. Mit einem Worte: Beethoven ist der nationaldeutscheste Musiker [...] (Landau: 1872, XI, Hervorhebung original).
Trotz dieser politischen Vereinnahmung ist nicht zu übersehen, dass die als große Leistungsschau sowohl künstlerischer Potenz als auch politischer Demonstration gedachte Feier – beim Bankett wurde sie mit den „olympischen Spielen“ ver glichen23 – ihre Ziele bei Weitem nicht erfüllen konnte: Aus dem großen internationalen Fest wurde ein einheimisches, das noch dazu nicht jene breiten Kreise ansprechen konnte, die man ursprünglich erreichen wollte. Über die mangelnde Popularität der Beethoven-Feier gibt auch eine im Figaro erschienene Karikatur Aufschluss (Anonym: 1870c, 1, Abbildung 3). Diese Abhandlung versteht sich als musikhistorischer Beitrag zur kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung. Gerade an der Wiener Beethovenfeier von 1870 kann die Problematik emphatisch aufgeladener, monumentaler, heroischer Gedächtnisorte analysiert werden. Diese waren sehr oft keineswegs eindeutig kodiert, sondern voller Widersprüche, Ambivalenzen, konkurrierender Sinnzuschreibungen oder konnten sogar schlichtweg scheitern. Es mag für die kulturwissenschaftliche Gedächtnisforschung daher durchaus erhellend sein, auch halb- oder sogar gänzlich misslungene Beispiele kollektiver Symbolgebung zu untersuchen, und es wäre vermutlich ein reizvolles Unterfangen, eine Reihe von Feiern innerhalb der österreichisch-ungarischen Monarchie mit einem solchen dekonstruktivistischen Blick zu betrachten.
23 Toast des Juristen und Direktionsmitgliedes der Gesellschaft, Joseph Unger, auf die Stadt Wien (Landau: 1872, 409).
52
Barbara Boisits
Abbildung 3: Karikatur über die Wiener Beethoven-Feier im Figaro vom 17. Dezember 1870
Monumentales Gedächtnis und kulturelle Identitat
53
Literatur Anonym, Anläßlich der Beethoven-Feier, in: Der Floh, 11. Dezember 1870a, Nr. 50, 200. Anonym, in: Die Presse, Samstag, 17. Dezember 1870b, Beilage zu Nr. 348, 5. Anonym, Karikatur, in: Figaro. Humoristisches Wochenblatt, 17. Dezember 1870c, Nr. 58, 1. Anonym, in: Neue Freie Presse, Abendblatt, 19. Dezember 1870d, 2f. Anonym, Das Beethoven-Festbanket im Musikvereinssaale, in: Die Presse, Abendblatt, Mittwoch, 21. Dezember 1870e, Nr. 352, 2f. Anonym, Activités du Conseil de l’Europe. Rapport du secrétaire général, Europarat, Straßburg 1973. Dr. Beck, Einleitung zur Beethovenfeier, in: Herrmann Josef Landau, Erstes poetisches Beethoven-Album. Zur Erinnerung an den grossen Tondichter und an dessen Säcularfeier, begangen den 17. Dezember 1870, Prag 1872, 388f. August Böhm, Geschichte des Singvereines der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Festschrift zum fünfzigjährigen Singvereins-Jubiläum, Wien 1908. Esteban Buch, La Neuvième de Beethoven – Une histoire politique, Paris 1999, deutsch.: Beethovens Neunte. Eine Biographie, übers. von Silke Hass, Berlin 2000. Esteban Buch, Beethovens Neunte, in: Etienne François und Hagen Schulze (Hrsg.), Deutsche Erinnerungsorte, Bd 3, München 2001, 665–680. Esteban Buch, Parcours et paradoxes de l’hymne européen, in: Luisa Passerini (Hrsg.), Figures d’Europe. Images and Myths of Europe, Brüssel 2003, 87–98. Moritz Csáky (Hrsg.), Orte des Gedächtnisses, 5 Bde, Wien 2000–2002. Moritz Csáky (Hrsg.), Gedächtnis – Erinnerung – Identität, Innsbruck u.a. 2002ff. Felix Czeike, Historisches Lexikon Wien, Bd 1, Wien 1992. Etienne François/Hagen Schulze (Hrsg.), Deutsche Erinnerungsorte, 3 Bde, München 2001. Carl Friedrich Glasenapp, Das Leben Richard Wagners, Bd 4 (1864–1872), Leipzig 1908. Ernst Gottschald, Ein Prophet des Stillstands und zwei Artikel der Allg. musik. Zeitung. Herrn J. Schucht, dem Verf. desselben, von Ernst Gottschald, in: Neue Zeitschrift für Musik, 29. Jg., 23. Dezember 1848, Nr. 51, 293–296 und 26. Dezember 1848, Nr. 52, 298–300. Robert Griepenkerl, Das Musikfest oder die Beethovener, 2. Aufl. Braunschweig 1841. Eduard Hanslick, Die Beethoven-Feier in Wien, in: Neue Freie Presse, Morgenblatt, Donnerstag, 22. Dezember 1870, Nr. 2271, 1–3; wieder abgedruckt in: ders., Concerte, Componisten und Virtuosen der letzten fünfzehn Jahre. 1870–1885. Kritiken, Berlin 1886, 3–6. Theodor Helm, Fünfzig Jahre Wiener Musikleben. Erinnerungen eines Musikkritikers, in: Der Merker 6 (1915), 426–438 und 499–504; wieder abgedruckt in: ders., Fünfzig Jahre Wiener Musikleben (1866–1916). Erinnerungen eines Musikkritikers, hrsg. von Max Schönherr, Wien 1977. Max Kalbeck, Johannes Brahms, Bd 2/2 (1869–1873), 3. Aufl. Berlin 1921. Ludwig Karpath (Hrsg.), Richard Wagner. Briefe an Hans Richter, Berlin, Wien, Leipzig 1924. La Mara (Hrsg.), Briefe hervorragender Zeitgenossen an Franz Liszt, Bd 2 (1855–1881), Leipzig 1895. Herrmann Josef Landau, Erstes poetisches Beethoven-Album. Zur Erinnerung an den grossen Tondichter und an dessen Säcularfeier, begangen den 17. Dezember 1870, Prag 1872.
54
Barbara Boisits
Dezsö Legány, Franz Liszt. Unbekannte Presse und Briefe aus Wien 1822–1886. Vorwort und Anmerkungen ins Deutsche übertragen von Anikó Harmath, [Budapest] 1984. Berthold Litzmann, Clara Schumann. Ein Künstlerleben. Nach Tagebüchern und Briefen, Bd 3, Clara Schumann und ihre Freunde, 2. Aufl. Leipzig 1909. Berthold Litzmann (Hrsg.), Clara Schumann. Johannes Brahms. Briefe aus den Jahren 1853– 1896, Bd 1 (1853–1871), Leipzig 1927. Camille Mauclair, Le bienfait de Beethoven, in: La Semaine littéraire, 29. März 1927. Scott Messing, The Vienna Beethoven Centennial Festival of 1870, in: The Beethoven Newsletter 6/3 (1991), 57–63. Andreas Moser (Hrsg.), Johannes Brahms im Briefwechsel mit Joseph Joachim, Bd 2, 2. Aufl. Berlin 1912. Hans Joachim Moser, Ludwig van Beethoven, in: Stuttgarter Neues Tageblatt, 26. Jänner 1941. Ludwig Nohl, Die Beethoven-Feier und die Kunst der Gegenwart. Eine Erinnerungsgabe, Wien 1871. Pierre Nora (Hrsg.), Les Lieux de mémoire, 7 Bde, Paris 1984–1992. Richard von Perger/Robert Hirschfeld, Geschichte der k.k. Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, Wien 1912. Edgar Quinet, Ce que dit la musique, Paris 1893. René Radius, Rapport sur un hymne européen, in: Assemblée consultative du Conseil de l’Europe, 10. Juni 1971, Dokument 2978, Archive des Europarats. Walter Salmen, Bilder zur Geschichte der Musik in Österreich, Innsbruck 1979 (Innsbrucker Beiträge zur Musikwissenschaft, 3). Hans Werner Scheidl, Die Europahymne. Ein Lied geht um die Welt, in: Die Presse, Samstag, 7. Februar 2004, 8. E[duard] Schelle, Das Musikantenthum in der Musik, in: Die Presse, Dienstag, 19. Juli 1870a, Nr. 197, 1. E[duard] Schelle, Zur Beethoven-Feier, in: Die Presse, Mittwoch, 14. Dezember 1870b, Nr. 345, 1f. Anton Schindler, Biographie von Ludwig van Beethoven, 4. Aufl. Münster 1871. Heribert Schröder, Beethoven im Dritten Reich. Eine Materialsammlung, in: Helmut Loos (Hrsg.), Beethoven und die Nachwelt. Materialien zur Wirkungsgeschichte, Bonn 1986, 187–221. Daniel Spitzer, in: Die Presse, Sonntag, 18. Dezember 1870, Nr. 349, 1. Cosima Wagner, Die Tagebücher, Bd 1 (1969–1877), hrsg. von Martin Gregor-Dellin und Dietrich Mack, München, Zürich 1976. Richard Wagner, Beethoven [1870], in: ders., Gesammelte Schriften und Dichtungen, Bd 9, Leipzig 1873, 77–151.
Archivalien der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien (GdM): Stenographisches Protokoll über die am 19. Dezember abgehaltene Generalversammlung der Gesellschaft der Musikfreunde (Exhibit Nr. 171/1868). Erinnerungen an die Beethovenfeyer am 17. 18. 19 Dezember 1870 (Sign. 100.500/48) Stenografisches Protokoll der Generalversammlung der Gesellschaft der Musikfreunde am 31. Jänner 1871 (Exhibit Nr. 26/15.2.1871)
Cakewalk contra Walzer
55
James Deaville Cakewalk contra Walzer: Negotiating Modernity and Identity on Jahrhundertwende Vienna’s Dance Floors1
In early March of 1903, a group of African-American entertainers called the Seven Florida Creole Girls introduced the cakewalk to Vienna. Upon arrival, the cakewalk encountered the waltz, that quintessentially Viennese dance and, more broadly speaking, representative of traditional Austrian cultural values. For the next five years, they would vie for the feet, ears and hearts of the public, with the cakewalk standing next to the waltz for this brief time. However, the waltz had already had to defend its position from a “foreign” dance, the Hungarian csárdás, which had entered Austrian cultural space during the course of the nineteenth century, before the Austro-Hungarian Empire took its definitive shape in 1867 (Sárosi: 1977). Thus Vienna became a nexus for the meeting of dances from West and East, and it was there that the cakewalk and csárdás were first regarded as kindred dance types, their duple meter, syncopations and untamed, inelegant character in stark contrast to the typically elegant, triplemeter, waltz. As we shall see, this contact between cakewalk and waltz reflected the debate over cultural values in Vienna at the Jahrhundertwende, as modernism was making ever greater inroads into central European society. I believe we have here the space where cultures meet, in the sense of Mary Louise Pratt’s “contact zone” and Homi Bhabha’s “third space”, both essentially mobile zones of interaction that are marked by hybridity (Pratt: 1992, 6–7; Bhabba: 1994, 208–209). For the cakewalk and waltz, we will see how Vienna and its particular “brand” of Modernism serves as the intracultural nexus. In particular, this study will investigate what it meant 1 I wish to thank the various scholars who have given valuable assistance to this project, most notably Prof. Michael Saffle (Virginia Tech) and Dr. Ingeborg Harer (Universität für Musik und darstellende Kunst Graz). Comments by Philip Bohlman (University of Chicago) have been most helpful. I also acknowledge the generous support of the Arts Research Board of McMaster University. Any scholar working on the topic of African-American entertainers in Europe would be remiss not to recognize the contributions of Rainer Lotz, whose painstaking research and encyclopaedic knowledge inform his numerous publications, which have been drawn together in Bonn: 1997. In the present article, all translations from the German are by the author. On the same topic see Deaville: 2002.
56
James Deaville
for the cakewalk to be labelled a “modern” dance and for the Viennese thus to be experiencing “modernism” in their bodies when they danced it. Before we examine the cakewalk in an Austrian milieu, we should consider its origins and character. The dance originated in the American South of the 1850s as the chalk line walk, but by 1889 it had stabilized into the dance form cultivated for the next 30 years.2 It featured a couple promenading in an excessively dignified manner, high stepping and kicking, mimicking high society, whereby they enacted an inversion ritual, in the words of Victor Turner (Turner/Turner: 1982). Along the way, the cakewalk had acquired special movements (bending back of the body and the dropping of the hands at the wrists) that authorities have traced back to African dance.3 (Ironically, blackface minstrels of the late nineteenth century themselves parodied the cakewalk in their walkabouts!) With parody at the core of the cakewalk, there was precious little in the dance that was regular, graceful, or even natural, at least in comparison with the waltz. This applies to the music as well, which accompanied the irregular steps through its prominent syncopations. Above all, the movements and music of the cakewalk seemed nervous to its Viennese audiences and participants, which made it a quintessentially modern dance.4 The cakewalk appeared in Vienna at a critical time in Austrian history when, under pressure from its increasingly nationalistic East Central European constituent political entities, the Habsburg Empire was trying to uphold reforms, enacted in 1867, which sought for it to evolve into a federation with equal rights for all nationalities. As established in the monarchy’s own propaganda, the official policy of the Habsburgs was to maintain a pluralistic state, to cultivate tolerance toward other peoples. Given the multi-cultural climate of the Habsburg empire (which gradually fell apart by 1914), it is no coincidence that cultural historian Peter Stachel should identify the origins of contemporary sociology in the “context of the ethnic-cultural pluralism [...] within the Vielvölkerstaat in the last decades of the 2 The literature about the cakewalk remains quite limited for a variety of reasons, including its musical simplicity in comparison with the successors ragtime and jazz and its embodied performance (dance music has traditionally occupied a problematic position within the canons of Western music). Moreover, the racially problematic titles, images and texts associated with the cakewalk have undoubtedly discouraged musicologists from dealing with this repertory. Abbott/Seroff: 2002 provides numerous press sources that document the practice of cakewalk performance in the United States during the early 1990s. 3 Thus the StreetSwing’s Dance History Archives notes the gestural similarities between the cakewalk and dances of certain tribes of the African Kaffir, see “Cakewalk,” StreetSwing’s Dance History Archives . 4 The connection between modernism and nervousness is well established by Knittel: 1995. See also Worbs: 1983.
Cakewalk contra Walzer
57
19th century.”5 And it should also not be surprising that Viennese Modernism, as an internationalist movement that stressed tolerance of otherness and difference, would emerge against this social and cultural backdrop. The official policy did encounter resistance, as evidenced by the riots following the Badeni Language Act of 1897, which had authorized the use of the Czech language in certain official capacities within that region of the Empire. A small number of Pan-Germans in Austria also opposed the introduction of Hungarian culture, whereby tensions between constituent nationalities within Austro-Hungary played themselves out on the dance floor. Thus in 1900, a group of upper-class German nationalists in the Wiener aristokratische Gesellschaft caused a scene at a dance, where the Hungarian csárdás and Austrian waltz came into collision as they stood for their respective national cultures: At a “picnic” of the Wiener aristokratische Gesellschaft in the Hotel Metropole... Several Hungarian members and guests of the society had invited a gypsy band from Budapest to attend the ball and Count Peter Szechenyi, who served as lead dancer, had also put a Csardas onto the programme [...]. The first notes of the Csardas had barely sounded when the Wiener aristokratische Gesellschaft began to make noise and boo, and booed down the gypsy band, whereupon the gypsies halted their music, the dancers stopped dancing and the Viennese band intoned a waltz [...].6
This response was not typical of the Viennese attitude toward the csárdás, which had become such an accepted feature of the city’s musical life that it made regular appearances in operettas. The csárdás co-existed with the waltz, although the latter was the dance of choice in purely Viennese contexts. Then the cakewalk – possibly the first African-American dance to be imported into Europe – arrived in early March of 1903, evoking the following enthusiastic review from the Illustrirtes Wiener Extrablatt about a performance of the Seven Florida Creole Girls at Ronacher’s Establishment: “Everyone wants to see the cakewalk, moreover performed by those who have brought it over from its southern home in Florida with all of its native Drastik.”7 5 “I[m] ... Kontext des ethnisch-kulturellen Pluralismus [...] innerhalb des Vielvölkerstaates in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts.” (Stachel: 2001, 199). 6 “Bei einem Picknick der Wiener aristokratischen Gesellschaft im ‘Hotel Metropole’ [...]. Mehrere ungarische Mitglieder und Gäste der Gesellschaft hatten aus Budapest eine Zigeunerkapelle zu dem Balle kommen lassen und Graf Peter Szechenyi, der als Vortänzer fungirte, hatte auch einen Csardas in die Tanzordnung aufgenommen [...]. Kaum waren die ersten Klänge des Csardas ertönt, als die Wiener aristokratische Gesellschaft zu lärmen und zu zischen begann und die Zigeunerbande niederzischte, worauf die Zigeuner die Musik abbrachen und die Tänzer zu tanzen aufhörten und die Wiener Kapelle einen Walzer intonirte.” (Illustrirtes Wiener Extrablatt: 1900, 5). 7 “Jeder will den Cake Walk sehen und von obendrein von Jenen, die ihn mit all’ seiner urwüchsigen
58
James Deaville
The 1903 Austrian sheet music publication of one of the most popular cakewalks in Vienna, Die lustigen Neger by Webster, likewise makes a case for the sensation it created: “[it has] found entry into the most fashionable salons”; “young and old learn the cakewalk with ardour and every dance instructor has adopted it in his instruction”; “the success of the new dance cakewalk grows from day to day; it is already danced everywhere.”8 In attempting to position this new dance and music within their sphere of knowledge, reviewers were quick to pick up on its affinity with the csárdás and its distinction from the traditional three-step waltz. The most important comparative discussion dates from February 22, 1903 and appeared in the Wiener FrauenZeitung – the anonymous article significantly calls it the “Cake-Walzer” and brings the cakewalk into connection with both the csárdás and the waltz: It is a two-step dance, similar to the csardas, and is easy to bring into combination with the two-step waltz. It permits total freedom of movement and when performed by good dancers, it proves to be quite diverting.9
The association of the cakewalk with the csárdás is interesting, since both dances can be considered to be the folk heritage of peoples who were the victims of marginalization and repression. Musically speaking, there is a clear affinity between who made the links, in associating the imported cakewalk with a dance form that would have been familiar to the readers. And probably not coincidentally, after these duple-meter dances: the cakewalk prominently features syncopation and the csárdás utilizes a snap figure that can be heard as a type of syncopation. To our eyes and ears, the similarities may seem strained, yet it was commentators of the period who made the links, by associating the imported cakewalk with a dance form that would have been familiar to the readers. And probably not coincidentally, after performances of The 7 Florida Creole Girls, Ronacher offered the tired dancers Zigeunermusik (at 5 a.m.).
Drastik aus seiner südlichen Heimat in Florida herübergebracht haben.” (Illustrirtes Wiener Extra blatt: 1903). 8 “Ein neuer Tanz! Der ‘Cake-Walk’ (Kuchen-Tanz). Die Sensation der Pariser und Londoner Bälle [...] Jung und Alt lernst nun den ‘Cake-Walk’ mit Feuereifer und jeder Tanzmeister hat ihn in sein Programm aufgenommen [...]. Der Erfolg des neuen Tanzes ‘Cake-Walk’ wächst von Tag zu Tag. Man tanzt ihn bereits überall.” (Webster, 1903). 9 “Es ist ein Zweitritttanz, ähnlich dem Csardas, und leicht in Kombination zu bringen mit dem Zweitrittwalzer. Er gestattet vollkommene Bewegungsfreiheit und gestaltet sich daher, von guten Tänzern ausgeführt, sehr abwechslungsreich.” (Neues Wiener Tagblatt: 1903b).
Cakewalk contra Walzer
Illustration 1: Promotion for the Cakewalk, Published with “Die lustigen Neger” by Webster (Wien: Josef Weinberger, 1903).
59
60
James Deaville
Still, it was in the context of the traditional Wiener Walzer that the cakewalk was perceived as competing for the feet and the ears of the Viennese. A closer look at the dance steps and the music makes this clear. Those of us who are at all familiar with late nineteenth- or early twentieth-century sheet music in the United States have undoubtedly encountered illustrations of black Americans dancing the cakewalk. Even though white Americans also danced the cakewalk, their images could not sell copies of the sheet music – after all, the dance was supposed to have originated in a parody of white plantation culture. Turning to central Europe, perhaps the most interesting feature of the 1903 Austrian re-publication of Webster’s cakewalk, Die lustigen Neger, is the title illustration (Illustration 2) which, in this German-language version, features a high-classed, elegantly dressed white couple dancing the cakewalk in front of a distinguished social circle. The illustration makes clear the unusual, unnatural body position of the dancers10 – no wonder it is called “grotesque” in several sources. The dance instructions on the last page of the music reveal the publisher’s intention to capitalize on the genre’s popularity by making the sheet music a necessary commodity, even for those who cannot read music.11 Is it possible that the Viennese were experiencing modernism in their bodies for the first time through this Ur-American, nervous, unnatural and hence subversive dance of the decidedly modern “Neger”? The music likewise participates in this discourse of otherness surrounding the cakewalk, with its irregular rhythms that so clearly contrast with the smooth line of the waltz. The characteristic rhythm of short-long-short – that which enables us to identify a piece of music as a cakewalk – is simple, and tends to fall into a pattern 10 Philip Bohlman has observed, in personal communication, how the body and hand positions of cakewalk dancers in illustrations resemble those of Jews in representations from Europe of the late nineteenth century. In fact, Jews of the period were also portrayed as dark in skin coloration. The connections between these racial representations in central Europe of the period merit closer study. 11 “Description of the Dance [... ]. The main requirements are: 1) to bend the body decidedly backwards, 2) to keep both arms horizontally extended, 3) to lift the knees very high with each step and to swing the legs forwards [...]. Figure 1 (with illustration). The gentleman and lady, one next to the other, dance with their bodies bent backwards and their arms extended forwards while they keep their knees as high as possible. This is the rule that is to be maintained for all of the other figures as well.” “Beschreibung des Tanzes [...]. Die Hauptbedingungen sind: 1. Den Körper sehr stark zurückbeugen. 2. Die beiden Arme horizontal ausgestreckt halten. 3. Die Knie bei jedem Schritt sehr hochheben und die Beine nach vorwärts schwingen... Figur 1. (Mit Abbildung). Der Herr und die Dame, einer neben dem anderen, den Körper zurückgebeugt, die Arme nach vorn ausgestreckt, tanzen, indem sie die Knie so hoch wie möglich haben. Dies ist die Regel, welche auch für alle anderen Figuren festzuhalten ist [...].”
Cakewalk contra Walzer
Illustration 2: Title Page for “Die lustigen Neger” by Webster (Wien: Josef Weinberger, 1903)
61
62
James Deaville
of 2/4 measures, with syncopated measures alternating with regular measures. Towards the middle of a section, that pattern may disappear for a few measures, with one more measure of syncopation just before the cadence. (Syncopations normally do not figure in the contrasting B and C sections). The prominence of the syncopations means that the cakewalk lacks the smoothness and elegance of the waltz. In fact, the irregularity and angularity of line anticipate the melodic and rhythmic vitality of ragtime and other jazz forms. Given the familiarity of the waltz, it should not be necessary to rehearse the features of the traditional Viennese waltz here, and the differences with the cakewalk have already been mentioned. We should note that the cakewalk normally fell into an ABACB form, which contrasted with the Introduction – ABA – Coda form of the classical waltz, even though by 1900 waltzes tended to be grouped into larger structures. Before dismissing the relative simplicity of the cakewalk in comparison with the complexity of its successor the ragtime, we should keep in mind that this dance is the first jazz (or pre-jazz) that Europeans heard, and the novel, modern-sounding syncopations may well have significantly contributed to the enthusiasm with which it was received. Not all Austrian voices welcomed the arrival of the cakewalk or other manifestations of black American culture. One particularly illuminating commentary from a 1903 feuilleton entitled “Aus guter Gesellschaft” reflects how more conservative tastes responded to the cakewalk sensation: Suddenly the united snobs of the continent take this Variété dance from a race, with whose movements and feelings they do not have the least experience, and you can no longer attend a party without experiencing timid attempts to be ungraceful [...]. You discover respectable men in the middle of clever exercises in their studies, frisking about with bent-in legs, shaking knees and bent elbows. But nothing will help here.12
The author dismisses the dance as the work of an inferior race, and implies that good Austrians should know better. This commentator may not have liked the cakewalk, but he leaves no doubt regarding the dance’s overwhelming popularity. The unspoken sub-text here is the cakewalk’s threat to the traditional cultural values represented by a dance like the waltz. The vehemence of the opposition to 12 “Plötzlich nehmen die vereinigten Snobs des Kontinents diesen Tanz, mit dem sie der Rasse, den Bewegungen und Stimmungen nach nicht das geringste zu tun haben, vom Variété, und man kann in keine Gesellschaft gehen, ohne schüchterne Versuche, im Cake-Walk ungraziös zu sein, mitzuerleben” (Illustrirtes Wiener Extrablatt: 1903).
Cakewalk contra Walzer
63
the cakewalk must be seen in the larger context of the aforementioned attempts to maintain a homogenous Austrian identity. We do not need to rely exclusively on the hyperbolic comments of reviewers to establish how the cakewalk challenged the supremacy of the waltz as the dance of choice for the Viennese, and how it was accepted into the mainstream of Viennese popular music next to the waltz. Apart from observed performances in the variety theatres and personal experiences on the dance floor, the construction of the third space took place on the operetta stage, which traditionally featured the popular dances as insertions (in German, “Einlagen”) (Csáky: 1998). Indeed, it was most evident in the operetta that the csárdás remained a powerful cultural force within Vienna after the dissolution of the Austro-Hungarian Empire in 1918. In fact, one could argue that the heyday of the csárdás first came after the outbreak of the war, with the immensely popular operettas of Imre Kálmán Die Csárdásfürstin (1915) and Gräfin Mariza (1924) that prominently featured the csárdás. The cakewalk almost immediately acquired an important role as insertion within operetta in early 1903, but unlike the csárdás, its period of heightened popularity in Viennese operetta lasted only until about 1908. This underlines a decisive difference between the two dances as Other to the waltz: while the csárdás served as a familiar marker of diversity within the dual monarchy, and thus it naturally cropped up as an exoticizing element within Hungarian-flavoured operettas, the cakewalk was foreign to the milieu of the operetta and thus its use therein made its Otherness all the more apparent. Still, given the pluralistic nature of AustroHungarian culture, we must consider the operetta as a major contact zone for the dances from the Old and New Worlds. Turning to specific works, the African-American operetta In Dahomey, premiered in London in May of 1903, at first did not feature a cakewalk, but later had to incorporate one because of popular demand.13 And in the world of Viennese operetta, Franz Léhar’s Der Rastelbinder and Wiener Frauen (1903) and Die lustige Witwe (1905) and Jean Gilbert’s Der Prinzregent (1903) (among others) featured cakewalks. One of the most interesting examples was the cakewalk in the very popular Viennese operetta Frühlingsluft from 1903, which Ernst Reiterer based on themes by Josef Strauss. The cakewalk is strategically placed towards the end of the third and final act, which leads directly to the closing ballet. The music itself is not pretentious (Illustration 3), yet in a slightly later piano score of the operetta the familiar music from the cakewalk has become the first theme of the overture. The illustration used for the individual publication of the cakewalk from Frühlingsluft 13 For a discussion of In Dahomey and its use of the cakewalk, see Cook: 1996. See also
Green: 1983.
64
James Deaville
Illustration 3: Ernst Reiterer, “Cakewalk” from Frühlingsluft (Wien: Ludwig Doblinger, 1903)
Cakewalk contra Walzer
Illustration 4: Ernst Reiterer, Title Page from Frühlingsluft (Wien: Ludwig Doblinger, 1903)
65
66
James Deaville
(Illustration 4) appears in no other sheet music for the operetta and may involve a cakewalk step: significantly, these characters are white, in Viennese Tracht, which again reflects the assimilation of the dance into Viennese culture. The cakewalk’s temporary pre-eminence over other forms of entertainment in Vienna is seen even in the relative type-size in advertisements, for example in the Neues Wiener Tagblatt of 15 February 1903, where the words “Cake-Walk” dwarf the reference to Léhar’s latest operetta hit Der Rastelbinder (Illustration 5).
Illustration 5: Advertisement for Cakewalk Music, Neues Wiener Tagblatt, No. 45 (15 February 1903), p. 53.
Perhaps the best summation of the relative positions of cakewalk and waltz in Viennese society in 1903 is ironically provided in a source from Berlin.14 The closing song to the Posse Cakewalk in Berlin from February 1903 ends with the words “Cakewalk, der Zukunftstanz”, which we could consider prophetic, given the coming jazz craze. Here is the text:15
14 The one-act work, dating from late February 1903, is by Leopold Ely and is preserved in
the censorship files of the Berlin Landesmuseum, 648.
15 The text is not of high quality, and some of the grammatical constructions are colloquial,
inaccurate or incomplete, all of which would suit the quasi-improvised, popular theatrical entertainment called Posse.
Cakewalk contra Walzer
Schlussgesang Cakewalk der heute Alle erfreute Kam aus der Ferne Und jetzt moderne Cakewalk, Geschwofe Ritter und Zofe Selbst schon am Hofe Cakewalk man tanzt Geht man zum Balle Rufen jetzt Alle Walzer ist schöne Polka ist bene Aber das Beste Sagen die Gäste Fest auf die Weste Cakewalk, der Zukunftstanz.
67
Closing Song The cakewalk, which delights Everyone today Came to us from afar And is now modern, Cakewalk, high stepping, Gentleman and servant And even at court, You dance the cakewalk. If you go to the ball Everyone will cry out, The waltz is beautiful The polka is good, But the guests Say that the best, Grab your vest, Is the cakewalk, The dance of the future.
In that short poem, the cakewalk is similarly called “modern”, distinguishing it from the waltz that is merely “schön”, which undeniably positions the dance squarely within the leading cultural movement of the day. In fact, I would argue that through their appreciation of African-American culture through the blacks and their cakewalk, the Viennese were enacting their “brand” of modernism, with its internationalism, openness to difference, and emphasis on the Other. By labelling the cakewalk itself a “modern” dance and by dancing it, they were experiencing “modernism” in their bodies, which musically and physically prepared the Viennese for the next waves of “modern” American imports, first ragtime and then jazz. Here we have a specific historical example of a space where cultures met, to the advantage of both.
68
James Deaville
Bibliography Lynn Abbott/Doug Seroff, Out of Sight: The Rise of African American Popular Music, 1889– 1895, Jackson 2002. Anonymous, Walzer contra Csardas, in: Illustrirtes Wiener Extrablatt, 2. März 1900, Nr. 59, 5. Anonymous, Etablissement Ronacher, in: Illustrirtes Wiener Extrablatt, 15. März 1903, Nr. 73, 20. Anonymous, Mode und Gesellschaft: Neue Tänze und Gesellschaftspiele, in: Wiener FrauenZeitung, in: Neues Wiener Tagblatt, 22. Februar 1903a, Nr. 52, 28. Anonymous, Feuilleton: Aus guter Gesellschaft, in: Neues Wiener Tagblatt, 13. März 1903b, Nr. 71, 2. Homi K. Bhabba, The Location of Culture, London 1994. Cakewalk, StreetSwing’s Dance History Archives www.streetswing.com/histmain/z3cake1.htm Will Marion Cook, The Music and Scripts of ‘In Dahomey’, ed. by Tom Riis, Madison 1996. Moritz Csáky, Ideologie der Operette und Wiener Moderne: Ein kunsthistorischer Essay, second edition, Wien 1998. James Deaville, Cakewalk in Waltz Time? African-American Music in Jahrhundertwende Vienna, in: Susan Ingram/Markus Reisenleitner/Cornelia Szabó-Knotik (eds.), Reverberations: Representations of Modernity, Tradition and Cultural Value in/between Central Europe and North America, Frankfurt a. M. 2002, 17–39. Jeffrey P. Green, ‘In Dahomey’ in London in 1903, in: The Black Perspective in Music 11 (1983), 22–40. Kay Knittel, ‘Ein hypermoderner Dirigent’: Mahler and Anti-Semitism in fin-de-Siècle Vienna, in: 19th Century Music 18/3 (1995), 256–276. Rainer Lotz, Black People: Entertainers of African Descent in Europe, and Germany, Bonn 1997. Mary Louise Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, London 1992. Bálint Sárosi, Zigeunermusik, Budapest 1977. Peter Stachel, Mehrsprachige, Fremde, Marginal Men: Zur transatlantischen Geschichte eines Forschungsansatzes, in: Susan Ingram/Markus Reisenleitner/Cornelia Szabó-Knotik (eds.), Identität – Kultur – Raum: Kulturelle Praktiken und die Ausbildung von Imagined Communities in Nordamerika und Zentraleuropa, Wien 2001, 199–221. Victor Turner/Edith Turner, Religious Celebrations, in: Victor Turner (ed.): Celebration: Studies in Festivity and Ritual, Washington DC 1982, 201–211. Harry Webster, Die lustigen Neger, Wien 1903. Michael Worbs, Nervenkunst: Literatur und Psychoanalyse im Wien der Jahrhundertwende, Frankfurt a. M. 1983.
The Politics of Distance in Mahler’s Musical Landscape
69
Peter Franklin The Politics of Distance in Mahler’s Musical Landscape
In Musical Meaning. Towards a Cultural History, Lawrence Kramer speaks of music as evoking a “sense of immediacy … like bodily self-presence”. Music, he says, “collapses the sense of distance associated with visuality, and more broadly with the whole field of concepts, images and words” (Kramer: 2002, 3). That potentially regressive removal from concepts and images nevertheless leads him to modify his theoretical account by accommodating aspects of music’s cultural reception as a metaphorical “sounding manifestation of life”. He invokes the rhetorical device of ekphrasis: …the literary representation of a pictorial representation; its aim is the ancient one of making the mind’s eye see, though what is seen is not a reality but a picture (Kramer: 2002, 3).
I want to propose that Mahler’s music might be used to elucidate Kramer’s interest in this device in a rather particular way, inviting a hermeneutic response in which conceptual and, indeed, political implications are always implicated (Richard Leppert’s book The Sight of Sound. Music, Representation and the History of the Body has been a source of inspiration here). Let me begin with a well-known opening – that of the First Symphony. An early-established tradition, fuelled by occasional comments and notes by Mahler, interpreted this as tone-painting, an evocation of “Nature”.1 In 1888 that located him in the Lisztian camp of New German School programmaticism – he originally called the work a “Symphonic Poem in Two Parts”. Later he would emphasize the symphonic over the poetic aspect of his works, as if wanting us to reinterpret that opening in terms of symphonic models for slow introductions, with or without emblematic evocations of sounds of nature (like birdsong). From that perspective, cuckoos, hunting horns and suggestions of rustic good humour might be no more than self-indulgent bolt-on extras that are neither here nor there when we are seeking to grasp the true mettle of Mahler as a “symphonist”. 1 While the “Titan” title and programmatic movement descriptions were only attached to the work from its second performance (Hamburg 1893), one Budapest critic of the first performance in November 1889 described the first movement as “a country-idyll, with forest murmurs …” (Roman: 1991, 80).
70
Peter Franklin
“Perspective” is nevertheless a provocative term here since it is integral to the musical experience: Mahler’s introduction first suggests and then actualizes a spatial reading of the arpeggiated triplet figures of the pianissimo clarinets from bar 9, as louder music heard from a distance. The romantic topic the music has always been taken to present would have us hear them as mimicking distant hunting horns – something that Mahler himself takes a striking stage further when, shortly after Cue 1 and just over ten bars later, he requires two trumpets, playing similar fanfares (now ppp!) to be placed “In sehr weiter Entfernung”. The discreet metaphor is now confirmed by bold enactment – these really are distant trumpets, suggesting the functional music of power, wealth, or organized society. Are they hunting or sounding the call to some princely festivity? Either way they heighten the “otherness” of the on-stage music, whose sustained string harmonics and foregrounded birdsong, suggests an idealized space for solitary spiritual and emotional contemplation at a remove from the material bustle, ceremony and/or “purposefulness” of those distant calls to hunt, to arms, or to celebration. We have, of course, become used to this music; grown accustomed to its historicallyconstrued face as one that reflects or even stands for “Nature” (it is even labelled “Wie ein Naturlaut” in the score). What is extraordinary about Mahler is that he seems to anticipate and welcome interpretative licence of a more sophisticated kind. This runs contrary to the anti-programmatic discourse of autonomy that he later indulged in. Encouraging such interpretative licence, he foregrounds its ramifications in demonstrably and yet quirkily “musical” ways – as here in the stressing of the clarinets’ possibly trivial mimesis by the diegetic enactment of the very effect they had conjured: that of distant fanfares. We could, of course, locate the origins of such effects in the opera-house; the Beethovenian, Wagnerian and even Verdian precedents were themselves all potent sites of musical meaning, linked to the particular kind of socio-cultural representation that I am interested in here. Those composers’ evocations of power and the facticity of the material world, be it liberating (the Fidelio trumpet) or terrible (the distant snatch of “La donna è mobile” towards the end of Rigoletto Act III) is nowhere more theatrically emphasized in Mahler than in the “Grosser Appell” episode of the Second Symphony’s Finale.2 The experiencing Subject, situated in the auditorium, is once again shadowed, provoked and defined by sounds of off-stage power: “summoning” fanfares and the rumbling timpani of thunder or the ancient terror-tactics of battle, starkly contrasted to the fragile on-stage music of improvisatory birdsong. That opposition
2 For this and subsequent references to Mahler’s internal titles and programmatic explanation of the last movement of the Second Symphony, see Mahler, Alma: 1991, 213f.
The Politics of Distance in Mahler’s Musical Landscape
71
was interpreted by a programmatic gloss that cast the off-stage music as the Last Trump, sounding from an apocalyptic, 360-degree au-delà (stage left and right, the latter louder); the on-stage music gathers to itself all the romantic tropes of unempowered, anti-materialist spirit: the “nightingale” standing for Nature, Being, the naive “eternal present” (as Schopenhauer had put it) of the animal kingdom.3 Far from being naive itself, in any pejorative sense, that programme is further re-interpreted or glossed by the musical experience it characterizes. Culturally approved religious myth, allied as always to worldly power and worldly terror, remains distant; it is what is transcended by the so-called “resurrection” chorale. If we attend carefully to Mahler’s descriptive words (written, ironically, for the King of Saxony), it effects a reversal of the standard apocalyptic eschatology. There are no judged, and no Judge, Mahler tells us. Redemption comes from within: from the shared realization that we “know and are” (Bauer-Lechner: 1980, 44; Mahler, Alma: 1991, 214). Innocent on-stage “spirit” has banished off-stage power to a realm of hocus-pocus theatricality. I shall return to the radical and always implicitly political implications of Mahler’s deployment of off-stage instrumentation in his earlier works. The value of the device as a critical indicator of Mahler’s musical political development is further revealed, however, when we consider its use in the Third Symphony – outwardly one of his boldest and most radical. The internal contradictions of the Third signal contradictions in Mahler’s own socio-cultural alignment, as he prepared to convert to Catholicism and become the director of the Austro-Hungarian Empire’s most cherished court opera house.4 Oddest of all, perhaps, is the huge (and last composed) first movement’s deployment of a tattoo of off-stage side-drums before its programmatically redundant recapitulation.5 At no other point in the movement are off-stage instruments called for; their use suggests almost a trivialization of what had been a provocatively rich and potent source of meaning in the earlier symphonies. We are already so used to the vernacular deployment of marching-band effects and instrumentation in the working-out of the military metaphor of the ‘battle’ between Summer and Winter, that the off-stage drums add little beyond evoking a circus “ring-master” effect, as if modified for the proscenium-stage: preludial drums “in the wings” reinforce the 3 The “nightingale”, in Mahler’s programme (see Note 2) is described as “a last tremulous echo of earthly life”; Schopenhauer’s phrase “ewiger Jetztzeit”, as applied to the world of animals, was to be alluded to in a early title-plan for Mahler’s Fourth Symphony, see Bekker: 1921/1969, 145. 4 On Mahler’s conversion, and the politics thereof, see de La Grange: 1974, 411. 5 Donald Mitchell has also questioned the musical wisdom of this recapitulation in Mitchell: 1975, 207. 6 Mahler added many internal headings and annotations in his 1896 manuscript of the Third Symphony; the opening horn theme is headed “Der Weckruf!”. See Franklin: 1991, 48f.; 92–99.
72
Peter Franklin
almost parodic theatricality of the “Weckruf ” theme’s return as a character, costumed and made up like a grandiloquent pantomime General.6 In contrast, the earlier-composed third movement – originally entitled “Was mir die Thiere im Walde erzählen” – employs a posthorn in a manner that is more like the off-stage instruments in the First and Second symphonies in the implicit meaning of its eventual separation from the main orchestra. Innumerable signs, signals and birdsong allusions, along with its origins in the early Wunderhorn setting Ablösung im Sommer, link the on-stage Scherzo material with the naive world of animals, just as that of the Second’s Scherzo had originated in a comic evocation of anthropomorphic fish. Here, however, the separation from the human world of the partially and self-protectively conscious animals of the Third is stressed in a variety of ways that are focussed and summarized in the posthorn episode. It may have been inspired by a Lenau poem in which a mail-coach stops so that its postillion can sound a sad, fond serenade to his friend who lies buried on a nearby hillside (Franklin: 1991, 63–4; Solvik: 1997, 345–58). “Man” certainly represents threatening power to the nervously listening animals, but the sympathy of the movement’s implied subject is split. Rather than power being vanquished by idealized spirit, to which the natural world of the animals was linked (as in the Finale of the Second), here it is the animals who are to be rendered subjectively obsolete as carriers of consciousness or “spirit”, by Man (as implicitly in the Scherzo of the Second). The possibly regressive moment of this evolutionary “Ablösung” is refracted in the Third’s wider reinterpretation of power in the guise of divinity. Mahler’s double or split investment of expressive sympathy here is fascinating. The anthropomorphic fish of the Second Symphony’s St Anthony of Padua Scherzo7 were presented as materially-obsessed caricatures of the sentient life which the lyrical Trio melody of St Anthony’s sermon sought to transcend. In the Third, the elaborate on-stage presence of the animals’ world, with its sentimental cartoon-creatures, nervously twittering birds and so on, is worked with such loving care and attention to detail that it seems more fully to evoke the Nature pictured by Romanticism: a site of freedom, innocence, youthful hope and vulnerability – albeit with some anarchic violence thrown in. Schiller’s “naive” and “sentimental” modes are thus dually engaged, with the sentimental posthorn player (sentimental perhaps in both Schiller’s and our senses) awakening an unnecessary “panic” fear in the animals, yet being presented as touchingly sympathetic and un-threatening to us. Thomas Peattie has noted that the player starts “as if from a far distance” but later is directed
7 The Scherzo of Symphony no.2 is an expanded orchestral version of Mahler’s setting of the poem Des Antonius von Padua Fischpredigt from Des Knaben Wunderhorn.
The Politics of Distance in Mahler’s Musical Landscape
73
to be in the distance (Peattie, 2002, 190–91). His threat, by then, is so far removed as to make the apocalyptically corybantic collapse of the animals’ world more tragic than comic, an act of ideologically necessitated imaginative violence in the wake of which the singing spirit of the Nietzschean Mensch will begin its painful ascent to the heights of power and glory with which the Adagio, and the symphony, will end. *** The Fourth and Fifth Symphonies dispense with any significant separation of onand off-stage musics. But the problem of music “from elsewhere” – heavenly or otherwise – had not gone away. These symphonies seem intentionally opposed to each other in ways that biographers have emphasized by latching on to Mahler’s reference to a “ganz neuer Stil” in the Fifth (Blaukopf: 1982, 404) as compared to the Wunderhorn-inspired Fourth. Mahler himself once described the latter as closing the “in sich geschlossene Tetralogie” (Bauer-Lechner: 1980, 154) of his first four symphonies. In its guise as a reduced recomposition of the once-envisaged plan of the Third Symphony, with the setting of Das himmlische Leben following the Adagio, the Fourth stays artfully closer to the world of the Third’s animals than does the more grown-up Bildungsroman of the Fifth, which dispenses with overt programmaticism and even reconciles us with traditional symphonic form to the extent of closing with a Rondo-Finale. This, of course, is where Mahler continues to fascinate and surprise us. He appears to be celebrating his own assimilation into German culture with overzealous relish, as if there were no more spooks lurking outside the bedroom door. But there were. Perhaps the biographical details of his triumphant and yet troubled marriage to Alma Schindler did play their part, although in ways that are more complex than “Adagietto” love-songs or her supposed depiction in the second-subject of the Sixth Symphony’s first movement.8 As Mahler’s symphonic model seems, from the perspective of bourgeois culture, to become more ‘mature’ and therefore (perhaps?) formally more traditional, so the model proves merely a vessel for an ever more volatile mixture of ultimately combustible and self-destructive elements. And off-stage music is once again employed here – or rather the off-stage sounds of two kinds of bells, heard in three of its movements. The famous cow-bells, first encountered in the opening movement, evoke the presence of animals, although
8 The information about the Adagietto as Mahler’s “love-song” to Alma comes from Willem Mengelberg; see de La Grange: 1995, 538, n.19 and Kaplan: 1992, 20; on Mahler’s claim to have depicted Alma in the second main theme of Symphony no.6/1, see Mahler, Alma: 1991, 70.
74
Peter Franklin
now ostensibly only realistic cattle whose distance defines the naturalistic space of a high mountain pasture in which the implied Subject seems musically to experience a harshly-curtailed spiritual transcendence of the material world. The other bells, deep church bells, suggest urban culture and organized religion. And both sound from afar – or do they? Not enough, I think, has been made of the explicit direction that at key points in the Sixth’s Andante the cow-bells come back on-stage.9 Evoking their earlier use in the distance, Mahler seems here to throw open the gates and lets the cattle roam in benign anarchy amongst the orchestra. They are still ‘real’ cattle, as it were, but their arrival signals liberation and a momentary sense of oneness with nature’s otherness that had arguably eluded him since the Scherzo of the Third Symphony. That naively subversive unity, emphasized in the first and third movements of the Third Symphony, had as its other face a kind of urban false consciousness, just as did the on-stage church- and cow-bells that turn the Rabelaisian circus of the Finale of the Seventh Symphony into an apotheosis of Vienna’s impossible dream of itself as a modern imperial capital in seamless unity with the ancient woods and meadows that surround it. Any tension between the private and the public, Self and Other, “I” and “Them” seems gloriously, if no less problematically resolved in the Eighth Symphony, where spatial effects are entirely a matter of on-stage spectacle: a baroque interior of power and glory in which nothing is seriously alienated or alienating, from the softest cymbal strokes and mandolin tremolandi to double chorus, full orchestra and organ “volles Werk”; from the most folksy Schuhplattler to the most intricate contrapuntal entanglements. This, Mahler said, was his “Geschenk an die Nation” (Specht: 1913, 304). *** My suspicion that changes in Mahler’s deployment of off-stage instruments might function as critical indicators of a rightward-tending politics of musical meaning in his middle symphonies seems borne out (if you accept my readings). His route from Romantic and ethnic “outsider”-status to that of a self-made and widely celebrated cultural leader seems marked by an increasing disinclination to play with effects of external or unseen sources of music which might threaten or at least generate critically meaningful relations with his on-stage symphonic discourse – however 9 See Mahler, Symphony no.6, two bars after cue 94. 10 The most public collection of these appeared in a so-called “interview” with Mahler published in New York in The Etude, May 1911, 301f. There is no published transcription of the complete text, but for a representative extract see Lebrecht: 1987, 292.
The Politics of Distance in Mahler’s Musical Landscape
75
complex and multi-faceted in its own right. But for all the evidence of increased ideological conservatism in some of his later public statements,10 we must remember that Mahler had not changed the world by means of his boldly fashioned creative self-projection – and he knew it. The last three symphonic works, biographical pathology set aside for a moment, resound with that realization in a way that makes them indispensable to us as negotiations and renegotiations of subjective stability in the face of the accepted fictitiousness of any outside source of power, divine or otherwise, that might redeem us from ourselves. That wider context of Mahler’s creative trajectory renders the Eighth Symphony peculiarly ambivalent: as a conservative, patriarchal and assimilationist paeon of pan-Germanized Catholicism, or (remembering Adorno’s earlier, more positive estimation of it [Franklin: 1997, 288]) as an appropriation of the machinery and theatre of religious myth and ritualized worship by a potentially challenging vox populi. Such ambivalence became central to the cultural work done by the late nineteenth-century symphony as prototypical mass-entertainment, covertly mediating shared mythology. It also draws upon and retrospectively illuminates the less comfortably resolvable tensions of the earlier works, whose character I have sought to trace in Mahler’s pitting of off-stage against on-stage instruments. Nowhere was that implicit contestation bolder than in Das klagende Lied, where a deliberate ambivalence of possible interpretation suggests much about Mahler’s long-developed and always highly subtle cultural awareness. Most obviously, the banda effect of the off-stage instruments in the final movement of Das klagende Lied (Hochzeitsstück) evokes realistic palace music at a wedding festivity. The realism and radicalism of the effect is attested variously by the boldness of its deployment in the original, rejected three-movement work, by Mahler’s subsequent removal of it (or most of it) when he was preparing a performable version in the mid-1890s, and by his restoration of it in the final movement in 1898, when he prepared the eventually performed two-part version of the work.11 Original score directions related to the so-called “Fernorchester” appeared quite explicit in their naturalistic intention. Off-stage trumpets and timpani in Der Spielmann, as the Minstrel is warned by the chorus not to play the flute he imagines carving from the bone he has found, are accompanied by on-stage percussion headed “Wie fernes Glockengeläute”; Hochzeitsstück had an initial footnote:
11 On the history of the versions of Das klagende Lied see the introduction to Reinhold Kubik’s edition of Das klagende Lied, Endfassung in Drei Sätzen (1880) für Soli, Chor und grosses Orchester und Fernorchester. Gustav Mahler Sämtliche Werke Kritische Ausgabe, Supplement Band IV, UE 13840 (n.d.).
76
Peter Franklin
In this piece a small wind-orchestra must be placed at a certain distance. It is supposed to represent wedding sounds, as if carried towards us by the wind, now more clearly, now dying away.12
What interests me is that the off-stage music in Der Spielmann (C major against C flat major!) already represents ill-gotten power and social position – acquired, indeed, at the expense of the life of the fair-haired brother who had actually found the rare flower that would gain the hand of the queen. What even the revised version of Hoch zeitsstück provides, in its unstaged staging of the wedding feast and the arrival of the Minstrel, is an extraordinary instance of music intervening in its own business, before the re-entry of the Fernorchester, stressing the significance of the distantiation effect that will follow. The Minstrel plays his flute fashioned from the ‘good’ brother’s bone, and it sings a revelatory and ghostly song of treachery and murder that leaves the marriage feast abandoned and the deserted castle crumbling into symbolic ruin. In all but one respect this is a standard melodramatic crisis situation from grand opera. What is odd, however, is that the Minstrel’s performance does not initially halt the carousing festivity of the Fernorchester, which continues, as if drawing attention to itself at a moment when all eyes should be on the Minstrel and the King. In fact it frames the episode of the King leaping up after the flute’s initial generalized utterance of woe and snatching it to his own lips, accompanied by a choral expression of foreboding (when he plays it will accuse him directly of the murder). Is this simply veristic realism, or does it suggest something else? Does the fact that its melodic contour seems fashioned from the music of the quest and its completion by the murdered brother suggest that the balance of on- and off-stage power has changed? What was a foretaste of the unjust wedding is now readable as actualizing the threat to it already posed by the Minstrel’s performance. Might we not now hear the off-stage bandsmen as musical insurgents, in ghostly allegiance with the murdered brother? The music they play is no dance, but a spirited march. This early instance of distanced instrumentation is a beautiful and perhaps formative example of how Mahler’s spatialized musical landscape invites not only “reading”, but specifically a cultural-political choice about how to read – particularly when the musical text may turn out to be startlingly political, or at least provocatively enigmatic.
12 The note appears in Reinhold Kubik’s edition (see Note 11), p. 147: “Bei diesem Stück muss in einiger Entfernung ein kleines Bläserorchester aufgestellt sein, welches die Hochzeitsklänge darstellen soll, wie sie vom Winde bald deutlicher bald verweht herüber getragen werden.”
The Politics of Distance in Mahler’s Musical Landscape
77
Bibliography Natalie Bauer-Lechner, Recollections of Gustav Mahler, trans. by Dika Newlin, ed. by Peter Franklin, London 1980. Paul Bekker, Gustav Mahlers Sinfonien, Berlin 1921, facsimile reprint Tutzing 1969. Herta Blaukopf (ed.), Gustav Mahler Briefe, Neuausgabe Wien, Hamburg 1982. Henry-Louis de la Grange, Mahler, Vol.1, London 1974. Henry-Louis de La Grange, Gustav Mahler. Vol. 2. Vienna: The Years of Challenge (1897–1904), Oxford, New York 1995. Peter Franklin, Mahler. Symphony no. 3, Cambridge 1991. Peter Franklin, “…his fractures are the script of truth.” – Adorno’s Mahler, in: Stephen Hefling (ed.), Mahler Studies, Cambridge 1997, 271–94. Gilbert Kaplan, Gustav Mahler Adagietto; Facsimile. Documentation. Recording, New York 1992. Lawrence Kramer, Musical Meaning. Towards a Cultural History, Berkeley, Los Angeles, London 2002. Norman Lebrecht, Mahler Remembered, London 1987. Richard Leppert, The Sight of Sound. Music, Representation and the History of the Body, Berkeley, Los Angeles, London, 1993–1995. Alma Mahler, Gustav Mahler. Memories and Letters, trans. by B. Creighton, ed. by Donald Mitchell, 4th edition, London 1991. Thomas Peattie, In Search of Lost Time: Memory and Mahler’s Broken Pastoral, in: Karen Painter (ed.): Mahler and his World, Princeton 2002, 185–98. Zoltan Roman, Gustav Mahler and Hungary, Budapest 1991 (Studies in Central and Eastern European Music, 5). Morton Solvik, Biography and Musical Meaning in the Posthorn Solo of Mahler’s Third Symphony, in: Günther Weiss (ed.), Neue Mahleriana. Essays in Honour of Henry-Louis de La Grange on his Seventieth Birthday, Bern, Berlin, Frankfurt a. M. 1997. Richard Specht, Gustav Mahler, Berlin, Leipzig 1913.
78
Peter Franklin
Identity and Voice in the Music of Gustav Mahler
79
Julian Johnson Identity and Voice in the Music of Gustav Mahler
Towards the end of the slow movement of Mahler’s 4th symphony is a passage with the performance direction “Innig” – meaning, sincere or heartfelt. It is a relatively rare direction in Mahler’s music, but one that denotes a particular tone of musical voice.1 Almost certainly, Mahler borrowed the term from Schumann for whom it also marked a particular kind of music.2 So how do we – as performers or listeners or readers – understand this specific indication of sincerity? Do we assume, by implication, that the music before or after such a passage is insincere? In a way we do, because we might well hear Schumann and Mahler in the same way that we might read their favourite authors – Jean Paul and E.T.A. Hoffmann. These authors and composers alike present us with texts which are pervasively double-voiced – that is to say, in which the notional authority of the author is repeatedly and self-consciously undermined. In Hoffmann the text may be doublevoiced by interleaving two separate tales into one or by embedding self-contained episodes such as fairy-tales into larger narratives. At any time, the artificiality of the story may be exposed by deliberate intrusions of the narrator into the world of the story itself. Schumann’s extensive play with genre reference and musical voices results in the abrupt structural discontinuities and carnivalesque forms of his early piano music.3 In the Wunderhorn songs Mahler unleashes a whole troupe of musical voices, which – in the symphonies – begin to weaken any notion of a central, authorial voice on which the form was traditionally based. This reading of Mahler is a familiar one, and seems to fit well with our own postmodern sensibilities.4 The music of an earlier age is thus reconnected to our own through discovering within it a radically deconstructive element that undermines 1 See Mahler Fourth Symphony, third movement at Figure 13 (b.326); the marking is “Sehr zart und innig”. In the fourth movement of the Fifth Symphony (at Fig.4) the marking is “mit innigster Empfindung” and in Part II of the Eighth Symphony (at Fig.178) Dr Marianus is marked “zart, aber innig.” The marking is more common in the songs; see for example, the Rückert Lieder, nos. 2 and 4. 2 Examples in Schumann’s piano music would include the second of the Davidsbündlertänze, Op.6, the first of the Phantasiestücke, Op.12, the second of the Kreisleriana, Op.16, and the section following the Intermezzo of the Humoreske, Op.20. 3 I have discussed this in greater detail in Johnson: 2003, 55-70. See also Newcomb: 1987, 164–74. 4 An excellent example of a recent reading of Mahler’s musical voices is found in Monelle: 2000.
80
Julian Johnson
any simple proposition of authorially-conferred meaning. Such readings provide a necessary and welcome antidote to one-dimensional accounts of Mahler’s music that reduce it to the direct outpouring of a romantic consciousness and the affirmation of an unproblematised constitutive subject. Mahler’s music thus seems to come close to a postmodern position – self-critical of its own status as aesthetic object, of the contingency of its own musical language and the propositions that it frames. Irony, in Mahler, is thus seen to call into question the idea of a unified expressive voice as the index of a similarly unified, expressive subject.5 But the passages marked “Innig”, and others like them, resist such a neat rereading of Mahler the romantic, not just by their presence but by the function that they fulfill in Mahler’s symphonic narratives. Hoffmann’s work celebrates heterogeneity as the condition of full self-knowledge, and Schumann accepts the essential duality of Florestan and Eusebius without apparent regret, but Mahler’s music risks a divided subject not for the pleasure inherent in playing with identity, but in order to salvage the possibility of a unified subject (Berio’s Sinfonia might usefully remind us of this difference). Mahler reactivates the world of early romanticism precisely to highlight the absence of such a unified subject for which his music remains profoundly nostalgic. In the Ninth Symphony, for example, the ironic humour of the Rondo-Burlesque presents a plural and fragmented identity as a terrifying prospect, one that the subsequent Adagio attempts to resolve through its quest to recover a unitary voice. This Adagio voice, found in the finale of the Ninth, might thus be summoned as evidence against a deconstructive reading of Mahler’s music. Its contrast with the plurality of voices that surrounds it proposes a structural and semantic opposition; in the face of unchecked parody and kitsch, the Adagio voice appears to affirm an idea of authenticity – as if, after the daemonic negativity of the carnivalesque, undermining the idea of any stable identity in its parade of musical masks, the Adagio speaks from the heart, as if it were in some way, an attempt to speak with Mahler’s own voice. But once again the balance of the argument shifts: How is the Adagio voice different to any other in this theatre of musical ventriloquy? How can this voice lay claim to a different status? If the symphonic discourse as a whole reveals itself to be made up of so many received, conventional, generic voices, does the Adagio voice not take its place as simply one more of such musical borrowings? Even as it presents itself self-consciously as different – as a voice of authentic identity in a world of inauthenticity – is its claim not unmasked as mere pretension? In a theatre of masks, no mask is any more real or true than another. Despite the rhetoric of 5 A great deal has been written on irony in Mahler. A key source is Hefling: 2001.
Identity and Voice in the Music of Gustav Mahler
81
authenticity then, the gesture made by the Adagio voice would thus necessarily be hollow because the rest of the symphony has already undermined the possibility of such a claim. In this paper I want to see what happens if we read such passages against the grain and treat them as every bit as generic, borrowed and conventional as the passages they appear to oppose. I want to focus on what I am calling here Mahler’s Adagio-voice, and to ask to what extent does it invite an equally deconstructive reading? My concern is not with the simple denotation of a tempo marking, but rather with a kind of musical material presented self-consciously as the authentic voice of an interior, lyrical subject. In the symphonies such a voice often functions as a structural opposition to a more dramatic voice with which a movement opens: the “sehr gesangvoll” melody in the Finale of the First Symphony (Fig. 16) or the E major “Gesang” in the first movement of the Second Symphony (Fig. 3) provide good examples.6 At other times, this voice determines the character of a slow movement but not all slow movements exhibit this voice, nor are all the instances of it confined to slow movements. Nevertheless, as prime examples here, I propose the finales of the Third and Ninth symphonies, the first and last movements of the Tenth, and the Adagietto of the Fifth. So what might be the defining elements of such a voice? Let us consider the opening bars of the Finale of the Ninth Symphony. Of course, this passage is framed in important ways before a single note is sounded. The previous two movements have been characterized by a disorientating juxtaposition of quite different voices, self-consciously contrived, artificial voices, brought in (as it were) from outside the presumed boundaries of symphonic discourse. Towards the end of the Rondo Burlesque, the impossible attempt to integrate such disparate voices is finally given up, in a series of gestures that address the question of musical voice in an unequivocal and self-conscious manner. Several times in quick succession, the violent contrapuntal drive of the movement is halted in its tracks to give way to quiet, lyrical anticipations of the turn figure that will be so prominent in the finale. These moments, marked “Mit grosser Empfindung”, are characterized by a complete change of texture, sonority and pace, and signaled by upward glissandi (in the violins or harp) which quite literally tear up the preceding page in order to start again with this quite other musical voice (see bars 347–522). As so often in Mahler, it is hard to avoid the gestural link with the opening to the Finale of Beethoven’s Ninth. In each case the music presents a voice only to reject it as inadequate and try out another. Both works foreground the question of voice and thematize the notion of inadequacy or inauthenticity as a foil to presenting a 6 Of this latter example, see the discussion in Abbate: 1991.
82
Julian Johnson
Music Example 1: Gustav Mahler: Ninth Symphony, Finale, bars 1–11
quite different voice as the thus far elusively authentic one. Arguably, in his Ninth, Mahler thus engages more profoundly with the “problem” of Beethoven’s Ninth than he had done in the early symphonies. And whereas, in the first three symphonies, Mahler had forged statements of collective affirmation in keeping with his
Identity and Voice in the Music of Gustav Mahler
83
Beethovenian model, in the Ninth the self-consciousness of the musical voice persists right through to the closing bars. It is perhaps this self-questioning of musical voice, rather than any more surface features, that defines the essential modernity of Mahler’s late works. But how do the musical gestures and materials at the start of the Finale propose themselves as the voice of an authentic subjectivity? The opening figure in the violins elaborates a familiar cadential gesture of vocal music: the turn figure propelling the solo voice upwards in order to descend again to the return of the melody and accompaniment texture. It is found in countless vocal and instrumental compositions marking the end of a cadenza or simple extension of the solo voice prior to the repeat of the main melodic material (as in the return to the A section of a simple ternary form). In this way, the finale opens in media res, as if it were returning to its Adagio material after the excursions of the earlier movements. At the same time it underlines its essentially vocal, even aria-like character. If the opening violin line stands in for an absent vocalist, it also denotes a very particular kind of singing voice. The intensity of tone here is achieved by the sul G marking, the use of 1st and 2nd violins in unison, the reminder to use a full bow and the relatively low tessitura. The style of delivery is shaped by a particularly exaggerated use of accents: both the turn figure in bar 1 and the linear descent in bar 2 would more normally be given legato in the vocal model to which they refer. The model is of course further deformed through the exaggeratedly slow tempo. The combination of all these elements draws unequivocally on a sign of subjective melos, but at the same time stretches that material close to breaking point through over-exaggeration: a vocalist, delivering the turn figure in this way in a da capo aria would introduce a disturbing element of irony into such a normally mellifluous device. The stretching-out of what is effectively an anacrusis into bar 3 has a number of other important effects. It holds up the onset of any regular metre, so that the opening bars are heard as it were in free time, senza misura – like the cadenza, a space for the elaboration of an individual voice prior to its being reabsorbed into a collective one. That moment of reabsorption (bar 3) is thus marked by several parameters: the slow regularity of the 4/4 metre, the hymn-like melody of the upper part, the full texture of orchestral strings and a concomitant shift to a gentler tone colour, reinforced by the new piano dynamic. It is a gesture with a very distinct lineage: the Adagio of Bruckner’s Ninth and the opening of Mahler’s Tenth present examples that are constructed in exactly the same manner.7 7 The type is so well-established that specific borrowings are not especially surprising or significant. In passing one could mention the Adagio of Bruckner’s Fifth Symphony, which anticipates the Ada-
84
Julian Johnson
In all three of these cases, the solo line functions as a long-range anacrusis and is absorbed into a rich, hymn-like collective. But the sense of resolution is here short-lived. The opening chords of bar 3 suggest, through their rich sonority and balanced deployment of diatonic triads, a sense of repose: one might assume the same purposeful progression of line towards closure that is promised by the Adagio finale of the Third Symphony. But the propulsive logic, given here by contrapuntal voice-leading is undermined by chromatic sidestep and disjunction. The keynote on the third beat of bar 3 is thus harmonized by a substitute chord, effectively creating an interrupted progression from V7 to bVI – a harmonic twist that pervades all four movements. Bars 3–10, taken together, are presented as a classical eightbar melodic unit, as amenable to the same subdivisions into two-bar and four-bar units as any classical lyrical adagio opening. But, at the same time, this formal unit threatens to burst apart at the seams: the continual sidestepping of the harmony, the false relations introduced by the turn figure and disjunct voice-leading are at odds with the formal composure implied by the melodic material and its phrase structure. It serves, perhaps, as a good illustration of Adorno’s comment on Mahler’s voice: “What is new is his tone. He charges tonality with an expression that it is no longer constituted to bear. Overstretched, its voice cracks […] the forced tone itself becomes expressive” (Adorno: 1992, 20). The opening of the finale to the Ninth is not a standard example of Mahler’s use of borrowed voices nor is it likely to be cited as an example of musical irony. And yet, it is both borrowed and ironic: borrowed because it is at pains to stress its provenance in the tradition of instrumental Adagio movements – ironic, in the sense that, like Hoffmann’s Kapellmeister Kreisler, it insists on the impossibility of giving voice to what it nevertheless attempts to voice: the exaggerated turns (too slow, too heavily accented), the thickly cloying tone, the harmonic sidesteps, all add up to a critical undermining from within of the most hallowed voice of musical self-disclosure, the expressive, lyrical outpouring of the arioso Adagio. The demand made by this voice, that we should hear it as the direct utterance of an unalloyed individuality, the unmediated voice of an authentic subjectivity, is part of the proposition that the music makes. So too, is the historical resonance of its tone and gesture. And the provenance of both might be traced, quite directly, to the slow movement style of Beethoven, as mediated through Wagner and gio of Mahler’s Ninth in its intense string lyricism, its stepwise motion and prominent turn figure. Mahler’s opposition of a dense string texture with a fragile two-part counterpoint reverses the order of Bruckner’s presentation of the same pairing. There are further points of contact with the slow movements of Bruckner’s symphonies 2 and 6, 7 and 9.
Identity and Voice in the Music of Gustav Mahler
85
Bruckner. A key moment in this process is undoubtedly Wagner’s Parsifal, whose predominant Adagio voice stands as a paradigm of all the principal elements of a music that raises the subjective lyrical voice to the status of an absolute religiosity. But behind Wagner, and all the examples in Bruckner symphonies and less obvious models in Mendelssohn, Schumann and Brahms, stands a certain type of Adagio movement in Beethoven. Mahler’s evocation of such a model signals a self-conscious historicism; in drawing upon the model to reference the tradition it also re-presents the qualities associated with that tradition – a certain unswerving, progressive logic, religious awe, grandeur, sublimity, nobility in suffering. But, and this is crucial, Mahler’s evocation of this voice is neither direct quotation nor unconscious modeling. Through the kind of deformations we have considered in the Ninth, it signals not only distance but regret: it invokes these qualities as anterior, belonging to a classical age now problematic to the point of unsustainability. Such a link can be clearly heard in the Adagietto of the Fifth Symphony whose opening is a kind of post-romantic composing out of a classical Adagio. A number of Beethoven slow movements show some obvious similarities in melodic construction, harmony and phrase structure. Without suggesting it as the origin of any direct modeling, a comparison with the Adagio of the early piano sonata Op.2/1 might serve to illustrate the point. The famous opening of Mahler’s slow movement hinges on the ambiguous shift from an opening tonic 6/4 chord to a root position in bar 3, via a weak dominant 7th on the last beat of bar 2. As if metrically separated from this background, the anacrusis figure in the first violin rises from ^ ^ ^ 5 to 8 with a characteristic suspension of 7 on the downbeat. In the Beethoven example, this progression is presented in a straightforward classical manner; in the Mahler, it is elongated and blurred by delayed voice-leading and suspensions. ^ Similarly, the melody in the Beethoven moves directly to the upper 5, before de^ scending stepwise to a half-close on 2, whereas in the Mahler this same process is more drawn out, the half close not being reached until bar 9. The manner in which the 6/3 chord propels the melody in the Beethoven (downbeat of bar 3) is echoed in the Mahler (bar 5), as is a pervasive use of chromatic steps within voice-leading descents. It is not that the Beethoven forms a direct model for the Mahler, but that a certain type of Beethovenian movement stands behind a certain type of Mahlerian one. My point is not about the use of any particular melodic construction, phrase structure or harmonic detail but the particular configuration of several such elements which combine to form a stylistic link between the two. What is significant in the Mahler, however, is precisely the departure from the Beethovenian model, the deformations of the known gestures. It is these that create the sense, simultaneously of drawing upon the genre (with all its musical and extra-musical associations)
86
Julian Johnson
Musical Example 2(a): Gustav Mahler: Fifth Symphony, Adagietto, bars 1–11
Identity and Voice in the Music of Gustav Mahler
Musical Example 2(b): Ludwig van Beethoven: Piano Sonata Op.2/1, Adagio, bars 1–9
87
88
Julian Johnson
and distancing itself from it. The effect of playing Mahler’s opening on the piano (with too much pedal) may well suggest a half-recollected, half-improvised recon struction of the Beethoven model. The sense of wistful nostalgia so often associated with the Adagietto has its roots in this relation.8 The proposition of Mahler’s Adagio voice is thus a complex one. Whilst proposing itself as the voice of a genuine, authentic subjectivity it simultaneously critiques its own claim. But it does not test the limits of its language simply to show that all language is essentially artificial. Rather, it uses its artificial nature to make space for something that might lie outside of artifice – to make the artificial project a sense of its own opposite. It does this by acknowledging the generic and historical sources on which it draws but highlighting its distance from them by definitive exaggeration. The subtlety of this strategy produces a music that is more than usually dependent on interpretation, in the sense of both musical performance and analytical reading. The music itself is thus far more complex than a music theory that would dissolve the category of authenticity by a simple deconstruction. Our task, as interpreters of whatever kind, is surely greater than this. At the very least, it involves bringing into greater relief the nature of the critical tension embedded in the musical material – not to collapse this tension, but to follow the music in exacerbating it. The question of voice in Mahler is thus not separable from the question of musical modernism and its overlap with ideas of romanticism on the one hand and postmodernism on the other. Mahler’s music brings out the continuity of artistic and intellectual problems across such theoretical boundaries, but in such a way that it resists any neat pigeon-holing into historical or aesthetic categories. Its play with language relates to both a reactivation of the romantic and an anticipation of the postmodern. Its borrowed materials, ironic voicings and constant undermining of the musical narrative seem to undermine the identity of an expressive subject for whom the composer stands as symbol. And yet, at the same time, the music lays claim to just such a subjectivity, and persists in doing so even in the face of its exposure as just another, constructed voice. This paper has called into question the status of the “lyrical-expressive”, or Adagio voice in Mahler’s music, given that it is presented as part of a wider theatre of masks or musical ventriloquy. My suggestion, however, is that the music anticipates our commentaries by asking this question of itself. By means of this heightened aesthetic self-awareness, it anticipates and opposes any simple, reductive reading. The question of voice in Mahler relates to a fundamental tension of aesthetic modernism: that between expression and construction. Mahler understands the 8 In this respect, the scene in Visconti’s film Death in Venice in which Aschenbach/Mahler plays through the opening of the Adagietto at the piano, is insightful.
Identity and Voice in the Music of Gustav Mahler
89
loss of innocence that comes with deconstruction – that is, that once language is fully understood, the idea of pure expression is forever lost. But music is neither philosophy nor theory: Mahler’s materials are deployed in such a way, that the acknowledgement of conventionality and construction is opposed by a recurrent reaffirmation of the idea of expression, albeit couched in terms that should no longer be believable. The constitutive tension of Mahler’s music derives from its way of speaking “as if ” something were true.9 This central category of all art (what Adorno refers to as an essential element of illusion or appearance – Schein) is brought to a heightened state of self-reflection in Mahler’s music. On the one hand, it undermines its own propositions with a constant self-awareness of the constructive, artificial element in all proposing; on the other, it has a theatrical capacity (even while acknowledging its own theatricality) to make present, to embody, to realize. The result is a music that, more than most, proposes a utopian content while at the same time acknowledging that all such propositions negate themselves. Mahler’s music thus intensifies its own fractures: it cultivates the edge of its own language, forcing it to say what it should no longer be able to say. In highlighting its own capacity for failure, the work nevertheless keeps alive the reality of a will to express, and the subject that wills it. In this, caught between the romantic and the postmodern, Mahler’s music defines a central category of the modern.
9 Hermann Danuser employs the phrase “als ob” which he credits to Hans Redlich. Writing of the finale to the Third Symphony, Danuser comments that “it speaks as if it still believed in the possibility of an unbroken art music.” [“Sie spricht umgekehrt […] also ob sie an die Möglichkeit ungebrochener Kunstmusik noch glaubte.”] See Danuser: 1991, 86. See also Eggebrecht: 1986, 24.
90
Julian Johnson
Bibliography Theodor Adorno, Mahler. A Musical Physiognomy, trans. by Edmund Jephcott, Chicago, London 1992. Carolyn Abbate, Unsung Voices. Opera and Musical Narrative in the Nineteenth Century, Princeton, Oxford 1991. Hermann Danuser, Gustav Mahler und seine Zeit, Laaber 1991. Hans Heinrich Eggebrecht, Die Musik Gustav Mahlers, München 1986. Stephen E. Hefling, Techniques of Irony in Mahler’s Oeuvre, in: André Castagné/Michel Chalon/Patrick Florençon (eds.), Gustav Mahler et l’ironie dans la culture Viennoise au tournant du siècle, Castelnau-le-Lez 2001, 99–142. Julian Johnson, Narrative strategies in E. T. A. Hoffmann and Robert Schumann, in: Rüdiger Görner (ed.), Resounding Concerns, München 2003, 55–70. Raymond Monelle, The Sense of Music, Princeton, Oxford 2000. Anthony Newcomb, Schumann and Late-Eighteenth-Century Narrative Strategies, in: 19thCentury Music 11/2 (1987), 164–74.
Mahler, Musicological Imperialism and the Decentred Self
91
Jeremy Barham “Made in Germany”: Mahler, Musicological Imperialism and the Decentred Self “Home is where one comes from, and it can also be where one goes to” Franz Nabl (1883–1974)
Introduction If reports of Mahler’s early childhood are accurate, at the age of about five or six he interrupted the chanting during one of his first visits to the synagogue in his home town of Iglau by singing his favourite song At se pinkl házi (“Let the Knapsack Rock”). This song was probably one of many folksongs sung to him as a young boy by Czech employees of his father. Its text runs as follows: A wanderer, A wayfarer, Went from Hungary to Moravia And there, in the first inn, Danced as if on water. He danced like a madman And his knapsack rocked with him, Whether it rocks or not, The devil won’t take it away. (Rychetsky: 1989, 729)
Interestingly, the song was not one of ancient provenance that had been orally transmitted through the generations, but rather was composed in the nineteenth century by a Prague organ-grinder, Fr. Hajs. Its popularity gave rise to a familiar Czech greeting: “Let the knapsack rock” which was answered by “let it rock”. Characterized by typically four-square rhythms, melodic/phrase structure and tonic-dominant harmonies, and labelled as a “Polka tremblante” in the copy of the wind-band arrangement obtained by the author from the Moravian Museum in Brno, it possibly had some influence on Mahler’s reputed first composition: a polka with funeral march for piano. Evidently the young Mahler was thoroughly steeped in the language, landscape, culture and music of his Czech surroundings, speaking the language fluently as a child (see Foerster: 1947 and Mahler: 1972, 437), visiting relatives in nearby towns
92
Jeremy Barham
and villages, hearing music of military bands and itinerant Bohemian Musikanten (a tradition that initially developed due to progressive German cultural domination from the seventeenth century and the relegation of Czech language and culture to the peasantry and a position of servility), receiving lessons from Czech musicians, and playing Czech folksongs on his accordion. He was later to admit, to his biographer Richard Specht, that almost exclusively those impressions he had gained between the ages of four and eleven were fruitful and decisive for his artistic creativity (see Specht: 1913, 165–66), and Josef Foerster claimed that “the melodies of Czech folksongs were of great influence on many of his later compositions” (1947, 44). Interviewed in the last year of his life by a reporter from The Etude, Mahler reputedly said: “As the child is, so will the man be. … So it is in music that the songs which a child assimilates in his youth will determine the musical manhood … the musical influences which surround the child are those which have the greatest influence upon his afterlife [later life] and also that the melodies which composers evolve in their maturity are but the flowers which bloom from the fields which were sown with the seeds of the folk-song in their childhood” (Mahler: 1911). Yet German was the language of his aspirant home environment and his schooling, and German high culture the ultimate content of his education. For within the Jewish communities of Bohemia and Moravia, as Hillel Kieval writes, “social and cultural elites promoted a new ideology of “Europeanness” tied to a programme of German linguistic acculturation and middle-class social aspirations”, a German liberalism that paradoxically neglected other national groups in the Empire, especially the Czechs with their unique cultural and national traditions (Kieval: 2000, 5). Furthermore, Iglau was part of a German enclave or language-island [Sprachinsel] on the Bohemian-Moravian border, within an Austrian Empire which, though German-dominated, during the 1860s had become increasingly alienated from the northern German states of Bismarck’s Prussia which it had previously dominated. The Habsburgs’ defeat by Prussia in 1866 and the resulting Treaty of Prague effectively ended centuries of Habsburg power in the German world, signalling Austria’s inability to underpin German unity and to determine its true German nature. Notably, during the Prussian occupation of Prague Let the Knapsack Rock was frequently used by soldiers as a rallying cry to generate goodwill amongst a resentful people. As a student in Vienna Mahler was closely associated with the pan-German cultural politics advocated by Viktor Adler, Engelbert Pernerstorfer and Heinrich Friedjung which centred on the figures of Schopenhauer, Nietzsche and Wagner, and devoted itself to the political and cultural healing of the 1866 wound. This cultural-political movement led indirectly to the founding of the Deutschnationaler Verein by the antiSemitic and aggressively nationalistic Georg von Schönerer, whose ultimate aim was to wreck the Habsburg Monarchy and incorporate it into Hohenzollern territory.
Mahler, Musicological Imperialism and the Decentred Self
93
From the 1870s even Jews who had moved to Vienna from Bohemia and Moravia were themselves already beginning to resent association with unassimilated Ostjuden: what Treitschke would call the “deluge” of ambitious “trouser-selling youngsters” from the East (cited in Klein: 1979, 249). On more than one occasion Mahler is known to have expressed the alienation he felt from these so-called “brothers”, suggesting a problematic, self-reflexive shifting back and forth between cultural-racial affiliation and disaffection: a “Jewish” anti-Semitism. In view of all this, it is justifiable to ask what precisely were Mahler’s ethnic and political allegiances in the context of the socialist, völkisch, anti-Liberal generational tension in late nineteenth-century Vienna with which he was closely implicated. Was his Deutschtümelei the same as the chauvinistic type associated with the bourgeoisie of the crumbling Habsburg empire? To what extent was he aware of and sensitive to the political and historical tensions he lived through, and how does this square with his idiosyncratic musical absorption of the sounds of “old” Austria? At what stages in his life and to what degree did he consider himself to be (or indeed not to be), Bohemian-Moravian, German, German-Bohemian, Austrian, Austro-German, Austro-Hungarian, or Central-Eastern European? How are Mahler’s supposed allusions to Slavic or Central-Eastern-European völkisch music to be understood (in, for example, Lob des hohen Verstandes, Wo die schönen Trompeten blasen, the third movement of First Symphony, the Scherzi of Symphonies 5 and 6, the first Nachtmusik of Symphony 7, the Ländler of Symphony 9, and the Steigerungsform of repeated refrains in Fischpredigt and Irdische Leben)? Are they to be taken as natural, authentic emblems of national belonging and identity dominant over the so-called classic-romantic traditions; or as objectified “foreign” elements held up for scrutiny within an imperialist high art stylistic language; or as fully integrated “yeast in the dough” (Hansen: 1981, 383) of a new inclusive musical idiom giving glimpses into the social condition? Just how deep did Mahler’s famous sense of alienation run? As an assimilationist Jew, he belonged to a minority – but self-appointedly culturally superior – German community located within an historically oppressed and suppressed larger Czech region (itself dominant over the Slovakians). This region was politically a part of German Austria, an empire which in turn had become alienated from the rest of the German world yet was the dominant partner in the bipartite, multi-national Austro-Hungarian empire. This study aims to provide at least an initial framework for addressing the potentially bewildering matryoschka-like configuration of Mahler’s political allegiances. It will attempt to do so with reference to both Mahler’s own comments and biography, and a previously unknown, highly politicized study of the composer dating from 1945, which was recently discovered in London.
94
Jeremy Barham
Mahler and his Czech-Bohemian origins and disposition First should be mentioned one of Mahler’s earliest compositional plans for the eventually aborted operatic project Rübezahl on whose libretto he worked in 1879 – the mythical story of the mountain spirit from the Silesian Riesengebirge or Krkonoše mountains, which ironically would later be used as a symbol of alienation by homesick Sudeten Germans who had migrated to West Germany or were expelled from the Czech lands during and after the Second World War. Whatever music Mahler composed for this probably found its way into his early songs and First Symphony. Five years on, in 1884, he apparently took some pleasure in showing his friend Fritz Löhr around the vicinity of his home town of Iglau. Löhr recalls the experience in a mixture of erotic, reverential and faintly condescending ethnographic tones: There in the height of summer we would go for walks lasting half the day, wandering among flowery meadows … to villages where the peasantry was in part Slav. And on Sunday there was an expedition to where authentic Bohemian musicians set lads and lasses dancing in the open air. … There was the zest of life, and sorrow too … all of it veiled by reserve on the faces of the girls, their heads bowed towards their partners’ breast, their plump, almost naked limbs exposed by the high whirling of their many-layered bright petticoats, in an almost solemn, ritual encircling. The archaically earthy charms of nature and of nature’s children, which Mahler came to know in his youth, prepared the ground for his creative work and never ceased to vitalize his art (Martner: 1979, 393; my italics).
Mahler was still referring to Iglau as his home in 1885 (Martner: 1979, 89), and in 1893 while in Hamburg he openly acknowledged that the Bohemian music of his childhood found its way into many of his works: “I’ve noticed it especially in the ‘Fischpredigt’” Mahler said, referring to the national sounds of Bohemian street musicians, his phraseology suggesting that their appearance was the result of unconscious processes (Franklin: 1980, 33). A relatively small, but nevertheless significant, number of commentators – both Czech and non-Czech – have recognized this element in Mahler’s music, and have provided examples either of Mahler’s actual use of existing Bohemian-Moravian melodies or of his instrumental, textural or harmonic indebtedness to Czech folk idioms (see, for example, Batka: 1906; Redlich: 1919; Komma: 1960; Quoika: 1960; Mahler: 1972; Klusen: 1963 and Karbusicky: 1978). When back in Vienna in 1901 at the centre of the Austro-Hungarian Empire, the situation took on a new light when Mahler described the difficulty of composing the Scherzo of the Fifth Symphony given the daring “simplicity of its themes, which are built solely on the tonic and dominant”, and his principle that “there should be no repetition, but only evolution” (Franklin: 1980, 172). He went on freely to admit,
Mahler, Musicological Imperialism and the Decentred Self
95
again using unconscious terminology, that the melody An dem blauen See by the Carinthian composer of popular folkloric choral waltzes, Thomas Koschat (1843–1914), had “crept into the second [sic: third] movement” and that it was preferable that this kind of undeveloped melody rather than one of Beethoven’s fully explored themes had been appropriated (ibid.). Here we have an example of Mahler not only endorsing the assimilation of, in this case, pseudo-folk sources, but also articulating the problematic reconciliation of a supposedly “primitive” material (whether authentic or not) with the logical and developmental methods of high culture; in other words the difficulty, couched in implicitly hierarchical terms, of matching a concrete/intuitive basic substance with an abstract/rational process, or as Michael Beckerman might say, the ingenuous with the stylized, a pairing whose coexistence lies at the root of his notion of musical “Czechness” (Beckerman: 1986, 71). Mahler’s experience of the Czech language and his views on Smetana are also revealing. While working in Prague in 1886, he wrote to his future employer in Leipzig of hearing the operas of Smetana (underlined), Glinka and Dvorak at the Bohemian National Theatre [Narodni Divadlo], saying: “I must confess that Smetana in particular strikes me as very remarkable. Even if his operas will certainly never form part of the repertory in Germany, it would be worthwhile presenting such an entirely original and individual composer to audiences as cultivated as those in Leipzig” (Blaukopf: 1996, 73). With either political naivety or extreme bravery, during his first year in Vienna he chose to celebrate the Emperor’s name day with the premiere of Smetana’s Dalibor, albeit in German, and this at a time when the tension between Czech and German speakers in the Empire had intensified. He surely knew that, although Smetana mainly spoke and wrote in German and was criticized by his fellow countrymen for being too Wagnerian, in Vienna he would be, and was, viewed by many as an extreme nationalist.1 Four years later, in the middle of his reign in Vienna, Mahler nevertheless spoke of Smetana’s Dalibor as follows: “You can’t imagine how annoyed I was again today by the imperfection of this work … He was defeated by his lack of technique and his Czech nationality (which hampered him even more effectively, and deprived him of the culture of the rest of Europe)” (Franklin: 1980, 180). Such sentiments would be repeated in some elements of post-1945 German music historiography, 1 In response to the dispute over the official language in Bohemia and Moravia, Count Badeni the Polish head of the Austrian Government issued the inflammatory decree in April 1897 that the Czech and German languages were to be of equal standing in all official communications, and the violent disputes that followed this pronouncement eventually led to his dismissal. Critics of Mahler’s performance noted the worrying preponderance of Slav officials and rowdy students in the audience. See Blaukopf: 2004.
96
Jeremy Barham
for example: “the secular art music of the Czechs arose late, as is appropriate to a primarily peasant society” (Moser: 1957, 528); the view of Smetana as a minor master (Kleinmeister); and the following description of Dvorak: “on account of the constantly erupting vernacular musicianship, [there is] an absence of true depth and concentration” (Moser: 1956, 1195 & 303).2 Curiously, Mahler nonetheless kept Smetana’s Dalibor in the repertoire for a further three years until 1904, while in his opening season at the Metropolitan Opera in New York in 1907 he gave the first American performance of The Bartered Bride. In 1909 a music society called “The Bohemians” gave a dinner in Mahler’s honour in New York, and in an interview with German reporters in New York he identified himself somewhat defensively as a Bohemian: “Ich bin ein Böhme” (Lea: 1979, 291). In stark contrast to this, Mahler’s well-known admonition against “Schlamperei” (slovenliness) in musical performance should be seen in the context of the widespread contemporaneous use of this term to denote many of the less desirable aspects of provincialism in general. While in 1894 Mahler’s command of the Czech language was good enough for him to make alterations to the libretto of The Bartered Bride (Mahler: 1972, 438), ten years later, again while in Vienna, in response to Janacek’s invitation to attend a performance of Jenufa in Brno he requested a piano reduction with German text “because I do not speak the Bohemian language” (Blaukopf: 1979, 287). These comments and events raise the questions of how the apparently assimilationist Mahler viewed the changing, or fixed, relationships of centre and periphery, self and other, and high and low in the German/non-German axis, and how his music might be said to articulate or reinterpret these relationships. To adapt a well-known anti-Semitic critique of the composer, does Mahler speak German with a Czech-Bohemian accent or Czech-Bohemian with a German accent? Or is the issue far more complex than this given the problems associated with determining his degree of conscious or unconscious resistance to assimilation? If Mahler, like the majority of German-speaking Bohemians of his time, identified Czech music primarily with folk music befitting rural and lower class communities, in contrast to “German” art music,3 does his musical language assume even greater political significance? The remainder of this study will review these and previous questions with reference to an unpublished mid-twentieth-century study of the composer by Alfred Rosenzweig.
2 Mahler had gone to great lengths in 1901 – although ultimately unsuccessfully – to secure a performance of Dvorak’s Rusalka at the Vienna Opera. 3 It should be noted that the Czechs were themselves complicit in the nineteenth-century revival of their folk culture and the establishment of these stereotypical cultural associations.
Mahler, Musicological Imperialism and the Decentred Self
97
The Rosenzweig manuscript and its historical importance for Mahler studies Rosenzweig, a Viennese musicologist (b. Vienna 1897), studied at the Universities of Budapest and Vienna, his doctoral dissertation on Strauss’ music dramas being examined by Guido Adler and Robert Lach in 1923. His writings mostly appeared in Der Wiener Tag which was where he published for the first time in 1933 Mahler’s early handwritten, four-movement plan for the Eighth Symphony. This marked the beginnings of Rosenzweig’s work on a large-scale study of the composer, a project whose completion was hindered both by his flight from Austria in the 1930s, to England – where he went by the name of Alfred Mathis – and by ill-health (he died in 1948). Nevertheless the recently discovered surviving manuscript, written in exile during what turned out to be the nadir of Mahler’s reception history, is substantial and gives a distinctive reading of the composer’s early twentieth-century political and cultural environment from the perspective of German cultural domination and the subsequent rise of fascist extremism. Most of the text appears to have been completed in August 1945 in London, a mere three months before the conclusion of the war in Europe. Within the overarching construction of a continuing Austrian versus Prussian, or Habsburg versus Hohenzollern opposition, and with an implicit inclination for pan-Slavism or Slavophilia, three main areas emerge from Rosenzweig’s study: 1. The placement of Mahler’s music within a specifically Austrian, as opposed to German, symphonic lineage 2. The view of Mahler as anti-Wagnerian rather than as Wagnerian epigone 3. An emphasis on Mahler’s profound spiritual and musical affiliation with the distinct, non-German culture of Central-Eastern Europe Early on, for instance, Rosenzweig sets the scene for his highly politicized cultural analysis, writing: Born on the eve of the imperialist epoch, Mahler experienced the great struggles of nationality between the German bourgeoisie in Austria and the strengthening Slav countries. There was no greater musician of this epoch who had felt and endured more intensely the prevailing nihilistic trends of the great-German chauvinism and racial hatred than Gustav Mahler (Rosenzweig, vii).
In support of his first contention, Rosenzweig cites the role of Bohemian and Austrian musicians such as Stamitz, Holzbauer, Wagenseil, Monn, Reutter and Tuma in
98
Jeremy Barham
preparing the way for the so-called “universal” style of Viennese classicism.4 He also refers to what he calls the Great-German annexing techniques of a large number of popular music histories from the turn of the century, through Weimar Germany to Nazi literature, but also from France, England and the USA – a body of literature which, by presenting figures such as Bruckner and Mahler under the stamp “made in Germany”, attempts to “wipe out the impression that, from Schubert onwards, there was a separate Austrian development of the post-Beethovenian symphony”(ibid., 24 & 25). For Rosenzweig, Hitler’s 1937 unveiling of the Bruckner bust in the Walhalla at Regensburg signalled the composer’s promotion to “German hero of music” and indicated that “the blow against the separate Austrian development of the post-Classical symphony – so disagreeable to Great-German ideology – had succeeded” (ibid., 39). However problematic it may be to trace securely a third symphonic lineage of volkstümlich-naturhaften Austrian “finale symphonists” (a term borrowed by Rosenzweig from Paul Bekker’s 1921 study of Mahler) of which Mahler was the consummation – separate from the middle-German Mendelssohn, Schumann and Brahms, and the new German Liszt – Rosenzweig’s analysis of the structural development of the post-Classical symphony nevertheless provides early notification of Siegfried Kross’s recent claim that: “It is at the very least necessary that the writing of music history liberates itself from the cliché of a ‘true’ Beethovenian succession and from the ideologically-rooted fixation on the formal type of Beethoven’s middle period as representing an ideal” (1990, 35). After all, the notions of a culturally central superior Germany and of Czech-Bohemian art as a peripheral German subtype are relatively recent ones: Burney, for instance, described Bohemia as the “conservatory of Europe”. Nevertheless in more recent times, as Draughon and Knapp write, “the myth of musical transcendence, that German art music […] was universal and culturally uninflected […] has occupied the background for most attempts to identify Jewishness (or Czechness, or Russianness, or any other implicitly marginalized ethnicity) in music” (Draughon & Knapp: 2001, paragraph 28). Rosenzweig’s polemic against Wagner centres on his view of the inauguration of the Bayreuth Festival in 1876 as “the most powerful cultural symbol of new-German imperialism” with its “insane hunger for power” (Rosenzweig, 13). In light of this, and given Cosima Wagner’s intrigues against Mahler’s Vienna appointment, her 4 Of course many figures, such as Vanhal, Benda, and Pichl, who appear as a subset of German composers in much German music historiography but as Czech in Czech historiography, moved to Vienna, Germany, Italy, France, England and Russia as part of the vast eighteenth- and nineteenth-century diaspora of intellectuals, artists and musicians from the Czech lands, thereby exerting huge influence on European music history.
Mahler, Musicological Imperialism and the Decentred Self
99
monopoly of a fossilized “authentic” Bayreuth performance tradition, and in the face of Mahler’s early Wagner veneration, Rosenzweig characterizes Mahler’s life as a unique struggle against the ideology of the Festival. Impelled by a mission to keep Wagner’s work alive in the contemporary theatre, Mahler came to see Wagner and Bayreuth as two different worlds: the one a “shining star in the firmament of his life” and the other a hotbed of “pan-Germanism and German imperialism which threatened his life and the existence of his work” (ibid., 14). In adopting this view Rosenzweig is building on the early work of Hans Redlich (neglected in the AngloAmerican academy) who describes Mahler’s music, in contrast to Wagner’s, as “folk music, music of the masses”, “permeated by German and Slav, particularly Czech folksong” (Redlich: 1919, 28), and the composer himself as a victim of the “spiritual annexing technique of German musical historiography which sought to misrepresent Mahler as a Wagner epigone” (Redlich, 1919 cited in Rosenzweig, 17).5 Such a position is reinforced by Rosenzweig’s reference to Zdeněk Nejedlý, another of his critical forbears who, as a Marxist professor of music in Prague and Czechoslovakian Minister of Education, was uniquely placed to recognize Mahler’s relation to Slav musical culture in his 1912 monograph on the composer. However, whereas Nejedlý generally emphasizes the essential Germanness of Mahler and his art as the means through which he was able to appreciate the culture of “foreign peoples” and to effect some kind of reconciliation of “the tension between the Teutonic and Slavic worlds” (cited in Karbusicky: 1978, 133), Rosenzweig goes further. Adopting a largely discredited, but perhaps historically defensible Slavophiliac stance derived from Herder’s late eighteenth-century contribution to Slavonic studies and to national revival, Rosenzweig tends to invert this hierarchy, recasting the notion of mediation between cultures to affirm the primacy of Mahler’s native and natural absorption of folk and other music from Bohemia and Moravia – areas which he describes as “the most intellectually and culturally active crown lands in the monarchy” (Rosenzweig, 45). For Rosenzweig, the life history of Mahler was the history of a musician equally at home in the Slav and Austrian musical landscapes and in whose work “the Slav element was a constituent part, thereby giving rise to a new universal value in the music of the Western world” (ibid., 17). For him, therefore, Mahler’s musical voice is unquestionably that of an Austrian speaker of a Czech-Bohemian language, a language whose sound ideal centred on the bagpipe and wind band, and whose aesthetic was characterized by the interpenetration of sophistication and simplic5 It is a matter of great regret that Rosenzweig did not live long enough to complement this historical and cultural examination with the extensive supporting musical analysis promised in subsequent chapters of his text.
100
Jeremy Barham
ity. If divested of high-cultural refinements, this musical voice may reveal its true, primal nature in terms not dissimilar, for example, to the madly rocking knapsacks and Dudelsack sound world of Uri Caine’s late twentieth-century, postmodern takes on the Mahlerian idiolect.6 Caine’s inspiration for his klezmer version of the third movement of Symphony no. 1 (track 5 of Gustav Mahler/Uri Caine: Urlicht/Primal Light (rec. 1997)) was most probably the following description by Mahler: You have to imagine the “Bruder Martin” funeral march carelessly played through by an extremely bad music band of the type which used to follow funeral processions. Amidst all this, the whole crudeness, joviality and banality of the world, and at the same time the Hero’s dreadfully painful lament, can be heard in the strains of any one of these motley “Bohemian street-bands” (Killian: 1984, 174).7
Caine’s approach might be frivolous or heretical to some, but it raises the important question of whether the results constitute a distillation of some pure essence or an elaborate distortion of Mahler’s musical substance.
Conclusion As one of the earliest contributions – albeit unrecognized at the time – to the rehabilitation of Mahler’s music within the artistic life of the mid-twentieth century, Rosenzweig’s study is representative of that sometimes controversial ideological partisanship brought to bear in the cultural healing process of liberated Europe, whose aim was to provide a powerful humanitarian corrective to the horrors of tyranny which, topically for Rosenzweig, were severely stifling Czech musical life in the Nazi occupation after 1939. As such it may justifiably be accused of occa6 See especially tracks 1 and 5 on Gustav Mahler/Uri Caine: Urlicht/Primal Light (Winter & Winter, New Edition CD 910004-2, 1997) and also Gustav Mahler in Toblach (Winter & Winter, New Edition CD 9100462, 1999) and Uri Caine/Gustav Mahler: Dark Flame (Winter & Winter Music Edition CD 910 095-2, 2003). 7 Invoking the Bakhtinian notion of “carnival”, Draughon and Knapp see this movement as addressing the “oppression of Vienna’s Jewish minority by its Catholic majority – as well as, perhaps, the Eastern lands under her dominion – constructing an inversion fantasy in which the culturally oppressed Jew (or Gypsy, or Slav etc.) surmounts the powers of the dominant group” (2001, paragraph 19); “The canon and the Catholicism it represents are but caricatures and effigies to be mocked within the [Bakhtinian] carnival space, where the relations of power are inverted, where – as Bakhtin points out – the inversion is both signified by and celebrated through the deriding laughter of the once marginalized” (ibid., paragraph 21). The canon’s final word in the movement suggests that the cultural oppression felt by Jews in fin-de-siècle Vienna remains unresolved.
Mahler, Musicological Imperialism and the Decentred Self
101
sionally overstating its case. Nevertheless, as a historical document, its provocative cultural critique serves as a revealing testament to a kind of world-view in which the condition of art, and in particular music, is accorded fundamental significance in the realities of political and social development. Furthermore, it encourages us to interrogate Mahler’s position in the political dimensions of twentieth-century musical historiography, providing something of a missing link in the development of Mahler scholarship between early personalized eulogies or invective and more recent historically detached biography and analysis. As far as Mahler himself is concerned, Rosenzweig seems to paint, avant la lettre, a quasi-Adornian picture of the sense of social awareness mediated through his music. Adorno would later write: “Mahler pleads musically on behalf of peasant cunning against the powers-that-be […] on behalf of outsiders, jailbirds, starving children, losers, lost causes. Mahler is the only composer to whom the term “social realism” could be applied, if it was not itself so depraved by power” (Adorno: 1960, 67). More recently, Dahlhaus has taken up this idea of the “sense of justice” in which Mahler’s forced heterogeneity is rooted. Mahler’s realism avoids the “petrifaction” and “embourgoisement” of folk art by “accepting the full extent of tradition without regard to bourgeois norms [and] attempt[ing] to involve itself in the continuing life of the folk song by emending and modifying” (Dahlhaus: 1985, 113). He does this not by pretending closeness but by emphasizing distance, adopting the sentimental or satirical tone to suggest that “it is as something lost […] that folk song is not lost” (ibid., 114). I would further argue that, in the face of increasing proto-Fascist anti-Semitism in the Vienna of the 1890s, Mahler’s nostalgia for assimilation could have been just as great. As Egon Schwarz suggests: “The problems in Vienna at the turn of the century were so complex that the answers to them led into pathless areas of utopia, eccentricity, ambivalence and resignation” (Schwarz: 1979, 282). Rosenzweig’s polemic thus invites the re-consideration of Mahler’s musical voice as an open-ended and richly ambivalent exposure and negotiation of geo-political tensions: tensions, for example, between a democratising of the local, everyday, even mediocre – aesthetically indebted to Herder’s elevation of the value of oral traditions alongside high culture within civilizations – and the impulse to conform to a universal but exclusive, imperialist ideology. It would be tempting, though not entirely problem-free, to see in this a correlation with the political configurations of, on the one hand, a multi-national, and hence, idealistically speaking, an antinationalist, Austria (torn between a pan-German impulse and its Central European vocation), and on the other hand a more monolithically perceived Prussian Germany. If this voice embodied what Bruno Nettl refers to as a German-Bohemian culture, resting uniquely both on the inclusive “interaction of Czech and Bohemian cultural and stylistic elements”, and on the fruitful confrontation of “universal” classical style
102
Jeremy Barham
(which Slav musicians did much to establish) with “pure” native folklore (Nettl: 2002, 285), it would explain its demonization at the hands of Fascist exclusivity. Mahler’s embodiment of the empowered Jew of liberal Austria and his apparent desire for the unification of German-speaking lands may ironically have served to increase the perceived value of what was at risk of being lost in the process: the Panslavic search for freedom from Germany, which was itself exclusive in turn, and very much a nineteenth-century political invention. In this way, his music may be said not just to have reflected in general terms the sorrows of an entire world, as Rosenzweig suggests (vii), but more specifically to have encoded the age-old historical tragedy and cultural inferiority complexes of Central and Eastern Europe, the early twentieth-century cultural heart of the continent which had always thrived on its complex racial and cultural impurities and as a consequence had always been on the “wrong side of […] history” (Kundera: 1984, 221). This was a creative achievement which even Nazi propagandists were ultimately powerless to silence.
Bibliography Theodor W. Adorno, Mahler. Eine musikalische Physiognomik, Frankfurt a. M. 1960. Richard Batka, Die Musik in Böhmen, Berlin 1906. Michael Beckerman, In Search of Czechness in Music, in: 19th-Century Music 10/1 (summer 1986), 61–73. Herta Blaukopf (ed.), Gustav Mahler Briefe, Vienna 1996. Herta Blaukopf, Mahler’s First Season as Director at the k.u.k. Hofoperntheater: the Composer Waits in the Wings, in: Jeremy Barham (ed.), Perspectives on Gustav Mahler, Aldershot 2005, 327–44. Kurt Blaukopf, Gustav Mahler und die Tschechische Oper, in: Österreichische Musikzeitschrift 34/6 (1979), 285–88. Carl Dahlhaus, Realism in Nineteenth-Century Music, trans. Mary Whittall, Cambridge 1985. Francesca Draughon/Raymond Knapp, Gustav Mahler and the Crisis of Jewish Identity, in: Echo 3/2 (Fall 2001). Josef Foerster, Poutník v cizinì [Der Pilger in der Fremde], Prag 1947. Peter Franklin (ed.), Recollections of Gustav Mahler by Natalie Bauer-Lechner, London 1980. Mathias Hansen, Zur Funktion von Volksmusikelementen in der Kompositionstechnik Gustav Mahlers, in: Rudolf Pecman (ed.), Hudba slovanských národu a její vliv na evropskou hudebni kulturu [Music of the Slavonic Nations and its Influence upon European Musical Culture], Brno 1981, 381–85. Vladimir Karbusicky, Gustav Mahler und seine Umwelt, Darmstadt 1978. Hellel Kieval, Languages of Community. The Jewish Experience in the Czech Lands, Los Angeles, London 2000. Herbert Killian (ed.), Gustav Mahler in den Erinnerungen von Natalie Bauer-Lechner, Hamburg 1984.
Mahler, Musicological Imperialism and the Decentred Self
103
Dennis Klein, Assimilation and the Demise of Liberal Political Tradition in Vienna: 1860–1914, in: David Bronsen (ed.), Jews and Germans from 1860 to 1933: the Problematic Symbiosis, Heidelberg 1979, 234–61. Ernst Klusen, Gustav Mahler und das böhmisch-mährische Volkslied, in: Georg Reichert/ Martin Just (ed.), Bericht über den Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongress, Kassel 1962, Kassel 1963, 246–251. Karl Michael Komma, Das Böhmische Musikantentum, Kassel 1960. Siegfried Kross, Das “Zweite Zeitalter der Symphonie” – Ideologie und Realität, in: Siegfried Kross (ed.), Probleme der symphonischen Tradition im 19. Jahrhundert. Kongreßbericht, Mainz 1990, 11–36. Milan Kundera, The Tragedy of Central Europe, in: Gale Stokes (ed.), From Stalinism to Pluralism. A Documentary History of Eastern Europe Since 1945, Oxford 1991, 217–23. Henry A. Lea, Mahler: German Romantic or Jewish Satirist?, in: David Bronsen (ed.), Jews and Germans from 1860 to 1933: the Problematic Symbiosis, Heidelberg 1979, 288–305. Arnošt Mahler, Gustav Mahler und seine Heimat, in: Die Musikforschung 25 (1972), 437–48. Gustav Mahler (interview), The Influence of the Folk-Song on German Musical Art, in: The Etude (Philadelphia, May 1911), 301–302. Knud Martner (ed.), Selected Letters of Gustav Mahler, London 1979. Hans Joachim Moser, Die Musik der deutschen Stämme, Stuttgart 1957. Hans Joachim Moser, Musik-Lexikon, Hamburg 1956. Bruno Nettl, Ethnicity and Musical Identity in the Czech Lands: a Group of Vignettes, in: Celia Applegate/Pamela Potter (eds.), Music & German National Identity, Chicago, London 2002, 269–87. Zdeněk Nejedlý, Gustav Mahler, Prag 1912. Rudolf Pecman (ed.), Hudba slovanských národu a její vliv na evropskou hudebni kulturu [Music of the Slavonic Nations and its Influence upon European Musical Culture], Brno 1981. Rudolf Quoika, Über die Musiklandschaft Gustav Mahlers, in: Sudetenland: Böhmen. Mähren. Schlesien. Kunst, Literatur, Volkstum, Wissenschaft 1 (1960), 100–109. Hans Redlich, Gustav Mahler. Eine Erkenntnis, Nürnberg 1919. Alfred Rosenzweig, Gustav Mahler. Neue Erkenntnisse zu seinem Leben, seiner Zeit, seinem Werk, (unpublished MS), London 1945. [Jeremy Barham (ed.), Aldershot, London, 2007]. Jiři Rychetsky, Mahler’s Favourite Song, in: The Musical Times 130 (December 1989), 729. Georgi Schischkoff, Slawische Philosophie und Slawophile Ideologie, in: Kant-Studien 63 (1972), 463–84. Egon Schwarz, Melting Pot or Witch’s Cauldron? Jews and Anti-Semites in Vienna at the Turn of the Century, in: David Bronsen (ed.), Jews and Germans from 1860 to 1933: the Problematic Symbiosis, Heidelberg 1979, 262–87. Richard Specht, Gustav Mahler, Berlin 1913.
104
Jeremy Barham
Die antike Moderne der jüdischen Musik
105
Philip V. Bohlman Rückkehr in die Zukunft – Die antike Moderne der jüdischen Musik
1. Theodor Herzl und die Musik der jüdischen Moderne Durch den herrlichen Raum begannen Gesänge und Lautenspiel zu rauschen. Wundersam ergriffen diese Klänge das Gemüt Friedrichs. Sie trugen ihn zurück in Fernen seines eigenen Lebens und in andere Zeiten Israels. Die Beter um ihn herum singsalierten und murmelten die vorgeschriebenen Worte. Ihm aber kamen schöne deutsche Verse in den Sinn: die „Hebräischen Melodien“ von Heinrich Heine. Da war Prinzessin Sabbath wieder, „die man nennt die stille Fürstin“. Der Tempelsänger hob das alte Lied zu singen an, das in vielen hundert Jahren dem zerstreuten Erdenrunde zu singen, das Lied des edlen Dichters Salomon ben Halevy: „Lecha Daudi Likras Kallo ... “ Und wie es Heine deutsch gemacht: „Komm, Geliebter, deiner harret Schon die Braut, die dir entschleiert Ihr verschämtes Angesicht! “
(Herzl: 1935, 374)
In diesem Augenblick des Schabbatanfangs erreicht die Hauptfigur in Theodor Herzls utopischem Roman aus dem Jahre 1902, Altneuland, das Ziel seines Lebens sowie das Ziel der jüdischen Diaspora. Friedrich Löwenberg betritt den Tempel in Jerusalem im Moment der historischen Allegorie, die sich jeden Freitagabend in jeder Synagoge in allen jüdischen Gemeinden die Geschichte der Diaspora hindurch wiederholt. Altneuland ist ein erdichtetes Werk, aber im Augenblick von Löwenbergs Bewunderung wirkt die Musik des Tempels – die Gesänge sowie das Lautenspiel – als ein Augenblick der Offenbarung und der Transzendenz. Der Tempel ist erfüllt von den Klängen des „alten Liedes“, das die „Prinzessin Schabbath“, Schechina, begrüßt, und durch das traditionelle Singen erscheint das Lied von Heine als jenes alte Lied, nur von „Heine deutsch gemacht“. Die Musik des Tempels in Jerusalem begrüßt Friedrich Löwenberg, der als ehemaliger kosmopolitischer Wiener nach Jerusalem pilgert, um seine Zukunft zu entdecken. In
106
Philip V. Bohlman
Altneuland symbolisiert der Tempel nach wie vor eine moderne Welt, die durch Lieder aus der Vergangenheit neu besungen wird. Am Ende des Gesangs stürzt die moderne Welt von Friedrich Löwenberg und Theodor Herzl jedoch wieder in sich zusammen, weil der Tempel bereits vor fast zwei Jahrtausenden zerstört worden war. 1902 blieb die moderne Welt des Altneulandes fiktiv und konnte nur durch die Verknüpfung von alter und neuer Musik realisiert werden. Ich beginne diesen Essay mit epigrammatischen Anspielungen auf Theodor Herzl, den Schöpfer des Altneulandes, nicht nur weil die 100. Wiederkehr seines Todestages (3. Juli 1904) in den Zeitraum des Symposiums Musik in der Moderne fällt, sondern auch weil Herzls Vorstellung einer jüdischen Moderne insgesamt zum Sinnbild eines Zeitalters geworden ist. Schon zwei Jahre nach dem Erscheinen seines Romans verkörpert dieser sowohl für die zionistische Bewegung als auch für eine jüdische Kultur des 20. Jahrhunderts das Sinnbild einer Kultur, die jüdisch und modern zugleich war. Diese Vorstellung von einer Ganzheit, das heißt die Bedingungen einer gemeinsamen jüdischen Kultur der Moderne, ist in diesem Beitrag zum Symposiumsband besonders wichtig. Wenn ich mich auf den Begriff „jüdische Musik“ beziehe, verwende ich ein Konzept, das Anfang des 20. Jahrhunderts eine breite Bedeutung besaß. Im 19. Jahrhundert war ein so umfassender Begriff kaum zu erkennen. Das Jüdische in der Musik, wenn es existierte, musste an den Gesang und die Instrumentalmusik des zerstörten Tempels in Jerusalem erinnern. Es war eine Musik, die aus Spuren und durch mündliche Überlieferung überlebte. Nur durch die Sammlung und das Zusammenfügen dieser Spuren war es möglich, eine jüdische Musik wieder zu beleben. Gerade aus dieser Wiederbelebung heraus entstand das Altneuland. Die allegorische Wirksamkeit des Altneulandes war bereits zum Zeitpunkt von Herzls Tod erkennbar. Die nachfolgende Abbildung zeigt Herzls Todesanzeige in der 1904 gegründeten Zeitschrift Altneuland. Diese Zeitschrift war zwar politischnationalistisch, aber ihr Inhalt sollte zudem eine Gesamtkultur der jüdischen Moderne stiften: „Auch unser ‚Altneuland‘ verdankt seinen [Herzls] Ideen Ursprung und Namen: denn was unserer Zeitschrift zugrunde liegt, ist die Erfassung des Zionismus als politische Bestrebung, und der Name unserer Zeitschrift entstammt Herzls Werk ‚Altneuland‘, in welchem er das von uns erstrebte Ziel in poetischer Verklärung dargestellt hat“ (Altneuland: 1904, 2).
Die antike Moderne der jüdischen Musik
107
Abbildung 1: Todesanzeige von Theodor Herzl in Altneuland Bd. 1, Heft 7 (Juli 1904)
In diesem Essay beziehe ich mich vor allem auf die „poetische Verklärung“ des Altneulandes sowie auf die Entstehung einer jüdischen Moderne durch die Realisierung einer jüdischen Musik. Die anderen Komponenten des Sinnbildes sind jedoch keineswegs weniger grundlegend. Auf dem Titelblatt des 7. Heftes der Zeitschrift Altneuland wird deutlich, dass dieses Sinnbild auf der Basis von Forschung und
108
Philip V. Bohlman
Wissenschaft aufgebaut wird. Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst sind die modernen Leistungen, durch welche die vereinzelten Spuren der Vergangenheit miteinander verknüpft werden können. Musik wird modern, indem sie das Alte erneuert.
Abbildung 2: Titelblatt von Altneuland Bd. 1, Heft 7 (Juli 1904)
Die antike Moderne der jüdischen Musik
109
2. Das radikale Moment der jüdischen Moderne Die Judaisierung der Welt, die in unserem Jahrhundert kulminiert, besteht in der Durchsetzung jüdischer Kategorien, die auch dann, wenn sie in unorthodoxem, selbst ausgesucht traditionsfernem Gewand erscheinen, doch stets als Abkömmlinge oder Verwandlungen einer ursprünglich auf die biblische Offenbarung zurückgehenden Berufung erkennbar bleiben. (Quinzio: 1995, 14)
Das geistesgeschichtliche Moment, das ich die „jüdische Moderne“ nenne, besteht aus mehreren Strömungen, die zwischen den 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts und den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts zusammenflossen. Einerseits waren es historische Bedingungen, die diese jüdische Moderne bestimmten: In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam es vor allem in Russland und in der Habsburgermonarchie, aber auch in Frankreich und Großbritannien zum Ausbruch eines neuen Antisemitismus. Die Ausgrenzungen und Pogrome setzten Migrationsprozesse in Gang, zunächst in die Metropolen Europas später nach Nord- und Südamerika, sowie nach Palästina. Andererseits wurde die jüdische Moderne durch ihre umgewandelte Diskursgeschichte erkennbar, vor allem durch die Abgrenzung der Kultur und Kunst der Diaspora als spezifisch jüdische Kultur. Für diesen Diskurs der Abgrenzung waren Karl Marx’ Judenfrage und Richard Wagners Schrift über das Judentum in der Musik grundlegend, aber auch Nathan Birnbaums Darstellung einer utopischen „jüdischen Moderne“ um die Jahrhundertwende (z.B. Birnbaum: 1893, 1910) und der dystopische „Jüdische Kulturbund“ der Nationalsozialisten in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts leisteten dazu einen Beitrag. Im Diskurs der Abgrenzung spielte die Musik – die jüdische Musik – eine besonders wirksame Rolle, und zwar paradoxerweise gerade weil heftig und öffentlich debattiert wurde, ob eine jüdische Musik überhaupt existierte. Die Spannungen und Wechselwirkungen solcher Debatten sind für meine Überlegungen hier entscheidend, weil sie einerseits die Kluft zwischen Antike und Moderne konstatierten, andererseits diese Kluft im selben Moment aufhoben. Obwohl sich der Begriff einer jüdischen Moderne keineswegs vereinfachen lässt, sind zwei Thesen der Moderne für meinen Beitrag zum Thema, „Musik in der Moderne“, insbesondere bestimmend. Erstens verwende ich eine theoretische Formulierung der Moderne, die aus Fragmenten entsteht, deren neuer Kontext einen neuen Text produziert. Diese Formulierung eines Verhältnisses zwischen Vergangenheit und Gegenwart ist der Musikgeschichtsschreibung wohl bekannt, zum Beispiel in der Geburt des nationalen Epos aus melodischen Bruchstücken, wie etwa Mitte des 19. Jahrhunderts durch die Erfindung des finnischen Kalevalas
110
Philip V. Bohlman
aus verschiedenen skandinavischen Runen. Zweitens beziehe ich mich auf die unter anderem von John Butt und Richard Taruskin vertretene These (vgl. Taruskin: 1994, Butt: 2002), die besagt, dass die alte Musik nur in der Form einer modernen Bewegung Relevanz erhält. Bei beiden Thesen handelt es sich um die wechselseitige Abhängigkeit von Geschichte und Gegenwart und darüber hinaus um die Historisierung der Vergangenheit beim Aufbau der Zukunft. Als ein radikales Moment der Moderne und als ihr unmittelbares Ergebnis lässt sich die bewusste Wiederherstellung der Formen und Sprachen der Vergangenheit herauskristallisieren, zum Beispiel wenn Ezra Pound um 1908 seine moderne Dichtung aus der poetischen Tradition der provenzalischen Troubadours heraus entwickelt (Rainey: 1999, 35–36). Die Moderne wird erst durch eine zergliederte und neu zusammengefügte Antike vorstellbar und realisierbar. Von vornherein besteht in der Diskursgeschichte der jüdischen Moderne keine Übereinstimmung in Bezug auf das Objekt und den Inhalt der jüdischen Musik. Sprache, Form, Klang, Geschichte, Verhältnis zur Nation oder Religion – jedes musikalische Element wird immer wieder infrage gestellt. Darüber hinaus ist die Musik, die sich im Laufe der jüdischen Moderne herausbildet, einigermaßen außergewöhnlich, weil sie in verschiedenen Sprachen existiert, worunter einige eine jüdische Identität musikalisch stiften können. Etwa das Hebräisch in der synagogalen Musik, ein jiddischer Dialekt in Osteuropa oder die mystische „Wortlosigkeit“ in den melodischen Niggunim – „Gespielten“ – der Chassidim. Einerseits werden die metaphysischen Fragen einer modernen jüdischen Musik aus ästhetischen Perspektiven formuliert, die auf der Musik fußen. Andererseits hängt die musikalische Bedeutung von der Religiosität ab, das heißt davon, inwieweit die jüdische Musik von einer in der modernen Welt bestehenden Volksfrömmigkeit geprägt wird. In den Repertoires und Gattungen, auf die ich mich in diesem Essay beziehe, finden sich verschiedene Hinweise auf den fragmentarischen Charakter der gesamten Diskursgeschichte der jüdischen Moderne. Es war fast nie der Fall, dass die Bestandteile der Geschichte nahtlos zusammenpassten. Aufgrund gewisser Spannungen zwischen den diversen Interpretationen der modernen jüdischen Kultur gab es häufig die Tendenz, Gattungsgrenzen zu überschreiten. Die Fragmente und Bruchstücke wurden meist aus eigentümlichen beziehungsweise einzigartigen musikalischen Zuständen zusammengetragen, sie repräsentierten aber immer historische Fragmente, die für die jüdische Moderne grundlegend sind. Selten beziehen sie sich auf isolierte Prozesse, sondern tragen zum Aufbau des Ganzen bei. Auf diese Weise ergab sich paradoxerweise eine durchgehend immanente Diskontinuität, die sich zum Sinnbild der Moderne entwickelte.
Die antike Moderne der jüdischen Musik
111
3. Technologien der Moderne Der lange historische Weg von der Antike bis zur Moderne entfaltete sich nicht von heute auf morgen, sondern verlangte bewusste Modernisierungsprozesse, die sich im buchstäblichen Sinne als wissenschaftliche Technologie erkennen lassen. Die Musik der jüdischen Moderne wurde mit der allerneuesten Aufnahmetechnologie gesammelt und konnte dadurch einem breiten Publikum vermittelt werden. Vergleichbare Technologien in anderen Wissenschaftsbereichen (z.B. Physik oder Völkerkunde) ermöglichten die erste Generation einer modernen jüdischen Wissenschaft. Durch die Technologien der Moderne offenbarte sich das Verhältnis zwischen Vergangenheit und Zukunft sowie die Ontologie einer musikalischen Identität, deren modernes Gesamtbild aus Bruchstücken entstehen konnte. Denn die Technologien der neuen Ontologie überbrückten die Kluft, die die Antike von der Moderne getrennt hatte. Diese Technologien der Moderne lassen sich drei Prozessen beziehungsweise diskursiven Formen zuordnen, die ich folgendermaßen benenne: 1. Technologien der Repräsentation, 2. Technologien der Reproduktion und 3. Technologien der Historisierung. Bei all diesen Technologien handelt es sich um Aufnahme, Archivierung und Überlieferung der traditionellen jüdischen Musik. Durch die Mittel der Technologie wurde versucht, den öffentlichen Raum für die liturgische Musik oder die Volksmusik – ein Lied, einen Tanz, einen Ritus – zu organisieren und zu strukturieren. Zum Teil wurde ein Repertoire an ein breites Publikum technologisch vermittelt; zum Teil wurde ein Repertoire gespeichert, um es wissenschaftlich analysierbar zu machen. Trotz ihrer Vielfalt können technologische Mittel als eine wesentliche Triebkraft für die jüdische Identität gelten. Unter den Technologien der Repräsentation sind vor allem Technologien der Feldforschung im weitesten Sinn zu verstehen. Am Vorabend der jüdischen Moderne war eine Feldforschung, wie sie im 20. Jahrhundert unternommen wurde, kaum möglich. Die Auswirkung der ersten Walzenaufnahmen war revolutionär. Die Bedeutung der Aufzeichnung und Transkription lag vor allem darin, dass dadurch die Gestalt der musikalischen Objekte normiert werden konnte (vgl. Idelsohn: 1917). Als ein Ergebnis der technologischen Revolution entwickelten sich unzählige Technologien der Reproduktion, die als Mittel der Modernisierung dienten. Um 1880 waren die Reproduktionsmöglichkeiten noch relativ begrenzt; doch schon in den 1930er Jahren waren sie beinahe grenzenlos. Waren die Technologien der Reproduktion im 19. Jahrhundert auf Beiträge in Sammelbänden und Zeitschriften beschränkt, so standen im 20. Jahrhundert durch Schallplatten und Rundfunksendungen ganz andere Möglichkeiten der Verbreitung zur Verfügung. Dadurch
112
Philip V. Bohlman
wurde zum Beispiel die jüdische Volksmusik in den 1920er- und 1930er-Jahren zu einem Weltphänomen: So konnten Volkslieder aus einem Dorf in Osteuropa zur jüdischen Kultur Mitteleuropas, Amerikas und Palästinas beitragen, da die moderne Welt der jüdischen Musik grenzenlos geworden war. Sowohl geografische als auch zeitliche Distanz müssen durch den Diskurs über eine moderne jüdische Musik überbrückt werden. Die Technologien, die solche Überbrückungsfunktionen leisten, sind jene der Historisierung. Im Verlauf der Historisierung eines Repertoires findet ein Austauschprozess statt: Funktionen der Gegenwart ersetzen jene der Vergangenheit. Die Mentalität der Historisierung untermauert die Technologie des musikalischen Denkmals, das ein weiteres Phänomen der Moderne stiftete, wie etwa die zehn Bände des von Abraham Zwi Idelsohn herausgegebenen Hebräisch-orientalischen Melodienschatzes (1914–1932). Durch den Prozess der Historisierung wurde die jüdische Musik der Gegenwart in ein Denkmal verwandelt, das die Aufgabe hatte, an die Antike zu erinnern.
4. Mythos/Geschichte – sakrale Musik/jüdische Musik Die jüdische Moderne ist ein Phänomen der Oberfläche. Den Begriff der Oberfläche verwende ich im Sinne einer Übergangszone, sei es zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, zwischen privatem Raum und Öffentlichkeit oder zwischen dem traditionellen Jüdischen und dem abstrakten Kunstobjekt. Im radikalen Moment der jüdischen Moderne fand eine Umkehrung von Innerem und Äußerem statt, die durch die Wandlungsprozesse auf der Oberfläche vermittelt wurde. Auf der Oberfläche ist das jüdische Kunstobjekt doppeldeutig – noch geistlich, aber schon weltlich. In diesem Sinne fungierte die Oberfläche als ein ästhetischer Knotenpunkt oder Katalysator für die Antike und die Moderne. Eine derartige ästhetische Umwälzung der Oberfläche begegnet uns auch in anderen Bereichen der Moderne, etwa in den flächigen Perspektiven des Kubismus, aus denen heraus sich die abstrakte Kunst entwickelte. Ohne die wiederaufgekommene Vorstellung von der Oberfläche wäre die moderne Kunst undenkbar. In der jüdischen Geschichte sind die ersten Verwandlungen der Oberfläche schon Mitte des 19. Jahrhunderts wahrnehmbar, etwa in der Architektur der kosmopolitischen Synagogen der liberalen reformierten oder neologischen Bewegungen. Die moscheeartigen Synagogen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaut wurden, zeigen sich nach außen mit dekorativen Arabesken und Minaretten, die auf den ersten Blick an den Islam erinnern. Diese Architektur kennen wir von
Die antike Moderne der jüdischen Musik
113
der Synagoge in der Oranienburgerstraße in Berlin sowie von der allergrößten Synagoge Europas, der Synagoge in der Dohánystraße in Budapest. Die Funktionen der Oberflächen dieser Synagogen sind besonders auffallend. Einerseits wird die Synagoge zum Kunstobjekt umgewandelt, wenngleich völlig in der abstrakten Form einer Arabeske, die im traditionellen Sinne bedeutungslos ist – es stehen keine Sprüche aus dem Koran auf solchen Synagogen! Andererseits erhebt die moderne Synagoge den unverkennbaren Anspruch auf eine Öffentlichkeit. Sie stehen in der Oranienburgerstraße oder in der Dohánystraße und gehören dadurch zur modernen Kulturlandschaft der Metropolen. Auf ähnliche Weise fand auf einer symbolischen Oberfläche die Reform der synagogalen Musik statt. Von Anfang an hingen die radikalsten Reformen in der Musik vom Neubau der kosmopolitischen Synagoge im 19. Jahrhundert ab. Salomon Sulzers (1804–1890) musikalische Tätigkeit in Wien war dem Bau und der Vergrößerung des Stadttempels vergleichbar. In Berlin spiegelte Louis Lewandowskis (1821–1894) neu konzipierte und neu komponierte Liturgie die Rolle der Synagoge in der Oranienburgerstraße für die norddeutsche Reformbewegung wider. Die synagogale Musik erwies sich als weitgehend modernisiert, vor allem weil der gemischte Chor und die Mehrstimmigkeit eine zentrale Präsenz gewannen und sich darüber hinaus auch außerhalb der Synagoge in der Öffentlichkeit des 19. Jahrhunderts verbreitete. Die neue Liturgie lässt sich außerdem auch deshalb als modern verstehen, weil sie aus Fragmenten entstand. So umfasste Salomon Sulzers Wiener Ritus, der in den 40er-Jahren des 19. Jahrhunderts als die zwei Bände des Schir Zion veröffentlicht wurde, stilistisch unterschiedlichste Kompositionen, zum Teil auch von Komponisten, die wie etwa Franz Schubert nicht Juden waren (Sulzer: 1941). Bei der Modernisierung der synagogalen Musik spielte der Kantor die allerwichtigste Rolle, und zwar als ein moderner Musiker, dessen Aufgabe in den Formen und Funktionen der Oberfläche lag. Im Vergleich zu seinem Vorläufer, dem chassan, war der Kantor ein Berufsmusiker, der seinen Lebensunterhalt vor allem durch seine musikalische Aktivitäten verdiente. Das Publikum des Kantors setzte sich nicht nur aus der Gemeinde beziehungsweise den Mitgliedern der Synagoge zusammen, sondern seine Musik richtete sich an die gesamte musikalischen Welt des späten 19. und des frühen 20. Jahrhunderts. Die Kunst des Kantors fußte auf einer lokalen Tradition, deren nusach, oder geistliches Kernrepertoire, er fast auswendig vorsingen musste; darüber hinaus beherrschte er auch die Kunst der Improvisation und der Erneuerung. Er war teils Vorbeter, teils Opernsänger. Er sammelte melodische Fragmente, um sie zu neuen Kompositionen zusammenzusetzen. Ende des 19. Jahrhunderts verstand sich der jüdische Kantor als die Hauptfigur der sakralen Moderne (vgl. Bohlman: 1994, Schmidt: 2003).
114
Philip V. Bohlman
5. Ost/West – Raum der Antike/Geografie der Moderne Die Landschaft der Antike sowie jene der Moderne liegt im Osten, denn in der jüdischen Geschichte sind sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft mit dem Morgenland verbunden. Durch den Impuls, sich nach Osten zu richten, ist die jüdische Moderne von einer historischen Doppeldeutigkeit geprägt, die zu einem verstärkten Ineinandergreifen von Vergangenheit und Zukunft führt. Sowohl in der Volksmusik als auch in der Popularmusik lagen die Ursprünge im Osten, das heißt im jiddischen Sprachraum. Es handelt sich um Authentizität sowie um „Jiddischkeit“, das heißt um die weltlichen Formen einer jüdischen Kunst. Die Kultur und die Kunst Osteuropas erwies sich als primitiv wenngleich echt, einfach wenngleich aktuell, traditionell wenngleich sakral. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Osten zum Vorbild des Jüdischen in der Kunst. Der Osten wurde zur Quelle des Orientalismus für eine jüdische Moderne erhoben. Der Orient zeigte sich überall als das Sinnbild der Moderne. Der Orientalismus der jüdischen Moderne manifestierte sich in der Vielfalt der neuen musikalischen Gattungen, die eine neue Präsenz als „jüdisch“ um die Jahrhundertwende gewannen. Anfang des 20. Jahrhunderts befand sich der Bezug auf dem Osten in sprachwissenschaftlichen und ethnologischen Untersuchungen, wie etwa die Forschungen von Friedrich Salomo Krauss, der die Zeitschrift AmUrquell in den 1890er Jahren in Wien gründete. 1901 wurde die Berliner jüdische Zeitschrift, Ost und West, veröffentlicht, die sich als „eine illustrierte Monatsschrift für modernes Judentum“ reklamierte, und deren Umschlag und Titelblatt mit Jugendstilgrafik von E. M. Lilien auszeichnete (s. Brenner: 1998, 42). Der Orient zeigte sich überall als das Sinnbild der Moderne. Dieser Orientalismus findet sich auch in zahlreichen musikalischen Repertoires und Gattungen der Jahrhundertwende. In diesem Essay möchte ich nur auf eine einzige Musikpraxis hinweisen, die zur Zeit der Moderne zum Vorschein kam, und zwar die Popularliedtradition der jüdischen Kleinkunstbühne. Von vornherein waren solche Lieder das Ergebnis der Einwanderung von osteuropäischen Juden in die Metropolen Mitteleuropas – Wien, Berlin, Prag usw. Die Lieder stellen eine Vielfalt von Traditionen dar, teilweise Volkslieder und Popularlieder in mündlicher Überlieferung, teilweise Flugblätter und Gelegenheitsrepertoire. Die Sinnbilder des Ostens und die Bedeutungen der Moderne wirken darauf vielfältig und widerspruchsvoll. In dem „Jüdischen Schaffnerslied“ (Abbildung 3) geht es beispielsweise um einen naiven Tunichtgut, der aus seinem Dorf in der Slowakei nach Großwardein im Osten fahren will, aber die Bahnrichtung verwechselt, und stattdessen in Wien ankommt (s. Bohlman und Holzapfel: 2001).
Die antike Moderne der jüdischen Musik
Abbildung 3: „Das jüdische Schaffnerslied“ (Wiener Flugblatt, Jahrhundertwende)
115
116
Philip V. Bohlman
6. Ikonen/Repräsentation – Ontologie des jüdischen Kunstobjekts Der Kulturkampf, der um die Jahrhundertwende nach einer allgemeinen Musik der Moderne strebte, verlangte neue Formen der Repräsentation, die sowohl die Symbole des traditionellen Jüdischen als auch die Zeichen des modernen Europäischen umfassten. Bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts ergab sich eine Form dieser zwiespältigen Repräsentation in der jiddischen Literaturbewegung Osteuropas. Schriftsteller dieser Bewegung wie Isaac Leib Peretz oder Scholem Aleichem stellten in ihren Werken eine ländliche Dorfkultur dar, deren fiktive Einwohner mit dem Modernisierungsdruck sowie mit der nichtjüdischen Welt außerhalb ihrer Dörfer konfrontiert wurden. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde der Kulturkampf zwischen dem Jüdischen und dem Modernen zu einem Konflikt zwischen Ost und West, in dem zwei jüdische Lebenswelten Europas aufeinanderprallen: die eine jiddischsprachig und auf die Vergangenheit bezogen, die andere deutschsprachig und auf die Gegenwart bezogen. Die Kluft zwischen diesen beiden jüdischen Lebenswelten, die Schriftsteller wie Karl Emil Franzos und Leopold von SacherMasoch in ihren Texten thematisierten (vgl. Hermand: 1987), stellt nicht nur die Grundlage der Diskursgeschichte der jüdischen Moderne dar, sondern bestimmt darüber hinaus auch die postmoderne jüdische Identität im „Neuen Europa“, weil die nach dem Holocaust wiederentdeckte jüdische Volksmusik zu einem Sinnbild für das Verhältnis zwischen Ost- und Mitteleuropa geworden ist. Die jüdische Volksmusik repräsentiert ein ideales Beispiel für den Umgang mit jüdischer Kultur auf dem Weg in die Moderne. Nachdem die jüdische Volksmusik zunächst im Zuge der Migration der osteuropäischen Juden in die urbanen Zentren zu einem Opfer des stattfindenden Akkulturationsprozesses geworden war, stieg nun ihr Wert erneut und führte zu umfangreichen Sammelaktionen und zur Wiederentdeckung ihrer traditionellen Funktionen. Ihre Andersartigkeit beziehungsweise der Orientalismus der osteuropäischen Musik sollte durch die Übertragung einen gesellschaftlichen Wandel bewirken. Die neu gesammelten Volkslieder wurden auf Jiddisch, das heißt in einer fremden Sprache gesungen und die Instrumentalmusik war durch weltliche Funktionen und sakrale Riten bestimmt, die in Mitteleuropa unbekannt oder vergessen waren. Die Volksmusik der „anderen Juden“ verlangte ein erneutes und vor allem ein leidenschaftliches Engagement für diese fremde Kultur, um sie sich zu eigen zu machen. Wie wird die Moderne in diesem Kulturkampf repräsentiert? Wodurch wird die Moderne in einem Kunstobjekt, insbesondere in einem jüdischen Kunstobjekt repräsentiert? Ich möchte diese Fragen am Beispiel der Liedersammlung Lieder des Ghetto, die bis 1902 in mehreren Auflagen erschienen war (Rosenfeld: 1902),
Die antike Moderne der jüdischen Musik
117
verdeutlichen, und ihren Bezug zur Moderne beziehungsweise ihr Reagieren auf die Modernität untersuchen. Hinter der feierlichen Ergriffenheit in Morris Rosenfelds Liedern und dem Jugendstil in Ephraim Moses Liliens Zeichnungen steckt eine tiefe Ironie, die einen unmittelbaren Einfluss und eine weite Verbreitung der Lieder ermöglicht. In dieser Sammlung von teils gedichteten, teils mündlich überlieferten jiddischen Liedern, die ins Deutsche übertragen wurden, findet eine Auseinandersetzung zwischen einem romantisch verklärten Bild vom osteuropäischen Ghetto und einer sozialkritischen Darstellung des aktuellen Ghettos der modernen osteuropäischen Diaspora statt. Diese Auseinandersetzung erweist sich als Konflikt zwischen zwei Welten: dem Osteuropa der jüdischen Tradition und dem Westeuropa beziehungsweise Amerika der Moderne. Gerade durch die Auswanderung nach Amerika kam es zu einer massiven Zerstörung und Zerstreuung der osteuropäischen Kultur. Elend und Feierlichkeit stehen in den Liedern des Ghettos in Konkurrenz zueinander. Die romantische Sehnsucht nach dem untergegangenen Ghetto der osteuropäischen Dörfer, das nicht weiter existieren konnte, führt zu einer positiv verklärten Schilderung der Vergangenheit mit zahlreichen jüdischen Zügen. Daraus folgt aber auch, dass das in den Liedern dargestellte neue Ghetto als ein Ort der größten Tragödie erscheint und als solcher Einfluss auf die Kulturgeschichte der jüdischen Moderne gewinnt. Die neuen Ghettos sind nicht mehr ländliche, traditionsbezogene Dörfer, sondern urbane Ghettos in europäischen oder amerikanischen Großstädten, die durch eine gemeinsame städtische Kultur der Moderne gekennzeichnet sind. Im deutschen Sprachraum wirkte Rosenfelds Sammlung als einr Art „Exotisierungsmittel“, das zu einem erheblichen Anstieg ostjüdischer Kultur führte. Die Lieder des Ghetto wurden zu einem Standardwerk der Belletristik und der musikalischen Rekonstruktion Osteuropas. Ihre herausragende Stellung in der Diskursgeschichte der jüdischen Moderne bezieht sich auf diese kulturhistorische Rolle. Wenn das osteuropäische Ghetto auch eine Welt von Gestern ist, so überleben dessen Lieder dennoch als Denkmäler, die in der gegenwärtigen Welt von Berlin oder Warschau daran erinnern. Die Ironie der Lieder des Ghetto zeigt sich darin, dass die Lieder und Zeichnungen als Sinnbilder gleichzeitig romantisch und vergangenheitsbezogen wie aktuell und modernitätsbezogen sind. Die jiddische Belletristik der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist mit einer ähnlichen romantischen Ironie erfüllt. Morris Rosenfeld gehört damit einer Generation an, die eine Brücke von der ersten Etappe der jiddischen Literaturgeschichte – Scholem Aleichem, Mendele Mocher S’forim, J.L. Perez – zur nationalistisch-zionistischen Schule schlägt. Bei Ephraim Moses Liliens Zeichnungen in der Sammlung lässt sich die Kunst des Zionismus
118
Philip V. Bohlman
Abbildung 4: Sinnbild von Herzl bei der Erschaffung der Musik (Rosenfeld: 1902, 113)
Die antike Moderne der jüdischen Musik
119
am deutlichsten erkennen (Berkowitz: 1990). Die Kunst des Zionismus und die der Jahrhundertwende greifen zu einem bestimmten Augenblick ineinander, woraus die prägnante Macht solcher Sinnbilder in der europäischen Gesellschaft auch ohne besonderen Bezug zum Zionismus entstand. In Lieder des Ghetto geht es auch um die Frage nach der Authentizität der jüdischen Kultur in einer modernen Welt. Die Suche nach Authentizität verlangt ein Erlebnis von Schmerz und Elend. Auf diese Weise erlangt der Herausgeber eine Zeitlosigkeit, die dazu beiträgt, sich eine jüdische Welt vor beziehungsweise außerhalb der modernen Geschichte vorzustellen. Zeitlosigkeit und Romantik fließen durch die jüdischen Volkslieder. Authentisch heißt demnach: aus dem jüdischen Daseinskampf stammend. Das europäische Judentum und die kosmopolitische Moderne der Jahrhundertwende sind in Morris Rosenfelds Lieder des Ghetto Synonyme. Darüber hinaus sollten Lieder des Ghetto als ein Präzedenzfall dienen, der in der jüdischen Moderne einen Wegweiser und Wendepunkt markiert. Diese Gegebenheiten lassen sich erkennen, wenn wir die Sinnbilder in Lieder des Ghetto mit jenen der von Zionismus geprägten Zeitschrift Altneuland vergleichen.
7. Musik in der Moderne der Heimatlosen. DER HERR: Und gerade das Reisen könnte so schön sein. Draußen jagt die Landschaft vorüber. Wie gut, dass man weitereilen darf. Es wird einem so wohl ums Herz. Gedanken, zusammenhanglos, hoch und fröhlich ziehen durch die Seele, wie der Vogelschwarm da oben durch den blassen Himmel. Dann fehlt nur eine Frau, der man es sagen kann. Aber sie muß sehr stolz, sehr zart, sehr unnahbar sein, und sie muß die Melodie fühlen können, die man in ihr erklingen macht. FÜRSTIN: Wer sind Sie? ... DER HERR: ... Ich war der Windstoß, der über eine Harfe strich.
(Herzl: 1900, 433–434)
Dieser Beitrag zum Verständnis der Musik in der jüdischen Moderne hat epigrammatisch begonnen, und er wird epigrammatisch enden. Die Zitate am Anfang und am Schluss erinnern an das Vorübergehende in der Moderne, das durch die Zeitlosigkeit und Ortlosigkeit der jüdischen Moderne geprägt wird, und zwar durch das Sinnbild des Reisens: die Diaspora. Das erste Zitat oben stammt aus dem abschließenden Dialog eines Theaterstücks – einer Skizze für die Kleinkunstbühne – von Theodor Herzl, an dessen Todestag vor hundert Jahren wir uns im Sommer 2004 erinnerten. Herzl thematisierte das Reisen in der jüdischen Geschichte als eine Rückkehr in die Vergangenheit, die durch eine Rückkehr – nach Israel – im Laufe
120
Philip V. Bohlman
Abbildung 5: „Schema Jisrael“, 1. Erscheinung in Arnold Schönbergs A Survivor from Warsaw, Op. 46
Die antike Moderne der jüdischen Musik
121
der Zukunft möglich werden würde. Das Wortspiel erwies sich als ein Zeitspiel, das sich janusköpfig zeigt. Es ging um die Einigkeit des Zeitpunktes, den man als die Moderne erfahren sollte, und gerade diese Einigkeit ist in der Reihenfolge der „Schema-Tonreihe“ in Arnold Schönbergs A Survivor from Warsaw immanent. Schema Jisrael, Adonoi elohenu, Adonoi echad! Höre Israel, der Ewige, unser Gott, ist ein einiges, ewiges Wesen!
Das Ziel zum Schluss der historischen Reise ist die Einigkeit, und die ist in Schönbergs Tonreihe zu finden. Das „Schema“ verkörpert musikalisch in der Einstimmigkeit der Rezitation das Traditionelle sowie durch die Zwölftontechnik die Moderne. Auf diese Weise erreicht man das gemeinsame Ziel: die Reise in die Ewigkeit. In diesem Essay ergab sich eine Vielfalt von musikalischen Metaphern, die ich zu Sinnbildern einer jüdischen Moderne verwandelte. Ich gebe zu, dass die Einigkeit der Sinnbilder nicht unmittelbar offenkundig ist. Ich gebe zu, dass ich die alte Streitfrage über die Identität der jüdischen Musik noch nicht ein für allemal entschieden habe. Entscheidend ist jedoch, dass sich im Laufe der jüdischen Moderne eine Vielfalt von musikalischen Sinnbildern verbreitete, wodurch die Moderne auch die Antike umfassen konnte. Dadurch wurde die historische Reise in die Diaspora demontiert und stattdessen zu einem Aufbruch in die Zukunft. Am Ende der historischen Reise, die in den Vorabend des Holocaust mündet, bildet der Glaube an eine Musik, die als jüdisch, ewig und einig verstanden wurde, die Grundlage einer Musik der jüdischen Moderne. Am 100. Todestag von Theodor Herzl würde es sich lohnen, diese antike Moderne der jüdischen Musik, wenngleich in einem utopischen Altneuland unseres Jahrhunderts, noch als realisierbar wahrzunehmen.
122
Philip V. Bohlman
Literatur Altneuland – Monatsschrift für die wirtschafltiche Erschließung Palästinas 1 (1904), Heft 7. Michael Berkowitz, Art in Zionist Popular Culture and Jewish National Self-Consciousness, 1897–1914, in: Richard I. Cohen (Hrsg.), Art and Its Uses: The Visual Image and Modern Jewish Society, New York, Oxford 1990 (Studies in Contemporary Jewry, 6), 9–42. Nathan Birnbaum, Die nationale Wiedergeburt des jüdischen Volkes in seinem Lande, als Mittel zur Lösung der Judenfrage, Wien 1893. Nathan Birnbaum, Ausgewählte Schriften zur jüdischen Frage, Czernowitz 1910. Philip V. Bohlman, Auf der Bima/auf der Bühne – Zur Emanzipation der jüdischen Popularmusik um die Jahrhundertwende in Wien, in: Elisabeth Th. Hilscher, Theophil Antonicek (Hrsg.), Vergleichend-systematische Musikwissenschaft. Beiträge zu Methode und Problematik der systematischen, ethnologischen und historischen Musikwissenschaft, Tutzing 1994, 417–449. Philip V. Bohlman, Otto Holzapfel, The Folk Songs of Ashkenaz, Middleton 2001 (Recent Researches in the Oral Traditions of Music, 6). David A. Brenner, Marketing Identities. The Invention of Jewish Identity in Ost und West, Detroit 1998. John Butt, Playing with History. The Historical Approach to Musical Performance, Cambridge 2002. Jost Hermand (Hrsg.), Geschichten aus dem Ghetto, Frankfurt a. M. 1987. Theodor Herzl, Der Judenstaat. Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage, Leipzig, Wien 1896. Theodor Herzl, Im Speisewagen, Wien 1900. Nachdruck in: Theodor Herzl, Gesammelte zionistische Werke, Bd 5, Berlin 1935, 421–435. Theodor Herzl, Altneuland, Berlin 1902. Nachdruck in: Theodor Herzl, Gesammelte zionistische Werke, Bd 5, Berlin 1935, 125–420. Abraham Zwi Idelsohn, Hebräisch-orientalischer Melodienschatz, 10 Bde., Berlin u.a. 1914– 1932. Abraham Zwi Idelsohn, Phonographierte Gesänge und Aussprachsproben des Hebräischen der jemenitischen, persischen und syrischen Juden, Wien 1917. Sergio Quinzio, Die jüdischen Wurzeln der Moderne, übersetzt von Martina Kempter, Frankfurt a. M. 1995. Lawrence Rainey, The Cultural Economy of Modernism, in: Michael Levenson (Hrsg.), The Cambridge Companion to Modernism, Cambridge 1999, 33–69. Morris Rosenfeld, Lieder des Ghetto, übersetzt von Berthold Feiwel, mit Zeichnungen von Ephraim Moses Lilien, Berlin, Wien 1902. Esther Schmidt, From the Ghetto to the Conservatoire. The Professionalisation of Jewish Cantors in the Austro-Hungarian Empire (1826–1918), Dissertation, Oxford 2003. Arnold Schönberg, A Survivor from Warsaw, Op. 46, Hillsdale 1949. Salomon Sulzer, Schir Zion, gottesdienstliche Gesänge der Israeliten, Wien 1841. Richard Taruskin, Text and Act. Essays on Music and Performance, New York, Oxford 1995.
Der Erste Weltkrieg und die Musikhistorische Zentrale
123
Eva Maria Hois Der Erste Weltkrieg und die Musikhistorische Zentrale beim k. u. k. Kriegsministerium* Im ausgehenden 19. Jahrhundert, als der Nationalismus überall in Europa mehr und mehr erstarkte, war es in der Donaumonarchie noch nicht gelungen, bei den verschiedenen Nationen auch ein Bewusstsein für eine übernationale Identität herauszubilden. Das war – auch trotz der durchaus positiv verlaufenen Staatsbildung – ein schwieriges Unterfangen, bestand die k. u. k. Monarchie doch aus elf höchst unterschiedlichen Volksstämmen mit verschiedenen Verfassungen, geografischen Bedingungen wie ökonomischen Entwicklungsstadien, mit kulturellen Gegensätzen, Religionen, Sprachen und Mentalitäten (Hanisch: 1994, 154). Kontextabhängige Mehrfachidentitäten waren durchaus üblich; das Österreichische, das als das übernationale Element und einheitliche Idee hätte angesehen werden können, war nicht eindeutig definiert und kaum ausgeprägt. Diese gesellschaftspolitische Situation spiegelte sich natürlich auch in der politischen wider: Auf der einen Seite standen die Verfechter des Nationalstaates, die die Monarchie aufgrund des Völkergemisches nicht für lebensfähig hielten – der Südslawenführer Anton Trumbič sprach beispielsweise von einem „Völkerkerker“, der Wiener Sozialdemokrat Fritz Adler von einem „stinkenden Feudalstaat“ (zitiert nach Magenschab: 1988, 14). Andererseits gab es die Befürworter von Vielvölkerstaat und Pluralismus, die die gegebenen multinationalen und -kulturellen Strukturen als Herausforderung und Chance für diese zentraleuropäische Region schätzten und die Monarchie sogar als eine „Lebensnotwendigkeit […] für die innere Freiheit der Menschen und der Völker“ (Lux: 1915, 20) ansahen. Deswegen hielten sie auch ihr weiteres Bestehen für gewährleistet. Dieses Gedankengut fand sich nicht nur bei Angehörigen der vorherrschenden deutschsprachigen Volksgruppe, sondern wurde auch in anderen Nationen vertreten. „Wahrlich, existirte der österreichische Kaiserstaat nicht schon längst, man müßte im Interesse Europas, im Interesse der Humanität selbst sich beeilen, ihn zu * Dieser Aufsatz beinhaltet Forschungsergebnisse aus meiner Dissertation „Ein Kultur- und Zeitdokument ersten Ranges“. Die Soldatenliedersammlung der Musikhistorischen Zentrale beim k. u. k. Kriegsministerium im Ersten Weltkrieg. Geschichte – Dokumente – Lieder, die im Herbst 2007 am Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien eingereicht wurde.
124
Eva Maria Hois
schaffen“ (Palacký: 1866, 83), meinte etwa der tschechische Historiker und Politiker František Palacký (1798–1876). Selbstverständlich war auch das Herrscherhaus auf eine gewisse übernationale Einheitlichkeit unter Beibehaltung der nationalen Eigenheiten bedacht und unterstützte in diese Richtung gehende Bestrebungen. Da das Reich aber aufgrund der unterschiedlich gewachsenen und strukturierten Kronländer auf der politischverfassungsmäßigen Ebene kaum vereinheitlicht werden konnte, wurde versucht, dies vor allem auf wirtschaftlicher und kultureller Ebene zu tun (Csáky: 1996, 174). Und so sollten „durch Geselligkeit, Sprachkenntnisse, Kongresse, Kunst- und Kulturpflege, vor allem aber durch praktische Arbeit, Wirtschaftsorganisation und Hilfsbereitschaft“ eine übernationale Annäherung der Völker und die „Bekämpfung und Abschaffung des nationalen Übereifers und der Vorurteile“ (Lux: 1915, 146) erreicht werden.
Das Volksliedunternehmen Ein Beispiel für die Förderung der Einheitsidee auf kultureller Ebene ist das großangelegte Sammelprojekt Das Volkslied in Österreich. 1904 kam es im Rahmen der damaligen Kunstsektion des Unterrichtsministeriums zur Gründung des sogenannten Volksliedunternehmens, des Vorläufers des heutigen Volksliedwerkes, das eine repräsentative Ausgabe der Volkslieder aller ethnischen Gruppen der Donaumonarchie – außer in Ungarn, wo es ein eigenes Sammelprojekt gab –, getrennt nach Völkern und Nationen und geschrieben in der jeweiligen Landessprache, herausgeben wollte. Die Vorbereitungen dafür liefen ab 1902 gemeinsam mit der erst im Jahr davor gegründeten Universal Edition-Aktiengesellschaft, die nicht nur die Idee dazu hatte, sondern die Bände auch herausgeben sollte. Unterstützt wurde das Vorhaben vom Kaiserhaus wie vom k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht, dessen Vertreter, Minister Wilhelm Ritter von Hartel (1839–1907), das Unternehmen für höchst „förderungswürdig“1, hielt. Denn dieses „erste wissenschaftliche Werk großen Stils, aus dem man ein wahres klares Bild der volksmäßigen Musikausübung wird gewinnen können“ – so Hartel –, sollte „auch den Zweck verfolge[n], die Völker einander näher zu bringen“2 und damit zum Frieden innerhalb der k. u. k. Monarchie beitragen. Außerdem sollte damit ebenfalls ein 1 Allgemeines Verwaltungsarchiv im Österreichischen Staatsarchiv (AVA), k. k. Ministerium für Kultur und Unterricht, Faszikel Nr. 3269/1520526 vom 24. Juni 1902. 2 Protokoll der Sitzung des leitenden Hauptausschusses des Volksliedunternehmens vom 6. Mai 1918, Zentralarchiv des Österreichischen Volksliedwerkes, Dokumentenmappe Dok. 2, o. Nr.
Der Erste Weltkrieg und die Musikhistorische Zentrale
125
Beitrag zum „geistigen“ Heimatschutz geleistet und mittels konstruierter Traditionen und Erinnerungen ein Gegenpol zur Kultur der „Moderne“ installiert werden. In allen Kronländern wurden Arbeitsausschüsse eingerichtet, Material wurde zusammengetragen, teilweise analysiert und für die Editionen vorbereitet. 1917 wurden bereits elf Bände als druckfertig bezeichnet, 1918 sollte ein Ankündigungsband erscheinen.3 Doch mit dem Kriegsende und dem Zusammenbruch der Donaumonarchie kam auch das (vorläufige) Ende für das Volksliedunternehmen.
Der Erste Weltkrieg Viele Anstrengungen wurden unternommen, der Donaumonarchie einen inneren Zusammenhalt, eine übernationale Identität zu geben. Forciert wurden diese Bestrebungen vor allem auch noch dann, als das Reich schon seinem Untergang entgegensah, der wohl durch nichts mehr aufzuhalten war, also während des Ersten Weltkriegs. Dieser löste zu Beginn wahre Begeisterungsstürme, eine Massenhysterie und den Höhepunkt des österreichischen Patriotismus wie auch Chauvinismus aus, vor allem auf kulturellem Gebiete – kaum jemand blieb davon verschont. Auch so manche Künstler gaben beredtes Zeugnis und zogen mit wehenden Fahnen in den Krieg. Für die Masseneuphorie und das Eintreten für eine Hegemonie der deutsch-österreichischen Kultur mögen folgende Zeilen aus einem Vortrag über Soldatenlieder und Kriegsgesaenge von Karl Jäger und Karl Kronfuß aus dem Jahre 1914 sprechen: Aus allen Gauen […] strömten unsere Soldaten zusammen. […] Mit Lächeln, mit einem Liede auf den Lippen marschierten sie ergreifend in der restlosen Selbstverständlichkeit mit der sie Weib und Kind und Haus und Hof verlassen. Und wieder ist es Musik, die auch mit diesen Scenen eng verwoben uns erscheint […]. Das „Heil dir im Siegerkranz“ greift uns beinahe so ans Herz wie unser „Gott erhalte“. – „Ich hatt einen Kameraden, einen bessern findst du nit!“ Das alte Lied hat tiefen Sinn bekommen und getrost dürfen wir dem Ende dieses fürchterlichen Krieges entgegensehen. Wir werden nicht die Welt erobern, aber deutscher Geist wird der Welt seinen Stempel geben (Jäger/Kronfuß: 1914, 53–56).
Und Bernhard Paumgartner schrieb einige Jahre später in einem Zeitungsartikel, in dem er vor allem das Volkslied würdigte, das die Soldaten als „etwas viel Besseres“ 3 Ein von Walter Deutsch und Eva Maria Hois bearbeiteter und kommentierter Nachdruck dieses „Ankündigungsbandes“ von 1918 mit dem Titel Das Volkslied in Österreich. Volkspoesie und Volksmusik der in Österreich lebenden Völker erschien anlässlich des 100. Geburtstages des Österreichischen Volksliedwerkes im November 2004 in Wien als Sonderband der Reihe Corpus Musicae Popularis Austriacae.
126
Eva Maria Hois
als die eigens geschaffenen Kunstlieder, „Heiliges unverrückbar und unverlierbar in ihren Herzen“ tragen: „Uns gingen die Augen über,“ sagte der Offizier, [der nach einer siegreichen Schlacht seine Soldaten singen hörte,] „denn wir wußten in diesem Augenblicke, daß wir, unsere Heimat, unsere Kinder, unsere Kultur nie und nimmer unterliegen konnten, so sicher, als wir Goethe und Beethoven, den ,Faust‘ und die Neunte Symphonie besitzen. Nie ward mir unsere Kraft bewußter als an diesem Abend“ (Paumgartner: 1918b, 1).
So wurde der „Große Krieg“ zu dieser Zeit nicht nur als Schrecken und Zerstörer gesehen, ihm wurden auch „positive“ Seiten zugeschrieben, etwa eine reinigende Kraft und ein neues Wertebewusstsein, aber auch das wieder erstarkte Singen, das als Selbstbesinnung auf die Kraft des eigenen Volkstums sowie als moralisch-sittlichkultureller Kampf gegen Verfremdung und schädliche Einflüsse von außen angesehen wurde. Denn, wie Guido Adler (1855–1941) schrieb, „Musik ist die Seele der Kultur. […] Sie spiegelt das Weltbild am reinsten und klarsten wider. Sie begleitet den Menschen, der Tonsinn hat, in allen Lebenslagen und ist auch sein Genosse im Kampf wie im Frieden“ (Adler: 1915, 1f.).
Die Musikhistorische Zentrale Die massive Österreichpropaganda, die vor allem 1915, als der Name „Österreich“ für die westliche Reichshälfte staatsrechtlich fixiert wurde, begann, wurde hauptsächlich für den Zweck der Kriegspropaganda und des gesamtstaatlichen Bewusstseins eingesetzt (Hanisch: 1994, 156f.). Die Kriegsbegeisterung innerhalb der Bevölkerung ging trotzdem bald zurück, Niederlagen, Tod, Hunger, Seuchen, Elend und Verzweiflung traten an die Stelle der einstigen Euphorie. Von offizieller Seite wurde aber nichts unversucht gelassen, nicht nur gegen die Feinde von außen, sondern auch im Inneren für die Idee der übernationalen und multikulturellen Monarchie zu kämpfen. Hier sollte nun auch das Volkslied einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten, und so kam es 1916, zu einer Zeit, als Polarisierung, Radikalisierung und Totalisierung zuungunsten integrativer Bestrebungen innerhalb der Donaumonarchie immer stärker wurden (Rauchensteiner: 1994, 371), zur Gründung der Musikhistorischen Zentrale beim k. u. k. Kriegsministerium. Diese dem Wissenschaftlichen Komitee für Kriegswirtschaft angeschlossene Institution (Geschäftseinteilung: 1917, 20)4 wurde damit beauftragt, monarchieweit Soldatenlieder zu sammeln. Die Sammlung unter den Soldaten entsprach einer wohlüberlegten Förderung 4 Siehe auch: Kriegsarchiv im Österreichischen Staatsarchiv (KA) – Armeeoberkommando/Kriegspressequartier (AOK/KPQu), Karton 1/7.
Der Erste Weltkrieg und die Musikhistorische Zentrale
127
eines Gemeinschaftsgefühls unter den kämpfenden Truppen, denn das Heer war ebenso wie die Schule (Hobsbawm: 1996, 137) im Bewusstsein der Regierenden jener Bereich, der zur Ausprägung einer gemeinsamen Identität im Sinne der supranationalen Identität der Habsburgermonarchie dienen sollte. Das Militär war eine der wenigen Institutionen, wo Angehörige verschiedener Nationen aufeinander trafen und sich so kennen- und verstehenlernen konnten (Lux: 1915, 145). Die militärisch strenge Organisation erleichterte es, Soldaten für eine derartige Sammlung heranzuziehen. Zugleich sollte diesem Berufsstand und seinen „heldenhaften Taten“ ein Denkmal gesetzt sowie auf die Bedeutung einer solchen Sammlung auch für Friedenszeiten hingewiesen werden: Die heldenmütigen Leistungen der Truppen in diesem Kriege machen es uns zur Pflicht, Erscheinungen des Soldatenlebens, wie unter anderem das Soldatenlied, in welchem sich das Denken und Fühlen des Soldaten während dieser großen Zeit so vielfach ausgesprochen hat, zukünftigen Geschlechtern zu bleibendem Gedenken aufzubewahren.5
Mit der Leitung der Soldatenlieder-Sammelaktion wurde Bernhard Paumgartner (1887–1971) betraut,6 ein studierter Jurist, der auch musikwissenschaftliche Vorlesungen bei Guido Adler gehört hatte und ein gut ausgebildeter Musiker und Dirigent war. Seit 1915 befand er sich im Militärverband, im Oktober 1917 wurde er zum Direktor des Mozarteums in Salzburg7 berufen, wozu er auch die Genehmigung des Kriegsministeriums erhielt;8 die Leitung der Musikhistorischen Zentrale lag weiterhin in seinen Händen. Paumgartner kann als österreichisch Fühlender und zugleich übernational Denkender apostrophiert werden, eine Lebenseinstellung, die vermutlich auf seine Zeit als Zögling der k. u. k. theresianischen Akademie in Wien zurückgeht, wo das Zusammenleben sowie das Mit- und Voneinanderlernen von Angehörigen verschiedener Nationalitäten praktiziert wurde. In seinen aus der zeitlichen Distanz vermutlich etwas verklärenden Worten klingt das wie folgend: Solange die alte, österreichisch-ungarische Monarchie bestand – und noch darüber hinaus –, hat das Theresianum die Gedanken und Traditionen, die es ins Leben riefen, getreu bewahrt. Es waren die Grundgedanken jenes Österreichertums, die seine Existenz im hohen europäischen Sinne rechtfertigten. Denn in diesem Reich – und in seinem kleinen Spiegelbild, dem Theresianum – hat sich von seiner Gründung bis zur Untergangskatastrophe das in engerem 5 KA – k. k. Ministerium für Landesverteidigung (K.k.M.f.LV) Mil 1916 27 Abt. II, Nr. 6706 präs. 21. Dezember 1916. 6 KA – Musikhistorische Zentrale (MHZ), Karton 99, Nr. 98. 7 Paumgartner hatte diese Stelle bis 1938 und von 1945 bis 1959 inne, er war auch an der Gründung der Salzburger Festspiele beteiligt und Präsident des Direktoriums von 1960 bis 1971. 8 KA – MHZ, Karton 99, Nr. 418.
128
Eva Maria Hois
Maße erfüllt, was Europa sein könnte und sollte: ein friedsam fruchtbares Zusammensein aller seiner Völker. Wir Zöglinge des Theresianums entstammten, wie wir verschiedenen Ständen, der Aristokratie, doch auch dem Bürgertum angehörten, allen Nationen der alten österreichisch-ungarischen Monarchie. Aber niemals sind uns diese Tatsachen als etwas Trennendes bewußt geworden, sondern immer nur als ein gemeinsam in uns Wirkendes, Verbindendes, ein herrliches Geschenk der Einmütigkeit in der Vielfalt des Reiches […]. Wir selbst, menschliche Abbilder dieses Reiches, wir verehrten unsere Vorfahren in den verschiedenen Nationen dieses unseres Vaterlandes. Wir waren stolz darauf, daß die Mischung deutschen, slawischen, ungarischen oder italienischen Bluts in vielen von uns die Quelle besonderer Anlagen oder Begabungen war (Paumgartner: 1969, 34f.).
Wer in einem so vielfältigen wie anregenden und kreativen Milieu aufwachsen durfte, konnte das „Fremde“, „Andere“ wohl zeit seines Lebens besser respektieren und verstehen, es als gleichberechtigt wie auch befruchtend und bereichernd ansehen. Diese Geisteshaltung wurde auch in Paumgartners Tätigkeit als Musikreferent des Kriegspressequartiers und später als Leiter der Musikhistorischen Zentrale, die angeblich auf seine Initiative zurückging, spürbar, wo er sich ja nicht nur auf die Sammlung deutschsprachiger Lieder beschränkte, sondern die Lieder aller Nationen miteinbezogen wissen wollte: Während des Weltkrieges leitete ich Aufbau und Organisation der Volksliedsammlung in unserer Armee. Der Grundgedanke dieser umfassenden Aufsammlung stammte von mir. Lange Zeit vorher war ich mit der Sammlung und Wiedergabe von Volksliedern beschäftigt gewesen. Plötzlich kam mir nun der Gedanke, in unserer so vielsprachigen Armee aus dem Chaos des Krieges wenigstens so viel zu gewinnen, daß eine kulturelle Wirkung davon auch in aller Zukunft zu erwarten wäre (Paumgartner: 1969, 72).
Die notwendige „Hilfe von oben her“ holte er sich direkt vom Leiter des Generalstabs, Franz Graf Conrad von Hötzendorf (1825–1925), der ihm auf seine Erklärungen hin gesagt haben soll: „Na, so machen ’s Sie ’s halt!“ (Paumgartner: 1969, 72). Laut einem Akt aus dem Landesverteidigungsministerium vom 13. Dezember 1916 wurde Bernhard Paumgartner vom Kriegspressequartier des Armeeoberkommandos bereits im Juli 1916 mit der Sammlung von Soldatenliedern an der Front betraut, um „dieses in patriotischer, künstlerischer und ethnographischer Hinsicht äusserst wertvolle Material vor Vergessenheit zu bewahren“.9 Zugleich wurde eine ähnliche Aktion für ungarische Lieder im Hinterlande eingeleitet. Ein Ergebnis dieser ersten Sammelarbeit waren die vier Soldatenliederhefte, die 1917 von Paumgartner herausgegeben wurden. Daran waren schon Karl Kronfuß, Konrad Mautner, Viktor Zack und Raimund Zoder beteiligt, die später auch in der Musikhistorischen Zentrale mitarbeiteten (Paumgartner: 1916/1917). 9 KA – K.k.M.f.LV. Mil 1916 27, Abt. II, Nr. 6706, 21. Dezember 1916.
Der Erste Weltkrieg und die Musikhistorische Zentrale
129
Aus demselben Akt geht auch hervor, dass aufgrund der hohen Bedeutung des Materials beim Kriegsministerium die Absicht bestand, eine Soldatenlieder-Zentrale einzurichten, „um einen reichen Schatz an patriotischen und künstlerischen Werten zu sammeln und zu bewahren“. Außerdem sollte das Ministerium für Kultus und Unterricht das Volksliedunternehmen zur Mitarbeit veranlassen. Paumgartner wäre dort zum die Soldatenlieder betreffende Leiter zu ernennen und darüber hinaus in den Hauptausschuss zu berufen.10 Zu einer offiziellen Zusammenarbeit mit dieser Institution kam es zwar nicht, wohl aber gab es Kontakt zu einzelnen Mitarbeitern des Volksliedunternehmens. Einer der führenden Mitarbeiter dieses Unternehmens, der Gymnasialprofessor und Reichsratsabgeordnete Josef Pommer (1845–1918), berichtete in der von ihm gegründeten Zeitschrift Das deutsche Volkslied über die Soldatenliedersammlung: Musikhistorische Zentrale … ein fürchterlicher Name, aber für eine gute Sache! Die Arbeit dieser musikalischen Sammelstelle ist, wie man uns schreibt, eine sehr ergiebige. […] Die verschiedenen, mit der Sammlung namentlich von Soldatenliedern und von im Kreise der Soldaten Gesungenem (was nicht ein und dasselbe ist) betrauten Offiziere und Mannschaften gehen in ganz erstaunlich kluger Weise auf Ansinnen und Wünsche der Leitung ein (Pommer: 1918a, 33).
Pommer kündigte außerdem eine eigene Soldatenliedersammlung des Volksliedunternehmens an, für die angeblich auch schon gearbeitet wurde. Auch der Gründer des Deutschen Volksliedarchivs, John Meier (1864–1953), stand in Briefkontakt mit Paumgartner und der Musikhistorischen Zentrale, um genaue Informationen und Unterlagen über die österreichische Sammelaktion einzuholen,11 denn offensichtlich war auch für das deutsche Heer eine ähnliche Aktion geplant, die aber aufgrund des Kriegsendes nicht mehr durchgeführt wurde. Das k. u. k. Kriegsministerium betrachtete diese Sammlung als ein „Kultur- und Zeitdokument ersten Ranges“12 und machte sich rasch an deren Verwirklichung. Zu den in der Musikhistorischen Zentrale angestellten Sammlern gehörten unter anderem der Musikhistoriker und Sänger Heinrich Knöll, der Industrielle und Volksliedforscher Konrad Mautner (1880–1924), der Musikwissenschafts- und Kompositionsstudent Felix Petyrek (1892–1951), der Musikschriftsteller Alfons Török, Maximilian Morberger sowie der Tanzforscher und Lehrer Raimund Zoder (1882–1963).13 10 KA – K.k.M.f.LV. Mil 1917 27, Abt. IIIu, Nr. 37, 26. Jänner 1917. 11 KA – MHZ, Karton 99, Nr. 127, 153, 308 und nicht nummeriert (2). 12 KA – MHZ, Karton 99, Nr. 126. 13 KA – MHZ, Karton 99, Nr. 107.
130
Eva Maria Hois
Etwas später kamen die beiden Kompositionsstudenten Alois Hába14 (1893–1973) und Wilhelm Grosz15 (1894–1939) hinzu. Paumgartner beschäftigte vermutlich ihm bekannte oder befreundete Musiker und Volksliedforscher. Teilweise hatten sich diese schon vorher als Liedersammler bewährt; manche von ihnen wurden durch Dritte vermittelt. Im Nachlass Felix Petyreks etwa erhielt sich ein Brief, aus dem hervorgeht, wie dieser Komponist und Student der Musikwissenschaft Mitarbeiter der Musikhistorischen Zentrale wurde. Er war in St. Andrä in der Nähe von Gleinstätten im steirischen Sausal in einem Lager für russische Kriegsgefangene stationiert und hatte begonnen, sowohl Volkslieder aus der Gegend als auch Lieder der Gefangenen aufzuzeichnen,16 wodurch Zoder auf ihn aufmerksam geworden sein dürfte, der ihn an Paumgartner weiterempfahl. Auf eine briefliche Einladung hin schickte Petyrek als Nachweis für seine bisherigen Arbeiten den ersten Bogen der von ihm gesammelten Sausaler Lieder17 an Paumgartner. Mancher Mitarbeiter mochte, wie etwa der Fall des Einjährig Freiwilligen Wilhelm Grosz zeigte, durchaus auch mit dem Hintergedanken von der Musikhistorischen Zentrale beschäftigt worden sein, ihn vor einem Frontdienst zu bewahren: Wilhelm Grosz würde sich für die angesprochene Verwendung bestens eignen, da er nicht nur sehr musikalisch, sondern als Kompositionsschüler der k. k. Akademie f. Musik u. darst. Kunst in Wien und Mitglied des Musikhistorischen Institutes der k. k. Universität die nötigen [sic!] theoretische Vorbildung in vollstem Maße besitzt. Da der Bittsteller sich im Augenblicke als Rekonvaleszent im Rek[onvaleszenten] Heim […] befindet und vorl[äufig] auf 2 Monate für eine Verwendung bei der Armee im Felde nicht in Betracht kommen kann, beantrage ich, daß […] Grosz schon jetzt der Propaganda Gruppe des K.P.Qu. [Kriegspressequartiers] zugeteilt und mir zur Hilfsdienstleistung beigegeben werde.18
Alois Hába hingegen bot seine Dienste selbst an, mit dem Hinweis, musikalisch ausgebildet zu sein und sich schon früher mit dem Volkslied, seiner Aufsammlung und Erforschung beschäftigt zu haben.19 Er war bereits zuvor vom Militärkomman-
14 KA – MHZ, Karton 99, Nr. 385. 15 KA – MHZ, Karton 99, Nr. 355 und 372. 16 „Vor Beendigung meiner Studien eingerückt, war ich fast vier Jahre Soldat (1915–1918). Diese Zeit brachte mich mit dem Volkslied in Berührung. Ich sammelte zahlreiche deutsch-österreichische und slavische, vor allem russische, polnische, ukrainische Lieder.“ Zitiert nach Lisa Mahn: Felix Petyrek. Lebensbilder eines „vergessenen“ Komponisten, Tutzing 1998 (Publikationen des Instituts für österreichische Musikdokumentation, 23), S. 96. 17 Ein Auswahl dieser von Petyrek gesammelten Lieder wurde veröffentlicht in: Hois: 1999. 18 KA – MHZ, Karton 99, Nr. 355. Brief Paumgartners an das Kriegspressequartier. 19 KA – K.k.M.f.LV Mil 1917 27, Abt. I, Nr. 20719, Präs. 12. November 1917.
Der Erste Weltkrieg und die Musikhistorische Zentrale
131
do Wien im Zuge der Fragebogenaktion der Musikhistorischen Zentrale als Sammler gemeldet worden.20
Abbildung 1: Mitarbeiter der Musikhistorischen Zentrale: 1. Raimund Zoder, 2. Konrad Mautner, 3. Felix Petyrek, 4. Heinrich Knöll, 5. Maximilian Morberger, 6. Alfons Török, 7. Wilhelm Grosz. Aufgenommen von Franz Löwy. Volkskultur Niederösterreich – Niederösterreichisches Volksliedarchiv NÖVLA BA 1481.
Wichtige Mitarbeiter für den ungarischen Teil der Sammlung waren Zoltan Kodály (1882–1967) und Béla Bartók (1881–1945),21 die sich beide schon ab 1905 mit der Sammlung, Archivierung und Bearbeitung von Volksmusik beschäftigt hatten. Mit Bartók stand Paumgartner in einem regen Briefkontakt und besprach viele die Sammlung betreffende Angelegenheiten.22 20 KA – MHZ, Karton 99, Nr. 162. 21 KA – MHZ, Karton 99, Nr. 206 und 411. 22 KA – MHZ, Karton 99, Nr. 110, 206, 326, 345, 407, 436 und 488; aus dem verschollenen Material von 1918 Nr. 1, 24, 115, 136, 137 und 141.
132
Eva Maria Hois
Vor allem Bartók ist in diesem Zusammenhang sehr interessant, entwickelte er sich doch von einem nationalistischen Denker und Volksliedsammler, geprägt von der Vorstellung der Hegemonie der eigenen Nation, hin zu einem, der den völkerverbindenden Wert der Volksmusik erkannte. Erklärte er noch 1903: „Was mich betrifft, so werde ich in meinem ganzen Leben, auf jedem Gebiet und auf jede Weise ein Ziel verfolgen: der ungarischen Nation, der ungarischen Heimat zu dienen“ (Bartók zit. nach Szabolcsi: 1957, 20), so schrieb er am 10. Januar 1931 in einem Brief an den rumänischen Ethnografen Octavian Beu: Meine eigentliche Idee, deren ich – seitdem ich mich als Komponist gefunden habe – vollkommen bewußt bin, ist die Verbrüderung der Völker, eine Verbrüderung trotz allem Krieg und Hader. Dieser Idee versuche ich – soweit es meine Kräfte gestatten – in meiner Musik zu dienen (Bartók zit. nach Szabolcsi: 1957, 265).
Nun hielt er eine „internationale Zusammenarbeit“ gerade auf dem Gebiet der Volksmusikforschung nicht nur für „wünschenswert“, sondern sogar für „dringend erforderlich“ (zitiert nach Szabolcsi: 1957, 197), da es für das Verständnis der eigenen Musik und Kultur wichtig sei, auch jene anderer Völker zu kennen (Szabolcsi: 1957, 25). Diesen Gedanken hatte ganz ähnlich bereits Joseph August Lux in seinem 1915 erschienen Buch Der österreichische Bruder formuliert: „Man lernt das Eigene nicht so recht kennen und schätzen, wenn man nicht auch das Fremde kennt.“ (Lux: 1915, 17). Sammlerlegitimationen erhielten unter anderem auch die beiden bedeutenden steirischen Volksliedforscher, der Lehrer Viktor Zack (1854–1939) und der Volkskundler Viktor von Geramb23 (1884–1958), der Musikhistoriker Hugo Robert Fleischmann, der Lehrer und Volkskundler Hans Commenda (1889–1971) sowie der Jurist und Volksliedforscher Georg Kotek24 (1889–1977). Die Musikhistorische Zentrale hatte darüber hinaus Kontakte zum Phonogrammarchiv der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften,25 wo in den Jahren 1914 bis 1916 auf Anregung des Kriegsministeriums durch Leo Hajek (1886–1975)26 eine Soldatenliedersammlung mittels Phonogramm- und Grammophonplatten angelegt wurde (Hajek: 1916).27
23 KA – MHZ, Karton 99, Nr. 61. 24 KA – MHZ, Karton 99, Nr. 376. 25 KA – MHZ, Karton 99, Nr. 258. 26 Der Physiker Leo Hajek, seit 1912 Assistent im Phonogrammarchiv und um die Weiterentwicklung des Aufnahmetechnik bemüht, leitete diese Institution von 1928 bis 1938. 27 Dieses Material wurde im Jahr 2000 bearbeitet und herausgegeben: Schüller: 2000.
Der Erste Weltkrieg und die Musikhistorische Zentrale
133
Abbildung 2: Mitarbeiter der Musikhistorischen Zentrale (v.l.n.r.): Raimund Zoder, Heinrich Knöll, Felix Petyrek, Konrad Mautner. Karikatur von Hans Konheisner. Zentralarchiv des Österreichischen Volksliedwerkes C 1302.
134
Eva Maria Hois
Neben deklarierten Volksliedforschern oder Volkskundlern wurden für die Sammel aktion also auch junge Komponisten und Musikwissenschaftler herangezogen, die, wie die Franz Schreker-Schüler Petyrek, Grosz und Hába, der Moderne zugerechnet werden, und bei denen von vorneherein wohl keine Nähe zur Volkskunst vermutet wird. Hier ist besonders Felix Petyrek hervorzuheben, der sich Zeit seines Lebens mit dem Volkslied auseinandersetzte und nicht nur traditionelle Bearbeitungen schuf, sondern Volksmusik auch als Grundlage für seine Kompositionen heranzog (Hois: 2001, 239–262). In seinem Nachlass finden sich außerdem einige ausführliche Berichte zu dem von ihm gesammelten Liedgut. Trotz der heftigen offiziellen Kriegspropaganda bemühte sich Petyrek stets um Objektivität. Er verfiel niemals in den damals so weit verbreiteten chauvinistischen und nationalistischen Tonfall, wenn es darum ging, andere Völker – im vorliegenden Fall den russischen „Feind“ – und deren Volksmusik zu beschreiben, und wurde so zum Vertreter einer „pluralistischen“ Denkweise: Wer Russen singen gehört hat, weiß, daß dieses Volk keineswegs so barbarisch und roh ist, als man es namentlich zu Anfang des Krieges gemeiniglich ausgeschrieen [sic!] hat. Wer erst eine größere Zahl aus dieser unübersehbaren unerschöpflichen Menge kennen lernt, wer sich mit ihnen beschäftigt, der findet immer Neues und Schönes an ihnen (Petyrek: o.J.a).
Zu slawischen Völkern und deren Musik schien Petyrek immer ein besonderes Nahverhältnis gehabt zu haben, das vermutlich auf seine Zeit als Wachsoldat in einem Kriegsgefangenenlager für russische Soldaten in der Südsteiermark zurückgeht. Dort begann er nicht nur mit dem Sammeln von slawischer wie steirischer Volksmusik, sondern zeigte auch großes Interesse an den Menschen. Manche der von ihm beforschten russischen Kriegsgefangenen wurden erst zugänglich, als er ihnen erlaubte, sozialistische Lieder zu singen (Petyrek: o.J.b). Aufgrund „zu menschenfreundlicher Behandlung russischer Kriegsgefangener“ (Petyrek: o.J.c) musste er sich vor einem Brigadegericht in Wien verantworten. Gesammelt wurden nicht nur Lieder aus Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch Militärmusik, Signale, Pfeifermusiken sowie „kulturhistorisch interessante Äußerungen des Soldatengeistes, welche mit den Volksliedern eng verknüpft sind“ (Paumgartner: 1918a, 29), also Zeugnisse des Aberglaubens, Soldatensprüche, Bräuche, Scherze, Reime, Rätsel, Briefe und dergleichen mehr. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Volksmusik, wobei in der Instruktion zur Sammlung der Soldatenlieder genau angegeben wurde, was darunter zu verstehen sei. Hier wird deutlich, wie nah verwandt die Ideen und Ansprüche der Musikhistorischen Zentrale denen des Volksliedunternehmens waren. So zeigen die Ansichten über das Entstehen des Volksliedes eine Übereinstimmung mit den Theorien Josef Pommers:
Der Erste Weltkrieg und die Musikhistorische Zentrale
135
Jedes Soldatenlied, nicht nur alte, neuere und neueste Soldatenlieder im eigentlichen Sinne, sondern auch jedes Volkslied, das ohne spezifisches Soldatenlied zu sein, in Soldatenkreisen üblich ist, ist in die Sammlung einzubeziehen. Kunstlieder, d. h. solche Lieder, welche von Komponisten in literarischer Ansicht geschaffen sind und durch den Druck Verbreitung gefunden haben, sind nur aus statistischen Gründen namhaft zu machen. […] Unter Volkslied im eigentlichen Sinne des Wortes sind solche Lieder verstanden, welche im Volke entstanden sind und bei demselben von Mund zu Mund fortgepflanzt und gesungen werden. Lieder volkstümlichen Charakters, welche von Dichtern und Komponisten in literarischer Absicht kunstmäßig erzeugt wurden und in das Volk eingedrungen sind, sind als volkstümliche Lieder zu betrachten.28
Für die Sammlung wurden verschiedene Methoden eingesetzt: Mitarbeiter wurden ausgeschickt, um Material in Bibliotheken zu sichten sowie im Hinterland bei den Ersatztruppen und dann auch an der Front Soldaten zu befragen. Schließlich kam es auch zu einer groß angelegten Fragebogenaktion: An jeden Ersatztruppenkörper wurde ein Fragenkatalog ausgeschickt, die Truppen hatten musikalisch gebildete Sammler wie Musiker und Lehrer zu melden, die jeweils vor Ort die Befragung durchzuführen und den Fragebogen auszufüllen hatten. Über diesen schrieb Pommer, es sei „das Netz dieser Fragen […] so engmaschig, daß sich in ihm selbst beim schlechtesten Willen und Können des Antwortgebers immer noch wertvoller Stoff verfangen müsste“ (Pommer: 1918a, 33). Um ganz sicherzugehen, wurde ein ausgefüllter Musterfragebogen erstellt,29 der zusammen mit den noch auszufüllenden Fragebögen verschickt wurde. Presseaufrufe führten zu einer regen Beteiligung der Bevölkerung, aus allen sozialen Schichten und aus allen Teilen der Monarchie wurden Volksliedaufzeichnungen, gedruckte Liedersammlungen, Zeitungsausschnitte, Briefe oder eigene Dichtungen und Kompositionen eingeschickt. Jacob Kunz, der Besitzer einer Kaffee-Großrösterei in Wien, war einer der Einsender und schrieb ganz im Sinne der übernationalen und völkerverbindenden Idee der Musikhistorischen Zentrale an dieselbe: Ich erlaube mir infolge der durch die Reichspost erfolgten Einladung das im September 1914 von mir verfasste Lied „Die Donau Wacht“ zu übersenden. Es ist sehr schön vertönt [sic!] und geeignet, das Zusammengehörigkeitsgefühl der verschiedenen Völker Oesterreichs zu beleben und zu vertiefen. Das war der leitende Gedanke für die Entstehung dieses Liedes.30
Gerade die Mitarbeit der „einfachen Bürger“ wurde vonseiten der Musikhistorischen Zentrale sehr geschätzt und auch dementsprechend gewürdigt; die der „gebildeten 28 KA – K.k.M.f.LV Mil 1916 27, Abt. II, Nr. 6706, präs. 21. Dezember 1916. 29 Ein Exemplar hat sich in der Sammlung Kotek im Zentralarchiv des Österreichischen Volksliedwerkes erhalten. 30 KA – MHZ, Karton 99, Nr. 34, Brief vom 10. Mai 1917.
136
Eva Maria Hois
Kreise“ wurde als selbstverständlich vorausgesetzt. Über die rege Beteiligung der Soldaten war man ebenfalls hoch erfreut, waren ihre Einsendungen auch nicht „besonders schön in Form und Ausstattung“, da sie „oft in Unterständen und Schützengräben unter vielfach widrigen Verhältnissen ausgeführt und […] auf mühselig zusammengesparten Papierstückchen, Zeitungsschleifen etc. niedergeschrieben“ wurden. Doch „gerade diese […] Gruppe von Einsendungen zeugt […] für den großen Idealismus und vaterländischen Geist unserer Truppen im Felde“.31 Auch Institutionen wie die Hof-, die Universitäts- und die Stadtbibliothek sowie das Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde wurden um ihre Mitarbeit ersucht beziehungsweise sollten ihre Unterlagen zur Verfügung stellen.32 Guido Adler vom Musikhistorischen Institut der Universität etwa sicherte der Musikhistorischen Zentrale seine Unterstützung zu.33 Gesammelt werden sollte in allen Teilen der Monarchie, was aber nicht immer und überall Begeisterung hervorrief. Manchmal kam es sogar zu recht heftiger nationalistischer Kritik, was etwa aus dem folgenden Zeitungsartikel aus Ungarn hervorgeht: Dass das gemeinsame Kriegsministerium […] auch der ungarischen Soldatenpoesie Schutz und Aufmerksamkeit schenkt, ist sehr schön von ihm. Jedoch können wir schwer die Zweckmäßigkeit einer solchen gemeinsamen Sammlung einsehen, wo doch einerseits in Ungarn die berufensten Gelehrten, Ethnographen, Folkloristen die Werke der Volksdichtkunst seit Beginn sammeln und unsere Soldatenlieder auch methodisch aufarbeiten; andererseits sehen wir in der Organisation einer Zentrale des Kriegsministeriums nicht die Garantie für eine genügende Gründlichkeit und Sachverständnis […]. Die Arbeit des Sammelns und methodischen Aufarbeitens der ungarischen Soldatendichtkunst betrachten wir als rein ungarische wissenschaftliche Aufgabe und nicht als gemeinsame Angelegenheit (Budapesti Hirlap: 1917).34
Die Sammelaktion stieß auch auf andere Widerstände und Schwierigkeiten, wovon unter anderem Bartók ausführlich berichtete.35 Manche Truppenteile konnten keine geeigneten, musikalisch ausgebildeten Sammler finden, andere wiederum machten die Meldung, die Sammlung sei bei ihnen negativ verlaufen, was meist auf eine inhomogene, aus Angehörigen verschiedener Nationen zusammengesetzte Mannschaft oder häufigen Mannschaftswechsel zurückgeführt wurde. Auch erhielten die Soldaten kaum eine Belohnung für ihre Mithilfe, mussten aber ihre Freizeit dafür 31 KA – MHZ, Karton 99, Nr. 126. 32 KA – MHZ, Karton 99, Nr. 28. 33 KA – MHZ, Karton 99, Nr. 64. 34 KA – MHZ, Karton 99, Nr. 286. 35 Alle folgen Zitate stammen aus KA – MHZ, Karton 99, Nr. 206.
Der Erste Weltkrieg und die Musikhistorische Zentrale
137
opfern und waren deshalb oft nicht sehr angetan von diesem Unternehmen. Außerdem ermüdeten manche von ihnen rasch und wollten dann nicht mehr vorsingen: „Zu einer physischen Leistung kann man die Soldaten zwingen, doch zum Gesang – nur eine kurze Weile.“36 Zum Teil mangelte es auch vonseiten der Vorgesetzten am Verständnis für die Liedersammlung. So beanstandete ein Oberstleutnant das Vorhaben mit den Worten: „Ich kann gar nicht begreifen, wie man in solchen Zeiten derartiges fordern kann. Jetzt! Singen!“37 Oft war den Soldaten das Singen während der Arbeitszeit auch verboten.38
Das Konzert Die Musikhistorische Zentrale präsentierte sich einer breiten Öffentlichkeit in einem Konzert im großen Wiener Konzerthaussaal am 12. Jänner 1918. Dieses hatte einen historischen und einen „zeitgenössischen“ Teil, in welchen die nicht deutschsprachigen Lieder eingebaut wurden. So erklangen nach einem Prolog unter anderem Landsknechtlieder aus der Zeit Maximilians, Prinz Eugen-Lieder, Militärmärsche aus Maria Theresias Herrschaftsjahren sowie ungarische und österreichische Soldatenlieder aus der jüngeren Vergangenheit. Die meisten Bearbeitungen stammten von Mitarbeitern der Musikhistorischen Zentrale. Ausführende waren die Bläservereinigung der k. k. Hof oper unter Karl Stiegler, der Wiener Männergesangverein, Maria Jeritza und Hans Duhan, ein Deutschmeisterorchester, Ferencz von Székelyhidy sowie Béla Bartók und Felix Petyrek am Klavier. Das Konzert „zu Gunsten der Witwen und Waisen österreich. u. ungar. Soldaten“ stand unter der Patronanz Kaiser Karl I. und wurde von Kaiserin Zita mit einer großen Gefolgschaft besucht (Historisches Konzert: 1918, 12).39 Es war auch in finanzieller Hinsicht ein großer Erfolg (Pommer: 1918b, 58). Große Aufmerksamkeit wurde der Gestaltung des Programmheftes gewidmet, das von der Kritik als Publikation gewürdigt wurde, der eine „über den Abend weit hinausreichende wissenschaftliche und bibliophile Bedeutung zukommt“ (Neue Freie Presse: 1918, 10). Neben allen Liedertexten, einigen Melodien und Abbildungen enthielt es auch mehrere Aufsätze. Schon deren Titel zeugen vom breit gestreuten Interesse der Musikhistorischen Zentrale wie vom Bemühen, neben den Deutschen 36 KA – MHZ, Karton 99, Nr. 206. 37 Brief von Bartók an Paumgartner vom 4. 8. 1917, KA – MHZ, Karton 99, Nr. 206. 37 KA – MHZ, Karton 99, Nr. 206. Brief von Bartók an Paumgartner vom 4. 8. 1917. 38 Siehe unter anderem KA – MHZ, Karton 99, Nr. 170, 246, 253 und 398. 39 KA – MHZ, Karton 99, Nr. 373.
138
Eva Maria Hois
auch Slawen und Ungarn gleichberechtigt mit einzubeziehen.40 Petyreks Aufsatz Ueber das Soldaten-Volkslied der Slawen sei hervorgehoben, weil er die multikulturelle Situation gut beschrieb, die auf die Angehörigen verschiedener Nationen höchst befruchtend wirken konnte: Die gegenwärtige Zeit ist mehr als irgend eine geeignet, Volkslied und Volksbräuche der zahlreichen Volksstämme der österreichisch-ungarischen Monarchie kennen zu lernen. […] Leute aus den entferntesten und abgeschiedensten Gegenden des Reiches kommen mit einem Male in die Großstädte und Sammelstellen. Der Umstand, daß sie auf ihre Heimat nicht vergessen können und ihrer in jeder Feierstunde gedenken, führt von selbst zu einer innigen Pflege von Volkslied und Volksbräuchen. Angehörige der verschiedenen Nationen finden sich zu kameradschaftlichem Leben zusammen. Es kommt vor, daß Soldaten eines Stammes Weisen eines anderen übernehmen, neue Texte unterlegen und bei ihren Volksgenossen weiterverbreiten. So stammt beispielsweise die Melodie des bei den Deutschen ungemein verbreiteten und beliebten Soldatenvolksliedes „Die Nachtpatrouille“ von einem tschechischen Gassenhauer. Solche Wechselbeziehungen, die wir selbst zwischen Deutschen, Türken, Bulgaren [also den Mittelmächten] feststellen können, sind natürlich unter den Völkern der österreichisch-ungarischen Monarchie besonders zahlreich. Trotzdem bewahrt jeder Volksstamm seine Eigenart, sowohl musikalisch als inhaltlich (Petyrek: 1918, 44f.).
Die Reaktionen auf die Veranstaltung fielen unterschiedlich aus: Eine der Konzertkritiken erschien in der Zeitschrift Das deutsche Volkslied. Josef Pommer, Gründer und Herausgeber dieser Zeitschrift, der das Konzert nicht besuchen konnte, informierte sich darüber durch drei Briefe. Wie zu erwarten, kritisierte er, der Vertreter des „Echten und Wahren“, vor allem die „modernen“ Volksliedbearbeitungen: „Man hat aus Volksliedern sezessionistisch-impressionistische Paraphrasen, Phantasien gemacht“, schreibt er [der eine Briefschreiber, ein Komponist], „die Orchestertechnik Mahlers und Strauß’, die Klaviertechnik Regers und Schönbergs gegen die armen Volkslieder losgelassen. Selbst die Neue Freie Presse hat es hinterher gewagt, ein schüchternes, abwehrendes Wort zu sagen“ (Pommer: 1918b, 59).
Dort hieß es nämlich: Sei gleich vorausgeschickt, daß selbstverständlich nicht das Soldatenlied, wie es als Volkslied gesungen wurde und gesungen wird, vorgeführt wurde, sondern durchwegs in kunstmäßigen, es also dem Kunstlied annähernden Bearbeitungen. Darin steckt das Problematische aller historischen Konzerte (Historisches Konzert: 1918, 12). 40 U. a. Béla Bartók, Die Melodien der madjarischen Soldatenlieder; Hanns Commenda, Vom Soldatenlied; Josef Pommer, Ueber den Juchezer; Heinz Knöll, Das Klagelied auf den Tod des Grafen Nicolaus von Serin (Niklas Graf von Zrinyi); Konrad Mautner, Über Prinz Eugen-Lieder; Raimund Zoder, „Schön ist die Jugend“.
Der Erste Weltkrieg und die Musikhistorische Zentrale
139
Etwas später werden aber die „effektvollen“ und „fast modern anmutenden“ Bearbeitungen durchaus gelobt. Der Kritiker beschrieb die einzelnen Stücke recht genau, sprach einmal von einem „launigen echten Volkston“, dann wieder von einer „kunstreichen Fassung [von Wilhelm Grosz], die […] beinahe ganz den Volksliedcharakter eingebüßt“ hat, dann wieder von einem „echten Volkslied in Melodie und Rhythmus“. Wesentlich differenzierter und positiver fiel die Konzertkritik im Fremden-Blatt aus, die vor allem die Tatsache schätzte, dass keine „gedankenlos jubilierenden“ oder „ruhmredigen“ Soldatenlieder vorgetragen wurden, denn „man hätte diese Art im vierten Kriegsjahr nicht leicht ertragen“. Danach ging der Autor auch auf das Wesen des Soldatenliedes ein, das er deutlich von kriegerischen Gelegenheitsdichtungen unterschied: Mag es nun deutsch oder ungarisch, polnisch oder böhmisch sein, immer ist dies Lied der wirklich Kämpfenden von der Melancholie des nahen Todes überschattet, immer ist sein bester Herzenston ernst, voll Sehnsucht nach dem Leben und voll Liebe zum Dasein. Auch die Heiterkeit klingt da von einem ernsten Seelengrund auf und auch der frischeste Jugendmut ist ohne bitteren Haß, ohne Feindseligkeit und von feierlichem, fast möchte man sagen, sittlichem Bewußtsein der Gefahr erfüllt. Diese Lieder sind nicht kunstmäßig, nicht auf den Vortrag und nicht auf die Applauswirkung gestellt; sie sind überhaupt nicht darauf gestellt, daß Einer sie zum „Besten“ gibt, ein anderer sie genießend anhört. Sie sind vielmehr die unbewußte Zwiesprache, die der Soldat nur sich selbst hält. Monologe der Volksseele, in einsamer Stunde, draußen im Feld, fern von der Heimat laut geworden und verhallend. Wenn sie im Konzertsaale ertönen, erscheint der laute Beifall beinahe als eine leere Konvention, die zu solcher Naturwüchsigkeit nicht recht passen will. Deshalb erscheint es auch äußerlich, von dem äußeren Erfolg dieses Abends zu sprechen. Seine innere Wirkung war eine ungewöhnlich große (I. B.: 1918, 2).
Dieses Konzert blieb nicht die einzige Veranstaltung der Musikhistorischen Zentrale, es folgten unter anderem Aufführungen in Linz und Salzburg41 am 17. Mai sowie am 29. August 1918 in Baden (Soldatenlieder-Konzert: 1918).42 Letzteres brachte im ersten Teil eine Zusammenfassung der Stücke des Wiener Konzertes vom 12. Jänner, im zweiten Teil aber „Alte Tänze und Soldatenvolkslieder aus Niederösterreich“, war also weitaus volkstümlicher gehalten als die erste und vermutlich größte Veranstaltung. Daneben wurde auch im Rahmen der Österreichischen Bühne in Wien ein „Soldaten-Volksliederabend“ gegeben, der „durchwegs einfache Volkslieder zur Aufführung brachte und daher ungleich mehr volkskundlichen Wert hatte als die große Veranstaltung“ (Soldaten-Volkslieder-Aufführung in der „Österreichischen 41 KA – MHZ, Karton 99, verschollenes Material von 1918, Nr. 156, 171, 175 und 298. Alle Akten datieren aus April und Mai 1918. 42 Dieses Konzert wird in den Unterlagen des Kriegsarchivs nicht erwähnt; die Akten ab Mai 1918 fehlen hier aber alle.
140
Eva Maria Hois
Bühne“: 1918, 107). Hier wurden auch die fremdsprachigen Lieder in der jeweiligen Landessprache gesungen. Im zweiten Teil dieses Konzertes wurde auf der Bühne eine Wirtsstube nachgebildet; die Sänger trugen nun auch die zu den vorgetragenen Stücken passenden historischen Kostüme und Trachten. Zum Budapester Konzert43 vom 26. Mai 1918 ist zu bemerken, dass Béla Bartók seine Mitarbeit aufkündigte, nachdem hier keine deutschen Soldatenlieder gesungen werden sollten: Das Kriegsministerium hat die Absicht, das Wiener Festkonzert hier in Budapest zu wiederholen. Budapester „maßgebende“ Kreise haben sich dahingehend geäußert, daß in Budapest ausschließlich nur ungarische Lieder gesungen werden dürfen! Darüber war wiederum das Kriegsministerium, das mich mit der künstlerischen Leitung des Budapester Konzerts betraut hatte, empört. Ich hatte nämlich in Wien erklärt, daß man hier auch einige österreichische Lieder vortragen könne – schon allein wegen der Gegenseitigkeit – und so könnten von ungarischer Seite slowakische und rumänische, eventuell auch kroatische Lieder neben den ungarischen auf das Programm gesetzt werden. Sollten die Budapester meinen Vorschlag bezüglich des Programms nicht annehmen, dann ziehe ich mich lieber von der ganzen Angelegenheit zurück. […] Hier handelt es sich nämlich um das Vortragen von Soldatenliedern der Armee, was übrigens auch der Titel des Konzerts ist, also ist es unmöglich und widerspricht jedem Gefühl von Recht, die Nationalitäten einfach mit Stillschweigen zu übergehen (Brief Béla Bartóks an János Buşiţia vom 28. Januar 1918. In: Béla Bartók Briefe 1, 178–179).
Das Ende der Musikhistorischen Zentrale Was mit der Musikhistorischen Zentrale und ihren Beständen nach Beendigung des Ersten Weltkrieges genau passiert ist, kann wohl nicht mehr mit Bestimmtheit festgestellt werden, da alle Unterlagen aus dem Jahr 1918 fehlen und selbst der Elench der Musikhistorischen Zentrale, das Akteneingangsbuch, nur bis Anfang Mai vorhanden ist. Paumgartner meinte, die einzelnen Nachfolgestaaten hätten sich ihre Bestände gesichert. Für Ungarn habe er das selbst überprüft, aus anderen Staaten hätte er auf seine Anfragen hin keine Antworten bekommen. Der (vermutlich deutschsprachige) Rest sei ins „Volksliedarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek“ eingegangen (Paumgartner: 1969, 73f.).44 Er dürfte aber wohl zur Gänze zerstört worden sein, denn einem anderen Bericht zufolge übernahm Curt Rotter 43 KA – MHZ, Karton 99, verschollenes Material von 1918, Nr. 141, 152, 168 und 169. Alle Akten datieren aus dem April 1918. 44 Hierbei dürfte es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen (sprachlichen) Irrtum Paumgartners handeln, da die genannte Bibliothek – heute Österreichische Nationalbibliothek – damals kein Volksliedarchiv besaß.
Der Erste Weltkrieg und die Musikhistorische Zentrale
141
(1881–1945), der Schriftführer des Volksliedunternehmens und Bibliothekar an der Staatsakademie für Musik, im April 1919 „12 Cartons mit handschriftlichem deutschen Liedermaterial der ehemaligen ,Musikhistorischen Centrale‘ des liquidierenden Kriegsministeriums“, und dieses Material wurde im Zweiten Weltkrieg durch einen Brand vernichtet (Deutsch: 1995, 25). Interessant ist, dass unter den erhaltenen Akten im Kriegsarchiv neben den meis ten aufgrund der Presseaufrufe eingegangenen Sendungen von Privatpersonen, also etwa eigene Dichtungen und Lieder, Texte und Aufzeichnungen, alle eingegangenen Fragebögen fehlen – laut Elench müssten das allein bis zum 6. Mai 1918 299 Stück gewesen sein. Das lässt auf den Sammelbestand von mehreren tausend Liedern schließen, da oft „50 und mehr Lieder“ (Paumgartner: 1918a, 30) pro Fragebogen eingegangen sind. Und schon im August 1917, als erst wenige Fragebögen an die Musikhistorische Zentrale eingesandt worden waren, wurden bereits über eintausend Aufzeichnungen gezählt, einen Monat später bereits mehr als 2.200.45 Ein Paumgartner-Biograf sprach gar von einem Sammelbestand von „über 20.000 einzelnen Musikstücken“ (Wagner: 1967, 478). Vermutlich wurden die Fragebögen mit den Liedern schon vorher aussortiert und getrennt aufbewahrt, was ihr „Verschwinden“ plausibler macht. Auch scheint es wahrscheinlich, dass manche Sammler wie Hans Commenda – seine mehr als tausend Titel umfassende Soldatenliedersammlung wird heute im Oberösterreichischen Volksliedwerk in Linz aufbewahrt46 – ihre Aufzeichnungen bei Auflösung der Musikhistorischen Zentrale an sich nahmen. So dürfte ein kulturhistorisch höchst interessanter und vermutlich auch sehr umfangreicher Liedbestand zum größten Teil verloren gegangen sein.47
45 ÖVLA, Sammlung Kotek, 1329-II, Hs, Mappe 7, Rohkonzept AOK. 46 Oberösterreichisches Volksliedwerk / Sammlung Commenda, VI/11/a–h. 47 Umso erfreulicher ist, dass Olga Szalay vom Musikwissenschaftlichen Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Budapest Zoltán Kodálys und Béla Bartóks im Rahmen der Musikhistorischen Zentrale erstellte Sammlung Száz magyar katonadal – Hundert ungarische Soldatenlieder des Jahres 1918 rekonstruieren konnte. Diese soll demnächst, versehen mit einem ausführlichen Kommentar, in ungarischer und deutscher Sprache veröffentlicht werden. Die Verfasserin selbst publizierte in ihrer Dissertation 85 von der Musikhistorischen Zentrale gesammelte handschriftliche Lieder, die heute unter dem Titel Österreichische Soldatenlieder. Zweites Hundert im Zentralarchiv des Österreichischen Volksliedwerkes in Wien (ÖVLA, 1329-II, Hs, Mappe 7) aufbewahrt werden; siehe: Hois: 2007, 231–388.
142
Eva Maria Hois
Literatur Archive und Sammlungen Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, Nachlass Felix Petyrek. Nationalbibliothek/Musiksammlung, Wien. Niederösterreichisches Volksliedarchiv, St. Pölten. Oberösterreichisches Volksliedwerk, Linz. Österreichisches Staatsarchiv/Allgemeines Verwaltungsarchiv, Wien. Österreichisches Staatsarchiv/Kriegsarchiv, Wien. Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien. Zentralarchiv des Österreichischen Volksliedwerkes, Wien.
Unveröffentlichte Texte Karl Jäger/Karl Kronfuss, Soldatenlieder und Kriegsgesaenge, maschinschriftlicher Vortrag, gehalten am 22. Oktober 1914 (Zentralarchiv des Österreichischen Volksliedwerkes, Wien / Sammlung Kotek). Felix Petyrek, Volkslieder und -spiele der Russen (Verbesserter Durchschlag), Nachlass Felix Petyrek, Karton XI, o.J.a. Felix Petyrek, Zum Volksliederabend im Südfunk, Nachlass Felix Petyrek, Karton XXXI, o.J.b. Felix Petyrek, Brief an die Sowjetische Militäradministration [nach 1945], Nachlass Felix Petyrek, Karton XXVIII, o.J.c.
Publikationen Guido Adler, Tonkunst und Weltkrieg, in: Kriegsalmanach 1914/16, Wien 1915, 1–19. I. B.: Soldatenlieder, in: Fremden-Blatt mit militärischer Beilage, Morgen-Ausgabe, 72. Jg./Nr. 13, Wien, 13. Jänner 1918, 1–2. Béla Bartók Briefe 1, gesammelt, ausgewählt, erläutert und herausgegeben von János Demény, Budapest 1973. Budapesti Hirlap vom 3. August 1917 (Österreichisches Staatsarchiv / Kriegsarchiv, Wien). Moritz Csáky, Ideologie der Operette und Wiener Moderne. Ein kulturhistorischer Essay zur österreichischen Identität, Wien, Köln, Weimar 1996. Walter Deutsch, 90 Jahre Österreichisches Volksliedwerk. Dokumente und Berichte seiner Geschichte 1904–1994, in: Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes 44 (1995), 12–50. Walter Deutsch/Eva Maria Hois, Das Volkslied in Österreich. Volkspoesie und Volksmusik der in Österreich lebenden Völker. Bearbeiteter und kommentierter Nachdruck von 1918, Wien 2004 (Corpus Musicae Popularis Austriacae, Sonderband). Geschäftseinteilung des Präsidialbüros, der Abteilungen und Hilfsämter, dann der sonstigen selbständigen Ämter und Kommissionen des KM [Kriegsministeriums], Wien 1917.
Der Erste Weltkrieg und die Musikhistorische Zentrale
143
Leo Hajek, Bericht über die Ergebnisse der auf Anregung des k. u. k. Kriegsministeriums durchgeführten Sammlung von Soldatenliedern aus dem Kriege 1914–1916, Wien 1916 (Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien, Mitteilung der Phonogramm-Archivs-Kommission, 42). Ernst Hanisch, Der lange Schatten des Staates. Österreichische Gesellschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert, Wien 1994 (Österreichische Geschichte 1890–1990). Historisches Konzert am 12. Jänner 1918 im großen Saale des Wiener Konzerthauses veranstaltet von der Musikhistorischen Zentrale des k. u. k. Kriegsministeriums zu Gunsten der Witwen und Waisen österreich. u. ungar. Soldaten, Wien [1918]. Historisches Konzert, veranstaltet von der musikhistorischen Zentrale des k. u. k. Kriegsministeriums, in: Neue Freie Presse, Morgenblatt, Nr. 19179 vom 13. Jänner 1918, 12. Eric J. Hobsbawm, Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780, englisch 1990, deutsch Frankfurt/Main 1991, Neudruck München 1996. Eva Maria Hois, Sausaler Lieder aus der Sammlung Felix Petyrek, Graz 1999 (meine Lieder – deine Lieder, 3/2). Eva Maria Hois, „… denn in der Tat greift die Moderne in die Vergangenheit“. Felix Petyrek – ein Komponist zwischen Tradition und Fortschritt, in: Antje Senarclens de Grancy/ Heidemarie Uhl (Hrsg.), Moderne als Konstruktion. Debatten, Diskurse, Positionen um 1900, Wien 2001 (Studien zur Moderne, 14), 239–262 . Eva Maria Hois, „Ein Kultur- und Zeitdokument ersten Ranges“. Die Soldatenliedersammlung der Musikhistorischen Zentrale beim k. u. k. Kriegsministerium im Ersten Weltkrieg. Geschichte – Dokumente – Lieder. Dissertation, Wien 2007. Joseph August Lux, Der österreichische Bruder. Ein Buch zum Verständnis Österreichs, seiner Menschen, Völker, Schicksale, Städte und Landschaften als Grundlage der geistigen und wirtschaftlichen Annäherung, Stuttgart, Berlin, Leipzig [1915] (Deutsche Bücher 2). Hans Magenschab, Der Krieg der Großväter 1914–1918. Die Vergessenen einer großen Armee, Wien 1988. Lisa Mahn, Felix Petyrek. Lebensbilder eines „vergessenen“ Komponisten, Tutzing 1998 (Publikationen des Instituts für österreichische Musikdokumentation, 23). Neue Freie Presse, Morgenblatt, Nr. 19178 vom 12. Jänner 1918, 10. František Palacký, Eine Stimme über Österreichs Anschluss an Deutschland. An den FünfzigerAusschuß zu Handen des Herrn Präsidenten Soiron in Frankfurt a. M. (1848), in: ders., Oesterreichs Staatsidee, Prag 1866. Bernhard Paumgartner, Österreichische Soldatenlieder, hrsg. mit Genehmigung des k. u. k. Armee-Oberkommando (Kriegspressequartier), 1.–3. Heft: Marsch- und Heimatslieder 1–3, 4. Heft: Lieder aus der Steyermark, [Wien 1916/1917]. Bernhard Paumgartner, Das Soldatenvolkslied und seine Aufsammlung in der Musikhistorischen Zentrale des k. u. k. Kriegsministeriums, in: Historisches Konzert am 12. Jänner 1918 im großen Saale des Wiener Konzerthauses veranstaltet von der Musikhistorischen Zentrale des k. u. k. Kriegsministeriums zu Gunsten der Witwen und Waisen österreich. u. ungar. Soldaten, Wien [1918a], 28–31. Bernhard Paumgartner, Das Soldatenvolkslied, in: Neue Freie Presse, Nr. 19175, Mittwoch 9. Jänner 1918b, 1–3. Bernhard Paumgartner, Erinnerungen, Salzburg 1969. Felix Petyrek, Ueber das Soldaten-Volkslied der Slawen, in: Historisches Konzert am 12. Jänner
144
Eva Maria Hois
1918 im großen Saale des Wiener Konzerthauses veranstaltet von der Musikhistorischen Zentrale des k. u. k. Kriegsministeriums zu Gunsten der Witwen und Waisen österreich. u. ungar. Soldaten, Wien [1918], 44–45. Josef Pommer, Die Wahrheit in Sachen des österreichischen Volksliedunternehmens, Wien 1912 (Sonderabdruck aus der Zeitschrift Das deutsche Volkslied). Josef Pommer, Musikhistorische Zentrale des k. k. Kriegsministeriums, in: Das deutsche Volkslied 20 (1918a), 33. Josef Pommer, Soldatenlieder-Aufführung, in: Das deutsche Volkslied 20 (1918b), 58. Manfried Rauchensteiner, Der Tod des Doppeladlers. Österreich-Ungarn und der Erste Weltkrieg, 2. Aufl. Graz 1994. Dietrich Schüller (Hrsg.), Soldatenlieder der k u. k. Armee, Wien 2000 (Tondokumente aus dem Phonogrammarchiv der österreichischen Akademie der Wissenschaften – Gesamtausgabe der historischen Bestände 1899–1950, 11). Soldaten-Liederbuch, hrsg. v. k. u. k. Kriegsministerium (Musikhistorische Zentrale). Erster Band, 100 deutsche Soldatenlieder, [Wien 1918]. Soldatenlieder-Konzert vom Donnerstag, den 29. August 1918 im Stadttheater Baden, Soldatenvolkslieder und historische Musik in der k. u. k. Armee (Zentralarchiv des Österreichischen Volksliedwerkes Wien / Sammlung Kotek). Soldaten-Volkslieder-Aufführung in der „Österreichischen Bühne“, in: Das deutsche Volkslied 20 (1918), 107. Bence Szabolcsi, Béla Bartók. Weg und Werk – Schriften und Briefe, Budapest 1957. Robert Wagner, Bernhard Paumgartners 50jährige Tätigkeit am „Mozarteum“. In: Österreichische Musikzeitschrift 22 (1967), 473–487.
Schönberg and Kandinsky: Artistic Ideals and the Question of Identity
145
Sylwia Zabieglińska Schönberg and Kandinsky: Artistic Ideals and the Question of Identity
Introduction Expressionism is “an anguished quest toward inner transcendence, an intuitive impulse evolving through a revolt of the consciousness against casual reality and gaining historical consciousness in Romanticism” (Rognoni: 1978, 27). Expressionism, that distorting mirror of Romantic aesthetics, transforming individualism into extreme solipsism, and sentimental love into limitless eroticism, has also assimilated and developed, with a characteristic panache, Edgar Allan Poe’s call for frères en art. The notion of art, glorified as a way towards a renewed spiritualism, assumed a total dimension, combining all fields of artistic and even semi-artistic activity. The dream of the synthetic work of art and a common language, drawing on all means of expression available to art, initiated an era of strengthened contacts between artists of all specialties, among them Arnold Schönberg and Wassily Kandinsky, despite their totally different cultural and artistic backgrounds. Kandinsky writes in his first letter to Schönberg (18th January 1911): […] What we are striving for and our whole manner of thought and feelings have so much in common that I feel completely justified in expressing my empathy. In your works, you have realized what I, albeit in uncertain form, have so greatly longed for in music. The independent progress through their own destinies, the independent life of the individual voices in your composition, is exactly what I am trying to find in my paintings.1
Reading through the decade-long correspondence between the two artists, their theoretical and aesthetical writings, as well as contemporary testimonies, one has the impression that they differed in almost every respect. The personality of Kan1 “Unsere Bestrebungen aber und die ganze Denk- und Gefühlweise haben so viel Gemeinsames, daß ich mich ganz berechtigt fühle, Ihnen meine Sympathie auszusprechen. Sie haben in Ihren Werken das verwirklicht, wonach ich in freilich unbestimmter Form in der Musik so eine große Sehnsucht hatte. Das selbstständige Gehen durch eigene Schicksale, das eigene Leben der einzelnen Stimmen in Ihren Compositionen ist gerade das, was ich in malerischer Form zu finden versuche.” (HahlKoch: 1983, 19, English translation in: www.schoenberg.at).
146
Sylwia Zabieglińska
dinsky, with his openness and enthusiasm towards almost all manifestations of human activity, and his desire to gather around himself artists of various specialties, seems to be a direct opposite of Schönberg’s character – that of a man looking for loneliness, rarely if ever collaborating with other artists, critical (especially towards his own critics), suspicious, even slightly egocentric. Their work doubtless reflects these characteristic traits. Yet this renders even more fruitful and fascinating a consideration of the similarities between their artistic identities, the ways in which they expressed strikingly similar aesthetic philosophies, and their artistic alliance, which they undertook without a hint of hesitation. Comparative studies of music and painting, however, are risky. Coincidences between terms employed in the description of both arts, such as colour, texture, form, tone, harmony, may turn out to be an interpretative trap. This tradition of analogous but ambiguous descriptive vocabulary is rendered even more confusing by the musical language used by Kandinsky himself in his writings. Hence, a semiotic analysis of these descriptive languages, which might lead to a possible comparison between the two artists, seems not only methodologically risky, but almost impossible to achieve. Such a comparison should be established on a higher, more abstract level – that of Kandinsky’s and Schönberg’s explicit aesthetics. A necessary impulse for such reflection may be found by looking at the cause and consequence of a fascinating phenomenon: a contemporary collapse of two most stable artistic conventions: tonal harmony in music and figurative painting. By comparing the aesthetic ideals of Schönberg and Kandinsky, generally viewed as “friends in art” and considering themselves as initiators of the modernist revolution in the two arts, a wider interdisciplinary perspective for research on modernist aesthetics can be opened up.
History of a friendship Kandinsky wrote his first letter to Schönberg delighted at hearing a concert of Schönberg’s works on 1st January 1911 in Munich. These works included the String Quartets No. 1 and 2 and the Klavierstücke Op. 11. The novel character of Schönberg’s harmonic language provoked discussions among Kandinsky’s circle of friends from the Neue Künstlervereinigung group. Franz Marc wrote to August Macke: Can you imagine music, in which tonality […] is totally suspended? Listening to this music, in which every beat becomes independent […], I kept thinking of the great compositions of Kandinsky’s, in which there is no trace of tonal system either (Weiss: 1997, 36).
Schönberg and Kandinsky: Artistic Ideals and the Question of Identity
147
The years 1911–1914 were a period of particularly animated exchange of artistic ideas between Schönberg and Kandinsky. Sensing the existence of a peculiar spiritual bond and seeking mutual acknowledgement, both artists included photographs of their paintings in their letters, reported on their artistic and theoretical activities, and exchanged remarks on their writings. Kandinsky also proved instrumental in the popularization of Schönberg’s music and theoretical works in Russia. He translated excerpts from the Harmonielehre and initiated, together with Nikolai Kulbin, the performance of two Schönberg compositions (Klavierstücke Op. 11, played by Serge Prokofiev, and the String Quartet No. 2) in Petersburg in 1911. Following repeated invitations from Kandinsky, the first meeting of the two artists took place on 29th August 1911 in Berg, on the Starnberger See, not far from Kandinsky’s summer holiday house. A second, more extensive meeting on 14th September that year, at Kandinsky’s and Gabriele Münter’s house in Murnau, also involved Franz Marc and was related to the project of publishing the Der blaue Reiter almanac, following two exhibitions with the same name. Kandinsky valued highly Schönberg’s musical and theoretical works as well as his paintings. He succeeded in persuading Schönberg to participate in the Blauer Reiter exhibitions and then to contribute to the catalogue, which featured samples of Schönberg’s three fields of creative activities: reproductions of his paintings, an excerpt from his song Herzgewächse Op. 20, with lyrics from Maeterlinck, and his article Das Verhältnis zum Text. Schönberg and Kandinsky met frequently in that time, yet their interrupted correspondence resumed only in 1922. Kandinsky spent seven years in Moscow. Upon his return he hoped to meet Schönberg in Berlin, but it turned out the composer had moved to Vienna. Kandinsky found out Schönberg’s Viennese address in June 1922 and contacted him. Both artists had survived difficult years of war and revolution. Kandinsky wrote to Schönberg about a period spent in isolation from major artistic events; Schönberg complained of never-ending difficulties in organising performances of his works. While returning to Germany meant a creative rebirth for Kandinsky, Schönberg was by then embittered by the social atmosphere that pervaded artistic circles. The post-war letters between the two artists disclose a wide gap in their judgment of contemporary art, which was to widen further in the following decade amid its thickening political atmosphere. Upon his enrolment as a painting teacher at the Bauhaus, Kandinsky tried to draw Schönberg into the Weimar circle of artists, and proposed that he took up the position of director of the local Musikhochschule. Schönberg responded with surprising reserve:
148
Sylwia Zabieglińska
If I had received your letter a year ago I should have let all my principles go hang, should have renounced the prospect of at last being free to compose, and should have plunged headlong into the adventure. Indeed I confess: even today I wavered for a moment: so great is my taste for teaching, so easily is my enthusiasm still inflamed. But it cannot be. For I have at last learnt the lesson that has been forced upon me during this year, and I shall not ever forget it. It is that I am not a German, not a European, indeed perhaps scarcely even a human being […] but I am a Jew. I am content that it should be so! Today I no longer wish to be an exception; I have no objection at all to being lumped together with all the rest. […] I have heard that even Kandinsky sees only evil in the actions of Jews and in their evil actions only the Jewishness, and at this point I give up hope of reaching any understanding. It was a dream. We are two kinds of people. Definitely!2
Schönberg’s bitter feelings were probably encouraged by an intrigue of Alma Mahler, who in a conversation with the composer had accused Kandinsky and other members of the Bauhaus of anti-semitism. Stunned by the tone of Schönberg’s letter, Kandinsky answered: Yesterday I received your letter, which shocked and grieved me extraordinarily. In earlier days I would never have been able to suppose that we – of all people – could write to each other in such a way. I do not know who, and why, was interested in upsetting and perhaps definitely destroying our (as I certainly thought) enduring, purely human relationship. […] I love you as an artist and a human being, or perhaps as a human being and an artist. In such cases I think least of all about nationality – it is a matter of the greatest indifference to me. Among my friends who have been tested through many years […] are more Jews than Russians or Germans. […] It is no fortune to be a Jew, Russian, German, European. Better to be a human being. But we should strive to be ‘superhuman’. That is the duty of the few.3 2 “[…] wenn ich Ihren Brief vor einem Jahr bekommen hätte, würde ich alle meine Grundsätze fallen haben lassen, hätte auf die Aussicht, endlich komponieren zu dürfen, verzichtet, und hätte mich, den Kopf voran, in das Abenteuer gestürzt. Ja ich gestehe: noch heute habe ich einen Augenblick geschwankt: so groß ist meine Lust zu unterrichten, so leicht entzündlich bin ich noch heute. Aber es kann nicht sein. Denn was ich im letzten Jahre zu lernen gezwungen wurde, habe ich nun endlich kapiert und werde es nicht wieder vergessen. Daß ich nämlich kein Deutscher, kein Europäer, ja vielleicht kaum ein Mensch bin […], sondern, daß ich Jude bin. Ich bin damit zufrieden! Heute wünsche ich mir gar nicht mehr eine Ausnahme zu machen; ich habe gar nichts dagegen, daß man mich mit allen anderen in einen Topf wirft. […] ich habe gehört, daß auch ein Kandinsky in den Handlungen der Juden nur Schlechtes und in ihren schlechten Handlungen nur das Jüdische sieht, und da gebe ich die Hoffnung auf Verständigung auf. Es war ein Traum. Wir sind zweierlei Menschen […]”. (Schönberg: Letter to Kandinsky on 19th April 1923 in: Hahl-Koch: 1983, 91; English translation in: www.schoenberg.at). 3 “[…] ich habe gestern Ihren Brief bekommen, der mich außerordentlich erschüttert und gekränkt hat. Nie hätte ich früher annehmen können, daß wir – gerade wir – uns so schreiben können. Ich weiß nicht, wer und warum jemand Interesse hatte, unsere, wie ich sicher dachte, feste, rein menschliche Beziehung zu erschüttern und vielleicht definitiv zu vernichten. […] Ich liebe Sie als
Schönberg and Kandinsky: Artistic Ideals and the Question of Identity
149
The friendship between the two artists was never resurrected. They met only once afterwards, by chance, during the 1927 summer holidays in Pörtschach on the Wörthersee. On this occasion, they did not look back to the misunderstanding that severed their bond. Yet Kandinsky always followed his friend’s destiny, and knew the locations of his forced exile. Kandinsky’s last letter to Schönberg came eight years later; the painter described his life and activities in Paris, hinting at a possible visit to Schönberg in Los Angeles. This letter was probably never answered by Schönberg.
Common aesthetic views and artistic trajectories The most intriguing facet of the contemporaneous emergence of atonality and vis ual abstraction is the synchronism between the various stages in the development of Schönberg’s and Kandinsky’s artistic languages. Yet this synchronism does not mean that both artists were under the same direct influences or worked together on new ideas. The first period of their work, in which traditional means of musical and visual language still dominate, ends in the year 1909. Post-romantic works by Schönberg, making use of extended tonality, find a corresponding stage in Kandinsky’s figurative period. The constant chromatic tensions of Verklärte Nacht Op. 4 (1899) and Pelleas und Melisande Op. 5 (1903) and the fourth-based harmonies of the first Kammersymphonie Op. 9 (1906), foreseeing the atonal language of Schönberg’s later works, are contemporaneous with Kandinsky’s gradually deepened technique of freely applied colour. Epic figurative compositions, technically approaching pointillism and evoking fairy-tale scenes from Russia (woodcuts Farewell, The Singer, The Golden Sail from 1903; temperas Volga Song (1906), Couple Riding (1906–7), Colourful Life (1907)) are maintained in a style more decorative than realistic, while the gradual freeing of colour from any organic link with the represented object would lead directly to an abstract treatment of colour as an independent vehicle of emotion. The first decisive step towards a suspension of tonality, beginning with the String Quartet No. 2, then Drei Klavierstücke Op. 11 and Sechs kleine Klavierstücke Op. 19, the quest for new theatrical forms in Erwartung Op. 17, again find a direct correspondence with the creation by Kandinsky of a series of MurKünstler und Menschen, oder vielleicht als Menschen und Künstler. In solchen Fällen denke ich am wenigsten am Nationalität – sie ist mir höchst gleichgültig. Unter meinen durch Jahre geprüften Freunden […] sind mehr Juden, als Russen oder Deutsche. […] Es ist kein großes Glück, Jude, Russe, Deutscher, Europäer zu sein. Besser ist Mensch […]” (Kandinsky, Letter to Schönberg on 24th April 1923 in: Hahl-Koch: 1983, 91–93; English translation in: www.schoenberg.at).
150
Sylwia Zabieglińska
nau landscapes (Grüngasse in Murnau, 1909, Murnau – Garden I, Murnau – Church, 1910), in which a strengthening of expression leads to a total freeing of colour from the object. Perspective is also visibly dissolved, and the object is gradually simplified and abstracted. A significant simultaneity can also be observed in the composition of both artists’ synthetic stage works, combining visual means with music, poetry and stage gesture: Die glückliche Hand Op. 18 and Der gelbe Klang. It thus appears evident that both artists developed their own original system of artistic means even before Kandinsky’s first contact with Schönberg’s music. Already in the early stages of their correspondence Schönberg and Kandinsky raised the major issues related to their vision of the status and possibilities of new art, and quickly found agreement on the most important points. The starting point of this peculiar artistic alliance was the expressionist aesthetic doctrine of subordination of every dimension of the work, notably its form, to intensified expression. Responding to Kandinsky’s very first letter (quoted above), Schönberg writes: […] I am sure that our work has much in common – and indeed in the most important respects: In what I call the ‘unlogical’ [Unlogische] and the ‘elimination of the conscious will in art.’ I also agree with what you write about the constructive element. No formal procedure which aspires to traditional effects is completely free from conscious motivation. But art belongs to the unconscious! One must express oneself! Express oneself directly! Not one’s taste, or one’s upbringing, or one’s intelligence, knowledge or skills. Not these acquired characteristics, but that which is inborn, instinctive.4
According to the expressionist doctrine, both artists in their respective atonal and abstract periods declared a will to subordinate the creative process to powers of unconsciousness and emotional sensibility. To Schönberg’s “art belongs to the unconscious!”, Kandinsky replies: “[…] when one is actually at work, there should be no thought, but the ‘inner voice’ alone should speak and control […]”.5 4 “Ich […] bin sicher, daß wir uns da begegnen. Und zwar in dem wichtigsten. In dem, was Sie das »Unlogische« nennen und das ich »Ausschaltung des bewußten Willens in der Kunst« nenne. Auch was Sie über das konstruktive Element schreiben, glaube ich. Jede Formung, die traditionelle Wirkungen anstrebt, ist nicht ganz frei von Bewußtseins-Akten. Und die Kunst gehört aber dem Unbewußten! Man soll sich ausdrücken! Sich unmittelbar ausdrücken! Nicht aber seinen Geschmack, oder seine Erziehung oder seinen Verstand, sein Wissen, sein Können. Nicht alle diese nichtangeborenen Eigenschaften. Sonder die angeborenen, die triebhaften.” (Schönberg: Letter to Kandinsky on 24th January 1911 in: Hahl-Koch: 1983, 21; English translation in: www.schoenberg.at). 5 “[…] wenn man schon bei der Arbeit ist, so sollen keine Gedanken kommen, sondern die innere ‘Stimme’ soll allein reden und lenken” (Kandinsky: Letter to Schönberg on 26th January 1911 in: Hahl-Koch: 1983, 23).
Schönberg and Kandinsky: Artistic Ideals and the Question of Identity
151
Art was meant to enable access to the most profound layers of inner emotions, in order to explore the super-phenomenal sphere of reality, and eventually fulfil a social mission. In Über das Geistige in der Kunst, Kandinsky diagnosed modern mentality and presented his prophetic vision of a future rebirth. Society is represented by a multi-layered triangle, and its spiritual progress, a slow “movement forward and upwards”, is realised mostly through art. The first impulse towards these metamorphoses should consist of turning one’s gaze away from the “external” to inner feelings; such a path is clearly indicated by modern art. But the healing action of subjectivism should not remain a goal in itself. On the contrary, stimulating the spiritual sensibility is only a first step towards a reborn faith in the existence of a non-material sphere of reality. It is in this spirit that Kandinsky identified two stages of development in art: the revision of the means of shaping artistic expression and the recognition of the true object of art: Almost unknowingly the artist follows the call. Already in that very question, ‘how?’, lies a hidden seed of renaissance. For even when this ‘how?’ remains without any fruitful answer, there is always a possibility that the same ‘something’ (which we today call personality) may be able to see in objects not only what is purely material but also something less solid; something less ‘bodily’ than was seen in the period of realism, when the universal aim was to reproduce anything ‘as it really is’ and without fantastic imagination. If the emotional power of the artist can overwhelm the ‘how?’ and can give free scope to his finer feelings, then art is on the crest of the road by which she will not fail later on to find the ‘what’ she has lost, the ‘what’ which will show the way to the spiritual food of the newly awakened spiritual life. This ‘what?’ will no longer be the material, objective ‘what’ of the former period, but the internal truth of art. […] This ‘what’ is the internal truth which only art can divine, which only art can express by those means of expression which are hers alone.6
According to Kandinsky a gradual evolution of artistic consciousness is therefore necessary. A starting point for this process should lie in an act of auto-percep6 “Erst unbewußt für sich selbst nicht bemerklich, folgt er [der Künstler] dem Rufe. Schon in derselben Frage ‘Wie’ liegt ein verborgener Kern der Genesung. Wenn dieses ‘Wie’ auch im großen und ganzen fruchtlos bleibt, so ist doch im selben ‘Anders’ (was wir auch noch heute ‘Persönlichkeit’ nennen) eine Möglichkeit vorhanden, nicht das reinharte Materielle allein am Gegenstande zu sehen, sondern auch noch das, was weniger körperlich als der Gegenstand der realistischen Periode ist, den man allein und ‘so wie er ist’, ‘ohne zu phantasieren’ wiederzugeben versuchte. Wenn weiter dieses ‘Wie’ auch die Seelenemotion des Künstlers einschliesst und fähig ist, sein feineres Erlebnis auszuströmen, so stellt sich schon die Kunst auf die Schwelle des Weges, auf welchem sie später unfehlbar das verlorne ‘Was’ wiederfindet, das ‘Was’, welches das geistige Brot des jetzt beginnenden geistigen Erwachens bilden wird. […] Dieses Was ist der Inhalt, welchen nur die Kunst in sich fassen kann, und welchen nur die Kunst zum klaren Ausdruck bringen kann durch die nur ihr gehörenden Mittel.” (Kandinsky: 1912, 14–15; English translation in http://onlinebooks.library.upenn.edu).
152
Sylwia Zabieglińska
tion by the creator, which should awaken in him an emotional-spiritual sensibility. Schönberg gives a similar definition of art in his Harmonielehre: Art in its most primitive state is a simple imitation of nature. But it quickly becomes imitation of nature in the wider sense of the idea, that is, not merely imitation of outer but also of inner nature. In other words, art does not then represent merely the objects or the occasions that make impressions, but above all these impressions themselves, ultimately without reference to their What, When, and How. […] In its most advanced state, art is exclusively concerned with the representation of inner nature (Schönberg: 1978, 18).
In his essay on Mahler, Schönberg writes: “In reality, there is only one greatest goal towards which the artist strives: to express himself…” (Schönberg: 1975c, 13). Yet both artists gradually evolved from a totally subjective perspective towards a vision of art in social categories. New art would assume the function of religious mystery, and the artist would become a priest. The passage from inner emotion to a metaphysical approach, from sensuality to spiritualism, is to be observed not only in Schönberg’s theoretical and aesthetical writings, but also in his artistic output and original commentaries to his works (Cf. Stopner: 1980, 100–116). Many researchers see a motive for this evolution in events in the composer’s personal life (the betrayal by his wife, a feeling of social isolation, suicidal thoughts). Schönberg revised his artistic ideals; according to Albrecht Dümling his “impotence in real life changed into phantasies of omnipotence. Art replaced love and religion. The most private was transformed into the universal” (Dümling: 1997, 124). While the problem of objectivism and subjectivism in interpretations of Schönberg’s and Kandinsky’s thought suggests a dialectical opposition, in the artist’s own testimonies these categories are not opposed. Subjectivism should rather be seen as a starting point for new art, oriented towards a universal goal. A similar relation can be observed between the emotional and intellectual element in the creative process, and between expression and form. Even in the period when Schönberg saw the origins of the creative process in the sphere of the unconscious, he addressed the key issue of musical form. And while in Harmonielehre there is still talk of a “sense of form”, of the “unconscious logic of harmonic construction” (Schönberg: 1978, 386), later declarations by the composer also stress the necessity of the creative process emphasising both intellect and emotion: “First, everything of supreme value in art must show heart as well as brain. Second, the real creative genius has no difficulty in controlling his feelings mentally; nor must brain produce only the dry and unappealing while concentrating on correctness and logic” (Schönberg: 1975d, 179). The ideal artist,
Schönberg and Kandinsky: Artistic Ideals and the Question of Identity
153
according to Schönberg, is able to reconcile the two spheres of activity, and “is as much at home in the world of intellect as in the world of emotions” (Schönberg: 1984, 254–255). Kandinsky’s intellectual history followed a similar pattern. In Über das Geistige in der Kunst the central category of “inner necessity” as the only artistic guideline is originally used to indicate the intuitive-emotional character of the creative process. Yet a painting’s composition is also based on “a corresponding vibration in the human soul“ (Kandinsky: 1912, 42), which determines the choice of colours, shapes and objects; without a consciousness of his material, notwithstanding the theoretical rules of composition, the artist is condemning himself, at best, to a purely casual effect on the viewer. Intentional movements of the soul should therefore not be limited to an experiment or game with available artistic means, but requires intellectual work leading to an understanding of the fundamental rules of visual composition and affecting the viewer with all elements of a painting. Kandinsky wrote in a letter to Schönberg (26th January 1911): Up to now the painter has thought too little in general. He has conceived his work as a kind of colouristic balancing act. But the painter (and precisely so that he will be able to express himself) should learn his whole material […].7
Artist as prophet The most striking similarity between Schönberg’s and Kandinsky’s visions of art, and the one element defining their artistic identity is the vision of the congenial artist-prophet, which in Schönberg’s musical output is embodied by e. g. Moses (in Moses und Aron), while in Kandinsky’s paintings it is the character of Saint George or the blue rider. According to Ulrike Becks-Malorny, “[…] the rider […] is a symbol of the fighter and the redeemer. He brings society salvation […] from the evil of materialism” (Becks-Malorny: 1999, 91–92). Yet in his theoretical writings, Kandinsky also refers to Moses: “The invisible Moses descends from the mountain and sees the dance round the golden calf. But he brings with him fresh stories of wisdom to man.”8 The artist-prophet is also the law-maker, bestowing upon mankind 7 “Nur hat bis jetzt gerade der Maler überhaupt zu wenig gedacht. Er faßte seine Arbeit auf als eine Art koloristische Equilibristik. Der Maler soll aber (und gerade um sich ausdrücken zu können) sein ganzes Material kennen lernen […]”. (Hahl-Koch: 1983, 23; English translation in: www.schoenberg.at). 8 “Der unsichtbare Moses kommt vom Berge, sieht den Tanz um das goldene Kalb. Aber doch bringt er eine neue Weisheit mit sich zu den Menschen”. (Kandinsky: 1912, 14; English translation in: http://onlinebooks.library.upenn.edu).
154
Sylwia Zabieglińska
rules of artistic language and grammar alongside his spiritual message: the desire to create a coherent harmonic system which would replace traditional conventions (Schönberg’s twelve-tone system) and the codification of rules governing the basic elements of painting (Kandinsky’s colour, form and composition theory). Their writings indicate that they both assumed the role of genius-prophet within a new spiritualism, using their respective new languages to help proclaim the gospel of renaissance. Schönberg writes: We are to still to remain in the darkness which will be illuminated only fitfully by the light of genius. We are to continue to battle and struggle, to yearn and desire. And it is to be denied to us to see this as long as it remains with us. We are to remain blind until we have acquired eyes. Eyes that see the future. Eyes that penetrate more than the sensual, which is only a likeness; that penetrate the supersensual. Our soul shall be the eye. We have a duty: to win for ourselves an immortal soul. […] We already possess it in the future; we must bring it about that this future becomes present […]. And this is the essence of genius – that it is future (Schönberg: 1975c, 34–5).
Kandinsky, too, foresaw the arrival of a prophet for the new times: But there never fails to come to the rescue some human being, like ourselves in everything except that he has in him a secret power of vision. He sees and points the way. The power to do this he would sometimes lay aside, for it is a bitter cross to bear. But he cannot do so. Scorned and hated, he drags after him over the stones the heavy chariot of a divided humanity, ever forwards and upwards.9
In this far-ranging vision of the artist-prophet’s social mission, his understanding of the work of art becomes significant. Its object far transcends the expression of self, understood merely subjectively, and becomes instead a universal human message. Schönberg writes: Though there is no doubt that every creator creates only to free himself from the high pressure of the urge to create, and though he thus creates in the first place for his own pleasure, every artist who delivers his work to the general public aims, at least unconsciously, to tell his audience something of value to them (Schönberg: 1975a, 193). 9 “Da kommt aber einer von uns Menschen, der in allem uns gleich ist, aber eine geheimnisvoll in ihn gepflanze Kraft des “Sehens” in sich birgt. Er sieht und zeigt. Dieser höheren Gabe, die ihm oft ein schweres Kreuz ist, möchte er sich manchmal entledigen. Er kann es aber nicht. Unter Spott und Hass zieht er die sich sträubende, in Steinen steckende schwere Karre der Menschheit mit sich immer vor- und aufwärts”. (Kandinsky: 1912, 9; English translation in: http://onlinebooks.library. upenn.edu).
Schönberg and Kandinsky: Artistic Ideals and the Question of Identity
155
Schönberg thus articulates this idea: From the lives of truly great men it can be deduced that the urge for creation responds to an instinctive feeling of living only in order to deliver a message to mankind (Schönberg: 1975a, 193).
This message is metaphysical in nature, and focuses on issues crucial to the intellectual and spiritual condition of man. It is thus no surprise that an important subject addressed by Schönberg, both in his artistic works and theoretical writings, is religion and his personal attitude towards faith. While, due to their different faiths, it is not possible to identify a close similarity between the religious views of the two artists, these ideals are realised in similar ways on the aesthetic and artistic level. Schönberg’s words about music “[conveying] a prophetic message that reveals a higher form of life towards which mankind evolves” (Schönberg: 1975a, 194) could just as well have been written by Kandinsky, and both artists saw art in religious terms as a way of learning about supersensual reality, and as a medium to communicate with it. The most sincere expression of these feelings can be found in their letters. Schönberg unveils one of his most profound convictions in a letter to Kandinsky of 19th August 1912: We must become conscious that there are puzzles around us. And we must find the courage to look these puzzles in the eye without timidly asking about ‘the solution’. It is important that our creation of such puzzles mirror the puzzles with which we are surrounded, so that our soul may endeavour – not to solve them – but to decipher them […]. For the puzzles are an image of the ungraspable. And imperfect, that is, a human image. But if we can only learn from them to consider the ungraspable as possible, we get nearer to God, because we no longer demand to understand him.10
Kandinsky answers: “there is a law which is millions of kilometers distant from us, towards which we strive for thousands of years, of which we have a presentiment, which we guess, apparently see clearly.”11 10 “Wir müssen uns bewußt werden, daß es Rätsel um uns gibt. Und müssen den Mut bekommen, diesen Rätseln in die Augen zu blicken, ohne feige nach ‘der Lösung’ zu fragen. Es ist wichtig, daß unsere Schöpferkraft solche Rätsel den Rätseln nachbildet, von denen wir umgeben sind. Damit unsere Seele den Versuch mache – nicht sie zu lösen – sondern sie zu dechiffrieren. […] Denn die Rätsel sind ein Abbild des Unfaßbaren. Ein unvollkommenes, d.i. menschliches Abbild. Aber wenn wir durch sie nur lernen, das Unfaßbare für möglich zu halten, nähern wir uns Gott, da wir dann nicht mehr verlangen, ihn verstehen zu wollen.” (Hahl-Koch: 1983, 69; English translation in: www. schoenberg.at). 11 “[…] es gibt ein Gesetz, welches Millionen Kilometer von uns entfernt ist, zu welchem wir Jahrtau-
156
Sylwia Zabieglińska
Despite the difference between the faiths in which they were brought up, Schönberg and Kandinsky seem to have experienced in common the influence of contemporary mystical movements. In the way Schönberg articulated theories about the nature of music, and in some of the texts to his works (both his own texts and those selected from other authors), influences of German philosophy (Kant, Hegel, Schopenhauer) can be observed alongside Swedenborg’s mysticism12, later developed in Honoré Balzac’s novel Seraphita, which Schönberg valued highly. Schönberg no doubt knew the theoretical writings of Goethe, and the most widely known interpretation of Goethe’s thought in Schönberg’s Vienna was that included in the theosophical writings of Rudolf Steiner – which was also of great interest to Kandinsky. Such an interpretative context would strengthen the hypothesis that the atonal breakthrough in Schönberg’s evolution (as happened with Scriabin) was a direct result of a quest for a new musical language, which would better communicate a mystical content through the use of totally new compositional means. In his own librettos and texts, which served as a basis for musical composition, Schönberg reveals his fascination with the religious-philosophical mystery of existence and the nature of the other, surreal world. Thanks to a new harmonic language, his atonal compositions created such a reality, impenetrable to analysis and interpretation by traditional means, and requiring a change of listening habits from audiences, whereas even the most advanced chromaticism of Schönberg’s tonal works essentially remained within traditional limits. His atonal works, opposed as they were to century-long musical tradition, did at the same time establish a new sound reality. Schönberg was deeply convinced of the existence of a second dimension of reality, drawing upon (among other writings) Schopenhauer’s concept of will, which found its most direct representation in music. Following Swedenborg, Goethe and Steiner, he believed in the possibility of accessing a higher dimension of existence through music. Moreover, Schönberg and Kandinsky did not hide their aspiration to imitate God in the process of creation. Schönberg writes: To understand the very nature of creation, one must acknowledge that there was no light before the Lord said: “Let there be Light”. And since there was no light yet, the Lord’s omsende streben, welches wir vorahnen, erraten, scheinbar deutlich sehen […]” (Kandinsky, Letter to Schönberg, 22nd August 1912 in: Hahl-Koch, 1983, 72; English translation in: www.schoenberg.at). 12 Schönberg’s interest in Swedenborg’s vision of heaven is further confirmed by the text of Jakobsleiter. Karl Woerner in his essay Schönbergs Oratorium “Die Jakobsleiter” claims that the composer’s libretto can be compared to Steiner’s mystical dramas (Wörner: 1965, 250–257; 333–340). This mystical motive can be seen as a completing element of the interpretation of the two artists’ prophetical attitudes.
Schönberg and Kandinsky: Artistic Ideals and the Question of Identity
157
niscience embraced a vision of it, which only His omnipotence calls forth. […] A creator has a vision of something, which has not existed before this vision. A creator has the power to bring his vision to life, the power to realize it (Schönberg: 1975b, 102).
Schönberg and Kandinsky believed that, through new compositional means, they could make available to their listeners and viewers access to a spiritual reality, that they possessed a creative power to call to life new, independent forms of being – artistic works, and finally, that apart from purely aesthetical values these works would also communicate moral values. The position of the category of beauty as the goal of artistic activity in this ethically-oriented understanding is thus taken by truth; initially an expressionist notion of subjective truth13, later absolute truth. Initially, Schönberg and Kandinsky saw, as the prerequisite of an artwork’s truthfulness, the unconditional, often painful sincerity of its creator, who with psychoanalytical meticulousness explored and then expressed the world of his own inner emotions. But if art is understood not only as a manifestation of “inner nature”, but also as an echo of “the music of the spheres”, the truth contained in that work gains a metaphysical dimension. It is significant that both Kandinsky and Schönberg saw themselves as prophets in times of general skepticism and suspicion towards articles of faith laid down in formal religious teaching. In both artists’ vision, art can replace religious rite in the process of communicating with the supernatural dimension of existence. It is so because artists possess means, which European religions have lost: sensibility, creative intuition, a specific language of communication. The further this language is detached from real objects, the less it is connected with the objective domain, the more adequate it seems as a tool for exploring the supersensual world. Similarly to Scriabin, Kandinsky and Schönberg had an ambition to create a form of communication through art, which would enable it to disclose the nature of spiritual existence. In his essay Das Verhältnis zum Text, Schönberg writes after Schopenhauer, “The composer reveals the inmost essence of the world and utters the most profound wisdom […]” (Schönberg: 1975e, 1).
13 “That is beautiful which is produced by the inner need, which springs from the soul.” (“Das ist schön, was einer inneren seelischen Notwendigkeit entspringt”) (Kandinsky: 1912, 100; English translation in: http://onlinebooks.library.upenn.edu).
158
Sylwia Zabieglińska
Conclusion: the question of identity The artistic identity of expressionist artists, shaped by the philosophical thought of Schopenhauer, the existentialism of Kierkegaard, Nietzsche’s concept of “will to power”, Georg Büchner’s social revolt and Freud’s psychoanalysis, found its manifestation both in a purely aesthetical revolt against the past and in a negative social reaction against nineteenth-century materialism, realism, positivism and secular tendencies. Spiritual values were also found to be threatened following Nietzsche’s philosophical provocation in proclaiming the death of God14. At the same time, expressionism was a symptom of a lack of faith towards science and its instruments, whose development had caused a diminution of man’s spiritual wealth. Kandinsky reminisces: The collapse of the atom was equated, in my soul, with the collapse of the whole world. Suddenly, the stoutest walls crumbled. Everything became uncertain, precarious and insubstantial. I would not have been surprised had a stone dissolved into thin air before my eyes and became invisible. Science seemed destroyed: its most important basis was only an illusion, an error of the learned, who were not building their divine edifice stone by stone with steady hands, by transfigured light, but were groping at random for truth in darkness and blindly mistaking one object for another (Kandinsky: 1982, 364).
Disillusion with the scientific vision of the world generated a need for spiritual renewal through art and religion. This tendency was also fed by the spread of a new, monistic thought, which saw spirit and matter as two facets of a single substance building the Universe. Quite unexpectedly, this vision received scientific confirmation. The discovery of the instability of mass and energy was judged to be empirical evidence for the coherence of spirit and matter. This general intellectual atmosphere was further strengthened by the rebirth of mystical movements. Both Kandinsky and Schönberg shared the spiritual anxiety of their time. Their personal experience further intensified this anxiety. Their quest for an artistic identity was accompanied by an inner quest for the true self. Schönberg confesses in a letter to Richard Dehmel:
14 Kandinsky writes: “When religion, science and morality are shaken, the two last by the strong hand of Nietzsche, […] man turns his gaze from externals in on to [ !] himself ”. (“Wenn die Religion, Wissenschaft und Moral (die letzte durch die starke Hand Nietzsches) gerüttelt werden […], wendet der Mensch seinen Blick von der Äußerlichkeit ab und sich selbst zu.”) (Kandinsky, 1912, 23; English translation in: http://onlinebooks.library.upenn.edu).
Schönberg and Kandinsky: Artistic Ideals and the Question of Identity
159
I have been wanting to write an oratorio on the following subject: modern man, having passed through materialism, socialism and anarchy and, despite having been an atheist, still having in him some residue of ancient faith (in a form of superstition), wrestles with God (see also Strindberg’s Jacob Wrestling) and finally succeeds in finding God and becoming religious (Schönberg: 1974, 35–36).
It is difficult not to see in this modern character, sketched by Schönberg, a reflection of his own biography. Both Kandinsky and Schönberg took the difficult decision to give up a stable professional life and dedicate their lives to art. Both also felt alienated from their environments: Kandinsky as a Russian in Munich, Schönberg first as a self-taught composer among professional musicians, later more so because of his Jewish birth. Kandinsky eventually found a circle of close artistic friends who shared his ideals; Schönberg never ceased to struggle with criticism and the incomprehension of his listeners. In the first stage of their development, their answer to the difficulty of their circumstances and their struggle for artistic recognition was the elimination of the conscious element in the creative process and an approach of extreme subjectivism. Even before being widely acknowledged, their respective decisions to undertake revolutionary changes in the artistic languages of music and visual art founded on unconscious creative processes. Subjectivism and the unconscious constituted a starting point for reshaping a new, stronger identity, an alter ego of one’s own self – one’s artistic attitude. Through art, Schönberg and Kandinsky found an opportunity to transform their weaknesses and anxieties into strength, which was then bestowed upon the image of the new artist – as genius, priest, prophet, transcending the passion of individual life into a social mission. The characters of the Blue Rider, Saint George, Moses and even God became tools towards a spiritual renewal. “[…] We should strive to be ‘supermen’,”15 as Kandinsky wrote to Schönberg.
15 “Wir sollen doch zum ‘Übermensch’ streben”. (Kandinsky: Letter to Schönberg, 24 April 1923 in: Hahl-Koch: 1983, 93; English translation in: www.schoenberg.at).
160
Sylwia Zabieglińska
Bibliography Ulrike Becks-Malorny, Kandinsky, Köln 1999. Polish translation by Cezary Jenne, Warszawa 1999. Albrecht Dümling, Public Loneliness: Atonality and the Crisis of Subjectivity in Schönberg’s Opus 15, in: Conrad Boehmer (ed.), Schönberg and Kandinsky. An Historic Encounter, Amsterdam 1997, 101–138. Jelena Hahl-Koch (ed.), Arnold Schönberg, Wassily Kandinsky: Briefe, Bilder und Dokumente einer außergewöhnlichen Begegnung, München 1983; english translation: http://www.schoenberg.at/6_archiv/correspondence/letters_database_e.htm. Wassily Kandinsky, Über das Geistige in der Kunst, München 1912; English translation by Michael T. H. Sadler, http://digital.library.upenn.edu/books. Wassily Kandinsky, Reminiscences, in: Idem, Complete Writings on Art., vol. 1 (1901–1921), ed. by Kenneth C. Lindsay and Peter Vergo, Boston 1982. Luigi Rognoni, La scuola musicale di Vienna. Espressionismo e dodecafonia, Torino 1966. Polish translation by Henryk Krzeczkowski: Wiedeńska szkoła muzyczna. Ekspresjonizm i dodekafonia, Kraków 1978. Arnold Schönberg, Harmonielehre (1911), 3rd edition Wien 1922. Englisch translatian by Roy E. Carter, Theory of Harmony, Berkeley, Los Angeles 1978. Arnold Schönberg, Letters, ed. by Erwin Stein, transl. by Eithne Wilkins and Ernst Kaiser, London 1974. Arnold Schönberg, Criteria for Evaluation of Music, in: Style and Idea. Selected Writings, ed. by Leonard Stein, London, 1975a, 180–95. Arnold Schönberg, Composition with Twelve Tones, in: Ibid. 1975b, 102–143. Arnold Schönberg, Gustav Mahler, in: Ibid. 1975c, 7–36. Arnold Schönberg, Heart and Brain in Music, in: Ibid. 1975d, 153–179. Arnold Schönberg, The Relationship to the Text, in: Ibid. 1975e, 1–6. Arnold Schönberg, Tonality and Form, in: Style and Idea. Selected Writings, 2nd edition, ed. by Leonard Stein, Berkeley, Los Angeles 1984, 253–257. Hubert Stoppner, Schönberg, oder: Der Aufstieg des Sinnlichen ins Geistige, in: MusikKonzepte, Sonderband Arnold Schönberg, München 1980, 110–116. Peg Weiss, Evolving Perception of Kandinsky and Schoenberg, in: Juliane Brand / Christopher Hailey (eds.), Constructive Dissonance. Arnold Schoenberg and the Transformations of Twentieth-Century Culture, Berkeley, Los Angeles, London 1977, 35–57. Karl Wörner, Schönbergs Oratorium “Die Jakobsleiter”: Musik zwischen Theologie und Weltanschauung, in: Schweizerische Musikzeitung 105 (1965), 250–257.
Wie neu, als sie neu war, war die „Neue Musik“?
163
Christian Kaden Wie neu, als sie neu war, war die „Neue Musik“? Aspekte eines Modernisierungsprozesses
Das Thema ist eine multiple Provokation. Da geht von Neuer Musik die Rede, die nur dermaleinst neu gewesen sein kann, zwischenzeitlich jedoch alt wurde. Schlimm genug. Indes kann sich die Diagnose auf Theodor W. Adorno (1954) stützen. Darüber hinaus offenbar erhebt sich die Grundsatzfrage, das ist weitaus schlimmer, ob diese Musik überhaupt je Innovationswert besessen habe, zumindest in ihrer Jugend jung gewesen sei – oder schon alt geboren wurde. Schüsse mit großem Kaliber. Freilich sind sie nötig: angesichts dessen, dass Neue Musik, sonderlich in der Überlieferung der Zweiten Wiener Schule (auf die ich mich im Weiteren konzentrieren werde), bis heute den Rang des Avantgardismus für sich beansprucht. Und: dass Apologeten, ex post facto, ihr die Vorwegnahme politisch und sozial erst einzulösender Strukturen zusprechen. Schönbergs Gleichordnung der zwölf chromatischen Halbtöne, so war noch vor Kurzem an prominenter Stelle zu vernehmen, sei eine Demokratie-Tat, auf deren Realisierung Gesellschaft als Ganzes bestenfalls hoffend harre.1 Dabei muss man Gerechtigkeit üben. Als der Begriff „Neue Musik“ aufkam, in den ersten Dezennien des 20. Jahrhunderts, gebrauchte man ihn mit größerer Dezenz. Paul Bekker, der 1919 ein Buch einschlägig betitelte, sprach vage von einer „grundlegenden psychischen Erneuerung und Erweiterung“ des „melodischen“, ja generell des „Musikempfindens“, allerdings auch von gewandelten „Tonkombinationsmöglichkeiten innerhalb der gegebenen Norm“ (Bekker: 1919, 31f.). Auf die letzte Formulierung werden wir zurückkommen. Einem gewissen Druck, avantgardistisches Propaganda-Vokabular zu übernehmen, dürfte die Musikszene nach 1900 auch seitens der Bildkünstler ausgesetzt gewesen sein. Im Umfeld des Blauen Reiters wurde „neue Kunst“ ausgerufen. Und den Wiener Sezessionisten hatte bereits seit längerem ein Ver sacrum, ein Heiliger Frühling sich angekündigt2 – und ein heilig frischer Wind. Dennoch institutionalisierte sich der Terminus „Neue Musik“ erst 1922, mit Gründung der Internationalen Gesellschaft gleichen Namens, IGNM. 1 Heinz-Klaus Metzger bei der Eröffnung einer Podiumsdiskussion mit dem englischen Komponisten Alexander Goehr am Musikwissenschaftlichen Seminar der Humboldt-Universität zu Berlin, Sommer 2003 (vgl. Metzger: 1991, 18). 2 So der Titel einer seit 1897 in Wien erscheinenden Zeitschrift.
164
Christian Kaden
Auch war mit den Musikblättern des Anbruch, die diesen Konsolidierungsprozess seit 1919 begleiteten, endgültig klargestellt, dass das Neue einer Morgenröte gleichkäme – und dass der Anbruch, genau genommen, ein Durchbruch sei. Als Selbstverständlichkeit darf man diese Definition nicht sehen – so kraftvoll die Schönbergschule in das Aufbruchspathos einstimmte. Aber gerade ihr Anführer selbst hatte, als Komponist wie als Kompositionslehrer, Traditionsbindungen wiederholt hervorgehoben. Und noch sein Begriff vom Fortschritt verpflichtete sich einem Überlieferungswissen, etwa, wenn er dem Wiener Publikum, das ihm bei Aufführung der frühen Quartette und der ersten Kammersinfonie Randale machte, vorwarf, es erkenne seines „eigenen Geistes Kinder nicht mehr“ (Schönberg: 1909, 159). Denn er, der Geschmähte, mache nur wahr, woran sie seit Generationen geglaubt hätten: die Progression im gesellschaftlich Allgemeinen – wie eben im Klanglichen. Noch über die Gegenspiegelung in den Vorvätern kultivierte Schönberg solche Rückversicherung. Einer seiner bekanntesten Aufsätze rühmt „Brahms, den Fortschrittlichen“. Wichtig scheint nun zu sein, dass diese Kontinuität sich nicht nur mit Blick auf Kontrast- und Komplementärrhythmen herstellte, oder in einer thematisch-motivischen Arbeit, die sich durch ihre Verästelungen selbst aufhob. Tradition gibt es auch und besonders in den Tonalitätsfragen. Jene Gleichordnung, Gleichberechtigung, Gleichwertung der Akkorde und Tonverbindungen – später der 12 Halbtöne –, die das Markenzeichen atonaler Musik werden sollte (Eybl: 2004, 66), war faktisch kein Neuansatz, sondern eine resultative Aufgipfelung.3 Sie ist auch nicht nur vor dem Hintergrund der Tonalität (Budde: 1994, 947) zu verstehen, als notwendige Außerkraftsetzung „aller Schranken einer vergangenen Ästhetik“ – wie Schönberg im Programm zur Uraufführung der Klavierstücke op. 11, im Januar 1910, suggerieren wollte (nach Budde: 1994, 948). Meine These: Weniger per Negation bezog sich die Wiener Schule auf das bis dato Regelhafte. Atonalität steht in einem sie selbst einbegreifenden Geschichtszusammenhang. Sie gehört zur „Regel“ eines historischen Prozesses, ex positivo. Wenn man den Vorgang von seiner phänomenalen Außenseite her betrachtet – soziologische Überlegungen seien für den Augenblick hinausgeschoben –, kann die erwähnte Aufgipfelung für mindestens drei Tendenzen in Anschlag gebracht werden. Sämtlich sind sie seit spätestens der Mitte des 19. Jahrhunderts ausgebildet. Zum ersten handelt es sich um das, was ich „Modulanz“, wachsende tonale „Übergängigkeit“ nennen möchte.4 Zuvörderst manifestiert sie sich in Chroma3 Dass Schönberg selbst, ebenso wie Webern, den Begriff „atonal“ ablehnte, darf im gegebenen Kontext als bekannt vorausgesetzt werden (vgl. Budde: 1994, 945f.). 4 In Anlehnung an Begriffsbildungen von Johann Nikolaus Forkel und Adolf Bernhard Marx (vgl. Rohwer: 1956, 1616).
Wie neu, als sie neu war, war die „Neue Musik“?
165
tisierungen und enharmonischen Verwandlungen, in der Nutzung eines überraschenden, zudem zeitlich verdichteten Harmoniewechsels. Mit ihm wiederum verbindet sich ein Denken in Akkord-Folgen, von Stufe zu Stufe, schrittweise, dem schon bei Wagner und Liszt gesetzten Ideal nacheifernd, von jeder Tonart zu jeder anderen unvermittelt einen Weg zu bahnen (Kurth: 1920; Rummenhöller: 1978). Die „Erfindung“ der Zwölftontechnik, die bekanntlich auf Einzel-Tönen und deren freier Bezüglichkeit gründet, scheint unvorstellbar ohne die lange Herrschaft des Modells der Akkord-Stufen, der Koppelung von Modulanz mit tonalen Elementarisierungen. Die zweite Tendenz, die ich rekapituliere, schließt sich der ersten an. Musikalische Neuerungen ruhen, seit dem 19. Jahrhundert, auf der Ausschöpfung potenzieller Kombinationen von harmonisch-tonalen Basiselementen – ganz ähnlich, wie Paul Bekker es artikuliert hatte. Kombination jedoch bedeutet vom Wesen her nicht Über- oder Unter-, sondern Bei-Ordnung. Noch zu zeigen sein wird, dass mit ihr eine Maximierung von Komplexität einherging, samt deren Vorteilen und Kehrseiten. Denn wo alles Mögliche möglich wird, oder fast alles möglich, ergeben sich auch Beliebigkeiten. Für mich selbst entdeckte ich das, als ich – blutjunger Student noch und durchaus zum Leidwesen meiner akademischen Vorgesetzten – in der Bibliothek des Musikwissenschaftlichen Instituts an der Humboldt-Universität, damals tief im Osten, Wagner’sche Klavierauszüge vom Blatt spielte. Furchterregend muss es geklungen haben. Aber entsprechend meinem Eigenerleben kam ich gut voran – und ziemlich mühelos durch den „Siegfried“ hindurch und durch weite Teile der „Götterdämmerung“. Fehlgriffe unterliefen mir. Aber im modulanten Wellenschlag des Wagner-Meeres mochte das so dramatisch nicht auffallen. Gewiss ist es für „Siegfrieds Rheinfahrt“ unerlässlich, dass man irgendwann in A-Dur ankommt, auf den Wogen des Rheins – und dann wieder in Es bei der Goldfanfare und den jubilierenden Rheintöchtern. Aber zwischendrin, wenn Siegfried sein schlingerndes Boot flott macht und in ihm werkelt (kleine Lizenz an die amerikanischen Narrations-Ästhetiker, s. Notenbeispiel 1): Zwischendrin kommt es auf letzte Präzision nicht an. Und namentlich ein Hörer wird den hastigen Akkordwechseln, obwohl sie sich kadenzharmonisch fassen lassen, vor allem aber dem bizarren melodischen Auf und Nieder im Detail gar nicht folgen wollen. Ähnliche Unschärferelationen, denen etwas von Aleatorik anhaftet, gibt es in den Prügel-Szenen der „Meistersinger“ oder im Violin-Flimmern der VenusbergMusiken. Eduard Steuermann, dem wir die psychologisch tiefe Einsicht verdanken, „Wagners Musik sei, im Vergleich zum Wiener Klassizismus, auf ein Zuhören aus weiterer Distanz angelegt“ (Adorno: 1952, 29), dürfte auf einschlägige Verschwommenheiten angespielt haben.
166
Christian Kaden
Notenbeispiel 1
Wie neu, als sie neu war, war die „Neue Musik“?
167
Die dritte angekündigte Tendenz ist vielleicht aber die entscheidende. Innovation vollzieht sich seit dem 19. Jahrhundert in und an klanglichen Materialien. D. h.: in der Immanenz der Tongebilde, ihren operativen Sinnstrukturen. Ein letztes Mal sei an Paul Bekkers Wort von den Ton-Kombinationen erinnert. Deren Essenz erschließt sich prioritär darin, dass man weiß, wie man mit ihnen umgeht, sie zusammenzufügen hat, nicht in semantischen Außenreferenzen. Zweifellos war derlei immanente Kombinatorik auch älterer Musik geläufig, in den Imitationsformen etwa, in subtilen Spiegelungs- und Krebstechniken. Athanasius Kircher (1650, Bd. II, Lib. VIII) veröffentlichte sogar ein Tabellenwerk für Kanonkompositionen, das ein jeweils gegebenes satztechnisches Problem nach allen denkbaren Lösungen – „vollständig“, in einem systema teleion – durchspielte (Klotz: 2001, 24ff.). Dennoch war musikalischer Fortschritt zur gleichen Zeit, und über weite Strecken auch neuzeitlicher Kulturgeschichte, auf völlig anderen Dimensionen möglich: durch gesellschaftliche Funktionalisierung, Funktionswandel, keineswegs zuletzt durch die Aufladung von Musik mit eidetischen Bedeutungen. Die Messzyklen nach „L’homme armé“, die in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts entstanden, wurden nicht allein ihrer kontrapunktischen Künste wegen zu Kompositions-Paradigmen. Ebenso vorbildgebend war, dass sie ein scheinbar weltliches Motiv – das des siegreich-edlen Kriegers – in den Kontext eines Kreuzzugsaufrufs rückten: gegen den Erzfeind der Christen, den türkischen Sultan Mehmed II., der Byzanz im Jahre 1453 unterworfen hatte (Lütteken: 1998, 209f.). Vormals Innerweltliches wurde so transformiert zum Heiligmäßigen, Überweltlichen. Auch die Oper empfand man, an ihren Ursprüngen, weniger als innermusikalische denn als soziale Herausforderung, sofern sie sängerische Professionalität einforderte, welche die ballettgeübten Fürsten ohne Weiteres nicht zur Verfügung hatten (Price: 1993, 17). Und: sofern die Götter der Alten Welt auferstanden, indem sie Göttersprache sprachen, ergo sangen (Rosand: 1991, 39).5 Natürlich mühte sich das 19. Jahrhundert nicht minder um die Umwälzung übergreifender Sinnbezüge: auf dem Musiktheater (Wagner: 1851; Roch: 1995), in den Entwürfen einer musikalischen Poetik und eines Konzepts des Programm-Sinfonischen (Berlioz: 1837; Liszt: 1855). Aber man geht nicht zu weit mit der Feststellung, dass der Haupt- und eigentliche Fortschrittsnenner nunmehr die ausdestillierte Materialqualität war, oder wie man unter Zeitgenossen sagte: die Musik „an sich“ (Robert Schumann, nach Floros: 1989, 118), die Musik „selber“. Das Zünglein der Waage, wo überhaupt es auszuschlagen hatte, neigte sich stets nach Seiten der Klangfi5 Vgl. das Urteil, dass “the purely musical innovations that sprang from opera were minimal, except perhaps for recitative” (Price: 1993, 14).
168
Christian Kaden
guren, der Werke, der tönend bewegten Gegenstände (Kaden: 1998, 2197ff.) – begünstigt, nicht verursacht, durch den vorherrschenden Darbietungsmodus und eine zunehmende Trennung der Kompetenzen: zwischen dilettierenden Hörern und hochtrainierten Berufsmusikern. Nur so konnte vermutlich die Idee von einer inhärenten, spezialistischen Materiallogik, einer Art Eigenlauf des akustisch sich mitteilenden Weltgeistes Gestalt gewinnen – und eben jene Ausweitung der immanent-kombinatorischen Potenziale, mit dem Zug zur Ausschöpfung des Möglichen, des Dinglich-Möglichen. Wechselt man nun die Blickrichtung und nimmt Musikgeschichte wahr aus der Perspektive gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen – ich sage dazu: von innen her, nach ihren tieferen Beweggründen –, ergeben sich deutliche Anknüpfungen zu Modernisierungsprozessen der bürgerlichen Gesellschaftsordnung (Wehler: 1975; Neitzert: 1990). Fortschritt, und Fortschreiten, bedeuten dieser, da verankert in unablässiger Wertschöpfung, ein stetes Mehr-Werden, und die Produktion von Mehr-Werten – aufgeladen mit der Annahme, dass solches Wachstum zugleich gut sei und in der Progression nur immer besser werde. Ökonomische Leistungsfähigkeit misst sich rein quantitativ in Steigerungs- und Gewinnraten. Abstrakt bestimmt sich der Tauschwert von Waren: nach der gesellschaftlich notwendigen Investition von Arbeitszeitquanten (Marx: 1867, 53f.). Auch kulturelles Kapital (in Anlehnung an Bourdieu: 1980, 1983) definiert sich in der Regel mengenmäßig, über Informationszuwächse, Mehr-Wissen. Und selbst die Entwicklung globaler Populationen konfrontiert die Menschheit mit Problemen quantitativen Wachsens und Weiterwachsens. Wächst moderne Musik demnach, bei alledem, schlicht und einfach mit? Es kommt mir darauf an zu zeigen, dass die skizzierten musikalischen Progressionstendenzen: Modulanz, Kombinatorik, Tonkombinatorik, das generelle soziale Wachstum nicht einfach widerspiegeln (Riethmüller: 1976; Franz: 1984). Eher drücken sie es aus: auf ihre Weise, zuweilen sogar konsequenter als in den Alltagswirklichkeiten. Es ist dies eine meiner Lieblingshypothesen: dass moderne Kunst, da ihr die pragmatischen Bremsen und funktionalen Widerstände des gewöhnlichen Lebens kraft ihrer Autonomie ermangeln, gesellschaftlich Wesentliches fundamentaler – und fundamentalistischer – zur Erscheinung bringe, fundamentaler als die sonstige soziale Praxis. Nachfolgend sei dies am Problem der Komplexität abgehandelt – das für den, der Niklas Luhmann (1984) gelesen hat, ein Kernstück von ModernisierungsVorgängen bildet; oft steht auch eine sich steigernde soziale Kontingenz in Rede (Brachmann: 2003, 53ff.). Dabei wird, angesichts der imperialen Singulare: die Kontingenz, die Komplexität, vielfach übersehen, dass zumindest gesellschaftliche Strukturverdichtung zwei Seiten besitzt, entsprechend zwei idealtypische Erschei-
Wie neu, als sie neu war, war die „Neue Musik“?
169
nungsformen (Kaden: 2004, 35ff.). Denn theoretisch nimmt die Komplexität C eines Systems zu mit der Anzahl seiner Elemente (N) sowie mit der Menge der zwischen den Elementen realisierten Beziehungen (M). Es gilt also: C ~ N, (Komplexität) (Menge der Elemente)
M. (Menge der Beziehungen)
Allerdings sind Elementen- und Beziehungswachstum nicht „eins zu eins“ korreliert (Abb. 1). Eine lineare Steigerung in der Zahl der Elemente entspricht einer geometrischen Zunahme der zwischen den Elementen möglichen Relationierungen. In sozialer Praxis wird das vornehmlich dann zur Lebensschwierigkeit, wenn sich die Beziehungen nicht irgendwie „platonisch“, sondern als aktive Beziehungen, als Interaktionen, Kommunikationen darstellen. Und: wenn es sich bei den Elementen um wirklich verschiedene Elemente, das heißt, um Individuen handelt.
Abbildung 1
Beispielsweise wird so die notorische Ambivalenz von Beziehungsdreiecken verständlich (Abb. 2). Während zwischen bloßen Partnern, etwa Frau und Mann, mindestens zwei Relationen vorkommen (und einmal hin, einmal her laufen), sind für das Triangel nicht etwa drei, sondern schlagartig sechs denkmöglich – und meist auch in Betrieb befindlich.
170
Christian Kaden
Abbildung 2
Im Quartett ergeben sich bereits 12 Interaktionen; für das Quintett sind es 20: wohlbemerkt, wenn man die ideale Vollstruktur – jeder interagiert mit jedem – zum Maßstab nimmt. Massengesellschaften, wie die der Moderne, aus Millionen oder Milliarden menschlicher Elemente sich zusammensetzend, sind füglich gar nicht in der Lage, die Fülle ihrer potenziell aktiven Beziehungen auch nur annähernd auszuleben. Verhielten sich alle Menschen als Schwestern oder Brüder, indem sie wie Schwestern und Brüder zueinander Kontakt knüpften – SchillerPhantasien –, überstiege dies robust die Kapazitäten des Einzelnen: hinsichtlich des informationellen Fassungs- und Verarbeitungsvermögens, der Reaktionsanforderungen. Eine Gesellschaft, bei der wesentlich die Anzahl der Elemente wächst – n-komplex –, muss mithin ein Krisenmanagement erfinden, das nicht zu verkraftende Strukturpotenziale dennoch bewältigt. Zentralisierung, Hierarchisierung, auch Gleichgültigkeit der zahllosen Einzelnen gegeneinander, Entfremdung, Egoisierung, schließlich ihr Gleich-Werden, Standardisierung, Ent-Individualisierung lauten die Schlüsselworte. Wo dagegen wenige soziale Elemente zusammentreffen, deren Wachstum sich überdies begrenzt – in Gruppen-Kulturen, Familien, (wirklichen) Freundeskreisen –, ist intensive Relationierung ohne Abstriche möglich. Entsprechende Systeme bezeichne ich als m-komplex, mit hoher Struktur-Dichte. Grundsätzlich auch korrespondieren die beschriebenen Komplexitätstypen mit sogenannten Großen und Kleinen (Sozial-)Systemen. Wie gesagt: Beide Arten von Systemen kommen vor, auch in modernen Gesellschaften; Staaten gibt es, globale Netzwerke – und Kleingruppen, in denen Menschen sich unentfremdet lieben, unentfremdet hassen. Gleichwohl ist evident: Der Akzent von Modernisierung liegt auf dem n-komplex Massenhaften, nach Marx: auf einer enormen Vergesellschaftung. Medienanstalten bedienen große Systeme – und formieren sie zugleich; vom Quotenwachstum sind sie abhängig, nach ihm sind sie süchtig. Auch der ideale kapitalistische Waren-Anbieter wünscht sich, dass alle Leute nur bei ihm kaufen. Und der ideale Herrscher eines Großen Systems strebt danach, dass alle ihn wählen oder ihm sich unterwerfen. Soziostrukturelle Perversionen. Darüber zu philosophieren, ist jedoch nicht unsere Aufgabe. Zurück also zur Materialprogression der musikalischen Moderne, ihrer Aufgipfelung in der Neuen Musik und der einschlägigen Komplexitätsauffassung. Die-
Wie neu, als sie neu war, war die „Neue Musik“?
171
se neigt, von der Intention her und vorerst alternativ zu gesamtgesellschaftlichen Strukturbildungen, dazu, die Komplexitätssteigerung doppelt zu verwirklichen: n- und m-komplex, über Elementen- und Relationszuwächse. Eindeutig belegen lässt sich dies für die Basiseinheiten des Materials, deren Definition tendenziell alle möglichen Akkorde, tonalen Stufen, im Falle der Dodekaphonie alle chromatischen Halbtöne mit Beschlag belegt. Das Attribut „alle“ muss dabei scharf betont werden. Denn selbst wenn die Zahl von 12 Tönen per se als bescheiden anmutet: Im gegebenen historischen Zusammenhang ist sie das Maximum tonaler Ausgangseinheiten, das n-Maximum. Hinzu kommt, dass man dieses Maximum wiederholt zu überbieten suchte: in Systemen von Viertel-, Achtel-, Mikrotönen, sagen wir getrost: „Mehr-Tönen“. Erst recht implizieren serielle Praktiken eine rigorose Ausweitung der n-Repertoires, da nicht mehr Tonhöhenvalenzen, sondern auch Tondauern, Klangfarben, Lautheitsgrade etc. zu Grundsubstanzen der Reihenbildung werden. Schwieriger zu verstehen ist in moderner Musik der Umgang mit Beziehungs-, mit m-Komplexitäten. Hier äußert sich eher ein Maximierungswunsch – als dass dieser im Detail schlüssig seine Erfüllung fände. Ich erläutere die wichtigsten Punkte an Schönbergs Zwölftontechnik (Stephan: 1998; Sichardt: 1990), da sie wesentliche ihrer Voraussetzungen systematisierte und explizit machte. 1. Bereits der Umstand, dass die Anzahl der Elemente, die 12 Töne, gleichgesetzt sind mit der Basis der für sie vorgesehenen Permutationen: aller denkbaren Zwölftonreihen, ohne Wiederholung eines Elements, unter steter Verwendung sämtlicher Halbtöne, erzeugt eine Formulierungsfülle, die weder von chromatischen noch diatonischen Leitern zu erzielen wäre. Immerhin entsteht ein Gesamtrepertoire von knapp einer halben Milliarde Einzel-Reihen.6 Wirksam werden diese natürlich nur über das spezielle Werk hinaus: als gigantische Matrix aller ZwölftonWerke. Indes lässt sich bereits auf diesem Argumentations-Niveau festhalten: dass 12er-Reihen zwar nicht sonderlich aufwendig zu konstruieren, als jeweils Ganzes hingegen ziemlich mühsam zu rezipieren sind. Das kompositorisch „Machbare“ ist konfrontiert mit dem erschwert Wahrzunehmenden. 2. Im Einzelwerk wird dann die je gewählte Ausgangsreihe für sich allein genommen und absolut gesetzt, unter der Bedingung, dass sämtliche Elemente gleich häufig, statistisch gleichverteilt in Erscheinung treten. Die Verteilung der Elemente per se ist dabei auch als elementarste Strukturdefinition zu erachten, insofern, 6 Die Formel für Permutationen, in denen die unter sich verschiedenen Anordnungen sämtlicher n Elemente manifest werden, lautet: Pn = n! Von n ist also die sogenannte „Fakultät“ zu bilden: n! = 1 x 2 x 3 .... (n-1) x n. Faktisch ergeben sich bei 12! = 479.001.600 Kombinationen.
172
Christian Kaden
als sie auf eben die Elemente sowie deren Präsenz abhebt – und nur auf diese. Und Gleichverteilungen wiederum markieren den Grenzfall entsprechender Elementarstrukturen: Sie weisen die Elemente aus als in (größtmöglicher) Freiheit = Unordnung befindlich (Clauß/Ebner: 1974, 129ff.; 214ff.). Strukturierung ist also für Gleichverteilungen, im Hegel’schen Doppelsinn, aufgehoben. 3. Beim Ablaufen, Abrollen der Reihe, währenddessen sich das Werk entfaltet, scheint zunächst stets die Ausgangstonfolge exakt wiederholt zu werden (sieht man von simultan auftretenden Tönen ab, die die sequenzielle Ordnung verunklaren). Schönberg relativiert allerdings die Strukturverfestigungen, die sich im linearen Vollzug ergeben könnten, indem er der Ausgangsreihe (wie geläufig) drei Ableitungen beigesellt: die Inversion der Grundgestalt, den Krebs der Grundgestalt und den Krebs der Umkehrung. Damit ist systematisch verbürgt – von den Regeln her (die nur zufällige Abweichungen einschließen) –, dass jeder einzelne der 12 Töne stets vier verschiedene andere Töne im Gefolge hat. Solche Folgebeziehungen sind offenbar für Schönberg kompositorisch relevant, andernfalls hätte er statt horizontaler Reihen vertikale kombinatorische Kolumnen verwenden können. Zugleich organisieren sie ganz wesentlich die Strukturwahrnehmung im Rezeptionsvorgang (immer noch grundlegend dazu Attneave: 1969). An den Basisreihen des 4. Streichquartetts op. 37 (Notenbeispiel 2) kann man sich klarmachen, was ein aufmerksamer Hörer, ein „Experten-Hörer“, „dem tendenziell nichts entgeht und der zugleich in jedem Augenblick über das Gehörte Rechenschaft sich ablegt“ (Adorno: 1962, 182), zum Beispiel beim Ton as=gis jeweils bemerken müsste. In der Grundgestalt zieht das as ein g nach sich, in der Inversion ein a, im Krebs ein c, im Krebs der Umkehrung ein e. Mithin entstehen vier Dyaden: as-g, as-a, as-c, as-e. Und die Übergänge von as nach g, a, c und e besitzen jeweils gleiche Wahrscheinlichkeiten. Dies verhindert, dass ein Folgeton an den vorhergehenden Ton auch nur versuchsweise fest sich anbindet. Ton-Dyaden – das gilt für die Dodekaphonie grundsätzlich7 – sind keine wirklichen Zweiheiten, sondern bekräftigen nur, kraft ihrer Schwäche, dass die Einzeltöne für sich allein, unabhängig bleiben.8 7 Ausnahmen im Beispiel, wie die Dyade a-b (die sowohl in der Grundgestalt als auch der Umkehrung vorkommt) oder f-b (im Krebs und im Krebs der Umkehrung), sind nicht systematisch herzuleiten; sie ergeben sich zufällig durch die „kontrapunktischen“ Manipulationen der Ausgangsreihe. 8 Zwei Einwände sind gegen die vorgetragene Argumentation möglich. Zum einen: dass Schönberg durchaus Vorstellungen von einem n-dimensionalen musikalischen Raum entwickelte, in dem der Zeitverlauf suspendiert sei und nicht etwa sequenzielle Glieder aufeinander bezogen würden, sondern jedes Einzelmoment mit jedem anderen, alles mit allem also zusammenhänge (vgl. Martin Eybl im vorliegenden Band). Diese „Vision“ Schönbergs (denn sie ist allenfalls mystisch, kaum je-
Wie neu, als sie neu war, war die „Neue Musik“?
173
Notenbeispiel 2
4. Erst bei höheren Verkettungsordnungen (Attneave: 1969, 32ff.), bei Drei- oder Viertongruppen, kommt es zu stabileren Verknüpfungen. Wiederum demonstriert am Beispiel von op. 37 (Notenbeispiel 2): Wenn as und g gegeben sind – was nur in der Grundgestalt geschieht –, tritt immer auch fis ein, deterministisch, zwangsläufig. Unter der Voraussetzung, dass as und g bereits vorliegen, entsteht also eine feste Triade, eine „echte“ Ordnung. Noch deutlicher lässt sich Gleiches für Tetraden zeigen. An und für sich ein informationstheoretischer Trivial-Effekt. Denn je höher der Verkettungsgrad einer Symbolfolge, desto wahrscheinlicher doch wahrnehmungspsychologisch zu begründen) müsste unsere Analyse als banal nachgerade aus dem Sattel werfen: indes zugunsten einer gigantisch größeren Komplexität als jener, die hier referiert wurde. Man kann unsere Betrachtung mithin als ein vorsätzliches methodisches Konstrukt verstehen: als Komplexitätsmodell der Minimal-Voraussetzungen. Und wenn bereits ihm der Nachweis von Chaostendenzen gelingt, müsste das Komplexitätsstreben in „höheren“ Sphären der Gestaltgebung nur konturierter hervortreten. Der zweite Einwand: Auf Reihen-Niveau, Material-Ebene ließen sich die Fragen von Ordnung oder Unordnung gar nicht diskutieren; dort finde lediglich Vorordnung statt, nicht Komposition des Eigentlichen. Schönberg selbst sah es, zumindest zeitweilig, deutlich anders (vgl. Kaden: 2004, 276f.). Nicht allein, dass er mit der Reihenorganisation Formgefühl restituieren wollte (vgl. dazu Reinhard Kapp im vorliegenden Band). Er sprach auch davon, das einschlägige Verfahren habe „kein anderes Ziel als Faßlichkeit“ (Schönberg: 1935/1941, 73). Ob diese Intention perzeptiv überhaupt zum Tragen kommen könne, und sei es als Konstruktionsmoment im Hintergründigen, wird hier gleichsam geprüft – und auch im Weiteren falsifiziert.
174
Christian Kaden
wird es, etwa bei der statistischen Analyse von Sprachtexten, dass echte Wörter oder Morphe aus der zunächst ungegliederten Sequenz „herausfallen“. Wer die Laute F – E – L zu hören bekommt, wird sie mit großer Wahrscheinlichkeit zu F – E – L – D = FELD ergänzen; und wo M – A – U dastehen, mag sich unschwer das S der MAUS anschließen. Beide Worte sogar lassen sich zur FELDMAUS zusammensetzen. Dabei stehen die Teilworte gleichwohl überschneidungsfrei nebeneinander. Tetraden, die zwischen ihnen liegen bzw. beide überlappen, zum Beispiel ELDM oder DMAU, kommen im Deutschen sehr selten vor; sie haben gegen die viel häufiger auftretenden FELD und MAUS bereits quantitativ keine Durchsetzungschancen – unabhängig von aller Sinndeutung.9 Völlig anders die Segmente von Zwölftonreihen. Sie sind ihrerseits gleichverteilt. Op. 37 präsentiert sämtliche Tetraden mit ein und derselben Häufigkeit. Zudem überschneiden sich die Gruppierungen regelmäßig. Auch auf einer höheren Verkettungsebene kann Gliederung mithin gerade nicht zustandekommen. Und der Experten-Hörer, der dessen gewahr würde, müsste entweder alle Segmente in ihrer Totalität sich merken, oder das Gliedern ganz sein lassen (und zu den Elementen selbst, der n-Komplexität zurückkehren), oder irgendwelche Gruppierungen irgendwie bevorzugen – sodass Ordnung, Struktur gewissermaßen ausgewürfelt würde. Was auf der Ebene der Einzeltöne bereits bestimmend wurde: Chaosstrebigkeit, Gleichordnung, Unordnung, reproduziert sich auf höherer Ebene, wo eigentlich Ordnung sein müsste. Maximierte Beziehungsdichte schlägt um in ihr Gegenteil: ins Beziehungslose. Über Ordnungsoperationen löst sich Ordnung selber auf (vgl. de la Motte-Haber 1991; Mackensen: 2000, 374).10 5. Das gilt natürlich nur für tonale Bezüge. Rhythmische Figuren, Zäsuren, auch Änderungen der Lautstärke, der Instrumentation können sehr wohl Gliederungseffekte schaffen (Musterbeispiel der letzte Satz von Schönbergs Bläserquintett op. 26, mit seinem metrisch prägnanten Rondo). Auch trifft das Gesagte nur auf jene Folgen zu, bei denen die Tonhöhenqualitäten ausdrücklich als solche berücksichtigt werden. Interessant ist dagegen Schönbergs Behandlung der Intervalle. Wohl postuliert sie die Äquivalenz von Konsonanz und Dissonanz (Schönberg: 9 Eine klassische Methode zur Bearbeitung des Problems ist der nach dem amerikanischen Linguisten Zellig S. Harris benannte Algorithmus für die statistische Ermittlung sprachlicher Morpheme (Apresjan: 1972, 127ff.). Er hat lediglich die Verteilung der zugrunde liegenden Phoneme und die Wahrscheinlichkeit ihrer Übergänge zu testen. Schon in den Anfängen der Computertechnik konnte die Aufgabe von Maschinen mit einer etwa 85%igen Erfolgsquote gelöst werden, ohne dass die Bedeutung der Morphe überhaupt zur Debatte gestanden hätte. 10 Mackensen (2000) formuliert sehr plastisch, dass die „effektive Komplexität maximaler Ordnung [... ] genauso gering [ist] wie die maximaler Unordnung.“
Wie neu, als sie neu war, war die „Neue Musik“?
175
1911) – was den Schluss nahelegt, durch sie sei auch die „Gleichwertigkeit sämtlicher Intervallkombinationen“ (Budde: 1994, 948) abgesichert. Hingegen wird in der Reihenkonstruktion selbst kaum mit intervallischen Gleichverteilungen gearbeitet.11 Erneut ein Blick auf op. 37: Ganz eindeutig dominieren kleine Sekunden bzw. große Septen, wohingegen große Sekunden und kleine Septen unterbelichtet bleiben; kleine Terzen/große Sexten schließlich und erstaunlicherweise auch der Tritonus sind – in den Reihen – gänzlich ausgespart. Hier zeigt sich, wenn man es überhaupt so begreifen will, in Schönbergs System die produktive Lücke. Alban Berg nutzte sie für sich aus, indem er den Reihen seines Violinkonzerts (1935) Dreiklangssegmente implantierte. Der gleiche Umstand macht erklärlich, warum Strawinsky streng dodekaphon komponieren – und dennoch tonale Wirkungen erzeugen konnte. Intervallreihen, Intervallordnungen sind dafür maßgeblich (Karallus: 1986), mit Präferenzen, prägnanten Unter- und Übergewichten12 – so, wie in der Fanfare for a New Theatre aus dem Jahr 1964 (Notenbeispiel 3). Diese stellt eine Zwölftonreihe dar, muss aber angesichts dessen, dass ihre „vier Trichorde aus vier chromatischen Dreitongruppen mit Drehbewegung gebildet sind“, „wie eine kunstvolle Variante der chromatischen Skala“ anmuten (Jers: 1976, 37). Schönbergs Lehre macht solche Adaptationen möglich; bei ihm selbst, wenn ich recht sehe, sind sie als Prinzip nur lückenhaft ausgefertigt (Stephan: 1998, 2513ff.).
Notenbeispiel 3
Was also war neu an der Neuen Musik, wenn wir vor allem auf die Wiener Schule blicken? Atonalität, Dodekaphonie kumuliert, ich wiederhole es, eine tonale Entwicklungslogik – indem sie Maxima von Elementen und Maxima von Bezüglichkeiten, n- und m-Maxima zu realisieren sucht, damit jedoch effektive Strukturierung überholt und zurückfallen lässt ins Elementarisierte, Chaoshafte. Vielleicht kann man die Summe ziehen: dass bei Schönberg und den Seinen tonales Überschwingen sich ereigne – ähnlich einer Luftschaukel, die von immer gleichen Impulsen getrieben wird, um am Ende sich zu überschlagen, oder wie bei einem 11 Vermutlich deshalb, weil andernfalls die kombinatorische Fülle der Permutationen insgesamt eingeschränkt würde. 12 Vgl. Strawinskys Aussage (1961, 176): „Die Intervalle meiner Reihen basieren auf der Tonalität.“
176
Christian Kaden
Traktor auf dem Rüttelprüfstand, der immer intensiver durchgeschüttelt wird, bis zum Auseinanderbrechen. Akzeptiert man dieses Modell des Überschwingens, das mehr ist als ein Gleichnis und eine Eselsbrücke, wird sofort deutlich, warum es sich gar nicht empfiehlt, Schönbergs tonale Module auf lebendige Gesellschaft zu übertragen. Was Neue Musik vorführt, positiv gewendet, sind Grenzen des Wachstums, des Maximierungsstrebens. Die Serialisten – Messiaen ausgenommen – haben das nie verstanden. Mit der Multiplizierung des Gleichverteilten auf verschiedenen Ebenen leisteten sie die Kumulation der Kumulation. Alternativen – weder zur tonalen Modernisierungstendenz noch zu Wachstumstendenzen von Gesellschaft allgemein – vermag ich darin nicht zu sehen. Lediglich Strawinsky trat den praktischen Beweis an und machte zudem sinnfällig, dass ein Weg aus der Dodekaphonie herausführt – und mitnichten zurück ins Dur-Mollige. Bei Strawinsky, mit den zwölftönigen Intervallreihen, gelingt, was in der Tat gesellschaftlich einzulösen bliebe: die Balancierung des Chaotischen und des Ordentlichen. Vielleicht sollte ich überhaupt ein letztes Wort zum Chaos sagen. Gängige Denkfiguren verwenden den Begriff negativ, abwertend. Indes eignet Chaotisches sehr verschiedenen Musiken, in divergierenden Kulturen, in unterschiedlichen Zeitläuften. Allerdings ist es ein Moment meist unter anderen. Dass effektive Komplexitäten schwinden, Handlungsorientierung, Wahrnehmung außer Kraft gesetzt werden, erscheint essenziell etwa für das Erreichen von Trancezuständen, mithin essenziell für die Entstehung von „Altered States of Consciousness“, alterierten Bewusstseinszuständen (Bourguignon: 1977; Rouget: 1985; Kaden: 2004, 40ff.). Schönberg, bemerkenswerter Weise, spricht das an, wenn er seine frühen Kompositionen mit Träumen kollationiert und Traumabläufen (dazu Eybl: 2004, 53ff.). Auch Krisen der Wahrnehmung also sind Wahrnehmungstatsachen. Sie können Öffnung wirken, wirkliche Befreiungen. Und sie können öffnen für neue Strukturfindung. Die Ethnologie beschreibt das als rituelle Passagen: Aus der Ordnung durch die Freiheit, Wildnis und Krise führen sie in gewandelte Ordnungen (Gennep: 1909; Duerr: 1985). Nach dem, was dargetan wurde, muss es schwer fallen, Schönberg seinesteils eine solch passagere Kompetenz zu bescheinigen. Erst recht fällt es schwer für die seriellen Künstler. Strawinsky, in den Spätwerken, dem „Canticum sacrum“, den „Threni“ – hochkomplexen, aber nicht maximalkomplexen Konstruktionen – scheint dagegen einen Übertritt geschafft zu haben, mit dem Konzept „dynamischer Ruhe“ auch das Heraustreten aus grenzenlos sich gebärdendem Wachstums-Denken (siehe die Selbstzeugnisse in Druskin: 1976, 22; 93; 106; 195; 239). Sollte es bei ihm gar passiert sein: dass die Neue Musik neu wurde?
Wie neu, als sie neu war, war die „Neue Musik“?
177
Literatur
Theodor W. Adorno (1952), Versuch über Wagner, in: ders., Die musikalischen Monographien, hrsg. von Gretel Adorno und Rolf Tiedemann, Frankfurt a. M. 1971 (Gesammelte Schriften, 13), 7–148. Theodor W. Adorno (1954), Das Altern der Neuen Musik, in: ders., Dissonanzen – Einleitung in die Musiksoziologie, hrsg. von Rolf Tiedemann, Frankfurt a. M. 1973 (Gesammelte Schriften, 14), 143–167. Theodor W. Adorno (1962), Einleitung in die Musiksoziologie, in: dasselbe, 169–433. Jurij Denikovic Apresjan, Ideen und Methoden der modernen strukturellen Linguistik, Berlin 1972. Fred Attneave, Informationstheorie in der Psychologie, Bern, Stuttgart 1969. Paul Bekker, Neue Musik, Berlin 1919 (Tribüne der Kunst und Zeit, 6), 1920. Hector Berlioz, De l’imitation musicale, in: Revue et gazette musicale de Paris, 1. Januar 1837, 9–11, 8. Januar 1837, 15–17. Pierre Bourdieu, La distinction: critique sociale du jugement, Paris 1980. Pierre Bourdieu, Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, in: Reinhard Kreckel (Hrsg.), Soziale Ungleichheit, Göttingen 1983, 183–189. Erika Bourguignon, Altered States of Consciousness, Myths and Rituals, in: Brian Murray DuToit (Hrsg.), Drugs, Rituals and Altered States of Consciousness, Rotterdam 1977, 7–23. Jan Brachmann, Kunst – Religion – Krise. Der Fall Brahms, Kassel u.a. 2003 (Musiksoziologie, 12). Elmar Budde, Artikel „Atonalität“, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, zweite, neubearbeitete Ausgabe, hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd. 1, Kassel u.a. 1994, Sp. 945– 954. Günter Clauss/Heinz Ebner, Grundlagen der Statistik, Berlin 1974. Hans-Peter Duerr, Traumzeit. Über die Grenze zwischen Wildnis und Zivilisation, Frankfurt a.M. 1985. Michail Druskin, Igor Strawinsky, Leipzig 1976. Martin Eybl, Die Befreiung des Augenblicks, in: ders. (Hrsg.), Die Befreiung des Augenblicks. Schönbergs Skandalkonzerte 1907 und 1908, Wien, Köln, Weimar 2004, 13–82. Constantin Floros, Musik als Botschaft, Wiesbaden 1989. Michael Franz, Wahrheit in der Kunst, Berlin, Weimar 1984. Arnold van Gennep (1909), Übergangsriten, Frankfurt a.M. 1986. Norbert Jers, Igor Strawinskys späte Zwölftonwerke (1958–1966), Regensburg 1976. Christian Kaden, Artikel „Zeichen“, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, zweite, neubearbeitete Ausgabe, hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd. 9, Kassel u.a. 1998, Sp. 2149–2220. Christian Kaden, Das Unerhörte und das Unhörbare. Was Musik ist, was Musik sein kann, Kassel, Stuttgart 2004. Manfred Karallus, Igor Strawinsky: Der Übergang zur seriellen Kompositionstechnik, Tutzing 1986. Athanasius Kircher, Musurgia universalis, Rom 1650.
178
Christian Kaden
Sebastian Klotz, Kombinatorik und die „Verbindungskünste der Zeichen“ in der Musik zwischen 1630 und 1780, Habilitationsschrift, Berlin Humboldt-Universität 2001. Ernst Kurth, Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners „Tristan“, Bern, Leipzig 1920. Franz Liszt (1855), Berlioz und seine Harold-Symphonie, in: ders., Gesammelte Schriften, hrsg. von Lina Ramann, Bd. 4, Leipzig 1882, 1–102. Niklas Luhmann, Soziale Systeme, Frankfurt a.M. 1984. Laurenz Lütteken, Ritual und Krise, Die neapolitanischen „L’homme armé“-Zyklen und die Semantik der Cantus-firmus-Messe, in: Hermann Danuser / Tobias Plebuch (Hrsg.): Musik als Text, Bd. 1, Kassel u.a. 1998, 202–213. Karsten Mackensen, Simplizität. Genese und Wandel einer musikästhetischen Kategorie des 18. Jahrhunderts, Kassel u.a. (Musiksoziologie, 8) 2000. Karl Marx, Das Kapital, Bd. 1, Berlin 1973 (Marx/Engels Werke, 23). Heinz-Klaus Metzger, Anarchie als ästhetische Kategorie, in: Otto Kolleritsch (Hrsg.), Musikalische Gestaltung im Spannungsfeld von Chaos und Ordnung, Wien, Graz 1991, 9–18. Helga de la Motte-Haber, Chaos: Die multiplizierte Ordnung, in: Otto Kolleritsch (Hrsg.), Musikalische Gestaltung im Spannungsfeld von Chaos und Ordnung, Wien, Graz 1991, 19–28. Lutz Neitzert, Die Geburt der Moderne. Der Bürger und die Tonkunst: Zur Physiognomie der veröffentlichten Musik, Stuttgart 1990. Curtis Price, Music, Style and Society, in: ders. (Hrsg.), The Early Baroque Era. From the Late 16th Century to the 1660s, London 1993, 1–22. Albrecht Riethmüller, Die Musik als Abbild der Realität. Zur dialektischen Widerspiegelungstheorie in der Ästhetik, Wiesbaden 1976. Eckhard Roch, Psychodrama. Richard Wagner im Symbol, Stuttgart, Weimar 1995. Jens Rohwer, Harmonielehre, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, hrsg. von Friedrich Blume, Bd. 5, Kassel, Basel 1956, Sp. 1614–1665. Ellen Rosand, Opera in Seventeenth-Century Venice, Berkeley 1991. Gilbert Rouget, Music and Trance, Chicago 1985. Peter Rummenhöller, Die verfremdete Kadenz. Zur Harmonik Franz Liszts, in: Zeitschrift für Musiktheorie 8 (1978), 4–16. Arnold Schönberg (1909), Ein Interview von Paul Wilhelm, in: ders., Stil und Gedanke, hrsg. von Ivan Vojtěch, Frankfurt a. M. 1976 (Gesammelte Schriften, 1), 157–159. Arnold Schönberg, Harmonielehre, Leipzig, Wien 1911. Arnold Schönberg (1935/1941), Komposition mit zwölf Tönen, in: ders., Stil und Gedanke, hrsg. von Ivan Vojtěch, Frankfurt a. M. 1976 (Gesammelte Schriften, 1), 72–96. Martina Sichardt, Die Entstehung der Zwölftonmethode Arnold Schönbergs, Mainz 1990. Rudolph Stephan, Artikel „Zwölftonmusik“, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, zweite, neubearbeitete Ausgabe, hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd. 9, Kassel u.a. 1998, Sp. 2505–2528. Igor Strawinsky, Gespräche mit Robert Craft, Zürich 1961. Richard Wagner (1851), Oper und Drama, hrsg. von Klaus Kropfinger, Stuttgart 1984. Hans-Ulrich Wehler, Modernisierungstheorie und Geschichte, Göttingen 1975.
Scriabin and the Modernist Idea of Correspondance des arts
179
Tomasz Baranowski Scriabin and the Modernist Idea of Correspondance des arts
Aiming at a synthesis of the fine arts is certainly one of the most significant and vital premises of nineteenth-century aesthetics and art itself. The climax of this trend – generally recognized as Charles Baudelaire’s theory of correspondance des arts on the one hand, and Richard Wagner’s concept of Gesamtkunstwerk on the other – was also a starting point for several artists making their debut at the fin de siècle, a time stigmatised by crisis. A distinct difference between romanticism and fin de siècle art, in this respect, involves the scale of the phenomenon. For the romanticists, the concept of a synthesis of the fine arts served mainly for heightening inspiration and expanding the artist’s sensitivity, whether a poet, musician or painter. Even if turning to other fields was to be a force shaping new forms, it was done within the boundaries of traditional material and traditional means of the particular art form in question. However, towards the end of romanticism the idea of correspondance des arts took on new meanings, becoming a synonym for the breaking of boundaries within particular disciplines. Aiming at a synthesis thus turned out to be the only way for artistic progress. Its purpose was seen as the discovery of the meaning of art itself (hence the slogan l’art pour l’art) as well as a way of fulfilling an artist’s mission in other, non-artistic spheres (for instance social, religious or spiritual ones). It could be claimed that the continuation of the romantic idea of correspondance des arts, that took place on the basis of individual tendencies within so-called modernist culture in Europe, seems to have been an attempt to find transcendental values for art. At the time of modernism, only music determined the future of art as such, thus becoming a driving force behind transformations in other disciplines. Philosophers (mainly Schopenhauer) considered music closest to the discovery of “absolute” truth; music thus became a sort of guiding point for painters, sculptors, poets and writers. Aiming at “musicality” dominated the creative output of many artists at the turn of the nineteenth and twentieth centuries. It can be perceived, for instance, in the poetry of the Symbolists, who were discovering the “sound of a word”, in a series of Secession paintings that were popular at that time (by painters who wished to give works a dimension of “enduring present time”), or, last but not least, in the abstract paintings of Wassily Kandinsky, that were proclaimed by him as an “art of the future” (Kandinsky: 1912, 189) and which followed the trace of music. “Breaking barriers
180
Tomasz Baranowski
of bygone aesthetics” (Leibowitz: 1947, 93)1, however, was in this period mostly the domain of music itself. This process resulted in many innovative undertakings, not only in the sphere of compositional technique, but also in the aesthetic dimension, and even in a metaphysical one. Impressionism, Secession and finally Expressionism, as the successive and the most important stages of modernism, provide many prem ises that confirm the thesis of a gradual development of the idea of correspondance des arts, understood through the categories of expanding boundaries of the fine arts. The first apparent turn to renew music (and art as such too) can be noticed in the works of Claude Debussy – a coryphaeus of modernism in the history of European music. Debussy – an artist associated with Impressionism and the Secession l (Art Nouveau) – contrasted faded conventions of romanticism with a cult of simple beauty that, in his view, derived from nature. “I wished” – he wrote – “to restore ease and freedom to music that are its natural properties to possibly greater degree than in any other art. Music is not limited to more or less exact copying of nature, but it is capable of discovering latent connections [my emphasis] between Nature and imagination”2. In Debussy’s poetics we find an ideal of art independent of any context beyond aesthetics, a pure aestheticism, aiming, however, at a closer bond between art itself and the experience of art, in other words – between the work and the audience. The Expressionists made the next step towards the breaking of boundaries mentioned earlier. The pioneers of this trend – that is mostly the painters of the Berlin group Die Brücke and the Munich group Der Blaue Reiter, as well as the composers of the Viennese School – insisted on the metaphysical aspirations of art, referring mainly to its spiritual dimension. Works of art became at that time a call for gen uine human experience – truth that is pure and original, hidden by the mask of convention. As Franz Marc claimed – with Kandinsky, one of the main authors of the Blaue Reiter manifesto – “each object has a surface and a core, pretence and essence, a mask and a real face. We only touch a surface not reaching the core, we live surrounded by pretence instead of seeing the essence, the mask of things make us blind so that we can not find the truth – should this go against the inner unambiguous nature of things?” (Marc: 1920, 124). Aiming at the discovery of this “inner unambiguous nature of things”, Schoenberg and his followers did not hesitate to go beyond music. Their purpose was above all the intensification of artistic 1 Schönberg’s commentary from the programm of concert in Verein für Kunst und Kultur (1909), concernig the George-Lieder op. 15. 2 Debussy’s statement of April 1902 given to G. Ricou regarding the performance of Peleas and Melizanda, [Pelléas et Mélisande] comp. also “Comoedia”, 17. 10. 1920 (Quoted after Jarociński: 1976, 100).
Scriabin and the Modernist Idea of Correspondance des arts
181
expression of the message – of the “inner content” to which all the senses react. That is why in the expressionistic period of the Viennese School we can notice numerous references to the art of painting or theatre that resulted in a new quality of musical style. Techniques of Klangfarbenmelodie and Sprechgesang should be above all regarded as such, as they are the result of a merging of sound and colour. Similarly, some elements of theatre influenced the language of expressionistic music drama. Above all, this genre absorbed gesture and scream – understood as the most direct and authentic source of expression. Characters of Schoenberg and Berg’s dramatic works express themselves best just through that rapid gesture and stillness well as through scream – generally a confirmation of torment; expressing fear (Woman from Erwartung), despair (Wozzeck) or finally death (Marie from Wozzeck, and Lulu). Expressionistic gestus, Ur-Schrei, Sprechgesang or Klangfarbenmelodie find a common denominator in the idea of correspondance des arts. Their aim is the expression of the true condition of man as a being dependent on a force majeure (such as laws of nature, fate or fortune, social pressure and finally, God). The personality of Alexander Scriabin, like that of his compatriot Fyodor Dostoyevsky, developed in the atmosphere of artistic change at the turn of the nineteenth and twentieth centuries as outlined above. Art, on the one hand, aimed at determining its own status and, on the other, aimed at renewing relations with its potential audience. Scriabin’s works did not belong to any trends of musical modernism germinating at that time but to an extremely radical aesthetic attitude, which to a great degree determined his creative achievement, the development of an original compositional language, and his absolute individuality as a composer. Scriabin’s aesthetic attitudes were influenced by three different sources: philosophy (Emanuel Swedenborg and representatives of German idealism – Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Friedrich Nietzsche), poetry (Russian symbolists – Konstantin Balmont, Valery Briusow, Alexander Blok) and theosophy (especially works of Helena Blavatsky and Rudolf Steiner). A symbolic announcement of the merging of those three fields (connected with music) can be found in the draft libretto for an opera sketched by the composer at the beginning of his artistic life between 1900 and 1902. The main protagonist of this unfinished work was to be, together with a beautiful Tsarina as an ideal of earthly and divine perfection, a character who united in one the roles of philosopher, composer and poet. This traveller in a land of paradise was, it seems, an alter ego of the young Scriabin himself, aspiring to achieve “higher aims” by going beyond the field of music as such. Indeed Scriabin, similarly to the Symbolists, understood art as the highest form of cognition. At the same time, the unrestricted power of artistic creation, in some ways a replica of the act of Creation, was seen to attribute divinity to the artist.
182
Tomasz Baranowski
A theme of absolute apotheosis of the freedom of the artistic spirit whose “final purpose is the restoration of the harmony of the world, that is ecstasy” (Scriabin: 1924, 72) pervades his notes and poetic texts to some of his works (among other things The First Symphony, the Poème de l’extase, and the L’Acte préalable). From this perspective the creative development of the Russian composer appears to be a flight towards the highest values (rather than a struggle for them, as it was in the case of the Expressionists). Music itself was thus only a starting point for this divine travel leading to more and more remote regions: to the land of Art (Hymn to art in the finale of The First Symphony), to a kingdom where the human spirit fights with heavenly spirits (The Third Symphony, Le Poème divin, Poème de l’exstase), and finally to a great beyond where the human spirit achieves a final victory and joins with the highest Being (Prométhée ou le Poème du feu, L’Acte préalable). Thus Scriabin’s understanding of his mission as an artist far exceeded traditional categories of technique (techne) or aesthetics (aisthesis). He treated art as the synonym of all-embracing completeness – fullness and unity (a perfect system), an oceanic whole (the author’s favourite metaphor), and finally something cosmic. It is worth emphasising here that almost all the texts associated with Scriabin’s works were written by the composer himself. In this respect he was a follower of Richard Wagner. Scriabin thus did not follow the majority of modernist composers who used “ready made” poems or themes from works of popular poets at that time3. A concern for the harmony of poetic and musical message united in a work, as guar anteed by both being written by a single author, makes Scriabin a direct successor of Wagner’s idea of the total work of art (Gesamtkunstwerk). Scriabin’s metaphysical aspirations were expressed in two fundamental ideas which were the foundations of his art: in the principle of universal analogies and the principle of universal vibration. Both of them have their source in a theosophical doctrine rooted in the Emerald Tablet (Tabula Smaragdina), one of the most ancient alchemy treaties, attributed to Hermes Trismegistos, and with which the composer was acquainted.4 According to the second of the twelve “commandments” which make up this ancient text “whatever is inferior is like that which is superior; and that which is superior is like that which is inferior: to accomplish one wonderful work”.5 This sentence describes a central point of Scriabin’s artistic attitude which understood art as a closed and perfect system of mutual correspondences. The composer wrote in his diary: 3 This trend was expressed in the practice known as Mehrfachvertonung, characteristic for songs created at the time of modernism involving “simultaneous” creation of music to a popular poem by various composers. 4 Wider discussion of the impact of the Emerald Tablet on Scriabin’s aesthetic attitudes can be found in Kelkel: 1999.
Scriabin and the Modernist Idea of Correspondance des arts
183
The substance of the world is similar to the ocean made of billions of water drops, each of them being the perfect imagery of the entire ocean. This ocean of imagination is full of creative power, which means that the ocean gives each drop a different colour. If this ocean changed the colour of one drop, it would be enough to make all the other drops change too, since each colour’s existence depends only on other colours. According to the principle of universal analogies the law of creative action influencing the entire universe can be deduced (Scriabin: 1924, 79, my translation).
The idea of a correspondance des arts (in a much broader sense than its traditional, i.e., romantic and modernist usage) means, therefore, the principle of Scriabin’s art, apparent on every level: of a musical language, aesthetics, and finally of a transcendental or mystical dimension. It should be emphasised that we are dealing here with a mutual dependence of these three aspects. Mystical motivation, to a great extent, determines solutions in compositional technique and aesthetics. On the level of compositional technique, a harmonic system based on the sixnote chord of fourths (commonly known as the mystic chord) formed in the mature period of Scriabin’s art, appeared to be above all the expression of an aspiration for combining analogous elements into a unity. This chord is identified with a hex atonic scale, in accordance with Scriabin’s idea that “melody is unfolded harmony, whereas harmony is condensed melody” (Danilewitsch: 1953, 98). Consequently, it is a tool unifying the dimensions of space and time; on the one hand, it determines a uniformity of sound combinations that give an impression of a constant vibration, on the other, it is a source of melodic details, in terms of themes and counterpoint. A similar aspiration for unity and uniformity of musical system can be noticed in Scriabin’s treatment of form, which – as he once was to tell Leonid Sabanejev – “should be as light and clear as a mountain crystal” (Bowers: 1969, 332). On this level the principle of correspondance is apparent in a searching for mutual propor tions between individual parts of a work – perfect proportions frequently referring to symbolism, or even number mysticism. For instance, in Poème de l’exstase the size of every section counted in bars is a multiple of the number 36 (double Pythagorean tetractys); in Prometheus or in Poème – Nocturne op. 61 for piano, a climax that marks the transition from development to recapitulation, takes place at the point of the “golden section”. In terms of aesthetics determining an original realisation of the idea of correspond ance des arts, a first sign of breaking the boundaries of music is Scriabin’s use of the category of a poem, characteristic of his works since 1903. At this time he composed, among other things, such piano works as Poème tragique and Poème satanique, as well 5 “Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius ad perpetranda miracula rei unius.” See Davis: 1926.
184
Tomasz Baranowski
as the sketch of The Third Symphony – Le Poème divin. The idea of breaking musical boundaries expressed in the titles of these works, as also in many later ones, can be interpreted in two ways. The first attempt at interpretation, rooted in the traditional ruts of historical musicology, places Scriabin’s “poems” in the romantic heritage of program music, especially among the symphonic poems of Franz Liszt and Richard Strauss. Another possibility, which can be specified as modernist, leads us to the poem as such. The term “poem” is not in this case burdened by any research tradition; it simply means an artistic expression of the author’s artistic message that is significant for him, in which its content is addressed directly and at the same time loftily to a potential recipient. At this point Scriabin’s aesthetics seem to be particularly close to German expressionism of the Blaue Reiter. Another aesthetic aspect of Scriabin’s art is characterised by his search for a harmony of sound and colour, the enriching of vocal expression by means of painting. However, this should not be understood as a reference to any masters of painting. Similarly to the category of a poem mentioned earlier, the essence of Scriabin’s idea lies in “calling for” light (which is indeed the material basis of painting, as sound is the foundation of music), but light as such. Its various shades should – according to the principle of correspondence – “shine” over ways of music aiming to achieve transcendental effects (both for the author and the music itself). The realisation of these effects can be noticed in Prometheus – Scriabin’s last complete symphonic work. It is, as is generally known, the best reflection of Scriabin’s concepts which span the laws of painting and music, involving the reference of the circle of fifths to the light spectrum. Without getting into details of this well-known theory, I would like here to focus only on its symbolic content. A low voice of a two-voice luce part in Prometheus moving on a circular line, whose beginning and end is determined by a blue colour, but of which the middle part is determined by a red one, serves a programmatic function of expressing the evolution of a human spirit. At the starting point, blue is silvery (like moonlight); it evokes the atmosphere of meditation and dream. The middle part of the work is under the control of various shades of red – that is, on the one hand, a colour of struggle (blood and torment), and on the other hand, of love (desire and euphoria). At the end, azure blue returns as a symbol of immortality and spiritual ecstasy. It should be noticed that the luce part in Prometheus is devoid of any shades of green – a colour identified by Scriabin with “passive vegetation”. We can find a similar depiction of colour symbolism in Arnold Schoenberg’s drama with music Die glückliche Hand which was created at the same time as Prometheus (although completed a little later, that is in November 1913). In the famous storm interlude from the third scene of this work the sound is intensified together with a kaleidoscopic play of coloured lights. Colour selection appears at many points
Scriabin and the Modernist Idea of Correspondance des arts
185
to converge with Scriabin’s “prometheic” vision. Red symbolises the passion of the main character (Man), inevitably evoking the imagery of blood, and gradually shades towards violet, then becoming orange. This sudden transformation depicts a double character of human nature. Movement towards blue signifies an approach to spirituality, whereas towards yellow signifies an approach towards physicality. Violet, however, is not identical with blue, just as orange is not identical with yellow. Schoenberg, therefore, confines himself to signalling the problem, whereas Scriabin aims at its final resolution. This problem is the truth of art. Whereas Schoenberg and the Expressionists wished to discover the truth about Man (as a Being involved in a series of different kinds of dependencies, that is to say “unhappy being”), Scriabin aimed at the dis covery of an absolute truth. “I wish to discover truth”, he wrote. “This desire is a main form of my consciousness. Thanks to it I am certain that I am alive, I identify with it. And even at this very moment I am this desire to discover truth, which means desire to be only the truth itself. All the rest is created around this central consciousness” (Scriabin: 1924, 91, my translation). In his works, Scriabin attempts to depict the idea of correspondance des arts at its “highest level” – that is, in a mystical sphere. The essence of the composer’s philosophical and artistic attitude lies in this field. He claimed that his music is a religion which can transform human consciousness through the state of ecstasy, and that only he, being an artist-prophet, in some sense equal to God, is capable of revealing this religion to humankind. This attitude towards his own art can be seen and confirmed by a letter to Tatiana de Schloezer written in January 1905, which contains a peculiar report on composing Poème de l’exstase: Everybody is asleep. I am sitting alone in the dining room composing. That is to say, I am rather thinking of a plan for my new work for the one thousandth time. Every time it seems to me that the foundation is already done, the universe interpreted from the point of view of free creation and that I can finally become God, playing and freely creating! And tomorrow I will certainly have doubts still, still problems! […] I need an ideal harmony of elements and a solid foundation for this enormous edifice I wish to build. As long as my thoughts are not absolutely clear, all phenomena will not be explained from my point of view – I cannot fly over. But this time is coming, I can feel it. Spread, my dear wings! Take me at insane speed! Let me fulfil a burning passion for life! Oh, I need celebration with all my heart! I am all unlimited desire! And celebration will come! We will lose our breath, we will burn and the whole universe will burn in our ecstasy! (Scriabin: 1976, 334f., my translation).
A full realisation of the concept of a total work of art, understood in eschatological categories, was to be achieved in Mysterium, the composer’s magnum opus devised as a “cosmic liturgy” and involving all the senses of its potential participants. The music of this work was intended to use powerful vocal and instrumental forces conducted
186
Tomasz Baranowski
by Scriabin himself (also playing the piano), joined in a harmonious synthesis with a féerie of colourful lights, incense, poetry, and finally a shared ecstatic dance. The ideal place for such a ritual was to be a theatre in India, in a temple the artist dreamed of and which was to be built specifically for this purpose (Scriabin’s Bayreuth). The edifice was to be erected on a lake. Its semicircular shape would give an illusion of complete sphericality by being reflected in the surface of the water. The round shape of this temple, devoid of any reference to the Christian religion or any other, was to emphasise the cosmic dimension of this celebration. However, the project of Mysterium, a work where the aesthetic idea of a correspondance des arts revealed a universal aspect, breaking the historical boundaries of romantic or modernist understanding, has to this day not yet been realised. It remained what it was in statu nascendi, that is, as “unlimited desire”. This artistic idea was immediately regarded by some as utopia (for instance by Nikolai Miaskovsky, an author quoted many times in Scriabin’s obituary). For many it turned out to be a testament which resulted in numerous innovative performances of Prometheus, as well as the attempt to reconstruct sketches of L’Acte préalable.
Bibliography Faubion Bowers, Scriabin. A Biography of the Russian Composer, 1871–1915, Tokyo 1969. Lev V. Danilewitsch, Alexander Nikolajewitsch Skrjabin, Moscow 1953. Tenny L. Davis, The Emerald Tablet of Hermes Trismegistos: Three Latin versions which were current among later Alchemists, in: Journal of Chemical Education (1926), vol. 3, no. 8, 863–75. Stefan Jarociñski, Debussy a impresjonizm i symbolizm [Debussy and Impressionism and Symbolism], Cracov 1976. Wassily Kandinsky, Über das Geistige in der Kunst insbesondere in der Malerei, München 1912. Manfred Kelkel, Alexandre Scriabine. Un musicien a la recherche de l’absolu, Paris 1999. René Leibowitz, Schönberg et son école, Paris 1947. Franz Marc, Briefe, Aufzeichnungen und Aphorismen, Berlin 1920. Alexander Scriabin, Prometheische Phantasien [German translation of Scriabin’s diary made by Oskar von Riesemann], Stuttgart 1924. Aleksander Skriabin. Cały jestem pragnieniem nieskoñczonym. Listy [A. Scriabin. I am all unlimited desire. Letters], translated by Jadwiga Ilnicka, Cracov 1976.
„Bedrohung“ und „Erlösung“ des männlichen Ich
187
Elfriede Wiltschnigg „Bedrohung“ und „Erlösung“ des männlichen Ich. Die bildliche Umsetzung und Interpretation von Beethovens Neunter Symphonie durch Gustav Klimt im Beethovenfries
Wer über mich – als Künstler, der allein beachtenswert ist – etwas wissen will, der soll meine Bilder aufmerksam betrachten und daraus zu erkennen suchen, was ich bin und was ich will. Gustav Klimt1
Einer der größten Anziehungspunkte für Wien-Touristen ist das Secessionsgebäude von Josef Olbrich, das mit seiner goldenen Kuppel aus Blättergerank heute einen fixen Bestandteil des Stadtbildes darstellt. Mehr noch als der Bau ist es jedoch der Beethovenfries von Gustav Klimt, der, 1902 als Hommage an den großen Komponisten und sein wohl berühmtestes Werk, die Neunte Symphonie, entstanden, die Besucher in Scharen anlockt.
1. Musik und bildende Kunst Die Musik ist als Thema aus der bildenden Kunst nicht wegzudenken. Von jeher waren die Maler von der Immaterialität der Musik sowie ihrer Unabhängigkeit von der sichtbaren Welt und den Zwängen der Realitätswiedergabe, an die sich die bildende Kunst jahrhundertelang gebunden glaubte, fasziniert. Denn während selbst die Dichtung trotz ihres höheren Abstraktionsgrades dem Konkret-Benennbaren verhaftet bleibe, könne sich die Musik in einem Freiraum entfalten, der lediglich durch die aus ihren eigenen Mitteln hervorgegangenen Gesetze der Harmonik limitiert sei. Um 1900 jedoch, parallel zum Beginn der abstrakten Malerei, überwand die Musik auch die tradierten Schranken der Tonalität (vgl. Maur: 1994–96, 3). „Ich beneide Sie sehr“ – schrieb Kandinsky im April 1911 an Schönberg: 1 Zit. nach Nebehay: 1969, 32.
188
Elfriede Wiltschnigg
[…] wie unendlich gut […] haben es die Musiker in ihrer so weit gekommenen Kunst. Wirklich Kunst, die das Glück schon besitzt, auf rein praktische Zwecke vollkommen zu verzichten. Wie lange wird wohl die Malerei noch darauf warten müssen? Und das Recht dazu (= Pflicht) hat sie auch: Farbe, Linie an und für sich – was für grenzenlose Schönheit und Macht besitzen diese malerischen Mittel. […] Man darf heute von einer „Harmonielehre“ auch hier träumen. Ich träume schon und hoffe, dass ich wenigstens die ersten Sätze zu diesem großen kommenden Buch aufstellen werde (zit. nach Maur: 1994–96, 354).
Noch im selben Jahr wagte Kandinsky selbst den Schritt zur Abstraktion und thematisierte in seiner Schrift Über das Geistige in der Kunst den inneren Klang von Farben und Formen (vgl. Kandinsky: 1952, 66–112). Der bildende Künstler, der sich mit der Musik schöpferisch auseinandersetzt, kann nur auf „seine“ Medien zurückgreifen, um das Nichtdarstellbare der Musik darzustellen. Die thematische Palette ist breit: Als Allegorie etwa findet sich die Musik in unzähligen Werken der bildenden Kunst – die weltliche Musik meist personifiziert in der Gestalt der Muse, die religiöse Musik verkörpert durch ihre Schutzheilige, die Heilige Cäcilie. 1885 entstand Klimts Orgelspielerin, die, in traditioneller Ikonografie ausgeführt, das Bild der Heiligen Cäcilie aufnimmt. Mit einer Frauen- und einer Sphinxgestalt enthält die Musik II (1898) dagegen zwar noch allegorisch-antikisierende Elemente, doch löst sich der Hintergrund bereits in einer Ornamentfläche auf, was für Klimts spätere Bilder charakteristisch werden wird. In diesem Werk bedient sich der Künstler schon einer eigenen, aus dem symbolistischen Gedankengut der Jahrhundertwende resultierenden Bildsprache. Der Komponist, dem in Portraits gehuldigt wird, wird zwangsläufig über sein musikalisches Werk identifiziert. Im 19. Jahrhundert und vor allem im Wien der Jahrhundertwende sind eine Vielzahl von Musikerportraits entstanden. Beispielsweise malte Richard Gerstl, eng verbunden mit dem Schönbergkreis, den Komponisten in einem auf das Streben nach einer neuen, modernen Malweise hinzielenden Stil, der die Brüche mit der österreichischen Portraittradition deutlich werden lässt. Schönberg wiederum, inspiriert vom jungen, von künstlerischen Zwängen weitgehend unbelastet malenden Gerstl, fertigte um 1910 ein Bildnis Alban Bergs, das dem Expressionismus verpflichtet ist. In langen Gesprächen diskutierte Schönberg mit Gerstl über Malerei, und wenn er auch im Rückblick diese Gespräche als „Verschwendung von Gedanken“ (Schröder: 1993, 182) bezeichnet, darf man doch auf einen geistigen Gleichklang der beiden in Bezug auf Kunst – Malerei wie Musik – schließen. Mehr noch als der Komponist findet der Musiker Eingang in die bildende Kunst. Die Musikwiedergabe bietet, indem sie Individuen miteinander verbindet, einen erzählerischen Zusammenhang für alle möglichen Figurenkonstellationen
„Bedrohung“ und „Erlösung“ des männlichen Ich
189
(vgl. Phillips: 1998, 11), wie in Gustav Klimts Gemälde Schubert am Klavier von 1899, das für den Musiksalon Dumbas vorgesehen war.2 Komponist und Interpret sind eins. Die Frauen, die den Komponisten umringen, scheinen mondäne Damen zu sein, die den romantischen Klängen lauschen; allerdings dürften sie hinsichtlich Kleidung und Frisur durchaus der Zeit Klimts entstammen.3 Die Stoffe ihrer Kleider sind schimmernd und wirken wie ein Echo der Klangvibrationen, die vom Klavier ausgesendet werden. Der bildende Künstler sieht sich mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert, wenn er sich an die Darstellung von musikalischen Phänomenen – wie etwa das Musikhören – heranwagt, geht es doch um das bildliche Festhalten von nicht Sichtbarem. So wird oft mithilfe des Bildtitels der Betrachter an den Bildinhalt herangeführt, wie etwa in Fernand Khnopffs Gemälde En écoutant du Schumann von 1883. Hier ist es jedoch nicht der Interpret, der ins Zentrum des Bildes gerückt ist, sondern das Erleben von Musik als sinnlich-intellektuellem Prozess. Tiefe Stille scheint im Raum zu herrschen und doch ist die weibliche Gestalt im Vordergrund lauschend in Musik versunken, die von der Person am Klavier erzeugt wird. Im Vergleich mit Klimts Schubert am Klavier werden die unterschiedlichen malerischen Zugänge der beiden Künstler klar ersichtlich: Während Khnopff bei aller symbolistischen Interpretationsmöglichkeit in Komposition und Ausführung auf traditionelle Bildmittel zurückgreift, nimmt Klimts Werk Elemente seiner sogenannten „Goldenen Periode“ vorweg: die durchwirkten Gewänder, das Flimmern des Goldes, das starre Gesicht der frontal ins Bild gestellten Frau, die durchaus Ähnlichkeiten mit Emilie Flöge, der langjährigen Freundin und Vertrauten des Künstlers, erkennen lässt. Der Vorgang des Lauschens wird in der bildenden Kunst häufig durch den auf die Hand gestützten Kopf, den gesenkten Blick, das in die Ferne schweifende Auge versinnbildlicht. Bereits 1861 schrieb Frederick Lord Leighton in einem Brief über sein Bild Lieder ohne Worte: Es zeigt ein Mädchen, das an einem Brunnen sitzt und dem Geplätscher des Wassers und dem Gesang eines Vogels lauscht. […], denn ich habe versucht, dem Betrachter etwas von der Freude, die das Kind übers Ohr empfängt, durch die Farben und durch zarte fließende Formen mitzuteilen (zit. nach Wilton: 1998, 109).
2 Das Gemälde verbrannte 1945 im Schloss Immendorf, erhalten geblieben ist der Öl-Entwurf. 3 Die Kostüme der Schubert umstehenden Damen durfte Gustav Klimt sich aus der Garderobe der Gattin seines Mäzens August Lederer wählen (vgl. Nebehay: 1969, 176).
190
Elfriede Wiltschnigg
Wie das Singen gehört auch der Tanz zu den häufig dargestellten Musikthemen. Angeregt durch den modernen Ausdruckstanz um 1900 entstand eine Vielzahl von Bildwerken, die sich mit dem ekstatischen Musikerleben und dessen Umsetzung in die Bewegungen des menschlichen Körpers auseinandersetzen.4 Die Tänzerin Grete Wiesenthal etwa inspirierte mit ihrem höchst individuellen Tanzstil ihren Ehemann Erwin Lang zu einer Holzschnittserie. Beispiele für die begeisterte Aufnahme des Ausdruckstanzes in die bildende Kunst finden sich auch im Schaffen Egon Schieles (Die Tänzerin Moa) und Auguste Rodins (Kambodschanische Tänzerin). Ganz anders ist hingegen Der Tanz von Henri Matisse, entstanden 1910, zu lesen. Zwar ist auch er Ausdruck elementarer Lebensfreude, bei Matisse wird sie jedoch – wie er selbst später zum Ausdruck bringen wird – versinnbildlicht im Klangakkord der Farben. „Die Farben sind Kräfte – wie in der Musik“ (Maur: 1994–96, 8). Weitaus schwieriger erweist sich die „Darstellung“ von Musik jedoch, wenn die Aufgabe des Malers darin besteht, ein ganz konkretes Musikstück, allerdings ohne leicht erzählbaren Inhalt – wie etwa eine Oper – in bildende Kunst umzusetzen. Mit seiner Interpretation des Schlusssatzes von Beethovens Neunter Symphonie im Beethovenfries versucht Klimt – ganz im Sinne der symbolistischen und synästhetischen Ideen Baudelaires5 – Wort, Bild und Ton in Übereinstimmung zu bringen und somit dem Werk des großen Musikers gerecht zu werden. Diese Übertragung vom musikalischen in ein bildkünstlerisches Medium verlangt nun einerseits die Übersetzung von Tönen beziehungsweise Noten – sowie im Fall der Neunten Symphonie auch dem Text Schillers –, andererseits muss der Maler auch zu einer Interpretation hinsichtlich der im Musikstück ausgedrückten Inhalte finden. Klimt schöpft in seiner Umsetzung der Neunten Symphonie alle ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten aus: Form und Farbe sind dabei die elementaren 4 „So saßen denn in dem weißen Saale die Damen, die Klimt gemalt hat, und vor ihnen tanzte das fremde Mädchen, das Klimt gewiß malen wird. Ihr Tanz wird ihm etwas sagen; vermutlich das nämliche, was seine Bilder ihr gesagt haben. Dem Tanztrieb in ihr, wie sie dem Maltrieb in ihm“ (Hevesi: 1990, 115). 5 „Synästhesie bezeichnet eine ‚Vermischung der Sinne‘. Darunter versteht man, dass es bei Stimulation einer Sinnesqualität – beispielsweise des Hörens oder des Riechens – zusätzlich in einer anderen Sinnesqualität, wie dem Sehen von Farben oder von geometrischen Figuren, zu einer Sinneswahrnehmung kommt. Am häufigsten ist dabei das so genannte ‚farbige Hören‘ – auch als Farbenhören, ‚audition colorée‘ und ‚coloured hearing‘ bezeichnet. Dabei führen Geräusche, Musik, Stimmen, ausgesprochene Buchstaben und Zahlen typischerweise zur Wahrnehmung bewegter Farben und Formen. Sie werden von den Betroffenen in die Außenwelt oder auch ins Kopfinnere projiziert.“ (Emrich/Schneider/Zedler: 2002, 11). „Der Begriff ‚Synästhesie‘ ist in der Medizin seit mehr als 300 Jahren bekannt. Wie viele andere subjektive Erlebnisqualitäten des Menschen wurde das Phänomen der Synästhesie insbesondere in den Jahren zwischen 1860 und 1930 lebhaft untersucht und diskutiert“ (Emrich/Schneider/Zedler: 2002, 14f.).
„Bedrohung“ und „Erlösung“ des männlichen Ich
191
Prozessoren, mit denen der Transfer von Wort und Ton in das Medium Malerei erfolgt; jedoch ohne im Versuch einer starren Illustration der Verse Schillers zu verharren, sondern in einer spezifischen bildsprachlichen Neukomposition. Ludwig Hevesi hat 1902 über die Umsetzung von Musik in bildende Kunst geschrieben: An der Schwelle des Jahrhunderts hat Beethoven dem Ohre gesagt, was Max Klinger heute dem Auge zeigt. Der eine Sinn löst den anderen ab, die Jahrhunderte hindurch. Heute malt man Eroica und meißelt Neunte Symphonie (zit nach. Zaunschirm: 1992, 30).
Der Beethovenfries Gustav Klimts lässt sich in diesen Kommentar Hevesis problemlos einreihen: Er zeigt die Bewunderung für den Musiker Beethoven und seine Neunte Symphonie; – er ist aber auch Sinnbild für die Ästhetik seiner Entstehungszeit, die bestrebt war, im Zusammenklingen von bildender Kunst, Dichtung und Musik der Synästhesie der Sinne sichtbaren Ausdruck zu geben. Klimt bedient sich dabei jener Symbole, die aus seiner individuell gestalteten Ikonografie resultieren. Der Maler setzt sie nicht als konkret lesbare Zeichen, sondern erst aus dem Kontext, dem Zusammenspiel, werden Metaphern ableitbar, welche die Verschmelzung der Künste bild- und sinnhaft werden lassen. Charles Baudelaire beschrieb schon in seinem Gedicht Correspondances die geheime Verbindung, die zwischen einem Seelenzustand und dem entsprechenden Zustand in der Natur existiert. Nach Baudelaire ist es eben dieses Gefühl, das es uns ermöglicht, in der bildenden Kunst eine Art von magischer Beschwörung zu betreiben, indem wir das geheimnisvolle Sein des Geschaffenen vor dem menschlichen Blick aufdecken: Übereinstimmungen – „Ton, Duft und Farbe ineinander klingen“ (Baudelaire: 1984, 19) – wie es Baudelaire ausdrückt. Eine Parallele zu diesem Denken findet sich ebenso in einem Ausspruch Stéphane Mallarmés, der meint: Ein Ding direkt zu benennen heißt drei Viertel vom Wert des Gedichtes zu unterdrücken, das in dem Glück besteht, nach und nach in der Tiefe zu ahnen. Andeuten, nahelegen, da liegt der Traum. Das ist der vollkommene Gebrauch dieses Geheimnisses, das das Symbol bildet. Ein Ding nach und nach heraufzurufen um einen seelischen Zustand zu zeigen oder umgekehrt ein Ding wählen und durch eine Reihe von Entzifferungen einen seelischen Zustand auslösen (zit. nach Lucie-Smith: 1972, 54).
Mit der Natur des Symbols setzte sich auch Paul Verlaine auseinander, der 1891 zu einem Korrespondenten des Figaro sagte: „So viele Symbolisten, so viele verschiedene Symbole, Symbole für was? Das ist es, was ich nicht weiß. Aber das Symbol,
192
Elfriede Wiltschnigg
das ist die Bildsprache, das ist die Dichtung selbst“ (zit. nach Peters/Jenderko: 1976, 17). Arnold Böcklin hat die Anforderungen, denen ein symbolistisches Bild genügen muss, wie folgt beschrieben: „Ein Bildwerk soll etwas erzählen und dem Beschauer zu denken geben so gut wie eine Dichtung und ihm einen Eindruck machen wie ein Tonstück“ (zit. nach zit. nach Peters/Jenderko: 1976, 12). Das Bild soll also den Inhalt wiedergeben, es darf sich nicht in einer Anekdote erschöpfen und der Inhalt soll zum Nachdenken anregen, weiters wird auch noch die musikalische Komponente des Kunstwerks angesprochen (vgl. Peters/Jenderko: 1976, 12). Die Idee des Ineinandergreifens von verschiedenen Ebenen der Kunst spiegelt sich auch in Richard Wagners Vorstellung vom Gesamtkunstwerk.6 Die Art und Weise, in der der Maler Henri Fantin-Latour, nachdem er im August 1876 die dritte Aufführung des Rings des Nibelungen während der allerersten Spielzeit im Bayreuther Festspielhaus gesehen hatte, die Aufführung beschreibt, macht deutlich, wie Wagners Konzept des Gesamtkunstwerkes wirkte: Oh, es ist einzigartig. Nichts kann damit verglichen werden. Die Szene ruft ein Gefühl wach, das ich bis jetzt erst zu einem geringen Teil verstanden habe […] Keine meiner märchenhaften […] Erinnerungen war schöner und näher an meinem Ideal. Die Bewegungen der Rheintöchter, die schwimmen, während sie singen, sind perfekt. Alberich, der das Gold begehrt, die Beleuchtung, der Lichtschein, den das Gold in das Wasser hinabwirft, ist hinreißend. Das ist Gefühl, das ist keine Musik oder Theaterdekor oder irgendein Sujet, der Zuschauer wird völlig gefesselt – aber „Zuschauer“ ist nicht das richtige Wort, auch „Zuhörer“ nicht. Es ist alles (in der Aufführung) enthalten (zit. nach Wilton: 1998, 214).
In seiner Studie über Richard Wagner und Tannhäuser à Paris 1861, kommt Baudelaire noch einmal auf sein Gedicht Correspondances und die synästhetischen Zusammenhänge, die „analogies universelles“, zurück: Car ce qui serait vraiment surprenant, c’est que le son ne pût pas suggérer la couleur, que les couleurs ne pussent pas donner l’idée d’une mélodie, et que le son et la couleur fussent impropres à traduire des idées; les choses s’étant toujours exprimées par une analogie réciproque, depuis le jour où Dieu a proféré le monde comme une complexe et indivisible totalité (Baudelaire: 1990, 696f.).
Auch Arthur Rimbaud beschäftigt sich in seinem Gedicht Voyelles mit den Übereinstimmungen, die zwischen unterschiedlichen Medien bestehen können: Er ordnet 6 Beispielsweise in Das Kunstwerk der Zukunft.
„Bedrohung“ und „Erlösung“ des männlichen Ich
193
dabei den Buchstaben Farben zu: „A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu [...]“ (Rimbaud: 1997, 106). Philipp Otto Runge sah in der Musik „zunächst der Religion“ die höchste und reinste Kunst, die durch ihre sinnliche Wirkung auf die Seele des Menschen diesen der Schöpfung näher bringen könne: Die Musik ist doch immer das, was wir Harmonie und Ruhe in allen drei Künsten nennen. So muß in einer schönen Dichtung durch Worte Musik sein, wie auch Musik sein muß in einem schönen Bilde, und in einem schönen Gebäude, oder in irgendwelchen Ideen, die durch Linien ausgedrückt sind (zit. nach Maur: 1994–96, 5).
Psyche, zugleich Sinnbild der Nachtigall, unterweist in Runges Bild Die Lehrstunde der Nachtigall, angeregt durch Klopstocks Ode Die Lehrstunde, Amor im Flötenspiel: Flöten mußt du, bald mit immer stärkerem Laute, Bald mit leiserem, bis sich verlieren die Töne; Schmettern dann, daß es die Wipfel des Waldes durchrauscht! Flöten, flöten, bis sich bey den Rosenknospen Verlieren die Töne (zit. nach Muller: 1987, 99).
Umgeben ist das zentrale Mittelfeld von einem grisailleartig gemalten Rand. Seinem Bruder Daniel berichtet Runge am 4. August 1802, dass dieses Bild dasselbe wird, was eine Fuge in der Musik ist. Dadurch ist mir begreiflich geworden, daß dergleichen in unserer Kunst ebenso wohl stattfinde, nämlich, wie viel man sich erleichtert, wenn man den musikalischen Satz, der in einer Composition im Ganzen liegt, heraus hat, und ihn variiert durch das Ganze immer wieder durchblicken läßt (zit. nach Maur: 1994–96, 5).
Gustav Klimt greift um 1884 das Motiv von Amor und Psyche für sein Bild Idylle wieder auf, allerdings wird deren Umrahmung nun von zwei gut gebauten, an Michelangelo gemahnenden Männerakten gebildet, die in ihrer monumentalen Körperlichkeit in extremem Widerspruch zum zurückhaltenden Grisaillemuster Runges stehen.
194
Elfriede Wiltschnigg
2. Der Beethovenfries Im Mittelpunkt der symbolistischen Bildthemen steht fast immer der Mensch, sehr oft der Mensch in den rätselhaften Zusammenhängen von Liebe und Tod – wie auch im Beethovenfries Klimts. Ludwig Hevesi hat mit seiner Beschreibung des Beethovenfrieses diesem Aspekt Rechnung getragen: „Klimt hat sich die Sehnsucht der Menschheit nach dem Glück gedacht. So ungefähr, sei hinzugefügt, denn Allegorien soll man gar nicht ganz verstehen“ (zit. nach Bisanz-Prakken: 1977, 31). Die Parallelität der Aussage zu Stéphane Mallarmés Forderung, „man solle nicht beschreiben, sondern suggerieren“ (vgl. Schabert: 1987, 993), ist augenfällig. Um 1900, ausgelöst nicht zuletzt durch die Schriften Richard Wagners und Friedrich Nietzsches, wurde Beethoven und seinen Werken großes Interesse entgegengebracht. Max Klingers Beethovenskulptur gab dann den unmittelbaren Anstoß für die 1902 von den Mitgliedern der Wiener Secession durchgeführte BeethovenAusstellung: Diese war als Gesamtkunstwerk konzipiert, wobei die Arbeiten der Secessionskünstler in direktem Bezug zu Klingers Plastik standen. Dies wird auch durch die Aufteilung der Räume in dem flexibel zu gestaltenden Secessionsgebäude deutlich. Die modernen Künstler um 1900 waren um die Einheit der Künste bemüht. Sie waren durchdrungen von der Vision, dass die Künste das Leben erhöhen sollten – was in weiterer Folge in einer geistigen und moralischen Besserung der Menschheit resultieren würde.7 Die Voraussetzungen, die zu einer solchen Gesamtkunstwerkausstellung führen sollten, wurden im Katalog zur XIV. Ausstellung formuliert: Ein einheitlicher Raum sollte vorerst geschaffen werden und Malerei und Bildhauerei diesen im Dienste der Raumidee dann schmücken. Hier gilt es, in gegebenen Verhältnissen, in enggezogenen Grenzen die Teile der Wirkung des Ganzen unterzuordnen (Partsch: 1992, 142).
Da einige der Secessionskünstler in persönlicher Beziehung zu Max Klinger standen, war auch bekannt, dass die Beethoven-Plastik bald fertiggestellt sein würde.8 7 Bereits 1893 erklärte Hugo von Hofmannsthal, „daß die Kunst der Farben an Gewalt über die Seele gleich ist der Kunst der Töne, daß die Bilder, wie in den wundervollen Werken der Musik, Offenbarung und Erlebnis enthalten“ (zit. nach Maur: 1994–96, 346). 8 Ernst Stöhr schrieb in seiner Einleitung zum Katalog: „Die leitende Idee, die unserem Unternehmen Weihe und das bindende Element geben sollte, bot sich uns in der Hoffnung ein hervorragendes Kunstwerk zum Mittelpunkt der Ausstellung machen zu können. Das Beethovendenkmal von Max Klinger ging der Vollendung entgegen“ (zit. nach Fliedl: 1997, 99).
„Bedrohung“ und „Erlösung“ des männlichen Ich
195
Klimt wählte zum Ausdruck seiner Beethovenverehrung den Schlusssatz der Neunten Symphonie als Grundthema eines Wandfrieses, der sich um drei Seiten des an den Hauptsaal angrenzenden Raumes zog.9 Das Dargestellte wurde vom Künstler selbst interpretiert und der Text im Ausstellungskatalog abgedruckt. Auf der linken Seitenwand, mit einer Gesamtlänge von 1378cm befand sich Die Sehnsucht nach dem Glück. Die Leiden der schwachen Menschheit. Die Bitten dieser an den wohlgerüsteten Starken als äußere, Mitleid und Ehrgeiz als innere treibende Kräfte, die ihn das Ringen nach dem Glück aufzunehmen bewegen.
Die Schmalwand mit einer Gesamtlänge von 636cm hat als Bildprogramm: Die feindlichen Gewalten. Der Gigant Typhoeus, gegen den selbst die Götter vergebens kämpften, seine Töchter, die drei Gorgonen. Krankheit, Wahnsinn, Tod. Wollust und Unkeuschheit, Unmäßigkeit. Nagender Kummer. Die Sehnsüchte und Wünsche der Menschen fliegen darüber hinweg.
Auf der rechten Seitenwand mit einer Gesamtlänge von 511cm + 400cm ohne Malerei + 470cm befindet sich: Die Sehnsucht nach Glück findet Stillung in der Poesie. Die Künste führen uns in das ideale Reich hinüber, in dem allein wir reine Freude, reines Glück, reine Liebe finden können. Chor der Paradiesengel, „Freude, schöner Götterfunken“. „Diesen Kuß der ganzen Welt!“ (zit. nach Nebehay: 1969, 283).
Die Neunte Symphonie von Beethoven wurde am 7. Mai 1824 in Wien uraufgeführt. 1786 hatte Friedrich Schiller, inspiriert von den Idealen der Aufklärung, seine Ode An die Freude veröffentlicht. Beethoven begann sich bereits 1792 für den Text Schillers zu interessieren, jedoch erst 30 Jahre später kam die Verbindung von Wort und Musik im Finale der Neunten zu Stande. Seit der quasi Wiederentdeckung der Wiener Moderne als einer bedeutenden Epoche der bildenden Kunst auf dem Weg ins 20. Jahrhundert hat der Beethovenfries intensive Beachtung erfahren. Die Darstellung Klimts zeigt den Weg des Men9 Die Technik des Frieses ist Kaseinfarbe auf Verputzgrund, unterlegt mit einer Rohrschicht, Stuckund Goldauflagen, Schmuckapplikationen (Halbedelsteine, Glas und Perlmutter), Kohle-, Grafit-, Pastellstift. Der Beethovenfries befindet sich heute wieder im Secessionsgebäude in einem speziell dafür adaptierten Raum und ist im Besitz der Österreichischen Galerie, Wien. (Auch die Längenangaben: Partsch: 1992, 168; 181).
196
Elfriede Wiltschnigg
schen gepflastert mit Leiden, falschen Verlockungen und feindlichen Gewalten; Frieden und Glück findet der Standhafte allein in der Kunst. Von den Leiden der schwachen Menschheit kehrt sich der wohlgerüstete Starke jedoch ab, er begegnet der Gefahr in Gestalt von Krankheit, Wahnsinn und Tod. Der Gigant Typhoeus wird auf dem Weg zur Erfüllung passiert, ebenso Wollust, Unkeuschheit und Unmäßigkeit, bis man schließlich mit dem nagenden Kummer konfrontiert wird.10 All die Personifikationen für diese aus den menschlichen Urängsten hervorgegangenen Gestalten werden – bis auf den Giganten Typhoeus – von Frauen verkörpert. Sie sind Sinnbild all jener Aspekte des „Schrecklich“-Weiblichen, die um die Jahrhundertwende in einer Vielzahl von Motiven in der bildenden Kunst auftreten. Der wohlgerüstete Starke, der Ritter, ist Symbol für den Mann, der intellektuell in der Lage ist, seinen Instinkten abzuschwören und mithilfe von Geist und Kunst eine höhere Seinsebene zu erlangen, durch die er sich über den von der Frau repräsentierten Bereich der Natur erhebt.
3. Misogynie in Wien um 1900 Aus feministischer Sicht ist die Kritik am Frauenbild, wie es sich letztlich im Beet hovenfries darstellt, bereits bei Schillers Ode an die Freude anzusetzen. Dieses Gedicht preist ganz im Sinne seines Entstehungszeitraumes die Werte von Brüderlichkeit, Gleichheit und Freiheit. So steht auch – folgt man dem Originaltext – an erster Stelle die Freundschaft zum Mann: „Wem der große Wurf gelungen, Eines Freundes Freund zu sein“. Erst darauf folgt: „Wer ein holdes Weib errungen, Mische seinen Jubel ein!“ Schiller macht das Verhältnis der Geschlechter zueinander deutlich: Der gegenseitigen Männerfreundschaft, das heißt der aktiven Handlung zweier bewusst agierender Personen, steht die Eroberung der passiven Frau gegenüber. Und wenn alle Menschen Brüder werden, erhebt sich zumindest aus heutiger Sicht die Frage: Wo sind dann die Frauen? Sind sie keine Menschen oder ist ihnen die Freude ganz allgemein verwehrt? Bereits Olympe de Gouges hatte mit ihrer 1791 publizierten Deklaration der Rechte der Frau und Bürgerin11 vehement die Gleichstellung von Mann und Frau gefordert und darauf hingewiesen, dass die 10 „Wie der Katalog eigens hervorhebt, überfliegen die Sehnsüchte und Wünsche der Menschheit die feindlichen Kräfte. Diese psychische Haltung ist geradezu klassischer Ausdruck einer Ich-Schwäche, die in der Phantasie einen Ersatz für die mangelnde Beherrschung der Wirklichkeit findet: der Wunsch ist alles, und die Auseinandersetzung wird vermieden“ (Schorske: 1994, 248). 11 Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. A décréter par l’Assamblée Nationale dans ses dernières séances ou dans celle de la prochaine législature.
„Bedrohung“ und „Erlösung“ des männlichen Ich
197
aus der französischen Revolution und der Deklaration von 1789 resultierenden Menschenrechte Männerrechte sind. Im Übrigen sind die Forderungen Olympe de Gouges bis heute nicht umgesetzt, sie selbst wurde 1793 hingerichtet. Seit Längerem schon wird in der Klimt-Forschung auf eine Analogie des inhaltlichen Programms des Frieses mit der Beethovendeutung Richard Wagners hingewiesen, wobei vor allem der 1870 von Wagner verfasste Aufsatz über Beethoven zitiert wird (vgl. Maur: 1994–96, 347). Der Grund für diese Untersuchungen liegt in der Neutitulierung des letzten Friesfragments, das 1903 in der Klimt-Kollektivausstellung in der Secession präsentiert wurde: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“ (Bisanz-Prakken: 1977, 32). Dieses Zitat aus der Bibel ist dem Aufsatz Richard Wagners von 1870 entnommen und soll wohl darauf verweisen, dass es die Musik ist, die den Menschen das Heil bringen, sie von der „Verderbtheit der modernen Zivilisation“ erlösen kann. Erwähnenswert ist auch die Aufführung der Neunten Symphonie durch Wagner 1846 in Dresden. Mit diesem Konzert ging eine Interpretation des Werkes durch Wagner einher; Klimt folgt im Beethovenfries der Deutung Wagners in wesentlichen Punkten (Bisanz-Prakken: 1977, 32). Klimts Frauenbild wird aus seinem Schaffen deutlich: auf der einen Seite die verehrungswürdige Dame, die – eingesponnen in ein Netz aus Ornamenten – zu einem stilisierten, ästhetisierten, entsexualisierten Objekt mutiert, andererseits die triebgesteuerte, dämonisierte, bedrohliche Frau, deren Existenz auf ihre Beziehung zu Natur und Geschlechtlichkeit reduziert wird. Diesem Bild der Frau in seinen Werken entsprechen auch Klimts Beziehungen zu Frauen im realen Leben. Die zahlreichen Geliebten und illegitimen Kinder zeugen von einer lustvoll ausgelebten Sinnlichkeit; das familiäre Zusammenleben mit Mutter und Schwestern und die platonische Beziehung zu Emilie Flöge hingegen geben Zeugnis von seiner Suche nach der reinen Weiblich- und Mütterlichkeit. Die Wahl des Gegenstandes läßt im 19. Jahrhundert tiefe Einsichten in die Persönlichkeit des Wählenden zu, denn anders als in den früheren Jahrhunderten wird dieser Akt in einem Zeitalter der Künstlerkunst vom Einzelnen getragen. Was immer er malt, er malt sich selbst: er beschwört sein Schicksal, seine Sehnsüchte und Ängste, seine Vorstellungen von der Rolle der Kunst und von den Aufgaben des Künstlers (Hofmann: 1974, 384).
Dies ist ein Gedanke Werner Hofmanns, der sicherlich auch für Klimts Interpretation von Beethovens Neunter Symphonie Gültigkeit hat. Über die künstlerische Bedeutung hinaus ist das Sichtbarwerden des Wandels des Frauen- wie des Männerbildes im Laufe des 19. Jahrhunderts ein zentraler Aspekt des Beethovenfrieses. Der wirtschaftliche und technische Fortschritt, die Kriege, die Landflucht sowie der bis hin zur Jahrhundertwende ständig zunehmende Pes-
198
Elfriede Wiltschnigg
simismus – ausgedrückt in den Schriften Schopenhauers, Nietzsches und Weiningers – bringen auch einen Wechsel im Lebensgefühl mit sich. „Das Verhältnis der Geschlechter, die Entfremdung zwischen Mann und Frau, der Wandel in menschlichen Beziehungen sind damit untrennbar verbunden“ (Bode, 1981, 68). In der Ode An die Freude räumt Schiller der Frau kaum Raum ein: Sie wird errungen, sie steht dem Mann im wahrsten Sinne des Wortes nur „zur Seite“. Beethoven hat durch seine Auswahl von Text-Passagen für den Schlusssatz der Neunten Symphonie keine Betonung des Weiblichen herbeigeführt, wiewohl die Frauen seiner Zeit gesellschaftlich wie künstlerisch keineswegs untätig waren.12 Bei Wagner hingegen erfährt die Frau eine Neudeutung im Sinne des Erlösungsmotivs (etwa Elisabeth im Tannhäuser);13 er selbst schrieb in einem Brief an August Röckel über sein Bild der Heroine: „[…] das leidende, sich opfernde Weib wird endlich die wahre Erlöserin sein: denn die Liebe ist eigentlich ‚das ewig Weibliche selbst‘“ (Storch: 1987, 59). Thomas Mann erkannte in den Heldinnen Wagners die Züge der Moderne, wenn er äußert: Die Heldinnen Wagners kennzeichnet überhaupt ein Zug von Edelhysterie, etwas Somnambules, Verzücktes und Seherisches, das ihre romantische Heroik mit eigentümlicher und bedenklicher Modernität durchsetzt (zit. nach Gregor-Dellin/von Soden: 1983, 100).
So enden die Wagner-Heldinnen auch meist als Leichen, ihr Tod bringt Leben oder Erlösung für den Helden. Klimt, wiewohl an Aspekte von Wagners ambivalentem Frauenbild anknüpfend, erweitert und verstärkt im Beethovenfries jene Inhalte, die geradezu typisch für die Interpretation der Frau um 1900 sind: Frauen sind bedrohlich, sie verkörpern Wollust und Sinnlichkeit, mit denen sie dem Mann Krankheit, Wahnsinn und Tod bringen. Diese negativen Eigenschaften sind auch vielen Frauengestalten Fernand Khnopffs beigegeben; ein Beispiel dafür ist seine Interpretation der Isolde, über die Louis Dumont-Wilden 1907 schrieb: Es ist das Tierische selbst, das sich ausdrückt in diesem Mund, diesen hingebungsvoll entblößten Zähnen, diesem Blick, in dem die Seele sich zermalmt, sich auflöst, verschwindet […] Gewiß, Khnopffs Isolde ist vielleicht nicht in demselben Maße vom romantischen 12 Für die Künstler der Romantik schienen Frauen das gesuchte Ideal der Verbindung von Kunst und Leben zu verwirklichen, Frauen standen ihrer Vorstellung zufolge „der Natur“, „dem Leben“ näher als die abstrakt argumentierenden Männer (vgl. Lühti: 1985, 8). 13 Man findet im romantischen Frauenbild einerseits die Frau als Gattin und Mutter, als lebende Synthese zwischen der ursprünglichen Harmonie und der entfremdeten, männlich dominierten Welt; sie wird aber auch als Abbild alles Bösen, als Hexe, Dämonin, Vampir zur femme fatale (vgl. Strobach: 1988, 13).
„Bedrohung“ und „Erlösung“ des männlichen Ich
199
Wahnsinn besessen wie die Heldin Wagners. Na und? Auch wenn sie ein wenig zivilisierter ist, warum sollte uns diese Figur, das ewige Opfer der Liebe, weniger zu sagen haben? (Königlich-Belgische Kunstmuseen: 2004, 202)
Das Motiv der Erlösung, die der männliche Held durch das weibliche Prinzip erfährt, ist in der Literatur durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch zu verfolgen. Faust wird von Gretchen und „dem ewig Weiblichen“ hinangezogen; Wagners Helden – wie Tannhäuser oder der Fliegende Holländer – erfahren ihre Erlösung durch die Frau und selbst Ibsen lässt am Ende Peer Gynt, den weit Gereisten, bei Solveig, die gleichzeitig als Frau und Mutter erscheint, Zuflucht finden. Aber nicht nur die Frau ist um 1900 einer Neuinterpretation unterworfen. Schillers Ode An die Freude preist die Brüderlichkeit als höchstes Gut, der Gemeinsam-sind-wir-stark-Gedanke durchzieht ganz im Sinne der Revolutionsideale sein Werk. Der romantische Held agiert von Emotion und Begeisterung getrieben, wie etwa Karl Moor in den Räubern. In Klimts Werk hingegen tritt der Gedanke „Alle Menschen werden Brüder“ in den Hintergrund; zum Generalthema wird das menschliche Dasein erhoben, das Hinterfragen des menschlichen Seins, der Lebenskampf des Einzelnen. Im Beethovenfries wird die Geschichte eines starken, gerüsteten Helden erzählt, eines Ritters, der, getrieben von dem Wunsch nach Glück, als einsamer Kämpfer gegen die Bedrohungen und Verlockungen der Welt antritt, und der – wie Parzifal – durch Entsagung und Reinheit zum höchsten Ziel zu gelangen scheint. Dieses Ziel erreicht er durch die Vermittlung der Kunst. Der Künstler, das Künstlergenie, kann somit als jene Person gedeutet werden, der allein es gegeben ist, durch den Kuss der Muse, die das weibliche Prinzip als positiv besetztes Anderes verkörpert, die Erlösung zu finden und sie an die Menschheit weiterzugeben. Diese Vorstellung mag als Resultat der negativen Kritiken, die Klimt mit seinen Fakultätsbildern bei den Anhängern der traditionellen Malerei geerntet hat, angesehen werden – der verachtete Künstler wird zum alleinigen Bringer von Glück und Freude.14 Das Schlussbild des Frieses wird gelegentlich auch im Sinne rein sexuellen Erlebens gelesen, was dem allgemeinen Erlösungsmotiv gegenüberstehen würde, denn Wagner etwa vermeint in der Neunten Symphonie noch die „von dem gequälten Streben nach Freude“ befreiten Menschen, deren Umarmung die „allgemei14 Als Beispiel für die vernichtenden Kritiken, denen sich Klimt ausgesetzt sah, sei jene von Robert Hirschfeld angeführt: „Klimt produzierte diesmal wieder eine Kunst, der nur drei Leute, ein Arzt und zwei Wärter gerecht werden könnten. Klimt’s Fresken paßten für einen Krafft-Ebing-Tempel […] die Darstellungen der Unkeuschheit an der Stirnwand des Saales gehören zu dem äußersten, was je auf dem Gebiete obscöner Kunst geleistet wurde. Das sind die Klimt’schen Wege, welche uns zu Beethoven führen sollen!“ (zit. nach Nebehay: 1969, 297).
200
Elfriede Wiltschnigg
ne Menschenliebe“ (zit. nach Bisanz-Prakken: 1977, 34) verkörpert, zu erkennen. Die Forderungen der französischen Revolution nach égalité, fraternité und liberté scheinen in der Darstellung Klimts auf jene der Freiheit reduziert zu werden; wo ein Genie existiert, kann es keine Gleichheit im geistigen Sinne geben. Das Individuum, die Thematisierung des Ich, bekommt die dominierende Rolle im Hinterfragen der menschlichen Existenz zugesprochen. Und dieses Ich ist im Beet hovenfries männlich.
Literatur Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal – Die Blumen des Bösen, Französisch/Deutsch, Stuttgart 1984. Charles Baudelaire, Curiosités esthétiques. L’Art romantique et autres Œuvres critiques, Paris 1990. Marian Bisanz-Prakken, Gustav Klimt. Der Beethovenfries – Geschichte, Funktion und Bedeutung, Salzburg 1977. Ursula Bode, Kunst zwischen Traum und Alptraum. Phantastische Malerei im 19. Jahrhundert, Braunschweig 1981. Hinderk M. Emrich/Udo Schneider / Markus Zedler, Welche Farbe hat der Montag? Synästhesie: Das Leben mit verknüpften Sinnen, Stuttgart 2002. Martin Gregor-Dellin/Michael von Soden (Hrsg.), Richard Wagner – Leben, Werk, Wirkung, Düsseldorf 1983. Natalia Magdalena Flecker, Synästhesie – Die Wiederentdeckung einer Fähigkeit, Dipl., Wien 1997. Gottfried Fliedl, Gustav Klimt 1862–1918. Die Welt in weiblicher Gestalt, Köln 1997. Ludwig Hevesi, Das große Keinmaleins, hrsg. von Gunther Martin, Wien, Darmstadt 1990. Werner Hofmann, Das irdische Paradies. Motive und Ideen des 19. Jahrhunderts, München 1974. Wassily Kandinsky, Über das Geistige in der Kunst, 10. Auflage, Bern 1952. Königlich-Belgische Kunstmuseen (Hrsg.), Fernand Khnopff (1858–1921), Ausstellungskatalog, Brüssel 2004. Claude Lévi-Strauss, Sehen – Hören – Lesen, München, Wien 1995. Edward Lucie-Smith, Symbolist Art, London 1972. Kurt Lüthi, Feminismus und Romantik. Sprache, Gesellschaft, Symbole, Religion, Wien, Köln, Graz 1985. Karin v. Maur (Hrsg.), Vom Klang der Bilder. Die Musik in der Kunst des 20. Jahrhunderts, Ausstellungskatalog Staatsgalerie Stuttgart, München 1994–96. Kristiane Müller / Eberhard Urban (Hrsg.), Die Kunst der Romantik, Menden 1987. Christian M. Nebehay (Hrsg.), Gustav Klimt Dokumentation, Wien 1969. Susanna Partsch, Klimt – Leben und Werk, Erlangen 1992. Hans Albert Peters/Ingrid Jenderko (Red.), Symbolismus in Europa, Ausstellungskatalog Staatliche Kunsthalle Baden-Baden 1976.
„Bedrohung“ und „Erlösung“ des männlichen Ich
201
Tom Phillips, Musik der Bilder. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart, München, London, New York 1998. Arthur Rimbaud, Sämtliche Dichtungen, Französisch und Deutsch, 8. Auflage, Gerlingen 1997. Werner Schabert (Red.), Vom Impressionismus zum Symbolismus: Edouard Manet, Claude Monet, Auguste Renoir, Camille Pissarro, Edgar Degas, Lausanne 1987 (Die Malerei, 11). Carl E. Schorske, Wien – Geist und Gesellschaft im Fin de Siècle, aus dem Amerikanischen von Horst Günther, München 1994. Arthur Schopenhauer, Metaphysik des Schönen. Philosophische Vorlesungen Teil III, hrsg. und eingeleitet von Volker Spierling, 2. Auflage, München 1988. Klaus Albrecht Schröder, Richard Gerstl 1883–1908, Ausstellungskatalog Kunstforum der Bank Austria, Wien 1993. Wolfgang Storch (Hrsg.), Die Nibelungen. Bilder von Liebe, Verrat und Untergang, Ausstellungskatalog Haus der Kunst, München 1987. Andrew Wilton/Robert Upstone (Hrsg.), Der Symbolismus in England 1860 – 1910, Ausstellungskatalog Haus der Kunst München und Hamburger Kunsthalle 1998. Thomas Zaunschirm, „Der Zeit ihre Kunst“: Über Max Klinger, in: Kunstpresse. Kunstforum Wien, Nr. 1, Februar 1992, 29–33.
202
Elfriede Wiltschnigg
Die Moderne im Musikdenken Guido Adlers
203
Georg Beck Die Moderne im Musikdenken Guido Adlers
Guido Adlers Stellung zur Moderne wirft Fragen auf. Adler ist Zeuge der Entstehung einer neuen Musik, auf die sein Musikdenken, wie nicht unbemerkt geblieben ist,1 hilflos, widerstrebend, sprachohnmächtig reagiert. Ein entwickeltes deskriptives Verfahren räumt der Moderne einen eigenen Platz in der Musikgeschichte ein und unterwirft sie zugleich Stilkriterien, die ihrerseits einer wertungsästhetisch gedeuteten Musikgeschichte entstammen. Insbesondere unter den Protagonisten der Moderne hat dies insofern Einspruch hervorgerufen, als diese natürlich daran interessiert sein mussten, zu einer Ästhetik auf Distanz zu gehen, die sich zu ihrem Kunstschaffen nicht anders als äußerlich verhalten konnte. Einer Bemerkung Schönbergs zufolge interessiert sich denn auch ein am Stil orientiertes Musikdenken nicht dafür was, sondern wie etwas gesagt wird, als ob wir, wie Schönberg mit der ihm eigenen Süffisanz hinzufügt, Beethoven „nicht wegen seines jederzeit neuen Inhalts mögen, sondern wegen seines seinerzeit neuen Stils“ (Hahl-Koch: 1983, 75). Äußerungen, die auch in ihrer polemischen Zuspitzung als Bestandteil eines von Schönberg beinahe lebenslang geführten Kampfes um die Autonomie künstlerischer Produktion verstanden werden dürfen. Namentlich in Schönbergs eigenen Zuspitzungen – Technik versus Ausdruck(sbedürfnis) (Schönberg: 1976b, 166), Stil versus Gedanke (Schönberg: 1976a, 25–34, 466–477)2 – steht die Kunst selbst, tauto1 Volker Kalisch, dessen Arbeiten zu den umfassendsten Würdigungen der wissenschaftlichen Lebensleistung Guido Adlers gehören, registriert eine „Unsicherheit“ Adlers gegenüber der Moderne, die in „Hilflosigkeit und Ablehnung“ umschlage, „wo Beispiele Neuer Musik zudem eine Anknüpfung an die angeblich bruchlos und kontinuierlich verlaufende (‚organische‘) Musikgeschichte nicht nur nicht erkennen lassen, sondern diese gar verweigern“ (Kalisch: 1988, 243). Und mit Bezug auf die Komponisten und Künstler in der Zeit zwischen Jahrhundertwende und den 20er-Jahren fügt er hinzu: „Viele begrüßten das Aufkommen der Musikwissenschaft, fühlten aber auch den gängelnden Griff der im Entstehen begriffenen Universitätsdisziplin nach der musikalischen Realität und wiesen ihn zurück.“ Vor allem Schönberg sei hier „Beobachter und Indikator“. Bezogen auf den berühmten Schönberg-Vortrag Neue und veraltete Musik, oder Stil und Gedanke (Prag, 22.10.1930), der in den nachfolgenden Jahren Gegenstand einer verwickelten Editionsgeschichte ist, habe Schönberg der „auf den Stil verpflichteten Forschung“ bescheinigt, „die musikalische Gegenwart unter das Kuratel von ‚Stil‘ und ‚Gesetzmäßigkeiten‘ zu zwingen“ (Kalisch: 2000, 82f.) Weitere Literaturhinweise siehe Kalisch: 1988, 352–368. 2 Zur Entstehungs- und Editionsgeschichte siehe Schönberg: 1976a, 504. Vgl. auch Schönberg, 1995.
204
Georg Beck
logisch gesprochen: das Neue der neuen Kunst, auf dem Spiel. Dabei scheint seine Kritik, obwohl der eindeutige Beleg fehlt, auch Adlers Stiltheorie einzuschließen, mit deren Autor Schönberg ab 1903 verschiedene Arbeitsbeziehungen verbinden3, was das Verschweigen des Namens erklären mag. Auch wenn der Befund der Sache noch nicht dessen Erklärung darstellt – im Musikdenken Guido Adlers erscheint die Moderne in ambivalenter Gestalt. Zu erklären bleibt, inwiefern der Musikhistoriker Guido Adler die Genese der Moderne beschreibt, deren Geltung er als Musiktheoretiker beschränkt, aus welchen Gründen der Stiltheoretiker verweigert, was der Chronist der Musikgeschichte couragiert einfordert, nämlich der Gegenwartsmusik ihren Platz in der Geschichte der Musik zuzuweisen. Manches deutet darauf hin, dass in solcher ambivalenten Haltung die Dichotomie von historischem und systematischem Denken nachwirkt, wie sie Adler in seinem vielbeachteten wissenschaftstheoretischen Grundlagenaufsatz (Adler: 1885) am Beginn seiner akademischen Karriere festschreibt. Unabhängig davon ist freilich ebenso festzuhalten, dass Adler der Musik sowohl als Historiker wie Theoretiker zweifellos in einem sehr elementaren Sinn dienen will, dass er nichts anderes will als den Fortschritt der Musik in der gesellschaftlichen Wirklichkeit seiner Zeit wie fortschreitende Erkenntnis und Anerkenntnis der Musik im Bewusstsein. „Kunstverstehen“, so argumentiert er in der Akademischen Antrittsrede, erfordert „Kunstwissen“.
3 Schönberg ist es, der die Begegnung sucht und den Kontakt herstellt, wobei er sich in seinem vermutlich ersten Schreiben v. 16.11.1903 seinerseits auf die ihm von Karl Weigl überbrachte „angenehme Nachricht“ beruft, „daß Sie [= Adler] sich in günstigem Sinne über meine Arbeiten geäußert hätten“. Welche „Arbeiten“ gemeint sind, lässt sich nicht mit Sicherheit angeben. Ob Pelleas und Melisande op. 5, Ende Februar 1903 vollendet, dessen Partitur im Sommer desselben Jahres auch Adler studiert (vgl. Anm. 6), mitgemeint ist, erscheint trotz Adlers stilkritischer Bedenken gegenüber dem Werk durchaus möglich. Infrage kommen ferner das D-Dur Quartett (EA: Wien 20.12.1898), Zwei Gesänge für Bariton und Klavier op. 1 (EA: Wien 1898) sowie das Streichsextett Verklärte Nacht op. 4 (EA: Wien, Kleiner Musikvereins-Saal, 18.03.1902). Neben dieser über das Werk gestifteten Beziehung zwischen Schönberg als der zentralen Künstlerpersönlichkeit der Wiener Moderne und Adler als einem kritischen Freund dieser Moderne werden in den Jahren bis zum Ersten Weltkrieg zwei weitere Berührungspunkte virulent: Einerseits ist es der Universitätsprofessor Guido Adler, der Schönberg Schüler für dessen Harmonielehrekurse vermittelt (vgl. die Schülerliste auf der Website des Arnold Schönberg Center Wien: Schönberg als Lehrer/Schüler in Wien und Mödling), andererseits ist es der Herausgeber der Denkmäler der Tonkunst in Österreich, der Schönberg ab 1911 als freien Mitarbeiter im Editionsprojekt beschäftigt und damit beauftragt, für verschiedene Konzerte der vorklassischen Wiener Komponisten Matthias Georg Monn und Johann Christoph Monn Generalbässe auszusetzen (Denkmäler: 1912, 32–40, 52–115, siehe auch die Zuschreibung von Guido Adler im Vorwort, V; Rufer: 1959, 73–75).
Die Moderne im Musikdenken Guido Adlers
205
Und Musikwissenschaft sucht „Hand in Hand mit der lebenden Kunst nach neuen Mitteln [...], mit denen diese bereichert und fortgeführt werden kann“. Es gelte, so die programmatischen Losungsworte, mit denen Adler seine Antrittsrede schließt, „durch die Erkenntnis der Kunst für die Kunst zu wirken“ (Adler: 1898, 31, 32, 39). So gesehen spricht denn auch einiges dafür, die abwartende Haltung, die Adler gegenüber der Moderne einnimmt, nicht als Abwehrhaltung, sondern vielmehr – so die in diesem Zusammenhang vertretene Lesart – als Resultat einer Selbstblockade zu interpretieren, verursacht durch striktes Festhalten an einem (möglicherweise nicht nur der Moderne)4 inadäquaten Stilbegriff.5 Die für Adlers Verständnis von Musikwissenschaft folgenreiche Dominanz des historischen über das systematische Denken (vgl. Kalisch: 1988, 59, 115ff.) gründet ihrerseits auf der Vorstellung einer Kontinuität der Kunstentwicklung. Hierauf beharrt Adler selbst noch dort, wo deren Diskontinuität mit Händen greifbar wird. Die Folge dieses Festhaltens an einer historischen Entwicklungslogik ist seine ambivalente Haltung zur Moderne. Einerseits öffnet sich Adlers Musikdenken für die Wahrnehmung der Moderne, andererseits bildet es zugleich ein nicht unerhebliches Verweigerungspotenzial aus, wovon die symbolträchtige Kritik an Schönbergs Pelleas und Melisande – 1911 in Der Stil in der Musik aufgenommen, 1929 unverändert in die zweite Auflage übernommen – beredtes Zeugnis ablegt. Im Zusammenhang mit den von ihm behandelten „Stilarten der Mehrstimmigkeit“ bemüht Adler Schönbergs op. 5 als Beleg für den stilistischen Niedergang von der Polyfonie zur sogenannten „Polyodie“: Werden „Stimmen nicht nach eigentlich kontrapunktischen Maßnahmen“ zusammengestellt, „sondern stellt man sie zusammen ohne Rücksicht auf geregelte Haltung zueinander, so möchte ich solche Haltung ‚Polyodie‘ nennen.“ (Adler: 1929, 254). Ein fünftaktiges Pelleas-Zitat dient zur „Illustration“ und wird folgendermaßen kommentiert: Da ist das Prinzip der Selbständigkeit der Stimmen, das im Sinne des Kontrapunkts geregelt und normiert werden soll, in einem andern Sinne zum Axiom erhoben: möglichste Unabhängigkeit der Bewegung und Haltung, ein Mit- und Gegeneinanderführen der Stimmen in Selbstherrlichkeit jeder einzelnen, rücksichtslos beim Aufeinanderstoßen der rhythmisch
4 „Den großen Individuen sprach er [Adler] die Aufgabe zu, die stilistischen Prozesse zu vollenden, den Talenten zweiten und dritten Grades die Aufgabe, den Stilwandel zu betreiben und den Stilwechsel zu vollziehen. (Das impliziert einen Begriff künstlerischer Größe, der der Kunstleistung Monteverdis kaum hätte gerecht werden können.)“ (Seidel: 1998, 1755). 5 Von einer „klaren Konsequenz sowohl seines [= Adlers] Stilkonzepts als auch seiner klassizistischen Ästhetikvorstellungen und seiner geschichtlichen Kontinuitätsannahme“ spricht auch Kalisch: 1988, 246.
206
Georg Beck
tragenden Intervalle auch bei den Imitationsführungen, im Einzelfalle fast herabsinkend zur rudimentären Aneinanderkleisterung von Stimmen in der Art der ars antiqua oder der Heterophonie (Adler: 1929, 256f.).
Mit methodischer Konsequenz vollzieht Adler unter Zugrundelegung den Übergang zur Kompositionskritik. Adler sieht „Grundgesetze“ verletzt: Während in der ältesten Periode der Mehrstimmigkeit diese Art der Stimmführung eine Begleiterscheinung des schweren Ringens nach kunstgerechter Behandlung ist, artet in der Kunst der Neoprimitiven die Freiheit zur Außerachtlassung der Grundgesetze der künstlerischen Polyphonie aus, zur Aufhebung der nach jahrhundertelanger Erarbeitung gewonnenen Normen (Adler: 1929, 257).6
Urteilen und Verurteilen fallen zusammen. Von der geforderten Offenheit gegenüber der Moderne – ausdrücklich sieht Adler den Historiker in der „Pflicht“, den „Werken der mitlebenden Künstler mit Liebe und Achtung zu begegnen, sie nicht durch unpassende Vergleiche mit den Werken der Vergangenheit zu erdrücken“ (Adler: 1898, 39) – ist in diesem Zusammenhang keine Rede mehr. Die Suche nach Gründen führt in die Anfänge der individuellen Entwicklung Adlers als Musikwissenschaftler wie in die Geistes- und Wissenschaftsgeschichte des späten 19. Jahrhunderts, deren szientifisches Selbstverständnis von Adler nicht nur geteilt, vielmehr auf die wesentlich von ihm mitgeschaffene universitäre Disziplin
6 Unkenntnis oder Desinteresse am Werk sind auszuschließen. Adler lernt Pelleas und Melisande offensichtlich bereits im Sommer 1903, wenige Monate nach Fertigstellung der Komposition, kennen. Vgl. Zemlinsky-Brief an Schönberg v. 23.6.1903: „Deine Symfonie ist momentan bei Prof. Guido Adler, der sie gern kennen lernen möchte.“ (Weber: 1995, 45). Welche „Symfonie“ ist gemeint? Weber diskutiert die denkbare Möglichkeit der am 12.2.1900 begonnenen g-Moll-Symphonie (Rufer: 1959, 98), verwirft sie aber mit dem Verweis auf den „fragmentarischen Zustand des Stücks“ (ebd., Anm. 130). Dem ist zuzustimmen, zumal aus einer (undatierten) Postkarte des Adler- und Zemlinsky-Schülers und Komponisten Karl Weigl der Pelleas-Bezug eindeutig hervorgeht: „Schönberg ist wieder in Wien und möchte Partitur und Auszug von ,Pelleas und Melisande‘ wieder haben; ich bitte also, – natürlich nur, wenn die Sache von Ihnen aus, Herr Professor erledigt ist – beides Dienstag aus dem Institut holen zu dürfen.“ The University of Georgia Libraries, Manuscript collection, Adler Papers, Acession No. 769, Box 38, Folder 28. Briefzeugnissen von Webern und Jalowetz zufolge habe Adler außerdem zu deren vierhändiger Bearbeitung von Teilen des Pelleas vermutlich im Frühjahr 1918 einen Vortrag gehalten (Library of Congress, Washington, D.C., zit. nach Kokinis/Kwasny: 1999, 238). Und auch nachdem die Berliner Erstaufführung am 31.10.1910 unter Leitung von Oskar Fried „dem Werk wohl zum entscheidenden Durchbruch verhalf “ (Kokinis/Kwasny: 1999, 221), sieht Adler keine Veranlassung, seine stilkritisch begründete Ablehnung in der zweiten Auflage seines Stilbuchs zu revidieren oder auch nur zu modifizieren.
Die Moderne im Musikdenken Guido Adlers
207
der Musikwissenschaft übertragen wird. Es ist diese, an naturwissenschaftlichen Standards orientierte Geisteswissenschaft, in der Methodensicherheit als Garant von Erkenntnisfortschritt verstanden wird, und die Adler letzten Endes auch für befähigt hält, das Erbe einer Ästhetik der Tonkunst anzutreten, wie sie mit dem Namen Eduard Hanslick, Adlers Vorgänger und Förderer an der Wiener Universität, verbunden ist.7 Nicht mehr Geschichte und Ästhetik der Tonkunst – Musikwissenschaft lautet das Wissenschaftscredo eines am Vorbild der Naturforschung orientierten Gelehrten, der an der Schwelle zum 20. Jahrhundert ein Musikdenken kreiert, dessen Bedeutung für die Selbstverständigungsprozesse der beginnenden Moderne noch kaum zur Darstellung gebracht ist. In Adlers Musikdenken begegnet vielleicht zum letzten Mal Größe und Grenze einer normativen Ästhetik, die ihre Fürsprecher nicht zuletzt als Ergebnis dieser verlorenen Schlacht mittlerweile vollständig eingebüßt hat.8 In welcher Weise sich ihrerseits die Protagonisten der Moderne, insbesondere der Wiener
7 Einerseits wird die Ästhetik der Tonkunst, verstanden als Wirkungsforschung, zu einer Unterabteilung der Systematischen Musikwissenschaft, andererseits ist von der 1885 immerhin noch vorgesehenen Zweckbestimmung „Feststellung der Kriterien des musikalisch Schönen“ in Adlers Methode der Musikgeschichte, wo der Grundriss wiederholt und wo die Ästhetik der Tonkunst bezeichnenderweise um die Fachdisziplin der Psychologie erweitert wird, keine Rede mehr. Sofern der ursprüngliche Zusatz eine Verbeugung vor der Autorität Hanslicks darstellen sollte, so ist diese jetzt, 1919, nicht mehr vonnöten. Darin entspricht Adler im Übrigen den Vorstellungen jener Berufungskommission, die für ihn den Lehrstuhl Geschichte und Theorie der Tonkunst einrichtet. Begründet wird die von der Kommission betriebene Abtrennung der Ästhetik ihrerseits mit einem Verweis auf das „Ergebnis veränderter wissenschaftlicher Strömungen“. (zit. nach Kalisch: 1988, 97) Kalisch selbst warnt in diesem Zusammenhang (Historisierung der Ästhetik, in: Kalisch: 1988, 140–147) vor einer Unterschlagung der „positiven ästhetischen Einsichten“ Adlers in dessen Kritik der Ästhetik der Tonkunst. Gestört habe Adler die terminologische Unschärfe, beeindruckt hingegen die Forschungen zur „künstlerischen Produktion und Apperzeption“ (Adler), respektive „Einfühlungsästhetik“ (Kalisch). – Alles in allem stehen wir auch im Fall des Verhältnisses Adler-Hanslick vor einem ambivalenten Resultat: Einerseits ist Adler der Nachfolger Hanslicks auf dessen Wiener Lehrstuhl, andererseits versteht er sich als der Überwinder eines Musikdenkens, das er in bloßer Ästhetik befangen glaubt. So gesehen ist Adler tatsächlich als erster österreichischer Musikwissenschaftler anzusprechen. 8 Eine Abbreviatur, hinter der sich natürlich nicht weniger verbirgt als die unter verschiedenen Arbeitstiteln – „Verlust der Mitte“, Relativismus, Postmoderne, Dekonstruktivismus – geführte Diskussion um die Problematik ästhetischer Urteilsbildung wie sie zeitgleich mit der entstehenden Moderne ins Bewusstsein tritt und seitdem, aufgrund immanenter Dialektik, zu einem notwendigen Bestandteil ästhetischer Theorie geworden ist. Die Diskussion ist breit. In Musikwissenschaft und Musiktheorie wie in der Praxis sogenannten Musiklebens erscheint der Verlust ästhetischer Verbindlichkeit primär als Gefühl der Unsicherheit und Hilflosigkeit gegenüber dem jeweils aktuellen Kunstschaffen. Vgl. u.a. Dahlhaus, 1978.
208
Georg Beck
Moderne um 1900, zu einer solchen Ästhetik verhalten, wäre Aufgabe ergänzender rezeptionshistorischer Fallstudien. An dieser Stelle handelt es sich zunächst darum, darzulegen, was die Ambivalenz dieses Musikdenkens ausmacht, inwiefern Adlers Wissenschaftsverständnis die Aneignung der Moderne einerseits integriert, inwiefern es den Geltungsanspruch dieser Moderne allerdings auch ignoriert und blockiert.9 Mithin ist es eine Widerspruchsposition, die Gegenstand dieser Überlegungen ist, angelegt wie in konzentrischen Kreisen um einen zentralen Problembefund. Die beiden Seiten dieses Befundes sind ablesbar an Adlers stiltheoretischem Grundlagenwerk einerseits, seiner immer noch Staunen machenden musikhistorischen Enzyklopädie andererseits, deren jeweilige Editionsgeschichten inbegriffen. Gewiss scheinen Der Stil in der Musik (Adler: 1911, 2. Auflage 1929) und das Handbuch der Musikgeschichte (Adler: 1924, 2. Auflage 1930) über weite Strecken zu harmonieren, beider Schwer- wie Fliehkräfte auf den ersten Blick in Balance gebracht, ist doch das Handbuch als Stellvertreter für den (nie erschienenen) zweiten Band des Stilbuches anzusehen, der die „historischen Stilperioden“ behandeln sollte (Adler: 1919, 1). Freilich werden auch die Bruchkanten sichtbar, sobald nach der jeweiligen Stellung zur Moderne gefragt wird. Die eigentlich nur methodisch gemeinte Unterscheidung zwischen historischem und systematischem Musikdenken, niedergelegt in dem die Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft einleitenden Grundlagenaufsatz von 1885, erscheint in dieser Hinsicht als unvermitteltes Auseinandertreten beider Seiten. Andererseits sind für Adler damit tatsächlich die Grundlagen geliefert, auf denen er in wenigstens drei Jahrzehnten rastloser Tätigkeit neben dem von ihm angestoßenen, monumentalen Editionsprojekt Denkmäler der Tonkunst in Österreich ein wissenschaftliches Werk von erstaunlichem Umfang generiert und eine akademische Hochschullaufbahn erfolgreich absolviert. Und doch verhält sich das WissenschaftsWerk zum Leben dieses ersten10 österreichischen Musikwissenschaftlers scheinbar wie die eine parallele Gerade zur nächsten. Schiedlich-friedliches Nebeneinander – ungestört, unbeeinflusst. „Leben“ und „Werk“, das klassische Denkmodell der Biografiegeschichtsschreibung, scheint im Fall von Guido Adler selbst keine kritische Masse ausbilden zu können. Ein Bild, für das Adler selbst einiges getan hat: „Persönliches“, so Adler rückblickend über die Grundsätze seines Wissenschaftsverständnisses, habe er in seinen Publikationen und Vorträgen stets „ausgeschaltet“, „ausgeschlossen“ (Adler:
9 Diesen Zusammenhang betont auch Kalisch: „Eine Kritik an Adlers Verhältnis zur Neuen Musik ist folglich auch eine Kritik an Adlers Wissenschaftsverständnis, an seinem Stilkonzept.“ (Kalisch: 1988, 247). 10 Vgl. Anm. 7.
Die Moderne im Musikdenken Guido Adlers
209
1935, VII). Dementsprechend gilt ihm die „biographische Methode“, das Korrelieren von „Leben“ und „Werk“, das Collagieren von Material aus beiden Quellen zu „Lebensbildern“ als verlassene Stufe des wissenschaftlichen Geistes. „Biographistik“, so definiert es bereits der Grundlagenaufsatz von 1885, ist „Hilfswissenschaft“ – und auch nur im historischen Teil der von ihm konzipierten Musikwissenschaft (Adler: 1885, 16). Richtige Wissenschaft folgt anderen Zielsetzungen, vor allem produziert sie Anderes, die „Logik der Tatsachen“ nämlich (Adler: 1898, 34). Es ist dies eine Begriffskonstruktion aus Adlers Wiener Akademischer Antrittsrede von 1898 und darin zugleich das Fanal eines universitären Paradigmenwechsels von der Ästhetik der Tonkunst zur Musikwissenschaft. Wie es das Methodenbuch von 1919 bestätigen wird, will Adler weg vom „Kriterium des Ästhetisch-Schönen“, das ein „schwankendes“ ist und in der Antrittsrede noch nicht einmal mehr Erwähnung findet. Stattdessen ist es der „positive Boden der wissenschaftlichen Forschung“ (Adler: 1919, 121), den Adler zu betreten gedenkt. Es herrscht Gründerzeit – auch in der Wissenschaft. Das unverrückbare Fundament, das diese braucht, verlangt von daher einen unverbrauchten Namen: „Stilbestimmung“ – und zwar, wie Adler hinzusetzt – „ohne Schönheitswertung“ (Adler: 1919, 122). Dem selbstbewusst auftretenden Wissenschaftsgründungsunternehmen, das damit zum Ausdruck gebracht ist, ist freilich unverkennbar auch ein Moment der Angstabwehr zu eigen. „Der exakte Forscher wird sich dies“ – eben jene „Stilbestimmung ohne Schönheitswertung“ – „stets gegenwärtig halten, um sich nicht in einen Irrgarten zu verlieren und die Wege, die zur Erkenntnis der Genetik führen, nicht zu verlassen“ (Adler: 1919, 122): Hier der drohende „Irrgarten“, dort die Lehre vom „richtigen Weg“, an dessen Ende, so die szientifische Formel aus Adlers Akademischer Antrittsrede von 1898, die „Logik der Tatsachen“ steht. Erst durch die Gegenüberstellung der Kunstwerke, durch die in ihrer zeitlichen Folge übersehbare und in ihrem organischen Entwicklungsgange erfassbare Reihe der Denkmäler erschließt sich uns die Logik der Thatsachen. Wir lernen die Bedingungen des Fortschrittes in der Kunst kennen, die Ursachen ihres zeitlichen oder zeitweisen Verfalles, die Möglichkeiten ihrer Erhebung zu neuem Gedeihen, die Stilgesetze der verschiedenen Epochen, die Arten ihrer Kunstausübung (Adler: 1898, 34).11
11 Die Frage, ob Adler die inaugurierten „Stilgesetze“ quasi-naturwissenschaftlich aufdecken oder ob er sie – für einen gelernten Juristen durchaus naheliegend – quasi-juridisch zu definieren gedenkt, scheint kaum entscheidbar. Barbara Boisits sieht darin ein „Changieren“. Tatsächlich bleibt unklar, ob Adler die „Stilgesetze“ als aufgefunden oder gesetzt, als normativ oder explikativ versteht. Vgl. Boisits: 2001, 23f.
210
Georg Beck
Die von Adler apostrophierte „Reihe der Denkmäler“ steht in der wissenschaftstheoretischen Tradition der „großen Kette des Seins“ als der endlosen Reihe hierarchisch geordneter Formen wie sie die Naturgeschichte und Naturforschung des 18. Jahrhunderts inspirierte – siehe Buffons Histoire Naturelle, siehe Linnés Systema naturae – und zu Ende des 19. Jahrhunderts schließlich die Kultur- und Geisteswissenschaft erfasst. Auch Guido Adler kommt zur Überzeugung, dass die „Denkmäler der Tonkunst“ im Prinzip nicht anders betrachtet werden können als die Gegenstände einer Botanik, Geologie oder Zoologie, zumal bereits die Wiener Kunsthistoriker-Schule ebenso verfahre (Adler: 1898, 31; vgl. auch Dömling: 1975): Man muss die Kunstwerke „gegenüberstellen“, sie periodisieren, klassifizieren, in die Reihe bringen. „Erst im Zusammenhange“, so die kategorische Definition im Methodenbuch, „läßt sich ein Kunstwerk kunsthistorisch erkennen und erfassen“ (Adler: 1919, 13). Dass Adler sich damit ein vertracktes Problem einhandelt, scheint ihm weder in dieser Aufbruchsphase noch in späterer Zeit bewusst geworden zu sein. Andererseits stellt das Desinteresse am konkreten Inhalt eines Werkes bei gleichzeitig gesteigertem Interesse an seinem „Zusammenhang“, in dem es mit anderen steht, insofern einen Widerspruch dar, als dieser „Zusammenhang“ ja erst durch das Werk selbst konstituiert wird (Adorno: 1958, zit. nach Kalisch: 1988, 244). Die daraus resultierende Forderung nach Werkanalyse steht für Adler allerdings noch außerhalb seines von der Stilanalyse gezogenen Horizonts. Unbeirrt hält er fest am „Erfassen“, „Einordnen“, „Einreihen“.12 Ist die klassifizierende Arbeit getan, soll im Auf und Ab der Stilgeschichte der „organische Entwicklungsgang“ der Kunst ablesbar werden – nachlesbar ist er im Handbuch der Musikgeschichte von 1924 dann allerdings tatsächlich geworden. Für Guido Adler ist der Wissenschaftsglaube des 19. Jahrhunderts alles andere als eine trügerische Hoffnung. Nach seinem Erfolgsgeheimnis befragt, hätte er auf die Einhaltung des, wie er sagt, „richtigen methodischen Verfahrens“ verwiesen (Adler: 1919, 4) und seine diesbezüglichen Veröffentlichungen zur Lektüre empfohlen. Beeinflusst vom Philosophen Alexius Meinong erlangt das von ihm vertretene Wissenschaftsverständnis, die „naturwissenschaftliche Methode“, von Kant in der „Kritik der reinen Vernunft“ transzendentalphilosophisch kodifiziert, zentrale Bedeutung (Eder: 1995, 38, 88). Wissenschaft, um es auf eine Formel zu bringen, ist in diesem Sinn Verfahrenssicherheit: Sofern ein gegebener „Stoff “ nach immer gleichen Regeln verarbeitet wird, Abweichungen nicht geduldet werden,
12 „Erklären und Bestimmen von Kunstwerken“ lautet deshalb auch konsequenterweise die seit dem Wintersemester 1898/99 im Rahmen von Adlers universitären Lehrverpflichtungen immer wieder angebotene Übung zur musikalischen Stilkunde. Vgl. Vorlesungsverzeichnisse der Universität Wien, Archiv der Wiener Universität, Z 84.
Die Moderne im Musikdenken Guido Adlers
211
wenn, mit anderen Worten, die Methode, der Gang des Verfahrens stimmt, dann stimmt notwendigerweise auch das Ergebnis. Darin liegt die Hoffnung eines in dieser Weise Wissenschaft betreibenden Subjekts, wobei es aufschlussreich ist, sich danach zu erkundigen, wie sich dieses Subjekt eigentlich selbst zu jener Erfahrung verhält, die es durch sein Verfahren produziert. Kants Antwort war sehr einfach: Es muss diese Erfahrung prinzipiell überschreiten, um Wirkung wie Grenzen der Erfahrung festlegen, um alles, was nicht in dieser Wirkungsweise aufgeht, blockieren zu können. Dafür hat Kant ein berühmtes Kunstwort geschaffen: „transzendental“. Ein „transzendentales Subjekt“ nach Kant ist ein solches, das Verfahrenshoheit wahrt, das Erfahrung nach immer gleichen Regeln produziert, ohne zugleich Teil dieses Erfahrungsproduktionsprozesses zu sein. In der Übernahme dieses erkenntnistheoretischen Postulats gründet Adlers Trennung von „Leben“ und „Werk“: Werkerkenntnis ist „Stilbestimmung“, „Stilbestimmung“ ist Aufgabe der Wissenschaft, Wissenschaft aber muss das „Persönliche“ „ausschalten“.13 Freilich nötigt die Art und Weise, wie sich der Musikhistoriker Guido Adler zur Moderne positioniert, umso mehr Respekt ab, wenn die konkurrierenden Versuche Hugo Riemanns (Riemann: 1907) oder Philipp Spittas (Spitta: 1892), in Betracht gezogen werden. Letzterer erklärt denn auch die Gegenwart rundheraus für nicht wissenschaftsfähig: Mit dem, was man künstlerische Tagesgeschichte nennen könnte, hat die Wissenschaft überhaupt nichts zu thun. Damit sichere wissenschaftliche Ergebnisse erzielt werden, ist es vor allem nothwendig, daß das Object dem Forscher stille hält, und nur was dem Interesse der Gegenwart entrückt ist, erfüllt diese Forderung (Spitta: 1892, 10).
Mit anderen Worten: Untersuchungen nur an „totem Gewebe“. Nicht dass Adler das zugrunde liegende Problem verkannt hätte, doch zieht er daraus nicht den Schluss, nur solche „Objecte“ zuzulassen, die, wie Spitta fordert, „dem Interesse der Gegenwart entrückt“ sind. Er versucht eben nicht, wie jener, das Problem einer prinzipiell abgeschlossenen Kunstentwicklung durch Umgehen aus
13 Darin liegt insofern ein bemerkenswerter Unterschied zum ästhetischen Subjekt, zum Künstler, als dieser nun einmal von den Erfahrungen, die er macht, in keiner Weise abstrahieren kann: Wenn (mit den Worten Schumanns) „der Dichter spricht“, muss dieser notwendig von sich reden und er muss auch so reden und gestalten können, wie er will und muss. Und in den Worten Schönbergs: „Die Kunst gehört [...] dem Unbewußten! Man soll sich ausdrücken! Sich unmittelbar ausdrücken! Nicht aber seinen Geschmack, oder seine Erziehung oder seinen Verstand, sein Wissen, sein Können. Nicht alle diese nichtangeborenen Eigenschaften. Sondern die angeborenen, die triebhaften. [...] Das unbewußte Formen [...] schafft wirklich Formen.“ (Hahl-Koch: 1983, 21).
212
Georg Beck
der Welt zu schaffen. Sein Entschluss, sich der beschriebenen wissenschaftstheoretischen Zwickmühle zu stellen, muss somit zu den mutigsten Entscheidungen gezählt werden, die Adler während seiner Zeit als Ordinarius an der Wiener Universität verantwortet: Zwar kann die Wissenschaft, so Adler, die „künstlerische Tagesgeschichte“ nicht schreiben, doch da diese nun einmal geschrieben werden muss, muss diese Aufgabe delegiert werden. Es ist Adlers Ideal des Zusammengehens von Kunst und Wissenschaft, die von ihm angestrebte „Synthese von forschender und künstlerischer Erkenntnis“ (Ficker: 1949–1951, 87; vgl. auch Adler: 1885), die nun wirksam wird und einen wissenschaftlichen Nonkonformismus initiiert, der seinen Ruhm ausmacht. Insofern kann über die Bedeutung seiner Entscheidung, der Moderne in der Musikgeschichte einen prominenten Platz zu reservieren, letztlich auch kein Zweifel bestehen: Es ist ein Bekenntnis zur Moderne. Was die „Moderne seit 1880“ indes verlässlich darstellt, ist Anfang 1920 natürlich eine vollkommen offene Frage. Adler ist sich denn auch darüber im Klaren, dass er mit seinem Näherungsversuch den, wie er sagt, „streng historischen Boden“ verlässt, dass sein Ideal der „objektiven Betrachtung“ nicht durchzuhalten ist, weswegen sich „Geschichtsschreibung und Tagesschriftstellerei“ hier notgedrungen begegnen müssten. Natürlich ist dies ein Kompromiss und für einen erklärtermaßen wissenschaftlichen Autor wie Adler gewiss eine große Überwindung. Doch soll nach seinem Verständnis Musikgeschichte ja gerade fähig sein, die Gegenwart – gewissermaßen als Tüpfelchen auf dem großen „I“ dieser Geschichte – miteinzuschließen. Andererseits ist der Löwenanteil, neunhundert von eintausend Seiten im „Handbuch der Musikgeschichte“, dem „großen Stoff der musikalischen Entwicklung des Abendlandes“ vorbehalten. Dieser wird, angefangen bei den orientalischen Kulturvölkern über die Gregorianik bis zur Wiener Tanzmusik und Operette, in drei „Stilperioden“ verhandelt und ausgebreitet. Hätte sich Adler an dieser Stelle zum Abbruch seiner Monumentalgeschichte entschlossen, niemand hätte ihm einen Vorwurf gemacht. Doch auch wenn er mit der „3. Stilperiode“ ein Ende der verlässlichen Darstellung der Musikgeschichte für erreicht hält, so sieht er sich als Musikhistoriker weiter in der Pflicht stehend. So wie sich der Herausgeber Guido Adler in einer bemerkenswerten Grundsatzentscheidung der historiografischen Unterstützung von „Fachgenossen“ versichert, so requiriert er für sein letztes Kapitel ein noch weitaus umfangreicheres Team aus „Vertretern verschiedener Nationen“, womit er, in Anbetracht der Wunden des Weltkrieges, der Musikwissenschaft ganz nebenbei auch eine völkerversöhnende Aufgabe zuweist.14 14 „Tonkunst“ ist „internationales Bindemittel“. Es geht um „internationale Verständigung und Fühlungnahme“, wofür das „Weltbild der Musik“ ein wirkliches „Vorbild“, ein Programm darstellt. Vgl. Adler: 1925, 37; 48.
Die Moderne im Musikdenken Guido Adlers
213
Nun will er auf den letzten einhundert Seiten zwar keine „4. Stilperiode“ folgen lassen, wohl aber ein Kapitel mit der Überschrift: „Die Moderne (seit 1880)“. Dabei handelt es sich um geschlossene Darstellungen der Musikentwicklungen in den süd-, mittel- und osteuropäischen Ländern sowie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Adler selbst zeichnet verantwortlich für das Einleitungskapitel, worin er den Abschluss der Romantik mit Schlüsseldatum 1882 konstatiert, der ParsifalUraufführung, deren Zeuge er ist. Damit sei die „romantische Oper zu Grabe“ getragen (Adler: 1924, 901). Hugo Wolf, Gustav Mahler und Hans Pfitzner gelten ihm als Nachwehen und Nachklänge. Neues geschehe mit Modest Mussorgskij, dessen Boris Godunow er als den „markantesten Vorstoß der Modernen“ wertet. Edvard Grieg, Richard Strauss, ebenso wie Wolf und Mahler, sieht er noch auf „romantischem Boden“. César Franck hingegen ist „Ausgangs- und Wendepunkt einer neu entstehenden Richtung“, wobei in Claude Debussy schließlich deren „erster Höhepunkt“ begegne. Insgesamt sieht sich Adler einem mit „Blüten überdeckten Baum“ gegenübergestellt, wobei freilich niemand wisse, „welche von ihnen zu Früchten gedeihen können“ (Adler: 1924, 901). In diesem Zusammenhang darf ein Exkurs zur Rezeptions- beziehungsweise Editionsgeschichte des Handbuchs der Musikgeschichte nicht fehlen: 1975 erscheint im Deutschen Taschenbuch Verlag ein fotomechanischer Reprint des zu diesem Zeitpunkt auch in zweiter Auflage längst vergriffenen Handbuchs. Der Nachdruck versteht sich als Verbeugung vor einem „Standardwerk der Musikliteratur“, will es „weiteren Leser- und Benutzerkreisen zugänglich machen“, wobei nun allerdings ausgerechnet das Moderne-Kapitel gestrichen wird.15 Für das gut meinende Lektorat ist Adler ganz offenkundig der reine Historiker. Und zwar so rein, dass sein Bild von allen Zweideutigkeiten wie etwa dem in zweiter Auflage noch einmal geprüften und erweiterten Näherungsversuch an die Moderne gereinigt werden muss. Keine Gültigkeit, keine Dauer! lautet der Bescheid. Was bleibt, ist nun tatsächlich der allwissende Gestus, der heute der historistischen Wissenschaft des 19./20. Jahrhunderts als ein fatales Odium anhängt. Doch ist dies in diesem Fall freilich nichts anderes als das Ergebnis einer verlegerischen Kastration. Nicht Adler – das positivistische Selbstverständnis eines Wissenschaftsverlages streicht die Moderne aus der Musikgeschichte, womit ausgerechnet der Deutsche Taschenbuch Verlag einen nicht unwesentlichen Beitrag für die Historisierung des Musikhistorikers Guido Adler leistet.
15 „Dieser Zeitraum“ – gemeint sind die 50 Jahre zwischen 1880 und 1930 – „stand den Autoren damals noch zu nahe, als daß sie über ihn historische Aussagen von einiger Gültigkeit und Dauer hätten machen können“ (Adler: 1975, I).
214
Georg Beck
Ganz anders der Handbuchautor und Handbuchherausgeber selbst. Guido Adler verpflichtet in erster Auflage nicht weniger als vierzehn Autoren – fast die Hälfte der insgesamt beschäftigten 33 „Fachgenossen“ –, damit diese ihm ein Bild der Gegenwart, der „Moderne seit 1880“ entwerfen helfen. Auch die rasch folgende zweite Auflage 1930 transportiert nicht nur dieses Moderne-Kapitel weiter mit, sondern präsentiert bemerkenswerte Ergänzungen. Jetzt finden sich auch Unterkapitel Belgien sowie Deutsche und Romanische Schweiz. Außerdem bringt die zweite Ausgabe nicht nur erneut den Fachartikel Musikwissenschaft (Wilhelm Fischer), sondern drei weitere Grundsatzbeiträge: zunächst eine, unter der Überschrift Reproduktion komprimierte Interpretationsgeschichte ernster Musik (Paul Nettl), ferner einen Schnelldurchgang Musiktheorie vom Ausgang des 15. Jahrhunderts bis zu Schönberg und zur Zwölftontechnik, die hier Joseph Mathias Hauer zugeschrieben wird (Johannes Wolf) und schließlich, im Anschluss an den Artikel Musikwissenschaft, sogar einen Beitrag zur Musikkritik (Hermann Springer). Keiner dieser Beiträge indessen hat die Aufnahme in den 70er-Jahre-Reprint geschafft, was für unser Bild von Adlers Musikgeschichts-Verständnis insofern verheerend ist, weil das Ringen des Herausgebers und Autors Guido Adler um Gegenwart und Gegenwärtigkeit einer Musikgeschichte mit einem Mal wie vom Erdboden verschluckt erscheint. Die kastrierte Taschenbuchversion spiegelt nun exakt, was das Verständnis historistischer Wissenschaft ohnehin zu wissen glaubt: Geschichte ist das, was vorbei ist. Als ein Geschehenes, ein nicht mehr Wirksames hat sie nur noch einen einzigen Ort – den zwischen zwei Buchdeckeln. So allerdings wird die Wissenschafts-Utopie, die Adler noch bei seinen entferntesten Studien umgetrieben hat – „durch die Erkenntnis der Kunst für die Kunst zu wirken“ (Adler: 1898, 39) – ihrerseits ausgetrieben. Ein weiterer Aspekt sollte in diesem Zusammenhang nicht übersehen werden: Indem das erwähnte Kapitel „Moderne seit 1880“ im Kontext dreier vorangegangener „Stilperioden“ steht, ist damit, was Adler vielleicht gar nicht intendiert haben mag, wie von selbst eine Art Definitionsdruck ausgelöst. Die Frage ist jetzt nicht nur, was zur Musikgeschichte seit 1880 hinzutritt – etwa wie bei Hugo Riemann weitere Unterkapitel einer Wagner- oder Beethoven-Nachfolge – vielmehr ist die Frage nach deren neuer Qualität aufgeworfen.16
16 Indem Riemann, der große Adler-Konkurrent und Adler-Gegenspieler, das Neue einfach zum Alten hinzuaddiert, umgeht er problematische Wesensdebatten, erspart sich Definitionsprobleme. Was Adler „Moderne“ nennt, erscheint bei Riemann als „Die neue Zeit“, die dieser freilich bereits im 18. Jahrhundert beginnen lässt, gewissermaßen aufgefächert in neue Gattungen, neue Instrumentalstile, neue Konzertinstitutionen, neue Opern, neue nationale Strömungen (Riemann: 1951, siehe insbesondere Die neue Zeit, Kapitel X bis XIV; s. auch Kalisch: 2000, 72f. sowie Boisits: 2001, 22ff.).
Die Moderne im Musikdenken Guido Adlers
215
Anders Adler. Wenn er dem Beginn der Moderne ein wirkliches Datum gibt, unterstellt er einen Neuanfang, einen Innovationsprozess, dessen Begriffsbestimmung freilich noch niemand kennen kann. Gegen sein erklärtes Wissenschaftsverständnis, das auf „Endergebnisse der Forschung“ (Adler: 1929, Vorwort, III) ausgerichtet ist, liegt in einem offenen Ende wie diesem, wo das „musikalische Abendland“ gewissermaßen in der Gegenwart „ausfranst“, ein eminentes Antriebsmoment für den Forschungsprozess. Andererseits bleibt die Ambivalenz bestehen, kann doch nicht übersehen werden, dass Adlers Musikdenken das Verständnis für diesen innovativen Prozess der Moderne eben auch blockiert, Bewusstseinsfortschritte behindert, die in diesem Fall als Fortschritte im Bewusstsein von Diskontinuitäten, Alteritätserfahrungen, von Brüchen und Abbrüchen, von wirklichen Neuanfängen im Kunstschaffen zu kennzeichnen wären. Vor allem die Stiltheorie, niedergelegt in Der Stil in der Musik (Adler: 1911, 2. Auflagen 1929) sowie in Methode der Musikgeschichte (Adler: 1919), steht in dieser Hinsicht in der Kritik. Mit dem Stilbegriff, mit der vorgeblichen Aufdeckung von „unabänderlichen Gesetzen und Normen“ (Adler: 1929, 170), streitet Adler, so Adorno, gegen den „Zerfall der kollektiven Verbindlichkeit von Kunst“ (Adorno: 1970, 306). In diesem Sinn präsentiert sich die Lehre vom Stil als Systematisierung wie Hierarchisierung aller möglichen Stilarten, den Personalstil des 19. Jahrhunderts eingeschlossen. Verbunden ist die Stiltheorie mit einer eigentümlichen Vorstellung vom künstlerischen Produktionsprozess, wonach das Kunstwerk zwar aus dem „höchstpersönlichen Schaffen des Künstlers“ hervorgeht (Adler: 1929, 7), ohne dass dieser doch die vollständige Autonomie über diesen Kreationsprozess erlangt. Dessen Schaffen ist durch das „allgemeine Kunstwollen“ bedingt, auf dessen „Boden“ es „erstanden“ ist (Adler: 1929, 7). Indem der Künstler „nach dem Kunstwerk immanenten Prinzipien“ (Adler: 1919, 116) produziert, erweist er sich als ein Diener des Stils: Kein Künstler kann sich seiner Macht, seiner Herrschaft entziehen, sei es, daß er sie [= Macht und Herrschaft des Stils] mitbegründet, festigt, ausbaut, sei es, daß er sie ändern oder stören will (Adler: 1919, 116).
Die Worte scheinen mit Bedacht gewählt. Der Künstler kann mitbegründen, festigen, ausbauen, ändern, stören. Aber er kann den Stil eben nicht zerstören, ebenso wenig wie er ihn offenbar überhaupt begründen kann. So ist Adlers Stiltheorie, indem sie das Kunstwerk ins Zentrum stellt, zugleich eine Theorie der eingeschränkten Autonomie des Künstlers. Selbstverständlich ist es Adlers Studium alter und vorklassischer Musik, die das dieser Theorie zugrunde liegende Material generiert, wobei der praktische Nutzen
216
Georg Beck
der Stilbestimmung angesichts der gewöhnlichen Zuordnungsprobleme, der Fragen um Autorschaft, Ort- und Zeitbestimmungen natürlich auf der Hand liegt. Selbst ein Kritiker des Stiltheorems in der Kunst wie Schönberg scheint dessen Berechtigung in der Editionspraxis durchaus akzeptiert zu haben. Anlässlich einer nach dem g-Moll Cellokonzert von Georg Matthias Monn zu schreibenden Kadenz für Pablo Casals kommt es im Frühjahr 1913 zwischen ihm und Adler zu einem intensiven fachlichen Austausch, in dem stilkritische Überlegungen zur Instrumentierung und Länge der Kadenz eine zentrale Rolle spielen und auch von Schönberg in diesem Kontext aufgegriffen werden17. Ein Zugeständnis, das notwendigerweise dort endet, wo die Stiltheorie die Retrospektive verlässt und Geltung auch für die Gegenwarts produktion beansprucht. Denn dass es so etwas wie eine „Herrschaft des Stils“ geben könne, ist für Schönberg selbstverständlich ganz und gar inakzeptabel. Adler, der an der Idee gesellschaftlicher Verbindlichkeit von Kunst strikt festgehalten hat, hat nicht verstehen können, dass die Kündigung des Stilbegriffs für die Moderne konstitutiv geworden ist, dass Stil, nach einem Wort Adornos, „die Einheit von Stil und seiner Suspension“ ist (Adorno: 1979, 307).18 Was Schönberg betrifft, so hatte dieser natürlich allen Grund, ein deutliches Wort zu sprechen, was er denn auch in seinem Prager Vortrag vom Oktober 1930, ein Jahr nach Erscheinen der unveränderten zweiten Auflage von Adlers Stilbuch, nicht versäumt: „Neue Musik, veraltete Musik, Stil und Gedanke“, der berühmte, mehrfach umgearbeitete Aufsatz, verschweigt zwar den Namen Adler – sicherlich aus Gründen persönlichen Respekts, wie ihn der gesamte Schönbergkreis Adler entgegenbringt – nicht aber die differente Einstellung zur Sache (Schönberg: 1976a).
17 Wenngleich Schönberg natürlich stets auch künstlerische Erwägungen im Blick hat („Mir scheint es fraglich, ob man nicht da dem Bedürfnis des Virtuos[en] die Entscheidung überlassen soll und nicht dem historischen Gesichtspunkt.“ Brief an Adler v. 14.3.1913), ist er in der Ausarbeitung der Kadenz durchaus in der Lage, sich auf die genannten „historischen Gesichtspunkte“, m.a.W., auf stilkritische Überlegungen im Sinne Adlers einzulassen. So richtet er (in einem undatierten, offenbar nicht auf dem Postweg zugestellten Notizzettel) an Adler u.a. folgende Frage: „Verlangt es der ,Stil‘ daß Vcll in Bso mit dem Continuo zusammengehen? Oder weisen nicht diese Pausen darauf hin, daß (insbesondere bei einem Vcl-Concert!) diese leicht deckenden Instrumente gelegentlich wegbleiben? Ich würde ebenso instrumentieren!!“ Adler notiert dazu: „frei gestellt“. The University of Georgia Libraries, Manuscript collection, Adler Papers, Acession No. 769, Box 32, Folder 38. 18 Dass umgekehrt jede Stilkritik, die sich selbst hinreichend ernst nimmt, konsequenterweise auch Kompositionskritik einschließt, zeigen die auf Schönberg bezogenen Wertungen Edward A. Lippmans im Zusammenhang seines MGG-Artikels zum musikalischen Stil: „Andererseits ist [...] hoher Wert im StrQu. d von Schönberg zu erkennen, dessen Stil mit Recht ernstlich kritisiert werden kann“ (Lippman: 1965, 1306).
Die Moderne im Musikdenken Guido Adlers
217
Schönberg, für den Stil nichts weiter ist als die „Eigenschaft eines Werkes“ (Schönberg: 1976a, 32), ist an der Autonomie des künstlerischen Prozesses gelegen, weswegen er sich gegen ein Musikdenken aussprechen muss, das die Kunst aufs Prokrustesbett einer Stiltheorie zwingt. Das entscheidende Argument fällt, wenn Schönberg über den Komponisten spricht: „Er wird nie von einem vorgefaßten Bild seines Stils ausgehen; er wird unaufhörlich damit beschäftigt sein, dem Gedanken gerecht zu werden“ (Schönberg: 1976a, 32). Dass dies freilich nicht nur ein Wort über den Komponisten ist, wie sich Schönberg ihn idealtypisch denkt, sondern auch dem Musikologen die Perspektive weist, hat Adler seinerseits nicht mittragen können. Ein kritisches Resultat also, dem in der Coda nun allerdings doch ein Hinweis auf das auch in diesem Sinn Nichtidentische, auf das, was nicht in diesem Negativbild aufgeht, hinzuzufügen ist: Auf Betreiben des Herausgebers des Biographischen Jahrbuches und Deutschen Nekrologes Anton Bettelheim, schreibt Adler unmittelbar19 nach Mahlers Tod ein kleines Mahlerbuch. Bewusst oder nicht restituiert er damit ein Programm, das sein Wissenschaftsdenken gerade zu überwinden gedachte – die „biographische Methode“: „Der Künstler und Mensch in seiner Eigenart und in seinen wechselseitigen Verhältnissen soll aufgedeckt und noch besser: sein Werk soll möglichst klar gekennzeichnet werden“ (Adler: 1916, 4), bemerkt Adler über das Ziel dieser dicht geschriebenen, schnörkellosen Studie, an der vor allem die noble Selbstzurücknahme des Stiltheoretikers überrascht. Wenn nicht alles täuscht, birgt deren reflektierte Form, „Leben“ und „Werk“ seines Freundes Gustav Mahler mit kritischer Sympathie zu betrachten, den Ansatz einer modernen Biografiegeschichtsschreibung. So gesehen liegt die Modernität Adlers vielleicht ja gerade dort, wo er sie selbst am wenigsten vermutet hätte. Kaum verwunderlich ist denn auch, wenn ausgerechnet der Adler-Kritiker Schönberg gerade dieses Buch in seine kalifornische Exil-Bibliothek aufnimmt.20
19 „Wie der Herausgeber des Jahrbuches, Dr. Anton Bettelheim im Vorwort hervorhebt, war mein Manuskript schon Anfang Oktober 1913 der Druckerei übergeben worden.“ (Adler: 1916, 3). 20 Brief an Hugo Leichtentritt v. 3.12.1938, in: Nono-Schönberg: 1998, 349.
218
Georg Beck
Literatur Guido Adler, Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft, in: Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft 1 (1885), 5–20, Nachdruck Hildesheim 1966. Guido Adler, Musik und Musikwissenschaft, in: Jahrbuch der Musikbibliothek Peters 5 (1898), 27–39. Guido Adler, Mahler, Wien, Leipzig 1916. Guido Adler, Methode der Musikgeschichte, Leipzig 1919. Guido Adler (Hrsg.), Handbuch der Musikgeschichte, 2. Auflage Frankfurt a.M. 1924. Guido Adler, Internationalismus in der Tonkunst. Bericht über den Musikwissenschaftlichen Kongreß in Basel 1924, Leipzig 1925. Guido Adler, Der Stil in der Musik, Wien 1911, 2. Auflage Wien 1929. Guido Adler, Wollen und Wirken – Aus dem Leben eines Musikhistorikers, Wien 1935. Guido Adler (Hrsg.), Handbuch der Musikgeschichte, 3 Bde., Reprint München 1975. Theodor W. Adorno, Zum Stand des Komponierens, in: National-Zeitung, Basel 5.10.1958, o.S. Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, Frankfurt a.M. 1970 (Gesammelte Schriften, 7). Barbara Boisits, Hugo Riemann – Guido Adler. Zwei Konzepte von Musikwissenschaft vor dem Hintergrund geisteswissenschaftlicher Methodendiskussion um 1900, in: Tatjana Böhme-Mehner/Klaus Mehner (Hrsg.), Hugo Riemann (1849–1919) Musikwissenschaftler mit Universalanspruch, Köln, Weimar, Wien 2001, 17–29. Briefwechsel der Wiener Schule, Bd. 1 hrsg. v. Horst Weber, Darmstadt 1995. Carl Dahlhaus, Probleme der Kompositionskritik, in: Schönberg und andere. Gesammelte Aufsätze zur Neuen Musik, Mainz 1978, 327–335. Denkmäler der Tonkunst in Österreich, Jahrgang XIX/2, Band 39, Graz 1959 (= Reprint der 1912 in Wien erschienenen Ausgabe). Wolfgang Dömling,Über den Einfluß kunstwissenschaftlicher Theorien auf die Musiktheorie, in: Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz 1974, hrsg. von Dagmar Droysen, Berlin 1975, 7–45. Gabriele Johanna Eder (Hrsg.), Alexius Meinong und Guido Adler. Eine Freundschaft in Briefen, Amsterdam, Atlanta 1995. Rudolf von Ficker, Artikel „Adler, Guido“, in: Friedrich Blume (Hrsg.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Bd. 1, Kassel u.a. 1949–1951, Sp. 85–88. Jelena Hahl-Koch (Hrsg.), Arnold Schönberg Wassily Kandinsky – Briefe, Bilder und Dokumente einer außergewöhnlichen Begegnung, München 1983. Volker Kalisch, Entwurf einer Wissenschaft von der Musik: Guido Adler, Baden-Baden 1988. Volker Kalisch, Unmaßgebliche Bemerkungen zu einem maßgeblichen Konzept: Guido Adlers Musikwissenschaftsentwurf, in: Anselm Gerhard (Hrsg.), Musikwissenschaft – eine verspätete Disziplin? Die akademische Musikforschung zwischen Fortschrittsglauben und Modernitätsverweigerung, Stuttgart, Weimar 2000, 69–85. Nikos Kokinis/Ralf Kwasny (Hrsg.), Arnold Schönberg – Sämtliche Werke, Abt. IV. Orchesterwerke, Reihe B, Bd. 10, Mainz, Wien 1999. Edward A. Lippman, Artikel „Stil“, in: Friedrich Blume (Hrsg.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Bd. 12, Kassel u.a. 1965, Sp. 1302–1330.
Die Moderne im Musikdenken Guido Adlers
219
Nuria Nono-Schönberg (Hrsg.), Arnold Schönberg 1874–1951. Lebensgeschichte in Begegnungen, Klagenfurt 1998. Hugo Riemann, Kleines Handbuch der Musikgeschichte: Mit Periodisierung nach Stilprinzipien und Formen, 1. Auflage, Leipzig 1907, 8. Auflage, Leipzig 1951. Josef Rufer, Das Werk Arnold Schönbergs, Kassel u.a. 1959. Arnold Schönberg, Neue Musik, veraltete Musik, Stil und Gedanke, in: ders., Stil und Gedanke – Aufsätze zur Musik, hrsg. von Ivan Vojtěch, Frankfurt a. M. 1976a (Gesammelte Schriften, 1), 25–34. Arnold Schönberg, Probleme des Kunstunterrichts, in: ders., Stil und Gedanke – Aufsätze zur Musik, hrsg. von Ivan Vojtěch, Frankfurt a.M. 1976b (Gesammelte Schriften, 1), 165–168. Arnold Schönberg, The musical Idea and the Logic, Technique, and Art of its Presentation, übers. von Patricia Carpenter und Severine Neff, New York 1995. Arnold Schönberg Center, Arnold Schönberg: Schüler in Wien und Mödling (1904–1924), in: http://www.schoenberg.at/1_as/schueler/wien/schueler_wien.htm. Wilhelm Seidel, Artikel „Stil“, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Zweite, neubearbeitete Ausgabe, Sachteil, Bd. 8, Kassel u.a. 1998, Sp. 1740–1759. Philipp Spitta, Kunstwissenschaft und Kunst [Akademierede von 21.3.1883], in: ders., Zur Musik. Sechzehn Aufsätze, Berlin 1892, 2–14.
220
Georg Beck
Zwei Wiener Schulen: Freud und Schönberg
221
Reinhard Kapp Zwei Wiener Schulen: Freud und Schönberg1
1. Hans Keller scheint den Vergleich zwischen Freud und Schönberg aufgebracht zu haben, wie er auch selbst vermeinte (Keller: 2003, 243f.) – Max Graf, der die beiden in einem Atemzug nennt, tritt in einen solchen Vergleich nicht wirklich ein.2 Außer Zweifel steht wohl, dass es sich bei der von Arnold Schönberg begründeten sogenannten Zweiten Wiener Schule um eine Schule handelt, mit allen Bestimmungsmerkmalen einer solchen. Wie in der Psychoanalyse auch gibt es einen Fonds von gemeinsamen Überzeugungen, Übermittlung durch mehrere Generationen, Ausdifferenzierung, Spaltungen und Neukonstitution. Man denke nur an die kontinuierliche Fortschreibung der Schönbergschen Form- und Formenlehre bei Webern, Rufer, Ratz, Stein und Spinner (Boynton: 2005). Daneben ist Platz für Sonderentwicklungen: die dissidente (politische) Lesart Eislers, die selbständige Lehre vom thematischen Zusammenhang bei Réti, die vom formalen bei Hersch1 Der Beitrag des Autors zu den Verhandlungen des Symposions beschränkte sich auf eine weitgehend extemporierte Problemskizze. Die schriftliche Ausführung allerdings nahm schon bald einen Umfang an, der die vollständige Aufnahme in den Berichtsband unpraktikabel und eine selbständige Publikation ratsam erscheinen ließ. Beim derzeitigen Stand umfasst der Text die Kapitel: Freuds und seiner Mitarbeiter Verhältnis zur Musik; Motive einer Psychoanalyse der Musik; Personelle Verbindungen zwischen dem Freud-Kreis und der Wiener Schule Schönbergs; Das Verhältnis einzelner Mitglieder der Wiener Schule zur Psychoanalyse; Teilmomente und Entwicklung einer Schaffens psychologie beim Theoretiker Schönberg; Analogien und Unterschiede zum psychoanalytischen Konzept; Historische Einordnung. In Arbeit befindet sich eine Vergleichsstudie zum Analysebegriff in den Schulen Freuds und Schönbergs. – Damit der Beitrag doch in irgendeiner Form im vorliegenden Band vertreten ist, haben die Herausgeber angeregt, den Abschnitt, welcher die Gegenüberstellung der psychologischen Theorien Freuds und Schönbergs enthält (vorausgegangen ist eine detaillierte Erörterung der einzelnen Schritte in der Bewegung des Schönbergschen Denkens über die seelischen Antriebe und die Leistungen des Unbewussten beim Komponieren), als eine Art Resümee gelten zu lassen, und so mag das Fragment hier seinen Platz finden. Einschränkend muss jedoch daran erinnert werden, dass es hier noch nicht auf einen Vergleich der generellen Konzeptionen von Musik bzw. Psychologie abgesehen ist. 2 Das Äußerste ist: „der große Mann [Freud], der die Wissenschaft von der menschlichen Seele so umgestaltet hat wie Albert Einstein das naturwissenschaftliche Weltbild und Arnold Schönberg die Musik unserer Zeit“ (Graf: o.J., 168).
222
Reinhard Kapp
kowitz, die nicht dissidente, aber gleichwohl eigenständige Weiterentwicklung der Aufführungstheorie durch Kolisch, die historisierte Aufführungslehre Fritz Rothschilds, die loyale Kritik Adornos. Wie die Psychoanalyse befindet sich die Theorie der Wiener Schule in ständigem Fluss. Sie folgt der entstehenden Musik und kommentiert deren Entstehungsbedingungen, aber sie sieht sich auch vor immer neue Fragen gestellt. Es handelt sich nicht um ein theoretisches „System“ à la Riemann (auch nicht ein sich bis zur Vollständigkeit erst entwickelndes), wohl aber um ständige Erweiterungen und Veränderungen, An- und Umbauten. Bei Freud wären zu nennen die Einführung des Es-Begriffs, der Topik (und deren Verabschiedung zugunsten einer funktionalen Theorie), des Todestriebs; bei Schönberg: die Einführung des Gedanke-Konzepts oder der harmonischen Regionen. Auch Motive und Funktionsweise der Theoriebildung selbst sind in Analogie zu setzen. Neben dem praktischen ist bei beiden ein spezifisch theoretisches Interesse im Spiel. Weder Busoni noch Debussy, weder Ives noch Reger, weder Bartók noch Strawinsky, weder Cowell noch Krenek (um jetzt Komponisten aufzuzählen, die in geringerem oder größerem Ausmaß auch als Musikschriftsteller mit einem gewissen konzeptionellen Anspruch hervorgetreten sind) haben wie Schönberg neben der Handwerkslehre (und Ästhetik) auch die Entstehung gerade ihrer neuen Musik mit theoretischen Entwürfen begleitet, welche den Namen verdienen, haben diese neue Musik selbst auch mit theoretischen Mitteln aufzuschließen und zu systematisieren versucht. Vielleicht kommt, an derselben Stelle, in derselben Situation wie Schönberg und in Kontakt mit ihm, einzig Kandinsky für einen Vergleich infrage. Wie Freud geht Schönberg von der Selbstbeobachtung aus, die ihm erstes Material und Orientierung in der Fülle der Erscheinungen liefert. So wie er nach seiner eigenen Erklärung die Harmonielehre „von [s]einen Schülern gelernt“ hat – in ständiger Auseinandersetzung, angeregt durch Erklärungsbedarf, Zustimmung und Widerspruch, so entwickelt Freud die Psychoanalyse mithilfe der Analysierten, die ihm nicht nur Material, sondern auch Deutungen und theoretische Hinweise anbieten. Beide begleiten den Diskurs unter den Schülern und greifen selbst in ihn ein. So wie der Psychoanalytiker aus dem ungeordneten Durcheinander in den Mitteilungen des Patienten den latenten, den eigentlichen Inhalt und die spezifische Logik von dessen Träumen erschließt, aus den individuellen Fällen das Gemeinsame herauszufiltern und zu einer Theorie zu synthetisieren sucht, so ist die Wiener Schule bestrebt, in den konkreten Problemen das Prinzipielle, zwischen Musiken unterschiedlichster Herkunft und stilistischer Richtung das gleichbleibend Gültige aufzufinden. So wie Freud als Pionier auf einem Kontinent, den vor ihm kaum jemand betreten hat, die ersten Schritte tut und gezwungenermaßen die kartografischen Grundlinien zieht, und wie er in Erscheinungen des Seelenlebens durch systema-
Zwei Wiener Schulen: Freud und Schönberg
223
tisches Vorgehen Gesetzmäßigkeiten dort entdeckt, wo vorher Metaphysik, Willkür und Ignoranz geherrscht hatten, so sieht sich Schönberg gezwungen, in einer Situation, in der Musik ohne angebbare Regeln für Harmonik, Form und Prosodie entsteht (Atonalität, Athematik bzw. Asymmetrie, Prosa) zumindest einen Grund zu finden oder zu hypostasieren. Wie Freud sucht Schönberg eine Art Modell zu entwerfen. Seine immer erneuten Anläufe folgen den wechselnden Erfahrungen, Bedürfnissen, Dispositionen – die Schaffenspsychologie ist nichts Statisches, das nur nach und nach, oder partienweise ausgebaut würde, sondern sie bleibt anpassungsfähig. Wesentliche Verhältnisse, wie das zwischen Bewusst und Unbewusst, verschieben sich, der Anteil des Bewusstseins an der künstlerischen Arbeit wächst – und so wie sich die Theorie bei Freud im Laufe der Zeit verändert, so auch bei Schönberg. Handelt es sich bei ihm analog zur Topik des seelischen „Apparats“ um einen Instanzenaufbau des Unbewussten mit lokalisierbaren Funktionen? Erinnert sei zumindest an das Konzept der Regionen in Structural Functions of Harmony sowie an die Vorstellung von Kern und Peripherie des musikalischen Gedankens (das stabile, zeitlose Gerüst und die wechselnd angepasste Einkleidung), aber eben auch an die Bewegung aus den Tiefen der seelischen Impulse zur Oberfläche der Gestaltung. So wie nach Freud „jeder Trieb auf den beiden Ebenen Affekt und Vorstellung ausgedrückt“ wird (nach Laplanche/Pontalis: 1973, 37), so nimmt Schönberg an, dass der Trieb sich in affektiven und plastischen Momenten des Kunstwerks äußert, und dass beide verschiedenen Schichten angehören. Freud zufolge behält sich der Arzt bei der medizinischen Behandlung des Seelenlebens üblicherweise das Recht vor, durch einen Schlußprozeß vom Bewußtseinseffekt zum unbewußten psychischen Vorgang vorzudringen; er erfährt auf diesem Wege, daß der Bewußtseinseffekt nur eine entfernte psychische Wirkung des unbewußten Vorgangs ist [...], daß er bestanden und gewirkt hat, ohne sich noch dem Bewußtsein irgendwie zu verraten (Freud: 1972, 580. Hervorhebung von Freud).
Dieser Rückschluss – weniger von bestimmten manifesten auf bestimmte latente Inhalte als von den Werken auf ihnen zugrunde liegende seelische Prozesse im allgemeinen, eher auf diese Tatsache des Ablaufens solcher Prozesse als auf bestimmte konkrete Abläufe und funktionale Abhängigkeiten, ist auch bei Schönberg zu beobachten. Die psychologische Analyse, die zugleich Bausteine für das Theoriegebäude abgibt, ist als Praxis selbst theoriegestützt und systematisierungsbedürftig. Auch Schönberg hat einen Analysebegriff mit psychologischen Anteilen: die subjektiven
224
Reinhard Kapp
Momente am Hören, die individuelle Produktion eines Klangeindrucks usw., dazu die seelischen Bedingungen, auf welche die Untersuchung der Kunstobjekte unweigerlich stößt; hier besteht gleichfalls wechselseitige Abhängigkeit zwischen dem musikalischen Gegenstand und seiner gedanklichen Erschließung. In beiden Schulen ist die Rolle der Theorie im Verhältnis zur Therapie (Klinik) im einen, zu Komposition, Aufführung, Analyse und Unterricht im anderen Falle konstitutiv. Wie die Praxis Materialreservoir und empirische Basis für die Fundamentierung und weitere Ausbildung der Theorie, für Konzeptualisierungen und Arbeitshypothesen bildet, so stellt die Theorie Prämissen, leitende Gesichtspunkte und Regeln für das ärztliche bzw. künstlerische Handeln bereit. In beiden Fällen gibt es eine bis heute geübte Praxis der Ausübung, der Weitergabe des Wissens, der Wissenschaft – eine Praxis, die nicht bloße Anwendung, eine Theorie, die kein reiner „Überbau“ ist. In beiden Fällen enthält jeder praktische Ansatz auch theoretische Bestandteile, konstituiert die Theorie aber auch ein eigenes, eigens zu bearbeitendes Feld. Sowohl bei Freud als auch bei Schönberg hat diese Theorie Textcharakter angenommen, es handelt sich nicht nur um ein Ensemble weiterzugebender Lehrmeinungen und Erfahrungssätze, sondern um einen breiten Strom von verschriftlichter Diskussion, publizierten Forschungsbeiträgen, Aufsätzen, Monografien, Tagebüchern, nicht nur von Notaten, sondern von verbindlicher Formulierung, auf die mit Studium, Auslegung, Referat und Kritik reagiert werden kann. Die Schönberg’sche Kompositionsweise bildet natürlich den Erfahrungshintergrund. Normalerweise wird schnell produziert, das heißt die energetischen Ströme können ungehindert fließen. Man kann beobachten, wie Elemente sich frei assoziieren und verschiedene Teilmomente zu Verknüpfungen auf verschiedenen Ebenen benutzt werden, um Beziehungen zwischen Themen oder Zusammenhänge zwischen dissonanten Klängen herzustellen; man ahnt, dass Entwurf und Korrektur, Umorganisation, Reformulierung, Modifikation im Spiel sind, ebenso Gedächtnistätigkeit, Anpassungsleistungen, Ausgleichen, Annäherung, Wiederaufgreifen usw.; aber auch wenn man annehmen darf, dass Arbeitsvorgänge zugrunde liegen, weiß man eigentlich nicht, welche im Einzelnen, wie dieses unbewusste Schaffen konkret vor sich geht, welche besonderen Kräfte wirksam sind, welches die einzelnen Phasen und Schritte bis zur ersten Niederschrift sind (so wie man etwa den Schaffensvorgang anhand der Beethoven’schen Skizzen nachvollziehen zu können glaubt): Man konstatiert im Resultat lauter interne Beziehungen, deren Logik sich ex post nachkonstruieren lässt, im Moment des Schaffens jedoch sich jeder Argumentation und Beweisführung entzieht, dem Komponisten keinerlei Handhabe liefert, ehe die Komposition nicht zum Bewusstsein emporgestiegen ist und sich der Beurteilung darbietet. – Dies ist in der Psychoanalyse, die auf die seelischen Vorgänge direkt aus ist, im Grunde auch nicht anders: Sie kann
Zwei Wiener Schulen: Freud und Schönberg
225
zwar aus den Resultaten auf im Unbewussten wirkende Kräfte schließen, und auch darauf, dass deren Wirken gewissen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, aber sie kann von den Träumen, den Versprechern, den Phobien, den Wahnsystemen her die abgelaufenen Prozesse als solche nicht im Einzelnen rekonstruieren. Die „Gesetze“, welche im Unbewussten walten, sind nach Schönbergs Vorstellung Bildungsgesetze, d.h. Gesetzmäßigkeiten, welche ebenso das Zusammen- und Gegeneinanderwirken der Kräfte im Innern des Künstlers bestimmen, wie sie dem Bau des Kunstwerks innewohnen. An der Oberfläche der jüngsten Hervorbringungen aber ist das Regelhafte fürs Erste nicht zu erkennen, man kann, nachdem das kompositorisch geschulte Ohr den Klängen, das Formgefühl den Proportionen und Zusammenhängen seine Beistimmung nicht versagen kann, allenfalls eine „innere Notwendigkeit“ annehmen. Erst die geduldige Beobachtung und der Vergleich lehren, dass tatsächlich wiederkehrende Muster und Ähnlichkeiten zwischen den divergenten Phänomenen zugrunde liegen. Das gilt ebenso von den scheinbar chaotisch ineinander fließenden Traumgestalten oder den Absurditäten der Symptombildungen. So wie die Psychoanalyse angesichts und vermittels der Zwangsvorstellungen, Traumerzählungen, Assoziationen des Patienten zu den Ursachen und Kräften, den Wünschen und Deformationen in seinem Innern vordringt, die Instanzen und Konfliktlinien systematisiert und zu einer kohärenten Theorie verbindet, mit dem praktischen Ziel der Therapie, der Auflösung von Blockaden, der Versöhnung des Ichs mit seinen unbewussten Strebungen – so schließt die Wiener Schule einerseits von den neuen kompositorischen Erscheinungen auf ursächliche im Innern des Subjekts wirkende Kräfte, andererseits von den Meisterwerken auf in ihnen wirkende Prinzipien (für die Formbildung: fest – locker; Periode – Satz; statisch – dynamisch; geschlossen – offen; vertikale – horizontale Darstellung usw.), wobei angenommen wird, diese seien nur teilweise bewusst befolgt worden. Dabei ist wohl ebenfalls anzunehmen, dass diese Prinzipien, die nunmehr offen zutage liegen und in der Lehre bewusst angewendet werden können, als Basis des Handwerks und subjektiver Stabilitätsfaktor beim Komponieren, ursprünglich unbewusst befolgt bzw. erst nach und nach entdeckt worden seien. Das Ziel ist hier: in der Lehre gewiss auch die Behebung von mancherlei technischen Gebrechen und solchen der musikalischen Vorstellungskraft, vor allem aber das Einswerden mit den eigenen Intentionen und „Trieben“, andererseits das Aufspüren und die zusammenhängende Darstellung von Gesetzen, wie man sie langfristig auch in den neuen Kompositionen wirksam zu sehen erwartet – irgendwann würde es auch um den Kompositionsvorgang selbst gehen können, seine logischen, ästhetischen und psychischen Implikationen, schließlich sogar um die Modalitäten des kompositorischen Denkens und der schöpferischen Fantasie.
226
Reinhard Kapp
Während für die Psychoanalyse eine ganze Literatur zur Begriffsbildung, zur Methode („Metapsychologie“), zu zahlreichen Termini, ihrer Verwendung und ihren Bedeutungsverschiebungen vorliegt, existiert für Schönberg zwar eine Reihe von Einzelstudien zu den Begriffen Analyse, Aufführung/Vortrag, Gedanke, Grundgestalt, Struktur/Form usw., aber noch relativ wenig über den systematischen Zusammenhang, über theoriegeschichtliche und philosophische Bedingungen. Erst recht existiert keine Untersuchung des begrifflichen Instrumentariums, dessen er sich bei seinen Exkursen in die Psychologie des Schaffens bedient. Eine ganze Reihe von Termini muss in diesem Kontext noch einmal untersucht und gegebenenfalls in Beziehung zur psychologischen Diskussion der Zeit oder auch zu anderen musiktheoretischen Konzepten im Hinblick auf deren psychologische Motivierungen gebracht werden. Allein aus der Traumdeutung gäbe es eine ganze Reihe von regelmäßig wiederkehrenden Kategorien, die sich – selbstverständlich nicht immer in gleichem Sinn und Zusammenhang – bei Schönberg ebenfalls finden, und die einer vergleichenden Untersuchung zu unterziehen wären: Affekt – Analyse – (das seelisch) Angeborene – Arbeit/Bearbeitung – Assoziation – Ausdruck – Bedürfnis – Bewusstsein – Darstellung(smittel) – Erlebnis – Erinnerung – Erregung – Funktion – Gedanke – Leistung – Material – Methode – Symbol – Symptom – Trieb(kraft) – Unbewusstes – Verdichtung – Vergangenheit. Aus Laplanche/Pontalis’ Das Vokabular der Psychoanalyse kommen darüber hinaus und statt dessen infrage: Ambivalenz – Darstellbarkeit – Deutung – direkte Analyse – Drang – Durcharbeiten – Dynamisch – Energie – Erinnerungsspur – gleichschwebende Aufmerksamkeit – Ich – Identifizierung – Instanz – Instinkt – Interesse – Komplex – Konflikt – Konstruktion – Latenter Inhalt – Manifester Inhalt – nachträglich – Neutralität – Objekt – ökonomisch – Phantasie – Projektion – Reaktionsbildung – Realität – sekundäre Bearbeitung – Selbstanalyse – Sublimierung – Tagesreste – Tagtraum – Topik – Trägheitsprinzip – Trauma – Traumarbeit – Traumgedanken – Überdeterminierung – Unterbewusstsein – Verdrängung – Verinnerlichung – Verschiebung – Verwerfung – Vorbewusstes – Vorstellung – Wahrnehmung – Widerstand – Wiederholung – Wunsch – Zensur – Zwang; dazu vielleicht noch: emotionale „Besetzung“ – Entwicklungsstufen – Innere Wahrheit – Interpretation – Psychische Leistungen – Struktur. Es würde sich sicher lohnen, im einen oder anderen Fall der Beziehung, den Parallelen, den Übereinstimmungen und Unvereinbarkeiten nachzugehen, oder die entsprechenden
Zwei Wiener Schulen: Freud und Schönberg
227
Kategorien Schönbergs von Freud her in Augenschein zu nehmen.3 Außer den auch von Freud in psychologischem Sinne verwendeten müssten aber natürlich auch diejenigen untersucht werden, die genuin musikalische Verfahren und Verhältnisse bezeichnen: Bearbeitung, Konstruktion, Material, Verdichtung, Ersetzung, Verschiebung, Wiederholung. In diesem Zusammenhang wäre dann auch zu diskutieren, ob nicht gewisse signifikante Ideen der expressionistischen Phase: musikalische Prosa, vagierender Akkord, Emanzipation der Dissonanz, ebenfalls am psychologisierenden Diskurs jener Jahre teilhaben (Khittl: 1991, insbes. 177ff.). Gewiss haben die Leistungen der Traumarbeit: Entstellung, Verdichtung und Verschiebung ihre musikalischen Äquivalente, sind sie zu vergleichen mit den Mechanismen, denen das kompositorisch(e) Unbewusste gehorcht. Aber sind die thematischen Verfahren: Abspaltung, Liquidation, Variantenbildung, getrennte Behandlung der Dimensionen Melodie, Harmonie, Rhythmus, Artikulation, Farbe etc. die Art Arbeit, wie sie im Un- oder Unterbewussten erfolgt, und nicht eher die nachträgliche „Bearbeitung“, welche der Verstand vornimmt?4 Nach Schönbergs Überzeugung wurde, wenn schon nicht im Unbewussten, so doch noch im Vorbewussten auch jene Bearbeitung vorgenommen, welche Verwandtschaften, Beziehungen, Ähnlichkeiten herstellt; mehr noch – jedenfalls in der expressionistischen Phase –: die gesamte Form, und innerhalb dieser all die Zusammenhänge, welche das Bewusstsein nachträglich entdeckt und versteht. Freuds Angaben in der Traumdeutung über das Verhältnis der Denkvorgänge unterhalb des wachen Bewusstseins zu dem, was im Traum daraus wird, hätte Schönberg seine Zustimmung nicht versagt: Die [latenten] Traumgedanken sind völlig korrekt und mit allem psychischen Aufwand, dessen wir fähig sind, gebildet; sie gehören unserem nicht bewußt gewordenen Denken an, aus dem durch eine gewisse Umsetzung auch die bewußten Gedanken hervorgehen. So viel an ihnen auch wissenswert und rätselhaft sein möge, diese Rätsel haben doch keine besondere Beziehung zum Traume und verdienen nicht, unter den Traumproblemen behandelt zu werden. Hingegen ist jenes andere Stück Arbeit, welches die unbewußten Gedanken in den [manifesten] Trauminhalt verwandelt, dem Traumleben eigentümlich [...]. Diese eigentliche Traumarbeit entfernt sich nun von dem Vorbild des wachen Denkens viel weiter, als selbst die entschiedensten Verkleinerer der psychischen Leistung bei der Traumbildung gemeint haben. Sie ist nicht etwa nachlässiger, inkorrekter, vergeßlicher, unvollständiger als 3 Natürlich ist kein „Vokabular der Wiener Schule“ analog zum „Vokabular der Psychoanalyse“ denkbar, solange noch nicht einmal eine halbwegs vollständige Ausgabe der Schönbergschen Schriften vorliegt. 4 Hans Keller hat den Versuch unternommen, solche technischen Prozeduren ihrerseits psychologisch zu deuten, siehe Keller: 2003, passim.
228
Reinhard Kapp
das wache Denken; sie ist etwas davon qualitativ völlig Verschiedenes und darum zunächst nicht mit ihm vergleichbar. Sie denkt, rechnet, urteilt überhaupt nicht, sondern sie beschränkt sich darauf umzuformen [...] Auf die logischen Relationen des Gedankenmaterials entfällt wenig Rücksicht; sie finden schließlich in formalen Eigentümlichkeiten der Träume eine versteckte Darstellung (Freud: 1972, 486f.).
Wird Schönberg diese Möglichkeit eines unbewussten Denkens sofort konzedieren, so wird ihn erst recht die Vorstellung befriedigen, die intuitive Umformung in ein Kunstgebilde behalte den Charakter des Gedanklichen bei, auch wenn sie dem traditionellen analytischen Instrumentarium (noch) nicht zugänglich sein sollte. Möglicherweise aber hätte er angesichts einer gewissen Verwandtschaft der expressionistischen Kompositionen mit Träumen, und auch noch diesen selbst gegenüber, als genuine Schöpfungen betrachtet, zu bedenken gegeben, dass Freud den formalen Eigentümlichkeiten und der spezifischen Logik ihrer gedanklichen Verknüpfungen vielleicht zu wenig Kredit einräume.
2. Bei allen Gemeinsamkeiten in der Tendenz: das Unbewusste durchs Bewusstsein gehen zu lassen, mit Bewusstsein sich dem Unbewussten zuzuwenden; im Nachhinein die Produkte zu analysieren, um ihnen die zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten zu entreißen und damit zugleich etwas über die Produktion, über das in Erfahrung zu bringen, was im Unbewussten geschehen ist, also über das Unbewusste selbst; die Kunstwerke, oder zumindest bestimmte Tendenzen in ihnen als symptomatisch zu nehmen –, so ist doch klar, dass es sich nicht um konkurrierende Theorien, um vergleichbare Ansätze zur Aufklärung der Tätigkeit des Unbewussten handelt. Freilich ist der Status des Theoriekomplexes „Schaffenspsychologie“ bei Schönberg kaum eindeutig zu bestimmen, und so scheint eine Schlüsselfrage derzeit nicht beantwortbar: Sitzt diese Schaffenspsychologie auf der von der Psychoanalyse entdeckten Struktur des Unbewussten auf, d.h. hat man sich in „Trieb“, „Ausdrucksbedürfnis“ usw. nochmals den ganzen seelischen Betrieb am Werk zu denken, und dort säßen dann die konkreten Bedürfnisse, Phobien, Konflikte usw.? Oder soll sich die gesamte Tätigkeit des Unbewussten analog zum psychoanalytischen Modell abspielen, allerdings in einem speziellen, nämlich rein musikalischen Material – so dass überhaupt nur von einem genuinen Schaffenstrieb (usf.) die Rede wäre? Ist vielleicht die Schaffenspsychologie ein Entwurf parallel zur Struktur des Unbewussten, wie sie damals nach und nach in der Psychoanalyse
Zwei Wiener Schulen: Freud und Schönberg
229
ausgearbeitet wurde, sodass also zwei Unbewusste nebeneinander bestehen würden, die nichts miteinander zu tun hätten, oder über deren Korrespondenz nichts auszumachen wäre? Es bleiben jedenfalls genügend viele Unterschiede, welche die Konzeptionen mit einiger Bestimmtheit gegeneinander abzugrenzen erlauben. Schönberg wie Freud haben neue Erdteile entdeckt, nämlich neue Bereiche des Seelenlebens erschlossen. Aber während Freud sich aufmacht, sie zu kartografieren und zu erklären, beschränkt sich Schönberg als Künstler darauf, einzelne aussagekräftige Bilder mitzubringen, als Theoretiker, sich einiges über die Bedingungen der Bildproduktion zusammenzureimen. Gewiss war Schönberg Seelenforscher, wie, nach Freuds Eingeständnis, die Dichter. Aber abgesehen von den wenigen Motiven, die in den vertonten Gedichten und selbst verfassten Libretti greifbar sind, ist er es in seiner eigenen unübersetzbaren Sprache: der Musik. Seine explizite psychologische Theorie ist nicht von gleicher Tiefe und Konsequenz, da sie gegenüber der musikalischen Seelenkunde sekundär bleibt und jedenfalls in einem anderen, ihm nicht gleichermaßen vertrauten Bezugssystem angesiedelt ist. Allem voran kehrt sich die Richtung der theoretischen Bewegung um. Bei Freud bilden der psychische Apparat, sein Bau, seine Funktionsweise und das Schicksal der Materialien im Verarbeitungsprozess das primäre Interesse. Die Psychoanalyse leitet von den Symptomen, vom Trauminhalt zu den Motiven, Verdrängungen, Widerständen, ursprünglichen Wünschen – kurz zu der konkreten Arbeit des Unbewussten. Bei Schönberg, der den traditionellen Themen der Ästhetik verhaftet bleibt – Ausdrucksprinzip, Verhältnis zwischen Inspiration und Arbeit –, wird von den Werken auf eine Produktionsinstanz, von den regelwidrigen, aber inkorrigiblen, dabei eigentümlich reizvollen oder befriedigenden Erscheinungen auf spezielle, individuelle Ursachen im Innern des Urhebers geschlossen, aber in gewissem Sinne abstrakt. Die Aufmerksamkeit bleibt auf das Resultat gerichtet, auch wenn immer wieder nach den Entstehungsbedingungen gefragt wird. Aber Schönberg schreitet zu keiner Psycho-Analyse fort. Der Trieb, das Ausdrucksbedürfnis selbst wird nicht wirklich untersucht (und braucht es ja auch nicht, da das nicht unter den Aufgabenbereich eines Musiktheoretikers fällt). Wenn Schönberg aus den höchst individuellen Gebilden „der Fantasie“ auf ein subjektiv-objektiv generierendes Prinzip schließt, so ist das eine Art Gottesbeweis, keine Wissenschaft. Wohl aber dient ihm dieser dunkle Urgrund als Ausgangspunkt für die Skizzierung eines prozesshaft vorgestellten Schöpfungsaktes, der in musikalischen Realverhältnissen terminiert. Die seelischen Faktoren dienen ihm dazu, sich eine tragfähige Hypothese zu zimmern, die ihm die äußeren Vorgänge: die entstandene Musik erklärt. Vielleicht hätte Schönberg mit Freud in der Auffassung der Seele als einer Art Kraftwerk übereinstimmen können – sein Modell des Kunstwerks ist der Organismus als geschlossener Funktionszusammenhang (er empfiehlt sich schon deswe-
230
Reinhard Kapp
gen, weil er sich aus einem ins Dunkel – der Erde, des Schoßes – gesenkten Keim gesetzmäßig und nahezu unbeeinflussbar entwickelt), während der Traum selbst für Freud reine, extern bezogene Funktion bleibt. Er löst sich dem Analytiker in lauter Detailbeziehungen auf, für deren Zustandekommen zwar ebenfalls gewisse Regeln angegeben werden können, aber kaum eine leitende Gesamtformel. (Die Erklärung im Sinne der Wunscherfüllung trägt zur Aufhellung seiner Struktur, seines Zusammenhangs oder seiner Dramaturgie nichts bei.) Aber auch Kunstwerke bedeuten dem Psychologen für sich genommen, als Schöpfungen sui generis, wenig, er berücksichtigt nur das an ihnen, was sie für die Deutung hergeben. In der Theorie (wie in der klinischen Praxis) sind sie bloße Demonstrationsobjekte. Für Schönberg dagegen sind die Produkte dasjenige, worauf es ausschließlich ankommt. Er lässt einen Bereich der unbewussten Triebe gelten, aber ihn interessiert die kompositorische Ebene, auf der sich die Triebe manifestieren. Der Psychologe Freud geht rational vor; der psychische Apparat funktioniert gesetzmäßig, die Resultate indessen erscheinen systemlos. Schönberg hängt bei allen Versuchen, gedanklich in das Dunkel des Unbewussten vorzudringen, weiterhin einer Metaphysik des Schaffens an. Statt des Versuchs gründlicher Aufklärung der schöpferischen Vorgänge verlässt er sich lieber auf die herkömmlichen Erklärungshülsen: Inspiration, die wunderbaren Leistungen des Unbewussten. Der Psychologe Schönberg verfährt weitgehend irrational (ohne systematische Prüfung), und ebenso erscheint ihm der psychische Apparat; die Leistungen des Unbewussten indessen (das ist ja das Wunder) stellen sich ihm konsequent, organisch, gesetzmäßig, logisch dar. Wirklich analytisch und rational wird er erst dort, wo er bei den Kunstwerken angekommen ist, deren Funktionsweise er systematisch zu ergründen sucht; nur dort, wo sein analytisches Instrumentarium die intern musikalischen Beziehungen nicht zu packen in der Lage ist, zieht er außermusikalische Faktoren in Betracht, nämlich seelische. Seine rationale Theoriebildung bildet sich zur Konsequenz dort aus, wo sie nicht Psychologie ist. Analyse zielt bei Freud auf die Person, in zweiter Linie auf die psychischen Verhältnisse, bei Schönberg weniger auf die Leistung als auf das Geleistete. So sehr er auf Individualität, auf Sich-Ausdrücken besteht, so wenig will er das eigentlich psychologisch verstanden wissen. Nicht das Persönliche an der Genese des Kunstwerks scheint ihm von Bedeutung, sondern das Persönliche an dessen Aussage. Seine Schaffenspsychologie enthält insofern keine Produktionstheorie, als der Sublimationsvorgang für ihn keine Rolle spielt: die Ersetzung unerwünschter Motive durch gesellschaftlich anerkannte, die Prozesse der Verdichtung des Gefühls- zu Gedankenmaterial, die Mechanismen der assoziativen Verknüpfung im rein Psychischen. Auch wenn später das Unbewusste bewusst gemacht werden soll, bezieht sich das wiederum ausschließlich auf die letzten Stadien der Fertigstellung
Zwei Wiener Schulen: Freud und Schönberg
231
des künstlerischen Gebildes, nicht auf die zufälligen Personalien, die vorher im Spiel gewesen sein mögen. Auch wenn er seine eigene Art Topik beziehungsweise Funktionstheorie des psychischen Apparats entwirft, interessiert er ihn nicht als psychischer, sondern als Apparat, als eine Art Generator. Er lässt es weitgehend auf sich beruhen, was dieser Bereich des Unbewussten – obwohl dort sich doch die entscheidenden Vorgänge abspielen – an polymorph Unbestimmtem oder topisch Kartografierbarem zutage bringen mag; er hat, wie es scheint, gar nicht versucht, die auf die Produktion ausgeübten „Reize“ und die „Quellen“ seines Schaffens – analog zu Freuds „Traumreize[n] und Traumquelle[n]“ – in seiner eigenen Psyche in Betracht zu ziehen, die Mechanismen, welche den seelischen „Vorgängen“ – entsprechend den „Traumvorgänge[n]“ Freuds – zugrunde liegen, zu ergründen. Auf diese Weise behielt er sich natürlich die Entscheidung vor, ob die treibenden Kräfte in ihm rein psychischer oder aber metaphysischer Natur seien; ich vermute allerdings, dass im Großen und Ganzen für einen Autor seiner Herkunft das im Innern angesiedelte Genie über die Niederungen der banalen Wünsche des Alltags erhaben ist. Wie er zum Beispiel persönlich mit seiner Ehekrise umging, darüber hat er, wie es scheint, keine Auskunft gegeben,5 und sich auch von Psychologen nicht raten und helfen lassen. Vorstellbar ist natürlich, dass sein Schaffen dieser Jahre, wo das Erlebnis allenthalben unübersehbare Spuren hinterlassen hat, auch als eine Art Selbsttherapie und Verarbeitung des Erlebten fungierte. Keine Frage, dass das 2. Streichquartett oder Die glückliche Hand auch solche Züge aufweisen, dass die Werke darin jedoch nicht aufgehen. Dass ihn dieser Hintergrund später nicht mehr interessierte, ist aber auch nicht weiter verwunderlich. Denn letzten Endes kann ihm als Komponisten natürlich nur daran gelegen sein, „was es ist“, nicht aber, „wie es gemacht“6 beziehungsweise unter welchen Umständen es entstanden ist, können ihn die Kompositionen nur als solche, nicht aber als pathografische Dokumente interessieren – und Psychologie kommt schließlich nur noch als Erklärung (= Sympathiewerbung) beim Wissenschaftler, als Blockade und Widerstand beim Hörer ins Spiel. Während die Psychoanalyse beim Vordringen vom Manifesten zum Latenten Transformationsvorgänge und einen Wechsel des Mediums annimmt, geht Schönberg davon aus, dass in der Latenz eben das vorbereitet und erarbeitet wird, was dann manifest wird; dass sich der „Trieb“, von dem er spricht, wenn auch als Aus5 Der Testaments Entwurf von 1908 lässt zumindest den Grad der Aufgewühltheit ahnen: Arnold Schönberg Center, Signatur T 06.08. 6 Schönberg führte die berühmte Unterscheidung in dem Brief an Kolisch zu dessen Reihenanalyse des 3. Quartetts (27.7.1932) an, Schönberg: 1958, 178f.
232
Reinhard Kapp
druck, auf eben dasjenige bezieht, was dann die Musik ausmachen wird. Selbst wenn er in der Diskussion mit Kandinsky vom Geistigen in der Kunst spricht und ausgeht, hat er dennoch die Materialität im Auge, lässt er doch die sinnliche Erfahrung nicht außer Acht. Noch nicht recht deutlich ist mir geworden, ob, und wenn, an welcher Stelle im Schönberg’schen Modell Widerstand, Verdrängung, Zensur sitzen? Einerseits fungiert der Trieb respektive das Unbewusste als Widerstandsagentur: Seine Leistungen lassen sich nicht zurichten, nicht „korrigieren“. Ästhetik und Theorie andererseits betreiben die Anpassung an gängige, kollektiv akzeptierte Werte. Unbestimmte Bedenken, die auszusprechen verhindern, der Verstand, der korrigierend verfälscht, was das Unbewusste sagen will. Bemerkenswert scheint mir, dass Schönberg, statt diesem Unkontrollierten, aus dem Unbewussten Aufsteigenden, rational nicht Fassbaren, ja allem Widersprechenden, was die Theorie der Musik als richtig erkannt hatte, Widerstand entgegenzusetzen (wie ihn der gewöhnliche Bürger den „asozialen“ Trieben wie auch der „Überschätzung“ der sexuellen Triebnatur entgegensetzt),7 es akzeptiert und ihm volles Vertrauen schenkt, sogar sich überzeugt gibt, die Gesetzmäßigkeiten, die bei dieser Art Hervorbringung und innerhalb der Hervorbringungen selbst herrschten, würden gegen den derzeitigen Anschein sich eines Tages herausstellen – was wie die Übertragung der in der Psychoanalyse an „pathogenen“ Erscheinungen gewonnenen Theorien auf künstlerische Tätigkeit wirken konnte. Das Eingeständnis, der Künstler, wie das Ich überhaupt, sei „nicht Herr [...] in seinem eigenen Hause“ (Freud; 1917– 1919, 7), bedeutet indessen nicht, dass es sich um Symptome im Sinne von Anzeichen für pathologische Zustände handelte, sondern dass der wahre Künstler „sich ausdrücken“ müsse, und dass es dabei, wie immer es um die seelische Verfassung des betreffenden Menschen bestellt sei, in jedem Falle mit rechten Dingen zugehe. Schönberg rekurriert dabei allerdings anders als Freud, der nur die reguläre Einrichtung der individuellen Psyche aufdeckt – also keine aus dem Individuum redende absolute Wahrheit – auf eine objektive Instanz, die sich immer schon im Innern des Künstlers eingenistet hatte und ihn in „unbewussten“ Konnex zu den allgemeinen Verbindlichkeiten brachte. Das Unbewusste der Person (der Gegenstand der Psychoanalyse) aber und die unbewussten Anteile des künstlerischen Schaffens bleiben theoretisch voneinander getrennt, wo nicht gegeneinander abgedichtet; weder lässt sich Schönberg auf eine Autopsychoanalyse ein, noch will er die Kunst als eine Art von Selbsterforschung gelten lassen. Alles, was an nach7 Dies ist Ausdruck dessen, was Freud die dritte, die „psychologische Kränkung“ der menschlichen Eigenliebe nach der „kosmologischen“ durch Kopernikus und der „biologischen“ durch Darwin nennt (Freud; 1917–1919, 4ff.).
Zwei Wiener Schulen: Freud und Schönberg
233
träglicher Reflexion und biografischer Rekonstruktion angestrengt wird, gilt dem künstlerischen, nicht dem psychischen Subjekt. Sollte eine gedachte Psychoanalyse der Musik bei deren seelischer Ergründung gewisser Werke auf Momente des Asozialen, Unangepassten stoßen – Schönberg würde es gar nicht wissen wollen und seiner Überzeugung nach wäre mit solchem Wissen auch niemandem geholfen. Wenn er 1930 Heinrich Strobel (dem Parteigänger Hindemiths und Strawinskys) gegenüber die „seelischen Hintergründe“ als „Privatangelegenheit“ behandelt sehen möchte, so entspringt das ebenso der Abneigung, als Romantiker zum alten Eisen geworfen zu werden, wie darin jene bange Ahnung mitschwingt, die bereits Schumann eine ganze Schaffenspsychologie in nuce entlockt hatte, der zufolge wir „schreckliche Dinge erfahren“ würden, „wenn wir bei allen Werken bis auf den Grund ihrer Entstehung sehen könnten“.8 Ganz und gar bewusster Haltung entspringt es, wenn das Schönberg’sche Ich vor jeder Vermischung von Kunst und Leben, vor jedem Eindringen kunstfremder Gesichtspunkte in sein Eigenes und Eigentliches auf der Hut ist. An der Stelle, wo die allmähliche Entfernung von psychoanalytischen Positionen manifest wird, skizziert Schönberg, angeregt durch die Aufforderung eines amerikanischen Redakteurs, die satirische Miszelle „Psycho-Analyse der Musik“, die ziemlich klar zu verstehen gibt, wie weit er in das Studium ihrer mittlerweile kanonischen Texte eingedrungen war. Es ist sicherlich ebenso charakteristisch, dass Schönberg sich damit abreagiert, dass er der Psychoanalyse alles in die Schuhe schiebt, was ihn im Zusammenhang mit Musik (im Musikbetrieb, in der Musikpublizistik, in den Reaktionen des Publikums) als zufällig, unsachlich, rein persönlich, insinuierend, manipulativ, untergriffig verdross (und dass er sich darin in Übereinstimmung mit einem Rest „neusachlicher“ Grundstimmung in den beginnenden 30er-Jahren befindet), – wie es bezeichnend ist, dass er den Aufsatz nicht ausgeführt und veröffentlicht hat9, vielleicht aufgrund der Einsicht, dass da noch ein Fundus an nicht aufgearbeiteten und der theoretischen Bearbeitung bedürftigen Problemen liege. Falls ihm nicht sogar klar wurde, dass er im Augenblick mit der Psychoanalyse im selben Boot saß und ein Rest Solidaritätsgefühl ihm direkte und wohl auch ungerechte Angriffe verbot.
8 Schönberg: 1976, 273; Robert Schumann in seiner bekannten Rezension von Berlioz’ Sinfonie fantastique (1835), Schumann: 1914, I, 83. 9 Schönberg bietet dennoch den Aufsatz in einem Brief vom 27.11.1931 der Zeitschrift Der Querschnitt an (erreichbar über die Briefdatenbank des Arnold Schönberg Center, schoenberg.at. Ich danke den Mitarbeiter(inne)n für den Hinweis auf diese Dokumente).
234
Reinhard Kapp
„Komponisten erweitert das Gebiet eures Wissens!10 Ich verstehe gar nichts von Psycho-Analyse. Oder, mit andern Worten: ebensoviel, wie alle andern, die davon reden. Keine Ursache also, die mich davon abhalten müsste, den gewünschten Artikel „PsychoAnalyse der Musik“11 zu schreiben. [...]“12
Kaum anders hat es Willi Reich ausgedrückt, der später mitteilte, Schönberg habe „von den Theorien Freuds wahrscheinlich nicht mehr“ gewusst „als jeder gebildete Mensch seiner Zeit“ (Reich: 1974, 62) – was dann allerdings nicht ganz wenig gewesen wäre.
3. Dies alles betrifft aufseiten Schönbergs Theorien, beziehungsweise Phasen der Theoriebildung, die unter dem Einfluss Freuds – oder von Freud-Adepten, oder der Freud-Debatte der Zeit –, und dann vielleicht sogar im Gegenzug gegen Freud entwickelt werden, unter dem Einfluss wiederum anderer Zeitlagen und Instanzen. Worin aber liegen die Unterschiede begründet? Schönberg ist kein Psychologe, sondern spricht als Musiktheoretiker, allenfalls -ästhetiker. Im mittlerweile allseits akzeptierten Zusammenhang der Wissenschaftsals Kulturgeschichte wäre es aber wichtig, die Wiener Schule als Denkschule zu sehen und zu all den anderen Wiener Schulen (der Nationalökonomie, der Soziologie, des Rechts, der Philosophie, der Sprachwissenschaft, der Wissenschaftstheorie, der Mathematik, der Physik, der Medizin, der Architektur, der Kunstwissenschaft, der Musikwissenschaft) in Beziehung zu setzen. Mit der Psychoanalyse in Vergleich gezogen wurde im Bisherigen nur die Musikpsychologie, also ein kleiner Teilbereich des Schönberg’schen Denkens. Schönberg nimmt die psychologischen Fragen jedoch niemals direkt in Angriff; seine Musikpsychologie ist auf einer untergeordneten Ebene angesiedelt, abgeleitet. Wo es um den Vergleich der Schulen ginge, kann das Entscheidende: wie die Wiener Schule der Musik in ihren Grundsätzen, in ihrer „philosophischen“ Orientierung, im Verständnis von Komposition usw. sich zur Psychoanalyse verhält, hier noch nicht thematisiert werden. 10 Diese Zeile ist am Rand angefügt. 11 Die näheren Umstände wurden noch nicht ermittelt. 12 Arnold Schönberg Center, Signatur T.39.23 – Dank an Larry Schoenberg für die freundliche Genehmigung zum Abdruck.
Zwei Wiener Schulen: Freud und Schönberg
235
Ungeachtet der möglichen direkten Beziehung zu Vertretern der psychoanalytischen Bewegung oder direkten Rezeption der psychoanalytischen Diskussion jedoch hatte Schönberg für seine Theorie des unbewussten Schaffens Vorgänger und Muster auch in der genuin musikästhetischen Tradition – vielleicht beginnend mit Leibniz’ bekannter Bestimmung der Musik als einer verborgenen arithmetischen Übung des Geistes, der selbst nicht darum wisse, dass er zählt: (Musica est) „exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi“13. Leibniz steht damit selbst in der Tradition des Pythagoreismus – Proportion in der Seele, in der Musik, im Makrokosmos –, aber er rezipiert zugleich eine Lehre von geheimnisvollen Korrespondenzen zwischen subjektiven und objektiven Instanzen. Dass Musik dem persönlichen Seelenleben des Komponisten entspringe, war eine Überzeugung, die, frühestens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der barocken Motorik der Affekte entgegengesetzt, im späten 19. Jahrhundert bereits zum traditionellen Gut geworden war. Auch nach der vollendeten Subjektivierung des Kunstschaffens war der noch immer verbreiteten Vorstellung von Inspiration, oder eines dem Künstler innewohnenden und sein Handeln leitenden Genius zufolge eine Art unbezwinglicher Drang, aber auch ein nicht erzwingbarer Gnadenerweis am Werke und im Spiel. Aus der Reihe der Selbstauskünfte von Komponisten über den Schaffensprozess sei hier nur Mozart erinnert, der das fast pflanzenhafte Wachsen und Sich-Entfalten der Komposition akzentuiert, gegen alle Vorstellungen von bewusster Gestaltung und rationaler Kontrolle. Und so sucht Wagner in seiner Beethoven-Schrift von 1870 „Aufklärung über das Wesen der Musik als Kunst [...] auf dem Wege der Betrachtung des Schaffens des inspirierten Musikers zu gewinnen“ (Wagner: 1983, 50). Dies geschieht im Anschluss an Schopenhauer und weniger psychologisch als philosophisch. Bei dem methodischen Versuch, Traum und musikalische Konzeption zu analogisieren, begegnen allerdings etliche der auch von Schönberg verwendeten Begriffe: Unbewusstes, Trieb, Instinkt, angeboren(er Charakter), auch der Wille, freilich wieder als metaphysische Kategorie. Aber dies entspricht ja bereits der Schönbergschen Überzeugung, dass, was da „will“, zwar aus den Tiefen der Persönlichkeit heraus agiert, aber vom Ich nicht beherrscht werden kann. Auch dass die Harmonie tiefere Schichten der Psyche repräsentiere, in denen die raumzeitlichen Koordinaten außer Kraft gesetzt sind, während der Rhythmus, die zeitliche Gliederung der Welt der Darstellung und der räumlichen, gegenständlichen Ordnung näher stehe (dem entspricht einerseits die somnambule Klangvorstellung, deren Rhythmisierung andererseits bewussten Gestaltens bedarf), ähnelt Schönbergschen Vorstellungen: dass der musikalische Gedanke durch Tonhöhe 13 Zit. nach Bailhache: 1999, 405.
236
Reinhard Kapp
und – allerdings – auch Tondauer definiert sei, sozusagen in zeitloser Form, dann im Lauf der Arbeit erst weiter konkretisiert werden müsse und dabei Zufälligkeiten des jeweiligen Auffassungsvermögens unterliege, im Aufschreiben etwa bereits einer ersten Interpretation durch den Komponisten selbst. Mit einiger Sicherheit darf man bei Schönberg zumindest indirekte Kenntnis der in Wien erschienenen Schriften Friedrich von Hauseggers erwarten (Die Musik als Ausdruck 1885, Das Jenseits des Künstlers 1893), die sich in der Ausspielung einer Ausdrucksästhetik gegen Formalästhetik an Wagner anschließen und den Ausdrucksbegriff entschieden psychologisieren, indem sie den Schöpfungsvorgang statt des Werks in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken und die Persönlichkeit des Komponisten als dasjenige, was sich in der Musik ausdrücke. Es ist schließlich eine Frage des Alters: Zwar ist die Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse eine aktuelle. Aber Freud gehört einer deutlich früheren Generation an. Natürlich macht die Wiener Schule selbst über mehrere Generationen Wandlungen durch. Aber es gibt auch neben den Gemeinsamkeiten im historischen Querschnitt zwischen den Schulen Veränderungen, die wiederum mit allgemein historischen zusammenhängen. Man muss Ernst Mach mit Brahms, Freud mit Tanejew (oder Janácek, d’Indy, Chausson), Einstein mit Schönberg, Wittgenstein mit Strawinsky zusammen sehen. Freuds geschichtlicher Augenblick (der Zeitpunkt seines Einsatzes, seines aktiven Eingreifens und der Festlegung seiner Richtung liegt in den 70ern, Mahlers in den 80ern, Schönbergs in den 90er-Jahren. Freuds Zeit sind die Ringstraßenjahre, Schönbergs Jahrhundertwende, Impressionismus und Jugendstil. Von Freud (*1856) wie von den musikalischen Vertretern der Neuen Sachlichkeit (*um 1900) ist Schönberg jeweils mehr oder weniger eine Generation entfernt, von den in den 60er-Jahren geborenen Komponisten der Moderne immerhin noch ein Jahrzehnt und mehr, und das spiegelt sich in den unterschiedlichen Reaktionen all dieser Theoretiker auf eine bestimmte Zeiterscheinung, wie auch im unterschiedlichen Verhältnis, das jeder zu Vertretern der eigenen, der älteren und der jüngeren Generation einnimmt. Wilhelm Worringers Abstraktion und Einfühlung (Dissertationsdruck 1907, Publikation München 1908, also zur Zeit des Übergangs zur Atonalität) sowie Kandinskys im selben Jahr 1911 wie die Harmonielehre Schönbergs erschienenes Buch Über das Geistige in der Kunst sind dagegen als direkte Parallelerscheinungen zu Schönbergs Theorien anzusprechen. Mit dem älteren Kandinsky (*1866) hat nachweislich eine Auseinandersetzung stattgefunden, und im Geistigen vs. dem Materiellen, im Subjektiven vs. dem Objektiven, in der inneren vs. der äußeren Natur hat Schönberg trotz des „älteren“ Ansatzes Anknüpfungspunkte für seine Schaffenspsychologie gefunden. Des jüngeren Worringer (*1881) Beitrag zur Stilpsychologie
Zwei Wiener Schulen: Freud und Schönberg
237
(ich weiß nicht, ob Schönberg davon Kenntnis hatte14) geht von einem ursprünglichen Abstraktionsbedürfnis aus, und von Bedürfnis, Drang, Instinkt und Trieb ist allenthalben die Rede; auch von Bildungsgesetzen – sollten diese aus der Natur aufs Kunstwerk übertragen worden sein, so müsse dies unbewusst geschehen sein. „Die eigentlich psychischen Werte“ seien „Ausgangspunkt und Ziel aller künstlerischen Produktion.“15 Worringer ist an einer Vorgeschichte der klassischen, nicht primär an der modernen Kunst interessiert. Aber ein Teil der zeitgenössischen Rezeption reagierte auf den Abstraktionsbegriff wie (und so hätte auch Schönberg darauf reagieren können) auf Worringers hauptsächliche Dichotomie, indem sie Naturalismus (sein „Einfühlung“sprinzip) als Darstellung äußerer, „Abstraktion“ als diejenige innerer Vorgänge verstand und letztere zur Maxime erheben konnte. Schönberg scheint das kollektive oder übersubjektive (Kunst-)„Wollen“ Riegl/Worringers – nicht durch das individuelle „Müssen“ zu ersetzen, sondern in dieses zu übersetzen, indem der Schopenhauer’sche überindividuelle „Wille“ in den individuellen „Trieb“ transformiert wird, während der persönliche Wille wenig mehr zu melden hat. Bedenkt man diese historische Staffelung, so hat Schönberg der Schopen hauer’schen Willensmetaphysik in dessen Musikästhetik, die er, wie alle Wagnerianer, für sakrosankt hielt,16 so etwas wie eine empirische Basis verliehen, indem er einen Willen annahm, der im Subjekt verankert sei und dessen Treiben weitgehend im Unbewussten verbleibe, dessen Hervorbringungen allerdings irgendwann auch dem rationalen Denken, der Systematisierung, der logischen Herleitung zugänglich sein würden. Was nicht weniger als die Psychologisierung dieses „Willens“ bedeutet. Die Schönberg’sche Anpassung an die 20er-Jahre gelingt nicht vollständig; die Wiener Schule des logischen Empirismus mag durchlaufen, und Schönberg ihr irgendwie zuzurechnen sein. Aber der Wiener Kreis zeigt, dass Schönberg auch dann, wenn er später Logik und bewusste Begründung als Widerlager in seine Musikpsychologie einbaut, aufseiten der „Metaphysik“ stehen bleibt, dass seine Reaktion sowohl anti-mystizistisch als auch franz-josephinisch ist. Trotz der allgemein empiristischen, antikantianischen Ausrichtung der Wiener Philosophie, die Wiener 14 Eike Rathgeber (Projekt Schönberg-Schriften, Arnold Schönberg Center Wien) erinnert mich daran, dass Kandinsky Worringers erstes Buch schätzte, und dass Abstraktion und Einfühlung ebenso wie Das Geistige in der Kunst, Der blaue Reiter und die erste Schönberg-Festschrift bei Piper erschienen. 15 So in Transzendenz und Immanenz von 1908, seit der 3. Auflage von 1910 in Abstraktion und Einfühlung aufgenommen. 16 Übrigens taucht Schopenhauer um die Jahreswende 1908/09 in seinen schriftlichen Aufzeichnungen auf, siehe Schönberg: 2004, 229, d.h. er gehört von Anfang an zur Grundausstattung des Musik ästhetikers Schönberg, und findet im Kontext des expressionistischen Schaffens Verwendung.
238
Reinhard Kapp
Schule und Psychoanalyse teilen – Schönberg geht von konkreten Beobachtungen aus, und was er Prinzipielles deklariert, entsteht durch Verallgemeinerung –, muss doch der spezielle Empirismus des Wiener Kreises als eine Besonderheit der Zwischenkriegszeit betrachtet werden. Obwohl eine Vorform des Kreises seit 1904 zusammentraf, sind dessen Hauptwerke erst seit den 20er-Jahren erschienen. Erst 1921 kam Wittgensteins Tractatus heraus, erst 1922 wurde Moritz Schlick nach Wien berufen; auch die Geburtsjahre der Vertreter der Neuen Sachlichkeit (Wittgenstein 1889, Carnap 1891) zeigen, dass zwar kein ganzer Generationenabstand, aber doch ein signifikanter Altersunterschied Schönberg von ihnen trennt.17 Um Zusammenhang und Differenz auch in diesem Falle ahnen zu lassen, abschließend noch zwei Stichproben zum Vergleich. Zunächst der „exklusive“ Standpunkt im Vorwort zu Rudolf Carnaps Der logische Aufbau der Welt (1928): Aus dieser Forderung zur Rechtfertigung und zwingenden Begründung einer jeden These ergibt sich die Ausschaltung des spekulativen, dichterischen Arbeitens in der Philosophie. Als man begann, mit der Forderung wissenschaftlicher Strenge auch in der Philosophie Ernst zu machen, mußte man notwendig dahin kommen, die ganze Metaphysik aus der Philosophie zu verbannen, weil sich ihre Thesen nicht rational rechtfertigen lassen. Jede wissenschaftliche These muß sich rational begründen lassen; das bedeutet aber nicht, daß sie auch rational, durch verstandesmäßige Überlegung, gefunden werden müsse. Grundeinstellung und Interessenrichtung entstehen ja nicht durch Gedanken, sondern sind bedingt durch Gefühl, Trieb, Anlage, Lebensumstände. [...] der Physiker beruft sich zur Begründung einer These nicht auf das Irrationale, sondern gibt eine rein empirisch-rationale Begründung. Dasselbe verlangen wir von uns in der philosophischen Arbeit. Das praktische Umgehen mit philosophischen Problemen und das Finden neuer Lösungen muß nicht rein denkmäßig geschehen, sondern wird immer triebmäßig bestimmt sein, wird anschauungsmäßige, intuitive Mittel verwenden. Aber die Begründung hat vor dem Forum des Verstandes zu geschehen; da dürfen wir uns nicht auf eine erlebte Intuition oder auf Bedürfnisse des Gemütes berufen. Auch wir haben „Bedürfnisse des Gemütes“ in der Philosophie; aber die gehen auf Klarheit der Begriffe, Sauberkeit der Methoden, Verantwortlichkeit der Thesen, Leistung durch Zusammenarbeit, in die das Individuum sich einordnet. [...] Was gibt uns [...] die Zuversicht, mit unserem Ruf nach Klarheit, nach metaphysikfreier Wissenschaft durchzudringen? Das ist die Einsicht, oder um es vorsichtiger zu sagen, der Glaube, daß jene entgegenstehenden Mächte der Vergangenheit angehören. Wir spüren eine innere Verwandtschaft der Haltung, die unserer philosophischen Arbeit zugrunde liegt, mit der geistigen Haltung, die sich gegenwärtig auf ganz anderen Lebensgebieten auswirkt; wir spüren diese Haltung in Strömungen der Kunst, besonders der Architektur, und in den Bewegungen, die sich um eine sinnvolle Gestaltung des menschlichen Lebens 17 Auch Bretons Schreibexperimente (écriture automatique) werden erst 1919 (Les Champs magnetiques, zus. m. Philippe Soupault, veröffentlicht 1920) in Reaktion auf Dada und unter ausdrücklichem Verweis auf die Psychoanalyse folgen.
Zwei Wiener Schulen: Freud und Schönberg
239
bemühen: des persönlichen und gemeinschaftlichen Lebens, der Erziehung, der äußeren Ordnungen im Großen [...] (Carnap: 1998, XIVf.).
Für Erkenntnisse, auf die man, vom Erkenntnistrieb geleitet, auf intuitivem Wege oder aber durch logische Schlussfolgerung gestoßen sein kann, eine rationale Begründung zu finden, das ist eine Intention, die nur noch ganz äußerlich der Schönbergschen ähnelt, die in drei Entwicklungsstufen dem intuitiv Geschaffenen Gesetzmäßigkeiten unterstellen, diese ergründen, schließlich das, was bisher nur intuitiv gefunden werden konnte, nach und nach auch rational durchdringen und bewusst ergreifen möchte. Carnap bedeutet einen Schritt weiter. Das impressionistische Zeitalter ist definitiv vorüber, die sinnliche Gewissheit hat abgedankt mitsamt dem Ich. Die Faktoren des Subjektivismus: Gefühl, Trieb, Intuition – und „dichterisch“ – sind noch im Blick, aber als Konzession. Die neuen Agenden des kollektiven Zeitalters sind Rationalität und Wissenschaft. Es ist streng zu unterscheiden zwischen persönlicher Praxis oder Einstellung und überpersönlicher Philosophie, subjektiver Genese eines Gedankens und seiner objektiven Begründung. Die sozialistischen Sympathien des Autors rangieren auf derselben Ebene wie das nur empfundene Bedürfnis nach Klarheit, ihnen kommt für sich noch keine philosophische Dignität zu. Die parallelen Erscheinungen in der Kunst sind ohne Beweiskraft, sie geben allenfalls die gefühlsmäßige Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein. Ebenso grundsätzlich liest sich: Wissenschaftliche Weltanschauung – Der Wiener Kreis, die quasi-offizielle Programmschrift des Vereins Ernst Mach, Wien 1929. Hier wird die Musik, der ihre Berechtigung als eines Ausdrucksmittels nicht abgestritten wird, von vornherein außerhalb der rationalen Begründungen gestellt. Die Klärung der traditionellen philosophischen Probleme führt dazu, daß sie teils als Scheinprobleme entlarvt, teils in empirische Probleme umgewandelt werden. In dieser Klärung von Problemen und Aussagen besteht die Aufgabe der philosophischen Arbeit, nicht aber in der Aufstellung eigener „philosophischer“ Aussagen. Die Methode dieser Klärung ist die der logischen Analyse [... Dabei zeigt] sich, daß es eine scharfe Grenze gibt zwischen zwei Arten von Aussagen. Zu der einen gehören die Aussagen, wie sie in der empirischen Wissenschaft gemacht werden; ihr Sinn läßt sich feststellen durch logische Analyse, genauer: durch Rückführung auf einfachste Aussagen über empirisch Gegebenes. Die anderen Aussagen [...] erweisen sich als völlig bedeutungsleer, wenn man sie so nimmt, wie der Metaphysiker sie meint [...] Der Metaphysiker und der Theologe glauben, sich selbst mißverstehend, mit ihren Sätzen etwas auszusagen, einen Sachverhalt darzustellen. Die Analyse zeigt jedoch, daß diese Sätze nichts besagen, sondern nur Ausdruck etwa eines Lebensgefühls sind. Ein solches zum Ausdruck zu bringen, kann sicherlich eine bedeutsame Aufgabe im Leben sein. Aber das adäquate Ausdrucksmittel hierfür ist die Kunst, zum Beispiel Lyrik oder Musik [...].18 18 Verfasser Rudolf Carnap/Hans Hahn/Otto Neurath, zit. n. Schleichert: 1975, 207f.
240
Reinhard Kapp
Das heißt wohl, dass die Trennung hier vollzogen ist, die Schönberg noch nicht vollziehen kann – weswegen er sich eben auf Musik beschränkt und mit psychologischen oder gar metapsychologischen Aussagen sich mehr und mehr zurückhält. Die neue Philosophie aber erlaubt nicht mehr, zwischen argumentativer und methodischer Erschließung des Kunstwerks als eines vorhandenen und unbestreitbaren Faktums und im Ernst weder veri- noch falsifizierbaren Spekulationen über die Bedingungen und Umstände seiner Entstehung zu unterscheiden – auch die musikalischen „Aussagen“ erweisen sich unter der logischen Analyse als „nichts besagen[d]“. So treibt zwar die Entwicklung des Schönbergschen Denkens, teils immanent, teils in Übereinstimmung mit den generellen Veränderungen des geistigen Klimas während der Zwischenkriegsjahre, über die triebgesteuerte Produktion von individuellen Einzelformen weiter zu verallgemeinerbaren und begründbaren Kompositionsmethoden, in Einzelheiten sind sogar gewisse Anpassungen an Lebensgefühl und Erwartungen der neuen Zeit möglich; aber seine „altösterreichische“, legitimistische, anti-gleichmacherische (trotz der „nur aufeinander bezogenen Töne“) und traditionsverhaftete Herkunft erlaubt ihm nicht, den Schritt zu objektivistischen Positionen – sei es sozialphilosophisch und -psychologisch, sei es kompositorisch – zu vollziehen. Dass am Ende Psychoanalyse, Wiener Schule und Wiener Kreis nahezu kollektiv in die Emigration getrieben und in alle Winde verstreut werden, steht auf einem anderen Blatt.
Zwei Wiener Schulen: Freud und Schönberg
241
Literatur Patrice Bailhache, La musique, une pratique chachée de l’arithmetique?, in: Dominique Berlioz/Frédéric Nef (Hrsg.), L’ actualité de Leibniz: Les deux Labyrinthes, Stuttgart 1999 (Studia Leibnitziana Supplementa, 34), 405–426. Neil Boynton, „And two times two equals four in every climate“. Die Formenlehren der Wiener Schule als internationales Projekt, in: Dörte Schmidt (Hrsg.), Musiktheoretisches Denken und kultureller Kontext, Schliengen 2005 (Forum Musikwissenschaft, 1), 203–229. Rudolf Carnap, Der logische Aufbau der Welt (1928), Hamburg 1998. Sigmund Freud, Die Traumdeutung (1900), Frankfurt a. M. 1972 (Studienausgabe, II). Sigmund Freud, Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse, in: Imago 5 (1917–19), 1–7. Max Graf, Jede Stunde war erfüllt. Ein halbes Jahrhundert Musik- und Theaterleben, Wien, Frankfurt a. M. o.J. Hans Keller, Music and Psychology. From Vienna to London, 1939–52, hrsg. von Christopher Wintle, London 2003. Christoph Khittl, „Nervencontrapunkt“. Einflüsse psychologischer Theorien auf kompositorisches Gestalten, Wien, Köln, Weimar 1991. Jean Laplanche/Jean-Bertrand Pontalis, Vocabulaire de la Psychanalyse, Paris 1967, deutsch: Das Vokabular der Psychoanalyse, Frankfurt a. M. 1973. Willi Reich, Arnold Schönberg oder Der konservative Revolutionär (1968), neue Ausgabe München 1974. Hubert Schleichert (Hrsg.), Logischer Empirismus – Der Wiener Kreis. Ausgewählte Texte, München 1975 (Kritische Information, 21). Arnold Schönberg, Briefe, ausgew. und hrsg. von Erwin Stein, Mainz 1958. Arnold Schönberg, Stil und Gedanke. Aufsätze zur Musik, hrsg. von Ivan Vojtěch, Frankfurt a. M. 1976 (Gesammelte Schriften, 1). Arnold Schönberg, Ein Kunsteindruck (1909), in: Martin Eybl (Hrsg.), Die Befreiung des Augenblicks. Eine Dokumentation, Wien, Köln, Weimar 2004, 228–231. Robert Schumann, Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, 2 Bde, 5. Aufl. Leipzig 1914. Richard Wagner, Beethoven, in: ders., Sämtliche Schriften und Dichtungen. Volksausgabe, Bd. 9, Leipzig o.J. [1911], 61–127.
242
Reinhard Kapp
The Psychophysics of Luigi Russolo’s intonarumori
243
Arndt Niebisch The Psychophysics of Luigi Russolo’s intonarumori
Following the precedent of Darwin, H. Berg has, to put it shortly, attempted to derive music from the amatory cries of monkeys. We should be blind not to recognize the service rendered and enlightenment conveyed by the work of Darwin and Berg. Even at the present day, music has power to touch sexual chords, and is, as a fact, widely made use of in courtship. But as to the question wherein consists the agreeable quality of music, Berg makes no satisfactory answer. And seeing that in musical theory he adopts Helmholtz’s position of the avoidance of beats and assumes that the males who howled least disagreeably received the preference, we may be justified in wondering why the most intelligent of these animals were not prompted to maintain silence altogether (Mach, eng.: 1996, 263).1
The author of these lines, the Austrian physicist Ernst Mach, clearly has critical doubts about the musical skills of our predecessors. Although he acknowledges the ritualistic and sexual function of human music and monkey screams, he doubts that the use of music in rituals induced the musical sensitivity and taste of mankind. For Mach, musical taste cannot be acquired. He claims that certain sounds had to be already pleasurable to be useable in such pairing rituals.2 For the psychophysics of the nineteenth century, the pleasure in music is wired into the brain. It is – as the famous physicist Hermann Helmholtz argued – a mental precondition that responds positively to regular, and negatively to irregular sound waves. Thus, 1 “H. Berg hat, um es kurz zu sagen, nach dem Vorgange Darwin’s versucht, die Musik aus dem Brunstgeheul der Affen herzuleiten. Man müsste verblendet sein, wenn man das Verdienstvolle und Aufklärende der Ausführungen Darwin’s und Berg’s verkennen wollte. Auch heute noch kann die Musik sexuelle Saiten berühren, auch heute noch wird sie zur Liebeswerbung thatsächlich benutzt. Auf die Frage aber, worin das Angenehme der Musik liegt, gibt Berg keine befriedigende Antwort. Und da er musikalisch auf dem Helmholtz’schen Standpunkt der Vermeidung der Schwebungen steht, und annimmt, dass die am wenigsten unangenehm heulenden Männchen den Vorzug erhielten, so darf man sich vielleicht wundern, warum die klügsten dieser Thiere nicht lieber ganz schwiegen” (Mach: 1903, 205). 2 “Niemand wird wohl das Angenehme der specifischen Wollustempfindungen dadurch erklären wollen, dass er deren Zusammenhang mit der Arterhaltung nachweist. Viel eher wird man zugeben, dass die Art erhalten wird, weil die Wollustempfindung angenehm ist. Mag die Musik immerhin unseren Organismus an die Liebeswerbung der Urahnen erinnern; wenn sie zur Werbung benutzt wurde, mußte sie schon positiv Angenehmes enthalten, [...]” (Mach: 1903, 205).
244
Arndt Niebisch
the only advice psychophysics can give to mating male monkeys without any talent for singing, is to shut up. Although Helmholtz was convinced that musical instruments are limited to those able to produce even and periodic sounds,3 modern music at the turn of the twentieth century abolishes the paradigm of clear sound and a new form of monkey talk arises. Most significantly, the Futurist painter Luigi Russolo changed the soundscape of modern Europe by developing aesthetics, compositions, and technologies based on the neglected category of music: noise. Luigi Russolo published his most significant manifesto L’arte dei rumori (Russolo: 1916) on March 11, 1913 as a public letter addressed to the composer Balilla Pratella. Pratella had already issued two manifestos about Futurist music in 1911 (Pratella: 2000a; Pratella: 2000b) and can be seen as the direct predecessor to Russolo’s ideas of an art of noise.4 His manifestos targeted the status quo of musical production and composition and were specifically directed against conservatism – in Futurist terms passatism – within the institutions of classical music. He criticized the modes and habits of musical education that obstruct the creativity of young artists (Pratella: 2000a). Although Pratella intended to incorporate greater tonal complexity and enharmonic structures, this Futurist music was still designed for classical instruments. Russolo overcame this limitation by constructing his multifunctional noise-intoners, intonarumori, the very technological gadgets that fulfill Russolo’s conceptual ideas (Pratella: 2000b; Kirby: 1986, 34). Russolo opened his manifesto by describing how he and some of his Futurist friends attended an orchestral performance of Pratella’s music. Russolo, enthusiastic about this experience, suggested further developments and improvements of Pratella’s concepts. Russolo’s main claim in his conception of an art of noise is to favor noise over sound. This distinction – which he tried to resolve with his newly invented term of suono-rumore (Russolo: 1916, 10) – reflects the two main categories of vibrations in acoustics: sound and noise. A sound is determined by an even 3 “We are justified in assuming that historically all music was developed from song. Afterwards the power of producing similar melodic effects was attained by means of other instruments, which had a quality of tone compounded in a manner resembling that of the human voice. The reason why, even when constructive art was most advanced, the choice of musical instruments was necessarily limited to those which produced compound tones with harmonic upper partials, is clear from the above conditions” (Helmholtz: 1954, 363). 4 Russolo’s public letter has to be understood as publicity trick. Pratella merely serves as a prominent receiver of the public letter for entertaining interest in the Futurist ideas. This becomes evident through the fact that the manifesto was written almost three months before Pratella’s concert (cf. Kahn: 1999, 58). Within the central text of the manifesto, there is no reference to Pratella, only the beginning and the end of the letter address this composer.
The Psychophysics of Luigi Russolo’s intonarumori
245
and uniform sine wave, whereas noise consists of an irregular wave pattern. Traditional music only uses regular sound as material for its compositions; a restriction that Russolo wanted to change. More generally formulated, Russolo attempted to replace the aesthetics of regularity with an art of complexity and irregularity. Russolo thereby challenged not only an established bourgeois understanding of art, but also contemporary theories of aesthetic perception; this argument is especially apparent in his criticism of Helmholtz’s acoustics in the chapter Principi fisici e possibilità pratiche of his book L’arte dei rumori of 1916. Helmholtz outlined his theory of acoustics in On the Sensations of Tone of 1863. In this book he defined acoustics as the theory of the movement of elastic bodies, but acknowledged that in addition to the merely physical investigation of vibrations, there is also a physiological acoustic which examines the effect of vibrations on the ear (Helmholtz: 1954, 3–4). Thus, the study of acoustics is not limited to mere physical phenomena, but also examines the subjective sensations caused by these phenomena. Accordingly, the distinction between sound and noise is, for Helmholtz, not limited to physical data but also characterized by different subjective responses. He states: On what difference in the external means of excitement does the difference between noise and musical tone depend? The normal and usual means of excitement for the human ear is atmospheric vibration. The irregularly alternating sensation of the ear in the case of noises leads us to conclude that for these the vibration of the air must also change irregularly. For musical tones on the other hand we anticipate a regular motion of the air, continuing uniformly, and in its turn excited by an equally regular motion of the sonorous body, whose impulses were conducted to the ear by the air (Helmholtz: 1954, 8).
For Helmholtz, the subjective difference between sound and noise is reflected by the measurable differences in the frequency patterns of each phenomenon. The physical difference between regular and irregular frequencies corresponds to different pleasurable and non-pleasurable sensations.5 Thus, the distinction between musical sound and non-musical noise is a product of subjective perception that nonetheless correlates to an objective distinction of acoustics. Although Helmholtz is very careful with remarks about musical aesthetics,6 his acoustics not only 5 “The sensation of a musical tone is due to a rapid periodic motion of the sonorous body; the sensation of a noise to non-periodic motions” (Helmholtz: 1954, 8). 6 Helmholtz claims throughout his book that his results are basically concerned with the mere physiological and not with the aesthetic nature of the sensation of tone. “Here I close my work. It appears to me that I have carried it as far as the physiological properties of the sensation of hearing exercise a direct influence on the construction of a musical system, that is, as far the work especially belongs
246
Arndt Niebisch
describe two different frequency patterns, but also imply an objective theory of aesthetic perception (Helmholz: 1954, 362). Furthermore, by emphasizing the physical regularity of sound, Helmholtz foregrounded an aesthetic understanding based on the categories of harmony, regularity and predictability.7 Russolo strongly opposed such aesthetics and such a distinction between noise and sound. Russolo argued that the difference between sound and noise is a random distinction; he emphasized that musical taste is not based on a fixed physiological foundation, but is rather acquired by training and habit (Russolo: 1916, 17).8 It is especially Russolo’s emphasis on the timbre of sound that casts a critical perspective on Helmholtz’s distinction between noise and sound. The timbre (the quality of a tone) is, after volume and pitch, a central category used to describe a musical sound. When a note is played on different instruments such as a piano or a flute, the distinctive character of each instrumental sound is called timbre. Russolo and Helmholtz assign the timbre a specific place in their theories. Helmholtz states: It is unnecessary to explain what we mean by the force and pitch of a tone. By the quality of a tone we mean that peculiarity which distinguishes the musical tone on a violin from that of a flute or a clarinet, or that of the human voice, when all these instruments produce the same note at the same pitch (Helmholtz: 1954, 10). to natural philosophy. For even if I could not avoid mixing up esthetic problems with physical, the former were comparatively simple, and the latter much more complicated. […] In all these fields [rhythm, composition, means of musical expression] the properties of sensual perception would of course have an influence at times, but only in a very subordinate degree” (Helmholtz: 1954, 371). 7 Even if Helmholtz tries to make very careful claims about aesthetic questions, he finds it self-evident that the sensation of the beautiful is founded on rational structures. He does not analyze this precondition for beauty, but rather examines the question of how it is possible to have a spontaneous sensation of the beautiful without any critical examination. “No doubt is now entertained that beauty is subject to laws and rules dependent on the nature of human intelligence. The difficulty consists in the fact that these laws and rules, on whose fulfillment beauty depends and by which it must be judged, are not consciously present to the mind, either of the artist who creates the work, or the observer who contemplates it” (Helmholtz: 1954, 366). 8 Helmholtz understands the basic distinction between sound and noise not as an aesthetic difference but as difference between a pleasurable and a non-pleasurable sensation, i.e. as a physiological distinction. (“When we spoke previously, in the theory of consonance, of agreeable and disagreeable, we referred solely to the immediate impression made on the senses when an isolated combination of sound strikes the ear, and paid no attention at all to artistic contrasts and means of expression; we thought only of sensuous pleasure, not of esthetic beauty. The two must be kept strictly apart, although the first is an important means of attaining the second” (Helmholtz: 1954, 234)). When Russolo tries to overcome the distinction between noise and sound, he short-circuits the domains differentiated by Helmholtz as aesthetic and physiological. Russolo and Helmholtz have in common that they privilege the physiological aspect of sound and noise in their studies. The difference between both is that while Helmholtz only very tentatively makes assumptions about aesthetic rules, Russolo builds his art of noise on such a physiological fundament.
The Psychophysics of Luigi Russolo’s intonarumori
247
Helmholtz already understood the timbre as an individualizing element, which poses problems in an aesthetics based on regularity. The timbre has a problematic place in an abstract classification of sounds, because it does not refer to a symbolic order of sounds but to a material referent, the instrument. Russolo interpreted this referential structure of the timbre as a parasitic distortion in instrumental music.9 Every sound produced by an instrument contains minimal irregularities, which at the same time specifically characterize that instrument.10 This connection between irregularity and materiality is at the core of Russolo’s aesthetics.
Russolo’s Genealogy of Noise The irregularity of noise was for Russolo not simply a new requirement for his Futurist music: he recognized an inherent development towards an increasing complexity in musical production and music history. In his manifesto L’arte dei rumori, he claimed that the ancient Pythagorean music was founded on an aesthetics of simple regularity; in the beginning of the history of music, sounds would have been pure magical objects. Throughout the course of history the structure became more and more complicated and complex. For Russolo, the Gregorian chants and the evolution of the chords testified to a progression towards the unpredictable frequency of noise (Russolo: 1916, 9–10). Increasing complexity in musical composition not only depends on the innovations of musicians but also correspond to major historical changes in the human environment. This evolution of music is comparable to the multiplication of machines, which everywhere collaborate with man. Not only in the noisy atmosphere of the great cities, but even in the country, which until yesterday was normally silent. Today, the machine has created such a variety and contention of noises that pure sound in its slightness and monotony no longer provokes emotion (Russolo: 1986, 24).11 9 The French philosopher Michel Serres acknowledges a similar structure in his book Le parasite. For him a parasite distorts a process, but becomes at the same time an intrinsic part of the performance. Thus, the parasite cannot any longer be distinguished from the process without parasitical intervention (Serres: 1987, 26). 10 “Ciò prova che solamente il corista dà vibrazioni semplici; ma, come è noto, il suo suono è leggerissimo. Tutti gli altri suoni danno invece una curva periodica alterata, la quale rivela che la loro vibrazione è composta” (Russolo: 1916, 28). “This shows that only the tuning fork produces simple vibrations, although it is well known that the sound is very faint. All other sounds produce an altered periodic curve, which reveals that their vibration is compound” (Russolo: 1986, 38). 11 “Questa evoluzione della musica è parallela al moltiplicarsi delle macchine, che collaborano dovunque
248
Arndt Niebisch
Russolo connected the expansion of technology in every field of human life to the insight that these changes transform the sensibility of man.12 This claim links Russolo to a tradition of art theorists such as Alois Riegl and Walter Benjamin, who identify an interdependence between the technological developments of a society and its sensory skills.13 This connection allows for an understanding of Russolo’s theories as a commentary on the Futurist image of modernity: the complexity of music bears direct parallels to the increasingly complex living space of modern life. The overload of stimuli in the environment changes the sensory threshold of human perception.14 Before the expansion of machines, men were drawn to pure sounds and did not require a stronger stimulus. With industrialization, music and sounds, which are inferior to the complex noises of industrial life, disappear from the perception of man (Russolo: 1916, 10). It is important to note that the founder of Futurism, Filippo Tommaso Marinetti, understood a modern mode of perception, sensibilità, not simply as a process that enhances the senses, but as one that adjusts perception to industrial stimuli.15 This model of modern perception corresponds to Futurism’s overall glorification of progress and focus on the future. coll’uomo. Non soltanto nelle atmosfere fragorose delle grandi città, ma anche nelle campagne, che furono fino a ieri normalmente silenziose, la macchina ha oggi creato tante varietà e concorrenza di rumori, che il suono puro, nella sua esiguità e monotonia, non suscita più emozione” (Russolo: 1916, 10). 12 Kahn criticizes such a view: “Russolo’s art of noise appears to be an ineluctable expression of the machines and motors of modernity, yet if that were the case, an art of noises seemingly would have arisen much earlier elsewhere” (Kahn: 1999, 57). 13 Walter Benjamin states in his art-work essay that there are historical changes in the perception of a society (Benjamin: 1963, 14). The art historian Alois Riegl is especially renowned for making a similar claim in his book on late Roman art production (Riegl: 1927). Also in a shorter essay, Das Naturwerk und das Kunstwerk I, he describes the evolutionary interdependence between perception and art production. „Es fragt sich nur, wie innerhalb dieser Theorie eine Entwicklung möglich ist. Sie wird allgemein in der Weise gedacht, daß die frühesten Sinneseindrücke und mit ihnen die Erinnerungsbilder und die dadurch determinierten Kunstwerke den sinfälligen Naturerscheinungen gegenüber völlig nebelhaft und unklar gewesen seien. Allmählich hätte man aber die Sinne für eine treuere Aufnahme der Erscheinungen im Detail und der Verhältnisse des Details zum jeweiligen Ganzen zu schärfen begonnen: so war das Kunstwerk mit der Zeit immer naturwahrer, die vagen psychologischen Eindrücke immer mehr zu physiologischen Kenntnissen, der Mythos zum Wissen, der Idealismus zum Naturalismus geworden, […]“ (Riegl: 1928, 54–55). 14 Fechner develops the theory of the sensory threshold. This theory claims that a stimulus is only perceived after a certain degree of force is reached (Fechner: 1964). 15 As a main part of his futurist project, Marinetti introduces the training and development of a specific mode of sensibility, sensibilità, which reacts to the demands of the modern world in a futurist sense. Cf. especially the manifesto Distruzione della sintassi Immaginazione senza fili Parole in libertà. (“Il Futurismo si fonda sul completo rinnovamento della sensibilità umana avvenuto per effetto delle grandi scoperte scientifiche” (Marinetti: 2000, 99)).
The Psychophysics of Luigi Russolo’s intonarumori
249
Russolo’s theory implies an increasing desensitization of mankind: a permanent numbing of the senses in order to endure the impacts of industrial civilization. Paradoxically, this desensitization demands the production of more complex and more accentuated stimuli, rather than merely stronger ones. The Futurist man’s increased sensitivity recognizes more complex patterns, while his ability to recognize simple structures weakens. This construction leads to concepts of complexity based on sense perception. Complexity can be understood as that which can be recognized despite the presence of other stimuli, not because it is stronger or louder, but because it is more differentiated, because it carries more information.
Noise Russolo recognized noise as a complex condition of one’s environment that constitutes the background of everyday life. The art of noise functions as a didactic apparatus allowing modern man to adjust to this condition of life.16 Determining noise as an irregular and chaotic effect is not only a central definition of physical acoustics. It is also central to the communication theory of the twentieth century. The most important theorist of ‘noise,’ the mathematician and engineer Claude E. Shannon, formulates in his text A Mathematical Theory of Communication the fundamental theory of information, as centered around a concept of noise. According to Shannon’s model, an information source selects an element from a set of possible messages, which could be words of the English language, pictures or sounds. In a second step, a transmitter encodes the message, meaning that it transforms the message into a signal, which it then transmits through a channel to the receiver. The receiver functions as an inverted transmitter that in a final step decodes the signal back into the message for the destination.17 The operation of selection is crucial to Shannon’s theory because it defines his concept of information. According to his notions, if the set of messages that can be generated by the information source is relatively small, then the probability of selecting the same message again is relatively high, making redundancy quite common. On the other hand, if the set of messages that can be generated by the information source is relatively large, then the probability of selecting the same message again is relatively low, making redundancy quite uncommon. If there is a 16 “This lyrical and artistic coordination of the chaos of noise in life constitutes our new acoustical pleasure, capable of truly stirring our nerves, of deeply moving our soul, and of multiplying a hundredfold the rhythm of our life” (Russolo: 1986, 87). 17 Shannon: 1949, 99.
250
Arndt Niebisch
high probability of redundancy, then the information transmitted will be relatively unsurprising, meaning that the amount of information is small. If the probability of redundancy is low, then the information transmitted is relatively surprising, which means that the amount of information is large. Thus, following from this model, information is a means of measuring the uncertainty in a communication system.18 A central element in this communication system is noise. Noise is something that affects the communication system because it can distort the transmitted signal. It adds errors and extraneous material to the signal and therefore to the message. The receiver can no longer simply register all incoming signals. One must secure the transmitted message from noise. The reception from a noisy channel thereby becomes an operation that selects the correct signal. The danger in such a situation is the possibility of not selecting the correct signal. The correct transmission becomes less probable, and therefore communication in the presence of noise acquires a greater amount of information. A noisefree channel does not add any distortion, thus it does not increase the information, and the same is also true the other way around.19 Like Shannon, Russolo understands noise as a highly differentiated irregular element, which means that the frequency of a noise wave is hard to predict.20 The probability for predicting a noise signal is, in comparison to a musical sound, very low, and the amount of information in noise is therefore high. While the musical tone contains a high redundancy through its regular vibration, noise is determined by high complexity.21 Shannon and Russolo do not understand complexity and redundancy in a semantic sense, but rather as a measurable difference within a frequency. Russolo and Shannon are not interested in the meaning that a medium processes but rather attempt to design a medium that processes high complexity. Yet, both assign “noise” a different place in their respective aesthetic and mathematical theories. For Russolo, noise is not something that is added by disturbances in the channel. Rather, it is an integral part of all possible messages generated by his noise-intoner – the “noise-sound” is produced by the information source. Shannon, in contrast, understands noise as an element not generated by the in18 Shannon: 1949, 98–106. 19 Shannon: 1949, 108–112. 20 “In creating noise, then, strength and irregularity with which a body is set into motion will determine the production of extremely different harmonic sounds.” (Russolo: 1986, 38-39) “Stir the senses with the unexpected, …” (Russolo: 1986, 86). 21 “This is the reason for the great variety in the timbres of noises in comparison to the more limited ones of sounds, in which different timbres are reduced to the few varieties of harmonic components that a vibrating body can produce in the particular conditions necessary or creating sound” (Russolo: 1986, 39).
The Psychophysics of Luigi Russolo’s intonarumori
251
formation source, but rather added by a perturbed channel. In fact, Russolo’s instruments do not emit mere noises namely acoustic sensations that are completely unpredictable in their structure. The intonarumori are designed to produce a scale of noises that have particular pitches and volumes.22 The “noisy” compound of his noise composition is limited to the irregular overtones generated by his machines and does not include the pitch. Russolo does not recognize this inability to produce pure cacophonic noise as a limitation for the complexity of his noise sound.23 Instead, he understands his musical theory as a strategy for generating highly entropic structures, i.e. surprising acoustic events. Stir the senses and you will stir the brain! Stir the senses with the unexpected, the mysterious, the unknown, and you will truly move the soul, intensely and profoundly! Here lies the destined and absolute necessity of borrowing the timbres of sounds directly from the timbres of the noises of life (Russolo: 1986, 86).24
Russolo’s music is not an aleatoric cacophony in which every parameter of the sound-noise can vary. Rather, he adapts the parasitic static of his noise instruments in order to formulate an art of noise. This static does not so much endanger musical production, but opens up musical expression to everyday phenomena. The noise and static of life should enter music. This refers to a new aesthetics of the readymade but also to the aesthetical consequences introduced by the gramophone.
Noise and Phonography Russolo’s art of noise is rooted in the materiality of sound and noise. He was especially interested in the timbre of musical instruments, which determines their in22 “Noi vogliamo intonare e regolare armonicamente e ritmicamente questi svariatissimi rumori” (Russolo: 1916, 14). “We want to give pitches to these diverse noises, regulating them harmonically and rhythmically” (Russolo: 1986, 27). 23 “Intonare i rumori non vuol dire togliere adesso tutti i movimenti e le vibrazioni irregolari di tempo e d’intensità, ma bensì dare un grado o tono alla più forte e predominante di queste vibrazioni” (Russolo: 1916, 14). “Giving pitch to noises does not mean depriving them of all irregular movements and vibrations of time and intensity but rather assigning a degree or pitch to the strongest and most prominent of these vibrations” (Russolo: 1986, 27). 24 “Fate prima vibrare i sensi, e farete vibrare anche il cervello! Fate vibrare i sensi mediante l’inaspettato, il misterioso, l’ignoto e avrete la commozione vera, intensa e profonda dell’animo” (Russolo: 1916, 90–91).
252
Arndt Niebisch
dividual tone, refers to their very materiality and is difficult to capture in symbolic notation.25 This difficulty results from the fact that noises do not have a regular frequency and cannot be repeated, in contrast to sound. Noise cannot be fixed by writing, because it is not limited to an iterable set of signs. Edison’s invention of sound recording in 1877 changes this constellation: Phonography stores analog impulses on a material carrier and is not based on a symbolic sign system, i.e., it does not code acoustic phenomena symbolically, but rather inscribes a material correlate with all of its individual varieties into the storage device. Edison’s invention enables complex acoustic phenomena to be recorded and reproduced and has therefore a great impact on the conceptual development of an art of noise. Russolo’s art of noise does not immediately adopt this technology. The influence should rather be seen in the ability of analog sound recording to store the entire spectrum of present sounds, and therefore to communicate the existence of a constant background noise to the population of industrial societies. Media theorist Friedrich Kittler claims that analog recording media foreground the unarticulated background by simply registering everything: The phonograph does not hear as do ears that have been trained immediately to filter voices, words, and sounds out of noise; it registers acoustic events as such. Articulateness becomes a second-order exception in the spectrum of noise (Kittler: 1999, 23).26
This claim requires a more precise discussion. The phonograph does not store the immediate impulses of acoustic events per se. Early discussions of sound recording, which can be found in the Phonographische Zeitschrift emphasize that phonographs do not simply capture the environment. During the process of registering sounds, errors in the material structure of the storing device cause irregularities, which add further noise to the reproduction. It is certain that interferences in the recording process cause a great part of the background noise, which is still contained in even the best phonographic recordings. The whirring noise from the rotating movement of the phonograph during the recording process not only causes distortions, but the rotation also creates vibrations that cannot be heard at the mo25 “Klangfarben bilden eine mehrdimensionale Manigfaltigkeit. Im Gegensatz zu den anderen Tonbzw. Klangeigenschaften Tonhöhe und Tondauer ist die Klangfarbe, wie die Lautstärke, nicht sys temfähig” (Fricke: 1996, 707). 26 A similar phenomenon can be observed for other analog recording media such as film. For example, reports from the screening of the early Lumière film A baby has breakfast state that the audience was much more fascinated by the visual noise of moving leaves in the background than in the actual action.
The Psychophysics of Luigi Russolo’s intonarumori
253
ment of recording. These vibrations are transmitted to the membrane, which inscribes the groove onto the cylinder of the phonograph with a blade. These inaudible vibrations influence the phonographic writing and later cause noise in the reproduction, i.e. a part of the background noise (my translation).27
This quotation addresses a lack as well as a capacity of phonographic media. In addition to reproducing the noise of everyday life the recordings produce their own noises. Therefore, the phonograph can be recognized as a genuine noiseintoner that is not limited to reproduction and imitation, but also contains a unique creative ability.
IntonarumorI
Illustration 1: Russolo and Piatti with intonarumori. From: Russolo: 1916, 9
27 “Es ist nicht zweifelhaft, dass ein sehr grosser Teil der Nebengeräusche, welche auch den besten Phonographen anhaften, von Ursachen bei der Aufnahme herrührt. Es ist nicht allein das schnurrende Geräusch, welches die Rotation der während der Aufnahme bewegten Teile des Apparats hervorbringen, sondern auch bei der Aufnahme gänzlich unhörbare Vibrationen des ganzen Apparats spielen dabei mit, welche durch die Rotation hervorgerufen werden, und die sich auch der Membran, welche mittels des Messers die Furche auf die Walze herstellt, mitteilen. Diese unhörbaren Vibrationen der Membran beeinflussen natürlich die phonographische Schrift und bringen später bei der Wiedergabe Geräusche, also einen Teil der Nebengeräusche hervor” (Phonographische Zeitschrift: 1900a, 18–19).
254
Arndt Niebisch
Russolo’s conception of an art of noise faces one central problem. Although his theory includes the everyday experience of noise, it should not be understood as a mimetic project, but rather as performance that generates an infinite range of new acoustic events. Russolo’s intonarumori are presented as the instruments that will free the art of noise from any accusations of imitation. At first glance, these machines resemble early phonographic devices, but are in fact much closer to a modern DJ set. Russolo described them as follows: Externally, the noise instruments take the form of boxes of various sizes, usually constructed on a rectangular base. At the front end, a trumpet serves to collect and reinforce the noisesound. Behind, there is a handle to produce the motion that excites the noise. On the upper part, a lever with a pointer is moved along a scale graduated in tones, semitones, and fractions of a tone. Through its displacements, this lever is used to determine the highness, that is, the pitch of the noise, which can be read on a graduated scale (Russolo: 1986, 75–76).28
Intonarumori are black boxes which hide a rotating mechanism that transmits impulses to a diaphragm that produces certain sounds. These noises can be manipulated in a wide spectrum and changed without any interruption.29 The amplification of sound, the use of rotating mechanisms, and the partial integration of electric motors30 are certainly derived from early phonographs.31 The crucial dif28 “Gl’intonarumori hanno esternamente la forma d’una scatola più o meno grande a base generalmente rettangolare. Dal lato anteriore esce una tromba che serve a raccogliere e rafforzare il suonorumore. Posteriormente hanno una manovella per dare il movimento che determina la produzione della eccitazione rumoristica. Sulla parte superiore, una leva con una lancetta che si muove sopra una scala graduata in toni e semitoni e frazioni di tono. Questa leva serve a determinare con i suoi spostamenti l’altezza cioè il tono del rumore” (Russolo: 1916, 75). 29 “Regolando la leva si muta il tono come si vuole, con qualsiasi possibilità di salti di tono, di toni e di semitoni non solo, ma si può anche ottenere il passaggio graduale enarmonico fra un tono e l’altro” (Russolo: 1916, 76). “By adjusting the lever, the pitch is changed as desired, with any possibility of change - not only leaps of tones and semitones but also gradual enharmonic passages between one pitch and another” (Russolo: 1986, 76). 30 “In alcuni intonarumori, invece, il movimento essendo ottenuto elettricamente per mezzo di una piccola corrente di 4-5 volts (data da una batteria di pile o da un accumulatore) alla manovella è sostituito un interruttore a forma di bottone” (Russolo: 1916, 75–76). “In some instruments, however, the motion being produced electrically by means of a small current of 4-5 volts provided by a pile battery or a storage battery, a switch in the form of a button is substituted for the handle” (Russolo: 1986, 76). This is by far not a new technology, already in the issue of the Phonographische Zeitschrift from February 27 1901 an electrical motor is discussed as the drive for a phonograph, which produces less noises and enables an even speed for the reproduction of the sound recording (cf. Phonographische Zeitschrift: 1901, 46). 31 Reading the major German journal of the early phonographic industry makes it apparent that
The Psychophysics of Luigi Russolo’s intonarumori
255
ference between phonographs and intonarumori is that they are not storing devices. All noises are genuine performances and not reproductions.32 In order to build an orchestra of noise-intoners, Russolo classifies already in his first manifesto six kinds of intonarumori. This orchestra is not arranged in a fixed and determined order: In this list we have included the most characteristic of the fundamental noises. The others are only associations and combinations of these. The rhythmic motions of a noise are infinite. There always exists, as with a pitch, a predominant rhythm, but around this there can be heard numerous other, secondary rhythms (Russolo: 1986, 28).33
Russolo’s discovery of the material world of sound by building up an orchestra of intonarumori was an ongoing project. (“The orchestra is continually in evolution and can be amplified infinitely, since nature and life offer us in noises a variety of timbres that will not easily be exhausted” (Russolo: 1986, 80)).34 Only a few years later in 1916, he referred in his book L’arte dei rumori to a much greater amount of noise-intoners. (“So far, I and Piatti have invented and constructed 21 noise instruments” (Russolo: 1986, 75)).35 Russolo is not so innovative. An article in the issue from December 19 1900 of the Phonographische Zeitung discusses the construction of a Signal Phonograph, which should not reproduce pre-recorded sounds, but rather produce signals for a certain aim. “Dieser Tage sahen wir in einem Wagen der Grossen Berliner Strassenbahn einen eigenthümlichen Phonographen in Betrieb. In der Thür zwischen dem Vorderperron und dem Wagen-Innern befindet sich eine Oeffnung, durch welche die Fahrgäste dem Schaffner Fahrgeld reichen sollen; die Oeffnung ist durch eine verschiebbare Messingplatte verschlossen, welche eine gerippte Oberfläche hat. Mit seiner Lochzange rieb der Schaffner über die Platte, und erzeugte dadurch einen auf dem Vorderperron trotz des Strassenlärms so gut vernehmbaren Ton, dass die Fahrgäste auf dem Perron aufmerksam wurden und der Schaffner das Fahrgeld einziehen konnte. Die Messingplatte war Membran und Walze in Einem, die Thür der Resonanzboden, der den Trichter ersetzte, die Zange vertrat den Membranstift. Wir können nicht umhin, diese einfachen Thatsachen den Erfindern als Anregung zu einem einfachen Signal-Phonographen mitzuteilen” (Phonographische Zeitschrift: 1900b, 75). 32 In 1923, Moholy-Nagy also refers to the productive abilities of the gramophone. Cf. Kittler: 1999, 46. 33 “In questo elenco abbiamo racchiuso i più caratteristici fra i rumori fondamentali; gli altri non sono che le associazioni e le combinazioni di questi. I movimenti ritmici di un rumore sono infiniti. Esiste sempre, come per il tono, un ritmo predominante, ma attorno a questo altri numerosi ritmi secondari sono pure sensibili” (Russolo: 1916: 15). 34 “Questa orchestra è continuamente in evoluzione e potrà essere ampliata all’infinto, poiché la natura e la vita ci offrono, nei rumori, una varietà di timbri che non sarà tanto facilmente esaurita” (Russolo: 1916, 81). 35 “Gli intonarumori inventati e costruiti da me e da Piati sono finora 21” (Russolo: 1916, 75).
256
Arndt Niebisch
Significantly, the order of the intonarumori is produced by irregularities of the timbre. The timbre also has – according to Russolo – a certain invariable quality. Every noise has a pitch, some even a chord, which predominates among the whole of its irregular vibrations. Now, from this predominant characteristic pitch derives the practical possibility of assigning pitches to the noise as a whole. That is, there may be imparted to a given noise not only a single pitch but even a variety of pitches without sacrificing its character, by which I mean the timbre that distinguishes it (Russolo: 1986, 27).36
At first, Russolo introduces noise as an untamable, irregular phenomenon; in a further step, he presents an ordering system for designing an art of noise. The timbre thereby builds up a double-sided structure: it functions as a “noise-sound” (Russolo: 1986,24). On the one hand, it is the only predominant feature of noise events that makes it possible to generate a noise system with distinctive categories; on the other hand, it emerges as an (un)welcome parasite from the material preconditions of musical production.37 It mediates between the merely distorting and irregular character of noise and the systematic arrangement of musical composition.38 This analysis of the timbre of noise as an ordering pattern depends on the possibility for analyzing acoustic events through modern media technology. Russolo’s project of discovering the hidden structure of noise can therefore be understood in analogy to Benjamin’s notion of the optical unconscious: in his artwork-essay he states that photography and film, through their capabilities to enlarge or diminish, to record and reproduce movements or perspectives otherwise non-accessible for the human eye, reveal new dimensions of every-day life. The details of movements and the beauty of small objects are not anymore merely part of an optical unconsciousness that exists under the threshold of perception. The optical gadgets lower for Benjamin the perceptual threshold and enable the world of the optical unconscious to enter into conscious perception.39 Similarly, early sound recording 36 “Ogni rumore ha un tono, talora anche un accordo che predomina nell’insieme delle sue vibrazioni irregolari. Ora, da questo caratteristico tono predominante deriva la possibilità pratica di intonarlo, di dare cioè ad un dato rumore non un solo tono ma una certa varietà di toni, senza perdere la sua caratteristica, voglio dire il timbro che lo distingue” (Russolo: 1916, 14). 37 The French philosopher Michel Serres acknowledges the two meanings of the French word “parasite” as “parasite” and “noise” in his book Le parasite. Serres understands the parasite as something that distorts a process, but thereby generating a new system of higher order (cf. Serres: 1987, 29). Similarly, Russolo understands the timbre as an interruption, which on a higher level of complexity has a systematic pattern that can be reintroduced into an order. 38 In this respect, Russolo’s noise-sound differs from the concept of noise in information theory. For Russolo “noise” is not pure entropy, but connotes a higher entropy than musical sound. 39 Benjamin: 1963, 34–36.
The Psychophysics of Luigi Russolo’s intonarumori
257
can be seen as a technology that introduced the perception of an acoustic-unconsciousness, which enabled Russolo to recognize patterns in noise and to train the Futurist sensibility. Russolo’s gadgets are designed to create such unknown, unconscious acoustic worlds and not to reproduce noise. The ability to produce noise intentionally is an innovative technological feature of such an apparatus. In traditional music, noise is not uniquely produced. It is only an undesired byproduct. Although Russolo exhibits these features of his noise machines, he also faces the accusation that his art of noise is merely imitative.40 As I pointed out in the manifesto, noise that comes from life we immediately restore to the same life (contrary to that which makes the sound) reminiscing quickly in our minds about the things that produce the determined noise that we hear. The restoration to life has, therefore, a character of an impressionistic fragmented episode of the same life. But as in every art, and thus also in the Art of Noise, we must not limit ourselves to an impressionistic fragmented reproduction of life. Noise must become a primary element in shaping the work of art. That is, it must lose its own accidental character in order to become an element sufficiently abstract so that it can reach the necessary transfiguration of every primary element in the abstract material of art. Well then, although the resemblance of timbre to imitated natural noise is attained in these instruments, almost to the point of misleading, nevertheless, as soon as one hears that noise varies in tone, one becomes aware that it quickly loses its episodic, uniquely imitative character. It loses, that is, all its character of result and effect, tied to causes that produce it (motor energy, percussions, rubbings produced by speed, clashes, etc.) and that are due to and inherent in the same purpose of the machine or of some other thing that produces the noise. It loses this character of effect by transforming itself into element and into primary material (Kirby: 1986, 177–178).
Here, Russolo discusses the central problem of his art of noise. Noises – parts of everyday life – are used for generating genuine works of art, but the material immediacy of noises carries a referential structure. If one records and reproduces an acoustic event, these noises refer back to the original event. In a certain sense, noise is always concrete. Russolo tried to avoid this referential structure of noise. From a semiotic perspective, this referential structure is based on the indexical nature of noise. Noise refers back to the machines that produced the noise. In the case of pure sound or orchestral music, this referential structure is not apparent to the same degree. Analog media by contrast, have a specific feature that enables them to distort this referential structure in a very elegant way. With these media, it is possible to manipulate the time-axis of sound recording, which leads to a strong 40 Indeed as Kirby points out, Russolo did in practice not fulfill his dogma of a non-mimetic art (cf. Kirby: 1986, 40).
258
Arndt Niebisch
effect of estrangement. Ernst Mach also emphasizes this effect of analog media in his book Die Analyse der Empfindungen: Reversal of the temporal order is even more destructive of a process than is the reversal of an object in space by turning it upside down; reverse the temporal order, and an experience becomes something other than itself, something quite new. This is why the words of a speech or a poem are reproduced only in the order in which they were experienced and not in the reverse order as well, in which they would generally have a quite different meaning, or no meaning at all. If the whole acoustic sequence is reversed by saying something backwards, or by making a phonograph work backwards, we do not even recognize any longer the words that are the component parts of the speech (Mach: 1996, 246).41
Similar to Benjamin’s optical unconscious in the optical media of photography, microscope and film, the manipulation of the time axis of sound recordings creates new phenomena, which are difficult to relate to the original recording in real time. In the citation, Mach thematizes the inversion of a symbolic order, but also highlights the manipulation of the sequential order in analog media. According to him, the manipulation of sound recordings produces radically new sensations without any semantic value: they are mere noises. The same is true when one accelerates or decelerates the gramophone excessively. If one increases or decreases the speed of a record on a gramophone, the sound becomes distorted and can appear as noise. More specifically, this manipulation of the gramophone generates an enharmonic scale: the tone becomes higher when accelerated and lower when slowed down. In this way, gramophones can be used for creating a dynamic glissando, something which is also central to Russolo’s intonarumori. Thus, some noises obtained through a rotary motion can offer an entire chromatic scale ascending or descending, if the speed of the motion is increased or decreased (Russolo: 1986, 27).42
Douglas Kahn points out in his essay “Concerning the Line: Music, Noise Phonography” (Kahn: 2002) that the musical glissando is of great importance for modern41 “Die Umkehrung der zeitlichen Ordnung entstellt einen Vorgang noch viel mehr, als die Umkehrung einer Raumgestalt von oben nach unten. Sie macht aus demselben geradezu ein anderes, neues Erlebniss. Deshalb werden die Worte einer Rede, eines Gedichtes, nur in der erlebten Ordnung reproducirt und nicht auch in der umgekehrten, in welcher sie im allgemeinen einen ganz anderen, oder gar keinen Sinn haben. Kehrt man gar durch umgekehrtes Lautiren, oder durch umgekehrten Gang des Phonographen die ganze akustische Folge um, so erkennt man nicht einmal mehr die Wortbestandtheile der Rede wieder” (Mach: 1903, 190–191). 42 “Così alcuni rumori ottenuti con un movimento rotativo possono offrire un’intera scala cromatica ascendente o discendente, se si aumenta o diminuisce la velocità del movimento” (Russolo: 1916, 14).
The Psychophysics of Luigi Russolo’s intonarumori
259
ist composers in general. Although glissandi can be generated by a variety of musical instruments, Kahn argues that sirens, which were relatively modern acoustic instruments are especially central to modernists’ attempts to produce dynamically increasing or decreasing scales of sound. (Kahn: 2002, 184-187) Sirens are acoustic devices, which generate a sound by blowing air through a rotating pinched disk. They are similar to intonarumori, because the pitch of the sound increases or decreases with the acceleration or deceleration of the rotating disk.43 Although sirens share constructive features with Russolo’s noise intoners, sirens were not designed for producing noise. The use of sirens had its place in the sound laboratory, and they served in Helmholtz’s experimental work for an analysis of sound frequencies in contrast to Russolo’s machines, which were used for experimenting with noise (Helmholtz: 1954, 11–12). Sirens as well as gramophones probably had an influence on Russolo’s work and I contend that intonarumori can be understood as hybrid forms in between gramophones and sirens. On the one hand, Russolo invented his intonarumori in order to produce noise. The first machine that was designed for processing noise was the phonograph, but the phonograph was limited to a mimetic reproduction of noise – its creative capacities only emerged in distortions. On the other hand, intonarumori were instruments for generating certain noise patterns that did not only have a certain identifiable timbre, but also could generate a determined pitch. It is significant that the intonarumori did not generate random noise events of unpredictable volume or pitch, but were able to regulate sonic structures such as pitch and volume. They did not produce a stochastic sequence of unpredictable acoustical events, but generated determinate sounds that only differed in their overtones from classical instruments. These machines did not simply create noise, but also served as musical instruments, which the composer Pratella could easily integrate in his orchestral performances.44 Intonarumori combine the ability to produce irregular noise with the constructive ability to generate closely controlled acoustic phenomena. This is an advantage but also a limitation of these machines: on the one hand, it enables actual compositional structure; on the other hand, it limits the unpredictable structure of the sound-noise to the most delicate part of acoustic events, the overtones. 43 A more detailed description can be found in Helmholtz’s book on the sensation of tone. (Helmholtz: 1954, 11–12. 44 Mark Radice argues that this controllable nature made the intonrumori interesting for the composer Pratella, who incorporated the intonarumori as sound effects in his orchestral compositions. (Radice: 1989 10) Furthermore, Rodney Payton argues that Pratella only incorporated the intonarumori, because Marinetti wanted him to do so (Payton: 1976, 36–37).
260
Arndt Niebisch
Conclusion Russolo’s art of noise lays the foundation for the generation of complex information. In this sense, he experimented with ideas of complexity, which are also important for Shannon’s model of information entropy. This model is based on the modern technical conditions of data processing and is independent from the semantic value of the processed information. Likewise, Russolo’s aim was not to represent sound icons of the modern world such as racecars or noisy factories, but to generate innovative sound patterns. The construction of such noise patterns does not represent an abstract l’art pour l’art, but rather a strategy of preparing mankind for the requirements of modern life. Russolo bridged the gap between art and technology. By generating noises, his apparatus attempted to constitute a precise psycho-physiological training for adapting mankind to the Futurist world. It was not his aim to expose his audience to an unpredictable cacophony of noise, but rather to irritate them through precisely regulated noise-sounds. The acoustics emissions generated by the intonarumori do not constitute random events, but offer sound noises highly contaminated with static, similar to the communication in traffic, warfare, or early radio. The technologies Russolo adapted represent the established standard in the phonographic industry of his time and his actual performances remain rooted in a mimetic project (Kirby: 1986, 39–40). Nonetheless, he opens up the discussion of an aesthetics based on a non-semantic understanding of communication and complexity that became of paramount importance for composers such as Iannis Xenakis45 and theorists such as Umberto Eco or Max Bense.46
45 See for example Iannis Xenakis’s book Formalized Music (Xenakis: 1992). Although Xenakis is influenced by advances in the mathematical analysis of probabilities, which is also the basis for modern communication theory, it is important to note that Xenakis’s stochastic compositions cannot simply be recognized as mere adaptation of communication theory to composition. Xenakis criticizes a purely communication theoretical approach towards composition as to reductive (Xenakis: 1992, 180). 46 For further reference see for example Umberto Eco’s Opera Aperta (Eco: 1962) or the essay “Informationstheorie und Ästhetik” (Bense: 2000) in which Max Bense correlates aesthetics and communication theory.
The Psychophysics of Luigi Russolo’s intonarumori
261
Bibliography Anonymus, Durch den Aufnahme-Prozess verursachte Nebengeräusche, in: Phonographische Zeitschrift, 13. September 1900a, 18–19. Anonymus, Phonograph und Verkehrsmittel, in: Phonographische Zeitschrift, 19. Dezember 1900b, 75. Anonymus, Spindellose Phonographen und elektrischer Antrieb, in: Phonographische Zeitschrift, 27. Februar 1901, 46. Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in: ders., Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie, Frankfurt a. M. 1963, 7–44. Max Bense, Informationstheorie und Ästhetik, in: Caroline Walther / Elisabeth Walther (eds.), Max Bense Radiotexte, Heidelberg 2000, 131–140. Umberto Eco, Opera aperta, Milano 1962. Gustav Theodor Fechner, Elemente der Psychophysik (1860), Vol. 1, Amsterdam 1964. Hermann Helmholtz, On the Sensations of Tone (1863), ed. by Henry Margenau, New York 1954. Douglas Kahn, Noise, Water, Meat: a History of Sound in the Arts, Cambridge Mass. 1999. Douglas Kahn, Concerning the Line: Music, Noise, and Phonography, in: Bruce Clarke / Linda Dalrymple Henderson (eds.), From Energy to Information. Representation in Science and Technology, Art, And Literature, Stanford 2002, 178–194. Michael Kirby, Futurist Performance with Manifestoes and Playscripts, translated from the Italian by Victoria Nes Kirby, New York 1986. Friedrich Kittler, Film, Gramophone, Typewriter (1986), translated from the German by Geoffrey Winthrop-Young and Michael Wutz, Stanford 1999. Friedrich Kittler, Real Time Analysis, Time Axis Manipulation, in: Friedrich Kittler, Draculas Vermächtnis, Technische Schriften, Leipzig 1993, 182–206. Julia Kursell, Schallkunst. Eine Literaturgeschichte der Musik in der frühen russischen Avantgarde, München 2003. Stanley Boyd Link, The Work of Reproduction in the Mechanical Aging of an Art: Listening to Noise, in: Computer Music Journal 25 (2001), 34–47. Ernst Mach, Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen, Jena 1903. Filippo Tommaso Marinetti (1913), Distruzione della sintassi, immaginazione senza fili, parole in libertà, in: Luciano De Maria (ed.), Filippo Tommaso Marinetti e il futurismo, Milano 2000, 99–111. Rodney J. Payton, The Music of Futurism: Concerts and Polemics, in: The Musical Quarterly 62/1 (1976), 25–45. Francesco Balilla Pratella (1911), La musica futurista, in: Luciano De Maria (ed.), Filippo Tommaso Marinetti e il futurismo, Milano 2000a, 53–58. Francesco Balilla Pratella (1911), Manifesto dei musicisti futuristi, in: Luciano De Maria (ed.), Filippo Tommaso Marinetti e il futurismo, Milano 2000b, 46–52.
262
Arndt Niebisch
Mark A. Radice, “Futurismo:” Its Origins, Context, Repertory, and Influence, in: The Musical Quarterly 73/1 (1989), 1–17. Alois Riegl, Naturwerk und Kunstwerk I., in: ders., Gesammelte Aufsätze, ed. by Karl Swoboda, Augsburg, Wien 1928, 51–64. Alois Riegl, Spätrömische Kunstindustrie, Wien 1927. Luigi Russolo, L’ Arte dei rumori, Milano 1916. Luigi Russolo, The Art of Noises, translated from the Italian by Barclay Brow, New York 1986 (Ital. orig.: 1916). Michel Serres, Der Parasit, translated from the French by Michael Bischoff, Frankfurt a. M. 1987 (Frz. Orig.: Michel Serres, Le parasite, Paris 1980). Claude E. Shannon, Mathematical Theory of Communication, Urbana 1949. Iannis Xenakis, Formalized Music, Thought and Mathematics in Composition, Stuyvesant 1992.
Hören und Gedächtnis in Schönbergs Ästhetik
263
Martin Eybl Hören und Gedächtnis in Schönbergs Ästhetik. Begriffs- und ideengeschichtliche Vorüberlegungen
1. Als Grundlage ihrer jüngsten Studie über „Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses“ unterscheidet Aleida Assmann zwei komplementäre Modi der Erinnerung, die sowohl das individuelle als auch das kollektive Gedächtnis ausmachen würden, Speichergedächtnis und Funktionsgedächtnis (Assmann: 1999, 133–137, siehe Grafik 1). Das Speichergedächtnis arbeitet unbewusst und passiv. Es sammelt die Daten unreguliert und kumulativ. Die Informationen liegen als eine amorphe Masse bereit; sie können assoziativ wachgerufen werden, vielleicht auch erst durch Analyse ans Licht kommen. Das Adjektiv amorph charakterisiert nicht die Datenelemente als solche. Diese werden ja bereits in der Wahrnehmung gestalthaft strukturiert, und auch Bibliothek und Archiv, die in Assmanns Darstellung kollektive Speichergedächtnisse repräsentieren, bewahren ihr Material nicht gänzlich ungeordnet. Zusammengenommen ergeben jedoch die im Speichergedächtnis konservierten Inhalte keine Story, keine Sinnfiguration. Sie bleiben isoliert und gegeneinander abgegrenzt; sie werden unbewusst und unwillkürlich aufgehäuft. Funktionsgedächtnis bewusst aktiv selektiv Verknüpfung, Sinnkonstitution zukunftsorientiert (Erwartungen)
Speichergedächtnis unbewusst passiv kumulativ amorphe Masse Hintergrund des Funktionsgedächtnisses
Abbildung 1: Funktions- und Speichergedächtnis als zwei komplementäre Modi der Erinnerung (nach Assmann: 1999, 133–137).
Das Funktionsgedächtnis wird dagegen bewusst eingesetzt, etwa um sich Lernstoff oder eine Telefonnummer einzuprägen. Aktiv wählt dieser Gedächtnismodus einzelne Daten aus dem Informationsstrom aus, um sie miteinander zu verknüpfen
264
Martin Eybl
und derart Zusammenhang und Sinn zu konstituieren. Das Funktionsgedächtnis verbindet das Gegenwärtige mit dem Vergangenen und baut Erwartungen über Zukünftiges auf. Theodor W. Adorno unterscheidet in seiner Einleitung in die Musiksoziologie (Adorno: 1975, 14–34) entsprechend unterschiedlichen Motivationslagen für den Umgang mit Musik acht Hörertypen. Er beschreibt dabei jedoch nur zwei Arten des Hörens. Das „bewußte“ oder „strukturelle Hören“, bei dem ‚spontan Zusammenhänge vollzogen‘ werden (Adorno: 1975, 23, 18 und 19), ordnet Adorno dem „Expertenhörer“ und dem „guten Zuhörer“ zu. Während der Expertenhörer „dem Verlauf auch verwickelter Musik spontan folgt, hört er das Aufeinanderfolgende: vergangene, gegenwärtige und zukünftige Augenblicke so zusammen, daß ein Sinnzusammenhang sich herauskristallisiert“ (Adorno: 1975, 18). Die übrigen Hörertypen charakterisiere dagegen eine „atomistische“ Hörstruktur (Adorno: 1975, 20), die die Synthese der Details zu einem Sinnzusammenhang nicht zuläßt. Als „Bildungskonsument“ mag der Hörer „grandiose Augenblicke“ erwarten und herbeisehnen (ebd.), ohne sie jeweils miteinander und mit der gesamten Struktur des Werks zu verknüpfen, oder, schlimmer noch, der Hörer verlegt sich als „Unterhaltungshörer“ auf die passive Hörweise „der Zerstreuung und Dekonzentration, unterbrochen wohl von jähen Augenblicken der Aufmerksamkeit und des Wiedererkennens“ (Adorno: 1975, 31). Adornos Bewertung der beiden Hörweisen kann außer Betracht bleiben. Korreliert man Adornos Befund mit Assmanns Wortprägungen, wird deutlich, dass Funktionsgedächtnis und Speichergedächtnis keine komplementären Systeme darstellen. Sie ergänzen einander nicht, sondern das Funktionsgedächtnis baut auf dem Speichergedächtnis auf. Strukturelles Hören im Sinne von Adorno ist ein Hören mithilfe des Funktionsgedächtnisses. Atomistisches Hören verzichtet dagegen auf dessen Einsatz; dennoch ist es nicht dezidiert ein Hören mithilfe des Speichergedächtnisses. Zwar wäre das Speichergedächtnis auch hier im Spiel, doch genau so, wie bei allen übrigen Wahrnehmungen. Es entspricht dem Datenträger, auf dem die Bilder einer Überwachungskamera gespeichert werden mit dem Unterschied, dass das mentale Speichermedium weniger neutral arbeitet und durch emotionale Interventionen störungsanfällig ist. Im Speichergedächtnis wird alles abgelagert, was unsere Sinne erreicht. Es ist ständig im Einsatz. Zur Differenzierung des musikalischen Hörens ist indes allein ausschlaggebend, ob und auf welche Weise das Funktionsgedächtnis mitwirkt.1 1 Ich widerspreche damit Michael Cherlin, der in einer Studie zu Schönbergs Streichquartett op. 7 in Anlehnung an Henri Bergson zwei Modi der Erinnerung unterscheidet, die recht genau Assmanns Begriffspaar Speicher- und Funktionsgedächtnis entsprechen: „cumulative memory“ und „recollec-
Hören und Gedächtnis in Schönbergs Ästhetik
265
Zu einem Werkzeug und Medium des musikalischen Hörens wurde das Funktionsgedächtnis – betrachtet im Maßstab der Gattungsgeschichte des Menschen oder auch im Kontext einer Geschichte des musikalischen Hörens – erst relativ spät entwickelt. Die Grundlagen dieser kulturellen Errungenschaft liegen in der Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts. Die Instrumentalmusik emanzipierte sich von der Vokalmusik, was zur Ausbildung differenzierter Formen der Instrumentalmusik führte. Es begann das „Zeitalter der thematischen Prozesse“ (Wörner 1969); musikalisches Hören bestand nun wesentlich darin, die Wiederkehr und Entwicklung von Themen zu erfassen. Für diese Art thematisch komponierter Instrumentalmusik wurde das Funktionsgedächtnis als spezielles Rezeptionsorgan ausgebildet. Dabei spielten drei Komponenten eine Rolle. Zum einen die Profilierung der musikalischen Themen: Sie sollten prägnant, mit einer individuellen, leicht wieder erkennbaren Kontur gestaltet sein. Zum andern wurden die Themen bestimmten Orten im musikalischen Ablauf zugewiesen. Die Voraussetzung dafür bildete eine Normierung der Formverläufe, die die Erwartung der Zuhörer steuerte und zugleich den Komponistinnen und Komponisten genügend Spielraum für immer neue Lösungen ließ. Zuletzt wurde das Funktionsgedächtnis am Verfahren der entwickelnden Variation geschult, bei der mit jedem neuen Auftreten eines Motivs oder Themas sukzessive gerade so viele Komponenten verändert werden, dass die Identifizierung der Gestalt nicht gefährdet wird. Die Technik, Gedächtnisinhalte mit bestimmten Orten eines strukturierten Raums, der Handfläche beispielsweise, zu verknüpfen, dient seit der Antike der Unterstützung des Funktionsgedächtnisses. Einer solchen Verräumlichung von Informationen, die nacheinander perzipiert werden, kommen traditionelle Raummetaphern für musikalische Sachverhalte entgegen. Man spricht von „hohen“ und „tiefen“ Tönen; selbst in der naturwissenschaftlichen Ausdrucksweise der hohen und tiefen Frequenz bleibt das Bild erhalten. Man versteht eine Tonfolge als Bewegung im Tonraum, als ob in einer Abfolge von Tönen mit steigender Frequenz tive memory“ (Cherlin: 2000, 63; 69). Cherlin stellt die These auf, dass bei der Wahrnehmung musikalischer Form beide Gedächtnismodi einander komplementierend zusammenspielen. Er mutet allerdings der „cumulative memory“ zu, die Wahrnehmung von formalen Zäsuren wie von Verbindungslinien zwischen den Teilen zu steuern. Das Speichergedächtnis würde mit den raumbildenden Funktionen von Musik korrespondieren, die entweder zur Abgrenzung der Teile führen oder die Kohärenz der Formteile und die formalen Einheit gewährleisten (2000, 69). Cherlins Auffassung zufolge erfasst das Speichergedächtnis, fokussiert auf die jeweilige Gegenwart, die Kategorie der Kontinuität (inklusive deren Unterbrechung), während das Funktionsgedächtnis auf ferner liegende Beziehungen abhebt. Damit entfernt sich der Autor jedoch beträchtlich vom Begriff des (passiven) Speichergedächtnisses, das Bergson in Materie und Gedächtnis (1908) „spontanes Gedächtnis“ nannte (Bergson: 1964, 103–113).
266
Martin Eybl
bloß ein einzelner Ton nach oben laufen würde. Das zeitliche Nacheinander wird in unserer Vorstellung in ein räumliches Nebeneinander übertragen. Ähnliches gilt für Formteile. Sie werden in der gängigen Sprache der Musiktheorie als Räume aufgefasst; im Mittelteil oder in der Reprise geschehe dieses oder jenes, sagt man. Das Funktionsgedächtnis verknüpft das Jetzt mit dem Vergangenen. Hörend imaginieren wir die Abfolge der Ereignisse als Bewegung durch einen Raum, der sich uns allmählich und sukzessive erschließt. Eine solche Bewegung ist freilich nur in eine Richtung möglich. Was musikalisch hinter uns liegt, müssen wir durch das Gedächtnis präsent halten. Eine Umkehr ist ausgeschlossen. Allenfalls kann man wie bei einer Langspielplatte aus Vinyl zurückspringen und von vorne beginnen. Doch die Richtung des Abtastvorgangs bleibt immer dieselbe.
2. Im Sprachgebrauch der Zweiten Wiener Schule spielen konventionelle RaumMetaphern ebenfalls eine große Rolle (vgl. Busch: 1983, 230–232). Tonarten werden als Räume begriffen. Tonale Stücke stehen in einer Tonart, so wie Schönberg oder Webern in zwölf Tönen komponierten (gemäß der Formulierung Weberns in einer Vortragsreihe 1932). In der Harmonielehre spricht Schönberg von den „Grenzen der Tonart“ und vergleicht die Herrschaft der Tonika in einer tonalen Komposition mit einem Verband von Territorien, die ungeachtet ihrer „Selbständigkeitsgelüste“ unter der festen Hand eines Tyrannen vereint bleiben (Schönberg: 1911, 262; 170f.). Auch der Begriff der „schwebenden Tonalität“ für Stücke, die sich zwischen zwei Tonarten nicht entscheiden zu können scheinen, ist von einer räumlichen Vorstellung getragen. Im Entwurf zu einem Vortrag, den Schönberg im Frühjahr 1934 in Princeton hielt, nennt der Komponist als eine Grundvoraussetzung seiner neuen Kompositionsmethode unter anderem die „Lehre von der Einheit des musikalischen Raums“ (Spies: 1974, 80). Diese Lehre, die der Autor in der publizierten englischen Fassung des Vortrags (1941) ein „Gesetz“ nennen sollte, stellt die Raummetapher für musikalischen Verlauf auf den Kopf. Wurde ehedem die Abfolge musikalischer Elemente in der Zeit als eine gerichtete Bewegung im Raum aufgefasst, bildet nun ein quasi zeitloser Raum das primäre Medium. Die Richtung und Reihenfolge, in der die Musik die im Raum positionierten Gestalten wiedergibt, ist sekundär. Nicht mehr der Raum ist Metapher für den Zeitverlauf; die zeitliche Abfolge bildet die Erscheinungsform des musikalischen Raums.
Hören und Gedächtnis in Schönbergs Ästhetik
267
Schönberg führt in dem zitierten Text zur Komposition mit zwölf Tönen zwei Kennzeichen des musikalischen Raums an. Zum einen betont er, „dass die Vertikale und die Horizontale, die Harmonie und die Melodie, das Gleichzeitige und das Nacheinander-Geschehende“ nicht gegeneinander abgeschlossen erscheinen. Sie würden „in Wirklichkeit einen einheitlichen Raum“ bilden (Spies: 1974, 82). Zum andern sei alles miteinander verknüpft. Ich zitiere wegen der klareren Ausdrucksweise die von Schönberg publizierte Fassung: Alles, was an irgendeinem Punkt dieses musikalischen Raumes geschieht, hat mehr als örtliche Bedeutung. Es hat nicht nur auf seiner eigenen Ebene eine Funktion, sondern in allen anderen Richtungen und Ebenen und ist selbst an entfernter gelegenen Punkten nicht ohne Einfluß (Schönberg: 1976, 77).
In allen Richtungen: Das meint ebenso Horizontale und Vertikale wie auch die Zeitrichtung, begründet doch Schönberg mit dem Gesetz von der Einheit des musikalischen Raums ausdrücklich die Verwendung musikalischer Spiegelformen wie Umkehrung und Krebs. Ein kompositorisches Ereignis hat demnach ebenso Konsequenzen für das Folgende wie Auswirkungen auf das Vorausgehende (sic!). In der Einheit des musikalischen Raums gibt es „kein absolutes Hinauf, Hinunter, Vor- oder Rückwärts, da jede Richtung von einem anderen Punkte des Raumes aus eine andere wird“ (Spies: 1974, 82–84). Zur Angabe der Richtung fehlen die Bezugsgrößen. In der Einheit des musikalischen Raums gibt es kein Davor und Danach, kein Oben und Unten. Der zentrale Standpunkt des Betrachters, von dem aus die Gegenstände im Raum aufeinander bezogen werden, hat sich ubiquitär aufgelöst. Eine solche Struktur erfordert, so Schönberg, eine „absolute Anschauung“. In der materiellen Welt würden Gegenstände – eine Uhr, eine Flasche, eine Blume – auf einen Blick erfasst, ohne dass sie zuerst aus allen Richtungen betrachtet werden müssten. Analog dazu werde die Identität musikalischer Gestalten „unabhängig von Richtungen und Ebenen“ unbewusst wahrgenommen (Schönberg: 1976, 79).2 Schönberg weiß dies aus eigener Erfahrung. Durch Selbstbeobachtung stellte er fest, „dass der musikalische Geist unbewusst die Tonfolgen auch in umgekehrter Reihenfolge oder in der entgegengesetzten Richtung denkt und eben absolut“ – das heißt: losgelöst von der zeitlichen Wahrnehmung – „nur die Tonverhältnisse empfunden und auskomponiert werden“ (Spies: 1974, 56). Gegen Regina Buschs Vermutung, Schönbergs Gesetz von der Einheit des musikalischen Raums entwerfe „ein Gegenbild zu einer Grundton-bezogenen“ Raum2 Die hier zitierte deutsche Übersetzung gibt das englische subconscious mit unterbewußt wieder. Schönberg selbst bevorzugte den Terminus unbewusst.
268
Martin Eybl
vorstellung (Busch: 1983, 232f.), lassen sich systematische und textimmanente Einwände vorbringen. Zum einen nimmt der Grundton in tonaler Musik keinen festen Platz ein. Seine Lage in Akkorden ist je nach Art der Akkordumkehrung frei. Im Tonraum eines tonalen Stückes ist der Grundton omnipräsent, er erscheint in jeder Oktavlage. Keineswegs bildet er ein „absolutes Unten“. Zum andern bezieht sich Schönberg bei der Erläuterung seiner Raumvorstellung auf das Vorbild der tonalen Musik. Die Einheit von Vertikale und Horizontale sei in der Tonalität präformiert, bei der sowohl die Akkorde als auch die Skala von den Obertönen abgeleitet werden könnten (Spies: 1974, 82). Für die Identität von Grundgestalt, Umkehrung und Krebs, zweifellos ein Fokus seiner Idee von der Einheit des musikalischen Raums, führt Schönberg „klassische Beispiele“ (Beethoven) an (Schönberg: 1976, 79). Drittens akzentuiert der Komponist den Aspekt der Form gegen über dem Tonsystem. Tonalität und Atonalität unterscheiden sich primär durch die Art der Tonbeziehungen. Anders als Busch spricht Schönberg nicht von einem absoluten Raum oder absoluten Tonverhältnissen, sondern er verbindet den Modus der Wahrnehmung mit dem Adjektiv „absolut“: „absolute Anschauung“. Nicht die Tonverhältnisse sind absolut – dann wäre tatsächlich unter Schönbergs neuartigem musikalischem Raum die Atonalität zu verstehen –, sondern deren Wahrnehmung unabhängig von der Art der Tonverhältnisse. Daraus folgt, dass durchaus bereits Schönbergs tonale Werke dessen Vorstellung eines musikalischen Raums realisieren können, auch wenn die Formulierung der Idee einige Jahre nach ihrer Entstehung erfolgte.3 Hören, bei dem das Funktionsgedächtnis auf Früheres zurückgreift und Kommendes erwarten lässt, entspricht einer solchen „absoluten Anschauung“ nicht. Denn es ist, metaphorisch gesprochen, an eine Richtung gebunden, vorwärts und rückwärts sind nicht einerlei. Das Ohr kann die ästhetischen Objekte jeweils nur nach und nach abtasten. Der bestehende Zusammenhang wird zwar in Schönbergs Auffassung vom Ohr vernommen, jedoch nur „gefühlsmäßig“ (Stephan: 1986, 300) und unbewusst. Selbst der Komponist schafft als willenloses Medium musikalischer Logik eine geordnete Struktur, ohne dass ihm die Ordnung zu Bewusstsein kommen müsse. Auffällig bei Schönberg ist die zunehmende Visualisierung der musikalischen Wahrnehmung: Der hörend zu erfassende akustische Informationsstrom wird zu 3 Albert Jakobik betrachtet das Operieren auf zwei Zeitebenen, „Raum“-Zeit und Entwicklungszeit, als ein Charakteristikum von Schönbergs Komponieren in allen Perioden seines Schaffens. Allerdings stellt sich die Frage, ob die der Einheit des musikalischen Raums entsprechende „verräumlichte ,statische‘ Zeit“ (Jakobik: 1983, 10) denn überhaupt als Zeitebene zu verstehen ist, wo doch gerade die Abwesenheit von Zeit ihr Wesensmerkmal darstellt.
Hören und Gedächtnis in Schönbergs Ästhetik
269
einem überblickbaren Raum. Die bewusste Wahrnehmung von Zusammenhängen fällt dabei dem Auge zu. Schönberg beschreibt das Auge als Wahrnehmungsorgan der motivischen Arbeit, jenes vom Komponisten bewusst hergestellte Beziehungsnetzes musikalischer Gestalten, das die Einheit des Kunstwerks gewährleisten soll. Wurden ehedem die Erscheinungsformen der Motive durch das Funktionsgedächtnis aufeinander bezogen, bleibt diese Aufgabe nun dem Auge. An die Stelle des hörenden Nachvollzugs tritt die Lektüre des Notentextes. In einem frühen Dokument zur Entstehung der Zwölftonkomposition heißt es dazu: Die motivische Arbeit ist nichts anderes als das Bestreben, sichtbar zu machen, was nur hörbar ist. Auch wenn man nicht motivisch arbeitet, muß, wenn man überhaupt logisch denkt, was man schreibt, logisch sein, Zusammenhang haben. Logisch schreibt man also auch, ohne daß man darauf hinarbeitet. Aber diese Logik ist für einen andern nur zu fühlen und nicht überzeugend. Die motivische Arbeit dient dazu, dieses Hörbare[,] gefühlsmäßig zu erfassende, auch sichtbar zu machen. Sie verlegt die Darstellung des Gedankens aus dem Hörbaren in das Sichtbare, wobei aus dem Notenbild der Zusammenhang erkennbar wird (Stephan: 1986, 300–301).
Im Medium des Klangs, lässt sich zusammenfassend sagen, ist musikalischer Zusammenhang dem Unbewussten zugänglich, im Medium der Schrift dem analytischen Blick. Das Funktionsgedächtnis hat seine zentrale Bedeutung für das Hören eingebüßt. Und zugleich wechselte motivische Arbeit das Medium: Aus dem hörbaren Verlauf zog sie sich ins Notenbild zurück, in dem, räumlich ausgebreitet, alle Details simultan verfügbar sind. Der zitierte Text beschränkt radikal motivische Arbeit auf den sichtbaren Zusammenhang. Daran anknüpfend und komplementär dazu sei im folgenden der Ausdruck „thematisch“ dem Bereich des bewusst hörbaren Zusammenhangs vorbehalten. Das eben zitierte Dokument, das allein wegen der prononcierten Akzentuierung des visuellen Aspektes von Komposition besonderes Interesse verdient, blieb als unvollständiger Durchschlag im Nachlaß Alban Bergs erhalten. Einige Hörfehler sowie eine gegenüber der Originalfassung veränderte Orthografie und Interpunktion in einem längeren Zitat lassen erkennen, dass das Typoskript eine Diktatniederschrift darstellt, die vermutlich als Vorlage für einen Vortrag diente oder dienen sollte. Der Durchschlag selbst wurde nicht korrigiert. Dies schließt nicht aus, dass die Erstschrift durch Korrekturen zu einem Vortragsmanuskript umgearbeitet wurde. Die Quelle ist anonym und undatiert, fällt aber jedenfalls in die Frühzeit der Zwölftonkomposition. Wer immer auch das Typoskript herstellte – Helene Berg schrieb in einer handschriftlichen Anmerkung (ohne weitere Begründung) den Text Anton von Webern zu, Jennifer R. Shaw bringt Erwin Stein ins
270
Martin Eybl
Spiel (2002, 582–583) – der Autor des diktierten Textes scheint Schönberg selbst gewesen zu sein.4 Áine Heneghans Vorschlag, Fritz Mahler als Autor des Textes anzunehmen (2006, 164–172), beruht auf der irrigen Annahme, der Autor des Textes und der Schreiber des Typoskripts müssten ein- und dieselbe Person sein. Die „elementaren Fehler“ (Heneghan: 2006, 164) des Typoskripts ergeben sich aus dem Charakter einer Diktatniederschrift und schließen Schönberg als Textautor nicht von vorneherein aus. Schönberg kannte natürlich die Revision seiner Harmonielehre in dritter Auflage (1922), aus der im Typoskript zitiert wird, bereits vor ihrer Publikation. Als weiterer Kenner der revidierten Fassung ist Fritz Mahler damit nicht notwendig bei der Herstellung des Typoskripts beteiligt. Ohne ausdrücklichen Hinweis zitiert der Vortragstext einen Absatz aus Schönbergs Harmonielehre,5 in dem mehrfach ein Ich spricht, etwa: „Dann habe ich bemerkt, daß Tonverdoppelungen, Oktaven selten vorkommen“. Nur Schönberg selbst konnte den Autor der Harmonielehre als ein Ich zitieren; jeder andere hätte angeben müssen, dass im Zitat jemand anderer als er selbst am Wort sei. Die bisher zitierten ästhetischen Äußerungen stammen aus den 1920er- und 30er-Jahren, einer Zeit, in der Schönberg seine Werke mittels Zwölftontechnik komponierte. Wie wirkten sich die ästhetischen Überlegungen auf die Gestaltung der Musik aus? Die Idee eines einheitlichen musikalischen Raums bildete zunächst die unmittelbare Grundlage dafür, dass die Reihe horizontal und vertikal eingesetzt wurde, indem Hauptstimmen und Gegenstimmen ebenso wie Akkorde aus den vorgegebenen Ton- bzw. Intervallfolgen hergeleitet wurden. Sie bildete weiters die Grundlage für die gleichberechtigte Verwendung von Grundgestalt, Umkehrung, Krebs und Krebsumkehrung der Reihe. Die Vermutung, es handle sich bei der Einheit des musikalischen Raums lediglich um eine Ad-hoc-Begründung von kompositorischer Materialdisposition, greift jedoch zu kurz. Die Einheit des musikalischen Raums impliziert eine große Dichte von werkimmanenten Beziehungen, alles sollte miteinander verbunden sein. Und in der Tat durchdringt in der Zwölf4 Die Autorschaft Schönbergs vermuten auch Rudolf Stephan (1986, 296) und Martina Sichardt (1990, 72 und 1996, 167). 5 „Für die Folgen sechs- und mehrstimmiger Akkorde [...]“ bis „[...] uns zu primitiv erscheinen“ (Stephan: 1986, 299). Das Zitat weist die oben erwähnten Abweichungen vom Original in Orthographie und Interpunktion auf. Das Zitat stammt aus der ersten (oder der unveränderten zweiten) Auflage des Lehrbuchs, Seite 469 bis 470. Die rätselhafte Angabe weiter unten im Vortragstext „(Harmonielehre Seite 70)“ bezieht sich vermutlich darauf. Denn weder in der ersten noch, wie Rudolf Stephan angibt, in der dritten Auflage der Harmonielehre kann die Seite 70 sinnvoll auf die benachbarten Passagen des Vortragstextes bezogen werden. Einen Hinweis darauf gibt bereits Shaw 2002, 599–600; es handelt sich allerdings um eine Passage, nicht um zwei.
Hören und Gedächtnis in Schönbergs Ästhetik
271
tonkomposition die Struktur der Reihe jedes kleinste Detail. Damit besteht eine Unzahl von Referenzen, ein Beziehungsnetz, das größtenteils unterhalb der Ebene thematischer Verknüpfung liegt. Einer bewussten hörenden Erschließung ist dieses Netz unzugänglich.
3. Neben dem subthematischen Beziehungsgeflecht im zeitlosen musikalischen Raum komponierte Schönberg in den Werken der 1920er- und 30er-Jahre durchaus auch thematische Beziehungen und unterwarf sich formalen Konventionen, die das Funktionsgedächtnis ansprechen. „Form in music serves to bring about comprehensibility through memorability“ – „Form in der Musik dient dazu, Faßlichkeit durch Erinnerbarkeit zu bewirken“, heißt es in Schönbergs Studie Brahms the Progressive (Schönberg: 1975, 399; Schönberg: 1976, 36). Die Passage findet sich noch nicht in der Vortragsfassung von 1933.6 Sie wurde vermutlich erst bei der Überarbeitung des Textes 1947 in die englische Druckfassung eingefügt. Fasslichkeit durch Erinnerbarkeit: Das ist das alte Prinzip des thematischen Komponierens. Wo das Gedächtnis angesprochen wird, ist der Zeitverlauf wichtig. Der einheitliche, nur der absoluten Wahrnehmung zugängliche musikalische Raum fällt demnach mit Form nicht zusammen. Im Gegenteil, die beiden Begriffe markieren zwei kontrastierende Ebenen des Kunstwerks (Grafik 2).
Einheit des musikalischen Raums zeitlos, ungerichtet unbewusste, „absolute“ Wahrnehmung subthematisches Beziehungsgeflecht innere Ordnung Auge
Form zeitabhängig, gerichtet Funktionsgedächtnis thematische Beziehungen äußere Ordnung Ohr
Abbildung 2: Form und musikalischer Raum
6 Die beiden Versionen des Vortrags vom 12. 2. 1933 befinden sich heute im Arnold Schönberg Center Wien.
272
Martin Eybl
Schönberg bezeichnet mit Form eine Ebene des Kunstwerks, für die das Prinzip Wiederholung zentral ist, eine Ebene, in der es Zeit und eine Richtung gibt, in der thematische Beziehungen das Funktionsgedächtnis ansprechen, in der eine äußere, das heißt eine mittels des Ohrs bewusst wahrnehmbare Ordnung herrscht. In Schönbergs zweiter Schaffensperiode, in der Periode der freien Atonalität etwa zwischen 1908 und 1923, waren athematisches Komponieren, die Vermeidung von Wiederholungen, ja die „[v]ollständige Befreiung von allen Formen“7 im Mittelpunkt des kompositorischen Interesses gestanden. Mit der Entwicklung der Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen wandte sich der Komponist verstärkt traditionellen Formmodellen zu. Die Begründung für diese Tendenz ist zwiespältig. Denn einerseits behauptet Schönberg, die Zwölftontechnik selbst diene der Fasslichkeit, andererseits hält er es für nötig, die durch diese Technik erzielte Komplexität der Tonbeziehungen durch leicht fassliche Formmodelle zu kompensieren.8 Die Restauration der alten Formen machte das Funktionsgedächtnis neuerlich zum Adressaten komponierter Struktur. Dazu war es nötig, die Verselbständigung der musikalischen Parameter9, ein Herzstück der Zwölftontechnik, partiell zurückzunehmen. Gerade im Umgang mit den Parametern unterscheiden sich motivische Arbeit (auf der Ebene des einheitlichen musikalischen Raums) und thematische Arbeit (auf der Ebene der Form) markant. Motivische Arbeit ist durch Selbständigkeit der Parameter gekennzeichnet, während thematische Arbeit der Koppelung mehrerer Parameter als wichtigstem Mittel, thematische Prägnanz herzustellen, bedarf. Motive und Themen auf der Ebene der Form greifen darüber hinaus auf weitere alte Techniken zurück, dem Funktionsgedächtnis Anknüpfungspunkte zu liefern, darunter die Gestaltung von Kontrasten, die Verortung von Motiven durch Einsatz formaler Zäsuren oder die ostinate Wiederholung einzelner Parameter. 7 Brief an Ferruccio Busoni, 13. (?) August 1909 (Theurich: 1977, 171). 8 „Die Komposition mit zwölf Tönen hat kein anderes Ziel als Faßlichkeit“ (Schönberg: 1976, 73). „Wenn die Faßlichkeit auf der einen Seite erschwert wird, muß sie auf der andren erleichtert werden. In der neuen Musik sind die Zusammenklänge und die Melodie-Intervalle und ihre Folgen oft schwer faßlich. Darum muß eine Form gewählt werden, welche auf der anderen Seite Erleichterung schafft, indem sie einen bekannten Ablauf herstellt“ (Notiz Schönbergs über Die alten Formen in der neuen Musik, Arnold Schönberg Center Wien, T35.18, veröffentlicht bei Blumröder: 1982, 101). Zur Problematik des Begriffs Fasslichkeit siehe Eybl: 2004, 61–64. 9 Unter Parametern versteht man üblicherweise einfache oder komplexe Toneigenschaften wie Tonhöhe, Tondauer, Lautstärke und Klangfarbe. Um den Begriff analytisch fruchtbar zu machen, empfiehlt es sich, auch Artikulation und als komplexen Parameter den Gestus hinzuzufügen. Komplex meint dabei zweierlei: Ein Gestus kann aus mehr als einem Ton bestehen, und er fasst mehrere Parameter in sich zusammen, Intervallrichtung, relative Intervallgröße und Artikulation.
Hören und Gedächtnis in Schönbergs Ästhetik
273
Hat nun also in Schönbergs dritter Schaffensperiode das Gedächtnis seinen alten Platz im Vorgang des musikalischen Hörens wieder erlangt? Verfahren Zwölftonkompositionen auf analoge Weise thematisch wie etwa die Musik Beethovens? Wohl kaum. Denn die äußere Ordnung kann bei Schönberg nicht für sich stehen, sie braucht das Netz subthematischer Beziehungen.10 Die Beziehungen auf der Ebene der Form sind zu löchrig. Es herrscht für Hörerin und Hörer zu viel Unklarheit zwischen einzelnen markanten Punkten. Man bemerkt A, man bemerkt B, kann jedoch den Weg zwischen A und B nicht nachvollziehen. Aber man hat gelernt und vertraut darauf, dass eine, wenn nicht hörbare, so doch sichtbare Verbindung zwischen beiden Punkten existiert. So verweist die äußere Ordnung auf die innere. Ein vergleichbares Hörmuster verlangt übrigens die Programmmusik, zumindest dort, wo überraschende Wendungen oder unerwartete Zäsuren keine innermusikalische Ursache erkennen lassen. Man nimmt hörend die einzelnen Stationen wahr. Doch nur für den, der den Plot über ein anderes Medium kennt, fügen sich die Details zu einem kohärenten Ganzen. Abschließend sei angedeutet, wie die hier vorgetragenen Überlegungen sich in Analyse von Musik umsetzen lassen sollten. Die These, dass das Funktionsgedächtnis des Hörers den Ablauf von Schönbergs Musik nicht mehr als kohärenten Prozess rekonstruieren kann, wäre durch eine Analyse der äußeren Ordnung zu überprüfen. Man hätte sich dabei auf die Wiederholung von Gestalten durch Koppelung von Parametern, weiters auf Beziehungen von Rhythmus und Syntax zu konzentrieren. Lässt sich auf dieser Basis integrieren, was den Zusammenhang bedroht? Lassen sich die Brüche und Diskontinuitäten in dieser Musik von den hörbaren Zusammenhängen aus erklären? Man nähert sich solcherart einem äußerst diffizilen Problem, der systematischen Frage nämlich, was denn hörbare musikalische Kohärenz überhaupt ausmacht. Die Korrelation von Gedächtnis und Kohärenz weist weit über Schönbergs Ästhetik hinaus. Sie verweist auf ein Kernproblem der Moderne, einen prekären Schnittpunkt von Wissenschaft und Kunst, von Psychologie, Erkenntnistheorie und Ästhetik.
10 Zu einem ähnlichen Schluss gelangt Martina Sichardt bei einer partiellen Analyse von Schönbergs 4. Streichquartett op. 37: In der Sonatenform des ersten Satzes lenke nicht die Dynamik der Sonatenelemente den Formprozess, sondern die Reihenstruktur (Sichardt: 1996, 168).
274
Martin Eybl
Literatur Theodor W. Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen (1962), in: Gesammelte Schriften, Bd. 14, Frankfurt a. M. 1975, 169–433. Aleida Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München 1999. Henri Bergson, Materie und Gedächtnis und andere Schriften, Frankfurt a. M. 1964. Christoph von Blumröder, Schoenberg and the Concept of „New Music“, in: Journal of the Arnold Schoenberg Institute 6/1 (1982), 96–105. Regina Busch, Über die horizontale und vertikale Darstellung musikalischer Gedanken und den musikalischen Raum, in: Heinz-Klaus Metzger/Rainer Riehn (Hrsg.), MusikKonzepte. Sonderband Anton Webern I, München 1983, 225–250. Michael Cherlin, Motive and Memory in Schoenberg’s First Quartet, in: Reinhold Brinkmann, Christoph Wolff (Hrsg.), Music of My Future. The Schoenberg Quartets and Trio, Cambridge (MA) 2000 (Isham Library Papers, 5), 61–80. Martin Eybl (Hrsg.), Die Befreiung des Augenblicks. Schönbergs Skandalkonzerte von 1907 und 1908. Eine Dokumentation, Wien 2004 (Wiener Veröffentlichungen zur Musikgeschichte, 4). Áine Heneghan, Tradition as Muse. Schoenberg’s Musical Morphology and Nascent Dodecaphony, PhD Diss. University of Dublin 2006. Albert Jakobik, Arnold Schönberg. Die verräumlichte Zeit, Regensburg 1983 (Perspektiven zur Musikpädagogik und Musikwissenschaft, 6). Arnold Schönberg, Harmonielehre, Leipzig, Wien 1911. Arnold Schoenberg, Style and Idea. Selected Writings (1975), hrsg. von Leonard Stein, übers. von Leo Black, 2. Aufl. Berkeley 1984. Arnold Schönberg, Stil und Gedanke. Aufsätze zur Musik, hrsg. von Ivan Vojtěch, o.O. 1976. Jennifer R. Shaw, Schoenberg’s Choral Symphony, Die Jakobsleiter, and Other Wartime Fragments, PhD Diss. State University of New York, Stony Brook 2002. Martina Sichardt, Die Entstehung der Zwölftonmethode Arnold Schönbergs, Mainz u.a. 1990. Martina Sichardt, Musikalische Sprache – musikalischer Raum. Zur Strukturierung der musikalischen Zeit in der Musik Arnold Schönbergs, in: Rudolf Stephan / Sigrid Wiesmann (Hrsg.), Arnold Schönberg – Neuerer der Musik. Bericht über den 3. Kongreß der Internationalen Schönberg-Gesellschaft, Duisburg 1993, Wien 1996, 162–170. Claudio Spies, „Vortrag / 12 T K / Princeton“, in: Perspectives of New Music 13 (Fall–Winter 1974), 58–136. Rudolf Stephan, Ein frühes Dokument zur Entstehung der Zwölftonkomposition, in: Gerhard Allroggen/Detlef Altenburg (Hrsg.), Festschrift Arno Forchert zum 60. Geburtstag am 29. Dezember 1985, Kassel u.a. 1986, 296–302. Jutta Theurich, Briefwechsel zwischen Arnold Schönberg und Ferruccio Busoni 1903–1919 (1927), in: Beiträge zur Musikwissenschaft 19 (1977), 163–211. Karl H. Wörner, Das Zeitalter der thematischen Prozesse in der Geschichte der Musik, Regensburg 1969.
Medialisierung eines Mythos: Das Bild Lulus bei Alban Berg
275
Kordula Knaus Medialisierung eines Mythos: das Bild Lulus bei Alban Berg
Am Beginn von Frank Wedekinds Drama Erdgeist, dem ersten der beiden sogenannten Lulu-Dramen, unterhalten sich zwei Männer, der Maler Walter Schwarz und Dr. Ludwig Schön, über Lulus Bild als Pierrot, das ihr Ehemann, der Medizinalrat Dr. Goll, beim Maler in Auftrag gegeben hat. In dieser Szene fallen zwei Begriffe, die jene entgegengesetzten Pole markieren, innerhalb derer Zuschreibungen Lulus im Laufe des Stückes stattfinden. Der Maler Schwarz spricht von Lulu als „Engelskind“, Dr. Schön bezeichnet sie als „Teufelsschönheit“ (Wedekind: 1913, 408f.). Da Lulu selbst im Stück Wedekinds erst in der nachfolgenden Szene auftritt, ist sie in der Wahrnehmung des Publikums als erstes nur Bild. Sie existiert nur innerhalb jener Parameter, in denen die Männer von ihr sprechen; innerhalb jener Eigenschaften, die Schwarz und Schön ihr anhand des bildlichen Eindruckes zuschreiben. Lulus Bild spielt auch im weiteren Verlauf der beiden Lulu-Dramen eine gewichtige Rolle, indem es in beinahe allen Akten in das Bühnenbild integriert ist und im letzten Akt der Büchse der Pandora schließlich Signum dafür wird, wie sehr sich die reale Lulu von ihrer Ikone entfernt hat. Als Bühnenfigur ist Lulu ein Bild. Als Bild ist sie ein Medium. Lulu als Medium vermittelt zwischen einem begehrenden Subjekt und dessen Wunschvorstellungen, die in eine medialisierte Lulu eingeschrieben werden. Die Medialisierung Lulus funktioniert in den Dramen auf zwei Ebenen: einerseits durch das konkrete Bild, das in der ersten Szene des Erdgeist von Lulu gemalt wird, andererseits durch das imaginierte Bild, das sich die anderen Handlungspersonen von Lulu machen beziehungsweise das sich Lulu von sich selbst macht. Die Verbindung zwischen erster und zweiter Ebene wird bei Wedekind durch das Gespräch zwischen Schwarz und Schön am Beginn des Stückes zwar etabliert, danach im Stück aber kaum weitergeführt. Wenn bei Wedekind über das Bild Lulus gesprochen wird, dann geht es tatsächlich nur um das konkrete gemalte Bild, wohingegen die Bilder, die sich die Handlungsfiguren von Lulu machen, unabhängig vom Gegenstand Bild verbal formuliert werden. In den 1920er-Jahren – also etwa dreißig Jahre nach dem Entstehen der ersten Fassung der Lulu-Dramen – beginnt Alban Berg eine Oper über die beiden Dramen
276
Kordula Knaus
Wedekinds1 zu schreiben. In Bergs Oper findet ein merklich anderer Umgang mit der Medialisierung Lulus statt, der in erster Linie mittels einer durchgehenden Verschränkung der Ebene des konkreten Bildes und jener der Vorstellungsebene operiert. Die folgenden Ausführungen möchten diesem Umstand nachspüren und zeigen, welche Konsequenzen für Lulu als Handlungsfigur daraus zu ziehen sind. Anschließend sollen mögliche Erklärungen für diese veränderte Medialisierung Bergs in zeithistorischen Kontexten aufgefunden und damit die Frage nach dem Einfluss eines Modernisierungsprozesses auf die Oper Lulu beantwortet werden. Der im Vergleich zu den Dramen Wedekinds veränderte Umgang Bergs mit Lulus Bild zeigt sich bereits auf der Ebene des konkreten Bildes. Dieses erfährt schon in den Szenenanweisungen der Oper durch die tragende Rolle, die dem Blick auf Lulus Bild zukommt, eine signifikant stärkere Fokussierung. Stellvertretend für das gesamte Stück seien hier die entsprechenden Szenenanweisungen für den ersten Akt der Oper genannt (Berg: 1985): Takt
Person
Text und Regieanweisung
T.96
Alwa
Lulu und das Bild miteinander vergleichend „Wenn ich Sie doch nur für meine Hauptrolle engagieren könnte!“
T.483
Schigolch
Lulus Porträt erblickend „Das bist ja Du, Du, ja Du!“
T.882
Alwa
„[...] sie zieht sich um.“ unwillkürlich ihr Bild mit den Blicken streifend.
T.1099
Alwa
„Über die ließe sich freilich eine interessante Oper schreiben.“ vor dem Plakat stehend.
T.1105
Alwa
wieder beim Bild „Zweite Szene: Der Maler ...“
T.1115
Prinz
mit Hinweis auf ihr Bild „Ich hatte bei Herrn Doktor Schön das Vergnügen der Künstlerin vorgestellt zu werden.“
T.1120
Alwa
mit Hinweis auf ihr Bild „Mein Vater hat sie durch einige Besprechungen in seiner Zeitung beim Publikum eingeführt.“
T.1133
Prinz
mit Beziehung auf das Bild „ [...] ihre körperliche und seelische Vornehmheit.“
T.1145
Prinz
wieder mit Hinweis auf das Bild „ [...] einen Mann über alles glücklich machen.“
1 Berg zieht die Ausgabe der Gesammelten Werke Frank Wedekinds von 1913 für seine Bearbeitung heran, vgl. Wedekind: 1996a und Wedekind: 1996b.
Medialisierung eines Mythos: Das Bild Lulus bei Alban Berg
277
Von diesen zehn Erwähnungen des Bildes in den Regieanweisungen des ersten Aktes der Oper stammt nur eine aus den ursprünglichen Szenenanweisungen in den Dramen Wedekinds. Dabei handelt es sich um Schigolchs Blick auf das Bild, während er sich in der Wohnung Lulus umsieht, also das Bild tatsächlich das erste Mal erblickt und dazu meint „Das bist ja Du, Du, ja Du!“. Der Blick auf Lulus Bild ist hierbei konkret auf das Erkennen des Bildes gerichtet. In den von Berg hinzugefügten Szenenanweisungen hingegen geschieht der Blick auf Lulus Bild meist unabhängig von der tatsächlich auf dem Bild gemalten Figur. Die Handlungspersonen reden mit dem Blick auf Lulus Bild über Lulu, denken über sie nach oder lassen sich von dem Bild inspirieren, ohne sich dabei auf das Bild selbst zu beziehen. Vielmehr fungiert der Blick auf das Bild hier als szenisch fassbares Zeichen für die Vorstellungen, die einzelne Figuren von Lulu besitzen. Bereits in der Verwendung der Szenenanweisungen durch Berg zeigt sich so der Zusammenhang von Bildebene und Vorstellungsebene. Der Blick auf das Bild wird zur szenischen Metapher für die Imaginationen Lulus. Parallel zur vermehrten szenischen Referenz auf Lulus Bild setzt Berg die sogenannten Bildakkorde als musikalisches Gestaltungsmittel für das Bild Lulus ein: (Vgl. etwa Redlich: 1957, Reich: 1963, Reiter: 1973, Perle: 1985). Diese ergeben sich aus einer vertikal orientierten Reihung der Grundreihe der Oper.
Notenbeispiel 1: Grundreihe
Notenbeispiel 2: Bildakkorde, aus der Grundreihe abgeleitet
278
Kordula Knaus
Aus der horizontalen Auflösung dieser Akkorde in eine Reihe lässt sich wiederum die Lulureihe ableiten:
Notenbeispiel 3: Lulureihe
Aus dieser Genealogie resultiert, dass (wie in der Forschungsliteratur vermehrt beobachtet) die Lulu zugewiesene Reihe – also ihre Personalreihe – erst aus der Formierung der Bildakkorde entsteht und sich nicht wie die Reihen Alwas oder Schöns etwa direkt aus der Grundreihe ableitet (vgl. Reiter: 1973, 19f., Perle: 1985, 109–111). Damit hängt Lulu musikalisch von ihrem Bild ab und kann nur durch dieses existieren. Diese musikalische Abhängigkeit stellt gleichsam die Analogie zur szenischen Verbindung zwischen Bild und Person dar. Auffallend ist außerdem die beinahe ausschließliche Instrumentation der Bildakkorde durch die Hörner, wobei die akkordische Verwendung der Hörner in der Oper insgesamt in signifikanter Verbindung zu Lulus Vergangenheit, Identität und Körperlichkeit steht.2 Wie diese szenisch-musikalische Bildmetapher im Werk selbst funktioniert, soll nun anhand deren Anwendung in der dritten Szene des ersten Aktes erläutert werden. In diese Szene fallen sechs der bereits erwähnten zehn Szenenanweisungen zum Bild im ersten Akt der Oper. Diese wiederum finden sich innerhalb von lediglich 55 Takten, die daher für eine detaillierte Analyse besonders interessant erscheinen. Die in der Theatergarderobe stattfindende dritte Szene des ersten Aktes besteht, inhaltlich umrissen, aus dem Dialog Lulus mit Alwa bevor Lulu auf die Bühne geht, dem Monolog Alwas beziehungsweise dem Dialog zwischen Alwa und dem Prinzen während ihres Bühnenauftritts, der Ensembleszene nach Lulus abgebrochenem Tanzauftritt und dem abschließenden Dialog zwischen Lulu und Dr. Schön, in welchem Schön sich ihr unterwirft. Das Bild spielt dabei im Monolog Alwas und im Dialog zwischen Alwa und dem Prinzen eine gewichtige Rolle – also in eben jenen beiden Abschnitten der Szene, in denen Lulu nicht anwesend ist. Der Text für diese Passage lautet: 2 Die Hörner spielen etwa im Duett Lulus mit dem Maler im ersten Akt zu Lulus Worten „Ich weiß es nicht.“ und des Malers „Sie weiß es nicht.“ eine prominente Rolle, in der zweiten Szene in den Takten 424–427 und 432–435 in Verbindung mit Liebkosungen des Malers an Lulu, in Lulus kurzem Monolog vor dem Auftritt Schigolchs bei den Worten „Du…Du…“ (Takt 445–448) und in der Monoritmica bei der Enthüllung von Lulus Vergangenheit (Takt 693–700).
Medialisierung eines Mythos: Das Bild Lulus bei Alban Berg
279
„ALWA: Über die ließe sich freilich eine interessante Oper schreiben. (vor dem Plakat stehend) Erste Szene: Der Medizinalrat … Schon faul! (Langanhaltendes, stark gedämpftes Klatschen und Bravorufen wird von außen hörbar) Das tobt, wie in der Menagerie, wenn das Futter vor dem Käfig erscheint. (wieder beim Bild) Zweite Szene: Der Maler … Noch unmöglicher! – Dritte Szene: Sollte es wirklich so weitergehn? PRINZ (tritt ein, tut als ob er zuhause wäre.) Ich hatte bei Herrn Doktor Schön (mit Hinweis auf ihr Bild) das Vergnügen, der Künstlerin vorgestellt zu werden. ALWA (sich leicht verneigend) Mein Vater hat sie durch einige Besprechungen (mit Hinweis auf ihr Bild) in seiner Zeitung beim Publikum eingeführt. PRINZ (setzt sich) Würden Sie es für möglich halten, daß ich sie zuerst für eine junge Dame der literarischen Gesellschaft hielt? Was mich zu ihr hinzieht, ist nicht ihr Tanz, es ist ihre körperliche (mit Beziehung auf das Bild) und seelische Vornehmheit. – Ich habe während zehn Abenden ihr Seelenleben aus ihrem Tanz studiert, bis ich heute vollkommen mit mir ins Klare kam: Sie ist das verkörperte Lebensglück. Als Gattin wird sie einen Mann (wieder mit Hinweis auf das Bild) über alles glücklich machen. (vor sich hin) Als meine Gattin…“ (Berg: 1985, 260–272).
Der Abschnitt ist inhaltlich in drei Teile zu gliedern. Zuerst monologisiert Alwa über eine Oper, die er über Lulu schreiben könnte, wobei er seine Inspiration offensichtlich aus dem Bild Lulus gewinnt. Im zweiten Abschnitt teilen sich der Prinz und Alwa gegenseitig ihre Beziehung zu Lulu mit dem Hinweis auf ihr Bild mit und im dritten Abschnitt analysiert der Prinz Lulu über das Bild. In der gesamten Passage beziehen sich die szenischen Anweisungen zum Bild demnach nicht auf das konkrete Bild (d.h. es wird nicht darüber gesprochen, wie das Bild gemalt ist oder wie Lulu auf dem Bild aussieht), sondern sie beziehen sich auf Lulu selbst oder die Vorstellungen, die sich Alwa und der Prinz von Lulu machen. Der Blick auf Lulus Bild wird dabei von Berg nicht immer musikalisch durch die Bildakkorde sondern auch durch verschiedene Varianten ausgedrückt, beziehungsweise treten die Bildakkorde auch einmal dort auf, wo es keinen szenischen Verweis auf das Bild gibt. Eine Analyse bringt folgendes Ergebnis:
Takt
Text
Musikalische Gestaltung
T.1099
ALWA: „Über die ließe sich freilich eine interessante Oper schreiben.“ (vor dem Plakat stehend)
Variante der Bildakkorde in Hörnern/ Streichern: Ton 1 und 6 vertauscht, Akkordreihenfolge 1, 2, 4, 3. Töne vertikal vertauscht.
T.1105
ALWA: (wieder beim Bild) „Zweite Szene: Der Maler …“
Originalgestalt, Bildakkorde in den Hörnern.
280
Kordula Knaus
T.1115
PRINZ: „Ich hatte bei Herrn Doktor Schön (mit Hinweis auf ihr Bild) das Vergnügen, der Künstlerin vorgestellt zu werden.“
Originalgestalt, Bildakkorde in den Hörnern.
T.1120
ALWA: „Mein Vater hat sie durch einige Besprechungen (mit Hinweis auf ihr Bild) in seiner Zeitung beim Publikum eingeführt.“
Variante der Bildakkorde in den Hörnern, Ton 1 und 6 vertauscht, Akkordreihenfolge 2, 1, 4, 3. Töne vertikal vertauscht.
T.1129
PRINZ: „Was mich zu ihr hinzieht.“
Originalgestalt Bildakkorde, in Hörnern, 2x Ton 8, 9 fehlt.
T.1133
PRINZ: „Es ist ihre körperliche (mit Beziehung auf das Bild) und seelische Vornehmheit.“
„Umkehrung“: Bildakkorde in Holzbläsern, aus der Umkehrung der Lulureihe gebildet.
T.1145
PRINZ: „Als Gattin wird sie einen (wieder mit Hinweis auf das Bild) Mann über alles glücklich machen.“
keine Bildakkorde aber Umkehrung der Lulureihe in Flöte, Fagott und Hörnern.
Alwas Verhältnis zu Lulu und ihrem Bild in dieser Szene kann nicht unabhängig von der Etablierung des musikalischen Materials am Beginn der Oper gesehen werden. In der ersten Szene der Oper, in der Alwa Lulu mit ihrem Bild vergleicht, werden auch die Bildakkorde erstmals eingeführt. Während Alwa Lulus Bild betrachtend meint „Wenn ich Sie doch nur für meine Hauptrolle engagieren könnte!“ erklingen die Bildakkorde zuerst in den Streichern leicht versetzt, dann in Streichern und Holzbläsern in Achtelnoten gemeinsam. Die szenische Bezugnahme auf Lulus Bild wird somit auch direkt musikalisch ausgedrückt. Die Bildakkorde treten jedoch bereits unmittelbar vor dieser Passage in den Streichern ebenfalls zu einer Textstelle Alwas auf, die lautet: „Seh’ ich recht? Frau Medizinalrat! (Verbeugung)“ (Berg: 1985, 28). Die Bildakkorde werden hier in jenem Moment gebraucht, in dem Alwa Lulu selbst begrüßt und sich gerade nicht auf ihr Bild bezieht. Für Alwa scheinen damit bereits am Beginn der Oper die Figur Lulu und ihr Bild nicht voneinander unterscheidbar zu sein. Lulu wird nicht erst zum Bild, wenn ihr Bild tatsächlich als Gegenstand eine Rolle spielt, sondern sie trägt das Merkmal der Bildlichkeit von Anbeginn in sich. Lulus Bildlichkeit steht dabei für Alwa sowohl in dieser Passage als auch am Beginn der dritten Szene in Verbindung zu seinem künstlerischen Schaffen. Will er sie hier für eine Hauptrolle engagieren, so soll ihr Leben dort den Stoff für eine Oper hergeben. Dass die Bildakkorde in der Szene der Theatergarderobe bei Alwas Blick auf Lulus Bild nur einmal in
Medialisierung eines Mythos: Das Bild Lulus bei Alban Berg
281
Originalgestalt – die sich hier außerdem explizit auf den Maler bezieht, für den die Bildakkorde in der Verführung Lulus in der ersten Szene konstitutiv waren – erscheinen und zweimal in einer Variante, kann darauf hindeuten, Alwas Bild von Lulu wäre im Verlauf des ersten Aktes einer Veränderung unterlegen.3 Der Prinz wird in der dritten Szene des ersten Aktes das erste Mal in das Handlungsgeschehen eingeführt, wobei der erste szenische Hinweis des Prinzen auf das Bild dabei ebenso wie bei Alwa durch die Bildakkorde gestaltet ist. Das zweite Mal treten die Bildakkorde dann aber an einer Stelle auf, wo sich der Prinz szenisch nicht auf das Bild bezieht. Wenn die Bildakkorde in dem Augenblick verwendet werden, in dem der Prinz Alwa gegenüber erläutert „Was mich zu ihr hinzieht …“, dann verdeutlicht dies, dass die Anziehung, die Lulu auf den Prinzen ausübt, offensichtlich von dem Bild ausgeht, das er sich von ihr macht. In seinen darauf folgenden Beschreibungen von Lulus Anziehungskraft rekurriert er zwar szenischoptisch wieder auf das Bild, Berg verzichtet dann allerdings auf die entsprechende musikalische Gestaltung durch die Bildakkorde. Stattdessen erklingt das eine Mal eine Art Umkehrung der Bildakkorde, die auf der Umkehrung der Lulureihe basiert und das andere Mal lediglich eine unzusammenhängende Akkordfolge aus dem Material der Umkehrung der Lulureihe. Die Anbindung des Blickes auf das Bild an die Bildakkorde wird so zunehmend aufgegeben und die Ebenen von Lulu als Person und Lulu als Bild vermischen sich. Dies geschieht vor allem durch die Unschärfenrelation zwischen szenischer Metapher und ihrer musikalischen Gestaltung, in der einerseits Lulu als Bild unabhängig vom Bild musikalisch umgesetzt wird und andererseits Lulu selbst die musikalische Position des Bildes einnimmt. Diese Verdichtung der Ebenen von Bild und Person führt zu einer gesteigerten Bildlichkeit an sich, die sich vom Gegenstand Bild löst. Berg wählt in der besprochenen dritten Szene des ersten Aktes dabei ein explizit zeitgenössisches Medium für Lulus Bild. Es ist hier nicht als gemaltes Bild wie in den anderen Szenen auf der Bühne platziert, sondern hängt als Reproduktion in Form eines Plakates mit Aufschrift an der Wand. Lulus Bild wird somit durch Plakate offensichtlich massenmedial ausgeschlachtet und dient jenen Werbezwecken, die Alwa auch anspricht, wenn er von den Besprechungen der Tanzaufführungen Lulus in Dr. Schöns Zeitung spricht. Doch nicht nur auf diese konkrete Art und Weise ist Lulus Bild innerhalb zeitgenössischer Wahrnehmungsparadigmen positioniert, sondern auch insgesamt erscheint die gesteigerte Bildlichkeit Lulus in der Oper Bergs als eine Konsequenz der Medienentwicklung der ersten Jahrzehnte 3 Diese Veränderung geht einher mit der sich im Laufe des ersten Aktes verändernden Beziehung zwischen Alwa und Lulu, die durch die dazwischenliegenden Ereignisse bestimmt ist (etwa den Tod des Malers, das Auftreten Lulus in einem Stück Alwas etc.).
282
Kordula Knaus
des 20. Jahrhunderts. Die visuellen Medien erhielten zwar bereits mit der Entwicklung der Fotografie im 19. Jahrhundert einen wesentlichen Impuls, doch kam es gerade zur Zeit der Entstehung von Bergs Oper zu weitreichenden Veränderungen, wodurch die visuellen Medien insgesamt zu einem Phänomen der Massenkultur wurden. Drei Faktoren scheinen für dieses veränderte visuelle Medienverständnis ausschlaggebend:4 Zum Ersten kam es um 1900 zur Etablierung der Amateurfotografie, die vor allem durch die Einführung der fotografischen Handapparate Aufschwung erfuhr. Große Popularität erlangten etwa die „Folding Pocket“-Kameras von Eastman Kodak, für die bewusst mit der Handlichkeit und Kleinheit des Produkts geworben wurde. Damit trat sowohl eine Mobilisierung des Bildes ein als auch – bedingt durch die wesentlich kürzere Belichtungszeit – eine Tendenz zur Momentaufnahme. Fotos konnten von nun an jederzeit und an jedem Ort ohne größeren Aufwand an Zeit oder Vorbereitung geschossen werden. Die Wirklichkeit war im Bild verfügbar, wodurch der fotografische Blick zum Bestandteil der Alltagskultur wurde. Der zweite Faktor betrifft den veränderten Umgang mit dem Bild in den Printmedien. Nach dem Ersten Weltkrieg kam es generell zu einer Steigerung der Anzahl und Auflagen von Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierten und politischen Blättern, innerhalb derer das Bildmaterial wiederum eine größere Rolle zugewiesen bekam. Schließlich veränderten sich die visuellen Medien essentiell durch die Entwicklung des Films im beginnenden 20. Jahrhundert, der sich bald an die Spitze der medialen Unterhaltungskultur setzte. Kann also für die Entwicklung der visuellen Medien um und nach 1900 von einer veränderten Wahrnehmungsperspektive gesprochen werden, die Teil eines Modernisierungsprozesses ist, so ist die Bildlichkeit Lulus bei Alban Berg künstlerisches Produkt derselben. Als ein weiterer Aspekt des Zusammenhangs zwischen kulturellem und künstlerischem Ausdruck erscheint die Tatsache relevant, dass die Verbindung von Visualität und Sexualität eben am Beginn des 20. Jahrhunderts und somit zur Entstehungszeit von Bergs Oper durch die Psychoanalyse Siegmund Freuds zum Gegenstand des intellektuellen Diskurses wird. Bereits in den Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie von 1905 etabliert Freud das „sexuell betonte Schauen“ als „intermediäres Sexualziel“ und weist ihm einen prominenten Platz zu (Freud: 2004, 59): Der optische Eindruck bleibt der Weg, auf dem die libidinöse Erregung am häufigsten geweckt wird und auf dessen Gangbarkeit – wenn dieses teleologische Betrachtungsweise zulässig ist – die Zuchtwahl rechnet, indem sie das Sexualobjekt sich zur Schönheit entwickeln lässt. 4 Zu den folgenden Ausführungen über die Entwicklung der Fotografie vgl. Jürgens-Kirchhoff: 1988; Abring: 1989; Kuchenbuch: 1992; Martin: 1996; Schanze: 2001.
Medialisierung eines Mythos: Das Bild Lulus bei Alban Berg
283
Freuds Modelle der Schaulust und der Fetischisierung eines Gegenstandes manifestieren sich durchwegs im Werk Bergs durch den Blick auf Lulus Bild. Für die Oper scheint dabei jedoch weniger bedeutsam, dass über den psychoanalytischen Diskurs, der sich in der Folge im 20. Jahrhunderts als eine der prominentesten Denkfiguren darstellt5, die Verbindung von Blick, Begehren und Frau theoretisierbar ist; sondern relevant scheint vielmehr, dass der spezifische szenisch-musikalische Ausdruck von Bildlichkeit auf dieselben Paradigmen zurückzuführen ist, denen auch der psychoanalytische Diskurs gehorcht. Die Medialisierung Lulus in der Oper Alban Bergs verdeutlicht, wie das Werk innerhalb kultureller Muster der „Moderne“ agiert. Einerseits tritt durch die verstärkte Referenz auf Lulus Bild eine Fetischisierung ein, die sich gleichzeitig vom Gegenstand des Bildes loslöst und sich auf die Ebene des Imaginativen verlagert. Die Zusammenhänge zwischen Bild und Imagination gehen dabei mit den zeitgenössischen Erkenntnissen Siegmund Freuds in der Psychoanalyse einher. Andererseits ist die verstärkte Bildlichkeit auf ein generell verändertes visuelles Medienverständnis des beginnenden 20. Jahrhunderts zurückzuführen. Lulu ist ein „modernes“ Werk, nicht nur und lediglich, weil Berg kompositionstechnisch die damals innovative Zwölftonmethode verwendet, sondern auch und vor allem, weil sich kulturelle Phänomene in dem Werk widerspiegeln. Die Figur Lulu wird dabei zum „modernen“ Medium.
5 Dieser Diskurs spielt in der feministischen kunst- und kulturwissenschaftlichen Diskussion – aber nicht nur hier – bis heute eine große Rolle. Für die vorliegenden Ausführungen sei besonders auf die Analyse statischer und bewegter Bilder in der Kunstwissenschaft (etwa Eiblmayr: 1993) oder Filmwissenschaft (etwa Mulvey: 1989) verwiesen. Jane Flax (1990, 16) formuliert die Zusammenhänge zwischen Psychoanalyse, Feminismus und Postmoderne folgendermaßen: „For all its shortcomings psychoanalysis presents the best and most promising theories of how a self that is simultaneously embodied, social, ‚fictional‘, and real comes to be, changes, and persists over time. Psychoanalysis has much to teach us about the nature, constitution, and limits of knowledge. Furthermore, often unintentionally, it reveals much about what Freud calls the ‚riddle of sex‘ and the centrality of this riddle to the formation of a self, knowledge, and culture as a whole.“
284
Kordula Knaus
Literatur Hans-Dieter Abring, Von Daguerre bis heute, Herne 1989. Alban Berg, Lulu. Oper nach Frank Wedekinds Tragödien „Erdgeist“ und „Büchse der Pandora“, Partitur (I. und II. Akt), hrsg. von Hans Erich Apostel 1963, revidiert von Friedrich Cerha, Wien 1985. Silvia Eiblmayr, Die Frau als Bild. Der weibliche Körper in der Kunst des 20. Jahrhunderts, Berlin 1993. Jane Flax, Thinking Fragments. Psychoanalysis, Feminism and Postmodernism in the Contemporary West, Berkeley, Los Angeles, Oxford 1990. Sigmund Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 8. Auflage Frankfurt a. M. 2004. Annegret Jürgens-Kirchhoff, Malerei – Fotographie – Fotomontage. Bildende Künste in der Weimarer Republik, in: Irene Lusk (Hrsg.), Die wilden Zwanziger. Weimar und die Welt 1919–1933, Hamburg 1988, 195–206. Thomas Kuchenbuch, Die Welt um 1900. Unterhaltungs- und Technikkultur, Stuttgart, Weimar 1992. Dieter Martin, Spaziergang durch die Geschichte der Fotografie, Hamburg 1996. Laura Mulvey, Visual and other Pleasures, Bloomington, Indianapolis 1989. George Perle, The Operas of Alban Berg. Volume Two, „Lulu“, Berkeley, Los Angeles, London 1985. Manfred Reiter, Die Zwölftontechnik in Alban Bergs Oper „Lulu“, Regensburg 1973 (Kölner Beiträge zur Musikforschung, 71). Helmut Schanze (Hrsg.), Handbuch der Mediengeschichte, Stuttgart 2001. Frank Wedekind, Erdgeist. Tragödie in vier Aufzügen (1913), in: Frank Wedekind: Werke. Kritische Studienausgabe, Bd 3/I, hrsg. von Hartmut Vinçon, Darmstadt 1996a, 401–476. Frank Wedekind, Die Büchse der Pandora. Tragödie in drei Aufzügen (1913), in: Frank Wedekind: Werke. Kritische Studienausgabe, Bd 3/I, hrsg. von Hartmut Vinçon, Darmstadt 1996b, 541–613.
Der Komponist Giuseppe Sinopoli und die Wiener Moderne
287
Ulrike Kienzle Entropie der Erinnerung. Der Komponist Giuseppe Sinopoli und die Wiener Moderne
War dies Klingsors Garten? Hätte Kundry hier vielleicht das Zauberkraut finden können, um Amfortas zu heilen? Diese Mauer schuf Distanz und verbarg etwas; ist das etwa nicht die Wirkung, die Raum und Zeit auf unser Bewusstsein haben? Über diese Mauer zu springen, sie einzureißen, ist, als sprenge man Zeit und Raum und damit die Grenzen der Logik und des Kausalitätsprinzips, die vergoldeten, beruhigenden Gefängnisse der Rationalität. Die Rationalität ist eine Mauer, die schützt, aber Distanz schafft und Dinge verbirgt (Sinopoli: 2001, 75).
Die Faszinationskraft des Verborgenen hat Giuseppe Sinopoli ein Leben lang umgetrieben – seien es die von Mauern geschützten Gärten seiner Geburtsstadt Venedig, deren verwinkelte Gassen und Kanäle ihm zur initiatischen Erfahrung wurden; seien es die verborgenen Botschaften der Partituren von Strauss und Schönberg, von Wagner und Webern, die er in seinen Interpretationen zu entschlüsseln suchte, seien es die Tonscherben in der Wüste, nach denen er gegraben hat und die ihm den Weg zu einer heute verlorenen Erkenntnis der Transzendenz weisen sollten. Auch seine eigenen Kompositionen spielen mit der Faszinationskraft des Verborgenen. Sie erinnern an die „Zaubergärten“ seiner nächtlichen venezianischen Reise, die er in seinem Buch Parsifal in Venedig beschreibt. Er vergleicht diese unzugänglichen Gärten mit den ersten Mauerwällen im antiken Mesopotamien: „In dem Augenblick“ ihrer Erbauung „wurde die Rationalität geboren. Man begann, alles einzuzäunen: den Tempel, dann die Stadt, zuletzt auch den Himmel; die Sterne entfernten sich immer mehr, und ihre Gesetze blieben unverständlich“ (Sinopoli: 2001, 76). Rationalität – davon ist Sinopoli überzeugt – ist „eine Mauer, die schützt“. Aber dieser Schutz setzt zugleich eine unzulässige Begrenzung, die es verhindert, dass wir zum „Wesen der Dinge“ durchstoßen können. Auch Sinopoli selbst hat in seinen kompositorischen Anfängen den musikalischen Horizont durch Rationalität begrenzt und seine „Zaubergärten“ abgesteckt. Er hat dann den Sprung über die Mauer gewagt und die „vergoldeten, beruhigenden Gefängnisse der Rationalität“ verlassen – ein Wagnis, das letztlich nicht nur das Verstummen Sinopolis als Komponist nach sich zog, sondern ihm zugleich neue Horizonte erschloss – in der fremden Welt der alten Kulturen. Eine
288
Ulrike Kienzle
wichtige Station auf diesem Weg war die Auseinandersetzung mit der Musik der Wiener Moderne, die sich in Sinopolis späten Kompositionen spiegelt. Sie schreiten die Grenzen der Rationalität aus und reißen sie ein. Am Schluss steht die Wendung nicht ins Ir-Rationale, sondern – auf diese Unterscheidung legte er großen Wert – ins A-Rationale, in eine Denkform, die in den alten Kulturen lebendig war und die wieder zu erneuern eines seiner Hauptanliegen gewesen ist.
Im Cartesianischen Labyrinth Der Komponist Giuseppe Sinopoli ist heute weitgehend unbekannt. Der Erfolg des Dirigenten hat den Ruhm des Komponisten nicht nur überschattet, sondern fast vollständig zum Verschwinden gebracht. Sinopoli selbst war daran keineswegs unschuldig, hat er doch – mit Ausnahme seiner beiden Suiten aus der Oper Lou Salomé – kein einziges seiner Werke auf CD eingespielt und sich nur äußerst selten dazu überreden lassen, eigene Kompositionen in seinen Konzerten zu dirigieren. Erst nach seinem plötzlichen Tod am 20. April 2001 erinnerte man sich wieder an das kompositorische Œuvre Giuseppe Sinopolis, der in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts mit seinen Kompositionen in Darmstadt und Donaueschingen, in Royan und Graz Furore gemacht hatte (eines seiner Hauptwerke, das Orchesterstück Tombeau d’armor II von 1977, war ein Auftragswerk des Musikprotokolls steirischer herbst). Sinopoli galt als bedeutender Repräsentant der jungen Komponistengeneration Italiens. Sein kompositorisches Schaffen fällt in die Zeit der Krise des Serialismus, die Sinopoli in seinen Essays und in seinen Werken gleichermaßen thematisiert. Als Schüler von Bruno Maderna und Franco Donatoni und stark beeinflusst von Pierre Boulez schrieb Sinopoli zunächst elektronische und serielle Kompositionen. Höhepunkt dieser ersten Phase ist die Klaviersonate des Achtundzwanzigjährigen (1974). Hier ist kein Ton, keine rhythmische Zelle, keine Metronomangabe der spontanen Intuition des Komponisten entsprungen; alles ist nach mathematischen Formeln determiniert. Die Klaviersonate ist als Entwurf einer neuartigen Grammatik der harmonischen Verknüpfung von Klängen aufgrund von präzisen mathematischen Formeln angelegt: Sinopoli definiert „harmonische Regionen“ aufgrund einer akkordischen Matrix, deren Prinzip es ist, die jeweils ersten, naturgegebenen Klänge der Obertonreihe (Oktave, Quint und Quart) zu vermeiden (Sinopoli: 1974). Dem entspricht eine intervallische Matrix, die teils spiegelsymmetrisch, teils nach komplexeren Ordnungen angelegt ist. Das Material entwickelt sich nach dem Gesetz der Permutation: Das Anfangsgesetz erzeugt fortwährend neue Konstellationen, die einander kontrapunktisch gegenübergestellt werden.
Der Komponist Giuseppe Sinopoli und die Wiener Moderne
289
Entsprechendes gilt für die Organisation der Tondauern. Die akkordische Matrix und ihre Ableitungen sind als Klangereignisse von langer Dauer stets präsent. Sie bilden einen Bezugsrahmen, einen „Mauerwall“, innerhalb dessen sich das komplexe musikalische Geschehen entwickelt. Sinopoli folgt hier einem Verfahren von Jean Barraqué, das er weiter entwickelt und neuartigen Lösungen zuführt. Dennoch wird die serielle Klangsprache schon hier von Erosionen erschüttert, die gleichwohl in der Logik der kompositorischen Struktur liegen: Wie durch Zauberei entstehen in dieser seriellen Komposition, die jedes tonale Moment konsequent vermeidet, hier und da auch terzgeschichtete Akkorde. Das musikalisch geschulte Ohr hört sie als Septim- oder Nonakkorde, als Fragmente der Erinnerung an tonale Musik, die ihren Sinnbezug verloren haben. In solchen Momenten gleicht Sinopolis Partitur jenen optischen Kippfiguren, in denen das Auge wahlweise eine Landschaft oder das Gesicht eines Menschen erkennen kann. Dieses musikalische Vexierspiel hat Sinopoli ganz besonders fasziniert. Die Relikte des Vergangenen, die „Trümmer der Erinnerung“ (Sinopoli, zit. nach Villatico: 1988, 4) nehmen in seinem kompositorischen Schaffen fortan immer größeren Raum ein. Die Rückwendung zur musikalischen Vergangenheit steht dabei in einem engen Wechselverhältnis zur Neuentdeckung der Wiener Jahrhundertwende. Sinopolis Liebe gehörte schon früh dem deutschen Sprachraum, vor allem der Wiener Moderne um 1900 – nicht zufällig tragen einige seiner Kompositionen deutsche Titel wie Erfahrungen, Klaviersonate oder Kammerkonzert. Der promovierte Mediziner Sinopoli, der seine Doktorarbeit über ein psychiatrisches Thema geschrieben hatte, war ein exzellenter Kenner der Psychoanalyse Sigmund Freuds und hatte ein sensibles Gespür für die psychische Labilität und Nervosität der Jahrhundertwende. 1972 ließ sich Sinopoli für einige Jahre in Wien nieder und wurde Schüler des Dirigenten Hans Swarowsky. In einem Interview aus dem Jahr 1996 erinnert er sich: Die Zeit in Wien war für mich wahnsinnig wichtig. Ich war damals Anfang der siebziger Jahre voll mit der so genannten Wiener Kultur am Ende des vorigen Jahrhunderts und vom Anfang dieses Jahrhunderts. Hans Swarowsky war ein Lehrer von mir, aber er war wie ein Vater, der mir nahe gewesen ist, und wir haben sehr oft über mehrere Themen gesprochen: Literatur, Psychoanalyse, Malerei – Swarowsky war ein direkter Zeuge von dieser Zeit. Erwin Ratz [....] alle diese Menschen habe ich kennen gelernt und noch die Frau von Alban Berg, die Helene. Ich habe durch Helene Berg und Gottfried von Einem damals mein erstes Stipendium gekriegt in Wien mit einem Essay über Lulu – und ein Mann, der mich sehr beeinflusst hat, war natürlich Friedrich Cerha, mit dem mich eine große Freundschaft verbindet. Das heißt: Wien war eine ganz wichtige Zeit für mich. Wien war noch nicht restauriert, als ich da war. Die Wiener Mahler-Gesellschaft war noch das kleine Zimmer von Erwin Ratz, und die Partituren von Mahler lagen unter seinem Bett (Sinopoli: 1996).
290
Ulrike Kienzle
Nicht zuletzt unter dem Einfluss solcher Entdeckungen distanzierte sich Sinopoli zunehmend vom Serialismus der Darmstädter Schule. Ihn faszinierte das Wiener Espressivo, das selbst noch aus den strengsten Zwölftonkompositionen Schönbergs, Bergs und Weberns fremd und faszinierend hervorleuchtet. Ihn interessierte das dialektische Wechselspiel zwischen der rationalen Ordnung des musikalischen Materials, die harmonisch neue Wege beschreitet, und der emotionalen Aussage der Musik, die – gemessen an der mathematischen Präzision des harmonischen Materials – seltsam widerständig, unkontrollierbar, arational bleibt. In diesem Widerspruch fand Sinopoli eine Verlusterfahrung formuliert: Der Zusammenbruch der intellektuellen, sozialen und psychischen Sicherheit zu Beginn des 20. Jahrhunderts erzeugt das Bedürfnis nach einer neuen Ordnung. Diese Ordnung jedoch ist trügerisch: Unter der Oberfläche von Rationalität und Kontrolle brodelt das Irrationale und Nichtkontrollierbare, das sich als conditio humana des Trieblebens weder bändigen noch verleugnen lässt. Was Sinopoli insbesondere an Berg und Webern faszinierte, war ihr offenes Zurschaustellen dieser Widersprüche. Was ihn an der Darmstädter Schule ärgerte, war ihr ängstliches Verleugnen gerade dieser Kehrseite der Rationalität. Aber auch Befreiungsschläge à la John Cage oder Morton Feldman waren Sinopolis Sache nicht. Dagegen opponierte sein ausgeprägtes historisches Bewusstsein. Es galt vielmehr, diese Widersprüche auszuhalten.
Von Darmstadt nach Wien In zwei Essays hat Sinopoli seine Kritik an der seriellen Kompositionsweise im Allgemeinen und an der Darmstädter Schule im Besonderen zum Ausdruck gebracht. Der erste dieser Texte, 1975 unter dem Titel Pour une auto-analyse in der Zeitschrift Musique en Jeu erschienen, begründet die Ablehnung des Serialismus aus der Perspektive Nietzsches: „Der Intellekt“, so zitiert er ein nachgelassenes Fragment des Philosophen, ist „der uranfängliche und einzige Lügner“ (Sinopoli: 1975, 7, vgl. Nietzsche: 1999, 8, 595).1 Der Versuch, mittels der seriellen Methode den Prozess der Komposition und die so geschaffenen musikalischen Strukturen einer vollständigen Kontrolle des Intellekts zu unterwerfen, geht nicht auf: Der Intellekt konstruiert mathematische Beziehungen auch zwischen solchen musikalischen Parametern, deren relationale Differenz das menschliche Ohr nicht wahrnehmen kann. Was klanglich dabei herauskommt, ist – im Gegensatz zur vorausgegangenen Kalkulation – willkürlich und irrational. Die Intention, durch die 1 Im französischen Text: „l’intellect est le menteur unique et originaire“.
Der Komponist Giuseppe Sinopoli und die Wiener Moderne
291
vorausgeschaffene Ordnung des musikalischen Materials eine Objektivität zu erzeugen, hinter der sich das Subjekt verbirgt, ist eine trügerische Fiktion. Somit verfängt sich der Serialismus „ohne Gnade“ in den Antinomien des „Cartesianischen Labyrinths“ (Sinopoli: 1975, 6).2 Der Serialismus betreibt einen Begräbniskult des Ich, indem er das komponierende Subjekt verdrängt und unter den Schichten des Materials begräbt. Die „Auslöschung des privaten Ichs und die Glorifizierung seines Todes in den Künsten“ spiegelt sich andererseits in einer Gesellschaftsordnung, die das Individuum zur bloßen Funktion degradiert (Sinopoli: 1975, 6). Der „Wille zur Macht“, um noch einmal mit Nietzsche zu sprechen, ist auch im Serialismus am Werk. Aber er verbirgt sich. Das Verborgene und Verdrängte jedoch, das wissen wir aus der Psychoanalyse, ist keineswegs tot oder verschwunden. Es führt ein gespenstisches Eigenleben. Pour une auto-analyse erschien kurz nach Vollendung der Klaviersonate und ist nicht zuletzt als eine kritische Selbstreflexion zu verstehen. Die Klaviersonate ist Gipfel und Umschlagpunkt der sich selbst verleugnenden Subjektivität, die Sinopoli in seinem Essay kritisiert. Die pianistische Zerreißprobe dieses extrem schwierigen Werks bringt genau diese Spannung von erzwungener Objektivität und subversiver Rebellion zum Ausdruck. Die Konstruktion der musikalischen Grammatik verbindet sich aber schon hier mit der Expressivität vergangener Epochen, die im Kontext der seriellen Strukturen gleichsam neu erschaffen wird. Sie markiert den Beginn einer Wendung zurück zur Vergangenheit, die über Berg und Webern führt. Im zweiten dieser Texte, Von Darmstadt nach Wien, der 1979 in dem von Hans Werner Henze edierten Band Zwischen den Kulturen. Neue Aspekte der musikalischen Ästhetik I erschienen ist, kritisiert Sinopoli die einseitige Webern-Rezeption der Darmstädter Schule: Webern kam aus Wien nach Darmstadt ohne sein Gewand, nämlich die Phrasierung Fin de siècle, auf die er (Zeugen zufolge) so großen Wert legte, wenn seine musikalischen Werke aufgeführt wurden [...]. Dafür wurde Webern die Uniform der Sommerkurse verliehen: rhythmische Exaktheit, formal perfekter Zuschnitt, und dann die Sache mit dem Raum der voneinander gleich entfernten Punkte, und so weiter undsofort. Kurzum, Webern war also gerade recht, um das zu kanonisieren, was damals in Darmstadt fabriziert wurde (Sinopoli: 1979, 236).
Und das war nach Meinung von Sinopoli nicht viel mehr wert als ein musikalisches Kreuzworträtsel, eine Art ‚Schiffe versenken‘ auf Notenpapier. Das Beunruhigende, 2 Deutsche Übersetzung der französischen Zitate von Ulrike Kienzle und Christoph Marinheiro.
292
Ulrike Kienzle
Verstörende, Aufregende in den Werken von Schönberg, Berg und Webern wurde, psychoanalytisch gesprochen, ‚verdrängt‘. Auf der Suche nach greifbaren Zeichen dieser Nähe zum Fin de siècle in den Partituren Anton Weberns und Alban Bergs stieß Sinopoli auf Vortragsbezeichnungen, die in Aufführungen und Analysen der Darmstädter Schule lediglich als Temporelationen gedeutet worden waren. Sinopoli las Angaben wie „Schleppend-rit…. – Sehr gedehnt-rit….“ in der Sinfonie opus 21 oder „zart 3/8, wieder sehr lebhaft ♪ = ♪“ in Weberns opus 31 dagegen nicht als Artikulation der Pulsation, sondern vielmehr als Elemente des „Ausdrucks“ einer „Phrase“, die „von Innen her“ die Struktur der Webernschen Musik bestimmt. Mit anderen Worten: Das, was die charakteristische „Form“ bei Webern ausmacht, beruht nur in einem sehr vordergründigen Sinn auf einer vorher gesetzten Reihe; die Form entwickelt sich vielmehr prozesshaft von innen nach außen, „wie das Wachsen einer Spirale, bei der jeder Aufstieg aus einer ‚Phrase‘ besteht, deren Funktion alles untergeordnet ist“. Webern komponiert keine „Strukturen“, sondern „,Phrasen‘ im traditionellsten Wiener Sinn des Wortes“, deren Fragmente sich „wie Aufstiege einer Spirale mit ihren gebrochenen Symmetrien widerspiegeln“ (Sinopoli: 1979, 237). Eine dergestalt „wienerische“ Lesart betont nicht nur ein sinnliches Element in der Musik Anton Weberns, das der Darmstädter Schule fremd war, sie betont auch die innere Zerrissenheit dieser Musik, die Trauer über den Verlust des Vergangenen. Denn – so Sinopoli über Webern – „Schubert bleibt eine nie erloschene Sehnsucht“ (Sinopoli: 1979, 237). In der Musik – und da macht auch die Zweite Wiener Schule keine Ausnahme – sind nach Sinopolis Überzeugung immer menschliche Urerfahrungen formuliert: Freude, Trauer und Melancholie, vor allem aber Verlust und Irritation. Objektives „Material“ gibt es nicht in der Musik, es ist immer schon Relikt eines Früheren oder ein Mikrowerk in Entwicklung und damit allemal „Ausdruck“ einer solchen menschlichen Urerfahrung. Der so genannte Fortschritt in der Kunst, sofern er sich allein auf das Rationale verlässt, führt unweigerlich zum Verlust einer Grammatik der Gefühle – übrig bleiben leere Hülsen, reine Gedankenspiele ohne tiefere Bedeutung. So ist für Sinopoli auch die Musik der Zweiten Wiener Schule dort am bedeutendsten, wo sie die zeittypische Erfahrung des Zusammenbruchs der intellektuellen und emotionalen Ordnungen am Anfang des 20. Jahrhunderts konkret benennt. Das – und nichts anderes – ist der „Sinn“ der von tonalen Relikten durchsetzten Zwölftonkomposition Alban Bergs: Die „Würmer der Tonalität“ zersetzen die neue Ordnung der Zwölftontechnik. Sie wird gleichsam von innen heraus „vergiftet“ durch das Weiterwirken einer Vergangenheit, die man nicht hinter sich lassen kann, weil sie – wie die prägenden Erlebnisse aus der Kindheit – die eigene Identität bestimmen (Sinopoli: 1979, 238f.).
Der Komponist Giuseppe Sinopoli und die Wiener Moderne
293
Es ist kein Zufall, meint Sinopoli, dass die Protagonisten der Darmstädter Schule zunächst einen Bogen um Alban Berg gemacht haben. Denn bei ihm wird die Serie „a porta inferi“ verwendet. Das „sempre lacrimoso“ einer AltsaxophonPassage des dritten Lulu-Aktes oder das „verstörte Des-Dur“ im zweiten Akt war mit dem „Darmstädter Kreuzzugsgeist“ nicht vereinbar. Die Kritik von Pierre Boulez und Theodor W. Adorno am „schlechten Geschmack“ der Lulu-Musik zeugt von dieser Verdrängung (Sinopoli: 1979, 238f.).
Der Ruf des Ich Wie findet man einen Ausweg aus dem „Cartesianischen Labyrinth“ des Serialismus? Mit seiner Kritik stand Sinopoli natürlich nicht allein. Aber die kompositorischen Konsequenzen, die er daraus zog, haben nichts mit einer „Neuen Einfachheit“ oder „Neo-Romantik“ zu tun. Auch eine Rückkehr zum Expressionismus der Zweiten Wiener Schule war für Sinopoli nicht denkbar – es sei denn als Dirigent. Sinopolis eindringliche, ebenso luzide wie expressive Einspielungen von Werken der Zweiten Wiener Schule legen davon Zeugnis ab. In seinen Kompositionen ging es ihm aber gerade nicht um eine Revitalisierung der Vergangenheit, sondern um die Artikulation der von ihm beschriebenen Verlusterfahrung. Traum, Verlust und Erinnerung sind Themen, die Sinopolis Denken seit Mitte der 1970er-Jahre bestimmen. Schon die Titel seiner Werke aus dieser Zeit weisen darauf hin: Sie heißen Souvenirs à la mémoire, Tombeau d’armor oder Requiem Hashshirim. In ihnen sucht er nach einer „anderen Lebensweise des vielleicht noch falsch verstandenen ‚Expressionismus‘“, wie es am Ende seines Essays Von Darmstadt nach Wien heißt (Sinopoli: 1979, 239). Diese „andere Lebensweise“ entwickelt sich jedoch aus dem Serialismus heraus und verleugnet ihn nicht. Aus den „vergoldeten, beruhigenden Gefängnissen der Rationalität“ auszubrechen hieß für Sinopoli keineswegs, die Logik der Konstruktion aufzugeben, sondern vielmehr, in Freiheit über sie hinaus zu wachsen. Sinopoli wollte zu einer musikalischen Semantik zurückfinden, in der Musik wieder zum Ausdruck einer „Botschaft“ wird und die emotionalen Tiefen der menschlichen Existenz auszuloten versucht. In den Souvenirs à la mémoire (1974) knüpft Sinopoli zum ersten Mal an das Wiener Espressivo an, das er in seinem Essay als Quintessenz der Musik Anton Weberns beschrieben hat. Aber die Souvenirs basieren durchaus noch auf seriellen Techniken – vor allem in der harmonischen Faktur. Sinopoli wählt aus dem chromatischen Total gewisse Regionen im Sinne eines immer neu zu bestimmenden Gleichgewichts der
294
Ulrike Kienzle
Intervalle aus und entwickelt die so entstehenden Tonreihen, indem er sie auf die Instrumentalgruppen verteilt und miteinander konfrontiert. Es entsteht eine ausdifferenzierte Polyphonie. Auch die Organisation der Zeit ist bewusst kalkuliert: Die Modifikationen der Metronomangaben sind nicht fließend, sondern plötzlich. Das musikalische Material wird immer neuen Sprüngen und Stößen ausgesetzt. Die berüchtigten Webern’schen Rubati sind hier gleichsam auskomponiert. Deutlicher noch ist die Rückwendung zur Zweiten Wiener Schule im Klavierkonzert (1975) thematisiert. Zu Beginn exponiert Sinopoli eine mikropolyphone Klangfläche im Orchester. Sie besteht aus einem feinen Gewebe von Stimmen, die teilweise nach seriellen Prinzipien organisiert sind. Gleichwohl entsteht ein Klang, der in Farbe und Ausdruck Assoziationen an die Orchestersprache Alban Bergs weckt – es ist gleichsam die Betrachtung einer Berg-Partitur unter dem Mikroskop des Analytikers. Man kann sogar noch weiter zurückgehen und Vorbilder für solche unendlich ausdifferenzierten Klangflächen schon bei Franz Schreker finden. Im Vogelstimmenkonzert aus dem dritten Akt des Fernen Klangs sind die Möglichkeiten einer solchen Orchesterpolyphonie bereits angedeutet. Er habe das Schwindelgefühl des Jahrhundertanfangs evozieren wollen, schrieb Sinopoli über sein Klavierkonzert: „labil, obsessiv und nervös“ – „ein Umschlagen des Rationalen, das bis an seine fernsten Grenzen geführt wird, in einen sehr privaten und gefährlichen Irrationalismus [...] Man hört den Ruf eines Ich, traumhaft, kreisend, extrem weit entfernt, in längst vergangenen Schichten der persönlichen Geschichte gelagert, das auf mutige und höchst gefährliche Weise versucht, ans Licht zu kommen“ (Sinopoli: o.J. a).3 Die Rebellion des „begrabenen“ Ich und seine Ausbruchsversuche aus den „vergoldeten, beruhigenden Gefängnissen der Rationalität“ werden im Klavierkonzert in harten Konfrontationen mit dem Widerspruch gegen diese Befreiungsversuche geradezu existentialistisch auskomponiert – die traumartige Rückerinnerung wird immer wieder zerstört, erschüttert von heftigen Stößen, die wie Einsprüche wirken. Das Klavierkonzert markiert – zusammen mit den Orchesterstücken Souvenirs à la mémoire und dem Zyklus Tombeau d’armor – einen kompositorischen Wendepunkt in Sinopolis Œuvre. Es entfernte sich immer weiter vom Mainstream der Avantgarde, was von der zeitgenössischen Kritik misstrauisch beäugt wurde. Im Kammerkonzert (1977–1979) setzt sich dieser Prozess fort: Hier kristallisiert sich die zuvor so komplexe Mikropolyphonie zu überschaubaren Strukturen; die stilistischen Anleihen an Alban Berg sind nunmehr ostentativ. Klavier und Orchester umkreisen einander in immer erneuten musikalischen Diskursen; Musik wird wieder zur Klangrede. Wie in einer Retrospektive zitiert die Solokadenz des ersten Satzes einen Ab3 Deutsche Übersetzung aus dem Italienischen von Ulrike Kienzle.
Der Komponist Giuseppe Sinopoli und die Wiener Moderne
295
schnitt aus der frühen Klaviersonate, deren serielle Ästhetik Sinopoli längst hinter sich gelassen hatte. Im Zentrum der Souvenirs wie des Kammerkonzerts steht jeweils ein Adagio, in dem Traum, Verlust und Erinnerung suggestiv auskomponiert sind. In den Souvenirs wird gleichsam der Tod der Musik zum Thema der kompositorischen Faktur: Durch die Verlangsamung des Tempos und durch das allmähliche Verlöschen der Dynamik bis an die Grenzen der Unhörbarkeit entsteht ein Grabgesang auf den Verlust der musikalischen Semantik. Im Kammerkonzert wird die „Entropie der Erinnerung“, wie Sinopoli in einem Interview ausführt, konkret (Sinopoli: o.J. b): Ein religiöser Gesang aus der Kindheit in Sizilien taucht wie eine ‚mémoire involontaire‘ aus den Tiefenschichten des Bewusstseins auf – ein Verfahren, bei dem sich Sinopoli auf Marcel Proust beruft. Die wiedergefundene verlorene Zeit, die der Gesang in sich enthält, führt eine Folge von tonalen Akkorden mit sich. Aber die Erinnerung erscheint prismatisch gebrochen; der Gesang bewegt sich zersplittert durch den Tonraum und erzeugt eine Klangfarbenmelodie.
Lou Salomé Die Hinwendung zur Wiener Moderne erreicht ihren Höhepunkt in Sinopolis Oper Lou Salomé (1981), die schon vom Sujet her die Krisis der Moderne formuliert. Das Leben der historischen Lou Andreas-Salomé umfasst die Zeit der tief greifenden sozialen Umbrüche der Jahrhundertwende von der Befreiung der russischen Leibeigenen 1861 bis zur nationalsozialistischen Diktatur. Der Verlust Gottes und das Herausfallen aus der religiösen Ordnung, die intellektuelle und soziale Emanzipation der Frau, Bindungsangst und Beziehungsunfähigkeit prägen die Biografie der Protagonistin. Nietzsche machte ihr einen Heiratsantrag. Mit Rilke bereiste sie Russland. Bei Sigmund Freud studierte sie Psychoanalyse und wirkte als erste weibliche Therapeutin in Deutschland. Sinopolis Oper stellt diese komplexe Problematik in einer Reihe von Stationen dar. In enger Zusammenarbeit mit dem Komponisten entwarf Karl Dietrich Gräwe das Textbuch: Eine Collage von Zitaten und Paraphrasen aus Schriften von Nietzsche, Rilke und Lou Andreas-Salomé ist Grundlage für eine Traumsequenz, die als anti-illusionistische Rückprojektion aus der Gegenwart in die Zeit der Jahrhundertwende angelegt ist. Deren Spuren ragen verfremdet in die eigene Gegenwart hinein wie Ruinen aus einem längst überwachsenen Trümmerfeld. Ursprünglich hatte Sinopoli eine Trilogie geplant: Nach dem Vorbild von Hermann Brochs Romanzyklus Die Schlafwandler wollte er die Krisis der Moderne
296
Ulrike Kienzle
anhand ausgewählter historischer Persönlichkeiten demonstrieren. Ähnlich wie Broch, der den Werteverlust und das metaphysische Vakuum seiner Zeit in einer komplexen Erzähltechnik analysiert, nähert sich Sinopoli dem Stoff seiner Oper – wie er sagt – in einer „schlafwandlerischen Technik“ (Sinopoli: 1996). Die Affinität zur Wiener Moderne ist auf Schritt und Tritt spürbar: Schon der Name der Protagonistin weckt Assoziationen zu Bergs Lulu; ähnlich wie Wozzeck und Lulu ist auch Lou Salomé aus einer Reihe selbständiger, in sich geschlossener Formen komponiert. Serielle Techniken wie Selektion des Materials, kontrapunktische Verfahren wie kanonische Stimmführung und Spiegelsymmetrien korrespondieren mit ironischen Walzerparaphrasen; das ‚objet trouvé‘ einer banalen Wiener Heurigenmelodie in polytonaler Verfremdung ragt als Relikt einer untergegangenen Welt in die Zeitlosigkeit koreanischer Gongs. Sinopolis Affinität zur Welt der Jahrhundertwende bewirkte geradezu, wie er in einem Interview sagte, eine „schlafwandlerische Konnexion und Beziehung mit der musikalischen Sprache – bis zur tonalen Blendung“. Tonalität wird zu einem „schwindelnden Effekt, weil es keine Sicherheit mehr gibt über die Semantik. Weil der eindirektionelle Weg des Verstehens heute eigentlich pathetisch klingt“ (Sinopoli: 1996). Es ging auch hier also um eine doppelte Optik: Sinopoli assoziiert die Klangwelt der Jahrhundertwende, und er zerstört sie sogleich durch Verfremdung. Das Wiedererkannte entzieht sich im selben Augenblick, in dem es wahrgenommen wird. Die Situationen, in denen Lou Salomé mit Nietzsche, mit Rilke oder mit Paul Rée gezeigt wird, stehen allesamt unter dem Zeichen des Verlustes. In diesem Sinne treten formale oder stilistische ‚Objektivationen‘ von Musik in Erscheinung, die den Trümmern der Erinnerung angehören, wie Walzer, Ländler oder [...] Passacaglia [...]. [Ihnen] ist der Charakter des Zitats nur insofern eigen, als sie dessen elementaren Aspekt übernehmen: nämlich den des geschichtlich bewahrenden Wiedererkennens (Sinopoli, zit. nach Villatico: 1988, 4).
Anhand einiger Beispiele sei dieses Verfahren näher beleuchtet; Sinopolis eigene Begriffe dienen dabei als Leitideen. Tonale Blendung: Der unsichtbare Chor zu Beginn der Oper – gleichsam in einem Augenblick jenseits von Zeit und Raum – hat eine doppelte Funktion: Einerseits deutet er die ambivalente Stellung der befreiten russischen Leibeigenen an, signalisiert also einen Zustand zwischen Bindung und Befreiung, zwischen Vergangenheit und Zukunft – man könnte auch sagen: den Beginn der Moderne, deren Krise Sinopoli
Der Komponist Giuseppe Sinopoli und die Wiener Moderne
297
darstellen will. Andererseits ist er ein Spiegel des Unbewussten von Lou, die an der Schwelle zwischen Kindheit und Erwachen steht. Für diesen Moment des Zwiespalts wählt Sinopoli Akkorde, die in sich ebenfalls zwiespältig sind, die auch musikalisch das Ineins von Nicht-Mehr und Noch-Nicht andeuten. Manche dieser Akkorde schließen Dreiklänge in sich, ohne doch in einem tonalen Gefüge zu stehen. Die Dreiklänge sind vielmehr durch hinzugesetzte Töne verschleiert. Es sind entweder komplexe Klänge, in denen zwei Dreiklänge übereinander geschichtet werden, sodass ein Spannungsklang entsteht, oder es sind Dreiklänge, an die eine Traube chromatischer Töne angehängt ist. Einem dieser komplexen Klänge kommt im weiteren Verlauf der Oper die Funktion eines Grund- bzw. Leitakkords zu: Es ist die Tonfolge e-g-h-dis-fis (vgl. dazu Danuser: 1981). Dieser terzgeschichtete Nonenakkord ist lesbar als eine Kombination von e-Moll und H-Dur, wenn man den Ton h als imaginäre Achse betrachtet. Der Traditionsbezug der Dreiklänge an sich, die Antinomie von Moll und Dur und der Dissonanzcharakter, der durch die bitonale Kombination entsteht, ergeben zusammen ein Symbol für die Ambivalenz der dramaturgischen Situation, die sich in der musikalischen Sprache spiegelt. Wenn im Verlauf der Oper dieser Akkord durch weitere dissonante Töne angereichert wird – zum Beispiel cis und gis, die jeweils symbolische Bedeutung haben –, dann entstehen Schärfen und Reibungen, welche den letzten Rest eines tonalen Eindrucks zerstören. Solche Beispiele demonstrieren, was Sinopoli unter „tonaler Blendung“ versteht: Klänge, die tonale Reminiszenzen beinhalten und sie zugleich negieren. Mentale Paraphrase: In der zweiten Szene des ersten Aktes wird ein Jugendgedicht von Lou AndreasSalomé zitiert, in dem sich eine melancholische Todessehnsucht manifestiert, ein Grundgefühl des Fin de siècle. Zwischen zwei prosaischen Szenen, die Lous Studien in Zürich und ihren krankheitsbedingten Aufbruch nach Rom mit perkussiven Effekten, harten Tonrepetitionen und gesprochener Deklamation geräuschhaft ausgestalten, wirkt schon das gebundene Versmaß des Gedichtes wie ein anachronistischer Fremdkörper. Und genau so hat Sinopoli dieses Lied auch komponiert: als sehnsüchtige Rückwendung und Verklärung eines Lebensgefühls, das in der Moderne eigentlich keinen Platz mehr hat. Das Orchestervorspiel zu diesem Lied klingt kaum anders als bei Alexander Zemlinsky oder Franz Schreker: Ein körperlos glitzerndes Lineament in der Celesta wird von liegenden Akkorden in gedämpften Blechbläsern gestützt. Diese Bläserakkorde erzeugen ein statisches Moment, schaffen eine ruhige Klangfläche. Zarte Akzente im Schlagwerk erzeugen dagegen Unruhe, indem sie die Flächigkeit
298
Ulrike Kienzle
der übrigen Klangebenen vertikal durchbrechen. Im vierten Takt tritt ein Streichquintett hinzu: Eine sensitiv sich aufschwingende Kantilene ist in einen polyphonen, kammermusikalischen Satz eingebunden. Der Einsatz der Singstimme geht eine innige Verbindung mit diesem Streichquintettsatz ein: In Gegenbewegung zur aufstrebenden Kantilene bewegt sich die Stimme zunächst abwärts. Indem die Streicher diese Abwärtsbewegung aufgreifen, schwingt sich aber die Singstimme in einem emphatischen Aufschwung zum zweigestrichenen fis empor, was wiederum der diastematischen Bewegung des Anfangs der Streicherkantilene entspricht. Nach diesem Höhepunkt sinkt die Stimme sogleich um einen halben Ton ab und verharrt unentschieden auf dem f. Eine solche melodische Gestik finden wir oft in den Liedern des Fin de siècle. Doch dann zerstört Sinopoli unversehens diese Illusion – durch eine plötzliche Verdoppelung des Tempos und einen Aufschrei im Orchester. Schlagwerk und Streicherklang gerinnen zu hart akzentuierten Akkordblöcken, die Bläser intonieren unaufhörlich ein und denselben dissonierenden Akkord in auf- und absteigenden Arpeggien, wobei auf der Spitze jeder Akkordbewegung eine dynamische Kulmination entsteht. Dieser instrumentale Aufschrei ist ein traumatischer Schock. Das Ende der Strophe knüpft wieder an den melancholischen Beginn an. Dieses Wechselspiel ist typisch für Sinopolis Intention, eine „mentale Paraphrase“ der Musik der Jahrhundertwende zu schaffen und sie im nächsten Moment wieder zu zerstören. Die „mentale Paraphrase“ ist nicht als neoromantische Rückwendung zu verstehen, sondern vielmehr als „schlafwandlerische“ Erinnerung, die im Augenblick des Erwachens vom realistischen Blick der Gegenwart her zertrümmert wird. Selektion des Materials: Die erste Szene des zweiten Aktes zeigt Lou und Nietzsche – bei Sinopoli eine Sprechrolle – auf dem Monte Sacro, wo dem Philosophen die Vision des Zarathustra erscheint. Das kurze Vorspiel intoniert den Leitakkord mit hinzugesetztem cis in Gestalt einer bruitistisch instrumentierten Invention. Sodann – ab der Vortragsbezeichnung Andante – erklingt über einem Orgelpunkt auf e ein flirrendes Klangfeld, das ausschließlich aus den Tönen e-f-fis-a und h gebildet wird. Die strenge Reduktion des Materials bewirkt, dass immer neue Mixturen entstehen: Die fünf Töne verschlingen sich in vielfachen chromatischen Reibungen und in immer neuen Klangfarben, auch in Vokalisen, und in einer Mikropolyphonie, die sich allmählich über sämtliche Orchesterstimmen verteilt und den gesamten Klangraum ausfüllt. So ergeben sich minimalistische Effekte. Daraus entsteht allmählich eine explosive Spannung, die – wie in einer neuen energetischen Potenz – eine Erweiterung des Tonvorrats geradezu erzwingt: Den
Der Komponist Giuseppe Sinopoli und die Wiener Moderne
299
mikropolyphonen Strukturen im Orchester antwortet ein Ensemble hinter der Szene. Auf dem Höhepunkt dieser Spannung bricht zu den Tönen des Leitakkordes, der um den Ton cis erweitert ist, auf den Ruf „Mittag“ des unsichtbaren Chores, die Erscheinung Zarathustras hervor – gleichsam ein synthetisch erzeugter Homunkulus. Nach dem Tod Gottes, den Nietzsche verkündet hat, ist Transzendenz nur noch als künstlich erzeugtes Rauschmittel möglich. Selektion des Materials bedeutet in Lou Salomé immer auch eine Privation, einen Mangel – die Abwesenheit der übrigen Töne des chromatischen Totals wird als Verlust empfunden. Insofern bedeutet der Tod Gottes eine Reduktion der menschlichen Existenz; die Steigerung der Empfindung dieses Mangels erzeugt die synthetische Stiftung einer Ersatzreligion, die Philosophie des Zarathustra. Stilistische Objektivation: Friedrich Nietzsche, Paul Rée und Rainer Maria Rilke werben im zweiten Akt um die angebetete Lou, aber diese entzieht sich jeder Annäherung. Die Absurdität dieser Situation unterstreicht der Komponist, indem er das vergebliche Liebeswerben in Form eines Wiener Walzers gestaltet, dessen exakte kanonische Form die Liebenden gleichsam in ein Gefängnis sperrt. So ruft die spieldosenhafte Verfremdung dieses Walzers eine gespenstische Totentanz-Assoziation wach. Die einfache Harmonik wird durch fremde und alterierte Noten permanent gestört; die Verselbständigung der Oberstimme zeigt Ansätze zur Bitonalität. Das harmonische und rhythmische Gefüge zwischen Begleitung und Mittelstimmen ist verschoben. Anfang und Ende der Strophen sind in Überblendung aufeinander montiert. Die marionettenhafte Steifheit und artifizielle Delikatesse dieser Musik sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich hier Abgründe auftun: Beziehungslos stehen die einzelnen Klanggebilde im Raum; die schöne Melodie – Sinnbild des Wiener Walzers überhaupt – zerfällt in monadenhafte Klangatome und Fragmente stereotyper Begleitfloskeln; beziehungslos tanzen die Figuren aneinander vorbei und ins Leere hinein. Sinopoli dachte hier an Otto Weininger und dessen Philosophie als die grotesk-tragische Kehrseite der Wiener Walzer- und Operettenseligkeit. Trümmer der Erinnerung: In der Szene der Sibirischen Nacht sind Lou Salomé und Rainer Maria Rilke auf der Suche nach einer Raum und Zeit überwindenden Grenzerfahrung an der Schwelle zum Unbewussten. Drei Klangkörper stehen im Raum: das Orchester im Graben, ein unsichtbarer Chor, der unaufhörlich die erste Silbe des Gottesnamens, „El“, intoniert, und ein Ensemble von 47 Perkussionsinstrumenten auf der Bühne, dar-
300
Ulrike Kienzle
unter sechs asiatische Gongs. Jedem der drei Klangkörper fehlen bestimmte Töne zum chromatischen Total: Die bisweilen clusterförmig geschichteten, bisweilen blockartig ineinander geschobenen Akkorde in den Streichern und Bläsern haben alle Töne außer d und f. Den Gongs wiederum fehlt gis. Die „El“-Rufe dagegen haben das gis, ihnen fehlen wiederum d und f. Die göttliche Totalität, die Rilke und Lou in der Einsamkeit der Sibirischen Nacht erfahren wollen, spaltet sich in mehrere Objektivationen auf, die für sich genommen unvollständig sind. Plötzlich bricht in die Transzendenz der Sibirischen Nacht, wie eine Eruption aus dem Unbewussten, die unfreiwillige Erinnerung an eine banale Wiener Heurigenkapelle herein und zerstört die metaphysische Versenkung – zuerst leise, dann eruptiv und katastrophisch. Melodischer Kern der Montage aus verschiedenen musikalischen Klangebenen – teils auf der Bühne, teils im Orchestergraben – ist eine populäre Wiener Heurigenmelodie: „Im Ohr noch die rauschenden Walzer, die Walzer von Lanner und Strauß“. Die banale Melodie ist das Einzige, was bei dieser musikalischen Tour de force intakt bleibt: In zwei ordentlich gebauten Perioden wird sie von Violinen und Klarinetten in B-Dur präsentiert und von zwei Stimmen begleitet: Das Akkordeon führt eine permanent durchlaufende Terzenschleife ad absurdum; die zweite Stimme intoniert eine typische Walzerbegleitung mit nachschlagenden Akkorden in simpelster Funktionsharmonik. Simultan und doch einer eigenen zeitlichen Logik folgend, spielt das Orchester im Graben in scharfer chromatischer Reibung zu B-Dur, nämlich in H, Fragmente mehrerer anderer Walzer und Ländler – darunter auch die Kärntner Volksweise, die schon Alban Berg in seinem Violinkonzert zitiert hatte. Die anfängliche Bitonalität kulminiert zeitweilig in einer Mixtur aus B-Dur, H-Dur, D-Dur und Es-Dur, das sind jeweils zwei im Abstand einer kleinen Sekunde liegende Tonarten. Ganz sicher ist diese Collage auch eine Reverenz an Gustav Mahler und Charles Ives, vielleicht sogar an Luciano Berios 1969 in Donaueschingen uraufgeführte Sinfonia. Im Kontext der Oper haben solche ironischen Verweise jedoch einen sehr präzisen dramaturgischen Sinn: Sie entlarven die aus dem Unbewussten hervorbrechende, schattenhafte Triebstruktur der Psyche. Der Heurigenwalzer bedeutet den Einbruch der Zeitlichkeit in die transzendente Welt der Gottesnähe. Und doch: Wenn der Spuk ein Ende findet, wenn endlich nur noch die „El“-Rufe des Chors und die Vibrationen der asiatischen Gongs übrig bleiben, erklingen überraschenderweise im Chor auf einmal alle zwölf Töne des chromatischen Totals, auch die vorher ausgesparten Töne d und f. Dahinter steht offenkundig eine theologische Aussage: Gott und Mensch, Zeit und Ewigkeit, Banalität und Vollkommenheit sind so aufeinander bezogen, dass nur im Aushalten der Widersprüche die Totalität der Gotteserfahrung möglich ist. So ist auch Sinopolis kompositorisches Verfahren zu verstehen: als Akt des „geschichtlich bewahrenden Wiedererkennens“, dem
Der Komponist Giuseppe Sinopoli und die Wiener Moderne
301
zugleich die Trauer über den Verlust des Vergangenen in ironischer Verfremdung eingeschrieben ist. Nicht zufällig steht am Schluss der Oper – vor einem letzten Lied der inzwischen alt gewordenen Lou – ein Requiem. Der Chor der Hoffnung ist eine Totenklage: das bereits 1976 komponierte Requiem Hashshirim für zwanzigstimmigen gemischten Chor. Es ist – rein äußerlich betrachtet – die ‚fortschrittlichste‘ Komposition im Kontext dieser Oper, unberührt von den „Trümmern der Erinnerung“, rein aus der Simultanität des chromatischen Totals heraus gestaltet, das beinahe in jedem Takt vollständig erklingt. In den drei Sprachen Deutsch, Lateinisch und Hebräisch sind Fragmente jüdischer und christlicher Texte simultan aufeinander montiert, als Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Auch die „El“-Rufe der Sibirischen Nacht kehren hier wieder. Die Texte formulieren eine Hoffnung, die auf eine jenseitige, außerhalb der Zeit liegende Erfahrung verweist, welche die Erfahrung des Todes zur Voraussetzung hat.
Ikonografische Fährten Die Kritiker der Münchner Uraufführung 1981 empfanden Lou Salomé als Verrat an den Tugenden der Avantgarde und schrieben Verrisse. Claus-Henning Bachmann zum Beispiel befand in der Neuen Zeitschrift für Musik, Sinopoli habe „vom Pult aus mit präziser Euphorie seinen Absturz als Komponist“ gesteuert (Bachmann: 1981, 384). Dagegen schrieb Erik Werba in der Österreichischen Musikzeitschrift: „Dieses Werk ist ein groß angelegtes musikalisches Abenteuer [...]. Neue Perspektiven werden kund, wenn außergewöhnliches Talent am Werke ist“ (Werba: 1981, 421). Tatsache ist: Nach Lou Salomé gab Sinopoli das Komponieren auf und verlegte sich aufs Dirigieren. Es war eine konsequente Entscheidung. Denn das Komponieren war für Giuseppe Sinopoli immer mehr zu einem Akt der geistigen Archäologie geworden: ein Graben nach den Wurzeln der Moderne, deren Widersprüche er schöpferisch zu erkunden unternahm. Aber mit Lou Salomé war für ihn der Endpunkt seines eigenen Komponierens erreicht: Die „mentale Paraphrase“ war nicht wiederholbar. Sinopoli gab das Komponieren auf und konzentrierte sich darauf, als Dirigent die verborgenen Botschaften in den Werken des 19. und 20. Jahrhunderts zu entschlüsseln. Es trieb ihn immer tiefer in die Vergangenheit – nicht nur musikalisch. Er studierte Archäologie und erforschte die frühesten Wurzeln der Menschheitsgeschichte: das mythologische Denken der alten Kulturen, deren Relikte über sich hinaus weisen und einen transzendenten Bezug offenbaren; die heiligen Schriften
302
Ulrike Kienzle
der alten Ägypter; die verschütteten Steine untergegangener Tempel, deren Architektur für ihn eine kosmologische Wiederholung der Welt bedeutete. In solchen „Trümmern der Erinnerung“ fand Sinopoli die Fragmente des wahren Fortschritts. Das Studium der Archäologie hat Sinopoli als einen Ersatz für sein Verstummen als Komponist verstanden. In seinem Buch Parsifal in Venedig, das Luigi Nono gewidmet ist, begibt sich Giuseppe Sinopoli auf eine imaginäre nächtliche Reise durch das Labyrinth der Stadt, in der er geboren wurde. Alles, was er dort sieht und erfährt, wird ihm zum Symbol. Es ist das Protokoll einer Reise in das eigene Unbewusste, in dem sich zugleich die Kulturgeschichte der Menschheit spiegelt – eine nächtliche Fahrt auf dem Strom der Erinnerung. Er ist sich bewusst, dass dies eine initiatische Reise ist, die in einer Zeit der „Gewöhnung ans Funktionale“, in der „historistischen Mentalität“ seiner Gegenwart auf wenig Verständnis stößt – aber das ist ihm gleichgültig: Mich interessierte vielmehr, die Spur einer Idee wiederzufinden, das Zeichen eines verlorengegangenen Inhalts zu entdecken, die ikonographische Fährte eines Symbols aufzunehmen und anhand dieser Zeichen und Spuren zurückzugehen zu einer Auffassung der Welt als etwas Heiliges, als Gerinnung der ursprünglichen Einheit, als Erscheinung des Göttlichen in der wirklichen Welt (Sinopoli: 2001, 123f.).
Eines dieser kryptischen, leuchtenden Symbole hat ihn besonders fasziniert: die Idee der Wiedergeburt, verstanden als Durchbruch zu einem Bewusstsein, in dem „die antagonistischen Kräfte, die die Welt regieren“, in einer coincidentia oppositorum aufgehoben sind (Sinopoli: 2001, 124). Nach seiner Doktorprüfung in Archäologie wollte sich Giuseppe Sinopoli wieder dem Komponieren zuwenden. Er hatte konkrete Pläne: Für den 13. Februar, den Jahrestag der Zerstörung Dresdens, wollte er sumerische Keilschrifttexte aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. vertonen, die von der Zerstörung der Stadt Ur durch ein barbarisches Volk berichten. Der Termin für seine Doktorprüfung stand bereits fest: Es war der 23. April 2001. Drei Tage zuvor ist Giuseppe Sinopoli in Berlin gestorben.
Der Komponist Giuseppe Sinopoli und die Wiener Moderne
303
Literatur Claus Henning Bachmann, Trügerische Balance auf dem Hochseil der Oper. Giuseppe Sinopoli: „Lou Salomé“ – Uraufführung in München, in: Neue Zeitschrift für Musik 142 (1981), 382–385. Hermann Danuser, Musik zwischen Psychoanalyse und Metaphysik. Zur Partitur von „Lou Salomé“, in: Giuseppe Sinopoli, Lou Salomé. Programmheft zur Uraufführung am 10. Mai 1981, München 1981, 25–36; Neufassung: Giuseppe Sinopolis Lou Salomé. Eine Oper im Spannungsfeld zwischen Moderne, Neomoderne und Postmoderne, in: Otto Kolleritsch (Hrsg.), Oper heute. Formen der Wirklichkeit im zeitgenössischen Musiktheater, Wien, Graz 1985 (Studien zur Wertungsforschung, 16), 154–165. Friedrich Nietzsche: Nachlaß 1875–1879, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München 1999 (Kritische Studienausgabe, 8). Giuseppe Sinopoli, Klavier Sonate, in: Festival international d’art contemporaine da Royan, 18.3.–2.4.1974 (ohne Paginierung). Giuseppe Sinopoli, [Klavierkonzert], Typoskript, o.J. a Giuseppe Sinopoli, [Interview mit Sandro Cappeletto], o.J. b Giuseppe Sinopoli, Von Darmstadt nach Wien, in: Hans Werner Henze (Hrsg): Zwischen den Kulturen. Neue Aspekte der musikalischen Ästhetik I, Frankfurt a. M. 1979, 235–240. Giuseppe Sinopoli, [Interview], Der Analytiker unter den Dirigenten, Giuseppe Sinopoli im Gespräch mit Fridemann Leipold, Bayern 4 Klassik, Erstsendung 1996. Giuseppe Sinopoli, Parsifal in Venedig, München 2001. Dino Villatico, Sinopoli: „Lou Salomé“, in: Sinopoli, Lou Salomé-Suites Nos. 1&2, Beiheft zur CD-Einspielung der Deutschen Grammophon Gesellschaft, [o. O.] 1988. Erik Werba, Sinopolis „Lou Salomé“ in München in: Österreichische Musikzeitschrift 36 (1981), 420–422.
Besprochene Kompositionen von Giuseppe Sinopoli Klaviersonate, Milano: Ricordi 1974 (132181). Souvenirs à la mémoire per due soprani (coloratura), controtenore e orchestra, Milano: Ricordi 1974 (132267). Klavierkonzert per pianoforte e orchestra, Milano: Ricordi 1975 (132110). Kammerkonzert per pianoforte, fiati, percussione, arpa e celeste, Milano: Ricordi 1977/79 (132604). Lou Salomé, Libretto di Karl Dietrich Gräwe. Riduzione per canto e pianoforte di Caspar Richter, Milano: Ricordi 1981 (133148).
304
Ulrike Kienzle
(Wie) Ist Musikästhetik heute noch möglich?
305
Nikolaus Urbanek (Wie) Ist Musikästhetik heute noch möglich? Unzeitgemäße Notizen zu einer zeitgemäßen Beantwortung einer zeitlosen Frage*
Auch wenn die beständige Klage über den zu allen Zeiten jeweils besonders bedauernswerten Zustand der philosophischen Disziplin namens Ästhetik in ihrer perennierenden Wiederkehr mittlerweile etwas mehr als Peinvolles an sich hat, komme auch ich zu Beginn meiner Notizen nicht umhin, einmal mehr darauf hinzuweisen, dass „die“ Ästhetik1 durch die radikale Infragestellung zentraler Kategorien in einer kritischen Bewegung gleichsam von innen heraus prinzipiell fragwürdig geworden ist. Zieht man die Summe aus der verschiedentlich konstatierten Verschiebung vom „Werk zum Text“2 respektive der direkten Fundamentalkritik am Werkbegriff,3 dem mehrfach proklamierten Tode des Autors,4 der grundlegenden * Einige der im Folgenden aufgeworfenen Fragen habe ich mittlerweile in meiner Dissertation weitergehend diskutiert; in Hinblick auf meine derzeitige Position sei aufgrunddessen auf die entsprechenden Ausführungen in dieser Arbeit (Nikolaus Urbanek, „Philosophie der Musik“. Zu Adornos Beethoven-Fragmenten, phil. Diss., Universität Wien 2008) verwiesen. 1 Wenn ich im Folgenden von „Ästhetik“ spreche, so stellt dies naturgemäß bereits eine beträchtliche Einschränkung dar. Dies ist beabsichtigt, es geht mir mit meinen Überlegungen ausschließlich um die ästhetische Erfahrung von Kunst; ich verwende also, soweit nicht anders ausgewiesen, „Ästhetik“ synonym zu „Kunstästhetik“. 2 Vgl. Barthes: 2003. Die sich hieraus ergebenden Konsequenzen für eine Ästhetik sind so evident wie fundamental, wenn man davon ausgeht, dass sich mit dieser Verschiebung der bisher zentrale Gegenstand der Ästhetik gewissermaßen selbst aufgelöst hat. 3 Rüdiger Bubner beispielsweise geht davon aus, dass „seit den Konstruktionen des Kubismus und Futurismus, seit den Ready mades und den Materialbildern aller Art […] eine der wesentlichen Tendenzen moderner Produktion auf Überwindung oder Sprengung der herkömmlichen Werkeinheit“ ziele. (Bubner: 1989, 33) Indem Bubner dergestalt eine „systematisch betriebene Auflösung der Werkeinheit“ konstatiert, und er darüber hinaus den Wahrheitsbegriff direkt und unauflöslich an den Werkbegriff bindet – „Es hatte sich bereits gezeigt, daß die auf Wahrheit in Kunst setzenden Ästhetiken notwendig einen Werkbegriff annehmen müssen, der den ontologischen Ort des Auftretens von Wahrheit außerhalb eines theoretischen Gedankenzusammenhangs bezeichnet.“ (Bubner: 1989, 32f.) – kommt er zu dem von diesen Prämissen ausgehend schlechterdings alternativlosen Schluss, dass eine wie auch immer geartete Wahrheitsästhetik nicht oder besser nicht mehr möglich sein könne. 4 Vgl. Barthes: 2000 und Foucault: 2000.
306
Nikolaus Urbanek
Destruktion des Wahrheitsbegriffs in diversen an Nietzsche anknüpfenden Denkfiguren der zeitgenössischen Vernunftkritik5 und schließlich den Überlegungen zu einer Überführung und/oder Auflösung der Ästhetik in eine „Aisthetik“,6 kann als Ergebnis letzten Endes lediglich die brisante Frage übrig bleiben, wie Ästhetik heute überhaupt noch möglich sei.
Von modernen Tendenzen und Zwängen Die Geschichte der Musikästhetik7 des 20. Jahrhunderts stellt in wichtigen Bereichen gewissermaßen eine Geschichte der Kritik an der musikästhetischen Konzeption Theodor W. Adornos dar. Nicht zuletzt aufgrund seiner äußerst wechselvollen Rezeptionsgeschichte in theoretischer wie kompositorischer Hinsicht kann insbesondere das Theorem der Fortschrittstendenz des musikalischen Materials mit gewisser Berechtigung als eines der wirkungsmächtigsten der musikästhetischen Schriften Adornos angesehen werden und möge daher auch den folgenden Überlegungen als vorläufiger Orientierungspunkt dienen. Ihre erste systematische Formulierung8 findet die Kategorie des musikalischen Materials in der Philosophie der neuen Musik, die ihrerseits bekanntermaßen als Exkurs der Dialektik der Aufklärung konzipiert ist. Die offensichtliche Diskrepanz, die sich zwischen der grundlegenden Kritik an Hegels geschichtsphilosophischem Projekt in dieser und der für uns heute etwas verstörenden, allzu direkten Anknüp5 Vgl. quasi als kleine philosophiehistorische Erzählung der zeitgenössischen Vernunftkritik Welsch: 1996a, 53–424. 6 Vgl. als eine mögliche Position beispielsweise Welsch: 1994, 9–40 und Welsch: 1996b, 135–177. 7 Es erschiene mir nicht sonderlich zielführend, das Verhältnis von Ästhetik und Musikästhetik bereits an dieser Stelle näher definieren zu wollen. Ich glaube jedoch nicht, dass Musikästhetik lediglich als eine Spezialdisziplin einer allgemeinen Kunstästhetik verstanden werden sollte, die – vielleicht um ein paar musikanalytische termini technici erweitert – mit den Kategorien und Kriterien der allgemeinen Ästhetik zu bestreiten wäre. Vielmehr müsste dem Umstand Rechnung getragen werden, dass und in welcher Weise die Erfahrung der musikalischen Kunstwerke eine spezifische ästhetische Erfahrung darstellt. Meines Erachtens wichtige Überlegungen in diese Richtung, wie aus philosophischer Perspektive mit dem Spezifikum der ästhetischen Erfahrung musikalischer Kunstwerke umgegangen werden könnte, hat jüngst Albrecht Wellmer in seinem Aufsatz über „Das musikalische Kunstwerk“ (Wellmer: 2002) zur Diskussion gestellt. 8 Freilich ist darauf hinzuweisen, dass die Wurzeln dieser Konzeption in den theoretischen Überlegungen der Wiener Schule zu finden sind, und auch Adorno – beispielsweise in der berühmten, bereits 1930 im Anbruch ausgetragenen Debatte mit Ernst Krenek – schon diverse Vorformulierungen einzelner Theoriebausteine vor ihrer systematischen Zusammenführung in der Philosophie der neuen Musik zur Diskussion gestellt hat.
(Wie) Ist Musikästhetik heute noch möglich?
307
fung an Hegels Fortschrittskonzeption9 in jener ergibt, durchzieht in unterschiedlichen Gestalten sämtliche ästhetischen Überlegungen Adornos und macht wohl ein irreduzibles Movens seines gesamten philosophischen Denkens aus.10 Auch ist meines Erachtens nicht von einer dezidierten Rücknahme dieser Konzeption in seinen späteren Schriften zu sprechen; noch in der Ästhetischen Theorie wird – wenn auch, die Erfahrungen der jüngsten kompositorischen Entwicklung reflektierend, in einigen Aspekten modifiziert11 – an dem theoretischen Kern dieser Konzeption festgehalten.12
9 „Schließlich ist Fortschritt doch nicht nur einer von Materialbeherrschung und Vergeistigung sondern einer des Geistes im Hegelschen Sinn des Bewußtseins seiner Freiheit.“ (Adorno: 1997a, 316). 10 Dies dürfte letzten Endes damit zusammenhängen, dass Adorno gewissermaßen mit Hegel gegen Hegel argumentiert. Wohl aufgrund dessen stoßen wir immer wieder auf Widersprüche, die, zu scharfen Aporien zugespitzt, von Adorno nicht aufgelöst werden. 11 „Eine wirkliche Erweiterung des Materialbegriffs hat Adorno allerdings selbst vollzogen […] Zum Material werden mehr und mehr die ,Verfahrungsweisen‘ hinzugenommen. Dies hängt unzweifelhaft mit der Darmstädter Entwicklung zur seriellen Musik und darüber hinaus zusammen, etwa mit der Erweiterung der Materialdimensionen um die der Zeit durch Cage und Stockhausen, […].“ (Kapp: 1982, 271f.) Auch Gianmario Borio verweist auf die besondere Bedeutung dieser Modifikationen: „Die theoretischen Ergebnisse von Adornos Auseinandersetzung mit der seriellen und informellen Musik sind für die Formulierung seiner Schriften aus den sechziger Jahren – und nicht nur der musikalischen – entscheidend gewesen. Erst ein genaues Studium des Inhaltswandels zentraler Begriffe innerhalb seines Gesamtwerkes wird das Vorurteil endgültig beseitigen können, Adornos Ästhetik sei eine abstrakte Konstruktion, die die Sachverhalte unzulänglich oder gar nicht berücksichtigt.“ (Borio: 1994, 110) Diesen Punkt halte ich für entscheidend, da letztlich von diesem theoretischen Ort aus das, was vielleicht als Reaktionsfähigkeit der ästhetischen Theorie Adornos bezeichnet werden könnte, plausibel zu machen wäre. Die systematische Verankerung dieser Reaktionsfähigkeit der (allgemeinen) Theorie in Hinblick auf das (konkrete) Kunstwerk scheint mir eine der wichtigsten und auch heute noch bedenkenswertesten – quasi-methodologischen, im Kern jedoch theoretischen – Überlegungen Adornos zu sein. Aus diesem Grunde dürfte auch die Kritik von Heinz-Klaus Metzger an dem von ihm verorteten „Altern der Philosophie der neuen Musik“ (Metzger: 1980) in Zusammenhang mit den direkten – in der bekannten Rundfunkdiskussion – und indirekten – in Adornos späteren Schriften – Reaktionen eines der interessantesten Lehrstücke über die Theorie der ästhetische Theorie sein, da Metzger die Überlegungen Adornos an ihrem eigenen Maßstab misst und sie dergestalt gewissermaßen mit ihrem eigenen Anspruch konfrontiert. 12 Zumindestens bedenkenswert scheint mir in diesem Zusammenhang zu sein, dass in der Ästhetischen Theorie in gewisser Weise sogar so etwas wie eine Radikalisierung zu beobachten wäre; während in der Philosophie der neuen Musik noch von „Tendenz“ des Materials die Rede ist, wird in der Ästhetischen Theorie an ähnlicher theoretischer Stelle mit direktem Bezug auf den Hegelschen „absoluten Geist“ von „Zwang“ gesprochen: „Die unter unreflektierten Künstlern verbreitete Vorstellung von der Wählbarkeit des Materials ist insofern problematisch, als sie den Zwang des Materials und zu spezifischem Material ignoriert, der in den Verfahrensweisen und ihrem Fortschritt waltet. […] Von
308
Nikolaus Urbanek
Es stehe mir fern, mit den folgenden Überlegungen eine adäquate Auseinandersetzung mit der ästhetischen Theorie Adornos zur Diskussion stellen zu wollen, vielmehr geht es mir an dieser Stelle zunächst lediglich darum, das der Kategorie des musikalischen Materials inhärente Kriterium eines notwendigen unilinearen Fortschritts als theoretische Folie für einige daran anschließende Überlegungen verfügbar zu machen. Dieses birgt in sich nun zwei entscheidende theoretische Aspekte: Zum ersten führt die zugrunde gelegte Fortschrittstendenz in strenger Konsequenz zu dem zentralen Theorem, dass nur der je avancierteste Stand der Materialentwicklung13 das jeweils für den Komponisten konkret verfügbare musikalische Material darstelle. Alle übrigen materialen Konstellationen gehen, so Adorno, in einen „Kanon des Verbotenen“ (Adorno: 1997b, 40) über, dessen kompositorische Verwendung nicht nur ästhetisch illegitim, sondern darüber hinaus auch objektiv falsch sei. Indem die jeweilige Verfügbarkeit des musikalischen Materials hier nicht potenziell, sondern normativ bestimmt wird,14 resultiert hieraus konsequenterweise eine explizite Kategorie ästhetischer Wertung: Keineswegs stehen dem Komponisten unterschiedslos alle je gebrauchten Tonkombinationen heute zur Verfügung. Die Schäbigkeit und Vernutztheit des verminderten Septakkordes oder gewisser chromatischer Durchgangsnoten in der Salonmusik des neunzehnten Jahrhunderts gewahrt selbst das stumpfere Ohr. Fürs technisch erfahrene setzt solches vage Unbehagen in einen Kanon des Verbotenen sich um. Wenn nicht alles trügt, schließt er heute bereits die Mittel der Tonalität, also die der gesamten traditionellen Musik, aus. Nicht bloß, dass jene Klänge veraltet oder unzeitgemäß sind. Sie sind falsch (Adorno: 1997b, 40).
Zum zweiten manifestiert sich in der Betonung der Unilinearität ein Verbot der Verwendung heterogenen Materials15 und damit die dezidierte Abwehr künstlerischer Vielfalt: Die gegenwärtige Mannigfaltigkeit aber ist nicht die des Reichtums kommensurabler, auf gleichem Niveau voneinander sich abhebender Produkte sondern eine von Disparatem. Sie verdankt sich der Inkonsequenz. […] Solcher Reichtum ist falsch, und ihm hat das Bewußtsein zu widerstehen, nicht ihm nachzulaufen (Adorno: 1997c, 177). dem abstrakt verfügbaren Material ist nur äußerst wenig konkret, also ohne mit dem Stand des Geistes zu kollidieren, verwendbar.“ (Adorno: 1997a, 222f.). 13 „Der fortgeschrittenste Stand der technischen Verfahrensweise zeichnet Aufgaben vor, denen gegenüber die traditionellen Klänge als ohnmächtige Clichés sich erweisen.“ (Adorno: 1997b, 40). 14 „Ihnen [den Bewegungsgesetzen des Materials] zufolge ist nicht zu allen Zeiten alles möglich.“ (Adorno: 1997b, 39). 15 „Die Geschichte der neuen Musikbewegung duldet kein ,sinnvolles Nebeneinander der Gegensätze‘ mehr.“ (Adorno: 1997b, 14f.).
(Wie) Ist Musikästhetik heute noch möglich?
309
Vielerorts wurde nun bereits deklariert, dass diese apodiktischen Forderungen Adornos heute keine wie auch immer geartete Relevanz mehr beanspruchen können, vielerorts wird davon ausgegangen, dass insbesondere Adornos scheinbar so fortschrittsgläubige Materialkonzeption für seine Zeitgebundenheit und damit direkt einhergehend für seine gegenwärtige Obsoleszenz verantwortlich zu machen wäre. Ob damit seine musikästhetischen Schriften in toto heute nur mehr als Kuriosa musikästhetischen Denkens längst vergangener und überwundener Zeiten zu werten seien, ist an dieser Stelle nicht zu entscheiden,16 auch geht es mir mitnichten um die Wiederbelebung eben dieser zwischen blinder Apologie und nicht minder blinder Fundamentalkritik fruchtlos hin- und herpendelnden Diskussion. Um sich denjenigen Phänomenen, welche vielleicht am ehesten mit dem Dahlhausschen Begriff einer „Abkehr vom Materialdenken“ (Dahlhaus: 1984, 45) sich bezeichnen ließen, in theoretischer Hinsicht ein wenig annähern zu können, scheint es mir jedoch unabdingbar zu sein, einige der zentralen Kritikpunkte an Adornos Ästhetik zur Sprache zu bringen. Bereits Peter Bürger stellte zur Diskussion, dass „Adornos Ästhetik Gegenwärtigkeit im emphatischen Wortsinn nicht mehr beanspruchen kann“. Da sie Kunstwerke außerhalb des „Kanons großer Werke“ (Bürger: 1990, 128) nicht adäquat ästhetisch zu reflektieren vermöge, sei dies – und das stellt meines Erachtens die Pointe von Bürgers provokant vorgetragener These dar – nicht nur diachron, sondern auch synchron zu denken: Bereits innerhalb „der“ Moderne stoße die Ästhetik Adornos an eine Grenze ihres theoretischen Geltungsbereichs. Dahinter liegt nun bei Bürger weniger eine Kritik an Adornos Konzeption eines linearen Fortschritts, denn eher der Vorwurf einer allzu großen Einengung des Blickwinkels auf einen bestimmten Kanon. Diese Einengung des Kanons jedoch lediglich als bloßen Mangel musik-, literatur- und kunstwissenschaftlichen Wissens bei Adorno zu werten, verführte meines Erachtens zu einer allzu billigen Interpretation, die einen Großteil der damit zusammenhängenden ästhetischen Brisanz zu nivellieren drohte. Mir scheint vielmehr die Denkfigur Bürgers bedenkenswert zu sein, dass 16 Unbeantwortet muss an dieser Stelle auch die Frage bleiben, ob Adornos Kategorie des musikalischen Materials mit der ihm inhärenten Fortschrittskonzeption jemals Relevanz im Sinne einer treffenden „deskriptiven“ Aussage beanspruchen konnte, ob sich also die von ihm reflektierte Musik – vornehmlich die der Wiener Schule – tatsächlich mit einem solchen historiografischen Modell eines notwendigen Fortschrittes fassen ließe. Freilich sprechen diverse Zeugnisse der Protagonisten der Wiener Schule durchaus für die Annahme, dass der Wiener Schule ein Fortschrittsdenken nicht allzu fremd gewesen sein dürfte, aber – wenn man das so pauschal sagen darf – in einer unbestimmten, lediglich auf „das Neue“ schlechthin zielenden Form. Die Linearität dieses autohistoriografischen Geschichtsmodells bezieht sich auf die großen Legitimationserzählungen aus der musikalischen Tradition heraus und stellt darüber hinaus eher eine Genealogie, denn eine Zukunftsutopie dar.
310
Nikolaus Urbanek
die rigide Beschränkung auf einen eng begrenzten Kanon von Meisterwerken bei Adorno einer bestimmten theoretischen Absicht gehorche, wir also in der vehementen theoretischen Abwehr der um 1920 hereinbrechenden historischen Avantgardebewegungen die Wahrung einer puristischen, den Paradigmen eines steten künstlerischen Fortschritts und eines letzten Endes idealistischen Kunstwerkbegriffs verpflichteten Moderne auf Seiten Adornos beobachten könnten. Bürger schlägt vor, dies als „Anti-Avantgardismus Adornos“ (Bürger: 1990, 71; Bürger: 2001b) zu bezeichnen und charakterisiert die gesamte Ästhetik Adornos als „postavantgardistische“.17 Damit geht bei Bürger eine Einengung und Präzisierung des Moderne-Begriffs einher, welchen er dezidiert gegen einen ebenfalls präzisierten Avantgardebegriff absetzt. Als spezifische Charakteristika dieses „strengen Moderne-Begriff[s] Adornos“ führt Bürger zum einen die „konsequente Entwicklung des künstlerischen Materials“ und zum anderen „die Geltung von Verbotsetzungen“ (Bürger: 2001c, 190) – dem Verbot eines Rückgriffs hinter den avanciertesten Materialstand und einer heterogenen Materialverwendung – an. Bürger macht also deutlich, dass die Ästhetik Adornos gerade an dem theoretischen Ort, an welchem das Theorem eines unilinearen Materialfortschritts anzusiedeln ist, problematisch geworden beziehungsweise immer schon gewesen sei. In seinem Aufsatz „Einheit in der Zersplitterung“ versucht Reinhard Kager (Kager: 1998) – sich hiermit durchaus in theoretischer Nähe zu den Überlegungen Bürgers befindend – die Problematik des Adornoschen Materialbegriffs aufzuzeigen, die sich aus der musikästhetischen Reflexion gegenwärtigen Komponierens unmittelbar ergibt. Kager geht von der zunächst rein deskriptiven Feststellung eines Nebeneinanders einander widerstreitender musikalischer Stile aus. Diese Disparität unterschiedlicher Materialstränge habe sich durch die Ausdifferenzierung und Segmentierung der „Materialentwicklung“ besonders in der Musikgeschichte nach 1960 ergeben.18 Da das grundlegende Wertungskriterium eines einsträngigen Materialfortschritts somit seiner Gültigkeit beraubt worden sei,19 17 „Seine [Adornos] Ästhetik ist im strengen Sinne eine post-avantgardistische. Betrachtet man sie von den historischen Avantgardebewegungen her, wird das (im wörtlichen Sinne) Restaurative an ihr erkennbar. […] Waren die Avantgarden werkfeindlich gesinnt, so ist dagegen Adornos Ästhetik um einen emphatischen Begriff des Kunstwerks zentriert“ (Bürger: 2001d, 198). Vgl. auch Bürger: 1990, 70–72, 88–91 und 128–135. 18 „Denn mit dem Ende der seriellen Avantgarde, das spätestens in den sechziger Jahren anzusiedeln ist, beginnt sich auch das Material gleichsam zu segmentieren.“ (Kager: 1998, 107). 19 „Der herrschende Pluralismus der jüngsten Kunst- und Musikgeschichte hat die Theorie des künstlerischen Fortschritts, derzufolge nur jene Kunst den Anspruch eines Avantgardismus einlösen könnte, die das künstlerische Material ,auf der fortgeschrittensten Stufe seiner künstlerischen Dialektik‘ ergreift, einigermaßen erschüttert.“ (Kager: 1998, 108).
(Wie) Ist Musikästhetik heute noch möglich?
311
sei ein übergeordneter Vergleich nun nicht mehr möglich. An diese Diagnose anschließend unternimmt Kager im Wesentlichen den Versuch, den unilinearen Materialstrang in mehrere divergierende, nebeneinander existierende Partialstränge aufzulösen. Die Aktualisierung, die Kager in dieser Weise an Adornos Materialbegriff vornimmt, stellt gewissermaßen eine Quantifizierung der Einsträngigkeit dar; die Unilinearität wird hierbei segmentierend in eine Multilinearität überführt. Die Grundlagen ästhetischer Reflexion und Wertung innerhalb dieser ausdifferenzierten Stränge könnten nun, so Kagers überraschender Vorschlag, jedoch durchaus noch denen Adornos vergleichbar bleiben: Zu prüfen wird dann folglich sein, inwieweit die jeweils einem bestimmten Strang des partialisierten künstlerischen Materials verpflichteten Kunstwerke die jeweils avanciertesten Mittel innerhalb jener Stilrichtung verwenden, der sie verpflichtet sind. Das bedeutet zwar die Absage an den Gedanken einer unverbrüchlichen, einheitlichen Avantgarde, wie sie Adorno im Bereich der Musik in der Person Schönbergs und in dessen Dodekaphonie noch erblickte. Wohl aber ließe sich weiterhin darüber urteilen, ob ein Kunstwerk im Adornoschen Sinne „wahr“ oder „falsch“, „fortschrittlich“ oder „rückschrittlich“ sei, indem der jeweils relevante Materialstrang zum Prüfstein wird. Innerhalb eines der Stränge wäre dann zwischen innovativen und regressiven Ansätzen zu unterscheiden. […] Und dennoch setzt die Diversifikation der Kunstformen die Adornosche Fortschrittskonzeption nicht gänzlich außer Kraft, […] (Kager: 1998, 109).
Auch wenn man nun von der gleichen Diagnose wie Kager ausginge, weist seine Argumentation meines Erachtens zumindest zwei Fragwürdigkeiten auf. Erstens wäre darauf zu insistieren, dass das ästhetische „System“ Adornos bei Verabschiedung des „Theorems der Einsträngigkeit“20 entscheidend mehr ins Wanken geriete, als dies zunächst den Anschein haben könnte. Ein in verschiedene Stränge ausdifferenziertes Material ginge, wenn man gleichsam aus der Theorie Adornos heraus argumentierte, seiner zwingenden Notwendigkeit verlustig, entbehrte als unausweichliche Folge dessen seiner Eigendynamik und Eigenlogik, wäre nur mehr ent-historisierte Materie, leeres Zeichen, totes Objekt. Eine Modifikation des Materialbegriffs im Sinne einer bloßen Verschiebung von einer Unilinearität zu einer (Pseudo-)Multilinearität hätte in letzter Konsequenz die vollständige theoretische Obsoleszenz der Kategorie des Materials zur Folge und implizierte dergestalt notwendigerweise auch einen Abschied von grundlegenden Konstellationen der Ästhetik Adornos, die ihrerseits direkt mit der Kategorie des Materials verknüpft sind; was von Kager als partielle Rettung der ästhetischen Theorie
20 Vgl. beispielsweise Bürger: 1995, 86ff.; Bürger: 1990, 11 und Bürger: 2001a, 15f.
312
Nikolaus Urbanek
Adornos intendiert war, versetzte ihr nolens volens den endgültigen Todesstoß.21 Albrecht Wellmer hat auf diese brisante Problematik hingewiesen, die sich ergibt, wenn man in einem derart auf dialektischer Konstellativität basierenden Denken wie demjenigen Adornos versucht, einzelne Kategorien aus ihrem Zusammenhang zu lösen, und aus eben diesem Grund dieser atomisierenden Leseweise seinen Vorschlag einer „stereoskopischen Lektüre“ (Wellmer: 1993a, 44) entgegengesetzt. Zweitens – und dies wäre in unserem Zusammenhang wohl der beträchtlich weiter führende Kritikpunkt – bliebe kritisch zu hinterfragen, ob diese Aktualisierung der Adorno’schen Ästhetik überhaupt die Möglichkeit bereitzustellen imstande wäre, die Phänomene gegenwärtiger Musikproduktion adäquat zu reflektieren. Dies dürfte jedoch – auch in Kenntnis der von Kager diskutieren musikalischen Beispiele – nicht der Fall sein; es scheint vielmehr, als ob sich die „Abkehr vom Materialdenken“ vor allem als eine Abkehr vom modernen Fortschritts- und Purismusgebot manifestiert. Eben für diese künstlerische Absage an die Gültigkeit des Fortschrittsgebots halten nun die Überlegungen Kagers keine schlüssige Erklärung bereit, wohl nicht zuletzt deshalb, da sie letzten Endes ausschließlich mit modernen Argumentationsfiguren operieren. Die gegenwärtig zu beobachtende Auflösung des Fortschrittsbegriffs22 stellt jedoch demgegenüber ebenso wie die 21 Kager ist sich dessen wohlbewusst, weist er doch dezidiert auf die Problematik einer Isolierung des Materialbegriffs hin (vgl. Kager: 1998, 103 und 99). Auch Bürger exponiert genau dieses Problem, wenn er aus literaturwissenschaftlicher Perspektive konstatiert, dass „eine Erweiterung [des Kanons Adornos, N.U.] nicht in der Weise möglich [sei], dass man den einen oder anderen Autor hinzufügt. Da die Ausschließungen bei Adorno systematisch begründet sind, bedeutet eine Erweiterung des Kanons, den Begriff der literarischen Moderne neu zu denken.“ (Bürger: 1988, 9). 22 Gianni Vattimo beispielsweise hat mit seinem Begriff der „Verwindung der Moderne“ einige grundlegende Überlegungen zu der Auflösung des modernen Fortschrittsbegriffs vorgelegt. Hierbei geht er, die Moderne als das „Zeitalter der Reduktion des Seins auf das novum“ (Vattimo: 1990, 186) bezeichnend, welches durch die Idee einer kritischen „Überwindung“ gekennzeichnet sei, davon aus, dass eine sich von einer so verstandenen Moderne absetzende „Epoche“ nun nicht einfach als „neue Epoche“ nach der Moderne gedacht werden könne, „aus dem einfachen Grunde, dass man dann immer noch ein Gefangener der diesem Denken eigenen Logik der Entwicklung geblieben wäre.“ (Vattimo: 1990, 6) Ein Verständnis, welches das Präfix „post“ der Postmoderne lediglich im Sinne eines Neuen, chronologischen Nachfolgenden kennzeichnet, weise sich somit als genuin moderne Denkfigur aus. In der Postmoderne hingegen konstatiert Vattimo demgegenüber eine radikale Auflösung genau dieser „Obsession“ der sich selbst stets überwinden-wollenden Moderne und entwickelt in einer der Nietzscheanischen „Umwertung aller Werte“ verpflichteten Lektüre des Aufsatzes „Identität und Differenz“ von Martin Heidegger seinen zentralen Begriff der „Verwindung“, der im Gegensatz zu der modernen „Überwindung“ eine zersetzende Auflösung zentraler Kategorien und Denkfiguren der Moderne impliziert. Bezüglich ihres theoretischen Kerns sehr ähnliche Überlegungen finden sich auch bei Lyotard, vgl. beispielsweise Lyotard: 1996b, 100 und Lyotard: 1994b, 213.
(Wie) Ist Musikästhetik heute noch möglich?
313
Missachtung des Purismusgebots eine grundlegende Abkehr von diesen modernen Prinzipien dar; die Verwendung unterschiedlicher Materialstände ist darüber hinaus mitnichten als bloße Quantifizierung einer zugrunde liegenden Einsträngigkeit zu deuten, sondern weist eo ipso auf eine emphatische Sichtweise von Pluralität und Heterogenität.23 Um die Frage nach einer möglichen theoretischen Annäherung an die Phänomene ästhetischer Pluralität und Heterogenität, die gewissermaßen die Kehrseite des modernen Purismusgebots darstellen, thematisieren zu können, möchte ich im Folgenden zwei nicht weiter ausgeführten Hinweisen Kagers nachgehen und die mögliche Relevanz der Konzeption des Widerstreits von Jean-François Lyotard und des nomadologischen Denkens, das Gilles Deleuze und Félix Guattari in ihrem Text Rhizom zur Diskussion gestellt haben, für ästhetische Überlegungen überprüfen.24 Obwohl ästhetische Implikationen in der letztlich auf eine politische Ethik25 zielenden Problematisierung der Diskursgerechtigkeit scheinbar nur eine untergeordnete Rolle spielen, ist Lyotards philosophisches Hauptwerk Der Widerstreit für unsere Argumentation in mindestens zweierlei Hinsicht für unseren ästhetischen Diskurs von unmittelbarem Interesse. Zum einen bildet es den philosophischen 23 Einem gewichtigen und äußerst bedenkenswerten Einwand kann ich zwar in der gebotenen Kürze einer Fußnotennotiz nicht adäquat begegnen, möchte ihn jedoch auch nicht völlig verschweigen. So ließe sich einwenden, dass die zu beobachtende beliebige Verfügung über das Material noch keineswegs ein stichhaltiges Argument gegen die grundlegende Relevanz des Verbots der beliebigen Verfügung schlechthin darstellen müsse. Natürlich muss Faktizität in einer ästhetischen Argumentation nicht notwendigerweise ein „Argument dagegen“ darstellen, allerdings sehe ich darin, dass die ästhetische Theorie Adornos die Idee einer steten Reaktionsfähigkeit der Theorie auf die musikalischen Ereignisse emphatisch für sich in Anspruch nimmt, einen in diesem Zusammenhang vielleicht nicht unwichtigen „Gegeneinwand“. Das soll nicht heißen, dass sich die ästhetische Theorie automatisch mit jedem beliebigen Neo-diesem und Neo-jenem, Post-diesem und Post-jenem fundamental ändern müsse, das soll aber sehr wohl heißen, dass die ästhetische Theorie – „theoretisch“ – in der Lage sein müsste, reflektierend auch zu jedem beliebigen Neo-diesem und Neo-jenem etc. Stellung nehmen zu können. 24 Diese Überlegungen basieren auf einer Diskussion des theoretischen Verhältnisses von Moderne und Postmoderne, die ich an anderer Stelle ausführlicher geführt habe, vgl. Urbanek: 2005. 25 Vgl. den Aufsatz „Zur Epistemologie und Politik der Differenz. Demokratiekonzeptionen im Gefolge der Postmoderne“, in welchem Seyla Benhabib anhand des Widerstreits diskutiert, „welche politischen Implikationen die Metakritik der Vernunft, wie sie Jean-François Lyotard in seinen Schriften entwickelt, für unser gegenwärtiges Verständnis von Demokratie hat.“ (Benhabib: 1993, 244) Ihr in diesem Text verfolgtes Projekt dürfte letzten Endes wohl das einer modernen Lektüre der Postmoderne sein, indem sie die Frage zu stellen unternimmt, „[welche] Modelle von Demokratie und demokratischer Legitimation […] aus einer Perspektive der Kritik der Vernunft noch vertreten werden [können], die von der Postmoderne gelernt hat, ohne ihre radikale Zurückweisung des Projekts der Aufklärung zu teilen?“ (Benhabib: 1993, 244).
314
Nikolaus Urbanek
Hintergrund für Lyotards eigene ästhetische Überlegungen,26 zum anderen stellt die Konzeption des Widerstreits als ein Denken der absoluten Differenz, in welchem Übergänge und Verbindungen zwischen radikal Heterogenem keinen Ort besitzen, eine in unserem Zusammenhang nicht zu vernachlässigende theoretische Extremposition dar. In direktem Gegensatz zu Jürgen Habermas, dessen berühmte Adorno-PreisRede (Habermas: 1994, 177–192) einen irreduziblen Bezugspunkt des einschlägigen Diskurses über das Verhältnis von Moderne und Postmoderne darstellt, votiert Lyotard für die Option einer radikalen Vielheit, die ihrerseits auf keine Einheit mehr rückführbar ist.27 Diese radikale Pluralität impliziert in Zusammenhang mit der sich hieraus ergebenden Heterogenität nun eine antinomische Situation, diejenige des Widerstreits: Im Unterschied zu einem Rechtsstreit [litige] wäre ein Widerstreit [différend] ein Konfliktfall zwischen (wenigstens) zwei Parteien, der nicht angemessen entschieden werden kann, da eine auf beide Argumentationen anwendbare Urteilsregel fehlt. Die Legitimität der einen Argumentation schlösse nicht auch ein, dass die andere nicht legitim ist. Wendet man dennoch dieselbe Urteilsregel auf beide zugleich an, um ihren Widerstreit gleichsam als Rechtsstreit zu schlichten, so fügt man einer von ihnen Unrecht zu (einer von ihnen zumindest, und allen beiden, wenn keine diese Regel gelten lässt). Aus der Regelverletzung einer Diskursart resultiert ein Schaden, der unter Beachtung eben dieser Regeln behebbar ist. Ein Unrecht resultiert daraus, dass die Regeln der Diskursart, nach denen man urteilt, von denen der beurteilten Diskursart(en) abweichen (Lyotard: 1989, 9).
Der Widerstreit ist per definitionem unauflösbar; jeglicher Rekurs auf eine Metaebene, welcher den Widerstreit zwischen zwei heterogenen Diskursen zu schlichten vermocht hätte, ist schlechterdings unmöglich, fügt er doch in der Verletzung der inhärenten Diskursregeln eines oder beider Diskurse möglicherweise diesem, jenem oder gar beiden Unrecht zu. Dieser Ausschluss der Metaebene kann als direkte und notwendige Konsequenz der viel zitierten „These“ vom Ende der großen Erzählungen angesehen werden,28 die ihrerseits überhaupt erst im Kontext des Widerstreits ihre volle Brisanz zu entfalten vermag, wenn man Lyotard dahingehend folgt, dass mit dem Ende der großen Erzählungen jegliche Möglichkeit einer „ver-
26 „Die politische Programmatik der Postmoderne mündet in einen ästhetischen Ansatz, den Lyotard, genauso wie Adorno, in der Avantgarde der modernen Kunst zu finden glaubt.“ (Peña Aguado: 1994, 107). 27 Vgl. aufgrund des direkten Bezuges zum Habermas’schen „Einheitskonzept“ Lyotard: 1996a, 13f. 28 Vgl. Lyotard: 1994a, 112 und in direkter Bezugsetzung hierzu Lyotard: 1989, 226.
(Wie) Ist Musikästhetik heute noch möglich?
315
gleichenden Verbindung“ heterogener und einander widerstreitender Elemente verloren gegangen sei.29 Nun ließe sich aber einwenden, dass in einem solch radikalen Differenz-Denken die Situation des Widerstreits gar nicht denkbar sei, da es, um den Widerstreit überhaupt bezeugen zu können, wenigstens minimaler Vergleichs-, Verkettungs- oder Übergangsmöglichkeiten bedürfe.30 Diese thematisiert Lyotard nun in direktem Bezug auf Kants Kritik der Urteilskraft. An seiner Kant-Lektüre werden nun die irreduziblen Unterschiede, die das Denken der beiden scharf voneinander trennt, besonders deutlich: Während sich in der Thematisierung des Übergangs zwischen heterogenen Diskursen bei Kant stets das Bemühen um das Zustandekommen desselben zeigt,31 zielt Lyotard viel stärker auf die grundlegende Inkommensurabilität des Heterogenen.32 Besonders augenfällig wird die Wahrung irreduzibler und inkommensurabler Heterogenität in dem von Lyotard vorgeschlagenen Denkmodell des „Archipels“: Jede der Diskursarten wäre gleichsam eine Insel; das Urteilsvermögen wäre, zumindestens teilweise, gleichsam ein Reeder oder Admiral, der von einer Insel zur anderen Expediti-
29 In seinem „Merkzettel zur Lektüre“ weist Lyotard auf den „Kontext“ seiner Überlegungen hin: „Die ,Sprachwende‘ der abendländischen Philosophie (die letzten Werke Heideggers, das Eindringen anglo-amerikanischer Strömungen ins europäische Denken, die Entwicklung von Sprach-Technolo gien); im Verein damit der Niedergang der universalistischen Diskurse (den metaphysischen Doktrinen der Moderne: der Erzählungen vom Fortschritt, vom Sozialismus, vom Überfluß vom Wissen). Die ,Theorie‘-Müdigkeit und die elende Erschlaffung, die sie begleitet (Neo-dies, Neo-das, Postdieses, Post-jenes). Die Stunde des Philosophierens.“ (Lyotard: 1989, 12). 30 „Denn wie Davidson und Quine gezeigt haben, könnten wir, wenn sprachliche, begriffliche oder andere Systeme miteinander völlig inkommensurabel wären, dies gar nicht wissen, da unsere Fähigkeit, ein System als System zunächst zu beschreiben, von der Möglichkeit abhängt, bestimmte Eigenschaften dieser andere Begriffssysteme hinreichend als den Eigenschaften des unseren gleich identifizieren, auswählen und bestimmen zu können, damit sie überhaupt als begriffliche Aktivitäten verstanden werden können.“ (Benhabib: 1993, 128). 31 Verwiesen sei in diesem Zusammenhang beispielsweise auf die Thematisierung des Übergangs zwischen ästhetischem und ethischem Diskurs anhand der Symbolhaftigkeit des Schönen in Hinblick auf das Sittlichgute bei Kant, vgl. Kant: 1996, 294–299. 32 Diesen Unterschied thematisiert Lyotard in einem Kant gewidmeten Exkurs und einigen direkt an diesen anschließenden Reflexionen, vgl. Lyotard: 1989, 217–226. Auch hier können wir in gewisser Weise eine Trennungslinie zwischen Moderne und Postmoderne verorten: das Festhalten an der Idee einer möglichen, alles legitimierenden Einheit auf der modernen, das Bewusstsein um das Nichtvorhandensein einer solchen und das Betonen heterogener pluraler Verfasstheiten auf der postmodernen Seite. Somit könnte dies in direktem Zusammenhang zu Lyotards berühmter Formulierung der Differenz zwischen Moderne und Postmoderne als Differenz zwischen „Trauer und Wagnis“ gelesen werden, vgl. Lyotard: 1996a, 27.
316
Nikolaus Urbanek
onen ausschickte mit dem Ziel, auf der einen darzustellen, was auf der anderen gefunden (erfunden, im ursprünglichen Sinne von invenire) wurde und der ersten als ,Als-ob-Anschauung‘ zu ihrer Validierung dienen könnte. Diese Interventionsmacht, Krieg oder Handel, besitzt keinen Gegenstand, keine eigene Insel, sondern erfordert ein Medium, das Meer, den Archipelagos, das Ur- oder Hauptmeer, wie einst die Ägäis genannt wurde (Lyotard: 1989, 218f.).
Dieser Figur des Reeders oder Admirals eignet aus systematischer Perspektive jedoch eine antinomische Ambivalenz. Einerseits ist eine absolute Metainstanz mit Lyotards grundlegender Prämisse unvereinbar; andererseits wurde sie von Lyotard in seiner theoretischen Praxis schon längst als Fixpunkt verankert. Es ergibt sich demnach innerhalb der Überlegungen von Lyotard das Paradoxon, dass er zwar für eine radikale Pluralität plädiert, dies aber letztlich von der Warte einer dieser zugrunde liegenden Einheit unternimmt, die in seiner eigenen Person als Philosoph respektive Reeder oder Admiral zu verorten wäre. Der von Lyotard als Ausweg aus dieser Aporie angebotene Vorschlag, die philosophische Reflexion als denjenigen Diskurs zu definieren, welcher auf die Ipseität anderer Diskurse altruistisch sich beziehe,33 kann in unserem Zusammenhang das brisante Problem der Konnexionslosigkeit des Heterogenen nur an der Oberfläche einer Auflösung zuführen. Das Modell eines zwischen den Inseln hin- und herfahrenden Admirals oder Philosophen müsste vielmehr zugunsten eines Modells aufgelöst werden, in welchem Verbindungen und Übergänge quasi dezentralisiert bereits von den einzelnen Inseln zueinander gedacht werden können. Ein derartiges Modell, in welchem die Konnexion des Heterogenen a priori verankert ist, haben Deleuze und Guattari in ihrem programmatischen Text Rhizom zur Diskussion gestellt. Dieser nimmt seinen Ausgang in einer dreifachen Unterscheidung von Denkformen. Die erste Denkform, die der klassischen Metaphysik, lässt sich durch das Bild eines sich verzweigenden Baumes charakterisieren; ihr liegt die Annahme eines einheitlichen Ursprungs zugrunde. Pluralität, Differenz und Heterogenität sind, da sie ausschließlich in dem einheitlichen Ursprung ihre Letztbegründung finden, bloß als sekundäre Qualitäten zu denken. Demgegen über versucht der zweite Typ des Denkens, Pluralität und Heterogenität als Werte dergestalt gegenüber der Einheit zu retten, indem er davon ausgeht, dass „die Hauptwurzel verkümmert“ (Deleuze/Guattari: 1977, 9) und an ihre Stelle eine wuchernde „Vielwurzeligkeit“ (Deleuze/Guattari: 1977, 10) zu setzen sei. Doch auch dieses Modell nimmt auf eine „noch umfassendere verborgene Einheit oder eine erweiterte Totalität“ (Deleuze/Guattari: 1977, 9) – eben die verkümmerte Haupt33 Vgl. beispielsweise Lyotard: 1989, 13 und 168.
(Wie) Ist Musikästhetik heute noch möglich?
317
wurzel – implizit Bezug; die Vielheit dieses Denkens, welches Deleuze und Guattari als Denken der Moderne ausweisen, ist somit lediglich eine „Pseudo-Vielheit“ (Deleuze/Guattari: 1977, 13). Angemerkt sei an dieser Stelle, dass aus dieser Perspektive das Philosophieren von Lyotard in strenger Konsequenz als modernes zu bezeichnen wäre. Das rhizomatische Denken hingegen, zu dessen Charakterisierung sich Deleuze und Guattari eines botanischen Vergleiches mit dem eigenwilligen unterirdisch wachsenden und sich wuchernd verzweigenden Sprossteil bedienen, ist durch einige besonders auffällige „Prinzipien“ gekennzeichnet. Das Prinzip der Vielheit34 verweist auf ein Verhältnis, in welchem Vielheit und Einheit nicht mehr als strikter Gegensatz gedacht werden müssen. In der schlichten Formel „n – 1“ (Deleuze/ Guattari: 1977, 11), welche „die Einheit zu einem Element der Vielheit herabsetzt“ (Welsch: 1996a, 359), findet das rhizomatische Denken seine formale Eingrenzung; Einheit markiert nicht mehr das Gegenteil von Vielheit, sondern stellt gewissermaßen einen Teil derselben dar. Zugrunde legend, dass „jeder beliebige Punkt eines Rhizoms […] mit jedem anderen verbunden werden [kann und muss]“ (Deleuze/Guattari: 1977, 11), erlauben die Prinzipien der Heterogenität und der Konnexion (Deleuze/Guattari: 1977, 11–13), die konsequenterweise nur zusammen zu denken sind, einen Modus des Übergangs im Widerstreit, in welchem auch das Differente in seiner jeweiligen Ipseität souverän erhalten werden kann. Das Andere wird in seiner Alterität belassen, es findet also keine Integration statt, da genau dies eine – moderne – Rückführung der Differenz auf eine Einheit darstellte. Das Prinzip des asignifikanten Bruchs (Deleuze/Guattari: 1977, 16–20) nimmt direkten Bezug auf die eigentümliche Eigenschaft des Rhizoms, dass in diesem Teile absterben können, ohne dass dies dem gesamten Netzwerk Schaden zuzufügen imstande wäre. Letzteres hat zur Folge, dass mit der Frage der Genealogie35 auch Fragen der Originalität, des Einflusses, der Entwicklung, des Fortschritts – durchwegs leitende Ideen der Moderne – in einem in Heterogenität wuchernden Rhizom nicht nur unentscheidbar werden, sondern darüber hinaus auch als nicht mehr relevant erscheinen müssen. Es erwächst an diesem Punkt gewissermaßen die theoretische Möglichkeit, Verbindungen des Heterogenen auch im Bereich der Kunst jenseits einer Scylla des einheitlichen Ursprungs und einer Charybdis absoluter Differenz zu denken. Einer zu entwickelnden rhizomatischen Ästhetik könnte es vor diesem Hintergrund 34 „Nur wenn das Viele als Substantiv behandelt wird, hat es keine Beziehung mehr zum Einen als Subjekt und Objekt, als Natur und Geist, als Bild und Welt. Vielheiten sind rhizomatisch und entlarven die baumartigen Pseudo-Vielheiten.“ (Deleuze/Guattari: 1977, 13). 35 „Das Rhizom dagegen ist eine Anti-Genealogie.“ (Deleuze/Guattari: 1977, 18).
318
Nikolaus Urbanek
vielleicht gelingen, die plurale Heterogenität gegenwärtiger Kunstproduktion adäquat zu reflektieren, ohne einerseits in die aporetische Situation des konnexionslosen Widerstreites zu geraten beziehungsweise andererseits in einer gewaltsamen Zusammenfügung des Heterogenen im Sinne einer modernen Integration den Platz auf einer nicht mehr zu legitimierenden Metaebene einnehmen zu müssen.36
Von postmodernen Tendenzen und Zwängen Stünde nicht eine Frage im Raum, die die Bedingungen der Möglichkeit meiner Argumentation fundamental infrage stellen könnte, könnte ich an dieser Stelle mit obigem Verweis auf das, was in näherer Zukunft auf dem Arbeitsprogramm des Musikästhetikers stehen könnte, vorläufig schließen. Eine mögliche Formulierung dieser Frage könnte etwa lauten: Ist nicht der Anspruch, den Kunstwerken eine adäquate ästhetische Reflexion gegenüberstellen zu wollen, eine obsolet gewordene Kategorie der Moderne, die im Anschluss an beispielsweise Nietzsches Umwertung aller Werte, Heideggers Destruktion der Metaphysik oder auch Vattimos Verwindung der Moderne schlechterdings nicht mehr zu rechtfertigen ist? Nicht, dass ich im Rahmen dieser Notizen eine adäquate Antwort darauf geben könnte – hieße das doch, auch gleichzeitig eine Antwort auf die Titelfrage geben zu können –, möchte ich dennoch abschließend wenigstens andeuten, in welchem Horizont sich eine mögliche Auseinandersetzung mit dieser Frage bewegen müsste. Der mehrfach implizit wie explizit in Anspruch genommene Anspruch einer adaequatio der theoretischen Reflexion in Hinblick auf die von ihr reflektierten Kunstwerke ist gewissermaßen nur das oberflächliche Symptom einer weitaus weiter reichenden Prämisse und findet seinen Ursprung letztlich in dem Festhalten an dem Anspruch des Kunstwerks, als Kunstwerk und nicht als bloß materiales Objekt rezipiert zu werden, oder etwas präziser formuliert: in dem Wahrheitsanspruch
36 Freilich wäre es hierbei nun durchaus verführerisch, eine direkte Verbindung vom rhizomatischen Denken zu der von Roland Barthes konstatierten Verschiebung vom Werk zum Text aufzusuchen und diese dergestalt zu parallelisieren, als nunmehr davon auszugehen wäre, dass das „Gewebe von Zitaten“ (Barthes: 2000, 190) gewissermaßen ein „Rhizom“ darstellte. Mit dem Hinweis auf die mögliche Relevanz des rhizomatischen Denkens ging es mir jedoch weniger darum, die Überlegungen von Deleuze und Guattari in einer solch direkten Art und Weise auf die Musik übertragen und hieraus analogisierend musikästhetische Kategorien ableiten zu wollen, sondern vielmehr darum, die Reaktionsfähigkeit der Theorie zu erhöhen respektive überhaupt erst wiederherzustellen. In eben diesem Sinne könnte das rhizomatische Denken einige überdenkenswerte Denkmodelle bereitstellen.
(Wie) Ist Musikästhetik heute noch möglich?
319
der Kunst.37 Die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Wahrheit respektive nach dem Wahrheitsgehalt von Kunst stand bekanntlich lange Zeit unangefochten im Zentrum der Ästhetik, bis mit der zeitgenössischen Vernunftkritik, die nach diversen „Toden“, „Abschieden“ und „Enden“38 letztlich in einen vielstimmig proklamierten „Tode der Vernunft“ (Wellmer: 1993b, 48) zu münden schien, auch die Frage nach der prinzipiellen Möglichkeit des Rekurses auf Wahrheit grundsätzlich in Zweifel gezogen wurde: Die Radikalisierung besteht in folgendem: Menschliches, Allzumenschliches geht von dem Vorsatz aus, eine Kritik der obersten Werte der Kultur durchzuführen, und zwar – diesseits jeglicher Sublimation – auf dem Weg einer „chemischen“ Reduktion (vgl. Aph.1) dieser Werte auf die sie konstituierenden Elemente. Dieses Programm einer chemischen Analyse führt jedoch, wenn man es bis ins letzte durchführt, zu der Entdeckung, daß die Wahrheit, in deren Namen die chemische Analyse sich legitimierte, selbst ein Wert ist, der sich auflöst. […] Genau mit dieser nihilistischen Schlussfolgerung läßt man Nietzsche zufolge die Moderne wirklich hinter sich. Da der Begriff der Wahrheit keine Gültigkeit mehr besitzt und das Fundament nicht mehr tragfähig ist – denn es gibt kein Fundament des Glaubens an ein Fundament und demzufolge an eine Begründungsaufgabe des Denkens mehr –, kann man die Moderne nicht durch eine kritische Überwindung hinter sich lassen, denn dies wäre ein noch gänzlich innerhalb der Moderne selbst verbleibender Schritt. Dies ist der Moment, den man als Geburt der Postmoderne in der Philosophie bezeichnen könnte: ein Ereignis, dessen Bedeutung und Konsequenzen wir – ebenso wie die im Aphorismus 125 der Fröhlichen Wissenschaft angekündigten Todes Gottes noch lange nicht genügend ermessen haben (Vattimo: 1990, 181f.).
Letzten Endes stellt die Frage nach dem Wahrheitsgehalt beziehungsweise Wahrheitsbezug der Kunst eine Variante derjenigen Frage dar, die die Ästhetik als philosophische Disziplin von Anbeginn39 umgetrieben hat und trifft in diesem Sinn naturgemäß den Kern auch des vorliegenden Problems: Wahrheitsästhetiken,40 sei es in ihrer unterbietungstheoretischen Variante, in welcher die Kunst zu einer bloßen Vorstufe philosophischen Denkens degradiert wird,41 sei es in ihrer komplementaritätstheoretischen Form, in welcher Philosophie und Kunst gleichen Rang beanspru37 „[Es] gibt etwas an der Kunst, das uns dazu verführt, die Kunstwerke selbst – oder doch viele Kunstwerke – als Träger von Wahrheitsansprüchen aufzufassen; und diese Wahrheitsansprüche von Kunstwerken hängen zusammen mit ihrem ästhetischen Geltungsanspruch.“ (Wellmer: 1993a, 33) 38 Vgl. hierzu beispielsweise die kurze Polemik von Martin Seel in: Seel: 2001, 154f. 39 Vgl. Kern/Sonderegger: 2002, 7–11. 40 Diese Differenzierung der unterschiedlichen Ausprägungen der Wahrheitsästhetik ist in Grundzügen der Darstellung von Reinold Schmückers „Grundlegung“ Was ist Kunst? verpflichtet, vgl. Schmücker: 1998, 19–47. 41 Schmücker nennt als Beispiel für ein unterbietungstheoretisches Modell einer Wahrheitsästhetik
320
Nikolaus Urbanek
chen respektive zugesprochen bekommen,42 oder sei es zuletzt in ihrer überbietungstheoretischen Spielart,43 in welcher die Kunst in Bezug auf eine nichtbegriffliche Erkenntnis eine hervorgehobene Position in der Wahrheitsfrage erhält, überfordern gewissermaßen die Kunst, indem sie ein heteronomes Bewertungsschema anlegen und die Kunstwerke lediglich mit dem außerästhetischen Maßstab philosophischer Wahrheit messen. Der Eigensinn und die Eigenlogik der Kunst werden in dieser Weise sträflichst vernachlässigt. Reine Erfahrungsästhetiken hingegen unterfordern die Kunst, indem sie den spezifischen Anspruch der Kunstwerke, als Kunstwerke insbesondere die Ästhetik Hegels, bei welcher die Kunst zu einer bloßen „Vorgestalt des begrifflichen Denkens degradiert“ werde, vgl. Schmücker: 1998, 27. 42 Diese Form einer komplementaritätstheoretischen Wahrheitsästhetik, in welcher Philosophie und Kunst gleichen Rang beanspruchen respektive zugesprochen bekommen, findet sich nach Schmücker beispielsweise im Frühwerk Schellings. Kennzeichen dieser „Theorie“ sei, dass „Kunst und Philosophie gleichwertige Weisen menschlichen Welt- und Selbstverstehens sind.“ (Schmücker: 1998, 30f.) Das Verhältnis von Kunst und Philosophie kann somit als das eines beiderseitigen Bedürfens gedacht werden: „So wie die Philosophie der Kunst bedarf, weil ihr anders das Moment der Objektivität fehlte, bedarf demnach auch die Kunst der Philosophie, weil sie ohne deren Explikationsleistung nicht als Versöhnungsgestalt wahrgenommen werden.“ Ich kann aber Schmückers Aussage, dass „diese Interpretation des Wahrheitsbezugs der Kunst […] in der Kunstphilosophie der Moderne keinen nennenswerten Einfluß erlangt [habe]“ nicht zustimmen, da gerade dieses Theorem – wenn wir es als solches bezeichnen wollen – einer Gleichberechtigung und eines gegenseitigen Aufeinander-Angewiesen-Seins von Kunst und Philosophie in der Ästhetik Adornos eine zentrale Stelle besetzt und in dieser Form sehr wohl einen „nennenswerten Einfluss“ hatte. Vgl. beispielsweise Wellmer: 1993a, 12–14, Kager: 1988, 223–234 und neuerdings auch Gehring: 2004, 5–23. 43 Beispiele Schmückers sind insbesondere Schellings System des transcendentalen Idealismus, Schopenhauer und im Zwanzigsten Jahrhundert: Heidegger, Gadamer und Adorno. Wiederum möchte ich darauf hinweisen, dass zumindestens in Bezug auf Adorno diese – zunächst sehr hilfreiche – Systematisierung differenzierend zu modifizeren wäre. Schmücker beruft sich in Bezug auf Adorno vor allem auf die Interpretation von Rüdiger Bubner (Schmücker: 1998, 37); nun wäre aber zu zeigen, dass die von Bubner vorgeschlagene Lektüre fast ausschließlich die unplausiblen Züge an Adornos Wahrheitsästhetik herausstreicht, infolgedessen recht einseitig argumentiert und hierbei die dialektische Konstruktion völlig außer Acht lässt. Sie negiert erstens die oben genannten komplementaritätstheoretischen Implikationen, sie negiert zweitens die spezifische Prägung der Wahrheit als stets prozessuale („Zeitkern der Wahrheit“) und sie negiert drittens die von Adorno quasi im Schreiben implizit thematisierte Fragilität der gesamten Wahrheitskonstruktion und damit einhergehend ihre dialektische Gestalt. In Bezug auf den letztgenannten Aspekt beziehe ich mich insbesondere auf die berühmte Passage der Umkreisung des Wahrheitsbegriffs in der Ästhetischen Theorie, in welcher in immer weiter geführten Negationen eine „spiralförmige“ Bestimmung der Wahrheit der Kunst versucht wird, ohne dies als positiv identifizierendes „Auspinseln“ eines Begriffs zu unternehmen oder gar eine begriffliche Definition zur Diskussion zu stellen. Es wäre somit darauf zu insistieren, dass Adornos spezifische Form der Wahrheitsästhetik sich keineswegs in einer dieser drei Varianten erschöpft, sondern in unterschiedlicher Weise und Intensität an allen partizipiert.
(Wie) Ist Musikästhetik heute noch möglich?
321
und nicht als bloße Objekte sinnlicher Anschauung rezipiert zu werden, schlichtweg negieren; auch dies stellt letztlich eine Vernachlässigung des Eigensinns und der Eigenlogik der Kunst dar.44 Zur Diskussion zu stellen wäre nun meines Erachtens auch nach den diversen „postmodernen“ Destruktionen der Wahrheit, ob tatsächlich anhand der Wahrheitsfrage eine Unterscheidung zwischen einer „Moderne“ und einer „Postmoderne“ möglich und vor allem sinnvoll sei, oder etwas anders formuliert: ob die noch immer vermutete Grenze zwischen Moderne und Postmoderne gleichbedeutend sei mit der Grenze zwischen einem Geltungsbereich der Wahrheit und einem Bereich, in welchem sich der Anspruch auf Wahrheit und die Möglichkeit des Rekurses auf Wahrheit schlechthin aufgelöst haben. Damit unmittelbar zusammenhängend wäre kritisch zu hinterfragen, ob das radikale Verabschieden des Wahrheitsbegriffs aus dem ästhetischen Denken tatsächlich der Weisheit letzter Schluss sei beziehungsweise überhaupt sein könne, da letzten Endes auch dies einen Begriff der Wahrheit notwendig voraussetzt.45
44 In strenger Konsequenz wären auf der Basis einer reinen Erfahrungsästhetik ready mades niemals als Kunstwerke zu rezipieren; Duchamps Fontaine beispielsweise ist rein phänomenal von einem herkömmlichen Urinal schlicht ununterscheidbar: Sinnlich wahrnehmen kann ich lediglich, dass ich mich in einem Museum und eben nicht in einer Bedürfnisanstalt befinde, was zwar durchaus ein gewisses Verhalten nahe legen könnte, zur Unterscheidung zwischen Kunst und Nicht-Kunst jedoch nicht hinreichen dürfte; nicht alles, was sich in einem Museum befindet, ist allein dadurch bereits Kunst, zwischen dem Kunstwerk Fountain und beispielsweise dem lediglich zum Schutz des Museums, seiner Besucher und seiner Kunstwerke aufgestellten Feuerlöscher gibt es in Bezug auf den Kunstwerkstatus „essenzielle“ Unterschiede. Nicht selten werden nun aber ausgerechnet ready mades als Argument gegen Wahrheitsästhetiken jeglicher Provenienz ins Feld geführt. Dies allerdings ist meines Erachtens in diesem Zusammenhang ein nicht ungefährliches Argument, das sehr leicht genauso gut auch gegen die Skeptiker gewendet werden könnte. Genau indem die ready mades aus sich heraus die Differenz zwischen ihrer physischen Existenz und ihrer Existenz als Kunstwerke implizit zum Thema machen, geben sie den „Essenzialisten“ in Bezug darauf, dass es sich um eine durchaus sinnvolle, in gewisser Weise auch adäquat zu stellende Frage handeln könnte, wenn man das „Wesen“ der Kunst hinter- und erfragt beziehungsweise die Frage aufwirft, was Kunst zu Kunst mache, ein nicht unstichhaltiges Argument an die Hand. Die Interpretation, die anhand der ready mades die Wahrheitsästhetiken schlechthin für obsolet zu deklarieren versucht, argumentiert also vielleicht etwas kurzschlüssig. 45 „Es geht [bei Derrida], wie in der philosophischen Ästhetik seit jeher, um die Wahrheit, diesmal um die daß es keine Wahrheit im strengen Sinn geben kann und daß sie – selbst als unreine, als Wahrheit im nicht ganz strengen Sinn – an ein Spiel zurückgebunden bleibt, das die Wahrheit bestimmt und nicht umkehrt. Und diese Einsicht müßte auch Derrida eine Einsicht nennen, wenngleich die einzige, die in seinem Spiel übrigbleibt“. (Sonderegger: 2000, 117) So wäre hier der theoretische Ort zu zeigen, dass Derrida letzten Endes eine Position vertritt, „derzufolge Wahrheit ein hoffnungslos metaphysischer Begriff ist, wobei es aber für Derrida keinen direkten Ausweg aus der Metaphysik
322
Nikolaus Urbanek
So zeigt bereits ein kurzer Blick auf die aktuelle Ästhetik-Debatte, dass die Frage nach dem Wahrheitsanspruch der Kunst mitnichten einfach negativ zu entscheiden ist. In ihrer Dissertation Für eine Ästhetik des Spiels. Hermeneutik, Dekonstruktion und der Eigensinn der Kunst46 hat beispielsweise Ruth Sonderegger in ihrer Gegen überstellung der Ästhetiken von Gadamer und Derrida aufgewiesen, dass nicht nur Ersterer, dessen äußerst enger Bezug zur Wahrheitsfrage nicht erst seit Wahrheit und Methode evident ist, sondern auch Letzterer47 – bekanntermaßen einer der Protagonisten der zeitgenössischen Vernunftkritik – eine Form „negativer“ Wahrheitsästhetik vertritt: Derrida und Gadamer erläutern die ästhetische Erfahrung nicht nur als irgend eine Erkenntnis, sondern bestimmen diese immer wieder näher als eine Erkenntnis über den Ort und die Funktion des Wahrheitsbegriffs. Bei Gadamer ist die ästhetische deshalb eine überlegene Erkenntnis, weil es ihr um jene Wahrheit jenseits von Aussagen geht, die unserer Rede von wahren und falschen Aussagen zugrunde liegt […]. Bei Derrida ist die Literatur deswegen außerordentlich und überlegen, weil sie angeblich das wahrheitssubversive Element in allem Zeichengebrauch ans Licht bringt (Sonderegger: 2002, 221f.).
An ihre Diagnose anschließend möchte Sonderegger sodann aufzeigen, in welchem Sinn der Wahrheitsbezug der ästhetischen Erfahrung gerade auch unter der Prämisse, daß hermeneutische und antihermeneutische Intuitionen in puncto Ästhetik zusammenzudenken sind, irreduzibel ist. Erst wenn man Wahrheitsästhetiken unterschied-
gibt, da wir offensichtlich nicht ohne den Wahrheitsbegriff auskommen können.“ (Wellmer: 1999, 158). 46 Ich entnehme aus Gründen der Kürze und Prägnanz einige der folgenden Zitate aus Sondereggers direkt an ihre Dissertation anschließenden Aufsatz „Wie Kunst (auch) mit der Wahrheit spielt“, hinsichtlich der Frage nach dem Wahrheitsbezug Derridas vgl. jedoch vor allem Sonderegger: 2000, 73–119. 47 Dies zeigt Sonderegger in einer brillanten Lektüre der Lektüre der Lektüre des PantomimenLibrettos Pierrot Assassin de sa Femme in Mallarmés Mimique in Derridas „La double séance“. Der Wahrheitsbezug wird hier von Derrida gleich zu Beginn quasi programmatisch exponiert: „Die zweifache Séance (Tableau 1), von der ich niemals zu behaupten die Stirn oder die Dreistigkeit haben werde, sie sei der Frage vorbehalten Was ist Literatur?, diese Frage, die von nun an aufgenommen werden muß als ein Zitat bereits, worin der Platz des Was ist ebenso einer dringenden Untersuchung bedürfte wie die angemaßte Autorität, mit der was auch immer, im besonderen die Literatur, der Form der Inquisition unterworfen wird, diese zweifache Séance für die ich niemals die militante Einfalt aufbringen werde zu verkünden, sie sei betroffen von der Frage Was ist Literatur, wird ihre Ecke finden zwischen (Entre) der Literatur und der Wahrheit, zwischen der Literatur und dem, was die Frage Was ist? an Antwort verlangt.“ (Derrida: 1995, 197).
(Wie) Ist Musikästhetik heute noch möglich?
323
licher Provenienz hinter sich gelassen hat, kann der spezifische Wahrheitsbezug der Kunst sichtbar werden (Sonderegger: 2002, 209).
Letztlich zielen ihre Überlegungen, auf die näher einzugehen hier nicht mehr der Ort ist, auf eine an Schlegel orientierte Ästhetik des Spiels. In diesem Spiel durchkreuzen sich, ausgehend von dem komplizierten Status des Kunstwerks, bloßes Ding, schöne Anordnung und sinnhafte Darstellung zugleich zu sein, stets unterschiedliche – hermeneutische, formale, materiale – Verstehens- und Erkenntnisvollzüge (vgl. Sonderegger: 2002, 227ff.). Wie man im Anschluss an Kant vielleicht formulieren könnte, geht es bei der ästhetischen Erfahrung von Kunst um ein „freies Spiel der unterschiedlichen Erkenntnisvermögen“, ein Spiel, in welchem die prinzipielle Unabschließbarkeit der ästhetischen Erfahrung dergestalt in ihr Recht gesetzt wird, als es sich nicht um eine resultatorientierte Suche nach der Erkenntnis der Wahrheit handeln kann, sondern vielmehr um die ästhetische Erfahrung der Wahrheit der Kunst. Zu denken wäre somit vielleicht das Paradox einer autonomen Wahrheitsästhetik, welche die Kluft zwischen der leeren Heteronomie einer in ihrer Systematik erstarrten Wahrheitsästhetik und der blinden Autonomie einer der bloßen Beliebigkeit Gefahr laufenden Theorie der ästhetischen Erfahrung aufzuheben imstande wäre, um das lustvolle, „vollzugsorientierte Spiel“ (vgl. Wellmer: 2002, 163f.) ästhetischer Erfahrung als ästhetische Erfahrung einer spezifischen Kunstwahrheit reflektieren zu können.
324
Nikolaus Urbanek
Literatur Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, Frankfurt a. M. 1997a (Gesammelte Schriften, 7). Theodor W. Adorno, Philosophie der neuen Musik, Frankfurt a. M. 1997b (Gesammelte Schriften, 12). Theodor W. Adorno, Kriterien der neuen Musik, in: ders., Musikalische Schriften I–III: Klangfiguren, Frankfurt a. M. 1997c (Gesammelte Schriften, 16), 170–228. Roland Barthes, Der Tod des Autors, in: Fotis Jannidis u.a. (Hrsg.), Texte zur Theorie der Autorschaft, Stuttgart 2000, 185–193. Roland Barthes, Vom Werk zum Text, in: Kunsttheorie im 20. Jahrhundert. Künstlerschriften, Kunstkritik, Kunstphilosophie, Manifeste, Statements, Interviews, hrsg. von Charles Harrison und Paul Wood, für die deutsche Ausgabe ergänzt von Sebastian Zeidler, Band II, Ostfildern-Ruit 2003, 1161–1167. Seyla Benhabib, Zur Epistemologie und Politik der Differenz. Demokratiekonzeptionen im Gefolge der Postmoderne, in: Christoph Menke/Martin Seel (Hrsg.), Zur Verteidigung der Vernunft gegen ihre Liebhaber und Verächter, Frankfurt a. M. 1993, 243–267. Gianmario Borio, Material – zur Krise einer musikästhetischen Kategorie, in: Gianmario Borio / Ulrich Mosch (Hrsg.), Ästhetik und Komposition, Mainz 1994 (Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik, 20), 108–118. Rüdiger Bubner, Über einige Bedingungen gegenwärtiger Ästhetik, in: ders., Ästhetische Erfahrung, Frankfurt a. M. 1989, 9–51. Peter Bürger, Theorie der Avantgarde, 10. Aufl. Frankfurt a. M. 1995. Peter Bürger, Zur Kritik der idealistischen Ästhetik, 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1990. Peter Bürger, Prosa der Moderne, Frankfurt a. M. 1988. Peter Bürger, Das Altern der Moderne, in: ders., Das Altern der Moderne. Schriften zur Bildenden Kunst, Frankfurt a. M. 2001a, 10–31. Peter Bürger, Der Anti-Avantgardismus in der Ästhetik Adornos, in: ders., Das Altern der Moderne. Schriften zur Bildenden Kunst, Frankfurt a. M. 2001b, 31–47. Peter Bürger, Ende der Avantgarde?, in: ders., Das Altern der Moderne. Schriften zur Bildenden Kunst, Frankfurt a. M. 2001c, 186–192. Peter Bürger, Ästhetik der Moderne – ein Rückblick, in: ders., Das Altern der Moderne. Schriften zur Bildenden Kunst, Frankfurt a. M. 2001d, 193–204. Carl Dahlhaus, Abkehr vom Materialdenken?, in: Friedrich Hommel (Hrsg.), Algorithmus, Klang, Natur: Abkehr vom Materialdenken?, Mainz 1984 (Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik, 19), 45–55. Gilles Deleuze/Félix Guattari, Rhizom, übers. von Dagmar Berger, Berlin 1977. Jacques Derrida, Die zweifache Séance, in: ders., Dissemination, übers. von Hans-Dieter Gondek, hrsg. von Peter Engelmann, Wien 1995, 193–320. Michel Foucault, Was ist ein Autor?, in: Fotis Jannidis u.a. (Hrsg.), Texte zur Theorie der Autorschaft, Stuttgart 2000, 198–229. Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, 6. Aufl. Tübingen 1990 (Gesammelte Werke, 1: Hermeneutik I).
(Wie) Ist Musikästhetik heute noch möglich?
325
Petra Gehring, Kunst und Wahrheit. Überlegungen zu einem theorieästhetischen Doppelprogramm, in: Musik & Ästhetik 8/30 (2004), 5–23. Jürgen Habermas, Die Moderne – ein unvollendetes Projekt, in: Wolfgang Welsch (Hrsg.), Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion, 2. Aufl. Berlin 1994, 177– 192. Reinhard Kager, Herrschaft und Versöhnung. Einführung in das Denken Theodor W. Adornos, Frankfurt a. M. 1988. Reinhard Kager, Einheit in der Zersplitterung. Überlegungen zu Adornos Begriff des „musikalischen Materials“, in: Richard Klein/Claus-Steffen Mahnkopf (Hrsg.), Mit den Ohren denken. Adornos Philosophie der Musik, Frankfurt a. M. 1998, 92–114. Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, hrsg. von Wilhelm Weischedel, 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1996. Reinhard Kapp, Noch einmal: Tendenz des Materials, in: Reinhard Kapp (Hrsg.), Notizbuch 5/6 Musik, Berlin, Wien 1982, 253–281. Andrea Kern/Ruth Sonderegger, Einleitung, in: Andrea Kern / Ruth Sonderegger (Hrsg.), Falsche Gegensätze. Zeitgenössische Positionen zur philosophischen Ästhetik, Frankfurt a. M. 2002, 7–15. Jean-François Lyotard, Der Widerstreit, übers. von Joseph Vogl, 2. Aufl. München 1989. Jean-François Lyotard, Das postmoderne Wissen. Ein Bericht, übers. von Otto Pfersmann, hrsg. von Peter Engelmann, 3. Aufl. Wien 1994a. Jean-François Lyotard, Die Moderne redigieren, in: Wolfgang Welsch (Hrsg.), Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion, 2. Aufl. Berlin 1994b, 204–215. Jean-François Lyotard, Beantwortung der Frage: Was ist postmodern?, in: ders., Postmoderne für Kinder. Briefe aus den Jahren 1982–1985, übers. von Dorothea Schmidt unter Mitarb. von Christine Pries, hrsg. von Peter Engelmann, 2. Aufl. Wien 1996a, 11–32. Jean-François Lyotard, Notizen über die Bedeutung von „post-“, in: ders., Postmoderne für Kinder. Briefe aus den Jahren 1982–1985, übers. von Dorothea Schmidt unter Mitarb. von Christine Pries, hrsg. von Peter Engelmann, 2. Aufl. Wien 1996b, 99–105. Heinz-Klaus Metzger, Das Altern der Philosophie der neuen Musik, in: ders., Musik wozu. Literatur zu Noten, hrsg. von Rainer Riehn, Frankfurt a. M. 1980, 61–89. Maria Isabel Peña Aguado, Ästhetik des Erhabenen. Burke, Kant, Adorno, Lyotard, Wien 1994. Reinold Schmücker, Was ist Kunst? Eine Grundlegung, München 1998. Martin Seel, Das Handwerk der Philosophie. 44 Kolumnen, München, Wien 2001. Ruth Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels. Hermeneutik, Dekonstruktion und der Eigensinn der Kunst, Frankfurt a. M. 2000. Ruth Sonderegger, Wie Kunst (auch) mit der Wahrheit spielt, in: Andrea Kern/Ruth Sonderegger (Hrsg.), Falsche Gegensätze. Zeitgenössische Positionen zur philosophischen Ästhetik, Frankfurt a.M. 2002, 209–238. Nikolaus Urbanek, Spiegel des Neuen. Musikästhetische Untersuchungen zum Werk Friedrich Cerhas, Bern u.a. 2005. Gianni Vattimo, Das Ende der Moderne, übers. und hrsg. von Rafael Capurro, Stuttgart 1990. Albrecht Wellmer, Wahrheit, Schein, Versöhnung. Adornos ästhetische Rettung der Modernität, in: ders., Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne. Vernunftkritik nach Adorno, 3. Aufl. Frankfurt a. M. 1993 (1993a), 9–47.
326
Nikolaus Urbanek
Albrecht Wellmer, Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne: Vernunftkritik nach Adorno, in: ders., Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne. Vernunftkritik nach Adorno, 3. Aufl. Frankfurt a. M. 1993 (1993b), 48–114. Albrecht Wellmer, Wahrheit, Kontingenz, Moderne, in: ders., Endspiele: Die unversöhnliche Moderne. Essays und Vorträge, 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1999, 157–177. Albrecht Wellmer, Das musikalische Kunstwerk, in: Andrea Kern/Ruth Sonderegger (Hrsg.), Falsche Gegensätze. Zeitgenössische Positionen zur philosophischen Ästhetik, Frankfurt a. M. 2002, 133–175. Wolfgang Welsch, Ästhetik und Anästhetik, in: ders., Ästhetisches Denken, 4. Aufl. Stuttgart 1994, 9–40. Wolfgang Welsch, Vernunft. Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft, Frankfurt a. M. 1996a. Wolfgang Welsch, Grenzgänge der Ästhetik, Stuttgart 1996b.
Die Wiener Schule und das Postmoderne
327
Dominik Schweiger Die Wiener Schule und das Postmoderne
Bevor ich im zweiten Teil meines Beitrags auf die (Musik der) Wiener Schule zu sprechen komme und insbesondere auf das an ihr, wovon ich glaube, dass wir es in den Blick bekommen können, wenn wir sie aus postmoderner Perspektive betrachten, möchte ich in einem ersten Teil auf den Begriff des Postmodernen selbst eingehen und vor allem darauf, wie er für unsere Sicht auf Musik generell und speziell auf die Musik (in) der Moderne fruchtbar gemacht werden kann. Dies halte ich alleine schon deshalb für notwendig, weil über diesen Begriff im Allgemeinen und im Besonderen darüber, was er in Bezug auf Musik beziehungsweise auf die Wissenschaft von ihr bedeutet, durchaus kein Konsens zu herrschen scheint.
Das Postmoderne Wenn ich das Ziel, mit dem Jean-François Lyotard den Begriff des Postmodernen vor nun bereits mehr als einem Vierteljahrhundert in den philosophischen und somit indirekt in den kulturwissenschaftlichen Diskurs eingeführt hat (Lyotard: 1993), recht verstehe, so hat dieses nicht darin bestanden, einer vermeintlichen oder tatsächlichen die Moderne ablösenden Epoche des Danach einen Namen zu geben, sondern darin, ein Werkzeug für die begriffliche Annäherung an bestimmte Differenzen im Denken, in der Wahrnehmung und im Ausdruck (in) der Moderne zu gewinnen. Wenn diese Lesart zutrifft, ist das Postmoderne nach Lyotard nichts anderes als ein Modus des Denkens, der Wahrnehmung und des Ausdrucks, der historisch und theoretisch weder nach noch in Opposition zu, sondern eher neben einem modernen Modus situiert gedacht werden sollte, ein Modus also, der vom modernen nicht im Prinzip, sondern lediglich in gewissen Nuancierungen oder Akzentuierungen differiert. Und diese feinen Unterschiede scheinen Lyotards Auffassung nach in erster Linie in der Positionierung gegenüber dem Komplexen und Instabilen zu liegen. In diesem Sinn möchte ich nun den Begriff des Postmodernen auch auf die Musik (in) der Moderne und auf ihre Historiografie und Analyse anwenden. Damit ist schon angedeutet, dass es mir notwendig zu sein scheint, zwei diskursive Schichten, in denen sich das Moderne wie das Postmoderne in musicis realisiert, zu
328
Dominik Schweiger
unterscheiden, womit ich allerdings keineswegs sagen möchte, dass diese Schichten nicht miteinander kommunizierten oder nicht miteinander verwoben seien, sondern nur, dass eine gewisse Differenz zwischen ihnen besteht: Die eine dieser Schichten ist die der musikalischen und hier vor allem der kompositorischen Diskurse, die andere ist die der diese betreffenden theoretischen und historiografischen. Ich wende mich zuerst der Letzteren zu: Wenn ich mich nicht täusche, realisiert sich das postmoderne Denken in der Musikwissenschaft vor allem in der analytischen und somit letztlich in der dekonstruktiven Auseinandersetzung mit vier zentralen Konstrukten des modernen Denkens, nämlich mit den „großen Erzählungen“, mit dem Konzept des „Autors“, mit dem des „Werkes“ und mit der gesamten Vorstellungsmatrix, die sich um den Begriff „Struktur“ gruppiert. Zwei Dinge möchte ich dazu anmerken: Erstens ist, wie wir wissen, die Auseinandersetzung mit diesen Konstrukten in keinem einzigen dieser Fälle innerhalb der Musikwissenschaft selbst entstanden, sondern sie ist aus anderen Feldern importiert. Daraus ergeben sich jeweils ganz spezifische Übersetzungsprobleme, deren Bearbeitung mir noch durchaus unabgeschlossen zu sein scheint – ob das nun den (vorwiegend auf dem verformenden Umweg über die Geschichtswissenschaft erfolgten) Rekurs auf die Lyotard in nicht ganz korrekter Weise zugeschriebene Formulierung vom „Ende der großen Erzählung(en)“,1 den auf die (an den Orten ihrer Herkunft in einem noch mehr oder weniger trivialen Sinn gebrauchten) Schlagworte vom „intentionalen Fehlschluss“ (Wimsatt, Beardsley: 2000) und vom „Tod des Autors“ (Barthes: 2000), den auf Begriffe wie „Diskurs“, „Text“ oder „Schrift“2 oder den auf Jacques Derridas oft sehr stark uminterpretierte Logozentrismus-Kritik3 betrifft. Zweitens besteht diese dekonstruktive Arbeit – wenn sie nicht gerade, wie etwa im Fall der Tötung des Autors durch Roland Barthes 1 Tatsächlich lautet die bei Lyotard nicht auf die Geschichte oder die Geschichtsschreibung im Allgemeinen, sondern auf die „Frage der Legitimierung des Wissens“ bezogene einschlägige Formulierung folgendermaßen: „Die große Erzählung hat ihre Glaubwürdigkeit verloren, welche Weise der Vereinheitlichung ihr auch immer zugeordnet wird: Spekulative Erzählung oder Erzählung der Emanzipation.“ (Lyotard: 1993, 112) 2 Müsste der folgenden Formulierung nicht misstraut werden, könnte man sagen, es entspräche dem „Wesen“ der mit diesen Worten bezeichneten Konzepte, dass sich deren theoriegeschichtlicher „Ursprung“ nicht angeben lässt. Verwiesen sei lediglich darauf, dass Roland Barthes, Michel Foucault und vor allem der frühe Jacques Derrida allgemein als die „Urheber“ des postmodernen Verständnisses und Gebrauchs dieser Begriffe gelten. 3 Am griffigsten fassbar wird diese Kritik wohl im ersten Teil von Derridas Grammatologie (Derrida: 1974, 9–170) und knapper noch in der Einleitung seines in deren historischer wie theoretischer Nähe entstandenen Aufsatzes Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen (Derrida: 1990, 114–120).
Die Wiener Schule und das Postmoderne
329
oder jedenfalls seiner Behauptung, dieser sei bereits gestorben (Barthes: 2000), als mitunter ja durchaus legitime polemische Geste, sondern ernst gemeint ist – einem verbreiteten Vorurteil entgegen nicht in der vollständigen Leugnung von Referenten dieser Konzepte in der Realität, sondern in der Analyse der kulturellen Bedingungen ihrer Existenz und ihrer Distribution sowie der Art und Weise ihrer kulturellen Funktion. Als ein frühes Beispiel für eine solche Analyse sei, um kurz beim Thema „Autor“ zu bleiben, etwa Michel Foucaults Untersuchung dieses Konstrukts (Foucault: 2000) angeführt. Im Feld des Komponierens – und mit diesem Wort geraten wir, wie ich freilich nicht ganz ohne klammheimliche Freude fürchte, in eine Kaskade von Paradoxien und Paralogismen – im Feld des Komponierens also können nun die Dinge nicht so ganz anders liegen: Das Postmoderne müsste sich demnach auch hier als Dekonstruktion der großen Erzählungen, etwa der von der fortschreitenden Materialbeherrschung, sowie der Konzepte des Autors, des Werks und der Strukturalität von Musik, letzten Endes also als paradoxer Versuch einer Dekonstruktion (der Idee) des Komponierens selbst oder als „schwaches Komponieren“ manifestieren. Und tatsächlich gibt es dafür ja bereits längst Beispiele: Wenn etwa Giacinto Scelsi ab den 1950er-Jahren seine Musik nicht mehr selbst notiert, sondern anderen, darunter auch Personen, die sie für vollkommen wertlos oder sich selbst für ihre wahren Urheber halten, auf Spezialinstrumenten vorimprovisiert und von diesen transkribieren lässt,4 oder wenn der kaum jüngere John Cage in Atlas Eclipticalis von 1961 unter anderem durch das Abpausen eines Sternenatlas zu seinen Tönen gelangt und dazu 1976 in einer Ansprache sagt, er habe „in diesem Stück versucht […], seine Ansichten darüber aufzugeben, wie Musik sein sollte“ (zit. nach: Knessl: 1992, 206), so hat dies, wie mir scheint, vor allem etwas mit einer Positionierung dem Instabilen gegenüber zu tun, die etwa von der Positionierung derer, die sich von der Quantifizierung und Rationalisierung möglichst vieler Tonparameter oder gar von der digitalen Klangsynthese so etwas wie eine Stabilisierung des „Materials“ erhoffen, nicht nur fein, sondern recht erheblich differiert. Von Lyotard her wäre ich sehr geneigt, erstere Haltung als postmodern, letztere als modern zu umschreiben. Wenigstens außerhalb der Musikwissenschaft würde diesen Bestimmungen wohl auch kaum widersprochen werden, decken sie sich doch ziemlich genau mit dem Befund, den Wolfgang Welsch vor allem aus seiner Lyotard-Lektüre heraus 1990 auf die Formel von der Geburt der postmodernen Philosophie aus dem Geist der modernen 4 Tristan Murail etwa bezeichnet ihn – zwar nicht in erster Linie aus diesem, sondern aus einem anderen technischen Grund – als einen „De-Komponist[en]“ (Murail: 1999, 59), und auch Scelsi selbst sagt von sich, er sei „kein Komponist“ (Scelsi: 1999, 70).
330
Dominik Schweiger
Kunst (Welsch: 1990) gebracht und dem sich Peter Bürger zehn Jahre später in seinem Buch über den Ursprung des postmodernen Denkens (Bürger: 2000) anscheinend angeschlossen hat,5 dem Befund also, dass die Philosophen der Postmoderne ihr Denken wenigstens zum Teil im Anschluss an künstlerische Ausdrucksformen, die mir mit den eben angesprochenen musikalischen in bestimmten Hinsichten durchaus vergleichbar zu sein scheinen, entwickelt hätten. Tatsächlich mag beispielsweise Jean Dubuffet, den Welsch als Postmodernen avant la lettre anführt (Welsch: 1990, 80–82), mit Cage irgendwie nicht schlecht zusammenpassen. Und selbst wenn man nicht gewillt ist, den Begriff des Postmodernen auf Cage anzuwenden, bietet sich für die Umschreibung der angesprochenen Differenz in der Positionierung gegenüber dem Instabilen, die kurz nach der Jahrhundertmitte zwischen ihm und beispielsweise seinem Korrespondenzpartner Pierre Boulez besteht, immer noch die Entgegensetzung von Moderne und Avantgarde an, die Bürger ein Vierteljahrhundert vor seiner späten und etwas zögerlichen Hinwendung zum PostmoderneBegriff in seiner Theorie der Avantgarde (Bürger: 1974) offenbar aus dem Bedürfnis heraus, Theodor Adornos vermeintlichem oder tatsächlichem Anti-Avantgardismus etwas entgegenzusetzen,6 vorgeschlagen hat und die, wie nun wiederum etwa Welsch zeigt (Welsch 1990, 84–97), fast gleichzeitig auch bei Lyotard immer wieder in ganz ähnlicher Weise anklingt. Das Avantgardistische wäre demnach dasjenige in der Kunst, was in der Philosophie dem Postmodernen entspricht. Es ist nun aber leider so, dass die offizielle Musikhistoriografie üblicherweise vollkommen andere Zuschreibungen und Differenzierungen vornimmt: Die Serialisten der Nachkriegszeit gelten ebenso sehr als die Avantgarde dieser Phase wie etwa Cage, zugleich repräsentierten sie alle zusammen – sofern der Begriff in diesem Zusammenhang überhaupt verwendet wird – die Moderne, und der Begriff der Postmoderne wird für die vor allem seit den 1970er-Jahren zu beobachtende Tendenz reserviert, die avantgardistisch-(post)moderne Dekonstruktion der Konzepte des Autors, des Werks und der Struktur zurückzudrängen, also den „Autor“, der möglichst viel von sich und seinen Emotionen ausdrückt, oder der, wenn er schon das nicht tut und sich als Person zurücknimmt, wenigstens ein so meisterlich wie möglich strukturiertes „Werk“ komponiert, oder der, wenn er auch das nicht tut, sondern sich dem ironischen Spiel hingibt, mindestens die dafür notwendige Meisterschaft mitbringen muss, wieder in seine alten Rechte einzusetzen. Legi5 Welschs Aufsatz wird allerdings hier ungeachtet der frappanten Parallelen in der Argumentation, die bei Bürger allerdings bedeutend dichter ausfällt, ebenso wenig erwähnt wie die von Welsch dort zitierten Schriften Lyotards. 6 Vgl. dazu Bürger: 2001, 31 und 33–38, wo die in Bürger: 1974 erst angedeutete Entgegensetzung von Moderne und Avantgarde genauer ausgeführt wird.
Die Wiener Schule und das Postmoderne
331
timiert wird diese Restauration der großen Erzählung vom meisterlichen Komponieren, also von der fortschreitenden Durchdringung oder Beherrschung des Objekts „Material“ durch ein Subjekt, nämlich den „objektiven Geist“ des Komponierens, in ebenso unverständiger wie unverständlicher Weise jedoch ausgerechnet mit der Formel vom Ende genau dieser großen Erzählung, nämlich der vom Materialfortschritt.7 Es gibt freilich noch einen gewichtigeren Einwand gegen meinen Versuch einer Bestimmung des Modernen und des Postmodernen als den Verweis auf die Nomenklatur der offiziellen Musikgeschichtsschreibung, und zwar den, dass das, was ich eben mit dem Begriff des Modernen zu umschreiben versucht habe, also der Drang nach fortschreitender Beherrschung des „Materials“, doch eigentlich dem traditionellen Habitus des Komponisten entspreche. Die immer präzisere Vorschreibung „weicher“ Materialaspekte wie der Instrumentation oder der Dynamik im 18. und 19. Jahrhundert, die Bemühungen um eine immer präzisere Notation rhythmischer Proportionen vom 12. bis zum 14. Jahrhundert, die um eine immer präzisere Notation der Intervalle um die Jahrtausendwende, das alles stehe doch seit jeher im Dienste dessen, das „Material“ immer weitergehend beherrschbar, also das, was am Ende als Musik herauskommt, für den, der es am Anfang zusammensetzt, immer besser kontrollier- und determinierbar zu machen. Zu diesem nicht ganz unberechtigten Einwand ist dreierlei zu sagen: Erstens spricht, wie mir scheint, auch dann nichts dagegen, die Erfindung etwa der diastematischen Neumen oder der Mensuralnotation als geradezu idealtypisch moderne Geste zu beschreiben, wenn sich diese bereits im Mittelalter ereignet hat. In beiden Fällen handelt es sich um die Steigerung der Performativität einer Technik, die der Verarbeitung und Verwaltung von Daten aus der und der Abgabe von Informationen an die Umwelt dient, also um eine technische Modernisierung. Zweitens ist der moderne Drang, die Fungibilität des Objekts „Material“ und damit die Macht desjenigen Subjekts, das als „Autor“ fungiert, durch solche oder ähnliche Modernisierungen zu steigern, bekanntlich nicht immer und überall gleich stark ausgeprägt. Die Umschreibung als „traditional“ käme demnach nur jenen musikkulturellen Dispositiven zu, innerhalb deren dieser Drang weniger stark ausgeprägt oder gar nicht vorhanden ist, also etwa dem des sogenannten „Gregorianischen Chorals“, dessen Kernrepertoire man, wie sein Name schon sagt, um die Jahrtausendwende aus bestimmten theologischen Gründen an Stelle eines Autors „nur“ einen Mediator zugewiesen hat, oder großen Teilen derer, die den Gegenstand jenes Teilge7 Dass ich somit „Materialfortschritt“ unter der Hand mit „fortschreitender Materialbeherrschung“ identifiziere, soll nicht ein tückischer argumentativer Trick sein, sondern entspricht meiner Auffassung, dass sich Ersterer nur als Letztere oder aber als Mythos denken lässt.
332
Dominik Schweiger
biets der Musikwissenschaft bilden, das wir auf so bedenkliche Weise als „Ethnomusikologie“ bezeichnen. Und drittens gibt es auch innerhalb der Geschichte des Komponierens im engsten Sinn Punkte, an denen sich die Relevanz des modernen Drangs nach Materialbeherrschung ereignisartig zu steigern scheint. Zu denken wäre etwa an das Luther-Wort über Josquin als „der noten meister“, der sich von diesen nichts diktieren lässt (zit. nach: Kapp: 2004, 32), oder an Beethoven, der für den in langen Prozessen des Skizzierens und Revidierens gewonnenen Vorteil der gesteigerten Durchstrukturiertheit seiner Werke den Nachteil ihrer im Vergleich zu den um 1800 üblichen Standards geringeren Zahl in Kauf nimmt. Die zeitliche Nähe dieser musikgeschichtlichen Phänomene zu jenen denkgeschichtlichen Phasen, die mit Begriffen wie „Humanismus“ oder „Aufklärung“ umschrieben zu werden pflegen, ist wohl kein Zufall.
Die Wiener Schule Was nun die Relation zwischen dem Postmodernen und der Wiener Schule betrifft, möchte ich zunächst drei auf den ersten Blick vielleicht etwas marginal scheinende Beobachtungen mitteilen, die mir aber in diesem Zusammenhang mitnichten unwichtig zu sein scheinen: Die Dekonstruktionsarbeit, die ich eingangs als Manifestation des postmodernen Denkens in der Musikwissenschaft beschrieben habe, hat bekanntlich innerhalb der letzten beiden Jahrzehnte vor allem in der englischsprachigen Musikwissenschaft eine gewisse institutionelle Festigung erfahren, und zwar unter der dem postmodernen Denken selbst zutiefst widersprechenden und folglich nicht besonders glücklich gewählten Bezeichnung „New Musicology“.8 In der „kontinentalen“ Musikwissenschaft dagegen scheinen sich diese Tendenzen nur äußerst zögerlich und jedenfalls ohne einen auch nur annähernd vergleichbaren Grad an Institutionalisierung zu realisieren. Auffällig ist nun, dass das methodische Feld „New Musicology“ und das thematische Feld „Wiener Schule-Forschung“ auch und gerade dort, wo letztlich beide am intensivsten betrieben werden, nämlich im englischen Sprachraum, kaum eine gemeinsame Schnittmenge aufweisen. Während also die „New Musicology“ ihre Themen überwiegend in der bis heute am nachhaltigsten kanonisierten Musik des 18. und 19. Jahrhunderts, in der Popmusik oder in der Mediävistik zu finden scheint, scheint sie – von ganz wenigen und nicht unbedingt immer ganz überzeugenden Ausnahmen abgesehen – das Themenfeld „Wiener 8 Die Problematik dieser Bezeichnung, die aus dieser Problematik resultierende Diskussion und die Frage nach möglichen Alternativbezeichnungen stehen hier nicht zur Debatte.
Die Wiener Schule und das Postmoderne
333
Schule“ ausgerechnet jenem konkurrierenden methodischen Feld zu überlassen, in Opposition zu dem sie sich nicht zuletzt überhaupt erst konstituiert haben dürfte, nämlich jenem Kanon von Methoden, die an amerikanischen Universitäten unter dem Titel „Music Theory“ betrieben werden. Die (Musik der) Wiener Schule befindet sich also bis heute nahezu vollständig in der Gewalt einer ausgesprochen szientistisch orientierten Fraktion der Musikwissenschaft, die ganz darauf fixiert ist, deren „Struktur“ und – per ipsam, cum ipsa, et in ipsa – ihr „Wesen“ zu ergründen, also das, was wir im Anschluss an Derrida als Logos, als transzendentales Signifikat bezeichnen können.9 Dieser modernistische Charakter eines Großteils der musikwissenschaftlichen Wiener Schule-Forschung korrespondiert mit meiner zweiten Beobachtung, dass die (Musik der) Wiener Schule auch im ästhetischen Diskurs außerhalb der engeren Grenzen unseres Faches gemeinhin als „modern“ gilt, nämlich als modern im Gegensatz zu „avantgardistisch“ im Sinne Bürgers beziehungsweise im Gegensatz zu „postmodern avant la lettre“ im Sinne Welschs. Deutlich wird das etwa dann, wenn Bürger den Anti-Avantgardismus Adornos gerade mit dem Hinweis auf dessen kritische Haltung Strawinsky gegenüber und auf die Wertschätzung, die er der Wiener Schule entgegengebracht hat, nachzuweisen versucht.10 Darauf, dass diese Wertschätzung indessen von Verwerfungen und Widersprüchen durchaus nicht frei ist, geht Bürger, soweit ich sehe, allerdings nicht ein. Und deutlich wird die Klassifikation der Wiener Schule als modernes und eben nicht avant la lettre postmodernes Phänomen etwa dann, wenn Lyotard, auf den Welsch seine These von der Geburt der postmodernen Philosophie aus dem Geist der modernen Kunst ja in erster Linie stützt, im Postmodernen Wissen auf Philosophen und Künstler der Wiener Moderne, unter ihnen auch auf Arnold Schönberg, zu sprechen kommt. Lyotard bezieht sich nämlich auf Schönberg und andere einzig unter dem Aspekt der im Angesicht des Komplexen und Instabilen geleisteten „Trauerarbeit“, die heute „abgeschlossen“ sei und „nicht wieder begonnen werden“ müsse (Lyotard: 1993, 121f.). Als die „Differenz zwischen Trauer und Wagnis“ (Lyotard: 1996, 27) bestimmt er aber an anderer Stelle die zwischen Moderne und Postmoderne. Schließlich scheint auch die kompositorische Rezeption der Wiener Schule ganz im Zeichen des Modernen zu stehen, nämlich sogar dann, wenn man jene bereits angesprochenen KomponistInnen in Betracht zieht, die sich unter der Vorgabe einer expressionistischen Poetik ausdrücklich auf die Wiener Schule der Zeit um 1910 beziehen oder wenigstens berufen und dafür von der offiziellen Musikge9 Letzteren aus seiner Heidegger-Lektüre heraus entwickelten Begriff dürfte Derrida zuerst in seiner Grammatologie eingeführt haben (Derrida: 1974, 38). 10 Vgl. Bürger: 2001.
334
Dominik Schweiger
schichtsschreibung als „postmodern“ klassifiziert werden. Dass sie gerade vor diesem theoretischen Hintergrund eines erneuerten Expressionismus, also der Idee, das „Material“ neuerlich dem eigenen „Ausdruck“, neuerlich dem „Ausdruck“ des Eigenen dienstbar zu machen, nämlich eigentlich nicht das Postmoderne, sondern das Moderne repräsentieren, hoffe ich bereits hinlänglich gezeigt zu haben. Wenn dagegen etwa Cage kaum etwas unversucht lässt, um seine Ansichten darüber aufgeben zu können, wie Musik sein soll, so heißt es gemeinhin, dass dieses, wie mir scheint, tatsächlich postmoderne Handeln mit seinem Lehrer Schönberg – sofern er überhaupt als dessen Schüler anerkannt wird – allenfalls im Sinn einer Abgrenzung zu tun habe. Und schließlich hat die sogenannte „Avantgarde“ der Nachkriegszeit wenigstens einen Teil der historischen Legitimation ihres zutiefst modernen Strebens nach Beherrschung des „Materials“ und der zu dessen Realisierung eingesetzten Technik der Quantifizierung und seriellen Rationalisierung möglichst vieler seiner „Parameter“ bekanntlich aus der Berufung auf genau dieses Streben und auf gewisse vermeintliche oder tatsächliche Vorformen dieser Technik beim späten Anton Webern zu beziehen versucht. Die Wut, die sie mit dieser Legitimationsstrategie oder jedenfalls dieser Rezeptionsweise auf sich gezogen hat, dürfte der, die ihrer Musik selbst bis heute entgegenschlägt, im Übrigen an Intensität und Nachhaltigkeit kaum nachstehen. In der Tat scheint nur wenig dafür zu sprechen, die Wiener Schule als postmodern avant la lettre oder auch nur als avantgardistisch im Sinne Bürgers anzusehen: Kaum jemand in der ganzen Geschichte des Komponierens und des Theoretisierens dürfte die große Erzählung vom Materialfortschritt mit derartiger Eindringlichkeit vorgetragen haben wie Schönberg und seine Schüler. Die Intensität, mit der sich Schönberg als Künstler im emphatischen Sinn wahrgenommen hat, kann kaum der entsprechenden Selbstwahrnehmung irgendeines anderen Komponisten zu irgendeiner Zeit nachgestanden haben. Hierin fällt er keineswegs aus der Rolle, die ihm die Kultur seiner Zeit und seines Raums im Prinzip zuweist, und noch die Tatsache, dass sich diese Rollenzuweisung mitunter als Skandal realisiert hat,11 kann als eine Art Kollateralschaden der Funktion des Konstrukts „Autor“ gelten. Kein Zweifel kann ferner daran bestehen, dass es das erklärte Ziel der Protagonisten der Wiener Schule gewesen ist, musikalische Kunstwerke im emphatischen Sinn zu schaffen und diese so durchstrukturiert, logisch und kohärent wie nur möglich zu gestalten. Und schließlich präsentiert sich in der Idee, dass dieser meisterliche „Stil“, dieses meisterliche Spiel mit dem, was man im Rahmen dieses Interpretaments als die materialimmanenten Signifikanten bezeichnen könnte, auf ein transzendentales Signifikat verweise, nämlich auf jenen transzendentalen 11 Vgl. etwa Eybl: 2004.
Die Wiener Schule und das Postmoderne
335
„Gedanken“, um den sich eine ganze Mythologie von Begriffen wie „Faßlichkeit“ und „Zusammenhang“ rankt, das, was Derrida als Logozentrismus bezeichnet, in der wünschenswertesten Deutlichkeit. Und doch scheint es mir da trotz alledem ein Problem zu geben; trotz alledem ist also, wie ich finde, mit dem Satz, die (Musik der) Wiener Schule sei modern im Gegensatz zu postmodern avant la lettre, etwas nicht in Ordnung. Es scheint mir nämlich in dieser Musik immer wieder Punkte zu geben, an denen diese Selbstund Fremdkonstruktion Risse bekommt. Und diese Punkte scheinen mir die zu sein, die in der Historiografie der Wiener Schule bisher meistens als solche des dialektischen Umschlags beschrieben worden sind. Ich greife zwei Beispiele heraus, die üblicherweise als besonders modern im nicht-avantgardistischen beziehungsweise nicht-postmodernen Sinn gelten: Schönbergs Kammersymphonie op. 9, in mehrfacher Hinsicht so etwas wie das idealtypisch moderne Meisterwerk schlechthin, also ein Werk, dessen Autor erfolgreich ein ganzes Bündel von noch dazu in einer großen Tradition stehenden Regeln zur Sicherung eines Maximums an Strukturalität, Logik und Kohärenz realisiert, dieser Text also markiert zugleich, wie schon die Protagonisten der Wiener Schule selbst es beschrieben haben,12 den Punkt des Umschlags in ein anderes Spiel, in ein Spiel, das ohne diese Regeln auskommen muss, das also darin besteht, dass „die Regeln dessen […], was gemacht worden sein wird“ (Lyotard: 1996, 30), permanent erfunden werden. Gelten aber diese Regeln nicht gerade der Befreiung des Instabilen vom Zwang zur Strukturalität? In der idealtypisch modernen Kompositionstechnik schlechthin, der Zwölftontechnik, schlage, so Adornos in der Philosophie der neuen Musik ausgeführte Analyse und Kritik, das einstige Versprechen von Freiheit durch die Beherrschung des Materials um in die Unfreiheit der Herrschaft des Materials. „Das Subjekt“ gebiete „über die Musik durchs rationale System, um selber dem rationalen System zu erliegen“ (Adorno: 1978, 68). Während „das musikalische Subjekt“ also „verstummend“ abdiziere (Adorno: 1978, 108), verfalle das von allem Sinn abgelöste Material einem Dasein als bloßes Ornament (Adorno: 1978, 70). Ist aber dieses sinnlose Ornament nicht nichts anderes als Derridas von jeder Verpflichtung auf ein transzendentales Signifikat freies Spiel? Die Beantwortung dieser Fragen scheint mir ganz von der Positionierung gegenüber dem Komplexen und Instabilen abzuhängen: Der Akzent kann mit dem jungen Georg Lukács auf die Beunruhigung gelegt werden, auf die Trauer über den „Verlust der Stabilität der Dinge“ und der „Stabilität des Ichs“ (zit. nach: Csáky, 1996, 63). Er kann aber mit Lyotard auch auf die „Steigerung des Seins“ und 12 Vgl. etwa Webern: 1960, 51f.
336
Dominik Schweiger
auf „den Jubel, die von der Erfindung neuer Spielregeln […] ausgelöst werden“ (Lyotard, 1996, 27), gelegt werden. Es gibt somit zwei Interpretationen der Interpretation, der Struktur, des Zeichens und des Spiels. Die eine träumt davon, eine Wahrheit und einen Ursprung zu entziffern, die dem Spiel und der Ordnung des Zeichens entzogen sind, und erlebt die Notwendigkeit der Interpretation gleich einem Exil. Die andere, die dem Ursprung nicht länger zugewandt bleibt, bejaht das Spiel und will über den Menschen und den Humanismus hinausgelangen, weil Mensch der Name des Wesens ist, das die Geschichte der Metaphysik und der Ontotheologie hindurch, das heißt im Ganzen seiner Geschichte, die volle Präsenz, den versichernden Grund, den Ursprung und das Ende des Spiels geträumt hat. (Derrida: 1990, 137f.)
Eine postmoderne Interpretation der Musik der Wiener Schule müsste also darauf verzichten, die Strukturalität und damit die Wahrheit oder den Ursprung dieser Musik zu entziffern zu versuchen. Und sie müsste darauf verzichten, den Ursprung oder das Ziel dieser Musik in den Menschen zu suchen, von denen es heißt, sie hätten sie hervorgebracht oder sie sollten sie irgend verstehen. Hingegen müsste sie ihre Aufmerksamkeit auf jene Stellen richten, an denen die Strukturalität dieser Musik zerreißt, an denen die Werke zergehen, an denen sich das Komponieren der Souveränität über die Zeichen begibt und an denen die große Erzählung von deren fortschreitender Beherrschung ihre Glaubwürdigkeit verliert. Dann könnte sichtbar werden, dass diese große Erzählung seit je unglaubwürdig ist, dass die Idee der Souveränität des Komponierens über die Zeichen, die ihrer Zurichtung zu Werken und die von deren auf einen Sinn jenseits ihres eigenen Zusammenhangs verweisenden Strukturalität immer schon ideologische Figuren sind, die den „wahren“ Un-Sinn des Spiels der Zeichen verschleiern. Und es könnte sichtbar werden, dass von der Musik der Wiener Schule, dem Bewusstsein ihrer Protagonisten entgegen, eine Spur zu jenem „schwachen“ Komponieren führt, das als einziges den Namen einer musikalischen Postmoderne verdient.
Die Wiener Schule und das Postmoderne
337
Literaturverzeichnis Theodor W. Adorno, Philosophie der neuen Musik, hrsg. von Rolf Tiedemann, Frankfurt a. M. 1978 (Gesammelte Schriften, 12). Roland Barthes, La mort de l’auteur, in: ders., Œuvres complètes, Bd. 2: 1966–1973, hrsg. von Éric Marty, Paris 1994, 491–495; dt.: Der Tod des Autors, in: Fotis Jannidis, Gerhard Lauer, Matias Martinez, Simone Winko (Hrsg.), Texte zur Theorie der Autorschaft, Stuttgart 2000, 185–193. Peter Bürger, Der Anti-Avantgardismus in der Ästhetik Adornos, in: ders., Das Altern der Moderne. Schriften zur bildenden Kunst, Frankfurt a. M. 2001, 31–47. Peter Bürger, Theorie der Avantgarde, Frankfurt a. M. 1974. Peter Bürger, Ursprung des postmodernen Denkens, Weilerswist 2000. Moritz Csáky, Die Wiener Moderne. Ein Beitrag zu einer Theorie der Moderne in Zentraleuropa, in: Rudolf Haller (Hrsg.), nach kakanien. Annäherungen an die Moderne, Wien, Köln, Weimar 1996 (Studien zur Moderne, 1). Jacques Derrida, De la grammatalogie, Paris 1967; dt.: Grammatologie, übers. von Hans-Jörg Rheinberger und Hanns Zischler, Frankfurt a. M. 1983. Jacques Derrida, Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen, in: Peter Engelmann (Hrsg.), Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französischer Philosophen der Gegenwart, Stuttgart 1990, 114–139. Martin Eybl, Die Befreiung des Augenblicks. Schönbergs Skandalkonzerte 1907 und 1908. Eine Dokumentation, Wien, Köln, Weimar 2004 (Wiener Veröffentlichungen zur Musikgeschichte, 4). Michel Foucault, Was ist ein Autor?, in: Fotis Jannidis/Gerhard Lauer/Matias Martinez/Simone Winko (Hrsg.), Texte zur Theorie der Autorschaft, übers. von Karin Hofer, Stuttgart 2000, 198–229. Reinhard Kapp, Thesen zur frühen Mehrstimmigkeit, in: Dominik Schweiger/Michael Staudinger/Nikolaus Urbanek (Hrsg.), Musik-Wissenschaft an ihren Grenzen. Manfred Angerer zum 50. Geburtstag, Frankfurt a. M. u.a. 2004, 13–32. Lothar Knessl (Red.), Wien modern [92]. Ein internationales Festival mit Musik des 20. Jahrhunderts, Wien 1992. Jean-François Lyotard, La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Paris 1979; dt.: Das postmoderne Wissen. Ein Bericht, hrsg. von Peter Engelmann, übers. von Otto Pfersmann, 2. Aufl. Wien 1993. Jean-François Lyotard, Postmoderne für Kinder. Briefe aus den Jahren 1982–1985, hrsg. von Peter Engelmann, übers. von Dorothea Schmidt, unter Mitarb. von Christine Pries, 2. Aufl. Wien 1996. Tristan Murail, Wegbereiter des Spektralen. Scelsi, der De-Komponist, in: MusikTexte. Zeitschrift für neue Musik 81/82 (1999), 59–63. Giacinto Scelsi im Gespräch mit Franck Mallet, Marie-Cécile Mazzoni und Marc Texier, „Ich bin kein Komponist …“, in: MusikTexte. Zeitschrift für neue Musik 81/82 (1999), 64–70. Anton Webern, Der Weg zur neuen Musik, hrsg. von Willi Reich, Wien 1960. Wolfgang Welsch, Die Geburt der postmodernen Philosophie aus dem Geist der modernen Kunst, in: ders., Ästhetisches Denken, Stuttgart 1990, 79–113.
338
Dominik Schweiger
William K. Wimsatt/Monroe C. Beardsley, The Intentional Fallacy, in: William K. Wimsatt, The Verbal Icon. Studies in the Meaning of Poetry, Lexington 1954, 3–18; dt.: Der intentionale Fehlschluss, in: Fotis Jannidis/Gerhard Lauer/Matias Martinez/Simone Winko (Hrsg.), Texte zur Theorie der Autorschaft, Stuttgart 2000, 84–101.
Dasselbe immer anders
339
Regina Busch Dasselbe immer anders. Über Variationen, Reprisen und Ähnliches
In seinem Feldman-Buch behandelt Sebastian Claren das eigentliche Thema meines Vortrags, Wiederholung, natürlich allenthalben (Claren: 2000). Drei aufeinander folgende Teile der Arbeit, in deren Zentrum Feldmans Oper Neither (nach einem Text von Beckett) steht, widmen sich dem Thema ganz besonders: „IV.: Musik als Kunstform“, „V.: Muster“, und „VI.: Variation“. Die zugehörigen Kapitel heißen unter anderem: Gedächtnisformen, „Form“ und „Maßstab“, Anfang, Mitte, Ende; Teppich, Abrash, Verkrüppelte Symmetrie; Wiederholung und Veränderung, Entfremdung der Erinnerung, Übersetzung, Desintegration. Ich berichte so ausführlich davon, weil mit diesen Titeln wichtige Begriffe in die Debatte kommen, die hier zwar nicht diskutiert, aber doch genannt werden sollen. Überdies wären im Zusammenhang mit „Wiederholung“ folgende Themen zu behandeln: die identische oder veränderte Wiederholung (Variation); Repeti tion, Imitation und Nachahmung; das Verhältnis von Urbild und Abbild, Original und Kopie oder Replik, und damit auch Fassung und Variante; die Beziehung zwischen Gedachtem (Idee, Einfall, Gedanke) und Notiertem. Des Weiteren auch die Beziehung zwischen Partitur und Aufführung, das heißt Aufführung als Lektüre, der Komponist als sein erster Interpret, wenn er seine Gedanken ausformuliert und aufschreibt; Transkription, Bearbeitung und Übersetzung; natürlich Identitätsfragen (Serialität, Singularität), schließlich Erinnerung und Gedächtnis, und nicht zuletzt und mit all dem zusammenhängend die Frage der Form. Morton Feldman: Alles, was Sie tun, und alles was ich tue, ist im Wesentlichen nicht mein eigen. Alles ist ein „found object“. Ich meine, ich habe die große Sexte nicht erfunden. Ich höre diese Dinge. Benutze sie. Ich beobachte diese „found objects“. Sie beschäftigen sich mit „found objects“. Sie sind alle Amateur-Duchamps, ohne es zu wissen (Feldman: 1985, 187).
Es läuft also für uns, die wir die Moderne und die Postmoderne und deren Erscheinungsformen erforschen wollen, darauf hinaus, den Umgang mit Vorgefundenem zu untersuchen, ja noch einen Schritt weiter zurück: uns klar darüber zu werden, womit wir eigentlich umgehen und womit die Komponisten arbeiten.
340
Regina Busch
Marcel Duchamp hat darauf bestanden, „das Vorgefertigte vom Vorgefundenen [zu] unterscheiden“. (Didi-Huberman: 1999, 170) Macht diese Unterscheidung auf dem Gebiet der Musik einen Sinn, wenn wir von Tönen und ihren Parametern sprechen, nicht nur, wie Feldman, von Intervallen? Was ist denn unser Gegenstand, was ist unser Material und wie sind sie beschaffen? In welchem – nicht mehr natürlichen, nicht mehr unberührten – Zustand befinden sie sich, und befinden sich Handwerkszeug und Verfahren, mit denen wir arbeiten und bearbeiten? Wer und was hat sie geprägt, gezeichnet, geformt, wo haben umgekehrt sie ihre Spuren hinterlassen? Sich mit Vorgefertigtem oder Vorgefundenem zu beschäftigen, bedeutet, etwas aufzugreifen, das schon da ist, mit dem schon einmal etwas geschehen oder gemacht worden ist. Unsere Beschäftigung damit ist eine neuerliche, eine wiederholte, auch wenn wir dabei nicht exakt jeden Schritt an jeder Stelle genau so setzen, wie er beim ersten oder vorigen Mal gesetzt wurde oder sich ereignet hat. Etwas noch einmal zu tun oder zu sagen, produziert etwas Verschiedenes allein schon deswegen, weil es zu einem späteren Zeitpunkt und an einem anderen Ort geschieht. Dieser Gedanke ist bekanntlich seit Heraklits παντα ρει in unzähligen Varianten ausgeprägt worden, um das Spannungsverhältnis von Wiederholung und Veränderung zu beschreiben. Oft wird dabei der Ablauf der Zeit in den Blick genommen, so auch in Schönbergs Formulierung: „Gleichzeitigkeit ist unendlich rasches Nacheinander / Nacheinander ist äußerst langsame Gleichzeitigkeit“.1 Erst recht ist auf Wiederholungen angewiesen, wer sich auf unbekanntes Terrain begibt, fremde Gebiete zu erforschen sich anschickt, Hypothesen aufstellt. Experimente bestehen darin, immer wieder dasselbe und immer wieder anderes auszuprobieren – wobei im Glücksfall „das technische Feld des künstlerischen Metiers“ geöffnet und erweitert wird (Didi-Huberman: 1999, 133). Duchamp, der Wiederholungen verabscheute, prägte für seine Produktionen und Reproduktionen des Selben den Begriff infra-winzig (inframince) zur Bezeichnung der Differenz, auf die es eigentlich ankomme (Didi-Huberman: 1999, 172). Morton Feldman hat, in Analogie zu den minutiösen, zuweilen kaum wahrnehmbaren Ab1 Arnold Schönberg Center, Wien, Archivnr. T65.03 66 (Faßlichkeit des Zusammenhangs). Mit welcher Akzentuierung der Gedanke formuliert wird, ist dabei weniger von historischen als von inhaltlichen Kriterien bestimmt. Vgl. etwa Montaignes Ausführungen zu Ruhe und Bewegung, die neuerdings wieder aktuell geworden sind: „Die anderen bilden den Menschen, ich bilde ihn ab […]. Die Welt ist nichts als ein ewiges Auf und Ab. Alles darin wankt und schwankt ohne Unterlaß: Die Erde, die Felsen des Kaukasus und die Pyramiden Ägyptens schaukeln mit dem Ganzen und in sich. Selbst die Beständigkeit ist bloß ein verlangsamtes Schaukeln. / So vermag ich den Gegenstand meiner Darstellung nicht festzuhalten, denn auch er wankt und schwankt in natürlicher Trunkenheit einher. […] Ich schildere nicht das Sein, ich schildre das Unterwegssein: […] von Tag zu Tag, von Minute zu Minute“, in: Montaigne: 1998, 398.
Dasselbe immer anders
341
weichungen in den Mustern und Farben orientalischer Teppiche, Kompositionsverfahren wie die Abschattung von Tonhöhen durch Instrumentation („mikrochromatisches Schimmern“) ersonnen (Claren: 2000, 212ff.).2
*** Dasselbe immer anders ist, aus dem Zusammenhang gerissen, ein grob vereinfachendes Schlagwort. Es klingt wie ein kurz gefasstes Schönberg- oder Webern-Zitat, ist aber viel älter, und sein Spektrum ist weit. Im letzten von Weberns Vorträgen über den „Weg zur Komposition in zwölf Tönen“ (2. März 1932) heißt es, man könne jetzt, vermöge der durch die Reihe gewährleisteten Einheit, „ohne Thematik – also viel freier – arbeiten. […] wir wollen nicht wiederholen, es soll immer etwas Neues kommen“, mit Berufung auf Schönberg: „Ganz neu sagen wollen wir dasselbe, was früher gesagt wurde“; und mit Hinweis auf Bachs Kunst der Fuge: „Was kann ich mit diesen wenigen Tönen machen? Es ist immer etwas anderes und zugleich immer dasselbe […]. Immer verschieden und doch dasselbe!“ (Webern: 1960, 59). Diese Formulierungen erinnern, wie die entsprechenden von Schönberg, an die Bestimmung der thematischen Arbeit in Johann Christian Lobes Compositionslehre von 1844: Thematische Arbeit ist […] die Kunst, einen musikalischen Gedanken vielmals wiederholen zu können, aber immer verändert, immer verwandelt, dergestalt, dass er stets als derselbe, aber immer zugleich auch als ein anderer erscheint (zit. nach Jacob: 2005, Bd. 1, 145).3
Schönberg selbst kreist in seinen Schriften über den musikalischen Gedanken, über Zusammenhang, Fasslichkeit und bei allem, was mit Kompositionslehre und ihren Teilbereichen zu tun hat, unablässig um die Frage der Wiederholung. Die Nuancen seiner Überlegungen und die Unterschiede im Vergleich zu anderen Autoren können hier nicht dargestellt werden. Ich greife eine Stelle heraus, in der es um den Umgang mit Vorgegebenem bzw. Vorgefundenem, in diesem Falle um Formen geht. In einem der Entwürfe für das Buch über den Musikalischen Gedanken bemängelt Schönberg, dass der Harmonielehre eine substanzielle Verbindung mit der Formenlehre fehle. Vor allem 2 Vgl. ebd. die Ausführungen zu „spelling“. 3 Andreas Jacob zufolge kannte Schönberg die Compositions-Lehre von 1844 wahrscheinlich nicht, verwendete aber im Unterricht das Lehrbuch der Komposition, als dessen Vorbild die Compositions-Lehre gedient habe (Jacob: 2005, Bd. 1, 144), und wird auch in anderen Büchern zur Kompositionslehre, die sich in seiner Bibliothek befinden, mehrfach auf Lobe gestoßen sein.
342
Regina Busch
fehlen (ausser einigen primitiven handwerklichen Kunstgriffen, Kadenzierungen, Modulationsmittel, Sequenzierung u. dgl.) Hinweise auf alle wichtigen Beziehungen zwischen Harmonie und Form, wie z.B.: über die Wirkungen bestimmter Harmoniegruppen in Hinsicht auf ihre Fortsetzungsfähigkeit; über die Konsequenzen bestimmter harmonischer Wendungen; über die systematische oder sinngemäße harmonische Variation kleinerer oder größerer Formelemente und dgl. mehr.
Der Grund sei, dass die Theoretiker in den vorhandenen Formen etwas Gegebenes erblicken, während es in Wirklichkeit so fest bleibendes, wie es ein Gegebenes sein müsste, welches jeder an sich fassen und füllen kann, hier niemals gegeben hat noch geben wird. Sondern, die musikalische Form ist (etwas Entstandenes zu sagen wäre schon unzutreffend) etwas Entstehendes, jedesmal neu Entstehendes und niemals ausser in dem fertigen Kunstwerk an sich Vorhandenes, Übertragbares und weiter Verwendbares. Konstant sind hierbei nur die Prinzipien, ewige Gesetze, welche nur richtig erkannt und formuliert werden müssen[,] um Form und Formen der jeweiligen Sachlage entsprechend zu erzeugen.4
Darin ist eine Antwort an alle späteren Kritiker enthalten, für die der Formbegriff Schönbergs und der Wiener Schule insgesamt in nichts anderem besteht als der „Gliederung von Dingen in Teile“ (vgl. etwa die Äußerungen von Feldman und Cage in Claren: 2000, 166f.).
*** Dass wir heute solcher Nuancen und Schattierungen, die ja die Frage der Identität, der Individualität, Singularität und Beliebigkeit wesentlich betreffen, gewahr werden und sie würdigen können, verdanken wir jenen Künstlern und Theoretikern, die in ihrer Arbeit die Spannung zwischen serieller Produktion (und Reproduktion) und individuellem, einzigartigem Werk gesucht und diskutiert haben. Spätestens um die Mitte des 20. Jahrhunderts war dieses Problem in vollem Umfang sichtbar und explizit ausgesprochen; in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts sind zahlreiche Lösungen vorgeschlagen und Theorien darüber formuliert worden. Aktuell war das Thema aber schon lange vor 1950, auch wenn es sich nicht in jeder Umgebung explizit als Identitäts- oder Reproduktions-Problem artikuliert hatte 4 Arnold Schönberg: Der musikalische Gedanke, seine Darstellung und Durchführung. Arnold Schönberg Center, Wien, Archivnr. T37.06 A und B, S. 1f.
Dasselbe immer anders
343
und noch nicht mit den Begriffen und dem theoretischen Apparat beschrieben wurde, die wir heute dafür verwenden können. Greifbar wurden die Fragen kompositorisch zum Beispiel im Begriff Variation selbst und in solchen Werken, die mit Variationstechniken arbeiten oder formal und im Detail auf Variationen basieren. Akut sind sie in der Zwölfton-Komposition geworden, da allein schon die Setzung der vier Erscheinungsformen der Reihe als gleichwertige Repräsentanten (Grundreihe, Krebs, Umkehrung, Krebsumkehrung) erzwang, die Begriffe Identität und Variation neu zu überdenken.5 Das musste notgedrungen auf sämtlichen kompositorischen Ebenen Revisionen nach sich ziehen, denn wo auch immer Veränderungen stattfinden oder etwas Neues hinzutritt, werden Spuren hinterlassen. Ich möchte das an Stücken von Anton Webern und John Cage erläutern. Die Thirty Pieces for Five Orchestras (1981) von Cage sind, wie der Titel angibt, ein aus 30 Stücken für 5 Orchester zusammengesetztes Werk. Diese 30 Stücke erklingen immer vollständig und immer in derselben Reihenfolge nacheinander. Insgesamt 82 Instrumente sind auf 5 Ensembles unterschiedlicher Besetzung aufgeteilt. Jedes Instrument gehört nur einem Ensemble an; die Summe aller ergibt ein volles Orchester, das aber als Ganzes nie in Erscheinung tritt, Tutti-Stellen kommen also nicht vor. Für jedes Ensemble sind ein Dirigent und eine Partitur vorgesehen, eine Partitur für das Ganze und einen Dirigenten für alle gibt es nicht. Die 30 Stücke sind jeweils gleich lang, ihre Anlage mit time brackets hat allerdings zur Folge, dass keine Aufführung des Werkes einer anderen genau gleichen wird.6 Das heißt, die Thirty Pieces haben so viele Identitäten, wie Aufführungen stattfinden, und alle sind in den 5 Partituren vorgesehen. Diese Vielfalt resultiert nicht aus den in einem vorgegebenen Rahmen offengelassenen Entscheidungen über Elemente der Komposition (die schriftlich und in eindeutiger Weise notiert sind) oder gar dem Fehlen einer Gesamtpartitur. Vielmehr stellen die fünf Ensemble-Partituren, OrchesterStimmen quasi, in genauer Abwägung freier und fixer Momente beliebig viele Möglichkeiten der Realisierung bereit. Denkbar wäre eine Gesamtpartitur, so etwas wie die Summe der fünf Ensemble-Partituren, als gemeinsamer Bezugspunkt, der aber selbst nie als konkretes, tatsächlich erklingendes musikalisches Ereignis in Erscheinung tritt.
5 Schönberg und Webern illustrierten das in Vorträgen häufig mit Gegenständen (Aschenschale, Messer, Flasche, Uhr, Blume), die, von welcher Seite aus man sie auch ansehe, immer „das gleiche“ sind (Webern: 1960, 57). „Sehen Sie, das ist ein Hut, ob ich ihn nun von oben, von unten, von vorne, von hinten, von links, von rechts anschaue, es ist und bleibt ein Hut, auch wenn er von oben anders aussieht als von unten“ (Stein: 1925, 64). 6 Ich fasse hier Überlegungen zusammen, die in anderem Zusammenhang ausführlicher dargestellt wurden (siehe Busch: 1998, 237–244).
344
Regina Busch
Einer solchen Idee ist auch Webern mit seinen Mitteln nachgegangen. Die Variationen für Klavier op. 27 (1936) – bestehend aus 12 Variationen und einem Thema, auf 3 Sätze verteilt – haben einen absichtlich verschwiegenen Bezugspunkt, der zwar dem Komponisten bekannt und bewusst, aber für Aufführung, Lektüre und Verständnis der Musik nicht vonnöten ist: Ich stelle auch das „Thema“ gar nicht ausdrücklich heraus (etwa in früherem Sinn an die Spitze). Fast ist es mein Wunsch, es möge als solches unerkannt bleiben. (Aber wer mich danach fragt, dem werde ich es nicht verheimlichen.) Doch möge es lieber gleichsam dahinter stehen.7
Das Verhältnis von Variationen zu ihrem Ausgangspunkt und zueinander ist in Weberns Zwölftonmusik nicht der einzige Problembereich, in dem Fragen der Identität, Wiederholung, Wiedererkennbarkeit zur Diskussion gestellt sind. Diese sind, wie erwähnt, geprägt von der Grundbedingung der Reihenkomposition, dass mit den vier Erscheinungsformen der Reihe „dasselbe immer anders“ gesagt werden könne. Auf formaler Ebene treten diese Fragen neuerlich auf, unter anderem da, wo Wiederholungen vorgesehen sind, etwa in Reprisen. Ein gutes Beispiel ist der erste Satz der Symphonie op. 21, in dem es einer weit verbreiteten Auffassung zufolge ein Reprisenproblem gibt. Die Form des Satzes, nach außen hin zweiteilig – angezeigt durch Doppeltaktstriche mit Wiederholungsanweisung (:||) – ist am besten zu beschreiben als ABC, wobei der letzte Teil, C, vorrangig geprägt vom ersten, Züge beider vorhergehender Teile trägt.8 Von Interesse ist nun, welche Elemente von A in C vollkommen gleich wiederkehren und wie ihr Verhältnis zu dem ist, was zwar auf A zurückzuführen, aber bis zur Unkenntlichkeit verändert ist. Den Reihen nach (Transpositionen, Kombinationen, Kanonpaare) ist in C alles genau wie zu Anfang, die Töne sind vielfach ähnlich gruppiert, die rhythmische Kontur der Motive als Ableitung von A deutlich erkennbar (und deutlich verschieden von den Motiven im Mittelteil B). Jedoch gelangen die vielen „buchstäblichen“, quasi rechnerisch zu ermittelnden Ähnlichkeiten nicht an die Oberfläche, sie bewirken keine dem A-Teil ähnliche Erscheinung von C. In C finden sich markante Einschnitte, die vorher nicht da, auch nicht vorbereitet waren; die Motive sind gegeneinander verschoben, ebenso die Zusammenklänge. Tonfolgen bleiben zwar als solche erhalten, setzen aber
7 Anton Webern an Eduard Steuermann, 6. Dezember 1936 (Busch: 1983, 32f.). 8 Die mittels :|| vorgeschriebene wörtliche Wiederholung wird in der Webern-Forschung als zusätzliches Problem gesehen.
Dasselbe immer anders
345
zu anderen Zeitpunkten ein, sind der Länge nach auseinander gezogen oder gestaucht. Wie in Cages Thirty Pieces sind also auch in Weberns Symphoniesatz bestimmte grundlegende Verhältnisse festgelegt und unausweichlich: die Abfolge von Tönen und Reihen, Zuordnung zu Stimmgruppen und Instrumenten, rhythmische Modelle, Anzahl der Takte. Aber nichts davon hat Einfluss auf den zeitlichen Ablauf im Einzelnen, das heißt darauf, was zusammenkommt und für wie lange. Dennoch ist der dritte Teil des Symphoniesatzes ohne Zweifel eine Reprise des ersten. Ihr Einsatz ist verschleiert durch überlappende Ereignisse aus den angrenzenden Teilen; sie äußert sich weder noch lässt sie sich fassen in konkreten, gegenständlichen, thematisch-motivischen Bildungen. Sie ist verzögert und verzerrt, aber sie findet statt.
*** Die umgekehrte Situation liegt vor, wenn die Gleichartigkeit der Bestandteile eines Werkes offensichtlich ist und sie sogar identisch zu sein scheinen. Auch hier ist Variation im Spiel; durch sie werden die Bestandteile einander angenähert und die Unterschiede zwischen ihnen eingeebnet. Ob die Form dadurch flächig wird, also an Tiefe verliert, sei dahingestellt. Auch mit gleichartigen Elementen (Puzzlesteinen, Moduln) kann man Zusammenhang herstellen und nicht-triviale Formen bilden, nur werden diese auf Permutation und Repetition basieren. Das soll an einigen Bildern von Gustav Klimt verdeutlicht werden. Wir folgen einer Beschreibung von Carl Schorske, der in seinem Buch über Wien, Geist und Gesellschaft im Fin de Siècle gezeigt hat, wie Klimt „in einer Serie von drei zwischen 1904 und 1908 gemalten Portraits […] die Vorherrschaft der Umgebung über die Gestalt des Sujets zunehmend“ ausdehnt: Die Umgebung selbst jedoch – stets ein imaginärer Innenraum – wurde der Natur immer mehr entfremdet und abstrahiert, wobei die zeichnerischen Elemente und Muster bald rein ornamental, bald symbolisch suggestiv wirkten. […] In Übereinstimmung mit einer älteren Tradition der Bildnismalerei ist der Leib der Dargestellten vollkommen im Gewand verloren; das Kleid selbst ist noch in der traumhaft impressionistischen Weise gemalt, die wir in der Hausmusik mit Schubert von 1898 beobachten konnten. Der Hintergrund jedoch ist auf völlig neuartige Weise behandelt als ein hermetischer, stilisierter Raum, ein schöner, aber unwirklicher Rahmen für das Leben der Dargestellten. Die Gestalt selbst ist plastisch und körperlich und scheint doch gefangen in den Kunstgebilden zweidimensionaler Ornamentik. Die formale Gestaltung der Wände verleiht dem Wohnraum eine Autonomie, die kraftvoller ist als die Persönlichkeit seiner Bewohnerin (Schorske: 1982, 257; Hervorhebungen von d. A.).
346
Regina Busch
Abbildung 2: Gustav Klimt: Fritza Riedler (1906) (Schorske: 1982, Tafel V)
Abbildung 1: Gustav Klimt: Margaret Stonborough-Wittgenstein (1905) (Schorske: 1982, Tafel IV)
Durch die kleinteiligen, gleichartigen Ornamente im Muster des Kleids kommt ein serielles Moment ins Spiel, das der „formalen Gestaltung“ der Wände und der zunehmenden Abstraktheit der Umgebung korrespondiert. […] die Stilisierung der Umgebung [hat] ihre Gewalt weiter über das menschliche Sujet ausgedehnt. Eine radikale Geometrisierung, von welcher jede literarische Bedeutung verbannt ist, verkündet Festigkeit und Dauer, aber von seltsam einkapselnder Art. Das mosaikartige Fenster hinter Fritza Riedler bricht die Außenwelt der Natur zu einem ornamentalen Gebilde, das wie eine Kopfbedeckung das Gesicht der Dargestellten umrahmt (Schorske: 1982, 257f.; Hervorhebungen von d. A.).
Erst das zweite Fensterstück am rechten Rand, also die Wiederholung des Motivs, macht klar, dass schon das ornamentale Gebilde hinter dem Kopf ein Fenster darstellt.
Dasselbe immer anders
347
Abbildung 3: Gustav Klimt: Adele Bloch-Bauer (1907), Ausschnitt (Schorske: 1982, Tafel VI)
[…] Sie wird nicht nur als völlig von der Natur abgeschnitten, sondern als in der steifen byzantinischen Pracht ihrer Umgebung gefangen gezeigt. Das Haus umkleidet die Dame, während sie das Haus schmückt. Gewand und Wohnung sind zu einem einzigen ornamentalen Kontinuum verschmolzen, und beide verflächigen ihren Körper (Schorske: 1982, 258; Hervorhebungen von d. A.).
Nur Gesicht und Hände sind nicht in das ornamentale, flächige Kontinuum einbezogen, noch nicht. Denkbar ist, dass im nächsten Schritt die Differenz zwischen menschlichem Sujet und Umgebung, zwischen Vorder- und Hintergrund vollständig aufgehoben würden. Was würde aus den Ornamenten – Schorske beschreibt sie (mit bezeichnender Wortwahl) als „kaleidoskopische Symbole – Kreise, Spiralen, Quadrate und Dreiecke“ – wenn sie nicht mehr den abstrakten Hintergrund
348
Regina Busch
und Widerpart des Natürlichen, Belebten bieten müssten, sondern die alleinigen Hauptmotive der Bildkomposition wären? Man könnte von hier aus einen roten Faden bis hin zu Feldmans Komposition mit Mustern und Moduln nach der Vorlage orientalischer Teppiche verfolgen oder auch Analogien zu anderen seriellen Kompositionsweisen herausarbeiten, aber ich möchte in der ersten Jahrhunderthälfte bleiben. An der durch die KlimtBilder illustrierten Schwelle war ja noch nicht entschieden, ob die Ornamente, die Muster, wenn sie die Bauelemente, die alleinigen Träger der Struktur, Textur und der Form sind, an Individualität verlieren oder gewinnen. In einer vergleichbaren Situation befand sich die Musik, nachdem die Beziehungen zwischen den Elementen der Komposition immer dichter und vielfältiger und schließlich „alles thematisch geworden war“. In der Musik der Wiener Schule ist auf diesen Zustand die Zwölftonmusik gefolgt, durch die, wie aus Weberns Bericht zu entnehmen, das Komponieren „ohne Thematik“ freier geworden war. Dieser Prozess ist in der Wiener Schule offenbar bewusst mitverfolgt worden, insbesondere von Schönberg, und war auf allen musikalischen Ebenen zu bemerken. In einem Brief, den Schönberg im Dezember 1920 aus Holland an seine Schüler und Freunde in Wien schickte, verglich er die Aufführungsweise des Budapester Streichquartetts, das sein I. Quartett (op.7) „ganz ausgezeichnet“ gespielt hatte, mit den Aufführungsprinzipien des Vereins für musikalische Privataufführungen. Schönberg hebt die Behandlung der Stimmen hervor, die „nicht Ornament, sondern Komposition sind, da einmal diese, einmal jene Stimme auf die Fortsetzung einen größeren Einfluss hat“: Dass wir über das letzte Ideal der Reproduktion: eine Hauptstimme deutlich zu machen, der sich alles andere unterordnet, schon wieder hinaus sind, indem uns das wahrhaft polyphone Vortrags-Ideal vorschwebt: Alle Stimmen (ausgehend von einem Vorstellungsbild aller Stimmen) vollkommen deutlich zu machen! Das beruht eben auf dem echten polyphonen Denken, welches unsere Schule charakterisiert. […] Und unser Streben: alles hörbar zu machen, nach seiner Bedeutung abgestuft, jedoch immer dabei einen „geschlossenen“ Klang zu erzielen, dieses unser Streben wird seinen wahren Wert erst recht an der homophonen Musik erweisen, wo eben dadurch alle Stimmen, die ja auch in den homophonsten Einkleidungen dennoch Stimmen sind, zum Leben erwachen werden. Und der „geschlossene Klang“, der trotzdem erzielt wird, ist dann noch ein anderer als der auf alleiniger Vorherrschaft einer Stimme beruhende. – […] Dann: bei polyphoner Musik insbesondere, kann man die Staccati gar nicht kurz und scharf genug machen. Nur bei äußerster Kürze stören sie den Klang nicht und bleiben selbst deutlich. Das ist derselbe Fall wie unser p>. (piano-marcato-staccato) Anschlag. Ich will nicht sagen, dass das das einzige Mittel ist, um Polyphonie deutlich zu machen; aber sicher ein gutes. Jedenfalls muss ich sagen: die Manier, eine Stimme deutlich zu machen, indem man sie stark und alles andere schwach spielen lässt, kommt mir heute immer mehr unerträglich vor. […] Es muss jede Stimme leben,
Dasselbe immer anders
349
relativ ausdrucksvoll sein und das ist nur dann möglich, wenn der Interpret eine Vorstellung von diesem Zusammenklang hat. 9
Hier, an der Schwelle zur Zwölftontechnik, stellt sich das Problem der Hierarchie, der Balance von Haupt- und Nebensachen zunächst im Bereich der Satztechnik, bei der Organisation von Motiven und Stimmen. Später, als die Zwölftonkomposition weiter ausgebildet war, konnte man es auch auf der Ebene der Form angehen. Webern wurde zum Beispiel in den von ihm häufig gewählten dreiteiligen Formen damit konfrontiert – eine Auseinandersetzung, die er offenbar gesucht hat.10 So scheint mit der Vorgabe, dass in einer ABA-Form der mittlere der drei Teile kontrastieren solle, eine simple Reihung von Ähnlichem oder gleichsinnig auseinander Entwickeltem nicht mehr möglich. In Weberns Adagioformen stellt jeder Formabschnitt in der Regel eine Variation der zugrunde liegenden Variationenreihe dar, insbesondere auch die Überleitungen, die somit lang und ausgedehnt sind.11 Mit anderen Worten: Die einzelnen Abschnitte der Form, jeweils Variationen, sind miteinander verbunden durch Überleitungen und Rückleitungen, die ebenso lang sind wie das, zu dem sie hinführen. Die Zeit, die nötig ist, um von einem Ort zum anderen zu kommen, entspricht der, die man an diesen Orten verbringt. Nicht nur verbinden die Übergänge zwei Zustände, der Charakter des Vorübergehenden selbst kann sich zu einem eigenen Zustand festigen. Das Verhältnis von Verknüpftem und Verknüpfendem ändert sich, sie zu unterscheiden wird schwierig. Unter solchen Bedingungen bleibt offen, wie der (in der Formenlehre der Wiener Schule grundlegende) Unterschied zwischen „fest“ (in den Hauptabschnitten der Form) und „locker“ (in Überleitungen, Durchführung, Coda) zu realisieren wäre. Über Weberns diesbezügliche satztechnische Erfindungen wissen wir immer noch sehr wenig. Aber wir können damit rechnen, dass auch in seinen Werken, vielleicht nicht spektakulär, aber doch spürbar, „das technische Feld des künstlerischen Metiers“ erweitert wurde.
9 Schönberg an Alban Berg, 6. Dezember 1920 (Brand/Hailey/Meyer: 2007, 84–86 (geringfügig korrigiert)). 10 Nochmals greife ich frühere Überlegungen wieder auf, siehe Busch: 1998, 235f. 11 Beispiele sind der erste Satz des Streichquartetts op. 28, der letzte Satz des Konzerts op. 24, und die drei Sätze der Klaviervariationen op. 27. – Später ist gerade von hier aus Leopold Spinner zu jenen rhythmischen Vorordnungen gelangt, die ihn in die Nähe serieller Verfahren gebracht haben.
350
Regina Busch
Literatur Juliane Brand/Christopher Hailey/Andreas Meyer (Hrsg.), Briefwechsel Arnold Schönberg – Alban Berg, Teilband II: 1918–1935, Mainz u.a. 2007 (Briefwechsel der Wiener Schule, 3). Regina Busch (Hrsg.), Aus dem Briefwechsel Webern-Steuermann. Transkribiert und mit Anmerkungen versehen von Regina Busch, in: Musik-Konzepte Sonderband Anton Webern I, München 1983, 23–51. Regina Busch, Über die Artikulation der Zeit durch Form, in: Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz 1998, hrsg. von Günther Wagner, Stuttgart, Weimar 1998, 225–244. Sebastian Claren, Neither. Die Musik Morton Feldmans, o. O. [Hofheim] 2000. Georges Didi-Huberman, Ähnlichkeit und Berührung, Köln 1999. Morton Feldman, Darmstadt-Lecture/Darsmtadt-Vortrag, in: Walter Zimmermann (Hrsg.), Morton Feldman: Essays, Kerpen 1985, 181–213. Andreas Jacob, Grundbegriffe der Musiktheorie Arnold Schönbergs, 2 Bde, Hildesheim, Zürich und New York 2005 (Folkwang Studien, 1, hrsg. von Stefan Orgass und Horst Weber). Michel de Montaigne, Essais, übers. von Hans Stilett, Frankfurt a. M. 1998. Carl E. Schorske, Wien. Geist und Gesellschaft im Fin de Siècle, 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1982. Erwin Stein, Neue Formprinzipien, in: H. Grues/E. Kruttge/E. Thalheimer (Hrsg.), Von neuer Musik. Beiträge zur Erkenntnis der neuzeitlichen Tonkunst, Köln 1925, 59–77; Vorabdruck in: Arnold Schönberg zum fünfzigsten Geburtstage. 13. September 1924 = Sonderheft der Musikblätter des Anbruch 6 (1924), 286–303. Anton Webern, Der Weg zur Neuen Musik, hrsg. von Willi Reich, Wien 1960.
„Réécrire la modernité“?
351
Susanne Kogler „Réécrire la modernité“? Überlegungen zum Wandel des Werkbegriffes in der aktuellen musikalischen Produktion
Mit den Forderungen der Avantgarde nach größerer Nähe von Kunst und Leben war auch der in der Konzeption einer autonomen Musik verwurzelte traditionelle musikalische Werkbegriff in eine tiefgreifende Krise geraten. Seit den 1970er-Jahren begannen Komponisten jedoch vermehrt wieder, sich auf traditionelle Formen zu beziehen: Man komponierte erneut Sonaten, Streichquartette und sogar Symphonien – ein Umstand, der als einer der Auslöser der Postmoderne-Debatte in der Musik gelten kann. Ein Blick in den Werkkatalog eines jener Komponisten, deren musikalisches Denken als ein radikaler Bruch mit den geltenden Spielregeln der Avantgarde wahrgenommen wurde, des unter dem von ihm selbst vehement abgelehnten Schlagwort „Neue Einfachheit“ bekannt gewordenen Wolfgang Rihm, zeigt jedoch klar die Ambivalenz dieser „Rückwendung“ zum traditionellen Werk. Neben Symphonien, Streichquartetten, Walzern, Ländlern, Konzerten, Liedern, Elegien, Motetten, Klavierstücken und Fantasien finden sich bei Rihm auch Stücke mit Titeln wie Dis- oder Sub-Kontur, Abgesangsszene, Schattenstück, Chiffre, Im Innersten, Hervorgedunkelt oder Siebengestalt. Betrachtet man Werke wie den Chiffren-Zyklus, die Tutuguri-Reihe, die Abgesangsszenen, die Fremden Szenen, die Vielzahl an unterschiedlich besetzten Kompositionen für Gesang beziehungsweise Soloinstrumente und Orchester, den Schwarzen und Roten Tanz (1982/83) mit dem Untertitel Fragment aus Tutuguri für großes Orchester, Nachtordnung (1976) mit dem Untertitel Sieben Bruchstücke für 15 Streicher, die Hölderlin-Fragmente (1977), Lenz-Fragmente (1980), umhergetrieben, aufgewirbelt (1981) mit dem Untertitel Nietzsche-Fragmente für Mezzosopran, Bariton, gemischten Chor und Flöten (1 Spieler), Segmente op. 12 (1971), werden drei Charakteristika deutlich: erstens das wiederholte Vorkommen von Werkzyklen, zweitens ein Überschreiten traditioneller Gattungsgrenzen, das sich in der Entstehung neuer individualisierter Formen äußert, und schließlich eine Vorliebe für fragmentarische Formen. Die folgenden Ausführungen zielen darauf ab, ausgehend von kunstphilosophischen Überlegungen Theodor W. Adornos und Jean-François Lyotards, solche im zeitgenössischen Musikschaffen nicht nur bei Rihm anzutreffenden Phänomene der Fragmentierung, Individualisierung und zyklischen Gestaltung als Ausdruck einer postmodernen Ästhetik des Fragments zu fassen.
352
Susanne Kogler
1. Bei seiner Differenzierung zwischen Moderne und Avantgarde hat der Literaturwissenschafter Peter Bürger in seinen vor einigen Jahren erschienenen Schriften zur bildenden Kunst unter dem Titel Das Altern der Moderne (Bürger: 2001) den Werkbegriff ins Zentrum gestellt: Während die Avantgarden des 20. Jahrhunderts in ihrem Bestreben, die Kunst der Lebenspraxis verstärkt anzunähern, traditionelle Vorstellungen des Kunstwerks zersetzten und bekämpften, sei das Festhalten am Werkbegriff ein Kennzeichen der Moderne. Besondere Beachtung schenkt Bürger neben der Position Walter Benjamins Theodor W. Adornos dialektischer Vorstellung vom Werk: Adorno habe den emphatischen Werkbegriff durch ein Hereinnehmen der Intentionen der Avantgarde in das Werk bewahrt. Das moderne Kunstwerk ist bei Adorno Werk und ist es in traditionellem Sinne doch auch nicht. „Die einzigen Werke heute, die zählen, sind die, welche keine Werke mehr sind“ (Adorno: 1975, 37), schrieb Adorno bereits 1948 in der Philosophie der neuen Musik. Radikal modern und damit die Moderne überschreitend, kann Adornos Konzept nicht nur im Sinne von Bürger als avantgardistische Moderne,1 sondern darüber hinaus auch in Anlehnung an Jean-François Lyotards Konzept eines „Réécrire la modernité“ als „postmodern“ gedeutet werden.2 Den Hintergrund für Adornos nur auf den ersten Blick paradox erscheinende Werkauffassung bildet die Überzeugung von der Unmöglichkeit der Identität des Einen und des Vielen. Die Fähigkeit, dieser Unmöglichkeit Rechnung zu tragen und damit die eigene Unvollkommenheit zuzulassen, statt sie zu negieren, macht, so ist es in der Ästhetischen Theorie ausgeführt, letztlich den Rang eines Kunstwerks aus. Aufgabe jedes einzelnen Werkes ist es, sich dieser Unvereinbarkeit zu stellen, wodurch das klassische Ideal formaler Geschlossenheit gleichsam von innen heraus aufgelöst wird. Das daraus resultierende Fragmentarische am Werk, Signum von Unvollkommenheit, interpretiert Adorno als Zeichen von Wahrhaftigkeit: Die Wendung zum Brüchigen und Fragmentarischen ist in Wahrheit Versuch zur Rettung der Kunst durch Demontage des Anspruchs, sie [die Werke] wären, was sie nicht sein können und was sie doch wollen müssen; beide Momente hat das Fragment (Adorno: 1970, 283). 1 Bürger versteht die Postmoderne als Einbruch der avantgardistischen Problematik in die Moderne, was mit einem Infragestellen des Werkbegriffs einhergeht. Statt mit der selbstbewussten Forderung nach Revolutionierung des Alltagslebens, konfrontiere die postmoderne Kunst aktuell mit einem „Pathos des Verschwindens“, das in seiner Radikalität schließlich auch die Kunst selbst an die Grenzen des Verstummens stoßen lässt. An Adornos Werkkonzeption betont Bürger die den traditionellen Werkbegriff bewahrenden vor den diesen sprengenden Elementen. Vgl. Bürger: 2001, 45. 2 Zu Lyotards Konzept einer „anderen Postmoderne“ sowie zu weiteren Details seiner Lesart des Terminus „réécrire“ siehe Lyotard: 1988, 33–44.
„Réécrire la modernité“?
353
Fragmentierung dient hier der Rettung der Form durch das Eingeständnis der Unmöglichkeit vollkommener formaler Einheit. Mit Adornos Vorstellung vom gelungenen Werk konkretisiert sich auch seine Vorstellung von der Sprachlichkeit der Kunst: Artikulation ist für ihn nicht in herkömmlichem Verständnis Ausdruck subjektiven Empfindens oder sprachliche Darstellung eines Inhalts oder einer Idee, sondern „Rettung des Vielen im Einen“, der Versuch, dem Heterogenen durch künstlerische Formung im Material Gestalt zu verleihen und dadurch Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Mit der Unvereinbarkeit des Einen und des Vielen korrespondiert in Adornos Theorie die unüberbrückbare Differenz zwischen Geist und Material, die sich im „Bemühen, Eines zu werden“ (Adorno: 1970, 292), voneinander entfernen. Das äußert sich in den für Adorno gelungensten Kunstwerken in einer Kluft zwischen Stoff und Formung: „Daß die obersten Werke nicht die reinsten sind“, heißt es in der Ästhetischen Theorie, „sondern einen außerkünstlerischen Überschuß, zumal unverwandelt Stoffliches zu enthalten pflegen zu Lasten ihrer immanenten Komposition, ist evident“ (Adorno: 1970, 271). Das gelungene Kunstwerk enthält Adorno zufolge somit ein Moment, das auf eine Begrenzung der geistigen Autonomie des Künstlers verweist. Diesem Gedanken entsprechend, definiert Adorno den Begriff der Vergeistigung neu: als Selbstbesinnung des Geistes „auf sein eigenes Naturhaftes“. Im in diesem neuen Sinne „vergeistigten“ künstlerischen Werk gelangt das Material zu Eigenständigkeit gegenüber seiner Formung: „Nicht durch Ideen, die sie bekundete, vergeistigt sich Kunst, sondern durchs Elementarische. Es ist jenes Intentionslose, das den Geist in sich zu empfangen vermag; die Dialektik von beiden ist der Wahrheitsgehalt“ (Adorno: 1970, 293). Wenn Vergeistigung im Sinne eines solchen ästhetischen Denkens stattfindet, eröffnet sich an den Bruchstellen der Form ein Raum für das dem Geist Entgegengesetzte. Diese Verselbständigung des Materials ist, wie Adorno vermerkt, mit Ich-Verlust verbunden: „Die Emanzipation des Subjekts in der Kunst ist die von deren eigener Autonomie“ (Adorno: 1970, 292). Dass ein solcher Ich-Verlust bereits in der musikalischen Moderne zu Beginn des 20. Jahrhunderts an Werken wahrgenommen wurde, die heute als tendenziell der Postmoderne zugehörig gewertet werden, zeigt eine Bemerkung Arnold Schönbergs zur Neunten Symphonie Gustav Mahlers: Seine „Neunte“ ist höchst merkwürdig. In ihr spricht der Autor kaum mehr als Subjekt. Fast sieht es so aus, als ob es für dieses noch einen verborgenen Autor gebe, der Mahler bloß als Sprachrohr benutzt hat. Dieses Werk ist nicht mehr im Ich-Ton gehalten. Es bringt sozusagen objektive, fast leidenschaftslose Konstatierungen“ (Schönberg: 1976, 23).
Von Mahler selbst ist die Bemerkung zu seiner Achten Symphonie bekannt, er habe „nur aufschreiben müssen, was ihm diktiert worden sei“ (Geck: 1993, 409).
354
Susanne Kogler
Das neue menschliche Selbstverständnis, das mit der Einsicht in die unaufhebbare Differenz von Geist und Material verbunden ist, geht auch aus Adornos Neufassung der Kategorie des Erhabenen hervor. Obschon Adorno zufolge bereits in Kants Konzeption des Erhabenen in gewissem Sinne eine Modifikation des Gedankens einer uneingeschränkten Herrschaft des Menschen über die Natur enthalten war, interpretiert er die bedrohliche Begegnung mit der überwältigenden Natur bei Kant letztlich doch als Bestätigung des Menschen als höheres Vernunftwesen: „Erhaben sollte die Größe des Menschen als eines Geistigen und Natur Bezwingenden sein“ (Adorno: 1970, 295). Heute dagegen, da die Vernichtung des Individuums nicht länger positiv aufgehoben werden könne, müsse der Geist auf sein naturhaftes Maß gebracht werden. Die Erfahrung des Erhabenen enthüllt sich „als Selbstbewußtsein des Menschen von seiner Naturhaftigkeit“. Auf die Kunstwerke bezogen, wird das Erhabene zur „Nötigung […], die tragenden Widersprüche nicht zu überspielen, sondern sie in sich auszukämpfen; Versöhnung ist in ihnen nicht das Resultat des Konflikts; einzig noch, daß er Sprache findet“ (Adorno: 1970, 294). Die Nähe von Adornos avantgardistischer Modernität zu Jean François Lyotards Entwurf einer Postmoderne, die auf der Vorstellung eines Redigierens der Moderne basiert, zeigt sich an Adornos Kant-Kritik, die zugleich eine an ideologisch verordneten Humanitätsfunktionen der Kunst ist: Kants Vorstellung von der Kunst war insgeheim die eines Dienenden. Kunst wird human in dem Augenblick, da sie den Dienst kündigt. Unvereinbar ist ihre Humanität mit jeglicher Ideologie des Dienstes am Menschen. Treue hält sie den Menschen allein durch Inhumanität gegen sie (Adorno: 1970, 293).
Diesen Rekurs auf „Inhumanität“ im Sinne eines neuen Bewusstseins von Naturhaftigkeit greift Lyotard in seiner Aufsatzsammlung L’inhumain (Lyotard: 1988, 10) direkt auf. Die von Adorno geforderte Fragmentierung der Form, das notwendige Misslingen der Werke, stellt letztlich eine Erinnerung des Menschen an seine eigene, ursprüngliche „Inhumanität“, an seine Naturhaftigkeit, dar. Diese Erinnerung zielt auf ein neues Verständnis von Humanität ab. Das fragmentierte Werk bleibt allerdings darin Werk im traditionellen Sinn, dass bei allem Verzicht auf Einheit dennoch Einheit als gedachter Zusammenhang weiterbesteht. Mit Lyotard lassen sich die Bruchstellen, die Ränder der Kunst, die Risse, die als Resultate der bereits von Adorno postulierten Fragmentierung in der aktuellen Produktion aufbrechen, näher fassen. Dabei sind die Überlegungen des Philosophen zum Schweigen und zum Ereignis besonders aufschlussreich. Beide Phänomene betrachtet Lyotard in Hinblick auf die Möglichkeit sprachlicher Darstellung. Das Schweigen steht für den unsicheren Moment vor dem Ereignis. Es verweist aber auch auf die Unmög-
„Réécrire la modernité“?
355
lichkeit, in Worte zu fassen, was gesagt werden müsste.3 Im Verzicht auf Realisierung liegt somit einerseits der Verweis auf noch offenstehende Möglichkeiten, auf den Freiraum der Fülle, den das Schweigen beinhaltet,4 andererseits aber auch der Hinweis auf die Unmöglichkeit einer vollständigen Darstellung. Diese „Instabilität des Zustandes“ geht mit einer spezifischen Melancholie, einem Zug von Trauer einher, den bereits Ernst Krenek als Charakteristikum fragmentarischer Formen der neuen Musik beschrieben hat (Krenek: 1977, 88). Wenn Lyotard in seiner Interpretation der Stille den Akzent auf die Möglichkeit setzt, dass nichts mehr geschehen könnte, radikalisiert er die Melancholie der Moderne hin zu einer neuen Art von Todesnähe: Die „Disziplinen und Institutionen des Denkens“ setzen im Vertrauen auf die von ihnen im Verlauf der Geschichte aufgestellten und eingeübten Regeln voraus, dass das Denken und Sprechen weitergeht, und vergessen die Möglichkeit „dass nichts geschieht, dass es nicht weitergeht“ (Lyotard: 1987, 253). Mit eben dieser Möglichkeit konfrontiere dagegen die Kunst „jedesmal, wenn etwas auf sich warten läßt, das heißt in Frage steht“ (Lyotard: 1987, 253). Mit der sie fragmentierenden Stille wenden sich postmoderne Werke Lyotard zufolge auch gegen die heute Kunst und Kunstmarkt weitgehend dominierende Innovationsgläubigkeit, indem das „Fragezeichen des Geschieht es? unterbricht“ (Lyotard: 1987, 269). Das Ereignis, von Lyotard auch Vorkommnis genannt, steht in der künstlerischen Produktion für das Undarstellbare, das Lyotard auch als das Ungeheure und das Formlose bezeichnet hat. Es macht eine Verpflichtung gegenüber dem ganz Anderen, dem Geist Entgegengesetzten spürbar und schränkt die Herrschaftsgewalt des Subjekts ein: „Im Vorkommnis ist der Wille besiegt“ (Lyotard: 1987, 265). Mit der geforderten Empfänglichkeit für das Ereignis lenkt Lyotard die Aufmerksamkeit auf das Detail. Statt der großen Erzählung verschreibt sich die Kunst der Mikrologie: Die Mikrologie schreibt das Vorkommnis eines Gedankens in den Zufall des großen philosophischen Denkens ein als das Ungedachte, das zu denken bleibt. Der avantgardistische Versuch schreibt das Vorkommnis eines sinnlichen Now in den Zerfall der großen repräsentativen Malerei ein, als ein Now, das nicht dargestellt werden kann, gleichwohl aber darzustellen bleibt (Loytard: 1987, 265).
Nicht nur die Anknüpfung Lyotards an die Terminologie der Negativen Dialektik (Lyotard: 1988, 41), sondern auch die Hinwendung beider zum Vorkommnis, zum Detail zeigt die starke Übereinstimmung der beiden Philosophen.
3 Zur Interpretation des Schweigens und der Stille bei Lyotard siehe auch Rogozinski: 2000, 36. 4 Zur Bedeutung der Stille in der Musik des 20. Jahrhunderts siehe auch Houben: 1992, 214.
356
Susanne Kogler
Ebenso werden aber auch Auffassungsunterschiede deutlich, die auf eine graduelle Differenz zwischen Adornos Moderne und Lyotards Vorstellung von Postmoderne verweisen. „Daß in manchen seiner Momente das Kunstwerk sich intensiviert, schürzt, entlädt“, liest man in der Ästhetischen Theorie, wirkt in erheblichem Maß als sein eigener Zweck, die großen Einheiten von Komposition und Konstruktion scheinen nur um solcher Intensität willen zu existieren; Danach wäre […] das Ganze in Wahrheit um der Teile willen, nämlich seines χαιρός, des Augenblicks wegen da, nicht umgekehrt (Adorno: 1970, 279).
Der Augenblick, das Vorkommnis, bei Adorno noch einer von mehreren Aspekten der Werke, wenn auch ein wesentlicher, ist im postmodernen Werk zum Zentrum geworden. Folgt man Lyotards Auffassung von Postmoderne, ist daher heute das Extrem der Momentform nicht mehr vorrangig als Widerruf der Objektivierung des musikalischen Werkes zu betrachten, wie es Dahlhaus in den 1970er-Jahren sah,5 sondern als radikale Profilierung des Details im Zuge einer emphatischen Hinwendung der Kunst zum Ereignis. Mit der Thematisierung des Undarstellbaren verweist die aktuelle Kunst auch auf ihre Wurzeln in der Tradition der Frühromantik.6 Deren Vertreter empfanden, wie etwa Schelling in seiner Fichte-Kritik, die für das 19. Jahrhundert bereits sprichwörtlich gewordene „Sehnsucht nach dem Unendlichen“ (Schlegel: KA XVIII, 418, Nr. 1168) wesentlich als „eine Erfahrung des Nicht-Besitzes, des Mangels, der Unzulänglichkeit“ (Frank: 1989, 238): Jeder ist von Natur getrieben, ein Absolutes zu suchen, aber indem er es für die Reflexion fixiren will, verschwindet es ihm. Es umschwebt ihn ewig, aber er kann es nicht fassen. Es ist nur da, inwiefern ich es nicht habe, und inwiefern ich es habe, ist es nicht mehr (Schelling: SWI/4, 357, Anm. 2).
Angesichts dieser Vorstellung von einer prinzipiellen Unfassbarkeit des Absoluten wurde bereits in der Frühromantik das Fragment zum bevorzugten Ausdrucksmittel, da es, wie Friedrich Schlegel erläutert hat, den Widerspruch des Unendlichen und des Endlichen punktuell in sich trägt. Das wesentliche Merkmal des Fragments ist sein Anspielungscharakter – eine bezeichnende Parallele zwischen gegenwärtiger 5 Zu Dahlhaus’ Überlegungen zum Werkbegriff vgl. „Plädoyer für eine romantische Kategorie – Der Begriff des Kunstwerks in der neuesten Musik“, „Über den Zerfall des musikalischen Werkbegriffs“ und „Das musikalische Kunstwerk als Gegenstand der Soziologie“ in Dahlhaus: 1978, 270–303. 6 Zur Vorstellung von Kunst als „Darstellung des Undarstellbaren“ in der frühromantischen Ästhetik siehe Frank: 1989, 255.
„Réécrire la modernité“?
357
und vergangener Kunst. Die Differenz der postmodernen Kunst zum 19. Jahrhundert wird deutlich an der Präzisierung dessen, worauf angespielt wird: „Das Unausdrückbare ist nicht in einem Jenseits, einer anderen Welt oder anderen Zeit beheimatet, sondern darin, daß es geschieht, daß etwas geschieht“, betont Lyotard (Loytard: 1987, 254). Trotz dieser Distanz zum idealistischen Denken steht die postmoderne Kunst mit ihrer Neigung zum Fragmentarischen dennoch unverkennbar der Frühromantik nahe, die sich ihrerseits, wie Manfred Frank nachgewiesen hat, bereits kritisch gegenüber metaphysischer Einheitsgläubigkeit zeigte und damit in gewissem Sinne radikal moderne Züge trug. Als fragmentarisch erlebten die Künstler der Frühromantik nicht nur die sie umgebende Welt, sondern auch das eigene Ich. Schaffen war nicht so sehr Selbst-Setzung wie Suche nach Identität.
2. Mit Lyotards Verständnis von Postmoderne als „réécrire la modernité“ korrespondiert Wolfgang Rihms in unterschiedlichen Äußerungen anzutreffende Anknüpfung an die Zweite Wiener Schule. Die Kritik, die Rihm zu Alban Bergs Musik vorbringt, verweist auf die Bedeutung des Fragmentarischen in seinem eigenen Œuvre. Während Rihm Schönberg ungeteilte Bewunderung entgegenbringt, ist er Berg gegenüber deutlich zurückhaltender und differenzierter: Es ist, als ob typische Wesenszüge eines Autors die Rezeption seines Werkes mitgestalten. Bei Berg: das Jugendliche und Schwärmerische – Berg ist mein Jugendschwarm. […] Bei Berg schien alles großzügig. Schönberg kannte ich zu wenig, das war ein Fehler. Nein, kein Fehler, denn so konnte ich ihn kennenlernen – ein Lernprozeß, der mich überhaupt erst zu mir kommen ließ. Nicht daß Bergs Kunst dann verblaßte, aber ich verstand sie zunehmend als Bewegung auf einer Ausdrucksebene, während Schönbergs jähe Wechsel der Ebenen, über Abgründe hin, scharf geschnitten, das Dagegengestellte seiner ganzen Kunst mir immer näher kamen und – da es nicht nur um mich geht – auch immer stärker als Keime und Energien für Zukünftiges erlebbar wurden. Heute wird ausgetragen, woran Schönberg um 1910 schon trug. Ich hoffe, es kommt nicht zu Glättungen (Rihm: 1997a, 282).
Bergs strukturelle und formale Konzeption erscheint Rihm zu sehr von der Intention zu verbinden durchdrungen: „Es gibt keine Willkür in Bergs Musik, nicht den plötzlichen Ausbruch in den anderen Bereich, die unbegreifliche Setzung […] Zwanghaft muß alles seine Entsprechung finden“ (Rihm: 1997a, 283). Rihms Wunsch „Berg zu zwingen, aus seinen Zusammenhängen aufzufahren, plötzlich loszulassen, ohne Verbindung“, macht sein eigenes kompositorisches Ideal deutlich. Rihms Kritik bezieht sich einerseits auf die Bergs Kompositionen konsequent
358
Susanne Kogler
durchziehenden Mikrostrukturen, andererseits wendet sie sich gegen die Bezugnahme auf traditionelle Formen und Techniken, wie auch aus einem Kommentar zu Bergs Schriften hervorgeht: „Wie stark sich die Künstler immer wieder verbal auf ein Terrain rückversichern mußten, das sie längst verlassen hatten […]. Es sind doch Sonaten, Fugen, es ist doch Kontrapunkt“. Rihms Auffassung nach wäre Kunst dagegen immer „die andere Möglichkeit“ (Rihm: 1997a, 287). Aus diesen Äußerungen wird eine Favorisierung von Brüchen, unvorhersehbaren Verläufen und freien Formen deutlich, die in ihrer Grundtendenz als Vorliebe für das Fragmentarische zusammengefasst werden kann. Einer solchen Ästhetik des Fragments entsprechend, ist für Rihm Bergs gelungenstes Werk die „Jahrhundertoper“ Wozzeck aufgrund ihrer „fragmentarischen Dramaturgie“, die sich „trotz Bindungen in sogenannte musikalische Formen als stärker“ erweist, wie Rihm erläutert: Am Wozzeck könne man lernen, „daß aber Dramaturgie, die ungelöst, also mit Rest und aufgeworfener Rätselhaftigkeit durchmischt bleibt, weiterfragt und somit weiter Antwort fordert – über den Vortrag hinaus“ (Rihm: 1997a, 284). Bereits Büchners Woyzeck beinhaltet als Textfragment für Rihm tief musikalische Dimensionen. Bevorzugt verwendet der Komponist auch in seinen eigenen Werken Textfragmente oder Texte mit fragmentarischer Qualität. Neben der Formlosigkeit der Großform, die sich aus prozessual konzipierten Verläufen ergibt und oftmals mit offenen Schlüssen einhergeht, findet sich Fragmentierung in Rihms Kompositionen auch in der Detailgestaltung der Klangverläufe, die vielfach auf- und abgerissen erscheinen und von plötzlichen strukturellen Umbrüchen sowie jähem Wechsel zwischen mehrfachem Piano und mehrfachem Forte gekennzeichnet sind. Schließlich korrespondiert die von Rihm selbst hervorgehobene Bedeutung der Stille in vielen seiner Werke mit seiner Ästhetik des Fragments. Pausen hat er auch als „die anderen Fragmente, in denen die Stille umrissen wird,“ charakterisiert. Die Hintergründe der in Rihms Musik vielfach beobachtbaren Hinwendung zum Fragment hat der Komponist in einem Gespräch mit dem Titel Fragment und Wahrheit angesprochen. Sie resultiert aus einer „Erfahrung, die Geschlossenheit und Stimmigkeit als etwas Brüchiges erlebt hat“ (Rihm: 1997c, 208). Wesentlich ist für den Komponisten das Wahrheitsmoment, das im Fragment liegt – eine Anschauung, die deutlich der Position Adornos nahekommt. Wahr ist die fragmentarische Form für Rihm allerdings nur dann, wenn sie sich quasi von selbst ergibt. Fragmentierung kann also nicht vorab angestrebt werden, sondern verlangt vom Komponisten zweifache Offenheit: „Fragment muß werden, und dann, wenn man merkt, daß es wurde, muß es das auch bleiben dürfen“ (Rihm: 1997c, 207). Hier wird die Forderung nach einer grundsätzlichen Haltung erkennbar, die mit jener der Empfänglichkeit, die Lyotard als für den postmodernen Künstler charakteristisch darstellt, verwandt zu sein scheint: eine Empfänglichkeit für das
„Réécrire la modernité“?
359
Materielle, Stoffliche, das der Künstler nicht primär bildet, sondern dem er sich ausliefern muß. „Mir wird immer klarer“, lautet ein Ausspruch Rihms über sein eigenes Schaffen, daß ich nicht komponiere, indem ich disponiere, sondern daß ich Zustände von Musik selbst ausdrücke, wenn ich etwas aufschreibe. Nicht etwas, das bereitsteht und über das ich verfüge, sondern etwas, dem ich ausgeliefert bin, das mir auch seinen Zustand aufzwingt und mich in die Lage versetzt, diesen Zustand dinghaft darstellen zu müssen (Rexroth: 1985, 61).
Korrespondenz zu Lyotard zeigt sich auch in einer besonderen Aufmerksamkeit für das Einzelereignis, das Detail, dessen grundsätzliche Priorität Rihm in Hinblick auf die serielle Musik Karlheinz Stockhausens erläuterte: Die Ableitung des Einzelmoments von einer übergeordneten Einheit, einer die Ausformung provozierenden Formel, diese Ableitung erfolgt nicht um der Ableitung willen – das ist ja das Mißverständnis, was die meisten Menschen denken, wenn der Begriff „serielles Komponieren“ im Raum steht, als ob es um den spießigen Nachweis ginge, woher welcher Ton stammt –, sondern sie geschieht der Gestalt des Einzelereignisses wegen. Dessen Unauslöschlichkeit ist das Geheimnis seiner Bezugsfähigkeit (Rihm: 1997b, 326).
Notenbeispiel 1: Wolfgang Rihm, Hölderlin-Fragmente, „Empedokles auf dem Ätna“ (Fragment 6), System 1 und 2.
360
Susanne Kogler
Die 1977 entstandenen Hölderlin-Fragmente weisen einen Traditionsbezug auf, der einer Ästhetik des Fragments nicht nur entspricht, sondern auch zu deren weiterer Charakterisierung beiträgt.7 Die Traditionslinie, in die Rihm seine Komposition stellt, ist eine von Werkfragmenten, wobei Rihm mit dieser Textwahl einen zweifachen Rückbezug setzt: nicht nur zur Frühromantik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, und im Besonderen zur Kunstphilosophie des Fichte-Schülers Hölderlin, sondern auch zur Tradition der Vorsokratiker, die bereits von Friedrich Nietzsche als Höhepunkt der abendländischen Philosophie bezeichnet wurden.8 Das sechste der von Rihm komponierten Fragmente, an zentraler Stelle ungefähr in der Mitte des Zyklus positioniert, besteht aus einem einzigen Vers, der allerdings nur als Titel aufscheint und nicht gesungen wird: „Empedokles auf dem Ätna“. Empedokles aus Akragas steht für ein Denken in unauflösbaren Widersprüchen. Seine beiden Hauptwerke, ein religiös ethisches Gedicht mit dem Titel Καθαρμοí und eine philosophische Dichtung, von späteren griechischen Gelehrten mit Περì φύσεωζ betitelt (Capelle: 1968, 183), sind fragmentarisch überliefert und repräsentieren die beiden divergierenden Pole der Persönlichkeit des Philosophen, der zugleich als Physiker und Mystiker galt. Er stellte sich die Welt als in einem kontinuierlich andauernden Prozess von Zerstörung und Entstehung befindlich vor, der durch die beiden widerstrebenden Naturkräfte Liebe und Streit in Gang gehalten wird und vom Zufall bestimmt ist. Diese beiden kosmischen Kräfte wirken auch auf die Schicksale der Seele ein. Legenden ranken sich um den mysteriösen Tod des Dichterphilosophen: Als dieser nach einer Reise zu den Olympischen Spielen nie mehr in seine Heimat zurückkehrte, entstanden seltsame Gerüchte: Wie Diogenes Laertius überliefert, sollen nur mehr seine Sandalen am Kraterrand des Ätna gefunden worden sein. Während seine Anhänger behaupteten, Empedokles sei zu den Seligen entrückt worden, erzählten seine Gegner, er habe sich in den Ätna gestürzt, um eben dieses vorzutäuschen. Über den Tod des Philosophen hat Hölderlin auch ein Trauerspiel verfasst, woraus Fragmente von drei verschiedenen Fassungen überliefert sind, in denen der Tod des Philosophen jeweils unterschiedlich interpretiert wird. Das mysteriöse Verschwinden wird zuerst als Versuch des Individuums dargestellt, die Einheit mit der Natur wiederzugewinnen. Zugleich wird diese Handlung als Hybris gesehen: Empedokles habe sich den Göttern gleich und somit für unsterblich gehalten, woraus seine Schuld und sein tragischer Untergang resultierten. In 7 Zu Rihms Hölderlin-Fragmenten siehe auch Nielinger-Vakil: 2000 sowie Andraschke: 1988. 8 Die Affinität Rihms zu Nietzsche zeigt sich unter anderem auch an der häufigen Verwendung von Nietzsche-Texten in seinem Oeuvre wie z.B. in den 6 Gedichten nach Friedrich Nietzsche für Bariton und Klavier (2001), in Oedipus, Musiktheater in 2 Teilen (1986–87), oder in Umhergetrieben, aufgewirbelt, Nietzsche-Fragmente, für Mezzosopran, Bariton, gemischten Chor und Flöten (1 Spieler) (1981).
„Réécrire la modernité“?
361
den späteren Fassungen wird Empedokles‘ Tod als freiwilliger Opfertod dargestellt und damit als exemplarische Handlung. Gegensätze von Kunst und Kultur auf der einen und Natur auf der anderen Seite versöhnend, symbolisiert die Tat Tod und Erneuerung der politischen Gemeinschaft und kann daher als Plädoyer des Dichters für eine republikanisch-demokratische Revolution der bürgerlichen Gesellschaft interpretiert werden. Mit der Textwahl ergibt sich ein Bezug zu Hölderlins Kunstphilosophie. Für Hölderlin eröffnete die Kunst die Möglichkeit, die faktische Existenz in Trennungen in der ästhetischen Erfahrung des unmittelbaren Überwältigtseins zu überwinden. Damit ist sie eine Form „höherer Aufklärung“, die Einblick in die „ewig eine Welt“ zulässt, indem sie aus der Begrenzung der alltäglichen Erfahrung ins Offene hinausführt. Das Undenkbare wird an der Grenze des Menschlichen, im Zustand von Selbstvergessenheit, der in Wahnsinn und Tod gipfelt, bewusst. Das Ereignis der Transgression, der Überschreitung der Grenzen der Erkenntnis in der Kunst, ist der existenziellen Erfahrung der Liebe ähnlich, sodass der Dichter im übertragenen Sinn als Liebender gedacht werden kann.9 Die von Rihm für seinen Liederzyklus ausgewählten Textfragmente bringen wesentliche Motive der Tragödiendichtung und der Kunstphilosophie Hölderlins zur Sprache: Der Aspekt der Hybris kommt in den Versen „Verwegener! Möchtest von Angesicht zu Angesicht / Die Seele sehn / Du gehest in Flammen unter“ zum Ausdruck, die verbindende Kraft der Liebe und der Kunst ist in den Worten „Ähnlich dem Manne, der Menschen frisset / ist einer, der lebt ohne (Liebe); Alles ist innig / Das scheidet / So birgt der Dichter“ erkennbar. Rihms eigene ästhetische Intention, Widersprüche nicht aufzulösen und größtmögliche Freiheit zuzulassen, bringen die folgenden Verse zum Ausdruck, die demnach auch als Schlüsselstelle der Komposition gelten können: „Denn nirgends bleibt er. / Es fesselt / Kein Zeichen. / Nicht immer / Ein Gefäß ihn zu fassen. / Gestalt und Geist.“ Sie zeigen die Identifikation des Komponisten mit der rätselhaften Gestalt des Dichter-Philosophen. Wesentlich für das Verständnis der Komposition sind weiters die Anspielungen, die sich aus der fragmentarischen Gestaltung ergeben. Rihm schreibt dazu: Dieser Zyklus Hölderlin-Fragmente – Einzelstücke gibt es nicht, sie können also auch nicht „vorgetragen“ werden – ist ein ausgebrannter Liederzyklus oder ein ungeborener. Alle extremen Wechsel sind integraler Bestandteil seiner zerstörten oder ungeformten Sprache (Rihm: 1997d, 308).
9 Eine anschauliche Darstellung der Kerngedanken der Kunstphilosophie Friedrich Hölderlins findet sich bei Lypp: 1991, 74ff.
362
Susanne Kogler
Diese Bemerkung macht klar, dass der Komponist sein Stück als Hinweis auf etwas in der Sprache nicht Darstellbares, etwas dem Denken Unerreichbares verstanden wissen will. Das zeigt sich auf mehreren Ebenen: Vom Inhalt her betrachtet, bietet der Liederzyklus keine narrativ fassbare Darstellung der Ereignisse. Vielmehr evoziert der Text in seiner fragmentarischen Gestalt ein Ereignis, das in seiner Rätselhaftigkeit nicht darstellbar ist. Jedoch wird mit künstlerischen Mitteln darauf als Erinnertes und Erahntes Bezug genommen. Auf der Ebene der ästhetischen Erfahrung wird der Anspielungscharakter in der zweifachen Bedeutung der Stille deutlich, die an Lyotards Interpretation der Stille erinnert: Aufgrund der radikalen Reduktion erscheint die Musik zu Beginn durchlässig für etwas, was hinter den gewohnten Klängen laut wird: den Klang der Stille selbst.
Notenbeispiel 2: Wolfgang Rihm, Hölderlin-Fragmente, „Ähnlich dem Manne, der Menschen frisset“ (Fragment 1), Takt 1–8.
Im weiteren Verlauf richtet sich die Aufmerksamkeit des Hörers vermehrt auf das plötzlich aus der Stille auftauchende klangliche Ereignis. Aufgrund der Fragmentierung der Musik ändert sich die Rezeptionshaltung: Sie wird mehr und mehr zu einer der Empfänglichkeit. Diese ist nachmetaphysisch in dem Sinne, dass sie nicht auf eine Botschaft jenseits der Komposition gerichtet ist oder auf das Erfassen einer aus dem Klangverlauf resultierenden Form, sondern auf die sinnliche Erscheinung der einzelnen Klangereignisse selbst.
„Réécrire la modernité“?
363
Notenbeispiel 3: Wolfgang Rihm, Hölderlin-Fragmente, „Am stürzenden Strom“ (Fragment 5), Takt 1–4.
Die einzelnen Ereignisse stehen zueinander in starkem Kontrast und haben wiederum fragmentarischen Charakter. Damit symbolisiert die Komposition, als Ganzes gesehen, die unauflösbare Widersprüchlichkeit, Unsicherheit und Unbegreiflichkeit der Welt, die die menschliche Vernunft an ihre Grenzen geraten lässt. Die Klanggestaltung, die die Aufmerksamkeit auf den Moment lenkt, beinhaltet zudem eine Öffnung der Gattung Lied hin zum Musiktheater: Die vom Sänger mittels des Klanges mit großer Intensität dargestellte Person gewinnt beinahe physische Präsenz. Die ins Offene verweisende Konzeption der Komposition betont Rihm auch durch die Besetzung: „Die Beschränkung auf das Klavier als […] zweite Stimme unterstreicht einerseits die Herkunft vom Klavierlied, weist andererseits (durch Satztechnik zum Beispiel) auf die mögliche Ausweitung ins konkrete ‚Instrumentierte‘, kann also als ‚Klavierauszug‘ oder Skizze verstanden werden“ (Rihm: 1997d, 308). Von der Komposition liegt auch eine zweite Fassung mit Orchester vor. Mit der Gestaltung des Liederzyklus als Zyklus von Fragmenten und damit als fragmentiertem Liederzyklus, mit seinen durch jähe Brüche und Extreme geprägten Klängen nimmt Rihm auch auf die musikalische Tradition, die Liederzyklen des 19. Jahrhunderts, Bezug. Insbesondere vermeint man immer wieder an die Musik Franz Schuberts und Robert Schumanns erinnert zu werden, sodass der in Klang und Sprache umrissene Zustand extremer Zerrissenheit und Entfremdung auch als Radikalisierung der Winterreise oder als neue Fassung der Dichterliebe gelesen werden kann.
364
Susanne Kogler
Notenbeispiel 4: Wolfgang Rihm, Hölderlin-Fragmente, Lied des Schweden (Fragment 9) Takt 1–6.
Die von Zentraltönen dominierte freie Tonalität, die Rihm bevorzugt verwendet, knüpft an die freie Atonalität der Zweiten Wiener Schule an, wobei diese um „tonale“ Konstellationen erweitert wird. Ein Vergleich der Hölderlin-Lieder mit Alban Bergs erster atonaler Komposition, dem vierten der Lieder op. 2 nach einem Text von Alfred Mombert, verdeutlicht Parallelen wie Differenzen zur musikalischen Moderne des beginnenden 20. Jahrhunderts. Bergs Lied kann als eine seiner radikalsten Kompositionen gelten, worauf bereits Adorno aufmerksam gemacht hat. Interessant für die Frage nach der Veränderung des Werkbegriffs ist, an welchen kompositorischen Merkmalen Adorno diese Radikalität festgemacht hat: Der Zug von Radikalismus, der das Lied bezeichnet, hat seinen Ort nicht in der Harmonik. Sondern vielmehr in der Prosa, mit der Berg das Pathos der vorausgehenden Lieder im letz-
„Réécrire la modernité“?
Notenbeispiel 5: Alban Berg, Lieder op. 2, Nr. 4, Takt 9–16
365
366
Susanne Kogler
ten zu entzaubern unternimmt, ohne von dessen Ausdruckskraft etwas preiszugeben: erste Etappe zum Wozzeck. […] Die Deklamation macht sich von allen Symmetrieverhältnissen frei […]. Nach dem Vorbild der Erwartung verzichtet das Lied wesentlich auf thematische Arbeit; kein Formteil ist wiederholt. […] Bergs tiefe Neigung zum Chaotischen – Ursprung aller Sicherungskünste – wagt zum ersten Male, laut zu werden (Adorno: 1971, 385f).
Die Freigabe der Form, die Adorno in Bergs Lied wahrnimmt, korrespondiert mit einer Hinwendung zum Theater, die Adorno ebenfalls bereits in dieser Komposition angelegt sieht: „In diesem Schockmoment“, heißt es im Anschluss an die zitierte Stelle, „blitzt Bergs musikalische Bestimmung auf: die Oper. Das Glissando ist eine Operngeste. In die Oper auch gehört das tiefe b, eine Schlagzeugwirkung, die sich, scheinbar, im Lied viel zu lang Zeit läßt. Wie hier die Form durchbrochen wird, verlangt es die Oper […]“ (Adorno: 1971, 386). Freigabe der Form und theatralische Züge charakterisieren auch Rihms fragmentarischen Zyklus wesentlich. Eine grundlegende Differenz besteht jedoch darin, dass Bergs Komposition letztlich nicht auf Brüche, sondern auf Geschlossenheit zielt.10 Das spiegelt sich zum einen in der Klanggestalt der Komposition, deren Makroform eine Tendenz zur Achttaktigkeit aufweist, die gleichsam den Gegenpol zu der von Adorno konstatierten Auflösung der Deklamation in Prosa bildet: Das Lied gliedert sich in drei, durch Tempoveränderungen gekennzeichnete formale Einheiten: Langsam Takt 1–8, langsameres Tempo Takt 9–16, molto rit. ganz langsam Takt 18–25. Die Symmetrie wird nur an einer Stelle, nämlich unmittelbar nach der von Adorno erwähnten Glissando-Stelle, durch einen eingeschobenen Takt (Takt 17) aufgebrochen. Durch das Ineinandergreifen von Klavier und Gesang erscheint Bergs Komposition im Gegensatz zu Rihms von Pausen durchsetzten fragmentarischen Klanggesten durchgängig gefügt. Eine Tendenz zu einheitlicher Sinnstiftung zeigt sich auch in Momberts Text, in dem eine ähnliche Thematik wie in den HölderlinFragmenten, der Gegensatz von Leben und Tod, angesprochen wird, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Die in poetischen Bildern einander gegenübergestellten Gegensätze Frühling und Winter, Jugend und Tod werden harmonisierend aufgelöst: „Der Eine stirbt, daneben der Andere lebt: / Das macht die Welt so tief schön.“ Dieser grundsätzliche Gegensatz zwischen Berg und Rihm kann nicht nur im Liedschaffen, sondern im gesamten Œuvre ausgemacht werden. So ist beispielsweise auch Bergs Violinkonzert einem ausgleichenden Modell, dem Schema „Leben, Tod und Verklärung“ verpflichtet. Die in die Komposition eingebundenen heterogenen Elemente fügen sich, parallel zur teleologischen Tendenz des Inhalts, in eine Ge10 Zu den strukturellen Zusammenhängen in Bergs atonaler Kompositionsweise siehe auch Pople: 2000, sowie Bailey: 2000.
„Réécrire la modernité“?
367
samtform. Ziel ist es, Manon Gropius ein klingendes Denkmal zu setzen. Betrachtet man dagegen Rihms Musik für Violine und Orchester mit dem Titel Gesungene Zeit, 1991/92 auf Anregung Paul Sachers für Anne Sophie Mutter komponiert, ergibt sich ein anderes Bild. Die Komposition ist auf die sinnliche Präsenz des gegenwärtigen Ereignisses gerichtet, das der Klang selbst ist. Die Bezeichnung Konzert wird im Titel nicht mehr gebraucht. Rihm schreibt zur Formidee des Stückes: Die Linie selbst, ist sie ein Ganzes? Alles ist nur Teil, Segment, Bruchstelle; beginn- und beschlußlos ist es unserer Beobachtung anheimgegeben – wir entwerfen hörend auf ein Ganzes hin, das es nicht gibt. Aber dort muß es sein … (Rihm: 1997e, 397).
3. Wie die Kompositionen Wolfgang Rihms zeigen – und es wären auch andere Komponisten in die Darstellung einzubeziehen11 – knüpft das künstlerische Schaffen heute auf verschiedenen Ebenen an die musikalische Moderne um 1910 an. Die kompositorische Bezugnahme zur Tradition berührt allerdings nicht nur künstlerische Entwicklungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, sondern reicht bis zu den Wurzeln der Moderne, in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, zurück. Positionen Adornos und Lyotards aufgreifend, konkretisiert sich aktuelle „postmoderne“ Werk-Ästhetik als eine Ästhetik des Fragments. Diese ist der Darstellung des Undarstellbaren in einem nachmetaphysischen Sinn verpflichtet. Sie übt Kritik an einseitiger Innovationsgläubigkeit und will das von der Moderne Vergessene durch Rückkehr zu den eigenen Wurzeln wieder in Erinnerung rufen. Insbesondere werden Beziehungen zu künstlerischen Richtungen deutlich, deren Vertreter bereits zu ihrer Zeit einer kritischen Einstellung gegenüber dem „Mainstream“ der Moderne verpflichtet waren. Dadurch trägt das aktuelle Schaffen zur Entdeckung einer „anderen“ Moderne in der Moderne bei und zielt damit – im Sinne Lyotards – auf eine „andere“ Postmoderne. Diese erschöpft sich nicht in Zitat, Stilkopien und einem unreflek11 Besonders markante Beispiele für eine kompositorische Ästhetik, die auf vergleichbare Weise an die musikalische Vergangenheit anknüpft, sodass ebenfalls vom Versuch, die Moderne zu „redigieren“, gesprochen werden kann, finden sich im Werk des 1927 in München geborenen Wilhelm Killmayer. Auch Killmayer verwendet freitonale Harmonik und stellt Verbindungen zur Musik der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts her. Das Fragment als Formmodell findet sich weiters bei Aribert Reimann (Sieben Fragmente in memoriam Robert Schumann für Orchester 1988) oder im Oeuvre György Kurtágs (Kafka-Fragmente für Sopran und Violine op. 24 1985/87). Sowohl Reimann als auch Kurtág knüpfen mittels Bezugnahme auf Robert Schumann auch an die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts an.
368
Susanne Kogler
tierten „Anything goes“, sondern kann als dem Ereignis und der Stille als Spur des Undarstellbaren verpflichtet charakterisiert werden. Sie beinhaltet brüchige Erinnerung an Vergessenes ebenso wie Zukunftsperspektiven, die sich aus einer neuen Haltung gegenüber dem Anderen, dem Stofflichen, Materiellen ergeben. Widersprüche werden nicht mittels formaler Systematik geglättet, sondern bewusst ins Zentrum gestellt. Dieser neuartigen Fragmentierung der Werke liegt die Intention zugrunde, die unauflösbaren Widersprüche zwischen Materie und Geist bewusst zu machen und den Menschen wieder an seine ursprüngliche Naturhaftigkeit und die Grenzen seiner Autonomie zu erinnern.
Literatur Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, hrsg. von Gretel Adorno und Rolf Tiedemann, Frankfurt a. M. 1970 (Gesammelte Schriften, 7). Theodor W. Adorno, Berg. Der Meister des kleinsten Übergangs, in: Die musikalischen Monographien, hrsg. von Gretel Adorno und Rolf Tiedemann, Frankfurt a. M. 1971 (Gesammelte Schriften, 13), 321–494. Theodor W. Adorno, Philosophie der neuen Musik, hrsg. von Rolf Tiedemann, Frankfurt a. M. 1975 (Gesammelte Schriften, 12). Peter Andraschke, Hölderlin-Fragmente, in: Hermann Danuser/Helga de la Motte-Haber/ Silke Leopold (Hrsg.), Das Musikalische Kunstwerk. Geschichte – Ästhetik – Theorie. Festschrift für Carl Dahlhaus zum 60. Geburtstag, Laaber 1988, 743–752. Kathryn Bailey, Bergs aphoristische Stücke, in: Anthony Pople (Hrsg.), Alban Berg und seine Zeit, Laaber 2000, 121–152. Peter Bürger, Das Altern der Moderne: Schriften zur bildenden Kunst, Frankfurt a. M. 2001. Wilhelm Capelle (Hrsg.), Die Vorsokratiker, Stuttgart 1968. Carl Dahlhaus, Schönberg und andere: gesammelte Aufsätze zur Neuen Musik, Mainz 1978. Manfred Frank, Einführung in die frühromantische Ästhetik: Vorlesungen, Frankfurt a. M. 1989. Martin Geck, Von Beethoven bis Mahler. Die Musik des deutschen Idealismus, Stuttgart, Weimar 1993. Eva-Maria Houben, Die Aufhebung der Zeit. Zur Utopie unbegrenzter Gegenwart in der Musik des 20. Jahrhunderts, Stuttgart 1992. Ernst Krenek, Über neue Musik. Sechs Vorlesungen zur Einführung in die theoretischen Grundlagen, Darmstadt 1977. Jean-François Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, in: Jacques le Rider/Gérard Raulet (Hrsg.), Verabschiedung der (Post-)Moderne, Tübingen 1987, 251–269. Jean-François Lyotard, Avant-propos: de l’inhumain, in: ders., L’ inhumain. Causeries sur le temps, Paris 1988, 9–15. Jean-François Lyotard, Réécrire la modernité, in: ders., L’ inhumain. Causeries sur le temps, Paris 1988, 33–44. Bernhard Lypp, Die Erschütterung des Alltäglichen. Kunst-philosophische Studien, München 1991.
„Réécrire la modernité“?
369
Carola Nielinger-Vakil, Quiet revolutions: Hölderlin Fragments by Luigi Nono and Wolfgang Rihm, in: Music & Letters 81 (2000), 245–274. Anthony Pople, Vier frühe Werke: Diesseits und jenseits der Tonalität, in: ders. (Hrsg.), Alban Berg und seine Zeit, Laaber 2000, 88–120. Dieter Rexroth (Hrsg.), Der Komponist Wolfgang Rihm, Frankfurt a.M. 1985. Wolfgang Rihm, Als ob Berg Geburtstag hätte, in: ders., ausgesprochen. Schriften und Gespräche Bd. 1, hrsg. von Ulrich Mosch, Winterthur 1997a, 282–290. Wolfgang Rihm, Laudatio auf Karlheinz Stockhausen, in: ders., ausgesprochen. Schriften und Gespräche Bd. 1, hrsg. von Ulrich Mosch, Winterthur 1997b, 323–329. Wolfgang Rihm, Fragment und Wahrheit, in: ders., ausgesprochen. Schriften und Gespräche Bd. 2, hrsg. von Ulrich Mosch, Winterthur 1997c, 207–212. Wolfgang Rihm, „Hölderlin-Fragmente“ für Singstimme und Klavier (1976–1977), I. Fassung, in: ders., ausgesprochen. Schriften und Gespräche Bd. 2, hrsg. von Ulrich Mosch, Winterthur 1997d, 308. Wolfgang Rihm, „Gesungene Zeit“, Zweite Musik für Violine und Orchester (1991–1992), in: ders., ausgesprochen. Schriften und Gespräche Bd. 2, hrsg. von Ulrich Mosch, Winterthur 1997e, 396–397. Jacob Rogozinski, Lyotard: Le différend, la présence, in: Claude Amey/Jean-Paul Olive (Hrsg.), À partir de Jean-François Lyotard, Paris 2000, 33–49. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Sämmtliche Werke. 1. Abteilung: 10 Bde (I–X), hrsg. von Karl F. August Schelling, Stuttgart, Augsburg 1856–61 (Schellings Werke. Nach der Originalsausgabe in neuer Anordnung, hrsg. von Manfred Schröter, München 2. Aufl. 1958ff.) (zit. SW). Friedrich Schlegel, Kritische Ausgabe in 35 Bänden, hrsg. von Ernst Behler, Paderborn, München, Wien 1958ff. (zit. KA).
370
Susanne Kogler
Abstracts
371
English Abstracts of the German Essays
Federico Celestini/Gregor Kokorz, Music and Modernism The speakers at the symposium Music and Modernism were asked to base their papers on one of the following thematic areas. These themes, adapted specifically to musicology, but arising from interdisciplinary research on modernism, were developed during the ten-year interdisciplinary research project Moderne. 1. Identity, Difference According to Adorno, art is the “refuge of mimetic behaviour” (“Zuflucht des mimetischen Verhaltens”) i.e. the behaviour exemplified by an actor who rejects his/her own identity in favour of another. This connection between art and deidentification is central to Nietzsche’s considerations about the Dionysian. In modern art, the dialectic between mimetic and rational moments is determined by the principle of the “increasing negation of the meaning” (“fortschreitende Negation des Sinns”, Adorno). The notion of “Self ” (Mach, Musil, and Freud, etc.) in music, as well as questions of identity and difference in musical material are relevant here. 2. Transformation Processes In Musical Perception The timeframe of Modernism is characterised by diverse changes in the perception and examination of music, through which even the interpretation of the term “music” itself is transformed. Technical innovations, beginning with the invention of the phonograph, enable the conservation and technical reproduction of music and introduce the media age. Music becomes the object of scientific observation as universities develop, and established ideas about music are questioned in the confrontation with non-European musical cultures. Related to this is the interest shown by many Western composers in “foreign” scales and harmonies as well as in their own folk music, which is often seen as “domestically exotic”. Even the surmounting of functional tonal harmony striven for in the Second Viennese School requires a change in perception, as expressed in Schoenberg’s phrase, “The Emancipation of Dissonance”. Here, changes in the perception of music during this period are examined.
372
Abstracts
3. Modernism/Postmodernism The diverse connections between modernism and postmodernism which are indicated in the thesis “The Birth of Postmodern Philosophy out of the Spirit of Modern Art” (“Geburt der postmodernen Philosophie aus dem Geist der modernen Kunst”) as developed by Lyotard, Welsch and others, is discussed with particular emphasis on Viennese Modernism. The idea of a dichotomy is considered, in which Modernism and Postmodernism are not to be understood in the sense of historical “periodising”, but as parts of a dialectic in which their differing configurations not only in the later, but also in the early 20th century may be detected.
Georg Beck, Guido Adler and Modern Music Guido Adler’s musical thinking is the object of this study which considers his eyewitness descriptions and assessments of (Viennese) Modernism. Here it becomes clear that Adler goes further in his music history than in music theory, demonstrating an ambivalent relationship between historic and systematic thinking. A developed descriptive process concedes Modernism a rightful place in music history. The openness to Modernism, demonstrated principally by Adler the music historian, appears to be an example of scientific non-conformity in comparison to the position of Philipp Spitta. In the first and second editions of Adler’s Handbuch der Musikgeschichte a whole chapter is dedicated to modernism, which is however absent from the 1970s paperback reprint, giving the impression that Adler the music historian was further removed from his own times than was really the case. At the same time, the relationship of Adler the music theorist to the Modern is characterised by structural problems. In particular, Adler‘s style theory presented in Der Stil in der Musik (Leipzig, 1911, 2nd edition 1929) and in Methode der Musikgeschichte (1919) hinders an adequate perception of the Modern, as recognisable particularly from the perspective of Schoenberg as a critic of style. As an advocate of Musicology oriented towards the standards of scientific research, Adler creates a style concept which is historically rooted in the 18th- and 19th-century traditions of artistic and scientific classification and periodization. He refers to a scientific logic which, in its inherent urge to classify and hierarchize, actually destroys the specific character of the aesthetic subject in the very attempt to do it justice.
Abstracts
373
Philip V. Bohlman, Return to the Future. The Ancient Modernism of Jewish Music The period of modernism in European music witnessed a radical transformation in Jewish music, symbolized by the appropriation of authenticity and antiquity to break free from tradition and pave new roads into the future. In this essay I take the impact of cultural Zionism and its founder, Theodor Herzl, on the formation of a utopian political vision that would bring the European Diaspora to an end. Herzl, the century of whose death was celebrated during the course of this symposium, appropriated an aesthetic vocabulary, often including music, from ancient Israel and juxtaposed it with the modern witness to Jewish otherness. At the beginning of the twentieth century, Herzl and Zionism constituted but one set of symbols for Jewish modernism, but they played a significant role in influencing what I call the “radical moment of Jewish modernism.” Significantly, that moment was felt in all areas of European Jewish music-making in the decades leading up to the Holocaust. The essay traces the musical transformation that characterized Jewish modernism by identifying several crucial areas in which modernism was particularly striking. First, the influence of technologies – new forms of printing and sound recording – on the representation music is examined. The transformation of music as myth, hence as anchored in the past, into history provides a means of examining the secularization of sacred music. The dialectic of ancient/modern is juxtaposed with a related dialectic, that of East/West, particularly as a means of understanding the modernization of Jewish folk music. Morris Rosenfeld’s 1902 Lieder des Ghetto serves as a case study for examining the social and political metaphors that engendered a poetics of Jewish modernism. The essay closes by returning to a theater sketch by Theodor Herzl, In the Dining Car, in which the metaphor of a journey through modernism might culminate in the musical representation of Jewish placelessness in Arnold Schoenberg’s A Survivor from Warsaw, whose modernism emerges from the twelve-tone realization of one of the most ancient of all Jewish melodies, Shema Yisrael.
374
Abstracts
Barbara Boisits, Monuments, Memory and Cultural Identity: The Viennese Beethoven Festival in 1870 Since the 19th century, Beethoven’s Ninth Symphony has remained one of the most outstanding musical „memorial places“, connected with ideas of greatness, monumentalism, respect for humanity, universal ideals and so on. These allusions, that have accompanied the reception of this work almost since its premiere, were for instance responsible for the choice of the theme of the Finale as the hymn of the European Union. In 1870, Beethoven Centenary celebrations were held all over Europe and the USA. With these festivals the bourgeoisie not only commemorated the birth of one of its heroes. Rather, they were also meant to demonstrate bourgeois capabilities in artistic and humanitarian respects. The war between France and Germany in 1870/71 cast a shadow over many of these celebrations and furthered an already existent nationalistic interpretation of Beethoven’s œuvre as can be seen in Wagner’s treatise on Beethoven from the same year. The Viennese celebration of 1870 was planned as a glorious international demonstration of bourgeois self-representation. Famous artists (Richard Wagner, Franz Liszt, Clara Schumann, Joseph Joachim, Franz Lachner) were invited, but withdrew their participation – mostly for personal, aesthetic and political reasons. The remaining local artists were able to produce only a second-rate festival, which – despite its deficiencies – was however made out to be an outstanding event in the press and propaganda.
Regina Busch, The same always different – On variation, reprises and similar musical phenomena In her article, Regina Busch reflects on the relevancy of musical categories such as variation and similar musical phenomena for postmodern and modern composition. Using Marcel Duchamps idea of the “object trouvé” and his differentiation between “already found” (Vorgefundenem) und “already made” (Vorgefertigtem), Busch describes musical structures in terms such as “shading” and links them to categories/questions of identity, individuality or randomness. Even though these aspects are of particular importance for compositions in the second half of the 20th century, they can already be found in the compositorial thinking from the beginning of the century. Busch illustrates her argumentation with a thorough analysis of John Cage’s Thirty Pieces for Five Orchestras (1981) and Anton Webern’s Variationen für Klavier op. 27 (1936).
Abstracts
375
Martin Eybl, Listening and Memory in Schoenberg‘s Aesthetics The function of memory in the act of perception, a rare topic in Schoenberg’s writings, can be reconstructed from his concepts of formal unity. Here, memory plays an ambivalent role. There are two types of memory. While cumulative memory works passively in the background of our consciousness, recollective memory actively connects the present with the past and – by evoking expectations – with the future. Since the 18th century instrumental music was adapted to this kind of perception. Themes and motives were shaped to be easily remembered and standard forms were developed in order to aid recollective memory. Schoenberg proclaimed the unity of musical space in the 1920s. The idea contradicted the traditional view of form by ignoring the linear progression of time. According to this concept, the unifying connections within a composition lack any direction; there would be no up and down – chords can be treated like melodic lines – and no back and forth: retrograde and prime forms would be identical. These kind of connections can be recognized by reading the music without using memory. An essential part of the 12-tone order consists of these subthematic connections that are not accessible to acoustical perception. Nevertheless, 12-tone composition restored traditional forms Schoenberg had abandoned in his 2nd period. Again, these forms address recollective memory. So, two levels of order are combined: the order of musical space that omits time, thus leaving memory inappropriate, and the order of form and formal correspondences. It is questionable, however, whether the recollective memory regained its old position in Schoenberg’s 3rd period. Compared to Beethoven, Schoenberg’s form does not exist independently; it depends on the subthematic network that lies beneath acoustical perceptibility.
Eva Maria Hois, The First World War and the „Musikhistorische Zentrale beim k. u. k. Kriegsministerium“ (Central Music-Historical Office at the Imperial War Ministry) Many efforts were made to give the Austro-Hungarian Monarchy, comprising of eleven nationalities, a supranational identity. These endeavours were greatly increased during the First World War. Its onset unleashed a storm of enthusiasm and an outpouring of ferventf Austrian patriotism. This was also evident in the field of culture.
376
Abstracts
At this time, the war was not only seen as a destructive force; it also accentuated a new sense of right and wrong and was regarded as a purifying force. One of the few positive aspects to come out of the war was an increase in the utilisation and popularity of singing. The war was not only interpreted as a fight with an external enemy but also as a struggle for the idea of a supranational and multicultural monarchy. Within this context, the Musikhistorische Zentrale beim k. u. k. Kriegsministerium (Music-historical Central Office at the Ministry of War) was founded in 1916. Its mission was to collect soldiers’ songs from all over the Monarchy, and to raise a monument to the soldiers and their heroic deeds. It was also their objective to instil and promote a sense of community and comradeship among the soldiers who were made up of many different nationalities from the monarchy. The Muskhistorische Zentrale was led by Bernhard Paumgartner. Important contributors were, for example, Konrad Mautner, Raimund Zoder, Felix Petyrek, Alois Hába and Wilhelm Grosz, as well as Zoltan Kodály and Béla Bartók who were responsible for the Hungarian part of the collection. Not only were songs collected, but also military music, pipe music and documents pertaining to the life of a soldier. Collectors were sent to gather material from libraries, into the hinterland with the reserve troops, and even to the front to interview the soldiers there. Finally, a large-scale questionnaire project was undertaken. A small part of the results of this large undertaking were presented at various concerts in 1918. Unfortunately it seems that most of the collected material went missing after the end of the war.
Christian Kaden, How New was „Neue Musik“? Aspects of a Modernisation Process This article argues that so-called New Music (the term was first coined around 1920, mainly in reference to the Schoenberg School) was not essentially a breakthrough resulting in a radically innovative style and completely new conditions for musical perception, but was rather the product of historical tendencies that had already been established already in the middle of the 19th century. The main characteristic of this music seems to be a permanent increase in the complexity of musical elements and structures, with a strong trend towards a maximum possible intensity of relationships between the elements. Maxima like these may
Abstracts
377
be understood ambivalently, either as expressions of order or of chaos. Musical developments that focus on such maximization are interpreted in general categories of social modernization processes. These are by no means alternatives to a growth-oriented society but are ideally paradigms, or even aesthetic affirmations, of it. Thus, New Music appears to be a climax of a gradual capitalist evolution in the West, and only seemingly its negation in a Hegelian sense.
Reinhard Kapp, Two Viennese Schools: Freud and Schoenberg This article, which is a section taken from a longer text, presents the results of a comparison between Freud’s Theory of the Unconscious and Schoenberg’s ideas on a “psychology of artistic creation”, which he presented scattered in various contexts, mainly during his so-called Expressionistic phase. Similarities and differences are discussed separately here. Reasons for differences are sought in the diverging interests of the protagonists as well as in their respective historic situations. Research methods differ for Freud and Schoenberg, as do the “products” of the unconscious, according to their position in the respective theories and their function in each system.
Ulrike Kienzle, The Composer Giuseppe Sinopoli and Viennese Modernism In the 1970’s, Giuseppe Sinopoli was regarded as an important representative of the young generation of Italian composers. He studied with Bruno Maderna and Franco Donatoni and initially composed serial music, though he later criticised the one-sided Webern reception of the Darmstadt school and turned away from serialism. His intensive studies of Mahler, Schönberg, Berg and Webern, as well as an extended period living in Vienna, inspired him to a partial compositional leaning towards the music of the turn of century, in the sense of a “vertiginous” appropriation and simultaneous alienation. Here, recollections of the musical language of Berg and Webern are combined with a micropolyphonic spread of orchestral voices. In his piano concerto composed in 1975, Sinopoli presents a “diversion from rationality, which is taken to its furthest boundaries, ie. to a very private and
378
Abstracts
dangerous irrationality”. In his opera, Lou Salomé (1981), in which the crisis of the modern is already contained in the subject matter, the affinity to the atmosphere of Vienna at the turn of the century is intensified to the point of “mental paraphrase” and “tonal deception”. A Viennese waltz, sounding like a music box, and a ghostly contorted pub melody reveal the precipitous character of turn-of-the-century Vienna and demonstrate simultaneously the onset of impulses from the unconscious. For Sinopoli, Lou Salomé was a form of spiritual archaeology, an excavation toward the roots of Modernism. After this work, Sinopoli gave up composing and shifted his attention to the study of ancient cultures.
Kordula Knaus, The Mediaisation of a Mythical Figure. Lulu‘s Image in Berg‘s Opera Comparing Frank Wedekind’s dramas Erdgeist and Die Büchse der Pandora with the opera Lulu Alban Berg produced from these pieces, one discovers that a significant change between the dramas and the opera, is the way in which the picture of Lulu is exposed throughout the piece. Whereas in Wedekind’s dramas the two levels of Lulu as a painted picture and Lulu as an image created by the other protagonists are separated, in Berg’s opera these two levels are combined. The stage directions already indicate Berg’s different usage of the picture: the five stage directions, in which the picture is mentioned in Wedekind’s plays, are expanded by Berg to thirty-three. In addition, Berg also employs a musical means for evoking Lulu’s picture – the so called picture chords. The extent to which Lulu depends on her picture and is identified with it by the other protagonists, is shown in selected examples of musical analysis. Consequently, the picture in Berg’s opera is not solely a medium between Lulu and her image, but rather Lulu is herself picturesque. This fact seems to be a result of both the development of visual media in the 1920’s and the beginning of psychoanalytical discourse. Both aspects demonstrate that the opera Lulu is not solely a ‘modern’ work because it uses the twelve-tone-method, but also because it interacts with the cultural pattern of the ‘modern’.
Abstracts
379
Susanne Kogler, “Réécrire la modernité”? The Transformation of the Work-Concept in Current Music Production In the course of the twentieth century, radical claims of the avant-garde for a close convergence of art and life profoundly questionedthe traditional conception of the artwork, rooted in the nineteenth-century aesthetics of artistic autonomy. Since the 1970s however, traditional formal concepts have been increasingly gaining attention once again and have left their traces in many contemporary works. We have to consider this growing interest in traditional artistic conceptions as one of the main factors that provoked the debate on post-modernism in music. In order to illuminate the conception of the artwork in contemporary composition, this paper follows Jean François Lyotard’s definition of post-modernism as “réécrire la modernité” by comparing contemporary pieces with works by the Second Viennese School. Taking Wolfgang Rihm’s Hölderlin-Fragmente as an example, current characteristics of the work of art (not peculiar to Rihm) such as fragmentation, individualization and cyclic formationare interpreted as a sign of post-modern aesthetics in favour of fragmentary forms. The analysis of Rihm’s song cycle, written in 1977, also demonstrates that the present recurrence of tradition does not only include artistic developments of the early twentieth century, but goes back to the roots of modernism, to early romanticism in the first half of the nineteenth century. As contemporary composition establishes relations to earlier artistic trends that, even in their own time, exposed a critical view of the “mainstream” of modernism, it takes part in the discovery of a different type of modernism within modernism itself. By doing so, it aims at establishing a different type of post-modernism in the sense of Jean-François Lyotard. This “other post-modernism” commits itself to occurrence, to silence and to the unrepresentable. It contains fragmented memories of a forgotten past as well as perspectives for the future, resulting from a novel attitude towards the other, the artistic material. This novel attitude corresponds with a purpose that Theodor W. Adorno had already exposed in his Aesthetic Theory: to draw attention to indissoluble contradictions between material and mind in order to sensitize human beings to their own bonds with nature and to the borders of human autonomy.
380
Abstracts
Albrecht Riethmüller, German‘s Faith in Musical Superiority Germans’ belief in their musical superiority began to unfold its full potential in the first half of the nineteenth century. Merging with the heady nationalism that continued to intensify following the unsuccessful revolution of 1848, the conviction coincided with Germany’s ambitions for a seat at the table of the big global powers throughout the years of the Reich’s unification and the subsequent founding of the Second Reich in 1871, gained further traction from the patriotic outburst at the onset of World War I, and reached its peak during the Third Reich, when ‘Germanness’ was regarded as the highest possible human and/or cultural value. Neither the nation’s unconditional defeat in 1945 nor the moral bankruptcy of the Holocaust succeeded in the mindset’s collapse. In the second half of the twentieth century its influence began to wane, yet manifestations continue to be observed. Since the creation of their present (second) Republic, the Austrians began to embrace this tenet by distinguishing between an Austrian and a German musical identity after their music had been labelled ‘German’ for over a century. The article examines various facets of the Germans’ belief in their musical superiority at key historical junctures and the discourse strategies that were employed – whether consciously or unconsciously – to maintain music’s uncompromised position, discourses that vacillated between pride and prejudice and were buttressed by a faith in cultural and artistic supremacy nourished by xenophobia and chauvinism.
Dominik Schweiger, The Viennese School and Postmodernism A meaningful concept of the post-modern in music, beyond its commonplace utilization for justifying anti-modern tendencies, can only be gained by transferring central features of post-modern thinking from philosophy to musicology and composition. Musicological post-modern thinking in that sense can be understood as a positive attitude towards instability and complexity and, conversely, as distrust in ‘modernist’ strategies of their reduction as, for example, historiographical ‘master narratives’, the concept of the composer as an ‘author’ and of music as a ‘work of art’, or the logocentric conception of the ‘structurality’ of (at least Western art) music. Compositional materializations of post-modern thinking have to be imagined paradoxically as some sort of ‘weak’ composing. In general, musicological research on the music of the Viennese School can be interpreted as an operation to reduce its evident complexity and instability by
Abstracts
381
means of the modernist strategies mentioned above. Philosophical and/or compositional aesthetic discourses also usually regard this music as an example of modernist ‘strong’ composing. However, a shift of perspective could make visible the traces of post-modern ‘weak’ composing in this music, or, conversely, the traces of its complexity and instability in ‘real’ post-modern music and, beyond that, in post-modern thinking as a whole: In fact, there are musical texts by Schoenberg and Webern which seriously challenge the ideas of technical development and of structurality – probably in opposition to the intentions of their ‘authors’.
Nikolaus Urbanek, Reflections on the Possibilities of Music Aesthetics Today It cannot be taken for granted today that the possibility of the language-game called the aesthetics of music exists anymore after a period of de(con)structing most of its central categories – such as the Abkehr vom Materialdenken, the moving de l’œuvre au texte, the mort de l’auteur and the Tod der Vernunft, or simply the oftencited Umwertung aller Werte. Based on a critical analysis of Theodor W. Adorno’s concept of musical material as one of the aesthetic values of modernity par excellence, I discuss some aspects of Peter Bürger’s fundamental Adorno-critique. As Bürger points out, the paradigms of purism and progress in particular, which are inherent to the category of the tendency of musical material, have become questionable. It can thus be seen, that the modernistic concept of an aesthetic of the arts reaches its impassable theoretical border. For this reason I try to confront it with some of the most prominent features of post-modern thinking, represented here by Jean-François Lyotard’s Differend and the theory of Rhizom by Gilles Deleuze und Félix Guattari. This paper explores the possible relevance of their argumentative strength for a theory of musical aesthetics as well as for an adequate approach to the work of art. The question, whether or not this claim of an adequate aesthetic reflection of works of art might itself be a genuine category of modern thinking and whether it might therefore be an obsolete one after the Verwindung der Moderne, is the crucial point of my considerations.
382
Abstracts
Elfriede Wiltschnigg, “Threat” and “salvation” of the Male Ego. The Pictorial Conversion and Interpretation of Beethoven’s Ninth Symphony by Gustav Klimt in his Beethovenfries Generally speaking, music was indispensable as a subject for the fine arts around 1900. Music as allegory, as well as the figures of composer, musician or dancer, appear as favourite motifs. A ‘pictorial expression’ of music is, however, far more difficult if the artist tries to convert a particular piece of music into something visual. With his interpretation of the final movement of Beethoven’s Ninth Symphony titled Beethovenfries, Gustav Klimt tried to unite language, painting and sound. The work shows the path of humanity paved with dolour, false allures and hostile forces. Only persevering through art provides peace and good fortune. Some of its elements can clearly be traced back both to Schiller’s ode, An die Freude, itself permeated by the ideals of the French Revolution, and to Wagner’s interpretation of the Ninth Symphony. The pictorial program of the Beethovenfries does, however, deprive itself of any concrete interpretation. Art-scientific analyses refer to “reine Freude” (pure pleasure) which mankind can only experience through art, and to human salvation by means of the female, symbolised in the kiss (Diesen Kuß der ganzen Welt), i.e., in the unification of the sexes. I think that Klimt’s Beethovenfries is – as a characteristic of Viennese Modernity – more concerned with the individual than with mankind as such. The well-armed strong man, and thereby a focus on Ernst Mach’s “unsaveable I”, can certainly be seen as central subjects both for questioning human existence as well as for Klimt’s Beethovenfries.
DOMINIK SCHWEIGER, NIKOL AUS URBANEK (HG.)
WEBERN_21 WIENER VERÖFFENTLICHUNGEN ZUR MUSIKGESCHICHTE BAND 8
Die Vielfalt der aktuellen Perspektiven auf das Werk Anton Weberns und seine nachhaltige Wirkung aufzuzeigen, ist das vorrangige Ziel des Sammelbandes. Er skizziert einen panoramaartigen Überblick über die gegenwärtige WebernForschung und dokumentiert so deren Standpunkte. Studien zu einzelnen Kompositionen, zu den Bezugnahmen Weberns auf ältere Musik sowie zu Theorie und Methoden der Webern-Analyse stehen Aufsätzen zu Webern als Leser und Verfasser von literarischen Texten sowie der kompositorischen und theoretischen Webern-Rezeption gegenüber. Der Band enthält eine umfangreiche Bibliographie und die deutsche Erstveröffentlichung von Weberns Schauspiel Tot. 2009. 392 S. GB. 40 NOTENBSP. 11–S/W ABB. 170 x 240 MM. ISBN 978-3-205-77165-4
böhlau verlag, wiesingerstrasse 1, 1010 wien. t : + 43(0)1 330 24 27-0 [email protected], www.boehlau.at | wien köln weimar
MARKUS GR ASSL , REINHARD K APP UND EIKE R ATHGEBER (HG.)
ÖSTERREICHS NEUE MUSIK NACH 1945: K ARL SCHISKE BAND 7
Mit dieser umfassenden Monographie wird einer der bedeutendsten österreichischen Komponisten der Mitte des 20. Jahrhunderts gewürdigt und damit auch ein Beitrag zu einer bisher nur in Ansätzen vorliegenden österreichischen Musikgeschichte der Nachkriegszeit geleistet. In der durchaus repräsentativen Entwicklung Karl Schiskes spiegeln sich die kompositionsgeschichtlichen Tendenzen des Jahrhunderts zwischen der Schreker-Schule und der internationalen Avantgarde der 1960er Jahre. Unter den Kompositionslehrern der Wiener Musikakademie der Vertreter des Fortschritts und eines analytischen und diskursiven Vorgehens im Unterricht, hat Schiske – lernend mit seinen Studenten, eine bedeutende Schule begründet. So gingen alle wichtigeren österreichischen Komponisten der Folgegeneration entweder durch seine Klasse oder standen mit ihm in Verbindung. Der Band enthält Aufsätze, die Schiskes Wirken von vielen Seiten beleuchten, und einen umfangreichen Anhang mit den bisher zum größeren Teil unveröffentlichten Schriften Schiskes sowie einem ausführlichen Quellenund Werkverzeichnis. 2008. 609 S. GB.-PAPPBD. 50 NOTENBEISPIELE 170 X 240 MM. ISBN 978-3-205-99491-6
böhlau verlag, wiesingerstrasse 1, 1010 wien. t : + 43(0)1 330 24 27-0 [email protected], www.boehlau.at | wien köln weimar






![Oscar Niemeyer: Eine Legende der Moderne / A Legend of Modernism [2., aktualisierte Aufl.]
9783038210825, 9783038214489](https://dokumen.pub/img/200x200/oscar-niemeyer-eine-legende-der-moderne-a-legend-of-modernism-2-aktualisierte-aufl-9783038210825-9783038214489.jpg)

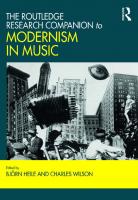
![Böse Macht Musik: Zur Ästhetik des Bösen in der Musik [1. Aufl.]
9783839413586](https://dokumen.pub/img/200x200/bse-macht-musik-zur-sthetik-des-bsen-in-der-musik-1-aufl-9783839413586.jpg)
