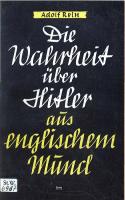Literarische Publizistik Adolf Glaßbrenners (1810–1876): Die List beim Schreiben der Wahrheit 9783111332758, 9783598212819
140 48 18MB
German Pages 399 [400] Year 1980
Polecaj historie
Table of contents :
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
A. Einleitung — Literaturlage, Gegenstand und Methode der Untersuchung
B. Struktur öffentlicher Kommunikation und ihre Veränderung im 18. Jahrhundert bis zum Vormärz — Öffentlichkeit und Publikum
C. Struktur der Medien öffentlicher Kommunikation und ihre Veränderung am Beispiel der Publikationen Adolf Glaßbrenners
D. Die Kommunikationsstrategie in Glaßbrenners periodischen Publikationen — Dichtung und Publizistik als politisches Kampfmittel
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Bildanhang
Register
Citation preview
Dortmunder Beiträge zur Zeitungsforschung Band 31 Herausgegeben von Hans Bohrmann, Institut für Zeitungsforschung der Stadt Dortmund
Ingrid Heinrich-Jost
Literarische Publizistik Adolf Glaßbrenners (1810-1876) Die List beim Schreiben der Wahrheit
K G Saur München New York-London Paris 1980
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek Heinrich-Jost, Ingrid: Literarische Publizistik Adolf Glassbrenners (1810—1876) [achtzehnhundertzehn bis achtzehnhundertsechsundsiebzig] die List beim Schreiben der Wahrheit / Ingrid HeinrichJost. — München, New Y o r k , London, Paris : Saur, 1980. (Dortmunder Beiträge zur Zeitungsforschung ; Bd.31) I S B N 3-598-21281 - X © 1980 by K. G. Saur Verlag K G , München Satz: münchrter fotoprint gmbh, München Druck/Binden: Hain-Druck K G , Meisenheim/Glan Printed in the Federal Republic of Germany I S B N 3-598-21281 - X
Vorwort
Die Märzrevolution 1848 ist in den deutschen Staaten zweifellos ein unvollendeter bürgerlicher Umsturzversuch, der sich weder mit der englischen noch der amerikanischen oder der französischen Revolution vergleichen läßt Nach Barrikadenkampf und raschem Rückzug des Militärs schienen die Fürsten, allen voran der preußische König zurückzuweichen. Mit viel Druckerschwärze wurde die Atempause der alten Kräfte genutzt, doch der Überschwang der Publizistik konnte nicht vergessen machen, daß die Stützen der realen Macht das Militär, der Adel, die Geistlichkeit nach wie vor zusammenstanden und zunehmend mit jener bürgerlichen Parteiung zusammenwirkten, die ein Fortschreiten des Aufruhrs in radikal-demokratisches Fahrwasser verhindern wollten. Weil sich Konstitutionalismus und Demokratie nicht zusammenfanden, konnte der Spätabsolutismus sich noch einmal in der Macht einrichten. Dennoch soll die Bedeutung der Märzrevolution nicht verkleinert werden. Sie war ein erstes unüberhörbares Zeugnis des Freiheitswillens in den deutschen Staaten. Sie hat zum erstenmal Pressefreiheit gebracht und in einer Fülle von Periodika, Flugblättern, Broschüren und Büchern ungeschminkt politische Kritik, neue westeuropäische Gedanken in der öffentlichen Meinung verbreitet. Diese Publizistik war freilich überwiegend großdeutsch gezielt und arbeitet einem Einheitsstaat ideologisch vor, den Bismarck nach dem siegreichen deutsch-französischen Krieg 1871 als kleindeutsche Lösung präsentierte. In ihrer Darstellung des Schriftstellers, Journalisten, politischen Leitartiklers und Humoristen Adolf Glaßbrenner geht Ingrid Heinrich-Jost den vielfältigen Motiven, Ursachen und Folgen politischer Literatur im Deutschland des 19. Jahrhunderts am konkreten Beispiel nach. Sie untersucht die Entstehung von Glaßbrenners politischen Ansichten im Kontrast und Konsens zum jungen Deutschland und im Vormärz. Sie beschreibt seine publizistischen Mittel, zu denen vor allem der Einsatz des Berliner Dialekts in der Schriftsprache gehört und geht auf die Konflikte mit der Zensur ein, die schließlich zu Glaßbrenners Exil in Neustrelitz (Mecklenburg) führten. Erst mit der Märzrevolution 1848 kann er wieder in seine Heimatstadt Berlin kommen und für die Revolution kräftig Publizität schaffen. Aber sein Mut und seine Tatkraft scheinen eigentümlich gebrochen durch die unverrückbare Einsicht, daß die traditionellen Mächte nur zurückgedrängt, nicht aber besiegt worden sind. Er mahnt zur Einsicht der Demokraten, ohne wohl recht eigentlich daran zu glauben. Glaßbrenners Dialoge, seine Prosa, seine knappen witzigen Gedichte legen dafür Zeugnis ab. In der Restaurationszeit mußte er sich erneut anpassen. Dabei kommen ihm die vormärzlichen Erfahrungen der humoristischen Camouflage zugute. Wer nach Erfolg oder Wirkung A d o l f Glaßbrenners fragt, wird in diesem, wie in manchem anderen deutschen Fall feststellen, daß die Bilanz doppeldeutig ist.
5
Glaßbrenners Unternehmungen, zumal seine Volkskalender und seine Zeitungen der letzten Lebensjahre, stellten ihn materiell gut, seine politische Wirkung, der Erfolg seiner Publizistik war aber beunruhigend gering. Schlimmer noch: Auch heute noch ist Glaßbrenners politischer Ansatz weitgehend unbekannt. Er gilt als Spaßmacher und Pointenjäger. Es war der Vorsatz von Ingrid Heinrich-Jost, diesem Vorurteil durch solide biographische Recherche und intensive Werkinterpretation zu begegnen. Diese Absicht traf sich mit den Bemühungen des Instituts für Zeitungsforschung um die Publizistik der Märzrevolution, die in einer umfangreichen Sammlung von Flugblättern, Zeitungen und Zeitschriften, und der Ausrichtung von Ausstellungen und Publikationen in dieser Schriftenreihe ihren Niederschlag fand. Das Beispiel Glaßbrenner zeigt erneut, daß die demokratische Publizistik im 19. Jahrhundert noch immer in wichtigen Teilen der Entdeckung harrt. Die lange Vorgeschichte, der lange Kampf um die deutsche Demokratie, sind noch immer nicht gründlich aufgearbeitet und deshalb auch nicht in wünschenswerter Weise geschichtsmächtig. Das Institut für Zeitungsforschung wird seine Bemühung um die Dokumentation und Interpretation der demokratischen Publizistik zur Märzrevolution fortsetzen. Hans Bohrmann
6
Inhaltsverzeichnis
A. Einleitung — Literaturlage, Gegenstand und Methode der Untersuchung
11
B. Struktur öffentlicher Kommunikation und ihre Veränderung im 18. Jahrhundert bis zum Vormärz — Öffentlichkeit und Publikum . . . .
17
Die politischen Forderungen des sich etablierenden Bürgertums an der Wende zum 19. Jahrhundert
21
C. Struktur der Medien öffentlicher Kommunikation und ihre Veränderung am Beispiel der Publikationen Adolf Glaßbrenners I.
Zeitschriften und Zeitungen
25
1.
Unterhaltungsblätter im Berlin der dreißiger Jahre
25
a. Glaßbrenners erste publizistische Beiträge a.a. Moritz Gottlieb Saphirs „Berliner Courier" a.b. Eduard Maria öttingers „Der Berliner Eulenspiegel"
25 25 28
b.
2.
Adolf Glaßbrenners „Berliner Don Quixote. Unterhaltungsblatt für gebildete Leser" b.a. Politik unter dem Deckmantel der Unterhaltung b.b. .Heerschau der Journale'
33 37 40
c.
42
Zensurverhältnisse
Die Zeitschriften zur Zeit des Jungen Deutschland — Das Ende des Kunstzeitalters
43
a.
43
Probleme einer Definition des Mediums Zeitschrift
b.
Die jungdeutsche Bewegung, ihre ideologischen Hintergründe und ihre Kommunikationsziele b.a. Die Zeitschriften der Jungdeutschen
45 48
c.
51
Constitutione!^' und .Volksblätter'
d. Adolf Glaßbrenner im Kontext des Jungen Deutschland d.a. Adolf Glaßbrenners „Das Brennglas. Eine humoristische Zeitschrift" d.b. Beginn der Synthese von Witz, Humor und politischer Botschaft
53 55 57 7
e. e.a. e.b. e.c. e.d. e.e.
3.
Produktions- und Distributionsverhältnisse der Zeitschriftsteller Die Gesetze des Marktes Zensur und Konkurrenz Das Lesepublikum Die Bedeutung des Verbots von 1835fürdie Publizistik der Zeit Glaßbrenners Zeitschriftenarbeit nach dem Verbot des Jungen Deutschland
66 68 69 71 73
f.
„Die Posaune" in Hannover
76
g.
„Der Freimüthige" in Berlin
79
Die Zeitschriften des deutschen Vormärz — Politisierung von Dichtung und Publizistik
80
a.
Ideologische und politische Hintergründe
80
b.
Adolf Glaßbrenner im Exil
83
b.a. ,Der Staat des Theaters'
86
c.
91
Politische Lyrik
d. Friedrich Wilhelm Alexander Heids „Volksvertreter" d.a. .Lebendiger Journalismus' e. 4.
74
Die Anfänge des politischen Witzblattes
93 98 103
Periodika des Revolutionsjahres 1848 in Berlin
104
a.
104
Der Ausbruch der Märzrevolution
b. Neue Publikationsorgane als Ausdruck neuer Freiheit b.a. Das politische Witzblatt als wichtigstes periodisches Publikationsmittel
109 110
c.
5.
Adolf Glaßbrenners „Freie Blätter. Illustrirte politischhumoristische Zeitung" c.a. .Einheit und Freiheit' c.b. Anzeichen der Reaktion c.c. Berlin im Zeichen der Bajonette
114 115 118 124
Zeitschriften und Zeitungen im Nachmärz bis zur Reichsgründung .
129
a. a.a. a.b. a.c. a.d. 8
Produktion und Distribution unter erneuten staatlichen Zwängen Erneutes Exil „Jahreszeiten. Hamburger Neue Mode-Zeitung" „Der Freischütz" in Hamburg „Asmodi" in Hamburg
129 132 133 135 141
b.
Adolf Glaßbrenners „Ernst Heiter. Deutsche Sonntagszeitung"
144
Adolf Glaßbrenners „Phosphor. Humoristische illustrirte Original-Wochenschrift"
153
d.
Die Entwicklung der sogenannten Massenpresse
159
e. e.a e.b e.c.
Adolf Glaßbrenners „Berliner Montags-Zeitung" Adolf Glaßbrenner als Verleger .Krieg gegen den Krieg' Adolf Glaßbrenner bleibt Vormärzler
161 166 167 172
c.
6.
Exkurs: Adolf Glaßbrenners Verhältnis zu den Juden
II.
Broschüren als periodische Publikationsmittel
1.
Definition und Erscheinungsbild
175
2.
Volkskalender
178
a.
Die Tradition des Kalenders
178
b.
Adolf Glaßbrenners „Komischer Volkskalender" und „Lustiger Volkskalender" — Vom Vormärz bis zur Bismarckzeit" Tradition des Mediums und aktuelle Inhalte bestimmen die Form Der „Komische Volkskalender" als ideologischer Wegbereiter gesellschaftlicher Veränderung Die unteren Bevölkerungsschichten als Zentralfiguren im „Komischen Volkskalender" Die Revolution des Jahres 1848 im „Komischen Volkskalender für 1849" Der „Komische Volkskalender" in den Jahren nach der Revolution .Brüder, es sind trübe Tage' Die Kalender der Jahre 1858 bis 1867 Die agitatorische Kraft des „Komischen Volkskalenders" läßt nach
b.a. b.b. b.c. b.d. b.e. b.f. b.g. b.h.
3.
174
181 183 187 190 194 198 200 204 206
Groschenhefte
212
a. a.a. a.b. a.c.
212 212 221
„Berlin, wie es ist und — t r i n k t " Die Groschenhefte und ihre Leser Berliner Charaktere Lebens- und Arbeitsverhältnisse in den unteren Bevölkerungsschichten a.d. Der Guckkästner als Kommentator seiner Zeit
225 228 9
4. 5.
a.e. Jahrmärkte u n d Feste als Kommunikationsformen a.f. Rentier Buffey, der aufgeklärte Kleinbürger a.g. Theater als Kommunikationsforum
234 236 243
Exkurs: Das Frauenbild in Glaßbrenners periodischen Publikationen
250
Die zentrale Bedeutung der Periodika im Gesamtwerk Glaßbrenners
253
D. Die Kommunikationsstrategie in Glaßbrenners periodischen Publikationen — Dichtung und Publizistik als politisches Kampfmittel I.
Ideologische Hintergründe
261
1. 2.
Politische Forderungen des Bürgertums Das Volk als zentrales Element gesellschaftlicher Veränderung
3.
Die Stellung des Schriftstellers in der Gesellschaft
265
II.
Inhaltliche und formale Elemente zur Einflußnahme in den periodischen Publikationen Glaßbrenners
274
1.
Satire
274
2.
Dialekt
283
...
261 263
3.
Karikatur
286
4.
Wiederkehrende Strukturelemente in Glaßbrenners Periodika . . . .
290
III. Adolf Glaßbrenners periodische Publikationen als Medien der politischen Avantgarde
297
Anmerkungen
302
Literaturverzeichnis
354
Bildanhang
367
Register — Namensregister — Register der Zeitschriften und Zeitungen
389 397
10
A.
Einleitung — Literaturlage, Gegenstand und Methode der Untersuchung
Es ist List nötig, damit die Wahrheit verbreitet wird. Bertolt Brecht Bertolt Brecht schrieb 1935 angesichts des Faschismus, daß ein Schriftsteller fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit zu überwinden habe: „Er muß den Mut haben, die Wahrheit zu schreiben, obwohl sie allenthalben unterdrückt wird; die Klugheit, sie zu erkennen, obwohl sie allenthalben verhüllt wird; die Kunst, sie handhabbar zu machen als eine Waffe; das Urteil, jene auszuwählen, in deren Händen sie wirksam wird; die List, sie unter diesen zu verbreiten."(1) Im 19. Jahrhundert, dem Zeitalter des Spätfeudalismus und des sich entwickelnden Kapitalismus in Deutschland, war die Opposition latenter als in der unmittelbar aktuellen Bedrohung durch den Faschismus. Aber auch in der Zeit der bürgerlichen Emanzipationsbestrebungen ging die Wahrheit im Sinne Brechts selten konform mit der Meinung der Herrschenden. Wie in allen Perioden staatlichen Drucks hatten nichtangepaßte Schriftsteller und Publizisten vor der Revolution von 1848 und nach deren Scheitern gegen Zensur, Verbot und persönliche Verfolgung zu kämpfen; sie mußten sich über ihre Funktion innerhalb der Übergangsgesellschaft zwischen spätfeudalem Absolutismus und bürgerlicher Demokratie klarwerden — ob sie auf der Seite des fortschrittlichen Bürgertums für dessen politische und gesellschaftliche Emanzipation kämpfen wollten, oder ob sie bereits den immanenten Widerspruch zwischen der Progressivität einer bürgerlichen Revolution und der darin ruhenden Gefahr der Unterdrückung unterer Bevölkerungsschichten erkannten; sie mußten Publikationskanäle und -formen finden, die ihnen ermöglichten, die Zensur zu umgehen, das, gemessen an der Zahl der Gesamtbevölkerung, nicht sehr zahlreiche Lesepublikum und möglicherweise darüber hinaus neue Leserschichten zu erreichen. Adolf Glaßbrenners Situation als Beobachter und Teilnehmer an den bürgerlichen Einheits- und Freiheitsbestrebungen im zersplitterten und dem politischen System des vergangenen Jahrhunderts verhafteten Deutschland des 19. Jahrhunderts wird bereits durch seine Lebensdaten, 1810 bis 1876, symbolisiert. Er wurde kurz vor den Befreiungskriegen gegen die napoleonische Herrschaft in den süd- und westdeutschen Ländern geboren. Er begann in der Zeit der sich formierenden bürgerlich-demokratischen Opposition, zu deren intellektueller Avantgarde das Junge Deutschland zählte, zu publizieren. Die Mitte seines Lebens fiel mit dem Datum der Märzrevolution des Jahres 1848 zusammen. Er starb kurz nach der Gründung des Deutschen Reiches, die nicht seinen politischen Vorstellungen entsprochen hatte. Adolf Glaßbrenner bekannte sich seit Beginn sei11
ner publizistischen Laufbahn zur Opposition gegen die herrschenden Mächte. Damit war er auf List angewiesen, wenn er die nicht systemkonforme Wahrheit publizieren wollte. Der Schriftsteller und Publizist Adolf Glaßbrenner wurde bisher in der publizistikwissenschaftlichen wie der literaturwissenschaftlichen Forschung kaum beachtet. Wie für eine ganze Reihe seiner politisch engagierten Kollegen gilt für ihn, was Peter Härtling angesichts des im 18. Jahrhundert mutig gegen Tyrannenwillkür anschreibenden Christian Friedrich Schubart bemerkt: „Die Deutschen haben es sich mit ihren dichtenden Widergängern stets schwergemacht."(2) Rudolf Rodenhauser schrieb 1912 die erste umfassendere Lebens- und Werkbeschreibung Glaßbrenners. Er vernachlässigt jedoch vollkommen dessen gesellschaftlichen Bezug und schildert Glaßbrenner als Humoristen, der sich selbst untreu werde, wenn er seinen Witz mit der „störenden Tendenz" vermische.(3) Diese Anschauung wird auch in verschiedenen kleineren Abhandlungen und Textsammlungen deutlich, die Glaßbrenner lediglich als witzigen Unterhalter präsentieren.(4) A u s dem gleichen Jahr wie Rodenhausers Buch stammt eine Auswahl von Glaßbrenners Texten mit dem Titel „Unterm Brennglas". Franz Diederich, der Herausgeber, betont in seinem Vorwort und in der Zusammensetzung der Anthologie Glaßbrenners Engagement während der Revolution von 1848 und stellt ihn in die Reihe der geistigen Vorläufer der Sozialdemokratie. Dabei wird der Humorist Glaßbrenner, den Rodenhauser allein gewürdigt wissen wollte, zu wenig beachtet. Dies ist auch der Fall in dem Vorwort des Herausgebers der Textsammlung „Unsterblicher Volkswitz", Klaus Gysi. Die Arbeit ist dennoch bemerkenswert, denn Gysi lieferte die erste marxistische Analyse von Glaßbrenners Werk als dem eines demokratischen Zeitschriftstellers und Volksdichters, wenn er auch Glaßbrenner kleinbürgerliches Reformverständnis vorwirft. (5) Die 1942 erschienene Dissertation von Waltraud Dübner trägt den Titel „Adolf Glaßbrenner als socialer Publizist", eine Firmierung, die nicht näher definiert wird. Die Erwartung einer Untersuchung der periodischen Publikationen Glaßbrenners, die der Titel weckt, wird nicht erfüllt. Dübner wiederholt lediglich bereits bekannte Fakten. Eine Reihe von Fehlern und Ungenauigkeiten in den Angaben über Glaßbrenners Zeitschriften und Zeitungen sind anhand der Quellen zu korrigieren. Dübner sieht Glaßbrenner in erster Linie als Versöhner aller Schichten, des Volkes als Ganzem. Eines der wichtigsten Ziele in Glaßbrenners Veröffentlichungen, die Entwicklung des Selbstbewußtseins der,Unmächtigen', wie es Joachim Schädlich nennt, negiert sie.(6) Willi Finger veröffentlichte 1952 das kleine Bändchen „Adolf Glaßbrenner. Ein Vorkämpfer der Demokratie", das einige wertvolle Hinweise auf Glaßbrenners Leben im Exil in Neustrelitz gibt. Da aber mit dem Begriff Demokratie die gegenwärtige Gesellschaftsform der D D R gemeint ist, wird Glaßbrenner allzu einseitig als Revolutionär herausgestellt.)?) 12
In dem Nachwort zu der Anthologie unter dem Titel „Der politisierende Eckensteher", die 1969 erschien, weist Jost Hermand darauf hin, daß Glaßbrenner nicht zu polarisieren ist in den politischen Schriftsteller und den Humoristen, sondern daß beides sich wechselseitig bedingt. Hermand macht aufmerksam auf den bisher verkannten politischen und literarischen Rang Glaßbrenners. Er schreibt, Glaßbrenner sei das, „was Tucholsky geworden wäre, wenn er im Biedermeier gelebt hätte".(8) Heinz Bulmahn untersucht in seiner 1974 in englischer Sprache verfaßte Dissertation „Adolf Glaßbrenner: His Development from a Y o u n g German to a Vormärz Writer" vor allem die zwischen 1840 und 1849 veröffentlichten Texte Glaßbrenners nach literaturwissenschaftlichen Gesichtspunkten.(9) Die letzte Veröffentlichung von Texten Glaßbrenners kam 1976 unter dem Titel „. .ne scheene Jejend is det hier" auf den Markt. Im Nachwort wiederholt der Herausgeber Kurt Böttcher im wesentlichen die Erkenntnisse des Vorworts zu der Anthologie „Unsterblicher Volkswitz", an der Böttcher mitgearbeitet hatte.(10) A u c h die Zusammenstellung der Texte bewegt sich in dem engen Rahmen der bisherigen Forschung. Dies ist besonders befremdlich, da der weitaus größte Teil von Glaßbrenners Nachlaß in der D D R archiviert ist und die Möglichkeit besteht, daß sich dort noch mehr Material befindet als mir für die vorliegende Arbeit zugänglich war.(11) In allen Untersuchungen und Anthologien werden die Inhalte von Glaßbrenners Groschenheften der Reihe „Berlin, wie es ist u n d — trinkt" berücksichtigt. Sie werden jedoch nicht näher untersucht, und die Frage nach dem Spezifikum dieses Publikationsmittels im Kontext der Medienentwicklung des 19. Jahrhunderts wird ausgeklammert. Die Erforschung der Groschenhefte überhaupt, ihre Produktion, Distribution und Rezeption, steht im Rahmen der Untersuchung von Trivialliteratur noch weitgehend am Anfang. Bisherige Analysen beziehen sich in erster Linie auf das Groschenheft unserer Zeit als Massenmedium. Die Vorläufer im 19. Jahrhundert werden höchstens am Rande erwähnt.(12) Der „Komische Volkskalender", den Glaßbrenner vom Vormärz bis in die sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts herausgab, blieb bisher ebenfalls unberücksichtigt. Die mangelnde Beachtung des „Komischen Volkskalenders", mit dem Glaßbrenner ein traditionsreiches Medium der Volksliteratur aufgriff und der in seiner Zeit hohe Auflagen hatte, gilt für das Medium Kalender schlechthin. Erst Ludwig Rohner legte 1977 eine umfassende Historie der Kalendergeschichte vor, bei der das Medium einbezogen wurde. Zuvor hatte es lediglich umfangreiche Literatur zum astronomischen Kalender oder zu der literarischen Gattung Kalendergeschichte gegeben, bei der die Frage des Kalenders, für den diese Geschichten geschrieben wurden, keine Rolle spielte.(13) Da Rohner die Entwicklung des Kalenders und der Kalendergeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart beschreibt, bleibt für die Kalender des 19. Jahrhunderts auch bei ihm nur wenig Raum, das Charakteristische des Volkskalenders wird in wenigen
13
Sätzen abgehandelt und Glaßbrenners „Komischer Volkskalender" in falsche Relation gesetzt.(14) Die Zeitschriften und Zeitungen, die Glaßbrenner gründete, werden in den wissenschaftlichen Überblicken über die Presse des 19. Jahrhunderts, die relativ zahlreich sind in bezug auf Zeitschriften- und Zeitungsforschung sowie die juristische und soziologische Bedeutung der Presse, in den meisten Fällen höchstens als Titel unter anderen erwähnt. Mit welch großer Zahl fremder Blätter seiner Zeit Glaßbrenner publizistisch verbunden war, ist bisher nicht behandelt worden. In der vorliegenden Arbeit sollen Glaßbrenners periodische Publikationen, denen neben Zeitschriften und Zeitungen die in seinem Werk breiten Raum einnehmenden Groschenhefte und Volkskalender zugerechnet werden, im Kontext des sich wandelnden Verhältnisses von Dichtung und Publizistik im 19. Jahrhundert untersucht werden. Dichtung und Publizistik werden meist als zwei unterschiedliche Formen medialer Kommunikation nebeneinandergestellt. Publizistik gilt als aktuell gebunden, Dichtung als zeitübergreifenden Idealen verpflichtet. In der Periode der gesellschaftlichen und politischen Etablierung des Bürgertums sind Dichtung und Publizistik Teil bürgerlicher Kultur und untrennbar mit deren Entwicklung verwoben. Sie sind nicht nur Widerspiegelung gesellschaftlicher Umschichtung, sondern wirken zeitweise als geistige Wegbereiter. In der Zeit der bürgerlichen Revolution von 1848 waren Dichtung und Publizistik — Subsysteme der Kommunikation — umfassende Medien gesellschaftlicher Verständigung und Solidarisierung im Hinblick auf politische Veränderung. Dichtung und Publizistik wurden in stärkerem Maße als je zuvor zu zielgerichtet eingesetzten Erscheinungsformen geschriebenen Wortes. U m zu untersuchen, wie weit sich diese Prämissen an den zeitgenössischen Publikationen, den Produktions- und Distributionsverhältnissen der Publizisten sowie der Struktur der wahrscheinlichen und potentiellen Leserschaft nachweisen lassen, soll vorab Struktur und Funktion von Öffentlichkeit und bürgerlichem Publikum als Rezipientenschaft und Dialogpartner erörtert werden. Daraus läßt sich messen, wie die Begriffe fortschrittlich und oppositionell, die mangels Parteiungen als Umschreibungen ideologischer Grundhaltungen im 19. Jahrhundert verwendet werden, in ihrem historischen und gesellschaftlichen Kontext zu verstehen sind. Da Glaßbrenners Werk eng gebunden ist an die historische Entwicklung der Emanzipation des Bürgertums im 19. Jahrhundert, muß die Analyse von Glaßbrenners Publikationsmitteln im historisch-genetischen Rahmen geschehen. Form und Inhalt sowohl der Zeitschriften und Zeitungen als auch der Broschüren sind nur aus dem gesellschaftlichen Zusammenhang heraus verständlich. Dabei entsteht die Frage nach einer Epochisierung, auch wenn die Parallele zu der Diskussion der Literaturepochen nur Orientierungshilfe sein kann. Grob läßt sich Glaßbrenners Schaffenszeit in die zeitlichen Abschnitte einteilen. 14
die durch seine inhaltliche und geistige Ausrichtung auf die Revolution bedingt sind. Dies sind: die Zeit vor der Revolution, das Revolutionsjahr 1848 und die Zeit nach der gescheiterten Revolution. Für die Jahre 1830 bis 1848 schwanken Literaturwissenschaftler zwischen den Kategorisierungen Biedermeier, Vormärz, Restaurationsepoche.(15) Wie bereits einschlägig nachgewiesen, trifft der Begriff Biedermeier dabei nur unzureichend. Taucht er in dieser Arbeit auf, so wird er nicht als literarische Epochisierung gebraucht, sondern als Charakterisierung des Verhaltens von Bürgerlichen im frühen 19. Jahrhundert, die sich mangels politischer Macht auf individuelles wirtschaftliches Streben und auf das Leben in der patriarchalischen Kleinfamilie zurückzogen und die es nicht wagten, sich für den gesellschaftlichen Fortschritt zu engagieren. Paul Kluckhohn benutzt als allgemeinste Formel, daß das Zeitalter der politischen Restauration kulturell das Zeitalter des Biedermeier sei.(16) Da die folgende Einteilung mit der Medienentwicklung korrespondiert, unterteile ich Glaßbrenners Schaffenszeit in die Epochen: die frühen Jahre, in denen sich die kurz mit dem Begriff Biedermeier angedeutete Geisteshaltung in den Unterhaltungsblättern niederschlägt; die dreißiger Jahre der liberalen Opposition des Jungen Deutschland; den Vormärz von 1840 bis 1848 als unmittelbare Vorbereitung der Revolution; das Revolutionsjahr; den Nachmärz als Reaktion auf die Revolution und Restauration der alten Mächte; die Bismarckzeit, den Beginn der Gründerjahre und der Einheit eines Deutschen Reiches. Die Zeit vor Ausbruch der Revolution bezeichne ich einheitlich als Vormärz, wohl wissend, daß das Junge Deutschland hinter dem Bewußtsein der Oppositionellen in den vierziger Jahren zurückstand. D o c h der bürgerlich-liberale Idealismus des Jungen Deutschland ist wie linksliberale und frühe republikanische Bestrebungen sowie deren Widerpart der konservativen bis reaktionären politischen und geistigen Strömungen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Bestandteil des Vormärz und gehört zu den Wegbereitern der bürgerlichen Revolution des Jahres 1848. Nach einem Blick auf die Situation von Öffentlichkeit und Publikum als Voraussetzung, sollen die zeitgenössischen Medien der Kommunikation anhand von Glaßbrenners Werk näher bestimmt werden. Da Glaßbrenner explizit programmatische Ziele verfolgte, werden die literarischpublizistischen Programme, wie sie sich in seinen Publikationen und in persönlichen Aussagen niederschlagen, wesentlicher Aspekt dieses Teils der Untersuchung sein. A u s den Inhalten und der Analyse von Glaßbrenners Selbstverständnis als Schriftsteller und Publizist folgt die Bestimmung formaler Mittel zur Erreichung des Lesepublikums und damit zur politischen und ideologischen Einflußnahme. Im letzten Kapitel soll der Stellenwert des Publizisten in der spezifischen historischen Situation des 19. Jahrhunderts anhand der vorausgegangenen Untersuchung von Glaßbrenners Werk und dessen publizistischem Kontext erörtert werden.
15
A u s diesem Rahmen der Untersuchung ergibt sich, daß die Methode für die Erforschung der sozialen Funktion von Publizistik im 19. Jahrhundert nicht einseitig festlegbar ist. Ausgangspunkt ist die Frage der Kommunikation als Grundlage gesellschaftlicher Organisation. Die Untersuchung muß innerhalb der Kommunikationswissenschaft integrativ angelegt sein, d. h., neben publizistischen Faktoren müssen literarische, sozio-ökonomische, politische und geistesgeschichtliche Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Unter sozial wissenschaftlicher Fragestellung muß sie empirisch-analytisch, gleichzeitig unter geisteswissenschaftlichem Ansatz historisch-hermeneutisch angelegt sein. Fragen literatur-wissenschaftlicher Kategorisierung werden dabei jedoch nur berücksichtigt, soweit sie für die Medienforschung relevant sind. Die Publikationsorgane werden qualitativ inhaltsanalytisch betrachtet, schwerpunktmäßige Interpretation wird durch exemplarische Textstellen belegt. Beschreibung des Inhalts findet nur statt, wenn er für die Bestimmung der Medienentwicklung von Bedeutung ist. Im Vordergrund stehen Fragen nach Medienstruktur und -Organisation. Die Variablen ergeben sich aus dem sozio-ökonomischen, geistes- und mediengeschichtlichen Umfeld. Die Struktur des Prozesses medialer Kommunikation kann in der medienhistorischen Forschung früherer Jahrhunderte weitgehend nur vom Kommunikator und von dessen Produktions- und Distributionsweisen ausgehen. Die Frage der Rezipienten- und Wirkungsforschung, die bisher ansatzweise geleistet worden ist, kann in die vorliegende Arbeit nur einbezogen werden, soweit sie sich aus der soziologischen Bestimmung wahrscheinlicher und potentieller Leser entwickeln lassen, oder soweit sie sich aus der inhaltlichen und formalen Konzeption der Publikationsmittel bestimmen lassen. Wie weit Glaßbrenner Leser mit seinen Publikationen erreichte, kann in der Arbeit nur belegt werden durch Aussagen des Publizisten selbst und durch das Echo anderer Publikationsorgane. Eine eigenständige Rezipientenforschung würde den Rahmen der Untersuchung sprengen.(17) In Exkursen soll am Beispiel der Darstellung abhängiger und geächteter Gruppen der Gesellschaft, wie den Frauen und den Juden, erhellt werden, wie Glaßbrenners postuliertes Eintreten für Unterprivilegierte konkret wird. Zitate, die mangels verbreiteter Kenntnis des Werks von Adolf Glaßbrenner relativ zahlreich sind, werden in der Schreibweise des Originals belassen.
16
B.
Struktur öffentlicher Kommunikation und ihre Veränderung im 18. Jahrhundert bis zum Vormärz — Öffentlichkeit und Publikum
Um aufzeigen zu können, unter welchen Bedingungen, mit welchen Mitteln und zu welchem Zweck ein politisch fortschrittlich denkender Publizist des 19. Jahrhunderts auf seine Leser Einfluß zu nehmen suchte, muß vorab geklärt werden, was unter den Begriffen Öffentlichkeit und Publikum zu verstehen ist und wie das bürgerliche Lesepublikum entstanden ist. Die Begriffsbestimmung folgt im wesentlichen der Definition von Jürgen Habermas, der Öffentlichkeit als historische Kategorie behandelt.! 1) Die Begriffe Öffentlichkeit und Publikum wurden im 18. Jahrhundert im Zuge der Aufklärung ins Deutsche übernommen.(2) Habermas geht davon aus, daß sich die Sphäre der Öffentlichkeit, die der bürgerlichen Gesellschaft zuzurechnen ist, erst in dieser Zeit gebildet hat. Sie tritt dem Bereich der öffentlichen Gewalt, wie er von den Inhabern gesellschaftlicher und politischer Macht verkörpert wird, als von der Privatsphäre abgesetzte Öffentlichkeit entgegen. Die Entwicklung dieser Öffentlichkeit hat ihren geistigen Hintergrund in der Aufklärung, die Immanuel Kant definiert als Ausgang des Menschen aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht an Mangel des Verstandes sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eignen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.(3) Die Sphäre der „zum Publikum versammelten Privatleute"(4), wobei .privat' den „Ausschluß von der Sphäre des Staatsapparates"^) meint, ist die bürgerliche Öffentlichkeit. Das Publikum besitzt strukturelle Eigenschaften der Öffentlichkeit, ist aber im Unterschied zu ihr sachlich eingeschränkt. In der Öffentlichkeit wird kein festgelegtes Kommunikationsmuster vorausgesetzt, wie beim Publikum zwischen Kommunikator und Rezipient.(6) Otto Groth bezeichnet Öffentlichkeit als diffus, während das Publikum nach innen zentriert sei: Immer ist das Publikum Bildende ein Außenseiendes, von außen Kommendes, ein an unbegrenzt viel Personen Herantretendes oder von ihnen Ausgesuchtes. .. So ist der Kern des Wesens des Publikums die Singularität der Bindung
17
einer unbegrenzten Vielheit von Personen durch einen von außen an sie herantretenden oder von ihr ausgesuchten Gegenstand.(7) Ein Publikum bildet sich erst, wenn unbegrenzt viele ein besonderes Interesse nehmen an einem bestimmten Gegenstand, sich von und zu diesem hingezogen fühlen wie die Stahlspäne von und zu dem Magnetstab, an dem sie haften bleiben, soweit und solange seine Anziehungskraft wirkt.(8) Öffentlich ist schon, was dem Publikum zugänglich ist... Aber auch das Publikum selbst ist grundsätzlich offen, sonst wäre es ein geladener Kreis oder eine geschlossene Gesellschaft, und durch die allgemeine Zugänglichkeit wird es öffentlich. Es ist auch nicht grundsätzlich beschränkt auf eine bestimmte Art von Leuten, deren Zahl nur unbegrenzt wäre, auch die Zusammensetzung ist unbeschränkt. .. Zwar gibt es für die verschiedenen Gebiete des Geisteslebens nicht ein einziges Publikum, sondern viele Publica. .. Aber: der Kreis des jeweiligen Publikums ist nie geschlossen.(9) Die Form von Öffentlichkeit, die die Erscheinungsweise bürgerlicher Öffentlichkeit beeinflußt hat, war bis zum 18. Jahrhundert die der staatsgebundenen repräsentativen Öffentlichkeit von Fürstenhöfen. Diese repräsentative Öffentlichkeit war vom Volk abgehoben, dem lediglich die Privatsphäre zur Verfügung stand mit ihren unterschiedlichen, von den Privatleuten gebildeten Publika, die nicht Teil der Öffentlichkeit waren. Der Begriff Volk wird hier im soziologischen Sinn sozialer Schichtenhierarchie benutzt und bedeutet gleichzeitig die Teile der Gesellschaft, die von der gesellschaftlichen und politischen Macht feudaler Herrschaft ausgeschlossen und ihr unterworfen sind. Die Privatsphäre des Volkes war jedoch ebenfalls teilweise vom Feudalherren reglementiert. „Der Feudalherr ist in unlöslichem Gehorsam an seinen Suzerän gebunden, denn er ist Vasall. Aber er ist auch selbst Suzerän, soweit er Macht über anderen Vasallen hat."(10) Als die Feudalgesellschaft im 18. Jahrhundert ihrem Ende entgegenzugehen begann, das Bürgertum an wirtschaftlicher Bedeutung gewann und sich in geistiger und politischer Hinsicht zu emanzipieren suchte, wandelten sich Struktur und Funktion der Öffentlichkeit. Das Bürgertum, das seine Forderungen als Teil des Volkes lediglich als Privatleute an die feudale Gewalt herantragen konnte, d. h., als Individuen ohne institutionalisierten gesellschaftlichen und politischen Einfluß, begann die bestehenden Herrschaftsverhältnisse mit dem Prinzip der .Publizität' zu unterlaufen. „Das Prinzip der Kontrolle, das das bürgerliche Publikum diesem (dem Prinzip der bestehenden Herrschaft; Verf.) entgegensetzt, eben Publizität, will Herrschaft als solche verändern."(11) Das Herrschaftssystem des 18. Jahrhunderts zeigte einen Januskopf. Der Absolutismus regierte eine Feudalgesellschaft, indem die Landesfürsten die Arbeitskraft ihrer Untertanen ausbeuten, ohne selbst produktive Arbeit zu leisten und eigenes Risiko zu tragen. Gleichzeitig förderte der Staat mit dem System des 18
Merkantilismus (12) massiv Handel und Industrie und legte Keime einer neuen Gesellschaftsordnung, da die wirtschaftliche Bedeutung des Bürgertums durch diese staatliche Wirtschaftspolitik zunahm. Die merkantil istische Wirtschaftsförderung sollte in erster Linie der Stärkung der Staatsgewalt nach innen und außen dienen.(13) Zugleich aber trieb sie die Initiative der Kapitalisten durch Handelserleichterungen und Unterstützungsmaßnahmen an. „Messen, Märkte und Verkaufsmagazine entstanden überall in großer Zahl, die Verkehrswege und Verkehrsmittel wurden verbessert, Bankgründungen gefördert, das Münzsystem in Stand gesetzt, Erlässe von Zinstaxen und Wuchergesetze wurden proklamiert um das Geld zu verbilligen, Prämien, Vorschüsse und Steuernachlässe gewährt, Handelsverträge abgeschlossen und neue Handelskompagnien gegründet."(14) So steigerten sich Produktionsmittel und Produktivkräfte seit dem 17. Jahrhundert stetig, während die Produktionsverhältnisse im 18. Jahrhundert zu stagnieren begannen. Das Bürgertum wurde durch wirtschaftliche Erfolge selbstbewußter. Dies schuf eine Diskrepanz zwischen Bewußtsein und realen Verhältnissen, der Unmündigkeit und Abhängigkeit in Politik und Gesellschaft. Die bürgerliche Öffentlichkeit mußte sich die rechtliche Absicherung ihrer wirtschaftlichen Macht und die damit verbundene politische Emanzipation erkämpfen. Als ersten Schritt zu dieser Emanzipation bildeten sich „die literarischen Vorformen der politisch fungierenden Öffentlichkeit".(15) Diese literarische Öffentlichkeit stellte eine Übergangsform dar, die noch eine gewisse Kontinuität zu der repräsentativen Öffentlichkeit der fürstlichen Höfe wahrte.(16) Die literarische Öffentlichkeit, in der sich das Publikum formierte, hatte eine Avantgardestellung innerhalb der Gesamtheit der Privatleute eines Staates. Sie beherrschten die Sprache in Wort und Schrift - eine Voraussetzung für die gesellschaftliche Kommunikation, die über die Verständigung zu materiellen Problemen des täglichen Lebens hinausgeht. Den Kern dieser Öffentlichkeit bildete die im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung entstandene neue Schicht der „Bürgerlichen". Habermas nennt als konstituierende Gruppen dieser Bürgerlichen: Beamte der landesherrlichen Verwaltung, Ärzte, Pfarrer, Offiziere, .Gelehrte', ,Kapitalisten'.(17) Die Bürgerlichen waren die „eigentlichen Träger des Publikums, das von Anbeginn ein Lesepublikum ist".(18) Handwerker und kleine Kauflaute, die bisher ebenfalls unter den Terminus .Bürger' fielen, stiegen sozial ab zum sogenannten Kleinbürgertum, das erst im 19. Jahrhundert politische Bedeutung erlangte. Die bürgerliche Öffentlichkeit, die noch nicht über institutionalisierte Repräsentation verfügte, konnte sich als Publikum in relativer Zufälligkeit der Zusammensetzung zuerst lediglich in ihrem Räsonnement in den Bereichen des geistigen und künstlerischen Lebens entfalten. Die Form ihrer Kommunikation mußte sich aus der direkten Form der Gruppe von Gesprächspartnern entwickeln. S o wurde die geschriebene Sprache in Literatur und Publizistik als Fortentwicklung aus dem 19
persönlichen Kontakt und Gespräch Voraussetzung für die politische Emanzipation. Die politische Öffentlichkeit ging aus der literarischen hervor, „sie vermittelt durch öffentliche Meinung den Staat mit den Bedürfnissen der Gesellschaft".^) Eine wichtige Grundlage für diese Entwicklung war die zunehmende Verstädterung, die Mitte des 18. Jahrhunderts einsetzte. Davon war jedoch nur ein geringer Prozentsatz der Gesamtbevölkerung betroffen, denn bis Anfang des 19. Jahrhunderts lebten drei Viertel der Bevölkerung in den deutschen Ländern auf dem Land. Für die bürgerliche Gesellschaft war die Stadt allerdings nicht nur „ökonomisches Lebenszentrum", sondern „im kulturpolitischen Gegensatz zum ,Hof' bezeichnet sie vor allem eine frühe literarische Öffentlichkeit, die in den coffeehouses, den salons und den Tischgesellschaften ihre Institutionen findet".(20) Diese Bereiche privater Öffentlichkeit, die noch nicht politische Institutionen waren, übernahmen nun den Charakter repräsentativer Öffentlichkeit, indem sie den Grad bürgerlicher Bildung zur Voraussetzung für die Teilnahme machten. In der Auswirkung des mangelnden Zugangs zum Publikum entsprach dies den Standesschranken der Feudalzeit, die den Adel vom Bürgertum abgeschirmt hatte. Die Bürgerlichen verstanden es nun in zunehmendem Maße, sich nach unten abzugrenzen. Als Weiterentwicklung der Kommunikations- und Diskussionsforen, die sich das fortschrittliche Bürgertum für sein Räsonnement geschaffen hatte, entstanden Zeitschriften. Die „Moralischen Wochenschriften", die es seit Beginn des 18. Jahrhunderts gab, waren unmittelbarer Ausfluß der Kaffeehausdiskussionen. Zu den bekanntesten Beispielen gehören die englischen Blätter „Tatler", „Spectat o r " und „Guardian", die zwischen 1709 und 1714 als Wochenschriften mit moralisierendem, didaktischem Inhalt den Zusammenhalt in den Diskussionen der Kaffeehäuser gewährleisten sollten. Die Zeitschriften enthielten in erster Linie Räsonnement und Kritik. Die bereits bestehenden Zeitungen dienten dagegen vorwiegend der Information. Die Bedeutung der Zeitung hatte mit dem Nachrichtenverkehr begonnen, der sich mit dem Warenverkehr entwickelte. Dementsprechend enthielten die ersten Zeitungen lediglich Handelsnachrichten.(21) Was heute als Merkmale einer Zeitung kategorisiert wird, hat seinen Ursprung im 18. Jahrhundert und erhielt seine Vollendung im ausgehenden 19. Jahrhundert.(22) Der Schwerpunkt der Zeitungsinhalte blieb in der Frühzeit des Bürgertums, nicht zuletzt aus Zensurgründen, im Bereich der Information.(23) In den Zeitschriften bereitete das Räsonnement in gelehrten Artikeln, die die Zeitschriften als Diskussionsforen etablierten, den Weg zur Erörterung staatspolitischer Fragen.(24)
20
I.
Die politischen Forderungen des sich etablierenden Bürgertums an der Wende zum 19. Jahrhundert
Da die bürgerliche Öffentlichkeit weder Parteien noch sonstige Einrichtungen oder Repräsentanten hatte, mit deren Hilfe sie ihre politischen Forderungen an die Machthaber herantragen konnte, schuf sie sich Publikationsorgane, die diese Aufgabe erfüllen sollten. Die Ausweitung der politischen Forderungen des Bürgertums ging einher mit der der wirtschaftlichen. Die Produktionsverhältnisse im absolutistischen Mitteleuropa waren veraltet. Das Bürgertum, dessen Zukunft mit dem entstehenden Kapitalismus verknüpft war, drängte auf Veränderung. Es wurde immer offensichtlicher, daß ökonomische Freiheiten auf die Dauer nur im Zusammenhang mit politischen Freiheiten zu erringen waren. In Frankreich erkannte das Bürgertum die historische Notwendigkeit einer tiefgreifenden Wandlung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Es kam zur Revolution von 1789, zur Durchsetzung bürgerlicher Forderungen. Das deutsche Bürgertum brauchte ein halbes Jahrhundert länger, um mündig zu werden. Erst 1848 verlangte es offen Freiheit und Gleichheit — die Parole von 1789 in Paris.(25) Als erste konkrete ökonomische Freiheitsbestrebungen äußerten sich bereits Mitte des 18. Jahrhunderts die Handeltreibenden, die Recht auf freie Konkurrenz und damit auf freie Preisbestimmung forderten, was bis dahin als verpönt galt.(26) Damit einhergehend drängten die bürgerlichen Kaufleute auf Befreiung von den Handelsbeschränkungen durch Zölle und Abgaben. Die Aufhebung der Zollschranken, die nach dem .Wiener Kongreß' den freien Handel zwischen den achtunddreißig deutschen Staaten und freien Städten behinderten, sollte erst der ,Deutsche Zollverein' im Jahr 1834 bringen. Diese ökonomischen Freiheitsbestrebungen, zu denen auch die Einführung der Gewerbefreiheit für die in den engen Bestimmungen der Zünfte eingezwängten Handwerker gehörte, haben ihre ideologische Grundlage in der .individualistischen Handelstheorie' von A d a m Smith. Die Grundgedanken dieser Theorie besagen, daß weder das Geld, wie die Merkantilisten glaubten, noch der Boden, wie die Physiokraten meinten, Basis für den nationalen Reichtum sei, sondern die Arbeit. A u s diesem Grund dürfe die Entwicklung der Produktivkräfte nicht behindert werden. Alle Privilegien, Handels-, Zoll- und Zunftschranken sollten fallen. Den zu erreichenden „idealen Naturzustand" sah Smith in der bürgerlichen Ordnung.(27) Neben der wirtschaftlichen spielte die Staatstheorie eine grundlegende Rolle in der Entwicklung des bürgerlichen Selbstbewußtseins. Im 18. Jahrhundert entstand eine Rechtsauffassung in Ablehnung des Absolutismus, die von der „legislativen Gewalt der Volksgesamtheit" ausging. Zu ihren Theoretikern gehörten Locke, Montesquieu und Rousseau, wenn sie auch unterschiedlich formulierten.
21
„Die bürgerliche Rechtsauffassung des 18. Jahrhunderts basierte auf Freiheit und Gleichheit. Die Freiheit oder Unabhängigkeit von der Willkür eines anderen war nach bürgerlicher Anschauung ein dem Menschen angeborenes, unveräußerliches Privilegium. Damit die Freiheit des einzelnen nicht so weit ginge, daß er die Freiheit des anderen schmälere, mußte der Freiheitsbegriff notwendigerweise den Gleichheitsbegriff einschließen."(28) Konkreter Ausfluß dessen war der Kampf u m eine Konstitution, die die Mitbestimmung der bürgerlichen Öffentlichkeit bei der Herrschaft institutionalisieren und legalisieren sollte. In Deutschland führte das Verlangen nach einer Verfassung nur in vereinzelten Fällen zu einem Inf ragestellen der monarchistischen Staatsform an sich. Im wesentlichen blieb es in den Kreisen des fortschrittlichen Bürgertums bis zu den Jahren des Vormärz bei der Kritik an Fehlern eines Regenten und beim A p pell an den Fürsten. Dieses Festhalten an der Reform wurde noch unterstützt durch das Wüten der Guillotine in Paris nach 1789, das die Furcht vor einer Revolution in Deutschland schürte. Die Mehrheit des politisch interessierten deutschen Bürgertums wünschte sich einen dritten Weg zwischen Absolutismus und Demokratie in Form eines bürgerlichen Parlaments mit einem Staatsoberhaupt, das durchaus ein König sein konnte. Die bürgerlichen Forderungen sollten damit auf legalem Weg durchgesetzt werden. Christoph Martin Wieland wollte „lieber den einen ,Tollkopf' des Fürsten als .Million schwindligen Köpfe' des Pöbels".(29) Aber Deutschland erhielt bis zum 19. Jahrhundert nicht einmal eine konstitutionelle Monarchie. Obgleich die staatsrechtlichen Errungenschaften der napoleonischen Herrschaft in den süd- und westdeutschen Ländern erste Voraussetzungen für den Gedanken des Nationalstaates schufen, blieb auch die Einheit Deutschlands noch in weiter Ferne.(30) Nach den Befreiungskriegen gegen Napoleon wurden die alten Dynastien Deutschlands und Europas auf dem .Wiener Kongreß' unter Federführung Metternichs 1815 wieder an die Macht gehievt. Danach war Deutschland in vierunddreißig erbliche Monarchien und vier freie Städte zersplittert, die in dem .Deutschen B u n d ' zusammengefaßt waren, einer Institution ohne exekutive Gewalt. Eine besondere Rolle in den Emanzipationsbestrebungen des Bürgertums spielten die Forderungen, die das räsonnierende Publikum betrafen. Meinungs-, Rede-, Versammlungs- und Pressefreiheit waren von existentieller Bedeutung für die bürgerliche Öffentlichkeit. Die Verbriefung dieser Rechte wurde zwar 1819 in Karlsbad von den Machthabern als eine Art Reform von oben versprochen, fand aber nicht vor 1848 statt, dem Jahr, in dem das fortschrittliche Bürgertum seine Geschicke selbst in die Hand zu nehmen versuchte. Die Bedeutung der Pressefreiheit als „pars pro t o t o " beschreibt der liberale Jurist Johann Ludwig Klüber 1824: „ A n der mehreren oder minderen Beschränkung der Pressefreiheit kann man den Grad der Freiheit erkennen, welche das V o l k genießt."(31) Bis in den Vormärz hinein blieb gültig, was Gotthold Ephraim Lessing 1769 über die geisti-
22
ge und politische Freiheit in Berlin schrieb: die Freiheit zu denken und zu schreiben sei die einzige Freiheit, „gegen die Religion so viel Sottisen zu Markt zu bringen als man w i l l " , versuche aber jemand, „dem vornehmen Hofpöbel so die Wahrheit zu sagen, als diese sie ihm gesagt h a t . . . lassen Sie einen in Berlin auftreten, der für die Rechte der Unterthanen, der gegen Aussaugung und Despotie seine Stimme e r h e b t . . . Sie werden bald die Erfahrung machen, welches Land bis auf den heutigen Tag das sklavistische Land von Europa ist."(32) Trotz der von Lessing angedeuteten Gefahr, die öffentliche kritische Äußerungen über die bestehenden Zustände mit sich brachten, wagten es seit der Jahrhundertwende auch in Deutschland immer mehr Angehörige des Bürgertums, Mißfallen und Forderungen zu äußern. Ihre geistige und publizistische Vorhut bildeten die bürgerlichen Intellektuellen. „Mit den Revolutionen des 18. Jahrhunderts trat eine Art weltlicher Klerus in den Vordergrund, eine immer breiter werdende Schicht von Intellektuellen."(33) In Deutschland brauchten die Intellektuellen, gemäß der gesellschaftlichen Entwicklung, länger, bis sie die Bedeutung erlangen konnten, die die Geistesarbeiter in Frankreich besaßen. Als Anwälte der Reform wurden die französischen Schriftsteller um die Mitte des 18. Jahrhunderts zu den ,ersten Politikern des Landes'. Indem sie sich über Privilegien, Institutionen, Mißstände von Kirche und Staat äußerten, gewannen sie den Rang von philosophischen Lehrern, denn sie vermochten über die Zustände, unter denen alle litten, so frei zu sprechen, wie alle gern frei von ihnen gewesen wären.(34) Nach der Französischen Revolution zeugten auch die Zeitschriften in Deutschland von einem aus seiner zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung erwachsenden Selbstbewußtsein des Bürgertums und seiner geistigen Avantgarde, den bürgerlichen Intellektuellen. „Sie sind nicht mehr nur das Sprachrohr ihrer Leser, sie sind zugleich ihr Fürsprecher und Lehrmeister."(35) Analog der inhaltlichen Tendenz der Zeitschriften entwickelten sich die Inhalte der Zeitungen ebenfalls von der reinen Information zum kritischen Räsonnement. Damit wurde die Presse und ihre Möglichkeiten zur Manipulation der Meinungsbildung eine Gefahr für den absolutistischen Staat. Johann Joseph Görres charakterisiert diese Entwicklung in seiner Zeitschrift „Rheinischer Merkur" des Jahres 1814: Wir haben uns unter den bestehenden teutschen Blättern umgesehen, in wiefern sie bis heran in dieser hochwichtigen Zeit ihre Bestimmung verstanden haben, und es ist uns klar geworden, daß der bessere Geist in ihnen wenigstens mächtig zu regen sich beginnt. Sie haben Alle mehr oder weniger eingesehen, daß sie zu etwas mehr da sind, als dem leeren Nachhall gleich blos das Geschehene in trocknen, dürren Worten zu erzählen. Allgemein ist es als ein knechtischer Grundsatz verworfen, daß sie blos Thatsachen erzählen, und jedes Urtheils sich enthalten sollen.(36) Die absolutistischen Machthaber erkannten die Bedrohung, die ihnen von dieser 23
Seite erwuchs. Metternich nannte die Presse „das dringendste Übel" und fürchtete den „bis zum Wahnsinn gesteigerten Unfug der Presse".(37)
24
C.
Struktur der Medien öffentlicher Kommunikation und ihre Veränderung am Beispiel der Publikationen Adolf Glaßbrenners
I.
Zeitschriften und Zeitungen
1.
Unterhaltungsblätter im Berlin der dreißiger Jahre
a.
Adolf Glaßbrenners erste publizistische Beiträge
1824 brach Adolf Glaßbrenner den Besuch des Friedrichswerderschen Gymnasiums ab, wo er Mitschüler von Karl Gutzkow gewesen war, und wurde Lehrling in der Seidenhandlung Gabain. Neben seiner kaufmännischen Lehrzeit besuchte er ab 1827 Vorlesungen der Philosophie an der Berliner Universität und veröffentlichte kleine Texte in zeitgenössischen Unterhaltungszeitschriften. Im Februar 1827 wurde sein Name zum ersten Mal in Moritz Gottlieb Saphirs „Berliner Courier, ein Morgenblatt für Theater, Mode, Eleganz, Stadtleben und Localität"(1) gedruckt, wenn auch nur als Einsender der richtigen Lösung eines Rätsels. Aber damit war der Kontakt zum erfolgreichen Saphir hergestellt. Im „Berliner Courier" vom 30. Juni 1827 erscheint auf der letzten Seite in der Rubrik „Damen-Sphynx" das erste von Adolf Glaßbrenner verfaßte Rätsel, unterzeichnet „Adolph". Daß dies sein erstes öffentliches Auftreten war und er vor 1827 noch keine eigenen Texte publiziert hatte (2), beweist eine Meldung in der Zeitschrift „Jahreszeiten, Hamburger Neue Mode-Zeitung" aus dem Jahr 1852, bei der Glaßbrenner in dieser Zeit mitarbeitete. Darin wird angekündigt, daß Glaßbrenner am 30. Juni 1852 sein 25jähriges Jubiläum als Schriftsteller feiere. (3) a.a.
Moritz Gottlieb Saphirs „Berliner Courier"
Saphirs „Berliner Courier", in dem Glaßbrenner nun publizierte, gehörte neben der ebenfalls von Saphir seit 1825 herausgegebenen „Schnellpost für Literatur, Theater und Geselligkeit" zu den erfolgreichsten Unterhaltungsblättchen der späten zwanziger Jahre. Beide waren inhaltlich recht anspruchslos. Sie brachten Beiträge aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, die nicht direkt politische Probleme betrafen. Meist beschränkten sie sich dabei auf Klatsch. Die Unterhaltungsblätter vom Schlag des „Berliner Courier" paßten sich den strengen Zensurverhältnissen nach den Befreiungskriegen und der Restauration feudaler Macht an. Gleichzeitig entsprachen sie dem resignativen Verhalten großer Kreise der mittleren Schichten zwischen dem wirtschaftlich führenden Bürgertum und den unteren Schichten, die sich einerseits für den wirtschaftlichen Fortschritt aussprachen, andererseits den Staat als Garant sozialer Ordnung akzeptieren. Hermann Marggraff schildert seine Zeit: Man hat sich gesetzt und trocknet sich den Schweiß von der Stirn, um zu-
25
gleich im Schweiße seines Angesichts sein Brot zu essen. Man verlangt, wie ehrliche Handwerksburschen und Kinder, die sich überlaufen haben, panem et circenses — Brot und Tanzvergnügen. Die wackere Ehefrau oder die romantische Liebste am Arm schlendert man vor das Tor der Weltgeschichte hinaus, freut sich über das Getreide, das so schön anschlägt, über die Kartoffel, die so vortrefflich behackt sind, und gelangt endlich in das Dorf, welches so nah und doch außerhalb der Weltgeschichte liegt. Man ist ein guter Bürger und respektiert die Landesgesetze selbst so weit, daß man nur an den Orten raucht, wo das Rauchen von Polizei wegen nicht verboten ist.(4) Der „Berliner Courier" hatte kein formuliertes inhaltliches Programm. Er versuchte einen möglichst weit gefächerten Themenbereich abzudecken. Ein „Manifest" in der ersten Nummer des Jahres 1827 zeigt, daß Saphir daran gelegen war, jegliche politische Tendenz aus seiner Zeitschrift herauszuhalten: Daß wir zuvörderst wollen reden von Coulissen Von Affen und Wölfen, von Leopard und Hund, Von allem was geschieht auf bretternen Grund, Der die Welt und die Menschen thut repräsentiren In 2, in 3 und 4bein'gen Thieren.(5) Desweiteren sollte der „Berliner Courier" „Spiegel für Mädchen, Zofen und Damen, in einem ganz kleinen satyrischen Rahmen" sowie die bei den weiblichen Lesern so beliebten Rätsel und Charaden enthalten.(6) Das Schema des „Berliner Courier" ist ganz auf seine Unterhaltungsfunktion ausgerichtet. Am Anfang stehen kurze Bemerkungen zu Theater und gesellschaftlichem Leben unter dem Titel „Kronik der Berliner Novitäten". Darauf folgt der „Spiegel für Mode und Eleganz", danach ein reichhaltiger „Anekdoten-Schatz", in dem Saphir oft nicht gerade rücksichtsvoll mit bekannten Zeitgenossen umgeht. Die Rätselseite, „Damen-Sphynx" genannt, bildet das Ende des „Berliner Courier". Äußert sich Saphir doch einmal zu Themen der Politik, dann höchstens in Form einer Huldigung an den preußischen König, der zu den Lesern Saphirs gehörte.(7) Saphir war im biedermeierlichen Berlin mit seinen witzigen Texten sehr beliebt. Friedrich Sengle nennt Saphir sogar einen „erfolgreichen Erneuerer der Witzkultur des Rokoko".(8) Er schränkt jedoch ein, daß Saphirs Witz fast immer mit Klatsch gepaart ist, also Lachen auf Kosten anderer Personen hervorruft. Von Schriftstellerkollegen wie den jungdeutschen Dichtern wurde Saphir vielfältig angegriffen. Stellvertretend kritisierte Karl Gutzkow, daß er „von der wahren Bewegung des Humors, seiner sanften Schlangen- und Wellenbewegung" nichts wisse, und daß er in erster Linie ein „Talent zur Fabrikation" habe, „wollen wir's pekuniär ausdrücken, er verstand seine Rechnung zu machen".(9) Ab Juli 1927 tauchen im „Berliner Courier" fast regelmäßig Rätsel von Adolf Glaßbrenner auf.(IO) 1828 sind regelmäßige Veröffentlichungen lediglich im letzten Drittel des Jahres zu finden.(11) 26
Von Glaßbrenners Hand erschienen im „Berliner Courier" einfache Rätselfragen, Charaden, Palindrome und Logogryphe.(12) Sie sind entweder mit seinem vollständigen Namen oder mit seinen Anfangsbuchstaben unterschrieben. Es gibt keinen Hinweis darauf, daß er schon in seiner frühen Schaffenszeit das beliebte Spiel der beziehungsreichen Pseudonyme mitgemacht hat, die im „Berliner Courier" sehr zahlreich sind.(13) Die Inhalte von Glaßbrenners Rätsel haben keine politischen Bezüge. Sie knüpfen an den gesellschaftlichen und privaten Erfahrungsbereich der Leser an und entsprechen der Definition des Rätsels, die J. B. Friedrich gibt: Das Rätsel ist die umschreibende Darstellung eines nicht genannten Gegenstandes, um das Nachdenken des Lesers oder Hörers zum Auffinden desselben anzuregen, es i s t . . . wesentlich ein freies Spiel des Geistes, wobei es auf Witz und Geistesgegenwart ankommt, und wobei es noch auf geistreiche Unterhaltung, auf ein gegenseitiges Messen des Scharfsinns und der Erfindungsgabe abgesehen ist. (14) Die Rätsel-Rubrik war ein äußerst beliebter Bestandteil der biedermeierlichen Unterhaltungsblätter, die besonders auf die weiblichen Leser zugeschnitten waren. Johann Gottfried von Herder spricht in seiner Definition des Rätsels von den „Völkern auf seinen ersten Stufen der Bildung", die Liebhaber der Rätsel seien.(15) Im Deutschland des frühen 19. Jahrhunderts entspricht das den Frauen. Sie waren im bildungsbeflissenen Bürgertum diejenigen, die die geringste Ausbildung erhielten, jedoch mittels der Zeitschriftenlektüre Teil haben konnten am öffentlichen Räsonnement. Allerdings standen ihnen nur die geringsten Möglichkeiten zur Verfügung, ihren Geist zu messen. Das waren im Fall der Zeitschriften die Rätsel. Die Rätsel im „Berliner Courier" und ähnlichen zeitgenössischen Blättern führen eine Tradition fort, die bis zur altgriechischen und römischen Literatur zurückgeht. Neben kurzen Rätselfragen und poetisch geformten Sprüchen, die das volkstümliche Rätsel von jeher kennt, werden besonders gern komplexere und kompliziertere Rätselformen verwendet. Wort-, Silben-, Buchstaben- und Bilderrätsel wechseln sich hierbei ab.(16) André Jolles weist darauf hin, daß das Rätsel nicht nur dazu dient, den Scharfsinn des Ratenden und dessen, der es aufgibt unter Beweis zu stellen, sondern auch ein gruppenkonstituierendes Element hat: „Der Ratende . . . ist nicht Einer, der die Frage eines andern beantwortet, sondern Einer, der zu jenem Wissen zugelassen, in jene Gruppe aufgenommen sein will und durch seine Antwort beweist, daß er dazu reif ist."(17) Die Lösung des Rätsels dient dabei als Losungswort. Das aufstrebende Bürgertum hatte keine Standesprivilegien, wie sie der Adel in der Feudalgesellschaft hatte, die von Geburt an Würde und Anerkennung sichern konnten. Es machte Bildung zum Kriterium für Ansehen und Achtung. Wie beliebt Rätsel in all ihren Erscheinungsformen waren, zeigen die vielfältigen Veröffentlichungen von Rätselheften, wie beispielsweise „Sphynx, ein Rätsel-Almanach" von Freimund Ohnesorge, der Mitarbeiter des „Berliner Courier", des „Berliner Eulenspiegel" und später bei 27
Glaßbrenners „Berliner Don Quixote" war.(18) Die Rätselhefte haben wie die Rätsel selbst Tradition. Schon in der Frühzeit des Buchdrucks hatte es billige kleine Rätselhefte gegeben, die von .fliegenden Händlern' auf Messen und Märkten verkauft wurden, wenn es sich auch hierbei um volkstümliche Rätselbüchlein handelte, die von den Bildungsinhalten der literarischen Rätselformen weit entfernt waren.(19) Nach seinen ersten publizistischen Arbeiten entschloß sich Glaßbrenner, die ungeliebte Kaufmannslehre an den Nagel zu hängen. In dem Artikel der Zeitschrift „Jahreszeiten" zu seinem 25jährigen Berufsjubiläum heißt es, daß seine ersten Veröffentlichungen im „Berliner Courier" so gute Aufnahme gefunden hätten, „daß er, dadurch aufgemuntert, es wagen durfte, dem Mercur den Rücken zu wenden, um in die Arme Apoll's zu eilen".(20) a.b. Eduard
Maria
Öttingers
„Der
Berliner
Eulenspiegel"
„Der Berliner Eulenspiegel. Zeitschrift von und für Narren"(21), der ab 1.4.1829 in Berlin erschien, enthält in seinem ersten Jahrgang lediglich sechs Charaden von Glaßbrenner, die denen gleichen, die er in Saphirs Zeitschrift veröffentlicht hatte. „Der Berliner Eulenspiegel" ist den Blättern Saphirs äußerlich ähnlich aufgemacht. Er gibt sich in erster Linie als Unterhaltungsblatt, das sich mit Themen des gesellschaftlichen Lebens, des Theaters, der Kunst.und der Literatur beschäftigt und sich kritisch mit anderen zeitgenössischen Zeitschriften auseinandersetzt.(22) Aber schon die Titelvignette zeigt, daß Ottinger mehr wollte, als bloßen Witz und Zerstreuung seiner Leser, öttinger beschreibt das Konterfei des Till Eulenspiegel, das über dem Titel der Zeitschrift zu sehen ist: Er macht ein Gesicht, als ob er das Melodrama .Die Rache wartet' gesehen oder ein Blatt der Berliner Staffette gelesen. In den gelockten Haaren liegen ihm kleine Schauspielerchens, Dichterchens und Uebersetzerchens . . . Der Mund hat die Form eines türkischen Säbels, mit dem pflegt er einzuhauen. In der linken Hand hält er ein neumodisches Fratzenbild, das etwas hinter den Ohren h a t . . . Die Girlande besteht aus geflochtenen Kantschus, Knuten, Korbatschen, Peitschen usw. Viele werden es für Blätter halten. Sind nicht viele Blätter auch Geißeln für manche.(23) Diese Beschreibung ist charakteristisch für die Tendenz von öttingers Zeitschrift, herrschende Unterdrückung in Preußen und die Schlafmützigkeit der Bürger mit Hilfe von Allegorien und Metaphern anzuprangern, auch wenn er über keine präziser formulierbaren politischen Vorstellungen verfügte. Im März 1830 mußte öttinger seinen „Berliner Eulenspiegel" wegen Schwierigkeiten mit der Zensur aufgeben. Er ging nach München und gründete dort die satirische Zeitschrift „Das schwarze Gespenst", die bald wegen einer Beleidigung des bayerischen Königs unterdrückt wurde. Öttinger wurde aus München und Bayern verbannt und kehrte nach verschiedenen Reisen im Herbst 1830 nach Berlin zurück. Anfang Oktober 1830 ließ er „Eulenspiegel" wieder erscheinen. 28
diesmal unter dem Titel „Till Eulenspiegel. Berliner, Wiener, Hamburger Courier", der später in „Berliner Eulenspiegel-Courier" umgewandelt wurde.(24) In einem programmatischen Artikel des „Till Eulenspiegel an seine Leser" nennt öttinger als Hauptaufgabe des Blattes, „nicht nur das Feuer, das in den Narren — Schädeln lodert sondern auch den Durst —nach Unterhaltung" zu löschen.(25) „Till Eulenspiegel" des Jahres 1831 enthält entgegen dieser Proklamation jedoch in stärkerem Maße die Forderungen der bürgerlich-demokratischen Opposition, als es in Ottingers Zeitschrift zwei Jahre zuvor der Fall war. In der Rubrik „Vexier- und Lügendose" taucht regelmäßig der Name „A-bas-fi-donc" auf als Pseudonym für einen absolutistischen Staat, in dem Unterdrückung und Verfolgung herrschen: „ I n A-bas-fi-donc ist das Niesen untersagt worden, weil es der Gesundheit sehr zuträglich ist."(26) Die Cholera, die die Bevölkerung Preußens und der anderen deutschen Staaten immer wieder bedrohte, wird zur Metapher für staatliche Zwänge: Die Cholera besteht aus sieben Buchstaben. Ein Spaßvogel hat sie so ausgelegt, C-Censur, H-Hundesteuer, O-Orden, L-Legation, E-Erblichkeit, R-Ruhe, AArmee. Die Cholera ist also eine böse.(27) Die Not der armen Bevölkerung kann nur in verschlüsselter Weise durch Meldungen aus dem Ausland angeprangert werden: „ A m 1.12. ist in Dublin Miss Jane Darley aus dem Gefängnis entlassen worden, sie war 34 Jahre in Haft und zwar in den letzten 17 Jahren nur wegen Kosten und Mietzins."(28) Die zunehmende Politisierung in Ottingers Texten ist ein Zeichen für das verstärkte Selbstbewußtsein der jungen deutschen oppositionellen Schriftsteller. Inzwischen hatte 1830 die Julirevolution in Frankreich stattgefunden, die der absolutistischen Bourbonenherrschaft ein Ende bereitete und den .Bürgerkönig' Louis Philippe auf den Thron holte. Der Erfolg der Revolution in Paris hestärkte das deutsche oppositionelle Bürgertum in seinen Forderungen nach verfassungsmäßiger Absicherung der Bürger- und Menschenrechte sowie seinem Kampf gegen die Allmacht des spätfeudalen Staates. Auf junge oppositionelle Intellektuelle in Deutschland wirkte die Nachricht von dem Sieg der revolutionären Bürger in Frankreich wie eine innere Befreiung. Hatten sie bisher fast ausschließlich in kleinen Zirkeln, vor allem an den Universitäten, mehr oder weniger verschwommene Ideen von gesellschaftlicher Veränderung entwickelt, so strebten sie jetzt an die Öffentlichkeit, um eine breitere Basis für ihre Gedanken zu finden. Karl Gutzkow schreibt angesichts der Julirevolution: „Die Wissenschaft lag hinter mir, die Geschichte vor mir."(29) Öttinger zählte nie zu dem Kreis der Schriftsteller des sogenannten Jungen Deutschland, dazu waren seine Zeitschriftenbeiträge zu sehr an die Ereignisse des Tages gebunden, aber schon 1831 propagiert er alsMottodes „Till Eulenspiegel": „Vive la jeunesse."(30) In einem Plädoyer für die Jugend und gegen die „großthuenden Alten, welche sich für Dictatoren in der Republik der Literatur halten 29
und von der Jugend eine sklavische Ehrfurcht, einen unbedingten Gehorsam und schweigsames Betragen verlangen", erklärt er begeistert: Gottlob! Der Plan ist geglückt. Das Blatt ist ein Freistaat jugendlicher Gesinnung, ein Tummelplatz großer Ideen geworden. Schon jetzt ist der Titel Till Eulenspiegel ein Dorn in den Augen der Engherzigen; doch in den Augen der Aufgeklärten, die mit dem raschen Strom der Zeit vorwärts schwimmen, ein Wegweiser, der nicht unwillkommen ist . . . Um der siegenden Jugend ein Grab zu graben, bemühen sie (die Alten; Verf.) sich, das Treiben derselben auf alle mögliche Weise zu verdächtigen. Aus dem Best-wollenden Jüngling wird schnell ein Unruhestifter, ein Volksaufwiegler oder sonst ein gefährliches Staats-Insekt gemacht. Die Behörden sorgen dann mütterlich-mild für sein Fortkommen, sie verrammeln ihm seine Carriere, zünden sich mit seinen Fähigkeiten die Pfeife an und — das matte Alter triumphiert. Doch nur auf wenige Minuten! Bald steht wieder ein Anderer auf, der mit der nämlichen Kraft seine Adlerschwingen entfaltet und unaufhaltsam seinen Flug zu den Regionen des Lichtes und der Wahrheit nimmt.(31) Glaßbrenner veröffentlichte 1831 in unregelmäßigen Abständen eine große Anzahl von Texten im „Till Eulenspiegel". Dazu gehören Gedichte, Theaterkritiken, Aphorismen und Erzählungen neben verschiedenen Rätselformen. Seine Beiträge sind mit seinem vollständigen Namen unterzeichnet, seinem Pseudonym, Adolf Brennglas, oder mit unterschiedlichen Ziffern. Anhand der im Nachlaß vorhandenen Werkmanuskripte läßt sich nachweisen, daß sich Glaßbrenner hinter den Ziffern 15, 27 und 37 verbirgt.(32) Im „Till Eulenspiegel" verwenden alle Mitarbeiter sowohl den eigenen Namen als auch Chiffren als Autorenangabe, öttingers Artikel, die meist am Anfang des Blattes stehen und aktuelle Ereignisse kommentieren, somit den Charakter eines Leitartikels tragen, sind mit 17 gezeichnet. Seine Initialen finden sich lediglich unter Artikeln, an denen die Zensur keinen Anstoß nehmen konnte. Aber auch harmlose Charaden haben Ziffern, um das Prinzip unverdächtig zu machen. Öttinger beklagt jedoch, daß das System der gelegentlichen Namensnennung, das den Kreis der Mitarbeiter eines Blattes weitgehend unbestimmbar läßt, nicht nur Vorteile habe. Im April 1831 beschwert er sich darüber, daß sich „viele Leute in Berlin" als Mitarbeiter des „Till Eulenspiegel" ausgäben.(33) Die von Glaßbrenner stammenden Charaden und Logogryphe auf der letzten Seite des „Till Eulenspiegel" unterscheiden sich nicht von denen, die er für den „Berliner Courier" und den „Berliner Eulenspiegel" erdacht hatte. Da kann sogar die Cholera als „hinreißendste aller Damen" umschrieben werden.(34) Neben diesen einfachen Rätselformen taucht im September 1831 ein „Anachronistisches Frage- und Antwort-Spiel" auf, das eine Spalte des Blattes ausfüllt, sowie eine „logogryphische Erzählung". Bei dieser zweispaltigen Erzählung in Form einer romantischen Liebesgeschichte müssen achtunddreißig Wörter durch Versetzen von Buchstaben gefunden werden. Für dieses komplizierte Rätsel, das 30
wie seine Lösung fünf Nummern später auf der ersten Seite des „Till Eulenspiegel" erscheint, wurde ein Preis ausgesetzt. Der „erste Löser" soll einen Vierteljahrgang der Zeitschrift gratis erhalten.(35) Daß ein Rätsel die Form eines Preisausschreibens erhält, ist für die Zeitschriftenrätsel der damaligen Zeit ungewöhnlich. Besonders ein Rätsel von Umfang und Erscheinung dieser „logogryphischen Erzählung" hat eine Tradition als Kunstform und ist weniger eine Kombination von Wissenselementen mit dem Zweck, für die Lösung materiell belohnt zu werden. Das Preisrätsel kann als frühes Beispiel von Abonnentenwerbung angesehen werden. Über die Auflage des „Till Eulenspiegel" konnte ich keine Angaben finden und die Herausgeber der Zeitschriften übertreiben oft mit ihren Angaben der Exemplarzahlen ihrer Journale.^) Die Lesegewohnheiten im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts sind zwar nur ansatzweise erforscht, aber die vorhandenen Untersuchungen lassen den Schluß zu, daß auf einen Abonnenten einer Zeitschrift eine größere Anzahl von Lesern kommt.(37) Diese Gratisleser könnten für die Lösung des Rätsels in Frage kommen. Neben den Rätseln lieferte Glaßbrenner sechs Gedichte an „Till Eulenspiegel". Diese Gedichte sind inhaltlich drei Schwerpunkten zugeordnet. Der Lobgesang des Autors auf sein abendliches Pfeifchen und die Beschreibung der Zerstreuungen, die eines der zeitgenössischen Vergnügungsetablissements bietet, dienen lediglich der Unterhaltung und knüpfen an persönliche Erfahrungen und Gewohnheiten des Lesers an.(38) Zwei weitere Gedichte Glaßbrenners haben eine subjektive Todessehnsucht zum Thema und weisen auf Glaßbrenners Streben hin, neben zeitgebundenen Gedichten Poesie zu schaffen, die ihre Entstehungszeit überdauert.(39) Die übrigen beiden Gedichte spielen auf aktuelle politische Themen an. Das Lied „Die Sensation", das Glaßbrenner auch in eines der Hefte der Broschürenreihe „Berlin, wie es ist und — trinkt" aufnahm, bezieht sich auf den Freiheitskampf der Polen gegen die zaristische Unterdrückung.(40) Die Verehrung für die Freiheitskämpfer, die den jungen deutschen Oppositionellen als Vorbilder des Mutes für den eigenen Kampf um Freiheit und nationale Einheit des zersplitterten Deutschland galten, veranlaßte eine ganze Reihe von Dichtern zu Huldigungsgesängen auf das polnische Heldentum.(41) In dem Gedicht mit dem Titel „Das Bild in meinem Herzen" legt sich Glaßbrenner in seiner politischen Aussage nicht fest. Mit dem Bild im Herzen ist das eines Königs gemeint. Es geht aber nicht eindeutig aus dem Text hervor, ob es sich dabei um den preußischen König oder um die Idealfigur eines Monarchen handelt.(42) Die Theaterkritiken, die Glaßbrenner für den „Till Eulenspiegel" lieferte, sind noch vom Bemühen um größtmögliche Objektivität gezeichnet.(43) In einem aus Wortspielen bestehenden Prosatext gibt er dagegen die Haltung des ernsten Kri-
31
tikers auf und legt auf satirische Weise Theatermißstände bloß. Er greift die hohen Gehälter mittelmäßiger Sängerinnen an sowie die mangelhafte Bildung und Ausbildung von Schauspielern, die Käuflichkeit von Rezensenten und schlechte Theaterdichter.(44) In den frühen Jahren seiner publizistischen Arbeit paßt sich Glaßbrenner den Erwartungen des Lesers einer Unterhaltungszeitschrift an. Er haucht der Natur und den Götterstatuen im Berliner Tiergarten menschliches Leben ein und unterhält sich mit ihnen. Sie antworten ihm in Form von Zitaten aus Werken Friedrich Schillers, Adolf Müllners und aus dem „Barbier von Sevilla". Glaßbrenners Zwischentexte liefern die Stichworte. Diese Einflechtung von Zitaten in einen Text waren eine beliebte Form der Gestaltung von Dialogen und Erzählungen in biedermeierlichen Zeitschriften. Die Möglichkeit des Wiedererkennens einer Textstelle oder deren Verfassers war von Reiz für den bildungsbeflissenen Leser, der den Grad seiner Bildung an dem Umfang abfragbarer Kenntnisse maß. Zitate und „Geflügelte Worte" fehlen in keiner Unterhaltungszeitschrift der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts, seien sie eingesponnen in einen Text oder eigenständiger Teil einer bestimmten Rubrik. Diese Rubriken, die eingebettet sind zwischen räsonnierende und unterhaltende Artikel und kurze Meldungen, enthalten neben den Zitaten auch Aphorismen und Sprüche. Glaßbrenner steuerte dem „Berliner Eulenspiegel-Courier" Aphorismen unter der Überschrift „Pfauen-Augen" bei, in denen bildreich Tugenden und Laster definiert werden.(45) Auch die Aufdeckung realer Verhältnisse in der Gesellschaft über den speziellen Bereich des Theaters hinaus kleidet Glaßbrenner im „Till Eulenspiegel" in Sprachspielereien. Er personifiziert Naturerscheinungen, Pflanzen, Tiere und Gegenstände, um unterschiedliche Schichten und Charaktere der Gesellschaft vorzustellen. Ein Stiefelpaar, das einem jungen Adligen gehört, schildert dessen schmarotzerhaftes Leben.(46) Verschiedene Sorten von Säcke verdeutlichen die Eigenschaften und Verhaltensweisen von „kriechenden Creaturen", „Interessendurchbringern", „behaglichen Schmerbäuchen . . . denen im schlechtesten Sinne Ruhe die erste Bürgerpflicht ist", „Sonettfabrikanten" und betrügerischen Kirchenmännern.(47) Damit setzt Glaßbrenner seine Sprachspiele nicht nur zur Unterhaltung des Lesers ein, sondern benutzt die unterhaltende Form, um über gesellschaftliche Mißstände aufzuklären. Durch die Schilderung seines vergeblichen Bemühens, einen politischen Artikel zu schreiben, belustigt Glaßbrenner den Leser. Gleichzeitig präsentiert er ihm die politische Aussage, die der Artikel enthalten sollte, von dem ihn unerwartete Besucher abhalten. Der Schriftsteller bleibt durch die wiederholte Ablenkung beim ersten Satz seines Textes hängen, der damit refrainartig im Bericht wiederkehrt. Der Artikel, der „Napoleon Buonaparte" heißen sollte, braucht nicht geschrieben zu werden, die Wiederholung des kursiv gedruckten Satzes: „Das Leben dieses großen Corsen ist der glänzendste Lichtpunkt der neuern — " ersetzt die fehlende Ausführung der Huldigung Napoleon.(48) Bereits der erste 32
Satz zeigt, daß Glaßbrenner den französischen Kaiser verherrlichen wollte, der schon bald nach den Befreiungskriegen vom Feind und Besatzer zum Mythos geworden war. Der Napoleon-Kult äußerte sich in unterschiedlichen Schattierungen. Glaßbrenners Bewunderung gilt in dieser Zeit wohl dem Bild von Napoleon als dem Vollender der französischen Revolution, dem volksverbundenen Herrscher, der aus dem Liberalismus geboren war. Dies war auch die Vorstellung der Schriftsteller des Jungen Deutschland. Ludwig Börne sah dagegen einen Diktator in Napoleon, der die Republik verraten habe.(49) Eine Verherrlichung Napoleons als ,primus inter pares' entspricht Glaßbrenners Ideal einer konstitutionellen Monarchie. Glaßbrenner war in seinen eigenen Zeitschriften von Anfang an eindeutiger als Saphir und Öttinger, in seiner politischen Tendenz aber übernahm er formale Mittel, die beide in ihren Blättern verwendeten. Ottingers Einfluß auf Glaßbrenners Zeitschriftenkonzeption war dabei entschieden größer als der von Saphir. Wie Öttingers Zeitschriften sind die Glaßbrenners deutlich in Stil und Form von ihrem Gründer, Herausgeber und wichtigsten Mitarbeiter geprägt. Saphir ist zwar in seinen Blättern namentlich immer präsent, hält sich aber mit der Äußerung eigener Meinung zurück und läßt Zweideutigkeiten lieber in Form eines Spruches oder eines Aphorismus ohne Nennung des Verfassers erscheinen. Ende der zwanziger Jahre finden sich auch Beiträge von Glaßbrenner in der „Königlich privilegierten Berlinischen Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen", die nach ihrem Verlag kurz „Vossische Zeitung" genannt wurde, und im „Berliner Intelligenzblatt".(50) Es handelt sich dabei jedoch lediglich um Nachrufe in Gedichtform. Im „Berliner Intelligenzblatt" von 1828 steht Glaßbrenners Name unter einer Grabrede auf den Königlichen Instrumentenmacher G. Gabriel.(51) Die „Vossische Zeitung" enthält 1831 ein Gedicht auf den verstorbenen Prediger Kindermann.(52) Wahrscheinlich waren dies Auftragsarbeiten. Da Glaßbrenner gerade erst begonnen hatte, freiberuflich als Schriftsteller zu arbeiten und keine vertragliche Bindung an einen Verlag oder eine Zeitschrift hatte, war er auf die Honorare für seine Zeitschriftenbeiträge angewiesen. b.
Adolf Glaßbrenners „Berliner Don Quixote. Unterhaltungsblatt für gebildete Leser"
Bereits während Glaßbrenner für Saphirs „Berliner Courier" arbeitete, begann er, sich über die Pointen- und Effekthascherei der Unterhaltungsschriftsteller hinaus weiterzuentwickeln. Als er noch Lehrling im Seidenhandel war, hörte er Georg Wilhelm Friedrich Hegels Vorlesungen an der Berliner Universität und las Texte von Ludwig Börne. Börne wurde für ihn zum wichtigsten Vertreter des politischen und geistigen Fortschritts unter den jungen Denkern und Literaten seiner Zeit. Glaßbrenner lernte von Börne die Geschichte als Kampf zwischen Völkern und Fürsten zu se-
33
hen und sich auf die Seite des Volkes zu stellen. Glaßbrenner bewunderte Börnes Aufrichtigkeit und die Klarheit seines Denkens: Du konntest ohnmöglich ein paar liberale Witzchen in einem Blumenbouquet (Heine) reichen und dann wieder Knickse und Complimente machen, um Deine Tollkühnheit vergessen zu lassen . . . Du ehrlicher Mann, Du konntest der größte Schriftsteller unserer Zeit werden, aber Du warst ein zu großer Mensch. Form war Dir Gefängnis, Grazie Kettengerassel. Fluch über Alle, die um das bischen eingebildete Kunst Menschen, Millionen von Menschen immer weiter knechten lassen. — Das hast Du gewiß oft gedacht, ehrlicher Mann, wenn Du's auch nie so ausgesprochen hast.(53) Bei diesen Gedankengängen konnte Glaßbrenner nicht mehr konform gehen mit einem Saphir, der politisch ignorant war und es stets verstand, sein Fähnlein nach dem Wind zu drehen. Saphirs Witz, der auf vordergründige Effekte aus war, und die Zeit, in der er wirken konnte, charakterisiert Glaßbrenner 1836: Der vorwitzige Saphir. . . hat Aufsehen in Deutschland gemacht, als die naive das ist die dumme Zeit war, als man sich eines Wortwitzes oder einer hübschen Larve einer beweglichen Kehle wegen von der Ostsee bis hinter die Alpen die Haare ausriß . . . Seine Nichtigkeit blickt uns wie ein hohles Gespenst aus jeder Zeile seiner Tagesschreiberei an, niemals hat er ein edleres Streben, niemals hat er das Gottesblut in sich gefühlt. Es war ihm von jeher nur um Aufsehen zu tun. Er leugnet und besudelt das Heiligste, um einen Witz anzubringen (und was ist leichter?) und kokettirt im nächsten Augenblick auf so widerliche Weise mit Gemüt, Religion und Gott weiß was, daß einem gesunden Menschen vieles näher ist als Rührung. Er ist durch und durch Verzerrung, Gespreiztheit, Affektation, es fehlt ihm an Weltanschauung, an Tiefe, an philosophischer, ästhetischer Bildung, an Intension, er tappt so lange zwischen Spott, Sonne, Mond und Sternen, Büchern, Speisen, Frauen, Männern, Pflanzen und Tieren umher, bis er einen Witz, eine Antithese, einen Aphorismus gefunden hat, und um diese opfert er Wahrheit, Charakteristik, Form und Schönheit. Aus alten und neuen Büchern nimmt er das Gold und vergoldet sein Kupfer . . . Sein Stil ist zwar lebendig wie die Straßen in Wien, aber ebenso krumm und eckig, nachlässig ohne Eigenart, ohne Eleganz und voller Schwulst.(54) Nach seiner freien Mitarbeit bei öttingers „Till Eulenspiegel" und „Berliner Eulenspiegel-Courier" bat Glaßbrenner zum erstenmal beim Polizeipräsidium um die Erlaubnis zur Herausgabe einer eigenen Zeitschrift. Um dies zu erleichtern, versicherte er in seinem Antrag, daß die zu gründende Zeitschrift mit dem Titel „Berliner Don Quixote" der „Unterhaltung der gebildeten Stände" dienen solle, weiter heißt es: „Diese Zeitschrift sollte nie etwas Politisches enthalten, durchaus heitere Tendenzen haben und alles gegen Sitte und Schicklichkeit vermeiden."^) Nach diesem Zugeständnis erhielt er die Erlaubnis am 21. November 1831. Die 34
Zensur des „Berliner Don Quixote" wurde dem Dichter und Privatgelehrten Langbein übertragen, der als nachsichtig galt. „Berliner Don Quixote. Unterhaltungsblatt für gebildete Leser" erschien nun ab Januar 1832 im-Verlag Bechthold & Hartje, gedruckt bei J. G. Brüschke in Berlin. Zuerst kam das Blatt zweimal, kurz darauf viermal wöchentlich im OktavFormat heraus.(56) In der äußeren Form erinnert der „Berliner Don Quixote" an Saphirs Zeitschriften. Die Seiten sind zweispaltig ohne Illustrationen. Die vier Seiten einer Ausgabe tragen keine Seitenzahl. Der Inhalt besteht aus Novellen, Gedichten, satirischen Aufsätzen, Theaterkritiken, Notizen, Anekdoten, Sprüchen und Rätseln. Auf der ersten Seite erscheint stets ein Prosatext in Form einer Novelle oder einer Erzählung, zum Teil mit Fortsetzungen. Einige dieser Texte veröffentlichte Glaßbrenner bereits im „Till Eulenspiegel".(57) Darauf folgen auf den nächsten beiden Seiten wiederkehrende Rubriken wie „Hufeisen der Rozinante" mit kleinen humoristischen Reimen und Anekdoten aus „Sancho Pansa's Taschenbuch". Daran schließt sich „Leben und Treiben" mit Klatsch aus der Berliner Gesellschaft an sowie die Rubrik des Theaters, „Zügel und Sporen". Zwischen diesen Rubriken, die in wechselnder Reihenfolge auftreten, sind oft Gedichte eingefügt. Den letzten Teil der Zeitschrift bilden lokale und auswärtige Meldungen, die vielfältige politische Anspielungen enthalten, und die Rätselsparte.(58) Auflagenzahlen des „Berliner Don Quixote" sind nicht bekannt. Da aber der Abonnementpreis für das Vierteljahr fünf Silbergroschen unter dem für Saphirs erfolgreichen „Berliner Courier" lag, kann eine recht große Verbreitung angenommen werden. Glaßbrenner selbst nennt seine Zeitschrift „beispiellos billig".(59) Christian Uhl schreibt, „Berliner Don Quixote" habe „reißenden Absatz" gefunden.(60) Und Christian Gehring vermerkt eine „ständig wachsende Leserschaft" in der Zeit seines Bestehens.(61) Im Februar 1833 schreibt Glaßbrenner in seiner Correspondenz aus Berlin, die er für die Zeitschrift „Posaune" in Hannover lieferte: „Daß mein Don Quixote viel gelesen wird, kann ich Ihnen versichern, und wollen Sie's nicht glauben, so fragen Sie nur das Stadtgericht, wie viele Injurienklagen gegen mich schweben."(62) Glaßbrenner war Herausgeber und Redakteur des „Berliner Don Quixote". Rudolf Rodenhauser gibt an, daß im April 1832 ein Julius von Ribics Mitredakteur werden sollte, aber vorher aus Berlin verschwunden sei.(63) Einen Beleg dafür konnte ich nicht finden. Glaßbrenners Zeitschrift verzeichnet eine ganze Reihe von regelmäßigen und gelegentlichen freien Mitarbeitern. Neben dem Zensor Langbein, der mit einigen Gedichten vertreten ist, tauchen verschiedene Autoren aus Saphirs und öttingers Blättern auf, die aber ansonsten keine größere Bedeutung als Schriftsteller erlangten.(64) Obwohl Glaßbrenner vielfältige Formen der Umschreibung politischer Kommen35
tare im „Berliner Don Quixote" einsetzte, blieb er von der Zensur nicht verschont. Die Quellenangabe unter einer beißenden Satire auf den Adel, „aus einem spanischen Journal übersetzt", täuschte Polizeiminister von Brenn nicht darüber hinweg, daß die einheimische Aristokratie gemeint war.(65) Er beschwerte sich beim Oberpräsidenten, von Bassewitz, der für die Durchführung der Zensur durch das Polizeipräsidium verantwortlich war, Glaßbrenner schildere „eine unangenehme, im hiesigen Akademiegebäude vorgekommene Begebenheit mit den gehässigsten Farben". Außerdem habe der Zensor, selbst wenn er den zum Stadtgespräch gewordenen Vorfall nicht gekannt hätte, den Artikel allein wegen des Titels und der Einleitung streichen müssen, da sie „gegen gewisse Stände" aufreizten.(66) Zensor Langbein, der der Obrigkeit zu nachgiebig war, wurde daraufhin durch den Geheimen Hofrat John ersetzt, den zuständigen Zensor für belletristische Blätter. Langbeins Nachfolger John strich unerbittlich und Glaßbrenner versäumte es, regelmäßig seine Zeitschrift beim Oberzensurkollegium vorzulegen, wozu er verpflichtet war. Das hinderte ihn nicht, im Sommer 1833 von Bassewitz um Erlaubnis für den Abdruck kurzer politischer Notizen zu bitten, wofür Glaßbrenners Freund und Kollege Karl Gutzkow 1831 für seine Zeitschrift „Forum der Journal-Literatur" das Plazet bekommen hatte. Glaßbrenners Gesuch wurde jedoch abgelehnt. Nach einer Beschwerde über satirische Bemerkungen zum Zusammentreffen des Kaisers von Österreich und des russischen Zaren in Münchengrätz bestellte das Oberzensurkollegium ein Gutachten bei dem Kammergerichtsreferendar von Grano, dem Vertreter des Zensors John. In dem Gutachten wurde Glaßbrenner vorgeworfen, er verspotte Landesgesetze und Verordnungen, errege Mißvergnügen und Unruhe gegen die Regierung und äußere sich boshaft über die Handlungen des Königs.(67) Außerdem stellte Grano fest, daß Glaßbrenner eigentlich Ladendiener sei und keine literarische Bildung habe. Darüber hinaus habe er bereits gestrichene Worte abgedruckt oder durch — verbotene — Zensurlücken angedeutet. Der Antrag des Oberzensurkollegiums auf sofortiges Verbot des „Berliner Don Quixote", das der Polizeiminister am 24.10.1833 verfügte, wurde aus Rücksicht auf die Abonnenten erst Ende des Jahres erfüllt. Nach vergeblichen Gesuchen an den König um Aufhebung des Verbots blieb Glaßbrenner nichts als die letzte Nummer des „Berliner Don Quixote" mit einem schwarzen Trauerrand zu versehen und das Blatt auf den „Journal-Kirchhof" zu schicken, wo er bereits über zwanzig verbotene Blätter begraben hatte. Im vorausgeschickten Nachruf heißt es: Mein Don Quixote kämpfte vergebens — und starb . . . Das schlechtste Blatt, das je gelebt. Man scharrt hier es ein; Wer andern eine Grube gräbt. Fällt endlich selbst hinein.(68) 36
Mit dem Verbot des „Berliner Don Quixote" wurde Glaßbrenner gemäß den ,Karlsbader Beschlüssen' untersagt, innerhalb der nächsten fünf Jahre „ein neues Zeitblatt" herauszugeben.(69) Um dieses Verbot zu umgehen, sammelte er seine besten Artikel aus dem „Berliner Don Quixote" und veröffentlichte sie 1834 unter dem Titel „Aus den Papieren eines Hingerichteten" bei Vetter & Rostosky in Leipzig, den Verlegern der Broschürenreihe „Berlin, wie es ist und — trinkt". Er folgte damit dem Beispiel Öttingers, der 1833 nach dem Verbot des „Berliner Eulenspiegel-Courier" das Büchlein „Der confiscirte Eulenspiegel" herausgegeben hatte. Doch auch Glaßbrenners Buch mit den Beiträgen aus dem „Berliner Don Quixote" wurde bald wegen „politisch höchst anstößiger Stellen" verboten.(70) b.a. Politik
unter dem Deckmantel
der
Unterhaltung
Sowohl der Titel der Zeitschrift „Berliner Don Quixote" als auch die Bezeichnungen der einzelnen Sparten des Blattes sind Miguel de Cervantes' Roman „Leben und Treiben des scharfsinnigen Edlen Don Quijote de la Mancha" entnommen.(71) Der Ritter von la Mancha wird verlacht, weil er in der Welt seiner Phantasie lebt. Heinrich Heine erkannte ihn jedoch als einen Mann voller „Geisteskraft und Edelsinn".(72) Für Glaßbrenner und seine Gesinnungsgenossen ist die Figur des Don Quijote ein Symbol für Phantasie, die nötig ist, um sowohl auf geistiger als auch auf politischer Ebene Veränderungen voranzutreiben. Neben der Figur des Don Quijote dürfte auch das Werk des Schriftstellers Cervantes für Glaßbrenners Selbstverständnis bedeutsam gewesen sein. Denn ähnlich den Satiren eines Cervantes auf den Ritterroman enthalten Glaßbrenners Zeitschriften wie sein gesamtes Werk die satirische Darstellung einer überlebten gesellschaftlichen Hierarchie und deren Auswirkung auf die Kunst. Die Erfüllung des Versprechens an die Zensur, bloße Unterhaltung zu liefern, bleibt im „Berliner Don Quixote" zum größten Teil Glaßbrenners Mitarbeitern überlassen, deren Prosatexte die ersten Seiten der Zeitschrift füllen. Dazu gehören romantische Liebesgeschichten, deren Genre in Glaßbrenners eigenen Beiträgen ironisiert wird. Glaßbrenner unterbricht damit die Erwartungen des Lesers, die von herkömmlichen Erzählmustern geprägt sind. Während der nicht näher zu bestimmende Mitarbeiter E. J. in dem Gedicht „Enttäuschungen. Ein abendliches Zwiegespräch" schildert, wie er eine verschleierte Dame anspricht und sie als seine eigene Ehefrau erkennen muß, lüftet Glaßbrenner das gleiche Geheimnis auf ganz andere Weise: „Nicht wahr, lieber Leser, nun wird es eine Häßliche oder eine Bekannte oder gar eine Verwandte sein? Mit nichtenl diesmal irrst Du Dich. Ein reizenderes Wesen hatte ich noch nicht gesehen."(73) Direkter distanziert sich der Redakteur des „Berliner Don Quixote" von dem Beitrag eines Mitarbeiters durch ein Fragezeichen als Fußnote, daß er unter den folgenden Satz der Theaterrezension von C.Fr. Ebers setzt: „Wohl uns, die wir nicht empfänglich für politische Zänkereien und Grübeleien sind, und noch so recht von Herzen lachen können."(74) 37
In der Beschreibung seiner Begegnung mit der verschleierten Dame schweift Glaßbrenner in einer Art »Spiel im Spiel' von der eigentlichen Handlung ab, als die Spannung an einem Höhepunkt angelangt ist. Er schildert plötzlich das für den Verlauf der Erzählung belanglose Gespräch zwischen einem mageren und einem dicken Herrn. Wie Heinrich Heine setzt er die Abschweifung als bewußtes Kunstmittel so ein, „daß der Autor die Neugierde seiner Leser aufputscht, um dann — nichts mehr zu sagen, um dann einfach abzubrechen und den genasführten Leser allein zu lassen".(75) Durch die ironische Unterbrechung seiner Erzählung gelingt Glaßbrenner eine Desillusionisierung des Lesers. Er deckt die Scheinwelt der Liebes- und Verwechslungsgeschichten auf, die ein bedeutender Bestandteil der Unterhaltungspublizistik des frühen 19, Jahrhunderts waren. In ähnlicher Weise ironisiert er die literarischen Erfahrungen der Leser, die an pathetisch-romantische Naturschwärmereien gewöhnt sind. In dem an Heine erinnernden Reisebild „Meine Reise nach dem Harz" bejubelter den Sonnenuntergang in einem mit Metaphern gespickten Abschnitt und erklärt, wie selig er gewesen sei, „Ich konnte auf dem Brocken Abendbrod essen".(76) Folgerichtig tauchen bei dem nächtlichen Hexentreffen auf dem Brocken keine metaphysischen Gestalten auf, sondern Phänomene der sozialen und politischen Wirklichkeit. Um Mitternacht tanzen Cholera, Grausamkeit und Revolution. Letztere beklagt sich über ihren Schnupfen: „Je suis enrhumée!"(77) Die Freiheit, die ebenfalls anwesend ist, spricht Berliner Dialekt. Der Teufel will sie in Ketten legen, aber sie gibt ihm eine so heftige Ohrfeige, daß er den Felsen hinabstürzt — ein deutliches Bekenntnis Glaßbrenners. Wie er hier Ideologie unter dem Deckmantel des märchenhaften Reiseberichts vermittelt, so kann er auch Kommentare zu Gesellschaft und Politik im spätfeudalen Preußen nur in verkleideter Form präsentieren. Geschichten, die voller politischer Bezüge sind, werden im Ausland oder in Phantasiestaaten angesiedelt, als Fabel oder Tierepos verbrämt. In den „Scenen aus dem Thierreich" läßt er verschiedene Tiere über die ideale Staatsform diskutieren. Dabei werden Meinungen jeder politischen Couleur aneinandergereiht. Der Ochse meint, der alte Weg sei der beste, während er Hahn darauf besteht, daß er als erster durch sein Krähen „die Freiheit am Morgen der Aufklärung erweckt" habe.(78) Sieht man die Aussagen der Tiere in ihrem Zusammenhang, wird deutlich, daß in jeder vertretenen Ansicht von Freiheit und vom Volk die Rede ist. Sogar die Negationen des Fortschritts sind so formuliert, daß die Tendenz des Verfassers erkennbar ist. Um die Zustände in Deutschland zu charakterisieren, druckt Glaßbrenner einen „Brief aus dem Saturn" ab, den der „Baccalaureus Samson Barrasco" an „Don Quixote" geschickt hatte. Der Schreiber berichtet, daß der Saturn in drei Millionen Provinzen eingeteilt sei, „und jede Provinz verwalten einige tausend Civilbeamten".(79) Der Leser wird damit an die deutsche Kleinstaaterei erinnert, die 38
jeden wirtschaftlichen und politischen Fortschritt hemmt. In einem weiteren Brief stellt der Baccalaureus seinen Saturniern Europa vor: Europa gleicht einer liegenden Jungfrau, deren Kopf (Spanien und Portugal) nach unten gekehrt ist, während sie ihre beiden Hände (Großbritannien nebst Zubehör und Italien nebst Anhang) ausstreckt. Den Hals bildet Frankreich und die Gebirge zwischen Hals und Kopf (die Pyrennäen) sind die Pulsadern, in denen vor so langer Zeit viel Blut, d. h. Gold gewesen sein soll. Deutschland ist der Oberlaib und ein Teil desselben, nämlich Österreich der Magen, Rußland endlich der große Reifrock, den auf der einen Seite Schweden und Norwegen als herabhängende Schleifen, auf der andern die Türkei als Schürze zieren.(80) Don Quixote beantwortet die Frage Samson Carrascos, wie es auf dem Planeten Erde aussähe, lakonisch: „Wenn Ihr das Journal meint, welches in Leipzig erscheint, so siehts sehr traurig aus; meint Ihr aber unsere Welt damit, so siehts noch viel trauriger aus."(81) Don Quixote berichtet, daß es in Spanien einen Krieg zwischen Brüdern und in Berlin eine Prügelei zwischen Eckenstehern gegeben habe, „letzteres ist das Wichtigste".(82) Neben Erzählungen, die in fremden Ländern oder auf fremden Planeten spielen, benutzt Glaßbrenner eine Geschichte, die in ferner Zukunft angesiedelt ist, um das Deutschland der Gegenwart zu kritisieren. Zwei Algerier besuchen im Jahr 2832 die Ruinen Deutschlands, die nach einem großen Erdbeben übriggeblieben sind. Obgleich nur noch Trümmer stehen, gibt es noch Zollgrenzen.(83) Da unter den herrschenden Zensurgesetzen ständig mit einem Verbot zu rechnen war, finden sich fast keine Meldungen und Kommentare zu konkreten politischen Ereignissen. Es gibt lediglich Notizen und satirische Bemerkungen zu ausländischen Ereignissen, oder Glaßbrenner schildert die Unterdrückung in einem fiktiven Land mit Namen „Otempora", ähnlich öttingers „A-bas-fi-donc". In verschiedenen Formen wird wiederholt ein Hinweis auf die zunehmende Auswanderungsbewegung in Deutschland eingeschoben. Durch die immer drückender werdende wirtschaftliche Not besonders der Landbevölkerung, die 70% der Gesamtbevölkerung ausmachte, und die ständig steigende Bevölkerungsrate wurden viele Familien gezwungen, ihre Heimat zu verlassen.(84) Glaßbrenner kritisiert zwar noch nicht deutlich die Hintergründe, die dazu führten, aber er spricht die Not immer wieder an. In der Rubrik „Leben und Treiben" dokumentiert er die herrschenden Meinungen zur Frage der Auswanderung. Er stellt sie ohne Kommentar nebeneinander und bemerkt im letzten Satz: „Dagegen malen Andere das neue Deutschland, das in Amerika aufblühen werde, gar schön aus."(85) Damit zeigt er nicht nur das Elend, das die Menschen aus dem Land treibt, sondern auch die Chance der Verwirklichung der Freiheitsideale in einer neuen Gesellschaft. Wie diese neue Gesellschaft aussehen soll, definiert Glaßbrenner nicht. Noch ist sein politisches Bewußtsein nicht so weit entwickelt, daß er über die Kritik an 39
der obsoleten Macht des Adels und den fehlenden bürgerlichen Freiheiten hinausgeht. Er fühlt sich schon glücklich, wenn er in einer Stadt wie Leipzig ist, dem Zentrum des deutschen Buchhandels, wo ein zahlreiches und selbstbewußtes Bürgertum nicht so starken Repressalien ausgesetzt war wie das preußische: „Hier ist jeder freundlich, aber keiner kriechend; hier bückt sich jeder aus Achtung, keiner aus Furcht; — hier weht eine reine Luft, die jede groß- und schönfühlende Seele mit rosiger Lust einathmet."(86) Dieses nicht näher bestimmte Freiheitsbedürfnis artikuliert sich auch in der Beschreibung eines „neuen Festlandes", das Glaßbrenner betreten möchte. Dort braucht man sich nicht anzumelden, kann Pfeife rauchen und liberal sein.(87) Glaßbrenners Angriffe auf die Aristokratie als Träger der spätfeudalen Macht schließen den König und die Monarchie nicht ein. Er möchte den Monarchen nicht abschaffen, er verlangt von ihm nur Pflichtbewußtsein und Anerkennung der Rechte des Volkes. Also appelliert er an den Regenten: „Je mehr Gewalt in Deiner Hand ist, je mehr sei unpartheiisch und gerecht. Der Knecht kann sich wohl einmal selbst vergessen, aber dem Fürsten schadet der geringste Fehler."(88) Zum Geburtstag des preußischen Königs bringt Glaßbrenner nur eine sehr milde Satire auf die vielfältigen Aktivitäten, die in großen Anzeigen des „Tivoli" angekündigt werden.(89) Dennoch verläßt sich Glaßbrenner nicht allein auf die Möglichkeit der von einem weisen Herrschen ausgehenden pol ¡tischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Er versucht gleichzeitig, das Selbstbewußtsein der Untertanen zu stärken. Deshalb äußert er immer wieder Entrüstung über die Unmoral und die politische Stagnation im Bürgertum. Diese Verurteilungen, die besonders in den Rubriken der Aphorismen, Sprichwörter und Zitate enthalten sind, gehen einher mit Aufforderungen zur Veränderung, indem er die Gegner als unbedeutend entlarvt, und indem er an ausländischen Beispielen Mut und Selbstbewußtsein von Abhängigen vorstellt.(90) Neben den inhaltlichen Schwerpunkten der Adelskritik und der Diskussion über die Stellung des Bürgertums enthält der „Berliner Don Quixote" bereits Beiträge, in denen Vertreter der unteren Bevölkerungsschichten im Mittelpunkt stehen. Es handelt sich dabei um Ausschnitte aus dem ersten Heft der Broschürenreihe „Berlin, wie es ist und — trinkt" und ähnliche Beiträge in Berliner Dialekt. Darin werden die Eckensteher und die anderen Berliner Charaktere aus den unteren Schichten nicht als unter dem Bürgertum stehend lächerlich gemacht. Glaßbrenner zeigt vielmehr deren Humor und Unverdorbenheit, besonders in der Konfrontation mit Vertretern der herrschenden Klasse.(91) b.b.,Heerschau der Journale' Da Glaßbrenners Zeitschriftenproduktion in der Kommunikationsstrategie seines Gesamtwerkes eine wichtige Rolle spielt, setzt er sich fortwährend mit 40
den anderen zeitgenössischen Blättern auseinander. Wie öttinger in seinem „Eulenspiegel", dem besonders die etablierte „Vossische Zeitung" ein Dorn im Auge war, ergreift er selbstbewußt und kritisch Partei. In der Rubrik unter dem Titel „Heerschau der Journale" tritt Glaßbrenner als Analytiker von Zeitschriften und Zeitungen auf, die er an ihre gesellschaftliche Verantwortung erinnert. Damit macht er gleichzeitig den Standpunkt und die Ausrichtung seines eigenen Journals deutlich. Wie schon vor ihm Voltaire bezeichnet Glaßbrenner die langweiligen Journale als die schlimmsten. Den „Beobachter an der Spree" verurteilt er wegen seiner „niedrigsten Stadtklatschereien". Aber während Karl Gutzkow in seiner Zeitschrift „Forum der Journal-Literatur" nur resigniert feststellt, die Berliner Journalistik sei „ein sumpfiges Feld, selbst Gold ist hier Schlamm geworden"(92), gesteht Glaßbrenner dem „Beobachter an der Spree" zu, er sei früher eher ein Localblatt gewesen und habe „für die untere Volksklasse moralischen und polischen Werth (gehabt), indem er die Thorheiten und Laster der Mitbürger an das Licht der Öffentlichkeit stellte".(93) Den Inhalt seiner eigenen Zeitschrift läßt Glaßbrenner in einem fingierten Brief loben: ein Blatt für rasches Blut, für das Zwergfell und die Milz. Kreislaufbeschleunigende, lachenerweckende Laune, stechender Witz ist sein Element! Hier grünt der Lorberrbaum, dem ich nur keinen Bettelstab wünsche! Hierher sollte sich die korpulente Berliner Muße, nicht Muse, denn diese hat der Almanach von Chamisso gepachtet, flüchten, um eine Taschenausgabe von Ihren vacanten und succesive gesammelten Gedanken zu veranstalten.(94) Glaßbrenner verlangt von einem Journal, daß es voller Humor und Geist sei, wendet sich aber gegen Extremismus, wie er ihn in der Zeitschrift „Eremit" zu entdecken glaubt: „Mit seinem Liberalismus geht diese Zeitung auch zu weit, besudelt achtbare Männer, nimmt jeden Freiheitsschwindler mit Entusiasmus auf und gefällt sich überhaupt in Extremen."(95) Als besonders verwerflich bezeichnet Glaßbrenner das Kriechertum und die Korrputheit vieler Berliner Blätter, deren Verhalten er auf die Formel bringt „Heute bin ich liberal; morgen kriech ich wie ein Aal."(96) Die Zeitschrift „Der Freimüthige", für die er später selbst arbeitet, bezeichnet er als ein „guter Mensch", weil er ein Schauspiel schon vor der Premiere lobt.(97) Drei Zeitschriften weist er nach, daß sie den gleichen Korrespondenten beschäftigen und mahnt das Publikum, künftig nur noch den Zeitschriften Vertrauen zu schenken, die nicht „durch den Magnetismus eines Goldstücks wie eine Wetterfahne nach jeder Seite zu drehen sind".(98) Saphir, den Glaßbrenner für einen käuflichen Schreiber hält, ist eine besondere Zielscheibe seiner Kritik. (99) In dem Nachfolgeblatt des „Berliner D o n Quixote", „Das Brennglas", erscheint 41
in dessen Rubrik „Neues unter der Sonne" die Rezension einer Aufführung des Königlichen Schauspielhauses. Der Rezensent zitiert darin einen unbekannten Zuschauer, der die Raupachsche Bearbeitung von Schillers „Wallenstein" als „frevelhafte Verstümmelung des Heiligthums einer ganzen Nation" bezeichnet. (100) Der Kritiker weist dieses Urteil entschieden zurück und lobt die Aufführung über alles. Die Besprechung ist unterschrieben: „250 Th.". Glaßbrenner schildert sich selbst als unbestechlich. Aber 1833 veröffentlicht der Schauspieler Moritz Rott nach einer herben Kritik Glaßbrenners an ihm ein Pamphlet gegen den Herausgeber des „Berliner Don Quixote". Er wirft ihm vor, Glaßbrenner habe ihn gebeten, „nachdem er das freie Entree der Kgl. Bühne verloren habe, ihn um Parterre-Billete dann und wann (Preis 15 Sgr) zu unterstützen". (101) Wie weit dieser Angriff auf Tatsachen beruht, ist nicht feststellbar, da sich Glaßbrenner nicht dazu geäußert hat. c. Zensurverhältnisse Adolf Glaßbrenner war mit dem Verbot des „Berliner Don Quixote" den harten Zensurgesetzen zum Opfer gefallen, wie viele seiner Kollegen in den dreißiger Jahren. Mit den .Karlsbader Beschlüssen' von 1819 hatte die Obrigkeit unter Federführung von Metternich zum Schlag gegen das erstarkende Bürgertum und die lauter werdenden Forderungen seiner geistigen Avantgarde ausgeholt. Ziel dieser politischen Restriktionsmaßnahmen war die Einschränkung der öffentlichen Kommunikation und die Politik einer möglichen öffentlichen Kontrolle zu entziehen. Schon 1810 hieß es in der Einleitung zur österreichischen Zensurverordnung: „Kein Lichtstrahl, er komme, woher er wolle, soll in Hinkunft unbeachtet und unerkannt in der Monarchie bleiben oder seiner möglichen Wirksamkeit entzogen werden."(102) Durch die Beschlüsse von Karlsbad im Jahr 1819 wurden die Burschenschaften verboten, die in den letzten Jahren immer lauter deutsche Einheit, Verfassung, Rechtsgleichheit und Volkssouveränität gefordert hatten.(103) Durch spektakuläre Feste wie dem auf der Wartburg im Oktober 1817 hatten sie große Publizität erlangt. Nun sollten die Universitäten, die sich zu Zentren des Widerstandes gegen den Feudalstaat entwickelten, unter staatliche Aufsicht gestellt werden. Für alle Druckschriften „die als tägliche Blätter oder heftweise, oder nicht über zwanzig Bogen im Druck stark sind", wurde die Präventivzensur eingeführt.(104) Damit die Zensur nicht zu lasch durchgeführt werden konnte, legte Paragraph 4 der Verordnung fest, daß jeder Bundesstaat bei Verletzung der „Würde und Sicherheit anderer Bundesstaaten" nicht nur dem Beleidigten gegenüber verantwortlich sei, sondern auch der Gesamtheit des Bundes,(105) Die Bundesversammlung wurde befugt, Schriften, in welchem deutschen Staate sie auch erscheinen mögen, wenn solche, nach dem Gutachten einer von ihr ernannten Commission, der Würde des Bundes, 42
der Sicherheit einzelner Bundesstaaten, oder der Erhaltung des Friedens und der Ruhe in Deutschland zuwiderlaufen, ohne vorhergegangene Aufforderung aus eigener Autorität durch einen Ausspruch, von welchem keine Appellation stattfindet, zu unterdrücken, und die betreffenden Regierungen sind verpflichtet, diesen Ausspruch zu vollziehen.(106) Einem Redakteur, dessen Zeitung oder Zeitschrift verboten worden war, wurde untersagt, vor Ablauf einer fünfjährigen Frist ein neues Blatt herauszugeben. U m die Verfolgung oppositioneller Schriftsteller zu vereinfachen, wurde bestimmt, daß alle Druckschriften den Namen des Verlegers, Zeitungen und Zeitschriften auch den Namen des Redakteurs nennen mußten.(107) Für Zeitungen kam der 1822 in Preußen eingeführte Zeitungsstempel und Zensurgebühren pro Zeitungsbogen hinzu.(108) Zwar wurde in Berlin eine Beschwerdestelle gegen die Anordnungen des Oberpräsidenten und der einzelnen Zensoren eingerichtet, die sich Oberzensurkollegium nannte. Doch die geforderte Neutralität dieser Stelle war eine Farce, denn das Kollegium unterstand dem Zensurminister. Im Beschwerdefall waren die Beauftragten des Ministeriums Richter und Partei zugleich.(109) Die .Karlsbader Beschlüsse' sollten ein Provisorium sein, bis „demnächst ein Definitiv-Beschluß über die rechtmäßigen Grenzen der Preßfreiheit in Deutschland" erfolgen sollte.(110) Nach fünf Jahren, in denen keinerlei Beschlüsse gefaßt wurden, lief die Frist für die einstweilige Verordnung ab. Sie wurde ohne Modifizierung verlängert. In Preußen versuchte man sich in der Diskussion u m ein Pressegesetz, das geeignet war, die liberalen Strömungen nach der Julirevolution und den Unruhen des Jahres 1830 einzudämmen. Doch das Oberzensurkollegium, das auf Geheiß des Königs Vorschläge ausarbeiten sollte, kam zu keinem brauchbaren Ergebnis. „Der Kampf lief weiter in den alten Bahnen und der Rotstift der Zensoren regierte weiter die Regungen und Meinungen eines Volkes, das mit allen Kräften um seine innere Gestaltung und staatspolitische Erneuerung rang."(111) 2. Die Zeitschriften zur Zeit des Jungen Deutschland — Das Ende des Kunstzeitalters a. Probleme einer Definition des Mediums Zeitschrift In der Periode des Jungen Deutschland, der ersten Hälfte der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts, spielte die Zeitschriftenproduktion eine bedeutende Rolle für die fortschrittlichen Kräfte in Deutschland. Die Zeitschrift begann sich zu einem der wichtigsten Publikationsmittel zur Vermittlung politischer Ideen und zur Schaffung einer Kommunikationsbasis für die bürgerliche Opposition zu entwickeln. Heine schrieb: „Journale sind unsere Festungen."(1) A u f periodisch erscheinende Publikationsmittel in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts lassen sich die Etikettierungen .Zeitung' und .Zeitschrift' nur be-
43
dingt anwenden. Bis in den Vormärz hinein sind die Unterscheidungsgrenzen fließend, da die Publikationsform dem Inhalt untergeordnet ist. Dies gilt ebenso für die Trennung von Literatur, die durch ihren Kunstwert Bedeutung über die Entstehungszeit hinaus erlangt, und Publizistik, die an aktuelle Probleme und Rezeptionsmöglichkeiten gebunden ist. Beide werden in den Jahren vor 1848 durch ihre Bedeutung als Mittel der Agitation und Propaganda bestimmt. Die „Zeitschriftsteller" selbst, wie Ludwig Börne die Schriftsteller und Publizisten seiner Zeit und seiner politischen Provenienz nennt, unterscheiden nicht deutlich in den Bezeichnungen ihrer Publikationsorgane und behelfen sich meist mit dem unbestimmteren Begriff „Journal".(2) In der Zeitschriftenforschung gab es Versuche, eine allgemeingültige Begriffsbestimmung zu liefern.(3) Doch schon Otto Groth stellt fest, daß eine einzige Definition, die für alle Typen von Zeitschriften und für alle Epochen zutrifft, nicht möglich ist: Es ist nur eine Konsequenz der außerordentlichen Verschiedenheit der tatsächlichen Erscheinungen (der Zeitschriften; Verf.), daß eine allumfassende und dabei doch scharf abgrenzende Begriffsbestimmung der Zeitschrift nie zu finden ist. Man kann die Zeitung aus der Gattung der periodischen Presse herausheben, nicht aber die Zeitschrift.(4) Um dennoch eine Trennung zu ermöglichen, unterscheidet er die Zeitschrift als die „Begrenzte" von der Zeitung als der „Unbegrenzten", unter Berücksichtigung der stärkeren Festlegung der Zeitschrift in Thematik, Form und Funktion.(5) Die Erscheinungsform der Zeitschrift und der Zeitung ist von den jeweiligen politischen und sozialen Bedingungen geprägt, unter denen sie erstellt werden. (6) Das bedeutet, daß die Grundbegriffe der Zeitungsdefinition, die von älteren Forschern versuchsweise auf die Zeitschriften des 20. Jahrhunderts angewendet worden sind, für den vorliegenden Zeitraum der Untersuchung eine Umdeutung erfahren müssen. Periodizität umschreibt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts größere Zeiträume(7); Publizität ist beschränkt auf den Bezug der Blätter über Abonnement und Buchhandel, wobei der Kreis der potentiellen Leser durch die relativ hohen Preise der Zeitschriften begrenzt ist (8); Universalität hat keine Bedeutung für die Zeitschriften im Umkreis des Jungen Deutschland, da die Tendenz der Inhalte im Vordergrund steht und die Themenkreise damit beschränkt sind; die Aktualität der Zeitschriften des Jungen Deutschland bezeichnet Walter Homberg als: situationsgebunden — im Sinne einer Gesamtdeutung des Geschichtsprozeßes. Die erstrebte Zeitnähe meint nicht ein möglichst schnelles Reportieren von Fakten, sondern die Verpflichtung, die Zeichen der Zeit zu deuten und zu erläutern. Das versuchen die Jungdeutschen in doppelter Weise: als Kritik der Relikte aus der Vergangenheit und als prophetische Antizipation der Zukunft.(9) 44
In Ludwig Börnes Ankündigung seiner Zeitschrift „Wage", die von 1818 bis 1820 in Frankfurt erschien, heißt es, ihre Aufgabe sei, „die Leser ihrem Wahn zu entziehen, als solle eine Zeitschrift nur als Sekundenzeiger an einer Uhr dienen, um den ungeordneten Puls des Staates zu verraten, nicht aber das Triebwerk selbst, welches die Gänge der Zeit regelmäßig erhält und ihre Fortschritte abmißt". (10) Aus dem Gesagten ergibt sich, daß Zeitschriften nur aus ihrem jeweiligen historischen und soziologischen Zusammenhang und auf Grund des Kommunikationsprozesses definiert werden können, den sie in der Öffentlichkeit ihrer Epoche initiieren und unterstützen.! 11) In den folgenden Kapiteln soll untersucht werden, wie die Zeitschriften des Jungen Deutschland und Adolf Glaßbrenners „Das Brennglas" von 1834, das in diesen geistigen Zusammenhang gehört, bestimmt werden durch die politischen und literarischen Zielsetzungen der Schriftsteller, die sie begründeten, sowie die gesellschaftlichen und staatlichen Zwänge, denen sie unterworfen sind. Joachim Kirchner versucht eine nähere inhaltlich orientierte Kategorisierung der einzelnen Zeitschriften. Dabei ordnet er Glaßbrenners „Berliner Don Quixote" und „Das Brennglas" ein als „Unterhaltungs- und Belehrende Zeitschriften", wozu er auch die dem Jungen Deutschland nahestehende „Mitternachtszeitung für gebildete Stände" rechnet.(12) Moritz Gottlieb Saphirs Blätter zählt er dagegen zu den ,,Theaterzeitschriften".(13) Die jungdeutschen Zeitschriften „Dioskuren", „Aurora", „Telegraph für Deutschland" sowie die geistesverwandte „Zeitung für die elegante Welt" bezeichnet er als „Literarische Zeitschriften".) 14) b. Die jungdeutsche Bewegung, ihre ideologischen Hintergründe und ihre Kommunikationsziele Zu dem engeren Kreis der Schriftsteller des Jungen Deutschland werden Karl Gutzkow, Heinrich Laube, Theodor Mündt und Ludolf Wienbarg gezählt. Das Verbot „der unter der Bezeichnung ,das junge Deutschland' oder ,die junge Literatur' bekannten literarischen Schule" vom 10.12.1835 rechnet auch Heinrich Heine hinzu.(15) Es gab jedoch keine konstituierte Gruppe dieses Namens in Deutschland. Über den Ursprung der Bezeichnung .Junges Deutschland' und der Annahme, es handele sich um einen parteiähnlichen Zusammenschluß gibt es verschiedene Versionen.! 16) Im Zusammenhang dieser Arbeit ist in erster Linie der Schlagwortcharakter des Namens von Bedeutung, unter dem die genannten Schriftsteller firmieren. Alles, was zum Wortfeld „jung" gehört, benennt in der Metaphorik des Jungen Deutschland und geistesverwandter Schriftsteller wie Adolf Glaßbrenner eine bewußte Abkehr von der Vergangenheit als dem Bestimmenden für die Normen des gegenwärtigen Handelns.) 17) Pendants des für eine zukunftsorientierte, optimistische Haltung, für geistige und politische Erneuerung stehenden Wortfelds
45
„jung" sind die Schlagwörter „Gegenwart", „Zukunft", „Bewegung", „Fortschritt", „Freiheit". Leben . . . gibt es. . . für die Jungdeutschen nur dort, wo „Gegenwart" herrscht, wo man sich also frei gemacht hat von „Vergangenheit". „Leben" bedeutet mithin „frei" sein, und der „Fortschritt ist dort an sein Ziel gekommen, wo „Freiheit" verwirklicht ist.(18) Der reichhaltige Gebrauch von Schlagwörtern und Metaphern, der hier angedeutet wird, resultiert aus dem Grad des politischen Bewußtseins der jungdeutschen Schriftsteller und dem Zwang zur Umschreibung.(19) Für die Bedeutung des Jungen Deutschland spielt es eine untergeordnete Rolle, ob eine Gruppe existierte. Der Symbolcharakter des Namens und die damit verbundenen Ideen genügten, um eine „literarisch publizistische Bewegung" herzustellen.(20) Zu dieser Bewegung konnte sich Adolf Glaßbrenner zugehörig fühlen, wenn er auch in verschiedenen literarischen und politischen Fragen nicht mit den Ansichten einzelner Schriftstellerkollegen konform ging. Aber selbst Gutzkow, Laube, Mündt und Wienbarg vertraten nicht immer dieselben Auffassungen von Literatur und Politik. Hätte sich das Junge Deutschland als Gruppe konstituiert, hätte das die Effektivität ihres publizistischen Schaffens nicht erhöht. Sie wären ohne den Rückhalt im organisierten fortschrittlichen Bürgertum immer nur ein Verein von Privatleuten geblieben. Außerdem wären sie sicher bald dem bestehenden Koalitionsverbot zum Opfer gefallen. Karl Gutzkow forderte 1832 die „Politisierung unserer Literatur".(21) Diese Politisierung beinhaltet im Selbstverständnis der Jungdeutschen nicht nur Veränderungen im Bereich der Politik, sondern auch in den gesellschaftlichen Grundhaltungen auf den Gebieten der Moral und der Religion. Das Streben der Jungdeutschen nach persönlicher und gesellschaftlicher Freiheit steht in der Tradition der Aufklärung. Ihr Vertrauen auf die formierende Kraft der Vernunft entspricht den Grundgedanken der Französischen Revolution. Die Jungdeutschen legten kein ausformulierbares Programm vor, sondern entwikkelten abstrakte Ideen. Daß ihre Erörterungen der gesellschaftlichen Bedingungen in Deutschland oberflächlich anmuten, liegt nicht nur an fehlender politischer Weitsicht, sondern vor allem an dem nicht vorhandenen Rückhalt in einer revolutionären Klasse. Zu diesem historischen Zeitpunkt war die revolutionäre Klasse im spätabsolutistischen Deutschland das Bürgertum, das sich zuvor jedoch nur vereinzelt selbstbewußt gezeigt hatte und Forderungen verlauten ließ. Die Postulate des Jungen Deutschland lassen sich nur grob auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Sie stimmen überein in der Überzeugung von der Bedeutung der Kunst für die gesellschaftliche Veränderung: „Wie die .Freiheit' die Kunst braucht, so bedarf die Kunst der .Freiheit'."(22) Dies steht nicht im Wider46
Spruch zu dem von Heine propagierten Ende des Kunstzeitalters, das er mit dem T o d Goethes gekommen sah.(23) Vielmehr war damit das Ende der Zeit eines „Literatur-Messias" gemeint, denn Der Messias der neuen Literatur wird und kann nur die Zeit selbst sein, in deren Dienst und für deren Ideen zu arbeiten sich alle einzelnen Kräfte bestimmt halten, für ihren schönsten Beruf und einzigen R u h m dies achtend, für die Sache da zu sein.(24) Ludwig Börne nennt Goethe einen ,,Stabilitätsnarren"(25), und Heine bezeichnet den ,Xenienkampf' zwischen Goethe und Schiller als „Kartoffelkrieg". Es war die Kunstperiode, es galt den Schein des Lebens, die Kunst, nicht das Leben selbst — jetzt gilt es die höchsten Interessen des Lebens selbst, die Revolution tritt in die Literatur, u n d der Krieg wird ernster.(26) Die Schlagwörter „Leben, Kunst und Wissenschaft", die im Titel von Gutzkows Zeitschrift „Deutsche Blätter" vorkommen, stehen im Mittelpunkt des literarischen Schaffens der Jungdeutschen.(27) Ihr Streben nach Gegenwartsbezogenheit bedingt die Ablehnung von Romantik und Historismus als Versuch, die Poesie und das Denken des Mittelalters auferstehen zu lassen. Sie propagieren den „Zeitgeist" als Wegweiser für Literatur und Publizistik: Der Geist der Zeit, der unsichtbar über allen Köpfen waltet, ergreift des Schriftstellers Hand und schreibt im Buch des Lebens mit dem ehernen Griffel der Geschichte, die Dichter und ästhetischen Prosaisten stehen nicht mehr wie vormals allein im Dienst der Musen, sondern auch im Dienst des Vaterlandes, und allen mächtigen Zeitbestrebungen sind sie Verbündete.(28) Als adäquate Form für eine realitätsbezogenere Schreibweise erachten sie die Prosa, die in der Literatur der Romantik zurückgedrängt worden war. Prosa eignet sich auch besser als Lyrik zur Umschiffung der Zensurklippen: „In ihren Arabesken konnte man alles verstecken, ohne sich hinter einem lyrisch-musikalischen Wortschwall verbergen zu müssen."(29) Die Prosa der Jungdeutschen grenzt sich deutlich von der Prosa eines Johann Wolfgang von Goethe ab: Jene früheren Großen unserer Literatur lebten in einer von der Weltabgeschiedenen Sphäre, weich und warm gebettet in einer verzauberten idealen Welt, und sterblichen Göttern ähnlich auf die Leiden und Freuden der wirklichen Welt hinabschauend und sich vom Opferduft der Gefühle und Wünsche des Publikums ernährend.(30) Die parallele Verwendung von Prosaformen zeigt die enge Verbindung von Zeitschrjftenproduktion und Literatur in dieser Epoche. Schon vorher war die Prosa meistbenutzte und angemessene Ausdrucksweise der Zeitschriften. Neben der Verwendung von Roman und Novelle in der Literatur erlangten Reisebeschreibungen, Briefe und Feuilletons Bedeutung. Diese Formen tauchen sowohl in den Büchern als auch den Zeitschriften der Jungdeutschen auf. Reiseberichte 47
bieten die Möglichkeit der Vermittlung von Meinung und politischer Information unter dem Deckmantel von Betrachtungen über Land und Leute. In ihrer publizistischen Form sind die Rersebereichte als Lieferanten von Bildungsgut, Belehrung, Kritik und Unterhaltung besonders verwandt.(31) Die politischen Tendenzen der jungdeutschen Kommunikationsstrategie lassen sich zusammenfassen in ihrem Kampf gegen den Adel und dessen Privilegien, die den Aufstieg des Bürgertums behinderten, neben der Propagierung von eher abstrakten Freiheitshoffnungen. Bei ihrem Einsatz für die Teilnahme der bürgerlichen Öffentlichkeit an staatlichen Institutionen und Entscheidungen äußern sie sich nicht eindeutig zu der Frage der Staatsform.(32) Gustav Kühne, der unter anderem Redakteur der „Zeitung für die elegante Welt" war, sagt von seinem Kollegen: „Gutzkow haßt die Monarchie und kann sich nicht für die Republik entscheiden."(33) Weder Gutzkow noch Laube, Mündt oder Wienbarg kämpfen in ihren Publikationen für einen Staat, in dem alle Klassen gleichberechtigt sind. Sie alle streben die Emanzipation des Bürgertums und den freien Spielraum für das Individuum an. Damit bleiben sie hinter dem Bewußtseinsgrad eines Heinrich Heine oder Ludwig Börne zurück. Den bürgerlichen Zielen dienen die Forderungen nach Meinungs-, Versammlungsund Pressefreiheit, die die Zensur, deren Strenge zur Selbstzensur treibt, zum Hauptgegner machen. (34) Ist in den Veröffentlichungen der Jungdeutschen die Rede von Not und Unterdrückung der unteren Klassen, wird darüber voller Mitleid berichtet. Sie prangern Elend an, um das Herz des Publikums zu erweichen, aber nicht, um das Publikum zur Solidarisierung in einem gemeinsamen Kampf zu bewegen. Immerhin schildern sie den Pauperismus in den Städten nicht mehr als Idylle, wie es im ausgehenden 18. Jahrhundert beliebt war. Die mangelnde Beziehung der Jungdeutschen zu den unteren Schichten der Bevölkerung hat ihre Ursache in der Herkunft der Schriftsteller. Alle sind durch ihre Biografie als im Bürgertum fest verwurzelt zu bezeichnen. Ihr Hintergrund ist kleinbürgerlich. Auf den Besuch des humanistischen Gymnasiums folgte das Studium der Philosophie und Philologie an der Universität. Um dies finanzieren zu können, gaben sie in der Freizeit Privatunterricht. Wienbarg und Laube wurden nach Abschluß des Studiums Hauslehrer bei Adelsfamilien. In ihrer Kenntnis des Bürgertums und der Aristokratie erfuhren sie gesellschaftliche Unterschiede nur nach oben. b.a. Die Zeitschriften
der
Jungdeutschen
Die Schriftsteller des Jungen Deutschland gaben bis zum Verbot ihrer Schriften 1835 eine Reihe von Zeitschriften heraus, die ihnen als „Munitions- und Bagagewagen" im „literarischen Feldzug" dienten.(35) Den wenigsten der Journale war eine lange Lebenszeit beschieden. Karl Gutzkows „Forum der Journal-Literatur"
48
erlebte wie „Phönix. Frühlingszeitung für Deutschland", dessen „Literaturblatt" Gutzkow leitete, nur einen Jahrgang.(36) Von Theodor Mündts „Schriften in bunter Reihe, zur Anregung und Unterhaltung" erschien lediglich ein Heft.(37) Das gleiche Schicksal ereilte Gutzkows „Deutsche Revue" und dessen Nachfolgeblatt, „Deutsche Blätter", das schon vor der ersten Auslieferung verboten wurde.(38) Die Verbreitung der Zeitschriften war nicht allzu groß. Walter Homberg schätzt die durchschnittliche Auflage der jungdeutschen Blätter auf eintausend Exemplare. (39) Von Gutzkows „Forum der Journal-Literatur" ist eine Auflagenhöhe von fünfhundert Exemplaren bekannt, von denen jedoch nur etwa zehn Prozent verkauft wurden.(40) Der „Literarische Zodiakus. Journal für Zeit und Leben, Wissenschaft und Kunst" erschien 1835 in vierhundert Exemplaren monatlich.(41) Die Journale waren teuer.(42) Da sie in den meisten Fällen an der konventionellen Aufmachung der bestehenden literarischen Unterhaltungsblätter wie der „Mitternachtszeitung für gebildete Stände" und der etablierten „Zeitung für die elegante Welt" festhielten, konnten sie wohl nur wenige von deren Leser abwerben.(43) Karl Gutzkow wagte es, seiner „Deutschen Revue" 1835 eine Auflagenhöhe von viertausend Exemplaren zu geben. Er hoffte auf Erfolg mit dieser Zeitschrift, die eine Synthese aus gelehrten Blättern und einer Nationalrevue sein sollte. Er wollte „die alten Hören, Athenäen usw. mit der Revue der Paris" verschmelzen.(44) Diese Unterscheidung in der medienspezifischen Orientierung zeigt sich auch in der Titelgebung der Zeitschriften. Während die Namen „Zodiakus", „Phönix", „Dioskuren" und „Aurora" mythologischen Ursprungs sind und damit an die Tradition der Zeitschriftentitel im 18. Jahrhundert anknüpfen, weisen Titel mit der Bezeichnung „Blätter" oder „Revue" eher auf den medialen Charakter als den geistigen Hintergrund hin.(45) Die Zeitschriftsteller versuchten die Zensur zu hintergehen, indem sie sich als gemäßigt bis unpolitisch darstellten. Aber selbst eine offene Distanzierung von den Ideen des verfolgten Jungen Deutschland, wie es Theodor Mündt im „Literarischen Zodiakus" tat, bot keinen Schutz vor der Zensur.(46) In ihren Programmen bieten sich die Zeitschriften der Jungdeutschen als Sammelplätze für die geistige Elite in Deutschland an. Mündts „Literarischer Zodiakus" sollte „zu gemeinnützigem Wirken einen Vereinigungspunkt der besten Köpfe Deutschlands . . . bilden, der einer literarisch zerstreuten Zeit wie der unsrigen Noth thut."(47) Gutzkows „Deutsche Revue" wollte die „ausgezeichneten literarischen Phänomene Deutschlands" ansprechen.(48) In den Zeitschriften des Jungen Deutschland kommen neben Gesinnungsgenossen der Gründer biedermeierlich-harmlose Schreiber zu Wort. Aber in besonderem Maße bemühten sich die Initiatoren um renommierte Gelehrte, die die Zensurbehörde beeindrucken und die Attraktivität der Blätter für das bildungs49
beflissene bürgerliche Lesepublikum erhöhen sollten.(49) Die jungdeutschen Zeitschriften sind im wesentlichen geprägt vom Kreis ihrer Mitarbeiter, das heißt, sie sind keine Individualzeitschriften. Ausnahmen bilden Heinrich Laubes „Aurora" sowie Karl Gutzkows „Forum der Journal-Literatur" und „Deutsche Blätter". Nachdem sich eine ganze Reihe berühmter Namen angesichts der Bedrohung des Projektes „Deutsche Revue" durch die Zensur distanziert hatten, beschloß Gutzkow, in den „Deutschen Blättern" seine „Mission" allein zu erfüllen, „ohne die die weltberühmten Schriftsteller Schulze, Meyer, Krause, Müller, W. Alexis . . . gänzlich ohne die deutschen Freifrauen."(50) Inhaltlich lassen die jungdeutschen Zeitschriften vier Schwerpunkte erkennen: Belehrung — wie im „Literarischen Zodiakus" durch zeitgeschichtliche Dokumentationen; Unterhaltung — durch Erzählungen, Novellen, Gedichte, Aphorismen; Information — im Feuilleton aus den verschiedenen Bereichen gesellschaftlichen Lebens in Form von Essays und Notizen; Kritik — in Theater- und Literaturbesprechungen. Die Kritik in den jungdeutschen Zeitschriften stellt die Bedeutung eines Werkes als Zeiterscheinung in den Vordergrund. Damit tritt die Betrachtung des gesellschaftlichen Zusammenhangs, in dem ein literarisches oder ein Werk einer anderen Kunstgattung steht, an die Stelle der immanenten Kunstkritik. Karl Gutzkow verlangt von der Kritik, daß sie „schöpferische Kraft wecken" könne. Das macht sie zu dem ersten Schritt auf dem Weg zur Veränderung.(51) Unter diesen Voraussetzungen äußert sich Kritik in erster Linie solidarisch, als Hilfe für den Dichter im Sinn Lessings. Dies steht jedoch nicht mehr im Dienst des Werkes an sich, wie es bisher in der Literatur vorherrschend war, sondern im Dienst der Beeinflussung des Publikums. Gutzkow erscheint im „Literaturblatt" des „Phönix" als Rezensent und Schriftsteller in einer Person. Während im Hauptblatt Information und Unterhaltung vorherrschen, liegt der Schwerpunkt der Literaturbeilage in Kommentar und Räsonnement: Was sich vordergründig als Orientierungshilfe über die ansteigende Zahl literarischer Neuerscheinungen ausgab, war in der Realität mehr. Einem Autor, der den engen Konnex zwischen Literatur und Leben immer wieder betont hat, boten sowohl die Literatur selbst als auch die Berichterstattung über Literatur die Möglichkeit, auf das „Leben" einzuwirken.(52) Was die Realisierung ihrer publizistischen Wünsche in Bezug auf Veränderung von Literatur und Gesellschaft betrifft, so waren die Jungdeutschen nicht sehr erfolgreich. Da die Zeitschriften alle nur von kurzer Lebensdauer waren, konnten sie nicht zu Sammelbecken der geistigen Avangarde werden. Durch ihre geringe Verbreitung erreichten die Journale nur einen kleinen Kreis innerhalb des Publikums. Das Publikum der Jungdeutschen war das bürgerliche Lesepublikum, das Bildung besaß. Die Zeitschriften mit ihren literarischen Anspielungen, fremdsprachigen 50
Zitaten und Verweisen auf kulturelle und historische Bezüge, waren ganz auf diese Zielgruppe zugeschnitten. Daher war ihre Verbreitung in den großen Städten, w o das bürgerliche Publikum vorwiegend lebte, am größten. Die Schriftsteller des Jungen Deutschland machten keine Versuche, neue Leserschichten anzusprechen. Da die Jungdeutschen nicht den Weg Heines wählten, sich zu verstellen, um in einem der großen Blätter schreiben zu dürfen, konnte lediglich die inhaltliche Ergänzung verschiedener Publikationsmittel wie Buch und Zeitschrift eine gewisse Verbreitung ihrer Ideen bringen. Ein in jeder Hinsicht politischer Schriftsteller m u ß der Sache wegen, die er verficht, der rohen Nothwendigkeit, manche bittere Zugeständnisse machen. Es giebt obscure Winkelblätter genug, worin wir unser ganzes Herz mit allen seinen Zornbränden ausschütten könnten — aber sie haben nur ein sehr dürftiges und einflußloses Publicum, und es wäre eben so gut, als wenn wir in der Bierstube oder im Kaffeehaus vor den respectiven Stammgästen schwadronirten, gleich andern großen Patrioten. Wir handeln weit klüger, wenn wir unsre Gluth mäßigen, und mit nächternen Worten, wo nicht gar unter einer Maske, in einer Zeitung uns aussprechen, die mit Recht eine Allgemeine Weltzeitung genannt wird, und vielen hunderttausend Lesern in allen Landen beiehrsam zu Händen kommt. Selbst in seiner trostlosen Verstümmlung kann hier das Wort gedeihlich wirken; die nothdürftigste Andeutung wird zuweilen zu ersprießlicher Saat in unbekanntem Boden.(53) Die Jungdeutschen waren zu abstrakt in ihren Angriffen auf die gesellschaftlichen Mißstände und in ihren Forderungen, u m konkrete Handhaben für den politischen Kampf zu geben.(54) Immerhin müssen die Schriftsteller des Jungen Deutschland als Helfer auf dem Weg zur bürgerlichen Revolution angesehen werden.(55) Das Verbot vom 10. Dezember 1835, das die Bundesversammlung für alle bereits erschienenen und zukünftigen Schriften des Jungen Deutschland aussprach, hält ihren Stellenwert als Propagandisten, nicht als Agitatoren, fest (56), die „die christliche Religion auf die frechste Weise angreifen, die bestehenden socialen Verhältnisse herabwürdigen und alle Zucht und Sittlichkeit zerstören". (57) Schon einige Monate vor dem Verbot hatte Metternich, von dem die Initiative dazu ausging, an den preußischen Minister Wittgenstein geschrieben: Gegen die Sache wird fest aufgetreten werden müssen; denn so Gotteslästerlich und unsinnig die Unternehmen auch immer sein mögen, so gefährlich sind sie dennoch — weil sie zur Verführung der Jugend und sinnloser reifer Menschen gereichen . . . Es gilt hier die Vertheidigung des Christenthum's, der Moral und der Zucht.(58) c. ,Constitutionelle' und ,Volksblätter' Die jungdeutschen Schriftsteller gehörten zu dem Teil der deutschen bürgerlichen Oppositionsbewegung, der in der Emanzipation des Bürgertums das Ziel
51
seiner politischen Wünsche sah. Doch es gab in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts bereits radikalere Stimmen. Sie wurden vor allem laut unter den im Exil in der Schweiz und in Frankreich lebenden deutschen Handwerkern und Intellektuellen sowie im Süden und Südwesten Deutschlands. Dieser Teil Deutschlands war seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts geprägt von der Herrschaft Napoleons bzw. derem geistigen und juristischen Einfluß, der sich in dem französischen Zivilrecht, dem ,Code Napoleon', und der französischen Verwaltungsordnung manifestierte.(59) Der französische Einfluß beschleunigte den Gegensatz zwischen absolutistischer Regierungsweise, die durch Polizeigewalt und Unterdrückung aufrechterhalten wurde, und dem Liberalismus, der in der bürgerlichen Öffentlichkeit immer breiteren Raum gewann. In Norddeutschland blieben die herrschenden Zustände trotz vereinzelten Auftretens deutscher .Jakobiner' am Anfang des Jahrhunderts unverändert.(60) Es entwickelte sich sogar eine Reaktion gegen die französische Herrschaft auf dem linken Rheinufer und den damit verbundenen staatsrechtlichen Errungenschaften in den südwestdeutschen Ländern. Erst nach 1830 begann der Unterschied zwischen Norden und Süden zu schwinden, und der Liberalismus breitete sich in ganz Deutschland aus.(61) Der Südwesten Deutschlands war ein Nährboden für republikanische Ideen wie sie Johann Georg August Wirth, ein Anwalt aus Bayreuth, und Philipp Jakob Siebenpfeiffer, ein Beamter in der Rheinpfalz, vertraten. Die zum Königreich Bayern gehörende Rheinpfalz wurde seit 1831 zum Zentrum oppositioneller Bewegung.(62) Die bayerische Regierung versuchte alles, um die liberalen Tendenzen zu unterdrücken. Die Steuern waren in der Rheinpfalz zum Teil doppelt so hoch wie in Altbayern.(63) Die bayerische Zollpolitik und schlechte Weinernten verschlimmerten die wirtschaftlichen Verhältnisse zusehends. Für die Oppositionellen, die vom Landtag keine Hilfe erwarteten, war die öffentliche Meinung die einzige Macht, die die Regierung zu Reformen zwingen konnte. Um sie zu bilden und zu verbreiten, brauchten sie eine freie Presse. Wirth veröffentlichte 1832 sein politisches Programm, in dem er politische Einheit Deutschlands und „Einführung der Volkssouveränität" forderte, da „dem Elende und der Erniedrigung Deutschlands nur durch eine durchgreifende politische Reform ein Ziel gesetzt werden" könne.(64) Siebenpfeiffer und Wirth brachten eine Reihe von Zeitschriften heraus, mit de•nen sie das Volk über dessen Rechte aufklären wollten. Die Verbreitung ihrer Blätter, die trotz Verboten, Verfolgung und wirtschaftlicher Schwierigkeiten in schneller Folge erschienen und wieder eingingen, war allerdings nicht sehr groß. „Kosmopolit", der ab 1.1.1831 erschien, brachte es nur auf sieben Nummern und sieben Abonnenten.(65) Von der Zeitschrift „Deutsche Tribüne", die ab Juli 1831 zuerst in München, dann in Homburg in der Rheinpfalz herauskam, wurde nahezu jede zweite Nummer konfisziert. Das Blatt trug den revolutionären Untertitel „Ein constitutionelles Tagblatt". Die Herausgeber reagierten auf 52
die anhaltende Zensurverfolgung mit dem Wechsel des Verlagortes, mit Änderungen des Titels und mit der Herausgabe zweier Nebenblätter.(66) Konnte die Zeitschrift überhaupt nicht erscheinen, behalf man sich mit der Veröffentlichung zensurfreier Flugblätter. Die süddeutschen Oppositionellen beschränkten sich nicht auf die literarische Form des politischen Kampfes. Sie gründeten neben ihrer publizistischen Produktion 1832 den ersten „Preß- und Vaterlandsverein". Er sollte die Verbreitung oppositioneller Schriften fördern, sich für verfolgte Gegner der bestehenden Ordnung einsetzen und die Forderungen nach vollständiger Pressefreiheit und deutscher Einheit institutionalisieren. In verschiedenen Städten Süddeutschlands entstanden Vereine dieser Art, und einer wurde sogar in Paris gegründet, dem immerhin 165 Exildeutsche, meist Handwerker, beigetreten sein sollen.(67) A u s diesen Aktivitäten ergab sich folgerichtig, daß sich die „Deutsche Tribüne" für die Bildung von Parteien einsetzte.(68) Dafür schien die Zeit noch nicht reif zu sein, aber die größte Zusammenkunft deutscher Oppositioneller bei dem ,Hambacher Fest' im Frühjahr 1832, zu dessen Initiatoren Siebenpfeiffer und Wirth gehörten, wurde zu einem lautstarken Plädoyer für deutsche Einheit, gesetzliche Freiheit und sogar für eine Republik. Das veranlaßte den Deutschen Bundestag zum sofortigen Verbot politischer Versammlungen, Vereine und Kundgebungen. Der Unterschied in der literarischen und politischen Konzeption zwischen den Bestrebungen der süddeutschen Oppositionellen und der Arbeit des Jungen Deutschland wird auch in der Kritik deutlich, die Georg Büchner, der Herausgeber des „Hessischen Landboten" und Mitglied der radikaldemokratischen „Gesellschaft der Menschenrechte" in Gießen und Darmstadt, an Karl Gutzkow richtete: Sie und Ihre Freunde scheinen mir nicht grade den klügsten Weg gegangen zu seyn. Die Gesellschaft mittels der Idee, von der gebildeten Klasse aus reformieren? Unmöglich! Unsere Zeit ist rein materiell, wären Sie je directer politische zu Werke gegangen, so wären Sie bald auf den Punkt gekommen, wo die Reform von selbst aufgehört hätte. Sie werden nie über den R i ß zwischen der gebildeten und ungebildeten Gesellschaft hinauskommen.(69) d. Adolf Glaßbrenner im Kontext des Jungen Deutschland Glaßbrenners Publikationen zeigen in den dreißiger Jahren formale und inhaltliche Parallelen zu denen der Schriftsteller des Jungen Deutschland. A u c h seine Zeitschriften sind ganz auf das bürgerliche Lesepublikum zugeschnitten. Gleichzeitig deutet der Beginn seiner Broschürenreihe unter dem Titel „Berlin, wie es ist und — trinkt" in dieser Zeit seine weitere Entwicklung an. Denn darin werden die unteren Volksschichten zum Gegenstand der Literatur, außerdem schaffen Form und Inhalt dieser Publikationen die Möglichkeit zur Erweiterung des Kreises seiner Leser. Eine Zeitschrift wie die immer größere Verbreitung findenden
53
„Penny-Papers", die den begrenzten Leserkreis stark ausweiteten, konnte Glaßbrenner aus wirtschaftlichen Gründen nicht herstellen.(70) In seiner Zeitschrift „Berliner Don Quixote" wird die Meldung über drei neue Journale, die nur einen halben Penny in London kosteten, kommentiert: „Kaum begreiflich bei den Kosten."(71) Aber nicht nur die Struktur der zeitgenössischen Medienentwicklung rückte Glaßbrenner an die Seite des Jungen Deutschland, sondern auch Übereinstimmungen in literarischen und politischen Grundsätzen. Dies war bedingt durch die Etappe der bürgerlichen Oppositionsbewegung in Preußen und Norddeutschland allgemein, sowie die spezifische Situation Berlins, der Stadt, die Glaßbrenner und seine schriftstellerische Arbeit prägte. Berlin war um 1830 eine Residenz, keine Metropole. Die Stadt war der Ort des königlichen Hofes und bestimmt von dessen Leben. Das Bürgertum war zahlenmäßig gering und hatte keine große gesellschaftliche Bedeutung. In Abwandlung eines Satzes von Heinrich Mann läßt sich sagen, „die große Stadt lebte von der Gnade ihres Fürsten". Es gab zwar geistige Zentren wie die Salons der Rahel Varnhagen, Bettina von Arnim oder Henriette Herz, aber die Mehrzahl der Bürger begnügte sich mit .Ästhetischen Tees', die Ludwig Robert beschreibt: Blumen und Kerzen Spiegel und Lichter geschnürte Herzen Bewachte Gesichter. — Dort Federn und Spitzen Und türkische Shawle Sind Damen, die sitzen Im Kreise im Saale, und ferner stehen Die Söhne, die Gatten, Schwarz wie die Krähen Mit weißen Krawatten — Man öffnet zum Hackwerk Das Piano-Forte, Nun trillern und stümpern Die Virtuosen, Und Tassen klimpern und Diener tosen. Es flüstern und zischeln Die Frau'n unersättlich Und rufen dazwischen Ach Bravo! wie göttlichl(72) Und noch 1855 charakterisiert Johannes Trojan, ein Freund und Mitarbeiter Gtaßbrenners, Berlin als „angenehme M i t t e l s t a d t . . . von etwa fünfhunderttau54
send Einwohnern, und wenn gesagt wurde: Berlin wird Weltstadt! so lachte man darüber, wie über einen guten Spaß."{73) Zwanzig Jahre zuvor hätte noch nicht einmal jemand Berlin eine Zukunft als Weltstadt vorausgesagt. Berlin hatte 1835 circa zweihundertfünfzigtausend Einwohner, von denen ein großer Teil Handwerker waren. Die Zahl der reichen Burger, zu denen Kauflcute, Fabrikanten oder Bankiers gehörten, war verschwindend gering. Ein Viertel der Berliner Bevölkerung zählt Ernst Dronke zu den „untersten Schichten".(74) Das Wachstum und die Entwicklung der Industrie setzte erst in den vierziger Jahren ein, und damit die zunehmende Bedeutung des Bürgertums und die Entstehung des Proletariats. Glaßbrenner kam wie Gutzkow, Laube, Mündt und Wienbarg aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Er besuchte wie sie das Gymnasium, jedoch ohne Abschluß. Während seine Kollegen nach dem Abitur mit dem Studium begannen, ging Glaßbrenner im Seidenhandel in die Lehre und konnte lediglich in der Freizeit Vorlesungen an der Universität besuchen. Er hatte keinen akademischen Grad und kritisierte sein Leben lang „Papiergelehrte", deren Blick auf die Realität durch Buchstaben verstellt sei. Glaßbrenner hatte in seiner Jugend nie engen Kontakt zu der Aristokratie. Er begann früh, für die unteren Schichten einzutreten, nicht lediglich gegen den Adel, wie die Schriftsteller des Jungen Deutschland. d.a. Adolf Glaßbrenners „Das Brennglas. Eine humoristische
Zeitschrift"
Da Glaßbrenner 1834 noch unter dem Verbot des „Berliner Don Quixote" und damit der Berufsausübung für fünf Jahre stand, ließ er seine neue Zeitschriftengründung im Verlag von Georg Wigand in Leipzig erscheinen. Gedruckt wurde „Das Brennglas", das vom 3. Oktober bis zum Ende Dezember 1834 bestand, in der Hofbuchdruckerei in Altenburg. Das Blatt, das es nur auf neununddreißig Nummern und ganze 156 Seiten brachte, gleicht äußerlich Eduard Maria Ottingers „Till Eulenspiegel". Eine Nummer besteht aus vier Seiten in Folio, zweispaltig, ohne Illustrationen. „Das Brennglas" erschien dreimal wöchentlich, einmal in der Woche mit einer Literaturbeilage. Der Preis betrug acht Taler jährlich für die Pränumeration. In der ersten Nummer verteidigt Glaßbrenner die Höhe des Preises, der ungefähr denen der jungdeutschen Zeitschriften entspricht. Er vergleicht die bestehenden Zeitungen und Zeitschriften in Berlin und stellt fest, daß sie alle so viel wie „Das Brennglas" kosten oder gar mehr, seiner Ansicht nach aber nichts dem Preis entsprechendes für den Leser bieten.(75) Am Ende kommt er zu dem Resultat, daß große Summen für nichts gegeben werden, und daß es sich wohl der Mühe verlohnen dürfe, für ein humoristisches Brenn-
55
glas 8 Thlr. auszugeben, das alle lichten Strahlen, welche hin und wieder durch die trüben Wolken der Zeit blicken, in sich concentriren soll, um Ihre Herzen für Recht, Wahrheit und edlen Lebensgenuß zu entzünden.(76) Auflagenziffern für „Das Brennglas" liegen nicht vor. Da die Zeitschrift nicht verboten wurde, ist wahrscheinlich, daß sie nach zwei Monaten an wirtschaftlichen Schwierigkeiten scheiterte. Als Mitarbeiter verzeichnet „Das Brennglas" W. Achat, der schon Beiträge für den „Berliner D o n Q u i x o t e " geliefert hatte, den Kapellmeister und Komponisten Hieronymus Thrun, mit dem Glaßbrenner bis zu seinem T o d befreundet war, Wilhelm Fischer und Kosten, die auch Gedichte für Glaßbrenners „Taschenbuch für ernste und heitere Poesie" lieferten. Über sie konnte ich sowenig Angaben finden wie über C. Bergen und G. Reben, dessen Name lediglich einmal in Heinrich Laubes Zeitschrift „ A u r o r a " als Verfasser von „Opern und Singspielen" genannt wird.(77) Bei den interpretationsfähigen Pseudonymen Gottlieb Lum-Lum, der aus China berichtet, Caesar von Nihil und X . v. U. dürfte es sich um Glaßbrenner selbst handeln. Die ersten beiden Seiten in „Das Brennglas" sind Prosatexten vorbehalten, nur einmal erscheint hier eine „Lyrische Scene". Die Prosatexte bestehen aus Kritiken zeitgenössischer Musikzeitschriften, einem Ausschnitt aus Edward BulwerLyttons Roman „Die letzten Tage von Pompeji" in Fortsetzungen, Humoresken, satirischen Novellen und Erzählungen, Besprechungen von aktuellen Ereignissen auf dem kulturellen und gesellschaftlichen Sektor in Berlin, fingierten und tatsächlichen Berichten aus dem Ausland. Darauf folgen einzelne Gedichte, Epigramme, Aphorismen, Sprüche, Rätsel und „Unverbürgte Nachrichten" aus dem Ausland. Die letzte Seite enthält die Rubrik „Neues unter der S o n n e " mit kurzen Meldungen aus der Gesellschaft, politischen Anspielungen, Klatsch sowie Notizen zu Erfindungen und Entdeckungen in Technik und Wissenschaft. Das Ende bilden Theaternotizen und gelegentliche literarische Anzeigen. Die inhaltlichen Schwerpunkte gleichen denen der jungdeutschen Zeitschriften, die sich subsummieren lassen unter Belehrung und Unterhaltung, Kritik und Information.(78) Bei Glaßbrenner sind sie jedoch fast immer in humoristische Form gekleidet. Die Haupttendenzen in „Das Brennglas" liegen in der Variierung von Adels- und Philisterkritik, Offenlegung von staatlichem Zwang, dargestellt an ausländischen Themen, Kulturkritik, in der Theatermißstände angeprangert, gesinnungslose Zeitungsschreiber und die von den Romantikern repräsentierte Restauration in der Kunst angegriffen werden. Texte, die der reinen Unterhaltung dienen, sind dabei in der Minderzahl. Glaßbrenner beginnt in „Das Brennglas" den Weg zur Synthese von Witz, Humor und politischer Botschaft, der in den politischen Witzblättern des Revolutionsjahres 1848 seinen vorläufigen Höhepunkt findet. Das „Literaturblatt" zu „Das Brennglas", redigiert von Prof. Oskar Ludwig Bernhard Wolff, der als Novellist, Anthologe u n d Übersetzer in Jena lebte.
56
gleicht dem Hauptblatt in der Form, es unterscheidet sich jedoch in Tendenz und Aufbau. Wie „Das Brennglas" enthält die Literaturbeilage jeweils vier Seiten mit einer oder zwei Spalten. Der Titelkopf erscheint ohne Vignette. Das „Literaturblatt" besteht ausschließlich aus Buchbesprechungen und gelegentlichen Buchanzeigen. Wolff bezeichnet seine Beilage als „Begleiter des Brenngiases", das „als Fregatte mein Literaturblatt auf dem Strom der Zeit bugsiert".(79) Es sei aber „streng von demselben getrennt".(80) Während Glaßbrenner seine politische Tendenz durchblicken läßt und die Zeitschrift ganz von ihrem Herausgeber und Redakteur geprägt ist, kündigt Wolff in der ersten Nummer seines „Literaturblattes" an, er fühle sich der „strengsten Wahrheit und Unparteilichkeit" verpflichtet.(81) Neben dem Streben um Objektivität unterstreicht er seine entschiedene Wendung gegen „alles Politisiren und Kannegießern".(82) Diesem Selbstverständnis entsprechend äußert er sich skeptisch über die zeitgenössische Tendenz der Politisierung der Poesie, bemerkt jedoch gleichzeitig: Betrachtet man die Leistungen Heine's, Börne's, Laube's und ihrer vielen Anhänger genauer, so wird man nicht läugnen können, daß die Grundidee ihres Strebens, jetzt und zu allen Zeiten eine lobenswerthe sei, insofern als ihnen nämlich das Alte, Bestehende, tadelnswerth, schädlich, selbst gefährlich erscheint, und sie Neues, Besseres an dessen Stelle zu bringen trachten.(83) Im „Literaturblatt" wird deutlich, daß Wolff nicht nur Sympathie für die Ziele des Jungen Deutschland äußert, sondern ihm auch in seiner geistigen Grundhaltung nahesteht. Wie die Schriftsteller des Jungen Deutschland tritt Wolff für die Verbindung von Geist und Leben ein, und wie sie bleibt er in seinem elitären Rahmen, der ihn euphorisch ausrufen läßt: Die schönste Frucht unserer sturmbewegten Zeit ist die allgemeine Verbreitung wissenschaftlicher Bildung und die rege Verbindung des Geistes derselben mit dem Leben. Der Gedanke erringt die Herrschaft fast überall, frei wird er geweckt, frei genährt, frei mitgetheilt, Jedem gleichviel weß Standes und Glaubens zugänglich, wenn er ihn fassen, sich seiner erfreuen mag. Der Gedanke ist der wahre constitutionelle Herrscher der Welt, und alle wahrhaft geistig Durchgebildeten seine getreuen Stände.(84) d.b. Beginn der Synthese von Witz, Humor und politischer
Botschaft
Brennglas", der Titel der Zeitschrift, ist auch Glaßbrenners Pseudonym. Franz Diederich beschreibt die Funktion eines Brennglases: Ein Brennglas ist ein nützlich Gerät in der Arbeit des Lebens. Es ist dem Auge ein unmittelbarer Helfer. Versteckte Dinge der Wirklichkeit zwingt es hervor, daß sie groß und breit dastehen und sich in ihre Poren hinein anschauen lassen müssen. Ein höchst unbequemes Muß für mancherlei lästiges Erdenzeug,
57
das aus umwallten Schlupfwinkeln hervor ungestraft Raub, Blutsaugerei und Aegeres treiben darf. Aber unbequemer noch ist die zweite Zauberkraft, deren ein Brennglas fähig ist und von dem eigentlich sein Name stammt. Es hat zu seinem Teile Macht über das Sonnenlicht, kann dessen Strahlen zu Dolchspitzen, heißen Bündeln zusammenschließen und mit dieser Glutpike totschmerzlich sengen, den Pelz brennen und Feuer anstiften. Eine peinliche Macht, ein Greuel allem, was kein Licht vertragen kann.(85) Wie die bildreiche Erklärung Diederichs deutlich macht, bewegt sich der Titel von Glaßbrenners Zeitschrift in der Metaphorik des Jungen Deutschland. Die Sonne gehört zum Bildfeld von „Frühling" und „Morgen", die für die Freiheit stehen, während „Dunkelheit", „Nacht" und „Winter" Reaktion, Unterdrückung und die „eiskalte Zone des Despotismus" symbolisieren, wie es Friedrich Hölderlin ausdrückt. Ohne näher darauf einzugehen, bezeichnet sich Glaßbrenner als zugehörig: „ 0 , warum muß auch ich gerade zum jungen Deutschland gehören? Warum hat mich meine Mutter zu früh geboren?"(86) Da dieser Ausspruch in einem Artikel gegen die Streitschrift des Kriegsrates Müchler steht (87), scheint sich Glaßbrenner hier in erster Linie in der Verfolgung zu solidarisieren, der er ebenso wie die Jungdeutschen ausgesetzt ist. In „Das Brennglas" finden sich sonst keine direkten Bekenntnisse zum Jungen Deutschland. Aus seiner Korrespondenz geht hervor, daß Glaßbrenner seit seiner Jugend mit Karl Gutzkow befreundet war und persönliche Kontakte zu Heinrich Laube und Theodor Mündt hatte. Bei der Kritik an Schriftstellerkollegen und zeitgenössischen Journalen klammert er die Jungdeutschen und ihre Zeitschriften in dieser Epoche noch aus. Es handelt sich dabei sicher nicht nur um persönliche Rücksichtnahme, vielmehr gehörten die Jungdeutschen zu den fortschrittlichsten Schriftstellern ihrer Zeit, und Glaßbrenner stimmte in grundlegenden Tendenzen mit ihnen überein, wie eine Analyse seiner Zeitschrift zeigt. Schon im „Berliner Don Quixote" hatte er im Sinn der Jungdeutschen Goethe kritisiert. Diese Kritik ist nicht nur von geistesgeschichtlicher Bedeutung, sondern sie macht auch Glaßbrenners Auffassung von der Stellung des Dichters in der Gesellschaft deutlich. Glaßbrenner bewundert zwar Goethes Gestaltungskraft, kritisiert ihn aber als Bourgeois, dem er den Citoyen Schiller entgegenhält: „Wenn ich den Namen Schiller sehe, nehme ich den Hut ab, wie ein Bürgerlicher, wenn ich Göthe sehe, salutire ich wie ein Militair — das ist der Unterschied."(88) In seinem Tagebuch wird der Unterschied ausführlicher erklärt: Es ist klar, daß in dieser geistigen Klarheit und marmornen Glätte der Götheschen Prosa ein Zauber liegt, und ein großer Zauber, aber wie dürfen uns nicht verhehlen, daß in dieser Sprache keine dichterische, sondern die Sprache des Hoflebens ist, eine feine, eiskalte, zerlegende und betrachtende... Es ist nicht zu leugnen, daß Göthe mit seinem scharf definierten, tiefen Geiste und sei-
58
nem feinen Geschmacke derjenige Dichter ist, welcher am meisten bildet und namentlich den sogenannten vornehmen Leuten schmeichelt, aber erheben und erwärmen kann er einen geistig-gesunden, bewußt-natürlichen Menschen fast niemals. Göthe ist der größte deutsche Dichter des politisch civilisirten, Schiller des jugendlich schaffenden, des wahren Menschen.(89) Noch in seinen letzten Lebensjahren ist Goethe ein abschreckendes Beispiel des aristokratischen Literaten für Glaßbrenner. 1869 schreibt er in seiner „Berliner Montags-Zeitung": „Goethe, der an Deutschland politisch ebensoviel verschuldet, als wir ihm literarisch verdanken . . . Seine Indifferenz gegen alles, was Völkerschicksal heißt, ist erhaben niederträchtig."(90) Glaßbrenner bezeichnet seine ideologische Ausrichtung in „Das Brennglas" als die des Liberalismus, ohne dies jedoch näher zu definieren. Er grenzt sich lediglich von falschem Liberalismus ab: „Die anscheinende Liberalität ist die Quelle der schwersten Bedrückung, so wie die wirkliche die beste Stütze der Gerechtigkeit ist."(91) Im „Berliner Don Quixote" heißt es über den „Berliner Liberalismus": Wenn die Leute den Liberalismus besitzen, schenken sie ihn noch lange nicht weg. Sie wickeln ihn behutsam in Baumwolle, verwahren ihn und putzen sich wieder damit auf, wenn sie ihr Amt oder gar ihr Geld verloren haben.(92) Glaßbrenners Kritik am Adel als der Inkarnation spätfeudaler Macht, als die auch die Jungdeutschen die Aristokratie angreifen, ist in „Das Brennglas" noch in erster Linie moralischer Art. Er verurteilt das dekadente Hofleben und die Falschheit und Heuchelei der Aristokraten. Gleichzeitig macht er sie wegen der Ränke, die sie schmieden, für die Mißwirtschaft im Land verantwortlich. Glaßbrenner konfrontiert die Schlechtigkeit des Adels in einem „Charaktergemälde in 2 Akten" einerseits mit bürgerlichen und intellektuellen Tugenden, andererseits mit einem gütigen und aufgeklärten Monarchen. Darin wird der ehemalige Hofnarr Arthello, der Titelheld, in der Einsamkeit des Waldes vorgestellt, in der er „Ruhe, Zufriedenheit, Unschuld, Tugend" findet.(93) Er t r i f f t im Wald auf eine höfische Jagdgesellschaft. Die Hofschranzen unterbrechen nicht einmal hier ihren intriganten und selbstsüchtigen Lebenskampf. Sie schrecken nicht vor Erpressung und Mord zurück, um einen Konkurrenten am Hof auszuschalten. Schon die Namen der Höflinge charakterisieren sie. Dr. Schwarz ist ein kriecherischer Heuchler, der täglich zur Kirche rennt. Ein flatterhafter Hofjunker heißt von Papillon. Von Lisper bezeichnet sich selbst als „sehr kommode", er liebe „die Kabale nur in sofern, als sie mir nicht viel Mühe macht".(94) Arthello lehnt die Bitte des Königs, der die Jagd leitet und ihn wieder an den Hof holen will, ab. Er wehrt sich auch gegen den Versuch von Lispers, ihn für eine Intrige gegen einen anderen Höfling zu gewinnen. Er erbittet sich von dem positiv gezeichneten Regenten lediglich, „daß der Fürst die Gnade haben möchte, mir mein Lebtag keine Gnade zu gewähren".(95) Indem er eine ganze Reihe
59
solch scheinbar sinnloser Bitten vorbringt, deckt er die Oberflächlichkeit und mangelnde Redlichkeit von Politik und Leben am Hof auf. Caesar von Nihil berichtet an anderer Stelle über die „ V o n — Herren", daß der Adel, um sich zu unterscheiden, des Sonntags die Hemden nicht wechselt, und diesen Tag überhaupt für „schauderhaft langweilig!" h ä l t . . . Den Adligen ist der Sonntag schon deshalb sehr langweilig und unangenehm, weil das Volk an diesem Tage nichts thut, und sie folglich keinen Vorzug haben. (96) In Texten von Glaßbrenner und seinen Mitarbeitern, in denen sie die Aristokratie angreifen, wird oft Adelskritik mit Kritik an Bürgerlichen gepaart, die mit allen Mitteln nach Titel und Ansehen streben. G. Bergen schildert in einer „Tragischen Humoresken" die Geschichte des Schneiders Feaps, der seine Tochter mit einem vermeintlichen polnischen Grafen verheiraten will. U m dem Schwiegersohn ebenbürtig zu werden, erbittet er sich die Erhebung in den Adelsstand vom Landesfürsten. Erst nach der Entlarvung des Bräutigams als Hochstapler ist der „Kleiderkünstler" von seinem Drang nach „ H ö h e r e m " geheilt, und die Tochter vermählt sich mit einem Staatsbeamten aus dem „eben so achtbaren Bürgerstand". (97) Doch auch der Durchschnittsbürger ohne den unbezwingbaren Drang zu Höherem bleibt nicht ungeschoren. Caesar von Nihil kreidet die Einfalt des Bürgers an, der am Sonntag „seelenvergnügt" ist, wenn er „des Abends heimfahren kann, ohne Schläge aufgeladen zu haben".(98) Er gehört zu dem Mittelstand, der dem in „Skizzen aus Spanien im Jahre 1 8 3 4 " beschriebenen gleicht: Der Mittelstand der Spanier lebt im Allgemeinen in der größten Erschlaffung und Trägheit; man merkt bei ihm wenig von dem größten politischen Sturm, der das Land durchbebt. Wer nur einigermaßen wohlhabend ist, hat nur zwei Wünsche: Ruhe und Zigarre.(99) Das Streben nach Ruhe und Ordnung, der Drang nach Anpassung an das Bestehende zeichnen für Glaßbrenner den mittelständischen Bürger aus, den er in allen seinen Publikationen als Philister verurteilt. „ E d m u n d " artikuliert in fingierten Liebesbriefen an „ L a u r a " Glaßbrenners Philisterkritik. A u f einer Reise sitzt er in der Schnellpost mit drei Philistern zusammen, die er neben den „ D u m m e n " als die langweiligsten Menschen der Welt bezeichnet. Er führt sie an der Nase herum, indem er den Geistesgestörten spielt. Mit Hilfe dieser .Narrenfreiheit' grenzt er sich von den Philistern ab, denn er gehe lieber mit einem gescheidten Manne um, dessen Rock kein Federchen mehr festhalten kann, als mit Leuten, denen der liebe Gott, als er sie in die Welt setzte, statt des Verstandes, Vatermörder und Manschetten gab.(100)
60
Der Unterschied zeigt sich in der Beurteilung der französischen Julirevolution von 1830, von der Edmund sagt, sie sei „äußerst schön durchgeführt" und erwecke „deshalb Nachahmung".(101) Sein Nachbar dagegen verabscheut sie als „scheußliche Revolution, die an allem unserem Unglück schuld ist".(102) Edmund beschreibt sich selbst als Schriftsteller, der zuweilen ein oder auch zwei Wörtchen gegen den Diener-Despotismus habe fallen lassen, und namentlich, daß ich nicht kriechen, schmeicheln und noch andere Pudel-Kunststückchen kann, daß ich ein Mensch, also weder Hund noch Schaf bin.(102) Glaßbrenner wendet sich in allen Bereichen des geistigen und gesellschaftlichen Lebens gegen Borniertheit und Unfreiheit, auch in bezug auf die Religion. Im Sinn eines aufgeklärten Deismus wendet er sich gegen Institutionen und Dogmen der herrschenden Kirche. Er vertritt die Ansicht, daß die Natur der beste Ort zum Beten sei. Sein Mitarbeiter Kosten beschreibt in dem Gedicht „Der D o m " den Wald als schönstes Gotteshaus: Und was das allerschönste A n diesem D o m ist: Ein Jeder kann drin beten, Türk', Jude oder Christ.! 103) Glaßbrenners Kritik am Klerus verdeutlicht eine Meldung aus Spanien in der Rubrik „Unverbürgte Nachrichten". Darin heißt es, ein Geistlicher sei plötzlich gestorben, worauf sein Körper obduziert worden sei. Dabei fand man in seinem Magen „eine Abschrift der neuen spanischen Verfassung. A u s der genaueren Untersuchung seines inneren Organismus ging hervor, daß er diese Speise nicht verdauen konnte. Sonst war er sehr fett und hatte nur ein kleines Herz."(104) Da die Zensurverhältnisse eine unverblümte Auseinandersetzung der Publizisten mit den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen ihres Landes nicht zuließen, waren sie gezwungen, Umschreibungen und Bilder zu verwenden. Glaßbrenner benutzt in „Das Brennglas", wie schon im „Berliner D o n Q u i x o t e " und später in fast allen seinen Publikationen, China als Bild für ein Land der totalen Knechtschaft und Entmündigung seiner Bevölkerung sowie der Pervertierung der Machtverhältnisse. In gleicher Weise taucht „ C h i n a " bei Hoffmann von Fallersleben und bei Heinrich Heine auf, der 1844 den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. in seinen neuen Gedichten als „Kaiser von C h i n a " darstellt. Wiederkehrendes Sujet ist China auch in den politischen Witzblättern des Jahres 1848, in denen es für das überwunden geglaubte absolutistische Deutschland steht. Gottlieb L u m - L u m liefert „Specielle Meldungen über C h i n a " in Fortsetzungen für „Das Brennglas". Er beschreibt, daß der Palast des chinesischen Kaisers von Kanonen umringt sei, „welche das kaiserliche Vertrauen zu seinen Unterthanen daselbst aufplanzen ließ". Die kaiserlichen Insignien „stellen das ganze chinesische Reich von einer Kette umgeben dar". Eingaben seiner Untertanen liest der
61
Kaiser nie, sie landen bei seinen Ministern. Nach „drei Sonnenjahren" erhält der Bittsteller die Mahnung, „das Querulieren künftig zu unterlassen". Der Kaiser wird morgens geweckt, indem einer seiner Hofräte „mit einem verbotenen Buche seine Nasenspitze berührt".(105) In der Fortsetzung des Berichts wird die chinesische Kindererziehung geschildert. Mädchen erzieht man grundsätzlich zu Hausfrauen. Knaben besuchen die kaiserlichen Schulen und erhalten Unterricht im Lobgesang auf den Kaiser, in „vaterländischer Geschichte oder Prügel", im Hungern und in „normalen" Disziplinen wie Schreiben und Malen. Mittags werden die Schüler in die kaiserliche Restauration geführt, wo sie zur Schonung des Magens und zur Gewöhnung an Entbehrungen „die Lehrer essen sehen, selber aber nichts bekommen".(106) Das Land China steht nicht allein, in der Rubrik „Neues unter der S o n n e " erfährt der Leser: „ I n Conchinchina ist eine Christenverfolgung ausgebrochen. — Merkwürdig! daß jetzt überall Verfolgungen ausbrechen und oft viel schlimmere als diese!"( 107) Bei einer Meldung wie dieser ist es unerheblich, ob der Ort des Geschehens fiktiv ist oder real. Die Bedeutung liegt in der Übertragbarkeit auf deutsche Verhältnisse. Die Form des zu erstrebenden idealen Staates, dem Gegensatz zu China, vergleicht Glaßbrenner nur sehr abstrakt mit einer Pyramide, die alsdann schön ist, wenn sie gehöriges Verhältnis hat, unten auf einem guten Grund ruht, und nach der Spitze zu immer dergestalt abnimmt, daß das Unterste das Oberste völlig, aber auch nicht mit der mindesten Beschwerde trägt. (108) Für die Spitze bedeutet das: Wohl dem Lande, das einen selbstregierenden König hat, und einen König, der klug, gerecht und freisinnig ist, der nie die Würde und die Rechte der Menschheit vergißt, der die Wahrheit in jeder Form liebt, und seinen Thron nicht mit eisernen Mauern umschließt; der seinen Dank im Glück seines Volkes, nicht aber in den Versen hungriger Poeten findet, dessen Wache die Liebe seiner Unterthanen, nicht die Schwerter seiner Söldlinge sind!"(109) Dem liegt die Auffassung von der Gleichheit des Menschen bei der Geburt zugrunde: Es ist gewiß, daß die Geburt eben so wenig einen Unterschied zwischen den Menschen hervorbringt, als zwischen einem Esel, dessen Vater Dünger und einem andern, dessen Vater Reliquien trug. — Erziehung macht den großen Unterschied, Talente machen ihn außerordentlich, Vermögen auffallend.) 110) Wie in den jungdeutschen Zeitschriften nimmt die Theaterkritik in „Das Brennglas" breiten Raum ein. Da die Ebene der Politik für das Räsonnement weitgehend verschlossen war, wurde die kulturelle Institution Theater zu einem bedeutenden Themenbereich. Das Theater und die Diskussion über Stücke und
62
Aufführungen waren in dem Deutschland ohne Pressefreiheit eine Möglichkeit, bestehende gesellschaftliche Verhältnisse unter dem Vorwand der Kulturkritik anzuprangern. Eduard Maria Öttinger reagiert auf den Vorwurf, er interessiere sich nur für das Theater, mit der Frage, „ob man z. B. in Marokko, wo bekannterweise keine Preßfreiheit herrscht, über andere Dinge, als über den herben Theaterthee sich auslassen könne".(111) Gleichzeitig schlägt sich in den Zeitschriften nieder, daß das Theater ein Mittelpunkt des bürgerlichen gesellschaftlichen Lebens im Berlin der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert war. Besucher gingen nicht selten mehrere Male in ein Stück. Peter Hacks spricht von einer „starken Verbundenheit und Vertrautheit" des Publikums mit dem Theater.(112) Die Qualität der Stücke ließ jedoch zu wünschen übrig. Die Theatermode war weitgehen an ausländischen Vorbildern orientiert. Autoren produzierten um jeden Preis. In „Das Brennglas" verurteilt Glaßbrenner die wirklichkeitsfremde Tendenz des zeitgenössischen Theaters. Der Kritiker Kukuk Waldbruder erzählt in einem „Frescobild aus dem Leben eines Kritikers", wie ihn der Teufel zu einer Opernaufführung in der Hölle holte. Sie dauerte zwölf Stunden und an ihrem Zustandekommen waren so ziemlich alle Schriftsteller und Musiker beteiligt, die Glaßbrenner als rückwärtsgewandte Romantiker ablehnt, und von denen es an anderer Stelle heißt: Vorzüglich aber tummeln einige Schriftsteller ihren überspannten, hochtrabenden Pegasus, den man füglich einen lendenlahmen, abgemagerten Klepper, wie Don Quixote's Rozinante, nennen kann, in dem trüben Sagenkreis des Mittelalters und in noch früherer Zeit umher, weil ihnen in ihrer Schwachköpfigkeit das klare Sonnenlicht der neuern Zeit und besonders der Gegenwart zu nüchtern und zu poetischen Erzeugnissen untauglich erscheint.(113) Das Stück, das in dem „infernalischen Hoftheater" gespielt wird, heißt: Orlando Furioso's Heldenthaten, Liebe, Wahnsinn und Tod, oder: Pipchen der kleine Stachelbeerfresser unter den Amazonen. Große heroisch-komische, burlesk-tragische, neu-romantische Zauber-Oper in 4 Akten, gedichtet von Karl Müchler, Benjamin Kaim, August Bürk und Julius Mansfeldt. Musik von Meyerbeer, Auber, Bellini und Morlachi. NB. Die Ouvertüre ist von Robert Schuhu.(114) In „Das Brennglas" zeigt Glaßbrenner Untugenden und Sinnlosigkeiten zeitgenössischer Theateraufführungen in einer naturalistischen Beschreibung eines mit Erfolg am Berliner Hof-Theater aufgeführten Stücks. Er macht die Zigeunermode in romantischen Theaterstücken wie Pius Alexander Wolfs „Preciosa" des Jahres 1821 lächerlich. Gleichzeitig gelingt ihm eine unterhaltsame Form der Theaterkritik, die auf leeren Pathos verzichtet: Der Vorhang fliegt auf, und man sieht eine Schaar Zigeuner, die sich schlauer Weise dicht vor den Souffleurkasten gelegt haben . . . Da er ein geborener 63
Graf ist, giebt er den Ton an, wenn auch mit einer sehr schlechten Stimme . . . Einzelne Stellen sind genial, z. B. ein Paar Takte bei dem Moment, wo der alte Graf von Hohenegk vor seinen verlorenen Sohn Polgar t r i t t und ihn von Kopf bis Fuß mustert.! 115) Obgleich Glaßbrenner das Stück zerreißt, differenziert er in der Beurteilung der beteiligten Personen. Er kritisiert Emil Devrient als Autor des in der „deutschromantischen Manier" geschriebenen Stücks, lobt ihn aber als Schauspieler. In der Hannoverschen „Posaune", für die Glaßbrenner in den dreißiger Jahren Beiträge liefert, versucht er erfolgreiche Theaterdichter wie Ernst Raupach und Karl von Holtei als überbewertet zu entlarven. Holtei bezeichnet er als „ledern", und seinen Erfolg führt er auf die massive Unterstützung seiner Freunde in der „Mittwochsgesellschaft", einem Schriftstellerclub, zurück. Für Glaßbrenner bestimmen die „feilen Scribler" in Berlin Erfolg oder Mißerfolg eines Theaterstücks.) 116) Glaßbrenner beschränkt sich jedoch nicht immer auf sachliche Kritik, sondern nutzt auch persönliche Schwächen der Kritisierten aus. Vor dieser Form persönlicher Bloßstellung schreckte auch etwa Ludwig Börne nicht zurück, und Eduard Maria Ottinger wurde im November 1829 wegen Beleidigung des Redakteurs der „Vossischen Zeitung", Ludwig Rellstab, zu einer dreiwöchigen Gefängnisstrafe verurteilte 117) Glaßbrenner führt als Beweis für ihre mangelnde Befähigung an, daß der Schriftsteller Friedrich Wilhelm Gubitz, der Theaterkritiker der „Vossischen Zeitung", eigentlich Holzschneider und der Direktor des Königstädtischen Theaters ein ehemaliger Pferdehändler sei. Die Neoromantik ist für Glaßbrenner nicht nur im Wort, sondern vor allem auch in der Musik ein wiederkehrendes Angriffsziel. Er beanstandet, daß in der herrschenden Musikmode das am meisten gelobt werde, was am unverständlichsten sei: „Der Kenner kann das Riesenwerk erst nach 500maligem Hören ganz fassen, verstehen und einsehen, daß das Werk gigantisch tiefsinnig ist, und nie verstanden, also auch nie ganz gewürdigt werden kann." n>e(d)e fein« 3"iaé ift entlief) ber t o b «nberé, als tin Bintetot am Scben. — Seifpiel. * e t ift bem Seifte M OTenfiften eigen, ba§ Seifpiele nitmanben beffern. S i e iöorljeiten ber ffiä« tcr finb für ibre Einher »crlori'n, jecea @efc(jled)t mu( feine eigenen begeben. — S.on»erfat.ion. * S i e Äunft ber (Jonoevfation beftebt meniger bariu, tilg man piel Seift j e i g t , a i i t a r i n , baé man anberii uiel Seift unterlegt. 2Ber auä Seiner Unter« Haltung, mit |1tb «nb feinem Sierftante jiifrieten, bin» weggebt, t|t aud) mit S i r febr jufrieten. Sie fieute mögen «idjt gern Sid) beipunCern, fte felblt ujotten fallen ¡ fie isoDen niebt fomobl belehrt unb ergoßt, olí auígfjciíljnet nnb beflatfdjt iperben, unb ei ift ber feintfc ® t i u i § , Slnberii S C H U B ju perfdjaffen, 3 u t t a u ' lid){eit trägt ber £ou»erfatiou mebr j u , a i i S i | l . —
l©or S r e u b ' u n b S u f b ®ec J ü n g l i n g , ber unten börref, (Seuftf tief a u « rounber S r u f h 23or © c l j n f u ^ t imb t>or C i c t t © d u arme« $ e r j »ergebt, © d j o n 3«1>ri bot tt
»ergeben«
U m i & t t $ u l b gefiefjt. Sie
foridtf:
Htiruljige
@m>arteti
bet
3 « f « " f f -
D i e unfldjete ^ u f u n f t , weldbr tin« e i n © l ü t f er« » a r t e n l a g t , i ( l e i n noef) u n g e p r i i f f e r g r e u n b , b e r u n ä 2 B i r fottten a i t ä b e r J e r n e f e i n e n SSefucf) o e r f p r i d j t . babei nie bie g r e u n b i n oernadjlajjigen, bie u n ä immer t r e u j u r S e i t e » a n b e l t , — id) meine Sie ©egenreart. Sßir r e n n e n n u r immer a u f b i e - ß i i f u n f t , u n b jät)len bie S a g e , © t u n b e n u h b ® ! i n u t c n , bie u n i » c m f ü n f , tigen @ e n u § beä CebenS t r e n n e n . D i e i 3 < W e n i ( l ber S a n g u m e i n r u n t e S © e b a u b e , beffett U m f r e i i m a t t m i t S t r i t t e n u n b 3 ° " ™ miffet u n b babei i m m e r wie» ber j u b e m f ü n f t e jitrürffetjrt, p e n b e m m a n j u jab» leit a n f i n g . S i r geben neuen ( f r w a r t u n g e n ¡ R a u m , u n b »erlieren t e n © e n u g u n b bie £ r f e n n t n i | ber @e« genmart. — © o ciele ©djcnijciten bleiben unbetrad)» t e t , müjirenb m i r jäblten — u n b fd)on roerben roir abgerufen, u m neue ©egenten j u burdjreifen. ©etiau f e n n e n w i r a n g e b e n , roie e f t roir u m fcaS © e b ä u b e g i n » gen — b o d ) bie © e f t a l t u n b ©cf;ön|)ett beffclbcn g i n g e n unferem Slnfdjauen cerloren.
„ 2 B e n n S>u mid) l U t e j t ,
G o H ü t t 3>td) rafd) tn'# f0?eeri" Sorteilenb ruft ber 3 ü n g ! i n g : „ 2 t t e m S r ä u U i n , td> batifc f e f j r ! " • * •
Crnf! Sigilantiui.
3 » « fenn' id) ben S ö n g l i n g nld)t fetter,. 3)od) bätt' fdj'i oud) fo gemödjt, U n b bie floljf, (wrrtfdje &a Hegen bie S o b t e n begraben
SDiit SR bin id> ber U n f d j u l b « I e i b ,
U n b bie Sebenben luflttmnbeln b o r t .
5£Wt ® ber ?)l)i[ofi!|j()en e t r e i t ,
U n b iteufn^ würbe ein 3>1>M)Iiit8 ® e m bunfien @rabe vertraut; 3 b m folgten flagenb bie G l t c t n , 3 & m folgte fiagenb bie 2 3 r a u L
SDiit i l e » a « alle SBelt erfreuu 5tb. © I .
Sie S u f U f i i n g ber i t i n f e t . e i i a r a b e in 3ìo. 12
U n b bie S t a u t befranjte ben $ f l g e l
„Kübln."
SETIit f i l m t e n von 2 b r i l n e n fo feurtif, U n b f a m bei ^ t f n b i ¡ u m (Stabe, 2>ort t a r r e n b , t i i S t e p « erbleidjr. S a m i t ( I i bie Strme niitit fflrd)tet, SScfudjt ¡eben ärtenb b a j
«rat
e i » S ü n g l i n g , bet triftet fie f r e u n b l ( $ U n b troitnet bie t r ä n e n ihr afc
öctiru unir Vrciifcn* £
o
c
a
t
e g.
, * , 3 u m ® l r e c t c r b e e S i n g a c a b e m t e i ( l n u n e n b l i d ) bee (etannte Q o m p o n i j t 9 I u n g e n i | a g e n grroa^t. £ i e SESa^t (lanb i i o i f d j e n i ^ m u n b u r n , g e l i i a S e n b e l s f o ^ n ^ j S a r t ^ o I b t ) . — / , ^ r . . u n b SSab. H o f f m a n n Jthigtiifc iBiItmf.
cer[a(fen
In t u r j e m
bie
t t B o r g e f l e r n fanfl Ü T a b a m e 3 e t ) , © d j r n i b t i m Ä 5 « n i g l i d i e n O p e r t i i ; u u f e u n b w ü r b e c o m p u b l i c u m b u r t f ) reitf)» licfien K p p l a u é o u f f l e m u n t e r t . Sfere © i i m m e fil o o i u b f l u n b m e l o b i f i , u m a b e r mcfcr ü b e r b i e f e l b e u r t b e i i e n j u t j n n e n , w o l l e n m i r ti)re f e r n r r e 8ei(iungen a b w a r t e n , b a bie e r f t « o f f e n b a r b u t ^ g r o i e Jtenglllicijffit begleitet m ü r b e . ® a l bar« auf folgenbe, » u n b e r f d j S n e ¡Ballet: . S B r a u b a r t , " reo» f ü r m i r b e m 3 n t e n b a n t e n b e r Ä ö n i g l i d j e n ®antoml*iifer i » t t $ o g u ( t , bet a b t t nidjt er(d)tin. D i e © a i l a t e r n e n »erbreiten feit einiget 3eit, fo» w o b l out ben © t r a f e n , ató in ben K ä u f e r n , fo wenig 8 í et) t , baS fie g u r d ) t not gefänglidiet -fiaft j u l)«ben |d)einen. — 9lid)t« gehört wot'l met)t bet Dfffentlidifctt an, ató bie ® a « > latenten, u n b folgltd) ill e« b i l l i g , b o i m a n ibre M ä n g e l audi öjfentlid) l ü g t . ® i e refp. JCaufleutf unb SReflaurateure, w e l i e bie bebeutenben Äoften nid)t gefdjeut Ijaben, ifjuc i ä b e n f ü r bie ®asbeleud)tung ein¡urfd>ten, muffen je|t Sfter ein l l id)t anfteefen, bamit fii bie ® a « f l a m m e (eben unb bort) w o nigften« »at)rn;t)mcn ( ß n n e n , w a r u m fit eigentlich fo im« menfe S u m m e n jäljrlid) jablen müffen. ¡Bie © a s l a t e t n e n finb witflid) fet)t folibe SMenfdjen 5 , m a n m a g Se ( ( S t a u b e n fo tiiel m a n will, fie fpeien bod) nicht geuet unb g i a m m e n , — aud) fdieinen fie geinbe bet Ä u f l l ä r u n g } u fein. SBora» fehlt e« benn eigentlid) ? 3 n einet 3eit, wo fo unenblieb oiele S o u r n a l e etfdjtinen, t s n n boif) fein «Sänget an ffialferfloff fein!! — < i ( ifl bereit« j u m © p r i t h w o r t in S e t i i n gewot* bent wenn ba« ® a s nicht b r e n n t , fo fagt m a n : e s f t e & t Monbfdjetn im Äalenbet! D i e guten t a t e m e n müfTen abet einen g a n j befonbitn Ä a l e n b e t haben, benn nad) 1 Ü b t bei SUadit« lautet bietet i m m e r auf SKonbfchein, u n b wer nad> biefet 3eit nod) auf bet © t r a j e gebt, obne fícíj einige j w a n * »igmal ben Ä o p f ¡ u flogen, bet J a n » wahrlich »on ©lüct fa* gen. — ©oldbe nächtliche 3Cn (t S fi i s te i t e n auf bet © t r a 6 e foliten bod) iermieben werben!
5( ii i re « t ( i g t 8. ® i e »ortrefflidie B o r f j e i t u n g e n t e i l t fotgenie B o r t e : f
Patrioten!
2üfriiiiijlt ra&tbtrt it>r ti>un, ihr ringeln l'iefKr (Aon prtljjn: SttrMufen fd)ltcb(c ä*rübi i m Meies ötlb, ^VHr^aiijen für S i t t e n unb M i b e ; Unb bobti g e W I M noib hielt) »rief unb für grogc Äiubcr.
Ün r; XfdtUtiä:
(fin ityitiittr, b e rg r « m ] eie Vit« Idj'rruni] f:iftb f l u
©rrltntr
Arbeiter*.
S i e b t r.
11.
3d
bin t e r B e r i e t
®opului,
Ä u r i r ' C;f . f f r a n f e n , mir i d f N a d ) ' , baji tie Jtrrbff
Sin iofratb, muK,
DOrroartG
¡HtvuMif
irbn,
.«lolif:
¡Cent j a b ' itf feinen B b f t i r t
blci,
U n b C u l t n in ete 6 o n n « f i t j n .
lln jltid; w a r
•in
3XaIbeur,
Ohl
l'tilnMun
j a n j r n l i t $ l : ( b frfctver:
T,r
ti-ar a n b e e t r
?tn
i'diiifii id) nacb S K t i i l f i i l ' u n i
JC6nig b a t t r tut
( f r iittt
3 d ¡ a b ii?m e:iva3 W u l v r r
ein,
0 i u feil et f d o n viel bciTer t r i n .
t l n half
n
tri
Uttel los.
reit $ e i f a u ®trnc
i b m l u e ß e r auf
3 n ( 5 a i W tvar ein ff'". 1 f r a n f .
Win i L*-!ix r ii'oPic 'i.iet)
"Tic C b r e n t i . n r t t
9)fil einet ^ c c i r r
Jd
bieb fff a b ,
Uli b e i m
li'm
¡anfl:
ivir et c c d ' f t t r i r .
I m
u m r e u t ISieb.
Sla
iuii) n
.tangier, ter irbr
r.inrnat
S e i t I.'in.tr, t i t e n alii t r e n i u i 'Trn
¡ab ttf a t ' ; n i u l ' r r n 'bn
Ter
3abr
v
Uniliid r.-at, t u
AIi u
*bm
6 - i b ' id cir
i.Htan.icl: ,.iii , ' i t i j i i
Uralten,
Ii;
Im
3tf
il'TTFR UM incinrn
jai irl'i
III.V f i r m
litt aut . H n i ' i l ' t i i f r a p :
nabnt rem
rridirii J&rrrn r . u 'Jt.u'
Ibaltr —
«triior
lurutr
'£d:u'riMu^ i m
®it $e|lir Ijjue
¡ort,
rerr.
fin u i ! r f ö
Wein ®er
Brucer « n aar
Sauf:,
bei 2 ! i ! l e t a i r ,
ui mir erbiiitvt ftbr, ibri
ceriül'rt:
T u t d ) Viebe tjab" i d it)n l u r i r t
teid),
.im ML'mntfn 3 e u 8 ¿atmilui.
t u I r ^nuifi.
J t ü t l Ü P e t i t r b i a d j t e n a d ) ¡Berlin lütl
beie! U u i t ( i r ' e r
T i e Urfadj' b a t ' td Damit
bin: abjefubir.
t i r '4.;la.ie jtdi '.'.-rlieri.
3d
f a b ' bie a U e n r o f i t e J t r a f t
feilt
r o t t e n '-Beilen a n | u i i b i ' , :
lln
einen icbrcar(>rotl!--8)itenr qewefen? G e g e n t e i l wat'fl: il?re
©in «njaö angeflogener OletdjSapffl, « i n Härterem ße mit bet gofrnen Statte:
Jpu J
cererete Webactio« ! «nf 31»re SUfcagt com 2j. h tt»rlertoeif«r. (9*8«!»0 wo € 4«« aieiaef 3i»lt o l f t e i n g l i i d l i t ^ , jeigt
Tnrt
S i d ^ bir in golbenen
Baumen;
Scr'm
Surg%r,
Stätten
f $ l u m m c r e füg
U n t ob 3 e t > i i t a u ( e n t
unter'm
gjollunber,
S e t i a f f e n ben beutfefeen ^ a f m :
D a n n mirft fofort t u
&
fomnambiil
Gngel fityrt t i r ju t i e
Die ö i n b e i t ,
Sen Du
®iatem
3n
U m j l ä n j t e unb »erHärte! fie^ft t u , S i t t e l ,
mit im
@ie(ift burd) ber ¿ u f u n f t D e n .'pitnmel e o l l e t
Silat'
S^Ieia
©eigen
S i t ©teile bei alten a l t e n
f^laftn!
fogleic^
i'eiet!
S l u t unt
unb K u m m e r :
^örf) ja ba$ buntme 9?auf^en nidjl beinern rratantifc^en
Dir 2en
im S e l t n e
U n t m a $ e n ftt^ and) ^ier unb ba ttiebet
Si^laf
f a n f t ! bann fleien injtoifciien SBun
bie f ^ r a a l t n
Scni
fte bit in bie
fiçen:
über bit bangt ja raagft
@«ft M l | ••febrtn. Üöucbe bie «Biffenfibaft n i $ t umfebren, fo müfcte fit immer getabeau* geben; mü&te bie S i M f c f t immer flerabeau« gebe", fo mü&te jle notbmenbiger« weife in'« Saftet faden; wütbe bie SBiffenfcbaft.iiotbwenbigertpeife in'* SBaffer faflra, fo würfe aQcä iaub butnm; mürbe aQre ^anb bwmm, fo tonnte aud) ©erlin nicbt bic 6tabt bei ¡JnteQigenj fem; rannte ©erlin nidjt bie Stöbt ber Jntefligenj fein, fo Klinten bie $emn 6 Übt unb ö ullrtd) au. Die filteren Oeienben befuét e« nur in 9tena«eriteu, wo e« fegen (Sntree fehen l&ft unb in ber ftütterungtftnnbe niemal« ohne Vwetit iß. Seine « a u t ift bunt unb fleefig, im 3an|ra aber malt* bie «tpdne einen f r ä u I i df e n fltinbrurf, weil biefe« ihre uatftrli^e g a r t e il.
S a * auf bem weiten fgrbenrunbe Der StenfHj jufammento^t unb braut. D a « wirb, mit Weift unb S i t i n ©unbe, ®Bfouutägütor" l a u t ; 8 m China bonnert er bi« Gaffel, * m ! über SJrfe, S d j l o i unb « a u « ! Den C M n freuet fein «rtaffel, D e n 8um»en maitt e« « n j f t unb Uran«! U«> wo ber « m f 4 f « 4 t fault ® i » t « u | e # e n t i e f « 6 4 4 » f u n i $ra