»Kooperationsverträge« zwischen Hochschulen und gesellschaftlichen Verbänden: Die Abkommen der Hochschulen mit Arbeitnehmerorganisationen in Bremen, Oldenburg, Bochum und Saarbrücken [1 ed.] 9783428454549, 9783428054541
146 49 27MB
German Pages 246 Year 1983
Polecaj historie
Citation preview
Schriften zum Öffentlichen Recht Band 454
„Kooperationsverträge“ zwischen Hochschulen und gesellschaftlichen Verbänden Die Abkommen der Hochschulen mit Arbeitnehmerorganisationen in Bremen, Oldenburg, Bochum und Saarbrücken
Von Michael Uechtritz
Duncker & Humblot · Berlin
MICHAEL
UECHTRITZ
Kooperationsverträge" zwischen Hochschulen und gesellschaftlichen Verbänden
Schriften zum ö f f e n t l i c h e n Band 454
Recht
Kooperationsverträge" zwischen Hochschulen und gesellschaftlichen Verbänden Die Abkommen der Hochschulen mit Arbeitnehmerorganisationen in Bremen, Oldenburg, Bochum und Saarbrücken
Von D r . M i c h a e l Uechtritz
D U N C K E R
&
H U M B L O T
/
B E R L I N
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek Uechtritz, Michael: „Kooperationsverträge" zwischen Hochschulen u n d gesellschaftlichen Verbänden: d. A b k o m m e n d. Hochsch. m i t Arbeitnehmerorganisationen i n Bremen, Oldenburg, Bochum u. Saarbrücken / von Michael Uechtritz. — Berlin: Duncker u n d Humblot, 1983. (Schriften zum Öffentlichen Recht; Bd. 454) I S B N 3-428-05454-7 NE: GT
Alle Rechte vorbehalten © 1983 Duncker & Humblot, Berlin 41 Gedruckt 1983 bei Buchdruckerei A. Sayffaerth - E. L. Krohn, Berlin 61 Printed in Germany ISBN 3 428 05454 7
Vorwort Die vorliegende Arbeit wurde i m Jahre 1982 vom Fachbereich Rechtswissenschaft der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg als Dissertation angenommen. Das Manuskript wurde i m A p r i l 1982 abgeschlossen. Später erschienenes Material konnte nur noch teilweise eingearbeitet werden. Zu danken habe ich allen, die mich bei der Abfassung dieser Arbeit mit Ratschlägen und K r i t i k aber auch bei der Beschaffung von Material unterstützt haben. I n erster Linie gilt dieser Dank meinem Doktorvater, Professor Dr. Konrad Hesse, für seine Bereitschaft diese Arbeit, trotz seiner sonstigen Arbeitsbelastung, zu betreuen. Ich verdanke i h m ferner zahlreiche Anregungen durch die Möglichkeit der langjährigen Mitarbeit i n seinem Seminar an der Universität Freiburg. Dem Zweitgutachter der Arbeit, Professor Dr. Martin Bullinger, gilt mein Dank für die rasche Erstellung des Zweitgutachtens. Auch ihm habe ich für Hinweise, Anregungen und K r i t i k zu danken, die ich während meiner Zeit als Assistent an seinem Lehrstuhl erfahren habe. Herrn Privatdozent Dr. Ulrich Karpen danke ich für wertvolle Hinweise und für seine Unterstützung durch das Gespräch über das Thema dieser Arbeit. Nicht zuletzt gilt mein Dank denjenigen, die auf Seiten der Gewerkschaften bzw. der Universitäten an der Kooperation beteiligt waren und die mich bei der Beschaffung von Material großzügig unterstützt haben. Stellvertretend seien Professor Dr. Jürgen Weißbach, sowie der stellvertretende Landesvorsitzende des DGB Niedersachsen, Wolfgang Schultze genannt, die m i r als Mitglieder des Kooperationsausschusses an der Universität Oldenburg Einblick i n die Praxis der Kooperation vermittelt haben. Dank schulde ich auch dem Kanzler der Universität Oldenburg, Herrn Dr. Jürgen Lüthje, für wertvolle Hinweise, Anregungen und K r i t i k . Mein Dank gilt nicht zuletzt Herrn Professor Dr. Dr. h. c. Broermann, für die Aufnahme dieser Arbeit i n die Reihe der Schriften zum Öffentlichen Recht. Stuttgart, i m Juni 1983
Michael Uechtritz
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
15
1. Teil Bestandsaufnahme I. Analyse des Inhalts der einzelnen Verträge 1. Der Bremer Vertrag
18 18
a) Die E n t w i c k l u n g v o n 1971 bis 1978
18
b) Die Entwicklung ab 1978
22
2. Der Oldenburger Vertrag
25
a) Vorgeschichte
25
b) Der Abschluß des Vertrages
27
3. Der Bochumer Vertrag
29
4. Die Saarbrücker Verträge
29
5. Die Konstanzer Diskussion u m einen Vertragsabschluß
31
I I . Parallelen u n d Differenzen zwischen den einzelnen Verträgen
32
1. Partner der Hochschulen
32
2. Rechtsnatur der A b k o m m e n
34
3. Ausmaß der v o n den Hochschulen übernommenen Verpflichtungen
36
4. Umfang der Einwirkungsrechte der Vertragspartner auf die Hochschulen
38
I I I . Faktische Intensität der Kooperation 1. Bremen
41 42
8
nsverzeichnis 2. Oldenburg
44
3. Bochum
45
4. Saarbrücken
46
5. Konstanz — Kooperation ohne Vertrag
46
2. Teil Kooperationsverträge und die Aufgaben der Hochschulen nach dem H R G und den Landeshochschulgesetzen
I. Der rechtliche Beurteilungsrahmen
48
I I . Rechtsstellung der Hochschule u n d Vertragsschließungskompetenz .. I I I . Aufgaben der Hochschulen
50 52
1. Verhältnis des H R G zu den landesrechtlichen Regelungen
53
2. Die Aufgabenzuweisung nach dem H R G
55
a) § 2 Abs. 6 HRG: Zusammenarbeit m i t anderen Wissenschaftseinrichtungen
55
b) § 2 Abs. 3 HRG: Der Weiterbildungsauftrag der Hochschulen . .
58
c) § 2 Abs. 1 HRG: Die Primäraufgabe Wissenschaftspflege
58
aa) Zur Systematik des § 2 H R G
59
bb) Die Entstehungsgeschichte
61
cc) Auslegung des Begriffs Wissenschaftspflege durch die Elemente Forschung u n d Lehre a) Der Begriff der Forschung i m H R G ß) Der Begriff der Lehre i m H R G
65 66 72
dd) Grenzen der Zusammenarbeit aus der m u n g des § 2 Abs. 1 H R G
73
Aufgabenbestim-
3. Aufgabenbestimmungen der Hochschulen i n den Landesgesetzen
77
a) Das Hamburger Hochschulgesetz
78
b) Die rechtliche Situation i n Hessen
80
c) Das Bremer H G
80
nsverzeichnis d) Das U G von Baden-Württemberg
81
e) Das Niedersächsische Hochschulgesetz
83
f) Unterschiede zwischen H R G u n d den Landeshochschulgesetzen bei der Aufgabenzuweisung
86
I V . Z u r Vereinbarkeit von Abweichungen i n Landesgesetzen gegenüber dem H R G
86
3. Teil Zur Kompetenz von Kollegialorganen I. Verfassungsrechtliche Determinanten der hochschulinternen Kompetenzregelungen 1. Kompetenzen v o n Kollegialorganen u n d individuelle rechte
Freiheits-
2. Kompetenzen von Zentralorganen und Fachbereichsorganen I I . Die Kompetenzen von Kollegialorganen zur Regelung von Fragen der Forschung u n d Lehre i m H R G 1. Koordinierungskompetenz der Hochschulorgane für fragen
Forschungs-
88 88 91
94 94
a) Allgemeine Bestimmung der Reichweite i m Verhältnis zur i n dividuellen Forschungsfreiheit
94
b) Kooperationsverträge u n d Koordinierungskompetenzen
97
c) Kooperationsverträge u n d das Verhältnis der Entscheidungsbefugnis v o n zentralen Kollegialorganen zu Fachbereichsorganen 100 2. Koordinierungskompetenz der Hochschulorgane für Lehrfragen . . 103 a) Grenzen der Befugnisse der Kollegialorgane i n bezug auf die individuelle Lehrfreiheit 103 b) Z u r Entscheidungsbefugnis von Zentralorganen
105
4. Teil Handlungsfreiheit der Hochschulen aufgrund der Hochschulautonomie? I. Problemstellung I I . Grundlagen u n d Grenzen der „Hochschulautonomie"
107 108
10
nsverzeichnis 1. Die herrschende Auffassung zu A r t . 5 Abs. 3 GG
108
2. Die K r i t i k Roelleckes
109
3. Präzisierung des Autonomiebegriffs
111
4. Die Reichweite der Autonomie der Garantien der Landesverfassung (Art. 20 L V B a W ü ) 115 5. Hochschulautonomie u n d politische Aktionsfreiheit
117
a) Die Darstellung der Position v o n Preuß u n d Stuby
118
aa) Die Position v o n Preuß
118
bb) Die Position v o n Stuby
119
b) K r i t i k
120
5. Teil Verfassungsrechtliche Grenzen der Kooperation aus Art. 5 Abs. 3 G G I. Zur Bindung der Hochschulorgane an A r t . 5 Abs. 3 GG
126
1. Problemstellung
126
2. Z u r Geltung des A r t . 5 Abs. 3 GG für das Handeln der Hochschulorgane 127 3. Die Klarstellung der Bindung durch § 3 Abs. 1 H R G
130
I I . Die objektiv-rechtliche Bedeutung der Verfassungsentscheidung für eine freie Wissenschaft 131 1. Problemstellung 2. Eigenständigkeit Einwirkungen
131 des Sachbereichs Wissenschaft u n d
staatliche 132
3. Eigenständigkeit des Sachbereichs Wissenschaft u n d gesellschaftliche Einwirkungsversuche 139 I I I . Spezifische Gefahren der Wissenschaftssteuerung tionsverträge 1. Die besonderen Problembereiche
durch
Koopera144 144
nsverzeichnis 2. Zur Beeinträchtigung des „Wissenschaftspluralismus" a) Z u m Begriff des Wissenschaftspluralismus
145 145
aa) Wissenschaftspluralismus als Garantie der Vielfalt
147
bb) Wissenschaftspluralismus als Garantie der Position des „theoretischen Pluralismus" 150 b) Gefahren für den Wissenschaftspluralismus tionsverträge
durch Koopera151
c) Personalentscheidungen nach Vertragsgesichtspunkten? 3. Schwerpunktbildung nach unzulässigen Kriterien?
156 157
a) Die K r i t i k an gesellschaftspolitisch motivierter Steuerung
157
b) Z u r E r m i t t l u n g inhaltlicher K r i t e r i e n für Schwerpunktbildungen 159 c) Gesellschaftspolitische Zielvorstellungen als generell sachwidriges Steuerungskriterium? 162 4. Steuerung der „Grundkapazität"
164
5. Verlust der Unabhängigkeit
167
a) Verletzung der Unabhängigkeit durch Selbstbindung
168
aa) Verpflichtung zur Zusammenarbeit
169
bb) Vereinbarung einer Unterstützungspflicht
172
cc) Legitimierung gebot?
der Kooperation durch das
Sozialstaats176
b) Gefährdung der Unabhängigkeit durch Einräumung v o n M i t wirkungsbefugnissen für den Vertragspartner 179 aa) Vorbemerkung
179
bb) Z u r rechtlichen Stellung der Kooperationsorgane
180
cc) Verfassungsrechtliche Würdigung der bestehenden E i n w i r kungsrechte a) Die Bremer Kommission bis 1978 β) Kooperationsorgane ohne Entscheidungskompetenzen . . γ) Einwirkungsmöglichkeiten des Bremer Kuratoriums . .
182 182 185 189
6. Teil Weitere verfassungsrechtliche Bedenken I. Verstoß gegen die Lernfreiheit?
194
1. Verfassungsrechtliche Begründung der Lernfreiheit
194
2. Bedrohung der Lernfreiheit durch Kooperationsverträge?
196
12
Inhaltsübersicht
I I . Verstoß gegen die Neutralitätspflicht?
198
1. Neutralität als Rechtsbegriff oder politisches Schlagwort
198
2. A r t . 5 Abs. 3 GG u n d die Neutralitätspflicht der Hochschulen
201
a) Neutralität i m Sinne der Bindung an einen Sachmaßstab
201
b) Zur Einbindung eines Machtfaktors
201
3. Neutralitätspflicht aus A r t . 9 Abs. 3 GG
206
Zusammenfassung
208
Anhang Vertragstexte und Beschlüsse der Universität Bremen zur Ausführung der Kooperationsverträge
213
Literaturverzeichnis
235
Abkürzungsverzeichnis a. Α . Abi. ALR AöR Art.
= = = = =
BÄK BayHSchG BaWüUG
BGBl BremHG BVerfG BVerfGE BVerwG BVerwGE
= Bundesassistentenkonferenz = Bayerisches Hochschulgesetz v o m 25. J u l i 1978 = Universitätsgesetz v o n Baden-Württemberg v o m 22. November 1977 = B u n d demokratischer Wissenschaftler = Gesetz über die Hochschulen i m Lande B e r l i n v o m 22. Dezember 1978 = Bundesgesetzblatt = Bremisches Hochschulgesetz v o m 25. J u l i 1978 = Bundesverfassungsgericht = Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts = Bundesverwaltungsgericht = Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
DFG DGB DÖV DUZ/HD
= = = =
BdWi BerlHG
DVB1 ESVGH
andere Ansicht Amtsblatt Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten A r c h i v des öffentlichen Rechts Artikel
Deutsche Forschungsgemeinschaft Deutscher Gewerkschaftsbund Die öffentliche V e r w a l t u n g Die deutsche Universitätszeitung vereinigt m i t Hochschuldienst = Deutsches Verwaltungsblatt
EUGRZ
= Entscheidungssammlung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes u n d des Verwaltungsgerichtshofes BadenWürttemberg m i t Entscheidungen der Staatsgerichtshöfe beider Länder = Europäische Grundrechte, Zeitschrift
FAZ FS
= Frankfurter Allgemeine Zeitung = Festschrift
GBl GG GROL
= Gesetzblatt = Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 22. M a i 1972 = Gesprächskreis Reformuniversität Oldenburg
HAZ HHG HambHG h. M. HRG Hrsg. HUG
= = = = = = =
Hannoversche Allgemeine Zeitung Hessisches Hochschulgesetz v o m 6. J u n i 1978 Hamburger Hochschulgesetz v o m 22. M a i 1978 herrschende Meinung Hochschulrahmengesetz v o m 26. Januar 1976 Herausgeber Hessisches Universitätsgesetz v o m 6. J u n i 1978
vom
14
Abkürzungsverzeichnis
JuS JZ
Juristische Schulung Juristenzeitung
M/D/H/S m. w. N.
Maunz / D ü r i g / Herzog / Scholz, Grundgesetz, Kommentar, 18. Lieferung, September 1980 m i t weiteren Nachweisen
NHG NJW NWZ
Niedersächsisches Hochschulgesetz v o m 1. J u n i 1978 Neue Juristische Wochenschrift Nordwest Zeitung Oldenburg
OVG
Oberverwaltungsgericht
PH
Pädagogische Hochschule
RUB Rdnr.
Ruhr-Universität-Bochum Randnummer
SH HSG StGH SUG
Hochschulgesetz Schleswig-Holstein v o m 2. M a i 1973 Staatsgerichtshof Saarländisches Universitätsgesetz v o m 14. Dezember 1972
VerwArch
Verwaltungsarchiv Verwaltungsgerichtshof Vorläufige Universitätsverfassung der Universität Bremen Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer VerwaltungsVerfahrensgesetz des Bundes v o m 25. März 1976
VGH VUV
WDStRL VwVfG
WRK WRV
Gesetz über die wissenschaftlichen Hochschulen des L a n des Nordrhein-Westfalen v o m 20. November 1979 Wissenschaftsrecht, Wissenschaftsverwaltung, Wissenschaftsförderung Wirtschafts- u n d Sozialwissenschaftliches I n s t i t u t des Deutschen Gewerkschaftsbundes Westdeutsche Rektorenkonferenz Weimarer Reichsverfassung v o m 11. August 1919
ZfP ZRP
Zeitschrift für P o l i t i k Zeitschrift für Rechtspolitik
WissHGNW WissR WSI
Einleitung Thema dieser Arbeit sind die hochschul- und verfassungsrechtlichen Probleme der Kooperationsverträge, die zwischen einzelnen Hochschulen und Arbeitnehmerorganisationen (Untergliederungen des DGB bzw. i n Bremen und i m Saarland Arbeiterkammern) abgeschlossen wurden. Anhand der Erörterung dieser konkreten Problemstellung versucht die Arbeit, einen Beitrag zu leisten, zur Klärung der Stellung der Hochschulen gegenüber gesellschaftlichen Anforderungen und Versuchen der Einflußnahme auf ihre Arbeit. Der erste der Verträge des hier untersuchten Typs wurde 1971 zwischen der neugegründeten Universität Bremen und der Arbeiterkammer Bremen abgeschlossen. Es folgten bis 1976 weitere Abkommen i n Oldenburg, Bochum und i n Saarbrücken. Wesentlicher Inhalt dieser Abkommen ist die von den einzelnen Hochschulen erklärte Bereitschaft zur umfassenden Zusammenarbeit bzw. zur Unterstützung des Vertragspartners, zur „Wahrnehmung und Förderung der Arbeitnehmerinteressen i n wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Hinsicht" 1 . Erklärtes Ziel der Vertragspartner ist es, die verstärkte Hinwendung der Hochschulen zu Problemstellungen aus der Arbeitswelt zu bewirken. Der Abschluß dieser Verträge hat erhebliche publizistische 2 und politische Kontroversen hervorgerufen. Die politischen Auseinandersetzungen fanden ihren Höhepunkt i n der kontroversen Erörterung der Verträge i m niedersächsischen Landtag 8 und i n einer Anfrage verschiedener CDU-Bundestagsabgeordneter an die Bundesregierung betreffend den Oldenburger Kooperationsvertrag 4 . Die juristische Erörterung des 1 So die Formulierung i n § 2 des Bremer Kooperationsvertrages v o m 27. J u l i 1971. 2 Eine umfassende Materialsammlung über die Auseinandersetzungen enthält die Dokumentation: „ A u f dem Weg zur Tendenzuniversität?", die v o m B u n d Freiheit der Wissenschaft herausgegeben wurde sowie — speziell für den Oldenburger Vertrag — die Sammlung „Dokumente u n d Materialien", Materialien zur KooperationsVereinbarung zwischen dem D G B Landesbezirk Niedersachsen der gewerkschaftlichen Bildungseinrichtung A r b e i t u n d Leben e . V . einerseits u n d der Universität Oldenburg andererseits, herausgegeben von der Pressestelle der Universität Oldenburg. Einen Uberblick über die Kooperation u n d ihre Einschätzung aus gewerkschaftlicher Sicht enthält der Sammelband Hochschule u n d Gewerkschaften, herausgegeben von Bamberg / Kröger / Kuhlmann.
» Protokolle Niedersächsischer Landtag / 8. Wahlperiode — 4. Tagungsabschnitt / 8. Plenarsitzung am 11. Dezember 1974.
Einleitung
16
Themas ist demgegenüber bisher knapp ausgefallen 5 . Soweit überhaupt Stellungnahmen vorliegen, beschränken sie sich auf eine knappe Behandlung der verfassungsrechtlichen Aspekte; meist w i r d — ohne nähere Begründung — die Unvereinbarkeit der „Tendenzuniversität" mit A r t . 5 Abs. 3 GG angenommen 6 . Eine vertiefte Untersuchung der juristischen Probleme, die durch die Kooperationsverträge aufgeworfen werden, steht bisher aus. Sie erscheint deshalb von besonderem Interesse, weil die Verträge als Ausdruck einer allgemeinen Tendenz zu werten sind, die Hochschulen gegenüber Anforderungen aus der Gesellschaft zu öffnen. Sie sind typisch für das Bemühen gesellschaftlicher Interessengruppen, Einfluß auf die Ausrichtung der Arbeit der Hochschulen zu gewinnen. Befürworter der Verträge haben denn auch gegenüber der erhobenen K r i t i k eingewandt, schon bisher gebe es vielfache Verflechtungen zwischen Hochschule und Wirtschaft, die praktisch kritiklos hingenommen worden seien. Erst die Tatsache, daß nunmehr Arbeitnehmerorganisationen Anforderungen an die Wissenschaft stellten, habe Befürchtungen aufkommen lassen7. Die Tatsache, daß sich die juristische Untersuchung hier auf die Kooperationsverträge konzentriert, bedeutet nicht, daß die vielfältigen anderen Formen der gesellschaftlichen Einflußnahme auf die Hochschulen verkannt werden. Es soll vielmehr versucht werden, anhand der Erörterung des Einzelphänomens „Kooperationsverträge" allgemeine Aussagen zu gewinnen, über das Verhältnis von Hochschule und Gesellschaft, konkret über die Schranken, die einer gesellschaftlichen Einflußnahme auf den Wissenschaftsbetrieb an den Hochschulen gesetzt sind. Die Verträge bieten sich für eine solche Untersuchung an, da sie den wohl plakativsten Versuch der Beeinflussung der Hochschulen darstellen. Zum Gang der Untersuchung ist folgendes zu bemerken: I n der vorliegenden Arbeit erfolgt zu Beginn eine Bestandsaufnahme. Dabei sollen die einzelnen Verträge i m Hinblick auf A r t und Umfang der von den Hochschulen eingegangenen Verpflichtungen näher untersucht werden. Es gilt zu klären, wie intensiv die Auswirkungen sind, die die Kooperationsverträge auf die Arbeit der Hochschulen haben. Diese Realanalyse dient der Schaffung der tatsächlichen Beurteilungsgrundlage für die juristische Würdigung. Da inzwischen durch HRG und 4
Bundes tagsdrucks ache 7/3260, sowie die A n t w o r t der Bundesregierung, Bundestagsdrucksache 7/3422. s Vgl. Kirchhof, ZRP 76, 238 ff.; Hailbronner, Funktionsgrundrecht, S. 290 ff.; ausführlich Bauer, Wissenschaftsfreiheit i n Lehre und Studium, S. 167 ff. « So Scholz, in: Maunz / D ü r i g / Herzog / Scholz, Rdnr. 97 zu A r t . 5 Abs. 3 GG. ? Vgl. Vetter, Was erwarten die Gewerkschaften von den Hochschulen, in: Hochschule u n d Gewerkschaften, S. 446.
Einleitung
Landeshochschulgesetze eine detaillierte Normierung des Hochschulrechts erfolgt ist, soll zunächst anhand der einfach-gesetzlichen Regelungen überprüft werden, ob von diesen eine umfassende Kooperation der Hochschulen mit gesellschaftlichen Interessengruppen gedeckt w i r d bzw. welche Grenzen das Hochschulrecht hier setzt. I m Anschluß daran sollen die verfassungsrechtlichen Vorgaben für Inhalt und Grenzen einer Kooperation von Hochschule und gesellschaftlichen Interessengruppen behandelt werden.
Erster Teil
Bestandsaufnahme I. Analyse des Inhalts der einzelnen Verträge 1. Der Bremer Vertrag
a) Die Entwicklung
von 1971 bis 1978
Der Kooperationsvertrag vom 27. J u l i 1971 zwischen der Universität Bremen und der Arbeiterkammer Bremen hat deshalb besonderes Gewicht, weil er als erster dieser Verträge Modellcharakter für die folgenden Vertragsabschlüsse gewonnen hat 1 . I n Bremen hatte sich die Arbeiterkammer bereits frühzeitig i n die Beratungen u m die Gründung und u m die Festlegung der Studieninhalte der geplanten Reformuniversität Bremen eingeschaltet. I m Frühjahr 1971 legte die Arbeiterkammer ein Konzept über die zukünftige Stellung und das Verhältnis der Universität zur Arbeiterkammer vor und schlug der Universität den Entwurf eines Kooperationsvertrages vor. A m 5. J u l i 1971 stimmte der Gründungssenat der Universität zu, und nach geringfügigen Änderungen wurde der Vertrag am 27. J u l i 1971 unterzeichnet 2 . I n § 1 des Vertrages verpflichten sich beide Partner zur gleichberechtigten, gegenseitigen Zusammenarbeit i m Rahmen ihrer gesetzlich übertragenen Aufgaben. Die Verpflichtungen, die die Universität übernimmt, sind i m wesentlichen i n § 2 und § 5 enthalten. I n § 2 verpflichtet sich die Universität, die Arbeiterkammer bei der Erfüllung ihrer A u f gaben, der Förderung und Wahrnehmung der Arbeitnehmerinteressen zu unterstützen, und zwar durch die ihr gegebenen Möglichkeiten der Forschung und der Lehre. I n § 5 verpflichtet sich die Universität, sich bei der Stellenausschreibung i n den entsprechenden Forschungsbereichen zu bemühen, die Zielsetzung dieses Vertrages zu berücksichtigen. 1
Vgl. die Bezugnahme auf das Bremer V o r b i l d i n der Βeschlußvorläge des Gründungssenats der Universität Oldenburg v o m 29. Januar 1974, Drucksache 220/74 in: Dokumente u n d Materialien, herausgegeben von der Universität Oldenburg. 2 F ü r die Einzelheiten siehe: Der Kooperationsvertrag zwischen der A r beiterkammer Bremen u n d der Universität Bremen, ein Bericht vorgelegt v o n der Arbeiterkammer Bremen, Bremen i m M a i 1976.
I. Analyse des Inhalts der einzelnen Verträge
19
Geht man davon aus, daß die Lebens- und Arbeitssituation der Arbeitnehmer dergestalt i n komplexe Zusammenhänge eingeordnet ist, daß sie sich der Zuordnung zu einer Fachdisziplin entzieht u n d „wissenschaftlich nur i n einem interdisziplinären Forschungsansatz mit Aussicht auf Erfolg bearbeitet werden kann" 3 , so kann § 5 Bedeutung für die Stellenausschreibung i n der Mehrheit der Fachbereiche gewinnen. Die Verpflichtungen der Arbeitnehmer Bremens enthalten die §§ 3 und 4. I n § 3 sagt die Arbeiterkammer zu, „die aus ihrer praxisbezogenen Arbeit sich ergebenden Erfahrungen an die Universität heranzutragen", zum anderen verspricht sie die Vermittlung der von der Universität erarbeiteten, die Arbeitnehmerschaft berührenden Erkenntnisse, an die Arbeitnehmer. § 3 bezweckt also, der Universität Zugang zur Praxis zu verschaffen, sowie ihr die Chance zu eröffnen, mit ihren Ergebnissen die Arbeitnehmerschaft überhaupt erreichen zu können. Die Universität versprach sich hiervon den Abbau des Mißtrauens der Mehrheit der Arbeitnehmerschaft gegen „die Wissenschaft", gegen die Institution Hochschule 4 . I n § 4 verpflichtet sich die Arbeiterkammer, zur Durchführung des Vertrages personelle und sachliche Mittel einzusetzen. Zur Sicherung der Durchführung dieses Vertrages vereinbaren die Vertragsparteien i n § 6 die Schaffung eines gleichberechtigt zu besetzenden Kuratoriums für Arbeitsschutz; besondere Ziele des Vertrages sind danach die Förderung von Arbeitnehmerinteressen hinsichtlich Unfallschutz, Arbeitsmedizin, Zukunftsberufen, Arbeitsplatzsicherung und Erwachsenenbildung. Zur Einleitung erster Schritte zur Realisierung der Zusammenarbeit und zur Klärung wie die Kooperation i n der Universität institutionell verankert werden sollte, konstituierte sich an der Universität ein A r beitsausschuß Arbeiterkammer, der i n Kontakt mit Vertretern der Arbeiterkammer die nähere Ausgestaltung der Kooperation erörterte. Als Ergebnis dieser Arbeit legte der Ausschuß dem Gründungssenat i m Februar 1972 den Vorschlag für die Einrichtung eines „Forschungsund Praxiszentrums Industrie und Betrieb" vor. Dieses Zentrum sollte als zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Universität betrieben werden 5 . Der Gründungssenat beschloß am 14. Oktober 1972 die Ein3 Bericht der Universität Bremen über die Durchführung des Kooperationsvertrages an den Senator für Wissenschaft u n d Kunst v o m 28. J u n i 1976, S. 5. 4 Z u m Verhältnis Hochschule/Arbeitnehmerschaft vgl. die Ausführungen des DGB-Vorsitzenden Vetter, Hochschule i n der Arbeitnehmergesellschaft, in: Hochschule u n d Gewerkschaften, S. 458 f. u n d Steinkühler, Die Rolle der Universität i n der Gesellschaft aus der Sicht der Gewerkschaften, in: K o n stanzer Blätter für Hochschulfragen, Jahrgang X I X , Heft 2 - 3 , November 1981; siehe auch Rüthers, Waffenschmieden gegen die Arbeiterbewegung?, in: F A Z v o m 6. Dezember 1980. δ Vgl. den Bericht der Universität, S. 9. 2*
20
1. Teil: Bestandsaufnahme
setzung einer paritätischen Kommission und die Stellenausschreibungen, ohne jedoch die Struktur der geschaffenen Einrichtung genauer festzulegen. Diese sollte vielmehr zunächst offen bleiben und „erst mit der Arbeitsvollziehung genauer bestimmt werden" 6 . Grundfragen der Organisation i m Innen- wie i m Außenverhältnis blieben also zunächst ungeklärt 7 . Die genauere Aufgabenstellung und die institutionelle Eingliederung der „Arbeitsstelle Arbeiterkammer" bildete sich m i t den ersten Stellenbesetzungen und der Arbeitsaufnahme heraus. I n Betracht kamen drei Möglichkeiten: (1) Die Ausgestaltung des Arbeiterkammerbereichs als eine zentrale Koordinierungsstelle, m i t der Aufgabe Bindeglied zwischen der A r beiterkammer und den einzelnen Studienbereichen zu sein. (2) Die Einrichtung eines Forschungs- und Praxiszentrums Industrie und Betrieb, das als Institut selbst Forschungsarbeit betreiben sollte. (3) Die Schaffung einer Stelle mit „Mischfunktion"; zum einen mit Aufgaben einer Koordinierungsinstanz, zum anderen aber auch mit der Möglichkeit eigene Forschungsvorhaben zu realisieren 8 . Die Entscheidung fiel zugunsten des dritten Modells 9 . Die Errichtung eines eigenen Forschungsinstituts für die Aufgaben aus dem Kooperationsvertrag wurde verworfen, weil sie die intendierte Öffnung der Gesamtuniversität für die Fragen der Arbeitnehmerschaft verfehlt hätte. Die Errichtung einer reinen Koordinierungsinstanz ohne eigene Forschungskapazität hätte wohl das von beiden Vertragsparteien erhoffte sofortige Angehen der von der Arbeiterkammer herangetragenen Wünsche erschwert oder zumindest verzögert. Das gewählte Modell war der Versuch, zwei jedenfalls nicht problemlos zu vereinbarende Aufgaben zu erfüllen: Koordination für die Gesamtuniversität und Schaffung eines sofort einsatzbereiten Forschungsschwerpunkts Arbeitnehmerprobleme. A m 25. A p r i l 1973 beschloß der akademische Senat die Satzung für den Arbeiterkammerbereich, i n der der Versuch gemacht wurde, die bisher offen gebliebene organisatorische Einfügung in die Universität 6
Bericht der Universität, S. 11. 7 Ebenda, S. 11. 8 Vgl. Bericht der Arbeiterkammer, S. 17; siehe auch den Bericht v o n Einemann, Entwicklungen u n d Perspektiven der Kooperation zwischen A r b e i t e r kammer (Gewerkschaften) u n d Universität Bremen, maschinenschriftlich v o m Januar 1978; dem Verfasser von der Universität Bremen zur Verfügung gestellt. 9 Bericht der Arbeiterkammer, S. 17.
I. Analyse des Inhalts der einzelnen Verträge
21
zu regeln 10 . Als Organisationsform wurde die Form der weiteren wissenschaftlichen Einrichtung für besondere Aufgaben in Forschung und Lehre nach § 2 Abs. 2 Ziff. b der V U V gewählt. I n § 1 der Satzung des Arbeiterkammerbereichs wurde die Zweiteilung in Kommission und Arbeitsstelle getroffen. Dabei fungierte die Kommission nach § 2 Abs. 1 als Rat des Arbeitskammerbereichs, also als Selbstverwaltungsorgan gem. § 5 Abs. 2 b der VUV. Dieses „Selbstverwaltungsorgan" einer wissenschaftlichen Einrichtung wurde aber zur Hälfte von den universitätsexternen Vertretern der Arbeiterkammer bestimmt, zur anderen Hälfte vom Senat der Gesamtuniversität gewählt. A u f diese Weise wurde dem Vertragspartner ein unmittelbarer Einfluß i n Form konkreter Mitentscheidungsbefugnisse auf die Institution der Universität eingeräumt, die sich mit der Realisierung der angestrebten Kooperation primär zu befassen hatte. Da somit der Einfluß der Arbeiterkammer hinreichend sichergestellt war, unterblieb zunächst die Einsetzung des i n § 6 des Kooperationsvertrages vorgesehenen Kuratoriums für Arbeitsschutz. Die Aufgaben der Kommission wurden i n § 3 Ziff. 3 der Satzung des Arbeiterkammerbereichs festgelegt: „Über die Aufgabenstellung der Arbeitsstelle und der ihr zugeordneten Mitarbeiter entscheidet die Kommission". Hierzu erklärt der Bericht der Arbeiterkammer erläuternd, zählten insbesondere die Beschlußfassung über Aufgaben der Arbeitsstelle, die Einrichtung von Projekten, Erstellung von Haushaltsvorschlägen, die Vergabe von Gutachten, Vorschläge für die Besetzung von Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter 1 1 . Für die Berufung von Hochschullehrerstellen enthält § 8 Ziff. 3 die Sonderregelung, daß die Mitglieder einer Berufungskommission für die Besetzung einer dem Arbeitskammerbereich gewidmeten Stelle zu Vs von den Vertretern der Arbeiterkammer i n der Kommission gewählt werden. Als Aufgabe der „Arbeitsstelle Arbeiterkammer" nennt die Satzung die Durchführung der Aufgaben der Universität aus dem Kooperationsvertrag. Als weitere Aufgabe erwähnt § 4 der Satzung den Auftrag, Verbindungsstelle zwischen Universität, Arbeiterkammer und den Gewerkschaften zu sein. § 3 Ziff. 6 der Satzung gibt den Mitarbeitern der Arbeitsstelle das Recht, mit beratender Stimme an der Sitzung der Kommission teilzunehmen. Von den unmittelbaren Entscheidungen über die den Bereich der Arbeitsstelle betreffenden Aufgaben 10 Vgl. für die Einzelheiten die Satzung des Arbeiterkammerbereichs, abgedruckt i m Anhang. 11 Der Kooperationsvertrag zwischen der Arbeiterkammer Bremen u n d der Universität Bremen, E i n Bericht, vorgelegt v o n der Arbeiterkammer, M a i 1976.
22
1. Teil: Bestandsaufnahme
waren die Wissenschaftler, die sozusagen hauptamtlich den Vertrag zu erfüllen hatten, durch die gewählte Konstruktion jedoch ausgeschlossen 12 . Zur Absicherung der Rechte der Mitarbeiter i n der Arbeitsstelle enthält § 3 Ziff. 4 die Bestimmung: „Die wissenschaftlichen Mitarbeiter sind i n der Wahl der Methoden der Forschung, Untersuchung und Darstellung sowie der Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse einschließlich der Feststellung von Lehrinhalten und Lehrvermittlung frei." Zweck dieser Bestimmung war nach dem Bericht der Arbeiterkammer „die Wahrung der Grundrechte (der der Arbeitsstelle angehörenden Wissenschaftler) aus A r t . 5 Abs. 3 des GG" 1 3 . Eine Folge der gewählten Konstruktion war die Einführung der „Wissenschaftskonferenz", die über die Geschäftsordnung geschaffen wurde und i n der die beteiligten Wissenschaftler der Arbeitsstelle eine A r t Ersatzorgan hatten für die inhaltliche Diskussion, auch wenn diese Wissenschaftskonferenz nur beratende Funktion hatte 1 4 . Zwischen der Arbeitsstelle Arbeiterkammer und der Kommission bildete sich dann eine — der Zwecksetzung der rechtlichen Konstruktion kaum entsprechende — Arbeitsteilung heraus. Die Kommission, obgleich sie alle Funktionen eines Selbstverwaltungsorgans innehatte, konzentrierte sich auf reine Verwaltungsarbeiten und die Bewältigung administrativer Schwierigkeiten; die Funktion der Beeinflussung und inhaltlichen Bestimmungen der Forschungsvorhaben wurde von der Kommission praktisch nicht wahrgenommen 16 . b) Die Entwicklung
ab 1978
Eine neue Situation ergab sich für die Vertragspartner durch die Verabschiedung des HRG und die daraufhin i n Bremen rasch i n Angriff genommene Novellierung des Bremer Hochschulgesetzes16. Das neue BremHG ließ für den Arbeiterkammerbereich nur die Organisationsform der zentralen wissenschaftlichen Einrichtung i m Sinne des § 92 des BremHG zu; für deren Leitung bestimmte § 6: „Die Leitung einer 12 Das aktive u n d passive Wahlrecht der Hochschullehrer des Arbeitskammerbereichs blieb durch die gleichzeitige Zuordnung zu einem Studienbereich gewahrt; vgl. Bericht der Universität, S. 14. 13 Bericht der Arbeiterkammer, S. 16. 14 Bericht der Universität, S. 14. 15 So die Einschätzung i n einem Bericht der Universität für das Projekt 3.140 „Arbeits- u n d Lebensbedingungen der Arbeitnehmer als Gegenstand der Hochschulforschung", Bremen, maschinenschriftlich, v o m 3. August 1977. 16 Einzelheiten über die E n t w i c k l u n g an der Universität nach Verabschiedung des H R G bei Stroh / Schmur, Der Kooperationsvertrag zwischen A r b e i terkammer u n d Universität i n Bremen, i n : Hochschule u n d Gewerkschaften, S. 163 ff.
I. Analyse des Inhalts der einzelnen Verträge
23
zentralen wissenschaftlichen Einrichtung besteht aus dem Rat, dem Vertreter aller an der Einrichtung tätigen Mitgliedergruppen angehören und der von den der Einrichtung zugeordneten Mitgliedern auf Zeit gewählt wird. I m Rat verfügt die Gruppe der Professoren über die Zahl von Stimmen, die für die absolute Mehrheit erforderlich und ausreichend ist." Auch der Bremer Hochschulgesetzgeber paßte sich so den Erfordernissen des Hochschulrahmengesetzes an. Damit war die halbparitätische M i t w i r k u n g von Vertretern der Arbeiterkammer an einer Universitätseinrichtung unmöglich geworden. Dies veranlaßte die Vertragsparteien zum Abschluß einer neuen Vereinbarung zur Ergänzung des Kooperationsvertrages am 27. Mai 1977, die am 5. September 1978 ergänzt wurde. Man vereinbarte nunmehr die Schaffung des i n § 6 des ursprünglichen Kooperationsvertrages vorgesehenen Kuratoriums; auch dies sollte halbparitätisch zusammengesetzt sein; dessen Aufgaben werden aber bereits i m ersten Satz der neuen Vereinbarung als „Beratungsfunktion" gekennzeichnet. I m einzelnen weist die neue Vereinbarung dem Kuratorium folgende wesentliche Aufgaben und Kompetenzen zu: — Sicherung der Durchführung des Kooperationsvertrages; — Förderung der Zusammenarbeit zwischen Hochschule u n d Arbeitnehmern; — Erarbeitung v o n Rahmenplänen (Forschungs-, Arbeiterbildungs- u n d Weiterbildungsprogramme) ; — M i t w i r k u n g bei der Bestimmung der Gegenstände der Forschung i m Rahmen des Kooperationsvertrages;
Ziff. 2 der neuen Vereinbarung betrifft die bisherige Arbeitsstelle Arbeiterkammer. Die Universität verpflichtet sich, diese als zentrale wissenschaftliche Einrichtung auf Dauer weiterzuführen und angemessen auszustatten. Die gestiegene Unabhängigkeit dieser Einrichtung von der Arbeiterkammer kommt nunmehr bereits i n der neuen Namensgebung zum Ausdruck; während die Arbeiterkammer an der Bezeichnung „Arbeitsstelle Arbeiterkammer" festhalten wollte 1 7 , entschied man sich für die Bezeichnung „Kooperation Universität Arbeiterkammer, zentrale wissenschaftliche Einrichtung Arbeit und Betrieb". Schon i m Namen deutet sich eine tendenzielle Schwerpunktverlagerung von der Konzeption des Arbeiterkammerbereichs als Koordinierungsund Arbeitsgremium zum industriesoziologischen Forschungsinstitut an. Die Aufgabenstellung w i r d i n der Vereinbarung mit Wahrnehmung von Aufgaben der Forschung und Schaffung eigenständiger Beiträge zur Arbeiterbildung/Weiterbildung umschrieben. U m den erstrebten " Bestandsaufnahme für das Projekt 3.140, S. 9.
24
1. Teil: Bestandsaufnahme
Praxisbezug der Forschung zu sichern, sollen für die Durchführung von Forschungsvorhaben begleitende Ausschüsse eingerichtet werden, zusammengesetzt aus den beteiligten Forschern, aus Vertretern der Arbeiterkammer und der Gewerkschaften sowie aus Betriebs- und Personalräten aus den betroffenen Betrieben 1 8 . Die wesentliche Funktion dieser neuen Einrichtung kann danach eindeutig als eine speziell auf die Forschung ausgerichtete Einheit bezeichnet werden. Es sollen Vorhaben durchgeführt werden, die geeignet sind, längerfristig die sozialwissenschaftlichen Grundlagen einer auf die Verbesserung der Lebens» und Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer zielenden anwendungsbezogenen Forschung, Entwicklung und Weiterbildung zu verbessern 19 . Nicht alle Planstellen sowie Personal- und Sachmittel, die bisher dem Arbeitskammerbereich gewidmet waren, wurden i n die neue wissenschaftliche Einrichtung Arbeit und Betrieb überführt. Zugleich wurde — als zentrale Betriebseinheit gemäß § 92 BremHG — eine „Zentralstelle für die Durchführung des Kooperationsvertrages zwischen der Universität Bremen und der Arbeiterkammer Bremen" geschaffen 20 , i n die die übrigen Stellen und Mittel überführt wurden. Als Aufgaben dieser Betriebseinheit nennt der Einrichtungsbeschluß vor allem: — die wissenschaftliche u n d verwaltungsmäßige Betreuung des K u r a toriums; — die Förderung v o n Projekten der Kooperationsforschung durch die Bereitstellung v o n Personal- u n d Sachmitteln u n d organisatorische Unterstützung i m Rahmen der Beschlüsse des Kuratoriums; — die Erarbeitung u n d V e r m i t t l u n g v o n wissenschaftlichen Gutachten u n d Stellungnahmen zu Arbeitnehmerproblemen auf Anforderung der Arbeiterkammer, der Einzelgewerkschaften u n d der Betriebs- u n d Personalräte; — die Entwicklung u n d Planung von Lehreinheiten u n d Kursen zur A r beitnehmerweiterbildung.
Nach den Vorstellungen der Vertragspartner soll die Zentralstelle wissenschaftliche Anforderungen aus dem gewerkschaftlichen Bereich — soweit sie sie nicht selbst erledigt — i n andere Forschungsbereiche der Universität vermitteln bzw. entsprechende Aufträge anderweitig vergeben 21 . 18
Vgl. i m einzelnen den Einrichtungsbeschluß für die zentrale wissenschaftliche Einrichtung A r b e i t u n d Betrieb v o m 19. J u l i 1978, abgedruckt i m Anhang. i» Einrichtungsbeschluß, Ziff. 2.1. so Einrichtungsbeschluß für die Zentralstelle für die Durchführung des Kooperationsvertrages v o m 19. J u l i 1978 u n d 27. September 1978. 2i Ströh / Schmurr, S. 167.
I. Analyse des Inhalts der einzelnen Verträge
25
Vergleicht man diese Aufgabenumschreibung mit derjenigen der zentralen wissenschaftlichen Einrichtung Arbeit und Betrieb, so w i r d deutlich, daß die unterschiedlichen Funktionen, die bisher der Arbeiterkammerbereich gemeinsam wahrgenommen hatte und deren rechte Zuordnung bzw. Gewichtung innerhalb dieser Einrichtung stets problematisch gewesen war, nun auf verschiedene Einrichtungen übertragen werden. Während die Forschungsfunktionen von der Einrichtung Arbeit und Betrieb erfüllt werden sollen, sind die Koordinationsaufgaben zwischen Arbeiterkammer und Universität, sowie die von dem Vertragspartner stets geforderten „Serviceleistungen" 22 — kurzfristige Erfüllung von Einzelforderungen — künftig durch die Zentralstelle wahrzunehmen. Eine Einwirkung des paritätisch besetzten Kuratoriums auf die Arbeit der zentralen wissenschaftlichen Einrichtung Arbeit und Betrieb findet nur insoweit statt, als daß das Kuratorium projektbegleitende Ausschüsse für praxisbezogene Forschungsvorhaben besetzt. I m übrigen sieht der Einrichtungsbeschluß keine direkten Einwirkungsmöglichkeiten des Kuratoriums vor. Demgegenüber heißt es i m Einrichtungsbeschluß zur Zentralstelle ausdrücklich: „Die Zentralstelle für die Durchführung des Kooperationsvertrages erfüllt ihre Aufgaben unter Beachtung der Beschlüsse des Kuratoriums zur Durchführung des Kooperationsvertrages 23 ." Diese stärkere Anbindung der A r beit der Zentralstelle an die Beschlüsse des paritätisch besetzten Kuratoriums entspricht der Zielsetzung dieser Einrichtung, die i m wesentlichen eine Dienstleistungsfunktion für den Vertragspartner haben soll; daher werden diesem auch stärkere Mitspracherechte eingeräumt.
2. Der Oldenburger Vertrag
a) Vorgeschichte A m 25. August 1970 beschloß das Niedersächsische Kabinett die Gründung der Universität Oldenburg. A m 26. März 1971 konstituierte sich der Gründungsausschuß. I m September 1971 gab es erste informelle Kontakte zwischen dem Gründungsausschuß der Universität und dem DGB Kreis Oldenburg 2 4 . Es bildete sich ein Gesprächskreis Reformuniversität Oldenburg (GROL), an dem neben Gewerkschaftsvertretern auch gewerkschaftlich organisierte Hochschullehrer beteiligt wa22 Ströh / Schmurr, S. 165. 23 Einrichtungsbeschluß für die Zentralstelle v o m 19. J u l i 1978 u n d 27. September 1978, Ziff. 1. 24 Z u r Entwicklung i n Oldenburg vgl. Schultze / Krüger, Zusammenarbeit von Gewerkschaften u n d Universität Oldenburg, in: Hochschule u n d Gewerkschaften, S.168.
26
1. Teil: Bestandsaufnahme
ren. Der GROL entwickelte eigene Vorstellungen über die Konzeption der Reformuniversität. Erster sichtbarer Ausdruck der hier stattfindenden Kontakte zwischen Universität und DGB war die Durchführung der ersten Betriebsräteschulung des DGB i n der Universität i m Mai 1973. A m 29. Januar 1974 erklärte dann der Gründungsausschuß „seine grundsätzliche Bereitschaft mit dem DGB zum Zweck einer langfristigen, gleichberechtigten und gegenseitigen Zusammenarbeit einen Kooperationsvertrag zu schließen" 25 . I n den Erläuterungen zur Beschlußvorlage zum möglichen bzw. erforderlichen Inhalt wurde ausgeführt, der Vertrag müsse eine Verpflichtung zur gleichberechtigten, gegenseitigen Zusammenarbeit enthalten; eine Unterstützung der Gewerkschaften bei der Wahrnehmung und Förderung von Arbeitnehmerinteressen sowie eine Unterstützung der Universität durch Einbringung von Erfahrungen und Hinweisen 2 6 . Nach Gesprächen zwischen der Universität auf der einen Seite und Vertretern des DGB sowie der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben auf der anderen Seite war i m November 1974 ein erster Vertragsentw u r f unterschriftsreif. Dieser lehnte sich eng an das Bremer Vorbild an. § 1 enthielt die generelle Verpflichtung der Partner zur gegenseitigen Zusammenarbeit i m Rahmen ihrer jeweiligen Satzungen. Bindungen für die Universität ergaben sich aus den §§ 2 und 4. I n § 2 verpflichtete sich die Universität, in Forschung, Lehre und Studium den DGB sowie Arbeit und Leben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere bei der Wahrnehmung und Förderung der Arbeitnehmerinteressen i n gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Hinsicht zu unterstützen. I n § 4 verpflichten sich die Partner, personelle und sachliche Mittel — über die jeweils i m Einzelfall zu entscheiden ist — i m Rahmen ihrer Möglichkeiten einzusetzen. Die Gegenleistung des DGB enthielt § 3. Der DGB und Arbeit und Leben verpflichten sich, die Einbeziehung von Arbeitnehmerproblemen i n Forschung und Lehre zu unterstützen und die Ergebnisse der wissenschaftlichen Fragestellungen den Arbeitnehmern zu vermitteln. § 5 des Vertragsentwurfes sah die Bildung einer paritätischen Kommission zur Durchführung des Vertrages vor. Nachdem i n der Presse erhebliche K r i t i k gegen den geplanten Vertragsschluß vorgebracht worden war, die unter anderem auch vom Beamtenbund und von der CDU-Landtagsfraktion unterstützt wurde 2 7 , 25 Beschluß des Gründungsausschusses v o m 29. Januar 1974, Drucksache 220/74 in: Dokumente u n d Materialien, herausgegeben von der Pressestelle der Universität Oldenburg, Oldenburg März 1975. 26 Erläuterungen zur Beschlußvorlage, in: Dokumente u n d Materialien, Drucksache 220/74.
I. Analyse des Inhalts der einzelnen Verträge
27
sagte der DGB am 26. November 1974 kurzfristig die geplante Vertragsunterzeichnung ab 2 8 . Der DGB machte rechtliche Bedenken gegen den vorliegenden Vertrag geltend 29 . Der Nichtunterzeichnung folgte eine intensive öffentliche Auseinandersetzung. U. a. kam es zu einer Anfrage von zwei Landtagsabgeordneten der FDP i m niedersächsischen Landtag, die Auskunft begehrten, ob die Landesregierung Kooperationsverträge dieser oder ähnlicher A r t für zulässig ansehe, wie sie die Auswirkungen auf die Freiheit von Forschung und Lehre beurteile und wie sie — falls sie derartige Verträge nicht für zulässig ansehe — ihren Standpunkt durchsetzen wolle 3 0 . I n seiner Antwort begrüßte der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst, Grolle, die Bereitschaft der Universitäten, „sich i n Forschung und Lehre den vielfältigen Problemen ihrer gesellschaftlichen Umwelt zu öffnen", räumte aber ein, daß der Entwurf i n seiner zunächst bekanntgewordenen Fassung mit rechtlichen Einwendungen zu rechnen gehabt hätte 3 1 . b) Der Abschluß des Vertrages Nach Verhandlungen zwischen den Vertragspartnern, an denen auch Vertreter des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst beteiligt waren, kam es am 17. Dezember 1974 zur Unterzeichnung einer teilweise umformulierten Übereinkunft. Eine erste Veränderung gab es schon i n der Bezeichnung; trug der ursprüngliche Text die Überschrift „Kooperationsvertrag", so heißt es nun „Kooperationsvereinbarung". I n § 1 des neuen Textes bekunden die Parteien ihre Bereitschaft zur gleichberechtigten und vertrauensvollen Zusammenarbeit i m Rahmen ihrer jeweiligen Satzungen. I n § 2 verpflichtet sich die Universität mit den Bildungseinrichtungen des DGB und der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, Probleme der Arbeitnehmer zu behandeln. § 3 enthält die Gegenverpflichtung von DGB und Arbeit und Leben, die Universität bei ihrem Bemühen, Arbeitnehmer27 Vgl. dazu i m einzelnen die Materialien i n der Dokumentation: A u f dem Weg zur Tendenzuniversität, herausgegeben v o m B u n d Freiheit der Wissenschaft, Bonn 1976 u n d die Zusammenstellung der Materialien, in: Dokumente und Materialien, T e i l I I . 28 Siehe dazu den Bericht des N W Z v o m 27. November 1974. 2« Gestützt w u r d e n diese Bedenken auf die Universitätsgrundordnung, die nach Auffassung des DGB eine Zusammenarbeit m i t Organisationen, die sich nicht ausschließlich oder p r i m ä r der Wissenschaftspflege widmeten, nicht deckte (dazu näher unter 2. Teil, I I I . 2.). Vorangegangen waren allerdings Kontakte zwischen der Staatskanzlei des niedersächsischen Ministerpräsidenten u n d dem DGB Niedersachsen. 30 Niedersächsischer Landtag — 8. Wahlperiode, 4. Tagungsabschn., 8. Plenarsitzung am 11. Dezember 1974; Frage Nr. 7 der Landtagsdrucksache Nr. 294. 31 Ebenda.
28
1. Teil: Bestandsaufnahme
fragen zu behandeln, zu unterstützen, und die von der Universität erarbeiteten Fragestellungen und Ergebnisse der Arbeitnehmerschaft durch geeignete Maßnahmen zu vermitteln. Zur Beratung der sich bei der Durchführung der Vereinbarung ergebenden Fragen sieht § 4 die Bildung eines paritätisch besetzten Gremiums vor. Vergleicht man die Formulierung des Vertragstextes, der den Bedenken des DGB zum Opfer fiel, mit dem Text der abgeschlossenen Übereinkunft, ergeben sich — abgesehen von der terminologischen Korrektur bei der Bezeichnung Vereinbarung statt Vertrag — folgende Unterschiede: aus der Formulierung, die Universität unterstützt in Forschung und Lehre und Studium den DGB und Arbeit und Leben, wurde die Bekundung der Bereitschaft der Universität zur Zusammenarbeit. Die i n § 4 des Entwurfes fixierte Verpflichtung, personelle und sachliche Mittel i m Rahmen ihrer Möglichkeiten einzusetzen, taucht i m Text der abgeschlossenen Vereinbarung nicht mehr auf. Zwar meldete die CDU Niedersachsen auch gegen diese revidierte Fassung erhebliche Bedenken an 3 2 und kündigte eine genaue rechtliche und politische Überprüfung an — doch das ebenfalls angekündigte parlamentarische Nachspiel blieb jedenfalls i m niedersächsischen Landtag aus 33 . Während jedoch i n Bremen zur Durchführung des Vertrages an der Universität erhebliche institutionelle Folgewirkungen auftraten (Einrichtung des Arbeiterkammerbereichs), kann derartiges i n Oldenburg nicht festgestellt werden. Speziell für die Durchführung der Vereinbarung hat die Universität Oldenburg keinerlei personelle oder materielle Ausstattung zur Verfügung gestellt. Die in § 4 der Vereinbarung vorgesehene Kommission trat am 15. A p r i l 1975 das erste Mal zusammen.
32 H A Z v o m 19. Dezember 1974. Es k a m aber zu einer kleinen Anfrage verschiedener Abgeordneter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion; vgl. Bundestagsdrucksache 7/3260; i m niedersächsischen Landtag k a m der Oldenburger Vertrag noch einmal i n der 17. Plenarsitzung zur Sprache, als Prof. Pols von der C D U - F r a k t i o n noch einmal seine Bedenken aus A r t . 5 Abs. 3 GG erneuerte u n d äußerte, der Vertrag bewege sich am Rande der Legalität (vgl. Protokolle des niedersächsischen Landtags, 8. Wahlperiode, 7. Tagungsabschn. am 4. A p r i l 1975, 16. Plenarsitzung, S. 1439). Der niedersächsische Wissenschaftsminister Grolle wies diese Bedenken erneut zurück; dadurch, daß § 1 der Vereinbarung auf die jeweiligen Satzungen verweise, sei klargestellt, daß v o n Seiten der Hochschulorgane keine Einflußnahme auf die einzelnen Wissenschaftler erfolgen könne u n d auch nicht beabsichtigt sei. 33
I. Analyse des Inhalts der einzelnen Verträge
29
3. Der Bochumer Vertrag
Als dritter Vertrag i n der Reihe der Abkommen zwischen Hochschulen und Arbeitnehmerorganisationen folgte am 9. J u l i 1975 der Abschluß zwischen der Ruhruniversität Bochum und der I G Metall. Erste Kontakte zwischen Universität und Vertretern der I G Metall datierten bereits aus dem Jahre 1965. Auch der zweite Rektor der Universität Biedenkopf bekundete das Interesse der Universität an der Kooperation. 1972 konstituierte sich ein paritätisch besetzter Arbeitskreis, der Möglichkeiten der Kooperation erkunden sollte. I n Sitzungen am 25. März 1974 und 22. A p r i l 1974 wurde ein Vertragstext entworfen. Nachdem dem Senat der Universität einige Bedenken vorgetragen worden waren, kam es zu Textänderungen. Der Senat der Universität billigte den Vertragsentwurf am 15. Mai 1975. Der Vorstand der I G Metall hatte bereits am 11. März 1975 zugestimmt 34 . I n § 1 des Vertrages, der die Überschrift trägt „Vereinbarung über die Zusammenarbeit", verpflichten sich die Partner zur Zusammenarbeit auf der Ebene der Einrichtungen der RUB und des I G Metall Bildungszentrums Sprockhövel i m Rahmen der ihnen gesetzlich bzw. satzungsgemäß übertragenen Aufgaben. I n § 2 bekunden die Vertragspartner ihr Interesse an einer zukunftsweisenden Bildungspolitik und der verstärkten Hinwendung der Wissenschaft zu Problemen, die sich aus der Arbeitswelt der abhängig Beschäftigten ergeben. Die Hauptverpflichtung der RUB enthält § 4; darin heißt es: „Die Ruhruniversität Bochum verpflichtet sich i m Rahmen der i h r gegebenen Möglichkeiten von Forschung u n d Lehre zur Zusammenarbeit m i t der I G M e t a l l bei der E r f ü l l u n g v o n deren Aufgaben i m I G M e t a l l Bildungszentrum Sprockhövel."
I n § 3 des Vertrages ist von Seiten der IG Metall das Bildungszentrum Sprockhövel mit der Durchführung des Vertrages beauftragt. Die Gegenleistung der IG Metall enthält § 5; darin verpflichtet sich diese, Fragestellungen, die sich aus der praxisbezogenen Arbeit ergeben und Erfahrungen soweit wie möglich für Forschung und Lehre an die Universität heranzutragen und Material zur Verfügung zu stellen. § 7 des Vertrages sieht die Bildung eines paritätisch besetzten Kuratoriums zur Sicherung der Durchführung der Vereinbarung vor. 4. Die Saarbrücker Verträge
A m 12. März 1976 folgte der Abschluß von Kooperationsverträgen in Saarbrücken. Beteiligt waren hier — wie i n Bremen — auf der einen 34 Vgl. zu den Einzelheiten der Entstehungsgeschichte die Angaben i n R U B aktuell, Zeitung der Ruhruniversität v o m 10. J u l i 1975, S. 3.
30
1. Teil: Bestandsaufnahme
Seite die Arbeitskammer des Saarlandes, der kraft Gesetzes alle i m Saarland beschäftigten Arbeiter angehören, sowie auf der Seite der Hochschulen die Pädagogische Hochschule und die Fachhochschule des Saarlandes. Vorausgegangen war eine Initiative von Seiten der A r beitskammer, die den Hochschulen des Saarlandes 1975 ihre Bereitschaft erklärte, „mit der Hochschule des Saarlandes bzw. ihren Einzelhochschulen Vereinbarungen über eine institutionalisierte Kooperation zu treffen" 3 6 . Dabei bekundete die Arbeitskammer besonders ihr Interesse an Initiativen auf dem Gebiet der Weiterbildung und der Behandlung von Arbeitnehmerfragen i n der Hochschulforschung, die die Arbeiterkammer wegen des starken Anteils wirtschaftlicher Drittmittelforschung als vernachlässigt ansah 36 . Daraufhin kam es zu Kontakten zwischen Fachhochschule, Pädagogischer Hochschule und der Arbeitskammer, die am 12. März 1976 zum Vertragsschluß führten. I m Vertrag zwischen PH und Arbeitskammer verpflichten sich die Vertragspartner zur Zusammenarbeit i m Rahmen der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben (§ 1). I n § 2 verpflichtet sich die PH, durch die ihr i n § 2 des Gesetzes über die PH eingeräumten Möglichkeiten die Arbeitskammer ergänzend zu unterstützen. § 3 und § 4 enthalten die Verpflichtung der Arbeitskammer: Erfahrungen aus der Praxis an die PH heranzutragen und Mittel zur Durchführung des Vertrages i m Rahmen ihrer Möglichkeiten einzusetzen. § 5 regelt die Bildung einer paritätischen Kommission zur Initiierung und Koordination der i m Rahmen des Vertrages durchgeführten Projekte. Ähnlich sieht auch der Vertrag zwischen Arbeitskammer und der Fachhochschule aus. Die Vertragspartner bekunden ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet der theoretischen und angewandten Arbeitswissenschaft und i n der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Weiterbildung (§§ 1 und 5). Die Fachhochschule verpflichtet sich — unbeschadet ihrer aus der Selbstverwaltung resultierenden Rechte —, die Arbeitskammer bei der Planung von Lehrveranstaltungen i n arbeitswissenschaftlichen Gebieten angemessen zu beteiligen und Mitgliedern, die an den mit der Arbeitskammer durchgeführten Projekten beteiligt sind, die Nutzung von Geräten und Einrichtungen zu gestatten, außerhalb der Zeit in der sie die Fachhochschule selbst nutzt und gegen Erstattung der direkten Kosten. Die Arbeitskammer bekundet i n § 2 auf die Durchführung von Untersuchungen und Entwicklungsaufträgen i m Bereich der ArbeitsgeBericht an die Regierung des Saarlandes, hrsg. von der Arbeitskammer des Saarlandes 1975, S. 212 ff.; vgl. zur Entwicklung i n Saarbrücken i m ü b r i gen Wagner / Peter, Saarbrücken als Modell der Zusammenarbeit v o n Gewerkschaften u n d Hochschulen, in: Hochschulen u n d Gewerkschaften, S. 215 ff. 3« Bericht an die Regierung des Saarlandes, S. 213 f., besonders S. 215 f.
I. Analyse des Inhalts der einzelnen Verträge
31
staltung an der Fachhochschule des Saarlandes hinzuwirken. § 6 enthält wie der Vertrag m i t der PH die Bestimmung über die Bildung einer paritätischen Kommission zur Vertragsdurchführung. 5. Die Konstanzer Diskussion um einen Vertragsabschluß
Während i n Bremen, Oldenburg, Bochum und Saarbrücken die Initiativen zur Kooperation jeweils erfolgreich i n den Abschluß eines förmlichen Kooperationsvertrages einmündeten — trotz teilweise intensiver K r i t i k —, ist die Universität Konstanz ein Beispiel für eine gegenteilige Entwicklung. Dort scheiterte eine geplante Kooperationsvereinbarung vorwiegend am internen Widerstand Konstanzer Hochschullehrer. Zu ersten näheren Kontakten zwischen der Universität Konstanz und dem DGB kam es 1974. Der damalige Rektor Naschold regte an, die auch i n Konstanz praktizierte Zusammenarbeit zwischen Industrie und Universität durch eine Kooperation mit den Gewerkschaften zu ergänzen 37 . I m Rahmen eines Arbeitskreises, der mit Vertretern der Hochschule und der Gewerkschaften besetzt war, wurde dann der Entwurf eines Kooperationsvertrages erörtert. Dies führte dazu, daß i m A p r i l 1976 der Entwurf einer Vereinbarung veröffentlicht und i n der Universität diskutiert wurde 3 8 . Die vorgesehene Vereinbarung entsprach inhaltlich weitgehend dem Bochumer bzw. dem Oldenburger Vertrag. Der Rektor Naschold begründete die vorgesehene Form der Zusammenarbeit damit, daß gegenüber den Gewerkschaften eine organisierte Form der Zusammenarbeit geboten sei, u m mehr Kontinuität unabhängig von zufälligen Repräsentanten zu ermöglichen. Dies sei i m Falle der Zusammenarbeit i m Unternehmensbereich wegen der Organisationsform der dortigen Zusammenarbeit nicht erforderlich 39 . Gegen den Vertragsschluß wandten sich 39 habilitierte Konstanzer Hochschulangehörige 40 . Der Konstanzer Arbeitsrechtler Rüthers warnte öffentlich vor den Gefahren der „Tendenzuniversität" 4 1 . M i t dem kurz darauf erfolgten Weggang a? Z u r Entwicklungsgeschichte der Konstanzer Vertragsdiskussion siehe vor allem Reisacher / Baeckmann, Krisenpunkte einer Entwicklung — Die Kooperation v o n Universität u n d DGB i n Konstanz, in: Hochschule u n d Gewerkschaften, S. 222 ff.; sowie Rüthers, Gewerkschaftliche Orientierung der Universitäten?, in: Konstanzer Blätter für Hochschulfragen, Jahrgang X I V , Heft 3, Dezember 1976, S. 30 ff. 38 U n i - I n f o Konstanz, Nr. 75 v o m 30. A p r i l 1976. 3« Ebenda. 40 Vgl. Die Welt v o m 28. J u n i 1976. 41 Rüthers, A u f dem Weg der Tendenzuniversität, in: F A Z v o m 23. Oktober 1976.
32
1. Teil: Bestandsaufnahme
des Rektors Naschold, der einen Ruf nach Berlin annahm, verließ eine der treibenden Kräfte zum Abschluß der Vereinbarung Konstanz. I n der darauffolgenden Diskussion um das Für und Wider des Vertrages 42 setzten sich auf Universitätsseite schließlich die Vertragsgegner durch; es kam zu weiteren Kontakten zum DGB, ein förmlicher Vertragsabschluß unterblieb jedoch.
II. Parallelen und Differenzen zwischen den einzelnen Verträgen Eine Analyse der Parallelen bzw. relevanten Differenzen zwischen den vorliegenden Abkommen soll hier nach folgenden Kriterien unternommen werden: — Partner der Hochschulen — Rechtsnatur der geschlossenen A b k o m m e n — Ausmaß der von den Hochschulen übernommenen Verpflichtungen — Umfang der Einwirkungsrechte der Kooperationspartner auf die Hochschulen. 1. Partner der Hochschulen
I m Hinblick auf die Vertragspartner muß zwischen dem Bremer und den Saarbrücker Abkommen auf der einen Seite und den Abschlüssen von Bochum und Oldenburg auf der anderen Seite unterschieden werden. Partner i n Bremen und i m Saarland sind dort jeweils die Arbeiterbzw. Arbeitskammer, also öffentlich-rechtliche Zwangskörperschaften, denen kraft Gesetzes alle Arbeiter i n Bremen und i m Saarland angehören. Es handelt sich also u m eine Kooperation von öffentlich-rechtlichen Körperschaften 43 . Zwar w i r d die Zuordnung der Hochschule zur „mittelbaren Staatsverwaltung" zum Teil nach wie vor m i t dem Argument i n Zweifel gezogen, die Hochschulen dienten „vorstaatlichen" öffentlichen Interessen besonderer A r t 4 4 , der staatliche Charakter der bestehenden Hochschulen 46 w i r d aber damit nicht widerlegt. Wissenschaftspflege ist — ohne beim Staat monopolisiert zu sein — auch Staatsaufgabe 46 . Ungeachtet der teilweisen Ausgliederung aus der all42
Siehe dazu Reisacher / Baeckmann, S. 227. « Z u m Streit, ob bei den Hochschulen nicht die anstaltlichen Elemente überwiegen (so etwa Forsthoff, Verwaltungsrecht, S. 489), siehe unten, 2. Teil, II. 44 Wolff / Bachof, Verwaltungsrecht I I , § 84 I f.; vgl. auch Gallas, Staatsaufsicht, S. 92 f.; dazu näher unten, 4. Teil, I I . 45 Vgl. Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, § 58 Rdnr. 3, Oppermann, K u l turverwaltungsrecht, S. 320 ff., Lorenz, Wissenschaftsrecht, B a n d i i (1978), S. 1 ff.; Bull, Staatsaufgaben, S. 295. 46 Bull, S. 295; Lorenz, JZ 81, S. 113; Hailbronner, in: Großkreutz u.a., HRG, Rdnr. 5 zu § 58.
I I . Parallelen und Differenzen
33
gemeinen Staatsverwaltung werden hier staatliche Aufgaben hoheitlich wahrgenommen 47 . Die Hochschulen sind nicht dem gesellschaftlichen Bereich zuzurechnen. Auch die Zuordnung der Kammern i n Bremen und Saarbrücken zum staatlichen Bereich kann nicht i n Zweifel gezogen werden. I n Hechtsform und Aufgabenbestimmung sind die Kammern auf den staatlichen Bereich bezogen, auf das Ganze von Staat und Gesellschaft 48 . Für das hoheitliche Handeln der Kammern gilt grundsätzlich das gleiche, was für das Handeln anderer Glieder der mittelbaren Staatsverwaltung gilt 4 9 . Während also i n Bremen und Saarbrücken staatliche Körperschaften miteinander kooperieren, handelt es sich bei dem Bochumer und Oldenburger Vertrag u m die Kooperation mit einem gesellschaftlichen Interessenverband. Vertragspartner i n Oldenburg ist der Landesbezirk Niedersachsen des DGB und die vom DGB mitgetragene Bildungsvereinigung Arbeit und Leben. I n Bochum kooperiert die I G Metall, die den Vertrag durch ihr Bildungszentrum Sprockhövel durchführen läßt. Die Tatsache, daß i n beiden Fällen nicht nur lokale Instanzen auf seiten der Gewerkschaften die Vereinbarung abgeschlossen haben, sondern i n Bochum der Bundesverband der I G Metall, i n Oldenburg der Landesbezirk Niedersachsen, ist Indiz für die Bedeutung, die von Gewerkschaftsseite den Kooperationsverträgen beigemessen wurde. Dieser Unterschied i n bezug auf die Vertragspartner w i r d dadurch i n seiner Bedeutung relativiert, daß es sich bei den Kammern zwar u m formell staatliche Körperschaften handelt, zu deren Hauptaufgaben aber auch die Vertretung der Partikularinteressen 50 der i n den Kammern organisierten Arbeitnehmer gegenüber anderen staatlichen und gesellschaftlichen Instanzen zählt. Das Bundesverfassungsgericht hat angenommen, daß „auf dem Gebiet der freien Interessenwahrnehmung" unzweifelhaft eine Konkurrenz der Kammern mit den Gewerkschaften besteht 51 . Es kommt hinzu, daß besonders i n Bremen die Gewerkschaften von Beginn an i n die Kooperation mit einbezogen wurden 5 2 . Dies w i r d nunmehr auch deutlich i n dem Einrichtungsbeschluß zu dem neu47 Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 3. 48 BVerfGE 38, 281 (307). 4» Dies bejaht auch Mronz, Körperschaften, S.261, auch w e n n dieser die K a m m e r n n u r als „formell öffentlich-rechtliche Körperschaften" ansehen will. so Z u r Problematik der Befassung m i t Partikularinteressen i n hoheitlicher Form, vgl. Mronz, Körperschaften, S. 258 ff. si BVerfGE 38,281 (308). 52 Vgl. den Bericht von Ströh / Schmurr, Der Kooperationsvertrag zwischen Arbeiterkammer u n d Universität i n Bremen; in: Hochschule u n d Gewerkschaften, S. 155 ff. 3 Uechtritz
34
1. Teil: Bestandsaufnahme
geschaffenen Kuratorium 5 3 und zur Zentralstelle für die Durchführung des Kooperationsvertrages 54 . So ist die Aufgabenstellung des Kuratoriums „Förderung der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Gewerkschaften"; die Berufung der Vertreter der Arbeiterkammer erfolgt „ i n Abstimmung" mit den DGB-Kreisvorständen Bremen und Bremerhaven. Als Aufgabe der Zentralstelle ist i m Einrichtungsbeschluß u. a. aufgeführt: „Die Erarbeitung und Vermittlung von wissenschaftlichen Gutachten und Stellungnahmen zu Arbeitnehmerproblemen auf Anforderung der Arbeitnehmer, der Einzelgewerkschaften und der Betriebs- und Personalräte 56 ." Der Entschluß, die Kooperation 1977 trotz Reduzierung der unmittelbaren Einflußmöglichkeiten der Arbeiterkammer auf die Arbeit der Hochschule fortzusetzen, wurde „ i n Ubereinstimmung mit den DGB-Kreisvorständen Bremen und Bremerhaven" gefällt 5 6 . Insgesamt kann festgestellt werden: Ungeachtet der Tatsache, daß die Gewerkschaften i n Bremen nicht Vertragspartner der Hochschulen sind, werden diese dennoch faktisch und institutionell i n die Kooperation miteinbezogen. Dies bedeutet, daß auch i n Bremen nicht lediglich eine Kooperation zwischen staatlichen Instanzen vorliegt, sondern daß auch hier ein besonderes Näheverhältnis zwischen der staatlichen Institution Hochschule und den Gewerkschaften begründet wird. Die Gewerkschaften haben sich — i n Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer — der Bremer Kooperation angenommen und Einfluß auf Ausgestaltung und Entwicklung der Kooperation ausgeübt. Insoweit besteht also eine Parallelität zwischen allen abgeschlossenen Abkommen. Durch sie w i r d eine besondere Befassung der Hochschulen mit Aufgaben der Gewerkschaften angestrebt. 2. Rechtsnatur der Abkommen
Eine Differenz besteht bei der Terminologie der geschlossenen Abkommen. Während i n Bremen und i m Saarland sowie i m ursprünglichen Oldenburger Vertragsentwurf die Abkommen als „Vertrag" bezeichnet werden, tragen die Abschlüsse i n Bochum und Oldenburg sowie der Konstanzer Entwurf die Überschrift „Vereinbarung". I n Oldenburg wurde dem Übergang auf den Terminus „Vereinbarung" eine 53
Vgl. den Beschluß des Konvents der Universität Bremen v o m 12. J u l i 1978, abgedruckt i m Anhang. 54 Beschluß des akademischen Senats der Universität Bremen v o m 19. J u l i 1978, abgedruckt i m Anhang. 55 Ziff. 2.3. des Einrichtungsbeschlusses v o m 19. J u l i 1978. M Stellungnahme der Arbeiterkammer Bremen zur weiteren Zusammenarbeit m i t der Universität Bremen i m Rahmen des Kooperationsvertrages v o m 27. J u l i 1971 v o m 19. A p r i l 1977, S. 1, maschinenschriftlich.
I I . Parallelen und Differenzen
35
gewisse Bedeutung zugemessen i m Hinblick auf mögliche Rechtsbedenken aus der Staatskanzlei 57 . Andererseits scheint man sich ζ. B. i n Bochum kaum Gedanken über die Terminologie gemacht zu haben. Das Abkommen ist überschrieben „Vereinbarung über die Zusammenarbeit", doch sprach das Rektorat i n einer Erklärung vom „abgeschlossenen Vertrag" und auch die von der Universität herausgegebene Zeitung kennzeichnet die Vereinbarung als Vertrag 5 8 . I n der Tat ist nicht ersichtlich, welche rechtliche Relevanz die unterschiedliche Einstufung der Abkommen teils als „Vertrag", teils als „Vereinbarung" besitzen soll. Bei den von den Hochschulen geschlossenen Abkommen handelt es sich nicht u m einseitige Absichtserklärungen, sondern um eine Übereinkunft mit dem jeweils ausgewählten Partner, i n deren Rahmen von beiden Seiten Erklärungen ausgetauscht werden über Fragen der Zusammenarbeit, der Unterstützung bzw. der genaueren Durchführung der Zusammenarbeit. Es liegt also eine Schaffung rechtlicher Beziehungen zwischen Rechtssubjekten vor. Durch die Abkommen w i r d ein Rechtsverhältnis zwischen den Partnern geschaffen, i n dem soziale Beziehungen rechtlich fixiert werden. Als wesentliches Element eines Rechtsverhältnisses ist die rechtliche Gebundenheit anzusehen, die i n der Regel gegenseitiger Natur ist, mindestens jedoch i n der Verpflichtung eines Rechtssubjekts besteht 59 . Durch die Abkommen w i r d zwischen den Hochschulen und ihren jeweiligen Partnern ein Rechtsverhältnis i n diesem Sinne begründet. Auch wenn man die übernommenen Verpflichtungen der Hochschule als wenig konkret ansieht, so werden doch besondere Rechtsbeziehungen zwischen den Partnern begründet. Diese getroffene Abmachung muß rechtlich als Vertrag qualifiziert werden. Die terminologische Scheu einiger Hochschulen, die i n der Wahl des rechtlich vagen Begriffs „Vereinbarung" zum Ausdruck kommt, war denn auch eher mit politischer Rücksichtnahme motiviert 6 0 . Klärungsbedürftig ist jedoch die Zuordnung der Abkommen zum öffentlichen bzw. privaten Recht. Für die Abgrenzung ist nach herrschender Meinung i n Rechtsprechung und Schrifttum auf den Gegenstand des Vertrages abzustellen. Öffentlich-rechtlich ist der Gegenstand, wenn es sich u m Sachverhalte handelt, die von der Rechtsordnung öffentlichem Auch ein Beteiligter an den damaligen Vertragsverhandlungen im niedersächsischen Wissenschaftsministerium meinte in einem Gespräch mit dem Verfasser, die Differenz in der Kennzeichnung Vertrag/Vereinbarung habe beiw der Überprüfung Rolle" gespielt. Vgl.damaligen RUB aktuell v o m 10. J u„eine l i 1975. s» Vgl. Wolff / Bachof, Verwaltungsrecht I, § 32 V a 1. β0 So auch die A u s k u n f t eines der Beteiligten auf Seite der Oldenburger Universität. Es ging bei der Umformulierung u m die Beseitigung „politischer Bedenken". 3*
36
1. Teil: Bestandsaufnahme
rechtlich geregelt sind 6 1 . Dabei ist auf den Gesamtcharakter des Vertrages abzustellen. Nach anderer Auffassung soll die Abgrenzung dadurch gelöst werden, daß man darauf abstellt, ob die i m Vertrag getroffene Regelung, wäre sie normativ erfolgt, eine Norm des öffentlichen Rechts wäre 6 2 . Für die hier zu beurteilenden Kooperationsverträge ist das Ergebnis nach beiden Auffassungen identisch. Es bedarf keiner Stellungnahme zu den kontroversen Meinungen 6 3 . Die Verträge betreffen die Zusammenarbeit der Hochschulen mit anderen Organisationen und beziehen sich auf die Aufgabe Wissenschaftspflege der Hochschulen. Die Aufgaben der Hochschulen sind i m Hochschulrahmengesetz bzw. i n den jeweiligen Landesgesetzen niedergelegt. Die Zuordnung des Hochschulrechts zum Bereich des öffentlichen Rechts ist unproblematisch. Alle Verträge, gleich ob sie mit einem gesellschaftlichen Vertragspartner oder mit den öffentlich-rechtlichen Zwangskörperschaften in Bremen bzw. Saarbrücken abgeschlossen wurden, sind als öffentlichrechtliche Verträge anzusehen. 3. Ausmaß der von den Hochschulen übernommenen Verpflichtungen
A l l e n geschlossenen Abkommen ist zunächst gemeinsam die Verpflichtung zur Zusammenarbeit i m Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben bzw. i m Rahmen ihrer jeweiligen Satzungen. Darüber hinausgehende Verpflichtungen sind i m Oldenburger und Bochumer Vertrag nicht enthalten. Eine ausdrückliche Unterstützungspflicht für den Vertragspartner enthalten § 2 des Bremer und § 2 des Saarbrücker Vertrages m i t der Pädagogischen Hochschule. I n diesen Abkommen erklären die beteiligten Hochschulen ihre Bereitschaft, den jeweiligen Partner bei der Erfüllung von dessen Aufgaben zu unterstützen. Eine Verpflichtung der Hochschulen zum Mitteleinsatz zur Durchführung des Vertrages enthielt § 4 des ursprünglichen Oldenburger und § 5 des Konstanzer Entwurfes. I n den abgeschlossenen Verträgen findet sich eine solche Verpflichtung nicht. Die Fachhochschule des Saarlandes verpflichtet sich nur i n eingeschränktem Maße (vgl. § 4 der Vereinbarung), die Nutzung von Geräten gegen Erstattung der direkten Kosten zu überlassen. Eine Besonderheit enthält der Bremer Vertrag i n § 5, i n dem sich die Universität verpflichtet, bei der Stellenausschreibung i n So ζ. B. Meyer, in: Meyer / Borgs, VerwaltungsVerfahrensgesetz, Rdnr. 17 zu § 54; Kopp, Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. § 53 Rdnr. 6. «2 So ζ. B. Wolff / Bachof, Verwaltungsrecht I, § 44 I I a 1. β3 Einen aktuellen Uberblick über den Diskussionsstand gibt Lange, N V w Z 1983, 313 ff.
I I . Parallelen und Differenzen
37
den entsprechenden Forschungsbereichen die Zielsetzung des Vertrages zu berücksichtigen. Unabhängig von der Frage, ob die Hochschulen sich zur Unterstützung oder lediglich zur Zusammenarbeit verpflichtet haben, ist allen Verträgen gemein, daß die kooperierenden Hochschulen diese Zusammenarbeit bzw. Unterstützung auf dem Feld von Forschung und Lehre anstreben. Da Forschung und Lehre nach der gesetzlichen Regelung von den einzelnen Hochschulangehörigen betrieben werden 6 4 , die Hochschule als Institution nicht forscht oder lehrt, ist der Inhalt der von den Hochschulen übernommenen Verpflichtung klärungsbedürftig. Da Forschung und Lehre grundsätzlich i m freien Bereich persönlicher und autonomer Verantwortung der einzelnen Wissenschaftler liegen 6 6 , und bindende Weisungen von Kollegialorganen nur i n eng begrenzten Ausnahmefällen anzuerkennen sind 6 6 , kann nicht angenommen werden, daß sich die Hochschulen dazu verpflichten wollten, generell auf die Hochschulangehörigen einzuwirken, i m Sinne der Vertragsziele zu arbeiten. Es entsprach auch nicht der Auffassung der Hochschulen, daß durch die Vereinbarung ihre einzelnen Mitglieder zur Mitarbeit i m Sinne des Kooperationsvertrages verpflichtet würden 6 7 . Unter Bezugnahme auf diese rechtlichen Gegebenheiten ist dann auch die K r i t i k geäußert worden, die Hochschulen verpflichteten sich zu einem objekt i v unmöglichen Tun; die eingegangenen Verpflichtungen könnten nicht von der Hochschule als solcher, sondern nur von den einzelnen Hochschullehrern i n die Tat umgesetzt werden 6 8 . Daraus könnte die Konsequenz gezogen werden, die Verträge seien nur Absichtserklärungen, i n denen die Hochschulen, die sich selbst als „Reformuniversitäten" verstehen, Bekenntnisse zur Grundausrichtung ihrer Universität von eher plakativer Natur ablegen wollten. Diese Deutung ist aber keinesfalls zwingend. Zwischen den Möglichkeiten, die Verträge als unverbindliche Absichtserklärungen zu deuten, bzw. der verfassungsrechtlich kaum haltbaren Übernahme einer Verpflichtung, auf die Inhalte «4 Vgl. § 43 HRG. «5 BVerfGE 35, 79 (113); vgl. auch bereits Röttgen, Grundrecht, S.21 u n d Rupp, V V D S t R L 27, 140. «β Vgl. Dallinger, in: Dallinger u.a., HRG, Rdnr. 6 zu §3; Reich, HRG, Rdnr. 4 zu §3; Hailbronner, in: Grosskreutz u.a., HRG, Rdnr. 27 ff. zu §3; Scholz, in: Maunz / D ü r i g / Herzog / Scholz, Rdnr. 118 zu A r t . 5 Abs. 3 GG; näher dazu unten, 3. Teil. Vgl. den Bericht i n R U B - a k t u e l l v o m 10. J u l i 1975, siehe auch das Rechtsgutachten zum Kooperationsvertrag zwischen der Universität Oldenburg u n d dem DGB-Landesbezirk Niedersachsen sowie der ΒildungsVereinigung A r b e i t u n d Leben, S. 6, in: Dokumente u n d Materialien; für Konstanz siehe die E r k l ä r u n g des Rektors Naschold zur Vorlage des Vertragsentwurfs in: U n i Info v o m 30. A p r i l 1976. Hentschel, M i t der Tendenzuniversität auf bildungspolitischer Talfahrt, in: A u f dem Weg zur Tendenzuniversität, S. 10.
38
1. Teil: Bestandsaufnahme
von Forschung und Lehre der einzelnen Hochschullehrer einwirken zu wollen 6 9 , liegt die Möglichkeit, die Verträge als den Abschluß einer „Rahmenvereinbarung" einzustufen 70 . Die Verträge sollen einen institutionell verfestigten, vom Wechsel der Personen unabhängigen Kontakt zwischen Wissenschaft und Gewerkschaft begründen 71 . Durch diesen Kontakt sollen Hochschulen und Gewerkschaften i n ein Näheverhältnis zueinander gebracht werden. Die traditionelle Distanz zwischen Universität und Arbeiterschaft soll reduziert werden. A u f diese Weise sollen Hochschulangehörige angeregt werden, sich verstärkt arbeitnehmerrelevanten Problemen zuzuwenden. Alle Verträge sehen die Bildung paritätischer Kooperationsorgane vor, deren Aufgabe mit „Durchführung des Vertrages" umschrieben wird. Durch diese Kooperationsorgane, an denen Vertreter der Gewerkschaften beteiligt sind, können Fragestellungen, die für die Gewerkschaften von Interesse sind, an die Hochschulen herangetragen werden. Die Pflicht, die die Hochschulen durch den Vertrag übernommen haben, besteht darin, diese Institution gleichfalls mit Hochschulangehörigen zu beschicken und Anregungen dieser Kooperationsorgane i n die Hochschule hineinzuvermitteln. A u f diese Weise können arbeitnehmerrelevante Fragestellungen einzelnen Hochschulangehörigen bzw. Arbeitsgruppen nahegebracht werden 7 2 . I m Gegenzug sollen die Kooperationsorgane auch dazu dienen, den Hochschulen bzw. ihren einzelnen Angehörigen den gewünschten Kontakt zur Praxis zu sichern. Legt man die von den Hochschulen übernommenen Verpflichtungen i n diesem Sinne aus, dann kann nicht behauptet werden, die Hochschulen hätten sich zu einem unmöglichen Handeln verpflichtet. Auch die Einstufung der Vereinbarungen als unverbindliche Absichtserklärung trifft dann nicht zu.
4. Umfang der Einwirkungsrechte der Vertragspartner auf die Hochschulen
A n allen Verträgen wurde kritisiert, daß tretern unmittelbar Einwirkungsrechte auf geräumt würden 7 3 . Diese Möglichkeit der wissenschaftlichen Arbeit der Hochschulen abgeleitet, die i n allen Abkommen den dort
hier gesellschaftlichen VerForschung und Lehre einexternen Beeinflussung der w i r d aus den Befugnissen vorgesehenen paritätischen
*» So aber die Deutung von Kirchhof, ZRP 76, 239. 70 Vgl. Rechtsgutachten zum Kooperationsvertrag, S. 7; ähnlich Hauck, Rechtsgutachten, S. 17 f. Vgl. die Begründung des Vertragsentwurfs durch den Rektor i n K o n stanz, U n i - I n f o Nr. 75 v o m 30. A p r i l 1976. 72 Vgl. Rechtsgutachten zum Kooperationsvertrag, S. 7. 73 Hentschel, Tendenzuniversität, S. 12; Kirchof, ZRP 76, 240; Bauer, Wissenschaftsfreiheit, S. 175 ff.
I I . Parallelen und Differenzen
39
Kooperationsorganen eingeräumt werden. Die Aufgaben dieser paritätisch besetzten Organe sind i n allen Verträgen fast gleichlautend beschrieben. I n § 4 der Oldenburger Vereinbarung heißt es „die Beteiligten werden die sich aus der Durchführung dieser Vereinbarung ergebenden Fragen regelmäßig gemeinsam beraten". I n Bochum ist die Aufgabe des Kuratoriums mit „Durchführung und Sicherung der Vereinbarung" umschrieben 74 . I n den beiden Saarbrücker Abkommen heißt es gleichlautend, die Kommission werde „zur Initiierung und Koordination aller i m Rahmen dieses Vertrages durchgeführten Projekte" gebildet 75 . Ergänzend heißt es, die Regelung grundsätzlicher Fragen und die Aufstellung des jährlichen Wirtschaftsplanes für derartige Projekte unterliegen der Zustimmung der zuständigen Organe von Arbeitskammer und Hochschulen. Alle Verträge betonen, durch den Abschluß blieben die für die Vertragspartner geltenden gesetzlichen bzw. satzungsmäßigen Regelungen unberührt. Beschränkt man sich bei der Betrachtung zunächst auf den Wortlaut der Verträge, so ist nicht ohne weiteres ersichtlich, worauf die pauschale Behauptung gestützt wird, i n den Verträgen würden hochschulfremden Dritten mehrheitshindernde Entscheidungsbefugnisse i n Bezug auf Forschung und Lehre eingeräumt 76 . Die Aufgaben der paritätischen Kooperationsorgane werden i n den Verträgen allgemein mit Beratungs- bzw. Vorschlagsfunktion umschrieben. Es werden den wissenschaftsexternen Vertretern der Gewerkschaften keine verbindlichen Entscheidungsbefugnisse i n Forschungs- und Lehrfragen eingeräumt 77 . Ob die Arbeit der Kooperationsorgane zu einer Präjudizierung bzw. faktischen Aushöhlung der Entscheidungsbefugnisse der zuständigen Hochschulorgane führen kann, bedarf einer näheren Prüfung 7 8 . Zunächst kann festgestellt werden, daß durch die Verträge zwar ein Kontaktrahmen geschaffen wird, der es den Vertragspartnern der Hochschulen erleichtert, ihre Vorschläge über die Ausrichtung von Forschung und Lehre i n den Entscheidungsprozeß an den Hochschulen einzubringen, daß diese Einwirkungsmöglichkeiten aber nur indirekter Natur sind. Ihre Realisierung bleibt abhängig von der Umsetzung durch verbindliche Entscheidung der zuständigen Hochschulorgane. 74 § 7 der Vereinbarung über Zusammenarbeit zwischen RUB u n d der I G Metall; fast identisch ist die Formulierung i n § 6 des Bremer Vertrages. 75 § 6 A b k o m m e n der Fachhochschule u n d § 5 A b k o m m e n der P H des Saarlandes. ™ So aber Kirchhof, ZRP 76, 240. 77 Zweifelhaft ist also auch die Annahme v o n Rüthers, daß nach Abschluß der Kooperationsverträge Themen, die nach Ansicht der Gewerkschaften praxisfern seien, nicht mehr bearbeitet werden könnten, Rüthers, A u f dem Weg zur Tendenzuniversität, in: F A Z v o m 23. Oktober 1976. Erforderlich wäre der Nachweis oder zumindest das Aufzeigen v o n Gefahren für die freie Entscheidung von Hochschulorganen bzw. einzelnen Hochschulangehörigen. 7 ® Dazu ausführlich unten, 5. Teil, I I I 5.
40
1. Teil: Bestandsaufnahme
Völlig anders muß allerdings die Situation in Bremen bis 1978 beurteilt werden. Aufgrund der dort von der Hochschule getroffenen organisatorischen Maßnahmen wurde dem Vertragspartner Arbeiterkammer eine unmittelbare Mitbestimmung i n Bezug auf die Gegenstände von Forschung und Lehre eingeräumt 79 . Der Senat beschloß am 25. A p r i l 1973 eine „Satzung des Arbeiterkammerbereichs" (siehe Anhang). Einer paritätisch besetzten Kommission wurde die Aufgabe eines Rates einer wissenschaftlichen Einrichtung übertragen, mit den vollständigen Zuständigkeiten von Fachbereichsräten (Entwurf und Feststellung des Haushaltsplanes, Bewirtschaftung der Sachmittel, Verteilung der Sachmittel für Lehre und Forschung, Beschlußfassung über den Haushalt, Bildung von Berufskommissionen) 80 . Auf diese Weise war den hochschulexternen Vertretern der Arbeiterkammer unmittelbar eine verbindliche Mitentscheidungsbefugnis in wissenschaftsrelevanten Angelegenheiten eingeräumt worden 8 1 . Nach Verabschiedung des HRG und noch vor Inkrafttreten des BremHG begannen zwischen den Vertragspartnern Beratungen, wie die vertraglichen Beziehungen unter veränderten rechtlichen Bedingungen fortzusetzen seien. Dabei ging es der Arbeiterkammer und den Gewerkschaften vor allem u m die Frage, welche Möglichkeiten bestünden, die gewerkschaftliche Mitbestimmung aufrechtzuerhalten 82 . I n einer Stellungnahme der Arbeiterkammer zur weiteren Zusammenarbeit w i r d unterstrichen: „Andererseits ist zu gewährleisten, daß die Freiheitsrechte der Wissenschaft i n der Verantwortung vor ihrer gesellschaftlichen Verpflichtung und i m Interesse der Arbeitnehmer wahrgenommen werden. Das Recht der Arbeitnehmer und ihrer Organisationen, an der Bestimmung der Gegenstände der Forschung mitzuwirken, die Durchführung und Vorhaben aktiv zu unterstützen und die Ergebnisse ihren Bedürfnissen entsprechend zu verwenden, muß gesichert werden 8 3 ." I n der am 27. Mai 1977 zwischen der Universität Bremen 79 Bericht der Universität Bremen über die Durchführung des Kooperationsvertrages zwischen der Universität u n d der Arbeiterkammer Bremen 1971 bis 1976, S. 10 ff. 80 Bericht der Universität Bremen, S. 12. 81 Die Arbeiterkammer äußerte entsprechend ihre Zufriedenheit über diese A r t der Realisierung des Kooperationsvertrages: „Durch diese K o n s t r u k t i o n u n d Aufgabenstellung ist ein Höchstmaß an gemeinsamer Zusammenarbeit der Vertragspartner institutionell abgesichert. Der Einfluß der A r b e i t e r k a m mer u n d der Gewerkschaften ist unter Wahrung der Grundrechte aus A r t . 5 Abs. 3 GG . . . gewährleistet." Der Kooperationsvertrag zwischen der Arbeiterkammer Bremen u n d der Universität Bremen; ein Bericht, vorgelegt von der Arbeiterkammer Bremen, M a i 1976, S. 16. 82 Ströh / SchmuTT, Der Kooperationsvertrag zwischen Arbeiterkammer u n d Universität i n Bremen, in: Hochschule u n d Gewerkschaften, S. 164; vgl. auch die Stellungnahme der Arbeiterkammer zur weiteren Zusammenarbeit m i t der Universität v o m 27. J u l i 1975. 83 Stellungnahme der Arbeiterkammer, S. 4.
I I I . Faktische Intensität der Kooperation
41
und der Arbeiterkammer abgeschlossenen Zusatzvereinbarung sollte dann der Einfluß der Arbeiterkammer über das neu gebildete, paritätische Kuratorium gesichert werden. Die Universität versuchte dabei die Mitwirkungsrechte des Partners durch eine möglichst umfassende Einbeziehung des Kuratoriums i n die Entscheidungsprozesse der Universität abzusichern, ohne Einräumung formeller Entscheidungsbefugnisse. Seine Einflußnahme auf die Arbeit der neugeschaffenen Zentralstelle hat deutlichere Absicherung erfahren als gegenüber der zentralen wissenschaftlichen Einrichtung Arbeit und Betrieb (für die Einzelheiten vgl. unten 5. Teil, I I I 5 b cc). Inwieweit diese Mitwirkungsrechte des Kuratoriums zu einer faktischen Aushöhlung der Entscheidungsbefugnisse der Universitätsorgane führen können, w i r d näher zu untersuchen sein 84 . Die Stellung des Bremer Kuratoriums, wie sie i n der Zusatzvereinbarung 1977 geregelt wurde, ist nunmehr mit der Stellung der anderen Kooperationsorgane vergleichbar. Auch hier bestehen nur noch mittelbare Einwirkungsrechte. Verbindliche Entscheidungsbefugnisse in wissenschaftsrelevanten Angelegenheiten stehen auch dem Bremer Kuratorium nicht zu. Das Bremer Kuratorium besitzt aber insoweit stärkere Einwirkungsmöglichkeiten, als hier die Universität Bremen sich gegenüber dem Vertragspartner verpflichtet hat, das Kuratorium in den Prozeß der Entscheidungsfindung ihrer Organe einzubeziehen. Solche förmlichen Beteiligungsrechte an der universitären Entscheidung können aus den allgemein gehaltenen Formulierungen der übrigen Verträge (siehe oben) nicht abgeleitet werden. Entsprechend steht i n Oldenburg und Bochum die Rolle des Kuratoriums als Kontaktinstanz zwischen Hochschule und Arbeitnehmerschaft i m Vordergrund. Die Kooperationsorgane fungieren hier primär als Vermittlungsinstanz. Diese Funktion erfüllt zwar auch das Bremer Kuratorium, dessen Hauptaufgabe ist jedoch, wie auch der Kompetenzkatalog i n der Vereinbarung zeigt, die Beteiligung an der universitären Entscheidungsfindung 86 .
I I I . Faktische Intensität der Kooperation I m Rahmen dieser juristischen Untersuchung über rechtliche Grundlagen und mögliche inhaltliche Grenzen einer vertraglichen Kooperation von Hochschulen mit gesellschaftlichen Verbänden kann eine umfassende empirische Erfassung der tatsächlichen Intensität der Koope«4 Siehe dazu unten, 5. Teil, I I I 5 b. 85 Es fällt auf, daß i n der Vereinbarung von 1977 nichts über eine mögliche Einschaltung des Kuratoriums i n die Aufgabe der Arbeiterkammer aus § 3 der ursprünglichen Vereinbarung (Vermittlung der Ergebnisse der Hochschule) gesagt ist.
42
1. Teil: Bestandsaufnahme
rationsaktivitäten nicht geleistet werden. Angesichts der Tatsache, daß an verschiedenen Hochschulen (ζ. B. Konstanz), die nicht durch förmlilichen Vertrag gebunden sind, eine Zusammenarbeit mit Gewerkschaften stattfindet, die durchaus derjenigen an kooperierenden Hochschulen vergleichbar ist, dürfte auch schwerlich eine Aussage darüber möglich sein, wie weit Kooperationsaktivitäten tatsächlich durch den Vertragsabschluß bedingt sind. Zur Aufhellung der tatsächlichen Situation an den kooperierenden Hochschulen soll i m folgenden versucht werden, einen kurzen Überblick über die Aktivitäten zu geben, die nach Ansicht der Vertragspartner selbst Folge der jeweiligen Vereinbarung sind. Ohne einen derartigen Versuch, die tatsächliche Intensität der Beeinflussung der Arbeit der Hochschulen durch die Verträge zu erfassen, erscheinen auch die von K r i t i k e r n erhobenen Vorwürfe gegen die Kooperationsverträge — vor allem die Warnung vor einer Bedrohung von Forschung und Lehre — als abstrakte Spekulationen 86 . Auch hinsichtlich der faktischen Intensität der Kooperation fällt sofort der Unterschied zwischen der Praxis der Universität Bremen und der Praxis der anderen Hochschulen auf. I n Bremen wurden umfangreiche institutionelle Maßnahmen an der Hochschule zur Realisierung des Kooperationsvertrages ergriffen. Zur Behandlung arbeitnehmerrelevanter Fragestellungen wurde eine spezielle wissenschaftliche Einrichtung geschaffen (für die Einzelheiten, siehe oben I, 1). Demgegenüber wurde die Kooperation an allen anderen Hochschulen sozusagen „nebenbei" betrieben. Keine Personal- oder Sachmittel wurden dem Zweck „Erfüllung des Kooperationsvertrages" speziell gewidmet 8 7 . 1. Bremen
Der Abschluß des Kooperationsvertrages führte an der Universität Bremen zu umfangreichen organisatorischen Folgemaßnahmen (für die Einzelheiten siehe oben). Nach Abschluß der Aufbauphase waren i n der Arbeitsstelle Arbeiterkammer, die speziell zum Zwecke der Erfüllung 8« Vgl. Kirchhof, ZRP 76, 239, der ein „ K l i m a tendenziellen Beteuerns u n d Bekennens" befürchtet; Rüthers, A u f dem Weg zur Tendenzuniversität, in: F A Z v o m 23. Oktober 1976, äußert die Meinung, der einzelne Forscher u n d Lehrer werde sich nicht dem Druck zentraler Planung entziehen können. 87 Verschiedene Angehörige der Universität Oldenburg, die persönlich an der Kooperation a k t i v beteiligt waren, sahen i m Gespräch m i t dem Verfasser h i e r i n eine der Hauptschwierigkeiten, die einer verstärkten Zusammenarbeit i m Wege stünden. Für die Universität Bochum siehe die Aussagen von Ostertag / Weigmann, Kooperation zwischen der Ruhruniversität Bochum u n d dem I G M e t a l l Bildungszentrum Sprockhövel, in: Hochschule u n d Gewerkschaften, S. 206. Seit 1979 stehen i n Bochum M i t t e l für ein Büro zur Zusammenarbeit zur Verfügung.
I I I . Faktische Intensität der Kooperation
43
der Pflichten der Hochschule aus der Vereinbarung geschaffen worden war, sieben Hochschullehrer, elf wissenschaftliche Mitarbeiter, acht wissenschaftliche Mitarbeiter i n zeitlich befristeten Forschungsprojekten, sechs Verwaltungsangestellte mit Sonderaufgaben, drei Verwaltungsbeamte und vier Schreibkräfte angestellt. Hinzu kamen studentische Hilfskräfte 8 8 . Nach der organisatorischen Umstrukturierung 1978 waren vorgesehen für die zentrale wissenschaftliche Einrichtung Arbeit und Betrieb: drei halbe Hochschullehrerstellen (H4), zwei halbe Hochschullehrerstellen (H 3), fünf wissenschaftliche Mitarbeiter, dazu eine Leiterstelle als Beamter, ein Sachbearbeiter und drei Schreibkräfte 89 . Für die Zentralstelle für die Durchführung des Kooperationsvertrages standen 1978/ 1979 zur Verfügung: elf Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter, zwei Sachbearbeiterstellen, eine Leiterstelle (H 4), eine Leiterstelle für Verwaltung (A 11) sowie vier bis fünf Stellen für Schreibkräfte 90 . A n bisherigen Ergebnissen, die bis 1980 vorlagen, sind zu nennen: zwei abgeschlossene Forschungsaufträge des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung über Belastungen (insbesondere Lärm) am Arbeitsplatz und über die soziale Lage der Hafenarbeiter. Hinzu kommen Arbeiten über Möglichkeiten der Arbeit der Betriebsräte und eine Untersuchung über den Metallarbeiterstreik 197491. I m Medienbereich wurden Lehrfilme für Arbeiterbildungskurse sowie Dokumentationsmaterial i m Zusammenhang mit den Forschungsprojekten erstellt 9 2 . Trotz dieses erheblichen Personal- und Mitteleinsatzes seitens der Universität wurden die Ergebnisse von den Gewerkschaften 1977/1978 skeptisch eingeschätzt 93 . Unbefriedigt blieb vor allem das Interesse der Arbeiterkammer an der Aufarbeitung kurzfristiger, unmittelbarer Organisationsinteressen 94 . M i t der Durchführung der Umstrukturierung i m Jahre 1978 steht nunmehr die zentrale wissenschaftliche Einrich88 Angaben nach Ströh / Schmurr, Der Kooperationsvertrag zwischen A r beiterkammer u n d Universität i n Bremen, in: Hochschule u n d Gewerkschaften, S.158. 8® Vgl. Einrichtungsbeschluß für die zentrale wissenschaftliche Einrichtung A r b e i t u n d Betrieb, i m Anhang. m Vgl. Ausstattungsplan zum Einrichtungsbeschluß für die Zentralstelle für die Durchführung des Kooperationsvertrages, «ι Vgl. Ströh l Schmurr, S. 158. «s Ebenda. ®s Ströh / Schmurr, S. 159 f.; Einemann, Entwicklung u n d Perspektiven der Kooperation zwischen Arbeiterkammer (Gewerkschaften) u n d Universität Bremen, internes Arbeitspapier des Arbeitskammerbereichs, Januar 1978, S. 1. w Vgl. den Bericht der Arbeiterkammer v o m M a i 1976, S. 31; siehe auch Einemann, S. 13 f.
44
1. Teil: Bestandsaufnahme
tung Arbeit und Betrieb als Sonderforschungsbereich Arbeitnehmerfragen speziell für langfristige Bearbeitung von Forschungsprojekten zur Verfügung. Daneben ist die Zentralstelle für die Durchführung des Kooperationsvertrages getreten; damit ist eine wissenschaftliche Einrichtung mit spezieller Dienstleistungsfunktion für den Vertragspartner geschaffen worden. Soweit ersichtlich, hat der Kooperationsvertrag keine Auswirkungen auf die Arbeit der anderen Fachbereiche der Hochschule gehabt. Die Kooperationsaktivitäten konzentrieren sich auf die speziell für die Erfüllung des Vertrages geschaffene Einrichtung. 2. Oldenburg
Verglichen mit der Situation i n Bremen nimmt sich die Kooperationsintensität i n Oldenburg bescheiden aus. Hier wurden keine institutionellen Maßnahmen zur Realisierung des Kooperationsvertrages ergriffen. Personal- oder Sachmittel mit spezieller Zweckbestimmung für die Erfüllung des Kooperationsvertrages stehen nicht zur Verfügung 9 6 . Als zentrale Schaltstelle für die Kooperation hat sich der Kooperationsausschuß herausgebildet 98 . Dieser t r i f f t sich etwa viermal i m Jahr; die Universität stellt dabei Forschungs- und Lehrschwerpunkte zur Diskussion, die als arbeitnehmerbezogen angesehen werden. Die Gewerkschaften tragen konkrete Einzelprobleme vor. Von Beteiligten ist die Arbeit so charakterisiert worden: Beide Seiten bringen ihre Wünsche und Anregungen ein, die Kooperationspartner finden sich auf freiwilliger Basis 97 . Ein besonderer Schwerpunkt der Zusammenarbeit i n Oldenburg besteht auf dem Sektor der Erwachsenen- und Weiterbildung. Hochschulangehörige beteiligen sich an Bildungsveranstaltungen von Arbeit und Leben sowie von Einzelgewerkschaften. Als besonders kooperationsbezogene Forschungsvorhaben nennen die Vertragspartner ein Projekt i m Diplomstudiengang Sozialwissenschaft: „Arbeitsmarktentwicklung und Arbeitsmarktpolitik i m Nordwestraum Niedersachsen". Bei der Realisierung dieses Projekts bestanden zahlreiche Kontakte zu Gewerkschaften; ein Mitarbeiter von Arbeit und Leben erhielt einen Lehrauftrag; eine Betriebsumfrage wurde von Gewerkschaftsseite unI m Bericht des Vorsitzenden des Kooperationsausschusses für das Jahr 1977/1978, maschinenschriftlich, heißt es auf S.4: „Als größtes Manko muß nach wie vor beklagt werden, daß weder die Hochschulen, noch die Gewerkschaften auf personelle u n d materielle Ressourcen für die Kooperation zurückgreifen können. Die A r b e i t geschieht nach wie vor auf beiden Seiten ehrenamtlich." w Schultze / Krüger, Zusammenarbeit v o n Gewerkschaften u n d Universität Oldenburg, in: Hochschule u n d Gewerkschaften, S. 174. Ebenda.
I I I . Faktische Intensität der Kooperation
45
terstützt. Als weiteres Projekt wurde — interdisziplinär zwischen Sozial« und Wirtschaftswissenschaftlern und Raumplanern — ein Projekt „räumliche Entwicklungsprozesse, Produktions- und Arbeitsverhältnisse Entwicklungsraum Ostfriesland" durchgeführt 98 . Als eine Schwierigkeit bei der Realisierung des Kooperationsvertrages hat sich erwiesen, daß die Gewerkschaften nicht über hauptamtliche wissenschaftliche Kräfte verfügen, die i n der Lage wären, konkrete Projektvorschläge zu unterbreiten, so daß die Initiative und Anregung von Seiten der Gewerkschaften bisher gering war 9 9 . 3. Bochum
Auch i n Bochum standen zunächst keine besonderen Mittel für die Realisierung der Zusammenarbeit zur Verfügung. Hier tagte das Kuratorium bis 1979 durchschnittlich zweimal i m Jahr. Wenn man sich vergegenwärtigt, daß dem Kuratorium auf seiten der Gewerkschaften ursprünglich Eugen Loderer als Vorsitzender der I G Metall sowie ein geschäftsführendes Vorstandsmitglied angehörten 100 , w i r d die begrenzte Arbeitskapazität des Kuratoriums wegen der starken sonstigen Inanspruchnahme der Mitglieder deutlich 1 0 1 . Das Kuratorium setzte zur Effektivierung seiner Arbeit verschiedene Ausschüsse ein, denen die Arbeit zum Teil übertragen wurde. Folgende Ausschüsse wurden gebildet — Ausschuß Aus -und Weiterbildung — Ausschuß Arbeitswelt und Gesellschaft — Ausschuß Ringvorlesung/Sprockhöveler Gespräche — Ausschuß Arbeits- und Sozialrecht Als Ergebnis der Kooperation führen die Vertragspartner vor allem an: Vermittlung von Lehraufträgen an Mitarbeiter des Bildungszentrums Sprockhövel zu Themen mit arbeitnehmerrelevanten Bezügen. Durchführung von Betriebsräteseminaren der Abteilung Geschichtswissenschaft, verschiedene Ringvorlesungen zu Themen, die die Gewerkschaftsseite interessierende Fragen betrafen, sowie die regelmäßige Für die weiteren Einzelheiten, siehe Schultze / Krüger, S. 177. 09 Seit September 1982 ist — zunächst für die Dauer von drei Jahren — m i t M i t t e l n des Bundesministers für B i l d u n g u n d Wissenschaft sowie des DGB eine „Kooperationsstelle" geschaffen worden; siehe dazu, DGB, Informationsdienst v o m 12. Oktober 82. io» R U B - a k t u e l l v o m 30. Januar 1976. ioi Siehe auch Ostertag / Weigmann, Kooperation zwischen der R u h r - U n i versität Bochum u n d dem I G Metall Bildungszentrum Sprockhövel, in: Hochschule u n d Gewerkschaften, S. 206.
46
1. Teil: Bestandsaufnahme
ge Durchführung der sogenannten Sprockhöveler Gespräche als Diskussionsforum zwischen Vertretern der Hochschule und der Gewerkschaften 1 0 2 . Auch i n Bochum konzentrierte sich die Zusammenarbeit somit auf einzelne Vorhaben; von einer Ausrichtung der gesamten Universität auf die Zwecke des Kooperationsvertrages kann nicht gesprochen werden. Ob die Bewilligung der Mittel für ein Büro zur Realisierung der Zusammenarbeit ab 1979 zu einer Verstärkung und Ausdehnung der Kooperation geführt hat, kann noch nicht beurteilt Werden. 4. Saarbrücken
Für die i n Saarbrücken ab 1976 kooperierende Fachhochschule sowie die Pädagogische Hochschule lautet der Befund gleichfalls: keine institutionellen Auswirkungen der Verträge sowie keine Bereitstellung zusätzlicher Mittel. A n beiden Hochschulen wurden einzelne Forschungsprojekte durchgeführt. Die Fachhochschule wandte sich — in Zusammenarbeit mit dem der Arbeitskammer angegliederten Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft — einer Projektstudie über „Schichtarbeit i n der saarländischen Industrie" zu. Als weiteres Kooperationsprojekt wurde ein Curriculum für eine interdisziplinär organisierte arbeitswissenschaftliche Lehre i m Rahmen der Ingenieurausbildung entwickelt 1 0 3 . Die PH des Saarlandes führte verschiedene Untersuchungen zu arbeitnehmerrelevanten Problemen durch 1 0 4 . 5. Konstanz — Kooperation ohne Vertrag
Auch wenn i n Konstanz der geplante Vertragsschluß am Widerstand aus der Universität scheiterte, findet dort eine Zusammenarbeit zwischen dem DGB und einzelnen Fachbereichen statt. Hochschullehrer beteiligen sich u. a. an der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, gemischte Kurse wurden i n der Universität durchgeführt 1 0 6 . Daraus ist von Seiten Beteiligter die Schlußfolgerung gezogen worden, die Kooperation müsse sich nicht unbedingt auf die gesamte Universität beziehen und die Zusammenarbeit zwischen universitären Einrichtungen und 102 v g l . für weitere Einzelheiten, Ostertag / Weigmann, S. 202 ff. los Vgl. Wagner ! Peter, Saarbrücken als Modell der Zusammenarbeit von Gewerkschaften u n d Hochschulen, in: Hochschule u n d Gewerkschaften, S.21; siehe auch Arbeitskammer des Saarlandes (Hrsg.), Bericht an die Regierung des Saarlandes 1977, S. 291 ff. 104 Für die Einzelheiten vgl. Wagner / Peter, S. 219 f. 105 Reisacher / Baeckmann, Krisenpunkte einer Entwicklung — die Kooperation v o n Universität u n d DGB i n Konstanz, in: Hochschule u n d Gewerkschaften, S.230.
I I I . Faktische Intensität der Kooperation
47
G e w e r k s c h a f t e n v o r O r t sei i n t e n s i v e r u n d r e a l i t ä t s n ä h e r als o f f i z i e l l e B e z i e h u n g e n a u f L a n d e s - oder B u n d e s e b e n e 1 0 6 . K o n s t a n z ist i n s o f e r n e i n Beispiel, daß die Z u s a m m e n a r b e i t v o n G e w e r k s c h a f t e n u n d Hochschulen n i c h t i n j e d e m F a l l v o m A b s c h l u ß eines f o r m e l l e n K o o p e r a t i o n s v e r t r a g e s a b h ä n g t 1 0 7 . A u c h d e r D G B k o n z e n t r i e r t sich b e i seinen umfassenden B e m ü h u n g e n z u r K o o p e r a t i o n v o n Hochschule u n d Gew e r k s c h a f t e n keinesfalls a u f f ö r m l i c h e K o o p e r a t i o n s v e r t r ä g e , die die gesamte U n i v e r s i t ä t erfassen, s o n d e r n ist b e s t r e b t , a u f l o k a l e r Ebene eine v i e l f ä l t i g e Z u s a m m e n a r b e i t z u r e a l i s i e r e n 1 0 8 .
ι«« Reisacher / Baeckmann, S. 231. 107 Siehe ζ. B. den Beschluß des DGB-Bundeskongresses i n Hamburg zum Thema Kooperation zwischen Hochschule u n d Gewerkschaften von 1978, abgedruckt in: Hochschule u n d Gewerkschaften, S.443. I n diesem Beschluß sind die Kooperationsverträge nicht ausdrücklich erwähnt. Vgl. auch Steinkühler, Die Rolle der Universität i n der Gesellschaft aus der Sicht der Gewerkschaften, in: Konstanzer Blätter für Hochschulfragen, Jahrgang X I X , Heft 2 - 3 , November 1981, S. 80 (85 f.). 108 Auch die neuen Versuche des DGB, die regionale Zusammenarbeit von Hochschulen u n d Gewerkschaften durch Einrichtung von „Kooperationsstellen" zu fördern, beschränken sich nicht auf die Universitäten, die einen Kooperationsvertrag geschlossen haben. „Kooperationsstellen" sind m i t M i t teln des Bundesministers für B i l d u n g u n d Wissenschaft i n Dortmund, H a m burg, Kassel, Oldenburg u n d Tübingen eingerichtet worden; D G B - I n f o r m a tionsdienst v o m 12. Oktober 1982.
Zweiter Teil
Kooperationsverträge und die Aufgaben der Hochschulen nach dem H R G und den Landeshochschulgesetzen I. Der rechtliche Beurteilungsrahmen Dem Betrachter, der gegenwärtig den rechtlichen Rahmen für das Handeln der Hochschulen und damit auch für ihre Möglichkeiten mit gesellschaftlichen Verbänden zu kooperieren untersucht, bietet sich das Hochschulrecht als eine bis oft ins Detail hinein durchnormierte Materie dar. Neben der zentralen Verfassungsnorm des A r t . 5 Abs. 3 GG und den für die Hochschulorganisation einschlägigen Normierungen der Landesverfassungen (Baden-Württemberg, A r t . 20 und 85; Bayern, A r t . 108, 138, 140; Bremen, A r t . 11, 12 Abs. 2, 34; Hessen, A r t . 10, 60, 61; Nordrhein-Westfalen, A r t . 16, 18; Rheinland-Pfalz, Art. 9 Abs. 1, 30 Abs. 1, 39; Saarland, A r t . 5 Abs. 3, 33; Schleswig-Holstein, A r t . 7) ist das Hochschulrecht bundeseinheitlich i m HRG geregelt 1 . Die Länder — i n allen Bundesländern existierten zum Zeitpunkt der Verabschiedung des HRG Hochschulgesetze2 — waren danach gehalten, ihre Landeshochschulgesetze bis zum Januar 1979 an das HRG anzupassen. Dieser Verpflichtung sind inzwischen alle Bundesländer nachgekommen 3 . Die Spielräume für autonomes Handeln der Hochschulen sind dadurch reduziert worden 4 . Innerhalb eines Jahrzehnts hat sich ein einschneidender Wandel auf dem Gebiet des Hochschulrechts vollzogen. Noch i n der ι B G B l I, 1976, S. 185; zu Umfang und Grenzen der bundesrechtlichen Normierungsbefugnis vgl. Sterzel, Wissenschaftsfreiheit, S. 40 ff., Oppermann, Kulturverwaltungsrecht, S. 304 ff. u n d S. 581; Lüthje, DÖV 73, 545. 2 I n Bremen allerdings n u r das Gesetz über die Errichtung der Universität i n Bremen v o m 8. September 1970, G B l 1970, S. 100; i n Niedersachsen n u r das Gesetz über Organisation der Universitäten Oldenburg u n d Osnabrück, GVB1 73, S. 479. 3 A l s letztes Land hat Nordrhein-Westfalen — unter Überschreitung der Anpassungsfrist — sein Hochschulgesetz zum 1. Januar 1980 neu gefaßt, vgl. GVB1 79, S. 926. 4 Z u r K r i t i k an dieser Entwicklung vgl. Riehn, Die Reglementierung der Hochschulen durch staatliche Gesetze u n d Hochschulsatzungen, DUZ 77, S. 507; von Mangoldt, JZ 77, S.433; ders., Universität u n d Staat, Z u r Lage nach den Hochschulgesetzen, passim.
I. Der rechtliche Beurteilungsrahmen
49
Mitte der 60er Jahre konnte man auf dem Gebiet des Hochschulrechts einen „chaotischen Zustand" 5 diagnostizieren. Abgesehen von der verfassungsrechtlichen Grundentscheidung i n A r t . 5 Abs. 3 GG, über dessen Reichweite und Bedeutung für die Hochschulorganisation äußerst unterschiedliche Auffassungen existierten 6 , war das Hochschulrecht bestimmt durch die Ordnungen der einzelnen Hochschulen. Dies führte zu einer starken Uneinheitlichkeit des Hochschulrechts selbst innerhalb der einzelnen Bundesländer 7 . Die Gründe für die Zurückhaltung des staatlichen Gesetzgebers gegenüber den Hochschulen bedürfen hier keiner näheren Darstellung 8 . Entscheidend war die Diskreditierung staatlicher Hochschulpolitik infolge der Gleichschaltung der Universitäten durch den totalitären Staat von 1933 - 1945. Außerdem fehlte auf staatlicher Seite zunächst — nach der Zerschlagung Preußens — eine kompetente, mit politischem Gestaltungswillen ausgestattete Hochschulbürokratie. Dem Bund fehlte die Zuständigkeit für eine richtungsweisende Hochschulpolitik. Diese staatliche Gestaltungsschwäche traf sich nach 1945 mit dem neuen korporativen Selbstbewußtsein der Hochschulen, die die Reorganisation des Hochschulwesens von sich aus i n Angriff nahmen 9 . Diese Phase staatlicher Zurückhaltung fand i n der zweiten Hälfte der 60er Jahre ihr Ende. Bereits die Bildung des Wissenschaftsrates durch Verwaltungsabkommen von Bund und Ländern vom 5. September 1957 markiert die Reaktivierung staatlichen Gestaltungswillens i m Hochschulbereich. Dabei sollte allerdings die Reform der Organisation der Hochschulen den Organen der akademischen Selbstverwaltung überlassen bleiben 1 0 . Die Notwendigkeit einer Hochschulreform wurde jedenfalls zu Beginn der 60er Jahre allgemein bejaht. Beschleunigt wurde die Hochschulgesetzgebung nach 1967 durch die Studentenunru5 So Menzel, Hochschulgesetze u n d Hochschulverfassung, JZ 64, S. 166 ff. u n d 214 ff. * Einen Uberblick gibt Sterzel, Wissenschaftsfreiheit, passim. Die Auffassungen reichten von der Bejahung der praktisch unbeschränkten Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers (vgl. Roellecke, JZ 69, S. 726) bis h i n zur Annahme einer naturrechtlichen Bindung des Gesetzgebers an wesentliche Elemente der herkömmlichen Universitätsstruktur (vgl. i n diesem Sinne v o n Lübtow / Harder, Autonomie oder Heteronomie der Universitäten, passim). 7 Überblick über die frühere Situation bei Gerber, Das Recht der wissenschaftlichen Hochschulen, B a n d i , S. 27 ff. und Thieme, Deutsches Hochschulrecht, S. 21 ff. β Vgl. dazu Thieme, Deutsches Hochschulrecht, S. 26 ff.; Kaiisch, Die E r neuerung des Hochschulrechts, DVB168, 237 ff.; Oppermann, Kulturverwaltungsrecht, S. 292 ff.; Schelsky. Einsamkeit und Freiheit, S. 134 ff. u n d Gerber, Hochschulen, Bd. 1, S. 8 ff. 9 Vgl. Gerber, Hochschulen, Bd. 1, S. 9 ff.; Sterzel, Wissenschaftsfreiheit, S. 30 ff. u n d Hennis, Die deutsche Unruhe, S. 31 ff. Wissenschaftsrat, Anregungen 1962, S. 10. 4 Uechtritz
50
2. Teil: Kooperationsverträge und die Aufgaben der Hochschulen
hen, die die Landesregierungen i n Zugzwang brachten 11 . I n den Jahren nach 1967 stand als staatliches Motiv der Hochschulgesetzgebung neben dem Reformimpuls — Anpassung der Hochschule an die veränderte gesellschaftliche Situation — auch das Bemühen um die Herbeiführung einer inneruniversitären Befriedung. Als Folge dieser Entwicklung, deren Schlußpunkt das Hochschulrahmengesetz von 1976 markiert 1 2 , ist heute der rechtliche Rahmen, der dem Handeln der Hochschulen gesetzt ist, wesentlich enger, als dies bis Mitte der 60er Jahre der Fall war. Die jetzt durch Erlaß des HRG bzw. der entsprechenden Landeshochschulgesetze bestehende Regelungsdichte gestattet es, das hier zu prüfende Verhalten der Hochschulen (die Kooperation mit gesellschaftlichen Verbänden) zunächst an den einfach-gesetzlichen hochschulrechtlichen Normierungen zu messen 13 .
II. Rechtsstellung der Hochschule und Vertragsschließungskompetenz Die Fähigkeit der Hochschule, sich vertaglieli zu verpflichten, setzt ihre Rechtsfähigkeit voraus. Nach § 58 HRG sind die Hochschulen aufgrund gesetzlicher Bestimmung Körperschaften des öffentlichen Rechts und zugleich staatliche Einrichtungen. Das HRG hat sich also i n der Kontroverse u m die Rechtsnatur der Hochschulen — Anstalt oder Körperschaft — für die moderne Auffassung von der Doppelnatur entschieden 1 4 . I n der Begründung zum Entwurf des HRG w i r d von dem herkömmlichen Körperschaftsstatus ausgegangen; zugleich soll durch die n Gewiß ist zutreffend, w e n n Lübbe, Hochschulreform u n d Gegenaufklärung, S. 61, kostatiert, daß die Hochschulreform bereits vor dem Beginn der Unruhen i n A n g r i f f genommen wurde; ebensowenig dürfte aber zu bestreiten sein, daß die Kodifizierung des Hochschulrechts durch die Unruhe an den Universitäten entscheidend beschleunigt wurde. Während n u r das Hessische Hochschulgesetz 1966 — also vor Beginn der Studentenunruhen — verabschiedet wurde, folgten 1968 Baden-Württemberg, 1969 B e r l i n u n d Hamburg, 1970 Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz u n d eine Neufassung des Hessischen Hochschulgesetzes. ι 2 Z u den unterschiedlichen Reformansätzen u n d ihrer teilweisen V e r w i r k lichung i m HRG, siehe auch v o n Schenck, HRG, S. 20 ff. is Bisher beschränkten sich die juristischen Untersuchungen der Kooperationsverträge fast ausschließlich auf die verfassungsrechtlichen Aspekte. Vgl. z . B . Kirchhof, Kooperationsvereinbarungen, ZRP 76, S. 239 ff., Bauer, Wissenschaftsfreiheit, S. 167 ff. u n d Hailbronner, Funktionsgrundrecht, S. 289 ff.; auch Hauck, Rechtsgutachten, setzt den Schwerpunkt auf die verfassungsrechtliche Zulässigkeit; die Vereinbarkeit der Kooperationsverträge m i t den Hochschulgesetzen der Länder w i r d i n dieser Stellungnahme jedoch auch geprüft, ebenda, S. 4 ff. 14 Vgl. Wolff / Bachof, Verwaltungsrecht I I , § 9 3 I V c ; Rupp, W D S t R L 2 7 , S. 118; Gallas, Staatsaufsicht, S. 88; u n d Leuze, in: Leuze / Bender, Gesetz über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen, Rdnr. 2 zu § 2.
I I . Rechtsstellung der Hochschule
51
Vorschrift des § 58 HRG klargestellt werden, daß die Hochschulen auch staatliche Einrichtungen sind, Teile des staatlichen Organisationsgefüges 15 . Dies geschieht i m HRG i n Übereinstimmung mit der Bezeichnung i n fast allen nach 1965 erlassenen Hochschulgesetzen 16 . Ungeachtet dieser positiven gesetzlichen Entscheidung soll dies zur Klassifizierung jedoch nicht ausreichen 17 . Die Rechtsnatur der Hochschule soll aus ihrem „Wesen" abgeleitet werden 1 8 . Dieses Wesen soll dabei i n Ansehung der realen Erscheinung der Hochschulen ermittelt werden, wobei dann für den Anstaltscharakter die vollständige Mittelbereitstellung und weitgehende staatliche Bestimmung angeführt w i r d 1 9 . Für die Qualifizierung als Körperschaft w i r d neben der Entscheidung des Hochschulgesetzgebers der Korporationscharakter der Hochschule angeführt, sowie die Ausstattung m i t Satzungsgewalt und die Fragwürdigkeit der Vorstellung, die Hochschulangehörigen — trotz bestehender Selbstverwaltungsbefugnisse zumindest i n den wissenschaftsrelevanten Angelegenheiten — nur als Anstaltsbenutzer anzusehen 20 . Der Streit u m die Rechtsnatur der Hochschule wäre hier nur von Bedeutung, wenn, wie teilweise vertreten wird, der Umfang der staatlichen Bestimmungsgewalt von der Rechtsnatur abhängt 21 . Es erscheint jedoch sehr zweifelhaft, die Frage nach der Intensität staatlicher Bestimmungsmacht i m Hochschulbereich anhand der kategoriellen Zuordnung zu den traditionellen verwaltungsrechtlichen Typen Anstalt oder Körperschaft vorzunehmen. Umfang und Grenzen der staatlichen Einwirkungsbefugnisse müssen i m Einzelfall ermittelt werden. Für die folgende Untersuchung w i r d der Entscheidung des Gesetzgebers folgend vom Mischcharakter der Hochschulen ausgegangen. Die Komplexität des Gebildes Hochschule, i n der die Bereiche akademische und sonstige Verwaltung untrennbar miteinander verwoben sind 2 2 , verbietet die eindeutige Zuordnung zu einem traditionellen Formtypus. Die Staatlichkeit der Hochschule einerseits und die — schon verfassungsrechtlich geforderte — korporative autonome Organisationsstruktur andereres Bundestagsdrucksache 7/1328, S. 72. i« Nachweise bei Gallas, Staatsaufsicht, S. 86. 17 Thieme, Hochschulrecht, S. 100 u n d Wolff / Bachof, Verwaltungsrecht I I , § 93 I V c. is Thieme, Hochschulrecht, S. 100. i» Forsthoff, Verwaltungsrecht, S. 455. 20 Thieme, Hochschulrecht, S. 103 ff.; Oppermann, Kulturverwaltungsrecht, S.327. 21 F ü r rechtliche Bedeutung i m Hinblick auf den Umfang staatlicher A u f sichtsrechte, ζ. B. Kimminich, Wissenschaft, in: v o n Münch u. a., Besonderes Verwaltungsrecht, S. 678 ff.; dagegen Thieme, Hochschulrecht, S. 107; Oppermann, Kulturverwaltungsrecht, S. 324. 22 Vgl. dazu Reinhardt, Autonomie, Selbstverwaltung, Staatsverwaltung, Wissenschaftsrecht, Band 1 (1968), S. 27 u n d Gallas, Staatsaufsicht, S. 87. 4*
5 2 2 . Teil: Kooperationsverträge und die Aufgaben der Hochschulen
seits kann nur durch die Annahme einer Mischform von Anstalt und Körperschaft adäquat erfaßt werden, wie i m HRG i n § 58 23 . Die Fähigkeit der Hochschulen, sich durch rechtsgeschäftliches Handeln vertraglich zu binden, kann daher nicht zweifelhaft sein. Der Rechtsstatus einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft — und damit ihre Rechtsfähigkeit — kommt dieser jedoch nicht zur beliebigen Handlungsfreiheit zu, sondern nur i m Hinblick auf die bestimmten, ihr zu eigenverantwortlicher Wahrnehmung zugewiesenen öffentlichen Aufgaben. Ihre Rechtsfähigkeit — wenigstens für den Bereich des öffentlichen Rechts — und damit auch die hier zu beurteilende Vertragsschließungskompetenz der Hochschulen — ist auf die von ihr wahrzunehmenden öffentlichen Aufgaben beschränkt 24 . Schon aus diesem Grund können also Verträge von Hochschulen mit gesellschaftlichen Interessengruppen, die sich auf die öffentlichen Aufgaben der Hochschulen beziehen, nur insoweit abgeschlossen werden, als sie von der Aufgabenzuweisung an die Hochschulen gedeckt werden 2 5 .
I I I . Aufgaben der Hochschulen Grundsätzliche Zulässigkeit der vertraglichen Kooperation von Hochschulen m i t gesellschaftlichen Interessenverbänden und inhaltliche Grenzen einer solchen Kooperation sind zunächst abhängig von den gesetzlich festgelegten Aufgaben der Hochschule. Bei dem Versuch einer Erfassung dieser Aufgaben geht die Untersuchung vom aktuell geltenden Rechtszustand aus 26 . 23 Gallas, Staatsaufsicht, S. 88; Oppermann, Kulturverwaltungsrecht, S. 324 u n d Thieme, Hochschulrecht, S. 108. 24 Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 3 zu § 58; Maurer, Zur Rechtsstellung der Fachbereiche, Wissenschaftsrecht, Band 10 (1977), S.202; Wolff / Bachof, VerwaltungsrechtI, §32 I I b 2 ; Forsthoff, Verwaltungsrecht, S.482. 25 Ebenso Hauck, Rechtsgutachten, S. 3 ff. 2« Sicher w u r d e n alle Verträge der hier untersuchten A r t zeitlich vor I n krafttreten des H R G bzw. der Novellierung der Landeshochschulgesetze abschlossen. Da die Kooperation aber auch unter den geltenden rechtlichen Bedingungen fortgesetzt werden soll, rechtfertigt sich die Orientierung am aktuell geltenden Rechtszustand. Es soll anhand dieser Verträge untersucht werden, wie bei der gegenwärtigen Rechtslage die Grenzen einer Zusammenarbeit zwischen gesellschaftlichen Interessengruppen u n d der Hochschule gesetzt sind. Betrachtet man die rechtliche Situation beim Abschluß der Verträge, so ergibt sich folgendes: I n Bremen existierte n u r das Gesetz über die Errichtung einer Universität i n Bremen v o m 8. September 1970, G B l 70, S. 100, das keine Aussagen über die Aufgaben der Hochschule enthielt. Gleiches gilt für das Niedersächsische Gesetz über die Organisation der Universitäten Oldenburg u n d Osnabrück, GVB1 1973, S. 479. Z u r Bestimmung der Aufgaben der Hochschulen konnte
I I I . Aufgaben der Hochschulen
53
1. Verhältnis des H R G zu den landesrechtlichen Regelungen
Bestimmungen über die Aufgaben der Hochschule finden sich sowohl i m HRG als auch i n den jeweiligen Landeshochschulgesetzen. Zunächst ist aber das Verhältnis der bundesrechtlichen Normierung i m HRG zu den landesrechtlichen Bestimmungen zu klären. Das Ziel des HRG war es, i m Gesamtstaat die Einheitlichkeit des deutschen Hochschulrechts in den Grundzügen zu wahren, die i n den 60er und frühen 70er Jahren durch die unterschiedlichen Reformtendenzen i n den verschiedenen Bundesländern gefährdet erschien 27 . Die verfassungsrechtliche Kompealso n u r auf autonomes Satzungsrecht bzw. verfassungsrechtliche Vorgaben zurückgegriffen werden. Dabei spielte besonders i n Oldenburg die Diskussion u m die satzungsmäßige Festlegung der Aufgaben eine Rolle (vgl. dazu näher unten). I n Nordrhein-Westfalen galt zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses das Hochschulgesetz v o m 7. A p r i l 1970, GVB1 1970, S. 154, das i n § 2 die Aufgaben der Hochschulen definierte: „Die wissenschaftlichen Hochschulen dienen durch Forschung u n d Lehre u n d Studium der Entwicklung u n d Verbreitung w i s senschaftlicher Erkenntnisse u n d der V e r m i t t l u n g wissenschaftlicher Methodik. Sie bereiteten dabei auf Berufe vor, fördern den wissenschaftlichen Nachwuchs u n d betreiben die wissenschaftliche Fort- u n d Weiterbildung." Untersucht man, ob der Bochumer Kooperationsvertrag v o n dieser A u f gabenumschreibung gedeckt ist, so k o m m t hier i n Betracht, daß die Hochschule sich zur Rechtfertigung auf die „Entwicklung wissenschaftlicher E r kenntnisse" beruft. Ob dieser Formulierung eine umfassende Kooperation m i t gesellschaftlichen Interessengruppen deckt, entspricht aber der Frage, die unten näher geprüft w i r d , ob die Kooperationsverträge von der Aufgabe Pflege u n d Entwicklung der Wissenschaften gedeckt sind. A u f das i m folgenden näher Dargelegte k a n n also verwiesen werden. Für die Fachhochschule des Saarlandes galt zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses das Gesetz über die Fachhochschule des Saarlandes v o m 25. Februar 1970, A B l 70, 263. Dort bestimmte § 2 die Aufgaben wie folgt: (1) Die Fachhochschule v e r m i t t e l t durch praxisbezogene Lehre eine auf wissenschaftlicher oder künstlerischer Grundlage beruhende Bildung, die zu selbständiger Tätigkeit i m Beruf befähigt. (2) Die Fachhochschule k a n n i m Rahmen ihres Bildungsauftrages eigene U n tersuchungen u n d Entwicklungsaufträge durchführen. Zusätzlich enthielt § 4 eine Bestimmung über die Zusammenarbeit m i t anderen Einrichtungen u n d sah die Zusammenarbeit m i t anderen Forschungsu n d Bildungseinrichtungen vor. Der von der Fachhochschule abgeschlossene Kooperationsvertrag bezieht sich i n § 1 direkt auf den Bildungsauftrag. Geht m a n davon aus, daß primäres Ziel der Fachhochschule i m Saarland auch die Sicherung des Praxisbezugs der eigenen A r b e i t war, dürften keine Bedenken bestehen, diese Bestimmung heranzuziehen, u m h i e r i n eine Ermächtigung zum Vertragsabschluß zu sehen. Für die P H des Saarlandes galt das Gesetz v o m 17. Dezember 1969, A b i 70, S. 27. § 2 dieses Gesetzes hatte folgenden Wortlaut: „Die Pädagogische Hochschule ist eine wissenschaftliche Hochschule. Sie hat zur Aufgabe, Forschung, Lehre u n d Studium i m Bereich der Erziehung u n d B i l d u n g u n d die A u s b i l dung von Lehrern. Sie w i r k t ferner bei der Weiterbildung der Lehrer mit." Auch hier k o m m t es darauf an, ob der Vertrag i m Zusammenhang m i t der Aufgabe Forschung, Lehre u n d Studium steht. Auch zur Beantwortung dieser Frage k a n n auf das verwiesen werden, was unten zur Problematik des §2 Abs. 1 H R G ausgeführt w i r d . 27 Z u dieser Absicht des Gesetzgebers bei der Verabschiedung des HRG,
5 4 2 . Teil: Kooperationsverträge und die Aufgaben der Hochschulen
tenzregelung setzte jedoch einer umfassenden Normierung des Hochschulrechts durch den Bund Grenzen. Gem. A r t . 75 Abs. 1 a GG hat der Bund auf dem Sektor des Hochschulwesens nur eine Rahmenkompetenz. Das Gesetzwerk des Bundes zur Wahrung der Einheitlichkeit i m Hochschulwesen mußte daher den Landesgesetzgebern Spielraum lassen und darauf angelegt sein, von diesen aufgrund eigener Entschließung ausgefüllt zu werden 2 8 . Ungeachtet dieser Einschränkung stand dem Bund nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Befugnis zu, für Einzelbereiche eine Vollregelung zu treffen und auch Normen mit unmittelbarer Wirkung zu setzen 29 . Allerdings war die Befugnis des Bundes, mit dem HRG unmittelbar geltendes Recht zu setzen, ungeachtet der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, i m Gesetzgebungsverfahren umstritten; das Hochschulrahmengesetz enthält einfachgesetzlich i n § 72 Abs. 1 HRG eine Klarstellung 3 0 . Unmittelbare Geltung haben danach nur die i m zweiten Halbsatz des § 72 Abs. 1 HRG genannten Vorschriften; ansonsten handelt es sich bei den Bestimmungen des HRG u m Anweisungsnormen für den Landesgesetzgeber 31 . Dies w i r d aus der Fassung des § 1 HRG nicht unmittelbar deutlich, obwohl sich gerade hier der Bundesrat m i t seiner Formulierung durchgesetzt hat. Das HRG „betrifft" nach § 1 Abs. 2 HRG die Hochschulen, es „gilt" jedoch nicht für die Hochschulen, sondern für die Länder 3 2 . Für die einzelnen Hochschulen verbindliche Fixierungen ihrer Aufgaben können daher nicht unmittelbar dem HRG entnommen werden. Für das Handeln der Hochschulen ist das jeweils maßgebliche Landesrecht entscheidend. Gerade i m Bereich der Aufgabenzuweisung hat das HRG jedoch bereits detaillierte Regelungen getroffen, die den Landesgesetzgeber weitgehend gebunden haben 33 . Da sich, die meisten siehe Thieme, Wissenschaftsrecht, Band 9 (1976), S. 193 u n d Dallinger, DUZ 1976, S. 34. 28 Z u den Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht i n ständiger Rechtsprechung an ein Rahmengesetz stellt, vgl. BVerfGE 4, 115 (128 f.); 33, 52 (64); 43, 291 (343); siehe auch Maunz, in: Maunz / D ü r i g / Herzog / Scholz, Rdnr. 8 ff. zu A r t . 75. Z u den Grenzen der Bundeskompetenz i m Hochschulwesen siehe Lüthje, DÖV 73, 54 f. ™ BVerfGE 43, 291 (343); Bode, in: Dallinger u. a. HRG, Rdnr. 7 zu § 72; vgl. auch die Äußerung der Bundesregierung in: BT-Drucks. 7/1328, Anlage 3 zu § 1; a. A . Maunz, Rdnr. 28 b. 30 Vgl. Avenarius, Hochschulen u n d Reformgesetzgebung, S. 13 u n d Bode, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 6 zu § 72. Avenarius, S. 13; Bode, Rdnr. 6 zu § 72; Thieme, Wissenschaftsrecht, 9. Band (1976), S. 198. 2 s Vgl. zur Terminologie Walter, in: Grosskreutz u. a., HRG, Rdnr. 5 zu § 1 HRG. Allgemein zweifelnd, ob der Bundesgesetzgeber nicht m i t dem H R G den durch A r t . 75 I a GG gesetzten Rahmen überschritten hat, Thieme, Wissenschaftsrecht, 9. Band (1976), S. 198 f.
I I I . Aufgaben der Hochschulen
55
Landesgesetzgeber bezüglich der Aufgaben auf die wörtliche Übernahme der HRG-Bestimmungen beschränkt haben, rechtfertigt es sich, die Untersuchung hier zunächst mit den Aussagen des HRG über die Aufgaben der Hochschulen zu beginnen. Erst i m Anschluß daran w i r d untersucht werden, inwieweit die einzelnen Landeshochschulgesetze Besonderheiten i n der Aufgabenzuweisung enthalten, die eine differenzierte Beurteilung erforderlich machen. 2. Die Aufgabenzuweisung nach dem H R G
Das HRG nennt die Aufgaben der Hochschule i n § 2. Die allgemeine Aufgabenstellung der Hochschulen ist i n § 2 Abs. 1 HRG niedergelegt. Demgegenüber werden i n den Absätzen 2 bis 7 spezielle Aufgaben hervorgehoben, die als besondere Ausprägung des Primärauftrages Pflege und Entwicklung der Wissenschaften angesehen werden können oder die mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe i m Zusammenhang stehen 34 . Von den i n Abs. 2 bis 7 genannten speziellen Aufgaben können Abs. 6 und 3 möglicherweise rechtliche Grundlage für eine Kooperation mit gesellschaftlichen Gruppen sein. a) §2 Abs. 6 HRG: Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftseinrichtungen § 2 Abs. 6 HRG weist den Hochschulen die Aufgabe zu, bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben — die aus Abs. 1 zu ermitteln sind — untereinander und mit anderen staatlichen und staatlich geförderten Forschungs- und Bildungseinrichtungen zusammenzuarbeiten. Eindeutig zielt Abs. 6 zunächst auf die Absicherung bzw. die besondere Verpflichtung der Hochschulen zur traditionellen Zusammenarbeit untereinander auf Landes- bzw. Bundesebene i n Landes- bzw. Bundesrektorenkonferenz 35 . Die Kooperation mit hochschulexternen Gruppen oder Institutionen könnte aber vom Begriff der Zusammenarbeit mit „staatlich und staatlich geförderten Bildungseinrichtungen" erfaßt sein. Eindeutig ist zwar, daß gesellschaftliche Verbände bzw. deren Bildungseinrichtungen wie ζ. B. das Bildungszentrum der IG Metall i n Sprockhövel, das für die I G Metall mit der Durchführung der Kooperation beauftragt ist, nicht von dem Begriff „staatliche Bildungseinrichtung" umfaßt werden. Gemeint sind mit dieser Formulierung des Gesetzes andere staat34 So die Begründung des RegE zum HRG, BT-Drucks. 7/1328, S.31; vgl. auch Reich, HRG, Rdnr. 1 zu § 2. 35 Reich, HRG, § 2 Rdnr. 9; Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 14 zu §2.
5 6 2 . Teil: Kooperationsverträge u n d die Aufgaben der Hochschulen
liehe Forschungs- bzw. Bildungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen. Durch Kooperation soll eine effiziente Nutzung aller staatlichen Institutionen, die sich mit Wissenschaftsentwicklung und -förderung befassen, ermöglicht werden. Als Partner der Hochschulen kommen vor allem die Forschungsanstalten des Bundes und der Länder i n Betracht 3 " 6 . Gesellschaftliche Träger und Institutionen der Wissenschaftspflege sind aber gleichfalls als Partner einer Zusammenarbeit angesprochen, wenn sie als staatlich geförderte Bildungseinrichtungen verstanden werden könnnen. Zu den bekanntesten Einrichtungen dieser A r t zählen wissenschaftsfördernde Institutionen, wie etwa die Max-Planck-Gesellschaft und die Deutsche Forschungsgemeinschaft 37 . Beiden gemeinsam ist ihr nicht-staatlicher Charakter, ungeachtet einer starken Beteiligung staatlicher Vertreter i n ihren Organen. I n der Begründung zu § 2 Abs. 6 HRG werden denn auch die Institute der Max-Planck-Gesellschaft ausdrücklich erwähnt 3 8 , als Partner einer Zusammenarbeit. Der Wortlaut des Abs. 6 gebietet jedoch keine Begrenzung auf etablierte Bildungseinrichtungen mit starkem staatlichen Einfluß, deren plurale Struktur sie der Zuordnung zu einer einzelnen gesellschaftlichen Interessengruppe entzieht. Es dürfte außer Zweifel stehen, daß von Abs. 6 auch eine Zusammenarbeit der Hochschulen mit Einrichtungen wie der Sozialakademie Dortmund umfaßt ist 3 9 . Der Wortlaut des Abs. 6 stellt keine weiteren Anforderungen an die Forschungs- und Bildungseinrichtungen, die als mögliche Partner einer Zusammenarbeit in Betracht kommen, als daß sie eine staatliche Förderung erfahren. Es ist unschädlich, wenn diese Institutionen von einer gesellschaftlichen Interessengruppe allein getragen und bestimmt werden. Dies entspricht dem Zweck des Gesetzes. Das HRG zielt auf eine Koordination aller Wissenschaftseinrichtungen, die — zumindest teilweise — finanziell von staatlichen Zuschüssen abhängen, u m auf diese Weise eine Optimierung des Einsatzes staatlicher Mittel zur Wissenschaftsförderung zu erreichen 40 . Eine Kooperation staatlicher Hochschulen mit Forschungs- und Bildungseinrichtungen einer gesellschaftlichen Interessengruppe w i r d also 3« Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 15 zu § 2; ein Überblick über die Forschungsanstalten des Bundes findet sich i m Bundesbericht Forschung V I , S. 314 ff. 37 Beide Gesellschaften sind organisiert als Vereine des Bürgerlichen Rechts, deren M i t t e l zwar nicht ausschließlich, aber doch ganz überwiegend v o n staatlicher Seite kommen, vgl. Gerber, Recht der wissenschaftlichen Hochschulen, S. 184 ff. 38 BT-Drucks. 7/1328, S. 32. 3« Vgl. zu dieser Einrichtung Kimminich, Wissenschaft, in: von Münch (Hrsg.), Besonders Verwaltungsrecht, S. 720. 40 Z u r Arbeitsteilung u n d zur Zusammenarbeit i m System der staatlichen Wissenschaftsförderung, vgl. Bundesbericht Forschung V I , S. 19 ff.
I I I . Aufgaben der Hochschulen
57
von Abs. 6 gedeckt 41 , soweit diese staatlich gefördert werden. Aus dieser Tatsache folgt jedoch nicht, daß auch die Kooperation mit der gesellschaftlichen Gruppe insgesamt, die Träger von einzelnen Bildungseinrichtungen ist, vom Wortlaut des § 2 Abs. 6 gedeckt wäre. Es überschreitet die Grenze des möglichen Wortsinns 42 , wollte man auch die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Großorganisationen, wie etwa dem DGB bzw. dessen Untergliederungen, Wirtschaftsverbänden, Verbraucherorganisationen oder ähnlichen Gruppen hierunter fallen lassen. Man kann diese Organisationen in ihrer Gesamtheit nicht als „Forschungs- und Bildungseinrichtungen" bezeichnen. Ein solches Verständnis ihrer Funktion entspricht nicht ihrer Aufgabenstellung und zwar weder unter Zugrundelegung des eigenen Selbstverständnisses noch der generellen Einschätzung 43 . Auch die Tatsache, daß die Bildungsarbeit traditionell von den Gewerkschaften intensiv betrieben w i r d und unbestritten wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit ist, macht die Gewerkschaften nicht zu Bildungseinrichtungen. Als Ergebnis dieser Auslegung des § 2 Abs. 6 HRG bleibt festzuhalten: Die Hochschulen sind aufgefordert zur Zusammenarbeit mit staatlichen und auch mit gesellschaftlichen Forschungs- und Bildungseinrichtungen. § 2 Abs. 6 HRG bezweckt nach dem Willen des Gesetzgebers die Koordination aller staatlich geförderten Wissenschaftseinrichtungen, unabhängig davon, ob es sich u m staatliche Einrichtungen, plurale wissenschaftliche Einrichtungen oder Einrichtungen der Wissenschaftspflege eines gesellschaftlichen Interessenverbandes handelt. Gesellschaftliche Organisationen aber, deren Hauptaufgabe eine umfassende Interessenvertretung der jeweiligen sozialen Gruppe ist, werden von dieser Vorschrift des HRG nicht als mögliche Partner der Hochschulen angesehen. § 2 Abs. 6 HRG kann also nicht als Ermächtigung für das Handeln der Hochschulen zum Abschluß von Kooperationsverträgen der hier untersuchten A r t angesehen werden.
41 Beschränkte sich die Kooperation i n Bochum und i n Oldenburg auf die Zusammenarbeit m i t dem Bildungszentrum der I G Metall i n Sprockhövel bzw. m i t der Organisation A r b e i t u n d Leben, so könnte diese Zusammenarbeit bereits auf § 2 Abs. 6 H R G gestützt werden. 42 Z u m Wortlaut als Grenze der Auslegung vgl. Lorenz, Methodenlehre, S. 307 ff. 43 Anläßlich der Kontroverse u m die Unterzeichnung des ersten Oldenburger Vertragsentwurfes äußerte der damalige DGB-Landesvorsitzender Niedersachsens gerade i n bezug auf § 5 der Grundordnung der Oldenburger Universität (der inhaltlich dem § 2 Abs. 6 H R G weitgehend entsprach) rechtliche Bedenken, w e i l nach seiner Auffassung der DGB Interessenvertretung der Arbeitnehmer sei, nicht aber als Bildungs- u n d Forschungseinrichtung verstanden werden könne; vgl. den Bericht der N W Z v o m 27. November 1974, siehe auch unten, F N 46.
58
2. Teil: Kooperationsverträge u n d die Aufgaben der Hochschulen
b) § 2 Abs. 3 HRG: Der Weiterbildungsauftrag
der Hochschulen
Als spezielle Aufgabe w i r d den Hochschulen i n § 2 Abs. 3 HRG die Förderung der Weiterbildung zugewiesen. Zusätzlich soll die Weiterbildung ihres Personals von ihnen betrieben werden. Hier berühren sich die Zuweisungen aus Abs. 6 und Abs. 3 erster Halbsatz; der Auftrag, mit staatlich geförderten Bildungseinrichtungen zusammenzuarbeiten, zielt i n die gleiche Richtung wie die Formulierung des Gesetzes, die Hochschulen „beteiligen sich an Veranstaltungen der Weiterbildung". Der Begriff „Weiterbildung" ist i m HRG i n einem umfassenden Sinn zu verstehen. Darunter fallen Kontakt- und Ergänzungsstudium, berufliche und allgemeine Weiterbildung, einschließlich der wissenschaftlichen Weiterbildung außerhalb der Hochschulen 44 . Die Öffnung der Hochschulen zum Zweck der Weiterbildung, auch für Teilnehmer ohne abgeschlossenes Hochschulstudium kommt auch noch i n § 22 HRG zum Ausdruck. Durch die Einbeziehung der Kapazitäten der Hochschulen für die allgemeine Weiterbildungsaufgabe sollen bisherige Defizite der Weiterbildung ausgeglichen werden. Über die A r t und Weise der Realisierung des Weiterbildungsauftrages enthält das HRG — abgesehen von § 22 — keine weiteren Aussagen; es läßt den Hochschulen hier also einen Freiraum für eigene Gestaltung und eigene Initiative. Auch eine vertragliche Kooperation der Hochschule mit einzelnen gesellschaftlichen Gruppen bzw. deren eigenen Weiterbildungseinrichtungen läßt sich so als eine Aufgabe kennzeichnen, die direkt durch das HRG den Hochschulen aufgegeben ist 4 5 . Die vorliegenden Verträge beschränken sich aber nicht auf den Weiterbildungsbereich. Sie sollen die gesamte wissenschaftliche Tätigkeit der Hochschule erfassen, u m den Vertragspartner umfassend bei seiner Interessenwahrnehmung zu unterstützen. Diese weite Zielsetzung w i r d nicht mehr von § 2 Abs. 3 HRG gedeckt 46 . c)§2 Abs. 1 HRG: Die Primäraufgabe
Wissenschaftspflege
Die bisherige Untersuchung hat gezeigt, daß weder § 2 Abs. 3 noch Abs. 6 HRG eine umfassende Kooperation von Hochschulen mit gesell44 BT-Drucks. 7/1328, S. 31, Begr. des Entwurfs zum HRG. 45 Reich, HRG, R d n r . 4 zu §2; Dallinger, in: Dallinger u.a., HRG, Rdnr. 10 zu §2. 4« Ebensowenig wie der DGB u n d seine Untergliederungen als Bildungseinrichtungen bezeichnet werden können, läßt sich behaupten, daß sie primär Weiterbildungsaufgaben verfolgten. Sicher beziehen sich einzelne Kooperationsaktivitäten speziell auf den Weiterbildungsauftrag. Die Zielsetzung der Kooperationsverträge insgesamt ist aber umfassender. Zur Zusammenarbeit von Hochschulen u n d Gewerkschaften bei der Weiterbildung, siehe Johannson / Weißbach, Zusammenarbeit von Gewerkschaften u n d Hochschulen in der Weiterbildung, in: Hochschule und Gewerkschaften, S. 15 ff.
I I I . Aufgaben der Hochschulen
59
schaftlichen Verbänden deckt. Es bleibt folglich nur die Möglichkeit des Rückgriffs auf § 2 Abs. 1 HRG, der die Grundbestimmung über die Aufgaben der Hochschulen enthält. I m folgenden ist daher zu prüfen, ob sich die Hochschulen beim Abschluß von Verträgen der hier untersuchten A r t und Zielsetzung noch i m Rahmen ihrer i n § 2 Abs. 1 genannnten A u f gabenstellung bewegen. Die Auslegung des § 2 Abs. 1 HRG, i n dem den Hochschulen die Pflege und Entwicklung der Wissenschaften aufgegeben ist, stößt auf die Schwierigkeit einer juristischen Definition des Begriffs „Wissenschaft" 47 . Der Interpret sieht sich mit dem Problem konfrontiert, daß nicht nur i n der juristischen Diskussion eine Vielfalt konträrer Βestimmungsversuche unternommen werden. Auch die wissenschaftstheoretische Grundlagendiskussion selbst u m die Klärung bestimmter Qualifikationsmerkmale bzw. der Herausarbeitung methodischer Prinzipien, die konstitutiv für wissenschaftliches Arbeiten sein sollen, ist kontrovers und weit von einem Konsens entfernt. Angesichts dieser Sachlage, die die Konsensfähigkeit eines gewonnenen Ergebnisses von vornherein reduzieren muß, soll zunächst versucht werden, die Auslegung der Aufgabe Pflege und Entwicklung der Wissenschaft aus dem systematischen Zusammenhang des §2 HRG bzw. aus der Entstehungsgeschichte dieser Norm zu entwickeln. aa) Zur Systematik des § 2 HRG Oben ist bereits festgestellt worden, daß eine umfassende Kooperation der Hochschulen mit gesellschaftlichen Gruppen nicht von einer speziellen Aufgabenzuweisung der Abs. 2 bis 6 des §2 HRG gedeckt wird. Da i n diesen speziellen Aufgabenzuweisungen (besonders i n § 2 Abs. 6 HRG) auch die Zusammenarbeit der Hochschulen mit anderen Institutionen angesprochen wird, liegt die Möglichkeit nahe, einen e contrario-Schluß zu ziehen, des Inhalts, daß eine Zusammenarbeit der Hochschulen mit anderen, i n §2 nicht genannten Institutionen, nicht von der Aufgabe der Hochschulen gedeckt ist. Ob ein solcher Schluß möglich ist, muß anhand der Systematik des § 2 HRG ermittelt werden. § 2 Abs. 1 nennt als „Primäraufgaben" 4 8 der Hochschulen die Wissenschaftspflege und -entwicklung durch Forschung, Lehre und Studium sowie die wissenschaftliche Berufsvorbereitung. Der Gesetzgeber ging davon aus, daß Abs. 1 die allgemeine Aufgabenstellung der Hochschulen enthält. Die Abs. 2 bis 7 stehen nicht gleichrangig neben der Grundbestimmung des Abs. 1; sie heben 47 Vgl. n u r Mallmann / Strauch, S. 6; Schrödter, Die Wissenschaftsfreiheit des Beamten, S.24ff.; Bauer, Wissenschaftsfreiheit, S. 21 ff.; Schumacher, Wissenschaftsbegriff u n d Wissenschaftsfreiheit, passim. 48 Ausdruck von Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 5 zu § 3.
6 0 2 . Teil: Kooperationsverträge u n d die Aufgaben der Hochschulen
spezielle Aufgaben hervor, die entweder besondere Ausprägungen der allgemeinen, i n Abs. 1 niedergelegten wissenschaftlichen Aufgaben der Hochschulen darstellen oder mit deren Wahrnehmung i n Zusammenhang stehen 49 . Dieses Verständnis der einzelnen Abs. des § 2 HRG zueinander verdeutlicht auch § 2 Abs. 8 Satz 2 HRG. Danach ist es den Ländern gestattet, den Hochschulen weitere Aufgaben zu übertragen, jedoch nur, soweit diese mit den in Abs. 1 genannten Aufgaben zusammenhängen. Abs. 8 Satz 2 w i l l die Hochschulen vor Überlastung mit Aufgaben schützen, die ihren wissenschaftlichen Primärauftrag und ihre Ausbildungsaufgabe nicht fördern 5 0 . Die ausschließliche Erwähnung der Aufgaben nach Abs. 1, die durch zusätzliche Aufgabenübertragung durch die Länder nicht beeinträchtigt werden dürfen, unterstreicht den Charakter von Abs. 1 als Grundsatznorm. Dieses Verhältnis des Abs. 1 zu den weiteren Aufgabenzuweisungen i n den Abs. 2 bis 7 dürfte einem e contrario-Schluß aus § 2 Abs. 6 entgegenstehen. Auch wenn § 2 Abs. 6 HRG nur die Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen bzw. staatlichen oder staatlich geförderten Bildungseinrichtungen nennt, kann daraus nicht gefolgert werden, eine vertragliche Kooperation mit Organisationen, die wie z. B. der DGB und seine Untergliederungen nicht hierunter fallen, sei nicht mehr Aufgabe der Hochschulen 51 . Entscheidend gegen die Möglichkeit eines e contrarioSchlusses spricht, daß § 2 Abs. 6 HRG nur eine besondere Hervorhebung einer Form der Wissenschaftspflege darstellt. Wissenschaft ist auf innerwissenschaftliche Kooperation, auf möglichst offenen und umfassenden Gedanken- und Ergebnisaustausch angewiesen. Diese Notwendigkeit unterstreicht § 2 Abs. 6 HRG. Die ausschließliche Nennung von staatlichen bzw. staatlich geförderten Wissenschaftseinrichtungen ist, wie bereits oben erläutert, darauf zurückzuführen, daß es dem Gesetzgeber darauf ankam, alle Wissenschaftseinrichtungen i n ihrer A r beit zu koordinieren, die mit staatlichen Mitteln Wissenschaftspflege 4 ® Begr. zu §3 des RegE zum HRG, BT-Drucks. 7/1328, S.31; vgl. auch Reich, HRG, Rdnr. 1 zu § 2. so Begr. des RegE, BT-Drucks. 7/1328, S.32; Dallinger, in: Dallinger u.a., HRG, Rdnr. 16 zu § 2. 5i Das e contrario-Argument spielte auch i n der Diskussion u m den Oldenburger Vertrag eine wesentliche Rolle. Die Grundordnung der Universität Oldenburg enthielt i n § 5 folgende Bestimmung: „Bei der E r f ü l l u n g ihrer Aufgaben arbeitet die Universität m i t anderen Hochschulen u n d m i t staatlichen oder staatlich geförderten sowie gewerkschaftlichen u n d sonstigen Forschungs- u n d Bildungseinrichtungen zusammen, sofern die Zusammenarbeit die E r f ü l l u n g des gesellschaftlichen Auftrages u n d der Aufgaben der Universität fördert. Die Universität k a n n die Zusammenarbeit durch Vereinbarung regeln." Unter direkter Bezugnahme auf diese Bestimmung erklärte der Landesvorsitzende Drescher das Zögern des DGB bei der Vertragsunterzeichnung. Da der DGB nicht Bildungs- u n d Forschungseinrichtung sei, k ö n n ten hier von anderer Seite Vorbehalte angeführt werden. Siehe dazu den Bericht der N W Z v o m 27. November 1974.
I I I . Aufgaben der Hochschulen
61
betreiben. A u f diese Weise soll ein effizienter Einsatz der finanziellen Aufwendungen der öffentlichen Hand i m Wissenschaftssektor erreicht werden. Zur Erreichung dieses Zieles enthält § 2 Abs. 6 HRG eine besondere Inpflichtnahme der Hochschulen, sich u m die Zusammenarbeit mit den dort genannten anderen Wissenschaftseinrichtungen zu bemühen. Aus dieser besonderen Pflicht der Hochschulen kann aber schwerlich gefolgert werden, daß eine Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, die nicht i n dieser Vorschrift genannt sind, grundsätzlich nicht Aufgabe der Hochschulen sein könne 5 2 . Andernfalls müßte auch eine Zusammenarbeit der Hochschule mit privaten Forschungsund Bildungseinrichtungen, die nicht staatlich gefördert werden, ausscheiden. Eine derartige Annahme dürfte nicht ernstlich i n Betracht kommen. Die systematische Auslegung der Aufgabenzuweisung für die Hochschulen i n § 2 Abs. 1 liefert also keine Hinweise auf die Auslegung des Begriffs Wissenschaftspflege bezüglich der hier interessierenden Fragestellung. bb) Die Entstehungsgeschichte Es bleibt zu prüfen, ob die kontroverse Entstehungsgeschichte des § 2 HRG Rückschlüsse für die Interpretation des § 2 Abs. 1 zu liefern vermag. Die Begründung des Regierungsentwurfs zu § 2 HRG ist unergiebig. Zwar w i r d dort betont, der wissenschaftliche und künstlerische Auftrag der Hochschulen erfülle gesellschaftliche Funktionen, eine Präzisierung des Begriffs gesellschaftliche Funktionen findet sich aber nur i n bezug auf Abs. 1 Satz 2. Hier w i r d unterstrichen, die Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten sei eine der bedeutendsten gesellschaftlichen Aufgaben der Hochschulen 53 . Dafür enthielt der Entwurf der Bundesregierung aber i n § 3 Abs. 1 die Formulierung: „Die Mitglieder der Hochschulen nutzen und wahren i m Bewußtsein ihrer Verantwortung vor der Gesellschaft die ihnen gewährte Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Forschung, Lehre und Studium" 5 4 . Der Bundesrat begehrte die Streichung der Worte „ i m Bewußtsein ihrer Verantwortung vor der Gesellschaft" mit der Begründung, die Formulierung des Regierungsentwurfes berge die Gefahr der Einschränkung des Individualfreiheitsrechts i n sich 55 . Dies lehnte die Bundesregierung i n einer Gegenäußerung ab; die Gefahr einer Einschränkung des A r t . 5 Abs. 3 GG werde durch die fragliche Formulierung nicht begründet 56 . 52 Vgl. auch die Ausführungen i m Rechtsgutachten der Universität Oldenburg zum Kooperationsvertrag zu § 5 der Grundordnung der Universität, in: Dokumente u n d Materialien. 53 BT-Drucks. 7/1328, S. 30. 54 BT-Drucks. 7/1328, S. 6. 55 BT-Drucks. 7/1328, S. 85.
6 2 2 . Teil: Kooperationsverträge u n d die Aufgaben der Hochschulen
I n der Plenarsitzung des Bundestages vom 12. Dezember 1974 blieb diese Formulierung des ursprünglichen Regierungsentwurfes einer der Hauptkritikpunkte der CDU/CSU-Fraktion. Für diese erklärte der Abgeordnete Dr. Klein, solange das Gesetz die Formulierung enthalte, die Mitglieder der Hochschule hätten ihre verfassungsrechtlich gewährleisteten Freiheiten i m Bewußtsein ihrer Verantwortung vor der Gesellschaft zu nutzen und zu wahren, könne seine Fraktion nicht zustimmen 5 7 . Diese Formulierung, deren Verwandtschaft m i t dem „berüchtigten" § 6 des Hessischen Universitätsgesetzes nicht zu verkennen sei, stehe für eine Hochschulpolitik, die die institutionellen Voraussetzungen für eine parteiliche Wissenschaft schaffen wolle 5 8 . Dr. Klein sah i n der angegriffenen Formulierung einen Rückfall i n „voraufklärerische Zeiten" und einen Widerspruch zum „Prinzip der Wertfreiheit" der Wissenschaft 50 . Als Beispiel für eine Hochschulentwicklung i n diese Richtung nannte er ausdrücklich die Universitäten Bremen und Oldenburg, zu deren Beurteilung es genüge, auf den Plan zu verweisen, „sich durch Vertrag i n den Dienst des Deutschen Gewerkschaftsbundes zu stellen"« 0 . Für die Koalitionsfraktionen wies der Abgeordnete Dr. Meinecke die K r i t i k zurück. Gemeint sei die Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft als einer demokratischen in einem sozialen Rechtsstaat 61 . U m klarzustellen, daß der Regierungsentwurf keine Einschränkung der Freiheit von Forschung und Lehre bezwecke, brachten die Fraktionen von SPD und FDP einen Änderungsantrag ein zur Einfügung eines neuen Abs. 2 zu § 2, der die Aufgabenbestimmung der Hochschulen enthielt, mit folgendem Wortlaut: „Die Mitglieder der Hochschulen erfüllen ihre Aufgaben i n Kunst und Wissenschaft, Forschung, Lehre und Studium i m Bewußtsein ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft i n einem freiheitlichen demokratischen und sozialen Rechtsstaat." I m Zusammenhang hiermit wurde dann auch eine Änderung des § 3 beantragt, der nur noch die Länder und die Hochschulen verpflichtete, sicherzustellen, daß die Mitglieder der Hochschulen ihre i n A r t . 5 Abs. 3 GG gewährten Grundrechte wahrnehmen könnten. Dieser Änderungsantrag wurde mit den Stimmen der Fraktionen von SPD und FDP beschlossen62. e« BT-Drucks. 7/1328, S. 111. 57 BT-Protokolle, 7. Wahlperiode/136. Sitzung v o m 12. Dezember 1974, S. 9336; auch Staatsminister Dr. Vogel lehnte die fragliche Formulierung eindeutig ab, ebenda, S. 9327. se Ebenda, s« Ebenda, S. 9336 f. Ebenda, S. 9337. ei Ebenda, S. 9339. œ Ebenda, S. 9340.
I I I . Aufgaben der Hochschulen
63
Der Bundesrat begehrte bei seiner Anrufung des Vermittlungsausschusses eine Änderung dieses neugefaßten §2 Abs. 2. Er schlug folgende Formulierung vor: „Die Mitglieder der Hochschulen erfüllen ihre Aufgaben i n Kunst und Wissenschaft, Lehre und Studium i m Bewußtsein ihrer Verantwortung gegenüber dem freiheitlichen demokratischen und sozialen Rechtsstaat" 63 . Der Vermittlungsausschuß schlug dann die gänzliche Streichung des § 2 Abs. 2 vor 6 4 . I n dieser Form w u r de das HRG schließlich verabschiedet. Eindeutige Schlüsse aus dieser Entstehungsgeschichte der §§ 2 und 3 HRG auf die Auslegung des § 2 Abs. 1 bezüglich der hier interessierenden Fragestellung — Kooperation mit gesellschaftlichen Verbänden — zu ziehen, dürfte schwerfallen. Es muß zunächst beachtet werden, daß i m Gesetzgebungsverfahren nicht die Abgrenzung der Aufgaben der Hochschulen kontrovers war, sondern daß die Diskussion darum kreiste, ob die einzelnen Mitglieder der Hochschule bei der Wahrnehmung ihrer Rechte eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zu beachten hätten. Nicht die Verhinderung einer unerwünschten zusätzlichen Aufgabe der Hochschulen war das primäre Ziel der K r i t i k der Unionsfraktion i m Gesetzgebungsverfahren. Unterbunden werden sollte vielmehr eine — nach Auffassung der Union — drohende Relativierung der individuellen Wissenschaftsfreiheit. Die Union wollte eine Formulierung i m HRG verhindern, die an die von ihr strikt abgelehnte Formulierung i n § 6 HUG erinnerte. Für diese Deutung spricht, daß die umstrittene Formulierung zunächst i n §3 HRG unter der Überschrift „Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Forschung, Lehre und Studium" enthalten war. Nach Ansicht der Regierung ging es dabei also nicht u m die Aufgaben der Hochschule. Auch der Umstand, daß die umstrittene Formulierung i m Zuge des Gesetzgebungsverfahrens — nach Äußerung der K r i t i k der Opposition — i n § 2, also i n der Vorschrift über die Aufgaben der Hochschule auftaucht, rechtfertigt keine andere Schlußfolgerung. I n keiner Phase des Gesetzgebungsverfahrens war die A u f gabenbestimmung der Hochschulen selbst unmittelbar kontrovers. Dem Bundesrat ging es mit seiner Formulierung, die eine Verantwortung der Wissenschaft gegenüber dem freiheitlichen demokratischen und sozialen Rechtsstaat vorsah, darum, eine Verpflichtung der Mitglieder der Hochschulen auf eine diffuse gesellschaftliche Verantwortung zu vermeiden 6 5 . Die direkte kritische Erwähnung der Kooperationsaktivi»3 BT-Drucks. 7/3279, S. 1. * 4 BT-Drucks. 7/4462. 65 Z u den äußerst unterschiedlichen Vorstellungen, die m i t der Normierung einer gesellschaftlichen Verantwortung der Wissenschaftler bzw. m i t einer Pflicht zum Mitbedenken der gesellschaftlichen Folgen verbunden sein können, vgl. die Äußerungen zu § 6 HUG, wiedergegeben i n BVerfGE 47,
2. Teil: Kooperationsverträge und die Aufgaben der Hochschulen
täten der Universitäten Oldenburg und Bremen durch den Abgeordneten Dr. Klein diente zur Illustration für eine „parteiliche Wissenschaft", die das Prinzip der Wertfreiheit verletze und der die Bestimmung über die gesellschaftliche Verantwortung des einzelnen Wissenschaftlers den Weg ebne. Nun ist sicher die geäußerte K r i t i k auch ein deutlicher Beleg dafür, daß die Opposition die geplante Kooperation der Universitäten i n Oldenburg und Bremen ablehnte. Der i n dieser K r i t i k zum Ausdruck kommende Wissenschaftsbegriff läßt Rückschlüsse darauf zu, wie der Terminus „Wissenschaftspflege" i n § 2 Abs. 1 HRG nach Auffassung der Opposition zu verstehen sei. Da die Opposition i n der direkten Zusammenarbeit mit einer gesellschaftlichen Interessengruppe eine Verletzung des Prinzips der Wertfreiheit sah, liegt die Annahme nahe, daß die Opposition den Begriff Wissenschaftspflege i m Sinne von § 2 Abs. 1 HRG so verstanden wissen wollte, daß er eine Kooperation mit gesellschaftlichen Interessengruppen nicht mehr abdeckte. Sehr fraglich ist aber, ob aus dem Gesetzgebungsverfahren tatsächlich gefolgert werden kann, daß sich die Regierungsfraktionen — durch Akzeptierung der Streichung der Passage über die gesellschaftliche Verantwortung — generell dieser Auffassung angeschlossen hätten. Dies würde bedeuten, die Regierungsfraktionen hätten einer Gesetzesformulierung zugestimmt, die eine Kooperation, wie sie i n Oldenburg und Bremen praktiziert wurde bzw. geplant war, nicht gestattet. Nun waren aber die A n sichten über die Zulässigkeit und die politische Wünschbarkeit einer solchen Kooperation zwischen Regierung und Opposition umstritten' 66 . Während die Opposition die Kooperation als „Hochschulpolitik unter einseitigem Vorzeichen" strikt ablehnte, wurde die Zusammenarbeit von der Regierung ausdrücklich begrüßt. Die Regierung brachte ihre Unterstützung für ein derartiges Verhalten der Hochschulen zum Ausdruck. Angesichts dessen erscheint es fragwürdig, anzunehmen, die Regierungsfraktionen hätten einer Formulierung i m HRG zugestimmt, die diese Kooperation ausgeschlossen hätte. Sowohl die Regierung als auch die Opposition nahmen bei ihrer Anfrage bzw. der Beantwortung auf §2 Abs. 2 des Entwurfes zum HRG Bezug. Die Opposition hatte gefragt, ob i n dieser Zusammenarbeit bereits eine Auswirkung des §2 Abs. 2 des Regierungsentwurfes zu sehen sei. Die Regierung antwortete, sie verstehe diese Vorschrift als „von der Überzeugung getragen, daß die Hochschulen sich den vielfältigen Problemen ihrer Umwelt öffnen und versuchen sollen, an ihrer Lösung mitzuwirken" 6 7 . Weder von sei327 (356 ff.); siehe auch Hailbronner, in: Grosskreutz u. a., HRG, Rdnr. 6 zu § 22. ®6 Dies erhellt besonders die A n t w o r t der Bundesregierung auf die A n frage der CDU/CSU-Fraktion zu den Kooperationsverträgen; vgl. BT-Drucks. 7/3422.
I I I . Aufgaben der Hochschulen
65
ten der Regierung noch von Seiten der Opposition wurde jedoch diese Vorschrift als entscheidend für ein rechtliches Urteil über die Kooperation angesehen. Die Streichung des Passus über die gesellschaftliche Verantwortung enthält daher keine abschließende Entscheidung des Gesetzgebers über die Frage der Zulässigkeit der Kooperation mit gesellschaftlichen Interessengruppen. Die Regierung bzw. die sie tragenden Koalitionsfraktionen verzichteten auf eine Vorschrift, die als Bekräftigung einer Auslegung des § 2 Abs. 1 HRG hätte angesehen werden können, die Wissenschaftspflege durch die Hochschulen decke auch Kooperationen, wie sie i n Oldenburg und Bremen praktiziert wurden. Für eine derartige Zustimmung war die Bundesratsmehrheit nicht zu erhalten. Dieser Verzicht ist aber nicht gleichzusetzen mit der Annahme, die Regierungsfraktionen hätten sich der grundsätzlichen Ablehnung der Kooperationsverträge durch die Opposition anschließen wollen. Eine derartige Annahme scheidet angesichts des positiven Urteils, das die Regierung über die Kooperationsaktivitäten hatte, aus. Die Entstehungsgeschichte der §§2 und 3 HRG gestattet also keine Rückschlüsse auf die Auslegung des Begriffs Wissenschaftspflege i m Sinne des § 2 Abs. 1 HRG. cc) Auslegung des Begriffs Wissenschaftspflege durch die Elemente Forschung und Lehre Der bisherige Versuch, aus dem systematischen Zusammenhang der einzelnen Abs. des § 2 HRG bzw. aus der Entstehungsgeschichte dieser Vorschrift Auslegungshilfen für die Frage zu gewinnen, ob die den Hochschulen i n § 2 Abs. 1 HRG zugewiesene Aufgabe Pflege und Entwicklung der Wissenschaften eine vertragliche Kooperation mit gesellschaftlichen Verbänden deckt, hat keine eindeutigen Ergebnisse erbracht. Die Interpretation des Begriffs Pflege und Entwicklung der Wissenschaften bleibt daher aufgegeben, und damit auch die Bewältigung des Problems, einer juristischen Klärung des met ajuristischen Sachverhalts Wissenschaft. Angesichts des fehlenden interwissenschaftlichen Konsens' u m die Klärung der Kriterien von Wissenschaftlichkeit soll hier zunächst versucht werden, eine Präzisierung des i m HRG verwandten Begriffs „Wissenschaftspflege" aus Einzelaussagen des HRG selbst über die Wissenschaft zu gewinnen. § 2 Abs. 1 HRG erläutert, daß die Hochschuβ7 BT-Drucks. 7/3422; i m übrigen verwies die Bundesregierung darauf, daß die Kooperationsverträge, die aus einer Zeit vor der Formulierung des § 2 Abs. 2 H R G stammten, natürlich nicht auf diesen E n t w u r f des HRG's Bezug nehmen könnten. 5 uechtritz
66
2. Teil: Kooperationsverträge u n d die Aufgaben der Hochschulen
len der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften „durch Forschung, Lehre und Studium dienen". Das HRG definiert also die A r t und Weise der Wissenschaftspflege, die den Hochschulen aufgegeben ist — ohne Hochschule und Wissenschaft zu identifizieren —, durch die traditionellen Formen der Wissenschaftspflege: Forschung und Lehre 6 8 . Als wesentliches neues Element kommt die ausdrückliche Anerkennung der Aufgabe der Hochschulen hinzu, auf berufliche Tätigkeiten vorzubereiten 6 9 . Nun sind allerdings die Kontroversen u m die Auslegung der i n A r t . 5 Abs. 3 GG garantierten Sachverhalte Forschung und Lehre kaum weniger intensiv als die u m den Wissenschaftsbegriff selbst 70 , so daß der Versuch, den Begriff „Wissenschaftspflege" durch die Modalitäten Forschung und Lehre zu definieren, gleichfalls auf Schwierigkeiten stößt. Während das HRG jedoch den Oberbegriff Pflege und Entwicklung der Wissenschaften nicht weiter erläutert (außer durch die Bezugnahme auf die Modalitäten Forschung und Lehre), finden sich i m Gesetz weitere Aussagen, die Rückschlüsse auf das Verständnis der Begriffe Forschung und Lehre i m Sinne des HRG gestatten. Dies bietet die Möglichkeit, anhand der Aussagen des Gesetzes selbst eine Präzisierung zu unternehmen, welche Aktivitäten der Hochschule noch von der i n § 2 Abs. 1 erfolgten Aufgabenzuweisung gedeckt werden. α) Der Begriff der Forschung im HRG Das HRG hat der Forschung i n den §§ 22 bis 26 einen eigenen Abschnitt gewidmet; außerhalb dieses Abschnitts enthält §3 Abs. 2 Aussagen über die Forschungsfreiheit. Das Bundesverfassungsgericht hat Forschung als „geistige Tätigkeit mit dem Ziel, in methodischer, systematischer und nachprüfbarer Weise neue Erkenntnisse zu gewinnnen", 68 Vgl. die Aussage bei Thieme, Deutsches Hochschulrecht, S. 3 f. u n d Röttgen, Grundrecht, S. 26 ff.; ähnlich auch Scholz, in: Maunz / D ü r i g / Herzog / Scholz, Rdnr. 103 ff. zu A r t . 5 Abs. 3; nach Mallmann / Strauch, S.4, F N 7, ist durchaus herrschende Meinung, daß Forschung u n d Lehre den Begriff der Wissenschaft erschöpfen, daß also andere Modalitäten der Wissenschaftspflege nicht existieren; ebenso Dreier, DVB1 80, 471. β® Z u m Verhältnis dieser Aufgabe zur Wissenschaftspflege siehe die Begr. des RegE, BT-Drucks. 7/1328, S. 30 ff. und Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 5 zu § 2. ™ Z u r Forschungsfreiheit vgl. etwa Schmitt Glaeser, Die Freiheit der Forschung, Wissenschaftsrecht, Band 7 (1974), S. 107 ff.; Tuppy, Wissenschaftsfreiheit u n d Forschungsorganisation, in: Die Rolle der Forschung i n den w i s senschaftlichen Hochschulen, Wissenschaftsrecht 1979, Beiheft 7, S. 178 ff.; Hailbronner, Forschungsreglementierung u n d Grundgesetz, Wissenschaftsrecht, Band 13 (1980), S. 212; ders., Funktionsgrundrecht, S. 256; Dreier, DVB1 80, 417; Flämig, Forschungsauftrag der Hochschule, in: Handbuch des Wissenschaftsrechts, Band 2, S.279; zur Lehrfreiheit vgl. Rnemeyer, Lehrfreiheit, passim; Thieme, Hochschulrecht, S. 240 ff.; Hailbronner, Funktionsgrundrecht, S. 161; Bauer, Wissenschaftsfreiheit, S. 52 ff.
I I I . Aufgaben der Hochschulen
67
charakterisiert 71 . Eine allgemeine Umschreibung der Aufgaben der Forschung findet sich i n § 22 HRG: „Die Forschung i n den Hochschulen dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium. Gegenstand der Forschung i n den Hochschulen können unter Berücksichtigung der Aufgabenstellung der Hochschule alle wissenschaftlichen Bereiche sowie die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse i n der Praxis einschließlich der Folgen sein, die sich aus der Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse ergeben können". Nach allgemeiner Auffassung enthält § 22 Abs. 1 HRG keine ausdrückliche Definition der Forschung 72 . Durch die Nennung des Ziels der Forschung und der möglichen Forschungsgegenstände sind aber wesentliche Determinanten für die Hochschulforschung angeführt 7 3 . §22 HRG verdeutlicht die vom Gesetzgeber gewollte Hinwendung des universitären Wissenschaftsbetriebes zu Problemen der gesellschaftlichen Praxis 7 4 , und enthält damit eine Absage an die noch vielfältig vorhandene Vorstellung von der notwendigen Distanz der Hochschule gegenüber praktischen Fragestellungen 75 . Eine ausschließliche Theorieorientierung der Hochschulforschung ohne Bezug zu aktuellen Problemen, ein Arbeiten jenseits jeder gesellschaftlichen Opportunität, entspricht nicht mehr der Konzeption des HRG. Die i n der Realität bereits längst vor Inkrafttreten des HRG vielfach vollzogene Praxisorientierung ist durch das HRG abgesichert und ausdrücklich als eine Aufgabe der Hochschulen bekräftigt worden. Dieses Anliegen kam i m ursprünglichen Regierungsentwurf noch deutlicher zum Ausdruck. Vorgesehen war in § 22 ein Abs. 2 mit folgendem Wortlaut: „Die Forschung i n den Hochschulen dient auch der Analyse von Problemen i n allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und zeigt wissenschaftlich begründete Lösungsmöglichkeiten auf. Sie soll die besonderen Aufgaben, die sich i n der 7i BVerfGE 35, 79 (113). Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 1 zu § 22; Reich, HRG, Rdnr. 1 zu §22; Flämig, Forschungsauftrag, S. 894. Wegen der verfassungsrechtlichen Gewährleistung der Forschungsfreiheit i n A r t . 5 Abs. 3 GG k a n n dem einfachen Gesetzgeber auch keine Befugnis zu verbindlicher Definition zukommen. 73 Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 1 zu § 22. 74 Begr. des RegE zum HRG, BT-Drucks. 7/1328, S.29 und S. 50; Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 2 zu § 22 sieht i n § 22 H R G ein Beispiel für ein grundsätzliches Anliegen des Gesetzes: Die Verbindung von Wissenschaft und Praxis; Bedenken bezüglich der Formulierung des § 22 H R G bei Scholz, in: Maunz / D ü r i g / Herzog / Scholz, Rdnr. 99 zu A r t . 5 Abs. 3 GG; nach Flämig, S. 894 bekundet das H R G eine deutliche Vorliebe für Praxisbezug. 75 von Schenk, HRG, S. 99 ff.; siehe auch Schelsky, Einsamkeit u n d Freiheit, S. 65; auch Flämig, Forschungsauftrag, S.882 n i m m t an, das H R G wende sich gegen Tendenzen, Teile der Forschung — nämlich die anwendungsorientierte — aus dem Hochschulwesen auszugliedern. *
68
2. Teil: Kooperationsverträge und die Aufgaben der Hochschulen
Region der Hochschule stellen, berücksichtigen." Dieser Abs. 2 wurde nach Einspruch durch den Bundesrat 76 vom Vermittlungsausschuß gestrichen 77 . Der Bundesrat hatte seinen Einspruch damit begründet, daß Ziel und Zweck der Forschung bereits i n Abs. 1 festgelegt seien. Die Bestimmung des Abs. 2 habe keinen normativen Charakter 7 8 . Zusätzlich wurde i n Abs. 1 Satz 2 auf Verlangen des Bundesrates das Wort „können" eingefügt, u m klarzustellen, daß keine Verpflichtung der Hochschulen bestehe, Aspekte der Anwendung mit i n die Forschungsarbeit einzubeziehen 79 . Diese Veränderungen gegenüber dem Regierungsentwurf haben aber die grundsätzliche Zielsetzung, daß die Hochschulen ihren Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme leisten sollten, nicht berührt. Dieses ursprüngliche Anliegen kommt i n § 22 Abs. 1 Satz 2 HRG noch hinreichend deutlich zum Ausdruck 8 0 . Diese vom Gesetzgeber gewollte Hinwendung der Hochschulen zur gesellschaftlichen Praxis 8 1 , die i n den Bestimmungen des HRG über Ziel und Gegenstand der Forschung ihren Ausdruck findet, muß auch Beachtung finden bei der Auslegung des § 2 Abs. 1 i n bezug auf die Frage, ob diese Aufgabennorm Kooperationsverträge der hier untersuchten A r t deckt. Die Verträge sollen Problemstellungen aus der Arbeitswelt der abhängig Beschäftigten den Hochschulen nahebringen. Die Institutionalisierung des Kontaktes und damit die kontinuierliche Kommunikation von Hochschule und diesem Bereich gesellschaftlicher Praxis soll durch die Verträge abgesichert werden. Damit schaffen die Verträge nach den Vorstellungen der handelnden Hochschulen die Voraussetzung, daß überhaupt ausreichend Material für praxisbezogene Forschung zur Verfügung steht. Sie sollen neue Betätigungsfelder für die wissenschaftliche Arbeit der Hochschulen eröffnen und den Praxisbezug der Arbeit sichern. I h r allgemeiner Zweck kann daher jedenfalls auch als Förderung der Kommunikation zwischen „Wissenschaft und Praxis" charakterisiert werden 8 2 . Damit 7« BT-Drucks. 7/3279, S. 6. 77 BT-Drucks. 7/4462, S. 4. 78 BT-Drucks. 7/3279, S. 6. 7» BT-Drucks. 7/1328, S. 92; vgl. auch Hailbronner, in: Grosskreutz u.a., HRG, Rdnr. 4 zu § 22 u n d Avenarius, Hochschulen u n d Reformgesetzgebung, S. 27. so Auch Hailbronner, in: Grosskreutz u. a., HRG, Rdnr. 1 zu § 22, betont, daß die Fassung des jetzigen § 22 H R G keinen wesentlichen sachlichen U n terschied i m Verhältnis zur Fassung des RegE darstelle. 81 Siehe dazu noch den allgemeinen T e i l der Begr. des RegE, BT-Drucks. 7/1328, S. 29. A l s ein Schwerpunkt des Entwurfs w i r d i n dem Abschnitt über Forschung ausgeführt: Dabei werden sich die Hochschulen stärker als bisher Aufgaben zuwenden müssen, die ihnen von der Gesellschaft gestellt werden. 82 Dazu allgemein Dupree, DUZ 77, 34; zu den Kooperationsverträgen siehe Bamberg / Kröger / Kuhlmann, Soziale Verantwortung u n d Freiheit, in: Hochschule u n d Gewerkschaften, S. 32 ff.
I I I . Aufgaben der Hochschulen
69
weisen aber die Verträge einen sachlichen Bezug zur Forschungsaufgabe der Hochschulen auf. Sie sollen dazu beitragen, die Voraussetzungen für die Forschung der Hochschule zu fördern. Sie sollen das „Vorfeld" für die eigentliche wissenschaftliche Arbeit der Hochschule bereiten® 3. Sie sollen auf die Wahl des Forschungszieles einwirken und vor allem die Beschaffung von Material und Informationen erleichtern. Der bestehende Bezug zur Aufgabe der Forschung 84 , die nach der Vorstellung des HRG ein Hauptelement der Wissenschaftspflege ist, gibt die Möglichkeit, die Kooperationsverträge noch der Aufgabe Wissenschaftspflege i m Sinne des § 2 Abs. 1 HRG zuzuordnen. Diese Schlußfolgerung dürfte der K r i t i k ausgesetzt sein. Es ist festgestellt worden, die Kooperationsverträge dienten alle, gleich ob sie nur eine Zusammenarbeit vorsehen oder darüber hinausgehend eine Unterstützungspflicht beinhalten, der besonderen Förderung eines gesellschaftlichen Partikularinteresses. Eine solche Orientierung der Hochschulforschung an der wissenschaftstranszendenten Zielsetzung „Förderung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeitnehmer" sei mit dem Gebot der Offenheit der Hochschulforschung unvereinbar bzw. sei wegen der Aufgabe der „Wertneutralität" nicht mehr als Wissenschaftspflege anzusehen 85 . Es ist an dieser Stelle noch nicht ausführlich der Frage nachzugehen, welche Grenzen für die inhaltliche Gestaltung von Kooperationsverträgen aus der Garantie des A r t . 5 Abs. 3 GG abgeleitet werden können (dazu ausführlich unten Teil 5). Es geht hier u m die Beantwortung der Frage, ob allein die Tatsache, daß die Kooperationsverträge auch die Zielsetzung haben, die Interessen des Vertragspartners zu fördern, dazu führt, sie nicht mehr als Ausdruck der Aufgabe „Wissenschaftspflege" anzusehen. Eine solche Schlußfolgerung wäre nur dann gerechtfertigt, wenn anerkannt wäre, daß jegliche Interessenbindung einer wissenschaftlichen Arbeit, die Absicht, ein bestimmtes gesellschaftliches Interesse zu fördern, dazu führte, die fragliche Tätigkeit nicht mehr als Ausdruck £3 Ganz überwiegend w i r d heute der Schutz der Wissenschaftsfreiheit auch auf „Vorarbeiten" bezogen, vgl. n u r Scholz, in: Maunz / D ü r i g / Herzog / Scholz, Rdnr. 100 zu A r t . 5 Abs. 3; Schmitt Glaeser, Wissenschaftsrecht, Bd. 7 (1974), S. 101 f.; Hailbronner, in: Grosskreutz u. a., HRG, Rdnr. 25 zu § 3 HRG; andere Auffassungen noch Röttgen, in: Die Grundrechte, S. 29 f.; differenzierend jetzt Schulz-Prießnitz, Einheit von Forschung u n d Lehre, S. 91. « 4 Vgl. etwa die Darstellung des Forschungsprozesses bei Flämig, Forschungsauftrag, S. 900 ff. 85 Vgl. etwa Hailbronner, in: Grosskreutz u. a., HRG, Rdnr. 7 zu § 22; siehe auch Scholz, in: Maunz / D ü r i g / Herzog / Scholz, Rdnr. 96 f. zu A r t . 5 Abs. 3, der davon ausgeht, eine „Tendenzuniversität", die sich gesellschaftspolitischen Interessen unterordnet, sei nicht mehr m i t A r t . 5 Abs. 3 vereinbar. Dies begründet Scholz ausdrücklich m i t der Aufgabe der Hochschulen, eine wertneutrale Wissenschaft zu pflegen; (näher dazu unten, 5. Teil).
70
2. Teil: Kooperationsverträge u n d die Aufgaben der Hochschulen
wissenschaftlichen Arbeitens anzusehen. Dies entspricht jedoch keinesfalls der herrschenden Auffassung. Es ist heute praktisch allgemein anerkannt, daß auch die „Auftragsforschung", die an den Hochschulen betrieben wird, grundsätzlich den Schutz des A r t . 5 Abs. 3 GG genießt, also als Wissenschaftspflege anzusehen ist 8 6 . Entscheidend ist grundsätzlich nicht die Zielsetzung, mit der eine wissenschaftliche Arbeit begonnen w i r d bzw. die — auch kaum nachprüfbare — subjektive Motivation des einzelnen Wissenschaftlers, sondern, ob bei der konkreten Arbeit „wissenschaftliche Mindeststandards" eingehalten worden sind 8 7 . Solche Mindeststandards sind sowohl i n der Literatur als auch i n der Rechtsprechung zur Bestimmung des Begriffs der wissenschaftlichen Forschung entwickelt worden. Das Bundesverfassungsgericht hat i m Hochschulurteil die bereits erwähnte Formel verwandt, Forschung sei „geistige Tätigkeit mit dem Ziel, i n methodischer, systematischer und nachprüfbarer Weise neue Erkenntnisse zu gewinnen" 8 8 . Ähnliche „technisch-formale" Definitionen werden von der überwiegenden Zahl der Autoren vertreten, die sich i n neuerer Zeit u m eine Klärung des Merkmals „wissenschaftlich" bemüht haben 8 9 . A l l e n diesen Versuchen ist gemein, daß sie auf eine abschließende Begriffsbestimmung von Wissenschaft verzichten. Angesichts des offenen, unabgeschlossenen Charakters von Wissenschaft müßte eine solche Definition auch die innerwissenschaftliche Diskussion über die Klärung des Begriffs an einem bestimmten Punkte w i l l k ü r l i c h abschneiden. Angestrebt werden kann daher nur eine Grenzbestimmung, die unter Rekurs auf technisch-formale, weitgehend anerkannte Mindestkriterien eine Trennung zwischen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Aussagen ermöglicht 90 . 8« So ausdrücklich auch Scholz, Rdnr. 98, zu A r t . 5 Abs. 3 GG; von Mangoldt / Klein, A r t . 5 A n m . X 4; Thieme, Hochschulrecht, S. 14. 87 Hailbronner, in: Grosskreutz u. a., HRG, Rdnr. 25 zu § 3. 88 BVerfGE 35, 79 (113); vgl. auch B V e r w G E 29, 77 (78) u n d 34, 69 (76); zustimmend trotz der konstatierten Vagheit der Formel, Dreier, DVB1 80, 472. «s Vgl. etwa Mallmann / Strauch, S. 5: Forschung als methodisches Streben nach E r m i t t l u n g neuer oder der Festigung alter Erkenntnisse; Schmitt Glaeser, Wissenschaftsrecht, Band 7 (1974), S. 115; Gallas, Staatsaufsicht, S. 7; Hailbronner, in: Grosskreutz u. a., HRG, Rdnr. 23 ff. zu § 3; Blankenagel will Wissenschaft — unter Rückgriff auf Wissenschaftsnormen, die i m Sozialsystem Wissenschaft akzeptiert sind — als „die i n der Gemeinschaft der Forschenden integrierte, methodische u n d planmäßige Untersuchung von Problemen unter Beachtung der Normen Universalismus, Kommunalismus, organisierter Skeptizismus u n d Desinteressiertheit definieren, A Ö R 105 (1980), S. 70; Thieme, Hochschulrecht, S. 47 sieht das bestimmende M e r k m a l der Forschung i n der Wahrheitsorientierung u n d folgt damit der Formel Smends: Wissenschaft ist alles, was sich als ernsthafter Versuch zur E r m i t t l u n g oder zur Lehre der wissenschaftlichen Wahrheit darstellt, V V D S t R L 4 (1928), S. 44 (67). m Vgl. Mallmann / Strauch, S. 6 unter Verweis auf F. Müller, Freiheit der Kunst, S. 39; kritisch zu den technisch-formalen Begriffsbestimmungen Schulz-Prießnitz, Einheit von Forschung u n d Lehre, S. 26 ff., die das Smendsche K r i t e r i u m der Wahrheitsorientierung m i t formalen K r i t e r i e n koppeln will.
I I I . Aufgaben der Hochschulen
71
I n Übereinstimmung m i t diesen Grundsätzen hatte auch der Wissenschaftsrat i n seinen Empfehlungen keine Bedenken, die Gesamthochschule Eichstätt trotz ihrer besonderen Bindungen an die Kirche und eine dadurch bestimmte Auswahl der Lehr- und Forschungsgegenstände als eine wissenschaftliche Einrichtung anzuerkennen. Entscheidend für die Wissenschaftlichkeit war auch hier die Annahme, daß bei der Bearbeitung der durch die Interessenbindung selektierten Forschungsund Lehrgegenstände keine anderen Voraussetzungen und Grenzen anerkannt werden, als sie den jeweiligen methodischen Ansätzen der beteiligten Disziplinen selbst immanent sind 9 1 . Akzeptiert man dies als Grundansatz zu einer juristischen Bestimmung des Merkmals „wissenschaftlich" 02 — trotz des Umstandes, daß die verwandten technisch-formalen Kriterien vielfach vage sind und daher i m Einzelfall zu Abgrenzungsschwierigkeiten führen dürften — dann kann allein aus der Tatsache, daß die Wissenschaftspflege in Vollzug der Kooperationsvereinbarungen auch Ausdruck der Absicht ist, die Interessen des Vertragspartners zu fördern, nichts gegen die „Wissenschaftlichkeit" vorgebracht werden 9 3 . Entscheidend ist, ob die vertragliche Bindung es den Hochschulen unmöglich macht, bei der Erfüllung ihrer Arbeit derartige Mindestkriterien zur Erfüllung der Wissenschaftlichkeit einzuhalten. Dies dürfte aber selbst für die Verträge, i n denen eine Unterstützungspflicht vereinbart wurde, zu verneinen sein. Es kann aus den Verträgen keine Verpflichtung herausgelesen werden, daß die Hochschulen die zugesagte Unterstützung i n einer Weise realisieren wollten, die die Einhaltung von wissenschaftlichen Mindesterfordernissen bei der A r beit nicht garantiert 9 4 . Die Aussagen des HRG über die Modalität Forschung als Ausdruck der Wissenschaftspflege lassen daher eine Auslegung des § 2 Abs. 1 HRG zu, die auch Kooperationsverträge der fli Wissenschaftsrat, Empfehlungen u n d Stellungnahmen 1978, S. 185. I n der Rechtsprechung sind ζ. T. ausführlichere Versuche einer Präzisierung unternommen worden, vgl. besonders BVerwGE 29, 77 (78); wesentlich allgemeiner u n d zurückhaltender demgegenüber BVerwGE 34, 69 (76); k r i tisch zu den Versuchen einer formalen Begriffsbestimmung, Denninger, HRG, S. 75 u n d Schrödter, Wissenschaftsfreiheit, S. 29 ff. Selbst w e n n m a n etwa m i t Scholz, Rdnr. 96 f. zu A r t . 5 Abs. 3 GG, den präzisierungsbedürftigen Begriff der „Wertneutralität" als wesentlich für die wissenschaftliche A r b e i t anerkennt, folgt daraus nicht ohne weiteres ein V e r stoß der Kooperationsverträge gegen dieses Prinzip. Auch von den A n h ä n gern der theoretischen Position der „Wertneutralität" w i r d eingeräumt, daß die A u s w a h l der Gegenstände wissenschaftlichen Arbeitens ein wertender A k t ist (vgl. v o r allem Albert, T r a k t a t über kritische Vernunft, S. 62 ff.). Gefordert w i r d nur, daß sich der Wissenschaftler bei der A r b e i t selbst auf deskriptive Aussagen beschränkt. M Generell zur Vereinbarkeit dieser Verträge m i t A r t . 5 Abs. 3 GG, vgl. ausführlich unten 5. Teil.
72
2. Teil: Kooperationsverträge u n d die Aufgaben der Hochschulen
hier untersuchten A r t noch von der Aufgabenstellung der Hochschulen gedeckt sieht. ß) Der Begriff der Lehre im HRG Die Lehraufgabe ist den Hochschulen — konkret den Hochschullehrern — als Amtsaufgabe gestellt. Durch Lehre leistet die Hochschule i m wesentlichen ihren Beitrag zur akademischen Berufsausbildung, die nach § 2 Abs. 1 Satz 3 HRG Aufgabe der Hochschule ist 9 5 . Den Begriff der Lehre hat das BVerfG i m Hochschulurteil als wissenschaftlich fundierte Übermittlung der durch die Forschung gewonnenen Erkenntnisse umschrieben 96 . Die Aufgabe der Hochschule, Wissenschaftspflege durch Lehre zu betreiben, ist primär eine Verpflichtung, die dieser gegenüber den Studenten obliegt, sei es zum bloßen Zweck der akademischen Berufsausbildung oder zusätzlich auch zum Zweck der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Die Frage, ob durch A r t . 5 Abs. 3 GG eine Lehrfreiheit außerhalb der akademischen Berufsausbildung garantiert ist 9 7 , kann offenbleiben; jedenfalls i m HRG geht es u m die Regelung der Lehre durch die staatliche Institution Hochschule 98 . Während die Forschung schon nach den Aussagen des HRG (§ 22) auf die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen und damit den Kontakt zur Praxis angewiesen ist, läßt sich gleiches von der Lehraufgabe so nicht behaupten. Die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse durch die Träger der Lehrfreiheit an den Hochschulen gegenüber den lernenden Hochschulmitgliedern bedarf grundsätzlich keiner externen Unterstützung. Das HRG enthält jedoch Aussagen, die auf die Offenheit des Lehrbetriebes abzielen. Bereits aus § 2 Abs. 3 HRG, wonach sich die Hochschulen an Veranstaltungen der Weiterbildung beteiligen sollen, geht hervor, daß die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse durch die Hochschule auch an hochschulexterne Adressaten erfolgen kann. Zugleich ist damit ausgesprochen, daß die Hochschule mit gesellschaftlichen Trägern der Weiterbildung zusammenarbeiten soll 9 9 . Der Weiterbildungsauftrag ist nicht beschränkt auf die Möglichkeit, daß die Hochschulen selbst Träger derartiger Veranstaltungen sind, möglich ist auch die M i t w i r k u n g i m Rahmen von Vorhaben, die etwa von einer Gewerkschaft oder berufsständischen Organisationen betrieben werden. w Hailbronner, Funktionsgrundrecht, S. 164. «e BVerfGE 35, 79 (113); zur Lehrfreiheit vgl. auch Knemeyer, Lehrfreiheit, passim; Schrödter, Die Wissenschaftsfreiheit des Beamten, S. 63; Bauer, passim u n d Schulz-Prießnitz, S. 95 ff. «7 Bejahend Knemeyer, S.35; Köttgen, in: Die Grundrechte, S.299; verneinend Hailbronner, Funktionsgrundrecht, S. 166; Thieme, S. 60. «β Zur Betonung des Ausbildungsauftrages i n § 2 HRG, siehe Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 5 zu § 2. Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 10 zu § 2.
I I I . Aufgaben der Hochschulen
73
Der allgemeine Weiterbildungsauftrag der Hochschulen, der i n §2 Abs. 3 HRG niedergelegt ist, ist zu unterscheiden vom „weiterbildenden Studium" i m Sinne des §21 HRG. Gemeint ist hiermit die Weiterbildung i n „Eigenregie" der Hochschulen 100 , die auf Erhaltung bzw. Erweiterung einer bereits vorhandenen wissenschaftlichen Qualifikation zielt. I n dieser Vorschrift ist eine besondere Lehraufgabe für die Hochschulen genannt. Der Wortlaut des § 21 HRG verdeutlicht, daß auch auf dem Gebiet der Lehre eine Gesellschaftsoffenheit grundsätzlich der Gesamtkonzeption des HRG entspricht. I n § 21 ist gefordert, daß sich die Hochschulen bei Weiterbildungsveranstaltungen bemühen, berufspraktische Erfahrungen für die Lehre nutzbar zu machen. Die Lehre an den Hochschulen soll praxisoffen sein und i m Austausch mit der Praxis eine Befruchtung erfahren 1 0 1 . Auch wenn sich diese Grundausrichtung des HRG nur i m Zusammenhang mit Vorschriften über den Weiterbildungsauftrag der Hochschule äußert, kann nicht zweifelhaft sein — besonders wegen des Auftrages der Hochschule, i m Rahmen der Lehre Berufsbildungsfunktionen zu erfüllen —, daß Offenheit gegenüber Fragen der gesellschaftlichen Praxis eine Vorstellung vom Inhalt der Lehre ist, die dem HRG entspricht. Da die Kooperationsverträge auch darauf abzielen, diesen Praxisbezug der Lehre zu sichern, stehen sie in einem engen Zusammenhang mit dieser i n § 2 Abs. 2 HRG den Hochschulen übertragenen Aufgabe 102 . dd) Grenzen der Zusammenarbeit aus der Aufgabenbestimmung des § 2 Abs. 1 HRG Akzeptiert man die hier vorgenommene Auslegung zu § 2 Abs. 1 HRG, dann folgt aus der Grundtendenz des HRG zur „Praxisoffenheit", daß eine Kooperation mit gesellschaftlichen Interessenverbänden grundsätzlich noch i m Zusammenhang stehen kann mit der Aufgabe „Pflege und Entwicklung der Wissenschaften". Diese Auslegung der Primäraufgaben der Hochschulen i n § 2 Abs. 1 HRG bedeutet nicht, daß sich die Hochschulen zu beliebigem T u n gegenüber ihrem gesellschaftlichen Partner verpflichten könnten. Eine unbegrenzte Handlungsfreiheit ist den Hochschulen hierdurch nicht garantiert. Die Zusammenarbeit mit loo Bode, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 1 zu § 21. ιοί Bode, in: Dallinger u.a., HRG, Rdnr. 4 zu §21; vgl. auch Bauer, S. 66; auch die wechselseitigen Abhängigkeiten der Freiheit von Forschung u n d Lehre — vgl. dazu Wussow, WissR (Bd. 13) 1980, S. 1 ff. — lassen eine Red u k t i o n der Gesellschaftsoffenheit der Wissenschaft auf die Forschung fragw ü r d i g erscheinen. 102 Für ein praktisches Beispiel der Zusammenarbeit auf dem Sektor der Lehre, vgl. R U B - a k t u e l l v o m 10. J u l i 1975: Lehrauftrag der Universität für Dozenten des Bildungszentrums der I G Metall Sprockhövel. Z u Auswirkungen der Berufsausbildungsfunktion für die Auslegung des Begriffs der Lehre, siehe Schulz-Prießnitz, Einheit von Forschung u n d Lehre, S. 134 ff.
74
2. Teil: Kooperationsverträge und die Aufgaben der Hochschulen
gesellschaftlichen Interessengruppen, die nicht selbst als Träger der Wissenschaftspflege anzusehen sind, muß einen sachlichen Bezug zur Forschungs- bzw. Lehraufgabe der Hochschulen aufweisen, bzw. muß geeignet sein, die Erfüllung dieser Aufgaben zu fördern. Die Wissenschaftspflege ist den Hochschulen als Amtsaufgabe gestellt 1 0 8 . Ziel ihres Handelns muß daher — auch bei der Kooperation m i t gesellschaftlichen Interessenverbänden — die Verfolgung des Auftrages wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung sein. Die i m HRG vorgenommene Betonung der Gesellschaftsoffenheit der wissenschaftlichen Forschung (besonders i n § 22 HRG) dient der Klarstellung, daß auch die anwendungsbezogene Forschung, nicht nur die Grundlagenforschung, Aufgabe der Hochschule sein kann. Es ging dem Gesetzgeber u m die Zurückweisung traditioneller Auffassungen, die zu einer Restriktion der Forschung i n bezug auf Ziele und Gegenstände hätte führen können 1 0 4 . Die vom Gesetzgeber ermöglichte Gesellschaftsoffenheit der Hochschulen ist aber nicht eingeräumt worden, u m den Hochschulen die Rolle eines Dienstleistungsbetriebes für konkrete Anforderungen aus der gesellschaftlichen Praxis zu ermöglichen. „Praxisoffenheit" ist vom Gesetzgeber gewollt wegen des damit verbundenen „Rückkoppelungseffekts" für die Hochschulen 1 0 8 . Dies bedeutet, daß die Hochschulen beim Abschluß von Verträgen mit gesellschaftlichen Gruppierungen die Durchführung bzw. Erleichterung eigener Aufgaben beabsichtigen müssen, d.h., Ziel muß die Erschließung neuer Problemfelder sein bzw. die Sicherung der Kommunikation mit Vertretern der Praxis aus Bereichen, die bisher Defizite der Hochschulforschung darstellten. Anders formuliert, eine Verpflichtung der Hochschule, dem Vertragspartner auf dessen jeweilige Anforderung h i n „Dienst- oder Serviceleistungen" zu erbringen, fällt nicht mehr unter die Aufgabe Pflege und Entwicklung der Wissenschaft. I n einem solchen Fall ordnet sich die Hochschule den Interessen des Vertragspartners unter; sie verpflichtet sich zur Interessenwahrnehmung des Vertragspartners, ohne die eigene Primäraufgabe der Wissenschaftspflege i m Auge zu behalten 1 0 6 . Sicher kann nicht schlechthin behauptet werden, daß Gutachten und ähnliche Äußerungen, die auf Anforderung des Vertragspartners von der Hochschule geleistet werden, generell nicht mehr die Kriterien der „Wissenschaftlichkeit" erfüllten. Bereits oben ist dargelegt worden, daß nach der ganz überwiegenden Auffasi«3 Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 7 zu § 3. 104 Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 2 zu § 22; Reich, HRG, Rdnr. 2 zu § 22, Flämig, Forschungsauftrag, S. 882. 105 Reich, HRG, Rdnr. 2 zu § 22. toe Vgl. Scholz, in: Maunz / D ü r i g / Herzog / Scholz, Rdnr. 97 zu A r t . 5 Abs. 3 GG, der die Äußerungen des Gründungsrektors der Bremer Hochschule k r i t i siert, die Hochschulen hätten als „dienendes Instrument" den Anforderungen der organisierten Arbeitnehmerschaft zu entsprechen.
I I I . Aufgaben der Hochschulen
75
sung auch die Auftragsforschung dem Schutzbereich des A r t . 5 Abs. 3 GG unterfällt. Problematisch ist vielmehr, daß die Hochschulen bei derartiger Unterordnung unter die Interessen des jeweiligen Vertragspartners eine Ausrichtung ihrer Arbeitsaktivitäten vornehmen, die nicht mehr von dem Bemühen gekennzeichnet ist, die Wissenschaft zu entwickeln bzw. zu pflegen, und zwar i m Hinblick auf die Anforderungen, die sich aus dem universitären Betrieb heraus ergeben. Das HRG stellt aber den Hochschulen die Aufgabe, allgemein Wissenschaftspflege zu betreiben, nicht wissenschaftliche Förderung einzelner gesellschaftlicher Gruppen. Ein Handeln, das an der Erfüllung der Bedürfnisse des Kopperationspartners orientiert ist, entspricht nicht mehr dem Amtsauftrag, unabhängige Wissenschaftspflege zu betreiben. Die Kooperation mit gesellschaftlichen Gruppen darf nicht mit dem Ziel der Förderung der Interessen dieser Gruppe von den Hochschulen betrieben werden, sondern i m Hinblick auf den Ertrag der Kooperation für die Aufgaben der Hochschule i n Forschung und Lehre. A n diesem Grundsatz ist die inhaltliche Gestaltung von Kooperationsverträgen zu messen. Untersucht man die abgeschlossenen Verträge, so läßt sich bezüglich der Hochschulen, die lediglich die Verpflichtung zur gleichberechtigten Zusammenarbeit übernommen haben (Bochum, Oldenburg) schwerlich sagen, hierin käme die Bereitschaft der Hochschulen zum Ausdruck, dem Vertragspartner gegenüber eine „Dienstleistungsfunktion" zu erfüllen. Bedenklicher ist die Verpflichtung zur Unterstützung, wie sie i n § 2 des Bremer und § 2 des Vertrages der PH des Saarlandes enthalten ist. Eine solche Formulierung legt die Deutung nahe, die Vereinbarung werde von den beteiligten Hochschulen nicht zum Zweck der Förderung ihrer wissenschaftlichen Arbeit geschlossen, sondern m i t der primären Zielsetzung, die Interessen des Vertragspartners zu fördern. Ein Handeln mit derartiger Zielsetzung 107 w i r d dann aber nicht mehr von der Aufgabe „Pflege und Entwicklung der Wissenschaft" gedeckt. Bedeutet der Vertrag die Unterordnung der Arbeit der Hochschule unter die Erkenntnisinteressen ihrer Vertragspartner, dann taugt er nicht mehr, die Erfüllung der Aufgaben der Hochschulen aus § 2 HRG zu fördern; er dient dann primär den Aufgaben bzw. Interessen des gesellschaftlichen Partners. 107 Aus diesem Grund erscheint es auch geboten, Erklärungen der V e r tragspartner über die Ziele der Zusammenarbeit zu berücksichtigen. Dies bedeutet nicht, die „juristische Analyse der Texte der Kooperationsvereinbarungen durch eine Wiedergabe politischer Wertungen dieser Verträge durch Vertreter der Gewerkschaftsseite oder Hochschulangehörige" zu ersetzen (so aber Hauck, Rechtsgutachten, S. 19), sondern die Berücksichtigung der subj e k t i v e n Vorstellungen der Vertragspartner bei der Auslegung der Vereinbarungen.
76
2. Teil: Kooperationsverträge und die Aufgaben der Hochschulen
Es kommt also darauf an, inwieweit die Verträge Auswirkungen auf die Unabhängigkeit der Arbeit der Hochschule haben. Dies w i r d unten (5. Teil, I I I 5) näher geprüft werden. Nur wenn man annimmt, die Entscheidungsfreiheit der Hochschulorgane bzw. der einzelnen Hochschulangehörigen werde durch den Vertragsschluß nicht präjudiziert, bleibt eine gesetzeskonforme Auslegung möglich, die annimmt, die Hochschulen wollten sich mit Vertragsschluß den Zugang zur Praxis sichern, die Unterstützung des Vertragspartners aber nur i n Form der unabhängigen Befassung mit seinen Anliegen realisieren; weitere Voraussetzung ist, daß diese Arbeit der Pflege und Entwicklung der an der Hochschule betriebenen Wissenschaft dient. Schärfer noch werden die Bedenken, wenn man die i n Bremen zur Erfüllung des Vertrages nach 1978 gewählten Formen der Ausgestaltung betrachtet. U m dem Drängen des Vertragspartners nachzugeben, der statt langfristig angelegter wissenschaftlicher Kooperation an der Erfüllung kurzfristiger Anforderungen i n Form von Gutachten und Stellungnahmen zu aktuellen Problemen interessiert w a r 1 0 8 , wurde die „Zentralstelle für die Durchführung des Kooperationsvertrages" geschaffen (zu den Einzelheiten siehe oben Teil 1), als deren Aufgabe i m Einrichtungsbeschluß ausdrücklich genannt ist: „Die Erarbeitung und Vermittlung von wissenschaftlichen Gutachten und Stellungnahmen zu Arbeitnehmerproblemen auf Anforderung der Arbeiterkammer, der Einzelgewerkschaften und der Betriebs- und Personalräte" 10 9 . Die Hochschule selbst hat die Aufgaben der Zentralstelle charakterisiert als eine A r t Dienstleistungsfunktion gegenüber den Gewerkschaften 110 . Berücksichtigt man, daß die Zentralstelle eingerichtet wurde i m Zusammenhang mit der Aufteilung des früheren Arbeiterkammerbereichs und daß bei Ausgliederung eines eigenständigen Forschungsbereichs (die zentrale wissenschaftliche Einrichtung Arbeit und Betrieb) die Zentralstelle für die Durchführung des Kooperationsvertrages nunmehr von ihrer Funktion her der Erfüllung der Anforderungen des Vertragspartners dient, dann dürfte es kaum mehr vertretbar sein, diese Aufgabe noch als Pflege der Wissenschaften anzusehen. I m Vordergrund steht hier die Dienstleistungsfunktion gegenüber dem Vertragspartner. M i t diesen organisatorischen Maßnahmen dürften also von der Bremer Hochschule die Grenzen über-
108 v g l . etwa die Stellungnahme der Arbeiterkammer zur weiteren Zusammenarbeit v o m 19. A p r i l 1977, maschinenschriftlich, S. 2; Der Kooperationsvertrag zwischen der Arbeiterkammer Bremen u n d der Universität Bremen, vorgelegt von der Arbeiterkammer, M a i 1976; sowie Ströh / Schmurr, Der K o operationsvertrag zwischen Arbeiterkammer u n d Universität Bremen, in: Hochschulen u n d Gewerkschaften, S. 159 ff. 109 Einrichtungsbeschluß v o m 19. J u l i 1978 u n d 27. September 1978. no Universität Bremen, Unipress v o m 5. September 1978, S. 3; vgl. auch Ströh / Schmurr, S. 165 ff.
I I I . Aufgaben der Hochschulen
77
s c h r i t t e n sein, die b e r e i t s einfach-gesetzlich nach § 2 A b s . 1 H R G f ü r die A u f g a b e n der Hochschule gesetzt sind.
3. Aufgabenbestimmungen der Hochschulen in den Landesgesetzen A u s d e m oben b e r e i t s A u s g e f ü h r t e n (vgl. I I , 1) f o l g t , daß f ü r das H a n d e l n d e r Hochschule n i c h t das H R G u n m i t t e l b a r v e r b i n d l i c h ist. Dieses e n t h ä l t — v o n e i n z e l n e n Ü b e r g a n g s v o r s c h r i f t e n abgesehen — n u r A n w e i s u n g s n o r m e n a n d e n Landesgesetzgeber, die diesen b i n d e n . F ü r d i e h i e r interessierende Frage, ob sich die Hochschulen b e i m A b s c h l u ß v o n K o o p e r a t i o n s v e r t r ä g e n noch i m R a h m e n der s t a a t l i c h f i x i e r t e n A u f g a b e n f e s t l e g u n g bewegen, s i n d die j e w e i l s g e l t e n d e n Landesgesetze u n m i t t e l b a r maßgeblich. I n a l l e n B u n d e s l ä n d e r n s i n d i n z w i s c h e n die Hochschulgesetze d e m H R G angepaßt w o r d e n 1 1 1 . D e r u m f a n g r e i c h e K a t a l o g des § 2 H R G s c h r ä n k t d i e G e s t a l t u n g s f r e i h e i t des Landesgesetzgebers i m H i n b l i c k a u f die A u f g a b e n s t e l l u n g v o n v o r n h e r e i n ein. A u s d r ü c k l i c h gestattet § 2 A b s . 8 Satz 2 H R G d e n L ä n d e r n d i e Ü b e r t r a g u n g a n d e r e r A u f g a b e n n u r , w e n n sie m i t d e n i n § 2 A b s . 1 H R G g e n a n n t e n P r i m ä r a u f g a b e n (Pflege u n d E n t w i c k l u n g der Wissenschaften u n d V o r b e r e i t u n g a u f berufliche Tätigkeiten) zusammenhängen. A l l e L ä n d e r h a b e n die F o r m u l i e r u n g e n des § 2 H R G w e i t g e h e n d w ö r t l i c h ü b e r n o m m e n 1 1 2 . I n s o w e i t k a n n g r u n d s ä t z l i c h a u f die o b e n ge111 I m einzelnen wurden folgende Gesetze beschlossen: Baden-Württemberg: Universitätsgesetz v o m 22. November 1977 (GBl, S.473); Fachhochschulgesetz v o m 22. November 1977 (GBl, S.522); Gesetz über die Pädagogischen Hochschulen v o m 22. November 1977 (GBl, S.557); Kunsthochschulgesetz v o m 22. November 1977 (GBl, S. 592). Bayern: Bayerisches Hochschulgesetz v o m 7. November 1978 (GVB1, S. 790); Bayerisches Hochschullehrergesetz v o m 24. August 1978 (GVB1, S. 571). Berlin: Gesetz über die Hochschulen i m Land B e r l i n v o m 22. Dezember 1978 (GVB1, S. 2449). Bremen: Bremisches Hochschulgesetz v o m 14. November 1977 (GBl, S. 317). Hamburg: Hamburgisches Hochschulgesetz v o m 22. M a i 1978 (GBl, S. 10). Hessen: Hochschulgesetz v o m 6. J u n i 1978 (GVB1I, S. 319); Universitätsgesetz v o m 6. J u n i 1978 (GVB11, S.348); Kunsthochschulgesetz v o m 6. J u n i 1978 (GVB11, S. 378); Fachhochschulgesetz v o m 6. J u n i 1978 (GVB11, S. 380). Niedersachsen: Niedersächsisches Hochschulgesetz v o m 1. J u n i 1978 (GVB1, S.473). Nordrhein-Westfalen: Gesetz über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen v o m 20. November 1979, GVB179, S. 920; Gesetz über die Fachhochschulen i m Lande Nordrhein-Westfalen v o m 20. November 1979, GVB1 79, S. 964. RheinlandPfalz: Hochschulgesetz v o m 21. J u l i 1978 (GVB1, S. 507); Verwaltungshochschulgesetz (Speyer) v o m 21. J u l i 1978 (GVB1, S. 568); Fachhochschulgesetz v o m 21. J u l i 1978 (GVB1, S. 543). Saarland: Gesetz Nr. 1093 „Saarländisches U n i versitätsgesetz" v o m 14. Dezember 1978 (Amtsbl., S. 1085); Gesetz Nr. 1096 über die Fachhochschule des Saarlandes v o m 31. Januar 1979 (Amtsbl., S. 269); Gesetz Nr. 1099 über die Musikhochschule des Saarlandes v o m 21. März 1979 (Amtsbl., S. 393). Schleswig-Holstein: Hochschulgesetz v o m 2. M a i 1973 (GVOB1, S. 153) geändert durch 3. Gesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes v o m 22. Dezember 1978 (GVOB1, S. 356).
78
2. Teil: Kooperationsverträge u n d die Aufgaben der Hochschulen
machten Ausführungen zu § 2 Abs. 1 HRG und die dort gezogenen Schlußfolgerungen für die Bestimmung der Aufgaben der Hochschulen verwiesen werden. I m folgenden sollen nur die landesgesetzlichen Abweichungen bzw. Ergänzungen zur Aufgabenbeschreibung der Hochschulen untersucht werden, die als zusätzliche Absicherung für die Möglichkeit des Abschlusses von Kooperationsverträgen Belang haben könnten. a) Das Hamburger Hochschulgesetz § 3 Hamburger Hochschulgesetz (HambHG) entspricht zunächst weitgehend §2 HRG. I m zweiten Teil des Gesetzes, der die Stellung der Mitglieder der Hochschulen behandelt, enthält § 9 unter der Überschrift „Allgemeine Rechte und Pflichten" i n Abs. 1 folgende Bestimmung: „Die Hochschulen und ihre Mitglieder sind gehalten, die ihnen durch A r t . 5 Abs. 3 des Grundgesetzes und durch dieses Gesetz verbürgten Freiheiten i n Lehre und Studium, Forschung und Kunst i m Bewußtsein ihrer Verantwortung vor der Gesellschaft auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung zu nutzen und zu bewahren. Die Hochschule und ihre Mitglieder dürfen Mittel Dritter für Lehre, Forschung und Kunst nicht unter Bedingungen annehmen, die deren Freiheit oder die Freiheit des Studiums beeinträchtigt." Der Hamburger Gesetzgeber nahm also die i m HRG-Entwurf enthaltene und dort i m Gesetzgebungsverfahren gestrichene Formulierung über die „Verantwortung vor der Gesellschaft" wieder auf; ergänzend wurde hinzugefügt, daß diese Verantwortung auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung gegeben sei. Schon die systematische Stellung dieser Vorschrift, die nicht i m Katalog der Aufgaben der Hochschule enthalten ist, macht klar, daß i n ihr keine ausdrückliche Erweiterung des gesetzlich festgelegten Wirkungskreises der Hochschulen gesehen werden kann. Die Aufgabenbestimmung für die Hochschulen enthält § 3 HambHG praktisch inhaltsgleich mit § 2 HRG. Es ist aber auch kaum angängig, die Bestimmungen des § 9 Abs. 1 HambH G nur als moralischen Appell aufzufassen, mit präambelartiger W i r kung ohne normativen Gehalt 1 1 3 . Eine gleiche Deutung wurde auch i n der Debatte u m die entsprechende Vorschrift i m Regierungsentwurf des HRG vertreten. Der Abgeordnete Dr. Meinecke hielt dort die entsprechende Vorschrift für einen „positiven Appell" an die Wissenschaft 114 . 112 v g l . A r t . 2 BayHSchG; § 3 UGBaWü; § 4 U G Berlin; § 4 BremHG; § 3 Abs. 2 H U G ; §3 HambHG; §2 WissHGNRW; §2 H G Rheinland-Pfalz; § 1 SUG; § 2 SHHSG. na Eine solche Deutung hält Avenarius, Hochschulen u n d Reformgesetzgebung, S. 29 für möglich. 114 Deutscher Bundestag, Protokolle 7. Wahlperiode, 136. Sitzung am 12. Dezember 1974.
79
I I I . Aufgaben der Hochschulen
Gegen die Deutung als bloße Appellvorschrift ohne normativen Gehalt sprechen aber die gleichen Argumente, die bereits i n der Diskussion gegen eine entsprechende Deutung des vergleichbaren § 6 H U G vorgebracht wurden. Die Ergebnisse wissenschaftlicher Tätigkeit sind i n Lehre und Forschung auf Publizität angelegt. Es ist folglich auch grundsätzlich eine Überprüfung möglich, ob bei der Arbeit der „gesellschaftlichen Verantwortung" Genüge getan wurde, bzw. ob bei § 6 H U G die „gesellschaftlichen Folgen" mitbedacht wurden 1 1 5 . Die Bestimmung des § 9 Abs. 1 HambHG hat also normative Verbindlichkeit und kann Bedeutung gewinnen für die Auslegung der den Hamburger Hochschulen i n § 3 Abs. 1 HambHG gestellten Aufgaben „Pflege und Entwicklung der Wissenschaften". Die Aufgaben der Hochschulen werden von den Mitgliedern der Hochschulen wahrgenommen. Wenn das Gesetz diese dazu anhält, ihre Freiheiten i n Verantwortung vor der Gesellschaft wahrzunehmen, dann unterstreicht diese Vorschrift den W i l l e n des Hamburger Gesetzgebers, daß sich die Hochschulen der Praxis und den Aufgabenstellungen aus der Gesellschaft zuwenden können. I m übrigen kann auf das verwiesen werden, was oben zur Bedeutung der entsprechenden Formulierungen i m Regierungsentwurf zum HRG ausgeführt wurde. Die Bestimmung des § 9 Abs. 1 HambHG kann daher als zusätzliches Indiz für die hier vertretene Auslegung herangezogen werden, daß eine Kooperation m i t gesellschaftlichen Gruppen zur wissenschaftlichen Behandlung praktischer Fragen auch von der Primäraufgabe Pflege und Entwicklung der Wissenschaften gedeckt ist. Bei der Auslegung des § 3 Abs. 1 muß auch § 73 HambHG beachtet werden. § 73 Satz 1 HambHG lautet: „Die Hochschulen fördern i m Bereich der Forschung insbesondere auch die Zusammenarbeit m i t Personen und Einrichtungen der Berufspraxis." Durch diese Bestimmung unterstreicht der Hamburger Gesetzgeber seine Auffassung, daß die Hochschulforschung „gesellschaftsoffen" zu betreiben ist: es w i r d ausdrücklich klargestellt, daß i m Vollzug des Forschungsauftrages auch eine Zusammenarbeit m i t gesellschaftlichen Einrichtungen — nicht nur m i t anderen Forschungseinrichtungen — erwünscht ist. Da die Gewerkschaften als „Einrichtungen der Berufspraxis" angesehen werden können, ist eine Zusammenarbeit Hochschule / Gewerkschaften, die darauf zielt, die berufspraktischen Erfahrungen der Gewerkschaften i n den Forschungsprozeß einzubringen, von den Regelungen des HambHG gedeckt.
lie BVerfGE 47, 285 (375); Kupfer, Wissenschaftsrecht, S. 119 ff.; Hailbronner, Funktionsgrundrecht, S. 298 ff.
Band 4
(1971),
80
2. Teil: Kooperationsverträge u n d die Aufgaben der Hochschulen
b) Die rechtliche Situation
in Hessen
Die Situation i n Hessen weist Parallelen zu der eben dargestellten Rechtslage in Hamburg auf. 6 HUG 1 1 , 6 enthält die bereits erwähnte umstrittene Verpflichtung: „Alle an Forschung und Lehre beteiligten Mitglieder und Angehörige der Universität haben die gesellschaftlichen Folgen wissenschaftlicher Erkenntnis mitzubedenken." Die eigentliche Aufgabennorm enthält das für alle Hochschulen des Landes geltende Hochschulgesetz i n § 3. § 3 Abs. 1 HHG lautet: „Die Hochschulen dienen der Verwirklichung des Rechts auf Bildung und der wissenschaftlichen Erkenntnis. I m Rahmen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung i m Sinne des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Landes Hessen sind die Hochschulen berufen, die Studenten auf die Verantwortung i n der Gesellschaft vorzubereiten und die Verantwortung der Wissenschaft für die Gesellschaft zu stärken." Der folgende Abs. 2 entspricht dem § 2 Abs. 1 HRG. Auch mit diesen Bestimmungen ist keine ausdrückliche Erweiterung des Aufgabenkreises der Hochschulen gegenüber dem HRG vorgenommen worden. Die Aufgabe, „die Verantwortung der Wissenschaft für die Gesellschaft" zu stärken, kann jedoch in Verbindung mit § 6 HUG ebenfalls als Indiz für die vom Gesetzgeber gewollte Zuwendung der Hochschulen zu gesellschaftlichen Problemen angesehen werden. § 3 Abs. 1 HHG und § 6 HUG stützen daher die hier vorgenommene Auslegung, auch eine umfassende Kooperation mit gesellschaftlichen Gruppen könne noch von der Aufgabe „Pflege und Entwicklung der Wissenschaft" gedeckt sein. c) Das Bremer
HG
I m Bremer HG sind verschiedene vom HRG abweichende Regelungen enthalten, die für die Frage einer rechtlichen Absicherung von Kooperationsverträgen Bedeutung haben. Entsprechend dem ursprünglichen Regierungsentwurf und dem bereits erwähnten § 9 HambHG heißt es i n § 6 BremHG: „Die Mitglieder der Hochschule nutzen und wahren, i m Bewußtsein ihrer Verantwortung vor der Gesellschaft, die durch A r t . 5 Abs. 3 Satz 1 GG und A r t . 11 des Landesverfassung verbürgten Grundrechte der Freiheit von Wissenschaft, Kunst, Forschung, Lehre und Studium." Während § 6 sich an den einzelnen Hochschulangehörigen richtet, w i r d die Verantwortung der Hochschule bei ihrer Aufgabenerfüllung zusätzlich i n § 4 betont. § 4 Abs. 1 BremHG lautet: „Die Hochschulen dienen entsprechend ihrer Aufgabenstellung i m ZuZur K r i t i k dieser Vorschrift siehe Kupfer, Wissenschaftsrecht, Band 4 (1976), S. 124 ff.; Schmitt Glaeser, Wissenschaftsrecht, Band 7 (1974), S. 113; Hailbronner, Funktionsgrundrecht, S. 298 ff.
I I I . Aufgaben der Hochschulen
81
sammenwirken aller ihrer Mitglieder der Pflege und der Entwicklung der Wissenschaften und der Künste i n ihren verschiedenen Richtungen durch Forschung, Lehre und Studium i m Bewußtsein ihrer Verantwortung vor der Gesellschaft in einem freiheitlichen demokratischen und sozialen Rechtsstaat." Durch diese Formulierungen sollen Gesellschaftsoffenheit und Praxisorientierung der Arbeit der Hochschule und der einzelnen Angehörigen unterstrichen werden. I n die gleiche Richtung zielt die Bestimmung des § 70 Abs. 2 BremHG, i n der als Aufgabe der Forschung auch „die Analyse von Problemen i n allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens" und das „Aufzeigen wissenschaftlich begründeter Lösungsmöglichkeiten" genannt w i r d 1 1 7 . I n Bremen findet sich darüber hinaus aber eine Bestimmung, die als eindeutige Absicherung der i m Lande Bremen stattfindenden Kooperation angesehen werden kann. I n § 4 Abs. 5 BremHG heißt es: „Die Hochschulen wirken bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben untereinander mit anderen staatlichen und staatlich geförderten Bildungseinrichtungen sowie mit sonstigen Trägern öffentlicher Belange zusammen." Die Bestimmung entspricht zwar weitgehend dem § 2 Abs. 6 HRG, durch die zusätzliche Nennung der „sonstigen Träger öffentlicher Belange" als mögliche Partner einer Zusammenarbeit geht das BremHG hier jedoch über das HRG hinaus. Da der Bremer Kooperationspartner, die Arbeiterkammer, „Träger öffentlicher Belange" i m Sinne dieser Bestimmung ist 1 1 8 , enthält das BremHG hiermit die ausdrückliche Ermächtigung zur Zusammenarbeit der Universität mit der Arbeiterkammer. Auch die Bestimmung des § 96 BremHG über die Möglichkeit der Bildung eines Kuratoriums zum Zwecke der Zusammenarbeit m i t anderen Einrichtungen ist Indiz für den Willen des Bremer Gesetzgebers, die i n Bremen stattfindende Kooperation rechtlich abzusichern. Die Einführung des § 96 BremHG erfolgte nicht zuletzt unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die von der Universität betriebene Kooperation mit der Arbeiterkammer 1 1 9 . d) Das UG von Baden-Württemberg I m Universitätsgesetz von Baden-Württemberg sind zunächst die Aufgaben der Universitäten i n § 3 UG entsprechend dem § 2 HRG umschrieben. Eine Regelung, die für die Zusammenarbeit der Hochschulen mit gesellschaftlichen Gruppen oder Einrichtungen von Interesse ist, enthält § 4 Abs. 1 Satz 2 UG. Der ursprüngliche Gesetzesentwurf beli? § 70 Abs. 2 BremHG entspricht dem Abs. 2 des § 22 HRG-Entwurf in der ursprünglichen Fassung der Regierungsvorlage (vgl. oben 2. Teil, I I I 2 cc). us Vgl. § 1 des Gesetzes über die Arbeiterkammer, G B l 1956, S. 79, u n d BVerfGE 38, 281 (298 ff.). no Vgl. die E r k l ä r u n g des Senators für Wissenschaft u n d Kunst (Hrsg.), ohne Jahrgang, S. I X . 6 Uechtritz
82
2. Teil: Kooperationsverträge u n d die Aufgaben der Hochschulen
schränkte sich i n § 4 Abs. 1 darauf, unter der Überschrift „Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre und Studium" inhaltsgleich m i t § 3 Abs. 1 HRG festzulegen: „Das Land und die Universitäten stellen sicher, daß die Mitglieder der Universität die durch A r t . 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes verbürgten Grundrechte wahrnehmen können 1 2 0 ." Dieser Bestimmung fügte der kulturpolitische Ausschuß auf Antrag der CDU-Fraktion folgenden Satz hinzu: „Verträge der Universitäten über eine nicht nur vorübergehende wissenschaftliche Zusammenarbeit oder Förderung mit Einrichtungen, deren Aufgabe nicht ausschließlich i n der Pflege der Wissenschaft liegt, bedürfen der Genehmigung des Kultusministeriums." Diese Ergänzung war i m kulturpolitischen Ausschuß umstritten 1 2 1 . Ein der SPD angehörendes Mitglied fragte gezielt, ob mit den „Einrichtungen, deren Aufgabe nicht ausschließlich in der Pflege der Wissenschaften liegt", die Gewerkschaften gemeint seien 122 . I h m wurde entgegengehalten, es sei an Einrichtungen jeder A r t gedacht. Ein Ausschußmitglied der FDP/DVP erkundigte sich, ob darunter „auch die Bestrebungen der Universität Konstanz verstanden würden, einen Kooperationsvertrag mit den Gewerkschaften zu schließen." Die Berichtsniederschrift des Ausschusses verzeichnet als Erwiderung: „daß diese Frage i n Konstanz eine Rolle gespielt habe. Das Justizministerium sei bereits m i t der Angelegenheit befaßt worden. Als Reaktion habe man auf Arbeitgeberseite überlegt, wie man solchen Kooperationsbestrebungen entgegensteuern könne. Das gemeinsame Interesse müsse sein, eine Tendenzuniversität zu verhindern. Die vorgeschlagene neue Bestimmung könne das gewährleisten 1 2 3 ." Der Ausschuß nahm die Ergänzung m i t 7 : 5 Stimmen an. Diese veröffentlichten Gesetzesmaterialien zeigen, daß mit der Einfügung dieser Bestimmung die Landtagsmehrheit auf die Vorgänge von Konstanz reagieren wollte. Die Versuche der dortigen Universität, eine Kooperationsvereinbarung mit dem DGB abzuschließen, hatten ein heftiges publizistisches Echo hervorgerufen 1 2 4 . Angesichts der bestehenden Unsicherheiten auch bei der baden-württembergischen Landesregierung über die rechtliche Beurteilung der geplanten Vereinbarung sollte die Einfügung dieses Satzes der Landesregierung eine eindeutige rechtliche Möglichkeit geben, die Kooperation von Universitäten mit außerwissenschaftlichen Einrichtungen zu kontrollieren (mit anderen Worten: „die Tendenzuniversität" zu verino Landtag von Baden-Württemberg, 7. Wahlperiode, Drucks. 7/2221, S. 8. 121 Landtag v o n Baden-Württemberg, 7. Wahlperiode, Drucks. 7/2222, Bericht über die Beratungen des kulturpolitischen Ausschusses, S. 31 f. 122 Ebenda. 123 Ebenda. 1 2 4 Vgl, n u r Rüthers, A u f dem Weg zur Tendenzuniversität, F A Z v o m 23. Oktober 1976; u n d den Bericht in: Die Welt v o m 28. J u n i 1976.
I I I . Aufgaben der Hochschulen
83
h i n d e r n ) 1 2 5 . A u c h w e n n d u r c h § 4 A b s . 1 Satz 2 U G B a W ü eine K o o p e r a t i o n d e r U n i v e r s i t ä t m i t gesellschaftlichen E i n r i c h t u n g e n z u s t i m m u n g s p f l i c h t i g gemacht w i r d , so gestattet doch gerade diese V o r s c h r i f t d e n Schluß, daß solche V e r t r ä g e j e d e n f a l l s g r u n d s ä t z l i c h noch v o n der A u f g a b e n z u w e i s u n g a n die U n i v e r s i t ä t e n gedeckt w e r d e n . D i e E i n f ü h r u n g dieses Zusatzes i n das Gesetz w ä r e überflüssig, w e n n eine Z u s a m m e n a r b e i t der Hochschulen m i t gesellschaftlichen G r u p p e n n i c h t m e h r v o n d e n A u f g a b e n der Hochschulen gedeckt u n d d a h e r g e n e r e l l u n z u l ä s s i g w ä r e . D i e V o r s c h r i f t ist I n d i z f ü r eine A u s l e g u n g d e r P r i m ä r a u f g a b e n Pflege u n d E n t w i c k l u n g der Wissenschaften i n d e m Sinne, daß eine K o o p e r a t i o n der Hochschulen m i t gesellschaftlichen G r u p p i e r u n g e n h i e r v o n noch u m f a ß t sein k a n n 1 2 0 . e) Das Niedersächsische
Hochschulgesetz
D a i n Niedersachsen die K o o p e r a t i o n zwischen d e r U n i v e r s i t ä t O l d e n b u r g u n d dem D G B w o h l die heftigsten Kontroversen auf politischer Siehe auch die K r i t i k an § 4 U G B a W ü v o n Reisacher / Baeckmann, Krisenpunkte einer E n t w i c k l u n g — die Kooperation von Universität u n d DGB Konstanz, in: Hochschule u n d Gewerkschaften, S. 234; Flämig, Forschungsauftrag der Hochschule, in: Handbuch des Wissenschaftsrechts, S. 898, sieht i n dieser Bestimmung einen „Ausfluß des Defensivcharakters der Forschungsfreiheit" . 126 Eine andere Frage ist, welche K r i t e r i e n das K u l t u s m i n i s t e r i u m bei seiner Entscheidung über die v o n einer Hochschule begehrte Zustimmung zum Abschluß eines Vertrages m i t einer gesellschaftlichen Gruppe anzuwenden hat. Das U G B a W ü t r i f f t i n § 123 Abs. 1 folgende Aussage: „ I s t i n den Bestimmungen dieses Gesetzes eine Zustimmung vorgesehen, so k a n n diese aus Rechts- oder Sachgründen versagt werden. Die Zustimmung k a n n teilweise u n d m i t Auflagen erteilt werden." Wortlaut u n d Entstehungsgeschichte (vgl. Landtagsdrucks. 7/2041, S. 149 u n d Landtagsdrucks. 7/2222, S. 137) machen klar, daß die Landesregierung davon ausgeht, eine Zustimmung auch aus Zweckmäßigkeitsgründen („Sachgründen") versagen zu können. Dies ist aber wegen A r t . 5 Abs. 3 G G bzw. der Garantie der Selbstverwaltung der Hochschulen i n A r t . 20 der Landesverfassung zweifelhaft. Die Selbstverw a l t u n g ist zwar n u r i m Rahmen der Gesetze gewährt; nach einhelliger Auffassung ist aber i m Bereich der akademischen Angelegenheiten der Gesetzgeber nicht frei i n der Schaffung von Einwirkungsmöglichkeiten auf die Hochschulen (vgl. Spreng / Birn / Feuchte, Die Verfassung des Landes BadenWürttemberg, Rdnr. 3 zu A r t . 20; vonMangoldt, Universität u n d Staat, S.36; sowie ausführlich Bullinger, Der Vorbehalt staatlicher Genehmigung von Universitätssatzungen i n Baden-Württemberg, Gutachten, maschinenschriftlich, 1971, S. 26 ff., besonders S. 37 ff.). Folgt m a n der hier vertretenen A u f fassung, daß sich Kooperationsverträge — wie auch der i n Konstanz geplante Abschluß — auf die Aufgabe Wissenschaftspflege beziehen, so erscheint es verfassungsrechtlich unzulässig, w e n n das U G hier dem K u l t u s m i n i s t e r i u m die Möglichkeit einräumt, aus Zweckmäßigkeitsgründen eine Zustimmung zu versagen (vgl. auch vonMangoldt, S. 34); aus verfassungsrechtlichen Gründen k a n n der Abschluß eines Kooperationsvertrages, soweit er sich auf akademische Angelegenheiten bezieht, n u r aus Rechtsgründen versagt werden. Hauck, Rechtsgutachten, S. 6, h ä l t den Genehmigungsvorbehalt i n § 123 Abs. 1 S. 1 U G B a W ü für „sehr extensiv", äußert aber keine verfassungsrechtlichen Bedenken. 6*
84
2. Teil: Kooperationsverträge und die Aufgaben der Hochschulen
Ebene 1 2 7 ausgelöst hatte, stand zu erwarten, daß die Kooperationsproblematik bei der Verabschiedung eines Niedersächsischen Hochschulgesetzes eine Rolle spielen würde. Vergleicht man das N H G 1 2 € mit dem HRG, so finden sich i n den Aussagen über die Aufgaben der Hochschulen nur geringe Abweichungen. § 2 NHG entspricht weitgehend dem § 2 HRG. § 2 Abs. 6 NHG ist i n Satz 1 inhaltsgleich mit § 2 Abs. 6 HRG. Der Niedersächsische Gesetzgeber fügte aber der Bestimmung, die den Hochschulen aufgibt, untereinander und mit anderen staatlichen und staatlich-geförderten Forschungs- und Bildungseinrichtungen zusammenzuarbeiten, einen Satz 2 mit folgendem Wortlaut an: „Das Nähere regeln die Beteiligten durch Vereinbarung." Dieser Zusatz war i m ursprünglichen Gesetzesentwurf nicht enthalten 1 2 9 und geht auf die Beschlüsse des Kulturausschusses zurück 1 3 0 . Der Wortlaut dieses Zusatzes erscheint i m Hinblick auf die Frage der Kooperationsproblematik unergiebig. Da i n § 2 Abs. 6 NHG nur die Zusammenarbeit der Hochschulen mit Wissenschaftseinrichtungen angesprochen ist, ergibt sich aus dem Zusammenhang von Satz 1 und Satz 2, daß dieser Zusatz kaum als Ermächtigung an die Hochschulen verstanden werden kann, mit nicht-wissenschaftlichen Einrichtungen Vereinbarungen abzuschließen. Die Entstehungsgeschichte dieser Vorschrift macht jedoch deutlich, daß hier die Kooperation der Universität i n Oldenburg eine Rolle spielte. Die Initiative zur Einfügung des Satz 2 ging auf einen Antrag der SPD zurück und wurde u. a. damit begründet, es solle nicht jedesmal, wenn die Hochschule eine Kooperation beschließe, Konflikte geben 131 . I m Zusammenhang mit diesem Änderungsantrag wurde dann i m Ausschuß allgemein die Kooperationsvereinbarung der Universität Oldenburg erörtert und die Frage diskutiert, ob die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen außerhalb der Hochschule überhaupt dem gesetzlichen Auftrag der Hochschulen entspreche 132 . Erörtert wurde die Frage, ob Vereinbarungen der Hochschulen mit nicht-staatlichen Einrichtungen generell einem Genehmigungsvorbehalt zu unterwerfen seien; dies wurde vom Ausschuß nicht für erforderlich gehalten. Gleichfalls auf eine Anregung des Kulturausschus127 Vgl. die Diskussion i m Niedersächsischen Landtag, am 4. A p r i l 1975, Niedersächsischer Landtag, 8. Wahlperiode, 16. u n d 17. Plenarsitzung u n d die A n t w o r t der Bundesregierung auf die kleine Anfrage verschiedener CDUAbgeordneter, Deutscher Bundestag, 7. Wahlperiode, Drucks. 7/3422. 128 GVB1 78, S. 473. i 2 « Niedersächsischer Landtag, 8. Wahlperiode, Drucks. 8/2151. 130 Niedersächsischer Landtag, 8. Wahlperiode, Drucks. 8/3660. 131 Niederschrift über die 95. Sitzung des Kulturausschusses des Niedersächsischen Landtags v o m 22. Oktober 1977; nicht veröffentlicht; das Protok o l l dieser Sitzung wurde dem Verfasser von einem M i t g l i e d des Ausschusses freundlicherweise zur Verfügung gestellt. 132 Ebenda.
I I I . Aufgaben der Hochschulen
85
ses i n der Sitzung vom 20. Oktober 1977 geht auch eine Anfrage zurück, die der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst am 31. Oktober 1977 an die Hochschulen des Landes richtete, i n der er Angaben über die Zusammenarbeit mit staatlichen oder staatlich-geförderten Forschungs- und Bildungseinrichtungen, Gewerkschaften, Verbänden und sonstigen Institutionen, geschlossene Vereinbarungen oder Verträge (ζ. B. Kooperationsverträge) erbat 1 3 3 . Das Ergebnis dieser Umfrage war jedoch relativ unergiebig. Von den abgeschlossenen Vereinbarungen konnte keine mit dem Oldenburger Kooperationsvertrag verglichen werden. Auch wenn Wortlaut und systematischer Zusammenhang des § 2 Abs. 6 Satz 2 NHG es nicht gestatten, die hier gegebene Ermächtigung „das Nähere" durch Vereinbarung zu regeln, auf gesellschaftliche Gruppierungen, die nicht primär der Wissenschaftspflege dienen, zu beziehen, so liefert die Entstehungsgeschichte dieser Vorschrift doch den Nachweis, daß der niedersächsische Hochschulgesetzgeber das Problem der Kooperation der Hochschulen mit außeruniversitären, nicht-staatlichen Organisationen gesehen hatte, und eine solche grundsätzlich für zulässig hielt. Der Kulturausschuß des Niedersächsischen Landtages hatte die Frage der Vereinbarkeit solcher Verträge mit der Aufgabenbestimmung der Hochschulen ausdrücklich erörtert und ging — trotz rechtlich nicht näher präzisierter Bedenken 1 3 4 — von der grundsätzlichen Zulässigkeit einer solchen Zusammenarbeit aus. Soweit ersichtlich, wurde als rechtliche Grundlage für eine solche Zusammenarbeit allein § 2 Abs. 6 des Entwurfs des NHG herangezogen. Eine Erörterung, ob die Primäraufgaben der Hochschulen, Pflege und Entwicklung der Wissenschaften, bereits ausreichen, u m die von der Universität Oldenburg betriebene Kooperation zu decken, fand — soweit ersichtlich — nicht statt. Dennoch dürfte es zulässig sein, die subjektive Vorstellung des Gesetzgebers über die Zulässigkeit der Kooperation der Universität Oldenburg, wie sie i n der Sitzung des Kulturausschusses mehrheitlich zum Ausdruck kam, als ein Indiz heranzuziehen, daß eine Gesellschaftsoffenheit der Hochschulen auch vom Gesetzgeber des NHG angestrebt wurde. Die Entstehungsgeschichte des § 2 NHG kann als Beleg für die hier vertretene Auslegung der Primäraufgaben aus § 2 Abs. 1 NHG herangezogen werden, daß davon auch die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen gedeckt wird. iss Brief des niedersächsischen Ministers für Wissenschaft u n d Kunst v o m 31. Oktober 1977; v o n der Universität Oldenburg dem Verfasser freundlicherweise zur Verfügung gestellt. 134 Bedenken w u r d e n i n der Sitzung des Kulturausschusses v o m 20. Oktober vor allem v o m Abgeordneten Dr. Niewerth geäußert.
86
2. Teil: Kooperationsverträge u n d die Aufgaben der Hochschulen
f) Unterschiede zwischen HRG und den Landeshochschulgesetzen hei der Aufgabenzuweisung Der Überblick über die Landeshochschulgesetze hat gezeigt, daß alle Landesgesetze weitgehend mit § 2 HRG übereinstimmen. Zusätzliche Aufgaben sind i n keinem Landesgesetz ausdrücklich genannt. Nur i m Bremer HG findet sich eine Vorschrift, die klar und zweifelsfrei als Ermächtigung zur Zusammenarbeit der Universität Bremen mit ihrem Partner Arbeiterkammer angesehen werden kann. I n keinem Landeshochschulgesetz finden sich Zusätze bzw. Ergänzungen, die eine restriktive Interpretation der Hauptaufgabe Pflege und Entwicklung der Wissenschaften i m Sinne einer Unzulässigkeit der Kooperation mit gesellschaftlichen Gruppen nahelegen könnten. Vielmehr stützen die hier erörterten Ergänzungen die i m vorherigen Abschnitt vorgenommene Interpretation der Aufgabe Wissenschaftspflege i n dem Sinne, daß davon grundsätzlich auch Vereinbarungen mit nicht-staatlichen, gesellschaftlichen Verbänden gedeckt werden. Für Baden-Württemberg ergibt sich dies aus der Zustimmungsbedürftigkeit derartiger Verträge. I n Niedersachsen ist vor allem die Entstehungsgeschichte des NHG als Indiz heranzuziehen. I n Bremen, Hamburg und Hessen ist die zusätzlich i m Gesetz enthaltene Betonung der gesellschaftlichen Verantwortlichkeit der Hochschulen bzw. der einzelnen Wissenschaftler zumindest ein Hinweis, daß von den zuständigen Gesetzgebern eine verstärkte Hinwendung von Forschung und Lehre zu Problemen der Gesellschaft beabsichtigt war. Der Überblick über die rechtliche Normierung i n den Landeshochschulgesetzen zur Aufgabenbestimmung der Hochschulen bzw. zur Freiheit ihrer Mitglieder hat damit durchgängig die bereits oben auf die Interpretation des § 2 Abs. 1 HRG gestützte Auffassung bestätigt, daß Verträge mit gesellschaftlichen Gruppen auch von der Aufgabenzuweisung an die Hochschulen umfaßt sind, soweit aus dem Inhalt der Verträge folgt, daß die Hochschulen die Vereinbarung zur Förderung ihrer Aufgabe Wissenschaftspflege abgeschlossen haben.
I V . Z u r Vereinbarkeit von Abweichungen i n Landesgesetzen gegenüber dem H R G
Klärungsbedürftig ist noch die Frage, inwieweit die Abweichungen i n den Landesgesetzen von der Rahmenbestimmung i m HRG rechtlich zulässig sind. Auch wenn das HRG als Rahmengesetz grundsätzlich noch ausfüllungsfähig und -bedürftig sein muß 1 3 5 , so folgt doch aus
I V . Vereinbarkeit der Landesgesetze m i t dem H R G
87
der Verbindlichkeit des Rahmens, daß die landesrechtlichen Ausfüllungsgesetze sich nicht i n Widerspruch zum HRG setzen dürfen 1 3 6 . Nun stellt bereits § 2 Abs. 8 HRG klar, daß dem Landesgesetzgeber noch ein Spielraum i m Bereich der Aufgabenfestlegung für die Hochschule verbleibt. Da die in Bremen erfolgte ausdrückliche Absicherung der Kooperation ein Handeln der Hochschule deckt, das i n Zusammenhang mit den Aufgaben aus § 2 Abs. 1 HRG steht, bestehen insoweit keine Bedenken. Problematisch könnte aber sein, ob die i n Bremen, Hamburg und Hessen normierte „gesellschaftliche Verantwortung" i m Widerspruch zur Entscheidung des HRG steht. Es ließe sich darauf verweisen, daß der Rahmengesetzgeber — nach kontroverser Diskussion — gerade die Einführung einer derartigen Verpflichtung der Hochschulen bzw. der einzelnen Wissenschaftler abgelehnt hat 1 3 7 . Diese Ergänzungen könnten daher i m Widerspruch zur Entscheidung des HRG stehen. Dagegen spricht aber folgende Überlegung: Die Gesetze von Hamburg, Bremen und Hessen versuchen, die Freiheit der Hochschulmitglieder unter Bezugnahme auf die gesellschaftliche Verantwortung zu bestimmen. Angesichts der verfassungsrechtlichen Vorgabe des Art. 5 Abs. 3 GG ist es dem einfachen Gesetzgeber i m Bund und i n den Ländern nicht gestattet, eine abschließende Fixierung dieser Freiheitsgarantien zu unternehmen 1 3 8 . Sieht man die i n Bremen, Hamburg und Hessen vorgenommenen Ergänzungen als Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit an, so sind diese verfassungsrechtlich nur haltbar, wenn man sie als deklaratorische Vollziehung verfassungsimmanenter Schranken versteht 1 3 9 . Da es nicht der Absicht des HRG-Gesetzgebers entsprach, die verfassungsrechtlichen Freiheitsrechte des A r t . 5 Abs. 3 GG abschließend zu normieren 1 4 0 , er keine verbindliche Aussage über den Grad der Gesellschaftsoffenheit der an den Hochschulen betriebenen Wissenschaft treffen wollte, dürfte kein Widerspruch der landesgesetzlichen Ergänzungen zum HRG anzunehmen sein.
135 Maunz, in: Maunz / D ü r i g / Herzog / Scholz, Rdnr. 14 zu A r t . 75 GG m i t weiteren Nachweisen; Bode, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 7 ff., § 72. «*e Walter, in: Grosskreutz u. a., HRG, Rdnr. 5 zu § 72. Siehe dazu auch Avenarius, Hochschulen u n d Reformgesetzgebung, S. 30. ι» 8 Hailbronner, in: Grosskreutz u. a., HRG, Rdnr. 1 ff. zu § 3; Avenarius, S. 30. « · Vgl. BVerfGE 47, 327 (379 ff.); siehe auch Dreier, DVB1 80, 471. 140 Avenarius, S. 30, Reich, HRG, Rdnr. 1 zu § 3.
Dritter
Teil
Zur Kompetenz von Kollegialorganen Wesentliches, typbestimmendes Merkmal der hier untersuchten Verträge ist die Tatsache, daß i n ihnen die gesamte Hochschule Bindungen i n bezug auf ihre Aufgabenstellung eingeht. Derartige Verträge können nur von zentralen Kollegialorganen abgeschlossen werden. I m folgenden Abschnitt soll nun untersucht werden, inwieweit die hochschulrechtlichen Kompetenzvorschriften ein solches Handeln von Zentralorganen gestatten und welche Schranken hier Individualrechtspositionen bzw. vorrangige Zuständigkeiten von Fachbereichen setzen. Da die verfassungsrechtliche Grundentscheidung des A r t . 5 Abs. 3 GG für diese Aufgabenverteilung von Bedeutung ist — zum einen setzt sie dem Gesetzgeber Schranken, zum anderen ist sie bei der Auslegung von hochschulrechtlichen Kompetenznormen zu beachten — soll hier zunächst der verfassungsrechtliche Rahmen für die Kompetenzzuweisung innerhalb der Hochschulen geprüft werden.
I . Verfassungsrechtliche Determinanten der hochschulinternen Kompetenzregelungen 1. Kompetenzen von Kollegialorganen und individuelle Freiheitsrechte
Die i n Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG garantierten Freiheitsrechte von Forschung und Lehre sind — ungeachtet des Streits, ob A r t . 5 Abs. 3 darüber hinaus eine objektive Wertentscheidung oder ein „Grundrecht der deutschen Universität" enthält — primär individuelle Abwehrrechte, die dem einzelnen Grundrechtsträger Schutz vor Ingerenz öffentlicher Gewalt gewähren sollen 1 . Dieser Vorrang der individuellen Freiheit — den das Bundesverfassungsgericht i m Hochschulurteil betont hat — dürfte i m Grundsatz heute weitgehend Anerkennung finden. Ein von Außenlenkung freier Raum des einzelnen Grundrechtsträgers ist die einfachste Form der Freiheitsgewährung 2 . Das traditionelle deutsche ι BVerfGE 35, 79 (112 f.). Bauer, Wissenschaftsfreiheit, S. 105; besonders dezidiert i n diesem Sinne vonLübtow, Autonomie oder Heteronomie, S.26; vgl. auch Schulz-Prießnitz, 2
I. Verfassungsrechtliche Determinanten der Kompetenzregelungen
89
Hochschulrecht sicherte diesen Freiraum durch die weitreichende Autonomie des einzelnen Lehrstuhlinhabers 3 . Dieser individuelle Freiraum fand seine Grenze i m unbestreitbaren Koordinierungsbedürfnis des Zusammenwirkens verschiedener Grundrechtsträger. Die Notwendigkeit der Koordinierung und Organisation des Wissenschaftsbetriebs wurde auch von der älteren Literatur — trotz der starken Betonung der individuellen Rechtsposition — anerkannt 4 . I m Spannungsfeld konkurrierender Rechte und Interessen, kann sich, so betont das Bundesverfassungsgericht, die Freiheit des einzelnen naturgemäß nicht schlechthin durchsetzen 5 . Das klassische Lösungsmodell der alten Universität war das Prinzip der „kollektiven Autonomie". Da schrankenlose, individuelle Autonomie ebenso ausschied wie eine externe staatliche Koordinierung und Organisation des Wissenschaftsbetriebes, war die akademische Selbstverwaltung Sache des Zusammenwirkens der einzelnen Hochschullehrer 6 . Dabei wurde bereits von der älteren Literatur betont, daß das individuelle Freiheitsrecht, die höchstpersönliche Natur der eigentlichen wissenschaftlichen Tätigkeit, den Entscheidungsbefugnissen der Kollegialorgane Grenzen setze7. Auch Kollegialorgane üben öffentliche Gewalt aus, ihr Handeln kann also den individuellen Schutzbereich des A r t . 5 Abs. 3 GG berühren 8 . Mochte das Problem des Schutzes vor Herrschaftsausübung durch Kollegialorgane i m traditionellen Universitätsbetrieb selten praktische Relevanz gewinnen, so änderte sich dies entscheidend durch die Einführung des Modells der Gruppenuniversität und durch das Auftreten zahlreicher inneruniversitärer Konflikte i m Gefolge der StudentenunEinheit von Forschung u n d Lehre, S. 88 ff.; kritisch zum Vorrang individueller Gewährleistung, Frerichs / Lieb, Entwicklungsphasen u n d Erfahrungen i n der Kooperation zwischen Arbeitnehmern und Wissenschaftlern i n der Hochschulforschung, in: Katterle / K r ahn (Hrsg.), Wissenschaft u n d Arbeitnehmerinteressen, S.210. 3 Reinhardt, Der Lehrstuhl u n d seine Bedeutung i n der Organisation der Selbstverwaltung der wissenschaftlichen Hochschule, in: Festschrift für Felgenträger, S. 186 ff.; Kiichenhoff / Lüthje, Sicherung u n d Ausbau der Wissenschaftsfreiheit, Wissenschaftsrecht, Band 2 (1969), S. 233. 4 Reinhardt, S. 187; ausführlich dazu Evers, Weisungsrechte i m Hochschulbereich, in: Festgabe für Hans Gerber, S. 43 ff. ß BVerfGE 35, 79 (122). « Röttgen, Universitätsrecht, S. 54; Evers, S.46 f.; Bauer, S. 107. 7 Thieme, Hochschulrecht, S. 82; dezidiert i n diesem Sinne auch von Lübtow, Autonomie, S. 27: „Das Prinzip der persönlichen Autonomie des einzelnen Hochschullehrers darf auch durch Mehrheitsbeschlüsse akademischer Organe, insbesondere der Fakultätsvertretungen, keine Einbußen erleiden." s Weber, Neue Aspekte der Freiheit von Forschung u n d Lehre, i n : Festschrift für Felgenträger, S. 257; Hailbronner, in: Grosskreutz u. a., HRG, Rdnr. 18 zu § 3; näher hierzu vgl. unten 5. Teil, I.
90
3. Teil: Zur Kompetenz von Kollegialorganen
ruhen. Die veränderten Rahmenbedingungen w i r k t e n ersichtlich auch auf die Interpretation des A r t . 5 Abs. 3 GG ein. Nachdem bis i n die 60er Jahre hinein die institutionelle Komponente betont worden war, die Verteidigung der Unabhängigkeit der Hochschulen gegenüber staatlichem Handeln i m Vordergrund stand, war die Diskussion auf der Staatsrechtslehrer-Tagung von 1968 gekennzeichnet von einer Tendenz zur „Repersonalisierung der Wissenschaftsfreiheit" 9 . Rupp unterstrich i n seinem Referat, auch die genossenschaftliche Korporation sei nicht herrschaftslos 10 . Offenkundig rief die teilweise realisierte, teilweise angestrebte Mitbestimmung von Nicht-Ordinarien als Reaktion Bemühungen hervor, den A r t . 5 Abs. 3 GG i m Sinne der Abwehr einer Fremdbestimmung durch Gremien mit Nicht-Ordinarien zu interpretieren 1 1 . Die Gegenposition i m Streit um die Auslegung des A r t . 5 Abs. 3 GG betonte den arbeitsteiligen, kooperativen Charakter moderner Forschung 12 , dem als wissenschaftsgerechte Prinzipien Chancengleichheit, Teilhabe und Mobilität entsprächen 13 . Die Diskussion wurde durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Niedersächsischen Vorschaltgesetz beendet 14 , i n der das Bundesverfassungsgericht zum einen die Verfassungsmäßigkeit der Gruppenuniversität grundsätzlich bejahte und zum anderen den Entscheidungsbefugnissen der Nicht-Ordinarien Grenzen setzte. Der Spruch des Gerichts vermochte nicht nur i n der juristischen Diskussion, sondern auch i m Alltag der hochschulrechtlichen Kontroversen, i n erstaunlichem Umfang die Weiterentwicklung zu bestimmen. Das Urteil enthält wichtige Hinweise für die Abgrenzung der Kompetenzen der Kollegialorgane gegenüber individuellen Freiheitspositionen. Das Bundesverfassungsgericht betont, daß es i m Bereich von Forschung und Lehre einen Kernbereich gibt, der stets unantastbar ist 1 5 . „ I n diesen Freiheitsraum fallen vor allem die auf wissenschaftlicher Eigengesetzlichkeit beruhenden Prozesse, Verhaltensweisen und Entscheidungen 9 Ipsen, Diskussionsbeitrag, in: V V D S t R L 2 7 , 199; Weber, Diskussionsbeitrag, ebenda, S. 193 ff.; kritisch zur E n t w i c k l u n g der Diskussion u m A r t . 5 Abs. 3 GG; Pieroth, Störung, Streik u n d Aussperrung an der Hochschule, S. 84 ff. m Rupp, V V D S t R L 27, S. 144, Leitsatz 4. 11 Vgl. z.B. Weber, Neue Aspekte, S. 238 ff.; u n d vonLübtow, Autonomie, S. 65 f. 12 Nitsch / Gerhardt / Offe / Preuß, S. 206; Hauch I Lüthje, Wissenschaftsfreiheit durch Mitbestimmung, S. 17 f. 13 Hauch / Lüthje, S. 19. 14 BVerfGE 35, 79 ff.; grundsätzlich zustimmend Menger, Verwaltungsarchiv 1974, S. 75 ff.; Oppermann, JZ 73, 433; kritisch Schlinh, DÖV 73, S. 541 u n d Seifert, Kritische Justiz 1973, S. 293 ff. is BVerfGE 35, 79 (122).
I. Verfassungsrechtliche Determinanten der Kompetenzregelungen
91
bei dem Auffinden von Erkenntnissen, ihre Deutung und Weitergabe" 16 . I m Hinblick auf die Forschung präzisiert das Bundesverfassungsgericht, daß die Fragestellung, die Grundsätze der Methodik, sowie die Bewertung des Forschungsergebnisses und seine Verbreitung geschützt seien 17 . Die Freiheit der Lehre umfaßt deren Inhalt, den methodischen Ansatz und das Recht auf Äußerung von wissenschaftlichen Lehrmeinungen 1 8 . I n der Entscheidung zum Hamburger Universitätsgesetz 19 hat das Bundesverfassungsgericht unter Bezugnahme auf die Ausführungen i m Hochschulurteil näher dargelegt, daß eine Koordination von Forschungsvorhaben durch den Fachbereich nicht i n den dem einzelnen Wissenschaftler vorbehaltenen Kernbereich, der vor jeder Ingerenz öffentlicher Gewalt frei zu halten sei, vordringen dürfe. Darüber hinaus betont das Gericht, daß auch außerhalb dieses Kernbereichs die individuelle Eigeninitiative des Hochschullehrers Vorrang habe vor der korporativen Initiative der Kollegialorgane 20 . Damit sind verfassungsrechtliche Maßstäbe vorgegeben, die bei der Auslegung und Anwendung der Vorschriften des HRG bzw. der Landeshochschulgesetze über die Reichweite der Kompetenz von Kollegialorganen zu beachten sind 2 1 . Die i m Zusammenhang dieser Arbeit interessierenden Präzisierungen werden unten bei der Prüfung der HRGVorschriften 22 über die Reichweite von Beschlüssen der Kollegialorgane vorgenommen. 2. Kompetenzen von Zentralorganen und Fachbereichsorganen
Verfassungsrechtliche Vorgaben bestimmen nicht nur das Verhältnis der Kollegialorgane gegenüber dem einzelnen Grundrechtsträger, sie begrenzen auch die Gestaltungsbefugnis des Gesetzgebers i m Hinblick auf die Kompetenzverteilung zwischen den einzelnen Hochschulorganen, konkret zwischen Zentralorganen und den Selbstverwaltungsgremien auf Fachbereichs- bzw. Fakultätsebene. Das Bundesverfassungsgericht hat i m Hochschulurteil die grundsätzliche Bedeutung von Organisationsnormen für die Realisierung der freien wissenschaftlichen i« BVerfGE 35, 79 (112). 17 BVerfGE 35,79 (113). is BVerfGE 35,79 (113 f.). ι» BVerfGE 43,242 ff. so BVerfGE 43,242 (270 f.). 21 Ausführlich zu dieser Problematik Hailbronner, Funktionsgrundrecht, S. 265 ff. u n d S. 178 ff. 22 Die Überprüfung beschränkt sich auf die maßgeblichen Organisationsvorschriften i m HRG, die i n der hier interessierenden Frage den Landesgesetzgeber weitgehend festgelegt haben. Zu den landesrechtlichen Besonderheiten siehe Avenarius, Hochschule u n d Reformgesetzgebung, S. 78 ff.
92
3. Teil: Zur Kompetenz von Kollegialorganen
Betätigung der Hochschulangehörigen betont 2 3 . Das Bundesverfassungsgericht führte aus: „ I m Bereich des mit öffentlichen Mitteln eingerichteten und unterhaltenen Wissenschaftsbetriebes, d. h. i n einem Bereich der Leistungsverwaltung, hat der Staat durch geeignete organisatorische Maßnahmen dafür zu sorgen, daß das Grundrecht der freien wissenschaftlichen Betätigung soweit unangetastet bleibt, wie das unter Berücksichtigung der anderen legitimen Aufgaben der Wissenschaftseinrichtungen und der Grundrechte der verschiedenen Beteiligten möglich ist 2 4 ." Aus dieser Bedeutung der Organisationsnormen für die Entfaltung einer freien Wissenschaft an der Hochschule hat das Bundesverfassungsgericht die Konsequenz gezogen, daß den Hochschullehrern i n Fragen der Lehre ein „maßgeblicher", i n Fragen der Forschung ein „ausschlaggebender" Einfluß einzuräumen ist 2 5 . Den Hochschullehrern kommt eine Schlüsselfunktion für das wissenschaftliche Leben an der Hochschule zu 26. Diese Funktion w i r d auf ihre besondere Qualifikation sowie auf ihre stärkere Betroffenheit i m Verhältnis zu anderen Hochschulangehörigen gestützt 27 . Dieser Gedanke beansprucht nun aber nicht nur i m Verhältnis der Abgrenzung der Befugnisse der Hochschullehrer zu anderen Gruppen Geltung. Er hat auch Bedeutung für die Zuständigkeitsverteilung auf die verschiedenen Hochschulorgane 2*. Angesichts der Differenziertheit des universitären Wissenschaftsbetriebs ist die Kompetenz und die Betroffenheit eines Hochschullehrers i n bezug auf fachbereichsfremde Entscheidungen gering zu veranschlagen. Aus der objektiven Bedeutung des Art. 5 Abs. 3 GG, die einen Vorrang der besonders qualifizierten und betroffenen Hochschulangehörigen bei der Entscheidungsfällung gebietet, ergibt sich auch eine Einschränkung der Einwirkung von fremdwissenschaftlicher Seite 29 . „Die Entscheidung wissenschaftsrelevanter Angelegenheiten muß daher grundsätzlich den Angehörigen desselben Fachgebiets oder wenigstens benachbarter Fachgebiete — d. h. den Mitgliedern des jeweiligen Fachbereichs — vorbehalten bleiben, es sei denn, daß es sich gerade u m Fragen handelt, die gemeinsam für alle oder mehrere Fachbereiche zu regeln sind 3 0 ." Daher ist der ver23 BVerfGE 35, 79 (115); vgl. auch Starck, Organisation u n d Finanzierung als H i l f e n zu Grundrechts Verwirklichungen?, in: Bundesverfassungsgericht u n d GG, Band 2, S. 499 ff. u n d Hesse, EuGRZ 1978, S. 427 (434 f.). 24 BVerfGE 35, 79 (115). 25 BVerfGE 35, 79, 80, Leitsatz 8. 2« BVerfGE 35, 79 (127). 27 Ebenda. 28 Ebenso Bauer, S. 109 ff. 20 Maurer, Zur Rechtsstellung der Fachbereiche, Wissenschaftsrecht, Band 10 (1977), S. 215; vgl, auch Thieme, Organisationsstrukturen der Hochschule, in: Handbuch des Wissenschaftsrechts, Band 1, S. 181.
I. Verfassungsrechtliche Determinanten der Kompetenzregelungen
93
fassungsrechtliche Vorrang der Kompetenz der sachnäheren Kollegialorgane gegenüber den Zentralorganen zu beachten. Ein weiterer Gesichtspunkt begründet die Beschränkung der Kompetenz der Zentralorgane. Das Bundesverfassungsgericht hat i m Hochschulurteil die Einführung des Repräsentativprinzips auch für die Hochschullehrer für zulässig erklärt 3 1 . Die Funktionsfähigkeit von Beschlußorganen der Wissenschaftsverwaltung m i t zu vielen Mitgliedern sei beeinträchtigt. Das Bundesverfassungsgericht betont aber, daß „der einzelne Hochschullehrer bei der Beratung über wesentliche Fragen seines Fachgebiets in geeigneter Form zu Gehör kommen müsse" 32 . Die Delegation von wissenschaftsrelevanten Entscheidungsbefugnissen auf Kollegialorgane ist für den davon betroffenen Hochschullehrer Fremdbestimmung. Diese Fremdbestimmung muß der einzelne hinnehmen als notwendige Konsequenz des Zusammentreffens verschiedener Grundrechtsträger. Je höher jedoch die Entscheidungsebene ist, desto geringer sind die Einwirkungsmöglichkeiten des einzelnen Grundrechtsträgers 33 . Die Intensität der Fremdbestimmung (durch fachfremde Repräsentanten) nimmt zu. Dies steht aber i n Widerspruch zu der aus A r t . 5 Abs. 3 GG abgeleiteten Forderung, daß Organisationsnormen die Geltungskraft des individuellen Freiheitsrechts gerade verstärken sollen. Aus diesen verfassungsrechtlichen Vorgaben ergibt sich eine Einschränkung der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers hinsichtlich der inneruniversitären Kompetenzverteilung. Außerdem ist die Entscheidung des A r t . 5 Abs. 3 GG auch bei der Auslegung der Kompetenzen von Zentralorganen i n Zweifelsfragen zu beachten. Die Entscheidung über die grundsätzliche Ausrichtung des Forschungs- und Lehrbetriebs ist daher Sache der jeweiligen Fachbereiche und darf nicht von Zentralorganen verbindlich vorgegeben werden.
30 Maurer, S. 215; ähnlich formuliert auch Bauer, S. 110: „Vorrang der E n t scheidungskompetenz der jeweils fachlich betroffenen Teilgliederungen der Hochschule gegenüber den relativ wissenschaftsferneren Gremien." θΐ BVerfGE 35, 79, 128; kritisch Fikentscher, N J W 73, 788. 32 BVerfGE 35, 79 (129). a» Bauer, S. 108.
94
3. Teil: Zur Kompetenz von Kollegialorganen I I . Die Kompetenzen von Kollegialorganen zur Regelung von Fragen der Forschung u n d Lehre i m H R G 1. Koordinierungskompetenz der Hochschulorgane über Forschungsfragen
a) Allgemeine Bestimmung zur individuellen
der Reichweite im Verhältnis Forschungsfreiheit
Das Verhältnis individueller Forschungsfreiheit zur Kompetenz von Entscheidungsbefugnissen von Kollegialorganen ist i m HRG i n §23 Abs. 1 und näher in § 3 Abs. 2 geregelt. Nach § 3 Abs. 2 Satz 2 HRG sind Beschlüsse der zuständigen Organe i n Forschungsfragen zulässig, wenn sie sich auf die „Organisation des Forschungsbetriebes, die Förderung und Abstimmung von Forschungsvorhaben und auf die Bildung von Forschungsschwerpunkten beziehen". § 23 Abs. 1 Satz 1 gibt „der Hochschule" den Auftrag, Forschungsvorhaben und Forschungsschwerpunkte i n der sachlichen gebotenen Weise zu koordinieren, bezieht sich also ebenso wie § 3 Abs. 2 Satz 2 HRG auf eine Koordination innerhalb der Hochschule. § 23 Abs. 1 Satz 2 sieht eine externe Koordination mit anderen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Einrichtungen der Forschungsplanung und -förderung vor. Das grundsätzliche Verhältnis zwischen individueller Forschungsfreiheit und der Kompetenz von Kollegialorganen präzisiert das HRG i n § 3 Abs. 2 dadurch, daß es i m Anschluß an die Nennung der Einwirkungsmöglichkeiten der Universitätsorgane betont, „sie (die Beschlüsse) dürfen die Freiheit i m Sinne von Satz 1 nicht beeinträchtigen". Der Gesetzgeber des HRG hat i n § 3 Abs. 2 die Kompetenzen der Kollegialorgane nur sehr allgemein beschrieben, mit Begriffen, die vom Wortlaut her unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten gestatten 34 . Die erste Alternative von Beschlußmöglichkeiten „Organisation des Forschungsbetriebes" erlaubt nach Ansicht Hailbronners „ein weites Spektrum rechtlicher Möglichkeiten, das begrifflich von der bindenden Zuweisung bestimmter Forschungsaufgaben über die Zuordnung bestimmter Forscher zu bestimmten Arbeitsgruppen bis zur organisatorischen Planung und Durchführung bestimmter Forschungsobjekte reicht" 5 5 . Alle Stellungnahmen zur Präzisierung dieser KompetenzHailbronner, Funktionsgrundrecht, S. 265; vgl. auch Thieme, Wissenschaftsfreiheit u n d Hochschulrahmengesetz, in: Festschrift für Hans Peter Ipsen, S. 197; Flämig, Forschungsauftrag der Hochschule, in: Handbuch des Wissenschaftsrechts, Band 2, S. 896; wegen der Weite der verwendeten Begriffe erscheint auch die Frage, ob § 3 Abs. 2 die Kompetenzen der Hochschulorgane abschließend nennt (so Reich, HRG, Rdnr. 4 zu § 3) oder n u r beispielhaft aufzählt (so Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 8 zu § 3) irrelevant. Hailbronner, Funktionsgrundrecht, S. 265.
I I . Die Kompetenz von Kollegialorganen i m H R G
95
norm 3 6 gehen aber von einer restriktiven Auslegung aus und beziehen die Befugnis der Kollegialorgane nur auf die äußere Organisation, auf Fragen der zeitlichen und räumlichen Nutzung von Hochschuleinrichtungen 3 7 . Thieme 38 w i l l in diesem Sinne den Schwerpunkt auf die Auslegung des Wortes „Betrieb" legen und die grundsätzlichen inhaltlichen Entscheidungen ausschließen. Eine vom Wortlaut dieser Bestimmung mögliche verbindliche Zuweisung von Forschungsgegenständen dürfte grundsätzlich außerhalb der Kompetenz der Hochschulorgane liegen. § 3 Abs. 1 Satz 1 HRG bekräftigt ausdrücklich — unter Rückgriff auf Formulierungen des Bundesverfassungsgerichts — das individuelle Recht, die Fragestellung frei zu wählen. Die Unantastbarkeit des individuellen Freiraums hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zum Hamburger Universitätsgesetz bekräftigt 3 9 . Auch i n der älteren Literatur vor Verabschiedung des HRG wurde eine verbindliche Zuweisung als mit A r t . 5 Abs. 3 GG unvereinbar abgelehnt 40 . Schon aus dem Gebot, den § 3 Abs. 2 HRG verfassungskonform zu interpretieren, folgt daher, daß einzelne Hochschullehrer nicht rechtlich verbindlich zur Übernahme von Forschungsgegenständen durch Kollegialorgane verpflichtet werden können. Eine andere Beurteilung dürfte nur dort geboten sein, wo bereits mit der Funktion des einzelnen Hochschullehrers, mit der näheren Ausgestaltung seines Dienstverhältnisses Pflichten bezüglich der Übernahme bestimmter Forschungsgegenstände verbunden sind 4 1 . Nach § 3 Abs. 2 HRG sind Beschlüsse der zuständigen Hochschulorgane weiter zulässig, zur Förderung und Abstimmung von Forschungsvorhaben sowie zur Setzung von Schwerpunkten. Diese Ermächtigung muß i n Bezug gesetzt werden zur Aufgabe der Hochschulen nach § 23 Abs. 1 Satz 1 HRG zur Koordinierung von Forschungsvorhaben und Schwerpunkten. Hier könnte die Möglichkeit von Eingriffen in individuelle Rechtspositionen durch den wenig präzisen Begriff der „Abstimmung" bzw. der „Koordination" bestehen. Thieme sieht die Gefahr einer „Steuerungsmöglichkeit i n die gewünschte gesellschaftliche Richtung" 4 2 . Bei verfassungskonformer Auslegung sind aber auch »« Thieme, Wissenschaftsfreiheit, S. 198; Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 9 zu § 3; vgl. auch Hailbronner, in: Grosskreutz u. a., HRG, Rdnr. 36 zu §3. 37 Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, § 3, Rdnr. 9; Hailbronner, in: Grosskreutz u. a. § 3, Rdnr. 36. 38 Wissenschaftsfreiheit, S. 198. 39 BVerfGE 43, 242 (270). 40 Evers, Weisungsrechte, in: Festgabe für Gerber, S. 50 f. 41 Hailbronner, in: Grosskreutz u. a., HRG, § 3 Rdnr. 36; ausführlich ders., Funktionsgrundrecht, S. 266 ff. 42 Thieme, Wissenschaftsfreiheit, S. 197.
96
3. Teil: Zur Kompetenz v o n Kollegialorganen
i m Rahmen solcher Beschlüsse Eingriffe i n den Kernbereich individueller Freiheitsentfaltung ausgeschlossen. Hält man die verbindliche Zuweisung bestimmter Forschungsgegenstände für unzulässig (siehe oben), ist damit eine wesentliche Eingriffsmöglichkeit zum Zweck der „Abstimmung" ausgeschlossen. Entsprechend muß dann aber auch das Urteil für eine denkbare Untersagung der Bearbeitung bestimmter Gegenstände i m Rahmen inhaltlicher Abgrenzungsentscheidungen ausfallen. Eingriffe setzen ein tatsächliches Abstimmungs- bzw. Koordinationsbedürfnis voraus. Nur die durch das Zusammentreffen verschiedener Grundrechtsträger hervorgerufene Erforderlichkeit, Koordinationsentscheidungen zu treffen, legitimiert die Einschränkung der individuellen Entfaltungsfreiheit. Dabei dürfte die Notwendigkeit zu Abgrenzungs- bzw. Koordinationsentscheidungen i m Bereich der Naturwissenschaften grundsätzlich eher auftreten als i m Bereich der Geisteswissenschaften, die unverändert vom Vorrang der individuellen Einzelarbeit bestimmt sind 4 3 . Unzweifelhaft muß aber dem einzelnen Hochschullehrer ein ausreichender Freiraum verbleiben, sich selbstgewählten Forschungsgegenständen seines Gebiets zuzuwenden 44 . Größere praktische Relevanz als die Frage nach den Grenzen von Eingriffen besitzt das Problem der Lenkung der Forschung durch Vergabe- bzw. Förderungsentscheidungen der Kollegialorgane. Angesichts der Abhängigkeit vieler Forschungsvorhaben von der Gewährung zusätzlicher Personal- oder Sachmittel — deren Bewilligung unter Umständen an Bedingungen geknüpft sein kann — besteht hier eine i n ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzende Einwirkungsmöglichkeit der Kollegialorgane. Es ist anerkannt, daß das HRG die zuständigen Hochschulorgane zu einer eigenen „Forschungsplanung" ermächtigt hat, die den Gremien wertende, prioritätsetzende Entscheidungen ermöglicht 4 5 . Hier kann ein indirekter Zwang auf den einzelnen Hochschullehrer ausgeübt werden, sich bei der Auswahl seiner Forschungsgegenstände thematisch an einer vorher gefällten Schwerpunktsetzung zu orientieren, u m seine Chance zu wahren, bei der Vergabe von Zusatzmitteln berücksichtigt zu werden. Die auf diese Weise eröffneten Einwirkungsmöglichkeiten verdeutlicht auch eine neuere Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts kann es gerechtfertigt sein: „aus organisatorischen Grün43 Vgl. dazu ausführlich Hailbronner, Funktionsgrundrecht, S. 271; dort w i r d bei naturwissenschaftlichen Forschungsvorhaben m i t starkem Planungsu n d Koordinationsbedürfnis eine bindende Weisung nicht grundsätzlich ausgeschlossen. 44 Hailbronner, in: Grosskreutz u. a., HRG, Rdnr. 36 zu § 3. 45 Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 8 zu § 3; vgl. auch Hailbronner, i n : Grosskreutz u. a., HRG, Rdnr. 37 zu § 3 u n d Scholz, in: Maunz / D ü r i g / Herzog / Scholz, Rdnr. 118 zu A r t . 5 Abs. 3.
I I . Die Kompetenz von Kollegialorganen i m H R G
97
den, aber auch angesichts des Umfangs einzelner Gebiete . . . bei der Mittelvergabe an die einzelnen Wissenschaftler innerhalb eines Fachs wie der Physik Forschungsmethoden zugrundezulegen 46 ." Neben der Verknüpfung der Mittelvergabe an die Befolgung bestimmter Forschungsmethoden kann auch eine Zusammenarbeit bzw. Abstimmung mit anderen Hochschullehrern eine Bedingung für die Mittelvergabe sein 47 . Die Position des einzelnen Wissenschaftlers ist auf einen Anspruch auf willkürfreie Entscheidung über die Vergabe zusätzlicher Mittel reduziert 4 8 , sowie auf einen Anspruch auf die Gewährung einer solchen Ausstattung, die ihn überhaupt erst i n die Lage versetzt, innerhalb seines Funktionsbereichs unabhängige Forschung und Lehre zu betreiben 49 . Jenseits dieser Grenzen gewährt das HRG aber den zuständigen Kollegialorganen bei Förderungs- und Vergabeentscheidungen ein weites Spektrum von Lenkungsmöglichkeiten 5 0 . b) Kooperationsverträge
und
Koordinierungskompetenzen
Der Abschluß von Kooperationsverträgen der hier untersuchten A r t bezieht sich auf die Ausrichtung der Forschungsaktivitäten der Hochschule und kann daher als ein Beschluß i n Forschungsfragen angesehen werden. § 23 Abs. 1 Satz 2 HRG, der die externe Forschungskoordination mit anderen Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen regelt, kommt nicht als Kompetenznorm i n Betracht, da i m Fall der Kooperationsverträge keine Zusammenarbeit mit einer gesellschaftlichen Institution stattfindet, die selbst eine Wissenschaftseinrichtung wäre. Das Handeln der Hochschule bzw. ihrer Organe w i r d aber gedeckt durch die Befugnis zur Förderung und Abstimmung von Forschungsvorhaben und Bildung von Forschungsschwerpunkten i m Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 2 HRG. Die Funktion der Kooperationsverträge und die Zielrichtung der Hochschulen bei ihrem Abschluß wurde oben (siehe 1. Teil) ausführlich dargestellt. Die Verträge sollen als „Rahmenvereinbarung" den Hochschulen neue Problemfelder erschließen bzw. den Praxisbezug ihrer Arbeit sichern. Die Schaffung eines institutionalisierten Kontaktrahmens i n Form der paritätischen Kooperationsorgane soll den dauer46 BVerwG, JZ 77, 716, 718; Zustimmung zu dieser Entscheidung bei Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 8 zu § 3. 4 7 Hailbronner, in: Grosskreutz u. a., HRG, Rdnr. 37 zu § 3. 48 BVerwGE, JZ 77, 718; vgl. auch Avenarius, S. 37. 4« BVerfGE 43, 242 (285); Scholz, in: Maunz / D ü r i g / Herzog / Scholz, Rdnr. 177 zu A r t . 5 Abs. 3 GG m. w . N. 50 Z u r Einschränkung dieses Spielraumes durch A r t . 5 Abs. 3 GG, siehe unten 5. Teil, I I und I I I .
7 Uechtritz
98
3. Teil: Z u r Kompetenz von Kollegialorganen
haften Kontakt unabhängig vom Wechsel von Einzelpersonen sichern und so das dauerhafte Herantragen von Arbeitnehmerproblemen an die Hochschule, konkret an einzelne Hochschulangehörige ermöglichen. Die Aufmerksamkeit bzw. das Interesse der einzelnen Grundrechtsträger für spezifisch arbeitnehmerrelevante Fragestellungen soll geweckt werden. Den Vorstellungen der kooperierenden Hochschulen entsprechend soll ein neuer Forschungsschwerpunkt geschaffen werden, und zwar i n einem Bereich, der nach vielfach geäußerter Auffassung bisher i n der Arbeit der Hochschulen nur schwach berücksichtigt worden w a r 5 1 . Die Schwerpunktbildung bzw. Förderung von Forschungsthemen i m Bereich „Lebensbedingungen der abhängig Beschäftigten" soll hier nicht auf die übliche Weise durch Erschließung neuer Finanzmittel (Drittmittel) erfolgen, sondern durch die Institutionalisierung eines dauerhaften Kontakts mit Vertretern der organisierten Arbeitnehmerschaft. Es dürften keine Bedenken bestehen, die Kollegialentscheidung, einen solchen institutionellen Kontakt zu den Gewerkschaften herzustellen, als einen i n § 3 Abs. 2 HRG genannten Beschluß anzusehen. Die Kollegialorgane handelten beim Abschluß der Verträge folglich innerhalb des Rahmens, der ihnen durch das HRG gesetzt ist. Problematisch könnte das Tätigwerden der zentralen Kollegialorgane aber unter dem Gesichtspunkt der Subsidiarität von korporativen Entscheidungen sein. Das Bundesverfassungsgericht hat unterstrichen, daß der individuellen Initiative grundsätzlich der Vorrang gebühre vor dem Handeln der Kollegialorgane 52 . Auch i n der Literatur ist der Primat der individuellen Initiative betont worden, und eine Berechtigung der Kollegialorgane zu einer umfassenden Steuerung der Forschung, bei der der einzelne nur noch als Ausführender erscheine, verneint worden 5 3 . Der Abschluß der hier untersuchten Kooperationsverträge erfolgte aber nicht zur Koordination von Einzelinitiativen, u m einem konkreten Abstimmungsbedürfnis zu entsprechen. Vielmehr ging es gerade u m eine Schwerpunktbildung zur Kompensation fehlender individueller Initiativen auf dem Sektor arbeitnehmerrelevanter Pro51 Vgl. die E r k l ä r u n g zum Abschluß des Bochumer Vertrages i n R U B - a k t u e l l v o m 10. J u l i 1975; siehe auch den Bericht über die Tagung der FriedrichEbert-Gesellschaft v o m 4. M a i 1976 „Hochschule i n der Arbeitnehmergesellschaft", hrsg. v o m Pressereferat des Bundesministeriums für B i l d u n g u n d Wissenschaft, abgedruckt in: A u f dem Weg zur Tendenzuniversität?, hrsg. v o m B u n d Freiheit der Wissenschaft. 52 BVerfGE 43, 242 (272); siehe oben 3. Teil, 11. 53 Hailbronner, i n : Grosskreutz u. a., HRG, Rdnr. 34, 37 zu § 3; ders., F u n k tionsgrundrecht, S. 276 f.; Reinhardt, in: Festschr. für Felgenträger, S. 187; Bedenken gegen weitreichende Kompetenzen der Kollegialorgane auch bei Thieme, Wissenschaftsfreiheit u n d Hochschulrahmengesetz, S. 197 f.; siehe auch noch die Begr. zum RegE des HRG, BT-Drucks. 7/1328, S. 33.
I I . Die Kompetenz von Kollegialorganen i m H R G
99
bleme. Die Regierungsbegründung zum Entwurf des HRG ging davon aus, daß solche korporativen Initiativen grundsätzlich zulässig sind 5 4 . Den Hochschulorganen sollte die Kompetenz auch zu eigener Prioritätsetzung eingeräumt werden 5 5 . Anerkennt man — jedenfalls grundsätzlich — die Zulässigkeit wissenschaftslenkender Entscheidungen durch staatliche, also wissenschaftsexterne Instanzen, weil der öffentliche Wissenschaftsbetrieb heute nicht mehr Raum für sich i n Eigengesetzlichkeit vollziehende Forschungs- und Bildungsprozesse, sondern auch Gegenstand und Mittel einer öffentlich kontrollierten Bildungs- und Forschungspolitik ist 5 6 , dann scheinen wissenschaftslenkende Maßnahmen durch universitäre Kollegialorgane nicht grundsätzlich bedenklich. Angesichts der Zusammensetzung dieser Organe spricht jedenfalls eine Vermutung für wissenschaftsgerechte Entscheidungen. Bemißt man den Spielraum universitärer Gremien zu eigener Schwerpunktbildung zu gering, reduziert man ihn auf eine „Notkompetenz", die erst beim Vorliegen konkreter Konflikte zwischen einzelnen Hochschulangehörigen eingreift, dann w i r d die notwendige Initiative zur Planung und Lenkung ausschließlich den wissenschaftsexternen, i n der Regel also staatlichen Instanzen überlassen. Damit wächst die Gefahr „wissenschaftsfremder" Entscheidungen. Eine derart restriktive Interpretation der Kompetenz der Kollegialorgane, die das HRG einräumt, kann nicht als durch A r t . 5 Abs. 3 GG geboten angesehen werden. Die Einwirkungsmöglichkeiten des einzelnen Hochschulangehörigen auf Schwerpunktsetzungen bzw. Förderungsentscheidungen, die von Kollegialorganen der Hochschule vorgenommen werden, sind größer als seine Einflußnahme auf mögliche staatliche Lenkungsentscheidungen. Akzeptiert man die Grundannahme des Bundesverfassungsgerichts aus dem Hochschulurteil, daß die Universitätsgremien bei Entscheidungen i n wissenschaftsrelevanten Angelegenheiten durch die überwiegende Besetzung mit Professoren eine Vermutung für sachgerechte, d.h. wissenschaftsgerechte Entscheidungen zu geben vermögen, dann entspricht es der Wertentscheidung des A r t . 5 Abs. 3 GG, auch eine korporative Initiative zur Schwerpunktsetzung zuzulassen. Dann bestehen aber auch keine Bedenken, daß die Entscheidung zum Abschluß der Verträge nicht aktuellen Koordinierungsbedürfnissen entsprach, sondern der freien Initiative der handelnden Kollegialorgane.
Begr. RegE für das HRG, BT-Drucks. 7/1328, S. 33. « Dallinger, in: Dallinger u.a., HRG, Rdnr. 8 zu §3; Scholz, in: M a u n z / D ü r i g / Herzog / Scholz, Rdnr. 118 zu A r t . 5 Abs. 3 GG. w BVerfGE 35, 79, 122; siehe auch Scholz, Rdnr. 118; vgl. auch Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, S. 165 (näher dazu unten, 5. Teil, II). 7«
100
3. Teil: Zur Kompetenz von Kollegialorganen
Folgt man der hier vorgenommenen Wertung, den Abschluß von Kooperationsverträgen als Förderungsmaßnalme bzw. Schwerpunktbildung einzustufen, bleibt noch zu klären, ob diese Maßnahmen nicht deswegen unzulässig sind, weil sie die individuelle Initiative i n zu starkem Maße beeinträchtigen. Das HRG selbst betont i n § 3 Abs. 2 Satz 3, daß die Beschlüsse der Kollegialorgane die Freiheit der Forschung nicht beeinträchtigen dürfen. Eine Schwerpunktsetzung, die zu einer Restriktion individueller Freiheitsräume führt, wäre demnach unzulässig. Nun ist aber die Steuerungs- bzw. Lenkungsintensität der Entscheidung für den Abschluß eines Kooperationsvertrages eher gering einzuschätzen. Zwar spricht die weite Fassung des Themas der Zusammenarbeit „Interessen der abhängig Beschäftigten" dafür, daß zahlreiche Fachbereiche der Hochschule davon betroffen sind, bzw. daß angestrebt wird, die Arbeit einer kaum abgrenzbaren Zahl von Hochschulmitgliedern zu beeinflussen, doch führt der Vertragsschluß selbst kaum zu einer Hemmung der Einzelinitiative bzw. zu einer Reduktion des Wahlrechts der einzelnen Hochschulangehörigen. Der Vertragsschluß kann nicht als Entscheidung für ein umfassendes Forschungsprogramm angesehen werden, das den einzelnen Hochschulangehörigen auf bloße Ausführungshandlungen zur Erfüllung des vorgegebenen Programms reduzieren würde. Die Realisierung des von der Hochschule mit dem Kooperationsvertrag angestrebten Zieles bleibt vielmehr der freien Initiative der einzelnen Hochschulangehörigen überlassen. Die Hochschulorgane selbst sind lediglich bemüht, durch Schaffung des institutionalisierten Kontakts das Interesse der Hochschulangehörigen für Themen der Zusammenarbeit zu gewinnen. Das Handeln der Hochschulorgane beim Abschluß der Verträge hält sich daher innerhalb des Rahmens, den § 3 Abs. 2 HRG setzt 57 . c) Kooperationsverträge und das Verhältnis der Entscheidungsbefugnis von zentralen Kollegialorganen zu Fachbereichsorganen Eingangs dieses Abschnitts wurden die verfassungsrechtlichen Vorgaben für Zuständigkeitsregelungen i m Verhältnis der Kompetenzen von Kollegialorganen auf zentraler Ebene zu den Organen auf Fachbereichsebene herausgearbeitet. Die verfassungsrechtlich gebotene Vorrangstellung der Gremien auf Fachbereichsebene sichert das HRG durch 57 Das Problem, ob der Abschluß der Kooperationsverträge nicht deshalb unzulässig ist, w e i l er wesentlich „gesellschaftspolitisch motiviert war, u n d eine derart motivierte Schwerpunktbildung durch Kollegialorgane unzulässig sein könnte, w i r d u n t e n (5. Teil, I I I 3) näher erörtert. Ebenso w i r d unten (5. Teil, I I I 5) noch weiter der Frage nachgegangen, ob der Vertragsschluß nicht i n unzulässiger Weise gesellschaftlichen Einflüssen auf die A r b e i t der Hochschule bzw. ihrer Angehörigen den Weg ebnet.
I I . Die Kompetenz von Kollegialorganen i m H R G
101
§ 64. I n § 64 Abs. 1 HRG w i r d die Stellung des Fachbereichs als die organisatorische Grundeinheit der Hochschule anerkannt. „Unbeschadet der Gesamtverantwortung der Hochschulen und der Zuständigkeiten der zentralen Hochschulorgane", erfüllt der Fachbereich für sein Gebiet die Aufgaben der Hochschule. Abs. 3 betont die Zuständigkeit des Fachbereichsrats (des Selbstverwaltungsorgans auf Fachbereichsebene) i n allen Forschung und Lehre betreffenden Angelegenheiten des Fachbereichs. Zuständiges Hochschulorgan i m Sinne des § 3 Abs. 2 HRG zur Fassung von Beschlüssen i n Forschungsangelegenheiten ist daher grundsätzlich der jeweilige Fachbereichsrat 58 . Durch den Vorbehalt i n § 64 Abs. 1 HRG, daß der Fachbereich seine Aufgaben nur unbeschadet der Gesamtverantwortung der Hochschule und der Zuständigkeit der zentralen Hochschulorgane erfüllt, w i r d aber klargestellt, daß auch Entscheidungen zentraler Organe betreffend die Aufgaben der Hochschule (Pflege und Entwicklung der Wissenschaften) möglich sind. § 63 HRG, der die Aufgaben zentraler Kollegialorgane regelt 5 9 , weist denn auch i n Abs. 5 Nr. 5 „Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung i n Fragen der Forschung" dem weiteren zentralen Kollegialorgan zu. Die Zuständigkeit des einzelnen Fachbereichs endet, wenn eine Materie nicht mehr einem Bereich zuzuordnen ist. Die erforderliche Koordination, die die Hochschule nach § 23 HRG zu leisten hat, muß durch Zentralorgane erfolgen. Soweit i n Forschungsfragen fachbereichsüberschreitende Entscheidungen zu fällen sind, ist daher die Zuständigkeit eines Zentralorgans gegeben 60 . Die i n den Verträgen angestrebte „ A r beitnehmerorientierung" der Forschung fügt sich nicht der traditionellen Abgrenzung zwischen den Einzeldisziplinen. Interdisziplinarität ist bestimmendes Merkmal einer solchen Forschungsorientierung 61 . Ein Entschluß zur Setzung eines solchen Forschungsschwerpunkts überschreitet die Grenzen einzelner Fachbereiche und kann nur auf zentraler Ebene gefällt werden. Die Entscheidung weist Parallelen auf, zum Beschluß einen Sonderforschungsbereich einzurichten. Auch dies ist eine Entscheidung, die von Zentralorganen zu fällen ist 6 2 . Erklärtes ss Reich, HRG, Rdnr. 3 zu § 64. 59 Die HRG-Regelungen i n § 63 über die Zentralorgane knüpfen an die traditionelle Existenz zweier Zentralorgane an. Die Terminologie zur Bezeichnung der beiden Zentralorgane der Hochschule w a r unterschiedlich; geläufig ist die Einteilung i n „Großer Senat" (das zentrale Kollegialorgan i m Sinne des § 63 Abs. 1) u n d „ K l e i n e r Senat" (weiteres zentrales Kollegialorgan i m Sinne des § 63 Abs. 2), vgl. hierzu Thieme, Wissenschaftsrecht, Band 9 (1976), S. 217. «o Reich, HRG, Rdnr. 3 zu § 64; vgl. auch Maurer, Wissenschaftsrecht, Band 10 (1977), S. 215. «ι Bosch I Katterle / Krahn, Z u r Konzeption arbeitnehmerorientierter W i s senschaft, in: W S I - M i t t e i l u n g e n 1978, S. 663, sowie Tolksdorf, Formen der Forschungsorganisation, in: Katterle / K r a h n (Hrsg.), Arbeitnehmer und Hochschulforschung, S. 153 ff.
102
3. Teil: Zur Kompetenz von Kollegialorganen
Ziel der kooperierenden Hochschulen war es, die gesamte Hochschule für arbeitnehmerorientierte Forschung zu öffnen. Die Frage, inwieweit zentrale Universitätsorgane durch Beschlußfassung über umfangreiche interdisziplinäre Forschungsprogramme den Fachbereichen einen verbindlichen Rahmen vorgeben können, ohne damit deren Vorrang in der Entscheidung über wissenschaftsrelevante Angelegenheiten zu unterlaufen, ist, soweit ersichtlich, bisher nicht näher erörtert worden. Bedenken bestünden, wenn unter Berufung auf die Interdisziplinarität von Forschungsvorhaben den einzelnen Fachbereichen ein Rahmenprogramm bindend vorgegeben würde, das für eigene Schwerpunktsetzung des Fachbereichs keinen Raum mehr beließe. Dies würde den i n § 64 Abs. 3 HRG garantierten, grundsätzlichen Entscheidungsvorrang des Fachbereichs aushöhlen. Die geringe Verbindlichkeit, die geringe Bindungsintensität, die einer Schwerpunktsetzung durch Kooperationsverträge der hier untersuchten A r t zukommt, wurde aber bereits oben herausgearbeitet. Der durch den Vertrag geschaffene institutionelle Rahmen hat Angebotscharakter nicht nur für den einzelnen Wissenschaftler, sondern auch für die einzelnen Fachbereiche. Diesen bleibt — ein durch den Kooperationsvertrag rechtlich überhaupt nicht eingeschränkter — Freiraum für Eigeninitiative bzw. eigene Schwerpunktsetzung auch außerhalb des thematischen Rahmens, der durch den Kooperationsvertrag gesetzt ist. Die Verträge können — angesichts der allgemein gehaltenen Zielsetzung — schwerlich als Forschungsrahmenprogramm verstanden werden. Selbst wenn man aber zu einer derartigen Deutung neigt, hätte ein solches Programm keine Verbindlichkeit für die einzelnen Fachbereiche. Da das Handeln der zentralen Organe so nicht zu einem Verlust an Entscheidungsfreiheit des Fachbereichs führt, bestehen grundsätzlich keine Bedenken, den Abschluß der Kooperationsverträge des hier untersuchten Typs durch Zentralorgane für zulässig zu halten. Bedenken i m Hinblick auf eine Einschränkung der Entscheidungsbefugnisse des Fachbereichs sind nur dann begründet, wenn durch den Vertrag ein Druck auf die verbindlichen Entscheidungen des Fachbereichs ausgeht, der — bei förmlicher Wahrung seiner Befugnisse — eine faktische Präjudizierung bewirken würde. Diesem Problem des möglichen Verlusts an Unabhängigkeit w i r d unten (5. Teil, III) näher nachgegangen. Soweit solche faktisch wirkenden Konsequenzen nicht bestehen, ist eine Entscheidung eines Zentralorgans, die auch ohne aktuelles Koordinierungsbedürfnis einen Impuls geben w i l l , die Forschung i n eine bestimmte Richtung zu lenken, nicht zu beanstanden.
«2 Reich, HRG, Rdnr. 9 zu § 63.
I I . Die Kompetenz von Kollegialorganen i m H R G
103
2. Koordinierungskompetenz der Hochschulorgane über Lehrfragen
Die Kooperationsverträge sehen ein Tätigwerden der Hochschule i n Fragen der Forschung und der Lehre vor. Folglich bedarf es auch der Klärung, welche Befugnisse den Kollegialorganen i m Bereich der Lehre zukommen. Da auch die Lehrfreiheit primär ein Individualrecht ist 6 3 , sind auch hier verfassungsrechtliche Grenzen der Befugnisse von Kollegialorganen gegenüber den einzelnen Grundrechtsträgern zu beachten. Gleiches gilt für den Vorrang von Entscheidungsbefugnissen der Fachbereichsorgane gegenüber Zentragorganen 64 . Da die Problemlage hier grundsätzlich derjenigen bei Beschlüssen zu Forschungsfragen entspricht, kann für die verfassungsrechtlichen Vorgaben, die bei der Verteilung von Kompetenzen auf Kollegialorgane zu beachten sind, auf die oben gemachten Ausführungen verwiesen werden 6 6 . a) Grenzen der Befugnisse der Kollegialorgane in bezug auf die individuelle Lehrfreiheit I n § 3 Abs. 3 Satz 2 erklärt das HRG Beschlüsse der zuständigen Hochschulorgane i n Fragen der Lehre für zulässig, soweit sie sich auf die Organisation des Lehrbetriebes und auf die Aufstellung und Einhaltung von Studien- und Prüfungsordnungen beziehen. Auch hier war das HRG bemüht, die bereits vorher geltende Rechtspraxis zu kodifizieren. Die rechtliche Möglichkeit von Beschlüssen zur äußeren Organisation des Lehrbetriebes wurde allgemein anerkannt 6 6 . Sowohl die stärkere Bedeutung der Ausbildungsfunktion der Hochschule als auch das Anwachsen des Universitätsbetriebes haben den Koordinationsbedarf i n der Lehre anwachsen lassen 67 . Diesen Erfordernissen entspricht es, wenn § 12 Abs. 1 HRG die Hochschulen ausdrücklich verpflichtet, auf «3 BVerfGE 35, 79 (115). m Dazu ausführlich Bauer, S. 111 ff. « 5 Dabei w i r d nicht verkannt, daß nach überwiegender Auffassung U n t e r schiede hinsichtlich der Möglichkeiten bindender Weisungen an einzelne Hochschullehrer bestehen. Z w a r hält ein Teil der Literatur bindende W e i sungen zur Übernahme eines bestimmten Lehrgegenstandes für verfassungsrechtlich unzulässig (ζ. B. Evers, Weisungsrechte, in: Festgabe für Gerber, S.46; Lübtow, Autonomie, S.49); i n neueren Stellungnahmen w i r d aber überwiegend eine Befugnis der zuständigen Kollegialorgane bejaht, zur Sicherung des Lehrangebots u n d der Ausbildungsaufgabe der Hochschulen verbindliche Weisungen i n Einzelfällen zu erteilen (vgl. dazu ausführlich Hailbronner, Funktionsgrundrecht, S. 178 ff. u n d Knemeyer, Lehrfreiheit, S. 38 ff.). Auch das H R G geht i n § 12 v o n einer solchen Möglichkeit aus. Vgl. Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 13 zu § 3; zumindest seit der stärkeren Reglementierung des Studiums durch Prüfungsordnungen (vgl. dazu Knemeyer, Lehrfreiheit, S. 36 f.) bedurfte es rechtlicher Möglichkeiten zur Sicherung des für die Ausbildungsauf gäbe erforderlichen Lehrangebots. «7 Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, § 3, Rdnr. 13.
104
3. Teil: Zur Kompetenz von Kollegialorganen
der Grundlage einer Studienplanung das zur Einhaltung der Studienordnung erforderliche Lehrangebot „sicherzustellen" und § 12 Abs. 2 HRG dem Fachbereich die Möglichkeit gibt, seinen i n der Lehre tätigen Angehörigen „bestimmte Aufgaben" zu übertragen. M i t dieser Regelung hat das HRG also grundsätzlich die Möglichkeit einer bindenden Weisung zur Abhaltung einer bestimmten Lehrveranstaltung anerkannt 6 8 . Zuständig für solche Weisungen ist gem. § 12 Abs. 2 i n Verbindung mit § 64 Abs. 3 HRG der Fachbereichsrat. Die rechtsverbindliche Möglichkeit, thematisch den Gegenstand einer Lehrveranstaltung festzulegen, muß aber die Grenzen des § 3 Abs. 3 Satz 1 und das i n § 12 Abs. 2 HRG niedergelegte Prinzip der Subsidiarität beachten. Rechtsverbindliche Beschlüsse sind nur zulässig, „soweit dies zur Gewährleistung des erforderlichen Lehrangebots notwendig ist". Damit ist — wie bei Forschungsentscheidungen — der Vorrang der Eigeninitiative und der Vorrang freiwilliger Koordinierung vor Fremdbestimmung statuiert 6 9 . Darüber hinaus ist klargestellt, daß rechtsverbindliche Beschlüsse des Fachbereichsrates nur zur Sicherstellung eines Lehrangebotes möglich sind, das von der Studienordnung (§11 HRG) gefordert ist 7 0 . Nur die Erfüllung der Ausbildungsfunktion, die wegen des durch Prüfungs- und Studienordnung gezogenen inhaltlichen Rahmens die thematische Abdeckung bestimmter Lehrgegenstände erfordert, legitimiert den Eingriff i n die individuelle Lehrfreiheit 7 1 . Keinesfalls steht es i m Belieben der Mehrheit des Fachbereichsrates, „Themenschwerpunkte" bei der Lehre zu setzen, u m die Probleme einer gesellschaftlichen Interessengruppe verstärkt zum Ausbildungsgegenstand zu machen. Verbindliche Koordinierungsentscheidungen i m Bereich der Lehre sind nach dem HRG nur zulässig zur Erreichung des vom Gesetz selbst gesetzten Zwecks — Erfüllung des zur Einhaltung der Studienordnung erforderlichen Lehrangebots. Damit sind inhaltliche Grenzen für Vereinbarungen, die sich auch auf die Lehre beziehen, markiert. Dieser Rahmen, der durch das HRG gezogen wird, ist durch den Abschluß der Kooperationsverträge aber nicht überschritten worden. Durch die Verträge wurde für die einzelnen Hochschullehrer keine Verbindlichkeit begründet, i n ihrer Lehre arbeitnehmerrelevante Themen zu behandeln. Auch die Gefahr eines mittelbaren Drucks auf den einzelnen Hochschullehrer, sich arbeitnehmerrelevanten Themen zuzuwenden, dürfte i m Bereich der Lehre geringer sein als i m Bereich der Fores z u verfassungsrechtlichen Bedenken vgl. die Nachweise bei Fn. 65; zur verfassungsrechtlichen Unbedenklichkeit dieser Bestimmungen vgl. Bode, in: Dallinger, u. a., HRG, Rdnr. 4 zu § 11. «« Bode, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 6 zu § 12; vgl. auch BVerfGE 35, 79 (129). w Bauer, S. 68. 7i Dallinger, in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 13 zu § 3.
I I . Die Kompetenz von Kollegialorganen i m H R G
105
schung. Der einzelne Hochschullehrer bedarf zur Durchführung seines Lehrprogramms i m Regelfall nicht der Zuweisung zusätzlicher Mittel. Damit entfällt die Möglichkeit, über die Entscheidung der Vergabe von Zusatzmitteln auf den Lehrinhalt einzuwirken. Bedeutung haben die i n den Verträgen enthaltenen Bestimmungen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Lehre bisher auch überwiegend i m Austausch von Lehrpersonal bzw. i n der Organisation von Ringvorlesungen an der Universität zu arbeitnehmerrelevanten Fragestellungen auf freiwilliger Basis gehabt (vgl. dazu oben l . T e i l , III). Eine Restriktion individueller Lehrfreiheit ist durch den Abschluß der Kooperationsverträge bisher nicht aufgetreten. Gefahren sind auch zukünftig nicht ersichtlich. b) Zur
Entscheidungsbefugnis
von
Zentralorganen
Das HRG geht i n § 12 Abs. 2 davon aus, daß Kollegialentscheidungen über die Lehre i n der Kompetenz des Fachbereichs liegen. Es bedarf der Klärung, ob nach den Regelungen des HRG überhaupt Entscheidungen von zentralen Kollegialorganen über Angelegenheiten der Lehre zulässig sind. Für solche Entscheidungen kommt nur das „weitere zentrale Kollegialorgan" i m Sinne des § 63 Abs. 2 HRG in Betracht. I m Aufgabenkatalog des § 63 Abs. 2 Nr. 1 - 7 findet sich keine Erwähnung der Lehre. Daraus kann aber nicht der Schluß gezogen werden, das HRG gehe von der generellen Unzulässigkeit jeglicher Entscheidung der Zentralorgane i n Lehrfragen aus. Schon der Wortlaut des § 63 Abs. 2 HRG („insbesondere für folgende Aufgaben") verdeutlicht, daß die Nummern 1 bis 7 keine abschließende Kompetenzaufzählung enthalten 7 2 . Auch der Vergleich zwischen § 63 Abs. 1 und 2 macht klar, daß der Gesetzgeber i n Abs. 2 keine abschließende Aufzählung der Zuständigkeiten des weiteren zentralen Kollegialorgans vornehmen wollte. Aus der Regelung des § 12 Abs. 2 HRG folgt aber, daß grundsätzlich der Fachbereich, nicht Zentralorgane i n Fragen der Lehre zuständig sind. Eine rechtsverbindliche Weisung zur Abhaltung bestimmter Lehrveranstaltungen könnte nicht von Zentralorganen vorgenommen werden. Unproblematisch zulässig sind demgegenüber aber fachbereichsüberschreitende Entscheidungen bezüglich der Nutzung der räumlichen Kapazitäten und sonstiger technischer Einrichtungen. Die Entscheidung zum Abschluß eines Kooperationsvertrages geht über eine solche rein technische Organisationsmaßnahme und Koordinationsentscheidung hinaus. Dennoch dürften keine Zweifel bestehen gegen die Zuständigkeit eines zentralen Kollegialorgans. Durch den Vertrag werden keine ra Reich, HRG, Rdnr. 4 zu §63; Dallinger, zu §63.
in: Dallinger u.a., HRG, Rdnr. 2
106
3. Teil: Zur Kompetenz von Kollegialorganen
verbindlichen Zuweisungen bestimmter Lehrgegenstände für einzelne Hochschullehrer begründet, noch w i r d i n die Kompetenz des Fachbereichs eingegriffen. Erleichtert w i r d aber eine bessere Zusammenarbeit i n Lehrfragen (wie sie ζ. B. an der Ruhr-Universität Bochum praktiziert wurde: Ringvorlesung mit hochschulexternen Dozenten) i m Problembereich „Arbeitnehmerfragen", der sich — wie oben bereits dargelegt — der Zuordnung zu einer einzelnen Fachdisziplin entzieht. Auch die Regelung einer Zusammenarbeit i n Fragen der Weiterbildung (§ 2 Abs. 3 und § 21 HRG) durch zentrale Organe erscheint bei fächerübergreifenden Grundsatzentscheidungen unbedenklich. Ein Eingriff i n Rechte des Fachbereichs findet durch den Abschluß der Kooperationsverträge nicht statt. Dessen vorrangige Befugnis zur Organisation des Lehrbetriebs w i r d nicht berührt. Die Verträge haben hier nur den Zweck, Anregungen zu geben und Kontakte zu schaffen. Beim Abschluß der Kooperationsverträge haben sich die Zentralorgane daher innerhalb des Rahmens gehalten, der durch das einfache Hochschulrecht gesetzt w i r d 7 3 .
73 Diese Aussage gilt aber n u r vorbehaltlich der u n t e n vorzunehmenden Prüfung (5. Teil, I I I ) , ob nicht die Hochschulorgane durch den Abschluß der Verträge ihre Pflichten aus § 3 Abs. 1 H R G — Wahrung der Grundrechte ihrer Angehörigen aus A r t . 5 Abs. 3 GG — verletzt haben.
Vierter
Teil
Handlungsfreiheit der Hochschulen aufgrund der Hochschulautonomie? I . Problemstellung
Der bisherige Gang der Arbeit konzentrierte sich auf die anhand des einfachen Rechts vorgenommene Untersuchung, inwieweit eine umfassende Kooperation der Hochschulen mit einer gesellschaftlichen Gruppe von der Aufgabenzuweisung gedeckt ist, die i m HRG bzw. den einzelnen Landesgesetzen vorgenommen worden ist. Beschränkte man sich auf die Erörterung dieser Frage, so bedeutete dies die undiskutierte Hinnahme einer staatlichen „Aufgabenhoheit" 1 , die Bejahung des staatlichen Bestimmungsrechts i n bezug auf den Wirkungskreis der Hochschulen. Anerkennt man eine diesbezügliche Befugnis des Gesetzgebers, dann würde sich die juristische Person Hochschule außerhalb ihres Wirkungskreises bewegen, wenn sie Aufgaben wahrnimmt, die i n § 2 HRG bzw. i n einem Landesgesetz nicht enthalten sind. Staatliche Instanzen könnten dann mit den Mitteln der Rechtsaufsicht die Einhaltung des W i r kungskreises der Hochschule sicherstellen. Fraglich ist jedoch, ob nicht verfassungsrechtlich dem staatlichen Bestimmungsrecht hinsichtlich der Aufgabenzuweisung an die Hochschule Grenzen gesetzt sind, konkret, ob nicht ungeachtet der inzwischen abgeschlossenen detaillierten Normierung des Hochschulrechts unter unmittelbarem Rückgriff auf verfassungsrechtliche Positionen zusätzliche Handlungsspielräume für die Hochschulen begründet werden können. Hier soll zunächst untersucht werden, inwieweit bereits A r t . 5 Abs. 3 GG eine „Autonomie der Hochschule" eine Garantie der Eigenständigkeit institutioneller Wissenschaft garantiert, und welche Konsequenzen daraus für die staatliche Aufgabenhoheit abgeleitet werden können. Ergänzend ist dann zu prüfen, ob einzelne Landesverfassungen Gewährleistungen enthalten, die eine darüber hinausgehende Handlungsfreiheit einräumen. I m Zusammenhang mit diesem Bestimmungsver1
Ausdruck v o n Dallinger,
in: Dallinger u. a., HRG, Rdnr. 4 zu § 58.
108
4. Teil: Handlungsfreiheit der Hochschulen?
such der Reichweite der „Hochschulautonomie" soll dann die Frage erörtert werden, ob auf die Position der „Hochschul- bzw. Wissenschaftsautonomie" auch ein verfassungskräftiges Recht der Hochschulen gestützt werden kann, wissenschaftliche Erkenntnisse i n die Praxis umzusetzen bzw. ob ein Recht zur aktiven Parteinahme für bestimmte gesellschaftliche Interessengruppen besteht. I n verschiedenen Ansätzen sind solche Interpretationen der Garantie der Wissenschaftsfreiheit i n der Literatur vertreten worden 2 .
I I . Grundlagen und Grenzen der „Hochschulautonomie" 1. Die herrschende Auffassung zu Art. 5 Abs. 3 G G
Untersucht man die zahlreichen Stellungnahmen zu A r t . 5 Abs. 3 GG, so stellt man fest, daß die ganz überwiegende Auffassung die „Hochschulautonomie" i n dieser Verfassungsnorm verankert sieht 3 . Unklarheit und Uneinigkeit herrscht jedoch i n der Bestimmung von Inhalt und Reichweite der Hochschul autonomie 4 und der A r t der Ableitung dieser Gewährleistung aus A r t . 5 Abs. 3 GG. Zum Teil w i r d unter Berufung auf die Hochschul autonomie nicht nur das Recht auf Selbstverwaltung, sondern auch das Recht auf Selbstgesetzgebung gefordert 6 . Dem Gesetzgeber wurde grundsätzlich das Recht zur Hochschulreform durch Gesetzgebungsakte bestritten 6 und eine Reduzierung seiner Rolle bei Neugründungen auf „unbedingt notwendige Maßnahmen" vorläufiger Natur gefordert 7 . Andere Autoren räumen staatlicher Bestimmungsmacht — bei grundsätzlicher Anerkennung der Hochschulautonomie — einen weiteren Gestaltungsspielraum ein 8 . Die Feststel2 Vgl. z. B. Sterzel, Wissenschaftsfreiheit, S. 260 ff.; Preuss, Das politische Mandat, S. 105 ff.; Stuby, Disziplinierung der Wissenschaft, S. 141 ff.; vgl. auch Nitsch / Gerhardt / Offe / Preuss, Hochschule i n der Demokratie, S. 186 ff., besonders S. 199. 3 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien genannt: Köttgen, Grundrecht, S. 23 ff. u n d passim; Thieme, Ho

![Hochschulprivatisierung und akademische Freiheit: Jenseits von Markt und Staat: Hochschulen in der Weltgesellschaft [1. Aufl.]
9783839416129](https://dokumen.pub/img/200x200/hochschulprivatisierung-und-akademische-freiheit-jenseits-von-markt-und-staat-hochschulen-in-der-weltgesellschaft-1-aufl-9783839416129.jpg)




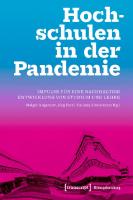



![»Kooperationsverträge« zwischen Hochschulen und gesellschaftlichen Verbänden: Die Abkommen der Hochschulen mit Arbeitnehmerorganisationen in Bremen, Oldenburg, Bochum und Saarbrücken [1 ed.]
9783428454549, 9783428054541](https://dokumen.pub/img/200x200/kooperationsvertrge-zwischen-hochschulen-und-gesellschaftlichen-verbnden-die-abkommen-der-hochschulen-mit-arbeitnehmerorganisationen-in-bremen-oldenburg-bochum-und-saarbrcken-1nbsped-9783428454549-9783428054541.jpg)