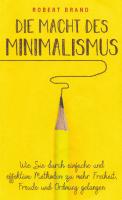Die Aufführung. Diskurs – Macht – Analyse 9783770553549
796 129 2MB
German Pages 357 Year 2012
Polecaj historie

- Author / Uploaded
- Erika Fischer-Lichte
- Adam Czirak
- Torsten Jost
- Frank Richarz
- Nina Tecklenburg (eds.)
Citation preview
Fischer-Lichte · Czirak · Jost · Richarz · Tecklenburg (Hrsg.) Die Aufführung
Erika Fischer-Lichte · Adam Czirak · Torsten Jost Frank Richarz · Nina Tecklenburg (Hrsg.)
Die Aufführung Diskurs – Macht – Analyse
Wilhelm Fink
Umschlagabbildung: David Weber-Krebs mit „Tonight lights out“ (UA 2011) Fotografin: Marie Urban Umschlagabbildung: Slavoj ŽiŽek in New York 2011 Fotograf: Kashish Das Shrestha
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Dies betrifft auch die Vervielfältigung und Übertragung einzelner Textabschnitte, Zeichnungen oder Bilder durch alle Verfahren wie Speicherung und Übertragung auf Papier, Transparente, Filme, Bänder, Platten und andere Medien, soweit es nicht §§ 53 und 54 UrhG ausdrücklich gestatten. © 2012 Wilhelm Fink Verlag, München (Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags-KG, Jühenplatz 1, D-33098 Paderborn) Internet: www.fink.de Einbandgestaltung: Evelyn Ziegler, München Printed in Germany Herstellung: Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG, Paderborn ISBN 978-3-7705-5354-9
Inhalt
VORWORT UND DANK ……………………………………………………
9
Einleitung ERIKA FISCHER-LICHTE Die verwandelnde Kraft der Aufführung …………………………………
11
DISKURS FRANK RICHARZ Diskurse der Aufführung – Die vierfache Diskursivierung eines Begriffs ………………………………
27
BARBARA GRONAU Ausstellen und Aufführen. Performative Dimensionen zeitgenössischer Kunsträume …………………
35
ALAN READ Über Aufführung überhaupt und über die Aufführung des Menschen. Bemerkungen über das Theater vor der Identitätstheorie. …………………
49
MATTHIAS WARSTAT Politisches Theater zwischen Theatralität und Performativität ……………
69
KLAUS-PETER KÖPPING Resonanz als Zeichen effektiver/affektiver Transformation bei rituellen Aufführungen in Japan ……………………
83
DAVID PLÜSS Aufführung von Liminalität. Gottesdienst als Text, Ritual und Theater …
103
6
INHALT
MACHT ADAM CZIRAK Macht in Aufführungen …………………………………………………
125
FRANK RICHARZ Von der Aufführung zum Performativ. Die theatralogische Untersuchung machtmimetischer Prozesse ……………
135
JON MCKENZIE Die Performance von Demokratie ………………………………………
157
NINA TECKLENBURG Telling Performance. Zur (Ent-)Mythisierung der Aufführung ……………
175
MATEUSZ BOROWSKI, MAŁGORZATA SUGIERA Macht der Verschiebung: zwei site-specific Hamlet-Inszenierungen ………
189
ERIN MANNING Der Tanz der Aufmerksamkeit ……………………………………………
205
JILL DOLAN Die Utopie der Aufführung ………………………………………………
227
ANALYSE TORSTEN JOST Analyse der Aufführung. Über die Pluralität der Perspektiven ……………
245
CHRISTEL WEILER, FRANK RICHARZ Aufführungsanalyse und Theatralanalyse − ein Dialog ……………………
253
JENS ROSELT Den Augen trauen: Theater und Phänomenologie ………………………
263
VIKTORIA TKACZYK Theater und Wortgedächtnis. Eine Spurensuche nach der Gegenwart ……
275
MATTHIAS DREYER Zäsur der Tragödie. Dimiter Gotscheffs Perser und die Historizität im Theater der Gegenwart ………………………………
291
INHALT
7
TOBIAS REES Diesseits von Ethnos: Über die heutige Möglichkeit einer ‚neuen‘ Begegnung zwischen Anthropologie und Theater ……………………………………
315
Nachwort MARVIN CARLSON Dynamiken und Herausforderungen von Aufführungen …………………
337
PERSONENREGISTER ………………………………………………………
343
SACHWORTREGISTER ………………………………………………………
347
ZU DEN AUTOREN ………………………………………………………
353
Vorwort und Dank
Der vorliegende Band geht auf die Arbeit des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Sonderforschungsbereichs Kulturen des Performativen an der Freien Universität Berlin und insbesondere seines theaterwissenschaftlichen Teilprojekts Ästhetik des Performativen zurück. Wie diese trägt er hoffentlich zur Weiterentwicklung eines performativen Kulturverständnisses bei, das die Ereignishaftigkeit und Wirklichkeit konstituierende Kraft von Handlungsvollzügen ins Zentrum rückt. Das Forschungsprojekt Ästhetik des Performativen reagierte mit seiner Theoriebildung auf eine von der zeitgenössischen Aufführungspraxis ausgehende Anregung, einen theoretischen Zugang zu kulturellen Ereignissen jenseits von und in Ergänzung zu semiotischen Ansätzen zu eröffnen. Seiner Arbeit lag die Annahme zugrunde, dass ein produktiver wissenschaftlicher Zugriff auf Kultur- und Kunstereignisse darin besteht, anders als bei der Interpretation von Artefakten die präsentische Körpererfahrung des Anderen zu akzentuieren und ästhetische Erfahrungen immer schon als verschränkt mit sozialen, ethischen und machtpolitischen Wirkungszusammenhängen zu betrachten. Die Aufführung als flüchtiges Beziehungsgeflecht zwischen Akteuren und Zuschauern bildete dabei den Untersuchungsfokus und diente als interdisziplinäre Beschreibungskategorie. Ausgehend von dem übergreifenden Ziel, eine Ästhetik des Performativen am Beispiel des Theaters zu entwickeln, wurden in den ersten der vier Förderungsperioden solche Dimensionen des Theatralen erforscht, die sich gegen eine rein produktions-, werk- oder rezeptionsästhetische Vorgehensweise sperren. Das Augenmerk richtete sich daher zunächst auf Wechselwirkungen zwischen Wahrnehmendem und Wahrgenommenem sowie zwischen Materialität und Referenzialität. Bei der Ermittlung dieser Verhältnisse zeigte sich, dass eine weitere Relation zu berücksichtigen war, die für das Performative eine elementare Rolle spielt: die Beziehung zwischen intendiertem Zur-Erscheinung-Bringen und kontingentem In-Erscheinung-Treten. Entsprechend wurde in den anschließenden Förderungsphasen – am Beispiel des Gegenwartstheaters, einschließlich des Musiktheaters sowie des Tanzes und der Performance- und Installationskunst – das Zusammenspiel von Planung und Emergenz für die Ästhetik des Performativen theoretisch erschlossen. Im Frühjahr 2010 veranstaltete das Forschungsprojekt eine internationale Konferenz, die keineswegs darauf zielte, den so gewonnenen Aufführungsbegriff einfach zu rekapitulieren. Vielmehr galt das Interesse der Frage, wie die zwölfjährige Forschungsarbeit sinnvoll weitergeführt werden könnte. Zur Debatte standen die
10
VORWORT UND DANK
Ergebnisse und Desiderate sowie die Reichweite, Folgen und weitere Verwendungsmöglichkeiten des Aufführungsbegriffs. Der vorliegende Band stellt die neuen Perspektivierungen zur Diskussion, die diese Konferenz erbrachte. Im Brennpunkt des ersten Teils steht die Frage, welche Perspektiven der theaterwissenschaftlich fundierte Aufführungsbegriff für andere kultur- und geisteswissenschaftliche Disziplinen zu eröffnen vermag. Die im zweiten Teil angeführten Beiträge unterziehen das herkömmliche Verständnis der in Aufführungen einnehmbaren Machtpositionen einer Revision. Sie erkunden ‚Macht‘ weniger als eine souveräne und individuelle Handlungsvoraussetzung, sondern konzentrieren sich primär auf die Offenlegung von komplexen Machtrelationen. Im abschließenden Teil stehen schließlich methodische Fragen im Mittelpunkt, die sich aus dem Aufführungsbegriff für die Analyse ergeben. Die Planung und Umsetzung einer Abschlusstagung und eines Sammelbandes sind auf vielerlei institutionelle und persönliche Unterstützung angewiesen. Unser Dank gilt in erster Linie der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie dem Sonderforschungsbereich Kulturen des Performativen, speziell seiner Geschäftsführerin Kristiane Hasselmann und seiner Koordinatorin Sabine Lange für ihre unermüdlichen und unerlässlichen Hilfeleistungen. An dieser Stelle sei auch den Dolmetscherinnen Vera Herchenbach und Natalie Nagel gedankt, die unseren Gästen die rege Teilnahme an der Konferenz enorm erleichtert haben. Nicht genug zu danken ist darüber hinaus Konrad Bach, Marcin Behlert, Georg Kasch, Christoph Nöthlings, Thomas Stachel und Claudia Weigel für die sorgfältigen Übersetzungen der fremdsprachigen Beiträge. Zu guter Letzt sind wir den wissenschaftlichen Hilfskräften Konrad Bach und Stefan Donath zu Dank verpflichtet, die durch ihr Korrektorat zum Gelingen dieser Publikation beigetragen haben. Die Herausgeberinnen und Herausgeber
ERIKA FISCHER-LICHTE
Die verwandelnde Kraft der Aufführung
Seit ihrem Erscheinen im Jahre 2004 hat meine Ästhetik des Performativen lebhafte Diskussionen ausgelöst – zunächst überwiegend in den deutschsprachigen Ländern, nach ihrer Übersetzung in verschiedene europäische und nicht-europäische Sprachen1 auch weit darüber hinaus. Die Diskussionen halten bis heute an und werden durch die Veröffentlichung jeder weiteren Übersetzung jeweils neu angefacht. Sie beziehen sich auf unterschiedliche Konsequenzen aus dem in meiner Schrift entwickelten Aufführungsbegriff bzw. auf seine Implikationen. Da im vorliegenden Band diese Diskussion fortgesetzt wird, seien einleitend kurz die grundlegenden Aspekte meines Aufführungsbegriffs rekapituliert. Sie beziehen sich vor allem auf die medialen Bedingungen von Aufführungen (1), die Erscheinungsweise ihrer Materialität (2), die von diesen beiden Aspekten begründete Emergenz von Bedeutungen (3) sowie den besonderen Modus einer ästhetischen Erfahrung, den alle diese Faktoren ermöglichen (4). In jeder dieser Hinsichten sind Aufführungen durch ein merkwürdiges Dazwischen charakterisiert.2
I. Der Aufführungsbegriff (1) Eine Aufführung ereignet sich in der und durch die leibliche Ko-Präsenz von Akteuren und Zuschauern. Sie entsteht aus ihrer Begegnung, Konfrontation, Interaktion. Was immer die Akteure tun, hat Auswirkungen auf die Zuschauer – ebenso wie auf die anderen Akteure –, und was immer die Zuschauer tun, hat Auswirkungen auf die Akteure und die anderen Zuschauer. In diesem Sinne entsteht die Aufführung immer erst in ihrem und durch ihren Verlauf. Sie erzeugt sich sozusagen selbst aus den Interaktionen zwischen Akteuren und Zuschauern. Daher ist ihr Ablauf auch nicht vollständig planbar und vorhersagbar. Aufführungen vollziehen sich als autopoietische Prozesse, die alle Teilnehmer, Akteure ebenso wie Zuschauer, involvieren; ihnen eignet entsprechend ein hohes Maß an Kontingenz. Der weitere Verlauf einer Aufführung kann bei ihrem Beginn nicht genau vorhergesehen werden. Zwar sind es die Akteure, die ganz entscheidende Vorgaben machen – Vorgaben, die durch ein System von Regeln oder den Proben1 Bisher sind eine slovenische, englische, polnische, ungarische, japanische, spanische, bosnische, arabische, griechische, russische und chinesische Übersetzung erschienen; eine italienische steht kurz vor der Publikation; an einer tschechischen und koreanischen wird gegenwärtig noch gearbeitet. 2 Vgl. zum Nachfolgenden Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004.
12
ERIKA FISCHER-LICHTE
prozess bestimmt sind. Gleichwohl sind sie nicht imstande, den Verlauf der Aufführung vollständig zu kontrollieren. Viele Elemente tauchen erst während der Aufführung als Folge von Interaktionen zwischen Akteuren und Zuschauern auf. Eine Aufführung eröffnet also für alle ihre Teilnehmer die Möglichkeit, sich in ihrem Verlauf als ein Subjekt zu erfahren, das Handlungen und Verhalten der anderen mitzubestimmen vermag und zugleich in seinem eigenen Verhalten und Handeln sich von anderen mitbestimmen lässt. Die einzelnen Teilnehmer – seien sie Akteure oder Zuschauer – erfahren sich als Subjekte, die weder völlig autonom noch vollkommen fremdbestimmt sind; als Subjekte, die Verantwortung für eine Situation übernehmen, die sie nicht geschaffen, an der sie jedoch Teil haben. Daraus erhellt sich, dass eine Aufführung – ganz gleich welchen Genres – sich immer auch zugleich als ein sozialer Prozess abspielt. In ihr treffen unterschiedliche Gruppen aufeinander, die ihre Beziehungen auf unterschiedliche Weise aushandeln und regeln. Dieser soziale Prozess wird zu einem politischen, wenn in der Aufführung etablierte Zuschauer-Akteur-Verhältnisse, tradierte Wahrnehmungsordnungen, Ansichten, Werte, Überzeugungen und Verhaltensweisen, die jeweils als Machtrelationen zwischen Akteuren und Zuschauern oder zwischen verschiedenen Zuschauern beschreibbar sind, gestört, verändert bzw. neu verhandelt werden. Da jeder einzelne – wenn auch in verschiedenem Ausmaß – sowohl den Verlauf der Aufführung mitbestimmt als auch sich von ihm mitbestimmen lässt, nimmt niemand ‚passiv‘ an ihr teil. Jeder ist insofern auch mitverantwortlich für das, was sich während der Aufführung ereignet. (2) Aufführungen verfügen nicht über ein fixier- und tradierbares Artefakt; sie sind flüchtig und transitorisch; sie erschöpfen sich im Prozess ihrer Autopoiesis. Das schließt keineswegs aus, dass die Räume, in denen sie stattfinden, und die materiellen Objekte, die in ihnen verwendet werden, nach dem Ende der Aufführung als solche zurückbleiben und als Spuren der Aufführung aufbewahrt werden können. Gleichwohl ist die Aufführung selbst nach ihrem Ende unwiederbringlich verloren. Denn ihre Materialität – Räumlichkeit, Körperlichkeit, Lautlichkeit – wird performativ hervorgebracht und tritt immer nur für eine begrenzte Zeitspanne innerhalb der Gesamtdauer der Aufführung in Erscheinung. Die je besondere Erscheinungsweise der Materialität von Aufführungen impliziert immer schon einen Verweis auf deren Eigenart, sich zwischen Akteuren und Zuschauern zu ereignen. Bereits die Gliederung des geometrisch-architektonischen Raums, in dem eine Aufführung stattfindet, macht Vorschläge oder auch Vorgaben für das Verhältnis zwischen Akteuren und Zuschauern und eröffnet zugleich spezifische Möglichkeiten für die Bewegungen von Akteuren – und Zuschauern – sowie für die Wahrnehmung der Zuschauer. Ob es sich um ein Amphitheater im Freien oder um eine italienische Bühne in einem Festsaal handelt, ob der Zuschauerraum erleuchtet oder verdunkelt ist, hat Konsequenzen für die Interaktionen zwischen Akteuren und Zuschauern, ohne sie jedoch völlig festlegen zu können. Auch wenn der Raum gegeben sein mag, wird die Räumlichkeit von Aufführungen erst durch die Bewegungen von Menschen, Objekten und Licht, durch die Laute, die im Raum erklingen, die Gerüche, die sich in ihm verbreiten, hervorgebracht. Darüber
DIE VERWANDELNDE KRAFT DER AUFFÜHRUNG
13
hinaus wird sie von der wechselnden Atmosphäre wesentlich mitbestimmt. Atmosphären sind, wie Gernot Böhme ausgeführt hat, zwar ortlos, aber dennoch räumlich ergossen. Er bestimmt sie als „Räume, insofern sie durch die Anwesenheit von Dingen, von Menschen oder Umgebungskonstellationen, d. h. durch deren Ekstasen tingiert sind. Sie sind selbst Sphären der Anwesenheit von etwas, ihre Wirklichkeit im Raum.“3 Atmosphären sind insofern als ein ‚Zwischenphänomen‘ zu begreifen, als die Zuschauer sich ihnen nicht gegenüber befinden, nicht in Distanz zu ihnen. Vielmehr werden sie von ihnen umfangen und tauchen in sie ein. Mehr noch, durch Licht, Laute und Gerüche, die wesentlich an der Entstehung einer Atmosphäre beteiligt sind, dringt diese in den Leib der Zuschauer ein. Aufgrund der leiblichen Ko-Präsenz von Akteuren und Zuschauern, welche die Aufführung konstituiert, kommt der Körperlichkeit von Aufführungen für die Hervorbringung des Dazwischen eine besondere Bedeutung zu. Sie verändert sich mit jeder Bewegung, jeder stimmlichen Entäußerung und wirkt unmittelbar auf die Körper der Zuschauer ein, indem sie in ihnen physiologische, affektive, energetische oder motorische Prozesse auslöst. Dies gilt in besonderem Maße für die von solchen Akteuren hervorgebrachte Körperlichkeit, denen eine besondere Präsenz eignet. Aufgrund bestimmter Techniken der Körper- und Stimmverwendung sind sie imstande, eine für alle im Raum Anwesenden leiblich spürbare Energie hervorzubringen. Dies scheint nicht nur die Zuschauer geradezu zu zwingen, dem Akteur ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, sondern bewirkt darüber hinaus auch deren eigene Energetisierung. Die Energie, die vom präsenten Akteur ausgeht, zirkuliert im Raum, überträgt sich auf die Zuschauer, in denen nun ihrerseits Energie freigesetzt wird, die im Raum zirkuliert und sich auf die anderen Zuschauer und die Akteure überträgt usf. Dieses Phänomen lässt sich besonders häufig beim Einsatz von Rhythmus beobachten, der auf spezifische Weise Räumlichkeit, Körperlichkeit und Lautlichkeit aufeinander zu beziehen und in ihrer Wirkmächtigkeit geradezu wie im Brennglas zu bündeln vermag. Nun stellt der Rhythmus ein Prinzip dar, das mit dem menschlichen Leib gesetzt ist. Nicht nur folgen Herzschlag, Blutkreislauf und Atmung ihrem eigenen Rhythmus; nicht nur führen wir unsere Bewegungen beim Gehen, Tanzen, Schwimmen, Schreiben etc. rhythmisch aus und bringen beim Sprechen, Singen, Lachen und Weinen Laute rhythmisch hervor. Auch die Bewegungen, die in unserem Leib, ja, in jeder unserer Zellen erzeugt werden, ohne dass wir sie wahrzunehmen vermöchten, werden rhythmisch vollzogen.4 Wir sind daher auch in besonderer Weise imstande, Rhythmen wahrzunehmen und in sie ‚einzuschwingen‘. Indem der Rhythmus die performative Hervorbringung von Materialität organisiert und strukturiert, lässt er sie also zugleich als Wirkungsfaktor in der Autopoiesis der Aufführung in Erscheinung treten und so bewusst werden. 3 Gernot Böhme, Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1995, S. 33. 4 Vgl. hierzu u. a. Gerold Beier, Rhythmus. Tanz in Körper und Gehirn, Reinbek b. H.: Rowohlt 2001.
14
ERIKA FISCHER-LICHTE
(3) Wenn man bedenkt, dass Aufführungen aus den Interaktionen von Akteuren und Zuschauern hervorgehen und ihre Materialität von Flüchtigkeit charakterisiert ist, leuchtet unmittelbar ein, dass sie außerstande sind, vorgegebene Bedeutungen zu übermitteln. Bedeutungen, die in ihrem Prozess generiert werden, tauchen erst in ihrem Verlauf auf. Auch wenn die beteiligten Künstler oder die Organisatoren die Absicht haben mögen, ganz bestimmte Botschaften zu übermitteln, sind sie wegen der beiden genannten Bedingungen nicht in der Lage, den Prozess der Bedeutungsproduktion bei den Zuschauern zu kontrollieren. Er hängt vielmehr einerseits von den Wahrnehmungen der einzelnen Zuschauer ab und andererseits von den Erinnerungen, Erfahrungen, Emotionen, Kenntnissen etc., die diese in die Aufführung mitbringen. Sie beeinflussen zum einen bereits seine Wahrnehmung und zum anderen den Prozess, in dem er dem Wahrgenommenen Bedeutungen beilegt. Darüber hinaus sind im Prozess der Wahrnehmung zwei Vorgänge zu unterscheiden. Sie kann sich zum einen auf das erscheinende Phänomen in seiner je besonderen Materialität, seine spezifische Erscheinungsweise konzentrieren. Diese Art der Wahrnehmung habe ich die Ordnung der Präsenz genannt. Den Leib des Akteurs als sein leibliches In-der-Welt-sein bzw. den Raum und die Objekte in ihrer je besonderen Erscheinungsweise wahrzunehmen, begründet diese Ordnung. Sie dagegen als Zeichen für eine fiktive Figur bzw. eine fiktive Welt oder eine bestimmte symbolische Ordnung wahrzunehmen, begründet eine andere Ordnung der Wahrnehmung – die Ordnung der Repräsentation. Jede der beiden Ordnungen generiert Bedeutungen nach anderen Prinzipien, die vorherrschend werden, wenn sich eine von ihnen für eine gewisse Zeit stabilisiert. Im Laufe der Aufführung gleitet die Wahrnehmung der Zuschauer in der Regel oszillierend zwischen beiden Ordnungen hin und her. Bisweilen wird sie auch abrupt von einer zur anderen umspringen. Die Dynamik des Wahrnehmungsprozesses nimmt bei jedem Umspringen ebenso wie beim Hin- und Hergleiten eine neue Wendung. Sie versetzt den Wahrnehmenden zwischen beide Ordnungen, in einen Zwischen- oder Schwellenzustand. Je öfter das Umspringen sich ereignet, desto häufiger wechselt der Wahrnehmende zwischen beiden Ordnungen hin und her. Dabei wird er sich zunehmend dessen bewusst, dass er nicht Herr der Übergänge ist. Zwar kann und wird er immer wieder versuchen, seine Wahrnehmung intentional neu ‚einzustellen‘ – auf die eine oder die andere Ordnung. Ihm wird jedoch sehr bald bewusst werden, dass die Wendungen erfolgen, auch ohne dass er sie beabsichtigt hätte – dass sie ihm widerfahren, zustoßen, dass er also ohne es zu wollen oder es verhindern zu können, in einen Zustand zwischen beiden Ordnungen gerät. Er erfährt in diesen Momenten seine eigene Wahrnehmung als emergent, als seinem Willen und seiner Kontrolle entzogen, als ihm zwar nicht vollkommen frei verfügbar, jedoch zugleich als bewusst vollzogen. Damit wird ihm zugleich bewusst, dass ihm nicht Bedeutungen übermittelt werden, sondern dass er es ist, der sie hervorbringt und dass auch ganz andere Bedeutungen hätten auftauchen können, wenn die Wendungen früher oder später oder weniger häufig oder öfter eingetreten wären. (4) Da Aufführungen aus der Interaktion zwischen Akteuren und Zuschauern hervorgehen, lassen sie sich angemessen nicht als Werke begreifen, sondern viel-
DIE VERWANDELNDE KRAFT DER AUFFÜHRUNG
15
mehr als Ereignisse. Wenn der autopoietische Prozess, in dem eine Aufführung sich selbst erzeugt, vollzogen ist, liegt nicht die Aufführung als sein Resultat vor, das sich als ein Werk bezeichnen ließe. Vielmehr ist damit auch die Aufführung vollzogen. Sie ist vorbei und unwiederbringlich verloren. Es gibt sie nur als bzw. im Prozess des Aufführens. Sie lässt sich insofern als ein Ereignis begreifen, das – im Unterschied zur Inszenierung, die auf Wiederholung angelegt ist – einmalig und unwiederholbar ist. Die Aufführung als Ereignis ermöglicht eine besondere Art von ästhetischer Erfahrung. In ihr erfahren sich die Beteiligten als Subjekte, die ihren Gang mitbestimmen und sich zugleich von ihr bestimmen lassen. Sie erleben die Aufführung als einen ästhetischen und zugleich als einen sozialen, ja politischen Prozess, in dessen Verlauf Beziehungen ausgehandelt, Machtverhältnisse aktualisiert, Gemeinschaften gebildet werden und sich wieder auflösen. Ihre Wahrnehmung folgt sowohl der Ordnung der Präsenz als auch derjenigen der Repräsentation. Was in unserer Kultur traditionell als Gegensätze gilt, die sich in dichotomische Begriffspaare fassen lassen – wie autonomes vs. fremdbestimmtes Subjekt; Subjekt vs. Objekt; Kunst vs. Gesellschaft; Ästhetik vs. Politik; Präsenz vs. Repräsentation – wird in Aufführungen nicht im Modus des Entweder-oder, sondern in dem des Sowohlals-auch erfahren. Die Gegensätze scheinen zu kollabieren. Da dichotomische Begriffspaare außer als Instrumente zur Beschreibung und Erkenntnis der Welt auch und vor allem als Regulative unseres Handelns und Verhaltens dienen, zieht ihre Destabilisierung nicht nur eine Destabilisierung der Welt-, Selbst- und Fremdwahrnehmung nach sich, sondern auch eine Erschütterung der Normen und Regeln, die Verhalten regulieren. Aus den Begriffspaaren lassen sich unterschiedliche Rahmensetzungen deduzieren, wie: ‚Dies ist Kunst‘ oder ‚Dies ist eine soziale Situation‘. Diese Rahmen beinhalten Vorgaben für ein angemessenes Verhalten in einer von ihnen gefassten Situation. Indem Aufführungen scheinbar gegensätzliche oder auch nur verschiedene Rahmen miteinander kollidieren lassen, indem sie auf diese Weise unterschiedliche, ja zum Teil einander diametral entgegengesetzte Geltungsansprüche nebeneinander stehen lassen, sodass sie einerseits alle gleichzeitig gelten, andererseits aber sich gegenseitig annullieren, schaffen sie Situationen eines Dazwischen: Sie versetzen die Zuschauer zwischen alle hier aufgerufenen Regeln, Normen, Ordnungen, sie versetzen sie in diesem Sinne auf eine Schwelle bzw. in einen Zustand der Liminalität.5Die Erfahrung einer solchen Liminalität geht häufig mit starken Empfindungen und Gefühlen einher, mit Veränderungen des physiologischen, affektiven, energetischen und motorischen Zustands. Sie wird also zunächst als eine Veränderung des körperlichen Zustands bewusst und erlebbar. Umgekehrt kann es das Bewusstsein körperlicher Veränderungen sein, das einen solchen Schwellenzustand herbeizuführen vermag. 5 Der Begriff der Liminalität wurde von dem amerikanischen Ethnologen Victor Turner unter Rekurs auf das Werk des belgischen Ethnologen Arnold van Gennep, Les rites de passage, Paris: É. Nourry 1909 geprägt. Vgl. Victor Turner, The Ritual Process – Structure and AntiStructure, London: Routledge & Kegan Paul 1969.
16
ERIKA FISCHER-LICHTE
Dies gilt vor allem für starke Empfindungen und Gefühle, wie sie im/vom Akt der Wahrnehmung einer auftauchenden Erscheinung im wahrnehmenden Subjekt hervorgerufen werden, vor allem, wenn es sich um eine Erscheinung handelt, die mit einem starken Tabu verbunden ist. Derart starke Gefühle vermögen häufig Handlungsimpulse auszulösen, die zum Teil tatsächlich zu eingreifendem Handeln führen. Damit ist der Erwerb eines neuen Status – der eines Akteurs – verbunden; zugleich werden neue Normen gesetzt und erprobt. Der Zustand der Liminalität, in den die Aufführung den Zuschauer versetzt, kann also zu Transformationen führen, die von höchst unterschiedlicher Art sein mögen. Zum einen handelt es sich um vorübergehende Transformationen, die nur für die Dauer der Aufführung oder auch nur für eine noch begrenztere Zeit anhalten. Zu ihnen sind die Veränderungen physiologischer, affektiver, energetischer und motorischer Körperzustände zu rechnen, aber auch tatsächlich erreichte Statuswechsel wie der vom Status des Zuschauers zu dem eines Akteurs oder auch die Bildung von Gemeinschaften. Je nach Genre der Aufführung sind die angestrebten Transformationen deutlich angegeben, unterschwellig suggeriert oder völlig offen. Sie können in einem gesellschaftlich anerkannten Statuswechsel bestehen wie zum Beispiel in Übergangsritualen, in der Bildung von Gemeinschaften wie bei Festen und vielen Sportveranstaltungen, in der Generierung von Siegern und Verlierern wie bei Wettkämpfen, in der Legitimation und Durchsetzung von Machtansprüchen wie in verschiedenen politischen Veranstaltungen u. a. mehr. Die Schwellenerfahrung stellt in allen diesen Fällen den Weg zu einem bestimmten Ziel dar. Dies lässt sich allerdings keineswegs mit eben solcher Sicherheit für künstlerische Aufführungen behaupten. Ästhetische Erfahrung als Schwellenerfahrung muss keineswegs zu entsprechenden, länger andauernden Transformationen führen, die von der Gesellschaft bzw. bestimmten Gruppen innerhalb einer Gesellschaft anerkannt werden. Sie kann sich durchaus in vorübergehenden Transformationen erschöpfen, die nur für die Dauer der Aufführung anhalten. Insofern kann eine ästhetische Erfahrung, die Schwellenerfahrung, der Weg selbst, bereits das Ziel darstellen. Gleichwohl ist keineswegs auszuschließen, dass auch durch eine ästhetische Erfahrung bewirkte Transformationen die Aufführung zu überdauern vermögen. Eine solche Annahme wird vor allem von jenen Theatertheorien nahegelegt und vorausgesetzt, die eine Wirkungsästhetik vertreten. Denn mit Aristoteles ‚Katharsis‘, den rasas des indischen Natyasastra, Lessings ‚Mitleids‘-Theorem, Artauds ‚Heilung oder Tod‘, um nur einige markante Beispiele zu nennen, wird eine Transformation proklamiert, deren Folgen sich auch nach dem Ende der Aufführung im gesellschaftlichen Leben auswirken, ja, eventuell gar zu einer Veränderung des Habitus der Zuschauer führen können. Ob und gegebenenfalls wie ästhetische Erfahrungen in Aufführungen tatsächlich länger andauern und in diesem Sinne nachhaltige Transformationen zu bewirken vermögen, lässt sich bis heute allerdings nicht empirisch nachweisen.
DIE VERWANDELNDE KRAFT DER AUFFÜHRUNG
17
II. Diskussion und Weiterentwicklung des Aufführungsbegriffs Die durch die Ästhetik des Performativen angestoßene Diskussion betrifft vor allem drei Problemkomplexe. Der erste ergibt sich aus dem von mir erhobenen Anspruch, dass der in ihr entwickelte Aufführungsbegriff für alle Arten von kulturellen Aufführungen gilt, ganz gleich, ob es sich um Aufführungen des Theaters (Schauspiel, Musiktheater, Tanz) und der Performancekunst oder um andere künstlerische Aufführungen wie Konzerte, Ausstellungen, Installationen, Dichterlesungen u. ä. handelt oder um cultural performances wie Rituale, Feste, Spiele oder Gerichtsverhandlungen, Sportwettkämpfe, politische Versammlungen. Entsprechend wird die Frage gestellt, ob der Aufführungsbegriff tatsächlich vergleichbar dem Text- und dem Bildbegriff als ein kulturwissenschaftlicher Grundbegriff zu gelten hat, vor allem aber, für welche Forschungszusammenhänge er in der Ethnologie, Religionswissenschaft, Theologie, Politik-, Rechts-, Sport- oder Geschichtswissenschaft ein sehr viel geeigneteres heuristisches Instrument darstellt als die bisher verwendeten Begriffe. Diese Frage lässt sich selbstverständlich nicht von der Theaterwissenschaft beantworten, sondern nur durch Anwendung des Begriffs bei der Bearbeitung der in diesen Wissenschaften behandelten Probleme. Der zweite Problemkomplex betrifft die Entwicklung einer Ästhetik des Performativen als einer neuen Wirkungsästhetik. Denn diese Ästhetik hat ihre Pointe gerade darin, dass sie die Aufführung als ein Ereignis begreift, welches sich zwischen Akteuren und Zuschauern zuträgt und eben aufgrund seines Status als eines Zwischengeschehens, das sich durch die leibliche Ko-Präsenz aller Beteiligten konstituiert, unmittelbar auf den Leib, die Einbildungskraft, das Erkenntnis- und Erinnerungsvermögen der Zuschauer einzuwirken vermag. An dieser ‚Macht der Aufführung‘ entzündet sich die Diskussion. Sie betrifft vor allem die Frage, wieweit diese Macht im Einzelfall tatsächlich reicht, und zwar sowohl den individuellen Zuschauer als auch eine Ansammlung von Menschen betreffend. Während in den Sozialwissenschaften die Einsicht in diese Macht der Aufführung vor allem im Falle bestimmter politischer Veranstaltungen zur Aufstellung der Manipulationsthese geführt hat, die behauptet, dass politische Feste und andere Arten von Massenspektakeln dazu geeignet sind, die an ihnen beteiligten Bevölkerungsgruppen im Sinne der Herrschenden zu manipulieren, erscheint im Lichte einer Ästhetik des Performativen eine solche Macht nur begrenzt wirksam zu sein. Denn eine Macht zur Manipulation in solchen Fällen würde voraussetzen, dass die Veranstalter imstande wären, den Verlauf der Aufführung zu steuern und zu kontrollieren, also erfolgreich eben die Inszenierungsstrategien einzusetzen, die ein ‚passives‘, ‚unschuldiges‘ Publikum in der genau vorausberechneten Weise zu überwältigen und das gewünschte Verhalten auszulösen vermöchten. Wenn man dagegen davon ausgeht, dass in eine Aufführung involviert zu sein zugleich bedeutet, in sie einzuwilligen, Mit-Verantwortung zu übernehmen, kann von Manipulation nicht oder jedenfalls nur unter Vorbehalt die Rede sein. Ebenso kontrovers wird die Frage nach der Möglichkeit einer nachhaltigen Wirkung einerseits auf einzelne Zuschauer, andererseits auf ganze Gruppen von Zu-
18
ERIKA FISCHER-LICHTE
schauern diskutiert. Lassen sich bei einzelnen Zuschauern länger andauernde Veränderungen ihres Verhaltens, ihrer Einstellungen und Werte im Gefolge der Teilnahme an einer Aufführung oder einer Reihe von Aufführungen, die mit einer ähnlichen Ästhetik arbeiten, feststellen? Ist entsprechend die Annahme gerechtfertigt, dass in und mit Aufführungen pädagogische oder gar therapeutische Ziele verfolgt werden können, wie u. a. es Schiller in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795), Brecht in seiner Theorie des Lehrstücks (1934) oder Jacob Levy Moreno in seiner Einleitung zur Theorie und Praxis des Psychodramas (1959) postulieren? Wie weit kann die Macht der Aufführung beim einzelnen und bei größeren gesellschaftlichen Gruppen überhaupt reichen? Da physiologische, affektive, energetische und motorische Veränderungen bei einzelnen Zuschauern während der Aufführung beobachtbar sind, lassen sich derartige Transformationen mit gutem Recht behaupten, auch wenn sie nicht in Experimenten beliebig nachvollziehbar sind. Nachhaltige Transformationen betreffend besteht dagegen immer noch großer Forschungsbedarf. Wie weit die Macht der Aufführung zu reichen vermag, welche Langzeitwirkungen tatsächlich auf sie zurückzuführen sind, lässt sich gegenwärtig nicht auch nur mit annähernder Sicherheit feststellen. Der dritte Problemkomplex bezieht sich – in dieser Hinsicht durchaus dem zweiten vergleichbar – auf methodologische Fragen. Während dort sich das Problem stellt, mit welcher Methode eine nachhaltige Wirkung einer Aufführung auf einzelne Zuschauer oder auch Gruppen von Zuschauern nicht nur theoretisch plausibilisiert, sondern empirisch nachzuweisen ist, ergeben sich die methodologischen Fragen auf dem dritten Problemfeld aus der Konstitution der Aufführung selbst, d. h. aus der leiblichen Ko-Präsenz von Akteuren und Zuschauern. Wie kann bei der Analyse einer Aufführung methodisch vorgegangen werden?Während bei der Analyse von Texten und Bildern der Analysierende sich seinem Objekt gegenüber befindet, stellt bei der Aufführungsanalyse der Analysierende selbst ein Element des Prozesses dar, den es zu analysieren gilt. Er ist selbst in ihn involviert und bringt durch sein eigenes Verhalten die Aufführung mit hervor. Die Position eines externen Beobachters ist ihm verwehrt. Bei der Analyse eines Textes kann der Analysierende immer wieder vor- und zurückblättern, ohne dass sich der Text in seiner Materialität dabei ändern würde. Bei der Analyse eines Bildes kann er unterschiedliche Positionen einnehmen; er kann ganz nah an das Bild herantreten, um ein Detail genauer erkennen zu können, oder einen Schritt zurück, um das Bild als Ganzes in den Blick zu nehmen. In beiden Fällen kann der Analysierende sich zwischenzeitlich von seinem Objekt trennen und andere Materialien konsultieren – andere Fassungen oder andere Texte und Bilder zum Beispiel, weitere Dokumente zu den Objekten, ihrem Entstehungsprozess, ihrer ersten und zweiten Rezeption etc. sowie sich mit der seinen Gegenstand oder spezifische Kontexte betreffenden Forschung auseinandersetzen. Mit den so gewonnenen Erkenntnissen kann er dann zu seinem Objekt zurückkehren und so fort. Diese Möglichkeiten bestehen aufgrund der spezifischen Materialität seiner Gegenstände ganz unabhängig von seinem Erkenntnisinteresse und seinen spezifischen Fragestellungen.
DIE VERWANDELNDE KRAFT DER AUFFÜHRUNG
19
Bei der Analyse einer Aufführung dagegen ist ein solches Vorgehen nicht möglich, ganz gleich von welchem Erkenntnisinteresse die Analysierenden ausgehen und welche Fragestellungen sie verfolgen. Wenn sie an einem beliebigen Moment der Aufführung innehalten wollen, um über bestimmte Vorgänge oder Details, die sie besonders irritiert oder fasziniert haben, nachzudenken und auf diese Weise mit der Analyse zu beginnen, werden sie nachfolgende Geschehnisse, die vielleicht ein ganz neues Licht auf eben diese Vorgänge und Details werfen mögen und die Zuschauer in eine ganz andere Atmosphäre versetzen – und insofern für ihre Analyse von grosser Bedeutung sein können – verpassen. Bemühungen um eine systematische Analyse der Aufführung unter welcher Fragestellung auch immer können daher erst einsetzen, wenn die Aufführung vorbei und damit der sinnlichen Wahrnehmung des Analysierenden entzogen ist. Eine Analyse wird daher von seinen Erinnerungen an das ausgehen, was er während der Aufführung wahrgenommen hat. Aus diesem Sachverhalt ergeben sich eine ganze Reihe weiterer Probleme, die allerdings bei jeder Analyse in Abhängigkeit von Erkenntnisinteresse und Fragestellung jeweils anders berücksichtigt werden können und müssen. Der Sonderforschungsbereich Kulturen des Performativen, in dessen Kontext meine Ästhetik des Performativen ausgearbeitet wurde, nahm seine Arbeit zum 1. Januar 1999 auf und beendete sie am 31. Dezember 2010. Es versteht sich daher von selbst, dass unsere Arbeitsgruppe nach der Fertigstellung meiner Ästhetik des Performativen die genannten drei Problemkomplexe weiter diskutiert und bearbeitet hat. Dies gilt aus verständlichen Gründen für den ersten nur mit Einschränkungen. Denn der Einsatz des von mir entwickelten Aufführungsbegriffs in anderen kunstund kulturwissenschaftlichen Disziplinen muss eben dort geleistet werden. Unser Beitrag zur Erprobung seiner Reichweite und Tauglichkeit beschränkte sich entsprechend auf Kooperationen im Sonderforschungsbereich und darüber hinaus.6 Auch jenseits unserer Kooperation ist der Aufführungsbegriff in anderen Kultur6 Vgl. dazu Erika Fischer-Lichte/Clemens Risi/Jens Roselt (Hg.), Kunst der Aufführung – Aufführung der Kunst, Berlin: Theater der Zeit 2004, wo die Zusammenarbeit mit Vertretern anderer Kunstwissenschaften sowie der Sozialwissenschaften innerhalb und außerhalb des Sonderforschungsbereichs bereits in dessen erster Phase dokumentiert ist; u. a. auch Dorothea von Hantelmann, How To Do Things With Art, Zürich/Berlin: diaphanes 2007; Gunter Gebauer, Sport in der Gesellschaft des Spektakels, St. Augustin: Academia 2002; ders./Thomas Alkemeyer/Uwe Flick (Hg.), Treue zum Stil. Die aufgeführte Gesellschaft, Bielefeld: transcript 2004; Christoph Wulf/Jörg Zirfas (Hg.), Rituelle Welten, Berlin: Akademie 2003; dies. (Hg.), Die Kultur des Rituals, Inszenierungen, Praktiken, Symbole, München: Wilhelm Fink 2004. Alle genannten Herausgeber waren Mitglieder des Sonderforschungsbereichs; Klaus Peter Köpping/Ursula Rao (Hg.), Im Rausch des Rituals, Münster/Hamburg/London: LIT 2000; Jürgen Martschukat/Steffen Patzold (Hg.), Geschichtswissenschaft und ‚performative turn‘. Ritual, Inszenierung und Performanz, Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2003; Lutz Musner/Heidemarie Uhl (Hg.), Wie wir uns aufführen. Performanz als Thema der Kulturwissenschaften, Wien: Löcker 2006; Herbert Willems (Hg.), Theatralisierung der Gesellschaft, 2 Bde, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2009. Mit allen hier genannten Autoren und Herausgebern bestand bzw. besteht noch eine enge Zusammenarbeit.
20
ERIKA FISCHER-LICHTE
wissenschaften rezipiert und hat sich nicht nur als tragfähig, sondern auch als ausgesprochen produktiv erwiesen.7 Gleichwohl sind die von ihm eröffneten Möglichkeiten noch keineswegs ausgeschöpft, wie u. a. der erste Teil des vorliegenden Bandes eindrucksvoll belegt. Zwar hat sich unsere Arbeitsgruppe durchaus auch darum bemüht, den Aufführungsbegriff für andere Kunst- und Kulturwissenschaften, insbesondere für Kunstund Kulturgeschichte fruchtbar zu machen.8 Dabei stand das zweite Problemfeld im Zentrum des Interesses. Die beiden auf Phänomene und Prozesse der bildenden Kunst bezogenen Arbeiten fokussieren die unmittelbare Wirkung von performativen Räumen auf ihre Besucher, die beiden kulturhistorischen Untersuchungen gelten dem Problem der Nachhaltigkeit von Wirkungen, die in der Tat letztlich nur durch historische Untersuchungen ermittelt werden kann. Die Frage nach der Macht der Aufführung, nach ihren Wirkungen und deren Nachhaltigkeit, die auch in den genannten Studien von Mitgliedern unserer Arbeitsgruppe gestellt wurde, stand nach dem Erscheinen der Ästhetik des Performativen ebenso wie das dritte Problemfeld im Zentrum von Reflexionen, Diskussionen und Untersuchungen unserer Arbeitsgruppe. Raum und Räumlichkeit betreffend wurde zum einen der Versuch unternommen, die Wirkung von Atmosphären besser zu erklären, indem ihre Wahrnehmung und ihre Erzeugung genauer erforscht wurden.9 Zum anderen wurde der Frage nachgegangen, mit welchen Mitteln Räume der Aufführung Grenzen einerseits zwischen dem theatralen und dem gesellschaftlichen Raum des Alltags und andererseits zwischen den Akteuren und Zuschauern ziehen bzw. im Falle gegebener Grenzen diese überschreiten oder ganz aufheben.10 Diese generelle Frage wurde angeregt durch Untersuchungen, die in der Gruppe zum Problem der Gemeinschaftsbildung im Theater durchgeführt wurden. Dabei interessierten vor allem solche Gemeinschaften, die nicht bereits vor Beginn der Aufführung bestanden wie bestimmte religiöse, weltanschauliche, ideologische oder politische Gemeinschaften, die durch die gemeinsame Teilnahme an einer Aufführung lediglich bekräftigt werden können. Vielmehr fokussierten die 7 Vgl. etwa Ursula Roth, Die Theatralität des Gottesdienstes, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2006; David Plüss, Gottesdienst als Textinszenierung, Zürich: Theologischer Verlag Zürich 2007. 8 Mit Blick auf die Kunstgeschichte vgl. Barbara Gronau, Theaterinstallationen. Performative Räume bei Beuys, Boltanski und Kabakov, München: Wilhelm Fink 2010; Sandra Umathum, Kunst als Aufführungserfahrung. Zum Diskurs intersubjektiver Situationen in der zeitgenössischen Ausstellungskunst. Felix Gonzalez-Torres, Erwin Wurm und Tino Sehgal, Bielefeld: transcript 2011; mit Blick auf die Kulturgeschichte vgl. Kristiane Hasselmann, Die Rituale der Freimaurer. Zur Konstitution eines bürgerlichen Habitus im England des 18. Jahrhunderts, Bielefeld: transcript 2009; Doris Kolesch, Theater der Emotionen. Ästhetik und Politik zur Zeit Ludwigs XIV, Frankfurt a. M.: Campus 2006. 9 Vgl. Sabine Schouten, Sinnliches Spüren. Wahrnehmung und Erzeugung von Atmosphären im Theater, Berlin: Theater der Zeit 2007. 10 Vgl. hierzu Erika Fischer-Lichte/Benjamin Wihstutz (Hg.), Politik des Raumes. Theater und Topologie, München: Wilhelm Fink 2010.
DIE VERWANDELNDE KRAFT DER AUFFÜHRUNG
21
Untersuchungen solche Gemeinschaften, die erst in der und durch die Aufführung als ein Resultat des gemeinsamen Erlebnisses der Aufführung sowie der in ihrem Verlauf geteilten Erfahrungen entstehen. Für diese Gemeinschaften wurde der Begriff der ‚theatralen Gemeinschaften‘ geprägt.11 In diesem Zusammenhang wurde der Rhythmus als ein im Hinblick auf Gemeinschaftsbildung besonders wirkungsmächtiges Phänomen näher erforscht. Im Zentrum des Interesses stand dabei die Prozessualität von Rhythmen und ihr Ordnungen herstellendes Vermögen, die Intermodalität ihrer Wahrnehmung sowie die durch sie ausgelösten Affekte.12Neben der Bildung von Gemeinschaften interessierte sich unsere Arbeitsgruppe vor allem für Macht, die sich in Aufführungen in intersubjektiven Relationen entfaltet. Wie lassen sich die immer wieder beobachteten physiologischen, affektiven, energetischen und motorischen Transformationen, die einzelne Zuschauer – häufig auch die Mehrheit der Zuschauer – in der Aufführung durchlaufen, theoretisch fassen? Um diese Frage zu klären, wurden zum einen Wahrnehmungsprozesse genauer erforscht und zwar sowohl von Seiten der Akteure als auch von Seiten der Zuschauer.13 Eine spezielle Untersuchung wurde in diesem Zusammenhang dem Blick gewidmet, in der die leibliche Ko-Präsenz von Akteuren und Zuschauern als Möglichkeit von Blickrelationen adressiert wurde, die als Verhältnisse des Sehens und Gesehenwerdens zu analysieren sind. Dabei wurde einerseits das Verhältnis von Blick und Körperlichkeit sowie von Blick und Räumlichkeit untersucht und andererseits das Verhältnis von Blick zu Emotionalität, Begehren und Macht. Im Zentrum standen die Wirkungen des Blickens und Angeblicktwerdens.14 Zum anderen wandte sich unsere Aufmerksamkeit den Emotionen zu, von denen Zuschauer im Laufe der Aufführung affiziert werden.15 Dabei wurde immer wieder bestätigt, dass und in welcher Weise die ästhetische Erfahrung als eine spezifische Form von Schwellenerfahrung, also der Zustand der Liminalität, in den die Wahrnehmung den Wahrnehmenden versetzt, die Voraussetzung für die Transformation darstellt, die in der Aufführung durchlaufen werden kann.16 In diesem Zusammenhang wurden zum einen die Wirkungen fokussiert, welche einzelne Momente der Aufführung – häufig ‚markante Momente‘ (Jens Roselt) – 11 Vgl. Matthias Warstat, Theatrale Gemeinschaften. Zur Festkultur der Arbeiterbewegung 19181933, Tübingen/Basel: A. Francke 2005; Erika Fischer-Lichte, Theatre, Sacrifice, Ritual. Exploring Forms of Political Theatre, London/New York: Routledge Chapman & Hall 2005. 12 Vgl. Christa Brüstle/Nadia Ghattas/Clemens Risi/Sabine Schouten (Hg.), Aus dem Takt. Rhythmus in Kunst, Kultur und Natur, Bielefeld: transcript 2005. 13 Vgl. Erika Fischer-Lichte/Barbara Gronau/Sabine Schouten/Christel Weiler (Hg.), Wege der Wahrnehmung. Authentizität, Reflexivität und Aufmerksamkeit im zeitgenössischen Theater, Berlin: Theater der Zeit 2006. 14 Vgl. Adam Czirak, Partizipation der Blicke. Szenerien des Sehens und Gesehenwerdens in Theater und Performance, Bielefeld: transcript 2012. 15 Vgl. Clemens Risi/Jens Roselt (Hg.), Koordinaten der Leidenschaft. Kulturelle Aufführungen von Gefühlen, Berlin: Theater der Zeit 2009. 16 Vgl. Erika Fischer-Lichte/Robert Sollich/Sandra Umathum/Matthias Warstat (Hg.), Auf der Schwelle. Kunst, Risiken und Nebenwirkungen, München: Wilhelm Fink 2006.
22
ERIKA FISCHER-LICHTE
beobachtbar in Zuschauern hervorrufen.17 Zum anderen wurde der Versuch unternommen, die von der Ästhetik des Performativen entworfene neue Wirkungsästhetik weiter zu entwickeln und zu erforschen, welche länger andauernden Wirkungen die Teilnahme an Aufführungen vor allem in therapeutischer Hinsicht zu entfalten vermag.18 In allen unseren Untersuchungen sind immer wieder Analysen von Aufführungen des Gegenwartstheaters unter den unterschiedlichsten Fragestellungen vorgenommen worden. Insofern ging die Arbeit auf dem zweiten und dem dritten Problemfeld überwiegend Hand in Hand. Mit Blick auf die spezifische Fragestellung galt es, jeweils neue Analysenmethoden zu entwickeln, die der besonderen Situation der Analysierenden als Teil des Prozesses, den es zu analysieren galt, Rechnung tragen; eine zusammenfassende Publikation, welche die spezifischen bei unserer Analyse auftretenden Probleme darstellt und diskutiert, wird demnächst erscheinen.19 Obwohl wir auf den genannten Problemfeldern in den vergangenen Jahren intensiv gearbeitet haben, bleiben weiterhin viele Fragen offen bzw. sind neue Probleme aufgetaucht. Die Abschlusskonferenz unseres Projektes im Frühjahr 2010 sollte dazu dienen, einige dieser Fragen und Probleme aufzugreifen und mögliche Antworten auf sie bzw. Lösungsvorschläge zu entwerfen. Diese Antworten und Vorschläge werden im vorliegenden Band zur Diskussion gestellt. Damit setzt er nicht nur die Diskussion um die Ästhetik des Performativen auf produktive Weise fort, sondern trägt hoffentlich auch zu ihrer Weiterentwicklung bei.
Literaturverzeichnis Beier, Gerold, Rhythmus. Tanz in Körper und Gehirn, Reinbek b. H.: Rowohlt 2001. Böhme, Gernot, Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1995. Brüstle, Christa/Ghattas, Nadia/Risi, Clemens/Schouten, Sabine (Hg.), Aus dem Takt. Rhythmus in Kunst, Kultur und Natur, Bielefeld: transcript 2005. Czirak, Adam, Partizipation der Blicke. Szenerien des Sehens und Gesehenwerdens in Theater und Performance, Bielefeld: transcript 2012. Fischer-Lichte, Erika, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004. —, Theatre, Sacrifice, Ritual. Exploring Forms of Political Theatre, London/New York: Routledge Chapman & Hall 2005. —/Gronau, Barbara/Schouten, Sabine/Weiler, Christel (Hg.), Wege der Wahrnehmung. Authentizität, Reflexivität und Aufmerksamkeit im zeitgenössischen Theater, Berlin: Theater der Zeit 2006. —/Risi, Clemens/Roselt, Jens (Hg.), Kunst der Aufführung – Aufführung der Kunst, Berlin: Theater der Zeit 2004. 17 Vgl. dazu vor allem die groß angelegte Studie von Jens Roselt, Phänomenologie des Theaters, München: Wilhelm Fink 2008. 18 Vgl. hierzu die Pionierarbeit von Matthias Warstat, Krise und Heilung. Wirkungsästhetiken des Theaters, München: Wilhelm Fink 2011. 19 Vgl. Christel Weiler, Aufführungsanalyse, Tübingen/Basel: UTB 2013 (in Vorbereitung).
DIE VERWANDELNDE KRAFT DER AUFFÜHRUNG
23
—/Sollich, Robert/Umathum, Sandra/Warstat, Matthias (Hg.), Auf der Schwelle. Kunst, Risiken und Nebenwirkungen, München: Wilhelm Fink 2006. —/Wihstutz, Benjamin (Hg.), Politik des Raumes. Theater und Topologie, München: Wilhelm Fink 2010. Gebauer, Gunter, Sport in der Gesellschaft des Spektakels, St. Augustin: Academia 2002. —/Alkemeyer, Thomas/Flick, Uwe (Hg.), Treue zum Stil. Die aufgeführte Gesellschaft, Bielefeld: transcript 2004. van Gennep, Arnold, Les rites de passage, Paris: É Nourry 1909. Gronau, Barbara, Theaterinstallationen. Performative Räume bei Beuys, Boltanski und Kabakov, München: Wilhelm Fink 2010. von Hantelmann, Dorothea, How To Do Things With Art, Zürich/Berlin: diaphanes 2007. Hasselmann, Kristiane, Die Rituale der Freimaurer. Zur Konstitution eines bürgerlichen Habitus im England des 18. Jahrhunderts, Bielefeld: transcript 2009. Kolesch, Doris, Theater der Emotionen. Ästhetik und Politik zur Zeit Ludwigs XIV, Frankfurt a. M.: Campus 2006. Köpping, Klaus Peter/Rao, Ursula (Hg.), Im Rausch des Rituals, Münster/Hamburg/London: LIT 2000. Martschukat, Jürgen/Patzold, Steffen (Hg.), Geschichtswissenschaft und ‚performative turn‘. Ritual, Inszenierung und Performanz, Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2003. Musner, Lutz/Uhl, Heidemarie (Hg.), Wie wir uns aufführen. Performanz als Thema der Kulturwissenschaften, Wien: Löcker 2006. Plüss, David, Gottesdienst als Textinszenierung. Perspektiven einer performativen Ästhetik des Gottesdienstes, Zürich: Theologischer Verlag Zürich 2007. Risi, Clemens/Roselt, Jens (Hg.), Koordinaten der Leidenschaft. Kulturelle Aufführungen von Gefühlen, Berlin: Theater der Zeit 2009. Roselt, Jens, Phänomenologie des Theaters, München: Wilhelm Fink 2008. Roth, Ursula, Die Theatralität des Gottesdienstes, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2006. Schouten, Sabine, Sinnliches Spüren. Wahrnehmung und Erzeugung von Atmosphären im Theater, Berlin: Theater der Zeit 2007. Turner, Victor, The Ritual Process – Structure and Anti-Structure, London: Routledge & Kegan Paul 1969. Umathum, Sandra, Kunst als Aufführungserfahrung. Zum Diskurs intersubjektiver Situationen in der zeitgenössischen Ausstellungskunst. Felix Gonzalez-Torres, Erwin Wurm und Tino Sehgal, Bielefeld: transcript 2011. Warstat, Matthias, Krise und Heilung. Wirkungsästhetiken des Theaters, München: Wilhelm Fink 2011. —: Theatrale Gemeinschaften. Zur Festkultur der Arbeiterbewegung 1918-1933, Tübingen/Basel: A. Francke 2005. Weiler, Christel, Aufführungsanalyse, Tübingen/Basel: UTB 2013 (in Vorbereitung). Willems, Herbert (Hg.), Theatralisierung der Gesellschaft, 2 Bde, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2009. Wulf, Christoph/Zirfas, Jörg (Hg.), Die Kultur des Rituals, Inszenierungen, Praktiken, Symbole, München: Wilhelm Fink 2004. —/— (Hg.), Rituelle Welten, Berlin: Akademie 2003.
DISKURS
FRANK RICHARZ
Diskurse der Aufführung – Die vierfache Diskursivierung eines Begriffs
Nach Beendigung des DFG-Sonderforschungsbereiches Kulturen des Performativen1, der sicherlich zu den einflussreichsten geisteswissenschaftlichen Forschungsverbünden der letzten Jahre zu zählen ist, ergibt sich ganz automatisch die Frage nach dem, was bleiben wird. Dieser Frage ist natürlich auch unsere Arbeitsgruppe Ästhetik des Performativen nachgegangen und hat sie in den Mittelpunkt ihrer Abschlusstagung MachtTheaterWissenschaft gestellt, deren Ergebnisse und Fragestellungen nun in diesem Band vorliegen. Wie Erika Fischer-Lichte bereits in ihrer Einleitung dieses Bandes dargelegt hat, interessierte uns dabei die weitere Ausarbeitung der Ästhetik des Performativen als Wirkungsästhetik mitsamt den daraus resultierenden methodologischen Problemund Fragestellungen. Insbesondere war uns daran gelegen, den Aufführungsbegriff als einen kulturwissenschaftlichen Grundbegriff in der Forschungspraxis jenseits der Theaterwissenschaft fruchtbar zu machen. Wie ist es also bestellt um die aktuelle Diskursivierung der Aufführung innerhalb des akademischen Feldes im Allgemeinen und die Wirkung und Bedeutung des von Fischer-Lichte geprägten Aufführungsbegriffs im Besonderen? Es erscheint mir schwierig, diese Frage gegenwärtig zu beantworten. Das Problem ist dabei einerseits der Begriff des Diskurses selbst, der in den Geistes- und Sozialwissenschaften mehrere Bedeutungen hat, und andererseits das daraus resultierende methodische Problem der ‚Diskursanalyse‘. Hier ist nicht der Raum, um sich dem zweiten Problem – der Methode – angemessen widmen zu können.2 Daher möchte ich mich an dieser Stelle auf das zeitgenössische Wechselverhältnis von Diskurs und Aufführung konzentrieren, indem ich ein heuristisches Hybridmodell verschiedener Diskursbegriffe vorschlage, das in der Lage ist, Diskursivierung auch als einen bewussten Akt des wissenschaftlichen Engagements zu fassen.
1 Der Sonderforschungsbereich Kulturen des Performativen der Deutschen Forschungsgemeinschaft war ein großer geisteswissenschaftlicher Forschungsverbund an der Freien Universität Berlin. Er bestand von 1999 bis 2010. Vgl. http://www.sfb-performativ.de (Stand: 2.3.2012). 2 Hierzu liegen bereits viele gute Einführungen vor, auf die ich an dieser Stelle verweisen möchte: Reiner Keller, Diskursforschung: Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2011; Achim Landwehr, Historische Diskursanalyse, Frankfurt a. M.: Campus 2008; Sara Mills, Der Diskurs: Begriff, Theorie, Praxis, Tübingen: A. Francke 2007; Philipp Sarasin, Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2003.
28
FRANK RICHARZ
Auf der ersten Ebene meines Modells ordne ich das an, was Foucault in Die Ordnung der Dinge und Archäologie des Wissens unter Diskurs versteht. Es handelt sich um eine Formation tatsächlich getätigter Aussagen, die als historische Monumente archäologisch beschreibbar werden. Dieses relational aufgespannte Feld von Aussagen ist zugleich ein Feld von Wirkungen, das bestimmte Aussagen zulässt und andere nicht und damit auch bestimmte Sprecherpositionen ein- und andere ausschließt. Um eine Diskursanalyse des Aufführungsbegriffes zu leisten, müsste man also sammeln, welche Aussagen in einem bestimmten historischen Zeitraum über die Aufführung getätigt worden sind, um herauszufinden, wie der Aufführungsdiskurs strukturiert ist. Alle in diesem Band versammelten Beiträge gehören naturgemäß zum zeitgenössischen Diskurs der Aufführung in diesem Sinne, da sie allesamt Aussagen über die Aufführung treffen. Dabei kann man Fischer-Lichtes Theorie als eine Diskursivierungslinie neben anderen abbilden. Präzisere Beschreibungen lassen sich auf der zweiten Ebene machen. Diskurse dieser Ebene sind in sich geschlossene, relativ kohärente Begriffssysteme und Logiken, die neben anderen Diskursen bestehen und mit diesen in Konflikt geraten können, sobald sich beide im Widerstreit auf die gleichen Dinge beziehen. Dieser Widerstreit, den Lyotard in seinem gleichnamigen Hauptwerk für unvermeidbar hält,3 kommt im akademischen Alltag sehr häufig vor. Gerade wenn es um die Begriffshoheit in neuen Forschungsfeldern geht, stehen verschiedene Diskurse oft in einem erbitterten Wettstreit miteinander. Diese Begriffshoheit oder -hegemonie ist das geisteswissenschaftliche Pendant zum Begriff des Paradigmas, den Thomas S. Kuhn in seiner epochemachenden Schrift Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen für die Naturwissenschaften eingeführt hat. In den Geisteswissenschaften lässt sich kein Paradigma ausmachen, auf dessen Basis eine ‚Normalwissenschaft‘ arbeiten könnte. Die Begriffe und Methoden sind im ständigen Fluss, sodass es nur vorübergehend zu begrifflichen und methodologischen Hegemonien im Feld der Geisteswissenschaften kommen kann. Allerdings kann die Hegemonie eines Begriffs auch ein Scheinphänomen sein, wenn sich auf der zweiten Ebene im Laufe der Diskurs-Auseinandersetzungen ein heterogenes Bedeutungsfeld eines Wortes auf der ersten Diskursebene scheinbar durchzusetzen beginnt. Im Klartext bedeutet dies, dass sich im wissenschaftlichen Gebrauch zwar das Wort „Aufführung“ durchsetzen könnte, aber im Laufe seiner Durchsetzung von einer präzisen Bestimmung oder Theorie entkoppelt werden und schließlich alles Mögliche bedeuten kann, sodass die Brauchbarkeit des Begriffs im Zuge dieser Durchsetzung gefährdet wird. In einem solchen Fall wird es notwendig, einen Meta-Diskurs zu führen, um sich über die verschiedenen Begriffspraktiken zu verständigen. Diesen Meta-Diskurs hält Jürgen Habermas im Gegensatz zu Lyotard stets für möglich, sofern man sich auf ein rationales, argumentatives Verfahren einigt, das
3 Vgl. Jean Lyotard, Der Widerstreit, München: Wilhelm Fink 1989.
DISKURSE DER AUFFÜHRUNG
29
auf strategische Sprachpraktiken verzichtet.4 Auf dieser dritten Ebene ist der Diskurs ein idealisiertes Verfahren, dessen scheinbare Universalität nicht seine Herkunft aus der europäischen Wissenschafts- und Philosophiegeschichte verbergen kann. Es wäre nun aber zu einfach, den Habermas’schen Entwurf aufgrund seiner idealistischen und eurozentristischen Tendenzen aufzugeben, da in ihm eine wichtige ethische Ausrichtung wissenschaftlicher Diskursivität aufgerufen wird, auf die wir uns in unserem täglichen wissenschaftlichen Handeln beziehen und verlassen. Wenn wir den Habermas’schen Diskurs als das begreifen, was er eigentlich ist, nämlich die Idealisierung einer Praxis, die sich nach einem bestimmten Wissenschaftsethos ausrichtet, dann bleibt das übrig, was ich einen pragmatisch geführten Diskurs nennen möchte, der es als Form des reziproken Austauschs nach klaren – und fairen – Regeln ermöglicht, Diskursivierungen in bedingter Form zu kontrollieren. Auf wissenschaftlichen Tagungen ist es möglich, von der zweiten auf die dritte Ebene des Diskurses zu gelangen, wenn man sich ernsthaft um einen verständigungsorientierten Sprachgebrauch bemüht. Jeder Diskurs der zweiten Ebene lebt vom Austausch und von der Befruchtung durch andere Ansichten, die in anderen Bezugsrahmen entstanden sind. So war für Fischer-Lichte zum Beispiel der Austausch mit der Anthropologie wichtig, um ihre Ästhetik des Performativen formulieren zu können. Die Tagung, deren Ergebnisse in diesem Band veröffentlicht werden, ist ein Zeugnis eines solchen Diskurses, den wir bewusst führen, um auf der einen Seite die Ästhetik des Performativen zu erweitern und auf der anderen Seite auch die Anwendung der Theorie in anderen Kontexten zu initiieren. Neben der bedingten Kontrolle von Diskursivierungen durch verständigungsorientierten Sprachgebrauch gibt es auch auf einer vierten Ebene die Möglichkeit, Diskurse zu initiieren oder zu revitalisieren, indem man ein Diskursangebot macht. Das Wort ‚Diskurs‘ bezieht sich nämlich nicht notwendig auf eine reziproke Struktur, die wir mehr oder weniger auf den drei anderen Ebenen finden. Es kann auch einfach ‚Vortrag‘ oder ‚Abhandlung‘ bedeuten. Hier gibt es noch keine reziproke Struktur, wohl aber einen möglichen Adressaten. Diese Form des Diskurses, die sich auch auf der ersten Ebene eingliedern lässt und oftmals der Vermittlung eines Diskurses zweiter Ebene dient, kann auch einen Diskurs der dritten Ebene in der Zukunft ermöglichen, denn Medien wie Schrift, Ton und Bild können geduldig auf den Adressaten warten, der durch diesen Diskurs in einen Diskurs der anderen Ebenen eintritt (1-2) oder eingreift (3). Die Diskursivierung der Aufführung findet nach diesem Modell also immer auf allen vier Ebenen gleichzeitig statt. Sie ist eine Bewegung, die von der Gegenwart in die Vergangenheit und in die Zukunft wirkt. Die Vielschichtigkeit der Bewegung macht ihre Komplexität aus, die jederzeit Emergenzen hervorzubringen vermag. Daher ist es nicht sinnvoll, alle Formen unter eine zu subsumieren, da ansonsten viele Facetten der Diskursivierung unsichtbar und daher auch unbegreifbar 4 Vgl. Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1987.
30
FRANK RICHARZ
werden würden. Gerade das sollte einem Begriff im Laufe seiner Diskursivierung nicht geschehen. Eine Foucault’sche Diskursanalyse des zeitgenössischen Aufführungsbegriffs wäre daher auch nicht ausreichend, um die Aufführung in ihrer aktuellen Diskursivierung zu betrachten. Die vier Ebenen des Diskurses lassen sich nicht vollständig auf der ersten Ebene abbilden. Der aktuell geführte und gelebte Diskurs verhält sich zur analytisch rekonstruierten Diskursformation wie der durch die Lüfte fliegende Archaeopteryx zu seinem berühmten Fossil im Berliner Naturkundemuseum. Die Gegenwart ist nicht bereits skelettiert und in Stein konserviert. Sie ist in Bewegung und voller Irrwege und Sackgassen. Daher müssen wir uns in ihr engagieren, statt sie bereits aus der Distanz lediglich als Diskurs (im Sinne Foucaults) zu analysieren. In dieser Weise versteht sich dieses Buch als engagierter Beitrag zur lebendigen und vielschichtigen Diskursivierung der Aufführung und will diese aktiv mitgestalten. Die Beiträge dieses Bandes tragen auf je unterschiedliche Weise zur Diskursivierung der Aufführung bei. Während jedoch in den Abschnitten ‚Macht‘ und ‚Analyse‘ eher speziellere Diskurse geführt werden, soll hier ein transdisziplinärer Diskurs über Gebrauchsweisen des Aufführungsbegriffs veranschaulicht werden. Dabei kam es uns gerade nicht auf die getrennte Darstellung verschiedener Disziplinen an, sondern auf das Aufzeigen verschiedener Begriffspraktiken, die auf jeweils verschiedene Frage- und Problemstellungen reagieren. So kommt es, dass drei von fünf Beiträgen von Theaterwissenschaftlern stammen (Barbara Gronau, Alan Read, Matthias Warstat) und nur zwei aus anderen Disziplinen, der Ethnologie (Klaus-Peter Köpping) und der evangelischen Theologie (David Plüss). Dennoch werden eine Vielzahl von Forschungsfeldern behandelt: bildende Kunst (Gronau), Biologie (Read), Anthropologie, Ritualforschung (Read, Köpping, Plüss), Politik (Warstat), Liturgie (Plüss) und natürlich Theater bzw. PerformanceKunst (Warstat, Read). Nachdem Erika Fischer-Lichte in der Einleitung ihren Aufführungsbegriff definiert hat, mit dem viele Autoren dieses Bandes arbeiten, möchten wir diesen Abschnitt mit dem Aufsatz „Ausstellen und Aufführen. Performative Dimensionen zeitgenössischer Kunsträume“ von Barbara Gronau einleiten, da dieser durch eine etymologische Herleitung des Aufführungsbegriffs das Bedeutungsfeld noch einmal weiter aufspannt. Bei der folgenden Lektüre wird man in der Lage sein, mit diesem Werkzeug aufmerksamer auf die feinen Unterschiede in den Begriffspraktiken zu achten. Dem Verhältnis von Ausstellen und Aufführen nähert sich Gronau über die Analyse der Rauminszenierung in der bildenden Kunst. In zeitgenössischen Installationen wuchere einerseits das Objekt der Ausstellung zunehmend in den Raum hinein und werde andererseits mit dem umgebenden Raum immer stärker in ein kontextuelles Verhältnis gesetzt, sodass sich die Besucher nicht mehr einem Objekt gegenüber sähen, sondern vielmehr in eine Situation einträten. Dies zeigt Gronau am Beispiel der Arbeit Aus den Archiven – The ReCollection Mechanism des amerikanischen Künstlers Arnold Dreyblatt, in der es darum geht, in einem Wechselspiel von Sehen und Gesehenwerden „biographisches Archivmaterial aus seiner historisch tradierten Form zu lösen, neu zu kombinieren und in den Kontext
DISKURSE DER AUFFÜHRUNG
31
einer gegenwärtigen Erfahrung zu stellen“5. Gronau zeigt, dass nicht nur die Ausstellung durch den performative turn einen Aufführungscharakter im Sinne FischerLichtes erhält, sondern dass durch die performative Ausstellungspraxis auch dem Aufführungsbegriff ausstellende Aspekte hinzugefügt werden, die nichts mit herkömmlichen theatralen Repräsentationslogiken zu tun haben. Auch der Londoner Theaterwissenschaftler Alan Read nimmt in seinem Aufsatz „Über Aufführung überhaupt und über die Aufführung des Menschen – Bemerkungen über das Theater vor der Identitätstheorie“ eine Neuakzentuierung des Aufführungsbegriffs vor, ohne sich dabei jedoch direkt auf die Ästhetik des Performativen zu beziehen. Anhand aktueller Aufführungsbeispiele sucht er im Rekurs auf Giorgio Agamben nach der kleinen Lücke zwischen den empirisch aufgefundenen Aufführungen und einem Allgemeinbegriff der Aufführung. Diese Lücke birgt das Potenzial einer Aufführung überhaupt, zur Agamben’schen anthropologischen Maschine zu werden. Immer wieder scheide sie den Menschen vom Tier, um dabei immer wieder nur auf das nackte Leben zu treffen. Doch dabei produziere sie von Aufführung zu Aufführung stets einen feinen Unterschied, den als einziges Tier nur der Mensch wahrnehmen könne, der daher die Aufführung auch immer wieder von vorne beginnen lasse. Auf völlig neue Weise figuriert Read damit das Thema der Unwiederholbarkeit der Aufführung im Verhältnis zur inszenierten Ähnlichkeit, wie es auch in Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen verhandelt wird. Interessanter Weise spielen in beiden Theorien Tiere auf der Bühne eine nicht unwichtige Rolle. Die Diskurse über den Aufführungsbegriff haben sich in den letzten Jahren vor allem innerhalb und im Wechselspiel zweier Bezugsrahmen entwickelt, die Matthias Warstat in seinem Beitrag thematisiert: Theatralität und Performativität. Damit schafft er eine Brücke zwischen den Beiträgen von Gronau und Read auf der einen Seite, die eher innerhalb des performativen Bezugsrahmens anzusiedeln sind und den folgenden Beiträgen von Köpping und Plüss auf der anderen Seite, die eher einem erneuerten Theatralitätsdiskurs zuzuordnen sind – wobei die beiden nicht trennscharf zu unterscheiden sind, da der neuere Theatralitätsdiskurs vieles vom Performativitätsdiskurs aufgenommen hat. Warstat weist auf die Ähnlichkeit der Begriffe in der theaterwissenschaftlichen Diskussion hin, ohne sie jedoch ineinander aufgehen zu lassen. So sei der Begriff der Theatralität immer auch zu historisieren, da er sich stets auf eine besondere historische und kulturelle Figuration des Theaters beziehe. Durch den Performativitätsdiskurs sei die Theaterwissenschaft auf Themen wie „Welterzeugung, Selbstreferenzialität, aber auch Iterabilität und Zitation“ gestoßen worden, die im Theatralitätsdiskurs keine wichtige Rolle gespielt hätten. Im Wechselspiel beider Bezugsrahmen erläutert Warstat das Potenzial von Politiken des Theatralen und des Performativen, das sich in Aufführungen zeigt: „Ohne den Augenblick der Krise, den plötzlichen Wendepunkt, die Möglichkeit zum Umschlag gibt es keine performative Politik und kein theatrales Dis5 Die folgenden Zitate entstammen immer, wenn nicht anders angegeben, den besprochenen Beiträgen.
32
FRANK RICHARZ
positiv.“ Aus diesem Grund seien diese Politiken gerade in Krisenzeiten fruchtbare Praktiken, da sie politische Emergenzen hervorzubringen vermögen. Im Bezugsrahmen der Theatralität entwickelte sich ein Austausch zwischen Anthropologie und Theaterwissenschaft, der sich bis in den aktuellen Performativitätsdiskurs weiterverfolgen lässt. So finden sich auch in Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen zahlreiche Bezüge zur Ritualforschung. Auch die darin unternommene Neubestimmung ästhetischer Erfahrung als Schwellenerfahrung ist aus der fruchtbaren Begegnung von Anthropologie und Theaterwissenschaft entstanden. So ist es nicht verwunderlich, dass in diesem Band gleich zwei Anthropologen zu Wort kommen – Tobias Rees und Klaus-Peter Köpping. Während Rees in der Nachfolge von Paul Rabinow neue methodologische Wege beschreiten will,6 zeigt Klaus-Peter Köpping, wie sich durch die Zusammenarbeit auch die Beschreibungen von Ritualen geändert haben. Dabei ist auffällig, dass Köpping Theatralität und Performativität kaum voneinander trennt, sondern beide Bezugsrahmen miteinander verbindet. In seinem Beitrag demonstriert Köpping am Beispiel japanischer Blumen-Festrituale, „dass Rituale nicht nur theatral sind, sondern des theatralen Aufführungsmodus bedürfen, um wirksam zu sein“. Damit vollzieht er die Umkehrung des Unterschieds zwischen Als-ob-Geschehen und Realität, indem er die Wirklichkeit als etwas beschreibt, das performativ aus der Wirksamkeit des rituellen Spiels hervorgeht. Wie die Anthropologie ist auch die evangelische Theologie vor allem über den Bezugsrahmen der Theatralität mit der Theaterwissenschaft verbunden.7 Aus diesem Kontext führt David Plüss den Aufführungsbegriff der Ästhetik des Performativen in die evangelische Liturgiewissenschaft ein. Wie bei Köpping überlagern sich auch hier Performativitäts- und Theatralitätsrahmen. Während die Anwendung des Theatermodells auf den Gottesdienst immer wieder heftig kritisiert worden sei, da der Gottesdienst keinen Als-ob-Rahmen darstelle, scheint der Aufführungsbegriff der Ästhetik des Performativen besser geeignet zu sein, den wirklichkeits- und gemeinschaftskonstituierenden Charakter des Gottesdienstes zu beschreiben. Insbesondere das Konzept der Liminalität macht Plüss für die Erforschung von Gottesdiensten fruchtbar. Man darf gespannt sein, wie sich die Diskursivierung der Aufführung in der Theologie fortsetzt und welche Rückwirkung dies wiederum auf die Theaterwissenschaft haben wird. Wie man sieht, hat nach dem Ende des Sonderforschungsbereiches ‚Kulturen des Performativen‘ die Diskursivierung der Aufführung erst richtig begonnen. Wir hoffen, dass wir mit diesem Band einen Beitrag geleistet haben, diese Diskursivierung nachhaltig mitzugestalten.
6 Vgl. hierzu den Beitrag „Diesseits von Ethnos: Über die heutige Möglichkeit einer ‚neuen‘ Begegnung zwischen Anthropologie und Theater“ von Tobias Rees in diesem Band. 7 Vgl. David Plüss, Gottesdienst als Textinszenierung: Perspektiven einer performativen Ästhetik des Gottesdienstes, Zürich: Theologischer Verlag Zürich 2007; Ursula Roth, Die Theatralität des Gottesdienstes, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2006.
DISKURSE DER AUFFÜHRUNG
33
Literaturverzeichnis Fischer-Lichte, Erika, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004. Habermas, Jürgen, Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1987. Keller, Reiner, Diskursforschung: Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen, Wiesbaden: VSVerlag 2011. Landwehr, Achim, Historische Diskursanalyse, Frankfurt a. M.: Campus 2008. Lyotard, Jean, Der Widerstreit, München: Wilhelm Fink 1989. Mills, Sara, Der Diskurs: Begriff, Theorie, Praxis, Tübingen: A. Francke 2007. Plüss, David, Gottesdienst als Textinszenierung: Perspektiven einer performativen Ästhetik des Gottesdienstes, Zürich: TVZ Theologischer Verlag 2007. Roth, Ursula, Die Theatralität des Gottesdienstes, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2006. Sarasin, Philipp, Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2003.
BARBARA GRONAU
Ausstellen und Aufführen. Performative Dimensionen zeitgenössischer Kunsträume
Die Weigerung, sich den Raum als Kiste vorzustellen, ist die Aufkündigung des Totengräberdienstes an der Wirklichkeit, den die Kunst zu lange versehen hat. Heiner Müller1
Etymologie der Aufführung Am 25. November 2005 stellte die Weltkulturorganisation Unesco eine Proklamation zum Schutz von ‚43 Meisterwerken des immateriellen Kulturerbes‘ in der Öffentlichkeit vor. Auf der Liste finden sich unter anderem das Schattentheater der Khmer aus Kambodscha, die Gesänge sardinischer Schäfer, ein guatemaltekisches Ballett und die Gongkultur in Vietnam.2 Genau genommen ist der Ausdruck ‚Meisterwerke’ unpassend, denn die Spezifik dieser Liste besteht darin, dass sie keine objekthaften Werke, sondern menschliche Praktiken, Kenntnisse und Aufführungsformen versammelt. Die Einsicht, dass nicht nur Texte, Monumente oder Kunstobjekte für die Definition und den Wert einer Kultur ausschlaggebend sind, hat sich in den Wissenschaften seit den 1990er Jahren unter dem Stichwort performative turn etabliert. Die unter Rückgriff auf den englischen Linguisten John L. Austin entwickelten Konzepte des Performativen sind die Basis einer Forschungspraxis, die die Funktion von Praktiken für die Konstitution kultureller Zusammenhänge hervorhebt und jene Aspekte der Wahrnehmung und der Interaktion in den Blick nimmt, durch die semantische Strukturen erst gebildet bzw. immer schon überschritten werden. Das Performative bezeichnet mithin die ereignishaften, körpergebundenen und wirkmächtigen Praktiken, von denen alle Kulturen auf den Ebenen der Politik, Ökonomie, Kunst und Gesellschaft durchdrungen sind. Zur Spezifik des Performativitätsbegriffes gehört jedoch sein Doppelcharakter. In ihm oszillieren Gelingen und Scheitern bzw. Normbildung und -verschiebung, denn der englische Begriff ‚Performance‘ meint einerseits Leistung, Wirkmächtigkeit 1 Heiner Müller, „Untitled 1990 für Robert Rauschenberg“, in: Regie: Heiner Müller, hg. von Martin Linzer/Peter Ullrich, Berlin: Zentrum für Theaterdokumentation und -information 1993, S. 82. 2 Vgl. http://www.unesco.de/immaterielles-kulturerbe.html (Stand: 2.3.2012).
36
BARBARA GRONAU
und Gelingen. Er umschreibt die Erzeugung von Bedeutungen, Körpernormen, sozialen Identitäten, Gefühlskulturen, Spielregeln, Rechtsformen, ökonomischen Wertsteigerungen oder Automotorenleistungen.3 Der Begriff meint aber andererseits auch das Aushandeln und Aufführen und verweist darauf, dass jedes Tun unter spezifischen situativen Bedingungen stattfindet, die die intendierte Wirkung zum Scheitern bringen oder die konventionelle Bedeutung durch Parodie oder Verfremdung transformieren oder subvertieren können.4 Austins Einsicht in den Wirklichkeit konstituierenden Charakter symbolischen Handelns hat sich heute in zahlreiche Performanzkonzepte ausdifferenziert, die sich grob gesprochen in drei Perspektiven unterteilen lassen: eine sprachpragmatische Perspektive wie bei John Searle und Noam Chomsky, die nach den Bedingungen gelingenden Sprechens fragt; eine iterabilisierende Perspektive wie bei Jacques Derrida und Judith Butler, die in der Wiederholung die Möglichkeit zum subversiven Zeichengebrauch erkennt; und schließlich eine korporalisierende Perspektive wie sie Erika Fischer-Lichte u. a. im Anschluss an Milton Singer entwickelt haben, die in körpergebundenen, öffentlichen Aufführungen die Bedingung jeder Kultur erkennt.5 Die Aufführung als Grundmodell performativer Praxis umfasst öffentliche, prozessuale Handlungsvollzüge zwischen verschiedenen Akteuren wie sie sowohl im Theater, als auch bei Festen, Sportveranstaltungen, Zeremonien oder politischen Versammlungen zu finden sind. In allen diesen Situationen treffen Zuschauer und Darsteller bzw. Beobachter und Beobachtete als Teilnehmer aufeinander und agieren miteinander.6 Im Gegensatz zum Begriff der Inszenierung, welcher die der Aufführung vorausgehende Festlegung von Rollen und Handlungen in einem raumzeitlichen Rahmen umfasst, ist mit ‚Aufführung‘ eine ephemere, unwiederholbare und ereignishafte Konstellation zwischen leiblich präsenten Akteuren gemeint. Betrachtet man die Etymologie des deutschen Begriffes ‚Aufführung‘ bzw. des Verbs ‚aufführen‘ so wird darüber hinaus deutlich, dass es sich hier keineswegs um eine zeitgenössische Eindeutschung des englischen performance handelt, sondern dass seinem semantischen Feld von jeher zentrale Topoi der Performanzdiskussion eingeschrieben sind, nämlich die Dimensionen Raum, Deixis, Theatralität und Intersubjektivität. So erinnert das Grimm’sche Wörterbuch daran, dass von „der Aufführung eines Palastes“ oder der „Kanonen“ die Rede sein kann und damit (im Anschluss an das lateinische ‚erigere‘ oder ‚exstruere‘) das in die Höhe Führen, Auf3 Vgl. Jon McKenzie, Perform or Else. From Discipline to Performance, London/New York: Routledge 2001. 4 Vgl. Sybille Krämer, „Was tut Austin, indem er über das Performative spricht? Ein anderer Blick auf die Anfänge der Sprechakttheorie“, in: Performativität und Praxis, hg. v. Dieter Mersch/Jens Kertscher, München: Wilhelm Fink 2003, S. 19-34. 5 Vgl. zu dieser Unterscheidung Sybille Krämers Einleitung in den von ihr hg. Band Performativität und Medialität: Sybille Krämer, „Was haben ‚Performativität‘ und ‚Medialität‘ miteinander zu tun? Plädoyer für eine in der ‚Aisthetisierung‘ gründende Konzeption des Performativen“, in Performativität und Medialität, hg. von ders., München: Wilhelm Fink 2004, S. 11-32, hier: S. 14ff. 6 Vgl. Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004, S. 47.
AUSSTELLEN UND AUFFÜHREN
37
richten, Errichten und Aufbauen von Gebäuden, Häusern, Türmen, Wällen oder Dämmen gemeint war.7 Die Aufführung hat hier eine spatiale Dimension, sie zielt ab auf eine Manifestation des Subjekts im Raum. Darüber hinaus kann eine Aufführung (im Anschluss an das Lateinische ‚extollere‘) im Sinne des feierlichen Vorführens verstanden werden, wenn „Regimenter im Paradeschritt“, „Sklaven im Gepränge“, das erlegte Wild nach einer Jagd oder die Zeugen vor Gericht aufgeführt werden. Diese demonstrativ-zeremonielle Ebene der Aufführung verweist auf das deiktische Potenzial, das jedem performativen Vorgang inhärent ist. Es ist zutiefst verknüpft mit der dritten Bedeutungsdimension der Aufführung, nämlich der „Vorstellung des Stücks“, d. h. einem theatralen Bühnenereignis, das wie schon Goethe wusste, nicht nur dramatische Werke, sondern auch die christliche „Messe“ umfasst. Nicht zuletzt taucht das Aufführen auch als reflexives Verb im Sprachgebrauch auf und markiert ein von Anderen beobachtbares Verhalten gegenüber bestimmten Normen und Erwartungen. „Wie wir uns aufführen“8 ist dabei nicht nur eine Frage intersubjektiver Spielregeln, sondern die Grundsituation aller sozial verfassten Wesen, nämlich das Produzieren des Subjekts über den Blick des Anderen. Der Aufführungsbegriff – so zeigt dieses Bedeutungsspektrum – ist eine genuin performative Kategorie. Ich möchte im Folgenden zeigen, wie diese Kategorie für das Verständnis von Produktion und Rezeption zeitgenössischer Kunst fruchtbar gemacht werden kann. Mit dem Überschreiten traditioneller Bildgrenzen, der Betonung von Flüchtigkeit, Ereignishaftigkeit und Materialität und dem Wunsch nach Betrachterpartizipation haben die Künste seit Mitte des 20. Jahrhunderts vermehrt zu Formen gefunden, die sich kaum noch mit dem Konzept des objekthaften Werkes beschreiben lassen. Am Beispiel der Installationskunst lässt sich zeigen, dass im Zuge dieses Prozesses Bildende Kunst und Theater eine Verbindung eingegangen sind, die beiden Seiten neue Impulse verleiht. Die Frage nach dem Aufführungscharakter stellt sich dabei insofern, als hier nicht nur Begegnungen zwischen Subjekt und Objekt, sondern auch zwischen verschiedenen Subjekten inszeniert werden. Die Vermittlung dieser Begegnung verläuft über die performativen Dimensionen des Raumes.
Aufgeführte Räume Die Reflexion auf den Raum und seine historischen, politischen und institutionellen Parameter kann als eine der wichtigsten Schnittstellen von Bildender Kunst und Theater im zwanzigsten Jahrhundert verstanden werden. Im Konzept der Ortsspezifik – also der direkten Bezugnahme auf den Umgebungsraum – und der Herausbildung der Installationskunst findet sie ihren beispielhaften Ausdruck. 7 Siehe dazu und im Folgenden die Einträge ‚Aufführen‘ und ‚Aufführung‘ in: Jacob Grimm/ Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch, Bd. 1, Leipzig: S. Hirzel 1854, S. 647. 8 Vgl. Lutz Musner/Heidemarie Uhl (Hg.), Wie wir uns aufführen. Performanz als Thema der Kulturwissenschaften, Wien: Löcker 2006.
38
BARBARA GRONAU
Während der white cube des Museums oder der Galerie einen scheinbar neutralen Ort etabliert, in dem der Betrachter autarken Kunstwerken gegenübertritt, thematisieren ortsspezifische und installative Arbeiten sowohl den Ort als auch die Körper und die Bewegungen derjenigen, die sie betreten. Im Bereich des Ästhetischen wird die Auseinandersetzung mit dem Raum zum zentralen Gravitationsfeld performativer Praktiken und Diskurse, markiert er doch jenen Punkt, an dem sich Subjekt und Objekt über eine perzeptive und politisch-soziale Konstellation gegenseitig ausdifferenzieren. Dabei wird dem Raum die Rolle zugesprochen, Austragungsort einer doppelten Überschreitung zu sein: Als Ort gattungsübergreifender ästhetischer Praktiken und als Terrain gesellschaftlicher Bedeutungsvermittlung markiert er das Versuchsfeld, auf dem ästhetische Autonomie über eine Kontextualisierung und Totalisierung des Raumes aufgehoben werden soll. So heißt es etwa in Wolf Vostells ästhetischem Programm Was ich will: „Kunst als Raum, Raum als Umgebung, Umgebung als Ereignis, Ereignis als Kunst, Kunst als Leben.“9 Die angestrebte Transgression verläuft über zwei Strategien: die Kontextualisierung des scheinbar neutralen Galerie- oder Museumsraumes, vor allem durch die Institutionskritik10 und die Ausdehnung, ja Auswucherung des bildnerischen oder plastischen Objektes (die Skulptur wird zur multimedialen Installation und die Blackbox des Bühnenraumes erstreckt sich nunmehr über die Rampe hinaus bis in den Stadtraum). Die Idee des Überschreitens der einzelnen Kunstgattungen und ihre Zusammenführung zu mehrdimensionalen Wahrnehmungsformen findet sich schon in den 1950er Jahren in einer Kunstform, die als direkter Vorläufer der Installationskunst gelten kann: dem Environment.11 Environments sind als gesamträumliche Situationen konzipiert, die ein bestimmtes Maß an körperlicher Partizipation voraussetzen. Ihre Qualität besteht in der Evokation eines ‚taktil-kinästhetischen Wahrnehmungsmodus‘12, der bis zu manifesten Handlungen des Publikums reichen kann und dem von Allan Kaprow ausgegebenen Motto folgt „Go 9 Wolf Vostell, Aktionen: Happenings und Demonstrationen seit 1965, Reinbek b. H.: Rowohlt 1970. 10 Zu Begriff und Geschichte der Institutionskritik vgl. Benjamin H. D. Buchloh, „Von der Ästhetik der Verwaltung zur institutionellen Kritik. Einige Aspekte der Konzeptkunst von 1962-1969“, in: Um 1968. Konkrete Utopien in Kunst und Gesellschaft, hg. v. Marie Luise Syring, Köln: DuMont 1990, S. 86-99; Christian Kravagna (Hg.), Das Museum als Arena. Institutionskritische Texte von KünstlerInnen, Köln: Walther König 2001; Andrea Fraser, „From the Critique of Institutions to an Institution of Critique“, in: Artforum 44:1 (2005), S. 278283. 11 „Before the term ‚installation art‘ became part of the vernacular of contemporary art, there was the term ‚environment‘, which was used by Allan Kaprow to describe room-size multi media works.“ Julie H. Reiss, From Margin to Center. The Spaces of Installation Art, Cambridge/London: MIT Press 1999, S. xi. Nach Reiss taucht der Begriff Environment 1969 im Art Index als allgemeine Bezeichnung auf und wird erst 1978 vom Begriff der Installation abgelöst. 12 Vgl. Lars Blunck, Between Object & Event: Partizipationskunst zwischen Mythos und Teilhabe, Weimar: Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften 2001, S. 21-31. Der Ausdruck geht zurück auf Edmund Husserl und findet sich bereits bei Gerhard Graulich, Die leibliche
AUSSTELLEN UND AUFFÜHREN
39
in, instead of look at“13. Damit fungiert der Raum nicht länger als neutraler Hintergrund, sondern wird selbst zum Gegenstand der Inszenierung. Der Besucher tritt nicht nur einem Objekt gegenüber, sondern in eine Situation ein, die ihn umfängt und adressiert; d. h. er agiert in einem Spiel aus Sehen und Gesehenwerden ein, dass dem ganzen Setting Aufführungscharakter verleiht. Wie stark die Performancekunst mit der ‚Neuentdeckung‘ des Raumes verbunden ist, zeigen die Interferenzen von Environment und Happening in der New Yorker Kunstszene der 1960er Jahre. Das Environment als neue Erlebniszone hat hier immer auch den Charakter eines Spielfeldes, das von den Besuchern mit- und umgestaltet wird.14 Wenn Kaprow formuliert: „Grundsätzlich sind Environments und Happenings einander ähnlich. Sie sind die passive und aktive Seite einer einzigen Medaille, deren Prinzip die Ausdehnung ist,“15 so setzt er theatrale und bildkünstlerischer Verfahren über das Prinzip der Transgression parallel. Hier wird der gestaltete Umgebungsraum zur Bedingung einer Ästhetik der Teilhabe, die den Modus der kontemplativen Distanz überwinden soll. Der Betrachter ist als Partizipierender und Handelnder Teil einer räumlich-sozialen Situation. Ebenso wie das Entstehen der Installationskunst nicht ohne den Einfluss des Theaters zu denken ist, lassen sich umgekehrt die theatralen Erneuerungen der vergangenen fünfzig Jahre erst über das Experimentieren mit installativen Raumformen erklären. Im Schnittpunkt dieser beiden Achsen liegt die Aufführung als zeiträumliches Zusammentreffen von Subjekt- und Objekt-Körpern. Dass und wie die Verbindung aus Subjekten und Objekten in solchen aufgeführten Räumen in Szene gesetzt und wahrgenommen werden kann, möchte ich an einem Beispiel erläutern.
Arnold Dreyblatts Gedächtnisraum als Theaterinstallation Die Arbeit Aus den Archiven – The ReCollection Mechanism des amerikanischen Künstlers Arnold Dreyblatt wurde im Jahr 2000 für den im Hamburger Bahnhof kuratierten Rückblick Das XX. Jahrhundert geschaffen.16 Dreyblatt, der seit den 1990er Jahren multimediale Formate zum Thema Gedächtnis entwickelt hat, beschreibt diese Arbeit als Betreten einer „Datenarchitektur“, in der das Suchen, Aus-
13 14 15
16
Selbsterfahrung des Rezipienten. Ein Thema transmodernen Kunstwollens, Essen: Blaue Eule 1989. Kaprow zitiert nach Reiss, From Margin to Center, a.a.O., S. 24. Vgl. Allan Kaprow, Assemblage, Environments & Happenings, New York: Harry N. Abrams 1965. Allan Kaprow, „Assemblage, Environments & Happenings“, deutsche Übersetzung in: Kunsttheorie im 20. Jahrhundert, Künstlerschriften, Kunstkritik, Kunstphilosophie, Manifeste, Statements, Interviews, hg. v. Charles Harrison/Paul Wood, Bd. 2, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz 2003, S. 862-869, hier: S. 865. Vgl. Klaus Pioch (Hg.), Das XX. Jahrhundert – Ein Jahrhundert Kunst in Deutschland. Ausstellungskatalog, Berlin: Staatliche Museen zu Berlin 1999.
40
BARBARA GRONAU
sortieren und Verorten von Begriffen mit Hilfe einer Hypertextsoftware, eines Lautsprechers und einer Lichtprojektion eine Dekonstruktion von Geschichte erlebbar werden lasse: „An automated writing and recitation machine is found in a darkened black space. One enters a three dimensional data architecture where the process of searching, sorting and locating words and the overlapping inter-textual linkages of information are simulated optically by metaphors of transparence and complexity. Projected onto a barely visible cylindrical screen are multiple transparent layers of continually flowing historical data, which appear to be suspended in the center of the space, and which delineate the room contours with textual landscapes. Two computers randomly search and locate thousands of words within an endless virtual page of biographical information in real time. As each word is found, it is highlighted visually and spoken out loud by a male or female voice. The voices gradually cross each other in time, creating a dialog. The viewer participates in a deconstruction of history through a non-linear and associational reading of forgotten archival fragments.“17
Der Künstler inszeniert inmitten des ‚Museums für Gegenwart‘ eine Höhle der Erinnerung, in der die Besucher in ein Labyrinth aus Worten und Blicken geschickt werden.18 Die Spezifik der Arbeit besteht darin, eine Aufführungssituation zu kreieren, die die Besucher in ein reflexives Verhältnis zu ihrer Rolle als Betrachter bringt. Die dabei entstehenden Blicke, Fragen und Assoziationen verdichten sich zu einer irritierenden Erfahrung die ich zunächst aus der Betrachterperspektive skizzieren möchte. Dreyblatts Installation beginnt mit einem langen, stockfinsteren Gang aus Moltonwänden. An dessen Ende schimmert grünlich ein kleiner Bildschirm, auf dem die Abbilder alter, in verschnörkelter Handschrift ausgefüllter Karteikarten vorüberziehen. Rechts davon öffnet sich der Gang in einen weiteren Raum, aus dem leise Stimmen und elektronische Signale herüber dringen. Im Zentrum dieser Black Box hängt eine luzide Drahtgittersäule von der Decke, auf die durch einen Projektor unaufhörlich ein Fließtext aus Licht auf die Säule projiziert wird. Bei dieser spärlichen Beleuchtung fällt es schwer, eine Orientierung zu gewinnen. Was liegt hinter der Säule? Befinden sich andere Museumsbesucher in diesem Raum? Kann man sich darin bewegen und wenn ja, wie weit? Neben der Verunsicherung über die Dunkelheit strahlt dieser Ort zugleich eine höhlenartige Geborgenheit aus. An der rechten unteren Wand sind – ähnlich einer antiken Orchestra – Stufen angebracht, auf denen man Platz nehmen und das Schauspiel beobachten kann. Die Lichtschrift aus dem Projektor ergießt sich über die Säule hinaus in den Raum und fließt über den Fußboden und die Wand an der Stirnseite. Aus unsichtbarer Quelle tönen Stimmen, die in beruhigender, einschläfernder, ja betörender Monotonie scheinbar unzusammenhängende Worte verlauten lassen: „memories ... fighting ... 17 http://www.dreyblatt.de/pages/arts.php?seite=11&id=&more=92#more (Stand: 02.03.2012). 18 Vgl. Claudia Banz, „Montage des Erinnerns: Clemens Weiss, Hanne Darbroven, Christian Boltanski, Joseph Kossuth, Arnold Dreyblatt“, in: Pioch, Das XX. Jahrhundert, a.a.O., S. 585-589.
AUSSTELLEN UND AUFFÜHREN
41
daughter ... spectacle ... propaganda ... independence ...“. Sie intonieren die im Lichtteppich markierten Begriffe und vermischen sich mit dem Sound von Morsezeichen, der in arrhythmischer Folge aus den Wänden hervorkommt. Obwohl sich kein Sinn aus den Wortgruppen ergibt, formt sich aus ihrer Aneinanderreihung eine Verkettung; greifen die Assoziation zu „daughter“ auf diejenigen zu „spectacle“ über. In hypnotischer Präsenz nennen die Stimmen Länder, Berufe, Orte: „Bohemian, religious, literature, Belgrade...“. Nahezu alle Besucher, die in die Black Box eintreten, reagieren verunsichert, tasten angstvoll mit beiden Händen um sich oder starren bewegungslos in den konturenlosen Raum. Sobald man vor die Drahtgittersäule tritt oder sich um sie herumbewegt, laufen die projizierten Buchstaben, Kommata und Zeilen über den eigenen Körper und verwandeln ihn in eine Leinwand mit Rundungen und Formen. Von der Orchestra aus wird das Durchschreiten des Feldes zum Auftritt vor einer dunklen Beobachtermenge. Das Wissen darum, im Zentrum einer Aufmerksamkeit zu stehen, erzeugt eine situative Spannung, die den ganzen Raum auflädt. Genau das bekommen die Besucher auch zu spüren, wenn sie die Installation verlassen: Sie müssen in das Zentrum des Sichtbaren treten.
Sehen und Gesehenwerden Die Arbeit von Arnold Dreyblatt beschränkt sich nicht auf die ausgestellten Objekte aus Draht, Licht und Sound, sondern integriert auch die Zuschauer in eine Architektur, die zur unmittelbaren Interaktion mit dem Raum und den anderen darin vorhandenen Besuchern aufruft. Sie hat damit den Charakter einer Theaterinstallation, in der Architektur, Medien, Materialien, Klänge, Objekte und Subjekte in einem Raumszenario inszeniert werden, das vom Publikum durch eigene Bewegung und Aktion erschlossen werden muss.19 Theaterinstallationen sind Ausdruck einer künstlerischen und diskursiven Synthese. In ihnen verbinden sich Medien und Materialien die traditioneller Weise einzelnen Künsten zugeordnet werden, zu einem Hybrid, das zur Aufführung gebracht wird. Dabei bewegen sich die Besucher innerhalb von installativ gestalteten oder szenisch veränderten Räumen, die aus Objekten, Sitzgelegenheiten, Videoleinwänden, Lautsprechern, Requisiten und landschaftlichen oder architektonischen Elementen bestehen. Innerhalb dieses Feldes begegnen sie spielenden, tanzenden, Geschichten erzählenden oder stumm anwesenden Akteuren, die die Besucher oft adressierend in ihre Handlungen einbeziehen. Die Besucher werden so in eine Situation gebracht, in der die ästhetische Grenze zwischen ‚Artefakt‘ und ‚Betrachter‘ erweitert, oftmals verunklart wird. In einigen Fällen hat das so entstehende Setting den Charakter eines Parcours, in dem verschiedene Stationen durch Wege verbunden sind, in anderen Fällen tragen die Räume den Charakter von Labyrinthen oder von geschlossenen Welten. Ob die 19 Vgl. Barbara Gronau, Theaterinstallationen. Performative Räume bei Beuys, Boltanski und Kabakov, München: Wilhelm Fink 2010.
42
BARBARA GRONAU
Besucher eine Serie von Einzelszenen abschreiten oder ob sie sich frei durch ein Gelände bewegen, in jedem Fall entsteht die Aufführung erst durch die Bewegung des Publikums in der Theaterinstallation und ist gebunden an eine direkte Interaktion mit der Architektur, der Landschaft und den darin auftretenden Akteuren. Damit ist der jeweilige Ort nicht mehr bloßer Hintergrund der Inszenierung, sondern tritt in seiner institutionellen, sozialen oder architektonischen Funktion, in seiner Historizität und seiner Materialität hervor. Auch der von Arnold Dreyblatt gestaltete Raum lässt sich in diesem Sinne als Bühne lesen: die ihn betretenden Besucher werden unwillkürlich zu Darstellern bzw. Beobachtern einer Aufführungssituation, in deren Mittelpunkt die Exponierung des eigenen Körpers und seine Verwandlung in eine Leinwand steht. Die Raumanordnung macht aus den Museumsbesuchern Zuschauer und Akteure eines Gedächtnistheaters. Auf den nach oben ansteigenden Bänken bietet sich ihm das Kunstwerk als dreidimensionaler Textkorpus dar, dessen äußere Ränder teilweise auf die Zuschauer der hinteren Sitzreihen übergreifen. Der Text wird sowohl auf vertikaler Ebene (in der Drahtgittersäule) als auch auf horizontaler Ebene (dem Fußboden) präsentiert, und verstärkt den Eindruck einer Szenerie aus Bühne und Orchestra. In Analogie zum berühmten ‚Theatro dell’ memoria‘ des barocken Gelehrten Giulio Camillo sind auch hier die Dinge der Welt als Bilder stellvertretend in einem Bühnenrund versammelt.20 Während Camillo jedoch einen universalistischen Horizont des Wissens abzubilden suchte, lässt sich Dreyblatts Theaterinstallation mit Georges Didi-Huberman eher als Aufzeigen der Lücke, des „durchlöcherte(n) Wesens(s)“21 des Archivs begreifen. Das Vorhandensein mehrerer Personen in der Installation erzeugt darüber hinaus eine kollektive Situation, bei der mit dem Wechsel der Position im Raum auch die Positionen innerhalb der theatralen Situation (Beobachtende-Beobachtete) vertauscht werden. Die Interaktion zwischen den Besuchern vollzieht sich vornehmlich über diese Blickverbindung. Der Eintritt ins Bühnenzentrum ist mit einer Sichtbarmachung des eigenen Körpers verbunden. Mit diesem Spiel aus Sehen und Gesehenwerden verweist Dreyblatt auf die zentrale Erfahrung der Intersubjektivität, denn in der Situation des Erblicktwerdens liegt – wie Jean Paul Sartre so treffend ausgeführt hat – der Ausgangspunkt für jede Form von Selbstbewusstsein: „Der Blick, den die Augen [des Anderen] manifestieren, ist reiner Verweis auf mich selbst. Was ich unmittelbar erfasse, wenn ich die Zweige hinter mir knacken höre, ist nicht, dass jemand da ist, sondern dass ich verletzlich bin, dass ich einen Körper habe, der verwundet werden kann, dass ich einen Platz einnehme und das ich auf keinen
20 Vgl. Frances A. Yates, Gedächtnis und Erinnern. Mnemonik von Aristoteles bis Shakespeare, Berlin: Akademie 1994. 21 Georges Didi-Huberman, „Das Archiv brennt“, in: Das Archiv brennt, hg. v. ders./Knut Ebeling, Berlin: Kadmos 2007, S. 7-33, hier: S. 7.
AUSSTELLEN UND AUFFÜHREN
43
Fall aus dem Raum entkommen kann, wo ich wehrlos bin; kurz: das ich gesehen werde.“22
Dreyblatts Arbeit erzwingt jedoch von den Besuchern beide Positionen. Sehen und Gesehenwerden, Zuschauer- und Darstellerpositionen werden wechselweise eingenommen. Im Spiel mit diesen Blicken kann der Einzelne den Akt fremder Bewertung allerdings selbstdarstellerisch nutzen. Er ist nicht Opfer dieser Blicke, sondern kann sich bewusst vor ihnen inszenieren.
Gedächtnisraum Dreyblatts Recollection Mechanism ist nicht nur eine Theatersituation, sondern auch ein Gedächtnisraum. Die Basis dieses Gedächtnisraumes ist ein Archiv aus biografischen Daten von über siebenhundert Personen, die der Künstler in einem antiquarisch entdeckten Who is Who in Central and East Europe von 1933 entdeckt hat.23 Der Künstler hat das Material aus dem Who is Who „wie einen kanonischen Text behandelt, [...] dem nichts hinzugefügt werden kann“24. Mit Hilfe eines computergenerierten Hypertextverfahrens wurden die Einträge jedoch auseinandergenommen, nebeneinander gestellt und unter bestimmten Kategorien wie „Vorfahren, Erbgüter, Radio, Wasser, Minderheiten, individuelle Philosophien“ neu organisiert. Zwei Computer durchstreifen parallel zueinander das Datenmaterial nach bestimmten keywords, springen im Text hin und her und markieren die gefundenen Worte durch Licht. Damit zitiert Dreyblatt den Grundvorgang der antiken ars memorativa, der in der Verknüpfung von Begriffen und Bildern innerhalb einer mentalen Raumarchitektur besteht. Bewegt man sich durch die Installation, so hat man denn das Gefühl, sich im Inneren eines arbeitenden Gehirns zu befinden. Bezeichnenderweise sind die Besucher dabei nicht nur Zuschauer eines Memorationsprozesses, sondern Beteiligte; sie verschmelzen mit dem Text und dem Raum in einer Zone visueller Ununterscheidbarkeit. Das Verfahren der Überlagerung, Verschmelzung und Verflechtung wird auch in den übereinander liegenden Drahtschichten der Säule in der Mitte des Raumes erfahrbar, durch die der projizierte Text Überlappungen und Brüche erhält, die den Überschneidungen der Biografien analog sind.25 22 Jean-Paul Sartre, Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie, Reinbek b. H.: Rowohlt 1993, S. 467. 23 Vgl. Arnold Dreyblatt, Who is Who in Central and East Europe 1933. Eine Reise in den Text, Berlin: Janus 1995. 24 Ebd., S. 5. 25 „Ein Who is Who lebt vom Mythos der Biografie – dass jeder Eintrag zu einer Lebensgeschichte ausgeweitet werden könnte, die das einzigartige Wesen einer Person einfängt – obgleich es diesen Mythos zerstört, indem es jedes Leben auf das kleinste Maß verkürzt und diese Verkürzung nahezu endlos wiederholt, so dass die großen Momente eines Lebens fast austauschbar sind und jede Person zu einem Eintrag wird, hoffnungslos unfähig, seinen Ge-
44
BARBARA GRONAU
Dreyblatts Textpartitur ist kein Versuch die Geschichten der Personen zu rekonstruieren. Vielmehr wird in dem von ihm angewendeten Verfahren genau das sichtbar, was Wolfgang Ernst als ‚Ästhetik der Absenz‘26 gekennzeichnet hat und in dessen Verlauf „sich Lücken auftun, die nicht nur auszuhalten, sondern auch als solche zu schreiben sind“27. Das Gedächtnis der vielen Personen, deren Andenken im Datenmaterial des Who is Who gespeichert ist, wird in Dreyblatts Arbeit als Netzwerk aus Verbindungen und Leerstellen re-inszeniert. Jede Begegnung der Besucher mit dem Text wird somit zum Zusammentreffen von Vergangenheit und Gegenwart, zur Aufführung von Gedächtnis im Prozess des Erinnerns.
Schrift, Stimme und Verkörperung Wissen, das über lange Zeit außerhalb des menschlichen Körpers gespeichert werden soll, bedarf eines externen Mediums, wie z. B. der Schrift. Die Genese der verschiedenen Speichermedien von der Bildschrift der Steinzeit bis hin zur modernen Digitalschrift lässt sich als Prozess fortlaufender Abstraktion beschreiben.28 Der Abstraktionsgrad der Digitalschrift geht soweit, dass sie unterschiedliche Medien (Bilder, Töne, Sprache und Schrift) kodieren kann. Ursache dieser Möglichkeitsvielfalt ist ihre eigene Körperlosigkeit, denn statt fixierender Eingravierungen besteht sie nur noch aus fließender elektrischer Energie. Der Vorteil ihrer Immaterialität bedeutet jedoch gleichzeitig, dass sie in einen anderen Zeichenträger transportiert werden muss. Die Datenmigration, die damit erforderlich wird, realisiert sich als Vorgang wiederholter Verkörperungen. Dieses Prinzip spiegelt sich in Dreyblatts Umgang mit dem historischen Datenmaterial wieder. Zunächst löste der Künstler die Daten aus dem Who is Who von dem Schriftkörper ihres Überlieferungsmediums und übertrug sie in ein digitales Computerprogramm. Von hier aus war es möglich, das Material neu zu strukturieren und in akustischen und visuellen Medien wieder ‚auferstehen‘ zu lassen. Die Strategien dieser Verkörperungen inszeniert Dreyblatt als Wechselspiel aus Stimmen, Lichtschrift und Besuchern: „The archival material is buried in a way and the vocalisation is bringing it to life again.“29 An Dreyblatts Einsatz der Stimmen lässt sich nachvollziehen, wie durch die performativen Qualitäten eines Mediums das Vergangene vergegenwärtigt und als ästhetisches Erlebnis wieder ‚aufgeführt‘ werden kann.
26 27 28 29
fährten zu entkommen.“ Jeffrey Wallen, „Nachwort“, in: Dreyblatt, Who is Who in Central and East Europe 1933, a.a.O, S. 228-230, hier: S.228. Vgl. Wolfgang Ernst, „Bausteine zu einer Ästhetik der Absenz“, in: Wahrnehmung und Geschichte, hg. v. Bernhard Dotzler/Ernst Müller, Berlin: Akademie 1995, S. 211-236. Ebd., S. 222. Vgl. Aleida Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München: Beck 1999, S. 211. Arnold Dreyblatt im Interview mit Barbara Gronau am 03.05.2000 in Berlin.
AUSSTELLEN UND AUFFÜHREN
45
Die Stimme ist an einen Körper, als deren Träger, gebunden und gleichzeitig ein ‚atopisches Ereignis‘ zwischen sprechendem Subjekt, dem umgebenden Raum und dem Körper des/der jeweils Hörenden.30 Die Stimme ist weniger ein festumrissener Gegenstand, als vielmehr ein atmosphärisches, energetisches und situatives Geschehen. Der Effekt des Begehrens, den eine Stimme in uns als Hörendem auslösen kann, zentriert sich um die in der Stimme präsente Körperlichkeit, denn der fremde Körper ist mit und in der Stimme präsent, ohne darin vollständig aufzugehen. In The Recollection Mechanism erzeugen die Stimmen eine affektive Verbindung zu den abwesenden Körpern – den verstorbenen Menschen aus dem Who is Who – die wir imaginieren. Das Vergangene und Unbenennbare liegt hier als „gespenstischer Blick auf Abwesendes“31 zwischen den Spuren des Anwesenden: den Fragmenten des Textes und den durch die Stimmen anwesenden Körpern der Menschen aus einem Buch, das bei seinem Erscheinen im Jahre 1933 die wichtigsten Personen Europas versammelte und bereits 1945 in weiten Teilen zu einem Erinnerungsbuch an jene Menschen geworden war, die der Shoa zum Opfer gefallen waren. Nicht zuletzt darin erweist sich Dreyblatts Installation als Dekonstruktion von Geschichte, d. h. als unendlicher Prozess des Neu- und Weiterschreibens eines historischen Textes. Ihr Antrieb liegt in dem, was Jacques Derrida die Unkompostierbarkeit eines Textes genannt hat, eben jenes Unverdauliche, das als widerständiger Rest über den kulturellen Nährwert eines historischen Textes hinaus existiert: „In der allgemeinsten und neusten Bedeutung des Begriffs muss ein Text kompostierbar (bio-degradable) sein, um die lebendige Kultur, das Gedächtnis, die Tradition nähren zu können. Und dennoch muss er [...] ihr auch widerstehen, sie bekämpfen, in Frage stellen und hinreichend kritisieren, um nicht zu sagen: dekonstruieren, also darf er in dieser Hinsicht nicht assimilierbar, kompostierbar sein. Oder er muss mindestens als unassimilierbar assimiliert werden, in Reserve gehalten, unvergesslich weil unempfänglich, fähig, Bedeutungen zu generieren, die vom Verstehen nicht erschöpft werden, unverständlich, elliptisch, geheim.“32
In ähnlicher Weise verfährt der Künstler bei seinen sogenannten ‚Reading Events‘, bei denen archivarische Daten in einer Theaterinstallation von den Besuchern über einen langen Zeitraum abwechselnd vorgelesen werden.33 Dreyblatts Spiel mit der ars memoriae hat auch hier den Charakter einer Wiederverkörperung qua Vertonung. An den Reading Projects nehmen Hunderte von eingeladenen Lesern teil, die ein vorher ausgewähltes Archivmaterial in stundenlangen parallelen Lesungen 30 Zur Atopie der Stimme vgl. Doris Kolesch/Sybille Krämer (Hg.), Stimme. Annäherung an ein Phänomen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2006. 31 Wallen, „Nachwort“, a.a.O., S. 230. 32 Jacques Derrida zitiert nach Assmann, Erinnerungsräume, a.a.O., S. 351. 33 Dreyblatt wählt dafür stets Formate zwischen Installation und Theater, wie die Hypertext Opera Who is Who in central and east europe 1933, aufgeführt an verschiedenen Orten zwischen 1991-1997 oder das Projekt Memory Arena, Bayerisches Staatsschauspiel 1995 etc. Vgl. Ernst W. Uthemann (Hg.), Arnold Dreyblatt aus den Archiven/From the Archives. Ausstellungskatalog, Saarbrücken: Stadtgalerie Saarbrücken 2003.
46
BARBARA GRONAU
präsentieren. Neben der Verschaltung von Körper und Stimme verdeutlichen die Events auch den strukturellen Funktionsaufbau archivarischer Institutionen, denn „um sicherzustellen, dass sich die Akte finden lässt, müssen die eingeladenen Personen zur festgesetzten Zeit an die richtige Stelle finden, so dass es für das Funktionieren des Systems einer aufwändigen Verwaltung bedarf“34. Das Zeigen und Durchlaufen des archivarischen Verwaltungsapparates ist Teil des Spiels.35
Zusammenfassung Dreyblatts Inszenierung von Raum, Text, Stimmen und Körper zielt darauf ab, biografisches Material aus seiner historisch tradierten Form zu lösen, neu zu kombinieren und in den Kontext einer gegenwärtigen Erfahrung zu stellen. Aus der Verbindung fragmentarischer Bausteine entsteht ein Netzwerk aus Spuren von Abwesenden. Erinnerung wird so als performativer Prozess, d. h. als Praxis der Verortung, Verkörperungen und Verlebendigung erfahrbar. Die Installation zeigt dabei die eingangs genannten performativen Qualitäten einer Aufführung. Sie generiert innerhalb eines schwarzen ‚Nichts‘ durch die Verbindung von vertikalen und horizontalen Raumelementen ein höhlenartiges Labyrinth aus Worten und Licht. Auf diesem Schauplatz treten Sound, Lichtschrift und Museumsbesucher als Akteure eines Gedächtnistheaters auf, das nicht nur Daten ausstellt, sondern eine Situation des Erinnerns kreiert, in der das Wechselspiel von Sehen und Gesehenwerden eine irritierende Erfahrung zwischen kollektiver Teilhabe und distanzierenden Vereinzelung stiftet. Dabei bleibt der Künstler nicht bei einer akustischen Verdopplung archivarischen Materials stehen, sondern inszeniert eine Situation leibhaftiger Begegnung im Gedächtnisraum. Damit werden traditionellen Grenzen der Repräsentation im Museum insofern überschritten, als das Zeigen und Exponieren von Material und Medien hier mit dem Teilnehmen und Interagieren verschaltet wird. An der Schnittstelle von Objekt und Subjekt entstehen Kunstereignisse, die als Aufführungen begriffen werden müssen.
34 Ebd. 35 „Diese reading projects sind als gut funktionierende aber temporäre Institutionen strukturiert, bei der staubige Aktenordner auf Archivregalen mit der digitalen Speicherung und Präsentation parallel geschaltet werden. Aber der bürokratische Aspekt wird durch eine rituelle Situation gemildert […]. Wir animieren und versprachlichen auf akustischem Weg die Information, […] indem man laut und gemeinsam liest. […] [V]ielleicht sollte das laute Lesen in einer Gemeinschaftssituation […] als mögliches zeitgenössisches Ritual funktionieren, [...] das uns ein Mittel in die Hand gibt, über unser Verhältnis zur Vergangenheit nachzudenken.“ Dreyblatt im Interview mit Claudia Banz, in: ebd., S. 57-79, hier: S. 67.
AUSSTELLEN UND AUFFÜHREN
47
Literaturverzeichnis Assmann, Aleida, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München: Beck 1999. Banz, Claudia, „Montage des Erinnerns: Clemens Weiss, Hanne Darbroven, Christian Boltanski, Joseph Kossuth, Arnold Dreyblatt“, in: Das XX. Jahrhundert – Ein Jahrhundert Kunst in Deutschland, Ausstellungskatalog, hg. v. Klaus Pioch, Berlin: Staatliche Museen zu Berlin 1999, S. 585-589. Blunck, Lars, Between Object & Event: Partizipationskunst zwischen Mythos und Teilhabe, Weimar: Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften 2001. Buchloh, Benjamin H. D., „Von der Ästhetik der Verwaltung zur institutionellen Kritik. Einige Aspekte der Konzeptkunst von 1962-1969“, in: Um 1968. Konkrete Utopien in Kunst und Gesellschaft, hg. v. Marie Luise Syring, Köln: DuMont 1990, S. 86-99. Didi-Huberman, Georges, „Das Archiv brennt“, in: Das Archiv brennt, hg. v. ders./Knut Ebeling, Berlin: Kadmos 2007, S. 7-33. Dreyblatt, Arnold (Hg.), Innocent Questions, Heidelberg: Kehrer 2006. —, Who is Who in Central and East Europe 1933. Eine Reise in den Text, Berlin: Janus 1995. Ernst, Wolfgang, „Bausteine zu einer Ästhetik der Absenz“, in: Wahrnehmung und Geschichte, hg. v. Bernhard Dotzler/Ernst Müller, Berlin: Akademie 1995, S. 211-236. Fischer-Lichte, Erika, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004. Fraser, Andrea, „From the Critique of Institutions to an Institution of Critique“, in: Artforum 44:1 (2005), S. 278-283. Graulich, Gerhard, Die leibliche Selbsterfahrung des Rezipienten. Ein Thema transmodernen Kunstwollens, Essen: Blaue Eule 1989. Grimm, Jacob/Grimm, Wilhelm, ‚Aufführen‘/‚Aufführung‘, in: Jacob Grimm/Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch, Bd. 1, Leipzig: S. Hirzel 1854, S. 647. Gronau, Barbara, Theaterinstallationen. Performative Räume bei Beuys, Boltanski und Kabakov, München: Wilhelm Fink 2010. Kaprow, Allan, Assemblage, Environments & Happenings, New York: Harry N. Abrams 1965. —, „Assemblage, Environments & Happenings“, deutsche Übersetzung in: Kunsttheorie im 20. Jahrhundert, Künstlerschriften, Kunstkritik, Kunstphilosophie, Manifeste, Statements, Interviews, hg. v. Charles Harrison/Paul Wood, Bd. 2, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz 2003, S. 862-869. Kolesch, Doris/Krämer, Sybille (Hg.), Stimme. Annäherung an ein Phänomen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2006. Krämer, Sybille, „Was haben ‚Performativität‘ und ‚Medialität‘ miteinander zu tun? Plädoyer für eine in der ‚Aisthetisierung‘ gründende Konzeption des Performativen“, in Performativität und Medialität, hg. von ders., München: Wilhelm Fink 2004, S. 11-32. —, „Was tut Austin, indem er über das Performative spricht? Ein anderer Blick auf die Anfänge der Sprechakttheorie“, in: Performativität und Praxis, hg. v. Dieter Mersch/Jens Kertscher, München: Wilhelm Fink 2003, S. 19-34. Kravagna, Christian (Hg.), Das Museum als Arena. Institutionskritische Texte von KünstlerInnen, Köln: Walther König 2001. McKenzie, Jon, Perform or Else. From Discipline to Performance, London/New York: Routledge 2001. Müller, Heiner, „Untitled 1990 für Robert Rauschenberg“, in: Regie: Heiner Müller, hg. v. Martin Linzer/Peter Ullrich, Berlin: Zentrum für Theaterdokumentation und -information 1993, S. 82. Musner, Lutz/Uhl, Heidemarie (Hg.), Wie wir uns aufführen. Performanz als Thema der Kulturwissenschaften, Wien: Löcker 2006.
48
BARBARA GRONAU
Pioch, Klaus (Hg.), Das XX. Jahrhundert – Ein Jahrhundert Kunst in Deutschland, Ausstellungskatalog, Berlin: Staatliche Museen zu Berlin 1999. Reiss, Julie H., From Margin to Center. The Spaces of Installation Art, Cambridge/London: MIT Press 1999. Sartre, Jean-Paul, Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie, Reinbek b. H.: Rowohlt 1993. Uthemann, Ernst W. (Hg.), Arnold Dreyblatt aus den Archiven/From the Archives. Ausstellungskatalog, Saarbrücken: Stadtgalerie Saarbrücken 2003. Vostell, Wolf, Aktionen: Happenings und Demonstrationen seit 1965, Reinbek b. H.: Rowohlt 1970. Wallen, Jeffrey, „Nachwort“, in: Arnold Dreyblatt, Who is Who in Central and East Europe 1933. Eine Reise in den Text, Berlin: Janus 1995, S. 228-230. Yates, Frances A., Gedächtnis und Erinnern. Mnemonik von Aristoteles bis Shakespeare, Berlin: Akademie 1994.
Internetquellen http://www.dreyblatt.de/pages/arts.php?seite=11&id=&more=92#more (Stand 02.03.2012). http://www.unesco.de/immaterielles-kulturerbe.html (Stand 2.3.2012).
ALAN READ
Über Aufführung überhaupt und über die Aufführung des Menschen. Bemerkungen über das Theater vor der Identitätstheorie
„Man muss dieses von diesem unterscheiden können. Und das da ist ein Elefant.“ Diesen Hinweis gibt eine undurchsichtige, mit einem weißen Kittel bekleidete Labortechnikerin namens Gemma zu Beginn des Stückes Tropicana, das das Londoner Performance-Kollektiv Shunt 2005 in den Gewölben unterhalb der U-Bahnstation London Bridge aufführte. Die Schauspielerin steht auf einer Leiter, die vor einer Art Batterie-Tier- Installation oder Vivisektionskäfigen steht. Den Zuschauern bringt sie ihre Aufforderung mit einem Schaubild nahe, das auf eine große Papierrolle gemalt ist und das neben einem Strichmännchen die Strichzeichnung eines Elefanten oberhalb einer abstrakten Scheibe zeigt. Wir waren mit einer Gruppe von zehn oder zwölf Leuten hergekommen und mit einem Aufzug in die Gewölbe unterhalb der U-Bahnstation gefahren – begleitet von einem Arbeiter in Portieruniform, der uns auf der Fahrt ins Nirgendwo böswillig beäugte. Von früheren Aufführungen der Truppe war das Publikum mit Knalleffekten und plötzlichen Offenbarungserlebnissen vertraut, die ihm seine Rolle als Publikum vor Augen führten, aber auch mit jener Art von Dunkel, wie es für improvisierte Bühnen abseits der amtlich zugelassenen Theater charakteristisch ist. Der beruhigende, wissenschaftliche Anschein der beschriebenen Episode mit ihrer handgemalten Gleichung zwischen Mensch und Tier wiegte uns vor diesem Hintergrund in falscher Sicherheit. Die Tatsache, dass Elefanten nur schwer vergessen und sogar das Ableben ihrer Artgenossen betrauern, war schon ein erster Hinweis darauf, dass es dem durch das Strichmännchen repräsentierten ‚Menschen‘ in dieser Aufführung kräftig an den Kragen gehen sollte. Schon kurze Zeit später wurde der in einen Käfig gesperrte Portier seitwärts durch den Kellerraum gezogen; nach Kundenwünschen gefertigte Leichenwagen dienten exotischen, mit Federboas geschmückten Tänzerinnen als Laufsteg; eine Obduktionsszene in einem kulissenhaft rekonstruierten Anatomiesaal, die man für eine unbeholfene Nachstellung der US-amerikanischen Fernsehserie Crime Scene Investigation hätte halten können, zog sich über Gebühr in die Länge. Nur einige Tage später stand im Londoner Barbican Theatre eine Aufführung von Yukio Ninagawas Hamlet-Inszenierung auf dem Programm. Die von Hamlets Feststellung aufgeworfene Frage, welch ein Meisterwerk der Mensch sei, wurde hier in einem Bühnenraum verhandelt, in den vom Schnürboden herab Stacheldrahtrollen wie dornige vertikale Säulen hineinragten. Standen bei der Shunt-Truppe im Käfig abgehaltene Anatomiestunden im Mittelpunkt, so waren es hier mit Zäunen
50
ALAN READ
umgebene Machtkämpfe, bei denen die Hauptfiguren – ohne hierbei an die Zwangsbedingungen zu rühren, denen die Handlung des Stückes insgesamt unterliegt – mit ihren Schwertern wild in der Luft herumfuchtelten. Ninagawa neigt für meinen Geschmack zu stark zu einer Ästhetisierung des Politischen, denn eine dramaturgische Aussage hat der Stacheldraht – immerhin eines der stärksten Techniksymbole der Moderne – bei ihm kaum. Dennoch konfrontiert er den Zuschauer unbeabsichtigt mit der Frage, in welcher Weise dieses fremdartige, scharf begrenzende Material an der Geschichte von Tier und Mensch teilhat. Im Angesicht des Stacheldrahts kann man die unwiderlegbare Tatsache schwerlich abstreiten, dass zwischen dem Einpferchen von Tieren und Menschen ein Zusammenhang besteht. Der vorliegende Beitrag über das anthropomorphe Verfahren ist aus der Gegenüberstellung dieser beiden Aufführungen und ihrer Aussagen über das im Theater bestehende Spannungsverhältnis zwischen Menschen und anderen Tieren hervorgegangen. Die Kategorie der Aufführung bringt man in der Regel nur mit dem von Gemma als diesem bezeichneten Wesen, d. h. dem Menschen, in Verbindung, sodass sich die Frage stellt, was denn auf dem Spiel steht, wenn man das da, nämlich ein anderes Tier, mit in die Bestimmung dieses Begriffs einbezöge, die sinnvollerweise – wenn man von Aufführung ‚überhaupt‘ spricht und sie einer Aufführung des Menschen gegenüberstellt – mit einer Operation dieser Art beginnen sollte. Dieser Beitrag will also im Wesentlichen nichts weiter als daran erinnern, dass die Aufführung des Menschen nur eine der vielen möglichen Unterarten von Aufführung ‚überhaupt‘ ist. Die schmale Lücke zwischen Teil und Ganzem, d. h. zwischen bestimmten empirischen Aufführungen und dem Allgemeinbegriff, hält einen minimalen Unterschied bereit, an dem die kritische Reflexion und das Nachdenken über eine Ethik der Assoziation einsetzen können, von der meine Bücher Theatre & Everyday Life und Theatre, Intimacy & Engagement handeln.1 Was Giorgio Agamben ‚anthropologische Maschine‘ nennt, siedle ich in dieser unergründlichen Lücke an. Hierbei soll nicht nur deutlich werden, dass es sich bei der Aufführung um eine solche anthropologische Maschine handelt, sondern auch, wie diese Maschine die Scheidung zwischen Menschen und anderen Tieren bekräftigt und sich ihr gleichzeitig widersetzt. Indem ich im Namen von Tieren im Allgemeinen spreche und den Menschen als eine bestimmte Art eines zur Aufführung befähigten Tieres betrachte, möchte ich das zeitgenössische Denken über das zwischen Menschen und anderen Tieren in puncto Aufführung bestehende Verhältnis dazu bewegen, über die bloße Zurkenntnisnahme einer beiden gemeinsamen Geschichte der Gewalt hinauszugehen und den durch diese Geschichte verursachten Erfahrungen von Leid und Verlust durch konkrete Maßnahmen zu begegnen. „Und dies hier ist eine Tablette“, sagt Gemma, die Labortechnikerin von Shunt, indem sie erklärend auf die Scheibe deutet, die sie zuvor in das Schaubild hineingezeichnet hat – ganz, als glaubte sie, der Unterschied zwischen „diesem“ und 1 Vgl. Alan Read, Theatre & Everyday Life. An Ethics of Performance, London: Routledge 1993, sowie ders., Theatre, Intimacy & Engagement, Houndmills: Palgrave 2008.
ÜBER AUFFÜHRUNG ÜBERHAUPT UND ÜBER DIE AUFFÜHRUNG DES MENSCHEN
51
„dem da“ würde uns einen Kopfschmerz von der Art bereiten, wie es sonst nur Hegel vermag. Nun, wir werden sehen. Der Titel des vorliegenden Beitrags spielt auf einen zu Lebzeiten unveröffentlicht gebliebenen Aufsatz Walter Benjamins an: „Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen“2. Benjamin geht es in diesem Text, wie Slavoj Žižek bemerkt hat, nicht darum, die Sprache des Menschen als die Unterart irgendeiner universellen Sprache ‚überhaupt‘ zu begreifen, der dann noch weitere Arten angehörten wie etwa, um die von Žižek genannten Beispiele anzuführen, die Sprache der Götter und Engel, die Sprache der Tiere oder anderer intelligenter Wesen im Weltall, die Computersprache, die Sprache der DNA. Außer der Sprache des Menschen gibt es nämlich keine ‚wirklich existierende‘ Sprache. Aber um diese bestimmte Sprache begreiflich machen zu können, sieht Benjamin sich veranlasst, einen minimalen Unterschied einzuführen und die Sprache des Menschen im Blick auf jene Lücke zu konzipieren, die sie von der ‚Sprache überhaupt‘ trennt. Žižek bezeichnet diese letztere als „die reine Struktur der Sprache, ohne die Kennzeichen menschlicher Endlichkeit, erotischer Leidenschaften und der Sterblichkeit, des Kampfes um Vorherrschaft und die Obszönität der Macht“3. Die „real existierende Sprache“4 ist demnach eine ganz bestimmte Sprache, d. h. Sprache verstanden als Reihe tatsächlich geäußerter Sätze im Gegensatz zu ihrer formal-linguistischen Struktur. Mein Vorhaben besteht nun darin, das Ereignis der Aufführung an die Stelle treten zu lassen, die bei Benjamin die Sprache innehat, und zu sehen, welche Art von minimalem Unterschied sich aus dieser Operation zwischen Besonderem und Allgemeinem ergibt. Das Besondere könnten im vorliegenden Fall ‚real existierende‘, durch Menschen auf die Bühne gebrachte Aufführungen sein, etwa die bereits erwähnten Tropicana und Hamlet. Und dennoch bewahrt die Aufführung ‚überhaupt‘ mit ihrer formalen Struktur etwas von der Faszination, der das Besondere stets gegenübergestellt ist. Und zwar nicht nur aus dem naheliegenden Grund, dass ich beim Schreiben über das Theater naturgemäß andere Beispiele verwende als der Leser und diese Beispiele schon deshalb etwas Besonderes sind, weil sie diejenigen des Lesers nicht ersetzen können (wie ja der Leser im Laufe der Lektüre dieser Abhandlung ohnehin seine eigenen Beispiele an die Stelle der von mir verwendeten setzen wird); sondern auch, weil die beiden von mir gewählten Beispiele implizit der Gesamtheit aller anderen Hamlet-Inszenierungen und Wanderaufführungen der Shunt-Truppe – und zwar den besseren wie den schlechteren – gegenüberstehen, von denen die Theatermaschinerie ‚heimgesucht‘ wird, wie Marvin Carlson im Anschluss an seine
2 Vgl. Walter Benjamin, „Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen“, in: Gesammelte Schriften, Bd. 2, hg. v. Rolf Tiedemann/Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1989, S. 140-157. 3 Slavoj Žižek, Die Puppe und der Zwerg, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2006, S. 137. 4 Ebd
52
ALAN READ
Arbeit über durch Aufführungen spukende Geister es vielleicht formuliert hätte.5 Mir geht es hier nicht allein darum, die Unterschiede zwischen diesen beiden wenigstens auf den ersten Blick so verschiedenen Theaterarbeiten zu betrachten, sondern auf die Möglichkeit vorbereitet zu sein, dass das allem Anschein nach jüngere Glied dieses Aufführungspaars, Tropicana, die es begleitenden Umstände seiner Unreife hinter sich lassen könnte, wenn man es dem fortdauernden Einfluss von Hamlet gegenüberstellt. Vor allem aber geht es mir darum, das weite Feld nicht aus dem Blick zu verlieren, das durch die Fokussierung auf diese Beispiele in den Hintergrund tritt, und die gattungsspezifischen Gründe im Auge zu behalten, die uns dazu veranlassen, das Theater als fortwährende Verhandlung zwischen Formen menschlichen Zeremoniells und anderen Weisen des Darstellens und Sich-Zeigens zu verstehen. Sollte es uns gelingen, das hier angesprochene Verhältnis zwischen dem Ganzen und seinen Teilen anzuerkennen, so würden uns andere Sprachen weniger Schwierigkeiten bereiten – etwa jene, die sich mit dem ‚politischen Theater‘ verbinden, aber auch akademische Streitereien über ‚Praxis als Forschung‘, ‚Zuschauer-Schauspieler-Beziehungen‘ und ‚Performancekunst vs. Theater‘, die wie eine Art Feigenblatt fungieren, welches ein grundsätzliches und allgegenwärtiges philosophisches Spannungsverhältnis verdeckt, das zwischen den Eigenheiten des Theaters und den Aufführungen des ‚signifikant Anderen‘ besteht. Das Problem sind die Universalien, von denen das Theater und speziell sein Kanon heimgesucht werden. Hamlet ist das Paradebeispiel dafür, dass ein Theatertext einen völlig ungezügelten Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt. Das ist gerade bei einer Aufführungsgeschichte merkwürdig, die – dem Zeugnis derer zufolge, die sich in der bewegten textgeschichtlichen Vergangenheit von Hamlet auskennen – aufs Engste verknüpft ist mit den Eigenarten der drei verschiedenen Folio- und Quarto-Fassungen, die während der ersten Aufführungen des Stücks unweit der Bühne entstanden. Solange Vielfalt und Verschiedenheit durch Allgemeingültigkeit herstellende Normierungen eingeebnet werden, wird die postkoloniale Kritik hiermit nichts zu schaffen haben wollen. Der Verlust des Universellen geht für das Theater aber auch mit dem Verlust seiner Möglichkeit einher, eine allgemeine Wirkung zu erzielen, also der Möglichkeit einiger Texte und Aufführungen, eine Vielzahl grundverschiedener Individuen, die sich in verstreuter Form an unterschiedlichsten Orten und Zeiten als Publika zusammenfinden, nachhaltig und tief zu beeinflussen. Die Angst vor den Universalien hängt damit zusammen, dass diese ein aktives politisches Handeln überflüssig zu machen scheinen, indem sie Gegensätze übergehen und die augenscheinlich radikale Einzigartigkeit der Erregung, die vom Theater ausgehen kann, auf etwas Allgemeines reduzieren. Ich habe in Theatre, Intimacy & Engagement gezeigt, dass es sich bei dieser scheinbaren Radikalität um ein Phantasma handelt und dass von daher ein vorsichtigeres Nachdenken über das Allgemeine vonnöten ist. 5 Marvin Carlson, The Haunted Stage: The Theatre as Memory Machine, Ann Arbor: The University of Michigan Press 2001.
ÜBER AUFFÜHRUNG ÜBERHAUPT UND ÜBER DIE AUFFÜHRUNG DES MENSCHEN
53
Sowohl in Alain Badious auf innovative Weise abstrakter Philosophie – sein Interesse an mathematischen Strukturen sowie seine Rückbesinnung auf die Faszination von Absolutismen – als auch bei Slavoj Žižek findet sich der Gedanke, dass das Allgemeine ein Schauplatz voller Gegensätze und Kontroversen ist. Žižek formuliert es kämpferisch so: „Allgemeinheit ist nicht der neutrale Behälter für besondere Gestalten oder deren gemeinsames Maß und auch nicht der passive (Hinter-) Grund, auf dem die Besonderheiten ihre Schlachten austragen, sondern sie ist diese Schlacht selbst, der von einer zur anderen besonderen Gestalt führende Kampf.“6 Die Angst vor dem Allgemeinen führt allenfalls dazu, dass mit der Forderung nach einer allgemeingültigen Theorie, wie sie in dieser Abhandlung erhoben wird, auch die Möglichkeit vereitelt wird, sich über radikale Besonderheit Rechenschaft abzulegen. Mit anderen Worten wird hier mit dem Allgemeinen zugleich das radikal Besondere wieder ins Spiel gebracht, das von jenem abweicht. Zwei kleinere Beispiele aus kanonischen Arbeiten der Performance- und Theaterwissenschaft mögen genügen, die hier angerissene Debatte in einen weiteren Rahmen zu stellen. Peggy Phelan eröffnet das vielzitierte Kapitel „The Ontology of Performance“ in ihrem Buch Unmarked mit dem Satz: „Performance’s only life is in the present.“7 Ausgehend von diesem Satz hat sich ein bestimmter Forschungszweig vor allem für den Aspekt der Gegenwärtigkeit interessiert, wohingegen die aus dem ‚life‘ abgeleitete liveness zum Ausgangspunkt eines angeregten Streitgesprächs geworden ist, das die Autorin mit Philip Auslander und anderen Performance-Kritikern führte.8 Was aber hat es mit dem ‚Leben‘, d. h. genauer: dem ‚nackten Leben‘, auf sich? Lässt sich nach Giorgio Agambens Homo Sacer überhaupt noch etwas Sinnvolles über diesen merkwürdig ambivalenten Begriff sagen; aus seiner scheinbar universellen Mehrdeutigkeit und Unbrauchbarkeit als analytisches Werkzeug so etwas wie Besonderheit aus ihm destillieren? In Anbetracht der Bedeutung, die dem Wörtchen ‚live‘ in ‚Live Arts‘ zukommt, ist es eigenartig, wie lange sich dieser Begriff schon der Fassbarkeit verweigert. Das ist umso erstaunlicher, als mit der Frage nach dem ‚Leben‘ – das, seit Sophokles es in der Unterredung zwischen Ödipus und der Sphinx über die Natur des Menschen zum Thema gemacht hat, stets zentrales Anliegen der Bühnendichter gewesen ist – ein zentrales Erzeugungsprinzip der Aufführung einfach übergangen wird. Und da ein Leben in der Tat die einzige Universalie ist, die die Aufführung kennt, kann man es eigentlich nur als Enttäuschung empfinden, dass sich weder die allgegenwärtige Forderung nach Lebendigkeit noch deren Anderes, die Vermittlung, für es interessieren. In engerem Sinn hat bereits Peter Brook vor mehr als 40 Jahren in Der leere Raum ein Anliegen verfolgt, das dem, worum es mir hier geht, durchaus verwandt ist. In Theatre & Everyday Life habe ich gezeigt, dass der erste Satz des Buches, „Ich
6 Slavoj Žižek, Parallaxe, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2006, S. 41. 7 Peggy Phelan, Unmarked. The Politics of Performance, London: Routledge 1993, S. 146. 8 Vgl. Philip Auslander, Liveness: Performance in a Mediatized Culture, London/New York: Routledge 1999.
54
ALAN READ
kann jeden leeren Raum nehmen und ihn eine nackte Bühne nennen“9, ungleich komplexer und problematischer ist, als er zunächst aussieht. Der zweite Satz aus Der leere Raum ist meiner These nicht weniger zuträglich: „Ein Mann geht durch den Raum, während ein anderer ihm zusieht; das ist alles, was zur Theaterhandlung notwendig ist.“10 Die beiden Merkmale der Aufführung, ihre Lebendigkeit und der Akt des Zuschauens, der Publikum und Darsteller in ein Verhältnis zueinander setzt, sind hier das ‚Überhaupt‘, vor dessen Hintergrund ‚tatsächliche AufführungsEreignisse‘ notwendig stattfinden. Dennoch ist das ‚Überhaupt‘ in beiden Fällen durchaus nicht unproblematisch, auch wenn die Beispiele in sich stimmig sind. Welcher Mann? etwa wird man fragen. Schwierigkeiten bereitet hierbei nicht so sehr die implizite Voraussetzung des (männlichen) Geschlechts als jene der Gattung. Phelan und Brook sind zutiefst humanistische Autoren, wobei Phelan von einem in sich vielfach differenzierten und für Geschlechter-, Rassen- und Klassenunterschiede sensibilisierten Menschen ausgeht, während Brook einen leistungsfähigen Mann als menschlichen Idealtypus annimmt. Die analytische Kraft ihrer Modelle rührt daher, dass beide der Versuchung widerstehen, die ‚Aufführung‘ und das Theater im Allgemeinen als Norm für die tatsächlich existierende Aufführung festzuschreiben. Daraus ergibt sich für sie ein Problem, das Slavoj Žižek in einem anderen Kontext aufgezeigt hat, nämlich, dass eine Politik, die sich unter Bezugnahme auf eine bestimmte – ethnische, religiöse, sexuelle oder den Lebensstil betreffende – Wesenseigenschaft begründet, per definitionem reaktionär ist. Der eigentliche Kampf findet demnach nicht zwischen zwei bestimmten Gruppen statt, die beide Teile des Ganzen sind, sondern zwischen dem Ganzen mitsamt all seiner Teile und dem hiervon ausgeschlossenen Rest. Unter den Besonderheiten, von denen jede energisch geführte Debatte über Performance lebt, ist es dieser ausgeschlossene Rest, der für das Allgemeine und damit für das ‚Überhaupt‘ steht, das den besonderen Teilen im Innern entgegengesetzt ist. Der hier in hegelianischer Terminologie formulierte Zusammenhang hat einen unmittelbar biografischen Hintergrund. Als ich Theatre & Everyday Life schrieb, hatte ich acht Jahre ein Laientheater in meiner Nachbarschaft geleitet. Mich ärgerten Kategorien wie das Politische, die Gemeinschaft, Laien- oder radikales Theater, die zur Analyse und Beschreibung von Aufführungen von außen an dieses herangetragen wurden und die untereinander, in wie disziplinierter Form auch immer, eine Art Bürgerkrieg austrugen, der das Alltägliche als das weite Feld des Ausgeschlossenen in Vergessenheit geraten ließ. Auch in meinen derzeitigen Arbeiten hüte ich mich – möglicherweise weil ich inzwischen eine Familie ernähre und in den letzten Jahren meinen Widerstand gegen die Anschaffung eines Hundes habe fallen lassen – vor der endlosen Liste angeblich befreiender Identitätsunterschiede, die den Platz des kritischen Hinterfragens eingenommen haben und als Geschlecht, Rasse, Lebensstil – bzw. für die Glücklichen: Gesellschaftsschicht – gegeneinander ausgespielt werden, während der unüberschaubare Rest, der diesem humanistischen Pro9 Peter Brook, Der leere Raum, Berlin: Hoffmann und Campe 1969, S. 9. 10 Ebd.
ÜBER AUFFÜHRUNG ÜBERHAUPT UND ÜBER DIE AUFFÜHRUNG DES MENSCHEN
55
gramm gegenübersteht, als das Nichtmenschliche (zu dem ich neben Kindern, Tieren auch andere Besonderheiten wie die Dinge zählen möchte) von diesem ausgefeilten, doch zutiefst konservativen Kollektiv des humanistischen Theaters ausgeschlossen bleibt. Ich möchte die Bedeutung, die die Vorstellung des nackten Lebens für das Theater hat, etwas eingehender untersuchen. Die anthropologische Maschine verdankt ihren Namen dem Umstand, dass sie im Begriff ist, eine Erscheinung dieses Lebens hervorzubringen. Eine solche Operation hat freilich insofern etwas überaus Paradoxes an sich, als das Leben leichter zu erkennen ist, wenn es abwesend oder gleichsam nur in einer Schwundstufe vorhanden ist. Eben daher rührt die Faszination, die die anthropologische Maschine auf mich ausübt: wie das Theater ist sie außerstande, ‚den Menschen‘ zu zeigen. Das beiden gemeinsame Bewusstsein für die Widerspenstigkeit des Menschen verdankt sich zu einem großen Teil dem Beispiel, in dem die Vorstellung von ‚einem Leben‘, und damit die anthropologische Maschine zum ersten Mal in der Moderne auftaucht. Im Zusammenhang des Versuches, die Idee von ‚einem Leben‘ jenseits der Subjektivität des Einzelnen zu formulieren, gilt das Interesse von Gilles Deleuze, Michel Foucault und Giorgio Agamben einem Abschnitt aus Charles Dickens’ Roman Unser gemeinsamer Freund, dem alle drei Interpreten eine nachgerade talismanische Bedeutung beimessen. Der Roman ist ein großangelegtes Werk über die Themse, dessen Stimmung sich infolge der vielen Beinahe-Ertrunkenen, die in ihm auftreten, in einem uneindeutigen Schwebezustand zwischen Auslöschung und Wiederbelebung hält. Bei Dickens geht damit ein Gefühl von Scheintod einher, das erzeugt wird durch die verwickelt detailfreudige Schilderung einer Großstadtvorhölle, in der die Romanfiguren in der Hoffnung auf eine Erlösung durch den Erzähler dahinvegetieren. Dickens beschreibt den Augenblick, in dem der Bösewicht des Romans, Riderhood, aus der Themse gezogen und in ein Wirtshaus gebracht wird. Von denen, die ihn retten, heißt es hier: „[…] alle hatten ihn gemieden, waren ihm mit Mißtrauen und Abneigung begegnet. Doch das Fünkchen Leben in ihm läßt sich nun seltsamerweise von ihm loslösen, und sie nehmen großen Anteil daran, wahrscheinlich, weil es schließlich Leben ist und weil sie selbst leben und doch einmal sterben müssen.“11 Leben ‚als solches‘ wiegt hier schwerer als ‚dieses Leben‘, und zwar weil all jene, die jetzt damit beschäftigt sind, dieses Leben zu retten, dem Tod ‚als solchem‘ begegnen. Dieses Leben ist der ausgeschlossene Rest, der den Tod aufschiebt und deshalb wertvoll erscheint. Dickens unterscheidet das Individuum Riderhood und das ‚Fünkchen Leben in ihm‘ unzweideutig von dem Schurken, in dem dieses Leben lebt. Der Ort dieses ablösbaren Lebens aber ist weder in dieser noch in jener Welt, sondern irgendwo zwischen beiden. Dickens beschreibt ihn so: „Da, ein Lebenszeichen! Unzweifelhaft ein Lebenszeichen! Das Fünkchen kann glimmen und ausgehen, oder es kann glimmen und stärker werden, doch seht mal! Die vier rauhen Gesellen sehen es und vergießen Tränen. Weder in dieser noch in jener Welt hätte 11 Charles Dickens, Unser gemeinsamer Freund, Bd. 2, Berlin: Rütten Loening 1983, S. 36.
56
ALAN READ
Riderhood ihnen Tränen entlocken können, doch eine menschliche Seele, die zwischen beiden Welten ringt, vermag es.“12 Das Fünkchen Leben, das in Riderhood glimmt, ist, was an diesem Schwebezustand, der sich keinem Subjekt zuschreiben lässt, interessiert. Nicht darum geht es, ob das Leben schwindet oder weitergeht, sondern dass es überhaupt als eine Gegenwart da ist, dass es nach Aufmerksamkeit verlangt und die Umstehenden herbeiruft. Begreiflicherweise ist es nicht als solches zugegen, sondern als ‚Zeichen‘. Und dieses Zeichen und seinen problematischen Status werde ich im Folgenden aus der Perspektive der Aufführung in den Blick nehmen. Die erste philosophische Auslegung dieses Passus stammt von Gilles Deleuze und hebt ab auf seine Theatralik: „Das Leben des Individuums ist einem unpersönlichen und dennoch singulären Leben gewichen, das ein reines Ereignis hervortreten läßt, ein Ereignis frei von den Zufällen des inneren und äußeren Lebens, d. h. von der Subjektivität und Objektivität dessen, was geschieht.“13 Das nackte Leben, das Dickens offenlegt, scheint also erst in dem Moment zu entstehen, wo es mit dem Tod ringt. Selbstverständlich ist dieses unpersönliche Leben auch Eltern und Erziehungsberechtigten vertraut, und zwar durch die Begegnung nicht mit dem Tod, sondern mit der Geburt. Bei Deleuze heißt es dazu: „So ähneln einander etwa die Kinder im frühesten Alter und besitzen kaum Individualität; aber sie haben Singularitäten, ein Lächeln, eine Geste, eine Grimasse, Ereignisse, die keine subjektiven Merkmale sind. Die Kleinkinder werden von einem immanenten Leben durchdrungen, das reines Vermögen ist […].“14 So wie es oben deutlicher als Abwesendes in Erscheinung trat, wird das Leben hier paradoxerweise dadurch begreiflich, dass man es vom Tod und gleichsam erst im Nachsatz von der Geburt aus betrachtet. Diese Anordnung stimmt übrigens durchaus mit der Ontologie der Performance überein, die Phelans an Lacan erinnernde Melancholie von Brooks manischem Enthusiasmus trennt, um noch einmal auf die beiden oben zitierten Autoren zurückzukommen. Phelan etwa schreibt in ihrer „The Ontology of Performance“: „Performance’s being becomes itself through disappearance.“15 Bei Brook hingegen heißt es: „[…] im tödlichen Theater zeigen sich oft quälende, unfruchtbare oder sogar auch augenblicklich befriedigende Funken wirklichen Lebens.“16 Von der Parallaxe dieser beiden Kommentare gelangt man über den engen Zusammenhang von Geburt und Tod, der uns bei Dickens begegnet, zu der Feststellung, dass sich die Geburt des Theaters in seinem Sterben ereignet. Wenn wir von der Vergänglichkeit des Theaters und seinem Hang zum Untergang sprechen, so bemächtigt sich der Verhandlungen darüber – als fiele uns hier eine privilegierte Aufgabe zu – eine durchaus nicht unangenehme Me12 Ebd., S. 38. 13 Gilles Deleuze, „Die Immanenz: ein Leben…“, in: Gilles Deleuze – Fluchtlinien der Philosophie, hg. v. Friedrich Balke/Joseph Vogl, München: Wilhelm Fink 1996, S. 31f. 14 Ebd, S. 31. 15 Phelan, Unmarked, a.a.O., S. 146. 16 Brook, Der leere Raum, a.a.O., S. 22.
ÜBER AUFFÜHRUNG ÜBERHAUPT UND ÜBER DIE AUFFÜHRUNG DES MENSCHEN
57
lancholie. Diejenigen, die sich dem Thanatos- oder Todestrieb einer sich von innen verzehrenden Kunstform widersetzen und am Herstellen von Bildern festhalten, kommen sich, freilich nicht ohne einen Anflug von fragwürdigem Heldentum, unversehens wie Kombattanten eines von Brains und Lady Penelope angeführten internationalen Theater-Rettungstrupps vor.17 Entscheidend ist an dieser Stelle, dass die scheinbar gegensätzlichen Auffassungen von Brook und Phelan, obwohl im zeitlichen Abstand von 40 Jahren entstanden, einander ähnlicher und verwandter sind als dem hier von mir vertretenen Standpunkt, der den Anspruch meines Untertitels begründet – Bemerkungen über das Theater vor der Identitätstheorie. Anders als jene beiden Protagonisten, die eine Generation trennt, bin ich nicht sonderlich an den Parolen und Streitereien im Namen von gender, Rasse oder Klasse in Aufführungen interessiert, sondern vielmehr an der radikalen Einbeziehung von Argumenten, die Gattungen und Objekte betreffen, genauer gesagt die bereits existierenden Verhandlungsprozesse zwischen Menschen, anderen Tieren und Dingen. Dass es zu einer Schauspielhandlung nichts weiter bedarf als eines ‚Mannes, der auftritt und gesehen wird‘, oder das ‚einzige Leben der Performance in der Gegenwart‘ liegt, sind durchaus interessante Behauptungen; weitaus interessanter freilich ist die Beobachtung, dass die Aufführung und das Theater den Horizont des Lebens und des Menschen überhaupt erst ermöglichen, und zwar genau dadurch, dass sie deren Erscheinen zunächst in Aussicht stellen und dann verweigern. Der Aufführung käme in diesem Falle die Bedeutung des Ursprungs (im besten Sinne dieses Wortes), dem Theater die Rolle ihres augenblicklich geduldeten, freilich (wenn man Richard Schechner Glauben schenken soll) kurz vor dem Bankrott stehenden Vermittlers zu. Der Grund, weshalb die Aufführung uns angeht und Leben ermöglicht, ist, dass sie als anthropologische Maschine funktioniert. Damit ist etwas anderes gesagt als mit dem Hinweis, genau diese Tatsache sei kulturübergreifend erst durch die vorbildliche Arbeit der Theateranthropologie aufgezeigt worden. Mit Ausnahme von Jean-Marie Pradiers unermüdlicher Arbeit und Richard Schechners kurzem Ausflug in die Verhaltensforschung hat die Theateranthropologie ihre Aufgabe allzu oft nur darin gesehen, den Menschen unter kulturellen Vorzeichen in seinen jeweiligen performativen Kontext einzuordnen.18 Sie neigt zu einer Domestizierung des Exotischen (das dem Forscher fremd und entlegen vorkommt) und hat darüber zu zeigen vergessen, wie exotisch das Heimische und dem Forscher Vertraute ist, nämlich die Frage nach ihrem anthropos, dem eigenen menschlichen Wesen (oder vielmehr dessen Voraussetzung). Schließlich sollte man davon ausgehen, dass die anthropologische Schlüsselfrage nach dem menschlichen Selbst und seinen Bedingungen 17 Anm. des Übersetzers: Anspielung auf die britische Fernsehserie Thunderbirds aus den 1960er Jahren. 18 Vgl. Alan Read (Hg.), On Animals. Performance Research 5:2 (2000), darin insbesondere die Einführung von Alan Read, S. iii-iv, sowie Jean-Marie Pradier: „Animals, Angel and Performance“, S. 11-22; vgl. ebenso Richard Schechner, Performance Theory, New York/London: Routledge 2004.
58
ALAN READ
erst auf dem Umweg über die Lebensformen eine Antwort findet, mit denen wir fortwährend in einem uneindeutigen Verhältnis stehen. Oder sollte es der Verhaltensforschung und den rassebiologischen Vorstellungen des 20. Jahrhunderts gelungen sein, dergleichen Überlegungen in einen Bereich zu verweisen, der nicht mehr als politisch korrekt gilt? Angesichts des stetigen Wandels der klimatischen, ökologischen und genetischen Bedingungen wäre es vielleicht an der Zeit, die Vorstellungen, die man vom Menschen und seiner Stellung innerhalb der Tierwelt hat, einmal auf den Prüfstein zu stellen. Giorgio Agamben zufolge handelt es sich bei der Grenzziehung zwischen Mensch und Tier schließlich nicht um eine von vielen möglichen Fragen, sondern um die Frage schlechthin, d. h. um ein fundamentales ‚metaphysisch-politisches‘ Unterfangen, durch das so etwas wie der ‚Mensch‘ überhaupt erst festgelegt und erschaffen werden kann.19 Die Grenze, an der das Politische entsteht, wird hier neu gezogen und in eine zwischen dem Menschen und anderen Tieren verlaufende Grauzone verlegt. Die Anhänger der Umweltbewegung, die unter Berufung auf irgendwelche ökologischen Argumentationsmuster auf der Suche nach einer Harmonie mit Gaia eher die Gleichschaltung des Menschen mit anderen Tieren anstreben und die Versöhnung beider mit politischen Mitteln beschleunigen wollen, wird die Festschreibung einer solchen Grenze eher enttäuschen. Nur sollte man sich darüber im Klaren sein, dass der Mensch aufhören würde, als denkendes Tier zu existieren, wenn man den minimalen Unterschied zugunsten einer solchen Gleichschaltung preisgäbe. Vielleicht hat niemand die hier entstehende Lücke und das Potenzial, das sie birgt, genauer erfasst als Beckett, wenn er Pozzo in Warten auf Godot die an Lucky gerichtete Aufforderung „Denke, Schwein!“ in den Mund legt.20 Giorgio Agamben hat den ‚Raum‘, in dem sich diese Grenzziehung ereignet, und die in ihm herrschenden Bedingungen unter Bezugnahme auf Rilkes Duineser Elegien und die Philosophie Martin Heideggers als ‚das Offene‘ bezeichnet. War es mir selber weiter oben darum gegangen, die Annahme eines allzu leichtfertig vorausgesetzten Kontextes oder leeren Raums unter Vorbehalt zu stellen, so begibt sich Agamben mit diesem Begriff auf eine ganz andere Ebene. Das Offene ist in seinen Schriften, um eine Formulierung Leland de la Durantayes aufzugreifen, eine Art ‚Substantiv im Schwebezustand‘: eine Bedingung, die in gewisser Weise die Lücke zwischen einzelner Aufführung und ‚Aufführung überhaupt‘ schließt. Die Offenheit, von der Agamben schreibt, ist nicht nur ortsbezogen oder allgemein, sondern sie ist das Potenzielle eines Lebens, das sich als unnutzbar erweist, die „Kraft, die im
19 Vgl. Giorgio Agamben, Das Offene. Der Mensch und das Tier, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2003, S. 87f. 20 Vgl. Adrian Kear, „Think Pig“ (Beitrag zu dem von Simon Bayly geleiteten Seminar ‚Anthropological Machine‘ bei der vom Centre for Performance Research aus Anlass von dessen dreißigjährigem Bestehen im April 2005 an der Universität Aberystwyth veranstalteten Konferenz Towards Tomorrow?).
ÜBER AUFFÜHRUNG ÜBERHAUPT UND ÜBER DIE AUFFÜHRUNG DES MENSCHEN
59
Übergang von der Potenz zur Wirklichkeit nicht erschöpft werden kann“21. Die Formulierung Durantayes lässt Agambens Hang zur Theatralik deutlich erkennbar werden: die Verwendung eines philosophischen ‚Als ob‘ in Hinsicht auf das Verhältnis zwischen Mensch und Tier, das er selber als ‚politisches Paradigma‘ bezeichnet, d. h. als ein „Verfahren, in dem das ‚Als ob‘ vollständig das ‚Dies‘ ersetzt, in dem gestaltloses Leben und leblose Gestalt sich zu einer Gestalt des Lebens verbinden“22. Um ihr eigenes Wirken zu verstehen, bedarf diese Gestalt nicht der Politik; politisch ist sie durch ihr bloßes Nichtfunktionieren und ihre Unnutzbarkeit. Das Verhältnis, in dem Tiere und Aufführung zueinander stehen, lässt sich auf vielerlei Weise aufzeigen. Schon Thomas von Aquin verwies auf das experimentelle Wissen, das der Mensch empfing, indem er den Tieren, die Gott ihm zuführte, Namen gab.23 Es gibt ein Lied von Townes Van Zandt, das mit der Zeile beginnt, „Man gave names to all the animals, in the beginning, in the beginning“, woraufhin der Sänger innehält, so als wollte er nicht nur die Geste unterstreichen, die dieses Wissen begründet, sondern auch den Moment, in dem der Mensch, nachdem er seine Herrschaft über die anderen Geschöpfe an sich gerissen hatte, Atem holt. Natürlich kursieren unter den Zeitgenossen andere Auffassungen von der Namensgebung. Die Theaterwissenschaftlerin Una Chaudhuri erkennt zwar durchaus, welche Deutungsmöglichkeiten hierin verborgen liegen, nähert sich dem Thema aber auf eine eher jesuitische, an Thomas von Aquin erinnernde Weise: „In recent decades […] many disciplines have begun ‚to take animals seriously‘, looking at them through disciplinary lenses that include the geographical, the literary, the philosophical, the art historical, the psychoanalytical and the performative, the latter being represented so far mainly by a special issue of the journal Performance Research. What might it mean to turn a specifically theatrical lens on animals? What light might be shed on cultural constructions of animality by framing them in terms of dramatic movements, genres and structures, or in terms of theatrical protocols, conventions and aesthetics?“24 Fraglos geht es hier mehr um die Bedürfnisse des Theaters als um die Gegenseitigkeit, auf der solche Operationen beruhen, und die zwischen ihnen bestehende Parallaxe. Mich persönlich stört die Austreibung der Tiere durch die pseudo-experimentelle und an Laborversuche erinnernde Rhetorik, die Rede davon, sie zu untersuchen, im Licht oder im Hinblick von etwas zu betrachten, sie für irgendetwas zu benutzen – als hätten die Tiere für uns nicht schon genug gelitten. Nicholas Ridout stellt in seinem Buch Stage Fright, Animals and Other Theatrical Problems die Frage nach dem Tier unter ökonomischen Gesichtspunkten und zeigt, 21 Leland de La Durantaye, „The Suspended Substantive“, in: Diacritics 33 (2003), S. 3-9, hier: S. 6. 22 Ebd. 23 Vgl. ebd., S. 5. 24 Una Chaudhuri, „Zoo Stories“, in: Theorizing Practice, hg. v. William B. Worthen, Basingstoke: Palgrave 2003, S. 136-150, hier: S. 138.
60
ALAN READ
dass die Arbeit von Tieren und Schauspielern einiges über Leistungsvereinbarungen im modernen Kapitalismus aussagt.25 In seinem ausgezeichneten Aufsatz über Tiere auf der Bühne untersucht er die im Rahmen einer Tierschau praktizierten Übungen, die Verwendung von Pferden in den Arbeiten der Societas Raffaello Sanzio und den Auftritt einer Ente in einer Inszenierung des Theatre Bazi und kommt zu dem Schluss, dass die Kosten und Mühen, die mit der ungewöhnlichen Einbeziehung von Tieren in eine Theaterproduktion verbundenen sind, nicht etwa eine Nebenwirkung, sondern vielmehr der eigentliche Sinn und Zweck dieser Wiederkehr der Tiere auf die Bühne sind.26 Ich teile Ridouts dringenden Wunsch, diese politischen und ökonomischen Fragen nicht in einem undurchsichtigen bio-ästhetischen Gespinst untergehen zu lassen, hoffe allerdings, dass man hierbei sowohl über das offensichtliche, die Erkenntnis begleitende Schamgefühl als auch über das perverse Vergnügen hinausgelangt, das Ridout mit dergleichen Verwirrungen auf dem Theater zu verbinden weiß, und sich die Einsicht Bahn brechen möge, dass in solchen Auftritten immer auch schon die Fremdheit zum Ausdruck kommt, die den Menschen inmitten der Tiere umgibt. Zwar hat Ridout durchaus Recht, wenn er sagt, dass die Tiere immer bei uns seien und nichts Fremdes an ihnen ist. In Frage steht hier aber etwas ganz anderes, und das ist die Fremdheit des Tieres Mensch. Vielleicht ist es sinnvoll, an dieser Stelle auf jenes ‚Substantiv im Schwebezustand‘ zurückzukommen und zu fragen, wofür denn ‚das Offene‘ bei Giorgio Agamben sich offen erweist. Zum Bedauern von Tier- und Umweltschützern haben die Beziehungen zwischen Menschen und anderen Tieren vielleicht weniger mit den Tieren als mit uns Menschen bzw. damit zu tun, dass der Bereich der menschlichen Dinge – also Politik, Ethik und Recht – allenthalben durch einen Schwebezustand zwischen Mensch und Tier gekennzeichnet ist. Das fragliche Experiment wird hier stets auf die Neuverhandlung der Frage hinauslaufen, was für den Menschen am wichtigsten sei. Für Agamben sind es die Konzentrationslager, die im 20. Jahrhundert die Dichotomie von Mensch und Unmensch in krassester Form aufs Spiel gesetzt und die Möglichkeit zunichte gemacht haben, zwischen beiden zu unterscheiden. In jüngster Zeit führt uns die Inhaftierung der Guantanamo-Gefangenen und die Weigerung, ihnen ein ordentliches Gerichtsverfahren zu gewähren, die Notwendigkeit vor Augen, den Boden für die Verhandlung der Frage nach dem Unterschied zwischen Mensch und Tier bei jeder politischen Gelegenheit neu zu behaupten. Und da Agamben mit zeitgenössischen Theatern wie der Societas Raffaello Sanzio auf Tuchfühlung steht, weiß er auch, dass an keinem anderen Ort das Wechselverhältnis zwischen Menschen, Tieren und Dingen auf subtilere Weise ausgehandelt worden ist als im Theater. Im gleichen Zusammenhang hatte ich oben mein Unbehagen darüber zum Ausdruck gebracht, mit welcher Leichtfertigkeit sich Ninagawa in seiner Londoner Hamlet-Inszenierung des Stacheldrahts bedient, um die Bühne, auf der ein be25 Vgl. Nicholas Ridout, Stage Fright, Animals and Other Theatrical Problems, Cambridge: Cambridge University Press 2006. 26 Vgl. ebd., S. 96-128.
ÜBER AUFFÜHRUNG ÜBERHAUPT UND ÜBER DIE AUFFÜHRUNG DES MENSCHEN
61
stimmtes menschliches Experiment aufgeführt wird (aber eben nicht das vom Stacheldraht suggerierte), mit einem Streifenmuster zu durchziehen. Dieses Experiment heißt Hamlet und muss von jenem anderen unterschieden werden, in dem der Stacheldraht gleichsam als Gründungsmaterial der Moderne tatsächlich zum Einsatz kommt; einer Geschichte, die sich wirklich auf der besonderen ‚Ebene des Fleisches‘ – und nicht bloß auf derjenigen des Körpers ‚überhaupt‘ – ereignet.27 Von der Ansiedlung der indianischen Ureinwohner Amerikas in Reservaten, der Ausrottung der Bisons als ihrer Lebensgrundlage, über die Kontrolle des Raums und des darauf weidenden Viehs bis hin zur britischen Erfindung der Konzentrationslager während des Burenkriegs im Jahr 1900 geht vom Stacheldraht als Mittel präventiver Quarantäne eine unverhältnismäßige Gewalt aus, die den Ausnahmezustand, der im 20. und frühen 21. Jahrhundert längst zum Merkmal der Politik geworden ist, bereits vorwegnimmt. Als biologisch motivierte Ideologie hat sich der Nationalsozialismus einer anthropologischen Maschine bedient, deren Aufgabe darin bestand, den hinter Stacheldraht gefangenen Juden in eine Leiche zu verwandeln. Es gibt in dieser Geschichte, um die leicht theatralische Formulierung von Reviel Netz aufzugreifen, keine Komparsen: „[...] they are all actors – humans, animals and their shared terrain. And because all these actors occupy the same stage, they cannot fail to interact.“28 Ich möchte im Folgenden auf das allgemeine ‚Überhaupt‘ zu sprechen kommen. Nicht einmal Linné, der Begründer der modernen Wissenschaftstaxonomie, hat den Menschen durch die Sprache hinreichend vom Affen unterscheiden können und musste sich schließlich damit abfinden, das Fehlen von Unterschieden zwischen dem Menschen und anderen Primaten zu verzeichnen. Giorgio Agamben weist darauf hin, dass Linné in seiner Taxonomie das Wort Homo schlicht um das philosophische Klischee nosce te ipsum (Erkenne dich selbst) ergänzt – also im Gegensatz zu anderen im Systema Naturae beschriebenen Geschöpfen nicht um eine biologische Gegebenheit, sondern um einen Imperativ – und zudem einen die Aufführung betreffenden.29 Denn wenn die Identität des Menschen sich erst seinem Vermögen verdankt, sich als Mensch zu erkennen, dann bedürfen die Menschen einer theatralen Maschine, damit sie auf dieses Bestimmungsmerkmal Einfluss nehmen und sich selber als Menschen in Szene setzen können. Der Mensch ist das Tier, das sich selbst erkennt und das sich, um menschlich zu sein, als Mensch erkennen muss. Und Menschen unternehmen bestimmte Dinge, um die genauen Grenzen eines solchen Entwurfs innerhalb der menschlichen Gattung ausfindig zu machen. Anders als die berühmte Anthropologin Wendy James bin ich der Auffassung, dass der Mensch sein Menschsein nicht auf dem Weg eines solchen Verfahrens erschafft oder erst aufgrund seines ‚zeremoniellen‘ Wesens zum Menschen wird. 27 Vgl. Reviel Netz, Barbed Wire. An Ecology of Modernity, Middletown: Wesleyan University Press 2004, S. XIII. Vgl. hier auch zu den weiteren Ausführungen im Fließtext. 28 Ebd., S. 229. 29 Vgl. Agamben, Das Offene, a.a.O., S. 36.
62
ALAN READ
Nach meiner Ansicht ist es im Gegenteil gerade die Erkenntnis, dass alles Zeremonielle an eine Grenze stößt, und die tief sitzende Ambivalenz der Menschen gegenüber allem Zurschaustellen, die sie aufmerksam macht auf das, was Deleuze im Anschluss an Dickens ‚ein Leben‘ nennt, und auf dessen Unvermögen, Wirklichkeit zu werden. Die meisten Menschen haben mehr Angst davor, öffentlich zu sprechen, als zu sterben. Genau diese Angst vor der Bloßstellung ist das Kennzeichen wahren menschlichen Lebens – was wenig überrascht, wenn man sich klar macht, dass der Mensch sich, den Ausführungen Linnés zum Trotz, von allen anderen Tieren signifikant nur durch die Fähigkeit unterscheidet, seinen Atem ohne Unterbrechung über einen längeren Zeitraum zu kontrollieren.30 Ein anhaltendes, kontrolliertes, ununterbrochenes Ausatmen mag sich dem ersten Anschein nach als ein bescheidenes Merkmal ausnehmen, das Menschliche vom Tierischen zu trennen, aber die menschliche Bereitschaft, beinahe die gesamte Potenzialität des Atmens der Sprache zu opfern, anstelle all der anderen, lautlichen Möglichkeiten, die ihm offen stehen – und im regen Wunder der infantilen Laute unmittelbar evident werden – deutet an, warum Menschen lieber sterben würden, als darum gebeten zu werden, den Grad ihrer Menschlichkeit damit zu testen, vor ihnen unbekannten Menschen Worte zu sprechen. Die Evolutionsanthropologin Ann MacLarnon und der Psychophysiologe Gwen Hewitt beschreiben diesen Sachverhalt so: „[…] the huge gulf between the breathing control of humans in even the simplest of phrases and the most demanding instances evident in nonhuman primate vocalizations clearly indicates that humans have evolved respiratory control mechanisms far beyond those of other primate species. These control mechanisms are essential to human speech production.“ 31 Es ist diese singuläre, den Menschen von allen anderen Tieren unterscheidende Fähigkeit, die den homo sapiens zum homo lingua und homo performans gemacht hat – ganz zu schweigen von dem unübersehbaren Gleichgewicht beider und der durch es ermöglichten Apotheose des homo rhetorica zum homo shakespearians. Schließlich war es Shakespeare, der im durchgehaltenen jambischen Pentameter den einfachen universellen Rhythmus des schwebenden menschlichen Atems erkannte, wobei die Frage im wahrsten Sinne des Wortes gegenstandslos ist, welche Sprache von diesem Atem getragen wurde. In den 1980er Jahren besuchte ich in den Riverside Studios in London eine Hamlet-Inszenierung des Collettivo di Parma in italienischer Umgangssprache, von der ich kein Wort begriff und die ich doch ohne Abstriche verstand. Mir wurde klar, dass es weder die englische Sprache und Eigenart noch die ganz und gar ortsgebundenen Erzählungen von Königtum und Liebeswerben sind, die aus Shakespeare einen Dichter im universalen menschlichen Sinne machen, sondern schlicht der gattungsspezifische, frei schwebende Atem als eine 30 Ich danke Ann MacLarnon für den Hinweis auf ihre umfangreichen Laboruntersuchungen zu diesem Thema. Vgl. Ann MacLarnon/Gwen Hewitt, „Increased Breathing Control: Another Factor in the Evolution of Human Language“, in: Evolutionary Anthropology 13 (2004), S. 181-197. 31 Ebd., S. 185.
ÜBER AUFFÜHRUNG ÜBERHAUPT UND ÜBER DIE AUFFÜHRUNG DES MENSCHEN
63
der wenigen Techniken, die wir besser (oder wenigstens länger) beherrschen als andere Tiere. Aber nachdem wir uns als Menschen erst einmal dieses Vermögens versichert hatten, machten wir gleich viel Aufhebens davon, begannen zu singen (so wurde die Oper erfunden) und entdeckten dann die Fähigkeit, Tanz und Gesang miteinander zu verbinden (und erfanden das Musical). Nicht von ungefähr sprach Harold Bloom in diesem Zusammenhang sogar von einer ‚Erfindung des Menschen‘ durch Shakespeare.32 Mit Rücksicht auf die Tatsache, dass der Mensch nackt zur Welt kommt und wie kein zweites Tier auf anhaltende Zuwendung angewiesen ist, um das Säuglingsund Kindesalter zu überleben, hat Linné einmal bemerkt, dass der Mensch, um im vollen Sinne Mensch zu werden, über sich selbst hinauswachsen muss.33 Das Paradox des Linné’schen Systems bestand darin, dass es Menschen, die der Selbsterkenntnis nicht fähig sind, den Affen zuteilt. Nach Giorgio Agamben verdankt sich das Entstehen der anthropologischen Maschine denn auch dem Bedürfnis, den Prozess, dem sich Selbsterkenntnis und Status des Menschen verdanken, abzusichern gegen verwandte Arten. Wenn der homo sapiens das einzige Wesen ist, das nicht durch Gattungszugehörigkeit oder Stofflichkeit festgelegt ist, dann handelt es sich bei ihm nämlich eher um eine Art Apparat, der die Erkenntnis des Menschen hervorbringen soll – und zwar um einen Apparat, der von seiner Anlage her zur Aufführung bestimmt ist. Die ersten Versionen der anthropologischen Maschine bedienten sich auch vornehmlich optischer Mechanismen, d. h. einer Reihe von Spiegeln, in denen Menschen ihre eigenen Gesichtszüge verzerrt und affenähnlich entstellt erblickten. Doch die anthropologische Maschine war ein anthropomorpher Aufführungsapparat, der so eingestellt war, dass er die Unterschiede zwischen dem Menschen und anderen Tieren erfasste und dabei das Fehlen einer dem homo sapiens eigenen Natur hervortreten ließ. Das seine Gestalt wechselnde Tier, wie Johnny Cash in seiner Hymne auf die anthropologische Maschine, The Beast In Me, einmal sang, war durchaus imstande, sich zu seinem Verhältnis zu jenem Anderen zu bekennen, von dem es vergeblich loszukommen suchte. Zu vermenschlichen, wo immer es vonnöten ist, sollte also nicht als Bedrohung humanistischer Rationalität verstanden werden – allen Menschen, die sich selber kennen, gilt es ohnehin als gesuchter Kunstgriff. Nicht nur Äsop hat dies begriffen, sondern auch Agamben. Ihre Erzählungen mögen sich in ihrer jeweiligen Eigenart unterscheiden, doch verorten beide die menschliche Politik am unsichtbaren Horizont einer sich ständig wandelnden Grenze zwischen Tieren und anderen menschlichen Tieren. Die anthropologische Maschine stellt also nicht einfach etwas her, so wie industrielle Maschinen etwas herstellen. Wie alle Maschinen markiert sie vielmehr die Unterbrechung einer Fließbewegung, die sonst unerkannt bliebe. Dass es eine Maschine gibt, weiß man schließlich erst in dem Moment, wo sie abgeschaltet wird. Giorgio Agamben hat die Funktionsweise dieser Maschine auf ebenso komplexe 32 Vgl. Harold Bloom, Shakespeare. Die Erfindung des Menschlichen, Berlin: Berlin Verlag 2000. 33 Vgl. Agamben: Das Offene, a.a.O., S. 37.
64
ALAN READ
wie philosophische Weise in einem Text beschrieben, der sich wie eine Gebrauchsanweisung liest: „Insofern in ihr die Erzeugung des Humanen mittels der Opposition Mensch/Tier, human/inhuman auf dem Spiel steht, funktioniert die anthropologische Maschine notwendigerweise mittels der Ausschließung (die immer auch ein Einfangen ist) und einer Einschließung (die immer schon eine Ausschließung ist). Gerade weil das Humane jedes Mal bereits vorausgesetzt wird, schafft die Maschine eine Art Ausnahmezustand, eine Zone der Unbestimmtheit, wo das Außen nichts als die Ausschließung des Innen und das Innen seinerseits nur die Einschließung eines Außen ist. Nehmen wir die anthropologische Maschine der Moderne. Sie funktioniert, wie wir gesehen haben, indem sie ein Schon-Humanes als (noch) Nicht-Humanes aus sich ausschließt, das heißt sie animalisiert den Menschen, indem sie das Nicht-Humane im Menschen absondert […].“34 Das klingt kompliziert – zumal wenn man nicht das Schaubild vor Augen hat, mit dem Gemma zu Beginn von Tropicana operiert – und vielleicht ist es das auch, denn das hier beschriebene Verfahren ist überaus vertrackt. Wer Zweifel daran hegt, dass wir als Menschen zu den erwähnten Ein- und Ausschließungen imstande sind, möge einmal die U-Bahnstation Arsenal im Londoner Norden aufsuchen und sich den 500 m langen Käfigzaun auf der Seite des Tunnels ansehen, der zum früheren, Highbury genannten Fußballstadion von Arsenal London führt. Einige hundert Meter entfernt, im Stadtteil Ashburton Grove, ist inzwischen ein neues Stadion entstanden, das unter dem weniger romantischen Namen ‚Emirates Stadium‘ firmiert, aber der Käfigzaun in der U-Bahnstation ist immer noch da. Erinnert man sich im Zeitalter von Premiership-Produkten und kapitalmarktabhängiger Förderung des Sports an den Sinn und Zweck des Käfigzauns und an die Rhetorik der Animalisierung, die in der 1970er und 1980er Jahren die Diskussionen über den Fußball in Großbritannien begleitete, dann wird deutlich, welche sprachlichen Voraussetzungen geschaffen werden mussten, um das Einpferchen von Fußballanhängern zu ermöglichen und sie mit einem Zaun gegebenenfalls daran zu hindern, dem Tod durch Zerquetschung, Ersticken oder Feuer zu entkommen. Oder man stelle sich vor, wie diese Tiere eingesperrt und durch aggressive, auf ihre Kinder zielende Jahreskarten-Verkaufskampagnen veranlasst wurden, der Anziehung dieses in vierzehntägigem Abstand wiederkehrenden Todestriebs zu widerstehen. Wer das Fußballbeispiel als zu wenig welthaltig empfindet oder einem weniger emotionsgeladenen Lieblingssport als dem englischen Fußball anhängt, der möge in diesem Zusammenhang an den Juden denken. Für Agamben ist dieser der Nichtmensch, der in der NS-Zeit durch eine Ausschließung innerhalb des Menschlichen hervorgebracht wurde. Während diese moderne Version der anthropologischen Maschine das Außen durch die Ausschließung eines Innen bzw. das Nicht-Humane durch die Animalisierung des Menschen erschafft, erzeugte ihre historische Variante das Innen durch die Einschließung eines Außen bzw. den Nicht-Menschen durch die Humanisierung eines Tieres. Für diese historische Spielart der anthropo34 Ebd., S. 46f.
ÜBER AUFFÜHRUNG ÜBERHAUPT UND ÜBER DIE AUFFÜHRUNG DES MENSCHEN
65
logischen Maschine gibt es unzählige Beispiele, Agamben nennt in seiner Aufzählung den Menschenaffen, das enfant sauvage, den Sklaven, den Barbaren und den Fremden als Figuren des Animalischen mit menschlichen Formen.35 Offen geblieben ist bei alldem die Frage, wo genau der Geist der Aufführung in der anthropologischen Maschine am Werk ist. Ich habe bereits wiederholt dargelegt, inwiefern diese Maschine an sich ein Aufführungsapparat ist; hier geht es mir jetzt darum, welcher Mechanik sie ihre Wirkung auf dem Theater verdankt – denn in der Tat ist derzeit so häufig von dieser Maschine die Rede, dass der Eindruck entstehen kann, sie hätte positive Wirkungen. Es verhält sich nun aber gerade nicht so, dass die Maschine etwas Negatives als ‚Negatives‘ hervorbrächte. Ihre aufführungsbezogene Funktion liegt vielmehr isoliert in einer Zone der Unbestimmtheit bzw. Indifferenz, die nach Giorgio Agambens Auffassung das Innere einer jeden solchen Maschine ausmacht. Wenn ich imstande wäre, hierfür ein Schaubild zu zeichnen – wie Gemma zu Beginn von Tropicana einen Menschen und einen Elefanten malt –, so wäre dessen Zentrum, das ich mit Kohle skizzieren und dann über das gesamte Blatt verwischen würde, durch einen Mangel an Artikulation bestimmt. Das Verwischen der Kohlezeichnung ist hier deshalb notwendig, weil der Raum, den die Aufführung für sich in Anspruch nehmen zu können glaubt, immer schon von der virtuellen Spannung zwischen Mensch und Tier, zwischen Mensch und Nicht-Mensch sowie zwischen sprechendem und lebendigem Wesen geprägt ist. Entgegen meinem Vorbehalt, dass das Theater keinen leeren Raum kennt, ist dieser Ausnahmeraum – wie andere Räume, für die sich Agamben interessiert – wirklich leer, und das eigentlich Humane, das sich hier ereignen sollte und das die Aufführung auffordert, sich zu zeigen, „[…] ist lediglich der Ort einer ständig erneuerten Entscheidung, in der die Zäsuren und ihre Zusammenführung stets von Neuem verortet und verschoben werden“36. Weder das Leben eines Menschen noch das eines Tiers wird sich hier jemals zeigen, sondern allenfalls ‚ein Leben‘, das von sich selber losgelöst und ausgeschlossen ist. Was schließlich in Erscheinung tritt, wenn die Maschine ihr Knirschen und Rotieren eingestellt hat, ist das ‚nackte Leben‘, und dann wird es die Aufführung sein, die uns im Menschenlabor als dem letzten Schauplatz des Menschen Nacht für Nacht das Innenleben dieses Apparats vorgeführt haben wird. Und auf diese Weise – so behauptet mancher Enthusiast, ohne seine Selbsttäuschung zu bemerken – habe das Theater seinen Beitrag dazu geleistet, Publikum und Darsteller auf den Trick vorzubereiten, mit dem es diese Maschine zum Stillstand bringen oder doch wenigstens, was vielleicht realistischer erscheint, unterbrechen wird. Allerdings befürchte ich, dass sich die anthropologische Maschine dergleichen Versuchen geschickt entwinden wird, was ihr ja im Blick auf das spezifisch menschliche Streben, sich Denkmäler, Mahn- und Grabmale zu errichten, in deutlich sichtbarer Form auch gelingt. Dergleichen Friedhöfe, die nur das Verlangen der anthropolo35 Ebd., S. 47. 36 Ebd., S. 48.
66
ALAN READ
gischen Maschine nach kalter Nachahmung vor Augen führen, baut sich unter allen Tieren allein der Mensch. Das Menschentier findet Gefallen an der Nutzlosigkeit dieser anthropomorphen Grab-Maschinen, denn es allein ist dazu imstande, Ähnlichkeit wahrzunehmen: „Wo wir bloße Ähnlichkeit wahrnehmen, nimmt das Tier entweder ein Selbes oder ein Anderes wahr – aber nicht beide in einem, wie wir es in der Erfassung der Ähnlichkeit tun.“37 Während man das Animalische als auf verfrühte und romantische Weise ‚unmittelbar‘ bezeichnen mag, wird man das Menschliche nüchtern erst in dem Moment erfassen, wo man es in seinem Angewiesensein auf Vermittlung wahrnimmt – das Zeitalter des Menschen ist im wörtlichen Sinne das Medienzeitalter. Als die Menschen irgendwann in ihrer Urgeschichte, in einer Grabkammer oder einer Höhle der Frühzeit, begannen, das Gleiche als ‚nicht identisch‘ wahrzunehmen, erkannten sie die Möglichkeit eines minimalen Unterschieds. Es ist dieser Unterschied, in dem die Aufführung von Neuem beginnt. Wie heißt es doch gleich am Anfang von Tropicana, in einem anderen niedrigen Gewölbe, das augenscheinlich tief im Innern der Erde lag: „Vergiss das da. Man muss dieses von diesem unterscheiden können.“ Aus dem Englischen von Christoph Nöthlings.
Literaturverzeichnis Agamben, Giorgio, Das Offene. Der Mensch und das Tier, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2003. Auslander, Philip, Liveness: Performance in a Mediatized Culture, London/New York: Routledge 1999. Benjamin, Walter, „Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen“, in: Gesammelte Schriften, Bd. 2, hg. von Rolf Tiedemann/Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1989, S. 140-157. Bloom, Harold, Shakespeare. Die Erfindung des Menschlichen, Berlin: Berlin Verlag 2000. Brook, Peter, Der leere Raum, Berlin: Hoffmann und Campe 1969. Carlson, Marvin, The Haunted Stage: The Theatre as Memory Machine, Ann Arbor: The University of Michigan Press 2001. Chaudhuri, Una, „Zoo Stories“, in: Theorizing Practice, hg. v. William B. Worthen, Basingstoke: Palgrave 2003, S. 136-150. Deleuze, Gilles, „Die Immanenz: ein Leben…“, in: Gilles Deleuze – Fluchtlinien der Philosophie, hg. v. Friedrich Balke/Joseph Vogl, München: Wilhelm Fink 1996. Dickens, Charles, Unser gemeinsamer Freund, Bd. 2, Berlin: Rütten & Loening 1983. De la Durantaye, Leland, „The Suspended Substantive“, in: Diacritics 33 (2003), S. 3-9. Jonas, Hans, Das Prinzip Leben. Ansätze zu einer philosophischen Biologie. Frankfurt a. M./Leipzig: Insel 1994. MacLarnon, Ann/Hewitt, Gwen, „Increased Breathing Control: Another Factor in the Evolution of Human Language“, in: Evolutionary Anthropology 13 (2004), S. 181-197. 37 Hans Jonas: Das Prinzip Leben. Ansätze zu einer philosophischen Biologie. Frankfurt a. M./ Leipzig: Insel 1994, S. 279.
ÜBER AUFFÜHRUNG ÜBERHAUPT UND ÜBER DIE AUFFÜHRUNG DES MENSCHEN
67
Netz, Reviel, Barbed Wire. An Ecology of Modernity, Middletown: Wesleyan University Press 2004. Phelan, Peggy, Unmarked. The Politics of Performance, London: Routledge 1993. Pradier, Jean-Marie, „Animals, Angel and Performance“, in: On Animals. Performance Research, 5:2 (2000), S. 11-22. Read, Alan (Hg.), On Animals. Performance Research, 5:2 (2000). —, Theatre & Everyday Life. An Ethics of Performance, London: Routledge 1993. —, Theatre, Intimacy & Engagement, Houndmills: Palgrave 2008. Ridout, Nicholas, Stage Fright, Animals and Other Theatrical Problems, Cambridge: Cambridge University Press 2006. Schechner, Richard, Performance Theory, New York/London: Routledge 2004. Žižek, Slavoj, Parallaxe. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2006. —, Die Puppe und der Zwerg, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2006.
MATTHIAS WARSTAT
Politisches Theater zwischen Theatralität und Performativität
Die Frage nach Möglichkeiten eines politischen Theaters richtet sich zuerst an die Theaterpraxis, und sie wird dort auf vielfältige Weise beantwortet. Man kann auf eine Reihe von Inszenierungen der letzten Jahre verweisen und sagen: So sieht politisches Theater heute aus, so kann es funktionieren, so wird es wirksam. Man kann aber auch – mit anderen, weniger überzeugenden Beispielen – den Mangel an politisch relevantem Theater beklagen. Es wäre ein naheliegendes Vorgehen, ein oder zwei Beispielinszenierungen zu analysieren und daraus verallgemeinernde Schlussfolgerungen über gegenwärtige Ausprägungen politischen Theaters zu ziehen. Ich möchte in diesem Aufsatz anders vorgehen. Den Ausgangspunkt sollen keine konkreten Inszenierungen, sondern zwei theoretische Begriffe bilden, mit denen die Geisteswissenschaften in den zurückliegenden Jahrzehnten intensiv beschäftigt waren und die wichtige Pole fachübergreifender Diskussionen bildeten – Theatralität und Performativität. Welches Licht werfen diese beiden Begriffe auf die Chancen des Theaters, politisch wirksam zu werden? Welche politischen Strategien lassen sich für das Theater aus einer Beschäftigung mit Theorien des Theatralen und des Performativen ableiten? Gibt es überhaupt eine vitale Beziehung zwischen der gegenwärtigen performance- und theatertheoretischen Debatte und den politischen Bemühungen des Gegenwartstheaters? Diese Fragen erfordern einige definitorische Vorbemerkungen zu Theatralität und Performativität. Im deutschsprachigen Raum hat die Theaterwissenschaft die beiden Konzepte eng zusammengerückt. Tatsächlich hegten Forschungsprojekte unter den Vorzeichen von Theatralität und Performativität oft ähnliche Erkenntnisinteressen.1 Viele dieser Projekte hatten es nicht allein mit dem Kunsttheater zu tun, sondern befassten sich mit Entgrenzungsbewegungen des Theaters hin zu anderen Künsten, Musiktheater, Tanz, aber auch zu ganz anderen Diskursen und alltäglichen Praktiken. Viele bezogen sich auf den Aufführungsbegriff und untersuchten Zusammenhänge von Wahrnehmung, Bewegung und Repräsentation, ganz gleich ob sie von Theatralität oder von Performativität sprachen. Und auch im Hinblick auf das Politische waren sich die Perspektiven ähnlich: In Frage stand die Hervorbringung von Identitäten, Gemeinschaften und Machtstrukturen, das Einnehmen, Besetzen
1 Ein Beispiel für diese thematische Nähe sind die Projekte des DFG-Sonderforschungsbereichs Kulturen des Performativen und des DFG-Schwerpunktprogrammes Theateralität als Modell in den Kulturwissenschaften, die in den 1990er Jahren phasenweise zeitgleich betrieben wurden und ihr Zentrum an der Freien Universität Berlin hatten.
70
MATTHIAS WARSTAT
und Verteidigen von Räumen, die Durchsetzung von Sprachregelungen, Verhaltensnormen und Wahrnehmungsanordnungen. Allen diesen Übereinstimmungen zum Trotz wird man heute – fast schon aus einer Art Rückschau – eher die Differenzen zwischen den Konzepten betonen. Dazu hat nicht zuletzt die Verdichtung des interdisziplinären Dialogs beigetragen: So musste es etwa aus kunsthistorischer Perspektive schon immer abwegig scheinen, Theatralität und Performativität miteinander zu verklammern. Zu Recht wurde darauf hingewiesen, dass viele Arbeiten der Performancekunst ihre Energie gerade aus der Abwendung von traditionellen Theatermodellen und aus einer Abneigung gegen Theaterkonventionen bezogen. Im Englischen eröffnen die Attribute ‚theatrical‘ und ‚performative‘ ganz unterschiedliche Bedeutungshorizonte und weisen insofern darauf hin, dass sich Theatralität und Performativität trotz einer gewissen Verwandtschaft eher ergänzen als ersetzen können.
I. Theatralität / Performativität Mit seiner Studie Überwachen und Strafen (frz. 1975, dt. 1977) hat Michel Foucault demonstriert, wie treffend sich selbst die auf den ersten Blick unspektakuläre Politik des modernen Anstaltsstaates mit Hilfe eines Theatermodells analysieren lässt. Die Machtstrategien der Disziplinierungsinstitutionen des 18. und 19. Jahrhunderts (Militär, Justiz, Medizin, Wissenschaft) gewinnen in Foucaults Beschreibung unverkennbar theatrale Züge: Es geht um eine körperbezogene Macht, die der Inszenierung bedarf, einen überwachenden Blick voraussetzt und im Handeln umgesetzt werden muss. Die angestrebte Formung der Seele am Körper erfolgt durch eine ‚Kunst der Verteilungen‘: Durch verschiedene Techniken der Platzierung, Isolierung und Parzellierung werden die Subjekte im sozialen Raum verteilt. Hinzu kommt eine penible ‚Kontrolle der Tätigkeit‘: Vormals individuelle Zeitabläufe werden zentral strukturiert, Regeln erlassen und Aktivitäten rhythmisiert, um ein effizientes Zusammenspiel der Kräfte zu gewährleisten. Dies ist Aufgabe der überwachenden Beobachter, die zugleich Regisseure und Publikum des modernen Macht-Theaters sind. Sie arrangieren die Körper zu artifiziellen Tableaus, konzipieren Übungspläne und kontrollieren deren Umsetzung.2 Die Theatermetapher hat hier ihre Berechtigung, denn gemeint sind körperliche Übungen, die als durchgängig wahrgenommene in den Stand von Aufführungen erhoben sind. Entsprechend ist in modernen Besserungsanstalten, wie Foucault an dem berühmten Gefängnisentwurf von Jeremy Bentham aus dem Jahr 1787 zeigt, jede Zelle „ein kleines Theater, in dem jeder Akteur allein ist, vollkommen individualisiert und ständig sichtbar.“3
2 Vgl. Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1994, S. 173-250. 3 Ebd., S. 257.
POLITISCHES THEATER ZWISCHEN THEATRALITÄT UND PERFORMATIVITÄT
71
In Foucaults Adaption der Theatermetapher gibt es ein Moment des Imaginären, denn der Clou an der Überwachung durch die Beobachter ist, dass sie auch dann funktioniert, wenn diese Beobachter, die Kontrolleure, von den Häftlingen nur eingebildet werden. Der Blick der Kontrolleure kann von den Häftlingen ohnehin nicht erwidert werden, weil den Häftlingen die Sicht auf den zentralen Beobachtungsposten verwehrt ist. Entscheidend ist allein die Vorstellung, dass jederzeit jemand auf dem Posten sein könnte. Es reicht, dass dieser beobachtende Jemand imaginiert wird, er muss nicht wirklich zu jeder Zeit in die Zellen hineinschauen. Foucault will damit verdeutlichen, dass das Funktionieren der Machtausübung nicht von einzelnen Handlungen, sondern von dem räumlichen Dispositiv ausgeht. Allein durch die Konstruktion des Raums und die Anordnung der Personen im Raum ist gewährleistet, dass sich die Häftlinge permanent beobachtet und dadurch zu einer Verhaltenskontrolle veranlasst fühlen. Sehr oft, wenn in der Literatur von theatralen Machtverhältnissen oder von einer Politik des Theatralen die Rede ist, geht es um solche Verhältnisse von Wahrnehmen, Verstecken und Zeigen. Im Mittelpunkt stehen weniger einzelne Akte der Hervorbringung als situative Konstellationen eines Wahrnehmungsdispositivs, das Machtausübung gewährleistet. Der Begriff meint – bei aller historischen Variabilität – eine Konstellation des Zeigens und Betrachtens, aus der sich für beide Seiten Konsequenzen ergeben. Während uns ‚Theatralität‘ an Situationen denken lässt, verweist ‚Performativität‘ auf Akte/Handlungen, die folgende Merkmale tragen: Sie erzeugen Wirklichkeit, und sie verweisen im Vollzug vorrangig auf sich selbst. Definiert man Performance als scripted embodiment (Freddie Rokem) oder als restored behavior (Richard Schechner), so kommt eine dritte Eigenheit in Sicht: Performativ werden Akte genannt, die sich auf vorgegebene Muster beziehen. In jedem Akt dieser Art gibt es eine Form der Rückwendung auf Praktiken der Vergangenheit, die der gegenwärtigen Handlung zugrunde liegen. Gegenwärtig kreist die Performativitätsdiskussion, ausgelöst durch das in den Künsten beobachtbare Interesse an Reenactments, verstärkt um Fragen der Rückwendung und der Wiederholung: Welche Funktion kommt im performativen Handeln dem Rekurs auf die Vergangenheit zu? Wie viel Handlungsspielraum bleibt dem Einzelnen, wenn er im Handeln auf vorgegebene Muster zurückgreifen muss? Was unterscheidet die in jedem Handeln feststellbare repetitive Komponente von einem bewusst gestalteten Reenactment? Es ist auf den ersten Blick nicht leicht, das Neue an dieser Diskussion zu erkennen. Denn dass performative (Sprech-)Akte auf vorgängige Codes, Regeln, Muster und Modelle rekurrieren, ist der sprachphilosophischen Theoretisierung von Performanz in der Tradition Austins, Derridas und Butlers seit Langem bekannt. Jeder Sprechakt wendet die diskursiven Regeln einer Sprachkultur an, die ihm vorausgeht. Jeder Akt wird durch einen früheren Akt präfiguriert. Neu ist aber die Annahme, dass die Wiederholungsstruktur des Handelns die Möglichkeit eröffnet, im gegenwärtigen Akt eine vitale Beziehung zu Akten der Vergangenheit herzustellen. Das bewusste Reenactment wird in diesem Sinne als eine Praxis beschrieben, im Zuge derer vergangene Handlungen regelrecht berührt und modelliert werden können.
72
MATTHIAS WARSTAT
II. Wiederholen: Politiken des Performativen Vom Performativitätsbegriff ausgehend auf politische Fragen zu kommen, war schon immer naheliegend. Judith Butler hat diesen Weg in ihren Büchern vorgezeichnet. Performative Akte sind politisch, so lässt sich von Butler lernen, weil sie unmittelbare – oft genug gewaltsame und brutale – Auswirkungen auf Menschen und deren Lebenswirklichkeit haben.4 Performative Akte sind politisch, weil sie die Gesellschaft im Kleinen wie im Großen verändern. Diese politische Dimension tritt zutage, wenn es um die performative Konstituierung oder Subversion von Identitäten, Beziehungen und Institutionen geht. In Butlers frühen Büchern Das Unbehagen der Geschlechter (USA 1990, dt. 1991) und Körper von Gewicht (USA 1993, dt. 1995) wurden konkrete Strategien einer performativen Geschlechterpolitik erörtert. Im Zentrum standen Gesten der Setzung oder Besetzung abweichender Geschlechtsidentitäten wie auch Akte der Negation oder Dekonstruktion einer binären, heterosexuellen Matrix. Es war klar, dass solche Praktiken von größter politischer Relevanz sein konnten, weil sie die sexuellen und geschlechtsbezogenen Machtverhältnisse in Frage stellten. Transsexualität, Travestie und andere gender performances wurden von Butler auf ihre konkreten politischen Chancen untersucht. Ähnliche Untersuchungen, von Butler und vielen anderen, richteten sich bald auf nahezu alle Felder von Identitätspolitik, so etwa auf kulturelle, religiöse, nationale, ethnische und klassenbezogene Orientierungen. Das Theater als Kunstform spielte in derlei Untersuchungen eine geringe Rolle. Als konkreter Schauplatz von Identitätspolitik schien es von untergeordnetem Interesse, und Butler selbst lieferte in ihren Überlegungen zur Travestie gute Gründe für eine gewisse Skepsis hinsichtlich der politischen Möglichkeiten des Theaters. „Das Theater theatert alles ein“ – diese Sorge Brechts teilte auch Butler: Gender performances im Theater, so subversiv sie auch immer angelegt sein mögen, muss man nicht gleichermaßen ernst nehmen wie im Alltag. Es mache einen Unterschied, ob man einem Transvestiten auf der Bühne oder im Bus begegne, argumentierte Butler in einem frühen Aufsatz und markierte damit die politischen Fallstricke des Theaterrahmens: Im Theater (wie in anderen Künsten) können politische Konflikte auf fatale Weise entschärft werden, indem sie in einen ästhetischen Rahmen geraten, der Distanz, Ironie, Illusion und Unwirklichkeit nahelegt.5 Performative Setzungen haben im Theater deshalb möglicherweise geringere politische Durchschlagskraft als außerhalb. Dies könnte der Grund dafür sein, dass Butlers Interesse für die Künste und zumal fürs Theater von Jahr zu Jahr und von Buch zu Buch abgenommen zu haben scheint. Die Hervorbringung von nationalen, ethnischen, kulturellen, geschlechtlichen oder klassenbezogenen Identitäten gerade am Theater zu untersuchen, erscheint tatsächlich kompliziert, denn eine Relativierung oder zu4 Siehe dazu insbesondere Judith Butler, Gefährdetes Leben. Politische Essays, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2005. 5 Vgl. Judith Butler, „Performative Acts and Gender Constitution. An Essay in Phenomenology and Feminist Theory“, in: Theatre Journal 40:4 (1988), S. 519-531.
POLITISCHES THEATER ZWISCHEN THEATRALITÄT UND PERFORMATIVITÄT
73
mindest Problematisierung der Identitätskonstruktion ist mit dem Kunstrahmen zweifellos verbunden. Daneben macht Butler auf eine zweite Inkongruenz zwischen Performativität und Theatralität aufmerksam: „Die Performativität ist [...] kein einmaliger ‚Akt‘, denn sie ist immer die Wiederholung einer oder mehrerer Normen; und in dem Ausmaß, in dem sie in der Gegenwart einen handlungsähnlichen Status erlangt, verschleiert oder verbirgt sie die Konventionen, deren Wiederholung sie ist. Darüber hinaus ist dieser Akt nicht in erster Linie theatralisch; seine augenscheinliche Theatralik wird in dem Umfang hergestellt, in dem seine Geschichtlichkeit verborgen bleibt (und umgekehrt gewinnt seine Theatralik eine gewisse Unvermeidlichkeit angesichts der Unmöglichkeit, seine Geschichtlichkeit vollständig aufzudecken).“6
Das Performative und das Theatralische werden von Butler hinsichtlich ihres jeweiligen Verhältnisses zur Wiederholung kontrastiert.7 Das Theatralische neigt aus ihrer Sicht dazu, den Rekurs auf frühere Regeln und Praktiken, also die eigene Geschichtlichkeit, zu verdecken. Das Performative ist für Butler dagegen gerade durch seinen Wiederholungscharakter gekennzeichnet. Diese Gegenüberstellung überrascht zunächst, denn verweist nicht das Theatralische auf die Kunstform Theater, die in der Praxis des Inszenierens (bzw. im Probenprozess) obsessiver als jede andere Kunstform an der Errichtung von Wiederholungsstrukturen arbeitet? Richtig ist aber auch, dass die Wirksamkeit von Theateraufführungen häufig in Kategorien des Wahrnehmungsereignisses beschrieben worden ist, d. h. als eine Zäsur, die in ihrer Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit den repetitiven Strukturen performativer Zitation klar entgegensteht.8 Es liegt insofern nahe, eine Politik des Theatralen im Ereignishaften aufzusuchen, eine Politik des Performativen dagegen in der Wiederholung. Zu einer Politik des Performativen hat Judith Butler Thesen entwickelt, die auch in der deutschsprachigen Diskussion häufig mitschwingen, wenn Performativität und Macht in ihrem Verhältnis beleuchtet werden: Performativität wirkt dort, wo Identitäten, Beziehungen und Institutionen hervorgebracht werden. Solche Akte der Hervorbringung sind bei Butler an Diskurse (Regeln, Codes, Symbolsysteme) gebunden, zitieren diese Diskurse, aber das heißt ausdrücklich nicht, dass alle Macht bei den Diskursen zu lokalisieren wäre. Entscheidend für die Bestimmung des Butler’schen Machtbegriffs ist vielmehr eine Auseinandersetzung mit der Idee der Wiederholung. Denn woher kommt die Macht, neue Identitäten zu setzen, Be6 Judith Butler, Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1997, S. 36. 7 Das Theatralische und das Theatrale dürfen normalerweise nicht gleichgesetzt werden. Im Englischen verweist das Attribut ‚theatrical‘ allerdings auf beide Konzepte, sodass sich die Aussage des Butler-Zitats mit gewissen Modifikationen meines Erachtens auch auf Theatralität im allgemeineren Sinne beziehen lässt. 8 So etwa bei Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004, S. 281-284.
74
MATTHIAS WARSTAT
ziehungen zu verändern und Institutionen umzugestalten? Sie resultiert nach Butler aus dem Verhältnis von Wiederholung und Abweichung. Zwar werden beim Praktizieren einer Identität, beim Führen einer Beziehung wie auch beim Arbeiten in einer Institution bestimmte Wendungen des Diskurses wiederholt, aber in dieser Wiederholung ergibt sich die Chance – und sogar die Notwendigkeit – zur Abweichung. Gestaltungsmacht (agency) manifestiert sich in Abweichungen von einem repetitiven Handlungsmuster. Über agency verfügt derjenige, dem es gelingt, sich in der Praxis, d. h. im Handeln, von den Wiederholungsschleifen des Diskurses stärker zu emanzipieren als andere. Eine solche eigensinnige Zitation des Diskurses eröffnet politische Potenziale, zumal zu erwarten ist, dass die abweichende Praxis über kurz oder lang den gesamten Diskurs verändert. Das Politische könnte unter performativen Gesichtspunkten also in die Frage gefasst werden, wie, an welchem Punkt, auf welche Weise und aus welchen Gründen in der Wiederholung Abweichung zustande kommt. Die in jüngster Zeit geführte Debatte über Reenactments, eine spezielle, vergangenheitsbezogene Sorte von Performances, hat auf eine zweite Möglichkeit repetitiver Politik aufmerksam gemacht. Rebecca Schneider beschreibt in ihrem Buch Performing Remains (2011) Praktiken, die darauf abzielen, eine Beziehung zur Vergangenheit herzustellen. Indem ich eine bestimmte Handlung aus der Vergangenheit mit größtmöglicher Exaktheit wiederhole, so die Suggestion der Schneider’schen Argumentation, kann ich die vergangene Welt nicht nur imitieren, sondern ‚berühren‘ (touch) und reanimieren. Handelnde Körper werden auf diese Weise zu Kreuzungspunkten verschiedener Zeiten, die sich in der Gegenwart/Vergangenheit/ Zukunft der Performance komplex überlagern. Schneider liefert überzeugende Beispiele für die politische Wirksamkeit einer solchen Praxis: „It is interesting to take the example of battle reenactment into account and look at the particular case of Robert Lee Hodge – an avid Civil War enthusiast who participates in reenactments. As Marvin Carlson described him in an essay on theatre and historical reenactment, Hodge has attained significant notoriety among reenactment communities for his ‚ability to fall to the ground and contort his body to simulate convincingly a bloated corpse.‘ The question is obvious: under what imaginable framework could we cite Hodge’s action as a viable mode of historical knowledge, or of remaining? Is Hodge’s bloat not deeply problematic mimetic representation, and wildly bogus and indiscreet at that? [...] Yet, within the growing ‚living history‘ and reenactment movement, Hodge’s bloating body is, for many enthusiasts, evidence of something that can touch the more distant historical record, if not evidence for something authentic itself. In the often-ridiculed ‚popular‘ arena of reenactment, Hodge’s bloat is a kind of affective remain – itself, in it’s performative repetition, a queer kind of evidence.“9
9 Rebecca Schneider, Performing Remains. Art and war in times of theatrical reenactment, London/New York: Routledge 2011, S. 101. Hervorhebung im Original. Zitat im Zitat: Marvin Carlson, „Performing the Past. Living History and Cultural Memory“, in: Paragrana 9:2 (2000), S. 237-248, hier: S. 244.
POLITISCHES THEATER ZWISCHEN THEATRALITÄT UND PERFORMATIVITÄT
75
Die ‚historisch exakte‘ Darstellung einer Leiche gewinnt in diesem Beispiel Überzeugungskraft, wenn nicht gar Beweiskraft, vor allem aber eine affektive Suggestivität, die ohne weiteres politisch besetzbar scheint. Der inszenierte Körper überbrückt Distanzen in mehreren Dimensionen, er verknüpft das historisierende Spektakel mit dem Feld historischer Dokumentation (record) und erstreckt sich zugleich über die zeitliche Kluft zwischen dem Amerika des ‚war on terror‘ und dem Jahrzehnt des Sezessionskriegs. Kein Zweifel: Ein Reenactment dieser Art ist in der Lage, unser Bild vom Krieg wie auch unsere Haltung zu konkreten Kriegen zu verändern. Dass sich diese Reorganisation des Bildes im Unbewussten vollziehen mag, macht sie nicht weniger wirksam. Die Bandbreite einer performativen Politik der Wiederholung reicht demnach von subtilen Strategien der Abweichung bis hin zu einem akribischen Bemühen um exakte Reinszenierung. Der Begriff des Performativen macht auf die Nachträglichkeit des Handelns, auf die (Vor-)Strukturiertheit aller denkbaren Akte aufmerksam. Er verweist auf eine übermächtige Struktur, die das Handeln einerseits bestimmt, zu der sich der/die Handelnde aber andererseits unterschiedlich und durchaus strategisch verhalten kann. So sind die politischen Implikationen von Performancetheorie stets dem Gegensatz von Struktur und Handeln verhaftet: Strukturen wiederholen sich im Handeln, und sie sind nirgendwo anders als im Handeln konstituiert. Daraus folgt aber kein in sich geschlossener Zirkel, denn ist die Existenz einer Struktur erst einmal erkannt und anerkannt, so erlaubt zum Beispiel der Theaterrahmen weitreichende Interventionen in diese Struktur. Politische Potenziale entstehen nur dann, wenn nicht allein das Handeln, sondern auch dessen Rahmen strategisch ausgerichtet wird.
III. Erkennen: Politiken des Theatralen Die im ersten Teil des Aufsatzes getroffene Feststellung, dass uns der Theatralitätsbegriff mehr an situative Konstellationen als an Handlungen denken lässt, bedarf noch einer Ergänzung. Denn gemeint sind Situationen des Zeigens und Erkennens. Zum semantischen Feld des Theaters gehört das Zeigen, Hervorheben, Vorführen, das Christoph Menke in folgender Formulierung vom einfachen Ausführen einer Handlung unterscheidet: „Eine Handlung auszuführen heißt, diese Handlung zu tun. Eine Handlung vorzuführen heißt, diese Handlung zu zeigen. Während es daher in der Ausführung nur eine Handlung gibt, gibt es in der Vorführung zwei: die gezeigte Handlung und die zeigende Handlung (oder die Handlung des Zeigens).“10 Komplementär zum Zeigen – und damit ebenso unverzichtbar in der theatralen Konstellation – ist eine Form des Erkennens, über die in der Geschichte der Theatertheorie in Kategorien der Demaskierung, der Evidenz, der Epiphanie oder der Verfremdung auf unterschiedlichste Weise nachgedacht wor10 Christoph Menke, Die Gegenwart der Tragödie. Versuch über Urteil und Spiel, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2005, S. 123.
76
MATTHIAS WARSTAT
den ist. Ein markantes Beispiel für ein solches situatives Erkennen ist die Urszene der Psychoanalyse: Die Eltern beim Geschlechtsakt zu ertappen und zu sehen, impliziert für das Kind ein traumatisches Erkennen, das aus dem Strom routinierten Wahrnehmens herausragt. Das Wahrnehmungsereignis, das wir als theatral hervorheben, ist – wie in diesem Beispiel – oftmals mit einer Erkenntnis, einer Enthüllung oder einem Déjà-vu verbunden.11 Die auf diese Weise angedeutete Relation von Theater und Erkennen/Erkenntnis muss näher erläutert werden, weil sie Missverständnissen Vorschub leisten und den Vorwurf der Ontologisierung heraufbeschwören kann. Erstens gilt es einzuräumen, dass es selbstverständlich Theaterformen gibt (und immer gegeben hat), an denen keine Erkenntnisse zu gewinnen, aber dennoch weitreichende Erfahrungen zu machen sind. Zweitens sind die Besonderheiten theatralen Erkennens genauer einzugrenzen. Nur in seltenen Fällen geht es dabei um Belehrung oder Wissensvermittlung. Kaum je soll der Zuschauer im Schauspieler einem Pädagogen, Lehrer oder Agitator begegnen. Es kommt bei dem hier gemeinten Begriff des Erkennens auch nicht darauf an, das Zeichenensemble einer Theateraufführung verständnisvoll oder gar ‚richtig‘ zu lesen. Ein Erkennen stellt sich vielmehr dann ein, wenn der Zuschauer den Rand dieses Zeichenensembles fokussiert und wenn ihm an diesem Rand eine komparative Operation gelingt, nämlich die inszenierte Welt der Aufführung mit der Welt außerhalb des Theaters in Beziehung zu setzen. Unter ästhetischen Gesichtspunkten muss darauf insistiert werden, dass im Theater eine eigene, von allen anderen unterschiedene Welt hervorgebracht werden kann. Diese Welt der Aufführung steht aber, wenn sie erst einmal konstituiert ist, in einer erkennbaren Beziehung zur Welt außerhalb des Theaters. Gertrud Koch hat diese ästhetische Konstellation folgendermaßen beschrieben: „Weltvermittlung geschieht in der Ästhetik durch Welterstellung. Nicht die Abbildung und Beschreibung der Welt steht in ihrem Zentrum, sondern die Aufstellung von Welten, die implizite Stellungnahmen zur Welt enthalten können. Das Aufstellen von Welten wäre, verkürzt gesagt, wozu die Autonomie der Kunst sie befähigt; das Aufstellen einer Welt, die sich fallibilistisch zu allen anderen Welten verhält; einer Welt, die virtuell bleibt, also Wirkungen zeitigt, ohne real zu werden, keine potentielle Welt eben, die auf ihr Möglichwerden hin angelegt ist.“12
Demnach besteht ästhetisches Denken in der Relationierung zweier Welten, von denen die eine eine inszenierte, dargestellte Welt ist, wie sie in den Künsten hervorgebracht (‚aufgestellt‘) werden kann. Die Relationierung kann auf einen Kontrast
11 Vgl. zum Begriff der Urszene den anregenden Sammelband von Marcus Coelen (Hg.), Die andere Urszene, Zürich/Berlin: diaphanes 2008. Darin findet sich unter dem Titel „Zerfahren“ (S. 113-148) ein Aufsatz des Herausgebers, in dem besonders über die theatralen Implikationen der Urszene reflektiert wird. 12 Gertrud Koch, „Filmische Welten – Zur Welthaltigkeit filmischer Projektion“, in: Dimensionen ästhetischer Erfahrung, hg. v. Joachim Küpper/Christoph Menke, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2003, S. 162-175, hier: 162.
POLITISCHES THEATER ZWISCHEN THEATRALITÄT UND PERFORMATIVITÄT
77
hinauslaufen, aber auch zu der (nicht selten unheimlichen) Erfahrung führen, Elemente der eigenen Welt in der fremden Welt wiederzuerkennen. Auch die politischen Potenziale, auf die der Begriff des Theatralen aufmerksam macht, scheinen entsprechend weniger im Handeln als im Erkennen zu liegen, vielleicht speziell in einem Wiedererkennen, wie es in der ästhetischen Reflexion des Theaters, in Diskussionen um die theatrale Doppelung, das Als-ob, Formen von Figuration und Defiguration, immer wieder auftaucht. Schon die antiken Theatermacher setzten auf eine Dramaturgie der anagnorisis, d. h. sie inszenierten Situationen des Wiedererkennens, die dem Zuschauer ebenso plötzliche wie verstörende Übertragungen auf eigene Erfahrungen und eigene Konfliktlagen ermöglichten. Wie ein pulsierender Fremdkörper konnte sich das Theater in den Alltag der Polis schieben, um dort Diskussionen und Reflexionen in Gang zu setzen. Ein solches Theater wäre als Reflexionsform zu charakterisieren, als eine besondere Art und Weise des Nachdenkens, die an konkrete Körper, Räume, Stimmen und Bewegungen gebunden ist. Auch in der europäischen Moderne setzte politisches Theater oft auf ein Erkennen, das aus der Konfrontation oder Implosion zweier Welten resultierte. Anders als etwa im Agitationsfilm war im politischen Theater der Zwischenkriegszeit die direkte, rhetorische Ansprache des Publikums nicht der Regelfall. Häufiger vertrauten Theatermacher auf die Inszenierung anderer, fremder (z. B. historisch anmutender) Situationen, um diese dann mit dem Alltag der Zuschauer kollabieren zu lassen. Der Theatralitätsbegriff lenkt den Blick auf dieses folgenreiche Zusammentreffen von Theaterwelt und Alltagswelt, aus dem ein augenblickliches, schockhaftes, aber auch befreiendes Erkennen erwachsen kann. 1933, im ersten Jahr seiner Flucht vor dem NS-Regime, die ihn über Österreich, die Schweiz und Frankreich nach Moskau führte, verfasste der süddeutsche Kommunist, Arzt und Schriftsteller Friedrich Wolf eine Schrift unter dem Titel Schöpferische Probleme des Agitproptheaters. „Leider fehlt mir in der Emigration mein ganzes über zehn Jahre gesammeltes Material“, klagt Wolf in einer ersten Fußnote, „ich bin bei den folgenden Angaben auf mein Gedächtnis angewiesen.“13 Trotz dieser widrigen Umstände entfaltet er ein großes historisches Panorama revolutionären politischen Theaters, das von den altindischen Tempelspielen, über frühneuzeitliches Volkstheater bis zur KPD-Landagitation in der späten Weimarer Republik reicht. Wolf interessiert sich für Theaterformen, die eine Wendung vom dargestellten historischen Narrativ zu einer aktuell gegebenen politischen Wirklichkeit in sich bergen. Besonders klar wird diese Wendung an einem Beispiel aus der Zeit der Bauernkriege, dem Fastnachtsspiel Das ehrsame Narrengericht in einer Aufführung der Bauern von Grosselfingen in der Schwäbischen Alb von 1514. „Gerade dies ‚Ehrsame Narrengericht‘ von Grosselfingen“, schreibt Wolf, „[...] hat aber seine besondre Geschichte, die ein Beweis ist für die politische Aktionskraft dieser mittelalterlichen Agitationsspiele. Die Avantgarde der revolutionären Bauern [...] hatten sich in solchen Spieltrupps organisiert und bewaffnet. Sie 13 Friedrich Wolf, Aufsätze über Theater, Berlin: Aufbau 1957, S. 12-54, hier: S. 13.
78
MATTHIAS WARSTAT
bestimmten als Zeitpunkt für das Losschlagen die Aufführung des Fastnachtsspiels [...] ein Fest, bei dem die Feudalherren, die gesamte Ritterschaft des Landes anwesend waren. Mitten im Spiel des ‚Ehrsamen Narrengerichts‘ zogen nun die Grosselfinger Bauern anno 1514 aus ihren Narrenpritschen ihre verborgenen Schwerter und machten die zuschauenden Ritter nieder; noch am gleichen Tag wurde die Burg der Buben von Bubenhofen von den aufständischen Bauern niedergelegt: aus dem Spiel war blutiger Ernst geworden. [...] Es organisierte, bewaffnete und tarnte die große Bauernrevolte von 1514.“14
Wolf beschwört das Modell einer historischen Theaterform herauf, die nicht politische Botschaften vermitteln oder zu zukünftigen Handlungen aufrufen möchte, sondern in sich selbst zugleich karnevaleskes Fest und reale politische Aktion ist: In der Aufführung verwandeln sich die dramatischen Figuren der Geschichte in reale politische Akteure der Gegenwart. Ein ähnlich gelagertes Beispiel bezieht Wolf aus seiner Arbeit mit dem KPDnahen ‚Spieltrupp Süd-West‘ im Stuttgarter Raum kurz vor Hitlers Machtübernahme im Winter 1932/33. Wolfs Truppe hatte ein Stück über Krieg und Revolution unter dem Titel Von New York bis Schanghai im Repertoire. Dazu schreibt Wolf: „Wir zeigten während des v. Papenschen Burgfriedens, ja noch Ende Februar unter der Reichskanzlerschaft Hitlers, unter starker Polizeikontrolle, vor 1200 Arbeitern eine militärische Zersetzungsszene, wie ein gefangener kommunistischer Funktionär zwei Soldaten aufklärt ... in China, in Chabarowsk während der japanischen Invasion. Wie dann die Hitlerschen Überwachungsbeamten gegen das Spielpodium vorgehen, nimmt der Hauptdarsteller, der ‚Funktionär‘, die Maske herunter und sagt: ‚Genossen, bewahrt die Ruhe, bewahrt die Besonnenheit; denn dieses unser Spiel spielt ja nicht in Deutschland, dem Land der Ruhe und Ordnung, sondern ganz weit, in China, in Shanghai!‘ Inzwischen hatten alle chinesischen Spieler – rein zufällig natürlich – die Masken abgenommen und standen als deutsche Proleten dar. Die Wirkung war jedesmal enorm: Die These und Antithese hatten wir oben auf der Bühne gezeigt, die Synthese vollzogen unter stürmischen ‚Rotfront!‘ oder tiefem Schweigen die Zuschauer.“15
Auch hier ereignet sich im Rahmen der Aufführung eine spektakuläre Demaskierung – und damit eine Wende von historischer Fiktion zu politischer Gegenwart. Die Wende funktioniert über eine doppelte ironische Brechung, denn die Akteure verweisen nicht nur dort auf China, wo sie Deutschland meinen, sie fordern auch dort zu Ruhe auf, wo sie echte politische Empörung stiften wollen. Techniken des Theaters – das Aufsetzen und Abnehmen der Maske, die ironische, uneigentliche Rede, das Wechselspiel zwischen Bühne und Zuschauerraum – werden in Wolfs Beispiel genutzt, um ganz reale, direkte, unmittelbar verfügbare politische Energien zu erzeugen. Wolf selbst bringt das Wirkungsprinzip folgendermaßen auf den Punkt: „Wir erkennen: die Maske ist im revolutionären Arbeitertheater kein artis14 Ebd., S. 17. 15 Ebd., S. 18.
POLITISCHES THEATER ZWISCHEN THEATRALITÄT UND PERFORMATIVITÄT
79
tisches Requisit; sie ist eine politische Waffe! Ein Mittel, die Klassenkämpfer zu organisieren, zu tarnen, zu bewaffnen, auf den Kampfplatz zu fahren [...].“16 Es ist nicht anzunehmen, dass politisches Theater in der späten Weimarer Republik tatsächlich immer oder auch nur vorwiegend nach diesem Schema funktioniert hat. Bezeichnend ist aber, dass in dieser Weise über politische Theatralität nachgedacht wurde – von Wolf, Brecht, Benjamin und vielen anderen mehr. Die politische Ästhetik dieser Autoren zielte nicht auf eine Ästhetisierung der Wirklichkeit, sondern ging von einem komplexen Verhältnis zwischen Kunst und Wirklichkeit aus.17 Politische Energie, politische Bewegung und Wirksamkeit sollten im Spannungsfeld von Theater und anderen Inszenierungsformen erzeugt werden. Es ging, wenn man so will, um Hybridformen zwischen Theater und Fest, Theater und Tribunal, Theater und politischer Versammlung, Überlagerungen, die nicht zur Deckung kamen, sondern fortwährend Reibung produzierten. Das Theater sollte den Inszenierungsformen der Wirklichkeit als Fremdkörper eingepflanzt werden, um mit Mitteln der Welterschaffung, der Fiktion, des Dramatischen mitten in der Wirklichkeit einen Veränderungsimpuls zu setzen. Man erhoffte sich den Anstoß zu einer politischen Aktion nicht aus dem realen Fest, der realen Kundgebung bzw. der realen Versammlung, sondern schmuggelte die nötige Energie mit Hilfe eines Theaters ein, das wie ein Trojanisches Pferd in sattsam bekannte Inszenierungsformen der Wirklichkeit – seien es Feste, der Karneval, eine politische Versammlung – hineingeschoben wurde. Weil das Theater in solche Konstellationen zunächst als Fremdkörper eintreten musste, damit es eine ernstzunehmende Reibungsfläche abgeben konnte, sprach nichts dagegen, Theater als eine eigene Welt und als eine autonome ästhetische Form zu betrachten. Im Gegenteil: Es erschien sinnvoll, das Theater als eigenständige Kunst zu stärken, damit es im Spannungsverhältnis mit der politischen Wirklichkeit einen ebenbürtigen Gegenpol abgab. So überrascht es nicht, dass Friedrich Wolf, obwohl er sich seit Mitte der 1920er Jahre der Arbeit mit Laienspielern und Arbeiterspieltrupps verschrieben hatte, in seiner Schrift aus dem Jahr 1933 entschieden für eine Professionalisierung des Agitproptheaters eintrat. Viel zu lange, so Wolf, habe man die Agitproptruppen in einem „Gegensatz zu der Bühnenkunst des professionellen Theaters“18 gesehen. In Wahrheit komme es aber darauf an, auch das politische Theater als avancierte Kunst zu betrachten und seine Macher entsprechend zu schulen: „Diese weitere Qualifizierung des selbsttätigen Arbeitertheaters wird in sei16 Ebd. 17 So wie es Benjamin im Nachwort zu seinem Kunstwerk-Aufsatz als kommunistische Gegenposition zur faschistischen Öffentlichkeit markiert: „Die Menschheit, die einst bei Homer ein Schauobjekt für die Olympischen Götter war, ist es nun für sich selbst geworden. Ihre Selbstentfremdung hat jenen Grad erreicht, der sie ihre eigene Vernichtung als ästhetischen Genuß ersten Ranges erleben läßt. So steht es um die Ästhetisierung der Politik, welche der Faschismus betreibt. Der Kommunismus antwortet ihm mit der Politisierung der Kunst.“ Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1963, S. 44. Hervorhebung im Original. 18 Wolf, Aufsätze über Theater, a.a.O., S. 12.
80
MATTHIAS WARSTAT
nen stärksten Formen – dramaturgisch, schauspielerisch und organisatorisch – zu dem professionellen Theater der sozialistischen Gesellschaft hinüberführen.“19 In Wolfs Texten begegnet also ein Theaterbegriff, der Theater als Kunst anspricht und eine Autonomie dieser Kunst befürwortet, solange gewährleistet ist, dass die Kunstwelt des Theaters qua Aufführung mit der Wirklichkeit in ein Spannungsverhältnis gesetzt wird, das politische Energien hervorbringt. Das Ästhetische wird als eine andere, autonom konstruierte Welt bejaht, unter der Voraussetzung, dass diese andere Welt gerade durch ihr Anderssein beim Eintritt in eine Beziehung zur Wirklichkeit politische Energien und Spannungen hervorbringt. Solche politisch-ästhetischen Strategien werden besonders dann auffällig, wenn man politische Kulturen ausgehend von einem Begriff des Theatralen untersucht. Der Theatralitätsbegriff lädt dazu ein, das Entstehen einer ästhetischen, fiktiven Welt in Rechnung zu stellen, die der politischen Wirklichkeit gegenüber tritt. Bei Friedrich Wolf z. B. erwächst politische Energie noch nicht dadurch, dass eine fiktive Welt hervorgebracht wird, sondern erst dadurch, dass diese fiktive Welt in ein spielerisches Verhältnis mit der politischen Alltagswirklichkeit eintritt. Solange man allein auf Gesten der Setzung oder auf Akte der Hervorbringung von Identitäten schaut, ist die Frage nach deren theatraler Qualität noch nicht berücksichtigt, ist also noch gar nicht geprüft, ob es sich um Setzungen und Identitäten einer besonderen Art handelt, die unter ästhetischen, ironischen oder dramatisch-fiktionalen Vorzeichen stehen. Diese theatrale Perspektive ist wichtig, um politische Kunstformen in ihrer Wirksamkeit verstehen zu können.
IV. Resümee Es wäre abwegig, Theatralität und Performativität als Forschungsparadigmen gegeneinander ausspielen zu wollen – dazu sind sie einander viel zu verwandt –, aber es lassen sich doch zwei verschiedene Analyseschwerpunkte bestimmen, die die beiden Begriffe in der Anwendung auf Inszenierungsformen des Politischen im Allgemeinen und politisches Theater im Besonderen nahelegen: Während Performativität (als Begriff) den Blick auf Arten und Weisen der Wirklichkeitskonstruktion durch Wiederholung lenkt, fordert der Begriff Theatralität – nicht zuletzt durch seine Rückbindung an historische Theaterformen – dazu auf, über Strategien des Spielens mit hervorgebrachten Welten nachzudenken. Virulent ist die Frage, ob in der performativen Wiederholung an einer Affirmation oder an einer Transformation gegebener Handlungsmuster gearbeitet wird. Genauso aufschlussreich erscheint der Versuch, die politische Wirksamkeit des komplexen Verhältnisses zwischen ‚Theaterwelt‘ und ‚Welt außerhalb des Theaters‘ zu ermessen.
19 Ebd., S. 13.
POLITISCHES THEATER ZWISCHEN THEATRALITÄT UND PERFORMATIVITÄT
81
Literaturverzeichnis Benjamin, Walter, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1963. Butler, Judith, Gefährdetes Leben. Politische Essays, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2005. —, Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1997. —, „Performative Acts and Gender Constitution. An Essay in Phenomenology and Feminist Theory“, in: Theatre Journal 40:4 (1988), S. 519-531. Carlson, Marvin, „Performing the Past. Living History and Cultural Memory“, in: Paragrana 9:2 (2000), S. 237-248. Coelen, Marcus (Hg.), Die andere Urszene, Zürich/Berlin: diaphanes 2008. Fischer-Lichte, Erika, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004. Foucault, Michel, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1994. Koch, Gertrud, „Filmische Welten – Zur Welthaltigkeit filmischer Projektion“, in: Dimensionen ästhetischer Erfahrung, hg. v. Joachim Küpper/Christoph Menke, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2003, S. 162-175. Menke, Christoph, Die Gegenwart der Tragödie. Versuch über Urteil und Spiel, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2005. Schneider, Rebecca, Performing Remains. Art and war in times of theatrical reenactment, London/ New York: Routledge 2011. Wolf, Friedrich, Aufsätze über Theater, Berlin: Aufbau 1957.
KLAUS-PETER KÖPPING
Resonanz als Zeichen effektiver/affektiver Transformation bei rituellen Aufführungen in Japan
Rituale und ihre Performativität Die Unterscheidung zwischen Ritual und Theater ist nur ein wissenschaftliches Scheinargument (‚an intellectual red herring‘), entschied der Ethnologe Edward Schieffelin vor einigen Jahren in der Behandlung eines Falles von schamanistischer Seance in Neuguinea. In einer Art Konkurrenzkampf unterlag einer von zwei Heilern dem anderen Protagonisten vor versammelter Dorfgemeinschaft in der Aufgabe des Herbeirufens einer ‚anderen‘ Realität, nämlich jener der Geister.1 Die Zuspitzung dieser Formulierung mag einer gewissen rhetorischen Konvention geschuldet sein, aber Schieffelins Argument ist konsistent mit der durch die performative Wende in den Kultur- und Geisteswissenschaften2 einschlägig gewordenen Sicht, in der eine Kontinuität zwischen der Performativität des alltäglichen Handelns im interaktiven zwischenmenschlichen Zusammenhang und jener Performativität gesehen wird, die durch die Hervorhebung der allen performativen oder theatralen Handlungen eigenen Expressivität die Aufmerksamkeit auf das aufführende und darstellende Handeln, also das Handeln innerhalb eines Genre lenkt und damit auch auf dieses performative Handeln als einem ästhetischen Genuss.3 Performativ oder theatral ist also genau jenes Handeln, das sich durch die Mitteilung jener Botschaft auf der Meta-Ebene auszeichnet. Bateson reklamierte dies schon für die Ebene des ‚Spiels‘, wo sich Darsteller wie Zuschauer etwa auf die Botschaft einigen, dass es sich um ein Spiel, eine Theateraufführung oder ein Ritual handelt.4 Diese spezifische Sicht des Performativen in den Aufführungsmodalitäten verschiedener Genres ist eine andere als jene, die seit der Renaissance die theologischen Gemüter bewegte. Theatrale Handlungen wurden immer wieder als Blasphemien problematisiert, da das schauspielerische Aufführen von Menschen und die Darstellung 1 Vgl. Edward Schieffelin, „On Failure and Performance“, in: The Performance of Healing, hg. v. Carol Laderman/Marian Roseman, London: Routledge 1996, S. 58-89, hier: S. 83. 2 Hier sind vor allem die von Bourdieu beeinflussten Arbeiten von Dell Hymes zu nennen, welche die performative Wende in der Ethnologie und in der Ethnolinguistik eingeleitet haben. Vgl. hierzu Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, Cambridge: Cambridge University Press 1977 und Dell Hymes, „Breakthrough into Performance“, in: Folklore: Performance and Communication, hg. v. Dan Ben-Amos/Kenneth S. Goldstein, The Hague: Mouton 1975, S. 11-74. 3 Vgl. Schieffelin, „On Failure and Performance“, a.a.O., S. 61. 4 Vgl. Gregory Bateson, „A Theory of Play and Fantasy“, in: Psychiatric Research Report 2 (1955), S. 39-51.
84
KLAUS-PETER KÖPPING
anderer Wesen einer mit der göttlichen Schöpfung rivalisierenden Tätigkeit gleichgesetzt wurden. Zudem wurde sie von den protestantischen (anti-pompösen) Ritualtheologen als eine in der katholischen Kirche vorherrschende Praxis der Schauspielerei, im Sinne einer Täuschung, angeklagt.5 Die Hauptfrage, die jedoch auch bei Zustimmung zur Ununterscheidbarkeit der Theatralität von Aufführungspraktiken in beiden Domänen, in Theater wie Ritual (deren heuristischer Unterscheidungswert nicht ganz in Abrede gestellt werden soll), noch offenbleibt, betrifft eine weitere aus der Linguistik und Sprechakt-Philosophie hergeleitete Bedeutung des Performativen. In der vergleichenden ethnologischen Forschungsliteratur herrscht weitestgehend Übereinstimmung darüber, dass der Begriff des Rituals im globalen wie historischen Kulturvergleich immer impliziert das, was er als Ziel ausgibt (genau wie jene illokutionären Sprechakte, die Austin z. B. für die programmatischen Aussagen des Handlungsvollzugs bei der Hochzeitszeremonie zitiert), auch erreicht.6 Diese Form der Wirksamkeit, die bei Austin wohlweislich nur im Kontext von institutionell sanktionierten Akten zum Tragen kommt, ist einer der umstrittenen Punkte der Differenzierung von Domänen des Handelns oder Genres der Darstellung. Wie sieht es in sozialen Handlungsdomänen aus, die nicht durch gesetzliche, institutionelle oder konventionelle Regelwerke eingeschränkt werden? Sicherlich kann auch dem liturgischen Ritual sein institutioneller Charakter nicht abgesprochen werden. Auch erscheint in diesem Zusammenhang unzweifelhaft, dass in liturgischen Ritualen gerade das Pompöse, ja sogar Extravagante, erst durch die ästhetische Gestaltung und Synästhesie der angesprochenen Sinne, durch Inszenierungspraktiken und körperliche Perfektion zustande kommt und damit jene Wirksamkeit erreicht, die mit dem Begriff der Transformation der Wahrnehmung umschrieben wird. Oft wurden dazu wie in christlichen Festritualen zu Ostern oder Pfingsten technische Mittel eingesetzt. Bei päpstlichen Inthronisierungen vom späten Mittelalter bis in die Barockzeit bediente man sich zum Beispiel echter Körper, die man als Engel von der Kirchenkuppel (an Seilen aufgespannt) herabließ oder feierte die Auferstehung durch eine von Licht umflutete Christusgestalt in Aureole, die man mit lebenden Protagonisten an Kränen hochzog oder setzte sogar Schießpulver für die „Inszenierung sakraler Überwältigungseffekte“7 ein. Im wahrsten Sinne wurde eine Theatermaschinerie in Gang gesetzt, um die heiligen Narrationen überzeugend für die Gläubigen sichtbar zu machen. Seit der Antike spielt der ‚deus ex machina‘ in beiden Domänen der Aufführungspraktiken, im Ritual wie im Theater, als theatrale und in Theateraufführungen bekannte Form der technischen Intensivierung von Wahrnehmungstransformationen eine bedeutsame Rolle. Diese Effektivität der Affizierung von Sinneswahrnehmung und Gefühlstonalität wurde schon von den Kirchenvätern mit einer der Körperlichkeit geschul5 Vgl. Stephen Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning, Chicago: University of Chicago Press 1984. 6 Vgl. John L. Austin, How to do Things with Words, Oxford: Clarendon Press 1962. 7 Thomas Macho, „Deus ex machina. Bemerkungen zur Technikgeschichte der Religion“, in: Neue Rundschau 115 (2004), S. 25-40, S. 26.
RESONANZ ALS ZEICHEN EFFEKTIVER/AFFEKTIVER TRANSFORMATION
85
deten Kausalität, der Erklärung einer Resonanz, verbunden: Effektivität von Aufführungen und das Affiziertsein durch Darstellungen (also ästhetischer Performanzen im weitesten Sinne) wird von ihnen als jenes Staunen (‚admiratio‘) umschrieben, von dem schon Albertus Magnus die somatischen, vor allem die intrasomatischen Reaktionen beschreibt, wenn er ausführt, dass die Verwunderung, das Entzücken oder das Staunen immer dann zustande kommt, wenn „das Herz sich zusammenzieht“8. Spätere Philosophien berauben, wie Greenblatt aufzeigt, das Staunen seiner ‚somatischen Autorität‘. Spinoza wie Descartes setzten die Verwunderung mit dem Aussetzen oder Versagen der Kategorien, einer „Lähmung der Assoziationsfähigkeit des Geistes“ gleich und sehen sie nicht als eine auf der Gefühlsebene operierende Leidenschaft, sondern als „Vorstellungsweise“ („imaginatio“)9 an. Das Problem klarer Kriterien für die Unterscheidung der zwei Handlungsdomänen, Theater und Ritual, die als spezifisch performative Darbietungen im Sinne einer reflexiv inszenierten Handlung besondere Affinität zu zeigen scheinen, hat die theoretischen Erörterungen schon geraume Zeit beschäftigt, ohne dass eine eindeutige Klärung oder gar Einigung zustande gekommen wäre.10 Bereits die antike Philosophie beschäftigte sich mit dieser Diskussion, die in den am Anfang des 20. Jahrhunderts virulenten Spekulationen um die rituellen Ursprünge des Theaters (vor allem der griechischen Tragödie und Komödie) ihren ersten modernen Höhepunkt erreichte. Jedoch zeigt die neuere Diskussion über Formen des Theaters der Avant-Garde, der Moderne, der postmodernen Praktiken sowie der ‚PerformanceKünste‘, dass es eine Annäherung der klassischen Theaterpraktiken wie der ‚Performance-Arts‘ an die Idee der Kontinuität ebenso wie die Einbeziehung des Performativen des Alltags in die Aufführungsmodalitäten des Genres ‚Theater‘ und ‚Performance‘ gibt.11 Auch haben Theoretiker der Theater- und Performance-Praktiken auf die Effektivität, also Wirkmächtigkeit der aufführenden und darstellenden Künste, die sich wie das Ritual in der Sphäre des ‚Zwischenspiels‘ zwischen Darstellern und Publikum befinden, hingewiesen. Sie drückt sich gerade dadurch aus, dass eine ‚Gemeinschaft des Imaginären‘, als eine Form der dargestellten und wahrgenommenen, wenn auch noch so temporären ‚Utopie‘ zustande kommt und darin die transformative Kraft der Aufführung besteht.12 Des Weiteren gibt es in den Praktiken der Theater- und Performance-Künste seit einiger Zeit die Tendenz, 8 Zitiert nach Stephen Greenblatt, Wunderbare Besitztümer, Berlin: Wagenbach 1994, S. 31. 9 Ebd., S. 34f. 10 Vgl. Klaus-Peter Köpping, „Inszenierung und Transgression in Ritual und Theater“, in: Ethnologie und Inszenierung: Ansätze zur Theaterethnologie, hg. v. Bettina Schmidt/Mark Münzel, Marburg: Curupira 1998, S. 45-86; siehe auch Erika Fischer-Lichte, „Theater und Fest“, in: Transformationen des Religiösen, hg. v. Ingrid Kasten/Erika Fischer-Lichte, Berlin/New York: Walter de Gruyter 2007, S. 3-17; dies., „Das Theater der Rituale“, in: Die neue Kraft der Rituale, hg. v. Axel Michaels, Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2007, S. 117-139. 11 Vgl. Erika Fischer-Lichte, „Verwandlung als ästhetische Kategorie“, in: Theater seit den 60er Jahren, hg. v. dies./Friedemann Kreuder/Isabel Pflug, München: UTB 1998, S. 21-91. 12 Vgl. Jill Dolan, Utopia in Performance, Ann Arbor: University of Michigan Press 2005; Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004.
86
KLAUS-PETER KÖPPING
Elemente des Rituellen in die Theater-Inszenierungen mit dem Ziel einzubeziehen, genau jene unhinterfragte Wirksamkeit, die man gemeinhin Ritualen zugesprochen hat, zu erreichen. Auf diese Inszenierungsstrategien, für die häufig auch Ethnologen und Theaterpraktiker zusammengearbeitet haben (Schechners Dionysos in 69 fungiert hier als ikonisches Paradigma13), soll hier nicht weiter eingegangen werden. Es sei nur betont, dass in diesen Aufführungs-Erneuerungen wiederum die Grenzen zwischen den für heuristische Zwecke und im allgemeinen Sprachgebrauch anscheinend feststehenden Grenzziehungen auf beiden Seiten der Genres deutlich neu austariert werden. Grenzverwischungen finden hier statt (und haben vielleicht immer schon stattgefunden), die eine eingehendere Beschreibung von nicht-liturgischen Ritualen sinnvoll erscheinen lassen. Denn die inszenatorische Strategie, den Alltag und das Publikum in die Aufführungspraktiken einzubeziehen, scheint genau jene Schnittstellen zu umschreiben, an denen die Domänen ‚Theater‘ und ‚Ritual‘ wiederum in ein fruchtbares Gespräch über Handlungswirksamkeit eintreten. Schwindendes Interesse des Publikums ist z. B. nicht nur eine Erscheinung der impliziten Wirkungsohnmacht traditioneller Theateraufführungen, in denen ein passives Publikum einer textgetriebenen Aufführung durch ‚professionelle‘ Schauspieler ausgesetzt ist; auch bei Ritualen lässt sich ein zunehmendes Desinteresse der Zuschauer (der Gläubigen) feststellen, dem in christlichen Kirchen nicht zuletzt das Mittel der Umformung der lateinischen Messe in die jeweiligen Landessprachen entgegenwirken wollten. Auch im außer-europäischen Raum, in diesem Falle in Japan, lassen sich solche Erscheinungen beobachten: Traditionelle liturgische Rituale finden bei ihren stark mythisch-symbolischen Handlungen kaum noch ein Publikum. Die Bezeichnung ‚gebetsmühlenhaftes‘ Ritual deutet auf diese Wahrnehmung hin. Neuere indologische wie ethnologische Theoriediskussionen haben nicht ohne Grund auf die ‚Bedeutungslosigkeit‘ liturgischer Rituale verwiesen und daraus neue Interpretationen über rituelles Handeln gewinnen können.14 Ohne die inzwischen kaum übersehbare Diskussion zu diesem Problem hier weiterzuverfolgen, möchte ich die Schieffelin’sche Sicht, der man nach meinen komparativen Einführungen kaum widersprechen möchte, einmal von der Seite des Begriffs der Resonanz auf eine Performanz und der Beziehung zwischen Performanz und Resonanz her betrachten. Dazu wende ich mich dem beobachtbaren Feld der Interaktivität von Darstellern und Publikum bei volksreligiösen, nichtliturgischen Ritualtänzen in Japan zu. Bevor ich zur beschreibenden Phase übergehe, sei aber noch einmal der Begriff des Performativen in der ethnologischen Debatte, auf den ich mich hier beziehe, näher eingegangen. In der ethnologischen Theorie wurde die Sicht der transformativen Wirkungskraft von Ritualen in der Nachfolge der Arbeiten von Victor Turner zum sozialen
13 Vgl. Richard Schechner, Between Theatre and Anthropology, Philadelphia: Pennsylvania University Press 1987. 14 Vgl. Caroline Humphrey/James Laidlaw (Hg.), The Archetypal Actions of Ritual, Oxford: Clarendon 1994.
RESONANZ ALS ZEICHEN EFFEKTIVER/AFFEKTIVER TRANSFORMATION
87
‚Drama‘, das sich im rituellen Rahmen vollzieht,15 im Jahr 1979 vor allem von Sir Stanley Tambiah zum Hauptkriterium von Ritualen gemacht. Für Tambiah sind Rituale performativ in einem dreifachen Sinne: im Austin’schen („saying something is also doing something as a conventional act“), im Sinne der theatralen Aufführung („a staged performance“) und im Sinne einer von Darstellern und Publikum wahrgenommenen und implizierten „indexikalischen“ Wertung.16 Mit dem dritten Punkt spricht Tambiah die soziale Umschichtung, Neuformierung oder auch die Re-etablierung und damit die ‚traditionalisierende‘ Haltung der Teilnehmenden hinsichtlich der sozio-kulturellen Ordnung an. In Schieffelins eingängiger formulierten Worten geht es nicht darum, das Genre selbst zu bestimmen oder den darstellenden, aufführenden, performativen oder theatralen Handlungen eine Domäne zuzuordnen, sondern darum, den Prozess zwischen Darstellern und Publikum zu verfolgen (und zu beschreiben), der seinen Beobachtungen folgend beispielsweise zum Erfolg für einen Darsteller und zur Niederlage für den zweiten wurde.17 Oder formuliert mit seinen Worten zur transformativen Wirksamkeit: die performative Dimension „is about the relative movement of moral and cosmological relationships, power and experience“18. Im Folgenden sollen Fallstudien aus dem Umfeld japanischer Ritualfeste vorgestellt werden, die für die These sprechen, dass Rituale nicht nur theatral sind, sondern des theatralen Aufführungsmodus bedürfen, um wirksam zu sein. Wirksamkeit soll dabei jedoch nicht in Hinsicht auf den symbolischen Inhalt oder den Bedeutungshorizont (z. B. eines narrativen Schemas oder einer politischen oder psychologischen ‚Botschaft‘ eines Dramas) verstanden werden, sondern auf den sozialen Kontext der Aufführenden, der Akteure wie der Zuschauer, verweisen. In der Performance werden diese sich der Effektivität ihrer aufführenden Gemeinschaft bewusst und bestätigen durch die theatrale Praxis diese soziale Solidargemeinschaft, auch und vielleicht gerade weil es dabei auch zu temporären Inversionen dieser zu re-etablierenden Ordnung kommt. Der Fokus der folgenden Beschreibungen und eingewobenen Interpretationen liegt weniger auf den Kriterien des Rituellen, die sich in ihrer Wiederholungspraxis, ihrer Redundanz und Iterativität widerspiegeln, wie es für sogenannte ‚liturgische Rituale‘ der Fall ist (auf die sich die meisten Ri-
15 Vgl. Victor Turner, The Ritual Process, Harmondsworth: Penguin 1969. 16 Vgl. Sir Stanley Tambiah, „A Performative Approach to Ritual“, in: Proceedings of the British Academy 65 (1979), S. 113-169, insbesondere: S. 119. 17 Über andere Fälle der ‚failure of performance‘ vgl. auch Laurel Kendall, „Initiating Performance“, in: The Performance of Healing, hg. v. Carol Laderman/Marina Roseman, London: Routledge 1996, S. 17-58; Klaus-Peter Köpping, Shattering Frames: Transgressions and Transformations in Anthropological Theory and Practice, Berlin: Reimer 2002; ders., „Failure of Performance or Passage to the Acting Self? Mishimas’s Suicide between Ritual and Theatre“, in: The Dynamics of Changing Ritual, hg. v. Jens Kreinath/Constance Hartung/Annette Deschner, Toronto: Peter Lang 2004, S. 97-114. 18 Schieffelin, „On Failure and Performance“, a.a.O., S. 83.
88
KLAUS-PETER KÖPPING
tualtheoretiker beziehen19), sondern richtet sich auf nicht-liturgische Praktiken in volksreligiösen Aufführungen in Japan. Bedeutsam für die Problematik der Performativität sind innnerhalb ihrer theatralen Aufführungspraxis zunächst einmal Formen kommunikativer Prozesse, deren Materialität in der Körperlichkeit angelegt ist.20 Das Theatrale soll eingrenzend als eine soziale Praxis verstanden werden, in der die Teilnehmer (Darsteller wie Zuschauer, wobei die letzteren oft selbst zu Darstellern werden, während die Darsteller im Festablauf nach ihren eigenen Auftritten auch wieder zu ‚Zuschauern‘ werden) sich im reflexiven Inszenieren über diese Praxis und ihre Grundlagen verständigen und auch über sie verhandeln, indem sie diese bewusst gestalten, öffentlich zur Darstellung bringen und damit auch zur Disposition stellen. Das Theatrale geht hier so weit, dass durch die Offenlegung der Selbsterschaffung die imaginierten Grundlagen des Sozialen performativ gestaltet werden, ohne die Grundlagen des Sozialen, nämlich die im Ritual angesprochenen konstitutiven Elemente der Wirklichkeit, zu erschüttern. Es geht mir darum, aufzuzeigen, dass es nicht immer die perfekt liturgisch vollendete Performanz ist, die im Ritual zur Resonanz, dem Effekt der subjektiv empfundenen Transformation von Wirklichkeit – oder gar dem Verbergen des Inszenatorischen und Theatralen durch weitere theatrale Dissimulationen – führt. Vielmehr sind es das Durchscheinen des Inszenierten und damit der theatralen Darstellungskunst oder die Künstlichkeit derselben, die zu einer positiven Resonanz, zumindest in einigen Ritualformen führen. Damit soll nicht verneint werden, dass eine ‚kompetente‘ Performanz, z. B. eine durch vollendete Körperbeherrschung sich auszeichnende Aufführung von Tanzsequenzen, zum Erfolg der einzelnen Sequenz oder einer rituellen Gesamtaufführung beitragen kann. Die folgenden Beispiele werden bezeugen wie diese ‚Geschicklichkeit‘, also der wohl als ‚ästhetisch‘ zu bezeichnende Impuls, auch bei Darstellern ein angestrebtes Ziel sein kann.
Die japanischen ‚Blumen-Festrituale‘ Im Folgenden beschränke ich mich mit Hilfe einiger ausgewählter Sequenzen aus dem gleichen Festtypus, der Hana-Matsuri oder ‚Blumenfeste‘, die in verschiedenen Dörfern der südlichen Alpenregion Japans in den Provinzen von Aichi, Nagano und Shizuoka zwischen Anfang Dezember und Ende Januar abgehalten werden, auf einige hervorstechende Merkmale der theatralen Darstellung, ohne auf symbolische Verweis-Strukturen oder geschichtliche Entwicklungen näher einzugehen. Die bis zu dreißig Stunden dauernden Feste bestehen aus rituellen Einleitungs19 Vgl. etwa Tambiah, „A Performative Approach to Ritual“, a.a.O.; Maurice Bloch, „Symbols, Song, Dance and Features of Articulation“, in: European Journal of Sociology 15 (1974), S. 55-81. 20 Vgl. Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, a.a.O.; Joachim Fiebach, „Brechts ,Straßenszene‘. Versuch über die Reichweite eines Theatermodells“, in: Weimarer Beiträge 24 (1978), S. 123-147.
RESONANZ ALS ZEICHEN EFFEKTIVER/AFFEKTIVER TRANSFORMATION
89
und Endsequenzen, die den Rahmen für die dazwischen ausgeführten rituellen und nicht-rituellen (im Sinne der nicht-sakralen) Tänze bilden. Sie werden mit und ohne Masken (bis zu vierzig Maskenrollen existieren) einzeln oder in Zweier-, Dreier- oder Vierer-Formation von verschiedenen männlichen Alterskohorten, die von den Dreijährigen bis zu den über Sechzigjährigen reichen, aufgeführt. Die Feste werden einmal im Jahr mit dem ausdrücklichen Zweck sowohl einer Danksagung an die Gottheiten für gute Ernten und andere Wohltaten des vergangenen Jahres als auch einer Bitte um dieselben Begünstigungen von Gesundheit und Wohlergehen für Mensch und Tier, für Natur und Gemeinschaft für das kommende Jahr begangen. Die Feste zeichnen sich dadurch aus, dass auch die rituellen Vorbereitungen und die Ausführungen ritueller Akte von der Dorfbevölkerung selbst, ursprünglich ohne die Vermittlung von Schreinpriestern, vorgenommen werden. Die Vermittlung zu den Göttern und die Herbeirufung der göttlichen Energien in diesen Ritualfesten findet durch eine Gruppe von Ältesten (Myodo) statt, die auch die musikalische Begleitung sowie die Vorbereitungen und Durchführung vor allem der rituellen Akte durch ihre Autorität und ihr traditionelles Wissen und Können gestalten. Sie werden angeführt von einem Laienpriester (Taiyu), der dieses Amt in männlicher Familiennachfolge ererbt hat und Spezialist in den zum Teil aus dem tantrischen Buddhismus der wandernden Bergasketen (Yamabushi des esoterischbuddhistischen Shugendo Ordens) seit dem 13. Jahrhundert überlieferten und entlehnten Mudras und Mantras ist, die einen Hauptteil der rein rituellen Rahmenhandlungen ausmachen. Obwohl die Priester des traditionellen Schrein-Shinto (kannushi) eine zunehmend bedeutende Rolle in der Kontrolle der Transferierung der göttlichen Kräfte vor allem der Dorfgottheit (ujigami) der Gründerklangemeinschaften (ujiko) bei den Tanzritualen einnehmen, finden wir hier eine starke und wiederholt betonte Basis einer Selbstermächtigung der Dorfbevölkerung, die Vermittlung zu den göttlichen Kräften herzustellen. Die Hana-Matsuri oder Blumenfeste eignen sich besonders gut, die Problematik der theatralen Gestaltung ritueller Performanzen durch gemeinschaftliches Zusammenspiel zu erörtern, da hier traditionelle religiöse Symbole in spielerischer und ästhetischer Form in einem rituellen Rahmen zur Darstellung gebracht werden. Insbesondere scheint es bezeichnend, dass die Teilnehmer nicht strikt in Darsteller und Publikum getrennt sind, da das Publikum, das ursprünglich nur aus den Klanangehörigen (ujiko) der Gründerfamilien bestand, zur Teilnahme nicht nur ermuntert, sondern als notwendig erachtet wird. Ein Merkmal, das wiederum für die Resonanz der Performanz spricht ist auch, dass sich ihre Mitglieder aus früheren oder zukünftigen Performern zusammensetzen. Zum anderen ist bemerkenswert, dass diese Festtänze mit regelrecht ‚ritualistischer‘ Aufmerksamkeit auf Details durchgeführt werden, obwohl die symbolischen Verweise vieler der rein rituellen Performanzen kaum mehr verstanden werden und sogar auch als irrelevant angesehen werden. Einige der älteren Männer der MyodoGruppe und der Taiyu kennen zwar die Bewegungsabläufe der Rituale genau, wissen aber über die Bedeutung derselben oft auch nicht mehr viel. Auffallend ist die
90
KLAUS-PETER KÖPPING
Abwesenheit der Dorfbevölkerung bei den rein rituellen Handlungen, was als Fingerzeig dafür angesehen werden könnte, dass die Feste eine andere oder weitere als die traditionell und offiziell angegebene Zielsetzung haben. Auch sprechen sie dafür, dass sich das Ziel des kommunalen Wohlergehens sich erst durch die Performanz für Teilnehmer wie Beobachter zu erschließen beginnt. Nicht nur die Reihenfolge der Tanzformen scheint relativ beliebig und austauschbar, auch die genaue narrative Struktur oder Verweisebene jedes einzelnen Tanzes ist nicht mehr auf der Bedeutungsebene gegeben, sodass einige Beobachter von einer Art ‚Potpourri‘ von Tanzsequenzen sprechen, die zugleich eine Art ‚Freilichtmuseum‘ aller theatralen Künste Japans darstellten.21 Dieser Eindruck trifft jedoch nur teilweise zu, da der Gesamtaufbau der Feste eine Struktur von kleineren Höhepunkten hat, die einen gesamten Spannungsbogen aufzeigen, auf- und abgebaut durch den Rhythmus und das Tempo der vom Festführer (Taiyu) geführten Trommel (die Flöte ist das einzige Melodie-Instrument). Es gibt meist drei Höhepunkte des Ritualfestes, bei denen es zu einem großen Gedränge der Zuschauer und zur Stimmungsaufladung kommt: den Tanz der Kleinkinder (hana-no-mai), das Auftreten des Berggottes (Yama-no Kami), und den ultimativen Schlusspunkt des ‚Wasserzerstäubens‘ (Yubayashi) auf die Anwesenden, das nur noch von rein rituellen Sequenzen gefolgt wird, die meist ohne Publikum von einer Gruppe Laienpriester durchgeführt werden. Der letzte Höhepunkt verweist auf den konkreten Fokus der Blumenfeste, nämlich den Heißwasserkessel, der in der Mitte des Tanzplatzes auf einem jedes Jahr neu konstruierten Lehmofen aufsitzt und um den sich sowohl die rituellen wie tänzerischen Darbietungen abspielen; denn individuelle und kommunale Fruchtbarkeit, Gesundheit und Wohlergehen werden von dem heißen Wasser erwartet, in welches die Energien aller Gottheiten Japans durch den Führer der Laienpriestergruppe (und durch die tänzerischen Aufführungen aller Teilnehmer) während dieses Ritualfestes geleitet wurden. Die Tanzsequenzen haben außerdem eine klare Zuordnung zu verschiedenen kontextuellen sozialen Rollen und Alterskohorten,22 eine strukturelle theatrale Komponente, die eindeutig zur Inszenierung der sozialen Positionen dient. Trotz der nicht zu verleugnenden relativen Beziehungslosigkeit oder Beliebigkeit der einzelnen Sequenzen achtet man jedoch auf die penible Ausführung der ‚korrekt‘ überlieferten Schrittfolgen und Körperbewegungen. Außerdem sind die Stücke weder in ihrer Gesamtheit noch im Einzeltanz wirklich ‚bedeutungslos‘, sondern werden als effektive Mittel zur Durchsetzung des traditionell gesetzten Zweckes angesehen, nämlich der konkreten Vergegenwärtigung göttlicher Agenten unter den Lebenden durch die Darstellungs- und Verstellungsperformanz (durch Masken) der menschlichen, aber durch und während der Aufführungen als transformiert betrachteten Rollenspieler. Zum einen deutet die genau festgelegte und einzuhaltende Zahl von Drehungen und Körperbewegungen – wie z. B. die Fünfer-Repetition – genauso 21 Vgl. Ulrich Pauly, Die Teufel kommen zum Tanz, Tokyo: OAG 2002. 22 Vgl. ebd.
RESONANZ ALS ZEICHEN EFFEKTIVER/AFFEKTIVER TRANSFORMATION
91
auf eine mythisch-mystische Geografie hin wie die fünf Farben der Dekorationen (fünf Himmelsrichtungen, die Mitte eingerechnet). Zum anderen können bestimmte Bewegungssequenzen als kulturell geprägte Formen mimetischer Nachahmung verstanden werden: Die Hände zum Himmel hin zu öffnen, mit dem Schwert in die vier Eckrichtungen zu stoßen oder mit dem Fuß auf die Erde zu stampfen verweist im gesamten kulturellen Repertoire japanischer religiös ausgerichteter Performanzen auf generelle, körperliche Manifestierungen und die Konkretisierung symbolischer Abstraktionen wie z. B. Einladung an die Götter, Abwehr unheilbringender Kräfte, Beruhigung von Erdgeistern. Diese Interpretationsebenen sind im vorliegenden Fall tatsächlich angesprochen, wie längere Gespräche darüber mit Laienpriestern zu Tage förderten. Die Merkmale der Selbstermächtigung, der Vereinnahmung des gesamten Publikums in eine Teilnehmergemeinschaft und das nachdrücklich genaue Ausführen von Handlungssequenzen verweisen daher auf die Bedeutsamkeit des Aufführungsmodus, also auf das Theatrale als einem Schlüsselelement für den Erfolg der rituellen Performanzen. Ich möchte mich jedoch im Folgenden weniger auf die verschiedenen, sich wandelnden Einflüsse innerhalb des gesamten historischen und sozialen Kontextes einlassen, zu dem auch die Erhebung dieser Dorftanzrituale zu ‚nicht-materiellen Kulturgütern‘ (mukkei bunkazai) und der damit zusammenhängende Zuwachs an auswärtigen Besuchern gehören. Die Resonanz auf die performativen Darstellungen machte über den Zeitraum der vorliegenden Forschungen eine deutlich wahrnehmbare Veränderung durch.23 Während diese Aspekte nicht unterschlagen werden dürfen, um die Emergenz von Resonanz sinnvoll zu diskutieren, soll der Fokus nun auf den beobachtbaren performativen Strategien liegen, die in verschiedenen Modalitäten das Theatrale des Rituellen zum Vorschein bringen. Diese verweisen meiner Ansicht nach auf wichtige Aspekte von gemeinschaftlichen Aufführungen, die ihre Wirksamkeit eben jenseits des tradierten generellen Symbolsystems evozieren. Zur Erläuterung dieser Aspekte konzentriere ich mich zunächst auf die Darstellungsmodi der zentralen Figur in all diesen Dorffesten, die des Berggottes oder Yama-no-Kami, um dessen performative Formen in ihren Variationen dann mit einigen anderen Rollen sowie den rein rituellen Vorbereitungen und Aufführungen zu kontrastieren.
Die Selbst-Inszenierung des Berggottes Der Berggott erscheint gegen Mitternacht des ersten Tages mit seiner schweren Maske und in knallroter Ganzkörperkleidung, die von riesigen Schleifen auf dem Rücken zusammengehalten wird, versehen mit einem immergrünen Sakaki-Zweig, der ihm als Zeichen seiner sakralen Rolle in diese Rückenschleifen gesteckt ist, und dem Emblem seiner Autorität, einer langstieligen Streitaxt. Während seines öffentlichen Auftritts auf dem Tanzplatz wechselt er die Axt von der einen zur anderen 23 Die Feldforschungen fanden im Rahmen eines von der DFG unterstützen Projektes zwischen 1995 und 2002 statt.
92
KLAUS-PETER KÖPPING
Hand und stemmt, nachdem er mit seinem Fuß kraftvoll auf den Boden gestampft hat, die freie Hand provokativ und autoritativ in die Hüfte. Er verharrt für eine geraume Weile dann jeweils in der Mitte einer der fünf Himmelsrichtungen – nach innen oder außen gewendet –, während er langsam seine Maske mit den übergroßen Augen von links nach rechts dreht, sodass die jeweiligen Zuschauer den Eindruck gewinnen, sie würden speziell ‚ins Visier‘ genommen. Der Berggott erscheint als Höhepunkt der Präsenz der heiligen Mächte in ihrer konkreten Form, nachdem die Ritualhandlungen in Wald und Feld gegen Sonnenuntergang beendet sind und der Tanzplatz durch den rituellen Transfer der Dorfgottheit sowie durch rituelle Tänze geweiht worden ist. Danach finden von zwei, drei oder vier Tänzern verschiedener Altersgruppen eine Reihe von nicht-rituellen Tanzsequenzen statt, wobei die Wahl der Tänzer manchmal ad hoc erfolgt, falls sie nicht entweder durch Familienanrecht oder durch Los vorherbestimmt wurde. In den meisten Dörfern gibt es nach wie vor jedoch eine soziale Rangordnung, die mit den verschiedenen Tanzrollen, vor allem mit den Hauptmasken wie der des Berggottes, verbunden ist. Bevor sie die Masken und Kostüme anlegen, unterziehen sich alle Tänzer, insbesondere die der Götterrollen-Masken, in den meisten Dörfern entweder im nahegelegenen Fluss oder unter einem Wasserfall nach wie vor einem – wenn auch kurzfristigen – asketischen Reinigungsritual. Im vorliegenden Falle wurde ein junger Mann einer Familie, deren männliche Mitglieder diese Maske traditionellerweise tragen (und damit ein entsprechendes soziales Prestige zum Ausdruck bringen können), zum ersten Male in diese Rolle eingewiesen. Vor der Vorführung in voller Öffentlichkeit auf dem Tanzplatz um den Heißwasserkessel wurde dem Darsteller die über sechs Kilogramm schwere Maske von drei Männern in langwieriger, etwa eine Stunde dauernden Prozedur im Hause seiner Eltern aufgesetzt. Die gesamte Prozedur des Ankleidens und Aufsetzens der Maske geschah praktisch in einem halböffentlichen Forum, da ursprünglich nur spezifische Familienangehörige, Verwandte, Nachbarn sowie die das Fest organisierenden Dorfältesten mit dem Laienpriester anwesend waren. Heutzutage gibt es jedoch auch bei solchen privaten Ritualhandlungen ein öffentliches Publikum in Form von Touristen, professionellen Fotografen oder Studenten von Ethnologie- und Folklore-Kursen. Im hier beschriebenen Fallbeispiel wurden auch Norito (Gebetsgesänge) aus der Shinto-Liturgie als Anrufungen an die Götter gelesen und von einem Laienpriester Segnungs- wie Reinigungsbewegungen vor dem Tanz des Berggottes durchgeführt, was mit Nachdruck auf den sozialen und den religiösen Initiationscharakter dieser Maskenprobe hinweist. Die geschilderte Maskenprobe und anschließende Heilungszeremonie waren sozusagen ein ‚Vorspiel‘ zum Hauptauftritt auf dem Tanzplatz. Normalerweise werden in diesem Dorf die Heilungsrituale durch den Berggott auf vorheriges Ersuchen des Leiters des Laienpriesterkollegiums in verschiedenen Familienhäusern nach dem mitternächtlichen öffentlichen Auftritt auf dem Tanzplatz abgehalten. Die Heilungsrituale, die nach der Initiationsanprobe stattfanden, bestehen aus dem Hauptgesangsstück des Berggottes in der Öffentlichkeit, wäh-
RESONANZ ALS ZEICHEN EFFEKTIVER/AFFEKTIVER TRANSFORMATION
93
rend er seinen Fuß auf die neuralgischen Punkte von meist älteren Leuten setzt. Nach diesen Heilungsritualen nimmt er meist die Maske ab, um sich mit den Familienangehörigen zum Mahle niederzulassen. Dieses Festmahl mit dem Gott ist noch heute eine völlig private Angelegenheit. Jedoch kann man sowohl bei der Initiationszeremonie als auch bei den Heilungspraktiken das theatrale Changieren innerhalb des rituellen Rahmens klar beobachten. Die Proben werden innerhalb der Aufführung durchgeführt, die Ankleidezeremonie gehört sogar mit zu den rituellen Akten, wie sie sonst in einem getrennten Raum vorgenommen werden. Während der Heilungszeremonien kommt es auch zu vielfältigen Zwischenrufen und spaßigen Kommentaren von Familien- und Dorfangehörigen zum Behandelten oder zum Berggott; beim Essen gibt man sich dann völlig der ungezwungenen Konvivialität und scherzhaften Unterhaltung hin. Es sind aber nicht nur diese Proben an sich oder die interaktiven Handlungsabläufe, die den Eindruck einer theatralen Inszenierung hervorrufen. Vielmehr sind es die genau gezirkelten Schritt- und Körperhaltungssequenzen in ihrer unendlich scheinenden Wiederholung und das damit verbundene häufige ‚Posieren‘ oder ‚Einfrieren‘ von Körperbewegungen und Gestiken, wenn sich etwa der Berggott mit seiner Axt breitbeinig aufpflanzt und nach allen Himmelsrichtungen verbeugt, die diesen Effekt auslösen. Die Bewegungsposen erinnern dann vor allem durch die zeitlupenartig verlangsamte Bewegung des Kopfes, durch welche die Maske ruckartig in einer Blickposition länger verharrt, an die Posen von Kabuki-Schauspielern. Auch deren ‚Gesicht‘-Pose (Mie) wird von den Darstellern für mehrere Minuten gehalten, um dann über die Seitenbühnenbrücke (Hanamichi oder ‚Blumenweg‘), die als eine Art Laufsteg durch die Zuschauermenge führt, unter Applaus ihren Abgang zu nehmen. Dieses ähnliche Sich-In-Positur-Werfen des Berggottes findet jeweils in der Mitte der Bewegung entlang der Seiten eines imaginären geografisch kosmologischen Quadrats (mit der Mitte als einer Richtung) statt. Jedoch wird hier nicht die kosmologische Symbolik von den Zuschauern goutiert, sondern der theatrale oder ästhetische Aspekt der Performanz, der durch langsame Kopfbewegungen nicht zuletzt auch von der Kompetenz des Anvisierens verschiedener Zuschauergruppen abhängt, einer Geste der Blickbeherrschung also, die zugleich Interaktivität herzustellen vermag. Bei anderen Tänzen wird die Redundanz dadurch augenfällig, dass dieselben Bewegungsabläufe mit verschiedenen Requisiten wie Fächern, Schellen, echten und Holzschwertern und einer Kombination derselben durchgeführt werden.
Performative Modalitäten Nach diesen ‚ritualisierten‘ und symbolisch vorgeschriebenen Bewegungen, die wie bei vielen anderen Tänzen und während der Aufführung vor sich gehenden Proben häufig durch genaues Zählen, durch Zurufe und Anmahnungen des Festführers
94
KLAUS-PETER KÖPPING
oder des Trommlers kontrolliert werden, tritt der Berggott jedoch in eine andere Tanzmodalität ein, die zum größten Teil durch die Synkopierung und Lautstärke der Trommel signalisiert und gesteuert wird. Der Berggott beginnt die Schrittfolgen in immer schnellerem Rhythmus zu absolvieren, wobei er die Axt in wilden Schwüngen durch die Luft wirbelt. Das Tempo wird in einem solchen Maß gesteigert, dass der Tänzer völlig außer Atem geraten und auch ohnmächtig werden kann. Zwischendurch werden ihm Orangenstücke zur Erfrischung zwischen die Maske geschoben. Ein wichtiges Merkmal, das auf die Theatralität wie auf die Sozialität der Rolle verweist, sind die mittanzenden, oft das Schritt-Tempo angebenden und auch herausfordernden, älteren betrunkenen Männer (eine nur teilweise konventionell vorgeschriebene Rolle), die mit oder neben dem Berggott tanzen oder die Fackeln vor ihm hertragen, um damit den Boden zu beleuchten, den der Maskenträger nur durch die Mundöffnung erkennen kann. An manchen Orten wird die gesamte Gemeinde vom Festführer oder dem Trommelschläger zum sehr schnellen Mittanzen animiert, sodass ganze Kohorten von jungen Männern und jungen Mädchen in einer Phalanx aufeinander zutanzen und wieder rückwärts schwingen, immer um den Berggott herum. Dieses chaotisch erscheinende ‚Aufkochen‘ des Publikums kann zu erheblichen, manchmal beabsichtigten Zusammenstößen (zwischen jungen Männern und Frauen) führen, wird aber wieder gebändigt, wenn es der Festleiter oder der Taiyu als Trommelherr für angebracht hält, die Stimmung zu beruhigen. Auch das sich anscheinend entwickelnde Tanzchaos ist damit ganz klar als inszenatorisch orchestriert oder als gebändigt zu erkennen. Es unterliegt der Konvention, den Berggott durch herausfordernde Äußerungen zur ‚gespielten‘ Wut anzustacheln, sodass er dann die Kohlen des vor dem Tanzplatz befindlichen großen Holzfeuers mit seiner Axt in die Menge, auf Dächer oder auf die Straße verstreut. Dann wieder zurückgeführt deutet sich vor der temporären Altar-Bühne mit einem Kopfsenken vor der Gottheit das Ende der Darstellung an. Neuerdings hat sich bei diesen Szenen ein Applaudieren für die bravouröse Tanzleistung eingebürgert, womit sicherlich eine erhöhte oder verschärfte Wahrnehmung der Performanz als theatraler Darstellung zum Tragen gekommen ist. Vor fünf Jahren gab es in dem hier beschriebenen Weiler noch einen heftigen Streit, da Beifallskundgebungen als Zeichen für eine erfolgreiche Theateraufführung, nicht aber als einer Ritualhandlung angemessen angesehen wurden. Dieser Unterschied wird performativ normalerweise klar dadurch markiert, dass man die rein rituellen Performanzen des Taiyu mit Schweigen quittiert, wenn er z. B. die Reinigungszeremonie, die des Feueranzündens unter dem Lehmofen oder die der Aufladung des Wassers mit göttlichen Kräften vollzieht. Insgesamt gilt auch die Berggott-Aufführung als genauso heilig wie die laienpriesterlichen Handlungen. Die letzte heilige Handlung, die nicht von der Laienpriesterschaft vorgenommen wird, ist dann das Verspritzen des heißen Wassers (Yubayashi), das in einem Tanz von vier jungen Männern mit Strohbündeln auf die anwesende Menge als Fruchtbarkeits- und Gesundheitssegen gestäubt wird. Die sakrale Qualität wird bei allen Tanzsequenzen, auch wenn sie nicht von der Laienpriesterschaft, sondern von
RESONANZ ALS ZEICHEN EFFEKTIVER/AFFEKTIVER TRANSFORMATION
95
verschiedenen männlichen Alterskohorten durchgeführt werden, dadurch gekennzeichnet, dass eine Strohmatte unter den Darstellern ausgebreitet wird. Jedoch ist selbst bei solchen mehr sakralen Performanzen zu beobachten, dass die priesterlichen Darsteller oder Laientänzer sich große Mühe geben, eine möglichst kompetente Darstellung mit Schwung und körperlich kontrollierter Akrobatik darzubieten. Je gekonnter diese Darbietungen sind, desto eher kommt es zu Beifallskundgebungen, die sicherlich an anderen, früheren Performanzen als auch an einem allgemeinen, kulturellen, regionalen wie überregionalen theatralen Repertoire in der Erinnerung der Zuschauer orientiert sind, also an dem, was ich als Interperformativität bezeichnen würde. Insgesamt ergibt sich für viele Tänze innerhalb des rituellen Ablaufs des Blumenfestes das Problem der Unterscheidung: im performativen Aufführungsmodus zwischen sakralen oder prononciert rituellen Tänzen insofern, als dass die performativen Strategien einschließlich der Resonanz bei den Zuschauern für beide Formen ähnlich sein können. So werden nicht die rituellen Tänze in einem unbedingt gemäßigteren Tempo ausgeführt als etwa die nicht-rituellen Einlagen. So können rein als rituell verstandene Tänze des Laienpriesters, z. B. die Segnung der Klöppel der Trommel (bachi-no-mai) oder die jugendliche Körperbeherrschung erfordernden anschließenden Sakraltänze wie der Ichi-no-Mai, der sowohl die Bewegungen einer besessenen Schamanin als auch die eines Vogels mimetisch nachvollzieht, jeweils in sehr ausgefeilter, tänzerisch bravouröser und kompetenter Manier von den Ausübenden, Priestern wie Laien, durchgeführt werden. Jedoch kommt es bei den priesterlichen Ritualtänzen nicht zu Beifallsbekundungen, obwohl die Laienpriester mit ähnlichen Gesten, häufig mit denselben Requisiten, mit demselben emblematischen Verweis auf das ‚Sakrale‘ der Bewegung ihren Tanz aufführen wie die anderen Tänzer, nämlich mit der Strohmatte zwischen dem Erdofen, dem Heißwasserkessel und dem Bühnen-Altar. Auch die Beschwörung der Götterkräfte in dem Heißwasserkessel durch eine spezifische Technik des Ausstoßens mantrischer Formeln unter Begleitung von mit esoterischer Bedeutung aufgeladenen Schwerthieben zieht nur wenige Zuschauer an. Der Grund mag darin liegen, dass das Publikum hier nicht partizipieren kann. Dies verweist in der Tat auf eines der Hauptmerkmale der theatralen, weil partizipatorischen Attraktion der Ritualfeste. Selbst wenn wir in den japanischen Ritualtanzfesten eine Unterscheidung zwischen rein rituellen Handlungen, tänzerischen Ritualhandlungen, rituellen Tänzen und nicht-rituellen Tänzen von Laien treffen würden, sind die Formen der Theatralität und die Resonanz nicht mit diesen Kriterien, die einem einfacheren Schema von Wirksamkeit gegenüber von Unterhaltung als Ziel oder Zweck eingepasst werden könnten, zu fassen. Die theatrale Komponente kommt bei der Durchführung der rituellen Teile genauso stark zum Ausdruck wie bei rituellen und nicht-rituellen Tänzen. In allen drei Formen, und das zeichnet die dörflichen Ritualfeste im Vergleich mit dem größeren Umfeld des sonstigen kulturellen Repertoires und der interperformativen Gegenüberstellung mit liturgischen Ritualen (wie teilweise sehr ritualisiert erscheinenden Theaterformen, z. B. dem Nō oder dem Kabuki) beson-
96
KLAUS-PETER KÖPPING
ders aus, kommt es zur Sichtbarmachung von theatralen Inszenierungs-, Probenund Lernvorgängen. In allen drei Situationen spielt jedoch im Gegensatz zum Theater auch die Kontextualität des Alltags in die Darstellung hinein.
‚Rehearsal‘ – Lernen während der Aufführung Die Lernvorgänge lassen sich am deutlichsten bei den sogenannten Hanamai (‚Blumentänzen‘) der jüngsten Alterskohorte beobachten, wenn die drei- bis fünfjährigen Jungen auf den Schultern ihrer Onkel auf den Tanzplatz getragen werden und ihnen die Schritte geduldig vorgemacht werden. Das Bemerkenswerte ist dabei, dass man selbst wegen Ermüdung nicht nachgibt, die genaue Zahl von Drehungen und Sequenzen auch bei den Kleinsten einzufordern. Dies verweist auf die wohl wichtigsten Komponenten, die die Ritualtänze von reinen Theateraufführungen unterscheiden: Es geht um die absolute Genauigkeit der oft mystischen und nur aus Gründen der Überlieferung penibel eingehaltenen Regeln. Es ist diese Genauigkeit der Regeleinhaltung, die auch in den viele Tage in Anspruch nehmenden Vorbereitungen der handgefertigten Dekorationen zum Ausdruck kommt, wie in den Regeln der rituellen Reinheit. So durfte ich den Raum, in dem die Papierschnitzereien vom Laienpriester und seinen Helfern vorgenommen wurden, das spätere Götter- und Ankleidezimmer, auch während dieser Vorbereitungen nicht betreten, bevor der Laienpriester ein Reinigungsritual an mir vorgenommen hatte, das alle unheilvollen Einflüsse, die an mir haften könnten, bannte. Andererseits gibt es soziale Bezüge, die selbst unabdingbar einzuhaltende Tabus außer Kraft setzen. So gibt es aus Mangel an männlichem Nachwuchs inzwischen Mädchen als Tänzer. Andererseits werden die Reinigungs-Ordale, wie das Waschen unter einem Wasserfall in frostiger Winterlandschaft, als notwendige Vorbereitung für die rituellen Tänzer nach wie vor strikt eingehalten. Allerdings stehen solch penible Regeln der Aufführungen unter ständigem Druck und werden damit teilweise verhandelbar. Jedoch ist nicht zu verkennen, dass die Genauigkeit und Regeleinhaltung sehr eng mit der dem Ritual eigentümlichen Repetitivität und Redundanz verbunden ist, allerdings wiederum auch notwendig, um jenes Resultat zu erzeugen, das aus körperlicher Selbstvergessenheit zum Ziele der spezifischen – zumindest bei den vorliegenden Ritualfesten erklärten – Erscheinung des Göttlichen in der konkreten performativen Realisierung führen soll. Ein drittes Moment, das die Theatralität auch im rituellen Teil klar zum Vorschein bringt, ist eng mit dem Lernvorgang und dem ‚Proben im Aufführungsmodus‘, wie ich das Normalverfahren der dörflichen Tanzfeste nennen würde, sowie mit dem Eindringen der alltäglichen Handlungsmodalitäten in den rituellen Rahmen verbunden. Nicht nur gibt es dauernd Pausen zwischen den Ritualsequenzen, bei denen die Laienpriester auf der Altarbühne unter dem Schrein der an-ikonischen Gottheit rauchen, trinken und scherzen. Auch werden während der rituellen Aufführungen selbst Zurufe an Teilnehmer gerichtet oder mit Helfern oder Umstehenden getauscht, etwa dass irgendein Gegenstand noch fehle oder etwas falsch an-
RESONANZ ALS ZEICHEN EFFEKTIVER/AFFEKTIVER TRANSFORMATION
97
gebracht sei. Genau wie das Lernen unter Anleitung und das Proben während der Aufführung selbst Zeichen der engen Verbundenheit aller Teilnehmer mit den Darbietungen sind, zeigt sich eine Selbstermächtigung der Gestaltung, die im Umgang mit den Maskenrollen ebenfalls zum Tragen kommt.24
Götterspiele: wer spielt wen? Hier spielt die Ambivalenz des Theatralen, die auch im Diskurs stark betont wird, eine herausragende Rolle. So ist nie ganz klar, wer eigentlich für wen spielt: Sind es die Götter, die die Menschen unterhalten oder sind es die Rollenspieler, die ein Schauspiel für die Götter vorführen? Wie man es ausdrückt, man spielt ‚zur Erbauung‘, ist aber gleichzeitig von der Gegenwart der dargestellten heiligen Kräfte überzeugt und von dem durch den Status des Laien-Priesters, des Maskenträgers oder Tänzers transformierten Status der Rollenperson, die man trotzdem noch kennt.25 Mit wem scherzt man also, wenn man einem Tänzer eine Orange unter die Maske schiebt, mit der Rollenperson oder den Göttern? Dies wird in allen Diskursen der Teilnehmer immer zweideutig offen gelassen, aber man antwortet mit Erstaunen und Entrüstung, wenn man sich im Gespräch mit Anwesenden über die Rollenspieler äußert, als hätten sie noch ihre soziale ‚persona‘, obwohl jeder Spieler sich andererseits mit seinen Altersgenossen oft ausführlich über die Rolle unterhält. Das Ritual aber transformiert für die Anwesenden die sozialen Rollen, sodass auch negative und scherzhafte Andeutungen und Pöbeleien nicht als Angriff interpretiert werden dürfen. Hier verstehen die Götter eben auch Spaß! Trotzdem werden sie als gefährliche Wesenheiten betrachtet, wie mir klargemacht wurde, als wir aus einem kleinen Waldschrein die Titulargottheit des Festes in stockdunkler Nacht einen steilen schlüpfrigen Bergabhang hinunter zum Hauptschrein geleiteten. Der die Zeremonie leitende Laienpriester warnte mich ernsthaft, nicht zurückzublicken, da diese gewalttätige Gottheit sich sonst mit ihrem unheilvollen Aspekten an meine Fersen heften und damit das Fest wie mich selbst negativ beeinflussen würde.
Paradoxien des Performativen: Kontingenz der Resonanz Wie sehr soziale Umstände das Gesamtgefüge eines Festes verändern können, wurde in dem beschriebenen Weiler innerhalb eines Intervalls von fünf Jahren durch die veränderte Resonanz auf die performative Kompetenz klar. Während zu den Höhepunkten der Zuschauerbeteiligung normalerweise die Sequenz gehörte, in der am Ende heißes Wasser verspritzt wird, war während der letzten Aufführung dieser Tanz kaum von der Dorfbevölkerung besucht. Als Resonanz darauf kam keine ausgelassene Stimmung auf, was sich auf die Kompetenz der Ausübenden wie24 Vgl. auch Schechner, Between Theatre and Anthropology, a.a.O. 25 Vgl. auch Irit Averbuch, The Gods Came Dancing, Ithaca: Cornell University Press 1995.
98
KLAUS-PETER KÖPPING
derum negativ auswirkte. Der Grund war ein bereits Jahre schwelender Streit um die Verteilung öffentlicher Gelder zwischen den die Tänze organisierenden Dorfgruppen. Anstelle eines gemeinsamen Höhepunktes kam es beim Herunterholen und Verteilen der Papierbaldachine, die über dem Heißwasserkessel aufgehängt sind, um mit göttlicher Energie aufgeladen und dann als Gesundheitsschutz in die Haushalte, die diese Baldachine gestiftet, bezahlt und hergestellt hatten, getragen zu werden, zu einer längeren, ungeplanten und streitbaren Unterbrechung des gesamten Festablaufs. Hier drängten sich plötzlich alle Dorfbewohner zusammen und forderten die Herausgabe ihrer Baldachine, um mit diesen dann das Fest zu verlassen, ohne sich um den Rest der Ritualtänze, die noch einen guten halben Tag weitergingen, zu kümmern. Der gemeinschaftliche Geist wurde für private Zwecke umfunktioniert, indem nur noch die Eigeninteressen hervorgekehrt wurden. Aber auch das Gegenteil konnte beobachtet werden: in einem Weiler verschwand die Dorfbevölkerung nach wenigen Stunden, da die Tanzsequenzen in absoluter Regelfolge ohne improvisierte Teile, ohne Zwischenrufe oder obszöne Ausschweifungen abliefen. Sie folgten einer inzwischen gedruckten Version, die zudem nur eine Wiederaufarbeitung der Arbeiten eines berühmten Folklore-Forschers von vor über 50 Jahren waren. Dies mag eine Folge der Erhebung des Festes zu einem immateriellen Kulturschatz sein, da dadurch eine Fossilisierung der Festformen stattfindet. Zum anderen sind die schwindenden Zuschauerzahlen aus der direkten Dorfbevölkerung eine Entwicklung der demografischen Verhältnisse, die zu einer stetigen Abwanderung und Überalterung in diesen harschen, ökonomisch unergiebigen Bergregionen geführt hat. Die positive Resonanz als emergente Qualität weist Beobachter, Darsteller und Publikum darauf hin, dass etwas ‚Außergewöhnliches‘ stattgefunden hat. Dass auch die Gegenwart der Götter sich im Außergewöhnlichen manifestiert (z. B. durch Heißwasser-Ordale, bei denen die Darsteller von Göttermasken keine Verbrennungen erleiden), ist eine risikobehaftete, kontingente Größe, die auch durch meisterhafte inszenatorische Praktiken nicht garantiert werden kann. Die Dörfler spielen die Götter durch das Aufsetzen von ikonischen Masken, die Götter werden – so hofft man – durch das Tanzen, die Musik, den Festlärm geweckt, um dann inmitten der Menschen zu tanzen. Ob und wann diese Epiphanie stattfindet, ist keine Frage der objektiven Beurteilung, sondern des erlebnishaften Mitgerissenwerdens, bei dem die Grenzen zwischen den Körpern in einer wogenden, fast nackten Masse genauso verschwimmen wie die Unterschiede zwischen Göttern und Menschen. Für manche Besucher bestand die Epiphanie in einer buddhistischen Imagination: Wie mir ein auswärtiger Teilnehmer in Erstaunen sagte, als er die Tänzer in ihren Drehungen verfolgte, jetzt verstehe er das Bild des Westlichen Paradieses (des Amida-Buddhismus, der sich u. a. in Tempelmalereien von beflügelten himmlischen Wesen auszeichnet). Für viele wurde hier jenes kollektive Volksbewusstsein (yamato-damashii) erfahrbar, von dem die Japaner gerne sprechen, wenn sie den affektiven Status des ‚Japanischseins‘ und des ‚Einsseins‘ mit anderen ausdrücken wollen. Man hofft, dass der Geist, der die Göttermaske ‚repräsentiert‘, unter der Maske nicht wie Masken generell das Gesicht des Individuellen verdeckt, sondern dass die persona, die man darstellt und aufführt, in die
RESONANZ ALS ZEICHEN EFFEKTIVER/AFFEKTIVER TRANSFORMATION
99
Körperlichkeit und damit in das Innere des Darstellers eindringt, sodass er konkret zur ‚lebenden Gottheit‘ wird.26 In der Tat wird in den volksreligiösen Aufführungen eine Art ‚liminales Zwischenreich‘27 gestaltet und erschaffen, in welchem es einen Gaben- und Substanztausch zwischen Göttern und Menschen gibt, in dem auch das Aufgeführte und das Reale verschmelzen. Dadurch können die Menschen genauso wenig einer ‚Klasse‘ klar zugeordnet werden, wie es kaum noch einen Unterschied zwischen Aufführung und Real-Präsenz dessen, was man darstellt, gibt. Dies sind die verschiedenen Erscheinungsformen der Resonanz, jenes Mitvibrierens, das man sonst dadurch ausdrückt, dass man sagt, man nehme den Trommelrhythmus durch den Bauch oder durch die Haut auf. Es ist diese ästhetisch vermittelte und affektiv wahrgenommene Transformation, der zuliebe man die Feste eigentlich veranstaltet (mit allen ökonomischen Bedingungen, enormen Zeit- und Kostenaufwand bis hin zur Zerstörung der Paraphernalia wie früher auch des das Fest gebenden Hauses einer Familie, einer potlatch-ähnlichen rituellen Destruktion, einer Verschwendung). Man hofft auf die Transformation, aber fürchtet sie auch. Sie ist in der Tat das von Religionswissenschaftlern wie Rudolph Otto und surrealen Philosophen wie Georges Bataille beschworene Heilige als Fascinosum und Tremendum. Konkret erlebt wird es nur in jenem Rausch, den die Festteilnehmer oft als ‚Matsuri-Wahnsinn‘ oder gar als ‚Besessenheit‘ beschreiben. Auch jene Touristen, die auf der Suche nach dem ‚authentischen Japanischsein‘ davon erfasst wurden, äußern, dass sie sich keinen Neujahrsanfang ohne Teilnahme an einem Matsuri vorstellen können und immer wiederkehren. Insofern verweisen diese Volksrituale auf den liminalen Status des ‚Spiels‘, das als unorganisiertes Erlebnis durch höchst genaue Regeln herbeigeführt wird.28 Ritualzeit und Ritualort sind trotz oder gerade wegen des Aufeinanderprallens von höchst liturgischen Elementen und nicht-liturgischen Einwürfen durch sozial bedingte Interaktivitäten des Alltagshandelns strukturiert. Im Zusammenstoß höchster Formen der Sanktifizierung von Platz, Zeit und Personen mit Tabu-Brüchen entsteht jener Ausnahmezustand, der sowohl ‚Utopie‘ (Nicht-Ort) wie ‚U-Chronie‘ (Nicht-Zeit) beinhaltet, aber weder der Zone des Sakrosankten oder einer ‚Anderswelt‘ noch der ‚Alltagswelt‘ zugeordnet werden kann.29 Ob die Resonanz in diesem Sinne zustande kommt, ist ein unplanbarer Prozess, der sich erst in der Immersion zwischen Darstellern und Publikum, in einem ebenfalls liminalen Bereich, in dem der eine zum anderen werden kann, einstellt oder eben auch nicht. Dies hängt schließlich nicht 26 Vgl. Klaus-Peter Köpping, „Masking as Ludic Practice of Selfhood in Japan“, in: Culture and Psychology 11 (2005), S. 29-46. Der japanische Begriff des ikigami (lebende Gottheit) ist eine der wichtigsten Metaphern für außergewöhnliche künstlerische Leistungen im offiziellen japanischen Ehrensystem, wird aber auch von Religionsstiftern bis in die neueste Zeit hinein immer wieder beschworen. Traditionellerweise gilt dieser Begriff für die Inkarnation der Sonnengöttin durch den regierenden Kaiser. 27 Vgl. Turner, The Ritual Process, a.a.O. 28 Vgl. auch Roger Caillois, L’homme et le sacré, Paris: Gallimard 1950. 29 Vgl. Köpping, „Shattering Frames“, a.a.O.
100
KLAUS-PETER KÖPPING
nur von enthusiastischen Darstellern oder künstlerischer Ausgefeiltheit ab, sondern von jener intersubjektiven und kollektiven Synästhesie der anwesenden Körper und ihrer Bewegungsformen. Die Konsonanz der Körper spielt dabei eine genauso wichtige Rolle wie das Einstimmen von Gesang, das saloppe Einbringen von Kommentaren und alltäglichen Banalitäten der Unvollkommenheit. Um es nochmals zu betonen: Die performative Eleganz und Kompetenz der Darsteller und Leiter der Feste ist keine Garantie für das Auftauchen der Resonanz als Hauptkriterium für die sich vollziehende Transformation, aus der nach der liminalen Schwellenphase keine neuen Statuspositionen hervorgehen. Vielmehr ist es die Resonanz der kollektiven Wahrnehmung eines Glückszustandes, an dem man körperlich aktiv mitwirkt, von dem man selbst affiziert wird und in welchem jeder individuelle und soziale Unterschied, oft auch jener der Gender-Differenzierung, verwischt wird. Die Kontraste sind überall wahrnehmbar: Die Sonnengöttin wird immer begleitet von einer recht obszönen Maske der witzigen Okame (dicke rote Backen beziehen sich eigentlich auf den dicken Hintern). Der weise Greis (bei Neujahrs-Nō-Spielen als Okina-Figur bekannt) wird von einer tölpischen ClownMaske begleitet. Der Segen des Okina, dessen andere Seite der Maske die des jugendlichen Gottes darstellt (oder der ein schwarzes und ein weißes Maskengesicht janusartig zeigt), der Glück und Fruchtbarkeit für das neue Jahr spendet, beruht auf seiner impliziten Eigenschaft des Dazwischenstehens, zwischen den Zeiten, zwischen Ernte, Dürre und Aussaat. Die Vielfalt der Einflüsse auf die theatrale Gestaltung ist an diesen wenigen Beispielen aus den Blumenfesten ausreichend illustriert worden. Sie zeigen, dass es in diesen Ritualen zu einer komplexen Verwobenheit von dem kommt, was Tambiah mit den Begriffen der Ikonizität und Indexikalität umschrieben hat, nämlich von tradierten Symbolverweisen auf ein generelles kulturelles Repertoire einerseits und sozialen Kontexten oder Unwägbarkeiten andererseits. Es sind weniger die symbolischen Verweise als die sozialen Formen ihrer Ausführung, die zur positiven wie negativen Resonanz bei diesen Festen führen. Die symbolischen Bezüge sind dabei keineswegs unbedeutend geworden und werden gerade durch die penible Regelbefolgung in ihrer Wirksamkeit betont. Zum anderen ist es die symbolisch fundierte Genauigkeit, die mit der Repetitivität und Redundanz verbunden ist, die im Gegensatz zu vorher voll durchstrukturierten Liturgien durch einen gemeinschaftlichen Lernvorgang wiederum in eine Aufführung umgestaltet werden kann. Die Selbstermächtigung der Laienbevölkerung, die Götter ohne Intervention einer professionellen Priesterklasse herbeizurufen, wird durch diese Lernvorgänge innerhalb der Aufführung am deutlichsten zum Ausdruck gebracht. Theatralität kann hier daher als Merkmal und Ausdruck jener Selbstermächtigung interpretiert werden, als die unabdingbare Voraussetzung, um die informelle, aber durch Regeln strukturierte Kommunalität der Gemeinde darzustellen. Alles Probieren, Scherzen, und das Fehlerbehaftete der Aufführungen führt zu dem, was Teilnehmer, Darsteller wie Zuschauer aus den Dörfern mir als das ‚wirkliche‘ Ziel der Feste nannten: Man zeigt sich untereinander, wie man gerne sein möchte und etabliert erneut den Frieden ‚zwischen den Herzen‘ der Gemeinschaft; auch dadurch, dass man in den Auf-
RESONANZ ALS ZEICHEN EFFEKTIVER/AFFEKTIVER TRANSFORMATION
101
führungen soziale Differenzen durch Zwischenrufe und Anpöbeln in betrunkenem Zustand zum Ausdruck bringt, um sie nie wieder zu erwähnen. Das Transgressive des Tabu-Bruchs mit Formen des guten Benehmens ist Teil der Wiederherstellung der beschworenen und imaginierten sozialen Harmonie des Alltags.
Literaturverzeichnis Austin, John L., How to do Things with Words, Oxford: Clarendon Press 1962. Averbuch, Irit, The Gods Came Dancing, Ithaca: Cornell Universitiy Press 1995. Bateson, Gregory, „A Theory of Play and Fantasy“, in: Psychiatric Research Report 2 (1955), S. 39-51. Bloch, Maurice, „Symbols, Song, Dance and Features of Articulation“, in: European Journal of Sociology 15 (1974), S. 55-81. Bourdieu, Pierre, Outline of a Theory of Practice, Cambridge: Cambridge University Press 1977. Caillois, Roger, Die Spiele und die Menschen, München: Ullstein 1958. —, L’ homme et le sacré, Paris: Gallimard 1950. Dolan, Jill, Utopia in Performance, Ann Arbor: University of Michigan Press 2005. Fiebach, Joachim, „Brechts ‚Straßenszene‘. Versuch über die Reichweite eines Theatermodells“, in: Weimarer Beiträge 24 (1978), S. 123-147. Fischer-Lichte, Erika, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004. — „Das Theater der Rituale“, in: Die neue Kraft der Rituale, hg. v. Axel Michaels, Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2007, S. 117-139. —, „Theater und Fest“,Transformationen des Religiösen, hg. v. Ingrid Kasten/Erika Fischer-Lichte, Berlin/New York: Walter de Gruyter 2007, S. 3-17. —, „Verwandlung als ästhetische Kategorie“, in: Theater seit den 60er Jahren, hg. v. Erika FischerLichte/Friedemann Kreuder/Isabel Pflug, München: UTB 1998, S. 21-91. Greenblatt, Stephen, Renaissance Self-Fashioning, Chicago: University of Chicago Press 1984. —, Wunderbare Besitztümer, Berlin: Wagenbach 1994. Humphrey, Carolin/Laidlaw, James (Hg.), The Archetypal Actions of Ritual, Oxford: Clarendon 1994. Hymes, Dell, „Breakthrough into Performance“, in: Folklore: Performance and Communication, hg. v. Ben Ben-Amos/Kenneth S. Goldstein, The Hague: Mouton 1975, S. 11-74. Kendall, Laurel, „Initiating Performance“, in: The Performance of Healing, hg. v. Carol Laderman/ Marina Roseman, London: Routledge 1996, S. 17-58. Köpping, Klaus-Peter, „Failure of Performance or Passage to the Acting Self? Mishima’s Suicide between Ritual and Theatre“, in: The Dynamics of Changing Ritual, hg. v. Jens Kreinath/Constance Hartung/Annette Deschner, Toronto: Peter Lang 2004, S. 97-114. —, „Inszenierung und Transgression in Ritual und Theater“, in: Ethnologie und Inszenierung: Ansätze zur Theaterethnologie, hg. v. Bettina E. Schmidt/Mark Münzel, Marburg: Curupira 1998, S. 45-86. —, „Masking as Ludic Practice of Selfhood in Japan“, in: Culture and Psychology 11 (2005), S. 29-46. —, Shattering Frames: Transgressions and Transformations in Anthropological Theory and Practice, Berlin: Reimer 2002. Macho, Thomas, „Deus ex machina. Bemerkungen zur Technikgeschichte der Religion“, in: Neue Rundschau 115 (2004), S. 25-40. Pauly, Ulrich, Die Teufel kommen zum Tanz, Tokyo: OAG 2002. Schechner, Richard, Between Theatre and Anthropology, Philadelphia: Pennsylvania University Press 1985.
102
KLAUS-PETER KÖPPING
Schieffelin, Edward, „On Failure and Performance“, in: The Performance of Healing, hg. v. Carol Laderman/Marian Roseman, London: Routledge 1996, S. 58-89. Tambiah, Sir Stanley, „A Performative Approach to Ritual“, in: Proceedings of the British Academy 65 (1979), S. 113-169. Turner, Victor, The Ritual Process, Harmondsworth: Penguin 1969.
DAVID PLÜSS
Aufführung von Liminalität. Gottesdienst als Text, Ritual und Theater
1. Ist der Gottesdienst eine Aufführung? Liturgik oder Liturgiewissenschaft1 ist die Theorie des Gottesdienstes, wobei zwischen einer historisch-genetischen, einer systematisch-normativen, einer anthropologisch-analytischen und einer praktisch-handlungsorientierten Perspektive und Herangehensweise zu unterscheiden ist. Die Liturgiewissenschaft ist wesentlicher Bestandteil der katholischen Theologie und Ausbildung. Diese entfaltet sich gleichsam von der Liturgie her und auf sie hin. Ganz anders verhält es sich im Protestantismus, welcher den Schwerpunkt der folgenden Überlegungen bildet. Die Liturgik etablierte sich in der protestantischen Theologie erst allmählich als akademische Disziplin, welche über die Liturgiegeschichte hinausgeht und kulturwissenschaftliche Zugänge einbezieht. Obwohl der Gottesdienst auch für Protestanten von zentraler Bedeutung ist, fand eine auf die konkrete liturgische Praxis bezogene Theoriebildung an den evangelischen Fakultäten bisher nur am Rande statt. Professuren ausschließlich für Liturgik gibt es im deutschen Sprachraum meines Wissens nicht, liturgiewissenschaftliche Lehrveranstaltungen gehören nicht zum Pflichtprogramm des Theologiestudiums. Das Curriculum einer protestantischen Theologin ist insgesamt auf die historisch-kritisch reflektierte und theologisch sachgemäße Auslegung von Bibeltexten fokussiert. Eine solche Auslegung erfolgt in der kirchlichen Praxis zuerst und vor allem im Rahmen der Predigt, die das Herzstück des reformatorischen Gottesdienstes darstellt und in den Jahrhunderten nach der Reformation gewöhnlich eine Stunde oder länger dauerte.2 Das spiegelt sich auch heute noch in der Umgangssprache: Deutschschweizer Reformierte gehen nicht in den Gottesdienst, sondern ‚z’Predigt‘. Die Wortlastigkeit des protestantischen Kultes ist somit weder ungerechte Polemik noch uninformiertes Vorurteil, sondern theologisches Programm. Hinzu kommt, dass die Predigt in Theorie und Ausbildung meist nicht als stimmhafte Rede in einem Kirchenraum vor bestimmten Menschen konzipiert wird, sondern als Text. Das theologisch gehaltvolle und sprachlich sorgfältig gestaltete Predigtmanuskript bildet in aller Regel den Ziel-
1 Von gr. Leitourgia: dem Gemeinwesen geschuldete Pflicht, öffentliche Dienstleistung. 2 Vgl. Peter Cornehl, ‚Gottesdienst/VII: Evangelischer Gottesdienst von der Reformation bis zur Gegenwart‘; in: Theologische Realenzyklopädie, Bd. XIV, Berlin/New York: Walter de Gruyter 1985, S. 54-85, hier: S. 58.
104
DAVID PLÜSS
punkt homiletischer Bemühungen.3 Selbst die Predigtanalyse bezieht sich auf das Manuskript und nicht auf dessen Vortrag. Ausgangs- und Zielpunkt homiletischer Arbeit ist somit ein Text und keine Aufführung. Das Kultische oder Liturgische rund um die Predigt wird als Rahmenhandlung derselben begriffen und gestaltet, welche zur – meist abgelesenen – Predigt hinführt und deren Inhalte bekräftigt. Entsprechend skeptisch fallen die Reaktionen auf den performative turn aus, welcher sich in der protestantischen Liturgiewissenschaft immer deutlicher abzeichnet.4 Wer die Predigt und den Gottesdienst als Inszenierung beschreibt, hat sich auf kritische Rückfragen oder gar Unverständnis seitens der Pfarrpersonen und Gemeindemitglieder gefasst zu machen. Die Begrifflichkeit klingt in vielen Ohren befremdlich. Der Inszenierungsbegriff hat den Beigeschmack des Unernsthaften, des bloß Vorgetäuschten. Im Gottesdienst gehe es, so die Kritiker, gerade nicht um Inszenierungen, und seien diese noch so kunstvoll, sondern um die Verkündigung des Evangeliums, um eine göttliche Wahrheit. Eine solche Verkündigung sei nicht Spiel, sondern durchaus ernst. Sie sei kein Theater, auch kein heiliges Theater, sondern aktualisierte biblische Botschaft mit existenziellem Gewicht, „Trost im Leben und im Sterben“5. Aus dieser an sich verständlichen Skepsis wird ein Missverständnis ersichtlich, aber auch die spezifische Situation liturgiewissenschaftlicher Theoriebildung. Das 3 Die Homiletik (von gr. homiletike techne: Kunst des Umgangs) ist die Lehre oder Theorie der Predigt und hat sich auf protestantischer Seite als Pendant zur katholischen Liturgiewissenschaft etabliert. 4 Zum performative turn vgl. Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek b. H.: Rowohlt 2007, S. 104-143. Folgende Autorinnen und Autoren haben den performative turn in Liturgik und Homiletik maßgeblich in besonderer Weise eingeleitet und befördert: Henning Luther, Predigt als inszenierter Text. Überlegungen zur Kunst der Predigt, in: Theologia Practica 18 (1983), S. 89-100; Michael Meyer-Blanck, „Inszenierung und Präsenz. Zwei Kategorien des Studiums Praktischer Theologie“, in: Wege zum Menschen 49 (1996), S. 2-16; Ulrike Suhr, „Das Handwerk des Theaters und die Kunst der Liturgie. Ein theologischer Versuch über den Regisseur Peter Brook“, in: Kulte, Kulturen, Gottesdienste. Öffentliche Inszenierung des Lebens, hg. v. Peter Stolt/Wolfgang Grünberg/Ulrike Suhr, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1996, S. 37-49; Michael Meyer-Blanck, Inszenierung des Evangeliums. Ein kurzer Gang durch den Sonntagsgottesdienst nach der Erneuerten Agende, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1997; Karl-Heinrich Bieritz, „Spielraum Gottesdienst. Von der ‚Inszenierung des Evangeliums‘ auf der liturgischen Bühne“, in: Drama „Gottesdienst“. Zwischen Inszenierung und Kult, hg. v. Arno Schilson/Joachim Hake, Stuttgart/Berlin/Köln: Kohlhammer 1998, S. 69-101; Arno Schilson, „Die Inszenierung des Alltäglichen und ein neues Gespür für den (christlichen) Kult?“ in: Drama „Gottesdienst“, a.a.O., S. 13-67; Petra Schulz, „Vom biblischen Text zu einer Performance im Kirchenraum“, in: Erfahrungsräume, hg. v. Anna-Katharina Szagun, Münster: LIT 1999; Thomas Kabel, Handbuch Liturgische Präsenz. Zur praktischen Inszenierung des Gottesdienstes, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2002; David Plüss, Gottesdienst als Textinszenierung. Perspektiven einer performativen Ästhetik des Gottesdienstes, Zürich: Theologischer Verlag Zürich 2007; Thomas Klie, Fremde Heimat Liturgie. Ästhetik gottesdienstlicher Stücke, Stuttgart: Kohlhammer 2009. 5 Vgl. die erste Frage des Heidelberger Katechismus, einem zentralen Referenztext reformierter Kirchen und Theologie.
AUFFÜHRUNG VON LIMINALITÄT
105
Missverständnis besteht darin, dass kulturwissenschaftliche und also analytische Beschreibungskategorien essentialistisch oder normativ interpretiert werden. Es wird aber auch deutlich, dass Liturgiewissenschaft bisher fast ausschließlich historisch und theologisch-normativ betrieben wurde und sich dazu einer Terminologie bediente, die dem christlichen Symbolsystem, der traditionell verfassten Dogmatik entstammt. Ein kultur- oder sozialwissenschaftlicher Zugang zum Gottesdienst erscheint noch wenig plausibel. Eine Kooperation zwischen Kulturwissenschaft und Theologie, zwischen Ritual und Liturgical Studies, wie sie außerhalb des deutschen Sprachraums vielfach besteht, ist bei uns noch in weiter Ferne. Dies ist darum bedauerlich, weil von der Theaterwissenschaft, den Performance und Ritual Studies einiges zu lernen wäre.6 Denn abgesehen von den erwähnten Abwehrreflexen und berechtigten Bedenken ist die Sachlage offensichtlich: Ein Gottesdienst ist ein Ritual, eine Aufführung und ein Gesamtkunstwerk. Ein Drama in verschiedenen Akten. Die Fokussierung auf die Predigt, das Medium Sprache oder auf das Skript der liturgischen Aufführung stellen Reduktionen dar und werden dem tatsächlichen Geschehen in keiner Weise gerecht: einem Geschehen in einem bestimmten Raum zu einer bestimmten Zeit, an dem mehrere Menschen beteiligt sind, sich zeigen und sich gegenseitig wahrnehmen, sich bewegen und bewegen lassen, sprechen und zuhören; einem Geschehen, das sich durch eine bestimmte Atmosphäre, durch Lichtverhältnisse und Klangräume auszeichnet. Gegenstand der Liturgik ist zunächst und vor allem dieses Geschehen im Vollzug, diese Inszenierung oder Aufführung.
2. Modelle der liturgischen Aufführung Der performative turn in der Liturgiewissenschaft findet, wie erwähnt, erst in Ansätzen statt. Dabei sind es drei Modelle, die zur Zeit die Diskussion bestimmen: das Ritual, das Theater und die Textinszenierung. Sie sollen im Folgenden kurz skizziert werden. 2.1. Der Gottesdienst als Ritual Den christlichen Gottesdienst als Ritual zu bezeichnen, scheint zunächst wenig aufregend. Die Ritualität liturgischer Handlungen ist jedem, der schon einmal an einer Eucharistie- oder einer Beerdingungsfeier teilgenommen hat, unmittelbar plausibel. Dennoch stößt der Ritualbegriff bei Protestantinnen und Protestanten auf Skepsis und Ablehnung. Dies hängt mit einem antikatholischen Abwehrreflex 6 Umgekehrt wäre auch denkbar, dass sich die auf Aufführungen spezialisierten Kulturwissenschaften neben archaischen Ritualen und säkularer Gegenwartskultur – wie dem Theater und den Performing Arts – mit Gewinn auch mit Performanzen und Ritualen gelebter Gegenwartsreligion befassen würden. Dies ist erstaunlicherweise noch kaum der Fall.
106
DAVID PLÜSS
zusammen. Im Unterschied zur mittelalterlichen Priestermesse mit eucharistischem Opferritus, welche auch ohne Gemeinde ‚funktioniert‘ und gültig ist, haben die Reformatoren den Gottesdienst als Gemeindefeier konzipiert, in der, so Martin Luther in seiner Torgauer Kirchweihpredigt von 1546, nichts anderes geschehen soll, „als dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir umgekehrt mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang“7. Diese so genannte Torgauer Formel stellt eine komprimierte Fassung der protestantischen Gottesdiensttheorie mit großer Wirkkraft bis in die Gegenwart dar. Sie hat sogar die Liturgiereform des II. Vatikanischen Konzils der römisch-katholischen Kirche (1962-1965) beeinflusst. Der Opferritus der Eucharistie wird von Luther nicht erwähnt. Auch der Priester und dessen besondere Weihe spielen keine Rolle. Die Einweihung der Schlosskirche zu Torgau wird gerade nicht als sakramentaler Ritus verstanden, dessen Wirkkraft am Weihesakrament des Priesters hinge, sondern als schlichte Gemeindefeier. Als eine solche Feier allerdings, die sich als Antwort auf das zuvor ergangene Gotteswort versteht und also responsorisch verfasst ist. Damit ist gerade kein Ritual, sondern ein Dialog im Blick. Ein Dialog, der sich auf der äußeren Bühne des Gottesdienstes eben nicht beobachten lässt. Zumindest der den Dialog eröffnende und also konstitutive Part Gottes entzieht sich der Anschauung. Er vollzieht sich allenfalls auf der inneren Bühne der Gläubigen. Gleichwohl zeitigte diese Neubestimmung des Liturgischen eine Neubewertung liturgischer Medien und Positionen. Das Ritual wird abgelöst durch die Sprache der Predigt, der Gebete und der Lieder. Das geweihte Amt wird abgelöst durch die Gemeinde als Trägerin der Liturgie. Der Messkanon in der Hand des Priesters wird abgelöst durch das Gesangbuch als Rollenbuch der Gemeinde. Den bis in die Gegenwart virulenten antirituellen Affekt protestantischer Gottesdiensttheologie bringt der emeritierte Kieler Praktologe Reiner Preul zum Ausdruck, wenn er schreibt: „Evangelische Gottesdienste oder andere liturgische Formen als Ritus oder Ritual zu bezeichnen, hat wenig Anlass in der liturgischen Tradition des Protestantismus, insofern die theologische Bestimmung von Gottesdienst im Vordergrund stand“ und sich das „dialogische Geschehen zwischen Gott […] und Mensch […] vor allem auf der Ebene sprachlicher Bewusstheit abspielt.“ Die „Pointe des gottesdienstlichen R[itus]“ liegt für Preul darin, „dass er in seiner Mitte in Gestalt der Predigt ein geradezu antirituelles Element zum Zuge bringt und somit ein ausbalanciertes Verhältnis von psychischer Regression und Progression ermöglicht“8, wobei Preul die regressiven Effekte gerade dem Ritual – etwa dem Aaronitischen Segen – anlastet. 7 Luther zitiert nach Michael Meyer-Blanck, Liturgie und Liturgik. Der Evangelische Gottesdienst aus Quellentexten erklärt, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2001, S. 29. 8 Reiner Preul, ‚Ritus/Ritual. II. Religionsgeschichtlich, 4. Christentum, c. Liturgisch (Evangelisch); III. Dogmatisch; IV. Ethisch; V. Praktisch-theologisch‘, in: Religion in Geschichte und Gegenwart, Bd. 7, hg. v. Hans D. Betz/Don S. Browning/Bernd Janowski/Eberhard Jüngel, Tübingen: Mohr Siebeck 2004, S. 555-559, hier: S. 555f.
AUFFÜHRUNG VON LIMINALITÄT
107
Preul unterläuft hier der Fehler, die religiös-normative Symbolisierung des Gottesdienstes – qua Dialog zwischen Gott und Gemeinde – nicht genügend von der Analyse des tatsächlichen liturgischen Verhaltens zu unterscheiden. Die fehlende Unterscheidung zwischen deskriptiver Ritualtheorie und symbolisch-normativer Theologie stiftet Verwirrung. Denn auf der Phänomenebene, auf der Ebene des Verhaltens lässt sich jeder Gottesdienst als Ritual rekonstruieren. Zwar stellt die Lateinische Messe nach dem tridentinischen Missale Romanum ein sinnfälligeres und gewissermaßen archaischeres Ritual dar als der nachkonziliare Ritus oder der protestantische Predigtgottesdienst, wie neulich der Schriftsteller Martin Mosebach in polemischer Schärfe und bisweilen überzeichnend herausgestellt hat.9 Rituale sind sie gleichwohl alle drei. So ist etwa eine kirchliche Beerdigungsfeier am Grab durch und durch rituell verfasst, in allen ihren Teilen und als gesamter Vollzug, mitsamt ihren zivilreligiösen (z. B. dreimaliges Absenken von Vereinsfahnen ins Grab) und paganen Einsprengseln.10 Aber auch ein auf die Sprache und die Vermittlung von Inhalten fokussierter Predigtgottesdienst reformierter Konfession stellt unabweisbar ein Ritual dar, insgesamt und in seinen Teilen.11 Das Orgeleingangsspiel, die Eröffnungssequenz, der Gemeindegesang, die Gebete und die Predigt sind alle nur als vertraute und wiederkehrende Elemente eines komplexen Rituals in ihrer Phänomenalität zu verstehen. Sie funktionieren nur dann, wenn sie vertraut sind, wenn die Gattung oder die Handlungsform der Mehrzahl der Beteiligten bekannt ist. Beerdingungsfeiern oder Predigtgottesdienste sind Schwellenrituale, wie sie Victor Turner konzipierte.12 Die Herstellung und Verwandlung einer Communitas ist theologisches Programm und erwünschter Effekt, selbst bei den auf Eigenständigkeit und Individualität bedachten Protestanten. Die Liturgie soll bei den Beteiligten eine Transformation, eine Verwandlung und Befreiung bewirken, insofern Schuld vergeben,13 die Begegnung mit Gott durch Wort und Sakrament ermöglicht und der Segen als vitale Kraft wirksam werden soll. Eine solche Transformation entspricht dabei
9 Vgl. Martin Mosebach, Häresie der Formlosigkeit. Die römische Liturgie und ihr Feind, München: Carl Hanser 2007. 10 Vgl. hierzu Walter Neidhart, „Die Rolle des Pfarrers beim Begräbnis“, in: Wort und Gemeinde. Festschrift für E. Thurneysen, Zürich: EVZ 1968, S. 226-235. 11 So auch Werner Jetter, Symbol und Ritual. Anthropologische Elemente im Gottesdienst, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1978. 12 Vgl. Victor Turner, Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur, Frankfurt a. M./New York: Campus 2000; vgl. dazu Petra Bahr, „Ritual und Ritualisation. Elemente zu einer Theorie des Rituals im Anschluss an Victor Turner“, in: Praktische Theologie 33 (1998), S. 143-158; Erika Fischer-Lichte, „Einleitung. Zur Aktualität von Turners Studien zum Übergang vom Ritual zum Theater“, in: Victor Turner, Vom Ritual zum Theater. Der Ernst des menschlichen Spiels, Frankfurt a. M./New York: Campus 2009, S. i-xxiii. 13 Die so genannte Offene Schuld, ein in die Eröffnungssequenz integriertes kollektives Schuldbekenntnis, war bis vor ca. 50 Jahren Urgestein reformierter Liturgie.
108
DAVID PLÜSS
nicht nur einem genuin christlichen, sondern auch einem menschlichen Grundbedürfnis.14 Sowohl seiner phänomenalen Gestalt wie seiner theologischen Intention nach ist der protestantische Gottesdienst ein ritualisierter Vollzug, der Communitas und Liminalität bewirkt und diese in spezifischer Weise gestaltet und deutet. 2.2 Der Gottesdienst als Theater Ein gewichtiger und berechtigter Vorbehalt gegenüber einer ritualtheoretischen Rekonstruktion des Gottesdienstes bleibt bestehen: Die christlichen Gottesdienste der Gegenwart stellen keine archaischen Rituale dar. Dies gilt in besonderer Weise für protestantische Gottesdienste. In diesen wird kein Gründungsmythos ritualisiert, keine Weltschöpfungs- oder Erlösungsmythen in genau vorgeschriebener Weise aufgeführt, um die Welt zu erhalten oder die Menschen ihrer Erlösung zuzuführen. Die liturgischen Handlungen sind nicht strikt vorgegeben, sondern variabel; die Teilnahme ist nicht verpflichtend, sondern freiwillig. Der Gottesdienst hat in der spätmodernen Gegenwart keine stabilisierenden, legitimierenden oder transformierende Funktionen für die Gesellschaft als ganze, sondern gehört in den Freizeit- oder Privatbereich von weitgehend individualisierten Menschen. Die Beteiligungsform und -intensität wird von den Individuen autonom bestimmt und dosiert. Regelmäßige Teilnahme ist selbst bei Kirchennahen zur Ausnahme geworden. Man ‚besucht‘ Gottesdienste anlässlich von Taufen, Hochzeiten oder an Weihnachten – und ansonsten nach Lust und Laune. Insofern sind Gottesdienste nicht nur als Rituale zu beschreiben, sondern auch mit anderen performativen Vollzügen unserer Freizeitkultur zu vergleichen wie Theateraufführungen, Filmvorführungen, Konzerten oder Museumsbesuchen. Die in solchen Veranstaltungen gesuchte ästhetische Erfahrung ist mit der religiösen Erfahrung eng verwandt.15 Liminalität und zumindest ephemere Communitas wird auch im Theater oder im Konzert gesucht und erfahren.16
14 So auch Erika Fischer-Lichte: „Es spricht vieles für die Auffassung, dass die Möglichkeiten, Schwellenzustände zu erreichen, so unterschiedlich diese auch ausfallen und in Erscheinung treten mögen, für Individuen ebenso wie für Gemeinschaften unverzichtbar sind.“ FischerLichte, „Einleitung. Zur Aktualität von Turners Studien zum Übergang vom Ritual zum Theater“, a.a.O., S. xvi. 15 Vgl. dazu Albrecht Grözinger, Praktische Theologie und Ästhetik, München: Kaiser 1991; Wilhelm Gräb, „Der inszenierte Text. Erwägungen zum Aufbau ästhetischer und religiöser Erfahrung in Gottesdienst und Predigt“, in: International Journal of Practical Theology 1 (1997), S. 209-226; Andreas Mertin, „Schönheit“, in: Der verborgene Sinn. Religiöse Dimensionen des Alltags, hg. v. Dietrich Korsch/Lars Charbonnier, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2008, S. 215-220. 16 So auch Victor Turner, „Liminalität und Communitas“, in: Ritualtheorien, hg. v. Andréa Belliger/David J. Krieger, Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1998, S. 251-262; Fi-
AUFFÜHRUNG VON LIMINALITÄT
109
Daraus ergibt sich eine gewisse Nähe zwischen Gottesdienst und Theater, wobei es mir weder um eine genealogische Verhältnisbeschreibung noch um die einer Ablösung geht. Vielmehr geht es um eine sowohl irritierende als auch produktive Nähe gerade zwischen Theater bzw. Performing Arts und Gottesdiensten der Gegenwart.17 Aus der Perspektive der Theatralität erscheinen die Vollzüge der Liturgie in einem anderen und anregend neuen Licht. Die Liturgie erscheint als Inszenierung, die Liturgen als Akteure, die Lektorin, der Kirchenmusiker und die Sigristin als Mitglieder des Ensembles und die Gemeinde als Publikum, wobei das Publikum als beteiligtes und aktives herausgestellt oder gar mit dem Chor in der griechischen Tragödie verglichen wird.18 Unterschiedliche Schauspieltheorien wie diejenige Konstantin Stanislawskis, Bert Brechts oder Jerzy Grotowskis lassen sich für die Frage liturgischer Körperlichkeit fruchtbar machen.19 Wiederholt werden Peter Brook und sein auf das Geheimnis ausgerichtetes Theaterkonzept aufgegriffen.20 Theater soll berühren und verändern, indem es mittels Reduktion und Konzentration auf das Nichtdarstellbare hinweist, das unverfügbare Ereignis in Szene setzt.21 Dieser Gedanke wirkte auf protestantische Liturgen und Liturgiewissenschaftler ungemein anregend. Die Nichtdarstellbarkeit, die Geheimnis- und Ereignishaftigkeit des in einem Theaterprojekt Erstrebten weisen eine hohe Passgenauigkeit zur protestantischen Theologie und liturgischen Religionspraxis auf. Die von Brook verwendeten Metaphern des leeren Raumes und der offenen Tür lassen sich unmittelbar auf das Konzept des reformierten Gottesdienstes anwenden. Hier wird auf einer beinahe leeren Bühne inszeniert. Die Reduktion auf das stimmhafte Wort sowie auf wenige Gesten und Handlungen hat System und gehört zum theologischen Programm. Der intellektuell anspruchsvolle Predigtgottesdienst der Protestanten erscheint nicht als entsinnlichte Schrumpfstufe eines katholischen Hochamts oder einer farbenprächtigen und ausgedehnten orthodoxen Liturgie, sondern als eigen-
17
18 19 20 21
scher-Lichte, „Einleitung. Zur Aktualität von Turners Studien zum Übergang vom Ritual zum Theater“, a.a.O. Das schwierige Verhältnis zwischen Kirche bzw. Gottesdienst und Theater wurde in historischer Perspektive bereits mehrfach rekonstruiert: Christine Schnusenberg, Das Verhältnis von Kirche und Theater. Dargestellt an ausgewählten Schriften der Kirchenväter und liturgischen Texten bis auf Amalarius von Metz (a.d. 775-852), Bern/Frankfurt a. M./Las Vegas: Peter Lang 1981; Norbert Greinacher, „Die Theologie und das Theater“, in: Theologische Quartalschrift 175 (1995), S. 347-354. Vgl. Ursulua Roth, Die Theatralität des Gottesdienstes, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2006. Vgl. Marcus A. Friedrich, Liturgische Körper. Der Beitrag von Schauspieltheorien und -techniken für die Pastoralästhetik, Stuttgart/Berlin/Köln: Kohlhammer 2001. Vgl. Suhr, „Das Handwerk des Theaters und die Kunst der Liturgie“, a.a.O.; Bieritz, „Spielraum Gottesdienst“, a.a.O.; Plüss, Gottesdienst als Textinszenierung, a.a.O., S. 97-99 u. S. 156-158. Vgl. dazu Peter Brook, Der leere Raum, Berlin: Alexander 1997; ders., Das offene Geheimnis. Gedanken über Schauspielerei und Theater, Frankfurt a. M.: Fischer 2000.
110
DAVID PLÜSS
sinniger, geistreicher und in seiner Schlichtheit durchaus zeitgenössischer Typus liturgischer Praxis. 2.3. Der Gottesdienst als Textinszenierung Nun lässt sich der Gottesdienst aber auch nicht auf eine theatralische Veranstaltung reduzieren. Wie einleitend vermerkt, stößt der Vergleich vor allem seitens der Praktikerinnen und Praktiker auf Ablehnung. Theater wird – wie Inszenierung – mit Künstlichkeit, mit bloß Vorgespieltem, gar mit Täuschung assoziiert. Theater geschehe im Modus des Als-ob. Nicht so der Gottesdienst. Hier gehe es um den Grund und das Geheimnis des Lebens, um die Hoffnung des Glaubens. Außerdem wird die Aufteilung zwischen professionellem Ensemble und Publikum kritisiert. Die Gemeinde ist im reformatorischen Verständnis nicht Publikum, sondern Subjekt, Trägerin des Gottesdienstes. Die Liturgen sind für ihre Aufgabe ausgebildete Glieder der Gemeinde. Sie alle stehen gewissermaßen auf der Bühne. Die Handlungen des Liturgen zielen gerade darauf ab, die Aktivität, die Beteiligung der Gemeinde anzuregen, sie ins liturgische Spiel einzubeziehen. Um dieser Kritik zu begegnen, wurde von verschiedener Seite der Inszenierungsbegriff in die liturgiewissenschaftliche Diskussion eingebracht.22 Er entstammt dem Konzept der Theatralität, wobei er einen zentralen Aspekt herausgreift: den Aspekt der absichtsvollen und reflektierten Gestaltwerdung, der Verkörperung und räumlichen Aufführung. Zudem steht der Inszenierungsbegriff in einer prominenten liturgiewissenschaftlichen Tradition der Moderne, nämlich in der Wirkungslinie Friedrich Schleiermachers (1768–1834). Schleiermacher hat das liturgische Handeln vom Alltagshandeln unterschieden und es als darstellendes Handeln – im Unterschied zum wirksamen Handeln – bestimmt. Religiöse Praxis im liturgischen Vollzug will nicht wirken, will weder belehren noch moralisch bessern, sondern einem Gefühl, einer Ahnung und einer Erregung zu einem stimmigen Ausdruck verhelfen.23 In diese spätromantisch grundierte Konzeption des stimmigen darstellenden Handelns zur Anregung einer religiösen Gemütslage wurde ein zunächst auf die Predigt bezogenes und später auf die ganze Liturgie ausgeweitetes Verständnis der Inszenierung eines Textes eingetragen. In der Predigt gelangt ein Bibeltext zur Aufführung, indem dieser nicht nur verlesen, sondern aktualisiert wird, indem ihm 22 Vgl. Henning Luther, „Predigt als inszenierter Text, a.a.O.; Michael Meyer-Blanck, Inszenierung des Evangeliums. Ein kurzer Gang durch den Sonntagsgottesdienst nach der Erneuerten Agende, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1997; Bieritz, „Spielraum Gottesdienst“, a.a.O.; Arno Schilson, „Die Inszenierung des Alltäglichen und ein neues Gespür für den (christlichen) Kult?“ in: Drama „Gottesdienst“, a.a.O., S. 13-67; Petra Schulz, „Vom biblischen Text zu einer Performance im Kirchenraum“, a.a.O.; Plüss, Gottesdienst als Textinszenierung, a.a.O. 23 Vgl. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Die Praktische Theologie nach den Grundsäzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt von Dr. Friedrich Schleiermacher, Berlin: Reimer 1850, S. 70f.; Michael Meyer-Blanck, Liturgie und Liturgik, a.a.O., S. 161-177.
AUFFÜHRUNG VON LIMINALITÄT
111
Erfahrungen und Übersetzungsversuche des Predigers beigefügt werden. Wenn nun festgestellt werden kann, dass Bibeltexte nicht nur das Skript der Predigt darstellen, sondern die gesamte protestantische Liturgie grundieren, lässt sich der Gottesdienst insgesamt als Inszenierung biblischer Texte deuten. Dabei ist davon auszugehen, dass liturgische Inszenierungen – qua Lautwerdung, Verkörperung, Verräumlichung und Dramatisierung – Bibeltexte nicht entfremden, sondern ihnen in mehrfacher Hinsicht entsprechen und zu ihrer authentischen Gestalt verhelfen. Denn Bibeltexte stellen über weite Strecken liturgische Gattungen dar: Gebete (Psalter), Predigten, Klagelieder, zur liturgischen Verlesung konzipierte Belehrungen. Zudem haben sich in den biblischen Texten Lebensweisheiten und Glaubenserfahrungen eingelagert, die es wieder zu verflüssigen gilt, um für unsere Zeitgenossen verständlich und plausibel zu werden. Mit dem Inszenierungsbegriff verbindet sich aber auch eine ganz neuartige Aufmerksamkeit für die Performanz liturgischen Handelns: eine Aufmerksamkeit für die Stimmhaftigkeit der Lesung, die Gestik und Mimik der Predigt, die Räumlichkeit der Bewegungen und Positionen, für das Licht, den Klang und die Materialität des Kultraumes. Eine Aufmerksamkeit auch für die Tatsache, dass Menschen im Gottesdienst nicht einen Text lesen und diesen kognitiv zu verstehen suchen, sondern sich an einer Aufführung beteiligen, die sie anregt oder langweilt, peinlich berührt oder fasziniert, tröstet oder ängstigt, betrifft oder belustigt. Selbst der reformierte Gottesdienst in seiner Kargheit erscheint so als eigenwillig moderne Inszenierung auf einer leeren Bühne.
3. Aspekte einer performativen Ästhetik des Gottesdienstes Eine performative Ästhetik des Gottesdienstes besteht im Wesentlichen darin, den Ereignischarakter liturgischen Handelns zu verdeutlichen und in unterschiedlichen Hinsichten zu entfalten, um den Gottesdienst als eigensinnige religiöse und kulturelle Praxis wahrnehmbar und reflektierbar zu machen. Anleihen bei oder gar Kooperationen mit den Kulturwissenschaften, der Theaterwissenschaft sowie den Performance und Ritual Studies scheinen mir dazu unabdingbar. Welche Aspekte stehen dabei für die Liturgiewissenschaft im Vordergrund? Ich werde im Folgenden die wichtigsten kurz skizzieren. 3.1. Zum Begriff der Aufführung Den Begriff der Aufführung trifft man in liturgiewissenschaftlichen Diskursen bisher noch kaum an. In meinen eigenen Arbeiten habe ich vor allem die Begriffe der Inszenierung und des Performativen verwendet.24 Wenn ich richtig sehe, hat Erika 24 Vgl. David Plüss, „Ist der Gottesdienst ein Ritual?“ in: Zwischen heiligem Drama und Event. Auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Agende, hg. v. Hanns Kerner, Leipzig: Evangelische Ver-
112
DAVID PLÜSS
Fischer-Lichte seit einigen Jahren, ausgehend von der Sprechakttheorie John L. Austins, den Begriff des Performativen aus seinem ursprünglich sprachphilosophischen Kontext herausgehoben und für die Analyse von Aufführungen fruchtbar gemacht, die sie als performative Prozesse par excellence ausweist.25 Dadurch entstand eine größere Aufmerksamkeit für das konkrete Geschehen zwischen Bühne und Zuschauerraum im Theater oder zwischen Menschen in anderen sozialen Interaktionen. Die Unterscheidung zwischen Aufführung und Inszenierung scheint mir sinnvoll, auch in liturgiewissenschaftlicher Hinsicht.26 Wenn Aufführung das konkrete Ereignis eines performativen Vollzugs – eines Theaterstücks, einer Performance oder eines Gottesdienstes – in seiner Komplexität und Kontingenz bezeichnet, dann meint Inszenierung die bewusste und intendierte Gestaltung desselben. Die Unterscheidung verdeutlicht, dass eine Theateraufführung nicht mit dem intendierten und eingeübten Verhalten der Schauspieler identisch ist, dass ein Gottesdienst nicht durch Manuskripte und Rubriken in seinem Verlauf definiert werden kann und dass selbst ein Zeremoniell mit strengen Regeln jedes Mal ganz unterschiedlich ausfällt und wirkt. Gottesdienste sind Aufführungen insofern, als sie komplexe und kontingente Ereignisse darstellen, deren Gestaltung und Steuerung begrenzt, aber gleichwohl notwendig sind. Diese kulturwissenschaftlich festgestellte Kontingenz wird theologisch symbolisiert durch das Pneuma, den Pfingstgeist, der weht, wo er will (Joh 3,8). 3.2. Nicht Zuschauer, sondern Teilnehmer Die Kontingenz der Aufführung ist dadurch bedingt, dass jede Aufführung ein einmaliges Ereignis vor wechselndem Publikum darstellt. Auch Ort und Umstände der Aufführung können variieren und diese erheblich beeinflussen. Im Zentrum steht aber der Einfluss, der vom jeweiligen Publikum ausgeht.27 Die Intention der Theater-Avantgarde oder auch der Performing Arts, das Publikum zu aktivieren, zum Mitspielen zu provozieren und dadurch die Grenze zwischen Publikum und Akteuren aufzuheben oder zumindest zu verflüssigen, ist im protestantischen Gotlagsanstalt 2008, S. 99-113; ders., „Körper und Kult. Gestisch-mimetische Kommunikation im ganz gewöhnlichen reformierten Gottesdienst“, in: Körper – Kulte. Wahrnehmungen von Leiblichkeit in Theologie, Religions- und Kulturwissenschaften, hg. v. Christina Aus der Au/ David Plüss, Zürich: Theologischer Verlag Zürich 2007, S. 197-217; ders., „Religiöse Erfahrung zwischen Genesis und Performanz“, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 105:2 (2008), S. 242-257; ders., Gottesdienst als Textinszenierung, a.a.O. 25 Vgl. Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004, S. 31-57. 26 Zur Unterscheidung vgl. dies., „Einleitende Thesen zum Aufführungsbegriff“, in: Kunst der Aufführung – Aufführung der Kunst, hg. v. dies./Clemens Risi/Jens Roselt, Berlin: Theater der Zeit 2004, S. 11-26, hier: S. 15; dies., Ästhetik des Performativen, a.a.O., S. 62-83 u. S. 318332. 27 So auch Fischer-Lichte, „Einleitende Thesen zum Aufführungsbegriff“, a.a.O., S. 12.
AUFFÜHRUNG VON LIMINALITÄT
113
tesdienst theologisches Programm. Dabei geht es nicht nur um die Verflüssigung der Grenzen zwischen Publikum und Akteuren, sondern um die Vermeidung dieser Unterscheidung, um die Vermeidung einer Zuschauerrolle. In einem Ritual, in einem Gottesdienst gibt es nur Partizipierende und keine Zuschauer. Wer zuschaut, ist nicht Teil des Rituals, wird von diesem weder angesprochen noch verändert. Das Ziel der Liturgie, das Ziel des Handelns der Akteure besteht nach evangelischem Verständnis gerade im Einbezug der Gemeinde. Allerdings ist es wichtig zu betonen, dass diese Aktivität im Theater wie im Gottesdienst zunächst und vor allem eine inwendige ist, eine mentale und emotionale, eine Aktivität auf der inneren Bühne, auf der Bühne der prägenden Erinnerungen und Szenen, der Bilder und Gefühle, welche aufgerufen werden, in Bewegung geraten und sich verändern. Auf diese inneren Bilder und Bewegungen hat die Inszenierung, hat das Handeln der liturgischen Akteure oder der Schauspieler keinen direkten Zugriff, aber es ruft Erinnerungen und Emotionen wach und bringt sie in Bewegung, beeinflusst Assoziationen und Wahrnehmungen, ohne diese Beeinflussung kontrollieren zu können. Mit der Metapher der inneren Bühne soll nun allerdings keinem neuerlichen Leib-Seele-Dualismus das Wort geredet werden. Die Emotionen, Szenen und Bewegungen auf der inneren Bühne ereignen sich keineswegs unabhängig vom Verhalten der betreffenden Person. Vielmehr bringt diese als embodied mind ihre Emotionen, Regungen und inneren Dialoge zum Ausdruck, spontan und vorbewusst, indem sie die Augen schließt oder im Raum umherschweifen lässt, die Sitzhaltung verändert oder die Arme verschränkt, die Predigerin belustigt, skeptisch oder nachdenklich betrachtet.28 Die Predigerin reagiert ihrerseits auf dieses Verhalten, wird im Gestus und in der Dynamik ihrer Rede unterstützt und bestärkt oder irritiert und in eine andere Richtung gelenkt. Sie gewinnt an Freiheit, Spontaneität und Präsenz oder sie versteift sich auf ihr Manuskript, fällt in eine monotone Sprechweise und schränkt sich in ihrer Gestik und Mimik ein. Ihr Verhalten hat wiederum Auswirkungen auf die Zuhörer und so weiter, in unabschließbaren FeedbackSchleifen bzw. mimetischen Interaktionsprozessen.29 Wenn Fischer-Lichte davon spricht, dass eine Aufführung „aus der Interaktion aller Teilnehmer, d. h. aus der Begegnung von Akteuren und Zuschauern“30 entstehe, dann gilt dies gleichermaßen für die Liturgie. Allerdings gilt es meines Erachtens, die spezifische Gestalt dieser Interaktion und Begegnung zu beachten. Es begegnen sich weder im Theater noch im Gottesdienst Privatpersonen, zumindest nicht seitens der professionellen Akteure. Schauspielerinnen und Liturgen sind zunächst Rollenträger, die sich anders verhalten, anders sprechen und sich bewegen, anders 28 Zum Begriff des embodied mind vgl. Mark Johnson, The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason, Chicago: The University of Chicago Press 1987. 29 Zum Konzept der mimetischen Interaktion vgl. Gunter Gebauer/Christoph Wulf, Spiel – Ritual – Geste. Mimetisches Handeln in der sozialen Welt, Reinbek b. H.: Rowohlt 1998. 30 Fischer-Lichte, „Einleitende Thesen zum Aufführungsbegriff“, a.a.O., S. 11; vgl. auch dies., Ästhetik des Performativen, a.a.O., S. 58-62.
114
DAVID PLÜSS
gekleidet sind als im Alltag. Sie spielen eine nichtalltägliche, eine auffällige und im Falle der Liturgie traditionell stark vorgeprägte Rolle. Die Interaktion und Begegnung erfolgt vermittelt durch die jeweilige Rolle, sei es die Rolle von Hamlet, einer Performance-Künstlerin oder der Liturgin. Allerdings: Rolle bedeutet nicht Künstlichkeit! Die Professionalität der Akteure besteht gerade darin, ihre Rolle authentisch, d. h. glaubwürdig zu spielen. Gleichwohl erfolgt die Begegnung im Medium einer Rolle oder, genauer, im Medium eines Rollenspiels, einer spezifischen Szene, die sich von der Szenerie des Alltags beträchtlich unterscheidet: Sie erfolgt in den vertrauten Szenen der Liturgie mit Gemeinde, liturgischen Akteuren und angerufenem, aber unsichtbarem und nur als angerufenem anwesendem Gott. Wenn die liturgische Szene in der Weise gestaltet wird, wie Luther sie bestimmte, dann ist die Begegnung zwischen Liturg und Gemeinde eine solche, die transparent werden soll für eine ganz andere Begegnung, nämlich für diejenige zwischen Gott und Gemeinde. Daraus ergibt sich keine Vergeistigung der Rollen und keine Aufhebung der konkret-leiblichen Interaktion. Erforderlich ist vielmehr eine Intensivierung derselben, damit geschieht, was Peter Brook über den befreundeten japanischen Schauspieler Yoshi Oida berichtet: „Einmal erzählte er mir von einem alten Kabuki-Spieler, der gesagt haben soll: ‚Ich kann einem jungen Schauspieler beibringen, mit welcher Geste man auf den Mond deutet. Alles andere, von der Fingerspitze bis zum Mond, liegt bei ihm‘. – ‚Für mich‘, fügt Yoshi hinzu, ‚ist es ohne Belang, ob den Zuschauern nach der Vorstellung noch in Erinnerung ist, wie schön die Geste war. Mich interessiert nur eins: Haben sie den Mond gesehen?‘ Mit Yoshi habe ich viele Monde gesehen.“31
Damit ist die Bedeutung der konkreten und kontingenten Begegnung zwischen Akteuren und Zuschauern nicht in Frage gestellt, im Gegenteil! Sie ist unabdingbar und unhintergehbar. Aber die Szene verbleibt nicht im Vorfindlichen und Beschreibbaren einer bestimmten Handlung an einem bestimmen Ort und zu einer bestimmten Zeit, sondern drängt über Ort und Zeit hinaus und wird transparent für andere Szenen, für existentielle Begegnungen und Bewegungen. Dass zu einer solchen Begegnung und ihren Effekten nicht nur die Akteurin oder der Liturg, sondern auch die Zuschauer oder Teilnehmerinnen beitragen, hat Fischer-Lichte plausibel und auch für die Liturgiewissenschaft anregend herausgestellt. Dass Brook den Mond sieht, ist nicht nur Yoshi Oida zu verdanken, sondern auch seinem eigenen Engagement als Zuschauer in der beschriebenen Szene. Dass die Gemeinde nicht Publikum eines sakralen Spiels, sondern Subjekt des liturgischen Vollzug ist, ist demnach nicht nur protestantisches Programm, sondern aufführungstheoretisch rekonstruierbarer Sachverhalt.
31 Peter Brook, „Vorwort“, in: Yoshi Oida, Zwischen den Welten, Berlin: Alexander 1994, S. 8.
AUFFÜHRUNG VON LIMINALITÄT
115
3.3. Körperlichkeit und Präsenz Die liturgische Präsenz ist seit dem Weiterbildungsprogramm des Schauspielers und ‚Pastorentrainers‘ Thomas Kabel zu einem Leitkriterium liturgisch-pastoraler Ausbildung avanciert.32 Kabel leitet in seinen Kursen und Publikationen Liturgen dazu an, auf ihre körperliche Präsenz im Kirchenraum zu achten, auf die Stimme, die Haltung, die Bewegungen, die Gestik und die Mimik. Dabei wird kein normiertes gestisches Repertoire antrainiert, sondern auf die Stimmigkeit des gestisch-körperlichen Ausdrucks geachtet, die sich dann einstellt, wenn Inhalt und Intention geklärt und die eigene Leiblichkeit als Medium liturgischer Kommunikation akzeptiert und integriert wird.33 Erstrebt wird ein Flow-Bewusstsein, bei dem Handeln und Bewusstsein zusammenfließen, bei dem höchste Konzentration und die Leichtigkeit des improvisierten Spiels keine Gegensätze darstellen.34 Präsenz ist nach Kabel zunächst mentale, auf die Inhalte der Predigt, des Segens und der Gebete fokussierte Präsenz; sodann räumliche, situative und atmosphärische Präsenz. Aus der Aufmerksamkeit für den Inhalt, den Anlass und die räumliche Situation folgen Kriterien einer stimmigen Gestaltung, wobei sich die Stimmigkeit nach Kabel daran misst, ob und in welcher Weise ein Inhalt für die Gottesdienstteilnehmer Klarheit und Verständlichkeit gewinnt, ob er sie existentiell anzusprechen vermag. Im Training geht es zwar zentral um Selbsterfahrung und Körperarbeit, aber die Professionalisierung stimmhaft-gestischer Inszenierung ersetzt die Arbeit an den Inhalten nicht, sondern gibt den Inhalten eine authentische liturgische Gestalt. Mit seinem Programm hat Kabel großen Erfolg. Sehr viele protestantische Pfarrerinnen und Pfarrer im deutschen Sprachraum haben seine Kurse absolviert. Es gelang ihm offenbar, den Mangel einer einseitig nach dem Modell des Textes konzipierten Gottesdiensttheorie zu plausibilisieren. Als wesentlichen Mangel stellt er ihre Körpervergessenheit heraus. Körper verstanden als grundlegendes Medium menschlicher Kommunikation. Wenn davon auszugehen ist, dass Menschen zunächst gestisch und mimisch kommunizieren, bevor sie sich verbal mittels kognitiver Konzepte verständigen35, so gilt es den para- und nonverbalen Aspekten menschlicher Kommunikation auch im Gottesdienst die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Die Unhintergehbarkeit der Dramaturgie und des Körpers gewann bei Ausbildungsverantwortlichen und Kirchenleitungen, aber auch bei den Liturgen eine erstaunliche Plausibilität.
32 Vgl. Thomas Kabel, Handbuch Liturgische Präsenz, a.a.O.; Helmut Wöllenstein (Hg.), Werkbuch Liturgische Präsenz nach Thomas Kabel, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2002. 33 Vgl. Kabel, Handbuch Liturgische Präsenz, a.a.O., S. 22; Vgl. zum Begriff der Präsenz: Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, a.a.O., S.160-175. 34 Vgl. dazu Mihaly Csikszentmihalyi, Das Flow-Erlebnis, Stuttgart: Klett-Cotta 2005; Victor Turner, Vom Ritual zum Theater. Der Ernst des menschlichen Spiels, Frankfurft a. M./New York: Fischer 1989. 35 Vgl. dazu Gebauer/Wulf, Spiel – Ritual – Geste, a.a.O.
116
DAVID PLÜSS
Der Erfolg von Kabels Programm wäre somit als Symptom eines wachsenden Körperbewusstseins in liturgischen Angelegenheiten zu interpretieren – vergleichbar etwa mit der Theater-Avantgarde zu Beginn des 20. Jahrhunderts.36 Jedenfalls wird die grundlegende Bedeutung von Präsenz und menschlicher Körperlichkeit in einem Feld entdeckt, das bis anhin als Text konzipiert und von der Bedeutung her erschlossen wurde. In der liturgischen Kommunikation des Protestantismus gilt die Sprache zu Recht als Leitmedium. Gleichwohl bedarf die Sprache auch im Protestantismus der Verleiblichung, der Verräumlichung, der stimmigen Präsentation in einer Situation. Dass damit ein bestimmter Inhalt nicht nur eine passende Form erhält, sondern der unabdingbaren Körperlichkeit der liturgischen Aufführung eine gesonderte Bedeutung, ein leiblicher Eigensinn zukommt, wie Fischer-Lichte in Bezug auf säkulare Aufführungen betont,37 scheint mir grundlegend, wird in der liturgiewissenschaftlichen Theoriebildung aber noch immer zu wenig berücksichtigt. Liturgie gilt noch immer als Repräsentation eines Vorausliegenden und nicht zugleich als Präsentation in actu.38 3.4. Liminalität Ein weiterer zentraler Aspekt der liturgischen Aufführung betrifft deren Liminalität.39 Dieser verbindet den Gottesdienst mit anderen Performing Arts. Die Liminalität als Konzept wurde von Victor Turner in Anlehnung an Arnold van Genneps Übergangsriten40 entwickelt und bezieht sich auf die mittlere Phase des Rituals. In dieser Phase wird eine Schwelle überschritten. Es ereignet sich eine Wandlung oder Verwandlung. Bisheriges verliert an Bedeutung, wird belanglos. Neues scheint auf. Die Schwelle selbst ist ort- und zeitlos, Niemandsland „betwixt and between the positions assigned and arrayed by law, custom, convention and ceremonial“41, keiner Ordnung zugehörig. Die Liminalität ist eine Kippfigur, das dynamische Modell einer Veränderung oder Transformation. Ihr eignet nicht nur Alltagsdistanz, die Aufhebung alltäglicher Normen und Strukturen, sondern auch eine spezifische Beziehungsstruktur und ein liminales Bewusstsein. Die Beziehungsstruktur bezeichnet Turner im Anschluss an Martin Buber als Communitas, als rituelle Gemeinschaft, die durch das Ritual hergestellt und gestaltet wird und nur im Schwellenbereich des Rituals ihre Gültigkeit hat. Eine solche auf das Ritual und dessen Dauer 36 Vgl. dazu exemplarisch Georg Fuchs, Die Schaubühne der Zukunft, Berlin/Leipzig: Schuster & Loefller 1905. 37 Vgl. Fischer-Lichte, „Einleitende Thesen zum Aufführungsbegriff“, a.a.O., S. 15. 38 Vgl. hierzu auch Hans Ulrich Gumbrecht, Diesseits der Hermeneutik. Die Produktion von Präsenz, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004. 39 Vgl. Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, a.a.O., S. 305-317. 40 Vgl. Arnold van Gennep, Übergangsriten (Les rites de passage), Frankfurt a. M./New York/Paris: Campus 1999. 41 Victor Turner, The Ritual Process. Structure and Antistructure, London: Routledge & Kegan Paul 1969, S. 95.
AUFFÜHRUNG VON LIMINALITÄT
117
begrenzte Gemeinschaft ist auch und in besonderer Weise in einem Gottesdienst anzutreffen. Es begegnen sich im Gottesdienst meist Menschen, die sich kaum kennen und auf der Strasse nicht grüssen, zumindest in Stadt- und Agglomerationsgemeinden. Diese Menschen beten gemeinsam, singen und geben einander den Friedensgruß. Eine solche Communitas wird im christlichen Gottesdienst hergestellt oder zumindest intendiert. Sowohl im Theater als auch in der Liturgie ist sie Teil und Zeichen der Liminalität eines Vollzugs, Symptom dessen, dass sich eine Veränderung, eine Wandlung mit sozialer Relevanz für die beteiligten Menschen ereignet. Die Liminalität verbindet sich zudem mit einem spezifischen Bewusstsein, einem Flow-Bewusstsein, wie es Turner im Anschluss an Mihaly Csikszentmihalyi42 nennt, bei dem das Individuum seine reflektierende Distanz aufgibt und ganz auf sein Handeln, seine Rolle, auf die Akteure und seine Mitspieler fokussiert ist. Im Schwellenbereich des Rituals steht der Teilnehmer nicht beobachtend und reflektierend neben sich, sondern taucht gleichsam ins Spiel ein. Sowohl Flow wie Communitas sind in der Liturgie – wie in anderen performativen Künsten – Elemente und Effekte der Liminalität, der Transformation von Sein und Bewusstsein. Gottesdienste zielen auf die Neuwerdung der Teilnehmenden, auf Reinigung und Erlösung, auf Befreiung und Trost. Sie zielen auf Freiheit und Identitätsgewinn, welche theologisch nicht als Besitz, sondern als je und je verliehen gedeutet werden. Und zwar im Rahmen des liturgischen Rituals, im Rahmen der aufgeführten Liminalität.43 Im Theater ist es das Konzept der Katharsis, mit welchem Aristoteles die reinigende Wirkung der antiken Tragödie auf die Zuschauer beschrieb und das noch bis ins 18. Jahrhundert – im Rahmen der Wirkungsästhetik – eine prominente (und umstrittene Rolle) spielte.44 Das Motiv der Transformation durch eine Aufführung wurde aber auch durch Friedrich Nietzsche und das Avantgarde-Theater an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wieder aktuell. Die Intention, Menschen durch dichte und stimmige Aufführungen zu berühren und zu verändern, verbindet Theater, Performance Arts und Gottesdienst.
42 Csikszentmihalyi, Das Flow-Erlebnis, a.a.O., 2005. 43 Denselben Sachverhalt beschreibt Fischer-Lichte in nichttheologischer Sprache folgendermaßen: „Die Aufführung eröffnet so allen Beteiligten die Möglichkeit, sich im Verlauf der Aufführung als ein Subjekt zu erfahren, welches das Handeln und Verhalten anderer mitzubestimmen vermag und dessen eigenes Handeln und Verhalten ebenso von anderen mitbestimmt wird; als ein Subjekt, das weder autonom noch fremdbestimmt ist und das die Verantwortung auch für eine Situation übernimmt, die es nicht geschaffen hat, in die es jedoch hineingeraten ist.“ Fischer-Lichte, „Einleitende Thesen zum Aufführungsbegriff“, a.a.O., S. 13. 44 Vgl. dazu Fischer-Lichte, „Einleitung. Zur Aktualität von Turners Studien zum Übergang vom Ritual zum Theater“, a.a.O., S. xf.
118
DAVID PLÜSS
4. Fazit Der kulturwissenschaftliche performative turn hat endlich auch die Liturgiewissenschaft erreicht. Modelle der Aufführung, der Inszenierung und der Ritualität haben für die Theorie des Gottesdienstes in den letzten Jahren grundlegende Bedeutung erhalten. Sie rücken das konkrete liturgische Geschehen, die körperliche und räumliche Interaktion aller Beteiligten in den Fokus der Aufmerksamkeit und bereichern dadurch eine bisher mehrheitlich historisch und dogmatisch-normativ verfasste Liturgiewissenschaft. Sie ergänzen zudem das im protestantischen Diskurs dominante Modell des Textes durch das Modell der Aufführung. Durch den performative turn wird die Liturgiewissenschaft kulturwissenschaftlich anschlussfähig. Die damit verbundenen Effekte lassen sich nach zwei Seiten hin bestimmen: Einerseits gewinnen aktuelle Diskurse der Theatralität, der Performanz, des Körpers und des Raumes auch für Liturgiewissenschaft an Relevanz. Andererseits erfolgt liturgiewissenschaftliche Theoriebildung mitunter im Referenzrahmen der Kulturwissenschaften, was eine produktive Kooperation in Forschungsprojekten ermöglicht. Der Gewinn des performative turn für die Liturgiewissenschaft liegt einerseits im Gegenwartsbezug. Liturgiewissenschaft lässt sich aufführungstheoretisch als empirische Theorie im Sinne des Ritual Criticism45 entwickeln, etwa durch Methoden der teilnehmenden Beobachtung oder der video-gestützten Ethnografie.46 Andererseits vermag eine auf die Performanz fokussierte Forschung auch historischen Arbeiten neue Lichter aufzusetzen, wie etwa die Arbeiten des Basler Patristikers Martin Wallraff zeigen.47 So wenig eine auf Körper, Raum und Aufführung fokussierte Liturgik eine Alternative zur liturgiegeschichtlichen Forschung darstellt, sondern deren Perspektiven ergänzt und verändert, so sehr durchwirkt und verändert sie auch die theologisch-normative Reflexion des Gottesdienstes. Liminalität und Communitas erweisen sich als erhellende Übersetzungen und Konkretisierungen zentraler dogmatischer Topoi. Aber auch Aufführung, Körperlichkeit, Flow-Bewusstsein und Raumästhetik werden zu Konzepten mit hoher theologischer Relevanz für die Bestimmung und Erforschung des Gottesdienstes.
45 Vgl. dazu Ronald L. Grimes, Ritual Criticism. Case Studies in its Practice, Essays on its Theory, Columbia: University of South Carolina Press 1990, S. 7-27. 46 Vgl. Bernt Schnettler/Hubert Knoblauch, „Videoanalyse“, in: Handbuch der Organisationsforschung. Quantitative und qualitative Methoden, hg. v. Stefan Kühl/Petra Strodtholz/Andreas Taffertshofer, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2009, S. 272-297, insbesondere: S. 274f. 47 Vgl. Martin Wallraff, „Gerichtetes Gebet. Wie und warum richten Juden und Christen in der Spätantike ihre Sakralbauten aus?“, in: Dialog oder Monolog? Zur liturgischen Beziehung zwischen Judentum und Christentum, hg. v. Albert Gerhards/Hans Hermann Henrix, Freiburg i.Br.: Herder 2004, S. 110-127.
AUFFÜHRUNG VON LIMINALITÄT
119
5. Literaturverzeichnis Bachmann-Medick, Doris, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek b. H.: Rowohlt 2007. Bahr, Petra, „Ritual und Ritualisation. Elemente zu einer Theorie des Rituals im Anschluss an Victor Turner“, in: Praktische Theologie 33 (1998), S. 143-158. Bieritz, Karl-Heinrich, „Spielraum Gottesdienst. Von der ‚Inszenierung des Evangeliums‘ auf der liturgischen Bühne“, in: Drama „Gottesdienst“. Zwischen Inszenierung und Kult, hg. v. Arno Schilson/Joachim Hake, Stuttgart/Berlin/Köln: Kohlhammer 1998, S. 69-101. Brook, Peter, Das offene Geheimnis. Gedanken über Schauspielerei und Theater, Frankfurt a. M.: Fischer 2000. —, Der leere Raum, Berlin: Alexander 1997. —, „Vorwort“, in: Yoshi Oida, Zwischen den Welten, Berlin: Alexander 1994. Cornehl, Peter, ‚Gottesdienst/VII: Evangelischer Gottesdienst von der Reformation bis zur Gegenwart‘; in: Theologische Realenzyklopädie, Bd. XIV, Berlin/New York: Walter de Gruyter 1985, S. 54-85. Csikszentmihalyi, Mihaly, Das Flow-Erlebnis, Stuttgart: Klett-Cotta 2005. Fischer-Lichte, Erika, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004. —, „Einleitende Thesen zum Aufführungsbegriff“, in: Kunst der Aufführung – Aufführung der Kunst, hg. v. dies./ Clemens Risi/Jens Roselt, Berlin: Theater der Zeit 2004, S. 11-26. —, „Einleitung. Zur Aktualität von Turners Studien zum Übergang vom Ritual zum Theater“, in: Victor Turner, Vom Ritual zum Theater. Der Ernst des menschlichen Spiels, Frankfurt a. M./ New York: Campus 2009, S. i-xxiii. Friedrich, Marcus A., Liturgische Körper. Der Beitrag von Schauspieltheorien und -techniken für die Pastoralästhetik, Stuttgart/Berlin/Köln: Kohlhammer 2001. Fuchs, Georg, Die Schaubühne der Zukunft, Berlin/Leipzig: Schuster & Loefller 1905. Gebauer, Gunter/Wulf, Christoph, Spiel – Ritual – Geste. Mimetisches Handeln in der sozialen Welt, Reinbek b. H.: Rowohlt 1998. van Gennep, Arnold, Übergangsriten (Les rites de passage), Frankfurt a. M./New York/Paris: Campus 1999. Gräb, Wilhelm, „Der inszenierte Text. Erwägungen zum Aufbau ästhetischer und religiöser Erfahrung in Gottesdienst und Predigt“, in: International Journal of Practical Theology 1 (1997), S. 209-226. Greinacher, Norbert, „Die Theologie und das Theater“, in: Theologische Quartalschrift 175 (1995), S. 347-354. Grimes, Ronald L., Ritual Criticism. Case Studies in its Practice, Essays on its Theory, Columbia: University of South Carolina Press 1990. Grözinger, Albrecht, Praktische Theologie und Ästhetik, München: Kaiser 1991. Gumbrecht, Hans Ulrich, Diesseits der Hermeneutik. Die Produktion von Präsenz, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004. Jetter, Werner, Symbol und Ritual. Anthropologische Elemente im Gottesdienst, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1978. Johnson, Mark, The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason, Chicago: The University of Chicago Press 1987. Kabel, Thomas, Handbuch Liturgische Präsenz. Zur praktischen Inszenierung des Gottesdienstes, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2002. Klie, Thomas, Fremde Heimat Liturgie. Ästhetik gottesdienstlicher Stücke, Stuttgart: Kohlhammer 2009. Luther, Henning, „Predigt als inszenierter Text. Überlegungen zur Kunst der Predigt“, in: Theologia Practica 18 (1983), S. 89-100.
120
DAVID PLÜSS
Mertin, Andreas, „Schönheit“, in: Der verborgene Sinn. Religiöse Dimensionen des Alltags, hg. v. Dietrich Korsch/Lars Charbonnier, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2008, S. 215-220. Meyer-Blanck, Michael, Inszenierung des Evangeliums. Ein kurzer Gang durch den Sonntagsgottesdienst nach der Erneuerten Agende, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1997. —, Inszenierung und Präsenz. Zwei Kategorien des Studiums Praktischer Theologie, in: Wege zum Menschen 49 (1996), S. 2-16. —, Liturgie und Liturgik. Der Evangelische Gottesdienst aus Quellentexten erklärt, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2001. Mosebach, Martin, Häresie der Formlosigkeit. Die römische Liturgie und ihr Feind, München: Carl Hanser 2007. Neidhart, Walter, „Die Rolle des Pfarrers beim Begräbnis“, in: Wort und Gemeinde. Festschrift für E. Thurneysen, Zürich: EVZ 1968, S. 226-235. Plüss, David, Gottesdienst als Textinszenierung. Perspektiven einer performativen Ästhetik des Gottesdienstes, Zürich: Theologischer Verlag Zürich 2007. —, „Ist der Gottesdienst ein Ritual?“ in: Zwischen heiligem Drama und Event. Auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Agende, hg. v. Hanns Kerner, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2008, S. 99-113. —, „Körper und Kult. Gestisch-mimetische Kommunikation im ganz gewöhnlichen reformierten Gottesdienst“, in: Körper – Kulte. Wahrnehmungen von Leiblichkeit in Theologie, Religionsund Kulturwissenschaften, hg. v. Christina Aus der Au/David Plüss, Zürich: Theologischer Verlag Zürich 2007, S. 197-217. —, „Religiöse Erfahrung zwischen Genesis und Performanz“, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 105:2 (2008), S. 242-257. Preul, Reiner, ‚Ritus/Ritual. II. Religionsgeschichtlich, 4. Christentum, c. Liturgisch (Evangelisch); III. Dogmatisch; IV. Ethisch; V. Praktisch-theologisch‘, in: Religion in Geschichte und Gegenwart, Bd. 7, hg. v. Hans D. Betz/Don S. Browning/Bernd Janowski/Eberhard Jüngel, Tübingen: Mohr Siebeck 2004, S. 555-559. Roth, Ursula, Die Theatralität des Gottesdienstes, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2006. Schilson, Arno, „Die Inszenierung des Alltäglichen und ein neues Gespür für den (christlichen) Kult?“ in: Drama „Gottesdienst“. Zwischen Inszenierung und Kult, hg v. Arno Schilson/Joachim Hake, Stuttgart/Berlin/Köln: Kohlhammer 1998, S. 13-67. Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst, Die Praktische Theologie nach den Grundsäzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt von Dr. Friedrich Schleiermacher, Berlin: Reimer 1850. Schnettler, Bernt/Knoblauch, Hubert, „Videoanalyse“, in: Handbuch der Organisationsforschung. Quantitative und qualitative Methoden, hg. v. Stefan Kühl/Petra Strodtholz/Andreas Taffertshofer, Wiesbaden: VS 2009, S. 272-297. Schnusenberg, Christine, Das Verhältnis von Kirche und Theater. Dargestellt an ausgewählten Schriften der Kirchenväter und liturgischen Texten bis auf Amalarius von Metz (a.d. 775-852), Bern/Frankfurt a. M./Las Vegas: Peter Lang 1981. Schulz, Petra, „Vom biblischen Text zu einer Performance im Kirchenraum“, in: Erfahrungsräume, hg. v. Anna-Katharina Szagun, Münster: LIT 1999. Suhr, Ulrike, „Das Handwerk des Theaters und die Kunst der Liturgie. Ein theologischer Versuch über den Regisseur Peter Brook“, in: Kulte, Kulturen, Gottesdienste. Öffentliche Inszenierung des Lebens, hg. v. Peter Stolt/Wolfgang Grünberg/Ulrike Suhr, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1996, S. 37-49. Turner, Victor, Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur, Frankfurt a. M./New York: Campus 2000. —, „Liminalität und Communitas“, in: Ritualtheorien, hg. v. Andréa Belliger/David J. Krieger, Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1998, S. 251-262.
AUFFÜHRUNG VON LIMINALITÄT
121
—, The Ritual Process. Structure and Antistructure, London: Routledge & Kegan Paul 1969. —, Vom Ritual zum Theater. Der Ernst des menschlichen Spiels, Frankfurft a. M./New York: Fischer 1989. Wallraff, Martin, „Gerichtetes Gebet. Wie und warum richten Juden und Christen in der Spätantike ihre Sakralbauten aus?“, in: Dialog oder Monolog? Zur liturgischen Beziehung zwischen Judentum und Christentum, hg. v. Albert Gerhards/Hans Hermann Henrix, Freiburg i.Br.: Herder 2004, S. 110-127. Wöllenstein, Helmut (Hg.), Werkbuch Liturgische Präsenz nach Thomas Kabel, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2002.
MACHT
ADAM CZIRAK
Macht in Aufführungen
Inwieweit theatrale Darstellungs- und Wahrnehmungsnormen und die ihnen eigentümlichen Machtverhältnisse transparent gemacht werden können, ist eine repräsentationspolitische Frage, die Jérôme Bel in seiner Choreografie The show must go on! (2001) zum dramaturgischen Thema erhoben hat. Diese Inszenierung basiert auf einem klaren Konzept: Ein DJ, der vor der Bühnenrampe sitzt, legt nacheinander 18 bekannte Popsongs auf, deren Refrainzeilen zu Instruktionen der szenischen Handlungen avancieren. Zunächst ertönt im dunklen Theaterraum der Song Tonight aus dem Musical West Side Story in seiner vollen Länge und suggeriert einen selbstreferenziellen Bezug zum aktuellen Theaterabend. Anschließend wird mit dem Titel Let the Sunshine in die graduelle Erhellung der Bühne ‚herbeigesungen‘. Nachdem die Refrainzeile des gleichnamigen Beatles-Lieds Come together erklungen ist, erscheinen zwanzig Akteure auf der Bühne. Sie führen ihre individuellen Tanz- und Alltagsbewegungen jedoch erst dann aus, wenn David Bowies Let’s dance sowie der Erfolgssong I like to move it, move it erklingen. Die Verse der Popsongs werden somit zu Handlungsanweisungen und ihre Befolgung zum ästhetischen Prinzip. Bels Choreografie besteht in der Fügung von appellativen Titelzeilen und ihrer prononcierten Verkörperung, ja einem Prozess der semantischen Dopplung, der dem Szenischen eine selbstreflexive Dimension verleiht und darüber hinaus die Strukturen der Aufführung offen legt, sodass hier nicht einmal der sonst im Off versteckte Ton- und Lichtregisseur verhüllt bleibt, sondern als DJ ausgestellt wird. All die Popsongs, die er während des Abends auflegt, übersteigen ihren popkulturellen Bedeutungshorizont, weil sie die szenischen Handlungen zu bestimmen scheinen und dadurch die Funktionsmechanismen des Theaters als institutionelle Praxis benennen, kommentieren oder reflektieren. The show must go on! bringt eine Aufführung der Aufführung hervor: eine Performance, die stets auf sich und ihre mediale und materielle Verfasstheit verweist und dadurch den Zuschauern die Machtstrukturen vor Augen führt, die der Theatralität und der Repräsentation innewohnen. Jérôme Bel deckt in und mit seiner Choreografie die theaterästhetischen Wirkungslogiken respektive die inszenierungspraktischen Normierungen von Aufführungen auf und enthüllt – ohne sie zu destruieren – die Konventionen theatralen Zeigens und Wahrnehmens. The show must go on! macht darauf aufmerksam, dass die Aufführung eine performative Praxis der Wirklichkeitskonstituierung tangiert, die unabdingbar auf die Mobilisierung und Aktualisierung von Regeln und Normen des (Sich-)Darstellens und Zuschauens angewiesen ist. Jede Aufführung hat Anteil an der Realisierung und Wiederholung von strukturierenden Regeln, die theatrale Kommunikation sowohl ermöglichen als auch regulieren. Und nicht nur das: Performative Prozesse vollzie-
126
ADAM CZIRAK
hen sich nur dann, wenn sie auf normativ, institutionell oder inszenatorisch hergebrachte Machtrelationen rekurrieren. Indem sie diese Relationen aktualisieren – d. h. verfestigen oder subvertieren, bestätigen oder verschieben – produzieren sie immer auch Macht. Die in diesem Kapitel versammelten theaterwissenschaftlichen Beiträge fragen allesamt danach, wie die Eigenschaften und Effekte jener Machtbeziehungen beschrieben werden können, die in Aufführungen latent oder ganz offensichtlich wirksam sind. Die Autorinnen und Autoren sind sich darüber einig, dass Macht in Aufführungen keine Instanz darstellt, deren Ursprung oder Zielpunkt sich personifizieren ließe: Macht kumuliert keineswegs bei einzelnen Teilnehmern der Performance, vielmehr setzt sie diese in Beziehung miteinander. Da die semantische Gleichsetzung der Macht mit Herrschaft und Souveränität mit dem Paradigma eines autonomen Subjekts korrespondiert, erscheint sie aus performativitätstheoretischer Sicht eindimensional und hinfällig. Im Einklang mit dem diskurspolitischen Impetus der folgenden Beiträge soll an dieser Stelle einleitend erläutert werden, wie sich ein aufführungstheoretisch orientierter Machtbegriff definieren ließe bzw. inwieweit dieser im theaterwissenschaftlichen Analysekontext produktiv sein könnte.1 Der Machtbegriff gilt als vielfach konzeptualisierter und transdisziplinär verwendeter Term, dessen theoretische Ausarbeitung in der Theaterwissenschaft noch aussteht, obwohl Machtbeziehungen sowohl in der Rezeption als auch in der wissenschaftlichen Reflexion von Aufführungen wirksam sind. Macht- und Kräfteverhältnisse durchziehen künstlerische Arbeitsprozesse, institutionelle Produktionsprinzipien und kommen im gesamten Kunst- und Kulturbetrieb zur Geltung. Allenthalben tritt ihre ambivalente Eigenschaft zutage, Handlungsakte gleichzeitig zu ermöglichen und zu regulieren, d. h. nicht bzw. nicht nur Autorität, Unterdrückung, Destruktion oder Gewalt auszuüben, sondern auch produktive bzw. kreative Kräfte der Hervorbringung und der intersubjektiven Bezugstiftung zu entfalten. In Anlehnung an Michel Foucault, Judith Butler und Hannah Arendt scheint es daher analytisch fruchtbar, Macht als konstruktive und konstitutive Grundlage interpersoneller Verhältnisse zu begreifen und als ein Handlungsrepertoire potenzieller sozialer Partizipationsformen zu definieren.2 Dieses Verständnis von Macht, ein 1 Auf die Rekapitulierung der Begriffs- und Diskursgeschichte des weitgehend inflationär gebrauchten Terminus ‚Macht‘ muss an dieser Stelle aus Platzgründen verzichtet werden. Einen weitaus differenzierten Überblick der einschlägigen Konzepte und Positionen der Machtforschung bieten Ralf Krause/Marc Rölli (Hg.), Macht. Begriff und Wirkung in der politischen Philosophie der Gegenwart, Bielefeld: transcript 2008, mit weiterführender Literatur. Zur performativitätstheoretischen Fundierung des Machtbegriffs vgl. Andreas Hetzel, „Figuren der Selbstantizipation. Zur Performativität der Macht“, in: ebd., S. 135-152; Andreas Hetzel, „Das Rätsel des Performativen. Sprache, Kunst und Macht“, in: Philosophische Rundschau 51 (2004), S. 132-159. 2 Vgl. u. a. Michel Foucault, „Erläuterungen zur Macht. Antwort auf einige Kritiker (Gespräch)“, in: ders., Schriften in vier Bänden, Bd. III (1976-1979), hg. v. Daniel Defert/François Ewald, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2003, S. 784-795; ders., „Wie wird Macht ausge-
MACHT IN AUFFÜHRUNGEN
127
Möglichkeitsfeld für soziales Handeln zu eröffnen und dieses Feld gleichsam zu strukturieren, lenkt die Aufmerksamkeit weniger auf das individuelle Tun eines ‚souveränen‘ Handlungssubjekts. Vielmehr akzentuiert es die relationalen Dependenzen und Austauschprozesse zwischen Aufführungsteilnehmern.3 Machtverhältnisse stellen Möglichkeiten bereit, ohne künftige Handlungen zu determinieren oder Konsens zu etablieren. Sie nivellieren die Differenzen und Asymmetrien zwischen den Partizipierenden keineswegs, dynamisieren hingegen ihre Kommunikation. Vor diesem Hintergrund tritt der Machtbegriff als eine produktive Analysekategorie zutage, welche die prozessualen und kontingenten Dynamiken intersubjektiver Relationen zu beleuchten vermag. Im Gegenwartstheater lassen sich zahlreiche Inszenierungen finden, die eine analytische Fragestellung nach unterschiedlichen Erscheinungsformen von Macht in Aufführungen geradezu herausfordern, weil diese künstlerischen Arbeiten die konsolidierten Machtverhältnisse zwischen Zuschauern und Akteuren thematisieren und reflektieren. Eine solche Strategie verfolgt auch Jérôme Bel mit The show must go on! Er zeigt, dass all das, was sich in der Choreografie vollzieht oder in ihr ausbleibt bzw. was während ihrer Aufführung aktuell oder virtuell existiert, nicht unabhängig gedacht werden kann von diskursiven und materiellen Möglichkeiten, die eine theatrale Kommunikationspolitik beeinflussen. Die dominanten Diskurse und Strukturen des Theatralen, die diese Möglichkeiten stellen, sind allerdings kulturell so weit verfestigt bzw. hegemonisiert, dass sie dazu tendieren, als neutral, standardisiert und unsichtbar zu erscheinen und ihre Geltungsmacht durch ihre Unmarkiertheit zu stabilisieren. Diese Strukturen liegen zwar jenseits der Intentionalität des Regisseurs oder des Handlungsvermögens einzelner Zuschauer, dennoch sind sie in all jenen performativen Prozessen aktiv, die die Erzeugung und Aushandlung von Identitäten, semantischen oder selbstreferenziellen Bedeutungen, Körpernormen, Spiel- und Verhaltensregeln im Rahmen von Aufführungen erzielen. Paradoxerweise suggeriert jeder performative Akt, dass er einmalig und singulär ist und kaschiert dabei, dass er zugleich auf Wiederholung oder Wiederübt?“, in: Hubert L. Dreyfus/Paul Rabinow, Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik, Frankfurt a. M.: Athenäum 1987, S. 251-261; ders., Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1994; Judith Butler, Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2001; dies., Die Macht der Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2009; Hannah Arendt, Vita Activa oder Vom tätigen Leben, München/Zürich: R. Piper & Co. 1987; dies., Macht und Gewalt, München: R. Piper & Co. 1970. 3 Vgl. Michel Foucault, „Wie wird Macht ausgeübt?“, a.a.O., S. 255. Diesem Verständnis von Macht als einer Dimension von Möglichkeiten steht das intentionale und kausalitätslogisch fundierte Erklärungsmodell von Handlungsmacht gegenüber, als dessen prominentester Vertreter Max Weber gilt. Weber führt eine Machtdefinition ins Feld, die den Gewaltaspekt dieser Instanz akzentuiert: „Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht.“ Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, Bd. 1, Köln/Berlin: Kiepenheuer und Witsch 1964, S. 38. Hervorhebung im Original.
128
ADAM CZIRAK
holbarkeit angewiesen ist bzw. dass er nur dann Macht produziert, wenn er auf tradierten Machtrelationen basiert oder auf diese Bezug nimmt. Je souveräner man vor einem Publikum erscheint, umso mehr ist man von kulturellen Inszenierungsnormen und Erwartungen abhängig. Diese paradoxe Korrelation nimmt Frank Richarz zum Anlass, um eine differenzierte machttheoretische Typologie zu entfalten, die den performativen Wirkungsdimensionen von flüchtigen Aufführungen Rechnung trägt. Insofern Richarz sein Machtkonzept im engen Bezug auf den Aufführungsbegriff entwickelt und theoretisch neu fundiert, bringt er ein Machttheorem ins Spiel, das bis dato vernachlässigte Fragen und Aspekte der Aufführungsanalyse bündelt und diese zur Grundlage für die anschließenden Beiträge erhebt. Er hinterfragt die einseitige Annahme, dass Macht sich aufgrund von performativen Konventionen entfalte, und wertet die Rolle der Aufführungsteilnehmer in Prozessen der Verfestigung von Machtstrukturen dezidiert auf. Die Aufführung ist ein Reflexionsmodus, mit dem ein ‚Performativ‘, d. h. eine Art Mikro-Dispositiv beobachtbar wird. Unter Rekurs auf Michel Foucaults und Pierre Bourdieus Machttheorien verdeutlicht Richarz, dass es an differenzierten Begrifflichkeiten mangelt, wenn die eigentliche Verfestigung von Handlungs- und Wissensverhältnissen innerhalb von performativen Prozessen ins Auge gefasst wird. Der Begriff des Performativs hilft entsprechend Vorgänge in Augenschein zu nehmen, die häufig unbewusst erlebt werden, längerfristige Effekte erzielen und bisher ausschließlich in den Krisenmomenten ästhetischer Erfahrung, in den Subversionen eingeübter Handlungsmuster oder der Etablierung asymmetrischer Beziehungen untersucht worden sind. Trotz seiner habitualisierten und mehr oder weniger unmarkierten Verfasstheit kann das Performativ im theatralen Reflexionsmodus der Aufführungen bewusst wahrgenommen und im Hinblick auf Strukturierungsprozesse aufschlussreich beschrieben werden. In der Beobachtung von Performativen stößt man auf Felder diffuser Wirkungen, ‚Kräfte‘ und ‚Energien‘, die Richarz als Macht beschreibt. Die Aufsätze von Jon McKenzie, Nina Tecklenburg, Mateusz Borowski und Małgorzata Sugiera befassen sich explizit mit rhetorischen und ästhetischen Strategien, die der theatralen Inszenierbarkeit zugrunde liegende performative Machtverhältnisse sichtbar machen bzw. kritisch kommentieren. Der Theater- und Medienwissenschaftler Jon McKenzie stellt in seinem Aufsatz Die Performance von Demokratie eine weit gefasste Definition von Performance zur Diskussion. Unter diesem Begriff subsumiert er sowohl cultural performances wie etwa Theater- und Tanzaufführungen respektive Medienereignisse als auch das Leistungsvermögen von Handlungs- und Produktionsprozessen. Diese breite Sicht auf performative Phänomene, die McKenzie in seiner Monografie Perform or Else4 ausführlich entfaltet, lässt es zu, Performance als ein Dispositiv zu betrachten, das vielfältige Konstellationen von Wissen und Macht umfasst. Performance bezeichnet somit partikulare Kräfteverhältnisse, die ambivalente Wirkungen entfalten: Zum einen 4 Vgl. Jon McKenzie, Perform or Else. From Discipline to Performance, London/New York: Routledge 2001.
MACHT IN AUFFÜHRUNGEN
129
bringen sie Normierungs- und Herrschaftseffekte hervor, zum anderen vermögen sie Widerstand auszuüben, d. h. sie organisieren die Machtkonstellationen qua ihrer Aktualisierung beständig um. In einem ersten Schritt dekonstruiert McKenzie die Rede des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush vom 20. September 2001, insofern er seine Argumentationslogik, die den „terroristischen Gruppen“ einen distinkten „Willen zur Macht“ unterstellt, mit Nietzsches Worten konfrontiert und einem relationalen Verständnis von Macht gegenüberstellt: Der ‚Wille zur Macht‘ soll McKenzie zufolge als ein Kräftefeld verstanden werden, als „ein unaufhörliches Wogen aus Differenz und Wiederholung, das die gesamte natürliche und soziale Welt durchdringt“. Diese performative Konzeption von Macht analysiert McKenzie in einem zweiten Schritt anhand der Effizienz und kontinuierlichen Neu-Entwicklung demokratischer Regierungssysteme, indem er nach deren Zukunft fragt. In ihrem Beitrag Telling Performance enthüllt Nina Tecklenburg die Taktiken einer narrativen Politik, die darauf zielen, ein Ereignis zu mythisieren, seine Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit zu stilisieren oder das Faktum seines ‚So-gewesenSeins‘ erst hervorzubringen. Es handelt sich um eine Rhetorik, welche die dramaturgische Struktur von Performances und Spektakeln ebenso durchzieht wie den analytischen Diskurs über Aufführungen. Als Ausgangspunkt ihrer Erläuterungen führt Tecklenburg eine Performance der bulgarischen Künstlerin Boryana Rossa an: Denn in der Aktion The Vitruvian Body, die auf die spektakuläre Dramaturgie von Verletzungsperformances rekurriert, entfaltet die Künstlerin eine narrative Ebene des bildlichen und verbalen Kommentars. Diese untergräbt die von den Zuschauern antizipierte Spannung und greift jene ontologisierende Verehrung des Ereignisses an, die in der Rezeption von performance art vorherrschend ist. Tecklenburgs Beitrag wertet diskursive Akte der Nacherzählung von Aufführungen sowie Fotodokumente ‚einmaliger‘ Ereignisse auf und rehabilitiert dadurch den Status der Performancedokumentation, um zu vermeiden, dass die Relation zwischen Aufführung und Übertragung als kausallogisches oder hierarchisches Verhältnis gedacht wird. Tecklenburg untersucht Erzählakte hinsichtlich ihrer Eigenschaft, Macht hervorzubringen, und führt vor Augen, dass das Erzählen seine wirklichkeitskonstituierenden Wirkungen in einer paradoxen Zeitlichkeit zwischen Nachträglichkeit und Gegenwärtigkeit des Erzählprozesses entfaltet. Durch die Wiederholung des Ereignisses im Erzählen suggerieren Erzählberichte und narrativ aufgeladene Bilder in actu die Einmaligkeit und vermeintliche Unwiederbringlichkeit des Ereignisses. Im darauf folgenden Beitrag legen Mateusz Borowski und Małgorzata Sugiera die Nahtstellen zwischen Kunst und Politik frei, indem sie zwei unterschiedliche Hamlet-Inszenierungen einer vergleichenden Analyse unterziehen. Ausgehend von Jacques Rancières Definition der Politik argumentieren die Autoren für die Inblicknahme der in dieser Theorie marginalisierten Dimensionen des Politischen in der Theaterästhetik. Aufgrund ihrer medialen und materiellen Qualität einerseits und hinsichtlich der Bedingung ihrer Wiederholung andererseits eignet der Aufführung das Potenzial, so die Autoren, die Grenze zwischen Sichtbarem und Un-
130
ADAM CZIRAK
sichtbarem, Eingeschlossenem und Ausgeschlossenem neu zu ziehen. Andrzej Wajdas und Jan Klatas Hamlet-Inszenierungen analysierend decken Borowski und Sugiera die physisch-architektonischen und diskursiven Konfigurationen von Macht im Theater systematisch auf; sie legen das Augenmerk jedoch weniger auf die politischen Eigenschaften des Einmaligen, des Kontingenten, des Materiellen oder Außersymbolischen, wie sie in der Aufführung emergieren, sondern betonen das Politische ihrer semantischen und repräsentationsästhetischen Bedeutungspotenziale. Damit entwerfen sie ein Bild vom Zuschauer, der nicht nur an einer singulären Aufführung teilnimmt, sondern diese als ein soziokulturell markierter und aktualpolitisch sensibilisierter Betrachter erlebt und reflektiert. Darauf fokussierend, wie die Hamletfigur oder die metatheatrale Szene der Mausefalle jeweils inszeniert werden bzw. auf welche Weise die Ortspezifik der Aufführung thematisiert wird, legen Borowski und Sugiera nachdrücklich dar, wie einzelne Inszenierungen desselben Sujets nationalpolitische Verhältnisse, gesellschaftliche Utopien sowie allgemeine Funktionsmechanismen der Politik immer wieder neu beleuchten und konstituieren können. Gilt das Interesse der oben angesprochenen Beiträge insbesondere den symbolischen Dimensionen performativer Machtausübung, so rücken Erin Manning und Jill Dolan das zeitliche und räumliche Zusammensein der Aufführungsteilnehmer in den Fokus der Betrachtung. Um die spezifische Machtstruktur von Aufführungen zu beschreiben, nehmen sie Figurationen der Macht in den Blick, die sich durch das soziale Miteinander körperlich anwesender Aufführungsteilnehmer konstituieren. In der Tat gehen Machtkonstellationen, die sich durch die Zusammenkunft von Menschen etablieren und mit ihrer Zerstreuung wieder aufgehoben werden, keineswegs darin auf, Gelegenheit für zweckgerichtetes Tun, interpretierendes Wahrnehmen oder andere symbolische Handlungen zu bieten. In Situationen des Zusammenseins kann immer auch die raumzeitliche Relationalität der Anwesenden in Erscheinung treten – und zwar nicht nur in ihrer Aktualität, sondern auch in ihrer Virtualität. Macht lässt sich hier Synonym verwenden mit jener Potenzialität, die Hannah Arendt als horizontal und a-hierarchisch strukturiertes „Handlungsvermögen“5 bezeichnet hat. Aufführungsteilnehmer sind nämlich imstande, Macht in einem elementaren Sinne zu verhandeln, eine Macht, die sich etymologisch „von [...] ‚möglich‘, und nicht von ‚machen‘ herleitet“ bzw. „deren Bedeutung sich [...] im Vollzug selbst erschöpft“6 und nie in der Befolgung „vorgefaßte[r] Ziele“7 aufgeht. Die ergebnisoffene und kontingente Verfasstheit von Machtbeziehungen, die speziell in Situationen körperlicher Ko-Präsenz zum Tragen kommt, durchkreuzt und untergräbt die Individualität und Souveränität einzelner Partizipanten bestän5 Arendt zitiert nach Andreas Grossmann, „Macht als ‚Urphänomen‘ des Politischen. Überlegungen im Anschluss an Hannah Arendt“, in: Macht, hg. v. Krause/Rölli, Macht, a.a.O., S. 49-62, hier: S. 50. 6 Arendt, Vita Activa, a.a.O., S. 261. 7 Ebd. S. 226.
MACHT IN AUFFÜHRUNGEN
131
dig. Diese Eigenschaft von Handlungsmacht, die grundsätzlich nicht darstellbar ist, hat Jérôme Bel in The show must go on! – um auf unser Anfangsbeispiel zurückzukommen – durch die physische Annäherung von Zuschauern und Performern erfahrbar gemacht: Während des Songs Every Breath You Take wurde die Refrainzeile „I’ll be watching you“ von den Performern buchstäblich realisiert. Sie liefen einzeln auf das Publikum zu und blieben jeweils an der Bühnenrampe nebeneinander stehen. Nachdem sie die Sicht auf die Bühne vollkommen verschlossen hatten, fingen sie an, einzelne Zuschauergesichter zu fixieren. Während sie ‚nur‘ das taten, was ihnen die Titelzeile anordnete, bespiegelten sie das Verhalten des Publikums und destabilisierten die bis dahin feste Rollendifferenzierung von Zuschauern und Beschauten. Die Akteure verweigerten, schauspielerisch etwas zu zeigen und befolgten lediglich die Anweisung, die sonst nur Zuschauer betrifft, nämlich anderen zuzuschauen. Somit wurde die ‚voyeuristische‘ Theaterkonstellation in einen Akt des gegenseitigen ‚Sich-Zeigens‘ verwandelt. Aus unmittelbarer Nähe waren nunmehr Phänomene wahrzunehmen, deren Bedeutsamkeit nicht in symbolischen Kodizes oder Strukturen aufging: Es entstand eine Prononcierung des Phänomenalen und des Singulären, Ordnungen der Buchstäblichkeit also, die sich nicht in die Repräsentationsstruktur theatralen Darstellens bündeln ließen. Die Präsenz der Körper, die Kontingenz ihrer Aktionen und Reaktionen, die Unberechenbarkeit der Blickbewegungen und Blickwirkungen bzw. die visuellen Details wie Textur und Farbe der Kleidung, die Individualität der Gesichter und der Hände, die Tönung der Haut, die Körperhaltungen und Physiognomien sowie die absichtslosen Resonanzen der einzelnen Körper in der starren Stillgestelltheit des Tableaus wurden vom autoreferenziellen Impetus der Darstellung zutage befördert und zum tatsächlichen voyeuristischen Objekt gemacht. Diese Szene der physischen Annäherung zeigt, dass eine Begegnung von oder Beziehung zwischen leiblich Anwesenden permanent die Strukturen des Symbolischen überschreitet. Indem Bel die Akteure geradewegs zurückblicken ließ, unterlief er konsolidierte Machtbeziehungen des Theatralen und exponierte zugleich eine dynamische und unvorhersehbare Geltungsweise von Handlungsmacht. Im Blickdialog zwischen Bühne und Zuschauerraum lösten sich die Rollengrenzen von Akteuren und Zuschauern auf und ihre Positionen wurden in der Pluralität und Heterogenität akzentuiert. Die „Gleichheit“ und „Verschiedenheit“8 der Blickenden trat hier in den Erfahrungshorizont, jene elementaren Signaturen der Sozialpraxis also, die Arendt als Grundbedingungen der Intersubjektivität erachtet, insofern diese die Letztbegründung, Totalisierung oder symbolische Schließung einer Gemeinschaft verhindern und Kommunikation in ihrem fortwährenden Aufschub und ihrer Unabschließbarkeit hervorheben.9
8 Ebd., S. 213. 9 Vgl. Joseph Vogl (Hg.), Gemeinschaften. Positionen zu einer Philosophie des Politischen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1994.
132
ADAM CZIRAK
Die letzten beiden Beiträge dieses Kapitels rücken jene flüchtigen Machtbezüge in den Vordergrund, die sich in den aktuell oder virtuell konditionierten Bindungen sozialer Akteure manifestieren. Erin Manning führt jenes Konzept von einer relationalen Politik zwischenmenschlichen Handelns weiter, das sie in ihrer Monografie Politics of Touch entwickelt hat. Dabei liegt ihr Augenmerk weniger auf der Hervorbringung des Körpers als soziokulturelles Konstrukt, vielmehr konzentriert sie sich auf die Relationen des Körpers innerhalb eines virtuellen Feldes: Anstatt Unterwerfungseffekte der Individuation zu beschreiben – wie dies konstruktivistisch orientierte Subjekttheoretiker tun – begreift Manning die Ich-Werdung als einen kollektiven Prozess der beständigen Bewegung und Bezugstiftung und löst somit die Begriffe wie Körperlichkeit, Zeitlichkeit und Räumlichkeit von ihren statisch oder phänomenologisch geprägten Definitionstraditionen. William Forsythes Choreografien dienen ihr dabei ebenso als Referenzpunkte wie ästhetische Erfahrungen oder Körperübungen – sie bringen jene relationale Gebundenheit der Individuation zum Vorschein, die in der Horizontalität verläuft und deshalb definitiv ‚keinen Horizont hat‘.10 Jill Dolan unternimmt in ihrem Beitrag Die Utopie der Aufführung den Versuch, das Konzept des Glaubens aus seinen religiösen Konnotationen zu lösen. Dabei entwindet sie den konservativen politischen Rhetoriken den Glaubensbegriff, um ihn als progressives Instrument kollektiven politischen Handelns neu zu diskursivieren. Sie räumt dem Theater die besondere Möglichkeit ein, die Zuschauer an der gemeinschaftsbildenden Kraft eines säkularisierten Glaubens teilhaben zu lassen. In scheinbarem, aber implizit bleibendem Rekurs auf Hannah Arendts Machtverständnis definiert Dolan theatral verfasste Machtrelationen als eine kollektive Handlungspraxis, die permanent im Werden begriffen und ausschließlich aus partikularen Perspektiven erfassbar ist. Dementsprechend bringen Aufführungen zufällige, vorübergehende und nicht-totalisierbare Gemeinschaften hervor, die ihre Zuschauer zu einem Forum des Möglichen zusammenschließen. Dolan macht eine emphatische Gemeinschaftsidee geltend, insofern sie diese als ‚harmonisch‘, ‚liebevoll‘ oder ‚gerecht‘ apostrophiert und zieht schlüssige Konsequenzen für die nachhaltigen machtpolitischen Wirkungen kurzlebiger Aufführungsmomente. Am Beispiel von Russell Simmons Def Poetry Jam on Broadway zeigt sie, inwieweit die performativen Dimensionen dieser Aufführung die eingeprägten Verhaltensweisen eines klassischen Broadway-Publikums und dessen künftige Erwartungen zu verwandeln vermögen.
10 Der Gedanke der (Un-)Möglichkeit einer Politik ohne Horizont spielt auf Erin Mannings Theorie einer ‚politics of touch‘ an: „A politics of touch is an impossible politics. It is a politics of the future anterior (the will-have come), a politics that is impossible because it has no horizon.“ Erin Manning, Politics of Touch. Sense, Movement, Sovereignty, Minneapolis/London: University of Minnesota Press 2007, S. 115.
MACHT IN AUFFÜHRUNGEN
133
Literaturverzeichnis Arendt, Hannah, Macht und Gewalt, München: R. Piper & Co. 1970. —, Vita Activa oder Vom tätigen Leben, München/Zürich: R. Piper & Co. 1987. Butler, Judith, Die Macht der Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2009. —, Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2001. Foucault, Michel, „Erläuterungen zur Macht. Antwort auf einige Kritiker (Gespräch)“, in: ders., Schriften in vier Bänden, Band III (1976-1979), hg. v. Daniel Defert/François Ewald, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2003, S. 784-795. —, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1994. —, „Wie wird Macht ausgeübt?“, in: Hubert L. Dreyfus/Paul Rabinow, Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik, Frankfurt a. M.: Athenäum 1987, S. 251-261. Grossmann, Andreas, „Macht als ‚Urphänomen‘ des Politischen. Überlegungen im Anschluss an Hannah Arendt“, in: Macht. Begriff und Wirkung in der politischen Philosophie der Gegenwart, hg. v. Ralf Krause/Marc Rölli, Bielefeld: transcript 2008, S. 49-62. Hetzel, Andreas, „Das Rätsel des Performativen. Sprache, Kunst und Macht“, in: Philosophische Rundschau 51 (2004), S. 132-159. Krause, Ralf/Rölli, Marc (Hg.), Macht. Begriff und Wirkung in der politischen Philosophie der Gegenwart, Bielefeld: transcript 2008. Manning, Erin, Politics of Touch. Sense, Movement, Sovereignty, Minneapolis/London: University of Minnesota Press 2007. McKenzie, Jon, Perform or Else. From Discipline to Performance, London/New York: Routledge 2001. Vogl, Joseph (Hg.), Gemeinschaften. Positionen zu einer Philosophie des Politischen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1994. Weber, Max, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, Bd. 1, Köln/Berlin: Kiepenheuer und Witsch 1964.
FRANK RICHARZ
Von der Aufführung zum Performativ. Die theatralogische Untersuchung machtmimetischer Prozesse
Die Aufführung der Macht Ich entdeckte den performativen Aspekt der Macht, lange bevor ich bei Erika Fischer-Lichte die Theorie der Performativität studierte – während des großen Hochschulstreiks 1997/98. Als einer der führenden studentischen Streikaktivisten meiner Universität sprach ich eines Tages vor einer großen Menschenmenge über Sozial- und Bildungsabbau. Während dieser Rede stieß ich zum ersten Mal auf das, was Fischer-Lichte in ihrer Ästhetik des Performativen die ‚auto-poietische feedbackSchleife‘ einer Aufführung nennt.1 Jede Geste, jede Veränderung meiner Mimik, jede Betonung war unmittelbar verknüpft mit der körperlichen Reaktion des Publikums. Ich spürte, wie ich die Stimmung der Menge anheizen konnte, indem meine Performance energischer wurde, wie ich sie beruhigen konnte, indem ich selbst Ruhe verkörperte, wie ich sie zum Lachen, Johlen und Brüllen bringen konnte, indem ich mich auf der Bühne entsprechend inszenierte. Mein Körper schien in diesem Moment der Brennpunkt der kleinen politischen Bewegung zu sein, der ich mich angeschlossen hatte. Es kam mir so vor, als wäre ich ein Marionetten-Spieler, der das Publikum und damit auch für kurze Zeit den Lauf der Geschichte in seiner Hand hielt. In diesem Augenblick größenwahnsinnigen Glücks empfand ich einen durchdringenden Ekel mir und der Welt gegenüber. Verwirrt und orientierungslos empfand ich plötzlich Schwindelgefühle. Während ich in meiner Rede den emanzipatorischen Politiker mimte, bemerkte ich an mir, dass meine theatralen Machthandlungen dies bereits unterliefen. Ich unterschied mich in keiner Weise von den ‚elitären Machtpolitikern‘, die ich zu bekämpfen versuchte. Indem ich mich machtvoll für meine Sache einsetzte, transformierte ich mich in die Gestalt meines Gegners, sodass ich mich selbst als Verräter meiner eigenen Sache empfand. Dieser Moment dort oben auf der Bühne zeigte mir, dass ich nicht Herr über die Machtpraktiken war, die ich anwendete. Ohne zu wissen, wie mir geschah, machte ich aus mir einen anderen Menschen. Ich stellte ihn nicht kalkulierend dar, sondern er trat in meinem Handeln in Erscheinung. Ich hatte den Eindruck, dass nicht ich selbst dort oben sprach, sondern ein vom Begehren des Publikums gesteuerter Politik-Performer, der nur aus diesem Grund den Eindruck haben konnte, ein Marionetten-Spieler zu sein, weil er mit dem Pu1 Vgl. Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004, S. 59ff.
136
FRANK RICHARZ
blikum durch unsichtbare Fäden verbunden war, die nur zu einem geringen Teil von ihm selbst gesponnen und schließlich gelenkt worden waren. Auf dieser Bühne erlebte ich das, was Fischer-Lichte als ‚Schwellenerfahrung‘ beschreibt, eine Erfahrung des ‚betwixt and between‘, als würde gerade mein auf klaren Gegensätzen beruhendes Wertesystem außer Kraft treten.2 Viele Jahre später begriff ich, dass es die besondere Struktur der Aufführung war, die es mir ermöglichte, diese Erfahrung zu machen und darüber in dieser besonderen Art zu reflektieren, die ich den theatralen Reflexionsmodus nennen möchte. Der theatrale Reflexionsmodus hat mit der besonderen Verfasstheit der Aufführung zu tun, die Fischer-Lichte an ihrer spezifischen Medialität, Materialität, Semiotizität und Ästhetizität festmacht.3 Von einem Buch oder einem Film unterscheidet sich die Aufführung dadurch, dass sie sich „in der und durch die leibliche Ko-Präsenz von Akteuren und Zuschauern“4 ereignet. Aus der Prämisse der leiblichen Ko-Präsenz folgt für Fischer-Lichte die systematische Unverfügbarkeit der Aufführung für einzelne Teilnehmer, da die Aufführung nur durch das ereignishafte Zusammenspiel aller Teilnehmer entstehe, das sich niemals vollständig planen ließe.5 In der Aufführung wird neben der Ebene symbolischer Kommunikation noch eine Ebene der interkorporalen Übertragung etabliert: „In Aufführungen wirkt der phänomenale Leib der Beteiligten mit seinen je spezifischen physiologischen, affektiven, energetischen und motorischen Zuständen unmittelbar auf den phänomenalen Leib anderer ein und vermag in diesen je besondere physiologische, affektive, energetische und motorische Zustände hervorzurufen.“6 Sowohl auf der körperlichen Wirkungsebene als auch auf der Bedeutungsebene kann es zu Emergenzen kommen. Die Aufführung „übermittelt nicht andernorts bereits gegebene Bedeutungen, sondern bringt die Bedeutungen, die in ihrem Verlauf entstehen allererst hervor.“7 Neben der Ordnung der Repräsentation, die auf Codes rekurrieren muss, etabliert die Aufführung vor allem eine Ordnung der Präsenz, in der Bedeutungen dadurch konstituiert werden, dass in der phänomenologischen Betrachtung immer „etwas als etwas [Hervorh. v. FR]“8 in seiner je eigenen Selbstbezüglichkeit wahrgenommen wird. Als Schlussfolgerung aus ihrem Aufführungsbegriff begründet Fischer-Lichte ihre Ästhetik des Performativen in einer besonderen Form ästhetischer Erfahrung, die sie im Anschluss an Arnold van Genneps und Victor Turners Ritualtheorien ‚liminale Erfahrung‘ oder ‚Schwellenerfahrung‘ nennt. Damit ist gemeint, dass es 2 Vgl. ebd., S. 305ff. 3 Vgl. Erika Fischer-Lichte, „Einleitende Thesen zum Aufführungsbegriff“, in: Kunst der Aufführung – Aufführung der Kunst, hg. v. dies./Clemens Risi/Jens Roselt, Berlin: Theater der Zeit 2004, S. 11-26, hier: S. 11. 4 Ebd 5 Vgl. ebd., S. 14. 6 Ebd., S. 16. 7 Ebd., a.a.O., S. 18. 8 Ebd., S. 18.
VON DER AUFFÜHRUNG ZUM PERFORMATIV
137
aufgrund der skizzierten besonderen Verfasstheit der Aufführung in einer solchen möglich sei, dass verschiedene Rahmen, Ordnungen und Normen aufeinander treffen und sich destabilisieren. Durch die gleichzeitige Wirkung verschiedener Ordnungen der Welterschließung können Teilnehmer die Erfahrung machen, dass Bezugssysteme kollabieren, sodass für kurze Zeit ein Schwellenraum entsteht, in dem man auf sich selbst zurückgeworfen wird. Fischer-Lichtes Theorem bietet die Möglichkeit, neu über Aufführungen nachzudenken und diese als einen besonderen Modus der Reflexion zu begreifen, der die sozialwissenschaftliche Forschung methodisch zu bereichern vermag. Zwar waren Aufführungen immer schon Objekte soziologischer und insbesondere anthropologischer Forschung,9 doch meist nur als partielle Objekte einer teilnehmenden Beobachtung, die letztlich auf größere, dahinter liegende Sinnzusammenhänge (Struktur, Sprache, Kultur, Diskurs…) ausgerichtet waren.10 Im Zentrum von Fischer-Lichtes Projekt einer Ästhetik des Performativen steht hingegen die einzelne Aufführung als Ereignis. In diesem Zusammenhang definiert Fischer-Lichte im Rekurs auf Max Herrmann die gesamte Theaterwissenschaft als eine ‚Wissenschaft von der Aufführung‘.11 Dieser Definition möchte ich eine etwas andere Wendung geben. Die Aufführung ist nicht nur das zentrale Objekt der Theaterwissenschaft, sondern sie stellt auch denjenigen Reflexionsmodus dar, der es ihr erlaubt, einen methodischen Zugang zu sozialen Prozessen zu finden, der sich von denen der Soziologie oder der Anthropologie unterscheidet. Jeder performative soziale Akt kann vom Theaterwissenschaftler in eine Aufführungssituation überführt werden – indem dieser seine Aufmerksamkeit darauf lenkt und ihn beobachtet.12 Diese theatrale Beobachtung unterscheidet sich von der distanzierten oder auch teilnehmenden Beobachtung erstens dadurch, dass das Phänomen, das beobachtet wird, in seiner Besonderheit nur durch das Aufspannen einer Aufführung zustande kommt. Dieses Aufspannen einer Aufführung ist im Vergleich zu den beiden anderen Beobachtungsmodi (distanziert oder teilnehmend) als ein Akt des vollständigen Engagements zu werten: theatrale Beobachtung bedeutet immer engagierte Beobachtung.
9 Gerade in der Theatralitätsforschung kam es zu einer engen interdisziplinären Zusammenarbeit, über die vor allem Klaus-Peter Köpping in diesem Band Zeugnis ablegt. Vgl. auch Erika Fischer-Lichte/Christian Horn/Sandra Umathum (Hg.), Diskurse des Theatralen (Theatralität 7), Tübingen/Basel: A. Francke 2005. 10 Vgl. hierzu die Argumentation von Tobias Rees in diesem Band, der eine anthropologische Denkbewegung vorstellt, die sich in eine ähnliche Richtung bewegt wie die ‚post-performative Theaterwissenschaft‘: das Auffinden und Beschreiben von sozialen Strukturierungen in ihrer Selbstbezüglichkeit. 11 Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, a.a.O., S. 43. 12 Ich vermeide den Begriff des Zuschauens, der in der Theaterwissenschaft oft alle anderen Arten des körperlich-geistigen Achtgebens zu verdecken droht. Das Zuschauen ist für eine theatrale Situation in keiner Weise notwendig, das Beobachten jedoch schon.
138
FRANK RICHARZ
Zweitens richtet sich die Aufmerksamkeit der Forschung nicht auf eine bereits dahinter befindliche Struktur, sondern verharrt bei der Aufführung selbst und folgt den sozialen Strukturierungsbewegungen in ihrer Genese. Damit wird die Aufführung als beliebiger Ausgangspunkt einer sozialen Strukturierung gesetzt, die sich von dort aus in die Zukunft und in die Vergangenheit fortsetzt.13 Drittens ist die theatrale Beobachtung keine reine Beobachtung im eigentlichen Sinne mehr, sondern in erster Linie eine wissenschaftliche Erfahrung, die keine Trennung zwischen Körper und Geist vornimmt. Die Verwicklung des Theaterwissenschaftlers in die feedback-Schleife der Aufführung lässt ihn körperlich spüren, auf welche Weise er in einem interkorporal fundierten Sozialverhältnis zu den anderen Aufführungsteilnehmern steht. Während man sich in der gewöhnlichen Reflexion über bestimmte Gedanken oder das Denken selbst bewusst wird, indem man die Aufmerksamkeit darauf lenkt, erspürt man im theatralen Reflexionsmodus zudem, was auf der körperlichen Wirkungsebene zwischen mir und den anderen im Hier und Jetzt geschieht und entsteht. Diese spezifische Erfahrung des in sozialen Interaktionen sonst Ungespürten ermöglicht es dem Theaterwissenschaftler, den ‚Stoff‘, aus dem das Soziale gewoben wird, zu erfassen und dessen Werden und Wirken von einem beliebig gesetzten ‚Ursprung‘ aus zu verfolgen. Da die Aufführung nun die Position des Forschungsobjekts verlassen hat und zum methodischen Setting geworden ist, stellt sich die Frage, was an die Stelle der Aufführung als Gegenstand dieser spezifischen Form theatralogischer Forschung treten könnte. Anhand eines weiteren biografischen Beispiels, das sich unmittelbar an das erste anschließt, möchte ich eine mögliche Neuperspektivierung skizzieren.
Performative der Macht Tief verunsichert von der oben geschilderten Erfahrung suchte ich nach einer Möglichkeit, meine Machtposition weiter auszubauen, ohne mich dabei selbst zu verlieren. Ich glaubte also noch an meine politische Mission, dachte jedoch, dass ich meine politische Einstellung, repräsentiert durch meine ‚Inhalte‘, durch eine bestimmte Formgebung schützen könnte. Durch das kontrollierte Einnehmen einer Rolle plante ich, mein ‚wahres Ich‘ von den Auswirkungen performativer Prozesse in der Politik abzuschirmen, denen ich zuvor offensichtlich relativ schutzlos ausgeliefert war. Damit wollte ich verhindern, mich als Figur auf der Bühne des politischen Geschäfts unmittelbar den dort auf mich wirkenden Kräften auszusetzen. So 13 Natürlich wird auch die Vergangenheit durch jeden weiteren Akt verändert. Bereits die Annahme, dass eine gegenwärtige Handlung eine Folge einer vergangenen Handlung sei, geht der vergangenen Handlung voraus und ändert diese. Das kann soweit führen, dass Handlungen aus der Gegenwart in die vergangene Wirklichkeit transplantiert werden, weil man einen Grund für eine gegenwärtige Handlung sucht. Die Psychologie des Unbewussten verwendet solche Transplantationstechniken. Die psychoanalytischen Re-Enactments produzieren performatives Material, aus dem die Vergangenheit neu gewoben werden kann.
VON DER AUFFÜHRUNG ZUM PERFORMATIV
139
gerüstet entschloss ich mich, in der Rolle des Politikers meine politische Karriere fortzusetzen. Ich ließ mich zuerst in die Studierendenvertretung meiner Universität und schließlich in den Vorstand der studentischen Bundesvertretung wählen. Meine politische Tätigkeit lässt sich als eine Verkettung performativer Akte beschreiben, die meine spezifische politische Wirklichkeit hervorbrachten, verwandelten oder verstetigten. Dazu gehören neben Aufführungen wie im ersten Beispiel auch das Schreiben von Artikeln und Strategiepapieren, das Führen von Gesprächen und Interviews oder das Einrichten des Büros. Das wichtigste Ziel meiner politischen Tätigkeit bestand in der Vergrößerung des Verbandes durch das Anwerben zahlungskräftiger Mitglieder. Dazu war es nötig, das demokratische Grundprinzip des Verbandes ‚eine Hochschule, eine Stimme‘ zu kippen.14 Ich handelte in wochenlanger Arbeit ein Kompromissmodell aus, das schließlich vom Vorstand zur Abstimmung gestellt wurde. Da sich meine Vorstandskollegen in der entscheidenden Sitzung überraschend vom eigenen Antrag distanzierten, verlor ich die Abstimmung. In diesem Moment fühlte ich mich vom Vorstand und vom ganzen Verband hintergangen und verraten, weil diese sich in einer demokratischen Abstimmung mir gegenüber nicht loyal verhalten hatten. Voller Wut ermächtigte ich mich selbst, hinter dem Rücken meiner Vorstandskollegen weiterzuverhandeln. In einem Geheimtreffen mit den wichtigsten Studierendenverbänden und ausgewählten politischen Akteuren wollte ich darüber beraten, wie man nach dieser Niederlage weitermachen könne. Dem Vorstand wurde allerdings meine Einladungsmail zugespielt, sodass ich nun als undemokratischer Verräter entlarvt war. Schockiert musste ich feststellen, dass diese Vorwürfe auf der Grundlage politischer Vorstellungen geäußert wurden, die ich selbst zu teilen dachte und somit als berechtigt akzeptieren musste. Mir ging auf, dass ich nun auch außerhalb von politischen Aufführungssituationen zu einer mir fremden Figur geworden war. In dieser Krisenerfahrung spürte ich, dass die Rolle, die ich zu spielen und kontrollieren dachte, mich nicht hatte beschützen können, da sie im performativen Prozess mit mir verschmolzen war. Daher musste ich mich nun damit auseinandersetzen, dass ich mich in einem längeren Prozess, in dem ich mich selbst meinen performativen Akten und der daraus entstandenen Wirklichkeit permanent geistig und körperlich ausgesetzt habe, in einen Menschen verwandelt hatte, den ich zu Beginn dieses Prozesses sicherlich als meinen politischen Feind ausgemacht hätte. Mein selbstbewusstes, charismatisches Auftreten und der Glaube, die anderen mehr lenken zu können als selbst gelenkt zu werden, wich nun schlagartig einem hilflosen und apathischen Verhalten.
14 Dieses Prinzip war eingeführt worden, um zu verhindern, dass die kleinen Fachhochschulen, die den Verband gegründet hatten, von den großen Universitäten dominiert werden konnten. Gerade die großen Universitäten pochten jedoch darauf, einen größeren Einfluss bei den Abstimmungen zu haben, da sich schließlich auch die Mitgliedsbeiträge nach den Studierendenzahlen errechneten. Zudem sahen sie sich als Vertreter eines größeren Anteils der deutschen Gesamtstudierendenschaft.
140
FRANK RICHARZ
Meine Erfahrung, die ich in der eingangs geschilderten Aufführungssituation gemacht habe, wiederholte sich hier also vielfach verstärkt auf einer komplexeren Ebene: ‚Es war stärker als ich.‘15 Dieses ‚Es‘, das mein vorgängiges politisches ‚Ich‘ so restlos vernichten konnte, hat nichts mit dem Es der Psychoanalyse gemein. Nichts in mir hatte mich deformiert oder fehlgeleitet. Es war die Strukturierung selbst, die Verkettung performativer Vorgänge, die ich initiierte, an denen ich teilnahm oder die mir widerfuhren. Es war das, was ich von nun an ein ‚Performativ‘ nennen möchte. Ein Performativ ist eine Art Mikrodispositiv. Als Dispositive bezeichnet Michel Foucault Strukturierungen heterogener Elemente diskursiver und nicht-diskursiver Art („Diskurse, Institutionen, Gebäude, Gesetze, polizeiliche Maßnahmen, philosophische Lehrsätze usw.“), die aus einer „Verschränkung von Macht- und Wissensverhältnissen“16 hervorgehen und strategisch auf spezifische historische Problematisierungen antworten. Damit sind Dispositive von einzelnen Akteuren weitgehend entkoppelte dynamische Strukturen, die räumlich weit ausgedehnt und zeitlich von langer Dauer sind.17 Verglichen damit ist ein Performativ von sehr überschaubarer Ausdehnung in Raum und Zeit. Wie im Beispiel gesehen, entwickelt sich ein Performativ um Subjekte herum aus der Verkettung ihrer performativen sozialen Interaktionen mit anderen Akteuren und ihrer Umwelt.18 Während man das Dispositiv als eine fast übermächtige, alles durchdringende Struktur ansehen kann, die soziale Akteure zu (Untertanen-)Subjekten transformiert, so kann man das Performativ als eine instabile bis metastabile Strukturierung betrachten, die sich aus den performativen Akten weniger Akteure bildet und somit immer eine an den Einfluss dieser Akteure gebundene soziale Wirklichkeit ist. Dabei hat diese Strukturierung drei Entwicklungsmöglichkeiten. Sie kann sich erstens durch die Wiederholung performativer Akte und die Einbeziehung von Materialität (Gebäude etc.) verstetigen und zu einer Struktur verfestigen, die sich von den Akteuren entkoppelt, oder sich zweitens auflösen, wenn das Spannungs15 Dieses Zitat entstammt einem Interview mit Pierre Bourdieu. Vgl. Pierre Carles, Soziologie ist ein Kampfsport – Pierre Bourdieu im Portrait (OmU), Frankfurt a. M.: Filmedition Suhrkamp 2009. 16 Giorgio Agamben, Was ist ein Dispositiv?, Zürich/Berlin: diaphanes 2008, S. 9. 17 Vgl. Paul Rabinow, Was ist Anthropologie?, hg. v. Carlo Caduff/Tobias Rees, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004, S. 64ff. 18 Der hier vorgestellte Begriff des Performativs unterscheidet sich deutlich vom Begriff des utopischen Performativs, wie er sich bei Jill Dolan findet. Dolans utopische Performative sind „kurze, spezifische und bedeutungsvolle Momente einer Aufführung, in denen der Zuschauer zu einem gewissen Grad aus der Gegenwart herausgehoben und in einen Zustand versetzt wird, in dem er voller Hoffnung in die Zukunft schaut“. Jill Dolan, „Die Utopie der Aufführung“, in diesem Band. Im Gegensatz dazu soll es hier nicht um utopische Momente in Aufführungen gehen, sondern um mittel- und langfristige komplexe Strukturierungen, die Aufführungen und andere performative Prozesse einschließen. Vgl. auch Jill Dolan, Utopia in Performance: Finding Hope at the Theater, Ann Arbor: University of Michigan Press 2006.
VON DER AUFFÜHRUNG ZUM PERFORMATIV
141
feld zwischen den Akteuren nicht stark genug ist und sich die Akteure nicht regelmäßig aufeinander und auf eine gemeinsame Umwelt beziehen. Die dritte Möglichkeit ist der Verbleib in einem metastabilen Stadium, in dem das Performativ gefestigt genug ist, um sich von seiner Umwelt abzugrenzen und gleichzeitig aber an den Einfluss der Akteure gebunden bleibt.19 Ein solches Performativ ist im Gegensatz zu einer festen Struktur hochkomplex, denn es bedarf einer deutlich längeren Beschreibung.20 In dem Beispiel haben wir gesehen, wie sich das Performativ, an dem ich beteiligt war, für mich zu einer Struktur verändert hatte, auf die ich keinen bewussten transformierenden Einfluss mehr nehmen konnte. Neben dem Komplexitätsgrad der Strukturierung eines Performativs stellt sich natürlich die Frage ihrer Begrenzung und ihres Inhalts – oder anders formuliert: Wer oder was gehört zu einem Performativ und wer oder was nicht? Offensichtlich hat ein Performativ sehr viel mit einem einzelnen Akteur zu tun, wie wir im zweiten Beispiel gesehen haben. Es lässt sich aber nicht durch einen Akteur allein aufspannen, denn es besteht ja aus performativen sozialen Akten, die in der Regel zwischen mehreren Akteuren stattfinden. Die Beschreibung eines Performativs und damit auch seine klare Abgrenzung hängen zugleich jedoch vom Bezugssystem und damit vom jeweiligen Akteur ab, aus dessen Perspektive ein Performativ beschrieben wird. Bleiben wir einmal bei dem Beispiel. An dem geschilderten Performativ waren noch einige andere Akteure beteiligt, unter anderem meine Vorstandskollegen. Wenn nun eine Vorstandskollegin dieses Performativ des politischen Lebens aus ihrer Sicht geschildert hätte, dann hätte es klare Überschneidungen gegeben bei den gemeinsamen Erlebnissen und Abweichungen bei nicht geteilten Erlebnissen. Allerdings besteht das Performativ eben nicht nur aus dem kleinsten gemeinsamen Nenner aller beteiligten Akteure, sondern aus der Vielfalt derjenigen performativen Akte, an denen Mitglieder der besagten Akteursgruppe beteiligt sind und die sich auf die anderen Akteure im Performativ auswirken. Wir sehen, dass das Performativ eine komplizierte Angelegenheit ist, die sich schwer fassen lässt. Offenbar ist es diffuser strukturiert als zum Beispiel ein soziales Feld bei Pierre Bourdieu oder ein soziales System bei Niklas Luhmann, da es eben eine komplexe, metastabile, vielfältige Strukturierung ist, die sich im permanenten Wandel zwischen Verfestigung und Auflösung befindet. Kompliziert wird das Performativ auch dadurch, dass es nach meiner Konzeption nicht nur von außen beschrieben wird, sondern vor allem von innen heraus. 19 Auf die Idee metastabiler Sozialstrukturierungen haben mich vor allem Erin Mannings metaphorische Modelle auf Basis der mikrobiologischen Arbeiten von Lynn Margulis gebracht. Vgl. Erin Manning, Politics of Touch: Sense, Movement, Sovereignity, Minneapolis: University of Minnesota Press 2007, S. 84ff.; Lynn Margulis/Dorion Sagan, Acquiring Genomes: A Theory of the Origins of Species, New York: Basic Books 2002. 20 Murray Gell-Mann misst die grobe Komplexität einer Sache durch die Länge der kürzesten Beschreibung, die wir einem Abwesenden über sie geben können. Vgl. Murray Gell-Mann, Das Quark und der Jaguar: Vom Einfachen zum Komplexen - Die Suche nach einer neuen Erklärung der Welt, München: Piper 1994, S. 70ff.
142
FRANK RICHARZ
Dadurch ist es notwendig, den differenten Bezug der verschiedenen beteiligten Akteure, aus deren Sicht das Performativ beschrieben werden soll, als unterschiedliche Bezugssysteme des Performativs einzubeziehen. Nur so können wir das Performativ theatralogisch beschreiben und somit in der Beschreibung seine Eigenart als performative Strukturierung gegenüber etablierten Systemen, Feldern und anderen Strukturen erhalten. Das Performativ ist also eine intersubjektive Wirklichkeit, die sich aus den aufeinander bezogenen performativen Akten weniger Akteure aufspannt. Diese Wirklichkeit ist nicht imaginär und kann sogar eine gewisse Materialität annehmen (man denke an die Eigenschaft von Dispositiven). Dass performative Akte wirklichkeitskonstituierend sind, gehört seit der Einführung des Begriffs durch John L. Austin zu ihrer Definition.21 Allerdings wird diese Möglichkeit der Wirklichkeitskonstitution seit Austin meist an bereits etablierte Institutionen, Normen und Diskurse gebunden. Das berühmteste Beispiel ist der Standesbeamte, dessen Trauungsritual unwirksam wird, wenn er nicht die institutionelle Berechtigung zur Trauung hat. Eine gespielte Trauung ist eben keine wirkliche Trauung. Fischer-Lichte verbindet nun den Als-ob-Rahmen des Theaters mit der Möglichkeit von Wirklichkeitskonstitution ohne einen festen institutionellen Rahmen, da gerade diese Rahmung in den von ihr beschriebenen Aufführungen fraglich wird. Ein gutes Beispiel hierfür bietet Fischer-Lichtes erstes Beispiel in Ästhetik des Performativen, in der sie die berühmte Performance Lips of Thomas von Marina Abramović beschreibt. In dieser Performance verletzt sich Abramović so, dass sie blutet. Soll man ihr als Mitmensch nun helfen oder ist die Situation trotz des echten Blutes für mich als ‚Zuschauer‘ unter Kontrolle, weil es einen stabilen Als-obRahmen gibt?22 Jede aus dieser Situation entstehende Wirklichkeit ist nicht bloß eine Variation von diskursiven Möglichkeiten, sondern sie emergiert aus dieser Situation und ist daher durch die ihr vorgängigen Normen, Diskurse oder andere Strukturen nicht notwendig bestimmt. Daher müssen wir im performativen Vorgang selbst nach dem schon angedeuteten Stoff suchen, aus dem diese neue, emergente Wirklichkeit gewoben wird, die imstande ist, die Flüchtigkeit des performativen Geschehens zu überdauern. Dieser geheimnisvolle Stoff, der soziale Akte über Performative zu Dispositiven, Institutionen und anderen Strukturen zu versammeln und zu stabilisieren vermag, ist das, was wir gemeinhin als ‚Macht‘ bezeichnen.
Macht und Mimēsis – Die unfassbare Stofflichkeit sozialer Wirkkräfte Bisher habe ich ‚Macht‘ immer in einer der vielen alltäglichen Bedeutungen benutzt. Im Folgenden möchte ich präziser bestimmen, mit welchem Machtmodell ich operiere und in welchem Zusammenhang es mit der Ästhetik des Performativen steht. 21 Vgl. John L. Austin, Zur Theorie der Sprechakte, Stuttgart: Reclam 2002. 22 Vgl. Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, a.a.O., S. 9ff.
VON DER AUFFÜHRUNG ZUM PERFORMATIV
143
Da hier nicht der Raum ist, das weite Feld alltagssprachlicher und theoretischer Machtbedeutungen vorzustellen, möchte ich mich darauf beschränken, das Machtmodell zu skizzieren, das ich in meiner Arbeit verwende. Dabei gehe ich von der basalsten Deutung der Macht aus, die sich sowohl in der Alltagssprache als auch im theoretischen Diskurs findet. Macht steht immer im Zusammenhang möglicher oder tatsächlicher Wirkungen im sozialen Raum. Ich möchte daher behaupten, dass Macht nichts anderes ist als eine soziale Wirkung. ,Wirkung‘ ist ein wichtiger, aber nicht ganz klarer Begriff im theaterwissenschaftlichen Diskurs. So fragt die Theaterwissenschaftlerin Christel Weiler zu Recht, was Wirkungen eigentlich sind: „Wenn wir von ihnen sprechen, dann impliziert dies, dass es eine Macht gibt, dass Kräfte und Energien wahrnehmbar sind, die mit diesen Wirkungen in Verbindung stehen. Irgendwer oder -etwas tut etwas mit uns, etwas vollzieht sich an uns, meist ohne unser bewusstes Zutun.“23 Offenbar geraten wir schnell in einen tautologischen Kreis, in dem Begriffe wie Wirkung, Macht, Kraft und Energie beliebig die Plätze tauschen können. Um dies zu verhindern, schauen wir uns zwei der hier aufgerufenen Modelle sozialer Wirkung genauer an: Mimēsis und Macht. Dabei werden wir sehen, dass beide nahezu konvergieren, obwohl das eine ein theatralogisches und das andere ein soziologisches Modell ist. Fischer-Lichte beschreibt in ihrer Ästhetik des Performativen zahlreiche Wirkungsformen: Berührung als Nahwirkung, Ansteckung als relative Fernwirkung,24 Kraft und feedback-Schleife als Konzepte von Wechselwirkungen, sowie Speicherund Aufladungsformen von Wirkungen wie Energie und Präsenz. All diese Formen fasse ich unter dem Begriff der Mimēsis zusammen. Das alt-griechische Wort Mimēsis wird in der Regel mit ‚Nachahmung‘ übersetzt. Dadurch wird jedoch das ungeheure soziale Potenzial der Mimēsis verschleiert. Die Mimēsis ist nicht notwendig eine intentionale, also bewusste und gerichtete Handlung der Nachahmung. Vielmehr handelt es sich bei ihr um eine ursprünglich interkorporale Übertragung, die nur in geringen Teilen bewusst kontrolliert werden kann. Gunter Gebauer und Christoph Wulf weisen historisch vier Aspekte der Mimēsis nach. Der Begriff beschreibe (1) „die Identifikation einer Person mit einer anderen durch mimetische Fähigkeiten“ und (2) eine „Handlungsund eine Wissenskomponente“ wie zum Beispiel den praktischen Sinn (sens pratique) bei Bourdieu. Die Mimēsis sei zudem (3) „ursprünglich eine körperliche Handlung, die sich zuerst in oralen Kulturen entfaltet. Sie hat den Charakter des
23 Christel Weiler, „Weiter denken – analytisch und wild zugleich“, in: Strahlkräfte: Festschrift für Erika Fischer-Lichte, hg. v. dies./Jens Roselt/Clemens Risi, Berlin: Theater der Zeit 2008, S. 28-41, hier: S. 33. 24 Vgl. auch Erika Fischer-Lichte, „Zuschauen als Ansteckung“, in: Ansteckung. Zur Körperlichkeit eines ästhetischen Prinzips, hg. v. Mirjam Schaub/Nicolai Suthor/Erika Fischer-Lichte, München: Wilhelm Fink 2005, S. 35-50.
144
FRANK RICHARZ
Zeigens“. Schließlich (4) hänge mit der körperlichen Komponente der Mimēsis auch das Performative zusammen.25 All diesen Bedeutungen liegt die Vorstellung zugrunde, dass die Mimēsis letztlich eine körperlich-ethische Wirkung ist, die eben nicht nur unser körperliches Verhältnis zu anderen Akteuren beeinflusst, sondern auch die Art und Weise, wie wir uns geistig, psychisch, ethisch oder sozial zur Welt verhalten. Aufgrund dieser unmittelbaren körperlich-ethischen Wirkmächtigkeit der Mimēsis wurde sie in der antiken Philosophie immer dann problematisiert, wenn es um die kontrollierte und bewusste Weitergabe eines ethos ging.26 Der wirkmächtigen, nicht-intentionalen Form der Mimēsis, die unsere Haltung27 unkontrolliert beeinflusst, wurden seit der Antike das Training, „die Arbeit der Gegendressur“28 oder die Übung29, also ‚Anthropotechniken‘30 der Selbst- und Weltkontrolle entgegengehalten, die intentionale Formen der Nachahmung beinhalten können. Die unkontrollierte Form der Mimēsis macht Fischer-Lichte in ihrer Ästhetik des Performativen in Aufführungen sichtbar31 und beschreibt die damit verbundenen Wirkungsprozesse in naturwissenschaftlichen Metaphern, die sowohl einem physikalischen (Kraft, Energie etc.) als auch einem biologischen Kontext (Autopoiese) entstammen.
25 Vgl. Gunter Gebauer/Christoph Wulf, Mimesis: Kultur – Kunst – Gesellschaft, Reinbek b. H.: Rowohlt 1998, S. 13f. 26 Hier ist der Grund zu suchen, warum Platon in seiner politeia die Tragödie und alle mimetischen Künste aus seinem idealen Staat verbannen wollte. Allerdings war er bereit, der Mimēsis dann eine Chance zu geben, wenn sie ihre Heilsamkeit unter Beweis hätte stellen können. Diesen ‚Beweis‘ versuchen Theatertheoretiker seit Aristoteles immer wieder neu zu erbringen, angefangen von Aristoteles’ Katharsis bis hin zur Schwellenerfahrung bei FischerLichte. Vgl. Platon, „Politeia“, in: Sämtliche Werke, Bd. 2, Reinbek b. H.: Rowohlt 1994, S. 520f. Buch X, 607b ff.; Aristoteles, Poetik (Griechisch/Deutsch), übers. und hg. v. Manfred Fuhrmann, Stuttgart: Reclam 1994, S. 19; Erika Fischer-Lichte, „Ästhetische Erfahrung als Schwellenerfahrung“, in: Dimensionen ästhetischer Erfahrung, hg. v. Joachim Küpper/Christoph Menke, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2003, S. 138-161. 27 Mit Haltung ist eine körperlich-ethische Haltung gemeint wie die hexis in der Nikomachischen Ethik des Aristoteles oder der Habitus bei Bourdieu. Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik, übers. und hg. v. Ursula Wolf, Reinbek b. H.: Rowohlt 2006, 81ff., 1105b Z. 19ff.; Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1987, S. 277ff. 28 Pierre Bourdieu, Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2001, S. 220. 29 Vgl. Michel Foucault, Hermeneutik des Subjekts. Vorlesung am Collège de France 1981/1982, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004; Peter Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern: Über Anthropotechnik, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2009. 30 Vgl. Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern, a.a.O. 31 Damit steht sie in der Tradition antiker (philosophischer) Reflexion über die Mimēsis, kommt jedoch als Theaterwissenschaftlerin zu einem anderen Schluss: Die Mimēsis sei nicht das Problem des Theaters, sondern gerade dessen Stärke.
VON DER AUFFÜHRUNG ZUM PERFORMATIV
145
In Bezug auf die Beschreibung von Macht möchte ich im Anschluss an Helmuth Plessner, Foucault und Bourdieu ähnlich verfahren. Dabei werde ich über den Umweg einer physikalischen Beschreibung Macht als Wirkung rekonstruieren. Die Wirkung ist das, was mit dem physikalischen Begriff der Kraft und den damit zusammenhängenden Begriffen ‚Arbeit‘ und ‚Energie‘ beschrieben wird. Es könnte sich lohnen, diese physikalischen Begriffe metaphorisch zu transferieren, um sie dann in eine neue sinnvolle Ordnung zu bringen.32 Meine heuristische Annahme lautet, dass Macht sowohl als Kraft als auch als Energie begriffen werden kann. Wenn ich Macht als Wechselwirkung zwischen sozialen Akteuren beschreibe, dann fasse ich sie als eine Kraft auf. In diesem Sinne versteht Foucault die Macht.33 Auch Bourdieu nimmt diese Idee mit seinem Modell sozialer Kraftfelder auf. Die Bestimmung der Macht als Kraft impliziert, dass die Macht selbst „eine normsetzende und -zerstörende, selbst aber normlose Größe“34 ist, wie es Plessner formuliert. Hierarchische oder gar herrschaftsförmige Formationen können aus dem Spiel der Mächte/Kräfte hervorgehen, sie sind aber nicht bereits in der Kraft selbst angelegt. Daher behaupte ich, dass das Phänomen der Macht bisher meist zu einseitig interpretiert worden ist – als asymmetrisches Sozialverhältnis, das in sich zur Herrschaftsförmigkeit tendiert. Aus der Vorstellung der Macht als Kraft kann man schlussfolgern, dass symmetrische und in keiner Weise herrschaftsförmige Sozialverhältnisse (Liebe, Freundschaft, Kollegialität, Solidarität) ebenso daraus hervorgehen können wie die so oft beschriebenen ‚dunklen Seiten‘ der Macht. Die Vielfältigkeit der Macht wird von keinem Autor so facettenreich geschildert wie von Michel Foucault. Während er in Überwachen und Strafen und in Der Wille zum Wissen zeigt, wie sich in der Moderne Subjekte einer dezentrierten, disziplinierenden und produktiven Macht unterwerfen, also zu arbeitsamen Untertanensubjekten werden, trifft er in seinen Studien zur antiken Philosophie auf Strukturierungen von Macht und Wissen, die vor dem Hintergrund einer Sorge um sich in Meister-Schüler-Verhältnissen abhängige, ohnmächtige und unwissende Akteure in selbstständige Subjekte verwandeln, die sich selbst und daher auch andere zu regieren vermögen. Diese Form der Macht wurde innerhalb der Geistes- und Sozialwissenschaften erstmals im feministischen Diskurs als Mothering beschrieben.35 Die Theorie des Mothering fußt auf der Annahme, dass Mütter 32 Niemand behauptet, dass Macht genauso wie eine physikalische Kraft funktioniert – weder Plessner, noch Foucault, Bourdieu oder ich an dieser Stelle. Daher ist es jedoch absolut notwendig, eine Anordnung der Begriffe zu finden, die unabhängig von deren Herkunft kohärent ist und eine ernsthafte Erklärungskraft für die beschriebenen Phänomene besitzt. 33 Vgl. auch Gilles Deleuze, Foucault, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1992. 34 Helmuth Plessner, „Die Emanzipation der Macht“, in: ders., Gesammelte Schriften V, hg. v. Günter Dux, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1981, S. 262. 35 Diesen Hinweis habe ich Thomas E. Wartenbergs Buch The Forms of Power zu verdanken. Vgl. Thomas E. Wartenberg, The Forms of Power: From Domination to Transformation, Philadelphia: Temple University Press 1990, S. 183ff.; Jean Baker Miller, Women and Power, Wellesley: Stone Center for Developmental Services and Studies, Wellesley College 1982; Nancy Chodorow, The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender, Berke-
146
FRANK RICHARZ
(in der Regel) nicht daran interessiert seien, ihre Kinder ein Leben lang von sich abhängig zu machen. Vielmehr sei das zunächst asymmetrische Machtverhältnis darauf ausgerichtet, die Mutter überflüssig zu machen. Das Kind solle als Erwachsener auf eigenen Beinen stehen. Die Machtstrategie des Mothering ist also nur dann erfolgreich, wenn sie sich selbst aufzuheben vermag. Damit steht sie nahezu allen anderen Beschreibungen von Macht entgegen, die Macht immer als sich selbst akkumulierend verstehen. Thomas Wartenberg löst im Anschluss an Foucault diese Form der Macht aus dem feministischen Diskurs und verallgemeinert sie unter dem Begriff der Transformative Power.36 Die transformative Macht zielt weder auf Repression noch auf unmittelbare Produktivität, sie zielt auf die Bildung eines handlungsfähigen Subjekts. Die Macht als Kraft kann also unterschiedlichste Sozialstrukturierungen generieren, die erst im Prozess der Strukturierung eine Form annehmen, die wir dann als ein bestimmtes Machtverhältnis vorfinden und analysieren können. Wenn wir unser metaphorisches Spiel weiter treiben, dann können wir Macht nicht nur als Kraft, sondern auch als Energie beschreiben. Mit dem Begriff der Energie kann man eher Speicherformen der Macht beschreiben, die in den Arbeiten von Foucault und Bourdieu eine besondere Rolle spielen. Dort findet man einerseits die Vorstellung, dass sich die Macht in Körper einzuschreiben (bei Bourdieu als Habitus)37 oder sich in Architekturen, Institutionen oder sonstigen materiellen Gebilden zu sedimentieren vermag (bei Foucault ist es das Dispositiv, bei Bourdieu die Institution bzw. das Feld).38 Jede Form potenzieller Sozialwirkung, ob sie nun aus vergangenen performativen Prozessen hervorgegangen ist oder aus anderen Gründen besteht, kann als Energie beschrieben werden, die durch ihren praktischen Gebrauch freigesetzt werden kann. Es ist müßig zu diskutieren, welche Form der anderen hier vorgängig ist – Kraft oder Energie. Aus analytischen Gründen bietet es sich an, die Energieform der
ley/Los Angeles/London: University of California Press 1978; Nancy Hartsock, Money, Sex and Power: Towards a Feminist Historical Materialism, New York/London: Longman 1983. 36 Interessanterweise erschien die englische Ausgabe der Ästhetik des Performativen unter dem Titel The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics. Die transformative Kraft der Aufführung bezieht sich bei Fischer-Lichte auf die Möglichkeit einer Schwellenerfahrung. Vgl. Erika Fischer-Lichte, The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics, New York: Routledge 2008; Vgl. Wartenberg, The Forms of Power, a.a.O., S. 183 ff. 37 Vgl. Pierre Bourdieu, Sozialer Sinn, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1993, S. 122ff.; Michel Foucault, „Die Machtverhältnisse gehen in das Innere der Körper über“, in: ders., Analytik der Macht, hg. v. Daniel Defert, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2005, S. 126-136, hier: S. 126. 38 In Abgrenzung zum physikalischen Energie-Begriff ist zu sagen, dass es Unsinn ist, einen Machterhaltungssatz aufzustellen. Da Macht performativ erzeugt wird, ist sie erheblichen qualitativen und quantitativen Schwankungen unterworfen. Es kann keine feste, sich stets erhaltende Machtmenge geben, auch nicht in geschlossenen Systemen.
VON DER AUFFÜHRUNG ZUM PERFORMATIV
147
Macht aus ihrer Kraftform abzuleiten. Dies hat auch den Vorteil, dass man soziale Akteure nicht vorschnell zu bloßen Funktions- oder Strukturträgern degradiert.39 Meine Behauptung, Macht sei einerseits eine Wechselwirkung zwischen sozialen Akteuren (Kraft) und könne andererseits materiell gespeichert werden (Energie), provoziert die Frage, wie viel diese Metaphorik mit der beschriebenen Wirklichkeit zu tun hat. Ist die Macht nur eine Als-ob-Kraft und eine Als-ob-Energie? Vollziehen sich die oben beschriebenen Prozesse nur auf einer symbolischen Ebene? Meine klare Antwort lautet: Nein. Wenn ich von Körperlichkeit oder Materialität der Macht spreche, dann meine ich damit das Gleiche wie Fischer-Lichte, wenn sie diese Termini in ihrer Ästhetik des Performativen verwendet. So verstehe ich auch Bourdieus Habitus nicht nur als eine eingebildete Geisteshaltung. Die Stärke des Habituskonzeptes liegt gerade darin, dass sich hier eine soziale Praxis (Machtpraxis) in einer sowohl geistigen als auch körperlichen Haltung figuriert.40 Bei Fischer-Lichte hieße dies embodied mind.41 Bourdieu weist darauf hin, dass der Habitus kaum mit bloßer Aufklärung zu ändern sei: „Wenn das Erklären dazu beitragen kann, so vermag doch nur eine wahre Arbeit der Gegendressur, die ähnlich dem athletischen Training wiederholte Übungen einschließt, eine dauerhafte Transformation des Habitus zu erreichen.“42 Um in die verkörperte Macht als Energie transformierend einzugreifen muss körperliche Arbeit verrichtet werden. Auch Foucault wird in diesem Punkt sehr klar: „Meine Suche geht dahin, dass ich zeigen möchte, wie die Machtverhältnisse materiell in die eigentliche Dichte der Körper übergehen können, ohne dass sie durch die Vorstellung der Subjekte übertragen werden müssen. Wenn die Macht den Körper trifft, so nicht, weil sie zunächst im Bewusstsein der Leute verinnerlicht wurde.“43 An einem Beispiel möchte ich kurz erklären, dass Macht materiell wirksam ist, also nicht notwendig einer symbolischen Form bedarf. Ein Gefängnis ist ein physisches Objekt, das bestimmte Handlungsmöglichkeiten eröffnet und andere verhindert – nur allein dadurch, dass es faktisch existiert. Doch wie das Gebäude tatsächlich genutzt und verstanden wird, hängt natürlich auch vom diskursiven, also symbolischen Rahmen ab. Wenn es allerdings zur Einsperrung genutzt wird, dann kann man sich nicht einfach aus dem Gefängnis heraus denken, nur weil man das Gefängnis nicht als Ort der Einsperrung versteht. Der physikalische Raum ist damit zu einem Machtraum geworden. Natürlich ist das Wechselverhältnis zwischen
39 Vgl. Giddens’ Kritik an Funktionalismus und Strukturalismus in: Anthony Giddens, Die Konstitution der Gesellschaft: Grundzüge einer Theorie der Strukturierung, Frankfurt a. M./ New York: Campus 1997, S. 45 ff. 40 Bereits bei Aristoteles finden wir die Idee der hexis (Habitus) als körperlich-ethischer Haltung. Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik, a.a.O., S. 81 ff., 1105b Z. 19ff. 41 Vgl. Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, a.a.O., S. 130ff. Mit gleichem Recht könnte man aber auch von enminded body sprechen. 42 Bourdieu, Meditationen, a.a.O., S. 220. 43 Foucault, „Die Machtverhältnisse gehen in das Innere der Körper über“, a.a.O., S. 129.
148
FRANK RICHARZ
symbolisch-diskursiver und materieller, imaginärer und realer Ebene in Bezug auf die Macht sehr viel komplizierter. Zuletzt bleibt noch die Frage nach der Bedeutung von ‚Wirkung‘. Mit Wirkung ist oft das Ergebnis eines Vorgangs gemeint, der auf eine Ursache zurück geht. So entsteht eine Ursache-Wirkung-Relation. Meiner Ansicht nach greift dieses Modell von Wirkung zu kurz, denn es versucht von statischen Punkten aus auf gerade die Prozesse zu schließen, die wir theatralogisch und soziologisch beschreiben möchten. Wie ich oben gezeigt habe, kann man während einer Aufführung die transformativen Kräfte in actu spüren oder zumindest bemerken, sofern sich eine Schwellenerfahrung einstellt. In der Schwellenerfahrung können wir gerade nicht zwischen Ursache und Wirkung trennen. Die Wirkung, wie sie sich in der Schwellenerfahrung zeigt, kann hier sowohl als Ausgangspunkt einer Strukturierung gesehen werden, die affirmativ oder transformativ sein kann, wie auch als der Strukturierungsprozess selbst und natürlich auch als das Ergebnis der Strukturierung. Was ich feststellen, ja spüren kann, ist das Wirken selbst, eine Ursache, die der Wirkung vorgängig wäre, kann ich nicht immer sicher ausmachen. Wenn ich oben von der Macht als dem Stoff gesprochen habe, aus dem das Soziale gewoben ist, dann meinte ich damit, dass die hier beschriebenen Wirkungen nicht nur ein analytisches Netz aus Relationen bilden, sondern tatsächlich eine gewisse Stofflichkeit entwickeln, die wir spüren können.44 Was zunächst unplausibel erscheint, soll kurz anhand physikalischer Kräfte erläutert werden. Die Welt besteht aus lauter Materie. Der Baum draußen im Hof ist genauso stofflich wie der Computer, vor dem ich gerade sitze. Schaue ich aber genauer hin und fokussiere meinen Blick auf immer kleinere Details, so stoße ich alsbald auf nichts anderes als eine Verwebung von Wirkungen, die aus sich heraus Stofflichkeit produzieren, aber selbst kaum noch als Relation zwischen stofflichen Substanzen zu beschreiben sind. Auf subatomarer Ebene verlieren stoffliche Vorstellungen mehr und mehr an Plausibilität. Was uns bleibt, wenn ich Atome, Elementarteilchen und Quarks betrachte, sind vor allem Energien. In einem ähnlichen Sinne kann man sich die Stofflichkeit der Macht vorstellen – als Effekt sozialer Wirkungen. So kann man verstehen, wieso Macht in die Körper dringt und sich in Dispositiven organisieren kann. Sie bildet eine sich stets in Bewegung befindliche Wirklichkeit, die uns umgibt, durchdringt, ja, die wir – auch – selbst sind. Dies gibt Plessners Ausspruch von ‚Menschen als Macht‘45 eine neue Wendung. Die Wirk44 So sind auch die Energien im Raum bei Fischer-Lichte nicht bloße Konstruktionen, sondern real existierende Phänomene wie das Licht oder der Schall. Auch Brian Massumi und Erin Manning sprachen in ihrem Vortrag „Propositions for Thought in Motion: Preface to Research-Creation“, den sie am 13. Juni während des Festivals InTransit 2008 im Haus der Kulturen der Welt in Berlin hielten, davon, dass soziale Relationen einen physischen Charakter hätten und nicht bloß fiktiv seien. Der Vortrag wurde leider nicht publiziert. 45 Vgl. Helmuth Plessner, „Macht und menschliche Natur. Ein Versuch zur Anthropologie der geschichtlichen Weltansicht (1931)“, in: ders., Macht und menschliche Natur. Gesammelte Schriften V, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2003, S. 185ff.
VON DER AUFFÜHRUNG ZUM PERFORMATIV
149
lichkeit der Wirkungen ist dasjenige, was die Flüchtigkeit performativer Ereignisse überdauert.46 Der körperlich-materielle Wirkungsaspekt der Macht deutet auf ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen den beiden Sozialwirkungen Macht und Mimēsis hin. Präziser ließe sich sagen, dass beide nur verschiedene Beschreibungen der gleichen sozialen Wirkkäfte sind, wobei in beiden Beschreibungssystemen unterschiedliche Perspektivierungen und Fokussierungen vorgenommen werden. Während wir mit dem Begriff der Mimēsis den Prozess des Wirkens gut beschreiben können, befasst sich die Machttheorie häufig mit Strukturierungsursachen und -resultaten. Reformuliert man beide Konzepte in einer naturwissenschaftlichen Metaphorik, dann sieht man, dass sie nahezu konvergieren. Es ist also kein Zufall, dass die Mimēsis in den Sozialtheorien Pierre Bourdieus, Erving Goffmans und Gabriel Tardes eine so wichtige Rolle spielt. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts bezeichnete Tarde die Soziologie als dasjenige Projekt, das die ‚Gesetze der Nachahmung‘ finden und beschreiben müsse.47 Damit stellt Tarde die Soziologie als Wissenschaft in eine Reihe mit der Physik und der Biologie, die beide ebenfalls auf der Suche nach Gesetzen universeller Wiederholungen seien – Schwingung in der Physik, Vererbung in der Biologie und Nachahmung in der Soziologie.48 Die Mimēsis tritt in Tardes Theorie an die Stelle, die bei Plessner und Foucault von der Macht eingenommen wird. Natürlich sind diese Theorie-Ansätze nicht vollständig zur Deckung zu bringen,49 doch bewegen sie sich genauso wie Fi46 Wenn Fischer-Lichte in ihrer Ästhetik des Performativen den Werkbegriff verabschiedet, dann als etwas, das sich aufgrund eines schöpferischen Aktes eines autonomen Subjekts vergegenständlicht. Durch die Hintertür bringt sie das Werkhafte – die Wirklichkeit – selbst wieder ins Spiel, sei es als Wirkung oder als Autopoiese. Wirkung und Werk sind etymologisch eng verwandt. Wirken bedeutet nicht nur Handeln, sondern auch das Herstellen von Artefakten, also Werken. Mit Poiesis ist im Alt-Griechischen das Gleiche gemeint. Im Gegensatz zur Handlung als praxis geht aus der poiesis immer ein Werk hervor. Maturanas Begriff der Auto-Poiesis als permanente Selbstherstellung von vielzelligen Organismen leistet bereits die gleichzeitige Beschreibung von Substanz und Prozess, um die es mir hier geht. Eine Wirkungsästhetik wird das Werkhafte, das Stoffliche nicht endgültig los, kann diese Stofflichkeit aber nun relational und prozessual denken. Vgl. Humberto R. Maturana/Francisco J. Varela, Der Baum der Erkenntnis. Die biologische Wende des menschlichen Erkennens, Bern/München: Scherz 1987. 47 Vgl. Gabriel Tarde, Die Gesetze der Nachahmung, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2009. 48 Tarde bezieht sich natürlich auf die vorherrschenden Theorien des 19. Jahrhunderts, also die Evolutionstheorie und Vererbungslehre in der Biologie und das theoretische Modell des Äthers in der Physik. Vgl. ebd., S. 31. 49 So geht es Tarde zum Beispiel um einen Prozess der Angleichung: „Eine soziale Gruppe ist eine Gruppe von Wesen, die sich gegenseitig momentan nachahmen oder einander ähnlich sind, ohne sich gegenwärtig nachzuahmen, deren gemeinsame Merkmale aber früheren Nachahmungen desselben Vorbilds entstammen.“ Ebd., S. 89. Bei Plessner und Foucault geht es eher um eine kämpferische Strukturierung zwischen Oben und Unten. Bourdieu verbindet die beiden Ansätze und ergänzt das angleichende Prinzip der Mimēsis durch das Prinzip der Distinktion. Vgl. Bourdieu, Die feinen Unterschiede, a.a.O.
150
FRANK RICHARZ
scher-Lichtes Ansatz auf eine Theorie der sozialen Wirkkräfte zu. Auf welche Weise Macht in Performativen wirksam wird, lässt sich besonders deutlich an virtuellen Performativen wie z. B. einem Pen&Paper-Rollenspiel untersuchen.
Die Untersuchung virtueller Performative Wie ich gezeigt habe, sind die meisten Performative notwendig diffus, weil ihre Grenzen vom jeweiligen Bezugssystem abhängen. Das führt dazu, dass sich eine Beobachtung im Alltag als äußerst schwierig erweist. Zudem ist es dort kaum möglich, dauerhaft im theatralen Reflexionsmodus zu verharren, um langfristige Transformationsprozesse zu beobachten. Daher habe ich begonnen, mit einem experimentellen Setting zu arbeiten, das übersichtlich und relativ klar abgegrenzt ist. Konkret sollten nicht mehr als fünf Personen involviert sein und das Performativ sollte auch möglichst wenige Bezüge zur alltäglichen Sozialwelt haben. Aus diesem Grund habe ich mich für ein Setting entschieden, das auf geteilter Fiktion basiert.50 Die gemeinsame Erschaffung einer Als-ob-Wirklichkeit in einer Live-Situation gehört in den Bereich theatraler Praktiken. Da in meinem experimentellen Setting aber keine klassische Aufführungssituation simuliert und somit auf Zuschauerrollen verzichtet werden sollte, habe ich mich gegen klassische Theatersettings entschieden. Nach einigen fruchtlosen Versuchen mit Studenten, die auf Brechts Lehrstückarbeit und Barbas Arbeit im Odin Teatret basierten, fand ich das ideale Ausgangssetting im Pen&Paper-Role-Playing Game (PPRPG). Im PPRPG gibt es keine Zuschauer, sondern nur Spieler und Spielleiter.51 Dem Spielleiter fällt die Aufgabe des Erzählers zu. Er führt in die Geschichte ein, beschreibt die imaginäre Welt und spielt alle Charaktere, die nicht von den Spielern gespielt werden.52 In der Sprache des PPRPG spielt man eine Rolle, indem man in die Haut eines sogenannten Charakters schlüpft. Die Geschichten, die man gemeinsam am Tisch sitzend erlebt, nennt man Abenteuer oder Szenarien. Diese spielen zumeist in fantastischen Welten, die durch das Spielen des PPRPG wachsen und sich zunehmend verdichten.53 Fast alle mir bekannten Rollenspielwelten lassen sich einem Genre zuordnen, zumeist Fantasy (Dungeons & Dragons, Pathfinder, 50 Dies ist eine Anlehnung an den Terminus shared fantasy, den der Anthropologe Gary Alan Fine in Bezug auf Pen&Paper-Rollenspiele geprägt hat. Vgl. Gary Alan Fine, Shared Fantasy: Role-Playing Games as Social Worlds, Chicago/London: The University of Chicago Press 1983. 51 Dieser wird auch Meister, (Dungeon-)Master oder Referee genannt. 52 Vom Spielleiter gespielte Charaktere nennt man Non-Player-Characters (NPC), von den Spielern gespielte entsprechend Player-Characters (PC). 53 Es gibt zwar unzählige Rollenspielpublikationen, in denen bereits detaillierte Welten ausgearbeitet worden sind, allerdings gehen auch diese Publikationen oft auf die Entwicklungen lokaler Spielergruppen zurück. Die Spieler erspielen sich also mit jeder Rollenspielrunde einen weiteren Teil ihrer virtuellen Wirklichkeit.
VON DER AUFFÜHRUNG ZUM PERFORMATIV
151
Das Schwarze Auge, ...), Science Fiction (Star Wars, Cyberpunk 2020, ...), Horror (Cthulhu, Vampire, Werewolf, ...) oder einer Mischung dieser Genres (Shadowrun, Schattenjäger, Freihändler). Die Handlungsmöglichkeiten der Charaktere in der imaginären Welt werden von Spielregeln bestimmt, die zum Teil so detailliert ausgearbeitet sind, dass sie mehrere Bücher füllen. Die meisten PPRPG nutzen Würfelsysteme, um den Erfolg von Handlungen in Abhängigkeit von durch Zahlenwerte ausgedrückten Eigenschaften und Fertigkeiten der Charaktere zu simulieren. Als Beispiel schauen wir uns eine einfache Kletteraktion eines imaginären Charakters an. Nehmen wir an, ein Charakter möchte über eine Mauer klettern. Seine Fertigkeit ‚Klettern‘ hat einen Prozentwert von 56%. Um nun die imaginäre Mauer zu erklettern, muss der Spieler zwei 10-seitige Würfel werfen, wobei der eine Würfel die Zehner- und der andere die Einerstelle markiert. Würfelt man eine 4 und eine 3, dann ergibt sich daraus eine 43, was unterhalb des Fertigkeitswertes von 56% liegt. Der Charakter hat seine Kletteraktion geschafft. Bei einem Würfelergebnis über 56 wäre er gescheitert.54 Der Spielleiter nimmt nach dem Wurf den narrativen Faden wieder auf und schildert die Konsequenzen dieser Aktion: „Du hast es geschafft und hockst nun auf der Mauer. Hinter der Mauer erspähst du einen weitläufigen Garten. Hinter einer Gruppe von Bäumen erkennst du die Schemen einer Person – eine Wache? Was machst du nun?“ Der Spieler antwortet in der Rolle des Charakters: „Ich flüstere meinen Gefährten zu, dass ich eventuell eine Wache gesehen habe. ‚Hey!‘ flüstere ich. ‚Werft mir bitte vorsichtig und vor allem leise das Kletterseil hoch, damit ihr nachkommen könnt. Passt bitte gut auf, denn wir wollen die Wache nicht auf uns aufmerksam machen.‘“ So oder so ähnlich vollzieht sich eine Handlung im PPRPG zwischen Spielleiter und Spielern. Für meine Fallstudien habe ich mir das PPRPG Call of Cthulhu ausgesucht, das in der Welt des Autors Howard Phillips Lovecraft angesiedelt ist und hauptsächlich ältere Spieler anspricht.55 Die Geschichten spielen in den 20er und 30er Jahren unserer Welt. Allerdings wird diese Welt auch von abscheulichen Monstern und mächtigen Gottheiten bewohnt und damit ins Fantastische verzerrt. Derzeit bin ich als Spieler an einer epischen Spielgeschichte, einer sogenannten Kampagne56 beteiligt, die mich und meine Gefährten in die Antarktis des Jahres 1933 führt.57 Ich spiele den jüdischen Archäologieprofessor Samuel Goldstein, der an der fiktiven Miskatonic University in der ebenso fiktiven Stadt Arkham unterrichtet, wo er zudem Meister vom Stuhl des lokalen Freimaurer-Ordens ist. Goldstein hat sich 54 Dieses Beispiel bezieht sich auf das Prozentsystem des Basic RPG-Systems, auf dem auch Call of Cthulhu basiert. Neben dieser Variante gibt es unzählige andere Ansätze, durch Regeln virtuelle Handlungen zu simulieren. 55 Call of Cthulhu erschien erstmals 1981 bei Chaosium. Meine Gruppe verwendet die deutsche Ausgabe. Vgl. Sandy Petersen/Lynn Willis, Cthulhu. Spieler-Handbuch: Rollenspiel in der Welt des Howard Phillips Lovecraft, Friedberg: Pegasus Press 2007. 56 Als Kampagne bezeichnet man ein komplexes narratives Konstrukt, das aus vielen Szenarien/ Abenteuern besteht und daher eine relativ lange Spieldauer hat. 57 Vgl. Charles Engan, Cthulhu: Berge des Wahnsinns. Aufbruch in die Antarktis, hg. v. Frank Heller, Bd. 1, Friedberg: Pegasus Press 2010.
152
FRANK RICHARZ
der Antarktisexpedition angeschlossen, um seine Theorie zu belegen, dass die Mayakulturen auf die Zivilisation von Atlantis zurückzuführen sind, deren Ursprung er in der Antarktis vermutet. Was für uns wie blanker Unsinn klingt, ist in der Welt von Cthulhu ein ernsthaftes Projekt. Zwar ist Goldstein ein humorvoller Mensch, aber als seriöser Wissenschaftler nimmt er seine Atlantis-Theorie sehr ernst. Begleitet wird er von seinem Studenten Aaron Winterbloom und dem zwielichtigen jungen Londoner Arzt Ebenezer Northington (beide ebenfalls von mir gespielt), der ihm von dessen Vater, einem einflussreichen englischen Freimaurer, anvertraut worden ist. Im Zuge der Expeditionsvorbereitungen freundet er sich mit dem Geologen und ehemaligen Offizier Jonas F. Weyland an, der von meinem Freund Mario,58 einem professionellen Theater- und Filmschauspieler, gespielt wird. Weyland ist etwas zurückhaltender als Goldstein und auch weniger liberal. Er legt großen Wert auf Etikette und gefällt sich zusammen mit seinem ihm treu ergebenen Kompagnon Noah Masterson in der Rolle eines Sherlock Holmes. Unsere Spielergemeinschaft wird komplettiert durch Emma, die ebenfalls zwei Charaktere spielt, nämlich die reiche Witwe und Hobbyfotografin Theresa Mayford und ihren Schwager Joshua Mayford, seines Zeichens Geologe an der Miskatonic University. So kommen wir also auf sieben Charaktere, die an der Expedition teilnehmen.59 Hinzu kommen die unzähligen Nichtspielercharaktere, die von unserem Spielleiter Malte gespielt werden. Auf der Ebene des Spiels vervielfältigen sich damit die Bezugssysteme im virtuellen Performativ (aus vier Spielern werden sieben plus x Charaktere). Hier bietet es sich an, zwischen verschiedenen Rahmen zu unterscheiden, wie Gary Alan Fine dies im Sinne der Rahmen-Analyse von Erving Goffmann für das PPRPG vorgeschlagen hat.60 Wir können nach Fine mindestens drei Rahmen unterscheiden, den gewöhnlichen Alltagsrahmen, in dem Mario ein Fernsehschauspieler ist und ich ein Theaterwissenschaftler. Darin befindet sich, das Performativ real begrenzend, der Spieler-Rahmen mit drei Spielern und dem Spielleiter, in dem die narrativen und regeltechnischen Handlungen vollzogen werden, um eine imaginäre Welt zu erschaffen, die dann den dritten Rahmen bildet – den Spiel-Rahmen. Während des Spiels sind wir jederzeit in der Lage, zwischen den Rahmen zu wechseln und wechselseitige Bezüge herzustellen.61 Der Unterschied zum alltäglichen Performativ liegt nun darin, dass allen Spielern bewusst ist, dass sie gemeinsam eine Wirklichkeit erschaffen und auch mit wel58 Die Namen meiner Mitspieler habe ich aus Gründen des Schutzes ihrer Privatsphäre geändert. 59 Mario und Emma haben noch jeweils einen ‚Notcharakter‘, falls ihre anderen beiden während der gefährlichen Expedition sterben sollten. Diese sind aber bisher noch nicht ins Spiel gebracht worden. 60 Vgl. Fine, Shared Fantasy, a.a.O., S. 181ff.; Erving Goffman, Rahmen-Analyse. Ein Versuch über die Organisation von Alltagserfahrungen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1980. 61 Goffmann nennt diesen Vorgang ‚keying‘ (up- und down-keying), was in der deutschen Ausgabe mit ‚Modulation‘ übersetzt worden ist. Vgl. ebd., S. 52ff.
VON DER AUFFÜHRUNG ZUM PERFORMATIV
153
chen Mitteln sie das tun. Zudem ist die Spielwelt jederzeit anhaltbar, wie bei einem Computerspiel, das man abspeichert. Daher ist es möglich, diesem Performativ im dauerhaften Aufführungsmodus zu folgen, da es aus kurzen Zeitsegmenten zusammengesetzt ist, zwischen denen längere Pausen liegen (in der Regel eine Woche). Ein weiterer Vorteil des PPRPG liegt darin, dass es eine transparente Rollenstruktur aufweist, sodass ich eines der zentralen Probleme aus dem zweiten biografischen Beispiel, nämlich das Scheitern der Rollenstrategie, hier noch einmal im virtuellen Raum untersuchen kann. Tatsächlich ist es so, dass ich meinen Hauptcharakter Samuel Goldstein zu Beginn des Spiels kaum ausgestaltet hatte. Ich habe ihn durch Auswürfeln mit Eigenschaften und Fertigkeiten versehen, wie es die Spielregeln vorsehen und die zugehörigen Zahlenwerte auf einem sogenannten Charakterbogen notiert. Zudem habe ich sein Alter, seinen Beruf und seinen freimaurerischen Hintergrund festgelegt. Goldsteins wohlhabende Kaufmannsfamilie sollte aus Boston stammen. Mehr wusste ich über Goldstein zu Beginn des Spiels nicht. Erst während des Spiels erfuhr ich etwas über ‚meinen‘ Vater, da mich unser Spielleiter in einem Gespräch mit ihm konfrontierte. Durch meine Gesprächsführung, meine Fragen und Antworten und meinen spontan gespielten Habitus legte ich Goldsteins Rolle als Sohn fest – selbstbewusst, aber respektvoll. Da mein Goldstein es schwer hatte, sich gegen den eindrucksvollen, da präsent gespielten Weyland zu behaupten, legte er sich in den Dialogen eine humorvolle, ja sarkastische Art zu, die von mir vorher nicht geplant war und die mein anderer Charakter Ebenezer Northington nicht aufweist. Im Wechselspiel entstand eine virtuelle soziale Wirklichkeit, die natürlich abhängig war von unserem Vermögen, unsere Charaktere ins Spiel zu bringen. Die machtmimetischen Prozesse, die nach und nach diese Wirklichkeit erzeugten, konnte man deutlicher im Spiel-Rahmen beobachten als im Spieler-Rahmen. Allerdings bestand eine klare Korrelation zwischen den Machtverhältnissen in beiden Rahmen. Emma fiel es zum Beispiel sehr schwer, ihre Charaktere ins Spiel zu bringen, da sie selbst eher zurückhaltend ist und sich im Kampf um Präsenz daher bisher kaum gegen die beiden männlichen Spieler durchsetzen konnte. So entwickelten wir über unsere Charaktere wiederum eine PatronageMacht-Strategie, die Emmas Charaktere stärken sollte. Wir verzichteten auf einige Gelegenheiten, uns in Szene zu setzen oder bereiteten gezielt für ihre Charaktere die Bühne. Ich habe gezeigt, wie sich im virtuellen Performativ machtmimetische Prozesse erfahrbar machen lassen. Dabei ist man nicht unbedingt auf Schwellenerfahrungen angewiesen. Während meiner bisherigen Untersuchungen habe ich keine einzige Schwellenerfahrung mehr gemacht, wahrscheinlich, weil das Setting zu kontrolliert ist und daher zu wenige Überraschungen bietet. Stattdessen entwickelte ich eine subtilere geistig-körperliche Aufmerksamkeit. Während ich im Geiste das Leben meines Charakters reflektierte, spürte ich an meinem Leib, den ich ihm für die Dauer der Sitzungen lieh, wie er sich durch Wechselwirkungen mit den anderen Charakteren und der Spielwelt allmählich veränderte und entwickelte. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Effekt auch auf mich selbst übergeht oder sich nach jeder
154
FRANK RICHARZ
Sitzung verflüchtigt. Die Theatralogie virtueller Performative ist eine Forschung der langen Dauer – ähnlich der anthropologischen Feldforschung. Doch anders als in Feldstudien über virtuelle Welten, wie sie etwa von Gary Alan Fine und Tom Boellstorff62 vorgelegt worden sind, geht es mir darum, gezielt eine neue Wirklichkeit zu erschaffen und diese Genese zu beschreiben statt eine bereits vorgefundene Wirklichkeit in der Sprache der Beobachteten zu erklären. Die Beschreibung eines Performativs ist stets abhängig von meinem Bezugssystem und darf daher diese Perspektive weder überspringen noch verlassen, um das ‚große Ganze‘ einzufangen. Ich beobachte mich und meine Mitspieler während dieses machtmimetischen Prozesses und lerne dabei praktisch und vor allem körperlich, wie man in begrenztem Ausmaß kontrolliert auf Sozialstrukturierungen Einfluss nehmen kann. Freilich ist die Performativ-Analyse mit einer anthropologischen Feldstudie vereinbar, doch nur durch eine genaue Abgrenzung voneinander lassen sie sich auch füreinander fruchtbar machen.63
Literaturverzeichnis Agamben, Giorgio, Was ist ein Dispositiv?, Zürich/Berlin: diaphanes 2008. Aristoteles, Poetik (Griechisch/Deutsch), übers. und hg. v. Manfred Fuhrmann, Stuttgart: Reclam 1994. —, Nikomachische Ethik, übers. und hg. v. Ursula Wolf, Reinbek b. H.: Rowohlt 2006. Austin, John L., Zur Theorie der Sprechakte, Stuttgart: Reclam 2002. Boellstorff, Tom, Coming of Age in Second Life: An Anthopologist Explores the Virtually Human, Princeton/Oxford: Princeton University Press 2008. Bourdieu, Pierre, Die feinen Unterschiede, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1987. —, Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2001. —, Sozialer Sinn, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1993. Carles, Pierre, Soziologie ist ein Kampfsport – Pierre Bourdieu im Portrait (OmU), Frankfurt a. M.: Filmedition Suhrkamp 2009. Chodorow, Nancy, The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender, Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press 1978. Deleuze, Gilles, Foucault, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1992. Dolan, Jill, Utopia in Performance: Finding Hope at the Theater, Ann Arbor: University of Michigan Press 2006. Engan, Charles, Cthulhu: Berge des Wahnsinns. Aufbruch in die Antarktis, hg. v. Frank Heller, Bd. 1, Friedberg: Pegasus Press 2010. Fine, Gary Alan, Shared Fantasy: Role-Playing Games as Social Worlds, Chicago/London: The University of Chicago Press 1983. Fischer-Lichte, Erika, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004. 62 Vgl. Fine, Shared Fantasy, a.a.O.; Tom Boellstorff, Coming of Age in Second Life: An Anthopologist Explores the Virtually Human, Princeton/Oxford: Princeton University Press 2008. 63 Der Anthropologe Tobias Rees sucht in seinem Beitrag ebenfalls nach einer neuen Verbindung von Theater(-wissenschaft) und Anthropologie. Dieser Text ist mein Angebot an ihn. Vgl. Tobias Rees, „Nach Ethnos: Über die heutige Möglichkeit einer ‚neuen‘ Begegnung zwischen Anthropologie und Theater“ in diesem Band.
VON DER AUFFÜHRUNG ZUM PERFORMATIV
155
—, „Ästhetische Erfahrung als Schwellenerfahrung“, in: Dimensionen ästhetischer Erfahrung, hg. v. Joachim Küpper/Christoph Menke, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2003, S. 138-161. —, „Einleitende Thesen zum Aufführungsbegriff“, in: Kunst der Aufführung – Aufführung der Kunst, hg. v. dies./Clemens Risi/Jens Roselt, Berlin: Theater der Zeit 2004, S. 11-26. —, The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics, New York: Routledge 2008. —, „Zuschauen als Ansteckung“, in: Ansteckung. Zur Körperlichkeit eines ästhetischen Prinzips, hg. v. Mirjam Schaub/Nicolai Suthor/Erika Fischer-Lichte, München: Wilhelm Fink 2005, S. 35-50. —/Christian Horn/Sandra Umathum (Hg.), Diskurse des Theatralen (Theatralität 7), Tübingen/ Basel: A. Francke 2005. Foucault, Michel, „Die Machtverhältnisse gehen in das Innere der Körper über“, in: ders., Analytik der Macht, hg. v. Daniel Defert, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2005, S. 126-136. —, Hermeneutik des Subjekts. Vorlesung am Collège de France 1981/1982, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004. Gebauer, Gunter/Wulf, Christoph, Mimesis: Kultur – Kunst – Gesellschaft, Reinbek b. H.: Rowohlt 1998. Gell-Mann, Murray, Das Quark und der Jaguar: Vom Einfachen zum Komplexen – Die Suche nach einer neuen Erklärung der Welt, München: Piper 1994. Giddens, Anthony, Die Konstitution der Gesellschaft: Grundzüge einer Theorie der Strukturierung, Frankfurt a. M./New York: Campus 1997. Goffman, Erving, Rahmen-Analyse. Ein Versuch über die Organisation von Alltagserfahrungen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1980. Hartsock, Nancy, Money, Sex and Power: Towards a Feminist Historical Materialism, New York/ London: Longman 1983. Küpper, Joachim/Menke, Christoph (Hg.), Dimensionen ästhetischer Erfahrung, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2003. Manning, Erin, Politics of Touch: Sense, Movement, Sovereignity, Minneapolis: University of Minnesota Press 2007. Margulis, Lynn/Sagan, Dorion, Acquiring Genomes: A Theory of the Origins of Species, New York: Basic Books 2002. Maturana, Humberto R./Varela, Francisco J., Der Baum der Erkenntnis. Die biologische Wende des menschlichen Erkennens, Bern/München: Scherz 1987. Miller, Jean Baker, Women and Power, Wellesley: Stone Center for Developmental Services and Studies, Wellesley College 1982. Petersen, Sandy/Willis, Lynn, Cthulhu. Spieler-Handbuch: Rollenspiel in der Welt des Howard Phillips Lovecraft, Friedberg: Pegasus Press 2007. Platon, „Politeia“, in: Sämtliche Werke, Bd. 2, Reinbek b. H.: Rowohlt 1994, S. 520f. Buch X, 607b ff. Helmuth Plessner, „Die Emanzipation der Macht“, in: ders., Gesammelte Schriften V, hg. V. Günter Dux, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1981, S. 259-282. —, Macht und menschliche Natur. Gesammelte Schriften V, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2003. —, „Macht und menschliche Natur. Ein Versuch zur Anthropologie der geschichtlichen Weltansicht (1931)“, in: ders., Macht und menschliche Natur. Gesammelte Schriften V, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2003, S. 135-234. Rabinow, Paul, Was ist Anthropologie?, hg. v. Carlo Caduff/Tobias Rees, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004. Sloterdijk, Peter, Du mußt dein Leben ändern: Über Anthropotechnik, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2009. Tarde, Gabriel, Die Gesetze der Nachahmung, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2009.
156
FRANK RICHARZ
Wartenberg, Thomas E., The Forms of Power: From Domination to Transformation, Philadelphia: Temple University Press 1990. Weiler, Christel, „Weiter denken – analytisch und wild zugleich“, in: Strahlkräfte: Festschrift für Erika Fischer-Lichte, hg. v. dies./Jens Roselt/Clemens Risi, Berlin: Theater der Zeit 2008, S. 28-41.
JON MCKENZIE
Die Performance von Demokratie1
In dem Sammelband Performing Democracy stellen Wissenschaftler aus aller Welt ihre Forschungen zum Thema urban-gemeinschaftlich organisierter Aufführungen vor.2 Die in ihm versammelten Aufsätze untersuchen das Phänomen der cultural performance als Instrument der sozialen Gestaltung und des demokratischen Widerstands. Ich selbst habe in den letzten Jahren die zunehmende Digitalisierung dieser performativen Praktiken untersucht und gezeigt, wie Gruppen wie das Critical Art Ensemble und das Electronic Disturbance Theater durch die Verschmelzung von Kunst, Aktivismus und Technologie neue Praxen des zivilen, elektronischen Widerstands erzeugen.3 Ein Interesse an der Performance von Demokratie unterliegt, wie ich glaube, einem Großteil der Forschung zur cultural performance der letzten fünfzig Jahre: Es durchzieht nicht nur die Arbeiten über das politische Theater der sechziger Jahre, sondern auch die Forschungen zu ACT-UP und NEA Four4 aus den achtziger und neunziger Jahren ebenso wie die aktuellen Studien über gemeinschaftlich organisierte Aufführungen und andere Formen des zivilen Ungehorsams – ganz gleich, ob es sich dabei um Proteste im Sinne der ‚direct action‘ oder im Rahmen der neu ent1 Anmerkung der Herausgeber: Der Aufsatz wurde aus dem Amerikanischen übersetzt und erschien erstmals 2003. Vgl. Jon McKenzie, „Democracy’s Performance“, in: The Drama Review 47, 2 (2003). Zur Semantik des angloamerikanischen Performancebegriffs gehört nicht nur die Dimension der Aus- und Aufführung, sondern auch Werte wie Leistung, Effizienz und Wirksamkeit, welche die Semantik des dt. Aufführungsbegriffs übersteigen. Da McKenzies Argumentation im Folgenden auf dieser weiteren Semantik des englischen Performancebegriffs aufbaut, haben wir auf seine Übersetzung ins Deutsche weitgehend verzichtet. 2 Vgl. Susan C. Haedicke/Tobias Nellhaus (Hg.), Performing Democracy: International Perspectives on Urban Community-Based Performance, Ann Arbor: University of Michigan Press 2001. 3 Vgl. Jon McKenzie, „Int3rh4ckt!v!ty“, in: Style 30:2 (1999), S. 283-299; ders., „Towards a Sociopoetics of Interface Design: etoy, eToys, TOYWAR“, in: Strategies: A Journal of Theory, Culture and Politics 14:1 (2001), S. 121-138; ders./Ricardo Dominguez, „Dispatches from the Future: A Conversation on Hacktivism“, in: Connect: art. politics. theory. practice 2 (2001), S. 115-122. 4 Anmerkung der Herausgeber: Die AIDS Coalition To Unleash Power (ACT-UP, 1987 von Larry Kramer gegründet) war in den 1980-90er Jahren eine soziale Bewegung in den USA und Europa, die u. a. durch Dramentexte und -aufführungen versuchte, gesellschaftliche Aufmerksamkeit für die sich ausbreitende Krankheit zu erzeugen. NEA Four bezeichnet eine Gruppe von vier Performancekünstlern, die in den 1990er Jahren im Rahmen der US-amerikanischen cultural wars gegen staatliche Einflussnahmen protestierten und klagten; Stipendien der US-Behörde National Endowment for the Arts (NEA) wurden ihnen zunächst zugesagt, dann aber aufgrund des ‚sexuellen Inhalts‘ ihrer Arbeiten doch verweigert.
158
JON MCKENZIE
stehenden elektronischen Medien handelt. Tatsächlich könnten wir das Feld der Performance Studies selbst auch als ein globales Testgelände betrachten, auf dem performative Formen von Kreativität, Kooperation und Demokratie erforscht werden. Die Wertschätzung des Testens zeigt sich hier an unserer Begeisterung für Experiment und Methode, unserem Enthusiasmus bei der Infragestellung kultureller Normen und beim Protest gegen soziale Ungerechtigkeit. Testen beeinflusst unsere Forschung, deren administrative Verwaltung und Lehre. Es beeinflusst nicht nur, wie wir unsere performativen Untersuchungsgegenstände analysieren, sondern auch, wie wir den Arbeiten unserer Kollegen und Studenten begegnen – beide stellen wir regelmäßig auf die Probe. Gründend in der Bemühung, die eigene Arbeit in Forschung und Lehre mit experimentellen Methoden zu bereichern, blickt das Feld der Performance Studies auf eine lange Tradition zurück, seine eigene Institutionalisierung zu hinterfragen. Dieser Aufsatz widmet sich einem zweiten Testgelände der Performance von Demokratie, das auf die normativen Dimensionen von Aufführungen besonderes Gewicht legt. Auch hier werden Demokratie, Performance und das Testen thematisch. Mein Beitrag gliedert sich in drei Teile: Der erste befasst sich mit einer Rede des amerikanischen Präsidenten George W. Bush, der zweite mit Nietzsches Fröhlicher Wissenschaft und der dritte Teil mit ‚frustrierten Demokraten‘. Die hier verfolgten Gedanken entstammen Überlegungen, die ich zuerst in meinem Buch Perform or Else angestellt habe.5 Dort beleuchte ich Performance nicht allein als eine Form des Widerstands und der Transgression, sondern ebenso als eine der Normierung und Herrschaftsausübung. Um die Hypothesen meines eigenen Klappentextes zusammenzufassen: Ich glaube, dass Performance für das 20. und 21. Jahrhundert das gewesen sein wird, was Disziplin für das 18. und 19. Jahrhundert war – eine onto-historische Verschränkung von Wissen und Macht. Ausgehend von den Arbeiten Butlers, Lyotards und Marcuses, nenne ich diese Formation ‚Performance-Stratum‘. Dabei handelt es sich um ein Schichtungsphänomen, welches partiell aus der Überlagerung unterschiedlicher Performance-Typen besteht: Performance nicht nur kultureller, sondern auch organisatorischer und technologischer Art. Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg haben Manager und Organisationstheoretiker die Performance von Arbeitern und Institutionen studiert und geplant, während Ingenieure und Computerwissenschaftler high performance Militär- und Kommunikationstechnologien entwickelt haben. Vom Annual Performance Review, der jährlichen Leistungsüberprüfung von Angestellten, bis zu high performance Raketensystemen – und ja, auch bis hin zu Ritualen und Theater – gegenwärtig umfasst der Performance-Begriff ein riesiges Spektrum zeitgenössischer Phänomene. Alle Kulturen, alle Organisationen, alle technischen Systeme können heute anhand unterschiedlicher, dabei aber historisch verwandter Performance-Modelle betrachtet werden. Wobei den bereits angeführten Paradigmen noch die finanzielle Performance des Aktienmarkts, die Lern-Per5 Vgl. Jon McKenzie, Perform or Else: From Discipline to Performance, London: Routledge 2001.
DIE PERFORMANCE VON DEMOKRATIE
159
formance von Schülern sowie die sexuelle Performance hinzugefügt werden können. Alle diese Modelle sind Teil des Performance-Stratums, zu dessen Entstehung sie beigetragen haben und auf dessen Grundlage sie nun immer enger werdende Verbindungen eingehen. Bei diesem Performance-Stratum geht es weniger um die Ablösung des Industriekapitalismus der Disziplin und ihrer Kolonialisierungsprojekte im Namen der Aufklärung. Vielmehr bedeutet es ihre Verschiebung und Neu-Einschreibung in die digitalen Schaltkreise unserer postkolonialen, postmodernen Welt. Hier weicht das alphabetische Archiv der digitalen Datenbank und die Fabrik dem Wohnzimmer. Einst vom Establishment gering geschätzte Lebensweisen werden nun in Establishments überall auf der Welt für geringste Schätze verkauft, runtergesetzt an Orten wie Benetton, Gap und Starbucks. Begehren wird dadurch un-diszipliniert: mehr und mehr performt es. Kurz: Performance ist zur Macht-Matrix der Globalisierung geworden, weshalb ich behaupte, dass wir dabei sind, in ein Zeitalter globaler Performance einzutreten.
George W. Bush und der Wille zur Macht Am 20. September 2001 hielt Präsident George W. Bush vor dem versammelten Kongress und einem globalen Fernsehpublikum eine Rede. Zu behaupten, dass an diesem Abend die ganze Welt zuschaute, ist keine Übertreibung. Ich werde mich hier auf zwei Passagen der Rede konzentrieren. In der ersten identifiziert der Präsident die Verantwortlichen für die Angriffe des 11. September und verortet sie in einer historischen und, wenn man so will, philosophischen Perspektive. „The evidence“, so Bush, „all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as al Qaeda“. Und er fährt fort: „Americans are asking, why do they hate us? They hate what we see right here in this chamber – a democratically elected government.“ Und jetzt kommt die Stelle, die mich vor allem interessiert: „We have seen their kind before. They are the heirs of all the murderous ideologies of the 20th century. By sacrificing human life to serve their radical visions – by abandoning every value except the will to power – they follow in the path of fascism, and Nazism, and totalitarianism.“6
Sechs Wochen später, am 7. Dezember, benutzt Bush dann erneut sehr ähnliche Ausdrücke in seiner Rede zum Gedenken an den Angriff auf Pearl Harbor: „We’ve
6 George W. Bush, „Address to a Joint Session of Congress and the American People“, in: http://web.archive.org/web/20011207212934/www.whitehouse.gov/news/releases/2001/ 09/20010920-8.html (Stand: 2.3.2012). Hervorhebungen v. McKenzie.
160
JON MCKENZIE
seen their kind before. The terrorists are the heirs to fascism. They have the same will to power, the same disdain for the individual, the same mad global ambitions.“7 Ich interessiere mich hier für das Konzept des ‚Willens zur Macht‘, das der Präsident evoziert, und für die performative Kraft seiner Rede vor dem Kongress. Vermutlich sind die Mitglieder von Al-Qaida keine großen Nietzsche-Leser. Auch Präsident Bush, so nehme ich an, hat nicht sehr viel Zeit mit diesen schwierigen Texten verbracht. Hätte er sie gelesen, dann würde er vielleicht ahnen, dass der ‚Wille zur Macht‘ nicht ein distinktes Etwas ist, sondern Vieles, und dass seine Reduzierung auf die Visionen machthungriger Individuen den kürzesten Weg zu einem Missverständnis des Nietzsche-Textes darstellt. Meiner Ansicht nach (und ich lasse hier Deleuze, Guattari, Foucault und viele andere durch mich hindurch sprechen) ist der ‚Wille zur Macht‘ am besten im Sinne eines Kräftefeldes zu verstehen, das in allen erdenklichen Formen und Vorgängen am Werke ist, ob lebendig oder tot. Er ist ein unaufhörliches Wogen aus Differenz und Wiederholung, das die gesamte natürliche und soziale Welt durchdringt, all unsere Versuche vereitelnd, das Existierende in zwei zu teilen: Natur/Kultur, physis/techne, Leben/Tod. Weil er mit sich selbst nicht identisch ist, ist die Frage nicht so sehr ‚Was ist der Wille zur Macht?‘, sondern ‚Welcher?‘. Welcher Wille zur Macht, welche Kräfteformation ist hier am Werk? Welche Form nimmt er an? In welcher Handlung, in welcher Leidenschaft? Agiert oder reagiert er? Wird Differenz bekräftigt oder negiert? Und wie lässt sich der Ton dieser Bekräftigung oder Negierung beschreiben? Erinnern wir uns daran, dass Derrida in Signatur, Ereignis, Kontext Austin und Nietzsche gerade im Hinblick auf die Kraft performativer Äußerungen miteinander in Beziehung setzt.8 Und erinnern wir uns ebenfalls daran, dass Austin selbst argumentiert, dass performative Akte sich nicht auf die gesprochene Sprache beschränken9 – und in der Tat: Gesten, Unterschriften und, im weiteren Sinne, jede Art und Weise eine Markierung oder Differenz hervorzubringen, können performativ sein. Aus dieser Perspektive ist die wichtigste zu treffende Unterscheidung weder eine zwischen linguistischen und ‚verkörperten‘ Performances, noch eine zwischen performativen und konstativen Akten, sondern vielmehr die zwischen verschiedenen Formen von Performativität, unterschiedlichen Formationen von illokutionären und perlokutionären Kräften. Solche komplexen Formationen können dann vielleicht als Instanziierungen des Willens zur Macht begriffen werden. Aus diesem Grund möchte ich behaupten, dass die Performance von Präsident Bush im September 2001, weit entfernt davon, den Willen zur Macht zu bekämpfen, de facto 7 George W. Bush: „President: We are Fighting to Win – And Win We Will: Remarks by the President on the USS Enterprise on Pearl Harbor Day. USS Enterprise“, in: http://web.archive.org/web/20011209224952/www.whitehouse.gov/news/releases/2001/12/20011207. html (Stand: 2.3.2012). 8 Vgl. Jacques Derrida, „Signatur, Ereignis, Kontext“, in: ders., Randgänge der Philosophie, Frankfurt a. M./Berlin/Wien: Ullstein 1976, S. 124-155. 9 Vgl. John L. Austin, Zur Theorie der Sprechakte, Stuttgart: Reclam 2002.
DIE PERFORMANCE VON DEMOKRATIE
161
eine spezifische Aufführung eben dieses Willens zur Macht war (ebenso wie jede Kritik an ihr, wie ich anmerken sollte, meine eigene eingeschlossen). Damit komme ich zur zweiten Passage seiner Rede vor dem Kongress. An einer Schlüsselstelle seiner Ansprache wendet sich der Präsident in seinen Ausführungen von seinem heimischen Publikum ab und richtet sich an die gesamte Welt, wodurch seine eigenen irrsinnigen, globalen Ambitionen zutage treten. „Every nation, in every region now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists. From this day forward, any nation that continues to harbor or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime“.10 Wir sollten hier für einen Augenblick über die performative Kraft nachdenken, die dieser Äußerung innewohnt – und die Bedingungen, die über ihren Erfolg und Misserfolg entscheiden. Ich werde nur die groben Züge einer solchen Lesart zeichnen und mich dabei eng an Austin halten. Das entweder/oder-Ultimatum des Präsidenten spaltet die Welt in zwei Lager: ein ‚wir‘ und ein ‚die‘, Freiheit versus Tyrannei, Gut versus Böse, Demokratie versus den Willen zur Macht. Es statuiert eine Trennung und verlangt eine Entscheidung. Mit einem Wort: Es ist ein Test, ein globaler Test der Performance von Demokratie in einer neuen Weltordnung. Im Grunde fordert Präsident Bush mit diesem Test die Staaten dieser Welt auf, zu performen – oder sonst ... Entweder Regierungen performen im Einklang mit diesem ‚Krieg gegen den Terrorismus‘ oder sie bekommen es mit den high performance Waffensystemen der USA zu tun. Dieser ent- und zugleich unterscheidende Test lässt sich als die illokutionäre Kraft auffassen, die der Sprechakt des Präsidenten zu entfalten sucht. Doch Präsident Bushs Kampfansage birgt zudem eine perlokutionäre Kraft: Sie produziert Sekundäreffekte. Angesichts der enormen Macht seiner Vortragsmaschinerie und deren weltweiter Reichweite sind diese Effekte von labyrinthischer Komplexität, aber ich denke, wir können sie bereits bei der Arbeit beobachten – in Tschetschenien, auf den Philippinen, im Mittleren Osten und anderswo. Und noch über diese bereits reichlich besorgniserregenden Wirkungen hinaus können wir fragen: Welche Auswirkungen wird sein performativer Akt auf die Konsolidierung des gerade entstehenden Performance-Stratums haben, auf diese neue Weltordnung, dieses Weltreich, diesen integrierten Schaltkreis, der stolz von sich behauptet, er sei demokratisch – in welchem die USA mal als der oberste Herrscher auftritt, mal als Topmanager und mal als zögerlicher, gleichwohl aber als umso kraftvollerer Polizist? Dies bringt mich zurück zum ersten, anfangs von mir erwähnten globalen Testgelände: demjenigen, das sich aus Orten des Widerstands konstituiert, wie sie sich im Band Performing Democracy beschrieben finden, aus politisch engagierten Theatern, aus Hacktivist-Webseiten und – noch allgemeiner – aus dem Feld der Performance Studies. Welche Beziehung besteht zwischen diesen beiden Orten der Auf-
10 Bush, „Address to a Joint Session of Congress and the American People“, a.a.O.
162
JON MCKENZIE
und Ausführung von Demokratie: den Orten des Widerstands, die wir so eingehend erforschen, und den Machtzentren der neuen Weltordnung? Ich bin mir nicht sicher, dass wir ohne weiteres annehmen können, wir hätten es hier einmal mit einem Lokalisierungs-, das andere mal mit einem Globalisierungsphänomen zu tun; dass es in dem einen Fall um cultural performance geht, im anderen um eine Performance techno-organisatorischer Art. Schließlich kombinieren zum Beispiel die Praktiken des zivilen, elektronischen Protests experimentelle Kunst, soziale Gestaltung und technisches Know-How. Außerdem arbeiten diese Künstler, Aktivisten und Programmierer zusammen an Performances, die global produziert, jedoch lokal situiert sind: in Chiapas, in Seattle, in Frankfurt. Auf der anderen Seite, dies zeigen Michael Hardt und Antonio Negri in Empire, sind die organisatorischen und technologischen Netzwerke der gegenwärtigen Macht zunehmend von Formen der immateriellen Arbeit und der biopolitischen Kontrolle beherrscht, die Aspekte wie Differenz, Ephemeralität und site specifity aufwerten, also Aspekte eines Terrains, für das eigentlich die Performance Studies Ansprüche angemeldet haben.11 Vielleicht gibt es dann also nur ein Testgelände, einen globalen Platz, auf dem sich gerade eine Vielzahl von Demokratie-Experimenten abspielen. Seit 1989 sind eine Menge neuer demokratischer Staaten entstanden: einigen geht es gut, andere haben zu kämpfen und sind vom Scheitern bedroht. Zu beobachten ist auch, wie bereits fest etablierte Demokratien die Wahrnehmung von Schlüsselfunktionen immer häufiger an trans- oder supranationale Institutionen abtreten, wodurch Politikwissenschaftlern mit Themen wie ‚außerstaatliche demokratische Prozesse‘ und ‚Ende des Nationalstaates‘ reichlich Stoff zum Nachdenken entsteht. Indes führen Menschen überall auf der Welt in ihrem täglichen Leben und Existenzkampf Demokratie auf und aus. Und nur damit es nicht vergessen wird: George W. Bush agiert im Namen einer freien und demokratischen Welt, mit einer breiten öffentlichen Unterstützung in den USA. All dies begründet das Testgelände der Performance von Demokratie.
Performance, Demokratie und Die Fröhliche Wissenschaft Nietzsche zufolge besteht ein enges Verhältnis zwischen Aufführung und Demokratie. Mit diesem Verhältnis befasst er sich im fünften Buch seiner Fröhlichen Wissenschaft12, in einem als Vorhersage auftretenden Kapitel mit dem Titel Inwiefern es in Europa immer ‚künstlerischer‘ zugehn wird. Obwohl Nietzsche oft und in enthusiastischer Weise den Künstler, Schöpfer und Maskenspieler feiert, geben uns die Anführungsstriche in ‚künstlerischer‘ den Wink, dass hier etwas vor sich geht und 11 Vgl. Michael Hardt/Antonio Negri, Empire, Cambridge: Harvard University Press 2000. 12 Vgl. Friedrich Nietzsche, „Die fröhliche Wissenschaft“, in: ders., Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 2, hg. v. Giorgio Colli/Mazzino Montinari, Berlin/New York: Walter de Gruyter 1973.
DIE PERFORMANCE VON DEMOKRATIE
163
Nietzsche einen anderen Weg als üblich einschlägt. Der Autor der Geburt der Tragödie und der Dionysos-Dithyramben wendet sich jetzt gegen Schauspieler, gegen Rollenspiele und sogar und vor allem gegen Performance, ‚gute Performance‘, oder, wie er es nennt: gutes Spiel. Bezeichnenderweise vermengt die Aufführung, gegen die Nietzsche sich hier wendet, das Theatrale mit dem Beruflichen, wodurch sie die Ausführenden benutzt und missbraucht. Nietzsche schreibt: „Die Lebens-Fürsorge zwingt auch heute noch – in unsrer Uebergangszeit, wo so Vieles aufhört zu zwingen – fast allen männlichen Europäern eine bestimmte Rolle auf, ihren sogenannten Beruf; Einigen bleibt dabei die Freiheit, eine anscheinende Freiheit, diese Rolle selbst zu wählen, den Meisten wird sie gewählt. Das Ergebniss ist seltsam genug: fast alle Europäer verwechseln sich in einem vorgerückteren Alter mit ihrer Rolle, sie selbst sind die Opfer ihres ‚guten Spiels‘ […].“13
Was Nietzsche mit seiner Rede vom ‚guten Spiel‘ beschreibt, ist meiner Ansicht nach die Entstehung des Performance-Stratums (Ich sollte kurz darauf hinweisen, dass drei führende Theoretiker normativer Performance – Butler, Lyotard und Marcuse – allesamt Nietzsche-Leser waren). Laut Nietzsche werden in der Zukunft des ‚guten Spiels‘ die Menschen das Opfer ihrer eigenen Rollen und Handlungen. Bemerkenswert ist, dass er dieses ‚Spiel‘ mit Demokratie und mit Amerika in Beziehung bringt. Obwohl er das ‚gute Spiel‘ anfangs lediglich mit Blick auf europäische Männer behandelt, platziert er es in der Folge in einem weitaus größeren Kontext und verbindet es mit einem gewissen ‚kecken Glauben‘, der in demokratischen Zeitaltern zu finden sei: „[J]ener Athener-Glaube, der in der Epoche des Perikles zuerst bemerkt wird, jener Amerikaner-Glaube von heute, der immer mehr auch Europäer-Glaube werden will: wo der Einzelne überzeugt ist, ungefähr Alles zu können, ungefähr jeder Rolle gewachsen zu sein, wo Jeder mit sich versucht, improvisirt [sic], neu versucht, mit Lust versucht, wo alle Natur aufhört und Kunst wird…“14
Zu sagen, Nietzsche sei kein Freund der Demokratie und der Massen, ist ein Gemeinplatz. Ich denke aber, man muss hier genauer sein und hinzufügen, dass er kein Befürworter einer Demokratie im Banne der modernen Nationalstaats-Idee war, einer Vorstellung von ‚Volk‘, in der die Kräfte und Energien des Einzelnen allein dazu dienen, etablierte Ordnungen zu erhalten oder sich in Rollen abzuplagen, mit denen die Möglichkeiten der Zukunft abgestumpft und verschlossen werden. Dies genau ist die Gefahr, die er hinter dem ‚guten Spiel‘ der allzu-amerikanischen ‚guten Performance‘ wittert. Paradoxerweise sind es gerade die Experimente des Schauspieler-Werdens, in denen Nietzsche eine Unfähigkeit zum Schöpfertum verortet, eine Unfähigkeit, wie ein Architekt zu bauen, zu planen, zu organisieren und eine Zukunft zu entwerfen, die Jahrtausende umfasst:
13 Ebd., S. 277. 14 Ebd., S. 277f.
164
JON MCKENZIE
„Es stirbt eben jener Grundglaube aus, auf welchen hin Einer dergestalt rechnen, versprechen, die Zukunft im Plane vorwegnehmen, seinem Plane zum Opfer bringen kann, dass nämlich der Mensch nur insofern Werth hat, Sinn hat, als er ein Stein in einem großen Baue ist: wozu er zuallererst fest sein muss, »Stein« sein muss... Vor Allem nicht – Schauspieler!“15
Um es noch einmal zu sagen: Diese Passagen stehen im Widerspruch zu vielen anderen, in denen Nietzsche die Existenz des Künstlers, des Schauspielers und des Maskenträgers nicht allein begrüßt, sondern ihrem Dasein in ganz grundsätzlicher Weise Modellcharakter verleiht. Vielleicht markiert ja sogar dieses Spiel, das wir hier bei Nietzsche finden, dieses Hin und Her zwischen dem Theatralen und Anti-Theatralen, den Einbruch der Performance in das moderne Denken, die Entstehung von Performance als einem Problem, einem Feld der Auseinandersetzung. Es geht Nietzsche in der Fröhlichen Wissenschaft nicht um die Absetzung der Kunst und die Inthronisierung der Wissenschaft. Er stellt vielmehr Künstler gegen Künstler und Wissenschaftler gegen Wissenschaftler. Um genau zu sein: Er lässt den Architekten gegen den Schauspieler antreten und den fröhlichen Wissenschaftler gegen den allzu ernsten Wissenschaftler. Durch diese Wettkämpfe versucht er eine neue Art von Wissenschaft hervorzubringen, eine andere Kunst, eine fröhliche Wissenschaft, eine, die uns nicht nur dazu auffordert, die uralte Trennung anzuzweifeln, die zwischen Kunst und Wissenschaft besteht, sondern dazu, sie zu überwinden. Wir wollen deshalb fragen: Wie kann eine fröhliche Wissenschaft heute aussehen, eine Wissenschaft, die uns dabei helfen könnte, über das Testgelände nachzudenken, auf dem die Performance von Demokratie stattfindet? Hier erweist sich die Bedeutung der Arbeiten Avital Ronells. In The Test Drive, ihrer provozierenden Lektüre der Fröhlichen Wissenschaft, stellt Ronell die folgenden Fragen: „What is a science that predicates itself on gaiety without losing its quality of being a science? And how does Nietzsche open the channels of a scientificity that, without compromising the rigor of inquiry, would allow for the inventiveness of science fiction, experimental art and, above all, a highly stylized existence?“16
Diese Fragen sind nicht nur erkenntnistheoretischer, sondern onto-historischer Natur: Sie haben mit unserem Dasein und mit unserer Zeit zu tun. Für Ronell liegt die Bedeutung, die Die Fröhliche Wissenschaft heute haben kann, in dem Ereignis, auf das sie von ferne verweist, einem Ereignis, das eng mit Technologie und den Anforderungen des Testens verbunden ist. Sie schreibt: „Gay Sci signals to us today the extend to which our rapport to the world has undergone considerable mutation
15 Ebd., S. 278f. 16 Avital Ronell, „The Test Drive“, in: Deconstruction Is/In America: A New Sense of the Political, hg. v. Anselm Haverkamp, New York: New York University Press 1995, S. 200-220, hier: S. 201.
DIE PERFORMANCE VON DEMOKRATIE
165
by means of our adherence to the imperatives of testing.“17 Ronell zufolge lässt die Die Fröhliche Wissenschaft eine Verbindung mit einer neuen experimentellen Gesinnung erkennen, einer Einstellung, die Nietzsche vor einhundert Jahren ankurbelte und die sie für uns nun neu hochfährt, als den Test Drive. Und genau darin liegt die heikelste aller Herausforderungen – zumindest für jemanden mit einer Ausbildung in den Künsten, den Geisteswissenschaften oder irgendeiner anderen Schule der Kulturkritik – die Herausforderung, das ununterbrochene Testen, das in Wissenschaft und Technologie stattfindet, nicht nur als Gegenstand der Kritik aufzufassen, als Aktivität, die es infrage zu stellen und zu negieren gilt, sondern auch als eine Performance, die bejaht werden kann und bejaht werden muss. Für mich ist dies der schwierigste Test, den die fröhliche Wissenschaft heute zu bestehen hat: „Testing, which our Daseins encounter every day in the form of SAT, GRE, HIV, MCATS, FDA, cosmetics, engines, stress, and arms testing, 1-2-3-broadcast systems, and testing your love, testing your friendship, in a word, testing the brakes – was located by Nietzsche mainly in the eternal joy of becoming.“18
Sie fragen sich vielleicht: Soll das ein Witz sein? Den Test Drive bejahen? Aber überlegen Sie mal: Gegen Kunst und Wissenschaft zu sein und Technik, Technologie, Kreativität und Analytik zu verneinen – ist das nicht eine der bequemsten Haltungen und eines der größten Vorurteile, die man überhaupt einnehmen und haben kann? Um es noch zu verkomplizieren: Beinhaltet Kritik und sogar Kritik an der Kritik nicht immer, dass man etwas auf den Prüfstand stellt und es testet, nicht ein für allemal, sondern immer und immer wieder? Und um es noch komplizierter zu machen: Sind die meisten engagierten Künstler und Aktivisten nicht gerade diejenigen, die mit ihren Materialien, ihren Bündnissen und ihren Leben experimentieren – die sie alle in gewisser Weise einem Test unterziehen? Im Zeitalter globaler Performance wird die ganze Welt zum Testgelände. Die große Herausforderung ist daher: diese Teststruktur zu negieren und zu bejahen.
Frustrierte Demokraten Im nie ins Deutsche übersetzten ‚Political Preface‘ zur zweiten Auflage von Eros and Civilization berichtet Herbert Marcuse 1966 von einer Hoffnung, die er einst gehegt habe. Seine Hoffnung war, dass die Gesellschaft eines Tages in der Lage sein 17 Ebd., S. 201. 18 Ebd., S. 206. Anm. des Übersetzers: SAT (Scholastic Aptitude Test; auch Scholastic Assessment Test): Standardisierter Studierfähigkeitstest für Highschool-Absolventen; GRE (Graduate Record Examination): Test zur Aufnahme in amerikanische Graduate Schools; MCAT (Medical College Admission Test): Test zur Aufnahme in amerikanische Medical Schools; FDA (Food and Drug Administration): Amerikanische Bundesbehörde für die Lebensmittelüberwachung und Arzneimittelzulassung.
166
JON MCKENZIE
werde, die Ausübung der ‚fröhlichen Wissenschaft‘ zu erlernen, einer Wissenschaft jenseits der Sublimierung des Eros zur technologischen Rationalität, diesem Realitätsprinzip, das er das ‚Leistungsprinzip‘ (‚performance principle‘) nennt. Erlernt werden sollte insbesondere, „how to use the social wealth for shaping man’s world in accordance with his Life Instincts, in the concerted struggle against the purveyors of Death.“19 Kurz: „[...] how to live in joy without fear.“20 Später habe er einsehen müssen, dass diese Hoffnungen übertrieben optimistisch gewesen waren, denn er habe die Macht einer Dynamik vollkommen unterschätzt, die er ‚demokratische Introjektion‘ nennt. Es sei dies ein mit aller ‚politischer Finesse‘ geschmückter Prozess, der „[...] permits people (up to a point) to choose their own leaders and to participate (up to a point) in the government which governs them – [while] it also allows the masters to disappear behind the technological veil of the productive and destructive apparatus which they control.“21
Marcuse schrieb dies 1966. Heute gilt es erneut zu fragen: Welche Chancen hat die fröhliche Wissenschaft auf dem Testgelände der Performance von Demokratie? Könnte es eine fröhliche Wissenschaft geben, die nicht jenseits der Performativität liegt, sondern die innerhalb des Performance-Stratums ans Licht gelangen kann? Angesichts der theoretischen Komplexität und der enormen technischen Vielfalt der heutigen Performance-Landschaft schlage ich vor, sie als ein Feld zu betrachten, das sich in besonderer Weise zur Ausübung der fröhlichen Wissenschaft eignet: um sie zu erfinden, sie zu erproben, sie überhaupt erst ‚reinzulassen‘ und ihr eine Chance zu geben. Unterdessen kann uns die fröhliche Wissenschaft vielleicht auch eine fiktive oder Sci-Fi-Methode liefern, mit der wir über die Grenzen der vielen Paradigmen der Performance-Forschung hinweg operieren können: kulturelle, organisatorische und technologische, aber auch darüber hinaus. Mit dieser fröhlichen SciFi ist es vielleicht auch möglich, verschiedene Performance-Typen daraufhin zu befragen, welche affektive Atmosphäre sie umgibt, wie ihre Kräfteverteilung aussieht und welcher Machtwille in ihnen am Werk ist. Die Herausforderung liegt darin, nicht nur verschiedene Arten der performativen Evaluierung zu untersuchen, sondern diese selbst wiederum zu evaluieren, um auf diese Weise neue Typen, neue Performances, und vielleicht auch neue demokratische Formen hervorzubringen. In dem nun folgenden, letzten Teil meiner Ausführungen werde ich einige Forschungen vorstellen, mit denen ich gerade erst begonnen habe. Sie befassen sich mit einem Performance-Paradigma, das noch einmal eine ganz andere Perspektive auf die Performance von Demokratie eröffnet. Ich bin mir noch nicht sicher, welchen Namen es tragen soll. Ich werde es hier provisorisch ‚Regierungsperformance‘ nennen. Eine Möglichkeit, sich ihm zu nähern, ist durch die organisatorische Per19 Herbert Marcuse, Eros and Civilization: A Philosophical Enquiry into Freud, Boston: Beacon Press 1966, S. XI. 20 Ebd., S. XIV. 21 Ebd., S. XII.
DIE PERFORMANCE VON DEMOKRATIE
167
formance. Im Jahr 1993 verabschiedete der US-amerikanische Kongress das Gesetz über die Performance und Bilanzen von Regierungsbehörden (Government Performance and Results Act). Dieses Gesetz rief den National Performance Review ins Leben, ein regierungsweites Programm zur Effizienzsteigerung aller Bundesministerien und -maßnahmen. Als Ziel dieser Initiative nannte Al Gore die Schaffung einer Regierung, die „works better and costs less.“22 Dabei handelte es sich keineswegs um eine einmalig durchgeführte Prüfung der Performance, sondern um eine jedes Jahr stattfindende Begutachtung, ob Ministerien effizient und effektiv performen. Und die Prüfung der Performance war nur der Anfang. Worum es eigentlich ging, war die Verbesserung der Performance: Die jährlichen Reporte machten Verbesserungsvorschläge, aus denen ein Performance-Plan hervorging, der wiederum eine Auflistung der jeweiligen Performance-Ziele enthielt. Im Jahr darauf wurde dann gefragt, inwiefern diese Ziele erreicht werden konnten – und so begann der ganze Prozess von neuem. Dieser Ablauf wiederholte sich während der gesamten acht Jahre der ClintonRegierung. In ihm kommt der ausdrückliche Wunsch nach Verbesserung der Regierungsperformance zum Ausdruck, ein Projekt, das sich moderner Business- und Management-Methoden bedient. Der in ihm durchlaufene Performance-Zyklus sieht so aus: messen, begutachten, optimieren, implementieren – und dies immer und immer wieder. So sieht der Test Drive des National Performance Review aus, dessen Resultat man sich etwa in dem Bericht für den Zeitraum von 1999 bis 2000 anschauen kann. In diesem ‚Performance-Plan‘ werden einige der ‚strategischen Ziele‘ des Außenministeriums vorgestellt – eine Art Aufgabenliste (Abb. 1). Hinsichtlich der Performance von Demokratie ist vor allem der letzte Punkt wichtig: Steigerung der Bereitschaft anderer Regierungen zur Achtung demokratischer Verfahren und der Menschenrechte. Obwohl der National Performance Review dem Feld der Organisations-Performance angehört, ragt der Plan des Außenministeriums auch in einen anderen Bereich hinein: in das Paradigma der Performance von Regierungen. Um dieses Paradigma besser verstehen zu können, habe ich meinen Ausführungen ein Dokument der U.S. Agency for International Development (USAID, Abb. 2) beigefügt. Die Aufgabe dieser Behörde besteht in der finanziellen Unterstützung ausländischer Regierungen. Dass die Performance und ihr Testapparat sich immer weiter ausbreiten und an Kraft gewinnen, hatte ich bereits erwähnt. In diesem Dokument ist nun abzulesen, wie dieses Muster das Regierungshandeln auf globaler Ebene beeinflusst. Der Leitfaden bietet Ratschläge zur Erstellung eines ‚Performance-Überwachungsplans‘. Der entscheidende Punkt dabei ist, dass die zu überwachende Performance nicht diejenige der USAID ist, sondern die ihrer ‚Klienten‘ und ‚Kunden‘. Die Anleitung informiert die Behördenmitarbeiter darüber, wie die Performances anderer Regierungen zu bewerten sind. Regierungsperformance meint hier nicht 22 Al Gore, From Red Tapes to Results: Creating a Government that Works Better and Costs Less. Report of the National Performance Review, New York: TimeBooks 1993.
168
JON MCKENZIE
Abbildung 1: Auswahl von Schwerpunktsetzungen der U.S. Außenbehörde, Quelle: FY 1999-2000 Performance Plan (1999)
allein die Messung der eigenen Leistung, sondern die der ganzen Welt: das Testen der Demokratie überall, um festzustellen, wie gut sie performt. Eine Möglichkeit, diesen Leitfaden zu lesen, besteht darin zu untersuchen, wie die Kriterien, die dem National Performance Review zugrunde liegen, externalisiert
DIE PERFORMANCE VON DEMOKRATIE
169
Abbildung 2: Ratschläge der U.S. Agency for International Development zur Überwachung der Performance fremder Staaten (1996)
und auf die gesamte Welt projiziert worden sind, sprich die Regierungsperformance als eine Art ‚International Performance Review‘ zu verstehen. Dieser Zugang, obwohl interessant, wäre jedoch irreführend, denn die USAID kratzt lediglich an der Oberfläche des Phänomens, das ich hier ‚Regierungsperformance‘ nenne. Neben der amerikanischen Regierung sind noch viele andere Einrichtungen
170
JON MCKENZIE
mit der Überwachung dieser Performance betraut. So listet etwa der gleiche Leitfaden auch internationale Organisationen, private Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen als Datenquellen auf. Alle diese Institutionen beschäftigen sich mit der Erstellung und dem Austausch von Studien zur Performance von Demokratie. Um es noch einmal zu unterstreichen: Die Forschungen, die ich hier vorstelle, sind vorläufiger Natur. Doch sie zeigen schon jetzt, dass das Konzept der Regierungsperformance bis mindestens in die siebziger Jahre zurückreicht. Zu den bedeutendsten akademischen Disziplinen, die heute zu diesen Forschungen beitragen, zählen Politische Wissenschaften, Internationale Beziehungen, Public Policy und Soziologie. Seit dem Fall der Mauer sind eine Unmenge an Untersuchungen zur Performance neuer Demokratien entstanden – und dies nicht nur in Ost- und Mitteleuropa, sondern auf der ganzen Welt. Die Kriterien, die in diesem Feld zur Bewertung der Performance von Demokratie herangezogen werden, sind zahlreich und komplex. Zu den wichtigsten gehören: die Existenz eines Mehrparteien-Systems, freie und regelmäßige Wahlen, der Schutz von Menschenrechten, faire Bedingungen für Arbeiter, ausreichende Gesundheitsfürsorge, ein funktionierendes Strafrechtssystem, Umweltschutz sowie die generelle Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Performance der Regierung. In Perform or Else versuche ich zu zeigen, dass zusätzlich zu den Wissensformen, aus denen das Performance-Stratum besteht, das Zeitalter weltweiter Performance auch in einer komplexen Atmosphäre von Kräften und Affekten angesiedelt ist. Wie sich herausgestellt hat, wird diese Atmosphäre tatsächlich regelmäßig mit einem System von Barometern gemessen, zu denen das Eurobarometer, das Latinobarómetro, das Afrobarometer, sowie einige noch in der Planungsphase steckende asiatische Barometer gehören.23 Diese Barometer sind nicht meteorologischer, sondern demographischer Natur: Sie sind Meinungsumfragen, mit denen die Performance von Demokratie in bestimmten Ländern und Regionen der Welt gemessen wird. Einige dieser Barometer sind schon seit über zehn Jahren in Betrieb, ebenso wie ein weiteres, oft genanntes Messinstrument: der World Values Survey.24 Die mit den demographischen Studien befassten Wissenschaftler sind sehr darum bemüht, ihre Fragen so konsistent wie möglich zu stellen und zu übersetzen, um auf diese Weise Vergleiche zwischen verschiedenen Ländern durchführen zu können. Antworten zu bestimmten Fragen können darüber hinaus tabellarisch mit den Resultaten aus ganz anderen Bereichen verglichen werden, sodass immer komplexere Beziehungen zum Vorschein kommen. Besondere Aufmerksamkeit ver23 Vgl. etwa The Afrobarometer Network: Afrobarometer Round I: Compendium of Comparative Data from a Twelve-Nation Survey. Erstellt vom Institute for Democracy in South Africa, dem Centre for Democracy and Development in Ghana und der Michigan State University, USA; www.afrobarometer.org/index.php?option=com_docman&task=doc_ download&gid=95&Itemid=39 (Stand: 2.3.2012). 24 Vgl. Ronald Inglehart/Miguel Basanez/Alejandro Moreno, Human Values and Beliefs: A Cross-Cultural Sourcebook, Ann Arbor: University of Michigan Press 1998.
DIE PERFORMANCE VON DEMOKRATIE
171
Abbildung 3: Ergebnisse des vom Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung (WZB) durchgeführten World Values Survey (1998)
dient dabei ein Diagramm aus einem Aufsatz von Hans-Dieter Klingemann, einem Wissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.25 Das Diagramm basiert auf einem World Values Survey, der Mitte der neunziger Jahre durchgeführt wurde (Abb. 3). Klingemann konzentriert sich auf 39 demokratische Staaten – einige von ihnen gut etabliert, andere gerade erst entstanden. Die vertikale Achse zeigt an, in welchem Maß die Befragten ein demokratisches System als wünschenswerte Regierungsform betrachten, während die horizontale die Zufriedenheit der Befragten mit der Performance ihrer jeweiligen Regierung erfasst. So bekennen sich zum Beispiel die Befragten in Aserbaidschan mit Nachdruck zur Demokratie als bester Staatsform und zeigen sich sehr zufrieden mit der Effektivität der Performance ihrer Führung, wohingegen in Russland sowohl das Bekenntnis zur Demokratie als auch die Zufriedenheit mit der Regierung nur auf sehr geringe Werte kommt. Ich bin hier vor allem an der Zusammenballung von Ländern im oberen linken Quadranten interessiert, in dem Staaten zu finden sind, die hohe Sympathiewerte für Demokratie aufweisen, deren Bevölkerung der Performance ihrer eigenen Re25 Vgl. Hans-Dieter Klingemann, „Mapping Political Support in the 1990s: A Global Analysis“, in: Critical Citizens. Global Support for Democratic Government, hg. v. Pippa Norris, Oxford: Oxford University Press 1999, S. 31-56.
172
JON MCKENZIE
gierung jedoch negativ gegenübersteht. Zu ihnen zählen die Vereinigten Staaten, ebenso einige andere, seit langem etablierte Demokratien. Klingemann nennt den Typus, der in diesem Bereich zum Vorschein kommt, ‚frustrierte Demokraten‘: Menschen, die fest an die Demokratie glauben, mit ihrer jeweiligen Verkörperung aber ganz und gar nicht zufrieden sind. Wir wollen uns kurz mit den Implikationen dieses Typus befassen. Bedeutet er, dass die ‚demokratische Introjektion‘ nicht mehr funktioniert und dass die Menschen bald gegen ihre Regierungen aufbegehren werden? Ist vielleicht sogar die Demokratie selbst in Gefahr? Dass heißt, ist sie das geworden, was man als eine ‚permanent scheiternde Einrichtung‘ kennt?26 Oder stehen diese frustrierten Demokraten Derrida mit seiner These zur Seite, dass Demokratie an sich ein unabgeschlossenes und unvollständiges Projekt ist, eines, das stets ‚wird‘ und in Ankunft begriffen ist und daher immer aufs neue erfunden, getestet und angegriffen wird?27 Eines wissen wir jedenfalls mit Sicherheit: Anhand des Phänomens der Regierungsperformance werden wir Zeuge der Entstehung eines weltweiten, fragmentierten Netzwerks, mit dem die Performance von Demokratie getestet und überwacht wird. In einer direkteren Weise als die Performance Studies, das Performance Management und die Techno-Performance dies vermögen, kann die Regierungsperformance Souveränitätsmechanismen und juristische Ordnungen für sich in Anspruch nehmen. Gegenwärtig besteht dieses Netzwerk aus Regierungen, transund supranationalen Firmen und Institutionen, Staaten, Nichtregierungsorganisationen, Forschern und, besonders wichtig, frustrierten Demokraten, dass heißt unzufriedenen Menschen. Wozu dieses Netzwerk verwendet wird und durch wen oder was, bleibt die Frage. Obwohl diese Forschungen zur Regierungsperformance sich größtenteils mit Demokratien auf nationaler Ebene befassen, gibt es viele Anzeichen – und den Wunsch –, dass hier noch etwas anderes entsteht bzw. entstehen möge. Wenn wir davon ausgehen, dass die Griechen die Demokratie in Form des Stadtstaates erfanden und das koloniale Nordamerika diese in Form des Nationalstaats noch einmal neu erfand, dann stellt sich die Frage, welche Form von Demokratie die Welt wohl im Zeitalter der Performance erfinden wird. Einen supra- oder transnationalen demokratischen Staat? Oder vielleicht ein locker gefügtes Netzwerk von nach allen Seiten durchlässigen Kleinst-Demokratien? Oder möglicherweise noch etwas ganz anderes? Und schließlich: Welche Performances eignen sich zur Schaffung einer solchen, noch gänzlich unbekannten Demokratie, und welche Rolle wird die fröhliche Wissenschaft in der Performance dieses Gebildes spielen? Aus dem Amerikanischen übersetzt von Thomas Stachel. 26 Vgl. Marshall W. Meyer/Lynne G. Zucker, Permanently Failing Organizations, Newbury Park: SAGE Publications 1989. 27 Vgl. Jacques Derrida, „Politics and Friendship. [Interview von Michael Sprinker]“, in: ders., Negotiations: Interventions and Interviews. 1971-2001, hg. v. Elizabeth Rottenberg, Stanford: Stanford University Press 2002, S. 147-198.
DIE PERFORMANCE VON DEMOKRATIE
173
Literaturverzeichnis Austin, John L., Zur Theorie der Sprechakte, Stuttgart: Reclam 2002. Derrida, Jacques, „Politics and Friendship. [Interview von Michael Sprinker]“, in: ders., Negotiations: Interventions and Interviews. 1971-2001, hg. v. Elizabeth Rottenberg, Stanford: Stanford University Press 2002, S. 147-198. —, „Signatur, Ereignis, Kontext“, in: ders., Randgänge der Philosophie, Frankfurt a. M./Berlin/ Wien: Ullstein 1976, S. 124-155. Gore, Al, From Red Tapes to Results: Creating a Government that Works Better and Costs Less. Report of the National Performance Review, New York: TimeBooks 1993. Haedicke, Susan C./Nellhaus, Tobias (Hg.), Performing Democracy: International Perspectives on Urban Community-Based Performance, Ann Arbor: University of Michigan Press 2001. Hardt, Michael/Negri, Antonio, Empire, Cambridge: Harvard University Press 2000. Inglehart, Ronald/Basanez, Miguel/Moreno, Alejandro, Human Values and Beliefs: A Cross-Cultural Sourcebook, Ann Arbor: University of Michigan Press 1998. McKenzie, Jon, „Int3rhackt!v!ty“, in: Style 30:2 (1999), S. 283-299. —, Perform or Else: From Discipline to Performance, London: Routledge 2001. —, „Towards a Sociopoetics of Interface Design: etoy, eToys, TOYWAR“, in: Strategies: A Journal of Theory, Culture and Politics 14:1 (2001), S. 121-138. —/Ricardo Dominguez, „Dispatches from the Future: A Conversation on Hacktivism“, in: Connect: art. politics. theory. practice 2 (2001), S. 115-122. Klingemann, Hans-Dieter, „Mapping Political Support in the 1990s: A Global Analysis“, in: Critical Citizens. Global Support for Democratic Government, hg. v. Pippa Norris, Oxford: Oxford University Press 1999, S. 31-56. Marcuse, Herbert, Eros and Civilization: A Philosophical Enquiry into Freud, Boston: Beacon Press 1966. Meyer, Marshall W. /Zucker, Lynne G., Permanently Failing Organizations, Newbury Park: SAGE Publications 1989. Nietzsche, Friedrich, „Die fröhliche Wissenschaft“, in: ders., Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 2, hg. v. Giorgio Colli/Mazzino Montinari, Berlin/New York: Walter de Gruyter 1973. Ronell, Avital, „The Test Drive“, in: Deconstruction Is/In America: A New Sense of the Political, hg. v. Anselm Haverkamp, New York: New York University Press 1995, S. 200-220.
Internetquellen http://web.archive.org/web/20011209224952/www.whitehouse.gov/news/releases/2001/ 12/20011207.html (Stand: 2.3.2012) http://web.archive.org/web/20011207212934/www.whitehouse.gov/news/releases/2001/ 09/20010920-8.html (Stand: 2.3.2012) http://web.archive.org/web/20011129133930/www.usaid.gov/pubs/usaid_eval/pdf_docs/ pnaby215.pdf (Stand 2.3.2012) http://1997-2001.state.gov/www/global/general_foreign_policy/00_perf_intro.pdf (Stand 3.2.2012),
174
JON MCKENZIE
Abbildungsnachweis Abb. 1: United States Department of State (1999): „The United States Department of State FY 1999-2000 Performance Plan.“ In: US State Department. Plans, Resources, and Reorganization. Stand: 19. Januar 2001. URL: http://1997-2001.state.gov/www/global/general_foreign_policy/00_perf_intro.pdf (Stand 3.2.2012), Deckblatt und S. 7. Abb. 2: U.S. Agency for International Development (1996): „Performance Monitoring and Evaluation Tips. 1996, Number 7“ In: USAID. The United States Agency for International Development. Stand: 14. Februar 2002. URL: http://web.archive.org/web/20011129133930/ www.usaid.gov/pubs/usaid_eval/pdf_docs/pnaby215.pdf, S. 1 (Stand 2.3.2012), S. 1. Abb. 3: Klingemann, Hans-Dieter (1999): „Mapping Political Support in the 1990s: A Global Analysis.“ In: Pippa Norris (Hrsg.): Critical Citizens. Global Support for Democratic Government. Oxford: Oxford University Press, S. 56.
NINA TECKLENBURG
Telling Performance. Zur (Ent-)Mythisierung der Aufführung
Manchmal – so erzählt die Performancekünstlerin Marina Abramović – waren es nur vier oder fünf Zuschauer, die ihre frühen Performances aus den Anfängen der 1970er Jahre besuchten. Abramović zufolge führte dies zu einem Dilemma: Das mündliche Weitererzählen, das sich nach ihren Performances ausbreitete und oftmals deren einzige Dokumentationsform darstellte, verfälschte das, was sich während der Darbietungen zugetragen hatte. Wie Abramović beklagt: „The unreliability of the [...] witnesses led to the total mystification and misrepresentation of the actual events. This created a huge space for projection and speculation“.1 Zugleich jedoch stellte das Weiter- und Nacherzählen die einzige Wissensform dar, durch die Abravomic selbst von anderen Performancekünstlinnen und -künstlern außerhalb des damaligen sozialistischen Jugoslaviens erfuhr. Die Faszination, die Abramović in den frühen 1970er Jahren für Chris Burden, Vito Acconci, Terry Fox und viele andere entwickelte, war vornehmlich dem Hörensagen geschuldet: „[I]t was very difficult to get information about performance events from abroad. [...] Most of the time, testimony was just word-of-mouth from witnesses who claimed they saw the performance or said that they knew somebody who had seen it.“2 Ähnlich wie Abramović erging es auch der bulgarischen Performancekünstlerin Boryana Rossa. Wie Rossa in ihrer Performance The Vitruvian Body in der Akademie der Künste in Berlin im Februar 2009 erzählt, sei eine Performance von Rudolf Schwarzkogler prägend für die Entwicklung ihrer persönlichen Performancepraxis gewesen. Schwarzkoglers Performance selbst habe Rossa nicht gesehen. Rossa, ebenso wie Abramović durch den Kommunismus abgeschnitten von der westlichen Kunstwelt, habe über Schwarzkoglers Performance lediglich durch Hörensagen erfahren. Schwarzkogler, so erzählt Rossa, habe sich, so habe man ihr damals erzählt, in seiner für sie prägenden Performance die Genitalien abgeschnitten und sei schließlich an den Folgen dieses schmerzhaften Eingriffs gestorben. Doch mehr dazu später. Abramović und Rossa – so ließe sich zuspitzen – verdanken ihre Karrieren weniger den live miterlebten Momenten einer Aufführung, sondern vielmehr den wild grassierenden Erzählungen, welche beide dazu inspirierten, ihre eigenen künstlerischen Arbeiten auf eine ganz bestimmte Weise voranzutreiben. Und es waren ebenso jene Erzählungen, die letztlich eine Ausbreitung von Abramović’ Performances 1 Marina Abramović, „Reenactment“, in: dies. (Hg.), Seven Easy Pieces, Milan: Charta 2007, S. 9-11, hier: S. 10. 2 Ebd., S. 9.
176
NINA TECKLENBURG
über eine Anzahl von vier oder fünf Zuschauern hinaus sicherten und ihr damit zum beruflichen Erfolg verhalfen. Noch schneller und noch wirkungsmächtiger als die ‚performance energy‘, die Abramović’ Aufführungen immer wieder attestiert wird,3 scheint sich die Energie der Nacherzählung zu verbreiten. Die Stärke und auch die Gefahr dieser Energie der Nacherzählung liegt darin, dass sie die Differenz zur ‚performance energy‘ nachträglich zu verwischen droht. Oder wie lässt es sich sonst erklären, dass Abramović’ Performances ‚an sich‘ immer wieder so viel energiegeladene Wirkung zugeschrieben wird, wo wir doch über die meisten ihrer Performances nur nachträglich erfahren und damit – im Sinne Jacques Derridas – die Ereignisse der Aufführungen erst nachträglich zu dem machen, was sie vermeintlich ‚waren‘?4 Unser Wissen über Aufführungen resultiert zu einem Großteil aus Übertragungsprozessen: aus mündlichen, schriftlichen, visuellen, akustischen oder gestischen Wiederholungen der Aufführung in unterschiedlichsten Medien.5 Inwiefern – so möchte ich fragen – hat dieses auf Übertragungen beruhende Wissen schließlich eine Auswirkung auf die Wahrnehmung von Aufführungen im Moment ihres Vollzugs, insofern es sozusagen wechselwirkend auf die Aufführung zurückwirkt, sich in die Wahrnehmung einschreibt, die Wahrnehmung in actu strukturiert, diese bedingt? Vor dem Hintergrund einer theoretischen Perspektive, wie sie in unserem Projekt Ästhetik des Performativen in den vergangenen Jahren entwickelt wurde – eine Perspektive, die sich auf die Wirkung von Aufführungen im Moment ihres Vollzugs konzentriert6 –, droht die sowohl vorgängige als auch nachträgliche konstitutive Macht der Wirkung von Aufführungsübertragungen aus dem Blick zu geraten. Unser primärer Untersuchungsschwerpunkt lag dabei weniger auf der Betrachtung von Aufführungsmomenten der Wiederholung und der Aufbewahrung, sondern vor allem auf Momenten der Unwiederholbarkeit, der Einmaligkeit, terminologisch besetzt mit Begriffen wie ‚Ereignishaftigkeit‘ oder ‚Emergenz‘. Eine solche Perspektivierung ermöglichte, eine zuvor unbeachtete Dimension von Aufführungen in den Blick zu nehmen. Sie erlaubte es, die Flüchtigkeit des nicht-verifizier3 Der Begriff ‚Energie‘ wird in ästhetischen Zusammenhängen häufig in Bezug auf eine „körperliche, affektive, imaginäre oder mentale Wirkung eines Objekts, Textes, Stoffes, Bildes oder Körpers“ verwendet. Im Kontext der Performancekunst wurde der Begriff ‚Energie‘ vor allem in Bezug auf die Wirkung von Austauschprozessen zwischen Darstellern und Zuschauern virulent. Vgl. hierzu zusammenfassend: Jenny Schrödl: „Energie“, in: Metzler Lexikon Theatertheorie, hg. v. Erika Ficher-Lichte/Doris Kolesch/Matthias Warstat, Stuttgart/Weimar: Metzler 2005, S. 87-90, hier: S. 89. 4 Derrida ermahnt zur Wachsamkeit gegenüber des sich häufig selbst verblendenden, nachträglichen ‚Machens‘ des Ereignisses: „Stillschweigend und ohne es zuzugeben lässt man ein Sprechen, das das Ereignis macht, als simple Mitteilung des Ereignisses durchgehen.“ Jacques Derrida, Eine gewisse unmögliche Möglichkeit, vom Ereignis zu sprechen, Berlin: Merve 2003, S. 23. 5 Zum Begriff der Übertragung im medienphilosophischen Kontext vgl. Sybille Krämer, Medium, Bote, Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2008. 6 Vgl. Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004.
TELLING PERFORMANCE
177
baren Gegenstandes ‚Aufführung‘ aufzuwerten, die Wahrnehmung für flüchtige Präsenzeffekte zu sensibilisieren und genau diese Qualität als zentrale Eigenschaft unseres Gegenstandes ernst zu nehmen. Damit gelang es zugleich, dem Orchideenfach Theaterwissenschaft eine zentrale Neupositionierung im Kontext der Geisteswissenschaften zu sichern und das Feld der theaterwissenschaftlichen Forschung für andere Disziplinen anschlussfähig zu machen. Die Fokussierung auf Aufführungen trifft nämlich ins Zentrum einer allgemeinen epistemologischen Verschiebung: Der Blick auf Aufführungen verschärft geradezu exemplarisch die Einsicht, dass Untersuchungsgegenstände allgemein niemals feststehende, wirkungslose Objekte darstellen und stets unter dem direkten Einfluss seiner Betrachterinnen und Betrachter stehen. Gerade die künstlerische Aufführung avanciert dabei als ‚flüchtigste aller Kunstformen‘ zum paradigmatischen Gegenstand, welcher die Paradoxien eines performativen Untersuchungsgegenstandes allgemein zu exponieren vermag. Als besonders repräsentatives Material gelten vor allem Aufführungen der Performancekunst bzw. der Body Art der 1970er Jahre, da hier die Emergenz unvorhersehbarer Momente geradezu forciert wurde. Um als Beispiele dienlich zu sein, müssen jene Performances im wissenschaftlichen Kontext dabei zwangsläufig reinszeniert werden. Dies geschieht zumeist in Form schriftlicher Nacherzählungen, welche ihrerseits häufig auf vorherigen Übertragungsakten basieren wie der Rezeption von Videos, Fotografien und anderen Erzählungen. Unwiederholbarkeit ist auf Wiederholung angewiesen. Über diese unumgängliche Aporie in der Theoriebildung ist man sich allgemein bewusst. Trotz einer methodologischen Selbstreflexivität suggerieren jedoch viele theaterwissenschaftliche Untersuchungen von Aufführungsereignissen – wenngleich unbeabsichtigt – eine Unabhängigkeit des Gegenstandes ‚flüchtige Aufführung‘ von dessen Wiederholungen. Genau eine solche Unabhängigkeit jedoch kann die Aufführung ihrer Wirkung nach aber aufgrund ihrer Flüchtigkeit niemals haben. Lässt sich zwar auf einer zeitlichen und medialen Ebene unterscheiden zwischen ko-präsentischer Aufführung einerseits und deren nachträglicher Dokumentation andererseits, lässt sich genau diese Differenz auf der Ebene der Wirkung nicht aufrecht erhalten. Mit anderen Worten: So sehr das Definitionskriterium ‚Ko-Präsenz‘ zur Bestimmung einer Aufführung einen notwendigen, medialen Unterschied zu markieren vermag, bleiben Aufführung und deren Übertragungen ihrer Wirkung nach zwangsläufig aufeinander bezogen und konstitutiv ineinander verschränkt, obgleich beide niemals zur Deckung gelangen.7
7 Barbara Gronau und Jens Roselt über das Verhältnis von Erfahrung und deren Versprachlichung: „Weder die Erfahrung noch ihre Versprachlichung können als abgeschlossen, auf sich selbst bezogene Vorgänge aufgefasst werden, da sie wechselseitig aufeinander verweisen, d. h. Erfahrungen entgleiten sich, insofern sie Sprache hervorrufen, und die Diskursivierung entgleitet sich, insofern sie das Erfahrungsgeschehen voraussetzt.“ Barbara Gronau/Jens Roselt, „Diskursivierung des Performativen“, in: Praktiken des Performativen (=Paragrana 13:1), hg. v. Erika Fischer-Lichte/Christoph Wulf, Berlin: Akademie 2004, S. 112-120, hier: S. 119.
178
NINA TECKLENBURG
Nach unserer bisherigen, emphatischen und notwendigen Beleuchtung der Aufführung als ereignishaftes Phänomen, gilt es nun davon ausgehend denjenigen Anteil der Aufführung, der sich durch Wiederholung, durch Aufbewahrung und durch Speicherung auszeichnet, unter veränderter Perspektive theoretisch zu reaktivieren und produktiv mit unseren bisherigen Überlegungen zu verschränken. Ich frage daher im Folgenden nach den Wirkungen von Übertragungsprozessen, die sich im Vollzug einer Aufführung unentwirrbar mit flüchtigen Präsenzphänomenen verweben – wie z. B. mit einer spezifischen Atmosphäre oder einer besonderen Präsenz des Körpers – und die die Wahrnehmung dieser Präsenzphänomene zuallererst strukturieren. Ich werde dabei besonders zwei Dimensionen in den Blick nehmen, die in der Debatte rund um die Wirkungsmacht von Aufführungsdokumentationen bislang lediglich am Rande diskutiert wurden.8 Zum einen frage ich nach der mythischen Dimension und ihrer quasi-sakralen Wirkung, die Aufführungsdokumenten und dem Diskurs der Aufführung als flüchtiges, als ein immer im Verlust begriffenes Phänomen zueigen sind. Zum anderen geht es mir um die konstitutive Kraft von konkreten, mündlichen und auch schriftlichen Nacherzählungen von Performances. Dabei gilt mein Interesse insbesondere der Frage, inwiefern die Wahrnehmung von so genannten liminalen, transgressiven Momenten besonders in der Body Art von klassisch-aristotelischen Erzählstrukturen durchzogen sind.
1. Aufführung, Ereignis, Mythos Was genau ist mit der mythischen Dimension von Aufführungsdokumenten gemeint? Mythisch wirken jene Dokumente insofern, als sie einen Moment annehmbar und erklärbar machen, der sich selbst jeder Erklärung entzieht und der dieser Erklärung – so suggeriert der Mythos – zeitlich vorausgeht. Die Dokumentation einer Aufführung ist, wie man mit Hans Blumenberg sagen könnte, ‚Arbeit‘ am unwiederbringlichen Ursprung.9 Dies freilich setzt voraus, dass die Aufführung als Ursprung erachtet wird. Genau diese Annahme jedoch ist dem Verständnis von Aufführungen als Ereignis paradoxerweise zumindest anteilig implizit. Wenn zum 8 Zu dieser Debatte vgl. u. a. Hans-Friedrich Bormann/Gabriele Brandstetter: „An der Schwelle. Performance als Forschungslabor“, in: Schreiben auf Wasser. Performative Verfahren in Kunst, Wissenschaft und Bildung, hg. v. Hanne Seitz, Bonn: Klartext 1999, S. 45-55; Barbara Clausen (Hg.), After the Act – The (Re)Presentation of Performance Art, Nürnberg: Verlag für moderne Kunst Nürnberg 2005; Philip Auslander, Liveness: Performance in a Mediatized Culture, London/New York: Routledge 1999; Rebecca Schneider: „Archives. Performance Remains“, in: Performance Research. On Maps and Mapping 6:2 (2001), S. 100-108. 9 „Die Grenzlinie zwischen Mythos und Logos ist imaginär [...]. Der Mythos selbst ist ein Stück hochkarätiger Arbeit des Logos.“ Hans Blumenberg, Arbeit am Mythos, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2001. Vgl. auch Jamme: „Der Ursprung ist präsent, so lange an ihm gearbeitet wird, der Mythos ist mithin nicht vorweltlich, sondern gehört zu unserer Welt.“ Christoph Jamme, Geschichten und Geschichte. Mythos in mythenloser Gesellschaft, Erlangen/Jena: Palm & Enke 1997, S. 16.
TELLING PERFORMANCE
179
Beispiel nach Peggy Phelan die Performance aufgrund ihrer Uneinholbarkeit ein subversives Phänomen markiert, welches dem System des Warentauschs und der Reproduktion durch sein Immer-schon-entzogen-Sein Widerstand leistet,10 scheint diese Rede insofern anfällig für Mythisierung, als hier die Möglichkeit vorstellig wird, die Welt ließe sich in zwei Teile teilen: in eine ursprüngliche, subversive (heilige) Welt der Performance als sich entziehendes Ereignis und eine jetzige (profane) Welt, von der aus die Performance immer nur als unzulänglich Reproduziertes betrachtet werden kann. Wie Maurice Godelier gezeigt hat, ist es gerade das dem Tauschprinzip Entzogene, welches in Ursprungsmythen für die heilige Welt kennzeichnend ist.11 Obgleich sich Phelans Überlegungen einer solchen vereinfachenden Opposition freilich widersetzen, da Performance hier gerade nicht als essentialistisch-transzendentes, sondern als ein immer schon strukturimmanent, subversives Moment gedacht wird, muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Rede vom subversiven Potenzial des Performance-Ereignisses ihrer Wirkung nach zumindest anteilig ins Fahrwasser des Mythischen zu geraten droht. Eine ähnliche mythische Wirkung haben viele Beschreibungen des Ereignisses aus dekonstruktivistischer und phänomenologischer Perspektive. Obgleich in diesen Denktraditionen stets eine unumgängliche, nachträgliche Konstruktion des Ereignisses betont wird, suggerieren dessen Charakterisierungen paradoxerweise eine Autonomie des Ereignisses gegenüber seinen Übertragungen, wenn zum Beispiel das Ereignis beschrieben wird als „absolute Ankunft“12, „als Quelle“13, als ein an „Glauben“ gekoppeltes „[J]enseits des Wissens“, als „Messianische[s]“14, als Vertikales, als Prädiskursives, usw. Zugespitzt formuliert ließe sich hier von einer ungewollten ‚Veressentialisierung‘ des Ereignisses sprechen. Und genauso droht auch Peggy Phelans diskursive Markierung von Performance als ‚unmarked‘ unbeabsich10 „Performance refuses this system of exchange and resists the circulatory economy fundamental to it. [...] Performance’s independence from mass reproduction, technologically, economically, and linguistically, is its greatest strength.“ Peggy Phelan, Unmarked. The Politics of Performance, London/New York: Routledge 1993, S. 149. 11 Vgl. Maurice Godelier, Das Rätsel der Gabe. Geld, Geschenke, heilige Objekte, München: Beck 1999. 12 Derrida, Eine gewisse unmögliche Möglichkeit, vom Ereignis zu sprechen, a.a.O., S. 60. 13 Dieter Mersch, Was sich zeigt. Materialität, Präsenz, Ereignis, München: Wilhelm Fink 2002, S. 20. 14 Derrida, Eine gewisse unmögliche Möglichkeit, vom Ereignis zu sprechen, a.a.O., S. 60. Obgleich Derrida seine Überlegungen zum Ereignis zunächst von konkret religiösen Implikationen losgelöst wissen will, zieht er einen religiösen Diskurs schließlich doch wieder heran: „So, wie ich ihn verwende, hat der Begriff der Vertikalität aber nicht mehr notwendig die religiöse oder theologische Bedeutung, die zum Allerhöchsten emporhebt. Vielleicht fängt die Religion hier an. Man kann den Diskurs, den ich über die Vertikalität, über die absolute Ankunft halte, nicht halten, ohne dass der Akt des Glaubens schon begonnen hätte – wobei der Akt des Glaubens nicht unbedingt mit der Religion, mit dieser oder jener Religion identisch ist –, ohne einen gewissen Raum des Glaubens ohne Wissen, jenseits des Wissens. Ich würde es also akzeptieren, dass man hier von Glauben spricht.“ Ebd.
180
NINA TECKLENBURG
tigt in ein mythisches Objekt verwandelt zu werden. Erst vor Kurzen hat Gianluca Solla auf eine solche „unbewusste [...] theologische Dimension der heutigen ‚Vergötterung‘ des Ereignisses“15 aufmerksam gemacht. Wenn nun die klassische Performancekunst Ereignisse exemplarisch in Szene setzt, dann werden ihre spezifischen Darstellungstechniken – wie z. B. die Verwendung des Körpers als Material oder die Herstellung von Momenten der Potenzialität (Gefahrensituationen bis hin zur Lebensgefahr) – zu ebenso exemplarischen Signifikanten des Ereignisses. Die Darstellungstechniken der klassischen Performancekunst signifizieren Ereignishaftigkeit. Und genau hier droht die Verwandlung jener Techniken in mythisch aufgeladene Objekte: Sie werden mit einem metasprachlichen Wahrheitsgehalt versehen,16 indem sie zu Trägern eines für immer schon verlorenen, immer nur unzulänglich beschreibbaren Augenblicks werden. Die mythische Wirkung dieser Signifikanten realisiert sich dabei nicht nur in einer mündlichen und schriftlichen Rede über sie, sondern in jeglichen Übertragungsformen: in Videos, in Fotografien, usw. – und sie zeigt sich schließlich auch in Aufführungen der Performancekunst selbst, sofern diese immer auch einen Wiederholungs-, einen Dokumentationsakt ihres eigenen Genres darstellen. Genau dies wird zum Thema in Boryana Rossas Performance The Vitruvian Body. Ihre Performance ‚performed‘ ihre eigene mythische Qualität.
2. Du sollst Dir ein Bildnis machen Diese Fotografie von Rossas Performance (s. Abb. 1) stellt ein relativ repräsentatives Abbild dessen dar, was die Künstlerin während ihrer Performance mit einem Augenzwinkern als das bezeichnete, „what really happened“. „What really happened“ meint Folgendes: Rossa stellt sich unbekleidet in eine der Darstellung des vitruvianischen Menschen von Leonardo da Vinci nachgebauten, kreisförmigen Stahlkonstruktion, durch deren vier Löcher sie Arme und Beine ähnlich der von da Vinci dargestellten männlichen Figur von sich spreizt, um sich im Folgenden die Extremitäten von ihrem Arbeitspartner Oleg Mavromatti mit Nadel und Faden an die Stahlkonstruktion annähen und anschließend ihren Mund zunähen zu lassen. Laut Programmheft geht es in ihrer Performance um eine Kritik an einem idealisierten und damit normierenden Körperbild, das sich auf das frühneuzeitliche Ideal des vitruvianischen Menschen zurückführen lässt und von dem ein machtvoller Imperativ zur körperlichen und damit letztlich zur schmerzlichen Anpassung ausgeht. 15 Vgl. Gianluca Solla, „‚Alles, was der Fall ist.‘ Der Messias als Ereignis überhaupt“, in: Ereignis. Eine fundamentale Kategorie der Zeiterfahrung. Anspruch und Aporien, hg. v. Nikolaus Müller-Schöll, Bielfeld: transcript 2003, S. 48-59. Das Zitat stammt von Nikolaus MüllerSchöll aus seiner Einführung in den Beitrag von Solla: Nikolaus Müller-Schöll: „Vorwort“, in: ders., Ereignis, a.a.O., S. 9-17, hier: S. 14. 16 Zum Mythos als Metasprache vgl. Roland Barthes, Mythen des Alltags, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1964, S. 92ff.
TELLING PERFORMANCE
181
Abbildung 1: Boryana Rossa, The Vitruvian Body, Akademie der Künste, Berlin 2009. Foto: Jan Stradtmann
Dass Rossa während dieser Operation tatsächlich Schmerzen empfindet, dass sie an den Einstichstellen der Nadel heftig zu bluten beginnt, dass ihr Körper sich mit einer Gänsehaut überzieht – all dies scheint sich zunächst geradezu nebenbei zu vollziehen. Die am Material des real schmerzenden Körpers zur Aufführung gebrachten affektiven und potenziell ‚liminalen‘ Qualitäten bleiben zunächst vollkommen unauffällig. Das, was gemeinhin als das spezifisch Ereignishafte einer Body-Art-Performance deklariert wird, fällt hier nicht auf und taugt damit nicht zum Ereignis. Auffällig stattdessen werden die verbalen Äußerungen der Künstlerin, mit denen sie den Body-Art-Anteil ihrer Performance buchstäblich überspielt: Unablässig kommuniziert sie mit dem Publikum und kommentiert selbstreflexiv ihre künstlerische Absicht. Sie berichtet über ihre vergangenen Arbeiten und liefert Nacherzählungen berühmter Performances. Rossa nimmt damit die Haltung nicht nur einer Performancekünstlerin ein, sondern sie erscheint immer schon als ihre eigene Beobachterin, Kommentatorin und Theoretikerin. Darüber hinaus lädt die Künstlerin ihr Publikum dazu ein – entgegen des zu Beginn der Performance seitens der Kuratorinnen ausgesprochenen Fotografierverbots – das Geschehen auf der Bühne mittels allen, den Zuschauern zur Verfügung stehenden, visuellen Speichermedien festzuhalten und dafür möglichst nah an die Performerin heranzutreten. Die Performance wird dominiert von Erklärungen, von Erzählungen vergangener Performances und vom Akt des live-Dokumentierens. Ihr Effekt ist entsprechend ein gänzlich anderer als der, den die während Rossas Performance entstehen-
182
NINA TECKLENBURG
den Bilder zu suggerieren, oder sagen wir, zu zitieren vermögen. The Vitruvian Body ist eine Anti-Body-Art-Performance: kein Energie geladener, intensiver Blickaustausch, keine mit Tränen gefüllten, geröteten Augen, kein Schock, kein Begehren, kein Ekel, keine Scham, kein moralisches Bedürfnis zum Einschreiten oder zum Unterbrechen transgressiver Handlungen auf der Bühne; keine spannungsgeladene, fokussierte Konzentration auf das, „what really happened“. Rossas amüsiert-unangespannte Haltung hingegen, ihr unablässiges Erklären, Witzeln, Dozieren und Erzählen erinnern eher an eine anspruchsvolle Stand-upComedy-Show als an eine Body-Art-Performance. Ex negativo wird hier das Fehlen einer für Body Art bekannten Atmosphäre deutlich. Anstelle dieser dominiert eine andere Atmosphäre. Statt Konzentration, Intensität und Fokussierung macht sich Diffusion breit. Statt stiller Andacht in einer Performance, von der man sich laut Kuratorinnen kein Bildnis machen soll, wandern Zuschauer unruhig umher und lassen unentwegt ihre Handykameras aufblitzen. Deren fetischisierenden, durch die Kamera herangezoomten close-ups von Rossas Körperteilen schließlich werden die zukünftige Wirkung dessen verbürgen, „what really happened“. Vornehmlich durch die Handydisplays wird während der Aufführung sozusagen ‚vorträglich‘ das erkennbar, was den meisten Anwesenden über Body Art bekannt sein dürfte: die Inszenierungen des Schmerzes, das Blut, der Schock, die Mythen der Body-Art-Performancekunst – Mythen, die das Unfassbare fassen. Nicht die Macht des virtruvianischen Körpers, wie das Programmheft verspricht, sondern die Macht der Mythen der Performancekunst bilden das Zentrum von Rossas Arbeit. Und so fordert Rossa ihr Publikum während der Aufführung auf: „Think about what kind of mythology you are creating with your cameras right now or what kind of myth I am creating by telling you all these stories.“ Die meisten Fotos werden am Ende von Rossas Performance geschossen, dann, wenn Rossas Mund zugenäht ist und ihre Erzählungen und Kommentare verstummen. Der ‚ereignisreichste‘ Augenblick der Performance, geboren durch die digitalen Speichermedien der Besucher, und jetzt hier, als fotografische Reliquie abgedruckt in diesem Text erfahrbar gemacht als das, „what really happened“ (s. Abb. 2). Bevor Rossa gezwungenermaßen zu reden aufhörte, gab sie ihrem Publikum noch eine kleine Fotografier-Inszenierungshilfe: „One last thing“, sagte sie, „it is important that the pictures that you make, that they portrait the action in one, that you have at least one picture that really shows what happened: that I am stitched up to this construction here.“ Die Body Art-Praktiken der 1970er Jahre, wie zum Beispiel die frühen Performances von Marina Abramović, erscheinen im Kontext von Rossas Performance als eine zum transzendentalen Signifikat stilisierte künstlerische Darstellungstechnik, die es in Zeiten einer spezifischen, (medien-)historischen Konstellation vermochte, im Kunst- und Theaterkontext als Erschütterung des Ablaufs, als Unterbrechung des Gewohnten wahrgenommen zu werden.17 Die Tatsache, dass Merkmale wie 17 Philip Auslander hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Behauptung der Aufführung als eines von ‚Medialisierungen‘ unabhängigen Phänomens medienhistorisch betrachtet selbst
TELLING PERFORMANCE
183
Abbildung 2: Boryana Rossa, The Vitruvian Body, Akademie der Künste, Berlin 2009. Foto: Jan Stradtmann
184
NINA TECKLENBURG
Nacktheit, Blut und Schmerz zu Trägern von schockanten, liminalen Erfahrungen werden konnten, wird erst jetzt mittels Rossas formaler Distanzierung zum prototypischen Body Art-Format deutlich. Jede heutige Body Art-Performance entpuppt sich in und durch Rossas Negativ-Performance als ein Reenactment ihrer selbst, d. h. als ein Reenactment ihrer eigenen, von mythischen Implikationen durchzogenen Konventionen, die eine in Performancetheorie geschulte Wahrnehmung und Rede über Aufführungen immer schon durchziehen. Die Aufführung selbst ist hier Übertragungsakt. Sie ist das Speichermedium ihrer eigenen Techniken, Diskurse und Wirkungen.
3. Es geht um Leben und Tod Damit etwas ein Ereignis sein kann, muss es immer schon vergangen sein. In der Singularität des Ereignisses ist, wie Derrida präzisiert hat, „der Tod mit von der Partie“18. Es ist die Nähe zur eigenen Endlichkeit, die in der Versehrtheit der Körper in vielen Aufführungen der Body Art vergegenwärtigt wird. Die aufflackernde Möglichkeit des Todes als Garant für Ereignishaftigkeit: Es waren gerade die Genre-definierenden Pioniere der Performancekunst, die sich in ihren Darbietungen der Gefahr des Todes aussetzten und damit die Paradoxien einer gegenwärtigen Flüchtigkeit des Ereignisses in Szene setzten.19 „What surprises most of us“, schreibt Phelan über die frühen Arbeiten von Marina Abramović, „is the finality of death.“20 Gerade die einschlägigen Wirkungen jener todesnahen Performances sollten fortan nicht aufhören, ihre Rezipienten in Form von Wiederholungen heimzusuchen. Die wohl anschaulichsten Zeugnisse einer Heimsuchung von todesmutigen Performances liefern ihre Nacherzählungen. Dabei bieten gerade die zunächst als antinarrativ verbuchten Spektakel den besten Stoff für eine spannende Geschichte. Nichts scheint sich besser für die Komposition einer ergreifenden story zu eignen als besonders ereignishafte Performances, in denen die Protagonisten gerade noch mal ganz knapp dem Tod entronnen sind: Und wenn nicht ein Zuschauer herbeigeeilt wäre, wenn die Kugel aus der Pistole daneben gegangen wäre, wenn die Hand gezittert und der Bogenpfeil sich gelöst hätte –, dann wären all jene Performancehelals Resultat einer Medialisierung von Gesellschaft verstanden werden muss. Entsprechend sei der Diskurs über sowie die Wahrnehmung von Aufführungen auch auf einer aufführungsstrukturellen Ebene immer schon von technisch-medialen Konfigurationen durchzogen, sprich, von einer Art ‚image‘ über liveness. Vgl. Auslander, Liveness, a.a.O., S. 10ff. 18 Derrida, Eine gewisse unmögliche Möglichkeit, vom Ereignis zu sprechen, a.a.O., S. 40. 19 „One of the archievements of body art in the 1970s was that its embodiments and navigations made it impossible, even now, to discuss live performane without also talking about death. The entwined relationship between live performance and death has been at the core of the most radical art practice of the postwar period.“ Peggy Phelan, „On Seeing the Invisible: Marina Abramović’s The House with the Ociean View“, in: Live. Art and Performance, hg. v. Adrian Heathfield, London/New York: Routledge 2004, S. 16-27, hier: S. 20. 20 Ebd., S. 19.
TELLING PERFORMANCE
185
dinnen und -helden gestorben. Wie es über Chris Burdens Performances Prelude to 220 und 220 von 1971 heißt: „[…] had the buckets been tipped over, electrical current might have traveled through the spilled water to Burden’s body“, oder „had the participants fallen off the ladders, they would have been electrocuted.“21 Dieses Spannungsnarrativ – häufig gekoppelt an die Konditionalstruktur ‚und wenn sie nicht ..., dann wäre sie gestorben ...‘ – ist an ein Mindestmaß an Potenzialität gebunden. Der Ausgang muss ungewiss sein. Und gerade diese Offenheit fordert zum imaginären Erzählen seitens der Zuschauer auf, nämlich zum Entwerfen der Gegenwart der Aufführung auf ein potenzielles Ende hin.22 Diese Meistertrope narrativer Sinnkonstitution – die Gerichtetheit auf ein Ende, welches die Gegenwart immer schon als Vergangenes zu einem Ganzen schließt – findet eine ultimative Zündstelle gerade in jenen Momenten von Todesgefahr, die schließlich zur Signatur des Kunstgenres Body Art wurden. Wie schon Walter Benjamin betont hat, liefert die unumstößliche Tatsache des Todes den Grund für den größten Erzähldrang, wenn nicht für den Erzähldrang überhaupt: „Der Tod ist die Sanktion von allem, was der Erzähler berichten kann. Vom Tode hat er seine Autorität geliehen.“23 Boryana Rossa setzt sich in ihrer Performance keiner wirklichen Gefahr aus. Im Gegenteil unterbindet sie jegliche ‚Dramatik‘, die sich mit der schmerzlichen Operation an ihrem Körper verbinden ließe. Wie sie betont: „Yes it’s kind of painful, but I don’t want to make it more theatrical than it is.“ Dennoch zitiert Rossa bekannte Effekte lebensgefährlicher Performances, wenn sie zum Beispiel eine Zuschauerin gegen Ende ihrer Performance dazu auffordert, sie mit einer Schere von der Stahlkonstruktion zu befreien. Die anschließend bei dieser bewusst inszenierten ‚Rettungsaktion‘ geschossenen Bilder dokumentieren nicht nur das berühmte Moment des Eingreifens von Zuschauern ins Bühnengeschehen, welches in der Performancetheorie zum Paradebeispiel von Ko-Präsenz und Liminalität einer Aufführung wurde. Die Fotografien markieren darüber hinaus den dramatischen Wendepunkt, die 21 Sam McBride zitiert nach Markku Eskelinen/Ragnhild Tromstad, „Video Games and Configurative Performances“, in: The Video Game Theory Reader, hg. v. Mark J. P. Wolf/Bernard Perron, London/New York: Routledge 2003, S. 195-220, hier: S. 205. 22 Zur narrativen Funktion des Ende-Setzens in einem narrativen Prozess vgl. Paul Ricœur, Zeit und Erzählung, Bd. 1: Zeit und historische Erzählung, München: Wilhelm Fink 1988, S. 107ff; Frank Kermode, The Sense of an Ending. Studies in the Theory of Fiction, New York: Oxford University Press 1967; Peter Brooks, Reading for the Plot. Design and Intention in Narrative, Cambridge/London: Harvard University Press 1984. 23 Walter Benjamin, „Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows“, in: ders.: Gesammelte Schriften II.2, hg. v. Rolf Tiedemann/Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1980, S. 438-465, hier: S. 450. Vgl. auch Peter Brooks, der die Lust am Erzählen als eine auf Finalität gerichtete Lust mit Freuds Todestrieb begründet: Erst im Tod, so die Verheißung, die im angenommenen und illusorischen Ende jeder Erzählung aufscheint, fallen Erzählen und Erzähltes zusammen. Diese Verheißung zwingt zur lustvollen Wiederholung: zum Erzählen als einen notwendigen und paradoxen Vorgang, der das Ende – wenn auch verkennend – fassbar macht und es zugleich erzählend aufschiebt. Zu erzählen, ist eine Lust „that never can quite speak its name [...] but that insists on speaking over and over again its movement toward that name.“ Brooks, Reading for the Plot, a.a.O., S. 61 und S. 103.
186
NINA TECKLENBURG
Peripeteia einer Geschichte, die sich ihnen zukünftig entnehmen lassen wird und dabei altbekannte Plotstrukturen und daran gekoppelte Inszenierungstechniken von Schmerz und Leid, ja von Mitleid und Furcht heraufbeschwört. Peggy Phelan beschrieb eine solche Rettungsaktion seitens der Zuschauer in Bezug auf AbramovićPerformances einmal bezeichnenderweise als „protector’s response to the unfolding drama“24. Wenn für Phelan Zuschauer Beschützer und die Aufführung ein dramatische Geschichte darstellen, dann lässt sich Rossas Performance schließlich als eine Dekonstruktion narrativer Dimensionen interpretieren, welche der Wahrnehmung vieler lebensbedrohlicher Aufführungen der Performancekunst, sofern diese immer auch Wiederholungen ihrer eigenen etablierten Inszenierungstechniken darstellen, zu einem Anteil immer schon eingeschrieben sind. Inwiefern, so lässt sich fragen, ist ein Kanonisch-Werden von Performances der Tatsache geschuldet, dass sie sich so gut erzählen lassen? Und was tragen wir als Theaterwissenschaftler und Theaterwissenschaftlerinnen zu einer solchen Kanonisierung bei, wenn man bedenkt, dass die Wiederholungen von Aufführungen in unserer zumeist schriftlichen Analysepraxis vornehmlich narrativ strukturiert sind? Wenn ein wichtiges und nach wie vor erstrebenswertes Ziel von Aufführungsanalyseseminaren darin liegt, die Wahrnehmung der Studierenden zu schulen, für Präsenzphänomene in einer Aufführungssituation zu sensibilisieren und schließlich die Aufführungserfahrungen als Grundlagen einer Analyse ernst zu nehmen, dann darf dabei nicht übersehen werden, dass auch diese Schulung von Strukturen durchzogen ist, die bestimmte Erfahrungen fördern, ggf. ausgrenzen und zuallererst ermöglichen. Diese Schulung also wirkt zurück auf die Wahrnehmung von Aufführungen im Moment ihres Vollzugs. In Rossas Performance spiegeln sich die eingrenzenden, teilweise mythisch aufgeladenen und narrativ geprägten Strukturen unseres theoretischen Handelns, Redens und Reflektierens wider und sie verdeutlicht die Macht unumgänglicher Übertragungsprozesse als Bedingung unseres Gegenstandes und damit einer Wissenschaft von Aufführungen.
4. Die Märtyrerin Ich wollte noch mal kurz zuende erzählen, was denn nun genau mit Rudolf Schwarzkogler passiert ist. Was hat es mit der Märtyrergeschichte von Schwarzkogler auf sich, von der Rossa in ihrer Performance berichtet? Schwarzkoglers Genitalselbstverstümmelungsperformance mit Todesfolge, jene Ursprungserzählung, die Rossas eigene künstlerische Praxis begründete, entpuppt sich, wie Rossa erzählt, nach eingehender Recherche ihrerseits als Fiktion. Wie Rossa weiter hinzufügt, fand sie außerdem heraus, dass die grassierende Geschichte über eine nie geschehene Performance auf der Grundlage von Fotografien entstanden war, die Schwarz24 Phelan, „On Seeing the Invisible“, a.a.O., S. 18.
TELLING PERFORMANCE
187
kogler noch nicht einmal von sich selbst, sondern von einem Freund gemacht hatte. Dieser hatte sich für die Aufnahmen einen aufgeschlitzten Fisch vor sein Genital gebunden und daran eine vorgetäuschte Kastrations-OP durchgeführt, was jedoch auf den Fotos nicht wirklich zu erkennen sei. Doch auch (beziehungsweise gerade) als Fiktion ist und bleibt Rudolf Schwarzkogler Boryana Rossas Märtyrer der Performancekunst, wie Rossa betont: „So it was always clear that none of what [I do] can [ever] be compared to Rudolf Schwarzkogler cutting his penis off.“ – Obgleich zu fragen wäre, ob Rossa sich nicht spätestens in dem Moment der mythischen Kraft ihres großen männlichen Vorbildes entledigte, als sie versuchte, in ihrer Performance Blood Revenge 2 von 2007 Schwarzkoglers fake-Performance mit einem Theaterblut beschmierten Umschnalldildo zu reenacten. Doch wie diese Geschichte ausging, erzähle ich ein anderes Mal.
Literaturverzeichnis Abramović, Marina, „Reenactment“, in: dies. (Hg.): Seven Easy Pieces, Milan: Charta 2007. Auslander, Philip, Liveness: Performance in a Mediatized Culture, London/New York: Routledge 1999. Barthes, Roland, Mythen des Alltags, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1964. Benjamin, Walter, „Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows“, in: ders.: Gesammelte Schriften II.2, hg. v. Rolf Tiedemann/Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1980, S. 438-465. Blumenberg, Hans, Arbeit am Mythos, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2001. Bormann, Hans-Friedrich/Brandstetter, Gabriele: „An der Schwelle. Performance als Forschungslabor“, in: Schreiben auf Wasser. Performative Verfahren in Kunst, Wissenschaft und Bildung, hg. v. Hanne Seitz, Bonn: Klartext 1999, S. 45-55. Brooks, Peter, Reading for the Plot. Design and Intention in Narrative, Cambridge/London: Harvard University Press 1984. Clausen, Barbara (Hg.), After the Act – The (Re)Presentation of Performance Art, Nürnberg: Verlag für moderne Kunst Nürnberg 2005. Derrida, Jacques, Eine gewisse unmögliche Möglichkeit, vom Ereignis zu sprechen, Berlin: Merve 2003. Eskelinen, Markku/Tromstad, Ragnhild, „Video Games and Configurative Performances“, in: The Video Game Theory Reader, hg. v. Mark J. P. Wolf/Bernard Perron, London/New York: Routledge 2003, S. 195-220. Fischer-Lichte, Erika, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004. Godelier, Maurice, Das Rätsel der Gabe. Geld, Geschenke, heilige Objekte, München: Beck 1999. Gronau, Barbara/Roselt, Jens, „Diskursivierung des Performativen“, in: Praktiken des Performativen (=Paragrana 13:1), hg. von Erika Fischer-Lichte/Christoph Wulf, Berlin: Akademie 2004, S. 112-120. Jamme, Christoph, Geschichten und Geschichte. Mythos in mythenloser Gesellschaft, Erlangen/Jena: Palm & Enke 1997. Kermode, Frank, The Sense of an Ending. Studies in the Theory of Fiction, New York: Oxford University Press 1967. Krämer, Sybille, Medium, Bote, Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2008.
188
NINA TECKLENBURG
Mersch, Dieter, Was sich zeigt. Materialität, Präsenz, Ereignis, München: Wilhelm Fink 2002. Müller-Schöll, Nikolaus, „Vorwort“, in: Ereignis. Eine fundamentale Kategorie der Zeiterfahrung. Anspruch und Aporien, hg. v. ders., Bielefeld: transcript 2003, S. 9-17. Phelan, Peggy, „On Seeing the Invisible: Marina Abramović’s The House with the Ociean View“, in: Live. Art and Performance, hg. v. Adrian Heathfield, London/New York: Routledge 2004, S. 16-27. —, Unmarked. The Politics of Performance, London/New York: Routledge 1993. Ricœur, Paul, Zeit und Erzählung, Bd. 1: Zeit und historische Erzählung, München: Wilhelm Fink 1988. Schneider, Rebecca, „Archives. Performance Remains“, in: Performance Research. On Maps and Mapping 6:2 (2001), S. 100-108. Schrödl, Jenny, „Energie“, in: Metzler Lexikon Theatertheorie, hg. v. Erika Ficher-Lichte/Doris Kolesch/Matthias Warstat, Stuttgart/Weimar: Metzler 2005, S. 87-90. Solla, Gianluca, „‚Alles, was der Fall ist.‘ Der Messias als Ereignis überhaupt“, in: Ereignis. Eine fundamentale Kategorie der Zeiterfahrung. Anspruch und Aporien, hg. v. Nikolaus MüllerSchöll, Bielfeld: transcript 2003, S. 48-59.
MATEUSZ BOROWSKI, MAŁGORZATA SUGIERA
Macht der Verschiebung: zwei site-specific Hamlet-Inszenierungen
Am Anfang des 20. Jahrhunderts gewann die Kunst infolge ihres Emanzipationspotenzials die ersehnte Unabhängigkeit von der aktuellen Politik und den Alltagsproblemen – eine Unabhängigkeit, die sie dann auf unterschiedliche Weise umsetzte. Die Grundlage für eine so entschiedene Separierung der Kunst von der Politik war nicht nur eine seit vielen Jahren bei Philosophen und Künstlern heranwachsende Überzeugung von der Andersartigkeit der Kunst, sondern auch von einer Überlegenheit der ästhetischen Erfahrung gegenüber den sonstigen Lebensbereichen. Am besten ausgedrückt hat diesen Gedanken wohl Friedrich Schiller in den Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen, in welchen er die für die ästhetische Erfahrung charakteristische und für seine besondere Qualität entscheidende doppelte Aufhebung definierte: Die Aufhebung der Erkenntnismacht des Verstands (des Intellekts), der normalerweise die Sinnesempfindung bedingungslos den eigenen Kategorien unterordnet, und die Aufhebung der Macht des Sinnlichen, die dem Willen das Gewollte rücksichtslos aufzwingt. Auf diese Weise ebnete Schiller das Feld für den Kampf der Kunst um ihre Autonomie, indem er sie als einen separaten Bereich der anthropologischen und politischen Aktivität des Menschen darstellte. Das, was jedoch zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Triumph erschien, erwies sich ein halbes Jahrhundert später als gefährliche Falle eines binären Gegensatzes, in die nach und nach die scheinbar unabhängigen Künstler und ihre Werke tappten. In dieser Zeit wurden zwei extreme und schwer zu vereinbarende Haltungen laut: Entweder verzichtet die Kunst gänzlich auf Absonderung und Produktion von Artefakten, indem sie diese durch Bildung lokaler Gemeinschaften ersetzt und in einem solchen Rahmen bereits nicht existierende oder vom Aussterben bedrohte Formen zwischenmenschlicher Beziehungen reaktiviert; oder – umgekehrt – sie vergrößert immer mehr die bisherige Trennung der Erfahrungsbereiche und der ihnen eigenen Rationalitätsordnungen, indem sie die Ebenen der Metadiskurse multipliziert und die so genannte Strategie der widerspenstigen Form ausnutzt, also indem sie Kunst mit einer radikalen Ablehnung von Kommunikation gleichsetzt. Die Fehlerhaftigkeit dieses binären Gegensatzes verdeutlicht der französische Philosoph Jacques Rancière in Die Aufteilung des Sinnlichen. Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien.1 Anders als Schiller und die übrigen Anhänger der Autonomie der Kunst macht Rancière nicht die Spezifik der ästhetischen Erfahrung zum Ge1 Vgl. Jacques Rancière, Die Aufteilung des Sinnlichen. Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien, Berlin: b_books 2006.
190
MATEUSZ BOROWSKI, MAŁGORZATA SUGIERA
genstand seiner Überlegungen, sondern die grundlegenden kognitiven Mechanismen, mittels derer wir es gewohnt sind, Kunst als solche, d. h. als eine Erfahrung zu identifizieren, die sich von anderen Erfahrungen unterscheidet. Dadurch gelingt es ihm, die von den Philosophen der Aufklärung begründete Trennung der Kunst von der Politik erfolgreich anzufechten, auf deren Basis sowohl Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung als auch das Konzept von der Autonomie der Kunst im 20. Jahrhundert entstanden waren. Für Rancière besteht kein Zweifel, dass sich Politik ebenso wenig auf bloße Machtausübung oder auf den Kampf um Macht beschränkt, wie auch Kunst nicht erst in dem Augenblick politisch wird, da sie sich zur Weltordnung äußert oder sich mit der Darstellung der sozialen Struktur, der Konflikte und der Identität der sozialen Gruppen und Schichten beschäftigt. Sowohl die Kunst als auch die Politik sind zwei gleichwertige Formen der Aufteilung des Sinnlichen, die mit einer bestimmten, historisch bedingten Identifizierungsordnung eng verbunden sind. Seiner Meinung nach wird Kunst bereits in dem Augenblick politisch, da sie entweder die bereits existierende Aufteilung des materiellen und symbolischen Raumes bestätigt oder eine neue Aufteilung vorschlägt, indem sie die Grenze verschiebt zwischen dem, was in der Gesellschaft sichtbar ist und dem, was unsichtbar, ausgeschlossen und des Repräsentations- und Stimmrechts beraubt ist. „Politik besteht darin,“ schreibt Rancière, „die Aufteilung des Sinnlichen neu zu gestalten, die das Gemeinsame einer Gemeinschaft definiert, neue Subjekte und Objekte in sie einzuführen, sichtbar zu machen, was nicht sichtbar war, und als Sprecher jene vernehmbar zu machen, die nur als lärmende Tiere wahrgenommen wurden.“2 Die spezifische Politik der Ästhetik dagegen ist auf die Art und Weise zurückzuführen, „wie die Praktiken und Formen der Sichtbarkeit der Kunst selbst in die Aufteilung des Sinnlichen und in ihre Umgestaltung einwirken, deren Räume und Zeiten, Subjekte und Objekte, Gemeinsames und Einzelnes sie zerlegen“3. Die Kunst muss also weder sichtbar in den öffentlichen Bereich eingreifen, noch muss sie Themen aus den Zeitungsschlagzeilen aufgreifen. Auch wenn sie in ihrem ‚Elfenbeinturm‘ verbleibt, hört sie nicht auf, politisch zu sein – in dem Sinne nämlich, in dem Künstler durch Worte, Farben oder Klänge ihren fantastischsten Visionen sinnliche Formen verleihen. Das Problem liegt lediglich darin, dass Rancière vor allem ein Philosoph ist, der eigenen Gedankengängen nachgeht, der seine Thesen mit Beispielen aus jenen Bereichen illustriert, die ihm dies am überzeugendsten ermöglichen. Es ist also kein Wunder, dass er bei der Behandlung historisch veränderlicher und per definitionem politischer Sichtbarkeitsformen und -praktiken vor allem künstlerische Bilder und ihren Status wählt – nicht nur die Malerei als solche, sondern auch die Fotografie, das Kino und bildhafte Darstellungen in der Literatur. Hier kann er nämlich am anschaulichsten beweisen, dass Bilder an sich keine Bedeutung haben, und dass ihr Sinn und ihre Bedeutung jedes Mal in vielfacher Weise mit der Ordnung von Dis2 Jacques Rancière, Das Unbehagen in der Ästhetik, hg. v. Peter Engelmann, Wien: Passagen 2007, S. 35. 3 Ebd., S. 35f.
MACHT DER VERSCHIEBUNG
191
kursen verknüpft sind, in welche sie im jeweiligen Augenblick eingeführt werden. Ähnlich und lediglich am Rande der Überlegungen zu den Thesen von Michael Fried über das Theatrale in der Malerei, erwähnt Rancière das Theater als einen spezifischen Raum der Sichtbarkeit der Sprache; der Sprache, die mit dem konfrontiert und durch das kommentiert wird, was wir auf der Bühne sehen, mit einer konkreten Situation, Interaktion oder Geste.4 Ist das Theater jedoch ausschließlich eine Sprache, die auf ihre eigenen performativen Sprechakte verweist? Für keinen Theaterwissenschaftler kann Zweifel daran bestehen, dass beide – sowohl Rancière, als auch früher Fried – das Theater auf eine Weise definieren, die die Spezifik der Bühnenkunst und die Funktion der ihr eigenen Darstellungssysteme und Wahrscheinlichkeitsprinzipien deutlich einschränkt. Wichtiger ist jedoch an dieser Stelle, dass sich Rancière, wenn er sich mit Bildern befasst, hauptsächlich auf Artefakte und ihre diskursiven Bedingungen konzentriert. Das heißt, dass er aus einem sehr traditionellen Verständnis heraus über die Politik der Ästhetik schreibt. Der französische Philosoph unterscheidet zwar zutreffend das Brecht’sche Theater, das für viele Theaterwissenschaftler weiterhin ein Archetyp des politischen Theaters tout court bleibt, von dem von ihm definierten Bereich. Rancière bezeichnet es jedoch – völlig richtig – als eine Form der ‚politisierten‘ Kunst, als eine komplizierte und geschickte Verknüpfung politischer Pädagogik mit künstlerischem Modernismus. Brechts episches Theater stellte nämlich nicht die in den Zwanziger- und Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts geltenden Sichtbarkeitsformen und -praktiken in Frage. Vielmehr bemühte es sich vor allem, diese für die Formulierung und erfolgreiche Vermittlung von Kommuniqués zu verwenden, die eine revolutionäre Veränderung der sozialpolitischen Struktur zum Ziel hatten. So zumindest klingt Rancières Diagnose der von Brecht vorgeschlagenen und teilweise verwirklichten epischen Lösungen. Rancière konzentiert sich dabei auf die Analyse von bloßen Artefakten aus Inszenierungen und auf aktualisierende Eingriffe in klassische Texte. Seine Diagnose könnte anders ausfallen, wenn Rancière nicht nur das berücksichtigte, was das Theater mit den anderen Kunstarten verbindet, sondern auch die dem Theater innewohnende Eigentümlichkeit – seine Ereignishaftigkeit. Die traditionelle Ästhetik wird der Theateraufführung als Ereignis nicht gerecht. Daher entspricht dem heute überwiegenden Konzept der Theateraufführung auch vielmehr eine Ästhetik des Performativen. In deren Zentrum steht die autopoetische Feedback-Schleife, welche den Mechanismus der Teilnahme der Zuschauer an der Gestaltung dessen beschreibt, was man als theatrales Ereignis bezeichnet und welche nur teilweise durch eine sich in den folgenden Aufführungen wiederholende künstlerische Struktur determiniert ist.5 Wichtig ist an dieser Stelle, dass der Ästhetik des Performativen ähnliche Prinzipien zu Grunde liegen, wie der Politik der Ästhetik von Rancière. Sie hebt nämlich die Teilung zwischen der Kunst und den anderen Formen des Lebens auf und ersetzt die traditionelle Dichotomie durch 4 Vgl. Jacques Rancière, Politik der Bilder, Zürich/Berlin: diaphanes 2006. 5 Vgl. Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004.
192
MATEUSZ BOROWSKI, MAŁGORZATA SUGIERA
eine graduelle Skala, an Hand derer jeder Rezipient den Kunstgehalt der Ereignisse, an denen er teilnimmt, individuell erkennen und bewerten kann. Dieses Erkennen wird für den Rezipienten zu einer gewissen Disposition, die ihn gegenüber jenen Ereignissen zur Annahme einer ästhetischen oder ethischen Haltung mit all ihren Konsequenzen zwingt. Rancière hat bislang keine geeignete Perspektive vorgeschlagen, welche die von der Ästhetik betriebene Politik reflektiert und welche somit nicht so sehr auf dem Artefakt basiert, sondern vielmehr auf der durch das Artefakt bedingten und von der spezifischen Rezeptionsweise gegebenen Situation, sprich: auf der Koproduktion von Ausführenden und Zuschauer-Zeugen. Trotzdem möchten wir in unserem Text eine gewisse Möglichkeit des Sprechens auch über die Politik der Ästhetik des Performativen aufzeigen, indem wir uns auf ein ganz spezifisches inszenatorisches Mittel beschränken, das für das Theater der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts recht typisch ist. Anhand des Beispiels zweier ausgewählter Aufführungen der Modelltragödie Shakespeares – Hamlet IV. von Andrzej Wajda (1989) und H. von Jan Klata (2004) – wollen wir zeigen, wie die Wahl eines bestimmten Aufführungsraumes, der deutlich von der typischen Guckkastenbühne abweicht und diese zugleich lesbar thematisiert, nicht nur die Art und Weise der Interpretation des aufgeführten Textes entscheidend beeinflusst. Vor allem verändert sie auf verschiedenen Ebenen auch die Relation zwischen der Bühne und dem Zuschauerraum und bedingt in letzter Konsequenz die politische Dimension der Theaterkunst. Für die Auswahl der beiden Inszenierungen lassen sich mindestens zwei Gründe anführen. Gerade im Kontext des polnischen Theaters liefert Hamlet nicht nur Material für Überlegungen über das als klassisch verstandene politische Theater, sondern vor allem über eine Ästhetik des Performativen und deren politische Implikationen im Sinne Rancières. Wenn Rancière auf die politischen Funktionen der Ästhetik hinweist, stellt er eine arbiträr und historisch festgelegte Sichtbarkeit ins Zentrum seiner Überlegungen, wobei er die politische Aussagekraft eines jeden Aktes der Redefinierung oder der Verschiebung ihrer Grenzen unterstreicht – sowohl im gesellschaftlichen bzw. sozialen Leben als auch in der Kunst. Und obgleich er selbst es vorzieht, seine Thesen am Beispiel der Verkörperung der Sichtbarkeit in Form künstlerischer Bilder darzulegen, liefert das Theater diesbezüglich ebenfalls zahlreiche überzeugende Beispiele – insbesondere dasjenige Theater, welches Marvin Carlson als ‚haunted stage‘6 definiert. Es fiele schwer, sich ein besseres Bildmaterial für Rancières Überlegungen über die politische Aussage des Redefinierungsaktes oder der Verschiebung der Grenze der Sichtbarkeit vorzustellen als eben jene Theaterbühne, auf der derselbe dramatische Text erneut (nicht selten unter Teilnahme derselben Schauspieler und unter Nutzung desselben realen und/oder symbolischen Raumes, derselben Kostüme, Requisiten oder Musik), jedoch anders und in Abhängigkeit von den Bedürfnissen der jeweiligen Gemeinschaft aufgeführt wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich um einen Text handelt, der für diese Gemeinschaft von be6 Vgl. Marvin Carlson, The Haunted Stage. Theatre as Memory Machine, Ann Arbor: University of Michigan Press 2001.
MACHT DER VERSCHIEBUNG
193
sonderer Bedeutung ist und seit mindestens einigen Generationen als ein maßgebendes Spiegelbild der gemeinschaftlichen Psyche gilt und als ein bewährtes Werkzeug zur Aufstellung von aktuellen sozialpolitischen Diagnosen herangezogen wird. Und ebendiese Rolle spielt im polnischen Theater sowie in der polnischen Kultur überhaupt mindestens seit Beginn des 20. Jahrhunderts zweifelsohne Shakespeares Hamlet. „In Polen ist Hamlets Rätsel dieses: Was ist in Polen zu denken?“7 – schrieb ohne zu zögern Stanisław Wyspiański vor über hundert Jahren, und sein Interpretationsvorschlag der Shakespeare’schen Tragödie drückte zum einen eine bestimmte Vision über eine entsprechende Inszenierung des Textes aus. Zum anderen markierte sie den Versuch, dessen aktuelle politische Funktionen in einem Polen aufzuzeigen, das zu jenem Zeitpunkt unter drei benachbarten Mächten aufgeteilt war und seit vielen Jahren nur noch in der Erinnerung der Polen existierte. Der Dramatiker, Theaterregisseur, Maler, Grafiker und Bühnenbildner Wyspiański, einer der wichtigsten Vertreter der polnischen Moderne, las Hamlet 1904 – einige Monate vor einem weiteren Aufstand im Kampf um die nationale Unabhängigkeit – als ein Stück über die aktuelle sozialpolitische Situation und über die polnische Geschichte als eine verfestigte Form des polnischen Patriotismus und der Tradition der Freiheitskämpfe. Aus diesem Grunde polemisierte er gegen die damals bekannte Goethe’sche Auslegung der Figur des Protagonisten und machte darauf aufmerksam, dass Hamlet die Rache an Claudius erst auf genau den Augenblick verlegt, in dem dieser ihn unmittelbar zu bedrohen beginnt. Wyspiański erklärte nämlich ausdrücklich, dass niemand das Recht auf Rache für die Leiden der Väter für sich beanspruchen könne, sondern dass man nur die eigenen Leiden vergelten dürfe. Anders gesagt: Jeder sollte aktiv und selbständig sein persönliches und nationales Erbe aus der eigenen Perspektive überdenken. Für Wyspiański ist Hamlet von Shakespeare ein hervorragendes Beispiel für ein literarisches Werk, das einen Raum für Erfahrung aufmacht, der den Rezipienten immer neue und persönliche Aktualisierungen abfordert. Wyspiański sah darin ebenfalls ganz klar ein Theatermodell, das sich nicht mit der Magie der Illusion und mit leeren Bühneneffekten zufrieden geben will. Das Theater müsse vielmehr zum Raum tatsächlicher Erfahrung und intellektueller Handlung werden. Nur in einem solchen Raum werde die Aufmerksamkeit der Zuschauer – ihr ‚Gewissen‘, wie es Wyspiański nennt – in die gleiche Falle tappen, in die Hamlet das Gewissen von Claudius lockte, als er Die Ermordung Gonzagos aufführen ließ. Das Theater werde dann beginnen, wie eine Art Gerichtssaal zu funktionieren, in dem die Zuschauer ihrer Schuld und ihren Fehlern Auge in Auge gegenüber stehen, um bewusst die Verantwortung für diese zu übernehmen. Wyspiańskis Lesart des Hamlet ist nicht nur deswegen wichtig, weil sie eine neue Interpretationsweise des Textes und des Titelhelden vorschlägt. Aus der Per7 Stanisław Wyspiański, „Studium über Hamlet“, in: Theater spielen und denken. Polnische Texte des 20. Jahrhunderts, hg. v. Mateusz Borowski/Małgorzata Sugiera, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2008, S. 80-92, hier: S. 83.
194
MATEUSZ BOROWSKI, MAŁGORZATA SUGIERA
spektive der weiteren Entwicklung des politisch und sozial engagierten Theaters in Polen zeichnet sie auch die wichtigsten Probleme einer solch spezifischen Form des Theaters ab: Die Notwendigkeit der Involvierung aller Zuschauer zwecks Veränderung des Artefakts in ein Theaterereignis, infolgedessen sich mindestens für die Dauer der Aufführung eine Gemeinschaft bildet, die die Teilnahme an einer tatsächlichen Erfahrung ermöglicht. Mehr noch: Zum ersten Mal in der Geschichte des polnischen Theaters hat Wyspiański die Aussage- und Wirkungskraft einer Aufführung eng mit der Notwendigkeit des Verlassens der traditionellen Guckkastenbühne verbunden, indem er die Nutzung eines historisch aufgeladenen Ortes vorschlug, der deshalb nahezu automatisch eine Verknüpfung zwischen der nationalen Geschichte und den persönlichen Schicksalen der konkreten Zuschauer herstellen sollte. Dieser Ort sollte die Wawel-Burg sein, jener Ort, an dem die polnischen Könige regierten und bestattet wurden, und der generell als Wiege des Polnischtums galt – die polnische Akropolis sozusagen. Aus heutiger Perspektive wird deutlich, dass Wyspiański eine Aufführung im Stil des site-specific theatre vorschlug. Und obwohl sein Projekt unverwirklicht blieb, sollte diese untypische, obwohl ideologisch begründete Ortswahl weiterhin eine Schlüsselrolle spielen – sowohl in Bezug auf eine ‚Polonisierung‘ der Figur Hamlet und des Dramas Hamlet als auch in Bezug auf eine Involvierung der Zuschauer und ihre Vorbereitung zur Übernahme der Hauptrolle im Prozess der historischen Umwälzungen außerhalb des Theaters. Die Behauptung, dass der Anfang des 20. Jahrhunderts verfasste und veröffentlichte Essay von Wyspiański die vornehmliche Rezeption von Hamlet in Polen bis heute bestimmt, ist nicht übertrieben. Die Geschichte des Modelldramas von Shakespeare in Polen lässt sich desweiteren als Beispiel für die Thesen von Carl Schmitt anführen. Schmitt, den man aus heutiger Perspektive als einen Vorläufer des New Historicism und von Stephen Greenblatt betrachten kann, hat sich als einer der ersten den psychoanalytischen und psychologischen Interpretationen von Hamlet und den Lesarten aus dem Kreis des New Criticism entgegengestellt. Stattdessen legte er großen Wert auf die Beachtung einer performativen Dimension und sah in der Relation zwischen der szenischen Fiktion und den außertheatralen Erfahrungen der Zuschauer – sowohl zu Lebzeiten Shakespeares als auch in seiner eigenen Gegenwart – die wesentliche Wirkung des Theaters, die Greenblatt später als ‚Zirkulation sozialer Energien‘ bezeichnen sollte. Um dies zu verdeutlichen, liefert Schmitt im Essay Hamlet oder Hekuba zwei Beispiele von Ungenauigkeiten im Text, die Shakespeare absichtlich eingeführt haben soll und die viele Forscher zuvor als Arbeitsfehler erklären oder gar brandmarken wollten.8 Derweil dienten solch scheinbare Mängel – wie z. B. das sehr undramatische, nachdenkliche Wesen Hamlets oder die ungeklärte Teilnahme Gertruds an dem Mord an ihrem ersten Ehemann – geschickt als verschleierte Darstellungen wesentlicher, jedoch aus politischen Gründen kaum direkt aufgreifbarer, aktueller Ereignisse (entsprechend 8 Roman Pawłowski, „Duński książę w cieniu stoczni“ [Dänischer Prinz im Schatten der Werft], Gazeta Wyborcza, 05.07.2004.
MACHT DER VERSCHIEBUNG
195
beziehen sich diese Lösungen auf das Bild von Jakob Stuart als Thronfolger der Königin Elisabeth und auf die Verstrickung von Maria Stuart in die Intrige, die zur Ermordung ihres Ehemannes führte). An diesem Beispiel zeigt Schmitt auf überzeugende Weise, wie die Realität des elisabethanischen Englands in der Struktur der fiktiven Handlung von Hamlet in Form von Unklarheiten und Rissen deutliche Spuren hinterließ, die aus der Sicht der Entwicklung der in der dargestellten Welt ablaufenden Ereignisse nicht eindeutig erklärt werden können. Diese negativen, leeren Stellen, die die Zuschauer zu Lebzeiten Shakespeares mit der eigenen Erfahrung und einem eigenen Wissen um den aktuellen Wirklichkeitskontext ausfüllten, ließen diese Tragödie zum vitalsten Mythos der Neuzeit werden. Jene Leerstellen bieten ebenso die Möglichkeit, weitere Realitäten an den literarischen Text erfolgreich anzubinden – ‚neue Aggregate des Mythos‘ zu schaffen, wie Heiner Müller sagte, der diese von Schmitt dargelegte Chance in seiner HamletMaschine nutzte. Vielleicht liefert die polnische Rezeption Hamlets aufgrund der spezifischen geopolitischen Lage Polens – wer weiß, vielleicht die besten – Beispiele dafür, wie der Mechanismus des Eindringens immer neuer Realitäten in die Handlung wirkt, wodurch zugleich die scheinbar ununterbrochene Aktualität dieser Tragödie erklärt werden kann. Das beste Beispiel dafür ist die jüngste der einschlägigsten, offensichtlich politisch ausgerichteten Inszenierungen der Modelltragödie Shakespeares. Im Juli 2004 fand die Premiere der Aufführung H. statt, die von den Theaterkritikern einstimmig als eine Aussage über die aktuelle Situation in Polen beurteilt wurde. Der junge, jedoch bereits anerkannte Regisseur Jan Klata inszenierte die Handlung Hamlets in einer allmählich verwahrlosenden Danziger Werft, in der vor fast fünfzehn Jahren die Bewegung Solidarność entstanden war. Sein Ehrgeiz beschränkte sich jedoch nicht lediglich auf die Vorbereitung einer Freilichtaufführung. Klata, der den Titel des aufgeführten Stückes auf den enigmatischen Anfangsbuchstaben H. kürzte, ging es eindeutig um eine größtmögliche Polonisierung der Handlung und um ihre Verankerung im ‚Hier und Jetzt‘; d. h. in einem Polen, das zum wiederholten Male seine historische Chance vertan hatte und dies in der Handlung der Tragödie von Shakespeare schmerzlich erkennen sollte. Deshalb zwang Klata die Zuschauer nicht nur dazu, aufeinanderfolgenden Handlungssequenzen hinterher zu eilen und so verschiedene Räume und Orte der Werft zu sehen. Er füllte auch die kleinen Bühnen mit symbolischen Bildern, die direkt aus der Requisitenkammer des nationalen Imaginären stammten, wie zum Beispiel bereits in der ersten Szene, in der der Geist des Vaters in polnischer Husarenrüstung auf genau jenem legendären weißen Pferd erscheint, auf dessen Rücken die ersehnten neuen Erlöser dem polnischen Volk die Freiheit bringen sollten. Die symbolische Aussagekraft der Werft als Handlungsort von H. und die lesbaren, beinahe rudimentären Symbole des gemeinschaftlichen Imaginären bewegten die Kritiker dazu, Analogien zwischen der Tragödie Shakespeares und der aktuellen Situation in Polen zu suchen. „Thema ist das heutige Polen“ – schrieb ohne zu zögern Roman Pawłowski in der meistgelesenen Tageszeitung Gazeta Wyborcza – „ein Polen, in dem die Regierenden es vorzögen, die Vergangenheit zu vergessen, und in dem sich ein großer Teil der jungen
196
MATEUSZ BOROWSKI, MAŁGORZATA SUGIERA
Generation wie Hamlet abgewiesen fühlt“9. Die übrigen Kritiker übernahmen seine Meinung einhellig. Die von Klata geplante Rückkehr an einen Ort, an dem vor anderthalb Jahrzehnten das freie Polen geboren wurde, war so selbstverständlich wie zielgerichtet. Das Bedürfnis, in H. ein getreues Selbstbildnis der Polen zu zeigen, führte selbstverständlich zu einer Reihe von Veränderungen im Shakespeare’schen Text, zur Entfernung oder Verkürzung der einen und zum Ausbau anderer Motive. Die augenfälligste Veränderung in Hinblick auf die üblichen Interpretationen auf den polnischen Bühnen war der neue Ansatz in der Betrachtung des Titelhelden – des Prinzen. In der polnischen Werft wurde er zum Aufwiegler, der mit einem Gebetsbuch in der Hand angesichts des ansteigenden Chaos erfolglos nach Ordnung und nach der im christlichen Dekalog gebotenen Wertehierarchie suchte. Sein polnischer Charakter schien so markant, dass die Kritiker sogar forderten, Klatas Inszenierung als letzten Teil der Trilogie über das Nachkriegspolen anzuerkennen, die Andrzej Wajda mit den zwei berühmten Filmen Der Mensch aus Marmor und Der Mensch aus Eisen begonnen hatte. Gleichzeitig war ein Teil der Kritiker, die über diese Aufführung schrieben, wie zum Beispiel der bereits erwähnte Pawłowski, der Meinung, dass es besser gewesen wäre, wenn Klata seinen Hamlet auf einer traditionellen Bühne gezeigt hätte, da der industrielle Raum keine subtileren Inszenierungsmaßnahmen erlaubt, und die Notwendigkeit des ständigen Ortswechsels die Wahrnehmung der Zuschauer gestört habe. Dabei lag doch der Grund für den polnisch-nationalen Charakter der Aufführung nirgendwo anders als gerade in der Dimension des site-specific theatre. Und das war auch nichts Ungewöhnliches: Wir erinnerten bereits an den Vorschlag von Wyspiański, Hamlet auf der Wawel-Burg aufzuführen, welcher 1981 von Wajda verwirklicht wurde. Hinzufügen könnte man auch das frühere und unvollendete Projekt von Konrad Swinarski, der nicht nur das Gebäude des Alten Theaters in Krakau, sondern ebenfalls dessen Umgebung zum Handlungsort machen wollte (1975), die spätere Inszenierung von Łukasz Barczyk in der Salzmine in Wieliczka (2004) oder Hamlet 44 von Paweł Passini im Museum des Warschauer Aufstands (2008). Wie man sieht, haben in der neuesten Geschichte des polnischen Theaters bedeutende Aufführungen von Hamlet nicht nur eine eigene Lesart der Tragödie durch das Prisma der aktuellen Situation in Polen angeboten. Sie haben auch die Handlung außerhalb der traditionellen Bühne an einem spezifisch ausgewählten Ort angesetzt und diesen so zum übergeordneten Kontext erklärt, der den Zuschauern eine neue Sichtweise auf den bekannten Text diktierte und ihnen seine neuen Bedeutungen aufzwang. Die polnischen Hamlet-Inszenierungen bestätigen demnach teilweise die Thesen Una Chaudhuris über die Bedeutung von Handlungsorten im Gegenwartstheater und -drama. In ihrer Arbeit Staging Place argumentiert sie, dass zwischen der Tendenz zur ortsspezifischen Gestaltung des Handlungsortes, die in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts an besonderer Bedeutung gewann, und dem naturalistischen Theater des ausgehenden 19. Jahrhunderts eine historische Linie 9 Roman Pawłowski, „Duński książę w cieniu stoczni“ [Dänischer Prinz im Schatten der Werft], Gazeta Wyborcza, 05.07.2004.
MACHT DER VERSCHIEBUNG
197
bestünde.10 Dreidimensionale Dekorationen, die reale Innenräume mit authentischen Möbeln und Gegenständen des täglichen Gebrauchs nachahmten, übernahmen im Naturalismus vornehmlich die Beglaubigungsfunktion für die Bühnenwelt. Im Rahmen der dominierenden Ideologie des biologischen und sozialen Determinismus dienten sie darüber hinaus als ein sichtbares Zeichen des Fatums, da sie Verhaltensweisen ausdrückten, die die Identität der Individuen bestimmten und ihr Verhalten diktierten. Am Wichtigsten ist für Chaudhuri jedoch, dass der so begriffene Bühnenraum auch die Schlüsselfunktion bei der Involvierung der Zuschauer zu spielen begann, denn sein richtiges Arrangement bedingte eine stärkere, beinahe hypnotische Wirkung der szenischen Illusion auf die Fantasie der Empfänger. Diese Thesen enthielten vielleicht nichts Bahnbrechendes, wäre da nicht die Konklusion, zu der die Autorin von Staging Place in ihrer Analyse der Funktion des räumlichen Arrangements in Strindbergs Fräulein Julie kommt, wenn sie dieses mit den grundlegenden Maßnahmen des so genannten environmental theatre aus den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts vergleicht. Nach Chaudhuri sei der Tatsache zwar zuzustimmen, dass das environmental theatre aus der kulturellen Widerstandsbewegung gegen die bürgerliche Kultur entstand, welche durch das bereits veraltete Theater des Naturalismus und des kritischen Realismus repräsentiert wurde. Aber das Verlassen des Theatergebäudes und die Nutzung realer Räume als Handlungsorte und als Orte politischer Interventionen habe doch hundert Jahre später im Grunde dieselbe Beglaubigungsfunktion ausgeübt wie im einstigen Theater gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Damit habe die Gegenkultur zum naturalistischen und realistischen Theater ihre traditionellen Wurzeln entschleiert, obwohl doch gerade die radikale Abwendung von der Vergangenheit, an welche ein Teil der Theaterhistoriker immer noch glaubt, einer der Gründe ihrer Entstehung war. Chaudhuri, beschäftigt mit der Suche nach dem Ursprung der Gegenkultur des Theaters, übersieht jedoch einen wichtigen Aspekt der Nutzung realistischer, nicht-theatraler bzw. geradezu antitheatraler Räume durch das neueste Theater. Um diesen Aspekt offenkundig zu machen, schlagen wir einen kurzen Blick auf die erste polnische Freilichtaufführung des Hamlet durch das Thorner Theater vor. Zunächst entstand hier im Juni 1926 eine Aufführung auf der traditionellen Bühne, mit einer für ein Provinztheater recht avantgardistischen, minimalistischen Dekoration, die lediglich aus Vorhängen und kleinen Gegenständen bestand und so einen schnellen Wechsel des Handlungsortes ermöglichte. Diese Inszenierung überführte der Regisseur und Hauptdarsteller Karol Benda einen Monat später in einen anderen Raum – in den gotischen Innenhof und in mehrere Stockwerke des örtlichen Rathauses. Erwartungsgemäß lobten die Rezensenten dieses klassische, „vom Dekorationsballast und künstlichem Tand, der zur Herbeiführung der theatralen ‚Täuschung‘ verwendet wird“11, losgelöste Drama. Den Eindruck des Au10 Vgl. Una Chadhuri, Staging Place: The Geography of Modern Drama, Ann Arbor: University of Michigan Press 1995. 11 Zitiert nach Andrzej Żurowski, Szekspir – ich rówieśnik [Shakespeare – Ihr Altersgenosse], Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2003, S. 188.
198
MATEUSZ BOROWSKI, MAŁGORZATA SUGIERA
thentischen vertieften zum Schluss Pferde, die vor den Fackeln scheuten und vor deren Hufen sich alle im Thronsaal von Elsynor verstreuten Leichen durch Flucht retten mussten. Wie zu vermuten ist, ist der tatsächliche Ort in Thorn so ausgewählt worden, dass der theatrale Betrug – die verurteilte ‚Täuschung‘, von welcher der Rezensent spricht –, durch eine wahrhaft magische Illusion ersetzt wurde. Als also auf der Guckkasten-Bühne die Kraft der naturalistischen, durch nackte Vorhänge ersetzten Dekorationen erschöpft war, wurde das gotische Bauwerk zum Garant der Illusion, das kraft derselben, weiterhin geltenden Konvention das Schloss der Hamlets, Elsynor, ‚darstellte‘. Es erfüllte also eine ähnliche Beglaubigungsfunktion, die Chaudhuri für die Charakteristik des environmental theatre geltend macht. Wenn wir nun zu H. von Klata zurückkehren, zeigt sich, dass diese Aufführung nur scheinbar Chaudhuris Thesen bestätigt. Es stimmt – die Verlegung der Handlung von Hamlet in die Werft, an einen Ort, der ein lebendes Zeugnis der historischen Umwälzungen darstellt, hat den Status der Handlung prinzipiell nicht verändert. Die Zuschauer sahen weiterhin fiktive Ereignisse, die im Einklang mit den traditionellen dramatisch-theatralen Konventionen verwirklicht wurden. Indem sie Schritt für Schritt der den Ort wechselnden Handlung folgten, durchschritten sie zwar riesengroße, verlassene Produktionshallen und Korridore der Werft, sie griffen jedoch keinesfalls in den Verlauf der Ereignisse ein, sahen diesen immer nur wie vom Zuschauerraum eines Guckkastentheaters aus zu und blieben typische Voyeure. Es scheint, dass die Verwendung dieses Mittels des site-specific theatre in H. weniger eine magische Illusion wie einst in Thorn entstehen lassen sollte, sondern dass vielmehr die Erinnerungen der Zuschauer an die Ereignisse, die sich vor fünfzehn Jahren in der Werft abgespielt hatten, geweckt und diese logisch mit der Handlung von Hamlet verknüpft werden sollten. Die Wahl des Ortes wurde also nicht von den Ereignissen in Elsynor diktiert. Der Regisseur ließ sich vielmehr von dem Willen leiten, sie als entsprechenden Kommentar zur aktuellen Situation im Land zu nutzen, deren Verständnis sowohl einer Erweiterung der Perspektive als auch einer gewissen Dosis Verallgemeinerung bedurfte. Die Geschichte des dänischen Prinzen in der Werft wurde in letzter Konsequenz zu einer traditionellen, szenischen Allegorie, zum Bild einer weiteren Generation von Söhnen, die von der von ihren Vätern erbauten Welt enttäuscht sind. Benda wollte, als er die Handlung von Hamlet in den Innenhof des Rathauses verlegte, die Wirksamkeit der klassischen Mechanismen von Projektion und Identifikation bewahren. Klata hingegen hatte etwas in der Art einer didaktischen Erzählung konstruiert, in der der reale Raum in jenem Maße zur Bedeutung kam, in welchem er offensichtlich die Ebene eines belehrenden Vergleiches zwischen dem Schicksal des fiktiven Hamlet und dem Schicksal des realen Zuschauers suggerierte. Aus diesem Grunde hatte auch der Ort der Handlung die für das Guckkastentheater typische Beziehung zwischen übergeordneten Ausführenden und untergeordneten Zuschauern kein bisschen verändert. Im Gegenteil, sie wurde zusätzlich betont. Voraussetzung für die erfolgreiche Wirksamkeit von H. als einer didaktischen Erzählung war ja die Darstellung des Theaters als einen Kunstbereich, der nicht nur Unterhaltung zu gewährleisten, sondern auch ‚Wahres‘ auszusagen vermag, obwohl das Theater nicht mehr die mi-
MACHT DER VERSCHIEBUNG
199
metischen Mittel für sich beanspruchen kann, die unter anderem durch das Fernsehen entwertet worden sind. Davon zeugt hinreichend die zum großen Teil improvisierte Szene der Ankunft der Schauspielertruppe auf dem Hof in Elsynor und die Aufführung der Ermordung Gonzagos. In Shakespeares Tragödie ist dies eine überaus metatheatrale Szene, die die Zuschauer zum Begreifen der Funktionsweise eines Theaters im Theater und dessen ‚realer‘ Wirkung auf Claudius vorbereitet. Hamlet kommentiert hier die Grundsätze der Schauspielkunst und hält eine eigene Vorlesung über die Macht des Theaters, welches der Welt als ein getreuer Spiegel zu dienen hat. In Klatas H. führten derweil Hamlet, Rosenkranz und Guildenstern eine Anhörung von Amateurschauspielern durch, die sich um die Hauptrolle im Hamlet bemühten und den wohl berühmtesten Monolog ‚Sein oder Nichtsein‘ rezitierten. Das Casting, das von verächtlichen Kommentaren seitens der Durchführenden begleitet wurde, gewann eine junge Frau mit kläglichen schauspielerischen, jedoch mit herausragenden körperlichen Qualitäten. So wundert es keinesfalls, dass schließlich Die Ermordung Gonzagos von einer Schauspieltruppe aus der Hauptstadt im denkbar schlechtesten Theaterstil präsentiert wurde. Die Aufführung spielte jedoch keine bedeutende Rolle. Es war Hamlet, der den Suchscheinwerfer bediente, den König damit aus der Dunkelheit hervorholte und ihn zum Hervortreten und damit zum Eingeständnis seiner Schuld zwang. Klata verspottete in H. auf beinahe kabarettistische Weise das mimetische, auf Identifikation angelegte Theater, um auf seine Kosten die Bedeutung eines Theaters als Scheinwerfer hervorzuheben, das nicht illustriert und den Zuschauer zwingt, sich im szenischen Bild wieder zu finden, sondern das auf etwas hinweist, das er- und beleuchtet wird und dadurch zum Denken anregt. Die Wahl des realen Raumes ermöglichte es, diese Funktion des Theaters stärker zu betonen, und bewies zugleich, dass die Wirkung der Konvention des site-specific theatre sich nicht auf die Beglaubigung der fiktiven Handlung beschränken muss. Man kann sie als bereits erkennbares Zitat verwenden, als Folie für den lesbaren Kampf zwischen verschiedenen Konventionen des traditionellen Theaters. Dies ermöglicht dem Regisseur, sich eindeutig auf die Seite einer dieser Konditionen zu stellen und dadurch die eigene, von der Bühne ausgehende Botschaft glaubwürdig zu machen. Dass site-specific theatre nicht – wie zumeist vermutet – zwangsläufig mit der Expansion des Theaters auf ihm ferne, ‚natürliche‘ oder ‚industrielle‘ Bereiche einher geht, zeigt Andrzej Wajdas Hamlet IV., der im Juni 1989 im Stary Teatr in Krakau aufgeführt wurde. Die architektonische Beschaffenheit des traditionellen Theaters lässt sich auch auf eine Weise thematisieren, die die metatheatralen Aspekte von Hamlet nicht nur als eine Möglichkeit der Reflexion über die Relation Theater (bzw. Kunst) und Leben erscheinen lassen, sondern auch als eine Auseinandersetzung mit dem Theater selbst, d. h. mit dem Theater als einem bestimmten Sehapparat, als einer Maschine des Sichtbarmachens (und ebenso des Unsichtbarmachens). Dies war u.E. gerade in Wajdas Hamlet IV. der Fall, auch wenn die damalige Kritik die politische Dimension dieser Aufführung größtenteils nicht zu erkennen vermochte. Vielmehr warf sie dem Regisseur tadelnswerten Eskapismus vor und unterstellte
200
MATEUSZ BOROWSKI, MAŁGORZATA SUGIERA
eine Vereinnahmung der Shakespeare’schen Tragödie zu Zwecken einer ausschließlichen Thematisierung des Theaters, wodurch das Erkenntnispotenzial der Tragödie verloren gegangen sei. Elżbieta Baniewicz resümierte kritisch in der Monatsschrift Twórczość: „In der Welt des Spiels und der Scheinhaftigkeit gibt es doch, kann es doch keine Tragödie geben.“12 Die römische Zahl im Titel der Aufführung von Wajda steht für einen erneuten Versuch seinerseits, sich mit Shakespeares Meisterwerk zu messen. Jener erneute Versuch war insofern ein besonderer, als er auf eine Hamlet-Inszenierung vom November des Jahres 1981 folgte, die nur wenige Wochen vor der Verhängung des Kriegszustandes auf derselben Bühne ihre Premiere gefeiert hatte. Nach einigen Aufführungsmonaten mit Jerzy Stuhr in der Hauptrolle war die Inszenierung überarbeitet und mit wesentlichen, den neuen Restriktionen der Zensur entsprechenden Änderungen neu herausgebracht worden. Aber auch nach diesen Änderungen hatte die Inszenierung ihren deutlich lesbaren politischen Charakter beibehalten. Kein Zuschauer zweifelte daran, dass das Land, welches von einem Angriff des mächtigeren Nachbarn aus dem Osten bedroht wird, Polen war, und dass in den am Ende der Vorstellung auf die Bühne tretenden Truppen Fortinbras das zum Glück nicht verwirklichte Szenario der kürzlich erfolgten historischen Ereignisse zu sehen war. Die nächste Inszenierung, Hamlet IV., fand im Juni 1989, einige Tage nach den ersten, tatsächlich freien – wie man damals sagte – Parlamentswahlen statt. Alle erwarteten damals von Wajda eine weitere, politisch klare, offene, weil von jeglicher Zensur befreite Aussage. Derweil erschien jedoch sein Hamlet IV. auf den ersten Blick als eine geradezu autistische Aufführung, als eine Abhandlung über das Theater selbst und über den Beruf des Schauspielers. Davon zeugte alles: Von der Wahl der Theatergarderobe als Handlungsort über die hauptsächlich auf Kammerszenen beschränkte Handlung und die intimen Überlegungen des Haupthelden, die lediglich von einer Handvoll Zuschauer im selben Raum begleitet wurden, bis hin zur Besetzung der Hauptrolle Hamlets mit der Schauspielerin Teresa Budzisz-Krzyżanowska.13 Sie versuchte dabei in keiner Weise, ihr Geschlecht zu verbergen oder es für Transgenderspiele einzusetzen, sondern betrachtete die Figur Hamlets ausschließlich als eine schauspielerische Herausforderung. Die Zuschauer, die die Theatergarderobe als Handlungsort über die Hauptbühne des Alten Theaters betraten, beobachteten zunächst Teresa Budzisz-Krzyżanowska in einer halbprivaten Situation, in der die Schauspielerin in Frauenkleidung am Seiteneingang erschien, um schließlich hinter einem Paravent in die männliche Kleidung Hamlets zu schlüpfen. Diese bereits im Theater des 19. Jahrhunderts bekannte ‚Umkleiderei‘ hatte jedoch nichts mit der vom Regisseur vorgeschlagenen 12 Elżbieta Baniewicz, „Hamlet: gram dla siebie“ [Hamlet: Ich spiele für mich selbst], in: Twórczość 5 (1990). Zitiert nach Andrzej Żurowski, Szekspir i Wielki Zamęt [Shakespeare und das große Durcheinander], Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum 2003, S. 49. 13 Teresa Budzisz-Krzyżanowska (1942) ist eine der bekanntesten und wichtigsten polnischen Theater- und Filmschauspielerinnen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im Theater hat sie u. a. mit Jerzy Jarocki, Jerzy Grzegorzewski und Andrzej Wajda gearbeitet.
MACHT DER VERSCHIEBUNG
201
Interpretation des Haupthelden in Shakespeares Tragödie zu tun. Berühmte Darstellerinnen wie Sarah Bernhardt14 oder Helena Modrzejewska15 hatten zuvor Hamlet teilweise deswegen gespielt, um durch ihre weiblichen Figuren, Bewegungen und Stimmen Hamlets ‚unmännlichen‘, d. h. nachdenklichen und zögerlichen Charakter zu unterstreichen. Wajda entschied sich hingegen – wie er häufig betonte –, die Rolle Hamlets mit Teresa Budzisz-Krzyżanowska zu besetzen, weil sie seiner Meinung nach vor allem ‚der beste polnische Schauspieler‘ war, der dieser einmaligen theatralen Herausforderung gerecht werden konnte. Die Zuschauer hatten die Gelegenheit, in der zwar nicht mehr benutzten, aber echten Garderobe des Stary Teatr einem Schauspieler beim Anziehen seines Hamlet-Kostüms zuzusehen und seinen intimen Herzausschüttungen vor dem Spiegel zu lauschen, deren Inhalte denen der einstudierten Rolle ähnelten. Die Szenen mit den Hofleuten spielten sich dagegen auf der Bühne ab. Die Zuschauer blieben die ganze Zeit in der Theatergarderobe und konnten den Vorgang auf der Bühne über Spiegel und Videoübertragungen verfolgen. Am Ende der Aufführung zog sich Jerzy Radziwiłowicz als Fortinbras die Kleidung Hamlets wie ein eindeutiges Theaterkostüm an. Es war, als müsste ein Schauspielerkollege unerwartet eine Vertretung übernehmen. Hamlet IV. wollte also über das Theater sprechen und handelte vor allem vom Theater, aber ausschließlich davon? Die demonstrative Eigenthematik von Wajdas Hamlet IV., die von zahlreichen Rezensenten negativ bewertet wurde, welche ausschließlich das von ihnen wahrgenommene Spiel beachtet hatten, müsste eine andere Aussage gewinnen, wenn man berücksichtigte, was einst Jan Kott nach Brechts Kleinem Organon für das Theater als Notwendigkeit bezeichnet hatte: „das Bedürfnis die Zeit im Auge zu behalten“16. Die Premiere fand, wie bereits erwähnt, einige Tage nach den ersten freien Parlamentswahlen statt. Jetzt sollte das Parlament sämtliche Angelegenheiten des öffentlichen Lebens übernehmen, welche in dem zuerst von fremden Mächten und später durch das kommunistische Regime regierten Polen die Kunst, die notgedrungen ‚die Seelen regierte‘, zu berücksichtigen bestrebt war. In dieser Situation wurde es zur aktuellen und politischen Aufgabe, für die nun von den früheren Verpflichtungen befreite Kunst – und somit auch für das Theater – eine Neupositionierung vorzunehmen, nach der die Kunst sowohl als öffentliche Einrichtung wie als Domäne von Wirklichkeitsreflexion fungieren sollte. Verändert hatte sich demnach der sozialpolitische Kontext, der das Begreifen der Shakespeare’schen Tragödie bedingt. In diesem aktuellen Kontext des Juni 1989 wurde das ‚Sein oder Nichtsein‘ aus dem 14 Sarah Bernhardt (1844-1923), eine der berühmtesten Darstellerinnen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, spielte 1899 in Paris den Hamlet in Shakespeares Tragödie. 15 Helena Modrzejewska (1840-1909) war die bedeutendste polnische Schauspielerin des 19. Jahrhunderts. Durch ihre Shakespeare-Rolle hat sie den englischen Dramatiker auf polnischen Bühnen bekannt gemacht. 1876 emigrierte sie nach Amerika, wo sie eine erfolgreiche Karriere verfolgte. Das traditionsreiche Stary Teatr in Krakau trägt ihren Namen. 16 Jan Kott, Szekspir współczesny [Der zeitgenössische Shakespeare], Kraków: Wydawnictwo Literackie 1990, S. 89.
202
MATEUSZ BOROWSKI, MAŁGORZATA SUGIERA
entscheidenden Monolog des Titelhelden zu einer Frage nach der Kondition des Theaters in der neuen Realität; einer ebenso politischen Frage, wie die einstige Darstellung Dänemark-Polens als Gefängnis. Um dies zu erkennen, reicht es, die räumliche Gestaltung von Hamlet IV. genauer zu betrachten. Tatsächlich konnten die in der Garderobe sitzenden Zuschauer aus direkter Nähe das Ringen der Schauspielerin mit der Rolle Hamlets beobachten. Aber nicht nur das. Wajda wählte nämlich eine Garderobe, die seit Ende des 19. Jh. in unverändertem Zustand war. Er ließ also nicht nur zu, dass die Zuschauer den Schauspielern hinter der Kulisse zusehen durften. Er enthüllte auch demonstrativ das Theatrale dieses Aktes, da er die Zuschauer keine Sekunde lang an die Authentizität der Situation glauben ließ. Zudem wählte er eine Garderobe, die sich genau in der Seitenkulisse des Theaters befand, und ließ einen Teil der Handlung (Hofszenen, das Gebet des Königs und das Finale des Hamlet) traditionell auf der Bühne spielen, obgleich er diese aus einem untypischen Winkel, nämlich durch die schmale Tür der Garderobe, ‚von hinten‘ beobachten ließ. Um das Blickfeld zu erweitern und um zugleich zum wiederholten Male die Wahrnehmung selbst demonstrativ zu unterstreichen, verwendete er eine Kamera und einen Bildschirm, worauf man zum Beispiel das Gesicht des sich während des Gebets peitschenden Claudius sehen konnte. Eine ähnliche Funktion übernahmen die auf einer der Garderobenwände speziell für diesen Zweck angebrachten Spiegel, in welchen sich teilweise deformierte Szenen widerspiegelten, die sich im Raum des traditionellen Theaters abspielten. Wenn Wajda auf so vielerlei Weise die Aufmerksamkeit der Zuschauer im Stary Teatr auf die Tatsache ihres im-Theater-Seins und ihres Gebrauchs der im Guckkastentheater erworbenen Wahrnehmungsgewohnheiten lenkte, musste er die grundlegende metatheatrale Lösung Shakespeares, also das Theater im Theater, in den Schatten stellen. Die Aufführung der Ermordung Gonzagos erfolgte hinter dem Vorhang, und sichtbar waren nur ihre Folgen. In Wajdas Aufführung waren die Zuschauer in einem Theater, das für sie die Aufführung von Hamlet erarbeitet hatte. Wajda entschied sich für diesen Text jedoch nicht aufgrund der von Shakespeare gewählten Geschichte von der aufgetragenen und hinausgezögerten Rache, sondern vielmehr aufgrund dessen, was darin über die sich normalerweise der Beachtung der Zuschauer entziehenden Sichtbarkeitsprinzipien des traditionellen Theaters ausgesagt wird. Die Rezensenten irrten sich also nicht, wenn sie den Selbstbezug in Hamlet IV. unterstrichen. Vergleicht man jedoch Wajdas Inszenierung mit der zuvor besprochenen von Klatas H., wird deutlich, dass die Rezensenten unglücklicherweise die politische Dimension der vom Regisseur gewählten Strategie übersehen hatten. Wajda versuchte schließlich nichts anderes, als die Zuschauer in eine Falle zu locken, die derjenigen ähnelte, die von Hamlet inszeniert wird, um Claudius’ Gewissen zu fangen. Deswegen vollzog er die folgenreiche Verschiebung im Theatergebäude selbst, indem er es in eine Art environment umgestaltete. Das Gebäude des Stary Teatr in Krakau, in dessen Mauern die Tradition wortwörtlich eingraviert ist – Stary Theatr heißt ‚Altes Theater‘ –, diente ihm als Bühnenbild für eine Aufführung, die im wörtlichen und übertragenen Sinne die Kulissen der Theatermaschi-
MACHT DER VERSCHIEBUNG
203
nerie entschleierte. So wie die Danziger Werft als symbolische Verkörperung der Höhenflüge und Niederlagen der jüngsten Geschichte Polens diente, stellten die Mauern des Theaters ein lebendes Denkmal der Geschichte des Theaters selbst dar – seiner historischen Konventionen und Wahrnehmungsweisen. Wenn man diese Lösung jedoch aus der hier angeführten Perspektive von Rancière betrachtet, dann wird deutlich, dass Hamlet IV. durch die Berührung des Erfahrungsbereiches des Zuschauers die historisch bedingte und im Gegenwartstheater gültige Aufteilung des Sinnlichen thematisiert. Indem er den Zuschauern das zeigt, was sie üblicherweise im Theater nicht zu sehen bekommen und nicht sehen sollten – nicht nur durch die Entschleierung der verborgenen Theaterkulissen, sondern auch durch das Lenken der Aufmerksamkeit auf das Sehen – verschiebt er die Grenze der Sichtbarkeit. Er zwingt also die Zuschauer dazu, jene Frage zu stellen, die für Rancière überaus politische Resonanz hat: Welche Mechanismen entscheiden darüber, was überhaupt in den Bereich der Sichtbarkeit zugelassen wird, und welchen Sinn bekommt es damit? Dabei ging es in Hamlet IV. nicht bloß um rein abstrakte, philosophische Überlegungen oder um eine Art praktische Demonstration der wichtigsten Thesen der Phänomenologie der Wahrnehmung. Indem Wajdas Aufführung das alte, aus dem 19. Jahrhundert stammende Medium Theater mit neuen Videotechniken und Live-Übertragungen verband, sensibilisierte er die Zuschauer für die grundlegenden Mechanismen der Konstitutionsleistungen medialer Vermittlung in ihren unterschiedlichen Formen und Konventionen – jene Vermittlung, die jedes Mal über das Wissen der Zuschauer und über die dadurch bedingten politischen Entscheidungen und Anschauungen entscheidet. Die beiden von uns angeführten Beispiele können durchaus als eine Illustration der im heutigen Theater praktizierten Verschiebungen im Rahmen der Institution des traditionellen Theaters dienen, die zur Veränderung des Verhältnisses zwischen der Bühne und dem Zuschauerraum führen. Wir haben absichtlich zwei Aufführungen ausgewählt, die denselben zum Kanon des Dramas und des Theaters gehörenden Text verwenden. Ihre Regisseure verzichteten nicht zugunsten einer rein politischen Betätigung auf ihre künstlerischen Ambitionen, wie es die Künstler der Avantgarde der Siebzigerjahre so oft getan hatten. Diese hatten zu eben diesem Zweck das Theatergebäude verlassen, die gesamte Theaterinstitution verschmäht und auf diese Weise versucht, den Bereich der Kunst endgültig zu verlassen und sich dem sozialen Leben anzuschließen. H. und Hamlet IV. sind Inszenierungen, die im Rahmen des Theater-Mainstreams entstanden und sehr schnell im Traditionskanon des jüngsten polnischen Theaters ihren Platz fanden. Umso besser dienen sie als Beispiele für jenen Mechanismus, dessen Funktionsweise wir zu demonstrieren beabsichtigten: den Mechanismus der Änderung der Rezeptionsposition gegenüber der szenischen Realität durch Nutzung realer Räume und ihrer Funktionalisierung als Bühnenbild, das jedoch ihre Eigenart beibehält. Zweifelsohne unterscheiden sich die Inszenierungen voneinander hinsichtlich der Thematisierung des Begreifens und Nutzens traditioneller Lösungen im Theater. Klata nutzt im Namen des Erfolgs und des Effekts sei-
204
MATEUSZ BOROWSKI, MAŁGORZATA SUGIERA
ner programmatischen Botschaft besten Gewissens die Theaterkonventionen zum Erzielen einer unmittelbaren, beinahe pädagogischen Wirkung auf die Rezipienten. Wajda hingegen will zusammen mit den Zuschauern eine Art Hermeneutik des Verdachts gegenüber der Maschinerie des Theaters und ihrer politischen Funktion betreiben. Beide Inszenierungen zeigen jedoch, dass die Wirkung der Theaterkunst zur Stärkung der politischen Aussage nicht mit der Ablehnung des Theatralen als solchem verknüpft sein muss. Sie kann vielmehr mit einer wichtigen und auf vielen verschiedenen Ebenen möglichen Akzentverschiebung innerhalb der traditionell definierten Theatersituation verbunden sein, die auf die politische Dimension der in ihrem Rahmen vollzogenen Wahrnehmungsakte aufmerksam macht. Gezeigt wird eine Quelle, die zugleich Quelle der Kraft und der Schwäche des Zuschauers als Mitgestalter des theatralen Ereignisses ist. Aus dem Polnischen übersetzt von Marcin Behlert und Konrad Bach.
Literaturverzeichnis Baniewicz, Elżbieta, „Hamlet: gram dla siebie“ [Hamlet: Ich spiele für mich selbst], in: Twórczość 5 (1990). Carlson, Marvin, The Haunted Stage. Theatre as Memory Machine, Ann Arbor: University of Michigan Press 2001. Chadhuri, Una, Staging Place: The Geography of Modern Drama, Ann Arbor: University of Michigan Press 1995. Fischer-Lichte, Erika, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004. Kott, Jan, Szekspir współczesny [Der zeitgenössische Shakespeare], Kraków: Wydawnictwo Literackie 1990. Pawłowski, Roman, „Duński książę w cieniu stoczni“ [Dänischer Prinz im Schatten der Werft], Gazeta Wyborcza, 05.07.2004. Rancière, Jacques, Das Unbehagen in der Ästhetik, hg. v. Peter Engelmann, Wien: Passagen 2007. —, Die Aufteilung des Sinnlichen. Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien, Berlin: b_books 2006. —, Politik der Bilder, Zürich/Berlin: diaphanes 2006. Schmitt, Carl, Hamlet oder Hekuba. Der Einbruch der Zeit in das Spiel, Stuttgart: Klett-Cotta 2008. Wyspiański, Stanisław, „Studium über Hamlet“, in: Theater spielen und denken. Polnische Texte des 20. Jahrhunderts, hg. v. Mateusz Borowski/Małgorzata Sugiera, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2008, S. 80-92. Żurowski, Andrzej, Szekspir – ich rówieśnik [Shakespeare – Ihr Altersgenosse], Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2003. —, Szekspir i Wielki Zamęt [Shakespeare und das große Durcheinander], Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum 2003.
ERIN MANNING
Der Tanz der Aufmerksamkeit1
Diagrammatische Praxis2 Schritt 1: Legen Sie sich auf den Boden. Schließen Sie Ihre Augen. Schritt 2: Fangen Sie an, ein Diagramm des Raumes zu entwerfen. Warten Sie, bis es sich gefestigt hat. Schritt 3: Finden Sie eine freie Stelle in dem Diagramm, und nehmen Sie sie virtuell ein. Schritt 4: Finden Sie eine weitere freie Stelle. Nehmen Sie sie ein. Schritt 5: Warten Sie. Spüren Sie die Dehnbarkeit der Zeit. Spüren Sie, wie der Raum sich verändert. Schritt 6: Halten Sie Ihre Augen geschlossen, auch während Sie sich im und durch das Diagramm bewegen. Schritt 7: Stehen Sie langsam auf, halten Sie Ihre Augen weiterhin geschlossen. Begegnen Sie Ihrem Diagramm im Stehen erneut. Schritt 8: Warten Sie. Schritt 9: Finden Sie im Diagramm eine weitere freie Stelle. Schritt 10: Nehmen Sie diese nun tatsächlich ein. Schritt 11: Wenn Ihre Bewegung zum Stillstand gekommen ist und das Diagramm sich gefestigt hat, öffnen Sie langsam Ihre Augen.
1 Anm. d. Herausgeber: Um die Verständlichkeit dieses Aufsatzes zu erhöhen, haben wir uns entschieden, englischsprachige Zitate, sofern sie im Haupttext erscheinen, ins Deutsche zu übersetzen. 2 Dieses Bewegungsexperiment bildete den Auftakt zu einem eintägigen Workshop zum Thema verteilter relationaler Bewegung, den ich am 16. September 2009 am Zentrum Critical Path in Sydney (Australien) geleitet habe. Auf der Website http://www.criticalpath.org.au/ SEAM.html (Stand: 2.3.2012) findet sich dazu Folgendes: „SEAM 2009 [was] a multi-tiered event that explore[d] the nexus between architecture, space, film and the moving body. It includ[ed] a 3-day Symposium, multiple workshops, specially comissioned performances and installations by some of Sydney’s most exciting choreographers and dance practitioners and a series of artist’s talks.“ Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den Teilnehmern des Workshops bedanken. Die Offenheit, mit der sie den Experimenten des Workshops begegnet sind, hat es mir ermöglicht, die in diesem Aufsatz vorgestellten Konzepte zu entwickeln. Zu den Teilnehmern gehörten: Debra Batton, Lone Bertelsen, Haya Cohen, Atlanta Eke, Paul Gazzola, Petra Gemeinboeck, Diana Hani, Baki Kocaballi, Christiane Lo, Pauline Manley, Brian Massumi, Jodie McNeilly, Andrew Murphie, Banu Pekol, Gretel Taylor, Jade Tyas Tunggal, Beth Weinstein, Danielle Wilde.
206
ERIN MANNING
Abbildung 1
Verteilte Relationale Bewegung Die diagrammatische Praxis untersucht, wie sich der Wandel von Raum und Zeit in der unmittelbar gelebten Erfahrung vollzieht. Schon mit dem anfänglichen Plan zu einem Diagramm beginnt ein Verfahren, in dessen Ablauf das kartografische Potenzial der Raumzeit durchlaufen wird. Bereits dieser erste Schritt, der in den anschließenden Diagrammen rekursiv wiederkehrt, geht über eine visuelle Kartierung hinaus. Obwohl die Grenzen des Diagramms sich anfangs noch perspektivisch abbilden lassen, wird schon mit dem zweiten Schritt ihr Veränderungspotenzial erfahrbar: Finden Sie eine freie Stelle und nehmen sie diese ein. Der von der Bewegung in und durch das Diagramm geschaffene Freiraum, der auf diese Weise gleich zu Beginn entsteht, dient einem Prozess der Vor-Beschleunigung: er aktiviert die Bedingungen für die Verwandlung aller folgenden Diagramme. Das ursprüngliche Diagramm wird nie ersetzt (die einzelnen Schritte sind nicht linear) – es wird in einer topologischen Neu-Kartierung der dehnbaren Raumzeit vervielfältigt. Im Übergang vom ersten zum zweiten Schritt steht die Aktivität des Raumbildens im Vordergrund. Durch das Verfahren des ‚Mit-Raumbildens‘ wird nicht etwa ein zuvor geschlossenes Diagramm geöffnet, sondern es werden aktive Intervalle – assoziierte Milieus – innerhalb der Kraft und der Form des Diagramms erzeugt. In
DER TANZ DER AUFMERKSAMKEIT
207
der Vorbeschleunigung der anfänglich bewegten Bewegung ist das ‚Mit-Raumbilden‘ bereits im Keim enthalten. Vorbeschleunigung ist eine virtuelle Vorbewegung, mit der die Bedingungen für die Erfahrung und für die Bewegung der Relationen geschaffen werden. Mit der geschaffenen Gelegenheit für konstitutive Relationen durch die raumbildende Aktivität kann sich das Diagramm selbst in Richtung seiner tendenziellen Dehnbarkeit vor-beschleunigen. Diese im Keim vorhandene Aktivität – bloße Aktivität3 – ist direkt mit dem Körper verbunden, der sich in den Freiraum hineinbewegt. Das Körper-Raumbilden – nicht des eigenen Körpers, sondern eines elastischen Körpers, der im Raumbilden selbst mitgeschaffen wird – besteht aus der Verschränkung zwischen der diagrammatischen Praxis und des ihr innewohnenden Bewegungspotenzials. Es handelt sich dabei nicht etwa um die Repräsentation eines bereits existierenden Körpers, sondern um das Empfinden durch die Bewegung eines Körper-Werdens. Dieser wahrnehmende, sich bewegende Körper vorbeschleunigt gemeinsam mit dem sich in-formierenden Diagramm, und bringt eine multiple Singularität hervor: eine Körper-Diagrammatik. Die Körper-Diagrammatik ist ein prozessuales ‚Ich‘. Das Eintreten der Individualität in die sogenannte präexistierende Raumzeit zersetzt sie. Die in der Übung gemachten Erfahrungen lassen fühlen, dass das ‚Ich‘ als „eine Gewohnheit“4 immer schon relational ist. Das nicht-gewohnheitsmäßige ‚Ich‘ steht jetzt für Individuation. Individuation ist eine diagrammatische Praxis. Sie läuft nicht auf der Basis eines im Voraus festgelegten Zeitplans ab, sondern verwandelt sich im Sinne einer gemeinsamen Konstituierung auf verschiedenen topologischen Niveaus: als RaumKörper und Verräumlichung der Zeit. Diese mit-konstituierende Kraft des Zeitund Körper-Werdens wird dann in eine Vielzahl tendenzieller Erfahrungsregister dephasiert und macht sich auf verschiedenen, miteinander verknüpften Relationsmilieus fühlbar. Innerhalb der Bewegungsübung vollzieht sich das Dephasieren auf bemerkenswerte Weise im Stehen. Hier, während der Neuausrichtung der Gleichgewichte, schneiden die Vorbeschleunigungen des Bewegungspotenzials die vertikal-horizontalen Achsen. Diese Vorbeschleunigung findet nicht so sehr in einem einzelnen 3 Das Konzept der bloßen Aktivität entstammt Brian Massumis Arbeit über Präemption, Wahrnehmung und Politik in einem unveröffentlichten Buchmanuskript mit dem Titel Perception Attack. Er definiert die bloße Aktivität als „human life in the instant’s off-beat. In that instant, a life is barely there, recoiled, bodily consumed in its infra-relation to itself. It is a life without determinate content. In that imperceptible instant, what its content will be next is in the making. A life is formatively barely there, tensely poised for what comes next. In that measureless instant, a life is intensely barely there, regathering in an immediacy of its capabilities. This is not vitality reduced to the minimum, this is life primed. This is also war. The life primed may indeed be in proximity to death. Yet the body is already arcing toward a next vital exercise of its capacity to act. Not re-animalization: re-animation: a stoking for the next step. This is a far cry from a life reduced to brute matter. It is the embodied event of a life regathering in recoil. This is life self-enfolding in affective vitality.“ 4 Gilles Deleuze/Felix Guattari, Was ist Philosophie?, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2000, S. 122.
208
ERIN MANNING
Körper statt, sondern vielmehr in den Intervallen, die mit der, jeder Bewegung innewohnenden, Relationalität gegeben sind. Wenn man eine diagrammatische Vorbeschleunigung spürt, dann ist das, was sich verändert hat, nicht schlichtweg der Körper, sondern die Bedingungen für die Körper in Bewegung. Während die Teilnehmer mit ihren sich verändernden Diagrammen stehen, machen sie häufig die Erfahrung einer intensiver werdenden Umwandlung, einer Vervielfältigung von Intervallen. Bemerkbar macht sich dies zum Beispiel durch eine erhöhte Empfänglichkeit für die affektive Tonalität der Raum-Zeit. Dabei steht vor allem die kinästhetische Dimension des Diagramms im Vordergrund: Die Teilnehmer sprechen von einer Intensivierung ihres Klang- und Tastsinnes und davon, dass die gefühlte Raumerfahrung vieldimensional wird, eine Infra-Dimensionalität, verursacht durch die Veränderung der Grundlage. In dieser Umwandlung der Grundlage geht die Neigung weniger in Richtung Verlagerung und Vervielfältigung potenzieller Grundlagen, als vielmehr in Richtung einer Infra-Dimensionalisierung der Idee der Grundlage selbst. In dieser infra-dimensionalisierenden Haltung tendieren die Teilnehmer zur absoluten Bewegung, in der das Potenzial für die Erkundung des ständig modulierenden Vorbeschleunigungsintervalls am intensivsten erfahren werden kann. In dieser Infra-Dimensionalität zeigt sich, dass durch die Vielfalt der Intervalle selbst Freiräume für die Bewegung entstehen. Vorbeschleunigung ist der Kern der diagrammatischen Praxis. Sie geschieht nicht im Raum, sondern schafft diesen erst in der Bewegung. Da sie virtuell ist, ist sie allein in ihren Wirkungen und Tendenzen erfahrbar: ‚als solche‘ können wir sie uns gar nicht vorstellen. Die Vorbeschleunigung speist die bewegte Erfahrung an den entstehenden Rändern, dort, wo das Davor und das Zwischen der Bewegung zusammentreffen. In der gewohnheitsmäßigen Bewegung ist die Vorbeschleunigung meist zu flüchtig, um überhaupt wahrgenommen zu werden. In einer konzentrierten diagrammatischen Praxis jedoch, besonders in der Bewegung durch verschiedene Register der Verzeitlichung des Raums hindurch, kann man es sehr wohl fühlen, und es ist dieses Gefühl, das die inhärente Dehnbarkeit des RaumzeitKörperns am deutlichsten macht. Das Verfahren ist selbst topologisch. Das erste Diagramm ist eine Infra-Schicht der unendlichen Potenzialität des Körperns. Dieses Körpern ist nicht nur die Individuation eines Körper-Werdens, sondern auch die des intensiven Kartierens der Raum-Zeit. Schritt 1 ist ein Refrain, der die nachfolgenden Infra-Schichten der diagrammatischen Praxis gleichzeitig aktiviert und anfüllt. Raum-Zeit-Veränderung, ein Körper-Werden, das sich entlang einer ontogenetischen, diagrammatischen Verbindung verwandelt – das ist die expressive Kraft der relationalen Bewegung. Doch obwohl relationale Bewegung zwischen zwei Körpern stattfinden kann und als relationales Intervall der Vorbeschleunigung eines Körpers mit und hin zu einem anderen Körper erfahrbar ist, ist relationale Bewegung nicht nur auf zwei Körper beschränkt. Sie ist immer ein Vielfaches und immer schon verteilt in sich wandelnden Raum-Zeiten der Erfahrung. Verteilte relationale Bewegung ist die Form, die Bewegung annimmt, wenn sie ontogenetischer Ausdruck sich rekombinierender Diagramme wird. Relationale Bewegung ist
DER TANZ DER AUFMERKSAMKEIT
209
Abbildung 2: One Flat Thing, reproduced (Synchronous Objects Webseite)
die intensive Kraft eines Rekombinierens, durch welches die Individuation einer diagrammatischen Raum-Zeit-Praxis eingeleitet wird.
Was bewegt sich? Es gibt die Tendenz, Bewegung zuerst im Körper zu verorten. Dies gilt insbesondere im Kontext der Choreografie, in dem der tanzende Körper meist im Vordergrund steht. In einem früheren Aufsatz mit dem Titel Choreography as Mobile Architecture untersuche ich anhand zweier unterschiedlicher Beispiele, wie sich Bewegung bewegt: in William Forsythes Choreografie One Flat Thing, reproduced5 sowie in den partizipatorischen Installationen meiner eigenen künstlerischen Arbeiten Slow Clothes und Volumetrics. In Choreography as Mobile Architecture konzentriere ich mich auf die Frage, wie diese beiden Fälle choreografischer Praxis jeweils ihre eigenen komplexen Diagramme hervorbringen – eine ‚Bewegliche Architektur‘. Mit Beweglicher Architektur ist weder ein Aufenthaltsort für menschliche Körper gemeint, noch irgendeine Form gebauter Umschließung. Wie in der oben beschriebenen diagrammatischen Praxis des Bewegungsexperiments geht es in der Beweglichen Architektur um das Durchlaufen experimenteller Raum-Zeiten, sodass eine starke Turbulenz hervorgebracht wird, die eine Destillation intensiver oder absoluter Bewegung möglich macht. Die Bewegliche Architektur einer Cho5 Vgl. dazu: http://synchronousobjects.osu.edu/ (Stand: 2.3.2012).
210
ERIN MANNING
Abbildung 3
reografie liegt nicht im Plan der Bewegung und auch nicht in der Aufteilung der individuellen Körper im Raum. Sie ist die relationale Kraft, die sich aus dem anfänglichen Einsetzen und Anpassen der kollektiven Bewegung erhalten hat. Sie ist die ursprüngliche Bahnung, die sich als grundierendes Kraftfeld zusammengeballt hat. Nicht als ein Kraftfeld der Körper per se, sondern der aktiven Intervalle ihrer Bewegung, Intervalle, die dann wiederum eine Fülle von Bewegungen einbringen. Durch eine genaue Analyse der Techniken, die von Forsythe und seinen Tänzern vorgeschlagen werden (Techniken, mit denen die Bahnung – das Einsetzen und Anpassen – bis an seine sehr komplexen Grenzen geführt wird), untersuche ich, wie dasjenige, was da einsetzt und sich anpasst, nicht von sich aus der menschliche Körper ist, sondern eine Landungsstelle für zukünftiges Einsetzen und Anpassen. Diese Landungsstellen gehen über das Menschliche hinaus. Sie sind die aktive Kraft des Bewegungsdurchlaufs, der in den ko-konstitutiven Raum-Zeiten der Erfahrung stattfindet; Tendenzen, die so schnell kommen und gehen, dass man sie kaum wahrnehmen kann. Was sich bewegt, ist weniger eine Bewegung an sich, sondern eine Tendenz zur Bewegung. Diese Tendenz speist einen Prozess und richtet diesen zu einer neuen Anpassung aus. Anpassung ist die anfängliche Tendenz eines Mit-Bewegens, mit dem das choreografische Ganze neu ausgerichtet wird, ein Ablauf, der nicht einfach den Körper im Raum verändert, sondern den körpernden Raum. Die diagrammatische Praxis ist ein Experiment des Einsetzens und Anpassens, in dem es um die Erfahrung der Dehnbarkeit der Raum-Zeit geht. Wie verwandelt sich die Erschaffung eines Diagramms in einen Bewegungsprozess, der über die visuellen Daten des kartierten Raums hinausgeht? Was passiert, wenn das choreografische Feld nicht mit einer bereits vorhandenen Kartierung beginnt, in die anschließend sich bewegende Körper integriert werden? Wie wird der sich bewegende Körper diagrammatisch (neu) erschaffen? Wie wird der sich anpassende Körper zu einer selbständigen diagrammatischen Praxis? Bei einer choreografischen Anordnung wie derjenigen, der wir in One Flat Thing, reproduced begegnen, wird oft davon ausgegangen, dass ihr Raum im Voraus festgelegt ist. Wäre dies der Fall, dann wäre das, was Susanne Langer die leitende
DER TANZ DER AUFMERKSAMKEIT
211
Abbildung 4: Volumetrics, Dancehouse Melbourne, September 2009
Form des Stücks nennt, seine in allen Wiederholungen sich erhaltende Kraft der Form, kaum möglich. Die leitende Form (oder „Matrix-Idee“6) ist die virtuelle Kraft – das Diagramm, wie Bacon es in Bezug auf die Malerei nennt7 – des einer Komposition inhärenten Potenzials zur Neukomposition. Sie ist die intensiv erfahrbare Größe des entstehenden Mit-Ausdrucks einer Komposition: ihrer Partitur und ihrer Aufführung. Im ‚Wie‘ des Stücks, in den Modi seiner Aufführung, in den wechselnden Anordnungen und Umgebungen, liegt seine leitende Form. Dieses ‚Wie‘ entsteht jedes Mal neu, weist dabei aber eine technische Präzision auf. Diese Technik – die Weise, in der sich das Stück an die Zukunft erinnert – ist nicht durch die einzelnen Noten oder getanzten Bewegungen empfindbar, sondern durch die relationale Umgebung, die von Musik und Tanz ermöglicht wird. Die leitende Form eines Stücks ist seine bewegliche Architektur. Diese bewegliche Architektur ist des Kunstwerks Tanz der Aufmerksamkeit.
6 Susanne Langer, Feeling and Form, New York: Scribner 1977, S.138 7 Vgl. Gilles Deleuze, Francis Bacon: Logic of Sensation, Minneapolis: Minnesota University Press 2003, S. 82.
212
ERIN MANNING
Ein Tanz der Aufmerksamkeit Ein Tanz der Aufmerksamkeit entspringt aus der Aufmerksamkeit einer diagrammatischen Praxis innerhalb der mit-konstitutiven Raum-Zeiten der Erfahrung. Dies ist kein Aufmerken, das im oder durch den Körper stattfindet, auch wenn der Körper natürlich eines seiner intensiven Eigenschaften sein kann. Der Tanz der Aufmerksamkeit ist eine den Diagrammen eigene, mit-kompositionelle Kraft der Bewegung, die in der Performance des Stücks entsteht. Es ist die Differenz und Wiederholung des ontogenetischen Feldes der Performance, während diese den Raum erschafft. Alle diese Konzepte – das Diagramm, die leitende Form, die Bewegliche Architektur, der Tanz der Aufmerksamkeit – sind kontextspezifisch. Das Diagramm eines Gemäldes speist sich aus dem Gewebe, dem Licht und der aufkommenden Form; die leitende Form eines musikalisches Werks sorgt für einen volltönenden Refrain über alle Aufführungen und Neukompositionen hinweg; eine Bewegliche Architektur vermittelt einen Eindruck der anfänglichen Form-ohne-Form einer Proto-Architektur; und der Tanz der Aufmerksamkeit vermittelt ein Gefühl dafür, wie das Milieu selbst eine Aufmerksamkeit für die komplexen Anlegestellen der entstehenden Erfahrung entwickelt. Jede dieser diagrammatischen Praxen ist auf intensive Weise verflochten. Die Konzepte sind in ihrer Differenz aktiviert, aber weniger, um eine allgemeine Unterscheidung deutlich zu machen, als vielmehr, um die Praxis auszurichten, durch welche sie auf intensive Weise zum Ausdruck kommen. Die Existenzweise eines gegebenen Diagramms wird immer mit anregenden Beschränkungen seiner werdenden Form zusammenfallen. Ein Tanz der Aufmerksamkeit ist kein sehr häufig auftretendes Phänomen. Viele Ereignisse sind zu offen, zu zerstreut, um eine wiederholbare diagrammatische Praxis zu schaffen. Die Erschaffung eines Tanzes der Aufmerksamkeit wird von der Fähigkeit angetrieben, auf das beginnende Potenzial bestimmter entstehender Relationen zugreifen zu können, Relationen, die stets mit so großer Präzision im Zaum gehalten werden müssen, dass Knoten der Intensität erzeugt werden, die das Entstehen über die Wiederholungen hinweg erhalten. Das Entstehen, verstanden als die Qualität eines unendlichen Potenzials, das sich im Kern durch einen Unbestimmtheitsspielraum auszeichnet, wird durch genau diese Dehnbarkeit der Intensitätsknoten aufrechterhalten, eine Dehnbarkeit, die die Raum-Zeit krümmt und dadurch Platz für Flexionspunkte schafft, was wiederum Relationsdifferenziale hervorbringt. Dieses Zugreifen auf eine kompositionelle Matrix relationaler Bewegungen hängt von dem Vermögen entstehender Raum-Zeiten ab, sich durch die, wie Simondon es nennt, ‚operative Solidarität‘8 der Elemente im Prozess der Ko-Komposition zu falten. Ein Tanz der Aufmerksamkeit entsteht, wenn diese operative Soli8 Zitiert nach einem Interview mit Brian Massumi. Vgl. Brian Massumi, „Simondon’s Technical Mentality Revisited“, in: Parrhesia 7 (2009), S. 36-45, http://www.parrhesiajournal.org (Stand: 2.3.2012), insbesondere: S. 40.
DER TANZ DER AUFMERKSAMKEIT
213
darität keine Struktur hervorbringt, sondern eine Bewegliche Architektur – ein Proto-Entwerfen der Bewegung im Tanz. Diese Bewegung im Tanz wird nicht allein durch menschliche Absicht angetrieben. Sie bricht ebenso in dem Dazwischen der sich anpassenden Einsätze hervor, in den relationalen Intervallen der verteilten Bewegung. So schreibt Brian Massumi über Simondons Begriff der Individuation: „Die Kausalkette ist immer eine indirekte, und sie durchquert ein Intervall der Immanenz: einen Augenblick der Konkretisierung, dessen Schema der aktiven Materie selbst zugehört.“9 Was als dominierende Form zurückkehrt, ist nicht die Form des Ereignisses, sondern die Kraft seiner Formation. Der Einsatz als Kraft der Form.
Die Kraft der Form Ein Tanz der Aufmerksamkeit verfügt über seine eigene Technizität. Für jedes Stück, sei es eine Choreografie, eine Performance-Installation, oder eine musikalische Komposition, ist eine strenge Anordnung von Bedingungen notwendig. Diese Bedingungen hängen immer vom spezifischen Ereignis ab, doch sie bleiben nicht über alle seine Wiederholungen hinweg vollkommen stabil. Jede Wiederholung des Ereignisses dephasiert die Erinnerung an das Entstanden-Sein des Ereignisses. Keine Bewegung kann nochmals in identischer Form einsetzen, sich anpassen oder aufgeführt werden. Die Bedingungen sind pragmatischer Natur und basieren stets auf dem Jetzt der sich empfindbar machenden Ereignis-Zeit. Die Ereignis-Zeit ist die Hervorhebung der mit-kompositionellen Infra-Schichtung der diagrammatischen Kraft-Form im Jetzt der Erfahrung. Die Ereignis-Zeit tritt nie völlig getrennt von früheren Evokationen diagrammatischer Praxis auf. Ein Tanz der Aufmerksamkeit findet in der Ereignis-Zeit nur dann statt, wenn unter strengen, anregenden Beschränkungen erneut auf das vorliegende Feld des Potenzials zugegriffen werden kann. Durch anregende Beschränkungen wird die Vielfalt gebündelt und in ihrer Entstehung unterstützt. Ohne diese konzentrierte Ausrichtung würde sich die Vielfalt zerstreuen und kaum eine oder gar keine diagrammatische Kraft entwickeln. Der Existenzmodus, der für einen Tanz der Aufmerksamkeit notwendig ist, ist der einer nachhallenden Intensität zwischen der Vorbeschleunigung der verzukünftigenden Gegenwart und dem Anpassen an eine vergegenwärtigende Zukunft: topologische Zeit, gepresst in die Jetztheit einer ontogenetischen Intensität. Was als Tanz der Aufmerksamkeit entsteht, kann nicht nachgebildet werden. Es ist kein Ding, keine Form. In Forsythes One Flat Thing, reproduced entsteht der Tanz der Aufmerksamkeit durch Zeitspannen sich bewegender infra-dimensionaler Bewegung hindurch, als gelebte Erfahrung tanzender Tische und tischender Körper. In der Beobachtung erleben wir die Entstehung der Raum-Zeit durch die Be9 Ebd., S. 42.
214
ERIN MANNING
wegung selbst, ein anfängliches Entstehen, das die tatsächlichen Körper in ihrer tänzerischen Getrenntheit in den Hintergrund treten lässt und ein aktives, assoziiertes Milieu zwischen Körpern, Dingen und dem choreografischen Feld schafft. Der Tanz der Aufmerksamkeit in One Flat Thing, reproduced macht fühlbar, wie das Ereignis des Tanzens sich der Kraft der Form fügt. Der Tanz der Aufmerksamkeit ist eine Pluralität in dem Sinne, dass seine Oberfläche topologisch ist. Als entwerfende Beweglichkeit schlägt ein Tanz der Aufmerksamkeit dem Raum beginnende horizontale und vertikale Linien vor, durch die die Bewegung hindurchgehen kann. Mit einem feinen Gespür für Einsätze und Anpassungen und bereit zur Vergegenwärtigung der Zukunft, übt der Tanz der Aufmerksamkeit auch eine magnetische Wirkung auf die singuläre Kraft der Form eines noch größeren Ereignisses aus.
Faire Oeuvre Die Kraft der Form ist die Arbeit des Stücks, oder besser: das Werk-Machen des Stücks – faire œuvre. Die Form ist nicht vorgegeben, sondern sie taucht teilnehmend auf. Teilnehmend, weil die Weise ihres Formens Einfluss auf jede weitere Form-Annahme haben wird. Souriaus Konzept des ‚faire œuvre‘ unterstreicht die Potenzialität, die der Form-Annahme eines Stückes innewohnt.10 Indem wir Souriaus und Simondons Begrifflichkeiten zusammenbringen und Simondon in seiner Ablehnung des Hylomorphismus folgen (da dieser die Vorstellung von Raum und Zeit als bereits existierende Größen enthält), könnten wir sagen, dass das Konzept des ‚faire œuvre‘ hervorhebt, dass das Machen immer ein Dephasieren ist. Das Dephasieren ist das transduktive Verfahren eines Milieus. Es findet in der relationalen Bewegung der Ebenenverschiebungen innerhalb eines Prozesses statt. In jedem Dephasieren wird der vorindividuelle Anteil des Potenzials hinüber- und hindurchgetragen. Das Vorindividuelle ist selbst immer schon unsynchronisiert. Es operiert hinüber und hindurch. Es ist die Vorbeschleunigung aller relationalen Bewegungen, verteilt auf verschiedene Phasen. Es ist die Kraft des Potenzials – Deleuzes ein Leben – das nach jeder Individuation und durch jede Individuation hindurch fortbesteht. Es ist das ‚faire‘ im ‚faire œuvre‘ des (Neu-)Machens eines Werks. Jede Individuation ist Modulation. Existenzweisen gehen nie einer konkreten Individuation voraus – sie sind ihr immanent. Wir könnten unter diesem Gesichtspunkt die Existenz durch die Individuation ersetzen und von Individuationsweisen sprechen. Die Individualisierung der Individuation treibt das diagrammatische Potenzial zu einem bemerkenswerten Punkt. Dieser Punkt, eine tatsächliche Gelegenheit, bricht nicht als eine sichere Identität hervor, sondern als intensive Choreografie der Kräfte in der Modalität einer Materieform. Eine Individualisierung ist jedoch zugleich immer auch eine beginnende Verformung, deren bemerkenswerter 10 Vgl. Etienne Souriau, Les différents modes d’existence : Suivi de Du mode d’existence de l’oeuvre à faire, Paris: PUF 2009.
DER TANZ DER AUFMERKSAMKEIT
215
Punkt eine bewegliche Flexion ist, der die Funktion einer vorläufigen Grenze zukommt. In einem Tanz der Aufmerksamkeit fungiert die Aufmerksamkeit selbst als Grenze. Es ist eine Aufmerksamkeit nicht gegenüber etwas, sondern etwas entgegen. Ein Tanz der Aufmerksamkeit ist die Warteschleife einer kaum zu identifizierenden Reihe an Kräften, die das Ereignis modulieren. Es ist das transduktive Potenzial des Ereignisses, welches es durch die verschiedenen Modalitäten der Raum-Zeit in Bewegung setzt, um potenziell unendlich viele Wiederholungen zu durchlaufen. In einem choreografischen Kontext kann der Tanz der Aufmerksamkeit nicht auf einer bereits existierenden Karte verortet werden. Er ist vielmehr das, was das Ereignis in einen Bereich jenseits seines gegenwärtigen Zeit-Nehmens hinausträgt.
Zeit-Nehmen Der Tanz der Aufmerksamkeit schafft Zeit für die Unsterblichkeit des Ereignisses über verschiedene Phasen hinweg. Die diagrammatische Vielfalt des Ereignisses erscheint hier als das Zusammensein getrennter Tendenzen. Diese ansonsten unabhängig voneinander einsetzenden Tendenzen werden in einem Zusammenhalten der dynamischen Form aktiviert. Die dynamische Form ist die In-Formation, die Kraft der Form, die der Einzigartigkeit des Ereignisses Beständigkeit verleiht. Ihr Entwerfen der Beweglichkeit in der Zeit geschieht, wenn sich das Ereignis über diese oder jene tatsächliche Gelegenheit hinaus vervielfältigt und zu einer entstehenden Existenzweise wird. Dies ist eher ein Registerwechsel – eine Bewegung über die Oberfläche des Diagramms der Verzeitlichung des Raums – als ein grundsätzlicher qualitativer Unterschied. Jede Existenzweise ist voll solcher im Entstehen begriffener, singulär-multipler Ereignisse. Die singulär-multiplen Tendenzen sind potenzielle Abweichungen, Schluckaufs, Unterbrechungen und als solche konstituieren sie den Unbestimmtheitsspielraum der Existenzweise. Dieser Spielraum und das ihm zugehörende vorindividuelle Potenzial sind dasjenige, was die entstehende Qualität der Existenzweisen in der Zeit erhält. Die Zeit des Ereignisses ist prozessual und nicht linear. Mit jedem Schritt in diesem Verfahren wird ein Potenzial in Umlauf gesetzt. Diese Zirkulation ist für die innere Differenz des Ereignisses verantwortlich: seinen Unbestimmtheitsspielraum. Hier, auf diesem Anstieg, wo das Durchgehende und das Unterbrochene aufeinandertreffen, wird das Neue erfunden. Denken wir etwa an Arakawas und Gins’ Directions for Architectural Procedure: Invention and Assembly. Arakawa und Gins verwenden Verfahren darin nicht als semiotische Strategie – als Sprachspiel – sondern als diagrammatische Praxis zur Transduktion von Zeit in das Ereignis. Verfahren brauchen Zeit. Sie mögen vielleicht wie die linearen Abschnitte einer Sammlung aussehen, aber, und dies unterstreichen Arakawa und Gins immer wieder, man muss zurückkehren, vermengen, verflechten. Man muss zirkulieren ohne einzukreisen. Man muss auf den Unbestimmtheitsspielraum zugreifen, der das relationale Intervall der assoziierten Milieus der Verfahren ist. Man muss sich nicht nur mit
216
ERIN MANNING
den einzelnen Schritten auseinandersetzen und einem nach dem anderen folgen, sondern man muss sie durchkreuzen, mit ihnen experimentieren, sie winden und verdrehen.
Architektonische Verfahren „Schritt 1: Um zu entdecken, was dringend neu gemacht werden muss, ist ein langer, mutiger und unnachgiebiger Blick auf das notwendig, was passiert, wenn ein Organismus menscht (zu einem menschlichen Wesen wird).11 Dies ist die Aufgabe derjenigen, die architektonische Verfahren hervorbringen wollen, die die Bioscleave,12 die unzureichende prozessuale Bioscleave, erweitern und umformen wollen.“13 Schon in diesem ersten Schritt sind alle Hauptaspekte von Arakawas und Gins’ Philosophie versammelt. Dieser erste Schritt, seine Dringlichkeit, sein Beharren auf dem Mehr-Als des Menschlichen – dem Organismus, der zur Person wird – seine Kompromisslosigkeit, seine Prozeduralität, sein Schwerpunkt auf dem assoziierten Milieu – der Bioscleave –, sein hervorgehobener Gedanke der Verwandlung und sein Glaube daran, dass die transduktive Kraft des Dephasierens die eigentliche Modalität des Erfindens ist: all dies macht deutlich, dass die Ansammlung entwerfender Mobilität – einer Mobilen Architektur, die einen tanzt – von der ewigen Rückkehr zur Dephasierungspotenzialität des Ausgangsschrittes abhängt. Hier gibt es keine Linearität, sondern nur die Aufforderung zu einem weiteren Schritt, hinüber, zurück, vorwärts und herum, in einem Tanz des Werdens. Schritt 5. „Das erhoffte Ergebnis entsteht vielleicht einfach so, als Resultat dessen, was in die architektonische Umgebung hineingearbeitet worden ist, aber es ist wahrscheinlicher, dass es nur indirekt auftreten wird. Der Grund dafür ist, dass es von hervorgerufenen Handlungssequenzen erzeugt wurde, die zu ihm hingeführt haben und die, wie sich in einigen Fällen herausstellen wird, in unterschiedlichem Maße sogar konstitutiv für es waren.“14 Das Ergebnis ist im Entstehen begriffen. Die Bedingungen für seine Auflösung werden geschaffen. Diese Bedingungen sind der Terminus des Ereignisses, die Kraft des ‚Endes in Sicht‘, die das Ereignis aktiviert, ohne notwendig das Versprechen ei11 Charles Sanders Peirce – der eindeutig der philosophischen Richtung zuzuordnen ist, um die es hier geht – vertritt ein ähnliches Konzept von ‚personing‘: „The conciousness of a general idea has a certain ‚unity of ego‘ in it, which is identical when it passes from one mind to another. It is, therefore quite analagous to a person; and indeed, a person is only a particular kind of general idea.“ Charles Sanders Peirce, The Essential Peirce Vol. 1, Indiana: Indiana University Press 1992, S. 350. 12 Vgl. hierzu http://www.reversibledestiny.org/Reversible_Destiny_-_Arakawa_and_Gins_-_ We_Have_Decidede_Not_to_Die/Bioscleave_House.html (Stand: 2.3.2012) 13 Shusaku Arakawa/Madeline Gins, Architectural Body (Modern and Contemporary Poetics), Tuscaloosa: University of Alabama Press 2002, S. 11. 14 Arakawa/Gins, Architectural Body, a.a.O., S. 14.
DER TANZ DER AUFMERKSAMKEIT
217
nes vorherbestimmten Ziels zu werden.15 Der Terminus ist das Potenzial für Handlung. Das Ende in Sicht in-formiert das Ereignis, ohne eine Vorwegnahme des Ergebnisses. Der Terminus zieht den Prozess in seinen Bann und erzwingt ein Dephasieren in den bemerkenswerten Punkt dieser oder jener Individuation: die Schaffung eines architektonischen Körpers, die Errichtung einer umkehrbaren Bestimmung, eines Organismus, der menscht (Arakawa und Gins). Das Ergebnis wird auf indirekte Weise erreicht, durch die relationale Matrix sich vermischender und infra-dimensionalisierender Verfahren. Die Zeit des Ereignisses wird durch den innewohnenden Terminus angetrieben, durch die prozessuale Ansammlung. Der Terminus aktiviert die verteilte relationale Bewegung. Er treibt eine Dephasierung voran. In einer Dephasierung „besteht kein substanzieller Unterschied zwischen Interiorität und Exteriorität; es gibt hier nicht zwei Bereiche, sondern eine relative Trennung“16. Schritt 1 ist schon die Erinnerung an den infra-dimensionalisierenden Schritt 10. Kehren Sie zur Bewegungsübung der diagrammatischen Praxis zurück. Sie liegen auf dem Boden und das Diagramm in-formiert sich und vervielfacht seine Winkel, Linien, Kräfte und Tendenzen. Wenn das zweite Diagramm zu entstehen beginnt – das Diagramm für das Bewegungskörpern – dann wird das erste nicht etwa externalisiert, sondern es wird umso intensiver. Die zwei Diagramme infra-individualisieren sich. Der Terminus – das Raumkörpern – erzeugt keine bereits entworfene Karte, sondern er potenzialisiert die Karte und macht sie mit der Energie des Erfindens dehnbarer. Die dem Diagramm innewohnende Relationalität macht die diagrammatische Praxis unendlich: unendliche Verwandlung, die Unsterblichkeit des Beinahs. Diese Unsterblichkeit – das extensive Kontinuum der Kraft der Form – ist nicht das Ereignis als solches. Das Ereignis ist die Verengung dieser Unendlichkeit an ihrer aufrührenden Grenze. Diese Grenze ist auf dem Scheitelpunkt aufgerührt, immer am Rande der Dephasierung. Die Unsterblichkeit ist in diesem Sinne nicht bekannt. Bekannt ist nur, was sich aktualisiert. Das Dazwischen des Bekannten und des Unbekannten – ihr relationales Milieu – ist bloße Aktivität, eine Agitation an der Grenze, wo Ereignisse sich individualisieren. „Das Individuum ist nicht Endlichkeit, sondern Grenze, was bedeutet, dass es fähig zu unendlichem Wachstum ist.“17 Endlichkeit ist die Vorführung einer prozessualen Linearität, die Zeit und Raum als etwas Vorgegebenes voraussetzt. Ein Ereignis entsteht nie aus Linearität. Es ist ein Grenz-Konzept, welches sich selbst immer auf der Schwelle zur Individuation – in den Worten Whiteheads zum Verschwinden – im Zusammenhang gelebter Erfahrung befindet. Individuation ist nicht durch seine Ereignishaftigkeit unsterb15 William James schreibt dazu: „[…] the percept’s existence as the terminus of the chain of intermediaries creates the function. Whatever terminates that chain was, because it now proves itself to be, what the concept had in mind.“ Vgl. William James, Essays in Radical Empiricism, Nebrasksa: University of Nebraska Press 1996, S. 29. 16 Muriel Combes, Simondon - Individu et collectivité, Paris: Presses Universitaires France 1999, S. 37. 17 Ebd., S. 38.
218
ERIN MANNING
lich, sondern durch sein transduktives Potenzial. Der Tanz der Aufmerksamkeit, obwohl selbst nicht unsterblich, trägt diese Unsterblichkeit im Keim in sich, als seinen vorindividuellen Potenzialanteil. Im Tanz der Aufmerksamkeit achtet das Ereignis auf die Grenze – das Ereignis rührt sie auf.
Maßstäbe des Prozesses Die Zeit des Ereignisses ist multi-skalar. „Zwischen dem Physischen und dem Lebendigen, zwischen Pflanze und Tier, dürfen wir nicht nach substanziellen Unterschieden suchen, um dann nach Art und Gattung zu trennen, sondern wir sollten sie anhand der verschiedenen Geschwindigkeiten unterscheiden, mit denen sie ihren Entstehungsprozess durchlaufen.“18 Organismen und Menschen bevölkern die intensiven Schichten des Tanzes der Aufmerksamkeit, aber sie beherrschen sie nicht. Verschiedene Geschwindigkeiten existieren in einer Infra-Art, einem infradimensionalen Feld, nebeneinander. Der Tanz der Aufmerksamkeit ist ein vorläufiges Festhalten der Agitation an ihrer Grenze, dort, wo Artenbildung und Dimensionalisierung zusammentreffen. Es ist das Festhalten des Rhythmus des Infra an einem Punkt, wo das Werden an der Schwelle zur Ausdifferenzierung in dieses oder jenes steht. „Was das Sein in verschiedene Bereiche aufteilt, ist nichts anderes als der Rhythmus des Werdens.“19 „Schritt 8: Ist ein architektonisches Verfahren einmal erfunden und zusammengestellt, werden immer noch andere Möglichkeiten seiner Zusammensetzung sichtbar.“20 In dem Intervall, in dem ein Verfahren sich als Zusammensetzung eines Entwerfens in Bewegung verwirklicht, kommt ein neues Diagramm zum Ausdruck. Maßstäbe der Prozeduralität überlappen hier und bringen ihre eigenen anregenden Beschränkungen hervor, wodurch neue Reihen potenzieller Handlungsanweisungen entstehen. Diese Anweisungen kennzeichnen die Ereigniszeit des Entwerfens für Beweglichkeit. Sie verfügen über ein vielfaches skalares Potenzial. Nehmen wir als Beispiel etwa das Entwerfen für Beweglichkeit in einem Krankenhaus. Man muss überlegen, was das Krankenhaus an seinem Ort festhält und welchen Tanz der Aufmerksamkeit es dadurch erzeugt. Erinnern Sie sich an ihren letzten Besuch in einem Krankenhaus und erleben Sie erneut die Entropie seiner Gleichheit: die immer gleichen bleichen Wände, erhöhte Betten, zugezogene Vorhänge, Schwingtüren. Erinnern Sie sich an den Geruch. All dies im Namen des sogenannten Lebens. Eine Prozeduralität nicht für das Leben, das Tanzen und Kochen und Lachen, sondern für das Sterben. Im Tanz der Aufmerksamkeit des Krankenhauses geht es um den Tod. Seine Schwingtüren bewegen sich im immer gleichen Refrain: Tod, Tod, Tod.
18 Ebd., S. 42. 19 Ebd. 20 Arakawa/Gins, Architectural Body, a.a.O., S. 15.
DER TANZ DER AUFMERKSAMKEIT
219
In Schritt 6 dreht sich alles um Zirkulation: „[W]enn immer häufiger neue Wege auftauchen, mit denen sich eine architektonische Umgebung so strukturieren lässt, dass sich das erhoffte Ergebnis einstellt, dann sollte dies Anzeichen genug dafür sein, dass man es hier mit etwas zu tun hat, dass es zu bewahren gilt.“21 Zirkulation findet in vielen Maßstäben und auf unterschiedlichen Zeitachsen gleichzeitig statt und erzeugt dadurch Topologien der Raum-Zeit. Wenn der Tanz der Aufmerksamkeit zirkuliert, dann widersteht er der Verdummung, die einhergeht mit dem linearen Prozess: Geburt – Tod. Aktiviert durch viele gleichzeitig stattfindende Dephasierungen in einer spiralförmigen, ewigen Wiederkehr entsteht das Intervall und nimmt als die radikal empirische Option des Lebens – oder in den Worten Deleuzes eines Lebens – Form an. Ein Leben: die Infra-Individuation der Potenzialkraft über die Fläche des Lebens selbst.
Die Politik der Individuation Die gegenwärtige Politik ist häufig präemptiv. Der Politik fehlt die Zeit, oder besser: Sie reißt die Zeit an sich, indem sie Erinnerungen vergangener und zukünftiger Angst ausbeutet. Das Ereignis wird immer schon stattgefunden haben. Der Tanz der Aufmerksamkeit der präemptiven Politik ist auf die rekursive Individuation eingestellt. Was von der affektiven Resonanz des Ereignisses zurückbehalten wird, ist das Schon der In-Formierung des Ereignisses. Zweifelsohne eine Erfindung, aber gebannt in den engen Teufelskreis des Terrors. Es gibt immer schon bereits nichts, was man wird getan haben können. Das Ereignis, das noch nicht stattgefunden hat, hat bereits die Form seiner potenziellen Landungsstelle verändert. Wir sind im Gleichgewicht auf dem defensiven Scheitelpunkt zwischen dem, was wir bereits gewusst haben sollen und dem, was wir uns bereits vorgestellt haben werden. Die prozessuale Kunst von Arakawa und Gins lehnt die präemptive Politik als die Kraft zur Schaffung von Zeit ab. Das Zeitmachen ihrer diagrammatischen Praxis ist eines der Modulation. Existenzweisen werden von dieser Praxis nicht hervorgebracht, sondern sie sind ihr immanent. Der Körper wird nicht schon vor dem Ereignis affektiv moduliert und auf der furchterregenden Spitze des noch nicht gewusst Habens bereitgestellt – das Ereignis moduliert vielmehr in einem prozessualen Tanz der Aufmerksamkeit, der nicht an der verzukünftigenden Vergangenheit teilnimmt, sondern am Zukunften einer erst entstehenden Tendenz – ein Erinnern der Zukunft. Während die Existenzweisen der präemptiven Politik auf der Angst vor dem immer schon noch nicht Gewussten basieren, ist Arakawas und Gins’ Politik der Performance voller entstehender ‚Freude‘22, die stets im Modus des Expe21 Ebd., S. 14. 22 Für Spinoza markiert Freude unser Vermögen affiziert zu werden. „We come closer to our power of action insofar as we are affected by joy.“ Gilles Deleuze, Expressionism in Philosophy, New York: Zone Books 1990, S. 246. Freude ist nicht quantifizierbar, noch ist sie eine moralische Kategorie. Es ist unser bloßes Vermögen affiziert zu werden. Wie die Nietzscheani-
220
ERIN MANNING
rimentierens aktiviert ist. Präemptive Politik nimmt sich nicht die Zeit für das Experimentieren im offenen Feld des Erinnerns der Zukunft: Sie wird dieses Feld immer schon erfunden haben. Die Modalititäten des Experimentierens nehmen im Transindividuellen ihre Form an. Sie sind immer schon kollektiv. Für Simondon bedeutet Kollektivität, die Rücknahme der Tendenz, das Werden auf den Bereich des Individuellen zu beschränken. Die Individuation ist vielfach, interskalar, transduktiv und metastabil. Das Mehr-Als-Individuelle, das jede Individuation auszeichnet, ist das Ausdruckspotenzial eines Intervalls: die Beziehung der Beziehungen. „Die Entdeckung des Transindividuellen entsteht aus der Begegnung und benötigt zur Durchquerung die Einsamkeit als Milieu.“23 Kollektivität wird hier nicht als die Vervielfachung von Individuen aufgefasst, sondern als die Fürsorge des Vielfachen durch die Ruhe des Intervalls hindurch. Der Tanz der Aufmerksamkeit ist das assoziierte Milieu des Ereignisses in seiner In-Formation, geballte Intensität an der Spitze der Handlung. Der Tanz der Aufmerksamkeit ist eine Warteschleife; er ist die intensive Dehnbarkeit der verteilten relationalen Bewegung des Ereignisses. Wenn der Tanz der Aufmerksamkeit ausdrücklich zur Relationalität als solcher tendiert, dann findet meiner Meinung nach eine Verlagerung zum Politischen statt. Arakawa und Gins sind politische Künstler. Ihre Verfahren schaffen ein Feld, auf dem das Politische sich ausdrücken kann. Das ‚Ich‘, das selbst ein aufrührendes Verfahren an der Spitze der Dephasierungen ist, wird dadurch vervielfacht. Wenn die Beziehung selbst der Modus der Aufmerksamkeit ist, beginnt das assoziierte Milieu dem Potenzial der politischen Kraft Ausdruck zu verleihen. Politik ist Ausdruck, noch bevor es Inhalt ist. Politischen Inhalt zu haben, bedeutet, dass man bereits in einer im Voraus erkennbaren Zeitzone gelandet ist. Arakawa und Gins sind dort am besten, wo es um die Schaffung multipler, interskalarer Ereigniszeiten geht. Ihr Entwerfen von Mobiliät erzeugt einen Tanz der Aufmerksamkeit, der sich unaufhörlich in der Transindividuation kollektiver Zu-Neigungen bewegt. Eine Küche ist ein Ort, an dem man kocht, aber sie lädt genauso auch zum Klettern, Singen und Schlafen ein. Ein Boden gibt einem die Möglichkeit zu laufen, aber man kann auf ihm ebenso Schwindel fühlen, stürzen oder rollen. Das Ereignis bietet Gelegenheit zum Tanz, doch lädt es darüber hinaus dazu ein, Zeit für das Politische zu schaffen.
Jenseits des Selbst, Mehr-Als Menschlich Politik wird häufig als die Relation zwischen einem Individuum und einem anderen verstanden. Diese Idee des ‚von Individuum zu Individuum‘ führt dazu, dass das Ergebnis des Zusammentreffens der beiden in einer bereits existierenden Raum-Zeit verortet wird, und zwischen Körpern stattfindet, die bereits individusche Affirmation ist die Spinozasche Freude mit dem präindividuellen Anteil verbunden: die Kraft eines Lebens, die durch ein gelebtes Leben fließt. 23 Combes, Simondon, a.a.O., S. 66.
DER TANZ DER AUFMERKSAMKEIT
221
iert sind. Deleuzes ein Leben hinterfragt diese individualisierte Politik. Ein Leben stellt die Kraft des Lebens in den Vordergrund – ihr politisches Potenzial als infraindividuierende Kraft für die diagrammatische Praxis des Leben-Lebens – und es tut dies an der Spitze der Individuation, dort, wo das Vorindividuelle in seiner vollen Intensität wirksam ist. Ein Leben, das ist Macht durch das Leben hindurch, nicht biopolitische Macht über das Leben. Es ist das Ereignis des lebenden Lebens, das auf der transindividuellen Schwelle kollektiver Individuation entsteht – nicht unbedingt als Leben des Menschen, auch nicht in diesem oder jenem Körper: Ein Leben ist Leben mit und hindurch. Ein Leben „ist eben genau dasjenige, das alles hinter sich gelassen hat, worin es enthalten sein oder von dem es repräsentiert werden könnte“24. Ein Leben: eine Kraft, die dieses Leben in das Mehr-Als-Menschliche dephasiert, wo das Lebendige quer durch seine komplexen relationalen Modi nach Leben strebt. Wie Combes zeigt, liegt die anfängliche Kollektivität politischen Denkens im Exzess der Individuation, im Vorindividuellen. Dieser nicht-individuelle Anteil konstituiert sich nicht als ein anderes Individuum. Er ist Mehr-Als (menschlich), ein Jenseits-des-Selbst des Trans-Individuierens. Es ist die affektive Kraft für das anfängliche Dephasieren der Individualisierung, ein Dephasieren, das nie einfach nur ein Moment in einem linearen Prozess darstellt, sondern ein topologisches Falten solch diagrammatischer Kräfte, die zu multiplem Ausdruck tendieren. In diesem Kontext kann Politik ausschließlich prozessualer Natur sein. Eine Reihe von Bedingungen, eine Reihe anregender Beschränkungen: kollektive Politik – d. h. die Politik kollektiver Individuation – nimmt an den ontogenetischen Modulationen der entstehenden Existenzweisen teil. Das Soziale existiert nicht vor ihnen – es wird in und durch die Verfahren mitbegründet, mit denen die Ereignis-Zeit aktiviert wird. Außerhalb des Ereignisses gibt es keine Zeit. Alle Ereignisse sind transindividuell und infra-dimensional. Mit dem Ereignis kommt eine diagrammatische Praxis, die eine intensive Spur in verschiedenen interskalaren Zeitmessungen hinterlässt. Ob absolute oder metrische Zeit, ob intensive Bewegung oder Verdrängung: die diagrammatische Praxis eines Ereignisses ist die Weise, in der dieses Ereignis auf seine eigene zeitliche Singularität aufmerksam wird. Diese Singularität ist transindividuell, „eine unpersönliche Zone […], die gleichzeitig eine molekulare oder eine intime Dimension des Kollektiven selbst ist“25. Der vorindividuelle Anteil des Ereignisses besteht aus einer besonderen Aufgeschlossenheit gegenüber dem Tanz der Aufmerksamkeit. Sie füllen Existenzweisen an, die selbst schon an den kollektiven Kundgebungen des prozessualen Potenzials teilnehmen. Die Politik-im-Keim der Ereignis-Zeit ist ihre Ethik: das, was für Si-
24 Peter Pál Pelbart, „Nuda vida, vida besta, una vida“, in: Euphorion 1 (2009), S. 34-42, hier: S. 41. 25 Combes, Simondon, a.a.O., S. 87.
222
ERIN MANNING
mondon „in sich selbst eine Macht der Verstärkung besitzt“26 und stets fähig bleibt, eine Beziehung mit seinem vorindividuellen Anteil einzugehen. Dieses Eingehen einer Relation ist der Akt par excellence. Darauf ist das Ereignis in seinem Tanz der Aufmerksamkeit ausgerichtet. Arakawas und Gins’ Verfahren erschaffen Affordanzen27 für den Tanz der Aufmerksamkeit. Sie sind immer schon in assoziierte Milieus der Relation eingelassen, die das Ereignis in einer Weise platzieren, die Erwartungen übertrifft. Ihre Verfügung des „örtlich verankerten Bewusstseins“28 macht deutlich, dass es unmöglich ist, einen Ort ein für alle Mal zu lokalisieren. Wie Jondi Keane hervorhebt, regen Arakawa und Gins die Schaffung einer Ökologie der Relationen an, der es um die Formung des Bewusstseins geht.
Eine Ökologie der Relationen „Wir sollten den Körper jedes Mal beim Namen nennen. Wir wissen NICHTS über den Körper! Wir sollten ihn immer wieder benennen, so wie wir es mit Essen machen. Ah, das ist Ketchup. Ah, das ist Knie.“29
Arakawas und Gins’ architektonisches Verfahren weicht dem Benennen nie aus. Benennen ist prozessual. Es funktioniert als ein Flexionspunkt, der die Individuation, die Individualisationen, vorantreibt, dephasiert und dabei eine Vielfalt übermittelt, die singuläre Ereignisse hervorbringt. Diese Ereignisse, einschließlich der Modi Knie, Ketchup, Tod und – um Deleuze in diese Mischung miteinzubeziehen – eines Lebens sind radikal empirisch. Sie werden in einer dehnbaren Prozeduralität durch eine spezifische Anzahl von Bedingungen relational aktiviert. Durch die Einfaltung dieser Prozeduralität entsteht ein Tanz der Aufmerksamkeit, durch ihre Ausfaltung eine Individualisation. Die Prozeduralität schafft die Bedingungen für Dephasierung, Metastabilität und Transduktion, und zeigt sich damit als ein Generator für die Unsterblichkeit der diagrammatischen Praxis. Ihre Benennung kommt dem Ereignis nicht zuvor. Sie ist das Ereignis. Prozessuale Techniken sind Modalitäten erfinderischer Identifizierung. Der Name koexistiert in einer Ökologie der Relationen. Es ist dieses oder jenes, aber es ist gleichzeitig dieses mit jenem, eine operative Autonomie als eine qualitativ neue Funktionsweise. 26 Gilbert Simondon, L’Individu et sa genèse physico-biologique, Grenoble: Jérôme Millon 1995, S 16. 27 Für eine detailliertere Erläuterung des Begriffs der Affordanzen vgl. James Jerome Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception, Boston: Houghton Mifflin 1979. 28 Jondi Keane, „Situating Situatedness through Æffect and the Architectural Body of Arakawa and Gins“, in: Janus Head 9 (2007), S. 437-457, hier: S. 439; Shusaku Arakawa/Madeline Gins, Reversible Destiny – Arakawa and Gins – We Have Decided Not to Die, New York: Guggenheim Museum Soho 1997, S. 86. 29 Jake Kennedy, „Gins, Arakawa and the Undying community“, in: Culture Machine 8 (2006), http://www.culturemachine.net/index.php/cm/article/viewArticle/44/52 (Stand: 2.3.2012).
DER TANZ DER AUFMERKSAMKEIT
223
Aus Arakawas und Gins’ Verfahren für das Leben (das es tatsächlich ist; vielmehr als es ein Verfahren gegen den Tod ist) schreien die Worte Nietzsches heraus: „War Das − das Leben? […] wohlan! Noch Ein Mal!“30 „Reversible Destiny“, der Titel ihres prozessualen Manifests, basiert auf „einer Ethik, die keiner Art von Ereignis, nicht einmal der Sterblichkeit, erlaubt, gesondert behandelt zu werden. Damit ist nichts unethischer als die Tatsache, dass wir verpflichtet sind, sterblich zu sein.“31 ‚Umkehrbares Schicksal‘ bezeichnet eine Politik für das Leben und mit dem Leben. Das Leben ist ein eigenständiges Ereignis, eines, das das Leben-leben zu seinem Ausgangspunkt hat und an etwas ähnlichem wie Deleuzes ein Leben teilnimmt; diese vorindividuelle Kraft des Lebens, die alle Existenzweisen begleitet. Das umkehrbare Schicksal macht auf das Milieu des Lebens, während es lebt, aufmerksam. Es ist ein Tanzen in die Aufmerksamkeit des Potenzials der Relation, der beherrschenden Form, hinein, das in einer diagrammatischen Praxis der Erfindung mitschwingt. Es ist eine Politik-im-Keim, eine Politik, die in Richtung ihrer Artikulation und Erschaffung vorbeschleunigt. Indem sie das Leben als Feld der Erfindung betrachten und es zur prozessualen Bedingung der Ereignis-Zeit machen, führen Arakawa und Gins eine Politik der Performance auf. Eine Politik der Performance nimmt am Leben teil. Die ‚Teilnahme an‘ ist eine Phase des Politischen, die zu häufig in den Hintergrund geschoben wird, so, als ob Politik sich nur im Bereich des tatsächlichen Gelebt-Habens abspielen würde und nicht auch in der absoluten Bewegung, die der Vorbeschleunigung des Ereignisses innewohnt. Die Politik der Performance des Tanzes der Aufmerksamkeit ist in der Dauer aktiv und dem Ereignis immanent. Sie kann nicht quantifiziert werden, und sie liefert auch keine vorherbestimmten Ergebnisse. Sie faltet sich durch das Ereignis hindurch und schafft so Öffnungen für entstehende Existenzweisen. Sie aktiviert einen singulären Tanz der Aufmerksamkeit, einen Tanz, der ganz speziell am assoziierten Milieu der Relation teilnimmt. Sie vergrößert das Potenzial noch an seiner erregenden Grenze, gefährlich nah an der Dephasierung, die ihr den eigenen Boden entzieht. Man kann sich die Politik der Performance als die bloße Aktivität des Diagramms vorstellen, seinen vorindividuellen Anteil, der durch alle Größenordnungen und Register hetzt, alles im Namen einer Mikropolitik interskalarer, zwischen den Arten stattfindender, umkehrbarer Schicksale. „Die Art in der der Körper sich hält, die vielen Weisen, in der der Körper sich hält, die vielen verschiedenen Aktionsausmaße und schließlich auch die Weise, in der er die Welt hält, ist kumulativ. Alle je von Ihnen erlebten und durchgeführten Haltungen bewegen sich innerhalb und durch die Haltung Ihrer selbst und hat Teil an Ihrem An-Etwas-Festhalten.“32
30 Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra IV, in: ders., Kritische Studienausgabe, hg. v. Giorgio Colli/Mazzino Montinari, Bd. 4, Berlin/New York: Walter de Gruyter 1988, S. 396. 31 Arakawa/Gins, Architectural Body, a.a.O., S. xviii. 32 Ebd., S. 82f.
224
ERIN MANNING
Der Tanz der Aufmerksamkeit ist ein „vorläufiges Konstruieren in Richtung eines Am-Platz-Haltens“33 einer möglicherweise entstehenden Politik. Eine Anmerkung: Der sich haltende Körper darf nicht als die Wiedereinsetzung des Individuums in die Rolle des Vermittlers der Ereigniszeit oder des Tanzes der Aufmerksamkeit missverstanden werden. Das Halten ist dasjenige, was die Relation Körper-Bewegung-Raum-Zeit stiftet. Es ist ein Halten, welches den Menschen der Raum-Zeit übersteigt, ein Halten, das mehr strukturierend als an sich reißend ist, ein Halten immer am Rande der Transduktion. Politik-im-Keim: eine vorläufige Teilnahme an den Bedingungen, durch die das Ereignis sich ausdrückt, ein vorläufiges Konstruieren in Richtung eines Festhaltens der Fürsorge, eine verteilte relationale Bewegung. Das Politische als Existenzweise, aktiviert als Aufmerksamkeit gegenüber dem Leben, bereitet das Terrain für sein assoziiertes Milieu, eine relationale Matrix, die das Ich nicht in Richtung der Individuation eines Körpers als solchem verschiebt, sondern einen dehnbaren Körper schafft, der ko-konstitutiv für die entstehenden diagrammatischen Praxen ist: eine Politik der Relation, die sich um das Mehr-AlsIch kümmert, und die in der Kraft der Form das prozessuale Potenzial versammelt, das selbst Performance ist. Performance als dasjenige, was die Zeit des Ereignisses benennt. Aus dem Amerikanischen von Thomas Stachel und Claudia Weigel.
Literaturverzeichnis Arakawa, Shusaku/Gins, Madeline, Architectural Body (Modern and Contemporary Poetics), Tuscaloosa: University of Alabama Press 2002. —/—, Reversible Destiny – Arakawa and Gins – We Have Decided Not to Die, New York: Guggenheim Museum Soho 1997. Combes, Muriel, Simondon - Individu et collectivité, Paris: Presses Universitaires France 1999. Deleuze, Gilles, Expressionism in Philosophy, New York: Zone Books 1990. —, Francis Bacon: Logic of Sensation, Minneapolis: Minnessota University Press 2003. —/Guattari, Felix, Was ist Philosophie?, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2000. Gibson, James Jerome, The Ecological Approach to Visual Perception, Boston: Houghton Mifflin 1979. James, Williams, Essays in Radical Empiricism, Nebrasksa: University of Nebraska Press 1996. Keane, Jondi, „Situating Situatedness through Æffect and the Architectural Body of Arakawa and Gins“, in: Janus Head 9 (2007), S. 437-457. Kennedy, Jake, „Gins, Arakawa and the Undying community“, in: Culture Machine 8 (2006), http://www.culturemachine.net/index.php/cm/article/viewArticle/44/52 (Stand: 2.3.2012). Langer, Susanne, Feeling and Form: A theory of art developed from philosophy in a new key, New York: Scribner 1977. Massumi, Brian, „Simondon’s Technical Mentality Revisited“, in: Parrhesia 7 (2009), S. 36-45, http://www.parrhesiajournal.org (Stand: 2.3.2012).
33 Ebd., S. 23.
DER TANZ DER AUFMERKSAMKEIT
225
Nietzsche, Friedrich, Also sprach Zarathustra, in: ders., Kritische Studienausgabe, hg. v. Giorgio Colli/Mazzino Montinari, Bd. 4, Berlin/New York: Walter de Gruyter 1988. Peirce, Charles Sanders, The Essential Peirce Vol. 1, Indiana: Indiana University Press 1992. Pelbart, Peter Pál, „Nuda vida, vida besta, una vida“, in: Euphorion 1 (2009), S. 34-42. Simondon, Gilbert, Du mode d’existence des objets techniques, Paris: Flammarion 2001. —, Individuation psychique et collective, Paris: Flammarion 2007. —, L’Individu et sa genèse physico-biologique, Grenoble: Jérôme Millon 1995. Souriau, Etienne, Les différents modes d’existence, Paris: PUF 2009. Whitehead, Alfred North, Process and Reality, New York: Free Press 1978.
Internetquellen: http://www.criticalpath.org.au/SEAM.html (Stand: 2.3.2012) http://www.culturemachine.net/index.php/cm/article/viewArticle/44/52 (Stand: 2.3.2012) http://parrhesiajournal.org/parrhesia07/parrhesia07_massumi.pdf (Stand: 2.3.2012) http://www.reversibledestiny.org/Reversible_Destiny_-_Arakawa_and_Gins_-_We_Have_Decidede_Not_to_Die/Bioscleave_House.html (Stand: 2.3.2012)
JILL DOLAN
Die Utopie der Aufführung
Der ultrakonservative Flügel des politischen Spektrums in den USA hat den Begriff des ‚Glaubens‘ in seine Gewalt gebracht. Diese Inbesitznahme reicht von der Forderung, ‚glaubensbasierte‘ Organisationen (‚faith-based‘ organizations) sollten an der Durchführung der aus Bundesmitteln finanzierten Armenunterstützung beteiligt werden, bis zu dem Ruf nach immer größerer Annäherung von Kirche und Staat, auf deren Trennung sogar die Gründer der Verfassung bestanden. Das Resultat dieser Entwicklung ist, dass progressive politische Kräfte davor zurückschrecken, in ihrer Sprache das Vokabular des Glaubens zu verwenden, weil dieses zu sehr mit den Exzessen der organisierten Religion, der Bekämpfung des Rechts auf Abtreibung sowie mit der Diskriminierung von Schwulen und Lesben in Verbindung gebracht wird – Tendenzen, die allesamt durch den Diskurs des Glaubens ihren Weg in die amerikanische Kultur und Politik gefunden haben. Aber genauso wie Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle heute dem Wort ‚queer‘ eine neue Bedeutung gegeben haben, genauso halte ich es für enorm wichtig, dass diejenigen unter uns, die etwas progressivere Ansichten besitzen, die Kraft des Glaubens nutzbar machen und diese der fundamentalistischen Rechten, die in den USA einen so beängstigenden Aufstieg erfahren hat, wieder entreißen. Ich bin davon überzeugt, dass ein säkulares, nicht religiös basiertes Verständnis von Glauben unserer Politik neue Inspiration verleihen könnte. Denn der Glaube ist in verschiedenen Arten und Strukturen von Realität unerlässlich, wenn man Fragen hinsichtlich der Affizierungsmacht von Aufführungen neu bedenken und ausrichten will: Wie gehen wir miteinander um und – vor allem – wer könnten wir möglicherweise sein? Ich glaube fest daran, dass wir die Idee des Glaubens für progressive politische Zwecke nutzbar machen können und fähig sind, unsere soziale Phantasie durch die Macht der Aufführung in einer Weise zu erneuern, dass wir sie eines Tages leben können: menschlicher, liebevoller und gerechter. Wie aber können wir das affektive Potenzial von Aufführungen als eine Art Methode nutzen, um politische Gefühle einzuüben, die eine progressivere Form menschlichen Zusammenlebens ermöglichen? In meinem Buch Utopia in Performance geht es mir um den Nachweis, dass mit jeder Live-Performance ein Ort geschaffen wird, an dem Menschen, in ihrer Körperlichkeit und mit ihren Leidenschaften, zusammenkommen, um gemeinsam an Erlebnissen der Bedeutungsproduktion und der Imagination teilzuhaben. In diesen Erfahrungsräumen kommt für kurze Augenblicke die Möglichkeit einer besseren Welt zum Vorschein.1 Utopia in Performance wendet sich dem Theater als Mög1 Utopia in Performance: Finding Hope at the Theatre erschien im Dezember 2005 bei der University of Michigan Press.
228
JILL DOLAN
lichkeitsraum zu, in dem wir unsere Kräfte in eine andere Zukunft investieren können. Diese Zukunft zeichnet sich durch Hoffnung und einen neu belebten, radikaleren Humanismus aus und ermöglicht die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und eines bewohnbaren Planeten, sodass der Kapitalismus mit seiner Gefräßigkeit vielleicht nicht die einzige Triebkraft unserer Träume bleiben muss. Das Buch untersucht verschiedene Arten von Aufführungen auf deren Fähigkeit hin, ein Gemeinschaftsgefühl unter den Zuschauern zu wecken und ein breiteres und umfassenderes Verständnis von Öffentlichkeit zu erzeugen, dem zufolge die gesellschaftliche Diskussion ein Potenzial des Menschen und nicht seine unüberwindlichen Hindernisse zum Ausdruck bringen. In den Worten Judith Butlers: „Fantasy is what allows us to imagine ourselves and others otherwise; it establishes the possible in excess of the real; it points elsewhere, and when it is embodied, it brings the elsewhere home.“2 In meinem Bemühen darum, dem ‚Anderswo ein Zuhause‘ zu geben, ziehe ich Aufführungsbeispiele aus verschiedenen zeitgenössischen Genres und Schauplätzen heran. In diesem Aufsatz werde ich mich auf eine meiner Fallstudien konzentrieren, auf die Aufführung von Russell Simmons Def Poetry Jam on Broadway, die ihre Zuschauer als Bürger der Welt anspricht bzw. sowohl eine Form der Kritik und des politischen Engagements vorführt als auch auf wirkungsvolle Weise das Gefühl der Hoffnung und Liebe zum Ausdruck bringt. Diese Liebe ist jedoch nicht auf die Beziehung zu einem Partner beschränkt, wie es die häuslichen Skripte des Realismus meist vorsehen, sondern sie umschließt auch andere Menschen und fußt auf einer weit abstrakteren Idee von ‚Gemeinschaft‘, oder sogar einer noch weniger greifbaren ‚Menschheit‘. Zuerst muss allerdings der theoretische Rahmen abgesteckt werden, durch den sich die Argumentation bewegt. Aus einer Perspektive, die Theater und Performancekunst als soziale Lebenspraxis begreift, richtet sich dieses Buch gegen den Zynismus jener progressiven Kritiker, die meinen, insbesondere die Linke habe längst ihren Glauben an die Möglichkeit einer politischen Transformation aufgegeben. So schreibt etwa Russell Jacoby: „Today, socialists and leftists do not dream of a future qualitatively different from the present. To put it differently, radicalism no longer believes in itself.“3 In Utopia in Performance nehme ich diese Behauptung zum Anlass, meine eigenen Anschau2 Judith Butler, „Global Violence, Sexual Politics“, in: Queer Ideas. The Kessler Lectures in Lesbian and Gay Studies, hg. v. Martin Duberman/Alissa Solomon, New York: The Feminist Press at CUNY 2003, S. 197-214, hier: S. 208. 3 Russell Jacoby, The End of Utopia: Politics and Culture in an Age of Apathy, New York: Basic Books 1999, S. 10. Unter den vielen Beiträgen zu diesem Thema siehe auch Sam Ginden/Leo Pantich, „Rekindling Socialist Imagination: Utopian Vision and Working-Class Capacities“, in: Monthly Review: An Independent Socialist Magazine, 51:10 (2000), S. 36-52. Über den tiefsitzenden Pessimismus innerhalb der Linken schreiben die beiden das Folgende: „Overcoming this debilitating political pessimism and keeping some sense of transformative possibilities alive is the most important issue anyone seriously interested in social change must confront.“ http://monthlyreview.org/2000/03/01/rekindling-socialist-imagination (Stand 2.3.2012)
DIE UTOPIE DER AUFFÜHRUNG
229
ungen von der Möglichkeit einer besseren Zukunft zu entwickeln, und zwar einer solchen, die im Medium von Aufführungen dargestellt und eingefordert werden kann. Utopia in Performance definiert und beschreibt ein Phänomen, das ich ‚utopisches Performativ‘ nenne. Utopische Performative sind kurze, spezifische und bedeutungsvolle Momente einer Aufführung, in denen der Zuschauer zu einem gewissen Grad aus der Gegenwart herausgehoben und in einen Zustand versetzt wird, in dem er voller Hoffnung in die Zukunft schaut. Das ‚utopische Performativ‘ lässt ihn erahnen, wie die Welt aussähe, wenn das Leben emotional genauso umfangreich und übervoll, ästhetisch gleichermaßen eindrucksvoll und gemeinschaftlich so intensiv erlebt werden könnte, wie dieser kurze Moment. Als Performativ wird eine Aufführung selbst zu einem ‚Tun‘ (im Sinne J. L. Austins), das sich in der Artikulation vollzieht – das Performativ setzt sich als Handlung um und wirkt, wie das ‚Ich will‘ bei einer Trauungszeremonie. Das Tun utopischer Performative macht in einer affektiv stark aufgeladenen Vision fühlbar, um wie viel besser es auf der Welt zugehen könnte, wenn die Idee sozialer Gerechtigkeit Wirklichkeit geworden wäre. Theater und Performancekunst eröffnen einen Raum, in dem die öffentliche Meinung unter die Lupe genommen werden kann, und zugleich stellen sie ein Forum dar, in dem die emotionalen Möglichkeiten dieses ‚Tuns‘, das auf eine bessere Welt verweist, verkörpert und – wenn auch im Raum der Fantasie – umgesetzt werden können. Die hier behandelten Performative bringen uns flüchtig mit einer Utopie in Berührung, die nicht abgeschlossen, perfekt und gefestigt ist. Sie stellt kein umfassendes, unabhängiges und selbstbestimmtes System dar, das Zwang ausübt, und sie ist auch nicht messianisch ausgerichtet, was die Gestaltung des Sozialen angeht. Stattdessen handelt es sich um eine Utopie, die immer in Bewegung ist und immer nur in Teilen erfasst werden kann, verschwindet sie doch vor unseren Augen um die Ecke erzählerischer und sozialer Erfahrungen. Meine Untersuchung zur Utopie in der Aufführung stellt also nicht den Versuch dar, Repräsentationen einer besseren Welt zu finden; das Wort ‚Utopie‘ bedeutet buchstäblich ‚kein Ort‘ und mein Buch respektiert diese buchstäbliche Bedeutung, indem es sich weigert, sie mit etwas Ausgeschlossenem zu identifizieren. Stattdessen stimme ich Ernst Bloch und Herbert Marcuse zu: Sie verstehen Kunst „as an arena in which an alternative world can be expressed – not in a didactic, descriptive way as in traditional ‚utopian‘ literature, but through the communication of an alternative experience“4. Jedes fixierte, statische Bild und jede feste Struktur wäre viel zu begrenzt und exklusiv für das hoch auffliegende Gefühl der Hoffnung, der Möglichkeiten und der Sehnsucht, von dem utopische Performative durchdrungen sind. Utopische Performative gehen über den Inhalt eines Theaterstücks und einer Performance hinaus; es kann vorkommen, dass das Publikum noch in der düstersten Schreckensvision ein utopisches Performativ erkennen kann. Utopische Performative entstammen einer komplexen Alchemie von Form und Inhalt, Kontext und 4 Ruth Levitas, The Concept of Utopia, Syracuse: Syracuse University Press 1990, S. 148.
230
JILL DOLAN
Schauplatz; aus ihr kristallisieren sich utopische Momente in Form von Handlungen, Prozessen und unabschließbaren Gesten heraus, die auf die Möglichkeit einer besseren Zukunft verweisen. In seiner Besprechung von Anne Bogarts Inszenierung von bobrauschenberginamerica schreibt der Kritiker John Rockwell in der New York Times das Folgende: „Mesmerizing moments are what those of us addicted to performance live for. Suddenly and unexpectedly we are lifted from our normal detached contemplation into another place, where time stops and our breath catches and we can hardly believe that those responsible for this pleasure can sustain it another second.“5 Rockwell beschreibt hier ein utopisches Performativ: Momente, die im Publikum das brennende Verlangen hervorrufen, die überwältigenden, nahezu vorsprachlichen Einsichten, auf irgendeine Weise fassen bzw. festhalten zu können, und sei es auch nur, damit sie uns noch eine Sekunde länger mit ihrem traurig gefärbten und dabei doch freudigen Gefühl erfüllen. Bloch nennt solche Momente ‚Vor-Schein‘ [‚anticipatory illumination‘] und bemerkt, dass sie sich „our efforts to apprehend them directly“6 entziehen. Dieser Entzug ist für die Traurigkeit in unserer Freude verantwortlich. Schon die Konstitution des utopischen Performativs birgt die Unvermeidlichkeit seines Verschwindens; seine Flüchtigkeit ist der Garant seiner Wirkungsmacht. Die schmerzliche Kurzlebigkeit von Aufführungen liegt allen unseren Erfahrungen im Theater zugrunde. Die Vergänglichkeit utopischer Performative stimmt uns melancholisch und heiter zugleich, denn für einen kurzen Augenblick erfahren wir in ihnen, wie sich das, was man ‚Erlösung‘ nennt, anfühlen könnte, was wahrer Humanismus wäre und wie großartig eine Welt aussähe, in der uns unsere Gemeinsamkeiten über unsere Unterschiede hinweghelfen würden. Jedes Publikum bildet eine vorübergehende Gemeinschaft, Orte öffentlichen Austausches, die gemeinsam mit der intensiven Erfahrung utopischer Performative neue Wege des Investierens und Interagierens in unterschiedlich zusammengesetzten Sphären der Öffentlichkeit vorführen. Anders als zum Beispiel religiöse Gemeinschaften, die zusammenkommen, um auf der Basis eines gemeinschaftlichen Glaubens bestimmte Rituale durchzuführen, sind Theaterzuschauer häufig Fremde, die der Zufall für eine Weile zusammengeführt hat und die sich außerhalb feststehender und kodifizierter Glaubenssätze begegnen. Obwohl sie vorübergehend eine distinkte Form von Öffentlichkeit bilden, kann sich kein Publikum (wie auch keine Aufführung) zweimal in identischer Weise konstituieren. So schreibt die feministische politische Theoretikerin Nancy Fraser: „Arrangements that accommodate con-
5 John Rockwell, „Reverberations: Living for the Moments when Contemplation Turns to Ecstasy“, in: New York Times, 24.10.2003, S. B4. 6 Zitiert nach Phillip E. Wegner, „Horizons, Figures, and Machines: The Dialectic of Utopia in the Work of Frederic Jameson“, in: Utopian Studies 9:2 (1988), S. 58-74.
DIE UTOPIE DER AUFFÜHRUNG
231
testation among a plurality of competing publics better promote the ideal of participatory parity than does a single, comprehensive, overarching public.“7 Das Theaterpublikum als eine solche partizipatorische Öffentlichkeit aufzufassen, kann auch dazu führen, dass sich die in utopischen Performativen erlebbare communitas weiter ausdehnt und den Wunsch entstehen lässt, dieses Gefühl von Gemeinschaft auch in anderen sozialen Kontexten zu etablieren. ‚Communitas‘ ist ein Begriff, der in den Performance Studies vor allem durch den Anthropologen Victor Turner Bekanntheit erlangt hat. Er beschreibt diejenigen Momente eines Rituals oder Theaterereignisses, in denen die Teilnehmer oder das Publikum sich als Teil eines Ganzen erfahren, und zwar in einer organischen, fast schon spirituellen Weise. In solchen Augenblicken sind die Individualitäten der Zuschauer aufeinander genau abgestimmt, und das starke Gefühl der Verbundenheit und der Zugehörigkeit zu einer Gruppe geht, wenn auch nur kurz, wie eine Welle über das Publikum hinweg.8 In Aufführungen bilden einzelne Menschen eine flüchtige Öffentlichkeit; solch eine Zuschauerschaft kann ihre Beteiligten sogar dazu animieren, in anderen Bereichen der Öffentlichkeit aktiv zu werden. Aufführungen könnten also den Anstoß dazu geben, vermehrt an gesellschaftlichen Diskursen teilzunehmen. Wenn, wie Fraser vermutet, „public spheres are not only arenas for the formation of discursive opinion [but also] arenas for the formation and enactment of social identities“9, dann können die Zuschauer bei einer Aufführung als Akteure betrachtet werden, die sich selbst zu Teilnehmern und Bürgern einer vielleicht radikaleren Demokratie heranbilden. Das soziale Kapital von Russell Simmons Def Poetry Jam on Broadway erwächst aus der Tatsache, dass es eine wesentlich gemischtere Öffentlichkeit ins Leben ruft, als dies eine Broadway-Show normalerweise zu tun pflegt. Diese Produktion formt die Öffentlichkeit in ein Forum des Möglichen um, was bedeutet, dass es sich nicht um politische Pietäten schert, sondern alles in einem lebendigen und gänzlich gegenwärtigen ‚Jetzt‘ unterbringt. Einen guten Grund dafür nennt die Queer-Theoretikerin Lauren Berlant: „[...] politicized feeling is a kind of thinking that too often assumes the obviousness of the thought it has, which stymies the production of the thought it might become.“10 Ganz anders der Def Poetry Jam: Anstatt didaktisch vorzugehen, heben die dort auftretenden Dichter vermeintliche politische und emotionale Selbstverständlich7 Nancy Fraser, „Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy“, in: Habermas and the Public Sphere, hg. v. Craig Calhoun, Cambridge: MIT Press 1992, S. 109-142, hier: S. 122. 8 Über den Begriff der ‚Communitas‘ vgl. Victor Turner, Drama, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society, Ithaca: Cornell University Press 1974, S. 274. Vgl. auch ders., From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play, New York: Performing Arts Journal 1982, S. 45-51. 9 Fraser, „Rethinking the Public Sphere“, a.a.O., S. 125. 10 Laurent Berlant, „The Subject of True Feeling: Pain, Privacy, and Politics“, in: Feminist Consequences: Theory for a New Century, hg. v. Elisabeth Bronfen/Misha Kavlea, New York: Columbia University Press 2001, S. 126-160, hier: S. 133.
232
JILL DOLAN
keiten aus den Angeln und beziehen die Zuschauer auf phantasievolle Weise in die Welt des Möglichen mit ein. Die neun Dichter der Show schaffen eine intersubjektive Zuschauerschaft der Öffentlichkeit, die Widerworte gibt und die Dichter bereits während der Aufführung wissen lässt, dass sie gehört und gesehen werden. Die Dichter des Def Poetry Jam sind in direktem Austausch mit einem Publikum zu sehen, das jung ist und von unterschiedlichster Hautfarbe.11 Ihre Aufführung stellt einen Dialog her, der die Zuschauer mit einem sehr spezifischen ‚Du‘ adressiert; durch diese Ansprache kann eine (in den Worten der marxistischen politischen Theoretikerin Chantal Mouffe) ‚politische Gemeinschaft‘ [‚political community‘] entstehen, in der „what makes us fellow citizens [...] is not a substantive idea of the good, but a set of political principles specific to [liberal democracy]: the principles of freedom and equality for all“12. Als Teil einer solchen Konversation wächst dem Def Poetry Jam die Rolle eines Vehikels zu, das ein radikaldemokratisches Weltbürgertum begründet. Die Aufführung selbst lässt uns durch ihren Reichtum an utopischen Performativen die Spannweite ihrer Möglichkeiten erfahren. Die Performer des Def Poetry Jam sprechen auf eindringliche Weise mit ihrem Publikum, in Wortkaskaden, die wie Hymnen auf die Notwendigkeit sozialer Veränderung klingen, ganz gleich, ob sie Themen wie Scham, Wut, Ruhm oder Angst behandeln. Ihre Liebesgedichte sind süß, durchdrungen vom Jetzt und sie überhöhen ihren Gegenstand mit einer derartigen Andacht und Hoffnungsfülle, dass das Mögliche zum Vorschein kommt. Der Def Poetry Jam zeigt, wie radikale Demokratie sich anfühlen könnte. Er zelebriert eine Idee von Handlungsmacht, die jeder einzelnen Stimme im Chor der Identitäten einen Wert beimisst und zugleich deren Harmonie imaginieren lässt. Die Aufführung tritt als kollektiver Akt dafür ein, dass das politische Gemeinwesen in neuer Weise als ein Gebilde begriffen wird, das alle Menschen umfasst. Das Publikum wird eingeladen, in der Macht, der Schönheit, dem Mitgefühl und der Notwendigkeit dieses Anspruchs zu schwelgen. Der Def Poetry Jam bringt die unterschiedlichsten Menschen zusammen und benutzt das Forum der Bühne und das Mittel der Aufführung dazu, Praktiken des miteinander Sprechens und einander Zuhörens einzuüben. Beau Sia, einer der Dichter des Jam, drückt dies mit Bezug auf Slam im allgemeinen so aus: „[...] it has brought a lot of kids together around the things affecting their world, who might not have even spoken to each other.“13 Die Tatsache, dass der Def Poetry Jam in einem konventionellen Theater aufgeführt wird, gibt den Performern die Möglichkeit, eine soziale Botschaft zu vermitteln und den Ort als ein soziales Forum nach ihren eigenen 11 Ich habe die Broadway-Produktion des Def Poetry Jam am 29.12.2002 im Longacre Theatre in New York gesehen. 12 Chantal Mouffe, „Democratic Citizenship and the Political Community“, in: dies. (Hg.), Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community, London: Verso 1992, S. 225-239, hier: S. 213. 13 Zitiert nach Danny Simmons (Hg.), Russell Simmons Def Poetry Jam…and More: The Choice Collection, New York: Atria Books 2003, S. 110.
DIE UTOPIE DER AUFFÜHRUNG
233
Vorstellungen zu beanspruchen. Der Slam Poetry- und Hiphop-Stil des Def Poetry Jam sorgt für eine eher ungewöhnliche Theatererfahrung und signalisiert, dass deren herkömmlichen Regeln aufgehoben sind. Diese Unkonventionalität, dieses spontane Sprechen ‚wie es einem in den Sinn kommt‘, weist den Weg in Richtung der hoffnungsvollen Definition von Kunst als eines ‚Vor-Scheins‘. Tatsächlich wurde in der Rezeption des Def Poetry Jam dessen regelwidrige und gänzlich ungewöhnliche Präsenz hervorgehoben, doch dies nicht immer in einem positiven Sinne. Tony Vellela schrieb im Christian Science Monitor: „On a street map, it’s a short 10 blocks from hip-hop mogul Russell Simmons’s office on Seventh Avenue to Broadway’s Longacre Theatre. On a cultural map, it can seem like a million miles. His latest vision, Russell Simmons Def Poetry Jam on Broadway, has made that journey, landing like a meteor in the middle of a theatre scene more known for Cats and cartoons than cutting edge. While Broadway has seen other nontraditional offerings in recent wears, [...] Def Poetry Jam breaks new ground.“14
Ed Siegel beginnt seine Rezension im Boston Globe mit einer Nachahmung der Hiphop-‚attitude‘: „Yo, dude. Got somethin’ to tell ya. BROADWAY RULES!“, und er fragt: „When was the last time the Great White Way was so welcoming to other skin and hair colors?“15 Bei Elysa Gardner in USA Today heißt es: „To say that Russell Simmons Def Poetry Jam isn’t your grandmother’s Broadway show would be an understatement.“16 In Variety, dem Fachblatt der amerikanischen Unterhaltungsindustrie, schreibt Charles Isherwood über die Show, dass der Broadway „[has] seen nothing like it before“17. Jon Pareles von der New York Times war einer der wenigen Kritiker der großen Zeitungen, der das Ereignis in relativ neutrale Worte fasste: „For the first time on Broadway, poetry with hip-hop roots is at center stage.“ Und er fährt fort: „While other Broadway theatres are filled with Les Miserables, revivals of old musicals and revues based on familiar songs, Def Poetry Jam is up to the minute. [...] ‚This show is not going to be engraved in stone,‘ Mr. Lathan [the production’s director] said. ‚The poems are constantly being updated.‘“18 Insgesamt unterstreichen alle diese Kommentare die radikale Unvertrautheit des Def Poetry Jam mit seinem altehrwürdigen Kontext. Gleichzeitig aber geben sie der Besorgnis darüber Ausdruck, was wohl die Ankunft dieses Stücks auf dem Broadway zu bedeuten hat. Anstatt die Produktion als einen Meilenstein zu feiern und als wichtigen Durchbruch für Gesellschaftsgruppen zu betrachten, die bisher nicht über ein solch weithin sichtbares Forum verfügten, versuchen einige der Kritiker, das Interventionspotenzial der Show einzudämmen, indem sie sie der leichteren 14 Tony Vellela, „Hip-Hop takes Center Stage on Broadway“, in: Christian Science Monitor, 22.11.2002, S. 19. 15 Ed Siegel, „A Promising Blend of Pop Art and High Art on Broadway“, in: Boston Globe, 19.01.2003, S. N5. 16 Elysa Gardner, „Def Poetry Jam is All Relative“, in: USA Today, 15.11.2002, S. E7. 17 Charles Isherwood, „Russell Simmons Def Poetry Jam“, in: Variety, 15.11.2002, S. 7. 18 Jon Pareles, „A New Platform for the New Poets“, in: New York Times, 10.11.2003, S. B1.
234
JILL DOLAN
Abfertigung wegen den vertrauten Kategorien der Kulturarbeit zuordnen. Gardner in USA Today sagt zum Beispiel, „[that the show’s] more stringent social commentary tends to strike one note, and it’s a predictable one. However superficially controversial their views, all adhere neatly to the rules on which political correctness is founded: 1) Insults are most acceptable when directed toward our own social or ethnic group or, even better, a group perceived as more empowered. 2) Preaching is easiest when you’re facing the choir.“19 Wenn Gardner meint, das Einrennen von Türen sei dann besonders leicht, wenn diese bereits offen sind, so berücksichtigt er nicht, dass die ‚offenen Türen‘ erst an diesem Ort entstehen. Schon die Einleitung ihres eigenen Artikels hatte genau dies festgestellt: Wir haben es hier nicht mehr mit „your grandmother’s Broadway show“ zu tun. Dieses ‚your‘, bezieht sich auf sie selbst und auf ihre Adressaten bzw. rekurriert auf eine überwiegend weiße Leserschaft aus der Mittelschicht, die einen komfortablen Abstand zu einem Phänomen halten, das ein anderer Kritiker als „another popular injection of ‚urban‘ culture into mainstream entertainment“20 bezeichnet hat. Die Ängste dieser Kritiker rühren demnach daher, dass sie sich aus einer kulturellen Mitte verdrängt fühlen, die bisher einer weißen Elite vorbehalten war. In ihren Kommentaren zu der Show treten diese Ängste deutlich zutage. Ed Siegel vom Boston Globe etwa reagiert auf die ethnische Vielfalt nicht nur damit, dass er einen ihrer Slangs nachäfft, sondern auch indem er erklärt, dass „[t]he nine poets follow one another onstage, forming a kind of victimization-on-parade“21. Der Vorwurf der ‚Opferkunst‘ [‚victim art‘], der Mitte der Neunziger von Arlene Croce, der Tanzkritikerin des New Yorker verachtungsvoll in die amerikanische Kultur geschleudert wurde (er richtete sich gegen den schwulen afroamerikanischen Tänzer Bill T. Jones), entfaltet seine Wirkung als Strategie der Mundtotmachung und Eingrenzung bis heute.22 Wenn das radikale Potenzial des Def Poetry Jam mit den Etiketten ‚Opferkunst‘ und ‚political correctness‘ ausgeschaltet wird, dann kann sein Einbruch in eine Domäne der weißen Mittelklasse vorübergehend toleriert und schnell verharmlost werden. Der Beginn des Def Poetry Jam arbeitet einer solchen Herabsetzung ausdrücklich entgegen, indem er es dem jungen, multi-ethnischen Publikum ermöglicht, sich im Theater wohl zu fühlen, einer Institution, mit deren Regeln und Konventionen es vielleicht nur unzureichend vertraut ist.23 An dem Abend, an dem ich mir die Auf19 20 21 22
Gardner, „Def Poetry Jam is All Relative“, a.a.O., S. E7. Isherwood, „Russell Simmons Def Poetry Jam“, a.a.O., S. 7. Siegel, „A Promising Blend of Pop Art and High Art on Broadway“, a.a.O., S. N5. Vgl. Arlene Croce, „Discussing the Undiscussable“, in: The New Yorker 70:43 (1994), S. 5459. 23 Tatsächlich hatte Simmons mit seiner Produktion genau dieses Publikum im Sinn. Für Simmons „Broadway means ‚long-standing shows that the whole world will see.‘ Otherwise, he is not exactly in awe of the territory. ‚I try to watch what they think is hot on Broadway,‘ he grouses, ‚and my ass starts to hurt.‘ Needless to say, Simmons isn’t counting on the average theatre-goer, so he’s already putting to work a number of marketing techniques that have al-
DIE UTOPIE DER AUFFÜHRUNG
235
führung angesehen habe, hatte der DJ die Zuschauer ein wenig in Stimmung gebracht, bevor er die einzelnen Dichter vorstellte. Er animierte uns dazu, uns in der Aufführung so zu verhalten, als wären wir auf einem Rock-Konzert oder einem Gottesdienst. Indem er Musik auflegte, half er den Zuschauern, sich die Perspektive eines Broadway-Zuschauers entspannt anzueignen, und verwandelte das Theater, das normalerweise nicht mit Hiphop assoziiert wird, in einen Ort, an dem sich junge Menschen wohlfühlen können. In vielerlei Hinsicht war der ungewöhnlichste, vielleicht sogar der radikalste Aspekt der Aufführung nicht die multi-ethnische Zusammensetzung des Ensembles, sondern der Generationenunterschied, der sich zwischen dem Alter eines durchschnittlichen Broadway-Publikums und der Jugendlichkeit der Zuschauer und Performer des Jam auftat.24 Im Bewußtsein der relativen Altersgleichheit der öffentlichen Gemeinschaft, die hier zusammengekommen war, forderte der DJ sein Publikum sodann auf, bestimmte Lieder anzustimmen, die dem Großteil der Zuschauer offensichtlich bekannt waren, und die meisten sangen bereitwillig mit. Spontan trafen sich alle in derselben Tonlage, und am Ende jedes Refrains brach allgemeines Gelächter über die eigene Gemeinschaftlichkeit aus, über all die vertrauten kulturellen Markierungen, Liedtexte und Melodien, auch wenn die meisten einander gar nicht kannten und nur wenige von ihnen mit den konventionellen, freundlich-andächtigen, überwiegend aus einer weißen Mittelschicht stammenden Codes des traditionellen Theaterpublikums vertraut waren. Ich habe die Aufführung zusammen mit meiner Freundin Vicki Patraka besucht; wir sind beide weiß, mittleren Alters, Professor von Beruf, jüdisch, und wir beide haben Ingwerbonbons gelutscht, um nach einem zeremoniellen Vor-Theaterabendessen unsere Mägen zu beruhigen. Als fast das gesamte Publikum mitsang, sahen wir einander mit großen Augen an, doch gleichzeiways worked to bring out his traditional audience of music, comedy, and clothes buyers. For example, prior to opening night, a mighty 50% of the ad budget is devoted to radio, with only 5% going to print. Most Broadway producers would reverse those figures. [...] But radio is the obvious choice for African-American-themed stage shows that successfully play the Beacon Theatre.“ Robert Hofler, „Broadway spreads ‚Jam‘ to new Auds“, in: Variety, 21.10.2002, S. 81. Gleichzeitig berichtet Suheir Hammad, einer der Dichter der Produktion, gegenüber Jon Pareles: „‚We want to open this up to the traditional theatre audience,‘ Ms. Hammad said. ‚They may be worried that they don’t relate to the hip-hop generation, but they’re raising the hip-hop generation.‘ (Ticket prices after the opening will range from $25 to $65).“ Pareles, „A New Platform for the New Poets“ a.a.O., S. B1. 24 Schließlich gab es bisher schon jede Menge Stücke und Musicals von und über ein nichtweißes Publikum (wenn natürlich auch nie genug) auf dem Broadway zu sehen. Dazu gehört etwa For Colored Girls Who have Considered Suicide when the Rainbow was Enuf (1976), das viele Kritiker mit dem Def Poetry Jam verglichen haben, weil sie beide zweifellos die gleiche poetische Ästhetik teilen; dann Bring in da Noise, Bring in da Funk (1996), eine Geschichte afro-amerikanischer Musik und Performance, die George C. Wolfe vom Public Theatre auf den Broadway brachte; weiterhin Suzan Lori Parks Top Dog/Underdog (2002), ebenfalls eine Übernahme vom Public Theatre; dann das erfolgreiche 2004 Revival von Lorraine Hansberrys Klassiker A Raisin in the Sun (1961), mit Sean ‚Puffy‘ Combs; und schließlich die vielen Broadway-Produktionen von August Wilsons Stücken.
236
JILL DOLAN
tig waren wir von dem Gesang bewegt und beeindruckt, ohne jegliche Ahnung von den Melodien, Texten oder Songs zu haben. Die Musik war nicht für uns bestimmt; sie richtete sich an eine andere Generation. (Dagegen gehören wir ganz sicher der Generation und demografischen Gruppe an, an die sich die besorgten Zeitungskritiken gerichtet hatten – wir waren die ‚Großmütter‘ des Broadway-Theaters!) Der DJ legte Songs auf, die nicht nur eine interaktive, vergnügliche und dankbare Stimmung erzeugten, sondern auch das Bewusstsein eines gemeinschaftlich geteilten, kulturellen Ortes. Er forderte das Publikum auf, sich bemerkbar zu machen und selbst die Kontrolle über den Abend zu übernehmen, anstatt in einer bloß reagierenden Passivität zu versinken. Wenn er das Publikum direkt ansprach, dann ganz allgemein mit „New York“, einer so vielseitigen geografischen Bezeichnung, dass sich fast jeder angesprochen zu fühlen schien. Diese Geste erinnert an tourende Musiker oder Comedians, die so etwas sagen wie „We love you, Austin“ oder „Pittsburgh“ oder „Washington“, oder wo immer sie auch auftreten mögen. Gemeinsam ist diesen Anreden, dass sie das Publikum als eine gesonderte Öffentlichkeit ansprechen, die speziell für diese eine Gelegenheit zusammengekommen ist, wodurch nicht selten so etwas wie ein erhöhter Bürgersinn oder sogar Stolz unter den Angesprochenen entsteht. Was eine solche Begrüßung auch leistet, ist, dass sie die Codes eines Konzertbesuchs auf einen Theaterabend überträgt, damit den Unschlüssigen unter den Zuschauern möglicherweise noch ein Extra an Sicherheit bei ihrer ersten Kontaktaufnahme mit dem Broadway verliehen wird. Nachdem der DJ eine paar vorbereitende Songs gespielt hatte, begann er schließlich mit der Vorstellung der einzelnen Dichter, die er so ankündigte, als wären sie Sportler, die auf einem Spielfeld auflaufen. In Verbindung mit den Codes des Konzertbesuchs rief dies bestimmte Aufführungstraditionen aus Sport und Freizeit auf, Verhaltensmuster also, mit denen das junge Publikum bereits eine gewisse Vertrautheit besaß. Der DJ rief Namen und Heimatstadt jedes Performers einzeln auf und endete mit der triumphalen Ankündigung: „This is Def Poetry Jam.“25 Die Dichter des Def Poetry Jam brechen aus der Decke der Konventionen und Banalitäten aus und treten damit den Unterdrückungen und Beschränkungen des Alltags entgegen. Die Gedichte beginnen als Solostücke und werden in der Folge zu kollektiv vorgetragenen ‚Riffs‘, Gesangseinlagen, die von Sehnsüchten handeln und mit den individuellen Erfahrungen und Träumen der einzelnen Dichter angefüllt werden. Auch diese Gemeinschaftsmomente heben die Aufführung aus dem Banalen in die Dimension des Schönen. Dadurch, dass sie jeweils ihre eigenen Verse dem Refrain „I write America“ hinzufügen, imaginieren sie eine erweiterte und ausgedehnte Idee von ‚citizenship‘, die Nicht-Weißen, Schwulen und anderen marginalisierten Gruppen ermöglicht, durch ihre Stimmen dominante Sprachmuster zu unterlaufen. Dies erreichen sie, indem sie geradezu zärtlich mit ihren Worten 25 Der DJ, Tendaji Lathan (der Sohn des Regisseurs Stan Lathan), unterlegte den Dichterworten während des gesamten Abends seine Klanglandschaften: „[H]e moved the performances [...] from one scene to another on beats that effortlessly hinge the transitions.“ Simmons, Def Poetry Jam on Broadway, a.a.O., S. 203.
DIE UTOPIE DER AUFFÜHRUNG
237
umgehen und ‚Herrschaftsinstrumente‘ (master’s tools) erotisieren bzw. für ihre eigenen Zwecke einspannen, statt sich von ihnen abstumpfen und unterdrücken zu lassen.26 Die Dichter werden während ihrer Performance zu sozialen Propheten, die die Möglichkeit eines Anderswo verkünden: Hier treffen Schwächen auf generöse Anerkennung, Schmerzen werden durch Stolz verdrängt und das Alltagsleben erscheint nicht mehr als Zwang, sondern als ein Potenzial der Verwandlung zum Besseren. Gegen Ende des ersten Teils, als alle Dichter auf der Bühne versammelt waren, nahmen sie innerhalb des garagenartigen Bühnenbildes auf verschiedenen Sitzgelegenheiten Platz und schauten sich gegenseitig bei ihren Soloauftritten zu. Dramatisch überspitzte Gesten und Blicke der Bewunderung, des Neids und der Rivalität wechselten dabei einander ab, denn schließlich entstammte die Produktion der Tradition des Poetry Slam, der ja eine Art Dichterwettkampf ist. Doch die Performer zollten einander auch Respekt und bildeten somit eine Gemeinschaft, in der man sich mit Aufmerksamkeit begegnet. Lemon, einer der Latino-Performer, sprach, wenn er seinen Mund bewegte, ausschließlich die Worte der anderen mit, als könne er sich an seinen Text nur dann erinnern, wenn er diesen als Teil eines sich nahtlos entwickelnden Ganzen artikuliert.27 Die Intensität, mit der die Dichter einander zuhörten, war so stark wie das Spotlicht, das die einzelnen Solisten beleuchtete; ihre wechselseitige Aufmerksamkeit bot fast eine Form von physischer Unterstützung. In diesen Momenten, in denen sie gemeinsam auf der Bühne waren, erhoben sie Anspruch auf das utopische Performativ. Ich konnte fühlen, wie ihre Energie vom einen auf den anderen überging, wie sie sich gegenseitig Halt ga26 Vgl. etwa Michael Giltz, „Getting Raves for her Rants: Chinese-jamaican Poet Stacyann Chin Brings her Outraged Eloquence from Broadway to HBO’s Def Poetry“, in: The Advocate, 29.04.2003, S. 60-62, der Chin zu ihrer lesbischen, multi-ethnischen Identität sowie zum Verhältnis zu ihrer Arbeit und dem Amerikaner-Sein befragt. Der Verweis auf die ‚Herrschaftsinstrumente‘ (master’s tools) bezieht sich auf Audre Lorde, „The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House“, in: dies., Sister Outsider: Essays and Speeches, Trumansburg/New York: Crossing Press 1984, S. 110-113. 27 Lemon ist halber Puertoricaner; er ist in Brooklyn als ‚outlaw‘ aufgewachsen. Seine Eltern waren beide drogensüchtig und starben an AIDS. Wegen eines bewaffneten Raubüberfalls saß er auf Rikers Island im Gefängnis, wo er sich selbst das Lesen und Schreiben beigebracht hat. Nach seiner Entlassung wurde er ein Mitglied der ‚Universes‘, einer Slam Poetry Performance-Gruppe. In seiner im Skript abgedruckten Biografie heißt es über ihn: „‚My stuff is profound,‘ he brags a little. ‚I’m speaking for the poor peoples‘“. Simmons, Danny (Hg.), Russell Simmons Def Poetry Jam…and More: The Choice Collection, New York: Atria Books 2003, S.134. Lemons Performance war virtuos, obwohl seine Technik, wie schon bezüglich seiner Mitsprechtendenz angemerkt wurde, eher rudimentär war. Diese Kombination von großer Kraft und Ungeübtheit charakterisierte die meisten der Performances, und sie war es auch, die der Produktion die Patina der Authentizität verlieh, ein Wert, der wiederholt von den Herausgebern des veröffentlichten Skripts hervorgehoben wird. Auch die gezielten Hinweise auf Lemons Gefängniserfahrungen sollen Authentizität garantieren und dem Def Poetry Jam den Status eines heilenden und erlösenden Unternehmens verleihen, für die Künstler ebenso wie für das Publikum.
238
JILL DOLAN
ben, einander anfeuerten, sich Einsatzzeichen gaben und gemeinsam das Tempo hielten. Denn schließlich gehörte diese Aufführung ja allen, und sie legten sie den Zuschauern nicht demütig, wie ein Geschenk, vor die Füße, sondern als Erklärung ihrer eigenen, neu vergegenwärtigten Unabhängigkeit und ihres Anspruchs auf Zugehörigkeit zu ihrem Land, als eine leidenschaftlich-stolze Nationalhymne ‚von unten‘, als oppositionelle Welterschaffung und als beharrlicher, vielstimmiger und hoffnungsvoller Marsch kritischer Klänge. Wie kann solch eine bewegende utopische Erfahrung vermittelt oder in die Welt außerhalb des Theaters transportiert werden? Hört der atemberaubende Augenblick der möglichen Verbundenheit und des großen Gefühls auf, sobald das Saallicht angeht und die Zuschauer in Zweier- oder Dreiergruppen in ihren viel prosaischeren Alltag zurückkehren und ihren Weg durch die Menge zum Ausgang bahnen? In den Worten Bert States’: „The return from the play world is like the awakening from the dream: it is always an abrupt fall into the mundane, fraught with the nostalgia of exile.“28 Auch die Künstler selbst spüren manchmal diesen melancholischen Verlust. Die Sängerin Nina Simone sagte einmal, „the saddest part of performing“ sei, dass „it didn’t mean anything once you were offstage“29. Es gehört zum Wesen des utopischen Performativs, dass es nicht einfach in ein gesellschaftspolitisches Programm umgesetzt werden kann, denn am wirkungsvollsten ist es als Gefühl. Solche Momente mit der Forderung zu überfrachten, dass sie auch nach dem Ende der Aufführung wirken sollten, würde das zerbrechlich-schöne Potenzial dieses Gefühls, das wir nur ganz kurz in unserem Herzen festhalten können, verschwinden lassen. Es entsteht eine Sehnsucht danach, zu fühlen, berührt zu werden, zu merken, dass die eigenen Wünsche angeregt werden, und man möchte an der Komplexität einer Hoffnung wieder teilhaben, die in Form von Anwesenheit einer Abwesenheit erscheint. Da ich weiß, dass die Menschen um mich herum genauso gerührt sind, lässt mich diese Sehnsucht immer wieder zum Theater zurückkehren, es bestärkt mich also darin, eine utopische Vision praktizieren zu wollen, für die man im wirklichen Leben kein greifbares Gegenstück findet. Das Politische liegt hier in der Sehnsucht nach der Möglichkeit eines Anderswo. Es liegt in unserer Bereitschaft, Aufführungen zu besuchen oder zu erschaffen und an wirklichen Orten zusammenzukommen, um in imaginären Räumen die Möglichkeiten des ‚nicht hier‘ und ‚noch nicht‘ zu erkunden. „Theater engages the operations of world-constitution [...]“, Stan Garner zufolge, „as spectator, actor, and character seek to situate themselves in relation to the world, both make-believe and radically actual, that confronts and surrounds them“30. Ich schwelge in meiner Liebe zu Theater und Performancekunst und setze 28 Bert O. States, „Phenomenology of the Curtain Call“, in: Hudson Review 34:3 (1981), S. 374. 29 Zitiert nach Alice Echols, Scars of Sweet Paradise: The Life and Times of Janis Joplin, New York: Henry Holt 1999, S. 260. 30 Stanton B. Garner, Bodied Spaces: Phenomenology and Performance in Contemporary Drama. Ithaca: Cornell University Press 1994, S. 3.
DIE UTOPIE DER AUFFÜHRUNG
239
es mir zum Ziel, aus diesem Gefühl heraus zu schreiben, statt diese tiefe, mich tragende Empfindung hinter einem Schleier der Abstraktion oder Verdunkelung zu verbergen. Ich möchte, dass mein Schreiben diese intensiven Gefühlsmomente auf meine Leser überträgt und sie dazu inspiriert, Aufführungen neu zu denken und sie als einen lebendigen Ort des menschlichen Zusammenhalts, der Kritik, der Liebe und des Respekts zu begreifen, der eine Form weltlichen Glaubens wiederbeleben kann. Utopia in Performance erlaubt den Zuschauern (vom engagiertesten Theatergänger bis zum Gelegenheitsbesucher), auf unsere Gefühle und Gedanken aufmerksam zu werden, und an unserem hoffnungsvollen und progressiven Projekt des Welt-Entwerfens (world-making) teilzunehmen. Vom Künstler/Kritiker/Bürger, der sich herausgefordert fühlt, utopische Performative zu ergreifen, wird verlangt, dass er auf sie achtet, ja bereit ist, sich aus der eigenen Alltagswelt herauszureißen und in einen Moment anmutvollen Schwebens zu versetzen. Diese Transformation bedarf keines außergewöhnliches Materials, wie sich dies am Beispiel des Def Poetry Jam gezeigt hat. Schon allein der Aufführungsbesuch als solcher stellt einen gesellschaftlichen Glaubensakt dar, d.h. er impliziert ein Vertrauen zu einer Kunst, die Freiheit und Gerechtigkeit einzuüben hilft. Durch unsere Liebe zum Theater, die uns animiert, Aufführungen zu besuchen, wird vielleicht eine Bedingung notwendigen Glaubens, Vertrauens und Begehrens bereits erfüllt. Denn so ist der Weg frei für die Gestaltung utopischer Experimente und Imaginarien, so kurzlebig sie auch sein mögen. ‚Utopia‘ ist immer eine Metapher, ein Wunsch, ein Verlangen, ein Kein-Ort, und Aufführungen können uns manchmal helfen, sie zu imaginieren, ohne sie tatsächlich zu finden. Ein ‚Performativ‘ jedoch ist keine Metapher: Es ist ein Handeln, und es ist das Performativ in der Aufführung, an dem Hoffnung haftet und in dem sich Gemeinschaft realisiert bzw. das Noch-nicht-Bewusste erblickt, gefühlt und angestrebt werden kann. Auch Humanismus kann ein Performativ sein, das aber stets neu geschaffen werden muss, damit wir seine Transparenz nie als etwas Gegebenes annehmen. Auch Emotionen und Affekte sind Performative, sie stellen Gefühlsmomente dar, die sichtbar werden müssen, um ihre Wirkung zu entfalten. Utopische Performative kristallisieren sich heraus, wenn wir uns bemühen, eine flüchtige Öffentlichkeit zu gestalten. Diese schließt eine vielfältige Präsenz zusammen und stimuliert die Hoffnung, erkannt, erweitert und gemeinschaftlich geteilt zu werden. Ein utopisches Performativ ist eine Weise des Denkens und Sehens. Es beruht auf dem magischen Effekt der Aufführungspraxis, auf dem Glauben an soziale Gerechtigkeit und eine bessere Zukunft, auf der Wirkung und Bedeutung eines Wunsches, und nicht zuletzt auf der Liebe am menschlichen Miteinander, den Unwägbarkeiten unserer Verschiedenheit zum Trotz. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Thomas Stachel.
240
JILL DOLAN
Literaturverzeichnis Berlant, Laurent, „The Subject of True Feeling: Pain, Privacy, and Politics“, in: Feminist Consequences: Theory for a New Century, hg. v. Elisabeth Bronfen/Misha Kavlea, New York: Columbia University Press 2001, S. 126-160. Butler, Judith, „Global Violence, Sexual Politics“, in: Queer Ideas. The Kessler Lectures in Lesbian and Gay Studies, hg. v. Martin Duberman/Alissa Solomon, New York: The Feminist Press at CUNY 2003, S. 197-214. Croce, Arlene, „Discussing the Undiscussable“, in: The New Yorker 70:43 (1994), S. 54-59. Dolan, Jill, Utopia in Performance. Finding Hope at the Theatre, Ann Arbor: University of Michigan Press 2005. Echols, Alice, Scars of Sweet Paradise: The Life and Times of Janis Joplin, New York: Henry Holt 1999. Fraser, Nancy, „Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy“, in: Habermas and the Public Sphere, hg. v. Craig Calhoun, Cambridge: MIT Press 1992, S. 109-142. Gardner, Elysa, „Def Poetry Jam is All Relative“, in: USA Today, 15.11.2002, S. E7. Garner, Stanton B., Bodied Spaces: Phenomenology and Performance in Contemporary Drama, Ithaca: Cornell University Press 1994. Giltz, Michael, „Getting Raves for her Rants: Chinese-jamaican Poet Stacyann Chin Brings her Outraged Eloquence from Broadway to HBO’s Def Poetry“, in: The Advocate, 29.04.2003, S. 60-62. Ginden, Sam/Pantich, Leo, „Rekindling Socialist Imagination: Utopian Vision and WorkingClass Capacities“, in: Monthly Review: An Independent Socialist Magazine, 51:10 (2000), S. 36-52. Hofler, Robert, „Broadway spreads ‚Jam‘ to new Auds“, in: Variety, 21.10.2002, S. 81. Isherwood, Charles, „Russell Simmons Def Poetry Jam“, in: Variety, 15.11.2002, S. 7. Jacoby, Russell, The End of Utopia: Politics and Culture in an Age of Apathy, New York: Basic Books 1999. Levitas, Ruth, The Concept of Utopia, Syracuse: Syracuse University Press 1990. Lorde, Audre, „The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House“, in: dies., Sister Outsider: Essays and Speeches. Trumansburg/New York: Crossing Press 1984, S. 110-113. Mouffe, Chantal, „Democratic Citizenship and the Political Community“, in: dies (Hg.), Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community, London: Verso 1992, S. 225-239. Pareles, Jon, „A New Platform for the New Poets“, in: New York Times, 10.11.2003, S. B1. Rockwell, John, „Reverberations: Living for the Moments when Contemplation Turns to Ecstasy“, in: New York Times, 24.10.2003, S. B4. Siegel, Ed, „A Promising Blend of Pop Art and High Art on Broadway“, in: Boston Globe, 19.01.2003, S. N5. Simmons, Danny (Hg.), Russell Simmons Def Poetry Jam…and More: The Choice Collection, New York: Atria Books 2003. States, Bert O., „Phenomenology of the Curtain Call“, in: Hudson Review 34:3 (1981), S. 374. Turner, Victor, Drama, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society, Ithaca: Cornell University Press 1974. —, From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play, New York: Performing Arts Journal 1982. Vellela, Tony, „Hip-Hop takes Center Stage on Broadway“, in: Christian Science Monitor, 22.11.2002, S. 19.
DIE UTOPIE DER AUFFÜHRUNG
241
Wegner, Phillip E., „Horizons, Figures, and Machines: The Dialectic of Utopia in the Work of Frederic Jameson“, in: Utopian Studies 9:2 (1988), S. 58-74.
Internetquellen http://monthlyreview.org/2000/03/01/rekindling-socialist-imagination (Stand: 2.3.2012)
ANALYSE
TORSTEN JOST
Analyse der Aufführung. Über die Pluralität der Perspektiven
„Hands off“, warnte 1899 der US-amerikanische Psychologe und Philosoph William James am Ende seines Vortrags On a Certain Blindness in Human Beings seine Schüler und Kollegen. Tunlichst sollten sie vermeiden, die gewissenhafte Analyse ihrer eigenen Beobachtungen für die Erkenntnis der ‚Realität an sich‘ zu halten, denn „[...] neither the whole of truth nor the whole of good is revealed to any single observer, although each observer gains a partial superiority of insight from the peculiar position in which he stands. [...] It is enough to ask of each of us that he should be faithful to his own opportunities and make the most of his own blessings, without presuming to regulate the rest of the vast field.“1
Wovor James hier warnt, sind gleichsam die Scylla und Charybdis des analytischen Umgangs mit empirischen Beobachtungen: Seine Scylla sieht der Philosoph in der Überschätzung des eigenen Beobachtungsstandpunkts, also in der Gefahr zu glauben, dieser böte eine privilegierte Aussicht auf ‚das Ganze‘ und mithin die Möglichkeit einer allgemeingültigen Erkenntnis. Seine Charybdis macht James in der Marginalisierung der eigenen Perspektive aus, das heißt darin, ihre ‚partial superiority of insight‘ zu verkennen und allzu leichtfertig zu Gunsten anderer Perspektiven zu relativieren oder gar zu negieren. Folgt man James, vermeiden diejenigen Beobachter epistemologischen Schiffbruch, die auf der einen Seite um die Vorzüge ihrer je besonderen Perspektive wissen und diese gründlich ausnutzen, auf der anderen Seite jedoch zugleich anerkennen, dass diese unvermeidlich mit einer spezifischen ‚certain blindness‘ einhergeht und entsprechend die Finger vom Versuch lassen, sie dem ‚rest of the vast field‘ aufzudrängen oder etwa verallgemeinernd zu unterstellen. Worauf James hier letztlich hinweist, ist das erkenntnistheoretische Potenzial einer Pluralität gleichberechtigter Beobachtungsstandpunkte. Ich sehe was, was Du nicht siehst ist nicht nur der Name eines Kinderspiels, das diese Gleichwertigkeit unterschiedlicher Perspektiven auf die Welt mustergültig in Szene setzt, sondern auch der Titel eines Aufsatzes des Soziologen Niklas Luhmann, der gut hundert Jahre nach James an dessen Warnungen erinnert. Im besagten Artikel kritisiert Luhmann ein ‚ontologisches Denken‘, welches die reguläre
1 William James, „On a Certain Blindness in Human Beings“, in: ders., Talks to Teachers on Psychology: And to Students on some of Life’s Ideals, New York: Henry Holt and Company 1907, S. 229-264, hier: S. 264.
246
TORSTEN JOST
akademische Erkenntnistheorie und -praxis noch immer präge. Nach wie vor neigten zahlreiche Wissenschaften dazu, die Welt als ein Kondensat von „[...] Erfahrungen [zu betrachten], die sich wiederholen lassen. Die Reflektion dieser Erfahrungen nimmt die Form der Ontologie an. Sie rechnet mit einer einwertigen Realität, zusätzlich aber auf der Ebene des Erkennens mit der Möglichkeit der Aufdeckung von Täuschungen, der Korrektur von Irrtümern.“2
Die Aktualität dieses Denkens zeige sich unter anderem daran, dass in den Wissenschaften noch immer vielfach nach der einen richtigen Beobachterposition gesucht werde, aus der sich übereinstimmend über die Welt berichten lasse. Sie zeige sich in der wissenschaftlichen Suche nach dem einen Standort und der einen Weise der Beobachtung, „die das Nichtsehenkönnen der anderen sich und den anderen erklärt und damit Weltwissen zur Verfügung stellt, über das man sich einigen kann“3. Denn als objektiv und rational gelte im Rahmen dieser Epistemologie eine Erkenntnis nur dann, „wenn alle Beobachter übereinstimmen“4. Ein anderer, mit epistemologischer Sprengkraft begabter Beobachtungsstil – nämlich das „empirische Beobachten von empirischen Beobachtern“5 – zeige jedoch, so Luhmann, dass alle Beobachtungen unvermeidlich perspektivisch sind, weil sie performative Akte der Handhabung sprachlicher Unterscheidungen darstellen.6 Folglich könne es so etwas wie einen allgemeingültigen ‚Einheitsbericht‘ nie geben: Keine Beobachtung könne ein Primat für sich in Anspruch nehmen, da jede auf einer sprachlichen Unterscheidung fundiere und mithin stets über einen ‚blinden Fleck‘ verfüge. Darum lege die Beobachtung von Beobachtern einen Verzicht auf sämtliche Anstrengungen nahe, beobachtendes Verhalten im Namen einer intersubjektiv ermittelbaren ‚Wahrheit‘ über die Realität zu normieren oder etwa anderen Beobachtern die „eigenen Unterscheidungen aufzudrängen“7 – nur, weil man aus eigener Warte deren ‚blinde Flecke‘ zu erkennen vermag. Eine Erkenntnis der Realität, so die Schlussfolgerung, sei allein als ein unaufhörliches „Prozessieren von Differenzen“8 zu denken und zu haben.
2 Niklas Luhmann, „Ich sehe was, was Du nicht siehst“, in: ders., Soziologische Aufklärung 5. Konstruktivistische Perspektiven, Opladen: Westdeutscher Verlag 1990, S. 228-234, hier: S. 231. 3 Ebd., S. 230. 4 Ebd., S. 229. 5 Ebd., S. 230. 6 Nach Luhmann ist die Beobachtung „eine unterscheidende und das Unterschiedene zugleich bezeichnende Operation eines Beobachters“. Detlef Krause, „Beobachtung“, in: ders., Luhmann-Lexikon: Eine Einführung in das Gesamtwerk von Niklas Luhmann. Stuttgart: Lucius und Lucius 2001, S. 111-112, hier: S. 111. Luhmann selbst betont den performativen Charakter der Beobachtung, wenn er festhält, „daß die Unterscheidung, die einer Beobachtung zugrunde liegt, erst rekursiv durch den Gebrauch konstituiert wird“. Niklas Luhmann, „Vorwort“, in: ders., Soziologische Aufklärung 5, a.a.O., S. 7-13, hier: S. 8. 7 Luhmann: „Ich sehe was, was Du nicht siehst“, a.a.O., S. 232. 8 Ebd., S. 232.
ANALYSE DER AUFFÜHRUNG
247
Zur Geschichte der theaterwissenschaftlichen Theorie und Praxis der Aufführungsanalyse: Diese ließe sich schreiben als eine der zunehmend kritischen Auseinandersetzung mit jener sowohl von James als auch von Luhmann kritisierten Epistemologie, die darauf setzt und zielt, voneinander abweichende Beobachtungen sich gegenseitig korrigieren zu lassen. Je differenzierter sich die Theaterwissenschaft damit befasste, Aufführungsanalyse zu betreiben und zu denken, umso nachdrücklicher bildete sich in ihr ein Bewusstsein über deren prinzipielle Unvereinbarkeit mit diesem Verständnis von Wissenschaftlichkeit und Objektivität heraus, das – zu Gunsten der Konstruktion eines vermeintlich allgemeingültigen ‚Einheitsberichts‘ – alle Beobachter zur Korrektur ihrer individuellen Beobachtungen anhält. Das grundlegende Problem der Theaterwissenschaft mit dem Modell des Einheitsberichts ist auf die schlichte Tatsache zurückzuführen, dass jede Aufführung notwendig eine Vielzahl divergierender und zum Teil sogar konkurrierender Wahrnehmungen und Beobachtungen hervorbringt, die sich grundsätzlich nicht ‚wiederholen‘ oder gar unifizieren lassen. Denn Aufführungen entstehen in der und durch die Interaktion leiblich ko-präsenter Individuen. Sie entspringen aus ihrer Begegnung und nicht selten sogar aus ihrer konfliktreichen Konfrontation. Die Perspektiven der an solch einem Geschehen Beteiligten korrespondieren zwar miteinander und ähneln sich zum Teil sogar, was nicht zuletzt am verbreiteten räumlichen Arrangement des Guckkastentheaters und anderen kulturellen Prägungen liegt, können aber doch nie in vollkommen deckungsgleichen Beobachtungsberichten münden. Denn in Aufführungen nehmen die Teilnehmer sowohl unterschiedlich als auch Unterschiedliches wahr: Sie fokussieren ihre Aufmerksamkeiten nicht nur auf verschiedene Aspekte der Aufführung und sind ungleich empfänglich für bestimmte ihrer Dimensionen, sie nehmen das Geschehen auch – ganz physisch gesprochen – aus je anderen Perspektiven wahr: Sie sehen, hören, spüren und erleben also in der Tat Unterschiedliches. Zudem bringen Aufführungsteilnehmer auch ungleiche Voraussetzungen, Kenntnisse und Fertigkeiten mit, auf ihre Wahrnehmungen und Erfahrungen in Aufführungen zu achten, diese zu beurteilen und zu diskursivieren. Selbst starke Eindrücke, die wir in Aufführungen zweifelsohne gemeinsam erleben, wie etwa ein Schuss, werden tatsächlich different wahrgenommen und bewertet – zum Teil als Schock erfahren, manchmal aber auch erwartet oder als ‚billiger Effekt‘ einfach nur genervt zur Kenntnis genommen. Dementsprechend werden sie auch nach einer Aufführung verschieden zur Sprache gebracht und reflektiert. Eine gute Gelegenheit, die immensen Schwierigkeiten zu beobachten, die aus ebendiesen Umstand erwachsen, dass jede Aufführung grundsätzlich eine Pluralität disparater Erfahrungen und Beobachtungen erzeugt, bietet sich bei Foyergesprächen: Diese kreisen des Öfteren um das Phänomen, dass eine Zuschauerin in der Aufführung Atmosphären, Bewegungen und Stimmungen oder Brüche, Anspielungen und Entwicklungen beobachten konnte, die ihre Gesprächspartner überhaupt nicht wahrgenommen oder ganz anders beurteilt haben. In eine regelrechte Krise oder gar zum handfesten Streit geraten derartige Unterhaltungen, wenn Einzelne – James und Luhmann zum Trotz, muss man hier sagen – nicht davon ablas-
248
TORSTEN JOST
sen können, ihrem Gegenüber die eigene Perspektive oder die eigenen sprachlichen Unterscheidungen aufzudrängen. Nicht zuletzt Aufführungen im Rahmen der historischen Theateravantgarde verstanden sich glänzend darauf, mit der Kraft der Aufführung zu spielen, eine Vielzahl heterogener Erfahrungen und Beobachtungen zu generieren – oftmals indem sie gerade mit dem räumlichen Arrangement der Guckkastenbühne brachen. Seit der ‚performativen Wende‘, die in den Künsten verstärkt ab den 1960er Jahren einsetzte, führten Theatermacher dieses Spiel mit nicht nachlassender Intensität fort. Eine Aufführung wie The Show must go on! von Jérôme Bel (UA 2001) vermag dies exemplarisch zu verdeutlichen. Wie bereits von Adam Czirak in seiner Einleitung in das zweite Kapitel dieses Bandes geschildert, gipfelte die Choreografie Bels in einem simplen, aber umso aufschlussreicheren Moment, in dem die Tänzer die vierte Wand der Guckkastenbühne durchbrachen, sich als geschlossene Front an der Rampe aufbauten und einzelne Zuschauer im Parkett direkt anblickten. Von welch ‚pluralisierender‘ Kraft dieser Moment war, ließ sich den anschließenden Foyergesprächen deutlich anmerken: Diese zielten plötzlich mehr auf einen Austausch denn auf einen Abgleich von differenten Erfahrungen. Da nicht jeder Zuschauer ein spannungsgeladenes Blickverhältnis mit einem Tänzer oder einer Tänzerin herstellen konnte oder wollte, fühlten sich viele offenbar auch im Nachhinein vom Drang oder Zwang befreit, einen homogenen Erfahrungsbericht generieren zu müssen. Statt Aussagen à la ‚Das war doch ganz anders …‘ oder ‚Ich glaube, das hast du falsch gesehen…‘, hörte man Fragen wie ‚Hast du etwa…?‘ oder ‚Na, wie war’s?‘. Differenzen wurden ent- statt verdeckt. Zurückzuführen ist dies sicher nicht zuletzt auf die Tatsache, dass ein Einheitsbericht hier allein zum Preis der ganz offensichtlichen Privilegierung, Negierung oder Nivellierung der eigenen oder fremden Perspektive zu haben gewesen wäre. Insbesondere Aufführungen wie diese Choreografie von Jérôme Bel trugen dazu bei, in der Theaterwissenschaft den Erkenntnisgewinn eines vermeintlich allgemeingültigen Einheitsberichts über Aufführungen grundsätzlich in Zweifel zu ziehen. Sie stellten sie vor die Herausforderung, Analysemethoden zu entwickeln, die viel nachdrücklicher auf die individuellen Körpererfahrungen und Bedeutungskonstitutionen fokussieren, die Aufführungen ihren Teilnehmern jeweils bereiten und ermöglichen. Die im Rahmen unseres Forschungsprojekts entwickelte Ästhetik des Performativen greift diese Herausforderung auf: Sie zielt ausdrücklich darauf ab, alle in Aufführungen auftauchenden Phänomene nicht allein im Hinblick auf ihr Potenzial zu beleuchten, als mehr oder weniger allgemeingültig codierte Zeichen zu fungieren, sondern diese gerade auch im Hinblick auf ihre Eigenschaft zu untersuchen, bei Aufführungsteilnehmern körperliche Wirkungen, Erfahrungen und Bedeutungsprozesse zu evozieren, die durchaus voneinander abweichen können. Ausgehend von einem performativen Verständnis der Aufführung hat unser Forschungsprojekt einen eigenen Ansatz der methodischen Aufführungsanalyse entwickelt. Dieser geht im ersten Schritt stets von konkreten, am und mit dem eigenen Leib vollzogenen Wahrnehmungen in Aufführungen aus. Sein zweiter Schritt, der vorzugsweise erst nach der Aufführung vollends einsetzt, führt diese Wahrnehmungen
ANALYSE DER AUFFÜHRUNG
249
und Erfahrungen der Sprache zu und zugleich auf Merkmale der Aufführung zurück. Sein dritter und letzter Schritt besteht darin, die entstandenen Beobachtungsberichte (die ‚Erinnerungsprotokolle‘9) mit spezifischen Fragestellungen zu konfrontieren, ggf. zu komplettieren sowie mit fremden Beobachtungsberichten bzw. anderen Informationsquellen (Programmheft, Künstleraussagen, Wissen über kulturelle Kontexte etc.) zu kontrastieren und schließlich im Licht geeigneter Theorien zu reflektieren. Ein so skizziertes methodisches Vorgehen bei der Aufführungsanalyse, das wir zusammen mit Studierenden fortwährend erproben und weiterentwickeln, verfolgt nicht zuletzt das Ziel, sowohl die Scylla als auch die Charybdis des analytischen Umgangs mit empirischen Beobachtungen zu meiden. Insbesondere mit dem zweiten und dritten Schritt ist die explizite Aufforderung an die Analysierenden verbunden, die eigenen und fremden Beobachtungsberichte, die die Grundlage ihrer Arbeit bilden, nicht so zu behandeln, als wären sie grundsätzlich für alle Aufführungsteilnehmer im gleichen Maße gültig. Die entscheidende Herausforderung besteht vielmehr darin, die prinzipielle Perspektivität der jeweils untersuchten eigenen und fremden Beobachtungen anzuerkennen und auszunutzen. Denn hierin liegt eines der besonderen Erkenntnispotenziale der Methode: Sie begreift Wahrnehmungs-, Beobachtungs- und Reflektionsprozesse als notwendig verkörperte Praktiken, deren jeweilige Dynamiken sich nicht allein aus persönlich-biografischen, sondern auch aus situativen und kulturellen Einflussquellen speisen. Indem unsere Methode dazu auffordert, die Perspektivität dieser Akte – so weit wie möglich und sinnvoll – offen zu legen und den Rezipienten der Analyse nachvollziehbar zu machen, schafft sie die Bedingung der Möglichkeit einer kritischen Reflektion der verschiedenen Faktoren, die unser Verhalten in, unser Erleben von und unser Nachdenken über Aufführungen prägen. Auf diesem Weg vermag sie einen Raum der Erkenntnis über leibhaftig durchlebte Aufführungen zu öffnen, in dem tatsächlich unaufhörlich Differenzen aufgespürt und reflektiert werden können. Ein zusätzlicher Gewinn der Methode besteht darin, eine wesentliche Eigenschaft von Aufführungen zum Vorschein zu bringen, die ich mit dem Philosophen Martin Seel als ihre Alterität fassen möchte. Dies vermag sie, indem sie ihre Befunde gerade nicht als allgemein- oder gar endgültige Bestimmungen des Soseins der analysierten Aufführung behandelt und präsentiert, sondern stattdessen von der prinzipiellen Einsicht ausgeht, dass es mit ihrer Hilfe zu keiner Zeit eine abschließende Bestimmung der Aufführung geben kann – „da alles, was so und so bestimmt worden ist, mag es auch für seine Zwecke zutreffend bestimmt worden sein, grundsätzlich anders hätte bestimmt werden können“10. Auf diese Weise reflektiert sie die Aufführung als ein Ereignis der Realität, das so und zugleich anders war. 9 Vgl. zu den Funktionen und Herausforderungen der Erinnerprotokolle insbesondere Jens Roselt, „Kreatives Zuschauen. Zur Phänomenologie von Erfahrungen im Theater“, in: Der Deutschunterricht 2 (2004), S. 46-56; Matthias Warstat, Krise und Heilung. Wirkungsästhetiken des Theaters, München: Wilhelm Fink 2011, hier vor allem: S. 202-209. 10 Martin Seel, „Der Konstruktivismus und sein Schatten“, in: ders., Sich bestimmen lassen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2002, S. 101-122, hier: S. 113.
250
TORSTEN JOST
„Es [war] so, wie es von den zutreffenden Bestimmungen erfasst wird und darüber hinaus so, wie es von anderen Bestimmungen (seien es nun unsere oder die anderer) erfasst werden könnte – und darüber hinaus so, wie es von gar keinen Bestimmungen erfasst, wohl aber von einer nicht auf Bestimmungen fixierten Wahrnehmung vernommen werden [konnte].“11
Dementsprechend fordert und fördert unsere Methode eine Aufführungsanalyse, als wissenschaftliche Praxis und als Textform, die nicht zuletzt die Alterität der Aufführung stets präsent hält – als prinzipielles Andersseinkönnen ihrer Erfahrung und Erfassung.12 Alle Beiträge des anschließenden Kapitels lassen sich mit dem hier skizzierten Ansatz der Aufführungsanalyse samt seinen spezifischen Herausforderungen, Problemen und eigenen, notwendig zu ihm gehörigen ‚blinden Flecken‘ in ein produktives Verhältnis setzen. Dabei ergänzen sie sich nicht nur gegenseitig, sondern stehen zudem mit Aufsätzen aus anderen Kapiteln dieses Bandes in Beziehung. Der Beitrag von Christel Weiler und Frank Richarz widmet sich insbesondere den praktischen Anforderungen, die mit der theaterwissenschaftlichen Aufführungsanalyse verbunden sind. Es ist bezeichnend, dass sie hierfür den Dialog als Form wählen: scheint diese Textgattung doch besonders dazu geeignet, sowohl die intersubjektiven als auch die vollzug- bzw. prozesshaften Dimensionen der aufführungsanalytischen Tätigkeit aus dem Schatten der theoretischen Reflexionen über ihren Sinn und Zweck treten zu lassen. Die Praxis der Aufführungsanalyse wird in ihrem Gespräch als eine graduelle Einübung in spezifische Formen der Wahrnehmung vorgestellt, d. h. als eine zeitintensive Arbeit an sich selbst, die u. a. über wiederholte Besuche von künstlerischen Theateraufführungen hinausweist und nicht zuletzt von einem intensiven Austausch mit Geübten lebt. Auch der Beitrag von Jens Roselt beschäftigt sich mit Wahrnehmungsvorgängen von Zuschauern in Aufführungen, die er als ‚Zwischengeschehen‘ ausweist, welche Denk- und Schreibweisen obsolet werden lassen, die einer Subjekt/Objekt- bzw. einer Produktion/ Rezeption-Dichotomie folgen. Anhand phänomenologischer Konzepte zeigt Roselt innovative Wege auf, wie die fluiden Wechselverhältnisse zwischen Bühne und Publikum in Analysen theoretisch erfasst und beschrieben werden können. Auf diese Weise demonstriert er die Potenziale phänomenologischer Theorien für die Aufführungsanalyse, die in der Tat grundlegend darauf angewiesen ist, dass ihre Verfasser ihren eigenen ‚Augen trauen‘. Viktoria Tkaczyk geht in ihrem Beitrag davon aus, dass sich Aufführungen und ihre Analysen im Rahmen übergreifender kultureller Verhandlungsprozesse vollziehen und diese absichtlich oder unbemerkt 11 Ebd., S. 114. 12 Die Analyse fundiert demzufolge auf einem Verständnis von Realität, das diese vom Prozess ihrer stets begrenzten und medial – d. h. hier in erster Linie sprachlich – vermittelten Erkennbarkeit her begreift, dabei jedoch nie den Gedanken „einer unserem Kenntnisstand widerstreitenden Beschaffenheit von Welt“ preisgibt. Martin Seel, „Bestimmen und Bestimmen lassen. Anfänge einer medialen Erkenntnistheorie“, in: ders., Sich bestimmen lassen, a.a.O., S. 146-166, hier: S. 166.
ANALYSE DER AUFFÜHRUNG
251
auf- oder angreifen. Ausgehend von der irritierenden Erfahrung einer Performance der Gruppe Gob Squad, in der die Autorin den ‚gekonnt inszenierten Abgang des Wortgedächtnisses von der Bühne‘ beobachtete, demonstriert Tkaczyk mithilfe der Methode der kulturhistorischen Spurensuche, wie eine Aufführungsanalyse aussehen kann, die sich besonders für die kulturellen Hintergründe von spezifischen Aufführungspraktiken interessiert. Ihr Ansatz verdeutlicht die Potenziale einer kulturhistorisch informierten und geleiteten Reflektion unserer Aufführungsbeobachtungen und damit zugleich einen innovativen Weg, wie kulturgeschichtliche Dimensionen in Analysen Berücksichtigung finden können. Matthias Dreyer geht in seinem Beitrag der Frage nach, inwiefern Aufführungen als ‚Orte der Geschichte‘ erfahren, beschreiben und analysiert werden können. Insofern stehen seine Ausführungen mit denen Tkaczyks in einem unmittelbaren Zusammenhang: Anders als Tkaczyk widmet sich Dreyer jedoch weniger der Frage, aus welchen kulturellen Antrieben historisch gewachsene Praktiken in gegenwärtige Aufführungen hineinragen, sondern geht von der Beobachtung aus, dass bestimmte Aufführungsaspekte bei Zuschauern ein ‚Bewusstsein von Historizität‘ zu evozieren vermögen. Am konkreten Beispiel wird gezeigt, wie diese Erfahrungen von Geschichtlichkeit auf konkrete Aufführungsmerkmale, wie etwa Sprechtechniken, bezogen und im Licht zeitgenössischer Geschichtstheorien reflektiert und interpretiert werden können. Den Abschluss dieses Kapitels bildet der Aufsatz des Anthropologen Tobias Rees, der die gravierende Neuausrichtung skizziert, die sein Fach in den letzten Jahrzehnten vollzogen hat. Rees’ Ausführungen zielen auf die Erneuerung des traditionsreichen Austauschs zwischen Anthropologie und Theaterwissenschaft, deren Potenziale sich in der Tat deutlich abzeichnen: Das im Beitrag beschriebene neue ‚Forschungsethos‘ der philosophischen Anthropologie und die mit ihm verbundenen methodischen Maximen sind zweifelsohne inspirierend für eine (nicht minder gewandelte) Theaterwissenschaft, die ausgehend von einer Ästhetik des Performativen u. a. darauf zielt, die verwandelnde Kraft von Aufführungen zu untersuchen – ihre Kraft, unsere Denk- und Handlungsgewohnheiten in Bewegung geraten und sich neu formieren zu lassen. Diesbezüglich verdeutlicht der Beitrag, wie wichtig für die Praxis der Aufführungsanalyse eine sichergestellte Offenheit und Flexibilität in jedem einzelnen ihrer Schritte ist. Schafft diese doch erst die Bedingung der Möglichkeit, dass wir Transformationsprozesse, die sich in unserer und durch unsere Gegenwart vollziehen, in ihrer Tragweite erfassen, zur Sprache bringen und reflektieren können.
Literaturverzeichnis James, William, „On a Certain Blindness in Human Beings“, in: ders., Talks to Teachers on Psychology: And to Students on some of Life’s Ideals, New York: Henry Holt and Company 1907, S. 229-264. Krause, Detlef, „Beobachtung“, in: ders., Luhmann-Lexikon: Eine Einführung in das Gesamtwerk von Niklas Luhmann, Stuttgart: Lucius und Lucius 2001, S. 111-112.
252
TORSTEN JOST
Luhmann, Niklas, „Ich sehe was, was Du nicht siehst“, in: ders., Soziologische Aufklärung 5. Konstruktivistische Perspektiven, Opladen: Westdeutscher Verlag 1990, S. 228-234. –, „Vorwort“, in: ders., Soziologische Aufklärung 5. Konstruktivistische Perspektiven, Opladen: Westdeutscher Verlag 1990, S. 7-13. Roselt, Jens, „Kreatives Zuschauen. Zur Phänomenologie von Erfahrungen im Theater“, in: Der Deutschunterricht 2 (2004), S. 46-56. Seel, Martin, „Der Konstruktivismus und sein Schatten“, in: ders., Sich bestimmen lassen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2002, S. 101-122. –, „Bestimmen und Bestimmen lassen. Anfänge einer medialen Erkenntnistheorie“, in: ders., Sich bestimmen lassen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2002, S. 146-166. Warstat, Matthias, Krise und Heilung. Wirkungsästhetiken des Theaters, München: Wilhelm Fink 2011.
CHRISTEL WEILER, FRANK RICHARZ
Aufführungsanalyse und Theatralanalyse − ein Dialog
Als Kollegen am Institut für Theaterwissenschaft werden wir im Sommersemester 2012 beide vor der gleichen Situation stehen, nämlich die Einführung in die Aufführungsanalyse zu unterrichten. Aus diesem Grund haben wir einen Dialog begonnen, in dem wir uns darüber verständigen, was denn nun eigentlich die Methode ausmacht, die wir als Aufführungsanalyse bezeichnen. Im Folgenden ist der aktuelle Stand unseres Gespräches wiedergegeben. FR: Unsere Ausgangsfrage ist: Was genau ist diese analytische Methode der Theaterwissenschaft – ganz gleich, ob wir sie nun Aufführungsanalyse oder – wie ich – Theatralanalyse nennen? Was kann sie und was nicht, welche Daten produziert sie und in welche Form bringen wir diese Daten? Wie lehrt oder lernt man das methodische Instrumentarium, wie verfeinert und verbessert man es? Was genau ist das Objekt der Analyse? CW: Was ist diese analytische Methode? – so kann man die Frage nicht formulieren. Man kann höchstens fragen: „Wie sieht das Verfahren aus, das wir an unserem Institut für Theaterwissenschaft ‚Analyse‘ nennen?“. Das lässt sich so einfach gar nicht beschreiben, weil es sich auf mehreren Stufen und prozesshaft abspielt. Zunächst sind wir Teilnehmer an einem Geschehen: Wir sind Teil einer sozialen Situation, die wir als Aufführung bezeichnen. Auch wenn wir mit mehreren den Raum teilen, gibt es doch ein individuelles Interagieren mit dem und Wahrnehmen von dem, was sich vor unseren Augen und Ohren abspielt. (Dass dieses Interagieren und Wahrnehmen / interagierende Wahrnehmen partiell durch die Anwesenheit von Ko-Teilnehmerinnen ‚gestört‘ oder in irgendeiner Art und Weise beeinflusst wird – durch Lachen, Zwischenrufe, Hüsteln etc. – lasse ich mal unbeachtet. Ich stelle mir also in idealer Weise eine Aufführung für mich alleine vor.) Dieses interagierende Wahrnehmen lässt sich genauer beschreiben als ein Vorgang, in dem Gedanken, Gefühle, Stimmungen entstehen und in dem unterschiedliche Energien zirkulieren. Dieses Konglomerat von Eindrücken, Gedanken, Bildern, Empfindungen, Erinnerungen etc. ist das, was zunächst übrig bleibt, wenn ich aus diesem Aufführungsgeschehen entlassen bin. Anders ausgedrückt, handelt es sich dabei um den ersten Datensatz, der uns zur Verfügung steht. Der zweite Schritt, der darauf folgt, ist ein Erinnerungs-, Ordnungs- und Reflexionsvorgang, der sich in den meisten Fällen als ein einsames Geschehen abspielt, aber durchaus auch gemeinsam mit anderen stattfinden kann: beispielsweise in den Seminaren zur Aufführungsanalyse oder nach der Vorstellung in Gesprächen mit Freunden über die Aufführung. Dieser Erinnerungs-, Strukturierungs- und Reflexionsvorgang orientiert sich prinzipiell an zwei Fragen: Was habe ich gesehen, gehört, empfunden, beobachtet, gerochen, vermisst? Was war – auf das Ganze bezo-
254
CHRISTEL WEILER, FRANK RICHARZ
gen – aus welchem Grund in besonderer Weise wichtig für mich? Dieses ‚wichtig für mich‘ kann sich aus verschiedenen Orientierungen ableiten: je nach dem, mit welchem Anspruch bzw. Erkenntnisinteresse ich an die Aufführung herangehe, je nach dem, mit welchen Anspruch das Aufführungsgeschehen in Gang gesetzt wurde, ergeben sich unterschiedliche Fragestellungen, die das Ordnen der Gedanken und die nachträgliche Reflexion leiten. Eine studentische Arbeit im Szenischen Projekt wird anders wahrgenommen und bewertet als ein Abend mit Rimini Protokoll. FR: Ich stimme dir zu, dass wir unseren ersten Datensatz durch unsere Beobachtung des theatralen Geschehens um uns herum erhalten. Doch mir scheint es, als würdest du deinen Fokus bereits zu sehr auf ein Objekt richten, das wir als Aufführung bezeichnen und das sich – wie du sagst – ‚vor unseren Augen und Ohren abspielt‘. Das klingt plausibel, wenn du tatsächlich vom Kunsttheater ausgehst, da es dort in der Regel bereits eine entsprechende vorgegebene zeitliche und örtliche Struktur gibt, die wir dann als Aufführung identifizieren. Wenn ich jedoch die Betrachtung auf soziale Situationen im Allgemeinen ausweite, dann ist dieses ‚Objekt‘ nicht mehr so klar aufzufinden. Zudem geht es natürlich gerade nicht nur um das, was um uns herum gespielt wird – wie du ja selbst richtig bemerkt hast – sondern auch um das, was uns in diesen Situationen widerfährt. Dies spielt sich aber nicht ausschließlich vor unseren Augen und Ohren ab und geschieht daher jenseits unserer Wahrnehmung einer irgendwie gestalteten Außenwelt. CW: Ja, ich bleibe mit Absicht beim so genannten Kunsttheater. Ich halte dies auch für äußerst wichtig, denn daran schult sich in erster Linie die Wahrnehmung für die Vorgänge auf der Bühne bzw. im beobachtenden und teilnehmenden Subjekt selbst. Was die Widerfahrnis betrifft: Das, was mir widerfährt, bzw. dass mir etwas widerfährt, lässt sich natürlich nie verhindern, vor allem im Theater nicht. Ich würde sogar so weit gehen und sagen: „Ich warte darauf, dass mir etwas widerfährt.“ Theater ohne diese Dimension rührt mich nicht an, weckt nicht mein Interesse. Es führt zu nichts. FR: Da kann ich dir nur zustimmen. Es führt jedoch zu der Frage, wie ich mit dem, was mir widerfährt und was daher in mir vor sich geht, methodisch verfahre. Eine wissenschaftliche Methode steht immer im Dienste eines Erkenntnisinteresses. Darüber hinaus produziert sie Daten, die grundsätzlich für andere Wissenschaftler nachvollziehbar und im besten Falle nutzbar sein sollten. Welches Erkenntnisinteresse steht hinter dem aufführungsanalytischen Projekt? Geht es darum, möglichst viel über das zeitgenössische Theater herauszufinden? CW: Das Erkenntnisinteresse des Naturwissenschaftlers zum Beispiel lässt sich grundsätzlich beschreiben als ein Interesse, die Vorgänge in der ‚Natur‘ zu begreifen und zu untersuchen. Warum sollte es uns nicht gestattet sein, das Erkenntnisinteresse der Theaterwissenschaftlerin ähnlich generalisierend zu formulieren, nämlich als Wunsch, das Theater (so allgemein zunächst verstanden wie der Begriff ‚Natur‘) in seiner Vielfalt und in seinen unterschiedlichen Funktionen und Wertigkeiten, die es für uns hat, zu begreifen? Im Grunde genommen gibt es zwei Bereiche von Erkenntnisinteresse: der eine bezieht sich auf das Phänomen Theater in all seiner
AUFFÜHRUNGSANALYSE UND THEATRALANALYSE
255
globalen Vielfalt, der andere bezieht sich auf die Subjekte der Erkenntnis selbst. Es geht nicht zuletzt auch darum, unsere Instrumentarien der Erkenntnis am Theater zu entwickeln und auszudifferenzieren. FR: Du sprichst hier von zwei Perspektiven – einem nach außen und einem nach innen gerichteten Blick. Bei dem nach außen gerichteten Blick stellt sich für mich weniger die Frage der Methode, als die der Begrenzung des Objektbereichs. Was ist denn alles Theater im allgemeinen Sinne von ‚Natur‘? Können wir auch nichttheatrale Phänomene theatral untersuchen? Der theatralogischen Neugier sind meiner Meinung nach erstmal keine Grenzen gesetzt und schon gar nicht diejenigen des zeitgenössischen Theaterbetriebs. Bei dem nach innen gerichteten Blick stellt sich für mich die Frage, wie ich diese Perspektive methodisch sauber einfange, ohne lediglich über meine Befindlichkeiten zu schwadronieren. Für wen sind diese Daten von Interesse und in welcher Form sind sie wissenschaftlich noch zu verkraften? CW: Die nach innen gerichtete Aufmerksamkeit, welche den Grundlagen und Bedingtheiten der eigenen Erkenntnisfähigkeit nachgeht, kann sich eher auf das Auftauchen von unreflektierten Bewertungen als auf die momentane Befindlichkeit richten, die in der Tat für die Wissenschaft in den meisten Fällen uninteressant ist. Es findet ja ein aufregendes Wechselspiel zwischen Innen und Außen statt, welches selbst wie eine Art Korrektiv funktioniert und somit die eigene momentane Befindlichkeit in den Hintergrund treten lässt. Die Tatsache zum Beispiel, dass ich mich ärgere, weil ich schon wieder in der ersten Reihe sitze, tritt in den Hintergrund, sobald das Interesse am Geschehen überwiegt. Letzteres muss natürlich an einem bestimmten Punkt gegeben sein. Aber davon gehe ich aus. Es geht darum, dass ich mich fokussieren kann. Die immer wieder zitierte Anwesenheit des Publikums ist für mich während der Aufführung nur insofern interessant, als sie den Raum energetisch auflädt und mir hinterher die Möglichkeit gibt, mich mit jemandem darüber auszutauschen. FR: Ich kann deine Fokussierung auf das Kunsttheater insofern nachvollziehen, als ich glaube, dass wir dort unsere Aufmerksamkeit auf das theatrale Spiel um uns herum und durch uns hindurch am besten schulen können. Ich halte es auch für legitim, sich ein Leben lang nur mit den Entwicklungen des jeweiligen zeitgenössischen Kunsttheaters zu beschäftigen. Aber ich glaube auch, dass die Theaterwissenschaft mehr zu bieten hat als nur ihr klassisches ästhetisches Objekt, das zwar vielfältig ist, aber in unserer Gesellschaft oft nur eine marginale Rolle spielt. Warum sollten wir nicht unsere am Theater geschulte und verfeinerte Beobachtungsgabe auch auf andere soziale Phänomene richten? Warum sollten wir uns ausschließlich um bereits fertig theatralisierte Situationen kümmern, wenn doch unsere Methoden selbst uns dazu befähigen, nahezu jede soziale Situation in ein theatrales Setting, also auch in eine Aufführung, zu überführen? Es könnte doch sein, dass dabei Erkenntnisse gewonnen werden, für welche die Methoden anderer Sozial- und Geisteswissenschaften blind sind. Allerdings müssten wir für diesen Ausfallschritt erst einmal genauer wissen, was denn diese analytische Methode der Theaterwissenschaft überhaupt ist. Können wir das konkretisieren?
256
CHRISTEL WEILER, FRANK RICHARZ
CW: Die Ausweitung unseres Geltungsbereiches ist eine Sache, der ich mit Vorsicht begegnen möchte. Aber bleiben wir doch zunächst einmal bei der noch ungeklärten Methodenfrage. Diese oder auch nur eine deutlich zu beschreibende analytische Methode der Theaterwissenschaft zu finden, ist die Aufgabe, die sich immer wieder neu stellt. Es gibt eine Art strukturierter Wahrnehmung, also so etwas wie ein Beobachtungsmuster – sowohl für die Innen- als auch für die Außenperspektive. Methode, so wie ich sie verstehe, ist allerdings kein immer wieder anzulegendes Raster, sondern ein dynamisches Modell, das sich im Abgleich mit dem zu untersuchenden ‚Gegenstand‘ immer wieder neu justiert, ohne dass wir rein willkürlich vorgehen. Nehmen wir an, eine Theaterwissenschaftlerin interessiert sich in erster Linie dafür, in welcher Weise der Chor in Pollesch’s Kill your Darlings eingesetzt wird, wie er funktioniert, ob er gängige Vorstellungen von ‚Chor‘ befragt, kritisiert etc. Dies wäre also das, was ich als die analytische Aufgabe bezeichnen würde. Um die damit einhergehenden Fragen beantworten zu können, so dass sie auch für eine künftige Leserin nachvollziehbar und von Interesse sind, braucht es zunächst eine detaillierte und präzise Beschreibung dessen, was auf der Ebene des Wahrnehmbaren – also als konkrete Sinnesdaten – verfügbar ist. Gleichzeitig spielt das Wissen um das, was nicht gezeigt wird, aber mit der Verwendung von Chören auf der Bühne einhergeht, eine große Rolle. Es gibt also keine methodische Rezeptur, die anzulegen wäre, weil die Sinnesdaten variabel sind, mit denen wir jeweils arbeiten. Methodisches Vorgehen bei einer analytischen Arbeit besteht meines Erachtens in erster Linie darin, die Sinnesdaten zu sammeln und Kontexte und Korrespondenzen aufzufächern, die sich strukturell miteinander verbinden lassen. FR: Du sprichst davon, dass man ein gewisses Vorwissen benötigt, um bestimmte Elemente im Theater identifizieren und diskutieren zu können – sicherlich auch ein bestimmtes Theatervokabular. Zudem muss man sich in der Modellierung von Theatererfahrung und in der Strukturierung von Wahrnehmung üben, um diese dann für die Analyse einer spezifischen Aufführung ‚justieren‘ zu können. Damit ist ein langwieriger und schwieriger Bildungsprozess verbunden, der in Aufführungsanalyseseminaren seinen Anfang nehmen, aber auf keinen Fall innerhalb dieser Seminare zu einem befriedigenden Ende geführt werden kann. Ein Ende gibt es in diesem Bildungsprozess ja überhaupt nicht. Allerdings gibt es einen Zeitpunkt, zu dem das Meister-Schüler-Verhältnis, das diesem Prozess zugrunde liegt, beendet ist. Dieser Zeitpunkt ist dann gekommen, wenn ich einer Studentin nichts mehr beibringen kann und sie wiederum in der Lage ist, andere in ‚Aufführungsanalyse‘ zu unterrichten. Da stellt sich mir die Frage, ob die Methode der Aufführungsanalyse nicht auch in der Pflege dieses Bildungsprozesses bestehen könnte. Wenn wir uns von der Idee verabschieden, dass der Text das Ziel all unserer Bemühungen ist und annehmen, dass unsere Bemühungen eher darauf gerichtet sein sollten, Menschen theatralogisch zu bilden und zu rüsten, bevor wir sie wieder ins Weltgeschehen entlassen, dann würde sich auch das Problem der Daten nicht in dieser Weise stellen. CW: Das ist wirklich ein faszinierender Gedanke. Ich betreibe seit nunmehr dreißig Jahren Aufführungsanalyse − angefangen in Frankfurt, dann in Gießen, in Mainz
AUFFÜHRUNGSANALYSE UND THEATRALANALYSE
257
und jetzt in Berlin − und alles, was ich darüber weiß, alles, was ich kann, habe ich mir in der auf die Ausbildung der Sinne bezogenen Praxis und im Unterrichten erarbeitet. D. h. alle entsprechenden Bücher haben letzten Endes nur eine Praxis bestätigt, auch Fischer-Lichtes Semiotik des Theaters. Meine eigene konkrete Einführung in die Aufführungsanalyse waren ihre Seminare, in denen wir Studenten sehr praktisch der Frage nachgegangen sind, was wir sehen, wenn wir etwas betrachten, was wir hören, wenn etwas unser Ohr erreicht und wie sich mit dem Wahrgenommenen Konzepte verbinden und Bedeutungszusammenhänge entstehen. Aufführungsanalyse ist für mich durchaus eine Übung in der Wahrnehmung von theatralen und somit ereignishaften Vorgängen oder auch anders ausgedrückt, eine am Theater geschulte Wahrnehmung von als ‚theatral‘ zu bezeichnenden Phänomenen in der Welt. Darüber hinaus ist sie zugleich eine Einübung in Distanz, in die Aufgabe von Erwartungen und Konzepten und eine Schulung des Denkens, das frei schwebend in Bewegung bleibt; idealerweise bei gleichbleibender ‚Liebe‘ zum Gegenstand. Darin zeigt sich für mich auch eine grundsätzlich wichtige ethische Dimension unserer Arbeit, die darin besteht, Wertungen aufzuschieben und anzuerkennen, dass mir etwas gegeben wird, in dessen Herstellung Überlegung und Mühe eingegangen sind. FR: Ich finde es interessant, dass du die freischwebende Aufmerksamkeit ins Spiel bringst. Damit konnotiere ich in erster Linie Freuds Psychoanalyse, die meiner Meinung nach ein interessantes Modell für die Aufführungsanalyse anzubieten hat. In der Psychoanalyse geht es darum, das Unbewusste des Analysanden mit dem Unbewussten der Analytikerin möglichst störungs- aber nicht spannungsfrei kommunizieren zu lassen. Dazu begibt sich die Analytikerin in den Modus der freischwebenden Aufmerksamkeit, die Urteile zuerst einmal suspendiert, um das theatrale Re-Enactment nicht voreilig zu unterbrechen und zu bewerten. Dieses Aufspannen eines theatralen Settings zu analytischen Zwecken teilt sie mit jeder Form der Theatralanalyse, insbesondere dann, wenn diese sich nicht bereits auf ein vorgegebenes theatrales Setting beziehen kann. Wir Theaterwissenschaftler sind ja in der Lage, durch unseren Beobachtungsmodus eine Aufführung oder ein theatrales Setting zu initiieren. Ich kann jede soziale Situation so beschreiben, als ob sie theatral wäre – mit mir als Zuschauer, der andere Akteure beobachtet. Der Prozess der Analyse wird schließlich in Fallberichten erzählt, die jedoch selbst in keiner Form die ursprüngliche Erkenntnis, die sich in beiden Beteiligten ereignet hat, zu ersetzen vermag. Sie zeigt für andere auf etwas, das sich ereignet hat, worüber sich aber nicht vollständig berichten lässt. Dieses Problem kann sich auch bei der Aufführungsanalyse und ihren verschriftlichten Überlegungen stellen. Idealerweise schreiben auch wir interpretative Berichte über etwas, was der Fall war oder uns widerfahren ist und versuchen auf eine Weise auf das vergangene Ereignis zu zeigen, die es unseren Leserinnen erlaubt, unsere Beobachtungen und Deutungen nachzuvollziehen. Hier wie dort entwickeln sich ein Vokabular und Modelle anhand der konkreten Fälle. Zwischen den beiden von mir sicherlich idealisiert dargestellten Analysearten sehe ich aber auch drei wichtige Unterschiede. Während es erstens in der Psycho-
258
CHRISTEL WEILER, FRANK RICHARZ
analyse um das Therapieren eines Anderen geht, verbleibt der Fokus des aufführungsanalytischen Blicks auf dem Verhältnis zwischen mir und einem theatralen Setting. Zweitens ist das theatrale Setting in der Aufführungsanalyse nicht nur Mittel zum Zweck sondern stellt immer ein selbstständiges Objekt der Erkenntnis dar. Drittens versucht die Aufführungsanalyse nicht, Zugang zu einem anderen Unbewussten zu erlangen; sie stellt eher eine ethische, körperlich-geistige Selbstarbeit dar, die mir Zugang zum Ungespürten in einem sozialen Wirkungsfeld verschafft. Mit dem ‚Ungespürten‘ meine ich die Wirkungen von sozialen Machtprozessen, die mir widerfahren und meinen Habitus als eine körperlich-ethische Haltung bearbeiten und verändern, ohne jemals auf einer diskursiven Ebene aufzutauchen. Diesem Ungespürten waren Foucault, Bourdieu und viele andere Sozial- und Machttheoretiker auf der Spur, brachen aber ihre Untersuchungen immer irgendwann ab, weil ihnen der methodische Zugang zu diesem Ungespürten versagt blieb. Ich möchte nun behaupten, dass die Aufführungs- oder Theatralanalyse eben diese Methode ist, die ihnen gefehlt hat. Hier verflicht sich der klassische distanzierte Blick des Analytikers mit einer ästhetischen oder sozialen Erfahrung, die es uns erlaubt, körperlich-ethische Vorgänge an uns selbst zu beobachten. CW: Ich stimme dir grundsätzlich darin zu, dass der am Theater geschulte Wahrnehmungsmodus in anderen Wissenschaften fruchtbar anzuwenden wäre. Dies wäre allerdings immer verbunden mit einer Arbeit am Habitus des jeweiligen Forschers selbst. Und hier beginnen meine Zweifel. Es ist viel leichter zu sagen: Die Aufführung ist zu lang und umständlich, als anzuerkennen, dass der wie auch immer motivierte Wunsch nach einer Pause diesen Eindruck entstehen lässt. Bei allem Reden über Performativität und dem, was dies für die Wissenschaft bedeuten könnte, sind wir immer noch weit davon entfernt, anzuerkennen, dass damit auch eine Veränderung der Forschungspraxis in der Universität einhergehen müsste. Die gegenwärtigen Entwicklungen zeigen zudem in eine völlig andere Richtung. Der Faktor Zeit, den die Einübung in eine Praxis erfordert, verträgt sich kaum mit der Modularisierung des Lehrens und Lernens. Die andere Frage, die sich mit deinen Ausführungen verbindet, ist die Frage nach dem Sinn und Zweck des analytischen Schreibens. Ein wenig erinnert mich das an einen Studenten, der mich fragte, wozu er denn über das Erlebte schreiben soll, wenn er es doch gesehen hat. Das Schreiben bzw. die Verschriftlichung dessen, was ich wahrgenommen, beobachtet, gedacht habe, kann in mehrerlei Hinsicht sinnvoll sein: als Erinnerungsstütze, als Hilfsmittel beim Ordnen der Gedanken, als Möglichkeit, die Komplexität nachvollziehbar zu entfalten, sich selbst Klarheit zu verschaffen, für andere Vergleichsmöglichkeiten und Bezugssysteme anzubieten. Ganz abgesehen davon, dass wir mit allem Geschriebenen ein Archiv konstruieren, über dessen spätere Nutzung wir natürlich nichts sagen können. FR: Ich glaube, dass die Verschriftlichung eine wichtige Praxis der Analyse ist und bleiben wird, weil damit eine Form der distanzierten Reflexion verbunden ist, die Bourdieu als ‚scholé‘ bezeichnet hat. Dabei ist es meiner Meinung nach jedoch wichtig, diese einsame Praxis des schreibenden Reflektierens zu öffnen, einerseits während des Prozesses als Dialog mit anderen Beteiligten und andererseits durch
AUFFÜHRUNGSANALYSE UND THEATRALANALYSE
259
die Strukturierung und Organisation des verschriftlichten und damit gewissermaßen auch stillgestellten Wissens. Wenn du von Archiv sprichst, dann denke ich daran, dass es bis heute noch kein zugängliches Archiv von aufführungsanalytischen Texten gibt, auf das jede neue Generation von Theaterwissenschaftlerinnen zugreifen könnte. Somit bleiben unsere Texte zwar eine Übung für uns selbst, aber sie helfen kaum Anderen bei ihrer Orientierung im Feld, da sie als reine Fallberichte nirgendwo erscheinen. Das Ziel aufführungsanalytischer Arbeit ist meines Erachtens leider immer noch allzu oft der Papierkorb. In der Homöopathie gibt es ein ausdifferenziertes System von Fallberichten, aus denen sich das Wissen dieser Paradisziplin aufbaut, ohne dass jemals eine systematische Theorie entwickelt werden müsste, die alle Fälle zu erklären wüsste. Ein Bekannter von mir arbeitet daran, diesen komplexen Wissensschatz weltweit zugänglich zu machen. Daran sollten wir uns methodisch wie publizistisch ein Beispiel nehmen. CW: Es ist auffällig, dass du zum einen die Psychoanalyse und zum anderen die Homöopathie heranziehst – also zwei Praxisfelder, die unterschiedliche Aspekte des Körpers, der Leiblichkeit und Gesundheit im Fokus und eine ‚Heilung‘ im Sinn haben. Die Fallberichte der Analytiker dienen möglicherweise anderen Analytikern als Hilfe, so wie der umfangreiche Wissensschatz der Homöopathie künftigen Patienten dienlich gemacht werden kann. Wem sollen – analog dazu – die analytischen Fallberichte aus der Welt des Theaters dienlich sein? Künftigen Praktikern wohl kaum oder nur in sehr begrenztem Maße. Vielleicht sind sie zunächst Teil eines Diskurses in der Gegenwart. Hier könnte man natürlich einwenden, dass es sich dabei um l‘art pour l‘art handelt, zumal die wenigsten der künftigen Leser (wenn es denn überhaupt welche geben wird) diese Aufführungen, von denen die Rede ist, gesehen haben werden. Sie müssten also schon mit einem historischen Interesse ausgestattet sein oder mit irgendeiner Art von Interesse, welches ihnen gestattet, das Geschriebene für sich − in welchen Zusammenhängen auch immer − sinnvoll zu finden ohne letzten Endes nur papageienhaft nachzuplappern – zum Beispiel in theaterwissenschaftlichen Prüfungssituationen –, was da geschrieben steht. All diese Befunde stärken natürlich dein Interesse, den Geltungsbereich der Theaterwissenschaft auszuweiten. Sie soll sich wenigstens auch für andere als hilfreich erweisen! Demgegenüber möchte ich doch noch ins Feld führen, dass sich in dem, was wir schreiben, auch unsere unterschiedlichen Arten der Betrachtung zeigen und beispielhaft vorführen lassen. Auf diese Weise können sie sich in anderen Praxisbereichen als möglicherweise nachahmenswerte Herangehensweisen präsentieren. Darüber hinaus sind unsere analytischen Texte immer von einer bestimmten Fragestellung bestimmt, die sich zum Beispiel mit dem Verhältnis des Theaters zur Gesellschaft auseinandersetzen kann. Wir sammeln nicht Wissen als solches, sondern tragen natürlich dazu bei, dass sich ein theater- und kulturwissenschaftlicher Diskurs fortschreibt. Wem dieser von Nutzen ist, können und sollten wir auch nicht festlegen. FR: Der Nutzen einer zeitgenössischen Kulturwissenschaft des Theaters besteht doch schon darin, dass man festhält, was sich gerade um uns herum in unserer Kul-
260
CHRISTEL WEILER, FRANK RICHARZ
tur oder auch in anderen Kulturen abspielt – sofern man so etwas wie Kultur als Entität anerkennt. Das Festhalten von etwas, was der Fall ist, war immer schon ein wichtiges Programm der Wissenschaften. Mittlerweile haben wir jedoch den rein positivistischen Sammeltrieb hinter uns gelassen und die Perspektivierung und Deutung unserer Beobachtungen in den Vordergrund gerückt. In jedem Fall übergeben wir damit an die folgenden Generationen einen Wissensschatz, dessen Nutzen völlig offen ist. Neben dieser nichtpositivistischen Archivbildung, die sich auf ein bestimmtes Kulturobjekt spezialisiert, sehe ich aber noch andere Entwicklungsmöglichkeiten für die aufführungsanalytische Theaterwissenschaft, die unmittelbar mit der Frage zu tun haben, wie diese sich methodisch gestalten könnte. Um meine Forschungsperspektive von der deinen besser unterscheiden zu können, nenne ich meinen Ansatz ‚Theatralanalyse‘ und ich spreche auch nicht mehr von Theaterwissenschaft, sondern von einer Wissenschaft des Theatralen oder Theatralogie. Damit möchte ich in keiner Weise sagen, dass man sich nicht mehr mit dem Kunsttheater auseinandersetzen sollte, sondern nur, dass wir durch die Einbeziehung des Theatralen in unsere Methodik einen Forschungsansatz entwickeln können, der auch nichttheatrale soziale Situationen zu analysieren vermag. Das möchte ich aber nicht anderen Disziplinen überlassen. Es ist eine Kompetenz und Methode, die wir entwickeln und einüben und die wir auch einsetzen können. Ich bezweifle, dass in unserem gegenwärtigen Wissenschaftssystem in anderen Disziplinen ausreichend Zeit und Mühe zur Verfügung stehen, diese Beobachtungsgabe zu trainieren. Aber wer weiß, wohin sich unsere modularisierte Wissenschaftswelt noch entwickelt? Vielleicht geht es irgendwann nicht mehr primär um Forschungsobjekte wie Theater, Musik oder Literatur, sondern nur noch um Kompetenzen und Methoden, die man sich in verschiedenen Modulen aneignen und auf die verschiedensten Objekte anwenden kann. Aber lass mich noch einmal präzisieren, was der Witz meines Ansatzes ist und warum er deinem Ansatz nicht widerspricht. Mir geht es darum, das Theatrale als einen Zugang zu nutzen, um Machtrelationen und -zirkulationen spürbar und damit auch schon live analysierbar zu machen. Dieser Ansatz wählt eine kleine soziale Situation im Hier und Jetzt aus und fragt, was dort mit mir gespielt wird. Die meisten Machtanalysen gehen im Vergleich dazu von großen Sozialstrukturen aus und befragen sie im Nachhinein auf ihre Machtrelationen. Mein Ansatz unterteilt sich noch einmal in zwei Analysemöglichkeiten, die ich mit zwei Figuren erklären möchte. Die eine Figur ist Sherlock Holmes. Wer sich die Arbeits- und Denkweise von Sherlock Holmes vergegenwärtigen möchte, dem empfehle ich die neue BBCVerfilmung von Steven Moffat und Mark Gatiss, die Sherlock – wundervoll gespielt von Benedict Cumberbatch – als zeitgenössische Figur zeichnet, die einen Tatort betritt und in rasendem Tempo alle wichtigen Details wahrnimmt, ordnet und mit weiteren Informationen über sein Smartphone abgleicht, um in Sekundenschnelle eine fertige Analyse liefern zu können. So ähnlich stelle ich mir den idealisierten Theatralanalytiker vor, der sich in eine soziale Situation begibt und blitzschnell erfassen kann, was um ihn herum und mit ihm gespielt wird und wel-
AUFFÜHRUNGSANALYSE UND THEATRALANALYSE
261
che Wirkungen er selbst auf seine Umgebung hat. Das ist natürlich kein wissenschaftlicher Ansatz, kann aber in vielen – vor allem politischen oder anderen brisanten – Sozialsituationen hilfreich und vielleicht sogar entscheidend sein. Daneben gibt es den Ansatz, den ich mit der schon eingeführten Figur Sigmund Freud verbinde. Diese Figur baut aus einer irgendwie gearteten Situation ein theatrales Setting des Als-ob, suspendiert aber ihre Wertungen und verschränkt ihre Kompetenzen in der Erfahrung des Sozialereignisses mit einem distanzierten Blick und einer distanzierenden Verschriftlichungsübung, die es ihr gestattet, die gegebene soziale Situation auf eine viel unpersönlichere, aber vielleicht auch tiefere Weise, zu analysieren und dies auch in geeigneter Weise anderen mitzuteilen. Gerade der letzte Punkt ist ja oft das, woran es Sherlock mangelt und womit er seine Mitmenschen oft zur Weißglut treibt. Wie zum Teufel kommt er auf seine Schlussfolgerungen und was geht nun schon wieder in seinem Kopf vor? Was Freud im Gegensatz zu Sherlock auszeichnet, ist die Reinigung von seinen Vorurteilen und seiner Neunmalklugheit, um für jede neue soziale Situation offen zu sein. In beiden Fällen geht es aber in meinem Ansatz darum, das Soziale einer Situation – ob im Theater oder sonstwo – einzufangen. Das Medium des Sozialen oder das, was du auch Energie genannt hast, nenne ich ‚Macht‘. Ansonsten bin ich mit deinen Ausführungen vollkommen einverstanden und möchte ihnen auch in keiner Weise widersprechen. Ich möchte sie lediglich um eine weitere wichtige Perspektive ergänzen. CW: Ein wenig bist du selbst wie Sherlock! Ich denke, der Unterschied zwischen uns beiden liegt hauptsächlich darin, dass ich lieber ins Theater gehe und mich das Theater der Wirklichkeit oder das, was du soziale Situation nennst nur bedingt interessiert. Wir sind uns immerhin einig darüber, dass man in der Theaterwissenschaft oder meinetwegen auch in der Theatralogie eine Kompetenz erwirbt, die sich in einem bestimmten Wahrnehmungsmodus niederschlägt, dessen Ausbildung Zeit braucht. Die Konsequenz aus dieser Position besteht darin, dass die pädagogische Situation, die sich zwischen Lehrenden und Studierenden abspielt, gegenüber dem Text eine größere Wertigkeit erhält.
JENS ROSELT
Den Augen trauen: Theater und Phänomenologie
Ignorieren und Hinzufügen Als der Sonderforschungsbereich Kulturen des Performativen 1999, im Fin de Siècle des 20. Jahrhunderts, seine Arbeit aufnahm, war ich als Mitarbeiter im Teilprojekt B1 von Erika Fischer-Lichte dabei. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich im Juli 1999 zum ersten Mal vor versammelter Mannschaft, also sämtlichen fachfremden Kollegen im SFB, das Forschungsanliegen von B1 darzustellen hatte. Zu dieser Zeit war die Ästhetik des Performativen, um die es auf dieser Tagung ja im Wesentlichen geht, noch lange nicht geschrieben. Die Rechtschreibprogramme unserer Computer markierten das Wort Performativität noch mit einer gezackten roten Linie als einen Begriff, den es gar nicht gab, und Word stellte uns programmatisch vor die Alternative: ‚Ignorieren‘ oder ‚Hinzufügen‘. Performativität ignorieren oder hinzufügen? Dass diese Entscheidung auch heute noch manchem schwerfällt, zeigt, dass die Forschungsfragen nicht nur einen Nerv der zeitgenössischen Kultur und gerade des Theaters trafen, sondern auch die Achillesferse des wissenschaftlichen Selbstverständnisses bzw. der Selbstrechtfertigungen mancher kulturwissenschaftlich arbeitenden Disziplin. Von der performativen Hervorbringung von Materialität war beispielsweise noch nicht die Rede und selbst die autopoietische feedbackSchleife war nicht nur mir noch kein Begriff. So orientierte sich das Forschungsdesign des Projekts zunächst an zwei begrifflichen Polen, die Textualität und Performativität genannt wurden, womit zum einen die sinnhafte Bedeutungsdimension und zum anderen die sinnliche Erfahrungsdimension von Theater gemeint war. Eben dies hatte ich 1999 den Kollegen anhand eines Beispiels darzustellen. Es handelte sich um ein Aufführungserlebnis, über das wir in der Forschergruppe schon diskutiert hatten, nämlich die Erfahrung eines Zuschauers von der Körperlichkeit eines bestimmten Schauspielers auf der Bühne, an dessen Po man einer Auffälligkeit gewahr werden konnte, eine Art Hautunebenheit. Diese wenig schöne anatomische Besonderheit konnte einen nun in die Zwickmühle versetzen, ob und wie man diese interpretieren könne. Bzw. wie mit der Beobachtung analytisch zu verfahren sei, wenn man ihr keine semantische Relevanz zusprechen sollte. Verdrängen? Vergessen? So tun als sei nichts gewesen? Der Po dieses Schauspielers ist inzwischen in einigen Publikationen des SFB wieder aufgetaucht, doch es geht mir in diesem Zusammenhang nicht um die theoretischen und methodischen Fragen, die an ihm hängen, sondern um die Gesichter meiner nichttheaterwissenschaftlichen Kollegen, in die ich schaute, als ich unser Anliegen schilderte. Denn seit zehn Jahren kann ich immer wieder in solche Gesichter blicken, wenn ich von Performativität und Theater spreche. Die Mimik zeigt im güns-
264
JENS ROSELT
tigsten Falle eine Art vornehmer Belustigung, häufig aber nur Ungläubigkeit oder Verblüffung darüber, womit wir uns beschäftigen. In der anschließenden Diskussion bekam ich dann auch die geballte interdisziplinäre Wucht eines SFB zu spüren, als mir die Kollegen im Anschluss an meine Problemskizze klar machen wollten, dass es aus ihrer Sicht eigentlich gar kein Problem gab. Jeder hatte irgendein Modell parat, um den nackten Po mit Theorie zu verhüllen. Und obwohl inzwischen auch die Ästhetik des Performativen ein Arsenal an Kategorien zur Verfügung stellt (nackte Ärsche beispielsweise haben etwas mit perzeptiver Multistabilität zu tun), scheint mir der springende Punkt des gesamten Unternehmens nicht zu sein, dass man neue Begriffe synthetisiert hat, sondern dass mit der Ästhetik des Performativen ein Wechsel der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit möglich wurde, der eine andere, mitunter quere Perspektive auf vertraute theatrale Phänomene erlaubte und so eine Dimension ästhetischer Erfahrung im Theater auf die Agenda theoretischer und methodischer Reflexion setzte, die nicht nur im wissenschaftlichen Kontext bis dato für unwürdig gehalten wurde. In diesem Sinne war (und wie ich glaube ist) das Projekt einer Ästhetik des Performativen eher eine Suchbewegung als eine Findstrategie. Wenn ich heute die Hunderten von Antrags- und Berichtseiten durchforste und die diversen Beispiele aus dem zeitgenössischen Theater Revue passieren lasse, die wir aufs Korn genommen haben, fällt mir eine Gemeinsamkeit auf. Das Interesse richtet sich bevorzugt auf Aufführungsmomente, in denen wir als Zuschauer einer Situation ausgesetzt waren, die wir als Wissenschaftler strikt zu vermeiden hätten, nämlich die der Krise und Verunsicherung, in der der eigene Status als souveräner Zuschauer oder Beobachter instabil wurde. Es ist m. E. das entscheidende Verdienst der Reformulierung des Aufführungsbegriffs, dass sie diesen Unruheherd heuristisch nicht gelöscht hat, sondern als Hotspot ästhetischer Erfahrung begreift. Im Zentrum dieser Überlegungen steht der Gedanke an die Aufführung als eines kulturellen Prozesses, durch den etwas entsteht und hervorgebracht wird. Dieses Etwas ist nicht nur ein möglicher Sinn, sondern auch ein jemand, nämlich die anwesenden Teilnehmer. Schauspieler und Zuschauer werden durch die Aufführung performativ hervorgebracht. (Das ist jetzt so ein Satz, der Verblüffung erntet, weil er nach Magie usw. klingt. Deshalb möchte ich den Aspekt der kreativen Hervorrufung jetzt weiterverfolgen.) In einer Aufführung passiert etwas zwischen Bühne und Publikum, was weder ausschließlich auf ein Inszenierungskonzept oder eine Aussageabsicht zurückgeführt werden kann noch eine rein subjektive Angelegenheit jedes einzelnen Beteiligten ist. Das Zwischen kann also weder auf eine objektive Ursache reduziert noch als bloß subjektive Wirkung diskriminiert werden, vielmehr wird jede starre Unterscheidung von Subjektivität und Objektivität schwierig. Theater gilt demnach nicht als Verschiebebahnhof vorgefertigter Interpretationen, Meinungen und Eindrücke, sondern als kreativer Ort, an dem Sinn erst entsteht in einem Ereignis zwischen Zuschauern und Bühne. Das bedeutet auch, dass eine Aufführung nicht lediglich die Durchführung eines geprobten und geplanten Programms ist, sondern dass im Vollzug zwischen allen Teilnehmern etwas passieren kann, was das Programm übersteigt oder unterwandert. Es geht damit um den Spielraum, der zwi-
DEN AUGEN TRAUEN
265
schen Akteuren und Zuschauern geschaffen wird und ein unerhörtes Ereignis zwischen Planbarkeit und Spontaneität, Strategie und Anarchie oder Willkür und Freiheit möglich macht. Im Rahmen einer Ästhetik des Performativen kann man sich also nicht darauf beschränken, Wirkintentionen, Aussageansprüche und Interpretationen zu ermitteln, noch wird man sich auf die Akkumulation subjektiver Erfahrungs- und Verhaltensweisen konzentrieren können. Zuschauer müssen nicht dem Programmheft glauben, sondern können ihren eigenen Augen und Ohren trauen. Und es ist merkwürdig, wie misstrauisch viele Zuschauer gegenüber ihren eigenen Wahrnehmungsfähigkeiten sind. Indem Zuschauer ihre Aufmerksamkeit auf etwas richten und sich mit ihren Beobachtungen zugleich selbst in Frage stellen, werden sie von der Aufführung in Anspruch genommen. Was dabei zwischen Bühne und Publikum passiert, kann Dynamiken entfalten, die weder Produzenten noch Rezipienten im Sinn hatten und die eine Aufführung für alle Beteiligten zu einem einzigartigen Ereignis oder einem deprimierenden Desaster machen. Nun habe ich viel von Wahrnehmung und Erfahrung gesprochen (und eine Ästhetik des Performativen ist ohne diese Begriffe bzw. kulturell codierten Vorgänge wohl nicht denkbar). Allzu schnell mag man sich deshalb schon für einen Phänomenologen halten, denn ein vordergründiges Verständnis von Phänomenologie erklärt diese für das rein Subjektive zuständig, während Semiotik und Hermeneutik für die objektiven Fakten verantwortlich sind. Doch die Nähe der Ästhetik des Performativen zur Phänomenologie (die ich im SFB ja untersucht habe) ist weniger begründet durch die Relevanz des nebulös Subjektiven, als vielmehr durch die Tatsache, dass die Phänomenologie Wahrnehmungsvorgänge wie eine Aufführung prinzipiell als Zwischengeschehen begreift, bei dem die kategorische Trennung von subjektiv und objektiv, von Aktion und Passion, von Ich und Wir fragwürdig ist. (Die Tatsache, dass Phänomenologen, die Wahrnehmungsvorgänge analysieren, auch wenn diese sich nicht explizit auf Theater beziehen, auf Theatermetaphorik zurückgreifen (Schauspiel der Sinne) ist ein Indiz für diese Nähe.) Im Folgenden möchte ich kurz skizzieren, wie die Performativität von Aufführungen phänomenologisch gefasst werden kann. Der Leitgedanke dabei lautet: Zuschauer werden von einer Aufführung in Anspruch genommen, indem sie diese in Frage stellen. Um dies zu erläutern, werde ich mich auf vier Kategorien beziehen, die ich im Wesentlichen der Phänomenologie Bernhard Waldenfels’ entnehme: Intentionalität und Responsivität sowie Dialog und Fremdheit.
Intentionalität Wenn man einen anderen Menschen sieht oder seine Stimme hört, wenn man einen Gegenstand anschaut oder in eine Landschaft blickt, wenn man ein Geschehen beobachtet oder einer Melodie lauscht, kurz, wenn man sich etwas oder jemandem zuwendet, wird damit eine Relation hergestellt und vollzogen. Diese Gerichtetheit mentaler Einstellungen wird als Intentionalität bezeichnet. Sie ist nicht nur auf Wahrnehmungsvorgänge bezogen, sondern kennzeichnet jede Form, in der etwas
266
JENS ROSELT
ins Bewusstsein tritt, also auch in der Phantasie, der Vorstellung und der Erinnerung. Dabei geht es nicht nur um die Tatsache, dass man sein Bewusstsein auf etwas richtet, sondern auch um die spezifische Art und Weise, in der man das tut. Unter Intentionalität ist also zu verstehen, dass sich ein Ich zur Welt öffnet und sich in Bezug auf diese erst entwirft. Auf die Aufführungssituation übertragen bedeutet dies z. B., dass sich Zuschauer in Hinblick auf das, was ihnen von der Bühne entgegenkommt, entwerfen. Damit ist ein gewaltiger Anspruch verbunden. Ich entwerfe mich in Hinblick auf Medea oder auf den Po eines Schauspielers. Aus der Perspektive der eigenen Intentionen bleibt man also nie bei sich, man überantwortet sich, wobei das gesamte Register affektiver Betroffenheit aktiviert werden kann. Jean-Paul Sartre hat Intentionalität deshalb als eine Figur der Überschreitung beschrieben: „[...] diese Überschreitung des Bewußtseins durch sich selbst, die man ‚Intentionalität‘ nennt, findet sich in der Furcht, dem Haß und der Liebe wieder.“1 Der Begriff Intentionalität meint also den grundsätzlichen Bezug dessen, was wir wahrnehmen, zu dem, wie wir es wahrnehmen, phänomenologisch gesprochen: die Verklammerung von Seinsgehalt und Zugangsart. Indem das Bewusstsein stets Bewusstsein von etwas ist, also nicht als Substanz, sondern „nur als Bezug auf die Welt existiert“2, kann dieses Zentrum der Subjektivität nicht mehr als pure Privatsphäre deklariert werden, denn, so Waldenfels: „Indem jemand etwas erlebt oder erfährt, ist er in sich selbst bei anderen, ist er außer sich, überschreitet sich selbst.“3 Doch dieses Etwas ist kein roher Wahrnehmungsstoff, keine pure Flut von Sinnesdaten, sondern es erscheint stets ‚als‘ etwas, und das heißt allgemein gesprochen „in einer bestimmten Gestalt, Struktur oder Symbolik, in einem bestimmten Sinn, in einer bestimmten Auffassung, Auslegung oder Deutung“4. Wenn man Intentionalität als „allgemeine Grundeigenschaft des Bewusstseins“5 jedem Akt der Erfahrung, der Wahrnehmung, der Erinnerung und der Fantasie unterstellt, ergibt sich damit allerdings auch die Frage, wie die Konfrontation mit Neuem oder Unbekanntem zu denken wäre. Denn wenn zutrifft, dass man in der Wahrnehmung stets etwas als etwas wahrnimmt, wäre doch jede Wahrnehmung eine Art Wiedererkennung, die ein Etwas dem Bekannten zuordnet. Und genau dies scheint angesichts ästhetischer Vorgänge im Theater problematisch zu werden. Das gilt insbesondere dann, wenn das wahrgenommene Etwas ein Jemand ist, also ein Mensch, ein Gegenüber, ein Anderer oder auch nur ein Teil von ihm. Der Andere wäre damit immer schon durch das Eigene kolonisiert und die Erfahrung radikaler Fremdheit wäre unmöglich. Phänomenologen haben deshalb im1 Jean-Paul Sartre, „Eine fundamentale Idee der Phänomenologie Husserls: die Intentionalität“, in: ders., Die Transzendenz des Ego, Reinbek b. H.: Rowohlt 1997, S. 33-38, hier: S. 36. 2 Jean-François Lyotard, Die Phänomenologie, Hamburg: Junius 1993, S. 11. 3 Bernhard Waldenfels, Einführung in die Phänomenologie, München: Wilhelm Fink 1992, S. 16. 4 Bernhard Waldenfels, Sinnesschwellen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1999, S. 37. 5 Edmund Husserl, Cartesianische Meditationen, in: ders. Gesammelte Schriften 8, Hamburg: Meiner 1992, S. 1-161, hier: S. 35.
DEN AUGEN TRAUEN
267
mer wieder gefragt, wie man den Bannkreis intentionaler Allmacht zerschlagen kann. Bei Waldenfels heißt es dazu: „Gewiß kann der Andere betrachtet und behandelt werden als ein Wesen, das bestimmte Reaktionen erwarten läßt und ausführen soll; doch bei all dem bleibt er eine ständige Quelle der Überraschung, bietet und verlangt mehr, als ich im voraus gegenwärtigen kann; er sprengt den Rahmen, den ich ihm vorhalte.“6 Dem intentionalen Elan, mit dem sich der Phänomenologe ‚zu den Sachen selbst‘ wendet, begegnet so ein Anspruch, der von den Sachen selbst ausgeht, der mir und meinen Erwartungen zuvorkommt, mich stört, überrascht oder aus der Bahn wirft. Mit anderen Worten: Unsere Intentionen haben Antwortcharakter, sie antworten auf einen fremden Anspruch. Die Kritik an der Intentionalität führt so zu einem Verständnis von Bewusstseinsvorgängen, bei dem Responsivität ein notwendiges Komplement intentionaler Gerichtetheit ist.
Responsivität Response heißt Antwort. Von Antwort kann nur die Rede sein, wenn es eine Frage gibt, auf die sich die Antwort bezieht. Das Wechselspiel von Bühne und Publikum wäre in diesem Sinne ein Hin und Her von Fragen und Antworten. Damit wird der Dialog zum Modell für Erfahrungsprozesse, die sich zwischen den Teilnehmern ereignen. Wenn man das Zwischengeschehen einer Aufführung als Dialog auffasst, ist deren Ereignischarakter dadurch bedingt, dass keiner der Dialogpartner die volle Verfügungsgewalt über den Verlauf hat, und dieser so quasi eigenmächtig seinen Fortgang zu nehmen vermag. Ein Dialog ist nämlich nicht als filigrane oder virtuose Kombination von Monologen zu denken. Die einzelnen Repliken der Sprecher sind nicht die Voraussetzung für das Zustandekommen des Dialogs, sie gehen vielmehr selbst gleichursprünglich aus dem Zwischenereignis hervor. Insofern ist der Dialog eine Provokation, die etwas hervorrufen kann, was vorher nicht niedergelegt oder vorgeschrieben war. Als Kommunikationsakt ist der Dialog durchaus auf die Bewusstseinsvorgänge der Sprecher zu beziehen, d. h. auch Dialoge sind von Intentionen durchzogen, doch als Zwischengeschehen können sie nicht auf „subjektive Gesprächsstrategien“7 reduziert werden. Als Zwischengeschehen kommt der Dialog nicht zur Ruhe, indem die Frageintentionen erfüllt werden; stattdessen wird eine Art Unruhe gestiftet, die sich als „Eröffnung von Möglichkeiten“8 erweisen mag, mit der weder der Fragende noch der Antwortende gerechnet haben dürfte. Zwischen Frage und Antwort klafft eine Lücke, in der Unvorhersehbares und Unordentliches einen kreativen Spielraum finden. 6 Bernhard Waldenfels, Das Zwischenreich des Dialogs. Sozialphilosophische Untersuchungen in Anschluss an Edmund Husserl, Den Haag: Nijhoff 1971, S. 48. 7 Bernhard Waldenfels, Antwortregister, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1994, S. 187. 8 Ebd., S. 187.
268
JENS ROSELT
In diesem Sinne provoziert eine Theateraufführung bei ihren Zuschauern permanent Fragen, ohne dass diese explizit verbalisiert werden müssen. Markante Aufführungserlebnisse finden gerade in der Fraglichkeit ihren Ausgangspunkt, von dem aus etwas entdeckt werden kann, was vorher nicht vermisst wurde. Um solche Aufführungssituationen zu beschreiben, sollte man nicht von der Intentionalität ausgehen, sondern von der Responsivität. Die Auseinandersetzung mit einer Aufführung wird damit anstatt von der Frage von der Antwort her konzipiert. Die Leitfrage lautet dann nicht: „Was soll das?“, sondern: „Worauf antworten wir, wenn wir etwas erfahren, sagen oder tun?“9 Responsivität heißt also, dass Fragen nicht als quasi eigenständige Akte des kritischen Bewusstseins entspringen, sondern dass sie selbst immer schon Antworten sind. Das Interesse liegt nach dieser Wende weniger auf der richtigen oder passenden Antwort der Frage, sondern darauf, worauf mit der Frage geantwortet wurde. Wenn Responsivität zu einem „generellen Grundzug“10 jeden Verhaltens ausgerufen werden kann, impliziert dies, dass das dialogische Modell von Frage und Antwort nicht nur auf Akte verbal-sprachlicher Kommunikation beziehbar sein muss, sondern auch außersprachliche Akte und Handlungen in das dialogische Schema eingepasst werden können. Damit kann auch dann vom Antworten die Rede sein, wenn man „hinsieht und hinhört und jemandem oder einer Sache Aufmerksamkeit schenkt“11. Frage und Antwort sind nicht durch ein „vorgängiges Ziel-, Sinn- oder Kausalkontinuum“12 miteinander verlötet. Zwischen Frage und Antwort bleibt stets ein Graben: die Frage provoziert eine Antwort, die ihr nicht zu Gebote steht, und die Antwort geht auf einen Anspruch ein, der ihr nicht zu eigen ist. In einem dialogischen Zwischengeschehen, das von der Responsivität her konzipiert ist, wird dieser Graben nicht geschlossen, sondern übersprungen; darin besteht der Ereignischarakter sowohl des Fragens als auch des Antwortens.13 In diesem Zwischengeschehen werden nicht nur „vorhandene Überzeugungen und Wünsche“14 zum Ausdruck gebracht, sondern es entsteht etwas „in der Verlautbarung selbst, so daß Sprecher oder Schreiber nicht weniger davon überrascht sind als Hörer oder Leser“15. Die intentionale Gerichtetheit des Ich hat einen Zielpunkt, der im positiven Sinne erreicht werden kann, womit das Streben zu einer Art Erfüllung kommt. Responsivität hingegen ist nicht als zielgerichtetes Tun zu begreifen, sondern setzt an der Unerfülltheit, also dem Mangel, der Störung oder dem Ungenügen ein, das mit dem Gewahrwerden eines fremden Anspruchs einsetzt. 9 10 11 12 13 14 15
Ebd., S. 188. Ebd., S. 324. Bernhard Waldenfels, Grenzen der Normalisierung, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1998, S. 95. Ebd., S. 194. Vgl. ebd., S. 334f. Ebd., S. 340. Ebd.
DEN AUGEN TRAUEN
269
Mit der Responsivität kommt eine Erfahrungsweise ins Spiel, die eben nicht beim Ich seinen Ausgang nimmt, sondern im fremden Anspruch ein Initial hat, auf den es zu antworten gilt. Damit entzieht sich das Zwischengeschehen der Kontrolle und Planbarkeit des Ich. Selbst der eigenen Antwort kann man sich nicht enthalten. Wer sich weigert, auf einen fremden Anspruch einzugehen, ist eben dadurch schon auf ihn eingegangen. Wer verstummt, die Augen und die Ohren schließt oder sich sonst wie abwendet, zeigt sich immer schon vom fremden Anspruch getroffen. Wenn die eigene Antwort beim fremden Anspruch beginnt, gibt der Antwortende etwas, was nicht schon fertig parat liegt, sondern im Antworten erst gefunden wird, mithin entstehen kann. Aus dieser Asymmetrie kann abgeleitet werden, „daß im Antworten nicht bloß ein bereits existierender Sinn wiedergegeben oder vervollständigt wird, sondern daß im Gegenteil Sinn im Antworten selbst entsteht“16. Für die Auseinandersetzung mit einer Aufführung bedeutet dies, dass der Zuschauer aus der Prüfungssituation entlassen wird, in der er sich angesichts der eigenen Erfahrung und Wahrnehmung stets zu fragen hat, ob das, was er gerade sieht und erlebt, denn richtig oder falsch ist. Fragen wie ‚Was wollte der Regisseur mir damit sagen?‘ oder ‚Was soll das?‘, werden in den Fundus einer Werkästhetik gestellt und machen Platz für die Thematisierung der eigenen Antwort, der wiederum eine Frage vorgelegt wird, die Zuschauer jedoch an sich selbst richten: ‚Was nehme ich wahr bzw. was erfahre ich, dass ich so und nicht anders antworte?‘ Damit wird nicht in Abrede gestellt, dass es Wirkungs- und Aussageabsichten gibt, wohl aber wird behauptet, dass Zuschauer nicht lediglich als Erfüllungsgehilfen fremder Intentionen in der Aufführung gefragt sind.
Fremdheit Aus dem Blickwinkel der Responsivität ist die Privatsphäre der eigenen Erfahrung immer schon verletzt durch den Anspruch, auf den man antwortet. Dieser muss nicht notwendig explizit als verbale Frage erhoben werden, denn auch impliziter Weise kann die Anwesenheit von Dingen und anderen Menschen, ihren Körpern und Bewegungen, einen in Anspruch nehmen. Dieses Andere am Gegenüber wird in der Phänomenologie häufig auf die Kategorie der Fremdheit bezogen. Als Paradigma dessen, was einem passieren und sich ereignen kann, wird das Fremde zum Schlüsselbegriff einer Phänomenologie der Erfahrung. Dabei bleibt das Dialogmodell der entscheidende Anker der Theorie: „Dialogisch gesprochen erscheint das Fremde als jenes, worauf wir antworten, wenn wir etwas sagen und tun.“17 Es meldet sich „in Form von Aufforderung, Provokation, Stimulation und Anspruch“18.
16 Ebd., S. 53. 17 Bernhard Waldenfels, Topographie des Fremden, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1997, S. 77. 18 Ebd., S. 164.
270
JENS ROSELT
Bevor man auf das Fremde zeigen kann, es sinnlich einzukreisen und sprachlich zu begreifen vermag oder es gar definitorisch dingfest machen kann, ist man bereits vom fremden Anspruch getroffen, der sich schockartig als Beunruhigung oder Störung geltend macht. So bleibt stets ein Residuum der Unbestimmtheit, Vagheit und des Provisorischen, welches Fremd- und Selbsterfahrung durchzieht: „Was Eigenes und Fremdes ist, bestimmt sich im Ereignis des Antwortens und nirgends sonst, d. h. es bestimmt sich niemals völlig.“19 Vom Zwischengeschehen der Erfahrung ausgehend kann deshalb gelten, dass das Fremde überhaupt kein Etwas ist, das positiv bezeichnet werden könnte. Das Fremde hat keinen Namen und keine Anschrift und doch ist es stets gegenwärtig, wenn man etwas erlebt und von seiner Erfahrung Auskunft gibt: „Das, wovon unser Reden und Sagen ausgeht, läßt sich nicht aussagen als etwas, das vorliegt, es kann sich nur zeigen in unserem Sagen und Tun; es ist angewiesen auf eine indirekte Rede- und Mitteilungsweise, die dem Schweigen verbunden bleibt.“20 Radikal gesprochen steht Fremdheit außerhalb der Ordnungsmuster und Regelungskompetenzen: „Die Aufforderung des Fremden hat keinen Sinn, und sie folgt keiner Regel, vielmehr provoziert sie Sinn, indem sie vorhandene Sinnbezüge stört und Regelsysteme sprengt.“21 Eine entscheidende Konsequenz dieser Konzeption von Erfahrung ist, dass diese nicht als Hort des Unteilbaren und Persönlichen bewahrt werden kann. Das Eigene kann gewissermaßen aus der Geborgenheit des Bekannten und Vertrauten herausfallen: „Die Erfahrung des Fremden impliziert ein Fremdwerden der eigenen Erfahrung, da diese im Zusammenstoß mit dem Fremden ihre Selbstverständlichkeit einbüßt.“22 Überraschung oder gar Schock gelten so nicht nur dem Fremden gegenüber, sondern auch angesichts der eigenen Antwort. Die Verklammerung von Fremd- und Selbsterfahrung, die im Gewahrwerden einer „Fremdheit in uns selbst“23 kulminiert, vermag so eine kathartische Dimension einzunehmen, bei der die toten Winkel im eigenen Selbstverständnis plötzlich in die Perspektive geraten. Eigenes und Fremdes können nie als autonome Pole reklamiert werden. Es handelt sich bei ihnen nicht um abgeschlossene und versiegelte Wertigkeiten, sondern sie öffnen sich, bewegen sich aufeinander zu und stoßen sich ab, ohne dass es zu einer fixierten Begegnung käme. Diese Zwischensphäre einer offenen Begegnung lässt sich auch als Schwelle auffassen, die damit „als Ort des Fremden par excellence“24 firmiert. Markante Momente sind so auch als Schwellenerfahrungen zu charakterisieren. Eine Leistung von Zuschauern ist es, Schwellensituationen zu ertragen, auszuhalten und so den fragilen Unterschied zwischen Beherrschung des Fremden und Infragestellung des Eigenen zu genießen.
19 20 21 22 23 24
Ebd., S. 109. Ebd., S. 121f. Ebd., S. 52. Ebd., S. 43. Ebd., S. 84. Ebd.
DEN AUGEN TRAUEN
271
Es mag zwar falsche Interpretationen geben, aber keine falschen Erfahrungen. Man kann nach dem Besuch einer Aufführung zwar beteuern, man habe nichts verstanden, aber man kann nicht behaupten, man habe nichts gesehen, gehört oder erfahren. Selbst wenn wir hartnäckig betonen, eine Aufführung nicht gemocht oder nicht ‚richtig‘ gesehen zu haben, dürften wir doch ad hoc in der Lage sein, Augenblicke zu erinnern, die uns auffielen, ohne einen Sinn ergeben zu haben, oder die uns schlichtweg fremd waren. Sich dieser Fremdheit der eigenen Erfahrung nicht zu verschließen und sich einem „Zustand der Instabilität“25 auszusetzen, kann unsere Leistung oder Performance als Zuschauer sein. In letzter Konsequenz bedeutet der Satz ‚Ich mache eine Erfahrung‘ damit auch ‚Die Erfahrung macht mich‘. Das bedeutet, das Ich ist nicht die Voraussetzung einer Erfahrung, sondern geht in seiner aktuellen Verfasstheit erst aus dieser hervor. In Hinblick auf die Erfahrungssituation von Theateraufführungen ist deshalb zu formulieren, dass Zuschauer nicht die Voraussetzung von Aufführungen sind, sondern als solche erst durch die Aufführung gemacht werden. Das bedeutet, dass ein Publikum mehr und anderes ist als die Summe seiner einzelnen Zuschauerinnen und Zuschauer. Rezeption im Theater ist nicht nur ein Phänomen der individuellen Wahrnehmung, sondern auch eines von kollektiver Erfahrung. Als soziales Ereignis stiften Aufführungen eigenwillige Formen der Gemeinschaft. Im Laufe einer Aufführung kann ein Publikum dynamische Veränderungen durchlaufen, in denen jeder Einzelne über sich hinauszuwachsen vermag. Das bedeutet, dass man im Theater Wir-Erfahrungen machen kann, die sich nicht auf Einzelerlebnisse reduzieren lassen. Diese Wir-Erlebnisse im Theater sind in der spezifischen Wahrnehmungssituation von Aufführungen begründet. Wir erblicken den Schauspieler auf der Bühne, wir verfolgen seine Handlungen und hören seine Stimme. Diese Wahrnehmung der Zuschauer ist nicht nur ein individueller Vorgang, sondern wird gleichzeitig mit anderen vollzogen; Wahrnehmung in Aufführungen ist in diesem Sinne auch eine chorische Prozedur. Knalleffekte können diese Dimension explizit machen, etwa wenn auf der Bühne unerwartet eine Pistole abgefeuert wird. Alle fahren erschrocken zusammen: Der Schuss auf der Bühne lässt einen Ruck durch die Reihen gehen und motiviert so ein ‚Wir‘ im Publikum. Dabei ist der eigene Schrecken zugleich auch der der anderen. Unmittelbar nach dem kollektiven Zucken im Parkett mag sich dieses ‚Wir‘ schon wieder auflösen: Einige Zuschauer lachen, manche schütteln mit dem Kopf, andere tuscheln mit dem Nachbarn oder versuchen, sich nichts anmerken zu lassen. Gemeinschaftserfahrung im Theater muss also nicht in erster Linie auf intellektueller Übereinkunft beruhen, sondern vollzieht sich als körperliches Miteinander. Eine besonders virtuose Leistung vollbringt das ‚Wir‘ beim Applaus, der eine eigene Form von Dynamik entfalten kann. Auch die temporäre Applausgemeinschaft 25 Erika Fischer-Lichte, „Rhythmus als Organisationsprinzip von Aufführungen“, in: Aus dem Takt. Rhythmus in Kunst, Kultur und Natur, hg. v. Christa Brüstle/Nadia Ghattas/Clemens Risi/Sabine Schouten, Bielefeld: transcript 2005, S. 235-247, hier: S. 246.
272
JENS ROSELT
muss nicht darin begründet sein, dass alle Teilhabenden der gleichen Meinung sind. Buh- und Bravochöre können nicht nur die Sänger auf der Bühne, sondern auch sich gegenseitig hervorrufen. Es kann eine markante Erfahrung von Sozialität im Theater sein, dass man in individueller Differenz gemeinsam handelt, nämlich den Applaus produziert. Auch spontaner Szenenapplaus erweist sich als interessantes Indiz für die Emergenz des Sozialen im Theater. Szenenapplaus kommt ja nicht dadurch zustande, dass ein einzelner Zuschauer die individuelle Entscheidung trifft, der Szene zu applaudieren, und im Vollzug seines Beifalls gewissermaßen überrascht wird von der Tatsache, dass die übrigen 600 Zuschauer offenbar denselben Gedanken hatten. Die Entscheidung zum Szenenapplaus fällt nicht jeder für sich, sondern jeder für den anderen. Es handelt sich um einen gemeinsam kreierten Impuls, der nicht auf die Eigenverantwortung reduziert werden kann. Dieser Applaus ist nicht die Summe einzelnen Klatschens, die sekundär als Beifall addiert wird, sondern wird ursprünglich zwischen den Zuschauern gestiftet. Als soziales Phänomen kann Applaus ebenso ansteckend sein wie man es sonst vom Lachen zu sagen pflegt. Ein solches Verhältnis, das durch Ansteckung zustande kommt, sieht Sartre durch das Prinzip der Serie gekennzeichnet, da „in der Serie jeder durch alle anderen bedingt ist, aber in Exteriorität; Wechselverhältnisse und einseitige Beziehungen sind ausgeschlossen, alles, was von einem zum anderen und so zu allen übergeht, scheint sich mechanisch zu übertragen wie eine Wellenbewegung“26. Dabei bildet sich ein Kollektiv, „das seriell wahrnimmt, empfindet und denkt, d. h. nach der Kategorie der Äußerlichkeit“27. Auf die Theateraufführung bezogen kann man also sagen, dass einzelne Zuschauer ein Publikum bilden, indem sie sich serialisieren. Aber auch hier macht sich eine responsive Dimension von Erfahrungen geltend, wenn die Nähe der Sitznachbarn oder ihr Verhalten als unangebracht angesehen wird: Man fühlt sich deplatziert und gehört doch dazu. In gewisser Weise sind Zuschauer im Theater Doppelwesen. Sie machen eigene Erfahrungen und werden damit zugleich Teil einer Gemeinschaft, die sie sich nicht unbedingt ausgesucht haben, die sie im Einzelnen nicht kennen und mit der sie doch als deren konstitutiver Teil gemeinsame Lebenszeit verbringen. Die Gemeinschaft des Publikums ist auch in diesem Sinne nicht schlicht als Gruppe einzelner Individuen zu denken. Die Gemeinschaft integriert nicht nur Individuen, sondern stellt zugleich in Frage, was diese als solche überhaupt auszeichnet. Als Teil der Gemeinschaft des Publikums gibt man etwas von sich oder droht es zu verlieren. Die Teilnahme geht einher mit Formen der Enteignung, indem man auf Handlungsvollmacht, Entscheidungsfreiheit und – im Theater insbesondere – auf Bewegungsfreiheit Verzicht leistet. Wer diese Enteignungen als unangenehm empfindet, kann sich seine Freiheit jederzeit zurückholen, doch bedarf es hierzu eines expliziten Aktes, der ihn zumindest zeitweise separiert, wie beispielsweise der Zwischenruf. Die26 Jean-Paul Sartre, Der Idiot der Familie. Gustave Flaubert 1821-1857. Zweiter Teil: Die Personalisation, Reinbek b. H.: Rowohlt 1986, S. 179. 27 Ebd., S. 180.
DEN AUGEN TRAUEN
273
ser ist insofern aufschlussreich, als durch ihn der Zuschauer als Doppelwesen in Erscheinung tritt. Der Zwischenrufer mag zwar im Dunkel des Saales verborgen bleiben, doch ist er zumindest qua Stimme indexikalisiert. Insofern hier jemand ruft, der eine Meinung hat bzw. mitteilt, handelt es sich um einen Akt der Dissidenz, auch wenn er davon ausgehen mag, die Meinung der Übrigen zu vertreten. Ein Zwischenruf kann trotzdem nicht auf die quasi persönliche Mitteilung eines einzelnen Zuschauers reduziert werden, die sekundär als eine Art Nebeneffekt auch vom Auditorium vernommen wird. Dass ein Zwischenruf überhaupt hervorgerufen wird, ist primär der sozialen Situation der Aufführung geschuldet und nicht der intellektuellen Disposition des individuellen Zuschauers. Eine Theorie der Aufführung, die diese als dialogisches Zwischengeschehen begreift, fragt nicht nur danach, was im Laufe des Theaterereignisses zwischen den Teilnehmern passiert, sondern wie hier etwas ursprünglich entsteht. Sowohl die Zuschauer im Parkett als auch die Figuren auf der Bühne werden in diesem Sinne performativ hervorgebracht. Den Wahrnehmungs- und Erfahrungsweisen der Zuschauer kommt damit eine produktive Dimension zu. Zuschauer werden von Aufführungen in Anspruch genommen, indem sie diese in Frage stellen. Jeder einzelne von ihnen wie auch die Gruppe des Publikums übernimmt somit Verantwortung für das, was im Theater passiert. Doch auch hierbei gilt, dass Zuschauer der Aufführung nicht fix und fertig gegenübertreten, sondern dass sie als solche aus ihr hervorgehen und mit ihr vergehen. Mit anderen Worten: Worum es in einer Aufführung geht, entscheidet sich erst in und durch die Aufführung.
Literaturverzeichnis Fischer-Lichte, Erika, „Rhythmus als Organisationsprinzip von Aufführungen“, in: Aus dem Takt. Rhythmus in Kunst, Kultur und Natur, hg. v. Christa Brüstle/Nadia Ghattas/Clemens Risi/Sabine Schouten, Bielefeld: transcript 2005, S. 235-247. Husserl, Edmund, Cartesianische Meditationen, in: ders. Gesammelte Schriften 8, Hamburg: Meiner 1992, S. 1-161. Lyotard, Jean-François, Die Phänomenologie, Hamburg: Junius 1993. Sartre, Jean-Paul, Der Idiot der Familie. Gustave Flaubert 1821-1857. Zweiter Teil: Die Personalisation, Reinbek b. H.: Rowohlt 1986. —, „Eine fundamentale Idee der Phänomenologie Husserls: die Intentionalität“, in: ders., Die Transzendenz des Ego, Reinbek b. H.: Rowohlt 1997, S. 33-38. Waldenfels, Bernhard: Antwortregister, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1994. —, Das Zwischenreich des Dialogs. Sozialphilosophische Untersuchungen in Anschluss an Edmund Husserl, Den Haag: Nijhoff 1971. —, Einführung in die Phänomenologie, München: Wilhelm Fink 1992. —, Grenzen der Normalisierung, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1998. —, Sinnesschwellen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1999. —, Topographie des Fremden, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1997.
VIKTORIA TKACZYK
Theater und Wortgedächtnis. Eine Spurensuche nach der Gegenwart
Seit Mai 2007 tourt die britisch-deutsche Performancegruppe Gob Squad mit ihrer Produktion Kitchen (You’ve Never Had It So Good). Die Produktion basiert auf Andy Warhols Film Kitchen. Weil dieser jedoch angeblich verschollen ist, stellen ihn vier Performer der Gruppe auf der Grundlage des Filmskripts von Ronald Tavel nach und projizieren das Ergebnis live in den Zuschauerraum. Dabei zielt das Projekt weniger auf ein möglichst authentisch wirkendes Reenactment von Kitchen. Vielmehr erwecken die Performer den Anschein, sie selbst befänden sich nun in der Küche des Filmtechnikers Bud Wirtschafter, in der Warhol den Film 1965 gedreht hatte. In der Ankündigung der Produktion heißt es über Warhols Film: „Nothing much happens in the film yet it somehow encapsulates the hedonistic experimental energy of the swinging sixties. Learning lines was considered ‚old fashioned‘ so the actors just hang around.“1 Während man im Avantgardefilm der 1960er Jahre bevorzugte, den Text nicht auswendig zu lernen, sondern frei zu improvisieren, scheint dies Gob Squad mittlerweile aber fast schon eine unzeitgemäße Praxis zu sein. Neben der spontanen Improvisation einzelner Szenen lernen die Performer ihren Text stellenweise doch wieder auswendig. Sie vermeiden es allerdings, die memorierten Passagen dann auch selbst zu sprechen. Stattdessen verlassen sie nach und nach das Film-Setting, um sich vor die Leinwand ins Publikum zu setzen. Unter den Zuschauern wählt sich dann jeder Darsteller ein Double aus, das ihn in der Küchensituation hinter der Leinwand vertritt und dem er per Kopfhörer seinen Part live souffliert. Damit wenden die Performer von Gob Squad teilweise wieder eine Mnemotechnik an, die man in der Gedächtnisforschung als ‚Wortgedächtnis‘ bezeichnet und die dem wortwörtlichen Auswendiglernen eines vorab schriftlich fixierten Textes dient. Die in die Küche entsandten Doubles hingegen arbeiten mit einer Technik, die man in der Kognitionswissenschaft das ‚Echogedächtnis‘ nennt: Auditive Informationen werden für 4 bis 18 Sekunden im Gedächtnis behalten, um einmal laut wiederholt und anschließend wieder vergessen zu werden.2
1 Nähere Informationen zu Gob Squads Produktion Kitchen und ein Demo-Video unter: http://www.gobsquad.com/projects/gob-squads-kitchen-youve-never-had-it-so-good (Stand: 2.3.2012). 2 Geprägt wurde der Begriff des ‚Echoischen Gedächtnisses‘ ursprünglich durch Ulrich Neisser, Cognitive Psychology, New York: Appleton-Century-Crofts 1967.
276
VIKTORIA TKACZYK
In Gob Squads Kitchen verlässt das Wortgedächtnis demnach gemeinsam mit den Performern den Platz hinter der Leinwand, nimmt im Zuschauerraum Platz und überlässt dem Echogedächtnis die Bühne. Auf ähnliche Weise verfuhr Gob Squad bereits in der Produktion Prater-Saga 3. In diesem Kiez ist der Teufel eine Goldmine (UA 2004). Hier waren es Passanten, die auf den Straßen im Umkreis des Berliner Praters (Spielstätte der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz) angesprochen und dazu eingeladen wurden, die Performer auf der Bühne zu vertreten. Über Kopfhörer wurde auch ihnen der jeweils zu sprechende Part, diesmal auf Grundlage eines von René Pollesch verfassten Dramas, souffliert.3 Bereits 2002 hatte die Gruppe Rimini Protokoll ebenfalls eine vergleichbare Technik angewandt: In der Produktion Deutschland 2 ist 237 Laiendarstellern in der Schauspielhalle Bonn Beuel per Funk die Bundestagsdebatte ins Ohr geflüstert worden. Auch diese Darsteller bedienten sich ihres Echogedächtnisses, um die Debatte in der Schauspielhalle nur wenige Sekunden später nachzusprechen.4 Die alleinige Präsenz des Echogedächtnisses und der damit jeweils verbundene, gekonnt inszenierte Abgang des Wortgedächtnisses von der Bühne in den genannten Produktionen lädt dazu ein, den Stellenwert des wortwörtlichen Memorierens in Gegenwartstheater und Performancekunst genauer in den Blick zu nehmen: In der Theatergeschichte hat das Auswendiglernen und Rezitieren eine lange Tradition; und auch in aktuellen, eher klassischen Theateraufführungen memorieren Schauspieler die Textgrundlage nach wie vor wörtlich. Doch um was für eine Wissens- und Mnemotechnik handelt es sich dabei eigentlich? Erstaunlicherweise ist diese Frage bislang kaum gestellt worden. Ich möchte daher zunächst einige Überlegungen dazu anstellen, weshalb sich die Theaterwissenschaft bislang so wenig für das Wortgedächtnis interessiert hat und es nun ex negativo in der Performancekunst zum Thema wird. Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, sind es drei heute höchst bedeutsame Diskursstränge der jüngeren Theaterund Kulturwissenschaft, die diese Mnemo- und Wissenstechnik aus dem Blick geraten ließen: a.) Zunächst ist hier eine stark an der Derrida’schen Dekonstruktion orientierte Forschung zu nennen, die sich für das Verhältnis von Sprechakt und Sprachdynamik interessiert, aber weniger für die physischen Ermöglichungsbedingungen des Sprechens auf der Bühne (und zu diesen Bedingungen gehört ja das Wortgedächtnis). b.) Beim zweiten Diskursstrang handelt es sich um die gegenwärtig viel diskutierte Ästhetik des Performativen (Erika Fischer-Lichte), die sich insbesondere dafür interessiert, was sich in der Aufführung zwischen Akteuren und Zuschauern ereignet. Das Wortgedächtnis des Schauspielers ist vordergründig weniger auf diesen Prozess bezogen. Seine Untersuchung gehört zuallererst in den Kontext einer Pro3 Nähere Informationen dazu unter: http://www.gobsquad.com/projects/prater-saga-3-in-diesem-kiez-ist-der-teufel-eine-goldmine (Stand: 2.3.2012). 4 Nähere Informationen dazu unter: www.rimini-protokoll.de/website/de/project_387.html (Stand: 2.3.2012).
THEATER UND WORTGEDÄCHTNIS
277
duktionsästhetik, also im engeren Sinne zu den grundlegenden Bedingungen, auf denen die Arbeit des Schauspielers beruht. Daher berücksichtigt die Ästhetik des Performativen zwar die auf dieser Basis hervorgebrachten sprachlichen Laute, nicht jedoch das Wortgedächtnis als eine der wichtigsten Bedingungen für ihre Hervorbringung. c.) Historisch besehen stellt das Wortgedächtnis eine Körpertechnik dar, die neben dem europäischen Schauspiel auch in zahlreichen weiteren kulturellen Kontexten praktiziert worden ist. Gleichwohl ist über die Kulturgeschichte des Wortgedächtnisses wenig bekannt. Begründen lässt sich dies durch eine Gedächtnisforschung, die sich, inspiriert durch die prominenten Studien von Frances Yates aus den 1960er Jahren und gegenwärtig gestützt durch den sogenannten iconic turn, intensiv mit der Visualität historischer Gedächtniskünste auseinandersetzt. Weil das Wortgedächtnis aber in der Theater-, Rhetorik-, Pädagogik- und Physiologiegeschichte meist als eine akustische Gedächtnisleistung beschrieben wurde, fällt es gegenwärtig aus dem Analyse-Raster. Ziel meines Beitrags ist es, eine Brücke zu schlagen zwischen zwei Forschungsrichtungen, die in der heutigen Theaterwissenschaft nahezu getrennt voneinander bestehen: der Performativitätsforschung, die sich tendenziell eher auf Phänomene des Gegenwartstheaters konzentriert, und der Theatralitätsforschung, welche sich vornehmlich für die Theatergeschichte interessiert.5 Ich möchte die bestehenden Ansätze zur Analyse des Gegenwartstheaters daher um eine Methodik der kulturhistorischen Spurensuche ergänzen. Diese Methodik fragt danach, ob und inwieweit sich die Vergangenheit im Gegenwartstheater bemerkbar macht, wie sie wahrnehmbar wird und wie eine Analyse aussehen könnte, die sich mit der Historizität von Elementen des Gegenwartstheaters beschäftigt. Unter Anleihe des aus dem New Historicism stammenden Begriffs der ‚kulturellen Verhandlung‘ möchte ich dabei aufzeigen, wie bedeutsam es ist, vom Gegenwartstheater aus nicht allein auf die Geschichte des Theaters im engeren Sinne zurückzublicken. Zu fragen gilt es vielmehr, inwiefern das Theater historisch besehen in Verhandlungsprozesse mit anderen medialen und kulturellen Feldern involviert war und inwiefern diese Verhandlungsprozesse in gewisser Weise bis in die Gegenwart hinein nachwirken. Die Performancegruppe Gob Squad geht in ihrer Produktion Kitchen von der Beobachtung aus, dass die Darsteller in Andy Warhols gleichnamigem Film nichts auswendig gelernt, sondern frei improvisiert haben. Damit verweisen sie auf eine Spieltechnik, die für die Avantgarde-Künste des 20. Jahrhunderts geradezu charakteristisch war. Doch sind Gob Squad nicht die ersten, die für die Improvisation eine Alternative suchen. Schon Antonin Artaud wollte mit seinem Theater der Grausamkeit über das hinaus, was das experimentelle Theater seinerzeit unter im-
5 Die Differenz beider Forschungsrichtungen basiert freilich nicht allein auf den Untersuchungsgegenständen, sondern zuvorderst auf ungleichen theoretisch-methodischen Ansätzen, vgl. dazu ausführlich den Beitrag von Matthias Warstat im vorliegenden Band.
278
VIKTORIA TKACZYK
provisiertem Sprechen verstanden hatte. In seinen Briefen über die Sprache heißt es, die Darsteller sollten sich idealerweise „[...] im Äußeren bewegen und in der offenen Natur, nicht in den geschlossenen Zimmern des Hirns Fuß fassen [also im Gedächtnis, V.T.], sie sind deshalb noch nicht der Launenhaftigkeit der ungebildeten, unüberlegten Improvisation des Schauspielers ausgeliefert; des modernen Schauspielers vor allem, der ohne Text schwimmt und nichts weiß.“6
Bekanntlich suchte Artaud über die Artikulation von Geräuschen, Geschrei und Glossolalie nach unmittelbaren, magischen Ausdrucksformen, – wobei er damit nicht nur die Wortsprache, sondern auch und vor allem das Wortgedächtnis vermeiden wollte. In seiner prominenten Interpretation des Artaud’schen Theaters der Grausamkeit hat Jacques Derrida diese Negation des Wortgedächtnisses nicht bedacht. Derrida konzentriert sich hier auf die Problematik der ‚soufflierten Rede‘. Mit dem Begriff des Souffleurs ist dabei nicht gemeint, was man darunter gemeinhin in der Theaterpraxis versteht: also eine Art Stellvertreter des Wortgedächtnisses, der den Akteuren den Text zuflüstert, wie es etwa auch die Performer von Gob Squad tun. Derridas Argumentation stützt sich hingegen auf eine Form des Soufflierens, die der Sprache auf struktureller Ebene innewohnt und die Derrida in Artauds Schriften bereits thematisiert sieht: Artaud habe erkannt, dass auch die Sprache nicht ohne ein Gedächtnis auskomme. In jeden Sprechakt mischen sich unendlich viele Bedeutungen und Bezüglichkeiten, die in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft relevant werden können. Dieses vieldeutige Soufflieren, Flüstern und Wispern des ‚Nicht-Gegenwärtigen‘ hindere den Sprechenden daran, nur sich oder nur etwas ganz Bestimmtes auszudrücken. Artaud ist (dies jedenfalls attestiert ihm Derrida) an der soufflierten Rede buchstäblich wahnsinnig geworden, weil sie sich in den Sprechakt stets ungebeten einmischt. Derrida hingegen findet gerade an dieser Dimension der Sprache großen Gefallen. Er versteht die soufflierte Rede sogar als das eigentlich Ereignishafte der Sprache: Sie verleihe dem Sprechakt etwas Kontingentes, Eigenmächtiges und Unkontrollierbares; unaufgefordert mische sie sich ein, sie rede von anderen Dingen und raube dem Sprechakt seine bloße Gegenwärtigkeit. Dieser Diebstahl, das Soufflieren, das Markieren der Gegenwart mit Spuren des Nicht-Gegenwärtigen hat Derrida zufolge performative Qualitäten.7 Einige Theatermacher und -theoretiker haben Derridas Performanzbegriff buchstäblich beim Wort genommen, um eine Rückkehr der Wortsprache und der dra6 Zweiter Brief Artauds an Jean Paulhan (28. September 1932), in: Antonin Artaud, Das Theater und sein Double, München: Matthes & Seitz 1996, S. 118. 7 Vgl. Jacques Derrida, „Die soufflierte Rede“, in: ders., Die Schrift und die Differenz. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1976, S. 259-301; Zu Derridas Performanzbegriff vgl. Jacques Derrida, „Signatur Ereignis Kontext“, in: ders., Randgänge der Philosophie, Wien: Passagen 1999, S. 325-351.
THEATER UND WORTGEDÄCHTNIS
279
matischen Sprache auf die Theaterbühne zu feiern: Zu denken ist etwa an Regisseure wie Robert Wilson, Laurent Chétouane oder Dimiter Gotscheff, die sich der Performanz der soufflierten Rede im Derrida’schen Sinne widmen. In ihren Arbeiten ist der Souffleur jedoch Metapher einer sprachlichen Performanz, die ohne Körper auskommt, weil sie allein in der Dynamik und Struktur der Sprache begründet ist.8 Wenn die Performer von Gob Squad in Kitchen jedoch die Rolle von Souffleuren einnehmen, indem sie ihren Doubles den Text per Kopfhörer zuflüstern, so praktizieren sie eine soufflierte Rede im ganz und gar physischen Sinne. Sie ersetzen und verweisen damit zugleich auf eine körperliche Voraussetzung des Auswendigsprechens, nämlich auf das Wortgedächtnis. Dass die Verkörperungsbedingungen des Sprechens in Derridas Sprechakttheorie außen vor bleiben, wurde von theaterwissenschaftlicher Seite zwar bereits in den 1980er Jahren bemängelt. So hat Helga Finter etwa darauf verwiesen, dass sich in den Sprechakt nicht nur die soufflierte Rede einmische, sondern auch die Stimme in ihrer Materialität und Körperlichkeit.9 Interessant ist jedoch, dass seither zwar auf die physischen Prozesse des Sprechakts abgehoben wird. Die Forschung konzentriert sich dabei jedoch bis heute in radikaler Entgegensetzung zu Derrida auf die phänomenalen (d. h. die physischen, unmittelbar wahrnehmbaren) Elemente des Sprechaktes wie die Stimme. In diesem Zusammenhang wird der ‚Souffleur‘ erneut als Metapher bemüht, nun aber als eine Metapher für den performativen Anteil des Stimmlichen am Sprechakt.10 Außen vor bleibt somit auch hier das Wortgedächtnis, das zwar zu den physischen Ermöglichungsbedingungen des Sprechens gehört, in gewisser Weise jedoch die Rolle eines Souffleurs spielt, der hinter den Kulissen arbeitet. Körpertechniken wie das Wortgedächtnis fallen demnach aus dem Analyse-Raster der an Derrida orientierten Sprechakttheorie ebenso wie aus demjenigen einer auf das Phänomen der Stimmlichkeit konzentrierten Theaterforschung. Es stellt sich jedoch die Frage, inwiefern gerade diejenigen Körpertechniken, die in den Aufführungen nicht unmittelbar wahrnehmbar sind, ebenfalls, aber indirekt zur Ästhetik einer Aufführung beitragen. Und wie macht sich selbst die oft lange Tradition dieser Techniken bemerkbar? Vorschläge dazu, wie sich das Gegenwartstheater historisieren lässt, sind bereits verschiedentlich gemacht worden. So widmet sich Erika Fischer-Lichte in der Ästhetik des Performativen zwar vornehmlich dem im phänomenologischen Sinne un-
8 Vgl. dazu bspw. Nikolaus Müller-Schöll, „Raisonner sur scène. Über zwei Arbeiten Laurent Chétouanes“, in: Resonanz. Potentiale einer akustischen Figur, hg. v. Karsten Lichau/Viktoria Tkaczyk/Rebecca Wolf, München: Wilhelm Fink 2009, S. 291-305. 9 Vgl. Helga Finter, „Das Reale, der Körper und die soufflierte Stimme: Artaud, heute“, in: Forum modernes Theater 13:1 (1998), S. 3-17. 10 Doris Kolesch, „Artaud: Die Überschreitung der Stimme“, in: Phonorama. Eine Kulturgeschichte der Stimme als Medium, hg. v. Brigitte Felderer, Berlin: Matthes & Seitz 2004, S. 187198.
280
VIKTORIA TKACZYK
mittelbar Erfahrbaren einer Aufführung. Sie betont jedoch, Theater habe immer auch die Funktion eines kulturellen Gedächtnisses, das sich im Interaktionsprozess von Akteuren und Zuschauern artikuliert. Damit werde die Frage nach der Historizität von Theater immer wieder aufgeworfen und ins Bewusstsein gerufen. So interpretiert Fischer-Lichte beispielsweise die Selbstgeißelung Marina Abramovićs in der Performance Lips of Thomas (1975) als ein „ästhetische[s] und in gewisser Weise verschobene[s] re-enactmen[t]“11 religions- und ritualhistorischer Traditionslinien, – wobei die Betonung auf dem Moment der Verschiebung liegt: Jede Aufführung transformiere und verwandle die Kulturgeschichte; letztere erscheine in der Aufführung jedoch stets nur als verkörperte Geschichte. Marvin Carlson gelangt in seiner Studie The Haunted Stage sogar zu dem Befund, es sei ein geradezu fundamentales Charakteristikum von Theater, bestimmte Elemente der Theatergeschichte zu wiederholen und zu verschieben: Texte, Schauspieler, Bühnenformen und -bilder durchziehen die Aufführungspraxis wie Geister, die in immer neuen Gewändern wiederkehren.12 Doch stellt sich hier die Frage warum. Lässt sich das Geisterhafte nur aus der Aufführung heraus begründen, zu deren Grundstruktur es gehört, die Theatergeschichte zu reiterieren wie Fischer-Lichte und Carlson dies aufzeigen? Oder zwingt die Geschichte das Theater gleichsam dazu wiederholt zu werden? Was also ist der performative Anteil des Geschichtlichen? Welche Macht hat die Vergangenheit über eine Aufführung der Gegenwart? Weshalb wird zum Beispiel das Wortgedächtnis in der europäischen Schauspielpraxis seit mehr als zwei Jahrtausenden angewandt? Worauf beruht der Zwang, diese Mnemotechnik zu wiederholen? Weshalb ist es überhaupt so spektakulär, sie zu vermeiden oder durch eine alternative Mnemotechnik zu ersetzen, wie Gob Squad dies in Kitchen erprobt und vorführt? Um der Frage nach den Spuren der Geschichte im Gegenwartstheater nachzugehen, möchte ich noch einmal auf den Derrida’schen Spurbegriff zurückzukommen. Aber weniger um – wie dies von theaterwissenschaftlicher Seite bisher versucht worden ist – gegenwärtige Sprechakte auf den Anteil der soufflierten Rede hin zu befragen, die in der Gegenwart abstrakte Spuren des Nicht-Gegenwärtigen hinterlässt und damit eine spezifische Form von Performativität entfaltet. Vielmehr möchte ich mich an den Vorschlag des Literaturwissenschaftlers Stephen Greenblatt anschließen, die Derrida’sche Nicht-Gegenwärtigkeit ganz wörtlich, nämlich im historischen Sinne zu verstehen. Greenblatt ersetzt die Rede von der Nichtgegenwärtigkeit eines abstrakten Zeichens durch die sehr viel konkretere Vergangenheit literarischer Verhandlungsprozesse. Er zeigt auf, wie bestimmte Themenkomplexe in ganz unterschiedlichen Textkulturen eines ausgewählten Zeitraums (in religiösen Texten, politischen Texten, ökonomischen Texten, im Drama) verhandelt werden, zwischen diesen Texten zirkulieren und dabei eine soziale Energie hinterlassen, die sich als irreduzible Spur 11 Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004, S. 40f. 12 Vgl. Marvin Carlson, The Haunted Stage. The Theatre as Memory Machine. Ann Arbor: University of Michigan Press 2001.
THEATER UND WORTGEDÄCHTNIS
281
(in Form von Bedeutungsverschiebungen einzelner Begrifflichkeiten oder literarischer Motive) in die Literatur einschreibt. Im Leseakt werden diese Energien gewissermaßen erfahrbar. Ihre Spuren erlauben dem Literaturhistoriker Rückschlüsse auf historische Tauschprozesse, die in den Textquellen archiviert sind. Was bei Derrida die Figur des Souffleurs ist, die sich in den Sprechakt auf abstrakter Ebene einmischt, sind bei Greenblatt also ganz konkrete Autoren, die einem literarischen Begriff oder einem Motiv unterschiedlichen Sinn verleihen. Greenblatt spricht auch nicht vom Souffleur, sondern von den ‚Stimmen der Toten‘. Wo Derrida der soufflierten Rede eine performative Kraft zugesteht, bevorzugt Greenblatt zudem den Begriff der ‚sozialen Energie‘: Diese ist in gewissem Sinne der Speichermodus des Performativen. Aber nicht nur das: Indem Spuren soziale Energie speichern, zwingen sie den Historiker zur Re-Lektüre historischer Texte. Greenblatt geht sogar so weit zu behaupten, er selbst verleihe mit seiner Interpretationsleistung den Toten eine Stimme, „insofern es den Toten gelungen war, Textspuren von sich selbst zu hinterlassen, die sich durch die Stimme der Lebenden zu Gehör bringen“13. Für eine theaterwissenschaftliche Analyse lässt sich Greenblatts Wunsch, den Toten eine Stimme verleihen zu wollen, vor allem dann fruchtbar machen, wenn sich der Blick weniger auf literarische Begrifflichkeiten, sondern auf körperliche Techniken richtet wie etwa auf das Wortgedächtnis. So möchte ich im Folgenden nachzeichnen, inwieweit auch diese Mnemotechnik eine ‚soziale Energie‘ in sich trägt, die nicht allein aus der Theatergeschichte heraus erklärbar ist. Das Wortgedächtnis stellt eine Mnemotechnik dar, die im Laufe der Geschichte zwischen Rhetorik-, Pädagogik- und Theatergeschichte zirkulierte. Die kulturhistorischen Verhandlungen um das Wortgedächtnis haben ihre Spuren so tief in dieser Mnemotechnik hinterlassen, dass sich die daraus resultierende soziale Energie auch in der gegenwärtigen Theaterpraxis nicht einfach ignorieren lässt. Diese Energie zwingt nicht nur zur Wiederholung und Verschiebung der Technik. Sie wird auch in der jeweiligen Anwendung als eine historisch gewordene, vielschichtige Technik wirksam. Dass das Theater in gewissem Sinne ein Speichermedium ist und es eigentlich an der Zeit ist, die Speichertechniken über Bord zu werfen, hat neben Artaud auch schon Bertolt Brecht festgestellt. In der Kurze[n] Beschreibung einer neuen Technik der Schauspielkunst, die einen Verfremdungseffekt hervorbringt (1940/1941) empfiehlt Brecht: „Daß der Text nicht momentan entsteht, daß er memoriert ist, etwas Fixiertes, braucht er [der Schauspieler] nicht vergessen zu machen; […]. Die Haltung wäre diese, als wenn er eben nur aus dem Gedächtnis spräche.“14 Brecht zielt darauf ab, die Gedächtnistechnik auszustellen und mit ihr zu experimentieren. 13 Stephen Greenblatt, „Die Zirkulation sozialer Energie“, in: ders., Verhandlungen mit Shakespeare. Innenansichten der englischen Renaissance, Frankfurt a. M.: Fischer 1993, S. 9-33, hier: S. 9. 14 Bertolt Brecht, „Neue Technik der Schauspielkunst“, in: ders.: Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, 30 Bde, Berlin/Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1988-2000, Bd. 22, 2, S. 641-659, hier S. 650 (Anm. 7).
282
VIKTORIA TKACZYK
Damit distanziert er sich von der europäischen Schauspieltradition, in der das wortwörtliche Memorieren stets eine wichtige, aber kaum reflektierte Rolle gespielt hat. Hervorzuheben gilt es jedoch zunächst, dass sich Brecht, eigenen Angaben zufolge, mit seiner Theaterarbeit der (natur-)wissenschaftlichen Experimentalkultur seiner Zeit weitaus näher fühlte als der Schauspieltradition. Folgen wir der Spur, die Brecht hier legt und wechseln einmal ins Feld der Experimentalwissenschaften zu Beginn des 20. Jahrhunderts, so treffen wir tatsächlich auf eine erstaunliche Parallele: Um 1900 ersetzt die experimentelle Psychologie den bis dahin gängigen Begriff der ‚Gedächtniskunst‘ (lat. ars memorativa) durch denjenigen der ‚Gedächtnistechnik‘. Ökonomie und Technik des Gedächtnisses lautet auch der Titel einer 1908 veröffentlichten Schrift des Hamburger Psychologen Ernst Meumann, der darin seine experimentellen Untersuchungen über das Merken und Behalten von Gedächtnisinhalten diskutiert. Meumann konstatiert, dass das Sprachgedächtnis im Normalfall weniger über ein ‚visuelles Gedächtnis‘ vonstatten geht als vielmehr über das Memorieren von Klangbildern und Modi der Klangerzeugung. Dieses ‚akustisch-motorische Gedächtnis‘ findet Meumann bei Berufen wie dem Wissenschaftler und Schauspieler besonders stark ausgebildet. In Anlehnung an den französischen Psychopathologen Jean-Martin Charcot und dessen Assistenten Gilbert Ballet nennt er es auch ein ‚innerliches Sprechen‘.15 Bemerkenswert ist nun, dass Gilbert Ballet seinerseits das Theater schon 1888 in seiner Aphasieforschung am Pariser Hôpital Salpêtrière zum Ort seiner Überlegungen gemacht hat, wenn er fragte: „Sind wir nicht oftmals beim Verlassen des Theaters ganz in Anspruch genommen durch das Gehörbild, welches hübsche Verse oder eine Kraftstelle eines Lieblingsdarstellers bei uns zurückgelassen hat? Wir hören nun diese Stelle genau so wie kurz vorher, als wir noch auf unserem Platze sassen. Freilich spricht der Schauspieler jetzt mit leiser Stimme, aber diese Stimme hat die nämlichen Eigenschaften, die uns soeben entzückten.“16
Beweisen wollte Ballet mit dieser Bemerkung, dass sich das Wortgedächtnis nicht zwingend auf die eigene Stimme stützen muss; memoriert werden kann auch die Stimme eines anderen oder eine Hörerfahrung, die sich aus vielen Stimmen zusammensetzt und in der Erinnerung neu strukturiert, um schließlich von Neuem artikuliert zu werden. Ballet nennt dies auch eine „Gehörshallucination“ und spricht
15 Vgl. Ernst Meumann, „Das Lernen (Technik und Ökonomie des Lernens)“, in: ders.: Ökonomie und Technik des Gedächtnisses. Experimentelle Untersuchungen über das Merken und Behalten, Leipzig: Engelmann 1912, S. 114-135. 16 Gilbert Ballet, Die innerliche Sprache und die verschiedenen Formen der Aphasie (Schrift zur Aufnahme in die medicinische Facultaet, Paris im März 1886), Leipzig/Wien: Deuticke 1890, S. 35.
THEATER UND WORTGEDÄCHTNIS
283
vom „innerlichen Wort“, das „gewissermaßen die Rolle des Souffleurs [spielt]: es sagt die Worte, welche gesprochen werden sollen“17. Gemeint ist damit freilich weder die ‚soufflierte Rede‘, mit welcher Derrida dann später im Namen einer dem Sprechakt vorgängigen Sprachstruktur und -dynamik argumentiert, noch die ‚soufflierte Stimme‘, auf welche Helga Finter abhebt. Vielmehr thematisiert Ballet das Wortgedächtnis, das in der europäischen Theaterpraxis eine lange Geschichte hat. Dennoch bedurfte es erst der experimentalpsychologischen Gedächtnisforschung um 1900, um diese Mnemotechnik als eine ,Technik‘ anzuerkennen, bevor das Theater sich ernsthafte Gedanken darüber machen konnte. Dies wiederum hat historische Gründe: Medienwissenschaftler wie Walter Ong und Eric Havelock haben in den 1980er Jahren darauf verwiesen, dass das akustisch geprägte Wortgedächtnis in den szenisch-rhapsodischen Künsten vorschriftlicher Kulturen beheimatet war – in jener als verloren behaupteten primären Oralität der Antike also.18 Das dann relativ zeitgleich mit der phonetischen Schrift entstandene griechische Theater wird hingegen häufig als ein ‚Schauplatz‘ interpretiert, der sich durch das Anschaubare und weniger durch das Orale und Akustische auszeichnet. Aus antiken Rhetoriktraktaten ist jedoch überliefert, dass die akustische Technik des wortwörtlichen Memorierens dem Theater erhalten geblieben ist, nur dass jetzt schriftlich fixierte Dramatik wortwörtlich memoriert wurde. Gerade weil das Wortgedächtnis nun in gewisser Weise an die Schrift gebunden war, erfuhr es allerdings eine Umwertung seitens der Rhetorik. Denn die antike Rhetorik (dies geht schon aus Platons Schriften hervor) definierte sich seit der Erfindung der phonetischen Schrift immer in Abgrenzung zur Schrift. Daher benötigte sie ein anderes Gedächtnis, – ein Gedächtnis, in dem es nicht um das wortwörtliche Memorieren schriftlich fixierter Gedanken ging, sondern um das Memorieren von Topoi, d. h. von Argumenten und Themen. Zu diesem Zweck kaprizierte sich die Rhetorik auf die sogenannte Gedächtniskunst (ars memorativa), also auf ein bildlich-räumliches Gedächtnis, während sie dem Schauspiel verachtungsvoll das Wortgedächtnis als natürliches, weniger kunstvolles (akustisches) Gedächtnis überließ. Frances Yates hat in ihren prominenten Studien zur ‚Art of Memory‘ darauf hingewiesen, dass die Gedächtniskunst ihren Namen zu Recht verdient, weil es sich dabei um eine bildende Kunst handelt: um Tempel, Paläste, Schatzkammern, die sich der Redner in seinem Kopf detailreich und kunstvoll ausmalt, um darin sein Wissen zu speichern und abrufen zu können.19 Es mag dem so genannten iconic turn geschuldet sein, dass auch gegenwärtig das Interesse der Forschung vor allem 17 Ebd., S. 30. 18 Vgl. Walter Jackson Ong, Orality and literacy. The technologizing of the world, London/New York: Methuen 1982; Eric A. Havelock, The muse learns to write. Reflections on orality and literacy from antiquity to the present, New Haven/London: Yale University Press 1986. 19 Vgl. Frances A. Yates, „Die drei lateinischen Quellen zur klassischen Gedächtniskunst“, in: dies., Gedächtnis und Erinnern. Mnemotechnnik von Aristoteles bis Shakespeare, Berlin: VEB 1990, S. 11-33.
284
VIKTORIA TKACZYK
diesen visuellen Merkhilfen der Kulturgeschichte gilt, zu denen mitunter auch die Gedächtnistheater aus der Rhetorik des 16. und 17. Jahrhunderts gezählt werden: visuelle Merkhilfen, die einem konkreten Theaterbau nachempfunden sind. Bei Robert Fludd zum Beispiel, der sich Anfang des 17. Jahrhunderts vom Londoner Globe Theatre für ein solches Gedächtnistheater inspirieren ließ, ist dann auch einmal mehr nachzulesen, dass er die Gedächtniskunst der Rhetorik als eine sehr viel anspruchsvollere Gedächtnisleistung ansieht, als sie der Schauspieler mit dem Wortgedächtnis zu vollbringen vermag.20 Während man in der Rhetorik von der Antike bis heute vornehmlich auf das Sachgedächtnis setzt, entdeckten englische Pädagogen im 16. Jahrhundert das Wortgedächtnis wieder, das Platon so vehement kritisiert hatte. Sie übernahmen es aus dem Elisabethanischen Theater. Die Kompanien spielten oft mehr als 30 Stücke gleichzeitig; geprobt wurde nur kurz. Ihre Rollen hatten die Darsteller daher häufig von einem Tag auf den anderen im Kopf zu behalten. Darauf nimmt beispielsweise William Shakespeares Sommernachtstraum Bezug, wenn der Zimmermann Peter Squenz seine Kollegen auffordert: „Hier Meisters sind eure Rollen, und ich muß euch bitten, ermahnen und ersuchen, sie bis morgen Nacht auswendig zu wissen. Trefft mich in dem Schloßwalde, eine Meile von der Stadt, beim Mondschein; da wollen wir probieren […]. Gebt euch Mühe! Könnt eure Rollen perfekt!“21 Vor diesem Hintergrund wundert es auch wenig, dass das Darstellende Spiel an englischen Schulen bereits im 17. Jahrhundert zum Schulfach erklärt wird, um die Kinder an das wortwörtliche Memorieren umfangreicher Literatur heranzuführen. Als Technik wird dafür die vociferatio empfohlen: ein auf Intonation und Rhythmik setzendes Lernen durch wiederholtes lautes Sprechen, das für beinahe alle Schulfächer von zentraler Bedeutung werden sollte.22 Die kulturellen Verhandlungen um das Wortgedächtnis zwischen Pädagogikund Theatergeschichte sind seitens der Forschung bislang kaum bedacht worden. Ein Grund dafür mag auch sein, dass die Theatertheorie des 18. und 19. Jahrhundert noch immer dabei war, sich gegen die Anti-Theater-Polemik und eine anhaltende Diffamierung des Wortgedächtnisses seitens der Rhetorik zur Wehr zu setzen und dabei stets zu betonen, Theater sei weit mehr als, wie Lessing es ausdrückte, „Papageientum“23, – nämlich: physische und emotionale Beredsamkeit.
20 Vgl. Robert Fludd, „Utriusque Cosmi Historia“, Auszüge in: Das enzyklopädische Gedächtnis der Frühen Neuzeit. Enzyklopädie- und Lexikonartikel zur Mnemonik, hg. v. Jörg Jochen Berns/ Wolfgang Neuber, Tübingen: Niemeyer 1998, S. 79-131. 21 William Shakespeare, Ein Sommernachtstraum, übers. v. Wilhelm Schlegel, Stuttgart: Reclam 1996, Akt I, 2, hier: S. 12. 22 Zum Theaterspiel im englischsprachigen Schulunterricht des 16. und 17. Jahrhunderts vgl. Bertram Joseph, Acting Shakespeare, New York: Theatre Arts Books 1969, insbesondere: S. 1-19 u. 82-109. 23 Vgl. Gotthold Ephraim Lessing, „Hamburgische Dramaturgie“, („Drittes Stück“, 08. Mai 1767), in: Lessings Werke: Vollständige Ausgabe in 25 Bänden, hg. v. Julius Petersen, Bd. 5, Berlin: Bong 1925, S. 35.
THEATER UND WORTGEDÄCHTNIS
285
Wertschätzend behandelte das Wortgedächtnis allein Johann Wolfgang von Goethe in den Regeln für Schauspieler (1791). Ohnehin zielt Goethes Verständnis von Schauspielkunst stark auf eine der Dramatik untergeordneten Deklamierkunst ab. Er erklärt das falsche, ungenaue Auswendiglernen zur ersten Ursache einer verfehlten Schauspielkunst und setzt auf die Intonation, die Rhythmik und damit auf akustische Aspekte des Memorierens.24 Dies verwundert auch deshalb nicht, weil Goethe mit Naturwissenschaftlern wie dem Anatomen Samuel Thomas von Soemmering in Kontakt stand, die um 1800 erstmals mit akustischen Modellen wie den Chladni’schen Klangfiguren und dem Resonanzmodell an die Erklärung des Gedächtnisses herantraten. Novalis hat diese Bestrebungen wiederum in dem Satz zusammengefasst: „Sonderbare bisherige Vorstellung vom Gedächtniß – als eine Bilderbude – etc. Alle Erinnerungen beruhen auf indirectem Calcül – auf Musik etc.“25 Was um 1800 noch metaphorisch ausgedrückt wurde, erklärte die psychologische Laborforschung an der Wende zum 20. Jahrhundert dann zur wissenschaftlichen Tatsache. Erst hier bestätigten der französische Psychopathologe Jean-Martin Charcot und sein Assistent Gilbert Ballet erstmals, dass das akustische Gedächtnis für das Memorieren eine wichtige Rolle spielt. Dass sich Psychologie und Pädagogik zu diesem Zeitpunkt für das akustische Gedächtnis interessierten, mag mitunter durch einen medienhistorischen Umbruch erklärbar sein. Denn mit der Erfindung des Grammophons und weiterer akustischer Speichertechniken, wurde auch die Gestalt und Funktion des menschlichen Gedächtnisses neu überdacht.26 Ein weiterer Grund für die (Neu-)Entdeckung des akustischen Gedächtnisses um 1900 liegt zudem in seiner zeitökonomischen Dimension: Über das Gehör spart man enorme Zeit und Kraft beim Auswendiglernen großer Textmengen. Auf diesen Umstand verweist auch der Medienwissenschaftler Stefan Rieger in seinen Studien zu Merktechniken.27 Was Rieger dabei jedoch fachbedingt außer Acht lässt, ist die Theatergeschichte der Mnemotechnik, die im Halbverborgenen ein akustisches Gegengedächtnis zur visuellen Gedächtniskunst tradierte. Auf dieses Gegengedächtnis waren die Theatermacher jedoch wenig stolz, bis es die experimentellen 24 Vgl. Johann Wolfgang von Goethe, „Regeln für den Schauspieler“[1824], in: ders., Berliner Ausgabe, 22 Bde., hg. von Siegfried Seidel, Bd. 17: Kunsttheoretische Schriften und Übersetzungen: Schriften zur Literatur I, Berlin: Aufbauverlag 1970, S. 86–87. 25 Novalis, „Fragmente (aus der Nachlese von Bülow)“, in: Novalis Schriften, Bd. 3, Jena: Eugen Diederich 1907, S. 209. 26 In diesem Sinne versteht Petra Maria Meyer das akustische Gedächtnis als ein ‚mediales Gedächtnis‘. Die Theatergeschichte zeigt aber, dass ein auf Lautlichkeit setzendes Gedächtnis bereits vor diesem medienhistorischen Umbruch eine tragende Rolle spielte. Vgl. Petra Maria Meyer, Gedächtniskultur des Hörens. Medientransformationen von Beckett über Cage bis Mayröcker, Düsseldorf/Bonn: Parerga 1997. 27 Vgl. Stefan Rieger, „Der Wahnsinn des Merkens. Für eine Archäologie der Mnemotechnik“, in: Seelenmaschinen. Gattungstraditionen, Funktionen und Leistungsgrenzen der Mnemotechniken vom späten Mittelalter bis zum Beginn der Moderne, hg. v. Jörg Jochen Berns/Wolfgang Neuber, Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2000, S. 379-403; Stefan Rieger, Speichern/Merken. Die künstliche Intelligenz des Barock, München: Wilhelm Fink 1997.
286
VIKTORIA TKACZYK
Lebenswissenschaften im 19. Jahrhundert wiederum für sich entdeckten und als eine Technik wertzuschätzten begannen. Brecht hat das Wortgedächtnis dann zu einem wichtig Charakteristikum des Theaters erklärt, welches es nicht länger zu kaschieren, sondern vielmehr zu reflektieren und auszustellen gelte. Zeitgleich wurde das Wortgedächtnis jedoch nicht nur von Lernforschern experimentell erprobt und für den Schulunterricht empfohlen. Das wortwörtliche Memorieren großer Wissensbestände galt zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch als Voraussetzung bürokratisch-juridischer, naturwissenschaftlich-technischer ebenso wie geisteswissenschaftlicher Berufe. Deutlich wird dies etwa an Hugo Weber-Rumpes 1902 erschienenem und bis in die 1930er Jahre wiederholt aufgelegten Lehrbuch Gedächtnismeisterschaft. Unterrichtsbriefe für das Selbststudium der Schnell-Lern-Methode. Der Autor wirbt mit den folgenden, reichlich ausschweifenden Worten für sein Buch: „Ich bringe also in den Briefen und den Beilagen dazu: Alle wichtigen Geschichtszahlen, Daten aus der Kultur-, Kunst-, Literatur- und Kirchengeschichte, eine Fülle von geographischen Daten aus der Statistik und der politischen Tagesgeschichte, Sprachstoff aus dem Französischen, […], Englischen, Russischen, Polnischen, Ungarischen, ja selbst aus dem Chinesischen, juristischen Stoff aus dem neuen ‚Bürgerlichen Gesetzbuch‘, die Daten einer Reihe von Reichsgesetzen, Bibelstoff, mathematische, technische, chemische und physikalische Zahlen und Formeln, ferner Stoff aus der kaufmännischen und Beamtenpraxis, ja selbst aus der Musik. Um zu zeigen, wie weitgehend die Anwendung meiner Mittel ist, werde ich für Postbeamte sogar das Morsealphabet der Telegraphie, welches nur aus Punkten und Strichen besteht, zur fast sofortigen Erlernung […] lehren.“28
Während das Auswendiglernen dann lange Zeit einen unumstrittenen Platz in der Schulbildung einnahm, streiten sich Pädagogen seit den 1980er Jahren über dessen Sinn und Zweck.29 Im Schulunterreicht werden alternative Lerntechniken herangezogen und erprobt. Gleichwohl hat sich das wortwörtliche Auswendiglernen als eine Mnemotechnik bis heute erhalten, die sich in den Körper schon im frühen Schulalter einschreibt und unser Wissen und Denken massiv beherrscht.30 28 Hugo Weber-Rumpe, Gedächtnis-Meisterschaft. Unterrichtsbriefe für allgemeine Geistesschulung, Gedächtnis-Ausbildung und Persönlichkeits-Kultur unter besonderer Berücksichtigung der Schnell-Lern-Methode, Friedland: Weber-Rumpe 1923, S. 5. 29 Vgl. dazu Liane Keller/Rolf Eigenwald/Benno Kieselstein, Soll man Dichtung auswendig lernen? Antworten auf die Preisfrage der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung vom Jahr 1985, hg. v. der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung (Darmstadt), Heidelberg: Schneider 1986; Peter Matussek, „In- und auswendig Lernen. Zur Dialektik von Bildung und Information“, in: Gedächtnis und Bildung. Pädagogisch-anthropologische Zusammenhänge, hg. v. Bernhard Dieckmann/Stephan Sting/Jörg Zirfas, Weinheim/Basel: Deutscher Studien Verlag 1998, S. 285-300. 30 Zur Frage, inwieweit sich das wortwörtliche Auswendiglernen im Schulunterricht nicht nur als Mnemotechnik in den Körper einschreibt, sondern diesen gleichermaßen mit hervorbringt vgl. Catherine Robson, „Standing on the burning deck: Poetry, Performance, History“, in: PMLA 120 (2005), S. 148-162.
THEATER UND WORTGEDÄCHTNIS
287
Die hier unternommene Spurensuche nach dem Wortgedächtnis führte von Gob Squad über Artaud und Brecht zur Entdeckung des akustischen Gedächtnisses in der experimentellen Psychologie der 1880er Jahre und weiter zurück in die von der Rhetorik überschattete Theatergeschichte des akustischen Gedächtnisses. Aufzeigen wollte ich damit Folgendes: Das europäische Schauspiel kannte und tradierte seit langem eine Mnemotechnik, auf die es wenig stolz war und die es zu kaschieren suchte, weil sie in den kulturellen Verhandlungen zwischen Schauspiel und Rhetorik lange Zeit negativ bewertet worden ist. Es bedurfte erst eines Umweges über die experimentelle Psychologie und Pädagogik des frühen 20. Jahrhunderts und einer dort vonstattengehenden Aufwertung des akustisch dominierten Wortgedächtnisses, um die Aufmerksamkeit auch im Theater wieder auf die ihm eigene Mnemotechnik richten zu können. Gerade weil das Wortgedächtnis aber zu einem Gegenstand kultureller Verhandlungen zwischen Theater-, Rhetorik- und Pädagogikgeschichte geworden ist und sich als eine Wissenstechnik tief in den Körper (und zwar nicht nur in diejenigen von Schauspielern) eingeschrieben hat, lassen sich seine Spuren auch in der gegenwärtigen Theaterpraxis nicht einfach wegwischen: Zwar werden an Schauspielschulen keine expliziten Mnemotechniken gelehrt und es scheint sogar fast zum Berufsethos zu gehören, dass Schauspieler nicht gerne darüber sprechen, wie sie zu ihrem Text kommen. Fragt man aber genauer nach, so bestätigen viele, dass sie nach wie vor mit dem gelernten Text auf der Probe erscheinen.31 Wenn mit dieser Mnemotechnik gegenwärtig in der Performancekunst experimentiert wird, so ist dies also wohl mit dem Eingeständnis verbunden, dass die Performancekunst die Theatergeschichte in gewissem Sinne ebenso wenig los wird wie bestimmte Kulturtechniken, deren Spuren weit über den Rahmen einer eng gefassten Theatergeschichte hinausreichen. Gerade das Sichtbarmachen dieser Spuren kann jedoch zu einem Ereignis werden, das die soziale Energie kultureller Verhandlungen ausstrahlt und als solches in der Aufführung erfahrbar wird. Stephen Greenblatt hat den Begriff der sozialen Energie dort gesetzt, wo bei Derrida ursprünglich der Begriff des Performativen stand. Es stellt sich demnach die Frage, ob die Spuren kulturhistorischer Verhandlungen im Gegenwartstheater nicht wieder rückübersetzbar wären in ein Sprechen von der Performanz eines Nicht-Gegenwärtigen. Denn was sich in den Handlungen der Gegenwart (wie etwa in der Handlung des Memorierens und Auswendigsprechens) beinahe unmerklich artikuliert und aktualisiert, ist eine wechselvolle und unhintergehbare Theater-, Medien- und Kulturgeschichte.
31 Vgl. dazu „Die verbotene Frage: Wie behalten Sie als Schauspieler eigentlich so viel Text?“, in: dt magazin [Magazin des Deutschen Theaters Berlin] 1 (2009/2010), S. 24-25, sowie das Feature „Literatur im Kopf. Eine kurze Geschichte des In- und Auswendigen“ von Simone Kucher und Viktoria Tkaczyk. Deutschlandradio Kultur, http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/literatur/1103585/ (Stand: 2.3.2012).
288
VIKTORIA TKACZYK
Literaturverzeichnis Artaud, Antonin, Das Theater und sein Double, München: Matthes & Seitz 1996. Ballet, Gilbert, Die innerliche Sprache und die verschiedenen Formen der Aphasie (Schrift zur Aufnahme in die medicinische Facultaet, Paris im März 1886), Leipzig/Wien: Deuticke 1890. Brecht, Bertolt, „Neue Technik der Schauspielkunst“, in: ders.: Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, 30 Bde, Berlin/Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1988-2000, Bd. 22, 2, S. 641-659. Carlson, Marvin, The Haunted Stage. The Theatre as Memory Machine. Ann Arbor: University of Michigan Press 2001. Derrida, Jacques, „Die soufflierte Rede“, in: ders., Die Schrift und die Differenz. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1976, S. 259-301. —, „Signatur Ereignis Kontext“, in: ders., Randgänge der Philosophie, Wien: Passagen 1999, S. 325-351. Finter, Helga, „Das Reale, der Körper und die soufflierte Stimme: Artaud, heute“, in: Forum modernes Theater 13:1 (1998), S. 3-17. Fischer-Lichte, Erika, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004. Fludd, Robert, „Utriusque Cosmi Historia“, Auszüge in: Das enzyklopädische Gedächtnis der Frühen Neuzeit. Enzyklopädie- und Lexikonartikel zur Mnemonik, hg. v. Jörg Jochen Berns/Wolfgang Neuber, Tübingen: Niemeyer 1998, S. 79-131. Goethe, Johann Wolfgang von, „Regeln für den Schauspieler“, [1824], in: ders., Berliner Ausgabe, 22. Bde., hg. v. Siegfried Seidel, Bd. 17: Kunsttheoretische Schriften und Übersetzungen: Schriften zur Literatur I, Berlin: Aufbauverlag 1970, S. 86–87. Greenblatt, Stephen, „Die Zirkulation sozialer Energie“, in: ders., Verhandlungen mit Shakespeare. Innenansichten der englischen Renaissance, Frankfurt a. M.: Fischer 1993, S. 9-33. Havelock, Eric A., The muse learns to write. Reflections on orality and literacy from antiquity to the present, New Haven/London: Yale University Press 1986. Joseph, Bertram, Acting Shakespeare, New York: Theatre Arts Books 1969. Keller, Liane/Eigenwald, Rolf/Kieselstein, Benno: Soll man Dichtung auswendig lernen? Antworten auf die Preisfrage der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung vom Jahr 1985, hg. v. der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung (Darmstadt), Heidelberg: Schneider 1986. Kolesch, Doris, „Artaud: Die Überschreitung der Stimme“, in: Phonorama. Eine Kulturgeschichte der Stimme als Medium, hg. v. Brigitte Felderer, Berlin: Matthes & Seitz 2004, S. 187-198. Lessing, Gotthold Ephraim, „Hamburgische Dramaturgie“, („Drittes Stück“, 08. Mai 1767), in: Lessings Werke: Vollständige Ausgabe in 25 Bänden, hg. v. Julius Petersen, Bd. 5, Berlin: Bong 1925, S. 35. Matussek, Peter, „In- und auswendig Lernen. Zur Dialektik von Bildung und Information“, in: Gedächtnis und Bildung. Pädagogisch-anthropologische Zusammenhänge, hg. v. Bernhard Dieckmann/Stephan Sting/Jörg Zirfas, Weinheim/Basel: Deutscher Studien Verlag 1998, S. 285300. Meumann, Ernst, „Das Lernen (Technik und Ökonomie des Lernens)“, in: ders.: Ökonomie und Technik des Gedächtnisses. Experimentelle Untersuchungen über das Merken und Behalten, Leipzig: Engelmann 1912, S. 114-135. Meyer, Petra Maria, Gedächtniskultur des Hörens. Medientransformationen von Beckett über Cage bis Mayröcker, Düsseldorf/Bonn: Parerga 1997. Müller-Schöll, Nikolaus, „Raisonner sur scène. Über zwei Arbeiten Laurent Chétouanes“, in: Resonanz. Potentiale einer akustischen Figur, hg. v. Karsten Lichau/Viktoria Tkaczyk/Rebecca Wolf, München: Wilhelm Fink 2009, S. 291-305.
THEATER UND WORTGEDÄCHTNIS
289
Neisser, Ulrich, Cognitive Psychology, New York: Appleton-Century-Crofts 1967. Novalis, „Fragmente (aus der Nachlese von Bülow)“, in: Novalis Schriften, Bd. 3, Jena: Eugen Diederich 1907, S. 209. Ong, Walter Jackson, Orality and literacy. The technologizing of the world, London/New York: Methuen 1982. Rieger, Stefan, „Der Wahnsinn des Merkens. Für eine Archäologie der Mnemotechnik“, in: Seelenmaschinen. Gattungstraditionen, Funktionen und Leistungsgrenzen der Mnemotechniken vom späten Mittelalter bis zum Beginn der Moderne, hg. v. Jörg Jochen Berns/Wolfgang Neuber, Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2000, S. 379-403. —, Speichern/Merken. Die künstliche Intelligenz des Barock, München: Wilhelm Fink 1997. Robson, Catherine, „Standing on the burning deck: Poetry, Performance, History“, in: PMLA 120 (2005), S. 148-162. Shakespeare, William, Ein Sommernachtstraum, übers. v. Wilhelm Schlegel, Stuttgart: Reclam 1996. Weber-Rumpe, Hugo, Gedächtnis-Meisterschaft. Unterrichtsbriefe für allgemeine Geistesschulung, Gedächtnis-Ausbildung und Persönlichkeits-Kultur unter besonderer Berücksichtigung der SchnellLern-Methode, Friedland: Weber-Rumpe 1923. Yates, Frances A., „Die drei lateinischen Quellen zur klassischen Gedächtniskunst“, in: dies., Gedächtnis und Erinnern. Mnemotechnnik von Aristoteles bis Shakespeare, Berlin: VEB 1990, S. 11-33. „Die verbotene Frage: Wie behalten Sie als Schauspieler eigentlich so viel Text?“, in: dt magazin [Magazin des Deutschen Theaters Berlin], 1, 2009/2010. „Literatur im Kopf. Eine kurze Geschichte des In- und Auswendigen“ von Simone Kucher und Viktoria Tkaczyk. Deutschlandradio Kultur, in: http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/ literatur/1103585/ (Stand: 2.3.2012).
Internetquellen http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/literatur/1103585/ (Stand 2.3.2012) http://www.gobsquad.com/projects/gob-squads-kitchen-youve-never-had-it-so-good (Stand: 2.3.2012) http://www.gobsquad.com/projects/prater-saga-3-in-diesem-kiez-ist-der-teufel-eine-goldmine (Stand: 2.3.2012) http://www.rimini-protokoll.de/website/de/project_387.html (Stand: 2.3.2012)
MATTHIAS DREYER
Zäsur der Tragödie. Dimiter Gotscheffs Perser und die Historizität im Theater der Gegenwart
Weit verbreitet ist die Rede, dass auf den Bühnen der Theater Gespenster erscheinen. Verschiedentlich wurde der Kontakt mit den Toten gar als Ursprung des Theaters verstanden.1 Wenn Heiner Müller in den 1980er Jahren erklärte, Theaterarbeit sei „Dialog mit den Toten“2, so aktualisierte er einen alten Topos vom Theater als Medium der gespenstischen Wiederkehr. In dieser Hinsicht lassen sich die bekannten Geisterfiguren der Dramengeschichte erinnern: Dareios aus Aischylos’ Persern, Hamlets Vater, Ibsens Gespenster oder Heiner Müllers Untote. Wenn von den Bühnen-Gespenstern die Rede ist, so betrifft das jedoch nicht nur die Gespenster-Figuren in den überlieferten Dramen. Der Topos von der Wiederkehr der Toten ist auch eine Metapher für die theatrale Belebung verschiedenster historischer Materialien. So wurden die allabendlichen Auftritte der großen literarischen Gestalten wie Medea, Don Carlos oder Woyzeck als Wiederkehr der Toten gedeutet.3 Wenn eine Erfahrung entsteht, die eine solche Rede rechtfertigt, dann bricht Vergangenes in die Gegenwart ein, gerät die Ordnung der Zeit aus den Fugen. Das mit der Metapher der Gespenster aufgeworfene Problem lässt sich begreifen als Einlass von Geschichtlichkeit in die flüchtige Gegenwart der Aufführung. Damit hat sich die Theaterforschung besonders in den vergangenen Jahrzehnten intensiv befasst. Ob narrated past, performing history oder haunted stage – eine Reihe reflexiver Ansätze deuten auf die Funktion des Theaters als Raum des Erinnerns.4 1 Vgl. Carl Niessen, Handbuch der Theater-Wissenschaft, Bd. 1.2: Ursprung des asiatischen und griechischen Dramas aus dem Toten- und Ahnenkult, Emsdetten: Lechte 1953; vgl. zu dieser Ursprungstheorie auch Theo Girshausen, Ursprungszeiten des Theaters. Das Theater der Antike, Berlin: Vorwerk 8, 1999, S. 197ff.; bei Roland Barthes heißt es: „Die ursprüngliche Beziehung zwischen Theater und Totenkult ist bekannt: die ersten Schauspieler sonderten sich von der Gemeinschaft ab; indem sie die Rolle der TOTEN spielten: sich schminken bedeutete, sich als einen zugleich lebenden und toten Körper zu kennzeichnen […].“ Vgl. dazu Roland Barthes, Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1985, S. 40f. 2 Heiner Müller, Gesammelte Irrtümer, Bd. 2, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1991, S. 64. 3 Vgl. Erika Fischer-Lichte, „Die Toten kehren zurück. Über die Wahrnehmung von Zeit im Theater“, in: Möglichkeitsräume. Zur Performativität von sensorischen Wahrnehmungen, hg. v. Christina Lechtermann/Kirsten Wagner/Horst Wenzel, Berlin: Schmidt 2007, S. 173-181. Marvin Carlson hat in seiner Studie The Haunted Stage unlängst sogar angeregt, das ghosting als universelle Beschreibungsmetapher der Theaterhistoriografie zu bedenken. Vgl. Marvin Carlson, The Haunted Stage. The Theatre as Memory Machine, Ann Arbor: University of Michigan Press 2001. 4 Vgl. die Nachweise im folgenden Unterkapitel.
292
MATTHIAS DREYER
Und dennoch öffnet sich an dieser Stelle ein Zwiespalt. Denn auch wenn es unbestritten ist, dass sich das Theater in besonderem Maße eignet, um die Zeit aus den Fugen zu bringen, so fällt doch gleichermaßen auf, dass die Frage nach den zeitlichen Dimensionen auf theoretischer Ebene besonders schwer zu bestimmen ist. Die französische Theaterwissenschaftlerin Anne Ubersfeld etwa betont, dass es zum Wesen des Theaters gehöre, dass die Dimensionen von Vergangenheit und Zukunft verschwinden, und dass jeder zeitliche Verweis naturgemäß auf die Gegenwart bezogen sei.5 Auf ähnliche Weise beschreibt Erika Fischer-Lichte das Theater als eine Zeitmaschine: „Alles was es berührt und auf die Bühne bringt verwandelt es in Gegenwart“6. In dieser sich im Aufführungsdiskurs abzeichnenden Doppelpoligkeit, im Zwiespalt zwischen der Gegenwärtigkeit des Theaters und seinen Gespenstern, scheint eine Spezifik der Zeitordnung des Theaters zu liegen, die es näher zu entwickeln gilt. Auf diese Weise lässt sich einer Qualität nachgehen, die Derrida als die „Ungleichzeitigkeit der lebendigen Gegenwart mit sich selbst“7 bezeichnet hat. Diese Erfahrung ist ein wichtiger Faktor gesellschaftlicher Erneuerung und wenn wir den Diskurs um die Gespenster der Vergangenheit zugrunde legen, so scheint das Theater dafür ein privilegierter Ort zu sein. So stellt sich also die Frage, wie sich jene Spuren des Geschichtlichen in der Präsenz auf der Ebene der Theatertheorie wie der Aufführungsbeschreibung fassen lassen. Ich möchte dieser Frage zuerst durch eine Reflexion auf den Topos der absoluten Gegenwärtigkeit des Theaters nachgehen, wie er sich seit den 1960er Jahren herausgebildet hat, aber auch durch einen Blick auf die in den letzten Jahrzehnten gewachsene Forschung zum Theater als Ort des Erinnerns. Damit sollen die aktuellen methodischen Möglichkeiten, die Erfahrung von Zeit im Theater zu fassen, untersucht werden. Im Anschluss gehe ich der Hypothese nach, dass die griechische Tragödie aufgrund des mit ihr verbundenen Fremden und Unzeitgemäßen geeignet ist, die Frage nach der Erfahrung von Zeit von neuem aufzuwerfen, zumindest wenn man eine bestimmte Aufführungstradition antiker Tragödien betrachtet. Dabei beziehe ich mich auf eine Inszenierung von Aischylos’ Perser durch den Regisseur Dimiter Gotscheff, die 2006 am Deutschen Theater Berlin entwickelt und in den letzten Jahren in verschiedenen Theatern Europas gezeigt wurde.8
5 Vgl. Anne Ubersfeld, Lire le theatre, Paris: Éditions sociales 1977, S. 215: „L’écriture théatrale est une écriture au présent. Tout ce qui sera signe du temps est donc par nature compris dans un rapport au présent […] La difficulté du temps au théatre est qu’on peut le designer comme référent, on ne peut pas le montrer, il est par nature hors de la mimesis“. 6 Erika Fischer-Lichte: „Was ist eine ‚werktreue Inszenierung’? Überlegungen zur Transformation eines Dramas in eine Aufführung“, in dies. (Hg.), Das Drama und seine Inszenierung, Tübingen: Niemeyer 1985, S. 37. 7 Jacques Derrida, Marx’ Gespenster. Der Staat der Schuld, die Trauerarbeit und die neue Internationale, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004, S. 11f. Hervorhebung im Original. 8 Teile der folgenden Überlegungen entstammen meiner Dissertation Zäsuren der Zeit. Aufführungen griechischer Tragödien seit den 1960er Jahren, Freie Universität 2011.
ZÄSUR DER TRAGÖDIE
293
Gegenwärtigkeit und Geschichtlichkeit Als die Wissenschaft in den 1960er Jahren begann, semiotische Analysemethoden für Aufführungen zu entwickeln, war die Frage, inwieweit diese auf die Vergangenheit oder gar die Geschichte zu beziehen seien, kaum aktuell. Denn zum einen war es wichtig, dass sich die Theaterforschung angesichts der starken Dominanz der Theaterhistoriografie, die bis dahin innerhalb des Faches führend gewesen war, endlich stärker auf das Theater der Gegenwart konzentrierte. Zum anderen galt es, die Gegenwart des flüchtigen Theaters gegen ein Theaterverständnis zu verteidigen, das auf Werktreue pochte und eine Dominanz der zumeist historischen dramatischen Texte über den theatralen Text proklamierte. Die Metapher vom Theater als einer Zeitmaschine, die alles in Gegenwart verwandelt, war daher in den 1980er Jahren eindeutig ein kämpferisches, gegen die Werktreue gerichtetes Statement. Eine Bezugsetzung zwischen Inszenierung, Vergangenheit und Geschichte scheint jedoch auch methodisch schwer möglich. Prägend für die Immanenz der Zeit in der Theatertheorie ist dabei der Umstand, dass Aufführungsanalyse und historiografische Analyse in der theaterwissenschaftlichen Fachkultur zumeist als getrennte Bereiche behandelt werden. Denn zwar ist es eine Selbstverständlichkeit, dass jeder Verstehensprozess geschichtlich bedingt ist und das System theatraler Zeichen einer historischen Norm unterliegt.9 Die Frage der Norm gehört jedoch nach fachlicher Tradition zur historischen Theaterforschung, während die auf das Theater der Gegenwart gerichtete Aufführungsanalyse sich damit kaum befasst. Die systematischen Grenzen, so unvermeidlich sie für die curriculare Struktur des Faches auch sind, erschweren es, die Frage nach der Geschichtlichkeit des Theaters in die Aufführungsanalyse zu integrieren; sie stützen den Topos der absoluten Gegenwärtigkeit des Theaters, der den Aufführungsdiskurs seit dieser Zeit entscheidend prägt. Versucht man, die verschiedenen Zeitschichten des Theaters zu beschreiben, so liefern jedoch auch post-hermeneutische Entwürfe, die mit Blick auf experimentelle Theaterformen besonders seit den späten 1990er Jahren entstanden, keine direkte Vorlage. In ihnen wird Zeit primär als Erfahrung von Gegenwart gefasst: „Es gehört zu den interessantesten Entwicklungen des neuen Theaters“, heißt es bei Hans-Thies Lehmann, „daß sich darin eine ganz eigene und eigentümliche Temporalität ausgebildet hat, eine Vielfalt von Ästhetiken der Theaterzeit.“10 Zugleich aber betont er, im postdramatischen Theater entstehe ein „Amalgam, das die heterogenen Zeitschichten in eine und nur eine Zeit der Theatererfahrung einschmilzt“11. Erika Fischer-Lichte betrachtet Zeitlichkeit in der Ästhetik des Performativen nicht 9 Vgl. Erika Fischer-Lichte, Semiotik des Theaters, Bd. 2: Vom ‚künstlichen‘ zum ‚natürlichen‘ Zeichen. Theater des Barock und der Aufklärung, Tübingen: Narr 1983, S. 56-61. 10 Hans-Thies Lehmann, „Zeitstrukturen, Zeitskulpturen. Zu einigen Theaterformen am Ende des 20. Jahrhunderts“, in: Theaterschrift 12 (1997), S. 31f. 11 Hans-Thies Lehmann, Postdramatisches Theater, Frankfurt a. M.: Verlag der Autoren 1999, S. 316.
294
MATTHIAS DREYER
als Teil der Materialität der Aufführung, sondern als eine ihrer Möglichkeitsbedingungen.12 Ihr Konzept von Aufführung, das diese als ein aus der momenthaften, leiblichen Interaktion von Akteuren und Darstellern emergierendes Ereignis denkt, löst Theater von determinierenden Ansätzen ab, „welche das Auftauchen eines Elementes auf bestimmte Ursachen zurückzuführen suchen und es so als Glied einer Kausalkette ausweisen“13. Die Materialität der Aufführung ist demzufolge gerade keine Darstellung oder Fortführung von etwas, das außerhalb ihrer läge, sondern ein Ereignis, das im Hier und Jetzt entsteht. Wenn die Aufführung als ein autopoietisches und selbstreferenzielles Ereignis gefasst wird, stellt jedoch die Frage nach der Präsenz der Vergangenheit und Zukunft, also jener die ‚absolute Gegenwärtigkeit‘ übersteigernden Dimensionen, konsequenterweise eine Überschreitung dar. Dabei beinhaltet der Topos der absoluten Gegenwärtigkeit des Theaters eine entschieden utopische Stoßrichtung. Das wurde bereits angedeutet durch den Hinweis, dass sich das Theater seit den 1960er Jahren sowie die mit ihm verbundene Wissenschaft von der Vergangenheit abwendet, sich gegen die Dominenz historischer Theatertexte verteidigt und sich im Sinne einer Zeitgenossenschaft neu zu definieren sucht. Dies ist auch vor dem Hintergrund der jüngeren Diskussion um den Geschichtsbegriff zu begreifen, in der deutlich wurde, dass das Konzept der Geschichte – zumindest das der damals verbreiteten staatspolitischen Programme – keineswegs als eine emanzipative Denkform gelten kann, sondern dass es vielmehr Zwang und Gewalt hervorbringt. Je deutlicher wurde, dass der teleologische Geschichtsentwurf, demzufolge das menschliche Geschick beherrschbar und planbar sei, als gescheitert betrachtet werden muss, desto stärker wurde es nötig, den Raum des Theaters als eine geschichtsfreie Zone zu konzipieren – und mehr noch: als einen Ort, der sich dem Zugriff der Geschichte verweigert. In diesem Sinne lässt sich die absolute Gegenwärtigkeit des Theaters als eine Kategorie der Freiheit und Kontingenz betrachten. Wenn seit den 1990er Jahren, parallel zum kulturwissenschaftlichen Boom der Gedächtnisforschung, neue Perspektiven entwickelt wurden, um die in Aufführungen sich öffnenden historischen Räume zu beschreiben, so entwickelten sich diese komplementär zur Erforschung der Präsenz- und Ereignisdimensionen des Theaters. Nach der revolutionären Zäsur von 1989, dem Zusammenbruch des Staatssozialismus, hat das Thema der Zeitlichkeit in den Kunst- und Kulturwissenschaften wieder stark an Relevanz gewonnen. Erstens betrifft dies den Boom der Gedächtnisforschung, der mit dem Ende des kalten Kriegs freigesetzt wurde, und in dessen Kontext eine Reihe wichtiger theaterwissenschaftlicher Überlegungen zum Thema der Erinnerung entstanden.14 Zweitens wurden in diesem Kontext neue Betrach12 Vgl. Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Edition Suhrkamp 2004, S. 233. 13 Ebd., S. 228. 14 Vgl. Patrice Pavis, „Klassischer Text und szenische Praxis. Überlegungen zu einer Typologie zeitgenössischer Inszenierungsformen“, in: ders., Semiotik der Theaterrezeption, Tübingen: Narr 1988, S. 187-198; Erika Fischer-Lichte, „Zwischen Historizität und Aktualität: Klas-
ZÄSUR DER TRAGÖDIE
295
tungen zur Historizität der Theatermittel und -techniken konzipiert bzw. zum Fortleben historisch-ästhetischer Dispositive.15 Drittens entwickelten sich neue Überlegungen zur Schnittstelle von Theater und Geschichte.16 Denn durch das Scheitern historischer Fortschrittsmodelle wurde eine geschichtsphilosophische Leerstelle sichtbar, die zwar unter dem Schlagwort ‚Ende der Geschichte‘ diskutiert wurde, die jedoch die Frage nach einem zeitgemäßen Begriff von Geschichte umso dringlicher zutage treten ließ. Die alten, modernen mit der Geschichte verbundenen Glücksversprechungen sind zwar Vergangenheit, doch trotz der ideologischen Gefährdung dieses Begriffs, so der Historiker Reinhardt Koselleck, bleibt Geschichte „als transzendentale Kategorie Bedingung unserer neuzeitlichen Erfahrung“17. Nicht zuletzt im aktuellen politischen Klima, dessen zentraler rhetorischer Terminus ‚Alternativlosigkeit‘18 ist, wird es wichtig, Theater wieder stärker auch als historischen Raum zu denken. In diesem Kontext gilt es, die beschriebenen Perspektiven zu verbinden, d. h. das wiedererlangte Bewusstsein historischer Bedingtheit mit der Ereignishaftigkeit der Aufführung zu vermitteln. Gerade wenn das Theater als Teil historischer Prozesse gedacht wird, so erhält der Ereignisbegriff ein stärker politisches Gewicht: die Aufführung lässt sich dann als eine Instanz konzeptualisieren, die sich mit den in die Gegenwart hinein wirkenden Prägungen und Mächten der Vergangenheit auseinandersetzt. Sie bildet einen Moment, der zwi-
15
16
17 18
siker-Inszenierungen im 20. Jahrhundert“, in: dies., Kurze Geschichte des deutschen Theaters, Tübingen/Basel: A. Francke 1993, S. 373-409; Gerald Siegmund, Theater und Gedächtnis. Semiotische und psychoanalytische Untersuchungen zur Funktion des Dramas, Tübingen: Narr 1996; Friedemann Kreuder, Formen des Erinnerns im Theater Klaus Michael Grübers, Berlin: Alexander 2002; Peter W. Marx, Theater und kulturelle Erinnerung. Kultursemiotische Untersuchungen zu George Tabori, Tadeusz Kantor und Rina Yerushalmi, Tübingen/Basel: A. Franke 2003. Vgl. Gabriele Brandstetter, Tanz-Lektüren. Körperbilder und Raumfiguren der Avantgarde, Frankfurt a. M.: Fischer 1995; Marvin Carlson, The haunted stage. Theatre as Memory Machine; Ulrike Haß, Das Drama des Sehens. Auge, Blick und Bühnenform, München: Wilhelm Fink 2005; Viktoria Tkaczyk, „Theater und Wortgedächtnis. Eine Spurensuche nach der Gegenwart“ in diesem Band. Vgl. Christel Weiler, „,Verzeihung, sind Sie Jude?‘. Über einen möglichen Umgang des Theaters mit Geschichte“, in: Theater seit den 60er Jahren. Grenzgänge der Neo-Avantgarde, hg. v. Erika Fischer-Lichte/Friedemann Kreuder/Isabel Pflug, Tübingen/Basel: UTB 1998, S. 375387; Nikolaus Müller-Schöll, „Theater der Potentialität. Zum Enden der Geschichte im Theater der neunziger Jahre“, in: Theater der Welt / Theater der Zeit. Arbeitsbuch, hg. v. Joachim Fiebach, Berlin: Theater der Zeit 1999, S. 69-74; Freddie Rokem, Performing History. Theatrical Representations of the Past in Contemporary Theatre, Iowa: University of Iowa Press 2000; Nikolaus Müller-Schöll, „Mitsprechende Erfahrung. Die Biographie, der Apparat und das Problem des Singulären“, in: Heiner Müller sprechen, hg. v. ders./Heiner Goebbels, Berlin: Theater der Zeit 2009, S. 163-174. Reinhardt Koselleck, „Wozu noch Geschichte?“, in: Historische Zeitschrift, 212:1 (1970), S. 1-18, wiederabgedruckt in: ders., Vom Sinn und Unsinn der Geschichte. Aufsätze und Vorträge aus vier Jahrzehnten, hg. v. Carsten Dutt, Berlin: Suhrkamp 2010, S. 32-51, hier: S. 39. Das im politischen Diskurs neuerdings zuhauf verwendete Wort „alternativlos“ wurde von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum „Unwort des Jahres 2010“ gewählt.
296
MATTHIAS DREYER
schen den Zwängen, Traditionen, Möglichkeiten der Vergangenheit einerseits und den Ansprüchen der Zukunft andererseits vermittelt. So lässt sich die Gegenwärtigkeit des Theaters als Zäsur denken – als eine Unterbrechung, die nicht eine Befreiung von historischen Determinierungen herstellt, wohl aber als Versuch einer kritischen Suspendierung dieser angesehen werden kann – als Versuch, Ereignis zu werden. Diese Frageperspektive bedeutet, einen stärker historiografischen Blick auf das Gegenwartstheater zu werfen; es bedeutet auch, jene ästhetischen Strategien genauer zu registrieren, durch die Theater als eine Unterbrechung und Zäsur wahrnehmbar wird, und die damit verbundenen zeitlichen Erfahrungen zu fassen.19
Antike Tragödie – Historizität der Gegenwart An dieser Stelle kommt der Bezug auf die antike Tragödie gelegen. Denn diese ist besonders geeignet, um die Zeit des historischen Ereignisses im Theater zu reflektieren, da sie selbst die Potenziale des Heraustretens aus den aktiven Mächten der Vergangenheit thematisiert. Diese Perspektive entsteht zumindest mit Blick auf die Tragödientheorie, wie sie etwa bei Walter Benjamin entworfen wurde, derzufolge der tragische Protagonist der fortlaufenden zyklischen Zeit des Mythos entgegentritt.20 Jean-Pierre Vernants einflussreiche Deutung der antiken Tragödie verfolgt eine ähnlich Stoßrichtung. So stellt er dar, dass die Tragödie in dem Moment entstand, als die alte mythische Welt mit der neuen rechtlichen und politischen Ordnung kollidierte.21 Aus dieser Perspektive ist die Tragödie eine theatrale Handlung, mit der sich eine aufbegehrende Auseinandersetzung mit einer Welt schicksalhafter Gewalt austrägt. Als Schnittstelle am Übergang der Zeiten reflektiert die antike Tragödie gewissermaßen eine historische Zäsur. So hat es auch Jean-Luc Nancy aus philosophischer Sicht gefasst, wenn er – von Brecht ausgehend – über die Tragödie schreibt: „Gewissermaßen ist dies der besondere Fall einer allgemeinen Reflexion über die Frage, worum es bei der ‚Herkunft‘ geht, bei einem ‚Hervorgehen aus‘; man findet dort stets einen Schnitt und eine Überlieferung zugleich. Diese doppel-
19 Dabei kann man zurückgreifen auf Walter Benjamins Geschichtsdenken, das von einer „Unterbrechung des Kontinuums“ ausgeht, von einer „Gegenwart, die nicht Übergang ist, sondern in der die Zeit einsteht und zum Stillstand gekommen ist“. Walter Benjamin, „Über den Begriff der Geschichte“, in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. I.2, hg. v. Rolf Tiedemann/ Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1991, S. 691-704, hier: S. 702. 20 Walter Benjamin bezieht sich in seinem Ursprung des deutschen Trauerspiels (1925) auf Franz Rosenzweigs Deutung des Schweigens in der Tragödie, durch das der tragische Held „die Brücke, die ihn mit Gott und Welt verbindet“ abbricht; vgl. Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Bd. 1, S. 286 ff. 21 Vgl. Jean-Pierre Vernant, „The Historical Moment of Tragedy in Greece: Some of the Social and Psychological Conditions“, in: ders./Pierre Vidal-Naquet, Myth and Tragedy in Ancient Greece, New York: Zone Books 1988, S. 23-28.
ZÄSUR DER TRAGÖDIE
297
te Verbindung zwischen dem Kultus und dem Theater gilt es zu finden oder genauer, zwischen den Gegebenheiten des Kultus und dem theatralen Ereignis.“22 Aus dieser Sicht eignen sich antike Tragödien besonders, um die Aufführung als historischen Moment zu reflektieren. Und dies gilt auch im Hinblick auf den Umgang mit historischem Material und theatralen Codes, die mit der antiken Tragödie in den Theaterprozess eingebracht werden und angesichts derer sich eine Differenz zur Gegenwart der Aufführung eröffnet – eine temporale Kluft, die verhandelt und gedeutet werden will. Dabei hat es sich eingebürgert, die antiken Stoffe auf den modernen Bühnen als zeitlos oder überzeitlich erscheinen zu lassen und damit den Aufbruch der Zeit zu negieren. Jedoch gibt es eine andere starke Tradition der Auseinandersetzung mit der antiken Tragödie, die dem genau widerspricht. Sie beginnt mit dem Zweifel, ob die griechische Tragödie in der Moderne überhaupt aufführbar wäre, und führt zu einer Geschichte der Unvereinbarkeit und des Anachronismus, der Fremdheit und Differenz, die mit der altgriechischen Tragödie in das moderne bürgerliche Theater eingebracht wurde. Schon Hölderlins SophoklesÜbersetzungen und seine poetologischen Anmerkungen zu den Übersetzungen markieren eine wichtige Station dieser Geschichte. Ausgehend von Brechts Theaterarbeit zieht sich mit Heiner Müller, Einar Schleef bis hin zu Dimiter Gotscheff eine Entwicklungslinie durch das Theater des 20. Jahrhunderts, die die antike Tragödie auf doppelte Weise als ein Ereignis der Geschichtlichkeit inszeniert:23 Einerseits widerspricht die antike Tragödie der Gegenwart, indem sie Verdrängtes in die Gegenwart einbringt, die immanente Zeit der Gegenwärtigkeit durchkreuzt und die Konventionen des zeitgenössischen Theaters infragestellt; andererseits wird der Tragödie durch die zeitgenössischen Inszenierungen widersprochen, indem diese die in der Tragödie gebildeten Muster hinterfragen, kritisieren oder sie gar negieren. So lässt die Auseinandersetzung mit griechischen Tragödien auf besondere Weise die Historizität des theatralen Handeln und seiner Zeit hervortreten; sie entfaltet einen Sinn für die vielfältigen historischen Spuren, die sich durch die Präsenz jeder auch zeitgenössischen Aufführung ziehen. Um Theater als Ort der Geschichte in diesem Sinne genauer zu betrachten, bieten sich Dimiter Gotscheffs Inszenierungen griechischer Tragödien an. Der Regisseur bulgarischer Herkunft verbrachte Theater-Lehrjahre in der DDR der 1970er Jahre unter anderem bei Benno Besson und wurde in der westlichen Kulturszene 1983 bekannt, als er Heiner Müllers auf Sophokles zurückgehendes Parabelstück Philoktet in Sofia inszenierte und Müller diese Inszenierung zum Anlass einer um-
22 Jean-Luc Nancy, Nach der Tragödie. In memoriam Philippe Lacoue-Labarthe, Stuttgart: Legueil 2008, S. 31. 23 Vgl. hierzu auch Matthias Dreyer, „Archiv und Kollektiv. Griechische Tragödien als chorisches Theater bei Einar Schleef, Theatercombinat und Theodoros Terzopoulos“, in: Wissensästhetik. Wissen über die Antike in ästhetischer Vermittlung, hg. v. Ernst Osterkamp, Berlin: Walter de Gruyter 2008, S. 345-368.
298
MATTHIAS DREYER
fassenden theatertheoretischen Überlegung machte.24 Wenig später wurde Gotscheff von westdeutschen Staats- und Stadttheatern engagiert, als einer von vielen wichtigen Regie-Importen aus der DDR respektive Ost-Europa. Aufgrund seiner formalisierten, mit Verfremdungstechniken arbeitenden Inszenierungen kann man ihn innerhalb der vielfältigen Entwicklungsgeschichte des epischen Theaters verorten. Obwohl seine Arbeiten nicht leicht konsumierbar sind, hat er mit einem auf das Elementare reduzierten Stil eine große Anhängerschar gewonnen. Vielfach hat Gotscheff antike Tragödien inszeniert: vier Mal in den 1980er Jahren,25 zudem verstärkt in jüngster Zeit: 2006 Aischylos’ Die Perser (Deutsches Theater Berlin), 2009 eine griechische Version der Perser für das Theaterfestival in Epidauros, Aischylos’ Prometheus an der Berliner Volksbühne und Ödipus, Tyrann am Thalia-Theater Hamburg, dort 2011 auch Antigone des Sophokles.26 Da Gotscheff in Die Perser von 2006 eine Formensprache entwickelt hat, deren Elemente in vergleichbarer Form auch in seinen übrigen Antike-Inszenierungen auftauchen, wird im Folgenden diese Produktion besprochen. Welche Perspektiven ergeben sich, um den Zusammenhang von Aufführung und Geschichtlichkeit zu fassen? Im Mittelpunkt stehen im Folgenden die Frage des Modellcharakters, die Behandlung von Sprache und Körper sowie die Konstruktionen historischer Zeitlichkeit.
Tragödie als Modell? Aischylos’ Die Perser erzählt von der Niederlage der antiken persischen Weltmacht in der Schlacht bei Salamis. Doch werden in dieser Tragödie, geschrieben für das Athener Publikum 472 v. Chr., nicht die Siege der Griechen gefeiert. Vielmehr sind die schmerzvollen Erfahrungen des Kriegs aus der Perspektive des persischen Feindes geschildert. Dargestellt werden die Furcht des in der Hauptstadt Susa gebliebenen Chors um die kämpfende männliche Bevölkerung, der Bericht von der Vernichtung des persischen Heeres, die mahnende Erscheinung des aus dem Grab zurückgeholten ehemaligen Herrschers Dareios sowie, in einer bedeutenden Klageszene, das Leid des heimkehrenden Tyrannen Xerxes, der sein Volk in den Ruin getrieben hat.27 Gotscheffs Inszenierung war geprägt von einer besonderen Kargheit: 24 Vgl. Heiner Müller, „Brief an den Regisseur der bulgarischen Erstaufführung von ‚Philoktet‘ am dramatischen Theater Sofia“, in: ders., Werke, Bd. 8, hg. v. Frank Hörnigk, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2005, S. 259-269. 25 1982 und 1987 Heiner Müllers Adaption von Sophokles’ Philoktet (Sofia und Basel), 1987 Sophokles’ Ödipus, Tyrann (Basel, in Müllers Übersetzung), 1989 Euripides’ Troerinnen (Köln). 26 Zudem inszenierte er 2001 Euripides’ Elektra (Thalia in der Gausstraße), 2005 wieder Müllers Philoktet (Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin). 27 Es ist die älteste der etwa 30 erhaltenen antiken Tragödien und die einzige, die mit einem historischen, nicht mythologischen Stoff arbeitet. In der Forschung wird heute jedoch davon ausgegangen, dass aufgrund der Ferne des historischen Bezugs, der ‚historical vagueness‘, dieser Unterschied kaum ins Gewicht fällt. Die Perser waren also nicht mehr und nicht weniger
ZÄSUR DER TRAGÖDIE
299
Beteiligt waren vier Schauspieler, wovon einer den Text des Chors sprach. Die Übersetzung beruhte auf einer von Heiner Müller leicht bearbeiteten, wortwörtlichen Übertragung, die eine starke Nähe zur antiken Syntax und dem ‚Gestus des antiken Originals‘ suchte und damit einen besonders fremden Klang erzielte.28 Requisiten und Musik waren ausgespart. Im klassizistischen Gebäude des Deutschen Theaters stand die Bühne dunkel und leer; strukturiert hatte der Bühnenbildner Mark Lammert die Tiefe des Raums allein mit einer glatten, gelbgetünchten Wand, die häufig hell herausgeleuchtet wurde, in alle Richtungen drehbar war und anfangs wie eine rätselhaft-auratische minimal sculpture frontal zum Publikum stand. Während Aischylos’ Text mit dem Einzugslied des Chors beginnt, wird der Zuschauer in Gotscheffs Inszenierung, wie auch in seinen späteren von Prometheus und Ödipus, zu Beginn mit einem pantomimischen Vorspiel konfrontiert. Die gelbe Wand drehte sich um 90 Grad und wurde zur Trennwand. Links und rechts davon erschienen zwei Männer (Samuel Finzi und Wolfram Koch), gekleidet in schwarze Hose und weißes Hemd, und grienten wie Clowns ins Publikum. Nun verschob der eine die Wand, um sich eine bessere Position zu verschaffen. Der andere wunderte sich darüber, reagierte aber mit dem gleichen Übertritt. Was anfangs noch lächelnd als ein Versehen entschuldigt wurde, führte schnell zu einem heftigen Hin und Her, bei dem die Wand so stark bewegt wurde, dass sie kräftig um die eigene Achse rotierte, sodass die beiden, von der drehenden Wand verfolgt, laut schreiend im Kreis rannten. Dabei sprachen sie nicht, sondern lachten überzogen und stießen sonderbare Geräusche aus. Ein albernes Kinderspiel, das man, aus analytischer Distanz, deuten kann: Der Jäger wird zum Gejagten und der Gejagte zum Jäger – eine Parabel auf die Relativität jeder Position, auf die Entstehung von Krieg und seine zyklische Wiederkehr?29 Die Szene verweist auf die epische Theaterpraxis des Modells, die gewöhnlich mit einem Vorspiel oder Prolog eingeleitet wurde. Das Modell ist insofern bedeutend für die Klärung des Verhältnisses von Theater und Geschichte, weil sich mit der modellhaften Darstellung von Konflikten die Vorstellung ihrer Verstehbarkeit und mithin Gestaltbarkeit verbindet. Eine Handlung soll durch Komplexitätsreduktion transparent gemacht werden, um Aufklärung zu leisten oder über eine Veränderbarkeit der Verhältnisse zu reflektieren. Wenn Theater häufig ein Modellcharakter für die Darstellung sozialer Prozesse zugesprochen wurde, so wurden antike ‚Zeitstück‘ als andere antike Tragödien auch. Vgl. Jonas Grethlein, „Variationen des ‚nächsten Fremden‘. Die ‚Perser‘ des Aischylos im 20. Jahrhundert“, in: Antike und Abendland 53 (2007), S. 1-20. 28 Vgl. auch Anton Bierl, „Die griechische Tragödie aus der Perspektive von Prä- und Postdramatik. ‚Die Perser‘ des Aischylos und die Bearbeitung von Müller/Witzmann“, in: MüllerSchöll/Goebbels, Heiner Müller sprechen, a.a.O., S. 201-214. 29 In den Kritiken wird die Szene ähnlich gedeutet: „Wie Gewalt entsteht und was sie auszulösen vermag“ (Irene Bazinger, Frankfurter Allgemeine vom 19.10.2006); „…auf dieses verhängnisvolle Grundprinzip lässt sich wohl jeder Streit reduzieren“ (Ulrich Seidler, Berliner Zeitung vom 09.10.2006).
300
MATTHIAS DREYER
Tragödien aufgrund ihres reduzierten Handlungsgerüsts im 20. Jahrhundert bevorzugt als Modelle benutzt.30 Den entscheidenden Ausgangspunkt für jene Verflechtung von Tragödie und Modell stellte Bertolt Brechts Antigone des Sophokles (1948) dar. Sein einziges Experiment mit einer antiken Tragödie und zugleich sein erstes Theatermodell begann mit einer Szene aus dem Zweiten Weltkrieg, in der über die Leiche eines Deserteurs verhandelt wird. Dadurch wurde die sich anschließende Handlung der antiken Antigone-Tragödie in eine aktuelle Perspektive gestellt. Später ersetzte Brecht das Vorspiel durch einen Prolog mit expliziter Lektüreanweisung: Zuschauer wurden aufgefordert, die Figuren und Handlung der antiken Tragödie nach Bezügen zu ihrer eigenen Gegenwart zu durchsuchen. Grundlage dieser Analogiebildung war bei Brecht die Historisierung, eine paradigmatische Verfremdungstechnik des epischen Theaters. Der Stoff wird ausgestellt in seiner Historizität, was im Fall von Antigone bedeutet, dass er als barbarischer Akt einer Opferung gebrandmarkt und daher als überkommenes Muster dargestellt wird. Das Geschehen wird jedoch so aufbereitet, dass man die Gegenwart in es hineinspiegeln kann, sodass auch aktuelle Situationen, Charaktere und Konflikte in ihrer Historizität – und das heißt hier Relativität – infrage gestellt werden können. Dieser modellhafte Anspruch war auf besondere Weise prägend für die Aufführungsgeschichte der griechischen Tragödie in Deutschland. Regisseure wie Erwin Piscator, Benno Besson, Günther Heyme oder Einar Schleef veränderten die Konzepte des epischen Theaters, gerade weil sie die didaktische Kraft des Theaters und die Veränderbarkeit gesellschaftlicher Realitäten weniger optimistisch einschätzten als Brecht. Die aufklärerische Modelltradition wurde mit der Reflexion auf unveränderliche, nicht dialektisch auflösbare Konflikte in den Tragödien konfrontiert. Vermittelt durch die Texte Heiner Müllers, kann man auch Gotscheff in dieser Entwicklungslinie verorten. Durch die abstrahierende Form und die klaren Arrangements, durch die das szenische Geschehen in Die Perser strukturiert ist, trägt die Inszenierung modellhafte Züge, ohne jedoch – wie sich zeigen wird – den aufklärerischen Gestus des Modellhaften zu folgen. Gotscheffs Transformation der Modelltradition soll im Folgenden in näheren Analysen der Sprachverwendung, der entstehenden zeitlichen Dauer sowie der Körperlichkeit der Aufführung diskutiert werden.
Zäsuren der Historizität Von besonderer Wichtigkeit für die Frage nach der Historizität ist die Art der Rede, die ein spezifisches Verhältnis zu dem historischen Text schafft. Die Schauspielerin Margit Bendokat, gekleidet in einen einfachen dunklen Kittel, steht in der eröff30 Zum Topos des Theaters als Modell vgl. Matthias Warstat, „Ausnahme von der Regel. Zum Verhältnis von Theater und Gesellschaft“, in: Strahlkräfte. Festschrift für Erika Fischer-Lichte, hg. v. Christel Weiler/Jens Roselt/Clemens Risi, Berlin: Theater der Zeit 2008, S. 116-133.
ZÄSUR DER TRAGÖDIE
301
nenden Chorszene anfangs im hinteren Teil der Bühne. Die erleuchtete Wand hat sie in ihrem Rücken während sie den Zuschauern zugewandt ist. Im Theaterraum herrscht äußerste Ruhe. Ihren Körper hält sie aufrecht und gespannt, ihre Arme angewinkelt, die Fäuste sind geballt. Langsam spricht sie den Text des Chors aus der Perser-Übersetzung von Peter Witzmann und Heiner Müller, die eine „Tuchfühlung mit dem alten Text“31 herzustellen sucht. Hoch konzentriert bahnt sich ihre Stimme einen Weg durch das Dickicht der komplizierten, zergliederten Syntax; sachlich und doch mit Hingabe widmet sie jedem Wort ihre Aufmerksamkeit. In den Zäsuren des Textes rückt sie zuweilen einen Schritt behutsam nach vorne bis sie die Rampe erreicht, wo sie ohne weitere Bewegung stehenbleibt. Zuweilen markiert sie Distanz zu dem Gesagten, indem sie hier und da innehält und die Worte mit einem Raunen oder einer Äußerung der Ratlosigkeit kommentiert. Häufig wirkt es so, als ob sie sich den Text durch das Sprechen selbst vergegenwärtigen und den Sinn klarmachen möchte, was auch den Zuschauer vom Gesprochenen Abstand nehmen lässt. Der weiche Sprechstrom und ihre Hingabe an den Text schaffen zugleich eine hypnotische Wirkung, einen Sog.32 Folgt man den Charakterisierungen Heiner Müllers, so ist seine Übersetzung gezielt „dunkel und für flüchtige Leser schwer zugänglich“33. Tatsächlich ergeben sich für den Zuschauer Probleme, die Worte zu begreifen. Eventuell kann man vernehmen, dass das Heer der Perser in seinem Glanz beschworen wird, dass die einzelnen Feldherren namentlich hervorgehoben und charakterisiert werden, dass Sorge aufkommt, ob die Männer heil aus dem Feldzug heimkehren werden. Das Spezifische besteht jedoch darin, dass man den Worten nachhorcht, indem man punktuell in den linearen Verlauf der Verse einsteigt, jedoch schnell den Faden wieder verliert. Die Rede wirkt wie ein Angebot, sich der fremden Realität der antiken Chorverse anzunähern. Dabei ist die Tätigkeit des Entzifferns, des Hinter-den-Worten-herSeins und zugleich das Gefühl prägend, dass der Sinn dieser Wort immer wieder zerfällt und letztlich nicht voll verfügbar ist. Für mich als Zuschauer entsteht in dieser Situation eine Unruhe und Aufmerksamkeit, die sich darauf zurückführen lässt, dass sich das Geschehen kaum einordnen lässt. Die Langsamkeit, mit der Margit Bendokat spricht und schreitet, intensiviert die Wahrnehmung für ihren 31 Heiner Müller, zitiert nach dem Programmheft der Uraufführung seiner Übersetzung: Perser, hg. v. Christoph Rüter, Freie Volksbühne Berlin, 1991, S. 14. 32 Zu dieser Szene vgl. auch Matthias Dreyer, „Fremde Zeit. Aischylos’ Perser und die historische Distanz im Theater der Gegenwart“, in: Antike Tragödie heute, hg. v. Erika Fischer-Lichte/Matthias Dreyer, Berlin: Henschel 2007, S. 147-162. 33 „Die Übertragungen von Peter Witzmann […] unterscheiden sich von andern per Tuchfühlung mit den alten Texten. Sie ziehn dem Autor nicht die Uniform der Zeit an wie die gängigen wilhelminischen der Droysen und Wilamowitz und ihrer Nachfolger. Der Gestus des Originals verschwindet nicht in der Information über den Inhalt. Das macht sie dunkel und für flüchtige Leser schwer zugänglich. […] Die Dunkelheit erhellt den Abstand zwischen Aischylos und uns. In der Distanz scheint das Kontinuum menschlicher Existenz auf und im Kontinuum die Differenz.“ Heiner Müller, zitiert nach dem Programmheft: Perser, hg. v. Christoph Rüter, Freie Volksbühne Berlin, 1991, S. 14.
302
MATTHIAS DREYER
gespannten Körper, der nicht in einer Figur aufgeht, und schafft eine besondere Sensibilität für ihre weiche Stimme sowie für die Worte, die aus der gestörten Syntax herausragen. Dabei ist der Betrachter hin und her gerissen zwischen der Gegenwart des Sprechakts und dem präsentierten Text, der auf die Vergangenheit seiner Herkunft verweist.34 Die ästhetische Erfahrung, die hier ermöglicht wird, lässt sich als Fremdheitserfahrung (der Sprache, des darstellenden Körpers, der Situation) beschreiben. Darüber hinaus liegt es nahe, auch der spezifischen Zeitlichkeit dieser Szene nachzugehen. Fraglos vollzieht sich das Bühnengeschehen im Hier und Jetzt, im Deutschen Theater der Gegenwart. Der Kontakt zur ‚Zeit des Zuschauers‘ entsteht zum einen, indem sich die Schauspielerin in Richtung Publikum wendet. Die zeitliche Qualität, die sich in ihrem Sprechen und Gehen entfaltet, entspricht jedoch keineswegs einer linear voranschreitenden Alltagszeit; dominant ist vielmehr eine schwer zu fassende theatrale Eigenzeit: Der Rhythmus der Rede produziert ein stop and go, das den Zeitfluss auf eigenwillige Weise modelliert. Die Langsamkeit in Bewegung und Vortrag schafft durch den Bruch der konventionellen Linearität das Empfinden einer Zeit, die schleppend vergeht, fast stehen bleibt. So lässt sich von einer Präsenz-Erfahrung sprechen;35 und doch ist der Vorgang durch diese Charakterisierung allein nicht angemessen zu beschreiben, denn hier entsteht nicht eine sich selbst genügende, in sich erfüllte Gegenwart. Vielmehr wird das merkwürdige Empfinden erzeugt, dass hier ein Außerhalb der Gegenwart markiert wird, das aber nicht mit einer konkreten Vergangenheit beziehungsweise der Fiktion des Textes zusammenfällt, denn die Zuschauer tauchen nicht in einen fiktiven Zeitraum ein, etwa in das persische Susa zur Zeit der Schlacht bei Salamis. So wird keine Zeitordnung etabliert. Margit Bendokats Verkörperung des Chors lässt sich am ehesten als Zäsur der Historizität verstehen: in Bezug auf den schwer durchdringbaren Text der Antike wird die Absolutheit der Gegenwart überschritten; es konstituiert sich ein vergangener Bezugspunkt, der über die Gegenwart hinausweist, aber nicht repräsentiert oder als dargestellte Zeit szenisch vergegenwär34 Dies macht auch die ästhetische Erfahrung in dieser Szene besonders intensiv, da diese Bewegung eine liminale Erfahrung ermöglicht, die selbst auf die Wahrnehmung zurückverweist. Zur ästhetischen Erfahrung als Liminalitätserfahrung vgl. Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, a.a.O. 35 Wenn auch die Theorien höchst unterschiedlich sind, so besteht ein Minimalkonsens darin, dass Präsenz die Kontinuität der Zeit unterbricht und den Wahrnehmenden in einen Modus ‚außerhalb der linearen Zeit‘ versetzt (sei diese unspezifisch als ein Zeitpfeil von der Vergangenheit in die Zukunft gedacht oder spezifisch als Zeit der Geschichte.) Präsenz-Erfahrung ermöglicht mithin eine Erfahrung von Gegenwart, die sich jenseits einer dramatischen Zeit der Repräsentation entfaltet, sich jedoch nicht mit der alltäglichen Wirklichkeit deckt. Vgl. Erika Fischer-Lichte, „Die Toten kehren zurück. Über die Wahrnehmung von Zeit im Theater“; Hans-Thies Lehmann, „Die Gegenwart des Theaters“, in: Transformationen. Theater der 90er Jahre, Erika Fischer-Lichte/Doris Kolesch/Christel Weiler, Berlin: Theater der Zeit 1999, S. 13-26; Umfassend aufgearbeitet ist der Präsenzdiskurs in Natascha Siouzouli, Wie Präsenz zur Absenz entsteht. Botho Strauß inszeniert von Luc Bondy, Bielefeld: transcript 2007.
ZÄSUR DER TRAGÖDIE
303
tigt wird.36 Die Vergangenheit des Textes ist nicht in die Gegenwart integrierbar und kann daher nicht ohne weiteres als Kontinuum gedacht werden oder in einem dialektischen Verhältnis von Vergangenheit und Gegenwart. So eröffnet Margit Bendokat mit Aischylos Text einen Schwellenraum zwischen Antike und Gegenwart, eine Übergangszeit. In dieser Spaltung der Gegenwart – so lässt sich behaupten – könnten die Toten wiederkehren.
Wiederkehr der Toten Wie aber lässt sich die Zäsur der Historizität näher fassen? Was wird durch sie bewirkt und in welches Verhältnis werden Gegenwart und diese ‚andere Zeit‘ gesetzt? Dies lässt sich an der Boten-Szene der Inszenierung diskutieren: Aus dem Dunkel näheren sich zwei Männer in Trippelschritten und stellen sich vorne an die Rampe in Zentralposition. Es handelt sich um jenes Paar, das vor Beginn der ersten Szene im Gestus von Clowns ihr Vorspiel gezeigt hat, diesmal allerdings gekleidet in zerrissene T-Shirts, die in modernen Farben aus dem Dunkel leuchten. Schulter an Schulter stehen sie da, zum Publikum gerichtet, die Körper angespannt und leicht gebeugt. Eine Zeitlang herrscht Stille, sodass man nichts hört außer ihrem gehetzten Atem. Die Männer sprechen nun gemeinsam, für zwanzig Minuten werden sie sich nicht vom Fleck bewegen. Ihre Stimmen lagern sich übereinander und ergeben einen rauen, leicht scheppernden Klang. Das gesprochene, gedoppelte Wort übt einen faszinierenden Sog aus. Auch hier entsteht eine Qualität des verfremdenden Sprechens, aber nun ist der Text besser verständlich als in der Chor-Szene zuvor. Berichtet wird vom fernen Schauplatz der Schlacht bei Salamis, wo das persische Heer ausgelöscht wurde. Da der gedoppelte Botenbericht nach vorne gerichtet ist und nicht zu Atossa und der Chor-Figur, die seitlich stehen, ist die Ebene der internen Kommunikation weitgehend ausgeschaltet, sodass der Bericht gewissermaßen aus der Anbindung an die Tragödie, der er entstammt, freigesetzt ist. Und dennoch wird klar, dass sich die Rede auch nicht direkt an die Zuschauer richtet, mit denen die Sprecher keine unmittelbaren Blicke suchen. Hier sind jene beiden Männer, die im Vorspiel miteinander im Clinch lagen, im Sprechen vereint. Symbolisch gesprochen klagen beide Konfliktparteien gemeinsam, Perser und Griechen, Freund und Feind. Beeindruckend an der Szene ist jedoch – über dieses dramaturgische Konzept hinaus – der historische Raum, der sich in ihrem Bericht öffnet. Aufgrund der Vortragshaltung der Schauspieler und ihres technisch präzisen, beinahe artistischen chorischen Sprechens, scheint es, als handele es sich nicht um eine individuelle Ansprache, sondern als flösse der Bericht durch die Sprecher hindurch. So werden die Zuschauer zum abwesenden Schlacht36 Ulrike Haß schreibt in ihrer Analyse der Szene – mit Alexander Kluge – von den Möglichkeiten, „den Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit“ abzuwehren. Vgl. Ulrike Haß, „‚Die Perser‘ sprechen“, in: Müller-Schöll/Goebbels, Heiner Müller sprechen, a.a.O., S. 229-239, hier: S. 235.
304
MATTHIAS DREYER
getümmel bei Salamis geführt, aber zugleich wandern die Sinne an andere Orte und Zeiten. Ein Kritiker stellte heraus, dass sich die Männer „auf zwei Zeitebenen“ zu bewegen scheinen, und beschrieb sie als „Zwitterwesen, die gleichzeitig von weit her kommen und doch absolut gegenwärtig sind“37. Damit wird auf die Zeitspanne verwiesen, die der Bericht hervorruft. In diesem Sinne beschreibt eine andere Kritik die evozierte Dauer: dass sich in den Schauspielern „die zweieinhalb Jahrtausende währende Menschheitstragödie in neunzig Minuten verdichte[t]“38. Man könnte argumentieren, das Kriegslied werde universalisiert, sodass nicht ein spezifischer Krieg vermittelt werde (die historische Schlacht bei Salamis oder der 2006 geführte Golfkrieg im Irak), sondern das Leid der Opfer auf beiden Seiten und die Summe der Kriege der menschlichen Spezies.39 Jedoch unterscheidet sich die Szene von einer solchen Klage über universelles Leid, indem sie die Wirklichkeit von Geschichte selbst fassbar macht. Wenn die Boten mit den Worten enden „Das ist alles wahr“, dies dreimal wiederholen und trippelnden Schritts wieder abgehen, so wird ihre Handlung auf fast naive Weise als Akt des Bezeugens evident.40 So ist der Bericht nicht ein retrospektives Eingedenken der Kriegsopfer, sondern öffnet das Theater als Raum für die ‚Wiederkehr der Toten‘ – diese Metapher zumindest klingt in einigen Kritiken an.41 Wenn der alte Diskurs von den TheaterGespenstern hier wieder auftaucht, dann – so scheint es – nicht, weil hier etwas dargestellt, abgebildet, materialisiert würde, sondern weil etwas ausbleibt. Der Topos der Gespenster ist mit einer Ästhetik der Absenz, Leere und Unterbrechung verbunden. Die zwei Sprecher sind nicht selbst die Toten, die erscheinen; vielmehr schafft die Aufführung einen Raum für etwas, das mit der Metapher der Wiederkehr der Toten benannt werden kann: auf der leeren Bühne mit dem weiten Dunkel, das auch die Zuschauer umgibt; in der gedoppelten synchron sprechenden Stimme, die weder den einen noch den anderen hören lässt, sondern einen schrillen Klang, der niemandem wirklich zugehörig zu sein scheint. Wahrnehmbar wird 37 Peter Lauderbach, Süddeutsche Zeitung vom 13.10.2006. 38 Christine Wahl, Tagesspiegel vom 09.10.2006. 39 Vgl. die Perser-Inszenierung (2006) von Theodoros Terzopoulos mit türkischen und griechischen Darstellern, die eine transnationale Klagegemeinschaft bilden (ebenso seine Prometheus-Inszenierung 2010 in Delphi, Istanbul und Essen, die zudem noch deutsche Akteure integriert). 40 Auf den Aspekt des Bezeugens (‚was gesagt werden muss‘) hat auch Ulrike Haß verwiesen. Die Zeugenschaft wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass – anders als bei Aischylos – nicht einer spricht, sondern ein ‚übersubjektiver‘ Chor. 41 „[…] plötzlich klingen die Erzählungen aus der Schlacht wie Gesänge aus dem Totenreich.“ (Peter Laudenbach, Süddeutsche Zeitung). Dass diese Deutung auch im Sinne von Gotscheff und seinem Bühnenbildner Lammert ist, davon zeugen auch Interview-Aussagen: „[...] wir zwingen uns gegenseitig zu reduzieren, damit die Toten reden.“ („Schönheit und Verzweifelung. Dimiter Gotscheff und Mark Lammert im Gespräch mit Gunnar Decker und Harald Müller“, in: Brecht Müller Theater. Brecht-Tage 2009, hg. v. Harald Müller, Berlin: Theater der Zeit 2010, S. 59-76, hier: S. 64).
ZÄSUR DER TRAGÖDIE
305
durch diese Rede jene unsichtbare Masse von Menschen, die sonst weder Sprache noch Sichtbarkeit bekommen kann, aber letztlich jeder Geschichte zugrundeliegt. Damit tritt Vergangenheit (oder Vergangenes) in die Gegenwart ein, Gegenwart selbst erscheint als Moment einer Geschichte von Kriegen, die sich in der Zukunft fortsetzen kann, aber ebenso nach einem Ausweg ruft. So wird die Klage zu einer Anklage und zielt auf das Unerledigte der Vergangenheit. Auf diese Weise ausgestellt, hat der Bericht eine Qualität des Fremden, das beunruhigen kann und – wie Bernhard Waldenfels in seiner Phänomenologie des Fremden schreibt – „worauf wir antworten und zu antworten haben“42.
Die Unterbrechung, die Kontingenz Im Horizont dieser Geschichtlichkeit der Aufführung rückt der Blick besonders auf die Körper. Es entsteht die Frage, inwiefern sie „von der Geschichte durchdrungen“43 sind und welche Kraft ihnen zukommt, Wirklichkeit zu gestalten. Die Körperlichkeit der Protagonisten wird in einem deutlichen Kontrast zur Chorfigur samt ihrer gebückten Dienerhaltung entwickelt: Atossa (Almut Zilcher), die Königsmutter, trägt ein elegantes ‚kleines Schwarzes‘, Highheels und Diamantenschmuck. Der Geist des Dareios (Wolfram Koch), der in der ausweglosen Lage als Berater aus dem Totenreich herbeigerufen wird, erscheint in weißem Hemd und Anzughose sowie als Karikatur eines krakeelenden, wild gestikulierenden Volkstribunen; auf ähnliche Weise auch König Xerxes (Samuel Finzi), der gescheiterte Held, von dessen Montur indes allein die Anzughose mit Hosenträgern und einem nackten Schlips übrig geblieben sind. Gerade im Verhältnis der Chor-Figur zu den Herrschenden werden zeichenhaft Macht-Strukturen demonstriert, etwa wenn Atossa dem Chor eine tiefe Verneigung abverlangt oder Dareios ihn mit einer abschätzigen Bewegung fortschickt. Besonders Dareios, in eingeschränktem Maße auch Xerxes, gerieren sich in ihren Monologpartien zunehmend als überhebliche Machtmenschen. Und dennoch setzt die Darstellung hier keineswegs eindeutige Zeichen. Grundsätzlich ist das Spiel von einer bemerkenswerten Statuarik gezeichnet, auf die sich der letzte Analyseabschnitt richten soll. Fast durchgängig sind die Körper nur wenig bewegt, zuweilen starr – wohlgemerkt nicht schlaff und bewegungslos, sondern gespannt und von starkem energetischen Potenzial. Zwar ist das Statuarische in Inszenierungen der sprachmächtigen griechischen Tragödien ein naheliegendes Mittel, so selbstverständlich beinahe, dass man es als pure Konvention abtun könnte.44 42 Bernhard Waldenfels, Topografie des Fremden. Studien zur Phänomenologie des Fremden 1, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1997, S. 51. 43 Michel Foucault, „Nietzsche, die Genealogie, die Historie“, in: ders., Von der Subversion des Wissens, Frankfurt a. M.: Fischer 1987, S. 75. 44 Wichtig sind etwa die Darstellungstraditionen des Winckelmann‘schen Ideals der antiken Plastik. Man trifft auf das Phänomen des Statuarischen aber auch in anderen Inszenierungen,
306
MATTHIAS DREYER
Hier jedoch wirkt die Körperlichkeit irritierend. Betrachtet werden soll zunächst der Auftritt des Geistes Dareios. Nach einer Drehung der gelben Wand steht der Schauspieler Wolfram Koch, bekleidet mit einer schwarzen Anzughose und weißem Hemd mit Hosenträgern, im hinteren Bühnenbereich mit dem Rücken zum Publikum. Langsam macht er einige Schritte rückwärts auf die Zuschauer zu, wobei er mit seinen Armen gestikuliert, ohne dass konkrete Zeichen lesbar wären. Es beginnt ein Gespräch mit der hinzugetretenen Atossa, wobei beide nach vorne schauen, ohne sich anzusehen. Für gewisse Zeit sprechen sie gewissermaßen ohne psychologische Ausgestaltung, sachte, ohne emotionale Bewegung. Natürlich könnte man dies als Veranschaulichung der irrealen Begegnung eines Geistes mit seiner ehemaligen Gattin lesen;45 zudem ist Dareios fassungslos, wenn sich ihm das vernichtende Schicksal seines Volks erschließt. Dennoch ist die starre Körperlichkeit durch eine psychologische Deutung nicht vollständig erklärbar. Es scheint, dass die Szene, die nicht realistisch ausgestaltet wird, wie in einem Entwurf gehalten ist. Der Zuschauer erlebt eine Figur, die eine konkrete Reaktion unterlässt – und dabei verschiedene mögliche Reaktionen mitführt, zumindest für einige Momente. Um diesen Entwurfscharakter, der in vielen Szenen der Inszenierung gestaltet ist, zu verstehen, lohnt es sich, an die Deutung der Brecht’schen Schauspieltheorie anzuknüpfen. Für ein Theater, das Geschichte als Gestaltungs- und Möglichkeitsraum mitprägt, forderte Brecht seine Schauspieler auf, niemals ganz mit der Figur zu verschmelzen: „Das was er nicht macht, muß in dem enthalten und aufgehoben sein, was er macht.“46 Und an anderer Stelle: „Das historisierende Abbild wird etwas von den Skizzen an sich haben, die um die herausgearbeitete Figur herum noch die Spuren anderer Bewegungen und Züge aufweisen.“47 Eine Weiterentwicklung dieser Versuche, einen verfremdenden ‚Widerspruch im Abbild‘ herzustellen, lässt sich in dem Phänomen einer statischen Präsenz erkennen.48 Die Stillstellung im Statischen, die Zäsuren und Pausen, die den Sprachfluss unterbrechen, sind in diesem Sinne Momente der Öffnung – Versuche, ein Bewusstsein für das Unvorhersehbare und die Kontingenz zu schaffen. Sie lassen gebannt blicken – auch auf das, was sich ereignen könnte.
45 46 47 48
die mit Abstraktion und Reduktion arbeiten (z. B. bei Christoph Marthaler, Michael Thalheimer, Jürgen Gosch und Laurent Chétouane), sodass man die Statik verstehen kann als eine wichtige Signatur des postdramatischen Theaters, das sich von Darstellungskonventionen befreien möchte. Da der durchschnittliche Zuschauer die Tragödie vermutlich nicht kennt und daher nicht weiß, dass es sich um einen Geist handelt, ist dies wenig relevant. Bertolt Brecht, „Kurze Beschreibung einer neuen Technik der Schauspielkunst, die einen Verfremdungseffekt hervorbringt“, in: ders., Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Bd. 22, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1988, S. 641-659, hier: S. 643. Bertolt Brecht, „Kleines Organon für das Theater“, in: ders., Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Bd. 23, S. 65-96, hier: S. 80. Im Unterschied zu der Körperlichkeit in Die Perser sind in Prometheus und Ödipus auch tierhafte Körper anzutreffen.
ZÄSUR DER TRAGÖDIE
307
Ähnliches ist zu beobachten, wenn zum Schluss der tragische Held Xerxes mit nacktem Oberkörper und Schlips erscheint. Allein und verloren steht er im Raum – ein Täter, ein Opfer. Schweigend tritt er dem Tribunal der Zuschauer gegenüber und steht bewegungslos da – ein ‚nackter Mensch‘. Die einzelnen, aus dem Schweigen heraus gesprochenen Sätze, die der Darsteller nun sucht, behandelt er, als ob er sich selbst fragt, was er mit der Sprache anfangen soll. Die verfremdende Art des Sprechens und Spielens verhindert die Einfühlung und emotionale Identifizierung des Zuschauers mit einem etwaigen Schmerz der Helden. Doch anders als bei Brecht geht es nicht darum, alternative Varianten des Plots aufzuzeigen. Der Körper ist in solchen Augenblicken vielmehr in seiner Hilflosigkeit inszeniert; im Ringen mit der Sprache treten Sprache und Körper auseinander. Die Darstellung bringt die opake Eigenheit des Körpers zur Geltung und lässt gewissermaßen das Schweigen unterhalb der Sprache hörbar werden. In diesen Momenten tritt die tragische Spannung des statuarischen Körpers hervor. Man mag ihn lesen als einen Verweis auf die Begrenztheit des Menschen, der über sich selbst und seine Geschichte nicht souverän verfügen kann:49 Das dargestellte Scheitern von Xerxes’ Versuch, sein Reich durch den Feldzug gegen das quantitativ unterlegene Heer Griechenlands auszudehnen, verdeutlicht, wie stark jedes politische Geschehen von Zufällen durchdrungen ist und konfrontiert mit der Unbeherrschbarkeit von Geschichte. Es weist darauf hin, dass Geschichte im modernen Sinn – mit Rancière verstanden als die ‚Macht des gemeinsamen Schicksals‘ – sowohl das umfasst, was die Menschen machen, als auch das, was die Menschen macht, d. h. „das, was ihnen einen spezifischen Stempel aufdrückt, was den Sinn ihrer Handlungen verkehrt und jene, die sich für ihre Urheber hielten, verschlingt“50. Der statische, ohnmächtige, sprachlose Körper deutet in diesem Sinne auf seine Endlichkeit und auf die Unmöglichkeit, den Wandel zu kontrollieren. Doch das ‚Entsetzen des Körpers‘ hat gewissermaßen auch eine Rückseite: Die Starre zersetzt den Handlungsvorgang und lenkt die Aufmerksamkeit auf das theatrale Material des Gestaltens; sie lässt den Körper – unabhängig von der konkreten Aktion – als Gestaltungsinstrument erfahrbar werden. Die in Gotscheffs Inszenierung anzutreffenden statuarischen Körper zeigen daher in ihrer Ohnmacht zugleich die Möglichkeit der Alternative, ohne dass diese ausformulierbar (bzw. gegenwärtig handhabbar) wäre. Sie verweisen auf einen zukunftsgerichteten Möglichkeitsraum, ohne
49 So deutet Nikolaus Müller-Schöll Gotscheffs Ödipus-Inszenierung. Vgl. Nikolaus MüllerSchöll, „‚Unter Undenkbarem wandelnd…‘. Ödipus von Sophokles nach Hölderlin von Müller im Raum von Mark Lammert inszeniert von Dimiter Gotscheff am Hamburger Thalia Theater“, in: Lücken sehen… Beiträge zu Theater, Literatur und Performance. Festschrift Hans-Thies Lehmann zum 66. Geburtstag, hg. v. Martina Groß/Patrick Primavesi, Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2010, S. 165-178. 50 Jacques Rancière, „Die Geschichtlichkeit des Films“, in: Kunst, Fortschritt, Geschichte, hg. v. Christoph Menke/Juliane Rebentisch, Berlin: Kulturverlag Kadmos 2006, S. 69-86, hier: S. 71.
308
MATTHIAS DREYER
eine Utopie zu gestalten. Hier ist es zweifellos angebracht, auf Walter Benjamins Geschichtsdenken zurückzublicken, auf seinen Begriff einer „Gegenwart, die nicht Übergang ist, sondern in der die Zeit einsteht und zum Stillstand gekommen ist“51. Es entsteht die Frage, wie man diesen Raum zwischen dem ‚Denkbaren‘ und dem ‚Möglichen‘ im Fortgang der Inszenierung bewertet. In der radikalen Ambivalenz indes, zwischen dem Wunsch nach Gestaltungsmacht und der Einsicht in einen grundlegenden Mangel an Gestaltungsfähigkeit bzw. Souveränität, artikuliert sich eine zeitgenössische Qualität des Tragischen.
Gestein und Geschichte Überblickt man die bisherigen Analyse-Ergebnisse, so lässt sich Gotscheffs Perser als ein auf Verfremdung beruhendes Modell begreifen, das die Relativität des Gestaltungsvermögens reflektierbar macht. Die Aufführung ist jedoch nicht ad hoc sinnvoll ausdeutbar, sondern erzeugt im Zuschauer eine Ratlosigkeit, indem sie Sprache, Körper, Situationen ausstellt, ohne eine Interpretation nahezulegen. Um die Qualität der daraus resultierenden Hermetik zu beschreiben, kann man auf eine Metapher Heiner Müllers zurückgreifen. Dieser bezeichnete Aischylos’ Sprache, die er in seiner mit Peter Witzmann betriebenen Übersetzung wiederbeleben wollte, als ‚Gesteinsschicht‘52. Solche Assoziationen haben auch Kritiker angesichts Gotscheffs Inszenierung entwickelt, wenn sie das Bühnenobjekt der drehbaren Wand oder die Inszenierung als ganze mit einem Monolithen verglichen,53 oder die gesprochenen Worte mit Meteoriten.54 In Besprechungen der Inszenierungen Gotscheffs kann man seit den 1980er Jahren viele Beispiele für diese geologische Vergleichsebene finden. Die Art der Sprachverwendung produziert die Vorstellung des Textes als eines erratischen Blocks. Dieser Eindruck wird gestützt durch die Gespanntheit der statuarischen Körper. So erscheint die Tragödie als ein distantes, opakes Objekt.55
51 Benjamin, „Über den Begriff der Geschichte“, a.a.O., S. 702. 52 „Früher konnte man da richtig drübergehen, früher hatte die einen Zusammenhang. Jetzt kannst du nur Stücke rausbrechen“ (Programmheft ‚Perser‘, a.a.O., S. 68). 53 Vgl. Hans-Thies Lehmann (wenn auch über die Neuinszenierung der Perser für das Epidauros-Theater) in: Theater der Zeit, Oktober 2009, S. 45. Auch Peter Laudenbach schreibt in seiner Rezension in der Süddeutschen Zeitung vom 13.10.2006, die Inszenierung sei „wie ein schroffer Felsblock oder wie ein Monolith aus Kubricks ‚2001‘: rätselhaft, dunkel und absolut faszinierend“. 54 Vgl. Ulrich Seidler, Berliner Zeitung vom 09.10.2006. 55 Wenn dies auch eine Festigkeit und Starre der dargestellten Inhalte impliziert, gewissermaßen eine Monumentalisierung der tragischen Konflikte, so lässt es zugleich fragen nach dem „utopische[n] Moment, das in der (Vers)Sprache aufgehoben ist wie das Insekt im Bernstein.“ Vgl. Müller, „Brief an den Regisseur der bulgarischen Erstaufführung von ‚Philoktet‘ am dramatischen Theater Sofia“, a.a.O., S. 260.
ZÄSUR DER TRAGÖDIE
309
Betrachtet man die Schauspieler in ihrem Bemühen, mit den Sprachbrocken umzugehen, so kann man sie als Geologen oder Archäologen sehen, als Forscher an der Naturgeschichte des Menschen. Sie versuchen die Sprache gewissermaßen aus dem Fels zu hauen bzw. sich in die opake Fremdheit, in eine verborgene Schicht, ein schwarzes Loch, hineinzubohren.56 Aber ebenso die Rezeptionshaltung der Zuschauer erfordert forschendes Interesse. So bezeichnete Müller seine Texte unter Anwendung jener geologischen Metaphorik als „ein Gestein, ein Material, das je nach dem Einfall des Lichts, je nach Witterung, anders aussehen kann“57. Gotscheffs Perser lässt in diesem Sinne eine Vielfalt an Aspekten in Erscheinung treten und macht verschiedenste historische und subjektive Bezugnahmen möglich. Das ‚hermetische Modell‘ in den Persern verändert daher – im Vergleich zu Brechts aufklärerischem Ansatz, der auf Wiedererkennbarkeit und Vereinfachung beruhte – die Wirkung des Modellhaften, da Wirklichkeit bei Gotscheff schwer abbildbar, d. h. das Interesse an einer Plot-Erzählung gering ist. In der Historizität und Verfremdung erwächst der Eindruck, dass etwas Grundlegendes zu erfassen wäre, während die Inhalte schwer lesbar sind und gewissermaßen im Verborgenen bleiben. Vom Modell als aufklärerischer Abstraktion ist vor allem die reduzierende Form geblieben, die zum Appell wird, sich der Fremdheit der theatralen Zeichen auszusetzen. Die beschriebene Mannigfaltigkeit der Assoziationen sollte indes nicht mit Beliebigkeit verwechselt werden, sondern als ein Versuch, den binären Konflikten der Tragödien-Tradition zu entkommen. Wenn Xerxes sowohl als Opfer des Schicksals wie als verantwortungsloser Täter gesehen werden kann und sich konträre Aspekte in die Inszenierung hineinspiegeln lassen, so schafft die Aufführung eine Art Pattsituation. In der Inszenierung sind verschiedene Möglichkeiten aufgehoben, ohne dass sie selbst für eine Partei ergreife.58 Daher erschließt sich eine interessante Perspektive auf Gotscheffs Theater, wenn man bedenkt, dass die Fülle der Perspektiven zugleich eine ‚Entleerung‘ hervorbringt. Tatsächlich wird in Kritiken zu Gotscheffs Inszenierungen seit den 1980er Jahren immer wieder betont, dass der Regisseur konkrete Interpretationen vermeidet, was die Kritiker häufig mit einer ‚Leere‘ assoziierten.59 Dies lässt an Heiner Müllers Brief an den Regisseur denken, in dem es
56 Franz Wille etwa spricht in seiner Kritik von „unerbittlichen Wortbohrungen“. Vgl. Theater heute 11 (2006). 57 Zit. nach Theresia Birkenhauer, „Die Zeit des Textes im Theater“, in: Dramatische Transformationen. Zu gegenwärtigen Schreib- und Aufführungsstrategien im deutschsprachigen Theater, hg. v. Stefan Tigges, Bielefeld: transcript 2008, S. 247-261, hier: S. 255. 58 Müller spricht von der „absolute[n] Gleichberechtigung von zwei Positionen“ bei Aischylos (Programmheft Perser, a.a.O., S. 77); Ulrike Haß beschriebt ein Prinzip des „UND“, das nicht eine Totalität schafft, sondern ein Nebeneinander, als zentrales ästhetisches Moment der Inszenierung. Vgl. Haß, „‚Die Perser‘ sprechen…“, a.a.O. 59 Vgl. beispielsweise die Kritiken zu Ödipus, 1988 in Basel, oder zu Ödipus, 2009 in Hamburg. Gekoppelt sind diese Beschreibungen daran, dass die Inszenierungen enigmatisch und unverständlich seien.
310
MATTHIAS DREYER
heißt: „Die Tragödie geht leer aus. Ihr Gang verwirft die Tröstung, die ein Aufschub ist. Er transportiert das Nichts, den möglichen Anfang.“60 Gotscheffs Inszenierung der Perser ist in diesem Sinne als ein Endspiel verstehbar. Sie zielt darauf ab, die ewige Wiederkehr des Gleichen zu Ende zu bringen, wobei Drama und Geschichte gewissermaßen in ihre Bestandteile zerfallen. Das bringt uns zurück zu dem, was Foucault als den historischen Sinn beschrieben hat: Dieser ist bestrebt, alles aufzusprengen, was als notwendig und unveränderlich erscheint; er führt „alles wieder dem Werden zu, was man am Menschen für unsterblich gehalten hatte“61. Den sens historique versteht Foucault als Frage nach der Physiologie der Geschichte. In diesem Sinn lassen sich Gotscheffs Perser als eine Rückführung auf den Körper, das Material und die Sinne der Geschichte verstehen: auf die Darsteller-Körper, die sich aus der Verkörperung lösen und andere Verwendungen denkbar werden lassen; auf die ‚Sprachkörper‘, die im Sprechen zersetzt und dabei anders hörbar werden; auf die Zeit, in der Geschichte sich ereignet und die in ihrer Tiefe und Dauer erfahrbar wird. An diesem Nullpunkt fragt die Inszenierung, welche Rollen sich mit diesem entblößten Material – angesichts eines ewigen Wechsels der Ordnungen – werden spielen lassen. Ob ein neuer Anfang möglich sein wird, lässt sie offen. Vermutlich ist der große Erfolg der Inszenierung gerade mit diesem Empfinden der Schwebe verknüpft, diesem Zustand einer Suspension, der utopielos ist, aber die Gegenwart für ein anderes Denken öffnet. Gotscheffs Theater der Entleerung ist in diesem Sinne ein Theater der Zäsur, nicht weil es alles neu macht, sondern weil es die Frage nach der Möglichkeit der Erneuerung stellt.
60 Müller, Werke, Bd. 8, a.a.O., S. 267. Vgl. auch Heiner Müller, „Dialoge gibt es heute nicht mehr“, in: ebd., S. 467-484 und insbesondere seine Überlegung, die im unmittelbaren Umfeld seiner Übersetzung entstand, ebd., S. 475: „Warum gehen die Leute eigentlich noch ins Theater? Das ist noch ein Bedürfnis, offensichtlich, auch eines, was man ernst nehmen muss, doch das Theater kann das Bedürfnis nicht mehr befriedigen, es kann auch eine Leere herstellen, was bestimmte Bedürfnisse angeht, und die Leere ist vielleicht ganz wichtig, und die Leere ist natürlich ein Schock, und da wehrt man sich dagegen. Im Moment sehe ich nichts Produktiveres als im Vakuum, vielleicht auch nur, um kenntlich zu machen, was sowieso da ist.“ 61 Foucault, „Nietzsche, die Genealogie, die Historie“, a.a.O., S. 78.
ZÄSUR DER TRAGÖDIE
311
Literaturverzeichnis Barthes, Roland, Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1985. Benjamin, Walter, Gesammelte Schriften, Bd. 1, hg. v. Rolf Tiedemann/Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1991. —, „Über den Begriff der Geschichte“, in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. I.2, hg. v. Rolf Tiedemann/Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1991, S. 691-704. Bierl, Anton, „Die griechische Tragödie aus der Perspektive von Prä- und Postdramatik. ‚Die Perser‘ des Aischylos und die Bearbeitung von Müller/Witzmann“, in: Heiner Müller sprechen, hg. v. Nikolaus Müller-Schöll/Heiner Goebbels, Berlin: Theater der Zeit 2009, S. 201214. Birkenhauer, Theresia, „Die Zeit des Textes im Theater“, in: Dramatische Transformationen. Zu gegenwärtigen Schreib- und Aufführungsstrategien im deutschsprachigen Theater, hg. v. Stefan Tigges, Bielefeld: transcript 2008, S. 247-261. Brandstetter, Gabriele, Tanz-Lektüren. Körperbilder und Raumfiguren der Avantgarde, Frankfurt a. M.: Fischer 1995. Brecht, Bertolt, „Kleines Organon für das Theater“, in: ders., Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, hg. v. Werner Hecht, Bd. 23, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1988, S. 65-96. Brecht, Bertolt, „Kurze Beschreibung einer neuen Technik der Schauspielkunst, die einen Verfremdungseffekt hervorbringt“, in: ders., Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, hg. v. Werner Hecht, Bd. 22, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1988, S. 641-659. Carlson, Marvin, The Haunted Stage. The Theatre as Memory Machine, Ann Arbor: University of Michigan Press 2001. Derrida, Jacques, Marx’ Gespenster. Der Staat der Schuld, die Trauerarbeit und die neue Internationale, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004. Dreyer, Matthias, „Archiv und Kollektiv. Griechische Tragödien als chorisches Theater bei Einar Schleef, Theatercombinat und Theodoros Terzopoulos“, in: Wissensästhetik. Wissen über die Antike in ästhetischer Vermittlung, hg. v. Ernst Osterkamp, Berlin: Walter de Gruyter 2008, S. 345-368. —, „Fremde Zeit. Aischylos’ Perser und die historische Distanz im Theater der Gegenwart“, in: Antike Tragödie heute, hg. v. Erika Fischer-Lichte/Matthias Dreyer, Berlin: Henschel 2007, S. 147-162. —, Zäsuren der Zeit. Aufführungen griechischer Tragödien seit den 1960er Jahren, Dissertation, Berlin: Freie Universität 2011. Fiebach, Joachim (Hg.), Theater der Welt / Theater der Zeit. Arbeitsbuch, Berlin: Theater der Zeit 1999. Fischer-Lichte, Erika, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004. —, „Die Toten kehren zurück. Über die Wahrnehmung von Zeit im Theater“, in: Möglichkeitsräume. Zur Performativität von sensorischen Wahrnehmungen, hg. v. Christina Lechtermann/ Kirsten Wagner/Horst Wenzel, Berlin: Schmidt 2007, S. 173-181. —, Semiotik des Theaters, Bd. 2: Vom ‚künstlichen‘ zum ‚natürlichen‘ Zeichen. Theater des Barock und der Aufklärung, Tübingen: Narr 1983. —, „Was ist eine ‚werktreue Inszenierung‘? Überlegungen zur Transformation eines Dramas in eine Aufführung“, in: Das Drama und seine Inszenierung, hg. v. dies., Tübingen: Niemeyer 1985, S. 37-64. —, „Zwischen Historizität und Aktualität: Klassiker-Inszenierungen im 20. Jahrhundert“, in: dies., Kurze Geschichte des deutschen Theaters, Tübingen/Basel: A. Francke 1993, S. 373-409.
312
MATTHIAS DREYER
Foucault, Michel, „Nietzsche, die Genealogie, die Historie“, in: ders., Von der Subversion des Wissens, Frankfurt a. M.: Fischer 1987, S. 69-90. Girshausen, Theo, Ursprungszeiten des Theaters. Das Theater der Antike, Berlin: Vorwerk 8, 1999. Grethlein, Jonas, „Variationen des ‚nächsten Fremden‘. Die ‚Perser‘ des Aischylos im 20. Jahrhundert“, in: Antike und Abendland 53 (2007), S. 1-20. Haß, Ulrike, Das Drama des Sehens. Auge, Blick und Bühnenform, München: Wilhelm Fink 2005. —, „‚Die Perser‘ sprechen“, in: Heiner Müller sprechen, hg. v. Nikolaus Müller-Schöll/Heiner Goebbels, Berlin: Theater der Zeit 2009, S. 229-239. Koselleck, Reinhardt, „Wozu noch Geschichte?“, in: Historische Zeitschrift, 212:1 (1970), S. 1-18, wiederabgedruckt in: ders., Vom Sinn und Unsinn der Geschichte. Aufsätze und Vorträge aus vier Jahrzehnten, hg. v. Carsten Dutt, Berlin: Suhrkamp 2010, S. 32-51. Kreuder, Friedemann, Formen des Erinnerns im Theater Klaus Michael Grübers, Berlin: Alexander 2002. Lehmann, Hans-Thies, „Die Gegenwart des Theaters“, in: Transformationen. Theater der 90er Jahre, hg. v. Erika Fischer-Lichte/Doris Kolesch/Christel Weiler, Berlin: Theater der Zeit 1999, S. 13-26. —, Postdramatisches Theater, Frankfurt a. M.: Verlag der Autoren 1999. —, „Zeitstrukturen, Zeitskulpturen. Zu einigen Theaterformen am Ende des 20. Jahrhunderts“, in: Theaterschrift 12 (1997), S. S. 28-46. Marx, Peter W., Theater und kulturelle Erinnerung. Kultursemiotische Untersuchungen zu George Tabori, Tadeusz Kantor und Rina Yerushalmi, Tübingen/Basel: A. Francke 2003. Menke, Christoph/Rebentisch, Juliane (Hg.), Kunst, Fortschritt, Geschichte, Berlin: Kulturverlag Kadmos 2006. Müller, Harald (Hg.), Brecht Müller Theater. Brecht-Tage 2009, Berlin: Theater der Zeit 2010. Müller, Heiner, „Brief an den Regisseur der bulgarischen Erstaufführung von ‚Philoktet‘ am dramatischen Theater Sofia“, in: ders., Werke, Bd. 8, hg. v. Frank Hörnigk, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2005, S. 259-269. —, „Dialoge gibt es heute nicht mehr“, in: ders., Werke, Bd. 8, hg. v. Frank Hörnigk, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2005, S. 467-484. —, Gesammelte Irrtümer, Bd. 2, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1991. —, Werke, Bd. 8, hg. v. Frank Hörnigk, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2005. Müller-Schöll, Nikolaus, „Mitsprechende Erfahrung. Die Biographie, der Apparat und das Problem des Singulären“, in: Heiner Müller sprechen, hg. v. ders./Heiner Goebbels, Berlin: Theater der Zeit 2009, S. 163-174. —, „Theater der Potentialität. Zum Enden der Geschichte im Theater der neunziger Jahre“, in: Theater der Welt / Theater der Zeit. Arbeitsbuch, hg. v. Joachim Fiebach, Berlin: Theater der Zeit 1999, S. 69-74. —, „‚Unter Undenkbarem wandelnd…‘. Ödipus von Sophokles nach Hölderlin von Müller im Raum von Mark Lammert inszeniert von Dimiter Gotscheff am Hamburger Thalia Theater“, in: Lücken sehen… Beiträge zu Theater, Literatur und Performance. Festschrift Hans-Thies Lehmann zum 66. Geburtstag, hg. v. Martina Groß/Patrick Primavesi, Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2010, S. 165-178. Nancy, Jean-Luc, Nach der Tragödie. In memoriam Philippe Lacoue-Labarthe, Stuttgart: Legueil 2008. Niessen, Carl, Handbuch der Theater-Wissenschaft, Bd. 1.2: Ursprung des asiatischen und griechischen Dramas aus dem Toten- und Ahnenkult, Emsdetten: Lechte 1953. Pavis, Patrice, „Klassischer Text und szenische Praxis. Überlegungen zu einer Typologie zeitgenössischer Inszenierungsformen“, in: ders., Semiotik der Theaterrezeption, Tübingen: Narr 1988, S. 187-198.
ZÄSUR DER TRAGÖDIE
313
Rancière, Jacques, „Die Geschichtlichkeit des Films“, in: Kunst, Fortschritt, Geschichte, hg. v. Christoph Menke/Juliane Rebentisch, Berlin: Kulturverlag Kadmos 2006, S. 69-86. Rokem, Freddie, Performing History. Theatrical Representations of the Past in Contemporary Theatre, Iowa: University of Iowa Press 2000. Rüter, Christoph (Hg.), Perser (Programmheft), Berlin: Freie Volksbühne Berlin 1991. Siegmund, Gerald, Theater und Gedächtnis. Semiotische und psychoanalytische Untersuchungen zur Funktion des Dramas, Tübingen: Narr 1996. Siouzouli, Natascha, Wie Präsenz zur Absenz entsteht. Botho Strauß inszeniert von Luc Bondy, Bielefeld: transcript 2007. Ubersfeld, Anne, Lire le theatre, Paris: Éditions sociales 1977. Vernant, Jean-Pierre, „The Historical Moment of Tragedy in Greece: Some of the Social and Psychological Conditions“, in: ders./Pierre Vidal-Naquet: Myth and Tragedy in Ancient Greece, New York: Zone Books 1988, S. 23-28. Waldenfels, Bernhard, Topografie des Fremden. Studien zur Phänomenologie des Fremden 1, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1997. Warstat, Matthias, „Ausnahme von der Regel. Zum Verhältnis von Theater und Gesellschaft“, in: Strahlkräfte. Festschrift für Erika Fischer-Lichte, hg. v. Christel Weiler/Jens Roselt/Clemens Risi, Berlin: Theater der Zeit 2008, S. 116-133. —, Krise und Heilung. Wirkungsästhetiken des Theaters, München: Wilhelm Fink 2010. Weiler, Christel, „‚Verzeihung, sind Sie Jude?‘. Über einen möglichen Umgang des Theaters mit Geschichte“, in: Theater seit den 60er Jahren. Grenzgänge der Neo-Avantgarde, hg. v. Erika Fischer-Lichte/Friedemann Kreuder/Isabel Pflug, Tübingen/Basel: UTB 1998, S. 375-387.
TOBIAS REES
Diesseits von Ethnos: Über die heutige Möglichkeit einer ‚neuen‘ Begegnung zwischen Anthropologie und Theater I. Am Anfang standen Gespräche (etwa der Austausch zwischen Victor Turner und Richard Schechner über die Ndembu), Experimente (Jerzy Grotowskis Experimentaltheater), Entwürfe (Eugenio Barbas Jenseits der schwimmenden Inseln) und Expeditionen in ferne Länder (Peter Brooks Reisen durch Indien und Afrika). Die Begegnung von Anthropologie und Theater hat ihre ganz eigenen mythischen Urpsrungsszenen. Die in ihnen gebannte (und immer noch von ihnen ausgehende) Faszination ist das Ergebnis einer in den frühen 1970er Jahren neu entdeckten Verwandtschaft – zwischen den Ritualen exotischer, in der Ferne lebenden Gesellschaften (etwa den zentralafrikanischen Ndembu), die das tägliche Brot der Anthropologen waren, und den modernistischen Theaterperformances der Avantgarde. Nach gut vierzig Jahren hat die Entdeckung kaum etwas von ihrer Faszination eingebüßt: Könnte es sein, dass es zwischen dem Nicht-Modernen und dem Modernen eine direkte Entsprechung gibt? Zwischen den Ritualen der kleinen, weitab liegenden Gesellschaften, die von Anthropologen untersucht wurden, und den avantgardistischen Theaterperformances in den Metropolen Europas und Nordamerikas? Eine Entsprechung, die spielerisch einen Raum diesseits der scheinbar unüberwindlichen Differenzen eröffnet, den das vermeintlich Vormoderne vom vermeintlich Modernen trennt? Der Versuch auf diese Fragen Antworten zu finden – nicht zuletzt, um neue Fragen aufzuwerfen – glich dem Versprechen einer für alle Beteiligten fruchtbaren Zukunft. Im Gespräch über einengende Fachgrenzen hinweg wollten sich Anthropologen, Theaterwissenschaftler und Dramaturgen gegenseitig bereichern: Sollte man Rituale nicht mit den Methoden der Theaterwissenschaftler analysieren? Sind Theatertheorien der Schlüssel zu ihrem Verständnis? Könnte man Stücke nicht besser machen, indem man sie als Rituale inszeniert? So, dass Dramaturgen von Ethnografen – oder den Ethnografierten – lernen? Und könnte man dann nicht die Theaterbühne zu ethnografischen Zwecken nutzen? Etwa derart, dass das, was in einem Stück aufgeführt wird, sprichwörtlich ein Ethnos ist? Aber wie würde das Publikum dann die fremde Lebensform verstehen? Ist ‚Verstehen‘ primär eine körperliche Kategorie? Was würde daraus wiederum für das Theater folgen? Diese und ähnliche Fragen wurden zum Gründungsdokument der Theateranthropologie. Sie definiert Menschen als ausdrucksfähige, performative Tiere und betrachtet das ‚Verstehen‘ als eine körperliche Tatsache – zwei Beschreibungen, die
316
TOBIAS REES
eine Generation von Theateranthropologen immer wieder aufs Neue erprobt haben, sei es in der Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Aufführungen, sei es im Versuch Kathakali und Nō mit ethnografischen Ritualbeschreibungen und katholischen Messen zu vergleichen. So faszinierend das Gespräch zwischen Anthropologie und Theater ist – in diesem Essay gehe ich der Frage nach, ob man sich heute nicht ein ganz anderes, neues Gespräch vorstellen kann, vielleicht sogar muss. Ist heute eine neue Begegnung von Theater und Anthropologie möglich? Neu in dem Sinne, dass sie sich in einem ganz anderen Raum entfaltet als dem des etablierten, klassischen Austauschs? Neu in dem Sinne, dass sie sich in einem anderen, emergenten und daher gedanklich und begrifflich erst noch zu erfassenden Raum ereignet? Was es für mich, als Anthropologen, notwendig macht diese Fragen zu stellen, ist die jüngere Entwicklung meines Faches. Die Anthropologie hat sich während der letzten zwei Jahrzehnte weitgehend von ihrem einstigen ethnologischen, auf das Studium fremder Völker hin ausgerichteten Selbstverständnis entfernt. Heute, zumal auf internationaler Ebene, definiert sich die Anthropologie kaum mehr als Wissenschaft des Exotischen. Sie ist nicht mehr primär Ethnologie, das Studium marginaler Völker, ihrer sozialen Strukturen und kulturellen Muster, die genau deshalb interessant sind, weil sie (noch) jenseits der Moderne liegen. Nicht nur haben Anthropologen die gedanklichen Voraussetzungen ihrer erkenntnisleitenden Interessen einer grundlegenden, sowohl politischen wie auch ästhetischen Kritik unterworfen – einer Kritik, die versucht hat das ethnografische Projekt der klassischen Moderne als eine Illusion sichtbar werden zu lassen. Im Anschluss an diese Kritik haben sie sich auch in neue Forschungsfelder vorgewagt, die weit ab von den ehemals das Fach definierenden Fragestellungen liegen. Daraus folgt, dass sich ein Großteil der Anthropologie von dem entfernt (vielleicht sogar distanziert) hat, was einst ihr eigentlicher Beitrag zum Gespräch mit Theaterwissenschaftlern und Dramatikern war – das Wissen um das Vormoderne, um Rituale. Kurz: Die Anthropologie vollzog einen tiefgreifenden, ihr Selbstverständnis neu ausrichtenden Wandel, der für mich die Frage aufwirft, ob heute ein neuer, anderer Austausch zwischen Anthropologie und Theater möglich ist. Um meinen Teil zu einer ‚neuen‘ Begegnung beizutragen, werde ich eine Skizze der jüngeren Geschichte der Anthropologie bieten, die zwangsläufig provisorischen Charakter hat – ‚die Eule der Minerva fliegt erst in der Dämmerung‘. Ich richte mein Hauptanliegen dabei auf das Entstehen einer neuen, gewissermaßen philosophischen Anthropologie (des Denkens), die sich als Anthropologie ohne – oder diesseits von – Ethnos bezeichnen lässt. Die gebotene Skizze besteht aus drei Teilen. Zunächst werde ich kurz die Kritik der 1970er und 1980er Jahre Revue passieren lassen, die das ethnografische Projekt in seiner klassischen Ausprägung in Frage gestellt hat. In einem zweiten Schritt versuche ich nachzuzeichnen, wie diese Kritik die Bedingungen für die Möglichkeit einer neuen, eher philosophisch ausgerichteten Anthropologie schuf, um dann – drittens – einen Überblick über die Maximen und Leitlinien dieser neuen, philoso-
DIESSEITS VON ETHNOS
317
phischen Anthropologie zu geben (wobei mich hier gerade der radikale Bruch mit den soziokulturellen Großprojekten der als Ethnologie praktizierten Anthropologie interessiert, die das zwanzigste Jahrhundert dominiert haben). Meine Hoffnung ist, dass eine Skizze dessen, was ich philosophische Anthropologie (des Denkens) zu nennen vorschlage – bzw. des offenen (Denk-) Raumes, in dem sie sich entfaltet – ein Echo unter Theaterwissenschaftlern und Dramaturgen findet und damit zum Beginn einer ‚neuen‘ Begegnung zwischen Theater und Anthropologie beitragen kann.
II. Rückblickend muss man festhalten, dass das ethnografische Projekt der Moderne, wie es einst die Anthropologie definierte, in den späten 1980er Jahren an sein Ende gelangt ist. Ich schreibe ‚rückblickend‘, weil das Ende der traditionellen Ethnografie – so seltsam das klingen mag – von niemandem beabsichtigt war und folglich auch von niemandem erwartet wurde. Es ließ sich nur ‚rückblickend‘ (und nicht ohne Erstaunen) feststellen. Bereits in den 1970er Jahren geriet das ethnografische Projekt so, wie es Bastian und Ratzel in Deutschland entwarfen (oder Boas und seine Schüler in den USA; Haddon, Rivers, Malinowski und Radcliffe-Brown in Großbritannien; und Durkheim, Mauss und Lévy-Bruhl in Frankreich) in die Kritik. Ziel der vor nunmehr vierzig Jahren erstmals aufgekommenen kritischen Stimmen war es die ethnografische Darstellung jener fernen Anderen, die Anthropologen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts systematisch untersuchten, sowohl ‚poetisch‘ als auch ‚politisch‘ zu erneuern und dadurch zu verbessern.1 Eine neue Generation von Anthropologen, deren erste Feldforschung inmitten der Wirren der Entkolonialisierung fiel, machte es sich zur Aufgabe die ‚Fehler‘ der großen Ethnografen der Vergangenheit – die größtenteils in ihrer Verstrickung im Kolonialismus gesehen wurden – zu korrigieren. Für meine Zwecke ist es an dieser Stelle nicht nötig den Verlauf der vielstimmigen Kritik der 1970er und 80er Jahren genau nachzuzeichnen.2 Es genügt stattdessen die beiden Ereignisse in den Blick zu nehmen, die rückblickend den Anfang vom Ende der traditionellen Ethnografie markieren – einerseits die Kritik an der Geschichtsphilosophie, mit der die Anthropologie seit dem Aufkommen des Begriffs ‚Ethnografie‘ im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts unauflöslich verflochten
1 Vgl. George Marcus/James Clifford, Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, Berkeley: The University of California Press 1986. 2 Für einen Versuch in dieser Richtung vgl. Tobias Rees, „Today, What is Anthropology?“, in: Paul Rabinow/George Marcus/James Faubion/Tobias Rees, Designs for an Anthropology of the Contemporary, Durham: Duke University Press 2008, S. 1-12.
318
TOBIAS REES
war, andererseits das Bemühen, die anthropologische Forschung jenseits der von der Geschichtsphilosophie aufgemachten ‚great divides‘ neu anzusiedeln.3 Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts brachte eine ‚Verzeitlichung‘ der bis dahin weitgehend ‚räumlich‘ gedachten Differenz menschlicher Lebensformen. Hintergrund dieser Entwicklung war vor allem die seit 1700 stark zunehmende Zahl von gedruckten Reiseberichten in denen, wenn auch zumeist spärlich und fantastisch, fremde Lebensweisen beschrieben wurden. Dokumentiert wurde eine wirre, oft verwirrende Vielfalt des In-der-Welt-Seins, die interessierte Leser vor die Frage stellte, wie man diese unterschiedlichen Völker und ihre Daseinsformen sinnvoll ordnen könnte.4 Die Aufklärung antwortete auf diese Herausforderung mit der Erfindung eines neuen Genres – der Geschichtsphilosophie. So unterschiedliche Autoren wie Turgot, Voltaire, Condorcet oder Herder machten sich an das Verfassen von Menschheitsgeschichten, in denen sie die Völker der Welt entlang einer Achse anordneten, die von jenen anderen, die ‚noch immer‘ ab originem lebten (die Vor-Modernen – ‚lebende Fossilien‘, wie Edward Burnett Tylor sie später nennen sollte), zu jenen Europäern führte, die ‚bereits‘ in der Geschichte vorangeschritten und damit im Hier und Jetzt angekommen waren (die Modernen). Für das Entstehen der Anthropologie war das Aufkommen einer europäischen Geschichtsphilosophie ein konstitutives Ereignis. Die der Geschichtsphilosophie inhärente Unterscheidung zwischen den (noch) Vormodernen und den (schon) Modernen schuf erst die Bedingung der Möglichkeit einer (wissenschaftlichen) Disziplin wie der Ethnografie – die Möglichkeit einer Disziplin, die sich durch ihr modernes Fachwissen über diejenigen definierte, die noch in einer vormodernen Vergangenheit lebten: Die Anthropologie entstand als ‚Wissenschaft‘ der Völker ohne Geschichte, als Wissenschaft derjenigen, die ‚noch‘ in einem Kosmos lebten, noch mythisch argumentierten, noch rituell handelten – und ohne Wissenschaft, Technik und Staat waren. Die Kritik der 1970er und 1980er Jahre versuchte den Nachweis zu bringen, dass viele Ethnografen – auch wenn sie sich längst gegen den Gedanken vom ‚Primitiven‘ oder ‚Vormodernen‘ ausgesprochen hatten – doch nach wie vor geschichtsphilosophisch dachten, ja dass sie in ihren ethnografischen Texten den zeitlichen Abstand, den sie ja aufheben wollten, immer wieder aufs Neue herstellten, etwa indem sie geschichtsphilosophisch kodierte Begriffe wie Kosmos, Mythos oder Ritual verwendeten, um fremde Gesellschaften zu beschreiben (oder indem sie von Gesellschaften ohne Staat, ohne Wissenschaft, mit geringer Naturbeherrschung etc. berichteten). Kurz: Die Ethnografen der klassischen Moderne bestätigten bestän-
3 Vgl. Jack Goody, The Domestication of the Savage Mind, Cambridge: Cambridge University Press 1977. 4 Ich folge hier den Studien von Michael Harbsmeier, Wilde Völkerkunde: Andere Welten in deutschen Reiseberichten der frühen Neuzeit, Frankfurt a. M./New York: Campus 1994; Justin Stagl, A History of Curiosity: The Theory of Travel, 1550-1800, London: Routledge 1995.
DIESSEITS VON ETHNOS
319
dig, was sie sich zu kritisieren vorgenommen hatten: die Annahme, dass die Anderen primitiv, vormodern etc. seien.5 Der Versuch die Ethnografie jenseits dessen neu zu erfinden, was Johannes Fabian die ‚Verweigerung von Gleichzeitigkeit‘ nannte – die Anonymisierung der im Feld gefundenen Zeitgenossen, denen man eben diese Zeitgenossenschaft versagte und sie stattdessen in der europäischen, vormodernen Vergangenheit verortete – bestand im Wesentlichen darin, Wege des Forschens und Schreibens zu finden, die die Ethnografie über die ‚great divides‘ der Geschichtsphilosophie hinweg heben würden. Den zunächst vielleicht wirkungsmächtigsten Versuch dies zu erreichen sah man im Verfassen von historisch ausgerichteten Ethnografien, in denen sorgfältig die ‚weltgeschichtliche‘ Teilnahme fremder Gesellschaften dokumentiert wurde (ein Versuch die Illusion vom ‚geschichtslosen Anderen‘ zu untergraben).6 Eine weitere gängige Reaktion bestand im Versuch, das ethnografische Schreiben durch Textstrategien zu bereichern, die den unmittelbaren Eindruck von Gleichzeitigkeit erzeugen können – etwa indem man die bis dato anonymen, oft nur im Kollektiv beschriebenen Anderen individualisierte und konkret benannte; indem man sie in den Texten selbst zu Wort kommen ließ; durch die Beigabe von Fotografien; durch Co-Autorenschaft. Selbstbewusst begannen Ethnografen mit Formen des Schreibens zu experimentieren – ein ‚experimentelles Moment‘, das zu einer Fülle von selbstreflexiven, dialogischen und polyphonen Texten führte.7 (Auch die Theateranthropologie nahm hier ihren Ursprung. Insofern sie die Deutung von Ritualen für Interpretationen jenseits strukturell funktionaler Erklärungen öffnete und auch insofern, als sie versuchte Ethnografien als Theaterstücke zu inszenieren, ist sie als ein Produkt der experimentellen Suche nach neuen ethnografischen Formen zu verstehen.) Im Schatten dieser zwei in den 1980er Jahren sicherlich das Fach dominierenden ‚Rettungsversuche‘ formulierten einige wenige Anthropologen – etwa Paul Rabinow und Marilyn Strathern, aber auch Margaret Lock, Emily Martin oder Allan Young – ein ganz anderes Programm, um die Anthropologie aus dem geschichts5 Vgl. Fritz Kramer, Verkehrte Welten: Zur Imaginären Ethnographie des 19. Jahrhunderts, Frankfurt a. M.: Syndikat 1977; Johannes Fabian, Time and The Other: How Anthropology Makes its Objects, New York: Columbia University Press 1982. 6 Beispielhafte Bemühungen darum, eine historische Dimension in die Ethnografie einzuführen, waren Eric Wolf, Europe and the People Without History, Berkeley: University of California Press 1982; Renato Rosaldo, Ilongut Headhunting: A Study in Society and History, Stanford: Stanford University Press 1980; Richard Price, First Timer: The Historical Vision of an African American People, Baltimore: Johns Hopkins University Press 1982. 7 Vgl. zum Beispiel Paul Rabinow, Reflections on Fieldwork in Morocco, Chicago: University of Chicago Press 1977; Vincent Crapanzano, Tuhami: Portrait of a Moroccan, Chicago: University of Chicago Press 1985; Kevin Dwyer, Moroccan Dialogues: Anthropology in Question, Baltimore: Johns Hopkins Press 1982. „Experimentell“ bezieht sich hier auf George Marcus/ Michael Fischer, Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences, Chicago: The University of Chicago Press 1986.
320
TOBIAS REES
philosophischen Dilemma der traditionellen Ethnografie heraus zu führen. War dieser ‚dritte Weg‘ zunächst kaum von Bedeutung, so entwickelte er sich doch rasch in eine breite, unterschiedliche Theorielager umfassende Bewegung, die das ganze Fach in eine neue, unerwartete Richtung führte, die kaum noch etwas mit den bis dahin maßgebenden Fragen und Forschungsfeldern zu tun hatte. Über viele Jahre hinweg, so ließe sich die Argumentation des ‚dritten Weges‘ rückblickend zusammenfassen, haben Ethnografen sich vergeblich bemüht darzulegen, dass die sogenannten ‚Primitiven‘ nicht ‚primitiv‘ sind, dass es keine ‚geschichtslosen‘ Völker gibt, dass wir in Wahrheit gleichzeitig mit den vermeintlich Anderen leben. Vielleicht wäre es daher sinnvoll nun einen ganz anderen (aber komplementären) Weg einzuschlagen und sich zu fragen: ‚Sind wir denn überhaupt jemals modern gewesen?‘ Um einen Eindruck des kritischen Impulses zu vermitteln, der diese Frage Mitte der 1980er Jahre für viele faszinierend machte, zitiere ich eine Passage aus Paul Rabinows Beitrag zum Sammelband Writing Culture: „We have to anthropologize the West. We have to show how exotic its constitution of reality has been: emphasize those domains most taken for granted as universal; make them seem as historically peculiar as possible; show how their claims to truth are linked to social practices and have hence become effective forces in the social world.“8
Als diese Zeilen 1986 erstmals veröffentlicht wurden, konnte man sie auf ganz unterschiedliche Weise deuten (und eben darin lag wohl die Kraft des Appells). Bedeutete er für die einen eine ethnografische Kampfansage an die Hegemonie und Ideologie der westlichen Wissenschaft und Medizin, hörten andere die Aufforderung den ethnografischen Nachweis zu erbringen, dass diejenigen Institutionen, die unsere vermeintliche Moderne (Wissenschaft, Technik, Medizin) konstituieren, ebenso kulturspezifisch, ebenso sozial konstruiert seien wie Mythen und Rituale. Wieder andere sahen in Rabinows Essay schlicht das Vorhaben die Moderne als eine besondere, ja faszinierende Denkform zu verstehen, die man in ihrer Eigenart erforschen sollte. Erinnert man in diesem Zusammenhang an Bruno Latours 1991 erschienenes Werk Nous n’avons jamais été modern (dt. Wir sind nie modern gewesen), wird deutlich, wie nah sich Anthropologie, kritische Theorie, Wissenschaftsforschung, Literaturkritik, Feminismus oder Kulturwissenschaft in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren waren. Gemeinsam mobilisierte man gegen eine epochal verstandene Moderne, bevor man sich über der Frage, wie diese denn nun genau zu kritisieren sei, überwarf und wieder voneinander distanzierte.
8 Paul Rabinow, „Representations are Social Facts: Modernity and Post-Modernity in Anthropology“, in: Writing culture: the poetics and politics of ethnography: a School of American Research advanced seminar, hg. v. James Clifford, Berkeley: University of California Press 1986, S. 234-261, hier: S. 241.
DIESSEITS VON ETHNOS
321
Auch hier ist es nicht nötig sich in die konkreten Umstände interdisziplinärer Ereignisse zu vertiefen und detailliert nachzuzeichnen, wie die ersten, noch etwas unbeholfenen ‚Ethnografien des Westens‘ allmählich und über Umwege zu der Anthropologie führten, die heute in den großen Forschungsuniversitäten (zumindest in Nordamerika) vorherrschend ist.9 Für meine Argumentation genügt es mir hier auf zwei Entwicklungen hinzuweisen. Erstens: In den späten 1980er und frühen 1990er Jahren machten sich Anthropologen daran ‚Felder‘ zu erforschen, die man bis dahin jenseits anthropologischer Expertise und auch jenseits der für die Anthropologie formgebenden Interessen liegend betrachtet hatte, allen voran moderne Wissenschaft, Medizin und Technologie. Zweitens: Im Lauf der 1990er Jahre wurde diese, nach anthropologischen Standards ‚exotische‘ Erforschung von Laboren und anderen Zitadellen der Moderne – und das hatte kaum jemand vorhergesehen – zu einem der wichtigsten und innovativsten Forschungszweige der Anthropologie.10 Die Folge dieser unvorhergesehenen Entwicklung war ein tiefgreifender, noch lange nicht abgeschlossener Wandel des intellektuellen Selbstverständnisses der Anthropologie, der sich besonders in der seit Mitte der 1990er Jahre ausgebildeten Anthropologen-Generation niederschlug – denn diese Generation wurde (als erste) nicht mehr in den Begriffen der traditionellen Ethnografie geschult und betrieb größtenteils keine klassische Feldforschung mehr. Ihre Arbeiten lösten sich fast gänzlich von dem ehemals zentralen Interesse an segmentären Abstammungslinien, Ritualen, Gabentausch oder mythischen Strukturen – alles Themen, die noch in den 1980er Jahren die Anthropologie dominierten und heute fast völlig aus Fachzeitschriften verschwunden sind (heute wird diese neue Anthropologie oft als ‚Anthropologie des Zeitgenössischen‘ bezeichnet).11 9 Ich verweise hier auf die frühen Laborethnografien von Sharon Traweek, Beamtimes and Lifetimes, Cambridge: Harvard University Press 1988; Hugh Gusterson, Nuclear Rites, Berkeley: University of California Press 1998; Paul Rabinow, Making PCR: A Story of Biotechnology, Chicago: University of Chicago Press 1996; Emily Martin, The Woman and the Body, Boston: Beacon Press 1989. 10 Selbstredend haben Anthropologen auch schon vor den 1990er Jahren ‚zu Hause‘ gearbeitet, Lloyd Warner zum Beispiel. Allerdings zeichneten sich diese frühen Arbeiten – in deutlichem Kontrast zu zeitgenössischen Arbeiten – durch den Versuch aus, marginale Gruppen der eigenen Gesellschaft mit den klassischen Begriffen der Anthropologie zu studieren. 11 Der Ausdruck ‚Anthropologie des Zeitgenössischen‘ wurde von Paul Rabinow eingeführt. Vgl. dazu Paul Rabinow, French DNA: Trouble in Purgatory, Chicago: University of Chicago Press 1999. Der Begriff des ‚Zeitgenössischen‘ zeigt den Versuch an, die Gegenwart (oder einen Aspekt derselben) als ein ‚Assemblage‘ zu denken – als zusammengefügt aus verschiedenen Elementen, die alle unterschiedliche historische Zeitläufe haben, die sich in der Gegenwart überschneiden. Folglich sind diese Elemente einander ‚Zeit-Genossen‘. Entnommen hat Rabinow den Begriff des Zeitgenössischen wie auch den Begriff der Assemblage einem Interview, das Bruno Latour mit Michel Serres geführt hat (wenngleich bei Rabinow Deleuzes und Guattaris Begriff des agencement und Foucaults Konzept der actualité nachhallen): „Welche Dinge sind zeitgenössisch? Betrachten wir ein neues Automodell. Es ist eine disparate Gesamtheit der wissenschaftlichen und technischen Lösungen aus verschiedenen Epochen. Man kann es Komponente für Komponente datieren: Dieser Teil wurde um die Jahr-
322
TOBIAS REES
Einen Eindruck davon, wie grundstürzend die Veränderungen des anthropologischen Denkens und Tuns in der Tat sind, vermittelt die intensiv, zuweilen polemisch diskutierte Frage, wie man das begriffliche Werkzeug, die das Fach seinen Vertretern einst zur Verfügung gestellt hat, gedanklich neu ausrichten müsste, damit es den neueren Arbeiten nützlich sein kann – und ob das überhaupt möglich (oder wünschenswert) ist.12 Hintergrund dieser Debatte ist die Feststellung, dass die ‚alten‘ Begriffe, die die Anthropologie einst jenen zur Verfügung stellte, die Ethnien aufsuchten, um ihre Kultur und Gesellschaftsstruktur zu analysieren, für die Untersuchung jener ‚neuen‘ Bereiche, die Anthropologen heute größtenteils studieren, weitgehend unbrauchbar sind. Wie erforscht man eigentlich eine HIV-Epidemie? Und wie klinische Versuche an Krebspatienten? Was ist interessant an der, sagen wir, Plastizität des Erwachsenengehirns? Was an der Pharmakogenomik? Und was an neoliberaler Städteplanung? Die Anthropologie findet sich seit den späten 1990er Jahren in einer neuen, noch weitgehend undefinierten Situation wieder, die von Praktikern intensiv – mit Ressentiment, Polemik, Leidenschaft – diskutiert wird, eine Diskussion, die geprägt ist von dem deutlichen Gefühl, dass das Fach einer Erneuerung bedarf: Neue Forschungsbereiche brachten die Notwendigkeit mit sich, neue anthropologische Erkenntnisinteressen zu formulieren, neues Handwerkszeug, neue Denkweisen und Forschungsdesigns. Diese Findungsphase scheint – aus heutiger Sicht – kaum abgeschlossen. Noch immer experimentieren Anthropologen mit neuen Fragestellungen und Forschungsdesigns – und inmitten dieses Experimentierens stellte man auf einmal, und nicht ohne eine gewisse Trauer, fest, dass das ethnografische Projekt der klassischen Moderne aufgehört hatte zu existieren. Was als eine anthropologische Kritik auf die geschichtsphilosophischen Antinomien der klassischen modernen Ethnografie begann, wuchs sich zu einer Anthropologie aus, die sich genau von dieser klassischen modernen Ethnografie entkoppelt hat. hundertwende erfunden, ein anderer vor zehn Jahren, und Carnots Kreisprozess ist fast 200 Jahre alt. [...] In seiner Gesamtheit ist es nur durch die Zusammenfügung zeitgenössisch, durch sein Design, seine Ausführung.“ In ähnlicher Weise lässt sich die Gegenwart als ein Assemblage begreifen. Solche Assemblages sind fortwährend in Bewegung und also Veränderungen unterworfen – meist in Form von kleinen Mutationen, in deren Verlauf einige Elemente an den Rand gedrängt werden (oder ganz aus dem Assemblage herausfallen), während andere, die vorher eher marginal waren, plötzlich eine zentrale Stellung einnehmen. Es können auch ganz neue, Anordnung und Dynamik des Assemblages verändernde Elemente hinzukommen. 12 Für einen Überblick über diese Debatten vgl. Rabinow u. a., Designs for an Anthropology of the Contemporary, a.a.O. Für die Diskussion allein um den Feldbegriff vgl. Akil Gupta/James Ferguson (Hg.), Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science, Berkeley: University of California Press 1997; George Marcus, Ethnography through Thick and Thin, Princeton: Princeton University Press 1998; Paul Rabinow, Anthropos Today: Reflections on Modern Equipment, Princeton: Princeton University Press 2003.
DIESSEITS VON ETHNOS
323
III. Eine der aufregendsten intellektuellen Folgen der empirischen und begrifflichen Neuausrichtung der Anthropologie war – so möchte ich behaupten und damit zum Hauptteil meines Essays übergehen – die Entstehung der Möglichkeit einer sich eher philosophisch orientierenden Anthropologie. Um zu erklären, was ich unter ‚philosophischer Anthropologie‘ verstehe und inwieweit ihr Möglichwerden das Resultat des oben beschriebenen Wandels ist, möchte ich den ihr zugrundeliegenden Anthropologiebegriff demjenigen der klassischen Ethnografie gegenüberstellen. Denn gerade auf der Ebene der Konzeptualisierung dessen, was Anthropologie ist, ist die Möglichkeit einer philosophischen, auf Feldforschung beruhenden Anthropologie ein Ereignis.13 Das ethnografische Projekt der Moderne war nicht auf die Erforschung von Anthropos sondern von Ethnos ausgerichtet. Dennoch war die Ethnografie ein anthropologisches Forschungsunternehmen – allerdings eines, das in der Annahme gründete, die für die Anthropologie konstitutive Frage – Was ist der Mensch? – sei bereits beantwortet. Erst diese Annahme machte die Forschungspraxis der Ethnografie möglich, was besonders deutlich wird, wenn man sich den zwei wirkungsmächtigsten ‚Antworten‘ zuwendet, mit denen Ethnografen gearbeitet haben – ‚Kultur‘ und ‚Gesellschaft‘.14 Menschen, so argumentierten ‚Sozial‘-Anthropologen, sind ‚soziale‘ Wesen. Alles, was Menschen tun, ist in gesellschaftliche Strukturen eingebettet – nichts ‚Menschliches‘ kann außerhalb des Sozialen existieren. Die Herausforderung für Sozialanthropologen besteht folglich darin, die Welt zu bereisen und die auf ihren Reisen aufgefundenen Gesellschaftsstrukturen ethnografisch zu dokumentieren (immer das Ideal einer die Welt erschöpfenden Bestandsaufnahme vor Augen) und andererseits zu zeigen, dass allein das genaue Verständnis der jeweiligen Gesellschaftsstruktur der wahre Schlüssel zum Verständnis der Daseinsform eines Volkes ist. In ähnlicher Weise haben ‚Kultur‘-Anthropologen vorausgesetzt, der Mensch sei ein ‚kulturelles‘ Wesen. Sie definieren ihn als Sinnproduzenten, als in selbst gestifteten Sinnzusammenhängen verstricktes Lebewesen: Überall und zu allen Zeiten arbeiten Menschen demnach mit Symbolen – sei es in einem komplexen Ritual oder in einem einfachen Experiment – und leben in symbolischen Systemen. 13 Ich möchte hier hervorheben, dass ich über eine ‚Möglichkeit‘ schreibe. Der Fokus ist daher auf Umstände gerichtet – nicht auf das Werk eines oder mehrerer Autoren. Diverse Autoren haben die Möglichkeit einer philosophischen Anthropologie auf unterschiedliche Weise zu verwirklichen versucht. Ich verweise hier insbesondere auf Paul Rabinow, Anthropos Today: Reflections on Modern Equipment, Princeton: Princeton University Press 2003, Allan Young, The Harmony of Illusion: Inventing Post-Traumatic Stress Disorder, Princeton: Princeton University Press 1997; Veena Das, Critical Events: An Anthropological Perspective on Contemporary India, Dehli: Oxford University Press 1995. 14 In gewisser Weise kann man sagen, dass die Anthropologie des 20. Jahrhunderts der anthropologischen Frage aus dem Weg gegangen ist.
324
TOBIAS REES
Nichts, was Menschen tun oder denken, existiert ohne Sinn – auch die Idee einer ‚Gesellschaft‘ (so die ‚Kultur‘-Kritik an der ‚Sozial‘-Anthropologie) ist letztlich eine kulturelle Kategorie, ist Sinnstiftung.15 Daraus folgt, dass die Herausforderung für die Kulturanthropologen – die mit der Gewissheit ausgestattet sind, dass alles, was sie finden, wie bizarr es auch sei, Kultur ist – darin besteht, die Welt zu bereisen, fremde ‚Kulturen‘ ethnografisch zu dokumentieren und zu zeigen, dass ein korrektes Verstehen des ‚webs of meaning‘ (wie es bei Geertz heißt) der wahre Schlüssel zum Verständnis dafür ist, wie Menschen anderswo ‚sind‘.16 Für die Sozial- und die Kulturanthropologie lautet die erkenntnisleitende Frage also nicht: Was ist der Mensch? Diese Frage betrachten sie als längst beantwortet. Menschen sind Gesellschafts- bzw. Kulturwesen. Die für sie entscheidende Frage kann daher nur lauten: Welche Formen können Gesellschaft bzw. Kultur annehmen? Die Bedeutung dessen, was ich ‚philosophische Anthropologie‘ zu nennen vorgeschlagen habe, besteht nun genau darin, dass sie diese immer schon in einer Antwort gründende Konzeption von Anthropologie radikal in Frage stellt. Anlass für dieses radikale In-Frage-Stellen war das Ernstnehmen einer Einsicht, die als solche vielleicht nicht ‚neu‘ ist, aber im Kontext des empirischen und begrifflichen Wandels, den die Anthropologie seit einem guten Jahrzehnt durchläuft, akut an Bedeutung gewann – dass die Selbstverständlichkeit, mit der wir Menschen als weltstiftende (kulturelle und/oder soziale) Wesen begreifen, alles andere als selbstverständlich ist. Um es mit Gilles Deleuze zu sagen: Unsere Anthropologie ‚erklärt nichts, ist vielmehr der Erklärung bedürftig‘.17 Um ein Beispiel zu geben: Wann, wo und unter welchen Umständen wurde ‚Kultur‘ zu einer überzeugenden Antwort auf die Frage nach dem Menschen? Zweifelsohne ist ‚Kultur‘ keine universale, zeitlose Kategorie. Weder war der Begriff zu allen Zeiten vorhanden, noch stand er von jeher im Mittelpunkt des Nachdenkens über den Menschen. ‚Kultur‘, mit anderen Worten, hat Geschichte, ist eine ortsspezifische Kategorie des Nachdenkens über den Menschen (und was für Kultur gilt, gilt in gleichem Maße für ‚Gesellschaft‘). Im Kontext der gedanklichen Neuausrichtung der zeitgenössischen Anthropologie hat diese ‚Historisierung‘ und ‚Provinzialisierung‘ etablierter anthropologischer Schlüsselbegriffe (wie eben Kultur oder Gesellschaft) zu einer neuen, neue Räume öffnenden empirischen Frage geführt – einer Frage, deren Aufkommen die Mög15 Brillant argumentiert von David Schneider, A Critique of the Study of Kinship, Michigan: The University of Michigan Press 1984. 16 Man könnte die Theateranthropologie als eine weitere Variante dieser in einer Antwort gründenden Konzeption der Anthropologie bezeichnen – insofern sie in einer Definition des Menschen als performativem Wesen gründet. 17 Bedauerlicher Weise lässt es der Umfang der vorliegenden Essays nicht zu, zumindest einige der philosophisch bedeutsamen Anstrengungen zu skizzieren, die die Zentralität des ‚Menschen‘ für die Philosophie in Frage stellen – ob Heidegger und Arendt oder die französische Kritik an der Subjektphilosophie von Lévi-Strauss und Lacan bis Barthes, Foucault, Derrida und Deleuze.
DIESSEITS VON ETHNOS
325
lichkeit einer philosophischen Anthropologie markierte: Existieren ‚woanders‘ ganz andere Formen des Nachdenkens über den Menschen?18 Sind, hier und heute, neue Möglichkeiten über Menschen nachzudenken im Entstehen? Diese Fragen stehen ein für das Ereignis, als das ich das Möglichwerden einer philosophischen Anthropologie bezeichnet habe: Wo der klassische Ethnograf zuerst eine Antwort formuliert, um dann die Welt zu bereisen und die fremden, exotischen Lebensformen mit Hilfe seiner Antwort zu entschlüsseln (wodurch er Andere immerfort auf die seiner Lebensform eigenen gedanklichen Zusammenhänge reduziert), will der philosophische Anthropologe herausfinden, ob es anderswo andere Möglichkeiten gibt den Menschen zu denken (oder unsere Denkräume gegenwärtig, etwa in den Wissenschaften, so mutieren, dass neue Möglichkeiten des Nachdenkens über Menschen entstehen); Möglichkeiten, die in ihrer gedanklichen Spezifität so sind, dass sie mit unseren etablierten Denk- und Wissensweisen nicht zu fassen sind, dass sie ihnen also entfliehen, sie ihrer Selbstverständlichkeit berauben und dadurch neue, bislang unerschlossene Denk- und Seinsräume eröffnen (die dann durch Feldforschung konkret untersucht werden können). Kurz: An genau der Stelle, wo Sozial- und Kulturanthropologie immer mehr vom immer Gleichen finden – weil alles, was ist, immer schon Kultur und Gesellschaft war und sein wird – sieht sich die philosophische Anthropologie immer neuen Fragestellungen gegenüber, die in noch unerforschte, faszinierende Richtungen zeigen. Aus Sicht der philosophischen Anthropologie sind die soziokulturellen Großprojekte der Ethnologie folglich intellektuell zutiefst unbefriedigend. Ein ums andere mal werden hier die Türen fest verschlossen, die aufzuschließen die philosophische Anthropologie sich zur Aufgabe gemacht hat. Die Möglichkeit, dass es ‚anderswo‘ ‚anders‘ sein könnte, wird sprichwörtlich ausgesperrt – und damit wird das Projekt einer auf das Denken ausgerichteten Anthropologie verneint, die exakt auf diese Möglichkeit hin ausgerichtet ist.19 Für die empirische und begriffliche Neuausrichtung der Anthropologie ist das Aufkommen der Möglichkeit einer philosophischen Anthropologie von einer Bedeutung, die nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Denn ihr empirisches Interesse an den Kategorien, mit denen wir unser Wissen ordnen, die den Rahmen, innerhalb dessen wir über den Menschen nachdenken können, abstecken, bietet die Möglichkeit, eine Großzahl der Probleme hinter sich zu lassen, mit denen sich Anthropologen konfrontiert sehen, seitdem sie für sich neue Forschungsfelder erschlossen haben. Etwa, dass weder die klassischen ethnografischen Gegenstände (Gesellschaft und Kultur) noch ihre wichtigsten analytischen Begriffe (soziale
18 Vgl. Dipesh Chakrabarthy, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton: Princeton University Press 2000. 19 Fast scheint es, als ob die Tatsache, dass die philosophisch geprägte Anthropologie einen Möglichkeits-Raum eröffnet, sichtbar macht, dass die klassische moderne Ethnografie sich eben dieser Möglichkeit verweigert hat.
326
TOBIAS REES
Struktur und kulturelle Muster) den Phänomenen angemessen sind, die im Zentrum zeitgenössischer Anthropologie stehen. Ist die Vogelgrippe eine kulturelle Kategorie? Ist das Internet eine soziale Tatsache? Für die philosophische Anthropologie sind diese Fragen bedeutungslos. Da sie die Anthropologie nicht als das Studium von ‚Gesellschaft‘ oder ‚Kultur‘ definiert, sieht sie sich auch nicht der Notwendigkeit ausgesetzt den Gesellschafts- oder Kulturbegriff so umzuformulieren, dass man die Vogelgrippe oder das Internet auch mit ‚anthropologischen‘ Mitteln erforschen kann. Die Historisierung und Provinzialisierung der bisherigen anthropologischen Antworten hat die Möglichkeit einer anderen Art von Anthropologie eröffnet, einer Anthropologie, die sich weder auf Gesellschaft noch auf Kultur konzentriert, sondern auf das ‚Denken‘ und die merkwürdige Figur, die einst mit großer Selbstverständlichkeit ‚der Mensch‘ genannt wurde. Gibt es heute neue Wege, um die Frage nach dem Menschen zu stellen? In welchen Bereichen? In der biologischen Erforschung von Hefezellen? In der Fruchtfliegen-Genetik? In der genomischen Verhaltensbiologie von Hunden? In der Vogelgrippe-Forschung? Bei der HIV-Impfstoff-Forschung? Wo und in welcher Weise sehen wir das humanum in Bewegung, in Verwandlung? Vielleicht wird jetzt verständlich, weshalb ich von einer ‚philosophischen Anthropologie‘ spreche. Sie artikuliert die Anthropologie in sprichwörtlich anthropologischen Begriffen, begreift ihren Gegenstand als den Menschen und das Nachdenken über ihn. Und vielleicht wird auch verständlich, weshalb ich von einer ‚philosophischen Anthropologie‘ spreche. Es handelt sich um eine Variante des kritischen Nachdenkens über das Denken selbst, geleitet von dem Bestreben, durch Feldforschung zu erfahren, wie und in welchem Umfang es möglich ist, anders zu denken als bisher.20 Ein philosophischer Anthropologe zu sein, heißt, sich im historischen Werden des Denkens nachdenkend zu orientieren – durch Feldforschung –, um herauszufinden, ob und in welchen konkreten Formen neue Wege des Denkens und des Seins im Entstehen begriffen sind.21 20 Ich beziehe mich hier auf Michael Foucault, Geschichte der Sexualität: Bd. II: Der Gebrauch der Lüste, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1987. 21 In dieser Hinsicht unterscheidet sich die philosophisch geprägte Anthropologie der Gegenwart von der deutschen Tradition der philosophischen Anthropologie. Wo letztere die Wissenschaften heranzieht, um deren Ergebnis erst synthetisch zusammenzufassen und dann die Frage nach dem Menschen zu beantworten, nutzt erstere die Wissenschaften, um herauszufinden, wo diese Mutationen des Möglichen initiieren, die es möglich machen, über Menschen in noch neuer, ungeahnter Weise nachdenken zu können. Natürlich kann man sagen, dass Ethnografie, insofern sie sich mit dem native point of view beschäftigte, schon immer ein philosophisches Unternehmen gewesen ist; dass sie seit jeher das Selbstverständnis untergrub; seit jeher konkrete neue Räume des Denkens eröffnete. Ich will dem nicht widersprechen – und doch auf einen bedeutenden Unterschied hinweisen: Ging es der klassischen Ethnografie um räumliche Differenz, so richtet die philosophische Anthropologie ihr Augenmerk eher auf eine zeitliche Differenz, indem sie das Emergente in den Blick nimmt.
DIESSEITS VON ETHNOS
327
Es wäre wohl nur leicht übertrieben, wenn man behauptete, dass sich die Anthropologie im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte vom hundert Jahre alten Joch der ethnologischen Dominanz befreit hat – vom alleinigen Fokus auf Ethnien, auf ihre sozialen Strukturen und kulturellen Muster. Diese Befreiung wäre dann gleichbedeutend mit der Rückkehr der Anthropologie zu sich selbst – als Anthropologie. (Ich möchte hinzufügen, dass die philosophische Anthropologie des Denkens auch angesichts ihres Fragens nach dem Menschen keineswegs anthropozentrisch ist. Im Gegenteil: Gerade insofern sie einen Raum jenseits der anthropologisch-anthropozentrischen Selbstverständlichkeiten der europäischen Moderne eröffnet, lädt sie dazu ein, ‚eine Anthropologie jenseits der Menschen‘22 zu betreiben, um diesen auf neue Weise denken und kennen zu lernen – sei es vermittels E. coli Bakterien oder durch Ökosysteme, planetarische Ereignisse, Finanzregulierungen, saisonales Brutverhalten von Spatzen oder dank träumender Hunde.)
IV. Ich fasse das bisher Gesagte schematisch zusammen: Die Kritik der 1970er und 80er, die auf die geschichtsphilosophischen Antinomien des ethnografischen Projekts der Moderne zielte, führte Anthropologen seit den späten 1980er Jahren zunehmend in Forschungsfelder, die jenseits der klassischen anthropologischen Expertise liegen – vorwiegend im Bereich der Wissenschaft und Medizin. Die Folge dieser bald weite Teile des Faches in ihren Bann ziehenden Entwicklung war, dass sich Anthropologen zunehmend in einer offenen, noch undefinierten Situation wiederfanden: Die ehemals der anthropologischen Forschung Form gebenden Fragestellungen, Methoden und Begriffe verloren ihre Bedeutung – ohne das neue gedankliche Instrumente und Techniken bereits zur Verfügung standen (und sie stehen nach wie vor nicht zur Verfügung). Der intellektuell vielleicht faszinierendste Effekt dieser Entwicklung weg vom Fokus auf fremde, exotische Völker (Ethnos) ist, dass sie die Möglichkeit einer philosophischen Anthropologie schuf – einer Anthropologie, die sich primär mit Denkmöglichkeiten, mit deren Mutationen und mit den durch sie (neu) konstituierenden Menschen befasst. In diesem Abschnitt möchte ich umreißen, was man die Maximen der philosophischen Anthropologie nennen könnte – oder, etwas trockener, die methodologischen Richtlinien vermittels derer sie danach strebt, die für sie konstitutive Offenheit zu sichern, also die Möglichkeit, dass ‚anderswo‘ andere Formen des (Nach-) Denkens über den Menschen existieren oder im Entstehen begriffen sind.23
22 Diesen Ausdruck verdanke ich meinem McGill Kollegen Eduardo Kohn. 23 Offenheit bewahren – dies verlangt, dass man es vermeidet, eine neue, in einer definitiven Antwort gründende Anthropologie zu formulieren.
328
TOBIAS REES
Keine Epochen (das Konkrete) Es war eines der wichtigsten Anliegen der Kritik der 1980er Jahre: Epochale Aussagen, die die Welt au total in ein Vorher und ein Nachher teilen, gilt es mit Skepsis zu betrachten. Anlass zu dieser Skepsis gab einerseits die ethnografische Einsicht, dass die vermeintlich Primitiven eben keineswegs primitiv sind, und andererseits der Verdacht, die von der Geschichtsphilosophie gezogenen Trennlinien dienten allein dazu, die fernen Gesellschaften, mit denen die klassischen Ethnografen arbeiteten, in der europäischen Vergangenheit zu verorten, um Europa dadurch als modern definieren zu können. Die philosophische Anthropologie ist tief von der kritischen Haltung gegenüber epochalen Aussagen geprägt – hat sie aber neu, nämlich als erste Maxime ihres Forschungsprojektes formuliert: Die Mutationen des Möglichen, die sie in den Blick nimmt sind nicht epochal – sondern sektorial. Sie besitzen den Charme des Konkreten, nicht die Grandeur des Allgemeinen (keine Welle, die über das in den Sand am Meeresufer gezeichnete Gesicht hinwegspült – und plötzlich ist alles anders). Hat die Biotechnologie das Menschsein unwiderruflich verändert? Hat die Gentechnik die ‚Natur‘ ein für alle Mal in eine ‚kulturelle‘ Kategorie verwandelt? Aus Sicht der philosophischen Anthropologie sind solche Fragen sinnlos. Derart allgemein formuliert sind sie nicht zu beantworten – es sei denn durch moralische Bekenntnisse, die das Verständnis der Biotechnologie (für gewöhnlich) eher behindern als fördern. Für einen philosophisch sich orientierenden Anthropologen bestünde die Herausforderung eher in der Frage, ob das Aufkommen von rekombinanten DNSTechnologien ein Ereignis gewesen ist – also etwas, dass unsere Denkkategorien in Bewegung versetzt hat. Hat die neue Technologie den Möglichkeitsraum verändert, in dem Biologen über Organismen nachdenken? Zu welchen neuen Experimenten, zu welchen neuen Wissensformen hat das geführt? Wurden dadurch ältere Annahmen und Begriffe obsolet? Hatten diese Veränderungen zur Folge, dass Biologen den Menschen neu denken konnten? Hat die Möglichkeit DNS zu rekombinieren in Bewegung versetzt, was Hannah Landecker ‚the human biological‘ genannt hat?24 Desweiteren bestünde die Herausforderung darin, darauf hinzuweisen, dass weder ‚Natur‘ noch ‚Kultur‘ selbstverständliche Bereiche des Seins sind, sondern historisch bedingte Kategorien des Denkens – und das rekombinante DNS-Technologien gerade deswegen interessant sind, weil sie mit diesen Denkkategorien nicht zu fassen sind. Sie entkommen ihnen – und genau darin besteht die Aufgabe: Den neuen Raum, den die Rekombination von DNS-Molekülen eröffnet, verständlich zu machen und zu benennen. Und diese Aufgabe lässt sich allein durch eine detaillierte, viele Monate umfassende Feldforschung im Labor bewerkstelligen. 24 Vgl. Hannah Landecker, „Between Beneficence and Chattel: The Human Biological in Law and Science“, in: Science in Context 12:1 (1999), S. 203-225.
DIESSEITS VON ETHNOS
329
Die Phänomene, die die philosophische Anthropologie in den Blick nimmt, sind spezifische, auf konkrete Bereiche begrenzte Ereignisse, die den Möglichkeitsraum ändern, in dem wir unsere Gedanken ordnen können. Keine Theorie (Entgleisung) Die zweite Maxime, die ich anführen möchte, ist die Geringschätzung von Theorien. Mit ‚Theorie‘ möchte ich hier ein Erklärungsschema bezeichnen, das verwendet wird, um ein spezifisches Phänomen auf einen allgemeinen Begriff zu bringen. Eine Theorie ist eine Kausalität und Kohärenz herstellende Hypothese, die von ersten Prinzipien ausgeht und eine ontologische Wahrheit über die Welt aussagt. Die für die Möglichkeit einer philosophischen Anthropologie konstitutive Geringschätzung der Theorie geht zurück auf die Einsicht, dass Theorien Überraschungen, also die Möglichkeit von neuen, unvorhergesehenem Wissen ausschließen – eben weil Theorien ja schon (alles) wissen. Ein Theoretiker, das heißt der Verfechter einer Theorie, geht selbstverständlich davon aus (und muss selbstverständlich davon ausgehen), dass er den Schlüssel zum Verständnis der Welt besitzt. Wie sonst könnte der Akt der Entschlüsselung, den eine gegebene Theorie erlaubt, plausibel sein? Um nur ein Beispiel zu geben: Eine der bedeutendsten Theorien, derer sich Anthropologen bislang bedienten, war zweifelsohne die Sozialtheorie. Aus der Sicht der − für die philosophische Anthropologie konstitutiven − Offenheit, ist das grundlegende Problem der Sozialtheorie, dass sie jedes Phänomen in den immer gleichen Erklärungshorizont einschreibt. Der Schlüssel zum Verständnis wird immer die Gesellschaft sein, ganz egal, was es zu erklären gibt. Doch was wäre, wenn Menschen anderswo den Menschen anders, eben nicht als Gesellschaftswesen denken würden? Oder wenn sie darauf bestehen würden, dass Gesellschaft nun wahrlich keine anthropologische Besonderheit sei, da Tiere und Pflanzen und Steine auch Gesellschaft haben und darüber hinaus in direkten Verwandtschaftsverhältnissen mit Menschen stehen? Oder wenn sie erklärten, dass der Unterschied zwischen Menschen und (anderen) Tieren nicht im Gesellschaft haben liege sondern in der Aktivierung der adulten Neurogenese im menschlichen Gyrus dentatus des Hippocampus durch L-1-Retrotransposonen? Immer schon alles Gesellschaft? Die armen Wilden – und die ungebildeten Neurowissenschaftler – wissen es nur noch nicht? Die philosophische Anthropologie schätzt Theorie gering, nicht, weil sie uninteressant wäre (das zu behaupten wäre nicht nur vermessen sondern auch falsch). Sie schätzt sie gering, weil sie Phänomene ihrer – nie auf nur einen Begriff zu bringende – Eigenart beraubt, weil sie das, was noch unbekannt und unerforscht ist, von vorneherein und guten Gewissens auf bereits etablierte Begriffe (Theorien) reduziert (schlussendlich wird es ja immer ein soziales oder ein kulturelles oder ein ... Phänomen sein). Für einen philosophischen Anthropologen resultiert daraus gähnende Langeweile, hervorgerufen durch die ewige Wiederkehr des Immergleichen.
330
TOBIAS REES
Anders gesagt, ein fester Bestandteil von Theorien ist das, was man ‚Horizontbegrenzung‘ nennen könnte. Eine von vornherein festgelegte Einengung der Denkund Wahrnehmungsmöglichkeiten, die mit der undefinierten, für eine philosophische Anthropologie grundlegenden Offenheit unvereinbar ist – eben weil sie ausschließt, dass sich Mutationen des Möglichen ereignen, die wir nicht mit unseren etablierten Denkweisen erfassen können. Wo Theorien nach Zeitlosigkeit streben, interessiert sich die philosophisch geprägte Anthropologie gerade für die Zeitlichkeit der Dinge. Wo sich Theorien für das Allgemeine interessieren, wo sie versuchen, das Besondere auf allgemeine Begriffe zu reduzieren, interessiert sich die hier vorgestellte Anthropologie für genau jene Aspekte der Gegenwart, die sich nicht auf einen allgemeinen Begriff bringen lassen. Wo Theorien kausale Schemata liefern, ontologische Grundprinzipien wie Gesellschaft oder Kultur, interessiert sich der Anthropologe erst noch im Entstehen begriffener Denkweisen für jene Entwicklungen, die diesen ontologischen Grundprinzipien entkommen, sie in Bewegung versetzen, sie untergraben und so zu neuen, noch unerforschten Denkmöglichkeiten führen. Kurz: Theorien mögen inspirierend sein. Sie können faszinieren, anregen, neue Einblicke bieten – weswegen man sie lesen, studieren und weiterspinnen sollte. Ungeachtet dessen ist die philosophische Anthropologie, gerade insofern sie sich über Forschung definiert, durch ein Desinteresse gegenüber Theorien geprägt. Wo es darum geht, von Entstehendem zu berichten, singuläre Dynamik zu dokumentieren und gedanklich zu erfassen, die durch Ereignisse ausgelöst wird, die mit etablierten Begriffen nicht zu fassen ist und also Wissensfelder in Bewegung versetzt, hilft Theorie kaum weiter. Im Gegenteil: Theorien verneinen die Möglichkeit einer philosophisch-anthropologischen Forschung. Das Primat der Recherche (das Feld) Die dritte Maxime – untrennbar verbunden mit der zweiten, der Geringschätzung der Theorie – betont das Primat der Recherche. Im Vordergrund steht die Forschung, aus der heraus sich zu stellende Fragen ergeben sollen, nicht die Theorie.25 Eine vorhersagbare Reaktion auf dieses Lob der Forschung, insofern es auf Kosten der Theorie ausgesprochen wird, ist, dass hier einem naiven Positivismus das Wort geredet wird. Ein theoriefreier Zugang zur Wirklichkeit sei eine Illusion, da theoretische Vorannahmen in jedes menschliche Tun und Wahrnehmen unauslöschlich eingebaut seien. Eine Erforschung der Wirklichkeit jenseits der Theorie sei daher – unmöglich. Um diesem Missverständnis zu begegnen, bedient sich die philosophische Anthropologie des vielleicht ältesten Kunstgriffes der Disziplin: dem Verweis auf die Feldforschung. Gewiss betritt ein Forscher das Feld stets mit bestimmten Vorstel25 Vgl. dazu brillant: Martin Vialon (Hg.), Erich Auerbachs Briefe an Martin Hellweg. 19391950, Basel: A. Francke 2001.
DIESSEITS VON ETHNOS
331
lungen, mit einer Intuition, vielleicht sogar mit einer ausgearbeiteten Theorie, die man testen möchte. Doch was geschieht, wenn man im Feld angekommen ist? Ist es nicht meist der Fall, dass das Feld – in seiner Dynamik, in seiner Eigenart – die mitgebrachten Vorannahmen als unbrauchbar entwertet? Dass es die imaginierten Feldforschungsszenarien buchstäblich entgleisen lässt? Für falsifizierende Theoretiker mag diese Eigendynamik des Feldes, diese Entgleisung nichts als störendes Rauschen sein, Hintergrundlärm, der den Forscher von seinem eigentlichen Geschäft ablenkt. Für die hier zu umreißende philosophische Anthropologie jedoch ist dieses Entgleisen der methodische Kern der Feldforschung: Im Prozess des aus der (vorhergesehenen) Bahn Geworfenwerdens entwerten sich die mitgebrachten Vorannahmen. Der Feldforscher wird seines mitgebrachten konzeptionellen Rahmens beraubt, was einem Orientierungsverlust gleicht, der die Bedingung dafür ist, sich im Feld neu, und zwar in Begriffen des Feldes, orientieren zu lernen. Darin besteht die Besonderheit der Feldforschung: Entgleisung als Methode. Es gilt inmitten der zunächst verwirrenden Eindrücke und Unverständlichkeiten einen Weg zu finden, die Eigenart des Feldes in den Blick zu bekommen und zu lernen, diese Eigenart in den ihr eigenen und allein angemessenen Begriffen zu denken (dabei immer den eigenen gedanklichen Beitrag zur Begriffsarbeit reflektierend – um nicht zum naiven Positivisten gestempelt zu werden). Die philosophische Anthropologie ist, im traditionellsten Sinne, eine ‚Feldwissenschaft‘. Und damit meine ich nicht nur, dass sich die Wissensproduktion im Feld ereignet. Ich meine vielmehr eine Wissen produzierende Praktik (eine Wissenschaft), in deren Mittelpunkt das Potenzial des Feldes steht, mitgebrachte Forschungsszenarien gründlich zum Scheitern zu bringen – und eben durch dieses Scheitern (Entgleisen) Forscher in unvorhergesehene Richtungen zu führen, in noch unerforschte, wundersame, gedanklich erst noch zu durchdringende Regionen. Die Herausforderung der Feldforschung besteht darin, sich vom Feld hinweg tragen zu lassen – um dann mit neuem Wissen zurückzukehren und es in seiner Konkretheit darzulegen. Feldforschung ist ein Verfahren, das erfunden wurde, um über das bereits Bekannte und Gedachte hinauszuführen. Es ist eine Technik der Wissensproduktion, die diesseits der Theorie, aber nicht jenseits des Denkens liegt. Das Primat der Recherche – des Feldes – hat daher wenig mit einem naiven Positivismus zu tun. Vielmehr ist es eine aufmerksame, selbstreflexive, forschungsorientierte Auffassung der Anthropologie, die um die Möglichkeit kreist, dass es ‚anderswo‘ anders sein könnte, dass andere Weisen des Denkens und Seins existieren und entstehen können. Eine Form finden (sich im Denken orientieren) Die letzte Maxime, die ich hier erwähnen möchte, ist der logische Fluchtpunkt der ersten drei – die Notwendigkeit, eine Form zu finden, die den im Verlauf einer Feldforschung gemachten Entdeckungen angemessen ist.
332
TOBIAS REES
Die Herausforderung ist beträchtlich. Denn man kann kaum auf bereits etablierte Begriffe zurückgreifen, wenn die Aufgabe darin besteht, davon zu berichten, was mit den etablierten Begriffen (oder den etablierten Kategorien des Denkens) nicht zu fassen ist. Wie also eine angemessene Form finden? Wieder verweist hier die philosophische Anthropologie auf das Primat der Recherche, genauer: auf die Notwendigkeit sich denkend im Feld zu orientieren. Eine Feldforschung besteht zu einem erheblichen Grad aus Nichtvorhersehbarem: flüchtige Begegnungen, zufällige Beobachtungen und eine Unzahl unerwarteter Ereignisse. In den Anfangsmonaten einer Feldforschung schlägt sich diese Unvorhersehbarkeit meist in einer Serie von nur lose zusammenhängenden, in ihrer Inkohärenz frustrierenden Sammlung von Notizen wieder. Eine Szene hier, eine Beobachtung da, nichts, was sich wirklich zu einer kohärenten Geschichte, geschweige denn zu einem Forschungsthema fügen würde. Allmählich aber, im Laufe von Monaten, beginnen die in Notizbüchern festgehaltenen Anekdoten in neuem Licht zu erscheinen. Nach wie vor blickt man auf ein scheinbar jeder Ordnung entbehrendes Notizkonvolut. Jedoch, nach und nach lassen sich diese Notizen als lose Kapitel einer noch ungeschriebenen, vage erahnbaren Geschichte verstehen – und eben diese Geschichte, die erst im Verlauf der Feldforschung Kontur gewinnt, entspricht dem eigentlichen Gegenstand (oder Thema) der Forschung. Die Möglichkeit des Formgebens besteht darin, im Verlauf des Forschungsprozesses einen Weg zu finden, die entstehende, unvorhergesehene (und unvorhersehbare) Geschichte gedanklich auf den ihr angemessenen Begriff zu bringen. So, dass Feldforschung und Formgebung beinahe miteinander identisch sind. Einen einzig richtigen Weg gibt es für diesen Formgebungsprozess nicht. Unterschiedliche Forschungsprojekte entwickeln sich in unterschiedliche, meist unvorhersehbare Richtungen, die nach ihrer je eigenen Darstellungsform verlangen. Hinzu kommen individuelle Neigungen. Wo sich manche auf ein Schlüsselerlebnis der Feldforschung konzentrieren, das ihnen half, die Beziehungen zwischen den einzelnen Anekdoten wahrzunehmen, konzentrieren sich andere auf eine ganze Serie von Schlüsselereignissen, eben weil diese Serie sie zu einer neuen Sichtweise geführt hat, der sie ganz unerwartete Erkenntnisse verdanken. Wo der eine einen seine Geschichte(n) brillant zusammenfassenden Begriff im Verlauf eines Gesprächs ‚entdeckt‘, mag ihn ein anderer durch einen zufälligen Blick auf ein Werbeplakat finden. Entscheidet dieser sich dafür andere zu Wort kommen zu lassen, eben weil diese gemachte Entdeckungen elegant sichtbar, greifbar oder denkbar machen, entscheidet sich jene vielleicht für eine völlig entindividualisierte, objektivierte Darstellung, eben weil diese der gefundenen Geschichte entspricht. Jedoch, auch wenn es keinen einheitlichen Weg der Formfindung gibt – eines haben, so scheint mir, alle philosophisch sich orientierenden Versuche der Formgebung gemeinsam: Sie entsprechen allesamt der Arbeit des Denkens an sich selbst, dem Versuch, die gemachten Entdeckungen dadurch in den Blick zu bekommen, dass man nachzeichnet, wie sie verändert, was und wie man vorher denken und/ oder existieren konnte.
DIESSEITS VON ETHNOS
333
Die vierte Maxime bringt die ersten drei auf den Punkt: Das Anliegen besteht darin, die Geschichte, die aus der Feldforschung heraus entstanden ist, deren Teil man geworden ist, in ihrer gedanklichen Einmaligkeit zu fassen. Dies kann nur gelingen, wenn man sich von epochalen Aussagen und theoretischen Erklärungen fern hält und sich stattdessen denkend im Feld orientiert. Zweifelsohne wird jemand die hier gebotene Skizze lesen und kopfschüttelnd am Textrand notieren: ‚Ach, das ist doch auch Theorie!‘ Aber was ich hier skizziere ist keine Theorie, sondern ein Forschungsethos. Dieses Ethos basiert auf dem Primat der Recherche, also dem Vorschlag, die eigene Feldforschung nicht schon im Vorfeld durch Theorie derart einzuengen, dass man sich der Möglichkeit des Überraschtwerdens beraubt. Einer Theorie entspricht dieser Vorschlag – oder dieses Ethos – wohl kaum (es sei denn, man würde jegliche Form des Nachdenkens als Theorie bezeichnen). Hier wurde kein Erklärungsschema konstruiert, keine alles entschlüsselnden Grundprinzipien feilgeboten, keine falsifizierbaren Aussagen formuliert. Auch habe ich keine Theorie des Emergenten entwickelt. Keine Systeme, keine Erklärungen, keine Grundprinzipien, keine Theorien. Ich bin, schrieb Foucault irgendwo, ein glücklicher Positivist (und das ist etwas ganz anderes, als ein naiver Positivist).
V. Sind heute neue Formen der Begegnung zwischen Anthropologie und Theater möglich? Neu in dem Sinne, dass sie sich diesseits der Frage nach der Korrespondenz von Ritual und Theater ereignen? Diesseits auch des Versuches, diese Korrespondenz durch einen anthropologischen Entwurf zu erklären, dem zufolge Menschen primär ausdrucksfähige, performative Wesen sind? Aus Sicht der hier dargestellten philosophischen Anthropologie wäre ein Gespräch interessant, das es sich zur Aufgabe macht, die Türen zu öffnen, die solche – letztlich immer arbiträre – Setzungen unweigerlich schließen. So gibt es zum einen Dramaturgen (etwa Jean François Peyret), die sich weniger für die Inszenierung von Texten interessieren, als dafür Aspekte der Gegenwart durch feldforschungsähnliche Methoden genauer in den Blick zu nehmen. Peyret wiederholt in Laboratorien betriebene Feldforschung und lädt Laborwissenschaftler ins Theater ein, immer geleitet von dem Anliegen auf der Bühne darzustellen, was für ein Typus Mensch etwa von der zeitgenössischen Neurowissenschaft oder der Evolutionstheorie erzeugt wird.26 Und zum anderen gibt es Theaterwissenschaftler (etwa Frank Richarz), die sich weniger für die Analyse von Theaterstücken interessieren, als für das feldforschungsähnliche Auffinden theatraler Potenziale des
26 Zu den Neurowissenschaften vgl. Jean François Peyret/Alain Prochiantz, La Génisse et le Pythagoricien, Paris: Odile Jacob 2002. Zur Evolutionstheorie vgl. auch Jean François Peyret/ Alain Prochiantz, Variations Darwinienne, Paris: Odile Jacob 2007.
334
TOBIAS REES
Alltags, die sie notieren, um sie mit den Mitteln der Theaterwissenschaft zu beschreiben. Aber hier muss der (interessierte) Anthropologe ans Theater und dessen Expertise übergeben – neugierig wartend, mehr zu erfahren. Aus dem Amerikanischen von Georg Kasch.
Literaturverzeichnis Chakrabarthy, Dipesh, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton: Princeton University Press 2000. Crapanzano, Vincent, Tuhami: Portrait of a Moroccan, Chicago: University of Chicago Press 1985. Das, Veena, Critical Events: An Anthropological Perspective on Contemporary India, Dehli: Oxford University Press 1995. Dwyer, Kevin, Moroccan Dialogues: Anthropology in Question, Baltimore: Johns Hopkins Press 1982. Fabian, Johannes, Time and The Other: How Anthropology Makes its Objects, New York: Columbia University Press 1982. Foucault, Michael, Geschichte der Sexualität: Bd. II: Der Gebrauch der Lüste, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1987. Goody, Jack, The Domestication of the Savage Mind, Cambridge: Cambridge University Press 1977. Gupta, Akil/Ferguson, James (Hg.), Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science, Berkeley: University of California Press 1997. Gusterson, Hugh, Nuclear Rites, Berkeley: University of California Press 1998. Harbsmeier, Michael, Wilde Völkerkunde: Andere Welten in deutschen Reiseberichten der frühen Neuzeit, Frankfurt a. M./New York: Campus 1994. Kramer, Fritz, Verkehrte Welten: Zur Imaginären Ethnographie des 19. Jahrhunderts, Frankfurt a. M.: Syndikat 1977. Landecker, Hannah, Between Beneficence and Chattel: The Human Biological in Law and Science, in: Science in Context 12:1 (1999), S. 203-225. Marcus, George, Ethnography through Thick and Thin, Princeton: Princeton University Press 1998. Marcus, George/Clifford, James, Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, Berkeley: The University of California Press 1986. —/Fischer, Michael, Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences, Chicago: The University of Chicago Press 1986. Martin, Emily, The Woman and the Body, Boston: Beacon Press 1989. Peyret, Jean François/Prochiantz, Alain, La Génisse et le Pythagoricien, Paris: Odile Jacob 2002. —/—, Variations Darwinienne, Paris: Odile Jacob 2007. Price, Richard, First Timer: The Historical Vision of an African American People, Baltimore: Johns Hopkins University Press 1982. Rabinow, Paul, Anthropos Today: Reflections on Modern Equipment, Princeton: Princeton University Press 2003. —, French DNA: Trouble in Purgatory, Chicago: University of Chicago Press 1999. —, Making PCR: A Story of Biotechnology, Chicago: University of Chicago Press 1996.
DIESSEITS VON ETHNOS
335
—, Reflections on Fieldwork in Morocco, Chicago: University of Chicago Press 1977. —, „Representations are Social Facts: Modernity and Post-Modernity in Anthropology“, in: Writing culture: the poetics and politics of ethnography: a School of American Research advanced seminar, hg. v. James Clifford, Berkeley: University of California Press 1986, S. 234-261. —/Marcus, George/Faubion, James/Rees, Tobias, Designs for an Anthropology of the Contemporary, Durham: Duke University Press 2008. Rees, Tobias, „Today, What is Anthropology?“, in: Paul Rabinow/George Marcus/James Faubion/Tobias Rees, Designs for an Anthropology of the Contemporary, Durham: Duke University Press 2008, S. 1-12. Rosaldo, Renato, Ilongut Headhunting: A Study in Society and History, Stanford: Stanford University Press 1980. Schneider, David, A Critique of the Study of Kinship, Michigan: The University of Michigan Press 1984. Stagl, Justin, A History of Curiosity: The Theory of Travel, 1550-1800, London: Routledge 1995. Traweek, Sharon, Beamtimes and Lifetimes, Cambridge: Harvard University Press 1988. Vialon, Martin (Hg.), Erich Auerbachs Briefe an Martin Hellweg. 1939-1950, Basel: A. Francke 2001. Wolf, Eric, Europe and the People Without History, Berkeley: University of California Press 1982. Young, Allan, The Harmony of Illusion: Inventing Post-Traumatic Stress Disorder, Princeton: Princeton University Press 1997.
MARVIN CARLSON
Dynamiken und Herausforderungen von Aufführungen
Obgleich ich dieses Nachwort auf Englisch verfasse, bin ich mir überaus bewusst, dass die hier verwendeten Begriffe durch ihre Übersetzung ins Deutsche beträchtliche Veränderungen in ihren Konnotationen und Assoziationen erfahren werden. Dies ist natürlich für jeden ein allzu vertrautes Phänomen, der in mehr als einer Sprache mit Texten arbeitet, was in der heutigen, zunehmend globalisierten Welt sicherlich auf die Mehrzahl der sachkundigen Wissenschaftler zutrifft. Dieser geläufigen Schwierigkeit erwächst jedoch besondere Bedeutung in einer Disziplin, in der eine grundlegende Differenz auftritt zwischen dem wohl elementarsten Begriff im Feld – einmal in englischer und in deutscher Sprache. Bei diesem Begriff handelt es sich natürlich um das englische Wort performance, das ins Deutsche am direktesten mit dem Wort Aufführung zu übersetzen ist. In ihren gebräuchlichsten und transparentesten Verwendungen verweisen beide Begriffe auf dasselbe kulturelle Phänomen – die Präsentation einer Art von strukturierter Handlung durch eine Gruppe vor einer anderen. Für diese und ähnliche kulturelle Handlungen verfügen beide Sprachen über eine Reihe von anderen Begriffen, beide Begriffe sind aber in ihren Sprachen bekannt, geläufig und ähneln sich im Hinblick auf ihre grundsätzliche Bedeutung. Im ausgehenden 20. Jahrhundert erlangte der performance-Begriff in den Vereinigten Staaten als theoretischer Terminus größere Popularität. Seine Verwendung dehnte sich weit über seine grundsätzliche Bedeutung hinaus aus, nicht nur um ein sehr breites Spektrum von kulturellen Aktivitäten zu bezeichnen, sondern auch, um diese als eine elementare Form menschlichen Handelns zu markieren, die es als eigenständiges Phänomen zu untersuchen gilt, durch das, was später als performance studies bekannt werden sollte. Im Zuge dieser sehr beachtlichen referenziellen und disziplinären Ausdehnung entfernte sich das englische Wort performance merklich von seinem ehemals nahen Verwandten, dem deutschen Wort Aufführung, und demonstrierte auf zunehmend klare Weise eine Reihe von sehr folgenreichen Differenzen zwischen den beiden Begriffen und ihren Assoziationen innerhalb ihrer jeweiligen Kultur. Eine der gewichtigsten Differenzen hat mit der Beziehung der Zuschauer zu dem Ereignis zu tun, auf welches die beiden unterschiedlichen Begriffe verweisen. In den Vereinigten Staaten befasste sich die Theaterwissenschaft traditionell vornehmlich mit der Inszenierung des literarischen Texts, unabhängig davon, ob dieser Prozess innerhalb eines spezifischen historischen Rahmens oder in der Gegenwart analysiert wurde. Der literarische Text bildete das Zentrum der kritischen Aufmerksamkeit und die Untersuchung des Theaters widmete sich vornehmlich der Frage, wie Schauspieler, Regisseure und Bühnenbildner diesen Text in das dreidimensionale Leben der Bühne übertrugen. Es sollte bis in die 1980er Jahre dau-
338
MARVIN CARLSON
ern, bis eine alternative Sicht auf die Aufführung – nicht einfach als Bühnenversion eines bereits existierenden Texts, sondern als ein eigenständiges, kulturelles Ereignis – neue Aufmerksamkeit auf das Publikum lenkte, welches seit Beginn der modernen Theaterwissenschaft für die deutsche Forschung ein viel zentraleres Anliegen dargestellt hatte. Trotzdem bestand und besteht im Hinblick auf die jeweilige Perspektive auf die Zuschauer noch immer eine deutliche Differenz zwischen den meisten deutschen Theatertheoretikern einerseits und der Mehrzahl der amerikanischen andererseits. Seit langem ist es die Auffassung der deutschen Theaterwissenschaft, dies geht zurück bis zur grundlegenden Arbeit von Max Herrmann, den Zuschauer als einen aktiv Mitwirkenden am theatralen Geschehen zu begreifen, als einen Koproduzenten seiner Bedeutungen. In den Vereinigten Staaten hingegen betrachteten die meisten Theoretiker die Rolle des Publikums traditionell im Wesentlichen als eine passive. In den Arbeiten der Mehrheit der US-amerikanischen Theoretiker fand die Öffentlichkeit vorwiegend als Empfänger oder Beobachter der aufgeführten Handlung Berücksichtigung. Nicht nur fortgeführt, sondern de facto bestärkt wurde diese Vorstellung eines passiven Publikums durch die sehr einflussreiche Einführung der linguistischen Theorien John L. Austins in die modernen performance-Diskussionen, insbesondere seines Konzepts des Performativen. In Austins Theorie ist das Performative ein Typ von Äußerung, der in der Welt etwas vollbringt, anstatt diese einfach zu beschreiben oder zu bezeichnen. Obwohl Austin das Wort Performativität selbst nicht gebrauchte, hat diese Ausweitung seines Begriffs in etwas andere Richtungen, die Judith Butler et al. durchführten, neue wichtige Dimensionen zu den Implikationen des Begriffs des Performativen hinzugefügt. Obgleich es nun einen sehr umfangreichen und vielschichtigen Diskurs bezüglich der Performativität und des Performativen gibt, bleibt festzustellen, dass vieles davon im Bannkreis von Austins ursprünglicher Betonung auf den Sprecher des Sprech-Akts verbleibt. Das Etwas, was das Performative in der Welt vollbringt, ist etwas vom Sprecher Gemachtes und Kraft seiner Handlungsmacht Bewirktes. Die Rolle des Rezipienten des performativen Diskurses ist lediglich eine passive, empfangende. Und tatsächlich: Damit eine performative Äußerung gelingt (um zu ‚glücken‘, wie Austin sagt), muss der Rezipient das Gebot des Sprechers ohne Widerstand oder signifikante Änderungen akzeptieren oder befolgen. In seiner einfachsten Form scheint Butlers Performativ diese Passivität zu untermauern, da sie den reiterierten Diskurs selbst zum Agens macht, welcher Handlungs- und Verhaltensmuster für den nach wie vor passiven Rezipienten diktiert – Muster, die Handlungsmacht auch einschränken, weil sie die Performanzen dieser Welt kontrollieren. Natürlich ist es richtig, dass Butler und andere argumentiert haben, dass in der Iteration selbst eine unvermeidbare Abweichung stattfindet, die eine entscheidende Öffnung für Handlungsmacht bereithält. Aber bereits die Kontroversen über diese Dynamik und die Operationen der Handlungsmacht innerhalb der Performativität deuten auf eine immanente Abwehrhaltung der Performanztheorie hin. Sie offenbaren eine Renitenz gegenüber einem Konzept des freien Flusses von kreativer Energie
DYNAMIKEN UND HERAUSFORDERUNGEN VON AUFFÜHRUNGEN
339
und, ja, auch von Handlungsmacht zwischen den mutmaßlichen Schöpfern der Performance bzw. der performativen Akte und ihren mutmaßlichen Rezipienten. Anders gestaltet sich diese Situation im ungleichen kulturellen Kontext des Aufführungsbegriffs. Obgleich der Wortstamm ‚Führung‘ einen Zwang oder zumindest eine Handlungsanleitung von Seiten der Produzenten des theatralen Ereignisses zu suggerieren scheint, was ein Model nach amerikanischem Vorbild nahe legen würde, orientierte sich die deutsche Theaterwissenschaft traditionell immer schon mehr am Ereignis in seiner Gesamtheit und berücksichtigte das Publikum viel mehr als in der angelsächsischen Tradition üblich als einen Koproduzenten der Aufführung. Zwar hat das Aufkommen der modernen Rezeptionsästhetik (die vornehmlich in Deutschland entwickelt wurde, wie ich hinzufügen sollte) den angelsächsischen Blick auf das Theater verändert, gleichermaßen wie der Wandel des Theaterverständnisses weg von einer Textdarstellung hin zu einem eigenständigen, kulturellen Ereignis. Dennoch bleibt eine viel stärkere Tendenz als in Deutschland bestehen, sich darauf zu fokussieren, wie die Aufführung ihre Zuschauer beeinflusst, als darauf, wie die Zuschauer mit und in der Aufführung interagieren und helfen, diese allererst hervorzubringen. Erika Fischer-Lichtes sehr einflussreiche Ästhetik des Performativen hat eine bedeutende Brücke zwischen den deutschen und amerikanischen Konzepten der Aufführung und des Performativen geliefert, indem sie die physische Begegnung zwischen Akteuren und Zuschauern ins Zentrum ihrer Analysen rückte und argumentierte, dass die umfangreichen und grundsätzlich unvorhersehbaren Resultate von Aufführungen nur durch eine Beachtung des Zusammenspiels zwischen diesen beiden Gruppen aufgespürt und erfasst werden können. Der zentrale Begriff der Autopoiesis, den Fischer-Lichte in die zeitgenössische Aufführungsanalyse eingeführt hat, betrifft eben diesen Prozess. Autopoiesis ist ein theoretischer Begriff, der vormals zumeist unter Biologen, Soziologen und Kulturwissenschaftlern Verwendung fand. Er bezeichnet eine spezifische Qualität lebender Systeme, die in einer fortlaufenden Feedback-Schleife arbeiten und aufgrund dieser zirkulären Funktionsweise zugleich die Produzenten und Produkte ihrer Operationen sind. Ein solches sich selbst organisierendes System, kann, im Gegensatz zum autonom kreierten Kunstwerk, neu auftauchende, ungeplante und auch unvorhersehbare Elemente von beiden Enden der Schleife fortwährend in sich aufnehmen und integrieren. Veränderung geschieht hier nicht als eine Art der unvermeidlichen Funktionsstörung, als ‚Abweichung‘ der Iteration, sondern vielmehr als eine positive, kontinuierliche Anpassung an neuerlich eingeführtes Material durch die so genannten Produzenten und die so genannten Empfänger des kulturellen Ereignisses. Als embodied minds sind wir kontinuierlich in Autopoiesis verstrickt, einfach durch die Interaktion mit unserer Umwelt. Theater und performance art bieten uns jedoch die Gelegenheiten zu einer erhöhten Aufmerksamkeit und Sensibilität für diesen Prozess. An die Stelle des vormals im Wesentlichen statischen Bezugs auf das Theater als eines Objekts der formalen ästhetischen Analyse tritt in der aktuellen Sicht auf die Aufführung eine bedeutend dynamischere Dimension. Im Rahmen dieser Perspektive wird Theater als ein andauernder Prozess begriffen, als ein Teil
340
MARVIN CARLSON
unseres in-der-Welt-seins, das sich durch diesen Prozess in konstanter Transformation befindet. Der Titel der englischen Übersetzung der Ästhetik des Performativen, The Transformative Power of Performance, betont diesen Aspekt des Ansatzes von Fischer-Lichte sehr genau. Wenngleich das Theater als eine Art Laboratorium der Arbeit am Autopoietischen betrachtet werden kann, ist es möglich, diese transformative und sich selbst transformierende Kraft, sobald man einmal auf ihre Arbeit aufmerksam geworden ist, in den unterschiedlichsten Formen menschlichen Handelns und Interagierens zu beobachten. Daher war es höchst angebracht und vielleicht sogar unvermeidlich, dass Fischer-Lichte sich bei ihrer Pionierarbeit in diesem Gebiet zunächst auf das Theater konzentrierte, dass sie die Wirkungen von Gemeinschaft und eines gemeinsam geteilten Raums in theatralen Aufführungen untersuchte, die Materialität dieser Kunstform, die Erzeugung von Erfahrungen und von Bedeutungen sowie nicht zuletzt die Transformation sowohl der Darsteller als auch der Zuschauer durch ihre jeweiligen Beiträge zum theatralen Ereignis. Ebenso angebracht ist der nächste logische Schritt dieser aktuellen Forschung, die unser Verständnis der Aufführung und des menschlichen Verhaltens insgesamt verändert, nämlich der, über das Theater hinaus zu gehen und mit der Untersuchung der Autopoiesis in anderen kulturellen Sphären zu beginnen. Die in der vorliegenden Anthologie versammelten Aufsätze regen ein Verständnis dieser zentralen Dynamik der menschlichen Interaktion in vielerlei Hinsicht an und werfen zugleich ein neues Licht auf eine Reihe von kulturellen Handlungen. Diese Handlungen schließen selbstverständlich nach wie vor das traditionelle Theater ein, erstrecken sich aber auch weit über dieses hinaus. In diesem Sinne tragen die Aufsätze von Matthias Warstat, Christel Weiler, Jens Roselt, Viktoria Tkaczyk, Nina Tecklenburg, Barbara Gronau, Erin Manning, Matthias Dreyer sowie von Małgorzata Sugiera und Mateusz Borowski dazu bei, die Möglichkeiten der Aufführungsanalyse für ein breites Spektrum von Fragestellungen im Theater- und Tanzfeld weiterzuentwickeln, während Klaus-Peter Köpping und David Plüss diese Analyse in das sehr nahe Feld der Ritualforschung übertragen. Das Ritual war eine der ersten angrenzenden Disziplinen, die von den Wegbereitern und Gründern der modernen performance studies erforscht wurden, oftmals, vor allem in den Vereinigten Staaten, unter Anwendung von analytischen Strategien, die in den Sozialwissenschaften entwickelt wurden, insbesondere der Anthropologie. Dieser interdisziplinäre Ansatz, der viel zur Entwicklung der performance studies beigetragen hat, wird von den originellen und anregenden Beiträgen von Tobias Rees und Frank Richarz in eine zeitgemäße Perspektive gerückt. Beide werfen einen frischen Blick auf die Triangulation von Theater, Performance und Anthropologie, die sich in den modernen performance studies als ungemein fruchtbare Quelle von originellen Hypothesen erwiesen hat. Beinahe alle der hier versammelten Beiträge ermuntern ihre Leser direkt oder indirekt dazu, über den Tellerrand des gerade analysierten, speziellen kulturellen Phänomens hinauszuschauen, um die breiteren Implikationen der Aufführung und ihrer transformativen Kräfte im menschlichen Handeln und der Gesellschaft insge-
DYNAMIKEN UND HERAUSFORDERUNGEN VON AUFFÜHRUNGEN
341
samt zu bedenken. Ein Reihe von ihnen fokussieren sich indes im Kern mehr darauf, in den grundlegendsten Anliegen der gegenwärtigen Gesellschaft ein ‚performatives Bewusstsein‘ zum Tragen zu bringen, wie zum Beispiel in der Arbeit des politischen Systems, in der Ausbildung einer individuellen Identität sowie in der Suche nach einer faireren und gerechteren sozialen Ordnung. Jill Dolans Aufsatz über die ‚Utopie der Aufführung‘ repräsentiert diese Orientierung vielleicht am deutlichsten, die Strategien und die Stoßrichtung ihres Textes werden aber auf gewichtige Weise durch die Beiträge von Jon McKenzie und Alan Read unterstützt. Die vorliegende Anthologie stellt insgesamt einen vielschichtigen und aufschlussreichen Beitrag zum sich entwickelnden Feld der Theaterwissenschaft dar und zugleich einen Begleitband und eine Erweiterung zu Erika Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen. Seine Erkundungen der transformativen Kraft der Aufführung in Gebieten des menschlichen Handelns weit jenseits des traditionellen Theaters demonstrieren die Bedeutung von Erika Fischer-Lichtes Einblick in dieses Phänomen und die breite Anwendbarkeit ihrer Theorien. Die neuen Perspektiven, die dieser Band eröffnet, versprechen weitere Forschungsarbeit in diesem inspirierenden und sich rasant entwickelnden Feld sowie fortwährende Erkenntnisse im Hinblick auf die sich ständig wandelnden Formen menschlicher Interaktion. Aus dem Amerikanischen von Torsten Jost.
Personenregister
Abramović, Marina, 142, 175, 176, 182, 184, 186, 280 Acconci, Vito, 175 Agamben, Giorgio, 31, 50, 53, 55, 58-65 Aquin, Thomas von, 59 Arendt, Hannah, 126, 130, 131, 132 Aristoteles, 16, 117, 144 (Fn.*), 147 (Fn.) Artaud, Antonin, 16, 277, 278f., 281, 287 Auslander, Philip, 53, 182 (Fn.) Austin, John L., 35f., 71, 84, 87, 112, 142, 160f., 229, 338 Badiou, Alain, 53 Ballet, Gilbert, 282f., 285 Baniewicz, Elżbieta, 200 Barba, Eugenio, 150, 315 Barczyk, Łukasz, 196 Barthes, Roland, 180, 291 (Fn.) Bataille, Georges, 99 Beckett, Samuel, 58, 285 (Fn.) Bel, Jérôme, 125, 127, 131, 248 Benda, Karol, 197f. Benjamin, Walter, 51, 79, 185, 296, 308 Bentham, Jeremy, 70 Berlant, Lauren, 231 Bernhardt, Sarah, 201 Besson, Benno, 297, 300 Bloch, Ernst, 229f. Bloom, Harold, 63 Blumenberg, Hans, 178 Boas, Franz, 317 Bogart, Anne, 230 Böhme, Gernot, 13 Borowski, Mateusz, 128-30, 189-204, 340 Bourdieu, Pierre, 83 (Fn.), 128, 140f., 143-47, 149, 258
*
Brecht, Bertolt, 18, 72, 79, 109, 150, 191, 201, 281f., 286f., 296f., 300, 306f., 309 Brook, Peter, 53f., 56f., 109, 114, 315 Buber, Martin, 116 Budzisz-Krzyżanowska, Teresa, 200f. Burden, Chris, 175, 185 Bush, George W., 129, 158, 159-62 Butler, Judith, 36, 71-74, 126, 158, 163, 228, 338 Camillo, Giulio, 42 Carlson, Marvin, 51, 74, 192, 280, 291 (Fn.), 337-41 Charcot, Jean-Martin, 282, 285 Chaudhuri, Una, 59, 196-98 Chétouane, Laurent, 279 Chomsky, Noam, 36 Combes, Muriel, 217, 220f. Condorcet, Marquis de, 318 Croce, Arlene, 234 Csikszentmihalyi, Mihaly, 115 (Fn.), 117 Czirak, Adam, 125-33, 248 Das Shrestha, Kashish, 4 Deleuze, Gilles, 55f., 62, 160, 214, 219, 221-23, 321 (Fn.), 324 Derrida, Jacques, 36, 45, 71, 160, 172, 176, 179 (fn.), 184, 276-83, 287, 292 Dickens, Charles, 55f., 62 Didi-Huberman, Georges, 42 Dolan, Jill, 130, 132, 140 (Fn.), 227-41, 341 Dreyblatt, Arnold, 30, 39-46 Dreyer, Matthias, 251, 291-313, 340 Durantaye, Leland de la, 58f. Durkheim, Émile, 317 (Fn.)
Die Abkürzung Fn. verweist auf den Fußnotentext.
344
PERSONENREGISTER
Ernst, Wolfgang, 44
Jost, Torsten, 245-52, 341
Fabian, Johannes, 319 Finter, Helga, 279, 283 Finzi, Samuel, 299, 305 Fischer-Lichte, Erika, 11-23, 27-32, 36, 108 (Fn.), 112-17, 135-37, 142-44, 146-49, 257, 263, 276, 279, 280, 292f., 339-41 Fludd, Robert, 284 Forsythe, William, 132, 209f., 213 Foucault, Michel, 28, 30, 55, 70, 71, 126-28, 140, 145-47, 149, 160, 258, 310, 321 (Fn.), 333 Fox, Terry, 175 Fraser, Nancy, 230f. Freud, Sigmund, 185 (Fn.), 257, 261 Fried, Michael, 191
Kabel, Thomas, 115f. Kaprow, Allan, 38f. Klata, Jan, 130, 192-203 Klingemann, Hans-Dieter, 171f. Koch, Gertrud, 76 Koch, Wolfram, 299, 305f. Köpping, Klaus-Peter, 30-32, 83-102, 137 (Fn.), 340 Koselleck, Reinhardt, 295 Kott, Jan, 201
Gardner, Elysa, 233f. Gebauer, Gunter, 113 (Fn.), 143 Gennep, Arnold van, 15 (Fn.), 116, 136 Godelier, Maurice, 179 Goethe, Johann Wolfgang von, 37, 193, 285 Gotscheff, Dimiter, 279, 292, 297-300, 304, 307-10 Greenblatt, Stephen, 85, 194, 280f., 287 Gronau, Barbara, 30f., 35-48, 177 (Fn.), 340 Grotowski, Jerzy, 109, 315 Guattari, Pierre-Félix, 160, 321 (Fn.) Habermas, Jürgen, 28f. Haddon, Alfred C., 317 Havelock, Eric, 283 Heidegger, Martin, 58, 324 (Fn.) Herder, Johann Gottfried, 318 Herrmann, Max, 137, 338 Hewitt, Gwen, 62 Heyme, Günther, 300 Hodge, Robert Lee, 74 Hymes, Dell, 83 (Fn.) Isherwood, Charles, 233 Jacoby, Russell, 228 James, Wendy, 61 James, William, 217 (Fn.), 245, 247 Jones, Bill T., 234
Latour, Bruno, 320f. Lessing, Gotthold Ephraim, 16, 284 Lévy-Bruhl, Lucien, 317 Linné, Carl von, 61-63 Lock, Margaret, 319 Luhmann, Niklas, 141, 245-47 Luther, Martin, 106, 114 Lyotard, Jean, 28, 158, 163 MacLarnon, Ann, 62 Malinowski, Bronislaw, 317 Manning, Erin, 130, 132, 141 (Fn.), 148 (Fn.), 205-25, 340 Marcuse, Herbert, 158, 165f., 229 Martin, Emily, 319 Massumi, Brian, 148 (Fn.), 207 (Fn.), 213 Mauss, Marcel, 317 Mavromatti, Oleg, 180 McKenzie, Jon, 128f., 157-74, 341 Meumann, Ernst, 282 Modrzejewska, Helena, 201 Moreno, Jacob Levy, 18 Mosebach, Martin, 107 Mouffe, Chantal, 232 Müller, Heiner, 35, 195, 291, 297, 299, 300f., 308f. Netz, Reviel, 61 Nietzsche, Friedrich, 117, 129, 158, 160, 162-65, 219 (Fn.), 233 Ninagawa, Yukio, 49f., 60 Novalis, 285 Oida, Yoshi, 114 Ong, Walter Jackson, 283 Otto, Rudolph, 99
PERSONENREGISTER
345
Pareles, Jon, 233 Passini, Paweł, 196 Patraka, Vicki, 235 Pawłowski, Roman, 195f. Peyret, Jean François, 333 Phelan, Peggy, 53f., 56f., 179, 184, 186 Piscator, Erwin, 300 Platon, 144 (Fn.), 283f. Plessner, Hellmuth, 145, 148f. Plüss, David, 30-32, 103-21, 340 Pollesch, René, 256, 276 Pradier, Jean-Marie, 57 Preul, Reiner, 106f.
Simone, Nina, 238 Singer, Milton, 36 Soemmering, Samuel Thomas von, 285 Solla, Gianluca, 180 Sophokles, 53, 297f., 300 Stanislawski, Konstantin, 109 States, Bert O., 238 Strathern, Marilyn, 319 Strindberg, August, 197 Stuart, Jakob, 195 Stuhr, Jerzy, 200 Sugiera, Małgorzata, 128-30, 189-204, 340 Swinarski, Konrad, 196
Rabinow, Paul, 32, 320, 321 (Fn.), 323 (Fn.) Radcliffe-Brown, Alfred, 317 Radziwiłowicz, Jerzy, 201 Rancière, Jacques, 129, 189-92, 203, 307 Ratzel, Friedrich, 317 Read, Alan, 30f., 49-67, 341 Rees, Tobias, 32, 137 (Fn.), 154 (Fn.), 251, 315-36 Richarz, Frank, 27-33, 128, 135-56, 250, 253-61, 333, 340 Ridout, Nicholas, 59f. Rieger, Stefan, 285 Rilke, Rainer Maria, 58 Rivers, Pitt, 317 Rockwell, John, 230 Rokem, Freddie, 71 Ronell, Avital, 164f. Roselt, Jens, 21, 177 (Fn.), 263-73, 340 Rossa, Boryana, 129, 175, 180-87
Tambiah, Sir Stanley, 87f., 100 Tavel, Ronald, 275 Tecklenburg, Nina, 128f., 175-88, 340 Tkaczyk, Viktoria, 250f., 275-89, 340 Turner, Victor, 15 (Fn.), 86, 107, 116f., 136, 231, 315 Tylor, Edward Burnett, 318
Schechner, Richard, 57, 71, 86, 315 Schieffelin, Edward, 83, 86f. Schiller, Friedrich, 18, 189f. Schleef, Einar, 297, 300 Schleiermacher, Friedrich, 110 Schmitt, Carl, 194f. Schwarzkogler, Rudolf, 175, 186f. Searle, John, 36 Seel, Martin, 249f. Shakespeare, William, 62f., 192-97, 199202, 284 Sia, Beau, 232 Siegel, Ed, 233f. Simmons, Russell, 132, 228, 231-37
Ubersfeld, Anne, 292 Urban, Marie, 4 Vellela, Tony, 233 Vinci, Leonardo da, 180 Voltaire, 318 Vostell, Wolf, 38 Wajda, Andrzej, 130, 192, 196, 199-204 Waldenfels, Bernhard, 265-69, 273, 305 Warhol, Andy, 275, 277 Warstat, Matthias, 30f., 69-81, 249 (Fn.), 277 (Fn.), 340 Weber-Krebs, David, 4 Weber-Rumpe, Hugo, 286 Weiler, Christel, 143, 250, 253-61, 340 Wilson, Robert, 279 Wirtschafter, Bud, 275 Wolf, Friedrich, 77-80 Wulf, Christoph, 143 Wyspiański, Stanisław, 193-96 Yates, Frances, 277, 283 Young, Allan, 319 Zandt, Townes Van, 59 Žižek, Slavoj, 4, 51, 53, 54
Sachwortregister
Affekt, 18, 98f., 106, 136, 176 (Fn.*), 219 agency, 74, s. a. Macht (Handlungsm.) Akteur, 9, 11-14, 16-18, 20f., 21, 36, 41f., 46, 70, 78, 87, 109, 112-14, 117, 125, 127, 131f., 136, 139-42, 144f., 147, 231, 257, 265, 276, 278, 280, 294, 339 Alterität, 249f. Anagnorisis, 77 Anthropologie, 29f., 32, 103, 137, 154, 189, 251, 315-34, 340; Theateranth., 57, 319, 324 (Fn.) Anthropologische Maschine, 31, 50, 55, 57, 61, 63-65 Architektur, 12, 41-43, 146, 199; bewegliche Ar., 209, 211-13, 216-19, 222; Datenar., 39 Ästhetik, 15, 18, 39, 76, 79, 111-18, 129, 190-92, 235 (Fn.), 279, 293; Ästh. d. Absenz, 44, 304; Ästh. d. Performativen, 9, 11, 17, 19f., 22, 27, 29-32, 111-18, 135-37, 142-47, 149 (Fn.), 176, 191f., 248, 251, 26365, 276-79, 293f., 302 (Fn.), 339-41; Produktionsästh., 276f.; Rezeptionsästh., 339; Werkästh., 269; Wirkungsästh., 16f., 22, 27, 117, 149 (Fn.) Atmosphäre, 13, 19f., 105, 166, 170, 178, 182, 247 Aufführung, 29, 39-42, 44, 46, 63, 65f., 70, 73, 76-78, 80, 88, 90f., 93-97, 99f., 125-32, 135-44, 146 (Fn.), 148, 157f., 161-63, 175-78, 181, 184-86, 191f., 194-203, 211f., 221f., 227-32, 235f., 238f., 253-59, 263-69, 271-73, 276, 279f., 287, 291-95, 297f., 300, 304f., 308f., 316; A.sanalyse, 10, 18f., 22, 54,
*
112, 126, 129, 186, 245-51, 253, 256-58, 260, 277, 281, 293, 333, 339f.; A.sbegriff, 9f., 11-22, 27f., 30-32, 37, 49-58, 69, 111f., 113, 128, 136, 157 (Fn.), 178-80, 267, 337-41; A.spraxis, 9, 86, 88, 239, 280; Etymologie d. A., 35-37; Ritual(forschung) u. A., 83-88, 103, 105-18, 315-34 Aufmerksamkeit, 13, 21, 41, 56, 83, 89, 111f., 115, 137f., 153, 193, 202f., 237, 247, 255, 265, 268, 301, 307, 339; freischwebende A., 257; Tanz d. A., 205, 212-15, 218-24 Autopoiesis, 11-13, 15, 144, 149 (Fn.), 263, 294, 339f.; autop. FeedbackSchleife, 113, 135, 138, 143, 191, 263, 339f. Avantgarde, 77; hist. Theaterav., 112, 116f., 248, 277; Neoav., 203, 275, 277, 315 Beobachtung, 71, 128, 150, 213, 245-50, 254, 255-57, 260, 263, 265, 277, 332; engagierte B., 137; theatrale B., 137f.; teilnehmende B., 118, 137 Bewusstsein, 15, 147, 222, 236, 251, 26668, 306; Flow-Bew., 115-18; Körperbew., 116; liminales Bew., 116; performatives Bew., 341; Selbstbew., 42; Volksbew. (yamato-damashii), 98 Biotechnologie, 328 Body Art, 177-85 Chor, 109, 232, 256, 271, 272, 298f., 301-05 Choreografie, 125, 127, 132, 209f., 213-15, 248
Die Abkürzung Fn. verweist auf den Fußnotentext.
348
SACHWORTREGISTER
cultural performance, 17, 128, 157, 162 Dekonstruktion, 40, 45, 72, 186, 276 Demokratie, 128, 157f., 161-72, 231f. Dephasierung, 216-23 Dialog, 40, 70, 106f., 113, 153, 232, 250, 253, 258, 265, 291, 310 (Fn.), 319; D. a. Modell f. Erfahrungsprozess, 267-69, 273; D. d. Blicke, 131 Diskurs, 27-32, 71-74, 38, 69, 74, 97, 111, 118, 126f., 129, 137, 140, 142f., 145f., 178f., 182 (Fn.), 227, 231, 259, 276f., 292f., 295 (Fn.), 302 (Fn.), 304, 338; D.sanalyse, 27f., 30; D.sbegriff, 27-31, 73; Diskursivität/ diskursiv, 29, 41,71, 97, 127, 129f., 140, 142, 147f., 177 (Fn.), 179, 191, 247, 258 Dispositiv, 71, 128, 140-48, 295 Distanz, 13, 39, 46, 72, 75, 116, 117, 137, 139, 184, 257f., 261, 299, 301, 316 Drama, 37, 87, 105, 192, 194, 196f., 203, 276, 280, 293, 310; Dramatik, 283, 285; Dramatiker/in, 193, 201, 316; d. Dramatische/dramatisch, 59, 79, 78, 80, 111, 186, 198, 302 (Fn.); postdramatisch, 293, 305 (Fn.); Psychodr., 18; soziales Dr., 86f. Dramaturgie, 50, 77, 80, 115, 125, 129, 186, 303; Dramaturg/in, 315, 317, 333 embodied mind, 113, 147, 339 Emergenz, 9, 11, 29, 32, 91, 136, 176, 177, 272 Energie; physikalische E., 44, 146 (Fn.); politische E., 79f., 163; rituellgöttliche E., 89f., 98; soziale E., 194, 280f., 287; theatrale, physische E., 13, 79f., 89f., 98, 128, 143-48, 176 (Fn.), 217, 237, 253, 261, 338; E. d. (Nach-) Erzählung, 176 Environment, 38f., 202 environmental theatre, 197f. Epiphanie, 75, 98 Ereignis, 38, 45f., 56, 164, 194f., 198, 200, 233, 261, 296, 307, 318, 321, 323, 325, 327-30, 332; E.sbegriff, 179f., 295; Aufführung als E., 9, 15, 17, 37, 51, 54, 73, 76, 109, 112, 129, 137, 149, 176-87, 191f., 204, 212-24, 231,
249, 257, 264f., 267, 271, 273, 287, 294, 294-97, 337-40; E.shaftigkeit, 9, 35f., 37, 73, 109, 111, 136, 191, 217, 257, 278; Zwischenereignis, 267f., 270 Erfahrung, 14, 21, 31, 40, 46, 50, 76f., 111, 138, 140, 193-95, 203, 206-08, 210, 212f., 217, 230, 236f., 251, 256, 258, 261, 265f., 273, 282, 298, 340; ästhetische Erf., 132, 189f., 264, 302; ästh. Erf. (als Schwellenerf.), 16, 21, 32, 128, 136, 144 (Fn.), 146 (Fn.), 148, 153, 270, 302 (Fn.); Diskursivierung v. Erf., 177 (Fn.), 246-50, 186f.; Erf. als Dialog, 267, 269-71; Erf. d. Anderen/ Intersubjektivität, 9, 42, 131, 138, 227, 229, 263, 266, 269-71; Erf. v. Historizität, 251, 291-93, 302; Erf. v. Utopie, 227, 229f., 233, 238f.; Präsenz-Erf., 302; religiöse Erf., 108, 111; Selbsterf., 115, 270; Wir-Erf., 271f. Erinnerung, 14, 17, 19, 40, 44-46, 95, 113f., 193, 198, 213, 217, 219f., 253, 266, 282, 285, 291, 294; E.sprotokoll, 249, 253, 258 Ethnografie, 319 (Fn.), 321 (Fn.), 325 (Fn.), 326 (Fn.) Ethnologie, 17, 30, 83 (Fn.), 92, 316f., 325 Eucharistie, 105f. Experiment/experimentieren, 18, 39, 59-61, 150, 158, 162f., 164, 205, 209f., 216, 220, 239, 293, 300, 315, 319, 322f., 328; Experimentalkultur, 281-83, 285-87; exp. Gesinnung, 165 Feedback-Schleife, s. Autopoiesis Figur, 65, 91, 100, 138f., 180, 260f., 266, 281, 326; dramatische F., 14, 78, 193f., 200f., 273, 291, 300, 302f., 305f.; Figuration, 31, 77, 130, 182 (Fn.), 185 (Fn.) Fiktion/fiktiv, 78f., 148 (Fn.), 150, 186f., 194, 302 Flüchtigkeit, 12, 14, 37, 142, 149, 176f., 184, 230 Gedächtnis, 39, 77, 278; Echoged., 275f.; Ged.forschung, 275, 277, 283, 294; Ged. kunst, 277, 282-85; Ged.technik, 281f.; Ged.theater, 39-46, 284; Sachged., 284; Wortged., 251, 275-87
SACHWORTREGISTER
Gegenwart, 29, 30, 40, 44, 56f., 73f., 78, 118, 138 (Fn.), 140, 185, 194, 213, 229, 251, 259, 277f., 280, 287, 291310, 321 (Fn.), 330, 333, 337; Gegenwärtigkeit, 31, 44, 46, 53, 56f., 71, 73f., 129, 138 (Fn.), 184, 270, 278f., 292-96; G.stheater, 9, 22, 69, 127, 196, 203, 276f., 279f., 287, 293, 296, 302; Nicht-Gegenwärtige, 278, 280, 287; Vergegenwärtigung, 90, 97f., 214, 238, 301 Gemeinschaft, 15f., 20f., 32, 46, 54, 69, 83, 85, 87, 89, 91, 98, 100, 108 (Fn.), 116f., 131f., 152, 157, 189-95, 228-39, 271f., 291 (Fn.), 304 (Fn.), 340 Gesamtkunstwerk, 105 Geschichte, 29, 38 (Fn.), 40, 44f., 50, 61, 66, 75, 77, 126 (Fn.), 135, 193f., 203, 235 (Fn.), 247, 251, 276, 283, 293-95, 297f., 299, 302 (Fn.), 304-07, 308-10, 318, 324; G. (Erzählung), 41, 78, 150f., 184, 186, 198, 202, 291, 332f.; G.sphilosophie, 317-19, 328; Inszenierungs/Aufführungsg., 52, 196f., 300; Kunst/Kulturg., 20, 277, 280, 284, 287; Liturgieg., 103; Theaterg., 277, 280f., 284f., 287, 297f. Gesellschaft/gesellschaftlich, 15f., 18, 20, 35, 38, 54, 72, 80, 108, 130, 157 (Fn.), 165, 182 (Fn.), 190, 192, 228, 231, 233, 238f., 255, 259, 292, 295 (Fn.), 300, 315-30, 340f. Geste/Gestik, 56, 59, 72, 80, 93, 95, 109, 111-15, 135, 160, 191, 230, 236, 237, 305f. Gottesdienst, 32, 103-18, 235 haunted stage, 52 (Fn.), 192, 280, 291 Historisierung, 300, 324, 326 Historizität, 42, 251, 277, 280, 295, 297, 300f., 303, 309 iconic turn, 277, 283 Identität, 36, 54, 61, 69, 72-74, 80, 117, 127, 190, 197, 214, 232, 237 (Fn.), 341; I.stheorie, 49, 57 Ikonizität, 100 Illusion, 72, 193, 197, 198, 316, 319, 330 Imagination, 98, 227 Indexikalität, 100
349
Individuation, 132, 207-09, 213f., 217, 219-24; Infra-Ind., 217, 219 Infra-Dimensionalität, 208, 213, 217 Initiation, 92f. Installation, 9, 17, 30, 37-41, 49, 205, 209; Theaterinst., 41-43, 45f.; Performance Inst., 213 Inszenierung, 30, 39, 42, 46, 49, 51, 60, 62, 69f., 73, 75-77, 79f., 84, 86, 88, 90, 93, 96, 105, 109, 110f., 113, 115, 118, 125, 127, 129f., 182, 185, 191-97, 200, 202-04, 230, 251, 292f., 297-300, 303, 305-10, 315, 319, 333, 337; I.sbegriff, 15, 36, 112; I.snormen, 128; I.stechnik/strategie/konzept, 17, 186, 264; Reinsz., 44, 75, 177 Intentionalität, 127, 265-68 Interaktion, 11f., 14, 35, 41f., 112-14, 118, 138, 140, 191, 247, 280, 294, 339-41 Ironie, 72 Iterabilität, 31, 36, 338f.; Iterativität, 87 Kapitalismus, 60, 159, 228 Katharsis, 16, 117, 144 (Fn.) Kollektivität/kollektiv, 42, 46, 49, 55, 98, 100, 132, 210, 220f., 232, 236, 271f., 319 Kolonialismus, 317 Kontingenz, 9, 11, 97-98, 112, 114, 127, 130f., 278, 294, 305f. Kontrolle, 14, 29, 61, 70f., 78, 89, 142, 144, 162, 236, 269 Kooperation, 19, 105, 111, 118, 158 Ko-Präsenz, 11, 13, 17f., 21, 130, 136, 177, 185, 247 Körperlichkeit, 13, 21, 38, 45, 84, 88, 91, 99, 100, 109, 115-18, 132, 147, 227, 263, 279f., 305f. Liminalität, 15f., 21, 32, 103, 108, 116-18, 185, 302 (Fn.); s. a. Erfahrung (Schwellenerf.) Liturgie, 30, 92, 100, 106-18; L.wissenschaft, 32, 103-05, 109-18; L.reform, 106 Liveness, 53, 182 (Fn.) Macht, 27, 30, 50, 51, 69-74, 78, 89, 91f., 97, 100, 139f., 145-54, 158-62, 166,
350
SACHWORTREGISTER
189f., 193, 201, 221f., 258, 260f., 267, 298, 305, 307f., 338f.; M.begriff, 10, 70-74, 126f., 142f., 145-50, 261; Gestaltungsm., s. agency; Handlungsm., 127 (Fn.), 131, 232, 338f., s. a. agency; M.konstellation, 129f.; M.relation, 10, 12, 260; M. in/ von Auff., 9f., 12, 15-18, 20f., 86, 12532, 135, 138f., 142, 145-50, 158f., 176, 178, 180, 182, 186, 199, 227, 230, 232, 260f., 272, 280, 295f.; Wirkungsm., 13, 21, 35, 85, 144, 176, 178, 230, 319, 323 Maske, 78, 89-94, 97f., 100, 162, 164 Materialität, 9, 11-14, 18, 37, 42, 88, 111, 136, 140, 142, 147, 263, 279, 294, 340 Medialität/medial, 11, 38f., 125, 129, 136, 177, 182 (Fn.), 203, 250 (Fn.), 277, 285 (Fn.) Messe, 37, 86, 106f., 316 Mimesis, 142-44, 149, 292 (Fn.) Mnemotechnik, 275f., 280-87 Musiktheater, 9, 17, 69 Mythos, 43 (Fn.), 108, 178-80, 195, 296, 318 Naturalismus, 196-98 New Criticism, 194 New Historicism, 194, 277 Öffentlichkeit/öffentlich, 35, 62, 79 (Fn.), 88, 103 (Fn.), 190, 228 Oralität, 283 Paradigma, 28, 59, 86, 126, 166, 167, 269 Partizipation, 37f., 39, 95, 113, 126f., 130, 209, 231 Performance, 49, 69, 74f., 85, 87, 126, 142, 135, 212, 228-30, 236 (Fn.), 237, 251, 271, 275, 277, 280, 315; Perf. begriff, 35f., 53-59, 71, 128f., 157-59, 178-80, 337-40; cultural perf., 17, 128, 157, 162; gender perf., 72; Perf. Installation, 213; Perf. Stratum, 158-63, 166, 170; Perf. Studies, 105, 111, 158, 162, 172, 231, 337, 340; Perf. v. Demokratie, 128, 157-72; Perf. dokumentation, 129, 175-87; Perf. kunst, 9, 17, 30, 52, 70, 85, 114, 117, 129, 175-87, 228f., 238, 276, 287, 339;
perf. energy, 176; perf. principle, 166; Politik d. Perf., 219-24; Regierungsperf., 166-72; Verletzungsperf., 129, 185-87 Performanz, 36, 71, 86, 88-91, 93-95, 105 (Fn.), 111, 118, 278f., 287, 338 Performativität, 31-36, 69-80, 83, 126, 135, 160, 166, 258, 263, 265, 277, 280, 338; Begriff/Theorien d. Performativen, 9, 31, 35, 69, 73, 75, 84, 86, 97, 111, 144, 287, 338f., s. a. Ästh. d. Performativen; Interperformativität, 95; performativ (attrib./adverb.), 9, 12, 30f., 36, 37, 46, 57, 71-75, 83, 85, 87f., 91, 93-97, 100, 108, 111-12, 125, 127-30, 132, 135, 137-42, 146, 149, 157, 160f., 166, 177, 191, 194, 246, 248, 263f., 273, 278-81, 287, 315, 324 (Fn.), 333, 338f.; Performativ (Subst.), 128, 140-42, 150-54, 338; utopisches Performativ, 229-32, 237-39; virtuelles Performativ, 150-54; performative turn, 31, 35, 83 (Fn.), 104f., 118, 248 Performer/in, 89, 131, 135, 181, 232, 235, 236, 237, 275-79 Peripeteia, 186 Potenzialität, 62, 130, 180, 185, 208, 214, 216 Präsenz, 13, 41, 92, 99, 113, 131, 143, 153, 177f., 233, 239, 276, 294, 297, 302, 306; Ordnung d. P., 14f., 136; liturgische P., 115-16; s. a. Ko-Präsenz Praxis, 18, 29, 46, 52, 69, 71, 73f., 84, 87, 125, 132, 149 (Fn.), 186, 246, 257-59, 275, 278, 286f., 299; Ausstellungs/ Aufführungs/Theaterp., 9, 31, 36, 88, 239, 280, 281, 283; Forschungsp., 27, 35, 258, 323; soziale P., 88, 131, 147; liturgische/religiöse P., 103, 109-11; Performancep., 175; theaterw. Analysep., 186, 247, 250f., 257; diagrammatische P., 205-39; Schauspielp., 280 Predigt, 103-11, 115 Provinzialisierung, 324, 326 Prozess, 12-15, 18, 20-22, 37, 44-46, 57, 63, 87f., 99, 112f., 125-29, 132, 13740, 144, 146-50, 153, 162, 166f., 176, 178, 185 (Fn.), 186, 194, 205-24, 230,
SACHWORTREGISTER
246, 248-51, 253, 256f., 258, 264, 267, 276f., 279-81, 293, 295, 297, 299, 322 (Fn.), 331f., 337; autopoietischer P., 11f., 15, 339f.; Probenp., 11f., 73; Prozessualität, 21 Publikum, 17, 41f., 49, 54, 65, 70, 77, 85-87, 89-99, 109-14, 128, 131f., 135, 159, 161, 181f., 229-37, 250, 264f., 267, 271-73, 275, 298f., 302f., 306, 338f.; s. a. Zuschauer Rasa, 16 Realismus, 228; kritischer R., 197; real. Theater, 197 Reenactment, 71, 74, 75, 81, 184, 275 Regisseur/in, 70, 125, 127, 193, 195, 197f., 199f., 202-03, 236 (Fn.), 269, 300, 309, 337 Repräsentation, 31, 69, 116, 125, 130, 190, 229, 302 (Fn.); Ordnung d. R., 14f., 136 Resonanz, 83, 85-91, 95, 97-100, 203, 285 Responsivität, 265, 267-69 restored behavior, 71 Rhythmus, 13, 21, 62, 90, 94, 99, 218, 302 Ritual, 17, 46 (Fn.), 83-101, 105-08, 113, 142, 230, 280, 315f., 319, 321, 323, 333, 340; Ritualität, 105, 118; R.forschung/R. Studies, 30, 32, 105, 111, 340; R. Criticism, 118; Übergangsr., 16, 107, 116 Rolle, 36, 40, 49, 89-94, 97, 113f., 117, 128, 131, 138f., 150-53, 163, 194, 199-202, 279, 283f., 291 (Fn.), 310, 338; Rollenspiel, 150-53 Schauspieler/in, 49, 52, 60, 76, 86, 112-15, 152, 163-64, 199-202, 263f., 266, 271, 276-78, 281f., 284f., 287, 291 (Fn.), 299f., 302-04, 306, 309, 337, 347 Schwelle, 217f., 221, 270; Schwellenphase/ raum/zustand, 14f., 100, 108 (Fn.), 116f., 137, 270, 303; s. a. Liminalität scripted embodiment, 71 Semiotik, 9, 215, 293, 257, 265 site-specific theatre, 194, 196, 198, 199 Spiel/spielen, 17, 32, 39, 41-46, 64, 77f., 80, 83, 85, 89, 97-100, 104, 107, 110,
351
112, 114f., 117, 135, 139, 142, 145f., 162, 172, 181, 200f., 245, 248, 254f., 260, 279, 283f., 291, 299, 305, 307, 310; Endsp., 310; Fastnachtssp., 77; gutes Sp., 163f.; Pen&Paper Rollensp., 150-54; Schauspiel(kunst), 17, 97, 265, 277, 281f., 283, 285, 287; Sp.feld, 39, 236; Sp.raum, 212, 215, 264, 267; Sp.regel, 36, 37, 127, 151, 153; Sp.technik, 277; Sprachsp., 215; Vorsp., 92, 299, 300, 303 Stimme, 40f., 44-47, 77, 100, 115, 201, 232, 236, 265, 271, 273, 279, 281-83, 301-04; vociferatio, 284 Synästhesie, 84, 100 Tanz, 9, 13, 17, 41, 63, 69, 88, 90-98, 125, 128, 205, 209, 211, 213f., 216, 218, 220; T.ritual, 89, 91, 95; T.platz, 90-92, 94, 96; T.fest, 96; T. d. Aufmerksamkeit, 212-15, 218-24 Theaterhistoriografie, 291 (Fn.), 293 Theaterwissenschaft, 17, 27, 31f., 69, 105, 111, 126, 137f., 177, 247f., 251, 253, 256, 259f., 277, 334, 337-41 Theatralanalyse, 253, 257-61 theatraler Reflexionsmodus, 136 Theatralität, 31f., 36, 84, 94, 96, 100, 109f., 118, 137 (Fn.), 277; T.sbegriff, 69-80; theatrale Gemeinschaft, 21 Theatralogie, 154, 260, 261 Tonalität, 208 Torgauer Formel, 106 Tragödie, 85, 109, 117, 144 (Fn.), 192f., 195f., 199-201, 291, 296-310 Transformation, 16, 18, 21, 80, 83, 84, 88, 99f., 107, 116f., 147, 228, 239, 251, 300, 340 Übung, 60, 70, 132, 144, 207, 217, 250, 257-59, 261 Unbewusste, 75, 128, 138 (Fn.), 180, 257f. Ungespürte, 138, 258 Verfremdung, 75, 281, 298, 300, 308, 309 Verkörperung, 44-46, 110f., 125, 172, 192, 203, 279, 302, 310
352
SACHWORTREGISTER
Verwandlung, 42, 107, 116, 180, 206, 216, 217, 237, 326 Wiederholung, 15, 36, 71, 73-75, 80, 87, 93, 125, 127, 129, 140, 149, 160, 176-78, 180, 184, 186, 211-13, 215, 281 Wirklichkeit, 9, 32, 35, 59, 62, 71f., 77, 79f., 88, 125, 138-40, 142, 147, 149 (Fn.), 152-54, 195, 201, 229, 261, 302 (Fn.), 305, 309, 330; Als-obWirklichkeit, 150 Wirkung, 9, 11, 13, 18, 20-22, 27, 28, 36, 60, 65, 72, 76, 78, 86, 113, 117, 125, 128f., 131f., 136-38, 143-45, 147-49, 153, 161, 176-80, 182, 184, 194, 197,
199, 204, 208, 214, 230, 234, 239, 248, 258, 261, 264, 269, 301, 309, 319, 323, 340; W.sohnmacht, 86 Zeitlichkeit, 129, 132, 293f., 298, 302, 330 Zirkulation, 215, 219, 260; Z. sozialer Energie, 194 Zuschauer, 9, 11-22, 36, 41-43, 50, 76-78, 83, 86-88, 90, 92f, 95, 97f., 100, 112-14, 117, 125, 127, 130f., 136, 142, 150, 175f., 181f., 184-86, 191204, 228-36, 238f., 247f., 250f., 257, 263-66, 268f., 270-73, 275f., 280, 301-08, 337-40; Z.raum, 78, 112, 131, 192, 198, 203, 275f.; Z.rolle, 113, 150
Zu den Autoren
Mateusz Borowski ist wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Performativität an der Jagiellonischen Universität, Krakau. Daneben arbeitet er als Übersetzer wissenschaftlicher und szenischer Texte aus drei Fremdsprachen. Gemeinsam mit M. Sugiera hat er u. a. Erika Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen ins Polnische übersetzt. Forschungs- und Publikationsschwerpunkte sind das moderne europäische Drama in vergleichender Perspektive sowie Gender und Queer Theorie. Mit M. Sugiera edierte Borowski: Fictional Realities / Real Fictions (2007); Theater spielen und denken: Polnische Texte des 20. Jahrhunderts (2008); Worlds in Words. Storytelling in Contemporary Theatre and Playwriting (2010). Marvin Carlson hat die Sidney E. Cohn Professur für Theater und Vergleichende Literaturwissenschaft am Graduate Center der City University of New York inne. Zu seinen Preisen und Würdigungen zählen die Ehrendoktorwürde der Universität Athen, der ATHE Achievement Award, der ASTR Distinguished Scholarship Award, der George Nathan Award for Dramatic Criticism und der Calloway Prize for writing in theatre. Carlson ist Gründungsherausgeber der Zeitschrift Western European Stages und Autor von weit mehr als hundert wissenschaftlichen Artikeln zur Theatergeschichte, Theatertheorie und der dramatischen Literatur. Zu seinen Monografien zählen The Theatre of the French Revolution (1966); Goethe and the Weimar Theatre (1978); Theories of the Theatre (1984); Places of Performance (1989); Theatre Semiotics: Signs of Life (1990); Performance: A Critical Introduction (1996); Voltaire and the Theatre of the Eighteenth Century (1998); The Haunted Stage (2001); Speaking in Tongues (2006). Carlsons Werke wurden in 14 Sprachen übersetzt. Adam Czirak studierte Germanistik, Theaterwissenschaft und Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft in Budapest, Wien, Dresden und Berlin. Seit 2006 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich Kulturen des Performativen tätig. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in Theorie und Ästhetik des Gegenwartstheaters, Visual Culture, Theorien der Repräsentation, Psychoanalyse und Intertextualität. Im Rahmen des Teilprojekts Ästhetik des Performativen hat er 2010 eine Dissertation mit dem Titel Partizipation der Blicke. Szenerien des Sehens und Gesehenwerdens in Theater und Performance angefertigt, die 2012 beim transcript Verlag erschienen ist. Derzeit arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Theaterwissenschaft an der FU Berlin. Jill Dolan ist Annan Professorin für Englisch und Theater an der Princeton University, an der sie auch das Programm für Gender and Sexuality Studies leitet. Sie ist Autorin zahlreicher Bücher und Artikel, u. a. von Utopia in Performance: Finding Hope at the Theatre (2005), sowie des Blogs The Feminist Spectator (www.feministspectator.blogspot.com), für den sie mit dem George Jean Nathan Award for Dramatic Criticism 2010-2011 ausgezeichnet wurde. Dolan war Präsidentin des Programms Women and Theatre sowie der Association for Theatre in Higher Education der USA.
354
ZU DEN AUTOREN
Matthias Dreyer studierte Theaterwissenschaft, Germanistik und Philosophie in Wien, Paris, Baltimore und Berlin. Von 2005 bis 2011 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Theaterwissenschaft der FU Berlin, u. a. im Sonderforschungsbereich 644 Transformationen der Antike. 2011 promovierte er zu dem Thema „Zäsuren der Zeit. Aufführungen griechischer Tragödien seit den 1960er Jahren“. Seit 2012 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Er ist Mitherausgeber der Bände Antike Tragödie heute (2007), Medeamorphosen. Mythos und ästhetische Transformation (2010) sowie Autor mehrerer Artikel zur Problematik von zeitgenössischen Inszenierungen von Kollektivität. Dreyer arbeitete auch als Dramaturg am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und am Ulmer Theater (vor allem mit L. Chétouane). Erika Fischer-Lichte ist seit 1996 Universitätsprofessorin für Theaterwissenschaft an der FU Berlin. Von 1963 bis 1971 Studium der Theaterwissenschaft, Slavistik, Germanistik, Philosophie, Psychologie und Erziehungswissenschaften an der FU Berlin und der Universität Hamburg. Direktorin des Internationalen Forschungskollegs Verflechtungen von Theaterkulturen und Sprecherin des Internationalen Graduiertenkollegs InterArt. Mitglied der Göttinger Akademie der Wissenschaften, der Academia Europaea, der Berlin-Brandenburgischen Akademie und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Als Gastprofessorin lehrte sie in den USA, Russland, Japan, China, Indien, Norwegen, Schweden, Portugal, Spanien, Brasilien und auf Kuba. Ihre Arbeitsgebiete umfassen Ästhetik und Theorie des Theaters, die europäische Theatergeschichte und interkulturelles Theater. Barbara Gronau arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Theaterwissenschaft der FU Berlin und als Gastprofessorin und Gastdozentin an der Universität der Künste, Berlin. Von 2002 bis 2006 war sie Mitarbeiterin am Sonderforschungsbereich Kulturen des Performativen und promovierte an der FU Berlin mit einer Arbeit über die Interferenzen von Theater und Bildender Kunst (Theaterinstallationen. Performative Räume bei Beuys, Boltanski und Kabakov, 2010), die mit dem Joseph Beuys Preis für Forschung ausgezeichnet wurde. Momentan forscht sie im Rahmen ihrer Habilitation zu ästhetischen Strategien des Unterlassens (Performanzen des Nichttuns, 2008; Ökonomien der Zurückhaltung. Kulturelles Handeln zwischen Askese und Restriktion, 2010; beide hg. mit A. Lagaay). Daneben ist sie immer wieder als Dramaturgin an verschiedenen deutschsprachigen Theatern tätig und kuratierte internationale Theaterfestivals. Torsten Jost studierte Theaterwissenschaft sowie Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der FU Berlin. Von 2008 bis 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Sonderforschungsbereichs Kulturen des Performativen, seit 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Internationalen Forschungskollegs Verflechtungen von Theaterkulturen der FU Berlin. Forschungsschwerpunkte sind Kunsttheorie und Theater der historischen Avantgarde. Aktuelle Veröffentlichungen: „Zum Zusammenspiel von Medialität und Performativität. Oder: Warum noch Hoffnung für das Theater besteht“, in: Theorien des Performativen (2011); zusammen mit M. Weiß: „Spielend zwischen Kunst und Leben. Zur Frage des Selbst in Texten und Porträtfotografien Gertrude Steins“, in: Selbst-Reflexionen (2012). Klaus-Peter Köpping ist seit 2008 Fellow am Internationalen Forschungskolleg Verflechtungen von Theaterkulturen der FU Berlin; Professor emeritus des Instituts für Ethnologie der Universität Heidelberg (seit 2005); von 2005 bis 2007 Gastprofessor am Goldsmiths College der University of London. Promotion nach Feldforschungen in Japan an der Universität Köln mit einer Arbeit zu Akkulturationsphänomenen und messianischen Bewegungen. Nach Lehrtätigkeit in den USA und Gastprofessuren in Japan, auf den Philippinen und in Afghanistan 1985 Berufung auf den Gründungslehrstuhl für Ethnologie an der Universität Melbourne, Australien. Durchführung
ZU DEN AUTOREN
355
von Feldforschungen in Japan, Australien, Neu-Guinea und Afghanistan zu Themen des Kulturwandels, der Hybridität und der Performanz, vor allem im Rahmen von Forschungen zu Ritualfesten in den alpinen Regionen Japans. Veröffentlichungen (u. a.): Maschinenkörper/Körpermaschinen: Mediale Transformationen (Hg. mit B. Papenburg/Ch. Wulf, 2005); Adolf Bastian and the Psychic Unity of Mankind (2005); Shattering Frames: Transgressions and Transformations in Anthropological Theory and Practice (2002); Im Rausch des Rituals (Hg. mit U. Rao, 2000); Games of Gods and Man: Essays in Play and Performance (1997). Erin Manning bekleidet derzeit einen Forschungslehrstuhl für Relationale Kunst und Philosophie an der Faculty of Fine Arts der Concordia University in Montreal, Kanada. Zugleich ist sie Direktorin des Sense Lab (www.senselab.ca), eines Labors, das mittels des fühlenden Körpers in Bewegung die Schnittstellen zwischen künstlerischer Praxis und Philosophie untersucht. Ihr Schreiben erkundet die Beziehung zwischen Bewegung, Erfahrung, Denken und Politik in einem philosophischen Rahmen. Zu ihren Veröffentlichungen zählen Relationscapes: Movement, Art, Philosophy (2009); Politics of Touch: Sense, Movement, Sovereignty (2007); Ephemeral Territories: Representing Nation, Home and Identity in Canada (2003). 2012 erscheinen Always More Than One: Individuation’s Dance sowie Thought in the Act: Passages in the Ecology of Experience (gem. mit B. Massumi). Jon Mckenzie ist Associate Professor für Englisch an der University of Wisconsin-Madison, wo er Seminare über Performance Theory und New Media leitet. Darüber hinaus koordiniert er dort die einflussreiche Initiative für Digitale Geisteswissenschaften, wozu die Arbeitsfelder und Themenbereiche der New Media Studies, der Studio-based Practices, des Digital Learning sowie der quantitativen Methoden der Geisteswissenschaft gehören. Veröffentlichungen (u. a.): Perform or Else: From Discipline to Performance (2001); „Global Feeling: (Almost) All You Need is Love“, in: Performance Cosmology: Testimony from the Future, Evidence of the Past (2006); „Abu Ghraib and the Society of the Spectacle of the Scaffold“, in: Violence Performed: Local Roots and Global Routes of Conflict (2009); Contesting Performance: Global Sites of Research (Hg. mit H. Roms/W.-L. Wee, 2010). David Plüss ist Professor für Homiletik, Liturgik und Theorie der religiösen Kommunikation am Institut für Praktische Theologie der Theologischen Fakultät der Universität Bern. 2005 bis 2009 war er Assistenzprofessor für Praktische Theologie und Studiendekan der Theologischen Fakultät der Universität Basel. 2005 erfolgte die Habilitation mit einer Arbeit über die performative Ästhetik des Gottesdienstes. 1999 bis 2004 war er als Assistent für Praktische Theologie an der Basler Theologischen Fakultät tätig. 2001 Promotion mit einer Arbeit über Emmanual Lévinas. Studium der Theologie auf dem zweiten Bildungsweg in Basel, Berlin und Paris. Forschungsschwerpunkte: Liturgik, Performance, Ritual, Körper und Geschlecht. Alan Read ist Professor für Theater am King‘s College London, wo er derzeit am Aufbau der Performance Foundation arbeitet (performancefoundation.org.uk). Veröffentlichungen (u. a.): Theatre & Everyday Life (1995); Theatre, Intimacy & Engagement (2008). Herausgeberschaften (u. a.): The Fact of Blackness (1996); Architecturally Speaking (2000). Als beratender Gründungsherausgeber der Zeitschrift Performance Research hat Read zwei ihrer Ausgaben ediert: On Animals (2000) sowie On Civility (2004). Demnächst erscheinen Ergebnisse seiner aktuellen Forschung über das Schicksal der dramatisch Unbedeutenden (The Theatre & Its Poor: Performance, Politics and the Powerless). Tobias Rees studierte u. a. Ethnologie und Philosophie in Tübingen und Heidelberg. Von 2001 bis 2006 Promotion in Anthropologie an der University of California at Berkeley. 2007: Institut für Ethnologie in Freiburg; 2007 bis 2008: Lecturer am Lehrstuhl für Wissenschaftsforschung
356
ZU DEN AUTOREN
ETH Zürich; 2008: Assistent am Institut für Ethnologie, Universität Zürich. Seit Januar 2009 ist er Professor für Anthropologie im Department of Social Studies of Medicine an der McGill University in Montreal, Kanada. Seine Arbeiten erkunden in Form von ethnologischer Forschung die Möglichkeit einer Anthropologie des Wissens/Denkens. Sein Hauptaugenmerk gilt dabei Situationen, in denen Kategorien, die unser Wissen ordnen und ihm Sinn verleihen, in Bewegung geraten. Seine bisher publizierten Versuche, Wissen in Bewegung zu erfassen, enthalten einerseits eine groß angelegte Studie zur Entdeckung der Plastizität des Erwachsenengehirns (Plastic Reason, 2006) und andererseits Studien zur Geschichte der Anthropologie und den ihr immanenten Kategorien wie Kultur oder Gesellschaft (Designs for an Anthropology of the Contemporary, 2008). Frank Richarz ist Theaterwissenschaftler und Philosoph. Er studierte Philosophie, Theaterwissenschaft, Kulturwissenschaft, Öffentliches Recht und Volkswirtschaftslehre in Potsdam, Hagen und Berlin. Von 2008 bis 2010 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich Kulturen des Performativen an der FU Berlin im Teilprojekt Ästhetik des Performativen. 2011 wechselte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Sonderforschungsbereich Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung der Künste. Neben dem Studium ging er einer Vielzahl politischer Tätigkeiten nach. Zudem war er selbstständiger Unternehmer im Bereich Onlinecommunities und E-Learning sowie Mitgründer und Namensgeber der internationalen eSports-Marke mousesports (www.mousesports.de). Forschungsschwerpunkte sind die Entwicklung einer theatralanalytischen Methode und einer damit verknüpften theatralogischen Spieltheorie. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden in der Dissertation Als ob und doch erscheinen. Jens Roselt ist Theaterwissenschaftler und Professor für Theorie und Praxis des Theaters an der Universität Hildesheim. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Ästhetik des zeitgenössischen Theaters und der Performancekunst, die Geschichte und die Theorie der Schauspielkunst, die Probenanalyse sowie die Methoden der Aufführungsanalyse. Veröffentlichungen (u. a.): Kunst der Aufführung – Aufführung der Kunst (Hg. mit E. Fischer-Lichte/C. Risi, 2004); Phänomenologie des Theaters (2008); Koordinaten der Leidenschaft. Kulturelle Aufführungen von Gefühlen (Hg. mit C. Risi, 2009); Chaos und Konzept. Proben und Probieren im Theater (Hg. mit M. Hinz, 2011). Małgorzata Sugiera ist Professorin und Lehrstuhlinhaberin für Performativität an der Jagiellonischen Universität, Krakau. Zudem ist sie Übersetzerin wissenschaftlicher und szenischer Texte aus drei Fremdsprachen. Forschungs- und Publikationsschwerpunkte: modernes europäisches Drama in vergleichender Perspektive, Gender und Queer Theorie, Drama nach Shakespeare, Verhältnis von Gedächtnis, Geschichte und Drama. Mit M. Borowski ist sie Herausgegeberin von: Fictional Realities / Real Fictions (2007); Theater spielen und denken: Polnische Texte des 20. Jahrhunderts (2008); Worlds in Words. Storytelling in Contemporary Theatre and Playwriting (2010). Nina Tecklenburg ist Theaterwissenschaftlerin, Performerin und Regisseurin. Sie studierte Theaterwissenschaft und Literaturwissenschaft in Berlin und Glasgow. Von 2006 bis 2010 arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Sonderforschungsbereich Kulturen des Performativen an der FU Berlin im Teilprojekt Ästhetik des Performativen. Seit 2002 realisierte sie zahlreiche Theater- und Performanceprojekte u. a. in Zusammenarbeit mit Gob Squad, Lone Twin Theatre, She She Pop, Baktruppen, Reckless Sleepers, Bernadette La Hengst und Till Müller-Klug. Ihre Dissertation Performing Stories. Narrative Praktiken in den performativen Künsten der Nullerjahre erscheint 2013. Viktoria Tkaczyk ist Assistant Professor of Arts and New Media an der University of Amsterdam und Dilthey Fellow am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Sie lehrt
ZU DEN AUTOREN
357
und forscht zu Themen am Schnittpunkt von Theater-, Medien- und Wissenschaftsgeschichte. Gegenwärtig ist sie mit dem Projekt „Akustisches Theater, 1750-1930“ befasst. Tkaczyk studierte Theaterwissenschaft, Neuere Deutsche Literatur und Soziologie in München, Madrid und Berlin. Ihre Dissertationsschrift „Himmels-Falten. Zur Theatralität des Fliegens in der Frühen Neuzeit“ wurde 2008 mit dem Ernst Reuter Preis ausgezeichnet. Von 2008 bis 2010 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Sonderforschungsbereich Kulturen des Performativen (Teilprojekt Theatrum Scientiarum) an der FU Berlin. Anschließend folgte ein Forschungsaufenthalt als Feodor Lynen Fellow am Atelier de Recherche sur l’Intermédialité et les Arts du Spectacle (CNRS, Paris). Veröffentlichungen (u. a.): Himmels-Falten. Zur Theatralität des Fliegens in der frühen Neuzeit (2011); Resonanz. Potentiale einer akustischen Figur (Hg. mit R. Wolf/K. Lichau, 2009). Matthias Warstat ist seit 2008 Professor für Theater- und Medienwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg. Von 2005 bis 2008 wissenschaftlicher Assistent am Institut für Theaterwissenschaft der FU Berlin und Mitglied im Sonderforschungsbereich Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung der Künste. 2007 Habilitation (Krise und Heilung. Wirkungsästhetiken des Theaters, 2011). Mitglied der Jungen Akademie an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften seit 2008. Forschungsschwerpunkte: Theorien des Ästhetischen, Theatralität der Politik, Theater und Fest/Ritual, Theatergeschichte der Moderne. Christel Weiler ist Akademische Oberrätin am Institut für Theaterwissenschaft der FU Berlin und seit 2008 Programmdirektorin des Internationalen Forschungskollegs Verflechtungen von Theaterkulturen. Ihr primäres Interesse besteht in der Betrachtung und Analyse des zeitgenössischen Theaters. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit kulturell unterschiedlichen Formen der Ausbildung von Schauspielern. Gemeinsam mit J. Roselt hat sie zuletzt den Band Schauspielen heute. Die Bildung des Menschen in den performativen Künsten (2011) herausgegeben.
![Organisationsforschung nach Foucault: Macht - Diskurs - Widerstand [1. Aufl.]
9783839421710](https://dokumen.pub/img/200x200/organisationsforschung-nach-foucault-macht-diskurs-widerstand-1-aufl-9783839421710.jpg)