D. Iunii Iuvenalis satirae: Volumen 2 Commentar zu Juvenals Satiren [Reprint 2022 ed.] 9783112689202
158 23 116MB
German Pages 558 [560] Year 1840
Polecaj historie
Table of contents :
EINLEITUNG
ERKLAERUNG
ERSTE SATIRE
ZWEITE SATIRE
DRITTE SATIRE
VIERTE SATIRE
FUENFTE SATIRE
SECHSTE SATIRE
SIEBENTE SATIRE
ACHTE SATIRE
NEUNTE SATIRE
ZEHNTE SATIRE
EILFTE SATIRE
ZWOELFTE SATIRE
DREIZEHNTE SATIRE
VIERZEHNTE SATIRE
FUENFZEHNTE SATIRE
SECHSZEHNTE SATIRE
REGISTER ZUM COMMENTAR
Citation preview
D. I U N I I I U V E N A U S
S A T I R A E cum C O M M E N T
CAROLI FRID
A R I I S
HEINRICHII.
ACCEDUNT
SCHOLIA V E T E R A EIUSDEM HEINRICHII
ET LUDOVICI
AN N O T A T I ON I B U S C R I T I C I S
VOLUMEN
SCHOPENI
INSTRUCTA.
If.
B O N N A E APUD
ADOLPI1UM MDCCCXXXIX.
MARCUJVI.
C O M M E N T A R zu
JUVENALS
SATIREN
VON
CARL FRIED.
Vol.
IL
HEINRICH.
1
E
I
N
L
VON
E
I
DER
T
U
N
G
.
SATIRE.
D i e Dichtkunst der Römer war eine Tochter der Griechisclien , und beruhte grösstenteils auf Nachahmung. Doch die Muse, welche seihst Barharen nicht ganz verlässt, hatte eine eigentümliche Gabe auch den Römern verliehen,- Woran sie sich begnügten, noch bevor die Reize Griechischer Kunst für sie anziehend werden konnten. Die Römer haben eine eigene, von fremden Mustern unabhängige , einbeimische Poesie gehabt. Gleichzeitig mit einer unförmlichen Art lustiger Gesänge oder Schwanke, die sie sich aus der Nachbarschaft, von den Etruskern, aneigneten (carmina Fescennina , von der Etruskischen Stadt Fescenniu), gab es alte Italische Volkslieder von den Thaten grosser Vorfahren, eine Art Rundgesänge bei Gastmälern, die von den Gästen selbst zur Flöte gesungen wurden. Die oxoXict der Griechen waren diesen ziemlich ähnlich-; auch sie wurden bei Tafel gesungen. Die Versart dieser altrömischen Volkslieder war regellos, versus Saturnii, Knittelverse. Nicht zu Cato's Zeit waren sie noch vorhanden, wie Niebuhr sagt in der Rom. Gesch. 1. T h . S. 178., nach einem Missverständniss ; sondern Cato selbst gab bloss Bericht über ihr Daseyn in eiuer frühern Zeit. Die Haupt-,teilen darüber bei Cicero, Tuscul. I, 2. Brut. c. 18, und 19. Ebenfalls gehören schon in die früheste
4
EINLEITUNG.
Z e i t die annosa Volumina
vatum ,
alte O r a k c l s p r i i c h e ,
die
d e m prophetischen F a u n u s des allen Lutiums und alten W a h r sagern
in den Mund gelegt
A e n . VII. p. 156. 1, 26.
waren.
Hevne's E x c u r s , V . a d
und die Ausleger
des H o r a z zu E p i s t . II,
A b e r m e h r mit unserer D i c h t a r t v e r w a n d t w a r eine
dramatischer
altrömische G a t t u n g L i v i u s erhalten hat
Spiele,
deren
in d e r b e r ü h m t e n Stelle v o m
des Römischen S c h a u s p i e l s , V I I , 2.
Geschichte Ursprung
D e n U r s p r u n g bei G e -
legenheit einer P e s t a. U . 3 9 1 . , a . Chr. 361. erzählt seihst L i vius n u r Um
als S a g e ,
was
jene Zeit liess man
man
noch
i m m e r übersehen
aus E t r u r i e n
ludiones,
hat.
Spielleute,
nach R o m kommen ; o d e r sie kamen a u c h wohl ungerufen. Denn a u f die V e r a n l a s s u n g , wohl w e n i g
zu
rechnen.
wie die S a g e sie e r z ä h l t e ,
welche diese L e u t e
Tänze,
eine Art von P a n -
m i t b r a c h t e n , w a r e n ursprünglich t o m i m e n , ivobei Zweifel
schon
ist
Die Spiele,
nicht g e s p r o c h e n
eine Handlung
wurde,
darstellten,
die a b e r ohne
also d r a m a t i s c h e
T ä n z e , dergleichen auch schon in d e r Homerischen W e l t v o r kommen.
E b e n diess w a r das E i g e n e dabei, d e r mos
wie L i v i u s sagt. schen S p r a c h e
Ein
solcher T ä n z e r hiess in
hister;
d e r histrio
daher
der L a t e i n e r , mit
d e r E n d u n g des altrömischcn W o r t e s ludio. kische F o r m hält sich d e r Q u e l l e näher. w a n d t mit instar, d a h e r tacur/;$i ,
f r ü h e r istar,
iuventus
m e r in solchen D i n g e n , die f r e m d e K u n s t
nach,
wähnten lustigen L i e d e r , gen.
D i e alte E t r u s Das W o r t ist v e r -
und beides von i'aog,
zusammengezogen
R ö m i s c h e Jugend,
Tuscus,
der Etruski-
lar/jp ,
assimilator.
IUOCO
;
Die
— so spricht d e r ernsthatte R ö wo und
w i r das verband
Volk sagen —
ahmte
damit jene erst e r -
die F e s c e n n i n a , in W e c h s e l g e s ä n -
An die Stelle dieser, von den R ö m e r n a u f g e n o m m e n e n ,
S p i e l e traten bald a n d e r e in etwas besserer F o r m , mit B e gleitung d e r F l ö t e , ad tibicinem. gentlichen .Namen saturae, und satura
ist misccllurn
gemisehtes W e s e n .
D a s waren mit ihrem ei-
d. i. f a b u l a e miscellae. aliquid,
Lanx s a t u r a ,
ein
von
Saturum
allerlei Sachen
das O p f e r a u f d e m A l t a r
VON DER
SATIRE.
5
d e r G o t t h e i t , aus den Erstlingsfrüchten des Jahres gemischt. D a h e r per saturam sprichwörtlich, wo vielerlei durch einand e r geschieht. Die Beispiele vom Gebrauch des W o r t e s hat man zusammen in den grossen Lexicis von Gesner und F o r cellini. U n d eben auf diese W o r t b e d e u t u n g geht der Ausdruck des Livius von diesen Spielen: impletae rnodis saturae. Livius bezog den Grund der Benennung auf die modos, die Rhythmen der begleitenden Musik., was doch wohl nicht richtig ist, und als Versuch einer E r k l ä r u n g bei dem Geschichtschreiber nicht so genau genommen wird. Aus dem Zusammenhange der Sachen zeigt sich vielmehr, dass der Ausdruck satura auf das ganze Mancherlei in Materie und F o r m dieser Spiele bezogen w u r d e , wozu denn freilich die wechselnden Rhythmen ebenfalls gehörten. U d i n g e n s ist merkwürdig, dass noch das heutige-Italien f ü r regellose L u s t spiele eine, der altrömischen völlig entsprechende, Benennung h a t . Das Italienische W o r t Farsa , von dem Lateinischen farcio , farsum , bedeutet eigentlich, ganz wie s a t u r a , ein Gemisch von Allerlei. Lessings Collectaneen I. 237. In diesem Zusammenhang erklärt sich nun leicht im Glossario H. S t e p h a n i : aaTVQiax^Q, o axijvixöi;, ludio, welches von Salinasius in Vopisc. p . 504. C. unrecht genommen worden ist. aajVQiaTTjg gebrauchte der Grieche von dem ludio der altrömischen satura. U n d hiernach kann auch Schneider im Griech. W B . berichtigt w e r d e n . Aus dem Bisherigen ergibt sich bereits, dass kein Griechischer Einfluss auf die altrömische satura statt fand. Aber auch nicht einmal von den Etruskern w a r sie entlehnt: die von diesen gekommenen Spieler hatten bloss Anlass dazu gegeben. Die erste s a t u r a der Römer w a r also etwas D r a m a tisches. Dergleichen Schauspiele enthielten ohne Zweifel schon viel tüchtigen Stoff zu einem eigentlichen D r a m a : aber der Stoff w a r gemischt, Ernsthaftes und Lustiges durch einander; das Ganze ohne Plan und formlos. Es wird ausdrücklich von Livius gesagt, dass jenen Spielen das argumentum, die
G
EINLEITUNG.
Anlage einer H a n d l u n g , Griechisch /nv&og, gefehlt habe. Von solchen Schauspielen macht man sich freilich nur schwer einen Begriff; denn selbst bei den bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts in Deutschland und lange in Italien üblichen improvisirten und extemporirten Stücken lag eine Skizze nach Acten und Scenen zum Grunde. Aus ihnen ging dennoch bald ein mehr geregeltes Drama h e r v o r , und dieses blieb denn in den Händen der Histrionen, der Spieler von Profession , da einmal die Sache künstlich geworden w a r , und deshalb eine eigene Künstlerzunft nothwendig machte. Die freie Römische iuventus aber blieb' bei jenen alten W e c h selgesängen , und wusste noch durch eingeschaltete Lächerlichkeiten sie interessanter zu machen. Livius gebraucht den Ausdruck ridicula intexta versibus, und setzt h i n z u : es /ind diese nachmals exodia g e n a n n t , und hauptsächlich mit den Atellanischen Schauspielen verbunden w o r d e n , conserta fabellis potissimum Atellanis. Dieses w a r eine andere Art S p i e l e , die schon die Osci im alten Latium hatten ; daher auch ludi Osci, Cicero ad Div. VII, I . , zunächst ai\s Atella in Campanien zu den Römern g e b r a c h t , und die von den eigentlichen Histrionen nicht gespielt werden durften ; diese w ü r d e n sie nur entweihet haben. Aus der Verbindung der Sachen beim Livius sieht man, dass die Atellanae erst in der Folge von den -Römern sind aufgenommen worden , dass diese an die Stelle der v o r m a ligen Wechselgesänge traten, und dass nun die altvaterischen ridicula u n t e r einem neu aufgekommenen TV amen , exodia, mit den Atellanen vereinigt w u r d e n . Die Osci, ein Urvolk des alten Italiens, waren längst als Volk v e r s c h w u n d e n : die Oscische S p r a c h e a b e r , als eine alte einheimische Mundart, erhielt sich noch , w o r a u f Strabo besonders aufmerksam m a c h t , V. p. 2 3 3 . A. Diesen Dialect redeten noch die S a b i n e r , Samniter und C a m p a n e r , und man verstand sie auch in Rom. In diesjem Dialect wurden die Atellanen gespielt, etwa wie Wenn man Schauspiele iin Dorischen Dialect in
V O N DER
SATIRE.
7
Athen aufgeführt h ä t t e , oder noch Schauspiele in Plattdeutscher Sprache gäbe. Mit dem Ausdruck exodia lässt sich weniger leicht fertig werden. Nach einer genauen Auslegung der W o r t e beim Livius , sind sie von den Atellanen selbst verschieden, mit diesen aber verbunden, so dass man exodia allein nicht aufführen konnte. Daher exodium Atellanae gesagt wird in der Stelle des Juvenal VI, 71. als etwas, das zur Atellana gehört: desgleichen Atellanicum exodium beim Sueton. Tib. c. 45. Die exodia hält mfln für komische Nachspiele, welches die Bildung des Wortes anzudeuten scheint. Diess ist die allgemeine Meinung, seit dem grossen Jos. Scaliger ad Manil. p. 360. ed. Argent. und Casaubonus de sat. poesi p. 184. ff., und dabei lassen es auch die Auslegei; des Livius, und Blankenburg Literai*. Zusätze zu Sulzers Theorie, Art. Comödie, I. Bd. S. 268., den man übrigens mit Nutzen bei dieser Materie vergleichen kann. Jene Vorstellung lässt zwar Sahnasius in Scriptt. H.Aug, p. 384. A. B. nicht gelten, und versichert, das exodium sey etwas anders: was es aber sey, sagt er nicht. Dass es ein Schlussstück gewesen seyn müsse, ist freilich aus der Etymologie allein nicht zu erweisen. Livius sagt bestimmt, nachdem die alten ridicula längst bestanden, sey später der Name exodia aufgekommen. Ohne eine Veränderung in der Sache selbst konnte eine neue ausländische Benennung nicht leicht eingeführt werden. Nach der Zusammenstellung der Sachen beim Livius, und selbst nach dem, von ihm absichtlich gewählten, Ausdruck, exodia conserta Jabeliis potissimum Alellanis sunt, zusammengereiht, denkt man eher an Zwischenspiele, als Ruhepunete der Atellanen. Doch muss man diese wieder sich nicht gerade zwischen den Acten denken : denn diess w ü r d e eine irrige Vorstellung von den Atellanen selbst voraussetzen; sondern es wurden mehrere Atellanische Stücke an Einem Schauspieltage gegeben, und Exoclien dazwischen. U n t e r italien w a r voll von mehreren Arten dramatischer Spiele; von dort scheint F o r m und Benennung der Exodien nach
8
EINLEITUNG.
Rom verpflanzt zu seyn: oäov, was hors cPoeuvre hei Atelliiiiischen Stücken war , ludicra extra argumentum. Was übrigens die dramatische Beschaffenheit der Atellana betrifft, wie sie sich lange Zeit unverändert erhielt, so war unstreitig diese, ihrem Wesen nach, von der alten theatralischen satura nicht viel verschieden, und hätte wohl mit Fug auch diesen Namen führen können. Die alte Mundart war wohl eigentlich das Einzige, was die Atellana vor ihrer altern Schwester voraus behielt. Diese Gattung hat sich lange behauptet, bis in die Zeiten Juvenals und darüber: so dass sie unter Hadrian nicht Konnte schon längst abgekommen seyn, wie Salmasius irrt in Spart, p. 51. a. C. Tertullian .kannte sie noch: de Spectaculis p. 80. B. Sie hatten früher auch schon einen oder den andern Dichter gefunden , der dergleichen schrieb. Einer davon wird oft yon den Alten erwähnt, L. Fomponius Bononiensis, dessen Fragmente Münk gesammelt hat. Auch ausser der Bühne wurde ähnlicher Stoff von Komischen Liebhabern benutzt. Denn es entstand bald in einem verschiedenen Kreise eine satura, für Leser geschrieben ; damals noch nicht bei Recitationen für Zuhörer. So wenig wie auf der Bühne, so wenig war ausser ihr die satura als Kunstart etwas Bestimmtes, und blieb vielmehr auch so noch ein sehr Gemischtes in Rücksicht des Inhalts und der F o r m , gemischt aus Prosa und Vers, und wieder -aus verschiedenen Arten des Verses. Aber schon als Theaterspiel war die satura ein durchaus launiges Wesen, welches sich überall auf die wirkliche Welt und das tägliche Menschenleben warf, mit Witz, Spott und Neckerei, ohne Schonung persönlicher Gegenstände und lebender Vorbilder, sich weidlich belustigte, diesem Charakter nach schon Personal - Satire. Der Saturist, der auftrat, traf sonder Zweifel schon sehr häufig im Augenblick der Laune den wahren Ton der eigentlichen Satire, gleichwie Hanswurst bei unsern deutschen Vorfahren gerade so oft der beste Satiriker "War, Bei solcher Gelegenheit wird aber auch leicht die
VON D E R
SATIRE.
9
Grenze cles Erlaubten überschritten; häufige Beispiele von grober Ausschweifung in persönlichen Anfallen machten auf Missbrauch aufmerksam, und veranlassten Gesetze dawider. In gleichen Fall kam denn auch die geschriebene satura , die nur ausser der Bühne weniger bedenklich w a r , weil sie weniger Aufsehen erregte. Sie halte ebenfalls, bei ihrem angeerbten Hange zur Persönlichkeit, die Gesetze zu fürchten. Die zwölf Tafeln verordneten Strafe für mala carmina, i. e. maligna (Pasquille). Die Sache ist bekannt genug aus Horaz Epist. II, 1, 152. ff. Zu vergleichen Cicero's Fragmente S. 1080. beiErncsti, die Stellen aus Augustinus. Nur kommt dabei ein Missgriff vor, der durch die W o r t e des Horaz, Jormidine fuslis, veranlasst ward; es haben nämlich Interpreten gesagt, die Strafe sei körperlich, fustuaríum gewesen. Indessen war Jiistii metaphorisch gebraucht für gesetzliche Strafe im Allgemeinen. Bei allem -dem darf man die alte satura mit unserer Satire nicht verwechseln. Jenes blieb noch immer eine allgemeine, vieldeutige Benennung, wie die ähnlichen in der Poesie der Alten, sermo, écloga, idyllium. Saturas dieser Art erhielten die Römer von ihrem Enräus und Pacuvius, schon im zweiten Jahrhundert vor Christi Geburt, und etwa hundert und fünfzig Jahre später im Zeitalter des Cicero, von dem!. „Romanorum doctissimus", Dil. Terentius Varro, letztere in Prosa, mit untermischten Versen, von ihm selbst Menippeae genannt, Nachahmung einer originellen Gattung, worin Menippus sich ausgezeichnet hatte, der Vorläufer des Lucían , anoväoytXoiog, wie ihn die Griechen seines Characters wegen nannten. Ueber die Varronianische oder Menippeische Satire ist man noch nicht gehörig im Reinen. Ein gewisser J. G. Hauptmann hat zwar de Sat. Varroniana s. Menippea in den Miscell. Lips. nov. V. p. 358. sqq. geschrieben ; allein hierdurch ist die Sache noch lange nicht erschöpft. Die Manier dieser Satire hat sich erhalten in der Schrift des Seneca: Ludus de tnorte Claudii; in den Schriften des Petronius und des Kaisers Julianus. Aher die des Varro
10
EINLEITUNG.
scheint viel mehr Buntscheckiges gehabt zu haben, und man macht sich einen Begriff davon aus einer beträchtlichen Anzahl von Fragmenten, in der Zweibr. Ausg. S. 260—318. F ü r Satiren Römische Sprache und Sitten waren die Varronischen eine reiche .Fundgrube. Quintilian in der classischen Stelle von der Satire der Römer X, 1, 95. nennt die d e s V a r r o nach der Lucilischen, von der wir gleich reden werden, als das alterum genus: die Stelle bat aber eine bedeutende Schwierigkeit. Bald nach Ennius' und Pacuvius trat C. Lucilius aufj um 606 a. U . , 121 v. C h r . , ein Ritter aus Suessa in Campanien, welches Auruncer gestiftet hatten. Campaniens Bewohner wjiren bekannt durch ihre Laune und ihren W i t z ; sie waren in Italien, was in Frankreich die Gascogner, oder in England die Irländer .sind. Die Griechen schrieben den Namen yiovy.ikb.og, zum Beweis, wie die Römer ihn aussprachen , das c wie ein k , und das l in der Mitte verdopp e l t , Lukillius. Dieser war der E r s t e , der den Charakter der poetischen Satire feststellte, und den reichhaltigen Stoff der alten satura der Bühne zum Sitten - und Strafgedicht, als eigener poetischen Gattung, in einer bestimmten Versart ausbildete. Diess ist denn endlich der Character Luciiianus, nach Varro's Ausdruck de Re Rust. III, 2, 7. Der Stoff der Lucilischen Satire w a r höchst mannichfaltig, und verbreitete sich selbst über litterarische Gegenstande und Erscheinungen, Gellius 1. X V I I . in fin. Die Frage, wie Jemand darauf verfallen konnte , das alte Possenspiel in die Litteratur zu verpflanzen, und bloss für Leser zu bearbeiten, lasst sich eben so schwer abweisen, als sie unschwer zu beantworten steht. Lucilius w ü r d e sein Talent dem Theater gewidmet haben, er würde als Dichter der Comödie Epoche gemacht haben, wären die Umstände in Rom dazu einladend gewesen. Es lag gewiss nicht an seiner Neigung, dass er f ü r das damalige Rom nicht eben das wurde , was zu ihrer Zeit die Dichter der altern Attischen C o m ö d i e , ein R r a f i n u s , Eupolis, Aristophanes, f ü r Athen waren. Dazu besass er Freimüthigkeit
VON DER
SATIRE.
11
im vollen Masse, die er auch in seinen Schriften, völlig im Ton der altern Comödie, geltend machte. Denn seine Satire hatte ganz den persönlichen Charakter von der Griechischen Comödie entlehnt, wie wir aus Horaz und Andern wissen. Aber das damalige Rom war nicht das Athen der alten Komiker ; die Römische Theaterfreiheit hatte schon grosse Beschränkungen erfahren, und der fustis der zwölf Tafeln war für den Freimüthigen eine ängstliche Sache. Viel zu m'äcbtig war auch der erste Stand in Rom, a u c h , durch die Clientschaft, in seinem Einfluss auf die Stimmung des Volkes, als dass, selbst ohne Furcht vor der Strafe, die Geissei der Satire auf öffentlichem Schauplatz ihr Glück hätte machen können. Ueberdem liess das Amphitheater bei den Römern nie recht ein Theater aufkommen; die Lucile konnten deswegen wenig Lust haben, sich eifrig um die Lorbeern zu bewerben, die auf diesem Felde nur sparsam blühten, und zogen daher lieber den engern Kreis vor, worin sie, mit weniger Gefahr, mehr Belohnung zu erwarten hatten. Lucilius sah auch diese Erwartung erfüllt: die neue, durch ihn gebildete, Dichtart machte ihn zum Liebling Roms; und noch spät hatte Lucilius seine Verehrer, denen er mehr galt, als selbst Horaz. Dialog, de corr. eloq. c. 23. Curtius Nicia, zu Cicero's und Pompejus Zeit, schrieb ein W e r k über Lucilius, und selbst Satiren, wodurch er sich als Kunstrichter über ihn bewährte; Sueton. illustr. Grammatic. c. 14. extr. ; und die alten Grammatiker, Laelius Archelaus und Vectius Pliilocomus , erklärten in Schulen Lucils Satiren. Suet. 1.1. c. 2. (legisse se apud — ut diseipulos.) Vortrefflichen Stoff zu einer Charakteristik bieten die Stellen beim Cicero, Horaz und Quintilian vom Lucilius, sammt einem Zeugniss des P e r sius gegen das Ende der ersten Satire. Horaz war gerecht gegen sein Genie ; aber er hat ihm die Incorrectheit nicht verzeihen können, und er rügt sie mit Strenge, weil auch seine unkritischen Verehrer in Rom es bedurften, dass ein feinerer Geschmack in der Poesie durch Rüge des Gegen-
12
EINLEITUNG.
theils ihnen empfohlen wurde. Schon Quintilian missbilhgt das zu einseitige Urtheil des H o r a z ; viel einseitiger aber war Wieland zu Horaz 4. Sat. des l. Buchs , in den Erläuterungen Nr. 1. Geläutert ist hier wenigstens nichts, und mit Gemeinplätzen nach weiland Batteux lässt sich nicht Alles ahthun. Lucilius war ein Vielschreiber; die Alten fuhren dreissig Büclicr Satiren von ihm an , welches aber freilich nur ein sehr unbestimmtes Mass für die Menge seiner Schriften ist. W i r haben nur noch Fragmente, Zuerst gesammelt von dem Holländer Franc. Dousa. Eine zweite Ausgabe dieser Sammlung ist 1735 in Padua in Octav herausgekommen , und eine dritte, bis jetzt die beste, durch Haverkamp ad calcem Censorini, L. Bat. 1743. 8. Auch mit dem Zweibriicker Juvenal und Persius sind diese Fragmente wieder erschienen. Aus ihnen würde sich unstreitig noch Etwas machen lassen, wodurch Lucils Charakter mehr Licht erhielte. Sie geben noch vielen Stoff zu einer verdienstlichen kritischen A r b e i t , wie schon langst auch von Bayle bemerkt ist; denn Lucilius war ein Siltcnmaler; seine Dichtart schöpfte aus dem wirklichen Menschenleben, w a r ein Lehrgedicht zu sittlichen Zwecken, mit der Absicht, T h o r , heit und Unsittliehkeit zu rügen. So wurde die Satire erst durch Lucilius zum eigentlichen Gedicht erhoben, und zu einer bleibenden Gattung ausgebildet. Der alte Name des Gedichts blieb weiterhin der in ihm vorherrschenden eigenen Art von Laune oder Gemüthsstimmung, die daher die satirische heisst, und die in Rede oder Schrift sich auf sehr mannichfaltige Weise darstellt, auch jeder beliebigen F o r m sich bedienen d a r f , und übrigens in der Art ihrer Aeusserung verschieden modificirt wird nicht allein durch Gegenstand und Veranlassung, sondern ganz hauptsächlich durch den sittlichen Charakter, durch die Gesinnung, aus der sie entspringt, und durch den Grad der Geistesbildung, der sie begleitet; weshalb es eine gutmüthige Satire gibt und eine bösartige, eine milde und bittere, eine feine und grobe, u. s. w.
VON
DER
SATIRE.
13
Sehr verschieden ist daher auch das Wesen der Satire in der Litteratur aller literarischen Völker ausgeprägt. E i n e nützliche Sammlung, als Stoff zur Kenntniss des Mannichfaltigen, in dem Buche von Flögel, Geschichte der komischen Literatur, vier Bande, im ersten und zweiten Band von der Satire. Jene Verschiedenheit muss sich begreiflich auch der Satire mittheilen, wenn sie Gedicht wird ; nach Massgabe, wie das Gemüth des Dichters durch den Anblick von T h o r heiten und Lastern mehr oder minder bewegt; je nachdem es mehr von lacherlichen oder empörenden Erscheinungen Eindrücke empfangt, muss auch Ton und Charakter des Gedichts sich anders gestalten. Es gibt daher eben sowohl eine komische, als eine tragische Satire , deren Wirkung {inalog ist d e r , die eine Komödie oder Tragödie hervorbringt. In der Lucilischen muss der tragische Charakter bereits zum Theil vorherrschend gewesen seyn : das sieht man aus Juvenal, der von ihm sagt: er griff das Laster mit dem Schwerte in der Faust an, und donnerte den Sündern seiner Zeit ins Gewissen: Sat. I. am Ende. Juvenal selbst hat an vielen Stellen bewundernswürdige Züge eines acht tragischen Charakters. Bisher sahen wir die Satire als eine original-römische, von den Römern selbst erfundene und ausgebildete, Dichtart. Und dass diese Ansicht die wahre und richtige sei, beweis't der bisher nachgewiesene natürliche Gang ihrer Entwickelung ; beweisen ferner die gewichtvollsten Autoritäten der Allen selbst: Horaz Sat. I, 10, 6 6 . , Quintilian X , 1, 9 3 . , der Grammatiker Diomedes in der Sammlung des Putsch S. 482. f. Aber man hat früher eine entgegengesetzte Meinung gehegt: die Satire der Römer sey, mit den übrigen Dichtarten, von den Griechen entlehnt, sey ein Abkömmling des drama satyricuni, d. i. der travestirten Tragödie der Attiker, an den Bacchusfesten, worin muthwillige Satyre und Silenen auftreten , den Ernst der Handlung ins Lustige ziehend ; eine Gattung, woran die Attische Bühne sehr reich w a r , wovon
14
EINLEITUNG.
jetzt nur noch ein einziges vollständiges Muster übrig ist, der Cyklope des Euripides, und wovon auch Nachahmungen auf dem Römischen Theater versucht worden sind, nach Horaz A. Poet. 220. ff. F ü r diese Meinung sind die Hauptstreiter: JuJ. C. Scaliger im sechszehnten, und Dan. Heinsius im siebenzehnten J a h r h u n d e r t , beide nichts weniger als musterhaft« Forscher. Ihre ganze Lehre ist V e r w i r r u n g , veranlasst durch die zufällige Aelinlichkeit der Namen und durch Nichtunterscheidung ganz verschiedener Dinge. Schon durch Js. Casaubonus , einen der grössten Litteratoren seiner Zeit und aller Zeiten, der das gesundeste Urtheil und den schärfsten Blick mit der grössten Gelehrsamkeit verband , war die gänzliche Unabhängigkeit und Verschiedenheit der Römischen Satire vom Griechischen Satyrspiele wahrgenommen und e r wiesen , in einer vortrefflichen Schrift: De satyrica Graecor. poesi etRomanor. Satira, Paris. 1605.8., abgedruckt in Th. Crenii Museo philol. et histor. L. 13. 1699., und einzeln besorgt von Rainbach, Halae 1774., der nur seine Noten hätte weglassen sollen. Nach Casaubonus ist diese Frage noch vielmal besprochen worden von Andern ; in der Hauptsache ist durch alles diess nichts gewonnen worden. Nachweisung bei Blankenburg zu Sulzers Artikel Satire, Was dieser aus sich selbst beibringt über die Verwandtschaft der Römischen Satire mit ähnlichen Griechischen Dichtarten, wie er sagt, S. 4. und 5 . , ist in den einzelnen Sachen ungenau, und im Ganzen irrig. V o r ihm schwankte auch Flögel, und kann, da ihm die Aehnliclikeiten vor den Augen schweben, zu keinem Resultate kpmmen, 2. B. S. 1 2 — 2 1 . , wo er die „ b e rühmte F r a g e " abhandelt. Der Neueste ist Ast, im Grundr. d. Philol. 1808., der auf eine klägliche Weise in die alten Irrthümer zurückfällt. Das Schicksal litterarischer Wahrheiten und richtiger Erkenntniss ist kein anderes, als das, was über W a h r h e i t und Recht in der Welt überhaupt waltet. Recht und W a h r heit werden verkannt, erkannt und wieder verkannt. Weil
VON
DER
SATIRE.
15
aber das Allgemeine nicht belehrend ist , und alle Gründlichkeit n u r aus dem Besondern , aus der P r ü f u n g des Einzelnen erwachsen kann: so müssen wir bei dieser Frage noch einige Augenblicke stehen bleiben. Es ist genau auf den Unterschied zu achten, der, bei übrigens verwandtem Stoff und Gegenstand, dennoch zwischen Formen ynd Dichtarten statt findet. Den Griechen hat es natürlich nicht an Stoff und Anlass zur Satire gefehlt; auch haben sie beides reichlich b e n u t z t , aber auf andere "Weise , als die Römer. Sie hatten in gewissem Sinne Satire, aber nicht die Satire, nicht die durch Lucilius bestimmte D i c h t a r t , das didaktische Sittengedicht, welches bei den Römern mit dem öffentlichen Schauplatz nichts zu thun hatte. Bei den Griechen hingegen war die Satire, als Geissei der Thorheiten und Laster, oder, welches von den Griechen richtiger gesagt ist, der Thoren und der Lasterhaften, etwas, das sie in Rom zu sein gar nicht Freiheit hatte, nämlich Schauspiel, Komödie-, als solche wirkte sie auf offenem Schauplatz nur desto stärker und allgemeiner. Ausserdem hatten die Griechen das eigentliche Schmähgedicht, welches, seines ganz andern Ursprungs und Zweckes wegen, nichts weniger als Lucilische Satire w a r ; wie die Jamben des Archilochus und Hipponax. Pindar charakterisirt sie als Schmähreden, die aus Hass und Feindschaft entstanden, also ganz aus persönlichen Antrieben, ßapvXoya eyßect, in der Stelle vom Archilochus Pytli. 2, 10., und nach Iloraz A. Poet. 79. Archilochimi rabies armavil ianibo.. XvaatSvTSS i'ctfißoi, w'dthige Jamben, im Griechischen Epigramm , Analect. Brunck. II. p. 286. Das älteste Original in dieser Art w a r Margites, welches von den Griechen f ü r ein Homerisches Gedicht gehalten w u r d e , noch vom Aristoteles. Ein Fragment des Simonides a b e r , das eine witzige Zeichnung der weiblichen Charaktere enthält, und fälschlich eine Satire auf die Weiber genannt wird, bat mit jener Art iambisqlier Gedichte durchaus nichts gemein, als nur die Jamben. Gewöhnlich erwähnt man bei dieser Gelegenheit auch der
16
EINLEITUNG.
sogenannten Sitten , (aiXkot, mit aiXluho) und 2iltjvög zusammenhängend ,) die durch Xenophanes, und vorzüglich durch Timon, den Phliasier, einen skeptischen Philosophen aus derZeit des Ptolem'aus Philadelphias, berühmt geworden sind. Diese, sagt man, waren eine didaktische Satire, und hatten die grösste Aehnlichkeit mit der Satire der Römer. Die Sillen waren aber kein Sittengedicht, auch überhaupt nicht didaktisch ; sie waren weniger Gedicht, als versificirtes Spiel , waren bloss litterarisch , und ganz spcciell gerichtet gegen die Blossen gewisser philosophischer Schulen, also etwas , das von Römern kaum des Lesens gewürdigt wurde, geschweige der Nachahmung. Sie könnten mit den neueren Xenien verglichen werden. Hier schalten wir nur noch den kleinen Umstand ein, dpr die Rechtschreibung des Wortes betrifft. Man schreibt unrecht Satyre, Satyra; dem W o r t e gebührt das i. In der ursprünglichen Form satura wurde schon u wie ein ii ausgesprochen , und dadurch die Aussprache mit i vorbereitet; wovon die Richtigkeit erhellt aus der Analogie so vieler Formen, wie lacruma, optumus, maxumus, woraus lacrima, optimus, u. s. w. wurde. Die letztere Schreibart ist acht, und auf die feinere Aussprache gegründet, schon im Augustischen Zeitalter. Das y konnte in die Satire nur durch Irrlhum hineinkommen. Zu vergl. Jos. Scaliger zum Manilius a. a. O., und nach ihm Casaubonus de Rom. Sat. p. 249. sq.
VOM
DICHTER.
Je mehr Lucilius sich zum Liebling seiner Nation zu machen gewusst h a t t e , desto mehr fand seine Dichtart unter den Römern Nachahmung; doch erst von den Zeiten Augusts an; früher scheinen sie ihn bloss bewundert zu haben. Die
VOM
DICHTER.
17
Sermonen des Horatius sind Lucilische Satiren, aber im eigenthiimlichen Ton, Satiren der komischen Gattung. Von Gleichzeitigen ist uns kaum noch eine Nachricht geblieben., wie von einem Julius Morus, der ein Freund des Horaz war und comes des Tiberius; von Andern der blosse Name. Die Notizen gibt Wernsdorf, Poetae Lat. min. T.III, p. XIV. ff., und Zusätze dazu T. IV. P. II. p. 824—827. Der Verfall der ttlten Römfertugend, der mit vermehrtem Reichthum und Luxus erfolgte, hatte den Freistaat gestürzt.. August konnte durch Gesetze wilde Ausbrüche grober Laster hemmen: aber den Reim, zur gänzlichen Sittenlosigkeit, der einmal tiefe Wurfcel geschlagen hatte, zerstören konnt'e er nicht. Daher artete die' Gewalt seiner nächsten Nachfolger so bald in Despotie aus, wozu das Verderbniss dee Nation von selbst aufforderte. Denn es ist unstreitig gewiss, dass bei aufgeklärten Völkern Despotie wenigstens nicht von langer Dauer sein k a n n , wenn das Volk Charakter hat: ein Volk aber, charakterlos und verderbt, macht sich immer selbst seine Tyrannen. Doch konnte auch unter den Römern , in den Zeiten des tiefsten Verfalls, die alte Rechtlichkeit, Kraft and'- Würde b«i Einzelnen niemals ganz erlöschen. Aber gerade diese Einzelnen fühlen sich dann uin so mehr beim Anbliok einer allgemeinen Nichtswürdigkeit empört, und fühlten sich unter den Römern um so mehr empört, da eben dieses Volk, das einst durch Charakterstärke uud grosse Eigenschaften sich zum ersten Volke der Welt erhoben "hatte, jetzt von den abscheulichsten Tyrannen in den Staub getret e n , nur um so verächtlicher erschien. Aus solchen Gefühle'ri entstand die Satirc unter den Nachfolgern' des Au'gustus; der Eindruck, den die Zeit auf ein edleres Gemüth hervorbrachte , spiegelte sich ab in dem Gedichte; es wurde Strafgedicht im bittersten Tone. Der Phönix unter den Satirendichtern dieser Zeit, des ersten Jahrh. n. Chr., ist Decimus (nicht Decius, wie er auch geschrieben wird,) Junius Juvenalis. Persius ist etwas f r ü h e r , steht aber an Genie und
18
EINLEITUNG.
Wahrer satirischer Kraft hinter Juvenal weit' zurück. Noch weniger liisst sich ein gleichzeitiges Frauenzimmer, Sulpirid, mit ihm vergleichen, von der njir noch Eine., auf die Regierung des Domitian Bezug habende, Satire übrig gchjlichcn. Man halt sie für dieselbe, die als keusche Poetin, und hof* fentlich eben so keusche Ehefrau des Calenus beim Martial gerühmt wird. Ihr noch vorhandenes Mach werk ist übrigens schon von Casaubonus ganz richtig heurtheilt; es bat seinen Werth als historisches Document. Bedeutend als Dichter, und ein berühmter Meister in der ernstem Satire, ist Juvenal. Als satirae Iragicae werden seine Satiren äusserst treffend bezeichnet von Jos. Scaliger, Prima Scaligerana p, 95. ed. Tan. F a b r i , eine Bezeichnung, die seinen Hauptcl arakter trifft, und zugleich sein, wahres Yerh'ältniss jtum Horaz überraschend aufklärt. Scaliger und andere grosse Männer seines Zeitalters haben die moderne Aesthetik nicht dfcm Namqn nach gekannt: sie kommen aber gewöhnlich in solchen Dingen mit .jhrpm grossen und sicheren Verstände weiter, ;ils mancher Aesthetiker neuerer Zeit mit seinem kleinen hat kommen können. Doch hat die Satire Juvenals auch ihre komischen Züge, und zwar oft sehr starke. Daher ist eigentlich der Charakter gemischt. Von den Lebensumständen des Dichters wissen wir wenig, aber doch nicht gar viel weniger, als wir üben zu wissen nöthig .haben. Und auch hier tröstet uns Lessings, nur etwas zii allgemeiner, Ausspruch: „Das Leben eiues Dichter? s,ind seine Gedichte." Juvenal lebte als Zeitgenosse mit Martialis, Statius, Quintiiianus; die beiden letztern erwähnt er namentlich, Auf ihn bezieht man auph, wohl mit Recht, die Worte des Quintilian , da, wo er von den Verdiensten der Römer in der Satire spricht, X, 1, 9 5 : Sunt clari, hodieejue, et qui olim noniinabuntur. Den Dichter namentlich anzuführen, l|tt wohl sein Verhältniss eu Domitian nicht, dessen JNeffen er zu erziehen hatte. Im Anhang zum Suetonius, und unter seinem Kamen , faul, et sich in spätem Ausgaben unter
VOM
DICHTER.
19
den Lebensbeschreibungen verschiedener Dichter auch eine kurze Vita Juvenalis, in gutem Latein, a b e r , wenigstens in dieser Form, nicht von Sueton. Auch haben wir eine spärliche Notiz über ihn bei Suidas, und einige Angaben in den alten Scholien, die aber wenig zuverlässig sind. Man hat gesucht , in diese Bruchstücke von Nachrichten histori-» sehen Zusammenhang zu bringen; zuerst J. Lipsius Epistolic. Quaest. IV, 20. T. I. p. 200. ff. Opp., dann Cl. Salmasius Exercitatt. Plin. p. 319. ff., und H. Dodwell Annal. Quintilian. §. 37—41. Vor nicht langer Zeit ist dieselbe Unteri suchung auf meine Veranlassung aufgenommen worden: Frqnckii Examen criticiun Juvenalis vitae. Alt. et Lips. 1820. und die • Fortsetzung Dorpat. 1827. Juvenal war eines reichcn Libertiners, man weiss nicht, ob Sohn oder Zögling, und trieb bis etwa in sein vierzigstes Jahr die Hednerkunst zu seinem Vergnügen, declamavit animi causa, nach damaliger Studirart. Oa er einmal einige satirische Verse auf den berüchtigten Pantomimentänzer Paris gemacht, (Paris der Zweite, unter Domitian,; denn ein Erster spielte früher seine Holle, unter Nero,) lind dieser Versuch Beifall erhielt :• so beschloss e r , in dieser Dichtart weiter zu arber-' ten , und von dieser Zeit a n , scheint es, ging er gänzlich von den rhetorischen Studien ab. Durch die Rednerschule musste damals Jeder, der sich bilden wollte ; nicht bloss der Sachwalter vor Gericht, für den die IJebungen im kunstmässigen Reden über erdichtete Rechtsfalle das Practicum. Waren. Daher war es zu d e r Z e i t , und schon unter Augustus, ganz gewöhnlich, dass die Dichter erst durch die Redmnsehulc gingen, und als- scholastici oder declamatores lange unter einem ' oder mehrereh Rhetoren studirten. Ovidius hatte schon auf diese Weise studirt, vielleicht der Erste unter den grossen Dichtfern. Natürlich musste diese Studirart nicht geringen Einfluss auf die Poesie selbst haben, und dem' Geschmack eine veränderte Richtung geben. Der neue Ge~, schmuck in Litterutur und Sprache der Römer, der von
20
fcliCLEIilU'NO.
Augusts letzten Rogici'Hlig^üliren an sicli irtlfneY Sichtbarer zeigt, ging von den Rednerschulen' zuerst «lös ; in Ovids Poesie und Sprache liegt schon def ; Einflltss eihef rednerischen Bifdung vor Augen. Glänzende Beispiele, dass rhetorische Studenten nachmals grosse Dichter geworden waren,' verführten mittelrnässige K ö p f e , es ihnen nachthun zu wollen ; wollte es mit der Redekunst nicht recht f o r t , so -wurden sie Dichter. Und diese Leute waren es, die die Pbesie liertinterbrachten. Man lese denPetronius nach, e. 5. und 118. Gesetzt, P e t r o n hat erst um die letzte Zeit der Antonine geschrieben, wie die neuere Kritik behauptet': so Verändert tlieSs die Sache nicht. Gleiche Ursachen müssen auch schon f r ü h e r gleiche W i r k u n g gethan haben. Juvehal, dfer, dtarcli ßeifiill gereizt, der Redekunst untreu wurde, durfte doch lange Ztiit- efr nicht wagen, mit seinen Satiren öffentlich aufzutreten. Weiterhin erst kam die Zeit, wo 1 er sie r in mehreren Vorl'esungen (Recitafionen, wie damals üblich ,) bekannt machen' konnte, und diess geschah mit grösstem Beifall. Da- e r aber in einer der Satiren die Erstlingsfrüchte seiner satirischen Muse, jene" erwähnten Verse1 auf' den PantomimentänzVXÜTTOVTTG nrjuy/uuTCt i'yovai. q. d. perventilantes. E r fächelt sich Kühlung mit den Händen, und lässt zugleich die glänzenden Ringe spielen. lacernasl Forcellini s . v . Was ist aber das: humero revocante Galderinus und Grangaeus erklären es gar nicht; da kommt
40
ERKLAERUNG.
man am leichtesten weg. Britannicus: reiectis lacernü in humeros, quasi nimis ponclerosis. Farnabius: er liess den Mantel hinten überhängen, ita ut humerus ipsam crebro revoearet. Hat gar keinen Sinn. Gronovius Obs. Ii, 1 9 : er hatte den Mantel auf der Schulter mit Agraffen, fibulis, befestigt. Nach Gronov Gesner ad Claudian. p. 48. W a r e gar nichts besonderes: Salmas, in Tertull. Pall. p. 63. T. Hcmst. ad Schol. Luciani T. I. p. 366, 71.; und wenn revocare so gesagt werden kann , so wäre der Ausdruck doch ganz' fehlerhaft: denn das Instrument des Festhaltens, fibula, per fibulatnwelches gerade die Hauptsache ist, köunte durchaus nicht fehlen. Gronovius führt noch eine andere Erklärung an: er wechselt Purpurinäntel an einem Tage mehrmals, dass revocare stünde für de die mutare. Diess nimmt Ruperti an, ist aber auch nichts. Heinecke Censura Editt» Rupert, p. 51. hat die Stelle aufs neue vorgenommen , und erklärt: die weichliche Schulter verlangt den Sommermantel zurück, revocat, resumit. Sinnreich ist diese Erklärung, und mit dem Sprachgebrauch zu reimen : aber ich zweifle sehr, ob auch mit der Grammatik, humero revocante kann nur aufgelös't werden, dum humerus revocat, oder revocabat: hier aber erfordert der Sinn : quum humerus revoeaverit, und unrichtig. Diess ist einer von den hundert so ist revocante Fällen im Juvenal, wo man aus allen Auslegungen zusammengenommen um nichts klüger wird. Zuerst ist die dichterische Wendung zu betrachten, humerus revocat lacernam, wo die Schulter Subject wird, da sie nur Object sein kann, und daher der eigentliche Ausdruck ist: lacerna revocatur ad humeruin. Was heisst nun revocari von der Bekleidung, oder von Stücken der Bekleidung, und was dem ähnlich? Revocantur ea , quae sese nimium profuderunt, nach Cicero de Or. II, 21. Sueton. Caes. c. 45. deficientem capillum revocare a vertice assueve'rat, das Scheitelhaar von hinten nach vorne ziehen, wo der Ropf kahl war. Claudian. in Rufin. II, 79. revocat fulvas in pectore pelles, trägt den Pelz auf
SATIRE
I, 2 7 — 3 0 .
41
der Brust zugehakt , den er zu diesem Bebufe von hinten nach vorne ziehen musste; von welcher Stelle König mit vielen Worten nichts sagt, Forcellini 5. v. mit wenigen Alles, Servius ad Virg. Aen. VII, 612 : cinctus Gabinus est toga sie in tergum reiecta , ut una eius lacinia revocala hominem cingat-, von hinten nach vorne zu um den Leib gewunden. Isidorus Origg. XIX, 24. drückt es so aus: quam atita imponitur toga, ut lacinia, quae postsecus reiieitur, trahatur ad pectiis. Quintilian von der Toga XI, 3, 14Ö. Es folgt hieraus: dass revocare , vom Kleide gesagt, so viel ist als attrahere, retrahere. Diess ist der Sprachgebrauch, und nun erst kann man interpretiren. Den Tyriscben P u r purmantel, den der Geck t r a g t , muss man sich wie vom feinsten Musselin vorstellen, wie die multicia II, 66. sqq. Dieser nun hängt, mit einer iibula befestigt, nur kaum auf der Schulter, und flattert, vom leichtesten Lüftchen bewegt, v o n ' d e r Schulter ab. Der Dichter denkt wohl an das „ingrediendo ventum concipere veste" Quint. Xly 3, 179. humerus revocat, i. e. ipse movendo humerum et brachium lacernam revocat, attrahit. Unser Aegypter greift also zuweilen rückwärts und zieht den Mantel mit Grazie an, revocat ad humerum. Es ist eben so viel, als wenn der Dichter sagte: während er einmal übers andere nach dem Mäntelchen greifen muss , damit es nicht davonfliegt. Wakefield trifft daher mehrentheils das W a h r e , Silvae critt. Part. II. p. 11. „nihil est nisi poetica elegantia [imrao, elegans et poetica: sed Latine scribit, ut Anglus] descriptio Iaenae ex humero fluitantis; quam videtur abreptura venti vis, nisi distineret [retineret] , et quasi revocaret humerus." maioris gerttmae. Der Römer trägt gewöhnlich Siegelringe mit geschnittenen Steinen : unserm Patron sind Gemmen zu schwer: er trägt leichtere Ringe. Es sind diess alles Züge der äussersten Affectation, besonders im Contraste mit dem wahren Römer. 30. Satiram muss hier eine grosse Initialis haben, als eine A r t nomen proprium ; ebenso im folgenden Verse
ERKLAERUNG.
42 Urbis,
iniqua,
als R o m .
nicht flagitiosa ; das liegt nicht
teneat
im W o r t e : sondern non f e r e n d a , intolerabilis.
se:
teuere se statt se c o n l i n e r e , sibi m o d e r a r i . 32.
Die widrigsten C r e a t u r e n :
Delatoren
und
lebte e i n s t ,
Erbschleicher
bei
dickthuende Advocaten, alten
ein Mann w i e M a t h o .
Dem
Maiho
Weibern.
a b e r nicht m e h r zu Juvenals Z e i t ; armen Matho
hier ist e s :
geschieht
durch
die Ausleger U n r e c h t , aus p u r e m Missverständniss. VII, 129. X I , 34. heisst e r bucca,
macht er Schulden; bei Gericht. tial.
ein S c h r e i h a l s
Diess sind auch seine Eigenschaften b e i m M a r -
Also ein Scheusal ist d e r Mann eben n i c h t ;
e r ist ein
causidicus, d e r nichts hat, a b e r äusserlich was vorstellen will, D a h e r nova
um sich C r e d i t zu machen. Rechnung
ipso,
vielleicht
noch
nicht
lectica,
bezahlt
war,
nicht g e r a d e wegen d e r F e t t i g k e i t ,
sich b r e i t
macht,
latum
se facit.
auf
S o l c h e lecticae
und
sondern
D i e lecticae
sind nicht u n s e r e e r b ä r m l i c h e n P o r l e c h a i s e n , Art Sopha,
w o f ü r die
plena
weil
er
der R ö m e r sondern'eine
die man sich legte und s o austragen Hess. sind nun w i e d e r in d e r F o r m
verschieden,
d a h e r sie u n t e r verschiedener Bezeichnung bei J u v e n a l v o r kommen.
U n t e n v. 65. heisst die lectica eine cathedra,
Art Prachtsessel,
eigentlich
d e r Sessel d e r R ö m i s c h e n
eine Da-
men ; v. 124. w i r d sie g a n z einfach sella g e n a n n t ; da nun s o l c h e T r a g s e s s e l hoch u n d weich g e p o l s t e r t sind, so heissen s i e v. 159.
pensiles
plumae.
Cf. Böttig. S a b i n a II. p . 2 0 0 . f.
D i e lectica ist o f f e n , und der S c l a v e n ,
traphoron,
auch-geschlossen;
nach der Zahl
von welchen sie getragen w i r d , heisst sie te-
hexaphoron
u n d octophoron.
Zu Sänftenträgern,
welche r o b u s t e L e u t e sein mussten, w u r d e n gewöhnlich b r e i t schultrige C a p p a d o c i e r g e w ä h l t . 33.
Der
delator,
eine f ü r c h t e r l i c h e M e n s c h e n a r t ,
b e s o n d e r s unter dem D o m i t i a n ü b e r h a n d nahm.
die
D i e scheus-
lichsten U n g e h e u e r schlichen u m h e r , horchten und l a u e r t e n , u n d lieferten f ü r Belohnungen E s g e s c h a h Alles
unter
der Tyrannei Schlachtopfer.
dem V o r w a n d e der
lex m a i e s t a t i s ;
S A T I R E I, 30 — 34.
43
überalt witterte man Hochverräther und Majestätsverbi-echer, uin sie aus der Welt zu schaffen und ihre Güter zu confisciren. Stufenweis ging diese Abscheulichkeit so weit, dass^ zuletzt kein Verhältniss weder unter Freunden noch unter Blutsverwandten vor Verrätherei mehr sicherte. Eine Hauptstelle Plin. Panegyr. c. 34. Die gftlen Regenten, Titus, Nerva, T r a j a n , suchten aus allen Kräften das Uebel auszurotten; zu verschiedenen Zeiten wurden die härtesten Exempcl statuirt, die Angeber hingerichtet oder deportirt. Dieses scheusliche Gewerbe war übrigens schon viel frühern U r sprungs, aus den Zeiten der Proscriptionen. Ueber Delationen und Delatoren reiche Data bei Dio Cassius, Sueton, Tacitu?. Henr. Brencmanni lib. de Lege Remmia, et de fatis calumniator. sub Impp. in Ev. Otton. Thes. Jur. III. 1573. sqq. Eine Uebersicht bei Bach, Div. Traian. p. 77. sqq. Der Dichter gibt mit wenigen Zügen ein höchst sprechendes Gemälde: ein Unhold von Angeber, vor dem selbst andere seines Gelichters sich fürchten müssen, delator magni amici, seines eigenen Freundes, magnus in Rücksicht seines Standes, Reichthums und Einflusses, potens. VJ, 313. magnos visurus amicos, i. patronos. IV, 20. magnae amicae. 74. magna amicilia, Principis, des Kaisers, V, 14. des Patrons. Gesner v. Amicus n. 3. v. Magnus n. 2. et cito rapturus: d e r , nachdem er dieses Meisterstück gemacht h a t , in Kurzem auch noch den letzten Ueberrest verschlingen wird. de nohililate: denn auf diese war die Raubgier dieser Ungeheuer gerichtet. de nobilitate comesa quod superest gehört zusammen. comesa bezieht Wagner im Catal. lectionum Marburg 1813, Michaelis, auf den dureh Delationen fast ganz aufgeriebenen Adel. Aber das ist nicht comesa nobilitas. Forcellini: expilata, bonis multata. adesa pecunia Cic. p. Quint, c. 12. adesae Jortunae Taoit. Ann. XIII, 21. comedere selbst mehrmals Cicero in den Pliilippicis, pro Sext. §. 110. und 111. Unten v. 138. comedunt patrimonia. Cic. ad Fam. IX, 20. ne tuabona comcdim. it. XI, 21. Homer Od. v. 419. ßi'ozov de oi aXlot
ERKLAERUNG.
44
eSovai.
E s geht das comesa
also auf die Rnubsuclit des F i s -
quem Massa
cus und der Angeber.
ein Massa, ein Carus selbst fürchten
limet, ein ¡Kerl, den muss.
Bäbius
Massa
und Metius Carus, zwei der famosesten Delatoren zu D o m i -
mu-
tians Z e i t e n , bekannt aus Plin. E p p . und T a c i t u s . '
ñere palpat,
trefflicher A u s d r u c k ,
genommen , die man klopft ,
von wilden Pferden her-
um sie zu besänftigen.
Die
eigentliche Bedeutung fehlt in den Lexx., aber man lernt sie ans den Vett. Glossis:
Palpo
equum,
xarax^orcS
TOV innov.
U l p i a n . Digest. 1. I X . tit. 1. 1. 1. quum equum permulsit
vel palpatus
est.
Horat. S e r m . 1 1 , 1 , 2 0 .
quis,
und daselbst Bentl.
V i r g . Ge. III, 1 8 6 . , w o Heyne unrichtig. Aen. X I I , 86. 36.
et a trepido
etc. w i r d auf vielerlei Art e r k l ä r t : es
ist aber nicht möglich, eine w a h r e E r k l ä r u n g zu geben, wenn man nicht ut lies't, als partícula comparativa, und nicht die S a c h e erst e r ö r t e r t h a t ,
von der die Rede.
Ruperti ist so
blind, wie seine V o r g ä n g e r , und auch Achaintre weiss nichts. S i e nehmen an, dass auch Latinus sich f u r c h t e t , und u m ihn im Guten zu e r h a l t e n , coitum,
die Thymele
hergibt,
summittit ad
und diese soll des Latinus wirkliche E h e f r a u oder
Geliebte sein.
Von allem
Lad'
dem ist kein W o r t wahr.
nus wird V I , 44. Sueton. D o m i t . 15. Martial. 1 , 5 . , sein epitaphium I X , 29. e r w ä h n t ;
Thymele
VI, 6 6 . VIII, 197.- Beide
"sind Theaterpersonen, mimus und m i m a , die in den beliebtesten Mimen a u f t r a t e n , und grosses Aufsehn machten den
besondern Beifall des Domitian
hatten.
r
auch
H i e r , wie an
m e h r e r n Stellen des Juvenal, wie auch des Horaz, liegt eine Anspielung auf einen berühmten Mimus zum Grunde, wohin auch VI, 4 4 . gehört. Griechen h e r s t a m m t e , kommen w a r ,
Mimen,
eine G a t t u n g ,
und aus Unteritalien
die von den nach R o m ge-
daher auch ja nicht mit den Atellanen v e r -
wechselt w e r d e n ' darf, w a r e n schon zu Cicero's Zeit gewöhnlich (s. die Stelle p r o Coelio c. 27.) a u f die spätesten R a i s e r z e i t e n ,
und von August an bis
neben den ludis Circensibus
die vorzüglichste Ergötzlichkeit des Römischen Volks,
Der
S A T I R E I , 3 4 — 37.
45
beliebteste Stoil dieser Mimen waren Ehestandjgeschichten, Hahnreischuilen, adulteria, ins Lächerliche gezogen, und die gewöhnlichen vier Rollen, ein einfaltiger Tropf yon Ehemann als Hahnrei und Narr im Spiel, seine junge Frau, die ihm Hörner aufsetzt, ihr Liebhaber, und ein Sclav, als Ränkespieler, Kuppler und Geschäftsträger der beiden Verliebten. Diess muss man nothwendig erst wissen, wenn man den Dichter verstehen will. Die Beweise in meiner Cornmentatio von 1806. Latinus spielt den Liebhaber, Thymele die Frau. Der Mann ist höchst eifersüchtig und passt auf, wird aber,trotz dein tüchtig betrogen. Der Liebhaber kommt oft mit ihm in verzweifelte Situationen: die pfiffige Frau weiss aber immer Rath zu schaffen. Das einemal werden sie vom Ehemann überrascht, und die Frau versteckt den Liebhaber in einen Rasten, VI, 44. vergl. Ilorat. Serm. II, 7 , 5 9 — 61. Der Liebhaber zittert einmal sogar für sein Leben, trepidus; da schmeichelt und streichelt die Frau den Mann, und die Gefahr wird für diessmal glücklich abgewandt, summissa, abgeschickt vom Liebhaber, seinen Zorn zu besänftigen. Diese Scene hatte Jedermann oft spielen sehen; sie war bekannt, und so war die Anspielung zugleich höchst treffend und verständlich. Der Sinn ist also: Man streichelt deti grimmigen Angeber, wie Thymele im Miinus ihren erzürnten Mann streichelt, um ihn wieder gut zu machen. Wer ist nun aber dieser fürchterlichste aller Angeber zur Zeit Domitians ? Man räth bald auf diesen , bald auf jenen berüchtigten Schurken; in der Husumer Handschrift steht v. 33. die Glosse: actusator Heliodorus; alles vergeblich! denn es ist der Charakter hier geschildert, kein einzelnes Individuum. 37. summoveant, „iusta hereditate" meint Ruperti, elend ! Der Franzose sagt's dennoch nach. Es ist die Rede von Menschen, die Eile haben, und auf der Strasse sich Platz machen. III, 239. Ovid. Met. XII, 231. submovet instantes. Von den Lictoren ist das Gewöhnliche submovere,
46
ERJK.L A E R U N G .
submovendo iter facere, worüber zu vergleichen Düker
de
Latinit. ICt. p. 147. , und von den Magistraten subinoto incedere: Gronov. ad Liv. X X V I I I , 27. vom Schwätzer:
dispeream
JNigrin. §. 13. impellere
Daher das Horazische
Das W o r t hat seine Beziehung auf R o m , langsam und bescheiden wehe zu thun.
Lucian.
ni Summosses omnes.
obvios Senec. de An. Tranq. c. 12. gehen musste,
wo m^n meistens um Andern
nicht
Da werden aber Emporkömmlinge vorüber-
getragen , Erbschleicher, besonders bei alten Jungfern; die Sänftenträger, grosse Cappadocier, stossen die Leute auf die Seite und sperren die Strasse.
qui testamenta merentur
Cicero ad Att. I, 16. p. 534.
noctibits. lierum —
nonnullis
iudicibits pro
Westerh, ad Terent. I. p. 521. felices,
divites reddit.
men.
noctes certarum
mcrcedis cumulo
mu-
Jiierunt.
in coelum quos evehit, optima
nunc gehört
processus, des Emporkommens.
Der
zusamleichteste
W e g emporzukommen, zu Ehren und Würden zu gelangen, dass einer erst durch eine Schürze ein reicher Mann w i r d . Seneca Rhet. p. 134. Bip. ämtern.
processus,
der W e g
Qumtil. Deel. Iii, 9. Zu Sat. VI, 609:
zu EhrenMerill. O b -
servat. II. c. 6. Seneca de An. Tranq. c. 2. Plin. Epp. VIII, 6, 3. procedendi
libido.
Digest. I. X X I V . tit. 1. 1. 41.
ordnung des Antoninus: die Frau soll
eine Ver-
zu Schenkungen an
ihren Ehemann befugt sein, ad processus viri,
„ut is ab Im-
peratore lato clavo, vel equo publico, similive lionore honoretur."
Ulpian. Fragm. VII, 1.
Vielleicht tig
jiQoädovg.
Bynkershoek beruft sich dort mit Recht auf diese Stelle des Juvenal, aber Düker de Latinit. ICtor. vett. p. 434. mischt noch die Bedeutungen durcheinander.
In den Inscriptionen,
die Rigaltius citirt, p. 699. Henn., ist processus wieder v e r schieden: Fortschritte zum Gesundwerden, zur Wiedergenesung.
Gesner ist hier sehr unvollständig.
vesica
für
cunnus V I , 64. 40—44.
Eine Art Parenthese.
Der Sinn wird deutlich,
wenn man nach deuncem mit einem Komma, nach he res mit
S A T I R E I, 37 — 44.
47
unciolam, „ n e totam quidem einem Punct interpungirt. unciam" R u p . , also weniger als eine uncia! Man sieht gleich, dass das nichts ist. Die Alte hält sich zwei Liebhaber , die beide ihre Erben w e r d e n , aber sehr ungleich : einer bekommt ein Zwölftheil, der andere eilf Zwölftheile, deuncem. Die Eintheilung ist ganz Römisch , nach dem as, welches in zwölf Unzen getheilt w i r d ; daher ist heredem ex asse fieri Universalerbe werden. Die Vertheilung geschah nach einem gewissen Masse , dem Consistorialmass , ad Proculeius, mensuram inguinis ; ein verzweifelter Z u g ! GiUo, gleichgültige Namen , worunter /nan keine bestimmten Personen suchen muss. Proculeius ist von Proculius gebildet, diess von Proculus, und Proculus von P r o c u s ; noch könnte man aus Proculeius Proculeianus machen. Gillo ist "cosnomen in der gens Fulvia. V . Glandorp, und Gruter Ind. nom. Die falsche Interpunction in allen Editt. wird von Heinecke sehr richtig verbessert. jiccipiat geht auf den Gillo, sanguinis , virium. Palleat, ut nudis. Allusion auf ein schönes Homerisches GleichiSj? ¿fts od. Leisner. Pracfat. L. Bos. p. X X V . sq. Desgleichen ist magis aus dem vorhergehenden maior zu ergänzen, wie II, 122. aus dem Folgenden, welches eben nichts ungewöhnliches ist. neque enini loculis. Das zweite e in neque ist hier ein elidirter Vocal. An andern Stellen findet sich nec enim, welches härtere Aussprache ist: VII, 59. X I , 30. X V , 107. coli. X , 313. Aus diesen Stellen folgt jedoch noch nicht, dass der Dichter auch hier geschrieben hat nec enim. loculi, X I , 38. X I I I , 138. Die Schatulle, nach Gesner; Capsula vel crumena, Ruperti. Eigentlich F ä c h e r , Schrank, Kästchen, jedes Behältniss mit Fächern. Veit. Glossae: Loculi, yXutaaöxofioi, (Futterale.) Sie sind von Elfenbein oder Ebenholz. loculi bei Horat. Serm. I, 1, 74. Kästchen mit Rechenpfennigen, welches Gesner im Thesaurus ganz unrecht versteht, loculos tabulamque , sagt er, i. e. tabulam loculatam. Aber eine tabula kann keine loculos haben. S . Brisson. de Verb.
SATIRE
I , 8 8 — 93.
67
Signif. h. v. ad casum tabulae. Hierüber vergl. Salmas, in Vopi*c. p. 462. A. Graevius ad Cic. p.^Arch. c. 6. erklärt unrichtig tabula hier durch alveolum. arca ist den loculis entgegengesetzt; es ist der grosse eiserne Kasten , worin der Reiche sein Geld verwahrt. Drei oder vier Kappadocier tragen den Geldkasten nach Ems oder Wiesbaden, und das Geld wird in Portionen herausgenommen. 91. 92. Das' leidenschaftliche Glücksspiel unter dem Bilde eines hitzigen Kampfes. dispensator servus, der Ausgeber , Cassirer. Der Kampf wird mit Geld geführt; die Waffen sind also das Geld, der dispensator daher armiger, (Pignor. de Serv. p. 125. Brissonius ¡de Verb. Sign. v. Arcariiis,) wie auch armarium von der arca nummorum gesagt w i r d , z. B. Cic. pro Cluent. c. 64. Ganz falsch verstellt man die- W ü r f e l , wie movet arnia fritillo, die den dispensator nichts angehen. Äuperti von Heinecke zurechtgewiesen, aber Simmit neuem Irrthum. videbis i. e. videre licet. plexrie: „num parva tantum" Ruperti. Das wird aber mit Tacit. Germ. c. 22., wo siniplices cogitaliones den magnis opponirt sind , nicht bewiesen : denn jene sind Gedanken über einfache, nicht verwickelte Gegenstande; wo auch die Ausleger sämmllich i r r e n , Oberlin, Bredow, Passow. Hier ist Simplexne —•? non simplex f u r o r , sed duplex vel t r i plex. seslerlia. Ein seslertium enthält tausend sestertius. horrenti. Der arme Teufel von Sclaven klappert mit den Zähnen vor Kälte; er hat sein Röckchen abgetragen , und müsste wieder eine neue tunica haben; aber der Herr hat Alles verspielt. reddere ist nicht bloss dare, wie die Ausleger wollen. Richtig Oudendorp ad Suet. Tib. 16. „ubi reddere pro dare vel edere poni videtur, includit debitum". Diese Bemerkung muss auch auf andere Verba, welche mit der Partikel re, im Griechischen mit der P r ä p o sition und, zusammengesetzt sind, ausgedehnt und angewandt werden. Wyttenb. Animadv. in Plutarch. T. I. p. 307. So also dnoöovvai, so restituere. Brisson. v. Reddere sub n. 2.
68
ERRL
AERUNG.
94. erexit, nicht bloss „erbaut", sondern „in die Hölic gebaut", engere, von unten auf bis zu einer gewissen Hobe bauen, aufführen, turres, acdificia, aber auch tropaea, (Hier, de Bosch Observatt. et JVott. in Anthol. Gr. p. 484.) und sogar aras, wie v. 1 1 4 . , woran wir das silberne Zeitalter erkennen. Der Luxus der R ö m e r , mehrere Villen, Landgüter mit prächtigen, hoben Gebäuden zu haben, nahm besonders in dieser Zeit überband, so dass er durch Gesetze beschränkt werden musste. c/uis — avusl „Wer aus der ehrbaren Zeit unserer Vorfahren?" J'ercula, nicht einzelne Schüsseln, sondern Trachten , Gänge von Speisen. Sieben Gänge, wer weiss von wie viel Schüsseln jeder, ein ternis ganz honnetter Tafelluxus! Suet. Aug. 74 : Coenarn Jerculis, aut, quum abundantissime, senis praebebat. llainirez ad Martial. Spectac. 6 . , weil er diese Bedeutung von J'ercula übersah , und nun den Aufwand für jene Zeiten viel zu gering finden musste, legt den Sinn unter: Kein Vorf a h r , wenn er einmal luxuriös sein wollte, brachte es auch nur tu sieben Schüsseln; ihr hingegen u. s. w. Das secreto von den Altvordern, die sich dazu einschlössen, fällt so ins Lächerliche, und wozu die Zahl sieben genannt? secreto speis't man ohne Gesellschaft, und da bestand clie gewöhnliche Mahlzeit aus sieben Gängen. Man stelle sich den Luxus v o r , weun erst ordentlich tractirt wurde! Es ist auch so ein argumentum a minori ad maius. Die Griechen nennen das hier geschilderte Laster /.tovoqiayia. Lipsius ad Senec. Ep. 19. p. 420. 95. Nunc, soll bis tarn abiectis moribus sein, Besser': als Gegensatz der alten Zeit. Heutzutage schmaus't Alles, Reiche und Arme, und diese von jenen. Vormals war die Kost der Vornehmen einfach, und die Armen, ihre d i e n ten, Hessen sich begnügen. Jetzt muss für diese jeden Morgen die Austheilung bereit sein; das Verderbniss bat den Armen verwöhnt, er bedarf jetzt der Unterstützung viel mehr als in vorigen- Zeiten. Das Verhältniss des Patronus
S A T I R E 1, 94 — 96.
69
zum Clientcn brachte es mit sich, dass der bedürftige Client unterstützt werden musste. Anfangs war es coena recta, eine ordentliche Mahlzeit, die den Clicnten zuweilen gereicht wurde. Eine solche ~ Mahlzeit hiess sportula , von sporta, anvgi'g, eigentlich das geflochtene Körbchen, worin sie enthalten war. Daher dnö anv^iäog öttJivov , Alhenae. VI II. 365. A. mit Casaub. Ilesychius : *An6 anvgidoq, wo" man xui fiSQt] (Seliow. Slipplem. p. 123.) nicht ändern darf; es sind Mundportionen gemeint. Spater, als die Zahl armer Clientcn zu gross geworden w a r , traten an die Stelle der Naturalien Geldspenden, (v. 120. III, 249.) die nun ebenfalls sportulae hiesseil. Die Sache gehört in die Kaiserzeiten, und erhielt ihre Gestalt unter Nero, Sueton. c. 16. Domitian spor/ulas pitblicas sustulit, revocafa coenarttm rectarum consut ludine, Suet. c. 7. Es scheint aber dieses Verbot nicht lange in Kraft geblieben zu sein. , Das Gedränge zu diesen Spenden war überaus gross. Die ersten Familien Horns waren beinahe alle erloschen oder verarmt, uud die Despotie der Kaiser suchte auch noch den Rest auszurotten. So kam es denn, dass auch solche* die vielleicht früher Tribunen oder Prätoren gewesen (v. 101.), nun um eine sportula als Clienten bettelten. pritne limine. Das Almosen wird im vestibulum des Pallastes empfangen. parva: „nam sportula in dies inminuebatur" Rupert», ohne Beweis. Verringert, nach der Absicht des Dichters, wegen der turba togata und.rapiencla; ein trefflichcr Gegensatz, wie Demosthen. adversus Phormion. p. 918. 10. Reisk. TU aXfitu y.tti}' q/Lii'iXTOv /utTQOv/^tvoi yju y.arunaTOVfiivoi. Aber auch turb. tog. nimmtRup. schief, als wäre es eontemtim gesagt. Was er von der toga erzählt, die unter den Kaisera nur noch von armen und geringen Leuten soll getragen worden sein, ist. an sieh seicht und verworren, und gegen den Sinn des Dichters. Seine Citate enthalten nichts, und das: „Ferrar. R. Vesk I, 3 3 . " hat er entlehnt aus Hennin. p. 899., den Ferrarius aber nicht gelesen. Denn dieser lehrt gerade
70
ERKLAERUNG.
umständlich:' dass die toga noch immer hei allen Gelegenheiten die einzige A nstandskleidung blieb, und bei allen ofllciis fortwährend getragen wurde. So schon Salmasius in Tertull. Pal!, p. 22. sq.; togatus bezeichnet daher immer äussere W ü r d e , hebt aber nur zu oft in diesen Zeiten den Contrast der äussern Würde mit der innern Unwürde, wie hier turba togala. sedel für posita est. Für diesen Sprachgebrauch gibt es kein ganz gleiches Beispiel. AehnQuae — sederit. lich ist bei Horaz Serm. II, 2, 73.: escae, Cf. Vavassor. de Vi et Usu quor. verb. p. 171. "Heins, ad Ovid. Trist. II, 481. Das Wort scheint auf die Form des kleinen Behälters zu gehn, worin das Geld hineingelegt wurde. 97. l i l e , nicht der Herr selbst, sondern vielmehr der dispensator, der Aufseher über die Austheilung. S. Achaintre. Die Zahl der d i e n t e n , welche täglich Unterstützung bekommen, ist bestimmt. Der dispensator muss nun Acht geben, dass, nicht ungebetene Gäste si,ph einschleichen; denn dieser Betrug kam häufig vor. Er befiehlt also dem praeco, einem Sclaven, der eine Liste mit den Namen jener .dienten zu haben scheint, die Namen auszurufen. Der praeco servus darf nicht, wie von Ruperti geschehen, mit dem nomenipsos clátor vermengt werden. Pignor. de Servís p. 145. Troiugenas. dienten aus den ersten und ältesten gentibus, VIII, 181. XI, 95., werden zuerst ausgerufen: Der älteste Tatricische Adel, der seinen Stammbaum bis z a den Trojanern hinaufführte, patres maiorum gentium. Das thaten sie aber nicht erst, wie Ruperti will (ein Plagiat aus Casaub.-ad Pers. p. 42.), seitdem der neue Adel und die neuen Bürger so überband nahmen. Die Eintheilung der Patricier in minores und minores gentes ist älter und offenbar nicht aus dieser Ursache entstanden. Varro halte ein eigenes W e r k geschrieben de familiis Troianis; Serv. ad Aen. V. p. 404. F. Troiugena, eine Form wie Graiugena, statt Troiigena, Graiigena. Gifanius Ind. in Lucret. p. 354. nobiscum, „mit unser einem." Der Dichter scliliesst sieb mil ein.
SATIRE
I,
96—105.
71
101. Da Praetori. Nach Ruperti sprechen hier mehrere Personen: ein Prätor, ein T r i b u n , der dispensator und ein libertinus. Dicss ist willkührlich. Da Praetori sagt der Aufseher zu einem Gehülfen, nicht dem praeco, in natürlicher Verbindung mit dem vorhergehenden iubet. Seil libertinus prior est erinnert der Dichter: „Leider war der libertinus schon f r ü h e r d a " ; und sobald dieser das DaPraet. hört, fiingt er an zu expostuliren: Prior, inquit, bis Licinis, 109. libertinus, ordentliche Bezeichnung des Standes , ohne Rücksicht auf einen H e r r n : man kann nicht sagen libertinus Augusti, sondern libertus. Daher jenes die viel weitere Bedeutung hat, überhaupt libertinae conditionis. Sueton. Claud. .24. und das. die Intpp. Die libertini sind in dieser Zeit- die eigentlichen Emporkömmlinge; obschon reich, verschmäht dieser Mensch doch die Gabe nicht. prior est, f ü r prius advenerat. Euphraten. Aus Asien kamen die meisten Sclaven nach- Italien. Jenestrae, komische Bezeichnung f ü r Ohrlöcher. Das Tragen von Ohrringen in Oeffnungen, die ziemlich gross gewesen sein müssen, wenn sie fenestrae heissen konnten , war eine Sitte weichlicher Asiatischer Völker (daher molles), der L y d i e r , Iphrygier, Syrer. Intpp. ad Xenoph. Anab. p. 147. Schneid. Griechenland und Rom erlaubten höchstens Pei len in den Ohren zu tragen dem Frauenzimmer, und aifch das n u r als ü b e r triebenen Luxus, wahrscheinlich auch ohne Ohrlöcher. R u perti hat wieder hier Ariel Unrichtiges über molles und die durchbohrten Ohren. Sehr richtig Barton ad Plutarchi Ciceron. Vol. IV. p. 943. Reisk. arguerint ist facile a r g u u n t , arguere possunt. 105. sed ist auf das vorhergebende quamvis bezogen. Markland ad Stat. p. 163. quinque tabernae, auf dem F o r o , vormals Septem tabernae genannt, Livius XXVI, 27., und bloss mit der alten Benennung XXVII, 11. Es waren argentariae, die nicht Einer alle zusammen pachtete , wie Ruperti sagt, sondern wo viele Wechsler zugleich ihre Geschäfte trieben.
72
ERKLAERUNG.
Nardini, Thes. Graev. IV. p. 1178., will eleu O r t noch wissen, wo diese tabernae standen. Vergl. Brisson. Select. Autiqq. IF, li2. Horm. Hubert. Dissertatt. iurid. II. de Argenlariis Vol. If. T. I. Thes. Oelrichs. Rupcrti falsch: „Tabernao cum veteres, tnrn novae erant". Denn diese sind etwas a n ders als die quinque tabernae. Die Juvenalische Erwähnung gibt zu erkennen, dass die meisten Geschäfte hier gemacht v urden ; zu X, 24. quadringenta, millia sestertium, i. e. censum equestrem. parant. „Manchem meines Gleichen bat der W u c h e r schon so viel eingebracht, tlass er Ritter wurde." quid conjbrt, dat, trilmit, „was gewährt wünschenswerthes ?xvc,uuTaf (*IJQIL o/Ltazu, Flöten. Schneid. Ind. Scriptt. R . R. p. 365. a. Jos. Scaliger Castigg. inTibull. p. 143. ad I, 6 , 8 0 . und das. Heyne. Rupert! falsch: stamina in filum dedueta, eil» verfehlter Ausdruck für staminum glomera. calathis referre. Claudian. Vol. II.
1
ERKLAEÄUNG.
98
in E u t r o p . II, 383. Non alias lanam pargalis sordibim aeque Praebuerit eälalkis. Die gekrempten Wollknäuel Werden in Körbchen iibereinaniler gelegt. praegnantem, anschwellend vom G a r n e , das sich darum wickelt. Das in der Oilvssee häufige /¡Xuxuna axQ, und gelesen werden muss: evanadij ä. r. and&tjv. Dagegen heisst es von groben Zeugen male perciissae textoris pectine I X , 30. Aach v. 70. ist von der Toga die Rede; Salmas, erklart also hier multicia durch toga serica, heim Quintil. XII, 10, 47. Zwei Jahre später ad Tertullian. de Pall. p. 195. sagt er gegen Lipsius, das pellttces sei de bombyeinis et Cois zu verstellen, und nicht de sericis , weil letztere damals nur die Frauen getragen hätten, jene aber auch schon Männer; er beweis't diesen Unterschied aus dem Plin. H. N. XI, 23. Bombjcinae und Coae, auf Cos gewebt, sind nicht verschieden, wohl aber sericae und subsericae (halbseidene, serico subteuiine?) aus derAssyria bombyi, der Seide, die von den Seres durch Assyrien kam, Salmas, ad Tert. Palk p. 181. sqq. cf. Exercitt. Plin. p. 209. Voss Virg. Lb, p. 314.. Die feinsten Zeuge, bei uns von Baumwolle, waren bei den Alten von Seide, vestes pellucidae, ¡¡.lüna öiurf urtj; multicia die allgemeine Benennung. Jetzt trugen schon Männer Togen von Seide. Diese kennt auch Quintilian I. c., der ebenfalls unter Domitian schrieb; und schon viel früher unter Tiber ein Verbot: ne vestis serica viros foedaret, bei Tacit. Ann. II, 33. Damit ist nun Plin. 1. c. schwer zu vereinigen. Man muss aniiehmen , die serica vestis. d$r Männer kain nur in einzelnen Fällen und als Abnormität vor; Plinius aber denkt an die Sitte im Allgemeinen. Auch hier kann serica gemeint sein. Vergl. Is.
S A T I R E ri, 66 — 70.
101
Voss. Obss. ad Melam p. 268. D e r F o r t g a n g dieser Mode w a r übrigens d e r : zuerst libcrtinae, Hör. Serm. I, 2, 101., dann Matronen, Männer ausser Geschäften, 1 , 2 7 . , endlich sosjar vor Gericht. 67. Cretice, VIII, 38. M. Anton. Crelicus, und Q. Caecil. Eine Mönchslesart Critice, populo Metellus Creticus. miranle, weil es immer nur eine Ausnahme von der Regel war. perores, „ d e iudice sententinm multis verbis ferente et declamante" sagt R u p e r l i , abscheulich! Von demselben wird gesagt agere, 71. und 75. 7 6 . , der Richter und der Zeuge entgegengesetzt : also der a c t o r , accusator publicus. Pollilas, eine verdorbene Schreibart. Die Codd. haben noch viele andere Schreibarten, alle c o r r u p t , auch Polliucas, welches Achaintre aus eilt" Pariser Handschriften aufnahm. Der jName Hingt fast in allen Handschriften mit der Sylbe Poll-an. Aechte Römische Namensformen sind Pollus, Polla, (für Paulus, Paula, Spanhem. Us. Num. I. p. 43.) P o L lia, Pollidius. Vielleicht hat Pollidias hier gestanden, oder Polluüas, wie hei Tacit. Ann. X V I , 10. Fabiilla. Die meisten Handschriften haben Labulla, auch die Kopenhagencr. Dicss ist durch Contraction entstanden aus Labionilla Grut. p. 1149, 1., wie aus Hisponilla Bispulla. Zu X I I , 11. Auch Fabulla ist das Diminutivum von Fabia , wie Tertulla von Tertia. Manut. inEpist. ad Attic. X I V , 20. So Lucius, Lucullus, Catius, Catullus, Titius, Titullus (Martial. VIII, 44.). Labullus beim Martial. X I I , 3 6 . , aber auch Fabullus und Fabullinus X I I , 51. Fabulla X I I , 94. Catull. C. XIII. Carfiuia. cf. ad Digest. Gehau, p . 4 9 . E v . Otto ad Anton. Augustin. Vol. I. 514. Cuiacius Observatt. X X V I . c. 38- lies't: Carfania talem Non sum. damn. togam. togam. Die Kleidung der R ö mischen Matronen ist stola, eine Tunica mit der Falbel, instita. Sabina 11,116. OefTentliche-Mädchen mussten zur Auszeichnung die T o g a tragen, toga meritricia, wie in Athen die Hetären blumigto Kleider, uväiva. Man folgert aus dieser S t e l l e , dass vcriutlieilte Ehebrecherinnen ebenfalls die
102
ERKLAERUNG.
T o g a hatten tragen müssen. Muret. Opp. H. 986. HJ. 374. Lipsius Exc. ad Tacit. An«. II, 8 5 . Brisson. Select. Antiquit. I. c. 4. und de J u r e Gonnubior. p. 357. Das folgt, aber aas unserer Stelle nicht, sondern n u r , dass ein verdorbenes We'ib , deren Schande durch die Vcrurtheilung öffentlich erklart w a r , nun auch leicht förmlich zur Toga überging, wie das In der Th.it nicht selten der Fall w a r . Der Silin ist also: Lass diese oder jene verurtheilt w e r d e n ; vielleicht tragt sie dann die T o g a : aber auch so wird sie nocli züchtiger erscheinen als d u ! • 7 1 . Nudus, im Römischen S i n n , wie das Griechische yvfivöi, im Unterkleide, in der blossen tunien. Im folgenden S a l z sind zwei Lesarten , insania und iiifamia. W e l c h e ist die rechte? Ruperti erklärt sich für insania. „Man würde dich freilich für toll halten; aber weniger schandlich ist Tollheit, als Weichlichkeit." Ilcinccke sagt, dicss werde Niemand dem Dichter zugehen; er halt also, das eine f ü r so ehrlos wie das a n d e r e ! Gleichwohl behält er. die Lesart bei, und macht aus dein Satze eine F r a g e des W e i c h l i n g s : „Also willst du, dass ich Toll sein soll, und haltst das für weniger schändlich?" Die folgenden drei Verse sagt dann ebenfalls, der W e i c h l i n g : „In jenen alten Zeiten hatte das wohl einer w a gen d ü r f e n , und man hätte ihn nicht für toll g e h a l t e n : zu unsern Zeiten ist das ein ander Ding". So verdreht w i r d Alles nur zweckloses Geschwätz; die ganze Kritik von Heinecke über diese Stelle ist eine Missgebui't. Erstlich ist Sed Julius ardel, acsluo, die Entschuldigung des W e i c h l i n g s ; alles U e b r i g e sagt der Dichter ; zweitens ist von der insania nicht die R e d e , denn diese kann nicht lurpis heissen, was sie nicht ist, am wenigsten nach alter Vorstellungsart, w o r nach die insania ein blosses Unglück ist, xaxod'uif.ioviu, ävaxvyiu. Schon um deswillen rnuss man sich für infamia e r k l ä r e n ; noch weit mehr aber,-weil der ganze Zusammenhang es nothwendig macht. Kurz vorher w a r die lockere Kleidung bloss als infamirend b e t r a c h t e t : lalem non sumet
S A T I R E II, 7 0 — 7 2 .
103
damnala logam. ¡Nachher v. 82. kommt dieselbe Idee wieder, Foeilius hoc aliquid—amiclu, übereinstimmend mit den Worten des frühem Verbotes: ne veslis serica viros JoedareL Joedum ist turpe, infame. Also ist der Sinn: Kannst du es in der Toga nicht aushalten, so wirf sie lieber ab, und ngire Hildas; das wäre freilich auch eine Schande, infamia : aber sie wäre doch minder gross, minus turpis infamia. Drittens vollends als die einzig wahre erwird die Lesart infamia wiesen, und der Sinn des Dichters-erst recht deutlich durch den Rückblick, auf die Stelle des Cicero Philipp. II. §. 86. („divina Philippiea" X, 125.). Cicero malt das Benehmen des Triumvir Antonius bei einer famosen Gelegenheit in öffentlicher Volksversammlung : O praeclaram illam eloquentia.ni tuarn, quuin es nudus concionatus ! quid hoc l urpius? quidf oedius? quid sitpplieiis omnibns dignias? Und §. I I I . , wo er den nämlichen Antonius durcli die Erinnerung ati seinen eigenen Grossvater beschämt: llle nunquarn nudus est concionatus; tuum hominis simplicis pectas vidimus. Phil. III. §. 12. X I I I . § . 3 1 . Das Gemälde des Cicero ist wieder kopirt nach Aeschines e. Timarch. p. Reisk. 5 3 , 33. vom Timarchus, der ohne Oberkleid { sie m a chen muthwillige S p r ü n g e nach S a t y r a r t . 143. Die bisher geschilderten L a s t e r w a r e n abscheulich; a b e r sie scheuten doch das Licht des T a g e s , und blieben im V e r b o r g e n e n . Aber Alles ü b e r t r i f f t doch noch jene u n e r h ö r t e Nichtswürdigkeit, womit P e r s o n e n d e r ersten F a m i l i e n , Senatoren und Ritter, sich öffentlich zu Gladiatoren erniedrigen, u n d dem Volke zum Spektakel dienen. Dieser U e b e r g a n g lässt sich n u r verstehen , wenn man erst weiss, d»ss auch .im Bisherigen n u r von dem Verderbniss d e r h ö b e r n Stände die Rede w a r . D e r D i c h t e r urtheilt als R ö m e r . Die W ü r d e der ersten Stände w a r ein Heiligtliurn des Staats, u n d seine festeste Stütze; mit dem W e g w e r f e n dieser W ü r d e , u n d mit der öffentlichen Prostitution der ersten Stände u n d Geschlecliter, von welchen das Beispiel ausging, w a r das Signal zu einem V e r d e r b e n ohne Rettung gegeben. In M o narchien erfolgt eine gleiche W i r k u n g , wenn die Ilöfe sich öffentlich prostituiren : aber mit dem Unterschied, dass diess d e r eigentlichen Verfassung nichts schadet. In F r e i s t a a t e n zieht das Verderbniss der Grossen unvermeidlich den U n t e r -
118
ERKLAERUNG.
gang nach sich. Casar wusste, welchen Vortheil er für seine herrschsüchtigen Plane davon zu erwarten hatte, wenn er das Anselm der beiden ersten ordines in den Augen des Volks stürzte: er brachte eine-Menne novos homines in den Senat; er bewog (was Cicero noch mit ansehen musste) den eques Decimus Laherius bei den Thcatei;spielen, die er nach geendigtem Bürgerkriege dem Römischen Volke gab, in eigener Person als Mimenspicler aufzutreten, und sich zum histrio herabzuwürdigen ; Wieland zu Horaz Satiren I. Theil, S. 295. (wo aber die Vorstellung, die von den Mimen selbst gegeben wird, viel Unrichtiges enthält). Er liess es. geschehen, oder mochte es vielmehr veranlasst haben, dass bei eben dieser Gelegenheit Furius Leptinus, von prätorischer Abkunft, und Q Calpenus, gewesener Senator, als Gladiatoren hervortraten. Suet. Caes. 39. August verbot es zwar den Senatoren, erlaubte aber den Rittern, als Histrionen und Gladiatoren'zu agiren. In den letzten Zeiten Augusts, oder unter Tiberius, erschien ein Senatusconsult gegen diese Unsitte, das aber von geringem Effekt war. Caligula liess auf einmal sechs und zwanzig Ritter, und vollends Nero Senatoren und R i t l e r , darunter Männer von dem unbescholtensten Rufe, haufenweis Gladiatorendienste thun, theilsgezwungen , theils für Geld. Vitellius verbot es wieder. Lipsius Saturnal. II, 3. Aus Juvenals Schilderungen sieht man, dass der Greuel unter Domitian mit aller Schamlosigkeit wieder aufkam: IV, 99. f. VIII, 191. f. Es war diess nach Rötnischen Begriffen eine wahre Infamie; Histrioncn und Gladiatoren waren vor dem Gesetz infames; die letzlern in den Augen, des Volks die verachtetste Menschenklasse. (Von Toulongeon ein Memoire im Nat. Institut, Cl. der Geschichte und alten L i l t e r a t u r , über die Römischen Amphitheater, am Ende über die spätere verächtliche Gewohnheit, dass Senatoren lind Ritter zur Belustigung der Kaiser auf den Kampfplatz traten. Intell. Blatt der Hall. A. L. Z. tunicati fuscina Gracchi. Ein Gracchus 1807. IS um. 78.)
S A T I R E II, 1 4 3 — 1 4 9 .
119
als r e t i a r i u s , VIII, 200. f., mit der Jiiscina, TQiaiva, lind tunicalus, von dem secutor, dem gewöhnlichen Gegner des r e t i a r i u s , über die Arena hin verfolgt. luslravit, obiit, c i r c u ü t , p e r c u c u r r i t ; die eigentliche Bedeutung. mi/io* ribus,
p o s t e r i s , I, 148.
147. podium, eine niedrige Mauer im Amphitheater, die vor den Sitzen der Zuschauer um die Arena herumlief. ad podium, nahe d a b e i , dicht d a v o r , den Schauspielen zunächst , waren die Sitze der V o r n e h m e n , der magistratus curules , und des Kaisers selbst, e r h ö h t , da.ss sie über die Mauer wegsehen konnten, ein p a r t e r r e noble. Vergl. Reiz A l t e r t h . S . 579. His licet ip.utm etc. i. e. quin ipso edials torc muneris , ein Nero, ein Domitian w e n i g e r geiterosi der Gladiator. 149. Die Fabel von einer U n t e r w e l t , von Schatten, die sich dort aufhalten sollen, ist längst verlacht, und k a u m glauben noch R i n d e r daran. A b e r angenommen, sie wäre w a h r : was miissten die grossen Geister der Vorzeit, die Hei—, d e n , die ihr Leben Hessen in so viel K r i e g e n , was müssten diese d e n k e n , w i e müssten sie sich kreuzigen und segnen, Wenn von solchen vornehmen Schuften einer nach dem andern in ihre Gesellschaft k ä m e ! Ein äusserst effektvoller Contrast, den aber der Dichter selbst dadurch etwas geschwächt h a t , dass er die Vorstellung von einer Unterwelt als eine Fabel darstellt. Hierüber darf man sich weiter nicht w u n d e r n ; es w a r schon vor Juvcnal herrschende Ans i c h t ; der Volksglaube gab allmählich die schönen Phantasieen der V o r w e l t von e nem zweiten Leben der Menschen nach dem Tode a u f , und überHess sie nur noch der Poesie; J'abulae Manes schon Horaz, 1,4, 16., und daselbst Mitscherlich. Die Lehre des Cbristenthums gewährte Ersatz f ü r den verlornen Trost der Menschheit durch die cöttliche Verlieissung der Unsterblichkeit unserer Seele. Vgl. M u r e t i O p p . i l . p. 643. und 945. Dagegen Properz: Sunt aliquid Dianes, letum non omnia finit, nach einer reinern Idee von F o r t -
120
ERKLAERUNG.
dauer, und in jener sanftem Gemüthsslimmung, woraus die Elegie hervorgeht. Esse aliquot ist unstreitig das mehr Dichterische und die richtige Lesart, wenn gleich Properz aliquid sagte. Diess sah Ruperti nicht ein, und verwarf das Bessere. contum, nicht pontum, muss hier mit den meisten Handschriften gelesen werden. Yirg. Aen. Vi, 302. vom Cliaron: lpse ratern conto subigit. Es ist also hier komischer Ausdruck: eine Ruderstange und Frösche im Stygischen Strudel, statt ein rudernder Fährmann. Nie. Heins, wollte Porlhmeaque, .et Stygio lesen, erläutert von Burin. See. ad Anthol. Lat. T. II. p. 41. Es ist schön, aher nicht die Lesart. Vergl. 111,266. Ein neuerer Holländer in Actis Traiect. T. I. p. 172.: El cantum , et St. ranas, als Ilendiadys; Caritas kann zwar von Fröschen gelten ; s. Sturz Prol. VI. de Vocihus animal. p. 8. ; aber der Fährmann darf nicht fehlen. 155. Cremerae legio, die ganze gens Fabia, die sich e r b o t , den Krieg wider die Vejenter allein zu führen, und beim Flusse Cremera in Etrurien umkam, a. U. 276., a . C h r . 476. Liv. IT, 48. f. Ovids vortreffliches Gemälde dieser in ihrer Art einzigen Begebenheit, Fast. II, 195. ff. tot beilorum anintae, und die Geister aus so vielen andern Kriegen; ein grosser, acht tragischer Ausdruck. Schulting. ad Quintilian. Deel. 1. p. 25. Burin. erklärt egregie bellicosae, nach Beispielen, die nicht passen, belloritm ist zu nehmen : aliorum bellorum , nach dem Griechischen , wo oft älhog anf diese Art fehlt, to Zev xui &toi bei Demosthenes. näv~ T eg oi isXmvai xai oi ä/naoTtoXoi, Luc. XV, l . Luther: Es nahten sich zu ihm allerlei Zollner und Sünder. Schaefcr Ind. ad Bos. Ellips. v. "AXlog, und Apparat. Demosth. T. IV. p. 232. So auch Juven. III, 8. ac mille pericula, sc. alia. 38. et cur non omnia , sc. alia. VI, 55. X, 178. et quae, sc. alia. ibid. 174. et quidquidsc. aliud. 212. etquibtts sc. aliis. XIII, 126. A ergl. zu XII, 103. Cic. ad Att. II, 19. populi sensus maxime theatro et spectaculis perspectus est, i. e. ceteris spectaculis.
S A T I R E II, 149 — 163.
121
riin. Paneg. 85, 3. neqite est ullus qffectust i. e. uflus alius, wo Schäfer falsch. Persius i, 34. 159. Jlluc wird erklärt : Ad inferos i m u s , cum ex Lac vita migramus (Marshall), was keinen Sinn hat. R u p e r t i liest I l l i c : d o r t , in der Unterwelt werden wrt- Elende zum Gespött! Ist um nichts besser. Achaintre Illuc: bis zu dem Grade von Schlechtigkeit tradueimur, devenimus ; b e s s e r : a pristina virtute ad liane infainiam duci nos patimur. Das Präsens verstärkt. 160. Juverna, Juvenals Schreibart, nach den allermeisten Handschriften, auch bei Plinius und Mela III, 6. Beim Tacitus Agric. 24. Hibernia. Die einfachste Schreibart, hat S t r a b o 'léçvtj, mit ihm Claudian. de IV. Consul. Honor. 3 3 . Jerne, die allen übrigen F o r m e n und auch dem heutigen Namen Irland ( J e r n e - l a n d ) zum Grunde liegt. Schneider a d Orpli. 1181. Orcades,, Orkney lies. D e r Ausdruck und selbst Briist hyperbolisch: arma ultra promovimus, tannien war nicht ganz bezwungen ; denn mit dem nördlichen gebirgigen Theil (Caledonien) konnten sie nicht fertig werden. Gibbon I. p. 6. ff. Die Orcaden entdeckte und bezwang Jul. Agricola, T.icit. Agric. 1 0 . , aber mit Irland gelang es ihm nicht. Tacit. 24. Die Nachrichten, die man verbreitete, setzten h i n z u , was an der Sache noch fehlte; der Dichter konnte es besser wissen ; gleichwohl spricht er mit den damaligen Zeitungen, seinem Zweck gemäss; er will sagen: Schon haben wir die Welt bezwungen. Das Alles war geschehen v o r 85.' n . C h r . , in welchem Jalwe Domitian den Agricola aus Britannien zurückberief, modo captas Orcadas, wie oben 29. Qualis erat nuper: aber modo, „ s o e b e n , " rückt diese Einnahme der Z e i t , wo der Dichter schrieb, noch näher. Diess bestätigt unsere Zeitbestimmung bel V . 2 9 . dieser Satire. 163. et tarnen unus Armenius etc. Ein junger A r m e n i e r , der als F r e m d e r in Rom sich a u f h ä l t , wird durch einen Ti'ibuu v e r f ü h r t , und in die herrschenden Laster ein-
122
ERKLAERUNG.
geweiht. Zalales schreiben die Codd. sehr verschieden. W e d e r der Name, noch die Geschichte wird sonst erwähntArmenische Geissein in Rom würden beim Taeitus erwähnt, sagt Britannicus. Rupert! sagt es nach, und citirt zwei Stellen, worin — nichts davon steht: die erste spricht von Parthischcn Geissein, und die zweite von Armeniern zwar, aber nichts von Geissein. Dagegen hören wir von einer Armenischen Gesandtschaft in Rom unter Nero , Dio Cass. LXI, 3. a. U . 807. Vielleicht befand sich der junge Armenier mit bei dieser Gesandtschaft, wenn man venerat hospes aus einer Handschrift ( d e r Hamburger) annimmt. Sonst lassen sich Geissehl gar wohl d e n k e n , selbst im Zusammenhang mit der damaligen Gesandtschaft, venerat obses ist freilich nur eine Notiz, und weiter nichts. Zu vergleichen Sueton. Calig, 36. quosdam obsides dilexisse Jertur commercio mului stupri. Aber venerat hospes, das W o r t mit Nachdruck gehoben, hat viel mehr Bedeutung: Als Fremder kam e r ; und bald an Lastern ein Einheimischer kehrte er zurück. 169. mittentur soll gesagt sein für diinittentur, omittentur. So erklären die Meisten, und auch Ruperli. Also: sie werden ihre T r a c h t , ihre Sitten ablegen, und Römische annehmen. Der amator, der Verführer, verlangt nicht, dass sie ihre Sitten ablegen sollen; er schmeichelt vielmehr diesen Sitten, um sie zu gewinnen. Dann halle auch cullelli keinen Sinn. Ruperti will freilich dafür cliiellae lesen, der albernste Einfall, den n u r ein Mensch haben kann, clitellae sind Packsättel f ü r Esel; hier aber ist nicht von Eseln, sondern von Menschen die Rede , die frena und flige.lla für ihre Reitpferde gebrauchen ; dazu gehören ephippia. Aber die ganze Erklärungsart ist falsch. Vom Liebhaber ist die Rede, der Geschenke macht, mittentur, in seiner ersten und eigentlichen Bedeutung, sc. d o n o , muneri, 111,45. IV, 20. VIT, 74. IX, 50. braccae, &v\axoi, auxy.ot, Tracht der Armenier, wie vieler anderer Völker, bei langem schleppenden Talar. S t r a b o X I . p,530. D. frena, flagellum eben-
S A T I R E II, 164 — 111, 2.
123
falls f ü r den A r m e n i e r , , die gute Reiter sind. S t r a b o 1. c. Darunter gemischt cultelli, als Römische Galanterie, XI, 183. Horat. E p p . I, 1 , 51. 170. Arlaxala, domum Die Hauptstadt Gross-Armeniens am Araxes. A. U. 810. oder 811.'zerstörte sie Cn. Domilius Corbulo; DioCass. L X I I , 20. und Reimar. Neun J a h r e s p ä ter ward sie wieder a u f g e b a u t ; Dio. L X I I I , 6. praelextatos mores, Römische Verderbtheit, mores iuventutis p r a e textatae, i . e . Romanae. Die eigentliche Bedeutung des W o r tes muss bleiben. Andere Erklärungen taugen nichts, und man muss sich dadurch nicht irren lassen. V. ad Tacit. X I I , 41. init. F e r i a t . Epistoll. in Cic. Oratt. p. 1 0 0 . , der ganz richtig e r k l ä r t : puerorum mores depravatos.
DRITTE
SATIRE.
1. Zu Anfang spriejit der Dichter in der ersten P e r son ; er erwähnt den Abschied eines alten Freundes , der nach Cumä sich b e g a b , um den Beschwerden und Gefahren der Stadt Rom zu entgehen. Cumae, C u m a , Cume, südlich von R o m an der Küste von Caihpanien, unweit Neapel, w a r damals ein stiller, menschenleerer O r t , vacuae, wie
Tibur
II, 2, 81.
vaeuum, vacuae
Athenae Acenrae
vacuae Virg.
H o r a t . E p i s t . I, 7 ,
G e . II, 2 2 5 .
Der Ort
45. war
merkwürdig durch das Orakel der Sibylle in einer G r o t t e , die man noch heutiges Tages zeigt. Heyne Exc. III. ad Acn. VI. p. 879. D u r c h Cumä geht der W e g nach dem romantischen B a j ä ; daher ¡anua Baiarum. digressus, das v o cabulum proprium von der Trennung zweier F r e u n d e , die nun nach verschiedenen Seiten gehen, digrediuntur. E i n e ähnliche Verbindung wie hier, Plin. Paneg. 86, '3. coiifii~
124
ERKLAERUNG.
sus i . e . contristntus. den,
destinare,
m i t d e m Infinitiv v e r b u n -
gehört dem silbernen Zeitalter
amoeni
secessus;
gratum
an.
kein g e w ö h n l i c h e r G e n i t i v ;
litus
es ist d e r G e -
nitiv d e r E i g e n s c h a f t : ein U f e r , welches einen
angenehmen
Aufenthalt g e w ä h r t .
Prochyiam.
5.
hat Free'/ylen
Ruperti
Griechische F o r m , ohne G r u n d .
h ö h e r n T o n des epischen Gedichtes , d u n g , Aen. I X , 7 1 5 .
hat die R ö m i s c h e
Subura
dem
En.
Suburae,
dem g e -
w a r d e r belebteste und (ärmvollsle
clamosa
Theil des alten R o m s , schen
die
E s ist das h e u t i g e P r o c i d a , eine Insel,
d e r Campanischen K ü s t e g e g e n ü b e r . räuschvollen R o m .
geändert ,
Auch V i r g i l , obgleich im
Subura
beim Marttal,
zwi-
m o n s Coclius und Esquil'inus, z u r zweiten S t a d t -
region g e h ö r i g , m i t einem M a r k t e , T a b e r n e n und T a b ; i g i e e n ; Läufig die lupanaria
vidimus,
Suburae.
mille pericida,
solus.
quid
tarn
miserum
—
etwas kühn ge&agt, s t a t t : quis locus tarn miscr, tarn sc. a l i a ,
Augusto
ausser den genannten.
noch tausend Gefahren
mense,
in den
Ilundsta-
g e n , zur Q u a l d e r Z u h ö r e r . 10.
W ä h r e n d a u f g e p a c k t w i r d , geht d e r F r e u n d
a u s , und z w a r mit dem D i c h t e r ( v . 17. descendimus) d e m T h o r e bleibt
er stehen,
bis
vor
der Transportwagen
mit
d e m H a u s r a t h , mit F r a u und K i n d e r n nachgefahren u n d mittlerweile erfolgt
dum—componitur tion. X I V , 9 2 . 9 5 .
rheda
kommt,
die H e r z e n s e r l e i c h t e r u n g , v. 21. ff.
—
substitit,
reda,
ein
regelmässige (Konstrukeinspänniges
w ä r e Griechische O r t h o g r a p h i e ;
Gallisch, u n d also o h n e h zu schreiben. Caes. 57.
vor-
;
ad veteres arcus
etc.
Fuhrwerk.
das W o r t
ist
aber
Casaub. ad S u c t o n .
D i e s e r V e r s ist viel bestritten
in den U n t e r s u c h u n g e n ü b e r die T o p o g r a p h i e des alten R o m s und den G a n g d e r A q u ä d u k t e n .
V e r g l . Nardini R o m a V e -
tus, T l i e s a u r . G r a e v . T . IV., und F a b r e t t i de Aquis et A q u a e duetibus, ibid.
vplercs
arcuntum
Wasserleitung,
der
arcus
v e r s t a n d der L e t z t e r e vom o p u s wodurch
die A q u a
ü b e r die p o r t a C a p e n a hiuausgeleitet w o r d e n sei.
Marcia
arcus,
in
S A T I R E III, 3 — 15.
125
dieser Verbindung mit dem T h o r e , kann doch wohl nur von den Bogen des Thorcs selbst verstanden werden.
Eine W a s -
serleitung ging allerdings über das T h o r hinweg, da$ daher unter einer Art Traufe stand,
madida
Capena
grandi
gutta.
1447.
Es findet also hier
porta
quac pluit
und Martiah
hier,
Kar J i n i p. 976. uncl
eine fiendiadys statt.
Von die-
sem T h o r e aus führte ein anmuthiger W e g durch die lis Egeria, ein sich weit hinziehendes T h a l , Kardini p. 978. von
val-
jetzt CafFarella,
Dieses Thal war ehrwürdig durch die Sage
Numa's geheimen Zusammenkünften
Egeria,. durch den lucus Camenarum
mit dgr Nymphe
(Nymphen,
worunter
Egeria, später mit den Musen verwechselt,) mit der heiligen Quelle und einem alten
.Tempel
Tages die Quelle Caflarclla, Pappclhain.
Nardini p. 978.
der
Camenen.
mit einem dabei
Heutiges
befindlichen
Zu Juvenals Zeit war Numa's
alte Institution längst vergessen, der Tempel verfallen, der köstliche Hain verpachtet an
und
die Juden , die darin wie
Zigeuner haus'ten; Judenweiber statt der Nymphen! 12—16. wieder
eine Juvenalische Parenthese;
18. Qiianto
praesentius
bis 20.
so wie
Ueberal!
gleich
begegnen
dem Satiriker Reflexionen , die er auf diese Weise einschaltet.
mit dem dat. „tempus praefiniehat, quo
constiluebat
convenirent" F o r c e l l . , „ad constitutum vemebat cum amica" Salmas,
de RIodo Usur. p. 7 2 1 . ; pflegte ihr Rendezvous 'zu
geben.
Cic. de Or- I. in fi. Saue
in Tusculano
nie hodie
venlurum
vettern, esse,
aliquo. Gronov. Obss. p. 12. sq.
non
constituissem,
Laelio.
Sonst cum
amica,
satirisch anzüg-
lich, und im Römischen Sinn verächtlicher, als die vor dem Gesetze gültige concubina. L . 144. D. de Verb. Signif. fisvrjv 'Avitaviov
xahito&ui
ton. p. 193. T . V. Reisk.
ev raig
¿gco/uivais
enoirjoaxo
mitian die Domitia, Dio Cass. L X V I , 3. extr. nemus, Plural. arbor,
i. e. nemus cum sacro fönte. quorum
¿pco-
von der Cleopatra Plulnrch. An-
— supellex:
satirische Uebertreibung.
sacri
Dofontis
delubra,
poetischer
Lumpenpack.
Omru's
Der Hain war den Juden
126
ERKLAERUNG.
verpachtet, schwerlich um darin zu wohnen", sondern um ein Bethaus, n^otstvyjj, tiarin zu haben. Verg!. Zorn. Flist. Popula, nicht fisco : denn der fiscus iisci Judaici p. 294. Judaicus, der gerade zu Domitians Zeiten mit äusserster Strenge gegen die armen Juden zu W e r k e ging (Suet. D o init. 12.), war zur Erhebung der-Personensteuern, Reim, ad Dion. L X V F , 7. §. 43. Diese Pacht vom Haine hätte jeder Andere auch gehen müssen. mendicat, wimmelt von Bettlern, VI, 543. 17. descendimus, das lange Thal liinah, vorbei an der Grotte mit der Quelle, derselben, die v. 13. sacer fons lieisst. Die G r o t t e w a r nicht natürlich geblieben; man hatte ihr schon in frühern Zeiten eine künstliche Einfassung gegeben, und im Innern W ä n d e von M a r m o r . Diese Verkiinstelung missbilligt der D i c h t e r , mit grossem Rechte: „ V i e l näher w ü r d e inan hier die Gottheit fühlen, w e n n " etc. praesentius, mit Grangaeus und Nie. Heinsius, empfiehlt sich auch ohne Handschriften statt der gewöhnlichen Lesart praestanliits, mit Bezug auf die ¿mtpüvfiu TWV 9twv. Vales. ad E u seb. p. 25. c. 2. Unten X I , 111. Die Grotte denkt sich der Dichter ganz nach Ovids schönem Gemälde Metam. III, 1 5 7 — 1 6 2 . , das er unstreitig hier vor Augen hatte. violare, wie (.uat'vtiv schon bei H o m e r , vom Entweihen der Natur durch Kunst. Hemst. ad Lucian. T . I. p. 31, 13. Valckenaer ad Amnion, p . 169. 23. here, die alte F o r m , statt heri, welches hier nicht in den Vers passen würde. Quintil. I, 4, 8 . und daselbst Spalding. D i e Verbindung ist etwas geschraubt: eadem (sc. res) cras aliquid Deteret, f ü r : der morgige T a g wird von der zusammengeschmolzenen Habe etwas wegnehmen. illuc, sc. Cumas, nach einer abweichenden Sage, die wohl auch in Cumä entstanden war. V i r g . Aen. VI, 14. und Heyne daselbst. exuit alas, um sie dem Apollo in dem Tempel, den er selbst erbaute, zu weihen. torqueat. Der Ausdruck ist von der Spindel entlehnt. Die Parze spinnt bis zum
S A T I R E III, 15 — 33.
127
Lebensende eines Jeden eine gfewisse Portion Wolle. dum pedibus me porto meis, i. e. dum incedo pedibus meis. Der Ausdruck ist selten, aber offenbar aus dem gemeinen Leben; er kam von Rom aus in die Provinzen, nach Gallien, und liegt dem Französischen se porter zu Grunde. Analog ist das Deutsche: „ w i e geht's"? Cf. Scaliger ad Manil. p. 409. bacillo, diminutivum, charakteristisch f ü r die Sprache dieses Zeitalters. Artoriiis und Catulus sind Repräsentativnamen f ü r eine gewisse Klasse von Menschen, die in der Wahl der Mittel zu ihrem Fortkommen nicht eben sehr gewissenhaft waren. Auf Inschriften findet sich häutiger die Form Arturius-, Artorim aber auch: Quintil. IX, 1, 2. Vellui. Paterc. p. 307. ed. Ruhnken. Ursprünglich hiess die gens Arturia ;• später ging u in o ü b e r , und so kam die neuere Orthographie Arloria auf. nigrum in Candida vertunt, sprichwörtlicher Ausdruck, wie wir auch sagen: „aus Schwarz Weiss machen." 31. Der Horazische Gedanke: Pars hominum gestit conducere publica. Diess sowohl, als die übrigen zunächst genannten Gegenstände, beweis't, dass atdem richtig ist, den Bau oder die Reparatur eines Tempels in Entreprise nehmen. Ruperti sah hier nichts als ein Privathaus, und wollte daher lieber aedes gelesen haben, meint aber doch , der Singularis könne wohl auch vom Hause gebraucht sein. Das Gegentbeil war schon von Bentley bewiesen , mit Bestimmung von Rubnkenius. Cf. Heinecke. Im Cod. Husum, ist auch die richtige Glosse: aedem, templum. Derselbe Cod. bat ganz allein Quis, statt Queis, wie auch Bentley Hör. Serm. I, 1 , 75. das gewöhnliehe c/ueis corrigirt hat. ßumina, Flüsse, die aus ihrem Bette getreten sind, einzudämmen. eluvieni, wie die Pontinischen Sümpfe. portandum — cadaver. Die libitinarü, eine eigene Klasse von Leuten, werden gedungen , und besorgen Alles, was zum funus gehört. et praebere caput etc. Die bisherigen Erklärungsversuche alle klären nichts a u f , vom alten
E R K L A E R U N G . Sclioliasten an, d e r wegen domina
hasta
an den fiscus P r i n -
cipis d e n k t : „ q u i poscunt a fisco vendi, quasi debitorcs f i s c i " . D a s s bei caput
s u u m verstanden os
werden
ad iniurias,
Man sagt
praebere
hergehen.
Nach dieser Analogie ist g e s a g t :
venale , i. e. a d venditionem. Leben und Freiheit.
caput
Von der
ad
muss,
ist richtig.
contumcliam,
praebere
sich
caput
ist im Römischen Sinn
letztem
ist liier die R e d e :
die F r e i h e i t zum V e r k a u f hergeben, also v e i k a u f e n , sub
sta.
ha-
E s geschah häufig in diesen Zeiten , dass f r e i e B ü r g e r ,
die ganz v e r a r m t w a r e n und sieh weiter keinen R a t h w u s s t e n , sich als Sklaven verkauften an den Meistbietenden, sub
hasta.
Das
ansehen, etc.
Et
liisst sich
nun freilich als Erwerbszw.eig
w i e das ü b r i g e hier A n g e f ü h r t e , aedem zu Anfang, des V e r s e s
ist
aber# a u c h
das R e c h t e ; den rechten Sinn gibt erst Aut, verdorben war.
nicht
conducere,
gewiss nicht
w a s auch I, 157*
D e r G e d a n k e i s t : „ M ö g e n solche Menschen
in R o m b l e i b e n , denen es nicht s c h w e r w i r d ,
die sich also
leicht entschliessen, jeden E r w e r b s z w e i g , a u c h den n i e d r i g sten, zu ergreifen, oder die, wenn alle S t r i c k e reissen, ihnen w e i t e r nichts übrig b l e i b t , bietenden v e r s c h a c h e r n " . dem B e i w o r t d e r hasta? erklären.
Aut
Dagegen
praebere
daraus.
caput
sich selbst
W a s tinin w i r
domina,
aber mit
Dieses lässt sich befriedigend nicht
w i r d Alles d e u t l i c h ,
domino.
Der Räufer
wenn
an den Meist-
wenn man
W e g e n hasta
wird durch
lies't:
domina
wurde
den R a u f dominus,
und
d e r , w e l c h e r sich v e r k a u f t , geht in dessen dominium ü b e r . 34.
Quondani
cornicines,
auf bekannte Subjecte, nieipien
herumzogen
u n d bei
L i p s i u s S a t u r n , II, 19. e x t r . Hornbläser,
zusammen ; HI, OVTOI, weis't
vormals cornicines,
die die B a c k e n
die in den M u -
den Spielen Musik Zu X , 213. autblasen.
l u d o s , . w e i l diese S p i e l e gleichsam Geschenke sind.
verso pollice,
machtcn."
buccae, munera
,
als i. e.
f ü r das V o l k
ein A u s d r u c k , hergenommen von den
Gladiatorspielen, wo das V o l k häufig entschied, ob d e r ü b e r w u n d e n e G l a d i a t o r den T o d e s s t r e i c h empfangen solle ,
oder
S A T I R E III, 3 3 — 4 8 .
129
nicht, versus pollex war das Zeichen, den niedergeworfenen Gladiator zu tödten. occidunt, occidi iubent, occidendura' praebent. quem übet, was die meisten Handschriften haben, ist matt, und entstand wegen der Nähe eines verbi activi, occidunt. quivm libet ist richtig : So oft's belieht. populariter i. e. in gratiam populi. conducunt foricas, certo pretio a fisco, Bezeichnung des niedrigsten Erwerbzweigs. foricae, piiblicae latrinae zur Verrichtung der Nothdurft gegen Bezahlung. Bei einem Volke, das meist im Freien l e b t , war eiue solche Einrichtung nicht übel. Kaiser V e spasian verpachtete diese Nothdurftinstitute zu seinem Nutzen. Daher der bekannte Witz dieses Kaisers bei Suelon. V e spas. c. 23. Der Pächter davon hiess foricarius. Cuiacius Obss. X X I I , 34. quum sint etc. Leute, denen alles glückt, was sie anfangen, Glückskinder , V I , 605. Jastigia rerum. Hier steht rerum wie bei Horaz : quid agis, dulcissime rerum? wo ja nicht quid rerum zu verbinden ist. Fortuna steht im zweiten Satze, gehört aber schon zu extollit. Durch diese Stellung des Subjectes, die bei keiner neuern Sprache möglich ist, gewinnt die Satzbildung in den alten Sprachen sehr viel. voluit für vult, Griechischer Aorist. 44. ranarum viscera : Das extispicium aus den Eingeweiden der Kröten. Nach Ruperti soll sich das nicht „ad vaticinationem" [divinationem], sondern auf veneficas artes beziehen: „Ich habe die Giftmischerei nicht gelernt". So wird inspicere nicht gesagt, das durchaus nach seiner eigentlichen Bedeutung genommen werden muss, und verbum solenne ist. me nemo ministro etc. Es ist die Rede von furtis im Grossen, wie sie von Procuratoren in Provinzen begangen werden, die sich erst ihre tauglichen ministri und comités aussuchen. In der achten Satire werden solche E r pressungen näher geschildert. maneus, ein Invalide, der z. B. eine Hand verloren h a t , also zum Stehlen untauglich ist. exstinetae corpus dextrae. Markland ad Stat. p. 95'. stiess sich an diesen Genitiv, und wollte den ÀLlativ, exstineta fol. II. 9
130
ERKLAERUNG.
dextra. Wenn aber der Ablativ die ursprüngliche Lesart w a r , den ja auch der stumpfsinnigste Abschreiber verstand, so hätte der Genitiv unmöglich i . . . in . alle Handschriften korn-
men können. Der Genitiv ist vielmehr aufzulösen: corpus cum exstincta dextra; und gerade bei Jüvenal finden sich mehrere Beispiele dieses Genitivs. Vergl. oben v. 4. VII, 23. XII, 82. 49. fervens aestiiat bezeichnet die Wirkungen eines schweren Geheimnisses, das auf dem Gewissen lastet. I, 166. sq. Ferres, der berüchtigte Prätor Siciliens, hier Repräsentant aller grossen Verbrecher: ein Verres. 54. Tanti tibi — careas. Je länger Umbricius spricht, desto wärmer wird sein Gefühl und seine Sprache. tristis, et sis tristis, vom bösen Gewissen, woher auch das somno carere. Aber ponenda! Man sucht es auf allerlei Art zu erklären, ohne dass ein brauchbarer Sinn herauskommt. Heinecke p. 71. Die Ausleger, die sonst gewöhnlich die eigentliche Wortbedeutung übersehen, verfallen dann wieder, wie hier, in den- entgegengesetzten Fehler: sie kleben an der eigentlichen Bedeutung, wo diese nicht anwendbar ist. Ponere praemium ist freilich in der Regel proponere (Heusinger ad Cicer. OiF. p. 734.), r i d i v a i . Aber ponere ist auch häufig deponere. Horat. Epist. I, 1, 10. ludicra pono, und unserer Stelle noch näher 10, 31. ti quid mirabere, poties invitus. Serm. II, 3, 16. Selbst bei Cicero in der Prosa kommt ponere so vor. Diese Bedeutung allein gehört hierher. poiienda praemia sind also Belohnungen, die man doch einmal im Stiche lassen muss , sei es nun durch Tod, oder durch andere Lebenszufälle. Der Geniüthlichkeit der Stelle passt am meisten das Erstere. 60. Quirites, spöttische Anrede an die Römer, die der alten Benennung nicht mehr würdig sind. Graecam urbem, das gräcisirte Rom. lieber die Ueberschwemmung Roms durch die, Fremden in dieser Zeit s. Seneca Consol. ad IIclv. c. 6. tjuota porlio, i. e. pars minima, ein
SATIRE m ,
4 8 — 67.
131
Modeausdruck im silbernen Zeitalter, besonders bei Plinius H. N. Achaei. Die Variante Achaeae ist bloss aus Unwissenheit entstanden; Achaei ist Subject. 62. Syrische Moden und Syrische Mädchen in Rom, ambubaiae, eine Benennung aus dem Syrischen; eine musikalische Classe von Lustdirnen, fidicinae und crotalistriae. CaSaub. ad Suet. Ner. 27. Eine Syrische crotalistria Virg. Copa 1 — 4. caupona Syra, in einem Fragmente des Lucilius bei Priscian. VI. p. 684. Daliin gehören auch die sambucistriae. Sie spielten und tanzten in Tabagieen, bei Banquets , haben einen eigenen Direktor, den tibicen, und trieben ein einträgliches Gewerbe ad Circum (maximum) prostantes. Man muss sich denken, dass diese Geschöpfe aus dem schon längst, nach Alexander d. Gr., gräcisirten Syrien kamen , und dass sie als Asiatinnen mit Griechischer Eleganz Vorzüglich reizend sein mussten. gentilia sind gentibus ¡Iiis propria. gentilia tympana deuten auf Asiatischen Cultus, der sich immer mehr in Rom festsetzte. iussas, sc. a tibicine. Ite quibus : Geht (nämlich ad Circum) und vergnügt euch, ihr, die u. s . w . ; ich für meinen Theil danke dafür. picta mitra, i. e. acu picla, ein gestickter Kopfputz , gehört zur Landestracht; ßöttig. Arch. d. Malerei p. 265. mitra, mitella, überhaupt Asiatische Tracht; die Phrygische unterschied sich noch durch herabhängende Bänder, redimicula. Syrische Musikmädchen finden sich auf Wandgemälden iu Herculanum. 67. Witzige Anrede an den Romulus; die Griechische Nachäfferei durch Griechische Modeworte persiflirt. Pai. sticus, der Römer der alten Zeit, Ii, 127. Latii pastores, ille weis't zurück in die Vorzeit, illud montanum vulgus II, 73. trechedipna, ein schwer zu erklärendes Wort, worüber die Meinungen sehr verschieden sind; auch sehr viele Varietäten in Handschriften. Die Husumer hat rechidimna, eben so wie eine (ehemals) Wolfenhüttier, und eine Leipziger ad lanrginem , mit der Glosse über der Zeile ;
133
ERKLAERUNG.
„vestis parasitica".
Das
zu Anfang
t
das vorhergehende t in sumit, Aussprache von dipna,
verloren durch
ging
und dimna
ist
die
weichere
wie damnurn von d a p n u m ,
somnus von sopnus, vnvog.
äcmdvt/,
V e r g l . Scalig. E t y m o l . £ost V a r r .
Die sieben und dreissig P a r i s e r haben rechedipna,
von Achain-
t r e aus b e s o n d e r e r Gewissenhaftigkeit in den T e x t
erhoben.
D o c h gesteht e r selber im C o m m e n t a r : „ S e d quid sibi velit ilia v o * rechedipna,
ego ine nescire ingenue f a t e o r . "
Zweifel richtig ist trechedipna.
Griechisch ist
Oline
TQf/tStmvoq,
e i n - P a r a s i t , so hei P l u t a r c h . Sympos. V I I I , 6. T . III. p . 9 9 3 . W y t t e n b . Alciphron III, 4 . ;
daher
die Griechen nicht h a t t e n ,
und von
eine W o r t f o r m , welche den R ö m e r n
gemacht
w a r , wie m e h r e r e dergleichen (Salmas, in T e r t u l l . P a l l . p. 2 7 2 . G r o n o v . O b s e r v a t t . p. 6 7 5 . ) , W i r haben
trechcdipnum.
zösische B e n e n n u n g e n , hat.
Es war
die man
in F r a n k r e i c h
eine A r t M o d e k l e i d ,
Gaste g i n g , G a s t l ä u f e r ,
oder
TQtysStinvov
vielmehr
ebenso für m a n c h e Dinge F r a n worin
selbst nicht
der
wie das Hollandische
Stutzer
zu
Schanzläufer.
Rutgers. V. L e c t t . V I , 13. (Hennin. p . 9 0 4 . ) v e r m u t h e t , es sei d a s , was Italiener und Franzosen Livree form,
w o r i n die Clienten
nen müssen. an.
F ü r die Livreen
U n i f o r m e n in
n e n n e n , eine U n i -
eines V o r n e h m e n hätten führt
erschei-
e r unpassend
den Häusern d e r V o r n e h m e n
V,
143.
und R e i -
c h e n , in der L e i b f a r b e des H e r r n , waren allerdings g e b r ä u c h lich. ses
Lucian.
T . 1. p . 6 6 6 .
du S o u l .
formirt, weiss, prasini.
und
die A n m e r k u n g
D i e nurigae im Circus roth,
blau,
waren
grün; albati,
von M o -
ebenfalls u n i russati,
veneti,
Im W o r t e selbst liegt j e d o c h nichts von d e r F a r b e ,
und man k a n n sie n u r hinzudenken. 68.
Der
Römer
M a n . d a r f nicht die Athleten
an
als
Athlet
nach
G r i e c h i s c h e r Mode.
eigentliche Gladiatoren d e n k e n ;
d e r Griechischen Gymnastik.
Gymnasia
es sind .unter
den Kaisern , die Griechische Sitten begünstigten ; Nero e r baute
das
erste
in R o m ,
Spiele
nach G r i e c h i s c h e r
und Weise.
veranstaltete
gymnastische
S u e t . Ner, c . 1 2 .
Faber
S A T I R E III, 67 — 74. Agonislicon III, 15. p. 287. f.
Gymnasiis
133
indulgent
Graeculi
schreibt Trajan an den Plinlus nach Billiynien, X , 4 9 .
Die
Römer, ihre Nachahmer, wurden dadurch seihst zu Graeculis. viY.qvrjQiu , bei den Griechen Siegesfeste, für
niceterla,
die Römer Siegeszeichen, insignia victoris, am Halse getragen, eine Kette, oder dergl.
Siegeskränze um den Hals versteht
Wunderlich ad Tibull. Heyn. p. 93. cf. Böttig. Sahina I. ¡240.; Kränze um den Hals kennen wir
aber nur hei Gastmalen.
Y I , 245., eine Wachssalbe der Athleten;
ceroma,
eben-
falls Griechische S i t t e , aber erst späterer Zeit. 69.
Aus allen Ländern und Inseln ziehen sie nach Rom.
Die Hauptstelle über die Graeculi, die man zu Rom in allen Häusern fand, und die den Ton angaben. eine Stadt in Macédonien. bandae,
in Carien.
Samo
weil es in die Arsis fällt.
Amydon,
in Jonien.
Traites-, vor lue a vimine,
Ata-
wird nicht elidirt, von dem niedrigen
Gesträuch, womit der Berg bewachsen w a r ; so wie der
Collis
Esquilinus, Esquiliac, ursprünglich mit esculis, aesculis b e wachsen war.
, amici intimi, Lieblinge, eigent-
viscera
l i c h : partes intimae. dor. I, 44. ol jiaïâtç
Der Ausdruck ist Griechisch. anlày/ia
bedeutsam gesagt.
ktyoiTat.
ingéniant
velooc,
Jiduri
cin perdita, promlus,
velox
ist sehr
i. e. mobile, kommt
dem zu, der sich leicht in eine Sache hineinwirft. von ingéniant
Artemi-
Das L o b
wird sogleich herabgesetzt durch
dnôvoia.
Casaub. ad Theophr. p. 81.
audasermo
Zungengeläufigkeit, worin die Franzosen den Grie-
chen nahe kommen.
Tsaeus
sondern ein späterer R h e l o r , unter T r a j a n ,
nicht der Attische Redner, Zeitgenosse
unsers Dichters,
über den .Philostrat. Vit. Sophist. I, 20.
Es
ergibt sich hieraus die Zeit, wann diese Satire geschrieben worden.
Sein Lob steht bei Plin. Epist. II, 3.
mals über sechszig Jahre all. „ V o x Isaeo
h. 1. adicctive ponitur".
drucksart nicht; sermo Isaei sermone.
Isaeo
E r war da-
Tillemont T . II. p. 3 5 9 . R u p e r t i ; torrentior
Mehr davon bei v. 90.
E r verstand die Ausfür das vollständige
134
ERKLAERUNG.
74. Ede, quid illum esse pules ? Vielmehr iubes: „Sag' nur, was er sein soll; es hangt ganz von deinem Befehl ab." Der Indicativ nach vorhergegangenem Imperativ ede oder die ist Verbindungsart der belebten Rede. v. 29Ö. Ede, — in qua te quaero proseucha. VI, 29. Die, qua Tisiphone exagitare. Heinecke p. 83. Plin. Epp. Ii, 11. extr. scribe, quid — agunt, nicht agant. Wunderlich ad Tibull. I, 7, 15. Mit Unrecht nennt man diese Art zu. reden unregelmassig, eine Anomalie der Syntax. In dergleichen Dingen herrscht meist grosse Unheholfenheit bei allen Grammatikern. quem vis i. e. qualein desideras. geometres, hier mit kurzem o, obschon im Griechischen ca. aliptes, VI, 422., unetor, der curator corporis im Bade, gewisser»lassen der Badearzt; daher auch iatraliptes. Der aliptes auch in der Athletik, der Arzt bei Leibesübungen; Salmas, ad Vopisc. p. 454. Turneb. Adverss. X V I , 15. Schneider im W ö r t e r b . Philo Alleg. I. p. 58, D roig ufrltjTaig oi ukti.. m a l etc. Wyttenbach. Animadv. in Plut. TVI. p. 851. Dieser gehört aber schwerlich hieher. Ganz ungegriindet ist der Einfall von Ruperti: „medicus ocularius", aber wiederholt von Achaintre. omnia coelum. Besser interpungirt man — magus, omnia novit Graeculus esuriens: in coelum etc. Die Periode bekommt so mehr Rundung, und der ganzeSatz gewinnt an Klarheit, wenn das Subject Graeculus esuriens zuin vorigen Verse gezogen wird. Auf ähnliche Weise hat Bcntley mehrere Stellen im Horaz behandelt. Indess pnsst nach der Reihe von Subjecten, wobei est zu suppliren ist, das omnia novit nicht recht; die Verbindung ist hergestellt, wenn wir statt növil lesen nobis: omnia nobis , nuvru rj/.iü>. D e mosth. p. 240, 11. iiävTU ixstvoi; r/v avjots, Philippus. Hermann ad Vig. p. 722. edit. 2. Gonsal. ad Petron. p. 124, Buvmann. ad Propert. I, 11, 23. Ruhnken. ad Vcllei. p. 405. Schaefer ad Plin, p. 30. iusseris, si iusseris. in coelum ibit, komischer Ausdruck für volabit, wird Gaukler, ntiöfttpo$ ui/dQmnoi; Luciau,. ito Lucius 4. T . H. p. 571. Suet.
S A T I R E III, 7 4 — 9 1 .
135
Ner. 12. Dio Chrys. Or. XXI. p. 504. Reisk. Die unglückliche Luftfahrt des Simon Magus zu Rom , wobei Nero zusah, Tillemont Histoire ecclésiastique T. I. p. 477. f. Zu VI, 526. 79. Ad sunimam , für denique , ist sogar Ciceronisch. Athenis. Die Athener eigneten sich den Dudalus zu, in so fern sie sich den Ursprung aller Künste zuschrieben. Horum, sc. Graeculoruin. Im Folgenden geht der Dichter, wie in belebter Rede natürlich ist,, mit ille vom Plural zum Singular über. conc/iylia, purpuras, vestes purpureas, die Kleiderpracht bezeichnend. signabit. Beim Unterschreiben und Besiegeln von Urkunden, besonders von Testamenten, findet eine Rangordnung unter den signatores statt, zu denen man Freunde und Vertraute nimmt. quo pruna etc., aus Syrien. Damascener Pflaumen und Syrische Feigen ; cotluna, eine kleinere Sorte. Spanliem. de Usu Nu in. T. I. p. 346. Lacerda Adv'ersar. sacr. LIII. n. 14. Pruna und cottana, als Waaren einerlei Ursprungs , werden gewöhnlich zusammengenannt. Collana ist die richtige Sehreibart, nicht coctana. Schneider ad Pallad. p. 97. Die andere Schreibart ist durch die Aussprache entstanden, wie denn die Verwandlung des tt in et häufig ist ; so cocturnices Graminat. Putsch, p. 2248., Fectius VII, 150., Actius. bacca Sabina, nach Saliincr A r t , einfach, v. 169. Sabella mensa. 86. Ausgelernte Schmeichler. Herculis, Antaeum. Salmas, in Trebell. Poll. p. 333. A. Scalig. Animadv, in Euseb. p. 48. ille sonat etc. Man nimmt Anstoss an der Construction und sucht sich mit Aeiiderung der Lesart zu helfen. Ruperti bat einen Excurs. ad h. I. und bat drei Conjecturen vorgeschlagen, wovon noch die beste: ille sonat, cui mordetur gallina marito, nach der Horazisehen Construction : Uli, scripta quibus comoedia. prisca viris est. Dazu kommt noch, dass die Alten quoi schrieben für cui, woraus um so eher quo entstehen konnte. Jacobs will lesen : illa sonat, quum, Heiiiecke will nichts geändert haben
136
ERKLAERUNG
und vertheidigt quo marito, dòn Ablativ mit ausgelassenem a, beim passivo, nach Oudendorp. ad Suet, Caes. 19. Vergi. Vi, 29. qua Tisiphone exagilare. Diess ist richtig, und alle Handschriften haben so, auch J o . Sarseber. p. 134. Aber' Ileinecke hat Jacobs nicht "widerlegt, der illa ändert, sc. vox. Diese Aenderung ist falsch; illa wäre das Gemeine: der Dichter sagt aber ille, gallus i.e. vox galli. Mit derStimmò soll die iHimme des Hahnes verglichen wel-den : die Sprache aber nimmt es kürzer, und nennt den Hahn selbst fiir die Stimme des Hahnes. Ganz die nämliche Vergleichungsart lag oben in den W o r t e n , sermo Isaeo torrentior 7 4 . , und liegt in dem Ausdruck IV, 71. dis aequa potestas, i. e. deorutn potestati. V I , 486. Praefectura domus Sicula non mitior aula, i. e. praefectura Siculae aulae. VII, 72. Non minor antiquo Rubrenus Lappa cothurno, i. e. Rubrem colliurnus. X , 313. nec erit felicior astro Martis, i. e. astrum eius non erit felicius. VI, 486. Es ist eine Abkürzung des Ausdrucks, auch im Griechischen, schon im Homer, Od. ß, 121. o/«oi« voij/uuTa TlrjVtXo7ictrr II. p, 51. xó/uai, Xayi'iiooiv ¿/¿Mut. Und so häufig. 93. Geborne Comödianten sind sie alle ; jede Rolle spielen sie meisterlich, auf der Bühne wie im Leben. Mai» darf nicht verbinden, wie Ruperti , an melior comoedus; sondern : an melior ( quisqunm est), qiutm sustinet comoedus? i. e. nemo melius sustinet, unübertrefflich sind sie in den schwersten Rollen. Das Gewöhnliche war : nuni melior? Dafür an, des Verses wegen. Weiberrollen werden bloss genannt; es scheint, man liess diese am meisten von Graeculis spielen. Die Rede ist von eigentlichen Komödien. D a her Timida und uxorem, Thais ist die Ruhlerin in der palliata; uxor, die persona honesta, Doris, ein Madehennarne, wie Thais, auch von der nämlichen Classe. Solche Personen pflegen dergleichen romantische Namen aus der Mythologie zu führen. Doris heisst nullo culla palliolo, zur Bezeichnung einer freiem Lebensart, palliolum, operi,
S A T I R E III, 9 1 — 103.
137
mentum capitis muliebre. Digest. XXXIV, 2. 1. 38. Salmas, ad Vopisc. p. 476. in Tertull. Pall. p. 269. sq. Ovid. A. A. 1, 733. nec lurpe putaris, Palliolum nitidis imposuisse comis. 98. Die grossen Schauspieler, die man anderwärts anstaunt, sind bei ihnen nichts Besonders: denn die ganze Nation spielt Komödie; sie sind Komödianten von Haus aus. Nec (amen. Von Leuten, die selbst so geschickt sind, sollte man erwarten, sie würden den Künstler zu schätzen wissen. Doch ist dieses nicht der Fall. Heinecke p. 72. nimmt tarnen für t a n . dem: in welchem Sinn? Eine Handschrift hat Nec tantum; diess ist aber ein blosser Schreibfehler. Stratocles und Demetrius, Schauspieler inKomödieen, berühmt durch die vortrefFliche Charakteristik Quintilians XI, 3, 178. sq. Haemus, VI, 198. molli, sein Charakter, sanfte Grazie in Ton und Gebehrde, ro f.iuX&uxov in der Rhetorik. Sonst für mobilis-, Spald. ad Quint. II, 12, 2. Antiochiis kommt sonst nicht vor. 100. Natio comoeda est, commentirt von Pauw, Reclierches sur les Grecs I. p. 284. der Deutsch. Ueb., und von Wielaiid -zu Horaz. Briefen 2. Bd. S. 114. f., aber nicht im Sinne des Dichters. Diesem zufolge geht der Ausspruch nicht sowohl auf die eigentlichen Schauspielertalente, von denen im Vorhergehenden die Rede w a r , als vielmehr auf die Kunst der Verstellung im täglichen Leben , wie aus den folgenden Beispielen erhellt. igniculum, ein foculus Jnit F e u e r , ein Kohlenbecken, um die Hände darüber zu wärmen. aeeipit endromident, sogleich nimmt er den Flauss. ev$Qopis ist eigentlich der Jagdstiefel, cothurnus venatorius, z.B. der Diana und ihrer Nymphen, häufig äuf Kunstwerken ; Spanhera, ad Callim. H. in Dian. 16. Das W o r t erhielt aber, wie oben niceteria, und manche andere, bei der V e r pflanzung in die Lateinische Sprache eine andere Bedeutung. VI, 246. endromides Tyricie, bei gymnastischen Uebungen. Martial. IV, 19. schickt einem Freunde zum Geschenke peregrinani endromida, von dickem Zeuge, in Gallien verferr tigt, Sequanicae pinguem textricis alumnam; aber nützlich im
138
ERKLAERUNG.
kalte» Decembcr, besonders bei Erhitzung nncli Leibesübungen , auch wider den Regen, cf. eiusd. XIV, 126. Glossae: Gausapus, ¿väQO/tig. Martini. XIV, 138. in der Uebersebrift: Gausapa, vel mantile, Dccke oder Ueberzng eines kostbaren Tisches, lind im Texte: villosa lintea, zottige Leinwand, ein Zeug von geschlagenem Linnen mit wolligen Flocken, wie Barchent. Es war eine eigene Bereitung der Leinewand bei den Alten; Voss zu Virg. Lbau p. 858. und Kritische Beiträge zum Tibull S. 445. Die endromis war ein palliurn von leinenem Flauss, wider die Kälte, und keineswegs „athletis propria ac peculiaris", wie Salmasius in Tertull. Pal!, p. 271. sagt. Ganz richtig also im Cathol. Io. lanuensis: vestís villosa. Hieher gehört auch die Glosse: Gausapa, ßaoßagixov nuXkt'ov. Die flaussige endromis dient statt des Pelzes; Pelze waren bei den Römern nicht gebräuchlich ; desto mehr bei den nordischen Völkern; die Gothen brachten sie mit nacli Italien. Vergl. Beckmanns Beiträge 5. Bd. alienum vultum , erzwungene Miene; wie die Freier l a c h e n O d y s s . v, 3 4 7 .
yvafyiowtv
dlAorgiotai,
malis
alienis
nach Horaz. Huschke ad Tib. III, 6, 35. a facie iactare manus, basta iactare IV, 117., Kusshand, nicht aus Zärtlichkeit, sondern als Zeichen der Veneration, aus dem Orient, adorare, nooaxvvttv. Salmas, ad ilist. Aug. p. 440. 'Böttiger Sabina II. S. 51. Das a facie iactare drückt die Affectation trefflich aus; nach dem bekannten iaculari ab aure, Valcken. ad Hippolyt. 220. 108. si trulla etc. Die Erklärungen dieses Verses sind sehr verschieden, und keine befriedigend. Ganz grundlos die des Turnebus und Alciatus: „wenn er die trulla bis auf den Boden ausgetrunken hat". Invertere Jtuidum kann unmöglich „austrinken" heisseu, und crepilus wäre ganz unpassend. Eben so grundlos ist es, dass man den Vers auf den cottabus, ein in der Griechischen Welt bekanntes Spiel, bezieht, wie auch Schneider gethan b a t , unter Könußoi;. Diis ist alles nur aus der Luft gegriffen , auch ganz wider
S A T I R E III, 103 — 108.
139
den Zusammenhang: • denn nucli ructare und mingere muss man etwas anders erwarten. Ruperti lässt den Reichen auf den Nachtstuhl gehen, und cum crepitu ventris ihn seine Nothdurft verrichten. Das ist ganz albern : denn wenn auch ein goldener Nachtsluhl nichts unerhörtes ist (Lamprid. Heliogabal. c. 32. Martial. I, 38.), so kann er doch nicht trulla heissen; und wer hat jemals gesagt, und sagen können , fundum invertere f ü r sordes alvi immittere? Oder es soll vom blossen crepitus ventris verstanden werden können. Beide Meinungen hat Ruperti von Andern ausgeschrieben, die letztere vom Britannicus. Dieser sagt aber viel besser und verständlicher: metaphoricos omnia sunt intelligcnda , i. si trulla aurea, id est, venter divitum (divitis) dedit crepitum, hoc est pepedit. Nur mit inverso Jundo kann er nicht fertig werden. Trulla ist kein Becher, sondern ein anderes Tischgeschirr, eine Art Sauciere mit einem Henkel , manubrium, woraus auch getrunken w i r d , von r u n d e r , bauchiger Form. Ern. Cl. Cic. Griechisch rgvijkqg, von zgiitiv, Casaub. ad Tlieophrast. p. 122. Fisch. Lucian. Lexiph. §. 7. rgvijitjg BlevTQQOvQyliS (daselbst der Scholiast), was Schneider im "Wörterbuch unrichtig nimmt. S. die Note von F. G(uietus). Noch in der späteren Gr'.icität ist TQovkXog üblich für ein rundes Gebäude , eine Rotunde. Auf der Kieler Bibliothek befindet sich ein merkwürdiges Exemplar des Catalog. libror. Jos. Scaligeri, L. B. 1609., worin p. 18. von einer alten Hand folgende handschriftliche Anmerkung Scaligers aus einem der versteigerten Bücher beigeschrieben ist: „Trullus dicitur a rotunditate. zgovWog enim est &6Xog. Unde r o tunda moles in litore Bainno dicitur hodie. il Truglio. Item Romae S. Stephanus del Truglio non longe a Columna Antonini". Vide Du Fresne Glossaria. Ganz richtig ist daher trulla aurea vom Britannicus erklärt venter divitis, ein w i t ziger Ausdruck, und aurea übertragen von der eigentlichen trulla, die auf der Tafel eines Reichen von Gold war.. Vom exepitus veutris ist also die R e d e , und schon der alte Scho-
140
ERKLAERUNG.
liasl hat die Erklärung: „Si pepcderit". Nach nictare und mingere erwartet man auch in diesem Contexte nichts anders, als pedere. Man muss sich den reichen Gönner in Gesellschaft seiner d i e n t e n bei Tische denken; er genirt sich nicht, ructat; er lässt sich vom Sclaven den Nachttopf bringen, mihgit, (Nachttopf-Sclaven; Sabina I. p. 40.); er lässt einen Wind streichen, wofür der komische Ausdruck tmlla crepilum dat. Fundus ist der Boden des Gefässes ; der Bauch • als trulla gedacht, hat einen Jimdum, einen untersten Tlieil, und dieser ist der anus. Das invertere anuin gehört zur Impertinenz des Reichen; die Tischgesellschaft soll die ganze Musik vollständig gemessen, darum funditm invertit; er liegt seitwärts zu Tische auf seinem Polster, und kehrt den hintern Theil vollends h e r u m , um sich recht hören zu lassen. inversus steht also in der eigentlichen Bedeutung, wie manus inversa, und mehreres dergleichen. Jo. Januensis: „Tndla, bombus vel sibilus ani, qui trudendo emittitur", eine Juvenalische Glosse. 109. ab inguine, i. e. a libidine eorum. /?//« virgo, wie 7IA£$ XOQIJ Demosth. Mid., incorrupta. sponsus, der Verlobte der Tochter vom Hause. ante, i. c. antequam Graeculus ille in domum reeeptus esset. aviam, die alte Grossmutter. Viele Handschriften haben aidamauch die Husuiner, mit der Glosse über der Zeile: „revolvunt (seil. Graeculi) quaecunque sunt in domo." aula wäre so eine andere Schreibung für olla , worüber zu vergleichen Ou_ ilcncl. ad Appul. p. 357, „Sie kehren alle Töpfe um", wie wir sagen: sie stecken die Nase in alle Töpfe. Aber es ist nur eine willkürliche Aenderung der Mönche, die den anstössigen Sinn wegschaffen wollten. resupinal, in tergum reiicit; wie inclinare IX, 26. X , 224. 113. Scire volunt. Ein matter Vers, der auch gar nicht rccht in den Zusammenhang passt, da ja hier bloss von der Lasterhaftigkeit der Graeculi die Rede ist. Rigaltius wollte ihn daher versetzen nach 115.; damit wird nichts
S A T I R E III, 108 — 116.
141
gewonnen , so wenig, wie mit der Erklärung, wodurch sich Ruperti zu helfen sucht. Der Vers ist crhiirmlich, und ich erkläre ihn schlechterdings für unächt. Man kann auch recht offenbar s e h e n , wie er entstanden i s t , als Folge von der Aenderung aulam im vorhergehenden Verse. Man legte den Sinn u n t e r , den das Husumer Scholium angibt, und um das deutlicher zu sagen, machte man einen erklärenden Vers dazu. 114. coepit mentio, alter Gehrauch, wie Lucret. V, 1415. Sic odium coepit glandis. Gymnasia dienten schon in Griechenland als Versammlungsörter der Gelehrten, Philosophen und Sophisten. Schneider ad Vitruv. T. II. p. 392. und 403. transi Gymnasia-. wirf einen Blick auf die Weisen dieser Nation, und h ö r e , wozu diese fähig sind. Die Erklärung: transi silentio, omitte, bekümmere dich nicht weiter um sie, ist wider den Zusammenhang. maxoris abollae, i. e. nobilioris sectae, der Vornehmern unter ihren Secten. abolla, das Aeolische dfißöWa. i. e. avaßoXrj, ist der U m w u r f des Gewandes, und das Gewand selbst, das man umwirft, das pallium philosophicum. Schon in Griechenland zeichneten sich die Philosophen und Gelehrten durch eine besondere Tracht aus. Darüber zu vergl. Tertullians Schrift de pallio. Der Ausdruck maioris abollae ist ungefähr so , als wenn wir sagten; die Herren vom vornehmem K r a g e n , statt: die vornehmere Geistlichkeit. 116. Die Geschichte fiel vor unter Nero, p. Chr. 65., 13. der Regierung des Nero. Der edle JBareas Soranus hatte sich den.llass des Nero zugezogen, und wurde hingerichtet, als Opler einer falschen Anklage wider ihn. Puhl. Egnatius Celer, ein alter Stoiker, der Lehrer des fiareas und den dieser noch immer als Freund behandelte , legte unter Andern ein falsches Zeugniss wider ihn a b , und e i V a r b sich damit grosse Belohnungen vom Nero, Tacit. Ann. XVI. und (Jist. IV. Dio Gass. LXI1, 26. und das. Reimar. occidit, f e c i t , ut occideretur. delator. Der Stoiker wird hier
ERKLAERUNG.
142
nicht ganz genau delator
g e n a n n t ; e r w a r eigentlich falscher
ripa
Z e u g e , und so unterstützte e r freilich die delatio. nutritus.
Man nimmt mUritus f ü r n a t u s , TQOMptt'g. Nach D i o
w a r E g n a t . Celer
aus B e r y t u s
des Syrischen R e i c h s ,
in
Phönicien,
liche S y r i e n und Phönicien b e s c h r ä n k t e , digung
des letzten K r i e g e s
Rötnische P r o v i n z Reich
war
ward ,
gegen
als es nach B e e n -
Mithridates den G r o s s e n
64. v. Chr.
nach Alexander d u r c h
also auch P h ö n i c i e n ;
einem T h e i l
das sich zuletzt noch a u f das eigent-
Egnatius
Grieche betrachtet werden.
Das
ganze S y r i s c h e
die Seleuciden
gräcisirt,
aus B e r y t u s kann d a h e r
sehr g u t kennen aus Hegewisch, U e b e r d. Griechischen Zu B e r y t u s passt ripa,
lonien seit Alexand. d. G r .
Gorgoneus
liegt a m M e e r e .
caballus,
d i c h t e r i s c h e r als p e n n a , caballi herunterlassen.
deiabi
das geflügelte P f e r d ,
pinna,
mehr
poetischer A u s d r u c k f ü r P e -
, nicht bloss
f a l l e n , sondern
Also . ' » „ g e b o r e n an j e n e m U f e r ,
sus sich zur E r d e h e r a b l i e s s " . nie
zur E r d e ,
Olymp. Casaubonus
Ko-
denn es
P e g a s u s , aus d e m B l u t e d e r Medusa entsprungen. gasus alatus.
als
D a s g r ä c i s i r t e Asien lernt m a n
sich
wo Pega-
Nach der Fabel kam Pegasus
sondern erhielt
seine W o h n u n g
im
a d Persii P r o l . p . 8. bezog die Anspie-
lung a u f die S t a d t C o r i n t h , a u f deren Münzen d e r P e g a s u s als
insigne u r b i s .
Böttigers Vasengemälde
Diess ist a b e r bloss S y m b o l Schiffe
in ihren W a p p e n
D i c h t e r s s a g t das nicht.
1. H e f t S . 108.
d e r Schiftiahrt,
fuhren , und
Ueberdem
wie S e e s t ä d t e
d e r Ausdruck
ist es ganz
den E g n a t i u s z u m G o r i n t h i e r zu m a c h e n .
des
willkürlich,
D i e Ausleger wis-
sen sich keinen R a t h ; Manche nehmen die pinna
eigentlich,
dass dem P e g a s u s eine F e d e r ausgefallen w ä r e , und da diess sonst nirgends v o r k o m m t ,
so meint
Ruperti,
der Dichter
habe vielleicht einen „ m y t h u m nobis i g n o t u m " im S i n n e gehabt; von
eine blosse M ö g l i c h k e i t ! ganz
eigener
Art
lureconsultor. Academia, sei d e r J u r i s t Pegasus
Eine weitläuflige Erklärung
gibt J a c o b . H a s a e u s , cap. IV.
d e Berytensi
Das Gorgonische
u n t e r D o m i t i a n , I V , 76. f f . ,
Ross der'so
S A T I R E III, 116 — 120.
143
grosses Ansehn hatte, tlass man das lus Pegasianum nach ihm benannte; Gorgonei cab. penna sei satirisch gesagt für Pegasiana Iuris disciplina; delapsa, „quia illud lus Pegasianum ibi docebatur". Zu Berytus, das unter August colonia Romana iuris Itaiici wurde , war eine berühmte Rechtsschule, die aber erst im dritten Jahrhundert bestimmt erwähnt wird. Io. Strauch. Berytus, Brunsvigae, 1661. c. IV. §. 15. Menagius Amoenitatt. Iur. Civ. p. 135. Das thut aber nichts zur Sache; denn Hasagus gebraucht nun die Stelle des Juvenal, nach seiner scharfsinnigen Erklärung, als Beweis, dass schon unter dem Domitian eine Rechtsschule dort gewesen sei: deun die Schwinge des Pegasus war bei Berytus herabgefallen, d. h. in Berytus wurden Pandecten und Institutionen gelesen ! Diese seltsamen Einfälle führt glcichwohl Reimarus ad Dion. p. 1022. §. 132. als eine zuverlässige Erklärung an! Man muss den Ausdruck: ripa in illa, ad quam etc. beachten. Die ganze Küste des mittelländischen Meeres wird bezeichnet. Auf derselben Küste in Cilicien liegt T a r sus, dessen Namen man ableitete von Tapaoj, und hinzudichtete, hier, bei Tarsus, sei der Pegasus mit seinem Reiter Bcllerophon herabgefallen, und habe den Fuss gebrochen, TUQGÖV , plantam pedis. lan. Parrhasius, Quaesita per epistol. p. 42. Dionys. Perieg. 869—71. Anspielungen auf diese Fabel werden sich wohl auch auf Münzen von Tarsus finden. Der Dichter denkt bloss an die Küste: „ein Zögling jener Küste, wo einst Pegasus den Fuss brach". Deutlicher wüx'de es lieissen : delapsa est planta caballi; aber diess ist kein hinlänglicher Grund zur Aenderung. 120. Protogenes. Deren gibt es mehrere: Lamprid. Heliogah. c. 6. Loens. Epiphyll. II, 14. Gruter. Ind. Kom.; ein Grammatiker bei Fabric. Bibl. Gr. Dio Cass. L I X , 26. Hier ist ohne Zweifel an einen Grammatiker gedacht, der, nach unserer Stelle, grosses Glück in Rom gemacht haben muss. Eben so wenig wissen wir von einem Diphilus etwas näheres, der vor Juvcnals Zeit in Rom gelebt zu haben
144
ERKLAERUNG.
scheint. Hermarctis, wie man gewöhnlich lies't, ist kein Griechischer Name, sondern Hermarchus , "EQ(IUQXOQ , wie liier zu schreiben ist. D e r Name ist auch an einer Stelle des Cicero in den Handschriften verdorben (v. E r n . Clav.), und beim Seneca Epist VI, 14. 9. hat Schweighäuser dieselbe F o r m hergestellt. Ein Hermarchus w a r Epikureer, über den Diog. Liiert. X, 25. zu vergl., und dessen Büste von Bronze in Herculanum gefunden und in den Bronzi di Ercolano abgebildet worden ist. Cf. Villoison. Anecd. Gr. T. II. p. 159. Goerenz ad Cic. Fin. II, 30. Schweighäus. ad Alhenae. Animm. T. VII. p. 175. solus habet, seil, amicum. Die Verbindung ohne Partikel ist ganz Juvenalisch. tempora, friictus temporum. 126. Kein officium, kein meritum wird einem Armen mehr übriggelassen , seit die Vornehmen selbst darnach lauf e n , und alten reichen Weibern um die "Wette die Aufwartung machen, der Erbschaft wegen. Von Sportein ist hier gar nicht die Rede. Meritum ist mehr als officium. II, 132. Cic. ad Famil. XI, 17. Magna Lamiae- in me non dico qfficia, sed merita. Vergl. XII, 29. Ad haec officia vel merila potius etc. ne nobis blandiar, als Zwischensatz eingeschoben. W i r sagen: „Schmeicheln wir uns n u r nicht, dass". Statt nobis hat die Husumer Handschrift vobis : eine blosse Abirrung. si, f ü r si vel maxime, wie f t zuweilen f ü r ti xai steht. togatus ist der Römer immer, wenn er als Bürger erscheint. So sind die Clienten in der toga, wenn sie dem Patronus ihre Aufwartung machen ; cf. ad I, 96.; ebenso die Sachwalter vor Gericht, daher in späterer Zeit togatus und advocatus synonym sind. curet currere, cum cura c u r r e r e , curiose, studiose c u r r e r e , sich ein Geschäft daraus machen, schon vor Tagesanbruch zu dem dominus hinzulaufen , um ihm den Morgengruss darzubringen. Derselbe Ausdruck X I I I , 101. , currere curamus Rutil. 429. Wernsd. Poet. Min. T. V . , Sueton. de Gramm. 24. annotare curavit. Bentley ad Horat. p. 551. cf. Forceltini s. v.
S A T I R E III, 119 — 136.
145
Aelinlich schon Homer. II. i, 504. Aixati fittöntad-' "¿ity; dieyovat xtovoat, wo richtig Koppen. impellat, sc. m a n u , ist sehr charakteristisch. Der Priitor, dem der Lictor zu langsam geht, gibt diesem Rippenstösse, weil er f ü r c h t e t , nicht der erste bei der Matrone zu sein, um deren Erbschaft es zu thun ist. 131. lässt der Dichter die angefangene Verbindung fahren. Der Hauptgedanke ist: Reichthum entscheidet alles. servi, des gewesenen; liberti, aber für das Gefühl stärker. Was die Kraft bewirkt, ist der Gegensatz zwischen deui s'ervus und ingenuus. latus claudere vom Clienten, der zur Linken geht, auch tegere latus, und von demselben comes exlerior Ho rat. Sat. II, 5, 17. Die Redensart latus claudere findet sich übrigens nur bei Juvenal; darüber Scioppius Animadverss. in Vossium p. 18. ingenuoruni filiiis ist alterthümliche Umschreibung f ü r ingenuus. alter ist der reiche servus oder libertus, der den pntronus macht. quantum in legione etc. Staatsbeamte erhalten unter den Kaisern Gebalt. Die Besoldung eines Tribunen ist nach F r a u , zösiscliem Geldfusse auf etwa neunhundert Francs berechnet. Calvinae vel Catienae, matronis, die f ü r Geld wohl zu haben waren ; Horat.. Sat. I, 2, 28. ff. Calvinus von Calvus, wie Catienus von Catius. Die Wahl solcher Namen hat meistens einen historischen Grund. So finden wir bei Sueton. Yesp. 23. zu Yespasians Zeit eine Iulia Calvina e gente Augitsti, eine D a m e , die, soviel aus den Worten Suetons durchschimmert, nicht vom besten Ruf war. Catia auch beim Horas L 1. v. 95. eine Malrone von schlechtem Rufe. at tu, 1, 50. Chionen (denn so ist aus Handschriften zu lesen für Chionem], scortum, eine Ch'ione. Ihr Name kommt auch bei Martial an mehrern Stellen vor. aha sella , -cathedra, ein Prachtsessel, vorzüglich der Damen. Es ist die Rede von einer vornehmern Classe solcher F r a u e n zimmer, die nicht in einer cella, wie Muretus Opp. IV. p. 141. irrig lesen will, sondern f ü r sich wohnen, die Damen Vol. 11.
10
ERKLAERUNG.
146
spielen und a u f hohen Sessel i h r e A n b e t e r e r w a r t e n .
Daher
auch vestitum i. e._ eleganter vestitum. A r t e m i d o r . IV, 42. sitzt auch eine eni
nOQVtin) eni xa&sdoa;
sv ifturlmg
n0(>q>vjj0tg.
P l a u t . P o c n u l . I , " 2 , 5 7 . de m e r e t r i c i b u s : Quae tibi
bulum, statumque,
sellam
et sessibulum
merum.
olanl
S u c l . T i b . 4 3 . , ein Z i m m e r im H a u s e , locus Joedus
ski-
sellaria,
Daher ,
Tacit.
A n n . V I , 1.
A u s d e m Gegensatz m i t diesen v o r n e h m e r n D i r -
nen e r k l ä r t
sich die bisher nicht verstandene komische B e -
nennung d e r g e m e i n e m C l a s s e , / u f i u t r o n t j , dariae, oder pedaneae, philus g e n a n n t gebeten
cf. ad Gell. III, 1 8 .
bezieht sich a u f alta
sella;
Chionc w i r d
heruuterzustcigen.
137. ff.
D e r U n v e r m ö g e n d e h a t hier keinen G l a u b e n ;
ad
nach d e m G e l d e allein schätzt m a n den Menschen.
censum,
ohne V e r b u m , fit aestima'tio:
W o r t e de moribiis
scere,
pe-
w i e die iudices p e d a n e i v o m T l i e o -
w e r d e n ya^iaiSixuaxai.
deducere
in fi.
gleichsam
—Quaestio
quot pascit
etc.
Die
pa-
sind ein Zwischensatz.
f ü r alere, ein s e h r s p r e c h e n d e r A u s d r u c k von Sclaven,
pa~
von denen m a n w i e von P f e r d e n und K ü h e n r e d e t .
ropside.
So
lies't man
gewöhnlich
und J e d e r
denkt d a b e i
au oif/ov, o p s o n i u m ; doch d a m i t lasst sich nicht a u s k o m m e n . D i e richtige F o r m ist parapsis.
in absidibus.
Digest. X X X I V , 2. 1. 19. I. 3 2 . §. 1.
apsidibus.
Brisson. de V e r b . S i g n . V o s s . E t y r n o l . v . Paropsis.
Salmas,
§. 6.
§. 9 . parapsidas.
a d Hist. Aug. p . 3P8. und 5 1 9 . C a s a u b . u n d Oiulend. a d S u e t . G a l b . c. 12. S t u r z Lexic. X e n o p h . R h o e r ap. Reiff, a d A r t e m i d . p. 283.
Das W o r t
ist s e l t e n , vielleicht nicht einmal G r i e -
chisch , und bezeichnet einen T h e i l des Tafelgeschirres.
Der
S i n g u l a r ist collectiv zu nehmen. 143. Stelle
arca,
bewegt
Sämolhracum
d e r eiserne G e l d k a s t e n , d e r nicht von d e r wird,
irn Gegensatz
, überhaupt
für
von
crumena,
deorum
loculi.
peregrinorum.
D e r ausländische Cultus d e r C a b i r e n u n t e r den R ö m e r n k a m zu ihnen über E t r u r i e n ; dass der Cultus a b e r d u r c h Nuina eingeführt w o r d e n ,
wie Ste C r o i x ,
Mysteres S . 5 6 . d . U e b .
S A T I R E III, 136 — 153.
147
meint, scheint unhistorisch. Jiilmina alque deos, eine H e n . tliadvs, f ü r fulmina deorum, i. e. vindictam cleorum. dis ignoscentibus. Ein A r m e r , denkt m a n , s c h w ö r t leicht einen falschen E i d ; er lebt d a v o n , und die G ö t t e r selbst n e h m e t es mit ihm nicht zu genau. 147. Ja, dem Armen spricht man nicht n u r alle G l a u b . Würdigkeit ab, man macht ihn auch noch überall zur Zielscheibe -seines Spottes. letcerna", der toga entgegengesetzt, ein K l e i d , welches der R ö m e r gewöhnlich, im Hause trägt, a b e r auch öffentlich , wenn er nicht gerade in Geschäften ist. Sie ist von W o l l e und weiss, und muss daher häutig gefärbt werden. toga und calcmts sind unzertrennlich, wie laeerna und soccus. nihil habet — Jacit, fast wörtlich nach den Versen eines Griechischen Komikers, ap. Stobaeuin Serin. 236. p. 774. W e c h e l . ovx ean nepi'ag ovdev d&Xim•feqov etc. und p . 759. 153. Die Scene ist in einem T h e a t e r oder Amphitheater. Die Lex Roscia theatralis w u r d e von dem Yolkslribunen L. Rose. O t h o vier J a h r e vor Cicero's Consulat, d e r später als Consul eine jetzt verlorne Rede d a r ü b e r hielt, die O r a tio de L . O t h o n e , vorgeschlagen und angenommen, w e i t e r hin vom August durch eine Lex Iulia theatralis in manchen Stücken abgeändert. Durch diese Lex waren bei öffentlichen Schauspielen die XIV. ordines f ü r ' d i e equites eingeführt. Domitian erneuerte die ältere Lex Roscia, dehnte sie aber dahin aus, dass alle, die den census equestris h a t t e n , ohne equites zu s e i n , wie diese, das Recht haben sollten, in den XIV. au sitzen; X I V , 323. f. Ein Platzverwalter oder L o genmeister, designator (Lindenbrog. in Commcntar. Terentii Adelph. p. 152. W e s t e r h . ) , hatte f ü r die zweckmässige O r d nung zu sorgen und darauf zu s e h e n , dass die plebs sich nicht in die X I V ordines einschlich. Einen solchen designator, Lectius, erwähnt Martial. V, 8. 14 und 25. inquit ist keine Ellipse; es steht impersonal, wie VII, 242. XI, 291. Hoirtt. S e n n . I, 4, 7 9 . , wo es Bentley erläutert. Am h a u -
148
ERKLAERUNG.
figsten bei Jen gleichzeitigen Schriftstellern, Seneea und Quintilinn. Es ist das Griechische . führt es zwar auf, aber uftagrvQcog. Gebrauchten es etwa spätere Griechen , den Rötnern entlehnt.
so w a r es erst von
Bei den Attikern heisst es
eyxvxhov.
Brauck in Arisloph. Thesmoph. 2()1. 261.
perferat,
inferat, den Hieb führen, oder eigentlich
v o l l f ü h r e n : denn perferre
ist zum Ziele bringen, woraus m e h -
rere Nebenbedeutungen flicssen. Zu V i f , 153. quam
denso,
weg.
wie V. 2 9 . , fascia.
cjuanla —
und also mitss die Interpunction
Ruperti denkt sich mit Ferrarius einen
Harnisch von Tüchern
muniendo
pectori ad versus
Dabei vergessen sie ganz, dass sie bloss ad palum
iclus".
sich übt,
lind der palus keine ictus austheilen kann, übersehen auch das vesenlUchepoplilibus.
fascia,
fasciae crurales, eine A r t Strüm-
pfe, die in der Kniebeuge befestigt sind, tihialia; o d e r eine A r t Ilosen, ferninalia.
Letzteres scheint das W a h r e .
Ueber
die Geschichte dieser T r a c h t vgl. Casaub. inSuct. Aug. c . 8 2 . libro kann verbunden werden mit sedeat, mit Bast befestigt; oder fascia
denso libro,
Bast, über,
ist aus dieser Stelle zu merken.
die
fasciae
seihst von
Bast.
Der
scaphium
beim Martial, auch in den Pandecten, axütftov aus Griechischen
244
ERKLAERUNG.
Comikern Pollux X , 45., ein Gef'ass f ü r weibliche Bedürfnisse von eigenihümlieher F o r m , die den Männern wohl lacherlich vorkommen mochte. Gifan. Collectan. in Lucret. s. v. erklärt: vas ex aere ad retrimenta alvi, muliebre fere, ut lasanuin virile. 265. neptes, Enkelinnen, Töchter unsrer edeln V o r f a h ren. ludia, quae ludicram artem exercet, mima. ge• tnat, wie ingemiscere, Cic. Tusc. II. §. 56., vom Fechter, der mit aller K r a f t ausschlägt. Asylus. Glossa Husum.: „fuit gladiator excellentissimus in urbe". Es scheint, Asylae gelesen werden zu müssen; ein männlicher Käme Virg. Aen. X, 175. Asylas. 270. Die Scene hinter den Gardinen; bald W u l h , bald Verstellung. Tum mit Nachdruck : da ist erst der Teu-. fei los. Um siel» zu verbergen, spielt sie die Eifersüchtige. pueros, die hübschen Sclaven im Hause. Vgl. oben 34. in itatione sua, wie ein Diener, der auf den W i n k des H e r r n wartet. Terent. Eun, IV, 5, 46. Slo exspectans, si quidmihi imperent. Von den Ruderern Virg. Aen. V , 137. Intenti exspectant signum. Ruperti will illa lesen, zum Folgenden ; vor ihm auch Huschke Epist. crit. in Properl. p. 78. Aber die Construction in der vulgata ist nicht allein acht (s. Heinecke p. 29. und Taylor Indic. Lysiac. p. 917. Reisk,), sondern der Ausdruck auch lebhafter. 276. tu tibi places, tibi gratularis, gloriaris, exultas. tunc. D a f ü r haben wenige Codd., auch der Ilusumer, tum, vielleicht richtig. curruca steht in den meisten Handschriften und Ausgaben; andere, auch die Husumer, curuca-, die eine Ropenhagener corruta, verdorben statt cornute; Ofener Handschrift hatte Urtica mit dem Scholium: „stupidi mimologi nomen", ohne Grund, auf gut Glück aus dem Context g_egriifen ; eine solche JVamensform ist ganzlieh unerhört. Zwei andere Scholien, mit jenem zusammengeschmolzen, deuten auf die eruca , wie sich auch in heutigen Handschriften findet, die R a u p e , die das G^rtengemüs
S A T I R E VI, 264 — 276.
245
zerfrisst, und die bei mehreren Schriftstellern in Handschriften wieder auf mancherlei Art anders geschrieben wild, aeruca, uruca, urica, rauca. Unter diesen verschiedenen Schreibarten war unstreitig uruca diejenige, worauf die beiden Scholien sich beziehen: es liegt der vulgata am nächsten. Aber mit der Raupe lasst sich nichts anfangen , und die Lesart taugt bestimmt nichts. Am sichersten halten wir uns noch immer an die Lesart der Ilandschrr. curruca oder curuca, und an die gewöhnliche Tradition von der Bedeutung des Wortes. Sie gründet sich auf Scholien, wie im Cod. Husum., und auf Erklärungen, wie im Catholicon fo. Januens. und im PapiaS. Darnach ist curuca ein kleiner Vogel, in dessen Nest der cuciilus, der K u c k u k , seine Eier legt, und von diesem sie ausbrüten lässt. Der Kuckuk legt seine Eier bekanntlich in die Nester mehrerer kleinern Vogel, der Grasmücken, Bachstelzen u. a. Das Seholium im Cod. Husum..: „ Curuca est avis parva, cuius ova cuculus fovet et curuca cuculi credens se fovere sua et laetatur habere pullos grossos et pulchros quod posteri facti". Der Mönch hat aus mehreren Scholien .seiner altern Handschrift ein confuses Ding zusammengesetzt; es ist aber leicht zurecht zu bringen : quae ova cuculi fovet, credens se fovere sua , et laetatur habere pullos grossos et pulchros. Das letztere ist Mönchssprache, und gleichsam die Uebersetzung des bessern Ausdrucks, den der Mönch vor sich fand, und mit dazu schrieb: quod postej-i facti. Das Catholicon Ioaunis lanuensis, aus dem dreizehnten Jahrhundert, hat einen 'ahnlichen Artikel, aber im Wesentlichen besser gefasst: „Curuca, quaedam avis, quae alienos pullos educat vel nutrit. E t dicitur sie, quin dum cucufus eius ova sorbeat, sua relinquit. (Diese Herleitung taugt nur nichts.) Quae curuca tarn diu ea fovet et pullos natos educat, donec filii inde liati et exereti eam comedunt. (Blosse Fabel.) Unde et curuca dicitur ille q u i , dum credat nutrire filios suos, nutrit alienos. Haec eadeii» avis liuofa (MS. Bibl. Kiliens. linopha, Xivovipoq, eigentlich Xtrovrfiog, Salmas, in Vopisc.
246
E R K L A E R U N G .
p. 455. F . , w o r n a c h S c h n e i d e r im W o r t e r b .
zu b e r i c h t i g e n )
d i c i l u r sccundum q u o s d a m " . F e r n e r : „Cttruco ruca. E t est curucare
dicilur a
cu-
aliquem c u r n c a m f a c e r c , q u o d f i t eins
c o r r u m p c n d o n x o r e m " . Papias in V o c a b u l a r i o , ed. M e d i o l a r . 1476. F o l . : ,,Currucula est a v i c u l a : quac alterius iilios
edu-
c a t : l j a e c d i c i l u r l i n o f a v e l cucula e o :
dum
quod
eius o v a s o r b e a t sua r e l i n q u i t quae c u r r u c a
cuculus
tarn diu f o v e l :
d o n e c extracti pulli cam c o m e d a n t " . ,Das W o r t curruca
gilt
uns d e m n a c h f ü r eine komisclic Benennung des H a h n r e i ,
des
xtQao(pi>Qng b e i m A r t e m i d o r , und in
gehörnten Ehemanns, A n t h o l . G r . , ein S p a s s ,
d e r a b e r in d e r V o l k s s p r a c h e
Z w e i f e l schon f r ü h e r v o r h a n d e n Gebehrde, abstammt.
war,
ohne
und v o n einei' allen
w o m i t man Jemand v e r s p o t t e t e ,
(.loöxog, sanna,
D e s w e g e n k ö n n t e man hier leicht a u f corntile v e r -
fallen, wenn nicht andere
Gründe
dagegen
wären.
Conr.
G e s n e r Ilist. A n i m a l . I. I I I . de A v i b . p . 326. f ü h r t an : „Citrriinila liomen adhuc in usu Italiae esse audio, quum aliquis de
sloli-
d i l a t e n o t a t u r " , w e n n man einen Sclrops bezeichnen w i l l .
Das
finde ich a b e r nicht bestätigt. F e r n e r : „ n o m e n
cor-
niUo d e t o r t u m a c u r r u c a Slemmate
soremne venias
Das ist durcliaus falsch.
lecture f ü h r t d e r V e r s h e r b e i , statt Incturus. P e r s .
277. I I I , 28.
videtur".
quoque
luum
vel
hodierne;
quod
Tusco
quod
mm um millesime
Irabeate salutas.
w o Voss
dueis,
einen deum h o d i e r n u m
d e r eben so lacherlich ist, als ein deus hesternus, pomeridianus ; passt
¿Jou'iiova iig d'ev
Apoll,
tth.
ad
E h e r Callimach. E p i g r . L I V . -Brunek.
oiSe TOP avoiw;
Gronov.
Servius ad V i r g i l , p. 585.
E l e n c l i . p . 185.
S c h a e f e r . -ad Schot.
p. 193. H e r m a n n . A p p e n d . a d V i g e r . p . 894.
vollständigsten
ü b e r diese Construction S c a l i g e r
p . 210. sq. und Epistol. 279. servi hic.
erzwingt, matutinus,
und w a s e r aus d e m Plautus d a f ü r b e i b r i n g t ,
durchaus nicht.
A . Hand,
Am
in P r i a p e i a
I, 20.
aut cquifis: sie n i m m t , was sie k r i e g e n kann.
D i e meisten
die, statt hic.
Cen-
T i b u l l . 1 , 7 , 5 3 . Sic
Handschriften
haben
zum
drittenmal
lue ist allerdings n o t h i g , steht .aber nicht gut
S A T I R E VI, 2 7 6 — 300.
247
so spät. Vielleicht die Ilic aliquem. colorem, /Q(Z(ta, vocab. rbetor. 284. homo sunt , das Terenzische, so leiebt zu missbraueben ; h i e r : leb bin ein Mcnscli, wie d u ; was du thust,. kann ich auch lliun. S. Westerhov. ad Terent. iram clc. iin Bewusstsein der Schuld werden sie erst recht wüthig. ' 291. W ä h r e n d Hannibal Roin auf 3000 Schritte nahe s t a n d , hatten die Römischen Legionen unter FuN ius F l a c cüs, ihm gegenüber, ein Lager bezogen inier Esquilinnm
Collinarn(/ue portam
, Liv. XXVI, 10.
Colliua
turre,
ad
portain Collinam ; tur/is in vallo.. Also ist die richtige L m sclireibung : stantes in vallo ad Cöllinam porlam turribus imuiilo. 293. 94. Eine grosse W a h r h e i t , im grossen Stil ausgesprochen: das -unvermeidliche Schicksal erobernder Völker und die nothwendige Folge der erkämpften W e l t h e r r schaft. Die ganze Römische Geschichte seit Ponipejus und Casar ist der Coinmentar zu diesen zwei Versen. Die W e l t herrschaft, wenn Alles überwunden ist, bringt langen F r i e den, und im langen Frieden erzeugt sieb Luxus, Weichlichkeit, und wie die Keime des Verderbens weiter heissen. Das Glück der Welt liegt keineswegs im ewigen Frieden, sondern im rechten V e r h ä l t n i s zwischen Arbeit und Ruhe ; das AVohl der Völker besteht ganp nach denselben Gesetzen, wie. das W o h l des Einzelnen. Die Nemesis waltet über Völker uud Reiche, wie über ¡Menschen. 295. hiue, von der Zeit, ex hoc tempore, seitdem. ad islros haben zwei Kopenbagener, ad histros vier, und die Ilusumer , mit allen übrigen Ilaudschriften. Daraus ist ad islos corrigirt worden schon im sechszebnten Jahrhundert , wenigstens leidlich: aber es scheint noch nicht das Richtige zu sein. Luxus und Siltenverderb flössen nach Rom nicht aus Asien allein , sondern früher bereits- aus Unterhalten. 300. Quid enini etc. Der Ileichthum brachte den Luxus;
248
EIíKLAERUNG.
die Unmássigkeit w u r d e a l l g e m e i n , k a m unter das weibliche G c s c h l e c h t ; Venus und B a c c h u s vereinigt Hessen keine S p u r von Scham u n d Sittlichkeit m e h r ü b r i g .
D e r Ausdruck ist
.liier etwas sehr z u s a m m e n g e d r ä n g t , dass man M ü h e hat, die Beziehung des Causalsatzes a u f das V o r h e r g e h e n d e sich d e u t lich zu m a c h e n . 3 0 1 . capitis,
in Beziehung a u f ein unnatürliches L a s t e r ,
fellatio, X , 2 3 8 .
R u p e r t i mischt liier dreierlei
verschiedene
S a c h e n in E i n s . N u r die Stelle aus dem Aristophancs uuguentario
vinum
bibitur
Equit.
concha „ b . e. c u m in vase
1 2 8 4 — 8 6 . g e h ö r t hieher.
unguento
mixtum",
Forcellini.
E i n silbernes T r i n k g e s c h i r r . P a u l u s S e n t e n t . R e c e p t . III, 6, £¡0. Der Scholiast:
„ n o n c a l i c i b u s " ; es ist ein Gefass von m e h r
Titllia
als g e w ö h n l i c h e m Maasse.
etc.
D i e s e r V e r s ist
in d e r O f e n e r Handschrift ausgelassen , a b e r von einer s p ä t e m Hand supplirt. d r e i andern
steht
E b e n so fehlt e r in zwei P a r i s e r ; er erst nach
folgenden V e r s ,
und
diese Versetzung hat Acliaintre sich i m T e x t e erlaubt.
Die
gewöhnliche O r d n u n g
dem
in
ist a b e r die r e c h t e ,
und die V e r s e t -
zung in den drei H a n d s c h r i f t e n r ü h r t bloss d a l i e r ,
dass die
Abschreiber- den V e r s am R a n d e
s u p p l i r t fanden ,
und -an
d e r unrechten Stelle e i n r ü c k t e « .
Zwei W e i b e r , Tullía* u n d
M a u r a , verhöhnen die P u d i c i t i a bei ihrem eigenen T e m p e L
qua sorbeut,
w e s h a l b sie so
(jucrie.
die Nase z i e h t ;
eine G e -
samia , fivöxog ; d a h e r moxjuer,
bell r d e des S p o t t e s .
mo-
D a r u n t e r w e r d e n m e h r e r e Arten von S p o t t g e b e h r -
den b e g r i f f e n . Casaub. ad P e r s . p . 102.
OjUOf, naso
adunco
suspendere,
mehrsten H a n d s c h r i f t e n ,
Maura
H o r a t . S e r m . I, 6 .
collactea
auch a u f I n s c r i p t i o n e n .
H i e r d e r (.ivxTtjQifindet
sich
in
den
auch a u f I n s c r i p t i o n e n , w i r d a b e r
dennoch v o n Charisius f ü r ungebräuchlich e r k l ä r t , p . 62. P i g n o r . de
S e r v . p. 194. Iac. Oisei. ad Caii Institutt.
p. 23.
Schütting Iurispr. Anteilist., Muncker ad H y g i n . F . 224. p. 3 4 5 . l í a s Sicherste scheint
colladía,
w o f ü r auch
Handschriften
sind und Inscriptionen. Reines, ad Inacriptt. p. 5 ¿ 6 . Churisiu»
SATIRE
VI, 300 — 316.
249
wollte n u r collactanens gelten lussen ; eine offenbare Grille. siphonibus, tractibus in moilum siphonis. Eine Art der äussersten V e r a c h t u n g , I , 131. inque vices etc. Diese W e i b e r sind sogenannte T r i b a d e n , tribades, frietrices > Les» biades. 314. Gemälde d e r sacra Bonae Deae, berüchtigt wegen der Ausschweifungen, die dabei getrieben w u r d e n . Die F e i e r ist bekanntlich bloss f ü r die W e i b é r ; II, 83. f. wird sie aber auch von Männern affectirt, die sich weibisch machen. Dieser Cultus gehört zu den O r g i e n , wobei eine wilde Musik: tibia und bald nachher cormt das Blasinstrument bei dieser F e i e r , 11,90., wo das cornu von der tibicina geblasen'wird ; ein flötenartiges Instrument, das unten in ein H o r n ausging, beinah das heutige Bassethorn. Schneider Ind. Scriptt. Rei R. incitât, als wilde, aufregende Musik, wie Cicero de L . L. IL § . 3 8 . von der Musik s a g t : incitât languentes animos. Musik und W e i n bewirkt fanatische W u t h und wilde Be= gierde zu den grässlichstcn Ausschweifungen. Die Schilderung ist ausserordentlich merkwürdig und das W e r k eines Meisters. Diese Sacra sind, wie viele andere, ein Zweig des uralten Asiatischen Katurcultus , und hier hat man ein Bild vor sich von der schrecklichen Ausartung dieses Culfus in den Zeiten des Sittcnverderbnisses. crinem rotant. Q u i n til. XI, 3 , 71. caput iactarc et comas excutienlem rotare fanalicwn est, Brisson. Antiqq. Select. 1. II. c. 13. An Bacchanten sehen wir diese Erscheinung noch jetzt auf Kunstwerken. Daher heissen auch diese fanatischen W e i b e r Maenadex, uneigentlich. Vgl. Catull. 63, 23. Philippi Thessal. E p i g r . A I, 4. Anal. Brunck. 11.212. ululare, das Griechische o'AoXvÇeiv, ein religiöses Geschrei, womit die G ö t t e r um Gunst und Segen angerufen werden , auch bei den Israeliten, w o von noch ein Ueberrcst bei den heutigen Juden geblieben. Prinpi Maeuadcs hat sehr wenig Autorität , und lässt sich auch nur nothdürftig verstehen. D a f ü r haben fast aller IlamlbclirU'lcii, auch die Kopenhagener und H u s u m e r , ulu-
250
ER K L A EU U NG. ; es gibt
Iante Priapo
aber keinen vernünftigen Sinn.
Lesart ulul.antque Priapo
Der
geht es nur wenig besser.
Dì ess-
i m i scheint Iluperti das W a h r e getroffen zu halten:
ululant-
i. e. ululatu invoeant. Virg. Aon. IV, 609.
que Priapum,
cale. trivii.s ululata. cina domum.
respexil
Martial. Y , 41. ululai matris Gallus So esclamare
Celaenaeum. 318.
Stat. H i e b . 111,158. ululata
Lu-
concubinum
Cf. Forcellini s. v.
aliquem.
saitante libidine,
He-
nach dem Griechischen
saltare
e'¡¡ytìoSui. Ernest! ad Callim. in Ccr. 89. Schweigh. Anirttin. Alben. T . I. p. IG?. Ileindorf ad Plat. C r a t j l . §. 51. Aus unserer Stelle saltus libidinis 320.
Sauftia
bei Tertullian. p. 10. C.
I X , 117.
S. Glandorp. Onoin. und Scali-
geri Ind. ad Grulcr. Inscriptt. Laufella
einiger Handschrif-
ten ist keine Namensform; eher noch Lauf eia.
provo-
cai etc. D e r W e t t s t r e i t ' h a t Beziehung auf die famose Anekdote von der Messalina. Plin. H. j\~. X . s. 83. pendentif
pmeinia
ist nicht etwa ein Schinken als Prämie, wie
coxae
ernsthafte Männer gemeint haben, sondern pracuiium in certuinine-Veneris peitdulae,
nach dem Ausdruck des Appuleius
Met. II. p 132. Oudendorp. S. Ruhnken. »dlliitil. Lup. p. 260. pendere
in diesem Fall dieselbe Bedeutung,
hat
Aen. V,. 147. (aurigae) pivni
in verbera
pendent.
wie \ii'g. Burin. ad
Phuedr. p. 260. 322.
etc. w i r d gewöhnlich ganz v e r -
ipsa Medullinae
kehrt genommen, ßuetum
, nicht J'rietum :
iju'aos
aü)uv/,ia.
Lucret. I V , 1265« de mutiere viri Venerem retraetante: ipie exonaato
ciet omni pectore
fluetus.
At-
Das folgende crissare
niulicris est suecumbcntis, et quos aeeipit ictus, eos strenue rcpercutieutis,
nooG/.iveio&ui,
Toup in Schol. Theoer. cd. Be-
rol. p. 500. Gifan. Ind. in Lucret. v. Rctractare. tung -wird recht anschaulich p. 207 , 14.
Cri.ssavit,
den Vers
ut si friimenlurn
m i t p . 200, 11. Il une molere, liere citnnis.
durch
So ¿atuosodui
illuni
clunibu
D i e Bedeudes Lucillius vaunat,
autem ut Jrumeulum
und quXivtottut
vgl. van-
Anal. I5r. I. 504.
CTOiürc amlicrum und cevere virorum, 11,21., sind plnsisgho
S A T I R E C o r r e l a t a . D a s scholium ganz, richtig a n .
VI,
316—335.
251
ad h. 1. gibt den U n t e r s c h i e d sclion
Aus flen W ö r t e r b ü c h e r n
l e r n t man
nichts
h i e r ü b e r , und im Glossario S t e p h . beisst es v e r k e h r t :
Cris.
Saufeia subagitat M e d u l l i n a i n e i u s q u e
eris-
sat,
xtXtjiiZei.
santis motus 323.
admiratur.
Die Tapferkeit
g i b t dem
eben W e r t h mit dem A d e l ,
Errungenen
Siege
glci-
d. h. die G e r i n g s t e gilt so viel
•wie die V o r n e h m s t e , w e n n sie sich t a p f e r dabei hält. 327.
m ö c h t e ich in solchen S t e l l e n nicht in tum
Tunc
verwandeln.
Drakenborch
auf Stärke a n k o m m t , als tum, und
ad L i v . ii, 1 2 , 15.
E s hat, wo es
offenbar m e h r K r a f t d e r
Ausspräche,
welches, wegen des m, den T o n im Munde verschliesst,
etilen
Brummlaut
zuwege b r i n g t ,
mugiens
littcra
M
Q u i n t i l . X I I , 1 0 , 3 1 . D i o n y s , de C o m p o s i t . p. 1 6 9 . m i t den Ausll.
obsciirum
p. 5 5 5 .
in
extrenntate
dictiomtm
P r i s c i a n . I.
sonnt
bei solohen G e l e g e n h e i t e n
simplex,
sind sie auf-
r i c h t i g ; da allein verstellen sie sich• n i c h t . 328.
Jt — clamor
muss es beissen mit drei H a n d s c h r i f -
ten und e i n e r K o p e n l r a g e n e r : aus dem V i r g i l , wo d e r Ausd r u c k •sehr
gewöhnlich
sc. frustra ,
quacritur, überhaupt", Görenz
ist.
aus dem C o n t e x t .
a t q u e omnino ;
handelt
de
sc. alium «juem.
iuvenem,
L e g g . 1. II. 7 . p . 1 2 5 . ,
E r k l ä r u n g „ ut b r e v i m o n e a m " n o c h nicht mit Rücksicht
asello, von e i n e r
schönen
und
et „ u n d
beim C i c e r o ,
das que
wo
die
fabella
p. 2 4 8 . f. Asinaria
Pasiphae.
Gottes verbieten,
3 . R. Mos. 1 8 , 23.'
einem 'Thier und 2 0 , 16. tliut,
zu schaffen
335.
sich
ausgeführt
in
Appulci. Met a m . 1. X .
S c h o n Moses imisste dem V o l k e
haben:
„ " W e n n ein W e i b
„ R e i n "Weib soll mit
denn
es Ist ein
Greuel";
sich irgend zu einem
dass sie mit ihm zu schaffen h a t ;
und das A ich
ist.
Milesia
einen Esel
zum Galan e r w ä h l t h a t ; mit allen Umständen Lucians L u c i u s s. Asinus, T . I I . , und
seine
ganz richtig
a u f die b e k a n n t e
feinen D a m e ,
wovon
aber
Vlehe
die solt du tödten,
auch".
Atque
utiuam
— omnes,
ein f r o m m e r "Wunsch, den
ERKLAERUNG.
252
die bisherige Beschreibung freilich erweckt, der aber an dieser Stelle herzlich matt i s t , der W ä r m e
in
und den Leser auf einmal aus
die Kälte versetzt.
Verse für einen
gutgemeinten
Ich halte diese beiden
Zusatz von späterer Hand,
Der Gedanke beginnt mit dem folgenden Verse: Mauren und Inder wissen,1 d. Ii. die ganze W e l t weiss, wie durch einen Clodius diese Sacra entweiht worden sind: und damals war doch noch weit mehr Gottesfurcht unter den Menschen. Was geschieht jetzt nicht erst! W a s damals eine unerhörte T h a t war, ist zu unsern Zeiten etwas ganz Alltägliches. 3 3 8 . duo Anticatones,
duo Volumina Anticatonis. Cäsar
hatte nur seine Bücherrollen dagegen zu setzen. Kein W u n der also, wenn der Andere den Vorzug b e k a m ! allerdings der Sinn des Dichters, und durch die
Diess ist Anticatones
gar nicht undeutlich ausgedrückt.
Caesaris 365.
reputant
vorausging.
kann sehr wohl stehen ,
Solche Ungleichheiten
obgleich
in der Sprache
oft zu grösserer Lebhaftigkeit des Ausdrucks. liast bezeugt, schriften,
fehlte der Vers ehemals
dienen
W i e der Sclio-
in mehreren Hand-
also nicht bloss dureb Zufall.
Ganze keinen H a l t ;
sentit
So
in jenen Handschriften
hat aber das
stand vermuth-
lich At,
wie noch jetzt in mehreren statt Ac,
Prodiga
non sentit
und der Vers
wird nach 3 6 4 . gestanden haben.
Durch
diese Anordnung gewinnt selbst die Stelle an K r a f t . 3 6 6 . eunucluis,
eigentlich custos lecti, Frauen Wächter im
O r i e n t , hier synonym mit spado ,
3 7 6 . , wie eigentlich ein
J e d e r heisst, qui generare non potest.
Beides für castratus.
In der juristischen Sprache wird genauer unterschieden. Ulpian. 1. 128. de Verb. Signif. und Glossae jNomic. Verschnit-, tene behalten immer noch so viel übrig, um von den Damen ad exstinguendam libidinem mit Nutzen gebraucht zu w e r den. Es kommen sogar Fälle vor, dass Weiber, sich mit solchen Kapaunen verheiratheii; zu I , 22.
Domitian war der
lirste , der die abscheuliche Sitte des Castrirens im ganzen Römischen Reiche verbot; aber schon Jferva uiusate das V e r b o t
S A T I R E VI, 3 3 5 — 3 7 8 .
253
schärfen , uiul dann wieder Hadrian ; Constantin erneuerte zuletzt alle dawider ergangenen frühern Constitutionen. Brisson. Antiqq. lur. Civ. 11,21. Das Castratenwesen, auf Künstler eingeschränkt, hat aber dennoch bis auf die neuesten christlichen Zeiten fortgedauert! 367. desperatio barbae, gewöhnlicher de ha i hn; jenes nach der Construction desperare aliquid. Dem Castratcn, der es vor der Pubertät geworden , wächst kein Bart. E r folgt die Castration schon in reifern Jahren, so wächst, etwas B a r t , aber so sparsam, dass kein tonsor nöthig ist, V. 373, Bei der Castration im vollen Mannesaltcr wachst der Bart fort. Bärtige Castratcn erwähnt Dio L X X V , 14. lind Antonius Ulmus in Physiologia barbae humanae, Benon. 1602. Fol. p. 315. 370. pecten, TO itfrjßuiov, insi'atov, locus circa pudenda, ubi pili nascuntur. pectines mulierum Plin. II. IN'. X X I X , 1., y.reig, dann uneigenllich das ganze pudendum muliebre. L a ccrda Adverss. sacr. 173. n. 4. Heliodorus, überhaupt der Chirurgus. Grangaeus verweist über ihn auf Paulus Aegineta IV. c . 4 9 . balnea, X I , 156. 376 — 78. l i e b e r diese Stelle ist wunderlich Zeug gemacht worden; der einzige Lubinus hat hier Einsicht gezeigt. ille, cum inembro suo immani. durus erklärt sich durchs folgende tondendus, für maturus, liergenommen vom mannbaren Mädchen, wie Maximian. El. V, 28. Urebant oculos diirtie stantesque pupillae. Arnobius Y . et in speciem levigari nonduni duri el slriculi pusionis. Sidon. I. Epist. 2. dura brachia. Ebenso ax)>t]Qug, bei Plutarch. Agesil. c. 13. fiiyag >tat oxXtjQai;. Bromiiis, wie Aeersecomes VIII, 128. ein junger Apollo, hier junger Bacchus, für puer amatus. „Bei der gnädigen Frau mag so Einer immer schlafen; denn der tliut er keinen Schaden , die kann was vertragen : aber lass ihm deinen Liebling nicht in die Hände gerathen, cornmitlere nolii nam hunc certe diffindet et disrumpet enormitate meinbri sui. D i e . b e i d e a Causalsätze sind nicht mit
254
ERKLAERUNG.
ausgedrückt, und für den Römischen Leser war eine solche Deutlichkeit auch nicht nöthig; die Sache war an sich verständlicher, als sie für uns es sein kann, weil das Laster den Alten geläufig war. 379. nullius etc., i. e refihulat omnes citharoedos, tragoedos et comoedos: denn diese veudebant vocem Praclori. l>uxt welchen die Veranstaltung der ludorum scenieorum von Amtswegen oblag; ot t « j UVTWV qicovoig iot$ uoig ntoi.ovvTtg, Chrysostomus Orat. de Statuis. Der Ausdruck ist wie VI Ii, 194. 380—84. eine vortreffliche Stelle, wegen der Lebhaftigkeit der Schilderung. numerantur chordae, ,, est percurrere, et quasi aliam post aliam pulsando numerare, vel in numerum pulsare", Forcellini. Der Ausdruck, vom Spiel des Saiteninstruments, ist eigen ; Markland wollte am Texte andern. Es scheint indess ein Kunstausdruck in der Musik zu sein , der auf eine besondere Art des Saitenspiels geht. crispo, crispante, weil die Saiten durch den Anschlag ip Schwingung versetzt werden, crispantur. Die Wirkung der Sache wird als Eigenschaft betrachtet, wie in der Dichtersprache sehr gewöhnlich; pallida mors, u. v. dgl. 385. Eine damalige Anekdote von Einer , die sich in den Tempel begab und Opfer und Gebete verrichtete , damit die Götter ihr offenbaren möchten, ob ihr Lieblingssan. ger beim nächsten Wettstreit Sieger sein würde. J'ar et vinum, Bestandteile des Opfers. Iauum Veslamqut: diese nicht allein, sondern mehrere Gottheiten; es gehört aber zum ritus prccandi , den Janus zuerst und die Vesta zuletzt anzurufen. Die Hauptstelle Cic. de N. D. 11,27. rogabat, an etc. Nicht als wenn die Götter von dem Betenden, wörtlich befragt würden: die preces waren eigentliche Bitte, und das darauf folgende extispicium sollte erst ausweisen, oh die Bitte erhört sei, oder nicht. Das Befragen, rogare, will also auf die ganze Handlung bezogen sein. Pollio , citharocdus, VII, 176.
SATIRE
VI, 3 7 8 — 392.
255
391. velare caput, saerificium faeere: das Opfer w ir«l vorrichtet velato cnpite. verha, l"oi i)n11;>m prccandi. diclala , „a sacerdote, sive hnruspiee", Schul. Das Letztere gewiss nicht, und auch das Erstere nicht unbedenklich. Plin. II. N. X W I I I . s. ii. drückt sicli üher die Sitte so a n s : vidimus — ne quid verborum praatercalur aut praepostemm dicalur, de scripta praeire aluputm rursusqiic alium custodem dari •f/ui atlendat. Hier thut es E i n e r , der niclit bestimmt ist, nicht gerade der Priester. AV olf ad Cic. p r o Domo 141. schliesst gar aus jener Stelle, verha praeivisse Pontificem : dort aher ist nicht von diesem besondern Theil der Handlung , sondern von der Opferhandlung im Ganzen die Rede, die der Pontifex auch nicht selbst verrichtet, sondern den ritus davon einen Andern lehrt. pertulil ist allein das Richtige, verkannt von denen, die prolulit dafür schrieben, und von Itupeili , der noch anders schreiben möchte. I eher den eigenen Gebrauch dieses Zeitwortes sind die grossen I,exx. noch sehr mangelhaft , und er ist auch sonst nirgends hinlänglich erörtert. Die eigentliche Bedeutung hatten wir oben '261. in dem Ausdruck perferrc ichts. Die übrigen Bedeutungen bestimmen sich nach den Bedeutungen von ferre, werden aber zugleich durch die Präposition nach dem jedesmaligen Zusammenhang inodiiieirt. Dieselbe "Verwirrung, wie h i e r , VIT, 153. Auch hei andern Schriftstellern ist zuweilen die Lesart in diesem W o r t e verdorben, oder es wird unrecht verstanden. Suet. Galha c. 13. steht retulenmt, in einer Verbindung, wo es nicht passt, und wo auch Cnsnubonus schon Anstoss nahm : es ist pertulerunt zu lesen. Claud. c. 37. steht richtig ovdinem rei gestae perJ'rrre ad senatum , wird aber von Ernesti nicht richtig e r klart , und auch Wolfs Anmerkung ist ungenügend. Den Sprachgebrauch an unsrer Stelle beweise ich mit zwei ganz entscheidenden Belegen. Ovid. Trist. II,.2, 43. VerbMjue noslra favens Romana ad nurni/ia ptrfer. Lucan. Vi, 44(3. Verbaejue ad invitum perfert cogentia iiumen. Der Sinn ist: Sie
256
ERKLAERUNG.
sagt die vorgesprochenen W o r t e geduldig vom Anfang bis zu Ende nach. palhdt, aus Angst der Erwartung. 394. respondes, in Beziehung auf rogare, 386. Iiis, talibus, tarn insanis. varicosus, von langem Stehen, varices, prostantes venae, quae occaluerunt, hauptsächlicli an den Beinen , venae in suris inßexae et oblortae, Nonius. Pcrs. V, 189. varicosi centuriones. Savaro ad Sidon. Epp. V, 5. 398. Ein neuer Charakter: Die Umherlaul'erin, die Allwisserin, eine lebendige Alierweltszeitung. Die ersten Striche der Zeichnung finden sich beim Sitnonid. de mulierib. 12. f., der diesen Charakter aus dem Hunde entspringen lässt. AehnJiclie Charaktere schildert auch Theophrast. cnmr/uc paludatis etc., sie geht selbst den Kriegsleuten auf den Leib, den Heerführern, die im Begriff sind, zurArmee abzugehen, paludati. Diese sind gewohnt, den muthigen Feind recto vultu, stricto ense , auf sich losgehen zu sehen. Diese Ausdrücke sind liier komisch parodirt: das dreiste Weib geht auf den Kriegsmann los recta facie, mit frechem Angesichte; ein Schwerdt hat sie nicht, aber mamillas ; also strictis ma~ millis, exstantibus, nudis, mit unbedecktem Busen. Seres, jm äussersten Osten. Voss Virg. Lbau p. 3 1 4 . diripiatur, discerpatur, um welchen sich mehrere Liebhaberinnen reissen; ein feiner Gebrauch des Wortes, worüber Markland ad Stat. p. 304. Nach dem Griechischen äiaQnu^eiv. Persius II, 38. Martial. VII, 7 6 , 1 . 406. modis quot, in wie vielerlei Variationen, modi, TQÖnoi, a/rj/xaia, figurae, Sueton. T i b . c. 43. Die Ucppigkeit raffinirte auch in diesem Punkte; es gab nicht bloss Gemälde, auch berüchtigte Schriften JISQI jroixi'Xoav AY^^TÄTEAV dtpooöiaicav, unter den Namen von Frauenzimmern, Philaenis, Elephantis und Cyrene; die letztere SoaSexufiriyavoq, weil sie zwölf mögliche modos angab. Suidas in ¿tooäsxafiqxavov- aus dem Schol. Aristoph. ad Ranas. Natürlich steckten hinter diesen Namen meistens männliche Verfasser, und namentlich weiss man von der Philaenis, dass diese eigentlich der Sophist
S A T I R E VI, 4 1 3 — 4 1 8 .
257
Polycrates war. Das 'älteste Original über diese schlüpfrige Materie ging unter dem Namen einer Magd der Helena, Astyanassa. Nachweisungen über das Einzelne s. bei Heinsius ad Ovid. Trist. II, 418., den Commentatoren der Anthol. Lat. I. p. 633. und II. p. 483. und 534., und bei Jacobs in Anthol. Gr. I. 1. p. 385. Brunck ad Aristoph. "Concionatr. v. 8. Die nämliche Materie wurde noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts auf einer damals berühmten Deutschen U n i versität ordentlich scientivisch behandelt; ein bekannter gelehrter Arzt las dort ein Publicum, das im Lectionscatalcrg so angekündigt wurde: De variis concubitus modis. Gute Beiträge zu einer solchen Vorlesung gibt ein curioses Capitel imArtemidor 1,79., wo sechs modi beschrieben werden, und zuletzt noch von vielen andern die Rede ist. Ovid. A. A. III, 769. f. Aristoph. Lysistr. 229. sq. 407. Instantem, interitum minantem. Erscheinungen von Cometen werden unter Claudius, unter Vitcllius und Vespasian erwähnt. Index ad Dion. v. Cometa. Den zuletzt erschienenen muss der Dichter im Sinne gehabt haben ; Armenier und P a r t h e r waren zur Zeit noch unbesiegte Völker, die den Römern viel zu schaffen machten; auf diese wurde die Erscheinung gedeutet. Vergl. Suel. Vesp. c. 23. Niphaten, Fluss in Grossarmenien bei Dichtern; die Geographen kennen nur das Gebirge dieses Namens ; worüber sehr umständlich Mitscherl, ad Horat. C. 11,9. Jacit zeigt, dass es leere Gerüchte sind. Sonst kennt man drei grosse Erdbeben in Asien, zwischen 106—115. nach Chr. (Reimar. ad Dion. LXVII, 24.), die aber eben deshalb hier nicht gemeint sind. Marshall hat eine sinnreiche Interpunction: quosdam J'acit •. isse N. 413, quae hat keine Beziehung; es muss eius, quae verstanden werden; I , 161. exorata sc. frustra , aus dem Conlext, gerade wie V. 333. hie si quaeritur. Vgl. IV. extr. wo bei madenti aus dem Ganzen impune hinzugedacht wird. gravis occ,, teterr. vultu wird überall zum Folgenden Vol. II. IV
ERKLAEßUNG, g e z o g e n , in den neuesten Ausgaben
cariem.
mit einem P u n c t nach
Aber diese P r ä d i c a t e stimmen so nicht zum F o l g e n -
den, und stellen offenbar mit dem, was vorhergeht, in V e r bindung:
Mann und Hund lässt sie voller W u t h d u r c h p r ü -
geln. Nach'canem also ein Comma, und das P u n c t nach vidtu.
nocle.
D i e Nacht macht sie zum T a g e .
den R ö m e r n
ist Nachmittags;
vorher
D i e coena bei
regelmässig B a d ; III,
262. Dieser D a m e a b e r fällt's ein, erst in der Nacht das B a d zu nehmen, und die hungernden Tischgenossen so lange auf
conchas,
sich warten zu lassen.
castra
unguentarias.
komisch, f ü r die zahlreiche Begleitung, comitum agmen. (nam)
magno
sudare,
etc.
was zum B a d e g e h ö r t ,
und wozu
ein besonderes geheitztes Zimmer ist, sudatorium, caldarium, v a p o r a r i u m , L a c o n i c u m . V i t r u v . V , 10. mit Philander und Schneider. 4 2 0 . ff. D i e Stelle hat keinen Zusammenhang nach der gewöhnlichen I n t e r p u n c t i o n , d i e , nach M a r s h a l l , verbessert w e r d e n m u s s : nach tumidtu, wo der Sinn schliesst, ein P u n c t ;
Quum —coegit — urgentur lassata
sind Vordersätze eines neuen Sinnes, in Parenthese; tandern
illa venit,
convivae
der Nachsatz.
etc., erst wenn sie sich mit Gemächlichkeit m ü d e
gemacht hat, gravi
massa,
eine sehr heilsame, von den alten
Aerzten allgemein empfohlene Leibesbewegung nach dem B a d e , halteres.
Seneca E p p . 56. manits
plumbo
graves
iactant
das. Lipsius. Artemidor. I, 5 5 . und Reiffs Citate. h a t man das Mittel in E n g l a n d . Sein Amt i s t ,
aliptes,
und
Noch jetzt
unetor, III, 76.
den Badenden die Salben einzureiben,
auch
den Damen , die sich nicht schämen v o r ihm in puris naturalibus dazustehen, wobei er denn das R e c h t h a t , allenthalben herumzugreifen, wie es der K i r c h e n v a t e r Clem. Alexandr. beschreibt, P a e d a g . III. p . 232. G. reiben
der S a l b e n ging's
exclamare,
Seneca 1. c. spricht vom Alipten im B a d e :
illisae
manus
Cava,
ita
humeris,
sonum
quae,
mutat.
Beim Ein-
ohne mancherlei T ö n e nicht
prout plana
audio
perven.it
Diess ist hier gemeint
ab.
crepitum aut mit
con~ den
S A T I R E VI, 418 — 430.
259
Worten femur exclamare coegit, i. c. resonare, sonitum edere. Statius Tlieb. V I , 202. Iatnface subiecta primis inJrondibus ignis Exclamat. X , 263. Nt gravis exclamet portae mugitus ahenae.. Quintil. VIII, 3, 17. verba — exclamant, i . e . sonan. tiora sunt. crista, eigentlich der Busch auf dem Helm, Haarbusch, hier was oben 370. pecten war , das eipijßatov. 425. rubicundula, ziemlich erhitzt. Oenophorum. Das Fass enthalt eine volle Urne, tenditur, replelum est, wie öfter distendi gebraucht wird, und rumpi. Heyne Obss. ad Tibull. II, 5, 84. urna, eine mensura liquidorum, die Hälfte einer ampliora, d. h. vier congii oder vier und zwanzig sextarii. Der sextarius- war die gewöhnliche Portion ; diese trinkt schon den zweiten, d . h . zwei, vor demEssen. dum redit, reiicitur, was sonst zur Männerdiät gehörte. Sueton. luto in Aug. c. 77. und Casaub. ad eiusd. Vitell. c. 13. vielen Handschriften. Ruperti gibt die^s für eine alte F o r m aus von lavare, und hat den Pariser Herausgeber verleitet, es als Archaismus in den Text zu nehmen. Mit dem Archaismus ist's eine Erdichtung ; und was soll auch der Archaismus im Juvenal, an dieser einzigen Stelle? luto war aus loto durch die unreine Aussprache entstanden, wie epistula, u. v. W . ; man nahm es nun für Unratli, und intestino adjectivisch. Diess sieht, wer Augen hat, deutlich aus der Nachahmung beim Salvianus, die von Pithoeus in seinen Varr. Lect. h. I. angeführt ist. Andere, welche wussten, dass litlum die erste S-ylbe kurz hat, änderten atque luto terram, oder ttrramcjue luto-, beides wird in Handschriften gefunden, loto ist nur richtig: ausgespültes Gedärm. Der vomitus macht Appetit: darum darf der Satz nicht vom vorigen getrennt werden, und die Interpunction muss bleiben, die Ruperti und Achaintre neuerlich verhunzt haben. 430. aut lata Falernum, Lesart vieler Handschriften und der neuesten Ausgaben , der copula wegen, au rata ist aber an sich besser, und entspricht den marmoribus im erstem Satz. Die fohlende copula rechtfertigt Heinecke p. 41. aus
260
ERKLAERUNG.
der Manier des Juvenal.
Es fragt sich nur ,
ob aut auch
fehlen kann, wenn ein Satz den andern ausscliliesst. W a r u m soll man aber auch hier gerade ein aut suppliren ? Da diese vomilus willkülirlich und vorsätzlich sind, so geschieht's wohl allemal ins Becken ; hier läuft's darneben : Der Strom rinnt auf dem Boden hin, und auch das Becken duftet vom W e i n . Beides besteht neben einander; um so richtiger ist die vulgata.
Ergo,
quid mirum, si ; ganz natürlich ekelt den
Mann dabei, der lieber die Augen zudrückt, damit ihm beim Zusehn nicht die Galle überläuft.
substringit,
comprimit.
4 3 4 . Noch unleidlicher ist die afFectirte Kunstrichterin, die ästhetische Schwätzerin, aia&ijTix^ ygavg,
Alexis apud
Athenae. VIII. p . 3 6 4 . F . ; sie hat den Homer und den V i r gil studirt, und hält bei Tische über dieselben Vorlesungen, mit einem solchen Strom von Beredtsamkeit,
dass Niemand da-
vor zum W o r t e kommen kann. Statt Homer und Virgil d ü r fen wir nur Schiller
und Göthe setzen:
so passt Alles auf
unsere Zeit. Uebrigens gibt ein gleiches Gemälde Lucian. de merc. conduct. §. 3 6 . Schutz,
periturae
ignoscit, sie nimmt ihn in
dass er die Dido sterben lässt.
Diess
scheint ein
Streitpunct der damaligen Kritik gewesen zu sein. causidicus,
nec praeco,
nec
die Beide starke Stimmen haben : aber
sie würden überschrieen werden. Nach dieser Zusammenstellung mit dem Ausrufer bestimmt sich der Rang eines causidicus. Petron. c. 46. und Burmann. 441. Man glaubt, es gebt eine Musik los mit Becken und Schellen ; wir würden sagen : eine türkische Musik. ves, XeßtjTsg,
pel-
sind die ehernen Becken zu D o d o n a , die im
Kreise hingen, und sämmtlich e r l ö n t e n , sobald eines davon angeschlagen wurde. Schon das Griechische Sprichwort verglich
eine plauderhafte Zunge mit
dem Becken von
Do-
dona. Iacobs ad Anthol. G r . III. 2. p . 358. f., wo ein F r a g ment des Menander mit dieser Stelle verglichen wird.
tin-
tinnabula : wie Plautus Poenul. Prolog. 32. Matronae
tacitae
spectent, tacitae rideant, Canora hic voce sua tinnire temperent.
S A T I R E VI, 430 — 444.
261
444. Die Stelle hat ihr Bedenkliches. Ruperti interpretirt hier wieder einmal was Feines zusammen. D e r Dichter, sagt er, geräth liier alhnählig ins Ernsthafte. D e r Weise setzt auch pulcris honestisque rebus Maass und Ziel. Frauenzimmer müssen also so gut wie Manner ihren Geist tluich Leetüre guter Bücher und durch schöne Künste zu bilden suchen: aber sich ganz auf Philosophie, Rhetorik, Grammatik zu legen, geziemt n u r den Männern, und will eine F r a u solche Männersachen treiben , so muss sie auch Hosen anziehen , und ganz aufhören eine F r a u zu sein. Dicss soll der Sinn des Juvenal sein; nicht nur iin höchsten Grade schaal, sondern aus den W o r t e n gar nicht herauszubringen. Eben so lortin, Tracts II. 243. Beide thun, als wäre bei der Stelle gar weiter nichts vorgefallen: es gibt aber eine Menge verschiedener Erklärungsarten von Calderinus an. Der Franzos verhält sich dabei sehr schlau; er übergeht die Stelle mit vornehmem Stillschweigen. Die Sentenz 444. gibt keinen klaren Verstand, man mag sie drehen, wie man will. Der Sprachgebrauch, von dem immer zuerst die Rede sein muss, ist: imponere finem pugnae, labori, vitae, also finire : was lieisst nun res honestas finire? Der Horazische Satz: Est modus in rebus, sunt certi denique fines, ist hier nachgeahmt, aber ungeschickt, u n d , mit einem W o r t e , der Vers ist un"acht, eine von den vielen Mönchssentenzen, die dem Text des Dichters angeflickt worden sind. Die drei nächstfolgenden Verse, 445 — 4 7 . , sind versetzt; ein Zufall, der uns so viele Stellen in den Alten verdorben hat; ich setze sie unten nach V. 456. So folgen unmittelbar auf einander : Vna ö laboranti — Lunae. Non habeat mnlrona — recumbit, etc. Nach dieser veränderten Versfolge wird nun der Sinn und Zusammenhang der Stelle vollkommen klar: „Am unausstehlichsten ist die, welche die Gelehrte spielt, über Virgil und Homer abspricht etc. Deiue Ehefrau, mein Bester, muss keine Gelehrte sein wollen. Mir ist eine Jede verhasst, die tiefe Kenntnisse aft'ectirt, immer Kunstregeln im Munde führt, uud
262
ERKLAERUNG.
keinen Sprachfehler der Freundin, und selbst dem Mann nicht, ungerügt hingehen lässt. Eine solche müsste lieber gleich H o sen anziehen ; denn sie hört auf W e i b
zu sein , sobald sie
die Gelehrte spielt". So haben die versetzten drei Verse mit die
Nam
richtigste Causalbeziehung
auf odi hanc ego etc.
„Eine solche ist mir ganz zuwider: denn sie verleugnet ihre ganze Weiblichkeit".
tunicas succingere,
der Frauen Tracht vestis talaris, stola.
Männertracht: denn
Silvano:
diesem wird nur von Männern geopfert; einer der Feld- und Waldgötter,
die ihres verliebten Temperaments wegen übel
berüchtigt sind, und denen die Weiber deshalb keine Opfer bringen dürfen. Voss Virg, Idyll, p. 511. f. lavari,
quadrante
gegen Bezahlung in öffentlichen Bädern. Nam
mulie-
res neque ad tonsores, neque ad balneas publicas eitnt, Schol. in edit. ¡VIediolan. Diese richtige Erklärung der Verse, vom Schol. vet. angedeutet,
ist weiter ausgeführt von Ferrarius
ap. Hennin. p.919. Aber er irrt bei der Inschrift: S I L V A N O AVG., die hierher gar nicht gehört; doch schreibt Achaintre ihm treulich nach.
Man
muss lesen A V G V S T O .
Auguslus, i. e. Augustalis, wie Apollo gusta, Hercides Paternianus.
Augu stas, Thenns Att-
Vgl. Index Gruter., d'Orville's
vortreffliche-Anmk. ad Charit, p. 405. einer Steinschrift, Mercurio
Silvaniis
Mercurio
Aug.
auf
Magasin Encycloped. 1806. T . I. p. 343.
Augusto auf einem Sicilischeu Steine, den Munter
in Kopenhagen besitzt. 450.
in der Rhetorik, ein kräftiger, kurz
enthymema
ausgesprochener Gedanke. Das Dialectische gehört nicht hieher.
Viel Lehrreiches
darüber Ernesti Lex. rhetor. Graec.
s. v. Add. Isocrat. Panathen. init. , wo das ev&i'¡/zi]f.ia v o r kommt als eine novatöv.
twv
iötwv
rwv sv r a t j
(trjTOQttait;
Lex. rhet. Lat. p. 149.
Die Metapher des Satzes ist vom
Wurfspiess hergenommen: daher das Verbum torquere, lari, und sermone rotato. latär.
¿iuXu/li-
curtum ist richtig, nicht curvum. V g l . Ernesti iacu-
V I I , 193.. orator maximits et iacu-
'Schon Muretus V . L. V I I I , 21. hat die ganz ähnliche
S A T I R E VI,
444—462.
263
Stelle des Plato verglichen vom Lacedämonier, der in kräftigen Sentenzen spricht: svißa'ks Qtjfiu et'§iov Xoyov ßgu/v xui aweargaf-iftevor maneg deivog dy.ovTiaT)jg, Protagor. p. 342. E. ß g a y y ist curtum enthymema. historias, VII, 231., nicht W e l t - und Völkergeschichte, sondern ein Theil des studii grammatici, die Particularien vorzüglich aus der Mythologie, wie sie hei den alten Dichtern vorkommen, und in den commentariis graminaticorum gesammelt w u r den. Quintil. 1 , 9 , 18. mit Spaldings sehr guter Anmerkung. Es sind solche narratiuneulae , wie vrir sie in den Scholien zum Homer u. s. w. noch häufig finden , dergleichen viele auch, auf Veranlassung der l y r i j o t i g , von den AVTixotg fingirt wurden. 452. repetit volvitque, von öfterer Lectiire. Palaentonis artem, grammaticain, VII, 215., nach dem Scholiasten der Lehrer des Quintilian. antiquaria, eine Anhängeriii und Kennerin altrömischer Literatur. Dial. de corr. Eloq. c. 21. und 42. Vet. Onomast. : Antiquarius, (fi'KuQxuiog, nec viris, ne viris quidern. opicae, barbare loquentis. Zu III, 207. 457. Die reiche Frau. virides gemmas, smaragdos : denn diess ist der Name aller grünen Edelsteine und Halbedelsteine. Bottig. Sabina II. 153. 460. Intolerabilius nihil est. Eine ähnliche Sentenz bei Menander in Plocio, Fragmm. Cler. p. 152. v. 12. Mir scheint indess der ganze Vers unächt zu sein. 462. pane, Schönheitsmittel, II, 107. Poppaeana, eine Erfindung der berüchtigten Poppaea Sahina, einer von den Frauen des Nero, pinguia und das Verbum spirat, auch das trennende aut, zeigt deutlich, dass es elwas anderes war, als der vorerwähnte panis, allem Ansehn nach eine Hautsalbe. BriUanicus bemerkte schon den Unterschied; von Böttiger wird aber beides wieder miteinander vermengt, Sabina I , 39. Nach Dio Cass. LXII, 28. hielt sie beständig 500. melkende Eselinnen , uud badete sich täglich in Eselsinilch.
264
ERKLAERUNG.
Reimnrns sagt sehr wunderlich „eiusmodi fucuin" nenne Jn^ venal piugitia Poppaeana: vornfücus ist heimDio gar keine Rede, sondern bloss vom Bade. hinc miseri etc., sehr komisch : der arme Mann beleimt sich das Maul beim ehelichen Kuss. 464. Handschriften: veniunt Iota cute, oder Iota veniunt cute. Man zieht veniet v o r , der übrigen Singulare wegen. Gerade der Pluralis bringt in eine solche Sprache Abwechselung, und ist besser. Etwas f r ü h e r hatten wir den nämli. eben Fall. moechis. Bloss f ü r den Liebhaher macht sie die Toilette. Joliata, unguenta, der kostbarsten Art. Die Zubereitung kennt man ausPlinius. Bernard ad Theophan. Nonn. T . I. p. 181. Die Verse hier 464 — 466. unterbrechen den Zusammenhang; man will sie deshalb versetzen, Gonsal. in Petron. T. II. p. 121. ans Ende nach 473., Ruperti nach 470.. Die Manier Juvenals erlaubt hier keine Aenderung: die drei Verse machen eine Art Parenthese, einen Juvenalischen Zwischensatz. 470. R u p e r t i : , , I d fecit P o p p a e a , in exilium missa". So sagen auch frühere Ausleger. Es ist aber nichts als eine Posse, wieder einmal aus grobem Missverstaqd des satirischen Ausdrucks entstanden: nirgends wird gesogt, dass Poppiia jemals exilirt worden sei. In ihrer zweiten Schwangerschaft starb sie an den Folgen einer Misshandlung von ihrem Gemahl, der die That durch Erbauung eines Tempels, zu ihr e r E h r e , wieder gut zu machen suchte. Plinius H. N. XI. S. 96., d e r , wie D i o , von ihren vielen Eselinnen spricht, s a g t : Poppaea — quingentas (asinas) secum per omnia trahens Joetas ; sie nahm die Eselinnen überall mit h i n , d. b. nach den Garten, auf die Villen, auch wohl auf eine Reise, So hielt sie z. B. ihr erstes Wochenbett in Antium , Tacit. Ann. X V , 23. Dieser Umstand ist satirisch hyperbolisirt: „Sie schleppt die Eselinnen überall mit sich h i n , und wenn sie meinetwegen zu den Hyperboreern ins Exil müsste". si ist f ü r eliamsi, wie « nicht selten für y.ai iL III, 127.
S A T I R E VI, 462 — 483.
265
474. Est pretium cufae statt des gewöhnlichen opcrae prelium, was viele Handschriften im Texte haben, das Glosscin. Hier wissen die Ausleger nicht, dass jenes auch Plinius gebraucht, Epp. VIII, 6, 2. Poslea mihi visum est pretium curae, und beim Plinius wissen die Editoren wieder nicht, dass auch Juvenal so sagt. Deswegen hält der gelehrte Schafer diesen Ausdruck für ein ana% Afyv/.ievov, und will, was auch dort als Variante gefunden wird, operae pretium, vorziehen. Die Lexica von Gesner und Forcellini v. Pretium geben freilich nur das einzige Exempel aus dem Plinius. Jerulae, virgae. flagellum und scutica, Peitschen verschiedener A r t , dieses von OXVTO; , lorum ; das ßagellum h ä r t e r , mit Stacheln. Hör. Serm. I, 3. Ne scutica dignum horribili sectere fagello. 481. Höchster Grad von Grausamkeit, bei kaltem Blute. laluni auritm, breite Goldstreifen, segmenta aus geschlagenem Goldblech, laminis. Ein Kleid mit diesen Streifen wäre vestis picta. So müsste man die W o r t e nehmen, wenn Bottiger Recht hätte, Sab. II. 1 1 7 . , dass die Goldstickerei lind Weberei, wie wir sie haben , den Alten unbekannt gewesen sei. Die Goldstickerei und Weberei hat aber sicher existirt, eine kleinasiatische Erfindung, Phrygioniae vestes Plin. H. N. VIII. s. 74. Bei Ovid. Met. V I . webt ja auch Arachne mit Goldfäden, v. 68. Phrvgiones sind die Goldsticker, brodeurs. Salmas, in H. Aug. p. 510. B. Die instita am Frauengewande, der stola, ist gestickt; daher das Ganze vestis picta ; die Brodüre ist von reicher Breite, latum aurum, 483. transversa diurni hat auch die Husumer Handschrift mit der Glosse; „rationes scriptas ex contraverso", was sonst ex adverso ; daher adversaria. Vgl. Savaro ad Sidon. p. 150. Damit stimmt das scholium ad h. 1., aber keineswegs der Sprachgebrauch. Suet. Caes. c. 56. Jul. Cäsar schrieb seine Briefe an den Senat in paginis et forma memorialis libelli, die früher transversa charta geschrieben wurden ; in Patentform, wie Ernesti richtig erklärt. Eine andere Lesart ist
266
ERKLAERUNG.
transacta; und man nimmt transacta diurni etwa für acta diurna. Aber wer sagt transacta für acta? und was ist das für ein Genitiv, diurni ? diurnum, diurna, acta diurna, wird gesagt: aber acta diurni wäre wie acta libri, und ist schwerlich Lateinisch. 4 8 6 . Sicula aula, Sprachkürze statt praefectura Siculae aulae. Zu 111,91. und LV, 71. Imperium domus non est mitius quam imperium in aula Sicula, i. e. t'yrannorum Siciliae.in aula sua. Ruperti schlecht. constituit, sie will einem Liebhaber ein Rendezvous geben; I I I , 12". horti, immer im pluralis, auch in den Römischen Gesetzbüchern, wo wir nur von einem Garten sprechen: denn der Römische Garten besteht aus einer Menge Abtheilungen, horti, /OQTOI, eingezäunte Räume oder Plätze für verschiedene Zwecke, pomaria', rosaria, topiaria, platanones, daphnones, viridaria, ornithones, vivaria u. s. f. Christ im Villaticus Excurs. VII. und Böttigers Aufsätze üb. d. Gartenkunst im N. T. Merkur. 489. Der Dienst der Aegyptischen Isis war eines von den sacris peregrinis, die in Rom vielfaltig Eingang fanden. Die Einführung geschah unter Sulla; zwei Tempel, auf dem campus Martius und auf dem mons Aventinus. Der cultus erfordert Nachtwachen, pervigilia, und da hatte das Römische Frauenzimmer den bequemsten Vorwand, ganze Nächte ausser dem Hause zuzubringen. Nach dem Isistempel wurden die Liebhaber bestellt. Die sacraria versteht man von der Priesterin, wie in derselben Verbindung sacerdotum tabernacula Tertull. Apolog. p. 15. B. Isis - Priesterinnen lassen sich aber nicht beweisen, nur Tempeldienerinnen, ßöttiger Arcliaeol. d. Malerei p. 39. Also ist die lena lsidis eine Tempeldienerin, die die Kuplerin macht. Vgl. auch Sabina I, 232. f. nuda humeros haben viele Handschriften, humero weis't auf die richtige Lesart nudo humero> Psecas, ornatrix: die Arme wird während der Arbeit von der Furie schvecklicli gemlsshandelt; sie zerreisst ihr die Haare, und die Kleider am Leibe. Die Franzosen beziehen diess Alles „ a d
S A T I R E VI, 4 8 3 — 5 0 4 .
267
feStinationem"; s. Achaintre. Aber, was vorausgeht, laceratis capillis, bestimmt den Sinn deutlich genug auf besagte Weise. 493. ßexi altius, aus dem Context. In diesem Gemälde •w eiblicher Wuth gegen arme Sclavinnen ist nichts übertrieben. S. Martial. 11,66. nasus: sie sah im Spiegel ihr eigenes hässtiches Gesicht, und ärgert sich darüber; den A erger muss die Kammerjungfer entgelten. Ein Zug nach dem Leben! 497. Zwei arbeiten an der Frisur; eine dritte stellt dabei und muslert; noch einige jüngere müssen mit stimmen; ein ordentliches Conseil! matrona, „ ancilla vetula" die Ausleger. Man könnte sagen, das "Wort sei uneigentlich gebraucht. Matronalis habitus, vullus, gravitas, lässt sich ohne Zweifel auch von einer Sclavin sagen: denn es geht bloss auf eine Aehnlichkeit mit der Matrone; matrona aber so von einer Sclavin gesagt, wäre eine, gar zu starke Akyrologie, und ohne Beispiel. Denn nur die ingenua und materfamilias ist matrona. Die Variante beim Scholiasten, in mehreren Handschriften, auch' einer Kopenhagener, materna, sc. puella, verdient unter solchen Umständen den Vorzug, materna, quae matris fuit; das ist also schon eine betagte, und in Huhcstand gesetzte, admola lanis, ad lanificium. cessat emerita acu, sie hat mit dem Frisirgeschäft selbst nichts mehr zu thun. actis, crinalis. Martial. 11,66,2. 502. Persiflage der abenteuerlichen Haarmoden in jenen Raiserzeiten: ein ordentliches Haargebäude in mehreren F.tagen mit ganzen Reiben von Locken. Diess nannte man comam struere. Salmas, in Tertull, Pall. p. 246. Böttig. Beilage, Sab. I. 153. Vergl, Achaint. Anmerk. 504. Cedo, si etc. XIII, 210. cedo, si conala peregit? Seneca de Clement. I, 9. Cedo, si spes tuas solus impedio. Diess cedo hat die erste Sylbe kurz, wie auch PersiusII. in fi., das Zeitwort cedo sie lang. Bei den Komikern ist dieses cedo sein gewöhnlich, zusammengezogen aus cedito, wie das plu-
ERKLAERUNG.
268 r a l c cette aus cedite.
G a n z das Griechische ex itjg oiv.iuq i'äoi, von
einem Castraten.
Dasselbe gilt von Lahmen, Cinaden, v o r -
züglich von Affen; dessen Anblick des Morgens war von der schlimmsten Vorbedeutung.
Die Hauptstellen Lucian. Pseu-
dologist. 17. T . III. p. 175. und Amor. 39. T . II. p. 440. „Sieht man die Weiber des Morgens,
bevor sie ihre Toilette ge-
macht h a b e n s o könnte man sie für jene hasslichen Restien halten, deren Anblick Morgens früh von der übelsten V o r bedeutung ist".
Die Stelle ist im Texte nicht
muss dvofiaa&qvai, strichen werden.
richtig;
es
als ein falsches Glossem, geradezu ausgeWas man früh nicht sehen darf, ist v o r -
zugsweise der Affe; hiernach erklärt sich der Sinn des Dichters dahin : Du würdest einen Erben bekommen mit einem Mohrengesichte, der einen wahren Affen vorstellen kann. 602.
Treibt sie keinen Ehebruch : so betrügt sie dich
mit untergeschobenen Rindern.
gaiidia,
die Vaterfreude
wird oftmals getauscht ad spurcos lacus. Rupert! weiss iliesa
S A T I R E VI,
592—606.
283
nicht zu erklären. Es ist so viel als ad portas; an den Thoren waren Canäle, locus. Terent. Ailelph. I V , 2 , 44. prinsqnani ad portam venias, apud ipsum lacnm est pistrilla. Das. Donatus aus dem Varro. Parrhas.Epistt. p. 47. Pon. tifices Salios sagt Niemand, und es ist eine falsche Verbindung. Zu trennen: Pontifices, Salios, mit supplirtem et. Dasselbe hat auch Ileinecke bemerkt, p. 38. Die Stelle scheint auf einen wirklichen Fall anzuspielen. 605—609. Vortrefiliehc Verse; ein schönes Bild meisterhaft durchgeführt. Die Stelle ist aber durch einen alten Fehler leider verunstaltet, den die Kritik erst entdecken, und dann verbessern muss. Ruperti ist angestossen, aber weiter nichts. Die Hede ist von ausgesetzten Kindern, derer das Glück sich annimmt, die Fortuna die Mutterstelle vertritt ; forlunae /¡Iii, Horat. Serm. II, 6, 49. naiiieg zv/tjg. Mitimproba, die gehin Fortuna als xovfjozgörpog, nuiöoTftöffot;, waltige , unmässig in ihrem Einfluss, nimia, immodica; ein sehr viel umfassendes, sinnvolles W o r t , hier in der Beziehung, dass sie an Kindern von niedrigem Stande zu viel thut. stat, adstat fautrix. Die Scene ist nachtlieh, ein Gegenstand zum Malen. Jovere, das verbum proprium von zärtlicher Pflege der M u t t e r , der Amme. Publius Syrus in mimo : Fortuna nimium quos Jovet, stullos facit. omnes ist sehr matt gesagt an sich, d. b. ohne alle Kraft für das schöne Ganze, daher ganz zwecklos. Es ist aber auch nicht w a h r : denn unmöglich kann gesagt werden , dass alle ausgesetzten Kinder zu hohem Glücke gelangen. Von einem Dichter, wie Juvenal, kann man nicht glauben, dass er etwas so Zweckloses, etwas so Unwahres gesagt h a b e n , eines seiner schönsten Gemälde selbst so verunstaltet haben könne. Folglich kann das W o r t nicht von ihm herrühren , es muss für verdorben gehalten werden. Hierzu k o m m t : das so allein stehende Jovet ist für die Poesie der Stelle nicht befriedigend, es ist zu kahl, und es stört ferner die Harmonie des Ausdrucks; denn es folgt sinu; es fehlt also etwas diesem Entsprechendes im erstem
284
ERKLAEftUNG.
Satze. Die Corruptel selbst ist durch dicss Alles hinlänglich erwiesen. Die einzig richtige Emendation liegt aber aucli ganz nahe. Ich lese mit völliger Gewissheit: lios Jovet uhiis. In den ältesten Handschriften w a r das W o r t , nach alter W e i s e , mit dem o geschrieben, olnis: diess las man falsch omnis, und daraus ist onmes geworden. So haben wir die Glücksgöttin vollkommen, wie auf einem alten Denkmal: Fortuna puerum siistinens iilnis. Eine ganze Reihe von Dichterstcllen kann ich nachweisen, von Homer an bis auf die spätem L a t e i n e r , die den Ausdruck bestätigen. Aber die Richtigkeit und Schönheit des Ausdrucks ist auch schon so einleuchtend. 608. se ingerit, dringt sich auf. Plin. Pan. 8 6 , 2. praefectum praetorio non ex ingerentibus, sed ex siibtrcilientibus legere. 610. , Mit Zaubereien gehen sie u m , die Männer n ä r risch zu machen. valeant ist unstreitig das Richtige, naoh vielen Handschriften. vexare, perturbare. et solea etc., und kindisch zu machen, pulsare nates ist Kinderstrafe, und wird sprichwörtlich gebraucht von einer kindischen Behandlung. solea kommt hinzu, wenn die F r a u den Mann kindisch behandelt; von dem es daher auch sprichwörtlich in unsrer Sprache heisst: er steht unter dem PantoiFel. Bei andern Nationen ist das Sprichwort nicht,- die Griechen hatten es aber schon, beim Lucian an m. St. Die Attiker sagten ßkavTOvv. Hesych. in v. mit d. Anmerk. Verschiedene Variationen des Ausdrucks f ü r dieses Pantoffclregiuieut lassen sich sammeln aus der Griechischen Anthologie, aus Plautus, Terenz, Persius. Aber den Ursprung hat noch Niemand nachgewiesen ; aus den fabulis Satyricis , wo Omphale den Hercules mit dem Pantoffel t r a c t i r t e , eine lustige Vorstellung , wovon es auch alte Gemälde gab. Die Beweise: Lucian. D. D. XIII, 2. de Hist. conscrib. c. 10. Aehnliche Spasse werden auch die Römer in ihren Mimen nicht selten gesehen haben.
S A T I R E V I , ßOö — G36.
285
616. Milonia Caesonia, Frau des Caiigula, Dio Cnss. LTX,23. Das Gerücht, sie habe ihn durch einen Liebestrank toll gemacht, berührt auch Suet. Cal. c. 50. Nach V. 614. hat d-er Scholiast drei sonderbare Verse, die auch in einigen Handschriften stehen. Achaintre erklärt sie für Juvenalisch , und will sie in den Text rücken : der Mann weiss aber selbst nicht zu sagen, was die Verse heissen sollen. Ruperti erklärt sie geradezu für spurios. Wie können sie aber entstanden sein? Darüber Aufschluss zu geben, ist keine geringe kritische Aufgabe. Die Verse hingen ursprünglich gar nicht zusammen; es waren drei verschiedene Bruchstücke, an den Rand geschrieben. 1) Semper aquam portes etc. und 2) Semper istud onus etc. gehören zu V. 608. Iiis se ingerit, wobei ein Leser sich an das Sprichwort beim Plautus erinnerte, Pseud. 1 , 3 , 135. In pertiisum ingerimus dicta dolium. 3) Quo rabidus, oder vielmehr rabidum, ist eine Parallele zu 615., wer weiss, woher. Diese drei Bruchstücke wurden zusammengeleimt, an den Rand gesetzt, und endlich gar in den Text. 620. Minus ergo etc. Vergl. Reimar. ad Dion. LX, 35. 627. nemo repugnet, diess wäre noch verzeihlich. Aber auch privignum, die Stiefsöhne von der ersten uxor des Mannes zu morden, ist schon ordentlich in der Regel. Ja, die eigenen Kinder sind nach dem Tode des Vaters nicht sicher umgcbracht zu werden, wenn sie vom Vater Vermögen haben. In beiden Sätzen sind die Conjunctionen ausgelassen, wie gleich wieder 631. nam zu suppliren. adipata, „dulcia placcnta" Schol. Backwerk, wie wir sagen, von Butterteig. Man sagte adipatus panis, adipata puls, adipatuni opus. Cliaris. p. 74. livida, wegen der Wirkung auf die Haut, Jervent, wegen der Wirkung auf die Eingeweide. 635. scilicet gehört zum Hauptsatz Fingimus haec, und darnach muss sich die Interpunction richten, die richtig ist in der Zweibrücker. Terent. haec populus curat scilicet! carmen bacchari eine bemerkenswerthe Construction:
286
ERKLAERUNG.
bacchari als verbum neutrum erfordert eigentlich den Ablativ carmine. Evoe bacchari beim Catull. im Epitlial. ist Evoe clnmare bacchico more, und Carmen bacchari Carmen facere bacchico furore. ßax/ivtiv auch im Griechischen zuweilen transitive, aber in andrer Bedeutung , in furorem compellere. Von derselben Art ist oben ululare Priapuni. 638. Pontia, Mörderin ihrer eigenen Kinder, Marlial. II, 34. „Dryinionis uxor" sagen die Ausleger, was auf einen Zusatz zum Scholiasten sich gründet bei Ge. Valla. S. Pithoe. ad Sehol. h. 1. Die Scholien, wie Pithoeus sie edirt h a t , wissen davon nichts; sie heisst da P. Petronii filia. Eine Inscription auf sie, schon von Pithoeus angeführt, steht beim Gruter p. 921, 6. T. Pontii filia. Ich zweifle aber, ob diese Inscription wirklich acht ist; sie kann aus dieser Stelle des Juvcnal gemacht sein. 639. confiltor etc. Diesen Vers will Ruperti für unächt halten. Es ist zusammenzunehmen confiteor, quae depr. patent-. „Ich bekenne laut, was doch einmal entdeckt ist". puerisque — paravi ist Zwischensatz zur nähern Bestimmung, wobei das que zu bemerken , worüber Görenz zum Cicero. gute Bemerkungen gemacht hat. tarnen ist aber unpassend, auch wenn es für quidem genommen'wird. Die Conjectur von Jacobs ad'Anthol. Gr. III. 2. p. 8. calidum ist eben so unpassend. Das Wahre ist: Jacinus tan tum. Die Verwechselung war sehr leicht, da beide Wörter in den Handschriften mit ganz 'ahnlicher Abkürzung geschrieben werden, tm, tTi. Auch haben die Kritiker die Verwechselung beider W ö r t e r an vielen antlern Stellen bemerkt. Vergl. Drakenb. ad Liv. I, 29. Cort. ad Plin. p. 63. Weiter unten scelus intens. Der Satz enthält nun den stärksten Ausdruck verzweiflungsvoller Reue. 641. Tune etc., necasti ist ausgelassen, sehr trefflich für den leidenschaftlichen Ausdruck. 1, 89. Septem etc. ist keine Antwort der Kindermörderin, sondern die eigene Betrachtung des Dichters, die aus dem empörten Gefühl her-
S A T I R E . V I , Ö 3 6 - 6G0.
287
vorspringt. .et illae, ac sane illae. Vorher Progne, scheint Jiir tlie Zeit des Dichters die richtige Schrcihart; c in g. 649. Schöne Poesie der Sprache. Ein Fels stürzt vom hohen Berge ins T h a l ; latus montis, die Breite des Berges iveicht glcichsam z u r ü c k , und trennt sich vom schwankenden Gipfel. 651. computat, lucmm cogitat. Seneca Epistt. 14. Plu~ res computant, quam oderunt. De Benef. V , 17. Quotusquisque uxnris optimae mortem timet, ut nort et computet? 656. mane wollte Ruperti emendiren ; Heinecke sucht ihn zurechtzuweisen, p. 90. Der Sinn i s t : Jedes S t a d l q u a r tier hat seine Clytämnestra, die, wenn's darauf ankommt, hei nüchternem Muthe ihren Mann umbringt. Eine besondere Bedeutung von mane ist das weiter nicht, sondern bloss eine eigene Beziehung oder Anwendung der gewöhnlichen Bedeutung, die der Gedanke mit sich bringt. „Frühmorgens, ehe sie besoffen sind", liegt auch nicht darin ; sondern bloss, dass ain Morgen überhaupt der Geist ungetrübt ist und r u higer überlegt. Heinecke's Beispiele aus Martial passen nicht zum Besten. Mane wird aber durchaus bloss zur Clytämnestra gezogen, und Niemand nimmt Anstoss. Die Beliden und Eriphvlen geht aber die Sache eben so gut an. Mane mit dem Vorigen zusammengenommen kann dann viel eher auch beim Folgende» gedacht werden. Daher inuss, meiner MeiEriphylae nung nach, interpungirt werden: Belidcs atque JMane ; Clytaemnestram etc. „Schon am frühen Morgen kann man Beliden und Eriphylen genug finden, und seine" Clytiimnestra hat ein jedes Viertel der Stadt". Mane hat ganz dieselbe Stellung zu Anfang des Verses bei Horat. S. I, 3, 18. 659. tenui, mit unmerklichem Gifte. rubeta, die grösste K r ö t e , mit einem tödtenden Gifte, 1 , 7 0 . pulmone. Es s c h e i n t , man hat es vorzüglich" in der Lunge gesucht. 660. sed tarnen. Aber auch das Mordeisen verschmähen sie nicht, wenn's mit dem Vergiften nicht gelingen will,
288
ERKLAERÜNG.
und etwa der Mann, wie weiland Mithridat, sich durch Gegenmittel zu verwahren weiss. Mithridat eriand ein b e r ü h m tes Alexipharmacon ; X I V , 2 5 2 . Lucullus und Pompejus. die Lesarten praeguslabit in der Husumer.
Die Handschriften und praegustaret;
Autoritativ
zudenken
kann.
Aber
theilen sich in
letztere
lässt sich mithin
diese , noch f ü r jene entscheiden; tisch , da ich iin Vordersatz
vom Sulla,
ter victus,
auch für
eben so wenig gramma-
so gut
stärker,
ist
weder
agerent als agent h i n -
mithin mehr
Juvenalisch,
wird der Ausdruck, wenn man das F u t u r u m behält, welches offenbar gewählter ist, und vom gewöhnlichem Imperfectum leichter verdrängt werden k o n n t e , als umgekehrt. turum steht genau so im Griechischen: äXXa xai
Das F u aiätjQW
av
npugaisv, i i TtQOyevatiaif in welcher Construction sich Viele irren, wenn sie den Optativ für das F u t u r u m setzen wollen, gerade wie hier praegustaret.
Das F u t u r u m
bei den ächten A t t i k e r n , Aristophanes, moslhenes.
ist sehr häufig
Lysias, P l a t o , D e -
Brunck zu Aristoph. Eccles. 1G2.
Heindorf
zu
Plat. Phaed. p . 218. Zu X I V , 134.
SIEBENTE 1. stiidia
SATIRE.
schon nach dem neuern Sprachgebrauch, ohne
Beisatz, für studia artium liheralium, wie wir Studien
sagen;
eben so studere, studiosi und noch später studentes, Anfangs am häufigsten vom Studium der Redekunst, dann allgemein. Diese Latinität des silbernen Zeitalters herrscht beim Plinius, Quintilian und im Dialog, de O r a t o r i b . 3.
respexit,
das Griechische P r a e t e r i t u m , eifectus m a - ,
nens actionis p r a e t e r i t a e : e r hat den Blick geworfen , blickt also auf die Musen, respicit.
balneolum,
meritorium.
S A T I R E VII, 1 t - 1 2 .
289
Jimios, eine Bäckerei. Clio, Muse überhaupt.; als xltim , celebratrix, steht ihr auch die Poesie zu, zumal die epische. in Atria, Licinia, Cicero p. Quinct. c. 3. und 6., auctionaria, id. Agrar. 1,3., ein Local für öffentliche Auctionen. Gesner im Thes. und Ruperti falsch von der Anticliambre. Als eigener Name eines Gebäudes besser Atria, wie Facciolati auch in deu Ciceronischen Stellen. Muratori Thes. Inscrr. p. 482, 3. 8. Pieria — in umbra ist dgs Richtige; 59. sub antro Pierio. Dass die Musen und ihre Priester einsame Oerter, Wälder, Haine, Grotten, zu ihrem Aufenthalt wählen, ist ein Bild ihrer glücklichen Selbstgenügsamkeit und Abgezogenheit von dem Geräusche der Alltagswelt. Die Lesart arca entstand dem qitadrans zu Gefallen, für den man einen Kasten haben wollte. 9. ames, acquiescas, cöntentus sis. Horat. A. P. 234. Non ego inornata el dominanlia nomina sohun—am abo, i . e . inornatis non ero cöntentus. Senec. Controv. 1. I. p. I I I . videat, an nuptias suas amet. Plin. Paneg. 31, 4. Nilus amtt alveum suum. Es ist das Griechische dyanäv i t . Machaerae, eines Auctionscommissarius, wie der Context nicht zweifeln lässt. Aber den Namen halte ich nicht für richtig. Einige Handschriften haben Macerae. Vielleicht Magiri-, Gruter Intl. Inscriptt. Diess' wurde erst Machiri geschrieben, und dann verschlimmbessert Machaerae. 11. trípodes. Dafür will Boissonade ad Herodiani Epimerismos (Londini 1819.) aus dein Codex Reg. 8071. ripides durchaus in den Text haben; es habe „plus satiricae venae". FlabeIJa, Fliegenwedel, Fächer, würden die Auction ins Lächerliche ziehen, was nicht beabsichtigt wird. Auch gebraucht kein Lateiner das Wort ripis; sie haben ihr eigenes Wort ßabellum. 12. Statt Alcyonem Bacchi muss Alcitkoen Pacci hergestellt werden, wobei Ruperti im Exc. ad h. v. hätte stehen bleiben sollen. Er tappt, seiner Art nach, überall herum, Vol. 11. 19
ERKLAERUNG.
290
und trifft das R e c l i t e ,
lässt es aber auch wieder
fahren.
Bacchi wurde corrümpirt wegen der Nachbarschaft von ben. Tliebae für Thebais. ger Litteratur; Paccius
The-
Es sind alles Trauerspiele damali-
und Fauslus,
kannter dramatischer Dichter.
Kamen sonst nicht be-
Paccius
X I I , 99., und einem
Paccius, der in Rom lebte, schickt Plutarch seinen commentarius Trip/ ev^v/uiag,
p. 4 6 4 . E . Wegen Alcithoe s. Verheyk.
ad Anton. Lih. 65. 14. "equites Asiani, tische Sclaven,
die neugebackenen Ritter, kleinasia-
in Rom
zu Rittern
gemacht.
Diess wurde
man durch den census; und dergleichen Leute, wenn sie einmal manumittirt w a r e n ,
fanden leicht Mittel reich zu w e r -
den. Der folgende Vers „doch auch Kappadocische und Rithyhische Ritter können das
thun"
ist ein sehr
seltsamer
Zusatz, als wenn Cappadocier und Bithynier nicht auch waren !
Asiani
Es hatte Einer gehört von dem schlechten Kappa-
docischen Gesindel, das besonders auch wegen falscher Zeugnisse
übel berüchtigt war (Schol.
ad Pcrs. V I , 7 7 . ) ,
und
wollte diese Notiz hier an den Mann bringen. Den Vers erkläre ich ohne Bedenken
für untergeschoben.
Auch ist zu
beachten, dass Bithyni hier die erste Sylbe kurz hat, während sie X , 162. lang ist. cia.
traducit,
altera
Gallia,
Gtdatia, Gallograe-
spectandum proponit. V I I I , 17.
X I , 31.
nudo talo, I, 111. 17. Ein Compliment für den Kaiser, von dem man sich für die Litteratur ein goldenes Zeitalter zu versprechen hat. etc. , der zum tönenden
quicunque
Saitenspiel beredte
Lieder dichtet.
eloquium,
rumque
der sich begeistert h a t , von Propheten
momordit,
des Apollo,
den Text zur Musik.
lau-
die Lorbeer kaueten, um in heilige Regeiste-,
rung versetzt zu werden, übertragen auf Dichter,
rnordere,
manducare. U e b e r das Lorbeerkaueu gibt alles Köthige R e i mar. ad Dion. p. 1221. §. 141. 23.
croceae
membrana
tabellae,
schwer zu
Casaub. ad Pers. 111,10. schreibt crocea—tabella,
erklären. Pergamen
S A T I R E VII,
12-40.
291
mît gelber Flüche, Aussenseite; membrana bicolor In der Stelle des Persius. Achaintre e r k l ä r t tabella ganz sinnreich vom E i n b a n d , t e g m c n , und also un livre relié en m a r o q u i n c i tron. Eine F o r m von Büchern mit Einband gab es a l l e r d i n g s ; aber hier kann vom gebundenen Buche nicht die R e d e sein. Es sind pugillares m e m b r a n a c e i gemeint, w o r a u f d e r B r o u i l lon, die K l a d d e , gemacht w i r d ; tabella, d e r äussere Deckel, intcgumentum, von Holz, dem gewöhnlichsten Material, crocea von der F a r b e des Holzes. W a l c h , de p u g i l l a r i b u s v e terum, Act. Societ. Lat. Ien. Vol. V . p . 154. sqq. Zweifelhaft bin Leb nur noch d a r ü b e r , ob d e r Genitiv in diesem Sinn nicht auch vertheidigt w e r d e n k a n n . I I I , 4 8 . corpus exlinctae dextrae.
25. Thelesitius, ein g e w ä h l t e r Name, oft a u c h beim tial. Aber durchaus Telesiruis, TeXtatvoç, w i e auch die schriften beweisen. S. Indic. G r u t e r . Reines. Epistt. a d p e r t . p. 493. Derselbe F e h l e r bei M a r t i a l . V I , 5 0 . II,
MarInRu49.
Thelesina.
29. venias, II, 8 3 . imagine macra, P o r t r ä t b ü s t e von v e r h u n g e r t e m Ansehn. Die W e r k e beliebter D i c h t e r kamen in die Palatinische B i b l i o t h e k , m i t d e r Büste des Verfassers; auch in andere Bibliotheken. 3 7 . Der Tempel der Musen w u r d e , w i e d e r T e m p e l des Palatinischen Apollo , zu Dichterrecitationen geöffnet. Bentley ad H o r a t . Epp. II, 2, 92. Auf den Ruhm, d e r d o r t zu ärndten w a r , Verzicht zu l e i s t e n , ist eine grosse Aufopferung. 39. at, si, w i e Achaintre aus Handschriften , ist w i d e r den S i n n . „ E r ist so artig, dich mit selbstgemachten Versen zu regaliren, und erlaubt d i r ein altes Haus zu e i n e r V o r l e s u n g " . 40. Maculonis, Maculonus sind v e r d o r b e n e L e s a r t e n . D e r Dichter schrieb maculosas. D a r ü b e r habe ich u m ständlichen Beweis geführt im P r o g r a m m von 1 8 0 6 . Es sind aedes sordidae, ein altes schmutziges Haus, maculosus ist a l l gemein gebräuchlich bei den S c r i p t o r e s a r g e n t e a e aetatis.
292
ERKLAERÜNG.
longe, diu, wie longius und longissime auch gebraucht werden. Ein alter Bumpelkasten von einem Hause, längst fest verrammelt, wie ein Burgthor. Seit undenklichen Zeiten wohnt Niemand darin. 43. 44. Das Applaudiren und Bravorufen besorgt er auch. Was aber Aufwand verursacht, fallt dem armen Dichter zur Last.' conducto tigillo, i. e. conducta ; die anabathra sind von Holz, Bogen, wie im Thealer. subsellia, die Parterresitze. Yor diesen die orcheslra, das Parterre-Noble, für die vornehmen Zuhörer, (cum) calhedris, reportcuidisy die am Ende wieder weggetragen werden müssen. Alles kostet Geld. Mit diesen Anstalten vgl. die Stelle Dial. de Ora» torib. c. 9. 55. communi etc., der nicht ein alltägliches Gedicht mit gewöhnlichem Stempel ausprägt. Jerire Carmen bestätigt die Lesart im Horaz, A, P. 59. Signatuni praesenie nota procudere nomen, nicht nummum, die Lesart Bentley's. communis moneta , publica inoncta. Quintilian. 1 , 6 , 3 . mit Spaldings Anm. 70. deesset — caderent, defuissct — cecidissent. Auch schon Cicero: Heusinger ad Offic. p. 710. not. I. „Die Schlangen seiner Furie würden bald alle herabgefallen sein". Beim Virgil zeigt sich Alekto auf einmal dem Turnus in ihrer wahren Gestalt als Furie: tot Erinnys sibilat hydris , — et gemitios erexit crinibus anguis, Aen. MI, 447. surda, obmutescens; surdus und caecus bei Dichtern auch in der passiven Bedeutung. Poscimus , und doch verlangen wir, ein heutiger Dichter soll Grosses leisten, während e r , um über seiner Arbeit nicht zu verhungern, Bock und West^. im Lombard versetzen muss. alveolos, V, 88. pignerare, pignori dare. ,, Rubrenus dum tragoediam de Atreo scribit, cogitur ob paupertatem laenam pignori dare", Forcelli ni. 74. Numitor, VIII, 93. infelix, ironisch: der arme Kumitor; a r m , wpnn er für Freunde etwas thun soll. Der
S A T I R E VIT, 4 1 — 86.
293
Scholiast in einem andern Sinn : „animo, non faciiltatibus". Quintillae ohne c , die übliche Schreibart des Zeitalters, wie Quintiiianus. Quinctillae nur in einer Handschrift. Spalding Praefat.-ad QuintiJ. T . I . p. XXIII. sqq. leoneni für die Menagerie, vivarium. 79. M. Atinaeus Lucanus, der Dichter der PharsaJia, war berühmt und reich zugleich, Tacit. Ann. XVI, 17. horti marmorei, worin viel Marmor verwandt ist. ,,Ein Lucan mag sich wohl mit dem blossen Ruhm begnügen: was aber hilft auch der grösste Ruhm armen Dichtern, wenn es weiter nichts als Ruhm ist". Serranus oder Sarranus, die Form ist zweifelhaft. Sarrhano Cod. Husum. Saleius, ein bekannter Dichtername. Manche Handschriften, auch die Husumer, machen aus dem Dichter ein Salzfass, salino. Zur Unzeit dachte man an Horat. Od. II, 16, 14: Splendet in mensa tenui salinum. 82. Ein sehr merkwürdiges Zeugniss über den gleichzeitigen Dichter Slatius , den wir jetzt noch lesen , und die grosse Sensation, die besonders seine Thehais machte. W a h rend er mit der Ausarbeitung dieses Gedichtes beschäfftigt w a r , fiel er beim agon Capitolinus mit einem Lobgedicht auf den Juppiter durch, worüber er sich in einer oft inissverstandenen Stelle in den Silvis entschuldigt, die durch Oudendorp ad Sueton. Dom. c. 4. p. 904. erst recht ins Licht gesetzt ist. Durch die Tbebais wurde nachher dieser Unfall völlig wieder vergütet. 86. Jregit subsellia versu erklärt zuerst Casaub. ad Sueton. Dom. e. 4. vom schmetternden Beifallklatschen ; sonst rumpere : I, 13. assiduo ruptae lectore columnae. Diese Erklärung hat man neulich wieder zweifelhaft machen wollen, durch den Einwand, Jra,n%ere werde in der Sprache nicht so gebraucht; es soll also heissen: er brach die Bänke entzwei mit seinen Versen, weil gar zu viel Leute drauf sassen. Etwas Aehnliches hat man Sueton. Claud. c. 41., wo mitten in der Recitalion ein dicker Kerl mit ein paar Sitzen ein-
294
ERKLAERUNG.
bricht. Diess ist aber wider den Sinn der hiesigen Stelle : denn von vollgepropften ßiinken ist hier nicht bloss die Rede, sondern vom Beifall des vollen Auditoriums. Die erstereErklärung ist daher offenbar mehr sinngemäss, dann aber auch gewiss nicht wider die Sprache. Man erinnere sich nur an Jragor, welches in dieser Sache sogar das ganz, eigentliche W o r t ist ; fragor plaudentium et acclamantium, der bestandige Sprachgebrauch. S. ausser den Lexx., Schütting ad S.enec. Rhet. p. 161. und Graev. Lectt. Hcsiod. ad Sc. Herc. 2 0 3 . f r a c t u s sonus Virg. Ge. IV, 72. das Schmettern. Völlig entscheidend die Nachahmung Sidon. Apollin. V , 10. Ihme olim perorantem et rhetorica sediha plmtsibili oratione frangenteni. So auch concutere Quintil. I V , 2, 37. quatere Sidon. I X , 14. 8 7 . esurit, wird vom Statius selbst bestätigt im Epicedio in patrem: vilis honos studiis. Paris, der ¿weite unter Domitian. yigaue soll eine Tragödie sein. Was soll aber P a r i s , der Pantomimentänzer, mil Tragödieen? Als Unternehmer von Schau-pielcn ihn anzusehen, hat man nicht den geringsten Grund; die Unternehmung gehört für P r ä toren und Aedilen. Es ist also wohl eher der Entwurf, die Skizze zu einem' neuen Ballet, eine poetische Handlung, die pantomimisch dargestellt wird. So erwähnt Seneca Rhet. Suasor. p. 20. Bip einen gleichzeitigen Silo, qui pantomimis fabulas scripsit. Der Gegenstand ist tragisch, aus der Bacchusfabel. intacta, nagelneu (Benlley ad Hör. Epist. I I , 2, 8 0 . ) , von Dichtarten oder poetischen Gegenständen, die •vordem nicht bearbeitet waren. Die Spötterei auf den Statius selbst, die Henninius hier finden will, ist erzwungen. 88 — 92. Eine Parenthese, die dem Satiriker theuer zu stehen kam. Die drei letzten Verse waren schon längst unter Domitian auf jenen Paris gemacht, und wurden au dieser Stelle der neuen Satire einverleibt. Ein histrio am Hofe Hadrians, der jetzt eine ähnliche Rolle spielte, wie weiland sein allerer College am Hofe Domitians, bezog jetzt die Verse
S A T I R E
VII,
86—88.
295
a u f s i c h , u n d d e r D i c h t e r w u r d e m i t g u t e r M a n i e r ins E x i l
Ille
geschickt. t i g , o h n e et. jecturen
— auro.
D e r T e x t ist w i e d e r
Sehx-ader, R u p e r l i
emendiren
nicht,
und Jacobs mit
auch Ehrenstetten
U n t e r den Kaisern zu e r n e n n e n , den, Mit
und dem
und um Antn.
dann
bei
ein
wieder
halb J a h r
andern
Militärtribunal w a r
heutiges Tages Titel
auro
schon
kann
auf
selung, w i e X ,
284.:
is.
nicht
urbes,
sieh
w i e die V i t a
sehr
wohl
poelamr/ue
wo bezogen
auch
auf
bezogen
von Einem
eius
wo von
werden.
viele
wenigstens diess
nicht
mit
r u n g des L i p s i u s M i l i t . R o m .
ich Un-
Ruhnkenius
zu
eori'igiren
auf den S t a t i u s , II, 9 .
findet,
tröstet
paupertas.
verstanden
( P a r i d i s ) semestrilms
im T e x t e d e r V i t a s e l b s t
nen D i c h t c r ,
halte
l u v e n a l i s aus d e r h i e s i g e n S t e l l e a u c h
nen e r w ä h n t , Andere
ge-
überhaupt
„Betrübte Dichter
e r m i t T r i b u n s t e l l e n " . V o r h e r V . 6 0 . moesta
man
ange-
E s ist d i e n ä m l i c h e V e r w e c h -
sed multae
v o r t r e f f l i c h e m e n d i r t ist. an
wi-
eine
g e w o r d e n w ä r e n . D a s multis
lese m o est
v e r d o r b e n , und
tumentem;
so ist
Rupert!
semestrem,
vates
die
wie
offenbar
k o m m t e i n g a n z s c h i e f e r S i n n h e r a u s : dass
Dichtcr Tribunen
könnte
annu-
mililiae—seme-
und nicht die v o n
multis
sondern muss
moeslae
Gesners
aureum
u n d R a n g bei D i e n s t c n t l a s s e n e n :
meine Verbindung. aber
machten.
u n s t r e i t i g e b e n so f o r t d a u e r t e ,
Dicss ist das W a h r e ,
Viele,
stan-
verbunden,
IV, 4. mit
f ü h r t e C o n j e c t u r des R u b e n i u s , honorem
Dann
semeslres
Platz
equestris
d e r d i e S a c h e , u n d es m u s s g e l e s e n w e r d e n
stris.
Tän-
Dichter".
der Legion
Candidaten
dignitas
in u n s e r i n T e x t e semes/ri
die V e r b i n d u n g
„Der
trihunos
bei
d i e s e w a r es zu t h u u . P l i n . E p p .
Da aber der Rang
C011-
Heinecke
121.
Diesem Rang zufolge t r u g - d e r T r i b u n
lum.
ihren
d e r A r m e e an
w i n d e es g e w ö h n l i c h ,
die n u r
rich-
sondern corrumpiren.
p . 4 1 . W u n d c r l . a d H e y n . O h s s . in T i b . p zer vergibt
ganz
nur
militiis.
ist
Kamen
der Anfüh-
D i e s e also, d i e b l o s s E i -
u n d den S t a t i u s selbst, v e r s t a n d e n , Iahen
s i c h e r n i c h t in i h r e m T e x t e rnultis.
Ei-
mililiolis
dessen
nach
Diess werden,
Doch
auch
ist es f a l s c h , dass
296
ER K L A E R U N G .
nur ein Einziger gemeint sein sollte, wie V. 92. zeigt, wo von diesen Promotionen ganz deutlich in der Mehrzahl gesprochen wird. Praefeclos, alae erjuitum oder coliortis. Pelopea, Philomela, Rollen in Theaterhandlungen; in Tragödieen, sagen die Ausleger. Nach der obigen Meinung über Jtgaue, 8 7 . , waren auch diess Personen in Pantomimen, wozu die Dichter Skizzen entwerfen. Darnach auch 93. quem pulpila pascunl, „der für Tänzer schreibt". 98. Fester porro — serrptores nimmt man als ironischen Satz. Besser als Fragesatz: „Ist etwa —?" So 139. Fidimics eloquiol und 150. pagina surgit, ineipitur. So Ovid. Amor. 1 , 1 , 17. Cum bene surre xit venu nova pagina primo. pagina, folium chartae e papyro. operum lex, die Natur historischer v Arbeiten; opus für labor , also kein Beweis, dass man Lateinisch sagen könne, Horatii opera onmia; opus egregium scripsit. Nur opitsculum sagt Cicero vou einem Gedichte. 103. apertae, primum cultae cum labore. In dem
Ruperti tappt umher, und führt ausser
dicwUur.
seinen eigenen zwei Meinungen noch sieben von Andern an • 127.
„Bist du ein treuer V e r w a l t e r der dir anvertrau-
ten P r o v i n z ,
so gönnt
verdienst sie".
Jeder dir deine
cohors
und eine Hauptstelle V e r r . II. §. 27. ßog dxtgofxöftqg,
denn
du
Acersecomes,
Qioi-
Horn. II. v, 39., und bei Dichtern ganz g e -
wöhnlich Beiwort des Apollo , pend. ad Stepli.
Ahnen;
comitum : Cic. ad Qu. f r . 1, 1.
capillos intonsus. Scott. A p -
Hier Beiname eines pueri amati ; so
mius V I , 378.
trilninal
vendit , wie vendere
Bro-
mJJ'ragia,
X , 78. Eigentlich vom bestechlichen Richter; hier von einem Günstling des Richters. Der praeses der Provinz hat die Jurisdiction, durch
in coniuge. Viel EVhcl in den Provinzen wurde'
die Frauen
der Befehlshaber
angerichtet.
Zur Zeit
der Republik ging kein praeses in die Provinz mit Familie ; diese musste in Rom zurückbleiben. ¡Noch August hielt strenge darauf
und gestattete nur sehr selten der Frau eines
l'ro-
consul oder Legaten , dem Manne einen Besuch zu machen ; Suet. Aug. c. 24.
Allmiihlig wurde indess eine Gewohnheit
daraus; es kamen Beispiele
vor
von dem schädlichsten Ein-
ffuss der Dainen, von Missbräuchcn, die ihr Stolz, ihre Eitelkeit , Habsucht in den ohnehin so sehr gedrückten vinzen verursachte.
Pro-
Unter T i b e r schon kam die Sache im
Senat zur Sprache, und Severus Caecina sagt darüber derbe Wahrheiten beim Tacit. Ann. 111,33«. Erst drei Jahre spater, p. Chr. 24. , ein Senatusconsult : der Mann
sollte für alle
Excesse, die sich die Frau erlauben w ü r d e ,
verantwortlich
sein. Tacit. Ann. I V , 20. Ulpian. in Dig. I. t. 16. de off. P r o cons. I. 4.
Diess blieb die Regel, und
darauf
deutet
der
Dichtcr. 129. f. Beispiel einer solchen Dame, die in der Provinz lierumri'is't, und auf ihre eigene Iland Erpressungen macht.
SATIRE
Vili,
125—147.
329
Celaeno, Harpvie, curvis ungidbtis, yaptxpütvv'^, als Raubvogel. per conventm. Sucton. Ner. c. 28. circa conventus mercatusqite Graeciae, i. e. loca in provinciis constituta iuri dicundo, auch fora oder iurisdictiones genannt. 134. de quociaujue libro, sc. in quo fabulosa nomina traduntur. Jrangis, frangi iubes. virgis caedi ging allemal der Hinrichtung vorher. lasso lictore, V I , 484. facem. Marias Sallustii lug. 85. maiorum gloria posteris honen est; neque bona neque mala in occidto patitur. 140. conspectius, in dieser Bedeutung Sprachgebrauch der Kaiserzöit. E r n . ad Suet. Claud. 4. in se habet, facit. 142. falsas tabellas, 1 , 6 7 . In Tempeln werden Testamente niedergelegt; es erschleicht sich einer den Zugang, lind schiebt ein falsches Testament unter mit nachgemachten Siegeln, signare nicht wörtlich zu nehmen, sondern liir signatas supponere. cucullo V I , 118. nocturnos cucullos. III, 170. Cerda Adverss. Sacra XLIV, 12. Santonicct Gallico. Die Santones waren ein Gallisches V o l k . . Martial. XIV, 128. Gallia Santonico veslit te bardocucullo. Die dicken wollenen Zeuge, Flause, kamen aus Gallischen Fabriken ; zu I I I , 103. 146. Eine Jugenderinnerung des Dichters aus der Zeit des N e r o : die tolle Passion der jungen Herren von Adel f ü r Wagen und Pferde, aurigatio, I, 59. D e r Dichter individualisirt die Gattung, indem er eine einzelne Person sich vorstellt. Deren Name ist v. 147. 151. und 167. in allen Handschriften Damaiippus, auch in der IJusumer und den 6 Kopenhag. In den Scholien herrscht ein sonderbarer W i derspruch : beim ersten Verse Stillschweigen, beim zweiten im Context des Scholiums Damasippo, und erst beim dritten ist vorgezeiehnet Lateramis als Lesart, mit der N o t e : sive Dainasippus. W e r diese Variante anzeigte, muss auch in den beiden vorhergehenden Versen den Namen Lateranus in seiner Handschrift gehabt haben ; er hatte unstreitig die Vu-
ERKLAERUNG.
330
riante ebenfalls an den beiden erstem Stellen angezeigt; bei 147. ist die Kote verloren
und bei 151. eine andere, spä-
tere, an die Stelle gekommen. Handschrift,
woraus
hat
aus derselben
er die Scholien e d i r t e ,
Pithoeus
durchgehends
im Texte, und daher Schrevel. und Hennin.
Lateranus
Von
allen Pariser Handschriften hat dieses nur eine einzige, aber gerade die, welche Achaintre selbst für die älteste und w i c h , tigste e r k l ä r t ,
der Codex Puteani.
Rupert! und Achaintre
liaben die andere Lesart vorgezogen, bloss weil sie die Menge der Handschriften für' sich hat. Diess ist kein kritisches V e r fahren:
denn der Scholiast,
der Lateranus
las,
ist ohne
• Zweifel, und die beiden Codices Pithoei und Puteani,
die
eben so lesen, sind sehr wahrscheinlich älter, als alle andern. Nun aber hat der Scholiast auch schon die Abweichung gekannt,
weil er sie ausdrücklich anführt;
mithin
läsSt sich
auf diesem W e g e nicht ausmachen , welche von beiden die ältere. Man kann aber weiter gehen, und fragen , wie eine solche Dittographie möglich war. Dichter könne selbst in
Ich glaubte sonst,
neuern Abschriften
der
seiner "Werke
eine Veränderung gemacht haben, und es pflanzten sich nachmals beide Lesarten nebeneinander
fort,
in Handschriften,
die nach dem erstem und nach dem revidirten Original gemacht wurden. V l l , 139. theilen sich die Codd. zwischen
zwei Lesarten,
Dichter selbst herrühren.
die allem Ansehn nach Es
ebenfalls
beide vom
ist aber auch sehr möglich,
dass hier wieder die Mönche geändert haben. es in drei gentibus, Claudia, Plautia,
Sextia.
Laterani
gibt
Den Plautiis
Lateranis gehörte ehemals das prächtige Haus in rrionte Coelio, Lateranorum
egregiae
aedes,
X , 1 7 . , später basilica L a -
terana (Hieronyin. adOceanum), die Constantin d. Gr. dem Bischof zu Rom, Silvester, schenkte, lange Zeit der Sitz der Päpste , il Laterano. (Grang. ad X , 17.) Lateran,
Vergl. Foi'cellini v.
Der heilige JVuuie schien den Mönchen entweiht in
einer so profanen Verbindung, Damasippus
und Lateranus
wurde
mit
vertauscht, einem llorazischen Namen, der durch
S A T I R E VIII, 147 — 159.
331
seine Bedeutung sehr gut hieher passt, aber wegen des F o l genden dennoch nichts t a u g t : "denn weiterhin 185. ist masippits
Da-
ein ganz verschiedener Charakter ; man sieht also,
dass der Dichter vorher einen andern Namen gebraucht ben mtiss, und dass Lateranits 153. virga
annuet.
ha-
das Richtige ist.
vQUaxvvetv
r f j fiaariyt,
salutare, Dio
Cass. L X X V I I , 10. mit Salm, in Capitol. p. 105. C. in Vopi.sc. p . 4 4 l . D. Die Art der Begriissung ist ganz familiär: spect erfordert sonst, die virga zu nehmen ,
und mit
der
derlle-
beim Grass in die linke Hand
rechten
F l o r i d . p. 3 6 4 . Elm. oben, virga,
zu salutiren.
oiov'i'vt] Qaßäog
Appulei. Philodem.
E p i g r . 27. T . II. p. 9 0 . 157. Eponam,
die richtige F o r m , Turneb. Adverss. X X I V ,
4 . Die Stelle im Plutarch T . V I I I . p . 4 2 9 . Hütt. T . II. p. 2 8 0 . W y t t . 'Innwvav,
richtig,
vuv haben. Herculi
obgleich die alten Editionen
ner Thes. s. v. Hippona
Eno-
G r u t e r Inscr. p. 8 7 . 4 . 5 . G e s -
etEponae,
lässt sich als verschieden nicht e r -
weisen ; es ist eine schon alte Künstelei derer, die das Pferd gern schon im Namen haben wollten. „ E p o n a dea mulionum est", Schol., was auch die Kirchenväter bestätigen. Also Schutzgeist für Esel und Pferde, überhaupt für iumenta. Den G r i e chen ist diese Epona
fremd, also Römischen Ursprungs; d a -
her auch die Ableitung von o'roj unglaublich. 159.
könnte
Die Syrophönicier liener mit ihren netvreg ol
S y r e r aus dem Phönicischen ,
Syrophoenix,
man jetzt sagen
Gallobatavus , oder
in R o m , Boutiquen
2vQ0(p0i'vixig
jjdi) xai xsyotQiojievov,
wie
Danobolsatus.
wie in Deutschen Städten Itaund die
e/ovai
xaxa
Schweizerconditoren. TIJV
xoivtjv
¿'vjevfyv
Eunapius in Libanio p. 173. ed. C o m .
mel. 2vQorpotvi% e/xnOQog, Liician. T . III. p. 5 2 9 . E r handelt vorzüglich mit den feinsten Salben , ist pharmacopola , G a lanteriehändler.
amomum,
Virg. Idyll, p. 144.
Asiatische Gewürzstaude. Voss Obvius currit,
mit der Einladung
naher zu treten ; wie diess solche Leute zu thun pflegen. S o beschreibt Cicero pro Clu.
c. 5 9 . eine« W i r l h von der via
332 Litina.
ERKLAERUNG.
Idwnaea,
regio S v r i a e ; es liegt hierin eine ge-
nauere Bezeichnung der Gegend oder des O r t e s , wo diese K r ä m e r herkamen: Idwnaea porta, der O r t , eigentlich E n g pass , wo der W e g durch geht nach Idumäa ; porta Syenes XI, 124. Ciliciae portac Aepos D a t a m . 7 , 2 . E s ist eine geographische Bezeichnungsart; auch p o r t a e Caucasiae, nvXut. Diese Leute kamen also nicht aus ganz Phönicieu, sondern namentlich aus der hier bezeichneten Gegend, wie die Schweizer aus Graubünden. hospitis affectu, mit Gastwirtbsi'reundlichkeit. dominum regemque sal. Devote Ausdrücke, wie sie wohl in Rom bei den Gastwirthen in Gebrauch gewesen. Cyane succincta, hoch aufgeschürft, mit kurzem Röckchen, wie die aufwartende Dienerschaft beiderlei Geschlechtes, IV, 24. Cyane, Copa Syrisca des Virgil. 168. thermaritm, cauponarum, merkwürdig; thjermae f ü r thei'mopolium, zufolge _des Beisatzes calices. Die Bedeutung fehlt in den Lexx. X I , 4. gehört nicht hieher. E s sind die popinae g a n e a c q u e w o r i n calida und Gebratenes zu haben war, Lipsius Electt I, 4. , auch opera pisloria, Sueton. T i b . 3 4 . : Resta urationen. lintea, vela popinae, erklärt schon der Scholiast richtig. Casnub. ad Sueton. Ner. c. 27. , dein J e dermann nächspricht, vergleicht aus Dio C.ass. L X X 1 X , 13. xai TO anöoviov /ovootq xQt'y.oig ¿'¿¡jot>]fisvov ¿tuoit'cäv, und eben so Reimar. ad h. I. D o r t erkläre ich aber, wegen äietaet'tiv, das aivdöviov Musselintuch, durch Ringe gezogen (zun» S t a a t ) , dergleichen galante Mädchen in den llihulen tragen und damit winken, sudarium; oder die Schürze, semicinctium, ai/Litxt>'fhov. Stephan. Index Tbes. v. ^ifii/.ivStov. 171. Mitte ostia. Cod. Husum, mitte haec ostia, das lutec nach ' valet ausgelassen, und hier eingeflickt, mitte ostia soll heissen ad oslia Tiberis (zum Einschiffen), oder ad flumina praesidiis tuenda. W i e kann aber ad fehlen? Britannicus erklärt: mitte ostia eins, i. noli rjuaerere eum in sua domo, (|nia illie non iiivenics. Der Dichter hat sagen wollen mitte d o m u n i , und sagt dafür nach der Analogie oslia für
SATIRE
Vili,
160 — 1 8 0 .
333
ad Ostia ; oder es ist ein Ausdruck aus dem gemeinen L e ben, wie Terent. hera, mitte lacrimas: las« es nur init seiner Tliiire, lass, nur nicht erst an seiner Thüre fragen, Leim ostiarius. 173. percussore, sicario, Marsli., ist allerdings gegründet, aber hier doch etwas zu arg. Das Richtige geben die Vett. Glossae: P-crcussor, f.tovö/.iuyoG, welche Bedeutung in deri Lcxx. fehlt. sandapilarum. Glossae: Sandnpila, »fxQntpoQtiov. Sandapelo (ilo), vixyodiimtjg; aus aavidonvehog, Salmas. Exercitt. p. 848. A. E i n . Clav. Labeilum. Es sind Tragen, worauf die getödteten Gladiatoren zu Grabe getragen wurden. Schol. , und übereinstimmend Catliol. a Ianua. Mit den Verfertigern derselben in einer Ciasse carnißces. Die Ausleger und Lex*, haben nichts. Schol. Ilorat. Serm. J, 8, 10. „Soliti erant carnißces in Esquilina via puteos faeere, in quos corpora inittebant. flinc locus dictus erat Puticuli. Ilic etiam erant publicae ustrinae". et resupinati etc., ein betrunkener Priester dazwischen, resupinatiis, die Beine in die Höhe. Scene für den Pinsel eines Hogarth ! ergastula, X I V , 24. 179. sorlitus, i. e. si habeas. carcer ruslicus. Casaub. ad Suet. Aug. c. 32. p. 312. Beim llesvch. iyyuiwi'Si. Schaef. ad Gregor. Corinlb. p. 2 2 5 ; Salmas. in Spartiun. p. 49. sq. Die ergastula sind Privatgefangnisse auf den Villen der grossen Römischen Gutsbesitzer, für ganze Schaaren von Sclaven, die das Feld bauen inussten. So hatte jede Villa ihre förmliche Sclaverei ; ,.cine schreckliche Einrichtung, ohne welche aber Rom durchaus nicht bestehen konnte. Von der Zeit an,* als die ungeheuern Güterbesitzungen, latifundia, entstanden, die alles kleinere E i genthum verschlangen, hörte der Bauernstand fast ganz auf, und die Entvölkerung auf dem Lande von Italien wurde so gross, dass nichts anders übrig blieb, als das Land durch Sclaven, unter Aufsicht eines Villicus, bauen zu lassen. Dazu waren auf allen Gütern Gefängnisse für die Arbeitssclaven, weil diese unglückliche und durch ihre Lage ganz verstockte
334
ERKLAERUNG.
Menschenklasse nicht anders in Zaum gehalten werden konnte. Ihr Schicksal war äusserst h a r t ; mit geschlossenen Füssen und bei den elendesten Nahrungsmitteln verrichteten sie ihre Arbeit, squalidus in magna compede Jossor, X I , 80. und T i bull. IL, 6 , 25. Spes etiam valida solatur compede vinctum; Crura sonant ferro,- sed canit inier opus." Hie Sache war von sehr wichtigen Folgen für das W o h l des Römischen Staats; man lernt sie am besten kennen aus LipsiusElectt. II. c. 15. T. I. O p p . , eine vortreffliche lehrreiche Zusammenstellung. In die ergastula schickte man auch JJaussclaven, die Taugenichtse oder Verbrecher w a r e n ; Horat. Senn. II , 7. extr. Seneca de Ira Iii, 32. 181, Troiugenae, 1,100. cerdo, IV, 15. Bezeichnung" einer niedrigen Menschenklasse ; die Bedeutung ungewiss. Der Scholiast hilft sich mit der Ableitung aus dem Griechischen. Neuere Glossatoren, Papias, lo. lanuensis: Cerdones, sutores. Martial 111,99. cerdo—licuit si iugulare tibi. Volesus, Vater des P . Valer. Poplicola , wird auch anders geschrieben. Heins, ad Ovid. ex P.III, 2, 105. 185. 'Damasippus, ein Verschwender, aus Hör. Serm. II, 3. Der Dichter hat die Zeiten des Nero vor Augen, der ein grosser Künstler zu sein affectirte , selbst als Cithar'öde sich öffentlich hören liess , und unter dem es dahin k a m , dass Verschwender, Personen aus den erlauchtesten Familien, ohne Scheu Comödianten wurden , artem ludicram exercebant. Diese waren nach Römischer Denkungsart, und selbst nach den Gesetzen, infames; sie verloren die Rechte ihres Standes als patricii, equites, sobald sie nur ein einzigesmal öffentlich aufgetreten waren. Quintil. III, 6, 18. Digest. 1. ill. tit. 2. de Iiis, qui notantur infamia. Der Rechtsgrundsatz w a r : Qui in scenam prodierit, infamis est; die artifices scenici, späterhin tliymeliei genannt, histriones, pantomimi, mimi. Der eques Decim. Laberius wurde vom Cäsar genöthigt' bei den ludis scenicis, die dieser nach geendigtem Bürgerkriege dem Volke gab, als mimus aufzutreten: aber es wurde
S A T I R E V i l i , 1 8 0 — 190.
335
ihm seine E h r e restituirt. Das Anseilen der ersten Stünde war mittlerweile so sehr gesunken, dass unter iS'ero Altadelige, die von den Theaterkünsten ein Gewerbe maehten, gar nichts Seltenes waren. Der Dichter perhorrescirt diese Sitte, nach der Denkungsart besserer Zeiten. vocem, eigentlich operam locare ; hier von einer Rolle im mimus, v o t i n •viel geschrieen w i r d . stpario, scenae, das spätere W o r t fiir • aulaeum; Gesner im Thesaur. und in den Opusculis; Lips. ad Seuec. p. 161. siparium auch bei Quintil. VI, 1,33. mit Spald. Eigentlich separium, rj/uifuuiov : 'Sahnas, ad Tertull. Pall. p. 209. vom alten sipare, obsipare, h. e. ohiicere : Voss. Etym. v. Dissipare. ageres Pliasma, wie fahulam, mirnum agere. Pliasma der Griechische Titel eines mimus, das Gespenst; eine Comödie unter gleichem Titel vom Menander. Der Verfasser Q. Lutatius Catullus Urbicarius ; XIII, 111. Urbailiis in gleicher Bedeutung, Mimendichter, mimographus. 187. Laureolus, ein anderer mimus, sehr b e r ü h m t ; die Hauptrolle darin war ein durchtriebener Sclave, der bei einem Bubenstück als Rädelsführer ertappt und gekreuzigt wurde. Sueton. Martial. Ioseph. Antiqq. X I X , 1. Tertullian. adv. Valenlinianos p. 256. D, Catulli Laureolus. velox, agilis, im Charakter der Rolle. 190. triscurria haben-alle Handschriften, auch die Husunier, einige wenige triscuria, was eigentlich keine Variante ist. Das sonderbare W o r t kommt in keinem Glossarium und bei keinem Schriftsteller weiter v o r ; ein wirkliches una'% tiQij/JSVov. Was man darüber gesagt h a t , ist alles bloss e r ralhen. Voss. Etymol. L. L., Martin. Lex. Philol. , Gesner Thes. , der in diesem Artikel sehr seicht ist. Ruperti hat einen Excurs. ad h. 1., der eben so leer ist, wie alle ü b r i gen Excurse. Der Mann macht bei jeder Gelegenheit einen Auslauf, excurrit, kommt aber immer mit leeren Händen wieder zurück ; und wenn er einmal etwas zurückbringt, so ist es nicht einmal ein gekaufter Hase (Horat. Epp. 1,6, 61.),
336
ERKLAERUNG.
sondern ein gestohlener. Scaliger und zwei Andere hnben Emendationen versucht, aber unglücklich, triscurrium gehört allem Ansehn nach zu den vocabulis compositis der alten Satirensprache, und war wohl geradezu ein vocab. Lucilianum, von gleicher Beschaffenheit, wie die "Wörter von alter Zusammensetzung, triparcus, trifur, beim Pluutus, triJitrrittm beim Appuleius, und 'ähnliche. Yett. Glossac : Trepallus, TlQtanog, i. e. Triphatlus. Scaliger in Priapeia p. 211. Gesner adLucian. T . III. p. 383. Zu Petron. p. 97., zu Gellius 11,19. p. 202. triscurrium von scurra, ganz wie trifurcium von furen , componirt , wörtlich die Dreispässe , ein komischer Ausdruck für scurrilitates. Der Scholiast erklart „iocos", aber nach einer ganz andern Ableitung von currere, und bezieht es auf. eine lustige Handlung im S t ü c k e , wo Drei auf einmal hinauslaufen. Nach derselben Ableitung Salmasius Epist. X C V . ad Sarrav. Ich zweifle aber sehr an der Richtigkeit dieser Ableitung. Denn eine Form curriurn kann schwerlich vom Verbo gemacht werden, sondern vom Substantiv, also cursiitm; übex-baupt aber ist wohl die Endung ium nur statthaft bei Substantiven auf a. Ferner, wenn uiit tris componirt wird, bleibt wohl zuweilen das s im Griechischen, auch vor k, wie TQiay.azÜQuioq, aber nicht im Lateinischen , wo in Zusammensetzungen nur die Sylbe tri gebraucht wird, nicht tris; es würde also, wenn jene Ableitung richtig sein sollte, tricurria formirt sein, nicht triscurria. Diesemnach halte ich die Ableitung von scurra mit der vorbergegebenen Erklärung allein für die richtige. 192, Sie verkaufen sieb als Gladiatoren; voluntarii, auctorati. Lips. Saturnal. I I , 5. Yergl. oben I I , 143. f. Die Frage, statt: quovis, vel minimo, pretio vendunt sua Jitnera, i. e. vitam. 194. celsi, gewöhnlich als nomen,proprium, wie denn ein L. Celsus als Prätor vorkommt. Glandorp. Onomast. p. 512. Es ist indessen nur Adjectiv, vom Prätor gebraucht, der bei den Spielen auf einem höhern Sitze prasidirte,
S A T I R E VIII, 190 — 197. subllmis, wie celsus
equo. Ruhnken.
337
ap. K o e n . acl Gregor,
p. 3 0 7 . eil. Lips. Die Praetores h a t t e t curam ludorum, seit Claudius auch die Quaestores ; doch später auch wieder j e n e , Lipsius Saturn
1,9.
Das vendere,
zum drittenmal
wieder-
holt, darf nicht getadelt werden; es.ist desNachdruck.es w e gen : aber der ganze Vers wird für malt gehalten. hält ihn für un'ächt; Jacobs will emendiren. miiss richtiger interpretirt non dubitaut,
werden,
i. e. sponte, u l t r o ,
nec
Rupert!
Ich glaube, es
dubitarit,
et adeo
perlibenter se vendunt;
es ist verstärkender Zusatz, oder Erweiterung von nullo
co-
gente und p e r litoten ausgedrückt. 195. „ U n d doch, selbst wenn ein T y r a n n mit dem T o d e d r o h t e , so müsste der edle Mann lieber sterben, als sich e r niedrigen". Die specielle Anwendung von V . 8 3 . 8 4 . ruit,
exhorrescit,
esse malit.
exhorrescere p o t e s t , e x h o r r u e r i t ,
Auf diese W e i s e sind gladii
ter,- gedrohte Todesstrafe,
gladii
exhorut sit,
angedrohte S c h w e r -
können aber auch Gladia-
torenschwerter sein, und diess ist natürlicher, in diesem C o n text und wegen des Gegensatzes von pulpila. tem, sc. in arena , Gladiatorentod.
Also auch mor-
S o entsieht dieser S i n n :
Ist die W a h l zwischen Gladiatoren oder Possenreisser , was ist hesser? Kann Jemand den T o d so sehr scheuen, dass e r lieber sich zum Lustigmacher mes :
aber der T o d
erniedrigt?
des G l a d i a t o r s , der
Beide sind
infa-
der Schande
oft
schnell ein Ende macht, ist doch besser, als. das Leben eines Lustigmachers.
Man sollte denken , w e r einmal der Scham
entsagt h a t , würde wenigstens den Gladiator wählen : doch nein ! Mancher erniedrigt sich lieber zum Lustigmacher und trägt ein langes Leben mit Schande. klärung
ist der Gedanke s t ä r k e r :
nichts entscheiden. Wahrheit,
Nach der e r s t e m
Er-
diess kann aber für sich
Die letztere Erklärung hat darum mehr
weil sie näher liegt.
letztere das Scholium ad h. 1. spielung auf den beliebten Mimus:
Uebrigens hat auch diese zelotypus, maritus.
An-
die Hahnreischaften ; zu
I, 3 6 . Die Rolle des eifersüchtigen Ehemannes hatte Corinthus Vol. 11.
22
338
EBKLAERUNG.
gespielt; diese Rolle spielt auch der nobilis, und w i r d d a durch der collt'ga des Mimenspielers, stupidiis, dej; Einfaltspinsel, ist der Charakter der Rolle. Corinlhus, noincn miini, und ist als Namensfonn hinlänglich gesichert durch die Beweise hei Koen. ad G r e g o r . Praefat. p. VII. cd. Lips. 199. ff. Der S i n n : „Das Beispiel ist gegeben; bald w i r d die Schamlosigkeit Alles verschlingen , und Rom nichts a n ders haben als htchun, res ludicras. Und jenem Beispiel v e r dankt man die Schande R o m s , einen Gracchus mit frechem, unbedecktem Gesichte, für Jedermann kennbar, als retiarius, auf der Arena". Vgl. II, 143. f. Die Gladiatoren sind nach den Waffen und der Fcclitart verschieden; einige Arten sind Nachahmungen der Kriegsbewaffnung gewisser V ö l k e r , und werden nach diesen benannt, Samnites, Threees. Nur Gladiatoren von verschiedenen Waffen werden zusammengestellt. Lipsius S a t u r n . 11,7. zählt überhaupt zehn Classen a u f ; seine Schrift ist bis jetzt das Beste, aber noch nicht in allen Theilen richtig. E r erläutert unsere Stelle c. 8., doch nicht b e friedigend. Ein Gracchus als retiarius, Netzfänger, ohne P a n zer, Schild, Helm, in der blosse« tunica, mit dem Faivgnetz, rete , in der einen, der fiiscina , oder tridens, der Harpune, in der andern Hand , den Kopf bedeckt mit dem galerus, einer kegelförmigen H a u b e , die das ganze Gesicht frei lässt; Tertullian erwähnt noch spongias retiariorum , wohl nur aus Verwechselung mit den Samnilen. L i v . I X , 40. Lips. 1. I. c. 11. und Milit. Rom. I.II, 6. T . III. p. 87. Opp. Vales. ad Ammian. T. II. p. 338. Förcellini in v. Das ganze Manöver des retiarius ist vom Fischfang c o p i r t ; er ist darauf geübt, das Fangnetz zu werfen, und sucht beständig es seinem Gegner über den R o p f zu bringen; verfehlt er ihn, so muss er laufen, bis er mit seinem Fangnetz sich wieder i n Positur setzen kann. Davon hier eine malerische Schilderung. ( H i e r h e r gehört das Schol. Venet. ad Horn, lliad. xfj, 581. vergl. Heyn. Observ. T . VIII. p. 221. Lies: nctQi&tjxev —, Iva avxbv dnotgunij, opposuit, ut ipsum repelleret, i. e. eius ictus evitaret.
S A T I R E VITT, 197 — 199.
339
TO &(OQ(ixiov, lunica retiarii, Salmas, in Lamprid. p. 174. B, in den andern Scholien vollkommen richtig
TO nahov,
i. q.
7iaXh'ov; s. Ducange Glossar. Gr. o ös ßaXtov, der das Net« warf, der retiarius. O
4. XIV, 5. 41. privatiis, nondurn rex coeli. 44. et iam will Ruperti ändern in nec iam oder (tut iam. Allein da nec vorherging , w i r k t die Negation noch auf den folgenden Satz, und et ist f ü r et non. X I , 14S. non a rnangone petitus Quisquam erit, et magno. Zu VIII, 241. Blindlings trifft hier Ruperti mit dem grossen Bentley zusammen, der als Grundsatz annimmt, dass nach neefue z w a r die t r e n nenden Partikeln aut, v t l , ve, vim negandi haben könnten, nicht aber die verbindenden et, ac , que : zu Ilor^t. Epod. 1 6 , 6. und Serm. 1 , 6 , 68. ; welches auch Ruhnkenius a n nimmt ad Vellei. II, 45. Dagegen sind bereits Einwendungen gemacht worden ; s. Ilcinecke p. 103. Bentley selbst hat sich auf keine Erörterung eingelassen, und seine Behauptung hält sicher nicht die Probe. Denn man sieht keinen Grund, w a r um nicht dasselbe , was von ant elc. g i l t , auch eben so gut von et etc. gelten sollte. Ferner ist es gewiss, dass et etc. nach non so gebraucht w i r d ; warum nicht auch nach netjue ?
SATIR-E
XIII,
32—44.
461
Auch haben schon die Griechen diesen Gebrauch:
fujit
—
xut'. S. W i t t e n b a c h ßibl. Crit. XIT. p. 4. Pinzger ad Lvciirg. p. 234.
den Lateinern die Beispiele
Und endlich sind hei
zu zahlreich, als dass man Alles auf Fehler der Abschreiber schieben könnte, und gewisse Stellen bei Dichtern lassen sieh des Verses wegen nicht ändern. X V , 125. nec terribiles bri,
nec Britones
wx/uam, Sauromataer/ue
Inn J freilich ve andern tiliae
molles,
dern lasst.
will.
wo
CimMark-
Aber Ovid. Met. X , 02. Nec
nec Jttgits et innuba laurus, D e r Sinn
truces,
des ganzen Satzes
w o sich nichts anist übrigens nicht
lciclit. Man sagt siccare pocula, caliccs, für epotare, e\haurire, mehrmals bei Horaz ; und so auch viuum,
nectar sie*
eare. Die Erklärungen vom Ganzen sind alle grundlos.
Ru-
pert! zieht die Homerische Stelle hieher II. « , 597. f . ,
wo
der
hinkende Vulcan beim Göttermahl
den W e i n kredenzt
und ein grosses Gelächter erregt ; der Sinn soll sein : als noch Vulcan nicht den Weinscheuken machte". liegt aber nichts in den W o r t e n .
Er
zwingt
„und Davon
eine A r t An»,
spiclung hinein durch die Conjectur tendens, die sehr traurig ist und den Ausdruck des Dichters verhunzt. vermuthet hier einen F e h l e r ; sund.
die Stelle
Heinecke
ist aber völlig
ge-
Vulcan ist hier nicht Mundschenk, sondern Gast w i e
die andern Götter , aber ein schmutziger und grober Gast. D e r Dichter hat den Horner v o r Augen, aber eine ganz andere Stelle, nämlich 11. a, 410. f., w o Thetis zum Vulcan in die Werkstatt kommt, und dieser, tun sie zu empfangen, v o r ihren Augen
mit
dem Schwamm sich die Arme abwäscht,
das Gesiebt, den Hals etc. an&yytg d' d f i f i ngöotonu Xtt'j'
anofiöyyvv,
xui u/urpoi.
brachia tergebat. Diese drollige Toiletten-
scene parodirt liier der Dichter.
Vulcan kommt auch zum
Mahle, aber mit dem ganzen Schmutz
der Werkstatt;
er
hat vergessen sich vorher hübsch zu waschen; er hat schon eine W e i l e gezecht, iam siccalo nectare,
so fallt es ihm erst
ein, dass er doch gar zu schmutzig unter den feinen Göttern und
Göttinnen dasitzt,
und fängt
nun erst an ,
sich den
E R K L A E R U ' N G. Russ von den Armen zu wischen, so tlass natürlich die D a beisitzenden davon mit abkriegen, brachia nigra, sordida, fuliginosa, tabema, officina, Liparaea, von der Insel Lipara, der vornehmsten unter den Aeoliis oder Vulcaniis, oberhalb Sicilien, wo Vulcans Werkstatt in einer unterirdischen Höhle, antiitm Fulcani, I, 8. Yulcan ist der Tölpel unter den Göltern in der ganzen Homerischen Fabel, und diese Rolle lässt ihn hier der Dichter spielen , mit acht komischem Effect. An dergleichen komischen Zügen ist Juvenal r e i c h ; aber die wenigsten sind bisher brecht gefasst worden. Der Juvenalische Witz ist etwas Eigenes, und die Ausleger sind theils zu ernsthaft, theils zu stumpfsinnig, um sich darin finden zu köunen. 46. sibi, per se. Or. de Harusp. Resp. §. 26. id ipsum sibi monstrum est, mit Unrecht dort bezweifelt. Quintil. VI, 3, 16. vel sibi ludentium. 54. „Es galt f ü r eine Todsünde, wenn ein iuvenis nicht ehrerbietig aufstand vor einem Alten , und ein p u e r nicht wieder vor jedem Bärtigen. Vier Jahre älter zu sein, machte schon ehrwürdig". Die prima barba oder prima lanugo, als der terminus pubertatis, wird hier bestimmt vier Jahre nach der pueritia, die sich mit dem I4ten endigt, o d e r , nach V a r r o ap. Censorin. de die nat. c. 14., mit dem 15ten. Nach diesem fängt die adolescentia an , bis zum 3 0 s t e n , und bis zum 45sicn iuventus. Hier ist nichts bestimmt als die quatuor anni zwischen der pueritia und prima lanugo ; es gilt Einer diese vier Jahre nach der pueritia f ü r einen barbatus, dem die pueri eben so respectvoll begegnen, als die iuvenes, die jungen Männer, wieder den Alten. Die Altersstufen des menschlichen Lebens bestimmt der Römer nicht auf einerlei Art. Die Abweichungen hat Forcellini zusammengestellt v. Attas. 61. aerugo, der grünliche Schimmel, der sich an die edlern Metalle ansetzt; hier f ü r aes selbst. Tuscis: es thut Noth, dass die aruspices darüber befragt werden.
SATIRE
XIII,
44—G8.
463
Diese luiben ihre S c h r i f t e n , und die ganzo nruspicina ist wie libri disciplina Etrusca ; also Titsci, Etrusci , libelli, Ä'truscorum, Etruscae disciplinae Volumina hei Cicero und Plinius. 65. puero, aut ist die richtige Lesart, ein erlaubter Hiatus durch die lange Sylbe, die in die Arsis fallt, dem J u v c nal sehr gewöhnlich. miranli sub aratro haben bei weitem die meisten Handschriften, einige wenige mirandis, zu piseibus. Ruperti trifft hier einmal das R e c h t e , es sei eine E m e n d a t i o n ; nur setzt er falsch hinzu: „ e t quidem inepta: non enim pisces sunt mirandi, sed mirandum est, qiiod sub aratro inventi sint". Als wenn diess nicht eben auch durch 11itrandis gesagt w ü r d e ! Gataker gibt die Conjectur: liranti s. ar., ad Marc. Antonin. VIII. § . 1 5 . , die Heinecke f ü r v o r trefflich erklärt, lirare das eigentliche W o r t vom Auffurchen des bes'acten Ackers, Voss V i r g . L b a u p. 64. und 78. miranti ist aber dennoch nicht zu ä n d e r n , und weit mehr JuvenaJischer Ausdruck. Miratio wird unter allen Affecten am gewöhnlichsten leblosen Dingen beigelegt. Virg. Aen. VIII, 91. 9 2 . mirantur et undae, etc. Ovid. A m o r r . II, 1 1 , 1 . ranlibus acquoris undis. Völlig entscheidend f ü r unsere L e s art Virg. Ge. I I , 81. ingens Exiit ad coelum ramis Jelicibus arbos , Miraturque noyas Jrondes . et non sua ponia ; vom Baum, der gepfropft worden. examenve Ruperti aus Einer Handschrift. Aber tjue ist unverwerllich, wie et 66. Die hier erwähnten prodigia kommen alle auch sonst bei den Historikern vor. examen, exagmen, exagimen, von exagere, exigere, in der ersten Bedeutung omne (juod exigitur; davon die besondere : der Auszug der Bienen und Heuschrecken , und der Ausschlag der Wagschale. Von dieser eine Nebenbedeutung exploratio. apium , die seltenere F o r m f ü r a p u m , auch bei Ovid, und öfter in den Codd. Ptinii, wo jetzt immer apum steht. Voss, de Analog. II, l- 4 . feta mula, als Naturwunder, weil die F a l l e , dass die Bastarde von P f e r d und Esel, das gemeine Maulthier und der
m
ERKLAERUNG.
Maulesel, fruclilbar werden, zwar nicht unerhört, aber doch $chr seilen sind. 70. miris will man ändern, mit Unrecht, mirus ist p r o digiosm. Horat, E p o d . 1 6 , 3 1 . mirus amor. 73. arcana i. e. tacite commissa alteri. angulus ar~ cae, periphrastisch für a r c a , der Verschluss des geräumigen Kastens. zu suppliren: et quidq. aliud. X V , 9 9 . 83. quidquid, VIII, 27. seu tu Silanus, quocuuque alio de sangidne, und 3(3. si quid adhuc est. 84. Comedam, sc. si mentior. flebile etc. Versetzung der Beiwörter f ü r : flebilis nati sineiput elixum. elixi i. e. in aqua cocti. Der Stamm lix, i¡eis, in der ältesten Sprache aqua ; davon lixae aquatores in castris, tiquor, lixivium und prolixits. Prima Scaligerana p. 103. madentis sollte auch eigenU luli madens sein zu sineiput. Pharius, das Beiwort Aegyptisclier Schiffe und W a a r e n , von der Insel Pharos vor Alexandrien, IV, 33. D o r t waren, wie es scheint, die W a renlager und Packliäuser der Kaufleute von Alexandrien, und dort nahmen die Schiffer ihre Ladungen ein. Aegyptisclier Jissig schon in Griechenland vorzüglich geschätzt. Alhenaeu« II. p. 67. C. Der Handel mit Aegyptischen W a a r e n , von Alexandrien aus spedirt, w a r in der Römischen Welt sehr bedeutend und mannichfaltig. Salmas, ad Hist..Aug. p. 386. 8 6 . ff. „Manche glauben gar keine Götter, leiten Alles vom blinden Zufall a b , und schwören daher dreist in den T a g hinein. Andere glauben zwar G ö t t e r , wissen sich aber bei ihren Ruchlosigkeiten durch Sophismen zu täuschen
Sunt qui — ponunt Et — credunt viele Handschriften, wie X I I , 101. exsistunt, qui promittwit hecatomben. Beide Stellen hat man nun nach der trivialen Regel c o r r i g i r t , so wie Ernesti im Cicero ü b e r a l l , oft wider alle C o d d . , nach sunt , qui den Conjunctiv gesetzt hat. Dagegen Heusinger Praef.it. ad Cic. OfT. p. X L I X . und p. 204. Dass auch der Indicativ stehen k a n n , ist gewiss : aber eine feste Regel
S A T I R E X I I I , 6 8 — 92.
465
darüber fehlt noch. Wenn zu sunt ein Subject kommt, so folgt der Indicativ, wenn eine Thatsache ausgesagt wird": sunt interpretes, qui exponunt; multi sunt poetae, qui malos versus faciunt. Der Conjunctiv folgt als Stellvertreter des Griechischen Optativus oder als modus potentialis, wo etwas bloss Gedachtes, Denkbares oder Mögliches eintritt: sunt interpretes , qui male exponant, i. e. exponere possint. Nun sollte man meinen, der Analogie wegen müsse das Nämliche eben so wohl von dem blossen sunt qui gelten: denn hier gilt derselbe G r u n d , wie dort. Diess ist auch Heusingers Meinnng 1. c. Aber ein neuerer Ciceronischer Critiker, Görenz, ad Acad. II, 70. entscheidet nach dem blossen sunt qui ohne Unterschied f ü r den Conjunctiv; im ganzen Cicero wären kaum fünf Stellen, wo die Handschriften alle für den Indicativ sprächen. Der Mann spricht viel zu dreist über die Handschriften , wovon er nur ein kleines Theilchen kennen gelernt hat. Und was wird aus so vielen Stellen der ersten Dichter, wo die Structur mit dem Indicativ von allen Handschriften beglaubigt wird, wie beim Horaz: Sunt, quos curriculo pulverem Olympicum Collegisse iuvat\ oder wo selbst wegen des Metrums der Indicativ stehen muss? Beispiele gibt Heusinger I. c., wozu noch die kommen, wo das gleichartige est qui mit dem Indicativ steht. Beides ist sprachrichtig, sunt qui dicunt, und qui dicant: jenes die gerade, derbe Aussage, dieses mit einem Nebenhegriff: Etliche wollen sagen. Dieses Letztere, Sprechart des gemeinen Lebens, wurde auch in der Büchersprache das Gangbare, Gewöhnliche, und es kommt daher am häufigsten v o r ; es scheint auch an gewissen Stellen natürlich im Ton der Satire. Die Structur mit dem Indicativ scheint dagegen mehr dem ernstern Ton und der hohem Rede eigen zu sein. 91. et peierat, für sed tarnen. I, 74. et alget. 92—105. Selbstgespräch, sehr charakteristisch. Es ist wahrer f¡&tv.bgef;iliren li.it; neben sich hat e r ein Gemälde aufgestellt, wie er an der E r d e liegt, und der Karren mit dem r f o r d e ihm über den Fuss weggeht. 306. Licinus, ein Licinus, i, 109., Freigelassener des August, der grosse Reichthiimer e r w a r b ; Lips. ad Senec. E p p . p. 662., Fabric. ad Dion. L 1 V , 2 1 . Dazu das alte Scholion zu I , 109. von seiner Jugendgeschichte unter Julius Cäsar, unter dem er als Sclave bei der Armee diente, und sich diesem zuerst durch seine ,, I n d u s t r i e " bemerkbar inachte. Man findet den Kamen auch Licinius geschrieben, vermulhlich unrecht. 307. electmm, Bernstein, süccinum, nicht aber das dem Bernstein gleichfarbige Metall , nämlich Silber mit einem Fünftheil Goldes gemischt. Voss Virg. Lb. p. 663. Denn dass dieses damals zum Luxus verwandt worden sei , finde ich nicht; dagegen Bernstein zu kostbaren Gefässen, V, 38., und eleclrum in dieser Bedeutung auch noch bei Virgil und Ovid. 30S. ,,Der Cyniker in seinem Fass war glücklicher als Alexander". Dolium, nachher testa, irdenes Gefäss, aus gebrannter E r d e , nföoq, eigentlich eine grosse Vase. Zu b e merken ist: Juvcnal kannte schon nicht bloss die Sage vom Fass, sondern dass auch Alexander den Diogenes im Fasse liegend zu Korinlli sah. Plutarch, vita Alex., der die Anekdote erzählt, weiss nichts vom Fasse. Die Sage ist weltber ü h m t , aller doch nichts weiter als ein Witz der Griechen. Spätere Schriftsteller nehmen das Fass w ö r t l i c h , auch die Künstler, die den C j n i k e r leibhaftig im Fasse wohnend vorstellen. Juvenal benutzt die Fabel, wie Lucian de conscrib, • Historia, ohne sich um ihre historische Wahrheit zu b e kümmern. Aber eine Fabel ist das Geschichtchen ohne Zweifel. Ste Croix im Examen etc. (neue Ausgabe) liefert auf dem Titelblatt den Diogenes im Fass nach einer alten Vorstellung , und hat noch keine Ahnung von der Erdichtung. Auch Lessing in den Colleelaneen 1. Tb. v. Diogenes achtcte so wenig d a r a u f , als der gute Eseheuburg in de»
496
ERKLAER
UNG.
Zusätzen. Es gab untergeschobene Briefe des Diogenes, worin man ihn sagen liess, er habe sein Logis zu Corinth in einem •ni'Soz, cellula, Diog. Laert. VI. s. 23. Diess bezog sich auf rinen scherzhaften Ausdruck,'womit man seine schlechte W o h nung bezeichnete, als hätte man gesagt, „ e r wohnt in einem Mauseloch", und w a r eigentlich eine Anspielung auf eine Stelle im Homer, II. 6 , 387. Diess ist von mir weiter ausgeführt iin Prooemio zum Index scholarum 1806. 310. plumbo commissa, zusanimengelotet. W i r pflegen irdene Gefasse zu kitten, solidare, malthare; die Alten b r a u c h ten zur Ausbesserung Blei, p l u m b a t u r a , (xoh'ßömaig, V e r bleiung. Cato de Re R . c. 20. 21. und 39. und das. die A n merk., Düker de Lat. ICt. p. 241. 314. aequanda, comparanda, i . e . aeque magna, quam eius res gcstae erant. 315. Prudentia, w o f ü r 321. Sapientia. Die beiden Verse schon X, 365. 66. D o r t ist gezeigt, dass es nicht numen hohes, sondern ab est heissen muss, und dass vermuthlich auch weiterhin zu lesen: si adsit Prudentia, im Gegensatz von jenem abest. Der Sinn : „Reine Gunst der Götter fehlt uns, wenn uns die Weisheit zur Seite steht, wenn wir unsern Verstand gebrauchen : wir sind aber thöricht genug , lieber Alles vom Glück zu e r w a r t e n , unser W o h l s e i n , unsere Zufriedenheit von den Umständen abhängen zu lassen". W a h r scheinlich ist die Sentenz aus einem altern Dichter, aus einem Tragiker, entlehnt. An jener Stelle ist ihre Verbindung zum Uebrigen natürlich und einleuchtend.; hier greift sie weniger gut in den Zusammenhang. Die Rede ist von der Genügsamkeit, die allein glücklich macht; diese kann der Mensch sich selbst geben durch prudentia, durch die Macht seines Verstandes, und darf sie von der Gunst des Glücks nicht erwarten. Es steht in unserer eigenen Macht, uns vom Gluck unabhängig zu machen, wenn wir nicht mehr verlangen, als w i r wirklich bedürfen, und diess ist wenig. So schliesst sich das Folgende an: „Das wahre Maass des Besitzthums ist das
S A T I R E XIV, 308 — 329. Bedürfniss u n s e r e r N a t u r , tlie dvayy.uia
497
, und die Weisheit,
d. h . wer weise ist, f o r d e r t nie m e h r " . 3 2 2 . Das sind freilich herbe E x e m p e l , Diogenes, E p i c u r , S o c r a t e s ; dass man solchen n a c h a h m e n , sich nach diesen b e schränken s o l l ,
scheint dir zu viel v e r l a n g t l u r unsere Z e i -
claudere,
b e s c h r ä n k e n . Z u g e g e b e n : so b e g n ü g e dich
len.
a b e r mit einein massigen, anständigen V e r m ö g e n , strebe nicht thörieht ins U n e n d l i c h e .
e
ffi c e > c o m p a r a , summam,
cen-
sum e q u e s t r e m , die b e k a n n t e n 4 0 S e s t e r t i a ; I, 106. III, 1 5 4 . V, 132. 325.
„ Z i e h s t du
noch
d a r ü b e r Runzeln
und lässt das
Maul h ä n g e n , bist du damit noch nicht z u f r i e d e n " .
E s sind
A u s d r ü c k e aus d e r Mimik des Verdrusses. D e r Scholiast e r k l ä r t es schon sehr t r e f f e n d : „ S i displicet et tristem f a c i t " . Vgl. X I I I , 215. V a r r o R . Rust. 1 , 2 . fin. Huiusce
dolere , et in fronte
contrahere[ riigas.
tertia
' g e n , die man g i b t , sind falsch.
Jacere
pedes
solent
D i e übrigen D e u t u n eigentlich,
wenn
f ü r a d d e r e gesagt sein k ö n n t e : es ist a b e r so viel als effi-
cere, und folglich tertia
f ü r tria, n u m e r u s ordinnlis statt des
num. c a r d m a l i s . Aehnlich sexta
cervice I, 64. R u p e r t i : „ c e n -
s u m s e n a t o r i u m " . D i e s e r a b e r w a r bis a u f A u g u s t octingenta millia,
und w u r d e von diesem e r h ö h t a u f duodecies s e s t e r -
tium, 1 1 2 0 0 0 , nicht 1 2 0 0 0 0 . S u e t o n . Aug. 4 1 . vgl. V e s p a s . 17. 3 2 7 . gremium,
sinum vestis, t o g a e , der Bausch d e r T o g a ,
den d e r R ö m e r , w i e w i r die T a s c h e n , g e b r a u c h t , V I I , 215.
si panditur
etc. „ g i b t ' s R a u m
darin f ü r noch
grössere
Summen " . 329.
Narcissus,
Eunuch
und einer
der Freigelassenen
des K a i s e r s C l a u d i u s , ein College des Posides
oben 91.
Er
w a r a b epistolis, e r w a r b ungeheure R e i c h t h ü m e r , und liess im Namen des Claudius
die Messalina
e r m o r d e n . Seine G e -
schichte beim S u e t o n , T a c i t u s und D i o Cassius.
I'ol. II.
ERKLAERUNG.
498
FTJENFZEHNTE
SATIRE.
1. D a s Religionswesen d e r A e g y p t e r erscheint dem V e r fasser von der lächerlichen S e i t e ; b e s o n d e r s r ü g t e r den tollen C o n t r a s t : T h i e r e halten sie h e i l i g , und Menschen fressen sie!
Der Thierdienst,
alten Aegypten
ein Cultus d e r ältesten A r t ,
allgemein,
das Menschenfressen
w a r im
keineswegs.
D i e weiterhin erzählte Geschichte , die sich damals erst b e gehen hatte, w a r allerdings ein Rest von W i l d h e i t ; sie m a g a b e r theils sehr ü b e r t r i e b e n sein, theils ist sie ein ganz p a r tieller Z u g von Rohheit eines Volks tief in Aegypten, w o f ü r das ganze Aegypten
nicht v e r a n t w o r t l i c h sein konnte.
Der
S a t i r i k e r sieht ü b e r alles das w e g ; ihm ist die Geschichte des C o n t r a s t e s wegen w i l l k o m m e n .
K a n n es nun mit dieser D i e Reli-
ganzen S a t i r e bloss auf Aegypten abgesehen sein?
gion d e r A e g y p t e r h a t von den ältesten Zeiten an m e h r e r e Epochen gehabt;
in ihrer letzten E p o c h e d r a n g
sie in die
abendländische W e l t , v e r b r e i t e t e sich im Römischen Reiche, und n a h m grossen Antheil an d e r Mischung religiöser C u l ten,
die d e r A u f n a h m e und V e r b r e i t u n g des Christenthums
voranging.
S e r a p i s und Isis w a n d e r t e n nach R o m ,
i h r e T e m p e l sammelte sich
der Aberglaube.
scheint auf diesen Aegyptischen A b e r g l a u b e n
und um
Unsere Satire in
der Römi-
schen W e l t eine indirecte Reziehung zu nehmen.
D i e Nutz-
a n w e n d u n g folgt n u r a n d e r s ,
als man glauben s o l l t e ,
und
verliert sich in eine moralische R e t r a c h t u n g . D a d u r c h ist die T e n d e n z des Ganzen fast unkenntlich g e w o r d e n , und desswegen
gew issermassen verfehlt.
m u s s d a h e r auch diese S a t i r e
Als
Ganzes
eben
betrachtet,
den Dreisten a n d e r n
nachste-
h e n . D a g e g e n h a t sie im Einzelnen, d u r c h L e b h a f t i g k e i t der Gemälde, durch Witz
u n d S p r a c h e , vollkommen den Cha-
r a k t e r des, Dichters. 1—8. sind
D e r G t d a n k e u n d die W e n d u n g dieses Eingangs
nach Cicero
copirt,
Tuscul. V.
§. 78.
Aegyptiorum
SATIRE
XV,
1 —8.
499
morem qiäs ignorat? etc. Die Gegenstände religiöser Verehrung sind nicht überall in Aegypten dieselben; sie wechseln nach dem Local und den verschiedenen Völkern Unter-, Mittel- und Oberägyptens. Diese historische Verschiedenheit wird angedeutet, V. 3. ilis, der heilige Vogel der grossen Mutter Isis und von ihrem Dienste überall unzertrennlich ; daher auch auf dem berühmten Herculanischen Gemälde, die Isisfeier, Pitt. d'Ercol. T . II. tav. 6 0 . , vierfach im Tempel. Creuzer über ihn Mythol. u. Symb. 1.322., bloss nach Böttiger, Andeutungen S. 17. Alles fällt anders aus nach der wichtigen Untersuchung des Pariser Arztes und Archäologen Savigny, Histoire naturelle et mythologique de l'Ibis, 1806, mit der Anzeige im Magasin encyclop. 1806, Fevrier. Cuvier's anatomische Versuche gaben noch nicht die gewünschten Aufschlüsse; dessen Abhandlung im 20. Cahier der Annales du Museum d'histoire naturelle. Der heilige Ibis, den die Aegypter zur Mumie balsamirten, ist der "Wasservogel, den man in Italien Curli nennt, Falcinellus Linn. Herodot konnte nach damaliger Zeit nicht anders glauben, als dass er ausser Aegypten nicht fortkomme. E r kam aber in allen Ländern fort, wo der Isisdienst eingeführt wurde, namentlich in Italien. saluram serpentibus, nach der gemeinen Sage: der Vogel sei ein Wohlthäter der Nilländer, er befreie die Aecker von dem Ungeziefer, das von den Ueberschwemmungen des Nils zurückblieb. Diess ist aber, wie die übrige .fabelhafte Naturgeschichte des Ibis, nun von Savigny widerlegt. cercopitliecus (xtQy.og, cauda), der geschwänzte Affe, verehrt zu Theben oder Diospolis magna, in Oberägypten. Dort war auch der Localcultus des Memnon, Amenophis, Pamenophis mit der berühmten Memnonsstatue, die jeden Morgen beim ersten Strahl der aufgehenden Sonne wunderbare Töne hören liess; es waren Töne, wie von stark angeschla-, genen Sailen einer Cithara oder Lyra. Die Statue kannte schon das Alterthum nicht anders als verstümmelt, dimidio M., VIII, 4.
ERKLAERUNG.
500 1!.
„ W e l c h ein frommes V o l k !
tolles Volk, das Ziegenfleisch
Aber auch welch ein
nicht essen d a r f ,
aber Men-
schcnfleisch !'< Die zweite Exclamation ist nicht ausgedrückt, liegt aber offenbar im Gegensatz. 14. quum narraret — moverat, von
seinen Lästrygonen
sehr komisch: „ A l s Ulyss
und Cyclopen erzählte,
lief schon
einigen Phäakcn die Galle über".
quibusdam,
rischer Kebenzug: nur Einigen; denn
sie waren nicht Alle
gescheidt.
Jbrtasse,
16. aretalogits, am
liebsten
sine dubio, nach dem Atticismus i'aeog.
Suet. Aug. 74., w o August solche Leute
an seiner Tafel
Auiachluss gibt.
ein sati-
Sie gehören
hat;
Casaubonus aber
wenig
zur allgemeinen Gattung
der
scurrae (sequerrae), die in viele Unterarten zerfällt mit eigner ganzen Menge Namen, Sahnas, in Vopisc. p . 384. F , w o von mehrere den scurris der Bühne, den mimis, angehören. Bei den Griechen findet sich das W o r t nicht, nur UQtTukoyiui
beim Strabo und Manetho, mithin erst sehr spät. T u r -
nebus Advv. X , 12. will es lieber ableiten von « p f r d f , wovon aber nicht aretalogus
kommen könnte,
sondern aretologus.
tijTUQtzriaiiiäui ist eine komische Benennung der Philosophen in einem Epigramme bei Athenaeus IV. p. 162. B, w o m i t Casaub. die aretalogos den Mimen, Hofnarren
vergleicht. uQtToiköyoi. und ij&oiöyot
Es sind Tugendschwätzer,
in der neuern W e l t .
die mit ihren Tugenden prahlen, Aufschneider.
von
die Sittensprüche im Munde f ü h r t e n , wie die eine A r t Thraso, ula^oiv,
Das Richtigste Salmas, in Tertullian. p. 297.
V e r g l . Gesner Thes. Lobeck Aglaoph. p. 1317. 20. Cyanes ist corrupt. Ruperti hat drucken lassen Cyaneas, Apposition: saxa
Cyaneas. Da die Pariser Codd. Cya-
neis haben, so vertheidigt diess der Franzose auf eine lustige A r t ; die alten R ö m e r hätten gesagt: patreis,
sorteis,
darnach hätte Juvenal machen können Cyaneis
„noin. plur.
accus. (?) tert. decl. p r o CyanesHiernach eine ganz neue F o r m Cyanis, lind obendrein eine lange Sylbc
und
bekommen wir
die ein wahres Unding ist, in der Mitte!
Dausqueius
S A T I R E X V , 11 — 27. ad Sil. Ital. X I V , 515. liat emendirt saxa metri leges et xaxoipcövtog", Emendation
501
Cyanea,
„contra
sagt R u p e r t i . Beides falsch. Diese
ist die allein wahre, a fällt in die Cäsur
lind
w i r d d a d u r c h l a n g ; auch die Anfangsconsonanten des folgenden W o r t e s helfen mit verlängern ; eine seltenere Art d e r Position. 21.
tenui
verhöre,
Elpenora.
virga.
w i r d nach d e r Odyssee
nicht v e r w a n d e l t ;
Dieser gerade er
legt sich
in
der T r u n k e n h e i t a u f s D a c h schlafen, f ä l l t h e r u n t e r und b r i c h t den Hals. Diess wusste d e r V e r f a s s e r wohl so gut, wie w i r : e r g e h r a u c h t « h e r den Namen mit dichterischer F r e i h e i t f ü r jeden b e t r u n k e n e n G e f ä h r t e n des Ulysses. 25. G l o s s a e : Temetum, muss nicht in temtti
olvog naXuiog.
geändert werden.
minimum
temetum
Diu Richtigkeit d e r
C o n s t r u c t i o n ist von Heinecke p. 105. gezeigt. 26.
„ Ulysses erzählte diess Alles a l l e i n , ohne Zeugen ;
kein W u n d e r ,
wenn
eine T h a t s a c h e
von neulich , die keinem Zweifel
es keinen G l a u b e n f a n d .
Ich
erzähle
ausgesetzt
i s t " . D i e S a c h e w a r v o l l k o m m e n g l a u b w ü r d i g nach R o m b e richtet ; der D i c h t e r s a g t nicht, dass e r selbst sie in A e g y p ten erlebt h a b e ; u n d dasS vollends die S a t i r e geschrieben s e i ,
wie
noch D o d w e l l
vorstellt, ist völlig g r u n d l o s . hat augenscheinlich
eine
D a s quantum
ganz
früher g e m a c h t e E r f a h r u n g e n .
in Aegypten
in Annal. Quintil. sich
ipse notavi
45.
verschiedene Beziehung
auf
Völlig
so raisonnirt
schon
Salmas. E x e r c i t t . Plin. p. 3 2 1 . a. F . 27. Iunio,
z w e i s y l b i g , ist ohne allen Zweifel die rich-
tige L e s a r t , und alle V a r i a n t e n sind n u r - C o r r u p t e l e n des einzig Richtigen. Dahin g e h ö r t auch das lunco
in d e r Hustiiner
Handschrift, e n t s t a n d e n , a u s d e r A u s s p r a c h e l u n j o . Zwei lunii als Coss. dieses Zeitalters, einer unter D o m i t i a n , der andere
Q. Iunius
Rusticus,
a. U. 8 7 2 . , v. C h r . 1 1 9 . ,
mit Hadrian
zugleich, in dessen 3. R e g i e r u n g s j a h r . U e b e r dessen Abstammung und V e r w a n d t s c h a f t vgl. Reines. Epistol. a d H o f t m a n n . et R u p e r t , und
p. 2 1 7 .
Dodwell
F ü r diesen s p ä t e m w i r d von Sahnasius
cntschicdcn.
Drei
Jahre
d a r a u f ' w u r d e der
502
ERKLAERUNG.
Dichter im SOsten Lebensjahre aus Roin entfernt. Sollte der erstere Consul gemeint sein, so dass die Sutire unter Domitian geschrieben wäre: so miisste der Dichter sich wunderbar in seiner Gewalt gehabt haben , dass er so gar nichts von dem Ilaupthelden seiner Indignation mit einfliessen liess. Denn ohne gehörigen Grund wird abgenommen , er habe damals noch gar nicht geschrieben. W i r haben in. der Einleitung gezeigt, dass Juvenal schon seit 82, dem dritten Jahre des Domitian, zu schreiben anfing. Und wie, wenn gerade jenes scheussliche Zeitalter den Dichter zu der Betrachtung über die Unwiirde des Menschen veranlasste? Aber der Ton des Ganzen ist zu sehr gedämpft, zu ruhig und gelassen für jene frühere Lebenszeit des Dichters, und scheint allerdings die Gemütbsstimmung auf einer höhern Stufe des Alters zu verrathen. 28. Coptos calida, tief im Süden, in Oberägypten, Ko. nxög, auch KojiTtä, später lustinianopolis. Casaub. in Vopisci Probum p. 244. F . Ein sehr wichtiger Platz für den Welthandel ; von da ging der Handel aus Arabien und Indien auf dem Nil nach Alexandria, super, oberhalb, d. i. südwärts von Coptos: oben ist im Süden. Zwischen Tentyra und Ombi war der Streit. Diese heissen hier Grenznachbarn, Jlnitimi 33. und vicini 36. Das streitet aber iganz gegen die Sache, indem Ombi gar nicht an Tentyra grenzt, sondern vielmehr südwärts liegt, und Tentyra unterhalb, d. i. nördlich. Davon nachher. Die von Tentyra schlagen die von Ombi, und verfolgen sie, V. 76., bis sie einen der Fliehenden einholen, super moenia Copli. 30. syrmata, V I I I , 229. gumenta tragoediarum.
Tragische Schleppen, für ar-
33. Zwei benachbarte Völkerschaften befehden einander aus Religionshass. Die Tentyriten, geschworne Feinde und Verfolger des Crocodils (Aelian. H. An. X, 21. und die clas-r sische Stelle Strabo p. 814. D), fallen über ein Volk her, bei welchem der Cxocodil heilig ist, die Onibitenf die vor allen
S A T I R E X V , 27 — 33.
503
am meisten von diesem Thiere halten, und daher auch von Âclian 1. c. den Tentyriten entgegengesetzt werden. Dergleichen Religionsfchden gab es unter den Völkerschaften Aegyptens viele; Dio Cass.XLII, 33. §. 150. mit der Aninerk. Casaubon. in Spartian. p. 23. F . Ein Beispiel aus seiner Zeit, beinahe gleichzeitig mit Juvenal, erzählt Plutarch. de Is. et Osir. T . I I . p. 380. B. von den Einwohnern der Städte Oxyrhynchus und Cynopolis in Mittelägypten, die durch Römische Gewalt auseinander gebracht wurden. Hier entsteht nur ein wichtiges Bedenken, wie Ombi und Tentyra benachbart heissen können, da sie so beträchtlich weit auseinander liegen und fünf ganze Nomen (Pnifecturen ) zwischen sich haben. Die Ombiten waren Crocodilstliener : aber andere den Tentyriten näher liegende Völker waren es auch ; Crocodilopolis lag ihnen sogar näher : warum fielen sie gerade über das entfernteste Volk her, und wandten sich mit ihrer Wuth nicht an die Nähern, ebenfalls Anbeter des Crocodils? Und wie kann der Dichter sagen, die Affaire sei super Coptum vorgefallen, da, wenn er die Ombiten im Sinne hatte, und diese nach Coptos hinunter flohen, die Scene nothwendig infra war. Dieses Bedenken ist zuerst von Salmasius erhoben und umständlich auseinandergesetzt Exercilatt. Plin. p. 318. und 321. E r sucht sich zu helfen mit der Vermuthung: Juvenal spreche vielleicht von derselben Geschichtc, die Plutarcli erzählt; die Namen der Völkerschaften könne er .willkührlich anders gewählt haben. Dass aber damit nicht durchzukommen , fühlte Salmasius selbst, und schliefst mit den Worten : „Haec aliter expediant alii , virique per me s u n t o " . In den neuesten Zeiten haben fünf gelehrte Franzosen die Sache besprochen. Einer vertheidigt die Stelle, vier erklären sie für corrupt und geben auch zugleich die Emendation. Die Debatten, erzählt'Achaintre in einer kritischen ¡Vote. Sonderbar nur, dass dabei von Salinasius mit keiner Sylbe die Rede ist, und dass einem Uebcrsetzer Dusaulx ( 1 8 0 3 schon die 4tc Aufl. ) fälschlich die Ehre
504
ERKLAERUNG.
beigelegt wird , zuerst den Knoten entdeckt zu liabeo; ferner, dass die Emendation auch schon gemacht war, nämlich von de Pauw in den Rech. philos> sur les Egyptiens et Chinois. Grund zum Emendiren ist allerdings da; eine solche Verwirrung in ganz bekannten Dingen, wie der jetzige Text enthält, rührt wohl schwerlich von dem Verfasser selbst her. Und dennoch müssen wir dieses, auch gegen alle W a h r scheinlichkeit, glauben, wenn auf keine Art zu helfen ist. Aber die Hülfe wird uns geboten. V. 35. soll der Fehler liegen. Viele Codd. haben schon Combos, auch die Ilusumer; es war entstanden aus Comptos, welches nur eine andere Aussprache ist von Coptos. Dieses hielt ebenfalls den Crocodil heilig, Aelian. H. An. X, 24., und liegt Tentyra ganz nahe, nämlich schräge über am andern Nilufer. Hiermit halten die Franzosen die Sache für abgethan; Coptos et Tentyra hat der Pariser Herausgeber im Texte. Hierbei verfahren sie aber ganz schlau : sie setzen stillschweigend die Form voraus Copti, orum, da docli eine solche Form nicht existirt, sondern nur Konto; bei Strabo , Aelian. u. A. Es miisste also wenigstens Copton heissen: dadurch verliert aber die Emendalion wieder einen Theil ihrer Wahrscheinlichkeit. Ferner schweigen sie ganz vom obigen super moenia Copti V. 28. Wenn der Angriff auf Coptos geschah , so ging die Scene nicht vor super Coptum, nicht südwärts von Coptos, sondern infra, nordwärts. Tentyra liegt unterhalb, nördlich von Coptos. Der Pariser Herausgeber meint, es möchte vielleicht ( f o r t e ) zu verstehen sein sub moenia urbis, und zwar nicht ihre eigene Stadt, sondern die jenseitige, am andern Nilufer, contra Copton genannt, wohin die Geschlagenen geflohen wären. Das ist unlateinisch und thöricht zugleich : super ist nicht sub, und da nur Coptos hier genannt wird, wie kann dann nicht Coptos verstanden werden? W e r moenia Copti sagt, meint Goptos, und nicht contra Copion ; und es kann offenbar jenes eben so wenig für dieses gesagt werden, als Paris für Strassburg, Wie - weit haben uns also die
S A T I R E XV, 33 — 61.
505
fünf gelehrten Franzosen, Dusaulr, Brottier, Barllielemv, Larcher und Achaintre, mit dem sechsten Gehülfen dePauw, gebracht? Keinen Schritt weiter, als wir schon mit Salmasius waren. Zuletzt werden wir uns doch wohl noch b e q u e men müssen, Ombos stehen zu lassen, die Variante Combos für einen Schreibfehler zu nehmen, und zu bekennen, dass der Dichter hier nicht streng topographisch gerechtfertigt werden kann und die Verwirrüng wohl selbst veranlasst hat. Die Ombiten sind als Crocodilsdiener das bekannteste Volk Aegyptens; die Tentyriten hatten mit einem weniger bekannten Volke Streit, tind statt dessen verfiel der Dichter auf die berühmtem, ihm daher mehr geläufigen , Ombiten. Inter finitimos — Ombos et Tentyra hängt ganz ordentlich zusammen. Dass der Zwischenvers, der so gut ist, wie alle andern, ein pannus versificatoris sein soll, ist ein blosser Einfall Ruperti's. 35. Die Stelle Summus utrinque — ipse colit. Sed betrachtete mein Schüler und Freund, J o . Val. Francke, als ein Einschiebsel, das nicht vom Verfasser der Satire herrühre ; und allerdings erhält so die Rede bessern Zusammenhang. 38. Die Angreifer warten die Zeit a b , wo das Nachbarvolk gerade ein Fest feiert; wahrend der Feier machen sie ihren Ueberfall. Die Sprache bis V. 44. ist meisterhaft. 45. est Coptus für Aegyptus wollte Markland Explicatt. vett. aliquot auett. p. 267. Aber der ganze Satz von Ilorrida — titubanlibus ist eine Betrachtung, die eher für einen Klosterphilosophen p.asst, als für den Satiriker. Der Ruhin, die Un'achtheit dieser Verse zuerst ¡aufgedeckt zu haben, gebührt gleichfalls Francke. 51. Der Streit wird mit wörtlichen Beleidigungen begonnen; dann koinmt's zur Schlägerei: a verbis ad veibera. tuba für prineipium. III, 288. prooemia rixae. 61. quo tot millia als Accusativ. VIU , 90. effigies quo tot bellatorum ?
506
ERKLAERUNG.
64. domestica sedilioni , i. ipsis -domestica , consucta , in seditione. Sie fechten wie Wilde. Vergl. H ö r . S. I, 3, 99. f. 71. riefet et odit. Beides verträgt sicli nicht: et steht offenbar f ü r aut. Vorher V . 15. bilem aul risurn. 73. aueti, nicht O m b i t a e , wie Ruperti. aueti und pars altera ist ein und dasselbe Subject. Der K a m p f war bisher von beiden Seiten gleich; die eine Partei erhält aber V e r stärkung, und treibt die andere in die F l u c h t ; das sind die Tentyriten, V . 76. Diese waren also auch die subsidiis aueti. 75. terga praestantibus, i. dantibus, praebentibus. Mau will ä n d e r n , aber falsch. Tacitus sagt genau so Agric. 37. armatorum paucioribus terga praestare. Aber fugae kann als Dativ des Objects unmöglich Statt finden; es rnuss durchaus fuga (statt in f u g a ) heissen, mit Cod. Husum, und den P a riser Handschriften. E i n Objectscasus wird gewiss nicht nothwendig e r f o r d e r t ; man sagt terga dare mit und ohne hosti. Dennoch billigt Salmas. Exercc. p . 3 1 3 . die Conjectur eines Gelehrten: praestant instantibus Ombis, und zeigt, dass Ombi eine richtige F o r m ist für Ombitae. Diess verändert das ganze Verhältniss; die Tentyriten sind nun die Geschlagen e n , die vor den Ombiten das Reissaus nehmen; diese die victrix turba 8 1 . , die ohnweit Coptos die scheussliche That begeht. Die subsidiis aueti 73. müssten dann auch die Oinbiten sein, die eben dadurch die Mittel zum Siege erhielten. Man sieht bei allem dem nicht, welches die angreifende P a r tei ist, die Ombiten oder die Tentyriten. D e r Erzählung- des Dichters fehlt es an der Genauigkeit, die man wünschen möchte; um so mehr ist es g e w a g t , hier nach blosser Conjectur an der Lesart zu ändern. • 76. Tentyra liegt in der Nähe eines Palmenhains, palma für das collective palmetum. Die Länder des Orients, besonders Aegypten und J u d ä a , sind reich an Palmen utyl Palmenwäldern. 77. hinc, ex his, ex hac parte, von der letztern Seite. Das sind aber nach unserer Lesart die im Verfolgen begrif-
S A T I R E XV, 64—110.
507
fenen Sieger, und der Unglückliche gehört zu den Fliehenden. liinc also ex altera parte. 93. Vasconts, in der Griechischen Aussprache mit langem o, eine Verschiedenheit, die gerade in diesem Fall nicht viel auf sich hat und zu keiner Aenderung berechtigt. Derselbe Fall findet bei Britones Statt. Die Vascones, eine Völkerschaft in Spanien, am rechten Ufer des E b r o , mit der Stadt Calaguris, heutiges Tages Calahorra in Neukastilien. Diese Stadt hing dem Sertorius an, und hielt noch nach dessen Tode mit der äussersten Hartnäckigkeit eine der schrecklichsten Belagerungen aus, zwischen 72. und 73. v. Chr. fn der verzweifeltsten Hungersnoth sollen die Belagerten ihre Weiber und Kinder gegessen haben. Valer. Max. VII, 6. bellorumq. ultima (et) casus extr. ist zu verbinden, nicht etwa invidia ultima. Der Sprachgehrauch wie XII, 55. discriminis ultima, tu HAYUTU , TU eo/UTTÖTUTU. 99. post lierbas i. cotnesas, ¡.itiu ßoTUva, eine Art elliptischer Gebrauch, auch mit ante. In einem Griechischen Epigramm erblasst Pandora ¡j.tT(t näf.iu. Burm. ad Lucun. V, 473. und VI, 145. Boissonade in Philostr. p. 429, 104. Viribus sucht man zu erklären , aber vergebens. Urbibus haben neuere Eclitt. und die neueste Pariser nach vier Codd. Diess wäre zur JVoth passend, aber überaus matt. Beide Lesarten scheinen durchaus unäclit, und müssen aus einer gemeinschaftlichen Quelle herrühren ,, aus einer alten Abbreviatur Utribus, welche hätte gelesen werden sollen Venl ribus. 109. Q. Metellus Pius, der den Krieg gegen Sertorius in Spanien führte. anliquum ist für den Römer dieser Zeit Alles, was noch in die Zeiten des Freistaates fällt; Cicero gehört für den Juvenal schon zu den anlir/uis. Mit den Cäsarn begann eine neue W e l t , in jeder Rücksicht. 110. „Die Cultur Griechenlands und Roms wird jetzt schon allgemein". Der Dichter nennt insbesondere die Redekunst, weil diese ohne Litteratur und Philosophie nicht
508
ERKLAERUNG.
sein kann , und nach Römischer Ansicht als die Spitze der Cultur betrachtet wird. 113. ff. „Jene heroischen Völker, Vasconer und Sagunt e r , verdienen Entschuldigung durch ihre Lage. Auch die Taurische Göttin ist weniger unmenschlich ; sie fordert nur Opfer, aber ohne Grausamkeit. Sagunt maior clade, härter behandelt vom Sieger, Hannibal; zerstört. Calaguris liess der Römische Sieger doch stehen. tale quid excusat, excusabile'facit, in tali re excusationem habet. Maeotide etc. In der Taurischen Chersones (der heutigen Krimm) war im hohen Alterthum der Dienst einer wilden Gotlheit, die mit Menschenopfern versöhnt werden musste; die Griechen nannten sie Artemis, die Scythische Diana; bekannt aus der Mythologie der Iphigenie. 119. Quis modo, für tarnen. Sallust. Cat. 39. extr. quod modo hello usui Joret. Vgl. das. C o r t e , und Gesner Thes. in v. nr. 3. 122. Die Ausleger tappen im Finstern aus Unkunde der Sprache, invidiam dii's facere ist ein eigentümlicher Ausdruck, wenn die Schuld einer That oder eines Leidens dergestalt auf die Götter gewälzt wird, dass sie als Urheber Tadel verdienen, und auf sie ein Hass, eine invidia, fällt. Diess ist gezeigt, doch mit Ucbergehung der hiesigen sehr deutlichen Stelle, von Cuper Observatt. II, 4. p. 182. sq. Tertullian. de leiuniis p. 553. D. saccis velati et einer* conspersi idolis suis invidiam supplieem (lies supplices) obiieiunt. Falsch Laccrda Advv. sacr. c. 123. n. 2. Wenn also, du alle Fruchtbarkeit Aegyptens vom Nil abhängt, bei ausbleibender Ueberschwemmting und daher entstehender Hungersnoth die Menschen aus Verzweiflung sich selbst verzehrten: so fiele die Schuld dieses Greuels auf den Nilgott zurück, invidiam Jacerent Nilo. Der einfache und einzige Sinn ist also: „Könnten sie es ärger machen , wenn eine Dürre sie in die äusserste Notli versetzte?" Ruperti hat natürlich nichts verstanden ; der Pariser Herausgeber hat sich mit einer neuen Erklärung in
S A T I R E X V ; 1 1 0 - 127.
509
Unkosten gesetzt, die aber auch schlechterdings nichts taugt, Aller Sinn des Alterthums und seiner Werke geht von den Sprachen aus ; wer diese nicht versteht, kann nichts verstehen. 124. Brilones lesen alle Handschriften: denn auch Bistones ist keine Lesart, sondern ein Irrthum, entstanden aus der verkürzten'Schreibart Btones. Markland will Teutones lesen, weil Cimbern und Teutonen immer zusammengenannt würden. VIII, 249. Cimbri und keine. Teutonen. Der Grund zur Acnderung ist durchaus nichtig. Britones sind Britanni, und stehen hier iure suo in der Reihe wilder Völker ; das waren sie in der damaligen Zeit. Sauromataeve ist auch eine unnöthige Aenderung: que folgt auf nec, wie nec—et, wo beim. zweiten Salz die Negation repetirt werden muss. Zu VIII, 241. XIII, 44. 126. imbelle et inutile vulgus : die allgemeine Vorstellung , die in der Römischen Welt von Aegyptern herrschend w a r , zumal nach der Schlacht von Actium, wo man die Aegypter mit der Cleopatra verachten gelernt hatte. Das Volk war unstreitig in tiefem Verfall, empörte sich oft unT ter Römischer Herrschaft, aber ohne Kraft und Ausdauer, und wurde immer gar leicht zur Ruhe gebracht. 127. Spottende Beschreibung einer sonderbaren Wasserfahrt , wie sie in armseligen Kähnen von gebrannter Erde und bemalt, wenn das Land unter Wasser steht, einander Besuche machen. Die irdenen Kähne bestätigt auch Strabo p. 788. D. vgl. Salmas. Exercitt. p. 785. F . Voss Virg. Lb. p. 831., wo eine Uebcrsetzung der beiden Verse steht, im pomphaften, daher verfehlten Ton. Die Franzosen in Aegypten unter Bonaparte sahen ganze Flösse den Nil herabfahren, die aus sinnreich miteinander verbundenen irdenen Häven bestanden, deren OefTnung nach unten gekehrt war, und die von der Luft im Innern der Häven über Wasser gehalten wurden ; sie waren mit Matten belegt, um darauf zu ruhen, und ein Steuerruder war daran befestigt. Memoiren
510
ERKLAERUNG.
des Herzogs von Rovigo ( S a v a r y ) , - C a p . 8. remis ines sieht lächerlich a u s , wie sich die Schwächlinge cumbere: anstemmen, die Scherbe aus der Stelle zu bringen. brevibus, mit erbärmlichen kurzen Stummeln von Rudern ; scheint Voss gar nicht verstanden zu haben: „ D a s — die hemalete Scherl)' andrängt mit kürzeren R u d e r n " . 130. in qnorttm niente etc. „ d i e eben so fressbegierig als wüthend sind, die in der Wuth einander aufessen". 131. f. Eine höchst ernsthafte Betrachtung, mit grosser "Würde durchgeführt. Dadurch dass die Natur dem Menschen die Tliräne gab > wiess sie ihn hin auf seine Bestimmung, mild und menschlich zu sein. Das Weinen ist ein Vorrecht des Menschen; kein anderes Geschöpf kann weinen. 134. causam dicentis amici squaloremque rei. Wie kann das richtig sein? Achaintre hilft sich; er e r k l ä r t : casum amici causam dicentis et squalorem rei. E r schiebt also stillschweigend ein Substantiv e i n , welches nicht da i s t , und nimmermehr supplirt werden kann. Es scheint, man hat bei dieser Lesart sich verbunden gedacht causam squaloremque, und dicentis für sich. Der Cod. Hus. hat so über dein W o r t e dicentis die Erklärung „defendentis s e " , als könnte dicere allein so gesagt werden : weinen über die causa des amici dicentis. Diess ist wahres Unlatein. causam ist durchaus nur der Accusativ zu dicentis; plorare stände mithin ohne Beziehung. Man könnte darauf verfallen, zu (verbinden plorare amici, naqh Griechischer Construction, d i e l l o r a z gewagt bat E p o d . extr. Plorem artis, ,in te nil habentis exituni. S. W u n derlich Observatt. critt. p. 124. Daran aber kann der Dichter hier nicht gedacht h a b e n , da er die Accusative folgen hisst, squalorem, pupillum. Hier bieten die Codd. H ü l f e : viele haben lugentis , und einige casum. Diess gibt die lichtvolle und ohne Zweifel ächte L e s a r t : Plorare — casum lugentis amici. Virg. Aen. 11, 93. Et casum insontis mecum indignabar amici. Es sind zwei verschiedene Gegenstände: das U n g l ü c k , welches ein trauernder F r e u n d erlitten, und der
S A T I R E XV, 127 — 136.
511
Letrükle Aufzug des Freundes, der unschuldig verklagt ist. Oder es ist vielleicht besser, die beiden Sätze in Einen Gegenstand zu vereinigen: das Unglück eines Freundes, der unschuldig angeklagt ist, und sein rührender Aufzug vor Gericht, casum lugentis amici rei squaloremque. Die Bestimmung ,,unschuldig verklagt" wird, wie Aehnliches in ähnlichen Fallen, aus dem Ganzen leicht supplirt. Dem verklagten Freunde gegenüber steht der verklagende Mündel, der Recht sucht wider einen betrügerischen Vormund. Dieser Gegensatz zeigt, dass es wirklich besser ist, das Vorige als ein einziges Bild zu nehmen ; so nur kommt ein gehöriges Ebenmass in das Ganze: nicht zwei Bilder gegen eines, sondern Bild gegen Bild. Die Copula que ist alsdann in ihrer Ordnung, und zu pupillian ist kein Bindewort näthig. Heinecke hat hier gar nichts verstanden, p. 42. circumscriptorem, wie Juvenal an zwei Stellen sagt circumscribere pupillos, auch Cicero in der Bedeutung von defraudare. Clav. Ern. s. Circumscribere und Circumscriptio. Drei Bedeutungen hat das Wort, die man angibt, aber nicht abzuleiten weiss, und daher auch in allen Lexx. wild durcheinander wirft. Diese müssen so aufeinander folgen: 1) c o ercere, 2) e medio tollere, 3) defraudare. Die nämlichen Bedeutungen hat auch nEQiyQuq>tiv, dem es aber eben so ergeht in den Griechischen Lexx. und bei Heyne ad Epictet. 3 3 , 7 . Circumscribere, negiyguiptiv, ist circumducere, eine Gewohnheit iin Schreiben, dass man ein W o r t oder mehrere rundum mit Strichen oder Puncten einschliesst, zum Zeichen, dass sie nicht mit gelesen werden sollen. Diess ist die gelindere Art, wie man etwas Geschriebenes ausstrich, und findet sich noch oft in altern Handschriften. Die derbere Art ging quer durch's Wort oder die Zeile, perscribere, öiayQd(psiv. Aus dieser zweiten Art entstand derObelus, ein Querstrich, yQUf.iixrj, am Rande, der sagen wollte: hier ist etwas auszustreichen ; wenn man im Texte nicht selbst streichen wollte, oßtlög, veru, auch - ÄO^J; , hasta, woher das falsche
ERKLAERUNG.
512
Z e i c h e n des Obelus entstanden i s l : - ^ — .
D e r ächte Obelus
ist nichts als eine horizontale L i n i e :
.
nun,
Circumscribere
eigentlich von d e r S c h r i f t , wenn es a n g e w a n d t w i r d
auf andere Gegenstände, c e r e ; C i c . Senalus
heisst ü b e r h a u p t i n c l u d e r e , c o e r -
praetorem
circumscripsit,
B e t r a c h t e t von d e r S e i t e
hat eingeschränkt.
seiner W i r k u n g ,
b e d e u t e t es d e -
lere, und allgemeiner von j e d e r S a c h e , e m e d i o t o l l e r e . Cic. V e r r . 1 1 1 , 1 6 . hoc omni
cumscripta.
tempore
Sidlano
ex accusalione
cir-
A s c o n i u s : ,,sublato, c i r c u m d u c t o , ac ( f ü r id est,
w i e bei den Griechischen G r a m m a t i k e r n x a t gewöhnlich ist, l u r tovTsari)
p r a e t e r i n i s s o " . D a s mittlere W o r t weist g e r a d e
hin a u f den U r s p r u n g d e r B e d e u t u n g .
Von der Bedeutung
delere s t a m m t endlich die d r i t t e a b : f r a u d a r e , d e e i p e r e , eigentlich B e t r ü g e r e i e n in gerichtlichen D o c u m e n t e n m a c h e n Ausstreichen von W o r t e n ,
Zahlen , Namen.
durch
Forcellini be-
s c h r ä n k t diese B e d e u t u n g g a n z richtig auf fallacias forenses, d. b. solche, werden.
nen G r u n d gend.
wo v o r G e r i c h t gültige D o c u m e n t c v e r f ä l s c h t
E r sieht a b e r bloss a u f die Stellen, u n d weiss kei-' anzugeben. — D e r P u p i l l r ü h r t durch seine J u -
D e r A u s d r u c k ist s e h r schön, h e r g e n o m m e n von der
Sitte, dass d e r J ü n g l i n g das H a u p t h a a r bis zu gewissen J a h ren lang wachsen l ä s s t ; erst dann' w i r d es m i t F e i e r l i c h k e i t a b g e n o m m e n und d e r G o t t h e i t d a r g e b r a c h t , III, 1 8 6 . b e d a u e r t e Mündel ist noch s e h r j u n g , i n t o n s u s ; chenhaftes, m ä d c h e n h a f t langes H a a r , capilli
putllares,
sein verweintes Gesicht k a u m u n t e r s c h e i d e n , faciunt dubia, a m b i g u a ,
Diesem
sein m ä d lässt
incerla,
o b es ein M ä d c h e n - o d e r Jünglingsgcsicht
ist. D i e I d e e d r ü c k t H o r a z aus in den bekannten Versen O d . II, 5. Quem si puellarum
hospites Discrimen Achnliche
insereres
obscurum
Dichterstellen
sind häufig.
diese zweideutige S c h ö n h e i t , stellt im Ideal
choro, TVLire sagaees
solutis Crinibus
ambigitoque
vultu.
D a s A l t e r t h u m liebte
und die K u n s t
des sogenannten
falleret
hat sie d a r g e -
Hermaphroditen,
incertus,
a m b i g u u s , d^qiißoXog , d u r c h Beispiele e r l ä u t e r t von M a r k land ad S t a t . p . 113. D e r P u p i l l steht hier zu G e r i c h t w i d e r -
S A T I R E XV, seinen Vojfmund.
136—159.
W e n n ein Pupill
513
wider seinen Vormund
Klage hatte , so wurde ihm ein tutor Praetorius oder P r a c torianus
bestellt,
nämlich
durch den P r a e t o r Urbis:
nach
späterrn Römischen Rcclite ein curator, der nach ausgemacht tef Sache wieder abtrat. Iustiu. Institutt. I, 21. §. 3 . 140.
minor igttc rogi,
i. e. minor quam ut cremari fas
srt. Verstorbene neugeborne Kinder wurden begraben, • niemals auf dein IIolzstos& verbrannt; Plinius.
face
arcana,
bei keinem V o l k e ,
sagt
Werth der Eleusinischcn Weihe.
Ceres , die Gottheit der Eletisinien, ist Ideal sittlicher Reinh e i t , V I , 50. fünfte Tag Daduchie,
Die Fackel
dichterisch für die Weihe.
Der
der Eleusin ¡sehen Mysterienfeier ist eine grosse TJ TWP
XAFTNAÖCOP
YFISFIU
brennende F a c k e l n , Saäov/tiv
TU
: die Eingeweihten tragen Ein
¡UVOTTJPIA.
ähnlicher
Ritus gehört zur grossen Frohnleichnamsfeier der Katholiken', wobei
in der Prozession brennende Wachskerzen
getragen
werden. Das Christenthum hat diesen ünd andere Gebräuche aus der Griechisch-Römischen Religion aufgenommen. Rciske ad Constant. Porphyrog. Ceremon. p. 19. a. 147. ff. „ D e r Schöpfer des Thieren und Menschen gemeinsamen Alls verlieh den Thieren Seelen, dem Menschen Geist, die Kraft, die denkt und fühlt; er bestimmte die mit Geist begabten Metischen zum geselligen, menschlichen L e ben
Hier ist der philosophische Begriff des Menschen als
£töov nokixixbv
überaus schön ünd mit acht dichterischer
Beredsamkeit dargestellt. 159. ff. „ W i e schrecklich hat sieb der Mensch von seiner ursprünglichen Bestimmung entfernt!
In geselliger V e r -
träglichkeit soll sich die Menschheit
fordern,
Menschen hassen , verfolgen, tödten
sich in
Kriegen;
entwickeln: mörderischen
nicht so wiithet zerstörende Zwietracht unter gif-
tigen T h i e r e n " .
Die ganze Stelle hat den gemässigten Aus-
druck gerechter Indignation, und es ist die wichtige B e t r a c h tung,
die fast unwillkühilich dariiuf f ü h r t ,
dass es in der
W e l t nicht immer so kann gewesen sein, dass die Mensphheit Vol. II.
33
K R K L A ERLING.
514
einst einen Lessern, ihrer moralischen Natur gemässern Z u stand gehabt haben rmiss, und der jetzige Zustand der Unnatur, der Zwietracht, Verfolgung und Zerstörung nur V e r fall der Menschheit und Abfall von Gott und der Natur isl. Dahin deuten alle alten Sagen, tung vom Paradies der Griechen
die schöne , sinnvolle Dich-
und dem Sündenfall,
und- der Mythus
vorn goldenen Weltalter und den darauf fol-
genden immer schlechtem Altern. 166. (juiun, die Yulgata;
quum tarnen, quanquam.
nescierint
die zusammengezogene F o r m nescirint
ist
scheint
allerdings für das Zeitalter des Dichters die richtigere , wie längst zu Cicero's Zeit die Formen nescissem, audissem, allgemein üblich w a r e n ,
und auch von uns im acht Lateini-
schen Stil nur gebraucht werden sollten. scirint
gesprochen
und geschrieben,
ad l'lin.Epist. p. 1 3 8 . ; sirit für siverit Liv. X X X I V , 24.
Diese f o r m e n
So wurde
nicht scierint.
auch
Schäfer
restituirt Gronov. bei"
sind in Handschriften oft
mit dem Imperfectum verwechselt, wie De corr. Eloq. c. 33. noch scirent scirint.
steht,
wo durchaus ein Praeteritum sein rniiss, '
So haben auch hier nicht wenig Codd. nescirent,
übrigens hier auch gut wäre.
gladios
extendere
was
ist das
W a h r e , für proeudere. Bentley ad Ilorat. Epist. I I , 1 , 240. Andere leichtere Varianten sind blosse Glosseme. 171. crediderint,
„glauben wohl g a r " , possunt credeie,
ein qiodus potcntialis: daraus sind die falschen Lesarien entstanden crediderant
und
crediderutit.
SECHSZEHNTE
SATIRE.
Auf dieser Satire, die den Beschluss der ganzen Sammlung macht,
ruht schon längst der Verdacht,
dass sie den
Juvenal nicht zum Verfasser hat. Es ist eine Frage der h ö -
SATIRE
XVI.
515
liern K r i t i k , viel d a r ü b e r von j e h e r hin u n d her gesprochen, a h e r bis jetzt durchaus nichts entschieden. Domitius Calderinus (im 15. J a h r h . ) b e m e r k t e z u e r s t , diiss in alten Handschriften diese S a t i r e v o r der löten vorübergehe ; diess sei r e c h t ; d e r D i c h t e r h a b e sie gleich nacl¿ seiner V e r b a n n u n g zuin L o b e des Kriegsdienstes geschrieben, um den P a r i s damit zu ä r g e r n . Dieses Argument aber b e r u h t auf schwachem G r u n d e , was die Vevbannungsgeschichte b e t r i f f t , und ist falsch in Ansehung des P a r i s , der an der angeblichen V e r b a n n u n g keinen Theil haben konnte, weil e r schon t o d t war. Es müsste wenigstens ein a n d e r e r , u n b e k a n n t e r Histrio u n t e r Hadrian gewesen sein. O u d e n d o r p z u r Vita Iuvenalis. E s ist a b e r höchst wahrscheinlich, dass Calderinus sein ganzes Urtheil bloss einem Scholion in einer seiner Handschriften nachschrieb. D e n n völlig so lautet das Scholion e Codice C. Barth i i , Adverss. X I V , 16. V a l l a , 17 J a h r e spater, bezeugt, wie R u p e r t i sagt, in der altern Handschrift sei diese Satire g a r nicht v o r h a n d e n ; dasselbe sagt Lubinus , weiland zu Rostock ( 1 6 0 3 ) , mit d e r Nachricht : Jos. Scaliger habe ihm mündlich die Satire f ü r acht e r k l ä r t . F ü r uuächt w a r sie schon e r k l ä r t w o r d e n von Angelus D e ceinbrius, Politiae L i t e r a r i a e P a r t . I. p. 5 9 . Basil. 1572. 8,, erstlich wegen d e r „stili r a t i o " , u n d zweitens, weil sie f ü r den Juvenal g a r zü k u r z sei ; w o r a u f Cren. Animadvv. p h i lol. et bist. P . V. p. 113. e r w i e d e r t , in Ansehung des ersten P u ñ e t e s sehr v e r s t ä n d i g : d e r G r u n d w ü r d e viel Gewicht haben, „si explieuisset", auf den zweiten sehr n a t ü r l i c h : die D i c h t e r pflegten w o h l auch manchmal k u r z zu schreiben. Besonders wichtig ist das Scholion P i t h o e i : „Ista a plerísc/ue explodilur, et dicitur non esse Iuvenalis". Das "war also das Urtheil der meisten altern K r i t i k e r , der f r ü h e r n Verfasser alter Scholien ü b e r den Juvenal. Die Notiz ist g e r a d e so, wie h u n d e i t m a l in den Scholien zum H o m e r , ohne G r ü n d e . D e r vornehmste G r u n d w a r a b e r auch hier u n s t r e i t i g , weil sie in manchen angesehenen Handschriften fehlte. Entschie-
51ö
ERJC L A E R U N G .
xlen ist aber damit an und f ü r sich noch nichts; n u r dann w ä r e das' Fehlen in den Handschriften entscheidend , wenn es schlechterdings die ältesten gewesen w ä r e n : davon wissen w i r aber nichts. Gelehrte von Gewicht drücken sich seitdtm über den Verfasser behutsam aus , w i e Grotius ad L u c . III, 14. „luvenalis aut quisquis e s t S c r i p t o r S a t y r a e de commodis m i l i t i a e " ; Rutgers. Vav. Lectt. IV, 4. absprechend: „ S a t y r a X V I . ignoti poetae, nihil enim minus, quam l u v e n a l i s " ; und nichts w e i t e r . Ritter Barth 1. c. f ä l l t g a r kein Urtheil, wie denn dieser R i t t e r mit manchem andern gemein-hat, dass e r überhaupt w e nig urtheilt. M e h r e r e andere unbedeutende Stimmen kommen in keinen Betracht; doch soll, nach Schurzfleisch, auch Dempster. ad Corippum p. 137. die S a t i r e f ü r acht halten. Der vollgültigste Richter w ü r d e J . Scaliger sein, ein grosser K r i t i k e r , vom stärksten U r t h e i l : aber auf die p a a r W o r t e , die e r b e i läufig dem Lubinus s a g t e , ist wenig zu bauen. Es ist w a h r , Priscian. VIII. p . 8 0 1 . führt an luvenalis in V(libro ) mit qitod si subeantur prospera castra, v. 2 . , ferner Servius ad Virgil. Aen. 1 , 1 6 . p. 172. C. citirt unter Juvenals Namen v. 6. und nd Aen. I I , 102. p. 235. F . ebenso v. 42. Aber nicht r u g e denken , dass Servius sehr stark verfälscht i s t , mithin die beiden Verse gar wohl von der späteren Hand eines L e i c h t gläubigen zugesetzt sein können, so beweisen solche Allegate ü b e r h a u p t w e n i g ; man allegirt"gar manchmal g a n g b a r e S a chen unter dem einmal hergebrachten Namen. Dann aber ist g a r kein Zweifel, dass, wenn auch dieses Stück nicht vom Juvenal h e r r ü h r t , das Alter desselben doch ziemlich weit ü b e r die Zeiten der genannten Grammatiker, d. h. über das 6te und 4te J a h r h u n d e r t hinauf gesetzt w e r d e n muss. Die neuern Herausgeber beweisen sich auch hier sehr mittelmäßig. Rnperti hilft sich mit einem drolligen Dilcin. m a : „Diese S a t i r e ist entweder von Juvenal selbst gemacht, oder auch von einem Andern g e m a c h t , der kein schlechter S a t i r i k e r w a r ' i . Diess ist g e r a d e s o , wie die Antwort des Tfresias beim Horaz an den Ulyss: O Laerliades, (juidi/uid
S A T I R E XVI. ittcam,
auC erit,
aut non.
517
E s e r i n n e r t an den N a c h t w ä c h t e r ,
der f ü r einen grossen W e t t e r p r o p h e t ™ gehalten w u r d e . J e m a n d wandte sich an ihn m i t d e r F r a g e : W a s w i r d m o r gen f ü r W e t t e r s e i n ?
M o r g e n , g a b e r zur A n t w o r t ,
nach
ziemlich langem B e s i n n e n , m o r g e n kann es r e g n e n , es kann a b e r auch — nicht r e g n e n . Achaintre erklärt die S a t i r e liir unwürdig
eines
so
grossen S a t i r i k e r s
und
am
Ende
auch
noch f ü r v e r s t ü m m e l t ; dicss hat er nach dein letzten V e r s e m i t P u n c t e n bezeichnet.
A u c h Hcinecke will nicht glaubet),
dass sie vorn Juvunal sei, und urthei.lt unter allen um b e s t e n : die Behandlung scheine ihm nicht in d e r Manier des J u v e n i l ; dieser w ü r d e u i m t ä n d l i e b e r v e r f a h r e » sein , hier a b e r sei nichts, als ein m a g e r e r Abriss. Diese Herren hätten doch das Guiachten
des G e s c h i c h t s c h r e i b e r s G i b b o n
teil, C a p . 5 . in einer A n m e r k u n g .
kennen
sol.
E r s p r i c h t von d e r E r -
schlaffung d e r K r i e g s z u c h t u u t e r S e v e r ; „ l i e b e r die U n v e r schämtheit
und die V o r r e c h t e d e r S o l d a t e n
l ö t e S a t i r e , die m a n D i e Schreibart
irrig
d e m Juvenal
und die Sachen
l i c h , dass sie u n t e r S e v e r s ,
machen
kann m a n die
zuschreibt,
lesen.
es m i r wahrschein-
o d e r seines S o h n e s ,
Regierung
geschrieben i s t " . S e p t i m i u s S e v e r u s r e g i e r t e 1 9 3 — 2 1 1 . , d e r S o h n Antoninus ( I I . ) Caracalla 2 1 1 — 1 7 .
Hierin muss
be-
richtiget werden , 1) dass die Z e i t des allgemeinen V e r f a l l s d e r K r i e g s z u c h t keineswegs g e r a d e die R e g i e r u n g des S e v e r u s w a r , s o n d e r n s p ä t e r ; s. die A n m e r k . W c n c k s zur Deutsch. U e b e r s . l . T h l . 3 1 3 . ; und 2) wenn auch G i b b o n hierin B e c b t hätte, so g e b t die S a t i r e g a r nicht auf Verfall d e r discipliua militaris , sondern bloss auf die viel altere ineivilis s u p e r b i a et insolentia des S o l d a t e n s t a n d e s ,
und auf gesetzliche V o r -
rechte, die nicht erst vom S e v e r u s h e r r ü h r t e n .
Die Sachen,
wenn keine andern in d e r Satire enthalten sind, w ü r d e n folglich liier nichts entscheiden ; von d e r S c h r e i b a r t r e d e n w i r nachher. W e n n b e s t i m m t werden s o l l ,
ob
eiue S c h r i f t
acht ist
oder nicht, so kann diess n u r geschehen nach folgenden drei G r ü n d e n : 1) nach geschichtlichen U m s t ü n d e n , a) wenn g ü l -
518
ERKLAERUNG.
tige Zeugen die Sein ift dein Verfasser unzweideutig beilegen oder absprechen, fy wenn innere Kennzeichen für da» eine oder das andere klar entscheiden ; 2) nach der Sprache, worunter der Sprachgebrauch nicht allein, sondern vorzüglich auch die gesetzmässige Behandlung, die ratio grammatica, verstanden w i r d : denn hierin unterscheiden sich bei der Sprache Zeilalter, aetates; 3) nach dem S t i l , d. h. jdem subjectiven Charakter der Darstellung. Der erste Grund, wenn anders dazu hinlängliche Data vorhanden sind, gibt in allen Fallen eine zuverlässige Entscheidung; die beiden letztern leiden verschiedene Anwendung , theils nach dem Object, theils aber auch nach der subjectiven Fähigkeit dessen, der hierin Richter sein will. Am unfähigsten sind in der Regel die , die sich unter mancherlei Studien und Gegenständen herumtreiben, und dann auch einmal aus Curiosität oder von Amtswegen — der schlimmste Fall — auf eine soleh« Untersuchung geralben. Ihr Wesen ist allemal Stümperei. Das Geschafft der höbern Kritik, das schwerste und am meisten zusammengeselzte in der ganzen Litteratur, verlangt ein besonderes Genie sowohl, als eine völlig concentrirtc Uebung und Tüchtigkeit. Ist aber auch beides hinlänglich vorhanden, so bleibt doch die Anwendung oft misslicb, wenn der Gegenstand seinem Umfang nach klein ist, und eben dadurch das Urtheil zu sehr beschränkt wird. W i r werden das Ganze erst genau durchnehmen, und -nach dem, was wir darin bemerken werden, am Sclituss unser Urthejl bestimmen. Der Inhalt ist einfach: die praemia miHtiac, im Gegensatz des Civilstandes , der pagani , V. De Castrensibus ist die nichtssagende Ueberschrift gewisser Codd. Pithoe. p. 696. Henn. Die Vorzüge sind angemasste im Allgemeinen, und Vorrechte. Beides beweist Zeiten, wo der miles p6. Cotta, Aurelius 211, coltana 135. Cotytto 106. crepitio 198. crepitare 74crescit cibus 474' crinem rotare 249. Crisp.inus 39. 174. Crispus, C. Vibius 185. crista 181. 25q-. crotalistria, cicouia y4- S y r a crumena 4 >6. crystalline 235. cucullus 149. 329 cucurbita 478. culcita 200. coleus 344culina • 61 • cuhellus >23.
Cuniae 123. curabilis 5 2 6 . curare i44cursor 204. Curtius Montanus 188. curuca 245. cuspis 113. custos Urbis 470. Cybele 27 1. cyclas 243. cygnus 237. cylindrus 3o. 98. Cyniker 467. Daducliie 5i3. Daedalus 5|. dama 427. Damasijipus 334' damna 419. damnare 185. de 60. 224. December 367. decidere 447Decii 35o. ileclainatio 397. decocta aqua 204. deficere 44°delator 42. deliciae 170. 225. Delphisches Orakel 376. Demetrius 137. densiis 77. deponere i52. depositimi 4^7descendere fnnem 49®. designator i 4 j . destinare 124* deus 4 4 s ' develiere 298. tSiaijjv/tiy 3g. dicta 83. dictare 242. dictata 2 1 4 . • didticere 468. ditrundere 201. digressus 1 2 3 . dimidius 3 16. 466. 85. 101. 127. Diminutiva 300 231. 388. 43o. Diogenes foò. diripere 256. discorrere 65. discursus 64* dispensator 67.
549
168.
550
REGISTER
dissimulare 567. doctus 52, Duinitinnus 93. 186. 195. Doris 136. druina saty ricuni |3. Drusus, Ti. Claudius Caesar 160. dum 54. 124.481. durus 149. 353. (lux 1 o'|. jj — >] 3o3. ecce 16g. elfundere 38j. egregius 413. Éheconlract 368. fi'd'ttikof 242.
electruin 4g5.
454Elephanlen Elision 82. |33. 410. 480.
198.
a3g
3;3.
¡¡Xiwoii 44°.
e l i c m i 464. Ellipse 66. 80. 86. 120
i53. i5g.
166. 272. 304. 34g. 367. 3j8. 4o5. 469. 4;4 507. emblema 63. finendare 478. Emphase
2^7.
eil i3. 2 60.
Enallage modorum 164. 187. 4 ' 7 numeri 3 j o . personarum 36i. lem por um 466. 137. iväoopls Enhauslik 45'.
eiithymema 263. epiiiienia 298. epirliediuin 324. Epona 331. Etjuites egregii 390. erani ad dainua iucendiorum Sustiuenda 1 58, ÌQéaaea&ai
25o.
ergastula 333. ergo 3o. 36. 73. 85. 91. 274. 414. erigere 68. escalia 446-
eveliere iu coelum 46. exarare 60. excipere 5ig exclamare 2,Sg. exempio malo 4^6. exlieredatio 4°3. exodium 7. i5o. exsistuut 453. exspectare 344. exstare 63. extenilere 514. f und v 372. Fabius Persicus 317. tabula logata 3o. Fabulla 101. facere 96. Facliones
des Circus
Faesidius 460» Cal lax 456. faina 324. famosus 231. fauaticus 191. far caniiiuni 200. farrago 65. farrata 425. fartus 175. fascia 243. fateri 3g8. fatuin 91. favor 54°.
fensler
der Alien
421.
164.
fenestra 71. ferculum 68. ferine 475. fermentum i52. ferulae uianum subilucere 36. Fessidius 460. fessus 232. fibula 229 (icedula 477. Fidenae 3g2. fieri 365. figere 476fiiuin 482.
Finger
4o4-
flagellmn 265. Esquiliae 307. Fhiininius, C. 55* esse aliquem 62 aliquid 159. II no tus 25o. et 63. 104. 1 iC. 167. 178. 218. fodere 35g. 222. 1. 29g. 3og. 427' 465. folialum 264. 5o6. et — rjue 528. Fonteius 4&7* eunuchus 252. forica 129. fortasse 5oo. Euphemismus 170. 377- 438. Esel
297. 4^9-
ZUM COMMENTAR. mit veränderter
F o r i ima 283. f o n i l i 158. f o r u m y-j, l'ossa 90. I'ragor 29^. frangere 293. 4 2 3 fri ti 11 ns 4 7 7 . f r i v o l a 154. F r o n t o 35. frui dis iratis 5 o . frustra 1 5 7 . f u l i g o 107. 2 0 1 . fulnien 326. fu 1111 is d o m i 7 6 . funeslare 318. Fuscus, Aurelius 533. fustis 9 '
futurum 67. 81. 160 g und I 197.
Cn.
llendiadys
5i
Ilerinareus
Hiatus
Lenlulus
74.
Germanen gerra Gillo
470.
Cossus
124.
47°
125. 129.
45o.
4/1'
Gladiatorenspiele Glaukos
118. 33S.
Gradivus
Grammatik
i5o.
HiI)er 11s 2 2 S . Ilippia a3o. Iiippomanes 233. l l i r p i a u s 3-i3. H i s p o 96. l l i s p u l l a 9 7 . 443. h i s l e r 4llister 455. liistoriae. 2 6 3 . 3 i a . h o r r i d u s 98. h o r t i 63. 266. liospil iiiin 149. H y l a s 86.
Hyperbel 121. 171. 367 4^9i als Consonant 176. 231. 44$5oi. stall e 174* iacere
3;o.
a65.
111.
3oi. 3iO.
gras.salor iGtt. greiniuin 3 1 0 ^97-
Griechische tf ort formen von den 1 • Römern gebildet 13i. y-4'mit verändertem Genus in das Lateinische übertragen 206.
138.
190. i a c t a r e
s*
i a c t u s 446. iaculator 262. laTQOjxaS-i^uatixoi 278. ibis 4 9 9 .
Idiotismen
47^'
512.
(44*
i a c t a r e basia a l i c u i 56.
1 iG. 4;.
Goldstickerei
62. 111. ia5. 14/ 448'
Hermaphroditen
288.
Galliens, C . RutUius Valens G a l l i u a r i a p i n u s 166. G a m i n a r n s 207. Gaurauniii vinum 362. gausapa i38. g e n i e r e 106 3^4* 263. gemina 4 ' getiesis 2 7 8 . 2 9 1 . 34s- 365. g e n s 348. . g e n t i l i s 1 B I.
133.
Ilcraclea 5 i . Hercules 92. here 126. Herinae 322.
3.8. G a l l i a , A. 197. g n l b i n u s 108. g a l l a 38. Galli 271. 363.
Genitivus
Bedeutung
,37. giistus 4 1 4 . g u t l u r 470. gutlus i63. G y a r u s 62. gyimiasia i3'i. 1 4 t . liabitus 151. l i a b u s 343. Haemus 137. Heliodorus 253. Tlelvitliiis Priscus 2 0 2 .
G a b i i 392. Gaditanae 433. Gaelulicus,
•551
des Juvenal
76. 144'
223. 276. 4 8 1 . I d i i m a e a 332. iecur 5 o i g n i c u l u s 137. iguis 8 1 . i i l e 104. 13 1 - i l l e — i11c i m p r o b u s 164. 188. 3 6 6 in.inis incei'tus
512.
400.
REGISTER
552-
incestus 1 7 3 . incipere i u c i t a r e 249. i m l i u a r e 140. lndicalivus • 34- '49 4^4iiitlicium 3 8 6 . ¡mliiperator 174. inermi i u s t i l i a 1 8 5 . iufelix 1 7 1 . i n g e r e r e se 284ini(|iiiis 4 2 . iiKjuit i.'i7 3 i s . insert» 6 3 . inspicere 12g. i n v e r s u s 14 o. i n v i d i a m diis f a c e r e 5o8. l o n i n s 2 3 1. i p s e 56. Irdene Kähne in Aegypten Sog. ire in c o e h i m 1 3 4 . ' — et ^ 9 7 . it clamor a 5 1 . ilur 180. I s a e u s 13 3. Isis 2 6 5 . 2 7 4 . 2 7 5 . 4 4 i , 466. istiul i 5 ' J iucnntlus 1 8 5 . Juden 115 27^. ingera 1 7 1 . l u n i u s , Q. Rusticus 5 o l . Jnppiler 207. Juristen 179. invpnalis 4 1 2 Juvenalische Parenthesen 1 2 5 . >44* 1 4 6 . 2 0 7 . 2 3 8 . . 1 6 4 . 29',. 3843 y 6 . 400. 4 i 3 . 4 1 8 . 4 3 5 . 4 9 1 , iuveuis 148. Juveutius Celsus 242. inventus 4 Iiiverna 1 2 1 . xtii 299. 5 1 2 . XtQttS
47'-
xfoaaifiöooi; 246. xXujyuPQ 2 7 9 . Knabenliebe 407. xonvd-aioios 112. Krähe 4°4* xvmv 2 2 9 . 1 und r 79. labor 5 J o . lacerna 147. lacernata amica 56. lacerta 160. lacunar 52. lacus a83. Lucriuus
191-
laxxünoojxtos 90. Ittxxónvyos 90. L a m i a , L. A e l i u s P l a u t i u s A e i n i lianus 1 9 6 l a n a m trällere 9 7 . Laronia 94. Lateranus 33o. L a t i n u s 44l a t u s d a m i e r e 1 4 5 ' e v e r t e r e ' 4 j5. laureolus 3 3 5 . latirum m o r d e r e 2 9 0 . Iaxare 180. lectica 4 2 . Leila 226. legere t i . 3o2. ìejiToajtn&qTÓs* 1 0 0 . l.eaßiei^fiy 4°4l e x , Julia de adulteriis 52. 36g. 1 ulia t.lieatralis 1 4 7 . P a p i a l ' o p p a e a 3 6 8 . Hoscia t h e a t r a l i s • 4 " • S c a n t i n i . ! 96. liber 1 8 6 . 2 4 3 . libri aclorum 368. libertinus 7 1 . libet 5g. librarius 370. libum I 5 i . l.iburni 1 6 1 . 182. Libyen 417. L i c i n u s 7 2 . 493> ligula 200. lina piscatoria 1 7 7 . liuere 302. lirare 4 0 3 . Litotes 337. livorein d u c e r e i o 5 . loculi 66. 4 19. locus 242. longe 292. lorigus 3 4 3 . l o n g u m est 2 4 0 , loripes 92. l u b r i c a r e 4^7. Lucantis, M Aanaeus 293. lucerna Venusina 5 i . L u c i l i u s , C. 1 0 . luctus publicus 1 5 7 . Lucusta 6 1 . ludius 2 3 1 . luna 307. Lupercalia 117. l u s t r a r e 1 19, Xvxai 321. m a c e l l i m i 208. /uti^atQa 223.
ZUM
COMMENTAR.
maculosus agi. Maevia Galla 38. inagister 223. maguus 43malus 9. manducus i5o. inane 287. Manes 1 ig Mariilia 242. inanimi iinplere 275. mapalia 486. mappa 201. mare nostrum 192. 208. margo 3o. marisca go. Marius, C. 3^9 Priscus 5o. in arni or 445. marmora 36. i58. marra 166. Martis lucus 32, ¡¿aaTiyovo&ai 49. Matho 42. medicus go. Megalesia 438. Memnonsstalue 499Menippeae 9. mensa 63. incus sana 4°9nieritoricnn 160. meritimi Messalina 233. 408. fitta 507. [.ir,le — %tti 461. nietreta 161. fitnivtif 126. micturire 533. JM'tiiàrtriiunal 295. niilitia togata 535 Milonia Caesonia 285. miiiores 82 119. 347. lunatici 463. inirmillo 33y. miscellanea 416. mitra i3i. miti ere 122. Modefai ben 216. 36o. 439. modicus ali. niotlo 162. 5o8. modus 2D6. Moesi 375. fttòxos '-^S. mollis • 37.
monilia 106.
1uoyoifayia 68.
553
montauus 104. 221. Monyclnis 34. morbus gj. mox 448. Mucins 83 iiiuliimm eor 627. 111 u 1 In s 173. innlticia 99. mnltus 77. miinus 128.
murmur 4 Tentyra 502. terga praestare 5o6. tessera 3o4- 4,J,-8. Testamente S'g.
testa 435. lestaudi überlas 240. Tliais 136. i5o. 334Theater theatrum 3y5. Themison 4 o a
![D. Iunii Iuvenalis Satirae [Editio minor, Reprint 2022]
9783112629420](https://dokumen.pub/img/200x200/d-iunii-iuvenalis-satirae-editio-minor-reprint-2022-9783112629420.jpg)
![D. Iunii Iuvenalis satirae: Volumen 1 [Reprint 2022 ed.]
9783112683026](https://dokumen.pub/img/200x200/d-iunii-iuvenalis-satirae-volumen-1-reprint-2022nbsped-9783112683026.jpg)
![Das Satirische in Juvenals Satiren [Reprint 2011 ed.]
3110169258, 9783110169256](https://dokumen.pub/img/200x200/das-satirische-in-juvenals-satiren-reprint-2011nbsped-3110169258-9783110169256.jpg)
![A. Persi Flacci et D. Iuni Iuvenalis Saturae [Corrected]](https://dokumen.pub/img/200x200/a-persi-flacci-et-d-iuni-iuvenalis-saturae-corrected.jpg)
![Aktienstrafrecht: Kommentar zu d. §§ 288 – 304 d. Aktiengesetzes [Reprint 2014 ed.]
9783111534329, 9783111166254](https://dokumen.pub/img/200x200/aktienstrafrecht-kommentar-zu-d-288-304-d-aktiengesetzes-reprint-2014nbsped-9783111534329-9783111166254.jpg)
![Die Schule des Aristoteles. Texte und Commentar. Sotion [Supplementband 2]](https://dokumen.pub/img/200x200/die-schule-des-aristoteles-texte-und-commentar-sotion-supplementband-2.jpg)

![Der Sciendum-Kommentar zu den Satiren des Horaz [Illustrated]
3598777213, 9783598777219](https://dokumen.pub/img/200x200/der-sciendum-kommentar-zu-den-satiren-des-horaz-illustrated-3598777213-9783598777219.jpg)
![Der Sciendum-Kommentar zu den Satiren des Horaz [Hardcover ed.]
3598777213, 9783598777219](https://dokumen.pub/img/200x200/der-sciendum-kommentar-zu-den-satiren-des-horaz-hardcovernbsped-3598777213-9783598777219.jpg)
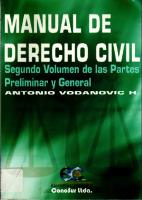
![D. Iunii Iuvenalis satirae: Volumen 2 Commentar zu Juvenals Satiren [Reprint 2022 ed.]
9783112689202](https://dokumen.pub/img/200x200/d-iunii-iuvenalis-satirae-volumen-2-commentar-zu-juvenals-satiren-reprint-2022nbsped-9783112689202.jpg)